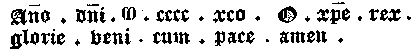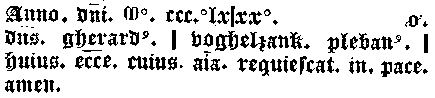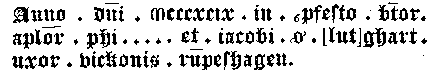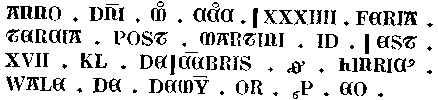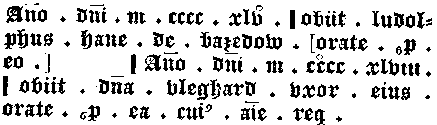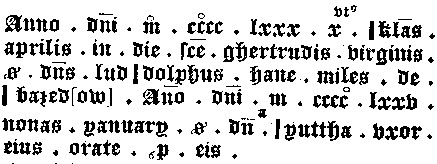|
[ Seite 391 ] |




|



|
|
|
- Bericht des Herrn Troyon aus Lausanne über die nordischen Alterthümer und deren Bearbeitung
- Alterthümer in der Gegend des Müritz-Sees (Vgl. Jahresber. III, S. 41 und 64 flgd.)
- Begräbniß von Plau
- Auslegung der Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern mit Kalk
- Ueber das Hünengrab von Katelbogen
- Hünengrab von Alt-Pokrent
- Rundschleifsteine oder Klopfsteine von Garvensdorf, Basdorf und Rederank
- Steinerne Alterthümer aus dem Amte Bukow
- Kegelgräber von Alt-Sammit
- Kegelgrab von Dammerow, D.A. Lübz
- Kegelgrab von Alt-Schwerin
- Kegelgrab von Mallin
- Kegelgrab von Kittendorf
- Bronze-Wagen von Peccatel und Frisack
- Bronze-Alterthümer von Wieck
- Alterthümer aus der Gegend von Krakow
- Heftel mit zwei Blechplatten
- Kopfring im Thürknopf am Dome zu Güstrow
- Antike Quetschmühlen
- Die Graburnen der Wendenkirchhöfe
- Wendenkirchhof von Naschendorf
- Topf von Gnoien
- Urnenscherbe mit Schriftzeichen (?), von Vietlübbe bei Plau
- Mosaik-Glas-Perle von Sülz
- Alterthümer von Lippiny in Polen
- Grab von Kittendorf
- Römische Urne von Stuer
- Gläserne Reliquien-Urne von Wittenburg
- Zwei Kelchtücher
- Geschnitztes Hifthorn
- Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg
- Burgwall von Werle
- Burgwall von Dargun
- Die Burg Bisdede (Nachtrag zu S. 27)
- Die Kirchen zwischen Güstrow, Gnoien und Neu-Kalen
- Die Kirche zu Alt-Kalen und Geschichte der Gründung von Alt- und Neu-Kalen
- Die Kirche zu Gnoien
- Die Kirche zu Lage
- Die Kirche zu Teterow
- Die Kirche zu Jördenstorf
- Die Kirche zu Schorrentin
- Die Kirche zu Reinshagen
- Die Kirche zu Wattmannshagen
- Die Kirche zu Warnkenhagen
- Die Kirche zu Belitz
- Die Kapelle zu Lewetzow
- Die Kirche zu Thürkow und die Kirche zu Polchow
- Die Kirche zu Dargun (Nachtrag zu Jahresber. III, S. 169, und VI, S. 89 flgd.)
- Die Kirchen zu Ribnitz
- Kirche zu Lübz (Vgl. Jahresber. VIII, S. 134 flgd. und IX, S. 456)
- Die Kirche zu Kirchen-Rosin (Nachtrag zu S. 7 flgd.)
- Die Grabplatten in Messingschnitt
- Ueber die Thon-Reliefarbeiten des 16. Jahrh.
- Münzfund von Wismar
- Münze des Herzogs Christoph von Meklenburg
- Die Siegel der meklenburgischen Städte
- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506
- Nachricht über das Buch von den drei Strängen von Nicolaus Ruß
- Das ribnitzer Stadtbuch
- Musterung, Roßdienst und Aufgebot
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 392 ] |




|


|
[ Seite 393 ] |




|



|



|
|
|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Im Allgemeinen.
Bericht des Herrn Troyon aus Lausanne über die nordischen Alterthümer und deren Bearbeitung.
Stockholm, 15. Avril, 1846.
Très honoré Monsieur.
S i je ne Vous ai pas encore donné une relation du voyage que je Vous avais annoncée l'année dernière, c'est que, comme Vous le voyez par cette lettre, je me suis arrêté en chemin. Arrivé à Stockholm, je trouvai la collection d'antiquités fermée, à cause de l'absence de son directeur Mr. Hildebrand; j'attendis long temps et ne voulant pas être venu pour rien, j'ai remis la fin de mon voyage à cette année. L'obligeance de Mr. Hildebrand m'a pleinement dédommagé de ce retard, et j'emporterai de son musée bon nombre de dessins et d'empreintes, mais je crains bien de ne faire que Vous répéter ce que Vous connaissez déja. Quoiqu'il en soit, j'essaierai une esquisse générale, et si Vous désirez plus de dètails sur certains points spéciaux, Vous voudrez bien me le faire savoir.
L'étude des antiquités de la Suede présente d'assez grandes difficultés, parcequ'il manque de recherches dirigées dans un but archéologique et qu'il est rare de pouvoir apprendre, dans quel genre de tombeaux se trouvaient les objets réunis dans les collections. La plupart des auteurs qui ont écrit sur ce sujet,


|
Seite 394 |




|
parlent bien plus de l'extérieur des monumens que de leur Intérieur. En un mot, il manque une statistique exacte des antiquités trouvés dans chaque province, travail indispensable pour pouvoir élever un système sur une base solide. Je me bornerai donc essentiellement à la citation des faits parvenus à ma connaissance.
Une différence assez sensible se présente entre les monumens de la partie la plus méridionale de la Suède, la Scanie entr'autres, et les autres contrées du pays. Au midi, même genre et même richesse d'antiquités que dans la Seeland: grands tombeaux avec salles sépulcrales, nombreux objets en pierre et en bronze. Au nord, la pierre et le bronze sont plus rares, le fer parait prédominer, en Norvège surtout, et les tombeaux avec salles de pierres n'y ont guère été remarqués. En Dannemark, on ne voit pas que je sache de Men-hirs, tandis que la Suède en possède plusieurs. Dans ce pays les arrangemens de pierres pour le couronnement des anciens rois, pour les sacrifices, les jugemens et les assemblées du peuple sont nombreux. On en voit representant la figure d'un cercle, d'un carré, d'un triangle aux côtés droits ou rentrans, ou d'un vaisseau avec ses mâts. Des arrangemens pareils entourent parfois la base d'un tumulus, ses côtés ou même son sommet. Quant aux pierres runiques elles sont généralement isolées et recouvrent presque toujours des tombeaux chrétiens. - Jusqu'à présent je n'ai pas de renseignemens positifs sur les retranchemens en terre des temps payens; ils paraissent avoir été plus généralement formés par des murs secs élevés sur des lieux présentant ordinairement une fortification naturelle. - Les tumuli existent en fort grand nombre. Certaines contrées sont couvertes de mamelons, dans lesquels on trouve souvent des urnes cinéraires avec des objects en fer. Un tumuli ouvert en Westrogothie mérit une mention particulière. Il recouvrait une salle sépulcrale en forme de T. Le long des parois de laquelle étaient des espèces de sarcophages à peuprès cubiques renfermant quelques instrumens en pierre et des squelettes d'hommes, qui n'avaint pu y être deposés qu'accroupis 1 ). Quoiqu'on ait dit à


|
Seite 395 |




|
cet égard, cette manière de reployer le mort ne me semble guères l'attitude d'une personne assise. Ce fait n'est du reste pas unique. Mr. le Prof. Wiggert m'a dit que cette position avait été observée dans les environs de Magdebourg. J'ai mentionné dans ma Descript. des Tomb. de Bel-Air la même attitude dans les tombeaux les plus anciens du Canton de Vaud. Enfin j'ai vu à Berlin, chez mon compatriote le Dr. Tschudi, des momies qu'il avait rapportées du Pérou, dont les bras et les jambes étaient violemment reployés sur la poitrine et liés avec des cordes, évidemment dans un autre but que pour les tenir assis. Je sais que la position assise se retrouve aussi, mais elle diffère de celle dont je parle et on doit l'en distinguer. J'émettrai à cet égard une hypothèse que Mr. Jb. Grimm m'a fait l'honneur de citer dans le supplement de la dernière édition de sa mythologie allemande. Avec les momies de Mr. Tschudi, se trouvait celle d'un oiseau dont la tête était reployée vers l'aile gauche et les pattes ramenées sur le thorax, tandis que les oiseaux déposés dans les tombeaux égyptiens sont généralement étendus. Cet oiseau péruvien me rappela la position du jeune oiseau dans la coquille, et les squélettes humains, celle de l'embryon. La terre, dans la plupart des anciennes mythologies, étant considerée comme la mère universelle du genre humain, il me parait qu'on a voulu donner à l'homme la position de l'embryon en le faisant rentrer dans le sein de la mère universelle, avec la foi à une nouvelle naissance. Ce fait nous revélerait donc la croyance à une vie à venir, et cette foi était commune aux Gaulois, aux Germains, aux Scandinaves, ainsi qu'aux anciens Péruviens, ce dont je me suis assuré.
On a retrouvé dans quelques provinces suédoises, entr'autres en Wermland, des tombeaux construits avec de grandcs pierres et qui ne paraissent pas avoir été recouverts de collines. Le peuple les appelle les tombeaux des géants. Ils ont 12 pieds de long sur 4 de large; ce qu'ils renferment je n'ai pu le savoir. - On trouve aussi dans quelques endroits des urnes cinéraires deposées en grand nombre dans le sol, les unes à côté des autres, ce fait est du reste commun à la Poméranie. - Après ce coup d'oeil rapide sur les principaux monumens, je vais passer aux collections, mais


|
Seite 396 |




|
en faisant observer que plusieurs des objets qui y sont réunis, ont été decouverts en terre sans trace de tombeaux dans des marécages ou parfois aucun dans des lacs.
Aprés avoir vu l'étonnante quantité des objets en pierre et en bronce receuillis dans la musée de Copenhague, on trouve pauvres à cet égard les collections de la Suède; mais il ne faut pas oublier que cette pauvreté serait une richesse pour un autre pays, Mecklenbourg-Schwerin excepté. Le coin en silex est commun. Les haches percées ne sont pas rares; quelques-unes sont terminées à une extremité par un tranchant, à l'autre par un marteau. A Calmar, chez Mr. le Dr. Eckman, j'ai vu une forme particulière. La pièce vue de côté présente la forme d'un losange irregulier et une épaisseur d'un à 2 pouces. On voit aussi dans les collections de Suède de beaux poignards en silex, des pointes de flêche et de lance, des ciseaux, des scies diverses et même des espèces de percets encore en silex, mais qui paraissent essentiellement de l'ile de Rügen. Le musée de Stockholm ne possède presqu' aucun vase en terre cuite, non qu'ils manquent dans les tumuli, mais parcequ'on les a presque toujours brisés sans les recueillir. A peine y en a-t-il 3 ou 4 en bronze. - Les épées de ce métal ont presque toujours une lame qui va se rétrécissant depuis la poignée pour s'élargir avant la pointe; la poignée est quelques fois ornée de spirales, d'autres fois elle a du être d'une autre matière que la lame. Jci, comme ailleurs, celts, pointes de lance, colliers et bracelets en bronze. - Les épées en fer paraissent être d'un usage fort ancien en Suède; elles sont généralement plus longues et plus larges que celles en bronze. Les tranchans de la lame sont parallèles et se recourbent brusquement vers la pointe. Plus tard, la croisière et le pommeau se recouvrent d'incrustations de filets d'argent. Une de ces pièces trouvée en Norvège, présente des entrelacs très pareils à ceux de mes agrafes de Bel-Air. Deux haches en fer des environs de Stockholm, sont également incrustées d'argent. L'age de ces pièces ne me parait par anterieur au 10 e siècle. L'argent s'incruste aussi sur le bronze dans les derniers temps payens, comme l'indiquent les monnaies trouvées avec ces objets. Grande est la variété des boucles, des fibules et des


|
Seite 397 |




|
broches. Les agrafes, beaucoup plus rares, ne présentent plus les fines rayures des temps primitifs, elles sont profondement ciselées et parfois dorées et ornées de verres rouges. Quelques pièces offrent des entrelacemens modernes de l'Islande; elles témoignent ainsi d'un art scandinave et d'un art autre que celui des objets byzantiens déposés en grand nombre dans le sol de la Suède. - Il me resterait beaucoup à dire sur l'abondance des antiquités en métaux précieux employés pour colliers, bracelets, medaillons, broches et même pour grains de collier. J'ajouterai seulement en terminant que l'argent est beaucoup plus rare à Copenhague que l'or, tandis qu'à Stockholm il s'y retrouvre presqu' en même quantité.
Veuiliez, Monsieur, agréer
.
Troyon.
|
Monsieur
Monsieur Lisch, |
|
archiviste, secrétaire
de la société archéologique
et historique de Mecklenbourg-Schwerin. |
| Schwerin. |



|



|
|
:
|
Alterthümer in der Gegend des Müritz=Sees.
Die Unterzeichneten begaben sich am 23. September d. J. nach Klink bei Waren an der Müritz, um die dortigen Gräber und sonstigen Stellen, wo bereits Alterthümer gefunden sind, zu untersuchen und nötigenfalls aufzugraben. Bei diesem Geschäfte erfreueten sie sich nicht allein der freundlichsten Aufnahme und bereitwilligsten Unterstützung des Herrn Gutsbesitzers Kähler auf Klink, sondern auch der Hülfe des Herrn von Randow zu Bök. Letzterer ist mit den zu Klink vorhandenen Localitäten und den dort gemachten Funden von Alterthümern durchaus bekannt und hat hier schon seit vielen Jahren selbst nach Alterthümern gesucht.
Zuerst begaben wir uns, nach einer vorläufigen Betrachtung der hauptsächlichsten Oerter, wo Alterthümer gefunden sind, nach den Tannen nördlich vom Hofe, unweit der Ziegelei, wo eine Hügelreihe von weichem, gelben Sande sich neben einer Niederung an der Müritz, die mit Erlen bewachten ist und der Kollin heißt, erhebt und von Osten nach Westen sich fortsetzt (vgl.


|
Seite 398 |




|
Jahresber. III, S. 41). Hier lagen Steine zu Tage, die sonst in diesem weichen Sande nicht vorkommen. Beim Nachgraben zeigten sich Steinlager, zum Theil in Kreisform, 2 bis 3 größere und kleinere Pflastersteine über einander, dazwischen und darunter Urnenscherben, Asche und Kohlen: also offenbar alte Grabstellen; indessen fanden sich an mehreren untersuchten Stellen weder ganze Urnen, noch sonstige Alterthümer. Der Lage nach, am südlichen Abhange des Sandhügels, und der etwa 1 Ruthe im Durchmesser haltenden flachen Steinsetzungen zufolge möchte hier ein Wendenkirchhof gewesen sein.
Demnächst besuchten wir die Stellen auf dem nördlichsten Theile des Gutes, welcher der Berendswerder heißt und bis an die Elde reicht. Auf den Höhen nördlich und nordwestlich sind kleine Kegelgräber gewesen, welche Broncesachen geliefert haben und vom Herrn von Randow früher aufgedeckt sind (vgl. Jahresber. III, S. 64).
Besonderes Interesse gewährte ein Sandhügel an der Elde, westlich etwa 200 Schritte von dem Fährhause, Bellevue genannt, wo offenbar Feuersteinmesser geschlagen sind (vgl. Jahresber. III, S. 41 u. IX, S. 362). Die Oberfläche ist so mit diesen spanförmigen Feuersteinen bedeckt, daß man Bruchstücke auf jedem Schritte trifft; indessen tiefer als 6 Zoll unter der Oberfläche, als wie tief geackert ist, findet sich keine Spur solcher Feuersteine, wie wiederholte Grabungen uns überzeugt haben. In diesem weichen, durchaus steinlosen Boden entdeckten wir eine Stelle mit dem Fühleisen, wo Steine unter der Oberfläche lagen; beim Graben fanden wir 2 flache Kalksteine, wie sie bei Sembzin vorkommen, und 6 geschlagene oder gespaltene Sandsteine; dazwischen lagen Scherben einer grobkörnigen Urne ohne Verzierung, und darunter Knochen. Gewiß ist dies eine zertrümmerte kleine Steinkiste, die vom Haken schon früher gefaßt ist. Am interessantesten aber war die Entdeckung, daß zwischen und unter diesen Steinen in einer Ausdehnung von mehreren Fußen sich eine Menge guter und schlechter spanförmiger Feuersteinmesser in einer Art Branderde zeigte; wir sammelten alle Steine, deren Zahl sich über 50 beläuft. Darnach würde dieses kleine Grab in die Zeit der Steinperiode, der Hünengräber, zu setzen sein.
Die letzte Stelle, wo bereits Bronzesachen gefunden sind, liegt unweit des Kölpin=Sees; es ist eine dünenartige, sandige Höhe, mehrere hundert Schritte lang. Außer einer bereits durchsuchten kreisförmigen Brandstelle konnten wir aber nichts von Anzeichen eines Begräbnißplatzes entdecken.


|
Seite 399 |




|
Auf dem nahe liegenden Acker, der schon von besserer Qualität ist und jetzt mit Roggen besäet war, sind mehrere Kegelgräber zerstört, wenigstens der Ackercultur wegen die Steine derselben ausgebrochen.
Sonach waren unsere Untersuchungen größtentheils fruchtlos, da alle sichtbaren Gräber bereits zerstört sind. Eben so wird das schöne Hünengrab zu Sembzin bald verschwinden; ein nahe daran liegendes ist bereits des Lehms und Mergels wegen verschwunden. Auf der Hof=Poppentiner Feldmark liegt auf einer Höhe noch ein Kegelgrab. Nahe bei Schlößchen Poppentin ist eine Menge langgestreckter Hünengräber (Riesenbetten) auf sandigem Boden dem Verschwinden nahe; an einigen Stellen wäre eine Untersuchung wohl noch Erfolg versprechend. - Bei Stuer ist eine große Steinkiste fast offen gelegt durch die zur Chaussee abgefahrenen Steine; - ein schönes Hünengrab und ein Kegelgrab sind noch unversehrt.
Gnoien und Vietlübbe, im October 1846.
| F. F. E. von Kardorff. | J. Ritter. |
Ueber die Graburnen der Wendenkirchhöfe
vgl. man unten die Alterthümer der Wendenbegräbnisse.
Ueber antike Quetschmühlen
oder die muldenförmig ausgehöhlten Granite vgl. man unten bei den Alterthümern der Kegelgräber.


|
Seite 400 |




|



|



|
|
:
|
Begräbniß von Plau.
Am Weinberge bei Plau in dem dort zur Chaussee gegrabenen Kiessande ward 6 Fuß tief unter der Oberfläche ein menschliches Gerippe in hockender 1 ), fast knieender Stellung, mit etwas rückwärts gelehntem Oberleibe, gefunden.
Neben dem Gerippe lagen folgende Geräthschaften, sämmtlich aus Knochen:
1) eine Streitaxt aus dem Wurzelende eines Hirschhorns, 6 1/2" lang, mit einem durchbohrten Schaftloche am stärkern Ende; das dünnere Ende ist zugespitzt;
2) zwei der Länge nach aufgeschnittene, halbe Eberhauer, von denen der eine nach der Außenseite hin einen, der andere nach derselben Seite hin drei regelmäßige Ausschnitte in Form eines Kreissegmentes oder Halbmondes hat;
3) drei Schneidezähne von einem Hirsche 2 ), deren zwei (die mittlern Schneidezähne ans dem Unterkiefer) an der Wurzelspitze regelmäßig durchbohrt sind, um auf eine Schnur gezogen zu werden; die Krone eines dieser Zähne ist gabelförmig ausgeschnitten. (Vgl. Zimmermann's Nachricht von einigen bei Uelzen aufgegrabenen Urnen, Titel=Vignette.)
Diese Geräthschaften waren in den Besitz der Frau Chaussee=Baumeisterin Mühlenpfort gekommen, welche dieselben sorgfältig aufbewahrte; auf Verwendung des Herrn Pastors Ritter zu Vietlübbe, welchem der Verein auch die erste, ausführliche und sichere Nachricht von diesem Funde verdankt, machte Frau Mühlenpfort diese Sachen dem Vereine zum Geschenk.
Das Gerippe, auch der Schädel, ward von den Arbeitern zerschlagen; der zerschlagene Schädel, und mit diesem die durchbohrten thierischen Schneidezähne, kam in den Besitz eines Mannes in Plau, von welchem wiederum der Herr Pastor Ritter dieselben zum Geschenk erlangte. Von dem übrigen Theile des Gerippes ist nichts mehr aufzufinden gewesen.
Der sehr zerbrochene Schädel ist in hohem Grade merkwürdig und es ist zu beklagen, daß er so sehr zerschlagen ist, daß eine Zusammensetzung nicht hat gelingen wollen. Fast ganz gerettet sind das Stirnbein und der Unterkiefer, welche


|
Seite 401 |




|
beide einen merkwürdigen Bau haben. Die Augenhöhlen liegen fast ganz horizontal. Aber ganz ungewöhnlich stark hervorragend ist die Erhöhung der Stirnhöhle, so weit sie von den Augenbrauen bedeckt gewesen ist, und des Jochfortsatzes des Stirnbeins bis zur Nasenwurzel. Die Stirn liegt fast ganz hintenüber und ist nicht 1 Zoll breit; durch unfehlbar starke Augenbrauen und starkes Haar muß sie fast gar nicht zu sehen gewesen sein. Die äußern Höhlenränder des Stirnbeins über den äußern Augenwinkeln sind ungewöhnlich stark und ragen über 1/2 Zoll über die Schläfe hervor. Der Jochfortsatz des Stirnbeins ist ebenfalls ungewöhnlich breit und an der Nasenwurzel bei der Nath 1 1/4 Zoll breit. (Dieses Stirnbein ist dem Stirnbein des Oberschädels, welcher tief im Moore von Sülz gefunden ward und in die großherzogliche Sammlung kam, auffallend ähnlich; auch dieser zeigt ungewöhnlich starke Erhöhungen des Stirnbeins über den Augenhöhlen und fast gar keine Stirn.) Der Unterkiefer ist sehr stark und breit und fast senkrecht, so daß er fast gar keine Hervorragung und Modellirung zeigt. Die Zähne sind alle vorhanden, alle vollkommen gesund; aber die Backenzähne sind schon stark abgeschliffen. Es gehörte der Schädel einem Menschen von reifern Jahren, jedoch noch keinem Greise.
Dieses im Vorstehenden beschriebene Begräbniß ist in hohem Grade merkwürdig und das erste dieser Art, welches in Meklenburg gefunden ist. Zwar waren bisher schon zwei Streitäxte aus Hirschhorn gefunden, die eine in der Lewitz, jetzt in der Vereinssammlung (vgl. Jahresber. I, S. 15), die andere in der großherzoglichen Sammlung; ein ganzes Begräbniß von lauter Knochen war aber noch nicht gefunden.
Diesem Grabe von Plau muß man nun ein sehr hohes Alter zuschreiben; denn
1) fehlt jeder Schutz des Grabes durch Steinbauten u. dgl.;
2) fehlt der Leichenbrand, welcher in Meklenburg schon in der Steinperiode eintritt;
3) fehlt jedes Geräth aus Stein, Thon oder Metall.
Dagegen weiset die Bildung des Schädels auf eine sehr ferne Periode zurück, in welcher der Mensch auf einer sehr niedrigen Stufe der Entwickelung stand. Wir wagen jedoch hieraus keine Schlüsse über den Entwickelungsgang des Menschengeschlechts zu machen, sondern überlassen Studien dieser Art tiefer blickenden Forschern. Wahrscheinlich ist aber, daß dieses Grab dem Autochthonen=Volke angehört und der Steinperiode voraufgeht.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 402 |




|



|



|
|
:
|
Auslegung der Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern mit Kalk.
In Jahrb. X, S. 266 ist berichtet, daß die Verzierungen von 4 Urnen eines Hünengrabes zu Moltzow mit Kalk ausgelegt sind. In der Sammlung nordischer Alterthümer zu Kopenhagen überraschte es mich nicht wenig, als ich die Verzierungen vieler Urnen aus der Steinperiode mit einer weißen Masse ausgelegt fand. Es ward dabei die Frage erhoben, ob diese Masse auch wirklich Kalk, nicht vielleicht Mehl oder irgend etwas anderes sei. Bei einer vorgenommenen Analyse hat sich nun ergeben, daß die Auslegung der Urnenverzierungen von Moltzow wirklich kohlensaurer Kalk sei; schon eine unbedeutende, abgeschabte Kleinigkeit brauset unter Scheidewasser hoch und vollständig auf, so daß ein erster Versuch zur Ueberzeugung völlig hinreicht. - Wäre die Masse ein vegetabilischer Stoff, so würde er in bloßer Erde ohne Zweifel in Verwesung übergegangen sein, während sie jetzt kreidehart ist.
Diese Auslegung der Urnenverzierungen mit Kalk muß in einer gewissen Zeit der Steinperiode sehr verbreitet gewesen sein. Auch von Estorff in den Heidnischen Alterthümern von Uelzen, 1846, bildet dort Taf. XV, Fig. I, eine charakteristische Urne aus der Steinperiode ab, welche nach S. 50 zu Masendorf im A. Oldenstadt in einem Steingrabe neben 3 steinernen Keilen und "sehr großen, ziemlich gut erhaltenen Knochen lagen, welche einem vollständigen menschlichen Skelette angehört zu haben scheinen. Auf dieser becherförmigen Urne ist die eingedrückte, sehr reiche Verzierung mit einer schneeweißen Masse, welche sich an mehreren Stellen erhalten hat, ausgestrichen, was dem Gefäße, der Bestimmung gemäß, etwas Leichenhaftes giebt".
Wozu dieser Kalk bestimmt gewesen sei, ob bloß zum Ornament, ob zur Verzehrung der fleischigen Theile des Leichnams, wie es noch heute in ansteckenden Krankheiten geschieht, muß einer genauern Beobachtung überlassen bleiben; so viel scheint gewiß zu sein, daß sich die mit Kalk ausgelegten Urnen in solchen Steinkammern finden, in welchen nichtverbrannte Leichen beigesetzt wurden. In dem Grabe von Moltzow waren einige Verzierungen nicht mit Kalk ausgelegt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 403 |




|



|



|
|
:
|
Ueber das Hünengrab von Katelbogen.
Das Hünengrab von Katelbogen bei Bützow, welches in Frid. Franc. Tab. XXXVI, Fig. I und III, und Erläut. S. 163, abgebildet und beschrieben ist, ist wohl das großartigste Denkmal aus der heidnischen Steinperiode in Meklenburg und gehört zu den bedeutendsten Steingräbern Deutschlands. Die aus dem Hügel hervorragende gewaltige Steinkiste ist an der einen Seite geöffnet. Der Herr Friedrich Seidel zu Bützow besuchte im August 1846 das Grab und untersuchte das Innere der Steinkiste; er fand in derselben noch eine Urnenscherbe mit Verzierungen, welche aus kräftig und kurz eingestochenen perpendiculairen Zickzacklinien bestehen, ganz in demselben Charakter, welcher Jahrb. X, S. 253 flgd. dargestellt ist. Es geht hieraus hervor, daß das Hünengrab von Katelbogen der Periode der bisher in Meklenburg aufgedeckten Hünengräber angehört, daß es aber, wie die meisten, jetzt offen stehenden Steinkisten, schon in frühern Zeiten ausgeräumt ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Alt=Pokrent.
Im Frühling des J. 1846 ließ der Herr Landdrost von Wrisberg zu Gadebusch ein Hünengrab auf der Feldmark von Alt=Pokrent bei Gadebusch unter sorgsamer Aufsicht öffnen und vorsichtig abtragen und übergab dem Vereine den Fundbericht und den alterthümlichen Inhalt des Grabes. Das Grab, welches an der neuendorfer Grenze lag, war 7 ' lang, gegen 5 ' breit und 3 ' tief, von großen Granitblöcken in den Wänden aufgebauet und mit 3 großen, breiten Granitblöcken bedeckt; die Fugen waren von außen sorgfältig verzwickt und das Ganze war auf einem Raume von einer Quadratruthe von vielen kleinern Steinen umgeben. Der innere Raum war bis zur Decke fest mit guter Erde gefüllt. Beim sorgfältigen Ausgraben der Erde fanden sich 3 geschliffene Keile aus Feuerstein, nämlich
1 kurzer, breiter und dicker Keil aus weißgrauem Feuerstein, 4 " lang,
1 dünner Keil ans grauem Feuerstein, 4 " lang,
1 hohl geschliffener Keil aus weißgrauem Feuerstein, gegen 6 " lang.
Weiter fand sich nichts in dem Grabe, keine
Urnenscherben, keine weiß ausgeglüheten
Feuersteine
 ., so daß es scheint, als wenn
eine nicht verbrannte Leiche in das Grab gesetzt
gewesen sei, da vom Leichenbrande keine Spur
vorhanden war.
., so daß es scheint, als wenn
eine nicht verbrannte Leiche in das Grab gesetzt
gewesen sei, da vom Leichenbrande keine Spur
vorhanden war.


|
Seite 404 |




|
In der Nordostecke der Steinsetzung war eine Oeffnung, ein Eingang, mit zwei Stufen, welche jedoch mit Erde und Steinen zugedeckt war.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Rundschleifsteine oder Klopfsteine von Garvensdorf, Basdorf und Rederank.
Der Herr Pastor Vortisch zu Satow hat dem Vereine zwei sogenannte "Klopfsteine" aus der Gegend von Neubukow eingesandt, die ersten, welche der Verein erworben hat; der eine ist auf dem Felde von Garvensdorf gefunden, der andere, ein Geschenk des Herrn Erbmüllers Tiedemann zu Satow, auf dem Felde von Basdorf. Der garvensdorfer Stein ist vollständig erhalten, der basdorfer nur zur Hälfte, da er der Länge nach durchgespalten ist.
Die Steine sind eiförmig, von ungefähr 3 " Länge und aus röthlichem, hornsteinfelsigen Gestein oder feinkörnigem, quarzigen, rothen Sandstein; sie sind nicht behauen, sondern naturwüchsig und haben an allen, einigermaßen breiten Seiten regelmäßige, durch Kunst gemachte, runde Vertiefungen. Die skandinavischen Forscher nehmen an, daß mit diesen Steinen die feuersteinernen Geräthe bearbeitet, roh zugehauen, geschlagen (tillknackat) wurden und nennen sie deshalb "Knacksteine" oder "Klopfsteine" (vgl. Jahrb. XI, S. 351); sie glauben, die runden Höhlungen auf den Seiten dieser Steine hätten dazu gedient, die Steine besser fassen zu können, um mit den Enden und Ecken die Feuersteine zu schlagen. Es lassen sich aber gegen diese Ansicht gerechte Bedenken erheben. Es finden sich freilich solche Steine, welche nur an zwei flachern Seiten Eindrücke haben und welche an den spitzen Enden rauh sind; jedoch mögen solche Exemplare nicht häufig sein. Es ist nicht anzunehmen, daß man sich um einer zierlichen Bequemlichkeit willen die Mühe gemacht haben sollte, die runden Vertiefungen in das harte Gestein zu schleifen; überdies gehen diese Vertiefungen oft viel tiefer, als es zu diesem Zwecke nöthig gewesen wäre. Ferner tragen diese Steine an den spitzen Enden oft keine Spur, daß mit ihnen etwas geschlagen worden sei; im Gegenteil sind sie oft ganz so, wie die Naturrevolution sie gestaltet und hergeschwemmt hat; auch in den nordischen Sammlungen sind einige Exemplare an den spitzen Enden nur so unbedeutend angegriffen, daß man diese Stellen mit Mühe heraussuchen muß.
An den vorliegenden beiden Steinen ist keine Ecke durch Schlagen angegriffen, sondern völlig naturgemäß. Der etwas


|
Seite 405 |




|
platte garvensdorfer Stein hat an den zwei breiten Seiten runde Eindrücke, ist aber auch an mehrern Stellen der übrigen Langsseiten angeschliffen. Der barsdorfer Stein hat rund umher und auch an einem Ende große Vertiefungen, welche so tief gehen, daß sie sich beinahe berühren. Von der Benutzung zum Klopfen ist keine Spur.
Es ist daher zu Vermuthen, daß diese Steine nicht zum Klopfen, sondern zum Schleifen gebraucht sind, und zwar zum Schleifen der convexen Seiten der hohlen Schmalmeißel u. dgl.; vielleicht konnten sie auch zum Bohren der Streitäxte benutzt werden, um nämlich dem einen, nicht bohrenden Ende des Bohrwerkzeuges bei dessen Umdrehung nach Art der Drechslerarbeit den nötigen Gegendruck zu geben. Zum Schleifen von Metallen ist das Gestein zu hart; dagegen schleift sich Gestein an Gestein dieser Art sehr leicht ab, schon wenn man zwei Stücke nur wenig an einander reibt.
Die in Jahrb. XI, S. 345 angeführten regelmäßig bearbeiteten, scheibenförmigen Steine, mit einer Rille um den Rand und einem regelmäßigen, leisen Eindrucke in der Mitte einer jeden flachen Seite haben ohne Zweifel eine ganz andere Bestimmung gehabt, vielleicht als Schwungrad zum Gegenschlagen und Aussprengen des Gesteins beim Bearbeiten von Geräthen.
Durch den Erfolg seiner Theilnahme ermuntert, setzte der um die Sammlungen des Vereins vielfach verdiente Herr Pastor Vortisch zu Satow seine Bemühungen fort. Anfangs wollten sie nicht glücken. Da wandte er sich an die Schuljugend 1 ), und in wenig Tagen konnte er 20 interessante Stücke aus fast allen Ortschaften seiner Pfarre und andern Dörfern des Amtes Bukow, nämlich aus Satow, Radegast, Rederank, Miekenhagen und Gerdshagen und aus Retschow und Wendelstorf, an den Verein einsenden, und unter denselben noch einen "Klopfstein" aus Rederank. Dieser, aus festem, quarzigen, rothen Sandstein, wie gewöhnlich die alten Schleifsteine, ist eben so groß und ungefähr eben so geformt, wie die übrigen, mehr vierseitig, an allen 4 Seiten zu einer rundlichen, mehr länglichen Höhlung angeschliffen, jedoch an zwei entgegengesetzten Seiten mehr, als an den andern beiden; das eine Ende ist naturwüchsig und völlig
 . besonders für
Landschullehrer drucken.
. besonders für
Landschullehrer drucken.


|
Seite 406 |




|
unversehrt, das andere Ende platt geschliffen. Auch dieser Stein hat auf keinen Fall zum Schlagen gedient.
Die übrigen von dem Herrn Pastor Vortisch eingesandten Stücke sind: 1 Keil aus Diorit, 1 rundgeschliffener Feuersteinkeil (zerschlagen), 1 halbmondförmiges Feuersteinmesser, 16 spanförmige Feuersteinmesser, 1 Schleuderstein, 2 kleine runde Scheiben, 12 Spindelsteine, welche unten aufgeführt werden sollen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Steinerne Alterthümer aus dem Amte Bukow.
Der Herr Pastor Vortisch zu Satow überreichte dem Vereine folgende von der Schuljugend seiner Pfarre gesammelte Alterthümer:
1 Klopfstein oder Rundschleifstein, gefunden zu Rederank (vgl. oben S. 404);
1 Keil aus Grünstein=Porphyr (Diorit), gefunden auf dem Pfarracker zu Satow, überall geschliffen, 5 1/2" breit, sehr selten;
1 dicke Scheibe aus feinkörnigem, rothen Sandstein, gefunden im See zu Satow, 2 1/4 " im Durchmesser und 7/8 " dick, mit einer Rille um den Rand, an beiden breiten Seiten ganz flach und naturwüchsig (vgl. Jahrb. XI, S. 345);
1 dünne, durchbohrte Scheibe aus feinkörnigem Sandstein, gefunden zu Wendelstorf im A. Bukow, 1 1/2 " im Durchmesser und gut 1/4 " dick, ganz platt und flach bearbeitet, in der Mitte mit einem Loche, um welches ein feiner Kreis eingegraben ist;
16 spanförmige Messer oder Splitter aus Feuerstein, gefunden im See zu Satow;
1 Meißel aus Feuerstein, gefunden unweit der Ostsee zwischen Brunshaupten und Arendsee, überall geschliffen, Bruchstück;
1 geschlagenes, halbmondförmiges Werkzeug aus Feuerstein, wie Frid. Franc. T. XVII, Fig. 3 und 4, gefunden ebendaselbst.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 407 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Alt=Sammit.
Die Feldmark von Alt=Sammit bei Krakow ist reich an interessanten Gräbern 1 ). In Jahrb. XI, S. 391 ist ein aus zwei schönen Bronzeschwertern mit Bronzegriff bestehender Fund aufgeführt, welcher wahrscheinlich zwei verschiedenen Kegelgräbern, hier jetzt mit Nr. 1 und 2 bezeichnet, angehört. Zu dem Inhalte dieser Gräber gehört noch ein später eingesandter
Doppelknopf aus Bronze, einem Hemdsknopfe gleich, von der Grundgestalt des kleinen Knopfes in Jahrb. XI, S. 378, mit einem kreuzförmigen Einschnitte auf der Oberfläche.
Bei dem fernern Ausbrechen von Steinen für die Chaussee griffen die Arbeiter einen hügeligen Platz an, welcher viele Steine zu bergen schien. Der Herr Pätz zu Alt=Sammit nahm die Arbeiter unter Versprechung von Belohnung in Aufsicht und beobachtete den Fortschritt der Arbeit. Es fanden sich auch Bruchstücke von zerbrochenen Urnen, jedoch zeigte sich nichts weiter. Endlich kamen bronzene Alterthümer zum Vorschein und jetzt nahm die Aufdeckung der Herr Pätz selbst vor, welcher auch die gefundenen Alterthümer an den Verein eingesandt hat.
Auf einem Räume von ungefähr 300 □R. lagen jetzt, leicht erkennbar, 12 bis 15 mit Rasen bedeckte Kegelgräber. Jedes Grab bildete einen Kreis von 1 bis 2 □R. und war mit einer in die Erde gesetzten Steinmauer von ziemlich starken Steinen umgeben, welche einen gegen NO. gerichteten Eingang von 12-14 ' Breite zu haben schien. Die meisten dieser Gräber enthielten nur Urnen, welche jedoch alle zerbrochen waren.
Ein Grab barg jedoch einen reichen Schatz von bronzenen Geräthen. Das Grab enthielt in der Mitte einen Steinkegel von 14 ' Länge, 7 1/2 ' Breite und 4 1/2 ' Höhe und war aus 9


|
Seite 408 |




|
starken, vierspännigen Fudern Feldsteinen aufgeführt; zwischen den Steinen fanden sich überall Kohlen und zerbrannte Knochen, und unter den Steinen (also auf dem Urboden) lagen unregelmäßig die Alterthümer. Am nordöstlichen Rande des Steinkegels stand eine aus 4 ziemlich regelmäßigen Steinen gesetzte kleine Steinkiste von 19 □Zoll Größe; in derselben stand
eine Urne, braun, grobkörnig, ohne Verzierungen, schon zerbrochen; sie war mit Knochen und Asche gefüllt und mit einem ziemlich regelmäßigen Steine bedeckt.
Unter dem Steinkegel lagen viele fein gearbeitete Alterthümer aus Bronze, alle mit edlem Roste bedeckt, nämlich:
ein paar Handbergen, wie Jahrb. IX, S. 349, und Frid. Franc. Tab. IV, von denen die eine zerbrochen ist;
ein Schwert, 20 " lang in der Klinge, mit Griffzunge, in welcher 4 Nietlöcher sind; die Spitze ist 4 " lang mit oxydirten Bruchenden abgebrochen. Das Schwert lag mit der Spitze gegen NO. Dieses Schwert hatte einen Griff von Holz und Leder gehabt; denn an der Stelle, wo der Griff hätte liegen müssen, fanden sich allerlei Reste von Sachen, welche denselben gebildet haben werden, nämlich:
Stücke von gebogenem Holze und feinem Leder,
ein bronzener Henkel von der Breite des Schwertes, mit gespaltenen Enden zum Ueberfassen, nur an einer Seite durch erhabene Parallellinien verziert, und
zwei kleine Bernsteinperlen, welche vielleicht auch zur Verzierung des Schwertgriffes gehört haben.
Ferner fand sich beim weiteren Aufräumen:
ein Messer, wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6, mit durchbrochener Griffzunge zum festern Halten des Griffes und mit einem Ringe am Ende des Griffes; der Rücken hat einen sägenzahnförmigen Einschnitt und die Griffzunge ist in einer ganzen Windung umgedreht, jedoch mitten durchgebrochen; in dem Grabe lag das abgebrochene Griffende einen Fuß weit von der Klinge entfernt;
eine Heftel mit zwei Spiralplatten, wie Jahrb. IX, S. 331, und Frid. Franc. Tab. XI; die Heftel ist ungewöhnlich, im Ganzen 10 " lang; der Bügel, welcher mit einer dreifachen Reihe eingeschlagener Dreiecke verziert ist, ist grade und 7 " lang und 5/8 " breit;
ein gravirter Halsring;
ein Diadem, ganz wie Jahrb. IX, S. 333, vollständig erhalten; in einer von den beiden engen Umrollungen an den Enden steckte ein oxydgrün gefärbtes Holz von ungefähr 1/10 " Dicke;


|
Seite 409 |




|
ein Endbeschlag, wie ein Stockknopf, ein Scepterknopf, 5/8 " hoch und im Durchmesser, welcher noch mit Holz gefüllt ist;
ein offener Ring, 1 1/4 " im Durchmesser.
Wahrscheinlich waren in diesem Grabe zwei Leichen, eine männliche und eine weibliche, bestattet. Die zuerst gefundenen Geräthe gehörten wohl der männlichen, die zuletzt gefundenen der weiblichen Leiche. Auch die Größe des Grabes deutet auf zwei Brandstätten neben einander.
In einem andern, dem Grabe Nr. 3 gleich construirten Grabe fand sich
ein Schwert aus Bronze, wie das oben beschriebene, mit Griffzunge und Nietlöchern in derselben, 22 " lang in der Klinge, in zwei Stücke mit oxydirten Bruchenden zerbrochen.
In dem Auswurfe eines andern Grabes fand sich
ein Spindelstein aus weichem, bräunlichen Sandstein, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 15; es ist jedoch nicht gewiß, wo und wie derselbe gelegen hat.
Aus einem andern Grabe konnte nur eine Seitenwand von einer
Urne herausgeholt werden, welche grobkörnig, braun und nicht verziert war.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Dammerow, D. A. Lübz.
Zwischen Vietlübbe und der Quasliner Mühle auf dem Dammerower Felde lagen früher mehrere Kegelgräber, von denen die meisten längst zerstört sind. Da wo von Vietlübbe nach der Quasliner Mühle der Weg durch den Geelsbach sich bis zu dem höchsten Puncte erhebt, auf der dritten terrassenförmigen Erhebung, lagen 4 Kegelgräber nahe an einander fast in grader Linie von Osten nach Westen; von diesen ist das östliche, kleine Grab anscheinend noch erhalten, dann das dritte, welches zur Sandgrube bei der letzten Vermessung ausgeschlagen ist und von welchem bereits zur Besserung des Weges durch die Wiesen ein Theil am nordwestlichen Ende weggefahren war. Der 2te und der 4te Kegel scheinen gänzlich durchwühlt zu sein. Da dem Grabe,


|
Seite 410 |




|
welches ich als das dritte von Osten bezeichnete, der Untergang drohte, besonders bei einem intendirten Brückenbaue über den Bach, im Frühjahre auch von Dars aus bereits Steine dicht am Rande ausgegraben und weggefahren waren, so hielt ich es für rathsam, im Interesse des Vereins die Aufgrabung vor weiterer Zerstörung vorzunehmen. Zu einer genaueren Aufdeckung, namentlich größerer Gräber forderten mich briefliche Andeutungen meines Freundes Lisch auf, und so begann ich denn, da dieses Grab einen Umfang von 10 1/2 Ruthen und eine Achsenhöhe von 11 Fuß hatte, also Ausbeute vermuthen ließ, die Aufdeckung im Monate September mit der größten Vorsicht und Aufmerksamkeit.
Das Grab war umstellt am Fuße mit einem Steinkreise, nur nordwestlich waren vor kurzem Steine ausgebrochen. Aufgetragen ist dieses Kegelgrab aus dem rothgelben, grobkörnigen Sande, aus welchem der Untergrund des Erdbodens umher besteht, obgleich die Oberfläche mit Geröllsteinen stark bedeckt ist. Doch ist nirgends umher eine Grube sichtbar, aus welcher der Sand genommen sein könnte. Bei der von Südosten und Südwesten fortschreitenden Aufdeckung kamen nach und nach drei Steinsetzungen zum Vorschein, nämlich ein Steingewölbe im Norden und ein anderes größeres im Süden, an welches letztere sich in einer Höhe von 5 Fuß ein drittes fast nach der Mitte des Hügels hin oben anschloß und bis dicht unter die Sanddecke des Hügels reichte. Um nichts zu zerstören, ließ ich nun von Norden und Westen graben und die Steinhügel bloß legen. Dadurch ward die Uebersicht des Ganzen gewonnen und konnte der Grundriß genau genommen werden. Das südliche Steingewölbe lag auf dem Urboden, ging bis auf 3 Fuß ungefähr an den Steinkreis des ganzen Grabes hinan, war 40 Fuß von Osten nach Westen lang, hatte eine größte Breite in der Mitte von 20 Fuß und eine Höhe von 7 Fuß. Das zweite Gewölbe ruhete auf einem Sandauftrage von 5 Fuß Höhe, reichte bis 1 Fuß unter die Decke, war also 5 Fuß in der Mitte hoch und zeigte eine Länge von 30 Fuß und eine Breite von ungefähr 18 Fuß, welche aber nach Süden sich etwas unregelmäßig nach dem ersten Gewölbe hinneigte. Das dritte Gewölbe lag nahe am nördlichen Rande, ein wenig mehr westlich, als die beiden ersten; es war auf einer kleinen Sanderhöhung, da der natürliche Boden nach Nordosten sich abdacht und daher ein kleiner Auftrag zum Ebenen der Fläche nöthig gewesen war, angelegt in einer Länge von 26 Fuß von Osten nach Westen, einer Breite von 10 Fuß und einer Höhe von 5 Fuß.


|
Seite 411 |




|
Zuerst ward dieser letzte, nördlich liegende Steinhaufe abgetragen, der keine Spur von Brand an den Steinen zeigte; unter demselben aber war eine fast kreisrunde Brandstelle von etwa 8 Fuß im Durchmesser, in deren Mitte eine kleine Urne mit der Oeffnung gegen Osten gewandt, aber zerdrückt lag. Diese Urne, hellbraun mit einem Henkel zum Durchfassen mit einem starken Finger, ohne Verzierung, ist 4 1/4 " hoch, am oberen Rande 5 ", im Bauche 6 " weit, hat keinen Fuß, sondern ist nach unten flach abgerundet und hat unten auswendig einen runden Eindruck von 1 3/4 " Durchmesser. Sonst hat sie fast die Form, wie die im Jahrb. XI, 362 unter 3 abgebildete Urne. In der Urne war nur etwas dunkler gefärbter Sand. Daneben lag ein Feuerstein mit einer fast halbkugelförmigen, nicht muschelartigen Vertiefung, mit einem fast wie abgeschnitten scheinenden Rande. Unterhalb dieser Urne zog sich der Brand tiefer in die Erde, und beim Nachgraben kam eine kesselförmige Vertiefung von 3 Fuß oberer Breite und eben so großer Tiefe zum Vorschein.
Darauf ward die zweite Steinwölbung abgetragen, unter welcher eine Brandstelle von 12 Fuß Länge und 8 Fuß Breite sichtbar ward, und in deren Mitte eine in der Mitte geschiedene Steinkiste, jede Abtheilung von 2 Fuß innerer Breite im Quadrate, stand; in jeder dieser Abtheilungen fand sich eine, aber durch die hineingedrückten Steine leider so zerbrochene Urne, daß sich deren Gestalt nicht ermitteln ließ; beide aber waren glatt, mit abgerundetem Bauche, unverziert, aber die eine grob und dick, die andere feiner und dünner gearbeitet. Unter und zwischen den Urnenscherben waren viele Knochen eines erwachsenen Menschen, und dazwischen eine Heftel aus Bronze, mit 2 vollen Blechplatten, um welche nur eine Windung von starkem Drathe läuft, der zugleich den erhabenen Bügel bildet. Die Platten haben in der Mitte einen getriebenen Buckel, zum Auf= und Anlegen der frei um den einen Bügelarm sich bewegenden Nadel, welche auf dem stumpfen Ende eine ringförmige Gestalt zum Auflegen auf den erhabenen Buckel hat. Die Drathwindungen sind oben mit leichten Schräglinien verziert und der kurze Bügel oben tiefer geriefelt. Sie trägt ganz den Character der im Frid. Franc. XX, 13 abgebildeten Heftel 1 ). Die Heftel war schon zerbrochen. Daneben lag noch ein geschlossener Fingerring aus Bronze.


|
Seite 412 |




|
Der dritte Steinhügel ward nun behutsam abgetragen, und fand sich darin in der Höhe von etwa 3 Fuß über dem Urboden eine Brandstelle. Sie ließ sich in einer Länge von 8 Fuß und einer Breite von 4 Fuß deutlich verfolgen, denn die oberhalb liegenden Steine zeigten keine Spur von Brand, während die darunter liegenden geschwärzt, theilweise mürbe waren, auch Asche und Kohlen auf den Steinen lagen. In der Mitte dieser Brandstelle stand eine zertrümmerte Urne, angefüllt mit brandiger, übel riechender Erde und im Sande ein Messer aus Bronze. Von Knochen war keine Spur zu finden. Die Urne ließ sich aus den Bruchstücken erkennen als eine ziemlich dicke, große, fast schalenförmige mit kleinem Fuße und oben fast gradwandige Urne, ungefähr wie Jahrb. XI, S. 357, unterhalb der Bauchwölbung nach unten ganz rauh. Das Messer, wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6 und 9, ist sensenförmig gebogen, in der mit 2 erhabenen, durch Querstriche verzierten Linien am Rücken auf jeder Seite ausgezeichneten Klinge 3 1/2 " lang; der Griff hat in der Mitte ein längliches und am Ende ein rundes Loch zum Anhängen; er ist an den Seiten ebenfalls mit Schrägstrichen verziert. Die Grifflänge beträgt nur 2 ". Der Oxyd ist tiefer, als der auf der Heftel.
Uebersehen wir nun noch einmal die abgetragenen Stellen, so war im Norden eine kesselförmige Brandstelle, über deren Ausfüllung eine kleine Henkelurne lag. In der Mitte des Grabes, aber etwas nach Süden, eine 5 Fuß hohe Brandstelle aus Sand, wo wahrscheinlich die Leiche verbrannt war, mit aufgesetzter Steinkiste zur Aufbewahrung der Knochen, zweier Urnen und des Bronzeschmuckes, nämlich der Heftel und des Ringes. Südlich davon eine Brandstelle, 3 Fuß hoch auf Steinen, mit einer Urne, worin Asche und das Messer aus Bronze. Fanden die Freunde Lisch und Beyer im Grabe zu Peckatel alle Alterthümer in einer Linie von Osten nach Westen, so waren hier die Alterthümer in fast grader Linie von Süden nach Norden. Deshalb möchte es gerathen sein, alle größeren Kegelgräber ganz abzutragen und keine Ecke stehen zu lassen, da eben in solchen Ecken sich Manches bergen kann.
In dem Sande unter der mittleren Brandstelle und zwischen den Steinen unterhalb der südlichen Brandstelle war keine Spur von Alterthümern. Die gänzliche Abtragung war erst im November vollendet.
| Vietlübbe, 1846. | J. Ritter. |


|
Seite 413 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Alt=Schwerin.
Ein Arbeiter brachte mir folgende Sachen, welche auf dem alt=schweriner Felde, in den Tannen, unweit der Chaussee, in einem kleinen Kegelgrabe, inwendig mit einer Steinkiste mit 2 Urnen, angefüllt mit Knochen, gefunden waren:
1 dünnes Scheermesser 1 ), mit leichtem Roste,
1 Hütchen, mit glänzendem edlen Roste,
1 Nähnadel, mit einem Oehr in der Mitte der obern Hälfte,
sämmtlich aus Bronze.
| Vietlübbe, 1846. | J. Ritter. |
Etwa zu gleicher Zeit sind von dem Herrn Senator Schultetus zu Plau folgende zu Alt=Schwerin gefundene Bronze=Alterthümer erworben und dem Vereine geschenkt:
2 Hütchen, mit glänzendem edlen Rost, beide zerbrochen;
1 Pfriemen oder eine grade Nadel ohne Kopf, 4 1/2 " lang, 1/8 " dick, am Kopfende mit Parallellinien verziert;
1 Halsring, gravirt, mit edlem Roste, Bruchstück;
1 Halsring, gewunden, Bruchstücke;
1 Ring, 1 " im Durchmesser;
1 offener Beschlagring, 5/8 " im Durchmesser und 3/8 " breit;
1 kleines Gefäß, 2 1/2 " hoch, ungefähr von der Gestalt der Urne in Jahrb. XI, S. 356, von äußerst schönen Formen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Mallin.
Zu Mallin bei Penzlin wurden eine kleine, dünne, schwarzbraune Urne, gegen 4 " hoch, und zwei spiralcylindrische Armringe aus Bronze, jedoch nicht vollständig, sondern jeder von zwei Windungen aus schmalen, platten Streifen, gefunden und von dem Herrn Baron von Maltzan auf Mallin dem Vereine geschenkt.
 . zusammen gefunden
werden, so liegt es nahe, zu glauben,
daß diese Messer zu feinern Näharbeiten
gebraucht wurden; vielleicht dienten
auch die bei diesen Messern häufig
gefundenen Zangen oder Pincetten zum
Zusammenhalten der Stücke, welche
zusammengenähet werden sollten. Dennoch
konnten auch diese Messer und Pincetten
zur Haarcultur gebraucht
werden.
. zusammen gefunden
werden, so liegt es nahe, zu glauben,
daß diese Messer zu feinern Näharbeiten
gebraucht wurden; vielleicht dienten
auch die bei diesen Messern häufig
gefundenen Zangen oder Pincetten zum
Zusammenhalten der Stücke, welche
zusammengenähet werden sollten. Dennoch
konnten auch diese Messer und Pincetten
zur Haarcultur gebraucht
werden.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 414 |




|



|



|
|
|
Kegelgrab von Kittendorf.
Beim Bau der Chaussee von Waren nach Stavenhagen ward auf der Feldmark Kittendorf beim Ausbrechen von Steinen in einem Hügel eine mit zerbrannten Knochen gefüllte Urne gefunden, welche jedoch bei der Arbeit ganz zertrümmerte. Auf dieser Urne stand ein kleines, gehenkeltes Gefäß aus Thon, 2 " hoch, fast halbkugelförmig, von einfachen Formen, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 11, welches der Herr Landrath von Oertzen auf Jürgenstorf dem Verein eingesandt hat.



|



|
|
:
|
Bronze=Wagen von Peccatel und Frisack.
In Jahrb. IX, S. 373 flgd. und Lithographie Fig. 3 ist ein in dem merkwürdigen Kegelgrabe von Peccatel bei Schwerin gefundener kleiner Wagen aus Bronze beschrieben und abgebildet, welcher vier vierspeichige Räder hat. Im J. 1846 ward nun auf einem Berge bei Frisack ein ähnlicher Fund gemacht, von welchem der Herr Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin Nachricht und Zeichnung an den Verein eingesandt hat. Es ward nämlich gefunden:
ein Messer aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6, schön verziert, mit einer Längsöffnung im Griffe;
ein Armring aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 3;
eine Nadel aus Bronze von einer Heftel mit zwei Spiralplatten;
zwei Wagenräder aus Bronze, wie die auf der Lithographie zu Jahrb. IX, Fig. 3 abgebildeten, 4 3/4 " im Durchmesser, ebenfalls mit 4 Speichen, nur etwas zierlicher gearbeitet, als die zu Peccatel gefundenen Räder.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Zu Wieck bei Schwaan, in der Nähe des Burgwalles von Werle (vgl. Jahrb. VI, S. 88 flgd.), ward bei Gelegenheit der Eisenbahnarbeiten ein interessanter Fund von Bronze=Geräthen gemacht und für die großherzogliche Alterthümersammlung erworben, besonders durch die Bemühungen des Herrn Amtsverwalters, Advocaten Görbitz zu Schwaan, welcher auch die Be schaffenheit der Oertlichkeiten ermittelt hat.
Der Hof Wieck liegt niedrig, nahe an der Warnow. Nicht weit von demselben, mehr südöstlich, liegt der Burgwall von


|
Seite 415 |




|
Werle, von der einen Seite von einem Kniee der Warnow, von den andern Seiten von einer tiefen Sumpfwiese umgeben, welche nach angestellten Bohrungen an 40 Fuß tief ist. - Mehr südlich, nach Kassow hin, grenzt der Garten des Hofes an eine ebenfalls mit den Warnowwiesen zusammenhangende Wiese. Südlich hinter dieser Wiese erhebt der Boden sich wieder und es beginnt, ungefähr einen Büchsenschuß weit von dem Burgwalle von Werle, eine allmählig aufsteigende Sandscholle, welche wohl 4 bis 500 Schritte lang und gegen die umherliegenden Flächen etwa 12 Fuß hoch ist. Wo die Sandscholle sich endigt, beginnt wieder der Warnowsumpf, welcher hier vor einigen 20 Jahren noch ein großer Teich gewesen ist. Durch diese Sandscholle geht die Eisenbahnlinie von Schwaan nach Bützow. Etwas über den Anfang der Sandscholle hinaus, ungefähr 50 Ruthen vom wiecker Garten nach Kassow hin, in der linken Dossirung der Bahnlinie, etwa 2 Fuß unter der Oberfläche im Sande, wurden von den Arbeitern mehrere Bronzegeräthe gefunden. Alle sind ziemlich gut erhalten und mit edlem Rost bedeckt. Es sind:
1 Streithammer, gegen 7 1/2 " lang und in der größten Ausdehnung 5/8 " hoch, mit Schaftloch, an dem einen Ende beilförmig wie eine Framea ausgeschweift, am andern Ende stumpf endigend und hier unregelmäßig offenbar breit geklopft, an den Seiten mit 4 Furchen verziert: ein seltenes Stück, das erste, welches in Meklenburg gefunden ist, ungefähr wie das in Büsching's Alterth. Schlesiens T. IV, Fig. 1, abgebildete Exemplar;
3 Frameen, mit Schaftrinne, wie Frid. Franc. T. XIII, Fig. 5, und Jahrb. IX, S. 335, 7 ", 7 1/2 " und 8 " lang;
1 Lanzenspitze, 12 " lang, am Schaftloche mit Reifen von Linien, eingeschlagenen Dreiecken und Spitzen verziert;
4 Sicheln, wie Frid. Franc. T. XVII, Fig. 7, alle mit einem rechtwinklig aufgesetzten Knopfe am breiten Ende;
1 Nadel, 14 " lang, am obern Ende mit einer runden Scheibe von ungefähr 3 " Durchmesser, wie Frid. Franc. T. XXIV, Fig. 20, und Jahrb. IX, S. 332, jedoch in der Mitte in einem Kreise und um diesen in 6 Kreissegmenten durchbrochen, das erste Stück dieser Art, welches in Meklenburg beobachtet ist, deren jedoch in den Rheingegenden viele gefunden sind; ähnliche Nadeln sind abgebildet in v. Estorf Heidn. Alterth. T. VIII, Fig. 5-7, Schaum Alterth. Samml. zu Braunfels, T. IV, Fig. 98, Klemm German. Alterthsk. Taf. II, Nr. 7, und §. 21, S. 61, Dorow Opferstätten T. II, Fig. 3 und T. X, Fig. 1 und 2; sie werden vorzüglich in den Rheingegenden gefunden;


|
Seite 416 |




|
Ungefähr 150 Schritte davon entfernt, in der Bahnlinie selbst, stießen die Arbeiter ungefähr 5 Fuß tief unter der Erdoberfläche auf einen kleinen, runden, oben flachen Bau von Feldsteinen, etwa 1 ' hoch und 1 1/2 ' im Durchmesser. Hievon ungefähr 100 Schritte entfernt, ebenfalls in der Bahnlinie, stand in gleicher Tiefe ein zweiter Bau von Feldsteinen; dieser war rund, ungefähr 4 ' hoch, 2 bis 3 ' im Durchmesser und oben flach. Die obere Fläche war aus abgeplatteten Steinen construirt, welche alle schwarz waren und eine schwarze, angebrannte Kruste zu haben schienen.
Alle diese Erscheinungen deuten offenbar auf Wohnstätten oder Opferstätten. Hiefür redet schon die Menge der Bronzegeräthe gleicher Art, welche alle keine Spur von Leichenbrand haben und bei denen nichts weiter gefunden ward. Auch bei der Steinerhöhung ward nichts weiter gefunden, weder Gefäß oder Gefäßscherben, noch Knochen oder Kohlen. Vielleicht aber war dieser Fund ein vom Rheine her hier eingeführter Waarenvorrath.
Diese Beobachtungen führen denn unwillkürlich zu der Ansicht, daß die großen wendischen Burgstellen schon in der Bronzezeit besonders ausgezeichnete und bewohnte Orte waren.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Alterthümer aus der Gegend von Krakow.
Von dem Herrn Apotheker Block zu Krakow sind dem Vereine folgende Bronzealterthümer geschenkt, welche in der Gegend von Krakow gefunden sind, jedoch ungewiß wo:
in Kegelgräbern sind gefunden:
1 kurze Schwertklinge, mit edlem Rost, 9 " lang in der Klinge, mit Griffzunge mit Nietlöchern; die Griffzunge und die Klingenspitze ist abgebrochen, die Klinge mitten durchgebrochen;
1 Messer, mit edlem Rost, mit Bronzegriff, im Ganzen 9 " lang; die Spitze ist abgebrochen;
1 Pincette, mit Rost, breit und kurz, 2 " lang;
1 Pincette, mit edlem Rost, schmal und lang, 2 3/4 " lang;
1 Doppelknopf einer Nadel, wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 3, ohne Rost (anscheinend in einem Moor gefunden);
1 Heftel mit 2 Spiralplatten, mit breitem Bügel,
wie Frid. Franc. Tab. XI, Fig, 2, nur kleiner, 4
" lang, in 2 Stücke zerbrochen; das
Kopfende der Nadel bildet eine massive, runde
Platte, in welche das gewöhnliche Doppelkreuz
 gravirt ist (vgl. Jahresb. VII,
S. 26);
gravirt ist (vgl. Jahresb. VII,
S. 26);


|
Seite 417 |




|
1 Heftelnadel, 5 1/2 " lang, mit Doppelkreuz am Ende; die Heftel fehlt;
1 Heftelbügel, 2 3/5 " lang, dünne gewunden, mit hellgrünem, edlen Rost;
im Acker ist gefunden:
1 Heftel, vollständig, 3 " lang, mit rundem, gebogenen Bügel, mit 2 ganz kleinen Spiralplatten, mit einer runden Scheibe am Ende der Nadel, welche zu einem einfachen Kreuze durchbrochen ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Heftel mit zwei Blechplatten.
Der Herr Erblandmarschall, Graf Hahn auf Basedow
 . hat dem Vereine eine Heftel aus
Bronze geschenkt, welche in Meklenburg zu den
größten Seltenheiten gehört. Sie ist in den
hahnschen Gütern gefunden und ohne Rost. Die
Hefteln aus der Zeit der Kegelgräber, welche in
Meklenburg häufig gefunden werden, haben an den
Enden des langen Bügels stets zwei runde
Spiralplatten, welche aus rundem Drath
zusammengebogen sind. Die vorliegende, 10 1/2
" lange Heftel hat jedoch zwei große,
schildförmige, gewölbte, ovale Blechplatten, von
4 1/2 " bis 5 " Durchmesser. Diese
Platten sind in der Mitte mit einem Buckel
verziert, um welchen vier schmale, erhabene, mit
gravirten Querlinien geschmückte Reifen liegen,
welche gegen den Bügel in zwei augenförmige
Verzierungen zusammenlaufen. Diese Platten
werden durch einen kurzen, nur 2 1/2 "
langen, muschelförmigen Bügel zusammengehalten.
Um den Bügel bewegt sich eine kurze, nur 4 1/2
" lange Nadel, welche mit einer
leierförmigen Gabel um das eine Ende des Bügels
gebogen ist. Der Bügel ist an beiden Enden durch
umgelegte Bronzestreifen geflickt.
. hat dem Vereine eine Heftel aus
Bronze geschenkt, welche in Meklenburg zu den
größten Seltenheiten gehört. Sie ist in den
hahnschen Gütern gefunden und ohne Rost. Die
Hefteln aus der Zeit der Kegelgräber, welche in
Meklenburg häufig gefunden werden, haben an den
Enden des langen Bügels stets zwei runde
Spiralplatten, welche aus rundem Drath
zusammengebogen sind. Die vorliegende, 10 1/2
" lange Heftel hat jedoch zwei große,
schildförmige, gewölbte, ovale Blechplatten, von
4 1/2 " bis 5 " Durchmesser. Diese
Platten sind in der Mitte mit einem Buckel
verziert, um welchen vier schmale, erhabene, mit
gravirten Querlinien geschmückte Reifen liegen,
welche gegen den Bügel in zwei augenförmige
Verzierungen zusammenlaufen. Diese Platten
werden durch einen kurzen, nur 2 1/2 "
langen, muschelförmigen Bügel zusammengehalten.
Um den Bügel bewegt sich eine kurze, nur 4 1/2
" lange Nadel, welche mit einer
leierförmigen Gabel um das eine Ende des Bügels
gebogen ist. Der Bügel ist an beiden Enden durch
umgelegte Bronzestreifen geflickt.
Hefteln ganz dieser Art, abgebildet in v. Estorf Heidn. Alterth., Taf. XI, Fig. 3, und in Antiquar. Annaler. IV, 2, T. II, Fig. IV, sind in Meklenburg=Schwerin bisher noch nicht beobachtet; vor nicht langer Zeit wurden einige an der Müritz bei dem Bau des vipperowschen Erddammes gefunden und an die großherzogliche Sammlung zu Neustrelitz abgeliefert. Eine sehr ähnliche, jedoch etwas verschiedene Heftel ward in dem Kegelgrabe von Dammerow gefunden; vgl. oben S. 411; jedoch ist bei dieser die Nadel noch länger und legt sich mit dem durchbohrten Knopf auf den einen Buckel. Hefteln dieser Art haben einen mehr nordischen Charakter.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 418 |




|



|



|
|
:
|
Kopfring im Thürknopf am Dome zu Güstrow.
An der nördlichen, noch im Rundbogenstyl erbaueten Hauptpforte des nördlichen Kreuzschiffes der Domkirche zu Güstrow ist als Thürknopf ein mit Weinlaub umgebener, großer, aus Bronze gegossener Menschenkopf angebracht, welcher einen großen Ring im Munde hangen hat. Der Kopf ist in strenge mittelalterlichem Style gearbeitet. Der Ring aber ist ein Kopfring aus der heidnischen Bronze=Periode der Kegelgräber ganz so, wie der in Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 3 abgebildete, bei Ludwigslust gefundene Kopfring. Wahrscheinlich ist dieser Ring ein Fund aus alter Zeit, zu diesem Zweck verwandt; möglich könnte es jedoch sein, daß der Kopf mit dem Ringe aus sehr alter Zeit stammte, und, wie vielleicht die öfter gefundenen Kopfringe selbst, welche allerdings immer aus derselben Form und etwas ungewöhnlich sind, aus dem früher germanisirten Deutschland in das damals noch heidnische Meklenburg eingeführt ward.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Antike Quetschmühlen.
1. Quetschmühle von Doberan.
Es werden sehr häufig im Lande längliche Granite gefunden, welche halbmuldenförmig ausgehöhlt sind, wie eine Abflußrinne. Im Aeußern sind die Steine immer unregelmäßig und naturwüchsig; die längliche Höhlung ist aber immer sehr regelmäßig und glatt, und stark und tief ausgearbeitet. An einer Seite ist der Stein immer unregelmäßig und naturwüchsig abgestumpft und die Höhlung offen. Diese Steine wurden früher für Weihkessel gehalten, welche mit dem abgestumpften, offenen Ende in die Mauer gesetzt worden seien. Es finden sich solche Steine wirklich mitunter zu Weihkessel benutzt, namentlich in die Außenwände der Kirchen unter Nischen zu Heiligenbildern eingemauert. Hiergegen reden aber mehrere Gründe:
1) die Steine werden bei einiger Aufmerksamkeit ungemein häufig gefunden, auch auf Feldmarken, auf denen nie ein christliches Gotteshaus gestanden hat;
2) die Steine sind in der ganzen Länge äußerst regelmäßig ausgehöhlt und in der Mitte ist die Höhlung etwas vertieft, so daß man klar sieht, daß die Höhlung durch langes Reiben so glatt und regelmäßig geworden ist;


|
Seite 419 |




|
3) Steine dieser Art sind mehrere Male tief in Kegelgräbern, zwischen den Steinen der über der Brand= und Begräbnißstelle aufgeführten Steinkegel, gefunden.
Es ist daher wahrscheinlich, daß sie in den ältesten Zeiten als Mühlsteine in der Art gedient haben, daß das Getreide mit Keulen in denselben gestampft und nach und nach aus dem offenen Ende herausgedrängt ist.
Der Herr Präpositus Crull zu Doberan fand nun auch einen solchen Stein von mäßiger Größe, so daß er sich durch Manneskraft noch tragen läßt, auf dem Felde zu Doberan in einer Steinsetzung unter andern Feldsteinen beim Brechen von Chausseesteinen und schenkte ihn dem Vereine; auf dem doberaner Felde finden sich nun sehr häufig unter dem beackerten Boden niedrige Kegelgräber, von denen sehr viele bei dem Chansseebau ausgebrochen sind; es ist daher wahrscheinlich, daß dieser Stein auch unter den Steinen eines niedrigen Kegelgrabes gelegen hat.
In Doberan selbst finden sich noch zwei solcher Steine: beide dienen jetzt zu Abflußrinnen unter den Ableitungen der Dachrinnen, der eine am Logierhause, der andere an einem Hause in einer hintern Straße des Ortes.
Im J. 1846 ward auch ein solcher Stein am Ufer des schweriner Sees im Wasser gefunden und an das großherzogl. Antiquarium eingeliefert. An der Kirche zu Verchen bei Demmin ist ein solcher Stein zu einem Weihkessel benutzt; vgl. Balt. Studien VII, 2, 1841, S. 104. In unserm Jahresber. VII, S. 45 ist ein solcher Stein als Weihkessel bezeichnet.
Uebrigens habe ich selbst dergleichen Steine ungemein häufig auf dem Lande beobachtet.
G. C. F. Lisch.
2. Quetschmühle von Spornitz.


|
Seite 420 |




|
neigt war. Der spornitzer Fund läßt indeß keinen Zweifel über den heidnischen Ursprung dieser Steine, was wichtig genug schien, denselben gelegentlich hieher kommen zu lassen. Es ist ein auf der Oberfläche stark verwitterter Block aus sehr grobkörnigem, rothen Granit von 2 ' 4 1/2 " Länge, 2 ' Breite und 1 ' 3 " Höhe. In der Mitte befindet sich eine völlig regelmäßig ausgehauene (trogartige) Vertiefung von 12 " Tiefe, 13 " Weite und 19 " Länge, welche an dem einen Ende, eben so wie am Boden, rund ausgehöhlt, an dem entgegengesetzten Ende aber offen ist. Da der Stein aber ursprünglich länger gewesen und schon im Alterthum abgebrochen ist, so läßt sich nicht bestimmen, ob die Vertiefung ursprünglich nicht etwa auf beiden Enden geschlossen gewesen sei. Auffallender Weise sind auch die übrigen in unserer Sammlung aufbewahrten Steine dieser Art ebenfalls durchbrochen, ein Umstand, welcher es bedenklich macht, über den Gebrauch dieser Steine schon jetzt eine Vermuthung zu wagen.
W. G. Beyer.
3. Die muldenförmigen Granitsteine.
Dieselben finden sich hier überall bei Retzow und Wangelin bei Lübz zwischen den Gruppen von Kegelgräbern; in Wangelin hat fast jeder Hauswirth einen solchen Stein, aus welchem das Federvieh getränkt wird, und diese Hauswirthe sagen aus, daß sie dieselben von den durch den Herrn Elbzoll=Director, Hauptmann Zinck zu Dömitz (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 5, 56 flgd., 71, 72) aufgegrabenen Kegelgräbern sich geholt haben; - bei Retzow liegen noch 3 solcher Steine bei Kegelgräbern. Auch der Stein zu Granzow (Jahrb. IX, S. 357) ist aus einem zerstörten Kegelgrabe. Ein Bruchstück fand ich 1845 in einem zu Retzow unweit des Landweges aufgegrabenen Kegelgrabe (Jahrb. XI, S. 384 flgd.), etwa 4 Fuß weit vom Umfange des Steinkegels, so daß also der Stein bei der Errichtung des Grabes hinein gekommen ist.
Noch mache ich darauf aufmerksam, daß nicht alle Steine nach einer Seite offen sind, daß ich selbst aus Retzow einen vollkommen muldenförmigen Stein, nach beiden Enden geschlossen, besitze; ja, ich möchte behaupten, es seien alle abgebrochenen Steine erst absichtlich zerschlagen, denn gebraucht sind die Steine stark, wie an den meisten Exemplaren die stufenförmig tiefere Aushöhlung es beweiset, - bei dem Gebrauche aber hätte sich das offene Ende entweder abgerundet, oder es hätte bei Schonung desselben sich eine kleine Erhöhung gebildet; es bricht aber in grader Linie ab.
| Vietlübbe, 1847. | J. Ritter. |


|
Seite 421 |




|



|



|
|
|
Die Graburnen der Wendenkirchhöfe.
Nachdem die charakteristischen Urnen der Stein=Periode in Jahrb. X, S. 253 flgd. und der Bronze=Periode in Jahrb. XI, S. 353 flgd. betrachtet und dargestellt sind, mögen schließlich die Gefäße der sogenannten Wendenkirchhöfe zur Anschauung kommen. Wir haben die Begräbnißplätze der dritten oder Eisen=Periode des Heidenthums Wendenkirchhöfe genannt, weil sie sowohl im Munde des Volkes, als auch in den ältern Acten so genannt werden; so z. B. hatte nach dem Visitations=Protocolle von 1662 der Kirchenbauer zu Walkendorf Acker auf der "Dorfstätte" und auf dem "Wendischen Kirchhofe auf der Heyde" hinter der "Fünte" und im J. 1584 lag in der Grenze des Gutes Fahrenholz der "Wendische Kirchhof" bei dem "wendischen Wege" nach "Wendthagen" (vgl. auch Jahresber. III, S. 124); daher werden die häufigen "Wendfelder" auf den Feldmarken, z. B. 1580, auch "Schottelfelder" genannt, d. i. Schüsselfelder, wegen der in denselben stehenden schüsselförmigen Grabgefäße. Im Munde des Landvolkes hört man noch häufig die Bezeichnung "Wendenkirchhof" für die oft in der Nähe der Dörfer liegenden Begräbnißfelder.
Die durchgehende Eigenthümlichkeit dieser jüngsten Begräbnißstätten des Heidenthums ist, daß ihnen beständig ein Hügelaufwurf (tumulus), kurz jeder Bau über der Erde fehlt. Während die Todten der Stein= oder Bronze=Periode beständig auf der natürlichen Erdoberfläche unter Steinbauten oder aufgeschütteten Hügeln beigesetzt sind, sind die Urnen auf den Wendenkirchhöfen beständig in die Erde eingegraben; man hat weder in Meklenburg, noch in andern Ländern des nordöstlichen Deutschlands, so viel zu Ohren gekommen ist, Urnen der Eisen=Periode unter Hügeln gefunden 1 ). Diese Bestattungsweise bildet den


|
Seite 422 |




|
Uebergang zu dem Begraben der christlichen Todten. Die Urnen sind häufig zwischen drei bis vier kleine, flache Steine, ungefähr von der Größe der Urnen, verpackt und mit einem solchen Steine zugedeckt; oft aber finden sich die Urnen auch ohne allen weiteren Schutz eingegraben. Gewöhnlich stehen die Urnen 1 bis 2 Fuß tief unter der Erdoberfläche; wenn zwei Schichten Urnen über einander stehen, was sich mitunter findet, so steht die untere Schicht verhältnißmäßig tiefer. Ist nun ein solcher Wendenkirchhof in neuern Zeiten zur Ackercultur gebracht, so faßt der Pflug oft den obern Theil der Urnen und reißt die Scherben zu Tage. Daher ist ein Wendenkirchhof durch nichts weiter aufzufinden, als durch asgepflügte Scherben oder durch Volkssagen; gewöhnlich zeigt sie der Zufall an, oft zu spät. Hin und wieder, jedoch selten, ist freilich ein von Natur etwas erhöheter Platz zu einem solchen "Kirchhofe" gewählt, am Ende eines Ackerstückes oder am Rande eines Baches oder eines Holzes; aber dies giebt, da die Oberfläche immer eben ist, kein Kennzeichen, da Millionen von Erhöhungen auf den Feldern stehen, ohne Begräbnißplätze zu sein.
Auf diesen "Kirchhöfen" stehen nun die Begräbnißurnen in großer Zahl, oft zu Hunderten, in geringen Entfernungen neben einander.
Die Leichen der Wendenkirchhöfe sind verbrannt und die verbrannten Gebeine mit einigen Geräthen in die Urnen gepackt. Jedoch sind einige wenige Fälle beobachtet, daß unverbrannte Leichen, zuweilen an den Rändern der Wendenkirchhöfe, eingegraben waren. So fand Ritter auf dem Wendenkirchhofe zu Helm zwei in Särge gelegte Leichen eingegraben (vgl. Jahresb. IV, S. 46, und V, S. 66), und ich selbst fand bei Börzow an den äußersten Rändern eines Wendenkirchhofes voll der charakteristischen Urnen mehrere Leichen begraben (vgl. Lisch Erster Bericht über das großherzogl. Antiquarium zu Schwerin, 1844, S. 17-18).
Das charakteristische Kennzeichen dieser Wendenkirchhöfe ist nun, daß in den in die Urnen gelegten Geräthen das Eisen bei weitem vorherrschend ist; die Periode dieser Begräbnisse ist daher mit Recht die Eisen=Periode genannt, um so mehr, da dieses Metall ganz plötzlich und in vielfacher Anwendung in die Geschichte tritt. In den beiden voraufgehenden Perioden ist die Verarbeitung und der Gebrauch des Eisens noch nicht bekannt. In der Steinperiode der Hünengräber ist, mit äußerst wenigen Ausnahmen, gar kein Metall beobachtet; nur einige Male haben sich Geräthe der Hünengräber, namentlich Keile, jedoch auch schon Halsringe, aus unpolirtem, rothen Kupfer ge=


|
Seite 423 |




|
funden, jedoch mag dies in allen Ostseeländern ungefähr ein Dutzend Male beobachtet worden fein. Man kann also im Allgemeinen annehmen, daß die Gräber der Stein=Periode kein Metall enthalten, am allerwenigsten Eisen. Es ist zwar "Eisen" in Hünengräbern gefunden, aber nicht auf dem Bestattungsraume. Die Auffindung von Eisen in Gräbern der Stein=Periode beruht theils gewissermaßen auf einer Mystification, indem es bei frühern Aufgrabungen oder bei Schatzgräbereien verloren gegangen ist: so waren die Eisenstücke in dem Hünengrabe von Brüsewitz (vgl. Jahresber. IV, S. 23) Eimerbände oder dgl. aus dem J. 1779, indem dieses Grab in diesem Jahre aufgedeckt und zur Erhaltung des Monuments wieder aufgebauet war (vgl. Jahresber. V, S. 102): es kann daher auch nur zu Mystificationen führen, wenn man auf solche isolirte, zweifelhafte Vorkommenheiten neue Systeme bauen will, welche nicht bei jeder Aufgrabung die Regel bilden. Oefter aber stammt Eisen in Hünengräbern aus jüngern Bestattungen. Es finden sich nämlich zuweilen sowohl in Gräbern der Stein=Periode, als in Gräbern der Bronze=Periode dicht unter der Rasendecke Urnen aus der Eisen=Periode nachbestattet (vgl. Erster Jahresber. des altmärk. Vereins, 1838, S. 44). Verschiedene Bestattungen aus verschiedenen Perioden und jüngere Bestattungen in alten Hügeln können durchaus nicht zweifelhaft sein, wenn man Gräber, wie das Grab von Waldhausen bei Lübeck (vgl. Mittheilungen des lübecker Vereins zur nordischen Alterthumskunde, I, 1844), das Grab von Moltzow (vgl. Jahrb. X, S. 264-267) u. a. vorurtheilsfrei betrachtet. Immer aber ist in Hünengräbern das Eisen, oft von zweifelhafter Form, dicht unter der Rasendecke gefunden, wenn es vorhanden war.
Die Kegelgräber der Bronze=Periode enthalten immer Bronze, aus Kupfer und Zinn legirt, und oft naturwüchsiges Gold. Beispiele, daß von der einen Seite steinernes Geräth, von der andern Seite Eisen in dieser Art von Gräbern gefunden ist, sind fast noch seltener, als das angebliche Vorkommen von Eisen in Hünengräbern, obgleich Stein und Eisen nicht immer durch Zufall in Kegelgräber gekommen sind, sondern oft die Uebergänge von einer Periode zur andern bezeichnen, wie z. B. die mattfarbige, sparsame Bronze, welche sich neben Eisen zeigt, zur Genüge darthut.
Immer aber werden Stein und Eisen in den Gräbern der Stein= und Bronze=Periode so selten gefunden, daß man sicher annehmen kann, es werde in tausend Gräbern kaum Ein Mal getroffen; solche vereinzelte Erscheinungen können also nimmermehr die Regel für alle andern, immer gleichen Fälle bilden.


|
Seite 424 |




|
Eben so wenig finden sich steinerne Geräthe in den Wendenkirchhöfen der Eisen=Periode. Es ist gesagt, daß auf den Wendenkirchhöfen von Kothendorf (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 92) und Camin (vgl. Jahresber. II, S. 65 flgd.) Sachen aus Feuerstein gefunden seien. Man bemerkt aber leicht, daß diese Feuersteinbildungen nichts weiter als Naturbildungen sind; wenn in einer Urne Echiniten, Belemniten, Orthokeratiten und andere Petrefacten gefunden werden, so wird ein gewissenhafter Forscher dies ruhig berichten, da er nicht voraussehen kann, ob nicht ein glücklicher Fund einst beweiset, daß man im Alterthume solchen Naturbildungen eine gewisse Bedeutung beilegte. Der Forscher wird aber noch weiter gehen und berichten müssen, wenn sich andere, ungewöhnlich geformte, vielleicht durch Kunst oder Natur gespaltene Steine u. dgl. in den Urnen finden. Es läßt sich nicht immer beurtheilen, ob solche Bildungen durch Zufall oder aus Absicht in die Urnen gekommen sind; jedoch muß es angeführt und beschrieben werden. Aber damit ist nicht gesagt, daß z. B. ein langer, rundlicher, etwa der Länge nach gespaltener Feuerstein das sei, was man einen Keil der Stein=Periode nennt. Wenn man diese in Urnen der Eisen=Periode gefundenen Feuersteine sieht, so kann man sie in Wahrheit für nichts anders als für Naturbildungen halten; sie aber für Keile oder andere kunstmäßig gearbeitetete Geräthe auszugeben und hieraus Folgerungen für die Alterthumskunde zu ziehen, kann nur für ein von vorne herein verunglücktes Unternehmen gehalten werden. Es soll damit nicht geleugnet werden, daß in den flachen Feldern der Wendenkirchhöfe nicht steinerne Keile sollten gefunden werden können, denn diese steinernen Keile sind überall auf den offenen Feldern so sehr verbreitet, daß sie in zahlloser Menge gefunden sind und immer noch gefunden werden, also auch auf den Wendenkirchhöfen verloren gehen oder auch hier (jedoch nicht in Urnen) schon liegen konnten, ehe ein solcher Platz zu einer Begräbnißstätte erwählt ward. Aber im Allgemeinen kann man dreist mit großer Bestimmtheit behaupten, daß sich die steinernen Geräthe der Hünengräber nie in den Urnen der Wendenkirchhöfe finden; dies läßt sich ohne Bedenken als Regel für Tausende von Fällen feststellen, ohne Ausnahmen und Zufälligkeiten wegleugnen zu wollen.
Mit den Kegelgräbern haben aber die Wendenkirchhöfe das gemein, daß sich in diesen neben dem Eisen noch häufig Schmucksachen aus Bronze finden, jedoch auch schon dieselben Sachen aus Eisen , z. B. Hefteln von derselben Art aus Bronze und aus Eisen, oder aus beiden Metallen construirt, auf einem und demselben Wendenkirchhofe. Aber es sind nur untergeordnete


|
Seite 425 |




|
Geräthe, welche sich aus Bronze in der Eisen = Periode finden, namentlich Hefteln mit Springfedern, kleine Ringe, kleine Beschläge und Verzierungen u. dgl. Es sinden sich keine Hauptgeräthe aus Bronze mehr; es fehlen durchaus die bekannten Schwerter, Dolche, Frameen, Lanzen, Kopf=, Hals= und Armringe, Handbergen, Hefteln mit zwei Spiralplatten, Diademe, kurz alle die vielen Prachtarbeiten, welche das classische Alter der Bronze=Periode charakterisiren. Auch hat die Bronze der Wendenkirchhöfe eine andere, leichtfertigere Mischung und mattere Farbe (vgl. Jahrb. IX, S. 341-344) und der edle Rost fehlt ganz, wenigstens ist er in einzelnen Fällen höchst unbedeutend.
Dagegen tritt mit dem Eisen ein anderes Metall auf, das Silber, welches den Gräbern der voraufgehenden Perioden durchaus fremd ist. Es ist in Meklenburg kein einziges Beispiel bekannt geworden, daß in einem Kegelgrabe Silber gefunden wäre. Dagegen ist in keinem Wendenkirchhofe Gold bemerkt. Das Silber tritt jedoch nicht sehr häufig, wenn auch nicht selten in Wendenkirchhöfen auf und ist in den bekannten Hefteln, in Spangen ("Hakenfibeln"), Nadeln, Ringen, auch Siegelringen u. dgl. wahrgenommen. Zugleich treten Filigranarbeiten mit kufischen und deutschen Silbermünzen aus der Zeit vom 7. - 11. Jahrhundert auf (vgl. Jahrb. IX, S. 389 flgd.).
Endlich charakterisirt die Wendenkirchhöfe das häufige Vorkommen von Glas in allen Farben und Bearbeitungsweisen. In der Bronze=Periode ist Glas sehr selten; in Meklenburg ist es in Kegelgräbern nur zwei Male (zu Lehsen und Peccatel) in Form kleiner Perlen von blaugrüner oder meerblauer ("coeruleus") Farbe beobachtet. In den Wendenkirchhöfen kommt aber sehr viel Glas vor, namentlich ward es zu Pritzier (vgl. Jahrb. VIII, S. 58 flgd.) viel gefunden; vorzüglich häufig sind: dunkelblaue Perlen, mit Kupfer gefärbt, da sie vor Kerzenlicht hell und grünlich erscheinen und nicht den violetten Schein haben, welchen Kobaltfärbung erzeugt, ferner mattgrüne und mattweiße Perlen; sehr häufig finden sich jedoch auch musivische Glasflüsse und eingeschmolzene Glasverzierungen von allen Farben. Auch kleine Gefäße von weißlichem und grünlichem Glase sind beobachtet.
Man ist genötigt, diese Wendenkirchhöfe für die jüngsten Begräbnisse der heidnischen Zeit zu halten, also für das, wofür sie die Volkssage ausgiebt, für die Begräbnisse der Wenden. Es liegt schon in dem Gange der menschlichen Cultur, daß das Eisenschmieden und das Silberscheiden jüngerm Ursprunges sei als das Bronzegießen und Goldhämmern; das Eisenschmieden


|
Seite 426 |




|
bewirkte einen eben so bedeutenden Umschwung in der Technik, als einst der Kupfer= und Bronzeguß. Dazu kommt, daß alle Geräthe der Wendenkirchhöfe mehr modern, als die ganz eigenthümlichen Geräthe der Bronze=Cultur, und verhältnißmäßig wohl erhalten sind, d. h. so gut als man es von Eisen erwarten kann, offensichtlich aber die Urnen. Es giebt aber auch besondere Zeichen für das jüngere Alter der Wendenkirchhöfe. Ihr Inhalt stimmt im Allgemeinen mit den unzweifelhaft jüngsten Gräbern des Nordens überein. Die Urnen und Geräthe der Wendenkirchhöfe sind allein den Urnen und Geräthen gleich, welche auf den bekannten wendischen Burgwällen gefunden werden, die erweislich in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh., bei der Einführung des Christenthums, verwüstet wurden. Die Silbersachen sind denen gleich, welche mit deutschen Münzen des 10. und 11. Jahrh. zusammen vorkommen. Die ältesten eisernen Geräthe, welche in Meklenburg gefunden sind, werden diejenigen sein, welche mit Silber und römischen Bronzen aus dem 2ten Jahrh. n. C. bei Hagenow gefunden wurden (vgl. Jahrb. VIII, S. 38 flgd., 49 und Lithographie). Die heidnische Eisen=Periode scheint in Meklenburg in den ersten Jahrhunderten n. C. allmählig zu beginnen und bis zur Einführung des Christenthums in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. fortzudauern.
Die Verbreitung der eigenthümlichen Cultur der Wendenkirchhöfe läßt sich sehr klar und bestimmt verfolgen. Sie reicht in Norddentschland von Osten her über ganz Meklenburg bis in Wagrien (das südöstliche Holstein) hinein und über die Elbe hinaus über die Altmark, also so weit als die Wenden gewohnt haben. Im ganzen Norden, in Schleswig und Holstein und im nordwestlichen Deutschland jenseit der lüneburger Haide fehlt die Eisencultur der Wendenkirchhöfe ganz, einzelne ähnliche, jedoch wesentlich ganz verschiedene Verkommenheiten ungerechnet, welche in die letzten Zeiten des germanischen Heidenthums fallen, welches in allen Ländern viel früher aufgehört hat, als in den jetzigen deutschen Ostseeländern.
Dieser Ueberblick war hier nöthig, um die Urnen dieser Periode bestimmen zu können. Ein genauerer Beweis ist nicht erforderlich, da er in allen Jahrgängen der Jahrbücher des meklenburgischen Vereins und in vielen andern Schriften, namentlich dänischen Werken, geführt ist.
Alle diese Eigenthümlichkeiten aber sind die charakteristischen Kennzeichen der Eisen=Periode oder der Wendenkirchhöfe in Meklenburg. Ein eben so bestimmtes Gepräge haben nun aber auch die Urnen dieser Wendenkirchhöfe, so daß sie sich auf den ersten Blick erkennen lassen.


|
Seite 427 |




|
Was zuerst die Bereitungsweise der Urnen betrifft, so ist sie von der aller andern heidnischen Grabgefäße aus den verschiedenen Perioden im wesentlichen nicht verschieden (vgl. Jahrb. X, S. 237 flgd.). Die Grabgefäße der Wendenkirchhöfe sind ebenfalls aus Thon mit zerstampftem Granit, auch wohl mit Kiessand, durchknetet, aus freier Hand geformt, mit einer feinen Thonschicht zur Glättung überzogen und am freien Feuer gedörrt. Von Töpferscheibe und Ziegel= oder Töpferofen findet sich noch keine Spur; beide wandern mit der christlich=deutschen Cultur ein: mit dieser erscheinen plötzlich im Ofen gebrannte Ziegel und fein geschlemmte, blaugraue Töpfe ohne Granitdurchknetung. Wenn Lehmstücke, welche durch Feuersbrunst röthlich gefärbt wurden, wendischeZiegel genannt sind, so hat dies nur gewissermaßen und gleichnißweise geschehen können. Wenn ferner auch gesagt ist, in Wendenkirchhöfen seien Gefäße gefunden, welche beim Anschlagen einen "klingenden" Ton von sich gäben, so heißt dies nur so viel, daß sie so laut klingen, als wohl erhaltene, nicht gerissene, aber nur am offenen Feuer gebackene Töpfe klingen können; ein vollkommener Vergleich mit dem heutigen Töpfergeschirr oder Porcellan hat natürlich nicht gemacht werden können.
Ist nun aber auch im Allgemeinen die Bereitungsweise der wendischen Urnen der aus früheren Zeiten gleich, so unterscheiden sich die Urnen der Wendenkirchhöfe sehr häufig, jedoch nicht immer, von den übrigen dadurch, daß sie häufig feinkörniger sind, als die Urnen der andern Perioden; so grobkörnige Urnen findet man in den Wendenkirchhöfen wohl nie, wie in den Hünen= und Kegelgräbern, wenn sich auch in diesen häufig eben so feinkörnige Urnen finden, wie in jenen.
Auch das darf nicht unbemerkt bleiben, daß die Urnen der Wendenkirchhöfe, wenn sie der Pflug nicht zerstört hat, gewöhnlich viel besser erhalten, häufig ganz unversehrt sind, obgleich sie der Erdoberfläche so nahe stehen, daß sie dem Witterungswechsel nicht entrückt sind.
Vorzüglich unterscheiden sich aber die Urnen der Wendenkirchhöfe von allen andern durch Gestalt und Verzierung, viele auch durch eine besondere Bekleidungsweise. Die Urnen der Hünengräber sind mehr kugelförmig und der Bauchrand liegt mehr nach unten. Die Urnen der Kegelgräber haben mehr senkrechte oder Cylinder=Formen und der Bauchrand liegt mehr in der Mitte. Die Urnen der Wendenkirchhöfe nähern sich mehr der Scheibenform, um einen mathematischen Ausdruck zu gebrauchen, und der Bauchrand liegt mehr nach oben; die Schüsselform ist im Allgemeinen ihr bestimmter Formcharakter.


|
Seite 428 |




|
Die Urnen der Wendenkirchhöfe laufen nach unten sehr spitz zu, der Boden hat einen sehr geringen Durchmesser, die Oeffnung ist sehr weit und der Bauchrand liegt oben nahe an der Oeffnung; es fehlt daher in der Regel das, was man einen Hals nennt, und der große Henkel.
Es lassen sich aber bis zur vollkommenen Ausbildung dieser Schüsselform mehrere Uebergänge beobachten, wenn auch der Inhalt der verschiedenartig geformten Urnen derselbe ist.
Wahrscheinlich die ältesten Urnen der Eisen=Periode sind diejenigen, welche den Urnen der Bronze=Periode gleich, wenn auch etwas plump sind. Zu diesen Urnen gehören die mit Eisengeräthen versehenen großen Cylinder=Urnen, welche bei Ludwigslust in die Erde gegraben und Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 1, abgebildet sind; vgl. Erläut. S. 63 flgd. Vielleicht wurden die Urnen von Deutschen gefertigt, welche von den Wenden in das Dickicht der Jabelhaide zurückgedrängt wurden.
Der Wendenkirchhof von Helm (vgl. Jahrb. IV, S. 39 flgd. und V, S. 66 flgd.) gab eine sehr große Mannigfaltigkeit von Urnen, so daß gar keine bestimmte Form vorherrscht.
Dergleichen Eigenthümlichkeiten liegen nun aber in gewissen Uebergängen, da zuverlässig keine Cultur= Epoche plötzlich eingetreten ist, sondern sich erst nach und nach Bahn gemacht hat.
Betrachten wir aber die größere Masse der Urnen der Wendenkirchhöfe, so lassen sich vorzüglich zwei Arten unterscheiden.
I. Die eine Art, wir wollen sie die ältere nennen, nähert sich noch etwas den Urnen der Kegelgräber; die geradwandige Cylinderform blickt noch etwas durch, der Bauchrand liegt noch häufiger in der Mitte und daher sind die Linien des Körpers vom Bauchrande bis zum Fuße und der Durchmesser der Oeffnung noch nicht so weit ausgedehnt und gewissermaßen so übertrieben, als es bei der Schüsselform der Fall ist; dennoch ist an diesen Urnen der Fuß kleiner und die Oeffnung größer, als an den meisten ältern Urnen. Die Urnen dieser Art sind wie alle übrigen gebrannt: bräunlich, gelblich, röthlich, oft geflammt, wie ein Schmauchfeuer diese Farben hervorbringt. Die Verzierungen bestehen gewöhnlich aus parallelen Schräglinien, welche zwischen horizontalen Bändern in Zickzackform gegenüberstehen, mitunter auch guirlandenförmigen Verzierungen aus Halbkreisen. Als Nebenverzierungen finden sich mitunter Augen oder ausgeschnittene runde Vertiefungen, auch Kreise. Alle diese Verzierungen sind in langen Linien eingeschnitten. Henkel fehlen in der Regel.


|
Seite 429 |




|
Urnen dieser Art sind nicht selten. Besonders reich an solchen Urnen zeigte sich der in Jahresber. VIII, S. 58-75 beschriebene Wendenkirchhof von Pritzier mit seinem reichen Inhalt an Eisen, Silber und Glas. Die beiden hier abgebildeten Urnen
| Nr. 1. | 1/4 Größe. |
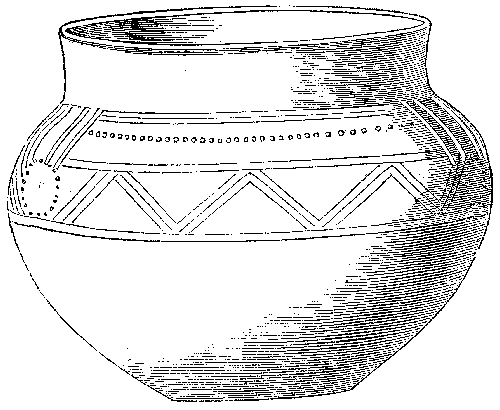
| Nr. 2. | 1/4 Größe. |
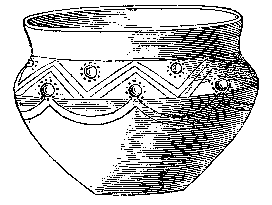
sind gute Repräsentanten dieser Gattung von Gefäßen; es wurden in diesem Begräbnißplatze sehr viele Urnen gefunden und fast alle vollständig erhalten.
Zu dieser Gattung gehört z. B. die in Jahrb. II, Lithogr. T. 1, Fig. 1 (vgl. S. 69) abgebildete Urne von Malchin mit ihrem charakteristischen Inhalt aus der Eisen=Periode.
II. Ganz anders ist die zweite Art der Wendenkirchhofsurnen, welche wir die jüngeren nennen wollen. Diese Urnen


|
Seite 430 |




|
haben vorherrschend die vollständig ausgebildete Schüsselform, sind sehr groß und sehr weit geöffnet; sehr häufig, ja gewöhnlich haben sie zwei am Rande angesetzte kleine Knötchen, welche durchbohrt sind, um ein Band durchziehen zu können. Von allen Urnen sind sie die feinkörnigsten und festesten.
Diese Urnen sind vor allen andern heidnischen Gefäßen des Nordens durch zwei Eigenthümlichkeiten ausgezeichnet, zu denen sich kein Uebergang zeigt. Sie sind nämlich
1) mit vielfachen Linien verziert, welche durch Fortbewegung eines kleinen gezahnten Rades entstanden sind; die Linien bestehen daher aus neben einander stehenden, eingedrückten kleinen Quadraten; wenn mehrere Linien neben einander stehen, so berühren und decken sich die Punctlinien oft: die hier abgebildete Probe ist ungefähr die Hälfte von dem ganz erhaltenen Boden einer zerbrochenen Urne aus dem Wendenkirchhofe von Camin (vgl. Jahresber. II, S. 61, Nr. 13); das diesem Boden eingedrückte Kreuz mit fächerförmig auslaufenden Balken ist auf dem Originale ganz vollständig.
| Nr. 3. | Volle Größe. |
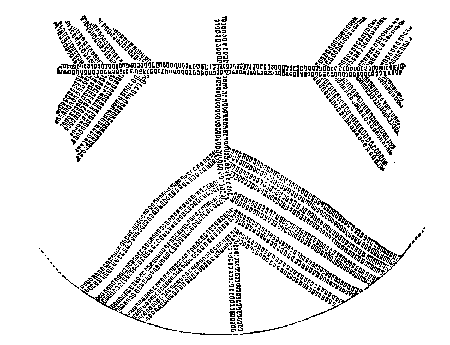
Ferner sind diese Urnen
2) mit einer überall gleichfarbigen, tief schwarzen letzten Thonschicht, in welche diese Verzierungen eingedrückt sind, zur Glättung überzogen, jedoch nicht immer, da sich auch also verzierte braune und flammige Urnen finden, welche diese Farbe nicht haben. Alle Urnen aber, welche diese Färbung besitzen, sind immer gleichmäßig schwarz. Bei dieser vollkommenen


|
Seite 431 |




|
Regelmäßigkeit kann diese Färbung nicht durch Zufall oder Absicht beim Brennen, sondern muß durch eine künstliche Bereitung der bekleidenden Thonschicht vor deren Auftragung hervorgebracht sein, um so mehr, da auch die Eindrücke immer gleichmäßig schwarz gefärbt, auch nirgends zugeklebt sind; die Urnen sind also auch nicht nach ihrer Vollendung und Verzierung angemalt. Der Herr Apotheker, Senator von Santen zu Cröpelin, welcher als gründlicher Chemiker bekannt ist, hat diesen Ueberzug einer chemischen Analyse unterworfen und berichtet darüber also:
"Die schwarze Farbe der Topfscherben ist durch die "Glasur", mit welcher dieselben überzogen sind, entstanden, also weder durch Bläuchern (Ruß), noch durch einen theerartigen Ueberzug hervorgebracht. Die Glasur" aber ist bleihaltig, da das Blei durch Glühen mit Aetzkali, Auflösung der Masse in Säuren und Verhalten gegen schwefelwasserstoffiges Ammonium unzweifelhaft auszuscheiden ist. In welchem Zustande der Oxydation oder möglichen Verbindung mit einer fixen Säure das Blei der "Glasur" sich gegenwärtig befindet, kann nur durch eine genauere Analyse ermittelt werden".
Der Herr von Santen war mit dem Verfahren bei der Verfertigung der Urnen nicht genauer bekannt, nennt daher den schwarzen Ueberzug gradezu eine "Glasur". Daß im technischen Sinne von einer deckenden, festen Glasur, welche zuerst in den schwarz glasurten Ziegeln in den Sockeln, Gliederungen und Verzierungen der Kirchen seit dem 13. Jahrh. vorkommt, nicht die Rede sein kann, versteht sich von selbst. Es kann hier nur die Rede von einer besondern Bereitung des letzten Thonüberzuges der Urnen die Rede sein; daß dieser aber durch künstliche Mittel gefärbt ward, ist wohl unzweifelhaft. Man könnte aber sagen, daß man in diesem gefärbten Ueberzuge die ersten Anfänge der Glasur hätte.
Diese schwarz gefärbten, mit Punctlinien verzierten Urnen sind in Meklenburg und jenseit der Elbe in der Altmark, sowohl in einzelnen Stücken, als in großen Lagern häufig ausgegraben. Sicher ist ihr Vorkommen in der ganzen westlichen Hälfte Meklenburgs und jenseit der Elbe bis an die lüneburger Haide und in der ganzen Altmark (in vielen Exemplaren jetzt in der berliner Sammlung) beobachtet. Aus Holstein ist nur ein einziges Exemplar in Scherben, welches in Wagrien gefunden sein soll, in der Sammlung zu Kiel vorhanden. In Kopenhagen und Lund findet sich keine Spur von Urnen dieser Art.


|
Seite 432 |




|
Die hier zunächst abgebildeten 4 Exemplare welche als Repräsentanten gelten können, sind mit einer sehr großen Menge gleicher Art in dem von mir aufgedeckten Wendenkirchhofe von Camin (vgl. Jahresber. II, S. 53 flgd.) gefunden worden.
| Nr. 4. | 1/4 Größe. |
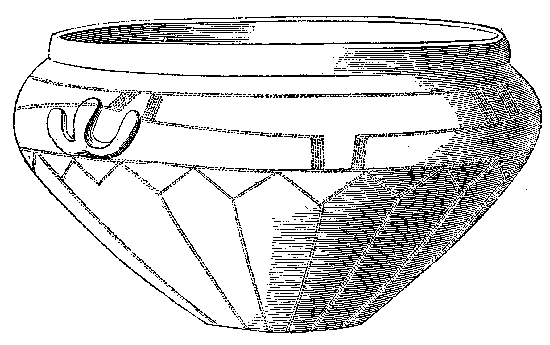
| Nr. 5. | 1/4 Größe. |
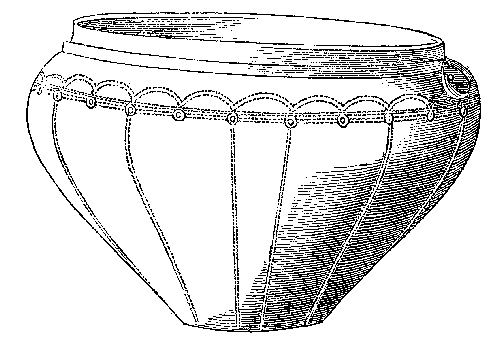
Diese beiden Urnen Nr. 4 und 5 haben nur wenige Verzierungen; Gefäße dieser Art, jedoch immer verschieden verziert, finden sich in den Wendenkirchhöfen sehr häufig. Etwas seltener


|
Seite 433 |




|
finden sich die folgenden in Nr. 6 und 7 abgebildeten Urnen mit reichern Verzierungen und gewöhnlich auch mit reicherm Inhalte; jedoch sind sie grade nicht selten zu nennen.
| Nr. 6. | 1/4 Größe. |
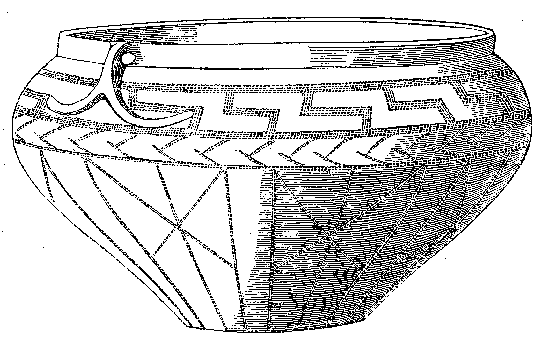
| Nr. 7. | 1/4 Größe. |
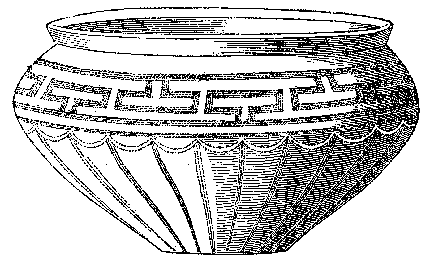
Abbildungen von Urnen dieser Gattung, mit den sie stets begleitenden Hefteln mit Springfedern, sind schon im Frid. Franc. T. XXXIV in vielen Exemplaren gegeben, von denen Fig. 1-6 in dem großen Wendenkirchhofe von Kothendorf (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 89 flgd.) gefunden wurden.
So sehr sich diese Urnen auch durch die Technik ihrer Färbung und Verzierung auszeichnen, so ist doch die Art und Weise,


|
Seite 434 |




|
in welcher die verzierenden Linien gezogen und zusammengestellt sind, nicht weniger bemerkenswerth. Man sieht aus den Abbildungen der caminer Urnen, daß man es liebte, die Urnen mit sehr vielen Linien zu verzieren, welche bald parallel laufen, bald sich kreuzen oder gebrochen sind.
Die merkwürdigste Verzierung, welche ohne Zweifel
eine gottesdienstliche Bedeutung hat, ist das
Kreuz mit gebrochenen Balken
 welches auf dem Bauche der in
Frid. Franc. T. XXXIV, Fig. 2 abgebildeten Urne
drei Male angebracht ist. Dasselbe Kreuz findet
sich auf einer bei Bützow gefundenen
Wendenkirchhofsheftel eingravirt (vgl. Jahrb.
IX, S. 393). Diese mit diesem Kreuze
bezeichneten Geräthe werden wohl mit den
nordischen Goldbracteaten, auf denen sich dieses
Kreuz häufig findet, in dieselbe Zeit fallen.
Eine andere auffallende Verzierung ist das oben
abgebildete Kreuz mit fächerförmig endenden
Balken auf dem Boden einer caminer Urne; mit
einem nicht verzierten rechtwinkligen Kreuze war
auch der Boden einer andern caminer Urne verziert.
welches auf dem Bauche der in
Frid. Franc. T. XXXIV, Fig. 2 abgebildeten Urne
drei Male angebracht ist. Dasselbe Kreuz findet
sich auf einer bei Bützow gefundenen
Wendenkirchhofsheftel eingravirt (vgl. Jahrb.
IX, S. 393). Diese mit diesem Kreuze
bezeichneten Geräthe werden wohl mit den
nordischen Goldbracteaten, auf denen sich dieses
Kreuz häufig findet, in dieselbe Zeit fallen.
Eine andere auffallende Verzierung ist das oben
abgebildete Kreuz mit fächerförmig endenden
Balken auf dem Boden einer caminer Urne; mit
einem nicht verzierten rechtwinkligen Kreuze war
auch der Boden einer andern caminer Urne verziert.
Die häufigste Verzierung der Wendenkirchhofsurnen besteht aber aus rechtwinklig gebrochenen Linien, welche in ihren Hauptrichtungen parallel laufen, und so allerlei rechtwinklige Züge bilden, welche jedoch wohl nichts weiter als Linearverzierungen vorstellen sollen. Durch die vielfache Anwendung dieser Verzierungen und Uebung in denselben gelangte das Volk, dem diese Urnen angehören, fast ganz zu demselben Ornamente des Mäanders, welches die Griechen erfanden und häufig anwandten; die auf den vorstehenden Blättern abgebildeten caminer Urnen geben diese auffallende Erscheinung in ihrer Entwickelung. Man braucht wohl nicht zu der Annahme seine Zuflucht zu nehmen, daß das Volk der Wendenkirchhöfe dieses Ornament von den Griechen oder Römern entlehnt habe.
Diese hier beschriebenen und abgebildeten Urnen bilden ungefähr die Regel in der Form und Verzierung der Urnen der Wendenkirchhöfe. In dem südwestlichen Theile Meklenburgs, namentlich in der Gegend zwischen Ludwigslust und Wittenburg, finden sich noch Urnen aus der Eisen=Periode, in welchen die beschriebenen Formen, um sich so auszudrücken, fast übertrieben sind, welche einen ungewöhnlich schmalen Boden, eine sehr weite Oeffnung und einen sehr hoch liegenden, scharfen Bauchrand haben und dadurch von den übrigen abweichen, daß der Bauch nicht nach außen gebogen, sondern nach innen etwas eingezogen ist. Solche, bei Krams, A. Hagenow, gefundene Urnen sind


|
Seite 435 |




|
schon in Frid. Franc. T. XXXIV, F. 9 und 16, dargestellt; hier ist eine abgebildet,
| Nr. 8. | 1/4 Größe. |
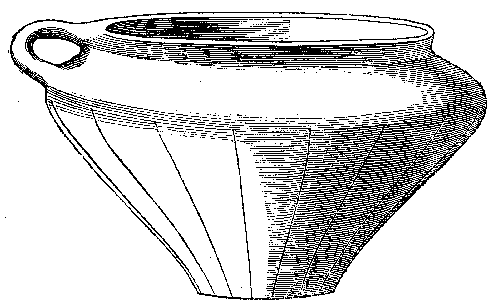
welche in dem Wendenkirchhofe von Perdöhl bei Wittenburg (vgl. Jahresber. VI, S. 42-43) gefunden ist. Diese Urnen sind ebenfalls gleichmäßig schwarz, jedoch nicht mit Punctlinien mit dem laufenden Rade, sondern mit zusammenhangenden, eingeritzten Linien verziert.
Alle diese Gefäße, von denen es natürlich viele geringe Abweichungen in Größe, Gestalt und Verzierung giebt, sind Grabgefäße zur Aufnahme der verbrannten Leichenreste und haben wohl wegen ihrer Bestimmung eine besonders sorgfältige Verzierung erhalten. Es liegt nun nahe, nach den Gefäßen zu suchen, welche den Wenden zum häuslichen Gebrauche dienten. Die Cultur der Wenden läßt sich sicher in den Burgwällen beobachten, welche der letzte Wendenfürst Niklot zuletzt bewohnte und entweder neu aufführte oder vergrößerte und befestigte, in den Burgwällen von Meklenburg, Dobin, Schwerin, Ilow, Werle u. a., welche in den Jahrbüchern nach und nach untersucht und beschrieben sind. Die Zerstörung dieser historisch gesicherten Burgen fällt in die ersten Zeiten nach der Mitte des 12. Jahrh. Auf allen diesen Burgwällen liegen nun von der Oberfläche bis mehrere Fuß tief hinab, neben den Resten der verbrannten, aus Holz, Lehm und Stroh aufgeführt gewesenen Gebäude, zahllose Scherben zertrümmerter Gefäße, welche ohne Zweifel zum häuslichen Gebrauche dienten. Alle diese Gefäße waren ganz auf dieselbe Weise angefertigt, wie die heidnischen


|
Seite 436 |




|
Graburnen, d. h. aus Thon, welcher mit zerstampftem Granit durchknetet ist, an offenem Feuer gehärtet und mit einer bekleidenden, dünnen Thonschicht überzogen, - jedoch viel sorgloser ausgeführt nnd lange nicht so geschmackvoll und regelmäßig verziert; nur auf den Burgwällen, welche erweislich noch zur christlichen Zeit bewohnt waren, wie z. B. auf dem Burgwalle von Meklenburg, finden sich neben den Scherben aus heidnischer Zeit und den gelbroth gebrannten Lehmstücken ("Klehmstaken") auch die bekannten, fest und in Brennöfen gebrannten, blaugrauen Scherben von Töpfen des christlichen Mittelalters nnd gebrannte Ziegel von größtem Format. Die Verzierung der heidnischen Töpfe, welche auf den heidnischen, in Mooren liegenden Burgwällen gefunden werden, bestehen nun fast regelmäßig in wellenförmigen Linien, welche unter dem Oeffnungsrande, wie es scheint mit einem Holzspan, eingedrückt oder eingekratzt sind; oft sind es einfache, oft parallele Wellenlinien, oft sind mit einem breiten Spane viele, dicht bei einander stehende Parallellinien eingekratzt. Der hier abgebildete
| Nr. 9. | Volle Größe. |
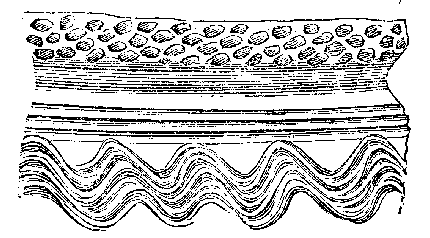
Rand eines auf dem Burgwalle von Werle (vgl. Jahrb. VI, S. 88 flgd.) gefundenen Gefäßes ist ein Beispiel von Tausenden von verzierten Scherben, welche sich in den genannten Burgwällen finden. Diese Wellenlinien, einfach oder in mehrern parallelen Linien, sind ohne alle Aengstlichkeit und sehr anspruchslos gemacht, zeugen aber von einer ungemeinen Fertigkeit und Leichtigkeit in der Anbringung dieses Ornaments. Freilich finden sich hin und wieder auch andere Verzierungen. Es giebt z. B. viele Gefäße, welche mit Ornamenten von eingedrückten kleinen Stempeln verziert sind, mitunter in Form kleiner Münzen, wie auf Gefäßen, welche in Holland mit römischen Ziegeln gefunden sind; zu lesen sind diese Ornamente schwerlich, wenn es auch versucht ist. Aber die Wellenverzierung bildet vorherrschend die Regel. Eine andere auf dem Walle von Meklenburg (vgl.


|
Seite 437 |




|
Jahrb. VI, S. 79 flgd.) gefundene Verzierung eines Gefäßes Nr. 10.
| Nr. 10. | Volle Größe. |
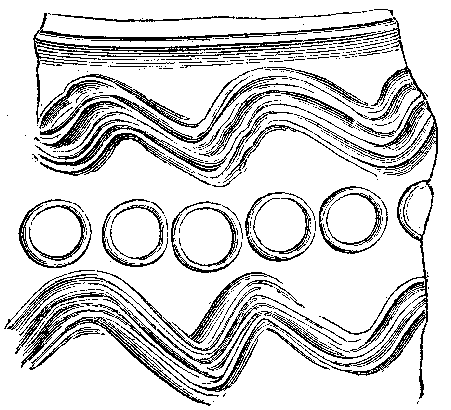
zeigt z. B. zwischen den Wellenlinien eingedrückte Kreise oder Augen, wie sie sich auch wohl auf Grabgefäßen finden.
So leicht nun auch Scherben von häuslichen Gefäßen aus der wendischen Zeit gefunden werden, so schwierig ist die Erlangung von solchen ganzen Gefäßen. Die Sammlung des Vereins besitzt nur das eine hier abgebildete Gefäß dieser Art, welches zu Bobzin bei Lübz an der Elde 4 Fuß tief in sumpfigem Boden beim Bau einer Schleuse gefunden ist (vgl. Jahresbericht I, S. 14). Das Gefäß ist nur klein, ohne Zweifel eine Art Becher, und trägt in jeder Hinsicht den Charakter der
| Nr. 11. | 1/4 Größe. |
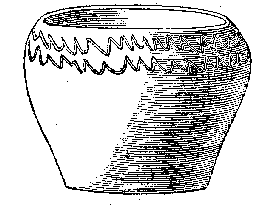
Scherben der wendischen Burgwälle. - Durch den Anhaltspunct, welchen bie niklotschen Burgen geben, sind die Scherben dieser Gefäße 1 ) von der größten Wichtigkeit für die Bestimmung anderer Burgplätze.


|
Seite 438 |




|
Alle diese bisher beschriebenen Gefäße lassen sich nun mit der größten Sicherheit einer bestimmten Culturepoche, der Eisen=Periode, zuschreiben; mag der Zeitraum, in welche diese Epoche fällt, auch von diesem und jenem anders bestimmt werden: die Epoche selbst in ihrer technischen Ausbildung liegt abgerundet und klar vor Augen.
Es werden jedoch hin und wieder einzelne Gefäße aus der Heidenzeit gefunden, welche kein bestimmtes Merkmal zur Zeitbestimmung an sich tragen; für die Bestimmung dieser Gefäße muß man denn zu andern Mitteln seine Zuflucht nehmen. So Z. B. ist das hier abgebildete
| Nr. 12. | 1/4 Größe. |
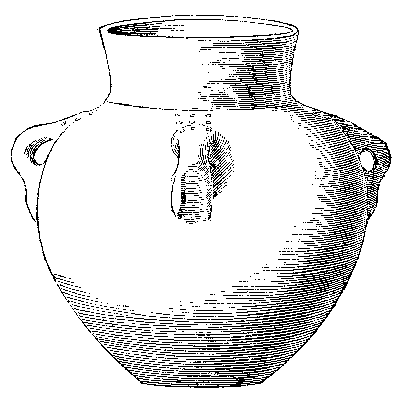
Gefäß ganz eigenthümlich, welches in dem Torfmoore von Gnoien 8 Fuß tief gefunden ward. Es hat an dem Obertheile des Bauches 4 starke, durchbohrte Knoten, in welchen beim Auffinden noch Reste einer Schnur steckten (vgl. Jahrb. X, S. 296). Ohne Zweifel ist dieses Gefäß ein häusliches Geräth, ein Tragetopf oder wie es noch heute heißt, ein "sêlpot": d. i. ein Topf (pot), welcher an einer Schnur oder an einem Seile (sêl) getragen ward, wie es noch heute geschieht, freilich auf weniger künstliche Weise. Dergleichen Funde gehören zu den allerseltensten. Vor kurzem (vgl. unten S. 439) hat Herr von Kardorf auf Remlin dem Vereine noch einen zweiten Topf ähnlicher Art geschenkt, welcher in demselben Moore gefunden ist.


|
Seite 439 |




|



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Naschendorf.
Bei dem Bau der Chaussee von Wismar nach Grevismühlen ward im J. 1846 bei Naschendorf ein Wendenkirchhof entdeckt, leider aber von den Arbeitern gänzlich zerstört, indem sie sämmtliche Steine herausbrachen und dabei alle Urnen ohne Ausnahme zertrümmerten. Dort wo der Weg von Jameln nach Meierstorf die Chaussee kreuzt, ungefähr 150 Schritt von hier nach Grevismühlen hin und von dieser Stelle 40 Schritte links von der Chaussee in den Tannen, lag ein runder Platz von ungefähr 22 Schritten im Durchmesser. Hier stand eine große Menge von Urnen, zwischen Feldsteine verpackt, welche sämmtlich ausgebrochen wurden; es fanden sich Urnenscherben in großen Massen, sehr viele Knochenstücke und auch noch einzelne eiserne Geräthe, z. B. große und kleine Messer. Die Urnen waren, nach den eingesandten Proben, schwarz und braun und mit einem laufenden gezahnten Rade mit Punctlinien verziert, dem eigenthümlichen Kennzeichen der Wendenkirchhöfe einer gewissen Periode; hiedurch wird dieser Platz, durch die Verbreitung dieser Kirchhöfe gegen NW. hin, interessant. Schon früher war zu Börzow bei Grevismühlen ein gleicher Wendenkirchhof entdeckt; vgl. Erster Bericht über das Antiquarium zu Schwerin, S. 17, Nr. 42. - In diesen naschendorfer Tannen liegt auch das schöne, gewaltige Hünengrab, welches Frid. Franc. Taf. XXXVI, Nr. II abgebildet und Erläut. S. 164 beschrieben ist (vgl. Jahresber. II, S. 145, u. III, S. 113), und bei Gressow am Wege stehen schöne Kegelgräber.
Die Nachricht über diesen Wendenkirchhof verdanken wir dem Hrn. Schullehrer Linshöft zu Barendorf, welcher sich schon mannigfache Verdienste um das großherzogliche Antiquarium erworben hat.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Topf von Gnoien.
In dem Torfmoore der Stadt Gnoien ward 8 bis 10 Fuß unter der Oberfläche ein altes Gefäß gefunden, welches durch Geschenk des Herrn von Kardorff auf Remlin in die Sammlung des Vereins gekommen ist. Das Gefäß ist ungefähr 7 " hoch, gut 2 " in der Basis, 7 " im Durchmesser und gegen


|
Seite 440 |




|
4" in der Oeffnung, mit scharfem Bauchrande in der Mitte der Höhe, und hat im Allgemeinen die Gestalt der Urnen der Kegelgräber. Die Masse ist im Innern grobkörnig, mit vielen Feldspathstücken und Glimmerblättchen vermengt; die Farbe ist ganz schwarz. Der Rand ist abgebrochen. Am Rande stehen zwei kleine Henkel, welche so große Oeffnungen haben, daß eine starke Schnur durchgezogen werden kann; es scheinen die Löcher auch durch eine Schnur etwas ausgerieben zu sein. Da das Gefäß im Torfmoor gefunden ist, so hat es gewiß nicht zum Todten=Cultus gedient; wir haben hier also ein ähnliches Gefäß, wie den in demselben Torfmoore gefundenen Tragetopf; vgl. S. 438 und Jahrb. X, S. 296. Das Alter des Topfes ist schwer anzugeben; die Masse deutet noch auf die Zeit der Kegelgräber hin. Der früher gefundene Tragetopf scheint aber der Eisen=Periode anzugehören.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Urnenscherbe mit Schriftzeichen (?),
Daß es wenigstens in der Jüngern wendischen Zeit Gefäße mit Inschriften (?) gegeben hat, davon scheint eine zu Vietlübbe gefundene Scherbe einen Beweis zu liefern. Der hiesige Pfarrgarten enthält viele Gefäßscherben aus verschiedenen Perioden, besonders aber aus der Wendenzeit, worunter sowohl grobkörnige (von Todtenurnen), als feinkörnige (von zu andern Zwecken gebrauchten Gefäßen) vorkommen. Das mit muthmaßlichen Schriftzeichen versehene Stück fand mein jüngster Sohn in meiner Gegenwart. Es soll der Garten vor vielen Jahren mit Erde erhöhet sein, doch habe ich noch nicht erforschen können, woher man die Erde geholt hat; vielleicht daß dort noch mehr solcher Inschriften zu entdecken wären.
| Vietlübbe, im April 1846. | J. Ritter. |
Die Gefäßscherbe stammt, nach dem Thongemenge zu
schließen, wohl schon aus der ersten
christlichen Zeit, vielleicht aus der Periode
des Ueberganges vom Heidenthum zum Christenthum.
Die Zeichen, welche auf dem Rande stehen, sind
folgende:
 Diese Zeichen gehören zu der
Gattung derjenigen
Diese Zeichen gehören zu der
Gattung derjenigen


|
Seite 441 |




|
Zeichen, welche jüngst L. Giesebrecht, in Baltischen Studien, XI, 2, S. 30 flgd. und 42 flgd., für Schriftzeichen, "Keilbilder", erklärt und gelesen hat. In Meklenburg finden sich dergleichen Gefäßscherben auf allen alten Burgwällen aus den bezeichneten Zeiten in großer Menge und grade solche Scherben, wie die vietlübber, werden in den schweriner Sammlungen aufbewahrt. Es sind Scherben von Gefäßen zu häuslichem Gebrauche und die Verzierungen sind theils aus freier Hand gebildet, theils, wie hier, mit Stempeln eingedrückt. Ich halte diese Zeichen für nichts weiter als für Verzierungen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Mosaik=Glas=Perle von Sülz.
Der Herr Geheime Amtsrath Koch zu Sülz hat dem Vereine eine antike Glasperle geschenkt, welche um das J. 1818 beim Abbohren eines Brunnens zu Sülz mit Sand und kleinen Steinchen zu Tage gefördert, von dem Herrn Geber erworben und bisher als ein seltenes, zweifelhaftes Product aufbewahrt ward. Die durchbohrte Perle ist von runder Stangenform, 1 3/8" lang und 5/16 " im Durchmesser, in der Hauptmasse aus dunkelblauem oder schwarzem, undurchsichtigen Glase, in welches auf der Oberfläche 3 feine Längsstreifen aus gelbem Glase, aus denen 14 gleiche Queerstreifen hervorgehen, eingelegt sind. Das Ganze hat entfernte Aehnlichkeit mit einem abgescheuerten, kleinen Orthokeratiten. proben von gleicher Arbeit finden sich in den Gräbern der Eisen=Periode.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 442 |




|



|



|
|
:
|
Alterthümer von Lippiny in Polen.
Von der größten Wichtigkeit für die
vaterländische Alterthumskunde ist die
Verbreitung gleicher Alterthümer nach allen
Seiten von den germanischen Ostseeländern,
besonders aber wichtig ist die Erkenntniß, wie
weit sich die deutschen Alterthümer gegen Osten
hin erstrecken. Die Petersburger Sammlungen
enthalten nach brieflichen Berichten nur einige
in den Küstenländern des schwarzen Meeres
ausgegrabene Alterthümer, welche mit den
deutschen in keinerlei Weise zu vergleichen
sind, und Kruse's Necrolivonica haben die
Erkenntniß auch nicht sehr gefördert, da sie
sehr einseitig sind und sich vorzüglich nur um
einige wenige, nicht sehr alte, ziemlich
eigenthümliche Funde bewegen. Alle Bemühungen,
zunächst in das Dunkel der polnischen und
gallizischen Vorzeit einzudringen, blieben
durchaus vergeblich und hatten aus bekannten
Gründen ihre eigenthümlichen Schwierigkeiten.
Endlich gelang dem rastlosen Eifer des
Reichsfreiherrn Albrecht Maltzan auf Peutsch,
für unsern Verein redende Zeugen
herbeizuschaffen. Der Oheim desselben, Se.
Excellenz der Herr Adolph Christian August von
Maltzan, Reichsfreiherr zu Wartenberg und
Penzlin, Commandeur des Stanislaus=Ordens, auf
Duchnow
 . besitzt in Polen 6 Meilen hinter
Warschau viele Güter, welche er bisher selbst
bewohnt hat. Dieser berichtete schon früher, daß
sich in Polen heidnische Gräber nach Art unserer
Kegelgräber fänden und öfter Alterthümer
ausgegraben würden, und ward, bei seiner Liebe
für die Beförderung der deutschen
Alterthumskunde, leicht veranlaßt, für unsern
Verein polnische Grabalterthümer zu gewinnen.
. besitzt in Polen 6 Meilen hinter
Warschau viele Güter, welche er bisher selbst
bewohnt hat. Dieser berichtete schon früher, daß
sich in Polen heidnische Gräber nach Art unserer
Kegelgräber fänden und öfter Alterthümer
ausgegraben würden, und ward, bei seiner Liebe
für die Beförderung der deutschen
Alterthumskunde, leicht veranlaßt, für unsern
Verein polnische Grabalterthümer zu gewinnen.
Der Reichsfreiherr von Maltzan auf Duchnow fand auf einem Gute ungefähr 12 Meilen hinter Warschau in einem Garten zur Zierde eine riesenmäßige Urne aufgestellt, in welcher eine große Urne stand; in dieser lagen wieder eine ganz kleine Urne und einige kleine Bronzeringe. Das Ganze ist, so wie es da stand, zusammen in einem Steinhügel zu Lippiny 1 ) (d. i. Linde), 12 Meilen hinter Warschau, Poststation Jerusal bei Minsk polski, gefunden. Die Riesenurne ward durch Zufall zertrümmert; das Uebrige ward von dem Reichsfreiherrn


|
Seite 443 |




|
von Maltzan gewonnen und unserm Vereine zugewandt. Dies ist folgendes:
1) Eine große Urne aus gebranntem Thon, gegen 12 " hoch, 9 " weit in der Oeffnung, 13 " weit im Bauche und 5 " weit im Boden. Sie ist, zur größten Ueberraschung, den norddeutschen Urnen aus der mittlern oder jüngern Zeit der Kegelgräber in jeder Hinsicht völlig gleich; sie hat ganz die Gestalt der in Jahrb. XI, S. 356, abgebildeten Urne,

ist, wie unsere Urnen, aus Thon, mit zerstampftem Granit durchknetet, gebildet, mit einer fein geschlämmten, reinen Thonschicht überzogen und röthlichbraun und geflammt gebrannt. Auf dem obern Theile des Bauchrandes läuft unter zwei horizontalen Parallellinien eine Verzierung aus Zickzacklinien umher, welche aus drei Linien gebildet ist, wie oben S. 429, Nr. 1. Kurz, die Urne ist von den meklenburgischen Urnen gar nicht zu unterscheiden.
2) Eine Schale, 3 1/2 " hoch, 9 1/2 " weit in der Oeffnung und 3 " im Bodendurchmesser. Sie hat ebenfalls ganz die Gestalt der Schalen unserer Kegelgräber und ungefähr die Form der in Jahrb. X, S. 283 abgebildeten Bronzeschale von Dahmen, nur daß der Rand nicht eingebogen ist, sondern sich mit einer leisen Schwingung nach innen öffnet. Sie hat einen kleinen Henkel und ist ganz so wie die große Urne Nr. 1 angefertigt und gebrannt und bildete wahrscheinlich den Deckel zu dieser Urne, wie es bei unserer in Jahrb. XI, S. 365 abgebildeten meyersdorfer Urne der Fall war. Unter dem Rande sind zwei Reihen rundlicher oder halbmondförmiger Vertiefungen eingeschnitten, so


|
Seite 444 |




|
daß die Schale eine ähnliche Verzierung hat, wie die Bronzeschale von Dahmen, eine Verzierung, welche meklenburgische Schalen öfter haben.
3) Eine ganz kleine Urne, 2 3/4 " hoch und ungefähr 2 " weit, ungefähr von der Gestalt des in Jahrb. XI, S. 362 abgebildeten perdöhler kleinen Gefäßes, jedoch ohne Henkel, mit einem einpassenden Deckel, wie ihn die gallentiner Urne, Jahrb. XI, S. 365, hat. Statt der Henkel oder kleinen durchbohrten Knöpfe sind das Gefäß und der Deckel vor dem Brande je mit zwei Löchern durchbohrt, durch welche eine Schnur gegangen ist, wie gewöhnlich bei den ältern skandinavischen Urnen, jedoch gar nicht bei meklenburgischen Urnen, welche immer statt der Löcher in den Wänden angesetzte durchbohrte Knötchen oder Henkelchen haben. Die Urne ist ebenfalls wie die beiden andern Gefäße aus Thon mit Granitgrus gebildet, mit Thon überzogen, dunkel röthlich braun und sehr fest gebrannt und wie die große Urne auf den Seitenwänden und dem Deckel mit Parallel= und Zickzacklinien verziert.
4) Ein spiralcylindrischer Fingerring von 2 1/2 Windungen, aus dünnem, runden Drath, aus der Bronze unserer Kegelgräber.
5) Zwei spiralcylindrische Fingerringe von 1 1/2 Windungen, ebenfalls aus Bronze, aus 2/10 " breiten Blechstreifen gebildet.
Alle drei Ringe haben wenig Rost.
Was bei diesem Funde in die Augen fällt, ist die völlige, durchgehende Gleichheit mit den Alterthümern der deutschen Ostseeländer. Es ist hier nicht die Rede von allgemeinen Merkmalen, in welchen z. B. alle heidnischen Grabgefäße der germanischen Länder übereinstimmen, wobei dennoch ein individueller Charakter vorherrschend sein kann, wie z. B. bei den nordischen Urnen, welche gröber, dicker und einfacher, und bei den lausitzer und nordschlesischen Urnen, welche künstlicher, aber auch mehr gekünstelt und geziert, und daher auf den ersten Blick zu erkennen sind: es ist hier eine völlige Gleichheit des Charakters in Bereitungsweise, Form und Farbe gemeint. Eben so sind diese Altertümer von den Alterthümern der russischen Ostsee=Provinzen, wie sie Kruse in Necrolivonica dargestellt hat, durchaus verschieden.
Diese polnischen Alterthümer sind daher das erste Zeichen von der Fortsetzung des Volksstammes der norddeutschen Bronzezeit über Pommern hinaus gegen Osten hin.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 445 |




|



|



|
|
:
|
Grab von Kittendorf.
Bei Gelegenheit des Chausseebaues zwischen Waren und Stavenhagen ward im Sommer des J. 1846 auf der Feldmark des Gutes Kittendorf ein Stein= und Kiesberg abgetragen, in welchem, 2 bis 3 Fuß unter der Oberfläche des Hügels, unter einem Haufen von Feldsteinen, namentlich unter 4 anscheinend in gewisser Ordnung niedergelegten großen Steinen, - also ohne Zweifel in einer sogenannten Steinkiste, -ein Menschenschädel und mehrere andere Menschen= und Thierknochen mit folgenden Alterthümern aufgefunden und demnächst als Geschenk des Herrn von Oertzen auf Kittendorf durch den Herrn Landrath von Oertzen auf Jürgensdorf, Dirigenten des genannten Chausseebaues, mit den Aufgrabungsberichten dem Vereine zum Geschenk überwiesen wurden.
Die Alterthümer sind folgende:
1) zwei Stücke eines etwas gebogenen Bleches von Bronze, 4 1/2 Zoll und 4 Zoll lang und 3/4 Zoll breit. An dem Ende des größern Stückes ist ein starkes Oehr eingenietet, in welchem ein Ring von 3/4 Zoll Durchmesser und in diesem ein doppelter Blechstreifen von 2 Zoll Länge mit einem Nietloche am untern Ende hängt: alles von Bronze. An beiden Rändern des Bleches läuft eine grade Linie, welche eingravirt ist, und an einem Rande befinden sich, in Abständen von ungefähr 1 1/2 Zoll, kleine Löcher, in deren zweien kleine, etwas über 2 Zoll lange silberne Blechstreifen mit silbernen Nieten befestigt sind und welche am untern Ende gleichfalls Nietlöcher haben; in einem derselben sitzt noch das silberne Niet. Beide Stücke sind an dem einen Ende grade abgeschnitten, und an diesem Ende befinden sich gleichfalls Nietlöcher, in deren einem noch das bronzene Niet sitzt. Beide Stücke werden zusammengehören, wenn auch die eingravirten Randlinien auf diesen beiden Bruchstücken nicht ganz genau zusammenfallen, sondern in der Verlängerung etwas divergiren, da der Blechstreifen nicht ganz regelmäßig ist. Das Ganze hat augenscheinlich als Beschlag irgend eines Werkzeuges oder einer Bekleidung, etwa einer Degenkoppel oder sonst eines Lederzeuges gedient. Nach dem Berichte des Herrn Landraths von Oertzen haben diese Bruchstücke an dem ganz zerfallenen Schädel gehangen.


|
Seite 446 |




|
2) Ein zierliches Messer von Bronze mit einem Griffe von gleichem Metall, Klinge und Griff jedes 3 1/4 Zoll lang, erstere in der Mitte etwa 1/2, letzterer 1/4 Zoll breit. Das Ende des Griffes ist ringförmig gestaltet.
3) Ein Bruchstück einer Scherenklinge aus Bronze.
4) Ein menschlicher Backenzahn.
Bei genauerer Betrachtung dieses Fundes drängt es
sich sofort auf, daß derselbe römischen
Ursprunges sei. Schon darin weicht die
Bestattungsweise von dem Inhalte der heimischen
Kegelgräber ab, daß nach den
Aufgrabungsberichten die Leiche nicht verbrannt
war; der noch gerettete Backenzahn beweiset ohne
Zweifele daß der Leichenbrand nicht zur
Anwendung kam. Eben so spricht die ganze
Bearbeitungsweise der Bronze für römischen
Ursprung; alles deutet auf eine ausgebildetere
Technik und auf vollkommnere Werkzeuge; die
eingravirten Randlinien sind entweder auf der
Drehbank gemacht oder von einer so sichern und
geübten Hand eingegraben, wie wir sie an den
Bronzen der Kegelgräber nicht wahrnehmen; auch
die Hammerarbeit, das Nieten, das Biegen
 . ist ganz ungewöhnlich. Wollte
man nun auch eine so ausgebildete Fertigkeit dem
Volke unserer Bronze=Periode einräumen, so redet
gegen die einheimische Fabrik ferner die
Metallmischung; die Bronze der kittendorfer
Alterthümer ist jene dunkle, glühende, dem
Ducatengolde an Farbe völlig gleiche Bronze,
welche bekanntlich aus Kupfer, Zinn und Zink
zusammengesetzt ist, während die heimische nur
aus Kupfer und Zinn gemischte Bronze stets viel
matter und heller an Farbe ist: in Meklenburg
ist diese glühende Farbe der Bronze nur an den
römischen Alterthümern von Gr. Kelle, namentlich
an dem Messer und der Schere, wahrgenommen (vgl.
Jahrb. III, S. 52 flgd.). Diese Geräthe führen
uns denn noch weiter in der Forschung. Das
Messer ist ganz ungewöhnlich zierlich. Das
Bruchstück der Schere ist die mittlere Hälfte
einer Scherenklinge von der bekannten alten
Gestalt der Schafscheren. Grade diese Geräthe,
Messer und Schere, und zwar von derselben
Bronze, wurden zu Gr. Kelle mit andern römischen
Alterthümern gefunden; diese sind auf der
Lithographie zu Jahresber. V, Tab. I, Fig. 6 und
7, abgebildet und den kittendorfer Stücken
durchaus ähnlich. Auch bei den römischen
Alterthümern von Hagenow ward eine gleiche
Schere gefunden, abgebildet auf der Lithographie
zum Jahresber. VIII, Tab. I, Fig. 7, vgl. S. 40.
Bronzene Scheren sind in heimischen Kegelgräbern
noch nie gefunden. Noch näher zum Ziele führt
die Vergleichung mit diesen römischen
Alterthümern von Hagenow, namentlich die
Vergleichung der Zusammensetzung der Metalle,
des Silbers mit der Bronze,
. ist ganz ungewöhnlich. Wollte
man nun auch eine so ausgebildete Fertigkeit dem
Volke unserer Bronze=Periode einräumen, so redet
gegen die einheimische Fabrik ferner die
Metallmischung; die Bronze der kittendorfer
Alterthümer ist jene dunkle, glühende, dem
Ducatengolde an Farbe völlig gleiche Bronze,
welche bekanntlich aus Kupfer, Zinn und Zink
zusammengesetzt ist, während die heimische nur
aus Kupfer und Zinn gemischte Bronze stets viel
matter und heller an Farbe ist: in Meklenburg
ist diese glühende Farbe der Bronze nur an den
römischen Alterthümern von Gr. Kelle, namentlich
an dem Messer und der Schere, wahrgenommen (vgl.
Jahrb. III, S. 52 flgd.). Diese Geräthe führen
uns denn noch weiter in der Forschung. Das
Messer ist ganz ungewöhnlich zierlich. Das
Bruchstück der Schere ist die mittlere Hälfte
einer Scherenklinge von der bekannten alten
Gestalt der Schafscheren. Grade diese Geräthe,
Messer und Schere, und zwar von derselben
Bronze, wurden zu Gr. Kelle mit andern römischen
Alterthümern gefunden; diese sind auf der
Lithographie zu Jahresber. V, Tab. I, Fig. 6 und
7, abgebildet und den kittendorfer Stücken
durchaus ähnlich. Auch bei den römischen
Alterthümern von Hagenow ward eine gleiche
Schere gefunden, abgebildet auf der Lithographie
zum Jahresber. VIII, Tab. I, Fig. 7, vgl. S. 40.
Bronzene Scheren sind in heimischen Kegelgräbern
noch nie gefunden. Noch näher zum Ziele führt
die Vergleichung mit diesen römischen
Alterthümern von Hagenow, namentlich die
Vergleichung der Zusammensetzung der Metalle,
des Silbers mit der Bronze,


|
Seite 447 |




|
und die Form des Beiwerkes. Die silbernen Nietstreifen und Nietnägel und deren Köpfe, auch der bronzene Nietstreifen, sind ganz wie die hagenower gestaltet, gearbeitet und angewendet, wie sie an dem silbernen Ringe Fig. 15 hangen. Die kittendorfer Nietstreifen haben dieselbe Größe und in den Rändern ganz dieselbe Schwingung, wie die kittendorfer, wenn auch die Umrisse grade nicht congruiren; eben so hängt der größere, bronzene Nietstreifen an dem kittendorfer Beschlage oder Ringe, wie die hagenower Nietstreifen an demselben Ringe.
Die Aehnlichkeit der Schere und des Messers von Kittendorf mit denen von Gr. Kelle und die Aehnlichkeit der kittendorfer Nietstreifen mit denen von Hagenow ist so groß, daß man die kittendorfer Alterthümer durchaus für römisch und sicher mit denen von Hagenow für gleichzeitig halten muß.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Römische Urne von Stuer.
Der Herr Geheime Justizrath Dr. Ditmar zu Rostock hat dem Vereine eine seltene Urne geschenkt, welche nach allen Nachrichten in Meklenburg gefunden ist. Sie ist aus gelber Sigelerde, sehr fest gebrannt, unbezweifelt in der Form und auch in mehrern Kreisverzierungen, namentlich auf der untern Seite des Bodens, auf der Töpferscheibe gedreht, also nach allen diesen Zeichen sicher römischen Ursprungs. Sie ist 10 " hoch, ungefähr 7 " weit im Bauche, 4 1/2 " im Durchmesser im Boden und 2 3/4 " weit in der Halsmündung und hat ganz die Gestalt der modernen Wasserflaschen, nur mit abgestumpftem Halse, und ist über den ganzen Bauch, zwischen horizontalen Parallellinien, abwechselnd mit etwas schräge laufenden, parallelen, vertieften Wellenlinien und geraden Linien, am Halse mit perpendikulairen Linien verziert. In der Urne liegen noch einige verbrannte Knochen, einige Bruchstücke von einer mit Granitgrus durchkneteten, heimischen Urne und eine ganz regelmäßige, in der Masse verwitterte Kugel aus Knochen von 3/4 " Durchmesser.
Nach den sichern Mittheilungen des Herrn Geheimen Justizraths Dr. Ditmar stammt das Gefäß aus der Sammlung des wail. Pastors Delbrügk zu Stuer und ward in dem von dem wailand Magister Siemßen zu Rostock angefertigten Verzeichnisse der Sammlung als in dortiger Gegend (am plauer See) gefunden aufgeführt; so viel scheint man gewiß annehmen zu können, daß die Urne in Meklenburg gefunden ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 448 |




|



|



|
|
:
|
2. Mittelalter.
Gläserne Reliquien=Urne von Wittenburg.
Beim Umbau des Altars in der Kirche zu Wittenburg ward in demselben ein Glas, mit einigen in Seide gewickelten Knochenstücken, gefunden, welches von dem Herrn Pastor Danneel zu Wittenburg an den Verein eingesandt ist. Das Gefäß ist von bläulichem Glase, 4 1/4 " hoch, unten kugelig und mit weitem Halse von der halben Höhe der ganzen Flasche. Dabei ward ein sehr gebräuntes und angegriffenes Wachssiegel gefunden, welches, nach den geringen Resten eines pergamentenen Siegelbandes zu urtheilen, an einer Urkunde gehangen hat; da aber von einer Urkunde kein Rest eingesandt ist, so ist sie wahrscheinlich leider ganz vergangen. Das Siegel ist das Hauptsiegel des Bischofs Ulrich von Ratzeburg (1257-1284), wie es in Masch Gesch. des Bisthums Ratzeburg S. 176-171 beschrieben ist: ein rundes Siegel, 2 1/4 " im Durchmesser, mit dem stehenden Bilde des Bischofs bis an die Mitte des Leibes, mit dem einwärts gekehrten Stabe in der rechten Hand und mit einem Buche im linken Arme; von der Umschrift ist noch zu lesen:
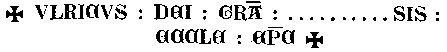
Der Altar ist also ungefähr 1260-1280 errichtet, wahrscheinlich bei der Vollendung der Kirche, welche aus dieser Zeit zu stammen scheint, wenn sie auch jetzt sehr verbauet ist; älter wird die Kirche nicht sein, obgleich die Stadt älter ist. Man vgl. Jahrb. VI, S. 80 flgd.
Ueber ähnliche gläserne Reliquien=Urnen vgl. Jahresber. III, S. 90, und Erster Ber. über d. Antiq. zu Schwerin, S. 24, Nr. 10.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Zwei Kelchtücher
aus der Stadtkirche zu Ribnitz, geschenkt von dem Herrn Burgemeister und Kirchen=Oeconomus Dr. Nizze zu Ribnitz:
1) Ein Kelchtuch aus weißer Leinewand, mit bildlichen Darstellungen und an den Rändern reich mit lateinischen Inschriften in rother und blauer (?) Seide gestickt; die blauen (?) Stickereien sind aber vergangen und fast ganz verschwunden und nur noch an den Stichen bemerkbar. In der Mitte ist Christus am Kreuze mit Maria und Johannes, in den vier Ecken sind die Symbole der Evangelisten gestickt. Ueber der Kreuzigung steht:



|
Seite 449 |




|
An den 4 Seiten dieser Darstellung stehen die vier großen, mit einer Krone bedeckten Buchstaben:
Um den Rand läuft zu beiden Seiten einer Verzierung mit einem Vogel (Taube?) eine Inschrift, welche, da fast immer ein Buchstabe um den andern verschwunden ist, schwer zu lesen ist; jedoch steht an einer Stelle noch klar von der Jungfrau Maria:
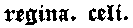
Dieses Tuch stammt also ohne Zweifel noch aus der katholischen Zeit und nach den Schriftzügen wahrscheinlich aus dem 15. Jahrh.
2) Ein Kelchtuch aus Leinewand, am Rande reich mit rother Seide und Gold gestickt und außerdem mit einer goldenen Tresse besetzt. In der Mitte ist in Roth und Gold ein Blumentopf, auf welchem ein Löwe steht, gestickt und umher die Inschrift:
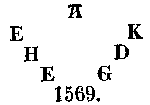
Der Rand ist mit goldenen Blumen und Löwen in rother Seide gestickt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Geschnitztes Hifthorn.
Aus dem Nachlasse des wail. Präpositus Crull zu Boizenburg ist neben mehrern andern Alterthümern auch das mit Relief=Schnitzereien gezierte dicke Ende eines Büffelhorns erworben, welches nach den Nietlöchern offenbar zu einem Hifthorne gehört hat. Auf der äußern Seite sind 5 menschliche Figuren dargestellt: in der Mitte eine Dame, hinter ihr, links, zwei Männer in spanischer Tracht, von denen der eine einen Spieß mit einer Fahne hält; vor ihr steht ein Mann mit einem Baret in der Hand, hinter demselben sitzt unter einem Baume ein Zitherspieler; unten liegt in jeder Ecke ein Hund. Diese Darstellung ist von einem Rahmen eingefaßt, welcher folgende italienische Inschrift enthält:
NON PENSA LHVON CHE CODE IN FESTA
ET CANTO CHE AL FIN IL RISO SI COVERT
IN PIANTONO 1541.
d. i.
Nicht denkt der Mensch, welcher sich freut in Frohsinn und Gesang, daß am Ende das Lachen sich verkehrt in Weinen. Anno 1541.
Auf der innern Seite ist ein ovaler Schild (ohne Wappenzeichen) zwischen zwei mit Blättern verzierten Greifen dargestellt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 450 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Baukunde.
1. Vorchristliche Zeit.
Ueber die wendische Fürstenburg Meklenburg.
In unsern Jahrbüchern ist häufig in den Untersuchungen über die alten wendischen Fürstensitze die Ansicht dargelegt, daß dieselben auf großen, in tiefen Mooren, auch wohl auf Inseln, häufig mit einer Seite an Gewässern aufgeschütteten Burgwällen standen. Nach dieser Ansicht sind denn auch alle bekannten Fürstenburgen wieder aufgefunden; namentlich ist die alte Fürstenburg Meklenburg in Jahrb. VI, S. 79-87 (vgl. S. 97 flgd.) Gegenstand einer kritischen Forschung gewesen.
Um den Mitgliedern des Vereins eine deutliche Anschauung von der Lage und Beschaffenheit des Burgwalles von Meklenburg zu verschaffen, theilt der Ausschuß des Vereins dessen Mitgliedern hieneben eine lithographirte Ansicht von dem Walle der viel genannten Burg mit, dem Schauplatz vieler merkwürdiger und blutiger Begebenheiten, von welchem unser Vaterland den Namen trägt. Die Ansicht ist von dem Maler Herrn Theodor Fischer zu Schwerin in Begleitung des Unterzeichneten an Ort und Stelle aufgenommen, nachdem der allerdurchlauchtigste Protector unsers Vereins, Se. Königliche Hoheit der allerdurchlauchtigste Großherzog Friedrich Franz den Burgwall, die Stammburg der meklenburgischen Fürsten, mit großer Theilnahme besucht hatte. Der Standpunct ist auf der letzten Höhe nahe vor dem Hofe Meklenburg, nicht weit rechts von der Chaussee, welche von Schwerin nach Wismar führt, genommen; die Ansicht auf den Burgwall ist auch von der Chaussee aus vor dem Hofe Meklenburg vollkommen geöffnet. Vor uns dehnt sich in der Tiefe die große Sumpfwiese aus, durch welche der ehemalige Kanal vom schweriner See in die


|
Seite 451 |




|
Ostsee ("die vichelsche Fahrt, der Schiffgraben"), jetzt ein schmales Bächlein, fließt. In der Mitte steht der Burgwall, der sich wie ein todter Riese durch den Sumpf streckt und den wir von seiner westlichen Längsseite erblicken. Links erblickt man das letzte Haus des Dorfes Meklenburg, von welchem ein schmaler Fahrweg auf den Burgwall führt. (Links von dem Standpuncte liegt der Hof Meklenburg, auf dem Bilde nicht sichtbar). Die Burgwallwiese begrenzt zunächst, etwas links, der Pingelsberg, auf welchem mehrere Kegelgräber liegen, von denen das größte aus der Ferne noch erkennbar ist (vgl. Jahresbericht IV, S. 71 und Jahrb. VI, S. 82 flgd.); an diesem Hügel entlang, hinter dem Burgwalle, liegt der Weg von Meklenburg nach Mödentin. In der Mitte des Hintergrundes, grade über die Mitte des Burgwalles, ragt der Thurm der interessanten Rundbogenkirche von Lübow hervor (vgl. Jahresber. VII, S. 66 flgd.), welches der uralte Ort war, in dessen Nähe der Burgwall von Meklenburg aufgeführt ward (vgl. Jahrb. IX, S. 407). Hinter Lübow erheben sich die Waldhöhen von Kritzow, neben denen rechts noch der Kirchthurm von Zurow in weiter Ferne zu erkennen ist. Eine Meile weiter hinter den Bergen von Kritzow liegen, von hier nicht sichtbar, die alten Burgen Ilow und Neuburg, östlich von Meklenburg, eine Stunde südlicher liegt der Burgwall von Dobin.
Durch das Dorf Meklenburg führt die im Bau begriffene Eisenbahn von Wismar nach Schwerin; sie geht mitten durch das Dorf, streift dem Dorfe zunächst die Sumpfwiese, in welcher der Burgwall liegt, geht dicht an dem Burgwalle vorbei und am mödentiner Wege hinter dem Burgwalle wieder auf das feste Land. Beim Bau dieser Eisenbahn machte man denn auch die Erfahrung, daß die Wiese, in welcher der Burgwall liegt, ein tiefer Sumpf sei, auf welchem die jetzige Wiesendecke gewissermaßen schwimmt. Man hatte im Herbst des J. 1846, zu der Zeit als das hier mitgetheilte Bild aufgenommen ward, eine ganze Strecke des Erddammes durch die Wiese gelegt; als eines Morgens die Arbeit fortgesetzt werden sollte, war das Planum völlig verschwunden und statt dessen ein Teich sichtbar, in dessen Nähe durch den unterirdischen Seitendruck sich einige Hügel in der Wiese erhoben hatten. Der versunkene Erddamm war nicht wiederzufinden; die Tiefe des Sumpfes war nicht weit von seinem Rande an 30 bis 40 Fuß!.
Bei der Fortführung der Bahn auf dem festen Lande am mödentiner Wege ward eine andere interessante Entdeckung gemacht. Dem Burgwalle östlich grade gegenüber, ungefähr 40 Schritte rechts vom Wege nach Mödentin und 400 Schritte


|




|



|




|


|
Seite 452 |




|
südwestlich von dem Pingelsberge, liegt ein Hügel, welcher von der Eisenbahn durchschnitten wird. Hier fand man unter der Erdoberfläche sehr viele Scherben von Töpfen zu häuslichem Gebrauche, genau von derselben Beschaffenheit und Verzierung, wie sie auf den wendischen Burgwällen und namentlich auf der Burg Meklenburg gefunden werden (vgl. oben S. 436), ferner mancherlei eiserne Geräthschaften, Knochen, auch Menschengebeine und Schädel, behauene Granitsteine und gebrannte Ziegel. Ein Topf, wie der oben S. 437 abgebildete und beschriebene, eine große Seltenheit, ward ganz gefunden und für die großherzogliche Sammlung unverletzt zu Tage gefördert. Die wendischen Burgwälle sind zu klein, um eine größere Volksmenge aufnehmen zu können; das Volk hat ohne Zweifel vor der Burg, der "Vorburg" (vgl. Jahrb. VI, S. 86), gewohnt. Wenn nun auch wohl das alte wendische Dorf an der Stelle des jetzigen Dorfes, nördlich von dem Burgwalle, gelegen haben mag, so haben doch auch an der beschriebenen Stelle, östlich von dem Burgwalle, Menschen gewohnt oder das wendische Dorf, die viel besprochene, sogenannte große Stadt Meklenburg hat sich so weit herum erstreckt. Jedenfalls ist dieser Fund ein Beweis, daß die Bevölkerung sich nicht auf den Burgwall beschränkt gehabt hat.
Schwerin, im Frühling 1847.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Burgwall von Werle.
Neben dem Burgwalle von Werle bei dem Hofe Wieck unfern Schwaan (vgl. Jahrb. VI, S. 88 flgd.) ward in der Warnow ein großer Grapen aus mittelalterlicher Bronze, von gewöhnlicher Form, mit dem gewöhnlichen Gießerzeichen der gekreuzten Haken, und eine eiserne Axt gefunden; der Grapen ist in die großherzogliche Alterthümersammlung gekommen, die Axt aber verloren gegangen.
In einer bei den Sumpfwiesen des werleschen Burgwalles liegenden Sandscholle wurden beim Bau der Eisenbahn viele Geräthe aus Bronze aus der Bronzeperiode und mehrere Bauten aus Feldsteinen gefunden, über deren Beschaffenheit die Beschreibung oben S. 414 flgd. zu vergleichen ist. Dieser Fund zeugt von einer Benutzung der werleschen Localitäten schon zur Zeit des Bronzezeitalters.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 453 |




|



|



|
|
:
|
Burgwall von Dargun.
In Jahrb. VI, S. 70-71 ist dargethan, daß der alte Burgwall von Dargun am äußersten, nördlichen Ende des Ortes, dem Dorfe Röcknitz gegenüber liegt und gegenwärtig zum Judenkirchhof benutzt wird; die Sache unterliegt keinem Zweifel und es hat der Herr Amtmann Hase zu Dargun im Laufe der Zeit auf dem Burgwalle viele Urnenscherben gesammelt, welche den Urnenscherben der übrigen heidnischen Burgwälle in jeder Hinsicht vollkommen gleich sind.
Dieser Burgwall ist aber eine ganze Strecke von dem Kloster oder dem jetzigen Schlosse Dargun entfernt, welches am entgegengesetzten, südlichen Ende des sehr langgestreckten Ortes liegt. Die Klöster pflegten aber unmittelbar an heidnischen Ortschaften oder Tempeln angelegt zu werden. Dies hat sich denn auch in neuern Zeiten bestätigt, indem der Herr Dr. Linsen zu Dargun in seinem am Schlosse liegenden Garten spanförmige Feuersteinmesser gefunden hat, welche darauf schließen lassen, daß auch die Stelle des Klosters zur heidnischen Zeit bewohnt gewesen sei. Wahrscheinlich hat also das heidnische Dorf Dargun, welches von der alten Burg Dargun verschieden war, an der Stelle des Klosters gelegen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Burg Bisdede.
Oben S. 9 und 27 ist bei der Untersuchung über das Land Bisdede, welches sich vom parumer See gegen Osten hin erstreckte, die Vermuthung aufgestellt, daß die in den Zügen der Dänen nach Wenden erwähnte Burg in dem großen See die Burg Bisdede in dem See Bisdede oder gutowschen See bei Güstrow sein könne. Zur Erforschung dieses Burgwalles und anderer historischer Merkwürdigkeiten begab ich mich daher im Interesse des Vereins am 14. Mai 1847, nach Vollendung des Druckes des ersten Theils der Jahrbücher, nach Güstrow und fand hier glücklich eine Burg, welche jedenfalls die vorzüglichste Fürstenburg jener Gegend in heidnischer Zeit oder eine Gauburg war und wohl ohne Zweifel die Hauptrolle spielte, ehe Güstrow erbauet ward.
Der Burgwall liegt, ungefähr 1/2 Meile von Güstrow, auf einer Landzunge, welche mit der Schöninsel den See Bisdede (Inselsee) in den rosiner See nördlich und den gutower See


|
Seite 454 |




|
südlich scheidet und von der Feldmark des Dorfes Bölkow ausgeht, grade zwischen diesem Dorfe und der Schöninsel, dort wo er auf der großen schmettauschen Charte eingetragen ist; er ist auf einer Insel mit festem Boden aufgeführt und hängt im Westen jetzt mit dem festen Lande des Dorfes Bölkow durch eine lange, tiefe Wiese zusammen, welche bei nassem Wetter schwer zugänglich ist und in frühern Zeiten einen tiefen Sumpf gebildet haben muß. Auch gegenüber an der Schöninsel liegen Wiesen, welche auf Sumpf "schwimmen", und große Rohrplaggen.
Der Burgwall liegt fast noch so, wie er zerstört ist, da der Boden nicht fruchtbar ist und daher von den Bauern in Bölkow nicht gerne beackert wird. Er ist oben noch mit einem Walle oder einer Brustwehr von etwa 10 Fuß Höhe umgeben, der innere Raum der Burgfläche bildet also eine große, kesselförmige Vertiefung. In alten Zeiten waren die wendischen Burgwälle alle mit einem Erdaufwurfe am Rande umgeben; so hatte Ilow noch im 16. Jahrh. einen Schutzwall auf den Rändern des Burgwalles (vgl. Jahrb. VII, S. 165). Da die bekannten Burgwälle aber alle beackert sind, so sind ihre Flächen, wie auf Ilow, alle geebnet. Der Burgwall von Bisdede ist daher wohl der einzige alte Burgwall im Lande, welcher noch seine ursprüngliche Gestalt hat.
Die Insel des Burgwalles bildet ungefähr ein regelmäßiges Viereck; daher erscheint die durch Aufführung eines Ringwalles entstandene kesselförmige Vertiefung der Oberfläche fast ganz rund und dieser Burgwall wird dadurch den sogenannten Ringwällen anderer Länder sehr ähnlich. Der Ringwall, welcher hart auf dem Rande steht, hat auf seiner Höhe einen Umfang von 210 Schritten. Der Burgwall fällt schroff in den See und in die Wiese ab und hat von außen ungefähr eine Höhe von 50 Fuß. Gegen Süden, nach der Richtung der Stadt Güstrow, liegt auf dem Wiesengrunde vor dem Burgwalle bis zum Wasser eine große, ebenfalls aufgetragene Erhöhung etwa 10 Fuß Höhe, die Vorburg, auf welchem wohl die Bevölkerung zur Burg wohnte.
Den sicheren Beweis für die Bedeutung dieses Burgwalles liefern die auf demselben gefundenen Topfscherben. Schon beim ersten Schritte auf das feste Land der Vorburg leuchteten aus der schwarzen Erde die bekannten Scherben aus der heidnischen Zeit entgegen. Ueberall ist der Burgwall und die Vorburg mit unzähligen Scherben bedeckt, welche den Scherben der übrigen heidnischen Fürstenburgen gleich sind: mit Granitgrus durchknetet, mit parallelen Kreisen oder mit Wellenlinien verziert, wie sie oben S. 436 flgd. geschildert sind, und am offenen Feuer gebrannt. Auch fanden sich häufig röthlich gebrannte Reste von


|
Seite 455 |




|
Lehmklumpen oder "Klehmstaken" von den Gebäuden. Dagegen ward keine einzige festgebrannte, schwarze oder blaugraue Scherbe, kein einziges Ziegelfragment aus christlicher Zeit gefunden.
Auch auf dem festen Lande vor dem Dorfe Bölkow, welches von dem Burgwalle durch eine Seebucht getrennt ist, fanden sich auf der Fläche nach dem Wasser hinab überall dieselben heidnischen Scherben von derselben Art. Dies redet noch mehr für die Auffindung der Burg Bisdede, da (vgl. oben S. 27) die Sagen melden, daß die Burg in der Nähe eines Dorfes gelegen habe, und für die Treue der alten Geschichtschreiber, welche sich auch für die Burg Ilow in den geringsten Einzelnheiten bewährte.
Für die alte Bedeutung der Burg redet auch noch der Umstand, daß bei der Christianisirung des Landes Güstrow die nächsten Umgebungen der Burg Bisdede Domainen waren, indem das Domstift Güstrow 1226 mit den Dörfern Gantschow, Gutow, Bölkow (mit Badendik) dotirt und das Kloster Michaelstein im J. 1229 mit den Dörfern Rosin beschenkt ward.
Da alle diese Dörfer unter Bauerwirthschaft kamen, so ist von Nachrichten und Sagen nirgends eine Spur. In Bölkow erzählte man mir jedoch: früher habe an der Stelle des Burgwalles ein Sandberg gestanden; als ein Mädchen zu einer Zeit, wo es nicht erlaubt gewesen sei, von dort Sand habe holen wollen und die Schürze schon mit Sand angefüllt gehabt habe, sei das Schürzenband gerissen und der Burgwall plötzlich entstanden. Auch sagte man, ein großer Granitblock, welcher am Fuße des Burgwalles im See liegt, sei von einem Riesen im Kampfe mit einem andern Riesen dorthin geschleudert, ein kleinerer Stein im Wasser soll von dem andern Riesen dahin geworfen sein.
Der andere, auf S. 27 Not. erwähnte "Burgwall" im Klueßer Forstrevier ist weit, über eine halbe Stunde von diesem Burgwalle von Bisdede entfernt. Er liegt dem Dorfe Kirch=Rosin grade gegenüber, jenseit der Nebel, dicht an derselben, in dem Holze, welches auf der schmettauschen Charte "In Stamen" bezeichnet ist. Er besteht aus zwei "Burgplätzen", wenn man sie so nennen soll. Der hinterste, größere ist nur eine wenige Fuße erhöhete Horst, ringsum von einem tiefen Ellernbruch umgeben, viereckig, 120 Schritt lang und breit. Genau am Rande ist dieser Platz rings mit Fliederbüschen besetzt und daher wird er auch der "Fliederwall" genannt. - Vor dieser Horst liegt ein anderer viereckiger, ebenfalls wenig erhöheter Platz, welcher rund ist, 110 Schritte im Durchmesser hat, ebenfalls ganz in


|
Seite 456 |




|
einem Ellernbruche liegt und am Rande von einem niedrigen, auch mit Fliederbüschen besetzten Walle umgeben wird. - Beide Wälle sind mit Buchen bewachsen.
Die Bedeutung dieses "Burgwalles" ist durchaus nicht zu ermitteln, um so weniger, da sich weder Scherben, noch sonst Spuren menschlicher Cultur, außer dem Ringwall und dem Flieder, auf ihm finden. Dergleichen niedrige Wälle und Horsten von Sümpfen umgeben, in einsamen Wäldern, finden sich öfter, ohne daß man sie deuten könnte. Vielleicht gehörten sie der ältesten Bevölkerung an.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 457 |




|



|



|
|
:
|
2. Mittelalter.
In Jahrb. X, S. 310 flgd. ist nach Privatberichten vermuthet, daß die meisten Kirchen östlich von Güstrow einen ziemlich gleichmäßig ausgezeichneten Baustyl haben könnten, wie die dort beschriebene Kirche zu Reinshagen, welche ein auffallend schönes Bauwerk ist. Durch Beförderung und in Begleitung des Herrn von Kardorff auf Remlin zu Gnoien, welcher sich für unsere Vereinsforschungen sehr lebhaft und vielseitig interessirt, habe ich im Junius 1846 alle diese Kirchen, 14 an der Zahl, untersucht. Hat nun eine wissenschaftliche Vergleichung jene Vermuthung nicht ganz bestätigt, indem nur die Kirchen zu Reinshagen, Wattmannshagen, Warnkenhagen und Belitz der ernstern Zeit des hohen und reinen Spitzbogenstyls angehören, so hat doch die Nachforschung sehr viele interessante und wichtige architektonische und chronologische Aufschlüsse gegeben. Namentlich ist der Bau der städtischen Kirchen zu Alt=Kalen, Gnoien, Lage und Teterow sehr wichtig. Für die mehr östlichen Kirchen ergiebt sich der Schluß, daß von dem Kloster Dargun aus, obgleich hier keine Spur von dem ersten und zweiten Kirchenbau mehr zu finden ist, sich der Uebergangsstyl weit umher verbreitete, dessen ältester Repräsentant in diesen Gegenden die Kirche zu Alt=Kalen ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Alt=Kalen
Zum rechten Verständniß der nicht unwichtigen Localitäten von Alt=Kalen ist ein kurzer Abriß der Geschichte des Ortes aus den Archivquellen notwendig.
Der alte wendische Ort Kalen oder Kalant, worunter in alter Zeit nur Alt=Kalen verstanden werden kann, kommt schon


|
Seite 458 |




|
sehr früh vor. Der Ort bestand schon zur wendischen Zeit und trägt seinen Namen aus der wendischen Sprache von dem Worte Kal: Morast, also: Morastort (vgl. Jahrb. VI, S. 54) 1 ). Schon im J. 1174 bei der Dotation des Klosters Dargun wird der See Kalen mit dem daran stoßenden langen Sumpfe (stagnum, quod dicitur Kalen - - ab orientali fine eiusdem stagni ad aquilonem per quandam longam paludem) genannt; vgl. Lisch Mekl. Urk. I, S. 9, und 18 und 23. Da in jenen nordöstlichen Gegenden etwas größere Seen nicht häufig sind, so erscheint die Benennung des Ortes hinlänglich begründet. Noch im J. 1174 lag bei dem See eine wendische Burg; in der darguner Urkunde vom J. 1174 wird der See Kalen mit seiner Burg (urbs) Kalen (stagnum Kalen cum sua urbe Kalen: Mekl. Urk. I, S. 9) genannt, da urbs im Mittelalter nur Burg bedeutet; dieselben Ausdrücke kommen noch im J. 1219 bei der Confirmation des Klosters nach dessen Wiederherstellung vor (vgl. Mekl. Urk. I, S. 23).
Die Kirche zu Alt=Kalen und mit ihr der christliche Ort müssen bald nach der 1216-1219 geschienen Wiederherstellung des Klosters Dargun gegründet sein, da schon um das J. 1232 das Kloster Dargun das Patronat der Kirche geschenkt erhielt (vgl. Mekl. Urk. I, S. 48) und am 1. März 1238 der Pfarrer Heinrich von Kalent als Zeuge in einer fürstlichen Urkunde genannt wird (vgl. das. I, S. 52).
Ungefähr zu derselben Zeit hatte der Fürst Borwin von Rostock, in dessen Lande Kalen lag, auf dem wendischen Burgwalle eine fürstliche Burg erbauet, dieselbe mit Rittern als Burgmännern bewehrt und neben der Burg eine Stadt gegründet; im J. 1244 erwarb er von dem Kloster Dargun den diesem früher verliehenen Grund und Boden zur Stadt und das Dorf Damm zu Burglehen für die Ritter (cum nos ciuitatem et castrum Kalant edificassemus in proprietate ecclesie Dargunensis): vgl. Mekl. Urk. I, S. 73. Da dieses Geschäft wegen des Eigenthums (ad edificandum castrum et ciuitatem ibidem construendam) nicht ganz klar bestimmt gewesen war, so ward es erst am 19. Febr. 1252 völlig regulirt (vgl. Mekl. Urk. I, S. 96). Die Sache mit der Gründung der Stadt hat ihre volle Richtigkeit, da der Fürst Borwin am 11. Februar 1253 ihr nicht unwichtige Privilegien ertheilt hatte, nämlich das lübische Recht und die Freiheit vom Schoß, zu der Stadt zwei Hufen


|
Seite 459 |




|
nach dem Dorfe Damm hin zur Stadtweide legte, sie von einer Kornpacht von Aeckern auf dem Felde von Lüchow befreiete, ihnen den Besitz der Stadtäcker bestätigte, u. s. w. 1 ) Hier ist offensichtlich von Neu=Kalen noch gar nicht die Rede.
Bei der Wichtigkeit des Ortes und da die Stadt wohl die älteste in jenen Gegenden war, ward Alt=Kalen auch der Sitz eines Propstes oder Archidiakons des caminer Bisthums. Der Pfarrer Heinrich von Kalen, welcher noch im J. 1238 bloßer Pfarrer war, erscheint von 1241-1262 als Propst von Kalen (Hinricus prepositus de Kalend, vgl. Mekl. Urk. I, S. 70, 73, 87, 93 und 124). Außerdem war der Priester Johannes Kapellan an der Burgkapelle (dominus Johannes capellanus de Kalant, im Stadtprivilegium vom J. 1252; dominus Johannes capellanus de Castro, Urk. vom J. 1251 in Mekl. Urk. I, S. 93). Im J. 1262 dotirte der Fürst Borwin auf der Burg Kalant einen Altar in der Kirche mit Hebungen von 7 freien Hufen; in der darüber ausgestellten Urkunde (Mekl. Urk. I, S. 124) scheinen alle Burglehen von Kaien vorzukommen.
Seit dem J. 1240 erscheint auch die meklenburgische Ritterfamilie von Kalant, welche einen Steighaken im Schilde führte; sie soll gegen das Ende des 18. Jahrh. ausgestorben sein; vgl. Mekl. Urk. I, S. 64 und 146 und a. a. O. Nach den Vornamen der Söhne des unbekannten Stammvaters, da sie Jereziav, Rademar und Lippold hießen, waren sie wendischen Ursprungs; sie hatten ihre Güter in der Gegend von Alt=Kalen und Dargun, namentlich besaßen sie lange das Gut Rey.
Nach dem Stadtprivilegium vom J. 1253 waren lübecker oder rostocker Patricier als Colonisten in die neue Stadt gezogen; so sind unter den Zeugen zu Kalen z. B. Herman Vorradt, Wescel, Osburn Rode u. a.
Nach allen diesen Zeichen war die Stadt Kalen oder Alt=Kalen im J. 1240 gegründet.
Die Stadt Alt=Kalen mochte für den Verkehr nicht günstig liegen, namentlich nachdem die Städte Gnoien, Tessin, Lage, Teterow, Malchin und Demmin Wichtigkeit erlangt und dem Verkehr andere Bahnen angewiesen hatten. Daher legte der Fürst Waldemar von Rostock 2 ) am 5. Jun. 1281 "de stadt Kalandt in dat dorp, welckes gnant was Bugelmast" und übertrug auf die "stadt Nienkalandt" alle Gerechtigkeiten,


|
Seite 460 |




|
welche die alte Stadt besessen hatte, legte dazu Fischerei auf dem See Cummerow und die Erlaubniß, das Dorf Warsow zu kaufen (vgl. auch Mekl. Urk. I, S. 181).
Der Ort Alt=Kalen hielt sich noch einige Zeit in seinem frühern Zustande. Am 21. März 1307 verkauften jedoch die Fürsten Heinrich von Meklenburg und Nicolaus von Werle dem Kloster Dargun wieder das Eigenthum des Dorfes Alt=Kalen (proprietatem ville Antique Kaland) nach den Privilegien des Klosters, zugleich mit dem Patronat der Kirche; dabei versprachen die Fürsten, die Burg in dem Dorfe Alt=Kalen ganz abzubrechen und nie wieder aufzubauen (vgl. Lisch Urk. des Geschl. Maltzan I, Nr. LX). Am 5. Februar 1311 bestätigte der Fürst Nicolaus von Rostock 1 ) dem Kloster den Erwerb des Dorfes Alt=Kalen mit dem See und dem abgebrochenen Schloß und Thurme, welche er nie wieder aufzubauen versprach (proprietatem ville Antique Kalant cum stagno adiacente cum castro et turre destructis, que ultra reedificari nolumus).
Alt=Kalen behielt nichts weiter als die
Präpositur. Am 28. Jan. 1309 wies der Bischof
Heinrich von Camin die Kirche zu Levin, deren
Patronat im J. 1241 dem Kloster Dargun geschenkt
war, von der demminer Präpositur an das
Archidiakonat zu Alt=Kalant. Im J. 1395 aber
entschied der Propst von Güstrow, als delegirter
Conservator, daß mit der Kirche zu Levin keine
Präpositur, welche der Pfarrer sich angemaßt
habe, verbunden sei, und daß die Jurisdiction
 . über die Kirchen zu Levin,
Alt=Kalant, Röknitz, Polchow, Bruderstorf,
Gülzow und Dukow dem Kloster Dargun zustehe. Im
J. 1397 aber versicherte der Vicar des Bischofs
von Camin dem Kloster Dargun den Besitz der
Präpositur Levin.
. über die Kirchen zu Levin,
Alt=Kalant, Röknitz, Polchow, Bruderstorf,
Gülzow und Dukow dem Kloster Dargun zustehe. Im
J. 1397 aber versicherte der Vicar des Bischofs
von Camin dem Kloster Dargun den Besitz der
Präpositur Levin.
So ward Alt=Kalen ein gewöhnliches Dorf.
Mit diesen urkundlichen Angaben stimmen denn auch die Alterthümer von Alt=Kalen überein.
Die Kirche aus Ziegeln ist noch in der letzten Zeit des Rundbogenstyls erbauet und die älteste Kirche in der ganzen Gegend. Sie ist ein Oblongum mit grader Altarwand von zwei Gewölben Länge; hinzugenommen ist der Raum des etwas jüngern Thurmgebäudes. Das Kirchengebäude (ohne den Thurm) hat rings umher den einfachen, regelrechten, auf Lissenen ruhenden Rundbogenfries, welcher auch an den Seiten des


|
Seite 461 |




|
Giebels hinaufläuft. Die Altarwand hat drei architektonisch verbundene, von reichen Wülsten eingefaßte Fenster, deren Gliederungen von abwechselnd glasurten und nicht glasurten Ziegeln ausgeführt sind. An der Nordseite hat die Kirche 2 Fensterpaare, welche durch einen zweiwulstigen Rundbogen verbunden sind; die schmalen, schräge eingehenden Fenster scheinen leise, kaum merklich gespitzt zu sein. An jeder Seite eines jeden zwischen zwei Lissenen gestellten Fensterpaares steht eine kleine, im Rundbogen gewölbte Nische. - Die Südseite der Kirche ist ganz verbauet.
Nach allen diesen Zeichen und der Geschichte ist die Kirche zwischen 1220-1230, vielleicht bald nach 1220 gebauet.
Der Thurm hat Strebepfeiler und weite Spitzbogenfenster.
Im Innern ist die Kirche von 2 gleichen, starken Gewölben bedeckt.
Vor der Kirche liegt ein alter, schöner Taufstein aus Granit, welcher jedoch zerschlagen ist.
Von den Glocken ist die größte aus dem J. 1782, die kleinste aus dem J. 1602; die mittlere hat die Inschrift:
(d. i.
Anno domini MCCCCXC°. O Christe rex gloriae veni cum pace. Amen).
Der "Wallberg" oder Burgwall liegt nahe bei dem Dorfe, am See, im Südwesten der Kirche. Es ist ein großes Plateau, umher mit Spuren von Wällen und Gräben umgeben; der Wall ist Pfarracker und unter den Pflug gebracht. Die Oberfläche ist mit unzähligen Fragmenten von großen Ziegeln und kleinen Feldsteinen bedeckt. Bei der Urbarmachung ward ein Löffel und ein Siegelring von Messing gefunden (vgl. Jahresber. I, S. 15 und 16).
Auch von der Stadt Alt=Kalen sind noch Spuren vorhanden. Von dem Burgwalle zieht sich ein Wall, der an jeder Seite einen Graben hat, wie die Landwehren der Städte, um das ganze Dorf und die Dorfgärten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 462 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Gnoien
ist viel älter, als die Nachrichten über die Stadt. Die älteste Urkunde, eine Privilegienbestätigung durch den Fürsten Heinrich von Werle, ist aus dem J. 1290; damals bestand aber schon die Stadt nach den Privilegien der Vorfahren des Fürsten. Im J. 1287 z. B. werden schon die Rathmänner der Stadt Gnoien genannt (vgl. Lisch Mekl. Urk. I, S. 178).
Die Kirche wird aber in den ältesten Theilen schon vor dem J. 1240 erbauet sein. Die einzelnen Theile sind zu sehr verschiedenen Zeiten erbauet.
Der Chor ist viereckig mit grader Altarwand. Die Altarwand hat 3 Fenster im Uebergangsstyl, deren Einfassungen mit glasurten Steinen verziert sind. An den Ecken laufen Lissenen hinauf und der Giebel trägt einen Rundbogenfries und rundbogige Nischen. An der äußern Südwand des Chors ist eine fensterartige Nische von 2 gekuppelten, im Halbkreise gewölbten Bogen, welche in der Mitte von Einer Säule getragen werden, - also eine ächte Baueigenthümlichkeit des Rundbogenstyls. Im Innern ist der Chor sehr verbauet, jedoch hat die Nordwand noch Spuren von Fenstern im Uebergangsstyl. Nach diesen Eigenthümlichkeiten wird der Chor spätestens 1230 bis 1240 erbauet sein.
Das Schiff, welches den Charakter des 14. Jahrhunderts trägt, hat Strebepfeiler. Es ist 3 Gewölbe lang und 2 Gewölbe breit. Es hat daher die Eigenthümlichkeit, daß die 3 Pfeiler, welche die Gewölbe des Schiffes tragen, in der Mitte der Kirche stehen, die Kirche also in zwei Schiffe scheiden. Diese seltene Bauweise ist bisher nur an den Kirchen zu Schlagsdorf, Ankershagen und Schwinkendorf beobachtet; vgl. Jahresber. VII, S. 64, und VIII, S. 124 u. 127.
Der Thurm ist jünger. Auf einem nicht ganz regelmäßig behanenen Steine, welcher an der Westseite neben der Pforte eingemauert ist, steht die schon etwas verwitterte Inschrift:
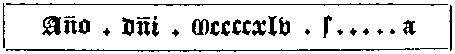
Das letzte Wort ist nicht mehr mit Sicherheit zu lesen. Jedoch ist so viel gewiß, daß nach der Jahrszahl, welche noch klar ist, der Thurm im J. 1445 gegründet ward.
An Mobiliar hat die Kirche noch einen aus dem 15. Jahrhundert stammenden geschnitzten Altar, welcher in der Mitte ein Marienbild, an jeder Seite derselben 6 Gruppen in ziemlich guter Arbeit hat.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 463 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Lage.
Die Kirche zu Lage, die einzige Merkwürdigkeit dieses Städtchens, ist in ihrer Art ein seltenes Bauwerk im Lande.
Sie besteht aus zwei ganz verschiedenen Theilen, Chor und Schiff, welche zu sehr verschiedenen Zeiten erbauet sind.
Der Chor bildet ein Oblongum mit grader Altarwand und hat 3 Fenster in der Altarwand und 2 Fensterpaare in jeder Seitenwand. Diese Fenster sind in der höchsten Entfaltung des Uebergangsstyls erbauet, eng, schräge eingehend, in der Wölbung leise gespitzt, mit Wülsten eingefaßt; sie sind zwar nicht in der Construction, aber in ihrer außerordentlichen Höhe ganz ungewöhnlich und vielleicht die einzigen Beispiele im Lande. Hiedurch zeichnet sich die Kirche zu Lage sehr aus. Da auch der Chor selbst für den Uebergangsstyl hoch ist und große Verhältnisse hat, so macht der Bau einen ungewöhnlichen Eindruck auf den Beschauer. Der Bau des Chors hat überhaupt viel Edles und Schönes; die zwei Gewölbe, mit starken Rippen, werden von Pilaster=Bündeln getragen, welche ungewöhnlich schöne Kapitäler von Laubwerk, auch mit Menschengesichtern, haben. Im Aeußern hat der Chor nur Lissenen, noch keine Strebepfeiler. Der Rundbogenfries fehlt schon, statt dessen steht eine umgekehrt treppenförmige Verzierung auf der Höhe der Mauer. Die Chorfenster sind an der Außenwand durch einen einfachen Mauerbogen zusammengefaßt. Nach allen diesen Erscheinungen ist der Chor der Kirche zu Lage eines der schönsten und edelsten, wenn auch jüngsten Werke aus der Zeit des Uebergangsstyls und wird noch vor der Mitte des 13. Jahrhunderts erbauet sein. Die Stadt Lage wird nach den bisherigen Nachrichten zuerst als Stadt bestimmt im J. 1270 genannt (vgl. Rudloff Urk. Lief. Nr. XXIII). Jedoch kommt schon im J. 1261 ein Pfarrer Johannes von Lage vor, neben und nach den Pfarrern von Röbel, Malchin und Schwaan (vgl. Lisch Mekl. Urk. I, S. 119); also stand damals gewiß schon die Stadt. Der Ort Lage, jedoch ohne weitere Beziehungen, wird schon im J. 1216 genannt (vgl. Lisch a. a. O. S. 15).
Das Schiff ist im ausgebildeten Spitzbogenstyle, also wohl im 14. Jahrh., erbauet. Es hat drei Gewölbe Länge, zwei Seitenschiffe, Strebepfeiler und einen kleeblattförmigen Fries, sonst nichts Ungewöhnliches oder Schönes; die Gewölbe fehlen ganz und sonst jede Erinnerung aus alter Zeit. Bei der Hinfälligkeit und Unsauberkeit des Mobiliars macht das Schiff keinen günstigen Eindruck.
Ueber der Pforte im Thurme sind zwei hellgrün glasurte kleine Reliefkacheln mit Heiligenbildern, wohl aus dem 15. Jahrhundert, eingemauert, auch eine seltene Erscheinung.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 464 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Teterow.
Die Kirche zu Teterow besteht aus zwei Theilen aus verschiedenen Bauperioden.
Der Chor ist ein sehr schöner Bau im Uebergangsstyle, wenn auch nicht in ungewöhnlichen Dimensionen aufgeführt. Er hat 3 Fenster in der graden Altarwand und 2 Fensterpaare in jeder Seitenwand. Die zwei Gewölbe ruhen auf Pilastern, welche Kapitaler mit sehr schönem Laubwerk haben. Sehr bemerkenswerth sind zwei mal 6 Nischen in den Seitenwänden des Chors. Die südliche Seitenwand unter dem ersten Gewölbe neben dem Altare hat über dem Fußboden neben einander 6 niedrige Nischen, welche schon im ersten Spitzbogen gewölbt sind und deren Bogen auf ganz kurzen Säulen ruhen, die eine sehr charakteristische, interessante Construction haben; die nördliche Seitenwand hat unter dem zweiten Gewölbe ebenfalls 6 ähnliche Nischen, welche jedoch nur aus schlichtem Mauerwerk construirt sind. Die südliche Pforte zum Chor ist mit hübschem Laubwerk verziert, jedoch verkalkt und von einem Vorbau verdeckt. Die Zeit der Erbauung des Chors dürfte in die Zeit kurz vor der Mitte des 13. Jahrh. fallen.
Das Schiff stammt aus jüngerer Zeit. Es hat 2 im 15. Jahrh. angebauete Seitenschiffe, welche sehr hoch hinaufgeführt sind und die ursprüngliche Construction des Mittelschiffes zum großen Theile vernichtet haben.
Der Hauptaltar ist ein ganz gutes Schnitzwerk aus einer guten Zeit des Mittelalters. Es zeigt die Maria und die 12 Apostel in ganzer Figur und unter diesen 17 Heilige in halber Figur; die Gewandung der Figuren ist sehr gut und besser als gewöhnlich.
Ein anderer, kleinerer Nebenaltar, welcher an einer Seitenwand befestigt ist, zeigt ein Marienbild und ist auch ziemlich gut.
Ein alter, großer Taufstein ("Fünte") aus Granit mit Verzierungen gehört zu den besten Arbeiten dieser Art im Lande.
In der Kirche liegen noch mehrere alte Leichensteine:
1) vor dem Altare liegt ein Stein mit dem Bilde eines consecrirenden Priesters in einer gothischen Nische; an den 4 Ecken stehen die Evangelisten= Symbole und zu den Füßen des Priesters lehnt ein Schild mit einem Vogel; die Umschrift lautet:


|
Seite 465 |




|
d. i.
(Anno domini MCCCLXXX obiit
dominus Gherardus Voghelzank, plebanus hujus
ecclesiae, cujus anima requiescat in pace.
Amen.)
Die Lücke nach der Jahreszahl ist nie ausgefüllt gewesen.
2) Im Schiffe liegt ein sehr abgetretener Leichenstein, von dessen Umschrift noch zu lesen ist:
d. i.
(Anno domini MCCCXCIX in profesto beatorum apostolorum Phi[lippi] et Jacobi (April. 30) obiit [Lut]ghart uxor Vickonis Rumpeshagen).
3) Im Chore liegt ein Leichenstein aus dem 15. - 16. Jahrh., jedoch sehr abgetreten. Er enthält rechts einen Schild mit drei gewässerten Querbalken und über demselben einen Helm mit 3 Pfauenfedern, wie es scheint, oder einem Vogelhalse mit Kopf zwischen 2 Federn, - links das von belowsche Wappen mit dem doppelten Adler. Darunter stehen die Namen:
| OTTO WOTZENITZ. | ELSE BELOW. |
Einige andere Leichensteine sind völlig abgetreten.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Jördenstorf.
Die Kirche ist im Uebergangsstyle gebauet.
Der Chor ist von Feldsteinen aufgeführt. In der geraden Altarwand stehen 3, in jeder Seitenwand 2 Fenster im Uebergangsstyl ohne alle Verzierung. Die Nischen sind unbestimmt, theils rundbogig, theils etwas gespitzt gewölbt. Im Innern ist der Chor mit Einem Gewölbe bedeckt, welches 8 Rippen hat, die oben in einem Kreise zusammen laufen (vgl. unten Wattmannshagen).
Das Schiff ist groß. Es hat an jeder Seite von Osten her zuerst 3 Fenster, dann eine Pforte, über welcher keine Fenster stehen, und dann wieder 2 Fenster. An den Ecken stehen Lissenen und unter dem Dache läuft ein einfacher Rundbogenfries umher, welcher durch den Thurm halb verdeckt ist. Die Hauptpforte ist spitzbogig, sehr einfach, von einem Wulst eingefaßt.


|
Seite 466 |




|
Der Thurm hat alle Oeffnungen, auch die ohne alle Verzierungen construirte Pforte, rund, ist zwar alt, jedoch nur Reminiscenz des Rundbogenstyls (vgl. Kapelle zu Levetzow).
Im Innern ist das Schiff mit Brettern gedeckt und hat nichts Bemerkenswerthes.
Von den Glocken sind die 2 größten neu; die kleinste ist mitten durch gesprungen und trägt die Inschrift:
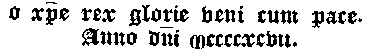
Neben dem Altare hängt das in Oel gemalte Brustbild des Predigers Joachim Grapius mit der Inschrift:
Pastor zu Jordensdorf
53 Jahr geb. zu Plau
anno. 1556. gest. anno.
16(1)2.
An den Kirchenstühlen vor dem Altare finden sich mehrere geschnitzte Wappen aus der Zeit von 1569, namentlich der von Blücher auf Sukow. Unter diesen ist auch das Wappen der Schmecker, deren Stammgut Wüstenfelde, in der Pfarre Jördenstorf, war. Das schmeckersche Wappen ist ein längs getheilter Schild: rechts im weißen Felde ein halber schwarzer Adler mit goldener Krone, goldenen Klauen und goldenem Ringe im Schnabel, - links im rothen Felde eine halbe blaue Lilie; auf dem Helme: auf einem Wappen: drei weiße Federn, auf einem andern Wappen zwei weiße Federn und dazwischen ein schwarzer Flügel; Helmdecken sind roth und weiß.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Schorrentin.
Die Kirche zu Schorrentin bei Neu=Kalen besteht aus zwei Theilen aus verschiedenen Bauperioden.
Der Chor ist im Uebergangsstyle gebauet, mit grader Altarwand, mit 3 von Wülsten eingefaßten Fenstern in derselben und mit 2 Fenstern an jeder Seite. In dem Giebel über der Altarwand stehen alle Steine im Zickzack, wie öfter in den Giebeln aus der Zeit des Rundbogenstyls. In der Spitze des Giebels steht eine große, flache Rosette in einem äußern Kreise, welcher aus der schmalen Seite der Mauersteine gebildet ist; die Rosette ist gebildet in der Mitte aus einem Knopfe, welcher


|
Seite 467 |




|
von 4 Dreiviertelkreisen gebildet ist, um welchen auf einem Kreise 8 nach innen geöffnete Dreiviertelkreise stehen.
Das Schiff ist im Spitzbogenstyle jüngerer Zeit aufgeführt und hat 2 Gewölbe Länge; die Gewölbe fehlen jedoch jetzt. An der Südwand ist folgende in Ziegelsteine eingegrabene Inschrift eingemauert, eine in Meklenburg seltene Erscheinung:
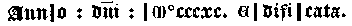
Das Schiff ist also im J. 1390 erbauet, zur Zeit, als Schorrentin schon ein Familiengut der von Lewetzow war.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Reinshagen,
ein sehr schönes Bauwerk im ernsten Spitzbogenstyl, ist in Jahrb. X, S. 310 flgd. beschrieben, und hat sich durch wiederholte Vergleichung mit den benachbarten Kirchen als ein seltenes Bauwerk bewährt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Wattmannshagen.
In Jahrb. X, S. 310 flgd. ist die Kirche zu Reinshagen als ein sehr schönes Bauwerk beschrieben. Die Kirche zu Wattmannshagen, deren Sprengel an den der Kirche zu Reinshagen grenzt, steht dieser in mancher Hinsicht sehr nahe und ist mit ihr vielfach verwandt, indem auch sie mehrere ausgezeichnete Einzelnheiten aus der schönsten Zeit des Spitzbogenstyls hat.
Der Chor ist im Uebergangsstyle ganz aus Granit aufgeführt, hat in der graden Altarwand 3 Fenster und in jeder Seitenwand ein Fenster im Uebergangsstyle und ist mit Einem Gewölbe bedeckt, welches 8 Rippen hat, die oben an einem Kreise zusammenstoßen, wie alle Gewölbe der Kirchen aus der Uebergangsperiode zwischen Sternberg und Schwaan (vgl. Jahrb. X, S. 309). Südlich führt zum Chor eine jetzt vermauerte Pforte im einfachen, ernsten Style.
Das Schiff mit dem innen zur Kirche gezogenen Thurmgebäude dagegen ist ein ausgezeichnet schöner Bau aus der besten Zeit des Spitzbogenstyls, wie der Bau der Kirche zu Reinshagen. Das Schiff hat einen Sockel von Granit und besonders schöne Ziegel; es hat noch keine Strebepfeiler, sondern nur Lissenen. Es ist zwei Gewölbe lang und hat an jeder Seite zwei schön construirte Fenster, welche in der Wölbung eine aus einem Vierblatt bestehende große Rosette tragen. An


|
Seite 468 |




|
der Südseite ist eine Pforte aus abwechselnd glasurten und nicht glasurten Ziegeln und mit geschmackvollen glasurten Kapitälern an den einfassenden Wulsten.
Das zur Kirche gezogene Thurmgebäude, welches früher auch gewölbt gewesen ist und an jeder Längsseite ein Fenster hat, ist vorzüglich schön ausgestattet. Die große Pforte in der Westwand ist schräge eingehend mit aus Ziegeln geformten 3 Wulsten eingefaßt, welche mit Weinlaub umwunden und mit Laubkapitälern geschmückt sind. Diese Thurmpforte, ganz glänzend und wie neu erhalten, ist eines der schönsten Denkmäler des Spitzbogenstyls und des Ziegelbaues im ganzen Lande und wahrhaft bewundernswerth; vielleicht hat es im Lande seines gleichen nicht. Ueber der Pforte hat der Thurm ein Rosenfenster, welches aus einem kleinen Kreise in der Mitte und 6 um diese gestellten Kreisen in einem großen umfassenden Kreise gebildet ist.
Die Giebel sind alle vielfach mit vertieften Gliederungen verziert.
Wahrscheinlich stammen diese trefflichen und seltenen Bauten aus der Zeit, wo die Familie Ketelhot das Gut Wattmannshagen besaß und in den J. 1277 und 1278 die Kirche so reich bedachte (vgl. Lisch Gesch. des Geschl. Hahn I, A, S. 33).
Von dem Mobiliar ist nichts bemerkenswerth, als etwa ein vor dem Altare liegender Leichenstein mit von oldenburgschen Wappen und der Inschrift:
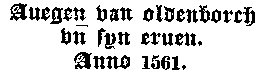
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Warnkenhagen
ist eine große Kirche mit einem hohen Thurmgebäude. Das Ganze hat den Charakter des Spitzbogenstyls. Der Chor hat 2 Gewölbe; das Schiff ist ebenfalls 2 Gewölbe lang, welche jedoch eingestürzt sind. Dann folgt der Thurm.
Der Chor ist freilich alt und hat noch Lissenen. Das Schiff ist jünger. Beim Bau des Schiffes und Thurmes ist jedoch der ganze Bau nach dem Spitzbogenstyl des 14. Jahrh. gemodelt. Am Chor sind noch einige Spuren des alten Uebergangsstyls, z. B. innen an den Gewölbeträgern, außen an einigen Thürwulsten; im Uebergangsstyle ist auch noch die Chorpforte erhalten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 469 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Belitz
ist ein großes ganz im schweren Spitzbogenstyle durchgeführtes Gebäude.
Der Chor ist dreiseitig, mit drei Gewölben bedeckt.
Das Schiff ist sehr hoch, drei Gewölbe lang, mit zwei Seitenschiffen, welche auf großen, kräftigen Bogen ruhen. Mittelschiff und Seitenschiffe sind nicht gewölbt.
Die ganze Kirche ist im Spitzbogenstyl durchgebauet.
In den Seitenschiffen stehen ein alter, sehr schöner, verzierter, großer Taufstein ("Fünte") aus Granit, etwas defect, ferner ein glatter Weihkessel von schöner Form und mehrere alte, aus Holz geschnitzte Heiligenbilder. Oben auf der Ostwand des südlichen Seitenschiffes, unter der Decke, sind 6 uralte, schon sehr vom Wurm zernagte, aus Holz geschnitzte Bildsäulen mit dem Fuße eingemauert, nämlich Christus, zwei weibliche Figuren, ein Ritter in altem, mittelalterlichen Harnisch mit Helm oder Hut, ein Ritter mit Panzerhemd und Sturmhaube und ein Geistlicher. Alle diese Bildsäulen sind sehr alt, stammen wahrscheinlich aus der Zeit der Gründung der Kirche und sind vielleicht die ältesten Holzsculpturen im Lande, freilich derbe und etwas plump, aber doch charakteristisch und wertvoll.
An der Südwand neben dem Altare steht ein aus Stein mit Bildhauerei gearbeitetes Epitaphium auf Mathias Schmecker auf Wüstenfelde, geb. 1531 † 1596, April 10, und dessen Gemahlin Hippolita von Dewitz, errichtet 1602, in der Art und Weise der saubern Epitaphien aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Unterschriften auf den zu beiden Seiten angebrachten Wappen der Ahnen stehen in folgender Ordnung.
| Schmecker. | | | | | Dewitz. | |
|
|
||||
| Hahn. | | | | | Arnim. | |
| Hahn. | | | | | Borken. | |
| Behr. | | | | | Bredow. | |
| Vieregge. | | | | | Wussow. | |
| Oertzen. | | | | | Plessen. | |
| Lehsten. | | | | | Osten. | |
|
|
||||
| Treskow. | | | | | Sparren. | |
Einige auf Glas gemalte Wappen aus dem 17. Jahrh. sind ohne Werth.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 470 |




|



|



|
|
:
|
Die Kapelle zu Lewetzow.
Die jetzige Kapelle zu Lewetzow bei Teterow ist ein mittelalterliches Gebäude einzig in seiner Art. Das Gut Lewetzow ist das Stammgnt der von Lowtzow, welche bis in das 16. Jahrh. von Lewetzow hießen (vgl. Jahrb. XI, S. 476 flgd.). Der Ritter Johann von Lewetzow auf Lewetzow hat im J. 1304 die Kirche zu Lewetzow erbauet und im J. 1305 die Stellen zweier Geistlichen an der Kirche dotirt; er hatte zugleich die Kirche wegen zu großer Entfernung von der Mutterkirche zu Jördenstorf zu einer Pfarrkirche erhoben und bewirkt, daß die Dörfer Lewetzow, Perow und Todendorf zu der neuen Pfarre gelegt wurden (vgl. Jahrb. XI, S. 478). Die Kirche ist also ohne Zweifel im J. 1304, in der Zeit des Spitzbogenstyls, neu aufgebauet, und doch sind viele Eigenthümlichkeiten des Rundbogenstyls nachgeahmt, eine Eigenthümlichkeit, die sich sonst schwerlich weiter in Meklenburg findet.
Die Kirche ist ein einfaches Oblongum mit gerader Altarwand. In der Altarwand sind 3, in jeder Seitenwand 4 Fenster. Alle Fenster, eben so alle Nischen, sind im einfachen Rundbogen gewölbt. Nur die Seitenpforte und die Pforte nach der Seite des hölzernen Thurmes hin sind im Spitzbogen aus dem Anfange des 14. Jahrh. gewölbt.
Vor der südlichen Seitenpforte ist eine Vorhalle und an die nördliche Seitenwand ist die Begräbnißkapelle der von Lowtzow angebauet. In den Giebeln beider Anbaue stehen zwei Wappen in Relief aus gebranntem Thon mit den Unterschriften:
| IOCHIM LOVWTZOW. |
MARGARETA
WINTTERFELTZ.
ANNO 1604. |
Dieselben Wappen finden sich auch im Innern der Kirche in Farben gemalt.
Die kleine Glocke stammt ohne Zweifel aus der Zeit der Erbauung der Kirche: sie führt die Inschrift:
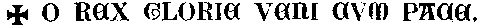
Die große Glocke ist vom J. 1738.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Die Kirche zu Thürkow
die Kirche zu Polchow
sind im Spitzbogenstyl gebaut und haben nichts Bemerkenswerthes im Bau. Zwar wird das Gut Polchow schon 1216 und die Kirche zu Polchow schon 1228 genannt (vgl. Lisch Mekl. Urk. I,


|
Seite 471 |




|
S. 15 und 42); aber von Bauten aus diesen Zeiten ist keine Spur mehr vorhanden
Die Kirche zu Boddin
ist so modernisirt, daß von dem alten Baustyl keine Spur mehr übrig ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Dargun.
Bei Gelegenheit einer im Junii 1846 vorgenommenen Untersuchung der hahnschen Leichensteine in der Kirche zu Dargun sind noch einige antiquarische Entdeckungen gemacht, deren Aufzeichnung hier Raum finden möge.
Die Glocken, welche früher nichtuntersucht waren, haben bei einer Besichtigung kein Resultat gegeben. Die beiden größten Glocken sind zwar alt, aber ohne alle Inschriften. Die kleinste Glocke hat die gewöhnliche Inschrift:
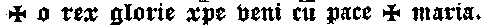
Von den Wappen in den gemalten Fenstern sind außer den in Jahrb. VI, S. 93, aufgeführten Wappen noch erkannt:
1) in einem nördlichen Fenster das Wappen der von Grabow: ein gelber Schild mit einem hellrothen Schrägebalken, auf welchem 3 sechsstrahlige gelbe Sterne stehen. In der runden Einfassung stehen die Worte:
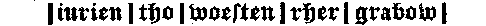
Die Worte sind ohne Zweifel, vielleicht bei einer neuen Verbleiung der Fenster in jüngerer Zeit versetzt und müssen so gestellt werden:
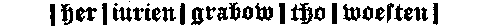
In dem Verzeichnisse der Wohltäter des Klosters (Jahresber. III, S. 178) zur Zeit der Verfertigung der Fenster werden genannt: her Jürgen Grabow tho Gamelow und Matthias Grabow tho Wusten. Das Gut Woosten bei Goldberg war das alte Stammlehn der Grabow; daher ist wohl dieses auch bei dem Ritter Jürgen Grabow genannt oder die Umfassung auch von zwei alten Wappen zusammengesucht.
2) in dem nördlichen Fenster über der Pforte steht das Wappen der von Lehsten: ein schwarzer Leisten zwischen zwei schwarzen Flügeln im weißen Schilde; die Umschrift ist nicht zu lesen, da das Wappen sehr hoch sitzt. In dem Verzeichnisse der


|
Seite 472 |




|
Wohlthäter werden Achim und Ulrik van Lesten tho Gottin genannt.
3) in dem südlichen Chorfenster neben dem Heiligenbrustbilde (Jahresber. VI, S. 93, Nr. 10) ward in den zwei Wappen mit dem weißen Schilde mit drei rothen Rosen das Wappen der von Kardorff: drei rothe, mit schwarzen Umrissen gezeichnete Richträder ("wettrade"), mit Spitzen auf den Felgen, durch ein Fernrohr erkannt, eine ausgezeichnet schöne Arbeit, von welcher Zeichnung genommen ist und welche Erhaltung verdient. Das ebenfalls ausgezeichnete Wappen der von Kardorff in einem nördlichen Chorfenster (Jahresber. a. a. Nr. 8) ist etwas jünger.
Auf dem Altare liegt ein großer Leichenstein, ohne alle bildliche Darstellung, nur mit der am Rande umherlaufenden Inschrift:
Die hahnschen Leichensteine konnten nach Hebung der Kirchenstühle, wenn auch mit Schwierigkeit, gelesen werden.
1) Der in Jahrb. VI, S. 98, Nr. 9, erwähnte Leichenstein, welcher auf dem Schilde der Frau einen Querbalken mit drei Rosen führt, hat zur Umschrift:
2) Der in Jahrb. VI, S. 98, Nr. 10, erwähnte Leichenstein, welcher auf dem Schilde drei Pfriemen (nicht drei Spitzen, also nicht das rohrsche Wappen) führt, hat zur Umschrift:
Die letzte Zeile steht im Felde unter der ersten Zeile.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 473 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirchen zu Ribnitz.
Die Stadtkirche.
Die Stadtkirche zu Ribnitz ist für die Geschichte der Stadt von großem Interesse, so schmucklos sie auch sein mag. Nach Rudloff M. G. II, S. 56, und v. Kamptz M. C. R. I, 1, S. 214, soll die Stadt im Jahre 1271 gegründet sein. Es wäre aber höchst auffallend, wenn ein in einer so wichtigen, schönen und günstigen Gegend liegender Ort so spät zur Stadt erhoben sein sollte. Das Privilegium des Fürsten Waldemar von Rostock vom J. 1271, die bisher bekannte älteste Urkunde der Stadt, kann daher nur eine Bestätigung und Erneuerung der alten Stadtprivilegien sein.
Der Ort ist, wie schon sein Name (Ribenitz=Fischort, Jahrb. VI, S. 53) andeutet, ein alter wendischer Ort. Schon im J. 1192 hatte der Fürst Borwin dem Kloster Doberan den Ort Rybenitz geschenkt (vgl. Franck A. und N. M. III, S. 221). Wie das Kloster um den Besitz gekommen sei, ist nicht bekannt. Jedoch schon im J. 1257 berichtet der Rath der Stadt Rostock an den Rath der Stadt Lübeck, daß sich die Bürger von Ribnitz (burgenses de Rybeniz) des lübischen Rechts bedienten 1 ) (vgl. Urk. Buch der Stadt Lübeck I, S. 220). Die Stadt ist also viel älter, als bisher angenommen ist und wahrscheinlich bald nach Rostock gegründet; und hiefür stimmt auch der Bau der Kirche.
Die Kirche besteht aus zwei ganz verschiedenen
Theilen. Die westliche Hälfte ist die alte
Kirche. Diese hat glatte Wände, dünne Lissenen
oder Wandstreifen an den 4 Ecken und einen aus
Halbkreisen gebildeten Fries des Rundbogenstyls;
es fehlen ihr Granitsockel und Strebepfeiler,
die gewöhnlichen Begleiter des Spitzbogenstyls.
An der nördlichen Wand ist noch die
Beschaffenheit der alten Fenster zu erkennen:
klein und schmal und im Uebergangsstyl fast
unmerklich zugespitzt; es standen immer zwei
Fenster zusammen, so daß die alte Kirche, nach
dem Styl der Rundbogenkirchen, an jeder Seite 3
Fensterpaare, im Ganzen also 12 Fenster gehabt
hat. In spätern Zeiten sind die Scheidungen
ausgebrochen und aus zwei Fenstern ist eines
gemacht. Die Kirche ist also in dem strengen
Style des Ueberganges vom Rundbogen zum
Spitzbogen gebauet, wie z. B. die Kirche zu
Neukloster, der Dom zu Güstrow
 ., und es wird die Erbauung
ungefähr in die Zeit 1220-1230 fallen. Die alte
Altartribune ist bei der Erweiterung der Kirche abgebrochen.
., und es wird die Erbauung
ungefähr in die Zeit 1220-1230 fallen. Die alte
Altartribune ist bei der Erweiterung der Kirche abgebrochen.


|
Seite 474 |




|
Die östliche Hälfte der Kirche ist nämlich ein jüngerer Bau. Als die Gemeinde wuchs und die Kirche zu klein ward, brach man die alte, gewiß nur kleine Altartribune ab und bauete im Osten einen Chor an, von der Größe der alten Kirche, welche dadurch Schiff ward. Dieser östliche Theil ist nun im Spitzbogenstyl gebauet und ohne Zweifel im 14. Jahrh. aufgeführt. Die Art der Ausführung hat viel Ähnlichkeit mit der rostocker Marienkirche namentlich darin, daß in den Oeffnungen glatte, glasurte Ziegel mit unglasurten wechseln.
Die ganze Kirche ist ein langes Oblongum, ohne Pfeiler und Seitenschiffe. Sie war früher gewölbt; bei dem großen Brande im J. 1445 (vgl. unten Rechtsalterth.) sind aber sämmtliche Gewölbe eingestürzt und die Kirche ist seitdem mit einer Balkendecke geschlossen. Uebrigens ist die Kirche im Innern verfallen und besitzt nichts Merkwürdiges.
Der im Westen angebauete Thurm ist noch jungem Ursprunges, als der Chor der Kirche, und hat viel Aehnlichkeit mit einem eigenthümlichen, interessanten alten Thorthurm, welcher leider überkalkt ist.
Die Klosterkirche.
Die Klosterkirche, welche erst in den nächsten Jahren nach der Stiftung des Klosters im J. 1324 erbauet sein kann, ist ein einfaches Oblongum ohne Seitenschiffe, im Spitzbogenstyl, ein gewöhnlicher, unansehnlicher Bau, ohne weitere Merkwürdigkeit, als daß etwa die Strebepfeiler in der Kirche liegen, wie in der Kirche zu Hohenkirchen (vgl. Jahresber. VIII, S. 148). Der Thurm ist aus der westlichen Giebelwand heraus modellirt, wie an der Kirche zu Tempzin (vgl. Jahresber. III, S. 156). Bei der in den letzten Jahren grade nicht mit Geschmack ausgeführten Restauration ist sämmtliches altes Mobiliar ausgeräumt. Das einzige Bemerkenswerthe in der Kirche ist das aus Sandstein im J. 1590 ausgeführte Epitaphium auf die Herzogin Ursula von Meklenburg, geb. 1510 † 1586, die letzte Aebtissin des Klosters, mit ihrem liegenden, lebensgroßen Bilde und ihrem Stammbaume an der Wand, in dem monumentalen Geiste jener Zeit. Vor dem Altare liegt ihr Leichenstein mit Inschrift und Wappen und mit den Schilden für Meklenburg, Rostock, Stargard und Werle in den Ecken. -Die nächste, etwas erhöhete Umgebung der Kirche, wo einst eine Burg des Fürsten Heinrich des Löwen von Meklenburg stand, hat ebenfalls nichts Bemerkenswerthes, wie überhaupt alle Klostergebäude neu sind.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 475 |




|



|



|
|
:
|
Kirche zu Lübz.
Bei der Restaurirung des fürstlichen Epitaphiums in der Kirche zu Lübz in den J. 1846- 1847 und der Legung eines neuen Leichensteines auf das Grab der Herzogin Sophie ist das Epitaphium von aller Umhüllung befreiet.
Das im Jahresber. VIII, S. 135 beschriebene Epitaphium enthält drei durch Säulen abgetrennte Räume, von denen jedoch nur der mittlere und der für den Beschauer links daneben befindliche Raum mit Bildsäulen ausgefüllt, der Raum rechts aber leer ist. Auf dem Unterbau für die Statuen stehen folgende drei Inschriften:
1) in der Mitte:
GEBOREN A. MDLXIX VND HERTZOG HANSEN ZU
MECKLENBURG A. MDLXXXVIII VERMÄHLET,
HAT MIT S. F. G. GEZEUGET H. ADOLPH FRIEDRICHN,
H. HANS ALBRECHTN VND FREWLIN ANNAM
SOPHIAM, AUCH IHRE STERBLICHEIT WISSEND
DIS MONUMENTUM A. MDCXXXIV IHR SELBST
SETZEN LASSEN, IST SEELIGLICHEN IN GOTT ENT
SCHLAFFEN A. MDCXXXIIII, DEN XIV NOUEMBRIS.
2) zur linken:
FREWLIN ZU MECKLENBURG
H. HANSEN ZU MECKLENBURG TOCHTER
IST GEBOREN A. MDXCI
VND SEELIGLICH IN GOTT
ENTSCHLAFFEN
A. MDC
CHRISTUS IST MEIN LEBEN,
STERBEN IST MEIN GEWIN.
3) zur rechten:
FREWLIN ZU MECKLENBURG
H. ADOLPH FRIEDERICHEN TOCHTERLIN
IST GEBOREN A. M. DCXXX
VND IN GOTT ENTSCHLAFFEN
A. MDCXXXI.
DER GERECHTEN SEELEN SEIN IN
GOTTES HAND VND KEINE QUALE
RUHRET SIE AN.


|
Seite 476 |




|
ad 1. Aus dieser Inschrift ergiebt sich, daß die Herzogin Sophia diese ihre Bildsäule noch bei ihrem Leben, und zwar in ihrem Todesjahre, selbst setzen ließ. Der Schluß der Inschrift ist also nach ihrem Tode nachgetragen. Nach den Acten starb die Fürstin am 14. Nov. 1634, Nachts 1/2 1 Uhr, und ward am 14. Jan. 1635 zu Lübz begraben. Viele ältere Einwohner der Stadt Lübz versichern, die Bildsäule habe früher ein Bund Schlüssel in den gefaltenen Händen gehalten; hieran knüpft sich die Sage, die ungewöhnlich kräftige, wirtschaftliche und auch heftige Fürstin habe einmal ihre Tochter mit einem Bund Schlüssel, welches sie stets zu tragen gewohnt gewesen, im Zorne an den Kopf geschlagen, wovon diese stumpfsinnig geworden sei.
ad 2. Die Bildsäule der Prinzessin Anna Sophia, Tochter der Herzogin Sophia, ist ohne Zweifel zugleich mit der Bildsäule ihrer Mutter gesetzt, als die Prinzessin ungefähr 42 Jahre alt war. Sie starb im J. 1648 zu Rehna, wo sie nach dem Tode der Mutter ihren Wohnsitz hatte und ward im Dome zu Schwerin beigesetzt; daher ist in der Inschrifttafel ihr Todesjahr nicht ausgefüllt, da man nach so langer und so schwerer Zeit die Inschrift wohl vergessen hatte. Bei der Restaurirung der H. Bluts=Kapelle im Dome zu Schwerin im J. 1844 und der Umsargung der in der Gruft ruhenden Fürsten fand sich die Leiche der Prinzessin Anna Sophia nicht in dieser Hauptgruft. Sie ward jedoch nach einigem Forschen in der Gruft des Herzogs Christoph unter dessen Bildsäule gefunden. Hier steht in einem ausgemauerten unterirdischen Gemache neben dem zinnernen Sarge des Herzog Christoph, dessen hölzerne Umhüllung gänzlich zerfallen ist, der wohl erhaltene hölzerne Sarg der Prinzessin Anna Sophia, mit rothem Sammet und Goldtressen überzogen, mit der Inschrift:
H. Z. M. F.
ANNO
1648.
ad 3. Die dritte Inschrift rechts redet von dem Tode der Prinzessin Hedwig, des Herzogs Adolph Friederich Töchterlein. Die Prinzessin ward während des Exils des Herzogs Adolph Friedrich I. am 11. August 1630, zu Lübeck, wo sich der Fürst nach dem Abzuge Wallensteins aufhielt, geboren und hier am 12. Septbr. d. J. getauft. Die Großmutter, welche seit der Uebersiedelung ihrer Söhne nach Lübeck mit diesen in größerm persönlichen Verkehr stand, nahm das Kind zu sich. Sie mußte


|
Seite 477 |




|
es aber schon nach 3/4 Jahren, am 17. Mai 1631, sterben sehen. In der Gruft der Heil. Bluts=Kapelle steht unter den Leichen der 5 letzten, jung gestorbenen Kinder des Herzogs Adolph Friedrich der Sarg der Prinzessin Hedwig nicht. Die Herzogin Sophie trug sie zu Lübz zu Grabe; aber auch hier ist keine andere Stelle für die Leiche zu finden, als in dem Unterbau des Monumentes selbst. Die Herzogin Sophia schreibt an ihren Sohn über das Begräbniß seiner Tochter an deren Sterbetage:
"Weil nun diese schwürige läufften grosse begangnussen schwerlich zugeben werden, alß weren wir woll gemeinett, da D. L. damit einigk, irgentt nach verfliessung einß Monateß den todten Corper in vnser neu hieselbesten erbauten begrebnuß bestetigen vnd mit christlichen Ceremonien ohne weitleufftigkeit hinsetzen zu lassen, D. L., dero hertzliebe Gemahlin vnd andere doch leider der begrebnuß nicht beywohnen konnen".
Die Eltern
"stellten es zu der Herzogin gefelligen disposition, weil sie mit der leichbegengnuß bey ihrem bekandten Zustande jetzo nichts anordnen konnten".
Nach diesen Worten ist die Begräbnißstätte der Prinzessin Hedwig nur in dem Unterbau des Epitaphiums hinter dem Altare zu suchen, da die Herzogin selbst in einem von Ziegelsteinen in der Erde ausgemauerten, gewöhnlichen Begräbnisse vor dem Altare ruht. Zugleich ergiebt sich aus diesen Worten, daß der architektonische Bau des Epitaphiums schon im J. 1631 fertig war, nach den Worten der Inschrift aber die Bildsäule der Herzogin Sophia erst im J. 1634 hineingesetzt ward. Vielleicht ward die Bildsäule der Prinzessin Anna Sophia zuerst fertig.
G. C. F. Lisch.
Ueber den Altar in der Kirche zu Wittenburg,
aus der Zeit 1257-1284, vgl. man oben Alterthümer des Mittelalters, Gläserne Reliquien=Urne von Wittenburg, S. 448.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 478 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Kirchen=Rosin.
Da das Dorf Kirchen=Rosin seit dem J. 1229 der Sitz der Verwaltung des auswärtigen Klosters Michaelstein war, indem daselbst ein Hofmeister und ein Pfarrer wohnten, so ließ sich annehmen, daß die Kirche sowohl durch Alter, als durch Kunst sich auszeichnen konnte. Bei Gelegenheit der Erforschung des Burgwalles von Bisdede bei Bölkow untersuchte ich auch die Kirche zu Rosin, fand aber nichts von Bedeutung.
Die kleine Kirche ist ein einfaches Oblongum ohne alle Gliederung und ohne allen Schmuck; sie hat in der graden Altarwand 3 und an jeder Seitenwand 3 Fenster im einfachen Spitzbogenstyl der ältern Zeit, wie die eben so construirten Pforten. Das Ganze ist höchst unbedeutend.
Der Altar ist ein schlechtes Schnitzwerk aus dem 15. Jahrh. mit einem Marienbilde.
Von einigem Interesse sind nur die Glocken:
1) Die große Glocke soll in die katholische Kirche zu Ludwigslust versetzt sein, wie eine Glocke von Techentin.
2) Die zweite Glocke hat folgende Inschrift auf dem Helme:
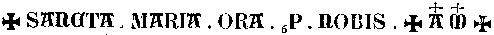
3) Die dritte, kleinste Glocke hat die Inschrift:
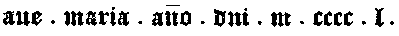
und darunter ein Gießerzeichen. An der Mündung sind 2 Bracteaten abgegossen, 1 großer und 1 kleiner, beide mit strahligem Rande; auf dem kleinern ist der lübecker Adler erkennbar.
Von Gebäuden des Klosterhofes zu Rosin ist keine andere Spur mehr vorhanden, als daß das Erbpachtgehöft Nr. 1, der ehemalige Hof Rosin, an einem See liegt und an den übrigen Seiten von einer Sumpfwiese umgeben ist, in welcher noch Spuren von einem Graben erkennbar sind.
Der Hof des Klosters Michaelstein in der Stadt Güstrow, welcher hier am Ziegenmarkte lag (vgl. S. 13), ist wahrscheinlich das große, unten in der Mühlenstraße rechts vom Markte aus liegende, im hohen Spitzbogenstyle erbaute Haus; es liegt zwar nicht unmittelbar am Ziegenmarkt, aber doch am Ende desselben, im Anfange der Mühlenstraße. Das Haus rechts daneben mit alten massiven Giebeln ist wahrscheinlich ein ehemals dazu gehöriger Kornspeicher. Dieser Hof reicht hinterwärts bis an die Holtstraße hindurch. Vielleicht bauete diese Gebäude das Kloster Doberan nach dem Ankauf der rosinschen Güter. Uebrigens ist dieses Haus das einzige mittelalterliche und für die Geschichte der Baukunst beachtenswerthe Privatgebäude in Güstrow.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 479 |




|



|



|
|
:
|
Die Grabplatten in Messingschnitt.
Bekanntlich besitzt der Dom zu Schwerin zwei große, geschnittene Messingplatten auf den Gräbern der vier Bischöfe aus dem Hause von Bülow, welche am Ende des Jahres 1845 aufgenommen und in einer Seitencapelle aufgerichtet sind. Die kleinere Platte auf den Gräbern der Bischöfe Gottfried († 1314) und Ludolph († 1339) ist in dem ernstern Style der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, die größere Platte auf den Gräbern der Bischöfe Heinrich († 1347) und Friederich († 1375) in dem vollen Reichthume und dem höchsten Aufschwunge des Spitzbogenstyles in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gearbeitet. Beide Platten aber sind ungewöhnlich groß, da sie Doppelplatten sind, und wahrscheinlich die schönsten in Norddeutschland, sowohl durch Geist, als durch Arbeit. Aber mehr Platten dieser Art besitzt Meklenburg auch nicht.
Erst in neuem Zeiten ist die Aufmerksamkeit auf diese wunderbaren Kunstwerke gelenkt. Es sind Messingplatten, auf dessen polirter Fläche die darzustellenden Gegenstände mit mehr oder minder starken Umrissen eingegraben und in glatter Fläche stehen blieben, der Grund dagegen bis zu einer gewissen Tiefe durch Schaben oder Graben vertieft, das Darzustellende also durch Aussparen zur Anschauung gebracht ward. Das Verfahren bei diesem Messingschnitt ist also wesentlich dem Verfahren beim Holzschnitt gleich, nur daß bei den Messingplatten die Bearbeitung des Grundes, weil er ganz sichtbar blieb, mehr Sorgfalt erforderte, wenn er auch nicht ganz eben gearbeitet ward. Sotzmann hat in seiner Aeltesten Geschichte der Xylographie und der Druckkunst in v. Raumer's Histor. Taschenbuch VIII, 1837, S. 490 flgd. diese Arbeit zur Betrachtung gezogen und sie nach Plinius Vorgange opus interrasile genannt, da sie schon den Alten bekannt war. Theils um die wenn auch geringe Unebenheit des Grundes zu verdecken, theils um die ausgesparten Figuren und Ornamente durch den Gegensatz mehr hervorzuheben, dieselben auch vor der Zerstörung durch Fußtritte mehr zu sichern, pflegte man den vertieften Grund mit einem schwarzen oder bunten Kitt auszufüllen, welcher jetzt meistentheils durch das Alter zerstört ist. Und so ward dieser Messingschnitt gewissermaßen mit einer Art Niellirung verbunden. Diese Ausfüllung der gravirten Vertiefungen der Grabplatten war überhaupt vom 13. bis in das 16. Jahrh. Mode. So wurden auch auf den steinernen Grabplatten, auf denen die darzustellenden Gegenstände durch bloßes Eingraben der Umrisse, die Buchstaben mitunter nur durch Eingrabung der Züge zur An=


|
Seite 480 |




|
schauung gebracht wurden, die Vertiefungen mit einem schwarzen Kitt von Pech und Kalk ausgefüllt; ja es giebt im Dome zu Schwerin einen sehr alten, ganz abgetretenen Leichenstein, auf welchem die Vertiefungen mit einem farbigen Kitt, in roth, blau und grün, ausgefüllt sind.
Dieser Messingschnitt oder das opus interrasile
unterscheidet sich wesentlich von den bloß
gravirten Messing=, auch wohl Kupferplatten,
welche sich in den norddeutschen Ländern aus dem
Mittelalter sehr häufig finden. Auf diesen sind
die darzustellenden Gegenstände, wie auf andern
Grabsteinen, nur durch die eingegrabenen Umrisse
dargestellt und der ganze Grund, mit Ausnahme
dieser Umrisse, ist stehen geblieben. Dieses
Verfahren ist also wesentlich das beim
Kupferstiche angewandte. Man findet seltener
ganze Platten dieser Art; gewöhnlich sind es nur
die durch Zeichnung sich hervorhebenden Theile
des Leichensteins, wie Figur, Wappen,
Evangelisten=Symbole, Inschrift
 ., welche ausgeschnitten, gravirt
und auf dem Leichensteine befestigt wurden. -
Hiebei ist aber zu bemerken, daß auch die
Grabplatten in Messingschnitt auf einen Stein
gelegt wurden.
., welche ausgeschnitten, gravirt
und auf dem Leichensteine befestigt wurden. -
Hiebei ist aber zu bemerken, daß auch die
Grabplatten in Messingschnitt auf einen Stein
gelegt wurden.
Diese Grabplatten in Messingschnitt sind vorzugsweise über die nördlichen Länder verbreitet und enthalten gewöhnlich die Figur des Verstorbenen in Lebensgröße in einer sehr reich und auch im Kleinsten sorgfältig gearbeiteten Nische, welche allen Reichthum des ausgebildeten Spitzbogens und die ganze Symbolisirung der christlichen Kirche, je nach den Beziehungen zu dem Verstorbenen, enthält. Vorzüglich reich ist Lübeck an solchen Platten in Messingschnitt; ich habe einmal an zwölf derselben in den verschiedenen Kirchen zusammengezählt. Es scheint, als wenn sie in Lübeck gemacht, oder durch Lübeck vielleicht in England bestellt und eingeführt wurden, da nach Sotzmann a. a. O. S. 492 England deren mehr als 100 besitzen soll. Der Styl erinnert allerdings an Gegenden, in welchen der Spitzbogenbau zu einer reichern Entwickelung gelangte, als der einfachere Ziegelbau in den norddeutschen Ländern.
Von allen Platten im nördlichen Deutschland sind die schweriner die schönsten; der Styl derselben ist edler und reicher, als z. B. der aller lübecker, auch der Platte auf dem Grabe des dänischen Königs Erich Menved, in Antiq. Ann. III abgebildet. Nur eine Platte kommt den schwerinern gleich, nämlich die stralsunder.
Pommern besitzt nur Eine Platte dieser Art. In einer Kapelle der Nicolaikirche zu Stralsund steht, jetzt an der Wand aufgerichtet, eine solche Platte, welche Kugler in seiner Pommerschen Kunstgeschichte, Balt. Studien, VIII, 1, 1840,


|
Seite 481 |




|
S. 179, "ein höchst vorzügliches Meisterwerk und eine der vorzüglichsten Zierden der Stadt" nennt. Kugler irrt jedoch wesentlich, wenn er sagt, daß die Platte eine "Bronzeplatte" sei, auf welcher die "Darstellungen in einfacher Weise durch eingegrabene "Umrißlinien bezeichnet" seien. In der Regel sind aber wohl alle diese Platten, die bekannten alle, aus Messing, da Bronze für den Zweck zu weich sein würde, und in dem Ausgraben des Grundes, wodurch grade die Bezeichnung der Umrisse durch vertiefte Linien verschwindet, liegt eben die Eigenthümlichkeit der in Messing geschnittenen Grabplatten. Bloß gravirte Messing= oder Kupferplatten (?), welche ganz grün oxydirt sind, besitzt die Nicolaikirche zu Stralsund mehrere, welche sich auf den ersten Blick durch ihre Flachheit wesentlich von der in Messing geschnittenen Platte unterscheiden.
Die stralsunder Grabplatte in Messingschnitt gehört dem Grabe des im J. 1357 gestorbenen stralsundischen Burgemeisters Albert Hövener (1341 † 1357, vgl. Brandenburg Gesch. des Magistrats der Stadt Stralsund, S. 82, zum J. 1328) und ist aus einem andern Grunde im höchsten Grade wichtig. Sie ist nämlich, nach genauer persönlicher Vergleichung, den schweriner Platten, wenigstens der jüngern derselben, in jeder Hinsicht, sowohl im Styl, als auch in der Architectur und den Ornamenten, auch in der Arbeit völlig ähnlich, selbst die Gesichtszüge der dargestellten Personen sind gleich.
Zwischen der stralsunder und der jüngern schweriner Platte liegt nur ein Zeitraum von 18 Jahren, vielleicht nicht so viel, wenn die stralsunder Platte spät, die schweriner gleich nach dem Tode dessen, den sie verherrlichen sollte, bestellt ward. Es ist also wahrscheinlich, daß beide Platten von demselben Meister oder in derselben Werkstätte verfertigt wurden. Für die künftige Bearbeitung dieser Kunstwerke diese Ansicht hier niederzulegen, ist der Hauptzweck dieser Zeilen. Die künftige Forschung wird sich zunächst vorzüglich mit den Platten in Schwerin und Stralsund und dann mit den Platten in Lübeck beschäftigen müssen. Außer dem bedeutenden Interesse für die Kunst gewähren diese Platten auch noch Stoff für manche andere Untersuchung, z. B. für die Musik, indem auf den Platten mittelalterliche Musikanten aller Art dargestellt sind.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 482 |




|



|



|
|
:
|
3. Neuere Zeit.
Ueber die Thon=Reliefarbeiten des 16. Jahrh.
Besonders charakteristisch für die Kunstbildung des 16.Jahrh. sind Reliefarbeiten aller Art, welche sich zu einer hohen Vollkommenheit ausbildeten und zu einem unverkennbaren Styl gelangten. Während im Süden unzählige kleinere Medaillons theils geschnitten, theils bossirt und darauf in Metall gegossen wurden, Kunstarbeiten, welche im Norden Deutschlands fast ganz fehlen, gingen hier sehr viele große Medaillons und andere Reliefarbeiten aus gebranntem Thon, dem unvergleichlichen Baumaterial der norddeutschen Länder, zur Verzierung der Ziegelgebäude aus den Händen tüchtiger Künstler hervor. Besonders blühete diese Kunst in Meklenburg unter den hochgebildeten herzoglichen Brüdern Johann Albrecht I., Ulrich und Christoph in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., nachdem schon in der ersten Hälfte dieses Jahrh. unter den Herzogen Heinrich dem Friedfertigen und Albrecht dem Schönen häufig Vorarbeiten zur Ausbildung dieses Kunstzweiges zu bemerken sind.
Besonders scheint in Norddeutschland Meklenburg die Heimath dieses Kunstbetriebes gewesen zu sein. Vergleichungen fördern die Erkenntniß am meisten, und daher mag denn ein Blick auf die Nachbarländer die eigenthümliche künstlerische Stellung Meklenburgs in den Bauten während des 16. Jahrh. befestigen helfen.
In Meklenburg sind bekanntlich die Schlösser zu Wismar, Schwerin und Gadebusch ganz mit diesen Thonreliefs bedeckt und es sind hier Tausende von Stücken nicht unbedeutenden Werthes vorhanden. Nach sorgfältigen Beobachtungen bemalte man auch diese Reliefs: man färbte oft den vertieften Grund blau und vergoldete die Reliefs. Außerdem finden sich an einzelnen Gebäuden, z. B. an der Burg zu Ulrichshusen bei Malchin, und im Bauschutt bei Neubauten noch überall häufig Fragmente solcher Thonbildungen. Auch die Ofenkacheln wurden mit Reliefbildern geschmückt und in allen Farben glasurt, und es finden sich oft große Massen sehr schöner Kacheln beim Graben. In Meklenburg ist dies bekannt und sehr verbreitet.
In Pommern finden sich nach Kuglers Beobachtungen nur 5 Stücke an einem Hause zu Stralsund in der Battin=


|
Seite 483 |




|
macherstraße mit der Jahrszahl 1568; vgl. Kugler's Pommersche Kunstgeschichte S. 161 u. 231. Kugler erhebt diese Stücke ungemein, indem er sagt: "Der Styl dieser Arbeiten gehört der Weise der italienischen Kunst an; die Motive der Schule Raphaels erscheinen in ihr, und zwar auf sehr tüchtige und erfreuliche Weise nachgebildet". - Ich habe diese Stücke persönlich verglichen, finde aber, daß sie den meklenburgischen Arbeiten bei weitem nachstehen; namentlich fehlt ihnen eine gewisse Harmonie und das was man Vollendung eines Styls nennt.
In Holstein habe ich dergleichen gar nicht bemerkt. In der Sammlung vaterländischer Alterthümer zu Kiel wurden mir zwei große Stücke mit allerlei symbolischen Darstellungen als etwas ganz Ungewöhnliches gezeigt. Im Zweiten Bericht der königl. Gesellschaft für Sammlung vaterländ. Alterth. 1837, S. 35, nach welchem diese Stücke inmitten einer dicken Mauer gefunden wurden, ist über solche Ornamente nichts weiter gesagt.
Auf Seeland sind die vielen Schlösser jünger, als die Periode der Relief=Verzierungen. Nur an der ganz aus Sandstein unter dem Könige Friederich II., dem Schwiegersohne des Herzogs Ulrich von Meklenburg, erbauten Kronenburg bei Helsingör hat sich durch die Königin Sophie der Einfluß meklenburgischer Bauweise geltend gemacht, indem sich an diesem Schlosse einige in Stein gehauene Medaillons mit Portraits, andere mit dem bekannten verschlungenen Namenszuge FS (= Friederich und Sophie) finden.
In dem benachbarten Lübeck findet sich außerhalb Meklenburg noch am meisten von dieser Art Kunst. Jedoch ist manches älter, vieles jünger, als die Blüthenzeit des Thonreliefs, die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Häuser in der Wahmstraße sind von dem Baumeister erbauet, welcher den Fürstenhof zu Wismar der Vollendung nahe brachte (vgl. Jahrb. X, S. 320) und dann nach Lübeck zog.
Es scheint also, als wenn sich die Kunst des Thonreliefs vorzüglich in Meklenburg seit dem J. 1554 und zwar durch niederdeutsche Baumeister, namentlich durch Gabriel von Achen (vgl. Jahrb. V, S. 20 flgd.), welcher geschickte Former und Steinbrenner, wie Statius von Düren, ins Land zog, unter Beförderung des Herzogs Johann Albrecht I. ausbildete und von hier aus vorzüglichen Aufschwung nahm. So viel ist gewiß, daß dieser ächt niederdeutsche Baustyl mit Thonreliefs, welcher sich jetzt an 300 Jahre bewährt hat, wohl nirgends so gut als in Meklenburg studirt werden kann. Schinkel hat bekanntlich diesen Styl durch die Bauschule zu Berlin wieder zu Ehren zu bringen gestrebt und die meklenburgischen Bauwerke


|
Seite 484 |




|
aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. immer hoch in Ehren gehalten. Bei der gegenwärtigen Restaurirung und dem theilweisen Neubau des Residenzschlosses zu Schwerin werden unter höherm Schutze alle Veranstaltungen zur angemessenen Verfolgung dieses Styls getroffen und es wird ohne Zweifel die Geschichte hier ihre Früchte tragen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 485 |




|



|



|
|
:
|
III. Zur Münzkunde.
1. Mittelalter.
Münzfund von Wismar.
Als am 27. April d. J. einige Arbeiter in der St. Nicolai=Kirche hieselbst beim Aufgraben des Erdreiches um das Fundament des von der Kanzel nach der Orgel zu an der Nordseite des Hauptschiffes der Kirche stehenden Pfeilers beschäftigt waren, stießen dieselben in einer Tiefe von ungefähr 1 1/2 bis 2 Fuß an der östlichen Seite des Fundaments im festen Lehmboden auf einen kleinen Krug, der aber, wie sich bei näherer Nachsicht ergab, durch den Spatenstoß in mehrere größere und kleinere Stücke zerbrochen war. Der Herr Provisor der Kirche, von diesem Funde benachrichtigt, nahm diesen Krug an sich und fand in demselben außer mehreren Nadeln, kleinen Kugeln, Stückchen Glas und Blei, eine große Anzahl kleiner Silbermünzen, die Oeffnung des Kruges selbst aber mit einem zusammengerollten Stück Leder verschlossen. Vom löbl. Hebungs=Departement allhier ist dieser Fund demnächst zur Aufbewahrung an das hiesige Raths=Archiv abgegeben.
Der Krug selbst, der mit Ausnahme 2 kleiner Stücke vollständig wieder zusammengesetzt ist, mißt 10 3/4 Zoll im Umfange und 5 1/4 Zoll in der Höhe, und hat am Fuße einen Durchmesser von 2 1/2 Zoll. Oben am Halse befindet sich an der einen vordern Seite eine kleine Ausbiegung zum Gießen. In der Mitte des Kruges, um denselben nach unten zu, sind 10-11 abwechselnd erhabene und vertiefte, grade laufende Ringe. Die Farbe des Kruges ist hellbraun, gebrannt und glasurt, etwa so wie die Bitterbrunnenkrüge; die Masse, aus schönem Töpferthon, scheint gleichfalls eine ähnliche zu sein, ist fest gebrannt und zeigt im Bruche eine schwarzgraue Farbe. - Der Stöpsel, mit dem die Oeffnung des kleinen Halses des Kruges verschlossen war, besteht aus einem mehrfach zusammengerollten, ziemlich gut erhaltenen Stücke Leder von mäßiger Dicke. - Oben am Halse hat der Krug 2 Henkelgriffe.


|
Seite 486 |




|
Der Inhalt dieses Kruges bestand aus Folgendem:
- aus 38 kleinen Stücken grünen Glases von verschiedener Dicke und Farbe,
- aus 9 länglichen Stücken Blei von etwa 3/4 Zoll Breite, die offenbar zu einem langen, hin und wieder durchlöcherten Streifen gehört haben,
- aus 18 kleinen, weißen Perlen, anscheinend von Horn und von der Größe einer ganz kleinen Erbse,
- aus 4 größeren Perlen von schwärzlicher Farbe, anscheinend von gebranntem Thon, der von der Größe einer Erbse und 3 Mal so groß ist, als die vorigen,
- aus 9 Stecknadeln verschiedener Größe, aus Messing gearbeitet, von denen die längste etwa 1 1/2 Zoll, die kleinste aber nur ungefähr 1/2 Zoll lang ist,
- aus einer runden, vertieften, kleinen Messingplatte mit 3 runden Löchern und übrigens abwechselnd erhaben und vertieft gepreßt, von der Größe eines Silbersechslings, und
- aus 439 Silbermünzen, und zwar bestehen diese in folgenden Münzen:
| 1) | 48 meklenburgische Bracteaten, größere. - Der Büffelskopf theils mit Hörnern, theils ohne Hörner, und in verschiedenem Gepräge; der Rand ist strahlenförmig. |
| 2) | 38 meklenburgische Bractaten, kleinere, wie die vorigen, und ebenfalls von sehr verschiedenem Stempel. |
| 3) | 8 rostocker Bracteaten, größere. - Der rechts aufgerichtete Greif mit aufgeschlagenem Schwanze, theils im Schilde, theils frei; der Rand strahlenförmig. |
| 4) | 70 rostocker Bracteaten, kleinere. - Der rechts aufgerichtete Greif mit aufgeschlagenem zottigen Schwanze; der Rand ist strahlenförmig. |
| 5) | 4 wismarsche Bracteaten, kleine.- Das Stadtwappen und strahlenförmiger Rand. |
| 6) | 162 königl. dänische Bracteaten, kleine. (Königin Margaretha. 1387-1412). Ein runder Mannskopf mit Seitenhaaren und einer Krone; der Rand ist strahlenförmig. (Königsberg i. d. N. M. ? - D. Red.) |
| 7) | 33 Bracteaten, von verschiedener Größe. - Rechts ein Adler, links ein aufrecht gestellter Schlüssel; der Rand strahlenförmig. (Stadt Salzwedel. - D. Red.) |
| 8) | 1 hamburger, großer, Bracteat |
| 9) | 8 = mittlere Bracteaten. |
| 10) | 37 = kleinere Bracteaten. |
| Der große: zwei Mauer= oder Thorthürme, zu deren Rechten das holsteinische halbe Nesselblatt, |


|
Seite 487 |




|
|
die übrigen: ein
dreifach gethürmtes, oder mit 3
Spitzen versehenes Thor, in dessen
Oeffnung das holsteinische
Nesselblatt.
Der Rand ist bei allen strahlenförmig. |
|
| 11) | 1 Bracteat, großer. - Ein rechts sehender, einfacher Adler; Rand strahlenförmig. - Wahrscheinlich brandenburgisch. |
| 12) | 13. Bracteaten, kleinere. - Ein rechts sehender, in der Länge getheilter, einfacher, halber Adler, an dessen linker Seite 3 Rauten oder Wecken; Rand strahlenförmig. (Stadt Stendal. D. Red.). |
| 13) | 2 meklenburgische Doppelschillinge, aus der gemeinschaftlichen Regierung der Herzoge Magnus und Balthasar (1477 - resp. 1503 und 1507). |
| A. |
Das Wappen mit 4
Feldern und dem Herzschilde, darüber
ein kleines Dreiblatt. Umschrift:
MONET. NOVA. GUSTROWESI.
 (GUSTROWEN.
(GUSTROWEN.
 )
)
|
| R. | Der meklenburgische Büffelskopf im Schilde auf einem durchgehenden Kreuze. (Der Büffelskopf mit dem Halsfelle). Umschrift: DUCU. MANG. NOPO. LENS. (DUGU. MAG. eine Rose. NOPO. LENS.) |
| 14) | 2 meklenburgische Schillinge, aus derselben Zeit. |
| A. |
Der meklenburgische
Büffelskopf oben mit einem
 . - Umschrift:
MONE. NOVA. GUSTROWES.
. - Umschrift:
MONE. NOVA. GUSTROWES.

|
| R. | Ein durchgehendes, schlichtes Kreuz, in dessen 4 Ecken in jeder ein Ring. Umschrift: DUCU. MAG. NOP. LEN. |
| 15) | 5 meklenburgische Schillinge, aus derselben Zeit. |
| A. |
(bei 3) der
meklenburgische Büffelskopf mit dem
Halsfelle im Schilde, darüber der
Buchstabe B. (Name des Münzmeisters
Jacob Brasche). - Umschrift:
MONET. NOVA. GUSTROWE.
 .
.
(bei 2) ebenso, aber ohne B. Umschrift: MONET. NOVA. GUSTROW.  .
.
|
| R. | Der wendische Büffelskopf im Schilde auf einem durchgehenden Kreuze. Umschrift: DUCU. MAG, NOPO. (NOP') LENS. (LEN-)-(OLE). |
| 16) | 32 meklenburgische Sechslinge, aus derselben Zeit. |
| A. | Der meklenburgische Büffelskopf im Schilde. - Umschrift: MONET. NOVA. GUSTROW. |
| R. |
Ein Kreuz in einem
Kreise. - Umschrift:
DUCU.
MAGNOPOLENS.
 . (MAGNOPOLENSI.
. (MAGNOPOLENSI.
 .)
.)
|
| 17) | 11 rostocker Schillinge aus mittlerer Zeit, aber vor 1500. |


|
Seite 488 |




|
| A. |
Der Greif, aufrecht,
rechts fortschreitend, mit
aufgesperrtem Rachen, ausgestreckter
Zunge, aufgeschlagenem, zottigen
Schwanze, mit einem Flügel, und an
jedem der 4 Füße 3 Klauen, - im
punctirten Zirkel . - Umschrift:
MONETA. NOVA. ROSTOKE: (ROSTOK)
 . (
. (
 .)
.)
|
| R. |
Der Buchstabe
r
auf einem durchgehenden Kreuze, in
dessen unterem rechten Winkel ein
Stern (bei einem ein kleiner Hund).
- Umschrift:
 . SIT. NOM'
o
DNI. Vierblatt.
BND. Dreiblatt. (
. SIT. NOM'
o
DNI. Vierblatt.
BND. Dreiblatt. (
 SIT. NOM. DNI'
o
BND -
SIT. NOM. DNI'
o
BND -
 SIT. NOM. DNI BND. -
SIT. NOM. DNI BND. -
 SIT. NOM
o
DNI'
o
BND'
o
).
SIT. NOM
o
DNI'
o
BND'
o
).
|
| 18) | 38 rostocker Sechslinge, aus derselben Zeit. |
| A. |
Der Greif, eben so. -
Umschrift: MONET. NOVA. ROSTOK
(ROSTOK
 )-(ROSTOK
o
)
)-(ROSTOK
o
)
|
| R. | eben so; unten rechts ein Stern. - Umschrift: SIT. NOM. DNI. BND. |
| 19) | 3 Groschen, herzogl. pommersch. - Bogislaus X. (der Große) 1474-1523. |
| 1) | A. |
Der pommersche Greif. -
Umschrift:
 DUX
o
BUGSLAUS
o
STETTIN
o
DUX
o
BUGSLAUS
o
STETTIN
o
|
| R. | Das Wappen im Schilde auf einem durchgehenden Kreuze. - Umschrift: MON-ET o N-OVA. D-AM 94 (1494.) |
| 2) | A. |
ebenso. - Umschrift
BUGSLAUS
o
DUX
o
STETTIN'

|
| R. | ebenso. - Umschrift: MON-ETA o N-OVA o D-AM. 96. |
| 3) | A. | ebenso. - Umschrift: BUGSLAUS o D o G o DUX o STETIN' Stern. |
| R. | ebenso: - Umschrift: MONE-TA o NO-VA o DN-AM. 92. |
| 20) | 1 Schilling, herzogl. pommersch, aus derselben Zeit. |
| A. |
ebenso. - Umschrift:
BUGSLAUS
o
D
o
G
o
DUX
o
STETIN.
 .
.
|
| R. | ebenso. - Umschrift: MONE-TA o NO-VA. o GA-RE. 89. |
| 21) | 1 Schilling der Stadt Stralsund. |
| A. | die drei Strahlen, oben jeder mit einem o, im punctirten Kreise. - Umschrift: DEUS IN NOMINE . T. Stern. |
| R. |
Der pommersche Greif. -
Umschrift: MONETA
 . . . . . . . . . .
(nicht zu lesen, soll aber wohl
heißen: NOVA SUND
o
. . . . . . . . . .
(nicht zu lesen, soll aber wohl
heißen: NOVA SUND
o
|


|
Seite 489 |




|
| 22) | 2 große Bracteaten: mit dem doppelten Reichsadler. |
| 23) | 4 dänische kleine Münzen. - König Johann. 1481-1513. |
| A. |
Gekröntes h. -
Umschrift: JOHES
 D [
D [
 G
G
 R. DANIAE.
R. DANIAE.
|
| R. | Ein Schild unter einem durchgehenden Kreuze. - Umschrift: MON. MAL. MOI. ENS. (nicht ganz deutlich mehr zu entziffern). |
| 24) | Münze. - In der Mitte 3 erhabene im Dreieck zusammengestellte Kugeln in einem einfachen, länglich runden Rande, um welchen rund herum vertiefte Kugeln, und dann rings umher ein strahlenförmiger Rand. Ohne Umschrift. - Bracteat. |
| 25) | 14 unkenntliche und theils zerbrochene Bracteaten. |
Die Schrift auf allen Münzen ist Mönchsschrift.
Wismar, im December 1846.
F. J. Briesemann.


|
Seite 490 |




|



|



|
|
:
|
2. Neuere Zeit.
Münze des Herzogs Christoph von Meklenburg.
Vom Herzoge Christoph von Meklenburg, welcher von 1554-1592 Administrator des Bisthums Ratzeburg war, sind außer dem Thaler von 1581, von dem Evers Meklenb. Münzverf. II, S. 32 drei verschiedene Stempel aufführt, noch keine Münzen weiter bekannt geworden; denn von den wenigen halben und Ortsthalern, welche, wie es die niedersächsischen Kreisacten von 1585 melden, der Herzog durch Hans Wechsel, einen lübeckischen Goldschmied, in Schönberg schlagen ließ, haben sich noch keine gezeigt.
Um so interessanter ist die Entdeckung eines Schillings von diesem Herzog, da man die Existenz desselben bisher gar nicht kannte 1 ). Er hat 3/4 Zoll im Durchmesser, wiegt 1/16 Loth und schließt sich in der Form den Schillingen der Herzoge Heinrich und Ulrich an, welche in demselben Jahrhundert, aber etwas früher geprägt wurden.
Auf der Hauptseite, welche die Umschrift hat:
ist in einem geriefelten Kreise der gekrönte meklenburgische Stierkopf mit einem Ringe durch die Nase zwischen der Zahl 8 8 (1588), und über demselben ist, in den Kreis der Umschrift gestellt, eine Bischofsmütze zwischen 2 Stäben.
Die Rückseite hat die durch ein durchgehendes Lilienkreuz geheilte Umschrift:
und in den Winkeln des Krenzes die Buchstaben:
(de deo est fortitudo (?) )
Merkwürdig ist es, daß der Herzog auf diese kleine Münze den Titel des Bischofs setzte, von dem er weder in den Urkunden, die er ausstellte (so viel mir zu Gesichte gekommen sind), noch auf dem Thaler Gebrauch machte, indem er sich immer Administrator des Stifts Ratzeburg nannte.
G. M. C. Masch.


|
Seite 491 |




|



|



|
|
:
|
IV. Zur Wappenkunde.
Die Siegel der meklenburgischen Städte
Seit 1842 sind die Siegel der Städte Meklenburgs gesammelt worden und die Jahresberichte haben seitdem Nachricht von dem Erfolg der Bemühung gegeben, die von vielen Seiten sehr günstige Unterstützung gefunden hat. (Jahresbericht VII, S. 55; VIII, S. 88; IX, S. 28; X, S. 17). Jetzt ist die Sammlung, so weit möglich war, vervollständigt und geordnet.
Es ergiebt sich aus derselben, daß folgende Städte noch die mittelalterlichen Stempel bewahrt haben: Parchim, Crivitz, Gadebusch, (das Secretum), Grevismühlen (Sigillum und Secretum), Neustadt (vgl. Jahresber. I, S. 29), Schwerin (großes und kleines Secretum), Boitzenburg, Maschin, Penzlin, Plau, Ribnitz, Sültze haben die Sigilla. Von Rostock und Wismar ist es nicht zu ermitteln gewesen und von den Strelitzischen Städten hat Neubrandenburg noch ihr älteres Secretum, der alte Stempel von Strelitz ist in der großherzogl. strelitzischen Alterthümersammlung; in Friedland sollen die alten Stempel noch vorhanden sein, jedoch sind keine Abdrücke davon zur Vereinssammlung gekommen.
Die Siegelstempel der übrigen Städte, welche jetzt im Gebrauche sind, sind neu und haben zum größten Theil die Jahrszahl ihrer Anfertigung in der Umschrift: so Brüel 1820; Neu=Bukow 1729; Dömitz 1620, 1653 und 1834; Grabow 1797, 1824 und 1841; Hagenow 1628; Kröpelin 1774; Lübz 1805; Malchow 1707 und 1769; Neustadt den 27. Julii 1728; Waren 1697, 1692 renov. 1804; Goldberg 1590 und 1630; Neu=Kalden 1701; Röbel 1707; Schwan den 17. März 1771; Sülte 1719; Tessin 1590; Wismar 1802; Schönberg hat das Jahr, in welchem es die Stadtgerechtigkeit erhielt, 1822.
Die Bilder dieser Städtesiegel, indem wir zunächst die schwerinschen berücksichtigen, sind folgende:


|
Seite 492 |




|
1) Der Stierkopf , und zwar:
a. ohne Beizeichen bei Rehna, Neu=Kalden 1 ), Krakow, Lage 2 ) (ungekrönt), Stavenhagen (auf dem ältern Siegel ungekrönt, auf dem neuern gekrönt), Sülze;
b. mit Beizeichen: das alte große Siegel von Rostock zwischen Stern und Mond 3 ); Parchim, ungekrönt zwischen 2 Kleeblättern und mit einem Hirschgeweih zwischen den Hörnern 4 ); Neu=Bukow, ungekrönt mit einem Baum zwischen den Hörnern; Gadebusch im gespaltenen Schilde vorn den Stierkopf, hinten einen Baum 5 ), während das alte Secretum beide Bilder im Siegelfelde hat; Malchin stellt an beide Seiten des Stierkopfes einen gezinnten Thurm und darüber ein Kreuz auf dem großen Siegel 6 ), läßt aber auf dem Secretum die Thürme weg und setzt das Kreuz zwischen die Hörner 7 ), Marlow hat einen Greif zwischen den Hörnern, Ribnitz giebt ihm auf dem alten Siegel zwei Fische zur Seite 8 ) und Sülze stellt ihn auf dem alten Siegel zwischen 2 Blätter über Wellen 9 , Lübz giebt ihm 2 Sterne zur Seite.
c. Ganze Stierköpfe in Umgebung finden sich auf dem alten großen Siegel von Grevismühlen, wo er in einem Mühlrade 10 ), und bei Plau, wo er von einem gezinnten Gemäuer eingeschlossen ist 11 ).
d. Halbe Stierköpfe. Grevismühlen hatte im alten Secretum einen halben Stierkopf und ein halbes Rad aus dem großen Siegel monogrammatisch verbunden; dies ist das neue Siegelbild in einem Schilde geworden 12 ). Gnoien hat vorne eine halbe Lilie und hinten einen halben Stierkopf 13 ). Penzlin


|
Seite 493 |




|
hat vorne im gespaltenen Schilde den halben werleschen Stierkopf und hinten 10 mal gestreift 14 ). Röbel stellt ihn gleichfalls vorn, und hinten einen aufgerichteten Schlüssel 15 ). Sternberg hatte vorne einen halben Stern und hinten einen halben Stierkopf 16 ), hat jedoch in neuern Zeiten die Bilder umgestellt. Tessin giebt dem halben Stierkopf einen Stern zwischen die Hörner und hat hinten eine halbe Lilie. Wismar, das ihn gleichfalls vorn stellt, theilt die hintere Hälfte viermal von Silber und Roth 17 ).
2) Der Greif findet sich auf dem Secretsiegel von Rostock seit den ältesten Zeiten 18 ) und in spätern Stadtsiegeln wird er auf einen Balken gestellt; er ist auf dem ältern Secret und den neuern Siegeln von Ribnitz 19 ); Stavenhagen hatte ihn auf seinem alten großen Siegel 20 ), hat ihn aber später mit dem Stierkopf vertauscht. Wachsend im blauen Felde auf einem Balken über einem silbernen Schildesfuß ist er das Bild der Neustadt Schwerin, wovon jedoch nur die Stadtgerichtssiegel bekannt sind.
3) Stadtzeichen als Thore oder Burgen gebildet, haben außer Plau, dessen schon erwähnt ist, Crivitz mit dem getheilten Schilde der Grafen von Schwerin zwischen 2 Rosen in der untern Bogenhalle 21 ), dann Dömitz und Malchow, welches ein Herz zwischen die Thürme über das Thor stellt 22 ). Neustadt hat ein Gemäuer mit dem überragenden Brustbilde des heil. Petrus, zu beiden Seiten einen Schlüssel 23 ). Waren stellt auf den alten Siegeln zwischen zwei großen Thürmen einen halben Stier, der den Kopf vorwärts kehrt, und darüber einen Helm mit zwei überschränk gelegten Bischofsstäben, zwischen denen ein Kreuz. In
 - Ueber die neue Veränderung
später. Das Secretum s. Lisch Maltzan. Urk.
II, p. 226 von 1371 und p. 390.
- Ueber die neue Veränderung
später. Das Secretum s. Lisch Maltzan. Urk.
II, p. 226 von 1371 und p. 390.
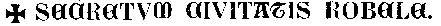


|
Seite 494 |




|
den neuern Siegeln ist an die Stelle des Stiers der Kopf getreten und Helm und Stäbe sind weggeblieben 24 ). Wittenburg hatte früher ein großes Siegel mit einem Thurm über dem Thore und zwei Seitenthürmen, auf welchem jeden ein einwärts gekehrter Lindwurm sitzt 25 ), späterhin, wie auf dem Secretsiegel der frühern Zeit 26 ), in der hintern Hälfte des gespaltenen Siegelfeldes ein Stadtzeichen und vorne einen an die Theiungslinie hinaufkriechenden Lindwurm aus den gräflich schwerinschen Siegeln. Boizenburg hat ein gar stattliches Thorgebäude 27 ) und haben sich durch Schuld der Siegelstecher die Dächer der Seitengebäude in Schilde verwandelt, welche gespalten sind und die auswärts gekehrte Seite balkenweise gestreift haben. Goldberg stellt zwischen zwei Thürme einen Stierkopf 28 ).
4) Heiligenbilder finden sich auf dem Siegel von Hagenow 29 ) und der Kopf des heil. Petrus mit den Schlüsseln auf dem alten Stadtsiegel von Neustadt 30 ). Grabow hatte früher den heil. Georg in seinem großen Siegel 31 ).
5) An die Gründer der Städte erinnern mehrere Siegel, vor allen Schwerin, welches das Bild des Herzogs Heinrich des Löwen von Sachsen in ganzer Figur zu Roß mit dem Löwenschilde am Arme zeigt 32 ), dann, wie bereits erwähnt ist, Crivitz und Wittenburg, welche Bilder aus den Siegeln der ehemaligen Grafen von Schwerin, ihrer Stifter, aufbewahrt haben. Bützow hat von den Bischöfen von Schwerin die Inful, welche früher über zwei Bischofsstäben stand 33 ), die jetzt durch dieselbe gesteckt sind, und Warin, welches von denselben seine 2 Bischofsstäbe im verzierten Schilde angenommen hat.
6) Eigene Stadtwappen haben: Brüel, getheilt, oben ein halber Stern und ein halber Stierkopf an einander gefügt, unten 3 Aepfel; Grabow ein Halbmond links gekehrt und 3 Sterne; Teterow im Schilde ein Helm mit 3 Straußfedern und auf dem
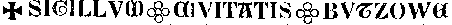 Das Siegelfeld ist gerautet
und in jeder Abteilung mit einer Kreuzblume
geziert.
Das Siegelfeld ist gerautet
und in jeder Abteilung mit einer Kreuzblume
geziert.


|
Seite 495 |




|
Helme, der den Schild deckt, 3 Rosen an langen Stielen 34 ). Güstrow hat beständig einen ganzen Stier geführt, der vor einem Rosenstocke steht 35 ). Den Namen andeutend sind die Bilder von Kröpelin, welches einen kriechenden Bettler oder Krüppel (plattdeutsch "Kröpel") unter einem Schilde mit dem Stierkopf 36 ), und Schwan, welches einen Schwan zeigt, vielleicht ist auch der Baum auf dem Stierkopfe von Neu=Bukow hieher zu rechnen.
7) Ein Schiff auf Wellen, in denen 2 Fische schwimmen, mit dem Stierkopfe auf einem Schilde am Maste und einem Papagei auf dem Bugspriet hat das alte große Siegel von Wismar 37 ).
Die Umschriften dieser Siegel sind fast überall: Sigillum (Secretum) Civitatis . . . . und neuer Siegel der Stadt . . . . oder Stadtsiegel von . . . . ; die Bezeichnung als Sigillum burgensium, die sich auf den alten Siegeln von Rostock und Stavenhagen und auf dem Secretum von Wismar, Grevismühlen, Ribnitz und Sternberg findet, desgleichen das Sigillum Civium in Gnoien hat den neueren gewöhnlichen weichen müssen. Als Siegel des Raths (Secretum consulum) bezeichneten sich früher Gadebusch, Malchow, (Signetum Consulum) Güstrow, (Burgermeister Rathman tho S) Schwan, (Secretum senatus reip. Rost.) Rostock und jetzt das neue Rathssiegel der Stadt Schwerin. Oppidum nannten sich Warin und Hagenow, und Neustadt zuerst nova civitas Gleve, dann um 1588 nova civitas mech. und jetzt seit dem 27. Juli 1728 Neustadt in Mecklenburg; auch Plau gab um 1620 das Vaterland (Meg.) auf dem Siegel an. Das alte große Siegel von Schwerin hatte die Umschrift Dux hinricus et secretum civitatis zwerin, Grabow bezeichnete auf dem alten Siegel den Schutzheiligen mit dem Namen Sctus Georgius, Wismar nannte sein kleines Siegel Signum wismariense.
Die Veränderungen, welche die Stadtsiegel erlitten haben, sind im Ganzen nicht sehr bedeutend und müssen zum Theil auf Schuld der Siegelstecher geschoben werden. Dahin ist besonders zu rechnen, daß der werlesche Stierkopf (ohne Ring und Halsfell) fast überall in den meklenburgischen verwandelt ist, daß Waren die Hälfte seines Stiers verlor und nur den Kopf behielt, daß Boitzenburg statt der Dächer der Thorgebäude Schilde be=


|
Seite 496 |




|
kommen hat. Die Bilder der großen Siegel sind von Rostock, Wismar, Malchin, Grevismühlen und Wittenburg aufgegeben und ist dafür das Bild der wohl eben so alten Secretsiegel aufgenommen worden. Stavenhagen nahm statt des Greifes der ältesten Zeit den Stierkopf, und Ribnitz gab den Stierkopf auf und nahm dafür den Greif an; Neukalden ließ das alte Stadtthor und Sülze die Wellen und Blätter weg, welche früher Beizeichen des Stierkopfes waren und nahm ihn allein auf, Neustadt fügte dem heil. Petrus eine Mauer bei, Hagenow gab seinem Heiligen die ganze Gestalt. Ueber die Veränderung des grabowschen Siegels, das 1363 den heil. Georg und etwa seit dem 18. Jahrhundert Mond und Sterne zeigt, fehlen die leitenden Andeutungen. Ganz unerklärlich ist es, daß Gnoien sein uraltes, auf seinen Münzen des Mittelalters vorkommendes Stadtzeichen aufgegeben hat und ein Stadtsiegel gebraucht, worin sich vorne ein links gekehrter Greif mit einem Schwerte und hinten ein ganzer Stierkopf zeigt.
Von den Siegeln der Städte im stargardischen Kreise erinnern an die Zeit der brandenburgischen Herrschaft zunächst Friedland, welches neben dem Adlerschild die Bilder der Stifter, der Markgrafen Johann und Otto, unter einen Bogen mit 3 Thürmen stellt 38 ), dann Woldegk, welches einen Adler mit einem Ring im Schnabel auf einen Eichenstamm sitzend führt, Stargard, welches einen Adler im Schilde hat, und beziehungsweise auch Neubrandenburg durch den mit Federn geschmückten Helm zwischen den beiden Thürmen des Stadtthors 39 ). Den stargardischen Arm haben Fürstenberg und Neustrelitz, letzteres vorn in einem gespaltenen Schilde und hinten den Stierkopf und zugleich hat dies Siegel auch die Schildhalter des meklenb. herzoglichen Wappens. Altstrelitz hat in seinem Siegel 40 ) die Wappen seiner Stifter, der Grafen Otto und Ulrich von Fürstenberg (aus dem Geschlechte der v. Dewitz) bewahrt, indem es vorne von den drei dewitzischen Bechern einen ganzen und einen halben, und hinten von dem gerauteten Schilde, welches die Grafen von Fürstenberg führten, einen Theil zeigt und beide Bilder im gespaltenen Schilde verbindet. Wesenberg hat auf einer Mauer drei Thürme, von denen die äußeren mit Adlerköpfen, neuerdings mit Schwänen gegipfelt sind.
Die Umschriften sind auch hier die gewöhnlichen und die Burgenses in den alten großen Siegeln von Neubrandenburg


|
Seite 497 |




|
und Friedland sind der Civitas gewichen und das neustrelitzische weiset sich als das des Magistrats in der Residenz-Stadt aus. Bei Wesenberg Insiegel : : Bur . . . Stadt Wesenberg bleibt es ungewiß, ob Bur eine Abkürzung von Bürger der Stadt sein soll oder ob es Bauerstadt statt Landstadt bezeichnet.
Da nur von Neubrandenburg, Friedland und (Alt) Strelitz die alten Siegel bekannt sind, so lassen sich die Veränderungen, welche diese Siegel etwa erlitten haben, nicht angeben. Die beiden ersten haben ihre uralten Stadtzeichen, im Ganzen genommen, treulich bewahrt, dagegen sind die neuen Siegel von Strelitz im hohen Grade entstellt worden, so daß der halbe Becher wegblieb und statt der Rauten Fahnen aufgenommen sind, wodurch denn dies Siegel die große heraldische Bedeutung, welche das alte in der monogrammatischen Verbindung beider Wappenbilder hatte, gänzlich verlor.
Im Fürstenthum Ratzeburg ist Schönberg, welches 1822 zur Stadt erhoben ward, wie auch das Siegel, das es damals bekam, die Jahrszahl aufbewahrt; das frühere Städtlein ist von jeher siegellos gewesen. Das Siegel der Stadt zeigt einen Schild mit den Landesfarben roth, blau und gold und einen rothen Mittelschild mit einem silbernen Ankerkreuze. Daß dieses Kreuz, welches das Fürstenthum Ratzeburg anzeigen soll, die Gestalt erhielt, in welcher dies Bild in den Siegeln der erloschenen güstrowschen Linie des herzoglichen Hauses vorkommt, ist unhistorisch; es mußte, da das Fürstenthum von der schwerinschen an die strelitzische Linie überging, das gekrönte Kreuz sein. Ueber dem Hauptschild steht eine Mauerkrone und er ist von Rauten umgeben.
G. M. C. Masch.


|
Seite 498 |




|
V. Zur Schriftenkunde.
Urkunden.
Der Verein erhielt zum Geschenke an Urkunden:
I. Von dem Herrn Pälz zu Alt=Sammit:
1) D. d. 1525. Mai 25. (am dage Urbani).
Der Bürger Cordt Kleinsmett zu Hameln verpfändet der Vicarei der Heil. Drei Könige in der S. Bonifacius=Kirche zu Hameln 8 Pfund Geldes jährlicher Rente aus seinem Wohnhause zu Hameln für 50 rhein. Goldgulden. (Original.)
II. Von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow:
1) 1519. Febr. 4. (des frydages na Blasii)
d. d. Bützow.
Heinrich Pren zu Hermannshagen verpfändet der Vicarei in der Heil. Kreuz=Kapelle am Thurm der Kirche zu Bützow 3 stral. Mark jährl. Pacht aus Hermannshagen. (Original.)
III. Von dem Herrn Rector Römer zu Grabow Abschrift von folgenden Original=Urkunden der Stadt Grabow:
1) 1252. Jan. 1. (die circumcisionis domini)
d. d. Grabow.
Der Graf Volrad von Danneberg stiftet die Stadt Grabow.
2) 1259. Jan. 25. (die conversionis Pauli)
d. d. Grabow.
Der Graf Volrad von Danneberg verkauft der Stadt Grabow das Dorf Karstädt.


|
Seite 499 |




|



|



|
|
:
|
VI. Zur Buchdruckkunde.
Hinrici Bogher Etherologium.
In Jahrb. IX, S. 480 flgd. (vgl. Jahresber. VI, S. 125-126) ist das vorstehend bezeichnete, interessante Werk eines bisher unbekannten rostocker Gelehrten beschrieben, nachdem dasselbe durch den Herrn Bibliothekar Dr. Schönemann in Wolfenbüttel entdeckt und in einem Exemplare unserm Vereine zugewandt war.
Der Verfasser dieses Werkes ist bis jetzt nur durch Schönemann's Entdeckungen bekannt geworden; erst längere Aufmerksamkeit hat auf Spuren geführt, welche diesen Mann, der ohne Zweifel eine nicht unbedeutende Stellung in der Gelehrtenwelt Meklenburgs gehabt haben muß, in ein hellere Licht stellen.
Heinrich Bogher war, nach einer in Jahrb. VI, S. 195, angeführten Rede, ein Zögling der Universität Erfurt und, wahrscheinlich von dort, Magister der Philosophie und Lehrer der biblischen Exegese. Er hielt diese Rede am 13. März 1493 bei der Degradirung des in Rostock hingerichteten sternberger Priesters Peter Däne vor dem Volke zu Rostock; er hatte sie ursprünglich zum Vortrage vor der Geistlichkeit bestimmt. Darauf ward er Doctor der Theologie. Wahrscheinlich war er Professor zu Rostock; jedoch ist es aus den Universitäts=Urkunden nicht ersichtlich, daß er eine ordentliche Professur bekleidet habe. Er war bei den Landesherren sehr beliebt und um die Wissenschaft verdient.
Am 23. Mai 1501 stifteten die Herzoge Magnus und Balthasar eine neue Domherrenstelle 1 ) an dem Dom=Collegiat=Stifte Rostock und verbanden damit die Pfarre zu Belitz bei Lage. Da diese Pfarre im Bisthume Camin lag, so mußte der Bischof von Camin seine Zustimmung geben, welche auch


|
Seite 500 |




|
am 26. Jun. 1501 erfolgte. Rostock lag im Bisthume Schwerin, und daher mußte der Bischof von Schwerin am 2. Jul. 1561 von dem caminer Bischofe die Commission zur Ausführung der Incorporirung der Pfarre mit der Domherrenstelle übernehmen. Diese neue Domherrenstelle verliehen die Herzoge dem Dr. Heinrich Bogher, welcher schon früher von den Herzogen mit geistlichen Lehen bedacht war 1 ).
Zu gleicher Zeit ward durch eine besondere Veranstaltung Heinrich Bogher zu höhern Würden erhoben. Der M. Johann von Greben war Dom=Dechant zu Rostock und Besitzer der mit der Dechanei verbundenen Pfarre S. Jacobi daselbst, an welche das Dom=Capitel gebunden war. Dieser wünschte seine Stelle zu verlassen. Zu derselben Zeit war eine Dom=Präbende an dem Dom=Collegiat=Stifte Güstrow durch den Tod des Canzlers Dr. Antonius Gronewald 2 ) erledigt und dem Dr. Heinrich Bogher zugedacht.
Es ward daher die Veranstaltung getroffen, daß der M. Johann von Greben die Dom=Dechanei zu Rostock mit der Jacobi=Pfarre dem Dr. Heinrich Bogher abtrat, dieser dagegen jenem die neu gestiftete rostocker Domherrenstelle mit der Pfarre zu Belitz und die güstrowsche Dom=Präbende überließ. Die Herzoge bestätigten diesen Tausch am 20. Jun. 1501 3 ) und der Bischof Martin von Camin gab am 26. Jun. 1501 für die Pfarre zu Belitz seine Zustimmung 4 ).
Nach dem Titel des Etherologii war Dr. Heinrich Bogher noch im J. 1506 Dom=Dechant zu S. Jacob in Rostock.
Mehr hat sich bis jetzt über diesen Mann nicht erforschen lassen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 501 |




|



|



|
|
:
|
Nachricht über das Buch von den drei Strängen von Nicolaus Ruß,
Während ich im Julius 1846 auf der rostocker
Universitäts=Bibliothek zum Behuf einer
inzwischen unter dem Titel "Zeugnisse von
Christus aus der meklenburgischen Kirche"
 . erschienenen Sammlung die ältere
Predigtliteratur durchmusterte., entdeckte ich
ein einer Sammlung von Predigten des
Superintendenten Draconites aus dem J. 1550
beigebundenes, umfängliches Werk in
plattdeutscher Sprache, welches auf dem Rücken
des pergamentenen Einbandes als "Ein
plattdeutscher Tractatus: Dat Boeck von dreen
Strängen sine anno et loco" bezeichnet war
und sich mir bald als das von Flacius im
Catalogus Testium Veritatis unter dem Titel
Triplex funiculus aufgeführte, seitdem nur aus
dieser Nachricht des Flacius bekannte
katechetische Werk des meklenburgischen
Priesters Nikolaus Ruß, eines unmittelbaren
Vorläufers der Reformation, auswies. Bei der
kirchengeschichtlichen und theologischen
Bedeutung dieses Werkes, welche schon Flacius
anerkennt, indem er die Absicht, eine
hochdeutsche Uebersetzung desselben zu
veröffentlichen, kund giebt, glaubte ich nicht
säumen zu dürfen, von meiner Entdeckung eine
öffentliche Nachricht zu geben. Ich that dies,
in der Jllgen=Niednerschen Zeitschrift für die
historische Theologie, durch einen Auszug in
hochdeutscher Sprache, welcher den Gang, die
Methode, den Geist und Inhalt des Werkes
möglichst zur Anschauung bringen sollte. Diesem
Auszuge ließ ich einige historische Nachrichten
und Erörterungen über den Verfasser und das Buch
vorangehen, so weit die spärlich fließenden
Quellen dies erlaubten. Da das Titelblatt des
aufgefundenen Exemplars fehlt, so boten
besonders die Fragen nach Jahr und Ort des
Druckes nicht geringe Schwierigkeiten dar. Die
gewöhnliche Annahme ist, daß das Buch im J. 1511
aus der Buchdruckerei des Michaelisklosters zu
Rostock hervorgegangen sei. In Hinsicht des Ortes
. erschienenen Sammlung die ältere
Predigtliteratur durchmusterte., entdeckte ich
ein einer Sammlung von Predigten des
Superintendenten Draconites aus dem J. 1550
beigebundenes, umfängliches Werk in
plattdeutscher Sprache, welches auf dem Rücken
des pergamentenen Einbandes als "Ein
plattdeutscher Tractatus: Dat Boeck von dreen
Strängen sine anno et loco" bezeichnet war
und sich mir bald als das von Flacius im
Catalogus Testium Veritatis unter dem Titel
Triplex funiculus aufgeführte, seitdem nur aus
dieser Nachricht des Flacius bekannte
katechetische Werk des meklenburgischen
Priesters Nikolaus Ruß, eines unmittelbaren
Vorläufers der Reformation, auswies. Bei der
kirchengeschichtlichen und theologischen
Bedeutung dieses Werkes, welche schon Flacius
anerkennt, indem er die Absicht, eine
hochdeutsche Uebersetzung desselben zu
veröffentlichen, kund giebt, glaubte ich nicht
säumen zu dürfen, von meiner Entdeckung eine
öffentliche Nachricht zu geben. Ich that dies,
in der Jllgen=Niednerschen Zeitschrift für die
historische Theologie, durch einen Auszug in
hochdeutscher Sprache, welcher den Gang, die
Methode, den Geist und Inhalt des Werkes
möglichst zur Anschauung bringen sollte. Diesem
Auszuge ließ ich einige historische Nachrichten
und Erörterungen über den Verfasser und das Buch
vorangehen, so weit die spärlich fließenden
Quellen dies erlaubten. Da das Titelblatt des
aufgefundenen Exemplars fehlt, so boten
besonders die Fragen nach Jahr und Ort des
Druckes nicht geringe Schwierigkeiten dar. Die
gewöhnliche Annahme ist, daß das Buch im J. 1511
aus der Buchdruckerei des Michaelisklosters zu
Rostock hervorgegangen sei. In Hinsicht des Ortes


|
Seite 502 |




|
glaubte ich mich dieser Annahme anschließen zu müssen, obgleich mir nicht bekannt ist, daß die Brüder vom gemeinsamen Leben durch ihre rostocker Druckerei sonst Werken ähnlicher reformatorischer Tendenz Vorschub geleistet haben; in Hinsicht der Zeit aber fand ich keinen Grund, mich gerade für das J. 1511 als das Druckjahr zu entscheiden, mußte es vielmehr für ziemlich wahrscheinlich halten, daß das Druckjahr näher mit der ersten oder zweiten Flucht des Nicolaus Ruß aus Rostock zusammen, also etwa in das J. 1516 falle.
Ohne hier die für die gedachte theologische Zeitschrift bestimmten Mittheilungen wiederholen zu wollen, glaube ich doch einer Entschuldigung nicht zu bedürfen, vielmehr einer gerechten Erwartung zu entsprechen, wenn ich in einer anderen Weise, als die Rücksicht auf theologische Leser es dort erforderte, auch in diesen Jahrbüchern von dem Buche nähere Kenntniß zu geben versuche. Ich habe dort einen Auszug aus demselben in hochdeutscher Sprache veröffentlicht. Als Ergänzung dieser Mittheilung lasse ich hier einige Abschnitte in der Sprache des Originals abdrucken, natürlich in durchaus getreuem Anschluß an den mir vorliegenden Text. Indem ich im Uebrigen auf meine in der niednerschen Zeitschrift niedergelegten einleitenden Bemerkungen verweise, muß ich indessen eine kurze, auch schon dort gegebene Beschreibung des von mir aufgefundenen Werkes, seinem Aeußern nach, voranschicken.
Das Werk hat einen Umfang von 25 Bogenlagen in Folioformat, deren jede, mit Ausnahme der letzten, aus vier Bogen besteht. Jede Seite enthält zwei Columnen. Die Signatur bilden bis zur dreiundzwanzigsten Bogenlage einschließlich die Buchstaben a bis z, mit Auslassung von u und w 1 ), und wird auf den beiden folgenden durch zwei eigenthümliche Zeichen fortgesetzt. Je die vier ersten Blätter einer Bogenlage sind mit der Signatur versehen, z. B. g. j., g. ij., g. iij., g. iiij. Seitenangaben und Columnentitel, so wie Custoden sind nicht vor=


|
Seite 503 |




|
handen. In der letzten Bogenlage fehlt der mittlere (vierte) Bogen. Dadurch ist das Ende des zum Schlusse befindlichen Registers und somit des Werkes selbst verloren gegangen. Denn was auf Bl. 6 a der letzten Bogenlage noch folgt, ist ein zwar ohne allen Zweifel von demselben Verfasser herrührender, doch für sich bestehender Tractat mit der Ueberschrift: "Dit is wedd' de dede van deme louen willen tredē. edder willen nicht louen dat ihūs is des waren godes sone effte de ware messias". Dieser Tractat füllt das sechste Blatt und die erste Seite nebst einer halben Columne der zweiten Seite des siebenten Blattes der letzten Bogenlage. Das übrige dieser Bogenlage ist unbedruckt, auch ohne irgend eine Schlußverzierung oder Druckerzeichen, welches ohne Zweifel am Ende des Registers, auf dem fehlenden Bogen, sich befunden haben wird. Die Schrift besteht in großen Missallettern, deren Form genau den in der schweriner Agende von 1521 gebrauchten Lettern entspricht, wie sie Lisch in der Tabelle zu seiner Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg 1 ) unter I, 3 im Facsimile mitgetheilt hat. Da diese Agende aus der Druckerei des rostocker Michaelisklosters hervorgegangen ist, so liegt in dieser genauen Correspondenz der Schrift eine ziemlich sichere Hinweisung auf den Druckort des in Rede stehenden Werkes, aber freilich meines Ermessens auch die einzige. Denn da außer dem Schlusse auch das Titelblatt fehlt, überdies das Wasserzeichen im Papier von den sonst bekannten in den Drucken der Brüder vom gemeinsamen Leben zu Rostock gänzlich abweicht 2 ), so mangelt es an allen sonstigen Indicien.
Die großen Anfangsbuchstaben der Kapitel sind der ergänzenden Federzeichnung überlassen geblieben, aber nicht nachgeholt worden, vielleicht in Folge des Sturmes, welcher das Buch sogleich bei seinem Erscheinen empfing und die meisten Exemplare vernichtete, so daß nur heimlich und mit Mühe einige wenige der allen zugedachten Vernichtung entgingen. Eine spätere Hand hat in den ersten Kapiteln diesem Mangel auf eine etwas unge=


|
Seite 504 |




|
schickte Weise abzuhelfen gesucht. Von derselben Hand rührt die Bemerkung auf dem unteren Rande der ersten Seite: "Dyth is dath Boeck vann dren strengen" nebst einem in kleinerer Schrift hinzugefügten Satze: "darinne de Lere des Catechismi vorfatet is, 12 articuli fidei, 10 precepta, 7 orationis dominice, cum registro", nicht minder die Worte auf dem oberen Rande derselben Seite: "funiculus triplex difficile rumpitur" mit einer nicht mehr ganz leserlichen Hinweisung auf den Prediger Salomonis.
Der Titel: das Buch von den drei Strängen, gebührt eigentlich nur dem ersten, aus zwölf Kapiteln bestehenden kleineren Theile des Werkes, in welchem Glaube, Hoffnung und Liebe unter dem aus dem Prediger Salomonis entlehnten Bilde von drei Strängen oder Schnüren dargestellt werden, die zu Einem Stricke zusammengeflochten werden, mit dessen Hülfe der Mensch allein im Stande sei, sich aus dem Abgrunde der Sünde und des Todes zu retten. Dieser Theil schließt mit folgenden Worten, aus welchen die Notwendigkeit, den obigen Titel auf diesen ersten Theil des Werkes zu beschränken, deutlich hervortritt: "Hijr endighet sik dat bokeken van deme repe. Hijr heuet sick wedder an de uthlegginghe ouer den louen". Der zweite, Haupttheil des ganzen Werkes, mit neuer Kapitelzählung anhebend, enthält dann in 95 Kapiteln eine Auslegung des apostolischen Symbolums, des Dekalogus und des Vater Unsers.
Ich theile hier aus dem ersten Theile das zehnte Kapitel, aus dem zweiten mehrere charakteristische Stellen mit:
I, 10.
Dat. x. capittel.
Nu is to hope vluchtē ein rep van dren
strenghen. van dem louē. van der hopene.
v
 leue. vnde einiewelik strank is
ghesāmeld van dren stuckē. dat is
van iij. capittelē. effte
vnderscheidē. Noch is nutte to
merkēde dat einiewelik stranck hefft dre
vedeme. alze de loue heft disse dre. De erste is
de bekenninghe. de ander is de leue der
schrifft. de drudde is de belustinghe in gode.
Den erstē vadē spinnen de
dūmen guden eintvoldighen edder simpelen.
den anderē de vornufftighen wisen edd'
cloken. den drudden de vullenkamenen. De ander
strank, de
leue. vnde einiewelik strank is
ghesāmeld van dren stuckē. dat is
van iij. capittelē. effte
vnderscheidē. Noch is nutte to
merkēde dat einiewelik stranck hefft dre
vedeme. alze de loue heft disse dre. De erste is
de bekenninghe. de ander is de leue der
schrifft. de drudde is de belustinghe in gode.
Den erstē vadē spinnen de
dūmen guden eintvoldighen edder simpelen.
den anderē de vornufftighen wisen edd'
cloken. den drudden de vullenkamenen. De ander
strank, de


|
Seite 505 |




|
hopene heft ok dre vedeme. de erste dat
nūmēt vortwyuele. de ander, dat
nūment sundighe up de hopene. de drudde.
dat einiewelik mit siner hopene de sūde
vorschuchtere vnde voriaghe. Auer de leue heft
dissen ersten vadem. dat de leffhebbinghe godes
sy bauen de lifliken wollust, de ander, dat se
sy bauē de lifflikē notrofft. de
drudde. dat se sy bauē dat lifflike
leuent. Unde ein rep dat alzo gheulechtet is dat
kan nicht lengher wesen. wente de salichmaker
ihūs secht iohānis in dem xv.
capittele. Nūment kan groter leue hebben
bauen dat, wen dat he syne sele sette vor syne
vrūde. Dissen vadem span de gotlike
wißheit de sone godes ihūs x
 s. do he van gnaden, nicht van
schuld, willichliken. nicht vnwillighen. nicht
vor syne vrunde. sūder vor syne viende,
vor vns sūd'e syne sele gaff. den
lichā up dat kruce des greselke dodes. Van
disseme spinnende v
s. do he van gnaden, nicht van
schuld, willichliken. nicht vnwillighen. nicht
vor syne vrunde. sūder vor syne viende,
vor vns sūd'e syne sele gaff. den
lichā up dat kruce des greselke dodes. Van
disseme spinnende v
 vedemē secht salomo in den
byspelē in dē latestē ca
vedemē secht salomo in den
byspelē in dē latestē ca
 . dat de starke vrowesnamē
sochte wullē v
. dat de starke vrowesnamē
sochte wullē v
 vlas. v
vlas. v
 heft ghewerket in dē rade
erer hende. ere hāt heft se uthgestrecket
vnde hefft begrepē de spillē. Disse
vrowesnamē van der salomō secht is
de hillige kerke. edd' de sāmelinghe d'
hillighen. dede is eine starke vrowe. de ere
brot nicht v'geues eth. sunder se arbeydet
konliken. dat se mochte vullenbringhen dit
spinnēt vnde dysse vedeme wente vā
dissē vedemen schal alle durbare kled
geweuet wesen. dat ere inghesinde ghekledet mit
tweuoldighen klederen. sik nicht bevruchte vor
den Winter, dat erste kled is vorborghen vnder
deme vodere alse wit blyant. v
heft ghewerket in dē rade
erer hende. ere hāt heft se uthgestrecket
vnde hefft begrepē de spillē. Disse
vrowesnamē van der salomō secht is
de hillige kerke. edd' de sāmelinghe d'
hillighen. dede is eine starke vrowe. de ere
brot nicht v'geues eth. sunder se arbeydet
konliken. dat se mochte vullenbringhen dit
spinnēt vnde dysse vedeme wente vā
dissē vedemen schal alle durbare kled
geweuet wesen. dat ere inghesinde ghekledet mit
tweuoldighen klederen. sik nicht bevruchte vor
den Winter, dat erste kled is vorborghen vnder
deme vodere alse wit blyant. v
 bedudet de vnschuld in der zele.
de wy al hijr nu nicht bekennen an ereme
inghesinde. dat ander buten wendighe klet is de
purpuren d' gude werke dede apenbar schinen vnde
kamē her uth der rechten leue. In dessen
twen klederē gheyt apēbar dat vrame
ghesinde vnses heren ihesu cristi. vnde sine
vortruwede hillige kerke de dar is ene starke
vrouwesname in den dogheden. wēte de
starke v
bedudet de vnschuld in der zele.
de wy al hijr nu nicht bekennen an ereme
inghesinde. dat ander buten wendighe klet is de
purpuren d' gude werke dede apenbar schinen vnde
kamē her uth der rechten leue. In dessen
twen klederē gheyt apēbar dat vrame
ghesinde vnses heren ihesu cristi. vnde sine
vortruwede hillige kerke de dar is ene starke
vrouwesname in den dogheden. wēte de
starke v
 schonheit is eer klet. nicht de
lifflike starke. sunder mit der konheit mit d'
se dore sik uthsetten vor kristo ihesu vnde sine
warheit beth in den doet also dat se vor eme
sterue van plichtinghe effte schult weghen. vor
de he starst
1
) ane schult uth gnadē,
dat de kindere up stande, van den sunden to
schonheit is eer klet. nicht de
lifflike starke. sunder mit der konheit mit d'
se dore sik uthsetten vor kristo ihesu vnde sine
warheit beth in den doet also dat se vor eme
sterue van plichtinghe effte schult weghen. vor
de he starst
1
) ane schult uth gnadē,
dat de kindere up stande, van den sunden to


|
Seite 506 |




|
den dogheden, vnde gnaden v
 heten se de ald' selighesten vnde
ere man ihesus de hefft se ghelauet. wente se
hefft ere munt uppe ghedan to der wißheit des
hillighen ghestes v
heten se de ald' selighesten vnde
ere man ihesus de hefft se ghelauet. wente se
hefft ere munt uppe ghedan to der wißheit des
hillighen ghestes v
 de en der guden is ghewesen in
eremem munde, vele dochtere, dat is vele
hillighe zelen. hebben ghesammelt rike dage. dat
is vele doghede. men se hefft fe allene auer
treden. wente de hillige kerke de dar is de
ewige vor truwede ihesu cristi. de he ghevriget
hefft dre vnde druttich iar myt er hefft he
ghearbeydet. vmme eren willen, do he an dem
Cruce hēghede do wart he mit deme spere
ghestekē an sine hillighē sidē
de en der guden is ghewesen in
eremem munde, vele dochtere, dat is vele
hillighe zelen. hebben ghesammelt rike dage. dat
is vele doghede. men se hefft fe allene auer
treden. wente de hillige kerke de dar is de
ewige vor truwede ihesu cristi. de he ghevriget
hefft dre vnde druttich iar myt er hefft he
ghearbeydet. vmme eren willen, do he an dem
Cruce hēghede do wart he mit deme spere
ghestekē an sine hillighē sidē
 me eren wyllē is he
ghestoruē. desse is em gantz leff to d' he
secht in deme boke canticorj Du bist auer al
schone mine vrūdinne nene beuleckinghe is
in dy, kū du scholt gekronet werdē.
Disse vortruwede hillighe kerke de dar is de
sāmelinge aller hillighē. der x
me eren wyllē is he
ghestoruē. desse is em gantz leff to d' he
secht in deme boke canticorj Du bist auer al
schone mine vrūdinne nene beuleckinghe is
in dy, kū du scholt gekronet werdē.
Disse vortruwede hillighe kerke de dar is de
sāmelinge aller hillighē. der x
 s is ere aldwerdigheste houet
disser hilligē kerkē alse he ein
mynsche is so hefft he auer treden in dē
rike daghen alle werdicheit. der anderen
dochtere dat is alle andere zele. de dar is ein
docht' x
s is ere aldwerdigheste houet
disser hilligē kerkē alse he ein
mynsche is so hefft he auer treden in dē
rike daghen alle werdicheit. der anderen
dochtere dat is alle andere zele. de dar is ein
docht' x
 i. v
i. v
 disse vortruwede ropt ereme
brudegāme in dē sengen salomonis.
the my na dy vor nym uth d' ydelicheit desser
werlt to d' ewighen salicheit. Unde the dy myt
deme repe des louē. der hopene v
disse vortruwede ropt ereme
brudegāme in dē sengen salomonis.
the my na dy vor nym uth d' ydelicheit desser
werlt to d' ewighen salicheit. Unde the dy myt
deme repe des louē. der hopene v
 d' leue de dar touorne geulechtet
is. wēte dar to is dit rep ghemaket.
d' leue de dar touorne geulechtet
is. wēte dar to is dit rep ghemaket.
II, 12.
Dat. xij. capittel.
Dat veerde stucke settede sunte andreas seggende,
he heft gheleden vnder poncio pilato. he is
ghecrucighet. ghestoruen vnde begrauen. he leth
gantz vele droffnisse mer wēne dre vnd
dortich iar. wyllighen ghinck he to deme groten
bitteren lidende, vnder poncio pylato deme
vnrechtuerdighen richtere. de sulve pylatus was
her van der yeghene dede ghenomet was pontus. he
is ghecrucighet myt einer scharpen dorne
kronē, de em in sin houet wart ghedrucket
mit grot' wedaghe he is ghestoruen. up dat he
ghenoch dede vor
 se wollust, vor
se wollust, vor
 sen hoen v
sen hoen v
 vor vnsen doet. he is bedrouet
beth to d' vorblotinghe des latesten cleides,
dat he willighen gaff den ritterē. up dat
he ghenoch dede vor vnse giricheit mit synem
armode, he leid den honliken doet mank synen
bekanden vnde van den synen, vnde in d' stad
steruende honliken. updat he vnsen homoet
dellighede. he leid in alle syne
vor vnsen doet. he is bedrouet
beth to d' vorblotinghe des latesten cleides,
dat he willighen gaff den ritterē. up dat
he ghenoch dede vor vnse giricheit mit synem
armode, he leid den honliken doet mank synen
bekanden vnde van den synen, vnde in d' stad
steruende honliken. updat he vnsen homoet
dellighede. he leid in alle syne


|
Seite 507 |




|
lithmaten. updat he ghenoechdede vor vnse
gheylicheit, dede alle vnse lythmate begrepen
hefft. vnde aldus hefft he arm, odmodich v
 drofflik vorhonet vnse giricheit.
vnsen homod vnde vnse vnkuscheit. Unde dat he
vns mit syneme dode vorlozede van deme ewighen
dode. Unde leid an deme holte. updat de slanghe,
dat is de duvel. dede hadde ouerwunen in deme
holte, worde wedder ouerwūnen an deme
holte, van vnseme leuen heren ihū cristo.
Ok starff he warafftighen an deme lichāme.
des doch syn licham nycht vorgaen konde, nicht
allene vmme der saluinghe willen, mit welkere he
ghesaluet was. men dar
drofflik vorhonet vnse giricheit.
vnsen homod vnde vnse vnkuscheit. Unde dat he
vns mit syneme dode vorlozede van deme ewighen
dode. Unde leid an deme holte. updat de slanghe,
dat is de duvel. dede hadde ouerwunen in deme
holte, worde wedder ouerwūnen an deme
holte, van vnseme leuen heren ihū cristo.
Ok starff he warafftighen an deme lichāme.
des doch syn licham nycht vorgaen konde, nicht
allene vmme der saluinghe willen, mit welkere he
ghesaluet was. men dar
 me. wente van der hillighen
dreualdicheit was id alzo gheschikket.
me. wente van der hillighen
dreualdicheit was id alzo gheschikket.
II, 24.
Dat. xxiiij. capittel.
Dat ander stucke disses artikels is to louende
dat ewighe leuent. vornym dat einiewelick
mynsche wert ewich. vnde alzo wert he hebben dat
ewighe leuent. Auer de bozen werden nycht hebben
dat ewighe leuent. van deme de here ihesus secht
iohannis in deme. xvij. ca
 Dyt is dat ewighe leuent, dat se
dy alleine bekennen einen waren got. vnde den du
ghesant hest ihesum x
Dyt is dat ewighe leuent, dat se
dy alleine bekennen einen waren got. vnde den du
ghesant hest ihesum x
 m. Uth disser rede hestu. dat to
bekennende den vader. den sone vnde den
hillighengeist in deme hemmelrike. dat is dat
ewighe leuent. dat is, in gode ewichliken
leuēdich wesen ene to bekennende. vnde in
em sick belustende. vnde dat sūte pawel
secht. j. corinthiorū. v. inuorende de
schrifft des propheten ysaie. vj. dede secht.
dat dat oghe nycht gheseen hefft. noch dat ore
ghehort hefft. noch ghesteghen is in dat herte
des mynschen welkerleye dink got bereit hefft
synen leffhebberen. Dar vmme so kone wij nicht
vele segghen van deme ewighen leuende. dat is
van der ewigen vroude. Dar umme secht de innighe
lerer sunte augustinus. Lichter moghe wij
spreken van dē ewighen leeuende wat dar
nicht is wen wat dar is. Dar en is neen doet.
dar en is neen hulueren. dar en is ok neen
kūmer. dar is neen vormodet arbeident. dar
is nene bedroffnisse. dar is nene wedaghe. dar
is neue vrnchte. dar is nene bozheit. dar is
neen iammer. dar is neene bekoringhe. dar is
neen hūgher. neen dorst. nene hette. neen
vorderff. nene krankheit. neen vighende. dar is
ock neene
m. Uth disser rede hestu. dat to
bekennende den vader. den sone vnde den
hillighengeist in deme hemmelrike. dat is dat
ewighe leuent. dat is, in gode ewichliken
leuēdich wesen ene to bekennende. vnde in
em sick belustende. vnde dat sūte pawel
secht. j. corinthiorū. v. inuorende de
schrifft des propheten ysaie. vj. dede secht.
dat dat oghe nycht gheseen hefft. noch dat ore
ghehort hefft. noch ghesteghen is in dat herte
des mynschen welkerleye dink got bereit hefft
synen leffhebberen. Dar vmme so kone wij nicht
vele segghen van deme ewighen leuende. dat is
van der ewigen vroude. Dar umme secht de innighe
lerer sunte augustinus. Lichter moghe wij
spreken van dē ewighen leeuende wat dar
nicht is wen wat dar is. Dar en is neen doet.
dar en is neen hulueren. dar en is ok neen
kūmer. dar is neen vormodet arbeident. dar
is nene bedroffnisse. dar is nene wedaghe. dar
is neue vrnchte. dar is nene bozheit. dar is
neen iammer. dar is neene bekoringhe. dar is
neen hūgher. neen dorst. nene hette. neen
vorderff. nene krankheit. neen vighende. dar is
ock neene


|
Seite 508 |




|
macht to sundighende. noch ienighe macht to
vordenende.
1
)
sūder dar is rouwe von arbeit, vrede
vā den vighendē. sekerheit van
bekūmeringhe. v
 vordrukkinghe. dar werden de lude
alze de enghele godes. dar werdē de
rechtuerdighen schyne alze de sūne in
dē rike godes. dar werd alletijt dat
leuent ane den doet. de dach ane de nacht,
wißheit ane twiuel. vronde ane wedaghe.
sekerheit ane vruchte. vredesāmicheit ane
arbeit, wetenheit ane erdoem. dar is vrede ane
ende. starcke ane losicheit. rechticheit ane
vorkeringhe. schonheit ane mistaldicheit.
sūtheit ane krankheit. lucke ane vnlucke.
warheit ane lichticheit. de leue ane
vorwitīghe. salicheit ane kūmer dar
is dat rechte guet ane vnrechticheit. dar is ere
ane ghebrek. dar is eddelicheit ane nolicheit.
leffhebben aller ane besmittinghe vnde ane
vnreynicheyt. dechtnisse ane vorghetent. vornuft
ane dwelinghe. de wille ane bekūmernisse.
gunst myt kuscheyt. eindracht aller, vnde vroude
ane ende. - - - - - - - - - - - - - - - - Unde
aldus hestu dat du werst got bekennen, du werst
ene leffhebben. vnde leffhebbende werstu dy in
em belusten. vnde belustende werstu to vreden
setthen de vornufft vnde den willen, alzo dat
sik nu nerghene uth thut, noch de wille, noch de
vornufft alze fe sik nu uththen in vnstedicheit
mank den scheppinghen. de den willē nicht
sadighen konen. hijr
vordrukkinghe. dar werden de lude
alze de enghele godes. dar werdē de
rechtuerdighen schyne alze de sūne in
dē rike godes. dar werd alletijt dat
leuent ane den doet. de dach ane de nacht,
wißheit ane twiuel. vronde ane wedaghe.
sekerheit ane vruchte. vredesāmicheit ane
arbeit, wetenheit ane erdoem. dar is vrede ane
ende. starcke ane losicheit. rechticheit ane
vorkeringhe. schonheit ane mistaldicheit.
sūtheit ane krankheit. lucke ane vnlucke.
warheit ane lichticheit. de leue ane
vorwitīghe. salicheit ane kūmer dar
is dat rechte guet ane vnrechticheit. dar is ere
ane ghebrek. dar is eddelicheit ane nolicheit.
leffhebben aller ane besmittinghe vnde ane
vnreynicheyt. dechtnisse ane vorghetent. vornuft
ane dwelinghe. de wille ane bekūmernisse.
gunst myt kuscheyt. eindracht aller, vnde vroude
ane ende. - - - - - - - - - - - - - - - - Unde
aldus hestu dat du werst got bekennen, du werst
ene leffhebben. vnde leffhebbende werstu dy in
em belusten. vnde belustende werstu to vreden
setthen de vornufft vnde den willen, alzo dat
sik nu nerghene uth thut, noch de wille, noch de
vornufft alze fe sik nu uththen in vnstedicheit
mank den scheppinghen. de den willē nicht
sadighen konen. hijr
 me de hēmelsche sadicheit
het eine vullenkamene sadinghe ane ghebrek.
wēte de opperste gotheit, de
vnbegripellike ghude sadighet de vornufft. den
willen. vnde ock dat dechtnisse. alzo dat de
salighe wert hebbē allēt wat he wil
vnde beghert. vnde nicht quades kan he willen
edder begheren. hijr vmme secht sunte augustinus
vnde ok de heindensche meister seneca. dat de
ienne salich is, dede hefft al wat he wil. vnde
wil nicht quades. vnde so de mynsche ein dinck
aldermeist sik beuruchtet. dat is den dod vnde
beghert aldermeist dat leuent vnde alzo vruchtet
de mynsche den doet vnde beghert dat leuent.
Unde dar ūme lauet de here ihesus vaken
deme mynschen dat ewighe leuend. segghende. We
in my leuet, de hefft dat ewighe leuent. Dar
vmme secht de hillighe leerer sunte augustinus.
O mynsche, wat begherstu leuēdich to
wesende. du werst dat leuent
me de hēmelsche sadicheit
het eine vullenkamene sadinghe ane ghebrek.
wēte de opperste gotheit, de
vnbegripellike ghude sadighet de vornufft. den
willen. vnde ock dat dechtnisse. alzo dat de
salighe wert hebbē allēt wat he wil
vnde beghert. vnde nicht quades kan he willen
edder begheren. hijr vmme secht sunte augustinus
vnde ok de heindensche meister seneca. dat de
ienne salich is, dede hefft al wat he wil. vnde
wil nicht quades. vnde so de mynsche ein dinck
aldermeist sik beuruchtet. dat is den dod vnde
beghert aldermeist dat leuent vnde alzo vruchtet
de mynsche den doet vnde beghert dat leuent.
Unde dar ūme lauet de here ihesus vaken
deme mynschen dat ewighe leuend. segghende. We
in my leuet, de hefft dat ewighe leuent. Dar
vmme secht de hillighe leerer sunte augustinus.
O mynsche, wat begherstu leuēdich to
wesende. du werst dat leuent


|
Seite 509 |




|
hebbende. vnde wat vruchtestu di doch to steruende. du werst hebbende dat ewighe leuent. Dar vmme leue truwe cristene mynsche, loue dyt vaste dat du werst hebben dat ewige leuent. isset dat du vulleherdich bist in d' gnade godes dines salichmakers. vruchte dy nicht tho steruende vor cristo na deme lichāme. de maket di wedder leuendich to ewighen tijden gheuende dy dat ewighe leuent. bevruchte dy nicht to vorlesende dat tijtlike leuent. dat vordretlike leuēt du werff 1 ) aff langhen de ewige vrolicheit. wente got de here ghifft den sinen dat ewighe leuent.
C. 33. - -. vnde enkede wēner wij rechte
vns suluen anseen, so beuinde wij in der
warheit. dat dat ald'meiste deel mank vns
cristen is besmittet mit affgoderighe. Wo dunket
dy, eere wij nicht mer mit kneboghende den
affghoden, den riken disser werlid, wen gode dem
heren. vnde dat
 me tijtlikes ringhes nuttes
willen, mer wen
me tijtlikes ringhes nuttes
willen, mer wen
 me erer eddelheit willen, edder
me erer eddelheit willen, edder
 me geistliker bate willen. Lat vns
geistlikē anseen. synt wij gicht vlitigher
tho denende den hertighen, edder anderen heren
vnde vorsten, wen godes denst tho ouende.
likerwijs ok werltlike lude. Unde nicht alleine
disse hebben sik alze affgodere. sunder ok alle
de iennen dede sodan kneboghent van anderen
upnemē mit begheringhe. v
me geistliker bate willen. Lat vns
geistlikē anseen. synt wij gicht vlitigher
tho denende den hertighen, edder anderen heren
vnde vorsten, wen godes denst tho ouende.
likerwijs ok werltlike lude. Unde nicht alleine
disse hebben sik alze affgodere. sunder ok alle
de iennen dede sodan kneboghent van anderen
upnemē mit begheringhe. v
 sunderghen de gheistliken, nicht
betrachtende dat de hilligen apostele cristi,
vnde ok vele andere hilligen den luden
vorbodē sik vor en to kneboghende. In
disser affgoderighe synt ok gantz vele
vrouwesnamen. dede alze de affgodinne dyana
gheciret, laten ander lude vor sik boghen de
kne. vnde begheren dat. vnde hebben in deme
sunderghe belustinghe. Ok synt se in disser
sunde der affgoderighe, dede sik upproppen alze
de bilde. alze dede in de wamboze bomwullē
steckē, dat me meinen scholde, dath se van
grother borst synt, vnde alzo stark vnde driste.
Likerwijs ok de vrouwesnamen. dede sik verwet.
edder vrōmede hare to vlighet. vnde is dar
mer vlitich to, dat se anderē
minschē mer behaghen mochte wen gode deme
herē. Unde van sodanen secht iohannes
crisostomi, dat is de mit deme guldene munde,
dat se vnrecht don der gantzen hillighen
dreualdicheit. wente alzo doende, so berouen se
dat bilde godes. edder tosetten to deme bilde
godes. vnde be=
sunderghen de gheistliken, nicht
betrachtende dat de hilligen apostele cristi,
vnde ok vele andere hilligen den luden
vorbodē sik vor en to kneboghende. In
disser affgoderighe synt ok gantz vele
vrouwesnamen. dede alze de affgodinne dyana
gheciret, laten ander lude vor sik boghen de
kne. vnde begheren dat. vnde hebben in deme
sunderghe belustinghe. Ok synt se in disser
sunde der affgoderighe, dede sik upproppen alze
de bilde. alze dede in de wamboze bomwullē
steckē, dat me meinen scholde, dath se van
grother borst synt, vnde alzo stark vnde driste.
Likerwijs ok de vrouwesnamen. dede sik verwet.
edder vrōmede hare to vlighet. vnde is dar
mer vlitich to, dat se anderē
minschē mer behaghen mochte wen gode deme
herē. Unde van sodanen secht iohannes
crisostomi, dat is de mit deme guldene munde,
dat se vnrecht don der gantzen hillighen
dreualdicheit. wente alzo doende, so berouen se
dat bilde godes. edder tosetten to deme bilde
godes. vnde be=


|
Seite 510 |




|
wisen alzo in den werkē gherade ifft got de vader nicht konde. vnde dat god de sone nicht wiste. vnde got de hillighegeist nicht ghudliken wolde den mynschen alzo scheppen, vnde wowol se dat nicht sprekē mit deme munde. so bewisen se dat doch mit den werkē, dat se willen wesen better scheppere wen god ts. Lichte kumpt sūmelkē van en in den danken, dat weret in ereme willen, dat se wat beth scheppen wolden. vnde licht kumpt en seldene in dat herte dat se disse dorheit beruwen vnde se bichten. vnde gheuen sik gode ereme heren schuldich van disser affgoderighe. dat eine gantz grote sūde is.
C. 41. - - Unde enkede in dissem ioden capittele
sint vele ieghenwardighe papē. de dar to
then. dat me en leuer geue wen deme vader vnde
d' moder. den kinderen vnde armen vrūden.
vnde dede mere achten ere vunde, wen de bade
godes. alze de bade der bischope. der meistere
vnde eecloken. dede willen dat me ere vūde
vlitigher beware wen de bade godes. darvmme wen
de truwen iungere cristi overtreden ere bade.
denne vorbannen se vnde honen vnde schenden vnde
voriaghen se. sūder wen de bozen mynschen
ouertredē de gotlikē bade, des
achten se nicht, noch bekumeren de ouertredere.
wente sulven holden se de bade godes nicht.
Likerwijs de werltlikē heren vnd vorsten.
wrekē gantz sere de ouertredinghe erer
bade. edd' eren hon. sūder de verhoninghe
godes dede schued in d' ouertredinghe siner
bade, in swerende. in vlokende. in scheldende,
in apenbareme kopslaghende des sondages. in
drūkenheit. in toverighe. vnde in anderen
apenbaren sūden. des achte se nicht.
Sūd' we ere bod nicht hold. de mod
lidē. Doch anders wert doen de here
ihesus. de rechtuerdighe richter. dede secht an
deme iūghesten daghe sodanen richteren,
alze he den ioden sede. Woru
 e holde gij nicht myn bod.
e holde gij nicht myn bod.
 me iuwer ansettinge. vnde se
sedē welker? v
me iuwer ansettinge. vnde se
sedē welker? v
 he antwarde en dit mathei xv.
gheuet wat einemeisliken to hort. my hebbe gij
nicht gheuē de ere deme neghestē de
leue. vnde iw suluē de bewaringhe vor de
sunde. Gij papen gij hebbet berouet de
armē mit der listighen loghene. vnde myt
der gheistliken kopenschop. edder symonighe vnde
gij werltliken mit deme woker. mit
he antwarde en dit mathei xv.
gheuet wat einemeisliken to hort. my hebbe gij
nicht gheuē de ere deme neghestē de
leue. vnde iw suluē de bewaringhe vor de
sunde. Gij papen gij hebbet berouet de
armē mit der listighen loghene. vnde myt
der gheistliken kopenschop. edder symonighe vnde
gij werltliken mit deme woker. mit
 rechtuerdighen richte myt walt.
myt nygen vunden. auer alle disse wert vnse leue
here ihesus betughen. alze he ouer de ioden
betughedt. dat se vader vnde moder vnereden
rechtuerdighen richte myt walt.
myt nygen vunden. auer alle disse wert vnse leue
here ihesus betughen. alze he ouer de ioden
betughedt. dat se vader vnde moder vnereden
 me der ensettinghe.
me der ensettinghe.


|
Seite 511 |




|
C. 59. - - Alzo hebben ghetughet de hillighen
prophete v
 de hilligen apostele. vnde darna
de anderen leuen hilligen. darūme weren se
rechte tughe godes. Auer de ieghenwardighen
papen willen nicht alzo don. Sunder anders
willen se. dat me en loue. alze wen se dat
afflath gheuen vor ghelt. so were id gued dat
sik de lude vorwissen latē mit der
hillighen schrifft. edder mit gotliker
apenbaringhe. edder mit liffliker sinliker
bekātnisse. vnde nadēmale dat en dat
nūmend betughet. so scholdē de lude
dar borghen vor nemen. dat id wisse were. v
de hilligen apostele. vnde darna
de anderen leuen hilligen. darūme weren se
rechte tughe godes. Auer de ieghenwardighen
papen willen nicht alzo don. Sunder anders
willen se. dat me en loue. alze wen se dat
afflath gheuen vor ghelt. so were id gued dat
sik de lude vorwissen latē mit der
hillighen schrifft. edder mit gotliker
apenbaringhe. edder mit liffliker sinliker
bekātnisse. vnde nadēmale dat en dat
nūmend betughet. so scholdē de lude
dar borghen vor nemen. dat id wisse were. v
 dat se dat gheld nicht vorgheues
uthgeuē. wente anders werden se lichte
vnde ringhe bedraghen. Wente weret dat de gantze
werlid den ludē wat betughede. vnde were
id nicht alzo. denne tugheden se alle valsch.
Unde de boßheit helpt nicht vor gode ouerwind de
warheit wēte de warheit ouerwind to
ewigē tiden. wowol dat se thor tijt is
dale slaghen. darūme de truwe leffhebbere
der warheit achten nicht uppe de valschen tughe.
nauolghende eren salichmaker. ieghen den
valschen tughet hebben de bischope. de prestere.
vnde dat mene volk. dat bedraghē was
seggende, dat he werdich were des dodes. alze
ein misdeder v
dat se dat gheld nicht vorgheues
uthgeuē. wente anders werden se lichte
vnde ringhe bedraghen. Wente weret dat de gantze
werlid den ludē wat betughede. vnde were
id nicht alzo. denne tugheden se alle valsch.
Unde de boßheit helpt nicht vor gode ouerwind de
warheit wēte de warheit ouerwind to
ewigē tiden. wowol dat se thor tijt is
dale slaghen. darūme de truwe leffhebbere
der warheit achten nicht uppe de valschen tughe.
nauolghende eren salichmaker. ieghen den
valschen tughet hebben de bischope. de prestere.
vnde dat mene volk. dat bedraghē was
seggende, dat he werdich were des dodes. alze
ein misdeder v
 alze ein ketter. - -
alze ein ketter. - -
C. 60. - - dat sprekent ieghen god is de sunde,
dede heth eyn honslaghent. vnde dat schut
drigerleiwijs. To dem ersten. wānner dat
iument in deme sprekende gode wat to lecht dat
em nicht en themet. alze dat goth ouel deyt. To
dem anderēmale. wen me myt worden gode aff
thut dat gode themet. alze wen men sede dat goth
nicht allemechtich is. edd' dat got nicht bekent
alle dinck. To deme drudden male. wāner
dat me einer puren scheppinghe to lecht dat
ghode alleine euen kumpt, alze wen me secht. dat
de pape scheppet den licham godes wen he wil.
edder wen me secht. dat einyewelik pape mit
siner macht mach de sunde vergheuen wen he wil.
In der erstē honslaginghe sundighen de
iodischen prestere seggende, dat de here
ihūs honslagende. vnde dat he ein
sūder is. vnde ein vorleid'. Mit der
anderē honslaginge sundighen se seggende,
dat vnse leue here ihūs nene macht heft de
sūde to vorgheūende. Mit d' drudden
wise honslaghen de cristliken papen seggende,
dat se mit erer macht de sunde vorgheuen. vnde
dat se to der holle senden weme se willē.
vnde to deme hēmele wē se willen,
v
 disse sundighen swarliker wen de
iodischen prestere sundighen. -
disse sundighen swarliker wen de
iodischen prestere sundighen. -


|
Seite 512 |




|
C. 61. - - Leider disse bitenden hunde synt gantz
sere vormerd. vnde dat achterkopent is nu so in
de wonheit kamen. dat se id vor nene sūde
hebben. Wente leider de papē. wen se
antheen de miscleide so achterkopen se noch. Jk
hebbe id vakene mit mynē oren ane hort.
v
 na der missen wen se in der
kerken weiffeleren ghaen. so vrethen se dat
leuendighe vleesch. eer wen dat dat ghesaden is.
vnde wat is eine groter achterkopinghe. wen
synen negheste einen ketter hetē. edd'
anders schenden. v
na der missen wen se in der
kerken weiffeleren ghaen. so vrethen se dat
leuendighe vleesch. eer wen dat dat ghesaden is.
vnde wat is eine groter achterkopinghe. wen
synen negheste einen ketter hetē. edd'
anders schenden. v
 aldus denen se mer dē
duuele wen gode deme herē. vnde synt nicht
werdich dat se dat brod ethen. Alze sunte
augustinus secht. Unde ok de mōnike.
baginen. vnde eūnen acht'kopen
anderē vnderwilen mer, wen de
werldlikē bewasschende de leuēdighen
v
aldus denen se mer dē
duuele wen gode deme herē. vnde synt nicht
werdich dat se dat brod ethen. Alze sunte
augustinus secht. Unde ok de mōnike.
baginen. vnde eūnen acht'kopen
anderē vnderwilen mer, wen de
werldlikē bewasschende de leuēdighen
v
 de dodē. segghende. alze
sūte dauid secht. Mit dem dede acht'kopet
sineme neghesten hebbe ik nicht geghetē. O
mit weme scholde de truwe minsche eueten.
wē he nicht wolde ethen mit den
achterkoperen. wente allerweghen voden se sik nu
myt achterkopende by den tafelen der papen. by
der se sitten. kume se ein stucke in de
mūt steken. se spreken x achterkopende
worde, darūme vnbarmehertigher vrethen se
eren neghesten. wen dat vleisch. wēte ouer
dat vleisch gnisteren se so sere nicht mit den
thenen, alze ouer den neghesten. Darūme
secht de rechtuerdighe got dar dauite. Se
gnisterden ouer my mit eren thenen. - -
de dodē. segghende. alze
sūte dauid secht. Mit dem dede acht'kopet
sineme neghesten hebbe ik nicht geghetē. O
mit weme scholde de truwe minsche eueten.
wē he nicht wolde ethen mit den
achterkoperen. wente allerweghen voden se sik nu
myt achterkopende by den tafelen der papen. by
der se sitten. kume se ein stucke in de
mūt steken. se spreken x achterkopende
worde, darūme vnbarmehertigher vrethen se
eren neghesten. wen dat vleisch. wēte ouer
dat vleisch gnisteren se so sere nicht mit den
thenen, alze ouer den neghesten. Darūme
secht de rechtuerdighe got dar dauite. Se
gnisterden ouer my mit eren thenen. - -
C. 62. - - Leider de werlid is nu alzo vordrunken
in der bozheit, dat de preddikere, meistere,
vnde andere truwe cristen, dede vorkundighen de
schrift godes. de bade vnde rade eres
salichmakers. de hed me nu dwelafftich. vnde
vnderwilē kettere vnde vorbannene
verleid'e, alzo dat wa
 er īūmend begind to
sprekende uth d' schrifft godes. edder uth den
badē godes. tohand seggen de bitenden
hunde. dat is ok ein ketter, vnde gheuē
sik ein teken seggēde. De sint alle
ketterer de de bade godes preddiken. vnde de so
schriuē in eren husen. vnde alzo hebben se
nu beslatē de ee godes, de vnse
salichmaker cristus verkundighet hefft. dat se
na der wonheit iennigher papen. vnde
dunckelguden. dede cristū mordeden. so
weghen se mer de mynschlikē vūde
vnde ansettīge, wen de ee godes. vnde de
iūgherē cristi rekenen se alze
vorbannene lude. Auer de truwen. dede trost
hebben uth der schrifft. de vorlaten nicht de
warheit
er īūmend begind to
sprekende uth d' schrifft godes. edder uth den
badē godes. tohand seggen de bitenden
hunde. dat is ok ein ketter, vnde gheuē
sik ein teken seggēde. De sint alle
ketterer de de bade godes preddiken. vnde de so
schriuē in eren husen. vnde alzo hebben se
nu beslatē de ee godes, de vnse
salichmaker cristus verkundighet hefft. dat se
na der wonheit iennigher papen. vnde
dunckelguden. dede cristū mordeden. so
weghen se mer de mynschlikē vūde
vnde ansettīge, wen de ee godes. vnde de
iūgherē cristi rekenen se alze
vorbannene lude. Auer de truwen. dede trost
hebben uth der schrifft. de vorlaten nicht de
warheit
 me x
me x
 m. - -
m. - -


|
Seite 513 |




|
C. 68. - - Doch schal he nicht vrūchte. dat
em de were to der verdomenisse. nadēmale
dat he wis is dat se ene bānen
vnschuldighen. edder lichte darūme dat se
ene stotten van deme willen godes.
 n to deme is de benedighinghe des
ald'hoghesten bischopes x
n to deme is de benedighinghe des
ald'hoghesten bischopes x
 i. dede secht. mathei in dē
v den sinen. de se vorba
i. dede secht. mathei in dē
v den sinen. de se vorba
 en
en
 me synen louē edd' vnschult.
Gij werdet salich, wanner dat iw de lude vloken
werden, vnde werdē iw voruolghen
me synen louē edd' vnschult.
Gij werdet salich, wanner dat iw de lude vloken
werden, vnde werdē iw voruolghen
 n sprekē alle quad ieghen
iw. leghende.
n sprekē alle quad ieghen
iw. leghende.
 me minē namē. Unde
echt' in dē euāgelio luce secht he.
Salich werde gij, wanner iw de lude hatē.
v
me minē namē. Unde
echt' in dē euāgelio luce secht he.
Salich werde gij, wanner iw de lude hatē.
v
 wa
wa
 er se iw affscheden. voreym van d'
meinheit. v
er se iw affscheden. voreym van d'
meinheit. v
 vorhonē iw. v
vorhonē iw. v
 vorwerpen iuwen namē alze
einen quadē.
vorwerpen iuwen namē alze
einen quadē.
 me des mynschen sone. vrouwet iw
in dē daghe
me des mynschen sone. vrouwet iw
in dē daghe
 n hoghet iw. sed iuwe lon ist
groet in dē hēmelē. wēte
alzo dedē ere ved'e den pphetē.
Disse worde schal ouerdenkē de truwe
cristē. v
n hoghet iw. sed iuwe lon ist
groet in dē hēmelē. wēte
alzo dedē ere ved'e den pphetē.
Disse worde schal ouerdenkē de truwe
cristē. v
 schal gherne liden vor sinen
salichmaker.
schal gherne liden vor sinen
salichmaker.
 n schal vlitich syn dat he nene
sūde do.
n schal vlitich syn dat he nene
sūde do.
 n besūderghen nene
dodsūde. Wēte wen he alzo leuet so
is he in d' hillighen meinschop vor gode. wowol
dat he is vorworpē, vordreuē. v
n besūderghen nene
dodsūde. Wēte wen he alzo leuet so
is he in d' hillighen meinschop vor gode. wowol
dat he is vorworpē, vordreuē. v
 voruloket, vor den ludē van
den
voruloket, vor den ludē van
den
 latē. U
latē. U
 wedder
wedder
 me. alle dede is ī
dodsūde. de is uthedreuē in d' tijt
vth d' hillighen meinschop. alzo dat he in d'
tijt nicht hillich is in d' leue vor gode. wowol
he vor den ludē gud
me. alle dede is ī
dodsūde. de is uthedreuē in d' tijt
vth d' hillighen meinschop. alzo dat he in d'
tijt nicht hillich is in d' leue vor gode. wowol
he vor den ludē gud
 n hillich schynd. - -
n hillich schynd. - -
C. 78. - - Du schalt nicht stelen, dat is ane den
willē godes schaltu nicht nemē dines
neghesten gudere.
 n so schaltu ene nicht
berouē. noch myt wokere noch mit walt noch
mit vnrechtē oredele efte schattinghe.
noch mit valscheme vorclagēde. noch mit
vorholdinghe des vordendē lons. effte du
n so schaltu ene nicht
berouē. noch myt wokere noch mit walt noch
mit vnrechtē oredele efte schattinghe.
noch mit valscheme vorclagēde. noch mit
vorholdinghe des vordendē lons. effte du
 ster ghelt esschende vor de
sacramēte. vor da afflat. Myt disser
rouerige sint vele papē seer besmittet.
dede neen sacramente vorgeues willen gheuen
v
ster ghelt esschende vor de
sacramēte. vor da afflat. Myt disser
rouerige sint vele papē seer besmittet.
dede neen sacramente vorgeues willen gheuen
v
 stelen so dat ghelt den
armē. - -
stelen so dat ghelt den
armē. - -
C. 82. - - Darūme wowol dat de heghestere edder ein ander vogel secht de worde des bedes, doch in rechter warheit bedet se nicht. vnde de orghelen wowol dat se klinghen. so en beden se doch nycht. likerwijs is yd van den kloster nūnen. dede singhen vnde vernemen des nicht. alze ein heghester. Darumme dat dat lutbare beth gud sy. so hort dar to sosleighe. alze du hest in dissen verschen wen du god den heren lauest. ene lauende


|
Seite 514 |




|
so beware sos dinghe. Sende dat herte upwart to
ghode. Spreck rechte vnde se to deme sinen. de
danke ss upghehauen. De vote to hope vnde de
oghen dalewart. De ersten dre dingk de schal de
minsche alletijt an sick hebben. wanner dat he
innighen beden wil. alzo dat he den danken
upheue. vnde dat he ok de worde rechte spreke.
vnde dat he se ok hebbe in dem sinne. Sunder de
anderen dre dinge, alze dat de danke sy
uppehauē. dat is dat he von gode denke.
 n dat de vote to hope sint. dat is
dat he nicht ga. v
n dat de vote to hope sint. dat is
dat he nicht ga. v
 dat de oghen syn dalewart. de
moghen vnd'wilen wol vorwādelt
werdē. wēte vnderwilen mach de
mynsche gande bedē. vnderwilen de oghen
upheuē to dē hēmele alze x
dat de oghen syn dalewart. de
moghen vnd'wilen wol vorwādelt
werdē. wēte vnderwilen mach de
mynsche gande bedē. vnderwilen de oghen
upheuē to dē hēmele alze x
 s. v
s. v
 vnderwilen denkē van
anderē dingeē wen von gode. alze dat
got vnd'wilen gifft. sūder to dē
erstē dat alletijt dat bed sy ane dodsūde.
vnderwilen denkē van
anderē dingeē wen von gode. alze dat
got vnd'wilen gifft. sūder to dē
erstē dat alletijt dat bed sy ane dodsūde.
C. 92. - - Vortmer hest du hijr uth. dat wowol
dat de prester mach de sūde vorgheuen.
doch mach he des nicht doen wen he wil. vnde
alze he wolde. darūme. wēte he kan
nicht vorgheuen de schult de ieghen god geschen
is. yd en sy denne dat so goth vorgheue. To deme
anderen male. wente myt syner macht kan he de
sele nicht reinighen van d' besmittinghe. Unde
to deme druddēmale. wente he en weth nicht
efft de wylle godes is to der vorgheuinghe. To
deme verden male. wente he en weth nicht. iffte
in deme sundighen minschen dede sundighet rechte
ruwe is. ok en weth he nicht efft he de warheit
secht in der bicht edd' efft he lucht.
darūme vraghet he wo he ghesundighet
hefft. Uth deme hest du vortan dat vele minsche
bedraghen werdē dede dat afflaten kopen.
dat se vor ghelt gheuen mit dissen wordē.
Jsset dat iūment hefft rechte ruwe vnde
bicht des mundes. vnde aldus. Wē de duuel
queme vnde gheue gelt. nemende an sik de
staltnisse des mynschen. vnde bichtede deme
mynschen enkede he sede em alze de anderen, ik
gheue dy vulle aflozinghe van dē sunden
vnde van aller pyne. isset sake dat du ruwe
hest, vnde
 me des segghendes vnde gheuendes
willen bleue doch de duuel alletijt in schult
vnde in ewigher pine. Jst is eine grote
vormetenheit. den luden so to vorgheuende pine
vnde schult. so doch de olden hillighen alzo
nicht deden. sunder se vormaneden de lude. dat
se bote deden vor de sunde. vnde leden gherne
wedderstalt in disser werlt beth to deme
me des segghendes vnde gheuendes
willen bleue doch de duuel alletijt in schult
vnde in ewigher pine. Jst is eine grote
vormetenheit. den luden so to vorgheuende pine
vnde schult. so doch de olden hillighen alzo
nicht deden. sunder se vormaneden de lude. dat
se bote deden vor de sunde. vnde leden gherne
wedderstalt in disser werlt beth to deme


|
Seite 515 |




|
dode. Hijūme neen hillige hefft in der
schrifft ghesettet sulk afflath. uppe iare vmme
ghelt. sunder up de rechten bote. de dar is eine
beruwinghe der sūde. hertliken sik van en
keren, alzo dat he nicht meer sundigen wölle,
vnde dat he hebbe hopene to der barmeherticheit
godes. de bade des allemechtighen godes to
holdende, vnde vor de sunde vul doen. wente goth
de gnedighe salichmaker secht. Ezechielis in
deme xviij. Jsset dat de sunder bote deit van
alle sinen sunden de he gedaen hefft, vnde isset
dat he wert alle myne bade holden, vnde wert dat
rechte donde vnde rechtverdicheyt. des leuendes
wert he leuen v
 nicht steruen. alle syner boßheit
de he ghedaen hefft der en werde ik nicht
denken. Su hijr hestu nu apenbar wisse
vorgheuinghe der sunde, by dissem bescheide.
ysset dat de sūder bote deit. Wat is bote.
dat de sund' vuldo vor de sūde. wo vele
stucke hefft de bote. dre. welker. Dat de
sūder gode bichte.
nicht steruen. alle syner boßheit
de he ghedaen hefft der en werde ik nicht
denken. Su hijr hestu nu apenbar wisse
vorgheuinghe der sunde, by dissem bescheide.
ysset dat de sūder bote deit. Wat is bote.
dat de sund' vuldo vor de sūde. wo vele
stucke hefft de bote. dre. welker. Dat de
sūder gode bichte.
 n hebbe hertlike ruwe. vnde vuldo
vor de sūde. Hirume sede de here mathei in
dē iij. Jsset dat de sunder bote deit
n hebbe hertlike ruwe. vnde vuldo
vor de sūde. Hirume sede de here mathei in
dē iij. Jsset dat de sunder bote deit
 . Unde x
. Unde x
 s anheuende to preddikede sede.
dod bote. wēte dat rike d' hēmele
nalet sik. Anderswar sede he sinen
iūgeren. Luce in dē xiij. Jsset dat
gij nicht bote don. alle to sāmede werde
gij vorgaen. - - Sund' de afflatesgheuer lauen.
dat we syne sūde bichte vnde hefft ruwe
s anheuende to preddikede sede.
dod bote. wēte dat rike d' hēmele
nalet sik. Anderswar sede he sinen
iūgeren. Luce in dē xiij. Jsset dat
gij nicht bote don. alle to sāmede werde
gij vorgaen. - - Sund' de afflatesgheuer lauen.
dat we syne sūde bichte vnde hefft ruwe
 me de sunde, vnde gifft ghelt. dat
de tohant hefft gantze vorgheuinghe der sunde.
dat is verlozinghe van pine vnde ok van schuld.
Auer war blifft dat drndde deel der böte, dat
dar is dat vuldoend des sūders vor de
sūde. vnde aldus settē se etlike
stucke ane den stert der bote, ieghon de
hillighen schrift, mit der got de here ghebaden
hefft, alze gheschreuen steit in dem boke
leuitici. in deme drudden capittele. dat se gode
gheuen ein gantz offer mit dem sterte.
Sūder in de stede desses stertes nemen so
dat gholt. Welkere is dat sekerste offer? lad
dat ok de kind'e richten. Enkede mit dem sterte
is dat sokerste. - Unde id were guet. dat de
iennen dede will afflad hebben. dat en de papen
borghon setten, wen se dat gheld gheuen, dat so
tohant anich wordē van pine vnde van
schult,
me de sunde, vnde gifft ghelt. dat
de tohant hefft gantze vorgheuinghe der sunde.
dat is verlozinghe van pine vnde ok van schuld.
Auer war blifft dat drndde deel der böte, dat
dar is dat vuldoend des sūders vor de
sūde. vnde aldus settē se etlike
stucke ane den stert der bote, ieghon de
hillighen schrift, mit der got de here ghebaden
hefft, alze gheschreuen steit in dem boke
leuitici. in deme drudden capittele. dat se gode
gheuen ein gantz offer mit dem sterte.
Sūder in de stede desses stertes nemen so
dat gholt. Welkere is dat sekerste offer? lad
dat ok de kind'e richten. Enkede mit dem sterte
is dat sokerste. - Unde id were guet. dat de
iennen dede will afflad hebben. dat en de papen
borghon setten, wen se dat gheld gheuen, dat so
tohant anich wordē van pine vnde van
schult,
 n so kregen nicht drade borghen.
Noch sūte peter. dede beleiden
n so kregen nicht drade borghen.
Noch sūte peter. dede beleiden
 n beruwen moste syno sūde.
lauede dar vor. Alze he nicht wolde lauen
simoni. dede van sunte petere wolde de macht
hebben. vnde van den anderē apostelen.
seggedē actuū in deme viij
capittele. Nemet
n beruwen moste syno sūde.
lauede dar vor. Alze he nicht wolde lauen
simoni. dede van sunte petere wolde de macht
hebben. vnde van den anderē apostelen.
seggedē actuū in deme viij
capittele. Nemet


|
Seite 516 |




|
gheld vnde gheuet my de wald, dat uppe wene ik de hant legghe. dat he entvanghe den hillighengeist. deme sede sunte peter. Din ghelt dat sy mit dy in d' vordomenisse. wente du hest ghemenet. dat du de gaue godes vmme gheld hebben woldest. dy en is neen deel noch meinschop in disser rede. wēte dyn herte en is nicht recht vor gode. do bote van disser diner bosheit. vnde bidde got. isset dat he dy gichtes vorgifft disse danken dines herten. wente in der gallen der bitterheit. vnde in der vorbindinghe der bosheit se ik dy wesen. Su hir hestu nu petrū den apostel. vul des billigen gheistes. dede doch nicht dorste simonem vorsekeren dat em syne sunde vorgheuen weren. wowol dat simon sede den apostelen ok tohant na dissen worden petri. Byddet goth vor my. dat nichtes ouer my kame van den dinghen de gij ghesecht hebben. In des simonis vate sind de papen. dede dat afflath huren van dem pawese. dat se dar ghelt mede mynnen gheuende den luden de aflates breue vnde leggen de hand uppe se. dat se entfanghen den hillighengeist. ane den de mynsche nicht kan hebben de vorgheuinghe der sunde. In siner vaten sint ok alle de iennen. dede aflat vorweruen van den closter breuen. edder myt anderen breuen. Ach dat se merkeden de werde sunte peters. dede secht. Dyn ghelt dat sy myt dy to der vordomenisse. wente du hest ghemeent. dat du de ghaue des allemechtighen godes mit ghelde kopen woldest. Unde wo sint se nicht werdich der vordomenisse. de iennē dede huren vnde kopen dat gheuent des afflates. vnde wo sint se anich der simonigge. dat is der gheistliken kopenschop. de dar is eine grote ketterigge. - - -


|
Seite 517 |




|



|



|
|
:
|
VII. Zur Rechtskunde.
Das ribnitzer Stadtbuch.
Die Stadt Ribnitz ist viel älter, als bisher angenommen ist, namentlich als das Privilegium vom J. 1271, welches man bisher für die Fundationsurkunde hielt. Schon im J. 1257 berichtete der Rath der Stadt Rostock an den Rath von Lübeck, daß sich die Bürger zu Ribnitz (burgenses de Rybeniz) des lübischen Rechts bedienten 1 ), und der Bau der Kirche deutet auf ein noch höheres Alter hin (vgl. oben Kirchenbauten S. 473.) Am 1. April 1455 brannte die ganze Stadt, mit Ausnahme des Klosters, ab und es gingen in dem Brande sämmtliche Briefschaften verloren, so daß die Stadt gar keine alte Urkunden besitzt; jedoch sind in neuern Zeiten die Urkunden ziemlich vollständig in Abschrift wieder gesammelt. Auch späterhin haben Brände die Papiere vertilgt; nur die Stadtbücher sind gerettet und die Stadt bewahrt dieselben vom J. 1456 an. Das älteste Stadtbuch beginnt nämlich mit dem nächsten Jahre nach dem großen Brande von 1455 und mag manches Wertvolle für die Rechtsgeschichte enthalten, da Ribnitz lübisches Recht hatte.
Das Stadtbuch beginnt mit folgenden Zeilen:
|
Versus de tempore
combustionis ciuitatis.
Anno post mille C quatuor L quoque quino Periit omnino prochdolor de foco pistrille Post palmas feria tercia Ribanitze perusta; Non est inusta domus hīe. nō aduocacia. Cenobium Clare voluit deus inde seruare, Quod non est ausa tangere flamma sine causa, Cum sint innocue vita moribus inibique. |
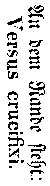
|
G. C. F. Lisch.


|
Seite 518 |




|



|



|
|
:
|
Musterung, Roßdienst und Aufgebot.
Ueber die Form der kriegerischen Lehnspflichten, welche noch sehr dunkel ist, erhalten wir Aufklärung durch nachfolgendes interessante Anschreiben, welches zwar das Herzogthum Sachsen=Lauenburg berührt, aber doch wohl als Analogie für die deutschen Ostseeländer dienen kann.
Von Gottes gnaden Frantz, Hertzog zu
Sachsen, Engern vnd Westpfahlen.
Vnsern gnedigen grnß zuuorn, Ernuester lieber Getrewer, Welchermaßen Wir Dich zu einer generall Muesterung vnlengst verwarschewet, ist dir vnentfallen, wan vns nun angelegen, Wißenschafft zu haben, wie du zusamt deinen Leuten, zu leistung gebuhrender Roßdienste, da es die notturfft erfordert, gefast seist, Dieweil bei eräugendem sorglichem Zustande sich begeben muchte, daß die Stände des löblichen Nider=Sächsischen Creißes zum Aufzugk Könten angemanet werden, vnd sonsten auch dem Vaterlande daran gelegen, daß die vnserigen kegen allen gewalthetigen ein= vnd vberfall, widerrechtliche beginnen, offension vnd vergewaltigung, zur ertrungener defension, in steter guter bereitschafft sitzen, Alß haben Wir zu einer heuptmunsterung den Dingstag nach Egydy, wirt sein der 4. Monatstag Septemnbris negstkunfftig, alß dan mit vnser Ritterschafft vnd ihren Leuten der anfang gemachet werden soll, anberahmet, Derogestalt, daß du dich des Abents furhero in dein Quartier, daß dir zeitig Kund gethan werden soll, begebest, auf dich vnd die deinen auff drey tage proviantirest, vnd erst namgemachten Dingstags frue zu Sechs Vhren vf dem Felde, bei Vnserm Dorffe Fitzen 1 ), in angeordente vor disem gehaltener Musterstelle, eigener Persohn mit schuldigem Roßdienste zu Mann vnd Pferde armiret, beneben deinen leuten bewehret, wie von alters herogebracht, gewonlich, vnd vns alß der Landeßfurstlichen obrigkeit Du vnd Sie schuldig seist, mit Pferden vnd gewehren versehen vnd gerustet, mit diser fernern erinnerung vnd befehll, daß deine Leute mit kurtzen Niderkleidernn an hosen vnd


|
Seite 519 |




|
gantz die Kleidungen Schwartz, Zu fuess, wie vnsere vntterthanen gehen, Ein gantz vnd halb huefener, auch Kossater, ein ieder besonders, mit einer Langen Büchse, mit aller Zubehörung bewehret vnd gefast erscheinest vnd darstellest, Vnd wer vnter Deinen Leuten des vermugens nicht ist, eine Lange Büchse sich zuuerschaffen, Du denselben an zeiten eine zur hand bringest vnd damit exerciren lassest.
Da auch Du vor Dich vnd Deine Diener Pantelohrröhre gleich wie wir vnd vnsere hoffdiener fuhren, vnd fur etzliche Deine leute Muscheten bedurftig, wollen wir Dir, vf Dein zeitlich begeren, vnd benennen, selbige verschreiben, vnd damit vmb billiche bezalung beforderlich sein, wornach alles inhalts dises vnsers ankundigungs schreibens, Du Dich wirst gehorsamlich richten, Sind dir mit fürstlichen gnaden vnd guten wolgeneigt, Datum vf vnserm Schloß Newhauß, den 30. July Ao.
. 620.
Frantz H. Zu Sachsen
 .
.
Nach einer Abschrift von einem an die von Lützow auf Turow gerichteten Ausschreiben im großherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin mitgetheilt von
G. C. F. Lisch.
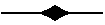


|
[ Seite 520 ] |




|