

|




|



|
|
|
- Hünengrab von Helm No. 2 (Vgl. Jahresber. IV, S. 21)
- Hünengrab von Helm No. 3
- Hünengrab von Wittenburg
- Hünengrab von Perdöhl
- Steinkisten bei Genzkow
- Hünengräber von Warlin
- Hünengräber von Goldenbow
- Kegelgrab zu Ruchow
- Kegelgräber von Genzkow
- Kegelgräber von Goldenbow
- Kegelgräber von Meyersdorf
- Kegelgräber von Perdöhl
- Kegelgrab von Bobzin No. 4 (Vgl. Jahresber. IV, S. 32 und 33)
- Kegelgrab von Bobzin No. 5
- Kegelgrab von Lehsen No. 2 (Vgl. Jahresber. IV, S. 27)
- Kegelgrab von Lehsen No. 3.
- Kegelgrab von Wittenburg No. 2
- Kegelgrab von Wittenburg No. 3
- Kegelgrab von Wittenburg No. 4
- Kegelgrab von Wittenburg No. 5
- Kegelgrab von Wittenburg No. 6
- Kegelgrab von Wittenburg No. 7
- Kegelgrab von Wohld No. 3 (Vgl. Jahresber. IV, S. 30)
- Kegelgrab von Dammereetz
- Urne von Wittenburg
- Ein Paar Handringe
- Alterthümer von Retzow (Vgl. Jahresber. III, S. 64)
- Nadel von Gallin
- Schwert von Wiebendorf
- Zwei Lanzenspitzen aus Bronze
- Wendenkirchhof von Helm : Fortgesetzte Ausgrabungen (Vgl. Jahresber. IV, S. 39-48)
- Wendenkirchhof von Porcelin (bei Wittenburg)
- Wendenkirchhof von Rülow
- Wendenkirchhof von Leussow (bei Eldena)
- Wendenkirchhof bei Doberan
- Wendisches Begräbniß von Boldebuck
- Wendische Graburne von Krickow
- Spindelsteine von Rülow
- Spindelsteine von Leussow
- Gußform für Schnallenringe
- Fragment eines Bronzegefäßes von Prillwitz
- Burgruinen von Ihlenfeld
- Handmühle von Leussow
- Fund von Gothmann (bei Boizenburg)
- Taufbecken
- Schäferbeil von Lehsen
- Der Heisterstein bei Waren
- Steinkiste von Ruthenbeck
- Hünengrab von Brüsewitz
- Hünengrab von Warlin
- Steinernes Geräth, gefunden bei Sadelkow
- Ueber die Verbreitung der bronzenen Alterthümer aus der Zeit der Kegelgräber
- Kegelgräber von Vellahn, Düssin und Brahlstorff
- Kegelgräber von Poltnitz (bei Marnitz)
- Kegelgrab von Schönbeck (bei Friedland)
- Begräbnißplatz von Warlin
- Wendischer Opferhain oder die Ravensburg bei Neubrandenburg
- Die Heidenmauer beim Eulenkrug und die Riesenmauer bei Granzin oder die Landwehren der Grafschaft Schwerin
- Die Kirche zu Grabow
- Hospital zu St. Georg von Rostock
- Urne von Friedland
- Beschreibung einiger Gegenstände in der naturhistorischen und Antiquitäten-Sammlung des Physicus zu Mirow, Hrn. Dr. Rudolphi
- Alter Taufstein zu Rülow
- Die heil. Catharina auf Altarblättern
- Reliquienkapsel von A. Käbelich
- Alte rostocker Leichensteine in der Schloßkirche zu Schwerin
- Der Altar in der Schloßkirche zu Schwerin
- Münzfund von Warlin
- Münzfund im Großherzogthum Meklenburg-Strelitz (bei Warlin?)
- Seltene Münzen aus der Großherzoglichen Alterthümersammlung zu Neustrelitz
- Niedersächsisch-ottonische Münzen bei Schwerin gefunden
- Auszüge aus Kirchenschriften des Dorfes Vietlübbe bei Plau, nebst Nachrichten über verschiedene Alterthümer auf der Feldmark dieses Dorfes
- Kirchenbuch von Gressow (bei Wismar)
- Erklärung der Steindrucktafel mit den römischen Alterthümern von Gr. Kelle
Jahresbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Arbeiten des Vereins
herausgegebenvon
A. Bartsch,
Domprediger zu Schwerin, mehrerer
alterthumsforschenden Gesellschaften
correspondierendem Mitgliede,
als
zweitem Secretair des Vereins für
meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Fünfter Jahrgang.
Mit zwei Steindrucktafeln.
Auf Kosten des Vereins.
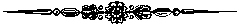
In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.
Schwerin, 1840.


|




|


|




|
Inhaltsanzeige.
Erster Theil.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
| S. | |
| 1. Angehörige des Vereins | 1 |
| 2. Finanzielle Verhältnisse | 3 |
| 3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung | 5 |
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
| 1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler. | |
| A. Sammlung von Schriftwerken. | |
| I. Bibliothek | 7 |
| II. Sammlung typographischer Alterthümer | 19 |
| III. Urkundensammlung | 20 |
| IV. Sammlung anderer Handschriften | 21 |
| V. Sammlung anderer Handschriften | 21 |
| B. Sammlung von Bildwerken | |
| I. Alterthümer im engern Sinne | |
| 1. Aus vorchristlicher Zeit | |
| A. Aus der Zeit der Hühnengräber | 21 |
| B. Aus der Zeit der Kegelgräber | 30 |
| C. Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse | 66 |
| 2. Aus unbestimmter alter Zeit | 83 |
| 3. Aus dem Mittelalter | 84 |
| 4. Aus neuerer Zeit | 94 |
| II. Münzen und Madaillen | 96 |
| III. Siegel | 98 |
| IV. Zeichnungen | 99 |
| C. Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art | |
I.
Nachrichten von heidnischen Gräbern,
mittelalterlichen Bauwerken

|
100 |
| II. Nachrichten von Bildwerken verschiedener Art | 120 |
| III. Nachrichten von alten Schriftwerken | 141 |
| 2. Bearbeitung des historischen Stoffes. | |
| A. Gelieferte Arbeiten | 146 |
| B. Begonnene oder vorbereitete Arbeiten | 149 |
| C. Unterstützte und empfohlene Arbeiten | 151 |
| Anhang: Erklärung der am Ende des Berichts befindlichen Steindrucktafel. |
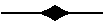


|




|


|
[ Seite 1 ] |




|
Erster Theil.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
1. Angehörige des Vereins.
W ie in allen seinen Bezügen und Verhältnissen, bietet unser Verein zunächst auch hinsichtlich seiner Personalchronik fortwährend ein überwiegend erfreuliches Bild dar. Nicht bloß, daß die sehr beträchtliche Zahl von Angehörigen, welche er schon in den ersten Jahren seines Bestehens sich erwarb, mit jedem Jahre noch sich vergrößert (daß dieses nicht in derselben Progression geschieht, wie in jenen ersten Zeiten, liegt ja in der Natur der Sache), fährt auch die eigentliche Teilnahme der unter verschiedenen Titeln ihm Verbundenen fort, auf die freundlichste und unzweideutige Weise sich zu bethätigen. So empfing er von Seiten seiner erlauchten Protectoren und seiner hohen Beförderer auch in dem jüngstverflossenen Jahre, außer manchen andern Begünstigungen und Zeichen des Wohlwollens, bald huldreiche, anerkennende Zuschriften in Folge der eingesandten Jahresschriften, bald Geschenke an Geld, kostbaren Büchern u. dgl., und von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten zu Schaumburg=Lippe die mit dem lebhaftesten Dank aufgenommene, auch bereits benutzte Erlaubniß, die bisher auf dem fürstlichen Gute Boldebuck aufbewahrten Alterthümer in dem Vereinslocale aufstellen zu dürfen. So schenkte ihm eins seiner Ehrenmitglieder, der Herr Minister von Kamptz zu Berlin, in der Antwort auf das Beglückwünschungsschreiben des Ausschusses bei Gelegenheit des funfzigjährigen Dienstjubiläums dieses hochverdienten Staatsmannes, der ein geborner Meklenburger ist und überdies nicht bloß in Meklenburg seine staatsdienstliche Laufbahn begann, sondern auch in der Literatur des meklenburgischen Rechts und seiner Geschichte einen ausgezeichneten Platz einnimmt, ein sehr werthes Gedenkblatt an dieses seltene Fest und ein sehr freundliches Zeichen ehrender


|
Seite 2 |




|
Anerkennung. Und was die übrigen einheimischen und auswärtigen Freunde des Vereins neuerdings für denselben gethan und geleistet, dessen Reichthum wird ja alle Rubriken des zweiten Theils dieses Berichts auch diesmal wieder ansehnlich genug füllen.
Was die Veränderungen in dem Personalbestande betrifft, so ist vor allem die erfreuliche Erwerbung eines neuen hohen Beförderers in der Person Sr. Königlichen Hoheit des Erbgroßherzogs Friederich Franz von Meklenburg=Schwerin zu erwähnen. - Von seinen Ehrenmitgliedern verlor der Verein Se. Excellenz den Herrn Minister Krüger zu Schwerin, der, nach einer fast 62jährigen treuen und erfolgreichen Wirksamkeit im Dienste seines Fürsten und seines Landes, am 13. Mai d. J. im beinahe vollendeten 87sten Lebensjahre starb. - Auch aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder rief der Tod mehrere hinweg, nämlich die Herren Oberhofmeister von Kamptz zu Neustrelitz, Pastor Merian zu Perlin, Landdrost von Bülow zu Schwerin, Bürgermeister Ackermann zu Brüel, Kammerherr Graf von Bernstorff auf Wedendorf und Dr. Wehber=Schuldt auf Goldensee; 3 schieden auf anderm Wege aus (die Herren Candidat Schröder zu Goldberg, Pastor Heyer zu Gr. Poserin und Pastor Reincke zu Plau), so daß der Gesammtverlust an ordentlichen Mitgliedern für dieses Jahr 9 beträgt. Dagegen traten im Laufe desselben 13 Personen dem Vereine in dieser Eigenschaft bei, nämlich:
| 1) | Herr | Musiklehrer Pauly zu Schwerin, |
| 2) | - | Ober=Inspector Rußwurm zu Reval, |
| 3) | - | Superintendent Wagner zu Potsdam, |
| 4) | - | Canzlei=Vicedirector von Maydell zu Schwerin, |
| 5) | - | Landrath Baron von Krassow zu Franzburg in Pommern, |
| 6) | - | Landrath von Blücher auf Suckow, |
| 7) | - | Baron von Maltzahn auf Peutsch, |
| 8) | - | Amtsauditor von Pressentin zu Boizenburg, |
| 9) | - | Advocat Witt zu Wittenburg, |
| 10) | - | Landrath von Oertzen auf Gr. Vielen, |
| 11) | - | Director Dr. Schadow zu Berlin, |
| 12) | - | Candidat Willebrand zu Dassow, |
| 13) | - | Pastor Kehrhahn zu Döbbersen. |
Hiernach ergiebt sich ein reiner Gewinn von 4 ordentlichen Mitgliedern, deren Gesammtzahl somit beim Jahresschlusse 354 betrug. - Der Schaar der auswärtigen Gelehrten, welche durch Rath und That unsere Bemühungen zu fördern beflissen sind, ward durch die von dem Ernannten freundlichst angenommene Wahl des Ausschusses der Herr Pastor Wilhelmi


|
Seite 3 |




|
zu Sinsheim in Baden, Director der dortigen historischen Gesellschaft, zugestellt, und da auch in dem verflossenen Jahre der Tod diesen Kreis verschonte, so beläuft sich die Zahl der correspondirenden Mitglieder gegenwärtig auf 53. - Den schon früher gewonnenen correspondirenden Vereinen, 13 an der Zahl, schlossen sich neuerdings 3 auswärtige Gesellschaften von gleicher Richtung an, nämlich: der historische Verein für den Untermainkreis von Unterfranken zu Würzburg, der nassauische Verein für Alterthumskunde und Geschichtsforschung zu Wiesbaden, und der altmärkische Verein für vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwedel.
2. Finanzielle Verhältnisse.
Vom 1. Julius 1839 bis zum 1. Julius 1840 betrug
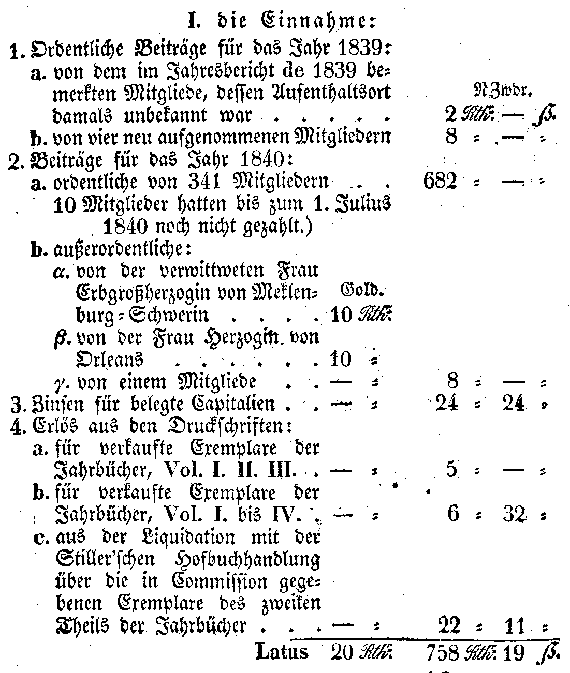


|
Seite 4 |




|
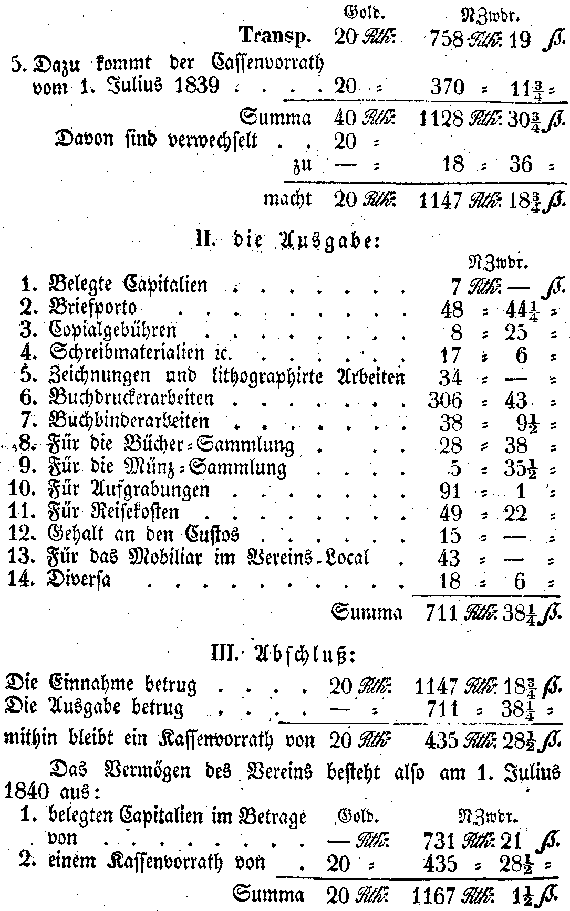
Schwerin, den 1. Julius 1840.
P. F. R. Faull,
Kassen
- Berechner.


|
Seite 5 |




|
3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung.
Von den auch in diesem Jahre zur gesetzlichen Zeit gehaltenden drei Quartalversammlungen (an die Stelle einer vierten tritt bekanntlich die Generalversammlung) ward auch diesmal in drei Quartalberichten (V, 1. 2. 3. ) regelmäßig Rechenschaft gegeben. Die Generalversammlung (11. Julius 1840) nahm zuerst mit lebhafter Freude die Versicherung entgegen, daß auch für das folgende Jahr in dem Präsidium keine Veränderung vorgehen werde, und hörte sodann die auf allgfemeine Uebersichten und auf Hervorhebung einzelner Hauptmomente sich beschränkenden Berichte des zweiten Secretärs und der übrigen Beamten. Sämmtliche Beamte wurden wiedergewählt; die Neuwahl der Repräsentanten, welche nach dem Beschlusse der vorigjährigen Generalversammlund nur zwei der bisher fungirenden wieder treffen durfte, fiel auf die Herren Oberlehrer Reitz, Kammerherr von Boddien, Hypothekenbewahrer Dr. Oldenburg und Oberlehrer Weber. Aus den ferneren Verhandlungen verdienen besonders folgende Punkte hervorgehoben zu werden:
1) ward auf die Nothwendigkeit hingewiesen, von Zeit zu Zeit, etwa alle fünf Jahre, ein möglichst genaues Inhaltsverzeichniß zu den Jahresschriften des Vereins (Jahrbücher und Jahresbericht) herauszugeben, um auf diese Weise das Auffinden und Benutzen der in denselben zerstreuten reichen Materialien zu erleichtern. Der gleichzeitig ausgesprochenen Bitte, daß eins der anwesenden Mitglieder sich dieser allerdings sehr mühsamen, aber auch sehr verdienstlichen Arbeit unterziehen möge, entsprach aufs freundlichste Herr Hülfsprediger Ritter aus Wittenburg, indem derselbe sich bereit erklärte, einen solchen Inder zu der ersten fünf Jahrgägen der Vereinsschriften anzufertigen.
2) ward beschlossen, daß, nachdem des Großherzogs von Mecklenburg=Strelitz Königliche Hoheit die Druckkosten für den ersten Band der von dem Herrn Archivar Lisch herausgegebenen "Mecklenburgischen Urkunden" dem Vereine geschenkt (Jahresbericht I, S. 93), die Kosten für den Druck eines zweiten Bandes auf die Kasse des Vereins übernommen werden sollen, wobei von Seiten des Herrn Archivars Lisch die Wahrscheinlichkeit in Aussicht gestellt ward, duch den Erlös aus dem Verkaufe der ersten beiden Bände die Kosten zu einem dritten zu gewinnen, welchem er dann Inhaltsverzeichnisse über alle drei beigeben werde. Der zweite Band, dessen Erscheinen somit


|
Seite 6 |




|
gesichert ist, wird die vollständigen Urkunden des vornehmsten Jungfrauenklosters in Meklenburg, Sonnenkamp oder Neukloster, enthalten.
3) ward Herr Hülfsprediger Ritter aus Wittenburg ersucht und ermächtigt, seine mit so viel Geschick und Glück unternommenen Ausgrabungen in der antiquarisch reichen Umgegend seines Wohnorts im Namen und auf Kosten des Vereins auch ferner fortzusetzen, soweit die Nothwendigkeit, namentlich in Folge der Chausseebauten, solche Ausgrabungen fordern werde.


|
Seite 7 |




|
Zweiter Theil.
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler.
A. Sammlung von Schriftwerken.
I. Bibliothek.
V erzeichniß der in dem Vereinsjahre 1839/40 erworbenen Bücher:
- G. G. Adler, Plendisteria, imagines, calcaria et arma veterum lapidea non ita pridem in pago H'Orlae et Sorbitzii Wirraeque ripas detecta. C. 20 figg. lith. Gerae. 8. (Geschenk des voigtländischen Vereins.)
- Alberti, Vierzehnter Jahresbericht des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. Gera 1840. 8. M. s. Nr. 386. 539.] (Geschenk des Vereins.)
785-789. Annalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Mit Lithographien. 1sten Bandes 2tes und 3tes Heft. Wiesbaden 1830. 2ten Bandes 1stes, 2tes und 3tes Heft. W. 1832. 1834. 1837. 3ten Bandes 1stes Heft. W. 1839. 8. (Geschenk des nassauischen Vereins. - Band 1. Heft 1. ist vergriffen und soll nachfolgen.)
- Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1836. 1837. Kjobenhavn 1837. 8.
- Annaler for Nordisk Oldkyndighed 1838. Kjobenhavn 1838. 8. (Nr. 790 und 791 Geschenke des nordischen Vereins.)
- Antiquitates Americanae sive Scriptores septentrionales rerum ante-columbianarum in America. Ed. Societas Regia antiquariorum septentrionalium. Hafniae 1837. Fol. (Geschenk des weil. Ministers Krüger in Schwerin.)


|
Seite 8 |




|
793-797. Archiv, Vaterländisches, oder Beiträge zur allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannover, wie es war und ist. Herausgegeben von G. H. G. Spiel. 5 Bände. Zelle 1819. Hannover 1820. 1821. 8.
798-826. Archiv, Vaterländisches, oder Beiträge zur
allseitigen Kenntniß des Königreichs Hannovers u. s.
w. Herausgegeben von Spiel, fortgesetzt von E.
Spangenberg. Band 1 bis 4: Lüneburg 1822. 1823.Band
5-22: Jahrgang 1824-32. Lüneburg. Band 23 bis 26:
unter dem Titel: "Vaterländ. Archiv für
hannoverisch-braunschweigische Geschichte"
durch von Spilcker und Brönnenberg. Jahrgang 1833.
1834. Lüneburg. Band 27-29: unter dem Titel:
"Vaterländ. Archiv des histor. Vereins für
Niedersachsen"
![]() . Jahrgang 1835. 1836. Lüneburg.
8.[M. s. Nr. 396. 397. 542-549.] (Geschenke des Hrn.
Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
. Jahrgang 1835. 1836. Lüneburg.
8.[M. s. Nr. 396. 397. 542-549.] (Geschenke des Hrn.
Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
827-839. Archiv des historischen Vereins für den Untermainkreis (von 1838 unter dem Titel: "Archiv d. histor. V. für Unterfranken und Aschaffenburg" ). 1sten Bandes 2tes und 3tes Heft. 2ten, 3ten und 4ten Bandes 1ste, 2te und 3te Hefte. 5ten Bandes 1stes und 2tes Heft. Würzburg 1832-1839. 8. (Geschenk des Vereins.)
-
Ausführung und Vertheidigung der Ansprüche Ihro
Herzogl. Durchlaucht der verwittweten Frau
Herzogin zu Mecklenburg
 . , geb. Herzogin zu Wirtemberg
. , geb. Herzogin zu Wirtemberg
 . an die von dem Kurhause
Brandenburg jetzt nach Abgang des Mannsstammes
der Markgrafen von Brandenburg zu Schwedt der
markgräfl. weibl. Linie zu erstattenden
Reluitions=, Kauf= und Meliorations=Gelder.
Schwerin. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
. an die von dem Kurhause
Brandenburg jetzt nach Abgang des Mannsstammes
der Markgrafen von Brandenburg zu Schwedt der
markgräfl. weibl. Linie zu erstattenden
Reluitions=, Kauf= und Meliorations=Gelder.
Schwerin. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- 842. Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 6ten Jahrgangs 2tes Heft und 7ten Jahrgangs 1stes Heft. Stettin 1839. 1840. 8. [M. s. Nr. 11-14. 224. 225. 400. 550-552.] ( Geschenk der Gesellschaft.)
- S. J. Baumgarten, Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von America. 2 Thle in 1 Bde. Mit vielen Kupfern. Halle 1752. 1753. 4.
- 845. N. Ludlow Beamish, Geschichte der Königlich Deutschen Legion. 2 Theile. Mit 18 colorirten Abbildungen, 9 Schlachtplanen, einer Lithographie und mehreren Tabellen. Hannover 1832. 1837. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- Joh. Chr. Beckmann Beschreibung des Ritterlichen Jo=


|
Seite 9 |




|
hanniter=Orden
. Vermehrt von Just. Chr. Dithmar. Frankfurt a. d. O. 1726. 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)
- L. F. Behm, Einladung zur Subscription auf mecklenburgische weiße Maulbeerbäume, Maulbeerbuschbäume und Maulbeersäämlinge, so wie Seidennraupen=Eier. Boizenburg 1839. 4. (Geschenk des Hrn. Revisionsraths Schumacher in Schwerin.)
- Beleuchtung, Kurze, des Zurufs: An das Publicum, über die gedruckte Sammlung einiger das Privilegium des Mecklenburgischen Erb=Jungfrauen=Rechts betreffende Stücke. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- Bericht, erster und zweiter, an die Mitglieder des Sächsischen Vereins für Erforschung und Bewahrung vaterländischer Alterthümer zu Leipzig. 1825. 1826. und erster und zweiter Bericht an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zu Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig. 1827. 1828. 8.
- Bericht, Dritter, über das Bestehen und Wirken des histor. Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Baiern. Bamberg 1840. 8. [M s. Nr. 559.] (Geschenk des Vereins.)
- Bericht, Fünfter, der Königl. Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Kiel .1840. 8. [M. s. Nr. 229. 230. 407. 561.] (Geschenk des Vereins.)
- J. E. F. Berlin, Kurze Prüfung der Gedanken eines Ungenannten über die Kornausfuhr von Mecklenburg, als ein patriot. Beitrag über die Materie von Schiffbarmachung der Elde. Neubrandenburg 1792. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- Bestätigung, Urkundliche, des Herzogl. Mecklenburg. Besteurungs=Rechtes in Ansehung der in den adl. Gütern befindl. Pensionarien, Müller, Holländer u. s. w. Der Meckl. Ritterschaft und ihrer s. g. gründlichen Wiederlegung schließlich entgegen gesetzet. 1752. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
Bestand, Erwiesener, der von dem Engern
Ausschuß und der auf dem allgem. Landtage 1788
gewählten Committe
 . gegen den grundsätzlichen neuen
Rostockschen Erbvertrag anwendlich befundenen
Erinnerungen, wodurch die von E. E. Rath der
Stadt Rostock zum Abdruck beförderte "Kurze
Prüfung" urkundlich widerlegt wird. Rostock
1789. Fol.
. gegen den grundsätzlichen neuen
Rostockschen Erbvertrag anwendlich befundenen
Erinnerungen, wodurch die von E. E. Rath der
Stadt Rostock zum Abdruck beförderte "Kurze
Prüfung" urkundlich widerlegt wird. Rostock
1789. Fol.


|
Seite 10 |




|
(Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- Bibliothek der elenden Scribenten. 1stes bis 7tes Stück in 1 Bde. Frkf. u. Lpz. 1768-1771. 8.
-
Bienenkorb. Des Heyl. Röm. Imenschwarms, seiner
Hummelszellen, (oder Himmelszellen )
Hurnaußnäster, Brämengeschwärm vnnd Wäspengetöß
 . Durch Jesuwalt Pickhart.
Christlingen 1586. 8. (Geschenk des Hrn.
Schulraths Meyer in Schwerin.)
. Durch Jesuwalt Pickhart.
Christlingen 1586. 8. (Geschenk des Hrn.
Schulraths Meyer in Schwerin.)
- Bornemann, Annalen des Gesundbrunnens zu Goldberg. Hamburg 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
C. Calvör, Saxonia inferior antiqua gentilis et
christiana, d. i. das alte heydn. und christl.
Niedersachsen
 . Goslar 1714. Fol. [M. s. Nr. 241.]
. Goslar 1714. Fol. [M. s. Nr. 241.]
859-862. Casopis Ceskeho Museum (d. i. Vierteljahrsjahrsschrift der Gesellschaft des Böhm. Nationalmuseums zu Prag). W Praze 1837. 4 Hefte. 8.
863-866. W. F. Christiani, Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. 4 Bände. Flensburg u. Lpz. 1775-1779. 8.
-
Chronica Carionis. Von Anfang der Welt bis vff
Keiser Carolum den Fünften. Auffs newe in
lateinischer Sprach beschrieben
 . durch Hrn. Philippum
Melanthonem und Doctorem Casparum Peucerum.
Jetzund zum Ersten
. durch Hrn. Philippum
Melanthonem und Doctorem Casparum Peucerum.
Jetzund zum Ersten
 . in Deudsche Sprach gebracht.
1573. Fol. (Geschenk des Hrn. Geh.
Medicinalraths Sachse in Schwerin.)
. in Deudsche Sprach gebracht.
1573. Fol. (Geschenk des Hrn. Geh.
Medicinalraths Sachse in Schwerin.)
-
Fr. Joh. Chr. Cleemann, Chronik und Urkunden
der Meckl.=Schwerin. Vorderstadt Parchim
 . Mit 4 Abbildungen. Parchim
1825. 8. [M. s. Nr. 27.] (Geschenk des Hrn.
Steuerraths Schultze in Schwerin.)
. Mit 4 Abbildungen. Parchim
1825. 8. [M. s. Nr. 27.] (Geschenk des Hrn.
Steuerraths Schultze in Schwerin.)
869. 870. J. Fr. Danneil, Erster und zweiter Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländ. Geschichte und Industrie. Neuhaldensleben 1838. 1839. 2 Bde. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Darstellung des Rechtsstreits zwischen. der ältern Linie des fürstl. Sammthauses Löwenstein=Werthheim und der jüngern Linie dieses Hauses u. s. w. 1817. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
-
Decisiones, Justissimae, imperiales in causis
mecklenburgicis
 . (von 1660 bis 1745). Dritte und
vermehrte Auflage. 1746. Fol. [M. s. Nr. 581.]
(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in
Schwerin.)
. (von 1660 bis 1745). Dritte und
vermehrte Auflage. 1746. Fol. [M. s. Nr. 581.]
(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in
Schwerin.)


|
Seite 11 |




|
-
G. H. M. Delprat, Die Brüderschaft des
gemeinsamen Lebens. Ein Beitrag zur Geschichte
der Kirche, Literatur und Pädagogik des 14., 15.
und 16. Jahrhunderts. Deutsch bearbeitet
 . von G. Mohnike. Leipzig 1840. 8.
. von G. Mohnike. Leipzig 1840. 8.
- G. B. Depping, Die Heerfahrten der Normannen bis zu ihrer festen Niederlassung in Frankreich. (Nach D. von F. Ismar.) 2 Thle. in 1 Bde. Hamburg 1829. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
-
Der neue Schwedter Proceß oder
Rechtfertigungsschrift
 . von Seiten Sr. H. Durchl. des
Herrn Friederich Franz regierenden Herzogs zu
Mecklenburg wider JJ. KK. HH. die fünf Frauen
Prinzessinnen Töchter der hochsel. Herren
Markgrafen Friedrich Wilhelm und Friederich
Heinrich zu Brandenburg=Schwedt u. s. w. Rostock
1794. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von
Maydell in Schwerin.)
. von Seiten Sr. H. Durchl. des
Herrn Friederich Franz regierenden Herzogs zu
Mecklenburg wider JJ. KK. HH. die fünf Frauen
Prinzessinnen Töchter der hochsel. Herren
Markgrafen Friedrich Wilhelm und Friederich
Heinrich zu Brandenburg=Schwedt u. s. w. Rostock
1794. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von
Maydell in Schwerin.)
- Die eiserne Jungfrau. (Berlin. spener. Zeitung 1838 Nr. 282.) 4. (Geschenk des Hrn. Grafen von der Osten=Sacken.)
- Die Königliche Gesellschaft für Nordische Alterthumskunde. Jahresversammlungen 1838 und 1839. Kopenhagen 1839. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- S. Egilssyni Olafs drápa tryggvasonar. Videyar Klaustri 1832. 8. (Geschenk des Vereins für nord. Alterth.)
- S. Egilssyni Brot af Placidus=drápu. Videyar Klaustri 1833. 8. (Geschenk des Vereins für nord. Alterth.)
880-885. Joh. Gottfr. Eichhorn, Geschichte der drei letzten Jahrhunderte. 6 Bde. Dritte bis auf die neuesten Zeiten fortgesetzte Ausgabe. Hannover 1817. 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- Ein Wort zu seiner Zeit, vielleicht brauchbar für die Zukunft, oder: Etwas über Kornmangel und Korntheurung in Mecklenburg. Rostock 1795. 8.
-
Einige unmaaßgebliche Bemerkungen über den
Entwurf wegen Einführung indirecter Steuern auf
Artikel des ausländischen Imports
 . Von 3 landschaftl. Mitgliedern
der ständ. Deputation geh. übergeben. 1809. 8.
. Von 3 landschaftl. Mitgliedern
der ständ. Deputation geh. übergeben. 1809. 8.
-
Erweis, In Rechten und Geschichten gegründeter,
daß in dem Herzogl. Meckl. Hause die
Testamentarische wie auch Mütterliche
Vormundschaften den Gesetzlichen vorgehen
 . 1753. Fol.
. 1753. Fol.


|
Seite 12 |




|
- Erzählung und Beurtheilung der über den Gerichtsstand in der Schwedter Successions=Angelegenheit entstandenen Streitigkeiten. Berlin 1790. Fol. (Nr. 886-889 Geschenke des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
890-892. J. E. Fabri, Magazin für die Geographie, Staatenkunde und Geschichte. 1r bis 3r Bd. Nürnberg 1797. 8. (Geschenk des Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)
- (Dr. Friedländer,) Eine kurtze Comödien von der Geburt des Herrn Christi. Von den Prinzen und Prinzessinnen des Churfürstl. Hofes i. J. 1589 in Berlin aufgeführt. Nach der Handschrift, nebst geschichtl. Einleitung herausgegeben. Berlin 1840. 8.(Geschenk des Hrn. Herausgebers.)
894-897. L. A. Gebhardi, Geschichte aller Wendisch=Slavischen Staaten. 4 Bde. Halle 1790-1797. 4.
- L. Giesebrecht, Ueber die Religion der Wendischen Völker an der Ostsee. (In e. Schulprogramm.) Stettin 1838. 4. 3 Exempl. (Geschenk des Hrn. Professors Hering in Stettin.)
899-901. F. H. Grautoff, Historische Schriften aus dem Nachlasse. 3 Bde. 8. Lübeck 1836.
- Grundgesetz für das Königreich Hannover nebst dem Königlichen Patente, die Publication desselben betreffend. Hannover 1833. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- Hacke, Gottl. Baron Geschichte der Vorderstadt Neubrandenburg. 1ster Theil, v. J. 1248 bis 1711. Neubrandenburg 1783. 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)
-
Fr. von Hagenow, Monographie der Rügenschen
Kreide=Versteinerungen. 1ste Abthlg. Phylithen
und Polyparien. (Aus d. Jahrbuche für Geologie
 . von v. Leonhardt und Bronn.
1839. Heft 3. besonders abgedruckt.) 8.
(Geschenk des Hrn. Verf.)
. von v. Leonhardt und Bronn.
1839. Heft 3. besonders abgedruckt.) 8.
(Geschenk des Hrn. Verf.)
905. 906. G. A. von Halem, Geschichte des Herzogthums Oldenburg. 2 Bde. Oldenburg 1794. 1795. 8.
- W. Hanky, Prawopis Cesky. W Praze 1839. 12.
- W. Hanky, Zpráwa o Slowanském Ewangelium w remesi. W Praze 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- W. Hanky, Mlawnice Polského Gazyka. W Praze 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)


|
Seite 13 |




|
- H. Ch. Heimbürger, Ernst der Bekenner, Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Celle 1839. 8.
- W. v. Hodenberg und E. F. Mooyer, Regesta nobilium Dominorum de Monte seu de Scalkesberge. Minden 1839. 8. (Geschenk des westphäl. Vereins.)
- Jahresbericht, Vierzehnter, der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, v. 22. Jun. 1839. Stettin 1840. 8. [M. s. Nr. 97-102. 265. 266. 615. 616.] (Geschenk des pommerschen Vereins.)
- Jahrbücher und Jahresbericht des Vereins für mekl. Geschichte und Alterthumskunde. 4r Jahrgang. Schwerin 1839. 8. [M. s. Nr. 264. 445. 613.]
-
J. Chr. M. von Ihlenfeldt, Gedanken über die
Frage: Ist in Mecklenburg eine erweiterte
Industrie ohne erhöhte Cultur der Ländereien
gedenkbar? Veranlaßt durch die Schrift des Hrn.
Kammerraths Zimmermann "Ueber Mecklenburgs
Creditverhältnisse
 . " Rostock. 8. (Geschenk des
Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
. " Rostock. 8. (Geschenk des
Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- von Kamptz, Einige Worte über die Gemeinsamkeit des Besteurungs=Regals in Mecklenburg. Neustrelitz 1798. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- K. F. Klöden, Zur Geschichte der Marienverehrung besonders im letzten Jahrhundert vor der Reformation in der Mark Brandenburg und Lausitz. Berlin 1840. 8.
917-923. H. H. Klüver, Beschreibung des Herzogthums Mecklenburg u. s. w. Andere Auflage. 6 Thle in 7 Bden. Hamburg 1737-1742. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- Kosegarten, J. G. L., De Academia Pomerana ab doctrina romana ad evangelicam traducta. Gripeswoldiae 1839. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- L. v. Ledebur, Ueber die in den Baltischen Ländern in der Erde gefundenen Zeugnisse eines Handels=Verkehrs mit dem Orient zur Zeit der arabischen Weltherrschaft. Berlin 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- G. Liebusch, Die Römerschanzen und der Römerkeller bei Costebrau im Amtsbezirk Senftenberg. Görlitz 1837. 8. (Geschenk des Hrn. Rentamtmanns Preusker in Großenhayn.)
- G. C. F. Lisch, Die Schlacht bei Gransee im J. 1316. (Fr. Abendblatt 1839 Nr. 1074.) 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)


|
Seite 14 |




|
- G. C. F. Lisch, Heinrichs von Krolewiz uz Missen Vater Unser. Quedlinburg u. Lpz. 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Herausgebers.)
-
G. C. F. Lisch, Geschichte der Buchdruckerkunst
in Meklenburg bis zum Jahr 1540
 . Aus d. Jahrb. des Vereins f.
mekl. G. u. A. Mit 1 Steindrucktafel. Schwerin
1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
. Aus d. Jahrb. des Vereins f.
mekl. G. u. A. Mit 1 Steindrucktafel. Schwerin
1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- (Liscow,) Sammlung Satyrischer und Ernsthafter Schriften. Frkf. u. Lpzg. 1739. 8.
-
Majoratsstiftung des am 15. Sptbr. 1825 zu
Windhausen verstorbenen Generallieutenants
Martin Ernst von Schlieffen
 . Kassel 1828. 4. (Geschenk des
Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
. Kassel 1828. 4. (Geschenk des
Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- E. J. Fr. Mantzel, De arboribus in feodo secundum §. CCCVII. transactionis provincialis Meclenburgicae a feminis fructuariis non caedendis. Buetzovii 1772. 4.(Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
933-936. J. M. Martini, Bemerkungen über Vormundschaften in Beziehung auf mecklenburgische Gesetze. 4 Abtheilungen. Rostock 1800. 1801. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- J. M. Martini, Welche Grundsätze befolgte man in dem hohen Meckl. Regierhause bei eintretenden Fällen der anzuordnenden Vormundschaften? 1ste Abthlg. Rostock 1796. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- Mecklenburgisches Wappenbuch. Herausgegeben und verlegt von J. G. Tiedemann. 3tes und 4tes Heft zus. Rostock. 4. [M. s. Nr. 473. 674.] (Geschenk Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)
- Mémoires de la Societé Royale des Antiquaires du Nord. 1836. 1837. Copenhague 1838. 8. (Geschenk des nordischen Vereins.)
- A. L. J. Michelsen, Urkundensammlung der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte. Namens der Gesellschaft redigirt. 1r Band. Mit e. Wappentafel. Kiel 1839. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
941-943. Mittheilungen, Neue, aus dem Gebiete historisch=antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem Thüringisch=Sächsischen Verein für Erforschung des vaterländ. Alterthums. 4ten Bandes 3tes und 4tes und 5ten Bandes 1stes Heft. Halle und Nordhausen 1839. 1840. 8. [M.


|
Seite 15 |




|
s. Nr. 150-153. 326-329. 479-484. 690. 691.] (Geschenk des Vereins.)
- Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer. 3tes Heft. 1839. 4. [M. s. Nr. 331. 689.] (Geschenk der Gesellschaft.)
- G. Monike, Die Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern. Stettin 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- C. von Moltke, Oeffentliche Erfüllung eines vormalig öffentlichen Versprechens. 1819. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- E. F. Mooyer, Nachträge zu dem Commentar des Calendarium Merseburgense. Halle 1840. 8. (Geschenk des westphälischen Vereins.)
948. 949. Nachrichten von Niedersächsischen berühmten Leuten und Familien. 1r u. 2r Bd. Hamburg 1768. 1769. 8.
- Th. Nugent's Reisen durch Deutschland und vorzüglich durch Meklenburg. A. d. Engl. übers. u. mit einigen Anmerkungen und Kupfern versehen. 2 Thle. in 1 Bde. Berlin und Stettin 1781. 1782. 8.
- Oesterreichische Hausprivilegium, Das große, von 1156 und das Archivwesen in Baiern. München 1832. 4. (Geschenk des Hrn. Schloßhauptmanns und Kammerherrn von Lützow in Schwerin.)
- Paepke, Actenmäßige Nachricht von den letzten Verhandlungen in Betreff des beabsichtigten Creditvereines ritterschaftlicher Güter in Mecklenburg. Lübeck 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
G. H. Pertz, Monumenta Germaniae Historica
 . Tom. V. Legum tom. III. Hannov.
1839. Fol. [M. s. Nr. 165-167. 494.] (Geschenk
Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)
. Tom. V. Legum tom. III. Hannov.
1839. Fol. [M. s. Nr. 165-167. 494.] (Geschenk
Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)
-
F. Petersen, Ausführliche Geschichte der
Lübeckischen Kirchen=Reformation in den Jahren
1529-1531
 . Lübeck 1830. 8.
. Lübeck 1830. 8.
- J. O. Plagemann, Kleines Handbuch der meklenburgischen Geschichte. Rostock 1809. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- K. Preusker, Der Gewerbgeist im hermetisch=verschlossenen Glase. Vortrag im Gewerbverein zu Großenhayn am 7. December 1838. Chemnitz 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- K. Preusker, Ueber Stadtbibliotheken für den Bürgerstand, deren Nützlichkeit, Gründungs= und Aufstellungs=


|
Seite 16 |




|
Art, damit zu verbindende Sammlungen und Orts=Jahrbücher. Leipzig 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Prüfung, Kurze, der auf dem Landtage 1788 verlesenen Erachten und sonstigen Bedenken über den zwischen J. H. Durchl. zu Mecklenburg=Schwerin und HöchstIhro Stadt Rostock am 13. Mai 1788 abgeschlossenen grundgesetzl. neuen Erbvertrag. Rostock 1789. Fol. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
O. H. Th. Recke, Zur Ehrenrettung eines
verklärten Fürsten
 . 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
. 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
-
D. Reinhold, Der Rhein, die Lippe und Ems und
deren künftige Verbindung
 . Hamm 1822. 8. (Geschenk des
Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)
. Hamm 1822. 8. (Geschenk des
Hrn. Steuerraths Schultze in Schwerin.)
- F. A. Reuß, Aelteste Urkunde über den Umfang der Würzburger Stadtmarkung, als Programm zur achten Stiftungsfeier des histor. Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg am 27. August 1838. Würzburg. 8.
- F. A. Reuß, Fragmente eines altdeutschen Gedichts von den Heldenthaten der Kreuzfahrer im heiligen Lande, im Archive der Stadt Kitzingen aufgefunden. Kitzingen 1839. 8. (Nr. 961 und 962 Geschenke des Hrn. Directors Prof. Dr. Bachmann in Rostock.)
-
Rhode, Chr. Detlev und Andreas Albert,
Cimbrisch=Hollsteinische Antiquitaeten=Remarques
 . Hamburg 1728. 4. Angebunden:
. Hamburg 1728. 4. Angebunden:
a . Treverus, Anastasis veteris Germani Germanaeque feminae cum integro vestitu comparentis, quorum effigies rarissima in urna prope Bostampium inventa etc. Helmstadii 1729.
b . Olearius, M. Joh. Chr., Mausoleum in Museo i. e. Heydnische Begräbniß=Töpfe oder Urnae sepulcrales, welche bei Jerichau, Köthen, Arnstadt und Rudisleben gefunden worden . Jena 1701.
. Jena 1701.
c . Eckhardus, M. Paul. Jac., Duo perantiqua Monumenta ann. 1728 et 1732 ex agro Juterbocensi eruta . , quibus accesserunt Scriptores
rerum Juterbocensium etc. Vitembergae et Lps.
1734. (Geschenk des Hrn. Geh. Medicinalraths
Sachse in Schwerin.)
. , quibus accesserunt Scriptores
rerum Juterbocensium etc. Vitembergae et Lps.
1734. (Geschenk des Hrn. Geh. Medicinalraths
Sachse in Schwerin.)
- Rügens metallische Denkmäler der Vorzeit, vorzugsweise chemisch bearbeitet, herausg. von Prof. Dr. L. Hünefeld und Ferd. Picht. Mit Abbildungen. Lpz. 1827. 8.


|
Seite 17 |




|
965. 966. Fr. Saalfeld, Geschichte Napoleon Buonaparte's. 2 Bde. 3te Aufl. Stuttgart 1818. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- H. Schéving, Hugsvinns=mál. Videyar Klaustri 1831. 8. (Geschenk des nord. Vereins.)
-
M. D. Schröder, Kurtze Beschreibung der Stadt
und Herrschafft Wismar, was betrifft die
Weltliche Historie derselben
 . Wismar 1743. 4.
. Wismar 1743. 4.
-
Schutzschrift des vormaligen Herzogl. Meckl.
Landraths und Hof=Marschals
 . Balthasar Henning v. Wendessen.
Prenzlau 1755. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
. Balthasar Henning v. Wendessen.
Prenzlau 1755. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
( C. Sibeth,) Grundzüge zu einer gerechten und
billigen Vertheilung der durch den
Kriegvermehrten Staats=Bedürfnisse
 . , mit Anwendung auf Mecklenburg.
Rostock 1808. 8. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzkow in Schwerin.)
. , mit Anwendung auf Mecklenburg.
Rostock 1808. 8. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzkow in Schwerin.)
- C. Spalding, Defensionsschrift des Großherzogl. Meckl.=Strelitzschen Oberjägermeisters und Kammerherrn C. von Moltke u. s. w. 1817. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
-
Species facti, Aufrichtige und Actenmäßige, des
Pantzow=Mulsow=Lühischen Debit=Wesens
 . 1773. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
. 1773. Fol. (Geschenk des Hrn.
Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- J. G. Sponholz, Nachricht von dem Ursprunge der Stadt Lichen und dem damit gränzenden ehemaligen Mönchskloster, Cistertienserordens, Himmelpfort genannt. (In den nützlichen Beiträgen zu den N. Strelitz. Anzeigen Februar 1780.) 4. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)
974-985. Staatskalender, Großherzogl. Mecklenburg=Strelitzscher. Jahrgang 1829-1840. 8. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- Thomas, Analecta Gustroviensia, h. e. de inclyta Meclenburgensium civitate Gustrovia etc. Gustroviae et Lps. 1706. 8. [M. s. Nr. 199.] (Geschenk des Hrn. Steuerraths Schulze in Schwerin.)
- Ueber den unstatthaften Widerspruch der Mecklenburgischen Ritterschaft in Ansehung der im Teschner Frieden dem Herzogl. Hause Mecklenburg versicherten uneingeschränkten Nichtberufungs=Freiheit. 1780. 4. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)


|
Seite 18 |




|
-
Joach. Chr. Ungnaden, Amoenitates
diplomatico=historico=juridicae
 . 8 Stücke. 1749. 1750. 4.
(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
. 8 Stücke. 1749. 1750. 4.
(Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
989-992. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der 14., 15., 16. und 17. Versammlung, 1836, 1837, 1838 und 1839. Prag 1836-1839. 4 Bde. 8. [M. s. Nr. 374-381.] (Geschenk des Hrn. Bibliothekars W. Hanka in Prag.)
- Volksbuch, Allgemeines Mecklenburgisches. 6r Jahrgang. 1840. Wismar. 8. (Geschenk des Hrn. Pastors Sponholz zu Rülow.)
- Vorstellung, Rechtsgegründete höchst=gemüßigte, was für eine Bewandniß es habe mit der von Beider jetzt regierenden Herren Hertzogen zu Meckl.=Schwerin und Strelitz unter sich, zur Trennung derer vereinigten Meckl. Lande und Land=Stände, d. 3. Aug. 1748 errichteten Convention. 1749. Fol. (Geschenk des Hrn. Vicedirectors von Maydell in Schwerin.)
- C. Wex, Ueber die Wurfwaffen aclys und cateia. (Aus d. Zeitschrift f. d. Alterthumswissenschaft 1839, Nr. 144.) 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. P. Wigand, Wetzlarsche Beiträge für Geschichte vnd Rechtsalterthümer. 4tes Heft. Wetzlar 1840. 8. [M. s. Nr. 527. 528. 767. ] (Geschenk des wetzlarschen Vereins.)
- Wolff, Repertorium über alle Landes=Angelegenheiten, welche auf den seit 1755 bis 1784 in Mecklenburg gehaltenen öffentl. Landes=Versammlungen verhandelt worden. Rostock 1786. 4. [M. s Nr. 774.]
- Zeitschrift für vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. 2r Band. Münster 1839. 8.[M. s. Nr. 779. 780. ] (Geschenk des Vereins.)
- Zimmermann, Sendschreiben an den Hrn. Kammerdirector von Ferber über die gegenwärtige Lage Mecklenburgs. Neustrelitz 1809. 8. (Geschenk des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
- Dr. E. Zober, Die ehemaligen Altäre der St. Marienkirche in Stralsund von Franz Wessel. Aus d. Handschrift herausgegeben.(Aus der Sundine des Jahrs 1839.) 4. (Geschenk des Hrn. Herausgebers.)
- Dr. E. Zober, Geschichte der Belagerung Stralsunds durch Wallenstein im J. 1628. Stralsund 1828. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)


|
Seite 19 |




|
-
Zoch, Pünktliche Beleuchtung des in Nr. 259. d.
freim. Abendblatts unter dem Titel "Ein
neues Wort über die Wiederbesetzung der theolog.
Professur in Rostock" anonym erschienenen
Aufsatzes
 . Rostock 1824. 4.
. Rostock 1824. 4.
- Zoch, Ueber Reichssteuern, Austräge und Extrajudicial=Appellationen in vorzüglicher Rücksicht auf die Stadt Rostock. Rostock 1797. 4. (Nr. 1002 und 1003 Geschenke des Hrn. Kammer=Präsidenten von Levetzow in Schwerin.)
H. W. Bärensprung,
Bibliothekar des Vereins.
II. Sammlung typographischer Alterthümer.
Gekauft:
1) Lucidarius. Lübeck 1520.
In 4°, 5 Bogen mit Sign. A=E, ohne Sz. und Cust., auf mehrern Sorten Papier. Auf der Titelseite (A. 1) eine Krone in Holzschnitt, darunter:
Der Text beginnt auf der Rückseite des Titels mit einem Holzschnitte; dann beginnt der Text:
Wo gud vn nutte dat dyt boek is.
Dat erste gesette.
Dyt boek heth Lucidarius Dat sprickt vp důdesch. eyn vorluchter. An dessem boke fyndet me vele schone lere de suß velen is vorborgen. In etliker schrift wert dyt boek gheheten Auro gemma.
Die Initialen der Abschnitte sind Holzschnitte; außer den angeführten enthält das Buch noch 5 eingedruckte größere Holzschnitte. Am Ende auf der letzten Seite:
- Un hir myt wyl wy dessen lucidarius sluten to der ere godes. dem ewich loff sy. Amen. anuo dni MCCCCCXX L
beck.
Darunter, rechts und links, die beiden Wappenschilde des unbekannten Buchdruckers: links mit 3 Mohnköpfen, rechts ein T, an dem rechts am Perpendikularbalken ein Kreuz hängt.
Geschenkt:
2) Speculum naturalis coelestis et propheticae visionis: omniu calamitatum tribulationu et anxictatum: quae super omes status: stirpes et nationes cristianae reipublice: presertim quae cancro et septimo climati subjecte sunt: proximis temporibus venture sunt.


|
Seite 20 |




|
Am Ende :
Impressum Nurnberge per me Georgiu Stuchs ciuem Nurnbergen. Anno. M. D. VIII. Septimo kalendas Nouembris.
In Fol., 9 Bogen, in 3 Ternionen, mit Sign. a-c, ohne Seitenzahlen und Custoden, mit dem Wasserzeichen p im Papier, mit einem Holzschnitt auf dem Titel und 12 Holzschnitten im Text, zu jedem Capitel einer, und mit in Holz geschnittenen Initialen; die letzte Seite ist leer.
Geschenk des Herrn Advocaten Dr. Beyer in Parchim.
3) Das Gebetbuch in niederdeutscher Sprache, im J. 1522 zu Rostock bei Ludwig Dietz gedruckt, welches in Jahrb. IV (Gesch. der Buchdruckerkunst), S. 164 beschrieben ist, durch Vermittelung des Hrn. Dr. Deecke zu Lübeck vom Hrn. Stud. Wolff aus Wilster geschenkt.
III. Urkundensammlung.
Die Urkundensammlung des Vereins gewann nachstehend verzeichnete Stücke:
1) durch den Herrn Pastor Sponholz zu Rülow:
Abschriften von 6 Urkunden aus dem 13. und 14.
Jahrh., geistliche Stiftungen zu Roga, Stargard,
Friedland, Neu=Brandenburg und Broda betreffend.
2) durch den Herrn Major von Raven zu Schwerin:
das Familien=Archiv des Geschlechtes von Negendank,
bestehend aus 54 Original=Urkunden aus dem Zeitraume
von 1384-1648, mehrern Genealogien und Repertorien.
3) durch den Herrn Senator Fabricius zu
Stralsund:
Abschriften von 2 Urkunden:
Confirmation über das Gut Wosen für das Stift
Schwerin durch den Fürsten Wizlav von Rügen vom J.
1278, und über die Einrichtung von Archidiakonaten
im Bisthum Camin vom J. 1303.
4) durch den Herrn Dr. Friedländer zu Berlin:
Abschrift eines Sendschreibens des Cardinal=Legaten
Campegius an die Herzoge von Meklenburg wegen der
lutherischen Lehre vom J. 1525.
5) durch den Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch: Abschriften von 4 Urkunden aus dem 16. und 17. Jahrh. aus dem v. maltzahnschen Familien=Archive.


|
Seite 21 |




|
Die Sammlung besteht daher jetzt aus
| 79 | Original=Urkunden, |
| 173 | Urkunden=Abschriften, |
| 230 | Urkunden=Regesten. |
| --------------------------- | |
| 482 | Stück. |
IV. Sammlung anderer Handschriften.
1) Relation des stargardischen Superintendenten Dr. Joh. Garcaeus sen. (1553-1558) zu Neu=Brandenburg an die Kirchen=Visitatoren im J. 1558 über die Begrenzung der stargardischen Superintendentur, über sein Verhältniß als Pastor zu Neu=Brandenburg und Superintendent des Landes Stargard, über seinen Glauben und seine Lehre
.
aus einem alten Manuscript der königlichen Bibliothek zu Berlin in Abschrift besorgt durch den Hrn. Dr. Friedländer zu Berlin.
2) ein Brief des Professors Levezow zu Berlin vom 3. Mai 1826 an den Pastor Rudolphi zu Friedland über die Runen auf einem, im Besitze des Letztern befindlichen Spindelstein und über die strelitzer Runendenkmäler überhaupt, geschenkt vom Hrn. Pastor Sponholz zu Rülow.
3) Ein Brief von demselben an wail. Pastor Masch zu Schlagsdorf, mitgetheilt vom Herrn Pastor Masch zu Demern.
V. Nekrologium des Vereins.
Nekrolog des Landraths G. D. von Oertzen auf Kittendorf, vormaligen Ehrenmitgliedes unsers Vereins († 5. Jul. 1838), geschenkt vom Herrn Regierungsrath von Oertzen zu Schwerin.
B. Sammlung von Bildwerken.
I. Alterthümer im engern Sinne.
1. Aus vorchristlicher Zeit.
A. Aus der Zeit der Hünengräber.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Helm No. 2.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 21.)
Im Auftrage des Vereins öffnete ich ein Hünengrab, welches rechts unmittelbar am Wege von Wittenburg nach Helm, nördlich vom Haidberge, unweit der wittenburger Scheide


|
Seite 22 |




|
liegt. Es ist mit bedeutend großen Steinen an den Seiten eingefaßt und hat eine Länge von 186 Fuß von Osten nach Westen. Das östliche Ende in der Länge von 64' war durch quergelegte mächtige Steine in drei gleich lange Abtheilungen getheilt; es ist 16' weit und die Erde dazwischen war 4' hoch umgekehrt muldenförmig angehäuft. Der westliche, 122' lange Theil ist nur 12' breit und die Erde dazwischen nur 3' hoch. Der Urboden ist gelber Sand; die Erde im Grabe war etwas brauner, zum Theil lehmhaltig.
In der ersten, östlichen Abtheilung, wo die Aufgrabung begann, fanden sich Scherben von drei verschiedenen, dünnen, braunen, gehenkelten Urnen ohne Verzierung; doch ließ sich ihre Größe und Gestalt nicht genau erkennen. In der zweiten Abtheilung lagen wenige Scherben von zwei großen, sehr dicken und roh geformten Urnen. Die dritte Abtheilung enthielt einige Knochen und in der Mitte des Grabes Scherben von zwei braunen, ziemlich starken Urnen; auf dem Rande der einen sind oben runde Vertiefungen eingedrückt. Nahe an den Steinen auf der südlichen Seite fanden sich noch Scherben einer schwarzbraunen Urne. Außerdem fand sich in dieser Abtheilung ein sehr kleines, etwas unvollkommenes, spanförmiges Messer aus hell grauem Feuerstein, 2 1/8" lang, sehr gebogen; ferner das Bruchstück eines ähnlichen Messers aus dunklerem Feuerstein, 1 1/2" lang; auch drei noch nicht bearbeitete, von der Natur keilförmig gebildete Feuersteine scheinen nicht durch Zufall in das Grab gekommen zu sein. Gleich zu Anfange des schmäleren Theiles des Grabes wurden etwa 1' über dem Urboden nahe der südlichen Steinsetzung zwei Stücke Eisen gefunden, welche nur Bruchstücke zerbrochener neuerer Geräthe sind; es fehlt ihnen auch der alte Rost. - Kohlen von Tannen und Eichenholz waren durch das ganze Grab zerstreut 1 ).
Wittenburg, Ende October 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Helm No. 3.
Auf der nordwestlichen Abdachung des Haidberges bei Helm, gegen hundert Schritte von dem im October v. J. aufgegrabenen Hünengrabe entfernt, liegt ein anderes von 22' Breite und 52' Länge in der Richtung von Osten nach Westen, welches ich im Auftrage des Vereins öffnete. Rings umher


|
Seite 23 |




|
mit gegen 3' Fuß über die Erde hervorragenden Steinen eingefaßt, von denen die größten am östlichen Ende stehen, ist es inwendig 4' Fuß hoch umgekehrt muldenförmig mit Erde angehäuft, die aus rothgelbem Sande besteht.
Nachdem am östlichen Rande die Aufgrabung begonnen war, zeigten sich 2' hoch über dem Urboden hin und wieder gespaltene graue und röthliche Sandsteine, flach, von verschiedener Größe, doch in keiner erkennbar regelmäßigen Ordnung und Lage. Etwa 6' vom östlichen Ende gegen die Mitte des Grabes lag auf einem gespaltenen, fast viereckigen Steine von 2' Länge, 1' Breite und 1" Dicke
eine zerdrückte braune, verzierte Urne mit einem Henkel. Sie ist noch zum größten Theile vorhanden, hat 7 3/4" Höhe, 2" Durchmesser in der Basis und 6 3/4" im Bauche. Der 3" lange Hals ist unten 2 7/8" und oben 3 3/4" weit. Die Oeffnung des Henkels, welcher unten am Halse sitzt, ist so groß, daß man bequem mit einem Finger durchfassen kann. Die Verzierung besteht in Streifen von je 6 Linien, welche in einer Breite von 1/2" von der Halsenge bis etwas unterhalb der Bauchweite perpendiculär herablaufen, sich oben vereinigen und hier von kleinen bogenartigen Linien begrenzt werden. In der Urne war nichts, die Scherben selbst aber lagen in einer dunkleren, etwas übel riechenden und klebrigen Erde. Weiterhin lagen noch viele Steine von verschiedener Form in diesem Grabe, aber von weiteren Urnen oder sonstigen Alterthümern war nichts zu finden. Kohlen waren in der ganzen Erdmasse zerstreut.
Wittenburg, im Junius 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Wittenburg.
Im Auftrag des Vereins ging ich an die Aufdeckung eines Begräbnißplatzes auf dem wittenburger Felde, der zwischen dem hagenower und helmer Feld auf der Haide nahe an dem Holze, die hohen Buchen genannt, liegt und eine Länge von 28' in der Richtung von Osten nach Westen hat; die Breite beträgt 20'. Er ist im Viereck mit großen, aber mehr runden als hohen Steinen umstellt, zwischen denen die Erde 3 1/2' umgekehrt muldenförmig angehäuft ist, bestehend aus gelbem Sande, wie der Boden umher.
Die Aufgrabung geschah von Osten. Etwa 4' von diesem Ende nach der Mitte hin fand sich, 1' hoch über dem Urboden, ein Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, fast 5" lang, an der beilförmigen Schneide 2", am hinteren stumpfen Ende


|
Seite 24 |




|
1" breit, von 3/4" Dicke. Die beiden Hauptflächen sind geschliffen, hinten aber und an den Kanten muschelförmig ausgebrochen. In einer Entfernung von 10' weiter westlich lag dicht über dem Urboden ein kleiner Schmalmeißel aus ähnlicher Masse, eben so geschliffen, 4 1/4" lang, 3/4" breit und 5/8" dick. In der ganzen Begräbnißstelle lagen zwischen der Erde hin und wieder Steine, aber keine flach gespaltene, auch in keiner erkennbaren Ordnung. Von Urnen war nirgends eine Spur zu entdecken.
Wittenburg, im Mai 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Perdöhl.
Etwa 400 Schritte östlich von der nördlichen Gruppe der von mir aufgedeckten Kegelgräber auf dem perdöhler Felde liegt an einer sich nach Westen abdachenden Anhöhe ein Hünengrab von 55' Länge, in der Richtung von Südosten nach Nordwesten; die Breite beträgt 16'. Rund umher mit ziemlich großen, aus der Erde hervorragenden Steinen umsetzt, ist die aus braunem Sande bestehende Erde umgekehrt muldenförmig zwischen denselben 3 1/2' hoch angehäuft. Die Urerde besteht aus gelbem, mit kleinen Steinen gemischten Sande.
Die Aufgrabung begann am südöstlichen Ende, wo sich anfangs in der Tiefe einige Kohlen von Tannenholz zeigten, nachher aber durchaus nichts weiter gefunden ward 1 ).
Wittenburg, im October 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Steinkisten bei Genzkow.
In der jüngsten Zeit kam ich auf dem Wege nach Friedland, unmittelbar an der Landstraße, auf der Feldmark Genzkow, etwa 500 Schritte jenseits der sadelkowschen Grenze, auf eine so eben von Steinsprengern geöffnete, schön erhaltene Steinkiste zu. In Friedland benachrichtigte mich der Herr Bau=Conducteur Mühlpfort ebenfalls von dieser Aufgrabung, mich zur nähern Besichtigung einladend. Diese stellte ich sofort auf der Rückkehr an. Ein ausnahmsweise ganz verständiger und mehr als gewöhnlich gebildeter junger Schachtmeister, der die
J. Ritter


|
Seite 25 |




|
Steinkiste selbst aufgegraben, führte mich nicht nur sehr freundlich, sondern gab mir auch über das bei sorgfältig geführter Arbeit Vorgekommene umständliche Nachricht. Die Steinkiste, mit dem Erdboden gleich, lag in der Tiefe des Thals, welches der Höhenzug der Südgrenze des friedländischen Werders mit dem Höhenzuge der genzkower Berge auf dieser Seite bildet, in gleicher Höhe mit den Wiesen, am fälschlich sogenannten Landgraben, einer Verbindung des Datzebaches mit dem friedländischen Teich, ein Beweis, daß doch wenigstens zur Zeit der Errichtung dieser Steinkiste schon trocknes Land dort war.
Die gedachte Steinkiste bestand aus 5 bedeutenden Granitplatten, von denen eine, fast herzförmige, von vorzüglich harter Masse, das Kopfende gegen S. bildete; die beiden Längsseiten waren von je zwei dergleichen Platten gebildet; der Stein am Fußende war von den Arbeitern schon weggenommen und zerschlagen. Die Masse dieses Steines war weniger hart, von jener dem rothen Feldspath nahe kommenden Farbe. Die Kiste hatte also die Richtung von S. nach N., war durchaus ohne Erd= oder Steinhügel; die Deckplatte, welche nicht die ganze Fläche bedeckt hatte, ebenfalls schon zerschlagen, hatte mit der Oberfläche des umgebenden Erdreichs gleich gelegen. Die Tiefe des Grabes betrug 3 1/2 Fuß, die Länge 5, die Breite 2 1/2 Fuß. Die Zwischenräume der einzelnen Granitplatten, nicht die mindeste Kunst, auch nicht einmal die rohste, verrathend, fand ich noch mit zerschlagnen Feldsteinstücken und einem eisenhaltigen Lehm sorgfältig fest ausgemauert, namentlich die beiden Winkel am Kopfende. Der Inhalt der Kiste, noch umherliegend, war oben, außer einer mit der angrenzenden Erdart gleichen, ein grobgrandiger Sand, der nach unten plötzlich in eisenhaltigen Lehm überging. Der Fußboden des Grabes von dieser letztern Erdart war wie eine Tenne fest geschlagen. Auf diesem hatte der Schachtmeister an der östlichen Seite hart an den Steinplatten eine zerbrochene Urne gefunden, wovon ich nur noch eines kleinen Bruchstücks habhaft wurde. Die Form ist daraus nicht mehr zu erkennen; die Masse ist jene hier oft vorkommende: Sandlehm mit Glimmer, äußerlich von gelber, nach innen von schwärzlicher Farbe. Daneben hatte der Mann der ganzen Länge des Grabes nach auf der westlichen Seite zerstreute und in Splitter zerfallene Knochen in Menge gefunden. Nur wenige derselben vermochte ich aus der aufgeworfenen Erde zu sammeln. Schade, daß ich bei der Aufgrabung selbst nicht gegenwärtig war! Von einer Brandstätte, von Kohlen u. s. w. war nirgends eine Spur; die Knochensplitter selbst verrathen nicht das Mindeste vom Feuer.


|
Seite 26 |




|
Wahrscheinlich also eine unverbrannt beigesetzte Leiche. Fünf Schritte davon, noch näher an der Wiese, fand sich eine zweite Steinkiste, der vorigen ganz ähnlich, geöffnet; doch war keine Messung oder nähere Untersuchung mehr möglich, weil die Arbeiter die Steinplatten schon über einander gestoßen hatten. Der Schachtmeister fügte nur bei dieser hinzu, daß in der Tiefe der Lehm wie Schlamm von Wassertheilen durchdrungen gewesen sei. - Schon vor 20 Jahren erinnere ich mich, daß ganz in der Nähe dieser Steinkisten eine bei weitem großartigere, die halb über die Erdoberfläche hervorragte, wahrscheinlich von Schatzgräbern geöffnet war. Die Deckplatte, ein schöner großer Stein, war abgehoben und lag in zwei Hälften neben der Kiste. Uebrigens ist die bezeichnete Gegend wohl an 3000 Schritte westlich von der Kegelgräbergruppe auf dieser Feldmark entfernt 1 ). Wie jene Steinkisten in der Tiefe liegen, befinden sich diese Kegelgräber auf der Höhe.
Rülow, im Junius 1840.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Hünengräber von Warlin.
Das Bedürfniß an Steinen zum Kunststraßenbau zwischen Neubrandenburg und Friedland bringt fast wöchentlich in dieser an Grabdenkmälern der Vorzeit reichen Gegend dergleichen ans Tageslicht. Bei zwei neben einander liegenden Kegelgräbern oder Hünenbetten unweit Warlin, hart an der Landstraße, hatten frühere Untersuchungen - ein Quergraben in der Richtung von N. nach S. durch eins derselben verrieth diese früheren Nachforschungen - und Benutzung der im Kreise am Fuße der bedeutenden Hügel liegenden großen Steine wenig Ersprießliches für die jetzige völlige Eröffnung übrig gelassen. Einige Kohlenreste, Urnenscherben, wie sie häufig aus den ältern Gräbern kommen, und ein kleiner Feuersteinsplitter waren Alles, was ich ausbeutete 2 ).
Rülow, im Junius 1840.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Hünengräber 3 ) von Goldenbow (ritterschaftlichen Amts Wittenburg).
Auf dem zum Gute Goldenbow gehörigen Vorwerke Friederichshof liegt rechts von der neuen Chaussee, die von


|
Seite 27 |




|
Albertinenhof nach Vellahn führt, nahe vor dem sogenannten Birkholze, eine Gruppe von Gräbern, deren Bau einiges Abweichende von sonst vorkommenden hat. Der Herr von Laffert auf Lehsen hatte die Gewogenheit, seine dort mit Steinbrechen beschäftigten Leute zur Aufdeckung dieser Gräber für den Verein anzuweisen.
Das nördlichste Grab ist ganz wie ein Riesenbett gebauet, in der Richtung von Osten nach Westen 80 Fuß lang und 18 Fuß breit, viereckig mit ziemlich großen Steinen eingefaßt, zwischen denen die Erde 3 bis 4' hoch umgekehrt muldenförmig angehäuft ist. Es fanden sich nur Urnenscherben darin, welche ganz nach Masse und Form den in den perdöhler Kegelgräbern gefundenen Urnen entsprechen.
Etwa 40 Schritte südlich davon liegt ein anderes, parallel mit dem vorigen, 75 Fuß lang und 20 Fuß breit. Unmittelbar an das westliche Ende schließt sich ein Kreis mit großen Steinen eingefaßt von 36 Fuß Durchmesser und über 6 Fuß Höhe in der Mitte. In diesem Kreise lag auf der Oberfläche sichtbar ein großer Stein fast viereckig, gegen 8 Fuß lang und breit und 3 bis 5 Fuß dick. Unter dem westlichen Ende dieses Steines lagen andere breite Steine in 2 Schichten so unter einander, daß jede davon etwa 2 Fuß breit vorsprang und sie wie Stufen schienen, auf denen man zu der oberen Platte gelangen könne. Unter den Steinen, wie im Kreise fand sich nichts; in dem langen Vierecke lagen Urnenscherben wie im vorigen zerstreut.
In fast gleicher Entfernung südlich läuft parallel ein Grab von 110 Fuß Länge und 18 Fuß Breite. Außer Scherben fanden sich hierin etwa 45 Fuß vom östlichen Ende und 3 Fuß von einander entfernt 2 Urnen, deren Gestalt erkennbar ist; sie standen auf dem Urboden :
a) die südlich stehende Urne ist hellbraun von fester Masse; sie mißt in der Basis 4", im Bauche 10", in der Höhe bis zum fehlenden Rande 8" und beträgt die Oeffnung etwa 6". Der Inhalt bestand aus Knochen.
b) Die andere Urne ist von gröberer Masse, braun, hat in der Basis 51/4", im Bauche 91/2", in der Höhe 7" und in der Oeffnung 8". Es waren einige Knochen darin.
In der Nähe der Urnen, aber nicht unmittelbar daran, lagen einige kleinere flache und runde Steine.
Wittenburg, im April 1840.
J. Ritter.


|
Seite 28 |




|
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Alterthümer von Gelbensande.
Zu Gelbensande bei Ribnitz wurden in einer Mergelgrube neben einander folgende Alterthümer gefunden und von Herrn Rettich zu Rosenhagen geschenkt:
1) ein Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, in der Schärfe nachgeschliffen und ausgesprungen.
2) ein Streithammer aus festem Gneis in rhombischer Gestalt, in den größten Dimensionen 5 1/2" lang und 2" breit, sehr regelmäßig gearbeitet und geglättet, aber nicht polirt und ohne Schaftloch, und in dieser Hinsicht höchst merkwürdig; es findet jedoch diese abweichende Form, welche entweder zum Einklemmen in einen gespaltenen Schaft gebraucht ist, ihre Analogie in den Frid. Franc. Tab. XXIX, Fig. 3 abgebildeten Fausthämmern, oder dieser Hammer ist unvollendet geblieben.
3) ein runder Gefäßdeckel aus lydischem Stein (Probierstein), oben gewölbt, nach unten etwas spitz zu gehend, 4" im größten Durchmesser, im flachen Boden 3" im Durchmesser, unbestimmt zu welchem Gebrauche, jedoch wohl zum Einpassen in ein Gefäß bestimmt.
Keile.
1 Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, 6" lang, gefunden beim Ausgraben eines Kellers zu Rehna unter einem am Markte belegenen Hause, geschenkt vom Herrn Bürgermeister Daniel daselbst.
1 Keil aus karneolfarbigem Feuerstein, 5" lang, an den breiten Seiten geschliffen, gefunden auf dem Felde von Jarchow bei Marnitz, geschenkt von Herrn Burmeister jun. zu Jarchow.
1 Keil aus grauem Feuerstein, mit braun gefärbter Oberfläche, gefunden in einer Mergelgrube zu Boldebuck, zu den von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Schaumburg=Lippe dem Verein zur Aufbewahrung anvertrauten Alterthümern gehörig.
1 Keil aus grauem Feuerstein, 4 1/2" lang, gefunden in einer Sandgrube zu Langsdorf, Amts Sülz, 2 Fuß tief im Sande, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.
Streitäxte.
1 Streitaxt aus Hornblende, wie Frid. Franc. Tab. I, Fig. 5, gefunden im Torfmoor von Sülz, 4 Fuß tief, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.


|
Seite 29 |




|
1 Streitaxt aus Hornblende mit großem Schaftloch, gefunden zu Boldebuck, von Sr. Durchl. dem Fürsten von Schaumburg=Lippe zur Aufbewahrung überlassen.
1 Streitaxt aus Hornblende, von der größten Gattung und von gewöhnlicher Form, wie Frid. Franc. Tab. XXVIII, Fig. 1, 8" lang, 2 1/2" hoch und um das 1 1/2" weite, gut gebohrte Schaftloch 3 1/2" breit, gefunden zu Grevismühlen beim Ausgraben eines Kellers unter dem Hause des Herrn Stadtsecretärs Behrmann und von diesem geschenkt.
Ein Dolch aus Feuerstein,
dunkelgrau und durchscheinend, muschelig geschlagen, trefflich gearbeitet, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXX, Fig. 2, gefunden im Torfmoor zu Langsdorf nahe an der sülzer Grenze, unfern einer Stelle, wo vor alter Zeit ein Damm, der Bärendamm (vgl. Jahresber. III, S. 186), durch das Moor geführt war, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.
Eine Lanzenspitze von Feuerstein,
muschelig geschlagen, ungefähr zur Hälfte vorhanden, noch 3 1/2" lang, neben zwei andern, wohl erhaltenen, ungefähr 6" langen, gleichen Lanzenspitzen oder Messern, welche zweischneidig nach beiden Enden spitz auslaufen, am Ende der Kegelgräberreihe auf der Feldmark Genzkow bei Friedland, dicht vor der Walkmühle vor Friedland, links an der Landstraße von Neu=Brandenburg nach Friedland, hart an der Landwehre, an der Stelle eines abgetragenen Grabes 1 1/2 tief unter der jetzigen Erdoberfläche zwischen Steinen gefunden und vom Herrn Hauptmann von Cramon auf Genzkow durch den Herrn Pastor Sponholz zu Rülow geschenkt; vgl. unten "Kegelgräber von Genzkow".
Ein Schmalmeißel aus Feuerstein,
weißgrau, 6" lang, 7/8" breit, an einer Seite hohl, an der andern Seite convex geschliffen, gefunden 1839 zu Langsdorf beim Ausmodden eines Teiches, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.
Ein Schleuderstein (?)
aus grobkörnigem, rothgelbem Sandstein, rund, ohne Rillen und Vertiefungen, 1" im Durchmesser, 1" dick, gefunden 3 Fuß tief im Torfmoor zu Langsdorf, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz.


|
Seite 30 |




|
Spanförmiges Messer aus Feuerstein.
Bei Anlegung einer Leimfabrik auf einer Landzunge am Schalsee nördlich von Zarrentin wurde ein spanförmig geschnittenes Messer aus Feuerstein und eine Streitaxt oder Streithammer gefunden. Ersteres, ungewöhnlich groß, ist 4 3/4" lang, vorne 1 1/2", hinten 1" breit; die eine Seite ist eine einzige Fläche, die andere zeigt 3 und auf einigen Stellen 4 Flächen, wovon die nach den Schärfen die breitesten sind; der Durchschnitt ist, wie gewöhnlich, trapezoidisch. Es ist nur wenig gebogen. Die Schärfen sind viel gebraucht, ausgesprungen und stumpf. Der Herr Oberforstmeister von Rantzau zu Wittenburg erwarb es von dem Eigenthümer der Fabrik und schenkte es dem Vereine. Die Axt oder der Hammer war schon an den Kammeringenieur Harms verschenkt.
B. Aus der Zeit der Kegelgräber.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.



|



|
|
:
|
Kegelgrab zu Ruchow.
In den Jahren 1820 und 1821 ließ Se. Durchlaucht der
Fürst von Schaumburg=Lippe eines der größten
Kegelgräber im Lande in der Art aufdecken, daß ein
Kreuzschnitt durch das Grab gezogen wurde. Der
Hügel, Königsberg genannt (abgebildet auf der
Titel=Vignette des Friderico=Franciscei), lag auf
dem Meiereifelde von Ruchow, ganz in der Nähe des
tieplitzer Kruges, rechts von der Landstraße von
Sternberg nach Güstrow, und hatte ungefähr 20'
Axenhöhe und 200' Umfang. Dieses Kegelgrab gab die
reichste Ausbeute, die wohl je ein Grab gegeben hat,
und daher erregte der Fund damals großes Aufsehen;
er ward zuerst zu Ruchow, darauf zu Boldebuck
aufbewahrt, bis der durchlauchtigste hohe Beförderer
des Vereins ihn diesem zur Aufbewahrung in der
Vereinssammlung überließ, in welche sie denn am 26.
Februar 1840 versetzt ward. Beschrieben ist die
Aufgrabung mit dem Funde wiederholt im Freimüth.
Schweriner Abendblatte 1821, Nr. 139, und im Frid.
Franc. Erläut. S. 43 flgd.; die Haupturkunde über
den Fund bleibt aber der bei den Alterthümern bisher
befindlich gewesene, hier angehängte
Aufgrabungsbericht ("Verzeichniß
![]() . ") des wail. Gutsaufsehers und
Organisten Lindig zu Ruchow, welcher mit der Leitung
der Aufgrabung, bei der auch schon der
Unterzeichnete öfter, auch mit dem Professor
Schröter, gegenwärtig war, beauftragt war. Es soll
hier daher nur eine kurze, kritische Beschreibung
der aufgefundenen Gegenstände gegeben
. ") des wail. Gutsaufsehers und
Organisten Lindig zu Ruchow, welcher mit der Leitung
der Aufgrabung, bei der auch schon der
Unterzeichnete öfter, auch mit dem Professor
Schröter, gegenwärtig war, beauftragt war. Es soll
hier daher nur eine kurze, kritische Beschreibung
der aufgefundenen Gegenstände gegeben


|
Seite 31 |




|
und ihre Deutung versucht werden; die in ( ) gesetzten Buchstaben und Zahlen bezeichnen die Nummern des Lindigschen Aufgrabungsberichts.
I. Ungefähr in der Mitte des Hügels stand eine Wölbung von Feldsteinen (B), in der Richtung von Osten gegen Westen, in einer Länge von ungefähr 14 Fuß. Unter derselben lag in derselben Richtung auf einem Steinpflaster ein ausgehöhlter Eichenstamm von 12' Länge und 6' Breite, in welchem die Leiche unverbrannt beigesetzt war. Der Eichenstamm war zum größten Theile vergangen, jedoch noch nach seiner ganzen Ausdehnung erkennbar, ja es wurden noch ziemlich große Stücke von demselben ans Tageslicht gefördert. Die Gebeine der Leiche waren jedoch, bis auf die Hirnschale, welche fehlte, fast alle gut erhalten und deuteten auf einen männlichen Körper von ungewöhnlicher Länge von ungefähr 7 Fuß; die Zähne waren alle gesund; die Arme lagen ausgestreckt neben dem Körper; das Gesicht war gegen Osten hingewandt. Neben diesen Gebeinen fand sich auch noch das schon calcinirte untere Ende des Oberarmbeins (humeri) von einem Pferde (nach der Bestimmung des Hrn. Professors Steinhof zu Schwerin); es ward also nach altem Gebrauche das Streitroß mit dem Helden begraben.
Die Alterthümer neben diesem Gerippe waren folgende:
1) (B. 3.) Neben dem Körper, zur linken Seite desselben, lag ein Schwert von Bronze, welches einen hölzernen Griff mit halbmondförmiger Ueberfassung über die Klinge gehabt hatte; das ganze Schwert, mit der nur 3" langen Griffzunge, ist etwas länger, als gewöhnlich, mißt 2' 4" und ist in 4 Stücke zerbrochen, deren Bruchenden oxydirt sind. Das Schwert ward also, wie es stets beobachtet ist, zerbrochen ins Grab gelegt.
2) (B.4.) Zur rechten Seite des Gerippes lag ein Scheermesser von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XVIII, Fig. 8, jetzt in 3 Stücke zerbrochen; ins Grab gelegt ward es in 2 Stücken, da nur 2 Bruchenden oxydirt sind.
Daneben lag ein kleiner viereckiger Beschlag von Bronze, in der Form wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 9, nur kleiner, wahrscheinlich Griffbeschlag des Messers.
3) und 4) (B. 1. u. 2.) An jeder Hand lag bei den Fingerknochen ein spiral=cylindrisch gewundener Finger=Ring von doppeltem, an den Enden verbundenem Golddrath, von 4 und 5 Windungen.
5) (B. 5.) Wahrscheinlich auf der Brust lag eine Heftel aus Bronze mit zwei Spiralplatten, wie Frid. Franc. Tab.


|
Seite 32 |




|
XI, Fig. 3 ("zwei Haarnadeln" nach Lindig), in sehr viele Stücke zerbrochen und stark oxydirt, und
6) (B. 6.) eine kurze Nadel von Bronze mit rundem,
gewölbtem Knopfe ("Bruchstücke von Ringen,
Knöpfen
![]() . " nach Lindig, der Nr. 5 und 6
vermengt); die Rückenwirbel des Skeletts sind
wahrscheinlich durch Nr. 5 und 6 von Oxyd grün gefärbt.
. " nach Lindig, der Nr. 5 und 6
vermengt); die Rückenwirbel des Skeletts sind
wahrscheinlich durch Nr. 5 und 6 von Oxyd grün gefärbt.
Zu den Füßen der Leiche stand
7) (B. 7.) eine schwarze Urne von feiner Urnenmasse, welche einen kleinen Henkel gehabt hatte, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 9, 5" hoch und 7 1/2" weit, ohne Verzierungen, und
8) (B. 8.) die Bruchstücke einer kleinern, jetzt restaurirten, dunkelbraunen Urne von sehr feiner Urnenmasse und schöner Form mit senkrecht gekerbtem Bauchrande, mit einem kleinen Henkel, 3 3/4" hoch und 6" weit.
Außerdem sind noch vorhanden:
9) (B. 9.) die meisten Knochen des Gerippes und
10) (B.10.) einige Reste von dem eichenen Sarge.
Die Gebeine, von denen die der rechten Seite am besten und nur die des rechten Beines fast ganz erhalten sind, deuten nur auf einen sehr hohen, kräftigen Bau von ungefähr 7 Fuß Länge; das Schenkelbein (femur) mißt 20 1/2" mekl. (= hamburger) Maaß, die Ausdehnung des Schenkelkopfes mit gerechnet. Es sind die noch vorhandenen Rückenwirbel, wahrscheinlich durch die durchgefallene Brustheftel, und einige Fingerknochen, vielleicht der linken Hand, wahrscheinlich durch das Schwert, von Oxyd grün gefärbt. Die Zähne sind alle gut erhalten. Vom Schädel sind nur einige kleine Fragmente vorhanden.
II. Zur linken Seite der mit Feldsteinen überwölbten Leiche stand in gleicher Richtung eine zweite Wölbung (D.) von 10 Fuß Länge, welche keinen Sarg, dagegen auf dem Boden auf einem Feldsteinpflaster eine Masse schlammiger, übel riechender Erde enthielt; hier fanden sich auf einem kleinen Raume von 2 Quadratfuß sehr viele Alterthümer zusammengedrängt. Zu diesem Begräbnisse war offenbar schon Leichenbrand angewandt. Es fand sich an Alterthümern:
11) und 12) (D. a. u. b.) zwei goldene Fingerringe aus spiral=cylindrisch gewundenem, doppeltem Golddrath, aus 4 1/2 und 5 1/2 Windungen, wie Nr. 3 und 4, nur etwas feiner im Drath und enger;
13) (D. g.) zwei gewundene Halsringe aus Bronze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2.


|
Seite 33 |




|
14) (D. h.) zwei Paar massive Handgelenkringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 3;
15) (D. e.) eine große Nadel aus Bronze ("Lanzenspitze" nach Lindig), mit einem großen, platten Knopfe, in vier Stücken, deren Bruchenden oxydirt sind, wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 2, nur etwas dünner und feiner, beim Funde 24 1/2", jetzt 19" lang, da die Spitze fehlt;
16) (D. f.) eine große Nadel aus Bronze ("Dolch" nach Lindig), mit Doppelknopf, in vier Stücken, deren Bruchenden oxydirt sind, 9 1/2" lang;
17) (D. i.) ein gekrümmtes Messer aus Bronze, mit bronzener Griffzunge, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 13;
18) (D. d.) eine runde Büchse von Bronze mit plattem Deckel, mit Henkeln zum Durchschieben eines Riegels, zwei auf dem Rande und einem in der Mitte des Deckels auf der untern Seite verziert, wie Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3; in derselben fanden sich, dem Anscheine nach, Reste von Birkenrinde;
19) (D. k.) ein Paar Handbergen von Bronze, ganz wie Frid. Franc. Tab. IV, wenn auch zerbrochen und in den Bruchenden oxydirt, doch vollständig vorhanden;
20) (D. c.) eine Urne von sehr dünne getriebener Bronze, mit einem angenieteten, zerbrochenen Henkel, mit rundem, wenig aus getriebenem Bauche, im Untertheile ganz zerbrochen, ursprünglich 3 1/3" hoch und im Rande 6" weit;
21) (D. 1.) Bruchstücke von einer thönernen Urne von grobkörniger, im Innern geglätteter, im Aeußern rauher Masse, welche ungefähr 12" Höhe und 10" Weite gehabt haben mag.
Vergleicht man die beiden Steingewölbe I und II, so ergiebt es sich unbestreitbar, daß sie zwei verschiedene Begräbnisse bildeten, welche später durch Einen Hügel verbunden wurden, das erste Begräbniß I, in welchem noch die Leiche unverbrannt beigesetzt ward, gehörte eben so unbestreitbar einem Manne und zwar einem Krieger; das zweite Begräbniß II scheint einer weiblichen Bestattung mit Leichenbrand anzugehören. Daß die beigesetzten Leichenreste und Alterthümer Weibern gehört haben, dafür redet der gänzliche Mangel an Waffen und das Vorhandensein von weiblichem Schmuck, wie Haarnadeln, Handringen, Halsringen, und weiblichem Geräth, wie Büchse und Messer (das Messer in II ist ein gewöhnliches, das Messer in I ein Scheer=Messer). Ja, man kann noch weiter gehen und vermuthen, daß die Alterthümer in II zwei erwachsenen weiblichen Wesen (zwei Frauen des Mannes in I) gehört haben,


|
Seite 34 |




|
da sich die Schmuckgegenstände alle doppelt finden, wie die Halsringe, Armringe und Haarnadeln. Dann würde jeder Frau ein goldener Fingerring, deren jeder in II auch etwas enger und feiner im Drath ist, als die beiden Ringe in I, gehört haben, und daher dürfte es sich erklären lassen, daß der Mann zwei goldene Spiralringe trug. Denn in ähnlichen Verhältnissen, wo ein Mann und eine Frau in demselben Hügel beigesetzt wurden, findet sich bei jeder Leiche nur ein goldener Spiralring (vgl. Jahresbericht IV, S. 27), der nach wiederholten Erfahrungen die Bedeutung eines ehelichen oder Trau=Ringes haben dürfte. Würden diese Vermuthungen Stich halten, so gehörten auch alle in II gefundenen Alterthümer zum weiblichen Geräth und daher auch die bisher sogenannten Handbergen, welche, wie schon Frid. Franc. Erl. S. 33 folgd. ausgesprochen ist, nur Armbänder mit auslaufenden Spiralwindungen sein dürften.
Es würde hiernach jeder der beiden Frauen gehören:
ein Halsring,
ein Paar Armringe,
ein goldener Fingerring,
eine Haarnadel,
eine Urne,
und einer von beiden im Ganzen oder zum Theile:
die Büchse,
das Messer,
die Handbergen.
III. Zu den Füßen der beiden Begräbnisse I und II, gegen Osten, fand sich eine dritte Steinanhäufung (A.). Unter dieser standen vier thönerne Urnen, welche zertrümmert waren, nämlich:
22) Reste einer großen Urne mit glatten, hellbraunen Flächen;
23) eine kleine, kürbisförmige, schwärzliche Urne, 3 1/2" hoch, gegen 4" weit im Bauche, auf der Oberfläche mit eingekratzten, senkrechten Parallelfurchen, von je 6 Furchen verziert;
24) Reste einer großen, grobkörnigen, hellbraunen Urne mit rauher Oberfläche;
25) eine kleinere, rundbauchige, schwärzliche Urne, 5" hoch und 6" im Durchmesser im Rande.
In diesen Urnen lagen
26) (A. d.) die verbrannten Knochen von Kindern, ungefähr zwischen 10-15 Jahren. Wahrscheinlich gehört nach der Zahl der Urnen und der Menge der Knochen diese Bestatung zweien Kindern.


|
Seite 35 |




|
In der kleineren Urne lagen
27) (A. c.) viele Enden von eng spiral=cylindrisch gewundenem Bronzedrath, Reste eines Halsbandes, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 6.
In der Urne Nr. 23 lag
28) (A. a.) ein enger spiral=cylindrisch gewundener Fingerring aus Bronze von 3 Windungen, von denen nur die mittlere erhalten ist.
Außerdem fanden sich
29) (A. b.) sehr dünne Blättchen aus Bronze, deren Bestimmung nicht mehr zu errathen ist.
IV. Zur linken Seite des weiblichen Begräbnisses in II, in der Höhe etwas über demselben, wurden zwischen Steinen (C.) noch mehrere Alterthümer entdeckt, nämlich:
30) eine große Urne mit schwärzlicher Oberfläche.
In der Urne lag
31) (C. a.) ein goldener Fingerring für einen starken Finger, aus zwei gewundenen Reifen zusammengelöthet, auf der Außenseite stark abgetragen und abgeplattet;
32) (C. b.) ein Doppelknopf aus Bronze, wie Tab. XXXII, Fig. 22, mit einer vertieften, kreuzförmigen Verzierung auf der obern gewölbten Fläche; der Knopf enthielt bei der Aufgrabung noch Reste von Leder;
33) (C. c.) ein viereckiger Beschlag (Stabbeschlag ?) von Bronze, der bei der Aufgrabung noch mit Holzresten angefüllt war, wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 9 und wie ein gleicher Beschlag (vgl. Jahresbericht V) in dem Königsgrabe von Lehsen gefunden ward.
Nach dem Stabbeschlage oder Scepterring könnte dieses Begräbniß einer ältern, männlichen Person gehört haben. Damit mag denn auch die abweichende Form des Fingerringes in Beziehung stehen.
Man kommt von selbst zu der Vermuthung, daß dieser Hügel einer ganzen Krieger= oder Fürsten=Familie angehört habe.
G. C. F. Lisch.
Verzeichniß
der Gegenstände, welche bei Aufgrabung eines Grabhügels auf dem ruchower Meiereifelde in der Nähe des tieplitzer Kruges und der schwerinschen Landstraße in den Jahren 1820 und 1821
A. Am östlichen Abhange des Hügels haben gestanden:
Bruchstücke von vier roh gearbeiteten thönernen Urnen, die mit Knochen angefüllt gewesen sind. Dazwischen lagen:


|
Seite 36 |




|
- in der mittlern Urne, welche etwas gereifelt gewesen, ein kupferner Ring, der aus drei Windungen bestanden hatte, von denen aber nur die mittlere ganz erhalten ist.
- mehrere theils platte, theils gewölbte sehr dünne Kupferblättchen, deren Bestimmung nicht zu enträthseln, und
- fast ein Dutzend kleinere gewundene Kupferstückchen, wahrscheinlich Reste eines Halsbandes, welche zwischen den Bruchstücken und den gebrannten Knochen dieser Urne sorgfältig ausgesucht worden sind.
- eine große Menge angebrannter, und wahrscheinlich Kinderknochen.
B. Aus dem zuerst geöffneten Grabgewölbe nach Süden sind erhalten:
1) ein Ring von 5 zusammenhängenden, spiralförmigen und elastischen Windungen von doppeltem Golddrath, der einfach etwa 1/2 Linie dick ist, Durchmesser 11 Linien, am Finger getragen, wie
2) ein Ring von 6 Goldgewinden, von denen das eine etwas beschädigt. Das Gold an 1) wie an 2) ist sehr fein, hell und glänzend. Gesammtes Gewicht 1 1/8 Loth. Beide Ringe lagen bei den Fingerknochen.
3) ein Kupferschwert in 4 Stücke zerbrochen, die Klinge in der Mitte erhaben, mit feinen Reifeln gearbeitet; im Heft, das ebenfalls eine bogenartig erhabene Verzierung zeigt, sitzen noch einige Nägel, mit welchen seine Bekleidung befestigt gewesen. Ganze Länge 2' 9" und 6 Linien. Lag auf der linken Seite des Körpers.
4) ein schmales Messer von Kupfer, in 3 Stücke zerbrochen, daneben ein kleines gereifeltes, inwendig hohles Viereck, vermuthlich Stielbeschlag des Messers. Lag auf der rechten Seite des Körpers.
5) zwei Haarnadeln, in mehrere Stücke zerbrochen, oben mit runden Platten aus gewundenem Kupferdrath.
6) Bruchstücke von Ringen, Knöpfen
![]() . , zum Theil unkenntlich, alles Kupfer.
. , zum Theil unkenntlich, alles Kupfer.
7) eine Urne aus schwarzem gebrannten Thon, der Henkel abgebrochen und schon geborsten, Höhe 5 Zoll.
8) Bruchstücke einer zweiten Urne, die verziert gewesen. Beide zu den Füßen.
9) Knochen, welche der Lage nach 8 Fuß lang lagen. Der Sarg ist nach genauer Ausmessung 12' lang und 6' breit gewesen. Der Deckel, der Boden und die Seitenwände waren freilich schon vergangen; doch fanden sich hin und wieder noch einige Stückchen Olm, woraus die Länge und Breite auf


|
Seite 37 |




|
dem Fundamente, worauf der Sarg gestanden hatte, ausgemessen ward.
10) die aufgenommenen Olm=Stücke vom Sarge.
C. Noch über dem zweiten Grabgewölbe nach Norden sind gefunden:
a. ein goldener Fingerring, aus 2 gereifelten zusammengelöthet. Durchmesser 11 Linien, Gewicht 1/3 1/2 Loth.
b. ein doppelter Knopf von Kupfer, auf der einen Seite mit einer kreuzartigen Verzierung, das Gewand zusammenhaltend.
c. ein viereckiger Beschlag eines hölzernen Stiels aus Kupfer mit erhabenem Rande. Sämmtliche Stücke befanden sich zwischen Bruchstücken einer Urne.
D. In dem zweiten Grabgewölbe, welches gar keine Spur von einem Sarge zeigte und wo die schlammigte, übelriechende Erde nur aus Laub und Moos bestanden haben muß, fanden sich in zweifüßiger Entfernung:
a. b. zwei Ringe von Golddrath, den obigen ähnlich, beide von 6 Windungen, Gesammtgewicht 7/8 Loth.
c. eine kupferne Opferschale, sehr dünn, im Boden und an der Seite beschädigt, der Handgriff fehlt, an den Niethen ist es noch zu sehen, wo selbiger gesessen. Höhe 3" 4 Linien, Durchmesser des Randes 6".
d. eine kupferne runde Büchse mit Deckel, letzterer hatte aber ein großes rundes Loch, woran aber der Henkel und Griff, abgebrochen, nicht aufzufinden war. Höhe 1 1/4", Durchmesser 4". In der Büchse befindet sich eine unkenntliche Masse, die zuerst weich war, jetzt, getrocknet, Spuren von Baumblättern zeigt.
e. eine Lanzenspitze (in 4 Stücken, ganze Länge 2" 6 Linien, aber bei der großen Dünne mehr zum Schmuck als zum wirklichen Gebrauch), wie sie Herr Professor Schröter nennt; allein mehrere achtbare Männer wollen selbige als zum Erstechen der Opferthiere bestimmt bezeichnen.
f. ein kurzer Dolch, der in mehrere Stücke zerbrochen und durch Grünspan sehr beschädigt worden ist, soll gleichfalls zum Tödten der Opferthiere gebraucht worden sein.
g. zwei zierlich gereifelte halbmondförmige Ringe, wovon der eine beschädigt war; sie haben mit den einwärts gebogenen Spitzen in einander gehängt und sollen ein Halsband gebildet haben. Mehrere Gelehrte nennen sie Ringe an der Sturmhaube. Weite 6 1/4";
h. vier dicke zierlich gearbeitete Kupferringe, die inwendige Weite noch nicht 3", Beschläge zu Speerschaften.
i. eine kupferne gekrümmte Messerklinge.


|
Seite 38 |




|
k. das Räthselhafteste des ganzen Fundes, doppelt vorhanden. Aus Kupferreifen, die dicker werden und gröber gereifelt sind, so wie sie nach außen zu laufen, sind zusammen gebogen zwei runde Platten, 4 1/2" im Durchmesser; sie liegen horizontal, werden aber durch einen senkrecht stehenden Ring verbunden, der, aus der Randspirale einer jeden Platte auslaufend, in der Mitte zusammengelöthet ist. Seine Weite hält 3", seine Breite 7 Linien. Beide Exemplare haben durch einen 10' hohen Steindruck sehr gelitten, jedoch das eine minder; von beiden sind alle einzelnen Theile vorhanden.
l. Trümmer einer groben, ungebrannten, grobgearbeiteten Urne.
m. vier Stückchen aus der zusammengerückten schlammigen Erde, jetzt getrocknet.
Ruchow, im August 1821.
Fürstlich Schaumburg=Lippescher
Gutsaufseher und Organist
J. G. Lindig.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Genzkow.
Das Terrain, welches die Gräber zwischen dem Hofe Genzkow und der Walkmühle vor der Stadt Friedland trägt, ist von NW. nach SO. etwas über 1/2 Meile lang und etwa 3/8 Meile breit. - Die größere Anzahl der 25 Kegelgräber befindet sich links der bisherigen Landstraße von Neubrandenburg nach Friedland, doch sind davon die Steinmassen von No. 1, 2, 8, 12 - 20 1 ) bereits zum Bau der Kunststraße, die hier wenig von der alten Landstraße abweicht, aufgeräumt. An einer andern Stelle, schon mehrere Jahre beackert, fanden die Arbeiter mit dem Sucher noch Steinmassen 1 1/2' tief unter der Ackerkrume und dort drei Lanzenspitzen oder Messer von Feuerstein. Im Kegelgrab No. 8 fand Unterz. eine Steinkiste mit zwei zertrümmerten Urnen. Im Kegelgrabe No. 12 fanden die Arbeiter auf der südöstl. Seite etwa 2' weit vom Rande, die bronzenen Waffen zwischen zwei mäßig großen flachen Steinen neben einer zertrümmerten Urne. Sämmtliche Kegelgräber von 1-25 waren und sind Steinhügel von sehr verschiedenem Umfange und wechselnder Höhe, doch alle als Grabhügel erkennbar. Die kleinsten haben in der Kegelspitze eine senkrechte Höhe von 3', die höchsten, besonders No. 5 und das Doppelgrab No. 10, 11, wohl 12-13' Höhe. Die an der linken Seite der Landstraße sind unverkennbar Kegelgräber nach des Herrn


|
Seite 39 |




|
Archivars Lisch Bezeichnung, von größern und kleinern Steinen jeglicher Masse aufgehäuft und mit einer Erde ausgefüllt, die dem umgebenden Boden angehört. Nirgends ist eine Spur von Brandstätten. Die beiden Gräber 24 und 25 sind schon theilweise als Sandgruben benntzt; besonders 24. Sie haben beide eine Structur, verschieden von den übrigen. No. 24 nämlich, halb abgeräumt, mit vertiefter Sandgrube, erscheint als nicht unbedeutender Erdhügel; allein, wie der gemachte Durchschnitt deutlich zeigt, geht 1 1/2' unter der Oberfläche des Hügels ein sorgfältig gepackter Steindamm von faustgroßen Steinen durch den Hügel hin. No. 25 hat, wie auch einige der Gräber von No. 1-20, hie und da am äußersten Umfange größere Steinblöcke als Marken. Vorzüglich traten diese an der Südseite von No. 8 hervor. Da die Jahrszeit zu weit vorgerückt ist, so werde ich im wiederkehrenden Frühlinge oder Sommer mit Vergünstigung des Herrn Hauptmanns von Cramon auf Genzkow vorzugsweise die beiden Gräber No. 5 und das Doppelgrab No. 10, 11 nach Vorschrift aufdecken, da diese, in der Saat liegend, für diesen Herbst von den Chaussee=Arbeitern verschont bleiben.
Bemerkenswerth ist noch, daß im Osten des Dorfes Genzkow, hart an der friedländischen Grenze, im Birkbusch eine freiliegende sehr bedeutende Steinkiste, oben mit mächtigen Platten gedeckt, schon vor Jahren wahrscheinlich durch Geldgräber zerstört ist. Einzelne Ueberreste sollen noch dort liegen. Der sel. Pastor Rudolphi hat diese Steinkiste, als sie noch wohl erhalten war, öfter besucht. Eine ganz ähnliche Steinkiste befand sich im Anfange der Gräberreihe links hart an der Landstraße; ich erinnere mich derselben noch aus frühern Jahren sehr wohl. Auch von dieser war der sehr bedeutende Deckstein abgehoben und zertrümmert. Was davon übrig, ist jetzt an der im Bau begriffenen Kunststraße aufgestapelt. Um noch einmal den Leser gegen O. zum Birkbusch zurückzuführen, ist nach der Versicherung der jetzigen Frau Hauptmannin von Cramon von Arbeitern in dem angrenzenden Moderbruche eine römische Münze von Silber, ein Trajan, gefunden worden, als jener Dame erster Gemahl, von Behr, jenes Bruch zur Verbesserung des anliegenden Ackers ausfahren ließ. Die Münze ist zur Zeit in den Händen des Hrn. Rath Preller in Neubrandenburg. Ich hoffe noch, wenigstens eine Zeichnung derselben vorlegen zu können.
Schon im Jahre 1820 oder 21, wo ich mit dem Prof. Schröter zu Rostock in Briefwechsel über antiquarische Gegen=


|
Seite 40 |




|
stände stand, theilte ich demselben einen flüchtigen Faustriß eines Theils der Feldmark Genzkow mit, einer Gegend, die, ähnlich der hinter Bergen auf Rügen, eine ganze Reihe von Kegelgräbern der germ. Vorzeit enthielt; denn seit 4 Wochen ist wohl ein Drittheil derselben der Picke der Steinarbeiter an der Kunststraße von Neubrandenburg nach Friedland gewichen. Meine damalige Beschreibung der Gegend und der Gräber nebst dem Wunsche, sie möchten aufgedeckt werden, sandte ich dem Prof. Schröter ebenfalls zu, der mit meiner Vergünstigung meinen Aufsatz zum Abdruck für das schweriner Abendblatt bestimmte. Ich meine, er ist im Jahrg. 1821 zu finden.
Was ich damals nur vermuthete, ist zur Gewißheit geworden. Auf die mir mündlich durch Herrn Archivar Lisch Seitens des geehrten Vorstandes unsers Vereins überbrachte geneigte Antwort auf meine desfallsige Anzeige wollte ich so eben die Vergünstigung des Herrn Hauptmanns von Cramon auf Genzkow nachsuchen, eins oder das andere jener Kegelgräber für den Verein aufdecken zu dürfen, als ich erfuhr, daß beim beschleunigten Bau der gedachten Kunststraße schon mehrere jener Steinmassen in den rohen Händen der angestellten Arbeiter seien. Es ward mir auch vom Hrn. Hauptmann v. Cramon mit der dankenswerthesten Zuvorkommenheit meine Bitte gewährt. Gerade die bedeutendsten der Steinhügel liegen jedoch noch unangetastet im Saatfelde; daher ich erst im kommenden Spätsommer an deren Aufdeckung Hand legen kann. Gleichzeitig zeigte mir die achtungswerthe Familie, welche in mehrern ihrer Mitglieder lebhaften Antheil an antiquarischen Forschungen nimmt, zwei von jenen Steinarbeitern schon gefundene dolchförmige, muschelig geschlagene Lanzenspitzen oder Messer von Feuerstein. Sie sind gegen 6" lang, in der Mitte 1 1/2" breit, mit erhabenem Mittelrücken, zweischneidig, nach beiden Enden spitz auslaufend, geschlagen, ohne geschliffen zu sein. Eben weil sie keine Verlängerung zeigen, die wie zum Griff bestimmt scheint, von einer Art, wie ich sie ehemals wohl gesehen, halte ich sie für Lanzenspitzen. Jene zwei wohl erhaltenen befinden sich als jener Familie werthe Stücke in deren Händen. Nur ein Fragment einer dritten Lanzenspitze, gleichzeitig an derselben Stelle gefunden, kann ich dem Verein vorlegen; doch ist eins der wohl erhaltenen Werkzeuge bei weitem regelmäßiger und schöner gearbeitet, als dies Fragment verräth.
Sofort begab ich mich denn zu den bezeichneten Kegelgräbern der Feldmark. Mehrere Steinbrecher fand ich dort


|
Seite 41 |




|
beschäftigt; doch alle versicherten, außer jenen "Steinmessern" sei noch nichts gefunden, womit der zur Aufsicht anwesende Ingenieur, Herr Siemers, übereinstimmte. Ueberhaupt sollen nach Versicherung des Bauconducteurs Herrn Adermann die Arbeiter, stets beaufsichtigt, streng angewiesen sein, alles Gefundene an die Bau=Commission abzuliefern. Zum Ueberfluß hatten mir beide Gedachten auf meine Bitte die Zusicherung gegeben, so wie bei der Arbeit irgend Auffallendes vorkomme, mich sogleich zu benachrichtigen. Dennoch kam ich gerade zu rechter Zeit bei einem der Arbeiter an, der schon einen bedeutenden Theil am Umfange eines Kegelgrabes (No. 8 der Reihe) hart an der Landstraße abgeräumt hatte. Wurzeln des auf demselben wuchernden Dorns hatten ihn einstweilen von der nördlichen Seite des Steinhaufens nach der südlichen Seite getrieben, wo überhaupt eine größere Masse von mäßigen Steinen lag. Dagegen fanden sich im N. und gegen W., wie gegen O. des Steinkegels mehr einzelne bedeutendere Steinblöcke mit minder großen Steinen zwischen denselben; doch traten erstere sichtbar am Umfange hervor. Die ganze Steinmasse war mit aufgeschütteter höchst staubiger Erde ausgefüllt, obgleich die nächste Ackerkrume, vielleicht durch Cultur, weit kräftiger erscheint. Der erste Blick, als ich die Nordseite des Kegelhügels betrat, zeigte mir den Anfang einer wohl erhaltenen Steinkiste, deren nähere Beschreibung weiter unten folgen soll. Zunächst aber eine genauere Angabe der Verhältnisse des Steinkegels selbst, wie ich sie an Ort und Stelle sogleich aufnahm, und die mit geringen Abweichungen auf die ganze Reihe der Kegelgräber passen. Das Kegelgrab, fast rund an der Basis, auf dem natürlichen Boden von Steinen aller Größe und aller Art errichtet, hatte am Fuße einen Durchmesser von 32' bei einer senkrechten Höhe von 5-6'. Ein anderes Grab, so wie ein Doppelgrab halten indeß wohl 12-15' Höhe.
Das Versprechen einer Remuneration, so wie ein Trunk, wie ihn die keinem Mäßigkeits=Vereine angehörenden Chaussee=Arbeiter nur zu gern haben, vermochten den Arbeiter, nach meiner Anweisung und mit meiner Hülfe an der verlassenen Seite des Steinkegels fortzuarbeiten. Vorsichtig ward sofort die gedachte Steinkiste in demselben aufgedeckt. Sie bestand aus 6 mächtigen, 2-3" dicken Platten eines mit röthlichem Feldspath gemengten Steins, der, wie es schien, mit leichter Mühe schieferartig gespalten war. Doch war die Platte im SO. (wie es schien, etwas aus ihrer ursprünglichen Stellung gewichen) ein glatter Kalkstein. Jede dieser 6 aufrecht stehenden Platten war 2 1/2' hoch, stand völlig senkrecht und war auf dem


|
Seite 42 |




|
Urboden errichtet, in und außer der Kiste mit passenden Steinen zur Erhaltung der Stellung verpackt. Die vier Platten der Längenseiten der Kiste hatten jede 3' Länge so daß die Kiste selbst 6' lang war; jede der beiden Platten in der Breite hatte 2' 4" Länge. Die an der NW. Seite schloß nicht nur fest an die Längenseiten, sondern stand zu beiden Seiten noch einige Zoll vor. Auffallend dicht schlossen die Fugen der Platten an der Langseite der Kiste. Diese Steinkiste nun hatte im Kegelgrabe genau die Richtung von NNW. nach SSO., befand sich durchaus im Mittelpunkte desselben; sie stand abgeräumt einem Herde nicht unähnlich da. Der innere Raum der Kiste war mit Erde gefüllt, die indeß so hart war, daß sie nur scharfen Werkzeugen wich. Hie und da schienen Streifen Asche unterzulaufen; doch von Brand oder Kohle war weder auf noch in der Kiste eine Spur. Wohl aber entdeckte ich, mit Hand und Messer aufräumend, mehr nach dem südlichen Ende der Kiste Reste einer sehr grobkörnigen, äußerlich rauhen, dickwandigen, morschen Urne mit Knochen. Eine zweite Urne, die, wie eine dritte, hart daranstehende, nicht in, sondern auf der Steinkiste sich fand, gleichsam wie 2 Töpfe auf einem Herde, war schon durch Wurzeln und die drückende obere Steinlast völlig zerstört; sie war dunkelbraun, mit unregelmäßigen Strichen von oben nach unten verziert, hochhalsig und wahrscheinlich gehenkelt (cinerarium); dagegen war die zweite, das ossuarium, denn in ihr fanden sich sämmtliche angebrannte Knochen eines erwachsenen Menschen, zwar auch zerdrückt, doch in ihrem Umfange noch erkenn= und meßbar. Sie war hellbraun, glatt, stark ausgebaucht, eiförmig, groß 9" in der mittlern Weite im Durchmesser, mit festen Linien von oben nach unten auf der Außenseite verziert, wie die gesammelten Fragmente ausweisen. An Geräthen oder Waffen entdeckte ich bei aller Aufmerksamkeit nichts, weder in den Urnen, noch in dem Raum der Steinkiste, in welcher letztern ich umsonst ein Skelett erwartete.
Kegelgrab von Genzkow No. 2.
Als ich noch hierbei beschäftigt war, näherte sich mir der anwesende Ingenieur Hr. Siemers, der bisher den Arbeitern bei einem andern nahen Kegelgrabe (No. 12 der Reihe) zugesehen hatte. Er zeigte mir den so eben dort gemachten Fund. Diesen lege ich, nachdem ich ihn für eine kleine Vergütigung an die Arbeiter erhalten hatte, mit ausdrücklicher Vergünstigung des Herrn Hauptmanns von Cramon für die Sammlung des Vereins an. Es ist der Griff mit dem Fragment der Klinge eines


|
Seite 43 |




|
seltenen Schwertes von Bronze mit edlem Roste bedeckt, ganz von derselben Form und Arbeit wie Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 1. Der Griff ist 2 3/4" lang, hohl gegossen, verläuft nach der Klinge zu in einen zierlichen Halbmond mit zwei Hornspitzen. In diesem Halbmond ist die 1 1/2" breite Klinge mit 4 äußerst zierlichen Nieten sorgfältig befestigt. Die Klinge, von der nur ein Fragment von 1 3/4" Länge vorhanden ist, ist zweischneidig, mit scharfem Mittelrücken auf beiden Seiten, hart über dem Griff gewaltsam nach einer Seite gebogen und abgebrochen, und im Bruch oxydirt. Der hohle Griff ist nicht nur abwechselnd in 6 graden und 6 zickzackförmig durchbrochnen Stäben gearbeitet, wodurch dieser Griff sich von dem oben angeführten im Frid. Franc. unterscheidet, sondern diese Stäbe, so wie Knopf und Halbmond, sind mit regelmäßigen Linien, Strichen, Spiralwindungen und concentrischen Kreisen verziert. Auf dem elliptischen Knopfe sind 6 Spiralwindungen eingegraben, wie sie auf den Alterthümern der Kegelgräber oft vorkommen; dieser Knopf ist dem in Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 1 b. abgebildeten ganz gleich. Das ganze Werkzeug verräth eben so viel Geschmack als Kunstfertigkeit. In demselben Grabe lag ein sichelförmiges Werkzeug, wie Frid. Franc. Tab. XVII, Fig. 7, ebenfalls aus Bronze mit edlem Rost. Durch Schuld der Arbeiter ist es leider in 2 Hälften gesprungen. Die Klinge, wie gesagt, sichelförmig, hat gegen 5" Länge, doch fehlt schon die Spitze im alten Bruche, so daß das Ganze leicht 6" mag gemessen haben. Das Werkzeug hat einen sensenartigen Rücken, neben welchem noch parallel eine erhabene Linie herläuft. Zwischen diesem Rücken und der Linie befindet sich am Anfange der Vorderseite der Klinge ein kegelförmiger Knopf. Bemerkenswerth ist noch unterhalb dieses Knopfs nach der Schneide zu ein deutliches erhaben gegossenes V, welches auf den bronzenen Sicheln öfter bemerkt wird.
Diese beiden bronzenen Stücke lagen auf der SO. Seite des Kegelgrabes, kaum 2' vom Rande desselben entfernt, zwischen 2 platten Steinen, welche ich, sogleich mich dahin begebend, noch in ihrer Lage fand. Von einer Steinkiste war hier so wenig, als von einer Brandstätte die Rede; und, obgleich ich - da die Nacht hereinbrach - am folgenden Tage sofort mich wieder dahin begab, ward weiter nichts Beachtenswerthes in diesem Steinhügel angetroffen. Nur wenige Reste von einer in der Nähe der beiden bronzenen Waffen befindlich gewesenen Urne fand ich auf.
Rülow, Mitte Octobers 1839.
F. Th. Sponholz, Prediger.


|
Seite 44 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Goldenbow.
Südöstlich 30 Schritte von dem dritten Hünengrabe bei Goldenbow (siehe oben) liegt ein rundes Grab mit Steinen umsetzt, von denen aber die größten weggenommen waren, um den Platz zu beackern. Der Durchmesser ist 44 Fuß. Fast in der Mitte stand auf einem flachen Steine 1 Fuß über dem Urboden und 8" unter der Oberfläche der Boden einer Urne mit einigen Knochen, zwischen denen eine geöhrte Nadel aus Bronze, 2 1/2" lang, 1''' dick und mit edlem Roste überzogen, lag. Die Basis der Urne ist 4 1/4" im Durchmesser; umherliegende Urnenscherben zeigten, daß die Urne an Masse und Gestalt der auf S. 27 unter 3a angeführten ähnlich war, nur war sie mit Linien zum Theile verziert.
Nahe westlich an diesem liegt ein rundes Grab von 16 Fuß Durchmesser mit kleineren Steinen umsetzt. Hierin fanden sich nur einige Urnenscherben.
Etwa 40 Schritte weiter südwestlich liegt ein Grab von 44 Fuß Länge von Osten nach Westen und von 20 Fuß Breite. Auch hierin zeigten sich nur einige Scherben.
Westlich von diesem Grabe gegen 50 Schritte entfernt ist ein rundes Grab von 32 Fuß Durchmesser mit ziemlich großen Steinen umsetzt, in der Mitte fast 4 Fuß hoch. Hierin fand sich 12 Fuß vom östlichen Rande nach der Mitte hin ein Grabgefäß aus gleicher Masse mit den Urnen, aber von abweichender Gestalt, wie ein hohler, einpassender Deckel zu einem weitmundigen Gefäße, oder wie eine niedrige Tasse mit hervorstehendem Boden. Es hat nämlich eine runde flache Basis von 4" Durchmesser mit einem Rande, der ringsumher 1/2" vor der eigentlichen Wand des Gefäßes vorsteht. Diese Wand steht fast senkrecht, wenig nach auswärts gebogen, so daß die obere Oeffnung, bei 1 3/8" Höhe der Wand, im Durchmesser 3 1/4" beträgt. Das ganze Gefäß ist 1 3/4" hoch; seine Farbe ist gelbbraun, auf der unteren Fläche des Bodens schwarz.
Alle diese Gräber (wie auch die Hünengräber) sind aus lehmhaltigem Sande aufgeschüttet, aus welcher Masse auch der Boden umher besteht. Die Lage des Ackers ist gegen Südwest geneigt.
Wittenburg, im April 1840.
J. Ritter.


|
Seite 45 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Meyersdorf.
Die Gegend um Marnitz ist reich an Gräbern der Vorzeit in Kegelform. Einzeln finden sie sich fast überall; unter den Gruppen aber zeichnen sich als die größten aus: die Gruppe bei Neu=Mühle und die bei Meyersdors. Erstere hat schon in frühern Zeiten Aufmerksamkeit erregt, und sollen mehrere Gräber derselben schon vom Herrn Ober=Zoll=Inspector Hauptmann Zinck aufgegraben sein (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 57, Nr. 17 und S. 71, Nr. 1). Letztere aber war bisher wohl ganz unbeachtet, und sie wäre gewiß in einigen Jahren ganz verschwunden, da man den Bewohnern der umliegenden Dörfer erlaubt hatte, die nutzlosen Steinhügel beliebig abzutragen, wäre nicht Herr Herm. Burmeister vor 3 Jahren in den Besitz von Meyersdorf gekommen. Dieser hatte kaum aus der Form der Hügel und aus den vielen zerstreut liegenden Scherben diese Hügel für Gräber der Vorzeit erkannt, als er alles Steineausbrechen an dieser Stelle strenge untersagte und so die noch übrig gebliebene, nicht unbedeutende Anzahl von Gräbern der Zerstörung entzog. - Man hat Grund zu hoffen, daß auch der jetzige Besitzer von Meyersdorf, Herr Peters, für die Erhaltung der Gräber Sorge tragen wird. - Der Begräbnißplatz liegt nordwestlich von dem Hofe und Dorfe Meyersdorf auf einem etwas erhabenen, steinigten und sandigen Ackerstücke ohne einen besondern Namen. Im Süden wird der Platz durch eine von Westen nach Osten sich hinziehende Vertiefung, welche an einigen Stellen als Wiese benutzt wird, begränzt, wahrscheinlich das ausgetrocknete Bette eines kleinen Flusses. Der Begräbnißplatz hatte gewiß früher einen viel größern Umfang, man hat ihn aber soviel als möglich einzuschränken gesucht, um den Boden zu benutzen. Dadurch liegen jetzt einige der größern Gräbern vereinzelt im bebaueten Acker, die größte Zahl aber ist in 2 Gruppen, eine länglichrunde und eine halbkreisförmige, geschieden. In den Gruppen liegen die Gräber sehr dicht aneinander gedrängt und die meisten sind wohl erhalten. Die nicht durch Abgraben oder Abpflügen gelitten haben, sind vollkommen rund. Der Umfang und die Höhe der Kegel ist sehr verschieden. Manche sind 5-8' hoch und haben einen Basisdurchmesser von 30-36', andere dagegen erheben sich kaum über den Urboden und halten im Durchmesser der Basis nur 6-8'. Die meisten Kegel haben einen Ring von größeren Feldsteinen außerhalb der Basis, einige auch einen aus der Rasendecke wenig hervorragenden Ring von kleinern Steinen innerhalb des Randes des Kegels. Einige Grabhügel


|
Seite 46 |




|
bestehen größtentheils aus Steinen, mit Erde untermischt; andere dagegen haben mehr Erde als Steine. Bei einigen sieht man nur eine Rasendecke, bei andern ragen mehr oder weniger Steine aus derselben hervor. Einige haben nur kleine Feldsteine, von welchen die länglichen größtentheils aufrecht stehen, andere dagegen enthalten auch einzelne größere Steine, welche schräge liegend im Mittelpuncte des Kegels zusamenstoßen und so ein Gewölbe bilden. Die Erde im Kegel ist der des unbebaueten Urbodens, aber nicht der des bebaueten Ackers gleich, welche letztere wohl durch vieljährige Bebauung eine andere Beschaffenheit und Farbe bekommen hat. Auffallend ist, daß sich in einigen Gräbern durchaus nichts findet, kein größerer, platter Stein, keine Scherbe, keine Kohle, noch eine auffallend gefärbte Erde. Die meisten aber von denen, welche geöffnet wurden, enthielten Urnen, welche größtentheils schon zertrümmert waren. Diese standen in Steinkisten von verschiedener Größe und Gestalt. Einige bestanden aus 5 großen, platten Steinen, von denen der eine, flach auf dem Urboden, oder sehr wenig über demselben liegend, die Grundlage, 3 andere, welche sich im Dreieck an diesen lehnten, die Seitenwände, und der 5te, auf letzteren flach aufliegend, den Deckel der Kiste bildeten. Andere waren viereckig, und noch andere rund, welche letzteren als Seitensteine nur kleine, längliche, auf den Grundstein gesetzte Steine und zum Theil auch nur einen sehr kleinen Deckstein hatten. - Der von der Urne freigelassene Raum der Kiste war fest mit Erde angefüllt, welche immer der des Urbodens gleich und hin und wieder mit kleinen Eichenholzkohlen untermischt war. Gewöhnlich fanden sich in jedem Grabe 2 Urnen, eine größere und eine kleinere, zuweilen auch eine große und mehrere kleine. Aber in den kleinen fand sich stets nichts als Erde, der des Urbodens gleich. Es scheinen also unter jedem Hügel nur die Ueberreste Eines Individuums geborgen zu sein. - Die Urnen selbst, an welchen die Gestalt noch mit Bestimmtheit erkennbar war, waren alle von verschiedener Form; ebenso war auch ihre Masse sehr verschieden an Feinheit und Farbe. Einige Urnen hatten einen hohen, bis an ihren Bauch genau überpassenden, schalenförmigen Deckel; andere, welche einen sehr kurzen und weiten Hals hatten, waren ganz ohne Deckel. Henkel fanden sich an keiner Urne und eben so wenig Verzierungen. Herr Burmeister hat indeß auf einer andern Stelle des meyersdorfer Feldes bei einem schon zerstörten, einzeln liegenden Kegelgrabe eine mit schrägen Strichen verzierte kleine Scherbe gefunden. Gepflasterte Brandstätten fanden sich nirgends.


|
Seite 47 |




|
Ueber jedes einzelne abgetragene Grab zu berichten, würde zu weit führen, da von dem Inhalte derselben nichts gerettet ist; es finde hier nur das Raum, was sich über die Auffindung der Gegenstände, mit welchen Hr. Burmeister dem Vereine ein Geschenk gemacht hat, berichten läßt.
Kegelgrab von Meyersdorf No. 1.
Auf der eben besprochenen Begräbnißstätte bei Meyersdorf ward vom Hrn. Herm. Burmeister, Hrn. Amtsauditor Mau in Güstrow und dem Unterzeichneten im Sommer 1836 ein Kegelgrab eigenhändig aufgegraben. Das Grab war ungefähr 5' hoch, hatte einen Basisdurchmesser von ungefähr 24', und zeigte weiter nichts Auffallendes, als daß sich die runde, nur aus kleinen Steinen bestehende Kiste bedeutend nach der westlichen Seite des Kegels hin befand. Sie enthielt nur eine große, wohl erhaltene, dunkelbraune Urne, mit scharfem Bauchrande in der Mitte des Gefäßes, dessen oberer Theil eine fast senkrechte Wand hat, ohne Verzierungen, wie Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 1, 8" hoch, 9 1/2" in der Oeffnung, 12" im Bauchrande, 4" in der Basis, und war mit verbrannten Knochen angefüllt. Unter diesen Knochenüberresten lag ein vom Roste sehr angegriffenes Messer von dünner Bronze mit einem ringförmigen Griffe, der durch Unvorsichtigkeit abgebrochen ward, und mit einem halbmondförmigen Ausschnitte im Rücken, wie Frid. Franc. Tab. XVIII, Fig. 10, ausgebrochen und sehr verbogen, ferner ein Fragment von einer Nadel und ein Ring von Bronze. Ueber diese Urne war ein weit und genau überpassendes, schalenförmiges Gefäß als Deckel gestülpt von der Masse und Farbe der großen Urne, mit einem kleinen Henkel, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 13, nur mit etwas ausgeschweiftem Rande, 5" hoch, 10" in der Oeffnung, 12" im Bauche und 3 1/2" in der Basis.
Kegelgrab von Meyersdorfs No. 2.
Die Vorhingenannten deckten ein zweites Grab derselben Gruppe auf, welches dem vorigen an Größe ungefähr gleich war. Es hatte in der Mitte auf dem Urboden eine Kiste, welche aus 5 platten, rohen Feldsteinen bestand, deren Seiten nach innen ein Dreieck bildeten. In dieser befanden sich 2 Urnen dicht neben einander, von denen die größere bis auf ein Stück der Mündung unverletzt, die kleinere aber nur zur Hälfte freigestellt wurde. Letztere war ungefähr 6" hoch und hielt in der Mündung 5", im Bauche 6 1/2" und in der Basis 3" im Durchmesser. Die größere Urne hatte bei 8" Höhe


|
Seite 48 |




|
fast dasselbe Verhältniß, nur daß sie im Bauche noch mehr gerundet war. Beide waren von gelblicher Farbe, bestanden aus grobkörniger Masse, waren nach außen rauh und verwittert, nach innen glatter, hatten fast gar keinen Hals und waren ohne Verzierung, Henkel und Deckel. Nachdem wir die Urnen, sorgfältig bedeckt, die Nacht über hatten stehen lassen, war am folgenden Morgen die noch übrige Hälfte der kleinern gänzlich zertrümmert und die größere zerfiel, trotz aller möglichen angewendeten Vorsicht, ebenfalls in unzählige Scherben, indem sie herausgehoben ward. Die kleinere enthielt nur Erde von nicht auffallender Beschaffenheit; die größere hingegen war mit Stückchen verbrannter Knochen angefüllt. Unter den Knochen in der größern Urne lag ein Scheermesser von dicker Bronze, 3 3/4" lang, 1 3/4" breit, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVIII, Fig. 7, mit eingegrabenen Verzierungen auf der rechten Seite.
Kegelgrab von Meyersdorf No. 3.
Aus einem andern, früher abgetragenen Kegelgrabe ist nur die senkrechte Hälfte einer kleinen Urne gerettet; diese ist ein kleines, hellbraunes Gefäß, mit parallelen Reifen über dem Bauchrande, mit zwei kleinen Henkeln, wie Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 8, ungefähr 5" hoch, 5" weit im Bauche und 3" in der Mündung.
Jarchow, im August 1839.
A. J. F. Tapp, Cand. d. Theol.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Perdöhl.
Einige hundert Schritte östlich von dem Dorfe Perdöhl, etwa 3/4 Meilen von Wittenburg an dem Wege nach Körchow, liegen zu beiden Seiten des Weges Kegelgräber in zwei Gruppen, etwa 150 Schritte von einander, getrennt durch eine Niederung, welche sich westlich durch das Dorf nach Camin hinzieht. Man zählt in beiden Gruppen noch einige zwanzig Hügel; sie sind aber zahlreicher gewesen, wie man zum Theil noch sehen kann und wie es auch die Dorfbewohner erzählen; erst seit der Verkoppelung sind viele theils aus Neugierde halb geöffnet, theils des Ackerbaues wegen zerstört, und am Fuße der nördlichen Gruppe ist die Sandgrube für das Dorf angelegt, wodurch schon einige Gräber herabgestürzt sind und andere am Rande den Einsturz drohen. - In der südlichen Gruppe sind zwei bedeutende Gräber, von denen eines vor einigen 20 Jahren durch den jetzigen Herrn Amtmann Passow zu Hagenow durchsucht


|
Seite 49 |




|
und ausgeleert ist. Es befindet sich darin eine Steinkiste von 28' Länge und 7' Breite im Innern; sie liegt jetzt offen. Die Decksteine haben zum Theil 3' Dicke, 6' Breite und 8 bis 10' Länge. Der andere Hügel von gleicher Größe ist noch nicht untersucht, doch liegen die Decksteine zu Tage.
Um zu retten, was möglich ist, begab ich mich im Auftrage des Vereines an Ort und Stelle und begann bei den am meisten bedrohten Hügeln der nördlichen Gruppe, wo der Boden aus lehmhaltigem Sande besteht, die Aufgrabung.
Der zuerst angegangene Hügel war rings umher mit mäßig großen Steinen eingefaßt, die mit Erde etwas bedeckt waren und einen Ring von 36' im Durchmesser bildeten. Die Axenhöhe des Hügels war 6 1/2'. Die ganze Oberfläche war mit Steinen bedeckt, über und zwischen denselben mit Haidekraut bewachsen. Gleich 4' vom östlichen Rande stand ein flacher breiter Stein senkrecht, welcher die Wand einer Steinkiste bildete, von welcher sich im weiteren Verlaufe zeigte, daß sie genau viereckig, inwendig von Osten nach Westen 4' lang und von Süden nach Norden 3' breit war. Die Decke bestand nur aus 2 flachen Steinen; über die Fugen waren kleinere flache Steine gelegt; die Seiten bestanden aus ähnlichen Steinen und außerdem lagen im Süden und Norden außerhalb 2 lange walzenförmige Steine horizontal, scheinbar um die hervorstehenden Ränder der östlichen und westlichen Seite aus einander zu halten. Der Boden der Kiste bestand aus einem einzigen flachen Steine. Alle diese flachen Steine scheinen gespalten; von künstlicher Bearbeitung zeigte sich keine Spur. Als die Kiste von oben geöffnet wurde, zeigten sich in Sand verpackt 3 Urnen, mit flachen, abgerundeten Steinen von 2 bis 2 1/2" Dicke bedeckt. Die Urnen waren ebenfalls ganz mit Sand gefüllt.
1) Die erste Urne ist braun, im Bauche 12", in der Basis 5", in der Oeffnung 8 3/4" und in der Höhe 9 1/2" haltend. Bei Ausräumung des Sandes zeigte sich über den Knochen ein Scheermesser aus Bronze, gut erhalten und nur schwach oxydirt, 4 3/4" lang, in der Klinge 1 1/4" breit, mit einer Schärfe von 2 7/8" Länge, am Griffende mit einem oval=spitzen Loche; die Dicke im Rücken ist ungefähr 1/12". Es lag mit dem Griffe nach Südosten, mit der Schneide nach Südwesten. Die Knochen waren stark. - Westlich von dieser stand
2) eine Urne von gleicher Masse, 8 1/4" hoch, 12" im Bauche, 5 1/4" in der Basis und 9 1/4" in der Oeffnung haltend,


|
Seite 50 |




|
wie die vorige zur Hälfte mit Knochen angefüllt, die aber nicht vollends so stark waren. - Südlich von beiden stand
3) eine dünnere, in den Verhältnissen etwas anders geformte braune Urne, mit 2 kleinen Henkeln an der Bauchweite. Sie ist 8 1/2" hoch, hält 4" in der Basis, 9" im Bauche und 6" in der Oeffnung. Der Inhalt bestand in schwächeren Knochen.
Etwa drei Fuß südwestlich von dieser Kiste stand eine andere, kleiner und nur 1/2' über dem Urboden. Der innere Raum maß nach beiden Richtungen 2'. Ueber den 2 flachen Decksteinen lagen noch 3 eben solche Steine zum Schließen der Fugen und Ränder. Der Boden bestand nur aus einem einzigen Steine und die Seitensteine gingen bis zum Urboden hinab. In der Kiste standen wieder drei Urnen, nämlich
4) eine braune Urne, 8 1/2" hoch, 4" in der Basis, 10 3/4" im Bauche und 9" in der Oeffnung haltend; sie ist unverletzt erhalten. Sie war ebenfalls mit einem flachen runden Steine bedeckt, der aber, weil die Urne schief stand, etwas herabgeglitten war und die beiden folgenden Urnen eingedrückt hatte. Als der Sand ausgeräumt war, lag auf den Knochen eine Nähnadel aus Bronze, 3 1/4" lang, mit der Spitze nach Südost. Sie ist mit grünem Rost bedeckt. Davon stand
5) südöstlich eine dünne braune Urne mit einer Schale aus gleicher Masse bedeckt und mit Knochen eines kleinen Kindes zur Hälfte angefüllt. Die Urne ist 6" hoch und hält 3" in der Basis, 6 1/2" im Bauche und 5" in der Oeffnung. Die Schale ist flach, am Rande umgebogen und hat 5 1/2" im Durchmesser, 1" in der Höhe.
6) Südwestlich stand eine gleiche Urne mit Kinderknochen. Außerdem stand auf dem Urboden ein 2' hoher Steinring, der, unter die erste Steinkiste durchgehend, dem nördlichen Rande bis auf 4' nahe kam und die zweite Kiste einschloß. Er war aus ziemlich großen Steinen aufgesetzt und hatte einen Durchmesser von 18'.
Brandstellen und Kohlen fanden sich nirgends im Hügel.
Ein anderes Kegelgrab lag südlich von dem vorigen etwa 30 Schritte entfernt, war ganz rund, 32' im Durchmesser, 4 1/2' hoch und ebenfalls mit Haidekraut bewachsen. Umher war ein Ring von Steinen, doch fehlten schon einige, und die Oberfläche war ebenfalls mit Steinen bedeckt. Nicht weit vom östlichen Rande traf man auf eine Steinkiste, wovon aber die Decksteine fehlten; auch waren die Seiten und der Boden aus gewöhnlichen, etwas langen und großen Steinen gebildet. Es standen darin:


|
Seite 51 |




|
7) und 8) zwei Urnen, aber gänzlich zerdrückt; den Scherben nach von der Größe, Gestalt und Masse der Urnen 1, 2 und 4. Ueber und zwischen den ziemlich starken Knochen fand sich nichts an Alterthümern; eben so wenig zeigte sich etwas im weiteren Verlaufe der Aufgrabung. Im Innern waren noch viele, aber unregelmäßig liegende Steine.
Etwa 40 Schritte von dem vorigen in östlicher Richtung entfernt war ein Kegelgrab von 30' Durchmesser und 5' Höhe; im Aeußern ganz wie die vorigen. Nahe dem östlichen Rande zeigte sich eine Steinkiste aus gewöhnlichen Steinen, ohne Decke, weshalb die beiden darin stehenden Urnen 9) und 10) ganz zerdrückt waren; den Bruchstücken nach waren sie wie die vorigen; unter den Knochen fand sich nichts. - Gegen 8' nach der Mitte stand eine andere ähnliche Kiste, in welcher
11) eine braune Urne stand; sie war größer und besser gearbeitet als alle vorigen; die Basis hatte 6" im Durchmesser; aber sie war leider ganz zerdrückt. - Alle diese Urnen sind schwarz im Bruche.
An Alterthümern fand sich nichts in diesem Hügel.
Etwa 20 Schritte östlich von dem ersten Kegelgrabe lag ein anderes von 34' Durchmesser und 5' Höhe, äußerlich wie die vorigen gebauet. Es enthielt in der Mitte zwischen gewöhnlichen Steinen
12) eine hellbraune Urne, wie No. 1 und 2 gestaltet, aber größer und von feinerer Masse. Die Knochen waren mit schmieriger Lehmerde bedeckt und enthielten ein dünnes Stück Blech aus Bronze, dem Anscheine nach den Rest einer Pincette, von 2 1/2" Länge und 1 bis 1 1/4" Breite.
Von dem dritten Hügel gegen 80 Schritte westlich entfernt und durch die Sandgrube getrennt (durch welche hier mehrere Grabhügel verschwunden sind) lag ein Kegelgrab von 40' Durchmesser und 6' Höhe. Die äußere Gestalt kam ganz mit der der vorigen Hügel überein. Vom östlichen Rande 6' fand sich in einer Höhe von 3' über dem Urboden eine kleine Kiste von flachen Steinen, inwendig 1' im Quadrate haltend; drei Steine bildeten die Decke und ein flacher Stein von ungefähr 10" im Quadrate den Boden derselben. Darin stand


|
Seite 52 |




|
13) eine braune Urne von 6 1/2" Höhe, 4" in der Basis, 7" im Bauche und 6" in der Oeffnung haltend. Sie ist sehr mürbe, enthielt nur Knochen und war mit einem Steine bedeckt, wie die Urnen 1 bis 4. (Der Deckstein von Urne 2 wiegt 13 Pfd.)
Etwa 10 Schritte westlich von dem vorigen lag ein Kegelgrab von 32' Durchmesser und 5' Höhe, äußerlich wie die vorigen gebildet. Fast in der Mitte fand sich eine aus gewöhnlichen Steinen gebildete Kiste, worin
14) eine große Urne, aber schon zerdrückt, stand. Sie war 11" hoch, hielt 4" in der Basis, 10" im Bauche und 4 3/4" in der Oeffnung; vom Rande geht ein 3 1/2" langer Henkel mit 2 rinnenförmigen, längslaufenden Verzierungen. Ueber der Bauchweite sind je 4 Zickzacklinien, welche ein horizontales Band von 2" Breite bilden, und darüber laufen in der Breite von 1" fünf horizontale Linien. In den Winkeln der Zickzacklinien sind runde Eindrücke. - In dieser Urne standen über den Knochen 2 kleine Urnen, nämlich
15) eine gelbe Urne, 3 1/4" hoch, 1 1/2" in der Basis, 3 1/4" im Bauche und 2 1/8" in der Oeffnung haltend. Ueber der Bauchweite sind 2 kleine Henkel.
16) eine gelbe Urne, 2 1/4" hoch, 1 1/4" in der Basis, 3" im Bauche haltend. Nach oben ist sie von 2 Seiten etwas zusammengedrückt, so daß die Oeffnung ein Oval von 1 7/8" und 2 1/2" im Durchmesser bildet. Vom Rande bis zur Bauchweite geht ein großer Henkel. Beide Urnen sind stark von Masse und enthielten sehr feine Kinderknochen. - Oben auf der großen Urne stand noch
17) eine braune Urne; sie ist 5 3/8" hoch, hält 4 1/4" in der Basis, 8" im Bauche und 6 3/4" in der Oeffnung. Ueber derselben war eine, 1 1/4" über den Rand der Urne fassende, genau darauf passende Schale, gewölbt, mit einer kleinen Basis; der Rand ist etwas nach außen gebogen. Es lagen nur schwache Knochen darin.
Etwa 8' vom südwestlichen Rande des Hügels standen zwischen Steinen verpackt, 2' über dem Urboden, 2 Urnen:
18) eine braune Urne, 7 7/8" hoch, 4" in der Basis, 8" im Bauche und 5" in der Oeffnung haltend. Oberhalb der Bauchweite ist sie mit 4 horizontalen und unterhalb derselben mit je 7 bis 8 bogenförmig laufenden Linien verziert. Auch über dieser Urne war eine gewölbte Schale als Deckel. - Die zweite


|
Seite 53 |




|
19) war eine braune Urne, 7 1/4" hoch, 5" in der Basis und 6" in der Oeffnung haltend; die Wand ist fast gerade. In beiden Urnen waren nur Knochen.
Nordöstlich von No. 5, ebenfalls am Rande der Sandgrube, lag ein anderer Hügel von 4' Höhe und 28' im Durchmesser, im Aeußeren ganz den vorigen ähnlich. Hierin fand sich etwa 8' vom nördlichen Rande eine Kiste aus platten Steinen, inwendig 2' im Quadrate, worin auf einem platten Steine
20) eine gelbbraune Urne stand. Sie ist 8" hoch, hält 5 1/2" in der Basis, 12" im Bauche und 9 3/4" in der Oeffnung, und enthielt nur Knochen.
Das östlichste Grab in der südlichen Gruppe lag unmittelbar am körchower Wege, wo derselbe im rechten Winkel von der früheren Richtung sich abwendet; es hielt 5' Höhe und 30' im Durchmesser, war schon seit mehreren Jahren, wie alle Hügel dieser Gruppe, beackert; die oberen Steine fehlten ganz und die Randsteine zum größten Theile.
Etwa 4" vom östlichen Rande stand 1 1/2' über dem Urboden im bloßen Sande
21) eine braune Urne mit 2 Henkeln. Zwischen den darin enthaltenen Knochen fand sich eine stark gekrümmte eiserne Hakenfibel, 5" lang, am breiteren Ende 1" haltend; sie ist in 3 Theile zerbrochen und stark gerostet. (Dem Stande und Inhalte nach läßt sich wohl fast mit Gewißheit annehmen, daß diese Urne in späterer Zeit hier eingesetzt sei.)
Etwa 2' weiter westlich war eine Steinkiste, inwendig 1 1/2' im Quadrate haltend, aus flachen Steinen, worin
22) eine dunkelbraune Urne stand, von 8 3/4" Höhe; sie hält 6" in der Basis, 9" im Bauche, 6 3/4" in der Oeffnung, und ist dem Anscheine nach aus bloßer Hand geformt. Es waren nur Asche und Knochen darin.
Etwa 100 Schritte westlich von dem vorigen Hügel lag ein Kegelgrab von 36' Durchmesser und 5' Höhe; äußerlich ganz wie das vorige. Gegen 8' vom südöstlichen Rande war eine Kiste aus flachen Steinen, mit einem flachen Bodensteine


|
Seite 54 |




|
und einem gleichen Decksteine, 1' über dem Urboden, welche inwendig 1 1/2' im Quadrate hielt. Darin stand
23) eine gelbbraune Urne, außen ganz rauh, etwas schief geformt, da der Boden mehr nach einer Seite hin sich befindet. Sie ist 7 1/4" hoch, hält 4 1/4" in der Basis, 11 1/2" im Bauche und 10" in der Oeffnung. Darüber war als Deckel eine gelbbraune Schale, von 5" Höhe mit einem abgebrochenen Henkel am Rande; der Rand ist etwas nach auswendig gebogen und hat 13" Durchmesser; dann baucht sich die Schale etwas aus, biegt sich wieder einwärts und bildet oben eine grade Fläche (umgekehrte Basis ) von 4 1/2" Durchmesser. Die Urne war voll starker Knochen.
Nordwestlich von dieser Steinkiste zeigte sich unmittelbar daran eine andere, eben so gebauet, 1/2' über dem Urboden, worin
24) eine braune Urne, welche 8 3/4" hoch, 5 1/4" in der Basis, 10 1/2" im Bauche und 7" in der Oeffnung hält. Der Inhalt bestand aus starken Knochen. Ueber der Urne war eine gelbbraune Schale als Deckel, 6 1/8" hoch, 12" weit im Rande und mit einer Basis, welche nicht ganz in der Mitte ist und 5 1/2" Durchmesser hat. - Nordwestlich auf dieser Urne stand
25) eine braune Urne mit einem Henkel am Rande, durch welchen bequem ein Finger geht. Sie ist 6 1/8" hoch, hat 3" in der Basis, 5 1/2" im Bauche und 3 7/8" in der Oeffnung. Etwa 2" unterhalb des Randes laufen drei horizontale Linien, in der Breite von 1/2", und unter denselben stehen 7 Bogen aus je 4 Linien, welche bis fast zur Bauchweite, etwa 3 3/8" unterhalb des Randes, herabgehen. Es war nur Sand in der Urne.
Unmittelbar nordwestlich an diese Kiste stieß eine dritte, eben so gebauet, worin unmittelbar über dem Urboden auf einem flachen Steine
26) eine braune Urne stand. Sie ist 11" hoch, hält 5 1/2" in der Basis, 8 1/2" im Bauche und 7 3/4" in der Oeffnung. Der Inhalt bestand nur aus Knochen.
Etwa 20 Schritte südwestlich von dem vorigen lag ein Kegelgrab von 28' Durchmesser und 4' Höhe; äußerlich wie die vorigen. Darin fand sich etwa 10' vom südöstlichen Rande eine Kiste aus flachen Steinen, 1 3/4' im Innern im Quadrate haltend. Darin stand


|
Seite 55 |




|
27) eine braune Urne von 11 3/4" Höhe, 4 1/2" in der Basis, 13" im Bauche und 8 3/4" in der Oeffnung haltend. Ueber den Knochen lag ein 3" langer, etwa 1/8" dicker, unregelmäßig verbogener Drath aus Bronze. Die eine Hälfte ist rund, die andere etwas breit gedrückt; hin und wieder zeigen sich Spuren von Windungen darauf. (Vielleicht ein Rest von einer Heftel?)
Vier Hügel in der nördlichen und drei in der südlichen Gruppe, welche ich außerdem öffnete, lieferten kein anderes Resultat als Scherben von Urnen. Doch ist zu bemerken, daß von allen Formen und Größen Urnen gerettet sind, auch unter den Scherben keine weiteren Abweichungen bemerkbar waren; nur bei den Schalen war es unmöglich von allen Arten hinreichende Stücke zu retten.
Wittenburg, Ende Octobers 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Bobzin No. 4.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 32 und 33.)
An das im Mai 1838 von mir aufgedeckte Kegelgrab (vgl. Jahresbericht 1839, S. 62) stößt ein anderes an der südwestlichen Seite, welches ich im Auftrage des Vereins öffnete. Der ganze Bau war dem früheren gleich, auch mit Gebüsch bewachsen; nur waren die zum eigentlichen Grabhügel angewandten Steine von mittlerer Größe, überhaupt kleiner. Die Aufgrabung ward von Osten angefangen. Etwa 3 Fuß östlich von der Mitte lagen auf einem flachen Steine, 1/2' über dem Urboden, mit Erde bedeckt und von 2 schräg gegen einander gelehnten breiten Steinen geschützt, zwei Oberarm=Bänder aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 2, eben so wie diese mit eingravirten Querlinien und Spitzen verziert, stark mit Rost bedeckt. Sie lagen neben einander, doch wurde das eine von der eisernen Brechstange eines Arbeiters gefaßt und durchbrochen. Sie sind einander völlig gleich: etwas oval gebogen und an den Enden überfassend, halten sie in den äußern Durchmessern 4 1/8 und 3 3/4"; im Durchschnitte fast viereckig sind die Ränder auf der innern und äußern Fläche etwas abgerundet; die Dicke beträgt 3/8 und 1/2". Die Enden sind 1/2" lang über einander gelegt.
Sonst fanden sich nur hin und wieder unter dem Hügel auf dem Urboden Kohlen, aber keine Spuren von Urnen oder andern Alterthümern.
Wittenburg, Ende Januars 1840.
J. Ritter.


|
Seite 56 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab vou Bobzin No. 5.
Auf dem bobziner Felde, links von der wittenburg=hagenower Landstraße, wo der bobziner Weg dieselbe verläßt, liegt ein Kegelgrab von 7' Höhe, welches ich im Auftrage des Vereins öffnete. Der Hügel liegt in einer etwas nach Osten geneigten Ebene und besteht wie der Boden umher aus etwas Lehm haltendem Sande. Von dem Steinringe umher war nur hin und wieder ein Stein vorhanden, da der Hügel schon lange beackert ist; er zeigte einen Durchmesser von 54'.
Die Aufdeckung geschah von Osten. Unter dem Hügel zeigte sich ein Steinhaufen von ovaler Form, 26' lang von Osten nach Westen, 19' breit und in der Mitte 5' hoch. Fast in der Mitte dieses Steingewölbes und 2' über dem Urboden lag auf eben gelegten Steinen und zwischen Asche das vordere Ende einer Lanzenspitze aus Bronze, theils mit edlem grünen Roste bedeckt, theils mit der Asche zusammengerostet. Es mißt 3 1/4". Der übrige Theil war nicht vorhanden. Die Steine, worauf diese Lanzenspitze lag, waren in einer Länge von fast 6" und einer Breite von 2" von der Größe gewöhnlicher Pflastersteine und stark mit Asche und Tannenkohlen bedeckt; auch die Steine waren weiterhin zu beiden Seiten vom Brande geschwärzt. In der den Hügel bildenden Erdmasse kamen hin und wieder kleine Kohlen zum Vorschein. Sonst fand sich nichts von Alterthümern.
Wittenburg, im Mai 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Lehsen No. 2.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 27.)
Der Herr von Laffert auf Lehsen gestattete mit gewohnter Bereitwilligkeit, wo es sich um Förderung der Zwecke unsers Vereins handelt, die Aufdeckung eines großen, auf dem lehsenschen Felde befindlichen Kegelgrabes, stellte unentgeltlich die erforderlichen Leute, leistete die nöthigen Fuhren und kam freundlichst allen Bedürfnissen zuvor.
Das Kegelgrab liegt rechts von dem Wege, der von Lehsen nach Perdöhl und Hagenow führt, einige hundert Schritte von wittenburger Feldes Porcelin, auf einer Ebene, die sich südlich nach einem Moore hin abdacht. Es führt seit Zeiten den Namen Königsberg I), und der Schlag, auf dem es liegt, heißt die Königsbreite 1 ). Der
G. C. F. Lisch.


|
Seite 57 |




|
Boden ist lehmhaltiger Sand und aus diesem besteht auch der Hügel. Die Axenhöhe des Kegels beträgt 18' und der Durchmesser 104'; doch muß die Höhe früher bedeutender gewesen sein, da der Hügel beackert und der Steinkreis umher schon 2' hoch mit Erde überschüttet ist.
Die Aufgrabung begann in zwei Durchschnitten von Osten nach Westen und von Süden nach Norden, später wurden auch die übrig bleibenden Ecken abgetragen. Um den ganzen Hügel war ein regelmäßiger Steinkreis, 4' breit und 3' hoch, von zum Theil mächtigen Steinen. Im östlichen Rande fanden sich neben den Steinen einzelne Scherben von 2 sehr dicken und groben braunen Urnen. Etwa 18' von Osten nach der Mitte hin war ein Steinhaufen aufgesetzt, 4' breit und 3' hoch, in welchem von platten Steinen überdeckt Asche und Knochen von einem Kinde enthalten waren. Nordöstlich von dieser Stelle 4' entfernt standen 4 große gespaltene Steine, die einen Raum von 3' im Quadrat bedeckten, oben gegen einander lehnten und eine Brandstelle umschlossen. Vom südlichen Rande 15' nach der Mitte hin zeigte sich ein Steingewölbe, rings umher gleich 3' hoch senkrecht auf dem Urboden aufgesetzt, in der Mitte bis auf 6' sich erhebend, 14' breit und 32' lang von Osten nach Westen. Zwischen und unter den Steinen von verschiedener Größe fanden sich viele Kohlen von Tannen und Erlen. An dieses Gewölbe schloß sich eine Lage von bald einfach, bald doppelt auf einander gelegten Steinen, welche sich bis 32' dem nördlichen Rande, in Westen und Nordwesten bis auf 10' dem Rande näherte, nach Osten aber nur 6' über den Mittelpunkt hinaus erstreckte. Auch hier fanden sich Holzkohlen. Nahe am Mittelpunkte zeigte sich ein Steinhaufen 5' über dem Urboden von 8' Durchmesser und 3' Höhe, von welchem eine einfache Linie großer Steine in südwestlicher Richtung sich nach dem Rücken des ersten Steingewölbes erstreckte. Ein gleicher Steinhaufen, aber von 10' Durchmesser, lag 16' von der Mitte des Hügels nach Südosten hin und in der Mitte desselben ein viereckiger Beschlag irgend eines hölzernen Instrumentes, vielleicht eines Stabes, wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 5, aus Bronze mit starkem, grünem Roste bedeckt. Das ganz durchgehende Loch ist ein regelmäßiger Cubus, dessen Seiten 6/8" messen. Die Dicke des Metalles ist gut 1/16"; an einem Ende ist ein 7/16" breiter Rand und die Seiten sind mit 6 umherlaufenden graden Linien verziert. In dem Loche befand sich noch ein Stück Holz ziemlich gut erhalten; (es ist von der in Meklenburg sogenannten Faulesche, populus tremens, Espe, Zitterpappel. G. C. F. Lisch).


|
Seite 58 |




|
Außer mehreren kleinen Knochen fand sich nichts weiter an Alterthümern in diesem großen Hügel.
Wittenburg, im October 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Lehsen No 3.
Auf dem lehsenschen Felde, etwa 250 Schritte südlich von dem im Julius v. J. aufgegrabenen Kegelgrabe (vgl. Jahresber. 1839, S. 27), lag ein kleinerer Hügel von 5' Höhe, und nach den zum Theile noch aufgefundenen Ringsteinen 60' im Durchmesser haltend. Leider war in der Mitte schon vor einigen Jahren der Steine wegen hineingegraben, aber nach Aussage der Leute nichts dabei gefunden; doch zeigte sich bei der von Osten begonnenen Aufgrabung bis nach der Mitte nichts. Am westlichen Rande des früheren inneren Steinhügels, etwa 15' vom Rande standen mehrere Urnen, aber schon so zerfallen, daß ihre Gestalt nicht herzustellen war. Neben einem sehr großen Steine fand sich dicht an den Urnen nach innen zwischen stark mit Asche und Kohlen vermischte Erde ein Stück Glas, offensichtlich von einer gläsernen Urne von 4" Durchmesser in der Oeffnung und 1/2" Bauchweite. Das Glas selbst ist hellgrün; dicht unter dem Rande laufen von außen nicht tief eingelegte, abwechselnd weiße und rothe Streifen, von gefärbtem Glasflusse, aus allen Richtungen wie in einen Punkt zusammen. Das Stück ist fast ein Quadrat von l 3/8". Alles Suchen nach mehr Stücken war vergeblich.
Der Herr von Laffert hatte die Gewogenheit, zu dieser Aufgrabung für den Verein die nöthige Mannschaft 4 Tage lang zu stellen.
Wittenburg, Anfang Novembers 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 2.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 28-30.)
Am 8. August d. J. öffnete ich im Auftrage des Vereins einen kleinen Grabhügel auf dem wittenburger Stadtfelde, dicht am hagenower Wege, 20 Schritte südlich von einer Sandgrube, durch deren Anlage der Klasberg, ein Kegelgrab zu der südlichen Reihe Kegelgräber gehörend, vor meheren Jahren zerstört ist. Der Boden, aus gelbem Sande und Steingerölle bestehend, senkt sich nordwestlich nach der Stadt hin. Der von mir geöffnete Hügel war kaum bemerkbar, erhob sich 3' über den Urboden, war völlig rund, oben flach, hielt 30' im Durchmesser und war aus brauner Haideerde aufgehäuft. Bei dem Auf=


|
Seite 59 |




|
graben zeigten sich gleich im Osten einige braune Urnenscherben und etwa 8' von der Mitte eine braune Urne; weiterhin südlich 6' von der Mitte standen 4 braune Urnen neben einander in einem Viereck; nördlich 7' von der Mitte fand sich wieder eine Urne und 9' nordwestlich noch eine braune Urne. Alle Urnen waren mit mäßigen Steinen umstellt, oben aber unbedeckt und hatten einen platten Stein zur Unterlage, 1/2' über dem Urboden. Sonst fanden sich nur am Rande des Hügels einige größere Steine. 4' vom nördlichen Rande lag 1/2' über dem Urboden ein völlig erhaltener Schädel mit mehreren guten Zähnen, doch war er sehr mürbe; das Gesicht war nach Westen gekehrt, der Scheitel nach Süden. Von den Urnen ist
1) die östliche inwendig schwarzbraun, 10" hoch, hält 5" in der Basis, 9 1/2" im Bauche und 7" in der Oeffnung. In dieser wie in allen übrigen waren Knochen, Asche und Sand enthalten.
2) Von den 4 südlichen Urnen ist
a. die eine aus feinerer Masse, 7 3/4" hoch, 3 7/8" in der Basis, 8" im Bauche und 6 1/2" in der Oeffnung haltend;
b. die zweite aus gleicher Masse ist 8 3/8" hoch, hält 4 1/2" in der Basis, 8 1/2" im Bauche, 6" in der Oeffnung und ist oberhalb der Bauchweite mit roh eingeritzten Figuren versehen, welche kreis=, halbkreis= und wellenförmig sind, entweder mit ähnlichen parallelen oder graden Linien inwendig ausgefüllt;
c. die dritte Urne ist etwas gröber, 7 7/8" hoch, hält 4 7/8" in der Basis, 10 1/8" im Bauche und 8 3/8" in der Oeffnung. Der Boden dieser Urne war mit Bodenstücken einer andern Urne belegt. Unter den Knochen fand sich ein fast herzförmig gebogener Drath (ein offener Ring oder eine Oese) von Bronze, mit glänzendem edlen Roste bedeckt; die Oese ist 5/8" hoch, der Drath ungefähr eine Linie dick 1 );
d. die vierte Urne dicker und gröber ist 9" hoch, hält 4 1/2" in der Basis, 9" im Bauche und 7" in der Oeffnung.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 60 |




|
3) Die nördliche und
4) die nordwestliche Urne waren beide zerdrückt, scheinen nach den Bruchstücken aber der Masse und Form nach der vorigen gleich gewesen zu sein.
Zwei andere weiter südlich am hagenower Wege liegende Hügel von gleichem Umfange und gleicher Höhe, aber von gelbem Sande aufgeworfen und mit Haide bewachsen, enthielten nichts an Alterthümern.
Wittenburg, den 15. August 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 3.
Etwa 400 Schritte östlich von dem im Julius v. J. von mir eröffneten Kegelgrabe auf dem lehsenschen Felde (vergl. Jahresber. 1839, S. 27), liegt auf dem wittenburger Felde ein Kegelgrab, zu dessen Aufgrabung der Herr von Laffert auf Lehsen vier Tage lang die erforderliche Mannschaft für den Verein stellte. Die Aufgrabung geschah von Süden (da die Ackerstücke hier von Süden nach Norden laufen und des Nachbars Acker nicht berührt werden durfte), und zeigte sich, daß die Randsteine in einem Kreise von 64' Durchmesser umherlagen. In der Mitte hatte der Hügel 5' Höhe über dem Urboden, doch waren nur wenige Steine darin in einer fast kreisrunden Lage von 30' Durchmesser und 2' Höhe. Es fand sich an Alterthümern nichts; doch bemerkenswerth waren 6 im Rande des innern Steinhaufens stehende Klumpen einer Masse, die an Schwere und Gestalt den Schlacken aus der Schmiedeesse gleichen; sie waren stenglicht zusammengeschmolzen, schwarzbraun und glänzend im Bruche, glasig in den abgerundeten Oberflächen, sehr leicht, wie geschmolzenes Glas, 2 1/2' hoch, rund, in der Mitte dünner, wie 2 mit den Spitzen einander berührende Kegel; die beiden Basen maßen ungefähr 11/2'. Der Platz umher war geschwärzt und die Erde mit Kohlen gemischt, so daß der Brand an Ort und Stelle geschehen zu sein scheint.
Wittenburg, im November 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 4.
Im November d. J. begann ich im Auftrage des Vereins die Aufdeckung eines Kegelgrabes auf dem wittenburger Felde, welches etwa 500 Schritte südlich von dem lehsenschen Wege hinter den Freihägen liegt. Der Boden ist lehmiger Sand und


|
Seite 61 |




|
dacht sich allmählig südlich nach dem wittenburger Holze ab, wobei die Ackerstücke ebenfalls von Norden nach Süden laufen. Deshalb fing ich die Aufgrabung von Süden an. Der Hügel hatte einen Steinring von 60' Durchmesser und darin einen ovalen Steinhaufen von 45' Länge von Osten nach Westen und 30' Breite; die Höhe betrug in der Mitte 3', worüber noch 1' Erde war, welche schon seit Menschengedenken beackert ist. Im Süden fanden sich unter dem Steinhaufen 2 Stellen, welche in der Breite von 2' noch 3' tief unter dem Urboden Kohlen, Asche und in der Tiefe schwarz gebrannte Steine und Erde zeigten; doch fanden sich keine Alterthümer. Vier Tage hatte ich graben lassen und mußte des rauhen Wetters wegen die Arbeit einstellen; es blieb noch der nordwestliche Theil, etwa 1/4, zu untersuchen übrig. Der Eigenthümer des Ackers (Fuhrmann Prüß) brach indeß ohne mein Wissen die übrigen Steine heraus und fand ein Schwert aus Bronze mit Griffzunge, mit grünem Roste dick überzogen. Es war in 2 Theile zerbrochen, der eine von der Spitze bis zum Bruche 8 1/2", der andere 16 3/4" lang, in den Bruchflächen oxydirt. Die größte Breite der Klinge mißt 1 3/4", etwa 9" vom Griffe. Der erhabene Mittelrücken ist auf jeder Seite mit einer feinen, erhabenen, scharf abgegrenzten Linie eingefaßt. Die Griffzunge ist bis auf den äußersten kleinern Theil, nämlich 2 1/4", vorhanden, mit drei Nietlöchern, wovon eins in der Mitte und zwei am Rande nahe an der Klinge.
Wittenburg, Anfang Decembers 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 5.
An dem Wege nach Lehsen lag auf dem wittenburger Felde ein Kegelgrab von 4' Höhe und 60' Durchmesser, worin außer den Ringsteinen nur wenige Steine vorhanden waren. In der Mitte des Hügels stand auf dem Urboden eine schwarze, dünne Urne von 9" Höhe und 11" Bauchweite, unten mit rohen , sich schräge durchschneidenden Linien verziert; sie zerfiel sogleich an der Luft. In der Urne befanden sich drei Bruchstücke einer Nadel aus Bronze. Der Kopf ist halbkugelförmig, 1/2" breit mit scharfem Rande; die Nadel selbst ist etwas gebogen und 3/16" dick. Die Länge der 3 Stücke, in welche die Nadel zerbrochen ist, ist 3"; das letzte Bruchende ist oxydirt; die Spitze oder vielmehr der größere Theil der Nadel fehlt.
Der Herr von Laffert auf Lehsen gab zu dieser Aufgrabung die erforderliche Mannschaft auf einen Tag her.
Wittenburg, Ende Novembers 1839.
J. Ritter.


|
Seite 62 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 6.
An dem lehsenschen Wege, fast grade dem wittenburger Kirchhofe gegenüber, wurde bei Anlegung der Chaussee eine kleine Erhöhung weggeräumt. Es ergab sich dabei, daß hier die Erde fast 3' über dem Urboden aufgetragen sei. Darin stand eine große rothe Urne, angefüllt mit einer wie Schlacken zusammengeschmolzenen Masse, ähnlich der im Novbr. d. J. in dem Kegelgrabe No. 3. gefundenen Masse, doch mehr metallisch, schwerer, heller von Farbe und anscheinend mehr mit Sand gemischt; an einigen Stellen ist sie glänzend, metallisch, opalisirend, auch mit einigen kleinen krystallinischen Bildungen der Glimmerkrystallisation, ganz wie die des böhmischen Wawellits. Die Erde um die Urne war schwarz gebrannt, so daß sie auf der Brandstelle zu stehen schien. Leider war sie durch Unvorsichtigkeit zertrümmert. Von sonstigen Alterthümern zeigte sich nichts dabei.
Wittenburg, den 12. December 1839.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wittenburg No. 7.
Auf dem wittenburger Felde liegt südlich von der Chaussee nach Lehsen, gegen 500 Schritte entfernt von der Stelle, wo der Weg nach Perdöhl von der Chaussee abgeht, ein mit Eichen und Gebüsch bewachsener Hügel, welcher den Namen Kapenburg führt, nach welchem auch seit undenklichen Zeiten die umherliegenden Aecker benannt werden. Von diesem Hügel geht die Sage, daß er früher befestigt und mit einem Thurm versehen gewesen sei, woher jener Name stamme. Die Gestalt entspricht jedoch den Kegelgräbern.
Im Auftrage des Vereins schritt ich zur Aufdeckung dieses Hügels, der eine Höhe von 8 Fuß und einen Durchmesser von 64 Fuß hatte. Rings umher zeigte sich ein Steinring von 3 Fuß Höhe und gleicher Breite. Innerhalb dieses Umkreises war ein Steingewölbe von ovaler Form, 22 Fuß von Osten nach Westen lang, 14 Fuß breit und 5 Fuß hoch; die größeren Steine standen im Rande. Fast in der Mitte dieses Steinhaufens lagen zwischen Steinen verpackt, 1 1/2 Fuß über dem Urboden, 2 Armringe aus Bronze für den Oberarm (der eine ist in 2, der andere in 4 Theile zerbrochen), stark oxydirt und theilweise mit edlem Rost bedeckt. Sie sind etwas oval, in den äußern Durchmessern 3 1/4' und 3 1/2" weit, mit den Enden gegen 1/2" lang über einander gebogen; ihre Stärke ist 3/8 und


|
Seite 63 |




|
1/2", da sie viereckig, aber an der inneren und äußeren Ecke abgerundet sind.
Weiter fand sich nichts, auch von Urnen zeigte sich keine Spur, noch viel weniger irgend etwas, was die oben angeführte Sage unterstützen könnte.
Wittenburg, im März 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wohld No. 3.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 30.)
Etwa 200 Schritte links von der wittenburg=hagenower Landstraße liegt auf dem stadt=wohlder Felde hart an der bobziner Scheide ein Kegelgrab, östlich von dem im Mai 1838 geöffneten Hügel (vgl. Jahresbericht 1838, S. 61). Zu Anfange d. M. begab ich mich im Auftrage des Vereins dahin, um das Grab aufzudecken. Der vollkommen runde Hügel war in der Mitte 6' hoch; es fand sich um denselben ein einfacher Ring von Steinen, alle mit Erde bedeckt; der Durchmesser des Hügels betrug 46'. Der Hügel besteht aus lehmhaltigem Sande und ist seit Menschengedenken beackert. Da südlich und östlich der Scheidegraben hinderlich war, so geschah die Aufdeckung von Westen. Es war in dem Hügel ein einziges ovales Steingewölbe, 24' von Osten nach Westen lang und 18' von Süden nach Norden breit; die Höhe in der Mitte betrug 4 1/2'. Hin und wieder kamen Spuren von Tannenkohlen zwischen den Steinen vor. Etwa 2' südwestlich von der Mitte lag auf einem flachen Steine, 1' hoch über dem Urboden, eine Speerklinge aus Bronze mit Schaftzunge (wie Frid. Franc. Tab. VIII, Fig. 2) mit 2 noch darin befindlichen bronzenen Nieten; sie ist stark von hellgrünem Rost angegriffen. Sie lag mit der Spitze nach Osten. Die Länge beträgt 6 3/8"; am Schaftende ist die Breite 1 1/4"; in der Mitte ist auf beiden Seiten ein schmaler, rund erhabener, scharf hervortretender Rücken. - Nur 1 1/2' östlich von der Stelle, wo sie lag, fand sich unter kleineren Steinen eine Heftel aus Bronze in Bruchstücken, welche ungefähr der Heftel in Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 3 ähnlich gewesen sein wird; es waren außer der eigentlichen Nadel (jetzt 3 1/2" lang), woran die Spitze fehlt, nur 3 Stücke des schön gewunden gearbeiteten Bügels (jetzt 3 1/4" lang) zu finden; alles ist mit edlem Rost bedeckt. Von Urnen fand sich keine Spur.
Wittenburg, im Februar 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Dammereetz.
In diesem Sommer wurde beim Ebnen eines Ackerstücks zu Dammereetz (ritterschaftlichen Amts Wittenburg) und Aus=


|
Seite 64 |




|
brechen der Steine aus einem Kegelgrabe ein Schwert aus Bronze gefunden und durch den Herrn Inspector Lehmann daselbst mir für den Verein zugesandt. Es ist im Ganzen jetzt 24 7/8" lang, schön mit edlem Roste überzogen. Der stark gewölbte Mittelrücken ist durch eine scharfe vertiefte Linie auf jeder Seite begrenzt. Die Griffzunge, von welcher der äußerste Theil fehlt, ist 1 1/8" breit mit nach beiden Seiten vorstehendem Rande; sodann biegt es sich nach der Klinge hin halbmondförmig bis 2 1/2" Breite, wo auf jeder Seite 2 Nietlöcher stehen. Die Spitze des Schwertes fehlt, etwa in einer Länge von 3", so daß die Klinge etwa 28" gehalten hat. Die größte Breite ist etwa 8 Zoll vom Griffe.
Wittenburg, im December 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Urne von Wittenburg.
Bei Anlage der Chaussee auf dem Wege nach Lehsen stießen die Arbeiter in der Tiefe von 3' in ebener Erde, etwa 60 Schritte westlich von dem Ende Novembers d. J. geöffneten Kegelgrabe Nr. 5 auf dem wittenburger Stadtfelde, auf eine sehr große Urne, worin sich nur einige Knochen befanden. So weit es mir möglich war, sie aus den Stücken zusammen zu setzen, hat sie 22 1/2" Höhe (sie war aber noch höher, da noch keine Randstücke darauf paßten), mißt in der Basis 11 1/2" und im Bauche 22". Die Oeffnung war wahrscheinlich der Basis gleich. Die Dicke der Masse ist 1/2 bis 5/8", inwendig gelbroth, auswendig theils schwarz, theils gelb. Es sind beim Bereiten der Urne, wie aus den einzelnen Stücken leicht erkennbar war, Schichten von etwa 4" auf einander gesetzt.
Wittenburg, Ende Novembers 1839.
J. Ritter.



|



|
|
|
Ein Paar Handringe
aus Bronze, mit den häufig vorkommenden Schräglinien verziert und mit edlem Rost bedeckt, durch den HerrnDirector Wex aus dem Naturalien=Cabinet des Gymnasii Fridericiani, wohin diese Alterthümer zur Zeit des wail. Directors Görenz gekommen waren, überwiesen; der eine Ring ist in zwei Stücke zerbrochen.



|



|
|
|
Alterthümer von Retzow.
(Vgl. Jahresber. III, S. 64.)
Bei Retzow, im Amte Lübz, ward, unbekannt unter welchen Umständen, gefunden und vom Herrn Fridericianer Hobein zu Schwerin geschenkt:


|
Seite 65 |




|
eine Framea von Bronze, mit durchgehender Schaftkerbe, mit breiter Schärfe, dünne, zierlich und leicht, - und
ein Handring, mit gravirten Linien geschmückt, beide mit edlem Rost bedeckt.



|



|
|
|
Nadel von Gallin
aus Bronze, 6" lang, am obern Ende etwas gebogen und hier an der äußersten Spitze mit einer 3 1/4" langen, unbeweglichen, gereifelten Querstange versehen, ganz wie die Nadel zu einer antiken Heftel (in Form einer Broche), jedoch ohne einen Bügel; die Nadel ist nach der Seite der Krümmung hin mit eingegrabenen Zickzacklinien verziert. Gefunden ist diese Nadel von seltener Form im Jahr 1806 zu Gallin bei Boizenburg in einer Urne beim Abtragen eines Hügels. Geschenk des Herrn Hofraths Knaudt zu Schwerin.



|



|
|
:
|
Schwert von Wiebendorf.
Zu Wiebendorf bei Boizenburg ward in einem Hügel ein Schwert gefunden. Leider wurden keine genauern Nachforschungen angestellt, und es kam nur die untere Hälfte der Waffe, 10" lang, in 3 Bruchstücken, in die Hände des Gebers, des Herrn Sanitätsraths Richter zu Boizenburg. Hiernach war es ein Schwert von der Art der Schwerter aus den Kegelgräbern, aus Bronze, zweischneidig, mit erhabenem Mittelrücken, stark oxydirt. Was den Fund interessant macht, ist, daß an beiden Seiten der Spitze sehr klar 4" lange Reste der Scheide angerostet sind, welche aus einem feinfaserigen, leichten Holze (wahrscheinlich von der Zitterpappel, populus tremens, Faulesche) bestand. (Nach andern Funden war die hölzerne Scheide in dieser Zeit auch noch mit feinem Leder überzogen.)
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Zwei Lanzenspitzen aus Bronze,
gefunden zu Radepohl bei Crivitz, 26 Fuß tief in einer Mergelgrube, geschenkt vom Herrn Driver auf Radepohl. Diese Lanzenspitzen, von denen die eine an einer Seite ganz erhalten, die andere nur in Bruchstücken vorhanden ist, sind den im Frid. Franc. Tab. VIII, Fig. 4-6 abgebildeten ähnlich und sind ohne Zweifel in den ältesten Zeiten der Bronzeperiode verschüttet. Sie haben freilich nicht den edlen, grünen Rost, aber jenen seltenern braunen Rost, wenn man sich so ausdrücken darf, der oft ebenfalls für ein sehr hohes Alterthum


|
Seite 66 |




|
zeugt; die ganze Masse ist nämlich in sich so vergangen, daß man sie leicht zerschneiden kann, ohne auf blanke Bronze zu stoßen, dabei aber noch so im Zusammenhange geblieben, daß nicht allein die äußere Form mit aller Schärfe, sondern sogar die Politur völlig erhalten ist. In diesen Lanzenspitzen stecken noch die Reste der Schafte von Eichenholz, fest und hart, und ganz wie neu.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
C . Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Begräbnißplätze.
Wendenkirchhof von Helm.
Fortgesetzte Aufgrabungen.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 39-48.) 1 )
Eine hellbraune, unten glatte, oben rauhe Urne, 12 1/8" hoch, 3 1/4" in der Basis, 11 1/2" im Bauche, 5 1/2" in der Oeffnung haltend. Darüber war als Bedeckung eine Schale, deren platte Basis, 1 5/8" im Durchmesser, mit vielen halbkugelförmigen Eindrücken von 1/6" Breite versehen ist. Inhalt: nur Knochen und Asche.
Drei braune Urnen, so zertrümmert, daß ihre Form nicht zu erkennen war. Inhalt: nur Knochen.
Eine braune Urne mit Henkel, 10 5/8" hoch, 4 1/4" in der Basis, 9 3/8" im Bauche, 5 3/4" in der Oeffnung haltend. Inhalt: Knochen uud Asche.
Eine braune Urne mit 2 großen Henkeln, 5 1/2" in der Basis, 10" im Bauche haltend; der obere Theil war, wie bei
G. C. F. Lisch.


|
Seite 67 |




|
der folgenden, ganz zertrümmert. Unter den Knochen lag eine eiserne Nadel, 3 7/8" lang, deren Spitze vom Roste verschont ist. Sie lag zerbrochen auf 2 Stellen in der Urne; jetzt ist sie in 3 Theile zerbrochen. Der Knopf dieser Nadel ist aus Kupfer und besteht aus 2 halbkugelförmigen Schalen, die im Durchmesser 1/2" breit sind, die auf einem zwischenliegenden Eisenplättchen mit den Rändern zusammenstehen und mit dem obern Ende der Nadel zusammengenietet sind. Die Form und Zusammenstellung ist ganz wie bei den in Urne 7 (vgl. Jahresber. IV, S. 43-44) gefundenen größern Halbkugeln, wornach auch jene wahrscheinlich den Knopf einer sehr großen Nadel bildeten.
Eine braune Urne mit Henkel, 4 3/4" in der Basis, 10 1/2" im Bauche haltend. Es fand sich unter den Knochen ein eiserner Ring, 1 3/4" im äußern Durchmesser weit, und eine eiserne Hakenfibel oder Spange (Knippe), ganz wie die in Urne 19, aber nur 4 3/4" lang; sie ist in der Mitte durchgebrochen.
Eine schwarze Urne mit 2 Henkeln, 8 1/4 " hoch, 4 1/4" in der Basis, 8 3/4" im Bauche und 4 1/2" in der Oeffnung haltend. Unter den Knochen war ein eiserner Ring, 1 1/2" im äußern Durchmesser haltend; er ist in 3 Theile zerbrochen.
Eine hell und dunkelbraun gescheckte Urne, mit 2 Henkeln, 11 1/4" hoch, 3 1/2" in der Basis, 9 3/4" im Bauche und 4 3/4" in der Oeffnung haltend. Darüber war als Deckel eine Schale aus gleicher Masse, 3 1/2" hoch, mit einer Basis von 2 1/2" Durchmesser und 7 3/4" weit am einwärts gebogenen Rande. Inhalt: nur Knochen, Asche und Sand.
Zwei schwarze, ganz zerdrückte Urnen, ohne weiteren Inhalt als Knochen und Asche.
Zwei braune, sehr zergangene und zerdrückte Urnen, worin auch nur Knochen waren.
Eine hellbraune Urne 11 3/4" hoch, 5" in der Basis, 11 1/2" im Bauche und 6" in der Oeffnung haltend, auswendig rauh bis auf den 2 1/4" hohen Hals; inwendig glatt und fast schwarz. Darüber war eine schwarze Schale, wovon aber nur Bruch=


|
Seite 68 |




|
stücke sich fanden. In der Urne lag über den Knochen ein Ring aus Bronze, 6/8" weit, aus dünnem, 15"' breitem Bleche; er ist auf einer Stelle gebrochen, 1/4" aus einander stehend und nach diesen Bruchenden mit runden Vertiefungen versehen, um welche ein etwas erhabener Rand läuft, gut 1/8" breit
Eine ganz zertrümmerte braune Urne, worin nur Knochen.
Eine schwarze Urne, nach den Bruchstücken anders als die bisherigen Urnen dieses Kirchhofs in ihren Verhältnissen gebaut, nämlich oben weit geöffnet. Der oben abgeplattete, 1 1/8" breite Rand mißt im äußern Durchmesser 8 1/4" und nur gleiche Weite hat die 2" darunter befindliche Ausbauchung der Urne, welche sich so stark abrundet, daß die ganze Höhe der Urne nur 5" gewesen zu sein scheint. Außer Sand und Knochen war nichts darin.
Eine braune Urne, wovon der Theil über dem Henkel fehlt; sie hat bis dahin 10 1/2" Höhe, hält 5 1/2" in der Basis und 7 1/2" im Bauche. Der Henkel ist in der Oeffnung 3/4" und 1 1/4" weit. In der Urne waren viele starke Knochen.
Eine rotbbraune Urne mit 2 Henkeln, 9" hoch, 5 3/4" in der Basis, 10" im Bauche und 8" in der Oeffnung haltend. Es war nur Sand darin.
Eine schwarze Urne, ganz aufgelöst und zerbrochen. Unter den starken Knochen lag eine große, schöne, nicht überall vom Rost angegriffene Hakenfibel aus Eisen, 7 1/2" lang, mit einer Krümmung von 7/8" über der Horizontallinie. An dem einen Ende ist sie 1 3/4" breit und mit einem 3/8" breiten und durch 3 Niete befestigten Eisenbleche belegt, welches an den Enden 1/4" vorsteht, hier zu einem Oehr umgelegt ist, dessen Enden auf der Rückseite eine Röhre bilden und durch die Niete befestigt sind. Auf der Außenseite der Hakenfibel läuft in der Mitte eine Erhöhung wie eine Rippe von 5/16" Breite; die Ränder sind nach außen gebogen. Das spitze Ende des Instrumentes in der Verlängerung der Rippe biegt sich hakenförmig nach außen und endigt in einem kleinen Knopfe 1 ). Da
J. Ritter.


|
Seite 69 |




|
dieses Stück äußerst gut erhalten ist, so giebt es Gelegenheit, die Arbeit zu untersuchen; diese ist ausgezeichnet in jeder Hinsicht, an Regelmäßigkeit der Form, Sauberkeit und Behandlung des Metalls, so daß es in einer gewöhnlichen Werkstätte heute schwerlich so gut gemacht werden würde. Diese Fibel nöthigt vor der Kunst der Alten, in Eisen zu schmieden, hohe Achtung ab. Dieses Ende lag nach Osten in der Urne. Dicht daran an der Nordseite lag ein eiserner Ring, im äußern Durchmesser 1 3/8", im innern 7/8" weit; er ist stark gerostet.
Eine dünne braune Urne mit 2 Henkeln, 10" hoch, 4" in der Basis, 9" im Bauche und 5 3/4" in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, zerdrückt, worin nur Knochen waren.
Eine schwarze Urne mit 2 Henkeln, über 7 1/2" hoch, 8 1/2" im Bauche und 4 1/4" in der Oeffnung haltend. Sie ist ohne Boden. Da sie zwischen Steinen sorgfältig verpackt war, auch noch in ihrer vollen Gestalt auf einem flachen Steine dastand, so war deutlich zu sehen, daß sie keinen Boden gehabt hatte. Doch ist das untere Ende rauh wie ausgebrochen. Ich mache diese Bemerkung, da ich schon früher bei mehreren schwarzen Urnen, z. B. 21, 41, 42, vergeblich nach dem Boden suchte.
Eine braune Urne, zerdrückt, mit Asche und Knochen gefüllt.
Drei zertrümmerte braune Urnen ohne Verzierung, worin sich nur Knochen fanden.
Eine braune Urne mit 2 Henkeln, 5 3/8" hoch, 6 1/2" im Bauche, 2 1/2" in der Basis und 4 1/8" in der Randöffnung haltend, während der Hals nur 2 3/4" inwendig weit ist. Es waren darin kleine Knochen.
Eine braune Urne von sehr mürber Masse, 11" hoch und 11 1/2" im Bauche haltend; die Basis hatte 5 1/2" und die Oeffnung 6 1/4" Durchmesser. An der Stelle der Henkel waren nahe unter dem Halse halbmondförmige Ansätze von 1" Länge und 1/4" Breite in der Mitte, mit den Enden nach unten gekehrt. Es fanden sich in der Urne nur Knochen.


|
Seite 70 |




|
Eine zweigehenkelte schwarze Urne, 9" hoch, 11 1/2" im Bauche, 4" in der Basis und 6 1/2" in der Oeffnung haltend. Sie ist mit Linien verziert, indem um die Bauchweite eine einfache und von dieser senkrechte Linien bis zur Basis hinablaufen.
Eine zweigehenkelte hellbraune Urne, 10 1/4" hoch, 12 1/2" im Bauche, 4 1/2" in der Basis und 9" in der Oeffnung haltend. Die Henkel sind so groß und weit, daß man bequem mit dem Finger durchfassen kann. Ueber den vielen und starken Knochen in der Urne lagen an der nordöstlichen Seite ein eiserner Ring von 1 1/2" äußerem und 1 1/8" innerem Durchmesser, so wie 2 zusammengehörige Stücke Eisen, jedes von 2 1/2" Länge, wovon das eine eine Nadel ist und welche wahrscheinlich zusammen eine Heftel bildeten. Beide Stücke sind stark vom Roste angegriffen.
Wittenburg 1 ).
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Porcelin (bei Wittenburg).
Zu Ende v. M. ward mir die Nachricht, daß auf dem zum wittenburger Gebiete gehörigen Felde Porcelin beim Ausbrechen von Steinen sich häufig Urnenscherben zeigten; ich begab mich deshalb dahin, um für den Verein nähere Nachsuchungen anzustellen. Der Platz liegt links vom Wege nach Perdöhl, nahe an der perdöhler Scheide, und ist meistentheils mit dichtem Gebüsche bewachsen. Der lehmhaltige Sandboden dacht sich südlich nach einer Niederung ab, die sich nach dem perdöhler Torfmoore hinzieht. Auf diesem Platze, dessen Grenzen durchaus nicht bezeichnet sind, finden sich hin und wieder kreisförmige Steinlagen, nur wenig über den andern Boden sich erhebend, unter denen zwischen Steinen verpackt sich einzelne Urnen 2-3' tief zeigten; oft aber waren die Urnen nicht durch solche Steinlagen bezeichnet, sondern nur in der Erde mit Steinen umsetzt. Die ganze Art des Standes, so wie die Form der Urnen zeigte nichts Abweichendes von dem helmer Kirchhofe am Haidberge, und der Inhalt der Urne 1 bezeichnet das Ganze als einen Wendenkirchhof. Von etwa 16 Urnen, die in einer Breite von 60 Schritten gefunden wurden,


|
Seite 71 |




|
konnten nur 3 so weit gerettet werden, daß ihre Gestalt deutlich erkennbar ist; etwas Besonderes fand sich an keiner derselben, sie stimmten vielmehr an Farbe, Größe und Form ganz zu den helmer Urnen. Der Inhalt bestand, da sie alle genau durchsucht wurden, nur aus Knochen, mit Ausnahme der Urne 1. Die erhaltenen Urnen sind nach der Zeit ihrer Auffindung:
Eine gut erhaltene braune Urne mit zwei Henkeln (von denen der eine abgebrochen ist), l0 1/2" hoch, 4 1/4" in der Basis, 9 1/4" im Bauche und 8" in der Oeffnung haltend. Ueber den Knochen lag im Sande die Spitze und darunter zwischen Knochen der übrige Theil einer eisernen Nähnadel (oder Stopfnadel), 5 3/4" lang und über 1/8" dick, stark mit Rost bedeckt.
Eine fast ganz erhaltene, dünne braune Urne mit einem (abgebrochenen) ziemlich großen Henkel, von 8" Höhe, 3 3/4" in der Basis, 7 3/8" im Bauche und 4 3/8" in der Oeffnung. Unterhalb und seitwärts vom Henkel sind 6 runde Eindrücke als Verzierung.
Eine über halb erhaltene braune gehenkelte Urne, 11 1/4" hoch, 5" in der Basis, 9 1/4" im Bauche und etwa 7" in der Oeffnung haltend.
Eine weitere Nachgrabung schien nach diesen Resultaten unthunlich, da auch die vielen Wurzeln die Arbeit sehr erschweren und der Inhalt nicht lohnend scheint.
Wittenburg, im Februar 1840.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Rülow.
Ein großer Begräbnißplatz bei Rülow in der Nähe von Neubrandenburg im meklenburg=strelitzischen Amte Stargard ist in mehrfacher Hinsicht von großem Interesse. Der Herr Pastor Sponholz zu Rülow, Mitglied des Vereins, hat nicht allein von Zeichnungen begleitete Nachrichten über die Localitäten eingesandt, sondern auch Nachgrabungen angestellt, deren Ergebniß, mit Allerhöchster Erlaubniß Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Strelitz, Eigenthum des Vereins geworden ist. Nach allen Zeichen birgt der Begräbnißplatz, wenn auch Reste der wendischen Cultur vorherrschend zu sein scheinen, Ueberbleibsel von den Erzeugnissen aller Perioden der Vorzeit. In dieser Hinsicht hat er bis jetzt allein Aehnlichkeit mit dem Begräbnißplatze von Klink (vgl. Jahresber. III, S. 66,


|
Seite 72 |




|
41 u. 64), führt in der Erweiterung unserer antiquarischen Erkenntnisse jedoch noch weiter, wenn sich nicht annehmen läßt, daß auf diesem Platze früher auch alte, erhöhete Gräber (wie zu Helm, vgl. Jahresber. IV, S. 34) gelegen haben, deren Ringsteine im Laufe der Zeit weggenommen sind. Es folgt hier der Bericht des Hrn. Pastors Sponholz mit einigen, durch Vergleichungen hervorgerufenen Zusätzen des Hrn. Archivars Lisch.
Leider haben seit Jahrhunderten der Pflug, das Wegführen größerer und kleinerer Feldsteine zu Bauten, Sandgruben und frevelnde Hände sehr viel zerstört und zerstreut. Der ganze Raum, den man als den sandigen Anfang eines nicht unbedeutenden Plateaus ansehen kann, das sich bei einzelnen unbedeutenden Erhöhungen gegen N. nach dem nahen Dorfe Glienke zum fälschlich sogenannten Landgraben zwischen dem Festlande und dem friedländischen Werder senkt, - der ganze Raum unsers Wendenkirchhofes, so weit seine Merkmale bis jetzt aufgefunden sind, hat über 3000 Schritte Umfang, im N. von einem sich lang hin auf der Dorfgrenze hinziehenden Moor (glienker Torfmoor), im S. von einem minder großen Bruche (Hänkers Moor links am Wege nach Liepen), das durch einen breiten Wassergraben theilweise trocken gelegt ist, begrenzt; gegen W. berührt den Kirchhof ein im Sommer trockner Bach, der ihn von dem nahen Dorfe Rülow trennt, doch liegen einige reichlich fließende Quellen (,,Der Spring") hart zwischen dem Bache und einer Begräbnißstelle auf dem Plateau. Drei größere oder kleinere Feldteiche (,,Sölle"), die ausdauernd Wasser halten, befinden sich auf der Hochebene: die Schweinkuhle und der große und kleine Schwemmpfuhl, und in deren Nähe immer unverkennbare Grabstätten. Der Boden ist durchweg trockner, kieshaltiger Sand, daher der Raum höchstens alle drei Jahre mit Roggen besäet wird.
Auf diesen Raum ward ich bald nach meiner Anstellung als Prediger zu Rülow (1820) aufmerksam durch eine Menge zu Tage liegender Urnenscherben. Diese sind von der mannigfaltigsten Masse und Structur; ich übersende hiebei Proben von allen Arten, wie ich sie über der ganzen Fläche zerstreut gefunden habe:
1) Scherben von sehr dickwandigen Urnen, bis zu 1/2" Dicke, mit grobem Kiessand oder Feldspathgrus durchknetet, ähnlich denen, die in den Hünengräbern vorkommen, jedoch fester gebrannt.


|
Seite 73 |




|
2) Scherben von glatten, gewöhnlich vorkommenden Urnen, aus Thon mit Kies und Glimmerfünkchen durchsprengt, braun und röthlich gebrannt, ohne Verzierungen, wie sie in Kegelgräbern und Wendenkirchhöfen vorkommen; jedoch fehlen die schwarzen Urnen des westlichen Meklenburgs.
3) Scherben von der gewöhnlichen Urnenmasse, aber viel härter und spröder gebrannt, als die eigentlichen antiken Aschenkrüge, unter dem Rande mit parallel laufenden Wellenlinien verziert, die zwar mit einem unvollkommenen Instrumente, aber mit sicherer Hand gemacht sind; dergleichen Urnen sind bisher selten gefunden und in der Regel einzeln im Urboden stehend.
4) Scherben von den äußerst fest gebrannten, altmittel=alterlichen Töpfen, aus fein geschlemmtem, blaugrauem Thon; diese Töpfe sind bisher noch nicht als zu Graburnen benutzt erkannt; die Benutzung dieser Töpfe zu Aschenkrügen ist jedoch in den letzten Zeiten des Heidenthums nicht unmöglich, um so mehr, da viele Scherben hier dadurch einen Uebergang zeigen, daß sie zwar aus blaugrauem Thon in der Hauptmasse bestehen, aber noch mit Kiessand vermengt sind.
Ferner finden sich auf dem Plateau häufig, wie die Proben zeigen:
5) Kohlen und angebrannte Stücke von Tannenholz;
6) Knochenreste, unter diesen auch, nach der Bestimmung des Hrn. Professors Steinhoff zu Schwerin: das untere Ende des Quer= oder Oberarmbeins von einem Hirsche, das untere Ende desselben Beines von einem Pferde, ein Bruchstück eines Backenzahns von einem Wiederkäuer, eine Kinnlade von einem Schweine;
7) große Massen von dreiseitig und vierseitig geschlagenen Spänen (Messern) aus Feuerstein; alle sind jedoch, wie zu Klink (vgl. Jahresber. III, S. 41), in Vergleich mit solchen, welche in Hünengräbern gefunden sind, klein, nicht ganz vollendet oder zerbrochen und wahrscheinlich als unbrauchbar verworfene Stücke.
Von diesen Urnenscherben, Feuersteinspänen und Knochenresten brachte ich für meinen verstorbenen Schwiegervater, den Pastor Rudolphi zu Friedland, einen eifrigen Sammler und Forscher, schon im J. 1821 eine große Menge zusammen.
Etwa im J. 1827 fand ich bei einem Spaziergange an zwei verschiedenen Stellen des Wendenkirchhofes, in der Mitte des Plateau's, nördlich von der Schweinkuhle, einige kleine Ueberreste der Vorzeit von Bronze, mit edlem Roste stark


|
Seite 74 |




|
überzogen, unter Urnenscherben frei zu Tage liegend, welche, so viel mir erinnerlich ist, vom Pastor Rudolphi für Fragmente eines spiralförmigen Handringes und einer Nadel oder eines Pfriemens erklärt wurden. Der Genannte unternahm auch bei einem Besuche zu Rülow mit mir eine oberflächliche Nachgrabung auf einer dieser Stellen, ohne jedoch andere Ausbeute zu machen, als Urnenscherben.
Was bis zum J. 1836 dort als zu Tage liegend von mir gefunden ward, befindet sich in seiner an seinen Sohn, den Hrn. Physicus Dr. Rudolphi zu Mirow, übergegangenen Sammlung, wahrscheinlich mit dem Fundorte bezeichnet.
Fernere Nachforschung.
a. am Hänkers=Moor.
Im J. 1836 kam ich auf eine, in dem oben bezeichneten Raume früher gar nicht beachtete Stelle, von der früher oft besuchten wohl 500 Schritte entfernt, hart zwischen dem Hänkers=Moor und der Schweinkuhle, wo mir eine schwarze, frisch aufgewühlte Brandstätte ins Auge fiel. Drei oder vier umherliegende Feldsteine von etwas mehr als der Größe eines Menschenkopfes waren von einem Hirtenknaben, ich weiß nicht warum, im Sande aus ihrer Lage gebracht. Es führt über die fragliche Stelle hin ein verlorner Feldweg, der leider den sandigen Boden zwischen den noch rechts und links übrigen Andeutungen einer mäßigen Anhöhe so gelöset hat, daß der Wind den leichten Boden bis auf 2 bis 3 Fuß tief allmählig fortgeführt hat, wodurch die Brand= und Begräbnißstätte nicht nur ihrer natürlichen Decke fast völlig beraubt, sondern auch durch die tief eindringenden Räder den Urnen, von denen unten die Rede sein wird, unersetzlicher Schaden zugefügt ist. Bei einigem Nachsuchen auf der entblößten Brandstätte mit der Hand und mit hölzernen Stäbchen, fand ich wenige Zoll tief unter der jetzigen Oberfläche
8) einen Haufen schwarz beräucherter Scherben von einer der oben unter Nr. 3 bezeichneten, hart und spröde gebrannten Urnen mit wellenförmigen Verzierungen unter dem Rande.
Etwa 8-10 Schritte davon fand ich erst in diesem Jahre (1839)
9) ein zu Tage liegendes Blech von Bronze, mit hellgrünem edlem Rost bedeckt, 3" lang, 1" breit, von der Dicke eines Zweigroschenstücks, mit einem sichtbar ausgeschlagenen Ausschnitte von 3/4" im Quadrat an einer Längenseite gegen das eine Ende hin, - wahrscheinlich eine Art von Beschlag;


|
Seite 75 |




|
10) daneben jene spanförmigen Messer aus durchscheinendem Feuerstein;
11) eine oxydirte eiserne Messerklinge, 4 1/2" lang.
b. an der Schweinekuhle.
Auf dem früher berührten Platze in der Mitte des Plateaus nördlich von der Schweinkuhle, die besonders reich an Spänen aus Feuersteinen und Urnenscherben ist, fand ich auch:
12) die abgebrochene Spitze einer muschelig geschlagenen Speerspitze aus weißlichem Feuerstein, 2" lang;
13) einen Pfriemen aus Bronze, l 1/4" lang, oxydirt;
14) einen Rundbeschlag aus ganz dünnem Bronzeblech mit leichtem Rost, 1" lang, 1/2" im Durchmesser.
Der Besuch eines für die Sache sich lebhaft interessirenden Freundes aus Neubrandenburg ward Veranlassung, daß wir in Begleitung meiner Söhne die einzelnen Grab= und Urnenstätten fleißiger absuchten und mit Werkzeugen versehen Nachgrabungen vornahmen.
Zunächst untersuchten wir eine Stätte
einer reichlich fließenden Quelle, zunächst beim Dorfe, an dem Bache, der im Westen das Dorf von dem sandigen Plateau scheidet. Leider überzeugten wir uns bald, daß hier das Graben nach Sand auf drei oder vier erkennbaren Brandstätten mit Knochensplittern, aber ohne Feuersteinspäne, alles bis auf zerstreut liegende Urnenscherben zerstört hatte. Der Rest einer
15) Streitaxt aus gestreifter, grünlicher Hornblende, welche eine frevelnde Hand zerschlagen hatte, war unsere Beute; es ist ein oberes Viertheil mit einem Viertheil der Rundung eines trefflich polirten Schaftloches.
Reichlicher aber lohnte sich unsere Mühe auf der oben bezeichneten Grabstätte
Bei einiger Untersuchung stießen wir auf der hart an dem verlornen Feldwege gelegenen vertieften Stelle, welche rechts und links die Reste einer ehemaligen Anhöhe begrenzen, auf ein Steinlager, etwa 3 Fuß unter der ursprünglichen Oberfläche. Es war von Dammsteinen gebildet, mit Asche, verkohltem Holze und schwarz beräuchertem Sande gemischt; die untersten Steine waren sichtbar im Feuer gewesen und sehr mürbe. Dieses Steinlager war 35 Schritte von der Schweinkuhle und 90


|
Seite 76 |




|
Schritte vom Hänkersmoor entfernt. Die augenscheinlich nicht zufällige Lage der Steine mit den zur Ausfüllung dienenden Materialien veranlaßte uns, die Dammfläche, welche in unregelmäßiger Rundung ungefähr 3 Fuß im Durchmesser hatte, nach dem Mittelpuncte hinaufsteigend durch horizontale Spatenstiche von allem Sande freizulegen, um den Damm eine Vertiefung zu ziehen, dann aber mit den Händen vorsichtig die Steinlage zu entfernen. Mein ältester Sohn war so glücklich, bald den Rand einer
16) Urne (No. 1.) in ihrer ganzen Höhe, fest zwischen Steinen verpackt, zu entdecken. Der Deckstein derselben mußte schon früher aus seiner Lage gekommen sein. Die Urne ward langsam in ihrem Umfange von feuchtem Sande, Steinen und Kohlengruß entblößt, einige Male mit Bindfaden umbunden, dann aber, es war gegen Abend, die Nacht über ruhig in ihrer Stellung gelassen, damit sie erharte. Für den nächsten (Sonntag=) Vormittag nahm mich mein Amt in Anspruch; doch ward der Fund indessen bewacht. Um Mittag hob ich die Urne von ihrem Lager auf einem darunter befindlichen flachen Steine, setzte sie noch kurze Zeit den Sonnenstrahlen aus und trug sie dann in meine Wohnung. Die Urne, ziemlich wohl erhalten, nur am obern Rande verletzt und mit einigen Rissen, im Aeußern glatt, sehr feinkörnig, dunkel= und hellbraun geflammt, mit ein gesprengten feinen Glimmerfünkchen, mit kugelichtem Bauche und hohem, eingezogenem Halse, ist 7" hoch, 2 1/8" in der abgerundeten Basis, 7" im Bauche im Durchmesser, mit einem hohen Halse, der in den senkrechten Wänden 3" Durchmesser hat, wie Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 4, jedoch ohne Henkel. Der Inhalt bestand aus Knochenresten mit wenig Asche, von Wurzelfasern durchzogen. Die Reste des Schädels lagen, wie in den übrigen entdeckten Urnen, oben auf.
Der neubrandenburger Freund hatte auf zwei nahen Stellen, 3 1/2 und 6 Fuß von dieser entfernt, während der Bewachung der bloß gestellten Urne, ebenfalls Urnen aufgefunden. Leider waren diese von den darüber hingegangenen Erntewagen bedeutend beschädigt; nur die größte Vorsicht hatte ihren Umfang und Inhalt zusammengehalten. Eine
17) Urne (No. 2.) ruhte auf drei mäßigen Steinen und war mit einem überstehenden flachen Steine bedeckt. Sie war in lauter kleine Stücke zersprungen, doch konnte der Umfang und Inhalt durch Vorkehrungen zusammengehalten und demnächst das Zersplitterte zum großen Theile zusammengekittet werden. Sie ist von ziemlich feiner Masse, mit Glimmerfünkchen durchsprengt, röthlich und hellbraun geflammt, ohne


|
Seite 77 |




|
Verzierung, 8 1/2" hoch, gegen 4" im Boden, gegen 9 1/2" im Bauche, 9 1/2" in der Mündung im Durchmesser, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 12, ebenfalls mit einem kleinen Henkel, durch welchem ein schwacher Finger gesteckt werden kann. Die Urne war ganz mit einer großen Masse zerbrannter Knochen gefüllt, welche auf die Bestattung eines unerwachsenen Menschen hindeuten; nach 6 aufgefundenen Zähnen gehörten die Gebeine einem fünf= bis sechsjährigen Kinde. Unter diesen Knochen befand sich, nach der Bestimmung des Herrn Professors Steinhoff zu Schwerin, auch ein nicht vom Brande angegriffener Zahn, der Aehnlichkeit mit dem dritten obern Backenzahn eines jungen Thieres aus dem Rindergeschlecht hat und wahrscheinlich vom Auerochsen, sicher nicht vom gewöhnlichen Rinde, stammt. Bei Abnahme des Decksteins erblickte ich sogleich am Rande der weitbauchigen Urne
18) eine eiserne Messerklinge, 7" lang, 1" breit in der größten Breite, wenig oxydirt; das kurze, breite Heft hat noch sichtbare Niete; das Messer ist den in Wendenkirchhöfen gefundenen gleich, jedoch etwas gebogen, wahrscheinlich um es in die Urne bringen zu können, was ebenfalls oft bei längern Geräthschaften in den Urnen der Wendenkirchhöfe beobachtet ist.
Mitten in der Urne zwischen den Knochenresten lag
19) eine knieeförmig gebogene Nadel von hartem Eisen, wenig oxydirt, gut gearbeitet, 4" lang, mit einem starken, runden Knopfe und 5 aufgeschobenen, ringförmigen Knöpfen über dem Kniee am obern Ende; die Spitze ist etwas umgebogen und scheint auch einen kleinen Knopf zu haben; der Rost hat den untern Theil der Nadel ergriffen und dieselbe in vier Stücke getheilt, an deren einem ein Stück vom Schädel angerostet ist.
Nahe bei dieser Nadel lag
20) ein Span von durchscheinendem Feuerstein, 1 1/4" lang, dem Anschein nach gebraucht,
21) ein hakenförmiges Heftchen von dünnem Bronzedrath, 3/4" lang, mit Rost überzogen, und
22) ein verrostetes Stück Eisenblech, 2 1/4" lang und 3/8" breit.
Nicht weit von dieser Urne stand
23) die Urne No. 3, ohne Steinumhüllung im reinen Sande, im obern Theile ganz zertrümmert, so daß keine Hoffnung zur Herstellung vorhanden war. Form und Größe scheint mit der von der Urne No. 2. übereinzustimmen. Die Masse ist, nach der geretteten untern Hälfte, grobkörnig, mit Glimmer=


|
Seite 78 |




|
fünkchen durchsprengt, im Aeußern rauh und ohne Thonüberzug, im Innern glatt. Sie enthielt nach vorsichtiger Untersuchung nur Knochen und Asche.
In der Nähe und in dem Umkreise des angedeuteten Raumes fanden sich bei einigem Nachsuchen noch einige Brandstätten und hin und wieder unter Steine verpackt Reste einer
24) Urne, völlig zerstört, deren Ausbeute, außer Knochenresten von einem sehr jungen Menschen, in einem
25) zusammengebogenen Ringbeschlage von dünnem Bronzebleche mit grünem Roste, 3/16" hoch und ungefähr 1" weit, in einem
26) Pfriemen aus Bronze, 1" lang, und in
27) stark verrosteten Nadelfragmenten aus Eisen bestand. Umher lagen
28) größere Kohlen von Tannenholz.
Im August 1839 ward mir noch eine, auf derselben Begräbnißstätte am Hänkers - Moor gefundene
29) grade Nadel von Bronze gebracht, im Ganzen 6" lang, mit starkem Knopf in gedrückter Eichelform (5/8" hoch und dick) und mit mehrern eingefeilten Reifen unter dem Knopfe; Forschung nach Gold hat den Finder veranlaßt, den Rost abzuscheuern.
Rülow, im August 1839.
Sponholz.
Auf demselben Wendenkirchhofe wurden in der ersten Hälfte des Jahres 1840 noch gefunden: angebrannte Knochen, Urnenscherben, unter denen wiederum sehr harte, blaugraue Gefäßscherben, kleine Feuersteinspäne, ein Stück Bronzeblech mit edlem Rost, eine hellgrüne Glaskoralle mit Längsreifeln und eine andere, zusammengeschmolzene Glaskoralle von ähnlicher Beschaffenheit.
Rülow, im Junius 1840.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Leussow (bei Eldena).
In der Nähe des Dorfes Leussow, eine kleine Viertelstunde südlich von demselben, ist ein von Natur hoch aufgesetzter sandiger Erdrücken von ziemlich großer Ausdehnung, der von den Bewohnern der Heidenkirchhof genannt wird, auf welchem immer Spuren von Alterthümern gefunden sind. Der Herr Lehrer Bade zu Schwerin, aus Leussow, gab dem Vereine Nachricht von diesem Begräbnißplatze und zugleich das Versprechen, an Ort und Stelle Nachforschungen anzustellen. Er zog zunächst genauere Nachricht ein und vernahm, daß dicht unter der ganzen Oberfläche des Sandrückens die Urnen in


|
Seite 79 |




|
sehr großer Zahl zwischen Steinen verpackt ständen, daß beim Pflügen häufig Urnenscherben ans Tageslicht kämen, weil die Urnen sehr hoch ständen, und daß auch hin und wieder einzelne beschädigte Urnen, die von den Leuten zertrümmert worden seien, auch wohl metallene Alterthümer ausgepflügt wären. Dies Alles fand Herr Bade bei der Untersuchung an Ort und Stelle bestätigt. Er stellte auch einige Nachgrabungen an, fand jedoch nur hin und wieder zwischen Steinen Urnenscherben, da schon Alles durch den Pflug zerstört war.
Es gelang ihm indessen, eine Urne, die jedoch bald auseinanderfiel, da sie schon zertrümmert war, an ihrem ursprünglichen Standorte und in ihrer Form zu beobachten. Sie hatte die gewöhnliche, schalenförmige Gestalt der Urnen in den Wendenkirchhöfen, war von brauner Farbe und mit Zickzacklinien verziert. Zwischen den verbrannten Gebeinen fanden sich ungefähr 20 hohle Halbkugeln von dünnem Bronzeblech, ungefähr 1/2" im Durchmesser, am Rande viermal halbmondförmig ausgeschnitten; von den dadurch stehen bleibenden 4 Spitzen sind zwei geenüberstehende länger als die beiden andern und nach innen hakenförmig umgebogen. Wahrscheinlich sind dies Buckel, welche vermittelst der hakenförmigen Umbiegungen zum Putz aufgeheftet wurden. Einige unter den Gebeinen gefundene Augen= und Schneidezähne sind sehr klein und deuten auf eine junge Leiche.
Ueber die daselbst gefundenen Spindelsteine vgl. unten. Leussow lag mitten in der Jabelhaide, in welcher sich die wendische Cultur in Meklenburg am längsten erhielt; vgl. Jahrb. I, S. 7 und II, S. 177.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof bei Doberan.
Zwischen Doberan und dem Heiligen Damm, links dicht am Wege nach dem Bade, liegen unmittelbar in der Nähe der Rennbahn mehrere heidnische Begräbnißstätten. Nordöstlich von der Rennbahn zwischen dieser und der Chaussee liegt in einer Vertiefung ein kleiner Teich; von der daneben liegenden Erhöhung nach der Rennbahn hin führte früher in diesen Teich ein Steindamm, von dem sich noch hin und wieder Spuren finden. Auf dieser Höhe nördlich, rechts neben der Rennbahn, standen früher im großen Kreise die Urnen in die Erde eingegraben; es war ein großer Steinkreis, in welchem wieder kleinere Steinkreise standen. Hinter den Steinen standen die Urnen, mit gespaltenen Steinen bedeckt, in großer Anzahl. Bei dem


|
Seite 80 |




|
wiederholten Steinbrechen wurden die Urnen alle zerstört; rothe, gespaltene Sandsteine sind an der Stelle noch zu finden. Diese Berichte stammen von dem Gastwirth Herrn Glöde, mit dem ich die Stelle im September 1839 untersuchte.
An derselben Stelle ward im October 1839 nach Steinen gesucht. Die Arbeiter fanden nicht weit von dem bezeichneten Teiche unter der Erde einen Steinkreis von ungefähr 2 Ruthen Durchmesser, in welchem nach dem Bericht der Arbeiter 10 bis 20 Urnen, zwischen Steinen verpackt, mit Knochen, und Asche gefüllt, standen. Die Urnen wurden beim Steinbrechen zertrümmert und die Scherben und Knochen wieder in die Löcher geworfen. Als Herr Glöde dies erfuhr, begab er sich sogleich nach dem Orte, fand jedoch eine Urne, welche die Arbeiter unverletzt ausgehoben und auf die Erde gesetzt hatten, auch schon zertrümmert. Die eingesandten Scherben sind schwärzlich und theilweise mit regelmäßigen Furchen. verziert.
An der andern, südlichen Seite der Rennbahn liegen zwei Kegelgräber, welche zwar sehr abgepflügt sind, aber nach Untersuchungen noch Steingewölbe im Innern haben.
Wahrscheinlich stand in der Nähe dieses Teiches und Begräbnißplatzes eine von den drei Ortschaften, welche den Namen Doberan führten; vgl. Jahrb. II, S. 25.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendisches Begräbniß von Boldebuck.
Vor einigen Jahren wurden auf dem Felde von Boldebuck bei Güstrow, nach Gülzow hin, unter Urnenscherben mehrere Alterthümer entdeckt, welche von Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Schaumburg=Lippe dem Vereine zur Aufbewahrung überlassen sind:
drei Hefteln (broches) aus Bronze, wie sie in den Wendenkirchhöfen gefunden werden (Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13), mit leichtem Rost, alle drei zerbrochen, mit Eisenrostflecken, welche von neben liegenden eisernen Alterthümern herrühren;
drei kleine gekrümmte Messer von Eisen, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVIII, Fig. 17, mit gekrümmtem, dünnem Griffe von Eisen, zerbrochen;
ein grades eisernes Messer, mit einem Beschlagringe von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XVII, Fig. 3, nur etwas kleiner, 4 1/2" lang;
eine Nadel aus Bronze, leicht oxydirt, in 3 Stücke zerbrochen, 2 1/2" lang; die Spitze fehlt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 81 |




|



|



|
|
:
|
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Wendische Graburne von Krickow.
Zufällig gelangte ich in den Besitz einer Urne, die von einem Arbeiter beim Bau der Kunststraße von Neustrelitz nach Neubrandenburg in der Nähe von Krickow, nicht weit vom Tollenze=See, etwa 1/2 Meile: von Prillwitz, gefunden war. Zwar war sie höchst mürbe durch den darin wurzelnden Wachholderstock geworden und in einige Stücke zerfallen; ich war indeß so glücklich, sie zu restauriren. Sie gehört zu den weitbauchigen, ist 8" hoch, hat im verloren gegangenen Fuße 3" Durchmesser, in der größten Bauchweite 8" und einen zollhohen wenig auswärts gekrämpten Rand. Die Masse ist ein grauer magrer Thon, mit Kies und Glimmer gemischt, scheinbar stark gebrannt, und inwendig wie auswendig auffallend schwarz.
Der ziemlich scharfe Bauchrand, liegt ungefähr in der Mitte der Urne. Die obere Hälfte des Bauches, vom Bauchrande bis zum Oeffnungsrande, ist mit Mäanderzeichnungen aus graden, eingeritzten Linien (nicht aus Linien mit dem gezahnten Rade, welche im Strelitzschen noch nicht bemerkt sind), die oben und unten durch drei concentrische Kreise begrenzt sind, verziert. - In der Urne befand sich ganz schwarz gebrannter, feiner Glimmersand, mit zerbrannten Knochen vermengt, unter denen viele, mäßig dicke Schädelfragmente waren. Dazwischen lagen zwei Hefteln (broches) aus Eisen von der Gestalt, wie sie den Hefteln in den Wendenkirchhöfen eigen ist.
Rülow, im November 1839.
F. Th. Sponholz.



|



|
|
|
Spindelsteine von Rülow.
Der Herr Pastor Sponholz zu Rülow hat in der Umgegend seines Wohnortes nach und nach 7 Spindelsteine gesammelt und eingesandt, welche theils aus feinkörniger Urnenmasse, theils aus blaugrauem Thon bestehen, auch zum Theil mit eingebohrten Punkten verziert sind.



|



|
|
|
Spindelsteine von Leussow
Der Herr Lehrer Bade zu Schwerin, der den Wendenkirchhof bei Leussow zur Kunde des Vereins brachte (vgl. oben S. 78), forschte bei den Dorfbewohnern auch eifrig nach früher gefundenen Alterthümern. Es ward glaubwürdig viel von häufiger Auffindung interessanter Alterthümer aus allen


|
Seite 82 |




|
Perioden der Vorzeit erzählt, zugleich aber immer auch der spurlose Untergang derselben berichtet, da die Leute begreiflicher Weise den historischen Werth der Alterthümer durchaus nicht erkannten und es diesen ganz an Metallwerth gebrach. Herr Bade ward jedoch nicht müde in der Nachforschung und fand endlich in vielen Häusern zu Leussow Schlüssl, um sie besser vor dem Verlieren zu bewahren, häufig an antike Spindelsteine gebunden, was in manchen Dörfern in Meklenburg gebräuchlich ist. Auf diese Weise, die der Nachahmung werth ist, brachte er 9 Spindelsteine zusammen, welche theils auf dem Wendenkirchhofe neben Urnenscherben, theils an andern Stellen der Feldmark ausgegraben waren. Sie sind von verschiedener Beschaffenheit: drei sind aus Urnenmasse, d. h. aus Thon mit Kiessand durchknetet, von brauner und grauer Farbe, jedoch härter gebrannt als die Urnen; einer ist aus blaugrauem Thon, aus der Masse der altmittelalterlichen Töpfe (diese vier sind am einfachsten und rohesten in der Form); einer, sehr zierlich geformt, ist aus reiner weißgelber Thonerde; drei, in regelmäßiger, gediegener Form, sind aus einer sehr festen, glasigen, bläulichen Masse, die mit einer festen, gelblichen Glasur überzogen ist; einer, in sehr einfacher, unregelmäßiger Form, ist aus dunkelgrünem Glase, umher mit eingeschmolzenen, hellgelben Schildchen, die mit hellblauen Reifen verziert sind, umgeben.
Ein Spindelstein
aus fester, grauer Thonmasse, leicht glasurt, halb durchbrochen, gefunden bei Ausmoddung eines Teiches zu Rethwisch, geschenkt vom Herrn Rettich zu Rosenhagen.



|



|
|
:
|
Gußform für Schnallenringe.
Im November 1839 gelangte der Verein in den Besitz einer seltenen Gußform, welche der Herr Lieutenant v. Levetzow (aus Ludwigslust) zu Hannover als einen auf einem meklenburgischen Gute gemachten Fund geschenkt erhalten hatte und dem Vereine freundlichst als ein seltenes Stück übergab. Die Form ist aus feinem Thonschiefer, 4 3/4" lang, 2 1/2" breit, nach der Gießöffnung hin etwas zugespitzt, und 5/8" dick; es ist das mittlere Stück einer doppelten Form, welches grade die obern Seiten der Güsse enthält: die beiden anliegenden Rückseiten sind verloren gegangen. Die Form hat an zwei entgegenstehenden Ecken Bindlöcher und an den beiden andern gegenüberstehenden Ecken Vertiefungen, in welche Knöpfe der Rückseiten hineingepaßt haben werden. Außerdem hat die Form durch das Innere


|
Seite 83 |




|
des Steins Kanäle zum Austreiben der Luft. Die am wenigsten bedeutsame Ecke ist abgeschlagen. Die Form ist für runde Schnallen bestimmt. An der einen Seite ist die Form eines großen, runden, glatten Schnallenringes, im Ganzen gegen 1 3/4", in dem Metallringe 3/8", in der Oeffnung 7/8" im Durchmesser, und daneben die Form der dazu gehörenden Zunge, welche in der Anfügung über einen Dorn gegossen werden mußte und mit einer muschelartigen Verzierung geschmückt ist. - Die andere Seite enthält 1) die Form zu zwei blattförmigen Ohr ringen; 2) die Form zu einem sechsseitigen Schnallenringe, 3/4" im Durchmesser, mit blumenförmigen Ornamenten an drei Seiten; 3) die Form zu einem runden Schnallenringe von 7/8" im Durchmesser, auf dessen einer, der obern, Hälfte Runenschrift eingegraben ist. Diese Charaktere weichen durchaus von allen bekannten Schriftzügen ab, scheinen größtentheils aus contrahirten Runen zu bestehen und in dem Falle, daß man dieses annimmt, erscheint jede Hälfte der Charaktere als ein Runenzeichen. Die Entzifferung ist jedoch bis jetzt noch nicht möglich geworden, und es bleibt die Abbildung und möglicher Weise die Aufklärung einem anderen Orte vorbehalten. Die Gebrüder Grimm "wagen" zur Zeit noch keine Erklärung. Was das Alter dieser Gußform betrifft, so scheinen sie in die letzte Zeit des Wendenthums zu fallen; dem deutschen Mittetalter gehören nämlich diese runden, breiten, platten Schnallenringe oder Spangen an, welche in dieser Form unter den heidnischen Grabalterthümern bis jetzt noch nicht bemerkt sind.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
2. Aus unbestimmter alter Zeit.
Fragment eines Bronzegefäßes von Prillwitz.
Vor einiger Zeit ist zu Prillwitz ein Fragment von einem Bronzegefäße gefunden, welches aus einem völlig sichern Funde von dem Herrn Pastor Boll zu Neubrandenburg eingesandt ist. Das Fragment ist ein Stück aus dem Bauchrande eines urnenförmigen Gefäßes, 2 1/2" lang und 2 " hoch, sehr dünne, aus antiker Bronze und gegossen. Das Stück hat durch einen glücklichen Zufall die perpendikuläre Gußnath und an jeder Seite derselben ein Kreuz als Gießerzeichen (X │ X). Der Guß ist an vielen Stellen poröse. Das Bruchstück erhält dadurch hohen Werth, daß es grade in eben demselben Pfarrgarten gefunden ist, in welchem die viel besprochenen Gößenbilder ausgegraben sein sollen. - Es fragt sich, wie alt das


|
Seite 84 |




|
Bruchstück sei. Prillwitz ist früher viel stärker bevölkert gewesen, als jetzt; es hatte eine feste Ritterburg, an welcher den Fürsten das Oeffnungsrecht zustand, und noch im 15. und 16. Jahrh. heißt der Ort: ,,dat stedeken Prillwitz". Daher die vielen altmittelalterlichen Topfscherben, die zu Prillwitz gefunden werden (vgl. Jahresber. II, S. 76 und III, G. 82). Für einen vorchristlichen Ursprung redet der Umstand, daß das Fragment gegossen und aus Bronze ist, überhaupt die ganze Form und Technik. Gegen eine sehr alte Zeit des Ursprungs reden die Gießerzeichen. Es dürfte nicht zu gewagt sein, das Bruchstück der jüngsten heidnischen Zeit zuzuweisen, in welcher die Wendenländer Verkehr mit den deutschen Staaten hatten. Auf jeden Fall aber wird es durch Auffindung dieses Bruchstücks nahe gelegt, daß die Ausgrabung metallener Gefäße zu Prillwitz nicht unwahrscheinlich sei; und in metallenen Gefäßen sollen die berühmten Gößenbilder gefunden sein.
G. C. F. Lisch.
Zwei alte Zeugproben
von der Bekleidung und eine Zeichnung eines Schuhes der alten Leiche, welche im J. 1817 im Moor bei Friedeburg in Ostfriesland mit voller Bekleidung gefunden ward, mit einer Sammlung der schriftlichen Nachrichten über diesen Fund. Geschenk des Herrn Regierungsraths von Boddien zu Aurich.
Eine Glaskugel,
farblos, von 1 1/4" Durchmesser, auf dem Acker des Hauswirths Lüth zu Dorf Nesow bei Rehna aufgepflügt und vom Herrn Bürgermeister Daniel zu Rehna geschenkt.



|



|
|
:
|
3. Aus dem Mittelalter.
Burgruinen von Ihlenfeld.
Im Mai d. J. theilte der Herr Amtshauptmann Michael auf Ihlenfeld, eine Stunde von Neubrandenburg, dem Herrn Pastor Boll zu Neubrandenburg, Mitgliede des Vereins, mit, daß auf seinem Gute eine alte Grabstätte entdeckt sei, und ließ das Vereinsmitglied zur Besichtigung derselben einladen.
In dem bei dem herrschaftlichen Hause gelegenen Garten, nicht weit westlich von dem Hause, befand sich eine mäßige Anhöhe, welche seit vielen Jahren bestellt worden war, jährlich aber, um sie mit dem übrigen Boden gleich zu legen, abgegraben ward. In diesem Frühjahre stieß man beim Graben


|
Seite 85 |




|
auf Feldsteine und Gemäuer. Nachdem man mehrere Fuder Feldsteine weggeräumt hatte, kam man auf einen gemauerten Bogen von Ziegelsteinen, auf Kohlen, Asche, Knochen, Scherben von Gefäßen, Eisenstücke u. dgl. Der Bogen war tief in die Erde hineingemauert und gleich bloß gelegt. Der Herr Pastor Boll nahm die aufgedeckte Stätte in Augenschein und berichtete, unter Beischließung von Scherben, an den Ausschuß des Vereins. Manches, z. B. ein Spindelstein, schien auf den ersten Blick auf eine vorchristliche Zeit zu deuten; das Meiste sprach jedoch offenbar für das christliche Mittelalter.
Bald, da der Gutsherr und dessen Familie ein reges Interesse für die Erkenntniß dieser Reste des Alterthums faßten, entdeckte man unmittelbar neben der zuerst entdeckten Stätte eine muthmaßlich gleich construirte zweite, welche zum Zweck einer genauern Untersuchung einstweilen unangetastet blieb. Der Herr Amtshauptmann Michael theilte diese Entdeckung dem Herrn Präsidenten des Vereins mit und lud freundlichst ein Mitglied des Ausschusses zur Untersuchung zu sich. Bei Gelegenheit anderer Untersuchungen im Lande Strelitz nahm der Unterzeichnete in Folge dieser Einladung seinen Weg über Ihlenfeld und ward hier, in Begleitung des Herrn Pastors Boll aus Neubrandenburg, nicht nur freundlichst aufgenommen, sondern es ward ihm auch zur Untersuchung das nöthige Terrain, eine ausreichende Anzahl Arbeiter und der etwanige Fund dem Vereine zur Disposition gestellt. Die Aufdeckung geschah am 16. und 17. September unter der Leitung des Unterzeichneten und des Herrn Pastors Boll, in Gegenwart der Gutsherrschaft und des Hauslehrers, Hrn. Candidaten Otto.
Um ganz sicher zu gehen und genau schildern zu können, folgt hier zunächst der Bericht über die zweite Aufgrabung, welche unter der Leitung von Vereinsmitgliedern geschah.
In der Richtung von Osten nach Westen ist tief in der Erde ein Gang oder eine Vertiefung mit Ziegelsteinen ausgemauert. Diese Vertiefung ist ungefähr 10' lang, 3 1/2" breit und 3 1/2" tief. Etwas über die Mitte hinaus, mehr nach Westen hin, steht in dieser Vertiefung ein Gewölbe von Ziegelsteinen, in der Form eines Tonnengewölbes, gegen 2' breit, etwas über 2 1/2´ hoch, 4' lang; die senkrechten Wände sind 2, der Bogen 1/2 hoch. Ueber diesem Gewölbe ruht ein zweites Gewölbe von Feldsteinen, nach oben hin ungefähr 1 1/2' dick, an den Seiten dünner, keilförmig sich an die Seiten lehnend. Dieses Gewölbe ist durch ein drittes Gewölbe von Ziegelsteinen, das auf den Seitenwänden der ganzen Vertiefung ruht, bedeckt. Dieses obere Gewölbe liegt ungefähr in der Ebene


|
Seite 86 |




|
des Erdbodens. Die Seiten des obern Gewölbes sind mit Feldsteinen ausgefüllt, und das Ganze bedeckte zuerst eine Schicht horizontal gelegter Ziegel und darauf eine Schicht von größern Feldsteinen, welche etwas über den Boden hervorragten und mit der sie bedeckenden Erde die Hügelerhöhung bildeten. Die Ziegelgewölbe bestehen aus einer einfachen Schicht in die hohe Kante gefetzter Ziegelsteine von der festen, körnigen Masse und der Größe, wie sie aus dem Mittelalter bekannt sind; die Ziegel sind 11 1/2" lang, 5 1/2" breit und 4 1/2" dick; die Gewölbe sind in Kalk gemauert. Gegen Westen war das Gewölbe mit Ziegelsteinen bis auf einen sehr niedrigen Bogen, der, einer Ofenthür ähnlich, in der Tiefe stand, geschlossen. Das östliche Ende war durch irgend einen Zufall geöffnet. Die ganze Vertiefung, in welcher dieses Gewölbe stand, ward bis auf 10' Länge ausgegraben.
Dieser Construction gleich ist die zuerst vom Herrn Amtshauptmann Michael selbst aufgedeckte, welche in gleicher Richtung mit der zweiten, ungefähr 2 von dieser entfernt, liegt.
1) Betrachten wir nun zuerst den Inhalt der zweiten, von den Vereinsmitgliedern aufgedeckten Vertiefung.
Unter dem Gewölbe lag nichts als eine große Masse heller, fest gewordener Asche und ein eiserner Ring, 4" weit, 1/2" breit und 1/4" dick, wahrscheinlich ein Beschlag.
In der viereckigen Vertiefung östlich vor dem Gewölbe aber fand sich eine Menge von Alterthümern aller Art in buntem Gemisch durch einander. _ Zunächst fand sich, nach Abräumung der Feldsteine, in einiger Tiefe eine einfache Schicht horizontal und etwas unregelmäßig liegender Ziegelsteine ohne Spur von Gewölbe. Darunter war die Erde mit Scherben, großen Kohlen und vielen Knochen (ohne Brandspuren) gemischt. In dieser Erde fanden sich unter einander folgende Alterthümer. Zuerst fand sich ein eiserner Sporn, dessen Bügel nach der Radstange hin spitzig ausläuft, wie die Sporen im Mittelalter an Harnischen getragen würden; das Rad fehlt. Etwas tiefer fand sich eine eiserne Lanzenspitze, 6" lang und in der Mitte 1 1/4" breit. In der Nähe lag ein eisernes Wehrgehenk, 3" lang, das sich ganz mit einem modernem Carabinerhaken vergleichen läßt, eine dünne Scheibe von Bronze, 1 1/4" im Durchmesser, mit einem Nagelloche in der Mitte, wahrscheinlich ein Endbeschlag, und Fragmente von einer kleinen harzigen Verzierung mit hervorragenden Knötchen, wie ein sehr kleiner architektonischer Perlstab. An andern Stellen lag ein Fragment eines breiten eisernen Messers, das augenscheinlich beim Ausgraben zerbrochen ist, und ein


|
Seite 87 |




|
eiserner Nagel; in der Nähe lag der Griff eines langzahnigen knöchernen Kammes, aus einem Röhrenknochen gearbeitet, 1" breit und 2" lang, mit dem Anfange der abgebrochenen Zähne: an der hintern Fläche sind noch die natürlichen Markhöhlen des Knochens sichtbar. Etwas weiter abwärts fand sich ein runder Deckel von gegossener Bronze; derselbe hat 7" im Durchmesser, der überfassende Rand ist gegen 1 1/4" hoch; die Decke hat oben eine geringe Vertiefung, über welche sich 4 1/2" weit ein niedriger Henkel spannt; an der einen Seite ist im Rande ein etwas unregelmäßiger, runder Ausschnitt, wie es scheint, mit Absicht gemacht. Auf den ersten Anblick scheint der Deckel einem großen Gefäße angehört zu haben. Auffallend war es jedoch, als sich einige Zoll tiefer, jedoch nicht grade unter dem Deckel, sondern etwas seitwärts verschoben, ein Stein fand, der mit dem Deckel in Verbindung zu stehen scheint. Dieser Stein ist eine viereckige Granitplatte, von ungefähr 2 Fuß Durchmesser. Der Stein, fast einem kleinen Mühlsteine vergleichbar, nur vierseitig, ist durch Kunst behauen und geebnet. Nehmen wir an, daß er mitten durchgebrochen sei, so hatte er in der Mitte eine regelmäßige, runde Oeffnung, um welche rings umher eine eingemeißelte Randvertiefung geht; in diese Vertiefung paßt genau der Deckel. Der Stein ist jedoch mitten durch die Oeffnung zerbrochen und nur zur Hälfte vorhanden. Diese Erscheinung wird weiter unten ein Gegenstück finden.
Zwischen der Erde in der ganzen Vertiefung fanden sich Kohlen von Tannenholz, in Stücken bis zu einigen Zollen Durchmesser. Ferner fanden sich Scherben von 14 verschiedenen Gefäßen, welche. alle alten Bruch zeigten und in den Scherben nicht mehr vollständig waren. Alle zeigten offenbar ihre Herkunft aus dem jüngern Mittelalter; sie bestehen aus jener fein geschlemmten, festen, unverwüstlichen Masse, entweder aus blaugrauem Thon mit schwarzer Oberfläche oder aus weißem Thon mit glasurter Oberfläche. Sie sind nicht allein durch die Festigkeit der Masse, sondern auch durch die edle Einfachheit der Formen und reifenartigen Verzierungen im höchsten Grade ausgezeichnet. Es fanden sich Reste von 6 Gefäßen aus blaugrauem Thon, von denen eines eine Mündung hat, welche fast die Weite des bronzenen Deckels erreicht; die größere Anzahl dieser bauchigen Gefäße hat Henkel gehabt und scheint zu Kochgefäßen gedient zu haben. Ein Gefäß ist von schlichter, rother Ziegelmasse. Ein Gefäß war ein kleiner, grünlich glasurter Henkeltopf. Sechs Gefäße sind aus weißlichem Thon, mit seiner Glasur überzogen oder


|
Seite 88 |




|
auch in der Masse glasurt, mit ziemlich senkrechten Wänden krugartig gebildet, mit zierlichen Reifen geschmückt, und scheinen zu Trinkgefäßen gedient zu haben. Auch fand sich ein Bruchstück eines rundbauchigen Gefäßes aus weißem Glase, welches durch das Alter eine opalisirende Oberfläche erhalten hat.
Am 3. und 4. Oct. 1839 unternahm Hr. Pastor Boll die gänzliche Ausräumung dieses Vorraumes und fand hier, außer mehrern Scherben und Knochen, ein gut erhaltenes eisernes Messer, in der Klinge 8 1/2" lang und 1" breit, in dem Griffheft 4" lang. Auch der Vorraum an der andern Seite des Gewölbes ward vollständig ausgegraben. Auch hier fand sich eine Menge von Kohlen, Scherben und Knochen, jedoch kein Metall.
Nach allen Richtungen hin und in allen Höhen fanden sich sehr viele, wohl erhaltene, feste Knochen, welche, nach der Bestimmung des Herrn Professors Stannius zu Rostock, Thieren angehören, die noch heute in die Küche kommen; vorherrschend waren Rinder= und Schweineknochen, dann Hühner= und Taubenknochen; auch fanden sich Hirsch= und Rehknochen
2) Die erste, von dem Hrn. Amtshauptmann Michael aufgedeckte Vertiefung zeigte ein ähnliches Resultat. In dem Gewölbe fand sich ebenfalls viel Asche und dabei ein vollständig erhaltener Schmelztiegel 1 ), 5" hoch und 4" weit im Quadrat, ganz in der viereckig gedrückten Form der heutigen Schmelztiegel, mit rundem Boden. Ferner fand sich, wie es scheint, unter dem Gewölbe, in Scherben ein großes, festes Gefäß, weitbauchig, aus festem, blaugrauem Thon, von 8" Durchmesser in der Oeffnung, mit einem Deckel mit einem durchbohrten Knopfe aus gleicher Masse. Vor und bei dem Gewölbe fanden sich Reste von noch wenigstens sieben Schmelztiegeln und von andern Gefäßen, wie bei dem andern Gewölbe, nämlich: Scherben von 4 großen blaugrauen Gefäßen und von 3 glasurten, zierlichen Krügen aus weißlichem Thon. Ferner fand sich, wie vor dem andern Gewölbe, auch hier der Rest einer Steinplatte, die noch zu einem Fünftheil vorhanden ist. Sie ist von feinkörnigem, weißlichem Sandstein, viereckig, ungefähr 2' im Quadrat, 1 1/2" dick, bearbeitet, auf der Oberfläche mit Strichen und Puncten behauen und hat ebenfalls ein Loch von ungefähr 7-8" im Durchmesser gehabt, welches gleichfalls auf der


|
Seite 89 |




|
obern Seite mit einer Randvertiefung umgeben ist; wie in die Randvertiefung des ersten Steins der bronzene Deckel paßte, so paßt auf die Randvertiefung dirses Steins grade der Boden des eben beschriebenen großen Deckelgefäßes. Endlich fand sich in dieser Vertiefung: ein Spindelstein aus blaugrauem Thon, ganz in der Form, wie die Spindelsteine in den Wendenkirchhöfen gefunden werden, ein Schleifstein aus lehmfarbigem Thonschiefer, rechtwinklig, 2 3/4" lang, 1 1/2" breit und 3/4" dick, und, dem Anschein nach, eine. kleine eiserne Messerklinge mit Griff 7" lang, in 3 Stücke zerbrochen. In dem östlichen Vorraum vor diesem Gewölbe, den der Herr Pastor Boll nachträglich aufdeckte, fand sich nichts als fester Lehm, keine Spur von Kohlen, Knochen oder Alterthümern.
In der Nähe dieses Gewölbes fand sich noch ein kurzer dreieckiger Fuß von einem Grapen aus Bronze, von der Erzmasse des oben beschriebenen Deckels, wie sich dergleichen Füße öfter an mittelalterlichen Grapen finden.
Die vielen Knochen, welche sich in der obern Hälfte des Raumes außerhalb des Ofens und vor demselben fanden, gehörten alle dem uns bekannten Schlachtvieh an und waren größtentheils Schweine= und Rinderknochen.
Am 3. und 4. Oct. 1839 nahm der Hr. Pastor Boll ein anderes Feldsteinpflaster auf, welches sich neben dem zuerst aufgedeckten Gewölbe zeigte. Es war schmaler, als die Steinpflaster über den Gewölben, auch länger, indem es bis an das Feld hinanreichte. Ein Gewölbe fand sich nicht darunter. Aber es zeigten sich hin und wieder Kohlen, Knochen, schwarze Topfscherben, glasurte Scherben. Ferner fand sich: ein zusammengebogenes Stück Eisen, 1 1/2' lang und 1" breit, ganz wie ein Tonnenband; eine eiserne Pfeilspitze mit Schaftloch; ein 2" langes und 1 1/2" breites eisernes Blech mit einem Einschnitte, der Blechdecke eines Thürschlosses ähnlich.
Diese Gewölbe oder die Vertiefungen scheinen sich, nach den unter der Oberfläche des Gartens liegenden Steinen zu schließen, noch weiter seitwärts zu erstrecken.
Hinter diesen Gewölben, gegen Westen und das Feld hin über die Grenze des Gartens hinaus, zeigt sich eine andere Eigenthümlichkeit. Hier stehen bedeutende Massen von Hohlziegeln, auf die hohe Kante gestellt und in einander geschoben und mit Kalk verbunden, in gleichem Niveau. Diese Ziegel, ähnlich den Dachpfannen, sind von rother, fester Ziegelmasse, etwas über 1/2´ hoch, ungefähr 3/4" dick, der Länge nach in einen rechten Winkel gebogen, der in jedem Schenkel 3 bis 4"


|
Seite 90 |




|
weit ist; einige haben auf der Außenseite auch einen Knopf, wie die Dachpfannen. Diese Ziegel stehen der Länge nach aufrecht in einander geschoben, fest durch Kalk verbunden, in langen Reihen neben einander, oben in gleicher Ebene. Ohne Zweifel haben sie den Fußboden von großen Wohngebäuden gebildet; zur größern Festigkeit sind die Ziegel auf die hohe Kante gestellt. Von oben sind diese Ziegel durch Brand bis gegen die Hälfte hin schwarz gefärbt; der unter ihnen stehende natürliche Lehmboden ist 2 1/2' tief durch Brand roth und gelb gebrannt, so daß er, vom Roth in Gelb übergehend, erst in der angegebenen Tiefe seine natürliche Farbe erhält. Nach der Versicherung des Herrn Amtshauptmanns Michael reichen diese Ziegelmassen und Trümmer noch weit in das Feld hinaus.
Auch an den Gewölben zeigten sich Spuren von Brand. Ueber den Gewölben war die untere Fläche der Steine schwarz berußt. Umher aber und an der Oberfläche zeigten auch die obern Flächen Spuren von Brand.
Ueberlegen wir jetzt, was diese Stelle zu bedeuten gehabt habe, so ergiebt sich nach allem, was hier gefunden ist, ohne Zweifel, daß sie im Mittelalter, etwa im 14. oder 15. Jahrhundert, verlassen worden sei. Die Mauerziegel, Gefäße, Waffen, zeugen unleugbar für diese Zeit. - Die Spuren eines Feuers, das den Boden über 2 Fuß tief zu Ziegelmehl brennen konnte und die aufrecht stehenden Hohlziegel mit eingerechnet 3 Fuß tief wirkte, zeugen dafür, daß hier ein gewaltiger Brand gewüthet habe. - Nach der Ausdehnung der Ziegelmassen waren auch die Gewölbe wohl nicht die Hauptsache, sondern nur untergeordnete Theile eines größern Ganzen.
Und für diese Ansicht, daß die aufgegrabenen Alterthümer die Reste einer durch Brand im Mittelalter untergegangenen Wohnstelle sei, zeugt auch die Geschichte: es sind die Trümmer der Burg Ihlenfeld. Seit alter Zeit 1 ) wohnten auf Ihlenfeld die Ritter von Ihlenfeld, im J. 1480 Vater und Sohn. Diese hatten auf der angrenzenden Feldmark der Stadt Neubrandenburg allerlei Gewaltthätigkeit geübt. Die Bürger der Stadt zogen deshalb gegen sie und bestürmten die Veste; die Ritter tödteten in der Vertheidigung von der Burg aus einen Rathsherrn. Darauf zündeten die Brandenburger die Burg an, verbrannten den alten Ihlenfeld in derselben und erstachen den Sohn, als er sich aus dem Fenster durch die Flucht retten wollte. Um nun solchen Gewaltthätigkeiten ein Ende zu machen und den Frieden zwischen der


|
Seite 91 |




|
Stadt und dem Geschlechte der v. Ihlenfeld wieder herzustellen, zogen die Herzoge Magnus und Balthasar in Person nach Friedland und legten auf dem Kavelpasse am 1. Julius 1480 den Streit dadurch bei, daß die Neubranbenburger eine harte Buße nach damaliger Sitte thun mußten. Ein Stück Tuch, welches seit dieser Zeit die Neubrandenburger jährlich an das Gut Ihlenfeld geben mußten, soll noch im vorigen Jahrhundert geliefert sein; die Abgabe hat seitdem aus unbekannten Ursachen aufgehört.
In diesem Brande ging die alte Burg Ihlenfeld unter, welche wahrscheinlich in der Nähe des jetzigen Hofes Ihlenfeld gelegen haben wird, da grade diese Stelle eine treffliche Aussicht in die Runde gewährt. Die Hohlziegel werden wohl die Pflaster der großen Gemächer oder Säle (Palas, Hofdönsk) gewesen sein. Die Gewölbe lagen offenbar in unterirdischen Räumen und waren, nach den Schmelztiegeln zu urtheilen, vielleicht Schmelzöfen. Umher waren natürlich freie Kellerräume. Während in dem Brande die Gewölbe unbeschädigt blieben, sanken die Decken der nicht gewölbten Kellerräume vor den Gewölben ein und hinein stürzte von oben in dem vernichtenden Brande das, was über ihnen lag. So läßt es sich erklären, daß vor den Oefen verschiedene Schichten von Alterthümern über einander lagen. Auch mag in dem unterirdischen Keller= und Küchenraum manches Stück des Alterthums früh verloren gegangen sein, und so trafen hier von oben und unten her so verschiedenartige Reste der Vorzeit zusammen. Die Feldsteinpflaster waren die Pflaster der einzelnen Räume der Gemächer (Küchen oder ähnlicher Wirthschaftsgemächer), die mit Feldsteinen ausgelegt waren. Wenn auch Reste der Burg Ihlenfeld erst vor nicht langer Zeit in ziemlicher Entfernung von den Gewölben abgetragen wurden, so ist dies kein Beweis, daß diese Reste die Ueberbleibsel der alten Burg Ihlenfeld waren. Die Ritter v. Ihlenfeld erbaueten sich nach der Demolirung ein neues Haus und, wie es nicht unwahrscheinlich ist, an einer andern Stelle in der Nähe, wie auch das jetzige Haus nicht auf den alten Fundamenten steht. Und so können füglich Ruinen von zwei Burgen derselben Herren neben einander liegen. Auch bleibt die Annahme noch immer gestattet, daß, was jedoch nicht die Gewölbe zu einem Gebäude außerhalb der alten Burg gehörten.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Handmühle von Leussow.
Unter den Fundamenten eines sehr alten Bauerhauses zu Leussow, welches im v. J. abgetragen ward, fand sich der


|
Seite 92 |




|
obere Stein von einer alten Handmühle aus grobkörnigem Granit. Der Stein ist dem von Wahmkow (vgl. Jahresber. III, S. 76) sehr ähnlich, nur etwas größer. In der Mitte hat der Stein ein Loch zum Einschütten des Korns und auf der innern Fläche zur Seite des Loches eine regelmäßig eingehauene, vierseitige Vertiefung in Form zweier an einander stehender Rechtecke, welche nach den Enden hin breiter werden, zum Einlassen des Endes der Drehstange oder Welle. Geschenk des Herrn Lehrers Bade zu Schwerin.
Bruchstück eines Bronzemörsers
von dicker, gegossener Arbeit, welcher unter dem Rande eine Inschrift, auf dem Bruchstück anfangend:

und um den Bauch zwischen drei erhabenen Reifen Verzierungen von einzeln stehenden Lilien gehabt hat, und eine
Spange von Bronze,
beides gefunden zu Schwerin beim Bau des Hintergebäudes des Herrn Weinhändlers Uhle in der Schusterstraße, geschenkt von demselben. Die Alterthümer lagen sehr tief in der Erde, und darüber Schutt, angebrannte Balkenfragmente und höher hinauf ein Steinpflaster unter dem neuern Steinpflaster.



|



|
|
|
Fund von Gothmann (bei Boizenburg).
Auf einem bei dem Dorfe Gothmann fast isolirt stehenden, kegelförmigen, ungefähr 8 Fuß hohen Hügel fand der Herr Sanitätsrath Richter zu Boizenburg im Herbste 1839 eine Menge Bruchstücke von Gefäßen, so wie einige Bruchsücke von eisernen Geräthen. Dabei ward erzählt, daß vor einigen Jahren ein Bauer daselbst Steine ausgegraben und eine kleine Höhle entdeckt habe, in der ein menschliches Gerippe gelegen. Erschrocken hierüber habe er die Höhle, deren Stelle noch nicht wieder aufgefunden ist, sogleich wieder zugeschüttet. - Die eingesandten Scherben stammen von Töpfen des frühesten Mittelalters; alle sind sehr hart und klingend, die meisten aus blaugrauem Thon, mit starken, gobogenen Rändern und langen Beinen, mehrere sind noch mit hellem Kiessand gemengt, jedoch sehr hart und bläulich. Die eisernen Bruchücke sind von dünnen Stangen und sehr wenig oxydirt.


|
Seite 93 |




|
Ein eisernes Panzerhemd
aus Drathringen, sehr gut erhalten, geschenkt vom Hrn. Rettich zu Rosenhagen, der es auf den Kupfermühlen bei Ratzeburg erwarb, wohin es mit alten Messingwaaren verkauft war.



|



|
|
:
|
Taufbecken.
Der Herr Rettich Rosenhagen hat dem Vereine eines jener berühmten Taufbecken geschenkt, welche in den Jahresber. II, S. 78 und III, S. 86 flgd. ausführlicher besprochen sind; es war unter altem Kupfer und Messing an die bei Ratzeburg gelegenen Messingwerke des Herrn Hasse zu Lübeck verkauft, wo unser Mitglied es erkannte und eigenthümlich erwarb. Das vorliegende Becken ist etwas kleiner, als das Becken von Rey, und von Messing, auch etwas nachlässiger gearbeitet, als dieses und viele andere Becken derselben Art. Die Mitte füllt ein erhabenes Medaillon, die Verkündigung Mariä darstellend: Maria knieet vor einem Betstuhl; hinter ihr beugt ein Engel ein Knie; zwischen beiden steht in einem Blumentopfe ein Rosenstock, über dem eine Taube schwebt, von der Strahlen auf die Jungfrau ausgehen. Um dieses Medaillon steht im Kreise die berufene Inschrift, in welcher sich 5 Mal dieselben 7 Charaktere wiederholen, und am Ende noch 4 Charaktere zur Füllung des Kreises stehen. Was dieses Becken auszeichnet, sind die klaren, völlig erkennbaren Schriftzüge, welche wohl nichts anders sind, als sehr gezierte, geschnörkelte Minuskeln oder sogenannte Mönchsbuchstaben, und gewiß nichts anders enthalten, als den englischen Gruß. Trügt nicht Alles, so lauten die Buchstaben:
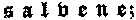
jedoch sind die Schnörkel des sechsten Buchstabens, obgleich hier klar erkennbar, im Stempel nicht ganz ausgeführt und es bleibt daher unentschieden, ob es ein u oder ein n sein soll; es neigt sich aber mehr zum n . Hiernach heißt die Umschrift entweder:

d. i. sal ve vene rabilis, oder:

d. i. salve. ue nerabilis sc. virgo. Die Buchstaben ve sind völlig klar. So viel dürfte wohl jetzt unzweifelhaft sein, daß die Inschrift nichts weiter, als einen Segensgruß enthält; es lohnen sich daher gelehrte Forschungen schwerlich der Mühe. Am Ende und im Anfange der Umschrift stehen an der sechsten Stelle die Buchstaben:


|
Seite 94 |




|
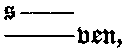
von denen das n theilweise das folgende s deckt. Man sieht klar, daß der Stempel mit den 7 Buchstaben hintereinander aufgesetzt ist und Anfang und Ende, oft auf einander geprägt, sich deckten, damit der Kreis voll ward. - Die Inschrift berührt auf diesem Becken den Rand. Ein zweites Relief fehlt, so wie jede andere Inschrift. - Auf den Rand sind 41 Blumen (oder Trauben) und unter diesen 55 kleine Rosetten mit Stempeln eingeschlagen
G. C. F. Lisch.
Zwei Reliefs
aus Messing getrieben, wahrscheinlich Sargbeschläge, von denen das eine die Kreuzigung, das andere die Grablegung Christi darstellt, von mittelmäßiger Arbeit, vom Herrn Rettich zu Rosenhagen auf den Kupfermühlen bei Ratzeburg gefunden und erworben und dem Vereine geschenkt.
Ziegel von der Burg Meklenburg.
Auf der Burgstätte von Meklenburg (vgl. Jahresber. IV, S. 93) wurden am 20. November 1838, wie früher öfter, Ziegel gefunden: ein Mauerstein von sehr großer Form und grobkörniger Masse und zwei Fragmente von einem Dachsteine, einer unglasurten Pfanne, geschenkt vom Herrn Hülfsprediger Dühring zu Meklenburg.
Ein großes eisernes Spornrad,
geschenkt vom Herrn Jahn auf Kl. Vielen zu Neustrelitz.
Eine eiserne Lanzenspitze,
16" lang, mit scharfem Mittelrücken, im J. 1839 auf einer Insel des Schalsees einige Fuß tief unter der Erde gefunden, geschenkt vom Herrn Apotheker Stockfisch zu Zarrentin.
4. Aus neuerer Zeit.
Ein (russisches) Altartäfelchen
von Bronze, darstellend einen segnenden Heiligen, neben dessen Haupte zwei Engel schweben und über welchem Gott Vater steht, mit slavischen Inschriften, 3" im Quadrat, von derselben Art, wie ähnliche, wahrscheinlich aus der Zeit der russischen


|
Seite 95 |




|
Kriegszüge im vorigen Jahrhundert, im Jahresbericht III, S. 88-89 beschrieben sind, geschenkt vom Herrn Rettich zu Rosenhagen.
Ein Hufeisen
aus weißlicher Bronze, mit hohem Stollen, mit mehrern gleicher Art bei Neubrandenburg gefunden, geschenkt vom Herrn Pastor Boll zu Neubrandenburg. Hufschmiede erklären diese Hufeisen für spanische; dem Anschein nach stammen sie aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges.



|



|
|
:
|
Schäferbeil von Lehsen.
In früheren Zeiten führten die Schäfer Meklenburgs eigenthümliche, mit langen Stielen versehene Beile, die ihnen zur Vertheidigung und Sicherstellung ihrer Person und ihrer Heerde als Waffe dienten.
Nachfolgender blutigen That verdankt das lehsensche Schäferbeil seine bisherige Erhaltung und Aufbewahrung.
Es war im Jahre 1759, als Meklenburg im siebenjährigen Kriege von preußischen Truppen feindlich überzogen und hart mitgenommen ward. Der Feind erlaubte sich vielfach gewaltsame Werbungen, und namentlich wurden die Schäferknechte häufig, bei nächtlicher Weile, in ihren Schäferkarren aufgehoben und in den Soldatenrock gesteckt. Der Schäferknecht Albrecht zu Lehsen, ein großer, wohlgestalteter Mensch, war mehrfach den Nachstellungen preußischer Werber entgangen. Die Furcht, daß auch ihn einmal das Schicksal so vieler seiner Genossen treffen werde, hatte denselben auf den Gedanken gebracht, seinen Karren mit einer zweiten kleinen Thür zu versehen, um aus dieser im Nothfalle entkommen zu können. Nur zu bald sollte eintreffen, was begründete Ahnung fürchten ließ. In der Nacht vom 13. auf den 14. April 1759 ward der einsame Schäferkarren des Schäferknechts Albrecht von einer Patrouille preußischer Husaren überfallen und der donnernde Ruf: ,,Bursche, komm heraus, oder wir schießen!" weckte den harmlosen Schäfer aus dem Schlafe. Nach dreimaligem, vergeblichem Rufen durchbohrte eine Pistolenkugel den Karren. Jetzt schlüpft der Schäfer aus seiner Noththür; es galt ihm Leben oder Tod. Verzweiflungsvoll stürzt er sich auf den im Wahne sicherer Beute an dem entgegengesetzten Ende des Karrens harrenden Husaren und kühne, mit seinem Beile vollführte Hiebe strecken den Husaren=Unterofficier Bernatowitz, einen polnischen Edelmann, leblos zu Boden. Durch schleunige Flucht entzog der Schäferknecht sich


|
Seite 96 |




|
der ihm drohenden Strafe; allein schon nach Verlauf von 20 Tagen ward derselbe ein Opfer der Blattern. Sowohl der Schäferknecht, als auch der preußische Husaren=Unterofficier sind auf dem wittenburger Kirchhofe begraben worden.
Auf dem Stiele dieses Schäferbeils befinden sich Worte ungefähr des Inalts eingeschnitten:"Kein Glück steht ganz in dieser Welt ungekränkt".
Lehsen, den 13. März 1840.
von Laffert.
II. Münzen und Medaillen.
Der Münzvorrath des Vereins, welcher am Schlusse des letzten Geschäftsjahres aus 2047 Stücken bestand, ist jetzt zu 2413 angewachsen und besteht aus 519 Bracteaten, 8 goldenen, 1405 silbernen, 404 kupfernen Münzen und 77 Medaillen.
Nur 13 Stücke wurden angekauft; die übrigen 353 sind dem Verein durch Geschenke geworden. Se. Königl. Hoheit der Großherzog Paul Friederich verehrten dem Vereine die schöne Medaille des patriotischen Vereins. Die Frau von Arnim zu Jamel und die Fräulein von Lützow schenkten 279 Münzen, worunter sich in großer Anzahl alte meklenburgische, rostocker und pommersche Schillinge und Doppelschillinge befanden. Herr Professor Dr. Crain in Wismar, Herr Hofküster Buchheim in Schwerin, Herr v. Stern auf Tüschow, Herr v. Laffert auf Lehsen haben durch einzelne werthvolle Gaben die Sammlung bereichert, welche vom Herrn Hofrath Nauwerck in Neustrelitz 30 altrömische und andere antike Münzen der späteren Zeit, die bei Girgenti auf Sicilien gefunden waren, zum Geschenk erhielt. Herr Gutsbesitzer Jahn auf Adamsdorf gab 3 abbassidische und 1 Ispehbediden=Münze, deren Fundort unbekannt ist 1 ). Herr Meyer in Schwerin
No. 2. Abbassidischer Dirhem, geschlagen ao. 154 zu Medinet essalam (Bagdad). (Gleichfalls aus der Regierung des El manssur.)
No.3. Abbassidischer Dirhem, geschlagen ao. 182 zu El dschei, einem Theile der Stadt Ispahan. (Eine seltene Münze, besonders wegen des Prägeortes.) Die Münze ist aus der Regierung des Herrun arraschid, aber im Namen seines damals bereits ernannten Thronfolgers und Sohnes,Mohammed El amin, geschlagen. Daher steht auf der einen Seite:
"ex eo, quod imperavit princeps El amin Mohammed, filius "princeps credentium, praefectus officio Moslemorum". ( ... )


|
Seite 97 |




|
eine metallene Rothmünze der Stadt Wismar von 1715; Herr Hofbuchdrucker Bärensprung eine meklenburgische Münze, und die Herren Moritz Friedberg aus Hamburg und Hauptmann von Maydell in Sternberg Kaisermünzen und sogenannte wendische Pfennige, von der Art, wie sie schon früher bezeichnet sind, welche theils bei Sülz, theils in Sternberg gefunden waren; von Letzterem erhielt die Sammlung eine schöne Medaille auf Carl XII. und eine andere auf dieHerzoge Friederich Christian und Heinrich Ferdinand von Braunschweig. (S. Rethmeyer III, p. 1610 Lub. XXXVII, No. 5.) Herr Rettich von Rosenhagen schenkte das seltnere Dreikopekenstück, welches 1774 für die Moldau und Wallachei in Jassy geschlagen ward (Schmieder, p. 330). Herr Reichsfreiherr v. Malzan auf Penzlin gab eine sehr alte Kupfermünze, auf der einen Seite mit einem durchbrochenen Kreuz, auf der anderen Seite mit einem Bogen, auf welchem 3 Thürme stehen, bezeichnet, die auf dem burg=penzliner Felde gefunden war, und einzelne theils ältere, theils neuere Münzen wurden geschenkt von den Herren Stadtsecretär Dölle in Wittenburg, Postschreiber Bölcken und Obermünzmeister Rübell in Schwerin, Pastor Ritter in Wittenburg, Benoni Friedländer in Berlin, Landrath von Blücher auf Suckow (ein Thaler der Stadt Campen, vgl. Madai II, No. 4808.), Amtsrath Koch in Sülz, Major v. d. Lühe auf Redderstorf (Schillinge und Groschen aus dem 16. und Anfang des 17. Jahrh.), Actuar Börsch in Wedendorf, Candidat Lorenz zu Boizenburg 1 ), Universitäts=
No. 4. Dirhem eines Ispehbediden.
(Diese Ispehdediden waren kleine persische Fürsten an der südlichen Küste des persischen Meeres, welche in den ersten Jahrhunderten nach der Eroberung Persiens durch die Araber sich erhielten, und Münzen mit altem persischen Gepräge zu prägen fortfuhren. Die Inschriften sind in Pehlewischrift, haben aber bis jetzt nicht entziffert werden können, weil die Schrift wahrscheinlich verderbt ist. Vergl. Bose über arabisch=byzantinische Münzen, S. 7, und Frähns Münzen der Chane vom Ulus Dschutschi, S. 63).
Greifswald. Dr. J. G. C. Kosegarten.
das gekrönte Brustbild, den Zepter haltend.
Rev. hEN RIO NLV NDE
(ND zusammengezogen): durch die Umschrift gehendes Doppelkreuz, in den Ecken mit 3 Kugeln ausgefüllt. - Groschen=Cabinet II, t. XXII, No. 43 und XXIII, 44 hat dies Gepräge, aber von andern Münzstätten; unser Exemplar ward auf dem boizenburger Stadtfelde gefunden.


|
Seite 98 |




|
Bibliothekar von Nettelbladt zu Rostock, Archivgehülfe Glöckler in Schwerin, Apotheker Stockfisch in Zarrentin, Bürgermeister Daniel und Senator Demmler in Rehna, Archivar Groth zu Schwerin und Obermedicinalrath Brückner in Ludwigslust.
Die Sammlung ist, ihrem nächsten Zwecke gemäß, besonders in Hinsicht der meklenburgischen Münzen vermehrt worden, unter denen die Medaille des patriotischen Vereins sich vorzugsweise auszeichnet 1 ); aber auch fast für jede Rubrik hat sie schätzbare Mittheilungen erhalten. Lücken, und sehr ansehnliche überdies, sind freilich noch überall genug auszufüllen; aber die Theilnahme für diese Abtheilung der Vereins=Sammlungen ist ja auch noch nicht erloschen und berechtigt zu der Hoffnung, daß die Bitte um Vermehrung nicht unerfüllt bleiben werde.
Demern, den 6. Julius 1840.
G. M. C. Masch.
III. Siegel.
1) Original=Stempel des letzten großen Siegels des Dom=Capitels zu Lübeck, welches der königl. dänische Geheime=Conferenzrath, Graf von Moltke, als Dechant und Präsident dieses Capitels, unter dem letzten Bischofe (l785 - 1802), Herzog Peter, führte, mit der Umschrift:
d. i.
Petrus Fridericus Ludowicus Dei Gratia Episcopus Lubicensis, Heres Norwegiae, Dux Sleswici, Holsatiae, Stormariae, Et Ditmarsorum, Dux Administrator Oldenburgensis.
geschenkt vom Herrn Reichsfreiherrn v. Maltzan auf Penzlin.
2) Siegel des Pfarrers Heinrich von Schwerin, gefunden auf dem altwismarschen Kirchhofe, geschenkt vom Hrn. Professor Dr. Crain zu Wismar. Dieses an Form und Sculptur merkwürdige Siegel ist eine Messingplatte ungefähr von Thaler=Größe und Dicke, welche schon durch zwei
R. In einem vollen Eichenkranze die Inschrift in 8 Zeilen: DER - MEOKLENBURGISCHE - PATRIOTISCHE - VEREIN - FÜR - ACKERBAU. - INDUSTRIE: - ERTHEILT DIESEN - EHREN=PREIS.


|
Seite 99 |




|
runde Nagellöcher in der Mitte und am Rande verletzt ist. Das Merkwürdigste ist, daß das Siegel auf beiden Seiten eingegraben ist. Das Siegel enthält auf beiden Seiten, in der Zeichnung etwas von einander abweichend, die Haupttheile des gräflich schwerinschen Wappens von der alten Hauptlinie: das runde Feld enthält links einen Baum, dessen Stamm eine Längstheilung des Siegelfeldes bildet, rechts einen Lindwurm, der sich mit dem Kopfe rückwärts zu dem Baume wendet. Die Umschrift lautet auf der einen Seite:
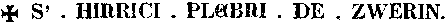
auf der andern Seite:
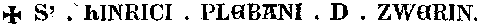
Die Form der Buchstaben spricht zwar für ein hohes Alter des Siegels, die Sculptur ist jedoch roh, und diese sowohl, als die runde Form deutet auf das 15. Jahrhundert.
3) Abdruck des Siegels der Stadt Schwerin in der Provinz Posen, geschenkt vom Herrn Professor Hering zu Stettin.
IV. Zeichnungen, Risse und Charten.
1) Zeichnung eines bei Rakow in Neu=Vor=Pommern gefundenen Götzen, vom Hrn. Dr. v. Hagenow zu Greifswald.
2) Sechs Blätter sauberer Zeichnungen von 22 Stück Grabalterthümern in der Sammlung des Domherrn und Landraths Herrn v. Zieten auf Wustrau in der Priegnitz, gezeichnet und geschenkt vom Herrn Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin.
3) Zeichnung eines Bronze=Grapens mit 3 Füßen, 6 1/2" hoch, 2 Pfund 12 Loth schwer, gefunden zu Quaden=Schönfeld im Strelitzischen beim Ausmodden eines Teiches, gezeichnet vom Herrn Gymnasiasten Brückner, geschenkt vom Herrn Pastor Boll zu Neubrandenburg.
4) Zeichnung einer römischen Silbermünze. Av. links gekehrtes Brustbild: CAESAR. TRAIAN . HADRIANV . Rev. sitzende Figur rechtwärts, die rechte Hand ausgestreckt, die linke auf eine Lanze gestützt: P. M . . . . . OS. DES. II - unten im Abschnitt: IVSTITIA ., gefunden zu Sadelkow oder Genzkow bei Friedland im Torfmoor, gezeichnet vom Herrn Oberlehrer Müller und geschenkt vom Herrn Rath Dr. Preller zu Neubrandenburg, in dessen Besitze die Münze ist.
5) Risse von Kirchen zu Lübeck in 5 Lithographien, geschenkt vom Herrn Dr. Deecke daselbst.


|
Seite 100 |




|
6) Copie einer Wasser=Charte vom Amte Mirow, ehemals im Besitze des wail. Herrn Hofraths Masch zu Mirow, copirt von Hermann Sponholz 1839, geschenkt vom Herrn Pastor Sponholz zu Rülow.
7) Charte von Neu=Vor=Pommern und Rügen von Dr. von Hagenow, Geschenk des Herrn Verfassers.
C. Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art.
I. Nachrichten von heidnischen Gräbern, mittelalterlichen Bauwerken und andern merkwürdigen Stätten.



|



|
|
|
Der Heisterstein bei Waren.
Der Herr Senator Freund zu Waren hat dem Vereine Nachricht von einem Hünengrabe der ältesten Art, einer Steinkiste, gegeben und zugleich eine genaue Zeichnung eingesandt, von welcher eine Copie zurückbehalten ist. Das Denkmal heißt in der Gegend der Heister= (Elster=) Stein und ist eine Steinkiste von 6 Tragsteinen und 1 Decksteine. Das Ganze hat eine Höhe von 6' 9" über dem Urboden. In dem Gipfel eines runden Steinhügels von 40' im Durchmesser am Urboden stehen die Tragsteine eingesetzt; gegenwärtig ruht der Deckstein nur noch auf 3 derselben, welche ungefähr 3 1/2' aus der Erde hervorragen. Der Deckstein hat eine Länge von 8', eine Breite von 6 1/2' und eine Dicke von 2'. Die Kiste ist inwendig leer und hat eine Tiefe von 3' 3 ".
Der Herr Senator Freund begleitet die Zeichnung mit folgender Nachricht in einem Briefe an den Herrn Pastor Masch:
"Der sogenannte Hester= oder Hästerstein liegt mitten im Holze, ungefähr 100 - 150 Ruthen rechts von der Landstraße nach Giewitz und Stavenhagen, auf der warenschen Stadtfeldmark. Der große Hügel, auf welchem es ruht, besteht aus kleinern Steinen, die mit Erde und Rasen bedeckt sind. In der Höhlung unter dem knapp aufliegenden Decksteine, der zu schweben scheint, kann man sich, wie die Dimensionen zeigen, gebückt bewegen. Dieser Deckstein liegt aber so genau und fest auf, daß eine bedeutende Hebelkraft würde angewandt werden müssen, um ihn abzuwälzen. Auf der obern Fläche hat der Deckstein eine Vertiefung, die sich nach einer Seite hinneigt; - daher die Meinung entstanden, das Denkmal sei ein Opfer=


|
Seite 101 |




|
stein und die Vertiefung habe zum Abfluß des Blutes gedient. Man wird aber auch eben so gut annehmen können, daß diese Vertiefung durch Verwitterung entstanden sei. Uebrigens sind alle Steine von Granit". Ostwärts in einer geringen Entfernung von diesem Steine liegt noch ein gleicher Kreis von nicht so großen Steinen, welche aber sichtlich in ihrer Stellung gestört und herumgeworfen sind; auch zeichnet sich die Erhöhung nicht bedeutend aus, doch ist der Kreis nicht zu verkennen. Man hat diesem den Namen des kleinen Heftersteins beigelegt." Daß hier von jeher Wald gewesen, glaube ich daraus abnehmen zu können, weil ich in dieser Gegend überall keine alte Ackerfurchen oder sonstige Spuren früherer Cultur, wie wir sie später fast überall im Holze finden, habe entdecken können. Auch muß ich bemerken, daß in hiesiger Gegend so große Steine, wie sie hier zusammengehäuft sind, sich nicht weiter finden." Noch bemerke ich, daß an der andern Seite der Stadt, in geringer Entfernung von der güstrowschen Landstraße, auf freiem Felde, sich noch eine solche Zusammenstellung von kleinen Steinen befindet, die als Hünengrab gilt, daher sie auch in ältern Registern mit diesem Namen bezeichnet ist. Leider haben Maurer vor einigen Jahren einige der größern Steine gesprengt; doch erfuhr ich es noch zeitig genug, um der völligen Zerstörung Einhalt zu thun."



|



|
|
:
|
Steinkiste von Ruthenbeck.
Im Jahresber. II, S. 107 flgd. ist über die alten Gräber im Amte Crivitz Bericht erstattet. Der Unterzeichnete hat diese Gräber in der jüngst verflossenen Zeit untersucht. Das allgemeine Resultat dieser Revision ist, daß sich im Amte Crivitz von der Stadt Crivitz bis gegen Parchim hin sehr viele, mit Steinen umstellte und bedeckte Hünengräber der ältesten Art finden, Kegelgräber und Wendenkirchhöfe jedoch sehr selten sind. Viele Hünengräber sind, beim Mangel an Steinen in diesem Amte, selbst in den neuern Zeiten, zu neuen Bauten zerstört, jedoch sind noch merkwürdige Ueberreste genug vorhanden. Eines der merkwürdigsten Monumente im Vaterlande ist die Steinkiste von Ruthenbeck bei Crivitz. Dieses großartige Denkmal der Vorzeit liegt an der Straße von Schwerin nach Parchim, nicht weit links vom Wege, hinter den ersten, links am Wege neu erbaueten Büdnerkaten. Das Denkmal ist in dem Jahresber. a. a. O. beschrieben, jedoch kann hier noch hinzugefügt werden,


|
Seite 102 |




|
daß dasselbe kein Riesen= oder Hünenbette, sondern eine Steinkiste ist. Es fehlt nämlich ein Grabhügel gänzlich. Den Ring des Denkmals bilden große Granitpfeiler, auf denen ein gewaltiger Deckstein ruht. Früher sollen zwei Steine den Ring bedeckt haben; der zweite ist jedoch vor längerer Zeit gesprengt und verbraucht. Gegenwärtig ist von den noch stehenden Tragsteinen dieses zweiten Denksteins her ein Eingang in die Grabkammer, in welcher mehrere Menschen Raum haben. Bei der vor kurzem geschehenen Regulirung der Dorffeldmark ist dies Grab von derselben ausgenommen und, als unmittelbares fürstliches Eigenthum, durch einen Graben von dem Acker getrennt. - In der Nähe liegen noch mehrere, jedoch kleinere Steingräber ähnlicher Art.
Nur um die Blicke der Freunde der Vorzeit auf diesen Riesenbau zu lenken und die wenigen sehenswerthen Denkmäler im Lande auszeichnend hervorzuheben, sind diese nachträglichen Zeilen geschrieben.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Brüsewitz.
In dem Jahresber. IV, S. 23, ist außer dem von dem Vereine im v. J. aufgedeckten Hünengrabe zu Brüsewitz eines zweiten zerstörten Hünengrabes erwähnt, welches im Walde in der Nähe des aufgedeckten liegt und Reste einer großen Steinkiste zeigt. Dieses ist wahrscheinlich schon früher planmäßig geöffnet. Der Geh. Archivrath Evers zu Schwerin öffnete nämlich im J. 1779 zu Kl. Brütz, d. i. jetzt Brüsewitz, ein Hünengrab und fand hier einen großen, 1 1/2 Fuß im Quadrat haltenden Schleifstein aus hellrothem, quarzigem Sandstein, der bedeutende Spuren von seinem Gebrauche zeigt. Dieser seltene Stein ward früher in den Sammlungen der Universität Rostock aufbewahrt, ist aber seit 1839 von dieser der Großherzogl. Alterthümersammlung in Schwerin überlassen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Warlin.
Südlich am Ausgange des genannten Dorfs zwischen den beiden Wegen nach Neubrandenburg und nach Pragsdorf zeichnete sich ein nicht unbedeutender Sandhügel, von bedeutenden Granitstücken in ziemlichem Umfange am Fuße umstellt, aus. Als die bedeutendste Anhöhe in der Nähe des Dorfes von dieser Seite ward sie bisher für die Stelle gehalten, auf der einst


|
Seite 103 |




|
die kleine Warte (Wardelin) gestanden. Schon vor 3 oder 4 Jahren wurden eine Menge Steine von dort zum Neubau der Pachterwohnung genommen. Die Lage derselben verrieth nur dem Kundigen ein vorchristliches Grab; doch sollen einige Urnenscherben vorgekommen sein. Im Winter 1839 - 40 räumten die Arbeiter an der neuen Kunststraße den Hügel fast ganz ab und fanden mit ihren Suchern (Nadeln) in der Tiefe noch mehrere Steine. Als die Mitte abgeräumt war, kam ein Hünenbette ans Licht, umher mit einer Masse von faustgroßen Steinen dammartig belegt, in Mitten auf zwei senkrechten Steinplatten der gewöhnlich vorkommenden Art ein bedeutender Deckstein. Das Grab war durchaus leer. (Nach mündlicher Mittheilung des anwesenden Bau=Conducteurs Herrn Adermann.)
An diesen Hügel knüpft sich unter den Bewohnern des gedachten Dorfes die Sage von der goldenen Kuh. Eine glänzend rothe Kuh finde sich, heißt es, jedes Jahr am ersten Mai unter der Dorfheerde ein. Im Herbste aber erscheine sie mit einem goldnen Halsbande, in welches der Lohn des Hirten sorgfältig genähet sei. Sobald dieses ihr abgenommen, kehre sie zu obrigem Hügel zurück, in welchen sie bis zum nächsten Frühlinge verschwinde. - Bei näherer Nachfrage: ob solche noch alljährlich erscheine, brachte Eins. heraus: gedachte Kuh sei seit mehrern Jahren nicht erschienen. Der vorige Hirte, von einem des Weges reisenden Wanderer erinnert, sich doch nach einer rothen Kuh umzusehen, die unsern in der Nähe einer Brücke auf der Landstraße nach Neubrandenburg in den letzten Zügen zu liegen scheine, begab sich zwar dahin; allein die bisher so reichlich zahlende Kuh war für immer verschwunden.
Rülow.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Steinernes Geräth, gefunden bei Sadelkow.
Von Arbeitsleuten, welche Steine zur neuen Kunststraße ausbrachen, wurden im Januar d. J. etwa 500 Schritte auf der Westseite des ritterschaftl. Gutes Sadelkow bei Friedland unter einem bedeutenden Haufen großer Granitstücke hart an der Landstraße nach Neubrandenburg - man hielt diese Steine für eine Schutzmauer gegen den Acker, wahrscheinlich aber ist es das seitdem zerstörte "Reesenbette", dessen in alten Visitations=Protocollen des Orts gedacht wird - zwei Geräthe von Feuerstein gefunden, die wohl Waffen der Vorzeit sind. Das erste möchte ich eine Streitaxt nennen. Sie ist indeß ohne Schaftloch hat 8 1/2" Länge bei einem Gewicht von 1 3/4 Pfd. Der Stein ist ein grauschwarzer Feuerstein von vier Seitenflächen, die


|
Seite 104 |




|
roh, aber künstlich, in muschligem Bruch geschlagen sind. Beide Enden der Axt haben keilförmige, halbmondförmige Schärfen oder Schneiden; das breitere Ende mißt 2 1/2". Das schmalere 2" das Werkzeug ist auf der Mitte zwischen beiden Schneiden so vertieft, daß es in einen Schaft eingeklemmt wohl befestigt werden konnte; oder vielleicht durch einen Schaft mit viereckigem Loch getrieben durch Keile gehalten werden mochte. Streitkeil oder Meißel ist es nicht. Daneben lag von gleicher Masse ein Keil oder Meißel, 5 1/2" lang, an der Schneide 1 7/8" breit, dann verjüngt und abgestumpft am entgegengesetzten Ende bis auf 1" Dicke auslaufend. Die beiden Längskanten, wie die Schneide sind durch vorsichtiges Schlagen zu Schärfen geformt. Beide Geräthe sind in das Großherzogl. Museum zu Neustrelitz abgeliefert. Von den Arbeitern sind weder Urnenreste noch Brandstätten bemerkt. - Dagegen mag hier noch erwähnt werden, wie etwa 500 Schritte von jenem Fundort mitten durch die Wiese zum sogenannten Landgraben gegen den Werder hin ein breiter Steindamm von den Arbeitern, etwa 1' unter der Oberfläche, vollkommen erhalten aufgefunden ward, der eine reiche Ausbeute für die Chaussee lieferte. Ein alter, fast 80=jähriger Küster, den ich hier 1820 vorfand, erzählte mir wiederholt, wenn wir in jene Gegend kamen, wie er sich aus seiner Jugend der ihm gewordenen Mittheilung erinnere: es ziehe sich ein Steindamm unter jener bedeutenden Wiesenbreite, über den Landgraben weg zum jenseitigen Ufer des Werders hin, und sei dieser Steindamm der Ueberrest einer Militärstraße der Vorzeit von Pasewalk nach Treptow a. d. Tollense. Seit Jahrhunderten ist auf diesem Steindamm schon Heu geworben.
Rülow, Februar 1840.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Ueber die Verbreitung der bronzenen Alterthümer aus der Zeit der Kegelgräber.
Das nordöstliche Deutschland, namentlich in den Ostseeländern Holstein, Meklenburg und Pommern, hat in seinen zahlreichen Kegelgräbern die uralte Bronzecultur ohne Ausnahme rein von jedem andern Einflusse erhalten; die Kegelgräber und die Bronzegeräthe weichen hier plötzlich der Eisencultur. Aehnlich ist es auch in Skandinavien. Anders verhält es sich schon im südlichen und westlichen Deutschland, wo die Erkenntniß der Bronzecultur durch manche andere Erscheinungen nicht wenig gehemmt wird. Von hohem Interesse ist es nun, von irgend einem Puncte, vielleicht von den genannten Ostseeländern aus,


|
Seite 105 |




|
die Verbreitung dieser Bronzecultur zu verfolgen. Am erfolgreichsten scheint diese Verfolgung gegen Südost werden zu können. In den Marken Brandenburg und in Schlesien sind nicht wenig bronzene Geräthe aus der Zeit der Kegelgräber gefunden, und in Ungarn findet man sie an verschiedenen Stellen in großen Massen. Auf diese Erscheinung hier aufmerksam zu machen, ist der Gegenstand diese Zeilen.
Am 10. 1839 schrieb der Herr Rath und Professor Dr. E. A. Zipser zu Neusohl in Ungarn an den Unterzeichneten. Nachdem dieser Gelehrte die mineralogischen Studien berührt hat, fährt er fort:
"Anders verhält es sich mit den in Ungarn aufgefundenen Antiquitäten,. die man vielleicht ohne Grund für römisch erklärt, obschon sie das wenig bekannte Werk Cimeliotheca musei nationalis Hungarici, sive. Catalogus historico=criticus antiquitatum, raritatum et pretiosorum eiusdem instituti etc. anführt. Indessen wird man vom Gegentheil belehrt, nimmt man das Friderico=Francisceum zur Hand. Durch Vergleichung überzeugt man sich nämlich, daß dieselben Handbergen, Lanzenspitzen, Schwerter, Fibeln, Frameen, Urnen u. dgl. auch in den nördlich 1 ) gelegenen Comitaten Ungarns vorkommen. So ist der Hügel Harsàs (lies: Harschasch, deutsch: Lindenhain) im Neograder Comitate als eine große Niederlage benannter Vorkommnisse durch die Ausgrabungen meines Freundes Franz Edlen von Kubiny bekannt und in der ungarischen Zeitschrift Sas (der Adler) näher beschrieben worden, was freilich nicht ganz zweckmäßig war, da grade in jenem Theile Deutschlands, in welchem ähnliche Alterthümer vorkommen, niemand die magyarische Sprache versteht. Das Einzige macht alle Vermuthungen schwierig, daß man keine Gräber nachweisen kann, die Alterthümer vielmehr zerstreut findet, oft in Gegenden, wo man sie am allerwenigsten vermuthen würde. Die Sammlung meines Freundes von Kubiny enthält mehrere tausend Stücke, selbst solcher Antiquitäten, die im oben angeführten Werke nicht vorkommen. Vor einigen Jahren hat man drei Stunden


|
Seite 106 |




|
von Neusohl unter einem Felsen mehrere Handbergen, hohle fein geschlagene Knöpfe mit Heftchen an den Seiten nebst vielen andern Dingen gefunden, die von Bronze gearbeitet sind. Die Sachen lagen, wie es heißt, in einem Kessel, dessen zertrümmerte, verbogene Theile ich besitze, und von denen ich fast glaube, daß sie eher einer Urne angehört haben. Das Unglück wollte es, daß die Sachen in die Hände eines rohen Zigeuners kamen, der das Meiste verdarb."
In einem zweiten Schreiben vom 12. October 1839 heißt es:
"Indessen will ich das fleißig sammeln, was die nördlichen Gegenden an Alterthümern enthalten. Hieher gehört der Harsàs, den ich diesen Sommer mit 36 bis 40 Mann untersuchte. Seine Kuppe konnte nicht gegraben werden, weil sie angebaut war, dagegen ward die Abdachung umgewühlt und ich fand mehrere Töpfe von verschiedenen Formen mit einem oder zwei Henkeln, viele Scherben und Bruchstücke von Urnen und eine Art Geräthe oder Schleifstein, an dem es auffallend ist, daß er aus Trachit ist, der mehrere Meilen in der Umgebung von Harsàs nicht vorkommt. Ich habe übrigens die schönen Bronzesachen meines Freundes v. Kubiny diesen Sommer fleißig gezeichnet. Umgebogen finden Sie einige Umrisse."
(Dies sind Urnen, ferner Frameen, Lanzenspitzen, Fibeln mit zwei Spiralplatten, Armringe, Nadeln, alles aus Bronze, Streitäxte aus Stein, wie diese Geräthe häufig in Meklenburg gefunden werden.)
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Vellahn, Düssin und Brahlstorff.
Von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht, daß bedeutende Kegelgräber auf den Feldmarken vorbenannter Dörfer sein sollten, begab ich mich dorthin und fand zuerst da , wo die Grenzen von Vellahn, Düssin und Brahlstorff zusammentreffen, östlich von der Bruchmühle, zu beiden Seiten des Gänsebaches mehrere Gruppen von Kegelgräbern mittlerer und geringerer Größe, wovon noch mehrere gut erhalten, zum Theil unbeackert sind. Der Boden besteht aus Sand, und ebenso die Hügel.
Einige tausend Schritte von hier südöstlich liegt auf dem düssiner Felde der Tröndelberg, eine natürliche Anhöhe, welche oben einen regelmäßig gebildeten spitzen Kegel hat, wahrscheinlich


|
Seite 107 |




|
ein Kegelgrab, von 25 bis 30 Fuß Höhe und 8 bis 9 Ruthen Durchmesser. Die Oberfläche zeigt groben Kiessand. Am Fuße des Kegels stehen alte Buchen umher. In diesem Hügel soll nach der Sage der hiesigen Landleute der goldene Sarg stehen; zwei Versuche von Schatzgräbern ihn zu heben sind verunglückt; - Spuren von Nachgrabungen sind auf der Spitze ersichtlich.
Von dem Dorfe Brahlstorff an, über die Feldmark Düssin nahe am Dorfe vorbei, erstreckt sich bis Melkhoff eine Reihe von Kegelgräbern von 50 bis 80 Fuß Durchmesser und 6 bis 12 Fuß Höhe; um die größeren sind gewöhnlich mehrere kleinere aufgeworfen. Die meisten sind unberührt und unbeackert; sie bestehen wie der Boden aus leichtem Sande. Alle liegen auf einer Hügelreihe, welche die bis dahin flache und niedrige Elbgegend begränzt. Eines der größeren Gräber, auf dem düssiner Felde an der brahlstorffer Scheide liegend, läßt eine alte Aufgrabung von Osten her vermuthen, die aber nicht vom Urboden an, sondern in einer Höhe von 5' unternommen zu sein scheint, und worüber noch von den bejahrten Leuten im Dorfe folgendes erzählt wird: Zur Zeit ihrer Großväter (einige geben die Mitte des 17. Jahrhunderts an) 1 ) sei eine Frau Abel Dorothea von Pentz Besitzerin von Düssin gewesen; von einer schweren Krankheit durch ihren Arzt befreiet habe sie diesem seine Bitte genehmiget, einen der Grabhügel zu öffnen. Er habe den oben bezeichneten Hügel dazu gewählt und darin viele Alterthümer gefunden. Doch habe die Gutsbesitzerin nachher jede weitere Aufgrabung strenge untersagt. - Ringsteine sind um alle diese Hügel gewesen und erst seit Menschengedenken weggenommen; an diesen Ringsteinen haben viele Urnen gestanden.
Einige Hügel sind schon der Steine wegen durchwühlt, von anderen sieht man nur noch kaum einige Spuren und bei dem in jener Gegend jetzt herrschenden Mangel an Steinen dürften bald noch mehrere Hügel zerstört werden.
Wittenburg, Anfang Septembers 1839.
J. Ritter.
Anm. des Hrn. Archivars Lisch.


|
Seite 108 |




|



|



|
|
|
Kegelgräber von Poltnitz (bei Marnitz).
Ueber einige Gräber der Vorzeit, wohl die interessantesten in dieser Gegend, möchten dem Vereine noch keine Mittheilungen geworden sein. Es ist dies eine Gruppe von 5 Kegelgräbern, die sich südlich unweit Dorf=Poltnitz befindet, dicht an der Stelle, wo der Weg von Marnitz nach Wulfsahl und die Landstraße von Parchim nach Perleberg sich durchschneiden. Die Bewohner der Umgegend nennen diese Hügel: "de Sülwerbuck" (der Silberbock) oder "de Sülwerberg" (die Silberberge). In Hinsicht ihres Umfangs und ihrer Höhe stehen sie in absteigendem Verhältnisse. Die beiden größten Kegel haben resp. circa 60 und 47' Basisdurchmesser und 15 und 10' Höhe, während der kleinste sich nur wenig über den Urboden erhebt. Die erstgenannten beiden hatten Ringsteine, welche aber schon ausgebrochen sind. Die Kegel selbst sind noch ziemlich erhalten, vollkommen rund und scheinen größtentheils aus Sand zu bestehen. - Irre ich nicht, so sah ich, als ich neulich dort vorüberfuhr, an dem Fuße des größten Kegels frische Sandgruben, die mich für die Erhaltung dieser Gräber besorgt machten. (Mittheilung des Hrn. Cand. d. Theol. Tapp zu Jarchow.)



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Schönbeck (bei Friedland).
In der Nähe des Pachterhofes gedachten Ortes ward im Herbste vorigen Jahres ein Moor ausgefahren, das in seiner Mitte eine ersichtlich künstliche kegelförmige Erhöhung - früher gewiß Insel - hatte. Auch die Erde der letztern ward zur Verbesserung der nahen Ackerkrume benutzt. Die Arbeiter stießen bald auf ein Gewölbe von größern und kleinern Feldsteinen, die den Erdkegel am Fuße umkränzten. Fast in der Mitte desselben stieß einer derselben auf eine Grabstätte und fand einen Kopfring (?) 1 ), eher wohl Achselring, ganz dem im Friderico=Francisceum Tab. XXXII, Fig. 3 abgebildeten gleich. Größe, Zahl der eigenthümlichen Verzierungen in gewundenen Strichen, Charnier treffen so genau mit dem bei Ludwigslust gefundenen Ringe zusammen, daß man gedrungen ist anzunehmen, beide kommen aus derselben Form,


|
Seite 109 |




|
aus derselben Künstlerhand. Auch die Erzcomposition, dunkelfarbige Bronze, scheint jener im Gehalte ähnlich: die erhabenen Theile der Windungen hatten ihren vollen, natürlichen Glanz, nur die Vertiefungen waren voll Moor=Erde; keine Spur von edlem Rost. Dieser Ring umkränzte eine kleine schwarze kannenförmige Urne, etwa 4" hoch und in größter Weite 3" haltend. Henkel und Rand waren leider von spielenden Kindern abgebröckelt, als sie in meine Hand kam. Die Masse war vorzüglich hart und durch und durch schwarz gebrannter Thon. Neben der Urne lag ein Hals= oder Kopfring von Bronze, ganz dem in oben gedachtem Werke Tab. X, Fig. 2 abgebildeten gleich, doch waren die Schlußenden bereits abgebrochen, so wie die Neugier des Finders den Ring überdies noch ein Mal durchgebrochen hatte. Von der Dicke einer starken Federspule nach der Mitte an Stärke zunehmend, war derselbe mit flachen Schlangenlinien gravirt. Auf der Urne, die Asche enthalten hatte, soll nach Aussage des Finders ein vom Rost fast verzehrtes eisernes 1 ) Werkzeug in Form eines "Spätels" - Lanzenspitze - gelegen haben, das leider zerbröckelt wurde.
Der Fund ist in das großherzogliche Museum zu Neustrelitz übergegangen mit einem Fundbericht des Unterzeichneten.
Rülow, im Februar 1840.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Begräbnißplatz von Warlin.
Ueber einen Begräbnißplatz in der Nähe der Kegelgräber von Warlin, zwischen Warlin und Sponholz, südlich von der bisherigen Landstraße von Neubrandenburg nach Friedland, in einem Holze, die kurze Kavel genannt, habe ich früher kurze Andeutungen gegeben. Die Structur des Platzes war ein nach dem Centrum hin erhaben gewölbter Damm von faustgroßen Steinen; in der Nähe lagen größere Granitblöcke halb zu Tage. Zwischen den Steinen standen mehrere zerstörte Urnen und zwei kleine Grabgefäße, deren Inhalt von den Arbeitern verschüttet ist. Beide Urnen sind glatt, ohne Verzierungen, hellbraun, hoch und nicht weit, von ungefähr gleichem Durchmesser in jeder Höhe, die größere 4" hoch und ganz erhalten, die kleinere 3" hoch, mit einem kleinen Henkel und zur Hälfte erhalten 2 ).
Rülow, im Junius 1840.
Sponholz.


|
Seite 110 |




|



|



|
|
:
|
Wendischer Opferhain
oder
die Ravensburg
1
)
bei Neubrandenburg.
A. Entdeckungsgeschichte.
Vorläufiger Bericht des Herrn Pastors Boll zu Neubrandenburg und des Herrn Archivars Lisch zu Schwerin.
Als wir am 16. Sept. von Neubrandenburg nach Ihlenfeld fuhren, um die unterirdischen Gewölbe aufzudecken (vgl. oben: Mittelalt. Alterth. S. 84), nahmen wir unsern Weg über die sogenannte Ravensburg bei Neubrandenburg, nicht weit von Ihlenfeld. Die Ravensburg ist eine bedeutende Umwallung in einem uralten, feuchten Walde; die Sage meint, der Ritter Albert von Raven, der im J. 1248 mit der Erbauung der Stadt beauftragt war, habe hier seine Burg gehabt. Ganz abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, daß ein Mann, der eine so regelmäßige Stadt wie Neubranbenburg in einer so schönen und hügelreichen Gegend, in der unmittelbaren Nähe eines Klosters (Broda) anlegte, eine Stunde weit davon in einem feuchten Walde seinen Wohnsitz nahm, schien uns die große Ausdehnung und Mächtigkeit der Umwallungen für Privatkräfte viel zu bedeutend, auch die ganze Lage so eigenthümlich, daß wir gegenseitig die Ueberzeugung aussprachen, daß diese Umwallungen etwas ganz anderes als mittelalterliche Burgwälle seien. Zugleich berichtete uns der Stadtholzwärter Müller, daß er vor der Umwallung auf einer freiern Stelle, der Rosenplan genannt, beim Einsetzen von Birken Steinanhäufungen gefunden habe, welche eben aus der Erdoberfläche hervorragten und beräuchert zu sein schienen. Wir besahen die Stellen, fanden auch sogleich beim Ausbrechen mit der bloßen Hand einen kubisch, fast kugelförmig behauenen Granitstein von ungefähr 1/2' Durchmesser, wie Gideon Sponholz deren in seiner Sammlung hatte. Wir beschlossen mit gespannter Erwartung, zu einer andern Zeit Nachforschungen vorzunehmen.
Während ich, der Archivar Lisch, bei der Untersuchung der Runen=Denkmäler zu Neustrelitz die über dieselben vorhandenen Acten studirte, fand ich, daß auch Gideon Sponholz in der Ravensburg und im Rosenplan gegraben hatte, jedoch, wie es scheint, ohne Erfolg. Darin aber stimmten alle Berichte bei den Acten überein, daß die wendischen Begräbnisse, die G. Sponholz bei Neubrandenburg aufdeckte, unterirdische Stein=


|
Seite 111 |




|
setzungen, nach dem stets vorkommenden wendischen Bestattungs-Ritus, gewesen waren. Dies bestärkte den Vorsatz, bei Neubrandenburg Nachgrabungen anzustellen. Während der Zeit erbat ich, der Pastor Boll, vom Magistrate der Stadt Neubrandenburg Erlaubniß zu Nachgrabungen, welche auch bereitwillig ertheilt ward.
Am 24. Sept. 1839 trafen wir in Neubrandenburg wieder zusammen und begannen sogleich unsere Nachforschungen, mit Hülfe des Studiosus Boll aus Neubrandenburg und der beiden Gymnasiasten Brückner aus Ludwigslust, und in freundlicher Gegenwart des Herrn Raths Dr. Brückner, des Herrn Raths=Secretärs Siemssen, Mitglieder des Vereins, und des Herrn Hauptmanns von Sprewitz.
Wir begannen die Nachgrabungen auf dem Rosenplan, wo wir die Steinlagen aufdeckten. Wir fanden behauene und gespaltene Steine und unter diesen auch gleich einen uralten seltenen Keil aus Hornblende (aus der Zeit der Hünengräber), dessen beide Enden abgeschlagen waren, der also schon zum Pflasterstein oder Werkstein behauen und benutzt war, daher eine jüngere Anwendung verrieth. Das Fragment, 4" lang, ist sehr regelmäßig bereitet und geschliffen. Trotz der größten Aufmerksamkeit, mit der wir überall nachgruben, wo sich Steine zeigten, fand sich doch nichts Alterthümliches.
Wir beschlossen daher, in der Ravensburg unser Glück zu versuchen. Freilich war bei der großen Ausdehnung der Umwallung die Aussicht auf einen Fund sehr entfernt: denn wo sollten wir die Wünschelruthe schlagen lassen? - Wir wählten die erste, beste freie Stelle gegen die Mitte der innern Umwallung und fanden sogleich Scherben von grobkörnigen Urnen mit Verzierungen, welche den bei Rülow gefundenen (vgl. oben S. 71 ff.) vollkommen glichen und allein der wendisch=heidnischen Zeit zuzuschreiben waren. Die Sage von der Ravensburg fiel und es entwickelte sich die Annahme eines heidnisch=wendischen Opfer= (Lager= oder Begräbniß=) Platzes.
Wir wählten eine zweite Stelle unmittelbar am innern Wallring, nicht weit von der Einfahrt. Auch hier traten uns sogleich kaum einen Fuß tief dieselben Erscheinungen entgegen: zahlreiche Scherben von heidnischen Urnen mit und ohne Verzierungen, mit Kiessand und Glimmer durchknetet, und schwarz berußt, so wie auch weiß calcinirte Feuersteinstücke. Auch fanden sich gespaltene rothe Sandsteine. Am interessantesten war jedoch die Auffindung vieler Fragmente von Lehmziegeln. Diese sind gelb und röthlich gebrannt und häufig von Rauch


|
Seite 112 |




|
geschwärzt; sie sind sehr leicht und porös, mehr oder weniger stark mit Sand in der Masse gemischt; manche sind an einer Seite ausgehöhlt, als hätten sie zu Urnenmänteln gedient, andere sind ganz eben, überall von gleicher Dicke, und zeigen offenbar die Benutzung eines Streichholzes zur Verfertigung. Es sind dies die ersten wendischen Ziegel, welche in Meklenburg gefunden sind. Unter allen diesen Resten eines vorchristlichen Alterthums lagen mehrere Thierknochen, vollständig oder auch nur in Splittern und Bruchstücken, jedoch ohne alle Spuren von Brand; sie stammen also entweder von geschlachtetem oder von gestürztem Vieh. Die noch erkennbaren Gebeine sind 1 ): "der calcaneus (Fersenbein)" vom rechten Hinterfuße eines Rindes, ein noch nicht völlig entwickelter letzter Backenzahn eines Schweines mit einem Fragmente vom Unterkiefer und der größere Theil einer tibia (Röhrenknochens) wahrscheinlich ebenfalls von einem Schweine.
Diese Umwallung gleicht in jeder Beziehung dem oft besprochenen Opferplatze bei Schlieben 2 ). Eine weitere, gewissenhafte Forschung über diesen Platz, der seines gleichen bisher in Meklenburg noch nicht gefunden hat, dürfte unzweifelhaft zu interessanten Ergebnissen führen. Eine solche Forschung in den nächsten Jahren anzustellen, habe ich, der Pastor Boll, im Auftrage des Vereins mit Freuden übernommen.
B.
Aufgrabungsbericht
des
Herrn
Pastors Boll zu Neubrandenburg.
Den 25. September 1839 Nachmittags, am 1. October und den 19. October Nachmittags sind die mit dem Herrn Archivar Lisch in der Ravensburg begonnenen Nachgrabungen von mir fortgesetzt worden. Gewöhnlich begleiteten mich dabei mein Bruder (der Studiosus Boll), die beiden Gymnasiasten Brückner und der Holzwärter Müller. Außerdem sind mehrere Nachmittage mit Ausmessung und Aufnahme des Terrains zugebracht, und der darnach entworfene Plan am 15. Jan. 1840 unter günstigen Umständen verificirt worden.
I.
Das Gehölz, in welchem die unter dem Namen Ravensburg bekannte Umwallung sich befindet, ist fast 1/2 Meile von


|
Seite 113 |




|
Neubrandenburg jenseit des Datze=Baches gelegen, und stößt an die Wiesen von Küssow und den ihlenfelder Busch. Es bestehet dem größten Theile nach aus sumpfigem Erlenbruch; nur die höher gelegenen Stellen sind Eichwald. Der Burgplatz selbst ist eine von Eichen und Gestrüpp dicht bewachsene Horst in einem tiefen Bruche, die zwar gegen Süden ziemlich nahe an den Eichwald reicht, von den übrigen Seiten aber durch den umgebenden Bruch in nasser Jahrszeit völlig unzugänglich wird. Die Horst wird von dem mittleren Walle (d b e) und dem nach außen gelegenen Theile des innern Walles (e f d) eingefaßt; die unregelmäßige Gestalt des Walles rührt lediglich daher, daß man bei Aufwerfung desselben der natürlichen Begrenzung der Horst nachging, so daß der mittlere Wall und der bezeichnete Theil des inneren Walles genau die Horst von dem Bruche scheiden.
Der mittlere, am Rande der Horst umlaufende Wall (d b e) hat eine Höhe von gegen 16 Fuß. Seine Länge beträgt 562 Schritte; von dem äußeren Walle ist er (a bis b) 60 Schritte, von dem innern (b bis c) 90 Schritte entfernt. Das Erdreich desselben ist von beiden Seiten her, vornehmlich aber von der äußeren Seite her aufgeworfen. Dadurch ist ein gegenwärtig noch deutlich erkennbarer, tiefer und breiter Graben gegen den Bruch hin entstanden. Aber auch an der innern Seite des Walles läuft eine starke Austiefung von gegen 2 Ruthen Breite umher, die bei hohem Wasserstande sich ebenfalls mit Wasser füllt, und durch die darin aufgeschlagenen Erlen und Schilf ganz das Ansehen eines verschlammten Wallgrabens darbietet.
Der innere Wall (d c e f) bildet einen nicht ganz regelmäßigen, aber geschlossenen Kreis von 294 Schritt im Umfange; sowohl von c bis f, als von d bis e hat er 83 Schritte im Durchmesser. Die Höhe des Walles ist aber ungleich: nämlich die nach dem Bruch zuliegende Hälfte (e f d) hat gleiche Höhe mit dem mittleren Walle und ist eben so wie dieser von beiden Seiten heraufgeworfen, mit dem breiten, tiefen Graben nach der Außenseite, und mit der von Erlengebüsch und Schilf gefüllten Vertiefung nach innen. Die andre, nach innen gekehrte Hälfte des Wallringes (d c e) ist bedeutend, wohl um gute Mannshöhe, niedriger, weil dieser Theil des Walles nur von einer und zwar von der äußern Seite her aufgeworfen ist. Um diese Seite läuft ein tiefer Graben, dessen Ränder noch deutlich zu erkennen sind, und der das Erdreich zu dem Walle geliefert hat; an der innern Seite aber ist keine Spur von Austiefung zu finden, so augenfällig diese auch bei der andern Hälfte des Ringes (d e f) hervortritt. Bei d


|
Seite 114 |




|
und e reicht der mittlere Wall an den innern ganz nahe heran, und bleibt nur in der Breite des Grabens d c e von demselben entfernt, so daß dieser Graben ohne Zweifel mit dem um die Außenseite des mittleren Walles laufenden Graben hier in Verbindung stand. Spuren von Brücken, die vielleicht vom mittleren alle auf den inneren führten, habe ich nicht entdecken können.
Endlich der äußerste Wall (f a g), 513 Schritte lang, befindet sich mitten im Bruche. Größtentheils ist er sehr niedrig, so daß er sich an manchen Stellen kaum über den Bruch erhebt; an andern Stellen hat er Mannshöhe, an den höchsten wohl 8 Fuß. Allem Anscheine nach ist er nur von außen zu aufgeworfen. Bei g nähert er sich dem mittleren und bei f dem innern Walle, so daß er nur durch die hier befindlichen Gräben von ihnen getrennt wird. Der Bruch zwischen dem äußern und zwischen dem mittlern Walle und der Strecke d f des innern Walles liegt so niedrig, daß er im Frühjahr gewöhnlich einen Teich von gegen 2 Fuß Tiefe bildet.
Nach der großen Stadtkarte mißt der vom mittlern und innern Walle eingeschlossene Raum (die eigentliche Horst) 885 □Ruthen, der Raum aber zwischen dem äußern und mittlern Walle 706 □Ruthen.
II.
An der auf dem Plan bezeichneten Stelle innerhalb des inneren Walles, wo in Gegenwart des Herrn Archivars Lisch die Nachgrabungen begonnen waren, habe ich dieselben auch fortgesetzt; der aufgegrabene Raum am innern Rande des Walles hat 1 1/2 Ruthen Länge und geht bis auf Mannshöhe in das Erdreich des Walles hinein. An andern Stellen in größerer Entfernung sowohl vom innern als auch vom mittleren Walle habe ich mit einer eisernen Stange das Erdreich untersucht, bis jetzt aber noch nichts von Bedeutung auffinden können. Die aufgegrabene Stelle aber lieferte folgende bemerkenswerthe Gegenstände, die fast alle in dem Aufschutte des Walles selbst oder in dem Urboden unter dem Aufschutt sind gefunden worden:
1) Eine Menge bearbeiteter Feldsteine (besonders Granit und Sandstein) zum Theil zu kleinen Pflastern zusammengefügt, unter denen Urnen befindlich waren; ferner an beiden oder an einer Seite bearbeitete Steine von 1/2 bis 1 Fuß Länge (auf mehreren derselben standen Urnen); ferner ganz dünne Steinplatten, zwischen denen einzelne Knochen lagen, die der Herr Rath Kirchstein für Menschenknochen erkannte; endlich Bruchstücke von Sandsteinen, die das Ansehen


|




|
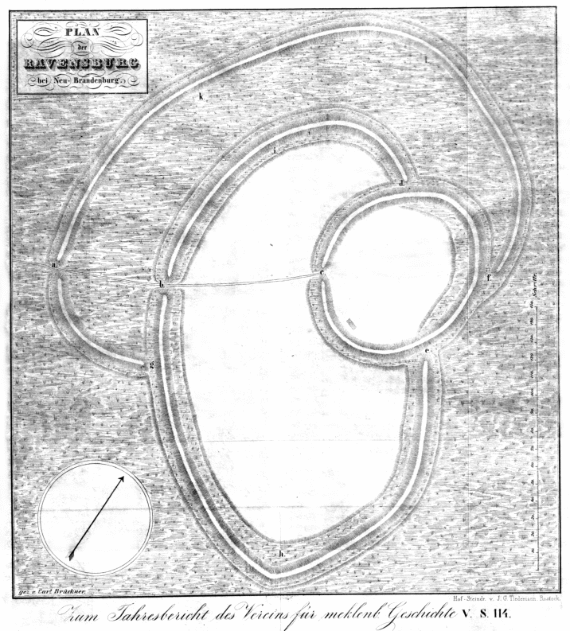


|




|


|
Seite 115 |




|
von Schleifsteinen haben. Einer derselben scheint offenbar als Schleifstein benutzt zu sein.
2) Aus Lehm gebrannte Steine, sowohl von rother Ziegelstein=Masse, wie sie Herr Archivar Lisch oben beschrieben, als auch von sehr harter gelber und schwarzgrauer Masse; weniger gehärtete Lehmmassen scheinen zur Verkleidung der Urnen gedient zu haben.
3) Feuersteine in großer Menge, die größtentheils zum Feueranschlagen gedient zu haben scheinen; auch ein kleines Feuersteinmesser von 1 1/2 Zoll Länge, vielleicht nur Bruchstück eines größeren.
4) Holzkohlen und Asche in großer Menge, theils einzeln, theils in förmlichen Lagern. Bei einem großen Kohlenlager, 4 Fuß tief im Walle und 2 Fuß über dem Urboden, das sich, so weit es aufgedeckt ist, 6 Fuß in die Länge erstreckt, habe ich meine Nachgrabungen für das Jahr 1839 einstellen müssen. In diesem Kohlenlager fand sich das erste Metall, vom Roste gänzlich zerfressenes Eisen, ungefähr 1 Zoll breit und 8 Zoll lang, gebogen wie eine Sichel; es zerbrach mir unter den Händen. Desgleichen ein Stück Eisen in Form eines Schnallenbügels, an dem eine Seitenspange ausgebrochen.
5) Sowohl einzeln, als besonders in den Aschenlagern große Anhäufungen von Thierknochen. Ich habe die verschiedenen Gebisse und Zähne ausgesucht, und Herr Professor Wiegmann zu Berlin hat die Güte gehabt, dieselben zu bestimmen. Sie gehören Schweinen, Kälbern, Rindern, Rehen und Hirschen an; auch sind Zähne darunter, die wahrscheinlich einem Auerochsen angehörten. Herr Prof. Wiegmann bemerkt: "die genera sind gewiß nicht verfehlt; über die Arten kann nur Vergleichung mit Schädeln entscheiden".
6) Kleinere Urnenscherben finden sich in dem Aufschutt des Walles in großer Menge; den zum Theil sehr sorgfältig verzierten Rändern nach zu urtheilen, haben sie mehr als 100 verschiedenen Urnen angehört. Zum Theil sind sie von Feuer geschwärzt, zum Theil haben sie ihre natürliche braune Farbe. Sehr auffallend ist es mir gewesen, daß sich nur wenige Bruchstücke darunter finden, die einer und derselben Urne angehört haben. Zwei Bruchstücke eines Urnenrandes glaube ich noch besonders erwähnen zu müssen; sie passen im Bruche auf das genaueste zusammen; eins derselben aber ist gänzlich von Feuer geschwärzt, das andre hellbraun.
7) Ganze Urnen sind bis jetzt nur sechs gefunden. Sie standen im Aufschutte des Walles auf einer der unter l) beschriebenen Steinplatten, und waren von oben ebenfalls durch


|
Seite 116 |




|
eine Steinplatte oder ein Pflaster von kleinen Steinen geschützt. Sie waren nur mit erdiger Asche angefüllt. Unzerbrochen sie zu Tage zu fördern war zwar nicht möglich, weil sie von Baumwurzeln fast gänzlich um= und durchwachsen waren. Von der größten habe ich jedoch einen bedeutenden Theil vermittelst gummi arabicum wieder zusammenfügen können; sie mißt einen Fuß am Rande im Durchmesser, ist auf einer Seite vom Feuer geschwärzt, auf der andern nicht.
III.
Die älteste schriftliche Nachricht über die sogenannte Ravensburg ertheilt im J. 1610 der damalige Rector der neubrandenburger Schule, Latomus, in seinem Genealochronico Megapolitano. Es heißt daselbst bei Westphal Tom. IV, pag. 225: "Des folgenden Jahres 1248 hat hochgedachter Markgraf von Brandenburg oder fünfte Kurfürst zu Landsberg Johannes I. seinen getreuen Lehnmann, Alberus Raven genannt, so in der Nähe in einem Morast und Holtzung, so noch heutiges Tags die Ravensburg genannt wird, und mit dreien unterschiedlichen Wällen zum Gedächtniß ansichtig ist, gewohnet hat, in Gnaden anbefohlen, eine neue Stadt auf der Grenze zu bauen, und sie nach der Hauptstadt in der Mark Brandenburg, Neuen Brandenburg zu nennen". - Diese Notiz ist von späteren Geschichtsschreibern, wie Klüver, von Behr u. a. ausgeschrieben worden. Erst von Hacke in seiner "Geschichte der Vorderstadt Neubrandenburg 1783" scheint wieder die Ravensburg aus eigener Anschauung zu erwähnen S. 5: "Sein (des Alberus von Raven) Rittersitz war schon vor Erbauung der Stadt die Ravensburg, ohngefähr eine Stunde von der Stadt Neubrandenburg bei dem Dorfe Ihlenfeld. Die Veste, wovon die Grundmauern noch zu sehen, ist mit 3 Wällen umgeben, und liegt mitten in einem morastigen Walde". Seine Bemerkung über die Grundmauern der Veste ist mir besonders deshalb auffallend, weil von Hacke in der genauesten Verbindung mit Gideon Sponholz stand 1 ), und wie seine Chronik S. 12 bezeugt, der Gefährte seiner Nachgrabungen gewesen ist.
Im Jahre 1817 wurde die Ravensburg Gegenstand einer öffentlichen Verhandlung. Der Herr Rath B. Funk hieselbst stellte in den "Nützlichen Beiträgen zu den Neuen Strelitzischen


|
Seite 117 |




|
Anzeigen" No. 39 vom 24. September die Vermuthung auf, die Ravensburg sei ein ähnliches heidnisches Heiligthum gewesen, wie die sogenannte Herthaburg auf Rügen. Die Aehnlichkeit der Lage beider ist sein Hauptargument. Auch macht er auf die für eine Ritterburg ganz ungewöhnliche Lage der Ravensburg aufmerksam, und bemerkt ausdrücklich: "Von Steinhaufen, Fundamenten und irgend einigen Resten von Gebäuden ist nirgends die allergeringste Spur". - Mein Vater, damals Prediger zu Neubrandenburg, vertheidigte dagegen in No. 41 desselben Blattes vom 8. October die gewöhnliche Meinung über die Ravensburg, auf Latomus Zeugniß sich stützend; für die ungewöhnliche Lage derselben fand er hinreichende Veranlassung in der ungemeinen Festigkeit, welche diese Oertlichkeit ihr giebt. Seiner Ansicht pflichtete auch Herr Pastor Sponholz zu Rülow (damals Subrector an der hiesigen lateinischen Schule) in No. 43 und 44 vom 22. und 29. October bei, der unter anderm sagt: "In dem innern Raume konnte ich bei allem Suchen nur einige Stücke von Feldsteinen finden, deren eins aber ganz deutliche Spuren von bearbeiteten Seitenflächen verräth". Auch stellt er die Frage: "Ob denn aber in der Burg nicht ein Erdbohrer oder Nachgrabungen mehr vom Fundamente finden möchten, als meinen Stein, der eine bearbeitete Seitenfläche zeigt?" Nachgrabungen haben nun zwar begonnen, freilich ohne das Fundament einer Burg zu Tage zu fördern. Aber um ein entscheidendes Resultat herbeizuführen und gesicherte Aufschlüsse über diese Umwallung zu geben, bedarf es noch weit umfassenderer Untersuchungen, als bis jetzt haben statt finden können. Sobald es die Jahreszeit erlaubt, werde ich die Nachgrabungen mit allem Eifer fortsetzen.
Neubrandenburg, den 31. Januar 1840.
F. Boll.



|



|
|
:
|
Die Heidenmauer beim Eulenkrug
und
die Riesenmauer bei Granzin
oder
die Landwehren der Grafschaft Schwerin.
Im Jahresbericht IV, S. 76 - 79 ist von diesen zwei großen Steinmauern bei Granzin und Brüsewitz die Rede gewesen, ohne daß deren Bedeutung hätte bestimmt werden können. S. 79 ist die Vermuthung aufgestellt, sie dürften alte Land=


|
Seite 118 |




|
wehren oder Landesgrenzen sein. Diese Ansicht stellt sich jetzt als die wahrscheinlich richtige hervor; in den Urkunden über die Theilung der Vogtei Schwerin zwischen den Herzogen, König Albrecht und Johann, vom J. 1407 heißt es nämlich:
"de lantwere to Bruseuitze scholen beyder heren lude lyke bekostighen vnde bewerken vnde beyde heren vnde de eren scholen erer lyke bruken";
und:
"den haluen see to Wanderum, dede licht to der lantwere wart (im Gegensatze von dem haluen Wanderomer see, dede licht to dermolen (Neumühle) wart");
ferner:
"Pycher halff, de syde do to krentzelyn wart lycht, vnde de helffte des holtes, dede licht to der landwere wart, de horet to der syde to Krentzelyn wart".
Vergleicht man hiemit die Beschreibung im Jahresber. IV a. a. O., so kann man sich kaum der Vermuthung enthalten, daß die dort beschriebenen Steinmauern die Reste der Landwehren der Vogtei oder der Grafschaft Schwerin seien.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Grabow.
Die Stadt Grabow hat aus dem Brande vom 3. Junius 1725 nichts Alterthümliches an Bauwerken gerettet, als die Kirche, und auch diese hat durch den Brand so sehr gelitten, daß sie nichts weiter als einige wenige Eigenthümlichkeiten im Bau bewahrt. Der gegenwärtige Bericht kann also vorzüglich nur dazu dienen, daß sich in Zukunft Niemand bemüht, Werke alter Kunst in Grabow aufzusuchen.
Die Kirche ist ein Oblongum, bestehend aus Chor, Schiff und Thurm; das Schiff hat Seitenschiffe, welche mit dem Hauptschiffe durch drei Bogen in Verbindung stehen. Diese Bogen, welche auf achtseitigen Säulen ruhen, sämtliche Fenster der Kirche und die Eingangspforten zum Schiffe sind im Spitzbogen gebaut. Das Schiff hat das Gewölbe verloren und ist mit Brettern überlegt. Der Chor ist aber noch gewölbt; er hat zwei Gewölbe im Rundbogenstyl, welche auf breiten Trägern, wahrscheinlich Resten von Pilastern ruhen, die abgehauen zu sein scheinen. Der Hauptgurtbogen zwischen Chor und Schiff ist auch Rundbogen, ebenso Pforte des Thurms


|
Seite 119 |




|
und Eingang aus dem Thurme zum Schiffe. Der Thurm hat aber ohne Zweifel öfter Restaurationen erlitten, so daß der Styl der Grundmauern nicht mehr mit Sicherheit erkannt werden kann. Der Bau der Kirche dürfte daher wohl in die Zeit des Ueberganges vom Rundbogenstyl in den Spitzbogenstyl fallen.
Ein alter Altar mit Schnitzwerk, welcher nach dem letzten Brande für die Kirche (in Lübeck?) gekauft ist, ist durch ein neues, schlechtes Oelgemälde verdeckt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Hospital zu St. Georg vor Rostock.
Auszug aus dem Rechnungsbuche des Hospitals zu St. Georg zu Rostock, von Michaelis 1630/31, geführt vom Vorsteher Jürgen Hagemeister:
"1631, den 22. Augustj des Abends vmb 5 Vhr der St. Jürgen durch Haubtman Moyses Soldatesca angestecket worden, vnd gebrand den 23, 24, 25 Aug., vnd auch ferner, vnd was nicht abgebrandt, herunter gerissen, alles demolirt, ruinirt, geraubet, geplündert vnd alles weggenommen worden, darauff die Armen, Arme Prövener, vnd was nicht sonst unterkommen können, in mein Hauß gekommen, vnd Ich Ihnen mein Hauß vnd Hinderhauß so woll mein Hauß auf der Ecke neben den Keller vnd wohnungen vergonnen vnd einthun müßen, also daß ich neben den meinen im Hause kaum raum gehabt, bis man dieselbe laut vbergebenem Memorial vnterbringen können, dieselbe auch nach ihrer gelegenheit nottürftiger weise vnterdeßen vnterhalten, vnd nach meiner gelegenheit viel gegeben, so sich wegen vieler beschwerungen, Vberläuffen vnd mitleiden vnd wehemuth nicht anschreiben oder Rechnung davon halten können".
Ich füge diesem Auszuge noch hinzu, daß man auf dem St. Georgshofe vor dem Steinthor bei vorfallenden Bauten, namentlich dort, wo die Kirche und das sogenannte "Theilhaus" - wo die Naturalhebungen der Präbener ausgetheilt wurden, und wo die Vorsteher die Geschäfte abmachten, also was jetzt die Mesterei genannt wird - gestanden haben sollen, auf große und starke Fundamente stößt. Das jetzige Krughaus daselbst ist in seinen Mauern nicht vom Brande verzehrt worden und ist dasselbe wahrscheinlich ein Theil des ehemaligen Theilhauses. Es ist massiv und in den Außenmauern sind noch ein paar Steine mit eingehauenen plattdeutschen Inschriften (Bibel=


|
Seite 120 |




|
sprüchen) befindlich. In diesem alten Hause wird auch jährlich auf der ziemlich geräumigen Diele, nach altem Gebrauche, zweimal Gottesdienst gehalten, einmal vor und einmal nach der Ernte. - (Mittheilung des Herrn Kaufmanns und Hospital=Vorstehers G. Prang zu Rostock.)
Burgstelle zu Göldenitz.
Zu Göldenitz, einem rostocker Hospitaldorfe, ist eine Anhöhe, nicht weit von einem See entfernt, welche "de Borg" genannt wird; es geht die Sage, daß dort eine Burg gestanden haben soll. (Mittheilung des Hospital=Vorstehers, Herrn Kaufmanns G. Prang zu Rostock.)
Moskowiterberg zu Dallwitzhof.
Auf der Feldmark des Hospitalgutes Dallwitzhof ist ein Hügel befindlich, der den Namen "Moskowiterberg" 1 ) führt. (Mittheilung des Herrn Kaufmanns und Hospital=Vorstehers G. Prang zu Rostock.)



|



|
|
:
|
II. Nachrichten von Bildwerken verschiedener Art.
Urne von Friedland.
Von einzelnen mit Steinbrechen für die neue Kunststraße beschäftigten Arbeitern ward auf der Westseite von Friedland nach Genzkow hin in flacher Erde zwischen Steine verpackt eine bedeutend große Urne zu Tage gefördert, die wenigstens zu Zweidrittheilen ihres Umfanges noch erhalten ist. Sie mißt 8 1/2" Höhe, hat im Fuß 4 1/2" Durchmesser, in der größten Bauchweite 11", im obern dünnen und wenig gekrämptem Rande 10 1/2". Von graubraunem Thone, auf der Scheibe geformt, gebrannt, sind die Seitenwände stark 1/4". Im Bruch erscheint der Thon von der Art Erde, welche der Sprachgebrauch hier mit blauem Schindel bezeichnet, doch mit eingestreuten Sandkörnern und Glimmer. Das Grabgeräth, glatt ohne verzierende Striche, ist ein ossuarium: in demselben befanden sich Knochenreste mit Asche, von den Findern verschüttet. Gedeckelt war dasselbe mit zwei platten Steinen, ebenfalls von jenen verworfen. In der Urne fanden sich, durchaus von Eisen und wohl erhalten abgeliefert: eine Speerspitze mit einem Theile


|
Seite 121 |




|
der Schafttülle, gegen 6" lang, fast herzförmig mit vorspringender starker Spitze. Das Geräth ist zweischneidig, auf jeder breiten Seite mit einem Rücken, der bis in die Spitze ausläuft, diese fast vierschneidig gestaltet. Zwar hat der Rost den untern Theil des Speers stark angegriffen, die Spitze aber ist rein von demselben und noch so gut erhalten, daß man sie für Stahl halten muß. Ferner das Fragment eines Streitbeils, halbmondförmig 1 ), von der Dicke eines Messerrückens mit wohl erhaltener, ebenfalls wie verstahlt erscheinender Schneide. Gegen den Rücken hin hat das Beil ein Loch von dem Umfang einer starken Federspule. Dann eine Messerklinge mit Heft 6" lang, 3/4" breit, mit starkem Rücken, unsern heutigen Fangmessern nicht unähnlich. Die Spitze und ein Theil der Schneide ist vom Rost kaum berührt. Endlich eine runde Schnalle, von welcher die Zunge durch den Rost getrennt ist. - Neben dieser Urne ward das Bruchstück des Fußes einer zweiten gefunden, das an der Seitenwand mit senkrechten, dicht an einander gehaltenen Strichen verziert ist.
Der Fund ist in die großherzogliche Sammlung von Alterthümern zu Neustrelitz abgeliefert.
Rülow.
Sponholz.
Beachtenswerth mag noch der Umstand erscheinen, daß man schon seit Jahren in Friedland die Bemerkung gemacht, wie die in und bei Urnen gefundenen Werkzeuge auf der Ostseite des Stadtgebietes nur von Bronze, auf der Westseite desselben stets von Eisen vorkommen.



|



|
|
:
|
Beschreibung
einiger Gegenstände in der naturhistorischen und Antiquitäten=Sammlung des Physicus zu Mirow, Hrn. Dr. Rudolphi.
Die gedachte Sammlung, früher Eigenthum des Vaters des jetzigen Besitzers, des sel. Past. Rudolphi zu Friedland, über deren allerdings sehenswerthe Einzelnheiten im Jahresbericht I, S. 35 ff. nähere Nachricht gegeben ist, bietet doch noch Manches dar, das einer nähern Beachtung werth ist. Beim Mangel eines Katalogs derselben erlaube ich mir die Beschreibung folgender Gegenstände in derselben.
a. Das linke Horn eines Büffelochsen oder Auerochsen (B. Urus), gefunden bei Retzow, 1 Meile von Mirow, in der Nähe der Müritz. Arbeiter, welche durch eine sumpfige
D. Red.


|
Seite 122 |




|
Wiese einen Graben zogen, stießen auf dasselbe, und fanden nicht weit davon einen jener stärkern Hämmer von Stein, Streithämmer geheißen, dessen Oberfläche theilweise stark von Säuren angegriffen erscheint. Das Horn von grober Textur, im Innern mit hohlen Gängen, schwarzbraun von Farbe, hat starke Poren, am untern Ende mehrere starke, runde Furchen. Es ist kegelförmig zulaufend ohne scharfe Spitze, auf 2/3 der Länge nach vorn gekrümmt. An der Krone - es ist völlig erhalten, noch sehr hart, und dicht über dem Schädel gewaltsam abgeschlagen - mißt es im Umfang 12 1/4 rheinl. Zoll, bei einer Länge von 1 F. 9 Z. Das Gewicht desselben beträgt 4 Pfd. 10 Lth. Aus der innern Höhlung schüttelte ich noch schwarze Wiesenerde. Der Fundbericht ist zuverlässig, da gedachter Herr Dr. Rudolphi selbst jenes Horn gleich nach dem Funde erhalten hat. - Vgl. Jahrbüch. des Vereins II, S. 87, Anm. l.
b. Eben so erhielt er ein aus einem Arm der Müritz mit dem Netz heraufgezogenes Geweih eines Elen (Cerv. alces). Ein Fischer in Laertz bei Mirow, der es heraufgezogen, wollte es so eben zersägen, um die scharfen Schaufeln (Stangen) beim Korbflechten als Werkzeug zu benutzen, als es der jetzige Besitzer vom Untergange rettete. Dies einzelne Geweih hat über der etwa 3 Z. langen Kolbe, wo es sich in eine handförmige Fläche ausbreitet, von einer der untern Stangen bis zur gegenüberstehenden, leider abgebrochenen, eine Breite von 1 F. 9 - 10 Z. gehabt bei einer Länge, von der Krone bis zur äußersten Spitze der mittlern Stange gemessen, von 1 F. 7 1/4 Z. Der Stangen sind 7 gewesen, wovon 6 noch wohl erhalten sind. Die einer hohlen Hand ähnliche Fläche unterhalb der Stangen ist 1 F. 4 Z. breit, ungefähr halb so hoch. Das Geweih hat noch ein Gewicht von 5 Pfd. Die Textur ist hie und da vom Wasser durch die Länge der Zeit angegriffen, doch im untern Theile der Fläche und in den Stangen oder Zinken noch fest 1 ).
Im November 1839.
F. P. Sponholz.



|



|
|
:
|
Alter Taufstein zu Rülow.
Seit Jahren ruhte am Eingange zum Thurm unsrer Kirche bis auf den Rand von etwa 3 Zoll in die Erde versunken ein alter Taufstein, der die obern Theile roher Figurenbildung auf
G. C. F. Lisch.


|
Seite 123 |




|
seinem äußern Umfange erkennen ließ. Theils um ihn vor Beschädigungen der Schuljugend zu schützen, theils um ihn von dem darin angesammelten Regenwasser zu befreien, ward ich veranlaßt, ihn aus der Erde heben zu lassen, und ihm dann seine Stelle auf einem freien Rasenplatze vor dem hiesigen Pfarrhause anzuweisen. Zufällig fand ich im Thurm selbst den massiven Fuß, auf welchem jener ehemals gestanden. Auch jetzt dient derselbe jenem als Unterlage. Dieser Fuß ist ein grobkörniger, hie und da röthlich gesprenkelter Granit, 1 F. 3 Z. hoch, rund und ziemlich glatt bearbeitet, in abgestutzter Kegelform, oben 1 F. 8 Z., unten 1 F. 17 Z. im Durchmesser haltend, doch mit drei an den Seiten hervorragenden Füßen. Der Taufstein selbst, von einer dunklern Granitmasse, hie und da mit eingesprengten unausgebildeten Granaten, ist rund, hat 9 1/2 F. äußern Umfang, ist 1 F. 8 Z. hoch bei einem innern Durchmesser von 2 F. 4 Z. Der Rand ist 3 3/4 Z. dick. Der innere Raum ist muldenförmig 1 F. 4 Z. tief. Mit roh gearbeiteten Gebilden ist der ganze äußere Umfang des Steins versehen. In der Mitte der gekreuzigte Heiland, das Haupt mit dem Heiligenschein umgeben, die Füße frei auf einer Unterlage stehend. Die Andeutungen von Fingern sind bei aller Rohheit der Sculptur unverkennbar. Zur rechten Seite unmittelbar unter dem gekreuzigten Arm - die Höhe des Steins hat sich dem Verhältniß der Figuren nicht fügen wollen - eine weibliche Figur, die mit der linken Hand den Fuß des Gekreuzigten berührt, den rechten Arm über die eigne Brust gelegt. Zur Linken des Kreuzes eine zweite weibliche Figur, durchaus roh mit unförmlichen Armen, die wie Henkel - den zuweilen von Bäckern geformten Semmelpuppen ähnlich - am Körper sitzen. Auf jede der beiden Figuren folgt die Lilie, leidlich geformt; dann zur Rechten zwei menschliche Antlitze, das erstere mit einem Nimbus, das andere mit einem Stirnbande. Darauf erblickt man weiter fort an dieser Seite ein kleineres menschliches Antlitz mit Stirnband auf einem Postament stehend. Ein höchst roh gezeichnetes Menschengesicht schließt die Reihe der Gebilde an dieser Seite. Zur Linken des Gekreuzigten folgen auf die schon gedachte weibliche Figur und Lilie noch zwei menschliche Antlitze, denen der rechten Seite ähnlich, doch zu jeder Seite mit der Lilie.
Der Taufstein hat wahrscheinlich ein weit hinauf reichendes Alter. Die rohe Steinmetz=Arbeit in den Figuren läßt, wie Herr Archivar Lisch bei eigner Ansicht desselben äußerte, seine Entstehung in den frühsten christlichen Zeiten unsers Vaterlandes ahnen.
Sponholz.


|
Seite 124 |




|



|



|
|
:
|
Die heil. Catharina auf Altarblättern.
Schon im Jahresber. III, S. 147, 163 und 193 ist des häufigen Vorkommens der heil. Katharina auf Altarblättern und Glocken aus der katholischen Zeit im Meklenb.=Schwer. gedacht. Vielleicht hat es einiges Interesse, zu wissen, daß die Heilige auch im Meklenb.=Strel. nicht fehle. Sie kam mir bisher auf alten Altarblättern in der Kirche zu Klockow und zu Brunn vor. Wie reimt sich aber die an jenes Heiligenbild geknüpfte, hier mir schon wiederholt vorgekommene Sage: Wo am Altare jene weibliche gekrönte Heilige mit einem zerbrochenen Rade im rechten Arm vorkomme - man wußte ihren Namen nicht -, da seien noch Schätze verborgen? Die Sage ist selbst im Munde ganz gebildeter Männer. Hat die Erfahrung sie etwa hie und da bestätigt?
Rülow.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Reliquienkapsel von A. Käbelich.
Als im J. 1822 die Kirche zu A. Käbelich, Amts Stargard, im Innern abgeweißt wurde, entdeckte man auf der Oberfläche des Altars eine Oeffnung, worin eine kleine Kapsel mit einigen Knochenstückchen, in seidene und sammtne Läppchen gehüllt, nebst einigen Pergamentstreifen mit Mönchsschrift befindlich waren. Die Schrift war sehr verwittert und größtentheils unleserlich; doch hat der sel. Präp. Horn, damals Pastor daselbst, auf einem der letztern herausgebracht: [Symbol: anno] 1290 consecratum est hoc altare - - -. Jene Knochenreste sind wahrscheinlich Reliquien des heil. Laurentius; denn später entzifferte man noch auf einem der Streifen: St. Laurentii. Alles ist wieder an seinen Ort gelegt und vermauert. Die ganze Kirche in ihrer Bauart, die Nischen am Thurm, in welchen wahrscheinlich Heiligenbilder ihre Stelle hatten, eine der Inschrift nach sehr alte Glocke, wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert, zeugen für ein hohes Alter dieser Kirche.
Rülow.
Sponholz.



|



|
|
:
|
Alte rostocker Leichensteine in der Schloßkirche zu Schwerin.
Im Jahresber. II, S. 121 ist eines alten Leichensteines gedacht, auf welchem die Eingangspforte der Schloßkirche steht. Im October 1839 entdeckte man bei Gelegenheit der Restaurirung dieser Kirche, daß auch zu den beiden Altarstufen alte Leichensteine benutzt worden seien.


|
Seite 125 |




|
Es ist noch zu lesen von der Inschrift
1) des Steins in der untern Stufe:
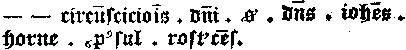
( [in die] circumcisionis domini obiit dominus
Johannes Horne proconsul rostoccensis).
2) des Steins in der obern Stufe mit ungewöhnlich vielen zusammengezogenen Buchstaben:
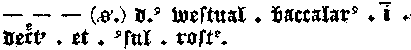
(obiit dominus (?) Westval baccalaureus in decretis et consul rostoccensis).
Beide Männer: der Burgemeister Johannes Horne und der Rathmann Westphal zu Rostock sind bisher aus den bekannten Verzeichnissen der Mitglieder des rostocker Raths noch nicht bekannt geworden. Der erste Stein scheint aus dem Ende des 14., der zweite aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts zu sein.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Der Altar in der Schloßkirche zu Schwerin
ist in den Jahren 1561 - 62 von dem Bildhauer Georg Schröder zu Torgau gemacht; der später aufgefundene Contract hierüber wird nachträglich zu Jahrbüch. V, S. 53 hier mitgetheilt.
"Zu wissen, das wir Johans Albrecht von gots
gnadenn Hertzogk zu Meckelnnburgk
![]() . Vnns heut Dato mit vnnserm liebenn
besondernn Jürgenn Schrotter Bildhawernn zu Thorgaw
vmb einen Altar vnnd darauff eine schone, zirliche
vnnd kunstreiche Tafell vonn Alabaster vnnd dann
auch ahnn drey seytenn des berurten Altars die vier
Euangelistenn von Alabaster eingelegett Vnnß inn
vnnser Capellen alhie allenthalbenn nach der Vnns
zugestalten Viesierunge zwischenn hieher vnd
negstkunftigenn Martini aufs vleissigste, zirlichste
vnnd seinem bestenn verstande nach vfs
kunstreichste, Wie solchs einem getrewenn Meister zu
thun, eigent vnnd gepurt, zu machenn vnnd zu
uorfertigenn vnnd darnach vf vnnsernn vncostenn zu
Vnns hereinher zu bringenn vnnd selbst zu uorsetzenn
vnnd aufzurichtenn endlich vnnd grundlich
vorglichenn vnnd vortragenn haben, Darzu Wir ihme
notturfftigenn Alabaster vorschaffenn wollenn, Vnnd
soll die Tafell des Altars inn die sechstehalb elenn
hoch vnnd funff ellenn mit denn funtzenn (?) breidt
sein. Dargegenn
. Vnns heut Dato mit vnnserm liebenn
besondernn Jürgenn Schrotter Bildhawernn zu Thorgaw
vmb einen Altar vnnd darauff eine schone, zirliche
vnnd kunstreiche Tafell vonn Alabaster vnnd dann
auch ahnn drey seytenn des berurten Altars die vier
Euangelistenn von Alabaster eingelegett Vnnß inn
vnnser Capellen alhie allenthalbenn nach der Vnns
zugestalten Viesierunge zwischenn hieher vnd
negstkunftigenn Martini aufs vleissigste, zirlichste
vnnd seinem bestenn verstande nach vfs
kunstreichste, Wie solchs einem getrewenn Meister zu
thun, eigent vnnd gepurt, zu machenn vnnd zu
uorfertigenn vnnd darnach vf vnnsernn vncostenn zu
Vnns hereinher zu bringenn vnnd selbst zu uorsetzenn
vnnd aufzurichtenn endlich vnnd grundlich
vorglichenn vnnd vortragenn haben, Darzu Wir ihme
notturfftigenn Alabaster vorschaffenn wollenn, Vnnd
soll die Tafell des Altars inn die sechstehalb elenn
hoch vnnd funff ellenn mit denn funtzenn (?) breidt
sein. Dargegenn


|
Seite 126 |




|
vnnd herwiederumb habenn Wir ihme für solche seine kunstreiche vnd wolgemachte arbeitt vollendt vndt gentzlich wie obstehet zu machenn Ein hundert vnnd sechtzigk Thaler, Vnnd dann auch vonn wegenn einer Alabaster Tauffe, darann etwas zurbrochenn, Welchs er wieder bessernn vnnd zurecht bringenn soll, ein kleidt zu gebenn versprochenn vnnd zugesagt. Alles trewlich vnnd vnngeuerlich. Des zu Vrkundt stetter vnnd vester haltunge habenn Wir diesenn Receß mit vnnserm Pitzschir wissentlich bekreftigett. Gebenn zu Schwerin den 4. Julii Anno der weiniger Zall Ein vnnd Sechtzigk."
(Nach einer Abschrift im Großherzogl. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin.)
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Münzfund von Warlin.
Auf dem Felde von Georgendorf, zu Warlin bei Neubrandenburg gehörig, ward im Spätherbste des J. 1833 ein bedeutender Fund von Münzen und Kostbarkeiten gemacht, der im Ganzen aus dem zehnten Jahrhundert stammt. Schon im Freimüth. Abendblatt, 1834, Nr. 791, ward dieser Fund folgendermaßen beschrieben. "Es war im Spätherbst des v. J., "als ein Haker auf der warliner Feldmark hart an der Grenze von Pragsdorf auf einem mit Sand bedeckten Lehmberge in der Tiefe von kaum 1 Fuß einen Topf mit einer Menge alter, sehr alter Münzen aushakte. Nur sieben Stücke, deren Beschaffenheit Sammlern und Forschern näher anzudeuten Einsender sich erlaubt, sind dem Verderben entzogen und in Sammlungen gekommen." Die 4 ersten Münzen, welche hierauf im Freim. Abendbl. sehr unklar beschrieben werden, sind deutsche Münzen mit dem Gepräge der Kirche, von denen einige den unten Nr. 21, 22 und 24 beschriebenen ähnlich gewesen sind. "Die bei weitem interessanteste Münze", fährt der Berichterstatter fort, "ist aber Nr. 5. Sie ist von der "Größe eines preußischen Viergroschenstücks, doch dünner, trägt sicht= und lesbar auf beiden Seiten arabische Charaktere, welche ein Kenner der Sprache, Herr Conrector Langbein in Friedland, vollständig entziffert hat. Man liest nach dessen Deutung:
"Avers:
1) Fläche: Es ist kein Gott als der einige Gott, ihm ist kein Theilnehmer."
"2) Innerer Rand: Im Namen Gottes ist dieser Dirhem geschlagen in Samerkand im Jahre 344"
(n. Chr. 955).


|
Seite 127 |




|
3) Aeußerer Rand: "Aus dem Kor. Sure 30, 4. 5. Gott hat die Herrschaft über das Vergangene und Zukünftige; jetzt freuen sich die Gläubigen der Hülfe Gottes."
"Revers:
1) Fläche: Gotte. Muhammed, der Gesandte Gottes. Almostaksi billah. Nuch' ben Nasr."
"2) Rand: Koran, Sure. 9, 33. Muhammed ist der Gesandte Gottes, den er gesandt hat mit der Leitung und wahren Religion, um sie zu erheben über alle Religionen, wenn sich auch widersetzen diejenigen, welche Gott Theilnehmer zugesellen."
"Eine Schwierigkeit ist hiebei dem gefälligen Uebersetzer aufgestoßen, darin bestehend: der Chalif Almostaksi billah wurde schon 334 d. H. (n. Chr. 947) der Regierung entsetzt und der semanidische Statthalter von Transoxana: Nuch ben Nasr starb schon 343 d. H. (954 n. Chr.). Wie kommen ihre Namen noch 344 auf Münzen vor?"
"Später gelangte Einsender noch unmittelbar von Findern in den Besitz von Fragmenten zweier sehr verschiedener Münzen. Das erstere rührt offenbar von einer der unter" (Nr. 24 unten) beschriebenen ähnlichen Münze her; das andere, der vierte Theil einer Münze, die an Umfang ein altes Achtgroschen= stück übertroffen hat, trägt auf beiden Seiten sehr grelle ara= bische Inschrift, deren Deutung noch nicht entziffert ist."
Ueber diesen interessanten Fund hat nun der Herr Rath Dr. Kirchstein zu Neubrandenburg weitere, willkommene Aufklärung gegeben. Auch zu ihm kam ein Schäfer von Warlin mit einem Beutel voll Münzen, als er grade im Begriffe war zu verreisen; der Schäfer schüttete die Münzen - es mochten ihrer wohl 200 sein - auf den Tisch und der Herr Dr. Kirchstein suchte aus, was für den Augenblick deutliches Gepräge zu haben schien. Mit dem Rest ging der Schäfer weiter, und der Fund zerstreute sich an Juden und Goldschmiede in Schmelztiegel. Was von dem Funde noch übrig sein mag, ist im Besitze des Herrn Raths Dr. Kirchstein, welcher dem Unterzeichneten die Münzen, alle Denare mit Ausnahme eines Stückes Nr. 25, zu der folgenden Beschreibung gütigst vorgelegt hat.
Deutsche Kaisermünzen.
Otto I. (936 - 973).
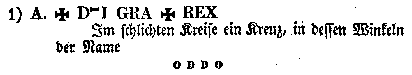


|
Seite 128 |




|
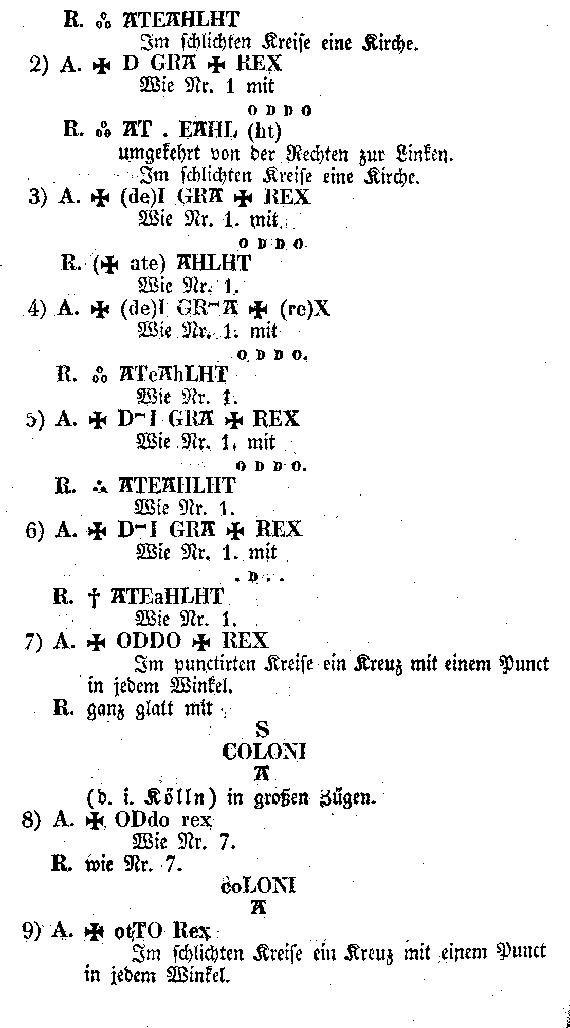


|
Seite 129 |




|
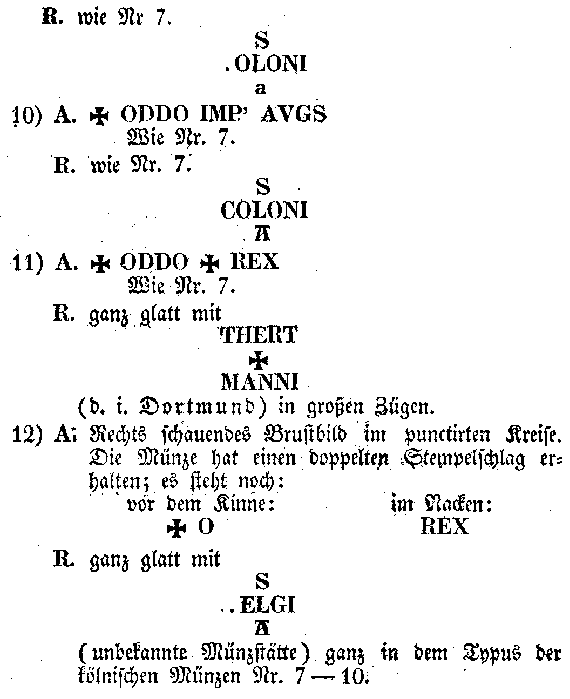
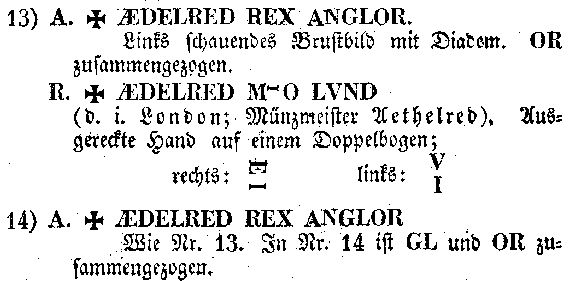


|
Seite 130 |




|
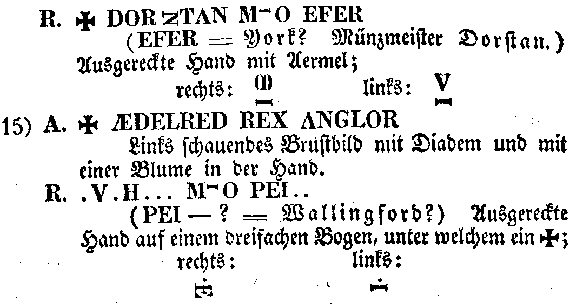
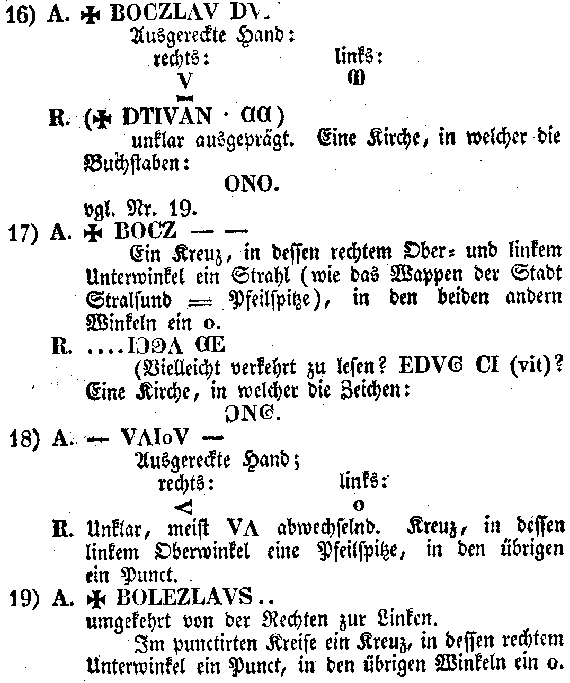


|
Seite 131 |




|
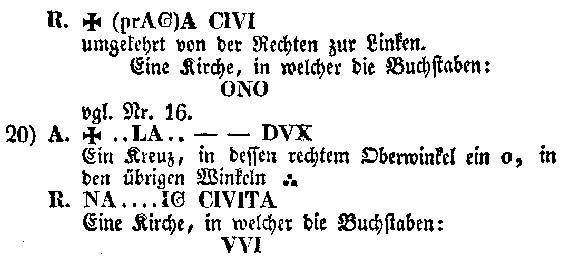
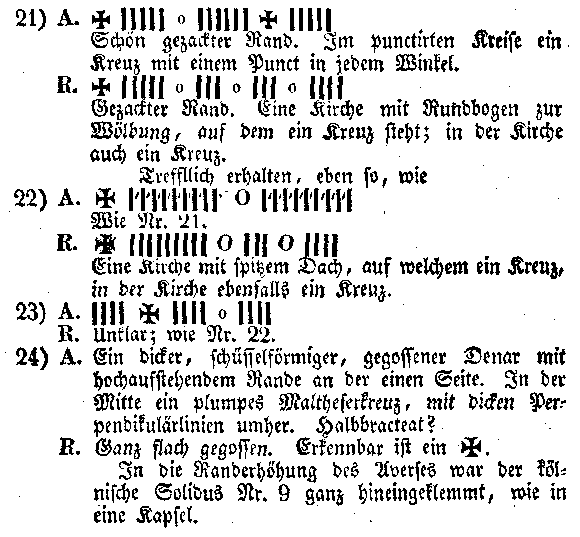
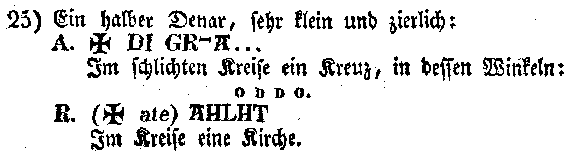


|
Seite 132 |




|
"Außer diesen Münzen", sagt der Berichterstatter im Freim. Abendbl., "sind früher von Suchenden nach Aussage eines glaubwürdigen Augenzeugen einzelne Bruchstücke von silbernen Ketten, dergl. Nägel (Spangen?) gefunden, aber sofort in die Hände von Israels Nachkommen gerathen." - Der Herr Rath Dr. Kirchstein versichert, bei dem Funde auch ein kleines Schmuckgefäß von durchbrochener Silberarbeit gesehen zu haben, das jedoch von einem Goldschmiede erhandelt und umgeschmolzen sei.
Sehr merkwürdig ist aber ein Ring, der ebenfalls neben den Münzen gefunden ward. Der Ring, der schon im Jahresbericht I, S. 37 beschrieben ist, war ebenfalls von durchbrochener Silberarbeit; eingefaßt war ein Karneol mit eingelegter Goldarbeit. Diesen Ring kaufte mit mehrern Münzen der Goldarbeiter Henck in Neubrandenburg, der den Stein, nachdem er alles eingehandelte Silber von dem Funde eingeschmolzen hatte, dem Herrn Rath Dr. Kirchstein schenkte, in dessen Besitz er sich noch befindet. Es ist ein trefflicher, ovaler Karneol, 5/8" lang. und 7/16" breit; eingelegt ist mit höchst sauberer und vollkommener Arbeit ein fünfarmiger Leuchter in Gold; die Flammen der Lichter sind von weißem Metall, wahrscheinlich Silber, eingelegt; neben dem Fuße des Leuchters sind zwei goldene Sternchen eingelegt. Oben herum sind, wie auf einem Siegel, mit sehr kleinen meisterhaft gezeichneten Buchstaben die hebräischen Worte in Gold eingelegt:
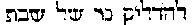
d. i.: = ad incendendum lucernam quae (est)
sabbati,
d. i.: = anzuzünden den Leuchter des
Sabbat,
nach der Erklärung des Hrn. Pastors
Boll zu Neubrandenburg.
Dieser ganze Fund, der aus dem 10. Jahrb. stammt, hat die auffallendste Aehnlichkeit mit dem bei Münsterwalde auf dem jenseitigen Ufer der Weichsel, ungefähr zur Zeit der Auffindung der bei Warlin ausgepflügten Münzen, gefundenen Schatze (vgl. Jahresber. der pommerschen Gesellsch. VII, 1836, S. 15 - 27), welcher aus einer großen Menge arabischer Münzen aus dem 8. bis 10. Jahrh. und vieler vortrefflicher Filigran=Arbeit aus Silber, wie Schlangen, Ringen und allerlei Schmuck bestand; diese Silberarbeit ist mit der bei dem warliner Funde angetroffenen völlig gleich. Den Münzen nach ward ein ähnlicher Fund bei Buggentin gemacht (vgl. Jahresber. der pomm. Ges. XIII, 1839, S. 17 flgd.), in welchem auch viele arabische, ottonische und kölnische Münzen vorkommen. - Sollte die Wiederholung von dergleichen Funden nicht darauf hindeuten,


|
Seite 133 |




|
daß die verborgenen Schätze arabischen Handelsleuten angehört haben, da sich neben den unzweifelhaft orientalischen Schmucksachen nicht nur arabische, sondern auch wahrscheinlich eingelöste europäische Münzen, die nach andern Funden in den Wendenländern coursirten, finden?
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Münzfund im Großherzogthum Meklenburg=Strelitz (bei Warlin?).
Nachdem der Hofrath Reinecke zu Neustrelitz gestorben war, fand sich in dessen Nachlasse eine kleine Münzsammlung; er hatte, als Alterthumsfreund, alle Münzen, die ihm bei seinem Leben als interessant in die Hände gekommen waren, bei Seite gelegt, ohne grade auf Münzen Jagd zu machen und es auf eine systematische Sammlung anzulegen. In diesem Münznachlasse fand sich auch ein Beutel mit kleinen Scheidemünzen aller Art, unter denen sich auch eine Anzahl altmittelalterlicher Münzen befand, welche ich für die Großherzogl. Sammlung zu Schwerin durch Kauf erwarb. Beim Studium derselben ward es bald klar, daß, nach Rost und dem ganzen Ansehen zu schließen, eine gewisse Anzahl zusammengehörte und aus demselben Funde stammte. Es sind dies die nachstehend beschriebenen 85 Münzen, welche ungefähr in die Zeit von 950 bis 1050 fallen, andern Funden aus alter Zeit, namentlich dem norwegischen Funde von Egersund (vgl. Münzzeitung III, S. 137 flgd.), auffallend ähnlich sind und manche seltene Stücke bieten. Wo und wie diese Münzen gefunden sind, ist nicht mehr zu ermitteln; jedoch ist es leicht möglich, daß sie ebenfalls Reste des Fundes von Warlin (vgl. oben S. 126) bilden. Ehe ich diese Münzen in die Großherzogl. Münzsammlung einreihte, hielt ich es für Pflicht, mit Hülfe unsers Freundes Thomsen in Kopenhagen, sie im Zusammenhange zu beschreiben.
G. C. F. Lisch.
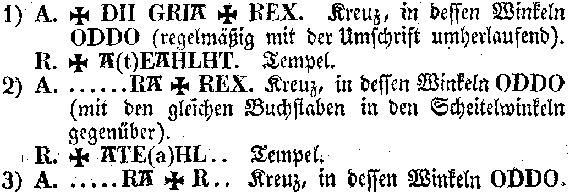


|
Seite 134 |




|
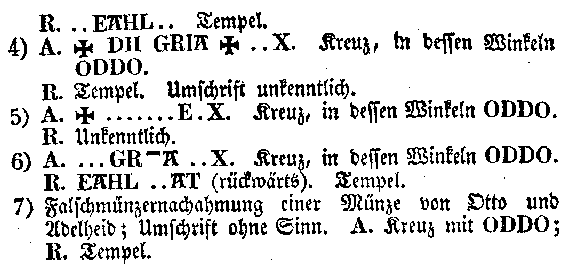
Köln
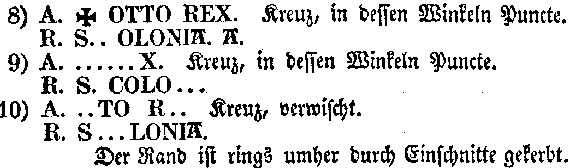
Mainz.
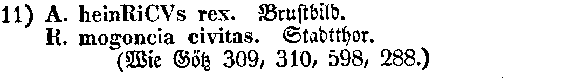
Erzbischof Piligrim. 1021 - 1036.
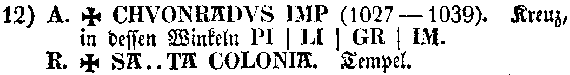
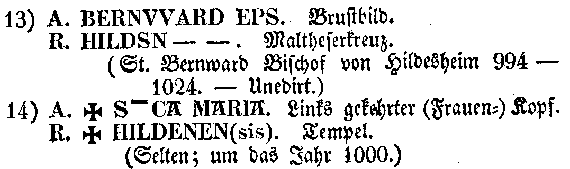
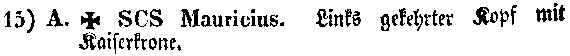


|
Seite 135 |




|
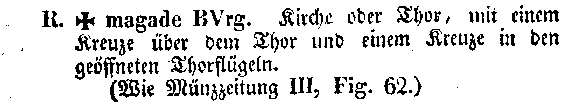
Herzog Bernhard 1011 - 1062.
(Vgl. Jahresber. IV, S. 104 u. 105.)
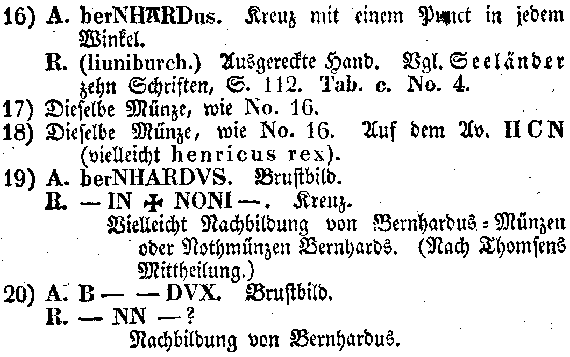
(962 - 973.)

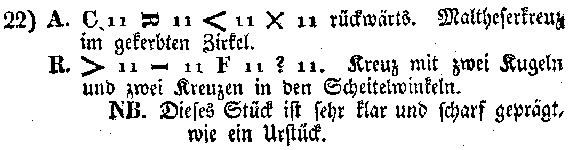


|
Seite 136 |




|
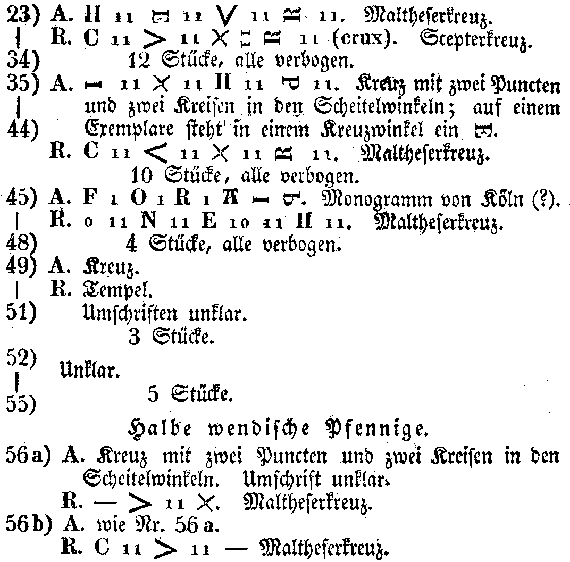
Herzog Bretislav I. 1037 - 1055.
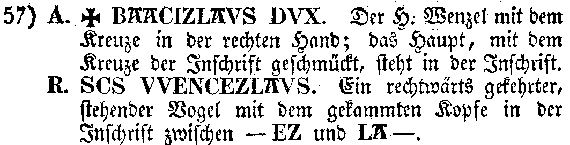
58) wie No. 57.
59) wie No. 57
60) wie No. 57.
61) wie No. 57.
62) wie No. 57.
Diese 6 Münzen, sehr wohl erhalten, anscheinend von 3 verschiedenen Stempeln, haben den Namen des Münzherrn um das Bild des Heiligen und den Namen des Heiligen um das Wappen (?) des Münzherrn.
63) Eine Falschmünzernachbildung mit einem Vogel auf der einen und einem durchgehenden Kreuze mit einem Kreise


|
Seite 137 |




|
mit Punct in jedem Winkel auf der andern Seite, mit ausgeprägten, aber durchaus verworrenen und unleserlichen Umschriften.
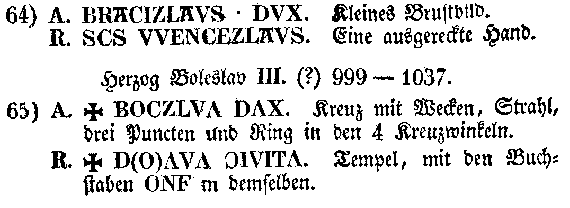
Hiadmer.
(Vgl. Jahresbericht III, S, 104 - 106.)
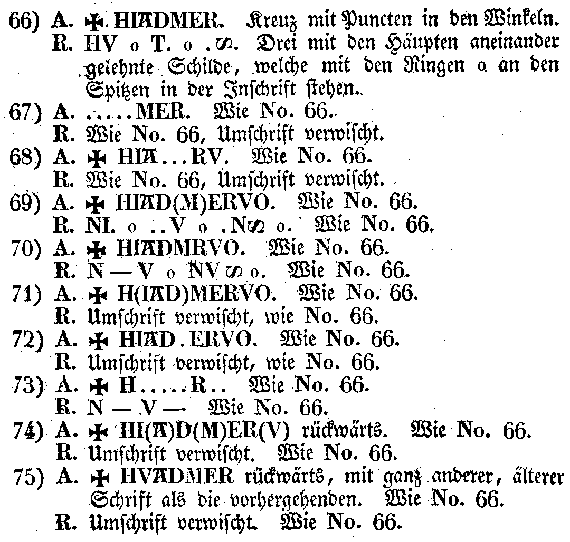
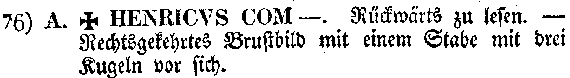


|
Seite 138 |




|
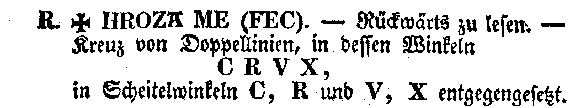
Höchst seltene Münze. Die Umschriften sind nach den wenigen Exemplaren in der königl. Sammlung zu Kopenhagen zuverlässig. Aus mehrern Gründen ist zu vermuthen, daß diese Münze von dem mächtigen Erik Jarl, (1000 - 1015), der sich Hinricus nennt, gemünzt worden, also eine norwegische sei. (Nach Thomsen's Mittheilung.)
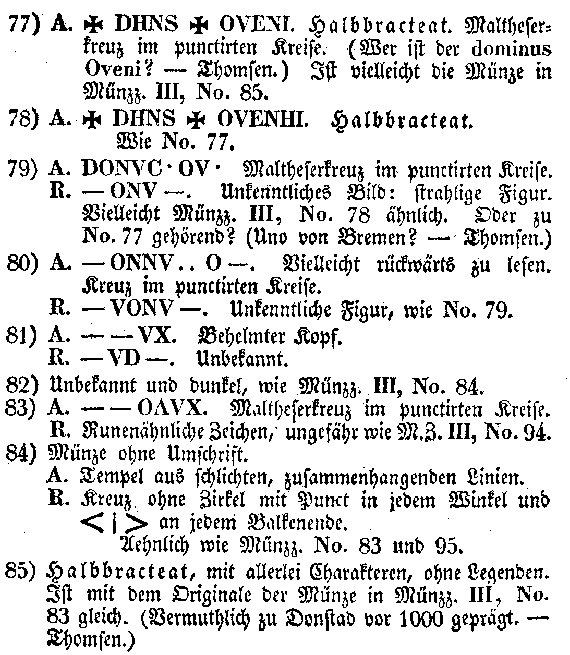


|
Seite 139 |




|



|



|
|
:
|
Seltene Münze aus der Großherzoglichen Alterthümersammlung zu Neustrelitz.
In der Großherzoglichen Alterthümersammlung zu Neustrelitz werden 20 kleine Hohlpfennige aufbewahrt, welche große Aufmerksamkeit verdienen. Sie sind vom kleinsten Durchmesser (von ungefähr 1/2 Zoll), von flachen Platten ohne schüsselförmige Erhebungen und starke Ausdrücke des Stempelschlages, so daß ihre Oberfläche nirgends höher oder tiefer liegt, als die moderner, flacher Münzen, und von feinem Silber. Sie scheinen einige Zeit vor oder kurz nach 1300 geschlagen zu sein. Sie sind den kleinen Dickpfennigen aus dem 12. Jahrh., von denen fast alle dieselben Gepräge in Meklenburg öfter vorkommen, ähnlich und scheinen den Uebergang von diesen zu den "vinkenogen" zu bilden. Von den Geprägen sind noch folgende zu erkennen:
1) ein Stierkopf (Meklenburg) ohne Krone, in zwei Stempelabweichungen.
2) zwei Bischofsstäbe im Andreaskreuze (Bisthum Havelberg? oder Schwerin? oder Camin?), mit einem Punct in jedem der vier Winkel.
3) ein Thor mit einem Thurm an jeder Seite und einem Helm in der Thoröffnung und, wie es scheint, einem Adler über derselben (Stadt Neubrandenburg).
4) ein Thor mit einem Thurm an der Seite, mit offner Thoröffnung und, wie es scheint, einem Adler darüber (strelitzische Stadt - ? Stargard?), in mehrern Stempelabweichungen.
5) ein Stern von sechs Strahlen mit einem Punct in der Mitte und einem Puncte in jedem Winkel. (Dieses Gepräge kommt unter den Bracteaten aus dem vierzehnten Jahrhundert, welche in Meklenburg gefunden worden, öfter vor.)
6) zwei halbe Monde neben einander, mit den Hörnern abwärts gekehrt, mit einem Sterne in jedem der durch die Stellung der Mondhörner gebildeten vier Winkel.
7) ein stehender Mann (Markgraf von Brandenburg).
8 Prägen sind unkenntlich.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Niedersächsisch=ottonische Münzen,
bei Schwerin gefunden.
In der hannov. Münzzeitung III, Tab. X, Fig. 189 und im Averse der Münze Tab. VI, Fig. 109 ist, wenn auch nicht sehr getreu, jedoch zum augenblicklichen Erkennen


|
Seite 140 |




|
charakteristisch eine Münze von einer Art abgebildet, die sich in den Ostseeländern nicht selten findet. Diese Münzen sind kleine flache Denare ohne Umschrift und führen im Avers das alte Tempelgebäude und im Revers das entstellte Monogramm von Cöln. Diese Entstellung entsprang ohne Zweifel dadurch, daß der kölnische Münztypus zur Zeit der Ottonen weit und breit angenommen ward; sie entwickelte sich aus dem Monogramm von Cöln mit den Buchstaben verschiedener Größe:

wie es bei Götz z. B. Fig. 106, 126, 128, 194, 221,
593,
![]() . und bei Lelewel Pl. XVII, Fig 17
und Pl. XIX, Fig. 30 und 31 abgebildet ist, und zwar
wohl dadurch, daß man die Buchstaben nicht als in
Reihen gesetzt, sondern als im Kreise um ein o
gruppirt ansah. Nach dem Groschencabinet II, Tab. 1,
Nr. 1. wurden die Münzen für Münzen Pipins gehalten,
indem man den Avers auf die Seite stellte und in den
Stufen und dem Thor des Tempels die Buchstaben des
Namens Pipin zu erkennen glaubte. In der Münzzeitung
III, S. 267 - 268 ist aber richtig nachgewiesen, daß
diese Münzen niedersächsische Nachahmungen des
kölnisch=ottonischen Münztypus waren, welche sich im
XII. Jahrh. verbreiteten, nachdem der Originaltypus
am Rhein im XI. Jahrh. herrschend gewesen war. Es
liegen auch wirklich scharf geprägte Originalstücke
vor, welche schon die Verstümmelung des kölner
Monogramms haben und Veranlassung zur Nachbildung
gegeben zu haben scheinen.
. und bei Lelewel Pl. XVII, Fig 17
und Pl. XIX, Fig. 30 und 31 abgebildet ist, und zwar
wohl dadurch, daß man die Buchstaben nicht als in
Reihen gesetzt, sondern als im Kreise um ein o
gruppirt ansah. Nach dem Groschencabinet II, Tab. 1,
Nr. 1. wurden die Münzen für Münzen Pipins gehalten,
indem man den Avers auf die Seite stellte und in den
Stufen und dem Thor des Tempels die Buchstaben des
Namens Pipin zu erkennen glaubte. In der Münzzeitung
III, S. 267 - 268 ist aber richtig nachgewiesen, daß
diese Münzen niedersächsische Nachahmungen des
kölnisch=ottonischen Münztypus waren, welche sich im
XII. Jahrh. verbreiteten, nachdem der Originaltypus
am Rhein im XI. Jahrh. herrschend gewesen war. Es
liegen auch wirklich scharf geprägte Originalstücke
vor, welche schon die Verstümmelung des kölner
Monogramms haben und Veranlassung zur Nachbildung
gegeben zu haben scheinen.
In Meklenburg werden diese Nachahmungen häufig gefunden. Im vorigen Jahrhundert wurden dergleichen öfter gefunden; die Großherzogliche Münzsammlung bewahrt außerdem mehrere Exemplare. Unser Verein besitzt 3 Stück bei Ludorf, 1 Stück bei Boizenburg (in einer Urne) gefunden und außerdem noch einige Exemplare. Bei Schwerin wurden nun vor kurzem 27 Stück derselben Art beisammen, ohne Münzen anderer Art, gefunden. Alle sind an Größe, Aussehen und Typus durchaus gleich, wenn auch viele, geringe Stempelabweichungen vorkommen; alle sind nachlässig geprägt, so daß es bei vielen scheint, als wären sie gegossen. Ueber das Schicksal dieser Münzen ist sichere Nachricht schwer zu erhalten; jedoch haben sie zum Studium vorgelegen, und dies ist die Hauptsache, da sie weiter kein historisches Resultat geben.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 141 |




|



|



|
|
:
|
III. Nachrichten von alten Schriftwerken.
Auszüge aus Kirchenschriften des Dorfes Vietlübbe bei Plau, nebst Nachrichten über verschiedene Alterthümer auf der Feldmark dieses Dorfes.
Die vietlübber Feldmark bietet dem Alterthumsfreunde manches Bemerkenswerthe dar, worauf Referent hiemit aufmerksam zu machen sucht, da, so viel ihm bekannt ist, solches bisher nicht geschehen ist.
Zuvörderst befinden sich hier, und zwar nordöstlich vom Dorfe, zur Linken des nach Plau führenden Weges etwa 8 bis 10 ansehnliche Hünengräber 1 ), die sich in geringer Entfernung von einander, in der Richtung von Ost nach West, erstrecken, und mit großen Felsblöcken besetzt sind. Ein anderes, isolirt liegendes Hünengrab, rechts vom plauer Wege und näher am Dorfe, zeichnet sich besonders aus durch die gewaltigen Decksteine, die über die aufrecht stehenden Granitblöcke gelegt sind. Doch sind einige der größten Steine nicht mehr vorhanden, sondern zu Brückenplatten gesprengt und benutzt worden. Südwestlich vom Dorfe, rechts vom Wege nach Damerow, sind ferner einige Kegelgräber, von denen eins im Jahr 1819 geöffnet wurde, bei welcher Gelegenheit man verschiedene Fragmente von Geräthen, und namentlich einen in mehrere Stücke zerbrochenen, etwa 1 1/2 Fuß langen Dolch von Erz fand. Diese Sachen wurden an das Großherzogl. Amt zu Goldberg abgeliefert.
Bemerkenswerth sind sodann die Rudera einer Burg und eines Dorfes, Namens Stievendorf, zu welchem in uralten Zeiten Vietlübbe als Filial und Pertinenz gehört hat. Das Dorf Stievendorf lag westlich etwa 1000 Schritte von Vietlübbe, auf dem jetzigen Pfarracker. Der vormalige Kirchhof wurde erst vor einigen und 20 Jahren urbar gemacht, doch ist der Umkreis desselben durch seine höhere Lage noch zu erkennen. Von der Kirche selbst war damals ein aus Feldsteinen und Schutt bestehender, mit Gesträuch überwachsener Hügel vorhanden. Seitdem brach man die Steine aus und planirte die Stelle, doch ließ man das hiebei sichtbar gewordene Fundament des Thurmes, etwa 2 Fuß hoch und 1 1/2 Ruthen im □, stehen. Noch fanden sich hier beim Steinausbrechen im Jahr 1819 zwei vollständige Menschengerippe in ausgemauerten Gräbern. Eine Strecke südwärts von der Kirche in der s. g. Deichwiese,


|
Seite 142 |




|
unsern des damerower Baches, lag vermuthlich eine Wassermühle, wie die hier ausgegrabenen Mühlensteine und große eichene Pfähle zu beweisen scheinen, so wie auf einer andern Stelle die in großer Menge ausgegrabenen Eisenschlacken das Vorhandensein einer Schmiede andeuten können. Die 12 Bauerhöfe von Stievendorf sollen, der Sage nach, auf dem Raume westlich von der Kirche bis an die etwa 400 Schritte entfernte Hagenswiese gestanden haben. In dieser Wiese lag die Burg Stievendorf, deren ehemaliges Dasein nicht nur die Volkssage, sondern auch der Augenschein deutlich lehrt. Die Ueberbleibsel davon bestehen in fünf erhabenen Flächen und Hügeln, die von Gräben und einem freilich jetzt sehr versunkenen Walle umschlossen werden. Der höchste dieser Hügel ist zwar nur von geringem Umfange, da seine Oberfläche nur 60 Fuß im Durchmesser hält, scheint aber doch das Hauptgebäude enthalten zu haben, da man beim Graben überall gleich auf Mauersteine und Schutt stößt. Im Herbste 1835 wurde ein Theil dieses Hügels aufgegraben; man gelangte bald auf ein Gemäuer von Feldsteinen, welches die Grundlage eines viereckigen Thurmes gebildet zu haben scheint und ziemlich weit zu Tage gefördert ist, und fand hier einen Dolch, einen zusammengerosteten Kettenpanzer, ein Paar Sporen, mehrere Pfeilspitzen und einen zusammen geschmolzenen Klumpen Metall 1 ). Bei einem Nachgraben in früherer Zeit soll eine eiserne Thür sichtbar geworden, aber bei fortgesetzter Arbeit immer mehr in die Tiefe versunken sein. Neben diesen Hügel, doch durch einen Graben davon getrennt, liegt eine ziemlich beträchtliche, jetzt als Acker benutzte Fläche, d. h. noch innerhalb der Umwallung, woselbst vermuthlich die Wirthschaftsgebäude gestanden haben. Die Gräben sind zum Theil noch ziemlich tief, wie denn wohl überhaupt die ganze Wiese in alten Zeiten mehr Sumpf gewesen ist. Geschichtliches ist über Stievendorf weiter nichts bekannt, als daß aus den Kirchenschriften von 1591 hervorgeht, wie dieser Ort schon damals lange zerstört gewesen. Die Volkssage erzählt, daß der letzte Besitzer von Stievendorf mit dem zu Wangelin, einem angrenzenden Dorfe, wo man ebenfalls noch Spuren einer Burg findet, in beständiger Feindschaft lebte und endlich von demselben im Schlafe ermordet wurde, indem der Wangeliner sich in die stievendorfer Burg eingeschlichen, worauf er sich selbst ebenfalls erdolchte.


|
Seite 143 |




|
Noch zwei andere Dörfer haben, der Sage nach, in alter Zeit auf der jetzigen Feldmark von Vietlübbe gelegen, nämlich Suckow und Hoppenrade. Von ersterem Orte führt noch eine Brücke den Namen, so wie auch der jetzt zum Forsthofe Sandkrug gehörige See; auch kommt im alten vietlübber Kirchenbuche ein Förster vom suckower Damm als Gevatter vor. Hoppenrade lag in dem jetzigen Eichengehölze, rechts vom plauer Wege, woselbst die Bezeichnung: große und kleine Dorfstelle von dessen vormaligem Dasein zeugen. Nahe dabei an einer jetzt sehr unbedeutenden Quelle, Risbeck genannt, soll eine Mühle gelegen haben.
Vietlübbe (nach dem Kirchensiegel: Vietelübde) hatte im Jahr 1591 13 Bauern, 2 Cossaten und 4 Einlieger, das eingepfarrte Dammerow 9 und das Filial Ganzlin 17 Bauern. Im 30jährigen Kriege wurde das Dorf gänzlich verwüstet und war 1643 völlig menschenleer; 1662 zählte die Gemeinde schon wieder 60 Seelen. Seit 1661 sind die Kirchen=Register vollständig vorhanden, und es wurden, nach Ausweisung derselben, in der Parochie von 1661 bis 1800 überhaupt nur 1302 Kinder geboren; von 1800 bis 1830 dagegen betrug die Zahl der Geburten 530.
G. Hempel.
der ältern vietlübber Kirchenschriften.
1) Extract Visitierbuchs im Amt Plaw wegen der Pfarrhebung zu Vietelübbe von anno 1591 den 28. Juny auffgerichtet.
Vietelübbe.
Daß Jus Patronatus ist unserm gnädigen Fürsten vnd
herrn zustendigk. Die Kirche ist ein Mater, darzu
gehört nur ein Dörff Damerow, verwaltet auch
jetziger Zeit Gantzelin mit, welches er alle
Sonntage sonderlich bereisen muß, ist eine große
meile weges abgelegen
![]() . -
. -
Es berichtet der Pastor, daß ein Dörff Stievendörff
geheißen, nahe bei Vietelübbe ehemalß gelegen, vnnd
nun gar verwüstet, dar eine Kirche gestanden, welche
die rechte Haubtkirche, vndt Vietlübbe dohmalß ein
Capell vnd Filial, vnd hernach es gar darauß
erbawet, daß feldt aber haben nun die Dameroschen
und Vietelübber ein.
![]() . -
. -
Der Pastor daselbst heist Mattheus Calander, zu
Grabow bürttig, Ist ungefehr bey 45 Jahr alt, vnd 19
Jahr auff der Pfarr gewesen, collegirt seine
Predigten, sitzt des Sonnabends beicht, vnd höret
einen jeden insonderheit, treibt den Catechismum des
Winters alle Sonntage abent fleißig
![]() . - -
. - -


|
Seite 144 |




|
Ist eine Neve Wehdem von 5 Gebinden hat Keine schlaff
Kammer, nur eine Stuben, der Keller ist auch noch
nicht wieder ausgebavet, ist ein Nev Bähn über daß
gantze hauß
![]() . -
. -
Auch hat man, auß dem in voriger gehaltenen
Visitation den Haubtman zu Plawe übergebenen
gravaminibus die nachrichtung bekommen, daß noch 2
Hufen die 4 kerl unter sich getheilet, dem Pastoren
Zugehören, die Pacht bringen sie zusammen, vnd
versauffens.
![]() . - -
. - -
Accidentia. Vor ein Kind zu taufen, ein sößling und eine Malzeit darzu. Vom Kirchgang der Sechswöchnerin 3 schilling vndt giebt einen witten ein leidel gelt, vndt opffert aufs Altar auch einen witten, darneben opffern auch alle andern weiber die mitgehen, einen witten. Vor auffbietten eine flasch bier vnd einen stutten. Vor vertravung 2 ßl.
Die Brautgäste opffern, wy ein jeder will.
Vor Kranken zu besuchen einen sößling.
Von todten alt vnd jung 1 gr. vnd opffert jeder 1 witten.
Wann ein reicher stirbt, Kriegt er bißweilen 12 ßl: bißweilen 6 ßl:
Auff Weihnachten einen sößling vor die Pröwenwurst
![]() . -
. -
2. Protocollum
so bey den Besichtigungen der DorffKirchen im Ambt Plawe und erkundigung deroselben Zustandes in gegenwahrt der fürstl. herrn Comissarien, herrn M. D. Michaelis , superintendenten, vnd Herrn Haubtmann J. Crügers, durch mich, J. Tielen, Visitationis Notarium den 17 vnd 22 Juny Anno 1643 gehalten.
Nachdem wolgedachte herrn Commissary die Commission zu Plawe wegen Auffnehmung der Oeconomy vnd Kirchen Rechnungen verrichtet, als seint dieselben darauf nebenst mir hinnauß ins Ambt gereiset, die darin belegenen DorffKirchen vnd darzu gehorigen Capellen in augenschein Zu nehmen, vnd den Kirchenzstandt sich Zu erkundigen, dieweil aber die Pastores vnd Juraten der Kirchen im gantzen Ambt todes verblichen, die Dörffer auch mehrentheils wüste gelegen, vndt an etlichen Orten Kein Mensch Zu finden gewesen, Als hat man von den Kirchen Intraden , vnd den gehaltenen Registern Keinen vollen Kommenen bericht erlangen Können, sondern es seint die Kirchen vnd Wehdem, iedes Ohrtts besichtiget, vnd wie dieselbigen in jetzigen Zustand befunden, vnd wz man sonsten von den bawern erfahren können, nachfolgend gestellt vnd beZeichnet.


|
Seite 145 |




|
Die Kirche zu Vietelübde ist in Holtzwerk gemauert, der giebel von Mauersteinen, die wende aber von lehmen, Im tache seint etzliche Steine weg, inwendig etwaz verwüstet, oben ein brettern Boden, Altar und predigstuel sint alt, der thurm ist von holtz gebavet, dz holtzwerk verstocket, etliche bende sint loß gangen, vnd ist gestützet, Sonsten sind noch im thurm vorhanden 2 mittelmäßige Klocken müßen herauß genommen werden.
Ist etwaz tachloß, die abseiten daugen nichts, der vorgiebeI ist eingebogen, die stuben Kammer vnd wende sehr verwüstet, die Fenster vnd Thüren sint darauß weg, In der haußstuben ein guter Kachelofen, zunebst 2 bencken, die Fenster sint darauß weg. Die Scheune auff beiden Seiten tachloß, sehr verwüstet vnd in der faste offen, daß Backhauß mit einem Kornhause ist von gutem holtze; daß tach vber dem Backhause ist mehrentheils weg, vber dem Backofen ein Schauer von Brettern.
Pastor:
herr
Matthaeus Calander
ist
mit den
Juraten
verstorben. Daß gantze Dorff
ist wüste, vnd wohnet Kein Mensch dar in; daher man
wegen dieser Kirchen Intraden nichts erfahren
können.
![]() . - -
. - -
Die Kirche ist in holtz gebawet, dz tach ist guth, der giebel von steinen, die wende von lehmen, ein New und ein Alt predigstuel, dz Altar vnnd andere stüle sint verwüstet, der thurm ist von holtz gebawet vnd bekleidet, iedoch mangeln etliche bretter, Im thurm sint zwo Klocken.
der Schultze alhier wohnhafft sagt, daß der
Pastor
zu Vietelübde, herr
Mathäy Calander
alle
Sonntage zu Gantzelin gepredigt, vnd auff die
Aposteltage den Küster geschicket habe. der Silberne
Kelch, dieser Kirchen angehörig, nebenst den
Kirchenbüchern, wehre von den Chur Sächsischen weg
geraubet, vnd etliche Bücher zu Plawe verkaufft
worden
![]() . -
. -
Rosenow, den 17. Aug. 1839.
Gustav Hempel.



|



|
|
:
|
Kirchenbuch von Gressow (bei Wismar).
In einem Kirchenbuche der hiesigen Pfarre, angefangen im Jahre 1655, befindet sich auf den letzten Seiten desselben


|
Seite 146 |




|
unter andern weniger interessanten Nachrichten folgende verzeichnet, die ich hier wörtlich mittheile.
"Anno 1673 den 23 junii ist trine Freytagß auß Greßow der Zauberei halben, womit Sie gantzer 50 Jahre vmbgegangen vnd eß von ihrer Mutter gelernet, öffentlich, nach freywilliger Bekänt= vnd Erkäntnuß verbrandt worden.
Anno 1673 den 16 julii ist Anna poffen auß Käselow der Zauberey halben, wie satsame indicia erwiesen, Sie aber nach grosser tortur nichtß bekennen wollen, verwiesen worden; so aber ein halbeß Jahr hernacher in der Wißmar schleünig gestorben, vnd weil ihnen die persohn vnbekandt, aüch daselbst begraben.
Anno 1675 d. 22 Maji ist Margreta Mollen, auß Greßow der Zauberei halben, welcheß sie vor 7 Jahr in Markhagen gelernet, hieselbst öffentlich verbrandt.
Weitere Verbrennungen scheinen seitdem in hiesiger Gemeinde nicht vorgefallen zu sein, denn die übrigen bis 1747 fortgeführten Notizen von begangenen und bestraften Verbrechen beziehen sich nur auf Unzucht, Diebstahl und dafür geleistete Kirchenbuße und auf Kindermord.
Ich weiß wohl, daß Hexenprocesse auch in unserm Vaterlande zu ihrer Zeit häufig vorgekommen sind, erinnere mich aber nicht gelesen zu haben, daß es darin in so später Zeit, wie das hiesige Kirchenbuch angiebt, bis zum Verbrennen gekommen sei; daher, glaubte ich, möchte diese hier mitgetheilte Notiz nicht unwichtig sein.
Gressow.
Keil, Pastor.
2. Bearbeitung des historischen Stoffes.
A. Gelieferte Arbeiten.
I. Grössere Abhandlungen.
Vom Herrn Regierungsrath von Boddien zu Aurich:
1) Ueber die alten Hauptlinge des Landes Ostfriesland.
Vom Herrn Dr. phil. Burmeister zu Wismar:
2) Erklärung des wendischen Vater=Unsers in Lazius de migr. gentium.
Vom Herrn Professor Dr. Fabricius zu Breslau:
3) Ueber das frühere Slaventhum der zu Deutschland gehörenden Ostseeländer.


|
Seite 147 |




|
Vom Herrn Dr. Friedländer zu Berlin:
4) Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg.
Vom Herrn Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg:
5) Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg.
Vom Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
6) Geschichte der Eisengewinnung in Meklenburg.
7) Ueber die Verfertigung der Graburnen.
8) Ueber Funde von altmittelalterlichen Münzen in Meklenburg.
9) Ueber Handschriften mittelhochdeutscher Gedichte in Meklenburg.
10) Ueber die ältesten wendischen Sprachdenkmäler in Meklenburg.
11) Ueber die Ueberreste der alten Fürstenburg Meklenburg.
Vom Herrn Consistorialrath Dr. Mohnike zu Stralsund:
12) Beiträge zur ältern Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg.
Vom Herrn Hülfsprediger Ritter zu Wittenburg:
13) Ueber die germanische spina des Tacitus in den meklenburgischen Kegelgräbern.
Vom Herrn Apotheker von Santen zu Kröpelin:
14) Chemische Analysen von Bronzen aus meklenburgischen Gräbern der Vorzeit, eingeleitet vom Archivar Lisch zu Schwerin.
Zu den schönern Seiten unsers Vereins gehört ohne Zweifel der rege schriftliche Verkehr nach außen hin, der eine Fülle von Erfahrungen und Kenntnissen zu Tage fördert, welche unsern Bestrebungen einen dankenswerthen Grad von Sicherheit gewährt. Springen auch die Resultate dieses Verkehrs nicht glänzend in die Augen, so wird doch der aufmerksame Leser überall die fördernde Hand nicht verkennen können, die in jedem schwierigen Falle zu helfen gern bereit war.
In einem hohen Grade haben wir Beistand, ja selbst Entgegenkommen von unsern correspondirenden Mitgliedern zu rühmen. Beträchtlich sind schon ihre Büchergeschenke, wo=


|
Seite 148 |




|
durch manche werthvolle Schrift zu unsern Händen kam, welche sonst vielleicht schwer zu erreichen gewesen wäre. Ueber Grabalterthümer machten Mittheilungen: der Herr Regierungsrath v. Boddien zu Aurich durch Mittheilung von Zeugproben von der im J. 1817 bei Friedeburg in Ostfriesland gefundenen alten Leiche und von vollständigen Fundberichten über dieselbe, und der Herr Dr. v. Hagenow durch Mittheilung einer Zeichnung von einem unsern der meklenburgischen Grenze gefundenen Götzenbilde. Der Herr Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin, wenn auch nicht Mitglied des Vereines, schenkte dem Verein 6 Blätter von ihm gefertigter, sauberer Zeichnungen von 22 Stücken Grabalterthümern aus der Sammlung des Herrn Domherrn von Zieten auf Wustrow in der Priegnitz. Den lebendigsten Antheil an der Förderung der Untersuchungen über die neustrelitzer Runendenkmäler nahmen die Herren Professoren J. und W. Grimm zu Cassel, der Herr Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg und der Herr Bibliothekar Hanka zu Prag, so wie der historische Verein zu Bamberg; Lappenberg unterstützte außerdem aus seinen handschriftlichen Schätzen andere Untersuchungen über die wendischen Vorzeit und Hanka Untersuchungen über die wendischen Ortsnamen in Meklenburg. Besondere Thätigkeit herrschte im vorigen Jahre auf dem Felde der Numismatik, theils dadurch, daß mehrere wichtige Funde aus früherer Zeit ans Licht gebracht wurden, theils durch die Bildung einer Großherzoglichen Münzsammlung, welche unfehlbar ihre Wirkung auf die Sammlung des Vereins haben wird; mit großer Aufopferung förderten diesen vielfachen Verkehr der Herr Justizrath Thomsen zu Kopenhagen, Herr Kretschmer zu Berlin und der Herr Bibliothekar Hanka zu Prag. Die Untersuchungen des Vereins über die ältere Buchdruckergeschichte Meklenburgs gaben vielfache Veranlassung zu fortgesetzten Forschungen und wichtigen Entdeckungen, von denen die Herren Dr. Friedländer zu Berlin, Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg und Consistorialrath Mohnicke zu Stralsund mittheilten, was sie für uns Wichtiges entdeckten; Lappenberg's Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg und Mohnike's Geschichte der Buchdruckerkunst in Pommern und dessen Uebersetzung von Delprats Geschichte der Brüder vom gemeinsamen Leben geben außerdem Zeugniß von der Theilnahme dieser Männer für uns. Unsern Urkundenschatz vermehrten durch Beiträge der Herr Gerichts=Director Fabricius zu Stralsund, welcher eine Geschichte von Rügen vorbereitet, und der Herr Dr. Friedländer zu Berlin. Lebendig war der Verkehr mit


|
Seite 149 |




|
dem Herrn Dr. Zober zu Stralsund über die Erforschung der Geschichte der dortigen Schulen, welche Meklenburg vielfach berührt. Kosegarten's niederdeutsches Wörterbuch und pommersche Urkundensammlung nahmen fortwährend große Theilnahme in Anspruch.
Von den ordentlichen Mitgliedern unsers Vereins ging, außer den größern, vorstehend verzeichneten Arbeiten, eine große Menge Notizen von kleinerm Umfange ein, welche in Jahrbücher und Jahresbericht an die passenden Stellen vertheilt sind. Namentlich waren besonders thätig: die Herren Pastor Boll zu Neubrandenburg, Dr. Burmeister und Professor Dr. Crain zu Wismar, Archivar Lisch zu Schwerin, Pastor Masch zu Demern, Pastor Sponholz zu Rülow und Hülfsprediger Ritter zu Wittenburg.
B. Begonnene oder vorbereitete Arbeiten.
I. Die meklenburgischen Regesten.
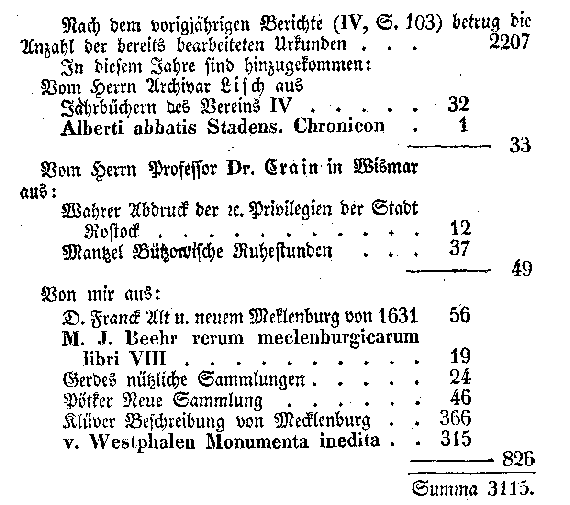
Die Zahl der bereits ausgebeuteten Werke ist 65.
G. M. C. Masch.


|
Seite 150 |




|
II. Die Sammlung meklenburgischer
ungedruckter Urkunden.
(Vgl. Jahresber. I, S. 93, II, S.
161 und III, S. 204.)
Nachdem der Verein die Druckkosten für einen zweiten Band meklenburgischer Urkunden bewilligt hat (vgl. S. 5), wird, da das Manuscript von dem Herausgeber, Herrn Archivar Lisch, bereits vollendet ist, der Druck desselben demnächst beginnen können. Dieser zweite Band wird die vollständigen Urkunden des vornehmsten meklenburgischen Nonnenklosters, Sonnenkamp oder Neukloster, enthalten. Der Ausschuß empfiehlt die Beförderung dieses Unternehmens dringend, damit der Erlös der beiden ersten Bände den Druck eines dritten Bandes und vollständiger Register über alle drei Bände in Wahrscheinlichkeit stelle.
Der Herr Hülfsprediger Ritter hat in der letzten General=Versammlung das verdienstliche Werk übernommen (S. 5), von Zeit zu Zeit, alle fünf Jahre, ein Inhaltsverzeichniß zu den Jahrbüchern und den Jahresberichten des Vereins auszuarbeiten. Der Verfasser hofft, die Register über die ersten fünf Jahrgänge unter Beirath des Ausschusses im Laufe k. J. beenden zu können.
Einzelne Gewässer, Landflächen und Stellen in Feld und Wald tragen oft noch Namen, die in der Vorzeit ihren Ursprung haben und an untergegangene Wohnorte, Unternehmungen, Begebenheiten oder durch die Sprache an untergegangene Volksstämme erinnern. Auf den in der letzten Generalversammlung von dem Herrn Revisionsrath Schumacher gemachten und von der Versammlung angenommenen Antrag werden die Großherzoglichen Beamten, Forstbedienten, Prediger, Gutsbesitzer und überhaupt alle diejenigen, denen eine Forschung im Alterthum werth und möglich ist, ersucht, solche alte specielle Ortsbezeichnungen nach einzelnen Feldmarken, in bestimmter Richtung von Osten nach Westen fortschreitend, mit Ausscheidung aller der neuesten Cultur angehörenden Bezeichnungen, aus ältern Feldcharten, Registern und Acten oder aus der Tradition zu sammeln und nach einzelnen Gütern zu verzeichnen und die Verzeichnisse dem Vereine zur Sammlung zuzusenden.


|
Seite 151 |




|
C. Unterstützte und empfohlene Werke, die außerhalb des Vereins erschienen sind oder erscheinen sollen.
I. Rosegarten's niederdeutsches Wörterbuch.
Dieses Werk (vgl. Jahresber. IV, S. 105) wird eifrig der Vollendung entgegengeführt, nachdem der Herr Verf. viele schätzbare Mittheilungen durch Sammlungen aus dem Munde des Volkes empfangen hat. Der Herr Verf. äußert noch den dringenden Wunsch, daß diejenigen Männer, welche aus älteren niederdeutschen Schriften und Urkunden sich seltenere oder ihnen fremd scheinende Wörter angemerkt haben, ihm auch diese, wenn möglich unter Angabe der Quellen, mittheilen mögen.
II. Historisch=statistische Beschreibung der
Kirchen und Pfarren des Großherzogthums Meklenburg=Strelitz,
vom Pastor Sponholz zu Rülow.
Der Herr Pastor Sponholz zu Rülow bei Neubrandenburg bereitet eine "Historisch=statistische Beschreibung der Kirchen und Pfarren des Großherzogthums Meklenburg=Strelitz mit kurzer Chronik der Oerter, Angabe und Aufzählung der Gutsbesitzer und der Geistlichen" vor und wünscht dringend Beiträge von allen Vereins=Mitgliedern, welche sich für dieses Unternehmen interessiren. Der Ausschuß des Vereins wird das wichtige Werk nach Kräften unterstützen, wie demselben bereits hohe Aufmunterung zu Theil geworden ist.
III. Handbuch der Alterthümer Deutschlands,
vom Superintendenten Wagner zu
Potsdam.
(Eingesandt.)
Ein bejahrter Schriftsteller, der seit einem halben Jahrhundert die Denkmäler der heidnischen Vorwelt in einem großen Theile seines Vaterlandes aufsuchte und die Literatur derselben studirte, ist im Begriffe, die Ergebnisse seiner Forschungen dem Publikum zu übergeben. Sein Buch, unter obigem Titel in groß Octav gedruckt, wird höchstens drei Bände Text und ein Bändchen mit Lithographien füllen. Vorausgesandt ist dem Werke eine vollständige Literatur der deutschen Alterthümer und eine chronologische Uebersicht der Haupt=Momente aus der Geschichte des heidnischen Germaniens. Dann folgen möglichst vollständig die Nachrichten von den bisher aufgefundenen anti=


|
Seite 152 |




|
quarischen Schätzen, nach ihren Fundörtern alphabetisch geordnet. Vereinigt hiemit sind kurze Notizen von sämmtlichen Volksstämmen, geschichtlichen Personen und sonstigen Denkwürdigkeiten der altgermanischen und eingewanderten Völker Deutschlands. Den Beschluß des Ganzen machen endlich die 1390 zu lithographirenden Abbildungen der interessantesten antiquarischen Gegenstände mit ihren Nummern und den Fundörtern, unter welchen sie im Texte beschrieben sind.
In ganz Deutschland - sagt der Herausgeber in dem Vorworte zu seinem Werke - scheint jetzt der Sinn für Erforschung vaterländischer Alterthümer zu erwachen. Vereine zur Erhaltung historischer Denkmäler der Vorzeit treten in allen Provinzen ins Dasein. Wohlgeordnete Museen machen hier und da ihre antiquarischen Schätze dem geschichtforschenden Publikum zugänglich. Auch obrigkeitlich nimmt man immer mehr in Schutz, was durch sein Alterthum ehrwürdig ist, aber früher oft muthwillig zerstört ward. Zahlreiche Privatsammlungen von Erzeugnissen unserer Altvordern hören allgemach auf, einzig die Schaulust der Neugierigen zu befriedigen. Umsichtiger und sorgsamer, als vormals, beachtet man jetzt den Fundort und das Geschichtliche der Entdeckungen dessen, was die Unterwelt zuweilen selbst aus vorgeschichtlicher Zeit uns treulich aufbewahrte. So gewinnt das, was vormals für die strenge wissenschaftliche Benutzung fast unbrauchbar war, selbst eine urkundliche Wichtigkeit, und eröffnet uns geschichtliche Blicke in Zeiten eines Volkes, welches der Schriftsprache noch ermangelte. Treffend bemerkt einer unsrer eifrigsten Alterthumsforscher, Archivar Lisch: "daß man dieß oder jenes Alterthumsstück gefunden hat, ist bei weitem nicht so wichtig, als eine verbürgte Darstellung darüber, wo und wie man es gefunden. Ein bedeutendes Grab, mit Sorgfalt aufgedeckt, hat nicht selten einen höhern Werth, als ganze Sammlungen einzelner Stücke, von denen man nicht weiß, woher sie stammen."
Wenn man jetzt die mannigfaltige Ausbeute der verschiedenen Grabdenkmäler Deutschlands aus heidnischer Vorzeit kritisch mit einander vergleicht, so dringen sich uns allerdings eine Menge Vermuthungen auf. Aber vollständig ist darum der dunkle Schleier, welcher unsere vaterländischen Merkwürdigkeiten umhüllt, nicht gehoben. Zwar liegen uns bereits werthvolle Schätze der Unterwelt vor Augen; "aber" - bemerkt ein anderer verehrlicher Alterthumsforscher - "mit Sicherheit dürfen wir es doch noch nicht wagen, aus ihnen Folgerungen für die Geschichte zu ziehen. Immer drohet der Irrthum, der sich


|
Seite 153 |




|
so leicht hinter vorgefaßten Meinungen und Ansichten verbirgt, uns zu beschleichen. Die deutsche Alterthumskunde ist noch zu jung, um Alles erklären zu können. Durch eine längere Reihe von Jahren gereift, wird sich gewiß über Manches, worüber sie zur Zeit noch bescheiden schweigen muß, Licht und Klarheit verbreiten." -
Bisher fehlte es noch an einer übersichtlichen Zusammenstellung der vorzüglichsten antiquarischen Schätze Germaniens und dessen nächster Umgebung. Der Herausgeber dieses Handbuchs macht den ersten Versuch, diesen Mangel abzustellen, um die Aufmerksamkeit eines größern Publikums auf diese Gesammtschätze hinzuleiten, indem er diese in gedrängtester Kürze beschrieben, nach ihren Fundörtern geordnet, auf die zahlreichen Quellen, woraus er schöpfte (die Zahl der von ihm namhaft gemachten Druckschriften beläuft sich auf 980) fleißig hingewiesen und mittelst der 1390 stark verjüngten Abbildungen zur klaren Anschauung gebracht hat. Sein auf die vieljährige Arbeit verwendeter Fleiß ist nicht wohl zu verkennen. Er benutzte zu dem Ende die reichhaltige königliche Bibliothek zu Berlin, das prächtige großherzoglich=mecklenburgische Kunstwerk, eine Menge Privatbibliotheken, Chroniken und Alterthums=Cabinets=Beschreibungen. Die öffentliche Mittheilung seiner Arbeit kann daher dem Publikum nur willkommen sein; denn nicht ein jeder Alterthumsfreund hatte Zeit und Gelegenheit, mit der Ausbeute von wenigstens dreitausend Fundörtern, deren hier gedacht worden ist, sich bekannt zu machen.
Natürlich kann nicht Alles, was hier berührt werden mußte, gleiches Interesse gewähren; aber gewiß wird jeder Leser mit besonderem Vergnügen unter andern bei Dem verweilen, was unter nachstehenden Ueberschriften berichtet wird: Augsburg's Antiken - Brenz heidnische Thierbilder an jetzt christlicher Kirche=Castell's Columbarien in unzugänglichen Felsen=Erphingen's vermauerte Hunnen=Fließen's römische Mosaik - Freienwalde's germanische Venus - Friedeburg's ältestes deutsches Gewand - Godramstein's (Götter=am=Stein) Götzenbilder an der Kirche - Grabwürfel im Spessart - Gressenik's deutsches Herkulanum - Heddersheim's persische Mithrastempel - Heidengräber in mehr als dreißig Verschiedenheiten - Herlitz goldenes Diadem=Homburg's Römerthum - Horn's Veleda=Tempel - Igel's thurmhohes Grabmal - Mainz Alterthümer - Miltenberg's altdeutsche Ringfeste - Mirow's Quaden=Schaumünze - Neuwied's Autiquitäten - Ostrova's Marstempel - Potsdam's Schanze eines Späh=Commando's des


|
Seite 154 |




|
Domitius - Satertand's Angeln - Salzburg's antiquarischer Reichthum - Semper's germanische Steinwaffen=Fabrik - Sündfluth=Spuren in Deutschland - Tholei's römischer Tumulus. - Trajans Felsenschrift und Donaubrücken - Trier's Wunderbauten - Ulpia=Trajana's Denkwürdigkeiten - Vorweltliches - Weißenburg's Druiden - Wetzlar's Musterfeste - Wien's, Wiesbaden's, Xanten's Alterthümer=Sammlungen u. s. w.
Ref. wünscht dem Herausgeber einen geschickten Lithographen für seine Zeichnungen.
D. E.



|
[ Seite 155 ] |




|



|



|
|
:
|
Anhang.
Erklärung der Steindrucktafel mit
den römischen Alterthümern
von Gr. Kelle.
Auf dem Gute Gr. Kelle bei Röbel, an der Westseite des Müritzsees ward im J. 1837 ein großes Kegelgrab von wenigstens 8' Axenhöhe abgetragen. Der Hügel enthielt unter der dicken Erddecke ein großes kegelförmiges Gewölbe von Feldsteinen, welche eine auf dem Urboden stehende Steinkiste bedeckten. Das Grab glich im Bau also ganz den Kegelgräbern aus der Bronzezeit. In der Steinkiste wurden viele merkwürdige Alterthümer gefunden, welche von dem Besitzer des Gutes, dem Herrn Vice=Präsidenten von Bülow, dem Verein zum Geschenke gemacht wurden und im Jahresbericht III, 1838, S. 42 - 57, als römische Alterthümer aus der letzten Zeit der Republik ausführlich beschrieben und erläutert sind. Des hohen Interesses wegen wird hier eine Abbildung der gefundenen Alterthümer mitgetheilt.
Es fand sich in der Steinkiste:
Fig. 1. eine große kraterförmige Urne von dünner Bronze, welche zerdrückt war und nur in einigen Randstücken erhalten ist; sie hatte die Asche, als eine dunkle, "torfartige" Materie enthalten. Die Mündung hatte ungefähr 16" im Durchmesser.
Fig. 1 a. ist ein Durchschnitt des Randes dieser Bronze=Urne in natürlicher Größe dargestellt.
Fig. 1 b. ist ein Stöpsel oder Handgriff, der vielleicht zu einem Deckel der Bronze=Urne gehört hat, in verkleinertem Maaßstabe; er ist 2 1/4" hoch.
Neben dieser Urne lag:
Fig. 2. eine silberne Schöpfkelle, 2 3/4" hoch und 7" im Durchmesser des Randes, von fast ganz reinem Silber, 1 Pfd. 14 Loth köln. schwer, mit einem Griffe, der mit ciselirten Reliefs (caelatura, argentum caelatum) geschmückt ist.
Fig. 2 a. ist der Griff der silbernen Schöpfkelle in natürlicher Größe dargestellt; es wird bei der großen Deutlichkeit der Zeichnung, an welcher nichts zu ergänzen ist, auf die eben angeführte Beschreibung und Erläuterung verwiesen.


|
[ Seite 156 ] |




|
Fig. 3. eine Schöpfkelle aus Bronze, 3" hoch und 5" im Durchmesser, fast so dünne wie ein Laubblatt getrieben und auf der Drehbank nachgearbeitet und mit Kreisen verziert, nur zum Handhaben eingerichtet, da sie auf den Griff zurückfällt, wenn sie hingestellt wird.
Fig. 4. ein Griff von einer ähnlichen Schöpfkelle aus Bronze. Nach einigen Fragmenten hatte das Grab außerdem noch ein ähnliches kleines Bronzegefäß enthalten, welches aber ebenfalls zerdrückt war.
Fig. 5. ein Messer aus Bronze von einer prachtvollen Goldfarbe, mit einem leberfarbenen Ueberzuge bedeckt, der allen Rost ferne gehalten hat.
Fig. 6. eine Scheere aus gleicher Bronze mit demselben Ueberzuge bedeckt.
Fig. 7. ein Griffel aus Elfenbein, vom Kupferoxyd (der nahe stehenden Bronzegefäße?) schön grün gefärbt.
Fig. 8. ein Beschlagring aus Bronze, mit dem Ueberzuge des Messers und der Scheere bedeckt.
Fig. 9 a. b. c. drei Würfel (tali) aus Elfenbein mit 0, 3, 4 und 6 Augen, wohl erhalten.
Fig. 10 a - e. fünf Brettsteine aus Elfenbein zu einem Kriegsspiele (ludus latrunculorum); einer ist weiß, drei sind rosenroth und einer grün (vom Oxyd der Bronzegefäße?) gefärbt. - Fig. 10 giebt einen senkrechten Durchschnitt dieser Brettsteine.
G. C. F. Lisch.
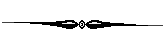


|




|
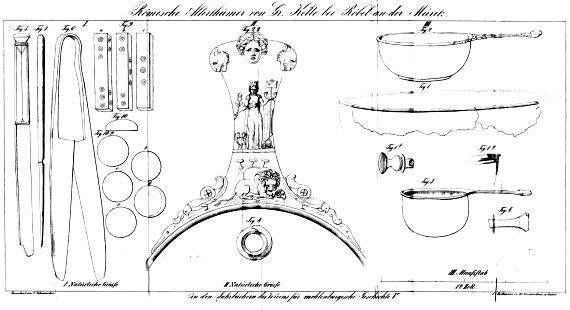


|




|
