

|




|


|
|
|
-
Jahrbuch für Geschichte, Band 23, 1858
- Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster
- Ueber des Wendenkönigs Niklot Enkel Kanut und Waldemar, Prizlavs Söhne
- Ueber Chotibanz und Chutun
- Katharine Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark, Administrators des Bisthums Schwerin
- Ueber die norddeutschen Familien von Platen und die Familie von Bevernest
- Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser
- Des Herzogs Johann Albrecht I. eigenhändiges Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553
- Ueber den lübecker Martensmann
- Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532
- Die meklenburgischen Formschneider des sechszehnten Jahrhunderts
- Der im sechszehnten Jahrhundert in Meklenburg gebräuchliche Cisiojanus
- Niederdeutsche Andachtsbücher
- Des rostocker Professors Nathan Chytraeus plattdeutsches Wörterbuch 1582
- Ueber eine Heilige des Nordens
- Ueber den Tod des Schweriner Bischofs Melchior, Herzogs von Braunschweig
- Zur Geschichte der Vitalienbrüder (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 51 flgd.)
- Antonius Schröder und der Türkenzug von 1532
- Des Herzogs Albrecht des Schönen Reise zum Kaiser Carl V. 1543
- Die Herzogin Katharine von Meklenburg
- Der Canzler Brandanus von Schöneich
- Ueber die Wiedertäufer in Meklenburg
- Ueber die Schweißsucht
- Ueber die Pest von 1589 und 1591 und das Gesundheitwünschen beim Niesen
- Belehnung durch Antastung des Hutes
- Die Fehler der Hansestädte
- Capitulation des Herzogs Adolph Friederich von Meklenburg über die Administration des Stiftes Schwerin (enthaltend eine Geschichte des Stiftes Schwerin während des dreißigjährigen Krieges)
- Ueber die Caselier in Meklenburg
- Christian Ludwig Liscow
- Auszug aus der im J. 1632 angefangenen Matrikel der Universität Dorpat, mitgetheilt in den Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, Bd. VIII, Heft 1, Riga 1855, S. 150 flgd.
- Die Johanniter-Comthurei Gardow
- Der Wanzeberg
- Die Dörfer Görgelin, Gallin und Gailen
- Etymologie des Namens Rostock (Nachtrag zu Jahrb. XXI, S. 8 flgd.)
- Fayence-Fabrik zu Gr. Stieten
- Ueber den lübecker Martensmann (Nachtrag)
- Urkunden-Sammlung
-
Jahrbuch für Alterthumskunde, Band 23, 1858
- Reib-, Roll- oder Klopfsteine von Friedrichshöhe
- Kegelgrab von Dabel Nr. 3 (vgl. Jahrb. XXII, S. 279 flgd.)
- Wendenkirchhof von Göthen
- Wendenbegräbniß von Vorbeck
- Messingene Taufbecken von Dambeck
- Alterthümer von Marlow
- Hölzerne Teller von Güstrow
- Bronzener Henkeltopf von Gnoyen
- Die wendische Burg Lübchin und der Bärnim
- Der Burgwall von Marnitz
- Der wendische Burgwall von Barth
- Burgwall zu Mestlin
- Das frühere Dorf Rodenbek
- Die romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg
- Die Kirche zu Lübchin
- Die Kirche zu Semlow
- Die Kirche zu Tribohm
- Die vorpommerschen Landkirchen zwischen Tribsees und Damgarten
- Die Kirche zu Sanitz
- Die Kirche zu Marlow
- Die Kirche von Thelkow
- Die Kirche zu Basse
- Ueber die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan
- Erläuterungen über die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan
- Drei Denksteine aus der Umgegend von Wismar
- Ueber die große Glocke zu Hohenkirchen
- Der Münzfund von Boek
- Der Hochaltar der S. Georgen-Kirche zu Parchim
- Das Amt und Wappen der Maler und Glaser und das Künstlerwappen
- Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 5. October 1857
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 4. Januar 1858
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 12. April 1858
Jahrbücher
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Arbeiten des Vereins
herausgegebenvon
Dr. G. C. Friedrich Lisch,
großherzoglich meklenburgischem
Archiv=Rath,
Conservator der
Kunstdenkmäler des Landes,
Regierungs=Bibliothekar,
Direktor der
großherzoglichen Alterthümer= und
Münzen=Sammlungen zu Schwerin,
Ritter
des königl. preuß. Rothen Adler=Ordens 4.
Cl., Inhaber der
großherzoglich=meklenburgischen goldenen
Verdienstmedaille und der königl.
hannoverschen goldenen Ehrenmedaille für
Wissenschaft und Kunst und der kaiserl.
russischen großen goldenen Verdienstmedaille
für Wissenschaft
correspondirendem
Mitgliede der königl. Akademien der
Wissenschaften zu Göttingen und zu
Stockholm, der kaiserl. archäolog.
Gesellschaft zu St. Petersburg und der
oberlausitzischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Görlitz, Ehrenmitgliede
der deutschen Gesellschaft zu Leipzig und
Ehrencorrespondenten der kaiserl. Bibliothek
zu St. Petersburg, Mitvorsteher des
naturgeschichtlichen Vereins für
Mecklenburg,
Ehrenmitgliede,
der
geschichts= und alterthumsforschenden
Gesellschaften zu Dresden, Mainz,
Hohenleuben, Meiningen, Würzburg, Sinsheim,
Königsberg, Lüneburg, Luxemburg und
Christiania,
correspondirendem
Mitgliede
der geschichts= und
alterthumsforschenden Gesellschaften zu
Lübeck, Hamburg, Kiel, Stettin, Hannover,
Halle, Jena, Berlin, Salzwedel, Breslau,
Cassel, Regensburg, Kopenhagen, Gratz,
Reval, Riga, Leyden, Antwerpen,
Kopenhagen
als
erstem Secretair des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Dreiundzwanzigster Jahrgang.
Mit zwei Steindrucktafeln, einer Stahlstichtafel, drei Holzschnitten und sechs Messingschnitten.
Mit angehängtem Jahresberichte.
Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung (Didier Otto).
Schwerin, 1858.


|




|


|




|
Inhaltsanzeige.
A. Jahrbücher für Geschichte. |
Seite | |||||
| I. | Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 1 | ||||
| II. | Ueber des Wendenfürsten Prizlav Söhne Kanut und Waldemar, von demselben | 14 | ||||
| III. | Ueber den Gau Chotibanz und den Ort Chutun, von demselben | 22 | ||||
| IV. | Katharina Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,, von demselben | 33 | ||||
| V. | Ueber die Familien von Platen und die Familie Bevernest, von demselben | 41 | ||||
| VI. | Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser, von demselben | 57 | ||||
| VII. | Des Herzogs Johann Albrecht I. Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553, von demselben | 79 | ||||
| VIII. | Ueber den lübecker Martensmann, von demselben | 81 | ||||
| Nachtrag vom Professor Dr. Deecke zu Lübeck S. 173. | ||||||
| IX. | Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532, von demselben | 91 | ||||
| X. | Ueber die meklenburgischen Formschneider des 16. Jahrhunderts von Wiechmann=Kadow | 101 | ||||
| Mit sechs Messingschnitten. | ||||||
| XI. | Ueber den im 16. Jahrhundert in Meklenburg gebräuchlichen Cisiojanus, von demselben | 125 | ||||
| XII. | Ueber alte niederdeutsche Andachtsbücher, von C. D. W. und von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 128 | ||||
| XIII. | Ueber das plattdeutsche Wörterbuch, von N. Chytraeus, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 139 | ||||
| XIV. | Miscellen und Nachträge | 143 | ||||
| XV. | Urkunden=Sammlung | 177 | ||||
| Mit zwei Steindrucktafeln. | ||||||


|




|
B. Jahrbücher für Alterthumskunde. |
Seite | |||||
| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne | 271 | ||||
| 1. | Vorchristliche Zeit. | 273 | ||||
| a. | Zeit der Hühnengräber | 273 | ||||
| b. | Zeit der Kegelgräber | 279 | ||||
| Kegelgrab von Dabel, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 279 | |||||
| Mit drei Holzschnitten. | ||||||
| c. | Zeit der Wendengräber | 286 | ||||
| 2. | Alterthümer des christlichen Mittelalters und der neuern Zeit | 289 | ||||
| II. | Zur Baukunde | 300 | ||||
| 1. | Zur Baukunde der vorchristlichen Zeit | 300 | ||||
| Ueber die wendische Burg Lübchin | 300 | |||||
| 2. | Zur Baukunde des christlichen Mittelalters | 308 | ||||
| a. | Weltliche Bauwerke | 308 | ||||
| b. | Kirchliche Bauwerke | 310 | ||||
| Ueber die romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 310 | |||||
| Ueber die Kirchen zu Lübchin, Semlow, Sanitz, Marlow u. s. w., von demselben | 315 | |||||
| Ueber die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan, von dem Geheimen=Regierungs=Rath v. Quast und dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 334 | |||||
| Mit einer Stahlstichtafel. | ||||||
| Ueber drei Denksteine in der Gegend von Wismar, von C. D. W. | 350 | |||||
| III. | Zur Münzkunde | 358 | ||||
| Ueber den Münzfund von Boek, von dem Pastor Masch zu Demern | 358 | |||||
| IV. | Zur Kunstgeschichte | 364 | ||||
| Ueber den Hochaltar in der S. Georgen=Kirche zu Parchim, von dem Archiv=Rath Dr. Lisch | 364 | |||||
| Ueber das Amt und Wappen der Glaser und Maler und das Künstlerwappen, von demselben | 377 | |||||


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Der heilige Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster
- Ueber des Wendenkönigs Niklot Enkel Kanut und Waldemar, Prizlavs Söhne
- Ueber Chotibanz und Chutun
- Katharine Hahn, Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark, Administrators des Bisthums Schwerin
- Ueber die norddeutschen Familien von Platen und die Familie von Bevernest
- Genealogische und chronologische Forschungen zur Geschichte der meklenburgischen Fürstenhäuser
- Des Herzogs Johann Albrecht I. eigenhändiges Verzeichniß der Landesschulden im Jahre 1553
- Ueber den lübecker Martensmann
- Tagebuch über den Reichstag zu Regensburg 1532
- Die meklenburgischen Formschneider des sechszehnten Jahrhunderts
- Der im sechszehnten Jahrhundert in Meklenburg gebräuchliche Cisiojanus
- Niederdeutsche Andachtsbücher
- Des rostocker Professors Nathan Chytraeus plattdeutsches Wörterbuch 1582
- Ueber eine Heilige des Nordens
- Ueber den Tod des Schweriner Bischofs Melchior, Herzogs von Braunschweig
- Zur Geschichte der Vitalienbrüder (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 51 flgd.)
- Antonius Schröder und der Türkenzug von 1532
- Des Herzogs Albrecht des Schönen Reise zum Kaiser Carl V. 1543
- Die Herzogin Katharine von Meklenburg
- Der Canzler Brandanus von Schöneich
- Ueber die Wiedertäufer in Meklenburg
- Ueber die Schweißsucht
- Ueber die Pest von 1589 und 1591 und das Gesundheitwünschen beim Niesen
- Belehnung durch Antastung des Hutes
- Die Fehler der Hansestädte
- Capitulation des Herzogs Adolph Friederich von Meklenburg über die Administration des Stiftes Schwerin (enthaltend eine Geschichte des Stiftes Schwerin während des dreißigjährigen Krieges)
- Ueber die Caselier in Meklenburg
- Christian Ludwig Liscow
- Auszug aus der im J. 1632 angefangenen Matrikel der Universität Dorpat, mitgetheilt in den Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands, Bd. VIII, Heft 1, Riga 1855, S. 150 flgd.
- Die Johanniter-Comthurei Gardow
- Der Wanzeberg
- Die Dörfer Görgelin, Gallin und Gailen
- Etymologie des Namens Rostock (Nachtrag zu Jahrb. XXI, S. 8 flgd.)
- Fayence-Fabrik zu Gr. Stieten
- Ueber den lübecker Martensmann (Nachtrag)
- Urkunden-Sammlung
A.
Jahrbücher
für
Geschichte.


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|



|


|
|
:
|
I.
Der heilige Erpho von Meklenburg,
Bischof zu Münster,
von
G. C. F. Lisch.
V or dem S. Mauritii=Thore der Stadt Münster, eine halbe Stunde von der Stadt entfernt, steht im freien Felde die alte, ehrwürdige Kirche zum H. Mauritius, und neben derselben jetzt ein Kloster zum guten Hirten für die barmherzigen Schwestern mit einem Kranken= und Waisenhause. Ich war nicht wenig überrascht, als ich an einem frühen Herbstmorgen 1854 in der westlichen Kapelle der Kirche eine Verehrung fand, die offenbar einen besondern Heiligen galt, und als ich auf einem erhöheten Grabdenkmale in der Mitte der Kapelle das meklenburgische Wappen sah und in lateinischer Sprache die Worte las:
Wenn ich auch aus Rudloff's meklenburgischer Geschichte den münsterschen Bischof Erpho dem Namen nach kannte, so war mir doch seine Bedeutsamkeit in der katholischen Kirche völlig unbekannt und Veranlassung genug, möglichst genaue Forschungen anzustellen. Die jetzt in kritischen Ausgaben eröffneten Geschichtsquellen des Bisthums Münster leiten auf sichern Wegen zum Ziele.
Erpho war der 17. Bischof von Münster, welcher 1085 bis 1097 auf dem bischöflichen Stuhle saß, der Nachfolger und Neffe des Bischofs Friedrich I., eines Markgrafen von Meißen aus dem Hause Wettin. 1 )


|
Seite 4 |




|
Der Hauptgegenstand der gegenwärtigen Untersuchung ist die Frage, woher man weiß, daß Erpho ein Meklenburger war.
Die schriftlichen Nachrichten sind nicht sehr alt: eine Hauptquelle ist die Ueberlieferung, welche den Bischof seit länger als 400 Jahren einen Meklenburger nennt.
Jedoch sind auch die geschriebenen Nachrichten nicht zu verachten, welche, wenn sie auch nicht sehr alt sind, doch gewiß aus alten Quellen fließen. Urkunden, welche die Herkunft Erpho's beweisen könnten, giebt es nicht. Die münsterschen Chroniken sind nicht sehr alt. "Bis auf das Jahr 1424 giebt es nur eine selbstständige münstersche Chronik des Bischofs Florenz von Wevelinghoven (1364-1379), der von unbekanten Händen die Leben der Bischöfe Potho, Heidenrich und Otto IV. zugesetzt wurden. Alle anderen münsterischen Chroniken sind bis zu jener Zeit nur Erweiterungen, Umarbeitungen oder Uebersetzungen dieser Chronik". In dieser Chronik (1364-1379) wird der Bischof Erpho ein Meklenburger und ein Neffe seines Vorgängers Friedrich genannt. Die in neuern Zeiten von Dr. Julius Ficker herausgegebene Chronik 1 ) sagt:
"XVII. Erpo, natus de Mekelenborch, nepos Frederici. Hic dedit fratribus Romoldinchof, unde datur talentum et molles casei XIIII diebus. Et cum Odone episcopo Leodiensi et Godefrido duce de Bolyun et quam pluribus aliis ad predicacionem et adhortacionem pape Urbani secundi ultra mare transiit. Et Anthiochiam et Jherusalem ceperunt. Quibus tunc sanctus Turpinus, qui cum Karolo vivus fuit, in omnibus laboribus apparuit et se esse dixit et ipsos confortavit et exitum rei bonum predixit. Et mortuus ductus est ad sanctum Mauricium et ibidem cum nepote suo Frederico honorifice sepultus."
Excellens merito vivat venerabilis Erpo.
Mente pia Christe Rumoldinchof dedit iste.
Eine zweite Quelle ist das sogenannte "Rothe Buch (Liber rubeus) des Collegiatstifts S. Mauritz vor Münster, eine sehr reichhaltige Sammlung von Urkunden, Güterverzeichnissen u.s.w., eine Pergamenthandschrift um das Jahr 1492 von Bernhard Tegeler, Scholastor des genannten


|
Seite 5 |




|
Stifts, gefertigt". 1 ) Dieses nennt auch den Erpho einen Meklenburger, indem es sagt:
"Huic (Friderico) successit secundus collegii fundator, diuus Erpho, Magnopolensis, dicti Friderici cognatus, Hic suscepto crucis signo et secum Ludolphus tunc prepositus huius ecclesiae cum multis nobilibus et principibus, quorum duces et primicerii erant Hugo Magnus Philippi Francorum Regis frater et duo Roberti, quorum alter Normandiae, alter Flandriae comes, et item Godefridus, Eustachius et Balduinus cognomento Boliani, Galitiae comites, profecti sunt anno salutis 1084 in expeditionem Hierosolymitanam contra Turcas et Saracenas, vbi in sancta terra Ludolphus prepositus occisus est".
Aus den Urkunden und Chroniken des Bisthums Münster hat Albert Boichorst, Syndicus des Dom=Capitels und des Collegiat=Stiftes zu S. Mauritz, im J. 1649 eine Lebensbeschreibung des H. Erpho herausgegeben. 2 ) Daraus, daß Erpho ein Meklenburger und ein Neffe Friedrichs von Wettin genannt wird, so wie aus der Zeit, schließt Boichorst, daß Erpho ein Sohn des meklenburgischen Fürsten Buthue (1066 - 1074) gewesen sei und gewesen sein müsse, und bildet folgenden Stammbaum:



|
Seite 6 |




|
Dieser Stammbaum hat viel Wahrscheinliches für sich, jedoch wird er sich in keinem Stücke urkundlich beweisen lassen. Diese Herstammung ist auch in die Gedächtnißtafel in der S. Mauritii=Kirche übergegangen.
Diesem münsterschen Geschichtsschreiber folgt Rudloff in seiner meklenburgischen Geschichte I, S. 62, wenn er sagt:
"Man hat ihm (Buthue) des H. Ordulfs Schwester Hildegard zur Gemahlin gegeben und von dieser ihm einen Sohn Erpho zugeeignet, der mit seiner Mutter in dem Schooße ihres väterlichen Hauses geflüchtet und nachher an ihres Mutterbruders Friedrichs Stelle, vielleicht auch durch dessen Beförderung, Bischof zu Münster geworden und nach seinem Tode unter die Heiligen aufgenommen ist".
Rudloff beruft sich nur auf das Buch des Boichorst 1 ) und nennt keine andere Quelle.
Wenn sich nun auch keine urkundliche Gewißheit über Erpho's Herkunft erlangen läßt, so läßt es sich doch beweisen, daß er im Bisthume Münster schon vor 500 Jahren, wie heute, für einen meklenburgischen Fürstensohn galt.
Es wird daher nicht unwillkommen sein, die Grundzüge seines Lebens, seiner Stiftungen und seines Begräbnisses hier mitzutheilen.
Erpho's Vorgänger und Oheim, Bischof Friedrich von Münster, gründete das Collegiat=Stift und die Kirche zu S. Mauritii vor Münster ("in suburbio") für zwölf Domherren. Die Thürme und der ältere Theil der Kirche, das jetzige Schiff, sind jetzt die ältesten Baudenkmäler Münster's. Bischof Friedrich starb am 18. April 1084 und ward in der S. Mauritii=Kirche begraben, in welcher ihm Gedächtnißfeiern gehalten wurden. Am 25. Mai 1576 öffnete man sein Grab und fand seine Gebeine, mit Kelch, Patene und Ring; es war die Inschrift: Frithericus episcopus, eingegraben.
Friedrichs Nachfolger war sein Neffe Erpho 2 ), welcher nach langer Sedisvacanz im J. 1085 den bischöflichen Sitz


|
Seite 7 |




|
einnahm 1 ). Seine erste Urkunde 2 ), über das Stift Freckenhorst, ist vom 30. Dec, 1085 datirt:
"Actum Mimigardeford in camera episcopi, anno dominice incarnationis millesimo octogesimo sexto, indictione VIIII a , III. kal. Januarii, anno vero ordinationis domni Erphonis episcopi primo".
Da er bei seiner Wahl zum Bischofe wenigstens 30 Jahre alt sein mußte, so muß er vor dem Jahre 1055 geboren sein.
Erpho nannte sich 1192 zuerst Bischof von Münster. Der alte Name der Stadt ist Mimigardeford. Auf seinem Siegel, auf welchem sein Brustbild dargestellt ist, 3 ) nennt er sich noch Bischof von Mimigardeford:

Jedoch blieb der Name Mimigardeford noch längere Zeit im Gebrauche. Münzen sind vom Bischofe Erpho nicht bekannt, obgleich unter ihm zu Münster geprägt ward 4 ).
Der Bischof Erpho führte eine thätige, segensreiche Regierung. Besonders sorgte er für die Vollendung des von seinem Vorgänger gegründeten Collgiat=Stiftes S. Mauritii und wird daher als der "zweite Gründer" des Stiftes angesehen; dies wird in dem Rothen Buche 5 ) wiederholt anerkannt:
"Huic (Friderico) successit secundus collegii fundator et ampliator diuus Erpho Magnopolitanus, Friderici cognatus"
und
"Memoria beati Erphonis, huius sedis episcopi, qui fuit secundus ecclesiae nostrae fundator"
Im J. 1091 unternahm der Bischof Erpho eine Wallfahrt nach Jerusalem zum Heiligen Grabe. Seit dem Jahre 1000, "in welchem die abendländischen Christen vergeblich des Heilandes Wiederkunft erwartet hatten", ward das Wallfahrten nach dem Heiligen Grabe zur weit verbreiteten Sitte. 6 ) Und so kann es nicht auffallen, daß ein so thätiger


|
Seite 8 |




|
und unternehmender Mann, wie Erpho, auch diese religiöse Pflicht zu erfüllen strebte. Nachdem er am 2. Nov. 1090 die nach einem Brande wiederhergestellte Domkirche zu Münster unter Beistand des Erzbischofs Hermann von Cölln und des Bischofs Heinrich von Lüttich neu eingeweihet hatte 1 ), trat er seine Wallfahrt am 12. Febr. 1091 an; er selbst giebt diesen Tag in einer Urkunde 2 ) an ("quo etiam die poenitentes in ecclesiam induxi, utpote insequenti die Hierosolymam iturus"). Sicher ist, daß ihn der Propst Ludolf von S. Mauritii begleitete. Wevelinghovens münstersche Chronik und das Rothe Buch von S. Mauritii geben ihm, nach den oben mitgetheilten Stellen, andere, vornehme Begleiter, namentlich die Herzoge Gottfried von Bouillon und Robert von der Normandie und den Grafen Robert von Flandern, und schreiben Ihnen die Eroberung von Jerusalem zu. Dies ist aber offenbar unrichtig und die Chroniken haben den ersten Kreuzzug in die Wallfahrt Erpho's hineingetragen. Auch war seit 1091 Otbert 3 ) Bischof von Lüttich und nicht Odo, der auch diese Wallfahrt mit Erpho mitgemacht haben soll. Peter von Amiens unternahm seine Wallfahrt erst in den Jahren 1093 und 1094, aus welcher der erste Kreuzzug im J. 1096 hervorging. Erpho erreichte glücklich sein Ziel. Aber sein Begleiter, der Propst Ludolf ward im Heiligen Lande erschlagen ("in sancta terra Ludolphus praepositus occisus es", nach dem Rothen Buche); der Gedächtnißtag des Propstes Ludolf ward in der Mauritii=Kirche am 8. Nov. gefeiert (nach dem Rothen Buche). Die Wallfahrt des Bischofs Erpho ward aber von großer Bedeutung, indem er auf seiner Rückreise zu Rom und sonst überall die Bedrückung der Christen im Heiligen Lande lebhaft geschildert und den ersten Anstoß zu den Kreuzzügen gegeben, oder dieselben doch vorbereitet haben soll. Am 4. Januar 1092 war er zu Mantua 4 ) bei dem Kaiser, wo er vergeblich versuchte, die Trennung Mährens von dem Bisthume Prag zu verhindern. Erpho kehrte glücklich nach Münster heim und brachte 27 Reliquien mit; auch ein seltenes, kunstreich gearbeitetes Kreuz, das er nach Jerusalem mitgenommen hatte, brachte er in die Mauritii=Kirche wieder zurück, wo es noch heute bewahrt und gezeigt wird.


|
Seite 9 |




|
Erpho starb am 9. Novbr. 1097 nach dem Rothen Buche und dem Todtenbuche des Mauritii=Stiftes. 1 )
"In festo Theodori martyris 9. Novemb. obiit Erpho, istius sedis, intelligo Mimigardefordensis, episcopus, nostrae ecclesiae fundator secundus, quatuor solidos de campo Richberti, nunc de domo subdiaconi, et peragetur ista memoria, vt in nota inferius signata."
und:
"Memoria beati Erphonis huius sedis episcopi, qui fuit secundus ecclesiae nostrae fundatur, peragetur circa festum b. Martini, cantabuntur vigiliae in capella ejusdem" etc.
Ebenso setzt das Nekrologium des Klosters Liesborn den Gedächtnißtag auf den 9. Nov. Das Nekrologium der Domkirche zu Münster setzt seine Gedächtnißfeier auf den 11. Nov. 2 ), das Nekrologium der Liebfrauenkirche in Ueberwasser Münster auf den 10. Nov.
Erpho ward neben der S. Mauritii=Kirche, dicht am Westende derselben, auf dem Kirchhofe begraben. Späterhin ward über seinem Grabe eine Kapelle gebauet und mit der Kirche verbunden. Diese Erpho=Kapelle stand schon im J. 1347. Am 4. Mai 1347 3 ) bestätigte das Mauritii=Capitel die Verbesserung des Lehns des Diakonats der Kirche, nachdem der Priester Gottfried, der Besitzer des Lehns, 2 Mark, und der münstersche Bürger Bruno von Calmere 52 münstersche Pfenninge Renten dazu geschenkt hatten, unter der Bedingung, daß in der Kapelle ein neuer Altar errichtet werde zu Ehren des heiligen Apostels Bartholomäus, der Heiligen Drei Könige und des heiligen Erpho Bischofs ("in honorem beati Bartholomaei apostoli et sanctorum Trium Regum et beati Erphonis episcopi") 4 ) Dieser Altar ward auch im J. 1347 errichtet; in dem Rothen Buche 5 ) heißt es:
"Anno domini 1347 erectum est altare in sacello diui Erphonis episcopi, fundatoris collegii nostri secundi, et consecratum in honorem beati


|
Seite 10 |




|
Bartholomaei apostoli, sanctorum Trium Regum et Erphonis" etc.
Auf diese Weise kamen die beiden verwandten Bischöfe Friedrich und Erpho, Gründer des Mauritii=Stiftes, in derselben Kirche zu liegen.
Erpho ward nicht kanonisirt, d. h. nicht förmlich heilig gesprochen, aber von dem Volke seit Jahrhunderten als Heiliger verehrt, und die Kirche hat es unter den Augen eines Bischofs gerne zugelassen, ja durch die Bulle 1 ) des Papstes Urban VIII. vom 4. April 1625 gut geheißen. Sicher seit dieser Zeit wird er immer der heilige Erpho genannt und als solcher verehrt.
Im J. 1492 ward über seinem Grabe ein Denkmal errichtet. Aber (am 5. Januar) 1534 in der Nacht stürmten die Wiedertäufer die Kirche zu S. Mauritii und verwüsteten alles. Auch der Leichenstein des Bischofs Friedrich und das Grabdenkmal des Bischofs Erpho wurden zertrümmert. In der Erpho=Kapelle blieb nur ein Bruchstück eines alten Steines zu den Häupten des Grabes übrig mit den Inschriftworten: "Sanctus Erpho"; man sah hierin ein wunderbares Zeichen. Wenn auch nach dem Sturze des Wiedertäuferregiments die volle Ordnung wieder hergestellt ward, so ward doch erst im J. 1620 das Denkmal gesetzt, welches noch jetzt das Grab Erpho's ziert.
Die Erpho=Kapelle ist gegenwärtig also eingerichtet 2 ).
In der Mitte der Kapelle ist das Grab des H. Erpho.
Das im J. 1492 auf dem Grabe errichtete und 1534 von den Wiedertäufern zerstörte Denkmal hatte folgende von dem damaligen Propste Johann Edlen von Bronkhorst verfaßte Inschrift 3 ):
"Sanctus Erpho multis largitionibus in pauperes, religiosas virgines et ecclesiam affectus multisque virtutibus dum vixit praeclarus."
Das jetzt in der Kapelle auf dem Grabe Erpho's stehende, gut gearbeitete Denkmal ist im J. 1620 von dem Stifts=


|
Seite 11 |




|
scholasticus Jodocus von Werne († vor 1648) errichtet und aus seinem baumberger Sandstein (dem sogenannten "inländischen Marmor") verfertigt. Auf einer Tumba ruhet die volle, lebensgroße Gestalt des Bischofes, in bischöflichem Gewande, unter demselben mit einem reichen Harnische gerüstet, mit der Bischofsmütze auf dem Haupte und dem Bischofsstabe im rechten Arme, die Hände über der Brust gefalten, den rechten Fuß über den linken gelegt. Am Fußende steht der Name
Am Kopfende steht das Wappen: ein vierfach getheilter Schild, an der 1. und 4. Stelle ein rother Querbalken im goldenen Felde, das Wappenzeichen der Stadt Münster, an der 2. und 3. Stelle ein schwarzer Stierkopf mit goldener Krone im goldenen Felde wegen Meklenburg; hinter dem Schilde Bischofsstab und Schwert, über dem Schilde die Bischofsmütze. Auf dem Rande der Tumba steht in zwei Reihen folgende Inschrift:
IN HONOREM OMNIPOTENTIS │ DEI ET S. ERPHONIS, MEGOPOLITANAE FAMILIAE COMITIS, PRAESULIS MONASTERIENSIS AC 2DI HUIUS │ COLLEGII FUNDATORIS, CUIUS S│ACRUM CORPUS HIC REQUIESCIT, DE NOVO EREXIT ET PONI CURAVIT AO. MDCXX │ REVERENDUS AC NOBILIS DOMINUS JODOCUS │ A WERNE, HUIUS ECCLESIAE SCHOLASTICUS, MAUSOLEUM HOC, OLIM MAGNIFICE EXSCULPTUM, │ SED PER DIRAM ANABAPTIST │ARUM RABIEM ANTE HAC DIRUTUM. RENOVATUM ANNO MDCCLXIX

Ueber der Pforte der Kapelle nach der Kirche steht auf einer großen Votivtafel von Holz folgende Inschrift:
D.O.M.
SANCTO ERPHONI EPISCOPO MONASTERIENSI
SECUNDO HUIUS ECCLESIAE FUNDATORI. │ DER HEILIGER ERPHO VOM VATTER BUTHUE UNDT MUTTER HILDEGARDE AUS DEM HOHEN GE│SCHLECHTE MECKLENBURG GEBOREN IST NACH FRUHEZEITIGEM ABSTERBEN SEINER ELTERN │ VON SEINEM GROSSMÜTERLICHEN BRUDER FRIDERICO, 16 TEN BISCHOF DIESES HOCHSTIFFTS MÜN│STER UNDT 1 STEN FUNDATORE DIESER KIRCHEN UNDT CAPITULI, IN ALLEN GEISTLICHEN TUGENDTEN │ UNDT WISSENSCHAFFTEN SO ERZOGEN, DASS SELBER NACH DESSEN ABSTERBEN ANNO 1086 DES-│


|
Seite 12 |




|
SEN SUCCESSOR MERITIRET. SELBER HAT VIELE KIRCHEN UNDT ALTÄREN IN DIESEN HOCHSTIFTT │ CONSECRIRET, DIESE KIRCHEN UNDT CAPITUL ALsO GLÜCKLICH REGIERET, DASS BEI SEINER REGIE│RUNG KEIN EINZIGE SECTA SELBIGES BEUNRUHIGET, NACHMAHLEN 1095 MIT DAMAHLIGEN PROBSTEN LU │ DOLPHO UNDT VIELEN ANDEREN BISCHÖFFEN NACH JERUSALEM, UM DAS HEILIGE GRAB VON DEN TÜR│KEN ZU EROBERN GEREISET, NACH GLÜCKLICHER EROBERUNG A° 1100 WIEDERUM DAHIE ANGELANGET, DEN │ PROBSTEN LUDOLPHUM ABER AUSGELASSEN, FOLGENTS DIESES STIFFT NOCH EINIGE JAHR GLÜCK│LICH REGIERET, GESTORBEN UNDT ALHIE BEGRABEN, AUCH DURCH GROSSE MIRACULN BERÜHMET WOR│DEN, DASS ÜBER DESSEN GRAB VOR MEHR ALS 300 JAHR DIESE CAPELL GEBAWET, ZU DESSEN GRAB SEHR │ VIELES OPFFER GEBRACHT UNDT DIE LEUTHE VON IHREN KRANKHEITEN BEFREIET WORDEN, ALSO DASS │ NICHT ZU ZWEIFFELN, DASS DURCH DESSEN VORBITT SEHR VIEL ZU ERHALTEN SEY UNDT DURCH EIN │ ANDÄCHTIGES GEBETT ANGERUFFEN WERDEN KÖNNE.
OMNIBUS ASSISTENS SUCCURRE FIDELIBUS ERPHO
ET DEFENDE TUUM SANCTE PATRONE GREGEM
TABULAM HANC ANNO MDCCXIII A LUBERTO DE TINNEN, ECCLESIAE HUIUS DECANO ET BENEFACTORE MUNIFICENTISSIMO, REDINTEGRATAM VETUSTATE CORROSAM CAPITULUM RENOVARI CURAVIT.
ANNO MDCCLIV.
Es leuchtet auf den ersten Blick ein, daß der Inhalt dieser Gedächtnißtafel aus neueren Schriften, namentlich aus Boichorst, zusammengetragen ist.
Im J. 1847 ist die ganze Erpho=Kapelle restaurirt und dabei zugleich auf die Votivtafel erneuert worden.
Der Bischof Erpho bleibt eine sehr merkwürdige und wichtige Erscheinung in der Geschichte, vorzüglich dadurch, dass er ohne Heiligsprechung seit uralter Zeit zu dem Rufe eines Heiligen gelangt ist, ohne Zweifel ein Beweis für seine


|
Seite 13 |




|
vielen und großen Verdienste. Noch heute wandern viele Andächtige nach St. Mauritii hinaus, um an dem Grabe des heiligen Erpho ihre Andacht zu verrichten. Ueber die gegenwärtige Stimmung mögen folgende Worte aus dem Briefe eines münsterschen Domgeistlichen an mich reden: "Erpho ist nicht kanonisirt; aber selbst jetzt noch wird sein Name von Allen mit Ehrfurcht genannt, wenn er auch nicht mehr als Fürsprecher bei Gott dem Herrn angerufen wird. Ja, seine 1371 erbauete Kapelle bleibt stets ein Lieblingsplätzchen, besonders für alle die, welche gerne in der Stille sich der Andacht hingeben. Daß aber Jemand, wie Erpho, vom Volke als Heiliger verehrt wird, duldet die Kirche, ja sie sieht es sogar mit Wohlgefallen, wie wir ein Beispiel haben an der Johanna von Portugal, der man Kirchen, Kapellen und Altäre weihet".
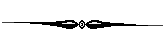


|
Seite 14 |




|



|


|
|
:
|
II.
Ueber
des Wendenkönigs Niklot Enkel
Kanut und Waldemar,
Prizlaus Söhne,
von
G. C. F. Lisch
Prizlav.
K önig Niklot von Wendenland hatte drei Söhne: Pribislav, Stammhalter des meklenburgischen Fürstenhauses, Wartislav und Prizlav. Ueber den Fürsten Prizlav schweigen die meklenburgischen Nachrichten gänzlich und er würde völlig unbekannt geblieben sein, wenn nicht dänische Chroniken und Urkunden über ihn berichteten. Die Nachrichten über Prizlav sind ziemlich vollständig enthalten in den Geschichtsbüchern des Saxo Grammaticus und in der Knytlingasaga, und es wäre wohl der Mühe werth, sein Leben zu beschreiben. In früheren Zeiten ist Prizlav vielfach mit seinem ältern Bruder Pribislav verwechselt und erst Rudloff (M. G. I, S. 125 und 139) hat den Prizlav scharf von seinem Bruder geschieden. In den neuesten Zeiten hat der Professor Werlauff zu Kopenhagen in der vortrefflichen Lebensbeschreibung der Königin Sophie von Dänemark, der Tochter des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow, welche in deutscher Uebersetzung in unsern Jahrbüchern IX, S. 111 flgd. mitgetheilt ist, in der Einleitung auch die frühern Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause beleuchtet und a. a. O. S. 118 auch das Leben Prizlavs mit Berücksichtigung der Quellen zur Untersuchung gezogen.


|
Seite 15 |




|
Prizlav hatte schon bei seines Vaters Lebzeiten die christliche Religion angenommen. Wegen dieses Schrittes soll er nach Saxo Gr. von seinem Vater verjagt, nach der Knytlingsaga soll er von den Dänen gefangen genommen sein. Er lebte seitdem in Dänemark und vermählte sich mit Katharina, einer Tochter des Knud Lavard, Herzogs von Südjütland und Königs der Wenden, des Vaters des Königs Waldemar I. von Dänemark. In Folge dieser Vermählung ward er von dem Könige Waldemar I. mit schönen Inseln des dänischen Reiches ("magna nobilium insularum pars") belehnt, namentlich mit Lolland, das späterhin im Besitze seines Sohnes erscheint, und vermuthlich mit Alsen. Er war in seinem Vaterlande im Gefolge Waldemars, als im J. 1160 mit Niklot und der Burg Werle das Heidenthum im Wendenlande fiel, und er sah vor der Burg Werle seines Vaters Haupt auf einer Stange stecken, als er den Bischof Absalon auf dessen Zuge durch Wendenland zum Herzoge Heinrich dem Löwen begleitete 1 ). Nach dem J. 1164 kommt Prizlav nicht wieder vor.
Prizlav hinterließ zwei Söhne. "Daß er auch Töchter sollte hinterlassen haben, beruht nur auf unbegründeten Vermuthungen 2 )". Den einen Sohn kennt schon Rudloff; der andere Sohn ist durch dänische Schriftsteller ans Licht gezogen, und Werlauff nennt ihn a. a. O. ausdrücklich.
Es kommt hier wesentlich darauf an, zu dem Besitze der ungetrübten Quellen zu gelangen, aus denen die spärlichen Nachrichten über das Leben der beiden Söhne Prizlavs fließen.
Kanut.
Der eine Sohn war Kanut, Herr von Lolland, und wird von Saxo Gr. wiederholt genannt. Dieser Kanut gründete auf dem östlichen Theile von Fünen eine Stadt, vermutlich Ryeborg, und vielleicht hat das nahe liegende Knudshovet von ihm den Namen.
Rudloff sagt in seiner M. G. I, S. 139, Not. o., daß die Universitäts=Bibliothek zu Upsala eine Urkunde von ihm aufbewahre, worin er am 20. Nov. 1183 der Kirche zu Odensee einen Theil seiner Erbschaft auf Alsen vermachte. Nach dieser Andeutung habe ich mich viele Jahre lang bemühet, eine Abschrift dieser Urkunde aus Upsala zu erlangen, jedoch blieben


|
Seite 16 |




|
alle Bemühungen nach verschiedenen Seiten hin vergeblich. Als ich im J. 1851 den Ankauf der handschriftlichen Urkunden=Sammlung Rudloffs aus dessen Nachlasse für das großherzogliche Geheime und Haupt=Archiv zu Schwerin vermittelte, fand ich in derselben zwar die lange vergeblich gesuchte Abschrift der Urkunde, aber offenbar so lückenhaft und fehlerhaft, daß auf diese Abschrift nicht viel zu geben war. Kurz vorher hatte ich in den Urkunden=Regesten zur dänischen Geschichte 1 ), Bd. I, auch diese Urkunde aufgeführt und einige Stellen, wo sie gedruckt sein sollte, angegeben gefunden. Ich setzte daher meine Bemühungen in Dänemark fort und war endlich so glücklich, durch die unermüdliche Bereitwilligkeit und Thätigkeit meines Freundes, des Herrn Directors und Professors Dr. Paludan=Müller zu Nyköbing auf Falster, früher Professors in Odensee, eine sichere Abschrift von der getreuen und zuverlässigen Abschrift des dänischen Geschichtsforschers Langebek mit vielen andern willkommenen Mittheilungen und Aufklärungen aus dem Geheimen Archive zu Kopenhagen zu gewinnen.
Diese Urkunde 2 ) und deren Inhalt in die meklenburgische Geschichte einzuführen, ist der Hauptzweck der gegenwärtigen Zeilen. Diese Urkunde in ihrer Vollständigkeit hat Inhalt genug, um einen Blick in das Leben unsers Fürsten Kanut zu gönnen, einen festen Grund zu gewinnen und manche Dichtung älterer Geschichtsschreiber zu zerstören. Aus dieser Urkunde ergiebt sich Folgendes mit ziemlicher Gewißheit:
Der Fürst Kanut, "ein Sohn des Fürsten Prizlav", hatte sich, obgleich er nicht Mönch ward, der Geistlichkeit sehr ergeben, wie nicht allein aus dieser Urkunde hervorleuchtet, sondern auch aus den Briefen des Abtes Stephanus des Klosters zu S. Genovefa in Paris, in welchem sein Bruder Waldemar als Mönch starb, wie sich aus der folgenden Darstellung ergeben wird. Gegen das Ende seines Lebens hatte der Fürst Kanut sein Begräbniß in der Mönchskirche zum Heiligen Kanut zu Odensee, in welche dessen Gebeine nach seiner Heiligsprechung versetzt worden waren, erwählt; der Heilige Kanut war ein Großoheim der Gemahlin des Fürsten Kanut gewesen. Die Mönche des Klosters hatten ihn in die volle Brüderschaft ("Fraternität", plenariae fraternitatis suae collegium") ihres Klosters aufgenommen und ihm nach seinem Tode den Mitgenuß aller ihrer guten Werke verheißen, gleich als wenn er


|
Seite 17 |




|
ihr wahrer, eingekleideter Klosterbruder gewesen wäre ("velut pro suo proprio fratre loci professo"). Aus diesen Worten geht klar hervor, daß Kanut nicht in den eigentlichen Mönchsstand getreten war, sondern nur die "Fraternität" (Brüderschaft) des Klosters verliehen erhalten hatte, eine Begünstigung, die das ganze Mittelalter hindurch nicht selten war; aus den etwas gesuchten und bestimmten Ausdrücken der Urkunden kann man aber als wahrscheinlich annehmen, daß er sich gegen das Ende seines Lebens als "Conversbruder" in das Kloster begab, um in frommer Einsamkeit zu leben, ohne gerade in den Mönchsorden zu treten. Er hatte, als er in die Fraternität aufgenommen war, noch einen eigenen Capellan Heinrich, der auch sein Arzt war, und drei Stallmeister: Ubbo, Gottfried und Toke. Zur Wiedervergeltung vermachte Kanut der S. Kanutskirche am Tage des Heiligen Märtyrers und Königs Edmund (20. Nov.) 1183 zwei Hufen in Tandzleth auf der Insel Alsen und alle seine Besitzungen, welche er auf der Insel Alsen hatte, und der Bischof Simon von Odensee bestätigte diese Schenkung mit seinem Banne. Nach dem ganzen Ton der Urkunde war dieselbe unbezweifelt das Testament Kanuts. Daß Kanut aber noch in dem Jahre 1183 gestorben sei, läßt sich nicht bestimmen. So viel scheint aber aus der Urkunde hervorzugehen, daß er der letzte seines Hauses war und keine Kinder hinterließ, da in der ganzen Urkunde nicht von Angehörigen oder Erben die Rede ist, wie es sonst wohl in ähnlichen Vermächtnissen der Fall zu sein pflegt, sondern statt der Zustimmung seiner Erben der Bann des odenseer Bischofs Simon eintrat.
Daß der Fürst Kanut, welcher die Urkunde vom 20. Nov. 1183 ausstellte, sicher ein Sohn des wendischen Fürsten Prizlav war, wird nicht allein durch die Worte der Urkunde, sondern auch durch die Umschrift auf seinem Reitersiegel 1 ) bewiesen, welche lautete:
S, Canuti filii principis Prizlai.
Der Löwe auf dem Rücksiegel Kanuts soll wohl auf seine Herrschaft Laland zielen. So viel läßt sich aus der Urkunde herauslesen. Daher ist denn auch Alles unbegründet, was ältere Geschichtschreiber so bestimmt von dem Fürsten Kanut erzählen, z. B. was Pantoppidan in seiner Kirchen=Historie des Reichs Dänemark I, 1741, S. 459, aus der Urkunde herausbringt: "daß der Fürst Kanut am 20. Nov. 1183 in Gegenwart vieler vornehmer Herren mit gewöhnlichen Cere=


|
Seite 18 |




|
monien vom Bischofe Simon eingeweihet und aller weltlichen Hoheit entzogen sei, daß er aber nur wenige Zeit im Mönchsstande zugebracht und bereits bei Antretung desselben eine zehrende Krankheit am Halse gehabt habe und im Jahre 1183 gestorben sei". Auch Suhm in seiner Geschichte von Dänemark, VIII, S. 37, nimmt an, daß Kanut in dem Kloster zu Odensee "ohne Zweifel am selbigen Tage als Mönch eingekleidet und bald nachher an der Auszehrung gestorben sei".
Alle diese Erzählungen sind nur unbegründete Vermuthungen, welche in diese Urkunde hineingetragen sind, da keine andere Nachricht vorhanden ist. Wie lange Kanut noch gelebt habe, läßt sich nicht bestimmen.
Waldemar.
Durch die Forschung über das Leben des Fürsten Kanut, Prizlavs Sohn, ist auch ein zweiter Sohn Prizlavs mehr in den Vordergrund getreten, der Fürst Waldemar, welcher zwar dänischen Geschichtsforschern bekannt, in der meklenburgischen Geschichte aber bisher völlig unbekannt war. Die einzige Quelle sind zwei Briefe des Stephanus, Abtes des Klosters zu S. Genovefa in Paris, welcher selbst in Dänemark gewesen war und der im J. 1203 als Bischof von Tournay starb. Diese zuverlässigen, vom J. 1159 bis zum J. 1196 geschriebenen, leider nicht datirten Briefe 1 ) eines bewährten Mannes sind den neuern dänischen Geschäftsforschern bekannt geworden, weil die Sammlung viele Briefe des Abtes an andere dänische Personen enthält. Der eine Brief 2 ) ist an den "Edlen Kanut von Dänemark" (Canuto nobili viro de Dacia") geschrieben. Stephanus redet ihn an als einen, der königlichem Geschlechte entsprossen sei, und schreibt ihm: sein leiblicher Bruder ("frater carnalis") Waldemar, ein Jüngling von guten Anlagen, der dem königlichen Geschlechte ("regio generi") seines Bruders Ehre gemacht habe und in gesegnetem Andenken stehe, sei in dem Genovefa=Kloster in Paris gestorben und daselbst begraben, und sei der guten Werke, wie einer der Klosterbrüder, theilhaftig geworden.


|
Seite 19 |




|
Zugleich bittet der Abt um milde Beiträge, da er die durch Kanuts heidnische Vorfahren eingeäscherte S. Genovefa=Kirche, in welcher Waldemar ruhe, zu restauriren und mit Blei zu decken beabsichtige.
Ein zweiter Brief 1 ) ist an den König Kanut von Dänemark gerichtet. In diesem Briefe schreibt der Abt Stephanus an den König, daß er nicht so unverschämt sein wolle, ihn um einen Beitrag zur Restaurirung der durch seine Vorfahren (die Normannen) zerstörten Genovefa=Kirche anzusprechen; er bitte ihn aber, seinen Verwandten ("consanguineum"), den Edlen Kanut ("nobilem virum Canutum"), zu erinnern, daß er seines Bruders Waldemar gedenken möge, der auf seinem Sterbebette Mönch ihres Klosters ("in beato fine suo canonicus noster factus") geworden, in ihrer Kirche begraben und der guten Werke des Klosters theilhaftig geworden sei, und ihn zu bewegen, daß er zum Seelenheile seines Bruders, der bei seinem Leben nichts von seinem Erbe genossen habe, der Noth der Kirche durch eine angemessene Gabe zu Hülfe kommen möge.
Zu derselben Zeit schrieb der Abt Stephan auch Briefe an den Erzbischof Absalon von Lund, an den Bischof Waldemar von Schleswig, an den Bischof Orm (Omerus) von Ripen, an den Abt Wilhelm von Eskelsöe, an Peter Sunesson mit derselben Bitte.
Es steht zur Frage, woher diese beiden Brüder Kanut und Waldemar stammen. Der scharfe dänische Kritiker Gram 2 ) vermuthet, diese Brüder seien bisher unbekannte Neffen des im J. 1157 zu Roskilde ermordeten Königs Kanut V. Magnussen gewesen. Suhm dagegen nimmt an, Waldemar sei der Bruder desjenigen Kanut, der in der Urkunde vom 20. Nov. 1183 als ein Sohn Prizlavs bezeichnet wird. Diese Ansicht ist von allen neuern dänischen Geschichtschreibern befolgt, und es steht der Annahme allerdings nichts im Wege; Stephanus nennt den Kanut einen "durchlauchtigen Mann und einen Edlen, der aus königlichem Geschlechte entsprossen und ein Verwandter des regierenden Königs Kanut sei". Dies Alles läßt sich ohne Zwang auf Söhne Prizlavs anwenden und hat wenigstens das für sich, daß der eine, Kanut,


|
Seite 20 |




|
urkundlich gesichert ist, während alle andern Annahmen rein erdacht sind. Daher werden denn auch die Brüder Kanut und Waldemar als Prizlavs Söhne angesehen; Werlauff a. a. O. nimmt dies ohne Bedenken an und die Regesten zur dänischen Geschichte (I, Nr. 353) fügen ausdrücklich zu dem Namen Kanut hinzu, daß er ein Sohn Prizlavs gewesen sei ("ad Canutum [Prislavi filium] epistola").
Da die nur in den Concepten erhaltenen Briefe nicht datirt sind, so ist über das Jahr ihrer Ausstellung mancherlei vermuthet. Suhm nimmt ohne Grund an, daß Prizlavs Sohn Kanut noch im Jahre 1183, dem Jahre der Ausstellung der Urkunde, gestorben sei und daß Stephanus, mit dem Tode dieses Fürsten unbekannt, den Brief an ihn mit den andern Briefen im J. 1184 geschrieben habe, nachdem er schon vorher vergeblich an ihn geschrieben haben müsse, weil er den König Kanut bittet, daß er es versuchen möge, das harte Herz seines Verwandten Kanut zu bewegen. Die dänischen Regesten (1843) setzen die Briefe nach Suhm auch in das Jahr 1184. Gram dagegen setzt die Briefe in das Jahr 1191 oder 1192 und nimmt an, daß Kanut, den er freilich nicht für Prizlavs Sohn hält, damals noch am Leben gewesen sei. Alles dies ist nur willkührlich angenommen und ohne Grund. Daß die Briefe ungefähr in jener Zeit geschrieben sein müssen, geht aus den übrigen Briefen an gleichzeitige Personen hervor. Da der dänische Prinz Waldemar im J. 1182 als erwählter Bischof von Schleswig aufgeführt wird und der König Kanut VI. am 12. Mai 1182 den Thron bestieg, so können die Briefe des Abtes Stephanus erst nach dem J. 1182 geschrieben sein. Da Waldemar 1191 oder 1192 zum Erzbischofe von Bremen und Peter im J. 1191 zum Bischofe von Roskilde erwählt ward, so müssen diese Briefe vor dem J. 1191 geschrieben sein. Es mag daher nicht weit von der Wahrheit liegen, daß die Briefe um das J. 1184 geschrieben wurden.
Es wird sich aber mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen lassen, das der Prinz Waldemar ein Bruder des "Durchlauchtigen und Edlen Kanut" und ein Sohn des wendischen Fürsten Prizlav gewesen sei, um so mehr, als in jener Zeit die königlicheWürde der Obotritenfürsten allgemein angenommen wird.


|
Seite 21 |




|
Nach diesen und anderen Forschungen gestaltet sich die Genealogie und Chronologie der ältesten Glieder des meklenburgischen Fürstenhauses folgendermaßen:

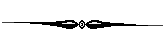


|
Seite 22 |




|



|


|
|
:
|
III.
Ueber
Chotibanz und Chutun
von
G. C. F. Lisch.
Z u den merkwürdigsten Gegenden für die älteste Geschichte Meklenburgs gehört ohne Zweifel der Landstrich zwischen dem südlichen Ende des Tollense=Sees und der östlichsten Biegung des Müritz=Sees, oder vom Lieps=See bis zum Specker See und zum Düster=Wohld (silva tenebrosa), dort, wo die Ortschaften (Nemerow), Prilwitz, Hohen=Zieritz, Peccatel, Kostal (jetzt Adamsdorf), Kratzburg, Pieverstorf, Dambeck, Speck liegen, um die Quellen der Havel. Diese Gegend gehörte in alten Zeiten der mächtigen adeligen Familie von Peccatel, auf dem Schlosse und "Städtchen" Prilwitz gesessen, deren gewaltige Burgwälle noch heute Zeichen ihrer Macht sind; in einer Urkunde vom J. 1408 1 ) werden alle peccatelschen Hauptgüter aufgeführt: Prilwitz, Usadel, Blumenholz, Weisdin, Dolgen, Oldendorf, Hohen=Zieritz, Peccatel, Langhagen, Stribbow, Peutsch, Dambeck, Zahren, Lübchow, Liepen, Wustrow, Zippelow, Ziercke, zu denen gewiß noch viele dienst= und pachtpflichtige Bauerdörfer gehörten. Es ist gewiß nicht von ungefähr, daß diese Räume in den ältesten Urkunden genannt worden, wenn dies auch nur daher kommt, daß es als verwüstetes Land, vielleicht einst heidnisches Tempelland, verlassen war und der christlichen Geistlichkeit übergeben ward. Es ist dieses Land in neuern Zeiten auch viel besprochen. Aber so alt, bestimmt und ausführlich


|
Seite 23 |




|
auch die alten Nachrichten sind, so sind sie doch bisher ziemlich dunkel geblieben, weil es häufig an sichern Anhaltspunkten fehlte. Ich will es versuchen, durch Hülfe einiger glücklicher Entdeckungen diese Gegenden etwas mehr zu erhellen, und will wünschen, daß ich dadurch zu Forschungen an Ort und Stelle Veranlassung geben möge.
Die nächste Veranlassung zur Forschung geben die sogenannten Strelitzschen Haidedörfer bei Kratzburg. Am 6. Jan. 1257 verlieh 1 ) der Fürst Nicolaus I. von Werle dem Kloster Dargun diese Dörfer, namentlich Kratzburg (auch Werder genannt), Techentin, Blankenförde und Granzin, und beschrieb die Grenzen derselben genau. Diese Dörfer gingen im J. 1359 durch Verkauf von dem Kloster Dargun an die Johanniter=Comthurei Mirow über. Diese Beschreibung beginnt mit dem südlichen Theile der östlichen Grenzen dieser Dörfer:
die Grenzen beginnen in dem See, der Langhagen heißt, und steigen grade gegen Süden hinauf bei zwei bezeichneten Eichen vorbei zu einem Berge, auf welchem eine bezeichnete Eiche steht, von wo sie in grader Richtung durch ein großes Moor fortgehen bis zu einem See, welcher Techentin genannt wird.
("Incipiunt in stagno, quod Lanckauel dicitur, et ascendunt directe ad austrum perante duas quercus signatas ad montem vnum, in quo stat quercus signata, inde recto cursu procedunt per paludem magnam vsque ad stagnum, quod Thechentin vocatur, a quo stagno circumflectuntur per ascensum Hobole" etc.)
Diese Grenze ist völlig klar. - Der Name Lanckavel ist die beständige, alte, häufig vorkommende Namensform für die Güter, welche jetzt Langhagen genannt werden. - Der See Techentin führt jetzt nicht mehr diesen Namen; ohne Zweifel hatte er seine Benennung von dem Dorfe Techentin, welches dem Kloster Dargun im J. 1257 mit verliehen ward, jetzt aber auch nicht mehr steht und früh untergegangen sein muß, da gar keine bestimmte Nachricht darüber mehr vorhanden ist Nach der Verleihung gehörte das Dorf mit zu den Haidedörfern und lag auch innerhalb der geschlossenen Grenzen derselben. Nach dem Visitations=Protocolle der Kirche zu Blankenförde vom J. 1651 hatte damals diese Kirche:
"ein Stück Ackers im Techentin vorm Holze"


|
Seite 24 |




|
und
"noch ein Stück Ackers im Techentinschen Felde."
Das Dorf Techentin lag also bei Blankenförde. Hiernach und nach der oben mitgetheilten Grenzbeschreibung kann der See Techentin kein anderer sein, als die nördliche Bucht des jetzt sogenannten Userinschen Sees. Die Comthurei Mirow behauptete im 16. Jahrh. wiederholt: der Techentin(=See) liege auf des Ordens Grund und Boden.
Dieser See und dessen nördliche Bucht hat sehr verschiedene Namen geführt. In den ältesten Zeiten hieß der ganze See: der See von Vielen. Im J. 1257 und späterhin hieß die nördliche Bucht der Techentiner=See. In jüngern Zeiten führte diese Bucht den Namen Krams=See; so steht auf der großen schmettauschen Charte von Mecklenburg=Schwerin, während auf der Charte von Meklenburg=Strelitz Krumme See steht. Den Namen Krams=See hatte diese Bucht von dem Dorfe Kramptz, welches ebenfalls untergegangen ist. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hatte die adlige Familie von Bardenfleth, außer den Gütern Zahren, Gr.Vielen, Dambeck und Pieverstorf, auch noch "etliche Gerechtigkeit an der Feldmark Kramptze, die Gerechtigkeit zu Kratzburg und drei Drömt Mehl aus der Neuen Mühle". In der Mitte des 16. Jahrh. heißt es: "de wuste Feldmarke de Kramtze genometh sampt 1 gemekligen schonen Sze heft den Bardenuleten gehorth. Desse veltmarckede hebben de grantzinschen, de dalmestorper, de kratzeborger und de blankenuörder". Die beiden untergegangenen Dörfer Techentin und Kramptze lagen also wohl an dem westlichen Ufer der nördlichen Bucht des Userinschen Sees. - Der Userinsche See hat in neuern Zeiten seinen Namen von dem Dorfe Userin erhalten.
Von den weitern Grenzen der Haidedörfer kommen hier nur die nördlichen in Betracht. Nachdem die westlichen Grenzen bis zum Pagel=See ("stagnum Paule") beschrieben sind und gesagt ist, daß sie von hier grade gegen Norden gehen, heißt es weiter, daß sie (an der Nordseite der Haidedörfer) gehen:
"vsque ad quoddam stagnum, quod dicitur paruum Sciruene, a quo per ascensum parai montis recto tramite ante multas quercus signatas versus orientem veniunt ad quoddam stagnum, quod Cuthimershe nominatur; inde paruo interuallo procedunt ad quandam quercum, quae tres praecipuos habet ramos et inferius est exusta; inde flectuntur et currunt


|
Seite 25 |




|
ad aliam quercum, vbi conterminantur campi illorum de Granzin et de Cutkune et de Dalmerstorpe, a qua procedentes vadunt directo cursu ad quendam valliculum, ubi concurrunt termini illorum de Dalmestorp et illorum de Chutune et de Dannenbeke; inde recto cursu tendunt ante multos valliculos pro terminis factos vsque ad quandam magnam crucem quatuor vicibus signatam; inde vadunt iterum ante tales valliculos et dirigunt gressum suum vsque ad Hobolam fluvium tenduntque per Hobolam ad castrum Zcarnitz, de quo videlicet castro vergunt ad vallem Liperi".
Dies heißt nach einer zugleich erläuternden Uebersetzung also:
(Die nördlichen Grenzen der Haidedörfer beginnen im Westen nicht weit östlich vom Specker=See) bei einem See, welcher der kleine Zilmann genannt wird, von welchem sie einen kleinen Berg hinauf in grader Richtung bei vielen bezeichneten Eichen vorbei gegen Osten gehen bis zu einem See, welcher der Cutuner See genannt wird; von hier gehen sie eine kurze Strecke weiter zu einer Eiche, welche drei große Zweige hat und unten ausgebrannt ist; von hier biegen sie sich und gehen zu einer andern Eiche, wo die Felder derer von Granzin und von Cutun und von Dalmerstorf grenzen, von welcher sie weiter grade aus zu einem kleinen Thale gehen, wo die Grenze derer von Dalmerstorf, von Cutun und von Dambeck zusammenstoßen; von dort gehen sie in grader Richtung bei vielen kleinen Thälern (Gräben), die zu Grenzen aufgeworfen sind, zu einem großen Kreuze, das an den vier Seiten bezeichnet ist; von hier gehen sie wieder bei solchen Gräben vorbei und lenken ihre Richtung bis zum Flusse Havel und gehen durch die Havel zur Burg Zcarnitz, von welcher sie zum Lieper=Thale gehen.
Darauf beginnt die Beschreibung der östlichen Grenzen gegen das Gut Liepen, in denen nur das Thal Margrevenbude in der Nähe des Käbelick=(Cobolc=)Sees einen auffallenden Namen hat.
Diese Gegend bedarf der Aufklärung, um einen sichern Grund für die folgenden Untersuchungen zu gewinnen. Der Anfangspunkt der Nordgrenzen ist sicher: der See Scirvene ist der See, welcher jetzt der Zilman=See heißt und


|
Seite 26 |




|
östlich neben dem Specker See liegt; zur noch deutlichern Bestimmung wird gesagt, daß sich von hier die Grenzen gegen Osten wenden.
Die Hauptfrage bleibt nun die, wo der Ort Cutun gelegen habe. Nachdem der Zug der Grenzen mit Sicherheit erkannt ist, kann Cutun nur nördlich von Granzin gelegen haben. Es ist dann unzweifelhaft, daß der in der Urkunde unter zwei verschiedenen Formen vorkommende Name einen und denselben Ort bezeichne: die Formen Cutkune und Chutune sind Namen Eines Ortes, obgleich sie neben einander stehen und verschieden geschrieben sind. Dann liegen die Grenzen der hier aufgeführten Ortschaften ungefähr also:
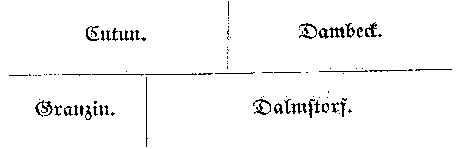
Nachdem diese Grenze ermittett ist, läßt sich denn auch der Cuthimershe genannte See feststellen. Dies ist ohne Zweifel der zu dem Orte Cutun gehörende See; der Name ist in Cuthimer=shê oder Cuthuner=shê, d. i. Cutuner See aufzulösen. Es ist möglich, daß in der Original=Urkunde auch cuthunershe steht, was durch Undeutlichkeit der Schrift wie cuthimershe erscheint. Jedoch ist diese verschiedene Lesart nicht von großer Wichtigkeit; der Cuthimer oder Cuthuner See ist der nicht weit östlich vom Zilman See in gleicher Richtung liegende Lange=See neben dem Gute Dambeck. Durch eine glückliche Entdeckung ist denn auh der Ort Cutun wieder gefunden, in der Feldmark des Dorfes Gottun neben Dambeck 1 ), welches schon im Mittelalter wüst ward. Die Güter Zahren und Dambeck mit Zubehörungen gehörten zu dem großen Besitze der Herren von Peccatel auf Prilwitz. Schon im J. 1408 stand der größere Theil dieser Güter den v. Bardenfleth zu Pfande 2 ), welche auch im Besitze derselben blieben. Im J. 1519 hatte Achim v. Bardenfleth, mit dem um 1548 das Geschlecht ausstarb,


|
Seite 27 |




|
die Güter an Henneke v. Holstein auf Ankershagen oder Wickenwerder verpfändet, bei dessen Familie sie auch zunächst nach dem Aussterben des Geschlechts v. Bardenfleth blieben. Diese Güter waren Zahren, Gr. Vielen halb, Dambeck, Pieverstorf 1 ) und die wüste Feldmark Gottun genannt 2 ). Als nach dem Aussterben des Geschlechts der Bardenfleth dessen ehemaliger Besitz bei dem Lehnhofe zur Untersuchung kam, wird gesagt, daß denselben gehört habe: Zahren, Gr. Vielen, Dambeck, Pieversdorf, die wüste Feldmark Goddun , das Gut zu Rutzenfelde, etliche Gerechtigkeit an der Feldmark Kramptze, die Gerechtigkeit zu Kratzeburg und drei Drömt Mehl aus der Neuen Mühle.
Es ist also außer Zweifel, daß der Ort Chutun oder Cutkun mit dem Cuthunersee die schon im 15. Jahrh. wüst liegende Feldmark Gottun war, welche zu Dambeck gehörte.
Nach dieser Ermittelung lassen sich die nördlichen Grenzen der Haidedörfer der Comthurei Mirow ganz klar bestimmen. Sie beginnen am Zilman=See (stagnum Sciruene), gehen von dort gegen Osten zu dem See, der Gottuner=See (Cuthimershe, jetzt Lange See) genannt wird, von diesem zu dem Punkte, wo die Grenzen von Granzin, Gottun und Dalmerstorf, und von dort zu dem Punkte, wo die Grenzen von Dalmerstorf, Gottun und Dambeck zusammenstoßen; von hier gehen sie zu einem großen Kreuze und nehmen ihre Richtung zum Havelflusse, d. h. dahin, wo die Havel aus dem dambecker See fließt, und durch die Havel bis zur Burg Zcarniz, von wo sie sich zum Lieper Thale wenden.
In dem letzten Theile dieser Beschreibung ist nur das große Kreuz, ungefähr südlich von dem Gute Dambeck, und die Burg Zcarniz merkwürdig. Die Burg Zcarnitz (d. i. wohl die schwarze oder dunkle Burg) lag ohne Zweifel südlich von Pieverstorf, ungefähr dort, wo auf der großen schmettauischen Charte ein großer Burgwall angedeutet zu sein scheint, in ziemlich grader Richtung zwischen Piverstorf und Kratzburg. Es ist die Frage, ob der Name Kratzburg nicht mit der Zcarnitz oder Zcarnburg im Zusammenhange steht. Das Dorf Kratzburg hieß im 13. Jahrh. Werder 3 ) und war sicher nur ein Bauerdorf zu einer Burg Kratzeburg;


|
Seite 28 |




|
im Anfange des 14. Jahrh. hatte aber das Dorf den Namen Kratzeburg erhalten ("villa Werder, quae nunc Kraceborch nuncupatur" 1 ), nachdem wohl die Burg ihre Bedeutung verloren hatte. Die Namen: Zcarnitz, d. h. auf deutsch: schwarze oder dunkle Burg, Pyvestorf, Kratzeburg, Cutun und andere in dieser Gegend, so wie die Nähe des Gaues Turne, scheinen eine große Bedeutsamkeit in Beziehung auf die viel besprochene Lage von Rethra zu haben.
In naher Beziehung zu diesen merkwürdigen Oertlichkeiten steht die frühe Stiftung des Klosters Broda bei Neu=Brandenburg. Als am Einweihungstage der Kirche zu Havelberg, am 18. August 1179, das Kloster Broda gestiftet ward, schenkten die Fürsten von Pommern demselben einen ungeheuren Länderstrich, von welchem aber das Kloster, als es zu Bestande kam, nur den geringern Theil behielt. Das Kloster erhielt 2 ) zu seiner Stiftung zugesichert: 1) den Landstrich westlich von der Tollense von Calübbe bis Hohen=Zieritz und in diesem unter andern die Ortschaften Penzlin, zwei Dörfer (Gr. und Kl.) Vielen, Wustrow, Zieritz; 2) im Lande Raduir östlich von der Tollense den Landstrich von Podewahl bis zur Lieps und in diesem unter andern die Ortschaften Prilwitz, Nemerow und Stargard, - im Ganzen also die ganze Gegend weit rund um den Tollense=See, - und dazu 3) die Lieps.
"Lipiz cum omnibus uillis suis in stagnum Woblesko et sursum Havelam usque Chotibanz et desertas villas quae a Vilem inter fines Chotibanz, Lipiz et Hauelam iacent".
(Die Lieps mit allen ihren Dörfern bis zum Woblitz=See (stagnum Woblesko) und die Havel hinauf bis Chotibanz und die wüsten Dörfer, welche von Vielen zwischen Chotibanz, der Lieps und der Havel liegen.)
Diese Gegend, welche kurz nach Vollenduug der Kreuzzüge gegen die Wenden wüst lag, scheint jetzt ganz klar nachgewiesen werden zu können.
Die Lieps ist ohne Zweifel der noch jetzt sogenannte See südlich von der Tollense bei Prilwitz.
Der See Woblesko ist der noch jetzt sogenannte Woblitz= See bei Wesenberg.


|
Seite 29 |




|
Chotibanz ist nach den obigen Ermittelungen ohne Zweifel bei Chutun oder Gottun bei Dambeck zu suchen. Vielleicht bezeichnet die Sylbe - banz: Gau oder Bezirk. So hieß auch bei Doberan ein Bezirk Cubanze, in welchem die Dörfer Diedrichshagen und Brunshaupten lagen.
Vilem oder Vielen muß ein anderes Vielen sein, als die Dörfer Gr. und Kl. Vielen bei Penzlin, welche schon in der ersten Gütergruppe westlich vom Tollense=See aufgeführt waren. Die Dörfer Userin, Quassow und Gor, welche östlich am Userinschen See liegen, gehörten in alten Zeiten dem pommerschen Kloster Stolpe, welches dieselben am 24. Febr. 1346 den Rittern von Dewitz zu Lehn gab 1 ) und dabei die Grenzen genau beschrieb; zu diesen Gütern gehörte auch der Userinsche See ("de gantze See tu Vylym") und die Mühle, und die Grenzen der Güter waren: der See zu Vylum, der die Havel durchfließt und eine Mühle treibt, die Havel niederwärts zu dem Bache, der aus dem Ziercker=See, (see tu Cyroch) kommt, den Bach aufwärts bis zu dem Ziercker=See, von hier in den Bruch bis zur Haide und von dort wieder bis an den genannten See von Vylum. Es ist also ganz klar, daß der jetzt sogenannte Userinsche See damals der See zu Vielen hieß und daß an demselben ohne Zweifel auch ein Dorf Vielen lag oder gelegen hatte. Klöden 2 ) meint, daß die Orte Vielen, Vilm, Viel(i)tz u.s.w., welche fast ganz auf Pommern und Meklenburg beschränkt bleiben, von der Vila oder Wyla, der slavischen Göttin der Unterwelt, den Namen haben.
Die Grenzen dieses dem Kloster Broda verliehenen Güterbezirkes lagen also zwischen den Endpunkten Lieps=See, Woblitz See, durch welchen die Havel strömt, und die Havel hinauf, und dem Bezirk Chotibanz oder Gottun bei Dambeck. Dies sind wesentlich die Gegenden der Dörfer Weisdin, Glambek, Ziercke und Prelank, der Raum der Städte Strelitz 3 ), die genannten spätern Stolpeschen Klosterdörfer Userin, Quaffow und Gor und die spätern Kloster=Dargunschen und darauf Comthurei=Mirowschen Dörfer Kratzeburg, Blankenförde (mit Techentin und Krampz), Granzin und Dalmerstorf.


|
Seite 30 |




|
Das Kloster Broda erhielt also geschenkt diesen Raum, welcher die Lieps genannt ward, mit allen Dörfern zwischen Lieps, Woblitz und Chotibanz, und besonders zugesichert noch die wüsten Dörfer zwischen Vielen und der Havel und Lieps und Chotibanz. Dieser zweite Bezirk ist kein neuer Bezirk, sondern nur die westliche Hälfte des im algemeinen schon zugesicherten Bezirks, in welchem die Dörfer wüst lagen, während es scheint, daß in dem östlichen Theile die Dörfer der Lieps schon oder noch besetzt waren.
Hier ist der Ort oder Bezirk Chotibanz von Wichtigkeit. Da er von den Seen Woblitz und Vielen die Havel aufwärts am Ende lag, so ist es keinem Zweifel unterworfen, daß er in oder bei Cutun oder Gottun in der Nähe von Dambeck lag, und wir gelangen hier wieder in jene Gegend, welche sich als besonders merkwürdig zeigt.
Es leidet kein Bedenken, daß die Wörter Chut-un und Chot - i - banz dieselbe Sprachwurzel Chut- haben. Der Name ist schon in den Jahrbüchern III, S. 18 - 19, zur Untersuchung gezogen. Der Wortstamm kommt in slavischen Namen öfter vor, z. B. Chotibuz, Chotimir, Chotibor. Der slavische Forscher Hanka erklärt den Namen Chotibanz so, daß Choti: Braut, heiße und -banz von buditi: wecken, herkomme. Chotibanz würde polnisch Chocibacdz heißen und dasselbe Wort mit Chotibuz = Kotbus sein. Ich füge hinzu, daß von der einen Seite die Namen Godebuz (Gadebusch) und Goderac oder Gudracco (Godehardsdorf, jetzt Goorstorf), von der andern Seite Kutsin (Quetzin bei Plau) und Kutsin (später Sonnenkamp und Neukloster) vielleicht dieselbe Sprachwurzel haben und mache darauf aufmerksam, daß alle diese Orte wendische Fürftenburgen oder Tempelorte waren. Vielleicht ist Gotebant (jetzt Gädebehn) dasselbe Wort Chotibanz. Nach Kosegarten (Codex Pom. I, S. 870) ist das polnische gody und das bömische hody = Fest, Feierlichkeit; die oft vorkommende Sylbe -bant aber ist wohl das Wort bud, welches im Altböhmischen und Polnischen = Wohnuug bedeutet. Gotebant oder Chotibanz, Chotibuz, Godebuz wäre also = Festwohnung, eine Bedeutung, welche zu der Berühmtheit der Orte dieses Namens trefflich paßt (Vgl. Kosegarten a.a. O. I, S. 254).
Noch wichtiger wird aber diese Gegend durch den Ort "Kuhstal", welcher in der Nordgrenze des Lieps=Bezirkes, zwischen Prilwitz und Hohen=Zieritz von der einen und Kratzburg und Chutun von der andern Seite lag. Das Dorf


|
Seite 31 |




|
"Kostal" 1 ) wird in alten Zeiten wenig genannt, da es früh verwüstet ward und noch während des 15. Jahrhunderts wüst lag. Merkwürdiger Weise gehörte dieses Dorf, obgleich mitten unter Lehngütern gelegen, den Landesherren; am 9. Junii 1460 verpfändete der letzte Herzog von Meklenburg=Stargard dem Henneke von Holstein auf Ankershagen die eine Hälfte des wüsten Dorfes "Kostall" 2 ) und darauf verpfändeten die Herzoge Heinrich (vor 1466) und Ulrich (vor 1471) von Stargard den von Peccatel die andere Hälfte, worauf nach dem Aussterben der herzoglichen Linie Meklenburg=Stargard der Herzog Heinrich der Dicke von Meklenburg=Schwerin zwischen 1471 und 1477 dem Claus v. Peccatel auf Gr. Vielen die andere Hälfte der wüsten Feldmark "Kostal" mit 6 freien Hufen für eine neue Anleihe von 100 Mark aufs neue verpfändete 3 ) und sich ausdrücklich den eigenen Gebrauch nach der Wiedereinlösung vorbehielt und allen benachbarten Vasallengeschlechtern die Auskaufung der v. Peccatel versagte. Nun ist Kostal oder Kostel, wie Masch das Dorf nennt, ein allgemein bekanntes slavisches Wort und bedeutet in der häufig in slavischen Ländern vorkommenden Form: Kostel = Kirche, Tempel 4 ). Nach den Mittheilungen zweier Besitzer 5 ) des Gutes Kostel liegt bei demselben ein großer Steinwall von fast einer Viertel Meile Länge, in deffen Nähe ein heidnischer und ein christlicher Kirchhof und viele heidnische Gräber liegen. Das Gut ist in neuern Zeiten wieder aufgebaut und in den neuesten Zeiten Adamsdorf genannt worden, vielleicht weil der Name Kuhstall, plattdeutsch Kohstall, etwas unästhetisch klang.
In der Maschschen Familie hat sich ohne weitere Veranlassung die Tradition fortgepflanzt, daß das Gut Kustal oder Kostel früher Koschwanz geheißen habe 6 ); dieser Ausdruck könnte eine gewöhnliche deutsche Verdrehung des Wortes Cotibanz oder Coscibanz sein. Vielleicht stehen mit diesem Namen auch noch der Kuck us berg und das Kud as bruch


|
Seite 32 |




|
in Verbindung, welche auf der schmettauischen Charte verzeichnet sind.
Ob der Name des nicht weit davon liegenden, nördlich von Kratzburg und an den Burgwall Zcarnitz grenzenden Gutes Pieverstorf, welches schon im J. 1273 unter dem Namen Pywesdorp vorkommt 1 ), und der Name des nördlich an Pieverstorf grenzenden Dorfes Freidorf, ebenfalls schon im J. 1230, sicher im J. 1273 Vridorp, jetzt Bornhof, genannt, auf welchem in alter Zeit der Ursprung der Havel angenommen ward 2 ), mit der geschichtlichen Bedeutung dieser Gegend in Verbindung stehen, ist noch nicht zu ermessen.
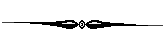


|
Seite 33 |




|



|


|
|
:
|
IV.
Katharina Hahn,
Gemahlin
des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,
Administrators des Bisthums Schwerin,
von
G. C. F. Lisch
D er dänische Prinz Ulrich, Herzog zu Schleswig=Holstein, war ein Sohn des Königs Friedrich II. und der schönen, klugen und guten Sophie 1 ), des wackern Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow einzigen Tochter und Kindes. Nach seines mütterlichen Großvaters Ulrich von Güstrow Tode († 14, März 1603) ward der junge Prinz in seinem 25. Lebensjahre Administrator des Bisthums Schwerin, als solcher in Meklenburg unter dem Namen Ulrich II. und nahm seine Residenz in der schwerinschen Stiftsstadt Bützow. Er starb am 27. März 1624 auf seinem nahe bei Bützow gelegenen Landsitze und "Hoflager" zu Kühn 2 ), einem ehemaligen Nonnenkloster; seine Leiche ward am 24, Mai 1624 in der Stiftskirche zu Bützow beigesetzt 3 ), aber im J. 1642 in die Domkirche zu Roeskilde auf Seeland versetzt 4 ).
 . von Dr. Werlauff, aus dem
Dänischen übersetzt von A.G. Masch, in den
Jahrb. IX, S. 111 flgd. und 131
flgd.
. von Dr. Werlauff, aus dem
Dänischen übersetzt von A.G. Masch, in den
Jahrb. IX, S. 111 flgd. und 131
flgd.


|
Seite 34 |




|
Von seinem Wirken und häuslichen Leben ist bis jetzt noch sehr wenig bekannt geworden. Er ward mit Sorgfalt erzogen. "Er ward schon in seiner Kindheit wegen seines guten Kopfes und seines vortrefflichen Gedächtnisses gelobt. Als jüngerer Prinz mit ferneren Aussichten zum Throne, aber mit früher Hoffnung auf ein auswärtiges Bisthum, welches er auch erhielt, scheint er späterhin durch Studiren, Reisen und Aufenthalt auf fremden Universitäten sich eine ungewöhnliche Bildung erworben zu haben." 1 ) Aus den auf ihn gehaltenen Leichenreden und seinem ganzen Leben zu schließen war er ein friedlicher Herr.
Nach den bisherigen geschichtlichen Ueberlieferungen und Stammtafeln war er nie vermählt. Nach einer im gräflich Hahnschen Archive aufbewahrten unverbürgten Nachricht 2 )soll er mit Katharine Hahn von Hinrichshagen vermählt gewesen sein und diese nach des Herzogs Ulrich Tode den Obristen v. Nidrum wieder geheirathet haben. Die Wahrheit dieser Vermählung ließ sich aus mehreren Gründen wahrscheinlich machen, jedoch durch keine Urkunde oder andere sichere Nachricht beweisen, so weit auch die Forschungen reichten. Katharine Hahn war die älteste Tochter des Otto II. Hahn auf Hinrichshagen und der Brigitte von Trotha von Krosigk und Wettin, welche nach ihres ersten Gemahls frühem Tode sich im J. 1598 mit dem Erblandmarschall Henneke von Lützow auf Eikhof wieder vermählte. Die ganze hahn=hinrichshäger Linie ist in vieler Hinsicht sehr merkwürdig. Katharinens Bruder Christoph ward während des dreißigjährigen Krieges im J. 1635 bei Vertheidignng seines Gutes Hinrichshagen erschossen und das Gut völlig verwüstet, worauf es durch Concurs von der Linie kam. Christophs Wittwe ward mit ihren Kindern im höchsten Elend flüchtig; ihr Sohn ward der


|
Seite 35 |




|
viel besprochene dänische Oberjägermeister Vincenz Joachim Hahn. Die hauptsächlichsten Begebenheiten dieser Linie ergeben sich schon aus dem folgenden abgekürzten Stammbaum.
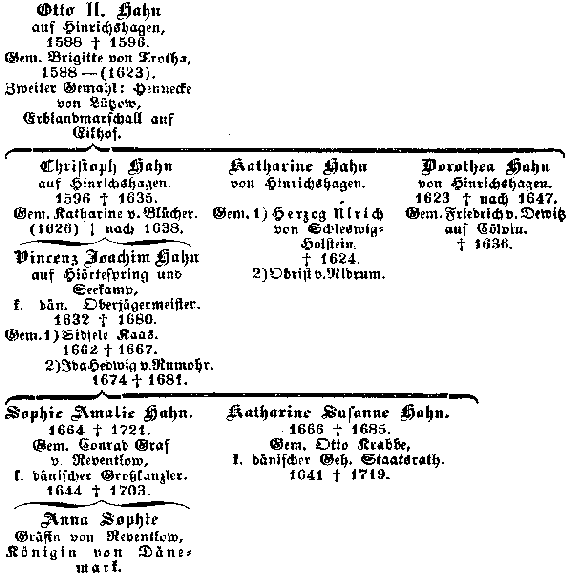
Es ist mir endlich gelungen, zuverlässige Nachrichten zu entdecken, aus denen klar hervorgeht, daß Katharine Hahn wirklich die eheliche Gemahlin 1 ) des Herzogs Ulrich gewesen ist. Der Herzog hatte ihr zum Wittwensitze das Gut Zibühl gekauft und geschenkt. Als nach des Herzogs Tode


|
Seite 36 |




|
der dänische Hof ihr das Gut streitig machen wollte, erhob sie bei dem herzoglich meklenburg=wallensteinschen Hof= und Landgericht Klage: und diese authentischen Acten eines strengen und ausgezeichneten Obergerichtes enthalten die Beweise der wirklichen Ehe.
Wann Katharine Hahn mit dem Herzooge Ulrich vermählt worden sei, läßt sich nicht nachweisen. So viel ist aber gewiß, daß der Herzog ihr bei der Vermählung 30,000 Reichsthaler, unter Ratification des Königs Christian IV. von Dänemark, verschrieb und ihr später noch das Gut Zibühl schenkte, welches der Herzog für 17,000 Reichsthaler gekauft hatte, wozu aber ihre Ehegelder des Betrages vom 5000 Gulden mit verwandt waren.
Das Verhältniß wegen des Gutes Zibühl gestaltete sich nun folgendermaßen. Nach der eidlichen Aussage des Johann Reimar v. Vieregge, Landmarschalls des Stifts Schwerin, hatte dessen Schwiegervater Dietrich Maltzan auf Trechow das Gut Zibühl von Jürgen Magnus von Bülow gekauft und schon über 4000 Gulden darauf ausgezahlt. Gleich darauf hatte der Herzog Ulrich den Marschall von Vieregge zu sich kommen lassen, um ihn zu ersuchen, daß er seinen Schwiegervater bereden möge, ihm das Gut zu überlassen, da er es "seiner Kätchen zu Gute für einen Todesfall" kaufen wolle; die übrigen v. Bülow würden dem Dietrich Maltzan das Gut nicht lassen, ihm, dem Herzoge, sollten sie es aber wohl lassen. Der ehemalige schwerinsche Stiftscanzler Dr. Heinrich Stalmeister sagte auch dasselbe eidlich aus, mit dem Hinzufügen, daß der Herzog Ulrich das Gut Zibühl im J. 1621 von Jürgen Magnus v. Bülow gekauft und 1622 bezahlt habe. - Ueber die Zeit der Vermählung sagen diese Acten nichts.
Ueber die Vermählung mit dem Herzoge Ulrich sagt Katharine Hahn selbst in ihrer Klage vom 16. Decbr. 1628 vor dem Hof= und Land=Gerichte wörtlich folgendes:
"E. F. G. bericht in aller demueth ich gehorsambst, waßmaßen weilandt Herren Ulrichen, Erbe zu Norwegen, Herzogk zu Schleßwigk unnd Holstein, fürstliche Gnade Christmilder gedechtnus mir bey unserm Ehegelubd 30,000 Reichsthaler, nach seinem tödtlichen Hintritt Erblich zu behalten, mit ratification der Königl. Maytt. zue Dennemarck, Ihres Herren Brudern, verschrieben, auch hernacher mich mit einem adelichen von einem Bulowen im Stifft Schwerin vmb 17,000 Reichsthaler (wotzue den meine ehegelder als 5000 fl. zugleich


|
Seite 37 |




|
angewandt) erkaufften guete Ziebuehl genannt erblich begabet, vnd aber nach erfolgeten todtlichen abgange hochgedachte I. F. G. meines Hochgeliebten Herren Sehl. mir so weinig die verschriebene 30,000 Reichsthaler von der fraw Mutter, der alten Königin, vngeachtet Ihr. Königl. Maytt. selbsten deßwegen bei deroselben fur mich intercedirett, gefolgett werden wolen, alß man mich in besitz des mir vermachten Guetes Ziebühl, woran ich dan auch ratione illatae dotis ein ansenliches interesse, gelaßen, sondern deßen zue aller vngebuer endtsetzett vnnd solches mir biß dato fürenthalten worden".
Aber nicht allein Katharine Hahn erklärte sich öffentlich für die Ehefrau des Herzogs Ulrich, sondern auch das Hof= und Land=Gericht, ohne Zweifel wohl und sicher unterrichtet, erkannte sie als solche an. In den Frage=Artikeln, welche dieses höchste Gericht den Zeugen stellte, heißt es:
"3. Ob nicht ein gemeiner beruff dero Zeit, wie hernach, gewesen vnnd annoch bei den Mehren, die sich so weit erinnern, ist vnnd plaibett, das geregtes Guet für I. F. G. dahmaln Ehegemahlinen Fraw Catharinen geborn von Hahuen von Hochgedachte I. F. G. zum besten erkaufft vnnd von I. F. G. dieselben eigenthumlichen zugeeigenet worden".
So bekannte auch der herzoglich=güstrowsche Leibarzt Dr. Joh. Krull zu Güstrow, welcher dem Herzoge auch auf seinem Sterbebette beistand, daß der
"Hertzogk Ulrich das Guet Ziebuhl darvmb an sich gekauft, selbiges seiner Fraweu, also er sie zu nennen pflach, Catharinen Hahnen anstaedt der Ihr sonsten auf S. f. g. Todesfall zugeeigneten dreißigk tausendt Reichsthaler zu vermachen".
Endlich ist es keinem Zweifel unterworfen, daß dieWitthumsverschreibung für Katharine Hahn von dem Könige von Dänemark anerkannt worden sei. Der Dr. Heinrich Stalmeister, ehemaliger Canzler des Stifts und des Herzogs, also ein ganz sicherer Zeuge, sagt aus:
"Das I. F. G. frawen Catharinen Hahnen dreißigk Tausendt Reichsthaler mit Consens Ihrer Königl. Maytt. zu Dennemarcken vermacht vnnd Ihr darvbor ein versiegelter brieff gegeben worden",


|
Seite 38 |




|
"das er das gemeltes originall in seinen handen gehabtt vnd gesehen, das es von Ihrer Maytt. zu Dennemarcken mit Dero Königlichen handt wehre unterschrieben unnd confirmirett geweßen".
Auch Katharinens Mutter sagte aus,
"daß ihre Tochter ihr den Brief auf die 30,000 "Reichsthaler, wie er vollzogen gewesen, gezeiget und daß sie denselben in Händen gehabt habe".
Auch der Dr. juris Thomas Lindeman zu Rostock sagte aus, "das er eß sowol von den Furstl. Mecklenb. Landt= unnd Hoffrähten, alß auch Hr. Cantzlern Doctore Stallmeistern vielmalß gehoret, das sichs interrogirtermaßen verhalten sollte".
Es leidet also keinen Zweifel, daß Katharine Hahn die angetrauete Ehefrau des Herzogs Ulrich gewesen sei. Jedoch führte sie nicht den Titel einer Herzogin, sondern wird beständig nur " Frau Katharine Hahn" genannt; sie führte also ihren Familiennamen mit dem Titel Frau.
Im J. 1621 kaufte der Herzog das Gut Zibühl zum Geschenke für sein "Kätchen" und bestimmte es zum Wittwensitze derselben als Allodialgut. Es war jedoch keine Urkunde des Herzogs darüber vorhanden, aber durch die Umgebung des Herzogs und das allgemeine Gerücht bezeugt, daß der Herzog ihr das Gut geschenkt habe. Sogleich darauf, nachdem das Gut gekauft war, ward es auch für Kaharine Hahn gebessert und gebauet und nach ihrem Wunsche eingerichtet, und Katharine Hahn nahm Besitz von dem Gute. Der Stiftsmarschall v. Vieregge bezeugte, daß Herzog oft und auch über Tafel gesagt habe, er habe das Gut für Frau Katharine Hahn gekauft und wolle seines Bruders des Königs von Dänemark Consens darüber auch schaffen. Derselbe sagte auch aus, daß er "von Frau Katherinen Hahnen selber gehört habe, daß sie bei Ihres Gottseligen Herrn Leben zu demselben gesagt, daß das Gut Zibühl ihre wäre, wogegen derselbe nichts gesagt habe". Der Herzog selbst führte den Stiefvater der Frau Katharine Hahn, den Landmarschall v. Lützow, in dem Hause zu Zibühl umher und zeigte ihm, wie die Gemächer eingerichtet werden sollten, und sagte ihm dabei, "daß sie nach seinem Tode alda eine bleibende Gelegenheit haben solle".
Nachdem die Einrichtung des Gutes vollendet war, ließen sowohl der Herzog, als Katharine Hahn viele ihrer Sachen und auch ihre großen holsteinschen Kühe, die sie zu Rühn stehen hatte, und Gänse aus Rügen dahin bringen und allerlei


|
Seite 39 |




|
Vieh und Fahrniß und andere zur Haushaltung dienliche Sachen dem Gute zum Besten ankaufen. Ihre Aeltern schenkten ihr dahin allerhand Hausgeräth zur Einrichtung an Betten und Bettengewand, Bettstätten, Kisten und Kasten, Silbergeschirr und Hausgeräth. Die Hofleute wurden von Katharine angesprochen, ihr in ihre Wohnung zu Zibühl Gemälde und andere Sachen zu schenken und zu verehren.
In den Fenstern ihres Wohngemaches zu Zibühl waren nicht allein ihrer Verwandten, sondern auch des Herzogs und ihr Wappen ("Schenkscheiben") neben einander angebracht. Zum öffentlichen Zeichen der rechtmäßigen Ehe und des rechtmäßigen Besitzes der Katharine Hahn waren auch
"I. F. G. (des Herzogs) und Frawen Catharinen Hahnen wapen an zweien Schornsteinen gemahlet, weil I. F. G. selbst solches geordnet und befohlen".
Auch war
"an andern Oertern auch, dar I. F. G. wapen gestanden, gemeiniglichen Fraw Catharinen Hanen Wapen darbei gesetzet",
wie zu Zibühl sonst
"ein Hahn angemachet gewesen sei".
Der Landmarschall Henneke v. Lützow sagte aus,
"es hatten I. F. G. ihm selbst berichtet, daß deswegen die wapen am Schornstein unnd in den Fenstern dahin gesetzet, daß Fraw Catharina Hahnen nach I. F. G. Tode solchs guett haben sollte.".
Im Verlaufe des Gerichtsverfahrens wird die Schenkung von Zibühl eine Schenkung zwischen Lebenden während der Ehe genannt ("donatio inter vivos stante matrimonio").
Als sich im J. 1623 Katharinens Schwester Dorothea mit Friedrich v. Dewitz auf Cölpin vermählte, ließ der Herzog Ulrich die Hochzeit auf seine Kosten zu Bützow ausrichten.
Kaum aber war die Wohnung in Zibüuhl eingerichtet, als der Herzog am 27. März 1624 an seinem Hoflager zu Rühn in seinen besten Lebensjahren starb. Er hatte seiner Frau keine Schenkungsurkunde über das Gut hinterlassen und es war nicht bestimmt, ob der Werth des Gutes auf das verschriebene Witthumsgeld von 30,000 Thaler angerechnet werden solle. Als nun nach des Herzogs Tode der dänische Hof ziemlich weit greifende Ansprüche an den Nachlaß des Herzogs machte, ward, bei der Einnahme des Stiftes für den neuen Administrator Ulrich III, eines Sohnes des Königs Christian IV. von Dänemark, Katharina Hahn "mit großem Unfug ohne


|
Seite 40 |




|
"rechtmaßige Ursache und Erkenntniß des Gutes destituirt und entsetzt und ihr Geräthe, Zeug und Mobilien von dem Gute weggeschafft, solcher Macht sie dero Zeit nicht widerstreben können, sondern mit Patienz und Geduld alles ertragen müssen".
Der Herzog ward in Gegenwart der Königin Mutter und vieler anderer hoher Personen in der Kirche zu Bützow, wo er sich selbst 12 Jahre vorher seine Ruhestätte erwählt hatte, begraben. In der auf ihn von dem bützowschen Prediger Andreas Cracovius gehaltenen "Ehrenpredigt", welcher des Herzogs Lebensbeschreibung eingefügt ist, ist aber weder von einer Ehe des Herzogs, noch von Katharine Hahn die Rede; auch nicht einmal eine Anspielung findet sich darin.
Einige Jahre nach des Herzogs Tode verheirathete sich "Frau Katharine Hahn" wieder mit Nicolaus Hermann von Nidrum, römisch=kaiserlicher Majestät bei dem Altringerschen Regimente bestallten Hauptmann, über den und dessen Familie keine Nachricht hat gewonnen werden können.
Als nun Wallenstein in den Besitz von Meklenburg gekommen war, glaubten beide Ehegatten in den Besitz des Gutes gelangen zu können und am 16. Dec. 1628 erhob Katharine Hahn bei dem Herzoge Albrecht von Friedland und Sagan eine Klage auf Wiedereinsetzung in den Besitz des Gutes, und am 6. Jan. 1629 bat v. Nidrumb den Herzog, ihn in das Gut einweisen zu lassen. Wallenstein erließ am 29. Aprit 1629 die Verordnung, daß die "Forderung vor dem Land= und Hofgerichte in gebührliche Cognition gezogen werden solle".
Der von Katharine Hahn erhobene Proceß schleppte sich eine Zeit lang ohne Erfolg fort und Dänemark behauptete sich die nächsten Jahre hindurch im Besitze des Gutes Zibühl; Katharine Hahn ließ sich während der wallensteinschen Regierung wegen der von ihr in das Gut Zibühl eingeschossenen 5000 fl. auf ihr eigenes Anhalten abfinden, woraus man schloß, daß sie selbst sich ihrer vermeinten Ansprüche begeben habe, und führte endlich ihre Klage nach den Grundsätzen des Processes nicht aus, weshalb sie auch kein rechtliches Urtheil erlangen konnte. Es handelte sich nach dem Sturze Wallensteins nur darum, ob Dänemark oder Meklenburg das Gut haben solle, bis die nächsten gewaltigen Stürme des dreißigjährigen Krieges alle früheren Zustände so gründlich vernichteten, daß nach einem Jahrzehend niemand mehr an diese Sache dachte.
Von Katharine Hahn und dem Hauptmann v. Nidrum ist nach der wallensteinschen Zeit keine Spur zu finden.
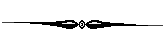


|
Seite 41 |




|



|


|
|
:
|
V.
Ueber
die norddeutschen Familien von Platen
und
die Familie von Bevernest
von
G. C. F. Lisch.
E ine der merkwürdigsten Erscheinungen in der Staats= und Bildungsgeschichte der Länder Norddeutschlands ist die Herkunft mehrerer altadeliger Familien verschiedenen Namens von Einem Stammvater oder die Stammesverwandtschaft verschiedener adeliger Familien mit demselben Wappen. Die Veranlassung ist ohne Zweifel die, daß zur Zeit der Germanisirung mehrere Söhne eines wendischen Vaters sich verschiedene Namen gaben, theils nach dem neu erworbenen Ritterlehn, theils nach Familien=Geschichten und Traditionen, oder persönlichen Eigenschaften, und dadurch verschiedene Familien stifteten, welche zwar verschiedene Namen, aber immer ein und dasselbe Wappen führten. Die Sache ist sehr klar und ohne Zweifel richtig; die urkundlichen Beweise gehören aber zu den größten Seltenheiten in der Geschichtsforschung. Ich habe diese Ansicht zuerst in meiner Geschichte des Geschlechts Hahn, 1844, Bd. I, S. 5 und 41 flgd. zur Ueberzeugung gebracht, indem ich durch eine Original=Urkunde bewiesen habe, daß der erste Hahn und der erste von Dechow, deren Nachkommen immer ein und dasselbe Wappen führten, Brüder und wahrscheinlich auch mit den von Bibow und Hardenack, welche ebenfalls dasselbe Wappen hatten, stammverwandt waren. Zu gleicher Zeit und selbstständig hat auch v. Ledebur dieselbe Idee verfolgt und darauf in den Märkischen Forschungen, Bd. III, S. 96 flgd.,


|
Seite 42 |




|
1847 und Bd. IV, "den Adel der Mark Brandenburg nach Wappenbildern gruppirt und auf Stammes=Gemeinschaft zurückgeführt".
Ich bin jetzt im Stande, ein zweites, sehr merkwürdiges Beispiel anzuführen und alle Verhältnissee klar und umständlich darzulegen.
Die von mir entdeckte Geschichte dreht sich zunächst und vorzüglich um eine Familie, die ich mit einem allgemeinen Namen von Plate benennen will. Um aber diese in deutlicher Gestalt vorführen zu können, wird es nothwendig sein, erst die verschiedenen Familien dieses Namens zu beleuchten. Es gab mehrere ganz verschiebene Familien dieses Namens, deren Namen in den älteren Zeiten von Plote hieß (vgl. Lisch Gesch. des Geschlechts Hahn II, S. 161 flgd.).
Die verschiedenen Familien von Platen.
1) Die Edlen Herren von Plotho hatten ihr Stammhaus in dem an der rechten Seite der Elbe liegenden Theile der Altmark in Alten=Platow und hatten auch in der Prignitz große Besitzungen mit landesherrlichen Rechten, z. B. auch die Städte Kyritz und Wusterhausen, schon seit dem 13. Jahrh., welche von ihnen gestiftet sind, da beide Städte noch die plothosche Lilie im Siegel führen (vgl, Riedel Cod. Dipl. Brand. I, 4, p. 385). Sie führten ihren Namen ohne Zweifel von der Burg Plote (jetzt Alt=Platow) und nannten sich im Mittelalter auch von Plote; vgl. Riedels Mark Brandenb. I, S. 225 flgd. Sie führten eine Lilie im Wappen und bildeten sicher eine alte Dynasten= oder edle Familie, was theils aus ihrer ganzen Stellung, theils aus ihrem Siegel zu schließen ist, da sie, wie auch die ihnen an Range gleich stehenden Edlen Hans zu Putlitz, größere Siegel führten, als die rittermäßigen Geschlechter zu führen pflegten. Noch im J. 1314 führte Johannes von Plothe ein großes, 2 1/2 Hamburger Zoll im Durchmesser haltendes, rundes Siegel, ohne Schild, mit einer Lilie. Von diesen Edlen Herren von Plote stammen die jetzt noch in Preußen blühenden, in der Gegend von Alten=Platow, vornämlich auf Parey ansässigen Freiherren von Plotho, Erbkämmerer des Herzogthums Magdeburg, ab, welche im 1. und 4. Felde des quadrirten Wappens eine Lilie, im 2. und 3. Felde einen gekrönten Mohrenrumpf führen. (Vgl. auch v. Raumer in v. Ledebur's Archiv IX, S. 289.)
2) Die rittermäßige Fautilie von Plato im Lüneburgischen, seit Alters zu Plate, Gralbow und Lüchow und


|
Seite 43 |




|
auch in der Altmark gesessen, führt im silbernen Schiöde zwei rothe Spitzen; vgl. Grote Hannov. Wappenbuch, 1843, Ch. Tab. 47, und v. Ledebur Märkische Forschungen III, S. 118. Ueber diese Familie sagt v. d. Knesebeck im Historischen Taschenbuch des Adels im Königreich Hannover, 1840, S. 227: "von Plato. Uradel. Die Familie gehört zu dem landsässigen Adel und besitzt drei Güter in Grabow und zwei Güter in Lüchow. Sie erscheint schon 1472 in Urkunden". Diese Familie v. Plat en besaß bis auf die neueste Zeit auch viele "zerstreute" Güter in der Prignitz.
3) Die rittermäßige Familie von Plate im Bremischen führt eine Seemuschel im Schilde. Ueber diese Familie sagt v. d. Knesebeck im Taschenbuch a. a. O: "von Plate. Uradel. Die Familie gehört zu dem landsässigen Adel und besitzt die Güter Bruchhof, Höven, Altenwisch, Stellenfleth und Wechtern im Bremischen. Sie erscheint schon 1300 flgd. in Urkunden".
4) Die rittermäßige Familie von Platen auf Rügen stammt ohne Zweifel von dieser Insel. Diese Familie führt ihren Namen von der plate (thorax), d. i. Brustharnisch oder Küraß, im Gegensatze zu dem Ringpanzer; vgl. Lisch Jahrb. VI, S. 183 flgd. Der muthmaßliche Stammvater dieses Geschlechts hieß Marquardus cum plata oder cum thorace und seine Nachkommen werden häufig mit der platen genannt. Die Familie, welche vorherschend eine rügische blieb und nie in Meklenburg angesessen gewesen ist, führt, nach der neuern Heraldik, "zwei Meerkatzenköpfe, jeder unten in einen Adlerflügel auslaufend", im Schilde, Vgl. Bagmihl pommersches Wappenbuch, III, S. 134 flgd. Auf allen neuern, selbst auf ältern Siegeln sind zwei Köpfe mit Hälsen, welche in eine Figur, wie einen Flügel, auslaufen, klar zu erkennen. Ich glaube aber, daß in den ältesten Zeiten der Schild zwei Flügel enthalten hat, deren Gelenke oben verziert sind, entweder mit einer Rosette oder auch mit einem Kopfe. Aehnliche Wappenzeichen kommen nicht selten vor; die Flügel sind aber, meiner Ansicht nach, immer die Hauptsache.
5) Die rittermäßige Familie von Plate gehört, so lange sie blühet, dem Lande Stargard an. Die Glieder dieser Familie nannten sich beständig von Plote und führten einen Querbalken im Schilde. Sie waren ohne Zweifel mit den von Peccatel stammverwandt, welche dasselbe Schildzeichen hatten und oft in der Nähe der von Plote und mit ihnen vorkommen, Vielleicht stammen beide Familien ursprünglich aus der Grafschaft Schwerin, indem südlich nicht weit von Schwerin


|
Seite 44 |




|
die beiden Dörfer Plate und Peccatel neben
einander liegen; vielleicht waren beide Familien
mit den von Zülow stammverwandt, da diese
ebenfalls einen Queerbalken im Schilde führen
und das Dorf Zülow nicht weit von Plate und
Peccatel liegt. Schon früh mögen die beiden
Geschlechter von Plate und von Peccatel, wie so
viele andere adlige Geschlechter von Westen
gegen Osten vorgerückt sein; beide erscheinen in
der Geschichte in der Folge nur als zu den
bedeutendsten Geschlechtern des Landes Stargard
gehörend; jedoch war diese Familie von Plate
außerdem noch spät mit alten Gütern in der
Gegend von Brüel im Lande Meklenburg angesessen,
An der Grenze des Landes Stargard, an das
bekannte stargardische Gut Prillwitz grenzend,
südlich von Penzlin und westlich von Stargard,
liegt das Gut Peccatel; östlich von Stargard bei
Woldeck liegt das Gut Plath früher Plote
genannt, nicht weit von Peccatel: von diesen
beiden Gütern werden die beiden Geschlechter
ihre Namen erhalten haben, wenn sie dieselben
nicht von den gräflich=schwerinschen Dörfern
gleiches Namens trugen und den stargardischen
Dörfern von ihren Personennamen die Namen gaben.
- Die von Peccatel, die mächtigste Adelsfamilie
des Landes Stargard, deren Hauptburg das
bekannte Städtchen Prillwitz mit den
angrenzenden Gütern Hohen=Zieritz, Peccatel
 und vielen andern Dörfern war,
sind in nämlicher Linie mit Gotthard Carl
Friedrich auf Peccatel im J. 1773 (oder 1775),
in weiblicher Linie in dem gegenwärtigen
Jahrhundert ausgestorben: im J. 1824 starb 72
Jahre alt zu Berlin die letzte von Peccatel,
Wittwe des August Dietrich v. Oertzen auf
Blumenow. - Die von Plote waren nicht minder
angesehen und reich. Schon im J. 1317 erwarben
sie die Burg, Stadt und Vogtei Wesenberg und um
dieselbe Zeit die Städte Freienstein und
Meienburg als Pfandgüter, ferner im J. 1378 den
Pfandbesitz der Städte Waren und Penzlin; darauf
erwarben sie noch den Besitz des Schlosses und
Städtchens Arensberg, vieler anderer Güter und
Dörfer nicht zu gedenken. In dem letzten
Viertheil des 14. Jahrhunderts ward die auf
Wesenberg ansässige Linie der von Plate mit dem
Erbmarschallamte des Landes Stargard belehnt.
Diese reiche Linie, welche im Besitze des
Schlosses Wesenberg und des Erblandmarschallamts
war, starb im J. 1464 mit Joachim von Plate aus
und die Güter und Würden derselben fielen heim.
Die altere Linie der von Platen auf Jarchow bei
Brüel starb erst in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrh. aus. Man vg. Lisch Geschichte des
Geschlechts Hahn II, S. 161 flgd, und Boll
Geschichte des
und vielen andern Dörfern war,
sind in nämlicher Linie mit Gotthard Carl
Friedrich auf Peccatel im J. 1773 (oder 1775),
in weiblicher Linie in dem gegenwärtigen
Jahrhundert ausgestorben: im J. 1824 starb 72
Jahre alt zu Berlin die letzte von Peccatel,
Wittwe des August Dietrich v. Oertzen auf
Blumenow. - Die von Plote waren nicht minder
angesehen und reich. Schon im J. 1317 erwarben
sie die Burg, Stadt und Vogtei Wesenberg und um
dieselbe Zeit die Städte Freienstein und
Meienburg als Pfandgüter, ferner im J. 1378 den
Pfandbesitz der Städte Waren und Penzlin; darauf
erwarben sie noch den Besitz des Schlosses und
Städtchens Arensberg, vieler anderer Güter und
Dörfer nicht zu gedenken. In dem letzten
Viertheil des 14. Jahrhunderts ward die auf
Wesenberg ansässige Linie der von Plate mit dem
Erbmarschallamte des Landes Stargard belehnt.
Diese reiche Linie, welche im Besitze des
Schlosses Wesenberg und des Erblandmarschallamts
war, starb im J. 1464 mit Joachim von Plate aus
und die Güter und Würden derselben fielen heim.
Die altere Linie der von Platen auf Jarchow bei
Brüel starb erst in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrh. aus. Man vg. Lisch Geschichte des
Geschlechts Hahn II, S. 161 flgd, und Boll
Geschichte des


|
Seite 45 |




|
landes Stargard, i, S: 167 flgd: Boll irrt
jedoch, wenn er diese Familie von der Familie
der Edlen von Plote auf Kyritz
 herleitet und die im Anfange des
16. Jahrh. aus der Prignitz in das Land Stargard
eingewanderte Familie von Plate aus dem Haufe
Quitzow mit dieser im J. 1464 ausgestorbenen
stargardtschen Familie von Plate verwechselt,
indem er dieselbe noch 1506 als auf Tornow
wohnend aufführt. - Nicht unwahrscheinlich ist,
daß die bekannte Familie Manteuffel, welche
wahrscheinlich aus dem Lande Stargard stammt,
mit den alten stargardischen Familien v.
Peccatel und v. Plate stammverwandt ist, da sie
dasselbe Wappen, einen Oueerbalken im Schilde, führt.
herleitet und die im Anfange des
16. Jahrh. aus der Prignitz in das Land Stargard
eingewanderte Familie von Plate aus dem Haufe
Quitzow mit dieser im J. 1464 ausgestorbenen
stargardtschen Familie von Plate verwechselt,
indem er dieselbe noch 1506 als auf Tornow
wohnend aufführt. - Nicht unwahrscheinlich ist,
daß die bekannte Familie Manteuffel, welche
wahrscheinlich aus dem Lande Stargard stammt,
mit den alten stargardischen Familien v.
Peccatel und v. Plate stammverwandt ist, da sie
dasselbe Wappen, einen Oueerbalken im Schilde, führt.
6) Eine andere rittermäßige Familie von Platen, früher auch von Plote, gehört in frühern Zeiten ganz der Prignitz an und war hier auf Quitzow und Mesendorf gesessen. Sie führte einen schräge oder queer liegenden, oben und unten abgehauenen Baumstamm mit drei Blättern im Schilde und ist mit den übrigen Familien gleiches Namens eben so wenig verwandt, als diese unter sich. Diese Familie ist vielfach mit den übrigen Familien gleiches Namens verwechselt, namentlich mit der stargardischen Familie, und daher ziemlich unbekannt geblieben. Diese prignitzer Familie v. Platen besaß in alter Zeit auch Schloß und Städtchen Kumlosen; ihre alten Güter lagen nicht weit davon. Die Ploten auf Cumlosen werden im 15. Jahrh. oft genannt (vgl. Riedel Cod. dipl. Brand. II, 4, S. 52, 49, 75, 81) und dieses Schloß scheint ein Hauptsitz der Familie gewesen zu sein. Um das J. 1400 verkauften die v. Plote zu Kumlosen die Fährgerechtigkeit über die Löcknitz an die Stadt Lenzen; der Elbzoll zu Kumlosen gehörte ihnen auch und ist erst im vorigen Jahrh. durch Verkauf an die v. Möllendorf übergegangen. Mehrere Ortschaften, die sonst zum Ländchen Kumlosen gehörten, wie Modtrich und Bentwisch, waren noch bis zur Ablösung in neuern Zeiten den von Platen auf Kuhwinkel und Mesendorf dienstpflichtig. Die alten Stammgüter Quitzow, Mesendorf und Demerthin sind von der Familie nach und nach verkauft; die jetzigen Besitzungen sind: Kuhwinkel, Platenhof, Wutike, Gantikow, Mechow und Köritz in der Prignitz und Pätzig in der Neumark.
Eine Periode aus der Geschichte dieser Familie soll hier eigentlich der Gegenstand der Untersuchung sein.


|
Seite 46 |




|
Die Familie von Platen auf Quitzow in der Prignitz.
Nach zahlreichen Urkunden, welche mehrere Jahrhunderte hindurch reichen, war in der Prignitz ein rittermäßiges Geschlecht von Plote einheimisch, welches das Gut Quitzow bei Perleberg als Stammgut und außerdem noch Mesendorf bei Pritzwalk und andere Güter in der Prignitz besaß. Diese Familie ist, wenn nicht Urkunden mit Siegeln vorliegen und sie sich sonst nicht historisch verfolgen läßt, sehr schwer von der in denselben Gegenden angesessenen Familie der Edlen von Plote zu unterscheiden, mit der sie aber gar nicht verwandt ist. Diese rittermäßige Familie von Platen nannte sich früher von Plote und ward oft auch von Plato genannt. Sie läßt sich schon im Mittelalter erkennen. Im J. 1386 erscheint der Knappe "Hans Plote to Quitzow" als Bürge, eben so im J. 1395: "Hans Plote wonaftich tu Quitzow" (Vgl. Riedel Cod. dipl. Braud. I, 1, p. 164 und 169); im J. 1454 erscheint wieder ein "Hans Plate wohnhaftig tho Mesendorp" (vgl. Riedel a. a. O. p. 379); im J. 1438 verkauft Otto Gans, Herr zu Putlitz, den "knapen Hans, Clawes und Victor brudern heten de Platen" einige Hebungen in dem Dorfe Pirow (vgl. Riedel a. a. O. p. 310); außerdem werden diese von Platen noch öfter genannt. Im J. 1445 übten, nach einer Original=Urkunde im schweriner Archive, die Brüder Hans und Vicke von Platen auf Mesendorf und Quitzow ("Hans et Vicko fratres condicti Platen moram trahentes in Mesendorp et villa Quitzow") das Präsentationsrecht zur Besetzung der Vicarei am Altare Mariä Magdalenen in der S. Georgen=Kirche zu Parchim. Diese Familie von Platen, welche noch jetzt blühet, hatte einen abgehauenen Baumstamm mit drei Blättern im Schilde; jedoch kommt sehr häufig auch ein Stamm mit fünf Blättern vor, drei oberwärts und zwei unterwärts. In v. Zedlitz Preuß. Adels=Lexcon Bd. V, S. 76, heißt es: "Eine Familie von Platen ist eine märkische. Das der Sage nach älteste Stammgut Quitzow bei Perleberg ist nicht mehr im Besitze der Familie. Auch sind mehrere andere Güter z. B. Mesendorf bei Pritzwalk u.s.w. verloren gegangen. Die Familie besitzt jedoch noch unter sich in männlicher Linie erbliche Lehen z. B. Kuhwinkel bei Perleberg, Wutike, Gantikow und Mechow bei Kyritz. Wappen: im silbernen Schilde ein fünfblätteriger Ast eines Hülfebusches "(Stechpalme)", also mit länglichen, gezackten Blättern".


|
Seite 47 |




|
Im 16. und 17. Jahrhundert, z. B. J. 1553, kommen Siegel der v. Platen auf Quitzow mit einem abgehauenen Baumstamme vor.
Ein Zweig dieser Familie von Plate zog ungefähr 35 Jahre nach dem Aussterben der alten stargardischen Familie gleiches Namens in das Land Stargard und ist daher mit der letzten durchaus nicht zu verwechseln, was bis jetzt gewöhnlich geschehen ist. Im Anfange des 16. Jahrh. nämlich gelangte Hans von Platen in den Besitz des im Lande Stargard gelegenen Gutes Tornow c. p., welches ihm ein halbes Jahrhundert lang gehörte.
Das Gut Tornow mit andern Gütern waren alte Güter der Familie v. Restorf; die Familie v. Restorf war in alten Zeiten in den südlichen Gegenden der jetzigen Großherzogthümer Meklenburg=Schwerin und Strelitz, und auch in der angrenzenden Prignitz vielfach angesessen. Die Familie, welche Tornow besaß, starb im Anfange des 16. Jahrh. aus. Ob diese mit der in Meklenburg noch blühenden alten adeligen Familie v. Restorf gleichen Ursprunges und nur ein Zweig derselben, oder ob sie eine mit dieser nicht verwandte, eigene Familie gewesen sei, läßt sich noch nicht bestimmen, da bis jetzt noch keine Siegel der stargardischen Familie v. Restorf aufgefunden sind. Man muß sich also einstweilen mit sichern Thatsachen begnügen, so viel ist aber sicher, daß die auch in der Prignitz bei Wittenberge auf Weisen und Breesen ansässig gewesene Familie v. Retzdorf mit der meklenburgischen Familie gleiches Namens dasselbe Wappen (ein Einhorn) geführt hat. Die Familie v. Restorf im Lande Stargard besaß die Güter Tornow, Ringesleben, Pripert und Strasem. Am Ende des 15. Jahrh. lebten noch zwei Brüder: Brüning und Kersten v. Restorf. Kersten hatte bei seinem Tode einen Sohn Hans v. Restorf und eine Tochter Anna hinterlassen, welche an Hans v. Hotstendorf verheirathet war. Im Anfange des 16. Jahrh., vor dem J. 1502, starb Brüning v. Restorf und hinterließ drei Töchter, von denen die älteste Anna späterhin an Hans von Platen verheirathet ward. Brüning hatte wenig Vermögen hinterlassen. Die Vormundschaft für dessen drei Töchter sollte nach altem Rechtsgebrauch Hans v. Restorf, der letzte seines Geschlechts, führen; dieser war aber auch so arm, daß er die Wittwe und Töchter seines Oheims Brüning nicht standesgemäß unterhalten, abfinden und aussteuern konnte. Daher übernahmen am 16. Julii 1502 die Herzoge die Vormundschaft und Unterhaltung, wogegen ihnen die dem Heimfall nahe stehenden Güter Pripert und


|
Seite 48 |




|
Strasem abgetreten wurden 1 ); die Herzoge setzten sich zugleich mit Hans v. Restorf auseinander, gaben diesem zur vollen Befriedigung für seinen Erbantheil das altväterliche, gemeinsame Gut Tornow zum alleinigen Besitze und belehnten ihn mit demselben. Aber auch Hans v. Restorf starb bald darauf, vor dem J. 1507, und mit ihm erlosch das Geschlecht der v. Restorf im Lande Stargard. Es ist ein im J. 1535 aufgenommenes Zeugniß des Pfarrers von Tornow vorhanden, nach welchem Hans v. Restorf bei seinem Sterben keinen Lehnserben kannte; es wurden ihm daher Siegel, Schild und Helm ins Grab nachgeworfen 2 ). Mit dem Tode des Hans v. Restorf fielen die Güter der v. Restorfschen Familie an die Lehnsherren zurück. Von diesen Gütern gaben die Herzoge am 12. Januar 1507 dem Hans von Platen das Gut Tornow mit der wüsten Feldmark Ringesleven zu einem Gnadenlehn, jedoch unter der Bedingung, daß er Brünings v. Restorf Tochter Anna heirathen und seinen Wohnsitz in Meklenburg nehmen sollte 3 ). Wahrscheinlich hatte Hans v. Platen Gelder in dem Gute stehen und schon früher einen Expectanzbrief darauf erhalten. Denn schon im J. 1506 wird in dem Register des Aufgebots zum lübeker Kriege aufgeführt, daß "Hans Plate von Tornow mit 4 Pferden gedient" habe. Es waren aber noch Erbjungfern am Leben, nämlich die drei Töchter des Brüning v. Restorf, deren Unterhaltung und Aussteuer die Herzoge übernommen und von denen sie die älteste an Hans v. Platen verlobt hatten, und des Hans v. Restorf Schwester, welche an Hans v. Holstendorf verheirathet war. Dieser fühlte sich für seine Frau beschwert, als Hans v. Platen,mit Tornow belehnt ward und sich in den Besitz des Gutes setzte, und wandte sich um Fürsprache an die Markgrafen von Brandenburg 4 ), welche denn auch ein Vorschreiben an die Herzoge von Meklenburg erließen. In Folge dieser Verhandlungen verglichen die Herzoge die streitenden Partheien dahin, daß Hans v. Platen am 28. Aug. 1509 die Frau des Hans v. Holstendorf mit 800 Gulden 5 ) und darauf deren Mutter, Kerstens v., Restorf Wittwe, auskaufte 6 ). Und so ward Hans v. Platen am 28. Aug. 1509 schließlich mit allen Anrechten an Tornow belehnt.


|
Seite 49 |




|
Der Stammbaum der v. Restorf und v. Platen gestaltet sich folgendermaßen:
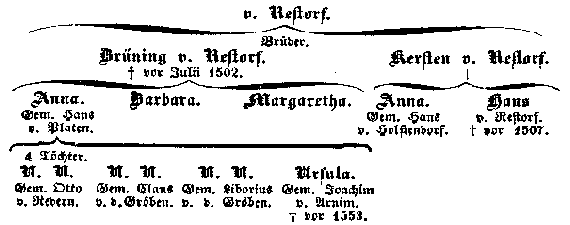
Dieser Hans v. Platen, welcher ein neues Haus im Lande Stargard gründete 1 ), stammt aus dem märkischen Geschlechte der von Platen auf Quitzow und ist mit der alten meklenburgischen Familie, welche im Lande Stargard längst ausgestorben war, durchaus nicht verwandt.
Aber auch dieses märkische Haus der v. Platen auf Tornow hatte nicht lange Bestand, obgleich Hans v. Platen lange lebte und fast funfzig Jahre im Besitze des Gutes Tornow war. Ungefähr im J. 1553 starb Hans v. Platen ohne Hinterlassung männlicher Leibeslehnserben; er hintertieß nur vier Töchter, welche an Otto v. Redern, Claus v. d. Gröben, Liborius v. d. Gröben und Achim v. Arnim verheirathet waren und welche als Erbjungfern Anspruch auf den lebenslänglichen Genuß der hinterlassenen Güter ihres Vaters machten, auch zu diesem Zwecke den Markgrafen Joachim v. Brandenburg zu einem Vorschreiben veranlassten.
Am 28. Dec. 1554 belehnte der Herzog Johann Albrecht den Hans von Buch um seiner getreuen Dienste willen mit dem heimgefallenen Gute Tornow, "nachdem Hans Plato kurzverschiener Zeit ohne Leibeslehnserben verstorben", und belehnte zugleich damit dessen Bruder Valentin. Haus von Buch, der sich selbst auch "von Boeck der ältere" nennt, hatte seit dem J. 1551 das meklenburgische Amt Gorlosen auf 5 Jahre zu Pfande und erhielt im J. 1555 von dem


|
Seite 50 |




|
Herzoge Ulrich die stargardischen Aemter Wesenberg und Feldberg verpfändet. Auf diese Weise kam die noch jetzt in Meklenburg blühende Familie v. Buch, deren Stammvater Hans v. Buch ward, ins Land und wohnte lange Zeit auf Tornow. Die Linie von Valentin v. Buch starb bald aus.
Die Famile von Bevernest auf Gülitz in der Prignitz.
Die märkische Familie von Bevernest war ebenfalls seit alter Zeit in der Prignitz als ein altes rittermäßiges Geschlecht einheimisch und ohne allen Zweifel mit der Familie von Platen auf Quitzow stammverwandt. Das Haupt= und Stammgut der Bevernest war Gülitz bei Putlitz, nach Perleberg hin. Das Gut Gülitz, zwischen Putlitz und Perleberg, gehörte zu dem großen Besitze der Edlen Herren Hans zu Putlitz (vgl. Riedel Cod. dipl I, 3, p. 506). Die v. Bevernest mögen es früher als ein Alterlehn besessen haben 1 ): in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. werden in Proceß=Acten die Edlen Herren zu Putlitz "Lehnsherren" von Gülitz genannt 1 ). Die v. Bevernest führten mit den v. Platen dasselbe Wappen, nämlich einen abgehauenen Baumstamm mit drei Blättern, oft auch, selbst in alten Darstellungen, mit fünf Blättern. In der Kirche zu Lübz ist ein auf Glas gemaltes Wappen des Gregorius v. Bevernest: im silbernen Schilde ein abgehauener Baumstamm mit drei grünen Blättern. - In hohem Grade merkwürdig ist ein im Staats=Archive zu Schwerin aufbewahrtes Siegel des Werneke Bevernest auf Gülitz vom J. 1412. An einer Original=Urkunde vom S. Agathen=Tage 1412, durch welche der Knappe Hans Bösel auf Goldbeck sich mit dem Kloster Eldena über die Streitigkeiten über die von dem Kloster erkauften 7 lüb. Mark Hebungen aus den Dörfern Ziegendorf und Wulffahl vergleicht, hängt auch das Siegel des "Werneke Bevernest wonaftich tů Ghůltze", als Mitunterhändlers. Dieses Siegel hat einen Schild mit einem aufrecht stehenden Baume, welcher drei Wurzeln und an jederseite drei


|
Seite 51 |




|
Blätter, wie Eichenblätter, hat; die Umschrift dieses Siegels lautet:
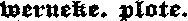
Man sieht hieraus, daß die Bevernest in alten Zeiten eigentlich auch den Namen von Plote führten und daß der Name Bevernest wahrscheinlich nur ein Beiname war, der später der Zuname einer Linie des Geschlechts ward. Die Bevernest sollen nach alten Ueberlieferungen früher auch den Namen v. Platen geführt haben, nämlich v. Platen genannt Bevernest, obgleich dies bis jetzt in keiner Urkunde beobachtet ist. Auch mag man in dem Schildzeichen noch das alte, ursprüngliche Wappen des Geschlechts erkennen, das wohl eigentlich in den ältesten Zeiten, wie ich glaube, ein Baum war; wie aber im Laufe der Zeiten im Wappenwesen, namentlich seit der Zeit der Renaissance im 16. Jahrh., wo man die Schilde häufig schräge lehnte, so viel verunstaltet, entstellt und verkrüppelt ist, so auch im platenschen Schilde, das man für einen Baum nicht groß genug halten mochte, und deshalb den Baum zum Stamme oder Aste verstümmelte. Die Wappen der v. Bevernest und v. Platen zeigen auch eine fast gleiche Helmzierde; beide nämlich führen auf dem Helme zwei schwarze Adlerflügel: bei den v. Bevernest zeigt sich zwischen denselben eine in die Höhe stehende goldene Kette; bei den v. Platen sind die Adlerflügel oben durch eine goldene Kette, von welcher zwischen den Flügeln ein goldener Ring herabhängt, rings verbunden. Die Einführung des Nebenwerkes scheint aus neuern Zeiten zu stammen; ein altes v. Bevernestsches Wappen zeigt nur die Flügel ohne Kette.
Die v. Bevernest kamen kurz vor den v. Platen, am Ende des 15. Jahrh., nach Meklenburg, wo das Geschlecht fast zwei Jahrhunderte fortgeblühet hat, während es in der Mark Brandenburg ausgestorben zu sein scheint. Eine sehr bedeutsame und merkwürdige Erscheinung ist das häufige Aussterben vieler alter Geschlechter am Ende des 15. und im Anfange des 16. Jahrh. So wurden auch die Bevernest durch Verleihung vieler eröffneter Lehen in Meklenburg wieder wohlhabend und kräftigh.
Zuerst erscheint WernekeB, auf Lambrechtshagen erbgesessen, am Mittwoch nach divis. Apost. 1492 im Besitze der Güter Lambrechtshagen, Lichtenhagen und Blisekow bei Doberan, welche dem nicht lange vorher ausgestorbenen Geschlechte der von Gummern gehört hatten. Vielleicht kam er durch den JohanniterComthur Nicolaus Bevernest zu Kraak, welcher 1504 starb, ins Land (vgl. Jahrb. I,


|
Seite 52 |




|
S. 23). Werneke Bevernest starb nicht lange darauf, wie es scheint, ohne Leibeslehnserben. Am 20. Sept. 1500 nahmen nach seinem Tode die Herzoge die gummernschen Güter wieder an sich und fanden sich mit der Wittwe Bevernest ab 1 ).
Zu derselben Zeit und bald darauf erscheinen in Meklenburg 5 Brüder: Claus, Hans, Dietrich, Curd und Jürgen Bevernest, welche wohl nicht des Werneke Söhne sind, weil sie sonst im Besitze von Lambrechtshagen gefolgt sein würden.
Von diesen erscheint zuerst Hans Bevernest im Lande Stargard. Am 27. Sept. 1489 gaben die Herzoge Magnus und Balthasar dem Haus Bevernest zur Belohnung der treuen Dienste, welche er von seiner Jugend an den Herzogen und schon deren Vater gethan, die Eventualbelehnung mit den Gütern des Geschlechts der v. Holtebütel, dessen Aussterben mit dem Tode des Hermann Holtebütel zu erwarten stand 2 ). Das Geschlecht der Holtebütel starb bald darauf aus und dadurch gelangte Hans Bevernest in den Besitz des Gutes Golm im Lande Stargard. Am 30. Nov. 1500 fand er die Erbtochter Anna, des wail. Bifpraw Holtebütel Tochter, welche an Hermann Glineke verheirathet war, wegen ihrer Ansprüche ab 3 ) und kaufte im J. 1508 einen Hof mit 6 freien Hufen in Golm, welchen früher das ausgestorbene Geschlecht der v. Lubbin und darauf die Manteuffel besessen hatten. So gelangte Hans Bevernest in den vollen Besitz von Golm. Im J. 1519 war Hans Bevernest todt und hatte eine Wittwe Magdalene und eine Tochter Anna hinterlassen, welche verheirathet werden sollte und zu deren Brautschmuck die Mutter 200 Gulden, mit Bewilligung der Herzoge, auf ihr Leibgedinge auflieh; damals waren die Herzoge mit den Brüdern Dietrich und Curd, welche nicht auf Golm mitbelehnt waren, wegen deren etwaniger Erbansprüche noch nicht einig.
In gleichem Verhältnisse stand Curd Bevernest. Am 25. März 1500 belehnten die Herzoge Magnus und Balthasar, unter Zustimmung des jungen Herzogs Heinrich, ihren Diener Curd Bevernest zur Belohnung seiner treuen und willigen Dienste, die er ihnen lange Zeit gethan, mit den im Lande Röbel gelegenen Gütern des ausgestorbenen Geschlechts der Wulf 4 ) und gestatteten ihm die Besitzergreifung, sobald eine Frau, die letzte des Geschlechts, ge=


|
Seite 53 |




|
storben sein würde. Die Güter der Wulfe waren Bolewick und Zierzow im Lande Röbel und einige kleinere Besitzungen und Hebungen in derselben Gegend. In den meklenburgischen Landen scheint es kein einheimisches adeliges Geschlecht Namens Wulf gegeben zu haben, so viele Geschlechter dieses Namens es in der angrenzenden Ländern gab. Allein in der Mark Brandenburg gab es vier verschiedene Geschlechter dieses Namens, welche nicht unter einander verwandt waren (vgl. v. Ledebur in den Märk. Forschungen, Bd. III, S. 105). Leider ist kein Siegel der Wulfe im Lande Röbel bekannt; vielleicht waren sie auch aus der Mark Brandenburg und gehörten zu dem ausgestorbenen Geschlechte, welches mit den v. Holstendorf gleiches Wappen hatte; jedoch ist es auch möglich, daß sie ein eigenes Geschlecht bildeten. - Außerdem hatte Curd Bevernest im J. 1506 das im Stifte Schwerin belegene Gut Büschow im Besitze.
Claus Bevernest begteitete im J. 1496 den jungen Herzog Heinrich in den Dienst bei dem Kaiser Maximilian (vgl. Lisch Urk. des Geschlechts Maltzan IV, S. 315).
Der wichtigste unter den Bevernest jener Zeit war aber Dietrich Bevernest. Dietrich Bevernest erhielt von den Herzogen von Meklenburg die Güter des ausgestorbenen Geschlechts v. Tulendorf, welches nach 1485 und vor 1489 ausstarb, nämlich die Güter Tulendorf, Lüsewitz, Petschow und Wolfsberg, in deren Besitz er schon 1492 war. Jm Jahr 1496 gaben die Herzoge ihm die Belehnung mit dem Gute Niendorf im Amte Ribnitz, welches dem rostocker Patriciergeschlechte der Wilden gehört hatte, das kurz vorher auch ausgestorben war. Daneben war Dietrich Bevernest Inhaber des Schlosses und der Vogtei Wredenhagen, vielleicht zugleich Pfandbesitzer des Amtes, in welchem sein Bruder Curd seine Besitzungen hatte; im J. 1505 übergaben die Herzoge Batthasar und Heinrich ihm wieder Schloß und Vogtei Wredenhagen, wie die Herzoge Magnus und Balthasar ihm dieselben zuvor übergeben, auf fernere 10 Jahre. Bei einem so umfänglichen Besitze war Dietrich Bevernest schon früh, sicher schon um das J. 1510, Rath der Herzoge Heinrich und Albrecht. Vermählt war er mit Anna Regendank.
Dieser Dietrich Bevernest ward der Stammhalter des Geschlechts in Meklenburg, welches seinen Hauptsitz auf Lüsewitz hatte und anderthalb hundert Jahre dem Lande mehrere Männer von Bedeutung gab. Sein Enlel war Dietrich Bevernest, welcher 1589-1608 meklenburgischer


|
Seite 54 |




|
Landrath war, Während des dreißigjährigen Krieges war der Geheime= und Landrath Gregorius v. Bevernest auf Lüsewitz Pfandbesitzer des Amtes Plau (vgl. Jahrb. XVII, S. 197 und 209). Mit dessem Sohne Joachim Friedrich starb das Geschlecht im J. 1665 aus (vgl. Jahrb. XI, S. 432, und XVII, S. 209).
Wann die Bevernest in der Prignitz ausgestorben sind, ist nicht gewiß. In der ersten Hälfte des 17. Jahrh. besaßen sie uoch Gülitz; es ist aber nicht klar, ob diese Linie die meklenburgische oder eine andere war. So viel ist gewiß, daß die Familie v. Bevernest auch in der Mark Brandenburg ausgestorben ist. Dies wird nicht lange vor dem J. 1668 geschehen sein, da "im J. 1668 Herrn Adam Georgen Gans Herr Sohn Herr Hans Albrecht ein durch den Abgang derer Bevernesten ausgestorbenes und ihm wieder heimgefallenes Lehngut zu Gülitz wiederum an die v. Kaphengsten geliehen". Es ist also wahrscheinlich, daß die Bevernest in Meklenburg die letzten ihres Geschlechtes waren und mit ihnen die ganze Familie ausstarb. In den Kirchenbüchern von Gülitz finden sich keine Nachrichten über die Bevernest mehr.
Der Stammbaum der v. Bevernest in Meklenburg gestaltet sich nach Latomus "Vom Adelsstande" also:
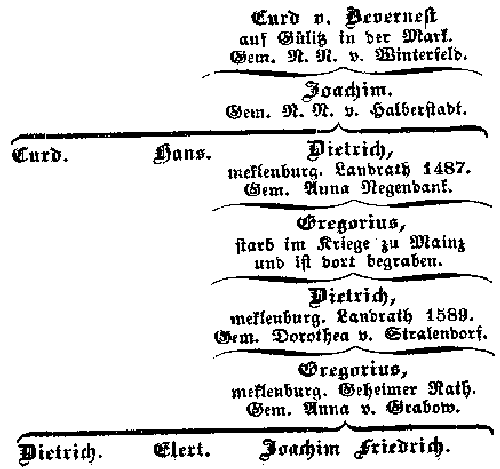


|
Seite 55 |




|
Die Familien von Grävenitz und von Rathenow.
Die Familien v. Grävenitz und v. Rathenow in der Prignitz waren vielleicht mit der v. Platen=Bevernestschen Familie stammverwandt, wenn sich dies auch nicht beweisen läßt.
Die v. Grävenitz, in der Mark auf Schilde angesessen, führen ebenfalls im silbernen Schilde einen abgehauenen Baumstamm mit drei Blättern. Auch diese Familie kam im 16. Jahrh. nach Meklenburg.
Die in Meklenburg in einzelnen Personen vorkommenden v. Rathenow scheinen ebenfalls dieser Familiengruppe anzugehören, wenn ich dies auch nicht ausführen kann. Jedoch führt ein Jürgen Rathenow im J. 1542 im Siegel einen queer liegenden, abgehauenen Stamm mit drei Blättern. Diese Familie war jedoch nicht mit Landgütern in Meklenburg angesessen, und daher haben die meklenburgischen Archive auch keine Nachricht über dieselbe. In jüngern Zeiten führt diese Familie im Schilde einen schrägen, abgehauenen Baumstamm, der jedoch mit einer grünen Weinranke mit Blättern umwunden ist, und auch auf dem Helme eine Weinranke.
Die urkundlich beglaubigte Stammesverwandschaft der von Platen und Bevernest.
Wenn auch aus der vorhergehenden Darstellung die Herkunft der Familien v. Platen und Bevernest von einem Stammvater mehr als wahrscheinlich sein wird, so hat diese Erscheinung doch die seltene geschichtliche Merkwürdigkeit, daß sich, was nur selten möglich ist, die Stammesverwandtschaft noch in sehr jungen Zeiten durch wiederholt verliehene Urkunden sicher beweisen läßt.
Als Hans von Platen auf Tornow um das J, 1553 gestorben war 1 ), hatten dessen nächste Lehnsvettern die von ihm hinterlassenen Antheile der im Brandenburgischen liegenden altväterlichen Lehngüter zu muthen versäumt, und der Kurfürst hatte dieselben als eröffnete Lehen seinen Hofdienern Curd Flans und Henning Pasenow verschrieben, Auf Bitten der nächsten Agnaten, Vicke, Melchior und Joachim v. Platen, ward aber diese Einziehung gegen eine Geldentschädigung an die Belehnten auf gütlichem Wege wieder rückgängig gemacht und den genannten von Platen das Lehn, das sie mit Hans von Platen zu gesammter Hand besessen hatten, wieder zugewandt. Am 27. November 1555 belehnte darauf der Kur=


|
Seite 56 |




|
fürst Joachim II. nicht allein die Brüder und Vettern Vicke, Melchior und Joachim von Platen mit des Hans von Platen hinterlassenen Lehngütern, sondern verlieh auch den übrigen v. Platen auf Quitzow und Mesendorf und desgleichen den Bevernesten, damals Joachim und Dietrich, wail. Gregorius Sohn, "die gesammte Hand, wie sie von Alters her versammelt gewesen" 1 ) waren. Nach des Kurfürsten Joachim II. Tode bestätigte der Kurfürst Johann Georg am 24. Sept, 1571 allen v. Platen auf Quitzow und Mesendorf und den Vettern Joachim und Dietrich Bevernest nicht nur alle ihre Lehngüter, sondern auch "die gesammte Hand, wie ihre Vorfahren die von Alters her besessen" 2 ). Dasselbe bestätigte beiden Familien nach der Urkunde vom 20. März 1645 auch der folgende Kurfürst Joachim Friedrich, wenn auch die Urkunde nicht erhalten oder bis jetzt nicht aufgefunden ist. Am 20. März 1645 versicherte aber der große Kurfürst Friedrich Wilhelm, nach dem Tode des Kurfürsten Georg Wilhelm, dem Joachim Friedrich Bevernest, dem Sohne des wail. Geheimen und Landraths Gregorius Bevernest, "die gesammte Hand an allen der v. Platen auf Quitzow und Mesendorf Lehngütern im Kurfürstenthume, so wie umgekehrt den v. Platen an allen Gütern, welche Joachim Friedrich Bevernest oder seine Erben im Kurfürstenthum kaufen oder mit der Zeit überkommen werde, da die von Platen mit den Bevernest Eines Stammes, Schildes und Helmes " seien 3 ). Diese klare, bestimmte und in ihrer Art seltene Bestätigung bedurfte jedoch der Erneuerung nicht, da Joachim Friedrich Bevernest als der letzte seiner Familie im J. 1665 ohne Hinterlassung von Leibeslehnserben mit Tode abging 4 ).
So ist die Stammesverwandtschaft der v. Platen und der Bevernest nicht allein durch Siegel, ja durch Namen, durch Tradition und Familienanerkennung, sondern auch durch lehnsherrliche Bestätigungen ununterbrochen und bis auf die neuern Zeiten anerkannt und außer Zweifel gesetzt.
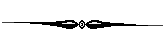


|
Seite 57 |




|



|


|
|
:
|
VI.
Genealogische und chronologische Forschungen
zur
Geschichte der meklenburgischen
Fürstenhäuser
Von
G. C. F. Lisch
A. Zur Geschichte des Hauses Meklenburg=Schwerin
1.
Fürst Hermann,
des Fürsten Johann I. von Meklenburg Sohn.
H ermann, der dritte 1 ) Sohn des meklenburgischen Fürsten Johann I. des Theologen, ist noch sehr wenig bekannt. Es wird im Allgemeinen gesagt, er sei geistlichen Standes und Domherr zu Lübeck und zu Schwerin gewesen (vgl. v. Rudloff M. G. II, S. 47 und 48, und v. Lützow M. G. II, S. 25). Die Quellen dieser Nachrichten sind zwei Chroniken, welche ungefähr zu einer und derselben Zeit geschrieben sind. Die doberaner und parchimsche Genealogie (Jahrb. XI, S. 18-19) sagt:
"Hermannus fuit canonicus Zwerinensis et Lubicensis".
Ernst v. Kirchberg sagt in seiner Reimchronik:
"Her Herman kunde canonike syn
zu Lubike vnde zu Zweryn",


|
Seite 58 |




|
Merkwürdig ist es nun, daß er weder in den Urkunden der Stadt Lübeck, noch in den Urkunden des Bisthums Lübeck, welche bis in das 14. Jahrh. jetzt gedruckt vor uns liegen, genannt wird und auch in den Schweriner Urkunden nicht beobachtet ist. Um so mehr ist jede Urkunde von ihm ein Gewinn für die Landesgeschichte. Kurz vor dem Tode seines Vaters war Hermann in Pommern. Als der Herzog Wartislav von Pommern=Demmin am 17. Mai 1264 der Stadt Greifswald die Aufführung einer Stadtmauer erlaubte und die Errichtung jeder fremden Burg auf dem Stadtgebiete verbot, auch der Stadt Einen Markt und Ein Recht gab 1 ), war der Fürst Hermann von Meklenburg bei ihm in der Nähe der Stadt Greifswald zu Darsin, jetzt Ludwigsburg bei Greifswald, und wahrscheinlich auch in der Stadt Greifswald. Die Vergleichung der Original=Urkunde 2 ) läßt keinen Zweifel über die richtige Lesart des Namens Hermann übrig. Am 27. Mai 1264 war auch der Fürst Heinrich von Meklenburg, sein Bruder, bei dem Herzoge Barnim von Pommern zu Greifswald. Am 17. Mai 1264 lag der Herzog Wartislav krank ("in nostra infirmitate") zu Darsin und machte hier sein Testament ("in nostro testamento nuncupativo, quod Darsim fecimus": vgl. v. Dreger Codex Pomer., Nr. 366, p. 475); an demselben Tage stellte er noch mehrere Urkunden aus, z. B. die hier mitgetheilte und die in v. Dreger Codex Pomer., Nr, 366, p. 475 gedruckte. Er starb noch in demselben Jahre, sicher vor dem Monate September.
In demselben Jahre, am 1. Aug. 1264, starb auch der Vater der meklenburgischen Fürsten, Johann I. der Theologe (vgl. Jahrb. XIX, S. 358). - Eine etwas spätere Urkunde Hermanns ist gedruckt in Rudloffs Urk. Lief. Nr. XIX. In diesen Urkunden wird Hermann noch nicht als Geistlicher bezeichnet.


|
Seite 59 |




|
2.
Ueber den Herzog Albrecht VI.
und
dessen Gemahlin Katharina
Ueber den Herzog Albrecht VI, den ältesten Sohn des Herzogs Heinrich des Dicken, und dessen Gemahlin Katharina sind die hauptsächlichsten Lebensumstände und Zeitbestimmungen noch alle sehr unzuverlässig und größtentheils unrichtig.
Rudloff II, 2, S. 836, sagt, daß Herzog Albrecht zuerst, im J. 1471, mit des Grafen Eberhard von Würtemberg Schwester Elisaabeth versprochen gewesen, die Heirath jedoch nicht zu Stande gekommen, die Braut dagegen zuerst mit dem Grafen Johann von Nassau und nach dessen Tode mit dem Grafen Heinrich von Stolberg vermählt worden sei. Albrecht habe dagegen im J. 1472 des Grafen Wichmann von Lindow Tochter Katharina geheirathet. Diese Angaben sind zum größten Theil unrichtig und fließen aus sehr trüben Quellen. Es ist im schweriner Archive ein Entwurf einer Eheberedung zwischen dem Herzoge Albrecht und der Gräfin Elisabeth von Würtemberg vorhanden, deren Datum aber vollständig verblichen und vermodert oder vielmehr wahrscheinlich noch gar nicht ausgeschrieben gewesen ist. Der herzogliche Secretair und Archivar Samuel Fabricius hat im 16. Jahrh. auf die Rückseite dieses Actenstückes geschrieben, daß daß Herzog Albrecht "Anno 1471" die Gräfin Katharina von Lindow zur Ehe genommen habe. Chemnitz giebt in seinem Chronicon einen weitläuftigen Auszug aus dieser Urkunde und fügt die Jahreszahl 1471 als Datum derselben hinzu, - und Rudloff nimmt alles dieses aus Chem nitz unbedingt auf! Die Sache verhält sich aber ganz anders.
"Unter des Kurfürsten Albrecht von Brandenburg Vermittelung" war allerdings eine Ehe zwischen dem Herzoge Albrecht von Meklenburg und der Gräfin Elisabeth von Würtemberg beabsichtigt und es war schon der Entwurf zu den Ehepacten festgestellt, welcher jedoch nicht datirt ist. Dies geschah aber im Anfange des Jahres 1466. Es sind nämlich noch Schreiben des Grafen Eberhard von Würtemberg vom 9. April 1466 und des Markgrafen Albrecht von Brandenburg vom 27. April 1466 vorhanden, welche diese beabsichtigte Heirath besprechen; es geht aus diesen Schreiben hervor, daß schon beim Entwurfe der Ehepacten Mißhelligkeiten über das Heirathsgut entstanden. Die Ehepacten kamen nicht zum Abschluß. - Das Jahr 1471 kann schon aus dem


|
Seite 60 |




|
Grunde nicht richtig sein, weil Elisabeth von Würtemberg schon im J. 1470 an den Grafen Johann von Nassau verheirathet ward, welcher schon im J. 1472 starb.
Vorzüglich aber können die bisherigen Zeitangaben deshalb nicht richtig sein, weil schon im Herbste des J. 1466 über die Vermählung des Herzogs Albrecht mit der Gräfin Katharina von Lindow verhandelt ward.
Sehr bald nach dem Abbruche der Verhandlungen mit dem Grafen von Würtemberg wurden Verhandlungen mit den Grafen von Lindow, Herren von Ruppin und Möckern, über eine Vermählung des Herzogs Albrecht mit der Gräfin Katharina von Lindow angeknüpft. Am 9. Oct. 1466 schrieben 1 ) die Grafen Johann und Jacob von Lindow an den Herzog Heinrich von Meklenburg, den Vater des Herzogs Albrecht, daß sie die Verhandlungen über eine Vermählung ihrer Schwester Katharina mit dem Herzoge Albrecht gerne empfangen und in Ueberlegung genommen hätten, und schlugen einen Tag zur Verhandlung am 15. Oct. zu Wittstock vor, um die vorbereiteten Verhandlungen zu einem guten Ende zu führen. Es leidet also keinen Zweifel, daß die Ehe des Herzogs Albrecht mit der Gräfin Katharina von Lindow, wenigstens durch die Ehepacten, im Jahre 1466 geschlossen ist.
Um Ostern 1468 unterzeichnet Katharina schon einen Brief als Herzogin von Meklenburg.
Rudloff a. a. O. sagt, die Gräfin Katharina sei eine Tochter des Grafen Wichmann von Lindow gewesen. Auch dies ist nicht völlig richtig. Katharina war eine Schwester der Grafen Johann und Jacob von Lindow, also eine Tochter des Grafen Albrecht III, welcher drei Male, und zwar das erste Mal mit Katharina, Herzogin von Schlesien, vermählt war; vgl. Riedel Cod. dipl. Brandenb. I, 4, S. 12 und 17. Nach den Vornamen zu schließen, war Katharina eine Tochter erster Ehe des Grafen Albrecht. Riedel kennt die Gräfin Katharina aber gar nicht. Der Graf Wichmann, mit welchem 1524 das Geschlecht der Grafen von Lindow ausstarb, ward erst im J. 1520 für mündig erklärt.
Es wurden zur Vermählung sicher nur allgemeine Ehepacten vollzogen, Die einzelnen Verschreibungen wurden erst später ausgefertigt. Im J. 1472 waren die Grafen Johann und Jacob von Lindow noch Gelder auf den Brautschatz ihrer Schwester Katharina schuldig. Da diese Verhandlungen die


|
Seite 61 |




|
ältesten, früher bekannten Actenstücke über die Vermählung sind, so hat man hieraus geschlossen, daß die Vermählung erst im J. 1472 oder im J. 1471 vollzogen sei. Der Herzog AIbrecht verschrieb erst am Johannistage 1482, also nicht lange vor seinem Tode, seiner Gemahlin das Leibgedinge.
Der Herzog Albrecht starb schon im Anfange des J. 1483. Rudloff sagt in der Stammtafel, er sei "1483 vor April 27" gestorben. Nach einer alten Aufzeichnung aus dem Anfange des 16. Jahrh. im schweriner Archive starb der Herzog am 16. Februar 1483:
"Im Jar des hern MIIII C LXXXIII des Sondages Invocauit starff h. Albert".
Am Pfingstabend, d. i. 17. Mai 1483, verschrieben sich die Herzoge Magnus und Balthasar für des Herzogs Albrecht Wittwe Katharina auf 4000 Gulden als den Nachstand ihrer Leibzucht, "nach dode des hochgebornen fursten hern Albrechts zeliger in godt vorstoruen" und am 1. NoV, 1483 wurden die Verhandlungen darüber weiter geführt.
Ueber den Tod der Herzogin Katharina herrscht noch völliges Dunkel Rudloff sagt nur, daß sie noch 1483 Nov. 1 gelebt habe, und es sind von ihr noch Briefe aus dem Herbste des Jahres 1483 vorhanden. Es wird sich aber das Sterbejahr der Herzogin nach neuern Entdeckungen genauer angeben lassen. Am 10. Sept 1485 schrieben 1 ) die Brüder Waldemar und Sigismund von Anhalt an die Herzoge von Meklenburg, daß, da nach einem Landgerüchte die Herzogin Katharina vor kurzem gestorben sei, die Herzoge ihnen hierüber sichere Nachricht geben möchten, damit sie ihre leibliche Schwester Fräulein Anna, welche sich bisher bei der Herzogin Katharina aufgehalten habe, zurückholen lassen könnten. Da eine Schwester der Grafen Johann und Jacob von Lindow, also auch der Herzogin Katharina, Namens Anna, mit dem Fürsten Georg I. von Anhalt=Dessau, dem Vater der Fürsten Waldemar und Sigismund, in dritter Ehe vermählt war, so war die Herzogin Katharina eine Tante der jungen Fürstin Anna und der beiden Fürsten von Anhalt. Die anhaltischen Fürsten nennen daher die Herzogin Katharina ihre "Schwester", ein Ausdruck, der bei Verschwägerungen sehr häufig vorkommt, namentlich wenn die Lebensjahre der Verschwägerten nicht sehr weit aus einander stehen.


|
Seite 62 |




|
Die Herzogin Katharina wird also im Spätsommer des J. 1485 gestorben sein, nach dem Inhalte des Schreibens der anhaltischen Fürsten gewiß nicht früher.
Nach dem Tode der Herzogin Katharina dauerten die Verhandlungen über die Rückzahlung ihres Heirathsgeldes noch lange fort Das erste noch erhaltene Schreiben 1 ) in dieser Angelegenheit ist vom 12. Januar 1489, das zweite 2 ) vom 26. März 1491, welchem noch einige bis gegen das Ende des J. 1491 folgen. Es ist also sicher, daß die Herzogin vor dem J. 1489 starb, also sicher zwischen 1485 und 1488, wenn man dem "Landgerüchte" keinen Glauben Schenken wollte.
Anlagen.
Nr. 1.
D. d. Ruppin, 1466. Oct. 9.
Vnnsen fruntliken dinst vnde was wy liues vnde gudes vormogen. Hochgebarnne Furste, liue ohme. So gy uns gefcreuen hebben van der vorhandelinge, de geschyn is tuschen deme hochgebarnnen fursten unde heren hertoge Albrechte, juweme fane, vnnsem liuen ohm, vnde vnnser suster, alle sulke vorhandelinge vnde gewerue, de dar tuschen geschin synt, hebben wy alle to gudermathen gut liken in andacht vpgenamen vnde mit den vnsen vnde andern, dar wy billick muchten mede spreken, fordan vorhandelt vnde nach den besten auerwagen, sunder so gy vns nu de tyt vnde stede als nomeliken amme sondage negest kamende nach Dionisii to Witstogk to kamende vorscreuen hebben, so sint wy alße gystern gantz spade van deme dage to Tempelin gekamen, dat vns de tyt gantz kort ist vnde de vnnsen vnde de anderen, de wy gerne dar by hadden, nicht kanen vppe deme sondage dar bringen vnde juwen knecht ok nicht so drade hebben kanen van vns forderen: bidden wy juwer leue in funderken flite, gy des nicht vor vnwillen nemen, sunder amme dingestdage negestkamende nach dissen suluen sunte Dionisius dage to Witstogk vppe den auent so meynen wy gewissze dar to kamende, vnbe des middewekes voert vnfe dedinge mit juw des haluen gerne fordan, so de vormals begrepen


|
Seite 63 |




|
vnde vorgenhamen fint, thome guden ende mit juw
to bringende vnde vns gutliken mit juw to
slitende, vnde juwe liue gewisse dar kame, dar
wy vns gentzliken to deme dage vorlaten, vnde
wes wy juwer liue kanen to dinste vnde to willen
werden, don wy ganz mit alle vnseme vormoge
gerne. Datum Ruppin, amme donresdage amme dage
dionisii, vnder vnnseme ingesegele, anno domini
 . LXVI
to
. LXVI
to
Johannes vnde Jacob gebrodere von gots gnaden grauen vom Lyndow vnde heren to Ruppin.
Deme hochgebarnnen Fursten vnde hern heren Hinrick herthogen to Melnborch, to Wenden vnde grauen to Swerin, vnnseme liuen ohme.
Nach dem Originale im großherzogl. Meklenburg. Geh= und K. Archive zu Schwerin. - Im J. 1466 fiel der S. Dionysius=Tag, der 9. Oct. auf einen Donnerstag.
Nr. 2.
D. d. Dessau. 1485. Sept 10.
Vnszer fruntliche vnde willige dinste zuuoren.
Hochgeborne, fruntlichen, lieben omheme. Wir
haben vß fremder irfarunge in eyneme
lantgeruchte, daz die hochgeborne furstinne
frauwe Katherine von Mecklenborg, vnszir liebe
swester, in ghot kortez vorschehden fy, vnde so
ir liebe in gantcz ghutlicher fruntschafft vnde
wolmeynunge das hochgeborne freuwechin Annen,
vnfze libliche liebe swester, by sich enthelt,
nicht gewyssens haben, wie eß dar vmb ist, vnde
so daz geruchte wdr were, weren wir deß sere
vorschrocken vnde bekummert vmbe vnßir swester,
der wegen ist vnszer fruntliche bethe, uwer
lieben wollen vns deß eyn gewisszen geben by
desszeme kegenwertigen vnszerm bothen, wollen
wir vnszir swester vorgenant lasszen holen. Daz
vordinen wir alle zeyt mith fruntlichen vnde
willigen dinsten gerne. Geben zu Dessow, amme
Sonnabende nach Natiuitatis Marie, Anno domini
 . LXXXV
to
. LXXXV
to
Waldemar vnde Sigemundt gebroder von gotis gnaden fursten zu Anhalt, Graffen von Asschanien
., heren zu Bernborgk
.


|
Seite 64 |




|
Denn hochgebornen fursten vnde heren heren
Magnuszen vnde heren Balthesararen, gebruderen,
Hertzogen zcu Mecklenborgh, fursten zcu Wenden,
Graffen zcu Swerin, der Lande Rostogk vnde
Stargerde
 heren, vnßern fruntlichen lieben
heren vnde omhem.
heren, vnßern fruntlichen lieben
heren vnde omhem.
Nach dem Originale im großherzogl. Meklenburg. Geh. und K. Archive zu Schwerin.
Nr. 3.
D. d. Cölln a. d. Spree, 1489. Jan. 12.
Vnnser frunttich dinst mit vermogen alles gutten zuuoren, Hochgebornen fursten, lieben ohmen. Vnns haben die wolgebornen vnnd edelen vnnser rete vnd lieben getrewenn Johanns vnnd Jacob, grauen von Lindow, herrn zu Ruppin vnnd Mokern, zu erkennen gebenn, das in nach abganck frawen N, etwan des hochgebornen fursten, hern Albrechts, hertzogen zu Mekelmburg, ewrs lieben bruders, inn got seligen, gemahel, yrer lieben swester, von dem widerfall irs hehrats ir mitgeben nach laut der hey ratsbriue, nemlich newntausend gulden heimgefallen, der fy by euch forderung getan vnnd doch bisher auff yr gutlich vnnd fruntlich ersuchen nichts haben bekomen mogen, demnach vnnd wir durch fy ytzundt mit vleis ersucht sind, fy deßhalben gen euch freuntlich zu uerschriben, bitten wir mit fruntlichem vleis, ewr lieb wolle den genanten grauen Johansen vnnd Jacob von Ruppin solchs gelts genugsamlich entrichten vnnd betzalung thun nach laut der verschribung obenberurt, wo yr aber inn vermeynug seyt, einrede zu haben, sein wir der genanten grauen als vnnser lantsessen vnnd verwanten zugleich vnnd aller billickeit mechtig, bitten auch van deßwegen ewr lieb der gebrech zu uerhorung vnnd handelung vor vnns auch nicht vßzuschIagen, als wir vnns deß vß fruntlichem wesen zu ewr liebe wol versehen thun werden, sein wir geneigts willens vmb ewr lieben fruntlich zu uerdienen vnnd bitten deß ewr lieben fruntlich antwort. Datnm Coln an der Sprew, am mantag nach Trium Regum, anno domini im LXXXIX ten .
Johanns von gots gnaden marggraue zu Brandemburg, des heiligen romischen richs erßcamerer vnnd curfursten, zu Stettin Pommern
., hertzog, burggraue zu Nuremberg vnnd fursten zu Rugen.


|
Seite 65 |




|
Den hochgebornen fursten vnnsen lieben ohmen herrn Magnus vnnd herrn Baltzer, gebrudern hertzogen zu Mekelmburg, fursten zu Wenden, grauen zn Swerynn, Rotstock vnnd Stargart der lannde herren,
Nach dem Originale im großherzogl. Meklenb. Geh. u. K. Archive zu Schwerin
Nr. 4.
D. d. Schwerin. 1491. März 26.
Vnsze frunthlicke dinste touornn. Wollgebornne,
fruntlike liue oheme. Allso denne Jwe liue vns
itzund gefcreuen hebbenn der sakenn halbenn, szo
jwe liue samptlikenn mit jwer liue bruder graue
Jacob van jwer vnde vnszer liuen sußter wegen
zeliger in godt vorstoruen vermeynen to vns to
hebbenn, vnde vns wider vermanen, wo jwer liuen
bruder imme latesten to Stettin dorch den
gestrengen vnde duchtigen unszen Radt vnde liuen
getruwen er Nic. Hanen Ritter darumme besandt
hebbenn, wo de meyninge des briues wider sundet,
hebbenn wy vernamen, Twiuelen wy des nicht, jwe
liue hebbe alle vorscriffte dorch vns vnde jwe
liuen vnderlangs ergangen noch woll in
dechtnissze, Jdoch wanner vnsze fruntlike liue
ohem vnde Bruder margreue Hans
 ., nach synen liuen vorscriffte
vnde affschede vns jegen syner liuen to kamen vp
bequemelike dage vnde legelike stede vorscrifft
scheffte halbenn van beiden delen vns berurende,
willenn wy jegen syner liuen komen vnde vnszen
vorscrifftenn an jwer liuen erlanget genuch don.
Wusten wy susz jwer liuen dinste vnde fruntschop
to donde, des weren wy gewilliget. Datum Zwerin
amme pallmeauendt, Anno
., nach synen liuen vorscriffte
vnde affschede vns jegen syner liuen to kamen vp
bequemelike dage vnde legelike stede vorscrifft
scheffte halbenn van beiden delen vns berurende,
willenn wy jegen syner liuen komen vnde vnszen
vorscrifftenn an jwer liuen erlanget genuch don.
Wusten wy susz jwer liuen dinste vnde fruntschop
to donde, des weren wy gewilliget. Datum Zwerin
amme pallmeauendt, Anno
 . XCI°,
. XCI°,
Magnus vnde Balltzar.
An
Grauen Johannszen to Ruppin,
Nach dem Concept im großherzogl. Meklenburg. Geh. u. K. Archive zu Schwerin. Am 18. März 1491 schreibt der Graf Johann von Lindow von seiner "Borch Oldenruppin" an die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg, daß sein Bruder den Herzog Magnus, als dieser zu Stettin gewesen sei, wegen der Angelegenheit ihrer verstorbenen Schwester durch "Clawes Hanen Ritter" beschickt und der Herzog Magnus durch diesen habe erklären lassen, daß er die Angelegenheit dem Markgrafen Johann von Brandenburg und den meklenburgischen Räthen zur Entscheidung verstellen wolle; der Graf Johann bittet nun um genauere Erklärung, um die Sache vorbereiten zu können.


|
Seite 66 |




|
3.
Ueber den Sterbetag der Herzogin Sophie,
Gemahlin des Herzogs Magnus II.
Der Sterbetag der Herzogin Sophie, des braven Herzogs Magnus II. Gemahlin, in deren hohes Lob alle Schriftsteller übereinstimmen, ist bisher noch nicht ganz sicher gestellt, obgleich der Sterbetag mehrfach von Interesse ist, wäre es auch nur wegen ihres seltenen Grabdenkmals. Die Herzogin ward vor dem Hochaltare des Dominikaner= oder Schwarzen=Mönchsklosters zu Wismar begraben und ihr Grab mit einer kunstreichen Messingplatte geschmückt, auf welcher ihr erhaben gegossenes, statuarisches, liegendes Bild aus Messing, von ihren Wappen und der Grabinschrift umgeben, dargestellt ist, dem einzigen Werke dieser Art, welches noch in Meklenburg vorhanden ist, leider aber nicht sehr geschützt zu sein scheint, da die Kirche nicht mehr als Gotteshaus benutzt wird.
Den sichersten Anhaltspunkt giebt wohl ohne Zweifel die Inschrift auf der Grabplatte. Diese lautet nach dem Originale:
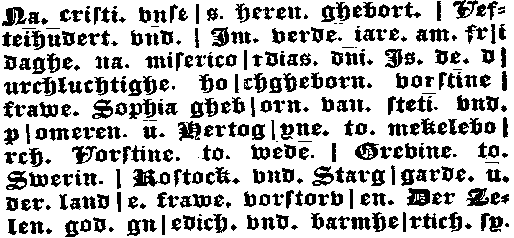
Vgl. Schröder Pap. Mekl. II, S. 2721.
Hiernach starb die Herzogin im J. 1504 am Freitage nach Misericordia domini. Dies war im J. 1504 der 26. April.
Hiemit stimmt auch der lübische Chronist Reimar Kock, ein wohl unterrichteter Wismaraner, überein, wenn er in seiner handschriftlichen Chronik schreibt:
1504. Des fridaghes na sunte Marcus iß frauwe Sophia, de nagelatene wedewe hartig Magni, ene Moder Hinrici und Alberti van Mekelnborg und thor Wißmar tho den schwarten Monnecken begraven.


|
Seite 67 |




|
Der S. Marcus=Tag, der 25. April, fiel im J. 1504 auf einen Donnerstag, also war der Freitag nach S. Marcus der 26. April. Beide Angaben werden durch die officielle Todesanzeige bestätigt; diese ist zwar nicht selbst, jedoch sind noch einige Antworten darauf vorhanden. In dem Beileidsschreiben des Kurfürsten Joachim I. von Brandenburg an die Herzoge Balthasar und Heinrich von Meklenburg wird Bezug genommen auf das herzogliche
"Schreybenn, das etwen dy hochgeborne furstin fraw Szophia gebornne zu Stettin Hertzogin zu Mecklnburg
. am freytag vorganngen, doch mit verwarung aller Sacramenten, als ein cristliche furstin von disem jamertall todtlichen abgeschiden".
Das kurfürstliche Schreiben ist von Cöln an der Spree "am tag walpurgis" datirt. Der Tag Walpurgis ward zwar gewöhnlich am 27. Febr. gefeiert, aber auch am 1. Mai. Die Feier am 1. Mai muß hier nothwendig angenommen werden; dann war der nächst vorher vergangene Freitag der 26. April. Das Beileidsschreiben des Kurfürsten Friedrich von Sachsen ist zu Torgau am Sonnabend nach Inventionis crucis, also am 4. Mai, das des Landgrafen Wilhelm von Hessen zu Cassel am Freitage nach Ascensionis domini, also am 17. Mai, datirt.
Anders redet Slagghert in seiner Chronik des Klosters Ribnitz, in welcher die Stelle nach dem plattdeutschen Originale nach einer Abschrift also lautet:
Anno M. D. IV. An deme dage Marci Froychen (?) Sophia, Hertich Magnus tho Meckelenborch naghelaten Vorstynne vnd des hochgebaren gnedigen Heren Hertich Eriche tho Pamern Dochter und Hertich Buglasses Suster und froychen Dorothea der Abdissen tho Ribbenitz er Moder, ys in Got den Herrn gestoruen vnde begrauen tho der Wysmer by den Broderen sunte Dominicus Orden vor deme hogen Altar in einem vorhauen Graue, dar up licht eyn gaten Missinges Sten myt enem groten, schonen Bilde, na er gebildet, mit eren Wapen. Desse [Vorstynne] hest gegeuen desseme Closter tho Ribbenitz in erem Testamente de alderbeste casele myt Golde dorchgeslagen vnd enem schonen Parlen Cruce vp deme Rueggen, myt ener schonen Amitten 1 ) van Parlen und Golde vnd eddelen Stenen.


|
Seite 68 |




|
Slagghert setzt also den Sterbetag der Fürstin auf den Tag des Evangelisten Marcus. Dies ist der 25. April.
Eben so berichtet die lateinische Uebersetzung des Slagghert in Westphalen Mon. Ined. IV, p. 878: "Ao. 1504 in die Marci evangeliste illustrissima Sophia etc. obiit"; wohl zu merken ist, daß diese Uebersetzung die ganze Stelle von dem Grabe der Herzogin ausläßt.
Eben so lautet auch eine Aufzeichnung in einem im Archive zu Schwerin aufbewahrten Verzeichnisse fürstlicher Sterbetage aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts:
"M C IIII. am dage marci evangeliste starff Sophia, gemaell h. magni".
Da alle amtlichen urid unmittetbaren fürstlichen Quellen für den 26. April reden, so ist dieser Tag auch unbedenklich als der Sterbetag der Fürstin anzunehmen.
Albert Krantz am Schlusse seiner Bandalia, XIV, 35, giebt den Todestag der Herzogin nicht an.
B. Zur Geschichte des Hauses Meklenburg=Stargard.
4.
Ueber die Gemahlinnen des Herzogs
Johann I.
von Meklenburg=Stargard.
Es sind bis jetzt zwei Gemahlinnen des Herzogs Johann I. von Meklenburg=Stargard, des Bruders des ersten Herzogs Albrecht von Meklenburg=Schwerin, bekannt: Anna, geborne Gräfin von Holstein, und Agnes, geborne Gräfin von Ruppin, verwittwete Fürstin von Werle; vgl. Rudloff. M. G. II, S. 526 (vgl. S. 457) und F. Boll Gesch. des Landes Stargard, II, S. 52 (wo unrichtig nur Rudloff, II, S. 456 citirt ist). Aus einer Stelle in einer Kriegsschadenberechnung des Ritters Otto von Dewitz vom J. 1358, die ich Boll zu seiner stargardischen Geschichte a. a. O. mitgetheilt habe:
"quum frater domini Magnopolensis duxit suan dominam"
geht hervor, daß der Herzog Johann sich im J. 1358 wieder vermählte. Die Gemahlin, mit der er sich im J. 1358 verband, wird aber nicht die zweite, sondern die dritte gewesen sein.


|
Seite 69 |




|
Nach Rudloff starb die erste Gemahlin Anna vor dem J. 1356.
Nun habe ich eine Urkunde entdeckt, nach welcher der Herzog Johann vor dem 13. Januar 1358 eine zweiteGemahlin Rixe durch den Tod verloren hatte. Am 13. Jan. 1358 stiftete 1 ) nämlich der Herzog Johann einen Altar in der Kirche des Klosters Himmelpfort zu Messen für das Seelenheil seiner Lieben, seiner Vorfahren und seiner Nachkommen, namentlich aber der Frau Riye, welche hiebevor seine liebe Ehegenossin gewesen war ("vru Ryccien, die hierbevorne uuse lêue echtghenote 2 ) was"), endlich seines Bruders Albrecht, seiner Gemahlin und ihrer Erben. Es geht hieraus hervor, daß Herzog Johann nicht lange nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Anna († vor 1356) die Rixe wieder geheirathet, diese aber bald nach der Vermählung (vor dem 13. Jan. 1358) durch den Tod wieder verloren habe, wahrscheinlich nicht lange vor dem 13. Jan. 1358, da der Altar, wie in solchen Fällen häufig zu geschehen pflegt, wohl bei oder bald nach dem Begräbnisse gestiftet ward. Woher diese Rixe stammt, habe ich noch nicht ermitteln können; vielleicht stammte sie aus dem Hause Werle oder aus einem nordischen Hause, wo der Name Rixe gebräuchlich war.
Hierauf nahm Herzog Johann, nach der oben mitgetheilten Stelle in der Rechnung des Ritters Otto v. Dewitz noch im J. 1358, zur dritten Gemahlin die geborne Gräfin Agnes von Lindow, verwittwete Fürstin von Werle.
Der Herzog Johann I. von Meklenburg=Stargard hatte also folgende drei Gemahlinnen:
1) Anna, Gräfin von Holstein, † vor 1356.
2)
Rixe (Fürstin von Werle?), 1356 † 1357.
3)
Agnes, Gräfin von Lindow. 1358.
5.
Ueber das Sterbejahr des Herzogs
Johann II.
von Meklenburg=Stargard.
Das Sterbejahr des Herzogs Johann II. von Meklenburg=Stargard ist bisher noch nicht bestimmt gewesen. Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 570 thut dar, daß er vor dem 19. März 1417 gestorben sei; F. Boll in seiner Geschichte des Landes Stargard, II, S. 109 sagt, daß er "aller Wahr=


|
Seite 70 |




|
"scheinlichkeit nach in dem Jahre 1416, wenigstens in den ersten Monaten des folgenden Jahres gestorben" sei. Daß er nach dem 7. Mai 1416 gestorben sei, beweiset Boll a. a. O. Es wird sich aber nachweisen lassen, daß er imJahre 1416 vor dem 9. October, also zwischen 7. Mai und 9. October 1416 gestorben ist. Am 9. Oct. 1416 schenkte 1 ) nämlich der Herzog Johann von Meklenburg=Stargard dem Kloster Himmelpfort "die Walkmühle, welche sein lieber Vater seliger Gedächtniß auf dem Stadtgraben zu Lichen bei dem fürstenbergischen Thore hatte bauen lassen und wie er und sein Vater die Mühle besessen hatten", wofür er dem Kloster die Pflicht auferlegte, für sein und seiner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil ewig Gedächtnißfeiern zu halten. Aus dem Umstande, daß der Schenker seines Vaters mit besonders zärtlichen Worten gedenkt und eine Gedächtnißfeier für das Seelenheil der Glieder seines Hauses stiftet, glaube ich mit Sicherheit schließen zu können, daß der Schenker der Herzog Johann III. ist und der Sohn des Herzogs Johann II, der nach dem Ton der Urkunde erst vor kurzem gestorben war. Auch würden, wenn unter dem verstorbenen Vater der Herzog Johann I. hätte verstanden werden sollen, die beiden Brüder Johann II. und UIrich I. die Schenkung gemacht haben. Es wird also der Herzog Johann II. im dritten Viertheil des Jahres 1416 gestorben sein.
6.
Das Sterbejahr des Herzogs Rudolph
von Meklenburg=Stargard, Bischofs von Schwerin.
Das Sterbejahr des Schweriner Bischofs Herzogs Rudolph ist für die Genealogie sowohl der Herzoge von Meklenburg, als der Bischöfe von Schwerin von, mehrfacher Bedeutung, nicht minder das Sterbejahr seiner beiden Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle Schwerins, Namens Heinrich, Rudloff sagt in seiner Mekl. Gesch. II, S. 560, daß Rudolph im J. 1415, nach Julii 25 gestorben sei, und ich habe in den Jahrbüchern VIII, 1843, auch das Jahr 1415 als sein Sterbejahr, auf urkundliche Beweise getützt, angegeben. Dennoch sagt Boll in seiner Geschichte des Landes Stargard, II, 1847, S. 109, daß Rudolph im J. 1416 gestorben sei. Die Be=


|
Seite 71 |




|
weisführung für das richtige Jahr ist sehr schwierig, da aus der letzten Zeit des Bischofs Rudolph und aus der ersten Zeit seines Nachfolgers Heinrich von Nauen nur sehr wenige Urkunden vorhanden sind. Jedoch wird sich der Beweis führen lassen.
Der Bischof Rudolph läßt sich im J. 1415 durch folgende Urkunden als lebend nachweisen.
1) 1415. Febr. 5.
"Henning Reventlow verkaufft dem Capitel zu Zwerin seinen Hoff zu Wendischen Rambow, den Hinrich von Loo sein Stiefvater und Grete seine mutter besitzet, mit den darzu ligenden hufen vnd allem, waß sein Vater Gottschalck Reventlow da gehabt vnd ihm geerbet, mit richte, dienste, vor 100 Mk, lüb. Datum Zwerin 1414, im Sontage Marteti Magdalenen tage (Julii 22). Vnd ist Bischoffs Rodolphi Consens hieran gehefftet sub dato Butzow 1415 in die Agathae (Febr. 5)."
Nach Daniel Clandrians Verzeichniß der Urkunden des Stifts Schwerin; das Original der Urkunde ist nicht mehr vorhanden.
2) 1415. Febr. 22.
Lübbert Witgerver, Scholasticus des Bisthums Schwerin, stiftet eine ewige Vikarei in der Kirche zu Schwerin mit 26 Mk. Lüb. Hebungen aus dem Dorfe Driefpet, die er von dem Bischofe Rudolph gekauft hat. Datum mensis Januarii die XII, pontificatus domini Johannis papae XXIII anno quinto (v. i. 12. Jan. 1415). Diese Stiftung wird von dem Bischofe Rudolph zu Bützow am 22. Febr. 1415 und von dem schweriner Dom=Capitel am 5. April 1415 bestätigt.
Diese Urkunde ist im Auszuge gedruckt in Schröder's Pap. Meckl. II, S. 1773.
3) 1415. April 3.
Der Bischof Rudolph von Schwerin verkauft dem Kloster Doberan das Eigenthumsrecht an dem Dorfe Retschow, unter Bewilligung des Dom=Capitels zu Schwerin. "Gheuen vnde screuen tu Zwerin 1415, des mydwekens in deme paschen."
An dieser Urkunde, welche im Originale bei den Urkunden des Klosters Doberan im Schweriner Archive vorhanden ist, hängt noch des Bischofs Rudolph großes Siegel ("grote ynghzeghel") und das große Siegel des Dom=Capitels.


|
Seite 72 |




|
Damals lebte also der Bischof Rudolph sicher noch.
4) 1415. Juli 28.
Die Herzoge Otto und Casimir von Pommern verbünden sich mit "hern Rodeloue bysscope to Zwerin" und seinen Brüdern Johann und Ulrich, Herzogen von Meklenburg=Stargard, und mit den Herzogen Johann und Albrecht von Meklenburg=Schwerin gegen die "wendeschen heren", 1415, des negesten sondages na s. Jacobes dage apostoli.
Rudolph lebte also noch am 28. Julii 1415; er konnte höchstens einige Tage oder Wochen vorher gestorben sein, wenn bei der Ausstellung dieser Urkunde die Nachricht von seinem Tode noch nicht zu den pommerschen Herzogen gelangt sein sollte. Jedenfalls kann man aber annehmen, daß er noch im Julii 1415 lebte.
Im December 1415 war Rudolph aber schon todt, "Johan vnd Albrecht Hertzogen zu Mekelnburgk stifften vnd machen eine ewige Prouenn in der Kirchen zu Zwerin, die genannt ist eine Middel=Prouen, deren verlehnung sie vnd ihren erben sich furbehalten, vnd geben darzu 24 Mk. sundischer pfenninge iarlicher gulde in den Muhlen zu Wotreutze vnd zum Brule vnd 9 Mk. lub. Bede im dorffe Jordenßhagen von den gemeinen Bauren deß dorffes. Item 2 Mk. lub. in der Bede im dorffe Meytin vff dem Buge vffzuboren alle Jar vff Michaelis. Datum Zwerin 1416 in S. Johannis Evangelisten tage in den Weinachten (d. i. 1415. Dec, 27).
und
"Lubbertus Witgherwer, scholasticus ecclesiae Zuerinensis, amministrator etc. vacante sede episcopali confirmiret vorberurte von H. Johan vnd Albrechte zu Mekelnburgk gestifftete Prouene, vnd ist Ihrer F. G. vor registrirter Fundation=brieff dieser Confirmation inserirt. Datum et actum Zwerin 1416 mensis Decembris die 27 (d. i. 1415. Dec. 27).
Diese Urkunden des Bisthums Schwerin sind nicht mehr im Originale vorhanden, aber aus den sichern Regesten Daniel Clandrian's,bekannt. Beide Urkunden sind vom 27. Dec. des Jahres 1416 datirt, d. h. nach jetziger Zeitrechnung im Jahr 1415, indem damals das Jahr mit Weihnacht begann.
Am 27. Decbr. 1415 war also der Bischof Rudolph schon todt und der Schweriner Dom=Scholasticus Lübbert Wit=


|
Seite 73 |




|
gerwer war bei der Sedisvacanz ("vacante sede episcopali") Administrator des Bisthums Schwerin; Rudolphs Nachfolger war also noch nicht gewählt.
Lübbert Witgerwer war damals ein bekannter, thätiger Mann. Am 22. Febr. 1415 stiftete er eine Vicarei im Dome zu Schwerin, wie oben angeführt ist. Am 3. April 1415 war er Dom=Scholasticus, der älteste Domherr und Stellvertreter des abwesenden Domdechanten; der Bischof Rudolph nennt ihn in der oben angeführten doberaner Urkunde:
"Lubbert Witgherwer, oldeste dumhere, an des dekens stede, de in dem houe tu Rome ys".
(Am 22. Febr. 1415 wird "Jacobus Oem senior" genannt). Am 27. Dec. 1415 war er während der Sedisvacanz Administrator des Bisthums. Am 10. Jan. 1416 gab er, "Lubbertus Wytgherwer, scholasticus, als Testamentarius fel. Johannis Hunnendorf, zu der Vicarien präbendenbrote und zum Jungfrauenkloster Rehna 4 Mk. jahrlicher Hebungen aus dem Dorfe Steinfeld", nach Dan. Clandrian's Regesten. Ob damals schon der neue Bischof gewählt worden war, läßt sich kaum bestimmen, da Witgerwer hier nur als Testamentsvollstrecker handelte. Jedoch ist es wahrscheinlich, daß Heinrich von Nauen schon am 10. Januar 1416 zum Bischofe von Schwerin gewählt war, da sich im entgegengesetzten Falle Lübbert Witgerwer wohl noch Administrator genannt haben würde.
Am 17. Julii 1416 war aber Heinrich von Nauen sicher schon Bischof von Schwerin. An diesem Tage ("anno millesimo quadringentesimo decimo sexto") bestätigte er ("Hinricus dei et apostolice sedis gratia episcopus Zwerinensis") die Stiftung einer Vicarei in der Kirche zu Dreweskirchen durch den Priester Marquard Roberstorf. Die Ur kunde 1 ), welche im Originale vorhanden ist und ein bisher noch unbekannt gewesenes Siegel des Bischofs führt, läßt keinen Zweifel übrig.
Zu gleicher Zeit bestätigt diese Urkunde die Richtigkeit der Annahme, daß die oben angeführte Urkunde des Dom=Scholasticus Lübbert Witgerwer als Administrators vom 27. Dec 1416 in das Jahr 1415 nach unserer Zeitrechnung gesetzt werden müsse, da am 27. Dec. 1416 keine Sedisvacanz mehr sein konnte, wenn der nachfolgende Bischof Heinrich schon am 17. Julii 1416 vom päbstlichen Stuhle bestätigt war.


|
Seite 74 |




|
Es ist also urkundlich erwiesen, daß der Bischof und Herzog Rudolph in der zweiten Hälfte des Jahres 1415 starb.
Die Regierungszeit seiner beiden Nachfolger gleichen Namens, Heinrich II. und III, läßt sich hiernach und nach andern Bestimmungen auch ziemlich genau festsetzen.
Da am 27. Dec. 1415 noch Sedisvacanz war, so wird Heinrich II. von Nauen wohl nicht mehr in diesem Jahre gewählt sein. Man kann also wohl mit Sicherheit annehmen, daß Heinrich II. erst im J. 1416 auf den bischöflichen Stuhl gelangte. Er lebte noch am 8. September 1418 (vgl. Jahrb. VIII, S. 23, Note), und am 27. Oct. 1418, als die Herzoge von Meklenburg und die Fürsten von Werle eine Aussöhnung 1 ) schlossen; in dieser heißt es:
"An desse endracht, vrede, stukke vnde artikel vorgescreuen thee wy hern vorbenomt an beyden siden den erwerdigen an got vadere hern Hinrike van godes gnaden biscop to Zwerin, vnsen gestliken vader, alle syne nakomelinghe vad syn stichte, like vns sulven".
Im Anfange des Jahres 1419 am 8. Jan. war jedoch wieder Sedisvacanz. Lübbert Witgerwer war nach einer Original Urkunde wieder Administrator, zugleich mit Johann Lunow während derselben (vgl. Jahrb. XXI, S. 177). Es ist daher mehr als wahrscheinlich, daß Heinrich II. noch im J. 1418 starb. - Der Bischof Heinrich III. v. Wangelin tritt im J. 1419 öfter auf.
Man kann daher die Zeit der Regierung, oder doch wenigstens die der eigentlichen Wirksamkeit des Bischofs Heinrich II. von Nauen mit ziemlicher Sicherheit in die Zeit 1416 - 1418 setzen. Sollte der wirklich früher gewählt oder später gestorben sein, so kann der Unterschied sicher nur einige Tage ausmachen.
7.
Die Söhne des Herzogs Ulrich I.
von Meklenburg=Stargard.
Die drei älteren, im J. 1414 noch lebenden Söhne des Herzogs Johann I. von Meklenburg=Stargard: Johann II, Ulrich I. und Rudolph starben bald nach einander: Rudolph


|
Seite 75 |




|
gegen Ende des J. 1415 1 ), Johann in der zweiten Hälfte des J. 1416 2 ) und Ulrich am 1. April 1417. Der Herzog Johann II. hinterließ einen Sohn Johann III. und zwei Töchter Hedwig und Agnes 3 ). Der Herzog Ulrich I. hinterließ "Söhne" und eine Tochter Anna. Der Herzog nennt in seinem Testamente 4 ) vom 19. März 1417 seine Tochter Anna ("generosa domina Anna filia sua") namentlich und setzt die Herzoge von Meklenburg=Schwerin und seine Gemahlin Margarethe zu Vormündern "seiner Söhne" und seiner Töchter ("filiorum suorum et filie sue") ein. In der doberaner Genealogie 5 ) wird auch gesagt, daß Herzog Ulrich "Söhne" und Töchter (filios et filjas") gehabt habe.Auch in Staats=Urkunden aus den Jahren 1417 und 1418 werden die "Kinder", also die Söhne, des Herzogs Ulrich erwähnt. In dem Vertrage der meklenburgischen Herzoge mit den werleschen Fürsten 6 ) vom 16. Oct 1417 uber die Befreiung des Fürsten Christoph von Werle verhandeln die Herzoge Johann und Albrecht von Meklenburg=Schwerin in ihrem und "ihrer: jungen Vettern, Herzogs Johann, und Herzogs Ulrich Kinder, von Meklenburg=Stargard," Namen ("van eer iunghen vedderen weghene hertogen Johan vnde hertigen Vlrikes kynderen heren van Mekelenborch van Stargarde"). Ebenso handeln in rostocker Aussöhnung zwischen den meklenburgischen und den werleschen Fürsten vom 27. Oct. 1418: Johan vnd Albrecht (von Meklenburg=Schwerin), iunghe Johan van Stargarde vnd hertoch Vlrikes kindere, vedderen, alle ghehetten hertogen to Meklenborch", und der Rath der Stadt Schwerin sagt in der am 21. Mai 1426 vollzogenen Beglaubigung dieser Urkunde, daß sie besiegelt gewesen sei, auch "mit den ingesegelen - - van hertoge Olrikes kindere" 7 ).
Der eine (jüngere) Sohn des Herzogs Ulrich, Herzog Heinrich, erscheint in der Folge lange Zeit als regierender Herzog. Der ältere Sohn Ulrichs ist aber bisher dem Namen nach nicht bekannt gewesen.


|
Seite 76 |




|
Rudloff sagt M. G. II, S. 570: "daß Herzog
Ulrich mehrere Söhne hinterlassen habe, ist aus
seinem Testamente unwidersprechlich: wie sie
aber hießen, bekommt man nicht zu wissen,
sondern in der Folge succedirte ihm nur sein
Sohn Heinrich". Ferner sagt Rudloff a. a.
O. S. 577: "daß unter "Hertoch
Vlricke's Kindern" nur die im Testamente
nicht nahmhaft gemachten minderjährigen Söhne
verstanden werden müssen, versteht sich von
selbst; deren Namen aber bleiben auch jetzt noch
ein Geheimnis". In dem
fürstlich=meklenburgischen Stammbaum zu der
Meklenburgischen Geschichte hat Rudloff den
ältern Sohn Ulrichs unter dem muthmaßlichen
Namen Johann in die Genealogie eingeführt:
"(Johann
 .) einer oder mehrere Söhne, † †
vor 1423", und der herzoglich
meklenburgische Stammbaum zum
meklenburg=schwerinschen Staatskalender hat
denselben unter dem bestimmten Namen
"Johann † vor 1423" aufgenommen,
.) einer oder mehrere Söhne, † †
vor 1423", und der herzoglich
meklenburgische Stammbaum zum
meklenburg=schwerinschen Staatskalender hat
denselben unter dem bestimmten Namen
"Johann † vor 1423" aufgenommen,
Dem Vorgange Rudloff's folgt F. B. in seiner Geschichte des Landes Stargard II, S. 112, indem ersagt: "Der andere Sohn Ulrichs muß schon früher verstorben sein, ohne daß sein Name uns erhalten wäre. Indessen ist wahrscheinlich, daß er auch nach seinem Großvater Johann hieß".
Diese Vermuthung ist nun nicht begründet. Es läßt sich urkundlich nachweisen, daß Herzog Ulrich I. von Meklenburg=Stargard zwei Söhne hinterließ, welche Albrecht und Heinrich hießen. Am 22. Junii 1417 erhob nämlich zu Costnitz vor dem Reichshofgerichte der Fürst Balthasar von Werle Klage 1 ) auf den Landestheil, welchen
"die hochgebornen fursten vnd herren her Albrecht vnd her Heinrich, gebrudere, hertzogen zu Meckelnburg von Stargarden"
inne hatten. Diese sind ohne Zweifel die Söhne Herzogs Ulrich I.


|
Seite 77 |




|
C. Zur Geschichte des Hauses Werle.
8.
Ueber den Fürsten Barnim von Werle.
Die traurige Begebenheit des werleschen Vatermordes (1291) ist bekannt genug. Weniger bekannt ist das Schicksal der Söhne, die ihrem Vater Heinrich das Leben nahmen, und ihrer Familien. Rudloff sagt (II, S. 199) von den Vatermördern:
"Nicolaus von Werle ließ zuvörderst die Burg und Stadt Penzlin einnehmen und Heinrich II, der sich bisher noch daselbst behauptet hatte, ward nun gänzlich von Land und Leuten vertrieben. Von Gewissensbissen gefoltert, folgte er, aller Vermuthung nach, in das Vaterland seiner Gemahlin (Mechtild), H. Barnims II. zu Stettin († 1295) Tochter, und beschlos da sein Leben frühe und unvermerkt. Sein einziger Sohn Barnim wagte es nicht, die Schande, die seinen Vater bedeckte, wieder auszulöschen, sondern beweinte den Fluch seiner Familie in den einsamen Zellen des Klosters Kolbatz".
Diese Darstellung, wohl eingegeben durch die Theilnahme, welche eine solche Geschichte erweckt, scheint aber aus einzelnen Andeutungen erfunden zu sein, so wahrscheintich sie auch klingt. Der Fürst Barnim war alterdings Geistlicher, und mag auch zuerst im Kloster Colbatz gelebt haben; aber gegen das Ende seines Lebens sehen wir ihn in hohen kirchlichen Würden und in einer Thätigkeit, welche nicht gewöhnliche Krafte in Anspruch nahm. Barnim war, sicher 1330 - 1332, Propst des Dom=Capitels zu Camin und Inhaber (? "patronus") der Pfarre zu Gützkow. Sein Vorgänger war 1321 - 1322 Reimar von Wacholt. Darauf folgt "Barnim von Werle" 1330 - 1332. Bei dem Mangel an gedruckten Urkunden läßt sich die Lücke von 1322 - 1330 bis jetzt nicht füllen. In der Zeit 1330 - 1332 wird aber Barnim von Werle wenigstens fünf Male als Dompropst zu Camin aufgeführt. Nach der letzten Urkunde vom J. 1332 wird er bald gestorben sein, da 1334 - 1336 der Propst Conrad genannt wird, dem 1336 Bernhard Behr in der Regierung der Propstei folgte (sicher bis 1343).


|
Seite 78 |




|
Es leidet keinen Zweifel, daß der "Propst Barnim von Werle" der Fürst sei. Am 25. Oct. 1331 wird er von dem Bischofe Friedrich von Camin der "edle Herr von Werle" genannt:
"nobilis et honorabilis dominus Barnym de Werle, ecclesiae nostrae praepositus ac patronus ecclesiae Gutzekowensis" 1 )
und damit gar kein Zweifel obwalten könne, nennen die Herzoge Otto und Barnim und die Herzogin Elisabeth von Pommern am 13. Dec. 1330 den caminer Dompropst Barnim von Werle ihren "lieben Oheim"
"mit anseme leven ome Barnym van Werle dem pravest" 2 ).
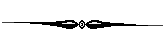


|
Seite 79 |




|



|


|
|
:
|
VII.
Des Herzogs Johann Albrecht I.
eigenhändiges Verzeichniß
der Landesschulden
im Jahre 1553.
No. 15 + 53 ahm
Verzeichnus.
| 2000 | Thaler die Magdeburger |
| 3000 | Thaler Luneburger. |
| 4000 | fl. Ma. |
| 2700 | goldtf. Steffen Loitze. |
| 17277 Thaler facit die Summa | |
| 27880 | Thaler. Nachstendiger turckenschatz, vorratt geldt, Baugeldt in Vngern, Camergerichts vnderhaltung, man wil auch fodern das hussgeldt, so andere wider die von Magdeburgk erleget, die summen alle das Camergericht botreffendt will ich achten von vnfer aller 3 wegen meines H. vattern vnd vettern H. Hinriches seligen vnd meinent wegen |
| 500000 | floren muntz |
| 3000 | Thaler, Den Hamburgern von Hertzog Hmrich seligen wegen vff dissen vmbschlag zu entrichten |
| 3000 | Thaler, Meines brudern Hertzog Jürgen seligen schulde, so ehr im niderlande vfgelehenet vnd alhie im Lande zu thun schuldigk worden, zum winzigsten. |
| 13632 | Thaler, Bastian Wadnitz hatt 170 Pf., 14 wagen, 3 Rotmeister, 3 schmide, 1 furirer. Der Ritmeister hat seinen gulden. Facit vff 5 monde vnd einen fur abzugk |


|
Seite 80 |




|
| 1000 | Thafer vff die muntz verleget, welche ausgabe der muntzmeister zu berechnen weyß. |
| 98425 | fl. Vff den heussern verpfandet vnd versetzet. |
| 40000 | fl. Schuldt so man aus der Camer verrenten mus. |
| 70000 | fl. Gemeine schuldt laut brissen vnd fygelen denen kaufleuten vnd andern. |
| 90000 | fl. kreygeskosten vnd vffgangk. |
Disser Zedel soll zu meiner ankunfft widerumb rein abgeschriben werden.
Nach der eigenhändigen Aufzeichnung des Herzogs Johann Albrecht I. im großherzoglich meklenburgischen Geheimen und Haupt=Archive zu Schwerin. Es giebt über die fürstlichen Schulden im 16. Jahrh. Zwar sehr viele Acten. Das vorstehende Actenstück ist aber sehr wichtig, da es ungefähr ein Jahr nach dem Regierungsantritte des Herzogs Johann Albrecht I. und nach Vollendung des oberländischen Krieges geschrieben ist, also den besten Anhaltspunkt zur Beurtheilung dieser wichtigen Angelegenheit giebt.
G. C. F. Lisch.
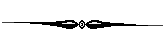


|
Seite 81 |




|



|


|
|
:
|
VIII.
Ueber
den lübecker Martensmann,
von
G. C. F. Lisch
D ie Stadt Lübeck war früher bekanntlich verpflichtet, alljährlich am "Martini Tage", am 10. November, nachmittags nach 1 Uhr, eine Tonne oder ein Ohm rheinischen Most durch einen Rathsdiener unter vielen Ceremonien an das herzoglich meklenburgische Hoflager im Schlosse zu Schwerin zu liefern, woher der Ueberbringer auch der "Martensmann" genannt ward. Die ganze Geschichte, welche viele noch jetzt lebende Leute noch erlebt haben, ist in allen sonderbaren Einzelnheiten, welche im Laufe kleinlicher Zeiten und bei mangelndem Bewußtsein des Ursprunges der Abgabe ohne Zweifel vielfach ins Kleinliche ausgebildet waren, im ganzen Lande bekannt genug, und es ist viel darüber geschrieben und gedruckt Köpken schrieb eine Abhandlung über den Martensmann ("Solennia Martinalia Sverinensia"), welche v. Westphalen in Mon. Ined., 1740, II, p. 2393 flgd. hat drucken lassen, worauf v. Westphalen selbst in Mon. ined., 1742, IV, Praef. P. 1 flgd. die Sache behandelt hat. Der Geheime Rath J. P. Schmidt hat die wichtigsten Nachrichten in Abschriften gesammelt und die Disposition zu einer Abhandlung ("Sciagraphia dissertationis historicae etc.") entworfen, handschriftlich in der Regierungs=Bibliothek. Eine ausführliche gedruckte Schrift ist: "Mark's Geschichte vom Martini=Abend und Martins=Mann, Hamburg und Güstrow, 1772". Nicht lange darauf, um das Jahr 1783, erschien eine "Ausführliche Geschichte des Lübecker Martensmannes", ohne Angabe des Verfassers, des Druckortes und Jahres. In den neuesten Zeiten hat v. Lützow Mecklenb. Geschichte II, S. 463 - 464 eine Uebersicht gegeben.


|
Seite 82 |




|
Die Sache wäre jetzt vielleicht nicht mehr der Rede werth, wenn sie nicht in den allerneuesten Zeiten wieder aufgefrischt worden wäre. In den beiden zu Schwerin erscheinenden Zeitungen (dem "Norddeutscheu Correspondenten" und der "Mecklenburgischen Zeitung") ist am 10. November 1857 die Sache wieder ins Gedächtniß gerufen und behauptet, die Abgabe am 10. November sei zu Ehren des Reformators Dr. Martin Luther geschehen, Nach einer von mir am Abend des 10. Novbr. 1857 im engern Kreise des Schweriner Künstlervereins gehaltenen heitern geschichtlichen Tischrede, in welcher ich den Irrthum dieser Annahme nachzuweisen mich bemühte, ist meine Ansicht in dem "Norddeutschen Correspondenten" vom 12. November verworfen und es ist daselbst wiederholt gesagt: "daß man nicht Veranlassung gehabt habe, bei der Erinnerung an eine in einer lutherischen Stadt celebrirte, auf den 10. Nov, fallende Volksfestlichkeit, in Betreff welcher weder urkundliche Kunde (?), noch Tradition (? ?), sondern höchstens (?) eine unbestimmte Analogie (?) auf den heiligen Martin von Tours "zurückweise, sich auf den Boden (?) der katholischen Kirche zu "stellen und deren Heiligenkalender für uns maßgebend (?) zu machen. Das alte Schwerin der lutherischen Zeit habe die Festivität des Martensmannes gewiß nicht (??) als an den Vigilien des Festes eines katholischen Heiligen gefeiert, sondern der Tag weise auf Doctor Martin Luther".
Nicht um einen nutzlosen Streit anzufangen, sondern um den Stand der Forschung festzustellen und zur Kritik der früheren Forschungen die Sache in die geschichtlichen Rechtsalterthümer einzuführen, wähle ich die Jahrbücher des Vereins für meklenburgische Geschichte, um hier meine bis jetzt unbekannten Forschungen niederzulegen.
Es giebt ietzt im Kalender drei Martins=Tage, welche im Monate November unmittelbar auf einander folgen: der 10. November der Geburtstag des Dr. Martin Luther, der 11. November der Tag des Heil. Martin des Bischofs, der 12. Novbr. der Tag des Heil. Martin des Papstes. Von diesen drei Tagen ist der Tag des Heil. Martin des Bischofs (seit dem 4. Jahrhundert), am 11. Novbr., des Wohlthäters der Armen, der älteste und wichtigste und erlangte im Geschäftsleben schon früh weit und breit eine große Berühmtheit. S. Martins Symbol war die Gans; daneben war er Patron der Trinker. Da nun sein Tag in die Zeit fiel, wo schon hinreichend Korn gedroschen war, und die Gänse fett wurden, so ward der Tag "Martini" schon früh der Tag der Ablieferung von Naturalabgaben, namentlich an


|
Seite 83 |




|
die Geistlichkeit: es wurden die fetten Gänfe und die ausgewachsenen Hühner, die Kornabgaben u. s. w. geliefert und der Tag Martini überhaupt ein landesüblicher Lieferungs= und Zahlungstermin. Zahllose mittelalterliche Urkunden beweisen, daß der Tag Martini ein weit verbreiteter Zahlungstermin oder "Umschlag" war. Noch heute ist an vielen Orten Martini der Tag für die Leistung von Abgaben oder für die Werthbestimmuug derselben und überhaupt noch ein Termin für bestimmte Geschäfte. Da nun so viele günstige Umstände zusammentrafen, so konnte es nicht fehlen, daß seit alter Zeit der Tag Martini 1 ) und der Abend vorher durch Trinkgelage und Schmausereien, wobei die fette "Martinsgans" eine Hauptrolle spielte, gefeiert ward.
Es ist aus allen diesen Gründen, deren Darlegung hier unnöthig ist, unmöglich, anzunehmen, daß der Geburtstag des Dr. Martin Luther die Veranlassung zu diesen uralten Gebräuchen geworden sei; die protestantische Kirche und das protestantische Volk würden sich auch entschieden geweigert haben, das Fest ihres Reformators auf diese Weise zu begehen. Und doch, wird man sagen, muß es auffallend sein, daß die Stadt Lübeck am 10. Nov., also am Tage Martin Luthers, den rheinischen Most in Schwerin zu liefern verpflichtet war.
Znr Lüftung des Schleiers, welcher über dieser Sache ruhet, wird es nothwendig sein, zuvor unsere bewährtesten Geschichtsforscher zu befragen. Die gesammelten Acten des schweriner Archivs über den Martensmann gehen nur bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück und enthalten über den Ursprung der lübecker Abgabe nichts. Der Geheime Rath J. P. Schmidt, ein bewährter Forscher, welcher die Archiv=Acten studirt hat, sagt: "Die ältesten Nachrichten von dieser Feyerlichkeit gehen nur bis in das Jahr 1567"; Rudloff kommt in seiner Meklenb. Geschichte III, 1, S. 343, nur bis zum J. 1550 zurück (vgl. III, 2, S. 240); v. Lützow sagt in seiner Meklenb. Geschichte II, S. 464, daß es "darüber keine historische Gewißheit giebt - - und Grund und Entstehungszeit schon im 16. Jahrhundert nicht bekannt waren". Es hilft also nicht, die bisherigen Angaben und Vermuthungen kritisch zu prüfen.


|
Seite 84 |




|
Es ist die Frage, ob es keine ältere Nachrichten giebt, als die bisher bekannten. Und hier kann ich eine sichere Nachricht mittheilen, welche wenigstens den Tag der Lieferung in das richtige Licht stellt und den Dr. Martin Luther aus dem Spiele bringt.
Bei der Landestheilung zwischen den Herzogen Heinriich und Albrecht im Jahre 1520 wird in dem Auseinandersetzungsverzeichnisse gesagt:
Landestheilungsprotocoll vom Jahre 1520.
"Item so ist noch bis Nachgeschrieben vber vorgeschriebenne Summa von einem kuchemeister zu Swerin jerlich auszugebenn, auch jdern fursten die helfte zu entrichten vnnd die vorerung geteylt zu entphangenn zugeschlagen:
I marck vnnd ein wilt Swein oder feisten wiltpredes dene, die den wein von Lubeck brenngenn vff Sant Martens Abent ."
In dem diesem Landestheilungs=Register angehängten alten Landbuche des Amtes Schwerin heißt es:
"Stadt Lubbeke gifft alle jar
I T. Rinischen must vpp Martini, dar sich de fursten woll werden vmme vordragen".
Dieses Landbuch ist ohne Zweifel das von Rudloff M. G. I, 1, S. 343, Note 4 erwähnte "Schwerinsche Amts=Buch von 1550", welches in verschiedenen jüngeren Abschriften, z. B. von 1550, 1560 u.s.w., vorkommt, in den Archiv=Acten und bei der Landestheilung von 1520 aber unter der Bezeichnung des "alten Landbuches" erwähnt wird und jedenfalls älter ist, als 1520, vielmehr nach manchen Andeutungen aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts stammt.
Aus dieser Nachricht geht unzweifelhaft hervor, daß bei dem Lieferungstermine nur an den Tag des Heiligen Martin des Bischofs gedacht werden kann, um so mehr, da ausdrücklich "Sant Marten" genannt ist. Es kann keinem Menschen einfallen, daß dabei an den jungen Martin Luther gedacht werden könne, da Luther im Jahre 1520 noch keine bedeutende Autorität, viel weniger "heilig" gesprochen war. In frühern Zeiten ist es auch immer angenommen, daß der Martens=Mann von dem Heil. Martin dem Bischofe seinen Namen habe, und nicht von Martin Luther, z. B. Mark a. a. O. S. 5 nimmt im J. 1772 den Dr. Martin Luther sehr bestimmt gegen alle diejenigen in Schutz, welche von seinem Namen die Benennung Martensmann herleiten wollen, was allerdings in den letzten Jahrhunderten oft geschehen ist.


|
Seite 85 |




|
Zugleich geht aber auch aus der alten Nachricht von 1520 klar hervor, warum die Weinlieferung am 10. Novbr., und nicht am Tage des H. Martin 11. Novbr. geschehen mußte. Es wird ausdrücklich gesagt, daß der Wein
"vff Sant Martens Abent"
geliefert werden müsse. Dies ist auch zu allen Zeiten immer festgehalten. So z. B. sprechen Burgemeister und Rath der Stadt Lubeck im J. 1592 von
"einer Ohme Reinischen Mostes, die sie jarlichen auf das Hauß Schwerin den Abendt Martini solten zu schickenn schuldig und pflichtig sein",
und das Landestheilungs=Inventarium vom J. 1610 berichtet:
"Alhie wirtt auch pillig erwehnett, daß einen Hochweisen Rahtt vonn Lübeck iherlich auf Martini=Abendt zwischen zwolff vnnd Einn Uhr nach Mittage altem herkommen nach durch dero Diener vnnd Rotrock Eine Ohme Neuwen Weinmost aufs furstliche Hauß Schwerin liefern laßenn",
und so weiter unzählige Male.
Der "Abend" ist aber zur katholischen Zeit immer der Abend vor einem Tage, die vigilia, der Abend des kirchlichen und gerichtlichen Tages, welcher von 12 Uhr Mittags ging wie noch heute der Sonna6end (d. i. Sonntagsabend): der Abend vor dem Sonntage, der heilige Abend: der Abend vor dem Weihnachtstage ist, u.s.w.; keinesweges aber darf man je den Abend des Sonnentages darunter verstehen. Daher war der Abend Martini: der Nachmittag des 10. Novembers. Aus diesem Grunde erklärt es sich auch, daß der Lübecker Martensmann den Most nicht vor 12 Uhr Mittags des 10. Novbr., sondern am Nachmittage des 10. Novbr., wie es in alten Acten heißt zwischen 1 und 3 Uhr, am Abend Martini, abliefern mußte. Es wurden auch sehr viele Lieferungen schon am Abend Martini, d. h. vor S. Martinstag, geleistet, und die Festfreude ward vorzüglich am Abend vor dem Tage gefeiert, wie denn überhaupt der Abend vor dem Feste oder die Vigilie mehrzu weltlichen Festlichkeiten benutzt ward und wird, als der Festtag selbst, der um 12 Uhr Mittags aufhört, wie denn z. B. auch die Juden ihren Sabbath=Abend am Freitag=Abend feiern.
Es ist also ein reiner Zufall, daß der Geburtstag Dr. Martin Luthers auf den 10. November und mit der Vigilie des Tages des Heiligen Martin zusammenfiel. Der Martensmann aber hat mit dem Dr. Martin Luther nichts zu schaffen.


|
Seite 86 |




|
Was aber die Mostlieferung zu bedeuten habe, darüber findet sich seine bestimmte Nachricht; es wird in frühen Zeiten nur wiederholt gesagt, daß die Lieferung ein "alter" Gebrauch sei, und es ist gewiß, daß die "Entstehungszeit schon im 16. Jahrhundert nicht mehr bekannt" war. Ich glaube mit Andern, daß die Lieferung ein Zeichen der Anerkennung, eine Recognition für irgend eine Oberherrlichkeit war. Dergleichen Recognitionen waren sehr häufig und gewöhnlich, als symbolische Zeichen nur von geringem Werthe und sehr häufig nicht durch Urkunden verbürgt. Auch v. Lützow M. G. II, S. 464, ist dieser Ansicht und führt mehrere Leistungen dieser Art auf; z. B. der Erzbischof von Cölln mußte seit dem J. 1223 den Grafen von Schwerin und Danneberg jährlich 15 Fässer Wein am Martini=Tage für geleistete Dienste liefern; das Kloster Reinfelden hatte den Herzogen von Meklenburg jährlich zu "Fastelabend" zwei fette Ochsen "nach alter gewohnter Weise" in die Hofküche zu liefern u.s.w. Diese Leistungen sind durch Urkunden verbürgt.
Ich füge noch folgende merkwürdige Leistungen hinzu, welche größtentheils nur aus gelegentlichen Aeußerungen zu erkennen sind.
Das Kloster Dargun hatte die pommerschen Burgen Demmin und Cummerow mit Fischen, Brot, Käse und Schuhen zu recognosciren, nach einem Zeugenverhör aus dem 16. Jahrhundert:
"Wahr das daher angeregtes Kloster Dargun vor alters vber 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80, iha hundert und mehr Jhar nicht allein das hauß vor Demmin, sondern auch daß hauß Cummerow, welche beide fürstliche Pommersche heuser gewesen, mit Rotschar, Weigelbrot, Khese, Schuhen recognosciren mussen vnd noch auf diesen heutigen tagck recognosciret".
Das Kloster Doberan mußte als Recognition für den in der Stadt Rostock gelegenen Doberaner Hof
"dem ganzen Rathe der Stadt Rostock jährlich einen feisten Bären verehren"
(vgl. Neue Rostocker Wöchentl. Nachr. 1840, Nr. 47, S. 227, aus den Rathsverhandlungen von 1558 - 1599). Unter einem "Bären" ist wohl ein Eber zu verstehen, da der Ausdruck "Behre" für Eber früher, auch in der Schriftsprache, in Meklenburg ganz allgemein war und noch heute in der Volkssprache gilt.


|
Seite 87 |




|
Das Dom=Capitel zu Ratzeburg hatte den Grafen von Schwerin
"jährlich 16 Ellen Tuch und ein Paar Socken" für die Beschirmung des Landes Wittenburg zu liefern, welche Lieferung schon im J. 1398 den Herzogen von Meklenburg für 100 Mark abgelöset ward (nach einer Urkunde).
Die Stadt Wismar mußte den Herzogen von Meklenburg jährlich am ersten Adent=Abend (oder: um "Martini") eine Tonne Schonischen Hering und den Schloßbeamten hölzerne Becher und ein Weißbrot darbringen; die Ueberbringung von hölzernen Bechern und Weißbrot an die Schloßbeamten geschah auch am Donnerstag vor Fastnacht. Das alte schweriner Landbuch aus dem Anfange des 16. Jahrh. sagt:
(Stadt) "Wißmar" (gifft alle jar): "I T. Schonschen Hering gegen den aduent, krigen de fursten famptlich"
und das Landestheilungsregister von 1520 führt als Ausgabe auf:
"VIII ß, den Hausdienern von der Wysmar, die eine Tune Schonischen Hering brengen".
Ferner sagt das alte Landbuch:
"Item de Wißmarschen geuen ock gegen Martini etzliche witte beker vnd krudebrodt" 1 )
und das Landestheilungsregister von 1520:
"II mark den reytenden dienern von der Wysmar, die das Weissebroth vnd holtzenbecher 2 ) brengen".
Im Landestheilungs=Inventarium vom J. 1610 heißt es:
"Die Wißmarischen.
Von dem Rathe zur Wißmer wirtt jerlich vffen "Aduent=Abent dem f. Hause Schwerin eine Thonne heringk vnd den f. beampten, als dem
 ., also - Kuchen. Das
plattdeutsche Wort Krüde, wohl gleich
mit Kraut, Kräutern, bezeichnet jetzt
vorzüglich einen Fruchtbrei oder
Obstbrei. In früheren Zeiten, als man
noch mehr einheimische, als ausländische
Kräuter gebrauchte, bezeichnete man mit
dem Worte Kraut: die Gewürze oder
Specereien. Daher heißt heute wohl noch
ein "Materialienhändler" -
"Krutkramer" und ein
Gewürzladen hieß: "Krutkram".
Vielleicht kommt daher das Adjectiv
krüdsch, das von einem Menschen
gebraucht wird, der nicht gewöhnliche
Speisen mag, sondern in den Speisen
wählerisch ist.
., also - Kuchen. Das
plattdeutsche Wort Krüde, wohl gleich
mit Kraut, Kräutern, bezeichnet jetzt
vorzüglich einen Fruchtbrei oder
Obstbrei. In früheren Zeiten, als man
noch mehr einheimische, als ausländische
Kräuter gebrauchte, bezeichnete man mit
dem Worte Kraut: die Gewürze oder
Specereien. Daher heißt heute wohl noch
ein "Materialienhändler" -
"Krutkramer" und ein
Gewürzladen hieß: "Krutkram".
Vielleicht kommt daher das Adjectiv
krüdsch, das von einem Menschen
gebraucht wird, der nicht gewöhnliche
Speisen mag, sondern in den Speisen
wählerisch ist.


|
Seite 88 |




|
"heubtman 2 Krudebroth vnd 2 holzerne Becher, dem kuchmeister, dem Schreiber, dem Haußvogtt, dem Schlueter vnd dem Koch auch 2 Krudebroth vnd 2 holtzerne becher gebracht"
und:
"Vff Fastnacht wirtt nur schlichter dinge von den Wißemarischen deme heubtman, dem Kuchmeister, dem schreiber, dem haußvogte vnd dem Koche das Krudebroth vnd die holtzerne becher dargebracht".
Diese Lieferung hörte mit dem Uebergange der Stadt Wismar an die Krone Schwedens 1648 auf. In dem Amtsbuche des Amtes Schwerin vom J. 1654 heißt es:
"Die Stadt Wißmar hat vor diesem den ersten Advent jehrlich eine Thonne Schonischen heringk vnd den Ambtleuten Krudebrodt vnd etliche weiße holtzerne becher mit hubelspohnen gefüllet gegeben;
diese Stadt hat auch den Donnerstag vor Fastnacht den Ambtleuten Krudebrodt vnd weiße holtzerne Becher mit hubelspohnen gebracht;
welches alles aber auff Advent 1649 vnd Faßnacht ao. 1650 die Stadt Wißmar daher, daß sie unter der Schwedischen gewalt kommen, letztmahls vnd nicht weiters gegeben hat".
In Schröders Geschichte der Stadt und Herrschaft Wismar, 1743, S. 137, erscheint diese Sache schon als dunkle Sage.
Aus diesen Beispielen wird sich schließen lassen, daß solche kleine Leistungen nur Recognitionen zur Anerkennung von Hoheits= oder Schirmrechten waren.
Wofür nun Lübeck den Rheinmost geliefert habe, ist wohl eben so wenig zu ermitteln, als sich der Ursprung der meisten Abgaben dieser Art ergründen läßt; sie verlieren sich gewöhnlich in eine so ferne Zeit, daß Urkunden darüber selten erhalten oder ausgestellt sind. Es sind sehr viele Erklärungen der lübecker Verpflichtung ersonnen; es läßt sich aber keine einzige erweisen, und manche von den Erklärungen sind auch zuverlässig falsch, da der Ursprung oft in zu jungen Zeiten gesucht wird. Die meisten Erklärungen gehen dahin, daß die Mostlieferung mit der Beschirmung der Stadt Lübeck durch die Herzoge von Meklenburg zusammenhange. Lübeck ward in den letzten wendischen Zeiten bis zur Erhebung zu einer Reichsstadt zu Meklenburg gerechnet und die Stadt stand späterhin bis auf die neuesten Zeiten immer in dem innigsten Verkehr mit Meklenburg, so daß sich endlich eine Schirmherr


|
Seite 89 |




|
schaft der meklenburgischen Fürsten daraus entwickelte. Die ältesten und älteren Urkunden der Stadt Lübeck liegen jetzt gedruckt vor und man kann wenigstens bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts den Gang einigermaßen verfolgen. Nachdem im 13. Jahrh. öfter über die Schirmvogtei verhandelt war, übernahm am 29. Sept. 1291 der Fürst Heinrich II. von Meklenburg die Beschirmung der Stadt (vgl. Lübeker Urk. Buch I, Nr. 583). Darauf erscheint aber der Graf Gerhard II. von Holstein am 1. Jul. 1304 als Schirmherr der Stadt (vgl. II, Nr. 176). Im Jahre 1306 hatten die Herzoge Erich I. und Albrecht II. von Sachsen=Lauenburg die Schirmvogtei auf 5 Jahre übernommen (vgl. II, Nr. 259, und Nr. 228, 258 und 259). Darauf erscheint der König Erich Menved von Dänemark als Schirmherr (vgl. Nr. 250, 325, 328, 330, 331, 334, 337, 341, 347 und 360). Vom Jahre 1321 erscheinen die Fürsten von Meklenburg wieder als Schirmherren; am 9. Junii 1321 quittirt der Fürst Erich von Meklenburg zuerst wieder über das Schirmgeld von 300 Mart halbjahrlich (vgl. Nr. 417) und erscheint in den nächsten Jahren als Schirmherr (vgl. Nr. 424, 430 und 434). Am 28. Junii 1336 übernahm der junge Fürst Albrecht von Meklenburg die Schirmvogtei auf 2 Jahre für 750 Mark jährlich (vgl. Nr. 633). Der junge Fürst war so eben volljährig geworden und mit seiner jungen Gemahlin auf der Seefahrt nach Schweden zu der Krönung seines Schwagers 1 ) begriffen. Am 23. Junii 1336 erscheint er vor der Reise zuletzt im Hafen von Warnemünde. Die Uebernahme der lübecker Schirmvogtei durch den Jüngling ist um so wichtiger, als er diese am 28. Junii 1336 übernahm und am 29. Junii zu Lübeck über das Schirmgeld quittirte (vgl. II, Nr. 634); er scheint also vorher noch in Lübeck gewesen zu sein. Am 17. Junii und 30. Nov. 1337 quittirte er über das Schirmgeld (vgl., Nr. 651 und 663). Am 11. Aug. 1342 übernahmen die Fürsten Albrecht und Johann von Meklenburg wiederum die Schirmvogtei Lübecks auf 3 Jahre für 200 Mk. reinen Silbers jährlich und quittirten am 5. Jan. 1344 und 27. Februar 1345 über das Schirmgeld (vgl. Nr. 788 und 824). Da die Urkunden noch nicht weiter gedruckt sind, so läßt sich der Fortgang noch nicht weiter verfolgen. Die Stadt Lübeck blieb aber, wie es scheint, von jetzt an ununterbrochen unter der Beschirmung der Herzoge von Meklenburg, bis die


|
Seite 90 |




|
Zahlung des Schirmgeldes im J. 1528 aufhörte (vgl. Rudloff I, 1, S., 55 und 342).
Es läßt sich zwar durch nichts beweisen, aber es ist nicht unwahrscheinlich, daß der lübecker Martensmann mit der Schirmvogtei zusammenhing.
Ungefähr so ist auch die Ansicht des Geheimen Raths J. P. Schmidt, welcher meint, daß die Weinlieferung zwar einer Lehns=Recognition gleiche, aber wahrscheinlich ein Aequivalent für die Reichssteller sei, welche die Kaiser oft anderen Fürsten cedirten. ("Ego crederem, quod haec praestatio sit stura civitatis Lubeck, Imperatori olim debita", - Sed Imperatores ejusmodi praestationes saepius ad alios transtulerunt"). Diese Cedirung der Reichssteuer hat nach den vorliegenden gedruckten Urkunden zwar allerdings ihre Richtigkeit: man vgl. Lübecker Urkunden=Buch I, Nr. 432 und 433, und vgl. Nr. 439. Ich möchte aber der Ansicht sein, daß die Reichssteuer nicht gegen eine so geringfügige Recognition aufgehoben ward.
Die Sendung des Martensmanns ward im Jahre 1817 aufgehoben. Am 6./11. Februar 1817 schlossen der Großherzog Friedrich Franz und die Stadt Lübeck einen Vertrag, nach welchem der Großherzog auf die jährlich am "Martini=Tage" zu leistende Weinlieferung verzichtete, die Stadt Lübeck dagegen die von der schwedischen Regierung ihr überlassenen Rechte an dem "Postritt" (seit 1724) und an der "Postfahrt" (seit 1683) von Lübeck nach Wismar aufgab.
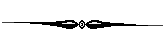


|
Seite 91 |




|



|


|
|
:
|
IX.
Tagebuch
über
den Reichstag zu Regensburg 1532,
mitgetheilt
von
G. C. F. Lisch
Nigedtidinge ßo to Regensborch vorgelopen
I tem am 15 in Julio fynth hyr dorch getagen III fenlin knechte, quemen vthe dem lande tho Wirtenberch.
Item diffuluygen dages voren ock II fenlin knechte de Dunow dael vor der stadt auer.
Item noch III fenlin knechte vthe dem badenße togen dar dorch.
Item Ke. Mtt. hefft XX M Spanniolin vnde Italianer tho vote vnde II M to perde, diefuluigen lude dorch des artzebiscuppes von Saltzborch, biscup van Passow, hertogen van Beygerenn lande passirnn zu lathenn, hefft Ke. Mtt. an difuluigen heyn gheschreuen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 20 in Julio frech ick egentliche kuntschaft, dat Ke. vnde Koninglike Mtt. by eyn ander worden, hebbenn III mael hundert dußent, XXIIII dußent mhan.
Item am 22 in Julio is die Romische koniug myth der koninginnen vnde ehren Junckfruwen to dem kaißer in dath bath gereden, vm affchet vnde vorloff tho nemende. Alße sie widerumme van dar togenn, is Ke. Mtt. myth ohn to Regensborch geredenn vnde de koninginne vor dat pallaß gebrachtvnde widerumme nha dem bade geredenn.


|
Seite 92 |




|
Item am 26. Julii synth an Keye. vnde Koniglichlike Mtt. Wissze tidinge ghekamen, wo des Turcken beyde auerste houetlude alße Inbrahim Bassa vnde Machumet Bech myth IIł M schepe tho Ouen ingekamen vnde dat floeth van dem houethman myth ohrer gwarden ingenamen.
Item deffuluigen dages is Ke. Mtt. die Dunow dael tho Regensborch ingekamen.
Don suluest quemen hyr tydinge, wo des feyßers vnde koninges sold in Hungeren denn Turckenn bauen IIII M mhan affgeslagen vnde ohn den Turckenn vele dußend houedt quekes grodt vnde fleyn genamen.
Item die Turcke ligt vp gunne fyth Quen.
Item am 27 in Julio hefft Marckgraue Jurgenn van Norenberg syne knechte hyr durch geschycketh. Dessuluigen bages synth hyr vele knechte by I, II C , LXX, LXXX dorch gegan, wo fast alle dage schuth.
Item vppe den auenth tho IIII slegenn hefft Ke.
Mtt. alle Stende vppe dath Rathus (welches ganß
tapper myth gulden stuckenn vnde andern schonen
tapeten vth staffirct, eyn vor den keißer, eyn
vor den koning,) boschedenn. Vm feygers V synth
vor dem kaißer vnde Romischen koninge her
getagenn alle spanniotischen hern ganz prengisch
vnde staetlich, dar nha die beyden Sceptern oder
sulen, her Hans van Planitze, des Churfursten
gheschickede van Sasszenn forde dat swert, alle
tho perde. Alße ohre Mtt. vppe dath Radthus
quemen, gyngen sie strax sittenn, wo ock
Churfursten vnde fursten Rethe eyn jeder in
syner Session. Dar nha hefft Doctor Mathias eyne
kleine Rede gedann, alße dath Ke. Mtt.
Churfursten, fursten vnde derselbigen gesantten
gnedige dancksagunge gedan, dath sich
dieselbigen sich alße ghehorsamelich ertoget
vnde vff dem Ridsdach erschenen vnde neuenst
ohre Mtt. flitigestes Inßenth ghehath, das alle
dynck to eynem guden beflute gekamen vnde
vullentagen. Dewyle nhu derselbige affschit
gefertiget vnde versegelt, waren ohre Mtt.
denselbigen offintlich leßen tho latende bedacht
 . Dar nha ns van einem virkanten
betapeten disck, dar by Doctor Casparus
Wischausen, Mensische Cantzeler, Doctor
Valentinus Tetline (?) vnde Doctor Laurens
gesetenn, Doctor Wishausen vp gestanden vnde
eyne Copie ader affcryfft in fyuen henden gehath
vnde Doctor Laurens dath original vorsegelt vnde
den asschith offentlich daruth geleßen, welker
wol yn de drudde stunde ghewaret. Alße nhu
desuluige asschidt geleßenn, hefft ouermals
Doctor Mathias vth beuel Ke. Mtt. III puncte den
stenden offentlich vorgedragen. Erstlich wo sich
todragende worde, dath ohre Mtt. nha dem Tur=
. Dar nha ns van einem virkanten
betapeten disck, dar by Doctor Casparus
Wischausen, Mensische Cantzeler, Doctor
Valentinus Tetline (?) vnde Doctor Laurens
gesetenn, Doctor Wishausen vp gestanden vnde
eyne Copie ader affcryfft in fyuen henden gehath
vnde Doctor Laurens dath original vorsegelt vnde
den asschith offentlich daruth geleßen, welker
wol yn de drudde stunde ghewaret. Alße nhu
desuluige asschidt geleßenn, hefft ouermals
Doctor Mathias vth beuel Ke. Mtt. III puncte den
stenden offentlich vorgedragen. Erstlich wo sich
todragende worde, dath ohre Mtt. nha dem Tur=


|
Seite 93 |




|
ckentoge widerumme in Hispanien fick geuende
worbe, dath alße denne Churfursten, fursten vnde
gemeyne Stende dem erwelten gekronten Romischen
koninge ohrem fken. leuen broder alße
Stadthalter gehorßam leisten
 . Tom andern wolden ohre Mtt. sich
vorßen, dat Churfursten, fursten vnde Stenbe ben
affschit alßo wo beslaten, vorsegelt vnde
bewilliget vastichlich holden worden vnde in
alten bewilligten fick ghehorsamlich ertogenn
vnde by ohren hern Churfursten vnbe fursten
verschaffen, dat de Turckenhulffe vppe dath
iligiste synen vortganck muge ghewynnen. Tom
brudden diewhle ber prosandtmeister halnen noch
nichtes egentlichsks beslaten vnbe dasselbige
ohre Mtt. togestellet, ßo hadde ohre Mtt. myth
dem biscup van Passow ghehandelt, ock handeln
lasszenn, in touorsicht, datsuluyge tho
beholdende, wo auerst nycht, dath alße denne
Churfursten, fursten vnde Stende dar tho neuenst
syne Mtt. muchten gedencken, datsuluige ohren
Churfursten vnde fursten antogen vnde widerumme
Ke. Mtt. eyn scrifftlich anthwerth tostellen,
damyt sich Churfursten, furften bodescup
vnterredet vnde nach vnderredinghe dorch den
Mensischen Cantzeler Caspar Wißhaußen anthwerth
geuen lathcn vnde die article in scryfft
tostellende gebedenn, alße denne wolden
Churfursten, fursten bodescup desuluigen ohren
Chur= vnde fken. gnaden tostellen. Dar nha synth
ohre Mtt. beide wedder vp gestanden vnde nha dem
pallassz geredenn, [ouerst de artickel synt
nycht in scyfft gestellet worden]
1
).Item des
anderen dages alße Sondages am 28 in Julio hefft
Ke. Mtt. eyn statlike processie im dome
thorichten lathenn myth allen geystlichen, ßo in
der Stabs tho Regenßborch, vnde dath koer myt
schonen gulden stucken vnde andern tapeten
behengen taten, ock dath lectrum. Vm sygers VIII
is Ke. Mtt. myth synem broder dem Romischen
koninge vnde bem jungen prynß tho Dennemarken
vthe dem pallaß gereden in statlyler ordeninge,
alle spanniolische heren vor her, dar nha die
beyden Columnen odder sceptra (ouerst dat swerth
worth nycht gheuoret, indeme her Hans van
Planitze euangelisch vnde de her van Papenheym
nycht tor stede, sunder myt krankheyt beladen);
dar nha toch de junge prynß van Dennemarcken,
dar nha keyßer vnbe koning, dar nha warth
Campegius gedragen, dar nha orator pontificis
Pimpinellus myt dem archiepiscopo Barensi vth
Hispanien, dar nha episcopus Cameracensis myt
vilen andern spanniolischen Biscuppen vnde
Magnaten. Alße nhu
. Tom andern wolden ohre Mtt. sich
vorßen, dat Churfursten, fursten vnde Stenbe ben
affschit alßo wo beslaten, vorsegelt vnde
bewilliget vastichlich holden worden vnde in
alten bewilligten fick ghehorsamlich ertogenn
vnde by ohren hern Churfursten vnbe fursten
verschaffen, dat de Turckenhulffe vppe dath
iligiste synen vortganck muge ghewynnen. Tom
brudden diewhle ber prosandtmeister halnen noch
nichtes egentlichsks beslaten vnbe dasselbige
ohre Mtt. togestellet, ßo hadde ohre Mtt. myth
dem biscup van Passow ghehandelt, ock handeln
lasszenn, in touorsicht, datsuluyge tho
beholdende, wo auerst nycht, dath alße denne
Churfursten, fursten vnde Stende dar tho neuenst
syne Mtt. muchten gedencken, datsuluige ohren
Churfursten vnde fursten antogen vnde widerumme
Ke. Mtt. eyn scrifftlich anthwerth tostellen,
damyt sich Churfursten, furften bodescup
vnterredet vnde nach vnderredinghe dorch den
Mensischen Cantzeler Caspar Wißhaußen anthwerth
geuen lathcn vnde die article in scryfft
tostellende gebedenn, alße denne wolden
Churfursten, fursten bodescup desuluigen ohren
Chur= vnde fken. gnaden tostellen. Dar nha synth
ohre Mtt. beide wedder vp gestanden vnde nha dem
pallassz geredenn, [ouerst de artickel synt
nycht in scyfft gestellet worden]
1
).Item des
anderen dages alße Sondages am 28 in Julio hefft
Ke. Mtt. eyn statlike processie im dome
thorichten lathenn myth allen geystlichen, ßo in
der Stabs tho Regenßborch, vnde dath koer myt
schonen gulden stucken vnde andern tapeten
behengen taten, ock dath lectrum. Vm sygers VIII
is Ke. Mtt. myth synem broder dem Romischen
koninge vnde bem jungen prynß tho Dennemarken
vthe dem pallaß gereden in statlyler ordeninge,
alle spanniolische heren vor her, dar nha die
beyden Columnen odder sceptra (ouerst dat swerth
worth nycht gheuoret, indeme her Hans van
Planitze euangelisch vnde de her van Papenheym
nycht tor stede, sunder myt krankheyt beladen);
dar nha toch de junge prynß van Dennemarcken,
dar nha keyßer vnbe koning, dar nha warth
Campegius gedragen, dar nha orator pontificis
Pimpinellus myt dem archiepiscopo Barensi vth
Hispanien, dar nha episcopus Cameracensis myt
vilen andern spanniolischen Biscuppen vnde
Magnaten. Alße nhu


|
Seite 94 |




|
ohre Mtt. in den Dom quemen, gyngen ohre Mtt. vorth vppe dat lectrum. In dem stich vppe dem predickstoel eyn swart monnick prediker ordens, eyn vast wol gheschickede mhan, sede erstlich dat Euangelium myt eyner korten vtlegginge, dar nha worumme Ke. Mtt. dat hilike ampt vnde processie angestellet, alße dewyle vnßer alle Erbsigendt stark myt aller macht vp, Hungern vnde gantz dusche nation auertotende vnde dat Cristen bloeth to uordelgende, were syn Mtt. sampt Romische Ke. Mtt. synem broder, Churfursten, furften vnde gantze Rathe demselbigen Erbsigendt widertostreuende bedacht, welkes ohre Mtt. nycht vth ohrer macht ader ghewaldt to donde moglich hedden, verhaluen ßodane ampte vnde processie angestellet, den almechtigen vm fyne gnade to gunde antoropende, daryn fick eyn jeder Schulde beflitigen. Na dem ßermone synth alle ampte bynnen Regensborch myth ohren bomen, lichten, sanen vorher vth der kerken gegan; dar nha folgeden die Augustiner, dar nha die Minores, praedicatores, Benedictiner, dar nha de heren van sunte Emernn, dar nha volgeden Scholer vnde alle prester vnde domherenn, dar nha des keysers senger, dar nha alle spanniolischen, hungerschen, bemischen heren, eyn jeder myth eyner torße, dar na Elemosinarii, Lefiten und Episcopi, Archiepiscopi, dar nha de beyden Columnen ader sceptra. Vppe der fiden der processien gyngen alle k. vnde ko. Mtt. Drabanten. De borgermeister vnde Radspersonen drogen die pawlun ader den himel; dar by her gyngen borgermeisters, radtlude, myt sundergen stocken versuluert. Cristophorus Welßer, domprawest tho Regensborch, droch dat Sacramenth; dar by gyngen duck de Alua, eyn spanniol, vnde prynß van salern vth Neapolis. Dar nha volgeden Ke. vnde Konyncklyk Mtt. blotes houedes myt witten tortzen. Dar nha gynck de junge prynß van Dennemarken, ock myth einer witten tortzen. Dar na de anderen groten huße vnde gesanten. Bthe dem Dome wente to sunte Emeran, ns eyne schone abdie, darynne vele reliquien, dar hildt mhen die statie wol eyne halue stunde. De gantze statie auer seten ohre Mtt. myth volden henden vor dem sacramenth. Alße de statie vthe waß, gyngen ße in den dom, dar warth die homisse angehauen, dar musten alle religioßen vnde werlick prestere celebriren (?) vnde bliuen, ßo lange die misse vth waß, wente tho eyns nha der Maltidt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item des mandages leth Ke. Mtt. einen ouerlenber dat houet affslan, de grep den prester an vppe der gaffsen,


|
Seite 95 |




|
alße he gynck myth dem sacramente to den franken, vnde sede:
Wo dreghet du dinen godt ßo laster(lich)? De spanniolen, ßo dem sacramente nauolgeden, flogen ehm erstlich wol by dem prester.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am lesten Julii ys de graue van Villa franka van hyr gereden vnde ys geworden viceroy in Neapolis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am ersten Augusti quemen tydinge hyr, wo tho wine vnde in Hungern in etlyken ordenn vele scholen fencklich sitten, die de Turcke vthgeschycketh, vm tho bernende steder vnde dorpore antostickende, wo in etlyken orden gheschen ys vnde gedan hebben.
Item quemen ock tidinge, wo des Churfursten von brandenborch houethman, ßo syn Chruf. g. auer syne voetknechte ahnnhem tho Regensborch, Fabian Hyrth genomet, myt synem lutelant sulff VIIII schole gegrepen syn, wente wolde den Turcken togetagen syn, vnde seggen hyr, dath men densuluigen hyr bryngende werth vnde syn recht don.
Item dessuluigen dages sede my doctor Mathias vicecancellarius, wo die lutterschenn stede Kr. Mtt. merklyk hulpe, stur vnde trost don myt busßen, krude, prophande, ruthere, knechte, gelde.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item dessuluigen dages (am drudden augusti) ys Ke. Mtt. wedderumme vthe dem bade to Regensborch ingetagen, in meninge, dar ßo lange tho bliuende, wente dath ohre Mtt. vp synde werde in Hungeren.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 6. Augusti morgens vm seygers VII is to Regensborch ingereden Marckgraue Fridrich van Norenberg myt LXX perde vnde XII drabanten, des anderen dages vorth na wine tho.
Item dessuluigen morgens vm seygers IX byn ick myth groten henßen (?) in eyn hemelich orth gheweßen vnde hebbe gheßen des kaißers banner im talle V myt XII klenen senlin, daryn dubbelde adeler [zuverlick adeler ßo breth alße eyne verkante schyuen] 1 ).


|
Seite 96 |




|
3Iem de houetbanner hefft in syck eynen groten adeler ganß swarth, nen schylt in der borst, ys likuth ßo hoch, alße ick lanck byn, vp beyden syden. Dar negest ist eyn bilde alße sunte Jurgen, hefft dat swert bauen syn houeth vnde den draken vnder dem perde; de drake hefft dorch syn lyff dat Burgundisch Cruce; dar nha die beyden columnen myt des keißers rym plus oultre, dar nha sunte andreas, dar na dat Burgundische Cruce, dar hefft sumte andreas de hanth vp. Vppe der anderen syde na dem arn ys ock eyn bilde, wo vppe der anderen syde, alße sunte Jurgen hefft vnder dem perde liggen eynen Turcken, dem ys dat houeth aff, vnde eyn fenlin licht by ehm, dar ys yn eyn halue mhan; dar na de beyden Columnen myt des keyßers rym, dar nha sunte Jacob, dar nha dat burgundische Cruce.
Item dat ander fenlin hefft den almechtigen goedth ym ringe hangende ganß verguldet; dar vore knidt Ke. Mtt. dar na eynen dubbelden arn myth ehnem schitde in der borst, bauen dem wapen des keyßers kron, vp beyden syden de beyden columnen edder sulen myt des keyßers rym plus oultre, dar na dat burgundisch Cruce. Vppe der anderen syden ock ßo.
Item ym drudden fenlin vppe der eynen syden vnßer leuen fruwen bilde; dar nha eyn drake vorhauen in dat burgundisch Cruce jegen dat Marien bilde, myt fulen ader columnen vnde fuit istic (?). Alle fenlin myt klynen klammen dorch vnde dorch vppe dat weste. Vppe der anderen syde funte anne sulffdrudde vnde myth drake vnde Cruce, wo de eyne fide.
Item in dem virden fenlin steyt vppe dei eynen syden sunte cristoffer, vppe der anderen syden sunte barbare myth dem burgundischen Cruce, des keyßers krone twischen bem Cruce vnde des keyßers rym lenges der sulen ganß vthgeschreuen myt groten bockstauen vergoldet.
Item im viften schlichtes eyn dubbelt adeler myt beiden sulen, rime fuit istic (?) vnde burgundisch Cruce.
De grunth aller fenlin gell.
Item dessuluigen dages schyckeden tho Regensborch die van Alm bauen Ił C perde.
Item die van Alm schyckeden vth anerfloth nach I tapper fenlin knechte.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item aw VIII augusti jegen den auenth vm feygers VI is Ke. Mtt. wedderumme vth Regensborch in dath bath


|
Seite 97 |




|
getagen, nycht krankheyd haluen, sunder dat de lucht syn Mtt. nycht lyden kan to Regensborch, ys alle tydt vngeschycketh vnbe sunder row. Darsuluest to Abach ist schone luft vnd jacht; de herberge ader dat huß, dar syn Mtt. inne licht, ys hartt an der Dunow gelegen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 10. Augusti synth hyr tidinge kamen, wo syck die Turcke van der Dunow gegeuen vnde thuth na der Stiermark tho vnde wurde atße huten ader morgen kamen tor neuweu stadt vnde dat belegerenn.
Item hyr is eyn groth tothut van Ruthere vnde knechte, wes (?) den dorch ander orde tuth. Ick hedde nummer gelouet, dath Ke. Mtt. so grote obedientie vnde gehorsam im ryke vnde in sunderheyt dusche nation schulde gehath hebben.
Item die legath, die betther by Ke. Mtt. gheweßen, Laurentius Campegius werth widerumme na wallanth tende, ßo balde de ander legate kumpt Hipolitus de Medicis, mhan is syner dachlyks vorwachtende, warth kamende myt IIIIC perde.
Item dath men betteher ßo harde vnde faste gheholden, dath men Ferdinanden vor nenen Romischen koninge hebben wolde, ys sachter geworden vnde dat banner ys dael geslagen, dat fur ys genslich vthgeloschet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 11. Augusti des morgens vm seygers VII starff de iunge prynß van dennemarken. Des namiddages vm seygers eyn was ick in dem ghemake, sach ohm vpsniden; dath ingeweyde was gantz sunth, vnde em warth eyn ganß suelueren schottel groth vul herrns ader bregens vth synem houede ghenamen vnde dar na gebalßamert; werth vppe die Capelle gestellet in Kr. Mtt. pallaß, dar schal he sthan, wente tom XXV in Augusto, alße den scholen schen de vigilien, dar na des anderen dages die selmisßen, vnde wenner dath ghyschen, schal mhen eyn yen aff voren to der moder to ginth (?).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 12. Augustt vm seygers II vppe den namiddach ys de nige legate Hipolitus de Medicis (welkern Ferdinandus Romische Konigl. Mtt. myth der gantzen gwarde inhalde vnde vor die herberge vorde, dar de Churfurste van Brandenborch lach,) ingetagen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


|
Seite 98 |




|
Item am 14 in Augusto synth beydelegaten Campegius vnde Hipolitus de Medicis to dem keyßer tho Abach in dat badth getagen.
Item des dages synth hyr tidinge ghekamen, wo Antoni de Dorio bauen 40 dußent starck myt groten schepen vnde geleyde in de ße gan schal.
Item van dem dage ahn alße de junge prynß gestoruen, is he alle dage in allen lerken beluth worden.
Item am 15 in augusto hebben de Spaniuolen, Itatianer, Neapolitaner, Franzoßen vnde andere eyn statlyke processie vthe dem dome in der Stadth myth allen gystliken vnde religioßen gheholden, gyngen alle nemendes vthgenamen myth bernenden waß lichtein.
Item des dages synth hyr tidinge ghekamen, wo de Turcke von der nuwen Stadth vnde der donow na der Stiermarke in dat gebirge getagen, vm syck tho vill . . . . n vnde wider inth Italiam to tende.
Item od tidinge, wo de konink van Frankryken synen gheschyckeden by dem Turcken hebben schal tho Ouen, desuluige schal od dem waide eyne grote stuer vnde hulpe myt geldt gedan hebben, schal eyn spanniol syn vude ys yn vngnaden des keyßers gefallen vnde hefft syck to dem franzoßen gegeuen.
Item dessuluigen dages ys paltzgraue Frederick myt synen rutern van Regensborch die Dunow dael getagen.
Item am 16 in augusto synth hyr wysse tidinge ghekamen, Romische koninglike Mtt. hefft II poste nach eyn ander gelregen, wo des keyßers vnde koninges solcker in Wine onde Neuwestadt dem Turcken, alße ehr na der Stiermarke getagen, affgeslagen bnde gegrepen scholen hebben VM mhan vnde scholen auer die VIC leuendige turkische perde gekregen hebben vnde etlyk dapper turcken genangen, in sunderheit Inbrahim bassa synen ouerften kemerlinck, dar by sie treffliche Clenode scholen gevunden hebben.
Item am 17 in augusto jegen den auenth is hyr tho Regensborch ingekamen Antoni de Leyua myt XVIII edder XX partesaner syue knechte vnde ruther, synth getagen van Isbruck na Osterrich; alle die Spanniolen halden ohne statlich in; lith syn Rosbon vor gan; dar nha drogen ohne (dewyle in henden vnde voten vnnutte) IIII hellebarderer vppe eyn dynck dar he syck up lende; mhen sach ehm nycht mer alße syn angesicht vnde eyne hanth; dat angesicht was hubsch, ouerst die hanth stund eyn krum.


|
Seite 99 |




|
Item am 18 in Augusto is Antoni de Leua, wo he des dages thouoren vor synem intoge by Kr. Mtt. to Abach in dath bath gheweßen, to Romische koninglik Mtt. gheweßen, vnde ohren Mtten. beyde gesecht, worumme ohre Mtten, beide ßo groten merckliken hupen folcks by eynander kamen lethe; wanner he eyn mal hundert dußent mhan hadde, he wolde den Turcken soken vnde ßo vnderrichten, he scholde syck bedencken, wanner he wedderumme in Hungerrn tho lende 1 ).
Item am 19. Augusti is vth Wine tho Regenßborch Inbrahim bassa, syn ouerste kemerlinck, dar van bauen, senklich ingeschycketh worden vnde yn koninglike Mtt. pallaß, dar nha hinder des Biscoppes van Trenth herberge geuoret, desuluige warth nicht verhoret; men secht ock, wo tho Regensborch noch X grote huße kamen scholen van des Turcken solcke, die ße ock sendlich genamen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 20 in Augusto synt hyr tidinge gekamen, wo des Churfursten houethman van Brandenborch Fabian Hyrth III myle vp genner syth win myt synem lutelant schole gherichtet vnde enthowdet syn, darumme gebeden ys worden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am XXI in Augusto synth hyr tidinge gekamen, wo by VIII dußent vmme wine her Turckenn getagen vnde gereden, alle lude groth vnde kleyn vermordert vnde ade dat ve, ßo ße auerkamen, hebben ße dot gheslagen vnde liggen lathenn, vnde die Turcke gysst syck wedderumme tho rugge vth.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -
Item am 22. Augusti is Cardinalis Campegius van Regensborch wedderumme na Rome gereyßet.
Item am 23. Augusti synth tidinge tho Regensborch gekamen, wo der Turcke vor Guntz IX mile bauen wine III storm vnde eyn treflich solck vorlarenn. Ke. Mtt. ruther scholen darsuluest etlike dappere Turcken geuangen hebben, welke mith pynlike verhoringe bekanth, wo de ock to Regensborch gedan, de dar sith, das die Turcke vpsinth ys vor wine tho rucken, vnde ßo he wine myth hulpe synes godes nomet, wyl he strax na welsche lanth vnde Rome rucken, den pawest strassen.


|
Seite 100 |




|
Item van deu geuangen Turcken synth am XXIIII augusti, alße de lude uppe den namiddach vm Regensborch gynck, IIII Turcken, myth keden vm de helße ghespunnen, ingeuoret vnde in des Cardinalis van Trentis herberge gebracht worden.
Dieses Tagebuch, oder Zeitung ("Nigetidinge"), welches ich im großhrzoglichen Geheimen und Haupt=Archive zu Schwerin aufgefunden habe, isst ohne Zweifel eine Aufzeichnung aus eigener Anschauung über den Reichstag zu Regensburg vom 15. Julii bis zum 23. August 1532. Wenn nicht schon alle Begebenheiten und Personen dafür sprächen, so redet dafür z. B. ganz bestimmt der unterm 11. August angeführte Tod des jungen Prinzen (Johannes) von Dänemark, welcher im J. 1532 zu Regensburg während des Reichstages starb. - ferner das Erscheinen der Türken vor Günz, u.s.w. Der Verfasser ist offenbar ein geborner Niederdeutscher, wahrscheinlich ein Meklenburger, welcher diesen werthvollen Bericht zu Hofe nach Meklenburg schickte. Die Handschrift ist klein und ungewöhnlich undeutlich, an manchen Stellen kaum lesbar und hat nur mit der größten Anstrengung während langer und fortgesetzter Bemühungen entziffert werden können. Mitgetheilt ist hier alles, was einigermaßen Werth haben kann, fortgelassen sind kleinere unbedeutende Begebenheiten, z. B. der fortwährende Durchzug weniger Krieger durch Regensbrug, welche immer aufgeführt sind.
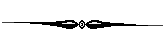


|
Seite 101 |




|



|


|
|
:
|
X.
Die
meklenburgischen Formschneider
des
sechszehnten Jahrhunderts.
Von
Wiechmann=Kadow
D ie Drucke der Michaelis=Brüder zu Rostock sind sehr arm an Holzschnitten Außer den Buchdruckerzeichen sind nur bekannt die Titeleinfassung der Schweriner Agende von 1521, den Bogen eines Portals darstellend 1 ), und ein Formschnitt in dem stralsundischen Missale, welches Mohnike in Jahrb. V, S. 184 flgd. ausführlich beschrieben hat Auf diesem Blatte, das zu dem eigentlichen Meßcanon gehört, sieht man den Heiland am Kreuze, zu dessen Seiten Maria und Johannes stehen, während mehrere Engel das Blut aus den Wunden des Erlösers in Kelche auffangen 2 ). Dann findet sich in der vor 1500 gedruckten Auslegung der zehn Gebote 3 ) eine Folge von zwanzig Holzschnitten, so daß zu jedem Gebote zwei gehören, von denen der erste die Uebertretung des Gebotes, der zweite dagegen die Strafe für die Sünde darstellt; H. 2 Z. 11 L. Br. 2 Z. 7 - 8 L. 4 ) Diese Formschnitte können nur roh genannt werden. Viel höher an Kunstwerth steht das große Buchdruckerzeichen der Brüder: der heil. Michael, den Lindwurm tödtend, H. 4 Z. 6 L., Br. 2 Z. 5 L. Das Signet, von dem in Jahrb. IV, Taf. 1, Nr. 5 ein Facsimile gegeben ist, wird von einem Meister der niederrheinischen Schule her


|
Seite 102 |




|
rühren 1 ). Ein kleineres Zeichen, von Kosegarten in Jahrb. VI, S. 194 erwähnt, findet sich in der Mitte eines schön verzierten Holzschnitt=Initials V .
Nicht weniger arm an Formschnitten sind die Drucke aus der Officin von Hermann Barckhusen. Neben einigen unbedeutenden Vignetten sind die Holzschnitte der bambergischen Halsgerichts=Ordnung (1510) 2 ) zu berücksichtigen, welche als gegenseitige Copien der Abbildungen in den hochdeutschen Ausgaben von Hans Pfeyll zu Bamberg und Johann Schöffer zu Mainz (1507 und 1508) betrachtet werden können. Sie sind in 4°, der Titelholzschnitt: das Weltgericht, in Fol., ebenso eine sich mehrmals wiederholende Darstellung verschiedener Hinrichtungs= und Strafwerkzeuge, in welcher das Fähnchen auf dem Dache des Prangers (Kaak) mit dem Buchstaben r (auf Rostock deutend) versehen ist.
Mit den großartigen typographischen Unternehmungen der beiden Männer Nicolaus Marschalk und Ludwig Dietz beginnt um das Jahr 1515 die glänzende Periode für die Formschneidekunst in Meklenburg, und bietet sich uns von jener Zeit eine, wenn auch nur kleine Reihe von Künstlern dar, welche vortreffliche Werke hinterlassen haben und fast alle der sächsischen Schule angehören.
Es sind bis dahin folgende Meister bekannt, die den Formschnitt in Meklenburg ausgeübt haben:
Melchior Schwarzenberg,
Monogrammist P. B.,
Erhard Altdorffer,
Jacob Lucius,
Monogrammist D.
Melchior Schwarzenberg.
Es ist wohl nicht zu bezweifeln, daß Melchior Schwarzenberg durch den herzoglichen Rath Nicolaus Marschalk nach Meklenburg gekommen ist; wahrscheinlich brachte ihn dieser selbst mit aus Sachsen und beschäftigte ihn als Formschneider


|
Seite 103 |




|
(vielleicht auch als Factor) für seine Buchdruckerei zu Rostock. Als Gehülfe Marschalks wird Schwarzenberg in den herzogl. Rechnungen erwähnt; leider nennt man ihn nach der Sitte der damaligen Zeit nur mit dem Vornamen, z. B.:
1516. II gulden Melcher, docter Marschalgks knechte, von eynem tittel zu schniten obber meiner g. hernn wappen am dienstage nach Lucie. Herz. Heinrich 1 ).
Im Jahre 1516 tritt der Künstler auch als Formschneider für die Officin des Ludw. Dietz auf, für den er mehrere Holzschnitte fertigte, die alle das Gepräge der altsächsischen Schule tragen. Es scheint aber, als ob Schwarzenberg nicht lange in Rostock verweilte, denn unter den vielen Formschnitten, welche die dietzischen Drucke nach 1520 zieren, wüßten wir nicht einen, der diesem Meister zugeschrieben werden könnte. Schon im Jahre 1532 findet man ihn an der Holzschnittfolge beschäftigt, welche zuerst in der 1534 von Hans Lufft zu Wittenberg gedruckten Bibel vorkommt und später in andere Bibel=Ausgaben übergegangen ist. Diese Holzschnitte sind nun freilich von bedeutend größerem Kunstwerthe, als diejenigen, welche Schwarzenberg in Rostock ausführte; aber warum dürfte man nicht annehmen, daß der Meister sich allmählig zu einer höheren Stufe hinaufgeschwungen habe, zumal da gerade damals in Sachsen die Schule Cranach's zu blühen begann? 2 ) Besonders schön ist in jener Bibel das Kinder=Alphabet von Schwarzenberg und dem Monogrammisten P. S., das durchaus in Cranach's Manier gehalten ist 3 ). Auch in Luther's Hauspostill, so wie in dessen Kirchenpostill, Nürnberg 1545, finden sich Blätter von ihm, theilweise nach Hans Brosamer, und endlich soll er nach Malpé's Angabe für Sigismund Feyrabend zu Frankfurt a. M. Titeleinfassungen und Vignetten geschnitten haben.


|
Seite 104 |




|
Schwarzenberg's Monogramm besteht aus den verschlungenen oder neben einander stehenden Buchstaben M S;
 1
)
1
)
Ueber Schwarzenberg vergleiche man Malpé et Bavarel, Notices sur les graveurs, qui nous ont laissé des estampes marquées, 1808, 11, p. 216; Heller, Geschichte der Holzschneidekunst, S. 132 2 ); Brulliot. Dictionnaire des monogrammes, II, No. 1943 und 2049; Nagler's Künstlerlexicon, Bd. 16, S. 128.
1. Das meklenburgische Wappen.
Der gekrönte Stierkopf mit Nasenring und heraußhangender Zunge in einem Schilde. Ueber dem Schilde die in Holz geschnittene Inschrift: Meckelnburgk. H. 7 Z. 4 L.; Br. 6 Z. 6 L. (ohne Ueberschrift.)
Dieser Formschnitt, von dem ein Exemplar im Großherzogl. Archive zu Schwerin vorhanden, ist ohne Zweifel derselbe, welcher in der oben mitgetheilten Stelle aus den fürstl. Rechnungen vom J. 1516 erwähnt wird (Jahrb. IV, S. 118).
Ein ähnliches Wappen (H. 2 Z. 8 L.; Br. 2 Z. 1 L.) findet sich in Marschalk's Institut. Reipubl. militar., 1515.
2. Titelholzschnitt zu: Der sele rychtestych Rostock, L. Dietz, 1515.
Kl. 4°. Christus am Kreuze, rechts von demselben Maria mit einem Schwerte in der Brust, links Johannes mit einem Buche. Am Fuße des Kreuzes das erste Monogramm.
In demselben Buche kommen noch zwei kleinere Holzschnitte in 8° vor, nämlich:
(Bl. 35 b.) der Schmerzensmann, im Grabe stehend,
und
(Bl. 59 b.) die heil. Elisabeth (Anna?)
und Maria mit dem Christkinde.


|
Seite 105 |




|
Auch die Holzschnitt=Initiale dieses Druckes müssen erwähnt werden, z. B. der Buchstabe V, in dessen Mitte ein von einem Pfeile durchbohrtes Herz steht (Jahrb. IV, S. 143 flgd.).
3. Die Jungfrau Maria mit dem Rosenkranze.
Maria, das Jesuskind tragend, steht in eiuer Glorie auf der Mondsichel. Sie ist von einem Rosenkranze umgeben, in welchem auf größeren Blumen ein durchbohrtes Herz, so wie zwei durchbohrte Hände und Füße liegen. In den Ecken vier Medaillons mit den geflügelten Attributen der Evangelisten. H. 7 Z. 3 L., Br. 4 Z. 6 L.
Der gut gelungene Holzschnitt steht auf der Rückseite einer von L. Dietz gedruckten Aufforderung des Dominikaner=Ordens zum Eintritt in die Brüderschaft des Rosenkranzes 1 ) (Jahrb. IV, S. 173).
4. Die heilige Familie
In der Mitte des Blattes sitzt die heil. Anna auf einem verzierten Throne, in einem Buche lesend; vor ihr sitzt Maria mit dem Kinde, welches letztere einen Apfel in den Händen hält. Rechts vom Throne steht der heil. Jofeph mit einem Maaßstabe, links der heil. Joachim mit einem Rosenkranze. H. 7 Z. 5 L., Br. 5 Z. 4 L.
Dies Blatt. das ebenso wie die vorige Nr. unverkennbar von Schwarzenberg herrührt, findet sich in einigen Exemplaren des Ordinarius ecclesie Swerinensis, 1519, und scheint erst während des Druckes vollendet zu sein, da es Exemplare giebt, in welchen die betreffende Seite leer geblieben ist.
5. Folge von 45 Heiligenbildern.
Die kleinen Holzschnitte sind ursprünglich für den eben genannten Ordinarius bestimmt gewesen, wurden aber später für andere Drucke benutzt. Sie stellen außer der Geburt und der Auferstehung Christi, der Anbetung der drei Könige und der heil. Dreieinigkeit jeder einen Heiligen mit seinem Attribute dar. H. 1 Z. 7 - 8 L., Br. 1 Z. 2 L.


|
Seite 106 |




|
6. Das große Buchdruckerzeichen des Nicolaus Marschalk.
Ein Knappe mit Federbaret halt vor sich einen quer getheilten Wappenschild mit einer zweigeschwänzten gekrönten Sirene. H. 5 Z. 3 L., 3 Z. 9 L. 1 )
Wahrscheinlich ist das Signet von Schwarzenberg, wenngleich die unverhältnißmäßig großen Hände und Füße auf einen später zu erwähnenden Gehülfen Altdorffer's hindeuten.
Auch mehrere Formschnitte in marschalkschen Büchern werden Schwarzenberg angehören, z. B. könnte er an den Folgen der Institut. reipubl militar., 1515, und der Historia aquatilium, 1517 und 1520, Theil haben. Die erstgenannten Holzschnitte (je sechs auf einer Folioseite) habe ich bereits in Naumann's Archiv für zeichnende Künste, Jahrg. II, S. 129 erwähnt und bemerkt, daß sie als verkleinerte Copien der Abbildungen in der erfurter Ausgabe des deutschen Vegetius (1511) zu betrachten sind; sie sind alle sehr leichtfertig behandelt.
Ferner mag unser Xylograph einige Blätter nach Altdorffer's und anderer Meister Zeichnungen geschnitten haben. Zu solchen rechne ich das Schlußbild 2 ) der Institutiones, einen geharnischten Ritter auf seinem Turnierrosse darstellend; H. 9 Z., Br. 6 Z. Beachtenswerth und gewiß nicht ohne Bedeutung sind bei diesem Holzschnitte die Brille und das Ohr einer Schellenkappe, welche neben oder über einander auf dem Boden liegen 3 ). Vielleicht wäre dieser Formschnitt nach jener Zeichnung ausgeführt, von welcher Hermann Barckhusen
In Jahrb. IV. wird die Sirene nur als ein Buchdruckerzeichen, nicht als das Wappen Marschalk's betrachtet. Ohne dieser Ansicht entgegentreten zu wollen, bemerke ich, daß in meinem Exemplar der Institut. militar., in welchem die Holzschnitte alt colorirt sind, der quer getheilte Schild gespalten ist und oben ein schwarzes, unten ein gelbes Feld erhalten hat.
Der Zeit nach könnte das von Lisch in Jahrb. IV, S. 150 beschriebene Crucifix für die Carthäuser zu Marienehe ein Holzschnitt Schwarzenberg's sein. Es ist mir nicht gelungen, ein Exemplar aufzufinden.
Die späteren Holzschnitte, welche der Meister in Sachsen fertigte, durften hier nicht weiter berücksichtigt werden.


|
Seite 107 |




|
in seinem bekannten Briefe an den Herzog Heinrich den Friedfertigen von Meklenburg vom J. 1510 sagt:
hebbe ok darupp alrede eynen forsten in einem harnsche offte Coritzen upp eynem Hinxte sittende dorch Henriche Juwer g. maler upp dat eerste blad mit anderen Juwer g. wapen
. entwerpen laten: u. f. w.
Ueber den Maler Heinrich fehlt jede weitere Kenntniß.
Der Monogrammist P. B.
Wichtiger als Schwarzenberg ist uns dieser, dem Namen nach noch unbekannte Künstler, der nur für LDietz zu Rostock thätig gewesen zu sein scheint. Die Monogramme 1 ), mit denen er seineWerke bezeichnete, sind aus den beiden Buchstaben P und B zusammengesetzt.
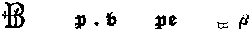
Einmal, und zwar auf einer Titeleinfassung, die dem Meister durchaus nicht abzusprechen ist, findet sich folgendes Zeichen

in welchem man die Buchstaben Lrebp erkennt.
Durch diese Monogramme sind mehrere Kunstkenner zu der Vermuthung gelangt, daß der Formschneider P. B. und der Maler Peter Bökel aus Antwerpen eine und dieselbe Person sein könnten 2 ). Es ist indessen zu erwägen, daß Bökel, der 1563 beim Schloßbau zu Schwerin als Maler beschäftigt war, noch im J. 1582 für den Herzog Ulrich (zu Wismar) Bildnisse meklenburgischer Herzoge fertigte, also schwerlich schon um 1520 in Meklenburg war, da er dann 1582 ein achtzigjähriger Greis gewesen sein müßte. Auch berichtet Lisch (Jahrb. V, S. 54), daß Bökel im J. 1563 drei "gemalte Bilder" für die herzogliche Capelle aus den Niederlanden mitbrachte und also erst in diesem Jahre nach Meklenburg kam 3 ).


|
Seite 108 |




|
Was des Meisters Kunstweise anbetrifft, so sind seine Arbeiten größtentheils wohlgelungene Nachahmungen der schönen Metallschnitte, welche wir in den französischen Heures (Gebetbücher) aus dem Ende des 15. und dem Anfange des 16. Jahrhunderts bewundern; sie haben wie jene gewöhnlich einen schwarzen Grund mit weißen Punkten (punktirter Grund, manière criblée) 1 ) und sind gleichfalls Metallschnitte. Wenn auch die Zeichnung mitunter etwas schwach ausfällt und die Schwierigkeiten, welche das Schneiden in Metall bietet, nicht immer so glücklich überwunden sind, wie dies der Schule Holbein's gelang, so gehören dennoch die vielen Blättchen unsers Künstlers zu den besten Leistungen in jener Manier. Besonders gelungen sind die Randleisten aus dem J. 1522, bei denen nicht allein der reichen Phantasie des Meisters freier Lauf gelassen ist, sondern auch die saubere, minutiöse Ausführung so viel Geschmack und Eleganz zeigt, daß der verstorbene Mohnike nicht zu weit geht, wenn er diese Zierleisten zu den schönsten jener Zeit zählt 2 ).
1. Folge von zwölf Vignetten zum Kalender.
Zu jedem Monate gehört ein Blatt, das in drei Felder getheilt ist. Das eine Feld stellt die landwirthschaftliche oder häusliche Verrichtung des Monats, das andere das Bild des Thierkreises dar; das mittlere enthält eine Arabeske, einmal (für den Junius) auch das Wappen des Ludw. Dietz an einer Weinranke hangend. Das zweite Monogramm ist zweimal, das dritte und vierte einmal vorhanden. Br. 2 Z. 4 L., H. 1 Z. Diese niedlichen Blättchen kommen in den Kalendern bes Breviarium Hamburgense, 1522, und der dietzischen Gebetbücher von 1526 und 1530 vor 3 ).
Sehr gute Copien (in Hozschnitt) findet man in dem von Hans Walther zu Magdeburg gedruckten Gebetbuche (v. J. 1534?) 4 ).


|
Seite 109 |




|
2. Zierleisten aus dem J. 1522.
Die Randleisten, welche zuerst in dem Gebetbuche des Ludw. Dietz von 1522 1 ) vorkommen, dann aber vielfach angewendet wurden und mit den dietzischen Lettern an Stephan Möllmann übergingen, wechseln neunmal. Für beide Seiten H. 4 Z. 5 L., Br. 5 L.; unten Br. 2 Z. 5 L.; H. g L.; oben Br. 2 Z. 2 L., H. bis 4 L. Nur einige der unteren Leisten sind mit einer Randlinie eingefaßt. Diese Zierleisten zeigen ein phantastisches Gemenge von Figuren, Thiergestalten, architektonischen Verzierungen und Arabesken: Indianer, die einen Vogel in die Höhe halten, auf langen Hörnern blasende Engel, einen Mann und eine Frau, beide ein menschliches Haupt auf einem Schwerte tragend, Bogenschützen, Sphinxe, Eidexen, Hunde mit Schneckenhäusern, eine Hasenjagd, Säulen von Männern getragen und mit Laubgewinden und Mascarons geziert u. s. w. Die Bordure mit der Frau, die ein menschliches Haupt trägt, hat das erste Zeichen 2 ); die Jahreszahl 1522 findet sich mehrmals. Ferner sind noch die in den unteren Leisten vorhandenen Devisen zu erwähnen, namlich:
DORHEIT. MACHT. ARBEIT.
AMOR. OMNIA. VINCIT.
ALLE. VOGEL. NEIDEN. VNS.
Der letzte Spruch steht zwischen drei Eulen 3 ).
3. Zierleisten.
a. Zierleiste mit zwei Hunden, die um einen Knochen streiten. Br. 2 Z. 10 L., H. 7 L. Dieselbe Darstellung findet sich auch auf einer der unter 1. besprochenen Leisten. In: Datnye schip van Narragonien, 1519, und: Eyne
Copien der Randleisten sind in Drucken von Joh. Balhorn zu Lübeck und auf dem Titel der niedersächsischen Ausgabe von Luther's Betbüchlein, o. O. 1525 (Scheller a. a. O. Nr. 673) bemerkt worden.


|
Seite 110 |




|
prophetie vā dem nyen erwelten Römischē köninge, 1519 1 ).
b. Rankende Pflanzen mit Blumen, zwischen diesen ein Vogel. H. 4 Z. 9 L., Br. 11 L. Diese schöne Arabeske kommt in dem Ordinarius Swerinensis, 1519, vor.
c. Zwischen Blumen und Blätterwerk sitzt ein Mann, dessen Kopfbedeckung in eine Blume ausläuft, und hält einen gebogenen Speer in den Rachen eines Lindwurms; weiter unten ein Löwe mit menschlichem Gesichte. H. 5 Z. 6 L., Br. 5 L. Die Leiste wurde in dem Fragmente eines dietzischen Druckes gefunden.
d. Ein Stab, um den sich Laubwerk windet. H. 5 Z. 5 L., Br. 7 L. In der unter a. zuletzt genannten Schrift, welche auch kleinere Zierleisten mit Blumen enthält.
4. Titeleinfassung zu dem Gebetbuche des Ludwig Dietz vom Jahre 1560, 12°.
Die aus vier schmalen Leisten zusammengesetzte Einfassung zeigt zu beiden Seiten verzierte Säulen mit mehreren kleinen Figuren, darunter ein Narr mit der Schellenkappe, ein Affe und eine Schnecke. Unten befindet sich das dietzische Wappen zwischen Diestelpflanzen; oben runde Bogen mit anderen Verzierungen. Die Leiste auf der rechten Seite ist mit jenem Monogramme versehen, das aus den verschlungenen Buchstaben L r e b p besteht. Die ganze Einfassung ist 3 Z. 6 L. hoch und 2 Z. 4 L. breit; sie wird schon früher benutzt sein.
5. Ein Stammbaum mit den Graden der geistlichen Verwandtschaft, welche die Ehe hindern (Arbor casibus cognationis spiritualis) in dem Ordinarius Swerinensis, 1519 2 ).
Ein mit Blättern und Blumen verzierter Baum trägt zu beiden Seiten mehrere Tafeln, auf denen die Grade der Verwandtschaft (mit Lettern) gedruckt sind. Um die Wurzeln schlingt sich ein Band mit den Worten:
 Arbor cognatiōis spūalis.
Arbor cognatiōis spūalis.
Mit wagerecht schattirtem Grunde. H. 7 Z. 4 L., Br. 4 Z. 11 L.


|
Seite 111 |




|
Wenngleich unten in der linken Ecke ein sehr undeutliches Monogramm steht, in welchem man den Buchstaben S zu erkennen meint, so glaube ich dennoch, diesen Formschnitt dem Künstler P. B. zuschreiben zu müssen, da namentlich die Blätter und Blumen durchaus seine Kunstweise zeigen. Vielleicht rührt die Zeichnung von einem anderen Meister (Schwarzenberg?) her.
6. Das sogenannte Wappen Jesu Christi mit der Inschrift: REDEMPTORIS. MUNDI. ARMA.
Der Wappenschild enthält in der Mitte ein Kreuz mit der Dornenkrone und den Buchstaben I. N. R. I. Zur Linken des Kreuzes ein Hammer, ein Speer, das Gewand des Herrn und drei Würfel; rechts eine Zange, das Rohr mit dem Schwamme, das Haupt des Judas mit zwei Rollen Geld und einem Geldbeutel, eine Laterne und ein Schwert. Das Kreuz steht in einem Grabe. Ueber dem Schilde befindet sich ein Helm mit einer Säule, an welcher Ruthen, Peitschen und Stricke angebracht sind; oben auf der Säule ein Hahn. Oben in der Ecke links das erste Zeichen, mit wagerecht schattirtem Grunde. H. 3 Z. 1 L., Br. 2 Z. 3 L. In Slüter's Gesangbuch, 1531 1 ), und Stüblinger, Eyn kleyn nödich stücke vam Predigampt, 1553 2 ).
7. Buchdruckerzeichen des Ludwig Dietz.
a. Buchdruckerzeichen mit einem getheilten Kreise, in welchem die Buchstaben L D stehen. Aus dem Kreise geht eine Stange in die Höhe, deren Spitze in einem sechsstrahligen Stern endet. In den Winkeln R│O│S│T│O│K│. Um die Stange fliegt ein Band mit den Worten: τελος id est FINIS. H. 2 Z. 9 L., Br. 1 Z. 5 L. Ein Facsimile in Jahrb. IV, Taf. IV, Nr. 1 b. . 3 ).
b. An einem Weunstamme hängt ein Schild mit der getheilten Kugel, aus welcher eine Stange mit dem Andreaskreuze geht. Diesen Schild halten zwei aufrecht stehende Löwen. Am Fuße des Baumes, auf einem Bande, der Name L. DIETZ . H. 2 Z. 9 L., Br. 2 Z. 4 ).


|
Seite 112 |




|
c. Ein sitzender Greif hält mit den vier Pranken einen Schild mit dem bei a. und b. beschriebenen dietzischen Wappen. Oben ein Band mit der Inschrift: DORHEIT. MAKET. ARBEIT; unten ein zweites mit: LVDOVICVS DIETZ. Zu beiden Seiten Blumen. Mit wagerecht schattirtem Grunde. H. 1 Z. 11 L., Br. 1 Z. 6 L. 1 ).
8. Das kleinere Buchdruckerzeichen des Nicolaus Marschalk.
Die zweigeschwänzte gekrönte Sirene in einem quer getheilten Wappenschilde, der mit Laubwerk und Troddeln verziert ist. Mit schwarzem Grunde. H. 2 Z. 4 L., Br. 1 Z. 11 L. Ein Facsimile findet sich in Jahrb. IV, Taf. III, Nr. 5.
Dies Signet wird von einem anderen Künstler gezeichnet sein 2 ).
9. Verzierte Initiale.
Die trefflichen Initiale, von denen der Meister eine große Menge geschnitten hat, gehören zu seinen besten Arbeiten. Sie sind fast alle Nachahmungen der gemalten Initiale in alten Handschriften, enthalten phantastische Blumen, Früchte, Arabesken, selten Thiere, und haben alle punctirten Grund. Die größten und wahrhaft prachtvollen Buchstaben kommen in dem Donat von 1518, in Brunswyck's Wundenartzstedye, 1518 und einzeln in anderen Drucken aus Dietzens erster Periode vor. H. 2 Z., Br. 1 Z. 11 L. 2 Z. Das zweite Alphabet (im Ordinarius Swerinensis, 1519) mißt 11 Linien im Durchmesser; dann folgen andere Buchstaben von 7 und 6 L. im Durchmesser, die in den meisten Büchern aus der dietzischen Officin benutzt sind. Auch der in Jahrb. IV, S. 152 beschriebene Initial T mit einem Crucifix, so daß der Buchstabe das Kreuz bildet, verdient besonders genannt zu werden.
Es soll hier noch ein Holzschnitt mit folgendem Zeichen erwähnt werden:

Derselbe (kl. 4°) ziert den Titel der von Jacob Lucius zu Rostock gedruckten meklenburg. Schäfer=Ordnung von 1578,


|
Seite 113 |




|
4°, und stellt einen Schäfer dar, der neben seiner Heerde den den Dudelsack bläst 1 ). Diesen Holzschnitt, welcher schon früher vorkommen soll, hat der ältere Meister P. B. nicht geschnitten, wie früher als wahrscheinlich angegeben wurde, vielmehr könnte er von dem oben besprochenen Maler Peter Bökel 2 ) herrühren; auch mag der Schnitt des Blattes Jacob Lucius beizumessen sein.
Erhard Altdorffer
Wie es mitunter vorkommt, daß zwei Forscher zu gleicher Zeit einen und denselben Gegenstand verfolgen, dabei aber von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehen, so geschah es kürzlich in Bezug auf Erhard Altdorffer, dessen Name und Wirksamkeit als Maler am Schweriner Hofe von meinem verehrten Freunde, dem Archivrath Lisch im XXI. Bande der Jahrbücher 3 ) gerade zu der Zeit besprochen ward, als ich in Naumann's Archiv für zeichnende Künste die erste Mittheilung über die Holzschnitte des meklenburgischen Formschneiders E. A. machte. Auf jene Nachrichten in Jahrb. XXI. verweisend, bemerke ich hier nur, daß Altdorffer Hofmaler des Herzogs Heinrich des Friedfertigen war, bei diesem in großer Gunst gestanden zu haben scheint, ihn auf die Reise zur Vermählung der Prinzessin Katharine (des Herzogs Schwester) mit dem Herzoge Heinrich von Sachsen=Freiberg begleitete, bei dieser Gelegenheit in Wittenberg verweilte und um 1550 den Titel eines Baumeisters führte. Die herzoglichen Rechnungen nennen ihn in der Zeit von 1512 bis 1550; von seinen Gemälden ist nichts erhalten, und eins seiner Hauptwerke, der Altar in der heil. Bluts=Kapelle zu Sternberg 4 ) (1516), wurde 1741 durch eine Feuersbrunst zerstört.


|
Seite 114 |




|
Für die Annahme, daß der Formschneider E. A. identisch mit Erhard Altdorffer sei, werden folgende Gründe angeführt.
- Das aus den Buchstaben E und A bestehende Monogramm, also gestaltet 1 ):
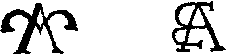
- Die große Zahl der Holzschnitte, welche der Meister für die rostocker Buchdruckereien von Nicolaus Marschalk und Ludwig Dietz fertigte
- Das Costum, welches besonders bei den Frauen auf dem unter Nr. 1 beschriebenen Blatte: das Turnier, das der Hansestädte Lübeck und Rostock ist.
- Die Benutzung des marschalkschen Buchdruckerzeichens, der zweigeschwänzten Meerjungfer, als Helmzierde.
- Die sehr naturgetrelle Auffassung der Weide, jenes Baumes, dessen eigentliches Vaterland Meklenburg und Vorpommern ist 2 ).
Die Holzschnitte aus der ersten Zeit des Künstlers weisen ihn der altsächsischen Schule zu, während die späteren Arbeiten den Einfluß Cranach's deutlich zeigen. Es ist also mehr als wahrscheinlich, daß Altdorffer sich längere Zeit in Wittenberg aufhielt und in Cranach einen Lehrer fand. In der Behandlung des Architektonischen kommt er häufig dem Erhard Schön nahe. Auch muß noch auf ein eigenthümliches Verfahren aufmerksam gemacht werden, welches sowohl unser Meister, als besonders Gottfried Leigel, ein Schüler Cranach's, bei Bäumen anwandte, indem sie die Zweige von Gewächsen, namentlich im Hintergrunde, durch neben einander gelegte Linien bezeichnen, wodurch der Baum häufig die Gestalt einer Trauerweide erhält.
Ein Theil von Altdorffer's HolzschnittWerk ist bereits in Naumann's Archiv, Jahrg. II, S. 132 - 134 und 179 - 181 beschrieben, der Vollständigkeit wegen werden jene Blätter noch einmal in das folgende Verzeichniß aufgenommen.


|
Seite 115 |




|
1. Das Turnier, 1513.
Der aus drei einzelnen Blättern bestehende schöne Formschnitt stellt ein großes Turnier dar. Auf den beiden äußeren Blättern sieht man zwei Gruppen Ritter mit der Lanze und dem Schwerte kämpfen, während das mittlere Blatt ein großes Haus zeigt, aus dessen mit Teppichen geschmückten Fenstern Damen zuschauen, wie zwei Ritter die Lanzen brechen. Merkwürdig sind die Helmzierden, z. B. ein Storch mit Hut und geschultertem Rechen, eine Storchfamilie auf dem Neste, ein hockender Affe, der in einen Spiegel sieht, eine Kanne mit einem Spieß voll Bratwürste, die zweigeschwänzte Sirene u. s. w. Der Kampfplatz ist durch eine Schranke begrenzt, vor welcher sich eine Bande Musikanten, Knappen, Bürger, Frauen und Kinder befinden; auch auf das Dach eines Erkers am Hause sind Schaulustige gestiegen. In der Mitte steht das erste Monogramm auf einer kleinen Tafel, auf dem äußeren Blatte rechts die Jahreszahl, 1513. Jedes Blatt ist 11 Z. 3 L. breit und 8 Z. 5 L. hoch 1 ).
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß dieser Holzschnitt als Andenken an ein bestimmtes Turnier gedient hat. So macht auch Lisch darauf aufmerksam, daß der Herzog Heinrich den Altdorffer zu dem großen Turnier am 23. - 28. Februar 1512 in Ruppin mitnahm.
2. Titeleinfassung zu Marschalk's Institut. reipubl. militar., 1515, und Annales Herulorum, 1521.
Oben eine Frau mit einem Kinde auf einem geflügelten Rosse, ihr gegenüber ein Teufel, auf einem Ungeheuer mit Elephantenkopf reitend; zu beiden Seiten Säulen, Waffen und Arabesken; unten zwei nackte Kinder, mit Ungeheuern kämpfend. H. 10 Z., Br. 6 Z. 5 L. (N. A., S. 180.)
3. Ein Krieger mit Schwert und Hellebarde.
Dies Blatt, das nach Altdorffer's Zeichnung geschnitten sein wird, kommt in dem unter Nr. 2 zuerst genannten Buche vor und stellt einen Landsknecht dar, der sich auf seine Hellebarde stützt. Er trägt ein Baret, und der mit vielen Federn gezierte Hut ist auf den Rücken hinabgesunken. H. 5 Z. 3 L., Br. 3 Z. 7 L. (N. A., S. 180.)


|
Seite 116 |




|
4. Holzschnitt zur Ankündigung des rostocker Glückshafens, Pfingsten 1518 1 ).
Der Holzschnitt in Querfolio ist in mehrere Felder abgetheilt, von denen das oberste (4 Z. 6 L. hoch) die Ziehung des Glückshafens darstellt. In der Mitte sitzt ein Jüngling, welcher aus zwei neben ihm stehenden Urnen die Loose nimmt; diesem zur Seite befinden sich die Geschwornen und ein Schreiber, der das Ergebniß der Ziehung in ein Buch einträgt; auf der anderen Seite stehen Spielleute, um das Treffen eines Gewinnes dem Volke durch Musik kund zu geben. Dann folgen drei Leisten mit Abbildungen der 24 Gewinne, aus silbernen Bechern und Schalen, Pelzwerk, Tuch und Damast bestehend. Das treffliche Blatt gleicht in der Kunstweise dem Turnier. Das einzig bekannte Exemplar befindet sich in der Universitäts=Bibliothek zu Rostock (N. A., S. 179).
5. Ein geharnischter Ritter.
Der geharnischte Ritter mit aufgeschlagenem Visir ist als Kniestück dargestellt. Mit der Linken hält er ein Schwert, mit der Rechten einen Wappenschild, worauf ein Kreuz befindlich. H. 2 Z. 11 L., Br. 2 Z. 7 L. Zweimal in:
Eyne prophecie va dem nyen erwelten Römesche köninge, Rostock, L. Dietz, 1519.
6. Schlußbild der Annales Herulorum von Marschalk, 1521.
Ueber einem verzierten Portale steht ein tartarischer Chan in ganzer Figur. Fol. Lisch bemerkt (Jahrb. IV, S. 128), daß diese Figur nach den im 16. Jahrh. gemalten Bildern zu Doberan und Neustadt das Bild des meklenburgischen Fürsten Niclot sein soll.
7. Titeleinfassung zu Marschalk's hochdeutscher Chronik v. J. und zu Mons Stellarum, 1522 2 ).
In einer dichten Verschlingung von Zweigen, Blättern und Blumen hängt links ein Helm mit Federn, rechts mehrere Waffen, Köcher, Schwert und Schild; unten sitzt in einer größeren BIume ein geflügelter Engel. Fol.


|
Seite 117 |




|
8. Die Holzschnitte der lübecker Bibel von 1533/34.
Die Holzschnitte der lübecker Prachtbibel bilden das Hauptwerk Altdorffer's, durch welches sein Talent als Zeichner und Formschneider glänzend beurkundet wird, so daß ihm wahrlich kein geringer Rang unter den altdeutschen Xylographen anzuweisen ist. Des Künstlers beide Zeichen kommen jedes einmal vor, und ist nicht zu bezweifeln, daß er einen Theil des schon im J. 1530 begonnenen Werkes eigenhändig geschnitten hat; die Holzschnitte selbst sprechen dafür. Doch werden auch andere Künstler dabei Hülfe geleistet haben. So hat man die Buchstaben D. K. N. 1 ), welche sich von der JahreszahI 1530 begleitet auf der Bl. VIII b. dargestellten Arche Noah finden, für das Monogramm eines Formschneiders angesehen, was leicht möglich ist 2 ). In dem vorliegenden Exemplare hat eine gleichzeitige Hand die genannten Buchstaben in De Kasten Noä umgewandelt. Die Stöcke waren Dietzens Eigenthum, und er benutzte sie nicht allein für die lübecker Bibel, sondern auch für das Neue Testament von 1539 - 1540 und die dänische Bibel von 1550.
a. Der Titelholzschnitt zum ersten und sechsten Theil. - Der schöne Formschnitt, welcher das Wesen des alten und neuen Bundes versinnlicht, ist durch einen Baum in zwei Hälften getheilt. Dieser Baum trägt an einem Zweige die Tafel mit dem Titel und hat auf der rechten Seite dürre, auf der linken belaubte Aeste. Rechts oben empfängt Moses die Gesetztafeln, darunter der Sündenfall und weiter unten ein Grabmal, auf dem ein Gerippe liegt; im Hintergrunde das jüdische Lager mit der ehernen Schlange. Links die Verkündigung Mariä, dann Christus am Kreuze, daneben ein Lamm mit der Siegesfahne, darunter der aus dem Grabe auferstehende Erlöser, welcher mit dem Stabe der Oriflamme den auf der Erde liegenden Tod vernichtet; im Hintergrunde verkündet ein Engel den Hirten die Geburt Christi. In der Mitte des Blattes sitzt am Fuße des Baumes ein nackter Mensch mit verzweiflungsvoller Miene und ängstlichen Geberden; neben diesem stehen ein orientalisch gekleideter Mann (nach Goeze ein jüdischer Gesetzlehrer) und Johannes der Täufer, welche beide auf den am Kreuze hangenden Erlöser


|
Seite 118 |




|
hinweisen. H. 10 Z. 3 L., Br. 7 Z. 4 L. Dieser Holzschnitt ist sehr viel und mit verschiedenen Abänderungen copirt worden.
b. Holzschnitt auf dem Titel des zweiten Theils. - Josua in Harnisch, in der Rechten ein großes Schwert, in der Linken den Helm haltend, sitzt auf einem Felsen. Zur Seite stehen der Schild und die Streitaxt; im Hintergrunde eine bergige Landschaft Br. 7 Z. 1 L., H. 6 Z. 9 L. Dies Blatt erinnert an Lucas Cranach den Aelteren, von dem ein ähnlicher Holzschnitt bekannt ist 1 ).
c. Die Titel des dritten und vierten Theils sind gleichfalls in Holz geschnitten, bestehen jedoch nur aus großen, zum Theil reich verzierten und mit Fracturzügen ausgestatteten gothischen Buchstaben; der vierte Titel enthält in dem verschlungenen Zuge am Ende das erste Monogramm 2 ). Es kommen in der Bibel auch einige schöne Initiale vor, z. B. die Buchstaben L D (Ludwig Dietz) im Anfange des Propheten Jesaias.
d. Das Paradies 3 ). - Adam sitzt unter dem Baume des Lebens und hält die vor ihm knieende Eva bei der Hand. Diese weis't nach dem Baume, in dessen Zweigen zwei Affen einander Früchte zureichen, und scheint Adam die Begierde des lüsternen Weibes abzuwehren. Rechts befinden sich verschiedene Thiere, dem Vordergrunde zu ein schöner Damhirsch; links hinter dem ersten Menschenpaare fließt ein Strom, an dessen Ufer Störche gehen. Oben Gott Vater aus einer Wolke, darüber die Sonne; links in der Ecke die Mondsichel mit Sternen. H. 10 Z. 4 L., Br. 7 Z. 4 L. (N. A., S. 134) 4 ).
e. Die Holzschnitte im alten Testament sind von verschiedener Größe. Br. 5 Z. 7 bis 9 L., H. 4 Z. 8 L. bis 5 Z. 4 L. Andere Blätter sind 5 Z. 8 L. hoch und


|
Seite 119 |




|
4 Z. 10 L. breit. Der Formschnitt auf Bl. XXXVII b., die Bundeslade im Tempel, trägt das zweite Zeichen. (N. A. S. 133).
Die Holzschnitte des neuen Testaments sind 5 Z. hoch und 4 Z. 4 L. breit.
9. Titelholzschnitt zu dem Neuen Testamente, Rostock, L. Dietz, 1539/40, 8°.
Der Titel steht in einer Säulenhalle, an deren Basen und Kapitälern sich die Symbole der Evangelisten befinden; unten Christus am Kreuze zwischen den beiden Schächern; im Hintergrunde die Auferstehung. H. 5 Z. 8 L., Br. 3 Z. 10 L. Sehr schöner Holzschnitt (N. A., S. 180) 1 ).
10. Bildniß des Herzogs Heinrich des Friedfertigen von Meklenburg.
Dieses Bildniß in Folie, das in jeder Hinsicht ausgezeichnet sein soll, erwähnt Lisch in Jahrb. XXI, S. 299.
11. Buchdruckerzeichen des Ludwig Dietz.
Das runde Druckerzeichen stellt einen sitzenden Greif mit ausgebreiteten Flügeln und vier Adlerklauen dar; er hält vor sich einen Wappenschild mit dem öfter beschriebenen Zeichen. Im Rande die Inschrift: CANIS LAPIDEM SEQVITVR OMISSO JACTORE. Durchmesser 2 Z. 3 L. (Jahrb. IV, S. 183).
12. Folge zu Reineke Fuchs.
Die Folge, aus 36 Holzschnitten 2 ) und einer Titeleinfassung bestehend, kommt in den rostocker Ausgaben des Reineke Fuchs von 1539 - 1592 vor und ist nach Altdorffer's Zeichnungen ausgeführt 3 ). Br. 3 Z. 9 L., H. 3 Z. 2 L. Die Titeleinfassung stellt die Bude eines Narren dar, der Fuchsschwänze und spitze Mützen feil bietet; der Titel selbst, über welchem ein Fuchs liegt, steht zwischen zwei Säulen mit


|
Seite 120 |




|
nackten Figuren. Der Holzschnitt ist wahrscheinlich nur theilweise von Altdorffer, denn die obere Hälfte fällt weit roher aus, als die untere. H. 6 Z. 7 L., Br. 4 Z. 10 L. Die Folge, von welcher es gegenseitige Copien giebt 1 ), darf den Vergleich mit den fast gleichzeitigen Holzschnittwerken von Jobst Amman 2 ) und Virgilius Solis 3 ) nicht scheuen; auch macht Frenzel darauf aufmerksam, daß Aldert von Everdingen Altdorffer's Holzschnitte für seine herrlichen Radirungen zur Fabel des Reineke Fuchs benutzt hat 4 ).
13. Titeleinfassung zu Georg Schmaltzing's Psalter, Rostock 1543, 8°.
Dieser Titelholzschnitt wird von Altdorffer gezeichnet sein und stellt Scenen aus dem Leben des Moses dar: der Zug durch das rothe Meer, der Mannaregen, der Empfang der Gesetztafeln, die Anbetung des goldenen Kalbes, die Aufrichtung der ehernen Schlange u. s. w. H 4 Z. 6 L., Br. 3 Z.
Die nicht unbedeutende Zahl der Holzschnitte Alttdorffer's, so wie die verschiedenartige technische Behandlung derselben beweisen hinlänglich, daß der Meister solche nicht alle eigenhändig geschnitten hat; er hatte mehrere Gehülfen zur Hand, über welche nichts Näheres zu bestimmen ist. Jedoch ist einer dieser Gehülfen, den man einen Schüler des Meisters Erhard nennen möchte, durch die unverhältnißmäßige Größe der Hände und Füße seiner Figuren leicht zu erkennen. Vergleicht man das erste Bild des Schapherderf Kalender, Rostock, 1523 (eine der besten Xylographien des Künstlers) 5 ) mit Holzschnitten von Altdorffer, so wird die zwischen beiden herrschende Aehnlichkeit der Technik leicht ins Auge fallen. Die übrigen Blätter des genannten Buches, freie Copien nach dem 1519 bei Hans Arndes zu Lübeck gedruckten nygen kalender, haben die erwähnten Zeichnungsfehler häufig in hohem Grade; man beachte nur den Fuß der Venus auf Bl. 34 a . Auch in anderen dietzischen Drucken finden sich Formschnitte dieses


|
Seite 121 |




|
Meisters, z. B. in der niedersächsischen Uebertragung des Narrenschiffes, 1519, und in Brunswyck's Wundenartzstedye, 1518. Ferner ist der Titelholzschnitt des Donat aus dem J. 1518 1 ), die Darstellung einer Schule, von ihm.
Jacob Lucius.
Jacob Lucius (Siebenbürger, Sövenbörger, Transylvanus), gebürtig aus Kronstadt in Siebenbürgen, war nicht allein einer der thätigsten Formschneider aus der sächsischen Schule Cranach's, sondern auch ein unternehmender Buchdruder, der nach einander eine Officin zu Wittenberg, Rostock und Helmstedt besaß. Nach Rostock zog er im J. 1564 und übernahm dort die neu errichtete Universitäts=Buchdruckerei, wie es scheint, mit sehr geringen Mitteln, indem der bekannte herzogliche Secretair Simon Leupold die Papierlieferung für ihn besorgte und den Verlag seiner Drucke erhielt 2 ). Später druckte Lucius für eigene Rechnung; sein Hauptwerk ist die niedersächsischeBibel vom J. 1580.
Auf den Formschnitten des Jacob Lucius finden sich verschiedene, größtentheils aus den Buchstaben J. L. C. und J. L. C. T. (Jacob Lucius Corona Transylvanus) bestehende Monogramme, welche im 1. und 2. Bande von Brulliot's Dictionnaire des Monogrammes zusammengetragen sind. Es ist jedoch mehrfach bemerkt worden, daß nicht alle jene Zeichen diesem Künstler, sondern theilweise auch dem sächsischen Meister Johann Thüfel angehören; dagegen wird das bei Brulliot I., Nr. 3195 besprochene Monogramm Lucius zuzuschreiben sein, wenn man nicht annehmen will, daß es einem Formschneider gehöre, der ihn stets begleitete.
Es sollen hier nur die wichtigsten von den Holzschnitten beschrieben werden, welche Lucius während seines Aufenthaltes in Rostock fertigte, und verweise ich seiner ferneren Leistungen wegen auf die Kunstschriftsteller, als Brulliot I, Nr. 1342, 2721, 3197 a ., 3267, und II, Nr. 1570, 1708 b .; Heller, Geschichte der Holzschneidekunst, S. 134; Nagler's Künstlerlex., Bd. 3, S. 117, und Bd. 18, S. 281; Naumann's Archiv, II, S. 251; R. Weigel's Kunst=Catalog, Nr. 8521, 9948, 18335, 20118.


|
Seite 122 |




|
1. Der Stammbaum des meklenburgischen Fürstenhauses vom J. 1578.
Dies vortreffliche, nur in wenigen Exemplaren erhaltene Formschnittwerk besteht aus sieben Stöcken und ist 70 Zoll 2 Linien lang und 20 Zoll 4 Linien breit. Die Ueberschrift (in fünf Zeilen) lautet:
Der Durchleuchtigen Hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Der Hertzogen zu Meckelnburg, Fürsten zu Wenden, Graffen zu Schwerin, der Lande Rostock vnd Stargard Herrn, GENEALOGIA oder Stamm Register, aus bewerten vrkunden vnd documenten, von ANTHYRIO biß auff den jetzigen Reqierenden Landesfürsten HERTZOG ULRICHEN zu Meckelnburg, zusamen verfasset vnd gezogen.
Die Stammtafel ist von einer etwa zwei Zoll breiten Einfassung umgeben, in welcher Kriegsrüstungen, Trophäen, Symbole, Namenszüge u. dgl. sehr sauber ausgeführt sind; oben in der Randleiste befindet sich das meklenburgische Wappen mit den beiden Greifen als Schildhaltern. Links unten in der Einfassung:
Corneliusi Cromenei pinxit. 1 )
rechts unten:
Jacobus Lucius Tranr. sculpsit,
dann die Unterschrift:
Gedruckt zu Rostock, durch Jacobum Kucium Siebenbürger.
Ein Exemplar ist im großherzogl. Archive zu Schwerin 2 ), ein zweites auf der Regierungs=Bibliothek daselbst.
2. Bildniß des Herzogs Ulrich von Meklenburg vom J. 1582.
Der Holzschnitt, welcher höchst wahrscheinlich von Lucius herrührt, stellt den Herzog mit Hut und Mantel als Brustbild dar und ist vortrefflich gelungen. Als Ueberschrift:


|
Seite 123 |




|
Von Gottes Gnaden Vlrich Hertzog zu Meckelnburgk, Fürst zu Wenden, Graff zu Schwerin, der Lande Rostock vnnd Stargard Herr.
Unten:
15 E. 82. H. G. V. V. G. 1 )
H. 7 Z. 11 L., Br. 6 Z. 5 L. (ohne Ueberschrift).
Exemplare im Großherzogl. Archive zu Schwerin und in der Bibliothek der Ritter= und Landschaft zu Rostock 2 ).
3. Die Wappen der wendischen Städte Lübeck, Hamburg, Rostock, Stralsund, Wismar und Lüneburg.
Die Wappen der genannten sechs Städte stehen zusammen auf der Rückseite des Titels der 1580 von Lucius gedruckten niedersächsischen Bibel. Der saubere Holzschnitt in 4° ist mit dem bei Brulliot I, Nr. 3195 erwähnten Monogramme versehen und hat die Ueberschrift:
INSIGNIA SEX CIVITATUM VANDALICARUM 3 ).
4. Das meklenburgische Wappen.
Das gut geschnittene Wappen kommt häufig in den bei Lucius gedruckten Verordnungen vor. H. 3 Z. 7 L., Br. 3 Z. 4 L.
Der eben erwähnte Formschnitt von Lucius ist eine veränderte Copie des größeren meklenburgischen Wappens, welches zusammen mit einem kleinen Wappen im J. 1552 nach Zeichnung des jüngeren Cranach 4 ) in Wittenberg in Holz geschnitten und zuerst in der meklenburgischen Kirchenordnung desselben Jahres angewendet wurde. Das kleine Wappen, von zwei sitzenden Löwen getragen (H. u. Br. 2 Z. 11 L.), steht unter dem Titel; das größere (H. 5 Z. 6 L., Br. 3 Z. 11 L.) befindet sich auf der zweiten Seite. Das letztere hat in der
Herr Gott verleih vns Gnade.


|
Seite 124 |




|
linken Ecke unten das Zeichen der geflügelten Schlange. Die Berechnung der Ausgaben für die Zeichnung und den Schnitt ist in Jahrb. V, S. 228 mitgetheilt.
Eine nur rohe Copie des großen meklenburgischen Wappens findet sich in der 1572 von Johann Stöckelman und Andreas Gutterwitz zu Rostock gedruckten kurländischen Kirchenordnung.
Der Monogrammist D.
Von diesem unbekannten Künstler, dem Gehülfen des Jacob Lucius, kennt man bis dahin nur eine aus 51 Holzschnitten bestehende Folge in dem Buche: Imaginum et Meditationum sacrarum Libri III. Nathan Chytraeus. Rostochii per lacobum Lucium. Anno M. D. LXXIII. Die Holzschnitte enthalten Darstellungen aus dem alten und neuen Testamente, beginnen mit der Schöpfung und endigen mit dem Weltgericht. H. 3 Z. 9 L., Br. 2 Z. 7 L. Das Monogramm D findet sich auf Bl. 29: Christus wäscht den Jüngern die Füße.
Auch Lucius wird an dieser Folge Theil haben.
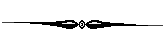


|
Seite 125 |




|



|


|
|
:
|
XI.
Der
im sechszehnten Jahrhundert
in Meklenburg gebräuchliche
Cisiojanus.
Mitgetheilt
von
Wiechmann=Kadow
M it dem Namen Cisiojanus bezeichnet man bekanntlich eine gewöhnlich gereimte Zusammenstellung der Namen von Heiligen oder einzelner Sylben dieser Namen zu dem Zwecke, um durch solche Reimsprüche die Fest= und Heiligentage jedes Monats dem Gedächtnisse leichter einzuprägen. Das Wort Cisiojanus (seltener Cisianus) bildet den Anfang der aus zwei Hexametern auf den Monat Januar bestehenden lateinischen Zusammenstellung, nämlich:
Cisio, Janus, Epi, sibi vendicat, Oc, feli, Mar, An, Prisca, Fab, Hang, Vincenti, Paulus, nobile, Lumen,
und ist aus dem eigenthümlich abgekürzten Worte Circumcisio (Beschneidung Christi, früher der 1. Januar) und aus dem Namen des Januar, Janus, entstanden. (Man vgl. noch des Schulraths Grotefend Abhandlung über den Cisiojanus in Ersch und Gruber Encyklopädie, Bd. XVII, S. 295 flgd., und Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Hannover, Jahrg. 1855, S. 184.) Der erwähnte lateinische Cisiojanus war auch bei der meklenburgischen Geistlichkeit gebräuchlich und findet sich z. B. in den Kalendern des Ordinarius Swerinensis 1519 und des Breuiarium diocesis Tzwerinensis 1529.
Der älteste deutsche Cisiojanus, den man bis dahin kennt, ist der im 14. Jahrhundert von Hermann, dem Mönch von Salzburg, verfaßte, dem andere von Oswald von Wolkenstein


|
Seite 126 |




|
(gest. 1445), Konrad von Dankratsheim (1435) und verschiedene von unbekannten Dichtern folgen; Franz Pfeiffer hat solche im Serapeum 1853, S. 145 flgd. zusammengestellt. Gedruckt wurde der Cisiojanus zuerst im J. 1470 von Günther Zainer zu Augsburg (vgl. Panzer's Annal. I, S. 59). Ich theile hier einen Cisiojanus in niedersächsischer Sprache mit, welcher in dem 1523 von Ludwig Dietz zu Rostock gedruckten schapherders Kalender vorkommt und lasse zugleich unten die abweichenden Lesarten eines wahrscheinlich zu Lübeck gedruckten Bedebock von 1548 folgen 1 ).
Januar.
Nyyars dach darna Dre konyng qwemen myt der vart, Felix merton 2 ) prisca fab ang vyncent ok Pawel do he bekert wart.
Februar.
Den Lycht Blasus ag Dorothe Ap Scho wart bekanth, Valent darna so vyrest du Petrum Mathyam tho hant.
März.
Ruwe bichte vasthe vor dyne funde 3 ) Gregorges pawes Gerdrud, yuncfrow Benedictus Maria hylgeystes brud.
April.
Ey paschen Ambrosy du hoch ghelerde biscop Tyburci, vnde strenge rydder Jurgen march byddet vor my 4 ).
Mai.
Philyp crutze god Johannes ewangelyst, bringhet vns des meyes lust, dama eyn grot frunt Vrban, den famer begunt.
Juni.
Dat wy goth eren altydt, des help vns 5 ) Barnabas myt Byt, efke to hulpe de rydder Johan jo dor lycht Pe Pau 6 ).


|
Seite 127 |




|
Juli.
Ach Maria vynde 7 ) Wyl Kylyan, help dat 8 ) Margret Apostel vns by styan 9 ), myt Magdalen Jac Anna Pan Mar abdon.
August.
Petrus Steffanus gy vns schaffen Laurentz dat wy, Marien eren ock den heren Bartolmeum aug Johannes.
September.
Nu lath vns denken so vort Marien gheborth des Crutzes leer, Lambert noch mer Mat Mauris vorsten wys Cos dam 1 )) Mich ier
October.
Remigi Franciscus darto Dyonysyus Calix Galle, Lucas de Eluen Seffrin 1 )) Crispyn help 1 )) Simon iude.
November.
Al zelen vorget nicht an dyn ghebet 1 )) Marthn mylde man, hochgebarn ylßbe Marya Clemens Katheryna vort An.
December.
O hylge Barbar Nicla Maria vnde Lucia, myt frowden bring vns Thomas dat fest Crist Steff Jo Kynder dach fyl 1 ).
Schließlich bemerke ich, daß im Munde des meklenburgischen Volkes bis auf den heutigen Tag einzelne Sprüche zum leichteren Behalten verschiedener Folgen von Sonntagen fortleben, z. B.:
für die Sonntage zwischen Ostern und Pfingsten:
Quasimodogeniti Misericordia Jubilate Cantate Rogate Exaudi.
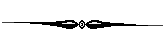


|
Seite 128 |




|



|


|
|
:
|
XII.
Niederdeutsche Andachtsbücher.
A.
Zwei Fragmente niedersächsischer Andachtsbücher
von
C. D. W.
E s ist wunderbar, wie wenig sich alte Manuscripte in Meklenburg erhalten haben. Gegen Ausgang des 16. Jahrhunderts nahm man ein Inventarium der in der Kirche der Dominicaner und der Marienkirche zu Wismar befindlichen Bücher auf, anscheinend aber nur, um sie desto gewisser dem Untergange zu übergeben. Dort hat sich auch unter den Actenmänteln, wozu man die Pergament=Manuscripte vorzugsweise benutzte, fast nichts von Interesse erhalten, als viele Fragmente von der schon früher in diesen Jahrbüchern von Dr. Lisch veröffentlichten niederländischen Handschrift (vgl. Jahrb. VIII, S. 214), ein Bogen aus einer lateinischen Papst= und Kaiserchronik und die nachstehenden beiden Fragmente aus niedersächsischen Andachtsbüchern, deren Veröffentlichung die Seltenheit vaterländischer Sprachdenkmäler dieser Art aus früherer Zeit rechtfertigen mag.
1. Fragment eines Gebetbuches.
Dasselbe besteht aus einem in Sedez gebrochenen Blatt Pergament, 4 Zoll breit und 4 3/4 Zoll hoch. Die Seite enthält 15 Zeilen. Die Ueberschriften find roth, die Anfangsbuchstaben der Gebete abwechselnd blau und roth. Außer den Gebeten enthielt das Manuscript noch "die sieben Freuden U. L. Frauen", wie der Schluß besagt.


|
Seite 129 |




|
| A. | Noch neen tuaghe mach vtspreken. Eya, here, hilghe gheist, de du dat reyne lif diner leuen moder marien heft ghehilghet vnde dar to formeredest, dat se vntfeng godes sone an dyner kraft, so troste my huden, here, hilghe gheist, myt dyner gnade, dat ik den hilghen licham vses heren ihesu cristi myt reyner samitticheit mote vntfan vnde myt vlite ene an myner sele bewaren, dat ik en del mote heb |
| b. |
ben myt den hilghen, de an deme
hemmelrike synt. amen.
Dith beth sprek, wan du heft godes licham vntfangen. H elp my, here, hemmelsche god, De spise de ik an myne munt ghenamen hebbe, dat ik se also beholden mote myt ynnicheit mynes herten vnde myt enen reinen wulenkamen leuende, dat ik dar van ghereyneghet werde binnen vnde buten van allen vlecken, de an my schedelik synt. amen. |
| B. | M ilde got, ihesu crist. wes my armen sunderinnen gnedich, wente ik hute dinen hilghen licham vntfanghen hebbe vnde dyn hilghe blot. So vorbarme dy auer my vnde danke dy, dat du my ghespiset vnde lauet heft myt dime hilghen vlesche vnde myt dime duren blode nicht van myner werdicheit men van dyner ouerblodighen (sic!) milden barmherticheit, so bidde ik dy vnde mane dy, dat du |
| b. |
di willest vorbarmen auer my armen
vnwerdighen mynschen, dat ik mit desser
kreftighen spise erwerdighen mote van
vntfan aflat van alle mynen sunden vnde
enen vullenkamen ende. AmeN
Vser leuen vrouwen vij vroude sint hir vte, dar to gude bede van deme hilghen lichame. amen. |
2.
Dies Fragment ist ein Pergamentbogen von 10 Zoll hoch und 15 Zoll breit, der einmal in der Mitte gebrochen ist. Jede Seite enthält zwei Columnen, jede Columne 30 Zeilen. Die Anfangsbuchstaben der Abschnitte sind abwechsetnd roth und blau. Die Schrift ist eine schöne gothische Minuskel, die


|
Seite 130 |




|
Anfangsbuchstaben der Sätze sind roth durchstrichen. Nach manchen Formen dürfte der Verfasser kein Meklenburger gewesen sein.
| A. | A. don wolde. komet en ander vnde hindert dat, |
| a. 1. |
de deit also grot sunde, also he it eme
vte der hant neme eder stele eder
rouede. Kint leue, du scalt neman ten
van guden dingen vnde scalt nene gude
werk hinderen.
D at was en here, de hadde enen sone, de was nies ridder gheworden, den had he sere lef. de iunge ridder scolde to ener tyd riden to dem torneye vnde quam to eme moneke closter; dar horde he godes denste. dar sach he so grote innicheit vnde hillicheit van den moneken, dat he alles dinghes sic bigaf vnde bleif aldar. dar quam de vader vnde wolde den sone vtem closter hebben vnde louede eme vele vnde bat ene sere. dat en halp nicht he wolde io nicht dar weder vth. Do drowede de here, dat he dat closter bernen wolde. eder he wolde sinen sone weder hebben, do spreken de moneke. Juwe sone mach kesen, welker he don wille. Do sprac de sone to deme vadere. vader, gi willen mi ten van |
| 2. |
godes denste to der werlde idelcheit
vnde louen mi grote dinc. Kunne gi ene
wonheit afleggen, de in iuweme lande is,
so wil ic don, wat gi willen. Do sprac
de vader, wat wonheit is dat. De sone
sprac, dat is en wonheit, dat de lude
allike steruen, de iungen alse de olden,
de rike alse de armen. legget dat af, so
wil ic weder to iv komen vnde anders
nicht. Do de vader dat horde, do
bidachte he sic vnde let dar van, vnde
toch den sone nicht mer van godes
denste. kint leue, du schalt oc neman
ten van godes denste. do suluen wat
gudes, wente du kanst nicht weten, wo
langhe du leuest.
D e verteynde vromde sunde dat is mort. so we enen minschen mordet mit vnrechte eder wo he dat to weghe bringhet, dat en minsche lif los wert, de is sculdich alle der sunde, de de minsche noch scolde hebben gebetert. he is ok sculdich alle der ghuden werc, de he mochte hebben gedan |


|
Seite 131 |




|
| b. 1. |
ofte he gheleuet hedde, vnde wert de
minsche vordomet, des is he oc sculdich
vnde heuet dat swarliken to beterende.
D at gheschach, dat en vrowe was, de hadde ene eghene maghet, der brachte se so vele drofnisse to, dat se sic seluen van dem liue dede van groter drofnisse weghen. der sunde was de vrowe delaftich K int leue, kanstu ienige vromde sunde mer ghedenken, der du en orsake heuest ghewesen vnde en ambegin, dat schaltu alto male bichten vnde beteren na diner macht. vnde der sunde mogen wesen vele, dar du en orsake heuest to ghewesen, der du seluen nicht en weist, de got an di weit, vnde de hemeliken sunde, de en minsche seluen nicht en weit, de doch hemeliken an eme sint, De scaltu aldus bichten, dat se di van alle dime herten leit sin, vnde dat du se wistes, dat du se gherne al sunderliken bichten woldest, vnde schalt gode alle dage bichten dine hemelken sunde vnde dine vrom |
| 2. |
de sunde, vnde spric mit koning dauite:
ab occultis meis munda me, domine, et ab
alienis parce seruo tuo. here got,
renige mi van minen hemelken sunden,
vnde scone mi van vromden sunden. Desser
sunde, der en minsche nicht en weit, de
sint schadeliker, mer wan he se wol
wiste, wente dat vur, dat in miner
kisten leghe, vnde ic des nicht en
wiste, dat were mi scedeliker, wan ic
dat wol wiste. den viant, den ic nicht
en kenne, de mach mi vil scedeliker
wesen, wan den ic wol bekenne. also is
it vmme de sunde, de ic wol weit, de
mach ik hir wol beteren in desseme
leuende, der sunde, de ic nicht ne weit
vnde doch hemelic an mi sint, de en
betere ik nicht, de mut ic beteren to
ienem leuende.
D at was en wokener, de gaf sunte faronius enen roc, den nam he van dem wokenere vnde wiste des nicht, dat he en wokenere was. Sunte faronius starf. do quemen de engele vnde wolden sine sele hebben. do quemen |


|
Seite 132 |




|
| B. | en ghut ende. |
| a. 1. |
K
int leue, nim in din herte vnde
bedenke dat dicke, dat na dessem leuende
nen tid mer en is to beteringe. dar vmme
do wat gudes de wile, dat du leuest vnde
gud don machst, er di desse tit vntgeit.
D at was en ensedelinc in eme wolde, de plach kronen to makene, de vorkofte he. dat was sine neringe. To ener tid droch he kronen in de stat vnde wolde se vorkopen, vnde quam to enes riken mannes hus, de lach vnde seletogede. Dar sach he, dat dar quemen riden lude, de gloenden vnde branden also en vur vnde ere perde branden. se leten ere perde stan vor der dore vnde gingen in dat hus. Do dat de rike man sach, dat se quemen to eme, do bigan he to ropen, here got, kvm mi to helpe, ic wil gerne min leuent beteren. Do spreken iene, dat is nv to spade, vnde lepen to vnde togen eme de sele vtem liue vnde vorden se mit sic hen. Kint leue, sine ruwe was nicht van rechter |
| 2. |
leue to gode. Kint leue, denke an den
iamerliken dot der sundere, de mit
iamere van henne sceden vnde eres iamers
wert numbermer en ende.
E n hillich ensedelinc bat vnsen leuen heren, dat he eme wisede, wo enes sunders sele sceden scolde van deme liue. Do quam en wulf vnde nam ene bi sime clede vnde ledde ene in ene stat. dar sach he stan de lude, de weneden ouer enem doden, vnde sach, dat de viande quemen vnde togen eme de vtem liue mit gloenden krowelen, vnde vorden se in de helle. Kint leue, bedenke gherne dinen dot, so en deistu number ouele, so wert di licht to lidende alle bote vor dine sunde. D at was en ridder, de hadde vele grote sunde ghedan, vnde quam to eme pawese vnde bichtede, vnde alle de bote, de he eme sette, de was eme io swar. Do dede eme de pawes sin vingerin, dat scolde he vor alle sine sunde dregen in siner hant, vnde also dicke, alse he dat vingeren an sege, so scolde he io den |


|
Seite 133 |




|
| b. 1. |
ken sinen dot, dat he io steruen moste
vnde ne wiste nicht weder dalinc eder
morne. he nam dat vingeren vnde droch it
ene wile vnde dachte, dat he io steruen
moste, vnde wiste nicht, welke tid. vnde
quam weder to dem pawese vnde sprac, he
wolde gerne alle bote vntfan, de he eme
setten mochte. Dar vmme, kint leue,
bedenke gherne dinen dot vnde wat din
licham werden schal na dessem leuende.
so vorgheit di aller werlde vroude vnde
allerhande giricheit.
D at gescach to ener tid, dat men enes riken mannes graf vp gruf. Do vunden se vor sinem munde enen groten breden worm, de at eme an antlat. do dat sin sone sach, do vortech he al sin ghut vnde gaf dor got vnde wanderde alle de werlt vmme also en arme pelegrime. to lesten quam he to rome to eme cardinale to der bicht vnde seghede eme sin leuent, dat he rike hedde ghewesen vnde to em queme dor gnaden willen also en arme minsche. Do nam |
| 2. |
en de cardinal in sinen hof vnde gaf eme
de almosen vnde wisede eme ene stede
vnder ener treppen. dar lach he vnder
unde hadde en hillich leuent, dat alle
de clocken, de to rome weren, lodden van
sic seluen, do he starf.
K int leue, du scalt gerne denken de vnwisheit dines dodes, wente nicht also wis en is also de dot vnde nicht also vnwis also de tid des dodes D at was en koning m kreken lande, de plach number to lachene, he was iummer drouich. des wunderde al sinen ghesinde. des en dorste eme nen man vragen, welc de sake were. Des ginge sin broder to dem koninge vnde vragede, wat de sake mochte sin, dat he number vro en worde. Do sprac de konning to hus, morgen wil ic di de sake seggen. he ginc to hus. Des auendes sande de koning vor sines broders hof en horn vnde leit dat blasen. dat horn plach men to blasen ouer de lude, de men doden scolde. Do iene dat horn horde, do wart be sere bedro |


|
Seite 134 |




|
B.
Drei Fragmente niederdeutscher Andachtsbücher
aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,
mitgetheilt
von
G. C. F. Lisch
In Jahrb. X, S. 375 flgd. ist ein Fragment eines alten Evangelienbuches mitgetheilt. Es folgen hier, in Veranlassung der vorstehenden Mittheilung, einige andere, im großherzoglichen Archive zu Schwerin aufgefundene Fragmente von ähnlichen Büchern, welche nicht viel jünger sind, als jenes, und alle ungefähr aus einer und derselben Zeit, aus der zweiten Hälfte des 14, Jahrh., stammen.
1. Niederdeutsches Erbauungsbuch,
auf Pergament, zwei Blättchen, in Sedez, 5 Zoll hoch und 3 1/2 Zoll breit, 16 und 17 Zeilen auf der Seite, in einer kräftigen Minuskel, mit rothen Ueberschriften und rothen und blauen Anfangsbuchstaben:
| A. | denken sîne martele vnde sînen dôt. De andere sâke is, dat got môghe belônen vnsen lôuen, vnde is en grôt gûde gôdes; wente got wil vns belônen dâr vmme, dat wy lôuet, des wy nicht en seen. De dorde sâke is, dat got vns môge mâken . . . ghen van vnsen sunden. wente . . . . . . . . . aller . . . . . . nicht . . . . . wardich, so mo . . . seke vorderuen . . . godes lîcham vns dat grôteste heyl vnde arstedie, dat wy . . môghen hebben. |
|
|
|
| b. | U nse here Jhesus Cristus sprekt in deme êwangelio: Sâlich sint de armen des ghêstes, wente dat rîke godes is ere. Dâr up sprek Gregorius: De armôd is des gheistes, vnde nicht in der grôte des lîdendes. Gregorius sprekt: Sâ- |


|
Seite 135 |




|
| lich is . . . grepen . . . gûdes . . . . . . desser werlt, men de beg . . . t . . . kende in deme hemmeleschen gûde. Gregorius sprekt: De armen sint nicht to hebbende alse de bederueghen, men se sint an se to bedende alse an . . . . | |
|
|
|
| B. |
borghenen dink sîner danken, vnde
vorvullet de selschop der engele vnde
beholt dat êweghe rîke. (Jhesus vorbarme
dy ôuer my.)
S âlich sint, de dâr lîden vorvolghinge dor de . . . . . hticheit, wente de hemmel is ere. G . . . . . s .. ighet d . r d . . du . . . . . rer, wen dat . . . te . . e wnder do. G . . . drîer hande wys wer . . . de dogt . . der . uldicheit vnde des . . . gheeruet ener . . de wys lîde wy van gode, ander wys lîde wy van vnseme nêghesten, ander wys lîde wy van deme olden vîende. Van gode lîde wy de tochrôden, van vnseme nêghesten lîtde wi vorvolghinge vnde schâden, vnde vorsmâheit, van deme olden vîende lîde wy vele vnde menegher hande bekôringe. Bernardus. Dat is en sachtmôdiger mynsche, de dâr gh . . . me . . t vnde also vel . . . is wil he num . . . schâden, vnde dat is ên lîdende mynsche, de dâr ghift nicht quat vmme quat, men he mach ôk lîden den schâden; vnde dat is ôk ên vredesâm mynsche, de dâr ghift gût vmme quat, vnde ôk is . . . . . . rômende de |
2.
Niederdeutsches Gebetbuch,
auf Pergament, ein Blatt, in Sedez, 5 1/4 Zoll hoch und 3 1/2 Zoll breit, ein Blättchen, 17 Zeilen auf der Seite, in einer etwas stumpfern Minuskel.
| A. | vorghif vns vnse sunde, dat wy werdichliken vntfân dînen hilghen lîcham vnde dîn blôt mit wâreme lôuen, myt yaster hôpene vnde royt vulle- |


|
Seite 136 |




|
| kômener lêue. Ere si deme vâdere, de vns gheschâpen heft, sône, lôsere der werlde, vnde got, de du dik suluen hefft ghebôden to êner spîse aller trûwen vnde du hefft berêt [vôr] myneme ansichte den disch wedder alle, de vns bedrôvet: wes vs gnedich vnde lôse vs van alleme ôuel, de dâgheliken | |
| a. | ôuer vs wascet, dat wi dat vntfân mit lû[tere]n danken. Ere si deme sône, de vs ghelôset heft. O hilghe ghêst gotdes; in gode vrouwet des mynschen herte, dat is to hanghe myt gode. vnde enghelt werde myt em: wes vs gnedich. Vnde dô vs nicht na vnsen sunden, sunder mit der vroude dînes aldersôtisten ghêstes. Vorvulle de inwendicheit vnser sêle. Ere si deme hilghen ghêste de vs ghehilghet heft. O hilghe drêualdich |
3.
Niederdeutsches Passional,
auf Pergament, in Groß Octav, 9 Zoll hoch und 6 Zoll 6reit, zwei Blätter, 21 Zeilen auf der Seite, in einer breiten Minuskel, mit rothen Anfangsbuchstaben (aus den Ribnitzer Acten):
| A. | mâken van der iôden walt. Do swêch mîn kynt vnde sprack nicht ein wort. Du Anselme, do nam de koninck de krône van sîme hôuede vnd settede se mîme kynde vp syn bilge hôeuet vnde swôr bi sîner koninckliken êre, dat he ein têken dêde, so wolde he ejn syn konninckrîke mede dêlen alse ême erfkynde. Do swêch myn kint vnde wolde nicht spreken. Dat vorsmâde Herodes also sêre, dat he hête ene van sic bringen vnde sede, myn kint wêre ein dôer, des wîsheit is ein [a]fgrunde alle den to begrîpende, dede konen wîsheit der werlde, vnde bespottede myn kint den âne vnderlâet, de hilgen engellen lâuen vnde singen em: sanctus, sanctus, sanctus, vnde sîne knechte hêlden en vôr einen dôeren, des râet de hemmelsche vâder nam, do he schop alle creatûren; dâr pa lêt de koninck em ein |


|
Seite 137 |




|
| wyt kleit an thên to ênem têken, dat he wêre ein dôre, de dat firmament klêdet myt der | |
| a. | sonnen vnde myt den sternen vnde mit dem mânen vnde de engellen myt ondôetlicheit, vnde sande myn kind wedder to Pilatus, de allêne de walt heft van synen êwigen vâder, alle creatûren to sendende to der êwigen pîne. Vnde do wart koninck Herodes Pilatus frunt vmme dat, dat he em myn kint hadde gesant. Do myn lêue kint wedder to Pilatus quam, do hadde Pilatus myn kynt gerne gefrîet vamme dôde vnde sprack to den iôden: ghi heren, gi hebbet einen wônheit, dat men iw to desse[r hô]chtît einen minschen scal lôes geuen; nu kêset: wille gi hebben Jesum, an deme ick kêne scult envinde, edder willen gi hebben Barrabam, de syn lyf myt rechter bôseheit vorwrocht heft? Do rêpen se mennichlick, dat me myn lêue kynt hengeden an den galgen vnde crûsegeden ene. Do sede Pilatus: wat heft he gedâen, dâr vmme he steruen scal? ick vinde nêne |
| B. | schult an em, dâr he den dôet mede vordênet hebbe; wille iw dâr an genôgen lâten, dat ick ene tuchtege vnde lâet en lôes? Do rêpen se wedder mit lûder stemmen, dat me ene scolde hengen an ene galgen vnde crûcigen ene. De wîle Pilatus myt mime lêuen kinde aldus beworren was, do sande sîne vrouwe to em vnde bôt em, dat he vnbeworren were mit deme gûden minschen mîme kinde, wente se hadde alle de nacht dor em grôt vngemack geleden, also vele wêren er vôrkâmen an deme slâpe. Do dachte Pilatus, wo he de iôden stillede, dat se ene lêten leuen, vnde lêt myn hartelêue kint binden an êne sûle vnde lêth starke lûde dâr to gâen vnde lêt myn kint slâen mit geiselen vnde mit rôden, dat van sîme hôuede bet an sînen versen nicht gantzes enblêf. Ancelme, dat ick di nu segge, dat is alto iâmerlick. De sûle, dar se myn lêue kint vmme bunden, de was al |
| b. | so dicke, dat se min kint nergen na konde vmme grîpen bi twên spennen lanck. Do nêmen se starke rêpe vnde bunden vmme sîne lêuen hende, mit den he sînes vaders vîande wîsen scal in de |


|
Seite 138 |




|
| grunt der hellen, dat se em worden blou, als ein dûc, vnde tôgen se to sâmende mit grôter walt, dat em sîne âderen begunden to knakende. Dâr na nêmen de riddere scarpen dorn vnde wunden êne krône, de was also scharp, dat se nûment mochte antasten, em enschûde wê: de krône slugen se mîme lêuen kinde an sîn hilge hôeuet, de dâr is êne krône, mit der sîn êwige vâder lônet alle hilligen, dat em sîn blût van sîme hôuede an dûsent enden vlôet âuer sîn antlet vnde âuer sîne ôgen, dat he nu syn alderlêueste mûder nicht mochte anseen, doch ick konde ene nich bekennen an sîme antlate, vnde gêuen em ein rôer in de hant tho ênes koninges têkene, dat se sîne walt mede |
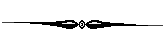


|
Seite 139 |




|



|


|
|
:
|
XIII.
Des
rostocker Professors Nathan Chytraeus
plattdeutsches Wörterbuch. 1582.
Mitgetheilt
von
G. C. F. Lisch.
B ei den neu erwachenden, eifrigen Bemühungen um die Erforschung und Wiederbelebung der plattdeutschen Sprache und Litteratur ist es von Wichtigkeit, ein Buch wieder hervorzuziehen, welches lange Zeit hindurch viel benutzt und häufig aufgelegt ward: das lateinisch=plattdeutsche Wörterbuch des Professors Nathan Chytraeus, unter dem Titel: Nomenclator latinosaxonicus, ohne Angabe des Verfassers auf dem Titel. Das Buch ist in 138 Abschnitten nach Materien geordnet, in Octav, in gespaltenen Columnen gedruckt und enthält immer die lateinischen, selbst seltenen Ausdrücke, bei welchen immer der Schriftsteller citirt ist, und daneben die plattdeutsche Uebersetzung. Die Uebersetzung ist häufig eine Umschreibung, welche entweder lateinisch oder hochdeutsch gedacht ist, und man kann es überall sehr leicht merken, daß der Verfasser kein geborner Meklenburger 1 ) war; daher ist die plattdeutsche Uebersetzung häufig nicht aus dem Munde des Volkes geholt und oft von untergeordnetem Werthe: immer aber ist das Buch mit seinen vielen Auflagen eine dankenswerthe und merkwürdige Erscheinung.
Da ich Veranlassung gehabt habe, wegen einiger Ausgaben Forschungen anzustellen, so will ich hier das Ergebniß meiner Bemühungen sicher stellen, da es manchem anderen vielleicht schwer fallen möchte, die leitenden Hauptrichtungen zu verfolgen.
Megapolis, Mekelnborch.


|
Seite 140 |




|
Das Buch hat folgende, oft vermehrte zwölf Auflagen erlebt.
1. 1582. Rostock (wahrscheinlich bei Stephan Myliander. Dies ist die erste Ausgabe.
Die in den spätern Auflagen oft wieder
abgedruckte Dedication ist: "Rostochio Cal.
April. Anno etc. 1582" und die Vorrede:
"Rostochio, Anno MDXXCII idib. Martiis.
Natali meo trigesimo nono." von Nathan
Chytraeus datirt. Vgl. Bibliotheca Christ. Frid.
Schmidii Rectoris Johannei Luneburgensis. Luneb.
(1748), p. 609, mit dem Titel: Nath. Chytraei
Nomenclator Latino - Saxonicus. Latinisch vnde
Pladdütsch Vokabelnbock. Rostock 1582. 8°. Vgl.
Kinderling f. Deutsche Spr., Litt. und Cult.
 . S. 101. Vgl. v. Auffeß Anzeiger,
1833, S. 158, nach einem Exemplare auf der
Bibliothek zu Breslau, nach Hoffmann v. F.
. S. 101. Vgl. v. Auffeß Anzeiger,
1833, S. 158, nach einem Exemplare auf der
Bibliothek zu Breslau, nach Hoffmann v. F.
2. (1585?) Rostock, bei Stephanus Myliander.
Dies ist die zweite Ausgabe, welche in einem Exemplare auf derUniversitäts=Bibliothek zu Rostock vorhanden ist. Der Titel nennt diese Ausgabe ausdrücklich die zweite. Leider ist in dem Jahre der Herausgabe auf dem Titel ein Druckfehler, so daß nicht mit Sicherheit das Jahr 1585 als das Jahr der zweiten Ausgabe angenommen werden kann. Der Titel lautet vollständig nämlich:
Nomenclator latinosaxonicus. Editio secunda paulo priore locvpletior. Rostochii. Typis Stephani Myliandri. Anno CI
I
XXV.
Dies heißt 1525; es versteht sich von selbst, daß dieses Jahr nicht richtig sein kann, da N. Chytraeus 1582 erst im 39. Jahre seines Lebens stand. Ich nehme daher an, daß beim Setzen des TitelS ein C ausgefallen ist und daß das Jahr der Herausgabe richtiger hätte lauten sollen:
 I
I
 XXCV d. i. 1585.
XXCV d. i. 1585.
Hierauf leitet nicht nur das Verhältniß dieser Ausgabe zu den übrigen Ausgaben, sondern auch ein Widmungsgedicht an Cajus Rantzow, welches: "Rostochio Idib. April. Anno 1585." datirt ist.
3. 1590. Lemgo.
Diese Ausgabe ist nur aufgeführt in dem Auctions=Kataloge der nachgelassenen Bücher des Professors von der Hagen zu Berlin: "F. H. v. d. Hagens Bücherschatz. Berlin


|
Seite 141 |




|
1857", S. 86, - vorausgesetzt, daß diese Ausgabe nicht mit der Ausgabe won 1596 identisch ist.
4. 1592. Rostock.
Vgl. Feuerlin Wat Plattdütsches, 1752, S. 45; Scheller Sass. Bücherkunde Nr. 1141, mit dem Titel: Nomenclator Latino-Saxonicus denuo editus, Rerum nauticarum nomenclaturis et phrasis paulo plenius insertis.
5. 1594. Hamburg.
Ein Exemplar auf der Rathhaus=Bibliothek zu Leipzig. Vgl. v. Auffeß Anzeiger, 1833, S. 316; Lappenberg Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg, S. 88 und 123.
6. 1596. Rostock.
Vgl. Kosegarten Wörterbuch der Niederdeutschen Sprache, Vorrede, S. IX.
7. 1596. Lemgo.
Vgl. Scheller Sass. Bücherkunde Nr. 1157, und
Kinderling f. Deutsche Sprache,
 . S. 101.
. S. 101.
8. 1597. Lübeck.
Diese Ausgabe des Nomenclator: "denuo editus, rerum nauticarum nomenclaturis et phrasibus paulo plenius insertis, Lubecae Anno 1597", ist angeführt im Rostocker Etwas, 1739, S. 380, und Cat. Bibl. Schmidii, (1748) S. 609.
9. 1604. Rostock, bei Christopher Reusner,
mit einer Zuschrift des Johannes Caselius an Adam Thraciger. Auch diese Ausgabe hat den Zusatz auf dem Titel: rerum naulicarum, nomenclaturis et phrasibus paulo plenius insertis. Diese Ausgabe ist wahrscheinlich auch diejenige, welche im Rostocker Etwas, 1739, S. 319 angeführt ist, welche den Titel nicht, wohl aber die Zuschrift des Johannes Caselius hatte. Aus der Bibliothek des Professors Heyse zu Berlin, jetzt in der großherzoglichen Regierungs=Bibliothek zu Schwerin.
10. 1613. Rostock, gedruckt bei Reusner, im Verlage von Johann Hallerford: "Rostochii, Typis Reusnerianis, sumptibus Johannis Hallerfordii, civis et bibliopolae Rostochiensis". Der übrige Theil des Titels lautet ganz wie der Titel der Ausgabe von 1604. Ein Exemplar befindet sich auf der Universitäts=Bibliothek zu Rostock.


|
Seite 142 |




|
11. 1625. Rostock.
Vgl. Scheller Sass. Bücherkunde Nr. 1238 A. und Kinderling Geschichte der Niedersächsischen Sprache S. 397.
12. 1659. Lübeck.
Nach v. Seelen Athen. Lub. c. XV, p. 392 ließ der lübecker Rector M. Seb. Meier diesen Nomenclator "1569 in usum scholae Lubecensis" neu auflegen; vgl. Rostocker Etwas, 1739, S. 320.
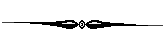


|
Seite 143 |




|



|


|
|
:
|
XIV.
Miscellen und Nachträge.
1.
Ueber eine Heilige des
Nordens.
I n dem Augustiner=Chorherrenstifte zu Bordesholm in Holstein, welches mit den Reliquien des H. Vicelin im J. 1332 von Faldera (jetzt Neumünster) nach Bordesholm verlegt und im 16. Jahrh. aufgehoben ward, sammelte im Anfange des 16. Jahrh. ein Glied des Stiftes Johann mit der Nese (Nase) ("Johannes cum naszo") die Lebensbeschreibungen mehrerer norddeutscher und nordischer Heiligen, welche ohne Zweifel in dem Kloster besondere Verehrung genossen, und setzte denselben einen Kalender vor. Die Handschrift, auf Papier, in Quart, hat den Titel:
"Liber sancte Marie virginis in Bardesholm, ordinis canonicorum regularium s. Augustini, Bremensis diocesis, quem ego frater Johannes cum naszo scripsi in diversis annis. Oretis dominum deum pro me unum Ave Maria".
Durch Zufall ist diese Handschrift nach Oesterreich gekommen und wird jetzt unter Nr. XII, D. 21. in der Bibliothek des Cistercienser=Stiftes zur h. Dreieinigkeit in Wiener=Neustadt aufbewahrt.
Im "Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, neueste Folge, Organ des deutschen Museums"; 1854, Nr. 1, S. 5, und Nr. 2, S. 26, ist der Inhalt dieser Handschrift durch den Cooperator Zeibig zu Nußdorf mitgetheilt.
Das Kalendarium im Anfange enthält nur die Namen derjenigen Heiligen, deren Leben in der Handschrift mitgetheilt ist.


|
Seite 144 |




|
| Jan. | 23. | Gregorii Nazianzeni ep. |
| Febr. | 3. | Anscharii ep. Brem. |
| Maj. | 5. | Godehardus ep. Hildesem. |
| Jun. | 10. | Rymbertus ep. Brem. |
| 30. | Theobaldi conf. | |
| Jul. | 10. | Kanuti regis Dacie. |
| 23. | Liborius ep. | |
| 29. | Olawus rex Norwe. | |
| Aug. | 26. | Habundus ep. et martyr. |
| Oct. | 7. | Birgitta ex Svecia. |
| 16. | Galli confessor. | |
| 24. | Severi ep. et conf. | |
| Nov. | 9. | Willehadi ep. Brem. |
| Dec. | 12. | Wicelinus ep. Oldenburgens. |
| 13. | odocus heremita. |
Interessant sind die beigefügten plattdeutschen Namen der Monate, welche fast alle ihre Namen von Thieren haben.
| Januar: | kalvermaen, hardemaen. |
| Februar: | fosmaen, hornunch. |
| März: | valenmaen, marstimaen. |
| April: | koltenmaen, ostermaen. |
| Mai: | floymaen, meymaen. |
| Junius: | lustemaen, brachmaen. |
| Julius: | hundemaen, howmaen. |
| August: | vleghenmaen, snustmaen. |
| Septbr.: | vnickemaen (?), harvestmaen. |
| Octbr.: | ossenmaen, wynmaen. |
| Novbr.: | swynemaen, slachtelmaen. |
| Decbr.: | hasenmaen, hardemaen. |
Dann folgen die Lebensbeschreibungen der im Kalender aufgeführten Heiligen. Von besonderem Interesse für uns ist der Kalendertag (12. Dec.) und das Leben des H. Vicelin 1 ):
"XXI. Vita beati Wicelini episcopi Oldenburgensis, qui primum altare consecravit in Lubecke et dedicavit ecclesiam sancti Joannis baptistae in Harena, quam comes Adolphus aedificavit"


|
Seite 145 |




|
"In exordio vitae descriptionis beati patris Wicelini opere pretium videtur aliqua de Slavorum populi historico compendio praelibare" etc.
Angehängt ist noch ein kurzes versificirtes lateinisch=plattdeutsches Glossar.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
2.
Ueber den Tod des Schweriner
Bischofs Melchior, Herzogs von Braunschweig,
berichtet der Pastor Andreas Cracovius in seiner Ehrenpredigt auf den Herzog Ulrich II, Administrator des Stifts Schwerin, † 24. Mai 1624, S. 10:
"Es sein S. F. G. gelegt an denselben Orth (in der Thumbkirche S. Elisabeth zu Bützow"), den sie vor zwölff Jahren schon außgesehen hatten, da viel der Schwerinschen Bischöffe begraben liegen. Unter andern findet man einen Leichstein auf dem Chor allhier, da begraben lieget Fürst Melchior von Braunschweig, der vor 243 Jahren allhier den 4 Junii ist beerdiget worden. Die Wort auf dem Stein lauten also:
"Anno Domini 1381 feria qvinta Trinitatis, quae tunc temporis fuit Crastina Beati Bonifacii Sanctus (?), venerabilis in Christo Pater D. Melchior, illustris Dux Brunsvicensis, Swerinensis Episcopus, hic sepultus est".
Melchior ward also am 6. Junii 1381 in der Kirche zu Bützow begraben. Feria quinta ist der fünfte Wochentag, also der Donnerstag. Der Tag des H. Bonifacius fällt auf den 5. Junii. Es wird daher statt: Trinitatis ohne Zweifel: ante Trinitatis zu lesen sein. Dann stimmt alles zu einander: denn der Donnerstag vor Trinitatis fiel im J. 1381 auf den 6. Junii und dies war der Tag nach Bonifacii.
Schröder Pap. M. I, S. 1523 giebt nur die Uebersetzung nach Hederich:
"Im Jahr des Herren M. CCC. LXXXI. Freytag nach Pfingsten oder des andern Tages nach Bonifacii ist der Ehrwürdige Vater in Christo Herr Melchior Hertzog zu Braunschweig und Bischoff zu Schwerin gestorben und lieget alhie begraben".


|
Seite 146 |




|
Diese Uebertragung ist nicht unrichtig; denn der Freytag vor Trinitatis ist der Freitag nach nach Pfingsten. Darin irrt Schröder S. 1543, daß er den Tag auf den 7. Junii setzt, indem feria quinta immer der Donnerstag ist.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
3.
Zur Geschichte der Vitalienbrüder,
von
G. C. F. Lisch.
Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 51 flgd.
In den Beiträgen zur Geschichte der Vitalienbrüder habe ich in Jahrb. XV, S. 57 und 61 ausgesprochen und zu beweisen gesucht, daß die Hauptleute der Vitalienbrüder, so lange die Gefangenschaft des Königs Albrecht dauerte, meklenburgische Edelleute waren, welche die Befreiung des Königs zu erreichen strebten, und daß die berüchtigten, eigentlichen Seeräuber erst nach der Befreiung auftraten. Dieser Ausspruch wird in seinem ersten Theile richtig sein, leidet jedoch in seinem zweiten Theile wohl eine Beschränkung. Es ist nämlich nicht zu bezweifeln, daß, so lange die Befreiung des Königs beabsichtigt ward, die meklenburgischen Vitalienbrüder in offener, angesagter Fehde eine rechtlich anerkannte Kaperei trieben; es ist aber auch gewiß, daß manche von ihnen auch nach der Befreiung des Königs die Kaperei nicht aufgaben, sondern, wie die berüchtigten Seeräuber, das Handwerk der Seeräuberei noch lange forttrieben. Dies beweiset eine Stelle in Burmeister's Alterthümern des Wismarschen Stadtrechts, S. 85 flgd., welche ich bei meinen Forschungen übersehen hatte. Es heißt nämlich in dem hanseatischen Recesse vom J. 1422:
Item sanden de stede ichtes welk râdessendebôde to der Wismer, umme de Russen dârsulues uptonemende to Lubeke vôr de gemeyne stede. Unde alse do de Russen vôr de stede quêmen, do vrâgeden de gemeyne stede, aldus se hadden wol vornômen, dat en schâde geschên were unde in der Nu berôved weren, dat were ene trûweliche leyt, unde were eres gûdes wes gekômen in de stede efte anderswôr, dâr de stede macht


|
Seite 147 |




|
ôver.hadden, dâr wolden se en recht ôver geven na der crûcekussinge. Hyr up antworden de Russen unde beclâgeden sick, dat se berôved und genômen worden in der Nu 1 ), dat hadde gedâen Vicke van Vitzen, Hinricus Tamenitze [Tarneuitze?], Vicke Stralendorp unde Wulff Lembeke unde ere medehulpere unde hadden se gevôred van dâr up ander holme in de zolten see na unser gissinge uppe Mone, unde dâr hadden se dat gûd gedêlet und dêden de drê dêl vaft dem gûde in dat grôte schip unde dat vêrendêl in eyne snicken unde zegelden do mit eren schepen unde gûde in Denemarken, unde wes se dârût nêmen efte nicht, des enwisten de Russen nicht, unde de Russen wurden van dâr wedder gevôred up eyn slot gehêten to den Ekhove int land van Mekelenborch, van der Wismar II mîle gelegen, unde dat grote schip quam to der Wismar, dâer was dat schip ûtgesegeld unde hôrde dâr to hûs. Vortmer vrâgeden de stede de Russen, efte se ôk vorscreuen wol vel gûdes in den schepen were, dat to der Wismar quam, edder wes ere gûd ôk anders wôr gekômen were in de stede gewold, dâr antworden de Russen, alse to: Se worden ûte deme leddighen schepe gesad by Rozstok uppe dat land unde worden van dâer to slote gevôred uppe wâgenen, dârumme enkonden se ny beschêd dâr mete van wêten, ôver dat dat schip tôr Wismer gekômen were, unde dâr were it ûtgemâket; dâr enbôven do deRussen to dep Wismer quêmen, do sêgen se ere rôvere uppe der strâten gân, de ere gerede unde caliten drôgen; ôk hadden se ênen sittende in deme torne, de ze gewundet unde geslâgen hadden, den lêten se ute deme torne unde lêten ene lôs. - - - - Vortmer antworden (de van der Wismar), - - - se hadden mit grôten kosten unde arbeyde unde hulpe erer heren unde vrunde dat so vere ge-


|
Seite 148 |




|
bracht, dat se de Russen wedder koften van den rôveren, dâr se, ghevangen sêten unde hadden vôr se gegeven - - wol up dûsend marc lub. - - - Mêr de rôvere, de en dat gûd genômen hadden, de enweren in der stede gewalt nicht, mêr se weren beseten under ander vorsten unde heren, dâr de stede nyne macht ôver haddern.
Hieraus geht bestimmt hervor, daß auch noch nach der Befreiung des Königs Albrecht meklenburgische Edelleute sich mit Seerauberei beschäftigten, wie zu jener Zeit die märkischen Edelleute Landraub trieben. Detmar und Corner erzählen außerdem ausdrücklich, daß die Vitalienbrüder sich nach der Befreiung des Königs noch ein Jahr lang an den östlichen Küsten der Ostsee umhergetrieben hätten. Vgl. Grautoff's Lüb. Chron. I, S. 370 - 371.
Vicke von Vitzen und Vicke Stralendorp gehörten belannten meklenburgischen Geschlechtern an, und Hinricus Tamenitze ist ohne Zweifel ein Tarnewitz aus der bekannten, jetzt ausgestorbenen Familie (vgl. Jahrb. XIII, S. 393 flgd.). Das Schloß Ekhov ist das bekannte Eickhof bei Warin. Wenn auch diese Familien in anderen Ländern Güter haben mochten, wie z. B. die Vietzen öfter in den nordischen Reichen vorkommen, so giebt doch die bekannte Burg Eickhof den sicheren Beweis, daß diese Räuber Meklenburger waren. Wer damals Eickhof, welches im 14. und 15. Jahrh. seine Besitzer häufig wechselte, besaß, hat sich noch nicht ermitteln lassen; die v. Lützow wurden erst am Ende des 15. Jahrh. damit belehnt.
Die meklenburgische Familie von Vietzen war stark in der nordischen Angelegenheit betheiligt. Wir besitzen darüber eine sehr willkommene Nachricht in Detmar's Lüb. Chronik, herausgeg. von Grautoff, I, S. 346:
1389. In demsulven iare degedinghede vrouwe Margarita, koninghinne to Norwegen, mit Clawese van Vitzen umme de slote Kalmeren unde Suluerborch: dit sint twe slote, dar deme koninkrike to Sweden grot macht an licht. Desse twe slote hadde Clawes na sines vader dode alse sine ervesone, wente sin vader her Vicke van Vitze blef dot in deme stride, do de konink van Sweden gevangen wart, also vore schreven steyt. Clawes dêde de slote der koninghinnen na deme, alse dat ghedegedinget wart,


|
Seite 149 |




|
wente he don moste, alse he mochte na deme, dat eme dat over de hand gheleghen was, unde quam na der tyd wedder hir tho lande, sines vaders erve tho besittende.
Hiernach war einer der Ritter des Königs Albrecht von Schweden der Ritter Vicke von Vietzen. Er fiel 1389 in der Schlacht von Axenwalde, in welcher der König Albrecht gefangen ward. Er hatte von dem Könige als Pfand die beiden Schlösser Kalmar und Silberberg, welche zu den festesten Schlössern Schwedens gehörten. Nach einer urkundlichen Nachricht im schweriner Archive "verglich sich Vicke von Vietzen am Mittwoch vor S. Margarethe 1375 mit dem Herzoge Albrecht von Meklenburg dahin, daß, wenn Boo Jonssen und seine Mitverwandten dem Herzoge 4000 löthige Mark erlegen würden, Vicke von aller Rechenschaft befreiet sein solle, womit er dem Herzoge von wegen des Schlosses und der Vogtei Kalmar, so ihm verpfändet gewesen, verpflichtet sein möchte; wenn aber solche Erlegung unterbleiben würde, solle er Rechnung zu thun schuldig sein". - Die Schlösser Kalmar und Silberberg, welche er jedoch 1389 besaß, gingen auf seinen Sohn Claus von Vietzen über, welcher sie der Königin abtreten mußte. Dieser ging darnach auf seine väterlichen Erbgüter zurück. Höchst wahrscheinlich war dessen Sohn Vicke von Vietzen (ein Bruder eines Ritters Claus), welcher sich noch im J. 1422 mit Seeräuberei beschäftigte. Die Genealogie 1 ) würde also sein:
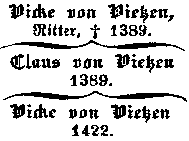
Von den in Jahrb. XV, S. 56 und 61 unter den
Vitalienbrüdern aufgeführten und noch nicht
nachgewiesenen meklenburgischen Edelleuten,
mögen sich Heine Schutte und Olav Schutte
verfolgen lassen, welche vielleicht aus dem im
Lande Grevismühlen auf den Gütern Schwansee,
Kalkhorst, Nienhagen, Dönkendorf
 . angesessenen Geschlechte der
Schosse, Schotze oder Schutze stammten und den
oben genannten v. Tarnewitz nahe wohnten.
. angesessenen Geschlechte der
Schosse, Schotze oder Schutze stammten und den
oben genannten v. Tarnewitz nahe wohnten.


|
Seite 150 |




|



|


|
|
:
|
4.
Antonius Schröder
und
der Türkenzug von 1532.
(Vgl. Oben S. 92.)
Antonius Schröder, Pfarrer an der S. Georgen=Kirche zu Parchim, dessen Leben in Jahrb. XII, S. 238 flgd, kurz gezeichnet ist, war dem Herzoge Heinrich dem Friedfertigen in mancherlei Geschäften dienstbar und verrichtete oft die Geschäfte eines außerordentlichen Secretairs.
Als der Kaiser Carl V. am 24. Junii 1532 eine "eilende Hülfe" der deutschen Reichsstände gegen die Türken ausgeschrieben hatte, sandte der Herzog die ausgeschriebenen 40 zu Roß und 67 zu Fuß auf 2 bis 4 Monate zunächst nach Wien zu Hülfe. Die Reuter waren:
| Asche von Cramm, Johanniter=Comthur zu Nemerow, als Hauptmann des Zuzuges, mit | 8 | gerüsteten | Pferden |
| Liborius v. Bredow, Johanhiter=Comthur zu Mirow, mit | 8 | - | - |
| Achim v. Halberstadt auf Brütz mit | 7 | - | - |
| Hans v. Kerberg mit | 8 | - | - |
| Valentin v. Knesebek mit | 6 | - | - |
| Jürgen Lehsten mit | 2 | - | - |
| Heinrich Lode mit | 1 | - | - |
| -- | ------- | ------- | |
| 40 | gerüsteten | Pferden |
Diese begleitete der Pfarrer Antonius Schröder, "Secretair des Herzogs Heinrich", als "verordneter Pfennigmeister".
Der Zug ging am 1. Sept 1532 von Parchim über Perleberg, Havelberg, Brandenburg, Wittenberg, Leipzig, Gera, Schleitz, Hof, Wunsiedel, Weiden, Neunburg, Lengefeld nach Regensburg, wo sie am 22. Sept. ankamen und zu Schiffe gingen. Am 28. gingen sie auf der Donau nach Wien, wo sie am 5. October anlangten.
Von Wien ging Antonius Schröder sogleich am 7. Oct zurück, über Olmütz, Zuckmantel, Neisse, Breslau, woselbst und vorher zu Olmütz er dem Markgrafen Joachim von Brandenburg, als des niedersächsischen Kreises obersten Feldhauptmann, die ihm zukommenden Gelder zahlte, ferner von Breslau am 21. October über Lüben, Crossen, Frankfurt a. O., Gransee und Mirow, wo er am 6. Nov. wieder ankam.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 151 |




|



|


|
|
:
|
5.
Des Herzogs Albrecht des Schönen
Reise zum Kaiser Carl V. 1543.
Ueber des Herzogs Albrecht Bemühungen, nach dem verunglückten Zuge nach Dänemark während der sogenannten Grafenfehde die sogenannte "spanische Schuldforderung" einzutreiben, sagt Rudloff Mekl. Gesch. III, 1, S. 110: "Albrecht hatte nun nichts angelegeneres, als die so oft verheißene Entschädigung für seine auf des Kaisers Wink gemachten Aufopferungen zu erhalten. Er ließ keinen Reichstag, noch sonstige Wege unbesucht, auf welchen er den Monarchen anzutreffen und seine Schuldforderung mittelbar oder unmittelbar in Anrege bringen zu können glaubte".
Eine solche Reise zum Kaiser machte er im Sept. 1543 in die Niederlande. Eine von mir im königl. Hauptstaatsarchive zu Dresden aufgefundene geschriebene Zeitung enthält folgende Stelle:
"Aus Antorff den 26. Septembris [1543].
Die key. Mayt. ist zu Dist vffgebrochen vnd ist hertzog Albrecht von Meckelborg vnterwegs zu Irrer Mayt. komme, sonst weiß ich von keinem andern Teutschen fursten oder fursten Botschaft, die itzo am hoffe were.
Der Oberst feldtheubtman hat die stadt Landerfi, wie man sagt, besichtiget, u. s. w.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vnd der gantze hauffe von allem kriegsvolck hat vngeferlich gestern vor Landerfi sollen susamen kommen".
Nach einer geschriebenen Zeitung
im königl. Sächsischen Haupt=Staats=Archive
zu Dresden.
"Landerfi" ist
die Stadt Landrecy in Flandern, welche der
Kaiser Carl V. im J. 1543 in dem Kriege
gegen den König Franz I. von Frankreich
vergeblich belagerte. - Diest ist eine Stadt
in Süd=Brabant.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
6.
Die Herzoging Katharine von Meklenburg,
über deren Schönheit in den Jahrb. VIII, S. 196, Nachrichten mitgetheilt sind, ward am 3. Julii 1512 an den Herzog Heinrich von Sachsen=Freiburg vermählt, worüber mehrere Ur=


|
Seite 152 |




|
kunden in Lisch Maltzan. Urk. IV, S. 411 flgd, gedruckt sind. In dem interessanten Buche von v. Langenn: Züge aus dem Familienleben der Herzogin Sidonie, Dresden, 1852, S. 95 flgd, findet sich eine charakteristische Schilderung der jungen Frau in einem Briefe des Kurfürsten Friedrich des Weisen vom 31. Julii 1512:
"An Herzog Georgen zu Sachsen.
Hochgeborner furst, fruntlicher liber vetter. Ouf hewt feyn mir II briffe von e. l. zcukomen, welche ich vorleßen. Und der erst Briff, in welchem e. l. mir anzcaigen der Hochczeit halben. ßoge ich e. l. fruntlichen danck der guthen bericht, vnd mir geffoldt nit, dos dye broudt noch das geprenge vnd geberde ayner broudt helldet, dan eß ist nuhe nit meher de tempore, aber bey mir hobe ich den wan olß ain older geßelhe, ßo ich ain ßo lang bey mir gehobt, ich welld syhe, ob got wyl, alßo ffyl wnderwesset hoben, dos syhe dos geprenhe ayner broudt ßolld ains teylls abgestellet hoben, eß feldt aber wol ayner jungen byß weyllen dyße kunst, ich wyl geschwehgen ayner alden. In Summa mir gesseldt dye weyße gor nicht, wye ich den e. l. ßogen wyl, ßo vnß got der almechtig zu ßamhen hyllfft". - - - - - Fost mit eylle, an ßomstog noch sont morthen tog, zcu Weymor, goncz bey nocht vud in dem fynstern geschriben. Ao. XV C XII."
Frid.
Es ist hier ohne Zweifel von der Herzogin Katherina die Rede, wenn auch v. Langenn (S. 50) die Veranlassung dieses Schreibens nicht kannte.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
7.
Der Canzler Brandanus von Schöneich,
der Oheim seines bekannten Amtsnachfolgers Caspar von Schöneich, ist bisher noch wenig bekannt. Er wird ein ausgezeichneter Mann gewesen sein, da er nach dem in Zarncke's Geschichte der Universität Leipzig 1 ) mitgetheilten Verzeichnisse der Rectoren dieser Universität für das Winter=Semester


|
Seite 153 |




|
1501-1502 Rector der Universität Leipzig war. Es heißt in diesem Verzeichnisse zum J. 1501:
1501. a. Sebastiauus Brandenburgensis M. th.
B.
b. Brandanus de Schoneich M.
utr. Iur. B.
Der Buchstabe M. bedeutet die "Nation" der Meißner ("Misnenses"), da die Universität Leipzig in 4 Nationen: Meißner, Sachsen, Baiern und Polen, getheilt war. Er war beider Rechte B(accalaureus).
Er wird im J. 1502 in die meklenburgischen Staatsdienste getreten sein, da er schon am 20. Julii 1502 in einer Original=Urkunde genannt wird ("magister Brandanus de Schoneich, cancellarius ducum Magnopolensium") und die Herzoge ihn, "ihren wohlverdienten Kanzler" ("Brandanum de Schoneich cancellarium nostrum bene meritum", und "clericum" nach einer anderen Urkunde,) am 25. Januar 1503 zu einer güstrowschen Domherrnstelle präsentirten 1 ). Sein Vorgänger Dr. Antonius Gronewolt oder Grunewald kommt seit 1495 bis in das Jahr 1501 vor und starb vor Lätare 1501. Brandanus von Schöneich starb im Anfange (vor dem 4.) des Monats März 1507 2 ).
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
8.
Ueber die Wiedertäufer in Meklenburg.
Von großem Interesse ist ein den "Berichten der Augenzeugen über das münsterische Wiedertäuferreich von Dr. C. A. Cornelius" (Geschichtsquellen des Bisthums Münster, II, 1853, S. 410 - 411,) mitgetheilter Brief des Rathes der Stadt Lübeck an den Rath der Stadt Rostock vom 6. Juni 1537, nach welchem sich der erste Anstifter der Wiedertäuferei in Münster, der "Pfaffe" Bernd Rothman, damals in Rostock aufhielt. Der Brief lautet also:
Lübeck 1537. Juni 6.
Uns kumpt waraftigen by, wo einer genoemt Berent Roethman, welcher kortzvorschêner tit binnen Munster der wedderdoper und sust alles uprors und nafolgendes qwades ein hovet und stifter gewest, sich in der stat Rostock entholden schole. Wes nu desselvigen mans,


|
Seite 154 |




|
condition, statur, habit und handelinge, ock wor he to vinden ist, solchs alle werden iwe erb. w. uth hir inliggende cedulen, de uns umme vorkuntschoppinge dessulvigen ist vorreket worden, nach notturft wol vornemen.
Beilage:
Einer genoemt her Bernt Roethman heft thor herbarge in Rostock gewest mit der Smedesken in der Steinstraten gegen den swarten Monniken, heft wandags Hans Ruther gewonet. Ploch tho Munster im regimenle tho hêthen Stuten-Bernt, und is de erst tho Munster de wedderdope und alle rumor anhôf. Is van personen ein drungen, vêrkant man, under ôgenen wit, blêck, brûn strack hâer kort, dricht int gemein eine Spaniske kappen unbosettet. De predicant in Marien kercken, her Henrich, heft siner wol kuntschop. Wonet itzundes by sunte Clawesse vor dem Schwychbagen, so men geit uth dem Molendore. Und let sick nomen doctor in medicin, holt sick gemeinlichen thom adel.
(Orig. im Stadt=Archive zu Rostock. Dem Herausgeber mitgetheilt vom Professor Dr. Waitz.)
Es wäre gewiß von hohem Interesse, wenn sich die Verbindungen und die Wirksamkeit dieses Mannes in Rostock, so wie dessen fernere Schicksale weiter verfolgen ließen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
9.
Ueber die Schweißsucht
und den Verlauf dieser Krankheit in Meklenburg, über welche in Jahrb. III, S. 60 flgd. gehandelt ist, sind bisher wenig Entdeckungen gemacht. Jetzt ist es klar, daß die Krankheit um Assumptionis Mariae (15. August) 1529 in Meklenburg einbrach, hier sehr rasch und gelinde verlief und um Nativitatis Mariae (8. September) erloschen war. Die Krankheit ging von Westen gegen Osten. Sie brach auf dem Continent zu Hamburg am 25. Julii 1529 aus, dann in Lübeck am 29. Julii. In Boizenburg und in der Nähe der Stadt in Blücher und Besitz erschien sie am 10. Aug.: in Boizen=


|
Seite 155 |




|
burg starben in 3 Tagen über 60 Menschen (Jahrb. III, S. 72). In Ribnitz brach sie am 16. Aug. aus (vgl. daselbst S. 73), jedoch starb im Kloster niemand, obgleich 25 Nonnen und mehrere andere Personen davon befallen wurden.
Um Nativitatis Mariae (8. Sept) scheint die Krankheit im Allgemeinen erloschen gewesen zu sein. Dies erhellt aus einer jüngst entdeckten Nachschrift eines eigenhändigen Briefes des Herzogs Heinrich des Friedfertigen an den Canzler Caspar von Schöneich, d. d. Stavenhagen am Montage nach Nativ. Mariae (13. Sept.), in welcher er sagt:
"Herczog Albrecht ist am vergangenen Freitag von strelitze na der Grimenitze myt sampt seyner gemahel und III jungfrawen wit XVIII kleppern gereysset".
"Es sol in Berlin an der krancheyt, so ytzunt vorhanden, ser sterben vnd dar an niderliggen."
"In Nienbrandenburg sein an der krancheit vber III C hindergelegen vnd nicht vber XII gestorben."
"In Parchem, Sternberg, Plawe vnd Waren haben auch ser dar ine nider [gelegen], sie haben aber den merenteill vff bleiben und lebendig, vnd sunderlich die das regiment halten".
["Stefenhagen am montag ua natiuitatis Marie ao. 29. fast yn eill geschriben."]
Es ist bis jetzt nicht bekannt geworden, daß irgend eine bedeutende Person in Meklenburg an der Schweißsucht gestorben sei. Nach neueren Entdeckungen starb jedoch der Dr. Ulrich Malchow, Senior des Dom=Capitels und Mitadministrator des Bisthums Schwerin, am 10. Sept, 1529, also wahrscheinlich an der Schweißsucht.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
10.
Ueber die Pest von 1589 und 1591
und
das Gesundheitwünschen beim Niesen.
"Anno 1589. 1591 hat die Pestis inguinata, wie es die Medici nennen, in gantz Europa grassieret, das ist eine solche geschwinde erschreckliche Krankheit gewesen, das wenn die Leute nuhr haben ein mahl gepraustet, sind sie


|
Seite 156 |




|
"alsbald vmbgefallen vnd gestorben. Es sind offt gesunde Leute beinander auff der Gassen gestanden, haben miteinander geredet, vnnd wenn sie nuhr ein mahl gepraustet, sind sie plötzlich niedergestürtzet vnd todt geblieben. Vnd daher ist die gewonheit bey den Christen auffgekomen, das man spricht: Gott helffe dich, wenn ein Mensch praustet, vnd das sie Gott bitten vmb eine selige stunde zu leben vnd zu sterben, wenn sie die Glocken hören schlagen."
Aus M. Conrad Schlüsselburg's Leichenrede auf den Herzog Christoph von Meklenburg. 1592.
Wahrscheinlich starb der Herzog Christoph am 4. März 1592 an derselben Pest. Schlüsselburg sagt nämlich weiter in dieser Leichenrede, nachdem er dargestellt, daß der Herzog am Tage vor seinem Tode wohl gewesen und zu Tempzin zum Fischen auf den See gefahren, jedoch am Abend von Todesgedanken beunruhigt war: "Ihre fürstl. Gnaden ruhet die gantze Nacht gahr sanffte: Auf den Morgen, zwischen 5 und 6 schlegen, praustet der Herr dreymahl hefftig nach einander, das die Hertzoginne dauon erwachet: wie aber der seliger Herr zum dritten mahl praustet, richtet er sich selber in dem Bette auff, siehet in die höhe, faltet seine Hende gahr dichte zusammen, drücket dieselben, das die Finger braun worden vnd spricht gahr laute: "Jefus", leget sein Haupt sanffte wider nieder, thut seine Augen selber zu, das die Hertzoginne nicht anders gemeinet, denn ihr Herr schlieff widervmb ein. Vnd ist also in einem solchen sanfften Schlaff, ohne alle vngeberde, selichlich abgescheiden".
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
11.
Belehnung durch Antastung des Hutes.
Die Belehnung durch den Hut oder die Mütze (auch Barret), welche der Lehnsherr dem Vasallen darreichte und dieser antastete, ist ein alter Lehnsgebrauch, welcher sich bis um das J. 1700 in Norddeutschland verfolgen läßt. J. Grimm hat in seinen Rechtsalterthümern Th. I, S. 148 flgd. diesen Gegenstand behandelt und gefunden, daß "der Gebrauch dieses Symbols sich vorzüglich in Sachsen (Schleswig, Holstein, Lauenburg, Pommern, Hoya, Braunschweig, Hildesheim bis nach Obersachsen hin), nicht in den übrigen Theilen des Reichs zeigt". Aus Meklenburg war bisher noch kein Beispiel dieses Lehnsgebrauches bekannt.


|
Seite 157 |




|
In den ältesten Zeiten ward in Meklenburg der Vasall durch Ring und Kuß belehnt. Die in Jahrb. VIII, S. 221 mitgetheilte Urkunde vom J. 1276 giebt eine klare Ansicht von der Form dieser Belehnung.
In jüngeren Zeiten ward der Vasall in Meklenburg auch durch Darreichung des Hutes belehnt.
Der Gebrauch der "Antastung des Hutes" bei der Belehnung kommt in den Acten des Lehngutes Wendisch=Lipze, A. Boizenburg, noch sehr spät zwei Male vor.
Am 4. Januar 1604 berichtete der Lehnmann des Erzstiftes Magdeburg, Busse von der Schulenburg zu Angern, an das magdeburger Dom=Capitel,
"daß er von weilandt dem durchlauchtigen hochgebornen Fürsten vnd Herrn Herrn Johann Albrecht Herzogen zu Meckelnburgk
. den 3 Martij Ao. 67 laut der copeylichen Beilage mit dem gutt Wendischen Lipze, imgleichen auch von S. F. G. Herrn Brudern Hertzogen Vlrichen christmilder gedechtniß in der Perfohn mit ausgesprochenen wortten, auch darreichung vnnd handtastungk derMutzen beliehen worden".
Am 25. Sept 1674 leistete der Oberst Jacob von Bülow auf Gudow dem Herzoge Gustav Adolph von Güstrow den Lehneid für dasselbe Gut Wendisch=Lipze, worüber folgendes Protocoll niedergeschrieben ward:
"Den 25. 7br. 1674 hat der H. Oberste Bülow in Ihrer Durchl. gemach in gegenwardh Ihro Durchl. des H. Cantzlers, H. Marschalls, Graffen vnd des H. Cammer=Junckern Major Vieregken diesen Lehneid mit aufflegung der finger auff Ihrer Durchl. Hut, den ihm der H. Cammer=Juncker vorgehalten, abgeleget".
Merkwürdig ist, daß diese Hutantastung beide Male an dem güstrowschen Hofe vorkommt.
Diese Beispiele von dieser Form der Belehnung mögen zu den jüngsten gehören. Es steht zur Frage, wie weit sich diese Form rückwärts verfolgen läßt. Es ist bisher nur noch ein Beispiel vorgekommen: als der Herzog Magnus, postulirter Bischof von Schwerin, die Administration des Stiftes selbst antrat, nahm er am 18. Sept. 1532 die Huldigung der Stiftsvasallen entgegen und belehnte sie von neuem mit ihren Lehngütern. Es sind bei dieser Huldigung 1 ) mehrere Acte


|
Seite 158 |




|
klar zu erkennen: 1) die Vasallen gelobten dem Lehnherrn Treue durch Ableistung eines Eides mit aufgehobenen Fingern ("erectis duobus versus celum digitis"); 2) der Lehnherr belehnte die Vasallen durch Darreichung des Hutes, welchen die Vasallen berührten ("per ostensionem sive porrectionem pilei domini et tactum pilei ejusdem per ipsos vasallos"); 3) der Lehnherr bewilligte hierauf den Vasallen Lehnbriefe ("litteras decrevit et concessit").
Aus Holstein ist noch ein Beispiel aus älteren Zeiten bekannt. Am 26. Sept. 1438 belehnte der Bischof von Lübeck den Grafen Adolph VIII. mit der Grafschaft Holstein und dem Fürstenthum Stormarn durch Darreichung des Hutes ("gab dem Herzoge den Hut in die Hände"); vgl. P(eter) H(ansen) Nachricht von den Holstein=Plönschen Landen, Plön (1759), S. 21. Vgl. Lackmann dissertatio de symbolica investiendi ratione per pileum p. 17 sq., wo das Notariats=Instrument über diesen Fall eingeschaltet ist.
Auch in dem an Meklenburg grenzenden rügen=pommerschen Landestheile war dieser Gebrauch herrschend. In einem vor dem Reichskammergericht von der Familie v. Behr gegen die Herzoge von Pommern über den Anfall des Gutes Bärenwalde siegreich geführten Processe heißt es im J. 1529: "Seit unvordenklichen Jahren sei es im Lande Baeth Gewohnheit und Gebrauch gewesen, daß, wenn ein Geschlecht von Adel, so der Lehnherr gestorben, von dessen Erben ihre alten Lehne hätten empfangen wollen, alle Personen des Geschlechts erschienen seien und um Belehnung nachgesucht hätten, welche allein mit Angreifung eines Hutes oder Birrets vollzogen sei".
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
12.
Die Fehler der Hansestädte.
urbium anseaticaram
olim haec circumferebantur sarcasmata.
De Lübschen kriegen as Kinder,
de Hambörger sehn dorch de Finger,
de Lünebörger willen nich int Feld,
de van der Wißmar hebben ken Geld,
de Rostoder föhren den Staat,
de Sundesken hebben bösen Raht,


|
Seite 159 |




|
de Danßker werden sick woll besinnen,
de Bremer werden nichts beginnen,
Cölln am Rein will nicht daby fyn,
den se drinken lever rinschen win,
Magdeborg fören den Crantz
und willen nich an den Dantz,
Brunschwick mot et bliven lan,
erer egen Sacken sick nehmen an.
Aus Segnitz handschriftl. Chronik von Rostock (bis 1732) im Archive zu Schwerin, mitgetheilt von G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
13.
Capitulation des Herzogs Adolph
Friederich von Meklenburg über die
Administration des Stiftes Schwerin
(enthaltend eine Geschichte des Stiftes
Schwerin während des dreißigjährigen Krieges).
Von Gottes Gnaden Wir Adolph Friedrich, Hertzogk zue Meckelnburg, Furst zue Wenden, Graff zue Schwerin, der Lande Rostogk vnnd Stargardt Herr, Thuen kund vnd bekennen hiemit fur Vnß, vnsere Erben vnd Nachkommen,
Nachdem durch die im Heiligen Römischen Reich
entstandene, vnd leider noch anitzo
continuirende Krieges Vnruhe es mit dem Stifft
Schwerin zu sothanem betruebten, verderblichen
Zustande gerahten, das nicht allein derselbe in
den negst abgewichenen Jahren von dem
Kayserlichen General, dem Hertzogen zue
Friedland occupiret vnd eingenommen, vnd so woll
der damahls erwehlter Administrator, der weiland
Hochwurdiger Hochgeborner Furst, Herr Vlrich,
Erbe zu Norwegen, Hertzogk zue
Schleswig=Holstein
 . hochsehligen angedenckens, alß
auch ein gantzes Ehrwurdiges Thum=Capittel vnnd
deßelben Capitularn Ihrer guter vnd intraden
priviret vnd destituiret, Sondern auch nach der
zwischen Ihr Kayßl. Maytt. vnd Kön. W. zu
Dennemarck beschloßenen friedenshandlung in
vorermeltes Kayßerlichen Generaln handen nach
wie vor verplieben, Auch furters, als durch Ihre
Kön. W. zu Schweden, Vnsers in Gott ruhenden
hochgeliebten herrn Vettern, Brudern vnd
Gevattern glorwurdigsten angedenckens siegreiche
waffen die Kayserliche darauß gesetzet, vnd
vertrieben worben, in höchstgedachter Ihr
. hochsehligen angedenckens, alß
auch ein gantzes Ehrwurdiges Thum=Capittel vnnd
deßelben Capitularn Ihrer guter vnd intraden
priviret vnd destituiret, Sondern auch nach der
zwischen Ihr Kayßl. Maytt. vnd Kön. W. zu
Dennemarck beschloßenen friedenshandlung in
vorermeltes Kayßerlichen Generaln handen nach
wie vor verplieben, Auch furters, als durch Ihre
Kön. W. zu Schweden, Vnsers in Gott ruhenden
hochgeliebten herrn Vettern, Brudern vnd
Gevattern glorwurdigsten angedenckens siegreiche
waffen die Kayserliche darauß gesetzet, vnd
vertrieben worben, in höchstgedachter Ihr


|
Seite 160 |




|
Kon. W. vnd Crohn Schweden macht vnb gewaldt vnd
ferner dahin gerachten, das davon
vnterschiedtliche ansehenliche stucke, vnd
endlich der gantze Stifft selbst Vornehmen
Krieges=Officirern vnd andern zu einem
gnadengeschencke vorliehen, vnd gereichet
worden, vnd also deßelben total dissolution,
dismembration vnd ruin offentlich fur augen
gestanden vnd obhanden gewesen, Wir aber so woll
wegen Vnsers ex jure Electionis habenden hohen
Interesse, alß auch aus gnediger affecton gegen
ein Ehrwurdiges Dohm=Capittel Vns höchlich
bemuehet, solche dissolution zu verhuten vnd
alles in vorigen stand zu bringen vnd zu setzen,
auch endlich vermittelst Göttlicher Hülffe vnd
gnedigen verleihung durch viele schreiben,
schickung vnd Kostbahre Bemuhung es Bey Ihr Kon.
W. vnd Krohn Schweden vnd dero Hern
Reichs=Cantzlern vnd Gevollmechtigten
General=Legaten in Teutschland, den
Hoch=Wollgebornen herrn Axell Ochsenstirn,
Freyhern
 ., so viel erhalten, das Sie aus
sonderbahrer respective freuntvetterlichen vnd
wollgeneigten affection gegen Vns mehrgemelten
Stifft Vns auff gewiße maße abgetretten vnd
deßen possession newlicher Zeit tradiret vnd
eingereumet, vnd darauff wollermeltes
Ehrwurdiges Dohm=Capittel wegen Ihrer vnd Ihrer
guter restitution bey Vns zu vnterschiedtlichen
mahlen vnderthenige ansuchung gethan, Wir auch,
ob Wir zwar Vns noch zur Zeit, weil Vns
vielermelter Stifft noch anitzo nicht auf vnfer
habendes jus Electionis, Vnserm beschehenen
Suchen nach, sondern nur de jure, wie Ihn
höchstgedachte Crohn Schweden bishero eingehapt,
vnd das alles damit in itzigem stande noch zur
Zeit gelaßen werden solle, cediret vnd
abgetretten, deme Wir auch in respect Ihr Kon.
W. vnd Crohn Schweden billig nachkommen vnd
durch diese Vereinigung, bis Vns auff obbesagtes
Vnser jus Electionis die Possessio confirmiret
werde, nichts zugegen gehandelt haben wollen,
sothaner gesuchten restitution pure et
simpliciter Vns nicht bemechtigen, noch
vnterrnehmen können, dennoch der vngezweiffelten
hoffnung geleben, es werde höchstgedachte Ihr.
Kön. W. vnd Crohn Schweden vnd hochwolermetter
Herr Reichs=Canzler sowoll wegen der respective
nahen anverwantnus, alß auch bishero verspurten
sonderbahren vnd von Vns jeder Zeit dancknehmig
erkanten wollgeneigten affection der Vuß
gethanen vertröstung nach Vnß auff Vnser
vorangezogenes jus Electionis quaesitum die
possession des Stiffts mit dem ehisten
gepetenermaßen freundvrttertich vnd wilfehrig
confirmiren vnd bestettigen.
., so viel erhalten, das Sie aus
sonderbahrer respective freuntvetterlichen vnd
wollgeneigten affection gegen Vns mehrgemelten
Stifft Vns auff gewiße maße abgetretten vnd
deßen possession newlicher Zeit tradiret vnd
eingereumet, vnd darauff wollermeltes
Ehrwurdiges Dohm=Capittel wegen Ihrer vnd Ihrer
guter restitution bey Vns zu vnterschiedtlichen
mahlen vnderthenige ansuchung gethan, Wir auch,
ob Wir zwar Vns noch zur Zeit, weil Vns
vielermelter Stifft noch anitzo nicht auf vnfer
habendes jus Electionis, Vnserm beschehenen
Suchen nach, sondern nur de jure, wie Ihn
höchstgedachte Crohn Schweden bishero eingehapt,
vnd das alles damit in itzigem stande noch zur
Zeit gelaßen werden solle, cediret vnd
abgetretten, deme Wir auch in respect Ihr Kon.
W. vnd Crohn Schweden billig nachkommen vnd
durch diese Vereinigung, bis Vns auff obbesagtes
Vnser jus Electionis die Possessio confirmiret
werde, nichts zugegen gehandelt haben wollen,
sothaner gesuchten restitution pure et
simpliciter Vns nicht bemechtigen, noch
vnterrnehmen können, dennoch der vngezweiffelten
hoffnung geleben, es werde höchstgedachte Ihr.
Kön. W. vnd Crohn Schweden vnd hochwolermetter
Herr Reichs=Canzler sowoll wegen der respective
nahen anverwantnus, alß auch bishero verspurten
sonderbahren vnd von Vns jeder Zeit dancknehmig
erkanten wollgeneigten affection der Vuß
gethanen vertröstung nach Vnß auff Vnser
vorangezogenes jus Electionis quaesitum die
possession des Stiffts mit dem ehisten
gepetenermaßen freundvrttertich vnd wilfehrig
confirmiren vnd bestettigen.


|
Seite 161 |




|
Daß Wir demnach in sothaner vngezweiffelten confitenz vnd Zuversicht eines Ehrwurdigen Dohm=Capittels gethanem vnderthenigen suchen bey itziger deßwegen angesetzten vnd gepflogenen handelung wegen Ihrer restitution in gnaden raum vnd stath gegeben, Thuen auch daßelbe hiemit, vnd crafft dieses wißentlich, also vnd dergestaldt, das Wir nicht allein die verschenckten Capittelsguter Rampe vnd Medewege mit Vnserm gelde von den itzigen Possessoribus, wie Wir Vns deßen mit denselben werden vergleichen können, lösen vnd reluiren vnd auff erfolgete obangedeutete confirmation einem Ehrwürdigen Dohm=Capittel alßbald cum fructibus jam pendentibus, oder da die confirmation ante messem nicht erfolgen solte, vnd Wir die guter interim wurklich einbekehmen, hernach wan Wir die confirmation erlangen werden, cum fructibus perceptis, oder auch da vber alles verhoffen es sich noch lenger mit der confirmation verweilen, Wir auch vber allen angewanten Fleis mit der reluition fur der Erndte nicht fertig werden, vnd also die itzigen Possessores noch dieses Jahrs fructus percipiren solten, alßdan sobald die reluition vnd confirmation von Vns zu wege gebracht worden, sampt Sechs Hundert Rthaler an staeth dieses Jahrs abnutzüng in gnaden restituiren vnd einantwortten, sondern auch die andern beeden Capittelsgüter Warkstorff vnd den Bawhoff bey der Schelff=Kirchen, so Wir anitzo in besitz haben, sampt dieses Jahrs hebung, also wie dieselbe fur sich vnd ohne Vnser Vnderthanen Zuthun vnd Kosten, secundum arbitrium boni viri, können genutzet vnd aestimiret werden, nach erlangter confirmation wieder abtretten, vnd einreumen, jedoch das Vnß wegen befindt= vnd erweislichen melioration gepuhrende vnd pillige erstattung geschehe vnd wiederfahre.
Vnd alß nun dahingegen ein Ehrwurdiges Dohm=Capittel, sowoll zu antzeige Ihrer vnderthenigen Danckbarkeit, das Wir durch so vielfeltige hohe Kostbahre Bemühung den Stifft obangedeutetermaßen a praesenti interitu et dissolutione vindiciret vnnd liberiret, vnd noch daruber durch die versprochene reluition vnd restitution vorgedachter Capittelsguter auß gnediger affection ein Ehrwurdiges Dohm=Capittel so ansehentlich vnd stathlich bedacht vnd begabet, alß auch in ansehung des gantzes Stiffts vnnd Dohm=Capittels vngezweiffelten nutz, besten, gedeien vnd auffnehmen, vnd das Sie hinfuro bestendigen mechtigen schutz vnd schirm bey einem so vornehmen Vhralten hohen Furstlichen hause haben vnd fur allen besor=


|
Seite 162 |




|
genden dissensionen, so zwischen dem Furstlichen hause Meckelnburgk vnd dem Stiffte, wie es leider die erfahrenheit vor diesem betzeuget hat, zu beederseits Vnderthanen, Landen vnd Leuten Verderb vnd ruin deswegen lichtlich entstehen konten vnd muchten, durch Göttliche verleihung desto beßer gesichert, vnd in gutem friedlichen ruhigen wolstande erhalten werden muchte, im nahmen Gottes auff vorgehapten reiffen vnd zeitigen vnubereileten Rath vnd einhellige beliebung, nach angestelleter vnd etzliche tage hero gepflogener handelunge auff vnfer gnediges ansuchen vnd gesinnen für sich vnd Ihre Successorn am Dohm=Capittel hiemit vnd crafft dieses sich verpflichtet vnd obligiret, hinfuro vnd zu ewigen Zeiten die postulation eines Administratoris oder Episcopi des Stiffts Schwerin auff das Furstliche Haus Meckelnburgk, vnd erstlich auff Vns vnd vnsere Furstliche Posteritet vnd Lini vnd zwar wegen hoher vnd wichtiger von Vnß angefuhreten motiven vnd Vrsachen auff den jeder Zeit Regierenden hern vnd Landes=Fursten, vnd da Vnsere Linie, welches der Allerhöchste gnedig verhueten wolle, gentzlich abgehen vnd nicht mehr sein sollte, alßdan auff den Hochwurdigen Hochgebornen Fursten, Herrn Hans Albrechten, Hertzogen zue Meckelnburg, Coadjutorn des Stiffts Ratzeburgk, Fursten zu Wenden, Graffen zue Schwerin, der Lande Rostogk vnd Stargardt Herrn, Vnsern freundlichcn vielgeliebten Brudern vnd Gevattern, vnd seiner Ld. Posteritet ebener gestaldt auff den Regirenden Landes=Fursten, dofern es vff solchen begebenden Fall also begehret wirt (jedoch da auch S. Ld. Linie vnd Posteritet, vnd also der gantze Meckelnburgische Stam, welches doch der vielgutige Gott väterlich abwenden wolte, abgehen solte, einem Ehrwurdigen Thumb=Capittel die freye wahl vnd postulation einen Episcopum, aus welchem hause Sie wollen, zu postuliren, vnd zu erwehlen, wieder heimbfallen, auch Kein ander Furstliches haus, so dem Furstlichen Meckelnburgischen abgehenden Stam in deßen Fnrstenthumen vnd Landen entweder jure cognaiionis, oder vermuge Kayßerlicher exspectantz, Verträge oder in andere Wege succediren muchte, durch diese restriction einig jus oder Recht auff den Stifft Schwerin nicht zu praetendiren haben solle,) bestendiglich vnd vnverrucket zu richten, vnd zu dirigiren, Auch dem zufolge, woferne wir nemblich fur Vns, vnd vnsere posteritet vorgemeltes Dohm=Capittel in schriften, durch eine sonderliche zwischen Vnß vnd Ihnen auffrichtende capitulation wegen Ihrer habenden freiheiten vnd gerechtigkeiten gnugsahmb assecuriren


|
Seite 163 |




|
vnd versichern vnd dieselbe vnter Vnserm
Furstlichen Insiegel vnd handtzeichen Ihnen
vollenzogen zustellen wurden, im nahmen der
heiligen Dreyfaltigkeit, Vns als Regierenden
hern vnd Landes=Fursten zu Meckelnburgk (Bevorab
weil Wir daßelbe aus angezeigten hohen
erheblichen Vrsachen also vnd auff Vns zu
richten, an ein Ehrwurdiges Dohm=Capittel gnedig
begehret und auff Ihre vnderthenige beschehene
erinnerung Sie in gnaden versichert, daß Ihnen
daßelbe weder Bey Vnserm Sohn, dem Hochgebornen
Fursten, Hern Christian, Hertzogen zu
Meckelnburgk
 . wegen der hiebenohr auff deßen
Persohn gerichteten postulation, noch sonsten
bey jemand anders, weil Wir hierin der itzigen
beschaffenheit nach, vnd sonsten nach Vnserm
belieben zu disponiren freie macht haben, zn
einigem Vorweiß noch vngelegenheit nicht
gereichen wurde oder solte,) aus vndertheniger
affection zue einem Administratorn des Stiffts
Schwerin vnderthenig postuliret vnd erwehlet,
Wir auch sothane Postulation gnedig acceptiret
vnd angenommen vnd Vns auff erlangte oberwehnte
confirmation des Titels zu gebrauchen Vns
ercleret, So haben Wir demnach löblichem vnd
wollhergebrachtem gebrauche nach vnd damit ein
Ehrwurdiges Dohm=Capittel, auch der gantze
Stifft vnd Kirche zu Schwerin, sampt allen vnd
Jeden deroselben Steuden, Verwanten, vnderthanen
vnd Nachkommen, Geistlichen vnd Weltlichen, zu
aller gepuhr desto mehr versichert sein mugen,
gegenwertige capitulation in Vnserm Nahmen mit
wolgedachtem Dohm=Capittel nach folgender
gestaldt wissentlich vnd wohlbedechtig
auffgertchtet vnd vollentzogen, u. s. w.
. wegen der hiebenohr auff deßen
Persohn gerichteten postulation, noch sonsten
bey jemand anders, weil Wir hierin der itzigen
beschaffenheit nach, vnd sonsten nach Vnserm
belieben zu disponiren freie macht haben, zn
einigem Vorweiß noch vngelegenheit nicht
gereichen wurde oder solte,) aus vndertheniger
affection zue einem Administratorn des Stiffts
Schwerin vnderthenig postuliret vnd erwehlet,
Wir auch sothane Postulation gnedig acceptiret
vnd angenommen vnd Vns auff erlangte oberwehnte
confirmation des Titels zu gebrauchen Vns
ercleret, So haben Wir demnach löblichem vnd
wollhergebrachtem gebrauche nach vnd damit ein
Ehrwurdiges Dohm=Capittel, auch der gantze
Stifft vnd Kirche zu Schwerin, sampt allen vnd
Jeden deroselben Steuden, Verwanten, vnderthanen
vnd Nachkommen, Geistlichen vnd Weltlichen, zu
aller gepuhr desto mehr versichert sein mugen,
gegenwertige capitulation in Vnserm Nahmen mit
wolgedachtem Dohm=Capittel nach folgender
gestaldt wissentlich vnd wohlbedechtig
auffgertchtet vnd vollentzogen, u. s. w.
Behandelt, geschehen vnd gegeben Schwerin den Siebenzehenden May Anno Christi Ein Tausent Sechs hundert vier vnd dreyßig.
AFriedHzM.
Otto von Estorff, Vlrich Wackerbardt,
Volraht v. Pleß,
prepositus mppa.
Dechand mpp. Senior mea manu s.
Balthasar v. Bothmer
mpia.
Nach dem Originale im großherzogl. meklenburg. Geh. u. K. Archive zu Schwerin.


|
Seite 164 |




|



|


|
|
:
|
14.
Ueber die Caselier in Meklenburg
(vgl. Jahrb. XIX, S. 3 flgd.)
giebt der Herr Archiv=Secretair Dr. Grotefend im Correspondenz=Blatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine, 1855, Juli, Nr. 10, S. 91 folgende Nachträge:
"Dem Referenten mag es vergönnt sein, bei dieser Gelegenheit (der Anzeige der Jahrbücher XIX.) an eine seltene Gelegenheitsschrift des bekannten Pädagogiarchen von Göttingen Justus von Dransfeld zu erinnern; es ist dessen Epistola ad d. Henr. Christoph. Domeierum, dom. Palmarum a. 1705 autoritate electorali - ecclesiasten aedis s. Crucis renunciatum. Gottingae, literis Josquini Woyken. Anno 1705. 4. Der gelehrte Pädagogiarch sagt darin S. 8: Cujus Matthiae Caselii, cujus item Joannis Caselii epistolas bene multas Germanicas et Latinas ad majores nostros (er war ein Verwandter des Pastors Domeier) scriptas, inter alias ad proevum tuum maternum (Herrn Jost von Dransfeld, Patricium Gottingensem), quem in Academia Rostochiensi per triennium contubernalem et discipulum habuit, scriniis meis asservo, und giebt als Probe zwei Briefe des Johannes Caselius an den Jost von Dranßfeld, deren ersterer als ein kleines Supplement zu Lisch's Aufsatz hier einen Platz finden mag:
"Henricopoli scripsi ad te, mecum actum esse de educatione illustrium Filiorum Illustrissimi Ducis Julii et Professione in nova Schola Julia, quae Helmstadii est. Ero vobis propior, si me hinc Illustrissimus meus dimittet: quod faciet, aut dabit, unde hic vivam. Nam profecto interea, dum tu abes, hic ne numum quidem, neque de 2000, neque de stipendio accepi: ut nihil mittam ad Parentes. Vos rogo, ut, si qua re egebunt, eos pro more juvetis. Reddetur bona fide. Statim etiam aliquid mittam, ut puto, mense Majo, quia ad Ducem Julium mittendus est tabellarius brevi. Interea videbo argentum. Etiamsi tibi istic manendum erit propter rem familiarem, tamen quaeso te, sis in literis: lege, scribe, meditare. Sed mallem te vivere, ubi ego ero, annos non plurimos. Novi ingenium et industriam


|
Seite 165 |




|
"tuam. Parentes optimos saluto. Fratres mei valent. Saluto matrem tuam, fratres, amicos. Vale".
"Rostochio, V Id. April. 1575.
"Außer den die beiden Hauptpersonen betreffenden Notizen, welche dieser Brief darbietet, lernen wir aus ihm auch, daß die beiden Brüder des Johannes Caselius, Christoph und Daniel, noch 1575 in Rostock lebten, während Herr Lisch von dem letztern nur bis zum J. 1569 Nachrichten gefunden hat. Die sonstigen Nachrichten der Dransfeldischen Schrift stimmen mit dem, was Herr Lisch über Matthias Caselius berichtet, überein und sind auch im Wesentlichen in der Zeit= und Geschichtsbeschreibung der Stadt Göttingen (Hannover und Göttingen, 1734 - 1738, 4.) Bd. I, S. 94 flgd., Bd. III, S. 12 flgd., S. 265 flgd. benutzt worden".
Der Herr Professor Dr. Henke zu Marburg schreibt mir: "In einer Schrift über einen der besten Schüler des Joh. Caselius, Georg Calixtus, (Th. I, Halle 1853) habe ich versucht, die ganze Stellung der Parthei, an deren Spitze Caselius in Helmstädt stand, ihr Verhältniß zur Regierung, wie zu andern kirchlichen und gelehrten Partheien, etwas näher zu charakterisiren, u. a. S. 48 - 53, 70 - 78, 88 - 99, 117, 145 - 147, 159, und hiernach sieht es zur Ehre meines braunschweigischen Vaterlandes doch etwas besser aus, als daß sein Aufenthalt in letzterm bloß durch "Hunger ,und Kummer", woran es zuletzt freilich auch nicht fehlte, charakterisirt wäre. Mein Freund Schmidt, welchen Sie dafür citiren, hat dabei wahrscheinlich auch Stellen der Arbeit im Auge, welche er selbst aus seinen archivalischen Schätzen so wirksam unterstützt hat".
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
15.
Christian Ludwig Liscow.
Ueber Liscow's Jugendbildung ist in den neuern Zeiten manche Vermuthung aufgestellt, da man seine Schicksale gerne mit seiner Jugendbildung in Verbindung zu bringen sucht. In den Jahrb. X, S. 120, ist die Vermuthung aufgestellt, daß er auf der Schule zu Lübeck gebildet sei. Classen in seiner Schrift über C. L. Liscow's Leben und Schriften,


|
Seite 166 |




|
Lübeck, 1846 (vgl. Jahrb. XI, S. 231), kann dies zwar nicht beweisen, nimmt es aber um so mehr als glaubwürdig an, als Christian Ludwig Liscow's Bruder Joachim Friedrich Liscow wenigstens 1722 - 1724 die Schule zu Lübeck besuchte (vgl. Classen a. a. O., S. 4 und 5, und Jahrb. X, S. 109); eine sichere Beglaubigung dieser Annahme hat sich aber in Lübeck nirgends auffinden lassen. Es hat sich aber jetzt aufgeklärt, warum über Liscow's Schulbildung weder bei der lübecker, noch bei den meklenburgischen Schulen etwas zu finden ist. Christian Ludwig Liscow hat nämlich diese Schulen gar nicht besucht, sondern ist auf der Schule zu Lüneburg zur Universität vorbereitet worden. Der Herr Director Volger zu Lüneburg theilt aus der im J. 1702 angelegten Matrikel des Johanneums zu Lüneburg einen Auszug mit, nach welchem unter den Ostern 1716 in die erste Classe eingetretenen Schülern auch Christian Ludwig Liscow war:
Anno 1716.
Christian Ludwig Liscow, Wittenburgo-Megapolitanus.
Hiezu stimmt denn auch, daß Liscow im Sommer 1718 die Universität Rostock bezog.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
16.
Auszug
aus der
im J. 1632 angefangenen
Matrikel
der Universität Dorpat,
mitgetheilt
in
den Mittheilungen
aus dem Gebiete der Geschichte
Liv=,
Ehst= und Kurlands,
Bd. VIII, Heft 1,
Riga 1855, S. 150 flgd.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rectore Henrico Hein, U. J. Doctore et Professore, sequentes inscripti.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


|
Seite 167 |




|
1634. Anno MDCXXXIV.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Martii 19.
Fridericus Hein, Rostochiensis Megapolitanus stip.
Valentinus Havemann, Rost. Megap.
Rectore Joanne Below, Med. Doctore et Professore primario, sequentes inscripti:
Anno 1634, Maji 3.
Bernardus Below, Rostochiensis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1635. Anno 1635.
25. Octobris.
Arnoldus Deene Rostochiensis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1635. Anno MDCXXXVI.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29. Julii.
Martinus Maasius, Ratzeburgensis.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1638. 1638.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
die 20 Septembris.
Casparus Eggerdes Rostochiensis Megapolitanus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rectore Johanne Below, Med. Doctore et Professore, sequentes inscripti sunt:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1641. 1641. 13 Februarii.
Henricus Vulpius Rostoch.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Novembris
Henricas Hein.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


|
Seite 168 |




|
1643. 1643. 12 Novembris.
Philippus Halbach Rostochiensis Megapolitanus.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1646. 1646. die 20. Junii.
Arvidus Sigismundus Brandt, Wismariensis, Megapolitanus, stip.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1647. 1647. die 1 Novembris.
Albertus Dobbin, Rostochiensis, stip.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1648. 1648. die 4 Octobris.
Matthaeus Willebrandus, Goriosio-Megapolitanus.



|


|
|
:
|
17.
Die Johanniter=Comthurei Gardow
im Lande Stargard, von welcher zwar wenig bekannt, deren Existenz jedoch in Jahrb. IX, S. 40 flgd. nachgewiesen ist, verdient noch immer genauere Aufklärung. Am 6. Dec. 1337 verglichen 1 ) sich zu Lichen Heinrich von Wesenberg, Comthur des Ordenshauses Gardow, und alle Brüder desselben Hauses, unter der Vermittelung des Comthurs Hermann von Werberg von Nemerow als Stellvertreters des Meisters in Wendenland, mit dem Kloster Himmelpfort über mehrere an der Grenze zwischen beiden Stiftungen gelegene Seen (Groß= und Klein=Kelle=, Klein=Karstavel= und Krumme=See), welche zwischen ihnen streitig gewesen waren, dahin, daß die Comthurei Gardow, unter Anhängung ihres Siegels, allen Ansprüchen an diese Seen entsagte.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
18.
Der Wanzeberg.
In Jahrb. XI, S. 123 flgd. und XVI, S. 187, ist der Wanzeberg im Amte Eldena als eine besondere geographische Individualität geschildert. Der Wanzeberg kommt noch während des 16. Jahrh. öfter als ein besonderer District vor.


|
Seite 169 |




|
Tilemann Stella begreift (XI, S. 123) darunter 9 Dörfer:
Conow,
Malk,
Göhren,
Mallis,
Karenz,
Grebs,
Bockup,
Probst=Woos,
Schlesin.
In einem Amtsbuche des Amtes Schwerin aus der ersten Hälfte des 16. Jahrh., etwa vom J. 1540, nach welchem damals dieser District vom Amte Schwerin verwaltet ward, werden folgende Dörfer auf und an dem Wanzeberge aufgeführt:
Item dyt Nachfolgende is der Wantzenberg vnnd watt die herren dar van hebben:
Glessyn (Glaisin),
Prawest Jetzser (Probst Jefar),
Kroen (Krohn) vnnd Stuke (Stück),
Grittell vnnd Lype,
Konow vnnd Mellutze (Mallis),
Karnitze (Karentz),
Prawest Wotzen (Probst=Woos) vnd Buckop,
Grebetze (Grebs),
Prawest Brifegur (Bresegard).
Von diesen Dörfern gaben jedes allein oder je zwei zusammen, wie sie hier aufgeführt sind, jährlich 1 Ochsen und 1 Schneidelschwein an die Landesherrschaft.
Hier sind jedoch mehr Dörfer dazu gezählt, als Tilemann Stella dazu rechnet, namentlich die 4 südlich von der Neuen Elde liegenden Dörfer Krohn, Stük, Liepe und Grittel, ferner die am Fuße des Wanzeberges liegenden Dörfer Bresegard und Glaisin und das weit davon nördlich am Rande der Jabelhaide liegende Probst=Jesar. Ohne Zweifel sind diese Dörfer aus Verwaltungsrücksichten später zum Wanzeberge gerechnet.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 170 |




|



|


|
|
:
|
19.
Die Dörfer Görgelin, Gallin und Gailen.
In den Jahrbüchern ist wiederholt von der nicht unwichtigen Topographie einiger Dörfer südlich zwischen Lübz und Plau die Rede gewesen und sind dabei die Dorfnamen Görgelin, Gallin und Gailen genannt, ohne daß ein bestimmtes Ergebniß über diese Namen erzielt worden wäre. Es wird sich aus der folgenden Untersuchung ergeben, daß nur Ein Name, nämlich Görgelin, urkundlich ist.
Das Dorf Görgelin hat wirklich existirt und ist jetzt urkundlich gesichert. Görgelin lag zwischen dem Dorfe Gnevsdorf und dem Hofe Retzow und ist die Feldmark desselben in dem Dorfe und Hofe Retzow untergegangen (vgl. Jahrb. XIII, S. 408). Darin ist meine Vermuthung nicht ganz richtig, daß das Dorf Görgelin schon im J. 1448 untergegangen sei, wenigstens nicht ganz. Noch im J. 1509 lebte nach einer Urkunde 1 ) in Görgelin ein Pfarrer Friedrich Kofahl. Es ist also Ritter's Bericht über den wüsten Kirchhof von Görgelin in Jahrbüchern a. a. O. ganz richtig. Gegenwärtig wird in der Sage das untergegangene Dorf Görgelin mit dem abgekürzten Namen Gallin belegt; der Name Gallin für dieses Dorf ist kein urkundlicher. Eine Stunde weiter nördlich, nördlich zwischen Lübz und Plau, wo sich mehrere südlich vorkommende Namen wiederholen, liegt das Dorf Gallin, welches in alten Zeiten Glin ("Glyna") hieß (vgl. Jahrb. XVII, S. 18).
Das Dorf Gaillen, eine Stunde westlich von Görgelin, hat unter diesem Namen urkundlich nicht existirt, sondern ist nur die im 18. Jahrhundert übliche traditionelle Benennung für die Feldmark eines untergegangenen Dorfes (vgl. Jahrb. XVII, S. 70). Die Feldmark gehörte damals größtentheils zu Karbow, zum geringeren Theile zn Wilsen und Darze. Dieses sogenannte Dorf "Gaillen" ist nichts weiter, als die letzte Verstümmelung des in ältesten Zeiten unter dem wendischen Namen Zesemow vorkommenden späteren Dorfes Michaelisberg, Michelsberg, Cheelsberg, Gailsberg, Gaillen, an dem Michaelsberg und Michaelsbach, oder Geelsberg und Geelsbach (vgl. Jahrb. XII, S. 22). Der Herr Ritter giebt hierüber die folgende Aufklärung.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 171 |




|
Im XVII. Bande der Jahrbücher S. 70 steht die Bemerkung, es sei ein Dorf Gaillen oder Geilen, eine halbe Stunde von Görgelin, untergegangen: in den Acker haben sich die 3 Dörfer Karbow, Wilsen und Darß getheilt. Dieses Dorf ist kein anderes, als Gehlsberg, Michaelisberg (das alte Cesemow), welches gerade in der Mitte zwischen den Dörfern Karbow, Wilsen und Darß gelegen hat; die Dorfstelle liegt noch auf der Höhe am Wege von Karbow nach Darß. In der breiten Aussprache des Plattdeutschen hört man hier stets statt Gehlsberg, Gehlsbach, Gehlsbrücke (über den Bach zwischen Karbow undDarß): Geilsberg, Geilsbach, Geilsbrücke. Aus diesen Ausdrücken hat der Gewährsmann der oben mitgetheilten Angabe wohl auf den Namen Geilen oder Gaillen für das untergegangene Dorf geschlossen.
J. Ritter.



|


|
|
|
20.
Etymologie des Namens Rostock.
In der "Rostocker Zeitung" vom 30. Nov. handelt es sich einmal um einen Gegenstand derjenigen Wissenschaft, die vom größern Publikum mit bewußter Virtuosität verachtet wird, der Etymologie, die jeder männiglich für eitel Taschenspielerei hält, wie laut sie selber auch rufe, sie sei das Gegentheil. Eine Berichtigung jenes Artikels mag beitragen zur gerechteren Würdigung. - Lies't man ihn, so sollte man glauben, die Slawen hätten den Begriff fliessen mit gar keinen andern Ausdrücken benannt, als solchen, die eigentlich stehen bedeuteten. Dem scheint aber ebenso wenig so zu sein, als die Möglichkeit eines solchen Verfahrens dem schlichten Verstande einleuchten will. Ein Wort, das gehen hieß, auf das FIießen anzuwenden, das würde man sich gefallen lassen; aber stehen? Daß das polnische stac (eigentlich doch = stehen) auf den Begriff werden, geschehen angewendet sei, ist ganz glaublich, da wir im Russischen und Böhmischen (z. B. l. Mos. 1, 7: und es geschah also) das Aehnliche sehen. Richtig ist auch, daß im Böhmischen stojim: ich stehe (so viel wir wissen, nicht stogim, Infinitiv: stati) heißt. Sein mag es ferner, daß rostac (nicht richtiger rozstac?) polnisch: auseinandergehen, sich auflösen, heißt (man denke nur an unsern Ausdruck entge=


|
Seite 172 |




|
gengesetzter Bedeutung: die Milch gesteht, d. h. ihre Theile stehn (treten) zusammen. Daß aber, wie es nun scheint, Rostock auf roz (auseinander) + stok (Zusammenfluß), d. h. Ausbreitung des Stromes, zurückgeführt werde, hiergegen glauben wir uns im Namen der Etymologie entschieden verwahren zu müssen, wie auch dagegen, daß dies stok oder stoka (das nicht bloß polnisch, sondern auch böhmisch ist) in irgend eine Beziehung zu jenem poln. stac - böhm. stati, gesetzt werde. Es giebt nämlich eine Wurzel, die nicht bloß in slawischen Mundarten, sondern auch in den sog. Letto=slawischen bedeutenden Umfang, Verbreitung, vor Allem aber Selbstständigkeit hat, wie eine Wurzel nur haben kann. Es ist böhm. teku (fließen): russ. tekή (fließen); litt. teketi (laufen, fließen, rinnen, siehe Nesselm. litt. Wb. p. 94 und 95). In Stender's lettischem Wb. wird man ebenfalls nicht vergebens darnach suchen. Nun ist es freilich ganz natürlich, daß stok oder stoka Zusammenfluß bedeuten, nämlich zufammengesetzt mit der slawischen Präposition s: wie z. B. böhm, rezum (aus eben jenem roz und um, welches als Simpler schon eine ähnliche Bedeutunghat): Verstand, srozumely: "einverstanden" bedeutet. (Das e in srozumely wie je zu sprechen.) Darnach wird Bialystock benannt sein, wenngleich ich solchen Ursprung des Namens nicht geographisch zu begründen weiß; um so einleuchtender wäre dieser Ursprung bei Wittstock, falls die Vermuthung richtig, daß es halbgelungene Verplattdeutschung jenes Namens sei (russisch: bjelyi oder bjel": candidus). Bei Wittstock erhält nämlich die Dosse drei Zuflüsse. Wenn endlich auch ein altslawisches rozetagil: "breitet aus", angeführt wird, so soll gegen die Thatsache, daß solches Wort mit solcher Bedeutung im Bereiche jener Chorführerin der slawischen Mundarten anzutreffen, nicht der mindeste Zweifel erhoben werden: auch im Böhmischen finden wir roztáhati (nebst Ableitungen): "ausstrecken"; nur scheint, daß hier eine dritte, nicht minder selbstständige Wurzel vorliege (böhm. táhati u. s. w. "ziehen"). Das e nämlich in rozetagil zeigt, wie es scheint, eine ältere Form eines Präfixes, vielleicht Rest einer Casusendung (denn sicherlich ist dies Präfix nicht Urpräposition, sondern jüngern, substantivischen Ursprungs): so finden wir auch im Böhm.: triti, reiben, rozetriti (mit erweichtem r), zerreiben. Nach dem Gegebenen muß es klar sein, daß Rostock (d. h. roz + tok) Auseinanderströmung sei; und so findet sich in der That noch im russischen: tók": Bach, Fließen, Fluß; rastók", der Arm eines Flusses. Wobei wir schließlich noch zu bedenken geben, ob nicht diesem russischen Gebrauch des


|
Seite 173 |




|
nämlichen Wortes gemäß auch unsere Stadt von der Thatsache benannt worden, die uns freilich nur durch mündliche Ueberlieferung zugekommen, daß einst ein Arm der Warnow von hier aus westlich geflossen sei und in der Gegend von Doberan in die Ostsee gemündet habe?
Dr. W.



|


|
|
:
|
21.
Fayence=Fabrik zu Gr. Stieten.
In den Jahrbüchern VIII, S. 244, ist aus dem handschriftlichen Nachlasse des Geheimen Raths Schmidt die Nachricht mitgetheilt:
"Fageance oder unächtes Porcellan ward eine Zeit lang auf Stieten, einem Gut der Kammerherrin von Bülau, verfertigt, und jetzt ist der Töpfer Appelstädt auf der Vorstadt Schwerin damit privilegirt worden".
Diese bisher noch nicht weiter belegte Nachricht ist durch einen Fund noch mehr aufgeklärt worden. Auf dem Gute Gr. Stieten bei Wismar ward im Parke dicht hinter dem Wohnhause ein sehr tiefer Graben angelegt und bei der Gelegenheit ein Satz Unterschalen von Tassen, gegen 12 Stück, in einander stehend, durch Feuer zusammengeschmolzen und zerbrochen, ausgegraben. Die Glasur ist weiß mit hellblauen Verzierungen. Diese Tassenschalen stammen ohne Zweifel aus der Fayence=Fabrik. Der Herr Justiz=Canzellist Fahrenheim hat diesen Fund dem Vereine übergeben.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
22.
Ueber den lübecker Martensmann
Nachtrag
von dem Professor Dr. Deecke zu Lübeck.
(Vgl. oben S. 81 flgd.)
Die Freundlichkeit, in welcher Lisch mir den ersten Abdruck seiner Nachrichten über den lübecker Martensmann mitgetheilt hat, veranlaßt mich, dieselben mit einigen Bemerkungen zu erweitern, welche vielleicht zu ferneren Forschungen anregen.


|
Seite 174 |




|
Die deutsche Sitte nun, nachbarliche Fürsten alljährlich zu begaben, ist eine so alte, daß sie in die Zustände, welche Tacitus vor Augen hatte, hinaufreicht: sie war um so angemessener, wo man den Herren große Gunst verdankte. In dessen ward zu einer Zeit, da man nach Menschengedenken und Herkommen ebenso oft verfuhr, als nach schriftlichen Verträgen, oft etwas zu einem Recht, was diesen Charakter ursprünglich nicht hatte. Dazu kam, daß man selbst da, wo man übrigens unbedingt begabte, sich eine Art Erinnerung an die Begabung gern vorbehielt, zumal bei hoheitlichen Rechten; es lag auch nicht selten beiden Theilen daran, der Begabung den Charakter einer rechtmäßigen für die Zukunft zu wahren, wenngleich die Freiwilligkeit für den Augenblick nicht zweifelhaft war. In dieser Hinsicht haben auch die auf jährliche Prästationen erfolgenden Gegengaben ihre Bedeutung.
Nun hatte nach einer alten meklenburgischen Sage einer der Fürsten Meklenburgs der Stadt Lübeck so viel Land geschenkt, wie man an einem Morgen umpflügen könnte; ats man aber die bekannte Praxis der Dido geübt, sich jährlich ein Faß Rheinwein für das ausbedungen, was seiner Ansicht nach zu viel war. Es ist in dieser Sage ein Anklang an die Zuweisung von Wiesenland zu Lübeck, welches Graf Günzel III. von Schwerin an Eberhard Westfal, dieser jedoch der Stadt überlassen hatte. wobei der Graf im October 1244 seinem Recht völlig entsagte. Indessen liegt hier ein förmlicher Kauf vor, und so wird auch die volle Ablösung durch Geld erfolgt sein; wäre aber auch, wovon die Urkunden nichts sagen, ein jährliches Geschenk außerdem bedungen, so wäre es ein unbedeutenderes, als die feierliche Martinalprästation gewesen.
Viel wichtiger war es für den Handel und Verkehr Lübecks, daß Graf Heinrich I. schon 1227 auf ewige Zeiten die Freiheit von Zoll und Ungeld durch sein Land gewährte, und daß seine Nachfolger dies ausdrücklich bestätigten. Schon ein anderer geborner Meklenburger, Dompropst Dreyer, hat darauf hingewiesen (Einleit. i. d. lüb. Verordnungen, S. 106 flgd.), daß auch anderswo eine jährliche Prästation für solche Begabung stattgehabt, und noch dazu stimmt die Art der Gabe, ein Pfund Ingwer, die der meklenburgische Kanzler Husanus für ältere Zeiten bezeugt, weil dieses Gewürz, so wie Pfeffer, die Stelle des Geldes bei Zollabgaben öfters vertrat. Später ward dafür Geld gegeben, zuletzt 2 Thaler, die aber in kleiner Münze unter das herbeiströmende Volk ausgeworfen wurden.
Das eigentliche Geschenk aber war eineTonne rheinischer Most, wie auch Lisch nachgewiesen hat. Auch die erste


|
Seite 175 |




|
Ankunft dieses in älteren Zeiten hochbeliebten Getränks ward in mancher Gegend Anlaß zu Festlichkeiten. Sie erfolgte in Lübeck gegen Martini; der erste Most wurde, sobald die Kärrner vom Rhein her ans Thor kamen, mit Trommeln und Pfeifen eingeholt und in den Rathsweinkeller unter dem Jubel des Volks gebracht; auch fand ein Tractement statt. Daß man von so edler Gabe auch denen mittheitte, die man sich günstig zu erhalten suchte, ist gewiß: noch jetzt kommen Weingaben wie in jener Zeit vor. Erst als man im Wein wählerischer wurde und die kunstgerechte Bearbeitung des Mostes die Lieferung um Martini schwierig, ja unmöglich machte, wie die Lübecker dies noch 1755 den Herzogen von Meklenburg darlegten, ward statt des Mostes guter alter Rheinwein (damals 200 Mk. an Werth) geliefert.
Indessen die Festlichkeit unterblieb darum nicht; denn man war, und dies ist ferner zu bedenken, seit uralter Zeit gewohnt, die Martinizeit ats Volksfest zu begehen. In manchen Gegenden war nämlich an die Stelle des heidnischen Gottes Wurten der christliche St. Martin, dem er schon in der äußern Erscheinung glich, getreten; überdies fiel das große Schlachtopfer in den eben deshalb Schlachtmonat genannten November; man feierte auch zu Martini das Fest des wiederkehrenden Winters. Darauf bezügliche Festlichkeiten, die den Tag oder die Zeit zu einer Art Vorweihnacht machten, haben sich auch noch in unseren Gegenden erhalten. Zu dem Weinmost aber stand der heil. Martin, der eben deshalb musto madidus heißt, in besonderer Beziehung; eine Menge Lieder deuten darauf, und an den zu seiner Festzeit häufigen Herbstgelagen führte der alte Spruch: "wol nich vul sick supen kan, de is ken rechte Martensmann!" manche Wein= oder Mannesprobe herbei, - wie sie denn auch der lübsche Martensmann im Schweriner Hofkeller nach altem Gebrauch bestehen mußte. Die von den meklenburgischen Fürsten schon im 14. Jahrh. bestätigten Martinsbrüderschaften gehören auch hieher; weil aber St. Martinus ganz besonders der Schutzpatron der Armen war, so fehlte es auch nicht an fröhlichen Spendungen für diese, wie sie nach der Derbheit früherer Tage, durch Auswerfen von Geld, Früchten, Nahrungsmitteln, bethätigt wurden.
Wenn nun der lübsche Reitendiener gerade am Martensabend zu Schwerin ankam und dort mitten in das Volksfest, noch dazu mit des Jahres Erstling, dem beliebten Rheinweinmost, fuhr: so bedarf der Jubel wohl keiner weiteren Rechtfertigung. Höchstens bedurfte es der Maßnahmen, und diese glaube ich allerdings in den Umständlichkeiten zu erkennen,


|
Seite 176 |




|
unter denen die Auffahrt geschah: denn das Geschenk mußte wohlbehalten überbracht werden. Daß dabei ein altheidnisches Recht, wie gestrandete Schiffe, so auch schadhaft gewordene Kaufmannswagen, als dem Landesherrn verfallen anzusehen, mißverständlich zur Anwendung kam, ist gewiß: aber schon aus der ganzen Procedur der Besichtigung des Wagens und der Pferde geht hervor, daß sie, wenn auch ernstlich genommen, doch ursprünglich bloß dem Charakter des Festes entsprach.
Legt man besonderen Werth auf diesen Punkt, so wäre gerade dieser Umstand ein Zeichen, daß die Prästation ursprünglich nicht eine Folge des freigegebenen Verkehrs sei. Für den Fall bliebe die Annahme übrig, daß sie die Verbittung oder den Schutz der im Lande belegenen lübschen Güter habe erwirken sollen. Und allerdings sprach man zu Lübeck in Betreff der Martinalprästation nach Segeberg, welche indeß ohne besondere Feierlichkeit geschah, die Ansicht aus, als die engere Verbindung mit Holstein wegen der dort liegenden Patriziergüter aufhörte: daß nun auch die Prästation unterbleiben müsse. Ich mag diese Ansicht nicht theilen; in Meklenburg besaßen nur wenig Lübecker Güter, und die geistlichen Stifter hätten ihre Schutzgabe selbst leisten müssen. Ich halte vielmehr dafür, daß auch der Segeberger Martensmann das gute Vernehmen in Bezug auf den freien Verkehr zu befestigen bestimmt war.
Darin, daß die Reichssteuer schwerlich gegen eine so geringfügige Recognition aufgehoben worden ist, stimme ich mit Lisch durchaus überein. Die Schirmvogtei, wenn auch nicht die Reichssteuer, welche fortwährend an den Kaiser gezahlt ward, hörte übrigens, seitdem 1374 Kaiser Karl IV. der Stadt Lübeck das beständige Vicariat in Verfolgung und Bestrafung der Landfriedensbrecher übertragen, schon wenige Jahre nachher gänzlich auf.
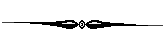


|
[ Seite 177 ] |




|



|


|
|
:
|
XV.
URKUNDEN-SAMMLUNG.


|
[ Seite 178 ] |




|


|
Seite 179 |




|
Nr. I.
Der Fürst Kanut, des Fürsten Prizlav von Meklenburg Sohn, schenkt der Domkirche zu S. Kanut in Odensee in welcher er vor dem Altare des heiligen Kanut sein Begräbniss erwählt hat, 2 Hufen in Tandzleth auf der Insel Alsen und die übrigen Besitzungen, welche er auf der Insel Alsen erworben hat.
D. d. 1183. Nov. 20.
Nach einer Abschrift des dänischen Geschichtsforschers Langebek im königl. dänischen Geheimen Archive zu Kopenhagen (nach der von dem Geschichtsforscher Cornelius Hamsfort zu Odensee von dem Originale genommenen Abschrift auf der Universitäts-Bibliothek zu Upsala).
In nomine domini nostri Jhesu Christi. Notum sit omnibus fidelibus, clericis et laicis, tam futuris, quam presentibus, in regno Danorum 1 ) sub protectione dei commorantibus, quod 2 ) ego Kanutus, Prizlaui principis filius, vitam hanc caducam transitoria vanitate 3 ) animaduertens ad tempus protelari ac ineuitabili meta mortis quantocius terminari 4 ), pro anime mee salutisque remedio sanctam Otheniensem ecclesiam, in qua sepulture mee locum coram altari beate genitricis Marie cum beniuolo assensu monachorum ibidem deo militantium elegi, hereditatis mee participem 5 ) sa-


|
Seite 180 |




|
lubri consilio et diuine recompensacionis intuitu constitui, sperans siquidem, imo reuera confidens 1 ), superna annuente gratia pro elemosinarum largicione in resurrectione iustorum me boni operis mercede non priuari et in terra viuentium nonnulla beate patrie porcione potiri: deo sanctisque eius martiribus Kanuto atque Albano, quorum reliquie 2 ) in eadem ecclesia requiescunt, dilectisque fratribus meis predictis monachis Otheniensibus, qui me expanso 3 ) karitatis sinu in plenarium fraternitatis sue collegium susceperunt seseque pro me quandoque defuncto velut pro suo proprio fratre loci professo in missis 4 ), elemosinis et omnimodis mortuorum officiis actituros promiserunt, duos mansos in Tandeslete 5 ) et reliquas terras ac possessiones, quas in vniuersa 6 ) Also usque in diem presentem acquisiui 7 ), habui 8 ) et possedi, post finem dierum meorum legittimo et irrefragabili iure possidendas voto et donacione 9 ) sollempni contuli. Quarum terrarum uel possessionum collacionem, a domino Symone 10 ), episcopo eiusdem ecclesie, sub sentenciali anathematis nodo roboratam, ne aliqua columpniarum procella in posterum, quod absit, perturbetur uel euacuetur, tam nostri, quam sancti Kanuti sigilli impressione ad memoriam presencium et testimonium futurorum placuit per cyrografum confirmare. Actum est hoc anno incarnacionis dominice M. C. LXXX. III., XII kal. Decembris, in die


|
Seite 181 |




|
sancti Edmundi regis et martiris, anno II gloriosi regis Danorum Kanuti quinti 1 ). Huius rei testes fuerunt idonei clerici et laici: Eskerus prepositus, Henricus capellanus meus 2 ) et medicus et magister Hylarius et Robertus sacerdos de Heslaker 3 ) et Vbbo, Godefridus, Toke, stabularii mei, et Thuri Scalmy filius 4 ) et Petrus filius Wangh 5 ) et Willerinus Saxe filius 6 ) et Hemmingh Eluf filius 7 ) et Grimme Taki 8 ) filius 9 ). Hec 10 ) seruans seruetur, destruens a domino deo destraatur. Fiat. Fiat. Amen. Amen.
Das Original dieser Urkunde findet sich nach der Versicherung des Herrn Professors Dr. Paludan - Müller zu Nykiöbing auf Falster, früher zu Odensee, nicht mehr in Odensee und nach der Versicherung des Herrn Matthiessen, Stipendiaten am Geheimen Archive zu Kopenhagen, auch nicht in Kopenhagen, und ist eben
"Testes fuerunt: Esgerus prepositus, Henricus sacellanus et inedicus Canuti principis, M. Hilarius, Robertus sacerdos Heslagriensis, Ubbo, Gotfredus, Taco, stabularii principis, Thuro Scalmi filius, Petrus Vangi filius, Wilhelmus Saxonis filius, Hemmingius Elevi filius, Grimmo Taconis filius".


|
Seite 182 |




|
"Haec sunt rescripta privilegiorum sanctae Othoniensis ecclesiae, quae de sua dignitate et libertate ante incendium habuit".
als ein Geschenk des Staatscanzlers Grafen de la Gardie, "Donatio de-la-Gardiana", nach Upsala gelangt und wird hier auf der Universitäts-Bibliothek unter Nr. 39 aufbewahrt.
Als der dänische Geschichtsforscher Langebek im J. 1756 in Upsala war, nahm er von der alten hamsfortischen Copie Abschrift, wie sich aus der Beschreibung der Siegel und anderen Umständen deutlich ergiebt, und brachte diese Abschrift mit nach Kopenhagen, wo sie im Geheimen Archive aufbewahrt wird.
Diese von Langebek von der alten hamsfortischen Copie genommene Abschrift liegt der Nachricht und Beschreibung des dänischen Geschichtschreibers Suhm in dessen Dänischer Geschichte, Kopenhagen, 1806, zu Grunde und ist jedenfalls auch von Thorkelin benutzt, welcher die Urkunde in
Diplomatarium Arna-Magnaeanum, exhibens monumenta diplomatica, quae collegit et Universitati Havniensi testamento reliquit etc., edidit Grimus Johannis Thorkelin etc. Tomus primus, Danica complexus ab anno 1085 ad 1259, Tom. I, Havniae et Lipsiae, 1786.
p. 271 (vgl. p. 56) hat abdrucken lassen.
Es giebt (oder es gab) aber auch noch eine andere Abschrift (Dipl. Arna-Magn. I, p. 50), welche schon in dem Werke
Annales Ecclesiae Danicae diplomatici oder nach Anordnung der Jahre abgefasste und mit Urkunden belegte Kirchen-Historie des Reichs Dänemark von Erich Pantoppidan. Erster Theil. Copenhagen. 1741.
S. 459 abgedruckt ist; dieses Werk hat Suhm auch benutzt.
Die Abschrift, welche sich Rudloff im vorigen Jahrhundert erwarb und wahrscheinlich schon früher aus Upsala gekommen und in den neuesten Zeiten mit der handschriftlichen Urkunden- Sammlung Rudloff's in das meklenburgische Staats-Archiv zu Schwerin gekommen ist, ist so schlecht und lückenhaft, dass sie neben den übrigen kaum einer Erwähnung verdient.
Dass Hamsfort noch das Original gekannt hat, geht aus der Beschreibung der Siegel hervor, welche Langebek mit abgeschrieben hat, also aus der hamsfortischen Abschrift stammen muss. Unmittelbar nach der langebekschen Abschrift steht:
"supra scriptum:
- - - - - [sigillum] principis Prizlaui. in posteriori parte apparuit - - - - - Scriptura legi non potuit vetustate. Secundum crat capi-


|
Seite 183 |




|
"tuli ecclesie Ottoniensis similiter in pressula pergamenea impendens, de cera rubea albe et late impressa, in quo residebat ymago regis habentis in dextra pomum cruce signatum, in sinistra sceptrum regale, in sede regali residentis, cum hac scriptura circumferentiali:
Sigillum Sancti Kanuti Regis et Martyris de Ottense".
An der Urkunde hingen also an Pergamentstreifen zwei Siegel.
Das zweite Siegel war das Siegel des Capitels zu Odensee, welches auf eingelegter rother Wachsplatte das Bild des thronenden Königs Kanut des Heiligen zeigte.
Das erste siegel war das Siegel des Fürsten Kanut, dessen Umschrift nach der vorstehenden lückenhaften Beschreibung Hamsforts vor Alter nicht zu lesen war. Langebek fand aber ausserdem in den Excerpten Hamsforts eine Zeichnung des Siegels Kanuts vor, welche Langebek in einer Note also beschreibt:
"Corn. Hamsfort in excerptis suis sigilli hujus picturam aliqualem adposuit, in cujus adversa parte videtur eques dextra manu gladium supra caput tenens, sinistra scutum prae se ferens, addita inscriptione:
S. Canuti filii principis Prislai.
In parte aversa stat Leo coronatus, non addita inscriptione".
Kanut führte also zwei Siegel. Auf der Vorderseite war das Reiterbild des Fürsten, der ein Schwert über dem Haupte schwingt und einen Schild vor sich hält, mit der Umschrift:
S. Canuti filii principis Prislai.
(Dieses Siegel ist also ganz dem Siegel seines Vetters Nicolaus I., des Sohnes Wartislavs, gleich.) Auf der Rückseite war das Rücksiegel oder Secretsiegel Kanuts aufgedrückt, mit einem gekrönten Löwen, ohne Umschrift. - Da auch Suhm das Siegel Kanuts beschreibt, so ist dies ein Beweis mehr, dass er die langebeksche Abschrift benutzte.
Nr. II.
Stephanus, Abt des Klosters zur H. Genovefa in Paris, verkündigt dem durchlauchtigen, edlen Herrn Kanut von Dänemark den Tod seines in dem Genovefa - Kloster gestorbenen Bruders Waldemar und bittet ihn um Beiträge zur Wiederherstellung der Klosterkirche.
D. d. (1184.)
Canuto nobili viro de Dacia.
Viris illustribus et qui de sanguine regio ducunt originem proprie conuenit, vt sicut sunt magnifici


|
Seite 184 |




|
genere, ita sint munifici largitate. Quodsi largitas vsque ad ecclesias extendatur et pro salute propria requieque defunctorum, et maxime parentum ac propinquorum, qui facultatibus abundant, loca religiosa visitent, pauperes alant, elemosinas distribuant, et coram deo gratiam et coram hominibus promerentur fauorem. Frater vestey carnalis bonae indolis iuuenis Waldemarus cuius memoria in benedictione est, regio generi vestro condigna virtute respondens, et apud nos spiritum reddidit deo et inter nos corpus commendauit sepulcro. Orationum ac beneficiorum spiritualium, sicut unus ex nobis, particeps est et erit in perpetuum, surrecturus in die iudicii cum beata virgine Genouefa et extremae benedictionis sententiam cum his, qui a dextris erunt, et cum ipsa pariter recepturus. Et quoniam parietes ecclesie, in quarequiescit, antiqua parentum vestrorum adhuc gentilium concrematos incendio et ruina, extunc vetustate comsumptos, renouare incepimus, et sarta tecta ipsius noua lignorum macerie plambeisque laminibus contegere proposuimus, nobilitati vestrae preces fundimus, ut ad coëmendum plumbum per praesentium latorem G., canonicum nostrum, aliquod beneficiam nobis mittatis, vnde et a deo remuneretur liberalitas vestra et ab hominibus commendetur generis vestri fama et a nobis celebrior et frequentior habeatur fratris vestri memoria sempiterna.
Gedruckt in: "Epistolae Gerberti - - archiepiscopi, postea Romani pontificis Silvestri secundi. - - Epistolae Stephani - - s. Genouefae Parisiis abbalis, tandem Tornacensis episcopi, ab anno 1159 usque ad 1196. Nunc primum in lucero editae - - auspiciis antistitum et cleri Galliae. Parisiis. M. DC. XI. Nr. CLXIX, p. 646". - Vgl. die folgende Urkunde.


|
Seite 185 |




|
Nr. III.
Stephanus, Abt des Klosters zur H. Genovefa in Paris, bittet den König von Dänemark, seinen Verwandten den Edlen Kanut zu bewegen, dass er zum Gedächtniss seines in dem Kloster gestorbenen Bruders Waldemar zur Wiederherstellung der Klosterkirche Beiträge gebe.
D. d. (1184).
Canuto illustri Danorum regi
salutem, vitam et victoriam.
Gloriosam ac foelicem regni Danorum potentiam et virtutem, qua antiqui parentes vestri pagano errore adhuc detenti in fortitudine brachii sui et in robore virium suarum Gallias inuaserunt, et annales historiarum continent, et communis fama recitat, et vrbium oppidorumque muri semiruti protestantur. Ex eorum vos nobili stirpe descendisse, et gentilem illam tyrannidem in christianam mansuetudinem mutasse, gaudet mater ecclesia, cui assiduum impenditis cultum, deuotum exhibetis obsequium, beneficum erogatis augmentum, nec regio fastu per dei gratiam sacerdotium premitis, nec debitam reuerentiam sacerdotio denegatis. Cumque in aliis quibusdam regnis per tyrannidem principum seruituti subiecta sit ecclesia, in vestro per regalem clementiam vestram libera est et quieta. Supradictae persecutionis a vestris potentibus gentilibus tum illatae calicem bibit et absintio doloris inebriata est ecclesia beate virginis Genouefae, in qua deo licet indigni deseruimus, fracta, diruta et combusta. Testantur hoc parietes incendio illo consumpti et calce in cinerem concremata, putrefacti, tremuli et exesi. Eos renouare incepimus, superponenda noua lignorum macerie et tecto plumbeo supponendo. Nec hoc dicimus, princeps victoriosissime, vt querulis aut mendicis vocibus importune aliquid vel improbe postulemus a clementia vestra: sed vt misericorditer consanguineum vestrum nobilem virum Canutum moneatis, ne omnino sit immemor fratris sui Waldemari , qui in beato fine suo canonicus


|
Seite 186 |




|
noster factus, in celebri claustri loco sepultus, in omnibus beneficiis et orationibus, quae in ecclesia nostra fiunt, particeps, frater et socius, nec in vita partem aliquam, vt dicitur, sui funiculum hereditatis suae possedit, nec post mortem siue ipse, siue ecclesia pro eo aliquid inde percepit. Vox iustitie ipsius clamat ad fratrem de terra: frater da mihi portionem substantiae paternae, quae me contingit. Rogamus, supplicamus ac petimus, vt vos, qui tociens-armis superalis idolatras et iugo subiicitis christiano, nobilis illius viri pectus licet ferreum precibus expugnetis, vt mortuo fratri suo gratiam non neget et in tanta necessitate ecclesiae, in qua frater eius et diem clausit vltimum et diem expectat extremum, pro tota hereditate, quam possidet, aliquid mittat, vnde et apud deum securior sit cius conscientia et apud hommes hilarior fama et circa mortuum liberalitas appareat debita, et beniuolentia manifestetur fraterna. Charissimum fratrem et canonicum nostrum presentium latorem G. clementiae vestrae commendamus, vt eum regali iuuetis patrocinio et si opus fuerit auxilio protegatis. Valeat et crescat in dies semper magnificentia vestra.
Gedruckt in: "Epistolae Gerberti - - Epistolae Stephani - - Tornacensis episcopi ab anno 1159 usque ad 1196. - - Parisiis M. DC. XI." Nr. CLXX., p. 647. - Vgl. die vorhergehende Urkunde.
Nr. IV.
Der Herzog Wartislav von Pommern giebt der Stadt Greifswald das Recht der Selbstvertheidigung und der Aufführung einer Stadtmauer und erlässt das Verbot der Errichtung einer fremden Burg auf dem Stadtgebiete.
D. d. Darsin. 1264. Mai 17.
Nach der Urkunde im Archive der Stadt Greifswald.
Wartislaus dei gratie dux Demminensis fidelibus suis burgensibus in Grypswold suae dilectionis integritatem. Quoniam incommoda, quae de diversis casibus suboriri poterunt, pro possibilitatis modulo sunt cavenda, univer-


|
Seite 187 |




|
sitati vestrae plenam damus ex parte nostri, necnon successorum nostrorum potestatem defendendi, prohibendi vos ipsos, murum opponendi, ne aliquis contra iustitiam castrum aut aliquam munitionem in terminis Grypeswold construat aut aedificet in vestrum vestrorumque praeiudicium aut gravamen. Volumus itaque ut in cadem civitate nostra unum sit forum, unus advocatus et idem ius, quod nostra dinoscuntur privilegia continere. Cum autem haec agerentur, hi testes astabant: Heinricus Ursus, Bartholdus advocatus, Henricus mareschalcus, Lippoldus Ursus, Theodoricus Ursus, Gherwin Stange, Domoslaus, milites, Hermannus Magnopolensis domicellus et alii quam plures. Et ut res gesta robur obtineat firmitatis, sigillo nostro praesentem paginam communimus. Datum Dersin, anno gratiae 1264, XVI kal. Junii.
Nach der Urkunde im Archive der Stadt Greifswald gedruckt in Dähnert's Pommerscher Bibliothek Band III, 1754, S. 407, Urkunde Nr. 5. Der Herr Professor Kosegarten berichtet, dass im Originale der Urkunde sicher:
Hermannus Magnopolensis domicellus
mit folgenden Abkürzungen:
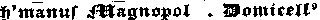
und im Datum sicher
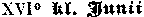
zu lesen ist.
Am 27. Mai (6. cal. Junii) 1264 war auch der Fürst Heinrich von Meklenburg zu Greifswald bei dem Herzoge Barnim von Pommern ("praesente etiam domino Henrico Magnopolensi"); vgl. Dähnert a. a. O. S. 409., Urk. Nr. 6.
Dersin oder Darsim ist, nach der Mittheilung des Herrn Archivars Dr. Klempin, das jetzige Ludwigsburg bei Greifswald, am östlichen Ufer der Dänischen Wiek, Greifswald und Kloster Eldena (Hilda) und der Mündung des Riekgrabens (Hilda) gegenüber; vgl. auch Kosegarten Codex Pomer., I, S. 828. - Darsin, welches in den pommerschen Urkunden im 13. Jahrh. öfter vorkommt, wird ein Lieblingsaufenthalt der vorpommerschen Fürsten gewesen sein; im J. 1264 machte hier auch der Herzog Wartislav von Pommern-Demmin sein Testament; vgl. v. Dreger Codex Pomer. I, Nr. 365, S. 475.


|
Seite 188 |




|
Nr. V.
Der Bischof Gottfried von Schwerin ertheilt denjenigen Ablass, welche das Heil Geist-Hospital in Hamburg unterstützen werden.
D. d. 1292. März 19.
Nach dem Originale im Privatbesitze.
G. dei gratia Zuerinensis episcopus vniuersis Christi fidelibus, ad quos presentes littere peruenerint, salutem in domino sempiternam. Quoslibet sancte fidei professores ad zelum devotionis et ad opera karitatis allicere cupientes, nos, de omnipotentis dei misericordia et apostolorum eius Petri et Pauli confisi suffragiis, omnibus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis, qui ad hospitale sancti spiritus in Hammenborg manum porrexerint adiutricem, quadraginta dies et karenam de iniuncta sibi penitencia misericorditer relaxamus, item ad altare eiusdem domus, quod consecratum est in honore beate Marie virginis et duodecim apostelorum, quadraginta dies et karenam. Datum anno domini M° CC° nonagesimo secundo, feria quarta post Letare.
Nach dem Originale, auf Pergament, im Privatbesitze in Berlin, mitgetheilt von dem Herrn Pastor Ragotzky zu Triglitz. Das Siegel fehlt.
Nr. VI.
Der König Erich von Dänemark verleiht den Rittern Pridbor, Nicolaus und Thetze von Putbus, Brüdern, und Johann van Gristow die Halbinseln Wittow und Jasmund, wie sie die Fürsten von Rügen bisher besessen haben, nach dem Absterben des Fürsten Wizlav von Rügen und des rügenschen Fürstenhauses zum erblichen Besitze.
D. d. Nyköping. 1309. Nov. 15.
Nach dem Originale im fürstlichen Archive zu Putbus.
Omnibus presens scriptum cernentibus Ericus, dei gracia Danorum Slauorumque rex, salutem in domino


|
Seite 189 |




|
sempiterum. Notom facimus vniuiersis, quod nos, sano ducti consilio nostrorum fidelium consiliariorum, deliberacione sufficienti prehabita, rite et racionabi[liter] iure hereditario dimisimus, contulimus et porreximus famosis militibus nobis sincere dilectis Prydboro, Nycolao et Thetzcen, fratribus, de Pudbuzke dictis, et Johanni de Ghrizstowe ac eorum veris heredibus, insulas videlicet Wyttowe et Jazmuncte dictas cum omnibus distinctionibus et pro[uentibus et cum] omni iure et iudicio, cum vasallatu et homagio vasallorum atque subditornm, cum precaria et denariis, qui dantur de moneta, et cum iure [patronatus] ecclesiarum, et generaliter cum omni fructu et vtilitate, sicut ipsas princeps magnificus dominus Wizlaus, Ruyanorum princeps, et [sui progenitores] actenus in longitudine et latitudine tenuerunt et possiderunt, ita quod predicte insule cum omnibus pertinenciis, ut premittitur, iure [hereditario ad he]redes et successores a progenie in progeniem predictorum militum deuolui perpetuo poterunt et debent, si idem dominus Wizlaus, Ruyano[rum princeps, absque prole h]erede legitimo moriretur, quando ipsius terra ad nos et ad successores nostros, reges Dacie, fuerit deuoluta, pro quibus insulis [et prouentibus earundem] predicti milites et eorum heredes perpetuis temporibus nobis et regno Dacie cum decem dextrariis expeditis seruire tenebuntur, nec [aliquid propri]etatis in ipsis insulis preter seruicium predictum obtinebimus quoquo modo. Insuper ipsi cum omnibus amicis suis et aliis, quos ad hoc allicere po[terunt, vbi] cum honore facere possunt, commodis, profectui et honori nostro et regni Dacie feliciter et fideliter intendere debent totis viribus et toto posse. Testes huius sunt: Hinricus, dei gracia dominus Mangnopolensis et Stargardensis, vir nobilis, item milites: Johannes de Cernyn, Nicolaus Herlogisson, camerarius noster, Lagho Akesson, marschalcus noster, Conradus de Cremon et Hermannus de Ordzce, milites, et plures alii fide dingni. In o[mnium tamen] premissorum testimonium et ne factum nostrum a quoquam nostrorum successorum infringatur, presentem litteram conscribi fecimus et sigillo nostro sigillari. Datum et actum ante castrum Nicopinghe, anno domini millesimo CCC° nono, sabbato post Martini.
Nach dem Originale im fürstlichen Archive zu Putbus abgeschrieben von dem Herrn Burgemeister Fabricius zu Stralsund. Die Schrift der Urkunde ist queer über durch Feuchtigkeit so ver-


|
Seite 190 |




|
blichen, dass viele Wörter nicht mehr zu erkennen waren, sondem aus einer beglaubigten Abschrift vom J. 1333 in [ ] ergänzt werden mussten. Das Siegel fehlt an dem Siegelbande von blauer Seide. Gedruckt in Ludewig. Reliq. XII, p. 421.
Nr. VII.
Der Bischof Gottfried von Schwerin vereinigt das Archidiakonat Rostock wieder mit der Präpositur Bützow.
D. d. Warin. 1310. Oct. 17.
Nach einer Abschrift aus dem 14. Jahrh. im großherzogl. meklenburg. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Nos G. dei gratia episcopus Zwerinensis notum facimus vniuersis, quod licet archidiaconatus Rozstokcensis aliquamdiu detentus fuerit diuisim a prepositura Butzowensi, ad quam spectat, attendentes tamen, quod, cum assumpti essemus ad pontificale officium, inuenimus eundem archidiaconatum quasi possideri et haberi pro vna eademque et indiuisa dignitate cum Butzowensi prepositura, cui quasi possessioni concordant instrumenta, que confecta de hoc habentur in ecclesia Butzowensi, supradictum archidiaconatum siue bannum nuper lapsis aliquot annis redintegrauimus ac vniuimus cum ipsa Butzowensi prepositura, per hoc futuris litibus obuiantes. Ad hanc quidem redintegracionem et vnionem accessit consensus honorabilis viri domini Hermanni Zwerinensis prepositi, qui in hac parte vice Zwerinensis capituli commissa sibi specialiter fungebatur, cum quo tractatum et deliberacionem, sicut de iure oportuit, prehabuimus diligentem. Huius rei testes sunt: Ludolfus de Bulow et Johannes de Luttekenborgh, Zwerinenses canonici, et alii fide digni ad hec vocati specialiter et rogati. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Warin anno domini M° CCC° decimo, sexto decimo kal. Nouembris.
Aus dem Pergament-Diplomatarium des Collegiatstiftes Bützow, fol. XXII.


|
Seite 191 |




|
Nr. VIII.
Die Herzoge Otto und Barnim und die Herzogin Elisabeth von Pommern schliessen ein Schutzbündniss mit dem Bischofe und dem Dom-Capitel von Camin.
D. d. Wollin. 1330. Dec. 13.
Nach einer Abschrift in der v. Dregerschen Sammlung zu Stettin.
Wy Otto unde Barnym, van der genâde gades etc., unde wy Elisabethen, hertoghinne der vôrbenômeden, van unser kyndern weghen, bekennen und betûghen âpenbâr yn dessem brêven, dat wy uns vorênet unde vorbunden hebben uppe alle, de nu sint, myt deme êrbâren manne unseme heren unde gêstliken vâder biscop Frederik van Cammyn unde mit unseme lêven ôme Barnym van Werle, dem prâvest, unde den dômheren dârsulvest, alle tydt êndrachtigliken tosâmen to blîven, unde wôrt en up weret, der schalt uns up weren. Wêre dat idt ene werre up unse mann edder up unse undersâten, des scole wy minne edder rechtes weldich wesen bynnen twee mânten; mochte wy des nicht dôn, so schulde wy em byhulpen syn uppe si ys de welghe(?); wêrt dat se unser bedroften, so scole wy en volgen unde helpen myt druttich mannen myt helmen van unser weghen unde mit druttich manne myt helmen van unser vedderen weghen, uppe ere kost unde uppe unse verlust, unde scolen se en antwerden in ere land, dat se uns besceiden, unde de dignisse scal volghen der kost. Wêret dat men vanghen venghen, de scal men dêlen nach mantâle. Wêret dat men slote wunne in vîgende lande, de scall men dêlen na mantâle; wurden se ôvers gewhinnen in deme stichte tho Camyn, scolen se des stichtes blîuen. Wêret ôk dat des stichtes slote bestallet wurden edder thôge man yn des stichtes land, so scole wy volghen unde helpen myt gantzer macht. Vortmer scolen wy uns nicht vorbinden mit ênghen mannen âne eren willen unde vulbôrt. Up dat alle disse dinck stete unde vast blîuen, so hebben wy unse inghesegele ghehenget an dissen brêf und myt trêwen lâuet myt unsen ridderen, de hyr na bescreuen stân: Hennink Borke, Hennynk unde Werner van Schwerin, Pardam van Wacholte, Hinrik van Reczym, Rolaff van Elsholte, Clawes


|
Seite 192 |




|
Troye, riddere, Herman Bruseuitze, Lüdeke van Sceninghe, knechte. Desse brêf ys gegheuen to Wollin na der bôrt unses heren dûsent iâr drêhundert iâr druttich iâr, yn sunte Lucien dâghe.
Nach den v. Dregerschen Urkunden-Abschriften aus der caminer Matrikel gedruckt in v. Eickstedt Urkunden-Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der von Eickstedt, Berlin, 1838, I, S. 146, Nr. 34.
Nr. IX.
Der Bischof Friederich und das Dom-Capitel zu Camin erlassen für eine Schuld von 600 Mk. wend. Pf. dem Kloster Eldena die jährliche Abgabe von fünf Drömt Korns aus dem Dorfe Dersekow an die Pfarre zu Gützkow und trennen die Kapelle zu Kröslin von der Mutterkirche zu Wolgast zur Errichtung einer eigenen Pfarre.
D. d. Camin. 1331. Oct 25.
Nach einer Abschrift in der v. Dregerschen Sammlung zu Stettin.
In nomine domini Amen. Fredericus, dei gratia Caminensis ecclesie episcopus, omnibus Christi fidelibus presentia visuris et audituris salutem in domino sempiternam. Cum hominum memoria sit labilis plerumque ad malum flexibilis, expedit presertim ordinationes ecclesiasticas scripture testimonio roborari. Quapropter noscat universa natio presentium et felix successio futurorum, quod cum religiosi viri abbas et conventus in Hylda, Cisterciensis ordinis, nostre dioecesis, per literas predecessorum nostrorum, videlicet Petri, Hinrici, Conradi et Arnoldi, recordationis felicis, nobis et nostro capitulo declarassent, ecclesiam nostram legitime fuisse eisdem et suo monasterio obligatam in sexcentis marcis denariorum monete Slavicalis, ob quorum solutionis defectum eidem abbas et conventus plurima dampna se asserebant pertulisse, supplicantes quatenus saltim aliquam recompensam nostre ecclesie minus nocivam et ipsis proficuam faceremus: nos tam piam et devotam et iustam supplicationem


|
Seite 193 |




|
exaudire cupientes, examinata et probata plenius dictorum religiosorum intentione, de speciali consensu nobilis et honorabilis domini Barnym de Werle, ecclesie nostre prepositi ac patroni ecclesie Gutzekowensis, tociusque dicte nostre ecclesie capituli in recompensam dictorum dampnorum dimittimus dictos religiosos et eorum bona liberos, quitos et solutos perpetuis temporibus a quinque tremodiis annone, quos annis singulis ecclesie in Gutzekow seu eius rectori dare hactenus consueverunt de villa Dersecowe, olim filia dicte ecclesie in Gutzekow, nunc autem ab ipsa separata. Insuper ad instantiam dictorum religiosorum erga nostram ecclesiam bene meritorum pure propter deum et divinum cultum augmentandum, de pleno consensu abbatis in Stolp et conventus ibidem eiusdem ordinis et patronorum ecclesie in Wolgast dimembramus et presentibus separamus capellam et villam Crasselin cum quatuor villis, videlicet Vrest et Vencemin, que villa nunc unita est ipsi Vrest, Voddowe et Holendorp, ab ecclesia matrice Wolgast, ita quod ab hoc die inantea dicti religiosus abbas et conventus in Hylda ad dictam capellam immo verius ecclesiam parochialem in Crasselin, canonice a sua matrice ecclesia dimembrata, habeant et possint sicut in Dersekow ydoneum clericum presentare, salvis iuribus spiritualibus in presentium et rectoris ecclesie predicte, quem nolumus, nec possumus, quam diu vixerit, suo iure privare, prefatas eciam villas Crasselin, Vrest, Venzemin, Voddowe et Hollendorp cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, prout ipsas ecclesia parrochialis in Wolgast possederat, esse volumus separatas. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Camin, anno domini millesimo CCC° XXXI°, feria sexta ante Simonis et Jude apostolorum, presentibus honorabilibus dominis Barnym preposito, Frederico cantore, Sifrido scolastico, Rodolfo thesaurario, magistro Johanne Bollentin et quam pluribus fide dignis.
Nach den v. Dregerschen Urkunden-Abschriften zu Stettin aus dem wolgaster Archive gedruckt in v. Eickstedt Urkunden-Sammlung zur Geschichte des Geschlechtes der v. Eickstedt, Berlin, 1838, S. 149, Nr. 37.


|
Seite 194 |




|
Nr. X.
Der Johanniter-Comthur Hermann von Wartberg zu Nemerow, Stellvertreter des Meisters in Sachsen, der Mark und Wendenland, und der Johanniter-Comthur Heinrich von Wesenberg zu Gardow bekennen, dass sie sich mit dem Kloster Himmelpfort über mehrere Seen verglichen und dieselben dem Kloster abgetreten haben.
D. d. Lichen. 1337. Dec. 6.
Aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpfort.
Nos frater Herman de Wertberge, commendator domus Nemerowe, gerens uices honorabilis in Christo uiri fratris Bartoldi de Hinnenberghe, magistri domorum ordinis sancti Johannis Baptiste in Almania scilicet Saxonia, Marchia et in Slauia, necnon frater Henricus de Wesenberghe, commendator domus Gardowe, ac uniuersi fratres domus eiusdem ac ordinis supradicti vniuersis, ad quos presentia peruenerint, volumus esse notum, dissensionem seu altercationem, quae inter nos, parte ex una, et religiosos uiros, uidelicet dominum abbatem et conuentum monasterii Coeliportae, parte ex altera, de quibusdam aquis seu stagnis hiis uocatis nominibus, scilicet Grotekelle, Lutkekelle, Lutcke Carstauel, Krummense uertebatur, hoc modo esse terminatam placitis interuenientibus ac sopitam, quod predictas aquas seu stagna ad dictos dominum abbatem ac conuentum monasterii supradicti, prout suis priuilegiis demonstrare poterunt, presentibus libere recognoscimus pertinere et omnem impetitionem, que contra predictas aquas aut stagna mouebamus, totaliter remittimus nullis temporibus repetendam, ac ei per presentes renunciamus penitus et expresse. In quoram omnium testimonium presentia nostris sigillis ac supradicte domus Gardowe fecimus communiri. Datum et actum in ciuitate Lychen, anno domini M° CCC° XXXVII°, in die beati Nicolai confessoris et pontificis, presentibus testibus


|
Seite 195 |




|
idoneis uidelicet: Ottone de Deuuitz, Lippoldo dicto Bere, Alberto de Warborch, militibus, et aliis quampluribus fide dignis.
Nach einer Abschrift aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpfort, im Privatbesitze in Berlin, jetzt auch in Abschrift im grossherzoglichen Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Nr. XI.
Die Fürstin Beatrix, Aebtissin des Klosters Ribnitz, und Mathias, Gardian desselben Klosters, geben einen Todtenschein über das Ableben der Nonne Margarethe von Wittenburg.
D. d. Ribnitz, 1350, nach Sept. 8.
Nach einem Abdruck nach dem Originale im Stadtarchive von Lübeck.
Nos Beatrix, domicella Magnopolensis, sororum ordinis sancte Clare in Rybbenitze locum tenens abbatisse, et frater Mathyas, gardianus ac provisor sororum predictarum, coram singulis presens scriptum cernentibus publice recognoscendo protestamur, quod Margareta de Wittenborch, una de nostris sororibus, viam universe carnis est ingressa, et hoc in anno domini M. CCC. quinquagesima, circa festum nativitatis virginis gloriose, et in evidentiam predictoram sigilla nostra presentibus sunt appensa.
Das Original auf Pergament auf der Trese zu Lübeck, mit zwei an Pergamentstreifen hangenden elliptischen Wachssiegeln, welche auf der Vorderseite das erste roth, das andere braunroth gefärbt sind.
No. 1 stellt die Krönung der Maria dar, in dem unteren Winkel knieet eine kieine weibliche Figur (St. Clara?). Umschrift:
 S'. abbatisse ordinis sce. Clare
in Ribeni ...
S'. abbatisse ordinis sce. Clare
in Ribeni ...
No. 2 ist durch zwei gegen einander gekehrte Rundbogen quer in zwei ungleiche Hälften getheilt: in dem oberen grösseren Felde Christus am Kreuz, rechts und links ein Stern; in dem unteren kleineren Felde eine knieende weibliche Figur (St. Clara?). Umschrift:
 S'. gardiani Ribinisensis.
S'. gardiani Ribinisensis.
Nach dem Abdruck in der Abhandlung des Professors Mantels zu Lübek: "Ueber die beiden ältesten Lübeckischen Bürgermatrikeln", im Osterprogramme der Katharinen-Schule, 1854, S. 33.


|
Seite 196 |




|
Nr. XII.
Das Kloster Rühn bittet den Rath zu Lübeck bei Anzeigung des Todes der Nonne Gertrud Ellerholt um Aufrechthaltung des letzten Willens derselben.
D. d. Rühn (um 1368).
Nach einem Abdruck nach dem Originale im Stadtarchive von Lübeck.
Eterne felicitatis incrementum cum humili salutatione premissa. Coram universis Christi fidelibus vestreque providentie cupimus fore notum, quod Ghertrudis Elreholtes, sanctimonialis in Rune, consoror nostraviam universe carnis feliciter est ingressa et cum Christo, ut speramus, in celesti sede exultat gloriosa: supplicantes dominationi vestre humiliter et devote, quatenus ultimam voluntatem suam in nullo inpediatis propter salutem animarum vestrarum in eternum. In illo valete, qui dat post mortem vivere. Datum Rune nostro sub sigillo.
Bernardus prepositus, Michtildis
priorissa
totusque conventus in Rune.
Das Original auf Pergament auf der Trese zu Lübeck, mit aufgedrücktem, zur grösseren Hälfte erhaltenem, rundem Siegel in gelbem Wachs, welches den gekreuzigten Christus und zur linken Seite eine Figur zeigt. Umschrift:
 Sigillum co[nventus in Ru]ne.
Sigillum co[nventus in Ru]ne.
Bernhard lebte 1368. Lisch Mekl. Jahrb. IX, 298. (Im J. 1360 lebten noch der Propst Hermann und die Priorin Gertrud; im J. 1371 lebte schon der Propst Marquard. G. C. F. Lisch.)
Nach dem Abdruck in der Abhandlung des Professors Mantels zu Lübeck: "Ueber die beiden ältesten Lübeckischen Bürgermatrikeln", im Osterprogramme der Katharinen-Schule, 1854, S. 33.


|
Seite 197 |




|
Nr. XIII.
Der Herzog Johann von Meklenburg-Stargard stiftet einen Altar in der Kirche des Klosters Himmelpfort zum Seelenheile seiner verstorbenen Gemahlin Rixe und seiner Erben.
D. d. 1358. Jan. 13.
Aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpfort.
Allein datt alle creatûrenn gott plichtich sindt thu lôuenn, alse die prophêtt spricht her Dauid, doch sindt die ghêne desz plichtig, de mêr vonn der mildenn handt godesz hebbenn entfanghenn vnd genommenn. Hirumb so issett, dat wie her Jhan, vonn der gnâde godesz hertoghe tho Mychelnborch, ein herre von Rotzstock vnnd vom Stargarde,vann deme tîdlikenn gûde, datt vnsz gott vorlêghenn hefft, stichtenn ein altar in vnseme clôster [to] der Hemelporthe inn die ehr gadesz vnd sîner bênedîdenn mûdere Marienn vnnd aller hilgenn godesz. Dâr gheuenn sich mett willenn tho de êrbâre abbet vnnd sîne conuenteszbrôdere, datt sie tho deme altâr scholenn holdenn alle dâghe eine misse, desz sondâghes vonn dem sondâge, desz mândâgesz sîlemisse, desz dinsedâghesz vann alle godesz hilgenn, desz midewekesz seelemisse, desz donnerdâgesz vomme hilgenn geyste, desz vrîdâgesz vamme hilligenn crûtze, desz sonnâuendesz vann vnser lêuenn vrûwenn, ett en sîe, datt andere heyligenn kommen binnen dessen dâgenn, de dat benômenn oder sie vann desz ordenn plicht andere missenn scholenn holdenn. Desse missenn scholenn sie holden tho trôste vnnd tho genâdenn vnsenn oldernn vnnd all vnsenn lîffhôuedenn vnnd vrû Ryccienn, die hierbeuôrne vnse lêue echtghenôte wasz, vnnd ock vnsz thôr sâldenn vnnd vnsenn erfgenâmenn, vnseme brôder hertoge Albrecht van Mychlenborch, sîner vrowenn vnnd erenn erfgenâmenn, êwichlikenn vnnd vmmer. Dat selue vôrbenûmbde altar begâue wie mett vôrbedachtenn mûde vnnd mett ganzenn willenn mett desseme gûde: meteme schultenn pachte vnnd dem schulten inn deme dorpe tho Pudwall, mett twelff hûuen inn dem seluenn dorpe, de geue wie dem êrbâren hern deme abbete vnnd


|
Seite 198 |




|
sîneme conuente, met aller vrîheitt, mett alleme êgendûme, mett aller vrucht, mett holtenn, mett wâthern, mett wiskenn, met weidenn, mett brûkenn vnnd mett aller nuth vnnd mett alleme rechte ôuerste vnd niederste, mett aller pacht, mett tinse, mett bêde, inn erenn vrom thu kêrende, mett alle deme, datt dâr aff plecht thu kômenn, vry vnnd ledich vnnd lôsz, sunder ênghere hande dînst. Och vorthîe wy aller ansprâke vnnd aller gewaldt vnnd aller herschaph vonn vnser wegenn, vann vnser erfnâmenn wegenn vnnd aller ghênenn weghene, die vnsz nâuolgende sindt ann der herschaph, vnnd alle desz rechtesz, datt vnsz mochte thûkômene vnnd tuuallende sîn in deme vôrbenûmbdenn gûde. Och vorbîde wie all vnsenn voghdenn, vnsernn landtrîdernn vnnd all vnsen anbachttlûdenn, datt sie neine gewaldt, nochte nein ghebîde inn deme soluenn gûde mehr scholenn hebben. Thûge alle desser ding sindt: de vrome here her Otto, grâue tho Vorstenberche, vnnd sin sone Albrechtt, die iunge greue, her Jacob vonn Dewitz, her Lippoldt Ber, riddere, Henninch Ber, knecht, her Nicolaus Arneberch, prîster, her Sander, her Henrich Rode, vnse capelâne, vnnd andere vele vrômer lûde, di trûwe vnnd lôuedesz werdich sîn. Thu einer ewigenn stedicheitt alle desser dinge, so hebbe wie en desse brîue ghegeuen besegelt mett vnseme ingesegele van vnser rechten witscaph, na godesz bôrth dûsendt iâr drîhundertt iâre in deme achte vnnd veftichstenn iâre, desz sunnâuendesz in deme achtendenn dâge epiphanie domini.
Nach einer Abschrift aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpfort, im Privatbesitze in Berlin, jetzt auch in Abschrift im grossherzoglichen Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.


|
Seite 199 |




|
Nr. XIV.
Die Ritterschaft und der Vogt der Vogtei Gadebusch und die Stadt Gadebusch verbinden sich mit den Herzogen von Meklenburg und allen andern Eingesessenen des Landes gegen die Königin Margarethe von Norwegen zur Befreiung des Königs Albrecht von Schweden aus der Gefangenschaft.
D. d. 1391. Mai 15.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
Ik Vlrick van Pentze, ridder, vnde wy borghermêstere vnde râtmanne der stad tho Godebutz, vnde Henneke van Bulowe tho Roghelyn, Henneke Scharpenbergh, Bosse Lutzowe, Hinrick Gustekowe, Hinrick Curdeshaghen, Luder Blucher, Ghoghelowe, Arnt van der Louetze, Hermen Cock, knapen wônaftich an der voghedye tho Godebutz, bekennen vnde betůghen ôppenbâre an desseme brêue vôr vns vnde vôr vnze eruen, dat wy vns myd gantzer êndracht vnde myd ghûden wyllen hebben vorzettet vnde vorbunden vnde vns zetten vnde vorbynden to den dorluchteghen vorsten vnde heren her Johanne deme alderen vnde tho deme êrewerdighen vadere an ghode Rodelof, byschop tho Zweryn vnde hertoghen tho Mekelenborgh, vnde tho Johanne, Vlrick vnde Albrechte, hertoghen tho Mekelenborgh, tho Rostok, Stargarde vnde tho Zwerin heren, vnde tho Johane, hertoghen Magnus zône tho Mekelenborgh, hertoghen tho Mekelenborgh, greue tho Zwerin, tho Stargarde vnde Rostok heren, vnde vortmer tho vnzes heren râde des konynghes vnde tho allen ritteren vnde knechten an deme lande tho Mekelenborgh vnde in deme stychte tho Zwerin vnde in deme lande tho Stargarde, landen, steden vnde sloten, vnde zunderghen tho den êrbâren lûden borghermêstere vnde râtman der stede Rostock vnde Wysmer vnde tho eren nakomelynghen vnde vortmer tho deme van Bůtzowe vnde van deme Sterneberghe vnde tho allen anderen steden, alzo dat wy vnde alle de ghêne, de vnzer heren man zyn vnde en dênstes plychtich zyn, en myd gantzen trûwen scholen vnde wyllen


|
Seite 200 |




|
beholpen wezen van stâden an iêghen de dorluchteghen vorstynnen vrowen Margreten konynghinnen tho Norweghene vnde vppe dat rîke tho Dennemarken tho zůkende, dâr vnse rechten heren myd vns an deme velde zynt, vnde alle ynwônere des rykes, de der zuluen konynghinnen beholpen zyn, ze zyn ghêstlick edder werlick, beyde hîr tho lande vnde ôuer de see, scholen vnde wyllen vns van den vôrbenômeden ritteren vnde knechten vnde zunderghen van den van Rostok vnde van der Wysmer vnde van allen anderen steden vnde eren nakômelynghen nummer zônen, vreden, dâghen edder zetten, êre vnze gnedighe here her Albrecht konyngh tho Zweden vnde zyn zône vnde ere vrunt vnde de rittere vnde knechte, de myd em ghevanghen zynt, gansliken lôs zyn vnde ze des kryghes ênen gantzen ende hebben. Ock zo schole wy edder vnse hulpere, de an desseme kryghe van vnzer weghen begrepen zyn, nêmende rôuen, schynnen edder beschedeghen, de vnzer vôrbenômeden heren vnde der rittere vnde knechte vnde der vôrbenômeden stede Rostock vnde Wysmer velich ys. Were ôck dat zick yênich man her vt tôghe, de hyr nêne hulpe vnde volghe tho dûen wolde vnde de dit nycht mede belêuen vnde bezeghelen wolde, he wêre ritter edder knecht, he wêre we he wêre, dat scholen vnde wyllen wy myd den vôrbenômeden ridderen vnde knechten vnde steden hulpe thô arbeyden vnde helpen, dat ze dâr ôuer richten, alzo ôuer ênen, de zynen heren vnderweghen let vnde nycht by em deyt, alzo em van êre weghen vôghet tho dûnde. Ock zo schole wy vnde wyllen, wo dicke des behůf vnde nôt ys tho vârende vnde tho reysende vppe dat sulue rîke tho Dennemarken vser vôrbenômeden heren, riddere vnde knechte vnde der stede vnde vnze vyande tho zůkende vnde argende vnde er hulpere rêde wezen na vser vôrbenômeden heren, ere râtgheuer vnde der stede rât, vnde trûweliken by en tho blyuende vppe schâden vnde vppe vrômen, vnde vns nycht tho scêdende van den reysen, wen wy tho sâmende kômen, wy en dûet dat na ereme râde vnde en yêslick vppe zyne koste vnde vppe schâden vnde vppe vrômen. Alle desse vôrscreuen dynck, stucke vnde articule lôue ik Vlrick van Pentze vôrbenômet vnde wy borghermêstere vnde râtmanne der stad tho Godebutz vnde wy knapen vôrbenômet, de wônaftich zyn an der voghedye tho Godebutz vôr vns vnde vôr vnze rechten eruen vnde vôr vnse na-


|
Seite 201 |




|
kômelynghe den dorluchteghen vorsten vnde heren her Johan deme olderen, Rodelof byschop tho Zwerin, Johan, Vlrick vnde Albrechte, brôderen, vnde Johan, hertoghe Magnus zône, alle hertoghen tho Mekelenborgh, vnde vses vôrbenômeden heren râde, rydderen vnde knechten vnde zunderghen den van Rostok vnde van der Wysmer vnde allen anderen steden vnde ere nakômelynghe an ghůden lôuen, trûwen vnde an êren stede vnde vast by en tho blyuende vnde ze wedder by vns, zunder yênegherleye arghelist edder hulperede, in desseme brêue, dâr wy vôrbenômet her Vlrick vnde wy borghermêstere vnde râtmanne der stat Godebutz vnde wy knapen vt der voghedye tho Godebutz, in cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Datum Godebutz anno domini millesimo tricentesimo nonagesimo primo, feria secunda pentecostes.
Nach dem Originale, im wismarschen Rathsarchive, in einer ziemlich kritzlichen Minuskel, auf Pergament in Quer-Kleinfolio. An Pergamentstreifen sind die Siegel von ungeläutertem Wachs gehängt, alle mehr oder minder abgerieben.
1) rund, enthält einen links gelegten Schild mit einem links gekehrten stehenden Löwen. Umschrift:
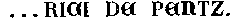
2) rundes Secretsiegel der Stadt Gadebusch.
3) dreieckiges Siegel mit dem bülowschen Wappenschild. Umschrift:
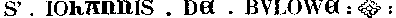
4) fehlt.
5) fehlt.
6) fehlt.
7) Auf dem dreieckigen Schilde des runden Siegels sind noch Spuren eines Hifthorns zu erkennen.
8) fehlt.
9) Auf einem dreieckigen Schilde im runden Siegel eine mit dem Schlosse aufwärts gestellte Muschel. Umschrift nicht mehr zu erkennen.
10) vorhanden, aber unkenntlich.
11)
vorhanden, aber unkenntlich.


|
Seite 202 |




|
Nr. XV.
Die Ritterschaft und der Vogt der Vogtei Grevesmühlen und die Stadt Grevesmühlen verbinden sich mit den Herzogen von Meklenburg und allen andern Eingesessenen des Landes gegen die Königin Margarethe von Norwegen zur Befreiung des Königs Albrecht von Schweden aus der Gefangenschaft.
D. d. 1391. Mai 18.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
Wy Helmolt van Plesse vnde Mathias Ketelhod,
riddere, Dythlef Neghendanken, Gherd
Neghendanken, Eggherd Barnecow, Eggherd
Neghendanken, Hinrik Quitzow, Marquard van deme
Haghene, Ludeke Neghendanke to deme
Krømekenhagen, Clawes Parkentyn, Henneke
Berenstorp, Werner Be
e
rnstorp,
Reddich Schøytze, Dytlef van deme Lo, Henningh
Parkentyn, Dythlef van Bokwolde, Syuerd van
Bokwolde, Bertram Kůle, Hartich
Kůle, Volrad van den Br
v
ke,
Hinrik van den Br
v
ke, Volrad
Schoytze, Cord Wedermůde, Hinrik
Neghendanken, Helmolt van Plesse to Poryn, olde
Hinrik Culebuts, iuncghe Hinrik Culebuts,
Eggherd Rode, Herman Pluzscow, Eggherd
Wederm
 de, Goldenzê, L
de, Goldenzê, L
 deke Storm, Johan Storm, Bernd
Storm, Ludeke Neghendanken, Marquard
Neghendanken, Cøpeke Hoykendorp, Tønyghes van
Plesse, Gotschalk Munt, Henneke Pluzscow,
Marquard van deme Lo tho Gotzenstorpe vnde
Ghereke Boonsack, knechte, wônaftich in der
vøghedye tho Gnewesmølen, Vicke
Veleh
v
ue, voghet t
v
Gnewesmølen, vnde wy borghermêstere vnde
râtmanne vnde gantze meenheyt der vôrbenømeden
stad Gnewesmølen bekênnen vnde betůghen
ôpenbâr in desme brêue vôr vns vnde vôr vnse
eruen, dat wy vns myt gantzer eendracht vnde myt
gûdem wyllen hebben ghesat vnde vorbunden vnde
vns setten vnde vorbynden tho den
dorlůchtighen vørsten vnde heren her
Johanne dem olden vnde th
v
deme
eerwerdighen vâdere an g
deke Storm, Johan Storm, Bernd
Storm, Ludeke Neghendanken, Marquard
Neghendanken, Cøpeke Hoykendorp, Tønyghes van
Plesse, Gotschalk Munt, Henneke Pluzscow,
Marquard van deme Lo tho Gotzenstorpe vnde
Ghereke Boonsack, knechte, wônaftich in der
vøghedye tho Gnewesmølen, Vicke
Veleh
v
ue, voghet t
v
Gnewesmølen, vnde wy borghermêstere vnde
râtmanne vnde gantze meenheyt der vôrbenømeden
stad Gnewesmølen bekênnen vnde betůghen
ôpenbâr in desme brêue vôr vns vnde vôr vnse
eruen, dat wy vns myt gantzer eendracht vnde myt
gûdem wyllen hebben ghesat vnde vorbunden vnde
vns setten vnde vorbynden tho den
dorlůchtighen vørsten vnde heren her
Johanne dem olden vnde th
v
deme
eerwerdighen vâdere an g
 de ber Rodolue, bis-
de ber Rodolue, bis-


|
Seite 203 |




|
schope tho Zweryn, vnde t
v
Johanne,
Vireke vnde Albrechte vnde Johanne, hertoghe
Magnus s
 ne, hertoghen tho Mekelenborgh,
greuen t
v
Zweryn, tho Stargarde vnde
Iho Rozstocke heren, vnde vortmer th
v
vnses heren râde des kønynghes vnde
th
v
allen ridderen vnde knechten in
deme lande t
v
Mekelenborgh vnde an
deme stichte th
v
Zweryn vnde an deme
lande th
v
Stargarde, landen, steden
vnde sl
ne, hertoghen tho Mekelenborgh,
greuen t
v
Zweryn, tho Stargarde vnde
Iho Rozstocke heren, vnde vortmer th
v
vnses heren râde des kønynghes vnde
th
v
allen ridderen vnde knechten in
deme lande t
v
Mekelenborgh vnde an
deme stichte th
v
Zweryn vnde an deme
lande th
v
Stargarde, landen, steden
vnde sl
 ten, vnde sůndereghen tho
den erbârn lůden borghermêsteren vnde
râetmannen der stede Rozstock vnde Wysmer vnde
th
v
eren nakømelynghen vnde vortmer
th
v
den van Bůtzowe vnde
t
v
den van deme Sternenberghe vnde
th
v
allen anderen steden, alzo dat wy
vnde alle de iêne, de vnser heren man synt vnde
de en deenstes plichtich synt, en myt gantzen
trûwen schølen vnde willen behulpen wesen van
stâden an tgêghen de dorlůchtighen
vorstynnen vrouwe Margareten, kønighynnen tho
Norweghen, vnde tghêghen de rîke Denemarken,
Norweghen vnde Sweden vnde alle inwônere der
sulven ryke, de der sůlven kønighinnen
behulpen syn, se syn gheistlik eder werltlyk.,
beyde hyr t
v
lande vnde ôuer de zê,
vnde scholen vnde willen vns van den
vôrbenømeden heren, ridderen vnde knechten vnde
sůnderghen van den van Rozstock vnde van
der Wysmer vnde van allen anderen steden vnde
van eren nakømelinghen nůmmer
z
v
nen, vreden, dâghen eder zetten,
eer vnse gnedighe here her Albert køningh
th
v
Sweden vnde syn s
ten, vnde sůndereghen tho
den erbârn lůden borghermêsteren vnde
râetmannen der stede Rozstock vnde Wysmer vnde
th
v
eren nakømelynghen vnde vortmer
th
v
den van Bůtzowe vnde
t
v
den van deme Sternenberghe vnde
th
v
allen anderen steden, alzo dat wy
vnde alle de iêne, de vnser heren man synt vnde
de en deenstes plichtich synt, en myt gantzen
trûwen schølen vnde willen behulpen wesen van
stâden an tgêghen de dorlůchtighen
vorstynnen vrouwe Margareten, kønighynnen tho
Norweghen, vnde tghêghen de rîke Denemarken,
Norweghen vnde Sweden vnde alle inwônere der
sulven ryke, de der sůlven kønighinnen
behulpen syn, se syn gheistlik eder werltlyk.,
beyde hyr t
v
lande vnde ôuer de zê,
vnde scholen vnde willen vns van den
vôrbenømeden heren, ridderen vnde knechten vnde
sůnderghen van den van Rozstock vnde van
der Wysmer vnde van allen anderen steden vnde
van eren nakømelinghen nůmmer
z
v
nen, vreden, dâghen eder zetten,
eer vnse gnedighe here her Albert køningh
th
v
Sweden vnde syn s
 ne vnde ere vrunt vnde de riddere
vnde de knechte, de myt en ghevanghen synt,
gentzliken lôes synt vnde se des vôrbenømeden
kryghes eynen gantzen ende hebben. Ok so schole
wy eder vnse hůlpere, de in dessem kryghe
van vnser weghene begrepen synt, nymende rôuen,
schynden eder beschedeghen, de vnser
vôrbenømeden heren vnde der riddere vnde der
knechte vnde der vôrbenømeden stede Rozstock
vnde Wysmer velich is. Wêret ôk dat syk ghyment
hyr vt t
ne vnde ere vrunt vnde de riddere
vnde de knechte, de myt en ghevanghen synt,
gentzliken lôes synt vnde se des vôrbenømeden
kryghes eynen gantzen ende hebben. Ok so schole
wy eder vnse hůlpere, de in dessem kryghe
van vnser weghene begrepen synt, nymende rôuen,
schynden eder beschedeghen, de vnser
vôrbenømeden heren vnde der riddere vnde der
knechte vnde der vôrbenømeden stede Rozstock
vnde Wysmer velich is. Wêret ôk dat syk ghyment
hyr vt t
 ghe, de hyr neyne hůlpe vnde
volghe th
v
d
v
n wolde vnde
dyt nicht mede bebrêuen vnde bezegelen wolde, he
wêre ridder eder knecht vnde were wy
e
he were, dâr schole wy vnde willen myt der
vôrbenømeden heren vnde der riddere vnde knechte
vnde der stede hůlpe th
v
arbeyden vnde helpen, dat se dâr ôuer richten,
alze ôuer ênen de synen rechten heren
vnderweghen let vnde nycht by en deit,
ghe, de hyr neyne hůlpe vnde
volghe th
v
d
v
n wolde vnde
dyt nicht mede bebrêuen vnde bezegelen wolde, he
wêre ridder eder knecht vnde were wy
e
he were, dâr schole wy vnde willen myt der
vôrbenømeden heren vnde der riddere vnde knechte
vnde der stede hůlpe th
v
arbeyden vnde helpen, dat se dâr ôuer richten,
alze ôuer ênen de synen rechten heren
vnderweghen let vnde nycht by en deit,


|
Seite 204 |




|
alze em van êre weghene v
 ghet th
v
donde. Ok so
schole wy vnde willen, w
v
dicke des
beh
v
ef vnde nôet is t
v
vârende vnde th
v
reysende vppe dat
sulue ryke th
v
Denemarken, vnser
vôrbenømeden heren, der riddere vnde der knechte
vnde der stede vnde vnse vyende th
v
sûkende vnde th
v
arghende vnde ere
hůlpere rêde wesen na vnser vôrbenômeden
heren vnde erer râetgheuen vnde der stede râde
vnde trůweliken by en blîuen vppe schâden
vnde vppe vrômen, vnde vns nicht th
v
scheidende van den sůluen reysen, wan wy
th
v
sâmende k
ghet th
v
donde. Ok so
schole wy vnde willen, w
v
dicke des
beh
v
ef vnde nôet is t
v
vârende vnde th
v
reysende vppe dat
sulue ryke th
v
Denemarken, vnser
vôrbenømeden heren, der riddere vnde der knechte
vnde der stede vnde vnse vyende th
v
sûkende vnde th
v
arghende vnde ere
hůlpere rêde wesen na vnser vôrbenômeden
heren vnde erer râetgheuen vnde der stede râde
vnde trůweliken by en blîuen vppe schâden
vnde vppe vrômen, vnde vns nicht th
v
scheidende van den sůluen reysen, wan wy
th
v
sâmende k
 men, wy d
v
n dat na
ereme râde vnde een yslik vppe syne koste vnde
schâden. Alle desse vôrbenømede dyngh
stůcke vnde articule lôue wy vôrbenømeden
riddere vnde knechte wônaftich in der v
men, wy d
v
n dat na
ereme râde vnde een yslik vppe syne koste vnde
schâden. Alle desse vôrbenømede dyngh
stůcke vnde articule lôue wy vôrbenømeden
riddere vnde knechte wônaftich in der v
 ghedye t
v
Gnewesmølen,
ik Vicke Velehoue, v
ghedye t
v
Gnewesmølen,
ik Vicke Velehoue, v
 ghet dârsulnes, vnde wy
børghermêstere vnde râetmanne van der
sůluen stad, vôr vns vnde vnse eruen vnde
vnse nakømelinghe, den dorlůchteghen
vorsten vnde heren her Johanne deme olderen, her
Rodolue, bisschoppe t
v
Zweryn,
Johanne, Vlrike vnde Albrechte,
br
v
deren, vnde Johanne, hertoghen
Magnus s
ghet dârsulnes, vnde wy
børghermêstere vnde râetmanne van der
sůluen stad, vôr vns vnde vnse eruen vnde
vnse nakømelinghe, den dorlůchteghen
vorsten vnde heren her Johanne deme olderen, her
Rodolue, bisschoppe t
v
Zweryn,
Johanne, Vlrike vnde Albrechte,
br
v
deren, vnde Johanne, hertoghen
Magnus s
 ne, hertoghen th
v
Mekelenborgh, vnde vnses vôrbenømeden heren
râde, ridderen vnde knechten vnde
sůnderghen den van Rozstok vnde den van
der Wysmer vnde allen anderen steden vnde eren
nakømelinghen an gûden lôuen, trûwen vnde an
êren stede vnde vast by en th
v
blîuende, vnde se weder by vns, sunder
iênigherleye arghelist eder hůlperede in
dessem brêue, dâr wy vôrbenømeden riddere vnde
knechte, ik Vicke Veleh
v
ue vnde wy
børghermestêre vnde râetmanne der stad
Gnewesmølen th
v
êner grôteren
bekantnisse, alle desse dynk t
v
holdende, vnse inghezeghele myt gûdem willen
hebben an henghet lâten, de ghegheuen vnde
ghescreuen is na godes bôrd dûsent iâr
dreehundert iâr in deme een vnde neghentighestem
iâre, des dunredâghes bynnen den achte dâghen
th
v
pynghesten.
ne, hertoghen th
v
Mekelenborgh, vnde vnses vôrbenømeden heren
râde, ridderen vnde knechten vnde
sůnderghen den van Rozstok vnde den van
der Wysmer vnde allen anderen steden vnde eren
nakømelinghen an gûden lôuen, trûwen vnde an
êren stede vnde vast by en th
v
blîuende, vnde se weder by vns, sunder
iênigherleye arghelist eder hůlperede in
dessem brêue, dâr wy vôrbenømeden riddere vnde
knechte, ik Vicke Veleh
v
ue vnde wy
børghermestêre vnde râetmanne der stad
Gnewesmølen th
v
êner grôteren
bekantnisse, alle desse dynk t
v
holdende, vnse inghezeghele myt gûdem willen
hebben an henghet lâten, de ghegheuen vnde
ghescreuen is na godes bôrd dûsent iâr
dreehundert iâr in deme een vnde neghentighestem
iâre, des dunredâghes bynnen den achte dâghen
th
v
pynghesten.
Nach dem Originale im wismarschen Rathsarchive, auf Pergament, in Gross-Querfolio. Die Siegel von ungeläutertem Wachs hangen an Pergamentstreifen.
1-8) fehlen.
9) Rund, Auf einem dreieckigen Schilde eine schmale, links gewandte Spitze. Umschrift:


|
Seite 205 |




|
10) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde eine rechts gewandte schraffirte Spitze. Umschrift:
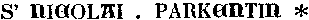
11) fehlt.
12) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde über Wellen im Schildesfusse drei rechts überhangende Seeblätter. Umschrift:
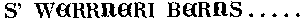
13 - 15) fehlen.
16) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde ein links gekehrter gekrönter Hundekopf mit offenem Maul. Umschrift:
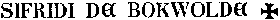
17) Ebenso. Umschrift:
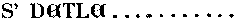
18 - 21) fehlen.
22) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde ein rechtsgekehrter Schwaan. Umschrift:
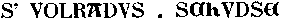
23 - 27) fehlen.
28) Dreieckiges Siegel. Auf dem Schilde ein Helm, anscheinend mit zwei Flügeln, und dazwischen ein Quast oder Baum. Umschrift:
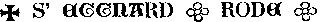
29) fehlt.
30) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde ein links hin springender halber Ziegenbock. Umschrift:
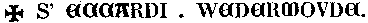
31) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde über Wellen im Schildesfusse drei aufwärts gekehrte Seeblätter. Umschrift:
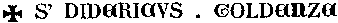
32 - 40) fehlen.
41) Rund. Auf- einem dreieckigen Schilde ein Kammrad. Umschrift:
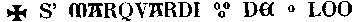
42) fehlt.
43) Rund. Ein viermal schräg rechts zackig gestreifter, dreieckiger Schild. Umschrift:
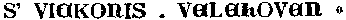
44) Rundes Secretum burgensium de Gneuuesmolen.


|
Seite 206 |




|
Nr. XVI.
Die Ritterschaft und der Vogt der Vogtei Schwerin und die Stadt Schwerin verbinden sich mit den Herzogen von Meklenburg und allen anderen Eingesessenen des Landes gegen die Königin Margarethe von Norwegen zur Befreiung des Königs Albrecht von Schweden aus der Gefangenschaft.
D. d. 1391. Mai 24.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
Vôr alle den iênen, de dessen iêghenwerdighen brêf seen, hôren edder lesen, ik Vicke Zwisow, voghet to Zwerin, vnde wy borghermêstere vnd râtmanne in der stad to Zwerin vnde alle riddere vnde knechte in der suluen voghedyge to Zwerin bekennen vnde betůghen ôpenbâre in dessem brêue vôr vs vnde vse rechten eruen vnde nakømelingen, dat wy vs mit gantzer eendracht vnde mit ghůden willen hebben ghesad vnde vorbůnden vnde vs setten vnde vorbinden to den dorluchtighen vorsten vnde heren, hertoghe Johanne deme olderen, vnde to deme êrwardighen vâdere in gode Rodolphe, bischop to Zwerin, vnde hertoghen to Mekelenborch, vnde to Johanne Vlrik, vndeAlberte vnde to Johanne, hertoghe Magnus sône, to Mekelenborch, to Stargarde vnde to Rostock heren, vnde vortmer to vses heren râde des koninghes vnde to allen rydderen vnde knechten in deme lande to Mekelenborch vnde in deme stichte to Zwerin, vnde sunderghen to den êrbâren lûden borghermêsteren vnde râtmannen der stede Rostok vnde der Wysmer, vnde to eren nakømelinghen, vnde vortmer to den van Butzowe vnde vamme Sterneberghe, vnde setten vnde vorbinden vs ôk to allen anderen steden in den suluen herschoppen, also dat wy scholen vnd willen en behulpen wesen van staden an iêghen de hôchghebôrne Marghareten koninginnen to Norweghen vnde iêgen dat rîke to Denemarken, Norweghen vnde Sweden vnde alle inwônere der sůlven rîke, de der sulven koninginnen behulpen syn, se sîn


|
Seite 207 |




|
ghêstlik edder weriik, beyde hîr to lande vnde ôuer der see, vnde scholen vnde willen vs van den vôrbenômden heren, ridderen vnde knechten, vnde sunderghen van den van Rostock vnde der Wismer vnde van allen anderen steden vnde eren nakømelinghen nummer sůnen, vreden vnde dâghen, êr vse gnedighe here her Albrecht, koningk to Sweden, vnde sîn sône vnde ere vrunt vnde de riddere vnde knechte, de mit em ghevanghen sîn, gantzliken quyd vnde lôs sîn vnde se des krîghes ênen gantzen ende hebben. Ok so schole wy edder vse hulpere, de in desseme krîghe beghrepen sîn, van vser weghen nêmende berôuen, schinnen edder beschâdeghen, de vser vôrbenômeden heren, ridderen, knechten edder steden velich sîn. Wêre ôk dat sik hîr iêmant vttôghe, de hîr nyne hulpe edder volghe to dôen wolde, vnde dat nicht mede bebrêuen vnde beseghelen wolde, he wêre ridder edder knecht, he wêre we he wêre, dâr schole wy vnde willen mit den vôrbenômeden heren vnde der riddere vnde knechte steden hulpe tô arbeyden vnde helpen, dat se dâr ôuer richten, alze ôuer ênen, de synen rechten heren vnderweghen let vnde nicht by em deyt, alze em van êre weghene vôghet to dônde. Ok so scholen wy vnde willen, wo dicke des behůf vnde nôt is to vârende vnde to reysende vppe dat sulve rîke to Denemarken, vsen vôrbenômeden heren, der riddere vnde knechte, stede, vnde vnse vyende to sûkende vnde to arghende vnde ere hulpere rêde wesen na vser vôrbenômeden heren, erer râtgheuen vnde stede râde, vnde trûweliken mit em blîuen vppe schâden vnde vrômen vnde vs nicht to schêdende van der reyse, wenne wy tosâmende kômen, wy døen dat na ereme râde, vnde ên êslik vp sîne êghene koste vnde schâden. Alle desse vôrscreuen stucke vnde artikele lôue ik vôrbenômed Vicke Zwisowe, voghet to Zwerin, vnde wy vôrbenômeden borghermêstere vnde râtmanne, vnde wy ridder vnde knechte in der vôrbenômeden voghedygen, alzo Otte van Sichusen, Vicke Hazencop, Hinrik Preen to Stenuelde, Borchart Dambeke, Tønyes Schoneuelt, Hinrik Knop to Exen, Claus Knop to Brůseuisse, Claus Knop to Stůke, Henneke Hazenkop, Hinrik Sikhusen, Hans Rusenhaghen, Hans Kurdeshaghen, Hans, Hinrik vnde Bolte ghehêten van Driberghe, Hans van Driberghe to deme Creuetesuorde, Hinrik Dorrepreen, Vlrik van


|
Seite 208 |




|
Dryberghe, Gotschalk Preen, Crhert Sulowe, Hartich Preen, Marquard Dambeke, Gotschalk Reddyghes, Vicke Haluerstat, Hermen Hunnendorp, Ludeke Sickhůsen, Důuelsbruck, knapen, vôr vs vnde vse eruen vnde vse navølghere, den vôrscreuen heren, vorsten vnde ridderen vnde knechten, mannen vnde steden, in deme lande to Mekelenborch vnde sunderghen den vôrbenômeden borgermêsteren vnde râtmannen der stede Rostok vnde Wysmer vnde eren nakømelinghen an gůdeme lôuen vnde eren stede vnde vaste to holdende, sunder yênnegherleye hulperede vnde arghelist. To tûghe vnde wârheyt aller desser dinck so hebbe wy vôrbenômede vnser aller ingheseghele mit vser witschop henghet lâten an dessen iêghenwardighen brêff, de gheuen is to Zwerin, na godes bôrt dûsent iâr drêhůndert iâr in deme ên vnde neghentighesten iâre, in deme âuende des hilghen lîchames.
Nach dem Originale im wismarschen Rathsarchive, auf Pergament in langem Querfolio. An Pergamentstreifen hangen die Siegel aus gelbem Wachs, nämlich:
1) Rund. In einen Sechspass ist ein senkrecht getheilter dreieckiger Schild gestellt, der in der vorderen Halfte eine halbe Lilie, in der hinteren ein halbes Hirschgeweih enthält. Umschrift:
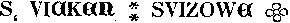
2) Rund. Siegel der Stadt Schwerin mit dem rechts hin sprengenden Herzoge Heinrich von Braunschweig. Umschrift:
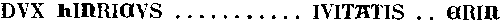
3) Rund. Im Siegelfelde ein Helm mit einem runden Aufsatze van Kreisform (?). Umschrift:
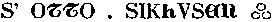
4) Rund. Im Siegelfelde ein dreieckiger Schild mit drei (2. 1) Hasenköpfen. Umschrift:
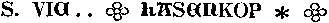
5) Dreieckig. Ein Schild mit drei geöhrten Pfriemen neben einander. Umschrift:
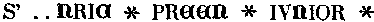
6) Rund. Dreieckiger Schild mit einem Querbande. Umschrift verschliffen.
7) Rund. Ebenso wie das vorige. Umschrift:
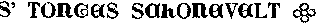


|
Seite 209 |




|
8) Rund. Schräg gelehnter dreieckiger Schild, im Andreaskreuz getheilt, der obere und untere Winkel schraffirt. Umschrift:
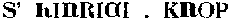
9) Rund mit einem gleichen Schilde. Umschrift:
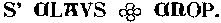
10) Rund. Dreieckiger Schild durch ein Andreaskreuz getheilt, alle vier Winkel schraffirt. Umschrift verdrückt.
11) Rund. Im dreieckigen Schilde drei (2. 1) Hasenköpfe. Umschrift:
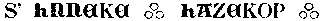
12) Rund. Schild mit einem Helm wie in Nr. 3. Umschrift:
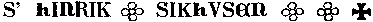
13) Rund. Im dreieckigen Schilde zwei kranzförmig geflochtene Rosenstöcke. Umschrift:
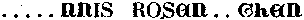
14) Rund. Im dreieckigen Schilde ein aufgehängtes Hifthorn. Umschrift:
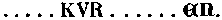
15) Rund. Im dreieckigen gespaltenen Schilde rechts eine aufwärts rechts gekehrte Vogelkralle, links ein Querband. Umschrift:
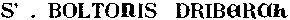
16) Rund mit einem gleichen Schilde. Umschrift:
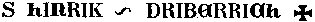
17) Dreieckiges Siegel mit gleichem Schilde, wie die beiden vorigen, Umschrift:
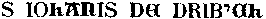
18) Rundes Siegel mit demselben Wappen, Umschrift verdrückt.
19) fehlt.
20) Rundes Siegel mit dem Dribergschen Wappen. Umschrift verdrückt.
21) fehlt.
22) Rund. Dreieckiger Schild mit einem Querbande. Umschrift:
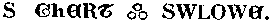
23) Rund. Im dreieckigen Schilde drei (2.1) geöhrte Pfriemen. Umschrift:
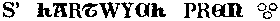
24) Rund. Dreieckiger Schild mit einem schraffirten Querbande. Umschrift:
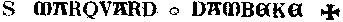


|
Seite 210 |




|
25 - 27) fehlen.
28) Dreieckig. Schild wie auf Nr. 3. Umschrift:
29) fehlt.
Gedruckt ist diese Urkunde in Ungnaden Amoenitates, Stück V, S. 370.
Nr. XVII.
Die Königin Margarethe von Norwegen versichert dem Herzoge Johann von Meklenburg, dem Rath des schwedischen Königs Albrecht und den Städten sicher Geleit zu den in Falsterbode angesetzten Friedensunterhandlungen zur Befreiung des Königs Albrecht und der seinen aus der Gefangenschaft.
D. d. Werdingborg. 1395. Jan. 28.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
Wy Margareta, van godes gnâden to Norweghen vnde
to Sweden konynginne vnde
 n recht erue vnde ên vorstinne des
rîkes to Denemarken, bekenne vnde betůghe
ôpenbâre in desseme brêue vôr allen lûden, de
ene z
n recht erue vnde ên vorstinne des
rîkes to Denemarken, bekenne vnde betůghe
ôpenbâre in desseme brêue vôr allen lûden, de
ene z
 n vnde hôren lesen, dat wy lôuet
hebben vnde lôuen in desser scrift den
dorluchtigen vorsten vnde heren, alse deme
erwerdigen vâdere vnde heren in gode Rodolphe,
byscope to Swerin, Johanne vnde Olrike,
brôderen, hertogen to Mekelenborch, konyng
Albertes râde, mannen vnde steden, alze Rozstok
vnde Wysmar, dat de êrbârn manne Ywar Lucke,
Jons Ruth, Folmar Jacobssone, Pridbern van
Pudbusk vnde Michel Ruth, riddere, Yesse D
n vnde hôren lesen, dat wy lôuet
hebben vnde lôuen in desser scrift den
dorluchtigen vorsten vnde heren, alse deme
erwerdigen vâdere vnde heren in gode Rodolphe,
byscope to Swerin, Johanne vnde Olrike,
brôderen, hertogen to Mekelenborch, konyng
Albertes râde, mannen vnde steden, alze Rozstok
vnde Wysmar, dat de êrbârn manne Ywar Lucke,
Jons Ruth, Folmar Jacobssone, Pridbern van
Pudbusk vnde Michel Ruth, riddere, Yesse D
 ue, Henneke Oluessone, Berneke
Schinckel, knechte, vse lêue trûwe r
ue, Henneke Oluessone, Berneke
Schinckel, knechte, vse lêue trûwe r
 t, hertoghen Johanne van
Mekelenborch, konyng Albertes r
t, hertoghen Johanne van
Mekelenborch, konyng Albertes r
 t vnde stede, de to deme
vruntliken dâghe kômen, to holdende, des de
stede râmet hebben tuschen en vnde vs vmme
konyng Albertes, synes sônes vnde der anderen
vangenen lôsinge to sprekende, vppe
t vnde stede, de to deme
vruntliken dâghe kômen, to holdende, des de
stede râmet hebben tuschen en vnde vs vmme
konyng Albertes, synes sônes vnde der anderen
vangenen lôsinge to sprekende, vppe


|
Seite 211 |




|
sunteJuriens dach nêgest to kômende to
Falsterbode, vnde de ze myt sik bringen,
velighen vnde leyden scholen vnde wyllen af vnde
to, vnde dâr velich to wesende, vnde vortmer
alle de gêne, de van erer weghene to deme suluen
dâghe kômen, scolen vrede hebben v
 r weken vôr deme dâghe, vppe deme
dâghe vnde vêr weken na deme dâghe vôrscreuen,
vnde velich to kômende in ere beholt, vôr alle
de gêne, de vte den dnên rîken Denemarken,
Norweghen vnde Sweden, vnde de vmme vsen wyllen
d
r weken vôr deme dâghe, vppe deme
dâghe vnde vêr weken na deme dâghe vôrscreuen,
vnde velich to kômende in ere beholt, vôr alle
de gêne, de vte den dnên rîken Denemarken,
Norweghen vnde Sweden, vnde de vmme vsen wyllen
d
 n vnde lâten wyllen, in gûden
trûwen, sunder hulperede vnde arghelist. Alle
desse vôrscreuen stucke lôue wy Margareta
konynginne vôrbenômet vnde wy Ywar Lucke, Jons
Ruth, Folmar Jacobssone, Pridbern van Pudbusk
vnde Mychel Ruth, riddere, Yesse D
n vnde lâten wyllen, in gûden
trûwen, sunder hulperede vnde arghelist. Alle
desse vôrscreuen stucke lôue wy Margareta
konynginne vôrbenômet vnde wy Ywar Lucke, Jons
Ruth, Folmar Jacobssone, Pridbern van Pudbusk
vnde Mychel Ruth, riddere, Yesse D
 ue, Henneke Oluessone vnde Berneke
Schinckel, knechte, vôrbenômet, myt êner sâmeden
hant in gûden tr
ue, Henneke Oluessone vnde Berneke
Schinckel, knechte, vôrbenômet, myt êner sâmeden
hant in gûden tr
 wen stede vast vnde vnbrekelk to
holdende in aller mâte, alze vôrscreuen is,
sunder gênigherleye hulperede vnde argelist. To
bekantnisse vnde mêrer hewâringe desser
vôrscreuen dink hebbe wy Margareta konynginne
vnde wy Ywar Lucke, Jons Ruth, Folmar
Jacobssone, Pridbern van Pudbusk vnde Mychel
Ruth, riddere, Yesse Duue, Henneke Oluessone
vnde Berneke Schinckel, knechte, dickebenômet,
vse ingezegele wêtende vôr dessen brêff
gehenget, gheuen vnde screuen to Werdingeborch
na godes bôrt dûsent iâr drêhundert iâr in deme
vîf vnde neghentighesten iâre, des donnerdâghes
nêghest na sunte Pawels dâghe alze he bekêrt wart.
wen stede vast vnde vnbrekelk to
holdende in aller mâte, alze vôrscreuen is,
sunder gênigherleye hulperede vnde argelist. To
bekantnisse vnde mêrer hewâringe desser
vôrscreuen dink hebbe wy Margareta konynginne
vnde wy Ywar Lucke, Jons Ruth, Folmar
Jacobssone, Pridbern van Pudbusk vnde Mychel
Ruth, riddere, Yesse Duue, Henneke Oluessone
vnde Berneke Schinckel, knechte, dickebenômet,
vse ingezegele wêtende vôr dessen brêff
gehenget, gheuen vnde screuen to Werdingeborch
na godes bôrt dûsent iâr drêhundert iâr in deme
vîf vnde neghentighesten iâre, des donnerdâghes
nêghest na sunte Pawels dâghe alze he bekêrt wart.
Nach dem Originale im wismarschen Rathsarchive, auf Pergament in Quer-Schmaloctav. Die Siegel hangen an Pergamentstreifen.
1) Rund. In einer Vierpassverzierung ein gekrönter Kopf. Umschrift:
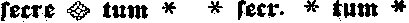
2) Rundes Siegel mit einem dreieckigen Schilde, worauf ein Kammrad. Umschrift:
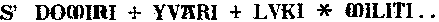
3) Rund. Auf einem rechts gelehnten dreieckigen Schilde eine schräge rechts gestellte Raute. Umschrift:
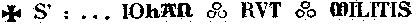
4) Rund. Auf einem rechts gelehnten dreieckigen
Schilde 3 Lilien mit den Spitzen
zusammenstossend
 . Umschrift:
. Umschrift:
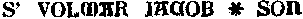


|
Seite 212 |




|
5) Rund. In einer Vierpassverzierung ein halber rechts sehender Adler. Umschrift:
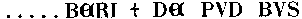
(sehr unklar).
6) Rund. Auf einem dreieckigen Schilde eine schräge rechts gestellte Raute. Umschrift verwischt.
7) Rund. In einer Dreipassverzierung ein dreieckiger Schild mit einem rechts sehenden Adler. Umschrift:
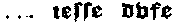
8) Rund (von rothem Wachs). In einer Vierpassverzierung ein dreieckiger Schild mit einer rechts gekehrten ausgespannten Kralle. Umschrift verwischt.
9) Rund. In einem dreieckigen Schilde drei mit ihren Spitzen an einen Ring stossende herzförmige Blätter. Umschrift:
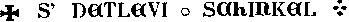
Nr. XVIII.
Die Vettern Nicolaus und Heinrich Pressentin mit ihren Vettern Henning zu Weitendorf und Peter zu Prestin verlassen dem Kloster Eldena ihre Besitzungen in Herzfeld.
D. d. Parchim. 1348. Mai 5.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geheimen- und Haupt-Archive zu Schwerin.
In nomine domini. Amen. Ne obliuio acta hominum sollempniter celebrata sepeliat succedente temporis diuturnitate, necesse est ea scripturarum testimonio, sigillorum munimine testiumque inscriptionibus firmiter roborari. Hinc est quod nos Nicolaus et Hinricus, filius Petri, patrui, dicti Preszentyn, famuli, ad omnium christifidelium noticiam, tam presentis, quam futuri temporis, cupimus peruenire, quod cum vnanimi consensu omium heredum nostrorum ac omnium, quorum consensus aderat requirendus, deliberatione matura et voluntate libera dimisimus et presentibus dimittimus honorabili viro domino Hinrico dicto Mund preposito, necnon religiosis dominabus Wycburgi priorisse totique conuentui sanctimonialium monasterii in Eldena, ordinis sancti Benedicti, omnia bona, quecunque hactenus in villa Hertesuelde habebamus, et precipue duos mansos, necnon omnia alia et singula inibi matri nostre nomine


|
Seite 213 |




|
dotalicii assignata, cum omni iure supremo et
infimo, sicut progenitores nostri et nos ea
possedimus, libere ac perpetue possidenda, illis
duobus mansis, super quibus lis vertitur inter
illos .. Dareszlaw et nos, duntaxat exceptis,
transferentes nichillominus in conuentum et
monasterium prelibatum omne ius, quod hactenus
nobis in ipsis competebat bonis et quod nostris
heredibus seu coheredibus quibuscunque competere
poterit in futurum, renunciantes eciam perpetuo
omni iuri, excepcioni, actioni, inpeticioni et
aminiculis vniuersis, quibus monasterium
predictum per nos aut heredes nostros posset in
eisdem bonis in posterum quomodolibet inpediri.
Et nos Henninghus, morans in Weytendorpe, et
Petrus, morans in Preszentyn, famuli, dicti
Preszentyn, vna cum patruis nostris
suprascriptis, videlicet Nicolao et Hinrico,
promittimus data fide et in solidum, nos velle
warendare conuentui et monasterio prememorato
bona supradicta pre omnibus iuri volentibus
conparere; item spondemus fide prestita et in
solidum, quod iam dictus Hinricus, noster
patruus, qui forte inennis reputari posset, ad
horum bonorum resignacionem, cum ad annos
discrecionis peruenerit, hec omnia et singula,
prout superius sunt expressa, approbare debebit
et ratificare et sepedicta bona predictis . .
preposito, . . priorisse et conuentui coram vero
domino pheudi denuo resignare, nullo proinde
munere requisito. Vt autem hec omnia supradicta
rata maneant et inconuulsa, fecimus presentes
literas super ea confectas nostrorum sigillorum
appensione communiri. Testes huius rei sunt
honorabiles viri: dominus Godfridus, plebanus
ecclesie beati Georgii in Parchim, et frater
eius Johannes, dicti Nygenkerken, Arnoldus
Nygenkerken, Ywanus de Radum, Johannes
Wotzenitz, Bernardus Schulto, ciues ibidem, et
alii plures fide digni. Datum et actum Parchim,
anno incarnacionis domini
 ° CCC° XL° VIII°, feria secunda
proxima post dominicam, qua cantatur
Misericordia domini.
° CCC° XL° VIII°, feria secunda
proxima post dominicam, qua cantatur
Misericordia domini.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gedrängten, festen, scharfen Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin. An Pergamentstreifen hangen 4 Siegel:
1) Ein kleines, rundes Siegel, aus ungeläutertem Wachs, Lithographie I, Nr. 1, mit einem stehenden Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
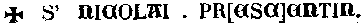


|
Seite 214 |




|
2) ein ähnliches Siegel, Lithographie, I, Nr. 2, mit der Umschrift:
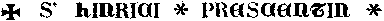
3) Ein schildförmiges Siegel, aus geläutertem Wachs, Lithographie, I, Nr. 3, mit einer nach unten links gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
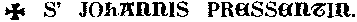
4) Ein schildförmiges Siegel, aus ungeläutertem Wachs, Lithographie, I, Nr. 4, mit einer rechts gekehrten Greifenklaue, mit der Umschrift:
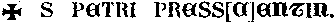
Der um die Geschichte des Vaterlandes lebhaft bemühete Herr Amtmann von Pressentin zu Dargun hat die im schweriner Archive und sonst bisher bekannt gewordenen, zu der vorstehenden und den nachfolgenden Urkunden gehörenden ältesten Siegel des Geschlechts von Pressentin gesammelt, zum Druck befördert und dem Vereine für meklenburgische Geschichte für dessen Jahrbücher eine Auflage der zwei lithographirten Tafeln geschenkt, welche diesen Urkunden beigeheftet sind.
G. C. F. Lisch.
Nr. XIX.
Der Knappe Heinrich Pressentin schwört den Herzogen Albrecht, König von Schweden, und Johann von Meklenburg Urfehde.
D. d. Schwerin. 1402. Febr. 21.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geheimen- uud Haupt-Archive zu Schwerin.
Ich Hinrik Pressentyn, knape, bekenne vnde betûghe ôpenbâre an dessem brêue, dat ich ghelôuet vnde gheswôren hebbe, lôue vnde swere mit vprichteden vyngeren to den hilgen an dessem brêue êne witlike rechte ôrveyde vnde êne ganze sône den dorluchtigen


|
Seite 215 |




|
hôghebornen fursten vnde heren, heren Alberchte, der Sweden vnde der Goten koninge, vnde hertogen Johanne, sînem vedderen, hertogen to Mekelenborch, greuen to Zwerin, to Stargarde vnde to Rozstok heren, vnde eren eruen, älso dat ich ere vyende nummer werden will edder schal na dessem dâghe, vnde ôch nummer will edder schal de vôrbenômeden heren edder ere eruen, ere man, land edder stede edder inwônere erer lande arghen edder beschedigen hêmelik edder ôpenbâre, âne dat wêre also dat myn eruehere edder de here, dâr ich vnder hûsseten wêre, der vôrbenômeden heren edder erer eruen vyend wurde, so mochte ich by mynes heren hulpe blîuen vnde sîner ghenêten vnde entgelden, vnde dat scolde in desser ôrveyde nicht schâden. Vortmer wy Hanss Pressentyn vnde Herman Pressentyn, brôdere, lôuen in gûden trûwen den dorchluchtigen fursten koning Albrechte vnde hertogen Johanne vôrbenômet vnde eren eruen vnde to erer trûwen hand Hinrike Tzichusen, Godscalke van Tzulowe vnde iungen Hinrike Tzichusen mitvnseme brôdere Hinrik Pressentyn, dat he all desse vôrscreuen stucke, de he lôuet vnde swôren heft, holden schal stede vnde vast sunder yênigherleye hulperede vnde sunder all arch. Vnde to mêrer bewâringhe hebbe wy Hinrik, Hanss vnde Herman, brôdere, ghehêten van Pressentyn vnse ingesegele witliken hengen lâten an dessen brêff, de gescreuen ys to Zwerin na godes bôrd vêrteynhundert iâr in dem andern iâre, dâr na des dingesdâghes vôr sunte Mathias dâge des hilghen aposteles.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer festen, klaren Minuskel. An Pergamentstreifen hangen 3 runde Siegel aus geläutertem Wachs, alle mit einem stehenden Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit folgenden Umschriften:

Lithographie, II, Nr. 1.
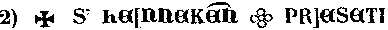
die Umschrift ist sehr undeutlich, jedoch scheinen die mit [ ] bezeichneten Buchstaben darin zu stehen. Lithographie, II, Nr. 2.
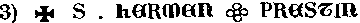
Lithographie, II, Nr. 3.


|
Seite 216 |




|
Nr. XX.
Die Brüder Peter und Reimar Pressentin verkaufen ihre beiden Höfe in dem Dorfe Witzin, auf denen die Burgen stehen, mit 8 Hufen, wie sie diese Güter von ihrem Vater geerbt haben, dem Kloster Tempzin.
D. d. 1408. Julii 15.
Nach dem Originale im grosshherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Peter vnde Reymer, brôdere, ghenômet
Pressentine, bekennen vnde betûghen myd vzen
rechten eruen ôpenbâre an desseme brêue, dat wy
myt vôrbedachten ghûden wyllen vnde na râde vzer
vrunt hebben vorkofft to êneme rechten kôpe vnde
vorkôpen vze beyden hôue an deme dorpe to
Wytzin, dar de borghe ane stân, myt achte
h
v
uen, de nů to der tiid de
b
 r to Wytzin bûwen, myt erer
tôbehôringhe, alze ze ligghen an erer schêden
vnde vze vader v
e
s eruet heft vnde wy
beseten hebben wente an desse tiid, deme
beschêdenen manne her Petere, mêstere to sunte
Anthonies hôue to Tempzin, vnde synen
nakômelinghen mêsteren vnde vôrstenderen vôr
hundert lubessche mark penninghe, de my de
vôrbenômede her Peter mêster wol to danke vnde
to der nôghe berêt heft, dâr schal de vôrscreuen
her Peter vnde syn vôrstender to sunte Gallen
dâghe, de nů nêghest kumpt, teyn lubessche
mark pacht êrst vnde to vôren vpbôren van den
bûren, dede nu de vôrscreuen h
v
uen
bûwen, sunder weddersprâke vnde bewêrnisse vzer
vnde vzer eruen, vnde ik vôrbenômede Peter vnde
Reymer scholen vnde wyllen deme vôrscreuen her
Peter meister, sînen nakômelinghen vnde
vôrstendere de vôrscreuenen h
v
uen
vnde hôue vorlâten vôr den heren vnde myt allen
vlyte dâr to helpen, dat em dat de heren lîgen
vnde vorêghenen wyllen. Wêre ôuer dat de heren
em nicht lîgen vnde vorêghenen wyllen, so schal
ik Peter vnde Reymer edder vzen rechten eruen
den vôrscreuen her Petere meistere, synen
nakômelinghen edder synen vôrstenderen to
sůnte Jacobes dâghe, de nu nêghest kumpt
vort ôuer deme iâre hundert lubessche mark
pennighe berêden vnde
r to Wytzin bûwen, myt erer
tôbehôringhe, alze ze ligghen an erer schêden
vnde vze vader v
e
s eruet heft vnde wy
beseten hebben wente an desse tiid, deme
beschêdenen manne her Petere, mêstere to sunte
Anthonies hôue to Tempzin, vnde synen
nakômelinghen mêsteren vnde vôrstenderen vôr
hundert lubessche mark penninghe, de my de
vôrbenômede her Peter mêster wol to danke vnde
to der nôghe berêt heft, dâr schal de vôrscreuen
her Peter vnde syn vôrstender to sunte Gallen
dâghe, de nů nêghest kumpt, teyn lubessche
mark pacht êrst vnde to vôren vpbôren van den
bûren, dede nu de vôrscreuen h
v
uen
bûwen, sunder weddersprâke vnde bewêrnisse vzer
vnde vzer eruen, vnde ik vôrbenômede Peter vnde
Reymer scholen vnde wyllen deme vôrscreuen her
Peter meister, sînen nakômelinghen vnde
vôrstendere de vôrscreuenen h
v
uen
vnde hôue vorlâten vôr den heren vnde myt allen
vlyte dâr to helpen, dat em dat de heren lîgen
vnde vorêghenen wyllen. Wêre ôuer dat de heren
em nicht lîgen vnde vorêghenen wyllen, so schal
ik Peter vnde Reymer edder vzen rechten eruen
den vôrscreuen her Petere meistere, synen
nakômelinghen edder synen vôrstenderen to
sůnte Jacobes dâghe, de nu nêghest kumpt
vort ôuer deme iâre hundert lubessche mark
pennighe berêden vnde


|
Seite 217 |




|
betâlen an sodâner munte, alzo denne to der Wysmer ghenghe vnde gheue sind, an êneme summen, to êner tiid, an deme godeshûs sunte Anthonius to Tempzin edder bynnen der stad to der Wysmer, wôr em dat êuenst kumpt, sunder iênegherleie vortôgheringhe, hulperede, hinder, schâden vnde arghelist. Dyt lôue ik Peter vnde Reymer vôrbenômet myd vzen rechten eruen vnde myd vzen medelôueren vnde segghen alzo myd Clawes Rutzen, wônachtich to Kobande, vnde Clawes Prestyne, vseme vedderen, deme vôrbenômeden mêster Petere, synen nakômelinghen vnde to syner trûwen hant, her Hinrik van Groben, syme vôrstendere, olde Clawes Sperlinghe vnde Reymer van Plessen, wônachtich to Tzůlowe, an ghantzem lôuen, mid ghûden trûwen, mid êner sâmenden hand an desseme brêue stede vnde vast to holdende, sunder hulperede vnde degher âne alle arghelist. To tûghe zo hebbe ik Peter vnde Reymer vôrbenômet vse ingheseghele myd den ingheseghelen vzer medelôuere, alzo Clawes Rutzen vnde Clawes Pressentyne vôrbenômet henghet lâten vôr dessen brêff, de ghegheuen vnde gheschreuen is na godes bôrt vêrteinhundert iâr dâr na an deme achten iâre, an deme dâghe der twelff apostele, also ze worden vorsant an de werlt.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer festen, grossen, breiten Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
An Pergamentstreifen hangen 4 Siegel:
1) Ein grosses schildförmiges Siegel, aus geläutertem Wachs, Lithographie, I, Nr. 5, mit einem stehenden Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
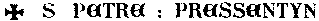
2) Ein rundes Siegel, aus geläutertem Wachs, Lithographie, I, Nr. 6, mit einem stehenden Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
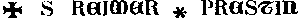
3) Ein schildförmiges Siegel, aus geläutertem Wachs, mit zwei Flügeln, auf denen ein Stiergehörn steht, gleich dem Wappen der von Barnekow, mit der Umschrift:
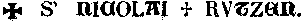


|
Seite 218 |




|
4) Ein rundes Siegel, aus geläutertem Wachs, Lithographie, I, Nr. 7, mit einem stehenden Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
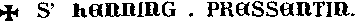
Claus Pressentin hat also ein anderes Siegel seiner Familie gebraucht; nach der bisherigen Genealogie ist Henning der Vater der Brüder Peter und Reimar gewesen.
Nr. XXI.
Die Brüder Peter und Reimar Pressentin auf Prestin verkaufen dem Kloster Tempzin all ihr Gut, welches sie in dem Dorfe Witzin besitzen und ihr Vater und sie bis dahin besessen haben.
D. d. 1409. Jan. 9.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerih.
Ik Peter vnde Reymer, brôdere, ghehêten Prestyne, wônachtich to Prestyn, bekennen vnde bethûghen ôpenbâr an desseme brêue, dat wy na râde vnde vulbôrt vzer rechten eruen mid ghûden willen vnde vôrbedachtenem mûde hebben vorkoft to êneme rechten kôpe alle vze ghût, dat wy hebben an deme dorpe vnde tobehôringhen des dorpes to Witzyn, alzo id licht an alle zynen schêden, alzo id vze vâder yê vryest bezeten heft vnde wy nâ bet an dessen dach, altesnicht ûtghenômen, deme êrwerdighen manne hern Petere, meystere to Temptzyn des godeshûzes sunte Anthonii, vnde alle zynen nakômelinghen dârzulues vôr twê hundert mark vnde druttigh mark lubescher pennynghe, de he vs wol to der nůghe berêt vnde betâlet heft, mit ghûden, rêden lubeschen pennynghen. Desse vôrbenômede hern Peter meyster edder zyne nakômelinghe scholen vnde môghen vtlôzen vnde wedder kôpen al dat ghût, wes wy vorzettet hebben edder to êneme wedderkôpe vorkoft hebben an deme dorpe vnde ghûde to Witzyn, van alle den ghênen, de van vs Peter vnde


|
Seite 219 |




|
Reymere, brôderen vôrscreuen, vzen eruen edder hîr bevôren van yênigheme rechten bezittere desses vôrscreuenen ghûdes dâr ichteswat ane hebben, na vtwîzinghe erer brêue, so wenne hern Peter meyster eergenômed edder zyne nakômelinghe dat vtlôzen edder wedderkôpen konen vnde vormôgen. Desses vôrbenômeden kôpes, alze hîr vôrscreuen steyt, schole wy Peter vnde Reymer brôdere mit vzen rechten eruen desseme vôrbenômeden hern Petere meystere vnde zynen nakômelinghen wâren vnde entvrygen van aller ansprâke ghêstlik edder werlik alle der ghênen, de vôr recht kômen willen vnde recht gheuen vnde nemen willen, alzo in deme lande ên recht is, vnde hebben em dat vorlâten vôr vnzen heren des landes. Alle desse vôrscreuenen stucke vnde ên iêwelik by zik ik Peter vnde Reymer brôdere vôrghenômet mit vzen rechten eruen vnde mit vzen trûwen medelôueren, alze mit Clawes Prestyne, wônachtich to Prestyn, Hinrik Prestyne to Weykendorpe, Hennynghe van Pomeren to deme Sterneberghe, wy alle lôuen vnde zegghen deme vôrbenômeden hern Petere, meystere des ghodeshûzes sunte Anthonii to Temptzyn, vnde zynen nakômelinghen, vnde to erer trûwen hant olde Clawes Sperlinghe vnde iunghe Clawes zyneme sone, wônachtich to Slawestorpe. Reymare van Plesse, wônachtich to Tzulowe, Clawes Rutzen to Kobande, hern Hinrike, vôrstendere des ghodeshûzes sunte Anthonii to Temptzyn, vnde hern Gherde Wunneken, vicario to Temptzyn, in ghûden trůwen, mit êner zâmenden hant an desseme brêue stede vnde vast to holdende, sunder hůlperede vnde degher âne alle arghelist, mede togelôuet, dat wy Peter vnde Reymer brôdere vôrscreuen, vze eruen edder nůment vata vzer weghen to êwighen tîden an desseme dorpe to Wytzyn vnde , an allen zynen tôbehôringhen altesnicht môghen edder scholen beholden. Tho tûghe, hooldinghe vnde wâringhe alle desser vôrscrenen stucke hebbe wy Peter vnde Reymer, brôdere, Clawes vnde Hinrik, ghehêten Prestyne vnde Hennyngh van Pomeren vnze inghezeghele mit witschop ghehenghet vôr vnde an dessen brêff, de gheuen vnde screuen is na godes bôrt vêrteynhundert iâr an deme negheden iâre, dârna des midwekens na der dryer hillghen konyngh dâghe.


|
Seite 220 |




|
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer kleinen, engen, festen Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
An Pergamentstreifen hangen 5 runde Siegel, aus geläutertem Wachs, alle mit einem stehenden Schilde:
1) mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, Lithograpbie, I, Nr. 6, mit der Umschrift:
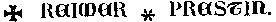
Peter Pressentin, welcher an die Urkunde vom 15. Julii 1408 sein eigenes Siegel gehängt hat, bedient sich hier also des Siegels seines Bruders Reimar.
2) dasselbe Siegel des Reimar Pressentin, wie es hier unter Nr. 1 und zur Urkunde vom 15. Julii 1408 beschrieben ist.
3) mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, Lithographie, I, Nr. 7, mit der Umschrift:
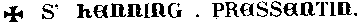
Claus Pressentin auf Prestin bedient sich also auch hier, wie an der Urkunde vom 15. Julii 1408, eines anderen Siegels seiner Familie, nämlich des Siegels des Henning Pressentin.
4) dasselbe Siegel, wie Nr. 3.
Heinrich Pressentin auf Weitendorf bedient sich also desselben Siegels des Henning Pressentin, dessen sich auch Claus Pressentin bedient.
5) mit einem aufgerichteten Greifen, mit der Umschrift:
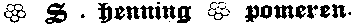
Nr. XXII.
Vicke Gantzow verkauft dem Kloster Tempzin sein Erbe in dem Dorfe Witzin.
D. d. 1410. Dec. 6.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Vykke Gantzowe, Vykke Gantzowen zône deme god gnedych zy, bekenne ôpenbâre vôr al den yênnen, de dessen brêf zeen edder hôren lezen, dat yk myt mynen rechten eruen na râde vnde wlbôrt myner vrunde hebbe vorkoft brôder Petere, meystere des hûzes zunte Anthonyezes to Temptzyn, vnde zynen nakômelynghen


|
Seite 221 |




|
vnde deme gantzen orden al myn erue vnde anval, dat my aneruet ys vnde anvallen mach van myner olderen weghene in deme dorpe to Wytzyn, vnde heft my dat myt rêden pennynghen to der nôghe wol betâlet, vnde gheue âuer myt ôrkunde desses brêues allen anval vnde erue, alze hyr vôr screuen ys, my vnde mynen eruen vnde nummende van vzer weghene dâr to êweghen tyden vp to zâkende, vnde hebbe dat vorlâten vôr den heren van deme lande, dâr yt af to lêne gheyt. Al desse vôrscreuen stukke lôue ik Vikke vôrbenômet myt mynen rechten eruen dat stede vnde vast to holdende brôder Petere, zynen nakômelynghen vnde deme gantzen orden in gûden trûwen to erer trûwer hant al den yênnen, de dessen brêf hebbet myt eren wyllen. To mêrer betůghynghe hebbe yk Vykke myn inghezeghel vnde wy Reymer Kremon, Clawes Schonenberch vnde Peter Prestyn vnze inghezeghel to tûghe myt wyschop henghet an dessen brêf, de screuen ys na godes bôrt vêrteynhundert yâr in deme teynden yâre, in zunte Nycolaus dâghe des hylghen byschoppes.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer gedrängten, breiten Minuskel. An Pergamentstreifen hangen 4 Siegel aus ungeläutertem Wachs:
1) Ein rundes Siegel mit einem Schilde mit einem schraffirten Queerbalken, mit der Umschrift:
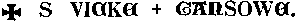
2) Ein rundes Siegel mit einem längs gespaltenen Schilde, rechts mit einem Queerbalken , links mit einem halben Rade; die Umschrift ist unleserlich.
3) Ein schildförmiges Siegel mit einer Kugel in der Mitte und einem sechsstrahligen Stern in jedem Schildwinkel, mit der Umschrift:
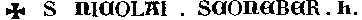
4) Ein rundes Siegel, Lithographie, II, Nr. 4, mit einem Schilde mit einer rechts gekehrten Adlerklaue, mit der Umschrift:
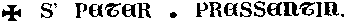
Dasselbe Siegel des Peter Pressentin hängt an der nächst folgenden, im Archive der Stadt Lübek aufbewahrten Urkunde, vom 27. September 1411, über die Sühne zwischen dem Knappen Henneke von Bülow zu Critzow und dem Rath der Stadt Lübek.
Ueber die Farnilie v. Ganzow oder v. Gantzkow vgl. Lisch, Gesch. des Geschl. Hahn, II, S. 84, und III, S. 63 flgd.


|
Seite 222 |




|
Nr. XXIII.
Der Knappe Henneke von Bülaw auf Critzow schliesst mit der Stadt Lübek eine Sühne wegen aller Fehde vnde Gewaltthätigkeit.
D. d. 1411. Septbr. 27.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Lübeck.
Ik Henneke van Bulow, knape, wônaftich to Critzow, bekenne vnde betûge âpenbâre in dessem brêue vôr alsweme, dat alle vnwille, veyde vnde schêlinghe, de gewesen syn bet an dessen dach twischen my vnde den mynen, vppe de ênen syd, vnde den êrbâren mannen borgermêsteren, râdmannen, der mênheyt der stad Lubeke vnde den eren, vp der anderen syd, gensliken vnde al in vruntscop syn geulegen, vorêneget vnde gesônet, alzo dat vnser nên dâr in tôkômenden tîden mêr vp zâken enschal, noch enwil; ok enschal ik efte enwil efte nêmant van myner wegen de êrbenômeden borgermêstere, râdmanne, de mênheit der vôrscreuen stad Lubeke efte de eren schuldigen, beclâgen efte veyden van rôue, brande efte van wat vnschicht vnde schêlinghe, de aldus langhe twischen my vnde en sint geweset; wêre ôk dat id schêge yênegerleye wys, dâr schal ik vnde myne eruen vnde nascreuene medelôuere se af entfrîgen vnde gensliken schâdelôs van beholden. Vortmêr enschal ik, noch enwil der êrbenômeden stad Lubeke vîende, rôuere efte vorfestede lûde hôuen, hûsen efte spysen, in nênerleye stukken to uorderende in mynen vesten, dorpen vnda gebêden vnde ôk der êrbenômeden borgermêstere, râdmanne, borgere vnde der eren vyent nycht to werdende in tôkômenden tyden, it enwêre dat myn rechte erfbôrne here ere vyent worde, dat god afkêre, so scholde ik my myd en tovôren an êren vorwâren vnde ik Henneke van Bulow êrgenômet myd mynen eruen vnde medelôueren nagescreuen, alse Peter Pressentine, Marquard Barnekowen vnde Henneken van Plesse wônaftich to Muselmowe, knapen, lôuen myd êner sâmenden hand in gûden trûwen alle vôrscreuene artikele vnde stukke vnde ên yslik besunderen den êrbenômeden borgermêsteren, râdmannen, der mênheit der êrbenômeden


|




|
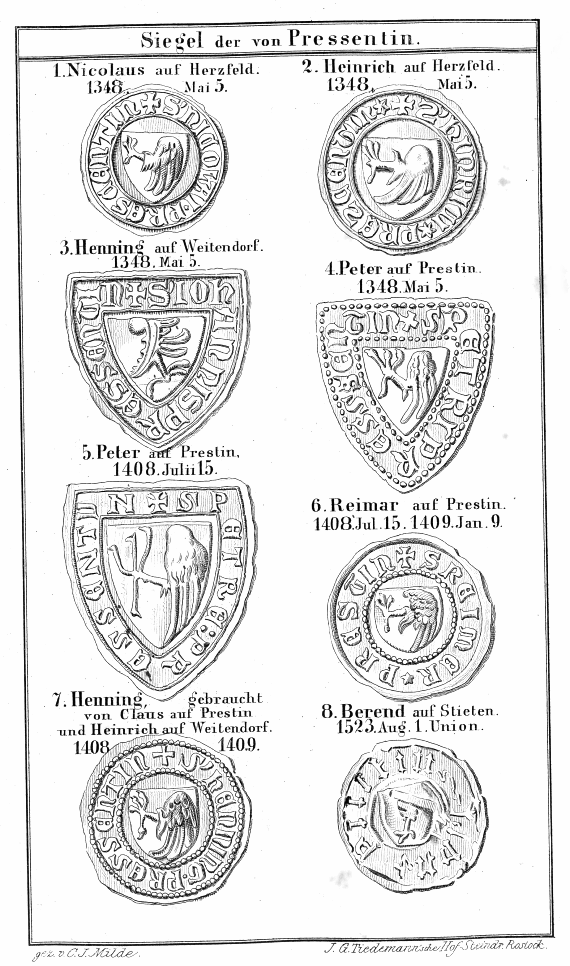


|




|


|




|
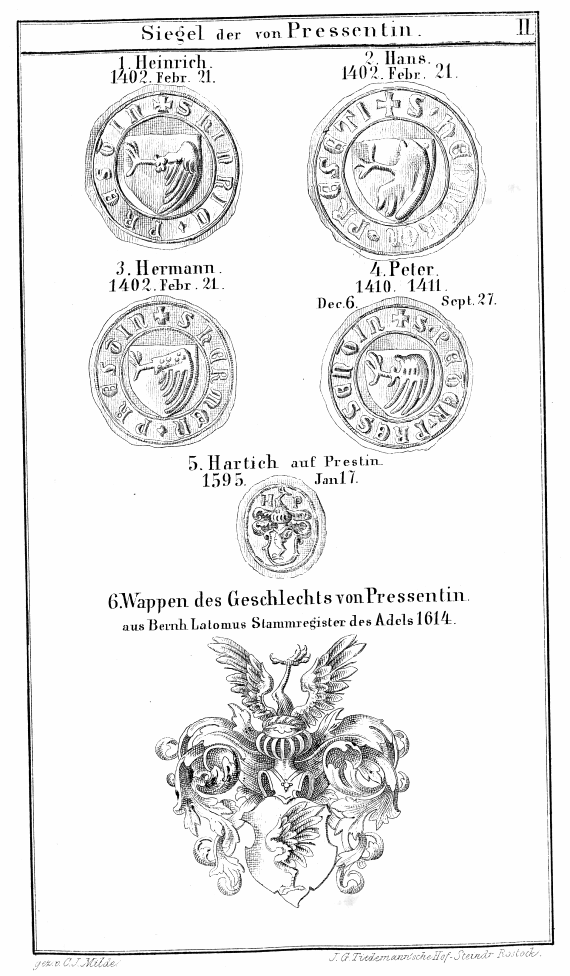


|




|


|
Seite 223 |




|
stad Lubeke vnde den eren stede vnde vast to holdende, vnuorbrôken, sunder arglist. To mêrer betûchnisse vnde grôterme lôuen hebbe wy Henneke van Bulow, hôuetman, Peter Pressentyn, Marquard Barnekow vnde Henneke van Plesse, medelôuere vôrscreuen, vnse yngezegele myd vnsen willen vnde witschop gehenghet vôr dessen brêff, screuen na Cristi gebôrt vêrteynhundert iâr dâr na in deme elften iâre, des nêgesten sondâges vôr deme dàge Mychahelis des erczeengels.
Nach dem Originale, auf Pergament, im Archive der Stadt Lübeck. Angehängt waren 4 Siegel, von denen das dritte, des Marquard Barnekow, abgerissen ist. Das zweite Siegel, des Peter Pressentin, ist dasselbe, welches an der nächst voraufgehenden Nr. mitgetheilten Urkunde des Vicke Gantzow vom 6. Dec. 1410 hängt. Lithographie, Taf. II, Nr. 4.
Nr. XXIV.
Die Fürsten Balthasar und Johann von Werle, Brüder, für sich und ihre Brüder Claus und Wilhelm, verbinden sich mit den Städten Hamburg und Lübeck.
D. d. (um 1410). Julii 3.
Witlic zi alle den yenen, de dessen breef seen edder horen lesen, dat wy Baltazar vnde Johan, brodere heren van Werle, van vnser brodere weghen Claus vnde Wilhelmes, der wy mechtich syn, hebben vns vordregen mit den beschedenen heren ratmannen tho Lubeke vnde Hanborch in desser wise, dat wy scholen vnde willen vns setten tho erer hulpe, bliuen vnde wesen by en an erme krighe midvnsen mannen vnde steden Parchen vnde Gustrowe in desser wise: waner dat zee van vns hulpe begherende sin, so schole wi en voren XXX, XL. efte L man efte mer, alze ze begherende syn van vns, vnde den scholen de vorbenumeden stede Lubek vnde Hamborch gheuen riddertzolt, vnde scholen en ok vor schadeo staen vnde scholen een ok gheuen spise vnde hofsclach, ynde dar wille wy Baltazar efte vnser broder een zuluen


|
Seite 224 |




|
mede wesen, vnde welk vnser dar mede ys, deme scholen de vorbenumeden stede nenen tzolt gheuen vnde ok vor nenen schaden staen, men de hulpe wille wy en doen vppe gude vruntscop, vnde dar na dat wy by een doen, dar na moghen see vns vruntscop wedder doen, vnde wes see vns denne yn vruntscop doen, dat schal vns wol tho danke wesen, vnde scholen, noch willen zee dar wurder nicht vmme andeghedinghen; ok wylle wy de vorbenumeden vnse stede Parchem vnde Gustrowe senden bi de vorbenumeden steden Lubeke vnde Hamborch, vnde wo zee sik mid een vordreghen, dat schal vnse wille wol wesen; vnde dit riddertzolt schal anstaen, wan eer wy tho Lubeke komen. Dit ys ghedeghedinget vnde wlghetheghen des neghesten daghes na der hilghen merteler daghen Processe vnde Martiniani.
Nach der gleichzeitigen Schrift, auf einem Pergament, 8" breit, 9 1/2" hoch, im wismarschen Stadt-Archive, mitgetheilt von C. D. W. Die Urkunde scheint bloss Entwurf zu sein; der untere Rand ist ausgeschnitten an den SteIIen, wo die Siegel hätten hangen müssen.
Nr. XXV.
Der Bürger Johann Schelp zu Wismar leiht dem Antoniuskloster zu Tempzin 400 lüb. Mark, zum Ankaufe des Hofes Zahrenstorf, für 32 Mk. lüb. Renten aus Zahrenstorf, welche Renten Johann Schelp wieder zur Stiftung einer ewigen Messe in dem Hospitale vor dem Antoniushofe zu Tempzin vermacht.
D. d. 1410. März 30.
(Vergl. Jahrb. XV, S. 102 und 208.)
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
In deme nâmen der hilghen vnde vnghedêlden drêualdicheit Amen. Vôr alle den gênen, de dessen brêff seen, hôren edder lezen, ik brôder Peter Berlonis, mêster vnde bêdegher des hôues sůnte Antho-


|
Seite 225 |




|
nius tho Tempzin, an deme stichte to Zwerin,
bekenne vnde betůghe ôpenbâre vôr allen
lûden gêghenwardich vnde thokômende, dat ik myt
vůlbôrt myner ôuersten vnde alle der
gênen, der ere vůlbôrt hîr van rechte was
thô tho êschende, vôr veerhůndert lubesche
mark, de my Johan Schelp, ên borgher to der
Wysmer, een sůnderich vrůnt vnde
ghůnner des hôues sůnte Anthonius,
hefft rêde berêt vnde betâlet, de an des
godeshûses brûkelicheit vnde nô
e
t
ghekômen syn, vnde sůnderghen an de
betâlinghe des dorpes to Tzarnstorpe, dat
beleghen is by deme suluen hôue sůnte
Anthonius, hebbe rechte vnde redelken vnde myt
wolbedachten môde vorkoft vnde vorlâten, vorkôpe
vnde vorlâte vnde vplâte an desseme suluen brêue
deme suluen Johann Schelpe twê vnde druttich
mark lubessch êwighes gheldes to hebbende vnde
vptobôrende vt deme vôrschreuen dorpe vnde hôue
to Tzarnstorpe, also dat beleghen is, to vôren
vp to bôrende vnde to hebbende vôr allen lûden
to sůnte Mertens dâghe, vnde de suluen twê
vnde druchtich mark gheldes to pandende, beide
 lde pacht vnde nyge, also dicke
alze en des behôff vnde nô
e
et is, myt
synen hulperen, vnde de pande to dryuende to der
Wysmer in vnde to vůrende vnde syn rêde
ghelt dâr mede to nemende sůnder
vorvolghinge, wan em vnde synen navolgheren des
behôff vnde nôt is, vnde wêre id dat in der
pandinghe worde we ghewundet edder dô t
gheslâghen, de de pandinghe hinderen edder kêren
wolde, dat schal sunder brô
e
ke wesen.
Vortmer schal ik brôder Peter der vôrscreuenen
twê vnde druchtich mark gheldes Johan Schelpe
vnde synen nauolgheren to ende wâren vôr alle de
gênen, de dâr vp spreken willen, ze sìn ghêstlik
edder werlik, vnde degher vôr alle ansprâke.
Vnde desse vôrscreuenen twê vnde druchtich mark
gheldes heft Johanschelp vmme heyls vnde
sâlecheit willen sîner zêle ghelecht vnde
ghegheuen vnde toghetêkent to êner êwyghen
missen vser lêuen vrowen an ere êre vnde sunte
Anthonius to êwighen tîden to singhende
êrbârliken van ambeghynne bet an den ende vnde
by twên beddemen prêsteren de yê cho (ock?)
prêstere syn, de neen leen en hebben, vnde ôk
anders neen leen hebben en scholen, vnde by by
sik suluen to wârende in deme hospitâle, dat
ghebûwet is vôr deme hôue sunte Anthonius
lde pacht vnde nyge, also dicke
alze en des behôff vnde nô
e
et is, myt
synen hulperen, vnde de pande to dryuende to der
Wysmer in vnde to vůrende vnde syn rêde
ghelt dâr mede to nemende sůnder
vorvolghinge, wan em vnde synen navolgheren des
behôff vnde nôt is, vnde wêre id dat in der
pandinghe worde we ghewundet edder dô t
gheslâghen, de de pandinghe hinderen edder kêren
wolde, dat schal sunder brô
e
ke wesen.
Vortmer schal ik brôder Peter der vôrscreuenen
twê vnde druchtich mark gheldes Johan Schelpe
vnde synen nauolgheren to ende wâren vôr alle de
gênen, de dâr vp spreken willen, ze sìn ghêstlik
edder werlik, vnde degher vôr alle ansprâke.
Vnde desse vôrscreuenen twê vnde druchtich mark
gheldes heft Johanschelp vmme heyls vnde
sâlecheit willen sîner zêle ghelecht vnde
ghegheuen vnde toghetêkent to êner êwyghen
missen vser lêuen vrowen an ere êre vnde sunte
Anthonius to êwighen tîden to singhende
êrbârliken van ambeghynne bet an den ende vnde
by twên beddemen prêsteren de yê cho (ock?)
prêstere syn, de neen leen en hebben, vnde ôk
anders neen leen hebben en scholen, vnde by by
sik suluen to wârende in deme hospitâle, dat
ghebûwet is vôr deme hôue sunte Anthonius


|
Seite 226 |




|
vôrbenûmet, ên prêster deme andcren to helpende to der missen vnde mâlk syne weke to wârende, alzo id sik bôret, vnde van deme offere, dat dâr wert to den missen, nicht sik to beholdende, men deme mêstere edder syneme procuratôre dat trûwelken to antwordende; io doch worden en votîuen an ere hant ghegheuen, de môghen see beholden; ôk scholen de prêstere desse missen holden in deme hospitâle vppe êne tyd, alzo id deme mêstere edder deme procuratôre des godeshûses beheghelik vnde bequême is, vnde scholen to chôre ghân to den tyden myt den anderen prêsteren vnde to den vîllegen, vnde scholen ere memôrien dâr af vpbôren, lîk den anderen prêsteren, vnde scholen nicht dô e n iêghen den mêster edder iêghen synen procurator. Vortmer van den vôrscreuenen twê vnde druchtieh mark gheldes scholen desse prêstere hebben mâlk alle iâr achte mark lubesch to sunte Mertens dâghe uptobôrende vnde to hebbende vt desseme vôrscreuenen dorpe vnde hôue to Tzarnstorpe sunder iênegherlei vortôgheringe; vnde de anderen sostein mark lubesch schal de mêster hebben des hôues vnde de procurator to des godeshûses behôff, vnde dâr vôre scholen de vôrscreuenen twê prêstere hebben ere vrîgen koste vnde drinkent to des mêsters tafelen vnde ên gêslik êne vrîge wôninghe to êwighen tîden. Vortmer desse vôrscreuenen missen scholen lênen de râet to der Wysmer vnde ere nauolghere to êwighen tîden in desser wîse, dat see, alzo dicke alzo zee Iô e s syn, dâr to setten prêstere, dâr de mêster des godeshûses edder sîn procurator an syner afwesinghe vôre bydden. Vnde wêre id dat der prêsteren welk deme mêster edder deme procuratôre nicht vnderdânich wezen en wolde vnde en wolde sik nicht stûren edder dwinghen lâten, zo schal de râet to der Wysmer ene afsetten vnde ênen anderen bedderuen man, de deme mêstere edder deme procuratôre ghedelik vnde vnderdânich sy, an syne stede wedder schikken vnde setten. Vortmer zo heft sik Johan Schelp beholden de lênwâre desser missen also langhe, alzo hee leuet. Alle desse vôrscreuenen stucke ik brôder Peter vôrbenûmet vôr my vnde vôr al myne nauolghere lôue vnde rede Johan Schelpe, synen nauolgheren vnde deme râde to der Wysmer, de to der tyd sîn, stede vnde vast to êwighen tîden to holdende, sunder iênegherlei hulperede, heren bo e t, here nghesette, pâweses ghesette edder pâweses bôde edder anderer


|
Seite 227 |




|
iênigher prelâten edder willekôre edder statuta iêghenwardich edder tokômcnde, vnde degher sunder alle arghelist, vnde myt welkereme se mânen willen, dat sy redent edder lôuent, dâr en schal ên deme anderen nicht ane hinderen edder schâden. Vortmer gheue ik brôder Peter dat ôuer vôr my vnde vôr alle myne nauolghere alle recht, alle excepcien, alle v e tnemynghe vnde toneminghe rechtes vnde der dâet drôghenactiticheit vnde vmmevôringhe, sunderghen dat recht, dat dâr secht, dat ê e n mêne øuergeuynghe njcht dôghen en scholde, vortmer alle hulperede, sunder argelist, to êwighen tîden. Tho tûghe vnde to grôterer bewâringe vnde to êwigher dachtnisse desser vôrscreuenen stucke hebbe ik brôder Peter myn ingheseghel myt den ingheseghelen her Hinrik van Grobis, des godeshûses procurator, vnde her Ghert Wunneken, ênes vicârius dâr sulues, van al vnser witschop lâten henghen an dessen iêghenwardigen brêff, de gheuen vnde screuen is na godes bôrt vêrteinhundert iâr dâr na an deme teynden iâre, des êrsten sondâghes na paschen.
Nach dem Originale, in kräftiger Schrift, auf einem Pergament in gr. Hochquart, mitgetheilt von C. D. W. Angehängt sind an Pergamentstreifen 3 runde Siegel von rothem Wachs:
1) In einer reichen ungewöhnlichen Maasswerkverzierung ein Schild, hinter dem ein Antoniuskreuz hervorsieht. Der Schild ist gespalten und zeigt vorne 3 Kugeln oder Byzanten über einander und hinten einen rechts gewandten, aufrecht stehenden Greifen. Umschrift:
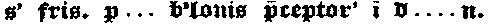
2) In einer Verzierung auf einem Kreuze das Schweisstuch mit dem Angesichte des Herrn. Umschrift:
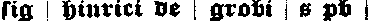
3) In einer Verzierung die heil. Jungfrau mit dem Kinde. Umschrift:
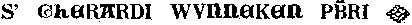


|
Seite 228 |




|
Nr. XXVI.
Bischof Heinrich II. von Schwerin bestätigt die Stiftung einer Vicarei in der Kirche zu Drewskirchen durch den Priester Marquard Roberstorp.
D. d. Bützow. 1416. Julii 17.
Nach dem Originale im Archive der Stadt Wismar.
Hinricus, dei et apostolice sedis gracia episcopus Zwerinensis, vniuersis et singulis cristifidelibus, tam presentibus, quam futuris, salutem in domino sempiternam ac ad perpetuam rei memoriam geste rei agnoscere veritatem. Per has nostras patentes litteras ad vestri noticiam deducimus ac publice recognoscimus et libere ac clare profitemur, quod hodie in nostra presencia constitutus honorabilis vir dominus Marquardus Roberstorp de Wismaria, presbiter Razeburgensis diocesis, pia deuocione et affectione temporalia bona intendens commutare pro eternis ac illorum intuitu seminare cupiens in terris, quod multiplicato fructa recolligere valeat in celis, cupiens quoque singulari deuocione diuinum cultum in ecclesia parrochiali Odeskerken, nostre diocesis, ampliari ac suorum parentum et progenitorum, quamuis morte preuentorum, pias et desideratas adimplere voluntates, in suorum peccaminum remissionem ac dictorum suorum parentum et progenitorum ob salutem animarum, in nostra presentis, conscencientis et autorizantis ac infrascriptorum testium presencia idem dominus Marquardus Roberstorp libere et ut asseruit deliberate et ex certa et spontanea sciencia et voluntate, non vi, dolo, metu, calliditate, machinacione uel quacumque decepcione uel circumuencione preuentus, deceptus, circumuentus, ob premissas et alias racionabiles causas sponte et ex certa sciencia dedit, cessit, concessit, tradidit et donauit pure, libere, simpliciter et irreuocabiliter ac perpetuo donacioiris titulo et ad augmentum cultus diuini in dicta ecclesia parrochiali Odeskerken tres mansos cum dimidio manso sitos et situatos in villa Bluwatze inter suos confines ex omni parte, cum omnibus iuribus, habitacionibus et pertinenciis suis, et quos mansos hodie et de presenti colunt, laborant et


|
Seite 229 |




|
inhabitant Marquardus et Nicolaus Achterledder, villani et inhabitatores eiusdem ville, et quandam domum in villa Odeskerken, sitam inter suos confines, quos mansos et domum dictus dominus Marquardus Roberstorp presbiter asseruit ad se spectare et pertinere et hereditario iure ad presens esse deuolutos, prout in litteris desuper confectis plenius continetur, ac de dictis mansis fundauit et instaurauit et dotauit quandam perpetuam vicariam in dicta parrochiali ecclesia Odeskerken ad altare retro ambonem et versus meridiem situatum perpetuis temporibus deseruiendam, reseruauit tamen sibi dictorum mansorum ac iurium, habitacionum et pertinenciarum sua vita dumtaxat durante ius, dominium et vsumfructum, dicta tamen donacione alias salua permanente, ac ius patronatus et presentandi sibi reseruat et per nos infrascripto modo peciit reseruari dominus Marquardus supradictus pro se et aliis infrascriptis, ita videlicet quod post sui obitum in illo succedere debeant Vicko, Andreas et Tymmo sui fratres condicti Roberstorpe et ipsorum heredes carnales et proximiores, ita quod tempore vacacionis senior inter ipsos tratres et heredes solus et in solidum habeat auctoritatem, personam ydoneam ad dictam vicariam, cum pro tempore vacauerit, eligendi et presentandi, deficientibus vero consanguineis dicte progeniei vtriusque sexus, dictum ius patronatus et presentandi deuoluatur ad proconsules et consules Wysmarigenses pro tempore existentes perpetuis temporibus apud illos permansurum, ita tamen quod predicti proconsules et consules debeant vice qualibet presentare et eligere dumtaxat presbiterum ydoneum et abilem uel clericum, qui infra vnius anni spacium a tempore vacacionis computandum ad ordinem sacerdotalem effectiue promoueatur et extunc infra vnius mensis spacium missam celebrare teneatur, alioquin dicto mense elapso prelatus immediatus infra alium mensem extunc inmediate sequentem dictam vicariam huiusmodi persone ydonee et abili ac ut premittitur in sacerdocio actu constitute libere conferat et assignet, alioquin dicto secundo mense eciam elapso extunc ius presentandi ista vice statim deuoluetur ad episcopum Zwerinensem pro tempore existentem. Vnde nobis idem dominus Marquardus humiliter et deuote supplicauit, premissa omnia et singula tam coniunctim, quam separatim dignaremur auctoritate nostra ordinaria gratificare, ratificare et confir-


|
Seite 230 |




|
mare dignaremur ac domum, mansos et agros predictos cum iuribus, habitaciombus et pertinenciis suis vniuersis in eoclesiasticam et nostram protectionem suscipere eosque et ea libertati ecclesiastice submittere et perpetuo asscribere ac in perpetuam vicariam et perpetuum beneficium ecclesiasticum erigere et ex certa sciencia nostra pontificali auctoritate dignaremur confirmare. Nos vero desiderantes diuinum cultum iugiter ampliari ac attendentes, quod semel deo dicata amplius ad humanos vsus reduci non debeant idcirca supradicta omnia et singula per predictum dominum Marquardum sic, ut premittitur, dotiata et data a potestate seculari et de quibuscumque prophanis vsibus absoluimus ac in ecclesiasticam et nostram ac nostrorum successorum protectionem assumimus et accipimus, ac ecclesiastice libertati, exempcioni et emunitati ac omni priuilegio submittimus, asscribimus et appropriamus ac in ecclesiasticam libertatem transferimus et in perpetuam vicariam et perpetuum ecclesiasticum beneficium ad laudem et honorem omnipotentis dei eiusque genitricis virginis Marie ac beatorum Nicolai episcopi et confessoris, Margarete virginis et martiris ac Marie Magdalene patronorum erigimus, creamus, fundamus et instauramus premissamque donacionem approbamus, ratificamus et confirmamus cum omnibus et singulis, tam circa donacionem et ordinacionem circa dicti beneficii fundacionem, quam iuris patronatus disposicionem et reseruacionem, necnon vsus et vsufructus predictorum, vicarii vero, qui pro tempore fuerint, de consensu domini Nicolai Pole rectoris dicte ecclesie Odeskerken presentis et vna cum dicto domino Marquardo fundatore consencientis sic obseruabunt, quod quocienscunque vicarium abesse contingerit, tunc anno quolibet soluet vicarius officianti duodecim marcas lubicensium denariorum Wismarie exponibilium sine ulla diminucione, quodque vicarius uel officians in qualibet ebdomada celebrabit ad minus tres missas ac dominicis et festiuis diebus in choro et extra legendo et cantando et cimiterium circuendo diuinis intererit, sacramenta tempore necessitatis ministrabit et missas pro defunctis leget uel dec[an]tabit, per rectorem ecclesie requisitus, nec sine rectoris licencia missas leget, nisi post cantum offertorii summe misse, nec aliquid verbo vel facto aliquid attemptabit vicarius uel officians huiusmodi in preiudicium predicte parrochialis ecclesie aut ipsius rectoris. Vicarius


|
Seite 231 |




|
eciam ammouebit suum officiantem totiens, quotiens requisitus fuerit per rectorem ecclesie cum legitima causa, et in locum officiantis alium substituet presbiterum pacificum sine dilacione. A[t] dictus vicarius publice uel occulte rectori ecclesie non preiudicabit uel ipsius rectoris aut ecclesie iura non occupabit et honorem et reuerenciam rectori exhibebit ac priuilegiis, prerogatiuis, bonoribus et utilitatibus inibi uel in uicinis locis solitis pocietur, consuetudines, statuta et priuilegia dicte ecclesie ac pacta et conuenciones inter rectorem et vicarios inibi facta et facienda, inita et ineunda inviolabiliter obseruabit ac sibi et dicto suo beneficio obseruare procurabit. In quorum omnium fidem et testimonium premissorum presentes litteras exinde conscribi ac nostri sigilli iussimus appensione communiri. Datum et actum in castro nostro Butsow, sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo decimo sexto, feria sexta post festum diuisionis apostolorum. Ceterum volumus ut quicunque vicarius uel officians residens in huiusmodi beneficio, quod ornamenta altaris videlicet lumina et alia correquisita et domum in esse suo obseruabit.
Auf einem Pergament in gross Hochquart. An einer braun und grün-gelben, gewirkten Schnur hängt das bisher nicht bekannt gewesene Siegel des Bischofs Heinrich II. von Schwerin (1415 - 1418), von rothem Wachs, von runder Form. Auf einem rechts gelehnten, von zwei Löwen gehaltenen, dreieckigen Schilde steht ein Helm mit zwei Hörnern. Der Schild ist quadrirt und enthält im 1. und 4. Felde zwei gekreuzte Bischofsstäbe auf einem quer getheilten Felde, im 2. und 3. einen Adler mit einem gekrönten Jungfrauenkopfe. Umschrift:
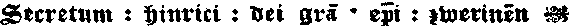
Dieses Siegel ist eben so gross, als das folgende Secretsiegel des Bischofs, welches nur einen Schild mit einem Adler mit einem gekrönten Jungfrauenkopfe und über dem Adler zwei gekreuzte Bischofsstäbe hat.
Die Roberstorp waren eine wismarsche Familie, die sich dort wahrscheinlich um 1340 oder 50 wohnhaft gemacht hat. Es kommen vor Timmo, sein Sohn Vicko und sein Bruder Martin 1332, vielleicht noch als Bauern; Vater und Sohn kommen wieder vor 1345. 1372 wird ein Vicko als Provisor zu S. Nicolaus genannt, wohl derselbe, der 1380 - 1397 im Rath sass. Des Rathmanns Vicko Sohn hiess Marquard. 1398 kommt Marquard vor, der Rathmann Martin 1416 - 1430. Andreas war 1431 gestorben. Darnach mag sich wohl die Abstammung so gestalten:


|
Seite 232 |




|
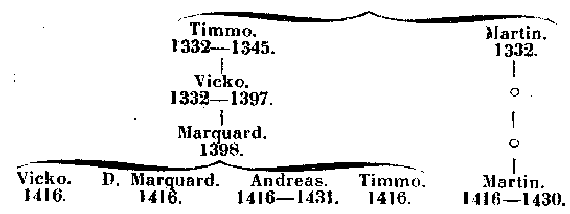
Nr. XXVII.
Der Herzog Johann von Meklenburg - Stargard schenkt dem Kloster Himmelpfort die Walkmühle auf dem Stadtgraben zu Lichen bei dem Fürstenbergschen Thore, wofür das Kloster das Gedächtniss seiner Vorfahren feiern soll.
D. d. Strelitz. 1416. Oct. 9.
Aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpfort.
Vppe datt die dingk, de in tîdenn schêhenn, mit der tîdt nichtenn verghânn vnde kâmenn vt der dechtnisse der menschenn, so isz des nôtt, datt me die dingk veste vnde stedeghe mett tûgenn vnnd besegeldenn brieuenn. Hier [vmme] wie Johann von gadesz genâde hertoge thu Meckelnborch, tho Stargarde vnnde tho Rosztock herre, bekennen vnde betûgenn ôpenbâre in desser iêgenwardigenn schrifft vôr allenn den lûdenn, die nu sindt vnde in thôkâmendenn tîdenn kâmenn môgenn, dat wie met vnsernn eruenn vnnd met vnsenn nakômelingenn tho êwigenn tîdenn na, ràde vnses thrûenn râdesz vnnd mit wolbedachteh mûde deme gadeszhûesse vnde clôstere tho der Hemmelporttenn hebbenn geuenn vnde geuenn yêgenwardich vmb vnser oldernn sehle willenn, vmb vnser sehle willenn vnnd vmb vnser eruenn vnnd nakômelinge sehle sâlicheitt willenn vnde sondergen vmme ôkhinge vnnd mehringe willen des gotlikenn dînstes, die walckmôlenn, die vnse lieue vâder sêliger


|
Seite 233 |




|
dechtnus gebûett hadde lâthenn vppe dem
stadtgrâuenn tho Lichenn bie den
Vorstenbergeschen dôre, mit all ehrer nutt,
thôbehôringe vnnd vpbôringe, also alse die vnse
vader vnnd wie haddenn mett alle. Vorthmehr wêre
datt de abbett vnnd di mêne conuent des
vôrschreuenn godeszhûses vnnd clôsters der
Hemmelportte, di nu sindt edder in thôkâmenden
tîden dâr kâmen môgenn, die walkemôlen wolden
vpbreken van der stede, dâr sie nu bûwett isz,
also datt sie
 n hindder dêde an
n hindder dêde an
 hrer môlen binnen der stadt
Lichen, so geue wie
hrer môlen binnen der stadt
Lichen, so geue wie
 n mett vnsen eruenn vnd
nakâmelingen gantze volkâmende macht dârthô,
datt sie sie vpbreken môgenn, vnnd wedder tho
bûwende vp eine andere stede, dâer sie
n mett vnsen eruenn vnd
nakâmelingen gantze volkâmende macht dârthô,
datt sie sie vpbreken môgenn, vnnd wedder tho
bûwende vp eine andere stede, dâer sie
 n gedelich isz. Vorthmer wie
vôrschreuene herre mit vnsenn eruen vnnd
nakâmelingen geuen ôuer, datt wie tho nîener
tîdt deme vôrschreuenn godeszhûsz tho der
Hemmellportte hinder dôenn willenn an der
vôrbenômeden walckemôlen, alse datt wie edder
die vnsenn tu nîener tîdt eine andere walckmôlen
wedder bûuenn lâthen willen vppe die
vôrschreuenn stede, dâr sie vnse vâder hadde
bûwen lâthen, edder ôck vp nîener ander stede,
dâr sie ohrer môllen schâden mach, inn der stadt
tho Lichen. Vorthmer willen wie, datt de abbett
vnd die meine conuenth desz vôrschreuen clôsters
tho êwigen tîden schallen vnser oldernn, vnser
vnd vnser eruen vnd nakâmelinge sehlenn inn
einer êwigen dechtnisse hebbenn vôr desse
vôrschreuen gifft. Hîrôuer hebben gewesett tho
tûge vnse lîeue trûwenn: die duchtigenn Hinrick
Feltberch, Ghereke van Bertekowe vnnd Borko vonn
Gerkowe, vnse râth, Ghodert von Plesse, Clauss
Manduwell, Heinrickus Craenn, vnse pâpe, vnd
Michel von Vrtze. Thu grôtterer bewâringe vnnd
mehr wiszheitt hebben wie vôrschreuene herre
vnse ingesegell hengen lâthen vôr dessen brieff,
die geueun vnd schreuen is vp vnsem schlotte tho
Strelitze na der bôrth vnsers herrenn dûsent iâr
vierhundert iâr dârna inn deme sostehendenn
ihâre, in sunte Dionisius dâghe.
n gedelich isz. Vorthmer wie
vôrschreuene herre mit vnsenn eruen vnnd
nakâmelingen geuen ôuer, datt wie tho nîener
tîdt deme vôrschreuenn godeszhûsz tho der
Hemmellportte hinder dôenn willenn an der
vôrbenômeden walckemôlen, alse datt wie edder
die vnsenn tu nîener tîdt eine andere walckmôlen
wedder bûuenn lâthen willen vppe die
vôrschreuenn stede, dâr sie vnse vâder hadde
bûwen lâthen, edder ôck vp nîener ander stede,
dâr sie ohrer môllen schâden mach, inn der stadt
tho Lichen. Vorthmer willen wie, datt de abbett
vnd die meine conuenth desz vôrschreuen clôsters
tho êwigen tîden schallen vnser oldernn, vnser
vnd vnser eruen vnd nakâmelinge sehlenn inn
einer êwigen dechtnisse hebbenn vôr desse
vôrschreuen gifft. Hîrôuer hebben gewesett tho
tûge vnse lîeue trûwenn: die duchtigenn Hinrick
Feltberch, Ghereke van Bertekowe vnnd Borko vonn
Gerkowe, vnse râth, Ghodert von Plesse, Clauss
Manduwell, Heinrickus Craenn, vnse pâpe, vnd
Michel von Vrtze. Thu grôtterer bewâringe vnnd
mehr wiszheitt hebben wie vôrschreuene herre
vnse ingesegell hengen lâthen vôr dessen brieff,
die geueun vnd schreuen is vp vnsem schlotte tho
Strelitze na der bôrth vnsers herrenn dûsent iâr
vierhundert iâr dârna inn deme sostehendenn
ihâre, in sunte Dionisius dâghe.
Nach einer Abschrift aus einem Diplomatarium des Klosters Himmelpforten, im Privatbesitze in Berlin, jetzt auch in Abschrift im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.


|
Seite 234 |




|
Nr. XXVIII.
Der Reichshofrichter Graf Günther von Schwarzburg ladet auf die Klage des Fürsten Balthasar von Werle gegen die Herzoge Albrecht und Heinrich von Meklenburg-Stargard auf ihr Land um 20,000 Mark Goldes die Beklagten zum nächsten Reichshofgerichtstag.
D. d. Costnitz. 1417. Junii 22.
Nach dem Originale im großherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Wir Gunther, graue von Swartzburg vnd herre zu Ranis, des allerdurchluchtigisten fursten vnd herren hern Sigmunds, romischen kungs, zu allen tzyten merers des richs vnd zu Vngern etc. kungs, hofrichter, bekennen vnd tun kund offenbar mit diesem brief allen den, die in sehen oder horen lesen, daz wir des itzgenanten vnsers herren des kungs vnd des heiligen richs hofgericht besessen haben zu Costentz in dem closter zu den Augustinern vf disen tag, als diser brief gegeben ist, vnd daz doselbst fur vns kome in gericht der hochgeborn her Balthasar, herre zu Wenden vnd zu Werle, vnd vordert durch sinen fursprechen verkundbrief, wann er zu clagen het vf Stargarden vnd Nuenbrandemburg die stete vnd vf Streltz das slosz vnd stat, mit allen iren zugehorungen, das alles die hochgebornen fursten vnd herren her Albrecht vnd her Heinrich, gebruder, hertzogen zu Meckelnburg von Stargarden innehaben vnd besitzen, vnd auch uf alle ander habe vnd gute, die sie haben, es wern stete, slosze, merckte, dorffer, wyler, manschaft, lehenschaft, pfantschaft, muntze, geleyte, zinse, gulte, rennte, schulde, wiltpenne, welde, holtzer, tyche, wyer, fischwaszer, wunne, weyde vnd wo sie icht haben, es sii varend oder ligend habe, besucht vnd vnbesucht, wie das alles genant, oder wo das gelegen ist, nichts uszgenommen, vmb zweintzigtusent mark goldes, mynner oder mere, vnd die wurden im mit vrteil zu geben erteilt. Dorumb von des egenanten vnsers herren des kungs gewalts vnd hofgerichts wegen gebieten wir


|
Seite 235 |




|
ernstlich mit diesem brief, wer das vorgeschriben alles verantworten vnd versprechen wolle, daz der oder die das tun uf dem nehsten hofgericht, das sin wirdet nach sant Bartholomeus tag des heiligen zwelfpoten schierst komende. Geben zu Costenz vnder des heiligen richs hofgerichts vfgedrucktem insigel, des nehsten dinstags vor sant Johans baptiste tag, nach Christi geburt viertzehenhundert iar vnd dornach in dem sibentzehenden iare.
Petrus Wacker.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer festen Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin. Auf der Rückseite ist das grosse Reichshofgerichtssiegel auf einer ganz dünnen, gelben Wachsplatte aufgedrückt gewesen, aber ganz abgefallen.
Nr. XXIX.
Die Herzoge Johann und Albrecht von Meklenburg-Schwerin, für sich und ihre Vettern von Meklenburg-Stargard, vertragen sich mit den Fürsten von Werle über die Befreiung des Fürsten Christoph von Werle, über die Klage des Fürsten Balthasar von Werle gegen die meklenburgischen Herzoge vor dem deutschen Könige und über die Zurückzahlung des Brautschatzes der verstorbenen Gemahlin des Fürsten Balthasar.
D. d. Rostock. 1417. Oct 16.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Aldus ys ghedêghedinghet tuschen den hôchghebôrnen vorsten vnde heren heren Johan vnde heren Albrechte, vedderen, to Mekelenborch herteghen etc., van erer vnde van eer iunghen vedderen weghene hertogen Johan vnde hertighen Vlrikes kynderen, heren van Mekelenborch van Stargarde, vppe de êne


|
Seite 236 |




|
syde, vnde de hôchghebôrnen vorsten vnde heren Baltazar vnde Wilhelm vnde heren Christopher, alle heren to Werle, vppe de anderen syde, also dat de êrghenanten heren Johann vnde heren Albrecht scholen den vôrbenômeden heren Baltazare vnde heren Wilhelme vmme lêue vnde vruntschop willen eren vedderen heren Cristophor en lôs gheuen vmme also vele penninghe, alse se ene koft hebben, alse vmme vêre dûsent sundesche mark, vnde scolen en de berêden, twê dûsent sundesche mark nů to sunte Merten vort ôuer ênem iâre vnde de anderen twê dûsent sundesche mark vort denne to deme nêghesten sunte Mertens dâghe dârna, vnde scholen en dàr nôgheaftighe wâêringhe vmme dôüen. Hîrmede schal leghert wesen alle twêdracht vnde ansprâke, de tuschen den êrbenômeden beyden dêlen is, vnde scholen bestânde blîuen van desser tîd an vort vîf vmme ghânde iâre, also dat se an êndracht vnde lêue vnde vruntschop scholen sitten tosâmende vmme de twêdracht vnde schêlinghe, de se tosâmende hat hebben bet to desser tîd, also dat de êne den anderen nerghen ane bewêren edder hinderen schal myt worden edder myt dâden, vnde de êne der anderen schâden kêren vnde wêren scholen na all ereme vormôghe. Vordermêr alse de êrbenômede heren Baltazar van Wenden de heren van Mekelenborch vnde vrowe Agnes, der Sweden koninghynnen, vnde ere manne vnde stede en deel vôr vsen gnedighen heren den romeschen koninghe vorclâghet vnde to rechte lâden heft, dat scholen de êrbenômeden heren Baltazar vnde heren Wilhelm vorarbeyden, yft se konen, myt gantzem vlîte, dat dat recht vphenghet werde desse vôrscreuen vîf iâr al vmme. Vnde wêre dat se dat nicht vort bringhen konden vnde dat vurder richtet wurde vnde en wes tôdêlet edder tôrichtet wurde vppe de mekelenborgheschen heren vnde de vôrbenômeden koninghynnen vnde de eren bynnen dessen vîf iâren vôrbenômeden nerghen mede beswâren edder hinderen, noch myt worden edder myt werken, van des gherichtes weghene. Vortmer vmme de twê dûsent mark lubesch, de heren Baltazar van Wenden den vôrbenômeden heren Johann vnde heren Albrechte van Mekelenborghe van Zwerin schuldich is van hertich Johans suster brûtschattes weghene, de scholen se on vmme lêue vnde vruntschop stân lâten vnde beyden desse vôrbenômeden vîf iâr al vmme. Vortmer wêret dat den


|
Seite 237 |




|
vôrscreuen heren wes vnder de anderen schêlde, dâr scolen se eren mannen vnde steden vruntscop vnde rechtes vmme hôren bynnen dessen vîf iâren. Desse dêghedinghe synt ghescheen yn sunte Johannes klôster bynnen Rostok, an dem iâre van der bôrt Christi vêrteynhundersten vnde sôuenteynden iâre, dâr na in sunte Gallen vnde Lullen dâghe der hilleghen bîchteghere. Vnde to êner hôgher bewâringhe vnde bekanntnisse desser vôrscreuen dingh hebbe wi heren Baltazar vnde heren Wilhelm vse yngezhegele henghen lâten an dessen yêghenwardighen brêff.
Nach dem Originale, auf Pergament, in einer sehr kleinen, engen Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin. An einem Pergamentstreifen hängt des Fürsten Balthasar von Werle Siegel; das zweite Siegel fehlt mit dem Siegelbande. Die Orthographie dieser Urkunde ist an vielen Stellen sehr ungewöhnlich, wie auch die Art der Handschrift selten vorkommt.
Die Klage des Fürsten Balthasar von Werle ist in der Urkunde vom 22. Junii 1417, Nr. XXVIII, enthalten.
Nr. XXX.
Die Herzoge von Meklenburg schliessen mit den Fürsten von Werle Frieden, Bündniss und Erbverbrüderung und geben diesen das Schloss Wredenhagen zurück, behalten es aber als Pfand für die Auslösung des Fürsten Christoph von Werle, erhalten auch die Fortdauer des Pfandbesitzes des Landes Röbel von den Fürsten von Werle zugesichert.
D. d. Rostock. 1418. Oct 27.
Nach beglaubigten Abschriften im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
In godes nâmen Amen. Wy Johan vnde Albrecht, iunghe Johan van Stargarde vnde hertoch VIrikes kindere, vedderen, alle ghehêtten hertogen to Meklenborch etc., vppe de ênen syde, vnde wy Baltezer,


|
Seite 238 |




|
Wylhelm, brôdere, vnde Cristofere, vnsem vedderen, alle gehêten fursten to Wenden etc., vppe de anderen syde, bekennen vnde betûghen ôpenbâr an desseme brêue vôr alsweme, dat vnser beyder trûer rât, manne vnde stede, tuschen vns gedêgedinget hebben alsodâner wys, alze hîr na screuen steyt, dat wy alle scêlinghe vnd mânynge, alle scult, scâden vnde tôsprâke, de wy vnder ênander gehat hebben bet an desse stunde, scolen dâle leghen vnde legghen dâle an desseme brêue, vnde hebben vns trûwelken to sâmende settet vnde iêghenwardigen setten, alzo dat vnser ên scal deme anderen behulpen wesen têghen alsweme, dâr wy edder vnser ên nicht lîkes vnde rechtes môghen ôuer mechtich wesen, vtgenômen dat hilge rômesche rîke, vnde vnser ên scal des anderen scâden kêren myt mannen vnde steden lîke syneme êghenen, dàr to scolen an beyden sîden vnser vôrbenômeden heren slote vnde stedere des ênen dem anderen ôpen stân, weme des nôt vnde behûff is, vnde wy hern alle vôrbenômet sweren myt vpgerichteden vingeren to den hilgen myt mannen vnde steden, dessen êndracht vnde vrede to holdende. Ok scal vnser hern ên des anderen hern vîgent nicht mêr werden, men wes vns vnde ênander schêlet, dâr schole wy vnser beyder râden, mannen vnde stede rechtes vmme hôren, vnde de scolen des nicbt van sik lâten, sunder se entrichtent van stunden an edder bynnen êneme mânte dârna, wen se dârto êschent sint, vnde we ên des nicht hôren wil, des scholen ze aff gân vnde blyuen by dem andern, alzo langhe wente yt entrichtet is. Hîr mede hebbe wy vns tosâmende settet vnde iêgenwardigen tosâmende setten myt craft desses brêues an olde vedderscop vnde stammen, alzo wy van oldinges sîn vt gebôrn, na vnser manne vnde stede râde: also dat wy wendeschen hern van stâden an scolen bestellen myt vnseb mannen vnde steden, dat se syk an nênen hern holden scolen, sunder an de meklenborgesken heren, vnde scolen dat bewâren myt brêuen, myt êden vnde erfhuldinghen, alzo sik dat gebôrt, wêret dat wy vorstoruen, dat got vorbêde, sunder sônes erue; des suluen gelîkes scolen wy meklenborgesken hern ôk van stâden an bestellen myt vnsen mannen vnde steden, dat se sik an nêne hern holden scolen, sunder an de wendeschen hern, vnde scolen dat pk bewâren myt brêuen, myt êden vnde erfhuldinghen, alse sik dat gebôrt, wêret


|
Seite 239 |




|
dat wy vorstoruen, dat ôk iô got vorbêde, sunder sônes erue. Schêge dat êk, dat wy dochtere eruen nalêten, an welker sîde dat were, de scal men êrliken berâden von deme lande des heren na mannen vnde steden râde. Vmme desser êndracht, vredes, sundergher lêue vnd olde vruntscop willen hebbe wy vôrscreuen meklenborgesken [heren] den êrbenômeden wendeschen heren den Vredenhagen, den wy en affgewunnen hadden, wedder gheuen to ereme (?), myt alle syner tobehôringe vnde iêgenwardigen wedder gheuen an desseme brêue, myt sulker vnderschêde, dat de Wredenhagen scal vnser meklenborgesken [heren p]ant blîuen vôr drê dûsent lubesche mark Rostoker penninge vôr scattinge hern Cristofers van Wenden, vnde dâr scolen wy wendeschen hern den meklenborgesken heren nûgaftige bewâringe vôre dûn myt vnsen brêuen, vnde wy meklenborgesken hern den wendeschen heren [des gelîkes wed]der, dat ze ene dâr vôre lôsen môghen, sunder vortoch vnde argelist. Vordermer vmme Robele stat, lant, manne vnde alle inwônere, dâr scolen wy wendeschen heren den meklenborgesken heren nêne bewêringhe ane dûn, bet alzo lange dat wy yt en afflôsen vôr den summen p[enninge, als de] brêue vtwîsen, den se dâr vp hebben, vnde wêret, dat wy meklenborgesken heren hadden vns erffhuldinge dôn lâten in der stat to Robele van den inwôneren vnde van den mannen in deme lande, der scole wy en vordreghen van stâden an in der iêghenwardicheit vns[er vôrbenômeden her]en an beyden sîden vnde lâten vns wedder huldigen to êneme pande na vtwîsingo vnser brêue. An desse êndracht, vrede, stukke vnde artikel vôrgescreuen thê wy hern vôrbenômet an beyden sîden den êrwerdigen an got vâdere hern Hinrike, van godes gnâden byscop[pe to Zwerin, vns]en gêstliken vâder, alle syne nakômelinge vnde syn stichte lîke vns suluen. Alle desse vôrscreuen stukke vnde articule vnde ên iêslik by sik lôue wy heren alle vôrghenômet meklenborgesken vnde wendeschen vnser ên dem anderen an gûden trûwen [sunder alle list] stede vnde vast to holdende vnde hebben dat stâuedes eedes vnser ên dem anderen lîfachtigen myt vprichtenden vingeren to den hilgen swâren vndo iêghenwardigen swêren myt mannen vnde steden, vnde hebben des to tûghe vnde hôgher bewâringhe vnser alle[r ingesegele mit] witscop vnde gûden wyllen henghen lâten


|
Seite 240 |




|
vôr dessen brêff, de gheuen vnde screllen ys to Rostok na godes bôrt vêrteynhundert iâr in dem achteynden iâre, dâr na an dem âuende Symonis et Jude der hilgen apostele.
Nach einer durch das Dom-Capitel zu Schwerin auf Begehren der Herzogin Katharine von Meklenburg genommenen beglaubigten Abschrift vom 18. Jan. 1424, auf einem sehr breiten, niedrigen Pergament, in einer sehr kleinen gedrängten Schrift. Das Pergament hat rechts in der Schrift ein grosses Loch durch Mäusefrass.
Eine zweite Abschrift, welche am 21. Mai 1426 durch Burgemeister und Rath der Stadt Schwerin beglaubigt und in einer kräftigen, klaren Minuskel geschrieben ist, ist an beiden Seiten durch Mäuse ungewöhnlich stark zerfressen und ausserdem durch Feuchtigkeit ("Eisenmale") an manchen Stellen verdorben.
Diese Abschrift des Rathes der Stadt Schwerin ist in der Orthographie offenbar viel reiner und besser, als die andere Abschrift; da die Raths-Beglaubigung durch Mäusefrass und Eisenmale aber zu lückenhaft geworden ist, als dass sich die Orthographie mit Sicherheit gleichmässig durchführen liesse, so hat die Dom-Capitel-Beglaubigung zum Grunde gelegt werden müssen; jedoch hat diese an den mit [ ] bezeichneten Stellen aus der Raths-Beglaubigung ergänzt werden können.
Die Beglaubigung des Rathes der Stadt Schwerin beginnt mit folgenden nicht unwichtigen Worten:
Wy borgermeste[re vnde ratman]ne der stat to Zwerin bekennen vnde butugen openbar an desseme breue, [dat wy] hebben seen vnde lesen h
rt enen breff, do [beseghel]t was mit den ingeseghelen der hochgebornen fursten vnde heren Joh[annes vnde] Albrechtes, iunghe Johannes van Starg[ard]e vnde van hertoge Olrikes kindere, vedderen, alle geheten hertogen to Mekl[enborch] vnde ok mit den ingeseghelen der eddelen hern Balthazares, Wilhelmes, broderen, vnde Cristofers, vedderen, alle geheten fursten to Wenden, [de] heel vnde vntobroken was, vppe permint gescreuen, vnde ludde van worden to worden, als hir nascreuen steit.


|
Seite 241 |




|
Nr. XXXI.
Der Maler Henning Leptzow zu Wismar schliesst mit den Vorstehern der S. Georgen-Kirche zu Parchim einen Contract über die Anfertigung eines Hochaltars für die S. Georgen-Kirche zu Parchim.
D. d. Wismar. 1421. Nov. 19.
Siehe unten in den Jahrbüchern für Alterthumskunde in der Abtheilung: "Kunstgeschichte".
Nr. XXXII.
Der Herzog Ulrich von Meklenburg-Stargard vergönnt dem Henneke Holstein die Einlösung des halben wüsten Dorfes Kostal mit allem, was der Landesherrschaft daran gehört.
D. d. Penzlin. 1460. Junii 9.
Van gades genâden wy Vlrik, hertoge tho Meckelnborch vnnd forste tho Wenden, bekennen vnnd betûgen âpenbâr vôr alszwem, vôr vns vnd vnse eruen vnd nhakâmelinge, dat wy vmme sunderiges verdînstes vnnd gunst willen dem duchtigen, vnseme lîeuen, getrwen Hennike Holtzen vnd synen eruen gunth hebben de lôsinge des haluen wûsten dorpes, genômet dy Kostall, vnd geuen hebben dy beteringe mit aller tôbehôringe, so dâr jewerlde dârto gehôret hefft, dat der herscop behôren mach, vnnd alderfrîgest gehôrt hefft, vnnd wes dârnach von rechte behôrt vnnd forder wes dâran fallen mach, wy edder vnse eruen dâr deger nicht an to beholdende ader to hebbende iffte vnse nhakâmelinge, men wy îrgenante furste vnd herre vnnd vnse eruen schollen vnd wollen dem vôrbenômeden Henneken Holtzen vnnd synen eruen des vôrscreuen gûdes ein rechte gewehr wesen vôr alszweme, dy vor recht kômen


|
Seite 242 |




|
willen. To mêr erkantenisse hebben wy Vlrik van gades genâden vnse ingesigel hêten hengen nedden an dessen vnsen âpen brêff mit willen vnd witscop. Screuen vnd geuen to Pentzelin am mândâge Trinitatis, in deme iâre als men scrifft dûsent iâr vêrhundert iâr dârna in dem sostigisten. Hîr an vnnd ôuer syn gewest: Henningk Pickatel, Jorien Bartkow vnnd Otto van Ilenuelde.
Nach einer Abschrift aus der Mitte des 16. Jahrhunderts im grossherzogl. meklenburgischen Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Nr. XXXIII.
Der Herzog Heinrich von Meklenburg-Schwerin verpfändet dem Claus von Peccatel zu Gr. Vielen für eine neue Anleihe von 100 Mark auf's Neue die Hälfte der halben wüsten Feldmark Kostal, welche er schon von seinen Vorfahren her für 270 Mark zu Pfande besitzt.
D. d. (um 1473).
Wii Hinrick etc, bokennen âpenbâre betûgende vôr alsweme, wôr dat nôth vnde behûff dônde wert, dat wii vppe de helfte der wûsten veltmarke genômet dei Kostal, vôrhen des duchtigen, vnses lêuen, getrûwen Clauwes Pickatels olderen to Vilem, do[r]ch vnser vedderen hern Hinrikes vnde hern Olrikes seliger dechnitze vôr LXX marck vnde twêhundert marck vinckenôgen munte vorsettet vnd vorpandet, so dat ere brîue wol vthwîsen, noch hundert marck vinkenôgen van deme genanten Clauwesz Pickatel genâmen vnde entfangen hebben, dâr vôr wii de vpgnanten helfte der wûsten veltmarck deme êrbenômeden Clauwesz Pickatel vppe dat nîge vorsettet vnde vorpandet hebben mit sodânem beschêde, dat nêmant, noch Johan van


|
Seite 243 |




|
deme Kalande, noch de Bardenflete, noch de Holsten, noch de Pickatel, den genanten Clawesz Pickatel edder sîne rechten eruen vthkôpnn vnde de gnanten helfte der wûsten feltmarke lôsen scholen, besundern wii edder vnse eruen willen denne der helfte der wûsten feltmarck suluen brûken, vnde wannêr wii edder vnse erueri se wedder lôsen willen, so scholen wii edder vnse eruen deme gnanten Clawesse vnde sînen eruen toseggen in den vêr hilligen dâgen to Paschen, vnde an deme nêgest folgenden sunte Michaels dâge edder in den achte dâgen sunte Michels deme gnanten Clauwesse edder sînen rechten eruen wedder geuen vnde wol to dancke betâlen LXX mark vnde drêhundert vinkenôgen munte an gûdem gelde nach sînem wêrde edder an gûdem, grâuen suluergelde, alse denne to Brandenborch vnde amme lande to Stargarde genge vnde geue is, in einem summen, vppe eyner stede amme lande to Stargarde, dâr dât deme gnanten Clauwesse edder sînen eruen êuenst kâmende wert, vnde de vîlgnante Clawesz schal sick der sosz vrîgen hôuen in der gnanten helfle der feltmarke belegen so quît, so vrîgh, alse sîne olderen der alderquîteste vnde frîgest beseten vnde gehadt hebben, brûken vnde besitten, von eruen to eruen to êwigen tyden. Alle desse bâuenscreuen articlen vnde eyn iêwelick by sick lâuen vnde seggen wii vpgnante here vnde furste vôr vns vnde vnse eruen in gûden trûwen stede vnde vast wol to holdende sunder alle argeliste vnde alle gefêrde vnde hebben des to ôrkunde
Nach dem undatirten Concepte, auf Papier, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin. Die Urkunde ist von dem Herzoge Heinrich dem Dicken zwischen 1471 und 1477, nach dem Tode des letzten stargardischen Herzogs Ulrich († 1471) und vor dem Tode des Herzogs Heinrich des Dicken († 1477) ausgestellt. Im J. 1471 wird auch in einer andern Urkunde "Clauss Peccatel to Groten Vylem wanafftich" genannt.


|
Seite 244 |




|
Nr. XXXIV.
Henneke Holstein zu Wickenwerder (Ankershagen) vereinbart sich mit Achim Barenfleth zu Clausdorf, dass, da er vormals die Güter Zahren, Gr. Vielen halb, Dambek und Pieversdorf von den Barenfleth laut des versiegelten Pfandbriefes gekauft hat, er 2 1/2 Mark von 100 Mark zahlen willm dass die wüste Feldmark Gottun gemessen und zu den andern Gütern verschrieben und das Gut zu Rutzenfelde dem Achim Barenfleth zum Pfande eingeräumt werden soll.
D. d. Wickenwerder. 1519. Jan. 2.
Ick HennickeHolste, erffgeszetenn tôme WickenWerder, bekenne vnnd dhô kundt offentligh in vnd myt disseme myneme âpenen brêffe vôr alsweme, dat ick hebbe gekofft vnd iêgenwerdigen kôpe to eyneme erfflicken, êwighen, dôetlicken, kôfften kôpe van Achim Bardenfleth tho Clawestorp vnd synen rechten eruen, myt gantzer vulbôrth vnd willen syner fedderenn, junghe Achim vnd Clawesz ôck die Bardenflethe, sîn erfflicke gûdt alse den Tzârne, Grotem Vilem halff, Dannenbecke vnd Pywestorp myt alle eren tôbehôringhen, bßgrentzungen vnd frygheiden, nha lûde vnd inholde desz vorseghelden pandtbrêuesz, êrmâlesz van den Bardenfleten dâr vp ghegheuen vnd den Holsten, alse niy, vorseghelt, dat nu wy Holsten dâr in brûckinge hebben in sulker mâthe vnd wîse, wôr my Achim Bardenfleth in den suluen gûderen berekenn kan vnd mach druddehalue marck gheldesz, scal vnd wil em hundert marck vp geuen vnd betâlen, vnd de wôeste veltmarcke die Gottûne genômet scal gemethen werden vnd gestellet alsdenne to vnser beider frundhe erkantnisse, vnd my dârnha entlicke vorseghelinge to dônde vp die suluesten gûder vnd myner g. h. willebrêff vnd confirmation, wennêr ick enhe dâr to erfordere, to beschickende, wennêr alsdenne de nîge vorscrîfinge vnd willebrêff vullentâgen vnd vorsegelt, scal ick Hennicke Holste de olde vorscrîfunge Achim wedder âuerantwerden


|
Seite 245 |




|
vnd vorrêken, ôck wedderstâdinge desz gûdesz tôme Rutzenfelde, wennêr my vorschrîeffinge vnde de willebrêff gefordert, weddervmme inwîsinge vnde vorlâtinge Achim vôr eyn pandt vôr vîeffhundert guldenn to vnbenômeden iârenn to dônde, wesz âuer bâuen blifft âuer de vornôghinge desz Rutzenfeldesz in der betâlinge der hôuetsummen, scal vnd wil ick Hennecke Holste nu tôme vmmeslâge nêgest âuer eyn iâr Achim betâlen edder synen willen dârvmme drâghen. Didt alle lâue ick Hennicke Holste myt mynen eruen by mynen êrhen vnd trûwen vnd gûden lôuen vnweddergerôpligh stedtes wol to holden. Desz to ôrkundhe vnnd mhêr sekerheyt hebbe ick Henneke Holste vôrgescreuen myn ingheseghel, ôck de êrbârenn vnd duchtigenn alse Henningk Bher, Hinrick Wanghelin vnd Hans Vosz mynen weghen dêgedinges lûdhe, hîr myt an vnd âuer gewesen, alle samptligh ere ingesegel to tûge mede ingedrucket benedden in dissenn myneu âpenen brêff, der twô lîckesz lûdesz hîr âuer begrepen vnd eyme îslikenn parte vorantwerdet. Actum Wickenwerder, amme sondâge nha Circumscisionis domini, anno etc. XIX °.
Nach dem Originale, auf Papier, in Minuskel, im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin. Der Text ist an mehreren Stellen verbessert, so dass Wörter durchstrichen und übergeschrieben, auch nachgetragen sind; die ganze Stelle über die neue Verschreibung ("wenner alsdenne de nige vorscrifinge - - vorreken") ist auf dem Rande nachgetragen. Untersiegelt ist die Urkunde mit 4 Siegeln, auf grünem Wachs mit Papierdecken, von denen eines verloren gegangen ist.
Zuerst steht das Siegel des Hennicke Holstein: im längs gespaltenen Schilde rechts ein Flügel, links zwei Rosen unter einander, mit der Umschrift:
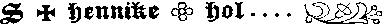
Dann sind noch zwei ganz gleiche Siegel des Henning Bere bei der Urkunde vorhanden, dasselbe Siegel, mit welchem Henning Bere auf Röddelin um die Zeit dieser Urkunde öfter siegelt, mit einem rechts gelehnten Schilde mit einem rechts aufsteigenden Bären und der Umschrift:
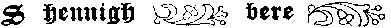
Henning Bere hat also die Urkunde für einen der beiden anderen Mitberather mit untersiegelt, es ist jedoch nicht mehr zu bestimmen für wen, da die beiden Bere'sche Siegel lose bei der Urkunde aufbewahrt wurden und das vierte Siegel fehlt.


|
Seite 246 |




|
Nr. XXXV.
Der Papst Julius II. ertheilt dem Propst von Magdeburg und den Officialen von Magdeburg und Halberstadt Auftrag, gegen einige Laien, welche dem Pfarrer von Görgelin (bei Plau) Gewalt gethan, so lange den Bann zu verhängen, bis diesem von jenen Recht geworden sei.
D. d. Ostia. 1509. Mai 10.
(Vergl. Jahrb., XIII, S. 408 - 409, und XXIII, S. 170.)
Nach einer Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Geheimen und Haupt-Archive zu Schwerin.
Julius episcopus, seruus seruorum dei, dilectis filiis preposito ecclesie Magdeburgensis et Magdeburgensi et Halberstadensi officialibus salutem et apostolicam benedictionem. Conquestus et nobis Fredericus Koual rector plebanus nuncupatus parrochialis ecclesie plebis nuncupate in Gorgelin, Hauelbergensis diocesis, quod nobilis vir Heyne Pentze, domicellus, Nicolaus Leppin, proconsul opidi Plawe, et quidam alii layci ville Gnewstorp, predicte et Swerinensis diocesis, in eum manuum iniectione eum, dei timore postposito, ausu sacrilego temere violenter ceperunt et eum acriter verberauerunt et de nonnullis excessibus et criminibus apud bonos et graues ut nequam diffamarunt, necnon ipsi et Petrus Keuerman laycus et eiusdem Petri vxor, Halberstadensis diocesis, super quibusdam pecuniarum summis, bonis hereditariis et rebus aliis iniuriarunt eidem et quasdam alias graues iniurias ei irrogarunt, pariter etiam iacturas, per quas expensas fecisse damna grauia se asserit incurisse. Cum autem dictus conquerens, sicut asserit, potentiam dictorum iniuriatorum merito perhorrescens, eos infra ciuitatem sepe dicte diocesis Hauelbergensis nequeat conuenire secure, discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus, si de manuum iniectione ac sacrilegio huiusmodi uobis legitime constiterit, dictos sacrilegos tam diu appellatione remota excommunicatos publice denunctietis et faciatis ab omnibus artius euitari, donec iniuriarum passo satisfecerint


|
Seite 247 |




|
competenter, et eum nostrarum testimonio litterarum vocarint ad sedem apostolicam absoluendi, super aliis vero vocatis, qui fuerint euocandi, et auditis hincinde propositis, quod iustum fuerit, appellatione remota, vsuris cessantibus ,decernatis fatientes, quod decreueritis, per censuram ecclesiasticam firmiter obseruari, prouiso ne ... ras dicti nobilis et dicfci opidani auctoritate presenti interdicti sententiam proferatis, nisi a nobis super hoc mandatum receperitis speciale, testes autem, qui fuerint nominati, si se ... itio, odio vel timore subtraxerint, censura simili, appellationibus cessantibus, compellatis, veritati testimonium perhibere. Quod si non omnes hiis exequendis poteritis interesse, duo aut vnus vestrum nihilominus exequatur. Datum Ostie anno incarnationis dominice millesimo quingentesimo nono, sexto idus Maii, pontificatus nostri anno sexto.
Aus einem sehr vermoderten und unleserlich geschriebenen geistlichen Processe, auf Papier.
In einem Register der Vogtei Plau vom J. 1531 heisst es:
"Dat felt zu Gorgelin buwen de Retzower"
(vgl. Jahrb., XIII, S. 408.)
Nr. XXXVI.
Der Herzog Magnus von Meklenburg, postulirter Bischof von Schwerin, empfängt als confirmirter Administrator des Stiftes Schwerin, die Huldigung der Vasallen des Stiftes Schwerin.
D. d. Bützow. 1532. Sept 18.
Nach dem Concepte im grossherzogl. meklenburg. Geheimen- und Haupt-Archive zu Schwerin.
[In nomine domini. Amen. Anno a natiuitate eiusdem domini millesimo quingentesimo trigesimo secundo, indictione quinta,] dio vero Mercurii, decima octaua mensis Septembris, mane hora tertiarum vel quasi, [pontificatus sanctissimi in Christo patris ac damini nostri


|
Seite 248 |




|
domini Clementis diuina prouidentia pape septimi
anno nono,] coram illustri ac altigenito
principe ac domino domino Magno, duce
Magnopolensi etc., necnon administratore in
spiritualibus et temporalibus ecclesie et
diocesis Zwerinensis, in arce seu castro suo
pontificali Butzouwensi et stuba magna pro
audiendis negotiis et causis diocesim suam
tangentibus pro tribunali sedente, astantibus
eidem egregiis viris dominis Hinrico Bantzkouw,
preposito, Henningo Lotze, archidiacono
Tribuszensi, Georgie Kanen, Petro Boye,
archidiacono Warnensi, Hinrico Bulouw, Casparo
Drendenburch, Johanne Ludkens, canonicis
capitularibus capitulum Zwerinense
representatibus, comparuerunt nobiles viri et
prelibate diocesis Zwerinensis vasalli et
feudatarii infrascripti, videlicet Hinrick de
Bulouw tu Zeb
 l, Jurgen van Bulouw tu Prutze,
Crystopherus Moltzan tu Trechouw, Frederick et
Hardenacke Veregge to Wokrenthe, Carsten et
Marcus Pr
l, Jurgen van Bulouw tu Prutze,
Crystopherus Moltzan tu Trechouw, Frederick et
Hardenacke Veregge to Wokrenthe, Carsten et
Marcus Pr
 n tu Lubessyn, Dyderick et Jasper
Flotouw tu Sthure, Jachim Fyneke tu Gnemern,
Lyppolt de Ortzen tu Gurouw, Gotschack Redestorp
de Boltzen, Jachim Stralendorp tho Prensberch,
Baltzar Holste in Katelbage, V. Barolt in
Moysalle, quibus sic, vt prefertur,
comparentibus et presentibus ipsi et quilibet
eorum prememorato domino administratori suisque
in episcopatu successoribus et legitime
intrantibus sua solita iuramenta vasallica et
fidelitatis solita iuramenta prestiterunt
plenumque et perfectum dicto domino
administratori homagium fecerunt, et nihilominus
ipsi et eorum quilibet erectis duobus versus
celum suis digitis iurauerunt et quilibet eorum
iurauit, se velle dicto suo domino
administratori sueque ecclesie Zwerinensi ac
diocesi fideles esse, sic quod exnunc et inantea
commodum et vtilitatem dicti domini
administratoris ac sue diocesis promouere et
procurare damnumque et incommodum auertere pro
nosse et posse suis, nec velle interesse, vbi
dicti domini administratoris vel sue ecclesie
periculum tractatum fuerit, nec quomodolibet
tractantibus consentire et alia omnia et singula
facere, que in et sub iuramento fidelitatis et
homagii continentur et comprehenduntur: Sic deus
eosdem et quemlibet eorum adiuuaret et sancta
dei euangelia. Quibus iuramentis sic prestitis
ad eorum extunc humilem petitionem et instantiam
sua feuda, que hactenus a predecessoribus ipsis
et dicta ecclesia siue
n tu Lubessyn, Dyderick et Jasper
Flotouw tu Sthure, Jachim Fyneke tu Gnemern,
Lyppolt de Ortzen tu Gurouw, Gotschack Redestorp
de Boltzen, Jachim Stralendorp tho Prensberch,
Baltzar Holste in Katelbage, V. Barolt in
Moysalle, quibus sic, vt prefertur,
comparentibus et presentibus ipsi et quilibet
eorum prememorato domino administratori suisque
in episcopatu successoribus et legitime
intrantibus sua solita iuramenta vasallica et
fidelitatis solita iuramenta prestiterunt
plenumque et perfectum dicto domino
administratori homagium fecerunt, et nihilominus
ipsi et eorum quilibet erectis duobus versus
celum suis digitis iurauerunt et quilibet eorum
iurauit, se velle dicto suo domino
administratori sueque ecclesie Zwerinensi ac
diocesi fideles esse, sic quod exnunc et inantea
commodum et vtilitatem dicti domini
administratoris ac sue diocesis promouere et
procurare damnumque et incommodum auertere pro
nosse et posse suis, nec velle interesse, vbi
dicti domini administratoris vel sue ecclesie
periculum tractatum fuerit, nec quomodolibet
tractantibus consentire et alia omnia et singula
facere, que in et sub iuramento fidelitatis et
homagii continentur et comprehenduntur: Sic deus
eosdem et quemlibet eorum adiuuaret et sancta
dei euangelia. Quibus iuramentis sic prestitis
ad eorum extunc humilem petitionem et instantiam
sua feuda, que hactenus a predecessoribus ipsis
et dicta ecclesia siue


|
Seite 249 |




|
diocesi obtinuerunt et possederunt, cum suis distinctionibus, limitibus, iuribus et iurisdictionibus ac suis pertinentiis vniuersis, sicut ab antiquo semper possederunt, sibi et eorum cuilibet sua bona feudalia a sepedicto domino administratore conferri, confirmari ipsosque de illis infeudari petierunt. Quiquidem extunc dominus administrator, presente ibidem adhuc et astante prelibato suo venerabili capitulo, commemoratis vasallis feudatariis ac cuilibet eorum sua feuda petita huiusmodi per ostensionem siue porrectionem pillei dicti domini administratoris et tactum pillei eiusdem, per ipsos vasallos et eorum quemlibet factum, conferenda, confirmanda ipsosque vasallos ac quemlibet in forma solita et consueta infeudanda duxit, necnon contulit, confirmauit, infeudauit, necnon ipsos et eorum quemlibet suos fideles, feudatarios et vasallos agnouit, acceptauit et pronunctiauit aliaque fecit, que in similibus necessaria fuerunt ac quomodolibet oportuna, litterasque suas in forma solita et consueta desuper decreuit et concessit. Acta fuerunt hec in dicta stuba castri pontificalis antedicti, sub anno, die ac aliis, quibus supra, presentibus ibidem strennuo ac nobili viris domino Nicolao Lutzouw milite et Henneke de Pleszen aliisque pluribus fidelibus atque nobilibus testibus.
Nach dem Concepte des Protocolles. Nachdem der Herzog Magnus als Administrator des Stiftes Schwerin bestätigt war, übernahm er im J. 1532 selbst die Administration des Stiftes durch mehrere bedeutsame Handlungen: am 17. Septemher 1532 nahm er Besitz von dem bischöflichen Schlosse zu Bützow, am 18. September empfing er die Huldigung der Vasallen des Stifts, am 19. September nahm er die feierliche Huldigung der Stadt Bützow an. Die bei diesen Gelegenheiten geführten Protocolle sind zusammen auf Einen Bogen geschrieben. Das zweite, vorstehende Protocoll enthält viele interessante Einzelheiten. Das Hauptdatum, welches nur im ersten Protocolle enthalten ist, ist diesem entnommen, da die vorstehende Urkunde im Concepte nur die Worte enthält: "Anno, indictione et pontificatu, quibus supra, die vero" etc. Die Namen der Vasallen sind von einer anderen Hand in den bei der Protocollführung offen gelassenen Raum geschrieben, und zwar in deutscher Form. Vor dem letzten Worte "testibus" sind die Worte "curie paribus" durchstrichen; bei der Huldigung der Stadt sind dagegen diese Worte den Zeugen hinzugefügt.


|
Seite 250 |




|
Nr. XXXVII.
Das Amt der Glaser und Maler zu Rostock präsentirt dem Herzoge Ulrich von Meklenburg, als Administrator des Stifts Schwerin, nach dem Ableben des Priesters Matthäus Katte den Magister Lucas Randow, Prediger an der Kirche zum Heil. Geist daselbst, zu einem dem Amte zustehenden Lehn in der Marien-Kirche zu Rostock.
D. d. Rostock. 1557. Aug. 24.
Siehe unten in den Jahrbüchern für Alterthumskunde in der Abtheilung: "Kunstgeschichte".
Nr. XXXVIII.
Die Herzoge Magnus und Balthasar geben dem Hans Bevernest die Eventualbelehnung mit den im Lande Stargard gelegenen Lehngütern des Geschlechts der Holtebütel, welche nach dem Tode des Hans Holtebütel an die Landesherren heimfallen werden.
D. d. Güstrow. 1489. Sept 27.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wy Magnus vnnde Baltazar, gebrôder, van gots gnâdenn hertogenn to Mekelenborch, fursten to Wendenn, greuen to Zwerin, Rostock vnnde Stargarde etc. der lannde heren, bekennen yêgenwardigen vôr vnns, vnnse eruen, nakômelinge vnnde susz vôr allesweme, dat wy vmme sunderker gunst, gnâde vnnde trûwe dînste willenn, die vnns die duchtige vnnse lîue getrûwe Hans Beuernest van sîner yôget an bette an dessen yêgenwardigen dach vnnsem heren vâder zeliger tovôrenn vnnde vns nu nah trûweliken gedân hefft vnde in tokâmenden tîden furdermehr dôn mach, mit eynem an-


|
Seite 251 |




|
gefalle beghiftiget vnnde gnedichliken besorget hebben, sunderken mit den landgûderen, alse vnse lieue getrûwe Hermen Holtebotell, in vnnser stad Nienbrandemborch wânaftich, in vnnsen lannden belegea to erue vnde m pandeswîse van vnnsen vôrfâren, vnns vnnde vnnser herschop in lehne vnde besittunge hefft vnnde sodâne gûdere an vnns vnde vnse eruen also an rechte landesfurstenn vnnde heren fallende werden, mit aller der landgûdere tobehôringe, fryheyden, rechticheyden, herlicheyden, bêde, eygendôm, gêstliken vnnde wertliken lehnen, dînsten, richten, hôgest vnnde sîdest, wo sie an dorperen, dorpsteden, ackeren, wâteren, weydenn, môllen, wischen, vischeryen, môren, holten, vth vnnde invlôten, in allen eren enden vnnde scheyden belegenn vnde begrepen sint, vnde qwîtest vnnde fryest gehat, beseten vnnde gebrûket hefft, nichts vthgenâmen, beghifftigenn, besorgen vnnde belehnen den vôrgnanten Hans Beuernest vnnde sîne rechten lêneseruen -mit den vôrgeschreuen landgûderenn, also dat hie vnnd sînes lênes rechte eruen der gûder mit eren tobehôringen, wo vôrgeschreuen, wannêr sie na dôde Hermen Holtebutels vôrgnanten vorfallen werden, van sînes lênes eruen van eruen to eruen besitten vnnde brûken môgen, in mâten wo Hermen Holtebutell gedân hefft, behaluen wes die vôrgnante Hermen Holtebutell denne van anderen gûderen hefft, die to stadrechte liggen, wûr dat sy, sie sint bewechlik edder vmbewechlik vnnde wo man die benômen mach, willen wy bûten desser ghift vôr vnns vnnde vnnse eruen bescheyden hebben, vnnde Hans Beuerneste edder sînes lênes rechten eruen êrgnant dâr nichts ane to beholdende, yêgenwardigen in crafft vnnde macht desses brîues. Des to ôrkunde vnnde grôter bewâringe hebben wy vnnse grôteste ingesegele beuâlen vnnde hieten hengen benedden an dessen brêf, die gegeuen is to Gustrow, am sonndâge na Mathei, na Cristi gebôrt dûsent vierhundert dârna im negenvndeachtentigesten iârenn.
Nach dem Originale, auf Pergament, im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin. Die beiden angehängt gewesenen Siegel sind mit den Schnüren ausgerissen und dadurch ist die ganze Urkunde sehr zerrissen.


|
Seite 252 |




|
Nr. XXXIX.
Die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg verleihen dem Curd Bevernest die nach dem Aussterben des Geschlechts der Wulffe die an die Fürsten heimgefallenen Güter dieses Geschlechts im Lande Röbel.
D. d. 1500. März 25.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wy Magnusz vnnd Baltasar, gebrôder, van gots
gnâdenn hertogenn to Mekelenborg, fursten to
Wenden, grauen to Szwerin, der lande Rotstogk
vnnd Stargarde etc. hereun, bokennen âpenbâre
betûgende vôr vnns, vnse eruen vnnd nakâmelingen
vnnd sust vôr alsweme, de dussen brieff sehn
edder hôren lesen, dat wy vth sunderger gunst
vnnd gnâden, ôck vmme trûwe vnnd willige dînste,
zo vnns de duchtige vnse dênre vnnd leue getruwe
Curdt Beuernest vnns vnnd vnnser herschop lange
tîdt gedân vnnd funder wol dhôn kan, schall vnnd
mach, to eyneme erffliken angefelle vnnd lehnn
gegeuen hebben, lehnen vnnd geuen iêgenwardich
en vnnd synes rechten lehns eruen alle vnnd
îchlike gûder des geslechtes der Wulffe in godt
vorstoruen, imme lande to Rabell vnnd sust wôr
de suluen in vnsen landen vnnd furstendhômen
belegen sindt vnnd nhû de frowe, alse de lâteste
des slechtes, inne hefft vnnd besyth, vnnd
wennêr de gedachte frowe dôdes haluen, dat godt
larige vorbêde, affgeyt, schall alsedenne de
êrbenômede Curdt Beuernest vnnd syne rechten
lehnseruen alsodâne gûedt mit aller
gerechticheyt, n
 dth vnnd frîgheyden an dorpen,
besettet vnnd vnbosottet, an ackere, wâteren, in
vnnd vtflâtenn, vischerîgen, weyden, holten,
môllen, dyken, buschen, holten, stûfeten, hôgest
vnnd sydest gerichte, nichtes vthgenâmen, wo dat
sulue gûdt in allen zînen scheyden vnnd grentzen
bolegen vnnd an vnns vnnd vnnse hersschop
allerqwîtest vnnd frîgest kâmen vnnd fallen
mach, to eyneme rechten manlehne inne hebben,
dye suluen besitten vnnd gebrûken, in
dth vnnd frîgheyden an dorpen,
besettet vnnd vnbosottet, an ackere, wâteren, in
vnnd vtflâtenn, vischerîgen, weyden, holten,
môllen, dyken, buschen, holten, stûfeten, hôgest
vnnd sydest gerichte, nichtes vthgenâmen, wo dat
sulue gûdt in allen zînen scheyden vnnd grentzen
bolegen vnnd an vnns vnnd vnnse hersschop
allerqwîtest vnnd frîgest kâmen vnnd fallen
mach, to eyneme rechten manlehne inne hebben,
dye suluen besitten vnnd gebrûken, in


|
Seite 253 |




|
mâten dat êrbenômede geslechte der Wulffe inne gehath, gebrûket vnnd beseten hebben, vnnd so vâken des nôdt vnnd behûeff is, van vnns vnnd vnser hersschop int lehn vntfangenn vnnd dâr van dhôn, so vele eyn lehnman synen herenn vorplicht vnnd schuldich is to dônde, in crafft vnnd macht dusses brîues, vnnd geuen dem gedachten Curdt Beuerneste vnnd synen rechten lehnseruen vnsen vaget vnnd amptman, dy to der tîdt vp vnser borch Wredenhagenn, wennêr zodâne vôrbonômeden gûder an vnns vallen, to eyneme inwyser. To ôrkunde vnnd mêrer sekerheydt hebben wy vpgemelten fursten Magnus vnnd Baltasar, gebrôder, eyn îchliker syn ingesegell, dat vnse sâne vnd fedder hertoge Hinrick van Mekelenborg etc. mede bowilleget, benedden an dussen brieff laten henghen, gegeuen vnnd gescreuen nach Cristi gebôrdt dûsent vîeffhundert, am dâge annuntiationis Marie virginis gloriose.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Nr. XL.
Die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg vergleichen sich mit der Wittwe des Werneke Bevernest, dass diese den Herzogen die nachgelassenen Güter des Geschlechts von Gummern gegen eine Entschädigung abtritt.
D. d. Doberan. 1500. Sept 20.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
To wêthen, dat am âuende Mathei apostoli anno veffteynhundert hebben wy Magnus vnd Baltasar, von gotts gnâden hertogen to Meckelnborg, fursten to Wenden, greuen to Swerin, Rotstock vnd Stargarde der lande etc. herrn, vns mit Werncke Beuernestes nagelâthen wedewen vordrâgen vmme die nagelâthen gûder


|
Seite 254 |




|
der Ghummern, in mâthen wô hîr nâ volgeth: Tome êrsten scholln vnd willn wy der gedachten frôwen to affdracht twuschen hîr vnd wynachten nêgestkâmende geuen vnnd entrichten vierhundert mark lub., vier dromppt moltes, vier dromet roggen, vnnd so sick die vôrbonômede frôwe vôr sodâner tîdt nicht voranderde, schall sie in sodânem gûde ere vee vthfôdern, weret ôck sie sick vorandernde worde, schollen wy solke gûder vmbehindert annhemen lâten vnd gebrûken, vnd so idt godt vorbêde, die gedâchte frowe sunder eruen in godt vorstorue, schall alsedenne sodâne ghelt der vierhundert mark wedderummer an vns vnnd vnse herscopp vorfallen syn. Hîrmit is alle dinck geszleten vnnd die vôrgnante frowe hefft vôr vns vorlâthen vnd afftich von vâder vnnd môder erue gedhân, nochmâls sie edder nhêmant von erenthweghen dâr vp to sâkende. Solkes alles is in bywesende der duchtigen vnd êrbârn Diderick Beuernestes, Arndt Bibowen vnd Johan Hasekopp geschên. Des to tûge synd desser recessz twê gelîkes lûdes, eyne by vns vnd den andern by der vîlgemelten Werncke Beuernestes nâgelâthen wedewen, mit vnsem vpgedruckeden signêten vorsegelt, vorantwerdet. Datum Dobbran, amme dâge vnd iâren wo bâuengeschreuen.
Nach dem Originale, auf Papier, im grossherzogl. meklenb. Staats-Archive zu Schwerin. Untergedruckt ist nur Ein kleines Ringsiegel mit dem meklenburg. Wappen.
Nr. XLI.
Hermann Glinecke und seine Ehefrau Anna, des Bisprow Boltebütels Tochter, treten dem Hans Bevernest die Güter des wailand Bisprow Holtebütel ab.
D. d. Neu-Brandenburg. 1501. Nov. 30.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Vôr alle den iênnen, dâr dessze brêff vôrkumpt, bekenne ick olde Hermen Glyneke mith myner hûsfrouwen Annen, eyne dochter Bisprowen Holte-


|
Seite 255 |




|
butels, dat ick mith er afflâte van lêne, erue, pandt ares zeligen vâders Bisprouwen Holtebutels erue, dâr nummermêr vp tho sâkende mith vnszen eruen, he sy gheystlick edder werlick, vnde effte dâr brêue vunden worden, dede lûden vppe lehn, erue effte panth Bisprow Holtebutels, de schalen vns edder vnse eruen nicht hulplick effte rômelick weszen, men Hans Beuerneste vnde syne eruen. Hîr vôr hefft vns Hans Beuernesth êrbenômet vornûgeth twêhunderth rînsche gulden. Des to tûge hîr an vnde âuer szynth geweseth Diderick Beuernesth, Albrecht van Gulen, Eggerth Entziten, Achim Dorne vnde mere lôuen werdiger lûde, vnde ick Hermen Glyneke vôrbenômet hebbe des to grôtter zekerheith myn ingesegell mith witschôpp vnde mith willen lâten hengen an dessen brêff, de geuen vnde schreuen is to Brandenborch, amme dâge Andree, na gades bôrth veffteyn hunderth iar vnde eyn.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Nr. XLII.
Die Herzoge Magnus und Balthasar iibernehmen auf Bitten die Vormundschaft und Versorgung der Wittwe und der Kinder des wail. Brüning von Restorf, welche dessen Neffen Hans von Restorf gebührt hätte, von diesem aber wegen seiner Armuth nicht besorgt werden kann, wogegen den Herzogen dafür die Güter Pripert und Strasen abgetreten, Hans von Restorf von denselben aber allein mit seinem altväterlichen Gute Tornow belehnt wird.
D. d. 1502. Julii 16.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wy Magnus vnd Baltazar, gebrôder, van gades gnâden hertogen tho Mekelenborch, forsten to Wenden,


|
Seite 256 |




|
grauen to Swerin, Rozstock vnde Stargardenn der lande heren, bokennen hyr mede âpenbâr, dath vôr vns kâmen syn de werdige vnde duchtige vnsere lêue getruwen er Nicolaus Hertzeberch, prâwest to Fredelanth, vnde Achim van Bredow vnd hebben vns to erkennen geuen, wo Hans van Retzstorp, dorch afsteruen Bruningk Retzstorps, synes vedderen vnde vaderbrôder, als eyn gewânliker rechter vôrmunder Margareten, syner nagelâten wedewen, vnde Anna, Barbara, ôk Margareta, syner nagelâten dochter vnde kinder synes vedderen getzgenanth, sculdich vnde plichtich, vth den gûdernn, szo sy intsampth mede ehn innen gehath vnde beseten, sie tho vorsorgen, en getrûwlich vôrstân vnde de junckfrawen meth eren brûtschatte êrlick to borâden, aber de wîle mennichlik âpenbâr vnde am dâge ys, dath he meth eygener ermôth der mâthen belâden, dath he swârlik genûchsâ e em sick sulues vnbêrlikes armôdes to entsetten, dath âuer syn vormâgen vnde craft, obgemelte synes vedderen nagelâten wedewen vnde kinder sampt aren gûderen, wie sick eynen rechten vôrmunder eygent, to besorgen vnnde to bewâren, der haluen hebbe sy vns van wegen vpgnantes Hanszen Retzstorps meth fiîtiger bede angefallen, wolten vth gnedigem willen, ôk forstliker mildicheyt solke vôrmuntscap vnde vorsorgunge der wedewen vnde der junckfrowen vpgnanth an vns nemen vnde kâmen lâten, vnde wuwol wy vns der haluen ethwas beswârth entfunden, hebben wy doch bedacht, dath vns ôck sonnsten dath vth forstliker ôbericheyt, wedewen vnde weysen to boschermen, hanthaben vnde schutten, to dônde gebôrth vnde eygenth, vnde hebben vpgemelten vnszen getrûwen szodâns an to nemende thogesecht vnde bowilliget, alszo vnnd der gestalth, dath vnsz Hans Retzstorpp als eyn vôremunder eregedachter wedewen vnde kynder vôr alle vnde gêcklike gûder, szo sy meth eynander to sampt in den dorpen Tornow, Priperth vnde Strassem gehath, dy twey dorpen Pryperth vnd Strasem, meth aller fryheyde, gerechticheyt vnde inkâmen an renten, ackern, holtungen, wâteren, molnen, vischen, weyden, thô vnde vthfloten, ôck gerichten, dênsten, hôgest vnde sydest, vnde alsus meth aller nuttinge vnde herlicheyt, wû de meth sunderliken vthgedruckden nâmenn genômeth vnde vthgesprâken mâgen werden, meth den hôuetbrêuen, szo de dârâuer nnnen hebben, meth wêten, willen vnd vulbôrth vildachter


|
Seite 257 |




|
wedewenn vnde arer kinder schal vnde wil âueranthwerden, alsdenne willen wy vpgnante wedewe meth aren kindern tho nôturftige besorging an eten, drincken, clêdingen, brûtschat, dâr tho meth allen vnde gêchliken liggeuden vnde fârenden erue vnde panthgûderen, vnde wâr dy kinder mêr recht an syn, de vns den ôck alle to hulpe kâmen schalen, in vnszer vormunthschaft, schut vnde scherm annemen vnde besorgen, vnde Hanszen Retzstorpp dat dorp Tornow to voller vorgnôginge synes vâderliken gûdes, szo he in obbestempten gûderen gehath, vôr sick vnd syne eruen, m aller mâthe sy vnde ere vârfâren dat sulue aller quîtest vnde frygest meth aller tôbehôringen ingehath, beseten vnde gebrûket hebben, als meth den hôgesten vnd sîdesten gerichten, dênsten, vischeryen, wischen, weyden, in vnd vthflâten, nichtes vthgenâmen, todeylen vnd lênen, doch vns an vnszer forstlicher herlicheyt vnde sust eynem gêderman an syneme rechte vnschedelich, vthgenâmen dat wy alle karn van desseme yâr schalen beholden vnde afmêgen lâten, dâr van wy alszdenne obgnanten Hanszen Retzstorp szo vale korns, als he vôr eyn andêll to syner winter vnde samer sâdt behûff heth, geuen schalen vndhe willenn. Szodâns vnszer meyninge hebben wy gemelten vnszen getrûwen prâwest vnde Achim van Bredow dem vilgedachten Hanszen Retzstorpp weddervmme vârgeholden vnde tho vorstâ e en geuen, hefft he meth tîdigem râde vnde wolbedachten môde solliches alles, wo bôuen berûrth, to danck dêmôdichliken angenômen vnde bewilliget, stede, vaste, sunder alle argelist vnde geuêrde to holden. Tho wîder ûrkunth hebben wy desser recess twê gelîkes lûdes, de eyn by vns vnde de ander by Hanszen Retzstorpp, mâken vnde meth vnseme sigel vorsegeln lâten, de geuen vnde screuen syn am sonâuendt na diuisionis apostolorum, anno etc. XY c . vnde twê.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.


|
Seite 258 |




|
Nr. XLIII.
Die Herzoge Balthasar und Heinrich von Meklenburg belehnen nach Brunings und Hans von Restorf Ableben den Hans von Platen mit dem heimgefallenen Gute Tornow in der Vogtei Fürstenberg mit der Bedingung, dass Hans von Platen des Brüning von Restorf Tochter Anna zur Frau und seinen Wohnsitz in Meklenburg nehme.
D. d. Schwerin. Jan. 12.
Nach dem Concept im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
[Wy von gotts genâden Balthasar vnnd Heinrich, gevettern, hertogen tho Meckelnborch, fursten tho Wenden, grâuen tho Swerin, Rostock vnnd Stargarde der lande herren,] bekennen âpenbâr in dussem brêue vôr ydermenniglich vôr vnns, vnser eruen vnd nakômen, dat wy dem duchtigen vnnsenn lieuen getrûen Hanszen Platen vnnd sînen rechtenn eruen vt sonderlichenn gnâden vmb sîner getrûen dênste, so hie vnns gethân vnnd hinfûro thûnn kan, mag, schall vnd will, dat gûdt gnant Dornow in der vagedie Furstenberg belegenn, mit tinsen, renten, peehten, muln, dîken, vischerîen, veltmarcken, wischen, holten vnd wîden, wô de in eren enden vnd schêden gelegen sint, vt vnd influt vnnd all ander herlicheit, fryheit, gerechticheyt, nichtes vtgenûmmen, wô idt Bruning vnd Hans de Restorpe innegehadt, bosetten vnnd gebrûket, vnd na erer beider tôdlickenn affgang vp dat allerquîttest vnnd frîgest an vns gefallenn is, inne to hebben, to besitten vnd to gebrûkenn, gnediglich tôgesegt, vorrêket vnd vorlehent hebben, thôsegenn, vorêkenn vnd vorlêhn gemeltem Hanszen Platen vnnd sînen rechten eruen vpgedacht gûdt Dornow mit aller vnnd iêwelcker sîner herlicheit, frîheit vnd gerechticheit, nichtes vtgenâmenn, wô itzt bâuen berûrt is vnd Brunig vnd Hans de Restorpe von vns int lehn entphangenn, besetten, innegehadt vnnd gebrûket hebbenn, to besittenn, inne to hebbenn vnd to gebrûckenn, in craft dusses


|
Seite 259 |




|
brêues, doch mit dussem beschêde, dat gemelter Plate de junckfrowenn Anna, Bruning Restorp zeligen nâgelâtenn dochter, wente se to eren manbârn jârn gekômmen, to einem eelicken gemâhel nemen vnd alzo mit ere de tîdt sîns leuendes, deszglickenn sîn eruen vîlgemeltes gûdt bewânen, sick edder sîn eruen in vnnsen landen entholdenn vnnd wesentlickh nicht dârvt tîhenn schallen vnd willen; geschê es ôk, dat hie edder sîne eruen sik dâr vt geuen wurden vnd von der herschop to der tîdt vormânt, sick wederum int landt nicht wenden wurden, so wollen wy, vnse eruen vftd nâkâmenn vns vôrbeholden hebben, solch gûdt sonder widerrede des gemelten Platen eder sîner eruen widerum to vns to nehmen vnnd damit to gebârn nach vnnsern vnd vnser eruen gefallen, in macht dusses brêues, ôk vns, vns furstlikenn ôuchereit vnnd sust einem yderman ann sînen rechtenn âne schâdenn. Tho ôrkunde [mit vnser vpgemelten beyder fursten ingesigelt tho endt diesses brîues gehangen vorsigellt. Datum Swerin, dinstag na trium regum, nach Christi vnses lêuen herren gebûrth dûsenth vîff hundert vnd dâr na im seuenden ihâre.]
Nach dem undatirten Concepte oder einer gleichzeitigen Abschrift von demselben im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin. Der Eingang und der Schluss, so weit beide durch [ ] bezeichnet sind, fehlen dem Concepte und sind ans einer noch aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammenden beglaubigten Abschrift entnommen. Auf der Rückseite steht von des Canzlers C. v. Schöneich Hand die Registratur: "Gnadenlhen vbir das gut Tornow im lant zcu Stargardt belegen".


|
Seite 260 |




|
Nr. XLIV.
Die Herzoge von Meklenburg antworten den Markgrafen von Brandenburg auf deren Vorschreiben für ihren Vasallen Hans von Holtzendorf, der aus dem durch seine Ehefrau, des wail. Hans von Restorf Schwester, ihm angefallenen Gute Tornow durch Hans von Platen verdrängt worden, dass sie, die Herzoge von Meklenburg, die Partheien anhören und über sie nach Recht entscheiden wollen.
D. d. (1508).
Nach dem Concepte im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
An die margaffen zcu Brandenburg.
Vnsen fruntlichen dinst mit liebs und guts vormogen zcuuorn. Hochgebornen fursten, lieben ohmen, sweger vnd bruder. Wir haben ewr. I. schreiben von wegen ihres vnderthanen Hansen von Holczendorff, wie er aus eynem gutte, so seyne eliche hausfraw von weilent Hansen Retczdorff, irem bruder, in vnserm lande angefallen, von Hansen Plato, vnserm vndirthanen, wider die pillikeit entsatczt vnd gedrungen wurde, ihres inholds vorstanden, vnd haben pis her dises handels keyn vnderrichtung entpfangen, vnd wollen der halebn e. l. zcu gefallen vff gemeltes ihres vndirthanen ansuchen Hansen Platen vor vns zcu irscheynen vorschreiben, szie in selben handel kegen einander gnugsamlich vorhoren vnd ime alsdenne, szo vil pillich ist, erghên vnd vorhelffen lassen, was wir e. l. gutter wolmeynung nicht haben wollen vorhalten, den der selben e. l. in disem vnd mhererm vil beheglicher wilfarung vnd fruntliche dinste zcu irczeigen sein wir allzceit gutwillig. Datum
Nach dem Concepte im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive von der Hand des Canzlers Caspar v. Schöneich. Wie alle Concepte dieses Canzlers ist auch dieses nicht datirt; nach


|
Seite 261 |




|
der leicht zu erkennenden Eigenthümlichkeit der Schriftzüge stammt dieses Concept aus den ersten Jahren seiner Amtsführung d. i. seit 1507, und ist sicher vor dem 28. August 1509 abgefasst, da an diesem Tage die hier berührte Streitigkeit schon beigelegt war.
Nr. XLV.
Die Herzoge Heinrich und Albert von Meklenburg belehnen den Hans von Platen mit dem Antheil an dem Dorfe Tornow und der wüsten Feldmark Ringesleven, welchen Anna von Restorf, des wailand Kersten von Restorf Tochter und des Hans von Holtzendorf Ehefrau, dem Hans von Platen für 800 Gulden baar Geld und Schuld verkauft hat.
D. d. Neu-Brandenburg. 1509. Aug. 28.
Nach dem Concepte im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wy Hinrick vnnd Albrecht, gebrûder, vann godds
gnâdenn hertogenn to Meckelborch, fursten to
Wendenn, greuenn to Swerin, Rostock vndd
Stargardt der lande herrn, bekennen ôpentlick
mit dussem vnnsem âpenen brêue, dat vôr vns
erschênen is [Hans Holczendorff von wegen Annen,
seiner êlichen hûsfrouen,] vnnd an vns drâgen
hefft lâten, wo se alle ore gerechticheyt, szo
 r vann orem vâder Kersten vann
Retzdorpe im dorppe Tornow vnnd inn einer
wûstenn feltmarcken Ringesleue angefallen, dem
duchtigenn vnnsem lieuenn getrwenn Hans Platenn
[fûr achthundert fl. Bâr gelt und schult, szo in
berûrten guttern stunden, zcusammen geschlagen,]
vorkofft hedde, der haluenn sie vôr vnns solcke
ore gerechticheyt an berûrdenn gûdern
frywillichlick hefft vorlâtenn, die wy gemeltem
Platenn vnnd sînen lîues lehns eruenn, wo sick
dat gebôrt, to einem rechtenn manlêhne inne to
hebben, to besitten, vnnd ti genieten gelêgenn hebbenn,
r vann orem vâder Kersten vann
Retzdorpe im dorppe Tornow vnnd inn einer
wûstenn feltmarcken Ringesleue angefallen, dem
duchtigenn vnnsem lieuenn getrwenn Hans Platenn
[fûr achthundert fl. Bâr gelt und schult, szo in
berûrten guttern stunden, zcusammen geschlagen,]
vorkofft hedde, der haluenn sie vôr vnns solcke
ore gerechticheyt an berûrdenn gûdern
frywillichlick hefft vorlâtenn, die wy gemeltem
Platenn vnnd sînen lîues lehns eruenn, wo sick
dat gebôrt, to einem rechtenn manlêhne inne to
hebben, to besitten, vnnd ti genieten gelêgenn hebbenn,


|
Seite 262 |




|
leyenn emhe vnnd sînenn rechtenn lehns eruenn sulcke gûder Tornow mit der wûstenn veltmarcke Ringesleue, so wy emhe vôrmâln to einem gnâdenlênhe vorschreuen hebben, die, wo vann olders vann Retzdorppe, to bosittenn, to genieten, tho gebrûckenn, vôr ydermennichlich vngehindert, dach vnns an vnser forstliken âuericheyt vnnd sust yêderm synem rechtenn âne schâdenn. Des to ôrkunde hebbenn wy dussenn brêff mit vnnser forstenn eins anhengenden ingesegel vorsegelenn vnnd geuen lâten to Nienbrandeborch, nha Christi vnnses lieuen hern gebôrt veffteinhundert vnnd im negendenn iâre, dinsdâges nha Bartholomei.
Nach dem verworfenen und durchcorrigirten Originale, auf Pergament, im grossherzogl. meklenb. Staats-Archive zu Schwerin. In diesem Archive befindet sicb auch noch das erste hochdeutsche Concept von des Canzlers Caspar von Schöneich Hand, wie gewöhnlich nicht datirt. Darnach ist der vorstehende Text von dem Secretair in plattdeutscher Sprache auf Pergament ausgefertigt und datirt, von dem Canzler aber wieder an den mit [ ] bezeichneten Stellen in hochdeutscher Sprache corrigirt und deshalb als Original verworfen. Die Correctur geschah vorzüglich deshalb, weil in dem ersten Texte steht: "dat vor vns erschenen is Anna, Hans Holczendorpes eelike husfrawe", wogegen durch die Correctur richtiger das Erscheinen des Mannes von wegen seiner Frau eingeführt ist.
Nr. XLVI.
Die Herzoge Heinrich und Albrecht von Meklenburg bezeugen, dass Kersten von Restorf's nachgelassene Wittwe ihre Gerechtigkeit an Tornow und Ringesleven vor ihnen aufgelassen habe, nachdem Hans von Plate, der mit den Gütern belehnt sei, ihr dieselbe abgekauft.
D. d. (1510).
Nach dem Concepte im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wir etc. bekennen, das fur vns irschynen ist Kersten Retzdorff nachgelassene witwe vnd zcu irkennen


|
Seite 263 |




|
gegeben, das ir der duchtige vnser lieber getrwer Hans Plate ir vorschriben lipgeding in dem dorffe Tornow vnd der wusten feldtmarke Ringesleue abgekaufft ynd wol zcu danck vorgenugt habe, der halben sie mit wolbedachtem mute vns sulch gutter freywilliglich in voser hende vff lassen, die wir gemeltem Platen vnd seynen leibslhenserben nach ausweisung eyns gegeben lhensbrieffs vorlihen haben. Des zcu
Nach dem undatirten Concepte im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin von des Canzlers Caspar v. Schöneich Hand. Diese Urkunde ist jedenfalls nach dem 28. Aug. 1509 gegeben, da in derselben schon des an diesem Tage ausgestellten Lehnbriefes gedacht wird; auch deutet die schon mehr flüchtige Handschrift und die blasse Dinte des Canzlers darauf hin, dass die Urkunde etwas später, als in den ersten Jahren der Amtsführung dieses Canzlers entworfen sei. Die Urkunde wird also wahrscheinlich nicht lange nach dem Lehnbriefe, also ungefähr im J. 1510, gegeben sein.
Nr. XLVII.
Propst, Hauptmann und Bürgemeister zu Zehdenick bezeugen, dass der Pfarrer Peter Karwe, ehemals zu Tornow, vor ihnen bezeugt, dass Hans von Restorf auf seinem Sterbebette ausgesagt habe, dass er keinen Leibeslehnserben habe, und dass ihm daher Siegel, Schild und Helm ins Grab nachgeworfen seien.
D. d. 1535.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Ich e[r]n Matthias Reczow, prâuesth tho Czedenick, vnd Hans Hacke, hôffethman dârsoluesth, ôck Petter Ebell, burgermêsther der stath Czedenick, bokennen


|
Seite 264 |




|
offentlichen vôr eynen îderman, von vath syn standes eder condicion sy syein vorden, dat desser vnszer âpener zcedell vorthôgert verth, vho dat vôr vnsz vth synem êgenen gûthden wyllen isth er Petter Karue, iczundes perner tho Musth, erschênen vnd met volbedachten mûde fâckenn bekant vnd frywyllich vtgeszecht, auch vorthan heth hee sick vorbâden, szo effthe des nôth es worde, dat he met synen dorporlicken eyden alsze tho bekrefftigen vnd vâr tho mâcken, dat he tho der tyth, alsze Hans Restorp in goth isth vorscheyden, szo isth he perner tho Tornow gewesth vnd in szoeynen lasthen affschêdende vormâneth vnd gefrâget, gy wolden recht boricht van jw geuen, effthe dâr noch êmâls dâr noch vmme gefraget vorden, vhô die nêgesthe nach synen dôde tho synen lehengûde muchte syn, geantwerdt, he vusthe nymandes nicht, sonder seyn genedge herenn von Meckelborg, von velchen he dath lehensvysze gehat heffth, den vert dat vedder imheynsz kâmen. Up dat heth dy perner, dyvyle nymandes vorhanden, dy dat gûth in ansprâcke uormeinden tho nemen veren, sein pitzir, schilt vnd helm noch vnd meth ehm in syn graff gevorppen vnd alszo begrâuenn. Dat isth alszo geschîn vnd isth van denn perner alszo gehôreth, vho dath vorthêget ist, kone vy nicht anders samptlicken, szo vâcken wy tho rechte dâr vmme gefrâget verden, seggen vnd bhockennen.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin. Auf der Rückseite steht die gleichzeitige CanzIei-Registratur: "Hans Platte zu Thornaw - - - - - - - ao. 35. am dinstage na Cantate zv Thornaw bekomen".


|
Seite 265 |




|
Nr. XLVIII.
Der Kurfürst Joachim II. von Brandenburg giebt den Brüdern und Vettern Vicke, Melchior und Joachim von Platen die Belehnung und gesammte Hand mit des Hans von Platen auf Tornow hinterlassenen brandenburgischen Lehngütern, deren Muthung sie versäumt, und nimmt die übrigen von Platen auf Quitzow und Mesendorf und die Bevernest wieder in die gesammte Hand auf, die sie seit alter Zeit besessen haben.
D. d. Cölln a. d. Spree. 1555. Nov. 27.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wir Joachim von Gotts gnaden, Marckgraff zu Brandenburgk, des Heiligen Romischen Reichs Ertzkamerer vnd Churfurst, zu Stettein, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Krossen Hertzogk, Burggraff zu Nurembergk vnd Furst zu Rügen, Bekennen vnd thun kundt offentlich mit diesem breife vor vns, vnsere Erben vnd nachkomende Marckgraffen zu Brandenburgk vnd sonsten allermenniglich, Alszdan nach absterben vnsers belehnten vntterthanen vnd lieben getruwen Hans von Platow zu Tornow seligen tzwischen seinen negsten Agnaten, alszVicken, Joachim vnd Mellichorn, gebruedern vnd Vettern, denen von Platowen vorseumung der Lehen vnd gesambter handt vorgefallen Vnd derwegen desselben Hans von Platows seine Lehengutter an vns alsz den Landtsfursten vnd Lehenherrn eroffenet vnd gefallen, Die wir auch ferner vnsern Hoffdienern, schencken vnd lieben getruwen Curd Flansen vnd Henningk Pasenow aus gnaden gegeben vnd vorschrieben, So sich aber berhurte Vicke, Joachim vnd Mellichor von Platow, gebrueder vnd Vettern, sollicher gutter halben ferner midt gedachten vnsern Hofdienern vf vnsere geschene bewilligung in der gutte vortragen vnd eine Summa geldes von Inen Embfangen vnd Denen von Platow den


|
Seite 266 |




|
Erbfall obgedachts Hans von Platown seligen wiedervmb zugesteltte gutter, neben den andern Iren Lehenguttern, so viel sie deren von vns zu Lehen tragen, Inen vfs Newe mydt iren Vettern, den andern von Platow ,dergleichen den Buernesten , wie sie den von alters vorsamblet gewesen, Die gesambte Handt gnediglich vorliehen wolten, So haben wir angesehen, ir Der von Platown ire vntterthenige vnd fleissige bitte, vnd haben alsz der Landtsfurst hir in gnediglich gewilliget, Vnd Lychen dorvf obgemelten Vicken, Mellichorn vnd Joachim den Platown, gebruedern vnd Vettern, vnd Iren Menlichen leibs-Lehenserben alle Hans von PIatows Lehengutter midt aller vnttertheniger Zugehörung vnd gerechtigkeit, Auch alle andere ire Lehengutter, wie sie vnd ire Vorfaren Die von Alters hero von vns vnd vnseren Vorfaren, Zu Lehenn gehabtt, besessen vnd gebraucht, Zu Rechtem Manlehen vnd gesambter handt, In Crafft vnd macht dieses briefes vnd also, dasz sie vnd ire menlige leibs lehens erben solliche gutter henferner mher von vns, Vnsern Erben vnd nachkommenden Marckgraffen zu Brandenburgk Zu Rechtem Manlehen vnd gesambter handt haben, besitzen vnd gebrauchen, so offt Nodt thudt, Die nhemen vnd Entfhangen, Vns auch daruon thun vnd Dienen sollen, Alsz manlehens vnd gesambter handt Recht vnd gewhonheitt ist. Wir haben auch obgemelten von Platown aus sondern gnaden vorgonnet vnd nachgegeben, obwoll Hans von Platow seliger von Denselben seinen Leuten, weill derselbe ausser vnserm Landte besessen gewesen vnd Dienstgeldt genhommen, Dasz sie sich doch henforder Jegen erlassung solliches Dienstgeldes, der Dienste, wie Die von Qwitzow vnd Rohre, Der Orte wochentlich, alsz Jder woche tzwie tage, gebrauchen mogen vnd sollen. Auch haben wir aus sondern gnaden vnsern lieben getruwen Christoff vnd Jörgen zu Qwitzow, Joachim, Mellichor, Pawell, Reymer, Hansen, Albrechten, Georgen vnd Matheus zu Mesendorff, gebruedern vnd Vettern, denen von Platow, vnd Dergleichen Joachim vnd Deiterichen, Gregorius seligen sohn, den Beuernesten vnd allen iren menlichen leibs Lehens Erben an allen obgeschriebenen Lehenguttern Die gesambte handt geliehen Vnd Lyehen inen Die hiemidt in Crafft vnd macht Dieses brieues, doch dasz sie zu idertzeitt der


|
Seite 267 |




|
gesambten Handt folge thun sollen, Vnd wir Liehen inen hir an alles, wasz wir inen von Rechtswegen daran vor- lyehen sollen vnd mogen, Doch vnsz an vnsern vnd sonsten Jdermenniglich an seinem Rechtenn ohne schaden. Zu Vrkundt midt vnsern anhangenden Insiegell Vorsiegeltt vnd geben Zu Colln an der Sprew, Mitwochens nach Catharinae Virginis, Christi vnsers lieben herrn geburdt im funfftzehen hundersten vnnd funff vnd funfftzigstem Jare.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Nr. XLIX.
Der Kurfürst Johann Georg von Brandenbwg erneuert nach des Kurfürsten Joachim II. Tode allen von Platen auf Quitzow und Mesendorf und den Vettern Joachim und Dietrich Bevernest die Belehnung mit allen ihren Lehngütern und die gesammte Hand.
D. d. Cölln a. d. Spree. 1571. Sept. 24.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wir Johanns Georg, von Gotts gnaden Marckgraff zu Brandenburgk, des Heiligen Romischen Reichs ErtzCammerer vnd Churfurst, in Preussen, zu Stettein, Pommern, der Cassuben, Wenden vnd in Schlesien zu Crossen Hertzogk, Burggraff zu Nurmbergk vnd furst zu Ruegen, Bekennnn vnd thun kundt offentlich vor vns, vnsere Erben vnd nachkommen Merckgraffen zu Brandenburgk, auch sonsten kegen idermenniglich, Das wir nach Todtlichen abgangk Weylandt des Hochgebornen Fursten vnd Herrn Joachims Marckgraffen zu Brandenburgk p. vnd Churfursten p. vnsers in Gott Ruhenden freundtlichen lieben Herrn vnd Vaters Hoch-


|
Seite 268 |




|
loblicher gedechtnussz vnsern lieben getrewen, Joachim vnd Mellichorn, Hanses Söne, Jurgen Hartweigs Sohn, Pawell vnd Hanssen, Vicken Söhne, Albrechten, Georgen vnd Matheusen, Achims Söhne, gebrueder vnd geuettern, die von Platow, zu Qwitzow vnd Mesendorff, Auch Joachim vnd Deitrich, geuettern die Beuerneste vnd ire menliche leibsLehnserben, auff ir vntterthenigs bitten vnd aus besondern gnaden, damitt wir inen gewogen, Alle vnd iede ire Lehengutter, die sie allerseits von dem Hause vnd Churfurstenthumb Brandenburg in Lehen vnd besitz herbrachtt, Zu Rechtem Manlehen vnd gesambter handt gereichtt vnd geliehen haben, Alles nach Laudt Hochgedachts vnsers herrn Vatern vnd vnserer Vorfahrn Lehens vnd angefels brieffe, Vnd wir Liehen gedachten von Platen vnd Beuerneste vnd iren menlichen Leibs Lehens erben alle ire Lehengutter, wie sie vnd ire Vorfharn die von Alters her von vns vnd vnsern Vorfharn zu Lehen vnd gesambter Handt gehabtt, besessen vnd gebrauchtt, zu Rechtem Manlehen vnd gesambter Handt Vnd vorsamblen sie nach gewhonliger siptzal hirmitt in Crafft vnd machtt diesses briefes Vnd also, Dasz sie vnd ire menliche leibsLehenserben solliche gutter henfurder mher von vnsz, vnsern Erben vnd nachkommen Marckgraffen zu Brandenburgk zu Rechtem Manlehen vnd gesambter handt haben, besitzen vnd gebrauchen, so offt nodt thudt, die nhemen vnd endtphahen, Vns auch dauon thun vnd Dienen sollen, Alsz Manlehens vnd gesambter handt Recht vnd gewhonheitt ist, Vnd wir Liehen inen hiran allesz was wir Inen von Rechtswegen doran vorliehen sollen vnd mogen, Doch vnsz an vnsern vnd sonsten idermenniglich an seinem Rechten ohne schaden. Vrkundtlich midt vnsern anhangenden Ingesiegell besiegelt vnd gegeben zu Colln an der Sprew, Montags nach Mathei Apostoli, Christi vnsers lieben herrn vnd selichmachers geburdt im Ein Tausent Funffhundertt vnd im Ein vnd Siebentzigstem Jahre.
Nach einer gleichzeitigen Abschrift im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.


|
Seite 269 |




|
Nr. L.
Der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg bestätigt dem Joachim Friedrich Bevernest die gesammte Hand an den Gütern der von Platen auf Quitzow und Mesendorf, so wie diesen die gesammte Hand an den Gütern der Bevernest, für jetzt und für die Zukunft, da die von Platen und Bevernest Eines Stammes, Schildes und Helmes seien.
D. d. Cölln a. d. Spree. 1645. März 20.
Nach dem Originale im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
Wir Friderich Wilhelm, von Gottes gnaden Marggraff zu Brandenburgk, desz Heiligen Romischen Reichs Ertzcammerer vnd Churfürst, in Preuszen, zu Gülich, Cleve, Berge, Stettin, Pommern, der Caszuben, Wenden, Auch in Schlesien zu Crossen und Jägerndorff Hertzogk, Burggraff zue Nuerembergk, Furst zue Rüegen, Graff zue der Merck undt Ravenspergk, Herr zue Ravenstein, Bekennen undt thun kundt öffendtlich hiermit vor vnsz, vnsere Erben undt Nachkommen, Merggraffen zue Brandenburgk p. vndt sonst jeder männiglichen, die diesen brieff sehen, hören oder lehsen, Dieweill Dieterich von Bevernest sel. mit den Platen zue Quitzau undt Mesendorff einesz Stammesz, Schildes undt Helmsz gewesen, haben Weylandt die Hochgebohrne Fursten, Herr Joachim, Herr Johans George undt Herr Joachim Friderich, vnsere in Gott ruhende freundtliche liebe Ahnherren, Ober- undt ElterVater, alle drey hochlöbl. gedechtnusz, Ihre undt seine Vettern derowegen mit den Platen versamblet, Dasz wir demnach auff tötlichem abgangh des Weylandt durchleuchtigen undt hochgebohrnen Fursten Herrn George Wilhelms, Marggraffens undt Churfurstens zue Brandenburgk p. Christmilter ahngederckensz, Vnserm lieben getrewen Joachim Friederichen von Beuernesten, Gregoriuszen sel. Sohn, undt seinen Menlichen leibesz lehens Erben auf sein vnterthänigstes suchen vndt bitten, vnd ausz besondern gnaden, damit wir Ihm gewohgen,


|
Seite 270 |




|
die gesambte handt an allen dero von Platen zue Quitzow undt Mesendorff lehengüetern, nichtesz ausgenommen, die Sie von vnsz zue lehne tragen, anderweit gnädiglich geliehen haben, Vnd wir leihen Ihm die gesambte handt mit denen von Platen an allen Ihren Guetern, wie obstehet, in Krafft und macht dieses briefes undt also, dasz der genante Joachim Friederich von Bevernest undt seine Menliche leibesz lehens Erben die gesambte handt mit denen von Platen an ihren Guetern haben undt besitzen, Vnd zue jederzeit, so offte es zue falle kömbt, derselben folge thun, Vnsz auch davon thun undt dienen sollen, Alsz Manlehens- undt gesambter handt recht undt gewohnheit ist. Wiederumb sollen auch die von Platen undt Ihre Menliche leibesz lehensz Erben an allen den Guetern, so beruerter Bevernest oder seine Erben in Churfurstenthumb kauffen, haben undt mit der Zeit überkommen werden, die gesambte handt haben undt besitzen, Auch zue jeglicher zeit der gesambten handt, wie gewöhnlich, folge thun, Getrewlich vndt vngefehrlich. Zue Vhrkundt mit vnserm anhangenden Insiegell besiegelt Vndt geben zue Cöllen an der Spree, Am zwantzigsten Martij, Nach Christi vnsersz lieben herren undt Selichmachers gebuhrt, Im Ein Tausendt Sechshundert funf undt Viertzigsten Jahre. p.
| Sigmundt von Goetzen, | Sebastian Stripe, |
| mppia. | Lehensecretarius, sbsc. |
Nach dem des Siegels beraubten Originale, auf Pergament, im grossherzogl. meklenburg. Staats-Archive zu Schwerin.
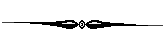


|
[ Seite 271 ] |




|



|


|
|
|
- Reib-, Roll- oder Klopfsteine von Friedrichshöhe
- Kegelgrab von Dabel Nr. 3 (vgl. Jahrb. XXII, S. 279 flgd.)
- Wendenkirchhof von Göthen
- Wendenbegräbniß von Vorbeck
- Messingene Taufbecken von Dambeck
- Alterthümer von Marlow
- Hölzerne Teller von Güstrow
- Bronzener Henkeltopf von Gnoyen
- Die wendische Burg Lübchin und der Bärnim
- Der Burgwall von Marnitz
- Der wendische Burgwall von Barth
- Burgwall zu Mestlin
- Das frühere Dorf Rodenbek
- Die romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg
- Die Kirche zu Lübchin
- Die Kirche zu Semlow
- Die Kirche zu Tribohm
- Die vorpommerschen Landkirchen zwischen Tribsees und Damgarten
- Die Kirche zu Sanitz
- Die Kirche zu Marlow
- Die Kirche von Thelkow
- Die Kirche zu Basse
- Ueber die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan
- Erläuterungen über die Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan
- Drei Denksteine aus der Umgegend von Wismar
- Ueber die große Glocke zu Hohenkirchen
- Der Münzfund von Boek
- Der Hochaltar der S. Georgen-Kirche zu Parchim
- Das Amt und Wappen der Maler und Glaser und das Künstlerwappen
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 272 ] |




|


|
[ Seite 273 ] |




|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Zeit der Hünengräber.
Streitaxt von Güstrow
Eine Streitaxt von Hornblende, auf der Oberfläche etwas verwittert, von der gewöhnlichen Form, mit schräger Schneide, ward von dem Herrn Ausschuß= und Ackerbürger Greffrath zu Güstrow geschenkt, der Sie auf seinem Acker gefunden hatte.
Streithammer von Krusenhagen.
Zu Krusenhagen, A. Redentin, bei Wismar, ward in einer Mergelgrube ein kleiner Streithammer aus Grünstein, 4 1/4 Zoll lang, gefunden und von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar erworben und dem Vereine geschenkt.
Eine Streitaxt von Gneis,
daher sehr mürbe und an der Schneide zersplittert, ward in Meklenburg von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.


|
Seite 274 |




|
Keil von Katelbogen.
Ein Keil, aus hellgrauem Feuerstein, überall geschliffen, 7" lang, gefunden im J. 1856 zwischen Katelbogen und Baumgarten, ward geschenkt von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar.
Keil von Benz.
Zu Benz bei Wismar ward ein kleiner Keil aus grauem Feuerstein, 3 3/8 " lang, in der Mitte 1 1/2 " breit und 5/8 " dick, an allen 4 Seiten geschliffen, jedoch an mehreren Stellen ausgesprungen, wahrscheinlich zum Einsetzen in eine Keule benutzt, gefunden und von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar geschenkt.
Kleiner Keil aus Feuerstein,
3 1/2 " lang, 2 " breit, nur 3/4 " dick, in Meklenburg von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.
Keil von Hornblende,
7 " lang, 3 " breit und gegen 2 " dick, in Meklenburg von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.
Dolchgriff aus Feuerstein,
viereckig, gefunden auf dem Felde von Wolfen bei Bützow von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow und geschenkt von demselben.
Eine abgebrochene Dolchspitze aus Feuerstein,
in Meklenburg gefunden, ward von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin dem Vereine geschenkt.
Ein vierseitig zubereiteter Feuerstein,
3 " lang und 1 1/2 " dick, nach beiden Enden hin in vier Flächen zugespitzt, so daß das Ganze zwei mal vier Flächen hat, welche


|
Seite 275 |




|
an beiden Enden zusammenstoßen, einem kleinen (nicht durchbohrten) Doppelhammer nicht unähnlich, in Meklenburg von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.
Ein Feuersteinspan,
in Gestalt eines Messers, 6 " lang, an den Kanten abgenutzt und offensichtlich gebraucht, gefunden am Mahnkenberge bei Bützow von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow und geschenkt von demselben.
Ein Feuersteinspan,
dick und roh, von der ersten Absplitterung, gefunden bei Bützow auf dem ersten Hohenfelde von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow und geschenkt von demselben.
Sieben Feuersteinspäne,
kurz und dick, gefunden bei Bützow in der Darnow in dem Kies der Eisenbahn von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow und geschenkt von demselben.
Die Fabrication der Feuersteingeräthe
zu erläutern, schenkte der Herr Staatsanwalt Rosenberg zu Bergen auf der Insel Rügen eine Sammlung charakteristischer Stücke, welche auf Fabrikstätten auf der Insel Rügen gesammelt sind, namentlich:
8 roh zugehauene Keile und Lanzen,
4
Pfeilspitzen von Schönen Formen und
über 100 Stück Späne, Spanmesser, Schleudern und andere bei der Bearbeitung der Feuersteine abgesprengte Stücke, endlich
ein Stück Harzkuchen aus einer Urne.
G. C. F. Lisch.
Schleifstein von Rogeez.
Zu Rogeez bei Malchow ward vor mehreren Jahren ein Schleifstein aus altem rothen Sandstein aus der Stein=


|
Seite 276 |




|
periode, 1 Fuß lang, 5 Zoll breit, 3 Zoll dick und 11 Pfund schwer gefunden und von dem Herrn Major von Bülow, auf Rogeez an die großherzogliche Alterthümersammlung geschenkt.



|


|
|
:
|
Reib=, Roll= oder Klopfsteine von Friedrichshöhe.
Zu Friedrichshöhe bei Rostock, der Besitzung des Herrn Ritter, fand dieser beim Ausfahren eines Moderloches von 6 bis 7 Ruthen Ausdehnung und gegen 10 Fuß Tiefe in der Mitte, beim Ausgraben von 470 Fudern nach und nach elf Klopf= oder Reibsteine, in der Tiefe, 1 bis 2 Fuß über dem Sandgrunde, so daß in der Mitte an 7 Fuß reine Modererde aus organischen Stoffen darüber gewachsen war. Die Steine bestehen vorherrschend aus weißem, alten Sandstein, dem Material der alten Schleifsteine für die feuersteinernen Geräthe, einige auch aus dem seinkörnigsten Granit oder aus vulkanischem Gestein, sind also alle sehr hart. Man sieht aus der Reihenfolge die allmählige Abschleifung bis zur Kugel ganz klar. Einige Steine haben noch große, natürliche, glatte Bruchflächen und haben noch eine längliche Gestalt; andere sind an vielen Stellen rundlich abgerieben und zeigen nur noch wenige, kleinere, natürliche Flächen; noch andere sind vollkommen kugelförmig abgerieben. Die Steine haben einen Durchmesser von 3 bis 5 Zoll; die kleinsten sind diejenigen, die sich der Kugelgestalt nähern, also am meisten abgerieben sind; dies sind aber auch zugleich diejenigen, welche aus anderer Steinart, als aus altem Sandstein sind. Diese Steine haben offenbar zu häuslichen Zwecken in den ältesten Zeiten gedient. Man hat wohl hin und wieder gemeint, diese Steine hätten zum Zurechtklopfen der steinernen Geräthe der ältesten Zeit gedient und sie daher Klopf= oder Knacksteine genannt; hiezu mag aber die Kugelform am wenigsten passen. Es ist auch keine Spur vorhanden, aus der man schließen könnte, daß etwas Hartes damit geschlagen wäre. Dagegen ist es klar sichtbar, daß die Steine ihre Rundung durch Reiben erhalten haben. Ich möchte daher annehmen, daß diese Steine zum Zerreiben des Brotkorns in den halbmuldenförmig ausgehöhlten Mühlsteinen gebraucht worden seien, ohne mit dieser Ansicht andern entgegentreten zu wollen.
Auffallend ist es, daß einige Steine vollkommen kugelförmig sind. Die Steine sind also entweder nach und


|
Seite 277 |




|
nach beim Gebrauch für andere Zwecke so rund gerieben, und in diesem Falle ist die Abrundung nicht absichtlich und die Steine können dann Reibsteine sein; - oder die kugelförmige Abreibung ist von vorne herein beabsichtigt, und in diesem Falle sind die noch nicht kugelförmig gestalteten Steine noch nicht vollendet und zu andern Zwecken als zum Reiben bestimmt. Ist die kugelförmige Gestaltung von vorne herein beabsichtigt, so können die Steinkugeln aus der Steinperiode 1 ) auch dazu bestimmt gewesen sein, die großen Decksteine auf die Hünengräber hinaufrollen zu helfen. Se. Majestät der König von Dänemark hat in einer in der Nordischen Gesellschaft zu Kopenhagen am 29. Mai 1857 gehaltenen Vorlesung 2 ) (vgl. Antiquarisk Tidsskrift, 1855 - 1857, Heft I, Kjöbenhaven, 1857, p. 88 flgd.) diesen Gegenstand zu einer besondern Untersuchung gewählt, da es allerdings fast unbegreiflich ist, wie die Menschen der Steinperiode ohne Maschinen so gewaltige Massen haben bewegen und heben können. Se. Majestät hat nun sehr wahrscheinlich gemacht, daß nach Aufrichtung der Tragsteine die Decksteine auf einer zum Zweck der Hinaufschaffung gefertigten schiefen Ebene bis zur Höhe der Spitzen der Tragsteine hinaufgerollt seien. Dies konnte durch Rollhölzer geschehen, meiner Ansicht nach aber auch vtelleicht durch steinerne Kugeln oder durch Mithülfe derselben. Und waren Kugeln hiezu nicht ganz zweckmäßig, so konnten sie vielleicht zur Fortbewegung auf der geraden Ebene gebraucht sein. Auch der große Denkstein am Seebade Doberan, welcher größer ist, als die größten Decksteine der Steingräber, ward auf metallenen Kugeln nach dem Seebade Doberan gerollt. Die große Menge der zu Friedrichshöhe gefundenen Steine scheint auch für diese Ansicht zu sprechen, da die Vermuthung dafür spricht, daß man sie rund reiben wollte, es dagegen nicht wahrscheinlich ist, daß auf einer Stelle so viel Mühlreibsteine mit einem Male sollten versenkt sein.
Am wenigsten glaube ich, daß diese Steine zu Schleuder=
Sur la construction des salles dites des géants par S. M. le Roi FrédéricVII. de Danemark. Copenhague. 1857.


|
Seite 278 |




|
steinen gebraucht worden seien; denn theils brauchten diese nicht gerade ganz rund zu sein, theils wäre die Arbeit woht zu groß gewesen, Steine rund zu reiben, um sie wegzuwerfen.
In gleicher Tiefe mit den Steinen lagen in dem Moderloche auch noch große und kleine Scherben von alten Gefäßen, welche sicher heidnisch sind, da sie mit zerstampftem Granit durchknetet sind; die Scherben sind aber sehr roh geformt, haben also zum häuslichen Gebrauche gedient.
Aus der Tiefe, in welcher Alterthümer dieser Art in Torf und Moder liegen, kann man wohl schwerlich einen sichern Schluß auf die Zeit machen, in welcher diese Gegenstände versunken sind, als die Moderlöcher noch Wasser waren. Schwere Gegenstände drücken sich leicht durch, bis sie festen Grund finden.
Außerdem ward in dem Moderloche noch die Hälfte einer großen durchbohrten Scheibe (eines Netzsenkers?) von gebranntem gelben Thon, 4 " im Durchmesser und 2 1/2 " dick, gefunden, welche aber wohl einer neuern Zeit angehört.
G. C. F. Lisch.
Ein kugelförmiger Stein
aus weißem, alten Sandstein, ungefähr 3 1/2 " im Durchmesser, an vielen Stellen so abgerieben, daß der Stein mit vielen in einander übergehenden Flächen fast kugelförmig ist, ward in Meklenburg gefunden und von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin dem Vereine geschenkt. (Vgl. die Reibsteine von Friedrichshöhe im Vorausgehenden.)


|
Seite 279 |




|



|


|
|
:
|
b. Zeit der Kegelgräber.
Kegelgrab von Dabel Nr. 3.
(vgl. Jahrb, XXII, S. 279 flgd.)
Neben dem großen, merkwürdigen Kegelgrabe von Dabel Nr. 1, welches der Herr Pastor Böcler zu Gägelow im October 1856 für den Verein aufdeckte, steht, ungefähr 30 Schritte von demselben entfernt, auf derselben Erhebung ein zweites großes Kegelgrab, in gleicher Front gegen Osten, so daß beide Gräber im Zusammenhange zu einander zu stehen schienen. Der Herr Pastor Böcler trug lange den Wunsch, auch dieses Grab im Interesse der Wissenschaft in meiner Gegenwart aufzudecken; dieser Wunsch konnte am 13. und 14. October 1857 erfüllt werden, da ich mich in dieser Zeit zu Gägelow aufhielt. Der Herr Pastor Böcler zu Gägelow übernahm mit großer Bereitwilligkeit alle Lasten und Kosten des Unternehmens und der Herr Erbpächter Schmidt zu Gägelow und der Herr Pächter Dühring zu Pastin stellten eben so bereitwillig Arbeiter zur Hülfe. Die Aufgrabung geschah unter meiner Leitung, unter Beistand des Herrn Erbpächters Wiechmann zu Kadow und der genannten Herren, so wie in zeitweiser Anwesenheit vieler theilnehmenden Männer aus der Umgegend, so daß diese Aufgrabung eine große Anregung hervorbrachte.
Das Grab war dem aufgedeckten Kegelgrabe Nr. 1 sehr ähnlich und fast eben so groß. Es war ein Erdhügel mit fester Rasendecke bewachsen, jedoch auf der Spitze schon etwas abgegraben, da in diesem Hügel früher offensichtlich nach Füchsen gegraben war, wie sich denn auch im Fortschritt der Aufgrabung tief im Innern des Hügels überall Fuchsgänge zeigten. Von Steinen war im Aeußern keine Spur zu entdecken. Das Grab hatte eine kegelförmige Gestalt mit runder Basis, einen Umfang von ungefähr 160 Fuß und noch jetzt eine Axenhöhe von ungefähr 9 Fuß; die früher abgegrabene Spitze mochte 2 bis 3 Fuß betragen haben.
Die Aufgrabung ward im Osten des Grabes mit einem breiten Durchschnitt begonnen und grade gegen Westen hin


|
Seite 280 |




|
durchgeführt; jedoch zeigte es sich im Fortschritte der Arbeit, daß die Bestattung mehr in der Richtung von Südost nach Nordwest angelegt war, weshalb gegen die Mitte hin der Durchschnitt nach Norden hin erweitert werden mußte.
Einige Fuß vom Rande im Osten fand sich bald auf dem Urboden eine Brandstätte: die Erde war stark mit Kohlen und Asche gemischt, unter welchen sich einzelne zerbrannte Knochensplitter zeigten; übrigens fanden sich einzelne Kohlen durch den ganzen Hügel zerstreut. In der Erdschicht unmittelbar über dieser Brandstätte bis zu einem Fuß Höhe fanden sich zerstreut einige größere Stücke menschlicher Gebeine, welche nicht zerbrannt waren, namentlich ein 6 Zoll langes Stück von einem Röhrenknochen, welches von Rauch schwärzlich gefärbt, also wohl nicht vom Leichenbrande ergriffen gewesen war. Nach der geringen Stärke des Knochens scheint dieses Bruchstück einer weiblichen Leiche anzugehören. Hiezu mag denn auch vielleicht stimmen, daß neben diesen Knochen ein röthlich gebrannter Spindelstein von Thon gefunden ward. Dieser Spindelstein hat jedoch eine jüngere Gestalt und scheint, nach der Regelmäßigkeit der concentrischen Ringe, gedreht zu sein. Vielleicht drehte man aber in alter Zeit die Spindelsteine auf einer Spule; vielleicht mag der Spindelstein aber auch durch eine jüngere Bestattung in das Grab gekommen sein. Die Sache ließ sich durchaus nicht genauer erforschen.
Andere Knochen werden durch die Füchse in das Grab gekommen sein, so z. B. ein bearbeiteter Thierknochen, welcher offenbar neu ist.
Die Beisetzung der Gebeine und der Geräthe war in der Mitte des Hügels geschehen. Hier lag 10 Fuß vom Ostrande entfernt auf dem Urboden ein Pflaster von Feldsteinen, 12 Fuß lang und 7 Fuß breit, von oblonger Gestalt. Die vier Seiten waren mit größern Steinen regelmäßig und fest umstellt; die vier Ecken waren ebenfalls von größeren Steinen aufgeführt, so daß die Ecken als Steinpfeiler über den Steinkegel in die obere Erde hinein ragten. Dieses Steinpflaster war 5 Fuß hoch mit fest geschichteten Feldsteinen bepackt, welche seitwärts über das Pflaster hinweg reichten, so daß das Grab im Innern einen großen Steinkegel barg, welcher überall mit Sand kegelförmig bedeckt war. Die innere Einrichtung des Grabes war also dem Innern des Grabes Nr. 1 an Einrichtung und Größe ganz gleich.
Unter diesem Steinhügel, unmittelbar auf dem Steinpflaster waren die verbrannten Leichen und deren Ge=


|
Seite 281 |




|
räthe beigesetzt. Die Sachen waren auf die unregelmäßig geformten Steine gelegt und mit eben solchen Steinen belegt, so daß bei der Aufgrabung die Alterthümer in engen Spalten zwischen den Steinen zu liegen schienen. Durch diese Unregelmäßigkeit der Lage waren aber mehrere Alterthümer zerbrochen und schwer zu gewinnen.
Nach den Altherthümern scheinen in dem Hügel zwei verbrannte Leichen auf demselben Steinpflaster beigesetzt gewesen zu sein. Die eine Gruppe von Alterthümern lag im Osten, die andere im Westen auf dem Steinpflaster.
Osten hatten zwei Urnen gestanden, von denen die eine etwas größer war, als die andere. Die Urnen hatten neben einander gestanden; die größere war von der Last der eng gepackten Steine ganz zerdrückt und lag in Scherben breit auf den Steinen; die kleinere war umgefallen und lag wohlerhalten auf der Seite über den Scherben der andern, durch einen außerordentlichen Zufall durch fest an einander geschobene Steine geschützt, welche sie fast berührten und nur wenig beschädigt hatten. Die kleinere Urne enthielt nur Sand und Asche, war also ein cinerarium, wie gewöhnlich. Beide Urnen haben eine kugelige Gestalt, mit kaum merklichem Rande, sind schwarz, glatt und ohne Verzierungen, wie gewöhnlich die Urnen der alten Kegelgräber, welche im Innern große Kegel von kleinen Steinen enthalten. Alle Urnen aus diesen scheinbar gleichzeitigen Gräbern sind unter einander gleich.
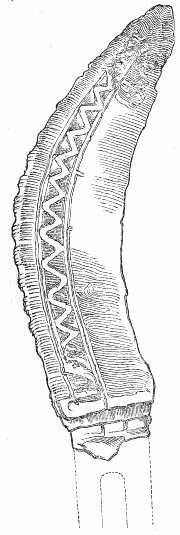
Einige Zoll südlich lag neben den Urnen ein sehr schönes Messer von Bronze, von sichelförmiger Gestalt (jedoch keine Sichel), 4 " lang in der Klinge, auf dem Rücken mit kleinen Buckeln und Querstrichen, am Rücken auf der Klinge auf beiden Seiten mit einem erhabenen Zickzackbande verziert. Der dünne, ausgehöhlte Griff, welcher mit Holz bekleidet war, war abgebrochen. (Vgl. den nebenstehenden Holzschnitt.)


|
Seite 282 |




|
Nicht weit von den Urnen gegen Westen lagen in einer kleinen Höhlung zwischen den fast sich berührenden Steinen mehrere bronzene Alterthümer: zwei voll gegossene, dicke Armringe, ein dünnerer Armring, ein Halsring, ein Hütchen. Alle diese Alterthümer lagen in einer Lücke von kaum einer Faust groß zwischen den Steinen und waren eng in einander geschlungen und geschoben. Der kleine Armring ist vollständig und in seiner Form erhalten; von den beiden dickeren Armringen ist der eine in zwei Stücke zerbrochen und hat alte Rostenden; der zweite ist fast grade auseinander gezogen und an den Enden zerbrochen und war mit einem Ende an den anderen festgerostet; der Halsring war in sehr viele Stücke zerbrochen. Alle Bronzen sind stark gerostet, an vielen Stellen aufgetrieben, der Länge nach häufig gespalten und stark angegriffen, so daß sie dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen zu sein scheinen, mit Ausnahme des kleinern Armringes, welcher wohl erhalten ist und vielleicht zu dem Röhrenknochen gehört, welcher sich auf der Brandstätte fand, und von dem Leichenbrande nicht zerstört worden zu sein scheint.
Dieses Begräbniß gehörte nach den Alterthümern offenbar einer weiblichen Leiche. Ist dieses sicher, so würde sich daraus der Schluß ziehen lassen, daß die Hütchen zum Frauenschmuck gehören.
Ungefähr 4 Fuß von den Urnen weiter gegen Westen lagen eben so zwischen die Steine verpackt andere Alterthümer, welche offenbar einer männlichen Leiche angehört haben. Jedoch war keine Spur von Urnen oder Gebeinen zu finden.
Auf der westlichen Seite des Steinpflasters lag ein schöner Dolch von Bronze, mit der Spitze gegen Osten gekehrt, als wenn er mit der Spitze nach unten hangend einer nach Osten schauenden Leiche am Gürtel gehangen hätte. Der Dolch (oder ein ungewöhnlich kurzes Schwert) ist im Ganzen 15 Zoll, die Klinge 11 Zoll, der Griff (ohne Knopf) 2 3/4 Zoll und der Knopf 1 1/4 Zoll lang. Die schmale Griffzunge läuft ohne Nietlöcher in die Klinge über. Der Knopf, welcher noch an die Griffzunge angenietet ist, hat eine rhombische Gestalt und eine öfter vorkommende Verzierung. Der Griff war von Holz gewesen, welches noch fest den hohlen Knopf füllt. Die Klinge war ein Mal durchbrochen ins Grab gelegt, da die Bruchenden alten Rost haben.


|
Seite 283 |




|

Zur rechten Seite des Dolches, etwas über den Knopf hinaus, lagen zwei Pfeilspitzen aus Feuerstein neben einander, mit den Spitzen gegen Westen gekehrt, so daß die Pfeile, wenn sie einer nach Osten schauenden Leiche in die Hand gegeben gewesen wären, mit den Spitzen nach dem Kopfe hin gelegen hätten. Die Pfeilspitzen sind den in den Jahrb. XXII, S. 282 und hier wieder abgebildeten gleich. Auch an diesen Pfeilspitzen war die hölzerne Schäftung noch vollkommen erhalten, an einer sogar noch festsitzend, so lang die feuersteinerne Pfeilspitze ist.

Das dünne Holz geht allmählig in die Flächen des mit den Kanten hervorragenden Steins über und hat an beiden flachen Seiten eine sauber und fein eingeschnitzte Rille, in welche noch ein anderes Holz oder Befestigungsmaterial einfassen konnte, wie der beistehende Holzschnitt andeutet. Diese Schäftung, welche noch ganz vollkommen so, wie Sie hier abgebildet ist, erhalten war, ist bei dem hohen Alter des Pfeiles eine gewiß sehr seltene Erscheinung. Die Arbeit ist in jeder Hinsicht vortreffIich. - Durch diese Pfeilspitzen gleicht dieses Grab ganz dem seltenen Grabe Nr. 1 von Dabel.
Ueber den Dolch und die Pfeilspitzen hinaus, am westlichsten Ende des Steinpflasters, also ungefähr am Kopfende einer unverbrannt beigesetzten, nach Osten schauenden Leiche lag, fest zwischen Steine verpackt, ein faustdickes, ungefähr 1 Fuß langes Stück Eichenholz, welches man in dünnern Verhältnissen gegen Westen hin ein Ende lang verfolgen konnte. Allem Anscheine nach war dies eine nach oben gerichtete Keule von Eichenholz gewesen. Es ist noch ein ziemlich wohl erhaltenes, jedoch sehr leicht gewordenes Stück Holz von ungefähr 3 Zoll Länge, 1 Zoll Dicke und 1 1/2 Zoll Breite aus dem Grabe gerettet, allerdings eine große Seltenheit. Dieses Holz, welches unter dem ganzen Steinkegel lag, muß nothwendig bei der Bestattung eingelegt worden sein, weil die eng gefügten Steine keinen Raum zur Durchlassung einer Baumwurzel übrig ließen.
Dieses merkwürdige Grab schließt sich zunächst an das in Jahrb. XXII, S. 279 flgd., beschriebene Grab von Dabel Nr. 1 und fällt mit demselben offenbar in dieselbe Periode. Dies beweisen nicht allein die steinernen Pfeilspitzen und die hölzerne Keule, sondern auch die Beschaffenheit


|
Seite 284 |




|
der in das Grab gelegten, dem Leichenbrande nicht ausgesetzt gewesenen Bronzen: der Dolch ist fast durch und durch von Oxyd durchdrungen und zeigt im Bruche im Innern des Mittelrückens nur noch einen dünnen Streifen röthlichen Erzes; der Rost ist nirgends mehr edel, sondern hat das Erz überall durchdrungen und an vielen Stellen in parallele Flächen gespalten.
Es leidet daher keinen Zweifel, daß dieses Grab zu den ältesten Gräbern der Bronzeperiode gehört und sich den in Jahrb. XXII, S. 286 zur Vergleichung gezogenen Kegelgräbern unmittelbar anschließt.
G. C. F. Lisch.
Kegelgrab von Letschow.
Zu Letschow bei Schwaan ward bei einem Grabe von einem Bauern ein bronzenes Schwert ausgepflügt, welches unter Steinen, wahrscheinlich in einem niedrigen, abgepflügten Kegelgrabe lag; es ist ein Schwert mit Griffzunge, in der Klinge 21 " lang, und war beim Auspflügen nicht zerbrochen; späterhin ist es ein Mal durchgebrochen und an der Griffzunge verstümmelt. Der Herr Amtsdiätar Otto Grotrian zu Schwaan erwarb dieses Schwert und machte es dem Vereine zum Geschenke.
Framea von Proseken.
Eine Framea, mit Schaftrinne, voll gegossen, mit schönem, edlen Rost bedeckt, gefunden zwischen Proseken und Zierow, ward geschenkt von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar.
Eine Sichel aus Bronze,
6 " lang, mit Rost bedeckt, in Meklenburg gefunden, ward von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin dem Vereine geschenkt.
Hütchen von Schwerin.
Im Schloßküchengarten bei Schwerin, in dem Abhange nach dem Kalkwerder hin, ward mehrere Fuß tief in moorigem Grunde ein bronzenes "Hütchen" (wie Frid. Franc. Tab.


|
Seite 285 |




|
XXXIII, Fig. 10), ohne Rost, von dem Herrn Hofgärtner Lehmeyer gefunden und von dem Herrn Segnitz dem Vereine geschenkt.
Eine bronzene Spule,
gefunden in der Mark Brandenburg, genau so wie die Jahrb. XIX, S. 318, beschriebene und abgebildete Spule von Viecheln, besitzt der Herr Registrator Voßberg zu Berlin in seiner kleinen, aber interessanten Alterthümersammlung. Vgl. Jahrb. XXI, S. 238.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 286 |




|
c. Zeit der Wendengräber.



|


|
|
:
|
Wendenkirchhof von Göthen.
Am Wege von Göthen nach Rutenbeck, D. A. Crivitz, liegt auf der Feldmark von Göthen, im sogenannten Streitkamp, ungefähr 1/4 Stunde in grader Richtung von dem Burgwall von Friedrichsruhe (vgl. Jahrb. XVIII, S. 273), ein Hügel, aus welchem im Winter 1856 - 57 Erde zur Uebersandung der dabei liegenden Niederung abgefahren ward. Bei dem Abgraben der Erde wurden ziemlich viele Urnen gefunden, an manchen Tagen zwei bis drei, welche aber leider fast alle in Scherben zerfielen. Nur vier derselben blieben durch die Fürsorge des Herrn Inspectors F. Prüssing zu Göthen ziemlich gut erhalten. Sämmtliche Urnen standen dem Anscheine nach unregelmäßig in der Entfernung von ein und mehreren Fußen von einander und etwa 1 Fuß unter der Oberfläche des Bodens, so daß sie vom Pfluge noch nicht berührt waren. Alle enthielten in ihrem untern Raume vom Feuer ausgeglühete Knochensplitter, während die obere Hälfte mit Erde gefüllt war. Nur in der größten der vier erhaltenen Urnen, welche am schönsten verziert ist, fanden sich vier kleine Lanzenspitzen und ein Messer, verhältnißmäßig gut erhalten. Aller Wahrscheinlichkeit nach stehen in dem noch unberührten Theile des Hügels noch mehr Urnen.
Kladow, den 26. August 1857.
Willebrand.
Durch die Bemühungen des Herrn Pastors Willebrand zu Kladow sind diese Alterthümer von demselben erworben und dem Vereine zum Geschenke gemacht. Die vier Urnen, welche ganz die Form und Verzierung der Urnen der Eisenperiode haben, sind alle hellbraun und fast ganz erhalten; die eine derselben hat die gewöhnliche Größe, die drei übrigen sind nur klein. Die Urnen sind folgende:
eine große Urne, 7 " hoch und 11 " weit im Bauchrande, ganz von der Gestalt und ähnlichen Verzierungen, wie


|
Seite 287 |




|
die Urne in Jahrb. XII, S. 433, Nr. 7; die Urne hat einen starken Henkel mit einer Oeffnung von dem Umfange eines Daumens;
eine kleine Urne von 5 " Höhe und 6 1/2 " Bauchweite, mit Zickzacklinien am Rande verziert, wie Jahrb. XII, S. 429, Nr. 2;
eine kleine Urne von 4 1/2 " Höhe und 7 " Bauchweite, mit Parallellinien am Rande verziert;
eine kleine Urne von 6 " Höhe und 9 " Bauchweite, kugelig und ohne Gliederung in der Form und ohne alle Verzierung.
In der größten Urne lagen folgende eiserne Alterthümer:
vier eiserne Lanzenspitzen, alle ungewöhnlich klein und dünne, jedoch gut gearbeitet und verhältnißmäßig wenig gerostet, drei 3 1/2 ", 3 1/4 " und 2 1/2 " in der Klinge lang, die vierte zerbrochen;
ein eisernes Messer, von gewöhnlicher Form, 4 " in der Klinge lang.
Späterhin hat einer der Arbeiter noch eine fast gar nicht gerostete eiserne Nadel, 2 1/2 " lang, mit rundem Knopfe, deren Spitze jedoch abgebrochen ist, abgeliefert.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Wendenbegräbniß von Vorbeck.
Vor etwa fünf Jahren fand ein Arbeiter beim Ausroden von Tannenstämmen auf dem Felde des Gutes Vorbeck, R. A. Crivitz, in der Nähe des Schlie=Sees zwei bronzene Hefteln mit Spiralfeder von der gewöhnlichen Gestalt der häufig vorkommenden Hefteln der Wendengräber; die eine derselben ist vollkommen wohl erhalten und hat noch Federkraft, die andere ward schon zerbrochen gefunden und ist nur noch der Bügel davon vorhanden. Ohne Zweifel hatten diese Hefteln in einer Urne gelegen, deren Scherben dabei lagen; die Wurzeln der Tanne waren durch die Urne gewachsen und hatten dieselbe zersprengt. Der Herr Uedermann auf Vorbeck macht die Hefteln dem Vereine zum Geschenk.
Kladow, den 26. August 1857.
Willebrand.


|
Seite 288 |




|
Wendenbegräbniß von Wotenitz.
Auf dem Schullehreracker zu Wotenitz bei Grevismühlen ward bei Umarbeitung des Ackers vor einer geringen Anhöhe 15 Zoll unter der Erdoberfläche gefunden:
eine Urne, halb zerbrochen, in welcher in Asche und zerbrannten Knochen
eine kleine zierliche Heftel von Bronze,
eine gleiche Heftel von Eisen, stark gerostet und zerbrochen, und
acht Glasperlen, nämlich 7 kleine und eine größere, von schmutzig weißem und von blauem Glase, lagen.
Der Herr Unterofficier Büsch zu Wismar erwarb diese Alterthümer und schenkte dieselben dem Vereine.
Urne von Dömitz.
Im Torfmoor von Dömitz ward vor einigen Jahren von einem alten Schmied eine große, wohl erhaltene Urne gefunden, von cylinderförmiger Gestalt, 15 " hoch, 13 " weit im Bauche und 8 1/2 " weit in der Mündung. Sie war mit Asche und halb verbrannten Gebeinen gefüllt und mit einem flachen, nicht bearbeiteten Granit von 1 1/2 Fuß Länge und 1/2 Fuß Breite bedeckt. Sie ist durch freundliche Bemühung von dem Herrn Rector Thiem zu Dömitz erworben und dem Vereine geschenkt.
Zwei Spindelsteine
aus gebranntem Thon, gefunden in Meklenburg, wurden geschenkt von dem Herrn Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin.
Ein Menschenschädel,
gefunden zu Godern auf einem heidnischen Begräbnißplatze im trocknen Sande, ward geschenkt von dem Herrn Präpositus Dr. Schencke zu Pinnow.


|
Seite 289 |




|



|


|
|
:
|
2. Alterthümer des christlichen Mittelalters und der neuern Zeit.
Messingene Taufbecken von Dambeck.
Am 30. Juni 1857 wurden im Torfmoore von Dambeck bei Röbel, beim Bau der Chaussee von Plau nach Röbel, auf dem von der Chausseebau=Direction für die Chaussee erkauften Boden zwei große messingene Schalen gefunden. Unter der Einbildung, daß sie von Gold seien, ward Anfangs viel Aufhebens davon in den Zeitungen gemacht, bis sich sehr bald, wie zu erwarten stand, herausstellte, daß das vermeinte Gold nichts weiter als Messing sei. Dennoch fanden sich Kaufliebhaber, bis Se. Königliche Hoheit der Großherzog die beiden Becken für einen ziemlich hohen Preis für das großherzogliche Antiquarium anzukaufen befahl, nachdem die Chausseebau=Direction auf ihre Ansprüche verzichtet hatte Die wesentlichsten Verdienste um die Festhaltung und Erwerbung der Schalen hat der Herr Burgemeister Dr. Klitzing zu Plau, Mitglied der Direction.
Die beiden Schalen sind von der bekannten, weit und viel verbreiteten Art, mit der räthselhaften, viel besprochenen Inschrift. Im Allgemeinen haben diese Schalen keinen besonderen Werth, da sie sich, auch in Meklenburg, häufig als Taufbecken in den Kirchen finden. Man hätte daher gar kein besonderes Gewicht auf diese Schalen zu legen brauchen, um so weniger, als sie gerade keinen hohen Kunstwerth haben, wenn nicht die eine Schale eine ganz besondere Verzierung trüge und zur Bestimmung dieser viel besprochenen Geräthe beitragen könnte.
Das eine Becken ist von gewöhnlicher Gestalt und Größe, wie sich oft dergleichen finden und auch die Sammlung des Vereins für meklenburg. Geschichte ein Exemplar besitzt. Es hat einen Durchmesser von 22 Zoll im Ganzen. Auf dem Boden ist im Innern der englische Gruß (Ave Maria) in getriebener Arbeit dargestellt und umher die bekannte Inschrift mit einem Stempel eingeschlagen; auf dem Rande sind laufende Hirsche in getriebener Arbeit dargestellt. Dieses Becken ist also ganz gewöhnlich.


|
Seite 290 |




|
Das andere Becken ist aber größer und anders eingerichtet. Es hat einen Durchmesser von 27 Zoll im Ganzen; der Boden hat 16 Zoll im Durchmesser. Der Rand ist gegen 4 3/4 Zoll breit. Der Boden hat in der Mitte eine getriebene Rundung, welche von der besprochenen Inschrift und diese wieder mit einem Rande von laufenden Hirschen umgeben ist; der Rand ist ebenfalls mit laufenden Hirschen geschmückt: den Rand mit den Hirschen auf dem Boden hat dieses Becken vor andern voraus und daher ist es auch größer, als die meisten. Was dieses Becken jedoch besonders auszeichnet, ist die Verzierung der innern Rundung des Bodens, welche ein rundes Wappen von 7 1/2 Zoll Durchmesser darstellt. Es ist der doppelte, gekrönte Reichsadler mit einem Wappen auf der Brust, welches jedoch der Untersuchung bedarf. Das Wappen 1 ) hat eine Haupteintheilung, deren Bilder sich je zwei und zwei (1 und 4, 2 und 3) wiederholen, und jedes Viertheil ist wieder in vier Felder getheilt.
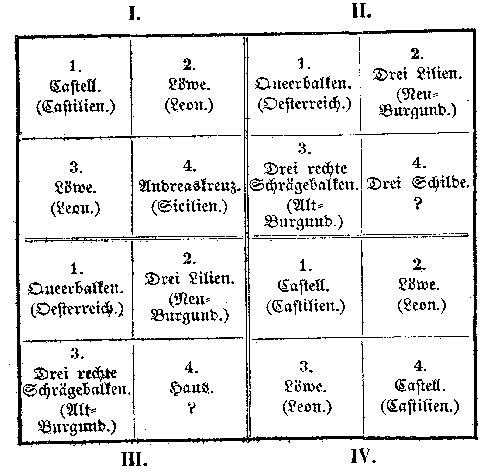


|
Seite 291 |




|
Man sieht, daß die Felder 4 nicht den Feldern 1 entsprechen, sondern in jedem Hauptviertheile verschieden sind. Alles Uebrige läßt sich wohl erklären, wenn sich auch kleine Bedenken regen mögen, so ist z. B. das Wappen I, 4 (Sicilien) im Andreaskreuze in vier Theile getheilt und hat in dem obern und untern Viertheile vier Pfähle und in den beiden Seitenviertheilen eine Kugel, statt Adler. Ferner haben die Felder II, 2 und III, 2 nur drei Lilien, statt daß das Feld eingefaßt und mit Lilien bestreut sein sollte. Jedoch sind die mit Oesterreich correspondirenden Felder II, 4 und III, 4 in der Heraldik der fürstlichen Häuser nirgends zu finden: das Feld II, 4 hat drei Schilde 1 3 2 grade so wie das bekannte Maler=Wappen; das Feld III, 4 hat ein Haus mit einer Thür und mit einem runden Dache, wie ein modernes Schilderhaus.
Die Hauptelemente dieses Wappens sind die Wappen, welche die deutschen Kaiser seit Carl V. führten, denn erst unter diesem Kaiser kamen die spanisch=burgundischen Wappen in den kaiserlichen Schild. Es läßt sich also mit Sicherheit annehmen, daß dieses Becken nicht vor Carl V. gefertigt sein kann. Aber auch nach diesem Kaiser wird es nicht gemacht sein, da Ferdinand mehr deutsche Wappenbilder in seinen Siegeln führte. Das Becken wird also unter dem Kaiser Carl V. gemacht sein. Dennoch läßt sich nicht sagen, daß Carl V. grade ein solches Wappen führte; die vielen bekannten Wappen und Siegel Carls V. sind alle anders angeordnet, wenn sich auch auf allen einige Elemente von dem Wappen des Taufbeckens finden.
Man kann also nur annehmen, daß das Wappen des Beckens eine decorative Fiction, vielleicht der Nürnberger ist, wenn das Wappen in Nürnberg getrieben ist, wie denn die Nürnberger zu allen Zeiten viel Decoration gemacht haben, die grade nicht strenge historisch ist.
Zu dieser Annahme stimmen denn auch die Felder II, 4 und III, 4. Das Feld II, 4 mit den drei Schilden im Schilde soll sicher das Maler=Wappen sein (vgl. unten zur Kunstgeschichte) und das Feld III, 4 mit dem Hause muß auf irgend eine, noch unbekannte Stadt, Zunft oder Person (Künstler oder Fabricant) sich beziehen. Man wollte also durch das Wappen wohl darstellen, wie nahe die Maler oder Künstler dem Fürstenhause Oesterreich standen. Vielleicht war diese Schale zu einer Eßschüssel irgend einer Künstlerzunft bestimmt; diese Schalen sind früher und werden noch jetzt auch zu Eßschalen benutzt.


|
Seite 292 |




|
So viel scheint durch dieses Becken festgestellt zu sein, daß die Becken dieser Art noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter dem Kaiser Carl V. als Fabrikwaare angefertigt wurden. Darauf deutet denn auch der Umstand hin, daß beide Becken denselben Fabrik= oder Handelsstempel RS mit den kleinen lateinischen Unzialen des 16. Jahrhunderts tragen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Alterthümer von Marlow.
Bei Marlow in der Reknitz, da wo vor alter Zeit eine Brücke stand, wurden im Jahre 1856 folgende eiserne Alterthümer gefunden und von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow dem Vereine geschenkt:
ein Hufeisen von ungewöhnlicher Kleinheit, nur 4 " hamb. Maaß lang und 3 1/2 " breit, mit sehr zweckmäßig gestalteten Nagellöchern, welche für die hohen, oblong gestalteten, dem Loche anpassenden Nagelköpfe so tief eingetrieben sind, daß zwischen dem Nagelkopfe und dem Hufe nur eine dünne Platte Eisen stehen bleibt, die Nagelköpfe also fast so lange halten, wie der Huf; der äußere Rand des Hufeisens ist durch das Eintreiben der Nagellöcher stark wellenförmig gestaltet;
ein Hufeisen, etwas größer, gegen 4 1/2 " breit und 4 3/4 " lang, mit eben solchen Löchern und darin passenden Nägeln;
ein Steigbügel, von alter, einfacher Form, defect;
eine Sichel, lang und schmal, in der Klinge 13 1/2 " in grader Richtung lang und ungefähr 1 " im Mittel breit, sehr beschädigt.
Einen kurzen Degen
("Rüting") von Eisen aus dem 16. Jahrhundert, gefunden zu Repnitz, schenkte der Herr von Oertzen auf Repnitz dem Vereine.
Ein eiserner Sporn,
gefunden beim Ausgraben des Wallgrabens der Festung Dömitz, ward geschenkt von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar.


|
Seite 293 |




|



|


|
|
:
|
Hölzerne Teller von Güstrow.
In einem an der Nordseite des Marktes zu Güstrow belegenen alten Bürgerhause, welches früher im Besitze des Kürschners Teetz war und jetzt dem Herrn Kürschner Saß gehört, wurden bei dem Durchbau des Hauses in einem vermauerten alten Wandschranke zwei hölzerne Teller gefunden, welche der Herr Saß dem Vereine zu schenken die Freundlichkeit hatte. Diese sehr merkwürdigen Teller sind hölzerne Scheiben oder "Bricken", wie man sie jetzt nennt, von 6 1/2 " Durchmesser, und ganz flache Scheiben; der eine ist ungefähr 3/8 " dick und hat an beiden Seiten umher einen ganz niedrigen erhabenen Rand, der andere ist noch einmal so dick und ohne Randerhöhung. Wahrscheinlich haben diese Scheiben oder "Bricken" zu "Confecttellern" gedient, da sie wegen ihrer Gestalt und Verzierung nur zu trockenen Sachen gebraucht werden konnten. Beide sind, wenn auch im Style der Verzierung etwas von einander verschieden, doch ohne Zweifel von derselben Hand verfertigt, da die auf ihnen befindliche Schrift von derselben Hand ist.
Diese Teller sind durch die Art ihrer Verzierung merkwürdig und werthvoll, da sie einen klaren Blick in die Bildung der Zeit geben, in der sie verfertigt sind. Sie sind nämlich an beiden Seiten mit architektonischem Blattwerk in roth und gelb und schwarz bemalt, so daß der Grund roth, das Blattwerk gelb, die Umrisse Schwarz sind; nach der Bemalung sind die Scheiben mit einem sehr dauerhaften Lack überzogen, der noch heute vollkommen wohl erhalten ist und jeder Nässe widersteht.
Diese Scheiben sind so verziert, daß in der Mitte ein runder Schild von etwa 1 1/2 " Durchmesser mit einem Symbole Christi steht. Dieses ist von einem innern Rande mit einer Inschrift umgeben, etwa 3/4 " breit. Dann folgt ein Kreis mit architektonischem Blattwerk von 1 1/4 " Breite. Auf dem äußern Rande von ungefähr 3/4 " Breite steht eine zweite Inschrift.
Die Inschriften geben einen ziemlich sichern Maaßstab für das Alter dieser Teller. Nach dem Charakter der Schriftzüge und der reinen plattdeutschen Sprache, auch der Verzierungen, fallen sie in die Zeit von ungefähr 1480 - 1500; man wird sicher gehen, wenn man die Zeit um das Jahr 1500 als die Verfertigungszeit annimmt; die Teller können etwas älter sein, jünger wohl nicht.


|
Seite 294 |




|
Die interessanten Inschriften dieser Teller sind folgende:
I. Erster Teller.
A. Eine Seite
1) In der Mitte:

(d. i. Jesus).
2) Innerer Inschriftrand 1 ):
help here goth
vth aller noth
dorch dynen bytteren doth
amen.
(Hilf Herre Gott
aus aller Noth
durch deinen bitteren Tod
Amen.)
Vele er werth enes fwerdes how tho reke 2 )
wen ener bosen tunge steke
eyn vntruwe mynsche mit deme munde
is boser wen eyn arge bose wunde.
(Viel eher heilt ein Schwerthieb sicherlich,
als einer bösen Zunge Stich;
ein Mensch untreu mit seinem Munde
ist böser als eine arge, böse Wunde.)
B. Andere Seite.
1) In der Mitte:

(d. i. Christus).


|
Seite 295 |




|
Och here vorlene vns dyne gnade
vnde gyff frede in vnssen dagen.
(Auch Herr verleihe uns Deine Gnade
und gieb Friede in unsern Tagen.)
Ayn ider late syck dar an benoghen
dat syck tho synen handel wyl fogen
werth he dar bauen tho vele begheren
ßo moth he dat grote myth deme kleynen entberen.
(Ein jeder lasse sich daran genügen,
was sich zu seinem Handel will fügen;
will er darüber zu viel begehren,
so muß er das Große mit dem Kleinen entbehren.)
II. Anderer Teller
A. Eine Seite.
1) In der Mitte:

(d. i. Jesus).
2) Innerer Inschriftrand:
So holt men encheyt recht
wen de ene des andren borde drecht.
(So hält man Einigkeit recht,
wenn der Eine des Andern Bürde trägt.)
Wol dar bespottet my vnde de mynen
de gha tho hus vnde beße de synen
vppe dat he se den anebrek 1 )
ßo kame he balde vnde strasse myck.


|
Seite 296 |




|
(Wer da bespottet mich und die Meinen,
der geh nach Haus' und beseh die Seinen,
auf daß er seh, was ihm gebricht,
dann komme er bald her und schelte mich.)
oder:
(auf daß er sein Gebrechen schau
und nehm's mit Andern nicht zu genau.)
B. Andere Seite
1) In der Mitte:
Eine Kreuzrosette.
2) Innerer Inschriftrand:
he is arger wen vorgyfft 1 ) vnde fenyn 2 )
de dar vyenth ys vnde wyl frunth syn.
(Der ist ärger als Gift und Pest,
Der da Feind ist und Freund läßt.)
De fyne frunde prouen 3 ) wyl vnde schal
de proue ße in vngeual 4 )
wenthe frunde der werlt in grother noth
der gan wol ver vnde twynchtych vp ein loth.
(Wer seine Freunde prüfen will und mag,
Der prüfe sie in Ungemach;
Denn Freunde der Welt in großer Noth,
Der gehn wohl vierundzwanzig auf ein Loth.)
G. C. F. Lisch.


|
Seite 297 |




|



|


|
|
:
|
Bronzener Henkeltopf von Gnoyen.
Zu Gnoyen ward in einer Sandgrube dicht bei der
Stadt ein Henkeltopf von Bronze gefunden und von
dem Herrn von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen
erworben und dem Vereine geschenkt. Der Topf ist
aus mittelalterlicher Bronze oder
"Grapengut" gegossen, demselben
Metall, aus welchem die alten Grapen gegossen
sind, hat drei dreiseitige Beine, einen großen
Henkel und eine unten geöffnete Ausgußdille und
ist mit den Beinen 10 1/2 " hoch, während
die Beine 3 " hoch sind. Das Ganze gleicht
einer modernen Kaffekanne mit drei hohen Beinen
und ist ohne Zweifel zum Kochen und Ausschenken
von Getränken oder Suppen gebraucht. So häufig
auch die alten Bronzegrapen von jeder Größe noch
vorkommen, so selten sind bronzene Henkeltöpfe
dieser Art. Im Innern sind auf der Henkelseite
drei Zeichen mit dem Topfe gegossen: in der
Mitte steht ein Zeichen wie zwei gekreuzte
Schwerter
 , zur Linken desselben ein Zeichen
wie ein
, zur Linken desselben ein Zeichen
wie ein
 , zur Rechten desselben ein
dreiseitiger, mit Kreuzstrichen schraffirter
Wappenschild mit einem glatten Queerbalken, wie
das Wappen der v. Peccatel, v. Plate, v. Zülow.
Der Topf scheint dem 14. Jahrhundert anzugehören.
, zur Rechten desselben ein
dreiseitiger, mit Kreuzstrichen schraffirter
Wappenschild mit einem glatten Queerbalken, wie
das Wappen der v. Peccatel, v. Plate, v. Zülow.
Der Topf scheint dem 14. Jahrhundert anzugehören.
G. C. F. Lisch.
Ein Löffel von Messing,
mit rundem Blatt, zu Kägsdorf bei Neu=Bukow an einem kleinen, runden Berge ausgegraben und von einem bützowschen Zinngießer auf dem Bukower Jahrmarkte mit altem Zinn gekauft, ward von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow erworben und dem Vereine geschenkt; der Stiel ist halb abgebrochen.
Ein Löffel von Messing,
gefunden bei Bützow, ward von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow erworben und dem Vereine geschenkt; der Stiel ist nur 2 Zoll lang und das Blatt zum größern Theile abgebrochen.
Ein Löffel von Messing,
mit rundem Blatt, am Ende des Stiels mit einer Traube, aus dem Ende des 15. oder der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammend, gekauft in Holstein, ward geschenkt von dem Herrn Rentier Wohlgemuth zu Schwerin.


|
Seite 298 |




|
Würfel aus gebranntem Thon.
Zu Rubow ward ein großer Spielwürfel auf einer Burgstelle im Walde neben Gefäßscherben gefunden. Der Würfel, welcher die gewöhnlichen Augen hat, ist von gewöhnlicher Ziegelarbeit und 2 1/4 Zoll im Cubus groß, was dieses Stück des Mittelalters interessant macht. Der Herr Hofmaler Schlöpcke zu Schwerin, welcher den Würfel geschenkt erhalten hat, hat denselben wieder dem Vereine zum Geschenke gemacht.
Ein Henkelkrug,
von weißgelber Farbe, 7 " hoch, gefunden zu Gremmelin, 10 Fuß tief bei Asche (wahrscheinlich in einem verschütteten Keller), ward geschenkt von dem Herrn Präpositus Dr. Schencke zu Pinnow.
Ein messingener Maaßstab,
gefunden zu Parchim, bei einem Hausbau in der Blutstraße im Bauschutt, ward von dem Herrn Baumeister Garthe zu Parchim dem Vereine geschenkt. Er trägt die eingeschlagene Jahreszahl 1657 und einen Stempel mit einem Thiere, wie es scheint einem Bären, ist zwei Fuß lang und zur Hälfte zum Einschlagen eingerichtet, jetzt jedoch zerbrochen. Von Interesse ist, daß die Zolle dieses Maaßstabes etwas länger sind, als die des jetzt in Meklenburg gebräuchlichen hamburger Fußmaaßes, wie folgt:
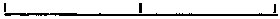 parchimscher Maaßstab,
parchimscher Maaßstab,
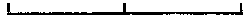 hamburger Maaß.
hamburger Maaß.
G. C. F. Lisch.
Eine Wasseruhr
schenkte der Herr Ad. Heinzelmann zu Tessin. Die Uhr soll sehr alt und seit dem Jahre 1700 im Besitze der Familie des Herrn Heinzelmann gewesen sein; sie trägt eine neuere Bemalung mit der Jahreszahl 1700.


|
Seite 299 |




|
Eine geschnitzte Verzierungsleiste
aus Lindenholz, mit geschnitzten Blättern, Blumen und Früchten, 2 Fuß lang, geschenkt von dem Herrn Rentier Wohlgemuth zu Schwerin.
Eine kleine gläseren Flasche
aus weißem Glase, künstlich gearbeitet, ohne Schleiferei, gekauft in Holstein, ward geschenkt von dem Herren Rentier Wohlgemuth zu Schwerin.
Ein Feuerschloß
in Form einer Pistole mit einem Gewehrschloß, aus dem 18. Jahrhundert, aus einem Privathause in Wismar, geschenkt von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar.
Der Herr von Behr=Negendanck auf Semlow schenkte dem Vereine drei Gypsabgüsse von dem Reiter=Denkmale auf dem Grabe des Hofmeisters Samuel von Behr († 1621) in der Kirche zu Doberan, nämlich die Büste des Hofmeisters Samuel von Behr und die Relief=Medaillons des Mannes und der Frau an der mittlern, vordern Säule des Denkmals zu beiden Seiten des von Behr'schen Wappens, wahrscheinlich der Aeltern Samuels von Behr.


|
Seite 300 |




|
II. Zur Baukunde.
1. Zur Baukunde der vorchristlichen Zeit.



|


|
|
:
|
Die wendische Burg Lübchin
und
der Bärnim.
Die wendische Burg Lübchin und die Alterthümer des Ortes spielen eine so große Rolle in der meklenburgischen Geschichte, daß ich viele Jahre hindurch bemühet gewesen bin, Nachrichten darüber zu gewinnen, freilich vergeblich, bis es mir endlich vergönnt gewesen ist 1 ), selbst an Ort und Stelle Untersuchungen vorzunehmen und die Sache aufs Reine zu bringen. Die nordischen Schriften erzählen: um Michaelis des J. 1184 habe der König Knud von Dänemark einen Zug in die Wendenländer unternommen; er sei uach Rügen gesegelt, um sich mit den Rugianern zu vereinigen, darauf von Stralsund durch das Land Tribsees nach Tribsees, und von hier durch das Circipaner=Moor (Trebel=Thal) gezogen und endlich nach einer Stadt Lubechinka gekommen, von wo seine Völker sich zerstreut hätten, um bis gegen Güstrow hin zu verheeren; der König selbst habe zu Lubyna (Liepen?) gelagert. Darauf habe er den Rückzug angetreten.
 . im Interesse des
Vereins.
. im Interesse des
Vereins.


|
Seite 301 |




|
So erzählen die Knytlinga=Saga und Saxo Grammaticus 1 ). Der letztere nennt ausdrücklich 2 )
(urbs Lubechinka.)
Dies kann kein anderer Ort als Lübchin sein: der Zug Knud's von Tribsees aus wird ziemlich genau beschrieben und der ganze Zug geht von Stralsund ganz grade über Tribsees nach Lübchin. Für die ungewöhnliche Bedeutsamkeit des Ortes Lübchin reden überdies noch andere Umstände. Noch im J. 1238 war Lübchin eine Burg von Bedeutung, also eine wendische Burg, da sich nicht annehmen läßt, daß so bald nach der Einführung des Christenthums in diesen wilden Gegenden schon eine große deutsche Burg erbauet gewesen sei. Am 1. März 1238 3 ) verlieh der Fürst Johann der Theologe von Meklenburg öffentlich zu Lübchin (publice in Lubichin) dem Kloster Dargun neue Gerechtsame an Gerechtsbarkeit; Zeugen dieser Verleihung waren der fürstliche Vogt Barthold zu Lübchin ("Bartholdus advocatus in Lubichin"), alle Burgmänner daselbst ("ceteri omnes castrenses ibidem") und der Kapellan Theoderich zu Lübchin ("Theodoricus capellanus in Lubichin"), wahrscheinlich ein Burgkapellan, da ein Pfarrer zu Lübchin wohl als "Pfarrer" aufgeführt sein würde. Für die große Bedeutsamkeit der Burg Lübchin redet die alte Felsenkirche zu Lübchin 4 ), welche ohne Zweifel die älteste von allen Kirchen im nordöstlichen Meklenburg und Vorpommern ist, so weit es sich bis jetzt beurtheilen läßt.
Es kam also darauf an, nach der Entdeckung der alten Kirche, die alte Burg aufzufinden. In Lübchin selbst und in unmittelbarer Nähe des Ortes ist nichts zu finden, was auf eine alte Burg hindeuten könnte. Dagegen habe ich einen großen, stadtähnlichen wendischen Burgplatz in geringer Entfernung von dem Orte gefunden.
Ganz nahe bei Lübchin liegt das Gut Grammow, so daß man von beiden Seiten jedes Gut klar sehen kann. Grade in der Mitte zwischen beiden Gütern, in grader Richtung zwischen denselben, erstreckt sich weit hin ein großes, langes


|
Seite 302 |




|
Moor, jetzt tiefe Wiese, an welches an einer Seite noch jetzt Waldung grenzt, während an den andern Seiten jetzt die Waldung in Ackerland umgeschaffen ist. An einem Ende dieses Moores, in der graden Richtung zwischen Lübchin und Grammow, liegt ein ausgedehnter, wendischer Burgwall in dem Moore aufgeschüttet, nicht sehr hoch, aber weit und von großem Umfange, von stadtähnlicher Anlage. Nach Lübchin und Grammow hin liegt er nicht sehr weit vom festen Lande. Der ganze Wallbau besteht aus drei Theilen: gegen Lübchin hin liegt ein großes Viereck, wahrscheinlich die Vorburg; dahinter liegt in der Mitte ein noch größerer Wall in oblonger Form, wohl die Stadt; gegen Grammow hin, also hinter den beiden Vorburgen, wenn man den Zugang als von Lübchin her gerichtet betrachtet, liegt ein kleinerer Wall, wahrscheinlich die eigentliche Burg. Wir haben hier also die in alten Zeiten genannte wendische Burg ("urbs") oder Stadt Lubechinka oder Lübchin. In der Anlage gleicht dieser Burgwall dem Burgwalle von Werle zu Wiek bei Schwaan. Jetzt gehört der Burgwall, der von Lübchin und von Grammow gleich weit entfernt liegt, zu Grammow. Dies kann aber nicht irre machen, da Grammow (früher Grambow) Pertinenz von Nustrow war und beide Güter mit Lübchin im Mittelalter der Familie Behr gehörten, daher noch jetzt auf dem Kirchthurme zu Lübchin ein Bär als Windfahne steht. Alterthümer ließen sich für den Augenblick nicht finden; jedoch sollen solche in frühern Zeiten hier oft gefunden sein. Die Ackercultur hat hier bedeutend gewirthschaftet: alle Ringwälle sind hinuntergearbeitet und die Oberflächen sind geebnet und zu Ackerland gemacht. Aufgrabungen zeigten an mehrern Stellen in der Tiefe, daß die Erde künstlich aufgebracht sei.
Wichtig werden diese Denkmäler noch durch die Betrachtung, daß sie an der großen, graden Heerstraße von Stralsund nach Güstrow, an dem Durchgange durch die Trebelmoore bei Tribsees liegen.
Nur am westlichen Ende des mittlern Walles sind
unter Gebüsch noch Erhebungen und Reste von
Wällen und Gräben erkennbar, welche sich über
einen Theil des Plateaus verfolgen lassen. Auf
dieser Stelle soll im Mittelalter eine Burg der
Behr auf Nustrow gestanden und der Platz davon
der Bärnim genannt worden sein. Im J. 1838
berichtete hierüber der Herr Geheime Amtsrath
Koch zu Sülz in den Jahrbüchern des Vereins für
meklenburg. Geschichte, III, B, S. 186: "Es
befinden sich die Güter auf der Sülz gegenüber
liegenden pommerschen Seite, Cavelsdorf, Semlow
 ., noch
., noch


|
Seite 303 |




|
in den Händen der Familie v. Behr=Negendanck. Diese Familie hatte in alter Zeit auch diesseits viele Güter, wie denn noch jetzt ein Bär statt des Hahns auf dem Thurme der Kirche zu Lübchin prangt. Diese Güter waren durch einen Damm verbunden, welchen man noch in dem sülzer Moor mit Torf überwachsen findet und der noch der Bärendamm heißt. Er verschwindet auf dem hohen Lande; man spürt ihn aber im lübchiner See, wo auch Reste von Pfählen sich finden. Die Richtung führt hier grade auf ein Holz zu, welches zu dem Gute Grammow gehört, welches noch jetzt der Bärnimm heißt, von einer Burg dieses Namens, deren Wälle und Gräben man noch im Holze findet. Füchse sollen häufig Bauschutt aus dem innern Burgplatze herausfördern und sollen auch silberne Sporen und andere Geräthe herausgegraben haben, die ein Schäfer gefunden und nach Sülz verkauft haben soll.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Der Burgwall von Marnitz.
Der Weg von Marnitz zum Ruhner Berge führt in seiner letzten Hälfte durch ein schönes Buchengehölz, späterhin bis zur Spitze des Berges durch Tannen. In den Buchen, östlich vom Wege sind die Quellen des bei Marnitz vorüberfließenden Baches, welcher weiter abwärts den Namen Mooster 1 ) Bach erhält. In diesen, zur großherzoglichen Forst gehörigen Buchen, etwa 1/4 Stunde links (östlich) von von dem Fahrwege, liegt, sehr zwischen Gebüsch versteckt, die s. g. "Burg". Schon der erste Anblick zeigt, daß dies ein wendischer Burgwall ist. - Rings herum läuft am Fuße des Wallringes ein verfallener, flacher Graben, dessen Umfang 265 Schritte, also etwa 50 Ruthen beträgt. Der Wallring ist kreisförmig und erhebt sich an seiner westlichen Seite am höchsten, etwa 10 Fuß, während er nach Osten hin allmählig niedriger wird und ganz im Osten kaum noch 2 Fuß über dem natürlichen Erdboden erhöht ist. Das inner=


|
Seite 304 |




|
halb des Wallringes liegende Plateau ist etwas vertieft, so daß der Wallring eine Art Brustwehr ringsum bildet und an den höchsten Stellen etwa um 4 Fuß das innere Plateau überragt. Leider ist der ganze Burgwall mit hohem Grase und jungen Buchen sehr überwachsen, so daß das Suchen nach Resten früherer Kultur sehr erschwert wird. Doch glückte es mir, in einem frisch aufgeworfenen Maulwurfshügel auf der Nordseite des Wallringes eine Scherbe 1 ) aufzufinden, welche wenigstens den Beweis liefert, daß die Burg nicht eine "Wallensteinsche Schanze" oder ein Werk des Mittelalters ist. Auch fanden sich hie und da einzelne Kohlenstücke, die jedoch neuern Ursprungs sein mögen, da sie, wenn freilich zerstreut, doch alle auf der Oberfläche des Bodens gesammelt wurden.
Als Curiosum mag noch angeführt werden, daß sich im Innern des Burgwalls, nahe am Nordrande, ein 8 bis 10 Fuß tiefes, rundes Loch befindet, welches vor einigen Jahren von Schatzgräbern gegraben ist. Aus der Beschaffenheit der dadurch entstandenen Erdwand ersieht man jedoch deutlich, daß das innere Plateau nicht aufgetragen, sondern (wie wohl bei den meisten Burgwällen) eine natürliche Erhöhung des Erdbodens bildet; nur die ringförmige Umwallung ist von Menschenhänden gebildet und von außen her aufgetragen.
Abweichend von anderen Burgwällen besteht die ganze nähere Umgebung aus festem Boden, nach keiner Seite hin findet sich Sumpf= oder Wiesengrund. Nur an der Westseite rieselt in der Entfernung von etwa 200 Schritten in einem schmalen Thale einer der Zuflüsse des Mooster Baches; die anscheinend etwas sumpfigen Ufer des Bächleins ließen sich jedoch im August d. J. trocknen Fußes durchschreiten. Der dichte Wald und die versteckte Lage scheinen den frühern Bewohnern dieses Burgwalls als Hauptschutzwehr gegolten zu haben; die Jagdausbeute in den Schluchten und auf den Höhen der Ruhner Berge mag ihnen hinreichende Nahrung geliefert haben. In botanischer Hinsicht fand sich weder auf, noch bei dem Burgwall irgend etwas Bemerkenswerthes.
Kladow, den 26. August 1857.
Willebrand.


|
Seite 305 |




|



|


|
|
:
|
Der wendische Burgwall von Barth.
Die wendischen Burgwälle Pommerns sind bei einer verhältnißmäßig reichen Geschichte wohl alle durch schriftliche Nachrichten, zum Theil auch noch durch ihre Lage und Beschaffenheit bekannt; so viel ich aber weiß, sind sie noch nicht von Seiten der Alterthümer untersucht und bestimmt, obgleich dies bei vielen von hohem Interesse wäre, z. B. bei dem viel besprochenen Julin, dessen Burgwall doch noch zu finden sein dürfte. Es war von Wichtigkeit, einen wendischen Burgwall in der Nähe Meklenburgs zu untersuchen, um über dessen Grenzen hinaus die wendische Eigenthümlichkeit zu verfolgen und zu bestimmen, und hiezu gab die in der norddeutschen und auch in der meklenburgischen Geschichte oft genannte Stadt Barth willkommene Veranlassung, deren Burg zur Wendenzeit wiederholt erwähnt wird. Bei der Stadt Barth liegen mehrere alte Burgwälle.
Südlich nahe bei der Stadt, in Wiesen, welche von Festland umgeben sind, liegt ein großer mächtiger Burgwall, welcher bei den Einwohnern den Namen "Alte Burg" trägt. Auf diesem Burgwall ist keine Spur von Alterthümern irgend einer Art je gefunden und zu finden. Dies berichtet der verstorbene geschichtskundige Burgemeister Oom zu Barth in seiner Geschichte der Stadt Barth, S. 3, und mündlich dessen Schwiegersohn, der Herr Holst zu Barth, welcher als Naturforscher diesen Berg häufig untersucht hat; auch ich habe bei einer Untersuchung in Begleitung des Letzteren keine Spur von Ueberresten der Vorzeit entdecken können, obgleich die Gelegenheit sehr günstig war, da der Berg als Grandgrube benutzt, nach und nach abgegraben und in nicht sehr ferner Zeit verschwunden sein wird. Dieser Burgwall war eine Residenz der Fürsten von Rügen, jedoch schon bei deren Aussterben verlassen, da er schon im J. 1325 an die Stadt verkauft war und die Landesherrschaft einen Hof (curia) in der Stadt an der Stelle des jetzigen Klosters besaß (vgl. Oom a. a. O. S. 33 flgd.). Auch der Dr. v. Hagenow kennt diesen Wall, indem er ihn auf seiner Karte von Neu=Vorpommern, fünfte Auflage, 1856, südlich von der Stadt unter dem Namen "Schloßberg" verzeichnet.
Nördlich bei der Stadt liegt ein zweiter Burgwall. Nördlich von der Stadt, von der Schiffbauerei aus, streckt sich eine sumpfige Landzunge in das Binnenwasser der Ostsee, den


|
Seite 306 |




|
Barther Bodden. Auf der letzten Spitze dieser
Landzunge liegt ein sehr großer, hoher Burgwall
in der Gestalt eines regelmäßigen Oblongums,
ungefähr wie der Burgwall von Meklenburg
gestaltet, jedoch etwas niedriger. Er ist von
drei Seiten vom Meerwasser mit etwas sumpfigem
Vorland umgeben, nach der Landseite geht der
Zugang durch Wiesengrund. Dieser Wall trägt bei
den Einwohnern den Namen "Burgwall".
Auch dieser Wall wird gegenwärtig abgetragen,
theils um den ziemlich weiten Weg zum Festlande
zu erhöhen, theils um die angrenzenden
Wiesenbuchten zu verbessern; er mag jetzt schon
zu 1/3 oder 1/2 abgetragen und wird
wahrscheinlich bald ganz verschwunden sein.
Durch die Abtragung ließ sich aber die
Beschaffenheit leicht und genau untersuchen. Der
ganze Burgwall ist aus verschiedenartiger Erde
künstlich aufgetragen. Die Oberfläche, oben auf
und tiefer in die Erde hinein, ist mit
zahlreichen Gefäßscherben aus der Wendenzeit,
Thierknochen, gebrannten Lehmstücken
 . bedeckt. Die Scherben sind nach
heidnischer Weise bereitet, aus Thon, mit Sand
oder zerstampftem Granit durchknetet, bräunlich
und nur gedörrt, und mit den bekannten
Wellenlinien am Rande verziert, mit denen die
Scherben auf alten wendischen Burgwällen in
Meklenburg verziert sind. Dieser
"Burgwall" ist also ohne Zweifel der
öfter genannte wendische. Burgwall von Barth und
mit allen Kennzeichen eines solchen ausgerüstet.
- Hin und wieder finden sich auf demselben auch
die blaugrauen Scherben von Töpfen des
christlichen Mittelalters, ein Beweis, daß der
Burgwall auch noch nach der Wendenzeit bewohnt
war. Oom berührt in seiner Geschichte der Stadt
Barth diesen Burgwall nicht; auf v. Hagenow's
Karte ist er jedoch an der rechten Stelle unter
dem Namen "Burgwall" eingetragen.
Vielleicht ist dieser Burgwall die "Wiek
bei Barth", welche noch im J. 1302 von
Wenden bewohnt war, als der Fürst Wizlav d. ä.
sein Testament machte. ("Item volo, quod
Slavi mei in vico apud Bard eandem libertatem
habeant in omnibus, quam meo tempore
habuerunt". Fabricius Rüg. Urk. I, p. 128.)
. bedeckt. Die Scherben sind nach
heidnischer Weise bereitet, aus Thon, mit Sand
oder zerstampftem Granit durchknetet, bräunlich
und nur gedörrt, und mit den bekannten
Wellenlinien am Rande verziert, mit denen die
Scherben auf alten wendischen Burgwällen in
Meklenburg verziert sind. Dieser
"Burgwall" ist also ohne Zweifel der
öfter genannte wendische. Burgwall von Barth und
mit allen Kennzeichen eines solchen ausgerüstet.
- Hin und wieder finden sich auf demselben auch
die blaugrauen Scherben von Töpfen des
christlichen Mittelalters, ein Beweis, daß der
Burgwall auch noch nach der Wendenzeit bewohnt
war. Oom berührt in seiner Geschichte der Stadt
Barth diesen Burgwall nicht; auf v. Hagenow's
Karte ist er jedoch an der rechten Stelle unter
dem Namen "Burgwall" eingetragen.
Vielleicht ist dieser Burgwall die "Wiek
bei Barth", welche noch im J. 1302 von
Wenden bewohnt war, als der Fürst Wizlav d. ä.
sein Testament machte. ("Item volo, quod
Slavi mei in vico apud Bard eandem libertatem
habeant in omnibus, quam meo tempore
habuerunt". Fabricius Rüg. Urk. I, p. 128.)
Wir haben also gegen Osten hin in diesem Burgwall einen vollständigen wendischen Burgwall, wie gegen Westen hin in dem alten Burgwall von Lübeck an der Mündung der Schwartau in die Trave sich dieselbe Erscheinung wiederholt, so daß man annehmen kann, daß sich die Eigenthümlichkeiten ber wendischen Burgwälle Meklenburgs auch in den benachbarten Küstenländern wieder finden.
Eine Viertelmeile westlich von Barth, am Ufer der Barthe,


|
Seite 307 |




|
diesseit des Flusses, links am Wege nach dem Barther Holze, findet sich, nach den Entdeckungen und Mittheilungen des Herrn Holst eine dritte wallartige Erhöhung von nicht bedeutender Erhebung, jedoch mit zahlreichen wendischen Gefäßscherben mit den wellenförmigen Linien bedeckt, welche denen auf dem Burgwalle ganz gleich sind. Es war dies also auch ein wendischer Wohnort, vielleicht die alte Stadt Barth für die größere Bevölkerung.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 308 |




|



|


|
|
:
|
2. Zur Baukunde des christlichen Mittelalters.
a) Weltliche Bauwerke.
Burgwall zu Mestlin.
Auf der Feldmark Mestlin, und zwar in der Hufe des Erbpächters Müller, erhebt sich in einer von dem mestliner Forste begrenzten Wiesenfläche ein kleiner Burgwall, der durch die landwirthschaftliche Cultur schon bedeutend von seiner ursprünglichen Höhe verloren hat.
Bei dem Beackern sind verschiedene Gegenstände von Eisen (Stücke von Ketten, ein Sporn u. m. A.), so wie auch ein sehr gut erhaltener Boden Talg aufgefunden worden. Die Bewohner der Nachbarschaft erzählen, daß hier früher eine Burg gestanden habe, die zuletzt von einem Tempelherrn bewohnt sei. Indessen berechtigt die Lage der Höhe in einer Wiesenfläche, welche sich einst weit ausgedehnt haben muß, zu der Annahme, daß der Burgwall wendischen Ursprungs und später dann zur Anlage eines festen Wohnsitzes benutzt sei.
Wiechmann=Kadow.



|


|
|
:
|
Das frühere Dorf Rodenbek.
Zwischen den Dörfern Bistow, Kritzemow und Gr. Schwaß bei Rostock ist eine Fläche Ackers, welche in älteren Zeiten bewohnt sein mußte und erst in ganz neuerer Zeit durch ausgebauete Gehöfte der drei genannten Dörfer in Cultur genommen ist. Bei näherer Bekanntschaft mit den Bewohnern erfuhr ich, daß hier eine alte Dorfstelle mit zwei Schloß=


|
Seite 309 |




|
bergen vorhanden sei, und glaube ich, daß dies sein anderes Dorf sein könne, als das in der Urkunde des Fürsten Heinrich von Meklenburg vom 15. Dec. 1328 (Rudloff Urk., Lief., Nr. CXXVII. und Lisch, Oertzen I, Urk. LXII.) bezeichnete Dorf Rodenbeke 1 ). Es liegt an einem Bache, welcher im Kritzemower Torfmoor entspringt (welcher aber jetzt abgegraben ist und sein Wasser größtentheils nach Rostock ergießt), diese alte Dorfstelle berührt, dann nach Gr. Schwaß, Mönchweden, Lambrechtshagen, Bargeshagen geht und bei Rethwisch in die Ostsee fließt. Das Dorf mit der Burg lag mit Gräben und Sumpfboden (Torfboden) fast rings umgeben und nur ein schmaler Landrücken südwestlich von der Burg bot einen festen Zugang; dieser konnte leicht durch einen Graben versperrt werden. Das Land weiter umher ist noch vielfach von Niederungen und Torfmooren durchschnitten. - Im Interesse unseres Vereins habe ich einen kleinen Grundriß von der Lage des Ortes entworfen, den ich hierbei zu den Sammlungen übersende.
Friedrichshöhe.
J. Ritter.


|
Seite 310 |




|



|


|
|
:
|
b) Kirchliche Bauwerke.
Die romanischen Feldsteinkirchen
im östlichen Meklenburg
von
G. C. F. Lisch.
Seit mehrern Jahren waren die in Ruinen liegenden Feldsteinkirchen von Dambeck und Papenhagen (bei Rambow) als alte Kirchen romanischen oder Rundbogen=Styls bekannt und bildeten als vereinzelte Beispiele uralter Bestrebung die Zielpuncte lebhafter Aufmerksamkeit. Die Entdeckung einer dritten Kirche dieser Art zu Gr. Wokern (vgl. Jahrbücher XXI, S. 264) im J. 1855 mußte um so mehr überraschen, als diese Kirche noch kräftig da steht und als sich trotz aöler Bemühungen keine Nachrichten von noch anderen Kirchen dieser Art gewinnen lassen wollten. Meklenburg besitzt zwar mehrere seit längerer Zeit bekannt gewesene Kirchen romanischen Baustyls; wie zu Ratzeburg, Gadebusch, Vietlübbe, Lübow, aus etwas jüngerer Zeit zu Rehna, Grevismühlen, Hagenow, Wittenburg u. s. w. Alle diese Kirchen sind aus Ziegeln gebauet und gehören dem Bisthum Ratzeburg an, mit Ausnahme der Kirche zu Lübow, welche jedoch unmittelbar an das Bisthum Ratzeburg grenzt. Diese Kirchen sind daher sicher von Ratzeburg aus gebauet. Das Bisthum Schwerin dagegen hat eine große Menge von etwas jüngeren Kirchen im Uebergangsstyle, theils aus Feldsteinen mit Ziegeln, theils allein aus Ziegeln aufgeführt. Dies läßt sich leicht dadurch erklären, daß im Bisthume Ratzeburg die Regierung der sächsischen Grafen von Schwerin und Ratzeburg jede Störung der christlichen und deutschen Bildung abwehrte, - im Bisthum Schwerin dagegen das Christenthum nach manchen Rückfällen der Wenden erst später durchdrang und feste Wurzel faßte. Es mußte daher auffallend sein, daß sich im östlichen Meklenburg Kirchen fanden, welche auf eine sehr frühe Zeit


|
Seite 311 |




|
zurückweisen: diese Kirchen haben jedoch eine andere Beschaffenheit, als die westlichen, indem sie aus Feldsteinen oder Granitgeschieben erbauet sind, und zwar in den bisher bekannt gewordenen Beispielen ohne jede Beimischung von Ziegeln, ja sogar mit Gewölben aus rohen, unbehauenen Feldsteinen, wie zu Dambeck und Gr. Wokern. Es konnte die Bemerkung nicht entgehen, daß diese Kirchen in andern Bisthümern lagen: die Kirchen zu Gr. Wokern und Papenhagen im Bisthume Camin, die Kirche zu Dambeck im Bisthume Havelberg.
Die Entdeckung mehrerer merkwürdiger Kirchen gleicher Bauart 1 ) in den nordöstlichen Gegenden Meklenburgs und in dem benachbarten Festlande des Fürstenthums Rügen giebt nun den bisherigen Beobachtungen, wie es scheint, eine festere Grundlage und weitere Ausdehnung, und es kann sich aus diesen Entdeckungen, in Vergleichung mit den Berichten über die ältesten Begebenheiten in diesen Gegenden, vielleicht eine lebendigere Gestaltung unserer Landesgeschichte für die nordöstlichen Gegenden ergeben.
Die bedeutendste Entdeckung ist die Kirche zu Lübchin, eine Kirche im ausgebildeten romanischen Baustyle und so viel sich bis jetzt übersehen läßt, die älteste Kirche von der Burg Meklenburg (Lübow) bis Stralsund. Diese Erscheinung trifft mit den häufigen Eroberungs= und Bekehrungszügen der Dänen nach Wendenland zusammen, in denen Lübchin als ein hervorragender Ort genannt wird.
Sichere dänische Quellen, die Knytlinga=Saga und Saxo Grammaticus, geben sehr ausführliche und merkwürdige Berichte, welche bereits vielfach untersucht sind und für den gegenwärtigen Zweck keiner besondern Prüfung bedürfen. Im Allgemeinen lauten diese Berichte 2 ) folgendermaßen. Um Michaelis des J. 1184 unternahm der König Knud von Dänemark mit dem Erzbischofe Absalon einen Zug iu die Wendenländer. Er segelte zuerst nach Rügen und vereinigte sich hier
 . für den Verein.
. für den Verein.


|
Seite 312 |




|
mit 2000 Rügianern. Von dort zog er über Stralsund (Strela), wo die Schiffe liegen blieben, durch das Land Tribfees ("Tribusana provincia"), welches ihm untergeben war, nach Tribfees ("Tribudiz") und drang von hier durch daß Circipaner=Moor ("Circipenensium palus"), d. h. durch die weiten Moore des Trebel=Thales, bis zur Burg oder Stadt Lübchin ("urbs Lubechinka") und darnach weiter hinauf nach Tribiden 1 ) oder Tribedne, d. i. das Land Gnoyen gegen Güstrow hin, wo sein Heer sich zerstreuete, um zu verheeren und zu brennen. Der König wollte nach Demmin ziehen, gab jedoch dieses Vorhaben auf; auf diesem Ritt verbrannte er die "Kaufstadt" ("kaupstadr") oder ein großes Dorf ("villa") (Gnoyen?), wo große Vorräthe von Korn erbeutet wurden. Der König selbst lagerte bei Lubyna (Liepen ? 2 ) bei Sülz). Darauf sammelte sich das Heer wieder, blieb in der Gegend drei Tage liegen und nahm dann seinen Rückzug.
Ein Blick auf die Charte genügt, um einzusehen, daß alle diese Angaben ganz richtig sein müssen, da der Zug auf der gradesten Straße von Stralsund bis gegen Güstrow hin ging und alle Orte genau zutreffen. Es leidet keinen Zweifel, daß die Stadt Lubechinka, urbs Lubechinka, das jetzige Kirchdorf Lübchin ist.
Es findet sich bei dem Dorfe Lübchin nicht allein der Wall der alten wendischen Stadt Lübchin 3 ), sondern auch in dem Dorfe die älteste Kirche in der ganzen so eben beschriebenen Gegend. Die Kirche ist eine Granitfeldsteinkirche im vollständigen romanischen oder Rundbogenstyle, mit rundbogigen Pforten und Fenstern und mit einer halbkreisförmigen Altarnische, welche sich weit und breit an keiner Kirche mehr findet. Ich will grade nicht behaupten, daß die Kirche von den Dänen gegründet worden sei; aber ich glaube, daß sie unter nordischem Einflusse zu Stande gebracht, und daß die Cultur in diesen Gegenden in der ältesten Zeit von Osten her gekommen ist, da in den meisten Gegenden des östlichen Meklenburgs bis in das 13. Jahrhundert hinein große


|
Seite 313 |




|
Barbarei herrschte. Noch im J. 1248 ward den Fremden, namentlich den Dänen, im Gebiete des Klosters Eldena die Niederlassung versichert (vgl. Kosegarten Codex Pomer., I, p. 827), wie dies auch im Kloster Dargun der Fall war; noch heute heißt der Meerbusen bei Eldena die dänische Wik; und Kosegarten bemerkt a. a. O. S. 829 wohl richtig, daß der in der Nähe des Dorfes Wik bei Eldena gelegene Ort Lathebo, jetzt Ladebo, nordisch sei, von den schwedischen Wörtern lada = Scheure, und bo = Haus, wie noch heute z. B. ladugard = Scheurenhaus heißt. Um das J. 1290 werden dem Kloster unter andern auch die Dörfer: "Denschewic, Wendeschewic und Ladebu" versichert. Ich nehme keinen Anstand, den Bau der Kirche zu Lübchin noch in das Ende des 12. Jahrhunderts zu versetzen, so daß sie nicht lange nach dem Zuge des Dänenkönigs Knud vom J. 1184 in Angriff genommen sein muß. Noch im J. 1238 war Lübchin ein ansehnlicher Ort, als sich der Fürst Johann von Meklenburg dort aufhielt und am 1. März dem Kloster Dargun neue Freiheiten verlieh. Damals waren Theoderich Kapellan zu Lübchin und Barthold Vogt zu Lübchin, welche neben "allen Burgmännern" daselbst ("omnes castrenses ibidem") die Schenkung des Fürsten bezeugten (vgl. Lisch Meklb. Urk. I, p. 52 - 53). Die Insel Rügen ward schon im J. 1168 von den Dänen unterworfen und bekehrt und schon im J. 1193 ward die noch stehende, aus Ziegeln ("opere latericio") erbauete Marienkirche zu Bergen auf Rügen geweihet.
Diese Ansicht, daß in diesen östlichen Gegenden sich eine eigene Cultur entwickelt habe, welche von Osten her Beförderung erhielt, wird dadurch noch verstärkt, daß an der östlichen Seite des Circipaner Moors in Festland Rügen bei Marlow die Kirche zu Semlow ein ähnlicher Feldsteinbau ist und ungefähr in das Jahr 1200 fallen mag; etwas jünger, vielleicht um das J. 1210, ist die an Semlow grenzende Kirche zu Tribohm. Von der andern Seite ist die Feldsteinkirche zu Gr. Wokern bei Teterow der Kirche zu Lübchin im Bau gleich, steht aber der Kirche zu Semlow im Styl näher. Den ersten Uebergang zu dem neuern Styl scheint die Kirche zu Sanitz bei Tessin zu bilden.
Man sollte glauben, daß die Cultur in den nordöstlichen Gegenden Meklenburgs von dem Kloster Dargun 1 ),


|
Seite 314 |




|
welches im J. 1173 gestiftet ward, ausgegangen sei. Der Andrang der unaufhörlich aufstehenden Wenden und die Noth des Lebens war so groß, daß die Mönche sich nicht halten konnten, sondern das Kloster verlassen und in fremden Schutz flüchten mußten; es fand also eine völlige Auflösung des darguner Convents statt und an der Stelle des Klosters entstand eine "Räuberhöhle". Erst im J. 1209 wagten sich Mönche von Doberan wieder nach Dargun und erst im J. 1216 ward das Kloster förmlich wieder hergestellt und bald darauf der Ziegelbau ("opus latericium") begonnen, von welchem noch das in den neuesten Zeiten wieder entdeckte Schiff der Kirche übrig geblieben ist. Wahrscheinlich flüchteten die darguner Mönche nach dem Kloster Hilda 1 ) oder Eldena bei Greifswald. Dies mag daraus hervorgehen, daß das Kloster Dargun um das Jahr 1210 eine Pfannenstelle in der Saline zu Eldena (oder Greifswald) geschenkt erhielt 2 ). Es wäre von Wichtigkeit, die Ruinen der in Ziegeln gebauten Klosterkirche zn Eldena 3 ), welche im Kreuzschiffe noch viele alte roma=


|
Seite 315 |




|
nische Elemente enthalten, mit dem Ziegelbau des Schiffes der Klosterkirche zu Dargun zu vergleichen, da es nicht unwahrscheinlich sein dürfte, daß Dargun Unterstützung von Eldena erhalten habe.
Die Beschreibung der im nordöstlichen Meklenburg und im westlichen Schwedisch=Pommern neu entdeckten Feldsteinkirchen romanischen Baustyls in chronologischer Ordnung möge den vorstehenden Zeilen zur Bestätigung dienen.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Lübchin
ist ein alter Bau in romanischem Baustyl und ganz von Granitgeschiebe oder Feldsteinen ausgeführt, ohne Zuthat von gebrannten Ziegeln. Die Kirche besteht aus einem quadratischen Chor, einem etwas breiteren Schiffe und einem Thurmgebäude. Der quadratische Chor hat eine halbkreisförmige Apsis, eine für Meklenburg große Seltenheit, welche sich sonst im östlichen Meklenburg, östlich von den Kirchen zu Lübow und Vietlübbe, wohl nicht weiter finden dürfte, wenn nicht die Kirchenruine von Papenhagen zu Rambow bei Malchin noch ein halbkreisförmiges Fundament für die Apsis hat. Die Apsis hat drei, der Chor an der Südseite ein, das Schiff an jeder Seite vier Fenster. Alle Fenster sind mit schräger, glatter Laibung, ohne weitere Verzierungen, im Rundbogen gewölbt; der Kalkputz der Wölbungen ist zum Theil noch alt, gelblichweiß, glänzend und steinhart. Das südliche Fenster der Apsis ist in jüngern Zeiten erweitert und verunstaltet. An die Nordseite des Chores ist die Sakristei angebauet und daher ist diese Seite ohne Fenster. Die Pforte in den Chor und die Pforte vom Chor in die Sakristei sind rundbogig; eben so hat die Südseite des Schiffes eine rundbogige Pforte.
1) Ich verdanke die Entdeckung dieser wichtigen Kirche der freundlichen Beförderung des Herrn von Behr=Negendanck auf Semlow im Interesse des Vereines. G. C. F. Lisch.


|
Seite 316 |




|
Alle Pforten sind einfach und ohne Verzierungen. Der Chor allein ist gewölbt und hat ein altes romanisches Gewölbe ohne Rippen, so daß die Gewölbekappen nur in einer Nath zusammenstoßen; die vier Gewölbenäthe des Chores laufen von den vier Ecken in den Scheitel zusammen; vom Scheitel laufen zwei Näthe in die Apsis zwischen die drei Apsisfenster hinab: die Gewölbe in der Apsis sind jedoch etwas unfertig angesetzt, als wenn in neuerer Zeit nachgeholfen wäre. Das Schiff hat eine Balkendecke.
Der Bau der alten Kirche hat alle Elemente des romanischen Baustyls vollständig. Die Kirche zu Lübchin ist also der gegenüber liegenden Kirche zu Semlow sehr ähnlich, nur daß dieser die halbkreisförmige Apsis fehlt und eine grade Altarwand gegeben ist. Ich möchte daher die Kirche zu Lübchin noch in das 12. Jahrhundert setzen. Im J. 1238 wird "Theoderich Kapellan zu Lübchin" (vgl. Lisch Mekl. Urk. I, p. 52) genannt; jedoch ist es möglich, daß dieser Kapellan der Burgkapelle war, indem sich der Fürst Johann von Meklenburg noch auf der Burg aufhielt und ein Burgvogt und Burgmänner auf derselben wohnten.
Der Thurm ist freilich alt, jedoch etwas jünger als die Kirche und schlechter gebauet; er hat schon einen behauenen, gegliederten Sockel. Er ist auch ganz von Feldsteinen gebauet, unten viereckig, oben achteckig, was schon an vorpommersche Kirchenbauten erinnert. Wenn unten im Thurm auch ein Fenster und eine Treppenöffnung in der Mauer und eben so die Schallöffnungen oben im Achteck des Thurmes noch rund sind, so ist doch die Hauptpforte in den Thurm und der Bogen vom Thurmgebäude ins Schiff schon spitzbogig gewölbt.
Eben so ist auch der Triumphbogen, der Gurtbogen zwischen Chor und Schiff, schon spitzbogig gewölbt. Dies ist aber auch der einzige Anklang aus einer jüngeren Zeit in der eigentlichen Kirche. Es findet sich aber oft, daß grade der Triumphbogen in romanischen Kirchen spitz gewölbt ist, vielleicht in jüngeren Zeiten.
Die Thurmhalle ist gewölbt gewesen; die Gewölbe haben sehr dünne Rippen von quadratischem Durchschnitt gehabt; jedoch sind die Gewölbeansätze an den Ringmauern noch rund. Dies alles zeugt für einen jüngern Bau des Thurmes. Der Thurm ist dem Thurme der Kirche zu Sanitz ähnlich.
Sonst ist die Kirche im Innern ganz restaurirt und nüchtern.
Auf dem Kirchhofe neben der Kirche steht ein alter, sehr


|
Seite 317 |




|
schöner, romanischer Taufstein, welcher in neuern Zeiten in drei Stücken zusammengestellt ist; an der Schale ist jedoch schon viel ausgesprungen. Außerdem liegt auf dem Kirchhofe noch ein behauener Stein, der auch zu einem Taufstein gehört zu haben scheint.
Die mittlere Glocke hat folgende Inschrift in gothischer Minuskel:
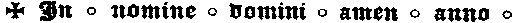
An der Stelle der Punkte stehen Münzenabdrücke.
Die kleinste Glocke, welche sehr dunkel hängt, stammt aus derselben Zeit; sie hat die Umschrift, ohne Jahreszahl:
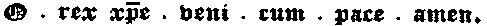
Vor dem Altare liegt ein Leichenstein mit dem Wappen der Behr rechts und dem Wappen der von Blankenburg links und folgender Inschrift in lateinischen Unzialen:
DIESEN STEIN VND BEGRÄBNIS HAT FRAW CATARINA VON BLANCKENBVR GEN, SEHL. HERRN CAMER IVNCKER VND DES RIBNITZER KLOSTERS PROVI SORIS HEINO BEHREN, SEHL. HERRN GEORG CHRISTOFF BEHREN SOHNS, NACHGELASSENE FRAW WITBE, VOR SICH VND IHREN SEHL. EHEHERREN VND IHRE KINDER VND ERBEN AUFF RICHTEN VND IHN DEN 15 MARTII ANNO 1695 DARIN SENGKEN LASSEN SEINES ALTERS 61 JAHR 6 MONAHT 22 TAGE.
G. C. F. Lisch.
Die Kirche zu Papenhagen
oder Domherrenhagen auf dem Felde von Rambow bei Malchin vgl. in Jahrbüchern XXI, S. 264 und 267.


|
Seite 318 |




|
Die Kirche zu Dambeck
bei Röbel vgl. in Jahrbüchern XV, S. 283, und XXI, S. 264 und 266.
Die Kirche zu Gr. Wokern
bei Teterow vgl. in Jahrbüchern XXI, S. 264 flgd.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Semlow
in Neu=Vorpommern.
Die Kirche zu Semlow, im Festlande Rügen oder Schwedisch=Pommern, an der Reknitz, Marlow gegenüber, ist freilich keine meklenburgische Kirche, hat aber für die Kunstgeschichte Meklenburgs einen hohen Werth, weil sie zu einer bestimmten Gruppe eigenthümlicher alter Bauten zu gehören scheint und Meklenburg sehr nahe steht.
Die Kirche besteht aus einem quadratischen Chore, einem oblongen Schiffe nnd einem ziemlich hohen Thurmgebäude. Alle diese Theile sind sehr tüchtig aus Granitgeschiebe oder Feldsteinen erbauet. Die Thür= und Fensteröffnungen sind mit großen rothen Ziegeln überwölbt. Der Chor hat eine grade Ostwand. Er hat in jeder Wand zwei gekuppelte Fenster; der Pfeiler zwischen je zwei Fenstern ist ebenfalls aus Ziegeln ausgeführt. Das Schiff hat an jeder Seite drei einfache, hoch liegende, niedrige Fenster. Die Kirche hat also im Ganzen zwölf Fenster. Alle Fenster sind gleich construirt, ohne Gliederungen, mit glatter Laibung schräge eingehend, in den Laibungen mit Kalk geputzt, alle mit einem halbkreisförmigen Bogen aus rothen Ziegeln überwölbt.
Die in der Südwand des Schiffes befindliche, jetzt zugemauerte Pforte ist ebenfalls im Rundbogen mit Ziegeln überwölbt. Die beiden andern Pforten in der Nordwand des Chores und des Schiffes sind mehr als wahrscheinlich eben so construirt gewesen; sie sind jetzt aber nicht zu erkennen, da vor etwa 15 Jahren bei der Restauration der Kirche sehr schlecht construirte spitzbogige Portale vorgebauet sind, welche hoffentlich in nächster Zeit wieder verschwinden werden.
Der Chor ist gewölbt. Das Gewölbe und die Gewölbeansätze sind rundbogig. Die Gewölbe haben noch keine Rippen, sondern die Kappen stoßen in seinen Näthen zusammen.


|
Seite 319 |




|
Das Schiff ist nicht gewölbt, auch nicht zum Ueberwölben bestimmt gewesen, sondern mit einer Balkendecke bedeckt, welche in neuern Zeiten erneuert worden ist.
Im Uebrigen ist die Kirche im Aeußern einfach und schmucklos, ohne Friese und Lisenen; der einzige Schmuck des tüchtigen Baues besteht in den rothen Ueberwölbungen der Thür= und Fensteröffnungen.
Wir haben hier also eine vollständig durchgeführte romanische Kirche, welche zwar nicht sehr alt ist, da sie statt der halbkreisförmigen Altarnische schon eine gerade Altarwand und statt der gewöhnlichen drei Fenster in der Altarwand nur zwei hat, aber doch sicher noch innerhalb der romanischen Bau=Periode liegt.
Die einzige Abweichung von diesem Style liegt darin, daß der Triumphbogen zwischen Chor und Schiff einen alten Spitzbogen zeigt. Es ist aber sehr häufig, daß der Triumphbogen, vielleicht in jüngern Zeiten, spitz gewölbt ist, während die Bautheile umher rundbogig sind (vgl. oben S. 316).
Der ganz aus Feldsteinen erbauete Thurm hat in den obern Theilen ebenfalls noch Elemente des romanischen Styles.
Ich trage daher kein Bedenken, die Kirche zu Semlow ungefähr in das Jahr 1200 zu versetzen; sie ist die älteste Kirche des Festlandes Rügen, so weit der Sprengel des Bischofs von Schwerin über die Reknitz hinausreichte, wenn man nach dem urtheilen soll, was über die Kirchen dieses Landestheiles bis jetzt aus gedruckten Schriften oder durch mündliche Mittheilungen bekannt geworden ist.
Der Ort Semlow muß auch in früherer Zeit eine gewisse Bedeutung gehabt haben, da Johann von Semlow als der älteste Rathsherr der Stadt Stralsund schon im J. 1256 bekannt ist, und die Rathsfamilie Semlow in Stralsund eine alte angesehene Familie war, von welcher eine Hauptstraße vom Markte und ein Strandthor den Namen Semlower Straße und Semlower Thor führen.
An alten Denkmälern besitzt die Kirche zu Semlow nur noch eine Glocke mit der Inschrift:
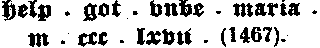
Es steht durch Versehen wirklich vnbe auf der Glocke, statt vnde .
Dagegen ist die Kirche reich an Epitaphien auf die Familie von Behr mit dazu gehörenden Statuen, Leichen=


|
Seite 320 |




|
steinen, Ahnentafeln, auf Glas gemalten Wappen u. s. w. aus dem 17. und 18. Jahrh.
Ein aus Ziegeln gemauertes Thor zum Kirchhofe aus dem 15. Jahrh, ist bemerkenswerth.
G. C. F. Lisch



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Tribohm.
Eine halbe Stunde nördlich von Semlow, an der Straße von Tribsees über Semlow nach Damgarten, liegt Tribohm. Diese Kirche hat dieselbe Anlage, wie die Kirche zu Semlow, ist aber jünger. Sie besteht aus einem viereckigen Chor und einem etwas breitern Schiffe; das Schiff hat an jeder Seite drei, der Chor an jeder Seite zwei Fenster; sie unterscheidet sich von der semlower Kirche nur dadurch, daß in der Altarwand zwischen den beiden Fenstern ein kleines rundes oder Rosen=Fenster angebracht ist, welches jedoch kein altes Stabwerk hat. Die beiden Fenster in der südlichen Chorwand sind im 15. Jahrh. in Ziegelbau zu Einem größern Fenster umgebauet. Die Kirche hat eben so viele Pforten, wie die semlower, und an denselben Stellen: in den nördlichen Wänden eine im Chore und eine im Schiffe, in der südlichen Wand eine im Schiffe, welche jetzt zugemauert ist. Die Kirche ist ganz aus Feldsteinen erbauet, ohne Verzierungen; die schmalen, mit glatter Laibung schräge eingehenden Fenster sind im Rundbogen mit Feldsteinen überwölbt. Die Pforten sind jedoch alle schon spitzbogig, die Chorpforte mit Feldsteinen, die Schiffpforten mit Ziegeln überwölbt. Eben so ist der Triumphbogen im Innern in einem schweren Spitzbogen aufgeführt. Gewölbe fehlen ganz. Der Thurm ist von Holz. Von alterthümlichen Geräthen ist nichts mehr vorhanden. Diese Kirche hat also vom romanischen Baustyl nichts weiter als die Fenster. Die spitzbogigen Pforten weisen jedoch schon auf eine jüngere Zeit hin.
Kugler in seiner pommerschen Kunstgeschichte, in den Baltischen Studien VIII, 1, S. 37 und 46, und in den kleinen Schriften, I, S. 689 und 695, hat diese Kirche richtig beschrieben und wohl richtig um das Jahr 1210 gesetzt. Er führt sie dem Alter nach als die sechste Kirche Pommerns auf. Wir haben aber nachgewiesen, daß die Kirche zu Semlow ohne Zweifel älter ist, da diese in Fenstern, Pforten, Gewölbe und Thurm alte Elemente des Rundbogenstyls und nur den Triumphbogen spitzbogig hat. Wie es scheint, ist die


|
Seite 321 |




|
Kirche zu Semlow das Vorbild der Kirche zu Tribohm; - Kugler sagt freilich, daß "es leicht möglich sei, daß noch mehrere Dorfkirchen dieser Art vorhanden" seien, es befremdet jedoch, daß er die Kirche zu Semlow nicht bemerkt hat, da sie mit der tribohmer an derfelben Landstraße liegt.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Die vorpommerschen Landkirchen zwischen Tribsees und Damgarten.
Die Kirche zu Semlow gehört ganz dem romanischen Baustyle an.
Die Kirche zu Tribohm hat noch Anklänge an den romanischen Baustyl, liegt jedoch schon in den ersten Anfängen des Uebergangsstyls.
Um die Ueberzeugung zu gewinnen, ob in der Nähe dieser Kirchen nicht noch mehr Kirchen romanischen Baustyls zu finden seien, habe ich mehrere der zunächst gelegenen Kirchen untersucht und theile hier die Ergebnisse meiner Forschungen kurz mit. Das Resultat dürfte sein, daß sich im westlichen Theile von Festland Rügen nichts weiter vom romanischen Style findet, daß sich jedoch in dieser Gegend alle Baustyle vertreten finden.
Die Kirche zu Eixen, in alten Zeiten ein Gut des Bischofs von Schwerin, ist durchweg im ausgebildeten Uebergangsstyle, wahrscheinlich im zweiten Viertheile des 13. Jahrhunderts, gebauet: Sie bildet nur ein Oblongum von hohen Verhältnissen und ist in den Wänden von Feldsteinen, in den Fenstern und Pforten von Ziegeln ausgeführt. Der Chorgiebel aus Ziegeln ist reich mit rundbogigen Nischen geschmückt.
Die Kirche zu Starkow im ausgebildeten Spitzbogenstyle, Wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts gebauet, ist eine ungewöhnlich große, hohe und schöne Kirche im Ziegelbau von ganz ausgezeichneter Ausführung und vielleicht eine der schönsten Dorfkirchen Pommerns. Der Chorschluß ist dreiseitig, das Schiff ist auf zwei niedrige Seitenschiffe angelegt, welche in den neuesten Zeiten vermauert sind. Die Fenster find hoch und groß, die Strebepfeiler vortrefflich. Die allerneueste, wenn auch tüchtige Restauration hat der Kirche manches Alte genommen und manches Neue gegeben. Die Farben des Anstriches in vielen Kirchen Neuvorpommems, rosa und grün, können nicht ansprechen.


|
Seite 322 |




|
Die Kirche zu Drechow, ein Oblongum von Feldsteinen mit Ziegeleinfassungen in Thüren und Fenstern und mit Stabwerk von Ziegeln in den Fenstern, ist ein unbedeutendes Bauwerk aus dem 15. Jahrhundert.
Die Kirche zu Schlemmin ist ebenfalls ein unbedeutendes Bauwerk ungefähr aus derfelben Zeit.
Die Kirche zu Deigelsdorf (früher Düvelstorf) ist ein ziemlich gutes, aus Feldsteinen und Ziegeln vermischt ausgeführtes Bauwerk der Renaissancezeit und im Jahre 1606 vollendet, ungefähr eben so eingerichtet, wie die neuencampensche Klosterkirche zu Franzburg ausgebauet ist. Diese Kirche besitzt jedoch einen großen Schatz in dem aus dem Ende des 14. Jahrhunderts stammenden, ungewöhnlich großen und schönen, reich mit vergoldeten und bemalten geschnitzten Figuren geschmückten Flügelaltar, welcher aus der Kirche zu Dorow hierher versetzt sein soll.
Daß die ehrwürdige Kirche des Klosters Neuen=Camp, jetzt Franzburg, bis auf wenige Leichensteine und ein Epitaphium alles Alterthümliche und Charakteristische, sogar die Fenstereinfassungen, verloren hat und im Innern gänzlich modernisirt ist, daß das Kloster völlig rasirt ist und das noch Stehende einer Ruine gleich sieht, ist allerdings sehr zu beklagen.
Die Spitzbogenkirche des berühmten Ortes Kenz hat noch manchen alten Schatz, namentlich ausgezeichnete alte gemalte Fenster.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Sanitz,
zwischen Rostock und Stettin, ist eine sehr gut gebauete Kirche 1 ), welche noch bedeutende Ueberreste des romanischen Baustyls enthält. Die Kirche ist von Granitgeschiebe oder Feldsteinen, mit behauenen Ecken, ausgeführt; die Fenster und Pforten sind mit Ziegeln gewölbt. Die Kirche besteht aus einem quadratischen Chore und einem etwas breitern Schiffe von zwei Gewölben Länge; alle Räume sind gewölbt. Der Chor hat an jeder Seite drei, das östliche Gewölbe des Schiffes zwei, das westliche Gewölbe, in der Thurmanlage, ein Fenster; die nördlichen Chorfenster sind durch die Sakristei zugebauet. Die


|
Seite 323 |




|
hohen Fenster, welche in glatter, einfacher Laibung ohne Rundstäbe schräge eingehen, sind im Chore im Rundbogen überwölbt; die Fenster des Schiffes sind im Uebergangsstyle construirt. Alle Gewölbekappen sind im reinen Rundbogen an die Wände gesetzt. Der Triumphbogen ist im Uebergangsstyle gewölbt. Die Gewölbe sind ebenfalls im Uebergangsstyl aufgeführt und haben Rippen von quadratischem Durchschnitte, welche, in einem großen, runden Schlußsteine zusammentreffen. Das Gewölbe des Chores und das östliche Gewölbe des Schiffes hat acht, das westliche Gewölbe des Schiffes hat vier Rippen. Die vier mit den Seitenwänden parallel laufenden Hauptrippen des Chores haben, wie die Rippen des Schiffes, einen quadratischen Durchschnitt; die vier diagonalen rechtwinkligen Rippen des Chores sind aber mit einem ganz runden Wulste belegt. Eine kleine Pforte in den Chor ist im Uebergangsstyle gewölbt und hat einen alten eisernen Thürbeschlag, dessen Bänder an den Seiten Flügel im Halbkreise haben, welche in Vogelköpfe auslaufen. Der Chorgiebel ist bis gegen die Spitze von Feldsteinen und nur in der Spitze von Ziegeln, mit einem kleinen vertieften Kreuze verziert. Der östliche Schiffgiebel ist von Ziegeln und mit zugespitzten Nischen verziert, wie der darunter stehende Triumphbogen construirt ist. Die Thurmpforte ist in neuern Zeiten gewölbt. Der Thurm ist übrigens dem Thurme der Kirche zu Lübchin (vgl. oben) sehr ähnlich.
Von alterthümlichen Geräthen hat die Kirche nur wenig. An der Nordwand des Chores neben dem Altare ist ein gut gearbeitetes Tabernakel in der Gestalt eines kleinen Schreines mit einem Baldachine befestigt, dem Anscheine nach aus dem Ende des 14. oder dem Anfange des 15. Jahrhunderts. Auf dem Kirchenboden liegt das Crucifix von dem Triumphbogen, mit den Evangelisten=Symbolen an den Enden, von guter Arbeit, ungefähr aus derselben Zeit, wie das Tabernakel. In der Kirche steht ein jetzt nach Wehnendorf gehörender alter Kirchenstuhl, neben dem Stuhle für Reppelin, mit hübscher Schnitzerei und zwei geschnitzten schönen Wappen verziert, unter denen Inschriften stehen, in der Ansicht:
| Wappen | Wappen |
| der | der |
| Behr. | Preen. |
| CATRINA . BEREN. | HINRICK . PREEN. |
| 1592. | GNADE . EM . GOT. |


|
Seite 324 |




|
Die Frau hat also als Wittwe den Stuhl machen lassen. Das behrsche Wappen hat auf Schild und Helm einen links gekehrten Bären mit Halsband.
Südlich neben dem Altare steht ein mit Wappen verziertes Chor. An der vordern Brüstung ist in der Mitte ein kleines Gemälde, auf welchem vor einem Crucifixe zur Rechten ein Ritter mit zwei Söhnen; zur Linken eine Frau mit zwei Töchtern kniet. In der Ansicht links davon sind die Wappen der
rechts davon die Wappen der
an der Seitenbrüstung stehen die Wappen der
Die Wappen folgen in der Ansicht von der linken zur rechten in der hier aufgeführten Reihenfolge.
Im Mittelgange des Schiffes liegt ein Leichenstein mit dem Wappen der v. Koppelow ohne alle Inschrift.
Vor dem Altare liegt ein halber Leichenstein mit den Resten der Inschrift:
— — — EHRENVESTER D IETRICH B EVERNEST FURSTLICHER MEKELBURGISCHER — — — ZUR ERDEN BESTETIGET WORDEN SEINES ALTERS IM 63 IHAR.
In den noch vorhandenen zwei Ecken stehen die Wappen der von der Lühe und der vom Sehe. Dies ist ohne Zweifel der Leichenstein des Landraths Dietrich Bevernest auf Lüsewitz, welcher 1589 + 1608 Landrath war, da Lüsewitz in Sanitz eingepfarrt ist.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Marlow
ist für die Kunst= und Landesgeschichte ein sehr merkwürdiger Bau 1 ), welcher noch dem Rundbogen= oder romanischen Baustyle zugezählt werden muß. Die Kirche ist ganz aus


|
Seite 325 |




|
Ziegeln gebauet und besteht jetzt aus einem quadratischen Chore mit grader Altarwand und einem etwas breitern Schiffe von zwei Gewölben Länge. Daran schließt sich ein Thurmgebäude aus etwas jüngerer Zeit. Der Chor hat an jeder Seitenwand drei Fenster, das Schiff unter jedem Gewölbe an jeder Seite je zwei Fenster, welche alle mit glatter Laibung schräge eingehen. An den Ecken der beiden Haupttheile der Kirche stehen Lisenen und um die ganze Kirche läuft ein Rundbogenfries von einfachen Halbkreisbogen. Wenn auch die Kirche in ihrer jetzigen Gestalt noch am Ende des romanischen Baustyls vollendet ist, so hat doch das Schiff noch Elemente eines älteren Baues. Das Schiff ist nämlich auf ein höheres Seitenschiff und zwei niedrigere Seitenschiffe angelegt. Die Gurtbogen zwischen dem Mittelschiffe und den Seitenschiffen sind im reinen Rundbogen gewölbt und ruhen auf viereckigen Pfeilern mit einfachen Deckplatten; diese Pfeiler und Gurtbogen sind sehr niedrig. Dieser beabsichtigte Bau ist jedoch nicht zur Ausführung gekommen, sondern die Bogen vom Mittelschiffe zu den beabsichtigten Seitenschiffen sind nach der Vollendung des Mittelschiffes interimistisch zugemauert, wie man an der Außenseite der Seitenwände der jetzigen Kirche klar sehen kann. Die Kirche gleicht daher in der Anlage und Gestalt ganz der Kirche zu Neuburg (vgl. Jahrbücher XVIII, S. 287). Die nördlichen Fenster des Schiffes sind noch im Rundbogen gewölbt; dagegen erscheinen die Fenster in der südlichen Seitenwand schon etwas zugespitzt, vielleicht aus einer jüngern Bauperiode oder einer Restauration. Die Chorfenster sind dagegen, wenn auch wie die Schifffenster construirt, doch schon im Uebergangsstyle leise gespitzt.
Es scheint daher, daß in den untern Theilen des Schiffes ein alter romanischer Bau einer dreischiffigen Kirche steckt, die ganze Kirche aber in den ersten Zeiten des Uebergangsstyls in ihrer jetzigen Gestalt hergestellt ward, wobet aber die Seitenschiffe nicht erneuert wurden, vielleicht weil sie für die neue Kirche zu niedrig angelegt waren.
Den Beweis für einen etwas jüngern Ausbau und Umbau der Kirche liefert auch das Innere derselben. Die Hauptgurtbogen, die Gewölbeansätze und die Gewölbe sind alle im gespitzten Bogen des Uebergangsstyles construirt. Die hohen Gurtbogen sind in den edelsten Verhältnissen des Uebergangsstyles aufgeführt und machen einen wohlthuenden Eindruck, wie man ihn sehr selten wahrnimmt. Die Gewölbe haben einen kreisförmigen Schluß, und die Gewölberippen


|
Seite 326 |




|
haben einen quadratischen Durchschnitt. Der Chor hat acht Gewölberippen; das östliche Gewölbe des Schiffes hat fünf Rippen, indem sich in der Mittellinie der Kirche durch die westliche Kappe die fünfte Rippe legt; das westliche Gewölbe hat vier Rippen. Das achtrippige Gewölbe des Chores hat eine Verzierung, welche ich sonst nirgends bemerkt habe: um den kreisförmigen Gewölbeschluß stehen nämlich in zwei concentrischen Kreisen viereckige Ziegel in angemessenen Entfernungen von einander aus dem Gewölbe hervor, gleichsam frei stehende, von den Gewölben hangende, kleine kubische Zahnschnitte, welche das Gewölbe nicht unschön beleben.
Das Thurmgebäude ist ein jüngerer Bau.
Westlich nahe bei der Kirche steht an der Stadt der alte Burgwall, welcher eine bedeutende Höhe und Ausdehnung hat. Er hängt nach der Seite der Kirche hin mit dem festen Lande zusammen, ist aber an den übrigen Seiten jetzt von schmalen Wiesen und Niederungen umgeben, welche an der längeren Seite noch jetzt von Wald begrenzt werden. Die Lage und Anlage hat daher sehr viel Aehnlichkeit mit dem Burgwalle und der Kirche von Gadebusch, von wo auch Marlow gegründet sein mag. Ohne Zweifel ist dieser Burgwall eine wendische Anlage, welche in der christlichen Zeit benutzt ward.
Die Geschichte von Marlow giebt vielleicht genügende Aufklärung über den Bau der Kirche. Schon im J. 1179 verlieh der Fürst Borwin von Meklenburg dem Heinrich von Bützow die Hälfte der Burg Marlow mit 9 dazu gelegenen Dörfern, um die Gegend von Marlow zu cultiviren. Aus der Geschichte der Dänenzüge in die Wendenländer läßt sich aber schließen, daß es damals mit der Cultivirung in diesen Gegenden sehr schwer hielt; sie wird also wohl einstweilen unterblieben sein. Im J. 1210 wiederholte der Fürst diese Belehnung, welche er erst im J. 1215 besiegelte. Um diese Zeit wird denn auch wohl die Kirche vollendet sein, wozu auch der Styl genau stimmt. Da Heinrich von Bützow ein Bruder des Herrn Thetlev von Gadebusch war, so läßt sich vermuthen, daß der Bau der Ziegelkirche von Baumeistern aus dem westlichen Meklenburg ausgeführt ward, während die übrigen alten Kirchen im nordöstlichen Meklenburg Feldsteinkirchen sind. Ueber die älteste Geschichte von Marlow vgl. Jahrb. XIV, S. 88 - 94 und 289 flgd.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 327 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche von Thelkow
ist ein einfacher Bau von Feldsteinen mit Ziegeleinfassungen der Wölbungen im Uebergangsstyl. Sie hat einen quadratischen Chor und ein etwas breiteres Schiff von zwei Gewölben Länge. Die grade Altarwand hat drei, die übrigen Wände haben je zwei Fenster an jeder Seite unter jedem Gewölbe. Die Kirche ist gewölbt. Das Chorgewölbe ist besonders verziert. Am Gewölbeschluß sitzt ein runder Gewölbeschild mit einem Agnus Dei in Relief; jede Rippe ist mit zwei kleinen Scheiben mit einem Stern in Relief geschmückt, ähnlich wie die Kirche zu Mestlin (vgl. Jahrb. XXI, S. 276). Das westliche Schiffgewölbe ist eingestürzt. Im Thurmgebäude steht ein großer Taufstein aus Kalkstein mit romanischen Verzierungen, ganz wie der lübchiner (vgl. oben). Die Gewölberippen sind früher blau, roth und gelb bemalt gewesen. Der geschnitzte Altar ist in neuern Zeiten mit Oelfarbe überstrichen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Basse
ist eine sehr gut gebauete Kirche. Der quadratische, gewölbte Chor ist im alten Spitzbogenstyle aus dem Ende des 13. Jahrh. oder etwas später aus Feldsteinen erbauet; das Gewölbe hat acht Rippen von quadtatischem Durchschnitt. Das von Ziegeln erbauete Schiff ist etwas jünger, jedoch noch alt. Es ist dreischiffig und auf Wölbung angelegt; die Pfeiler sind achtseitig und gut construirt. Gegenwärtig hat das Schiff aber nur eine Balkendecke.
Die Kirche hat mehrere geschichtliche Denkmäler.
Unmittelbar vor dem Altare liegt ein großer Leichenstein, 8 1/2 Fuß lang und 4 3/4 Fuß breit: in der Mitte steht ein großes Wappen der Familie von Bassewitz, der Schild mit vertieften Grunde, der Helm in Umrissen, in den Ecken die Symbole der vier Evangelisten. Die Inschrift in gothischer Minuskel lautet:
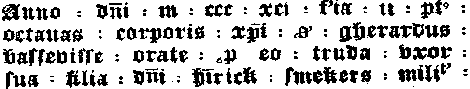


|
Seite 328 |




|
(= Anno domini MCCCXCI (1391), feria II post octavas corporis christi (Junii 5), obiit Gherardus Basseuisse. Orate pro eo. Truda vxor sua, filia domini Hinrick Smekers militis.
Hinter diesem Leichensteine liegt ein zweiter großer Leichenstein, 7 Fuß lang und 5 1/2 Fuß breit. In der Mitte sind die lebensgroßen Bilder eines Ritters und einer Frau in hohem Relief. In den vier Ecken stehen folgende Ahnenwappen mit den darüber stehenden Buchstaben, so viel davon noch zu lesen ist:
| . . . . B. | A. V . . . |
| (v. Bassewitz.) | (v. Quitzow.) |
| . . . . . . | . . . . . . |
| (Hahn.) | (v. Overn.) |
Das Wappen der v. Quitzow hat im queer getheilten Schilde oben und unten einen Stern, das Wappen der v. Overn im Schilde zwei Rauten neben einander, wie auf dem Epitaphium auf Victor Bassewitz. Die Inschrift lautet in fracturartiger, gothischer Minuskel:
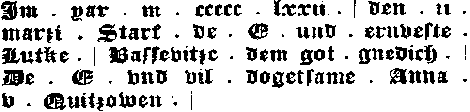
(Im yar MCCCCCLXXII (1572) den II Marzi starf de edle und ernveste Lutke Bassevitze, dem got gnedich. De edle und vil dogetsame Anna von Quitzowen.)
Vom Altare aus gesehen rechts oder nördlich von diesem Leichensteine liegt ein dritter bassewitzscher Leichenstein, welcher nur das Wappen der Bassewitz trägt, aber keine Inschrift, also ohne Zweifel eine jüngere bassewitzsche Familiengruft bedeckt.
Vom Altare aus gesehen links oder südlich von dem zweiten bassewitzschen Leichensteine liegt ein behauenes und neu benutztes Stück von einem sehr großen Leichensteine, 7 Fuß breit und nur 2 Fuß lang. Dieser Stein hat nur zwei kleine, eingeritzte


|
Seite 329 |




|
der Moltke und der Maltzan
und folgende Inschrift in gothischer Minuskel in zwei Zeilen:
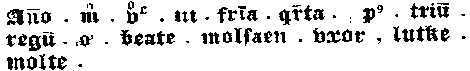
(Anno MVCIII (1503), feria quarta post trium regum (Jan. 11), obiit Beate Molsaen (Moltzan), uxor Lutke Molte (Moltke).
Im Schiffe im Mittelgange liegt ein Leichenstein mit dem behrschen Wappen in einem Kranze und darüber mit der Inschrift in lateinischen Unzialen:
GEHORET . DENEN .
BEHREN . VON . NVSTEROW .
VND . DERO . ERBEN .
ANNO . 1698 .
An der Nordwand des Chores ist ein großes, reiches Epitaphium aus Sandstein auf Victor oder Vicke Bassewitz 1592, mit 16 Ahnenwappen.
In den Fenstern des nördlichen Seitenschiffes sind noch Reste guter Glasmalerei aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Das östliche Fenster am Ende des Schiffes, 4 Luchten hoch, hat noch drei Gemälde: oben die Jungfrau Maria, sehr schadhaft; darunter der Apostel Jacobus mit Stab und Buch; die dritte Lucht ist leer; unten ein gut gemaltes Wappen: ein rechtsgelehnter goldener Schild mit drei rothen Deckelbechern, darüber ein Helm mit zwei Pfauenfedern. Dies ist nach der Zeichnung das Wappen der von Dewitz, obgleich jetzt die Farben umgekehrt sind, auch der Helmschmuck abweicht. In einem andern Fenster sind noch Reste von Ornamenten.
Von Interesse sind einige geschnitzte Kirchenstühle aus Eichenholz aus dem 16. Jahrhundert.
An der südlichen Chorthür vor dem Altare im Anfange der Stuhlreihe im Mittelgange steht ein Kirchenstuhl von drei Reihen Sitzen, an jeder Seite mit vier Seitenstücken, an denen am Mittelgange die drei Thüren hangen. Diese Seiten=


|
Seite 330 |




|
stücke haben Köpfe und an den vom Mittelgange sichtbaren Seiten auf denselben erhaben geschnitzte Wappen und Namen. Auf den Köpfen an der Wand stehen folgende Wappen und Namen:
an dem vordersten Stuhle auf einem breitern Seitenstücke:
HEI : BER
GNADE EM GODT
ANNA DOROTEA ALHEIDT
BATSEWIZEN . HANE MOLDT
GNADE ER GODT . GNAD ER GODT .
ANNO 1567.
an den andern drei Köpfen an der Wand:
JOCHIM BER
3.
ANNE WELTZIN
4.
DAVIT BER
GNAD EM GODT.
Auf den vier Köpfen am Mittelgange stehen folgende Wappen und Namen:
GERDT BER .
2.
ILSE LEWETSO .
3.
ADAM BER .
4.
ILSE KRAKEVITZE
Alle diese Wappen, welche man vom Mittelgange aus sieht, sind erhaben geschnitzt.
Außerdem sind noch folgende Wappen angebracht, welche vertieft geschnitzt sind.
An der innern Seite des vordersten Seitenstückes, auf welchem an der äußern Seite der Name Gerdt Ber steht, steht unter dem Wappen der Name


|
Seite 331 |




|
(richtiger Casper Ber).
Auf der Brüstung des vordersten Stuhles stehen folgende vier vertiefte Wappen und Namen:
| KATRINE | ANNE | MARGRETE | ANGNES |
| BER | BER | BER | BER |
Auf den Thüren stehen Sprüche in plattdeutscher Sprache. Auf der Thür zwischen den Seitenstücken mit den namen Adam Ber und Ilse Krakewitze steht:
WERDE : GI: EN : VIN : R : MOS : 5
ANO : 1567.
(d. i. 5 Buch Moses 4, 29).
Die Anordnung ist also folgende:
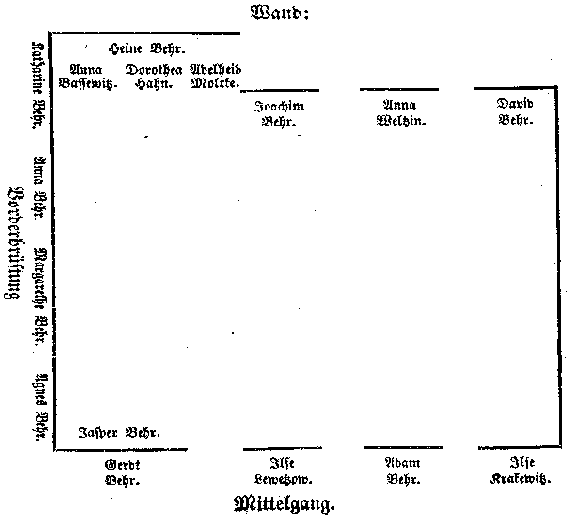


|
Seite 332 |




|
Dies ist also der im J. 1567 gebauete
Kirchenstuhl der Kinder und Schwiegerkinder des
Heine Behr auf Nustrow, Semlow
 Der Stammbaum, wie er bis jetzt
gilt, lautet also:
Der Stammbaum, wie er bis jetzt
gilt, lautet also:
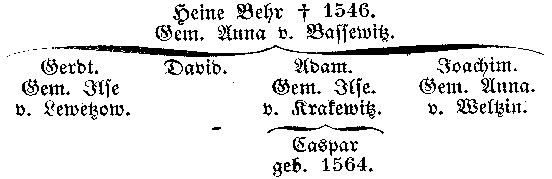
Dies sind ungefähr die Hauptpersonen, welche auch auf den Kirchenstühlen genannt worden. Aus den Inschriften auf den Kirchenstühlen geht aber hervor, wie es auch urkundlich nachzuweisen ist, daß Heine Behr drei Frauen hatte: die erste war Anna v. Bassewitz, die zweite Adelheid Moltke, die dritte Dorothea Hahn. Bei der Erbauung des Stuhles muß Dorothea Hahn als Wittwe noch gelebt haben. - Gerdt war der älteste Sohn von der Bassewitz, Joachim der zweite Sohn von der Moltke, Adam war ein Sohn der Hahn.
Der Chorthür gegenüber, an der Wand, neben dem Altare, steht ein zweiter Kirchenstuhl von ähnlicher Beschaffenheit, mit einer Bank und zwei Seitenstücken an jeder Seite, welche innerhalb an den Köpfen Inschriften tragen. Auf dem Seitenstücke links, an der Bank, stehen auf dem Kopfe zwei Wappen mit den Unterschriften:
BEHRE MOLTKE
GNADE EN GODT
Auf dem daneben an der Brüstung stehenden Seitenstücke steht:
NOT : ABGVNST
IS GRODT . 1567.
Auf dem Seitenstücke rechts, neben der Brüstung steht das v. weltzinsche Wappen und darunter


|
Seite 333 |




|
ANO 1667.
An der Brüstung vor dem Stuhle steht in einer Zeile:
WEDDER . VNs . ROM . AN 8. A. B.
d. i. Epistel Pauli an die Römer 8, 31. Die Buchstaben A. B. bedeuten Achim Behr.
Dieser Stuhl ward also besonders von Joachim Behr, zweitem Sohne des Heine Behr und der Adelheid Moltke, und seiner Gemahlin Anna Weltzin, ebenfalls im J. 1567, erbauet.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 334 |




|



|


|
|
:
|
Ueber
die Grabplatten von Ziegeln
in der Klosterkirche zu Doberan
I.
Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan,
vom
Geheimen=Regierungsrath
von Quast
,
königl. Preußischen Conservator.
Mit einer Tafel in Stahlstich.
Die Kirche des ehemaligen Cisterzienser=Klosters Doberan enthält die Gräber der großen Mehrzahl aller Glieder des meklenburgischen Fürstenhauses. Der größere Theil derselben, ihren Stammvater Pribislav an der Spitze, welcher erst 1164 zum Christenthume sich bekehrte, liegt im nördlichen Kreuzarme begraben; doch fanden sich hier nur noch wenige Ziegel mit den Spuren eines Büffelkopfes geziert, als Denkmale derselben vor, bis es in neuester Zeit der Thätigkeit des Herrn Archivraths Dr. Lisch gelang, sogar die Gebeine des Urahnen wieder aufzufinden.
Einige wenige Glieder jenes Geschlechts liegen aber auch im hohen Chore begraben, wo in neuester Zeit ebenfalls der der Sarkophag des ersten Großherzogs, Friedrich Franz I., von geschliffenem Granit aufgestellt wurde. Es sind namentlich drei Monumente, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, die sich zu beiden Seiten dieses Sarkophags, und das dritte zu dessen Füßen, gegen Osten, im Fußboden des Chors eingelassen, finden. Alle drei haben die gewöhnliche rechteckige Form der Grabplatten und deren Größe, bestehen aber nicht, wie diese, aus einem einzelnen Steine, dem die


|
Seite 335 |




|
nöthige Schrift oder sonstige Bezeichnung und Ausschmückung eingegraben ist, oder aus einer ähnlich bearbeiteten Metallplatte, wie sie sonst und auch in Doberan so häufig vorkommen, vielmehr schloß man sich hier dem vorherrschenden Ziegelmateriale an und bildete die Grabplatten aus einer Mosaik kleiner Ziegelplättchen, welche, ein jedes quadratisch gebildet, in rother Grundfarbe oder mit dunklerer Glasur versehen, theilweise noch jetzt in lichterer Farbe figürliche oder ornamentale Darstellungen zeigen. Es ist zu verwundern, wie man mit so geringen Mitteln einen nicht gewöhnlichen Erfolg hat erringen können.
Die beifolgende Tafel zeigt die drei Platten in der Reihenfolge, in welcher sie sich befinden, nur daß die mittlere etwas weiter nach unten hin hätte geschoben werden müssen, während sie selbst auf der Tafel, den Platz einnimmt, den gegenwärtig der moderne Sarkophag inne hat.
Das vorzüglichste der Monumente ist das auf der Nordseite gelegene des Fürsten Heinrich des Löwen von Meklenburg. Ein größerer übereck gelegter Ziegel nimmt im Obertheile die Mitte ein. Er enthält einen schräg gelehnten Schild, auf dem noch die Spuren des gekrönten Büffelkopfs, des meklenburgischen Wappenbildes, zu sehen sind. Auf dem noch höher gelegenen Quadratsteine sind ähnliche Spuren des Helms, der von zwei Büffethörnern überstiegen wird, zu erkennen; doch scheint der Stein gegenwärtig nicht in richtiger Lage sich zu befinden, da jene Helmzier sich an der Oberseite befinden mußte. Zu den Seiten dieses Ziegels ist jederseits ein Bandstreifen, der mit Laubwerk von noch romanischer Blattbildung belegt ist, und oberhalb sind zwei nicht hohe, aber breite Felder mit Schachbrettverzierung von nur zwei Ziegeln Höhe befindlich. Der übrige Raum ist durchgehend in gleicher Weise behandelt, nur daß die Ziegel hier übereck gelegt sind, und so das ganze Feld rautenförmig geschmückt erscheint. Ein senkrechter Streifen, der von der Unterspitze des Wappenziegels nach dem Fußende des Grabes hinläuft, theilt das Ganze in zwei gleiche Hälften. Einzelne der vorgenannten kleinen quadratischen Ziegel sind mit figürlichen Darstellungen versehen, meist wirkliche oder fabelhafte Thiere enthaltend, wie sich dergleichen und zum Theil noch andere auch auf den beiden anderen Grabplatten, nicht minder auch in anderen Theilen der Kirche, so wie in der Kapelle zu Althof gefunden haben. Die auf den drei Grabplatten befindlichen sind unten auf unserer Tafel, von a - o, in vierfach größerem Maaßstabe gezeichnet. Wenn einige derselben sich unzweifelhaft wieder=


|
Seite 336 |




|
holen, und deshalb nur einmal im Größeren dargestellt wurden, so ist dies bei anderen, wie eine genaue Vergleichung zeigt, nur in den Hauptmotiven der Fall und finden im Detail Abweichungen statt. Dr. Lisch hat in einem mit Abbildungen begleiteten Aufsatze 1 ) die große Uebereinstimmung, zum Theil sogar die Identität einiger dieser Ziegel mit den unter den Ruinen des Cisterzienser=Klosters Hovedöe bei Christiania in Norwegen gefundenen nachgewiesen, so wie den Zusammenhang dieser mit ähnlichen in England und dem nördlichen Frankreich neuerlich bekannt gewordenen, unter denen namentlich die aus Therouane (auch zu St. Omer und St. Pierre=sur=Dive) besonders hervorzuheben sind 2 ). Dennoch vermag ich meinem scharfsinnigen Freunde nicht auch bis zu dem Schlusse zu folgen, daß diese Ziegel noch etwa dem Ende des 12. Jahrhunderts angehörten. Die von ihm angeführten Beweise sind um so weniger zwingend, als diese Ziegel nirgend mehr an der Stelle eines Gebäudes liegen, welches jener Periode angehörte, vielmehr durchgehend an solchen, die anerkanntermaaßen jünger sind. Wenn nun der Ursprung jener Ziegel unzweifelhaft in dem damals tonangebenden Frankreich zu suchen ist, Herr von Caumont aber die dortigen, den Doberaner Fliesen am meisten verwandten Platten gewiß richtig erst dem 13. Jahrhundert zuschreibt, während die in Hovedöe und Doberan gefundenen an ihrer jetzigen Stelle nicht vor dem 14. Jahrhundert gelegt sein können, so liegt die Vermuthung nahe, daß auch hier, wie so oft anderwärts, eine ältere Formbildung noch sehr lange Zeit hindurch, selbst Jahrhunderte lang in Uebung blieb. Thier= und Bestiengestalten von ganz verwandter phantastischer Bildung, wie die in Rede stehenden, finden wir z. B. an den Ziegelkapitälen des südlichen Seitenportals der Stadtkirche zu Woldenberg in der Neumark, die erst dem 14. Jahrhundert angehört. Das Vorkommen derselben Formen in Doberan und Hovedöe, und eventuell auch an anderen Orten, würde sich dann am besten durch die gleiche Ordensverbindung beweisen, wie solche nun schon so oft an verschiedenen Orten


|
Seite 337 |




|
nachgewiesen worden ist, namentlich bei Bildungen, welche, wie die der Ziegel, aus bestimmten, leicht zu übersendenden Formen hervorgingen. Es liegt daher auch kein zwingender Grund zu der Annahme vor, daß die gemusterten Ziegel über den vorgenannten Gräbern älter als die Zeit ihrer Errichtung seien. Dasselbe gilt ebenso von dem vorgenannten Blattwerk=Ornamente, das trotz seiner romanischen Formen doch auch nicht älteren Ursprunges sein wird. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß gewisse Nebentechniken oft noch sehr lange einen älteren Styl bewahren, als welchen die gewöhnliche Architektur des Steinbaues zeigt, während umgekehrt in anderen Fällen einzelne Formen bei gewissen Kunstübungen schon früher erscheinen, ehe sie zu allgemeinerer Anwendung gelangten.
Alle vier Seiten des Grabes werden von einer fort laufenden Inschrift umgeben, die aus einzelnen länglichen Ziegeln besteht, deren jeder mehrere Worte, und nur wenige deren eins enthalten. Jedes Wort ist vom folgenden durch ein : getrennt. Auffallend ist, wie schon Lisch bemerkte, daß die Inschriften an den Gräbern aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts in Minuskelschrift abgefaßt sind, welche sonst erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts auf Grabschriften erscheint. Man dürfte allein aus diesem Grunde auf eine spätere Anfertigung zu schließen nicht berechtigt sein, da auch in diesem Falle das ungewöhnliche Material die Abweichung erklären dürfte. Die Inschrift selbst lautet nach unserer Abschrift folgendermaaßen:
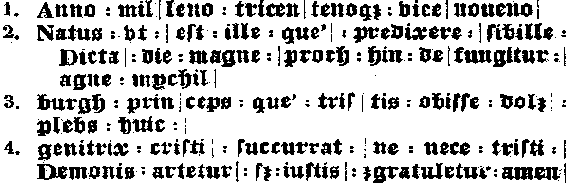
Dr. Lisch hat das Grab genau untersucht und beschrieben, und gab den Inhalt, so wie die Erklärung dieser Zuschrift nebst den sachlichen Erläuterungen a. a. O. IX. S. 428, auf welche wir deshalb verweisen. Später (XIX. S. 388) hat er, in Gemeinschaft mit Director Wiggert zu Magdeburg, die in leoninischen Versen abgefaßte Inschrift nochmals einer genauen Localuntersuchung unterzogen und demgemäß die von


|
Seite 338 |




|
Wiggert vorgeschlagene Redaction angenommen, welche also lautet:
Anno milleno tricen. vicenque noueno,
natus vt est ille, quem predixere Sibille
Dicta die magne proch Hin. defungitur Agne,
Mychilburgh princeps, quem tristis obisse dolet plebs,
Huic genitrix Cristi succurrat, ne nece tristi
Demonis artetur, sed iustis congratuletur. Amen.
Sie weicht von unserer Abschrift nur in Bezug auf die Worttheile des dritten Inschriftziegels ab, welche gegenwärtig unzweifelhaft in der von uns gegebenen Weise lauten: tenoqz : vice . Nach Dr. Lisch a. a. O. ist dieser Ziegel, der noch sehr wohlerhalten aussieht, nebst einem anderen, dessen wir später erwähnen werden, von ihm selbst bei der Aufräumung in der Tiefe des Grabes gefunden worden. Da derselbe aber den leoninischen Vers störe, so könne er nicht zu der gegenwärtigen Inschrift gehören, sei dagegen vielleicht Rest einer älteren, nicht mehr vorhandenen. Er ersetzt diese Sylben daher durch die oben genannte: vicenque, welche nach andern alten Nachrichten beglaubigt sei und dem Versmaaße entspräche. Sicher ist jedenfalls auch der anderwärts beglaubigte Sterbetag, der Tag der heil. Agnes (21. Januar) 1329. Auffallend ist es, daß der Name Heinrichs nur in der Abbreviatur wiedergegeben ist, welche allerdings allein zu dem Versmaaße paßt.
Der diesem entsprechende, auf der Nordseite befindliche Grabstein (Fig. 2) ist im Wesentlichen mit einem schachbrettartigen Muster der schon genannten dunkleren und helleren Ziegel belegt, deren noch mehrere, als bei dem Heinrichs, Muster mit Thieren und Bestien erhalten haben. Auch hier sind die correspondirenden Ziegel in größerem Maaße unter a - f, l, o dargestellt. Die Mitte des Ganzen nimmt ein quadratisches Mittelfeld ein, dem ein Andreaskreuz in dunklerer Farbe eingelegt ist, während die Zwischenräume desselben einfach gemustert erscheinen. Ein Rhombenmuster umzieht den ganzen Grabstein, und um dieses herum ist eine einfache Schrift von wechselnden hellen und dunklen Ziegeln gelegt. Die Mitte des Obertheils dieser letzeren nimmt die Inschrift ein:
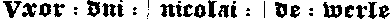 1
),
1
),
d. h. Vxor domini Nicolai de Werle. Es ist daraus nicht zu erkennen, ob dieselbe in sich abgeschlossen, oder ob sie, was wahrscheinlicher, nur der Rest einer größeren Inschrift ist, welche dann


|
Seite 339 |




|
natürlich auch den Vornamen der Fürstin, ihren Todestag und Todesjahr angegeben haben wird. So bleibt es jetzt zweifelhaft, wer damit gemeint sei, da jenen Vornamen mehrere Herren von Werle führten. Dr. Lisch (a. a. O. IX. S. 431) ist der Ansicht, es werde die Gemahlin Nicolaus I. sein, der bereits 1277 zu Doberan begraben wurde, während ihn seine Gemahlin nach 44jahriger Ehe überlebte. Wegen des Parallelismus mit dem Grabe Heinrichs von Meklenburg dürfte aber doch wohl auf eine ziemlich gleiche Todeszeit beider zu schließen sein, was bei jener Annahme schwerlich zutreffen würde, weshalb ich es vorziehen möchte, an die Gemahlin des 1316 verstorbenen Nicolaus II. von Werle zu denken, des gleichfalls zu Doberan begrabenen ausgezeichneten Zeitgenossen Heinrichs von Meklenburg (a. a. O. XIX. S. 362). Wenn Lisch als Grund, sich für den erstern dieses Namens zu erklären, annimmt, daß zu seiner Zeit kein anderer dieses Namens gelebt habe, die Gemahlin dieses einen also deutlich genug bezeichnet gewesen sei, so scheint dies doch nicht ausreichend zu sein, da die Inschrift, wie schon gesagt wurde, schwerlich vollständig ist, der fehlende Theil derselben also sehr wohl die nähere Bezeichnung enthalten konnte. Auch war Nicolaus II. seiner Zeit der einzige Herr von Werle dieses Namens, ein Zweifel also gleichfalls für die Lebenden nicht vorhanden. An künftige Geschlechter pflegte man aber wohl nicht eben sehr zu denken. Gegenwärtig befindet sich am Fußende noch das Inschrift=Fragment:
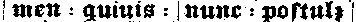
. . . men quiuis nunc postulet 1 ). So fragmentirt sind sie keiner Erklärung fähig, und bleibt es selbst ungewiß, ob sie diesem oder einem andern Grabe angehören.
Der dritte der gezeichneten Grabsteine (Fig. 3) liegt in der Mitte der beiden, doch vor ihnen, mehr östlich, dem Altare näher. Ein großes lateinisches Kreuz, aus dunkelglasirten Ziegeln deckt das ganze Grab. Zu den Seiten des unteren längeren Armes sind quadratische Felder, jedes mit einem Andreaskreuze in dunkelglasirten Ziegeln, und mit rautenförmig gelegten helleren in den Zwickeln. Der übrige Grund der Grabplatte ist mit den kleinen Quadratziegeln, zum Theil in schachbrettförmigem Wechsel belegt. Viele dieser Ziegel zeigen noch die schon genannten helleren Thiermuster, deren größeres


|
Seite 340 |




|
Detail unter g - o. nachgewiesen ist. Von den größeren Ziegeln sind nur einige in den Kreuzarmen gemustert, unter denen einer ein Flügelpferd darzustellen scheint, zwei aber Band= und Laubverzierungen in ziemlich strengem Style zeigen. Eine Inschrift oder sonstige nähere Bezeichnung zeigt diese Grabplatte nicht.
Nach Dr. Lisch (a. a. O. IX. S. 432) soll hier nach der Sage Herzog Albrecht der Große, Sohn Heinrichs des Löwen, ruhen. Bei der Aufgrabung des Grundes zeigte sich aber keine Spur von einem Sarkophage oder der Beisetzung eines Todten. Er hält es daher für möglich, daß diese Stelle eine Asylstätte sei. Dem dürfte aber die ganze Anordnung, welche völlig der der anderen Gräber gleicht, widersprechen. Es dürfte daher anzunehmen sein, daß diese Grabplatte später von ihrer ursprünglichen Stelle verrückt worden sei. Vielleicht lag sie ursprünglich in der Mitte zwischen den beiden vorgenannten, wo jetzt der Sarkophag des Großherzogs Friedrich Franz aufgestellt ist. Es ist zu bedauern, daß Dr. Lisch nicht das Ergebniß seiner Aufgrabungen an dieser Stelle mitgetheilt hat, namentlich ob hier etwa die Spuren eines Grabes gefunden wurden; in diesem Falle dürfte unsere Vermuthung sich bestätigen. Sollen wir dieselbe noch weiter ausdehnen, so würden wir annehmen, daß hier etwa Nicolaus II. begraben worden sei, dem dann später seine Gemahlin zur Seite beigesetzt wurde; denn es bleibt immer auffallend, daß keins der beiden jetzt vorhandenen Gräber sich in der Mittelaxe der Kirche befindet. Auch die Aehnlichkeit in der Ornamentik dieser Grabplatte mit der der Gemahlin des Nicolaus von Werle läßt auf Zusammengehörigkeit beider schließen, während die Heinrichs von Meklenburg von beiden wesentlich abweicht.
Daß unter denen der älteren Zeit nur diese Gräber sich im hohen Chore der Kirche befinden, fern von der Gruft der übrigen Fürsten im nördlichen Kreuze, dürfte, wie Dr. Lisch schon richtig bemerkt hat, wohl vorzugsweise daher kommen, daß sich die hier Begrabenen bei Erneuerung der Kirche vorzugsweise thätig bewiesen haben. Wenn, wie wir nach dem Style der Architektur anzunehmen Ursache haben, der Bau der jetzigen, im Jahre 1368 geweihten gothischen Kirche erst nach dem Brande 1291 1 ) begonnen hat, so wird beim Tode


|
Seite 341 |




|
Nicolaus II. von Werle (1316) derselbe vorgerückt gewesen sein, um diesen ausgezeichneten Herrn, der beim Neubau sich besonders thätig mag erwiesen haben, eine ausgezeichnete Grabstätte, und später seiner Gemahlin neben ihm, anzuweisen. Nachher wird Heinrich von Meklenburg sich neue Verdienste um die Fortsetzung des Baues erworben haben und gleicher Ehren würdig erachtet worden sein. Das Grab seines Sohnes Albrecht würde man schwerlich in der Mitte der beiden anderen Gräber erwarten dürfen, da hier nur ein älteres als diese vermuthet werden darf; im Falle er hier wirklich beigesetzt wurde, ist die Stätte wohl anderwärts zu suchen.
v. Quast.



|


|
|
:
|
II.
Erläuterungen
über
die Grabplatten von Ziegeln
in der Klosterkirche zu Doberan,
vom
Archivrath
Dr. Lisch,
großherzoglich
meklenburgischen Conservator.
Mein verehrter Freund, der Herr Geheime=Regierungsrath von Quast, auf und zu Radensleben bei Ruppin, Conservator der geschichtlichen Kunstdenkmäler des preußischen Staates, correspondirendes Mitglied unsers Vereins, hat die doberaner Ziegelgrabplatten seiner besonderen Aufmerksamkeit


|
Seite 342 |




|
für würdig gehalten und den vorstehenden Aufsatz in der von ihm und Otte herausgegebenen "Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst", Bd. II, S. 28 - 33, mit einer Abbildung der doberaner Grabplatten in Stahlstich herausgeben; er hat ferner nicht nur den Wiederabdruck dieses Aufsatzes in unsern Jahrbüchern für angemessen gehalten, theils um ihn weiter zu verbreiten, theils um mir "Veranlassung zu geben, mich über diesen Gegenstand zu äußern, wenn ich nicht ganz mit seinen Annahmen übereinstimmen sollte", sondern auch bie große Freundlichkeit gehabt, 450 Exemplare des Stahlstiches unserm Vereine für dessen Jahrbücher zum Geschenke zu verehren und den Verein zum allergrößten Danke zu verpflichten.
Ich habe daher den v. quast'schen Aufsatz nicht allein wieder abdrucken lassen, sondern mache auch von der Erlaubniß meines Freundes Gebrauch, mich in freundschaftlicher Weise über seine Ansichten zu äußern, da meine Erfahrungen über die meklenburgischen Fürstengräber in Doberan von großer Wichtigkeit für die Landesgeschichte sein dürften.
Ich habe zu beweisen gesucht, daß die in Rede stehenden gemusterten kleinen Ziegel aus der Zeit der ersten Erbauung der großen Kirche zu Doberan stammen und noch dem Ende des 12. Jahrhunderts angehören können. Der Hauptinhalt des v. quast'schen Aufsatzes zielt dagegen dahin, die Ansicht geltend zu machen, daß
"die in Hovedöe und Doberan gefundenen gemusterten Ziegel an ihrer jetzigen Stelle nicht vor dem 14. Jahrhundert gelegt sein können, da diese Ziegel nirgends mehr an der Stelle eines Gebäudes liegen, welches noch dem 12. Jahrhundert angehörte, vielmehr durchgehend an solchen, die anerkanntermaßen jünger sind".
Dieser Grund trifft nicht zu, da die allerneueste Baugeschichte uns eines andern belehrt. Die kleinen gemusterten Ziegel liegen, mit Ausnahme der Grabplatten, nicht mehr da, wo sie ursprünglich gelegen haben, sondern sind in früheren Zeiten, als man nicht das geringste Verständniß von alter Baukunst und Bau=Denkmälern hatte, ganz willkührlich von unwissenden, wenn auch wohlmeinenden Maurergesellen dahin gelegt, wo sie jetzt liegen. Jetzt liegen sie, außer auf den besprochenen Gräbern nur noch auf dem etwas erhöheten, beschränkten Altarraume, welcher allerdings in dem polygonen Chorschlusse liegt, der erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts erbauet ist und erbauet sein kann. Hierher sind sie aber erst


|
Seite 343 |




|
in neuern Zeiten gelegt worden, weil man sie doch für absonderlich hielt, ohne eine Ahnung von ihrer Wichtigkeit zu haben. Sie lagen überall gruppenweise zerstreut im Fußboden des ganzen Chores; man brachte endlich die letzten Ueberreste zusammen und pflasterte damit den Fußboden dicht um den Hochaltar, ohne Wahl und ohne ein bestimmtes Muster herzustellen. Ich habe die von dieser Umlegung noch übrig gebliebenen Reste, welche auf dem Altarraume nicht untergebracht werden konnten, überall in der Kirche umherliegen gesehen und davon manche Stücke für die großherzoglichen Sammlungen gerettet. In den Ecken und Winkeln des hohen Chores saßen früher noch einzelne ganze und halbe Ziegel dieser Art, die man nicht ausgebrochen hatte, weil sie grade die Winkel bequem füllten. Ich habe bei den Restaurationsbauten in Doberan viel mit dem alten Maurergesellen verkehrt, welcher die Umlegung ausgeführt und mir wiederholt alles genau erzählt hat. Und solche Umlegungen sind nicht etwa ein Mal, sondern wiederholt geschehen. Ich selbst habe bei den Arbeiten an den fürstlichen Begräbnissen manche Umlegungen vorgenommen, welche nicht die ersten waren. Es ist also auf die jetzige Lage dieser gemusterten Ziegel gar nichts zu geben; man muß vielmehr tiefer in die Erde hinabsteigen.
Man muß sich die Umstände nur so denken, wie sie in alten Zeiten wirklich gewesen sind. Ohne allen Zweifel waren nach vielen Spuren und nach den Traditionen, wie es auch die Sache selbst mit sich brachte, in alten Zeiten der ganze Chor und die Kreuzschiffe, vielleicht die ganze alte Kirche, zu Doberan mit den kleinen gemusterten Ziegeln gepflastert, und zwar ebenfalls ohne Zweifel in bestimmten passenden Mustern, wie man es noch im nördlichen Frankreich sieht. Als aber am Ende des 13. und Anfange des 14. Jahrhunderts das Begraben unter Leichensteinen Mode ward und immer mehr einriß, wurden die alten Kirchenpflaster unzählige Male aufgerissen, die Muster zerstört, die Pflasterziegel verkannt und endlich als unbequeme Materialien ganz verworfen. Ich selbst habe oben in dem Grabe des meklenburgischen Fürsten Heinrich des Löwen die jungen Gebeine vieler doberaner Einwohner gefunden, für welche also die Grabplatten aufgenommen werden mußten. Ein Glück ist es, daß die Leichen der alten fürstlichen Personen in der Kirche zu Doberan 5 Fuß tief in dem stark wasserhaltigen "Sogsande" des Grundes begraben liegen, so daß sie von jüngern Begräbnissen, welche lange so tief nicht gingen, stets völlig unberührt geblieben sind, wie schon die


|
Seite 344 |




|
wohl erhaltenen, aus Ziegeln aufgemauerten Sarkophage, in denen die Gerippe liegen, beweisen.
Auch der Umbau der Kirche in jüngern Zeiten scheint mir durchaus kein Beweis für das jüngere Alter der gemusterten Ziegel zu sein. Die doberaner Kirche, wie sie jetzt besteht, ist allerdings im 14. Jahrhundert umgebaut und im J. 1368 als gänzlich vollendet eingeweihet worden. Diese Spitzbogenkirche war aber keinesweges eine neue, auch keine größere Kirche, als die alte, sondern sie ward nur erhöhet und allein um den polygonen Chorschluß, d. h. um den eigentlichen Altarraum und den Umgang um denselben, verlängert. Man bauete überhaupt im 14. Jahrh. wohl nicht häufig ganz neue Kirchen, sondern man erhöhete sie gewöhnlich nur und gestaltete sie in neuem Styl um und benutzte dazu die alten Fundamente, Pfeiler und Mauern, so gut es gehen wollte. In der Kirche zu Bützow, welche ebenfalls um das J. 1368 einen polygonen Chorschluß erhielt und aus drei ganz verschiedenen Gebäuden besteht, kann jeder deutlich sehen, wie man den alten niedrigen Chor bis zur Höhe der zu beiden Seiten stehenden jüngern Bauten erhöhete. Auch die Kirche zu Doberan giebt ein redendes Zeugniß von der Erhöhung der Kirche. Die ganze Südwestecke der Kirche ist noch das alte romanische Kirchengebäude mit Rundbogenpforte und Rundbogenfries, ohne Granitsockel und ohne Strebepfeiler, welche erst in jüngern Zeiten nach Abbruch des Kreuzganges angesetzt sind; in der Nordostecke liegt der Fürst Pribislav begraben, dessen Leiche erweislich hier im J. 1219 eingesenkt ward. Wir haben hier also zwei uralte Ecken, welche den größten Durchmesser der Kirche bezeichnen und unwiderleglich beweisen, daß die alte Kirche, mit Ausnahme des Chorschlusses, grade so groß war, als die jetzt noch stehende Kirche, und daß die neue Kirche von 1368 nur auf den Ringmauern und Pfeilern der alten Kirche erhöhet und verdickt ist. Der hohe Chor, mit Ausnahme der jetzigen Altarstelle, ist also seit der Gründung der Kirche die Stelle des hohen Chores, und die Leichen des Fürsten Heinrich des Löwen und der Fürstin von Werle liegen auf dem alten Chore, früher näher vor dem ehemaligen Altare, da der alte romanische Chor ohne Zweifel viel kürzer war.
Der Chor war wohl sicher schon zu der Zeit der romamanischen Bauperiode mit den kleinen gemusterten Ziegel gepflastert. Hierauf deutet schon das Grab des Fürsten Heinrich des Löwen, welcher im J. 1329, also 40 Jahre vor der Vollendung der jetzigen gothischen Kirche, starb und hier be=


|
Seite 345 |




|
graben ward. Dies giebt zugleich den Beweis, daß man selbst bei bedeutenden Umgestaltungen die alten Baulichkeiten nach Möglichkeit unberührt ließ.
Aber gerade das Grab des Fürsten Heinrich des
Löwen giebt mir einen sicheren Beweis für das
hohe Alter der gemusterten Ziegel. Man irrt
gewiß sehr, wenn man annimmt, die jetzigen
sogenannten "Grabplatten", was sie
jetzt in dem kahlen, schlichten Fußboden auch
geworden sind, seien ursprünglich zu
"Grabplatten" angelegt. Im Gegentheile
besteht die Bezeichnung des Grabes Heinrichs des
Löwen nur in dem um die Grabstätte gelegten sehr
schmalen Inschriftrande und den eingelegten
Wappenziegeln. Die innerhalb des Inschriftrandes
liegenden kleinen, gemusterten Ziegel sind nur
Reste des alten Fußbodens, der auch um das Grab
lag, also älter ist, als das Grab. Alle anderen
gemusterten Ziegel umher sind verschwunden; der
Inschriftrand, welcher ein Grab bezeichnete und
die Ueberlieferung lebendig erhielt, rettete die
Ziegel innerhalb des Inschriftrandes und machte
sie zu "Grabplatten". Es scheint mir
also klar zu sein, daß die gemusterten Ziegel
älter sind, als die erhöheten Ringmauern der
Gebäude, in denen sie jetzt liegen. Die
Inschriftränder allein haben die Grabstellen
geschützt. Es lebte in Doberan eine einfache
Tradition, welcher auch ich bei der Aufnehmung
der Gräber gefolgt bin: man machte niedrige
Holzkasten und legte die aufgenommenen Ziegel in
derselben Ordnung, um sie nachher in derselben
Ordnung wieder in die Erde legen zu können;
dabei kam es aber nie darauf an, daß man
abgetretene Steine verwarf und an andern Stellen
des Chores besser erhaltene Stücke ausbrach, um
sie zu den "Grabplatten" zu verwenden.
So erhielt sich die Bezeichnung der Grabstätten
Jahrhunderte lang durch die Tradition. Aber auf
die jetzige Anordnung der einzelnen Steine ist
nichts zu geben, und es ist die große Frage, ob
die Legung in Kreuzmustern
 . aus alter Zeit stammt, oder
nicht vielmehr eine neue Erfindung ist.
. aus alter Zeit stammt, oder
nicht vielmehr eine neue Erfindung ist.
Viel wichtiger, als das, was, mit Ausnahme der Inschriftziegel und Wappenziegel, oben im Fußboden liegt, ist das, was in der Tiefe der Gräber gefunden ist: die Ziegelsarkophage in großer Tiefe mit den Gerippen und die beim Begraben der Leichen und beim Einsturze der Särge schon in alten Zeiten in die Tiefe gesunkenen Stücke der Grabbezeichnungen. Und hier muß ich wiederholt eine Erfahrung geltend machen, welche mir wichtiger ist als alle andern Andeutungen. Der Fürst Pribislav, der christliche Stammvater


|
Seite 346 |




|
der Fürsten von Meklenburg, fiel im J. 1178 auf einem Turniere zu Lüneburg und ward dort in dem Michaeliskloster auf dem Kalkberge beigesetzt. Nach der Unterdrückung des Aufstandes der Wenden und nach Herstellung der Ruhe und gesetzlichen Ordnung bestätigte sein Sohn Borwin im J. 1218 das Kloster Doberan, dessen Kirche schon so weit im Bau vorgerückt war, daß er die Leiche seines Vaters im J. 1219 nach Doberan versetzen konnte; die alte Kirche, auf deren Fundamenten die neue steht, konnte im J. 1232 als ganz vollendet eingeweihet werden. Da man beim Kirchenbau von Osten gegen Westen vorschritt, so läßt sich wohl annehmen, daß im J. 1219 bis 1232 das Schiff und die innere Einrichtung ausgeführt wurden. Diese Ansicht wird dadurch begründet, daß an das südliche Kreuzschiff der Kreuzgang mit dem Refectorium angebauet war, dessen noch in Ruinen stehende Mittelwand den reinen Rundbogenstyl zeigt, und daß im nördlichen Kreuzschiffe Pribislav begraben ward. Bei dem Grabe Pribislav's machte ich aber eigenthümliche Erfahrungen. Das Grab hatte früher einen mit einer Messingschnittplatte belegten Leichenstein gehabt; Pribislav's Leiche lag an 6 Fuß tief unter dem Fußboden der Kirche in einem Ziegelsarkophage. Ueber diesem Sarkophage war die Erde ganz rein, also ein Beweis, daß diese Stelle immer besonders geachtet gewesen und daß an derselben in jüngern Zeiten niemand begraben war. In der Tiefe der Gruft außen an dem Ziegelsarkophage lagen nun viele von den gemusterten Ziegeln, welche je 2, 3, auch 4 Stück zusammen in Kalk gelegt und noch fast ganz neu und glänzend in der Glasur waren. Diese Stücke hatten bei dem Begräbnisse Pribislav's sicher die Ränder der Gruft gebildet und waren beim Hinablassen des Sarges losgebrochen und getreten und in die Tiefe gefallen. Da das Grab Pribislav's völlig unberührt war, so läßt sich nichts anders denken, als daß beim Begräbnisse Pribislav's 1219 der Fußboden aus den kleinen gemusterten Ziegel schon lag. Ich habe dies alles in den Jahrbüchern XIX, S. 342 flgd. und S. 157 flgd. und XXII, S. 206 flgd. ausführlich beschrieben nnd begründet.
Eben so wichtig ist auch der ganze Styl und die Technik dieser gemusterten Ziegel, welche jedenfalls älter find, als das 14. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert ging man wohl viel derber und kräftiger zu Werke und folgte nicht mehr jener feinen Zeichnung, welche der alten Miniaturmalerei nicht unähnlich ist.
Ich kann mich daher von der Ansicht nicht lossagen, daß


|
Seite 347 |




|
die gemusterten Ziegel aus der Zeit der Erbauung der ersten Kirche zu Doberan stammen, älter sind als 1219 und dem Anfange des 13., vielleicht dem Ende des 12., Jahrh., wenn auch nur in der Tradition der Technik, angehören.
Nachdem ich meine Ansichten und Erfahrungen niedergelegt habe, muß ich zum Schlusse noch einige Einzelheiten berühren.
In der westlichen Hälfte des Chores, also in angemessener Entfernung vor dem Hochaltare der ehemaligen romanischen Kirche liegen: nördlich der Fürst Heinrich der Löwe, südlich die Gemahlin des Fürsten Nicolaus von Werle neben einander begraben. Genau zwischen beiden Gräbern steht jetzt der Granitsarkophag des Großherzogs Friedrich Franz I. Weiter gegen Osten, ungefähr in der Mitte des Chors, liegt in der Mittelaxe der Kirche eine dritte "Grabplatte" aus kleinen gemusterten Ziegeln. V. Quast sagt S. 32 (oben S. 340): "es ist immer auffallend, daß keines der beiden jetzt vorhandenen Gräber (zu beiden Seiten des Sarkophages) sich in der Mittelaxe der Kirche befindet", und: "es ist zu bedauern, daß Lisch nicht das Ergebniß seiner Aufgrabungen an dieser Stelle mitgetheilt hat". Ich habe im J. 1843 zur Fundamentirung des schweren Granitsarkophages für den Großherzog Friedrich Franz I. das westliche Ende des Chores ganz aufgedeckt und dabei die Stelle für den Granitsarkophag sehr tief ausgraben lassen, da er stark fundamentirt werden mußte. Die Ergebnisse der beiden Gräber neben dem Sarkophage habe ich in Jahrb. IX, S. 429 flgd. ausführlich beschrieben. An der Stelle, wo der Granitsarkophag steht, also in dem ganzen Raume zwischen den beiden Gräbern, ward bis zu großer Tiefe gar nichts gefunden. Deshalb habe ich auch nicht darüber gesprochen; sonst würde ich genau darüber berichtet haben. Es ist also an dieser Stelle sicher kein altes Begräbniß gewesen; vielleicht hat hier irgend ein kirchliches Geräth gestanden, welches die Stelle so lange geschützt hat; da der Laienaltar nicht weit davon im Westen stand. Daß eines der beiden Gräber nicht in der Mittelaxe der Kirche liegt, darf wohl gerade nicht auffallen. Auch im Dome zu Güstrow liegt der Stifter desselben Heinrich Borwin II. († 1226) nicht in der Mittelaxe der Kirche auf dem Chore, sondern gegen die Mitte des Raumes südlich von demselben.
Die dritte "Grabplatte" in der Mitte des Chores, nach dem Altare hin, unter welcher der Herzog AIbrecht II. begraben sein soll, wie mir der frühere Küster erzählte, halte ich für gar keine Bezeichnung eines Grabes, da sich in der Tiefe


|
Seite 348 |




|
keine Spur von einem Begräbnisse, sowohl unter der Platte, als umher befand und auch keine Inschrift darauf hindeutet. Ich halte jetzt die Platte gar nicht für eine Bezeichnung eines Grabes, sondern nur für eine willkührliche Zusammenstellung und Begrenzung von gemusterten Ziegeln, welche vielleicht vor längerer Zeit an dieser Stelle noch zusammenlagen. Der Herzog Albrecht II. wird nach allen Andeutungen wohl in der allgemeinen fürstlichen Begräbnißstätte im nördlichen Kreuzschiffe begraben sein. Jedenfalls ist aber die etwa zu dieser Platte gehörende Leiche nicht zwischen den beiden andern Begräbnissen zu suchen und die Platte nicht gegen Osten gerückt worden, da, wie so eben gesagt ist, zwischen den beiden Gräbern keine Spur von einem Begräbnisse zu finden war.
Was die Inschriften auf den beiden Gräbern betrifft, so muß ich an meiner letzten Lesung festhalten. Die Alten haben wohl schwerlich gegen das Sylbenmaaß des leoninischen Hexameters gefehlt, und außerdem zeugen ältere Abschriften für die Richtigkeit der Lesung. Ueber die Gemahlin des Fürsten Nicolaus von Werle läßt sich wohl nicht eher etwas Besseres sagen, als bis die Grabstätten der wendischen Fürsten festgestellt sind, was mit der Zeit wohl gelingen dürfte.
Die Glasur der gemusterten kleinen Ziegel ist nie eine "dunkle" sondern stets eine durchsichtige Glasglasur. Die dunkle porphyrartige Farbe der meisten Ziegel rührt von einem auf den rothen Ziegel aufgelegten, dunkel gefärbten Thongrund her, in den die weißen Figuren eingelegt sind; darauf ist die ganze Fläche mit einer durchsichtigen oder Glas=Glasur überzogen.
Endlich bemerke ich, daß der freilich nur noch in den Umrissen deutliche Ziegel mit dem Helme der Fürsten von Meklenburg ganz richtig steht. Ich gebe hier wieder die Umrisse, in welche im Innern einige auf dem Originale noch zu verfolgende Linien zum bessern Verständniß eingetragen sind.
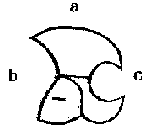
v. Quast meint, "es seinen noch Spuren des Helms, der von zwei Büffelhörnern überstiegen wird, zu erkennen, doch scheine


|
Seite 349 |




|
"der Stein gegenwärtig nicht in richtiger Lage sich zu befinden, da jene Helmzier, sich an der Oberseite befinden mußte". Der eigenthümliche Helm der fürstlichen Linie von Meklenburg ist unter den Fürsten Heinrich I und II. von der zweiten Hätfte des 13. Jahrh. bis gegen die Mitte des 14. Jahrh. ein rechts, gekehrter Helm, auf welchem ein von der Seite zu sehender, ausgebreiteter Pfauenwedel steht, vor welchem auf dem Helme in Schirmbrettern der meklenburgische Schild liegt, welcher nur halb zu sehen ist. Der Helm steht aufrecht, rechts gekehrt zwischen b und c; nach a hinauf steht der Pfauenwedel. Die nach c hin sichtbare Einbiegung wird also nicht durch zwei "Büffelhörner" gebildet, sondern der obere Theil der Krümmung a - c ist der hintere Theil des nach hinten hinabwallenden Pfauenwedels, der untere Theil der Krümmung nach c hinauf ist die hinauf wehende Spitze der Helmdecke.
Es freut mich, daß mein hochverehrter Freund v. Quast mich durch seine Einwürfe veranlaßt hat, mich deutlicher und ausführlicher auszusprechen und tiefer in die Sache einzugehen. Hoffentlich werden diese Verhandlungen zum gemeinschaftlichen Verständniß beigetragen haben. Jedenfalls aber ist der Verein dem Herrn v. Quast für die werthvolle Mittheilung zum großen Danke verpflichtet.


|




|



|




|


|
Seite 350 |




|
Ueber den Hochaltar der S. Georgenkirche zu Parchim
Vgl. Kunstgeschichte, unten.



|


|
|
:
|
Drei Denksteine aus der Umgegend von Wismar
So wie es noch heute im südlichen Deutschland Sitte ist, durch plötzlichen oder gewaltsamen Tod auf der freien Straße Umgekommenen an der Stelle des Unglücks Kreuze zu errichten, so wird es auch im Mittelalter überall gewesen sein. Da aber hölzerne Monumente, welche ohne Zweifel die Mehrzahl gebildet haben, im Laufe der Zeit zerstört sind, so haben nur die steinernen übrig bleiben können, von denen aber gewiß auch eine Menge untergegangen sind. Meines Wissens sind von dieser Art in Meklenburg bisher bekannt geworden: das Denkmal eines Grafen von Schwerin bei Wittenburg (A. X, 197), der Bernstorff'sche Stein von 1351 (B. II, 167 mit Abbildung), der Stein von Eversdorf für Lüdeke Moselenborg von 1391 (A. XI, 483. XX, 300.), der von Selow für Herman Lammeshovet von 1399 (A. X, 371), das Denkmal für Gottschalk von Köln zwischen Barnsdorf und Biestow bei Rostock von 1409 (Schröders P. M. S. 1753), und endlich der Denkstein für den Domprobst Thomas Rode in Rostock aus dem Ende des 15. Jahrhunderts (Francks A. u. N. M. B. VIII, S. 242). Der wittenburger Stein ist von Granit, alle übrigen noch vorhandenen aber von Kalkstein, der aus dem Norden eingeführt, auch das Material zu Leichensteinen, Altarplatten, Fünten, Weihbecken, Säulenschäften, Kapitälern, Basen u. s. w. abgab. Er ist nicht überall von gleichen Güte; während derjenige der älteren Denkmäler von großer Härte ist, so daß man ihn leicht für Granit halten kann, ist der in jüngerer Zeit oft blätterig 1 )
Bei liegenden Leichensteinen in Kirchen und im Freien bin ich immer am besten gefahren, wenn ich die Inschriften, ohne den Staub ( ... )


|
Seite 351 |




|
und von schlechter Farbe. In älterer Zeit verwandte man ausschließlich die weiße Art, im fünfzehnten Jahrhundert wählte man wenigstens zu Grabsteinen auch rothes und blaues Gestein. Mit Ausnahme des wittenburger Steins und des Denkmals für Gottschalk von Köln haben alle die Denksteine eine gleiche Form. Es sind Tafeln von 4-6 Zoll Stärke, 1 1/2 - 2 Fuß Breite und 6 - 8 Fuß Höhe, die mit einem abgerundeten Kopfe versehen sind, wie die Abbildung des bernstorffschen Steines zeigt. Franck a. a. O. nennt den Denkstein für den Domprobst Thomas Rode eine "Docke", im Mittelalter nannte man sie "Kreuze", wie man unten sehen wird. Die drei in folgendem beschriebenen "Kreuze" stehen in der Nähe von Wismar.
1. Denkstein von Wendorf.
Neben der Chaussee nach Grevismühlen auf dem wendorfer Felde, jetzt weiter als vordem, dicht an die gögelower Scheide gerückt, steht ein durch Wetter und Menschenhand arg mitgenommener Denkstein; der Kopf desselben fehlt bereits. Auf der vorderen Fläche ist ein Crucifix eingerissen, die hintere ist glatt. Die Inschrift ist auf den schmalen Seiten angebracht. Sie hat oben auf dem Kopfe begonnen und läuft die eine Seite hinunter, während die zweite Hälfte wieder auf der Spitze des Kopfes begann; wenn man diese liest, steht man dem Crucifixe gegenüber, so daß vielleicht die Seite, auf welcher dasselbe dargestellt ist, als die hintere angesehen werden muß. Was von der Inschrift noch übrig ist, lautet folgendermaaßen:
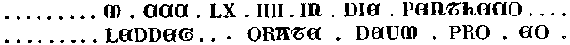
d. i. [Anno domini] mccclxiiii in die
pentheco[stes] [obiit . . . . . . . ]
Leddeg[he]. Orate deum pro eo.
= Im Jahre
des Herrn 1364 am Pfingsttage (12. Mai) starb .
. . . . . . Leddeghe. Bittet Gott für ihn.
Da die beiden letzten Buchstaben des Namens ausgesprungen sind, so ist derselbe nicht ganz sicher Leddeghe zu lesen. Höchst wahrscheinlich ist diese Lesart aber richtig. Die letzten


|
Seite 352 |




|
Reste der beiden abgesprungenen Buchstaben passen
nicht wohl anders als zu einem
h
und
einem
 , und der Name kommt, Leedeghe,
Ledeghe, Leddeghe geschrieben, in und bei Wismar
im 14. Jahrhundert mehrfach vor. So kaufte Otto
im Jahre 1324 von dem fürstlichen Notar Hinrik
Vrouwenberg ein Haus in Wismar, tritt 1344
zuerst als Rathmann daselbst auf und wird 1357
zuletzt genannt. Sein Sohn hieß Hinrik, 1349;
Hinrik Ledeghe kommt auch 1329 und 1337 vor.
Auch gab es einen Priester Otto Leddege,
vielleicht Sohn des Rathmannes (vgl. Schröder P.
M. S. 2079). Endlich verkaufen die Gebrüder
Albert, Marquard und Nicolaus Ledeghe 1344 mit
fürstlichem Consense dem Rathmann Johann von
Kröpelin zu Wismar eine Rente aus anderthalb
Hufen zu Wustrow; diese führen im Siegel einen
queer getheilten Schild. Freilich geben diese
Daten keinen Anhalt zur Ermittelung desjenigen,
dem unser Stein errichtet worden ist.
, und der Name kommt, Leedeghe,
Ledeghe, Leddeghe geschrieben, in und bei Wismar
im 14. Jahrhundert mehrfach vor. So kaufte Otto
im Jahre 1324 von dem fürstlichen Notar Hinrik
Vrouwenberg ein Haus in Wismar, tritt 1344
zuerst als Rathmann daselbst auf und wird 1357
zuletzt genannt. Sein Sohn hieß Hinrik, 1349;
Hinrik Ledeghe kommt auch 1329 und 1337 vor.
Auch gab es einen Priester Otto Leddege,
vielleicht Sohn des Rathmannes (vgl. Schröder P.
M. S. 2079). Endlich verkaufen die Gebrüder
Albert, Marquard und Nicolaus Ledeghe 1344 mit
fürstlichem Consense dem Rathmann Johann von
Kröpelin zu Wismar eine Rente aus anderthalb
Hufen zu Wustrow; diese führen im Siegel einen
queer getheilten Schild. Freilich geben diese
Daten keinen Anhalt zur Ermittelung desjenigen,
dem unser Stein errichtet worden ist.
2. Denkstein von Schimm.
Linker Hand an dem Kirchwege von Schimm nach Jesendorf steht ein sehr großer Denkstein. Auf der vorderen Fläche ist der Grund im Kopfe und die obere Hälfte des Körpers des Steines so vertieft, daß noch ein Rand stehen geblieben ist, dessen Breite der Dicke des Steines etwa gleicht. Auf der vertieften Fläche ist ein Gekreuzigter erhaben dargestellt, zu dessen Füßen ein Betender mit einem rechts gelehnten Wappenschilde vor und einem Spruchbande über sich knieet. Auf dem Spruchbande erkennt man das Wort dei (= dei). Die Inschrift beginnt etwas unterhalb der Vertiefung und läuft rings um dieselbe herum. Sie lautet also:
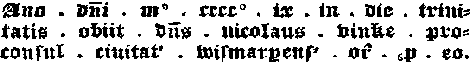
d. i. Anno domini mccccix in die trinitatis obiit dominus Nicolaus Vinke proconsul ciuitatis Wismaryensis, Orate pro eo. - Im Jahre des Herrn 1409 am Dreifaltigteitstage (2. Junii) starb Herr Nicolaus Vinke, Bürgermeister der Stadt Wismar. Betet für ihn.
Die hintere Fläche des Steines anlangend, so ist der Kopf gleichfalls hier vertieft, aber es erweitert sich die Vertiefung abwärts vom Halse parallel dem Rande, wie es auf der Vorderseite der Fall ist, nicht, sondern sie behält die Breite, welche


|
Seite 353 |




|
sie an der engsten Stelle des Halses hat, und geht das oberste Drittel abwärts. Ungefähr das zweite Drittel nimmt eine mit einem Stichbogen geschlossene, sonst rechteckige Vertiefung ein. In der oberen ist wieder ein Crucifix ausgespart, in der unteren ein Betender mit seinem Wappen vor sich. Dasselbe besteht (wie vorne) aus einem rechts gelehnten, unten abgerundeten, quer getheilten Schilde, während der Helm ein etwas ausgeschweiftes vierseitiges, mit Federbüscheln auf den drei freien Ecken verziertes und die Schildtheilung wiederholendes Schirmbrett zeigt.
Es ist also hier der Sterbeplatz des wismarschen Bürgermeisters Nicolaus Vinke, mithin der Stein von den bis jetzt bekannten nächst dem wittenburger und dem für den Domprobst Thomas Rode der historisch merkwürdigste. Dazu kommt, daß sich auch die Art seines Todes angeben läßt, nämlich Mord, und die Namen der Thäter aufbewahrt sind, denn es findet sich in dem wismarschen Liber proscriptorum S. 65 unter dem Jahre 1409 folgende Eintragung:
Clawes Surowe heft vorvested her Otte Vereggen, her Hinrik Reuentlowen, ryddere, her Hinrik Witten, borgermestere to Rostke, Henneke Moltken to deme Strytuelde, Henneke Moltken to Zůwan, Woldemer Moltken, Otte Vereggen, Euerd Moltken, Jurges Moltken, Hartich Reschynkel, Henneke Reuentlowe, knapen, vnde alle ere medehulpere, de se bevragen konen vmme den mord vnde vmme den rof, den se hebben daen in her Vynke vnde in synen vrunden; de he myt sic hadde vp deme velde, dar se vmme synt vorwunnen myt alme Lubeschen rechte.
Nicolaus Vinke wurde (Schröders K. B. S. 37) im Jahre 1399 in den Rath erwählt und wurde 1407 Bürgermeister, als welcher er sich 1408 auf einer Tagefahrt zu Lübeck als Vertreter der Stadt befand. Da der Name in älterer Zeit in Wismar nicht vorkommt, so wird die Familie erst im 14. Jahrhundert eingewandert sein, vielleicht von Poel, wo es Bauern dieses Namens gab und von wo mehrere bedeutende wismarsche Geschlechter stammen. 1361 wird ein Nicolaus Vinke genannt, der möglicher Weise der Vater des Bürgermeisters war. Daß dieser kein unbedeutender Mann gewesen, darf man wohl daraus schließen, daß er, nachdem er erst acht Jahre im Rathsstuhle gesessen, zum Bürgermeister erwählt wurde, und selbst die Umstände seines Todes dürften diese Vermuthung unterstützen. Denn daß hier kein gemeiner


|
Seite 354 |




|
Raubmord durch Stegreifritter stattgefunden, scheint auf der Hand zu liegen, da die Motivirung der Verfestung durch Raub offenbar nur zur Verstärkung derselben dient, während der Mord das Hauptmoment abgegeben haben wird; sicherlich ist der Raub auch nur von denen geübt, die man noch erst "erfragen" wollte, von den Knechten der Edelleute. Es spricht ferner gegen einen gemeinen Raubmord der Umstand, daß zwei Ritter sich unter den Verfesteten befinden, die, so weit meine Erfahrung reicht, sich mit Wegelagern in der Regel nicht abgaben und dies den Knappen überließen. Der Hauptgrund für die Annahme besonderer Motive zu dieser That liegt aber darin, daß ein Bürgermeister der befreundeten Stadt Rostock, Hinrik Witte, mit unter den verfesteten Thätern aufgeführt wird. Mag hier nun ein Act persönlicher Rache geübt sein, oder mag der Ueberfall dem Bürgermeister gegolten haben, das wismarsche Archiv bietet nichts mehr, was diese Angelegenheit aufklären könnte, und mag hier schließlich noch bemerkt sein, daß dieselbe später beigelegt worden ist, da die Inscription im Liber proscriptorum getilgt ist. Die Errichtung des Denksteines ist ohne Zweifel ein Theil der Sühne gewesen 1 ).
3. Denkstein von Sauensdorf
Nicht weit hinter Beidendorf an der Landstraße von Wismar nach Gadebusch steht links am Wege dem Hofe Sauensdorf gegenüber ein 6 1/2 Fuß hoher Denkstein. Der Kopf ist parallel seinem Rande vertieft, doch ist diese Vertiefung nicht rein kreisförmig, sondern sie erweitert sich in den Hals hinein noch einmal in einem geschweiften Spitzbogen (Eselsrücken), so daß die ganze Vertiefung die Fischblasenform hat. In derselben ist ein Crucifixus erhaben dargestellt; die hintere Seite des Kopfes zeigt dieselbe Verzierung. Die Schrift beginnt am Fuße des Steines und läuft an dessen rechten Rande bis zum Halse hinauf; sie setzt sich fort unter dem Halse in fünf


|
Seite 355 |




|
wagerechten Zeilen, welche sich bis an den linken Rand desselben erstrecken, und den Rest der Inschrift enthält eine Zeile, die unter der wagerechten beginnend am linken Rande hinunterläuft. Man liest folgendes:
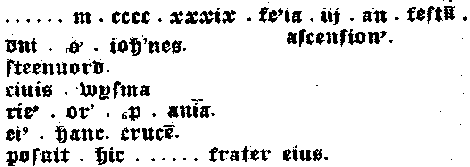
Das ist:
[Anno domini] mccccxxxix feria iij ante festum
ascensionis domini obiit Johannes Steenvord
ciuis Wysmariensis. Orate pro anima eius. Hanc
crucem posuit hic [ . . . ] frater eius.
=
Im Jahre des Herrn 1439 am Dienstage vor dem
Fest der Himmelfahrt des Herrn (12. Mai) starb
Johannes Steenvord, Bürger von Wismar. Betet für
seine Seele. Dies Kreuz setzte hier . . . sein Bruder.
Das Datum der Jahreszahl 1439 ist nicht ganz sicher und wäre möglicher Weise auch statt XXXIX zu lesen XXXV, doch scheint jenes richtiger. Der Name des Bruders ist ganz abgesprungen. Unter den wagerechten Zeilen und zwischen den seitlichen sind die Umrisse eines Betenden eingegraben, denen auf der Rückseite ein Schild mit einem Hauszeichen entspricht.
Der Name Stenvord ist nicht selten in Wismar. Um 1300, wahrscheinlich noch vor diesem Jahre, wurde Peter, 1339 Merten von Stenvord als Bürger dort aufgenommen. Johannes Stenvord wird 1360 genannt. Endlich vertragen sich Herman Stenvord und sein Sohn Johannes 1421 wegen des letzteren müttertichen Erbtheils, verdienten Lohns und alles bis dahin gehabten Haders und Unwillens. Vielleicht war es dieser, dem unser Denkmal gesetzt ist.
Zu bemerken ist, daß dieser Stein, diese "Docke" Francks, in der Inschrift crux, Kreuz, genannt wird. Es geht daraus hervor, daß wo im Mittelalter bei uns von steinernen Kreuzen als Denkmälern die Rede ist, Steine dieser Art zu


|
Seite 356 |




|
verstehen sein werden, welche ihre Benennung wohl von dem auf dem Steine angebrachten Crucifixe tragen. Solche Kreuze sind nicht ganz selten. So wird im wismarschen Stadtbuche um das Jahr 1290 eine crux auf der Stede des von der Stadt 1279 angekauften und zur Stadtfeldmark gelegten Dorfes Dargetzow erwähnt. 1333 wird "Cillinges krutze" genannt, welches, wie ich glaube, vor dem meklenburger Thore stand. In der wismarschen Friedensurkunde von 1430 wird Art. 4 bestimmt, daß man "eyn stenene cruce" auf den Markt setzen solle, wo der Bürgermelster Johann Bantzekow und der Rathmann Hinrik v. Haren enthauptet wurden; Reimar Kock kannte dasselbe als "eine stenen docke" (Grautoffs Lüb. Chron., Bd. II, S. 684). Auch in dem Vertrage zwischen dem Bischofe von Schwerin und der Stadt Rostock wegen der Domhändel wurde festgesetzt, daß die Stadt dem erschlagenen Probste ein steinernes Kreuz errichten sollte, das gegenwärtige Monument nennt Franck aber, wie bereits oben bemerkt, gleichfalls eine Docke.
C. D. W.



|


|
|
:
|
Ueber die große Glocke zu Hohenkirchen,
welche eine schöne und seltene Umschrift führt, ist im Jahresbericht III, S. 182 bis 185 sehr ausführlich die Rede gewesen. Nach ziemlich sichern Zeichnungen lautet die Inschrift:
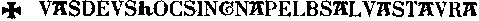
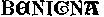
Ich versuchte 1838 statt der vielen andern Erklärungen, welche nicht zutreffen konnten, a. a. O. S. 184, Note, folgende Abtheilung und Erklärung, welche im Allgemeinen ziemlich richtig sein mußte:
und nahm an, daß: vas = Glocke, und signa = segne, bedeute, in pelb das l, statt plebs, versetzt und dahinter ein


|
Seite 357 |




|
s ausgefallen sei und endlich statura sc. sit für maneat oder sit stehe, so das der Sinn sei:
Segne, o Gott, diese Glocke; das gerettete Volk sei glücklich.
Nun theilt Otte in seiner Schrift: Glockenkunde, Leipzig, 1858, S. 81, Note 3, dieselbe seltene Anschrift mit, welche auch auf einer Glocke zu Wiesenburg bei Belzig, ebenfalls in Majuskelschrift, steht und also lautet:
Mit Hülfe dieser Inschrift wird sich die Inschrift der Glocke zu Hohenkirchen mit ziemlicher Sicherheit erklären lassen. Ich lese jetzt nämlich:
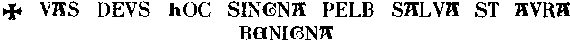
und bemerke dabei: daß mehr als wahrscheinlich:
SIN
 N
N
 für SI
für SI
 N
N
 steht, wie im Mittelalter häufig
ein N vor GN eingeschoben wird; daß in PELB das
L versetzt und das schließende S wegen des
folgenden S ausgefallen ist, das Wort also PLEBS
hätte lauten müssen; daß ST abbrevirt für
S
l
T, d. sit steht; man könnte auch
annehmen, daß in ST der erste Buchstabe beim
Abschreiben falsch gelesen sei und das Wort
steht, wie im Mittelalter häufig
ein N vor GN eingeschoben wird; daß in PELB das
L versetzt und das schließende S wegen des
folgenden S ausgefallen ist, das Wort also PLEBS
hätte lauten müssen; daß ST abbrevirt für
S
l
T, d. sit steht; man könnte auch
annehmen, daß in ST der erste Buchstabe beim
Abschreiben falsch gelesen sei und das Wort
 T (et) heißen müsse, jedoch ist
diese Abweichung nicht bedeutend. Ich lese daher
die hohenkirchensche Inschrift also:
T (et) heißen müsse, jedoch ist
diese Abweichung nicht bedeutend. Ich lese daher
die hohenkirchensche Inschrift also:
 Vas, deus, hoc signa; plebs salva
sit, aura benigna.
Vas, deus, hoc signa; plebs salva
sit, aura benigna.
(d. i. Segne, o Gott, diese Glocke; das Volk sei wohl, die Luft gesund.)
G. C. F. Lisch.


|
Seite 358 |




|



|


|
|
:
|
III. Zur Münzkunde.
Der Münzfund von Boek.
Zu Anfang des Decembers 1857 ward auf dem Gute Beek in der Nähe von Waren beim Pflügen eine Anzahl Münzen gefunden und vom Herrn Landrath Baron Lefort wurden diejenigen, welche die Sammlung des Vereins noch nicht besaß, derselben gütigst überwiesen.
Derjenige Theil der Feldmark, wo diese Münzen gefunden wurden, wird von den Leuten die Müritzfläche, oder kurzweg "de Flaeke" genannt. Es ist ein Areal von etwa 150,000 []R. neuen Landes, früher alten Seebodens, welcher seit der ersten Senkung der Müritz, die vor ungefähr 60 Jahren stattfand, allmälig trocken geworden ist. Stellenweise ist dieses Land schon früher in Acker umgewandelt, im Ganzen hat es jedoch lange als Weidefläche dagelegen, neuerdings wird immer mehr davon urbar gemacht. Nach Zurücktreten der Müritzgewässer entstand auf dem neuen Felde eine dichte Decke kurzer, aber sehr nahrhafter Gräser, deren Wurzelgewebe dort, wo der Pflug noch nicht hingekommen, eine ungemein zähe und filzige Narbe bildet. Unmittelbar unter dieser Narbe haben die Münzen auf einer kleinen Stelle beisammen gelegen und ist seine Spur von Kiste, Büchse oder Beutel, worin das Getd etwa verschlossen gewesen, aufgefunden worden. Der Wirthschafts=Inspector war zugegen, als die Münzen ausgepflügt wurden, hat alle aufgefundenen Münzen zu sich genommen, auch sofort weiter nachgraben lassen, ohne jedoch tiefer im Lande des alten Seebettes irgend etwas mehr zu finden. -


|
Seite 359 |




|
Die Leute erzählen sich übrigens, daß schon früher in derselben Gegend der Fläche alte Kessel und Grapen aufgefunden worden sind.
Die Anzahl der Münzen war 224 und ihr äußeres Ansehen bewies, daß sie im Wasser gelegen hatten, sie hatten nicht die Grünspan=Oxydation der Funde im Lande, sondern waren größtentheils ganz schwarz (Schwefelsilber), haben aber durch kunstmäßige Reinigung ihr volles Ansehen wieder erhalten.
Die neueste Münze ist von 1635 und weiset also bestimmt genug auf die Zeit hin, wo dieser Vorrath eines nicht unbemittelten Mannes in die Tiefe des Sees geborgen wurde, auf die letzten Zeiten des dreißigjährigen Krieges. Dies spricht sich in der Menge der verschiedenen Münzstätten aus, welche hier ihren Beitrag geliefert haben, nicht allein deutsche, sondern auch fremdländische, wie es denn überhaupt der Charakter aller Münzfunde aus den unruhigen Zeiten ist, die da Menschen aus den fernsten Gegenden umhertreiben und ihr vaterländisch Geld mit ihnen, welches sich dann, wenn es auch gar nicht den Währungen gemäß ist, wo es umlief, doch hinein fügen muß, wie es z. B. hier mit den englischen Sixpencestücken der Fall ist, welche sicherlich den halb Reichsorten gleich gerechnet wurden. Ferner ist zu bemerken, daß von den schwerern Münzen, die vor dem Kriege in Umlauf waren, nur sehr wenige vorkommen, die waren damals schon in den Tiegel zurück gegangen, jedoch eigentliche Kipper= und Wippermünzen, welche die Zeit in Menge hervorbrachte, finden sich nicht.
Wenden wir uns nun zu dem Einzelnen, so hat Meklenburg sowohl in der schwerinschen Linie Adolph Friedrich, wie in der güstrowschen Hans Albrecht, mit den beiden Städten Rostock und Wismar die meisten Stücke geliefert (70), jedoch ist keine größere Münze darunter, wiewohl von beiden Herzogen nach ihrer Rückkehr ins Land Thaler geschlagen wurden, die auch von beiden Städten vorhanden sind. Die Münzen, die sich hier vorfanden, waren die bekannten Schillinge und Sechslinge aus den Jahren 1621 - 24, dann schweriner Dütchen von 1632 und 33. Von Rostock und Wismar gleiche Werthe aus denselben Jahren, ein halb Reichsort von Rostock von 1634 (Evers II, 374. 4) war die größte vaterländische Münze. Aus den frühern Zeiten hatten sich 2 Schillinge erhalten, einer von Herzog Johann Albrecht von 1552 und ein wismarscher von 1553, und bot also diese Classe wenig bemerkenwerthes dar, und ist das Zahlverhältniß derselben:


|
Seite 360 |




|
| halb Ort. | Dütchen. | Schillinge. | Sechslinge. | |
| Fürstliche | - | 9 | 29 | 10 |
| Rostock | 1 | 2 | 13 | - |
| Wismar | - | - | 5 | 1 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 1 | 11 | 47 | 11 |
Die Münzen von Lübeck fallen in die Zeit von 1620 bis 1632; es waren: ein halber Thaler von 1629 (Schnabel, p. 93), 2 Ortsthaler von 1623 und 1632 (das. p. 86 und 87), 3 halbe Ortsthaler von 1622 (das. p. 80), ein Dütchen von 1629 (das. p. 59), ein Schilling von 1620 (ein Gepräge, das bei Schnabel p. 50 fehlt, denn es hat civitatis und die volle Jahreszahl 1620,) und 15 Sechslinge von 1621, 22 und 24, im Ganzen also 23 Stück.
Hamburg gab den Thaler von 1622 (Hamb. Münzen, II, S. 248. n. 412), einen halb Reichsort von 1621 (das. S. 266 n. 614) und einen ältern Sechsling von 1597, dessen Gepräge (AV) a. a. Orte S. 309 nicht vorkommt.
Pommern war mit 8 Münzen vertreten, nämlich es fand sich ein älterer Ortsthaler des Herzogs Johann Friedrich von 1582 mit Brustbild und Wappen, 2 Doppelschillinge von Philipp Julius von 1610, deren einer mit dem Stempel von Stralsund bezeichnet war, 2 Groschen von 1622 und desgleichen von 1623. Von Herzog Ulrich war ein Dütchen von 1622 vorhanden. - Stralsund gab 3 alte Schillinge und 11 Dütchen aus den Jahren von 1628 - 1631 in bekannter Form.
Der Thaler des Herzogs Augustus zu Sachsen (Lauenburg) von 1622 war die einzige Münze aus diesem Lande in der bekannten Form bei Madai I, 1313, der aber diesen Jahrgang nicht anführt.
Vom Bischof zu Ratzeburg, Augustus, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, war der bekannte halbe Ortsthaler von 1635 (die jüngste Münze des Fundes) vorhanden, von seinem Bruder, Christian zu Minden, 4 halbe Ortsthaler von 1627, 28 und 32.
Aus dem Hause Braunschweig=Lüneburg fanden sich ein halber Thaler des Herzogs Heinrich Julius und ein Ortsthaler desselben, beide von 1612 mit Wappen und Wildmann, welche sich beide in dem Numophyladum Brunsvico-Luneburgense von Nicol. Seeländer nicht finden, wiewohl er die ganzen Thaler iu dieser Gestalt von verschiedenen Jahren anführt. Von Herzog Friedrich Ulrich ist der Thaler von 1631 da, welcher mit dem behelmten Wappen und dem Wildmann


|
Seite 361 |




|
in verschiedenen Jahren vorkommt (Madai I, n. 1124), von ihm war auch ein halber und ein OrtsthaIer, beide von 1632, vorhanden, mit gekröntem Wappen und Wildmann. Von Herzog Wilhelm fand sich ein halb Ortsthaler von 1622.
Aus dem Hause Sachsen waren vom Churfürst Moritz 4 Ortsthaler da, aus den Jahren 1545, 48 und 50, von Churfürst August ein gleicher von 1555. Der Thaler von Churfürst Christian mit seinen beiden Brüdern, der eine Reihe von Jahren hindurch geschlagen ward (Madai I, n. 517) war hier vom Jahre 1597, desgleichen auch ein Ortsthaler der drei Brüder von 1609. Vom Churfürsten Johann Georg waren ganze Thaler von 1624 und 1630 da, desgleichen ein halber von 1612, alle mit Brustbildern und Wappen in bekannter Gestaltung. Aus dem Hause Altenburg war der Thaler des Herzogs Johann Philipp und seiner Brüder von 1623 da (Madai I, n. 1465), so daß also aus dem Hause Sachsen sich 11 größere Münzen fanden.
Von Würtemberg war ein sehr zierlicher halber Thaler des Herzogs Johann Friederich von 1624 da, der entsprechende ganze ist bei Madai I, 1629, desgleichen Köhler Münzbelust. III, p. 321 zu finden. Ein Kreuzer des Herzogs Ulrich mit den Wappen von Würtemberg und Teck auf der einen und dem montfortschen auf der andern gehört einer frühern Zeit 154. an. Der gräflich erbachsche Thaler, der zu den seltneren gerechnet wird (Köhler Münzbel. VII, p. 57, Madai I, n. 1684), war hier von 1624 und der gräflich mansfeldsche, den Madai 1804 von 1624 anführt, von 1625 vorhanden, der gräflich schlicksche Thaler von 1526 war von einem andern Gepräge als der von Madai II, 4370 angeführte, denn in der Umschrift steht nicht ET, sondern nur E und die Jahrszahl ist verkürzt 26 und nicht voll ausgeschrieben. Vom Grafen Johann von Stolberg war der halbe Thaler - von 1609 da, dessen ganzer von Madai I, n. 1417 angegeben ist.
Herzog Johann Adolf von Schleswig=Holstein ward durch einen Sechsling von 1615 in bekannter Form repräsentirt.
Von Städtemünzen fanden sich aber folgende:
Kaufbeuren ein sehr zierlicher Ortsthaler von 1543 mit dem Bilde und der Umschrift Kaisers Carl V. auf der einen und dem Stadtwappen auf der andern Seite, wovon der entsprechende Thaler bei Madai II, 4963 zu finden ist.
Nürnberg gab einen Thaler von 1627 in der Form,


|
Seite 362 |




|
wie ihn Madai II, 5058 von 1624 anführt und dabei bemerkt, daß er von verschiedenen Stempeln und Jahren vorhanden sei.
Werden ein halber Thaler von 1545. hat das
Brustbild des Kaisers mit der Umschrift CAROLVS
°
V
°
ROM . IMP
°
SEMP
°
AVG
 und auf der Rückseite den
gekrönten Reichsadler mit einem Schilde auf der
Brust, worin ein W. Umschrift MO
°
NO
°
ARGE
°
CIVI
°
SVE
°
WERD 45.
und auf der Rückseite den
gekrönten Reichsadler mit einem Schilde auf der
Brust, worin ein W. Umschrift MO
°
NO
°
ARGE
°
CIVI
°
SVE
°
WERD 45.
Worms hat einen halben Thaler von 1614, wo über dem Stadtwappen ein Drache hervorragt, im übrigen aber dem Thaler von 1617 bei Madai I, 2355 entspricht.
Der Ortsthaler von Braunschweig hat keine Jahrszahl, ist aber, da er Carls V. Namen trägt, in die frühere Zeit zu stellen; der halbe Reichsort von Hannover von 1625 hat die Werthangabe, und beide sind mit dem Stadtzeichen geziert, auch der halbe Thaler von Halberstadt von 1629 (Madai II, 4904 hat den entsprechenden ganzen) zeigt das Stadtwappen, aber auch das Bild des h. Stephan mit Buch und Palmzweig und den Namen in der Umschrift.
Aus dem deutschen Kaiserhause Oesterreich ist ein Ortsthaler des Königs Ferdinand mit Brustbild und einköpfigem Adler vorhanden. Von dem Erzherzog Albert und seiner Gemahlin Elisabeth fanden sich 3 viertel Kreuzthaler, einer von 1601, die andern ohne Jahrszahl, alle mit dem burgundischen Kreuze bezeichnet, und ist der entsprechende ganze Thaler bei Madai II, 3860 zu finden. - Von Erzherzog Ferdinand war der bekannte Thaler ohne Jahrszahl (Madai II, 3858) vorhanden. - Von Böhmen zeigte sich ein Viertelthaler des Königs Ferdinand II. von 1624 mit dem stehenden Bilde des Kaisers, und von Ungarn ein Viertelthaler des Königs Rudolph II. von 1588 und ein ganzer Thaler des Königs Matthias von 1614 (v. Schultheß = Rechberg I, n. 2442, Madai II, 2722 mit Bemerkung der Seltenheit).
Von den Münzen der Niederlande fand sich ein halber Thaler der Generalstaaten, mit einem Schilde, in dessen sechs Feldern die Wappen der Staaten, und auf der Rückseite ein Geharnischter mit 7 Pfeilen von 1590. Von Seeland war em Thaler von 1619, von Westfriesland dergleichen von 1624 (wie Madai II, 4643), von Utrecht ein halber Thaler von 1620 vorhanden und außerdem noch 2 abgegriffene, wie denn überhaupt die niederländischen Münzen weniger schön sind.
Von König Philipp von Spanien sind verhältnißmäßig viele Münzen in diesem Funde: 4 viertel und 10 achtel Piaster, welche sich in die Orts= und halben Ortsthaler einfügen


|
Seite 363 |




|
mußten. Die hier vorkommenden sind, so weit sie erkennbar waren, aus den Jahren 1562 -1572 und für die niederländischen Besitzungen geschlagen, wie sich aus dem burgundischen Kreuze, auf dem das Wappen liegt, ergiebt, und es ist bekannt, wie wenig diese Münzen zu dem Reichsfuße paßten.
Der Sixpence - Stücke von England fanden sich drei, eins von Elisabeth von 1570 und zwei von Jacob von 1604 und 1621, mit Brustbild und Wappen.
Mit Ausnahme der zuerst angeführten meklenburgischen Münzen waren fast alle größere Sorten, und es scheint also, als ob damals das kleine fremde Geld, das sich im Münzfund von Slate (Jahrb. XIX, 414) in so verschiedenen Geprägen fand, schon wieder aus dem Umlaufe verschwunden war. Außer den angegebenen fanden sich nur noch dänische kleinere Münzen, drei von König Friedrich II. von 1562 und 83, und 32 von König Christian IV. von 1596 - 1630, sowohl in 4, als 2 und 1 Skilling-Danske-Stücken, welche sich allerdings den Groschen, Schillingen und Sechslingen der norddeutschen Münzherrn leidlich anschlossen, und fast ein Jahrhundert lang ihren Weg in diese Gegenden nahmen, bis sie endlich bei dem schwereren Münzfuß unmöglich wurden.
Es befanden sich aber in dem Vorrathe, den der Mann gegen das Ende des 30jährigen Krieges in der Müritz verbergen wollte: 15 Thaler, 13 halbe Thaler, 23 Ortsthaler, 25 halbe Reichsorte oder Achtelthaler, 4 Vierschillingsstücke (dänische), 24 Dütchen, 24 Groschen (18 dänische 2=Skillingstücke eingeschlossen), 69 Schillinge (15 dänische 1=Sk. eingeschlossen) und 27 Sechslinge.
G. M. C. Masch.


|
Seite 364 |




|



|


|
|
:
|
IV. Zur Kunstgeschichte.
Der Hochaltar
der S.
Georgen=Kirche zu Parchim,
von
G. C. F. Lisch,
Archiv=Rath und Conservator.
Die S. Georgen=Kirche in der Altstadt zu Parchim hatte einen für die Kunstgeschichte höchst merkwürdigen Altar aus dem Mittelalter. Im J. 1842 stand dieser Altar noch (vgl. Jahrbücher des Vereins für meklenb. Geschichte, VIII, S. 109) innerhalb der mit reichem Schnitzwerk verzierten Altarschranken, nebst vielem andern alten Schnitzwerk 1 ). Seitdem ist die Kirche im J. 1844 gründlich "restaurirt" und damit alles alte Schnitzwerk aus der Kirche entfernt. Von dem alten Hochaltare sind die 12 Apostel abgebrochen und zu beiden Seiten eines auf Leinewand gemalten Christusbildes auf einem neuen Altarschreine angebracht, dessen zwei Pfeiler außerdem mit zwei weiblichen Heiligen von dem alten Altare verziert sind.
Da ich im J. 1842 die Einrichtung des Altares aufgenommen habe, so kann ich jetzt noch eine Beschreibung des=


|
Seite 365 |




|
selben liefern. Der Altar war ein Flügelaltar mit doppelten Flügeln. Die Vorderseite war mit vergoldeten und bemalten geschnitzten Figuren unter Baldachinen besetzt.
Die Mitteltafel war in der Vorderansicht in drei Abtheilungen getheilt. In der Mitte stand der dornengekrönte Christus (Ecce homo), über den zwei Engel den Königsmantel hielten; neben demselben standen in zwei Reihen über einander die zwölf Apostel. Die beiden Flügel waren in der Vorderansicht queer auch in zwei Abtheilungen getheilt: in jedem Flügel standen oben vier männliche, unten vier weibliche Heilige, also in den Flügeln zusammen sechszehn Heiligenbilder. Die Hinterseiten waren, wie gewöhnlich, mit Malereien auf Goldgrund geschmückt. Oben über der Verzierungsleiste stand ein alter Wappenschild: auf grünem Grunde ein schwarzer Queerbalken mit drei goldenen Weintrauben.
Dieser Altar ist in neuern Zeiten hart mitgenommen worden. Zuerst wurden am Ende des 17. Jahrhunderts die Malereien auf den Flügeln dem Untergange geweihet. Sei es, daß sie hinfällig geworden waren, sei es, was glaublicher ist, daß kirchliche Eitelkeit sich überhob und an die Stelle des Guten etwas recht Schlechtes im Geiste der Zeit setzte: im Jahre 1699 wurden die alten Gemälde mit schlecht gemalten neuen Passionsgemälden bedeckt. Cleemann berichtet (Chronik der Vorderstadt Parchim, 1825, S. 278): daß die Flügel "1699 auf Gregor Liedlich's und Jacob Brasch'ens Kosten bemalt" worden seien. Diese Nachricht, welche auch auf die Flügel gemalt war, ist jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit zu entziffern. Auf der Rückseite der Flügel ist noch zu lesen: "Zur Ehre Gottes und Zierde dießer Kirchen hadt dieße Paßiohn Seite vermahlen laßen . . . . . . . . . ch und seine Hausfrauw Elisabeth Foß. - - 1699". Diese Bilder sind in Oel auf Leinewand gemalt und fest auf die Flügel genagelt, so daß durch die Absperrung von Luft und Licht die alten Bilder darunter sicher dem Verderben preisgegeben sind, wenn noch etwas vorhanden war, was allerdings zu glauben ist.
Die Restauration der jüngsten Zeiten zerriß und vernichtete theilweise den ganzen Altar. Die Täfelung der Mitteltafel ward vernichtet, der Christus ward verworfen, die zwölf Apostel wurden zu dem nur einfach architektonisch construirten Altare verwandt und neu bemalt und vergoldet. Aus den Flügeln nahm man die Heiligenbilder und warf sie mit vielem andern Schnitzwerk auf ein in der ehemaligen Sacristei erbauetes jüngeres Grabgewölbe. Die Flügel selbst wurden in der Thurmhalle so an die Wande genagelt, daß die Vorder=


|
Seite 366 |




|
seiten mit den Baldachinen an die Wand gekehrt und die schlecht gemalten Passionen von 1699 zur Schau gebracht wurden.
Da der Altar eine besondere Wichtigkeit hat, so unternahm ich im J. 1857 eine Untersuchung und Herstellung, so weit die letztere noch möglich war. Ich ließ die Tafeln wieder umkehren, so daß der Goldgrund mit den Baldachinen wieder ans Tageslicht kam, suchte die Heiligenbilder von dem Sacristeigewölbe wieder hervor und setzte sie unter ihre Baldachine; sie fanden sich glücklicherWeise auch alle (14) wieder und konnten an ihre alte Stelle gesetzt werden, mit Ausnahme der beiden weiblichen Heiligenbilder, welche zur Verzierung der Pfeiler des neuen Altars verwandt sind. Eine weitere Untersuchung ergab, daß die alten Malereien auf den Flügeln unter den aufgenagelten jüngern Passionsgemälden völlig abgefallen waren; es waren nur noch ganz geringe Ueberreste vorhanden, aus denen sich aber ergab, daß die alte Malerei in lebhaften und kräftigen Farben ziemlich gut ausgeführt gewesen war.
Die auf der Rückseite mit Zeichen bezeichneten Heiligenbilder konnten genau wieder an ihre alte Stelle gesetzt werden. Die Anordnung ergab folgenden Zusammenhang.
Es standen:
auf dem Flügel zur Rechten:
oben: vier männliche Heilige:
der H. Gregor, als Papst;
der H. Hieronymus,
mit Kardinalshut und Buch;
der H. Georg im
Harnisch, mit Schild und Lirndwurm;
der H.
Victor (Gereon? oder Mauritius?), ein
geharnischter Ritter mit einem Rittergürtel;
unten: vier weibliche Heilige mit einer Krone auf dem Haupte:
die H. Barbara, mit dem Thurm im linken
Arme;
die H. Agnes, mit dem Lamm im linken
Arme;
die H. Katharina, mit einem Rade
(ohne Speichen, oder einer Scheibe?);
die
H. Dorothea (?), mit einem Korbe oder
Henkeltopfe in der Hand;


|
Seite 367 |




|
auf dem Flügel zur Linken:
oben: vier männliche Heilige:
der H. Nicolaus von Bari (?), ein Diakon mit drei Broten (?) im rechten Arme;
der H. Rupert (?) von Salzburg, als Diakon, mit einem Satzfasse, welches ganz wie noch jetzt die gewöhnlichen hölzernen Küchen=Salzfässer gestaltet ist;
der H. Antonius (? oder Johannes Elemosinarius?) mit einem viereckigen Beutel in der Hand;
der H. Veit, als Bischof, in einem Grapen stehend, mit einem Buche im Arme;
unten: vier weibliche Heilige:
die H. Maria Magdalena, im Schleier und einer goldenen Büchse im Arme, steht an einem Pfeiler des neuen Altars;
die H. Anna (?), deren beide Arme ganz abgebrochen sind;
die H. Maria (?) (Elisabeth?), im Schleier, mit einer Schüssel mit zwei Fischen im rechten Arme;
die H. Christine (?), mit goldener Mütze und langem Haar und einem Buche im Arme, steht an einem Pfeiler des neuen Altares.
Die Anordnung ist daher aus folgender Uebersicht anschaulich:


|
Seite 368 |




|
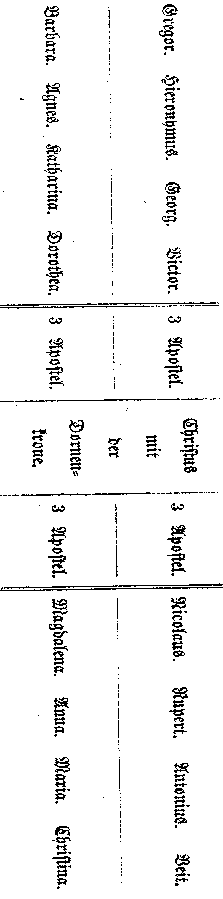


|
Seite 369 |




|
Die ganze alte Arbeit ist von mittlerer Beschaffenheit und wie gewöhnlich die Altäre in den größern Kirchen; die Bildschnitzerei der Figuren ist ziemlich gut. Die Baldachine sind nicht reich und nicht fein; das Thurmwerk derselben ist nur bemalt; allein die Bogenverzierungen sind vergoldet. Die Malerei auf den Flügeln scheint recht brav gewesen zu sein.
Dieser Altar hat nun eine besondere Wichtigkeit für die ganze Kunstgeschichte dadurch, daß über die Anfertigung desselben ein Contract vom Jahre 1421 im großherzoglichen Staats=Archive zu Schwerin aufbewahrt wird, der hier am Schlusse mitgetheilt ist.
Am 19. November 1421 schloß der "Maler Henning Leptzow zu Wismar" ("Hennyngh Leptzowe, eyn meler, wonaftich tho der Wisiner," und: "pictor et opidanus opidi Wismariensis,") mit den Vorstehern der S. Georgen=Kirche zu Parchim (dem Pfarrer, dem Vikar, dem Officianten und einem Rathsherrn) einen Contract über die Anfertigung eines Altarschreins ("tafel") für den hohen Altar der S. Georgen=Kirche zu Parchim zur Ehre Gottes, der Jungfrau Maria und des heiligen Ritters Georg; er verpflichtete sich darin, auf die Tafeln 30 geschnitzte Bilder ("snedene bilde") 1 ) mit den dazu gehörenden Pfeilern und Baldachinen zu setzen, die Tafeln und Figuren mit seinem Golde und mit Farben zu belegen und auf die Flügel so viele und diejenigen "Materien" zu malen, welche die Kirchenvorsteher haben wollten und den Grund zu vergolden, so daß jeder Meister des Malergewerkes sagen müsse, daß er Gott und seiner Pflicht Genüge geleistet habe; er verpflichtete sich ferner, alles Holz= und Bildwerk und die ganze Arbeit auf seine Kosten zu übernehmen und den Altar fertig abzuliefern, auch zu nächsten Pfingsten seine Wohnung in Parchim aufzuschlagen und nicht von Parchim zu ziehen und keine andere Arbeit vorzunehmen, bis der Altar vollendet sei, es sei denn mit Erlaubniß der Kirchenvorsteher. - Für diesen Altar versprachen die Kirchenvorsteher dem Maler Henning Leptzow zu geben: freie Wohnung in Parchim, das Holzwerk und (geschnitzte) Bildwerk, das schon in der Kapelle stand, das Holz zu dem Altarfuße, alles Eisenwerk, 210 lübische Mark Pfenninge, drei Fuder Holz und zwei Seiten Speck; das Geld sollte von Zeit zu


|
Seite 370 |




|
Zeit während der Arbeit ausgezahlt werden, und wenn nach Vollendung der Arbeit 20 bis 30 Mark rückständig sein sollten, so versprach der Maler, dieselben ein halbes Jahr lang zu stunden.
Dies ist der wesentliche und vollständige Inhalt des Contracts, aus welchem hervorgeht, daß ihn ein Maler übernahm, der den Altar nicht allein in Malerei und Vergoldung, sondern auch in Bildschnitzerei, ja selbst in der Handwerksarbeit an Tischlerarbeit und Schmiedearbeit zu vollenden versprach; aus den Andeutungen des Contracts ist zu entnehmen, daß schon einige Figuren fertig waren, deren Benutzung dem Maler gestattet ward.
Wahrhaft rührend ist die Einfachheit und auf Rechtlichkeit und Gottesfurcht gegründete Zuverlässigkeit des Contracts. Hier ist nicht von Höhe und Breite, nicht von Quadratfußen Vergoldung, nicht von Rissen und Kartons die Rede; der Maler verspricht nur, den Altar so herzustellen, daß "jeder Meister des Malergewerkes sagen müsse, daß er seinem Herrn Gott und seiner eigenen Redlichkeit Genüge gethan habe"; er verspricht nur, Alles so zu machen, "wie es sich von Rechts wegen gebührt", und erbietet sich, "auf die Flügel zu malen, welche und wie viele Materien sie darauf haben wollen": und mit diesen Verheißungen begnügen sich dann auch die Kirchenvorsteher.
Eine andere Hauptwahrnehmung ist der Preis, welcher dem Maler für die Vollendung zugebilligt ward; die freie Wohnung war ihm zu einem so großen Werke unumgänglich nothwendig; die drei Fuder Brennholz und die zwei Seiten Speck sind kaum der Rede werth. Der eigentliche Lohn für Arbeit und Material des ganzen Altars sind also 210 lübische Mark, welche im J. 1421 einen höhern Werth 1 ) haben mochten, nach jetzigem Silberwerthe aber nur ungefähr 370 Thaler pr. Cour. werth sind. Diese Summe ist allerdings nicht bedeutend und ein Beweis für die große Gewandtheit der Künstler damaliger Zeit, die den Styl beherrschten. Bemerkenswerth ist die Bedingung, daß der Maler seine Wohnung in Parchim nehmen solle, ohne Zweifel um das fertige Werk vor jeder Beschädigung sicher zu stellen.


|
Seite 371 |




|
Der Altar dieses Contracts ist nun ohne Zweifel der oben beschriebene ehemalige Hochaltar der S. Georgen=Kirche. Der Maler hatte sich verpflichtet, "30 geschnitzte Bilder" auf der Vorderwand anzubringen; der alte Altar hatte jedoch 31 Figuren: 1 Christusbild, 2 Engel, 12 Apostel und 16 Heilige. Wahrscheinlich ist die Darstellung des Christusbildes mit den zwei Engeln erst nach dem Abschluß des Contractes entworfen, oder die Christusfigur war schon vorhanden, oder der Maler rechnete die zwei Engel für eine Figur.
Von Interesse ist die Beschreibung der Bildsäulen und ihrer Einfassungen. In dem Contracte wird gesagt, daß Henning Leptzow liefern wolle: "druttich snedene bilde myd eren huseten, pilren, simborien vnde maschelrygen". Diese Ausdrücke sind dunkel und schwer zu erklären; ich will eine Erklärung versuchen:
husete sind die "Häuser", in welchen die Figuren stehen, ein allgemeiner Ausdruck für die äußere Einrahmung und Umkleidung der Figuren, der durch die folgenden besonderen Ausdrücke erläutert wird; besonders aber mögen auch die vergoldeten Hintergründe mit zu Häusern gerechnet sein.
pilre sind die "Pfeiler", in Form von Strebepfeilern, welche die einzelnen Figuren trennen.
simborien sind die ciboria oder Baldachine, welche die Figuren bedecken; ciborium oder cimborium war eine bedeckte Nische oder ein mit einem Thürmchen bedeckter Säulenbau über dem Altare, auch Tabernakel genannt; späterhin gebrauchte man das Wort überhaupt für eine Nische mit einer Krönung oder für die Krönung selbst, wie die Nischen des Hochaltars zu Doberan, in welchen die Figuren standen, im J. 1461 Cimborien genannt wurden: "imagines sanctorum, que continentur in cimborio summi altaris (vgl. Jahrb. XIX, S. 392). Auch in einer am 29. September 1399 von dem Fürsten Balthasar von Werle geschehenen Transfumirung einer darguner Urkunde vom 29. April 1313 im pommerschen Archive zu Stettin wird gesagt, daß auf dem Siegel des Dom=Capitels zu Camin unten: "fünf Figuren unter Ciborien ("inferius quinque ymagines super capitibus simboria") stehen. Das alte Siegel selbst (z. B. 1272 und 1274) zeigt unten fünf Figuren, über welchen drei einfache Rundbogen stehen; es werden also 1399 sogar einfache Bogen oder Wölbungen ohne Thürchen Ciborien genannt.
maschelrygen sind wahrscheinlich die Attribute der


|
Seite 372 |




|
Heiligen, plattdeutsch verderbt aus dem dem Italiänischen entlehnten mittellateinischen Worte massaritia = Geräth, Werkzeug, Hausrath, wohl von mansio (französisch maison) hergeleitet.
Aus dem ganzen Contracte geht aber hervor, daß Henning Leptzow, Bürger zu Wismar ("opidanus opidi Wismariensis"), in Wismar wohnhaft, sicher ein Meklenburger war und daß die Altäre von Einheimischen gemacht wurden, was bei der sehr großen Anzahl solcher Arbeiten auch nicht anders zu erwarten ist. Die Künstler für große Werke hatten ihren Sitz freilich wohl nur in großen Städten, wie die Kirchenvorsteher in Parchim sich zur Anfertigung eines Hochaltars einen Maler aus Wismar kommen lassen mußten.
Von Wichtigkeit würde die Zeichnung und Vervielfältigung einer Figur dieses Altars mit Pfeilern und Baldachin sein, um einen ganz bestimmten Anhaltspunct für den Styl der Zeit 1 ) zu gewinnen.
Es folgt nun hier der Contract selbst.


|
Seite 373 |




|
Contract.
Der Maler Henning Leptzow zu Wismar schliesst mit den Vorstehern der S. Georgen=Kirche zu Parchim einen Contract über die Anfertigung eines Hochaltars für die S. Georgen=Kirche zu Parchim.
D. d. (Wismar), 1421, Nov. 19,
mit dem Notariats=Instrumente über den Abschluss
d. d. Wismar, 1421, Nov. 30.
Nach dem Original=Notariats=Instrumente im grossherzogl. meklenburg. Geheimen= und Haupt=Archive zu Schwerin.
In nomine domini Amen. Anno natiuitatis eiusdem m. ccccxx primo, indictione xiiii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini, diuina prouidentia pape quinti, anno quinto, mensis Nouembris die vltima, in domo habitacionis honorabilis viri Johannis Vresen, consulis opidi Wismariensis, Raceburgensis diocesis, hora nona vel quasi, in mei notarii publici testiumque infrascriptorum presencia personaliter constituti discreti viri dominus Hinricus de Pritze, presbiter Zwerinensis diocesis, pro se et nomine honorabilium virorum dominorum Hermani Willer, plebani ecclesie sancti Georgii, Johannis Subus, officiantis ibidem, et Hinrici Rolof, consulis opidi Parchimensis, dicte dioceste Zwerinensis, et Hennynghus Leptzowe, pictor et opidanus opidi Wismariensis, dicte Raceburgensis diocesis, quandam cedulam papiream in manibus eorum tenuerunt, produxerunt et legi fecerunt in bec verba:


|
Seite 374 |




|
In godes nâmen Amen. Vôr allen cristen lû, de desse schrift zê, hôren edder lezen, bekenne ik Hennyngh Leptzowe, eyn meler, wônaftich tho der Wismer, dat ik na den iâren godes vêrteynhundert iâr inme eynvndetwynteghesten iâre dârna, in sunte Elizabet dâghe der hilghen vrûwenâmen, hebbe mâket vnde iêghenwardich mâke in desser schrift êne êndracht myd den êrbâren heren vnde lûden, alze her Hermen Willer kerkheren, her Hinrik van Pritze vicario, her Johann Subus offiante der kerken sunte Jurien vnde myd Hinrick Rolof, râdman der stadt to Parchem, vmme êne tâflen to mâkende vp dat hôghe altare in der suluen kerken sunte Jurien to Parchem in de êre des almechteghen godes, syner lêuen môder Marien vnde des hilgnen ridders sunte Jurien in sodâner wise, alze hîr nâ screuen steyt, dat ik Hennyng vôrscreuen schal vnde wil to paschen nêghest thôkômende thên tho Parchem wônen in êne wônynghe, de my desse vôrbenômeden prêstere vnde lûde vrîg dâr tho scheppen scholen, vnde schal desser tâflen beghynnen to mâkende, dârinne stân scholen druttich snedene bilde myd eren hûseten, pîlren, simbôrien vnde maschelrygen, alze zyk dat dâr tho van rechte bôrt, vnde ik schal de bilde vnde tâflen thôvâten myd varwen vnde myd finen gholde vorgholden vnde belegghen bynnen vnde bûten, alze syk dat ghebôrt, vnde in de vlôghele desser tâflen schal ik mâlen, watte matêrien vnde wo vele matêrien ze dâr in hebben wyllen, vnde de ôk myd fynem gholde belegghen bynnen vnde bûten, alze vôrscreuen is, vnde hôuen alle dinck schal ik desse tâflen mâken bynnen vnde bûten, alzo dat eyn iêwelk werkman des melewerkes zegghe, dat ik vnseme lêuen heren gade vnde myner reddelcheyt vôr de pennynghe, de ze my hîr vôre gheuen scolen, vul ghedân hebbe, wan desse tâfle gantzeken rêde mâket is, vnde ik Hennyngh schal desse tâflen mâken vp myne êghene koste, vnde ik schal dâr tho scheppen alle holtwerk vnde alle bylde, bôuen dat holtwerk vnde bilde, de alrêde to Parchem in der capellen stân, behaluen dat holtwerk, dat to deme vôte desser tâflen hôrt vnde nutte is, dat scholen ze my scheppen, vnde ik schal den vôet hôwen vnde mâken lâten vp myne koste; ok alle yzerwerik, dat hîr tho hôrt, dat scholen desse heren vnde lûde my scheppen vp ere koste, vnde ik Hennyngh en-


|
Seite 375 |




|
schal, noch enwil van Parchem nicht wônen thôn, id enzy dat desse tâfle gantzeken rêde zy. Ok enschal ik anders nyn mâlewerk vôre nemen to mâlende edder tho mâkende, êr desse tâfle rîde is, id enzy, dat ik dat dů na desser vôrbenômeden heren râde vnde willen. Hîr vôre scholen my desse heren vride lûde gheuen twêhundert lubesche mark pennynghe, alze tho der Wismer ghenge vnde gheue synt, vnde teyn lubesche mark pennynge, alze tho Parchem ghenge vnde gheue synt, drê vôder holtes vnde twê syde speckes. Desse twêhundert lubesche mark vnde teyn mark schalen desse heren vnde lûde my berêden bynnen Parchem edder bynnen der Wismer, vp ere êuentûre, wôr ik de berêdinghe lêuest hebben wil, van tyden to tyden allentêlen alze ik de tâflen berêde vnde mâke. Wêret ôk wan desse tâfle rêde is, dat dessen heren vnde lûden twyntich mark edder druttich mark enbrôke, alzo dat ze my de nicht rede gheuen konden, wan de tâfle rêde is, der pennynghe schal ik dach geuen vnde en der beyden myd ghû e den willen eyn half iâr. Alle desse vôrscreuen stucke vnde artikele vnde eyn iêwelk besunderghen lôue ik Hennyngh Leptzowe myd mynen eruen dessen vôrbenômeden heren vnde prêsteren, alze her Herman Willer, her Hinrick van Pritze, her Johan Subus, Hinrik Rolof, radman to Parchem, alze vôrstenderen desser tâflen vnde werkes, vnde tho erer vnde des suluen ghodeshûses sunte Jurien to Parchem trûwer hand den borghermêsteren vnde râdmannen dârsulues to Parchem stede vnd vast tho holdende in ghûden lôuen.
Post cuius quidem cedule productionem predicti dominus Hinricus de Pritze et Hennyngh Leptzowe omnia et singula in dicta cedula conscripta grata et rata habere et firmiter obseruare promisserunt, requirentes me notarium infrascriptum, vt ipsis super premissis vnum vel plura publicum vel publica conscriberem instrumentum vel instrumenta. Acta sunt hec anno, indictione, pontificatu et aliis quibus supra, presentibus honorabilibus viris dominis Jacobo Hoghenkerken, Gherardo Kos, presbiteris, Laurencio Manderowen, rectori scholarum apud beatam virginem, JohanneVresen, consule, Georgio Belowen, prothonotario, consulibus opidi Wismariensis


|
Seite 376 |




|
antedicti et Johanne Bolten, laico, Zwerinensis et Raceburgensis diocesis sepedicte, testibus ad premissa vocatis et rogatis in testimonium omnium premissorum.
|
(L. Sign.)
Nicolaus Craghe . |
Et ego Nicolaus Craghe, clericus Zwerinensis diocesis, publicus auctoritate imperiali notarius, quia huiusmodi cedule productioni, lectioni omnibusque aliis et singulis, dum sic, vt premittitur, fierent et agerentur, vna cum prenotatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, me aliis occupato negociis per alium fidelem conscribi feci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui rogatus et requisitus, in euidens testimonium omnium et singulorum premissorum |


|
Seite 377 |




|



|


|
|
:
|
Das Amt und Wappen der Maler und Glaser
und
das Künstlerwappen,
von
G. C. F. Lisch,
Archiv=Rath und Conservator.
In neuern Zeiten ist oft Rede von einem Künstlerwappen, welches der Kaiser Maximilian I., oder nach andern der Kaiser Carl V., dem Mater Albrecht Dürer verliehen haben und welches das Wappen der "Künstler" geworden sein soll. Ganz abgesehen davon, daß zu Carl's V. Zeiten der allgemeine Begriff eines "Künstlers" im heutigen Sinne noch gar nicht ausgeprägt und geltend war, sondern jeder Künstler sich nach der Kunst, die er übte, wie z. B. Peter Vischer sich nur "Rothgießer" titulirte, so muß man die Forschung über diese Wappen in die Zeit der strengen Zünfte, in das Mittelalter hinaufführen, in welcher auch jede Kunst zünftig und einem Handwerk angelehnt war. Ohne auf Dürers Wappen eingehen zu wollen, ist es doch sicher, daß das sogenannte Dürer= oder Künstler = Wappen sehr viel älter als Dürer, und sehr weit verbreitet ist.
Das Wappen mit
ist nämlich, so weit es sich verfolgen läßt, das Siegel der Zunft der Glaser und Maler, welche seit alter Zeit an sehr vielen Orten zu Einer Zunft oder Einem Amte vereinigt waren. Ursprünglich mag das Wappen den Malern allein gehört haben; es soll der Sage nach vom Kaiser Sigismund, nach Andern schon vom Kaiser Karl IV. den Malern verliehen worden sein. Hiefür mag auch das Wappen selbst sprechen, welches ein sogenanntes redendes Wappen ist. Da in alten Zeiten die Maler sich viel mit Bemalung von Schilden,


|
Seite 378 |




|
d. i. mit Wappenmalerei 1 ) beschäftigten, auch die Malerei, mit Ausnahme der allgemein verbreiteten Monumental=Malerei, vorherrschend Miniatur=Malerei war, so wurden die Mater schon früh im Mittelalter 2 ) Schilder, Schildener oder Schilderer genannt; schon der Bischof Rudolf von Magdeburg (1192 + 1205) soll eine Schilder=Innung gestiftet haben 3 ). Von dieser Benennung mag es gekommen sein, daß die Maler oder Schildener. drei Schilde im Wappen führten. Erst später mögen sich die Glaser mit den Malern zu Einem Amte vereinigt haben, theils weil die Glaser in schildähnlichen Formen arbeiteten, theils weil Maler und Glaser in der Kunst der Glasmalerei zusammentrafen, welche in den letzten Zeiten allein von den Glasern ausgeübt ward.
Sehr klar werden diese Verhältnisse in den neu entdeckten und so eben bekannt gemachten 4 ) "Rechten der S. Lucas=Zeche zu Wien" aus dem 15. Jahrh. geschildert, da in dieser Zunft alle zeichnenden Künstler und die ihnen dienenden Handwerker vereinigt werden". In einem alten "Maler=Recht" (vor dem J. 1430) werden die "schilter und geistlichen maler" zusammengestellt und "ir arbeit" ist "was zu dem leib herrn, rittern vnd knechten zu schimph oder zu ernst gehort, es sein stechezeug, turneisezeug oder wie es genant ist". Im J. 1410 waren die "schilter, geistlichen maler, glaser, goltslacher vnd slechten glaser" in der S. Lucas=Zeche zu Einer Zunft vereinigt. Von dem "schilter" wird gefordert, "daz er mit sein selbs hand vier new stuch mach, einen stechsatel, ein prustleder, ein rosskopf, ein stechschilt, vnd daz er auch das malen chunn, als es herren, ritter vnd knechte an in vordernt". "Ein geistlich maler sol zuberaiten ein tauel mit prunirten gold vnd sol darauf malen ein pild. Ein glaser sol machen ein stuck von glaswerch mit pilden, daz sol darin geprant sein. Es sullun auch alle die, die slechts glaswerich arbaitend vnd gebrants werch


|
Seite 379 |




|
"nicht kunnen, auch vor den maistern beweisen, ob sy des slechten glaswerich maister mugen sein oder nicht." Im J. 1442 erhielten die "maister schilter, maler vnd glaser vnd goldslaher" bestätigt, "das sich kain schilter, maler noch glaser, goltslaher, noch slechter glaser, der prants werich nicht kan, ze maister nicht seczen sol, er hat denn sein kunst vor den andern maistern ee beweist". Im J. 1446 waren die "maler, seidennater, schilter, glaser, goltslacher vnd aufdrukcher" vereinigt. "Ein seidennater sol stechen ain pild von seiden vnd ain pild erheben, als das zu perln gehöret vnd ain silt verwappen mit eim stechen von seiden." "Ein goltslaher sol slahen gold vnd silber, das die recht prait hab, vnd gesponnen arbait machen." "Ein aufdrukcher, der erhaben oder flache ding drukchen wil, der sol das auch erweisen vnd aufdrukchen." Im J. 1468 vereinigten sich die "maler, seydennater, goldtschlager vnd ausstruckher in einer zech". Im J. 1525 war auch "die karttenmacher in sand Lucas bruderschafft".
Diese S. Lucas=Zeche zu Wien ist wohl die weiteste Ausdehnung einer Künstlerinnung im Mittelalter. Gewöhnlich aber waren nur die Maler und Glaser zu Einer Zunft vereinigt, und diese beiden zusammen, oder die Maler und die Glaser allein führten immer drei Schilde im Schilde im Siegel.
In Rostock waren die Maler und Glaser schon früh zu Einer Zunft vereinigt; schon im J. 1400 hatten die Glaser und Maler zusammen 2 Mann Bewaffnete auszurüsten 1 ). Im J. 1533 beabsichtigte der Abt von Doberan, die Vorfahren des Herzogs Heinrich von Meklenburg "durch die glaser und maler" auf die Fenster des Kreuzganges malen zu lassen 2 ). Die Glaser und Maler hatten zusammen einen Altar und eine Vikarei in der Marienkirche und übten das Besetzungsrecht noch sehr spät. Noch am 24. August 1557 präsentirten die "Aelterleute des Glasergewerkes und Maleramtes zu Rostock" ("olderlude des glesewerkes vnnd melerampts to Rostock"), nach Ableben ihres letzten Vikars Matthäus Katte, den Magister Lucas Randow, Prediger an der Kirche des Heiligen=Geist=Hospitals, dem Herzoge Ulrich, als Administrator des Bisthums Schwerin,


|
Seite 380 |




|
zur Bestätigung durch die unten mitgetheilte Pergament=Urkunde 1 ), welche durch das "gewöhnliche Siegel" des vereinigten Amtes bekräftigt ist. Dieses runde Siegel, welches augenscheinlich im Anfange des 16. Jahrhunderts gestochen ist, enthält einen großen Schild, auf welchem drei kleine Schilde stehen, und auf einem in Falten umhergelegten Bande die nicht ganz klare und am Ende nicht mehr deutlich zu lesende Umschrift:
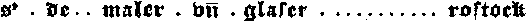
Das Glaseramt zu Rostock führt noch jetzt ein Siegel mit einem Schilde, auf welchem drei Schilde stehen, und der Umschrift:
Auch in Stralsund waren die Maler und Glaser in Einem Amte vereinigt und hatten ebenfalls eine eigene Capelle in der Marienkirche. In der aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammenden Beschreibung der 44 Altäre dieser Kirche durch Franz Wessel († 1570) heißt es 2 ):
"44. Dat lateste is der meler und glaser capell, dar hefft Peter Badendick vast vele in gestifftet, wie men findt in einer matricel. Man kan auerst by dem gedachten ampte nicht vormercken, dat sie idt im gebruke gehatt hebben. Die gleser bekennen, dat sie men 50 Mk. houetstohls capellengeldt hebben; dat is nu in Kösters des oldermannes hende gekamen, dar schal idt ovel tho redden wesen"
.
In Lübeck, wo in atter Zeit alles eine größere Gestalt hat und noch heute ehrwürdig fortlebt, waren zur Zeit der größten Kunstblüthe der Stadt die Maler noch von den Glasern getrennt. In Lübeck ist noch ein altes, großes, rundes Siegel vorhanden, welches einen Schild mit drei Schilden und über dem Schilde einen Helm enthält, auf welchem zwischen zwei Hirschhörnern eine wachsende Jungfrau steht, welche die beiden Hörner mit den Händen faßt, mit der Umschrift:


|
Seite 381 |




|
(mit der Jahreszahl 1425 in der Umschrift des Siegels).
In der S. Katharinenkirche steht noch der aus dem J. 1487 stammende Altar der Maler, welcher den H. Lukas enthält und das Wappen mit drei silbernen Schilden im rothen Schilde.
Darauf bildeten die Maler und Glaser auch in Lübeck Ein Amt. Sie haben sich aber im 17. Jahrh. zur Zeit der bürgerlichen Streitigkeiten wieder getrennt. Aus dieser Zeit stammt denn wohl das Siegel der Glaser, welche noch das alte Siegel führen: ein aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stammendes, kleines rundes Siegel, mit einem Schilde, auf welchem drei Schilde stehen, und einem Cherubimkopfe (wohl nur eine Verzierung) über dem Schilde und der Umschrift:
Die Glaser haben im Kreuzgange der Katharinen=Kirche noch ihr Versammlungszimmer und schenken dahin beim Meisterwerden noch gemalte Glasfenster. Innerhalb des Zimmers ist auf der Thür im vorigen Jahrhundert der H. Lukas gemalt, neben demselben ein rother Schild mit drei silbernen Schilden. Dieselben Farben hat ein neueres Schenkfenster in dem Saale. An dem alten Altare der Maler in der Katharinen=Kirche steht dasselbe Wappen mit denselben Farben.
Was nun die Farben des Maler= und Glaser=Wappens, oder des sogenannten Künstlerwappens, betrifft, so sind sie allgemein (mit wenigen, vielleicht neuern Ausnahmen).
in Deutschland roth für den Hauptschild und silbern für die drei kleinen Schilde,
wie sie in Lübeck noch heute überliefert sind. In den Niederlanden und Frankreich ist jedoch die Farbe des Hauptschildes blau und die der drei kleinen Schilde silbern. Diese Farben scheinen in neuern Zeiten von dem Auslande in einige deutsche Malerzünfte übertragen zu sein.
Die Vereinigung des Glaser= und Maler=Amtes hat an vielen Orten gute Früchte getragen, namentlich auch in Rostock, indem Glaser und Maler hier eifrig die Glasmalerei trieben. Noch im J. 1515 malten rostocker


|
Seite 382 |




|
Meister für die Kirche zu Doberan Fenster (vgl. Jahrb. II, S. 38); namentlich ward mit dem Fenstermacher Hans Goltschmidt zu Rostock verabredet, daß er für eine "vermalte Tafel" einen halben Gulden und für eine "unvermalte Tafel" sieben Schilling lübisch haben sollte. In Rostock ward auch noch sehr spät Glasmalerei von den Glasern getrieben. Im Anfange des vorigen Jahrhunderts lebte in Rostock der Glaser Jürgens, welcher der letzte glasmalende Glaser in Meklenburg gewesen zu sein scheint. Mantzel erzählt in seinen Bützowschen Ruhestunden, Th. VI, 1762, S. 30:
"Ist die Kunst, Bilder, Gold und Silber, auch andere Farben in Glaß zu brennen, würcklich verlohren? Diese Frage kömmt hierher, wegen einer besondern Rostockschen Geschichte. Man sagte, vor etwa 50 Jahren, der Letzte, welcher die Kunst verstünde, wäre der damals schon hochalte Glaser Jürgens. Der diß schreibt, kann so viel bezeugen, daß, als er, vor gedachten halben Jahrhundert, des wolseel. und unvergeßlichen Herrn D. Weidners Hauß= und Tisch=Genoß gewesen, derselbe den alten Mann ermahnet, das Geheimniß doch nicht mit sich sterben zu lassen, sondem es seinem Sohn, der von gleicher Profeßion, zu lehren, welches aber der Eigensinn nicht zulassen wollen. S. die Gel. Neuigk. 1750, S.440, woselbst man wil, daß die Kunst wieder entdeckt sey. S. Neri de arte vitriaria."
Dr. Johann Joachim Weidener, Professor der Theologie, war 1699 Diakonus und 1715 Pastor an der Marienkirche zu Rostock, bis 1733. Um das Jahr 1712 war also der Glaser Jürgens ein alter Mann.
Hiemit stimmen denn auch die noch vorhandenen Ueberreste überein. Die Gegend von Rostock ist sehr reich an neuern Glasmalereien gewesen und die Sammlungen des Vereins für meklenb. Geschichte besitzen einige große Wappen, welche, nach dem Datum auf denselben, im Anfange des 18. Jahrh., sehr brav gemalt sind, wenn auch nur vorherrschend in schwarz auf hellem Glase mit etwas grün und gelb, selbst noch roth. So z. B. besitzt der Verein zwei große rostocker Wappen mit den Namen "Hinrich Fridrich Hülsenbeek 1715" und "Anna Elisabet Hülsenbecken gebohrne Tarnauen".


|
Seite 383 |




|
Das Amt der Glaser und Maler zu Rostock präsentirt dem Herzoge Ulrich von Meklenburg, als Administrator des Stifts Schwerin, nach dem Ableben des Priesters Matthäus Katte den Magister Lucas Randow, Prediger an der Kirche zum Heil. Geist daselbst, zu einem dem Amte zustehenden Lehn m der Marien=Kirche zu Rostock.
D. d. Rostock. 1557. Aug. 24.
Nach dem Originale im Archive der Kirchen-Oekonomie zu Rostock.
Wy Albrecht Graue vnd Hans Euerdes, olderlûde des
glesewerkes vnnd melerampts to Rostock wunsschen
dem durchluchtigen hochgeborn fursten vnnd hernn
hern Vlrichen, hertogen to Mekelnborg, fursten
to Wenden, grauen vnd administrator des stiffts
to Swerin, Rostock vnd Stargerde der lande hern,
vnserm gnedigen hern, nach vnsern vnderdenigen,
verplichtsculdigen deinsten erbêdunge ewigen
heyel in godt den hern vnd allest gûtt. Gnediger
furste vnd her. Am iungesten is eine geistliche
commende edder lêneken belegen in vnser lêuen
frûwen kercken to Rostock durch den d
 th zeligen her Mattheus Katten,
des suluen lesten bositters, entleddiget worden,
dâr to wy, so vâken dat vacêrt, wârafftige
patronen syn vnd de belêninge hebbenn, syn denne
durch den werdigen vnd achtbarn hern magistrum
Lucam Randouwenn, godtliches wordes predikern in
der kercken thôm hilligen geiste alhîr to
Rostock, vmmhe êrlike erholdinge synes standes,
condition vnnd hennekumpstes durch godt dat
sulue to vorlênende flîtlich vnnd bittlich
besocht vnd angefallen, Demnha vmme sodâner
syner flîtigen, bitlichen ansôkinge, ôck syns
standes, condition vnd êrlichen ampts bewâgen
worden, hebben ene dat sulue eindrechtlichen
vorlênt vnd dâr tho erwelt vnd presentêrt, wie
wy ôck iêgenwerdigen in krafft disses vnses
brêues dâr to erwelen, verlênen vnnd presentêrn,
vnderdenichlich supplicirende vnnd biddende, den
suluen van iwer furstlichen gnâden edder der
suluen beuel-
th zeligen her Mattheus Katten,
des suluen lesten bositters, entleddiget worden,
dâr to wy, so vâken dat vacêrt, wârafftige
patronen syn vnd de belêninge hebbenn, syn denne
durch den werdigen vnd achtbarn hern magistrum
Lucam Randouwenn, godtliches wordes predikern in
der kercken thôm hilligen geiste alhîr to
Rostock, vmmhe êrlike erholdinge synes standes,
condition vnnd hennekumpstes durch godt dat
sulue to vorlênende flîtlich vnnd bittlich
besocht vnd angefallen, Demnha vmme sodâner
syner flîtigen, bitlichen ansôkinge, ôck syns
standes, condition vnd êrlichen ampts bewâgen
worden, hebben ene dat sulue eindrechtlichen
vorlênt vnd dâr tho erwelt vnd presentêrt, wie
wy ôck iêgenwerdigen in krafft disses vnses
brêues dâr to erwelen, verlênen vnnd presentêrn,
vnderdenichlich supplicirende vnnd biddende, den
suluen van iwer furstlichen gnâden edder der
suluen beuel-


|
Seite 384 |




|
hebber dâr to instituerende vnd inuestierende, ôck andere vnd îsliche to rechte edder sunsth vth wânheit hîr inne van nôden to dônde vnd gebrûkende vnd ene diessuluen J. F. G. canonicam institutionem vth gnâden mithdêlen, dâr vôr dath lôen van dem allemechtigen to iênner tidt die allest gûder belôner rîchlick enttangende werden, dem wy J. F. G. in langer gesuntheit vnd rowsâmen regimentt êwich dôn beuelen. Tho mêrer ôrkunde vnnd tûchenisse hebbe wy disse vnse presentation mith gûdem willen vnd vulbôrde gedachten vnses ampts mith vnserm gewôntlichen segele hîr vnder angehangen eindrechtlichen versegelt vnd beuestet, de gegeuen vnd schreuen is toRostogk int iâr na gades gebôrt dûsent vîffhundert vnnd sôuen vnd vefftich, dinxtedâges dede was die dach des hilligen Bartholomei apostoli.
Nach dem auf Pergament in Cursive geschriebenen
Originale im Kirchen-Oekonomie-Archive zu
Rostock. An einem Pergamentstreifen hängt ein
Wachssiegel mit einem Schilde, auf welchem drei
leere Schilde
 stehen; umher liegt ein
verschlungenes Band mit der Umschrift:
stehen; umher liegt ein
verschlungenes Band mit der Umschrift:
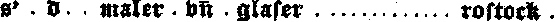
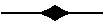


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
Jahresbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde
von
Wilhelm Gottlieb Beyer,
Dr. jur. und Archiv Secretair zu
Schwerin,
als
zweitem Secretair
des Vereins.
Dreiundzwanzigster Jahrgang
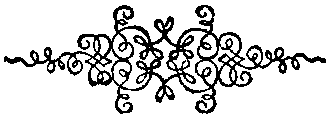
In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung (Didier Otto).
Schwerin, 1858.


|
[ Seite 2 ] |




|
Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.


|
[ Seite 3 ] |




|
Z u den hohen Beförderern unsers Vereines gehörte bekanntlich auch die Frau Herzogin Helene von Orleans K. H., deren frühzeitiger unerwartete Tod vor kaum 2 Monaten ganz Meklenburg mit gerechter Trauer erfüllte. Die hohe Verstorbene beehrte den Verein gleich nach seiner Gründung im März 1836 durch ihren Beitritt, damals noch als jugendliche Prinzessin ausschließlich die Freude und der Stolz unsers Landes. Aber auch nachdem ein verhängnißvolles Geschick sie schon im nächsten Jahre zur Erfüllung eines hohen Berufes unmittelbar an die Seite des französischen Thrones berufen hatte, entzog sie uns und unserm stillen Wirken in der alten Heimath ihre fürstliche Theilnahme nicht, und selbst als sie demnächst nach dem plötzlichen Zusammensturze jenes Thrones im Jahre 1848 als hohe Verbannte über deu Rhein zurückkehrte, gedachte sie gleich in den ersten Wochen dieses unheilvollen Ereignisses auch unsers Vereins, indem sie Sorge trug, daß die Zahlung des außerordentlichen Beitrages, welcher von ihrem ersten Beitritte bis zu ihrem Tode regelmäßig jedes Jahr in unsere Kasse floß, keine Unterbrechung erleide. Wir haben daher das volle Recht, die zu früh verstorbene edle Frau auch als die Unsre zu betrauern. Sie starb bekanntlich, erst 44 Jahre alt, am 18. Mai 1858 zu Richmond, und ward am 22. in der Gruft zu Weybridge beigesetzt, nun 3 großen Nationen zugleich angehörig: Deutschland durch Geburt und Bildung, Frankreich durch ein wechsel= aber ruhmvolles Leben, England durch ihr einsames Grab in der Verbannung!
Von unsern correspondirenden Mitgliedern starb im Laufe dieses Vereinsjahres am 8. August 1857 Dr. Johann Heinrich Schröder, Professor und Oberbibliothekar der Universität zu Upsala und Königl. schwedischer Reichshistoriograph. Er war ein eifriger Forscher auf dem Gebiete


|
Seite 4 |




|
der Geschichte, Numismatik und Bibliographie, und Verfasser zahlreicher Schriften, der unserm Vereine seit 21 Jahren (1837) angehörte. - Ihm folgte schon am 12. Januar 1858 der gleichzeitig mit ihm zum correspondirenden Mitgliede erwählte Professor T. W. Barthold zu Greifswald, der berühmte Verfasser einer ausführlichen Geschichte von Pommern, mehrer Schriften über deutsches Städtewesen, einer Geschichte der Stadt Soest zc., so wie vieler kleineren Abhandlungen in Raumer's historischem Taschenbuche. - Statt ihrer hat der Ausschuß des Vereins schon in seiner Octoberversammlung v. J. den Herrn Vicomte v. Kerckhove, Präsidenten der archäologischen Akademie zu Antwerpen, jetzt zu Madrid, so wie später den Herrn Riza=Rangabé, königl. griechischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des königl. Hauses zu Athen; ferner den Herrn Staatsminister a. D. Freiherrn v. Hammerstein zu Verden und den Herrn Archiv=Secretair Dr. Grotefend zu Hannover, mit welchen beiden letztern Herren unser Verein durch seinen ersten Secretair, Herrn Archiv=Rath Lisch, schon seit Jahren in lebhaftem wissenschaftlichen Verkehre gestanden, zu wirklichen correspondirenden Mitgliedern ernannt, was von allen Seiten bereitwillig angenommen ward. Die Zahl unsrer officiellen Herren Correspondenten ist daher in diesem Jahre auf 54 gestiegen.
In Betreff der correspondirenden Vereine ist zunächst zu erwähnen, daß die Gesellschaft für Frankfurts Geschichte und Kunst sich mit dem am Ende des Jahres 1857 gegründeten Vereine für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt verbunden hat, und daß unsre mit der erstgenannten Gesellschaft schon seit einer Reihe von Jahren bestandene Verbindung nunmehr auf den neuen Verein übergegangen ist - Neue Verbindungen sind ferner angeknüpft: 1) mit unserm jüngern Bruder=Verein, dem Verein der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg, welcher im Jahre 1847 durch zwei unserer eifrigsten Freunde und Mitglieder, den inzwischen verstorbenen Freiherrn Albrecht Maltzan zu Penzlin und Wartenberg auf Peutsch, und den Herrn Ernst Boll zu Neubrandenburg gegründet ward, und unter der Leitung des Letztern sich bereits in und außerhalb Meklenburgs einen ehrenvollen Namen und wachsende Theilnahme erworben hat; 2) mit der altehrwürdigen königl. Akademie der Wissenschaften zu Erfurt, und endlich 3) außerhalb Deutschlands mit der Akademie der Alterthumskunde Belgiens zu Antwerpen, welche zugleich unsern ersten Herrn Secretair,


|
Seite 5 |




|
Archiv=Rath Lisch zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannte, was unsererseits, wie oben bemerkt, durch eine gleiche Anerkennung der Verdienste des Präsidenten der Akademie, Herrn Vicomte v. Kerckhove, erwidert ward. - Auch eine Verbindung mit den in französischer Weise organisirten und sehr thätigen historischen Vereinen Frankreichs durch die Vermittelung des Herrn Grafen Reinhard in Paris ist schon im vorigen Jahre von unsrer Seite angebahnt worden, bis jetzt jedoch noch nicht zu Stande gekommen. Wir stehen daher gegenwärtig mit 78 gelehrten Gesellschaften und Vereinen in und außerhalb Deutschlands in geordnetem wissenschaftlichen Verkehr und Schriftenaustausch.
In der innern Leitung unsers Vereins war durch den Austritt des bisherigen Minister=Präsidenten, Herrn Grafen v. Bülow Exc., aus dem meklenburgischen Staatsdienste, in Folge dessen derselbe zugleich das Land verlassen hat, auch ein Wechsel unsers Präsidii nothwendig geworden. Es hat daher in der jüngsten Generalversammlung, welche dies Mal wegen des einfallenden Sonntags statutenmäßig am 12. d. M. gehalten ward, eine Neuwahl stattgefunden, welche einstimmig auf den jetzigen Herrn Minister=Präsidenten v. Oertzen Esc. fiel. Sr. Esc. hat sich denn auch demnächst gegen eine Deputation des Ausschusses zu unsrer großen Freude und Beruhigung zur Annahme dieser Wahl bereit erklärt. - Die bisherigen Beamten des Vereins wurden zwar von der General=Versammlung in ihren Aemtern bestätigt; Herr Gymnasial=Lehrer Dr. Wigger erklärte jedoch zu allgemeinem Bedauern, daß seine neuerdings außerordentlich vermehrten Berufsgeschäfte, die ihm augenblicklich überdies noch durch Kränklichkeit erschwert würden, ihm nicht gestatteten, das erst vor einem Jahre übernommene, und mit großer Liebe zur Sache verwaltete Ehrenamt als Bibliothekar des Vereins fortzuführen. Man war daher genöthigt auch hier zu einer Neuwahl zu schreiten, welche auf den anwesenden Herrn Candidaten Dolberg, Lehrer an der Militair=Bildungsanstalt hieselbst, fiel, und von diesem sofort angenommen ward. Die vorigjährigen Herren Repräsentanten des Vereins wurden dagegen sämmtlich wiedergewählt, so daß der Vereinsausschuß gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern besteht:
Präsident: Herr Minister=Präsident v. Oertzen
Exc.
Vicepräsident: Herr Geheime=Rath v.
Oertzen.
Erster Secretair: Herr Archiv=Rath und
Conservator Dr. Lisch.


|
Seite 6 |




|
Zweiter Secretair: Der unterzeichnete
Archiv=Secretair Dr. Beyer.
Antiquar: Herr
Hofmaler Schumacher und dessen Substitut Herr
Archiv=Rath Lisch.
Bibliothekar: Herr Candidat
Dolberg.
Berechner: Herr
Ministerial=Registrator Dr. Wedemeier.
Repräsentanten: Herr Canzlei=Director v. Bülow.
Herr Revisions=Rath Hase.
Herr
Gymnasial=Director Dr. Wex.
Herr Prorector Reitz.
Außerordentliche Beamte:
Herr Pastor Masch zu
Demern, als Aufseher der Münzsammlung, und
Herr
Archiv=Registrator Glöckler, als Aufseher der Bilder=Sammlung.
Von den ordentlichen Mitgliedern hat der Verein in dem abgelaufenen Geschäftsjahre 8 durch den Tod verloren. Es starben nämlich der Kammerherr v. Engel auf Bresen bei Neubrandenburg am 9. Juli, v. Behr=Negendanck auf Torgelow zu Ludwigslust am 22. Sept., Kaufmann Daries zu Plau am 29. Sept., Justiz=Rath v. Paepke auf Lütgenhof am 1. Octbr., Pastor Heyden zu Beidendorf am 15. Octbr 1857, so wie der Archiv=Rath Groth zu Schwerin, eine Zeitlang Aufseher der Münzsammlung, am 18. März, Consistorial=Rath Mag. Gentzken zu Ratzeburg am 20. März, und ganz neuerdings der zu unsern eifrigsten Freunden zählende Kammerherr v. Kardorf auf Remlin zu Gnoien am 5. Juli 1858: sowohl nach der Zahl als nach der Persönlichkeit der Abgeschiedenen, welche dem Vereine mit Ausnahme des Herrn v. Behr und des Kaufmanns Daries sämmtlich schon seit seiner Gründung im Jahre 1835 angehörten, ein sehr bedeutender Verlust. - Außerdem sind 5 Mitglieder, nämlich der zum Conrector des Gymnasiums zu Celle berufene Herr Oberlehrer Dr. Ebeling zu Schwerin, der Gutsbesitzer Herr Schröder zu Holzfelen bei Lenzen, früher auf Pöl, der Herr Freiherr v. Ketelhodt auf Hermansgrün bei Greitz, Herr Hofopernsänger Parrod in Schwerin und Herr Gerichts=Rath Karsten zu Rostock, letzterer bedauerlich wegen gänzlicher Erblindung, ausgetreten. - Als neue Mitglieder begrüßen wir dagegen die Herren Premier=Lieutenant Bruns, Landschaftsmaler Jentzen, Prinzen=Instructor Kollmann und Redacteur Schäfer zu Schwerin, Unterofficier Büsch zu Wismar, Candidat Neumann zu Bandelstorf, v. Restorf


|
Seite 7 |




|
auf Rosenhagen, Graf v. Schwerin auf Göhren bei Woldeck, die Gymnasial=Lehrer Dr. Bleske und Dr. Meyer, Premier=Lieuteuant Baron v. Nettelbladt, Manecke auf Duggenkoppel zu Schwerin, Pogge auf Jaëbitz, und Freiherr v. Maltzan auf Penzlin und Wartenberg zu Eschdorf bei Dresden. Mithin hat der Verein im Ganzen 13 ordentliche Mitglieder verloren und 14 wieder gewonnen, so daß unsre Zahl abermals um 1 Mitglied von 279 auf 280 gewachsen ist.
Die Vermögensverhältnisse des Vereins sind im Ganzen als günstig zu bezeichnen, Der in der
enthaltene Extract aus der letzten Rechnung weis't nämlich eine laufende Einnahme von 687 Thlr. 40 ßl. Cour. nach, d. h. 57 Thlr. 21 ßl. mehr als im Jahre 1847, dagegen aber nur eine Ausgabe von 634 Thlr. 31 ßl., also 237 Thlr. 17 ßl. weniger, als im vorigen Jahre, wo einer Seits die im letzten Jahre auf 61 Thlr. 24 ßl. gestiegene Einuahme für die Druckschriften des Vereins ganz ausgefallen war, anderer Seits die Druckkosten in Folge des Registers zu den Jahrbüchern 225 Thlr. mehr betrugen, als dies Jahr. Das Vermöqen des Vereins ist daher von 2267 Thlr 39 1/2 ßl., auf 2321 Thtr. 11 ßl., also um 53 Thlr. 19 1/2 ßl. Cour. gewachsen, so daß der vorigjährige Verlust von 241 Thlr. 29 ßl. erfreulicher Weise in einem einzigen Jahre fast zum vierten Theile ersetzt ist.
Ueber die zahlreichen und werthvollen Erwerbungen aller Sammlungen des Vereins geben die
nähere Auskunft. Neu ist darunter die Sammlung von Autographen, deren Anlegung und Pflege wir dem Herrn Archiv=Registrator Glöckler verdanken. Zu der Sammlung von Handschriften und Urkunden sind nur zwei Stücke hinzugekommen, nämlich ein Auszug aus einer Beschreibung des Amtes Gadebusch, und eine Abschrift von Hexenproceß=Acten aus diesem Amte, ein Geschenk des Herrn Bürgermeisters Mau zu Neu=Kalen. - Außerdem hatte der Herr v. Behr=Negendank auf Semlow in Pommeyn die Güte, dem Vereine einen Gypsabguß der Büste des 1621 verstorbenen Hofmeisters Samuel Behr und der Relief=Medaillons der Aeltern desselben von dem Reiterdenkmal über seinem Grabe in der Kirche zu Doberan zu schenken. - Die


|
Seite 8 |




|
Naturalien=Sammlung endlich ward durch einen im Torfmoore zu Müsselmow gefundenen und vom Herrn Wiechmann=Kadow geschenkten Schädel eines jungen Elen bereichert. Ueberhaupt verdankt der Verein auch in diesem Jahre den ganzen Reichthum seiner neuen Erwerbungen fast ausschließlich der Liberalität seiner zahlreichen Gönner und Freunde, denen er hiedurch öffentlich seinen besten Dank sagt. Es gilt dies namentlich den folgenden Herren: Freiherr von und zu Auffeß zu Nürnberg, v. Behr=Negendank auf Semlow, Böcler, Pastor zu Gägelow, G. Brüning, st. jur. aus Schwerin, v. Bülow auf Rogeez, Büsch, Unterofficier zu Wismar, G. Clement, Maler zu Ludwigslust, v. Conring zu Doberan, Crull, Dr. med. zu Wismar, Daniel, Bürgermeister zu Schwaan, Dolberg, Candidat zu Schwerin, Eggerss, wail. Oberlandforstmeister zu Schwerin, Garthe, Baumeister zu Parchim, Genzken, Stadtrichter zu Altstrelitz, Greffrath, Kaufmann zu Goldberg, Greffrath, Ausschußbürger zu Güstrow, Grotefend, Dr., Archiv=Secretair zu Hannover, Groth, wail. Archiv=Rath zu Schwerin, Grotrian, Amtsdiätar zu Schwaan, v. Hagenow, Dr. zu Greifswald, Havemann, Dr., Professor zu Göttingen, Hinzelmann zu Tessin, Hüen, Dr. med. zu Marlow, Jenning, Amtsverwalter zu Schwaan, Jenning, Gymnasiast zu Schwerin, v. Kamptz zu Schwerin, v. Kardorf, wail. auf Remlin, Helene Kotschoubey, Fürstin zu Petersburg, Lappenberg, Dr., Archivar zu Hamburg, Le Fort, Landrath auf Boeck, Lorenz, Schulrath zu Schwerin, Freiherr v. Maltzan, Klosterhauptmann zu Dobbertin, Masch, Pastor zu Demern, Mau, Bürgermeister zu Neu=Kalen, v. Oertzen, Geh. Rath zu Schwerin, v. Oertzen auf Repnitz, Parbs, Adv. zu Schwerin, v. Plessen, Geh. Rath, Exc. zu Schwerin, v. Quast, Geh. Regierungsrath auf Radensleben, Riedel, Geh. Archiv=Rath zu Berlin, Ritter zu Friedrichshöhe, Rosenberg, Staatsanwalt zu Bergen auf Rügen, Saß, Kürschner zu Güstrow, Scheiger in Steiermark, Schencke, Dr., Präpositus zu Pinnow, Schlöpke, Hofmaler zu Schwerin, Segnitz zu Schwerin, Fr. Seidel zu Bützow, Sellin, Gymnasiast zu Schwerin, Siemßen, Dr. med. zu Rostock, Stein zu Bützow, Thiem, Rector zu Dömitz, Ueckermann, Pensionair zu Vorbeck, Wex, Dr., Gymnasial=Director zu Schwerin, Wiechmann auf Kadow, Willebrand, Pastor zu Kladow, Wohlgemuth, Rentier zu Schwerin, Wollbrandt, Schriftsetzer zu Schwerin, Zober, Professor zu Stralsund.


|
Seite 9 |




|
Die historisch antiquarische Literatur Meklenburgs,
worüber ich mir alljährlich einen kurzen Bericht zu
erstatten zur Pflicht gemacht habe, ist in diesem
Jahre durch keine neue Werke bereichert, als eben
durch die Jahrbücher unsers Vereines selbst. Auch
diese bringen in dem mit diesem Berichte zugleich
ausgegebenen 23. Bande keine Arbeiten von größerm
Umfange, entschädigen aber dafür durch sehr
mannigfache kleinere Abhandlungen, durch welche die
Geschichte unsers Vaterlandes nach mehren Seiten hin
nicht unwichtige Aufklärung und Bereicherung
empfängt. Den größten Gewinn erhält die Genealogie
unserer Fürstenhäuser sowohl in älterer als in
neuerer Zeit durch die verdienstlichen
Untersuchungen des Herrn Archiv=Rath Lisch, denen
man jetzt, da die Resultate einfach und klar
vorliegen, den darauf verwendeten Jahre langen Fleiß
kaum ansieht. Es gehören hieher namentlich die
Mittheilung der Legende von dem heiligen Erpho,
einem angeblichen Sohne des Obotriten=Fürsten
Buthue, und besonders die urkundlich beglaubigten
Nachrichten über die Gebrüder Kanut und Waldemar,
Söhne des Prizlav, die in unserer Geschichte bisher
so gut als unbekannt waren; ferner einzelne Beiträge
zur Lebensgeschichte des Fürsten Hermann von
Meklenburg, des Herzogs Albrecht
 und seiner Gemahlin Katharina, der
Herzogin Sophie, Gemahlin Magnus II., des Herzogs
Johann I. von Meklenburg=Stargard und seiner
Gemahlinnen, des Herzogs Rudolf von
Meklenburg=Stargard, Bischofs zu Schwerin, und des
Herzogs Ulrich I. und seiner Söhne, so wie des
Fürsten Barnim von Werle. - Von demselben Herrn
Verfasser finden sich ferner Beiträge zur Genealogie
und Familiengeschichte unserer Adelsgeschlechter,
namentlich eine Biographie der Katharine Hahn,
Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,
so wie einzelne Nachrichten über die Familien v.
Platen und v. Bevernest, v. Schönaich u. a. - Einen
werthvollen Beitrag zur Geschichte der Kunst in
Meklenburg liefert sodann Herr Wiechmann auf Kadow
durch eine sehr fleißige Sammlung aller Nachrichten
über die meklenburgischen Formschneider des 16.
Jahrhunderts, wogegen die Mittheilung von Fragmenten
niedersächsischer Andachtsbücher von Herrn C. D. W.
und Archiv=Rath Lisch, so wie die Nachweisung und
Besprechung der verschiedenen Ausgaben eines
plattdeutschen Wörterbuchs von Nathan Chytraeus
durch Lisch, und des sogenannten Cisiojanus durch
Wiechmann=Kadow interessante Bereicherungen der
Literaturgeschichte des Mittelalters liefern. - Die
Freunde der Kulturgeschichte Norddeutschlands werden
den Herrn Archiv=
und seiner Gemahlin Katharina, der
Herzogin Sophie, Gemahlin Magnus II., des Herzogs
Johann I. von Meklenburg=Stargard und seiner
Gemahlinnen, des Herzogs Rudolf von
Meklenburg=Stargard, Bischofs zu Schwerin, und des
Herzogs Ulrich I. und seiner Söhne, so wie des
Fürsten Barnim von Werle. - Von demselben Herrn
Verfasser finden sich ferner Beiträge zur Genealogie
und Familiengeschichte unserer Adelsgeschlechter,
namentlich eine Biographie der Katharine Hahn,
Gemahlin des Herzogs Ulrich, Prinzen von Dänemark,
so wie einzelne Nachrichten über die Familien v.
Platen und v. Bevernest, v. Schönaich u. a. - Einen
werthvollen Beitrag zur Geschichte der Kunst in
Meklenburg liefert sodann Herr Wiechmann auf Kadow
durch eine sehr fleißige Sammlung aller Nachrichten
über die meklenburgischen Formschneider des 16.
Jahrhunderts, wogegen die Mittheilung von Fragmenten
niedersächsischer Andachtsbücher von Herrn C. D. W.
und Archiv=Rath Lisch, so wie die Nachweisung und
Besprechung der verschiedenen Ausgaben eines
plattdeutschen Wörterbuchs von Nathan Chytraeus
durch Lisch, und des sogenannten Cisiojanus durch
Wiechmann=Kadow interessante Bereicherungen der
Literaturgeschichte des Mittelalters liefern. - Die
Freunde der Kulturgeschichte Norddeutschlands werden
den Herrn Archiv=


|
Seite 10 |




|
Rath Lisch und Professor Dr. Deecke 1 ) zu Lübeck besonders für die lehrreiche Besprechung des berühmten Lübecker Martensmannes, so wie für verschiedene kürzere Mittheilungen in den Miscellen dankbar sein. Diese letztere Rubrik ist überhaupt dies Mal sehr reich ausgestattet, namentlich auch mit Beiträgen zur Rechtsgeschichte, Topographie, Baukunst u. s. w. - Auch die Jahrbücher für Alterthumskunde bringen außer dem Berichte über die gefundenen Alterthümer auch eine Reihe größerer, Abhandlungen zur Baukunde, Münzkunde und Kunstgeschichte. - Die Urkunden=Sammlung endlich veröffentlicht wieder nicht weniger als 50 bisher ungedruckter oder sehr Schwer zugänglicher Urkunden zur Geschichte Meklenburgs.
Ueber den Gesammtverein erlaube ich mir aus dem ausführlichen Geschäftsberichte des Verwaltungsausschusses von 1856/57 folgendes mitzutheilen:
Die Zahl der verbundenen Vereine ist durch den Beitritt der Vereine zu Wittenberg, Augsburg und Basel auf 53 gestiegen. Die Einnahme betrug in dem bezeichneten Jahr 677 Thlr. 3 Gr., worunter der Erlös aus dem Correspondenzblatte 382 Thlr. und das Entréegeld zur General=Versammlung zu Hildesheim und Hannover im J. 1856: 275 Thlr.; die Ausgabe dagegen 638 Thlr., so daß der disponible Vorrath von 196 Thlr. aus 235 Thlr. angewachsen ist, wozu noch ein von Sr. Maj. dem Könige von Sachsen zur Fördederung der Gaubeschreibungen Deutschlands bestimmtes Capital von 100 Thlr. kommt.
Die durch den Verein angeregten und beförderten gemeinsamen Unternehmungen beschränken sich im Wesentlichen noch immer auf die Erforschung des limes imperii romani und die Beschreibung der Gaue Deutschlands. In ersterer Beziehung sind über die Ausdehnung dieser merkwürdigen Gränzwälle ganz neue Resultate gewonnen, und die mit diesen Untersuchungen in Verbindung stehenden Ausgrabungen, namentlich auf der Saalburg, einem römischen Gränz=Castelle, haben gleichfalls zu höchst interessanten Entdeckungen geführt, worüber in dem Correspondenzblatte ausführliche Mittheilungen gemacht werden. - Der Commission für die wichtige Gaugeographie ist neuerdings der Oberbibliothekar Dr. Stälin zu Stuttgart beigetreten. Außer der Beschreibung des Gaues


|
Seite 11 |




|
Wettereiba hat der Herr Archivar Landau zu Cassel nun auch die Beschreibung des Hessengaues vollendet, und von Herrn Staats=R. Wippermann ist die Beschreibung des Bukki=Gaues soweit gefördert, daß die Vollendung der Arbeit auch nach inzwischen erfolgtem Tode des Verfassers gesichert erscheint. Zur rascheren Förderung des ganzen Unternehmens haben sich übrigens die verbundenen Vereine, oder vielmehr jeder einzelne derselben, für die Zukunft verpflichtet von allen durch die niedergesetzte Commission genehmigten Beschreibungen solcher Gaue, welche innerhalb ihrer respectiven Forschungsbereiche liegen, zu einem ermäßigten Preise iu hinreichender Anzahl anzukaufen, um dieselbe demnächst anstatt der sonst üblichen Publicationen des betreffenden Vereines ausgeben zu können. Es dürfte sehr wünschenswerth sein, wenn wir bald in die Lage kämen, diese Verpflichtung erfüllen, oder vielmehr den gebotenen Vortheil genießen zu können.
Zur Vermehrung der Geldmittel des Gesammtvereins überhaupt ward auf der letzten General=Versammlung zu Augsburg am 15. Sept. 1857 beschlossen, daß jeder der verbundenen Vereine künftig 5 Exemplare des Correspondenzblattes beziehen, und außerdem einen freiwilligen Beitrag von 5 Thlr. baar zu der gemeinschaftlichen Casse zahlen wolle, ein Beschluß welcher demnächst auch von der General=Versammlung unsers Special=Vereines vorläufig auf 2 Jahre genehmigt ist.
Aus den sonstigen Verhandlungen der Versammlung mache ich nur auf ein unsern Verein näher angehendes Curiosum aufmerksam. Durch Herrn Conservator Lindenschmit aus Mainz ward nämlich die schon auf der General=Versammlung zu Hildesheim im Jahre 1856 durch den Herrn v. Estorff angeregte Debatte über die bronzenen Kronen unserer Sammlung, welche Herr Archiv=Rath Lisch daselbst vorgezeigt hatte, nochmals aufgenommen, und wiederholt die Ansicht vertheidigt, daß diese Alterthümer ganz irrig für Kronen ausgegeben würden, während dieselben vielmehr Halsringe für Verbrecher oder noch wahrscheinlicher für Hunde seien! Man muß gestehen, wenn in einer solchen Versammlung solche Urtheile möglich sind, so kann man dem Publicum das allgemein verbreitete Mißtrauen gegen das Treiben der "Alterthümler" nicht verargen. Herr Archiv=Rath Lisch hat sich übrigens, was nicht leicht gewesen sein mag, überwunden, unsere Alterthümer in Nr. 4 des Correspondenzblattes vom Jahre 1858 ernst und ohne allen Spott zu vertheidigen und kann der Zustimmung jedes Unbefangenen gewiß sein; wenn er aber einmal die Möglichkeit eines Zweifels voraussetzte, so


|
Seite 12 |




|
wäre es gewiß gut gewesen, durch Angabe des genauen Maaßes ad oculos zu demonstriren, daß die Anlegung dieser Kronen um den Hals auch eines Hundes, wenn man sich nicht das Schooßhündchen einer Gnädigen der Urwälder vorstellt, physisch unmöglich ist.
Die Geschäftsverwaltung hat auf den dringenden Wunsch der Versammlung der niedersächsische Verein zu Hannover noch auf ein Jahr übernommen. Die nächste General=Versammlung wird im Herbste dieses Jahres zu Berlin gehalten werden.
Schwerin, im Juli 1858.
W. G. Beyer, Dr.,
Archiv=Secretair, als zweiter
Secretair des Vereins.


|
Seite 13 |




|
Anlage A.
Auszug
aus der Berechnung der Vereins=Casse vom
1. Juli 1857 bis 30. Juni 1858.
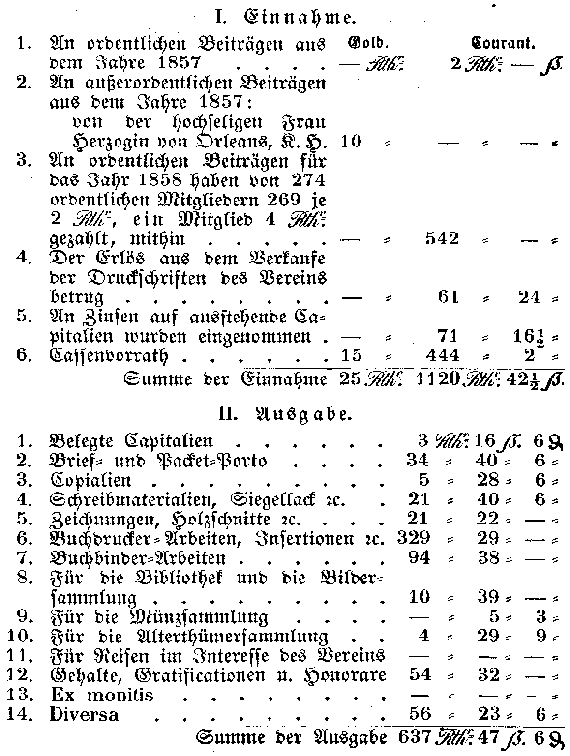


|
Seite 14 |




|
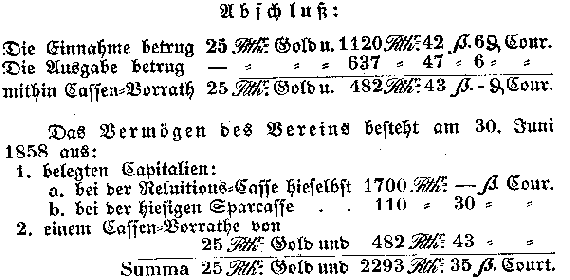
Schwerin, den 30. Juni 1858.
F. Wedemeier, Dr.,
Ministerial=Registrator,
p. t. Cassen=Berechner.


|
Seite 15 |




|
Anlage B.
Verzeichniß
der in dem Vereinsjahre von Ostern 1857
bis dahin 1858 erworbenen Alterthümer.
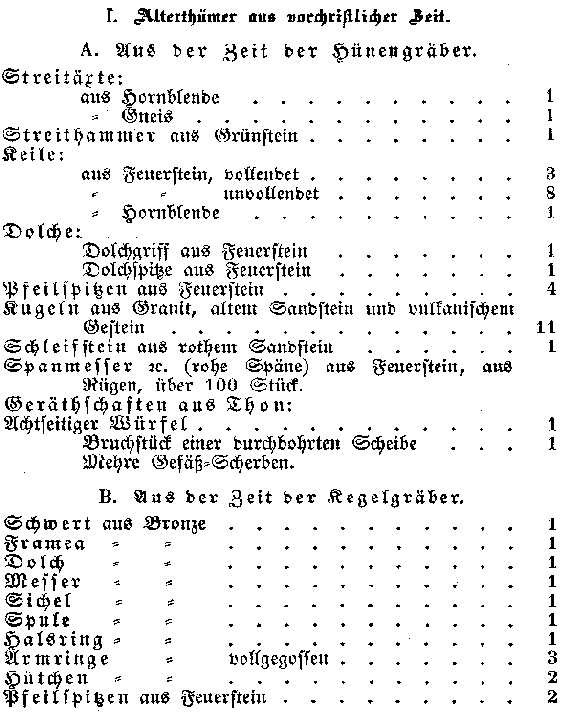


|
Seite 16 |




|
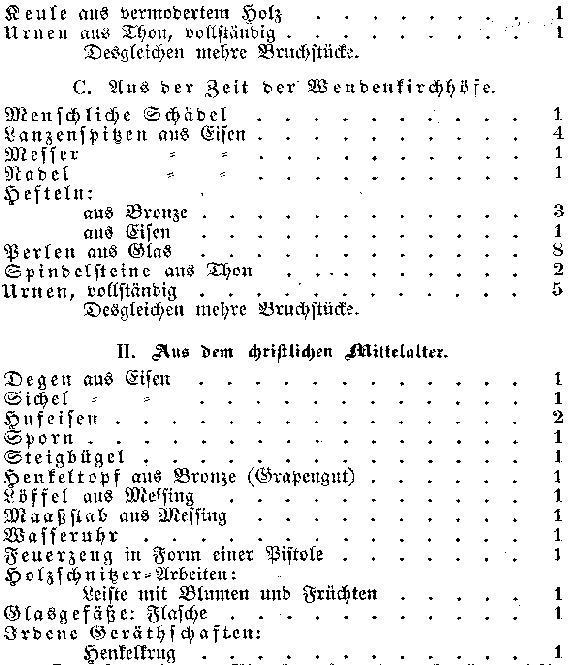
Der Zuwachs der Alterthumssammlung beträgt mithin im Ganzen 53 Stück, nämlich 35 aus der Zeit der Hünengräber, 16 aus der Zeit der Kegelgräber, 26 aus der Zeit der Wenden=Kirchhöfe und 17 aus dem christlichen Mittelalter. Die genauere Beschreibung dieser Alterthümer, mit Angabe des Fundortes und des Gebers findet sich bereits vollständig in den diesjährigen Jahrbüchern, S. 273 - 299.
W. G. Beyer.


|
Seite 17 |




|
Anlage C.
Bericht über die Münzsammlung.
Zur Münzsammlung sind im verflossen Geschäftsjahre 126 Stück gekommen, nämlich 87 silberne, 37 kupferne Münzen und 2 Schaustücke, mit Ausnahme eines einzigen Stückes, Geschenke der Freunde des Vereins.
Die bedeutendste Vermehrung seit langer Zeit erhielt die Sammlung durch den Münzfund von Boeck, welche der Herr Landrath Baron Le Fort zur Verfügung stellte. Es ist über denselben Jahrb. XXIII S. 358 ff. ausführlich Nachricht gegeben und es sind 62 Stück ausgewählt worden. - Aus einem Funde zu Sehlstorf, Klosteramts Dobbertin, übersandte Herr Klosterhauptmann Freiherr v. Maltzan 7 Wittenpfennige; sie gehören den Städten Rostock, Parchim und Stralsund an, und fallen zum Theil in die Zeit vor 1381, wo das Sterngeld aufkam, theils was Stralsund betrifft in die Zeit nach 1403, wo die Städte beschlossen, auf beide Seiten das Stadtzeichen zu setzen. Eine neue Erwerbung darunter für unsere Sammlung war der Rostocker Wittenpfennig welcher den Schild mit den Balken zeigt (Evers II. S. 394. 7. Abhandl. von der Stadt Rostock Gerechtsame Anl. XXI. N. 8). Zwar läßt sich aus dem Zusammenhange mit den übrigen Münzen nicht mit Bestimmtheit das Jahr dieser Präge, die ganz einzeln dasteht, angeben, es ist wohl wahrscheinlich, daß man sie in eine Uebergangsperiode vom Sterngelde bis zu dem Greifen auf beiden Seiten (1403) stellen muß. - Zwei antike Münzen wurden geschenkt: eine Kupfermünze des Kaiser Domitian durch Herrn Dr. Hüen in Marlow war bei Neubuckow gefunden; um des Kaisers Brustbild steht die Umschrift IMP CAES DOMIT AVG GERM XV CENS PERP, und auf der Rückseite zwischen S C eine weibliche Figur mit einem Füllhorn (nach Molan=Bohm. S. 229 N. 14 ist die hier unleserliche Umschrift moneta augusti). Die zweite, eine Silbermünze, ist eine Thurische mit dem Stier und ward vom Herrn Gymnasiasten Sellin geschenkt. - An Currentmünzen erhielt die Sammlung durch Herrn Geheimenrath v. Plessen Exc. einen Braunschweig=Lüneburgischen Thaler des Herzogs Johann Friedrich von 1669 (v. Madai II 3688). Herr v. Kardorff auf Remlin ist auch noch dies Jahr als Vermehrer der Sammlung zu


|
Seite 18 |




|
nennen, wie er denn ja auch kein Jahr hingehen ließ, ohne ihr seine Theilnahme thätig zu beweisen; sie erhieltals letzte Gabe von ihm einen ungarischen Thaler des Kaisers Rudolph von 1583 (v. Schultheß=Rechberg I N. 2402), einen spanischen Piaster von 1597 (das. N. 2280) und Münzen von Hamburg, Dänemark und Schweden. - Die übrigen Geber sind die Herren Ritter in Friedrichshöhe, Schulrath Lorenz in Schwerin, Bürgermeister Daniel in Schwaan, Kaufmann Greffrath in Goldberg, Sriftsetzer Wollbrandt in Schwerin, Seidel und Stein in Bützow, Advocat Wehnert in Crivitz.
Die beiden Schaumünzen sind die auf den Cölner Dombau 1842 vom Herrn Geheimenrath v. Oertzen und die Begräbnißmünze (Bürgermeisterpfenning) des Hamburgischen Bürgermeisters Martin Gottlieb Sillem von 1835 (Gaedeckens Hamb. Münz. I S.73 N. 23) von einem Ungenannten durch Fräul. A. Buchheim geschenkt.
Es hat dies Jahr freilich mehr gebracht, als manches frühere, aber es bleiben doch noch wohlbegründete Wünsche für die Vermehrung dieses Theils der Vereinssammlungen übrig, deren Erfüllung den Mitgliedern des Vereins hiemit ans Herz gelegt sein möge.
G. M. C. Masch.


|
Seite 19 |




|
Anlage D.
Bericht über die Bildersammlung.
Der Bestand der Bildersammlung umfaßte am Schlusse
des Vereinsjahres 1856/57 bereits 716 Blätter. Von
diesen waren 392 Bl. Portraits, 324 Bl. Prospecte,
Architekturen, Denkmäler
 Der Zuwachs des Jahres 1856/57 betrug
nur 6 Bildnisse, 6 Costümbilder, und 11. Bl. der
übrigen Abtheilungen, mithin im Ganzen 23 Bl.,
welche in dem angeführten Bestande von 716 Bl.
eingeschlossen sind.
Der Zuwachs des Jahres 1856/57 betrug
nur 6 Bildnisse, 6 Costümbilder, und 11. Bl. der
übrigen Abtheilungen, mithin im Ganzen 23 Bl.,
welche in dem angeführten Bestande von 716 Bl.
eingeschlossen sind.
Die im Laufe des J. 1857/58 Gemachten neuen Erwerbungen sind zahlreicher als im Vorjahre und namentlich für das Portraitfach nicht ohne Interesse, wie aus dem nachfolgenden Verzeichnisse erhellt. Dasselbe folgt der Ordnung der eingeführten Abtheilungen und kann als Fortsetzung des Katalogs gelten.
Neu angelegt sind die beiden Fächer: "Abbildungen von Thieren", und; "Wappen und Siegel", welche letztere im nächsten Jahresberichte verzeichnet werden sollen.
I. Bildnisse.
A. Meklenburg. Fürstenhaus und fürstliche Personen von meklenburg. Beziehungen.
Heinrich der Löwe, Hz. von Sachsen. Gez. und lith. von M. Knäbig. Fl.
Wallenstein, Hz. von Friedland
 nach van Dyk. Lith. 4.
nach van Dyk. Lith. 4.
Derselbe. Nach dem Fresko=Gem. im Schlosse zu Weimar. Kpf. 4.
Derselbe. Gleichzeitiger Kpf. 8.
"Sophia Ludovica, Regina Prussiae. Ducissa Megapol." In ganzer Figur, auf einer Garten=Terrasse, ein Gemälde betrachtend, mit der Linken die Schleppe haltend. Kpf. Von J. C. Weigel. Fl.
Louise, Königin von Preußen. Stahlstich. Naumburgs Kunstanstalt in Leipzg. 4.
Alexandrine, Prinzessin von Preußen. Gem. von Grahl, gest. v. L. Meyer. 8.


|
Seite 20 |




|
B. Staatsbeamte und Celebritäten.
Ulrich v. Hutten. Drei Ausgaben: in Holrzschnitt; Stör sc. Gottschick sc. 8.
Hugo Grotius. Kpf. nach W. de Broen. 4.
Derselbe. Kpf. 4.
Dr. Wolfgang v. Ketwigk, Kurbrandenbg. Canzler, im J. 1530 Canzler des Hz. Albrecht VII. von Meklenburg; gest. 1541. Kpf. 4.
Joh. Caspar Reichsgraf v. Bothmar, Großbritannischer und Kurhannoverscher Pr.=Minister; 1713 in den Grafenstand erhoben, erwirbt 1723 von J. L. v. Plessen die Arpshagenschen Güter, stiftet 1725 die Grafschaft Bothmar durch Familien=Fideicommiß und läßt um 1728 - 1732 das Schloß Bothmar durch den Baumeister Künneke erbauen; gest. 6. Febr. 1733. - Kpf. 8. - -
Matthias Johann Graf v. d. Schulenburg, Venetian.
Feldmarschall; auf Gr. Krankow, Petersdorf,
Köchelstorf
 stiftet 1744 und 1746 von Verona aus,
das v. d. Schulenburgsche Familien=Fideicommiß. Gem.
von Rusca, gest von Pitteri. R.=Fl.
stiftet 1744 und 1746 von Verona aus,
das v. d. Schulenburgsche Familien=Fideicommiß. Gem.
von Rusca, gest von Pitteri. R.=Fl.
Joh. Hartwig Ernst Graf von Bernstorf, dänischer Staatsminister, geb. 1712 zu Hannover, gest.1772 zu Hamburg. Kpf. von Wachsmann. 4. (Aus der Schumannschen Portrait=Sammlung.)
Andreas Peter Graf v. Bernstorf, dänischer Staatsminister , geb. 1735 zu Gartow, gest. 1797 zu Kopenhagen. Silhouette. Gleichz. Kpf. 8.
Ritter J. Taylor, englischer Augenarzt; behandelte den Herzog Christian Ludwig II; gest. von A. Reinhardt, 1750. 8.
Baron R. v. Ditmar, meklenbg. Geh. Rath und Vice=Canzler, Stifter der Freimaurerei in M. Lith. 8. (Aus dem Kalender für die Provinzial=Loge v. M.) - J. H. v. Schroeder, Canzlei=Vice=Director. Lith. 8. (Aus dem Kalender.) - Baron v. Nettelbladt, Ober=Appellations=Rath. Lith. 8. (Aus dem Kalender.)
Joh. Eustach v. Schlitz, .Graf v. Görtz, Preußischer Staatsminister, geb, 1737, gest. 1821. D. Berger sc. 1790. 8. (Aus der Berliner Monatsschrift. Jahrg. 1791.)
(Ohne Schrift:) C. v. d. Lühe zu Wien. Büste "Kininger del. John. Sc." (Vermuthlich von der Linie Schulenberg und aus der dänischen branche stammend. -


|
Seite 21 |




|
Im J. 1803 erschien zu Wien das Werk: "An Flora und Ceres. Mit 2 Portraits vom Freiherrn C. v. d. Lühe." - Am 9. März 1801 war zu Wien ein Varon C. v. d. Lühe gestorben, der Kaiserl. Kämmerer und Nieder=Oesterreichischer Regier.=Rath gewesen.)
F. L. Jahn, "Der Turnvater", lebte in jüngern Jahren eine Zeit lang in Meklenburg. Lith. von Brandt. 4.
H. Zschokke, lebte 1788 flg. als Hauslehrer zu Schwerin. Lith. 4.
K. Nauwerck, Abgeordneter zur National=Versammlung, 1849. Lith. nach Biows Lichtbild von Schertle. Fl. -Th. V. Scheve, Canzleidirector in Neustretitz, auf Cantzow, gest. 1853. Gez. von Wiese, lith. von Rohrbach. Fl.
C. Militärs.
Ulrich Otto.v. Dewitz, aus dem Hause Milzow, Dänischer Gener.=Lieutenant von der Cavallerie, flor. um 1700. Kpf. 8.
Curdt Chr. V. Schwerin, Preuß. Gener.=Wachtmeister. Kpf. 8.
Major Schill. Lith. G. Küstner. 4. Derselbe. Halbe Figur, beide Hände am Degen. Kpf, 4. (Ohne alle Schrift.)
Gebh. Lebrecht v. Blücher, Preuß. Gener.=Feldmarschall; in ganzer Figur, die Rechte auf den Degen gestützt; Kpf. Wien. Kl. Fl. Derselbe als Fürst Blücher. Bollinger fec. 1819. 4.
Schwedische Feldherren, welche in Meklenburg gefochten haben: Joh. Bannier, Feldmarschall. Kpf. 8. Carl Gustav Wrangel, Feldmarschall. Kpf. 4. Leonhard Torstensohn, F.=M. 4. Graf Magnus v. Stenbock, F.=M. Kpf. 8.
D. Gelehrte.
L. Bacmeister, Superintendent zu Rostock. Gest von C. F. Fritzsch. 1737. 4. H. Hamelmann, Theol. gest 1595. Ganze Figur. Kpf. 4. Jacob Coler, Theol., gest. 1612. Kpf. 8. Heinrich Müller, Theol. Kpf. 8. Joh. Lassenius, Theol. (als meklenburg. Schriftsteller). Kpf. 8. G. Raphel, Superintendent zu Lüneburg. (Desgl.) Kpf. .8. Joh. Rist, Theol., meklenburg. Rath. Kpf. 8. Imman. V. Essen, Ober=Pastor zu Riga. (Aus Meklenburg stammend.) Gem.von Becker, gest. Fritzsch. 1763. 8.


|
Seite 22 |




|
A. Balthasar, Professor der Rechte zu Greifswald. (Als meklenburg. Schriftsteller.) Gest. von Syfang. 4. D. J. C. Doederlein, Prof. der Theol. Geb. 1746, gest. 1792. (Desgl.) Schmidt sc. 12. C. Riedel, Univers.=Secretair in Göttingen, geb. um 1780 zu Demen in Meklenburg. Phot. 4. F. C. L. Karsten, Prof. zu Rostock. Lith. 8.
E. Künstler.
L. Ch. Sturm, Mathematiker, Meklenbg. Baudirector. Kpf. 4.
Conrad Ekhof. Lith. 8. K. Doebbelin. Gest. von Geyser. 12.
L. Gabillon, aus Güstrow, SchauspieIer am K. Burgtheater zu Wien. Handz. von Havemann. 4.
II. Prospecte und Architekturen.
Zwei Prospecte der Stadt Rostock. (Aus Zecheri Saxonia inferior.) O.=Fl.
Zwei Ansichten der Kirche zu Kraak; a, von der Altarseite; b. von der Westseite. Handz. von Element. 2 Bl. Fl. Situationsplan von Kraak. Desgl. R.=Fl.
Ansicht der steinernen Brücke im Park zu Ludwigslust. Gem. in Aquarell von Herzog Ad. Friedrich, um 1810. Kl.=Fl.
Grundriß des Parterre und der beiden Ranglogen des Hoftheaters zu Schwerin. Lith. von A. Achilles. 1836. Fl.
III. Abbildungen von meklenburg. Thieren.
Rockingham, Vollbluthengst im Hauptgestüte zu Redefin. Gez. und lith. von G. Rückert. Qu.=Fl.
Rambouillet=Stammbock zu Rentzow, Lith. Qu.=Fl.
Nach vorstehender Uebersicht beträgt die im verflossenen Jahre gewonnene Erweiterung der Sammlung an Bildnissen 53 Bl., an Architekturen und Prospecten 7, Abbildungen von Thieren 2 Bl.; mithin im Ganzen 62 Bl. Demgemäß stellt sich der Bestand der Sammlung am 12. Juli 1858 auf 778 Bl., von denen 445 dem Portraitfache angehören. Im April 1853, da ich die Bildersammlung übernahm, enthielt sie im Ganzen


|
Seite 23 |




|
nur 226 Blätter. Außer einem in Leipzig gemachten Ankaufe, bestehen diese neuen Erwerbungen nur in Geschenken. Namentlich ist der Verein dem Herrn Dr. Siemßchen zu Rostock zum Dank verpflichtet, welcher etwa 50 Stück Portraits schenkte, deren Mehrzahl freilich schon in unserm Besitze befindlich war, von denen doch auch manche Bl. für die Sammlung neu erschienen und andere zur Ersetzung defecter Exemplare dienten.
Schwerin, im Juli 1858.
A. Gloeckler.


|
Seite 24 |




|
Anlage E.
Bericht über die Autographen=Sammlung.
Neu angelegt ist die Sammlung meklenburgischer Autographen. Dieselbe wird sich theils der Bildersammlung anschließen, theils auch dem Inhalte nach interessante handschriftliche Denkmäler von Meklenburgern als solche berücksichtigen.
Der anfängliche Bestand der im Besitze des Vereins befindlichen Autographen ist gleich der ersten Grundlage der Bildersammlung ein Geschenk aus dem Nachlasse des verdienten fleißigen Sammlers Magisters Siemßen zu Rostock, aus etwa 30 brauchbaren Stücken bestehend. Im Laufe der Zeit habe ich aus älteren und neueren Schriftstücken, welche größten Theils zur Vernichtung bestimmten Acten angehörten, ungefähr 160 Stück Autographen asservirt, so daß die Sammlung nunmehr auf etwa 200 Blätter angewachsen ist.
Zu diesem Bestande sind im Laufe des letzten Vereinsjahres ferner erworben:
24 Briefe neuerer meklenburgischer Gelehrten, geschenkt vom Herrn Gymnasial=Director Dr. Wex; 8 Schriftstücke von meklenburg. Celebritäten, meist aus der Zeit um 1800, geschenkt vom Herrn E. v. Kamptz; 2 Desgl. geschenkt vom Herrn Oberlandforstmeister Eggerss a. D.
Ferner: ein Schreiben des Fürsten Blücher vom J. 1817, aus dem Besitze der verwandten Familie v. Conring der Sammlung zugewandt vom Herrn v. Conring zu Doberan. - "Die Meklenburger. Ein Prolog mit Gesang zur Feier des Geburtstages des Herzogs Friedrich Franz von C. G. H. Aresto. Herzogenbusch, 1789." Ein und einhalb Bogen in 8.; Handschrift des Verf. Geschenkt vom Herrn Archivrath Groth. - Ein literar. Brief des kürzlich verstorbenen Schriftstellers Advocaten Raabe zu Wismar vom J. 1854, geschenkt vom Herrn Archiv=Secretär Dr. Beyer. - Eine Stammbuchschrift des Rectors Georg Sched zu Güstrow vom J. 1639, und eine Dedication des Majors im Kriegsministerium in Berlin K. G. v. Rudloff (eines Sohnes des meklenburg=schwerinschen Regierungsrathes und Geschichtsschreibers) vom J. 1826, geschenkt vom Unterschriebenen.
Schwerin, im Juli 1858.
A. Gloeckler.


|
Seite 25 |




|
Anlage F.
Verzeichniß
der im Vereins=Jahr 1857/58 erworbenen
Bücher,
wissenschaftlich geordnet.
I. Europa außer Deutschland.
a. Nordische Geschichte und Alterthümer.
Nr.
- 2. Annaler for Nordisk Oldkyndighed og Historie, udg. af d. Kongelige Nordisk Oldskrift-Selskab. Kjöbenhavn 1854, 1855. 2 Bde. 8.
- 4. Antiquarisk Tidsskrift, udg. af d. Kong. Nord. Oldskrift-Selskab. 1852 - 54. 1855 - 57. 2 Bde. 8.
- Antiquités de l'Orient, monum. runographiques, interpr. par C. C. Rafn. et publ. par la Soc. Roy. des Antiquaires du Nord. Copenhagen 1856. 8.
- C. C. Rafn, Ucené zprávy, O kamene runském, na památku Bodritské Knezny v Dansku postavaném. - Vytah z prjednáni: Bemaerkninger om en runesteen i Danmark over en Obodritisk fyrstinde. Af C. C. Rafn. (Antiq. Tidsskrift 1852 - 54.) Prag. 8.
-
Atlas de l'archéologie du Nord représentant des
échantillons de l'âge de bronze et de l'âge de
fer, publié par la société royale des
Antiquaires du Nord, Copenhague. 1857.
fol.
(Nr. 1 - 7 Geschenke der Gesellschaft zu Kopenhagen.) -
a. Thomae Bartholini de armillis veterum,
praesertim Danorum schedion. Acc. Olai Wormii de
aureo cornu ad F. Licetum responsio. Hafniae
1647. 8.
b. BarLt. Bartholini comment. de paenula. Acc. H. Ernstii eiusd. Argum. Epistola. Ed. II. Hafniae 1670.
c. Thomae Bartholini de bibliothecae incendio diss. Hafn. 1670.


|
Seite 26 |




|
d. Eiusdem de medicis poetis dissertatio. Hafn. 1669.
e. Eiusdem Carmina varii argumenti. Hafn. 1669. (Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar.)
b. Rußland.
- 10. Description du Musée de feu le prince B. Kotschoubey par B. de Koehne. St. Petersburg 1857. Vol. I. II. 4. (Geschenk der verwittweten Fürstin Helena Kotschoubey.)
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands. 8. Bd. 3. Heft. (Geschenk des Vereins zu Riga.)
- v. Bunge und Paucker: Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands. Bd. VIII. H. 1. Reval 1856. 8.
- Das esthländische Landraths=Collegium und Oberlandgericht. Ein rechtsgeschichtliches Bild. Reval 1855. 8.
-
J. Paucker: Die Regenten, Oberbefehlshaber und
Oberbeamten Esthlands. I. Regenten und
Oberbeamten Esthlands zur Zeit der
Dänenherrschaft. Reval 1855. 8.
(Nr. 12 - 14 Geschenke der Esthländischen Gesellschaft zu Reval.) - Verhandlungen der gelehrten Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat 1857. (Kalewipoep, eine Esthnische Sage, verdeutscht von Carl Reinthal. 1. Lieferung.) 8.
- Die Civil= und Militär=Oberbefehlshaber in Esthland zur Zeit der Kaiserlich Russischen Regierung von 1704 - 1855. Dorpat 1855. 8. (Nr. 15 und 16 Geschenke der gel. Esthn. Gesellschaft zu Dorpat.)
c. Außerdeutsches Oesterreich.
(s. auch Nr. 55.)
- Arkiv za Povjestnicu Jugoslavensku. Kn. IV. 8. Agram 1857. (Geschenk des hist. Vereins zu Agram.)
- Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. 1854 - 57. 2 Hefte. 8.
- 20. Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge. 2. Bd. 2. Heft. Kronstadt 1856. II. Bd. 3. Heft. 1857. III. Bd. 1. Heft. 1858. 8.
-
A. Bielz: Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens,
Hermannstadt 1856. 8.
(Nr. 18 - 21. Geschenke des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde zu Hermannstadt.)


|
Seite 27 |




|
d. Belgien und Holland.
- Annales de l'acad. d'archéologie Belgique. IV. 3. 4. Anvers 1857. 8.
- N. J. van der Heyden: Notice sur la très-ancienne noble maison de Kerckhove, dite van der Varent, et sur son représentant actuel M. le Vicomte Joseph-Romain-Louis de Kerckhove-Varent. Anvers 1856. 8. (Nr. 22. 23 Geschenke der archäologischen Akademie Belgiens zu Antwerpen.)
- 25. Annales de la Societé Archéologique de Namur. T. IV. Liv. 3. 4. T. V. Liv. 1. Namur 1856 - 58. 8.
-
Rapport sur la situation de la Société
Archéologique de Namur, en 1856. 8.
(Nr. 24 - 26 Geschenke der Gesellschaft.) - Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg. Année 1856. XII. Luxembourg 1857. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
- 29. De frije Fries. VII. (Nieuwe Serie I.) 1 - 4 Stück. VIII. (Nieuwe Reeks II.) 1. Leeuwarden 1854 - 57. 8.
-
Sicco van Goslinga: Memoires relatifs à la
Guerre de Succession de 1706 - 9 et 1711, publ.
par Evertz et Delprat. Leeuwarden 1857.
8.
(Nr. 28 - 30 Geschenke der Friesch Genootschap.)
c. Schweiz.
- W. Wackernagel: Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Basel. Nebst einigen Schriftstücken aus derselben. Basel 1857. 4.
- Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgeg. von der histor. Gesellschaft zu Basel. 6. Bd. Basel 1857.
-
Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländ.
Alterthümer in Basel. VII. (W. Wackernagel: Die
goldene Altartafel von Basel.) Basel 1857.
4.
(Nr. 31 - 33 Geschenke der Gesellschaft zu Basel.) - F. Keller: Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen. (Mittheilungen der Antiquar. Gesellschaft in Zürich. IX. II. 3.) Zürich 1854. gr. 4.
- Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft (für vaterländ. Alterthümer) in Zürich. XXI. Geschichte der Abtei Zürich. IV. Heft. Mit einer Innenansicht der Abteikirche und einem Facsimile des Stiftungsbriefes vom 21. Juli 853. Zürich 1857. 4.


|
Seite 28 |




|
-
Zwölfter Bericht über die Verrichtungen der
antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Vom 1.
Novbr. 1855 bis 1. Novbr. 1856. 4.
(Nr. 34 - 36 Gesch. der antiquar. Gesellsch. in Zürich.)
II. Deutschland außer Meklenburg.
a. Allgemeines.
- - 39. C. V. Grupen. Origines Germaniae oder das älteste Teutschland unter den Römern, Franken und Sachsen. Lemgo 1764 - 68. 3 Bde. 4. (Geschenk des Hrn. Stadtrichters Genzken zu Alt=Strelitz.)
- Ebeling: Uebersicht der deutschen Verfassungsgeschichte. I. Merowinger und Karolinger. Schwerin 1857. 4. (Gymnasial=Programm. - Geschenk des Hrn. Directors Wex.)
- - 46. Correspondenz=Blatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. Jahrg. 1 - 3. Herausgeg. von Löwe. Dresden 1853 - 55. Jahrg. 4 und 5. Herausgeg. von Grotefend. Hannover 1856 - 57. 4. Jahrg. 5 in 2 Exempl.)
- von u. zu Aufsess: System der deutschen Geschichte und Alterthumskunde. Nürnberg 1853. 4.
- Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. Organ des German. Museums, IV. Bd. Jahrg. 1857. Nürnberg. 4.
-
50. Dritter und vierter Jahresbericht des
Germanischen National=Museums zu Nürnberg, von
Anfang Septbr. 1855 bis 1. Octbr.
[Setzfehler]1656 und vom 1. Octbr. 1856 bis Ende
1857. Nürnberg 1856, 1857. 4.
(Nr. 47 - 50 Geschenke des Germanischen National=Museums zu Nürnberg.)
- Jahresbericht des Römisch=Germanischen Central=Museums zu Mainz. 1857. (Geschenk des Central=Museums.)
b. Oesterreich.
- Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale in Oesterreich. Herausgegeben von v. Czörning und Karl Weiss. II. Jahrg. 1857. Wien 1857. (12 Monatshefte.) 4. (Geschenk der Centralcommission.)
- Monumenta Habsburgica. Abth. II. Actenstücke etc. zur Geschichte Kaiser Karl V. mitgetheilt von Dr. K. Lanz. Einleitung zu Bd. 1. Wien 1857. 8.


|
Seite 29 |




|
- Fontes rerum Austriacarum. II. Abth. X. Bd. Urkundenbuch des Stifts Klosterneuburg. Bearbeitet von Dr. H. Zeibig. I. Theil. Wien 1857. 8.
- Fontes rerum Austriac. II. Abth. XIII. Bd. Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte Venedigs. II. Theil. (1205 - 1255.) Herausgeg. von Dr. G. L. F. Tafel und Dr. G. M. Thomas. Wien 1856. 8.
- 57. Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Bd. XVII., 1, 2. XVIII., 1. Wien 1856, 1857. 3 Hefte. 8.
-
59. Sitzungsberichte der kais. Academie der
Wissenschaften. Phil.-histor. Classe. Bd. Bd.
XXI. H. 3. (Jahrg. 1856. Oct.) Bd. XXII. H. 1,
2. (Jahrg, 1856. Nov. Decbr.) Wien 1857. 3
Hefte. 8.
(Nr. 53 - 59 Geschenke der kaiserl. Akademie.)
- Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark, 7. Heft Gratz 1857.
- Achter Jahresbericht des hist. Vereins für Steiermark. 1857.
-
Bericht über die 8. allgemeine Versammlung des
histor. Vereins für Steiermark. 1857.
(Nr. 60 - 62 Geschenke des Vereins.) - Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 12. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Ems. Linz 1857. 8. (Geschenk des Museums.)
c. Bayern.
- 65. Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Herausg. von dem histor. Verein von und für Oberbayern. 16. Bd. 3. Heft. 17. Bd. 1. 2. Heft. München 1857.
-
19. Jahresbericht des histor. Vereins von und
für Oberbayern für das Jahr 1856. München 1857.
8.
(Nr. 64 - 66 Geschenke des Vereins.) - Verhandlungen des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. XVIII. (X. der neuen Folge.) Regensburg 1857. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Herausg. von E. C. v. Hagen. VII. 1. Bayreuth 1857. 8. (Gesch. des histor. Vereins zu Bayeuth.)
- Monumenta Zollerana. Urkundenbuch zur Gesch. des Hauses Hohenzollern. Herausg. von v. Stillfried


|
Seite 30 |




|
u. Märker. Bd. III. (Urk. der fränk. Linie 1332 - 1363. Berlin 1857. gr. 4. (Geschenk Sr. Majestät des Königs von Preußen.)
- Archiv des historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg. Bd. XIV. Heft 2. Würzburg 1857. 8. (Geschenk des Vereins.)
d. Würtemberg, Baden, Mittelrhein.
- Würtembergische Jahrbücher. Herausg. von dem königl. Statistisch-topograph. Bureau. Jahrg. 1856. Heft 1. 2. Stuttgatt 1857. 8. (Geschenk des Bureau's.)
- Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben. 11. Bericht. Der größeren Hefte 7. Folge. Mit 4 Kunstblättern. Ulm 1857. 4. (Geschenk des Vereins.)
- Schönhuth, Chronik der vormaligen Deutschordens=Stadt Mergentheim, aus urkundl. Quellen. Neue Ausgabe. 1857, 12. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
- H. F. Wilhelmi, Blätter der Erinnerung an Joh. David Carl Wilhelmi. s. l. & a. (1857). 8. (Geschenk der Hinterlassenen des Verstorbenen.)
- Denkmäler in Nassau. 2 Hefte. Die Abtei Eberbach im Rheingau, von Karl Rossel. 1. Lief. Das Refectorium. Text S. 1 - 15. Taf. I - VIII. Wiesbaden 1857. 4.
-
P. H. Bär, Diplomatische Geschichte der Abtei
Eberbach im Rheingau, II. 1. Herausg. von K.
Rossel. Wiesbaden 1857.
(Nr. 75. 76 Geschenke des histor. Vereins zu Wiesbaden.)
e. Thüringen.
- Zeitschrift des Vereins für Thüring. Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 3. Heft 1 - 3. Jena 1857, 8.
-
Michelsen: Die ältesten Wappenschilde der
Landgrafen von Thüringen. Jena 1857. 4.
(Nr. 77. 78 Geschenke des Vereins zu Jena.) - Thüringische Ortsnamen. Zweite Abhandl. Von Paulus Cassel. (Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu Erfurt.)
- Hennebergisches Urkundenbuch. Thl. 3. Meiningen 1857. 4. (Geschenk des Henneberg. Vereins zu Meiningen.)


|
Seite 31 |




|
f. Preußen. (s. auch Nr. 69.)
- Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 33. Heft 1 - 4. Görlitz 1856. 1857. 8. (Geschenk der Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz.)
- Pful, Wendisches Wörterbuch. Wendisch=deutscher Theil. 1. Heft. A-Dripa. Bautzen 1857. 8.
- Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Herausg. von R. Roepell. II. Bd. 1. H. Breslau 1858. 8. (Geschenk des Vereins.)
- 34. Jahresbericht der Schles. Gesellschaft fur vaterländ. Kultur. (Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1856.) 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
- 87. A. F. Riedel, Novus Codex diplomat. Brandenburgensis. I. Hauptth. 13. u. 14. Bd. II. Hauptth. 6. Bd. Berlin 1857. 4. (Geschenk des Hrn. Herausgebers.)
-
Baltische Studien. 16. Jahrg. 2. Heft Stettin
1857. 8. (Geschenk der Gesellsch. F. pommersche
Gesch.
 .)
.)
- Dr. F. v. Hagenow, Karte von Neu-Vor-Pommern und der Insel Rügen. 5. Aufl. 1856. (Geschenk des Herrn Herausgebers.)
- 91. Zober, Zur Geschichte bes Stralsunder Gymnasiums von 1680 - 1755. 4. u. 5. Beitrag, Stralsund 1858. 4. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
- E. Geisberg und W. E. Giefers, Zeitschrift für vaterländische und Alterthumskunde. Bd. XVIII. (Neue Folge Bd. VIII.) Münster 1857. 8. (Geschenk der Gesellschaft zu Münster.)
g. Hannover und Braunschweig.
- W. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, III. Bd. Göttingen 1857. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
- 95. Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1853. 2. Heft. Jahrg. 1855. 1856. 2 Hefte.
- 21. Nachricht über den histor. Verein für Niedersachsen. (Nr. 94 -96 Geschenke des Vereins.)
h. Hansestädte, Holstein und Lauenburg.
- Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Neue Folge. Bd. I. Heft 3. Hamburg 1857. (Geschenk des Vereins.)


|
Seite 32 |




|
- Urkundenbuch der Stadt Lübeck, II. Lief. 11. u. 12. Lübeck 1857. 4.
-
Zeitschrift des Vereins für Lübeckische
Geschichte und Alterthumskunde. Heft 2. Lübeck
1858. 8.
(Nr. 98 u. 99 Geschenke des Lübeckischen Vereins.) - Die Hochverräther zu Lübeck im Jahre 1384 von Dr. Ernst Deecke. (Geschenk des Herrn Verf.)
- Lappenberg, Von den Schlössern der Sachsen=Lauenburgischen Raubritter. (Separat=Abdruck aus dem vaterländischen Archiv des Herz. Lauenburg I. 2.) Ratzeburg 1857. 8.
- Urkundensammlung der Schleswig=Holstein=Lauenburg. Gesellschaft für vaterländ. Geschichte. 2. Bd. 3. Abth. Kiel 1856. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
- K. W. Nitzsch, Das Taufbecken der Kieler Nikolaikirche. Ein Beitrag zur Kunst= und Landesgeschichte Holsteins. Kiel 1857. 8.
- Heinzelmann, Von den alten cimbrischen und sächsischen Eidgerichten überhaupt, und von der dithmarsischen Nemede insbesondere. (Aus dem 2. Heft des 7. Jahrganges der schleswig=holsteinschen Provinzialberichte.) Kiel 1793. 8. (Geschenk des Herrn Gymnasiasten Jenning.)
III. Meklenburg.
-
Gerdes, Fortgesetzte oder neunte Sammlung
 Wismar 1744. 4. (Geschenk des
Herrn Stadtrichters Genzken zu Alt=Strelitz.)
Wismar 1744. 4. (Geschenk des
Herrn Stadtrichters Genzken zu Alt=Strelitz.)
-
G. G. Gerdes, Nützliche Sammlung verschiedener,
guten Theils ungedruckter Schriften und Urkunden
 1 - 9. Sammlung, Wismar 1736 - 44.
1 - 9. Sammlung, Wismar 1736 - 44.
-
J. M. Pötker, Neue Sammlung glaubwürdiger, aber
guten Theils ungedruckter Mecklenb. Schriften
und Urkunden
 Stück 1., Danzig 1744. 2 - 6.
Stück, Wismar und Leipzig 1746. 4.
Stück 1., Danzig 1744. 2 - 6.
Stück, Wismar und Leipzig 1746. 4.
(Nr. 106 und 107. Geschenke des Herrn Gymnasiasten Jenning.) - 111. J. K. Spalding, Meklenb. Öfftenliche Landesverhandlungen. Bd. I - IV. (pag. 1 - 444, nicht weiter erschienen.) Rostock 1792 - 1800. fol.
- Rostocker Stadtrecht, Anno 1597, von Dr. Heinrich Camerarius, Prof. zu Rostock, projectirt. Manuser.


|
Seite 33 |




|
4. Ungebunden: 31 Abhandlungen und Verordnungen, meistens Rostock betreffend, größtentheils handschriftlich. (Nr. 108 - 112 Geschenke des Herrn Amtsverwalters Jenning in Schwaan.)
- Archiv für Landeshmde in den Großherzogth. Mecklenburg und Revue der Landwirthschaft. 7. Jahrg. 1857. Schwein. Hoch 4.
- Jahresbericht über die Realschule zu Schwerin. Schwerin. 1858. 8.
-
Urkunden zur Geschichte des Geschlechts von
Pressentin. Herausg. von Dr. Lisch. (Ueberdruck
der Jahrbücher
 )
)
-
Dr. Lisch, Katharina Hahn, Gemahlin des Herzogs
Ulrich, Pr. von Dänemark, Administrators des
Bisth. Schwerin. 8. (Ueberdruck der Jahrbücher
 )
)
- Der Thronsaal des Schlosses zu Schwerin mit seinen Umgebungen. 3. Beitrag zur Geschichte des Schweriner Schloßbaues von Dr. Lisch, Schwerin 1857. (Abdr. aus dem Archiv für Landeskunde.)
-
Ueber Kirchen=Restaurationen in Meklenburg vom
Dr. Lisch. (Desgl.) -
(Nr. 115 - 118 Geschenke des Hrn. Verfassers.) - v. Quast, Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan. 1857. 4. (Gesch.des HerrnVerf.)
-
G. F. Stieber, Mecklenburgische Kirchen=Historie
 Güstrow 1714. 8. (Geschenk des
Herrn Fridericianers Jenning.)
Güstrow 1714. 8. (Geschenk des
Herrn Fridericianers Jenning.)
- J. G. Becker, Predigt und Rede am Confirmationstage, 1809. Rostock. 8.
- Fr. Studemund jun., Drei Zeitreden, Schwerin 1815. 8.
- Ch. D. Breithaupt, Dem Protestantismus. Eine Rede bei der 3. Säcularfeier der Reformation. Rostock 1817. 8.
-
F. Ch. Boll, Predigten über Dr. Martin Luther's
Leben und Wirken
 Rostock und Schwerin. Heft 1 - 4.
1817. 8.
Rostock und Schwerin. Heft 1 - 4.
1817. 8.
- F. Küffner, Kirchliche Feier der Leipziger Völkerschlacht. Güstrow 1819. 8.
- F. Küffner, Festgesänge am 10. December fürVolksschulen. Schwerin 1821. 8.
- F. Küffner, Feier=Gesänge am Confirmationstage, Rostock 1822. 8.
- F. Küffner, Feier=Gesänge am Tage der Beichte der Confirmanden. Greifswald 1824. 8.


|
Seite 34 |




|
- L. Hasse. Zur Weihe der neuen Leichenstätte in Wasdow. Rostock 1822. 8.
-
C. J. C. Grimm, Worte bei der Einweihung des
neuen Gottesackers in der Stadt Tessin. Rostock
1825. 8.
(Nr. 121 - 130 Geschenke des Herrn Candidaten Dolberg hieselbst.) - C. J. C. Grimm, Ueber unbillige und verkehrte Ansprüche, die in unserer Zeit an das christliche Predigtamt gemacht werden. Eine Bußtagspredigt. Rostock und Schwerin 1832. 8.
- C. Malchow, Rede, gehalten am Grabe des Bürgermeisters Hofraths Strempel am 28. Februar 1858. Schwerin 1858. 8.
- C. W. D. Plaß, Thatsächliches aus dem Treiben der Wiedertäufer in Meklenburg. Nach eigenen Erfahrungen. Schwerin und Rostock 1851. 8. (Aus dem Zeitblatt für die evangelisch=luth. Kirche Meklenburgs.)
- K. K. Münkel, Kurzer Unterricht über Taufe und Lehre der sogenannten Wiedertäufer. Verden 1850. 8.
- A. Niederhöffer, Meklenburgs Volkssagen. Bd. I. Heft 2 - 4. Leipzig 1857, 58. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- H. v. Cossel, Grundriss von der Seestadt Wismar. Wismar 1834. g. fol. (Geschenk der Hildebrandschen Buchhandlung.)
- 138. Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg. 1856. II. Jahrg. 3. Heft. 1857. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Andreas Mylius. Große Oper in drei Aufzügen. Text von Ed. Hobein. Schweirin 1857. 8.
IV. America.
- Tenth Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. January 1. 1856. - March 22. 1856. Washington 1856. 8.
- Haven (S. F.), Archaeology of the United States. Or sketches, historical and bibliographical of the progress of information and opinion respecting vestiges of antiquity in tho United States. Washington 1856. 4. (Smithsonian Contributions to Knowledge.)


|
Seite 35 |




|
- Brantz Mayer, Observations on Mexican History and Archaeology, with a special Notice of Zapotec Remains etc. Washington 1856. Mit Holzschnitten und 4 Kupferttafeln. 4. (Smithsonian Contributions to Knowledge.)
- Denison Olmsted, On the recent secular period of the Aurora Borealis. Washington 1856. 4. (Smithsonian Contributions to Knowledge.)
-
Appendix, Publications of learned Societies and
periodicals in the library of the Smithsonian
Institution. P. I. II. 2 Hefte. 4. 1855,
1856.
(Nr. 140 - 144 Geschenke des Smithsonian Institut.)
V. Anhang.
- - 147. Dr. M. Luther's deutsche Schriften, theils vollständig, theils in Auszügen. Ein Denkmahl der Dankbarkeit des deutschen Volkes im Jahre 1817. Herausg. von F. W. Lomler. Bd. I. - III. Gotha 1816, 1817. 8. (Geschenk des Herrn Studiosus Brüning.)
- Ein gedrucktes chinesisches Neues Testament. (Geschenk des Herrn Unteroffiziers Büsch zu Wismar.)
-
G. Draudii, Bibliotheca librorum Germanicorum
classica. Das ist: Verzeichnuß aller vnd jeder
Bücher, so fast bey dencklichen Jaren in
Teutscher Spraach von allerhand Materien hin und
wider in Truck außgangen
 Franckfurt am Mayn 1611. 4.
Franckfurt am Mayn 1611. 4.
-
La France littéraire. Tom. I. et II. Paris 1769.
2 Bde. 8.
(Nr. 149 und 150 Geschenke des Herrn Candidaten Dolberg hieselbst.) - C. L. Grotefend, Epigraphisches. I. Ein Stempel eines röm. Augenarztes. II. Norica. Hannover 1857. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
- Inscriptiones Spartanae partim ineditae octo. E lapid. Transscr. Ed. illustr. Guil. Vischer. Basil. 1853. 4. (Geschenk der Gesellschaft zu Basel.)
- J. Scheiger, Andeutungen über Erhaltung und Herstellung der Schlösser. Gratz 1853. 8.
- J. Scheiger, Ueber Reinigung der Alterthümer. (Aus den Mitth. des histor. Vereins für Steiermark. Heft 7 bes. abgedr.)


|
Seite 36 |




|
-
J. Scheiger, Von dem Einflusse der Pflanzen auf
die Zerstörung der Ruinen. Wien 1857. 4. (Aus
den Mitth. des Alterth.-Vereins zu Wien. Bd.
II.)
(Nr. 153 - 155 Geschenke des Herrn Verf.) - F. J. Wiedemann, Musicalische Effectmittel und Tonmalerei. (Sonderabdruck aus dem "Inland.") Dorpat 1856. 8. (Geschenk der Esthnischen Gesellschaft zu Dorpat.)


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
XXIII. 1.
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde.
Schwerin, den 5. October 1857.
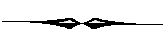
S eit dem Abdrucke der revidirten Matrikel unsers Vereines in dem letzten Jahresberichte vom 12. Juli d. J. sind bereits vier der dort genannten ordentlichen Mitglieder in die Ewigkeit abgerufen: Kammerherr v. Engel auf Breesen bei Neu-Brandenburg am 9. Juli, v. Behr-Negendank auf Torgelow zu Ludwigslust am 22. September, Kaufmann Daries zu Plau am 29. September und Justizrath v. Päpke auf Lütgenhof am 1. d. M., von welchen der letztere dem Vereine seit seiner Stiftung angehörte. Statt ihrer sind als neue Mitglieder bei getreten: die Herren Premier-Lieutenant a. D. Bruns, Landschaftsmaler Jentzen, Prinzen-Instructor Kollmann und Redacteur Schäfer zu Schwerin.
Zu den correspondirenden Gesellschaften ist unser jüngere Landsmann, der unter der Leitung des Herrn E. Boll zu Neu-Brandenburg frisch und kräftig aufstrebende Verein für Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg hinzugekommen. Auch ward in Folge der Ernennung unsers ersten Secretairs, Herrn Archivraths und Conservators Dr. Lisch zum correspondirenden Mitgliede der Academie d'archéologie de Belgique zu Antwerpen, welche unserer Seite durch die Ernennung des Herrn Vicomte de Kerkhove, Präsidenten der gedachten Academie, zum correspondirenden Mitgliede unsers Vereins erwiedert ward, die Verbrüderung beider Gesellschaften selbst, namentlich durch Austausch der beiderseitigen Publicationen eingeleitet. Ebenso ist der Herr Archivrath Lisch mit dem Herrn Grafen Reinhard zu Paris in Correspondenz getreten, um durch denselben eine ähnliche Verbindung mit den sehr thätigen historischen Vereinen Frankreichs anzubahnen.
Die Bereicherung unserer Sammlungen ist zwar mit Ausnahme der Bibliothek auch dies Mal nicht so bedeutend, als in früheren Jahren der Fall zu sein pflegte, aber doch immerhin erfreulich. Es wurden erworben:
I. Für die Alterthumssammlung.
A. Aus der vorchristlichen Zeit.
1) Aus der Zeit der Hünengräber:
1 Streitaxt aus Hornblende, gefunden zu Güstrow und geschenkt von dem Ausschussbürger Herrn Greffrath daselbst, und ein Keil aus grauem Feuerstein, gef. zu Benz bei Wismar, gesch. von dem Herrn Doctor Crull zu Wismar. Ferner schenkte der Herr Staranwalt Rosenberg zu Bergen auf Rügen, welcher diesen Sommer unsere Sammlung mit grossem Interesse besuchte, folgende auf der genannten Insel gefundenen, und für die Forschung über die Fabrikation der Alterthümer dieser Periode sehr instructive Stücke: 8 roh zugehauene Keile und Lanzen, 4 Pfeilspitzen von schönen Formen, über 100 Späne, Spanmesser, Schleudern und andere bei Bearbeitung der Feuersteine abgesprungene Stücke, so wie ein Stück Harzkuchen aus einer Urne.
2) Aus der Zeit der Kegelgräber:
1 Schwert aus Bronze, gef. beim Pflügen auf der Feldmark Letschow, gesch. von dem Herrn Amtsdiätar Otto Grotrian zu Schwan. — 1 Hütchen aus Bronze, gef. im Schlossküchengarten bei Schwerin von dem Herrn Hofgärtner Lehmeyer, gesch. von dem Herrn Segnitz zu Schwerin.


|
Seite 2 |




|
3) Aus der Zeit der Wendenkirchhöfe:
4 Urnen aus einer wendischen Begräbnissstätte zwischen Göthen und Rutenbeck, 4 eiserne Lanzenspitzen und 1 eisernes Messer, welche in der grössten der Urnen lagen, und 1 eiserne Nadel, gesch. von dem Herrn Pastor Willebrand zu Kladow. — 2 Hefteln aus Bronze, gef. zwischen Urnenscherben bei Vorbeck, A. Crivitz, gesch. durch Vermittelung des Herrn Pastors Willebrand von dem Herrn Pensionair Ueckermann zu Vorbeck. — 1 Menschenschädel, gef. in einem Wendenkirchhofe bei Godern, gesch. von dem Herrn Präpositus Dr. Schencke zu Pinnow.
B. Aus dem christlichen Mittelalter:
1 kurzer eiserner Degen, gef. zu Repnitz, gesch. von dem Herrn v. Oertzen auf Repnitz. — 1 eiserne Sichel und 2 Hufeisen, gef. in der Recknitz bei Marlow, gesch. von dem Herrn Dr. Huen daselbst. — 1 Henkeltopf aus Bronze oder sogenanntem Grapengut mit einem Wappenschilde, etwa aus dem 14. Jahrh., gef. bei Gnoien, gesch. von dem Herrn v. Kardorff auf Remlin zu Gnoien. — 1 irdener Henkelkrug, gef. zu Gremmelin, 10 Fuss tief, gesch. von dem Herrn Präpositus Schencke zu Pinnow. — 2 hölzerne Teller mit Malerei und plattdeutschen Versen aus der Zeit um 1500, gef. in einem vermauerten Wandschranke eines alten Hauses am Markte zu Güstrow, gesch. von dem Herrn Kürschner Sass daselbst. — 1 messingener Massstab mit der Jahreszahl 1657, gef. unter Brandschutt bei einem Hausbau zu Parchim, gesch. von dem Herrn Baumeister Garthe daselbst. — 1 Wasseruhr mit neuerem Anstrich und darauf die Jahrzahl 1700, gesch. von dem Herrn Ad. Hinzelmann zu Tessin.
Zu erwähnen ist noch, dass die in den Zeitungen mehrfach besprochenen, bei dem Chausseebau im Torfmoore zu Dambeck bei Röbel gefundenen messingnen Taufbecken, welche das Gerücht zu goldenen Schüsseln machte, glücklicher Weise für die grossherzogliche Sammlung erworben sind.
II. Für die Münzsammlung:
1 viertel Thaler des Grafen Ludwig von Stolberg o. J., unter dem Kaiser Karl geschlagen, 1 viertel Thaler des Herzogs Ernst August von Braunschweig, 1683, 1 Schilling des Herzogs Johann Albrecht I. von Meklenburg, 1 Sechsling des Herzogs Christian (Louis) von Meklenburg, 1661, gesch. von dem Herrn Schulrath Lorenz zu Schwerin. — 1 spanischer Piaster aus dem 16. Jahrh. 1 Reichsthaler des Kaisers Rudolf II. von 1583, 1 dänisches Markstück von 1615, gef. in einem Garten zu Gnoien, 1 schwedisches Vierschillingsstück von 1747, 1 hamburger Groschen von 1729, gef. beim Chausseebau, gesch. von Herrn v. Kardorff auf Remlin zu Gnoien. — 1 silberne Denkmünze auf Martin Garlieb Sillem, Bürgermeister zu Hamburg († 1835), gesch. von einem Ungenannten, der Sammlung überreicht durch Fräulein A. Buchheim. — 1 altgriechische Silbermünze, Av. Kopf, Rev. Stier, darunter ein Fisch, gesch. von dem Herrn Gymnasiasten Sellin zu Schwerin. — 1 zinnerne Denkmünze auf den Cölner Dombau, 1841, gesch. von dem Herrn Geh. Rath von Oertzen zu Schwerin.
III. Für die Bildersammlung:
1-3) Zwei Ansichten der Kirche zu Kraak: a. von der Altarseite; b. von der Westseite; 2 Bl. Fol. Situationsplan von Kraak. R. F. (No. 1-3 nach der Natur gezeichnet und geschenkt von dem Herrn Maler G. Clement jun. in Ludwigslust.)
4) Grundriss des Parterre und der beiden Ranglogen des grossherzoglichen Hoftheaters zu Schwerin. Lith. von A. Achilles. (1836.) Fol. 5) Portrait des Universitäts-Secretairs C. Riedel zu Göttingen, geb. um 1780 zu Demen in M. Phot. 4. (No. 4 und 5 Geschenke des Herrn Stud. jur. G. Brüning.)
IV. Für die Bibliothek:
1) Tenth annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution. Washington, 1856. 8.
2) Appendix. Publications of learned societies and periodicals in the library of the Smiths. Instit. P. I, 1855. P. II, 1856. 4.
3) S. T. Haven: Archaeology of the United States. Washington 1856. 4.


|
Seite 3 |




|
4) Brantz Mayer: Observations on Mexican History and Archaeology. Washington, 1856. 4. (Mit Holzschnitten und 4 Kupfertafeln.)
5) Denison Olmsted: On the recent secular period of the aurora borealis. Washington, 1856. 4. (No. 1-5 Geschenke d. Smithsonian Institution.)
6) N. J. van der Heyden: Notice sur la très-ancienne noble maison de Kerckhove, dite van der Varent, et sur son représentant actuel M. le Vic. d. R. L. de Kerckhove-Varent. Anvers, 1856. 8.
7) Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique. T. XIV, 3. [Th. Lejeune Recherches sur la résidence des rois Franks aux Estinnes.] Anvers, 1857. 8. (No. 6 und 7 Geschenke der Akad. zu Antwerpen.)
8) Annales de la Soc. Archéol. de Namur. T. IV, 3. 4. V, 1. Namur, 1856. 58.
9) Rapport sur la Situation de la Soc. Archéol. de Namur, en. 1856. 8. (No. 8 und 9 Geschenke der Gesellschaft zu Namur.)
10) Publications de la Société pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le G. D. de Luxembourg. Année 1856. T. XII. Luxemb. 1857. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
11) Description du musée de feu le Prince B. Kotschoubey par B. de Koehne. A. Pétersb. 1857. Vol. I. II. 4. (Geschenk der Fürstin Helene Kotschoubey.)
12) v. Bunge und Paucker: Archiv für die Geschichte Liv-, Esth- und Curlands. Bd. VIII, Hft. I. Reval, 1856. 8.
13) Verhandlungen der gelehrten Esthn. Gesellschaft zu Dorpat. Bd. IV. H. 1. Dorpat, 1857. 8. [Kalcwipoeg, verdeutscht von C. Reinthal. 1. Lief.]
14) G. Paucker: Die Regenten, Oberbefehlshaber und Oberbeamten Ehstlands. I. Regenten und Oberbeamten Ehstl. z. Z. der Dänenherrschaft. Reval, 1855. 8.
15) Das ehstländ. Landraths-Collegium und Oberlandgericht. Ein rechtsgeschichtl. Bild. Reval, 1855. 8.
16) Die Civil und Militair-Oberbefehlshaber in Ehstland zur Zeit der Kaiserlich Russischen Regierung von 1704-1855. Dorpat. 1855. 8.
17) F. J. Wiedemann: Musikalische Effectmittel und Tonmalerei (Sonderabdruck aus dem "Inland".). Dorpat, 1856. 8. (Nr. 12-17 Geschenke der Gesellschaft zu Dorpat.)
18) Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft (der Ges. für vaterländische Alterthümer) in Zürich. XXI. Geschichte der Abtei Zürich, H. IV. Mit einer Innenansicht der Abteikirche und einem Facsimile des Stiftungsbriefes v. 853. Zürich, 1857. 4.
19) 12ter Bericht über die Verrichtungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich, v. 1. Nov. 1855 bis 1. Nov. 1856. 4. (Nr. 18 und 19 Geschenke der Antiquar. Gesellschaft in Zürich.)
20) 3ter Jahresbericht des German. Nationalmuseums zu Nürnberg. Nürnberg und Leipzig, 1856. 4. 12 Exemplare. (Geschenk des Nat.-Mus.)
21) G. Draudii Biblioth. librorum Germanic. classica. Das ist: Verzeichniss aller vnd jeder Bücher, so in Teutscher Sprach hin und wider in Truck aussgangen. Franckfurt am Mayn, 1611. 4. (Geschenk des Herrn Cand. Dolberg in Schwerin.)
22) Fontes rerum Austriacarum. Abth. II, Bd. X. Wien, 1857. 8. (= Zeibig: Urkundenbuch des Stiftes Klosterneuburg bis zu Ende des 14. Jahrh. Thl. 1.)
23) Fontes rerum Austriacarum, Abth. II, Bd. XIII. Wien, 1856. 8. (= Tafel u. Thomas: Urkunden zur ältern Handels- und Staatsgesch. d. Republik Venedig. Thl. II. (1205-1255.)
24) Monumenta Habsburgica, Abth. II. Einl. zu Bd. I. Wien, 1857. 8. (= Actenstücke und Briefe zur Gesch. Kaiser Karls V. v. Lanz. Einl. zu Bd. 1.)
25) Archiv für Kunde österr. Geschichtsquellen. Bd. XVII, 1. 2. XVIII, 1. Wien, 1856. 1857. 8.
26) Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie d. Wissensch. Philos. Classe. Bd. XXI, H. 3. Bd. XXII, H. 1. 2. Wien, 1857. 8. (No. 22-26 Geschenke der kaiserl. Akademie in Wien.)
27) Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben, 11ter Bericht. Der grössern Hefte 7te Folge. Mit 4 Kunstblättern. Ulm, 1857. 4. (Geschenk des Vereins.)


|
Seite 4 |




|
28) Hennebergisches Urkundenbuch, Thl. III. Meiningen, 1857. 4. (Geschenk des Hennebergischen Vereins.)
29) Geisberg und Giefers: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. XVIII. (Neue Folge Bd. VIII.) Münster, 1857. 8. (Geschenk, des westfälischen Vereins zu Münster.)
30) Baltische Studien. Jahrgang 16, H. 2. Stettin, 1857. 8. (Geschenk der Gesellschaft für Pommersche Gesch. und Alterthumskunde.)
31) v. Hagenow: Karte von Neu-Vorpommern u. d. Insel Rügen, 5. Aufl. 1856. Fol. (Geschenk des Herrn Herausgebers.)
32) Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 33, H. 1-4. Görlitz, 1856. 1857. 8. (Geschenk der Oberlaus. Ges. d. Wiss. zu Görlitz.)
33) Mecklenburgische öffentliche Landes-Verhandlungen, aus öffentlichen Landtags- und Landes-Convents-Protocollis gezogen von Spalding. Bd. I-IV. Rostock, 1792-1800. Fol. (Bd. 3 u. 4 defect.)
34) Andreas Mylius. Gr. Oper in 3 Aufzügen. Text von Ed. Hobein. Schwerin, 1857. 8.
35) a. Th. Bartholmi de armillis veterum, praesertim
Danorum, schedion. Acc. Ol. Wormii de aureo cornu
resp. Hafniae, 1647.
b. Bart. Bartholini comm.
de paenula. Acc. H. Ernstii epistola. Ibid.
1670.
c. Th. Bartholini de bibliothecae incendio
diss. Hafn., 1670.
d. Ej. de medicis poetis
diss. Hafn., 1669.
e. Ej. Carmina var. argum.
Hafn. 1669. (Geschenk des Herrn Dr. med. Crull in Wismar.)
An wissenschaftlichen Arbeiten für den nächsten Band unserer Jahrbücher, dessen Druck bereits begonnen hat, sind bisjetzt eingegangen:
1) Ueber den heiligen Erpho von Meklenburg, Bischof zu Münster, von dem Herrn Archivrath Lisch.
2) Ueber des Wendenkönigs Niklot Enkel Kanut und Waldemar, Söhne des Fürsten Prizlav, von demselben.
3) Genealogische und chronologische Forschungen in der Geschichte des herzoglichen Hauses Meklenburg-Stargard, von demselben.
4) Genealogische Forschungen in der Geschichte des herzoglichen Hauses Meklenburg-Schwerin, von demselben.
5) Ueber die norddeutschen Familien v. Platen und die Familie Bevernest, von demselben.
6) Ueber das Land Chotibanz und den Ort Chutun, von demselben.
7) Ueber altniederländische Gebetbücher von den Herren C. D. W. und Archivrath Lisch.
Ferner an umfänglichern Berichten: über den Burgwall zu Marnitz von dem Herrn Pastor Willebrand zu Kladow; — über den Burgwall zu Mestlin von dem Herrn Wiechmann auf Kadow; — über die wendische Burg Lübchin und den Bärnim von Herrn Archivrath Lisch; — über den wendischen Burgwall zu Barth in Pommern von demselben. — Desgleichen über die romanischen Feldstein-Kirchen im östlichen Meklenburg; über die Kirchen zu Marlow, Thelkow und Basse von dem Herrn Archivrath Lisch; - über die Kirche zu Dambeck, Präpositur Meteln, und die Kirche zu Behrenshagen bei Bützow, von dem Herrn C. D. W. — Ueber den alten Taufstein im Dome zu Güstrow, von dem Herrn Archivrath Lisch; — über die Messingschnitt-Platten im Dome zu Schwerin, von demselben.
Ueber die jüngste General-Versammlung des Gesammtvereines, welche am 15. bis 18. Sept. zu Augsburg stattgefunden hat, ist uns noch kein eingehender Bericht zugegangen. Ich kann daher vorläufig nur aus den allgemeinen Zeitungsnachrichten wiederholen, dass der historische Verein zu München für das nächste Jahr zum Geschäftsführenden gewählt ist und die General-Versammlung im Jahre 1858 zu Berlin stattfinden wird.
W. G. Beyer,
Dr., Archiv-Secr.,
als zweiter Secretair des Vereins.
Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
XXIII. 2.
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde.
Schwerin, den 4. Januar 1858.
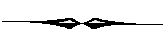
D as Correspondenz-Blatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine hat uns nunmehr in den ersten 3 Blättern des neuen (6ten) Jahrganges die Protokolle der unter dem Präsidio des Herrn Ministerial-Vorstandes a. D. Braun aus Hannover am 15.-18. Septbr. v. J. zu Augsburg gehaltenen Generalversammlung gebracht. Wir ersehen daraus, dass sich die Zahl der verbundenen Vereine zwar wiederum um vier vermehrt hat und sich jetzt auf 53 beläuft, dass sich aber die Einnahme noch immer fast ausschliesslich auf den Ertrag des Correspondenzblattes und der Entréegelder der Generalversammlungen beschränkt, und daher die Wirksamkeit des Vereins immer noch eine sehr beschränkte bleiben musste. Im Laufe der Verhandlungen der Section für die Alterthumsforschung kam man nochmals auf die in Mecklenburg gefundenen Bronze-Kronen zurück, jedoch in einer Weise, die es fast bedauern lassen könnte, dass die Versammlung nicht einige Monate später stattgefunden habe, nämlich — zur Zeit der allgemeinen Zopfabschneidung in Augsburg. Dass der historische Verein für Oberbayern zu München zum geschäftsführenden und Berlin zum Versammlungsorte für 1858 gewählt worden, ist schon berichtet; ersterer hat indess die Wahl abgelehnt, weshalb der Verein zu Hannover die Geschäftsführung noch ein Jahr behalten wird.
Unser Specialverein hatte sich in dem abgelaufenen Quartale wiederum des Beitritts von vier neuen ordentlichen Mitgliedern zu erfreuen, nämlich der Herren Büsch, Unterofficier zu Wismar, Neumann, Candidat zu Bandelstorf, von Restorf auf Rosenhagen und Graf von Schwerin auf Göhren bei Woldeck, wogegen wir nur den Verlust des am 15. Oct. 1857 verstorbenen Pastors Heyden zu Beidendorf und des zum Conrector des Gymnasiums zu Celle berufenen Herrn Oberlehrers Ebeling zu Schwerin zu beklagen haben.
Zum correspondirenden Mitgliede ward in der heutigen Quartal-Versammlung Herr Riza Rangabé königlich griechischer Minister des Hauses und der auswärtigen Angelegenheiten des Königs zu Athen, erwählt.
Die neuen Erwerbungen der Sammlungen des Vereins sind folgende:
I. Für die Alterthumssammlung.
A. Aus der vorchristlichen Zeit.
1) Aus der Zeit der Hünengräber:
1 Streitaxt aus Gneis, geschenkt von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin. — 1 Keil aus hellgrauem Feuerstein, gef. bei Katelbogen, gesch. von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar. — 1 Keil von Hornblende, gesch. von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin. — 1 kleiner Keil aus Feuerstein, gesch. von demselben. — 1 Dolchgriff aus Feuerstein, gef. zu Wolken bei Bützow, gesch. von dem Herrn Fr. Seidel zu Bützow. — 1 abgebrochene Dolchspitze aus Feuerstein, gesch. von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin. — 1 vierseitig zubereiteter Feuerstein, gesch. von demselben. — 11 kugelförmige Steine aus altem Sandstein, Granit und vulkanischem Gestein, die Hälfte einer durchbohrten Scheibe von gebranntem Thon und mehre Gefässscherben, gef. zu Friedrichshöhe in einem Moderloche und gesch. von dem Herrn Ritter daselbst. — 9 künstliche Feuersteinspäne, gef. bei Bützow, gesch. von dem Herrn Fr. Seidel daselbst.


|
Seite 2 |




|
2) Aus der Zeit der Kegelgräber:
1 Messer, 2 vollgegossene dicke Armringe, 1 dünnerer Armring, 1 Halsring und 1 Hütchen aus Bronze, ferner 1 Dolch aus Bronze, 2 Pfeilspitzen aus Feuerstein mit Resten hölzerner Schäfte, 1 vermoderte hölzerne Keule, endlich eine wohlerhaltene und eine zerdrückte Aschenurne und mehre Reste menschlicher Gebeine, gef. in einem auf Kosten des Herrn Pastors Böcler zu Gägelow unter seiner und des Herrn Archivraths Lisch Leitung aufgedeckten Kegelgrabe bei Dabel. — 1 Framea aus Bronze, gef. bei Proseken, gesch. von dem Herrn Unterofficier Büsch zu Wismar. — 1 Sichel aus Bronze, gesch. von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin.
3) Aus der Zeit der Wendenkirchhöfe:
1 grosse wohlerhaltene Urne, gef. im Torfmoore bei Dömitz, gesch. von dem Herrn Rector Thiem daselbst. — 2 Spindelsteine aus gebranntem Thon, gesch. von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin.
B. Aus dem christlichen Mittelalter:
1 Spielwürfel aus Thon, 2 1/4 Zoll im Durchmesser, gef. auf einer Burgstelle im Walde bei Rubow, gesch. von dem Herrn Hofmaler Schlöpke zu Schwerin. — 1 eiserner Sporn, gef. in dem Wallgraben der Festung Dömitz, gesch. von dem Unterofficier Herrn Büsch zu Wismar. — 2 Löffel aus Messing, gef. theils bei Kägsdorf, theils bei Bützow, gesch. von dem Herrn Fr. Seidel zu Bützow. — 1 Löffel aus Messing und 1 kleine gläserne Flasche aus Holstein, gesch. von dem Rentier Herrn Wohlgemuth zu Schwerin.
II. Für die Münzsammlung:
1 polnischer Groschen von 1619, 1 brandenburgischer Groschen von 1679 und 1 dänischer Schilling, gesch. von dem Herrn Ritter-Friedrichshöhe. — 1 anhaltscher Groschen von 1622, gesch. von dem Herrn Bürgermeister Daniel zu Schwan. — 1 schwedisch-pommersches Vierschillingsstück, gesch. von dem Herrn Schulrath Lorenz zu Schwerin. — 1 Thaler des Herzogs Friedrich zu Braunschweig-Lüneburg von 1609, gesch. von dem Herrn Geheimen Rath von Plessen Exc. zu Schwerin. — 1 Vierschillingsstück des Herzogs Friedrich IV. zu Holstein-Plön von 1702, gef. bei Schwerin (angekauft).
III. Für die Bildersammlung:
1) Ansicht der steinernen Brücke im Park zu Ludwigslust. In Aquarell vom Herzog Adolph Friedrich (um 1810). (Gesch. vom Herrn Adv. Parbs zu Schwerin.) Kl. Fl. 2) Rookingham, Vollbluthengst im Grossherzogl. Meklenb. Schwerinschen Hauptgestüte zu Redefin. Gez. und lithogr. von G. Rückert. Q. Fol.
IV. Für die Büchersammlung:
1) C. L. Grotefend: Epigraphisches. I. Ein Stempel eines römischen Augenarztes. II. Norica. Hannover, 1857. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
2) J. Scheiger: Von dem Einflusse der Pflanzen auf die Zerstörung der Ruinen. Wien, 1857. 4. [Aus den Mitth. des Alterth.-Vereins zu Wien, Bd. II.]
3) J. Scheiger: Andeutungen über Erhaltung und Herstellung der Schlösser, Gratz, 1853. 8.
4) J. Scheiger: Ueber Reinigung der Altertümer. [Aus den Mitth. des histor. Vereins für Steiermark, Hft. 7 bes. abgedr.] 8. (Nr. 2-4 Geschenke des Herrn Verf.)
5) La France littéraire. T. I., II. Paris, 1769. 2 Bde. 8. (Geschenk des Herrn Cand. Dolberg hieselbst.)
6) De vrije Fries. Bd. VII. (Neuer Folge Bd. I.) 1.-4. Stück. Bd. VIII. (N. F. II.) Hft. 1. Leeuwarden, 1854-57. 8.
7) Sicco van Goslinga: Mémoires relatifs à la Guerre de Succession, de 1766-1709 et 1711, publ. par Evertz et Delprat. Leeuw. 1857. 8. (Nr. 6 und 7 Geschenke der Friesch Genootschap.)
8) Annales de l'Acad. d'archéologie de Belgique. IV. 4. Anvers, 1857. (Gesch. der Acad.)
9) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Ehst- und Kurlands. Bd. VIII, H. 3. Riga, 1847. 8. (Geschenk der Gesellschaft zu Riga.)
10) Archiv des Vereins für siebenbürg. Landeskunde. Neuer Folge Bd. II. H. 2. Kronstadt, 1856. 8. II, 3. 1857.


|
Seite 3 |




|
11) Jahresbericht des Vereins für siebenbürg. Landeskunde. 1854-1857. 2 Hfte. 8.
12) A. Bielz: Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens Hermannstadt 1856. 8. (Geschenke des Vereins für siebenbürg. Landesk.)
13) Arkiv za Povjestnicu Jugoslavensku. Knjiga IV. Agram, 1857. 8. (Geschenk des histor. Vereins zu Agram.)
14) Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländ. Alterthümer in Basel. VII. [W. Wackernagel: Die goldene Altartafel von Basel.] Basel, 1857. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
15) Frh. v. u. z. Aufsess: System der deutschen Geschichts- u. Alterthumskunde. Nürnberg und Leipzig 1853. 4. (Geschenk des Mus. in Nürnberg.)
16) Correspondenz-Blatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine. Jahrg. 1-3, herausgeg. von Löwe. Dresden, 1853-55. Jahrg. 4, 5, herausgeg. von Grotefend. Hannover, 1856-57. 4.
17) H. F. Wilhelmi: Blätter der Erinnerung an Joh. Dav. Karl Wilhelmi. 8. (Geschenk der Hinterlassenen des Verstorbenen.)
18) Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. H. 7. Gratz, 1857. 8.
19) 8ter Jahresbericht des historischen Vereins für Steiermark. 1857. 8.
20) Bericht über die 8. allgemeine Versammlung des histor. Vereins für Steiermark. 1857. (Nr. 18-20 Geschenk des steierm. Vereins.)
21) Bericht über das Museum Francisco-Carolinum. Nebst der 12. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oestreich ob der Enns. Linz 1857. 8. (Geschenk des Museums.)
22) Schönhuth: Chronik der vormaligen Deutschordens Stadt Margentheim; aus urkundl. Quellen. Neue Ausgabe. 1857. 12. (Geschenk des Herrn Verf.)
23) Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Herausgegeben von E. C. von Hagen. 7. Bd. 1. H. Beyreuth, 1857. 8. (Geschenk des histor. Vereins für Oberfranken zu Bamberg.
24) Monumenta Zollerana. Urkundenbuch zur Gesch. des Hauses Hohenzollern, herausgeg. von v. Stillfried und Märcker. III. Bd. [Urk. der Fränk. Linie 1332-1363.] Berlin, 1857. 4. (Geschenk Sr. Majestät des Königs von Preussen.)
25) Zeitschrift des Vereins für thüring. Gesch. und Alterthumskunde. 3. Bd. 1. H. Jena, 1857. 8.
26) Michelsen: Die ältesten Wappenschilde der Landgrafen von Thüringen. Jena, 1857. 4. (Nr. 25 und 26. Gesch. des thüring. Vereins.)
27) Riedel: Novus Codex diplom. Brandenburgensis. I. Hauptth., 13. Bd. Berlin, 1857. 4. (Gesch. des Herrn Verf.)
28) 34. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländ. Kultur. [Arbeiten und Veränderungen der Gesellschaft im Jahre 1856.] 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
29) Zober: Zur Geschichte des Stralsunder Gymnasiums von 1680-1755. 5. Beitrag (Fortsetzung). Stralsunder Progr. 1857. (Gesch. des Herrn Verf.)
30) Lappenberg: Von den Schlössern der Sachsen-Lauenburgischen Raubritter. [Separatabdruck aus dem vaterländ. Archiv des H. Lauenburg I, 2.] Ratzeburg, 1857. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
31) Zeitschrift des Vereins für Lübecker Geschichte und Alterthumskunde. 2. H. Lübeck, 1858. 8.
32) Urkundenbuch der Stadt Lübeck. II. Band, 11. und 12. Lief. Lübeck 1857. 4. (Nr. 31 und 32 Gesch. des Lübecker Vereins.)
33) v. Quast: Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan. [Aus der Zeitschrift für christl. Archäologie und Kunst von v. Quast und Otte.]
34) Programm des Gymn. Frideric. Schwerin, 1857. 4. [Ebeling: Uebersicht der deutschen Verfassungsgeschichte. I. Merowinger und Karolinger.] [Gesch. des Herrn Dir. Wex.)
35) F. Küffner: Feier-Gesänge am Confirmationstage. Rostock, 1822. 8.
36) Dess. Feier-Gesänge am Tage der Beichte der Confirmanden. Greifswald 1824. 8.
37) Dess. Fest-Gesänge am 10. December für Volksschulen. Schwerin. 1821. 8.
38) Dess. Kirchliche Feier der Leipziger Völker-Schlacht. Güstrow, 1819. 8.
39) F. Ch. Boll: Predigten über Dr. Martin Luthers Leben und Wirken. Rostock und Schwerin, 1817. 8. (Hft. 1-4.)


|
Seite 4 |




|
40) Ch. D. Breithaupt: Der Protestantismus. Eine Rede bei der 3. Säcularfeier der Reformation. Rostock, 1817. 8.
41) Fr. Studemund jun.: Drei Zeitreden. Schwerin, 1815. 8.
42) C. J. L. Grimm: Worte bei der Einweihung des neuen Gottesackers in der Stadt Tessin. Rostock, 1825. 8.
43) L. Hasse: Zur Weihe der neuen Leichenstätte in Wasdow. Rostock, 1822. 8.
44) J. G. Becker: Predigt und Rede am Confirmationstage 1809. Rostock. 8. (Nr. 35-44 Geschenk des Herrn Cand. Dolberg hieselbst.)
45) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. 1856. 3. H. 2. Jahrg., 1857. 8. (Geschenk des Vereins.)
V. Für die neu angelegte Sammlung meklenburgischer Autographen:
24 Briefe meklenburgischer Gelehrten, gesch. von dem Herrn Gymnasial-Director Wex zu Schwerin. — 8 Schriftstücke von meklenburgischen Hof- und Staats-Beamten und sonstigen Celebritäten, gesch. von dem Herrn E. v. Kamptz. — 2 desgleichen, gesch. von dem Herrn Oberlandforstmeister Eggerss.
VI. Für die naturhistorische Sammlung:
Der Schädel eines jungen Elen ohne Geweih, gef. im Torfmoore bei Müsselmow, gesch. von dem Herrn Wiechmann-Kadow.
An wissenschaftlichen Arbeiten haben in diesem Quartale eingeliefert:
1) Herr Archivrath Dr. Lisch: Ueber den Schweriner Martensmann. — Ueber Katharina Hahn, des Herzogs und Administrators Ulrich II. von Dänemark Gemalin. — Ueber den Reichstag zu Regensburg von 1532. — Miscellen. — Urkunden. — Beschreibung der Kirche zu Gägelow. — Beschreibung der Kirche zu Sülstorf. — Beschreibung der Kirche zu Banzkow. — Der Laienaltar und das Triumphkreuz in der Kirche zu Doberan. — Alte Leichensteine in der Kirche zu Dobbertin. — Rostocker Leichensteine. — Die grosse Glocke zu Hohen-Kirchen.
2) Herr Wiechmann-Kadow: Ueber die meklenburgischen Formschneider des 16. Jahrhunderts. — Ueber den im 16. Jahrhundert in Mecklenburg gebräuchlichen Cisiojanus.
3) Herr C. D. W.: Drei Denksteine aus der Umgegend von Wismar.
4) Herr J. Ritter-Friedrichshöhe: Ueber die alte Dorfstätte und die Schlossberge von Rodenbek bei Rostock.
Die Bearbeitung des aus dem Nachlasse des verstorbenen Dr. Duve erworbenen Materials über die Besitzungen der Grafen von Schwerin am linken Elbufer hat der Hr. Staatsminister v. Hammerstein zu Verden zu übernehmen die Güte gehabt. In bessere Hände konnte dies Material nicht gelangen, da Herr v. Hammerstein schon seit Jahren über denselben Gegenstand geforscht hat, und eben im Begriff war, die Resultate seiner Forschung in den Jahrbüchern des historischen Vereins zu Hannover mitzutheilen.
W. G. Beyer,
Dr., Archiv-Secr.,
als zweiter Secretair des Vereins.
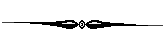
Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
XXIII. 3.
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde.
Schwerin, den 12. April 1858.
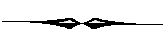
Z ur Personal-Chronik des Vereins ist zuvörderst nachträglich der Tod unsers zwanzigjährigen correspondirenden Mitgliedes, des schon am 8. September 1857 gestorbenen Dr. Johann Heinrich Schröder, Professors und Oberbibliothekars der Universität zu Upsala, zu berichten. Ihm folgte am 12. Januar 1858 der uns in gleicher Eigenschaft angehörige, bekannte Geschichtsschreiber Pommerns, Professor Dr. Barthold zu Greifswald. In der heutigen Versammlung des Ausschusses unsers Vereins wurden dagegen der Herr Staatsminister a. D. Freiherr v. Hammerstein zu Verden, und der Herr Archiv-Secretair Dr. Grotefend zu Hannover wiederum, was sie in Wahrheit längst gewesen, auch formell zu correspondirenden Mitgliedern erwählt.
Von den ordentlichen Mitgliedern haben wir in dem abgelaufenen Quartale zwei alte Freunde durch den Tod verloren: den unsern Verein schon seit seiner Gründung angehörenden Archiv-Rath Heinr. Groth zu Schwerin, gest. am 18. März im 79. Lebensjahre, und den Consistorial-Rath Mag. Gentzken zu Ratzeburg, gestorben am 20. März 1858. Beigetreten sind dagegen die Herren Gymnasial-Lehrer Dr. Bleske und Dr. Meyer in Schwerin, Premier-Lieutenant Baron v. Nettelbladt zu Schwerin, Manecke auf Duggenkoppel zu Schwerin und Pogge auf Jaëitz bei Plau.
Für die Sammlungen des Vereins ward erworben:
I. Für die Alterthumssammlung.
A. Aus der vorchristlichen Zeit.
1) Aus der Zeit der Hünengräber:
1 kleiner Streithammer aus Grünstein, gef. zu Krusenhagen bei Wismar, geschenkt von dem Herrn Unteroffizier Büsch zu Wismar. — 1 Schleifstein aus altem rothem Sandstein, gef. zu Rogeez bei Malchow, gesch. von dem Herrn v. Bülow auf Rogeez.
2) Aus der Zeit der Kegelgräber:
Bruchstücke einer Urne und mehrentheils ungebrannte, theils gebrannte menschliche Gebeine, gef. in einem Kegelgrabe bei Brunsdorf bei Marlow, gesch. von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow.
3) Aus der Zeit der Wendenkirchhöfe:
1 zerbrochene Urne, 1 Heftel aus Bronze, 1 Heftel aus Eisen und 8 Glasperlen, gef. auf einem Wendenkirchhofe bei Wotenitz bei Grevesmühlen, gesch. von dem Herrn Unteroffizier Büsch zu Wismar.
B. Aus dem christlichen Mittelalter:
1 Leiste aus Lindenholz mit geschnitzten Blättern, Blumen und Früchten, gesch. von dem Herrn Rentier Wohlgemuth zu Schwerin. — 1 Feuerzeug in Form einer Pistole mit Gewehrschloss aus dem 18. Jahrhundert, gesch. von dem Herrn Unteroffizier Büsch zu Wismar.
II. Für die Münzsammlung:
11 Thaler, 11 halbe Thaler, 16 Ortsthaler, 11 halbe Ortsthaler, 3 Dütchen,


|
Seite 2 |




|
4 Doppelschillinge, 4 Schillinge und 1. Sechsling aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, geschenkt von dem Herrn Landrath Baron Le Fort auf Boek, als Auswahl aus einem im Jahre 1857 gemachten Münzfunde von 224 Münzen, von welchem die jüngste vom Jahre 1635 ist. — 1 brandenburgischer Groschen 1658, 1 braunschweiger Schilling 1693, 1 Rostocker Dreiling 1622, gesch. von dem Herrn Schriftsetzer Wollbrandt zu Schwerin. — 1 Hamburger Groschen 1624, gesch. von dem Kaufmann Herrn Greffrath zu Goldberg. - 7 mittelalterliche Wittenpfennige, nämlich 2 von Rostock, 1 aus Parchim und 4 aus Stralsund, gef. zu Sehlstorf, Klosteramts Dobbertin, eingesandt von dem Herrn Klosterhauptmann Freiherrn v. Maltzan zu Dobbertin. - 54 Pappabdrücke von Medaillen, gesch. von dem Herrn Gymnasiasten Jenning zu Schwerin.
III. Für die Bildersammlung:
Von dem Herrn Dr. med. Siemssen zu Rostock sind 58 Stück Portraits geschenkt. Die Mehrzahl der Blätter ist zwar schon in der Sammlung vorhanden, jedoch theilweise zur Ersetzung defecter Exemplare verwandt. Durch die folgenden Blätter wird unsere Sammlung erweitert:
Louise, Königin von Preussen. Stahlst. Naumburgs Kunstanstalt in Leipzig. 4. - Wallenstein. Nach van Dyk. Lithgr. 4. Wallenstein nach dem Fr.-Gemälde im Schlosse zu Weimar. Kpf. 4.
Ulrich von Hutten, 3 Ausg. in Holzschnitt, — Stör sc. - Gottschick sc. 8.
Hugo Grotius, Kpf. nach W. de Broen, 4. Ders. Kpf. 4.
Ritter J. Taylor, Augenarzt (behandelte den Hz. Christian Ludwig II.), gest. von A. Reinhardt, 1750. Kpf. 8. — Joh. Nic. Tetens, dän. Conferenzrath, geb. 1736 als ehemal. Prof. zu. Bützow), Laurens sc. 8.
Baron v. Ditmar, Stifter der Freimauerei in M. Lith. 8. (Aus dem Kalender für die Provinzial-Loge von M.) Canzlei-Vice-Director J. H. v. Schröder. Lith. 8. (Aus dems. Kalender.) Baron v. Nettelbladt, Ober-Appellat.-Rath. Lith. 8. (Aus dems. Kalender.)
Curdt Ch. v. Schwerin, Königl. Preuss. Gener.-Wachtmeister. Kpf. 8. Major Schill. Lith. (G. Küstner) 4. Fürst Blücher. Bollinger fec. 1819. 4.
Jacob Coler, Theol., gest. 1612 Kpf. 8. H. Hamelmann, Theol., gest. 1595, ganze Figur. Kpf. 4. Val. Fromm, Superintendent zu Brandenburg (als meklenb. Schriftsteller). Kpf. 8. G. Raphel, Superintendent zu Lüneburg (als meklenb. Schriftsteller). Imm. v. Essen, Ober-Pastor zu Riga (aus Meklenburg stammend), gem. v. Becker, gest. v. Fritzsch. 1763. 8.
Conrad Ekhof. Lithogr. 8.
Ferner sind eingegangen: Th. v. Scheve, Kammerherr und Canzlei-Dir. in Neustrelitz, auf Cantzow, gest. 1853, gez. von C. Wiese, lith. von P. Rohrbach. Fl. (Geschenk des Hrn. Pastor Masch zu Demern.)
Als Geschenk des Hrn. Stud. d. R. G. Brüning: Alexandrine, Prinzessin von Preussen, gem. von Grahl, gest. von L. Meyer. 8. F. C. L. Karsten, Prof. zu Rostock, Lith. 8. — H. Zschokke. Lith. 4. L. Gabillon aus Güstrow, Schauspieler zu Wien. Handz. von Havemann. 4.
IV. Für die Bibliothek:
1) Ein gedrucktes chinesisches Neues Testament. 8. (Geschenk des Herrn Unterofficiers Büsch in Wismar.)
2) Inscriptiones Spartavae partim ineditas octo. E lapid. transscr. ed. illustr. Guil. Vischer. Basil. 1853. 4.
3) Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgeg. von der histor. Gesellschaft zu Basel. 6r. Band. Basel 1857. 8.
4) W. Wackernagel: Ueber die mittelalterl. Sammlung zu Basel. Nebst einigen Schriftstücken aus derselben. Basel 1857. 4. (2-4. Geschenke der Gesellschaft zu Basel.)


|
Seite 3 |




|
5) F. Keller: Die keltischen Pfahlbauten in den Schweizerseen. (Mittheilungen der Antiqar. Gesellschaft in Zürich IX, II, 3). Zürich 1854. gr. 4.
6) Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Neue Folge. Organ des German. Museums. IV. Bd. Jahrgang 1857. Nürnberg u. Leipzig. 4. (Geschenk des Museums.)
7) Mittheilungen der k. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale. Herausgeg. von v. Körnig u. K. Weiss. II. Jahrg. Wien 1857. (12 Monatshefte.) 4. (Geschenk der Commission.)
8) Oberbayeriches Archiv für vaterländ. Geschichte, herausgeg. von dem histor. Verein von und für Oberbayern. 16r. Band, 3s. Heft, 17r. Bd., 1. u. 2. Heft. München 1857. 8.
9) Neunzehnter Jahresbericht des histor. Vereins von und für Oberbayern für das Jahr 1856. München 1857. 8. (N. 8 u. 9. Geschenk des Oberbayer. Vereins.)
10) Jahresbericht des Römisch-German. Central-Museums zu Mainz. 1857. 4.
11) Denkmäler in Nassau. II. Heft. Die Abtei Eberbach im Rheingau von K. Rossel, 1. Lief. Das Refectorium. Text S. 1-15. Taf. I-VII. Wiesbaden 1857. 4. (Geschenk des Vereins in Wiesbaden.)
12) Pfal: Wendisches Wörterbuch. Wendisch-deutscher Theil. 1. Heft. A-Dripa. Bautzen 1857. 8.
13) A. F. Riedel: Novus Codex diplomaticus Brandenburgensis. I. Hauptth., 14r. Band. II. Hauptth., 6r. Band. Berlin 1857. 4. (Geschenk des Herrn Herausgebers.)
14) Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Herausg. von R. Röpell. Bd. II, Heft 1. Breslau 1858. 8. (Gesch. des Vereins.)
15) E. H. Zober: Zur Geschichte des Stralsunder Gymnasiums. 4. Beitrag (1680-1755). Stralsund 1858. 4. (Gesch. des Herrn Verfassers.)
16) Zeitschrift des histor. Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1853. 2s Doppelheft. Jahrg. 1855. Jahrg. 1856, 1. Doppelheft, 1. Abth. 8. (Geschenk des Vereins.)
17) Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Neue Folge. Bd. I, 3. Hamburg 1857. 8. (Geschenk des Vereins.)
18) Heinzelmann: Von den alten cimbrischen und sächsischen Eidgerichten überhaupt und von der dithmarsischen Nemede insbesondere. (Aus dem 2. Heft des 7. Jahrg. der schleswig-holsteinischen Provinzialberichte.) Kiel 1793. 8. (Geschenk des Gymnasiasten H. Jenning.)
19) Urkundensammlung der schleswig-holstein-lauenburgischen Gesellschaft für vaterländische Geschichte. Bd. II, Abth. 3. Kiel 1856. 4.
20) K. W. Nitzsch: Das Taufbecken der Kieler Nicolaikirche. Ein Beitrag zur Kunst- und Landesgeschichte Holsteins. Kiel 1857. 8. (N. 19 u. 20. Geschenke der schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft.)
21) Annales por Nordisk Oldkyndighed og Historie, udg. af d. kongelige Nord. Oldskr. Selskab. Kyöbenhavn 1854. 1855. 2 Bde. 8.
22) Antiquarisk Tidsskrift, udg. af d. kong. Nord. Oldskr. Selskab. 1852-1854. 1855-1857. 2 Bde. 8.
23) Antiquités de l'Orient, monum. runographiques, interpr. par C. C. Rafn, et publ. par la Soc. roy. des antiquaires du Nord. Copenhagen 1856. 8.
24) C. C. Rafn: Učené zprávy. O kameně runském, na památku Bodritské kněžny v Dánsku postavaném. — Vytah z pojednáni: Bemaerkninger om en runesteen i Danmark over en Obodritisk fyrstinde. Af C. C. Rafn. (Antiq. Tidsskrift 1852-1854.) 8. (N. 21-24 Geschenk der Kopenhagener Gesellsch. f. nord. A.-K.)
25) G. F. Stieber: Meklenburgische Kirchen-Historie von Stiftung der


|
Seite 4 |




|
christlichen Kirchen unter den Wenden. Güstrow 1714. 8. (Geschenk des Gymnasiasten H. Jenning.)
26) Der Thronsaal des Schlosses zu Schwerin mit seinem Umgebungen. 3. Beitrag zur Geschichte des Schweriner Schlossbaues von Dr. G. C. F. Lisch. Schwerin 1857. 8. (Abdruck aus dem Archiv für Landeskunde. Geschenk des Herrn Verf.)
27) Archiv für Landeskunde in den Grossherzogth. Mecklenburg und Revue der Landwirthschaft. 7. Jahrgang 1857. Schwerin. 4. (Geschenk Sr. Königl. Hoheit des Grossherzogs.)
28) G. C. F. Lisch: Katharina Hahn, Gemahlin des H. Ulrich, Prinzen von Dänemark, Administrators des Bisth. Schwerin. 8.
29) H. v. Cossel: Grundriss von der Seestadt Wismar. Wismar 1834. gr. Fol. (Geschenk der Hildebrand'schen Buchhandlung in Schwerin.)
30) G. G. Gerdes: Nützliche Sammlung verschiedener guten theils ungedruckter Schrifften und Uhrkunden, welche die meklenburgischen Landesrechte, Geschichte und Verfassung erläutern können. Mit kurzen und nöthigen Anmerkungen herausgegeben. 1.-9. Samml., Wismar 1736-1744. 4. Angebunden: J. M. Pötker: Neue Sammlung glaubwürdiger aber guten Theils ungedruckter mecklenburgischer Schriften und Urkunden, welche zur Kenntniss dortiger Landes-Geschichte und Rechte einigermassen dienen können. Mit den nöthigen Anmerkungen. Stück 1. (Dantzig 1744) — 6. (Wismar und Leipzig 1746). 4. (Geschenk des Herrn Amtsverwalters Jenning in Schwaan.)
31) Gerdes: Fortgesetzte oder Neundte Sammlung etc. Wismar 1744. 4. (Geschenk des Herrn Stadtrichters Genzken zu Alt-Strelitz.)
32) C. Malchow: Rede, gehalten am Grabe des Bürgermeisters Hofraths Strempel am 20. Februar 1858. Schwerin 1858. 8.
33) C. W. D. Plass: Thatsächliches aus dem Treiben der Wiedertäufer in Mecklenburg. Nach eigenen Erfahrungen. Schwerin und Rostock 1851. 8, (Aus dem Zeitblatt für die evangel.-luther. Kirche Mecklenburgs.)
34) K. K. Münkel: Kurzer Unterricht über Taufe und Lehre der sogenannten Wiedertäufer. Verden 1850. 8.
V. Für die Urkundensammlung:
1) Auszug aus einer handschriftlichen Beschreibung des Amtes Gadebusch von 1555 und
2) Abschrift von Hexenprocessen aus dem Amte Gadebusch, gesch. von dem Herrn Bürgermeister Mau zu Neukalden.
Ausser den vorstehend verzeichneten Gegenständen ward der Verein in dem abgelaufenen Quartale noch durch folgende werthvolle Geschenke erfreut; es schenkte nämlich:
1) der Herr v. Behr-Negendank auf Semlow Gypsabgüsse der Büste des Hofmeisters Samuel v. Behr († 1621), sowie der Relief-Medaillons seiner Eltern, abgeformt nach dem Reiter-Denkmale auf dem Grabe des erstern in der Kirche zu Doberan;
2) der Herr Geh. Regierungs-Rath v. Quast auf Radensleben 450 Exemplare eines Stahlstiches der Grabplatten von Ziegeln in der Klosterkirche zu Doberan;
3) der Herr Amtmann v. Pressentin zu Dargun 750 Exemplare von 2 lithographischen Tafeln mit den sämmtlichen noch erhaltenen alten Siegeln der v. Pressentin.
Die sub 2 und 3 genannten Gaben werden mit dem nächsten Jahrbuche als artistische Beilagen ausgegeben werden.
In Folge eines von dem Herrn Archivar Landau zu Cassel auf der Generalversammlung des Gesammtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthums-Vereine gestellten, und von der Versammlung zum Beschlusse erhobenen Antrages hat der Ausschuss unseres Vereins nach dem Vorgange vieler anderer beschlossen, zur wirksamern Unterstützung der gemeinschaftlichen Bestrebungen einen jährlichen Beitrag von 5 Thlr. aus unserer Vereinscasse in die Casse des Gesammtvereins zu zahlen, sowie auf 5 Exemplare des Correspondenzblattes zu subscribiren.
W. G. Beyer,
Dr., Archiv-Secr.,
als zweiter Secretair des Vereins.
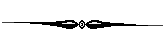
Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.
