

|




|


|
|
|
-
Jahrbuch für Geschichte und Alterthumskunde 1894
- Die Verpfändung meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition
- Die Schiffergesellschaft in Rostock
- Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563
- Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin
-
Alterthümer in der Umgegend von Rostock,
östlich der Warnow
- Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau
- Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf
- Urnenscherben von Kösterbeck
- Wendische Gefäßscherbe von Petschow
- Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu-Brodersdorf
- Der Lembken-Wall bei Billenhagen
- Urnenfeld, brandgruben und gerippe von der Feldmark Kassebohm
- Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen
- Urnenfelder auf der Feldmark Riekdahl den Cramonstannen gegenüber
- Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl
- Alterthümer von Alt-Bartelsdorf
- Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf
- Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen-Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel
- Wendische Wohn- und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf
- Zur Geschichte von Ankershagen
- Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in geschichtlicher Entwickelung
-
Quartalbericht des Vereins für meklenburgische
Geschichte und Alterthumskunde : October 1893
- Zum Wappen der v. d. Lühe
- Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496
- Zur Geschichte der S. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz
- Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen
- Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Januar 1894
-
Quartalbericht des Vereins für meklenburgische
Geschichte und Alterthumskunde : April 1894
- Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I von Meklenburg : von 1654-1693
- Alterthümer aus der Gegend von Laage
- Schiffs- und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts
- Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart : historisches Spottlied auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock aus dem Jahre 1713
- Quartal- und Schlußbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Juli 1894
Jahrbücher
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
| gegründet von | fortgesetzt von | |
| Geh. Archivrath Dr. Lisch. | Geh. Archivrath Dr. F. Wigger. |
Neunundfunfzigster Jahrgang.
herausgegebenvon
Archivrath Dr. H. Grotefend,
als 1. Secretair des Vereins.Mit angehängten Quartalberichten und Jahresbericht.
Auf Kosten des Vereins.
Schwerin, 1894.
Druck und Vertrieb der
Bärensprung'schen
Hofbuchdruckerei.
Kommissionär: K. F.
Koehler, Leipzig.


|




|


|




|
Inhalt des Jahrbuchs.
| I. | Die Kirchenbücher Meklenburgs. Von Dr. Friedrich Stuhr | S. | 1 |
| II. | Die Schiffergesellschaft in Rostock. Von Prof. Dr. Wilh. Stieda zu Rostock | S. | 86 |
| III. | Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563. Von Karl Koppmann | S. | 144 |
| IV. | Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin. Von F. v. Meyenn | S. | 177 |
| V. | Alterthümer in der Umgegend von Rostock, östlich der Warnow. Von Ludwig Krause in Rostock | S. | 220 |
| VI. | Zur Geschichte von Ankershagen. Von A. Graf von Bernstorff auf Ankershagen | S. | 282 |
| VII. | Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg. Im Auftrage S. K. H. des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg=Schwerin bearbeitet und gezeichnet von C. Teske. Von Dr. Crull in Wismar | S. | 315 |
Inhalt der Berichte.
| Zum Wappen der v. d. Lühe | I, | 2 |
| Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496 | I, | 5 |
| Zur Geschichte der St. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz | I, | 7 |
| Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen | I, | 9 |


|




|
| Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock | I, | 16 |
| Unbekannte meklenburgische Pläne und Ansichten | II, | 18 |
| Die Kapelle zum Heiligen Moor | II, | 21 |
| Die goldenen Freitage | II, | 22 |
| Der Wustrowsche Wassertag | II, | 23 |
| Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I. von Meklenburg : von 1654-1693 | III, | 26 |
| Alterthümer aus der Gegend von Laage | III, | 30 |
| Schiffs= und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts | III, | 33 |
| Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart. Historisches Spottlied auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock aus dem Jahre 1713 | III, | 37 |
| Auszug aus dem zweiten Bericht des Herrn Wossidlo = Waren über die Sammlung meklenburgischer Volksüberlieferungen | IV, | 54 |
| Meklenburgische Litteratur (Juli 1893 bis Juli 1894) | IV, | 59 |
| Zur Litteratur | IV, | 96 |
Berichtigung und Erläuterung
- Auf S. 182, Zeile 3 v. o. lies "her Brant Smyt" anstatt "Herbrant Smyt." Er ist von 1499 bis 1524 Bürgermeister von Wismar gewesen.
- Ulrich vamme Haue, - S. 186, Zeile 3 v. o. -, war von 1496 bis 1523 Rathmann zu Wismar.
- S. 187, Zeile 11 v. u. lies "vor setten" statt "vorsetten".
- S. 192, Zeile 2 v. o. lies " T apperogge" statt " R apperogge."
- S. 193, Zeile 16 v. u. "- - alle dynck tho ij duren is" sollte nach Dr. F. Techens Meinung heißen: "- - tho ij [malen] dure r is." Ich meine, daß hier ein Sprüchwort vorliegt, das etwa bedeutet: jedes Ding hat zwei Seiten oder Enden oder Ausgänge. Duren (doren) = Thore, portae.
- S. 195, Zeile 9 v. u. "in dem Wardesken sez torecke" sollte lauten "in dem W e rde r sken se e to reken[en]."
L. v. Meyenn.


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Die Verpfändung meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition
- Die Schiffergesellschaft in Rostock
- Dr. Johann Kittel, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock, 1561-1563
- Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin
-
Alterthümer in der Umgegend von Rostock,
östlich der Warnow
- Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau
- Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf
- Urnenscherben von Kösterbeck
- Wendische Gefäßscherbe von Petschow
- Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu-Brodersdorf
- Der Lembken-Wall bei Billenhagen
- Urnenfeld, brandgruben und gerippe von der Feldmark Kassebohm
- Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen
- Urnenfelder auf der Feldmark Riekdahl den Cramonstannen gegenüber
- Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl
- Alterthümer von Alt-Bartelsdorf
- Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf
- Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen-Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel
- Wendische Wohn- und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf
- Zur Geschichte von Ankershagen
- Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in geschichtlicher Entwickelung



|


|
|
:
|
I.
Die Verpfändung Meklenburgischer Aemter unter Herzog Karl Leopold und deren Reluition
Von Generalmajor z. D. von Schultz.
~~~~~~
I. Die Verpfändung von 12 Domanial=Aemtern an Chur=Braunschweig=Lüneburg, an Braunschweig=Wolfenbüttel und an Preußen.
Am 31. Juli 1713 starb Herzog Friedrich Wilhelm von Meklenburg=Schwerin und ihm folgte sein Bruder Karl Leopold in der Regierung. Bald nach der Thronbesteigung dieses Fürsten nahmen die Streitigkeiten zwischen ihm einerseits, der Stadt Rostock und der meklenburgischen Ritterschaft andererseits eine solche Schärfe an, daß sich der Rostocker Senat sowohl, wie die Ritterschaft wiederholt klageweise an den deutschen Kaiser, als Reichsoberhaupt, wandten und um Abstellung ihrer Beschwerden baten.
Es liegt nicht in dem Rahmen dieser Schrift, näher auf diese Streitigkeiten einzugehen, welche zum Theil schon aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms übernommen waren und welche, wie fast alle Streitsachen zwischen der meklenburgischen Regierung und ihren Ständen in damaliger Zeit, ihren Ursprung darin hatten, daß Erstere Geldforderungen stellte, welche die Stände nicht bewilligen wollten oder konnten. Ob dem Herzog Karl Leopold hierbei alle Schuld allein beizumessen ist, wie sämmtliche Schriftsteller es thun, oder ob nicht auch die Stände zu weit gegangen sind, als sie wiederholt dem Herzoge die Mittel verweigerten, welche derselbe forderte, um eine Miliz aufstellen zu können, kräftig genug, um bei den Wirren, die der Nordische Krieg über Meklenburg brachte, Gesetz und Ordnung aufrecht erhalten zu können, ist eine Frage, welche bis jetzt noch nicht spruchreif erscheint.


|
Seite 2 |




|
Der Herzog ließ alle Rescripte des Kaisers, durch welche er ermahnt wurde, die als begründet befundenen Beschwerden der Ritterschaft und der Stadt Rostock abzustellen, völlig unbeachtet, beging dagegen solche Gewaltthätigkeiten im Lande, daß im Jahre 1716 ein Kaiserliches Conservatorium für die Stadt Rostock ausgefertigt - "aus sonderbaren und wichtigen Gründen," wie die Worte in dem Reichs=Concluso lauten - und die Ausführung desselben dem König Georg I. von England als Churfürsten von Braunschweig=Lüneburg, d. i. Hannover, und dem Herzog August Wilhelm von Braunschweig=Wolfenbüttel übertragen wurde.
Diesem Conservatorium folgte schon unterm 22. October des Jahres 1717 ein zweites für die meklenburgische Ritterschaft. In demselben hieß es: "Ebenso wie wir den der Stadt Rostock durch den Herzog Karl Leopold abgedrungenen Vergleich für null und nichtig erklärt haben, so wollen wir den Churfürst von Hannover und den Herzog von Braunschweig zu Conservatoren für diese höchst bedrängte Ritterschaft hiemit bestellen und Selbige ersuchen, daß sie in Kraft unserer ihnen hierdurch ertheilten vollkommenen Kaiserlichen Gewalt, alsofort und ohne weiteren Anstand mit genugsamer Kreis=Miliz in die meklenburgischen Lande einrücken und falls ihre Miliz nicht ausreichen sollte, von den benachbarten Obersächsischen und Niederrheinisch=Westfälischen Kreisen nach Anleitung der Executionsordnung anderweitige Kreistruppen requiriren."
Aus welchem Grunde diese Conservatorien nicht dem König von Preußen als dirigirendem Fürsten des Niedersächsischen Kreises übertragen worden sind, darüber sind sich die Schriftsteller nicht einig. Pfeffinger in seiner Geschichte des Braunschweig=Lüneburgischen Hauses erzählt, daß Friedrich Wilhelm I. als director agens des Kreises sich der Uebernahme der Conservatorien geweigert hätte. Für diese Behauptung erbringt Pfeffinger aber nirgends den Beweis; auch ist es bei dem Charakter dieses Königs höchst unwahrscheinlich, daß er nicht jede Gelegenheit gern wahrgenommen hätte, auf legalem Wege festen Fuß in Meklenburg zu fassen, schon der Werbungen wegen, ganz abgesehen von der feindseligen Stimmung, welche zwischen den Höfen von Berlin und Hannover herrschte. Glaubwürdiger ist die Version, welche als Grund die schon damals bestehende Eifersucht des Hauses Oesterreich auf die kräftig emporstrebende Macht der jungen Preußischen Monarchie anführt. In den Jahren 1716, 1717 und 1718 bereiteten sich in Wien schlimme Dinge gegen Preußen vor, die zu dem Bündnisse vom 5. Januar 1719 führten, welches der Kaiser von Oesterreich mit den Kurfürsten von Hannover und von


|
Seite 3 |




|
Sachsen abschloß und dessen Zweck war, Preußen mit Krieg zu überziehen, um es zu zerstückeln. Daß dieses Bündniß nicht zur That wurde, lag nicht an dem Willen der drei Contrahenten, sondern an der rasch wechselnden Kabinets=Politik des vorigen Jahrhunderts, in welcher die Freundschaften und Feindschaften der Höfe Europas bunt durch einander gewürfelt wurden, wie die Steine in einem Kaleidoskop.
Diese Geschichts=Episode ist in weiteren Kreisen wenig bekannt.Erst in neuester Zeit ist es Droysen gelungen, in den Archiven von Dresden und Hannover Einsicht von diesem Vertrage selbst, sowie von den ihn vorbereitenden Correspondenzen zu erhalten. Das Resultat seiner Forschungen hat er in einem Vortrage: "Die Wiener Allianz vom 5. Januar 1719" (gehalten in der Berliner Akademie am 7. Mai 1868 und abgedruckt in seinen "Abhandlungen zur neueren Geschichte" vom Jahre 1876) bekannt gegeben.
König Friedrich Willjelm I. erhielt schon mit Beginn des Jahres 1718 Kenntniß von der ernsthaften Gefahr, welche sich gegen Preußen vorbereitete und traf seine Maßregeln. Uebrigens stand der König nicht allein gegen die Koalition. Schon im Frühjahr erbot sich der Czar Peter, dem König 35 Bataillone und 100 Schwadronen zu Hülfe zu senden, wenn er ihrer bedürfe. Dieses Anerbieten, das der König bereitwillig annahm, führte zu dem Vertrage vom 28. Mai 1718, in welchem Friedrich Wilhelm 47 Bataillone und 60 Schwadronen zu dem russischen Heere in der Neumark stoßen zu lassen versprach, wenn es zum Kriege kommen sollte. Der König hatte aber, um den Czar von einer zu raschen Offensive abzuhalten, dem Vertrage die Klausel beigefügt, daß die kriegerischen Operationen nicht früher beginnen sollten, bis er, der König, den Zeitpunkt für gekommen erachten würde. Es war fraglich, ob der Czar den so verklausulirten Vertrag genehmigen würde; aber der König wollte Zeit gewinnen, nichts überstürzen. Wenn sich der Krieg vermeiden ließe, wollte er ihn vermeiden. Er kannte die ehrgeizigen Pläne seines Schwiegervaters, des Königs Georg I., genau. Er wußte, daß dieser, seit er im Jahre 1714 zu dem Kurhute von Hannover die englische Königskrone ererbt hatte, unablässig bestrebt war, sein Stammland zu vergrößern und daß jetzt sein nächstes Ziel war, sich kraft des ihm ertheilten Conservatoriums in Meklenburg festzusetzen und, wie der Ausdruck damals gebräuchlich war, das weiße Welfenroß bis an die Ostsee grasen zu lassen. Er wußte ferner, daß der König Georg die Seele der sich bildenden Koalition war, und daß die drei Mächte bereit waren, wenn er sich dem Einmarsch der Executionstruppen in Meklenburg widersetzen würde, über Preußen herzufallen. Außerdem fehlte ihm auch der Rechtstitel für eine solche gewaltsame Einmischung.


|
Seite 4 |




|
Denn wenn er die Uebertragung der Conservatorien an den verhaßten Nebenbuhler auch als bittere Kränkung empfand, und wenn der Kaiser nach der Reichsverfassung auch die Vollstreckung der Reichsexecution dem Directorium des betreffenden Kreises übertragen mußte, so gab dies Verfahren des Kaisers dem Könige doch niemals das formelle Recht, die hannoversch=braunschweigischen Executionstruppen mit den Waffen in der Hand anzugreifen. Der König würde sich hierdurch vor ganz Europa ins Unrecht gesetzt haben.
Aus diesem Grunde hatte der König, nach Erlaß des zweiten Conservatoriums, sich darauf beschränkt, in einem Schreiben an den Kaiser vom 29. März 1718 seine Rechte zu wahren. "Ich behalte mir alle Befugniß vor, weil ich als mitausschreibender Fürst des Niedersächsischen Kreises hierunter präterirt werden will," schrieb der König. Und unterm 7. September desselben Jahres ließ er durch seinen Minister Burkhard in Wien vorstellen, ob nicht, bevor mit der Execution begonnen würde, die ausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises beauftragt werden könnten, zusammenzutreten und die zwischen dem Herzog Karl Leopold und dem meklenburgischen Adel obschwebenden Differenzen zu vergleichen. Endlich wurde der König in Wien dahin vorstellig: "Wie sich Ihre Majestät doch nicht die geringsten Kosten machten, wenn Sie, der Reichsconstitution gemäß, die Execution dem Directorium des Kreises aufzutragen geruhen möchten."
Für alle diese Vorstellungen hatte man aber in Wien ein taubes Ohr. Am 5. Januar 1719 wurde das Bündniß zwischen Oesterreich, Sachsen und Hannover abgeschlossen, und Anfangs März rückten die hannoverschen und braunschweigischen Truppen in Meklenburg ein. Diese besetzten das ganze Land bis auf die Residenzstadt Schwerin und die Festung Dömitz, welche beiden Orte auf ausdrücklichen Befehl des Kaisers dem Herzog Karl Leopold verbleiben sollten.
Es wurde nun in Rostock eine Kaiserliche Commission eingesetzt 1 ) und eine Executionskasse zu Boizenburg errichtet, welcher alle Einkünfte des Landes überwiesen wurden. Der Herzog Karl Leopold, der nach dem Einrücken der Executionstruppen zuerst nach Berlin, dann nach Demmin und von dort nach Dömitz gegangen war, bemühte sich zwar beim Kaiser, die Aufhebung der Executions=Commission und die Zurückziehung der fremden Truppen zu bewirken; auch der König von Preußen, so wenig er sonst die von Karl Leopold gegen die


|
Seite 5 |




|
Ritterschaft und die Stadt Rostock ergriffenen Gewaltmaßregeln billigte und so unzweideutig er dies auch dem Herzog kund gegeben hatte, unterstützte den Letzteren auf das Nachdrücklichste beim Kaiser, aber eine Zurücknahme der verfügten Maßregel war schlechterdings nicht zu erreichen. Im Jahre 1721 siedelte der Herzog dann nach Danzig über und fuhr fort, von da aus die Regierung des Landes zu führen. Karl Leopold war nämlich, trotz der von ihm verübten Gewaltthätigkeiten und unleugbaren Grausamkeiten, nicht ohne Anhang im Lande geblieben. Die gesammte Geistlichkeit gehörte zu den Anhängern des Herzogs, und besonders in den Städten gab es eine große Partei, welche für ihn gegen die fremden Räthe der Kaiserlichen Commission Partei nahm. Während so der Herzog von Danzig aus, die Kaiserliche Commission aber, die ihren Stützpunkt hauptsächlich in der Ritterschaft fand, von Rostock aus das Land regierte, geriethen die Fäden der Regierungsmaschine, wie man sich wohl vorstellen kann, in grenzenlose Verwirrung.
In dieser Verfassung verblieben die meklenburgischen Angelegenheiten bis zum Jahre 1728, nicht zum Segen und zur Wohlfahrt des Landes. Da that der Kaiser einen Schritt, welcher allgemein Erstaunen und Unwillen, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus, hervorrief. Am 11. Mai 1728 erging ein Rescript des Reichshofrathes, durch das der Kaiser "propria autoritate" den Herzog Karl Leopold von der Regierung suspendirte - "vielleicht zur Jubiläumsfeier wegen der gerade vor 100 Jahren an den Herzogen Adolf Friedrich und Johann Albrecht vom Kaiser verübten ähnlichen Gewaltthat," sagt ein zu den Acten liegendes Pro memoria mit bitterer Ironie - und die Regierung des Landes dem Herzog Christian Ludwig, dem Bruder Karl Leopolds, übertrug, der, sie in dem Allerhöchsten Namen Ihrer Kaiserlichen Majestät als Administrator des Landes führen sollte. Zu gleicher Zeit wurde die Kaiserliche Commission aufgehoben und dem Herzoge von Wolfenbüttel aufgetragen, die Unterthanen ihrer Pflichten gegen den Herzog Karl Leopold zu entlassen, alle bisherigen Commissionsgeschäfte dem Kaiserlichen Herzog=Administrator zu übergeben, die gesammte Subdelegation in Rostock aufzulösen und die hannoverschen und braunschweigschen Truppen aus Meklenburg abzuberufen.
Unter demselben Datum wurde nunmehr das Kaiserliche Conservatorium vom Jahre 1717 auch auf den König von Preußen, als mitausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises, ausgedehnt, zum Zweck der Sicherstellung der Kaiserlichen Administration und der Vollstreckung der Kaiserlichen Aufträge. Das diesbezügliche Rescript lautete folgendermaßen:


|
Seite 6 |




|
"Nachdem Ihre Kaiserliche Majestät aus besonderer Kaiserlicher Bewegniß und Vertrauen angeregte Extension verfüget, als versehen sich Allerhöchstgedachte Ihro Kaiserliche Majestät, es werde der König als Herzog zu Magdeburg und mitausschreibender Fürst des Niedersächsischen Kreises solchen Kaiserlichen Auftrag willig auf= und annehmen, und desselben sich unterziehen, folglich autoritate caesarea mit den übrigen Kaiserlichen conservatoribus sammt und sonders, die dabei zum Zweck gesetzte vollkommene Sicherheit dem Herrn Herzog Christian Ludwig als Administrator angedeihen zu lassen."
Dies Decret wurde den mitausschreibenden Fürsten des Niedersächsischen Kreises bekannt gegeben und ihnen mit der Klausel "sammt und sonders" ein gleicher Auftrag ertheilt; insbesondere wird ihnen auch aufgegeben, dem Kaiserlichen Administrator auf sein Ansuchen durch Absendung von Kreis=Truppen Hülfe zu leisten.
Wir müssen hier einen kurzen Rückblick auf das Jahr 1719 thun. Wir haben vorhin erwähnt, daß das Bündniß vom 5. Januar 1719, das Oesterreich, Hannover und Sachsen zur Niederwerfung Preußens geschlossen hatten, nicht zur That wurde. Dies hatte seinen Grund in Folgendem:
Das Bündniß war vorzugsweise ein defensives. Der Artikel 1 und 2 des Vertrages geben als Zweck der Allianz an: gegenseitige Vertheidigung der Provinzen und Erblande, welche die Contrahenten im Reiche haben, sowie "die Conservation der Kreise, in welchen solche Provinz gelegen," so daß also auch, wenn in Meklenburg der Niedersächsische Kreis mit Feindseligkeit überzogen wurde, oder mit anderen Worten, wenn sich Friedrich Wilhelm dem Einrücken der Executionstruppen mit gewaffneter Hand widersetzte - was man Ende des Jahres 1718 als zuverlässig erwartete - der casus foederis eintrat. Ferner bestimmte Artikel 6, daß, wenn eine der nordischen puissancen - hierunter verstand man Rußland und Preußen - Ungarn angriffe, die Verbündeten die vertragsmäßige Hülfe leisten sollten, doch so, daß des Königs von England Truppen des Kaisers deutsche Provinzen decken, oder durch eine Diversion in des Aggressors deutsche Lande, wenn er deren hat, dessen Streitkräfte distrahiren sollten.
Daß hiermit Preußen gemeint war, lag auf der Hand. Als der preußische Minister Ilgen sechs Monate nach Abschluß des Bündnisses eine Abschrift desselben erlangte und dem König darüber Bericht erstattete, schrieb Letzterer dazu: "Es ist kein anderer als ich, den sie darunter verstehen; dem Withworth 1 ) in die Nase reiben!"


|
Seite 7 |




|
Der Angriff auf Preußen unterblieb also, da weder Preußen noch Rußland etwas unternahmen, was als casus foederis gelten konnte. Aber es trat auch noch ein anderes Ereigniß ein, das die Ausführung des Bündnisses unmöglich machte, ehe es noch völlig abgeschlossen war: am 11. December 1718 wurde Karl XII. von Schweden in den Laufgräben vor Friedrichshall erschossen.
Das Friedensbedürfniß regte sich jetzt mächtig in ganz Europa; vor Allen war England als vermittelnde Macht in Stockholm thätig, zum Frieden zu rathen und zu drängen, und Lord Withworth, bis dahin Gesandter des auf Vernichtung seines Schwiegersohnes sinnenden Kurfürsten von Hannover, verwandelte sich plötzlich in einen Friedensapostel des Königs von England, der in Berlin auf das Eifrigste den Beitritt Preußens zum Frieden zu betreiben hatte. Der Lord hatte gegenüber dem jähzornigen Könige, der ihn mit der Abschrift des Bündnisses vom 5. Januar 1719 in der Hand empfing und der über die Perfidie seines Schwiegervaters maßlos empört war, keinen leichten Stand. Indeß das Friedenswerk gelang; am 1. Februar 1720 schloß Preußen seinen Frieden mit Schweden, und als Rußland mit Schweden den Tractat von Nystadt am 10. September 1721 abschloß, war der nordische Krieg beendet.
So war durch die Gunst der Verhältnisse, sowie durch eigene Mäßigung eine ernste Gefahr von dem jungen Königreich Preußen abgewendet und diesem sogar, seinem Wunsche gemäß, die Reichsexecution gegen Meklenburg mit übertragen worden. Um Letzteres zu verstehen, müssen wir wiederum einen Blick auf die politische Lage in Europa nach Beendigung des Nordischen Krieges werfen.
Im Jahre 1725 - also 6 Jahre nach dem Bündniß vom 5. Januar 1719 - wurde zum großen Verdruß des Kaisers von Oesterreich die sogenannte hannoversche Allianz zwischen England, Frankreich und Preußen abgeschlossen. Schon in dem darauf folgenden Jahre bewog der Kaiser den König Friedrich Wilhelm I. insgeheim, von diesem Bündniß zurückzutreten und im Jahre 1727 ließ sich Alles zu einem Bruch zwischen dem Kaiser und England an, so daß die Gesandten Wien und London verließen. In diesem Jahr starb Georg I., und es kam im Jahre 1728 zum Abschluß eines neuen Abkommens zwischen Oesterreich und dem Hofe von St. James. Dieses beseitigte aber nicht alle streitigen Punkte, und das Verhältniß zwischen Kaiser Karl VI. und König Georg II. blieb bis zum Jahre 1731 ein gespanntes.
In diesem Zeitraum faßte der Kaiser, wie wir oben gesehen haben, den Entschluß, den Herzog Karl Leopold seines Thrones zu entsetzen und die Landes=Regierung in seinem - des Kaisers -


|
Seite 8 |




|
Namen durch den Herzog Christian Ludwig als Administrator führen zu lassen. Vermuthlich aus Dankbarkeit gegen den König von Preußen für dessen Lossagung von der Hannoverschen Allianz, aber auch eben so sehr in Voraussicht der Bewegungen, welche über diesen unerhörten Entschluß des Kaisers, einen deutschen Reichsfürsten so ohne Weiteres zu entthronen, in ganz Deutschland entstehen würden und um sich dagegen eine mächtige Unterstützung im Reiche zu erwerben, ward das Conservatorium vom 22. October 1717 auf den König von Preußen ausgedehnt. Von nun an hatte Friedrich Wilhelm I unstreitig ebensoviel Recht, sich der Meklenburgischen Sache anzunehmen, wie die übrigen Conservatoren, ja solches allein zu thun, wenn Letztere den Herzog=Administrator im Stiche ließen oder den König nicht aufforderten, mit ihnen gemeinsam zu handeln.
Der König von Preußen war überaus zufrieden mit dieser Wendung der Dinge und besonders mit der Ernennung Christian Ludwigs zum Administrator des Landes. Durch den Kaiserlichen Befehl, die Subdelegation zu Rostock aufzulösen und die hannoversch=braunschweigschen Truppen aus dem Lande zu ziehen, war Friedrich Wilhelms Besorgniß, der König von England möchte dauernd festen Fuß in Meklenburg fassen, völlig beseitigt, und so erklärte er am 9. November 1728 die Kaiserlichen Verordnungen für "billig, nöthig und dem Kaiserlich Obrist=Richterlichen Amt überall gemäß und sich willig und verbunden das Conservatorium mit zu übernehmen."
Im deutschen Reiche aber regte es sich gewaltig. Die Thronentsetzung eines Reichsfürsten war ein bedenklicher Präcedenzfall, und es regnete förmlich Proteste. Der König von England und der Herzog von Braunschweig, ebenso auch andere Reichsfürsten wurden beim Kaiser gegen die Aufhebung der Executions=Commission vorstellig und erreichten auch die Abänderung des Kaiserlichen Decrets vom 11. Mai 1728 in einigen Punkten, z. B. darin, daß der Kaiser erlaubte, daß 3-400 Mann von den Executionstruppen im Lande verbleiben durften. Im Wesentlichen aber blieb das Decret von Bestand; namentlich hob ein neues Kaiserliches Schreiben die Aufhebung der bisherigen Commission hervor und bestätigte die Administration des Landes durch den Herzog Christian Ludwig nochmals ganz besonders.
Weder der König von England, noch der Herzog von Braunschweig waren mit diesen Kaiserlichen Verfügungen zufrieden und wendeten sich wiederholt mit Vorstellungen an den Kaiser, aber auch an den König von Preußen, der sich dem Proteste der Commissionshöfe nicht angeschlossen hatte. "Wir wollen nimmermehr hoffen," so schrieben sie an den König Friedrich Wilhelm, "daß nun Ew. Majestät als eine der stärksten Säulen, die Ihr eigenes und Ihrer Nachkommen,


|
Seite 9 |




|
mithin aller Reichsstände Heil und Wohlfahrt so wesentlich afficirende Sache, sollten mit befördern helfen und sich gar zum principalsten Instrument desfalls gebrauchen lassen wollen."
Nach vielen Hin= und Herschreiben und verschiedenen Kaiserlichen Decreten brachte der Kaiser die Sache an die Reichsversammlung in Regensburg; allein es kam dort nicht einmal ein Reichsgutachten, geschweige denn ein Reichs=Deputations=Hauptschluß zu Stande, und die Dinge gestalteten sich immer verwirrter in Meklenburg, denn nun wußte bald Niemand mehr, wem er gehorchen sollte, ob dem angestammten Herzog Carl Leopold, ob der Executions=Commission in Rostock oder dem Herzog=Administrator.
Bei diesem Zustande der Dinge kam Karl Leopold im Jahre 1730 nach fast neunjährigem Aufenthalte in Danzig nach Meklenburg zurück und schlug seine Residenz in Schwerin auf. Da er von hier aus die Regierung unentwegt weiterführte, auch anfing, Truppen zu werben, forderte der Kaiser am 10. November 1730 in einem Excitatorium den König von England, den Herzog von Braunschweig und den König von Preußen auf, den Herzog Christian Ludwig in seiner Stellung zu schützen.
So lagen die Sachen in Meklenburg, als durch eine neue Constellation in der europäischen Politik eine andere Wendung der Dinge eintrat. Es hatten sich nämlich der Kaiser von Oesterreich und König Georg von England durch den Wiener Tractat vom 16. März 1731, in welchem Letzterer dem Kaiser die pragmatische Sanction, kraft deren später Maria Theresia den österreichischen Kaiserthron bestieg, garantirte, völlig ausgesöhnt, und die Folge hiervon war, daß der Kaiser sich in der Meklenburgischen Angelegenheit dem König Georg willfähriger zeigte.
Infolgedessen wurde am 30. October 1732 unter stillschweigender Aufhebung der Administration, welche de facto niemals zur Anwendung gekommen war, dem Herzog Christian Ludwig eine neue Kaiserliche Commission übertragen, ganz in der Weise, wie sie früher dem König von England und dem Herzog von Braunschweig übertragen gewesen war, und bestimmt, daß die Executionstruppen so lange zum Schutz des Herzogs im Lande verbleiben sollten, bis es dem Letzteren gelungen wäre, eine hinreichende Anzahl Truppen von einem dritten unbetheiligten Reichsstand in Sold zu nehmen.
So zufrieden der König von Preußen mit den Kaiserlichen Bestimmungen, betreffend die Einsetzung der Administration, die Aufhebung der Subdelegation in Rostock und die Entfernung der fremden Truppen aus Meklenburg, gewesen war, so unzufrieden und aufgebracht war er jetzt über die neue Schwenkung der Kaiserlichen Politik, die das Verbleiben dieser Truppen im Lande sanctionirte. Dem König


|
Seite 10 |




|
war das gefahrdrohende, hauptsächlich auf Antrieb des Königs von England in Scene gesetzte Bündniß vom 5. Januar 1719 noch in zu frischer Erinnerung. Das seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wieder erwachende Welfenthum, welches seit der Erhebung des Kurfürsten Georg Ludwig von Hannover auf den englischen Königsthron mächtig erstarkt war, hatte sich stets in so bewußten Gegensatz gegen das Haus Brandenburg gesetzt, daß es sogar, durch einige im kurhannoverschen Dienste stehende Meklenburger, heimlich versuchte, das jus succedendi, das Preußen in Meklenburg besaß, zu erschüttern; und nun wollte Hannover, welches, in Kurzem von 350 auf 500 Quadratmeilen angewachsen, die Elb= und Wesermündung in Besitz hatte, sich auch, wie offenkundig war und wie wir es später bei Reluition der Hannoverschen Aemter sehen werden, an der Ostsee in Meklenburg dauernd festsetzen. König Friedrich Wilhelm war entschlossen, dies unter keinen Umständen zu dulden.
Zunächst wandte er sich in einem überaus scharf gehaltenen Schreiben vom 28. März 1733 direct an den Kaiserlichen Commissarius, den Herzog Christian Ludwig, und bezeugte ihm sein Mißfallen über die neue Wendung der Dinge. "Wir können nicht leugnen," so schrieb der König, "daß Wir fast alle Geduld bei der Sache zu verlieren anfangen und bei fernerem Verbleib der fremden Kriegsvölker in den Meklenburgischen Landen uns nicht länger werden entbrechen können, auf die Sicherstellung Unseres an denselben eventualiter habenden jus succedendi näher bedacht zu sein, zu solchem Ende auch eben so viel von Unseren Kriegsvölkern, als Andere daselbst haben, hineinrücken und verlegen, auch auf eben dem Fuß, wie von Anderen geschieht unterhalten zu lassen. Ew. Liebden würden aber alsdann Ursache davon sein, wenn Sie, wie Wir doch nicht hoffen wollen, etwa aus eigener Bewegniß oder auch von Auswärtigen dazu indiciret, durch Zurückhaltung der Reversalen 1 ) oder auf andere Art selbst behinderten, daß dero Landes=Administration nicht zu Stande kommen könnte."
Nachdem der Herzog geantwortet, daß er lediglich die Befehle des Kaisers vollziehe, erklärt sich der König vorläufig zufrieden gestellt, verspricht dem Herzog seinen ferneren Schutz, fügt aber hinzu, daß er diesen auch gewähren werde, ohne dazu requirirt zu sein.
Wie bekannt, erließ Carl Leopold am 7. September 1733 ein Patent, durch welches er alle wehrfähigen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren gegen seinen Bruder, den Herzog Christian Ludwig


|
Seite 11 |




|
unter die Waffen rief. Trotzdem Letzterer sofort in einem Patente seine Unterthanen von dem Aufruhr abmahnte, brach ein Aufstand aus, der aber bald durch aus Hannover und Braunschweig herbeigezogene Truppen unterdrückt und am 1. October desselben Jahres durch Gefangennahme des Meklenburgischen Generals Tilly beendet wurde.
Karl Leopold erließ hierauf ein Schreiben an den Kaiser, in dem er ihn um Wiedereinsetzung in sein Land bat. Dies Schreiben war von einem Intercessionsschreiben des Königs von Preußen begleitet. Beide Schreiben blieben indessen ohne Erfolg.
Am 16. October übermittelte der Preußische General=Lieutenant v. Schwerin - derselbe war vorher in Diensten Karl Leopolds gewesen und hatte im Jahre 1719 den Executionstruppen bei ihrem Einrücken in Meklenburg bei Walsmühlen eine Schlappe beigebracht -, von Lenzen aus, wo sein zu diesem Zwecke zusammengezogenes Truppencorps stand, dem Herzog=Commissarius ein Schreiben des Königs, in welchem Letzterer dem Herzog sein Mißvergnügen ausdrückte, daß er sich bei den obschwebenden Wirren nicht an ihn gewendet, sondern Hülfe bei Fremden gesucht habe. Er - der König - sei director agens des Niedersächsischen Kreises und da allen Fürsten des Kreises "sammt und sonders" das Kaiserliche Protectorium ertheilt sei, so sei er in erster Linie um Beistand anzusprechen gewesen, welchen er auch im Einvernehmen mit den übrigen Conservatoren gern geleistet haben würde. Weiter meldete dann der General, daß er Befehl habe, mit einem Truppencorps in Meklenburg einzurücken und daß dem Herzoge große Unannehmlichkeiten daraus entstehen könnten, wenn von den hannoversch=braunschweigischen Truppen einseitig, also ohne seines Königs Mitwirkung, etwas Weiteres gegen den Herzog Karl Leopold unternommen werden würde. Ein Schreiben ähnlichen Inhalts erließ der General v. Schwerin an den hannoverschen Generalmajor v. Campen, welcher die Executionstruppen commandirte und lud denselben zu einer mündlichen Conferenz ein.
Letzterer erwiderte umgehend, ihm schienen weitere gemeinschaftliche Maßregeln nicht mehr nöthig, da ja der Aufstand völlig gedämpft und er die aus Hannover herangezogenen Regimenter bereits in ihre Garnisonen zurückgeschickt habe. Uebrigens habe er sofort eine Staffete abgesandt, um Befehle einzuholen.
Inzwischen - am 5. October - hatte der Kaiser durch seinen Gesandten in Berlin Vorstellungen thun lassen, um zu verhüten, daß preußische Truppen in Meklenburg einrückten, da ja ein Grund hierfür jetzt überall nicht mehr vorhanden sei.
Am 19. October rechtfertigt der Herzog Christian Ludwig in einem Schreiben an den König von Preußen seine Handlungsweise


|
Seite 12 |




|
und erklärt, daß er als Kaiserlicher Commissarius lediglich die Befehle des Kaisers auszuführen habe. Dasselbe erklärt er dem General v. Schwerin.
Hierauf erläßt Letzterer am 21. October - allerdings post festum - ein Dehortatorium an die meklenburgischen Tumultuanten und rückt mit zwei Cavallerie=Regimentern und einem Infanterie=Regiment in Meklenburg ein. Da der Herzog den preußischen Truppen Quartier und Verpflegung verweigert, verschafft der General sich Beides auf eigne Hand, schickt auch Truppen zum Schutz des Landtags ab, der gerade im Begriff war, sich zu versammeln.
In Parchim wurde eine preußische Kasse errichtet, in welche von jetzt an die Einkünfte der von den preußischen Truppen besetzten Aemter flossen, die bisher in die oben erwähnte Executionskasse nach Boizenburg abgeführt waren.
Als sich Christian Ludwig über die zu großen Kosten beschwerte, welche die vielen fremden Truppen dem Lande machten, wies der König ihn an den Kaiser; der Abmarsch seiner Truppen würde sich ganz nach dem der übrigen Commissionstruppen richten.
Inzwischen war es dem Herzog gelungen, zwei Infanterie=Regimenter - ein holsteinisches und ein schwarzburgisches - in seinen Sold zu nehmen.
Der Kaiser, der wohl einsah, daß es ihm nicht gelingen würde, den König von Preußen zu bewegen, seine Truppen aus Meklenburg zu ziehen, wenn die beiden anderen Commissionsmächte nicht das Gleiche thäten, erließ nunmehr ein Rescript, demzufolge die hannoverschen und braunschweigschen Truppen bis auf 400 Mann zum Schutz der Executionskasse in Boizenburg, das Land verlassen und aus letztgenannter Kasse die Verpflegungsgelder für das holsteinsche und das schwarzburgsche Regiment gezahlt werden sollten. Dagegen sollten alle preußischen Truppen abmarschiren und alle in der Parchimer Kasse befindlichen Gelder an den Herzog abgeliefert werden.
Hieraufhin marschirten die hannoversch=braunschweigschen Truppen bis auf 400 Mann, welche in Boizenburg in Garnison blieben, ab; die preußischen ebenfalls, bis auf 200 Reiter, welche in Parchim zurückblieben. Außerdem ließ der König eine Quote von 5000 Thlr. zum Unterhalt der vom Herzog in Sold genommenen Regimenter aus der Parchimer Kasse auszahlen. Zu Weiterem, erwiderte er dem Kaiser, könne er sich nicht herbeilassen, da ja auch die Boizenburger Kasse von Bestand bliebe.
Der Kaiser war über die Unbötmäßigkeit des Königs von Preußen auf das Aeußerste erzürnt und ließ ihm durch seinen Gesandten in Berlin sein Mißfallen darübcr ausdrücken, daß er sich mit den


|
Seite 13 |




|
beiden anderen, vom Kaiser berufenen Commissionsmächten auf gleichen Fuß setzen und durch sein Benehmen den mit allseitigem Einverständniß im Jahre 1732 festgesetzten Plan verhindern wolle. Das Decret vom 11. Mai 1728, wodurch der Kaiser das Conservatorium auch auf Preußen ausgedehnt hatte, ignorirte derselbe völlig. In demselben Sinne ließ Christian Ludwig dem Könige wiederholte Vorstellungen machen, aber vergeblich. Der König blieb bei seinem Entschluß, sich in Allem nach dem Benehmen des Königs von England und des Herzogs von Braunschweig richten zu wollen. Im November desselben Jahres - 1734 - ließ er zwar die gerade in der Parchimer Kasse befindlichen Gelder - 16000 Thlr. - an den Herzog auszahlen, die Kasse selbst aber blieb bei Bestand.
Da es dem Herzog nicht möglich war, beim Abmarsche der Truppen die von Hannover und Braunschweig aufgewendeten Executionskosten aufzubringen, wurden dem König von England und dem Herzog von Braunschweig im Jahre 1735 acht Aemter, und zwar die Aemter Boizenburg mit dem Elbzoll, Bakendorf, Wittenburg, Zarrentin, Rehna, Gadebusch, Grevesmühlen und Meklenburg als Special=Hypothek - antichretischer Besitz 1 ) - vom Kaiser förmlich übergeben, deren Einkünfte bis zur Rückzahlung der Schuldsumme in die Boizenburger Executionskasse fließen sollten.
Da dem König von Preußen für seine Geldforderungen vom Kaiser aber keine Aemter als Hypothek zugesprochen wurden, half sich derselbe selbst und nahm die vier Aemter, die er bisher besetzt gehalten hatte, ebenfalls als Special=Hypothek in Besitz. Dies waren die Aemter Plau, Wredenhagen, Warnitz und Eldena.
Nach mehrfachen Kaiserlichen Rescripten und Vorstellungen des Herzogs Christian Ludwig, in denen die Rückgabe der vier Aemter und die Zurückziehung der preußischen Truppen wiederholt gefordert wird, erklärt der König am 21. April 1739 endgültig, daß er die Aemter sofort zurückgeben würde, wenn seine Geldforderungen befriedigt wären und daß die Ersetzung der Unkosten, um deretwillen er die Aemter in Besitz genommen, ihm schon vorlängst vom Kaiser zugebilligt sei.
Nach dem Tode Karl Leopolds im Jahre 1747 und der Thronbesteigung Christian Ludwigs ertheilte König Friedrich II. von Preußen durch den Preußischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten die Versicherung, daß die Aemter sofort zurückgegeben werden sollten, wenn Hannover ein Gleiches thäte und wenn die Forderungen bezahlt


|
Seite 14 |




|
wären. Diese Erklärung wird in dem §. 8 des unterm 14. April 1752 abgeschlossenen förmlichen Hausverbündnisses noch besonders bestätigt.
Am 29. October 1753 empfiehlt dann der König von Preußen dem Herzog Christian Ludwig die Einlösung der hannoverschen Hypothek sehr angelegentlich und bedingt sich nur vollkommene Gleichstellung aus, falls etwas Neues mit Hannover abgemacht würde.
Diese Geschichtserzählung der Verpfändung der Aemter ist einem Exposé des Geheimen Kanzleiraths Faull entnommen, das dieser im Jahre 1769, als die meklenburgische Regierung beabsichtigte, die von Preußen verpfändeten Aemter einzulösen, auf Befehl des Geheimen Raths=Präsidenten Grafen v. Bassewitz anfertigte. Die Regierung zog nämlich ernstlich in Erwägung, ob nicht, da jegliche Legitimation des Kaisers, die meklenburgischen Aemter in Besitz zu nehmen, für Preußen fehlte und da in den Regierungsacten eine förmliche .Zubilligung der Kosten=Entschädigung durch den Kaiser an Preußen nirgends aufzufinden war, die Herausgabe der Aemter ohne Geldentschädigung vom König von Preußen zu verlangen event. beim Reichshofrath einzuklagen sei. In diesem Exposé giebt Faull nach einer sehr ausführlichen Geschichts=Erzählung sein Rechtsgutachten ab, tritt also gewissermaßen als Kronjurist auf. Die meklenburgische Regierung trat den Ausführungen Faulls völlig bei und beschloß, die Verpfändung der vier Aemter als zu Recht bestehend anzusehen und auf dieser Grundlage die Verhandlungen mit Preußen zu eröffnen.
Es dürfte von Interesse sein, die Ausführungen des Geheimen Kanzleiraths Faull hier in Kurzem anzuführen, da mehrfach die Ansicht verbreitet ist, daß die Einmischung des Königs von Preußen in die Meklenburgischen Angelegenheiten ungesetzlich war; derselbe schreibt wörtlich:
"Ich muß offenherzig bekennen, daß ich bei Ausarbeitung dieser Geschichte, von dem Königlich Preußischen Betragen, andere Gedanken zu fassen angefangen habe, als ich bisher gehabt; nicht, daß ich mich unternehmen sollte, solches ganz tadelfrei zu erklären; ich unterstehe mich nur nicht, nach den Regeln der strengen Gerechtigkeit selbiges zu verurtheilen. Ich mag die Sache beschauen, soviel ich will, so fließt alle Schuld von dem Königlich Preußischen Benehmen auf den Wienerschen Hof oder den Reichshofrath, den ich auch hier nur als das Instrument zu der Ausführung der politischen Ansichten von jenem ansehen kann, zurück. Der König von Preußen ist nur in der Ausführung dieser Absichten mit hineingegangen, weil sie seinem Eigennutz willkommen waren. Das ist, Deutsch zu sagen, seine ganze Sünde; und vielleicht giebt es sehr wenige Fürsten in der Welt, die nicht ohne alles Bedenken an seiner Stelle eben dasselbe gethan hätten."


|
Seite 15 |




|
Dann beleuchtet Faull ausführlich, wie sich die Sache stellen würde, wenn sie im Wege Rechtens ausgemacht werden sollte, und schließt mit den Worten:
"Ich würde im Wege Rechtens keinen Muth haben, die Sache gegen den König von Preußen zu führen, wenn er auch ein Monarch wäre, gegen den sich ein gerichtlicher Streit führen läßt. Der Wienersche Hof ist die einzige Quelle auch dieses Unglücks des Herzoglichen Hauses. Es würde so vergeblich und unrathsam sein, sich über den Preußischen Hof zu beschweren, als ich es in der That nach meiner wenigen Einsicht und nach meinem Gewissen widerrechtlich finden würde, durch ein danach eingerichtetes Pro memoria diesen Hof schlechthin eines ungerechten Besitzes zu beschuldigen. Er ist es höchstens in Ansehung der Form. Aber wer kann es einem Fürsten, wie dem König von Preußen, anmuthen, nach der Pfeife des Reichshofraths auf= und abzutreten, ohne für seine Mühe Bezahlung zu verlangen oder, wenn ihm diese verweigert wird, sich selbst an dem Schwächeren bezahlt zu machen."
Faull ist außerdem der Ansicht, daß der König von Preußen auch durch ein Kaiserlich=Richterliches Decret die Ersetzung der Unkosten zugebilligt erhalten habe, denn in dem oben erwähnten Schreiben vom 21. April 1739 beriefe sich der König ja ganz ausdrücklich auf ein solches Erkenntniß, welches sich allerdings in den Acten des Schweriner Archivs nicht vorfände, aber bei der großen Unordnung, die in diesem Zeitraum in allen Branchen der Verwaltung geherrscht hätte, leicht abhanden gekommen sein könne, da doch nicht anzunehmen sei, daß die Preußische Regierung das Vorhandensein eines solchen Actenstückes erdichtet haben sollte.
Als Einleitung diene eine kurze Bemerkung über die Reluitions=Commission und die Reluitions=Kassen (s. Balcks Finanzwesen, §. 286):
Zur Einlösung derjenigen Domanial=Aemter, welche wegen aufgewandter Reichsexecutionskosten an Chur=Braunschweig=Lüneburg und Braunschweig=Wolfenbüttel verpfändet waren - also zur Begleichung landesherrlicher Schulden - wurde im Jahre 1765 eine Reluitions=Commission nebst Relutitions=Kasse - die sogenannte neuere Reluitions=Kasse - gebildet. Die Aemter wurden mit landesherrlicherseits aufgeliehenen Geldern eingelöst und der Verwaltung dieser Commission


|
Seite 16 |




|
zu dem Zwecke unterstellt, daß aus ihren Erträgnissen die contrahirte Darlehnsschuld verzinst und allmählich getilgt werde. Die Wirksamkeit dieser Commission wurde im Jahre 1787 auch auf andere, von Preußen reluirte Aemter und im Jahre 1803 auf Abtragung der zufolge des Malmöer Vertrags erwachsenen Schuld ausgedehnt. Im Januar des Jahres 1888 wurden die Commission und die Kasse aufgelöst.
Schon früher, zu Ende des 17. Jahrhunderts, waren einzelne Reluitionskassen für verpfändet gewesene und ausgelöste Aemter gebildet und nach erfülltem Zweck wieder aufgelöst worden. Als im Jahre 1752 die Aemter Crivitz und Lübz für 270 000 Thlr. aus dem Pfandbesitz der Familie von Barnewitz ausgelöst waren, wurden die Einkünfte dieser Aemter in die sogenannte ältere Reluitionskasse gelegt, welche dann später mit der oben erwähnten neueren Reluitionskasse vereinigt wurde.
Die acht an den König Georg II. als Churfürsten von Braunschweig=Lüneburg und an den Herzog Ludwig=Rudolf von Braunschweig=Wolfenbüttel verpfändeten Aemter waren:
1) das Amt Boizenburg mit dem Elbzoll. Dasselbe
zählte 1410 leibeigene Köpfe;
2) das Amt
Wittenburg mit 1199,
3) das Amt Gadebusch
mit 715,
4) das Amt Rehna mit 1102,
5)
das Amt Grevismühlen mit 1985,
6) das Amt
Zarrentin mit 681,
7) das Amt Meklenburg
mit 629 und
8) das Amt Bakendorff mit 1151 Leibeigenen.
In Summa 8872 leibeigene Leute; außerdem noch die Bewohner der Städte, welche freie Leute waren.
Schon im Jahre 1734 hatte sich die Meklenburgische Ritterschaft erboten, zur Bezahlung der Executionskosten 1 200 000 Thlr. in Holland anzuleihen, um die sonst unausbleibliche Verpfändung der Domänen an Chur=Braunschweig= und Braunschweig=Wolfenbüttel zu verhüten. Freilich ließ sich eine solche Anleihe auch nur gegen Versetzung der Einkünfte aus den fürstlichen Domänen bewerkstelligen, allein es war ein Unterschied, ob man die Einkünfte der Domänen an Privatleute verschrieb, denen man die geliehenen Summen nach Belieben zurückzahlen konnte, im üebrigen aber in Besitz der Domänen blieb, oder ob man die Aemter an eine fremde Großmacht in der Weise abtrat, daß Letztere die ganze Verwaltung mit ihrem Personal übernahm und die Städte durch ihre Truppen besetzen ließ. Bei der Ritterschaft fehlten aber auch die Hintergedanken nicht.


|
Seite 17 |




|
Dieselbe knüpfte nämlich an ihre Bereitwilligkeit, dem Herzog zu helfen, die Bedingung, daß außer den 1 200 000 Rthlr. zur Deckung der Executionskosten noch 400 000 Rthlr., ebenfalls gegen Verpfändung der Einkünfte fürstlicher Domänen, aufgenommen und diese der Ritterschaft als Abschlagszahlung auf die Forderungen, welche dieselbe noch an die Regierung zu machen hatte, übergeben werden sollten. 1 ) Hierauf ging die Regierung nicht ein und die Sache zerschlug sich.
Es wurden noch verschiedene andere Projecte zur Abzahlung gemacht, aber keines realisirt; man suchte Gelder in Hamburg und im Hannoverschen, bei Christen und Juden; in Altona bei Ruben und Moses Fürst; man wollte die Schuld in 8 Jahren zurückzahlen zu 6 und 4 1/2 %. Auch der Kaiser Karl VI. mischte sich in die Sache; vermuthlich um zu verhindern, daß sich der König von Preußen in derselben Weise in Meklenburg schadlos hielte, wie der König von England. Im Jahre 1734 rieth er in Holland Gelder negociiren zu lassen. Herzog Christian Ludwig wollte nun zunächst die fremden Mächte befriedigen und versuchte im Geheimen, ohne daß die Ritterschaft etwas merkte, die Executionskosten in der Höhe von 1 200 000 Rthlr. in Holland anzuleihen. Das Geheimniß war indessen vor den wachsamen Augen der Ritterschaft nicht zu bewahren, und aus der Anleihe wurde nichts.
Auch im Jahre 1738 drängte der Kaiser den Herzog, die Executionsmächte und seine Ritterschaft, welche letztere die ihr zustehenden 500 000 Rthlr. beim Reichshofrath eingeklagt hatte, zu befriedigen - ebenfalls ohne Resultat.
Im November 1748 beauftragt der Herzog einen Oberst=Lieutenant von Gottschall, welcher in Diensten des Königs von Polen steht und in Nordhausen wohnt, nach Holland zu reisen und dort zu versuchen, 18 Tonnen Goldes - 1 800 000 Rthlr. - anzuleihen, um die Aemter einzulösen. Gottschall legt dem Herzog die abenteuerlichsten Pläne vor; er wisse aus sicherer Quelle, daß der Großfürst=Thronfolger von Rußland nicht allein von der Kaiserin, sondern auch von den russischen Reichsständen mehrere Millionen Rubel als dons gratuits erhalten habe, welche er gegen sichere Hypothek außer Landes anlegen möchte. Gelänge es, diese Gelder anzuleihen, so gäbe dies zu gleicher Zeit eine gewünschte Gelegenheit zu einem Substdientractat zwischen dem Herzoge einerseits und dem Großfürsten, als Herzog


|
Seite 18 |




|
von Holstein=Gottorp, und der Czarin andererseits. Der Herzog könne dann in aller Stille 4, 5, 6, ja 10 Regimenter anwerben, welche mit russischen Subsidien in den meklenburgischen Landen unterhalten würden. Es sei reichskundig, daß durch solche Subsidien=Tractate Hannover groß geworden wäre und die Kurwürde erlangt habe; auch Hessen=Kassel, Braunschweig, Sachsen und Gotha seien dadurch ansehnliche Staaten geworden. Als der Herzog auf diese Projecte nicht einging, reiste Gottschall nach Amsterdam, um dort Gelder zu suchen; die 12 Aemter sollten nach ihrer Auslösung als Sicherheit dienen, die Schuld sollte nach und nach in Posten von 50-80 000 Rthlr. abgetragen und zu 4, höchstens 5 % verzinst werden. Die Generalstaaten nahmen aber in dem Jahre selbst Gelder im Lande auf zur Unterhaltung ihrer Truppen, und so scheiterte dies Project gänzlich.
Im nächsten Jahre - 1749 - tritt Gottschall mit einem neuen Plan hervor. Er hat auf der Reise am Zerbster Hofe seine Aufwartung gemacht und ist ganz bezaubert von der Liebenswürdigkeit und Schönheit der verwittweten Regentin von Anhalt=Zerbst, der Mutter der Großfürstin Peter von Rußland.
Er schildert dies dem Herzog in den glühendsten Farben, und Letzterer ist zuerst nicht abgeneigt. "Die Fürstin ist 37 Jahre alt, aber schön und so jung aussehend, daß man sie für 26 hält; dabei besitzt sie viel Vermögen und genießt eines großen Ansehens in Wien und Petersburg," schreibt Gottschall.
Der Herzog sollte aber keinen Heiraths=Antrag machen, sondern die Regentin sollte zunächst bewogen werden, das Geld vom Großfürsten zu erlangen; es sei nur nöthig, demselben auf das Darlehen eine Hypothek auf die zurückerlangten Aemter zu verschreiben gegen Zinsen und Rückzahlung in kleinen Posten. Später würde dann die Hypothek auf den Namen der Fürstin als vermählten Herzogin von Meklenburg umgeschrieben. Dann Subsidientractat, dann die Kurfürstenwürde! ...
Da sich der Unterhändler, der zu gleicher Zeit bat, ihn als Oberst in meklenburgischen Diensten anzustellen, immer mehr als Projectenmacher entpuppte, wies der Herzog denselben schließlich kurzweg ab.
Als König Georg von England im Frühjahr des Jahres 1748, wie er dies alljährlich zu thun pflegte, seine Kurlande besuchte, sandte Herzog Christian Ludwig seinen Comitialgesandten in Regensburg, den Baron Teuffel von Pürkensee, nach Hannover, um den König zu becomplimentiren und über die Rückgabe der Aemter mit ihm zu


|
Seite 19 |




|
unterhandeln. 1 ) Baron Teuffel wurde in Audienz vom Könige empfangen, aber nicht übermäßig freundlich behandelt.
"Ich muß mich sehr wundern," sagte der König übel gelaunt, "daß der Herzog, dem doch noch vor kurzem so sehr daran gelegen war, von meinen Truppen beschützt zu werden, sie nun aus dem Lande heraus haben will."
"Die Verhältnisse haben sich inzwischen geändert, Ew. Majestät, und mein Herr, der Herzog, will zahlen, was billig ist," entgegnete der Gesandte.
"Die Geheimen Räthe werden Ihnen weiteren Bescheid geben," brach der König kurz ab.
Noch unfreundlicher erwiesen sich die hannoverschen Minister. Der Geheimrath von Münchhausen sagte, in dem meklenburgischen Schreiben hätte nichts von Bezahlung der Executionskosten gestanden, das habe ihn auf den widrigen Gedanken gebracht, als wolle der Herzog sich völlig über die früher ergangenen Kaiserlichen Conclusa hinwegsetzen.
"Aber der Zweck meiner Sendung ist ja gerade, mich wegen dieser Kosten mit der churfürstlichen Regierung abzufinden," entgegnete der Baron Teuffel erstaunt.
Aber man blieb dabei. "Eine Abfindung ist nicht nöthig," sagte Münchhausen, "in den Kaiserlichen Decreten, welche sämmtlich von dem Herzog agnoscirt sind, ist klares Maß und Ziel in der Sache gegeben. Sie wissen das ja in Schwerin so gut wie wir." Baron Teuffel übergiebt nun ein schriftliches Pro memoria. Münchhausen erwidert ihm mündlich: Alles würde leichter gehen, wenn der Herzog nur erst wieder mit seinen Ständen in Harmonie wäre.
"Aber das hat doch mit unseren Verhandlungen nichts zu thun!" sagte der Gesandte.
"Direct allerdings nicht, aber ich muß dies erwähnen; Ihre Ritterschaft hat sich um Beistand an uns gewandt, wir haben ihr aber gesagt, wir könnten ihr nicht helfen, sie solle sich mit dem Herzog vertragen."
"Ich glaube bestimmt, daß die hannoversche Regierung unseren Landständen diesen Rath nicht gegeben hat, Ew. Durchlaucht. Hier ist nichts zu machen; der König denkt nur an sein Vergnügen!" schloß der Baron seinen Bericht.


|
Seite 20 |




|
Endlich beantwortet Münchhausen das Pro Memoria: bevor man auf etwas Weiteres sich einlassen könne, müsse der Herzog declariren, daß er alle Kaiserlichen Decrete anerkenne, daß die Hypotheken=Aemter niemals getrennt zurückverlangt, sondern so lange unter der jetzigen Administration belassen werden sollten, bis die ganze Summe völlig abgetragen sei. Ueber die Höhe der Summe waren keine bestimmten Angaben zu erlangen.
"Da man mir jetzt erklärt hat, nur schriftlich unterhandeln zu wollen, so bitte ich Ew. Durchlaucht, mich abberufen zu wollen, das Leben ist außerdem hier furchtbar theuer!" schrieb der Gesandte. Im Juli kehrte Baron Teuffel nach Schwerin zurück.
Da bei der Ueberweisung der Pfandämter an Hannover der Herzog von Meklenburg ungeschmälert im Besitze der Landeshoheitsrechte geblieben war, konnte es nicht ausbleiben, daß hier und da ärgerliche Competenzconflicte entstanden. So versagte z. B. der Commandeur der englischen Truppen in Boizenburg einem meklenburgischen Executions=Commando, welches der Herzog dorthin entsendet hatte, um den widerspenstigen Magistrat zum Gehorsam zu bringen, den Eintritt in die Stadt. Im Jahre 1750 wurde der Oberjägermeister von Bergholtz nach Hannover an den König gesandt, um diese Sache zu erledigen.
Im Mai des Jahres 1752 wird Herr von Bergholtz wiederum an den König nach Hannover gesandt, diesmal aber um zu sondiren, ob der König nicht geneigt sei, die Aemter zurückzugeben und unter welchen Bedingungen? Der König war sehr gnädig, ging aber auf die Sache selbst überhaupt nicht ein. Ebenso wichen die Minister aus. Als Bergholtz darauf ein Pro Memoria übergiebt, erwidert das Ministerium, man hege am hannoverschen Hofe die freundschaftlichste Zuneigung für den Herzog; dabei könne es aber sehr wohl bestehen, daß der König sich im Besitze dessen zu erhalten suche, was ihm gerichtlich zuerkannt sei. Die Verhandlung verlief ohne jedes Resultat.
In diesem Jahr erschien im Verlag von Joh. Andreas Berger in Rostock und von Jacob Boedner in Wismar eine Schrift, in welcher ein cand. juris Baleke seine "Gedanken von der Wiedererstattung der in die Hände benachbarter Mächte gerathenen meklenburgischen Aemter" ins Publikum brachte. Sein Ideengang war, daß Hannover und Braunschweig durch unrechtmäßigen Richterspruch des Reichshofrathes in den Besitz der Aemter gelangt seien, da ein Souverain nicht gehalten wäre, die von seinem Vorgänger in der Regierung contrahirten Schulden zu bezahlen. Diese Schrift, welche der Regierung, die gerade jetzt ernstlich daran dachte, von neuem Verhandlungen mit


|
Seite 21 |




|
Hannover anzuknüpfen, sehr ungelegen kam, wurde confiscirt; der unbesonnene Verfasser aber wurde für dieses Mal pardonnirt, demselben aber die härtesten Strafen angedroht wenn er es noch einmal wagen würde, ein ähnliches niederträchtiges Schriftstück zu publiciren.
Im Sommer des Jahres 1753 arbeitete der Kammerrath und Landrentmeister Balck 1 ) einen Plan zur Reluition der Aemter aus, welcher von den Ministern - Graf Bassewitz, Baron Dittmar und Geheimrath Schmidt - genehmigt wurde. Balck, der in der Nähe von Hannover Verwandte hatte, wurde von der Regierung nicht in officieller Mission abgesandt, sondern sollte sich dort unter dem Vorwande, eine Brunnenkur gebrauchen zu wollen, aufhalten. Der Plan, den er der hannoverschen Regierung vorlegen sollte, war folgender:
Die meklenburgische Regierung wußte aus zuverlässigen Nachrichten, welche ihr durch ihren Geschäftsträger in Wien, den Edlen v. Schmidt, zugegangen waren, daß sich die hannoverschen Forderungen zusammensetzten:
Aus den eigentlichen Executionskosten, welche durch die Mobilmachung und durch das Einrücken der hannoversch=braunschweigschen Truppen in Meklenburg im Jahre 1719 entstanden waren und die sich auf
| 864 061 Rthlr. | 27 ß. | 2 Pf. | beliefen; ferner aus den durch die Ausgabe dieses Kapitals erwachsenen rückständigen Zinsen in der Höhe von: |
| 496 374 Rthlr. | 46 ß. | 7 1/8 Pf.; | sodann aus den sogenannten Tumultskosten, welche durch das Wiedereinrücken der hannoversch=braunschweigschen Truppen, die zum großen Theil Meklenburg schon verlassen hatten, entstanden waren, als Herzog Karl Leopold im Jahre 1733 den unglücklichen Versuch machte, sich der Regierung des Landes wieder zu bemächtigen, mit: |
| 75 437 Rthlr. | 43 ß. | 8 Pf. | und aus den darauf rückständigen Zinsen mit: |
| 67 894 Rthlr. | 4 ß. | 9 3/5 Pf. | |
| 1 503 768 Rthlr. | 26 ß. | 2 Pf. | Hierzu traten noch das Kapital und die Zinsen, welche der König von England während der Wirren unter |


|
Seite 22 |




|
| der Regierung Karl Leopolds der meklenburgischen Ritterschaft geliehen hatte und welche von Herzog Christian Ludwig übernommen waren, in der Höhe von: | |||
| 124 000 Rthlr. | |||
| 1 627 768 Rthlr. | 26 ß. | 2 Pf. |
Balck sollte es bewirken, daß der König die hannoverschen Stände bewöge, diese Summe, von der man hoffte, daß Letzterer aus angeborener Generosität und den bedrängten finanziellen Zuständen Meklenburgs Rechnung tragend, auf 15 Tonnen Goldes ermäßigen würde, der meklenburgischen Regierung zu 4 % anzuleihen. Gegen Zahlung dieser Summe sollten alle 8 Pfandämter an Meklenburg zurückgegeben und die englischen Garnisonen aus dem Lande gezogen werden. Zur Sicherheit sollten den hannoverschen Landständen dieselben 8 Aemter als Special=Hypothek in der Weise verschrieben werden, daß der Besitz und die Verwaltung derselben dem Herzog verbliebe, daß die Pächter und Beamten der Aemter aber eidlich verpflichtet werden sollten, Pacht und Einkünfte nicht an die herzogliche Regierung, sondern an einen Bevollmächtigten der hannoverschen Landstände abzuliefern, der dann am Schluß des Jahres dem meklenburgischen Kammer=Collegio Rechnung über alle eingenommenen Gelder abzulegen hätte. Der Abtrag des Kapitals an die Stände sollte allmählich und nach jedesmal vorher erfolgter Kündigung geschehen und zwar in Posten von nicht unter 50 000 Rthlr.
Der Kammerrath Balck stellte folgendes Kalkül auf:
Die Einkünfte aus den 8 Aemtern betrugen
| im Jahre 1753 | 72 900 | Rthlr. |
| Der Ertrag aus dem Elbzoll | 28 000 | " |
| Die Landes=Contribution | 8 000 | " |
| 108 900 | Rthlr. | |
| Davon gingen ab die Verwaltungskosten und die meklenburg=strelitzsche Quote aus dem Elbzoll mit | 30 000 | " |
| Blieben zur Disposition | 78 900 | Rthlr. |
Zahlte man nun an Zinsen auf das Kapital von 1 500 000 Rthlr. 60 000 Rthlr. so blieben zur Amortisation des Kapitals jährlich 18 000 Rthlr. disponibel. Allerdings würde das Kapital dann erst in ca. 83 Jahren zurückgezahlt worden sein. Um den Diensteifer des Kammerraths noch ganz besonders anzufeuern, versprach der Herzog demselben das Gut Greven bei Lübz erb= und eigenthümlich,


|
Seite 23 |




|
wenn er die Sache so zu Stande bringe, daß die Total=Schuldsumme zu 1 400 000 bis 1 500 000 Rthlr. anerkannt würde. Müßte er aber 1 600 000 Rthlr. versprechen, so solle er ein Gut nicht unter 30 000 Rthlr. an Werth erhalten.
Der Kammer=Präsident Geheimrath von Münchhausen schien diesen Plan nicht ungünstig aufzunehmen und gab denselben dem Geheimen Secretär Meier, welcher die Aemter=Angelegenheit im Ministerium zu bearbeiten hatte, zur Begutachtung. In einer mündlichen Unterredung präcisirte der Kammerrath Balck dem Letzteren gegenüber die zu zahlende Summe zuerst auf 1 400 000 Rthlr., schließlich aber auf 1 500 000 Rthlr., und bald darauf ging ein Bericht des Ministeriums in dieser Sache nach London ab. Balck erwartete die Antwort mit Spannung, da man ihn gänzlich in Ungewißheit darüber gelassen hatte, ob der Bericht sich für oder gegen die meklenburgischen Anträge ausgesprochen hatte. Und davon hing Alles ab; denn fast immer genehmigte König Georg die Vorschläge seines hannoverschen Ministeriums, welche ein in London stationirtes Mitglied der letztgenannten Behörde dem Könige vortrug.
Nach etwa 4 Wochen ging die Antwort ein; der Plan sei unbillig und die Anleihe bei den hannoverschen Landständen völlig unthunlich, lautete der Bescheid, kurz und ohne weitere Begründung. Wolle der Kammerrath aber einen anderen Plan vorschlagen, sei man gern erbötig, denselben ernstlich zu erwägen.
Die meklenburgische Regierung beauftragte nun ihren Bevollmächtigten, anzufragen, wieso denn der Plan unbillig sei und was der König verlange?
Münchhausen erwiderte: "Unbillig ist es, zu verlangen, daß der König eine vom Deutschen Kaiser constituirte Special=Hypothek ohne baare Zahlung fahren lassen und sich dieser mit vieler Mühe erlangten Sicherheit begeben solle. Der König verlangt nichts; Vorschläge zu machen, geziemt sich für Meklenburg, nicht für Hannover. Würde Ihr Minister seinem Herrn wohl anders rathen?"
Mit dieser Erklärung war die Sendung des Kammerraths vorläufig zu Ende. Er hatte zwar vor seiner Abreise nach Hannover noch einen zweiten Plan zur Regulirung der Aemter seiner Regierung vorgelegt; da sich aber die Minister für den oben erwähnten Plan entschieden hatten, so mußte der zweite noch erst des Näheren erwogen werden, und dazu war die Anwesenheit des Kammerraths in Schwerin nothwendig. Er verließ daher im September Hannover.
Nachdem eine Mission des Geheimen Raths und Hofmarschalls v. Bergholtz nach Hannover im Juni des Jahres 1755 völlig ohne


|
Seite 24 |




|
Resultat geblieben war, erhielt der Kammerrath Balck am 14. Februar 1756 nochmals den Auftrag, sich nach Hannover zu begeben, um die im Jahre 1753 abgebrochenen Verhandlungen wieder aufzunehmen. Seine Instructionen, welche ganz dem von ihm selbst ausgearbeiteten Plane gemäß waren, lauteten folgendermaßen: Er sollte die Höhe der ganzen Schuldforderung als runde Summe feststellen und zu erlangen suchen, daß mit halbjähriger Kündigung größere oder kleinere Summen bezahlt werden könnten, die dann von dem Kapital abgerechnet würden. Diese Kapitalsumme bezifferte man in Schwerin auf 1 063 499 Rthlr. 22 ß. 10 Pf. Die Zinsen in der Höhe von 564 269 Rthlr. 3 ß. 4 Pf. sollten von Meklenburg im nächsten Johannis=Termin auf einem Brett bezahlt werden. Dagegen sollten 4 Aemter und zwar Grevesmühlen, Gadebusch, Wittenburg und Meklenburg nach Zahlung der Zinssumme an Meklenburg zurückgegeben werden. Die übrigen 4 Aemter, Boizenburg mit dem Elbzoll, Rehna, Bakendorf und Zarrentin sollten an Hannover verpfändet bleiben und nach Maßgabe des abbezahlten Kapitals zurückgegeben werden. Die 4 letztgenannten Aemter sollten als Sicherheit für das restirende Kapital dienen, die Einkünfte derselben aber das Kapital verzinsen; die Zinsen sollten von 5 auf 4 % herabgesetzt werden.
Dieser Plan wurde von allen Mitgliedern der hannoverschen Regierung ungünstig aufgenommen. Die Minister entschuldigten sich mit den vielen Geschäften, die namentlich der schleunige Abmarsch der hannoverschen Truppen nach England mit sich brächte. Der letztere Umstand, sowie der drohende Ausbruch des Krieges brachten den Kammerrath Balck auf folgende Idee. Auf seinen Rath ließ Herzog Christian Ludwig am 15. April dem König von England die meklenburgischen Truppen, welche aus 2000 Mann guter Infanterie beständen, durch den Kammerrath Balck anbieten; die Truppen sollten auf bestimmte Jahre unentgeltlich in englischen Sold treten, nur sollten die Unterhaltungskosten derselben von den Executionsgeldern abgerechnet werden; auch war der Herzog bereit, einen förmlichen Subsidientractat zu schließen.
Die hannoversche Regierung lehnte dies Anerbieten ab: sie kenne die meklenburgischen Regimenter nicht, auch seien ihr vorläufig genug Truppen angeboten; 6000 Bayern, 6000 Sachsen, 4000 Mann hessischer Cavallerie, 1000 Schwarzburger und 6000 Sachsen=Gothaer ständen dem König jederzeit zur Verfügung. Sollte es indessen noch an Truppen fehlen, würde man gern einen Subsidien=Tractat mit Meklenburg abschließen, doch dürfe dieser Tractat nie in Zusammenhang mit der Reluition der Aemter gebracht werden, da die Subsidien aus englischen Fonds bestritten würden.


|
Seite 25 |




|
Von wie geringen Ursachen hängen doch mitunter die Geschicke eines Landes ab! Hätte der König von England die meklenburgischen Truppen damals in seinen Sold genommen, so hätten diese aller Wahrscheinlichkeit nach während des 7jährigen Krieges unter dem Oberbefehl des Herzogs Ferdinand von Braunschweig gegen die Franzosen gekämpft und die unselige Alliance mit Frankreich vom 1. April 1757, welche Preußen das formelle Recht gab, Meklenburg als Feind zu behandeln, wäre nie geschlossen worden.
Am 1. Mai erhielt der Kammerrath Balck Antwort auf seine Vorschläge vom hannoverschen Ministerium. "Um zu ermessen, was billig von Meklenburg gefordert werden kann", hieß es in derselben, "wird es nöthig sein, sich die Situation, in der beide Theile sich in Bezug auf die Hypothek befinden, vorzustellen und zu Grunde zu legen. Der König hat vermöge Kaiserlichen Richterspruches 8 meklenburgische Aemter mit völliger Administration in der Weise in Besitz und Genuß, daß die Einkünfte derselben die ihm zugesprochenen 5 % Zinsen ergeben und der König nicht verpflichtet sein soll, die Aemter, sei es pro parte oder in totum, vor erhaltener Rückzahlung des Kapitals herauszugeben.
Dagegen wird nun meklenburgischerseits beantragt - um nur die Hauptpunkte hervorzuheben -,
1) 4 Aemter ohne Zahlung herauszugeben,
2) die noch ungetilgte Schuld auf eine runde Summe zu behandeln und auf die 4 übrigen Aemter allein zu übertragen,
3) die Zinsen auf 4 % herunterzusetzen und die Einkünfte der in diesseitigem Besitz bleibenden 4 Aemter als jährlichen Betrag der Zinsen anzurechnen, und
4) eine theilweise Tilgung der Schuld zu gestatten.
Alle diese Punkte gereichen, wie ersichtlich, nur Meklenburg zum Vortheil. Demnach erfordert es die Billigkeit, nun auch auf den Vortheil Hannovers Bedacht zu nehmen, deßhalb stellen wir folgende 3 Gegenanträge:
1) daß über diejenigen 4 Aemter, welche bis zur gänzlichen Tilgung der Schuld in den Händen des Königs bleiben, bis zu diesem Zeitpunkt die Landes=Hoheitsrechte mit abgetreten werden,
2) daß es dem König überlassen bleibt, diese 4 Aemter nebst dem Boizenburger Elbzoll in der Weise selbst auszuwählen, daß die Verzinsung der Schuld zu 4 % gewährleistet wird und
3) daß die Einlösung dieser 4 Aemter derart geschieht, daß die ganze Summe, nachdem dieselbe ein Jahr vorher gekündigt ist, auf einem Brett bezahlt wird."
"Der Vortheil," schloß die Antwort, "bleibt immer noch auf meklenburgischer Seite, denn es dürfte sich nicht leicht ein Beispiel


|
Seite 26 |




|
finden, einen Theil einer Hypothek, welche der Gläubiger auf richterliche Anweisung in Genuß und Besitz hat, ohne Zahlung frei zu machen und wieder zu bekommen, von der Wieder=Einlösung des übrigen Theils Meister zu bleiben und dennoch die Schuld zu vermindern."
Das hannoversche Ministerium hatte die Maske fallen lassen. Es war längst kein Geheimniß mehr bei den europäischen Höfen, daß Georg II. darnach strebte, seinen Besitz auf dem Festlande zu vergrößern, um Macht und Ansehen des Kurhauses Hannover zu mehren. Diese Gelegenheit war günstig. Wurden dem König die Hoheitsrechte über 4 Aemter übertragen, so war er, wenigstens zeitweilig, der souveraine Herr derselben und konnte in ihnen schalten und walten, wie er wollte. Die Rückgabe der Aemter war dann auf lange Zeit hinausgeschoben und zwar um so mehr, als die Bedingung, die Schuldsumme auf einem Brett zurückzuzahlen, bei den damaligen Conjuncturen des Geldmarktes überaus schwierig zu erfüllen war. Das Recht, sich die vier Aemter beliebig zu wählen, hätte dem Könige die Befugniß gegeben, das Amt Grevesmühlen zu behalten und somit den Besitz des Kurhauses Hannover bis an die Ostsee auszudehnen; ein verlockendes Ziel für eine Seemacht, welche mit ihren Flotten die Meere beherrschte!
Der Herzog und seine Räthe waren fest entschlossen, die Hoheitsrechte über 4 Aemter unter keinen Umständen zuzugestehen, auch nicht zeitweise, weil sie überzeugt waren, daß dieselben dann für immer verloren gewesen wären. Freilich gab es einen andern Weg, wieder in den Besitz der Aemter zu gelangen: wenn man die ganze Pfandsumme auf einem Brett zurückzahlte. Aber daran war bei dem Stande der meklenburgischen Finanzen und der Lage des Geldmarktes in Europa gar nicht zu denken. Die Minister erwogen hin und her. Sollte man die Sache vor das Forum des Reichs bringen und den Kurfürsten von Hannover beim Reichshofrath verklagen? Die Chancen auf Erfolg waren gleich Null. Man mochte diese Angelegenheit betrachten, von welcher Seite man wollte, es gab keinen anderen Weg, als sich die Rückgabe der Aemter lediglich von der Großmuth und der Gerechtigkeitsliebe des Königs von England zu erbitten. Wahrlich! Keine leichte Aufgabe für den Herzog und seine Räthe.
So verriethen die Minister auch jetzt mit keinem Wort ihre maßlose Empörung, welche sie empfanden, als ihnen die unerhörte Forderung der Abtretung der Hoheitsrechte zugemuthet wurde. Der Kammerrath Balck bemühte sich vergeblich, im mündlichen Verkehr mit den hannoverschen Ministern, Letztere zu bewegen, von dieser Forderung zurückzutreten. Schließlich erklärte er seine Instruction für


|
Seite 27 |




|
erschöpft und kehrte am 9. Mai 1756 nach Schwerin zurück, ohne aber, daß hierdurch ein gänzlicher Abbruch der Verhandlungen stattfand. Der Ausbruch des siebenjährigen Krieges verhinderte dann deren Wiederaufnahme, und bis zum Abschluß des Hubertsburger Friedensschlusses ruhten dieselben gänzlich.
Der Kammerrath Balck sollte die Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht mehr erleben. Erschöpft durch die langen vergeblichen Bemühungen und die umfangreichen Vorarbeiten in der Aemterfrage, erregt durch mancherlei Intriguen, welche in der Heimath gegen ihn in Scene gesetzt wurden, starb dieser verdienstvolle Beamte auf seinem Gute Mühlenbeck bei Schwerin im August 1756, einige Wochen nach seiner Rückkehr von Hannover. Noch bis kurz vor seinem Tode beschäftigte sich der treue Mann in seinen Fieber=Phantasieen mit der Auslösung der Aemter.
Nach den Leiden dieses Krieges war die meklenburgische Regierung weniger denn je im Stande, die große Summe, welche die Einlösung der Aemter erheischte, aufzubringen, namentlich nicht in der Weise, wie es Hannover verlangte. Und doch wäre die Erhöhung der Landeseinkünfte durch die Rückgabe der Aemter gerade jetzt, wo alle Kassen leer waren, so sehr erwünscht gewesen. Man sann vergeblich auf Mittel; da schien der Zufall eine günstige Chance in der wohlwollenden Gesinnung zu bieten, welche das englische Königspaar für den Herzog Friedrich hegte.
Nach dem im Jahre 1760 erfolgten Tode Georg II. hatte sein Enkel Georg III. den englischen Thron bestiegen. Derselbe war seit dem August des Jahres 1761 mit der Prinzessin Sophie Charlotte, der Schwester des Herzogs Adolf Friedrich IV. von Meklenburg=Strelitz, vermählt; die Königin war somit eine Muhme des Herzogs Friedrich. Schon während des siebenjährigen Krieges hatte sich Herzog Friedrich diese Verwandtschaft zu Nutze zu machen gesucht und wiederholt den König sowohl, wie die Königin um Schutz gegen die preußische Invasion angerufen. Er hatte sich hierzu der Vermittelung des Strelitzischen Schloßhauptmanns von Dewitz bedient, welcher die Prinzessin Sophie Charlotte zu ihrer Vermählung nach London begleitet hatte und bis zum Jahr 1763 dort geblieben war.
Dewitz hatte sich nicht nur einer außerordentlichen Beliebtheit beim englischen Königspaare zu erfreuen gehabt, sondern hatte es auch verstanden, sich eine sehr angesehene Stellung in der englischen Gesellschaft zu erwerben; namentlich war er befreundet mit dem Geheimen Rath v. Behr, welcher als Mitglied und vortragender Rath der kurhannoverschen Regierung in London dem König nahe stand. Zwar waren die Vorstellungen des englischen Gesandten, die


|
Seite 28 |




|
er auf die Bemühungen von Dewitz hin bei dem preußischen Staats=Minister, Graf von Finkenstein, hatte erheben müssen, von Erfolg nicht begleitet gewesen; indessen hatte die Königin nicht aufgehört, dem blutsverwandten Schweriner Lande, dessen Unglück sie tief bekümmerte, ein mitfühlendes Herz zu bewahren. Die überaus großen finanziellen Schwierigkeiten, mit welchen ihr Vetter, der Herzog Friedrich, nach dem Abzug der preußischen Truppen aus Meklenburg - im Mai 1762 - zu kämpfen hatte, blieben ihr nicht verborgen und lenkten ihre Aufmerksamkeit auf die meklenburgischen Aemter, welche sich noch immer im Besitze des Kurhauses Hannover befanden. Ob es der Königin nun gelungen war, ihrem Gemahl dasselbe Mitgefühl für den Herzog Friedrich einzuflößen, welches sie selbst besaß, oder ob das immerhin recht erhebliche Kapital, welches bei der Reluirung der meklenburgischen Aemter der Kasse des Königs zufloß, den Letzteren verlockte, eine Rückgabe derselben sich gefallen zu lassen, ist nicht ersichtlich; wir wissen nur, daß die Königin im Frühjahr des Jahres 1763 einen Brief an ihren Bruder nach Strelitz schrieb, in welchem nicht undeutlich zu verstehen gegeben war, daß der König jetzt geneigt sei, auch bei Theilzahlungen die Aemter nach und nach, je nach dem Fortschreiten dieser Zahlungen, an Meklenburg zurückzugeben.
Dieser Brief, welchen der Herzog Adolf Friedrich mit der Bitte um sofortige Rückgabe dem Herzog Friedrich vertraulich mitgetheilt hatte, erregte große Freude und weitgehende Hoffnungen bei der meklenburgischen Regierung. Man glaubte nämlich in Schwerin, daß die Königin diesen Brief nicht ohne Wissen ihres Gemahls geschrieben haben könne; die Minister gingen sogar soweit, anzunehmen, daß Georg III. denselben der Königin in die Feder dictirt habe und daß die notorischen Geldverlegenheiten, in welchen die Chatulle des Königs sich fort und fort befand, nicht ganz außer Zusammenhang mit diesem Briefe ständen. In der Freude seines Herzens beschloß der Graf Bassewitz, das Eisen zu schmieden, so lange es warm war. Es wurden sofort Verhandlungen mit Strelitz wegen Absendung eines gemeinschaftlichen Gesandten an den Hof von St. James angeknüpft, und im September desselben Jahres kehrte Herr v. Dewitz, welcher London erst im Januar verlassen hatte, nunmehr als Wirklicher Geheimer Rath und envoyé extraordinaire für beide Meklenburg dorthin zurück. Er sollte, an die im Jahre 1756 abgebrochenen Balckschen Verhandlungen anknüpfend, eine Rückgabe der Aemter unter möglichst günstigen Bedingungen zu erlangen suchen.
Dewitz begegnete gleich nach seiner Ankunft ein nicht angenehmer Zwischenfall. Als er nämlich den Wechsel eines Hamburger Handlungs=


|
Seite 29 |




|
hauses in London präsentirte, wurde derselbe nicht honorirt und ihm mit dem Bemerken zurückgegeben, das Hamburger Haus sei ja notorisch bankerutt. Dewitz, welcher nicht viel mehr Geld, als zur Ueberfahrt nöthig war, bei sich führte, hatte außer dem Geheimen Rath v. Behr keine so genauen Bekannte in der Londoner Gesellschaft, daß er sie hätte um ein Darlehen ansprechen mögen; seine diplomatischen Beziehungen zu Behr aber damit anzuknüpfen, daß er ihn persönlich anpumpte, erschien wenig geschmackvoll. Es blieb ihm nur die Königin. Auch diese nahm er ungern in Anspruch, und so erschien ihm denn, als er im Vorzimmer der Königin wartete, recht eigentlich als deus ex machina, eine Kammerfrau der Letzteren, aus Güstrow gebürtig, welche schüchtern ins Zimmer trat und mit vielen Knixen und tausendfachen Entschuldigungen Se. Excellenz fragte, ob sie wohl eine Bitte wagen dürfe. Sie habe sich 200 £ erspart und wisse nun nicht, wie sie das Geld sicher in die Heimath schicken solle; ob der gnädige Herr dies nicht gelegentlich übernehmen wolle?
"Holen Sie das Geld so schnell wie möglich, ich habe noch heute Gelegenheit!" lautete die freudige Antwort, und schon nach einigen Wochen konnte die Kammerfrau ihrer Herrin die große Gefälligkeit des Herrn Gesandten rühmen, denn ihren Verwandten in Güstrow waren die 200 £ von der Schweriner Renterei ausbezahlt worden, und zwar nicht in englischen Pfunden, sondern in gutem meklenburgischen Gelde.
Der Gesandte hatte Anfang September seine Antritts=Audienz beim König und der Königin und wurde mit Auszeichnung empfangen. Trotzdem ging die Sache nicht vorwärts. Dewitz hatte gehofft, daß der König in der Audienz des Briefes der Königin an den Herzog Adolf Friedrich Erwähnung thun würde, aber dies geschah nicht, und so fand sich keine Gelegenheit, die Aemterfrage zu berühren.
Als Mitte October noch nichts in der Sache geschehen war, wurde man in Schwerin ungeduldig und sprach dem Gesandten sein Befremden aus. Da berichtet Letzterer, daß er am 25. October in einer zweiten Audienz, bei welcher auch die Königin zugegen gewesen sei, den Wunsch des Herzogs, die Aemter wieder zu erlangen, dem König vorgetragen, und daß Letzterer zögernd geäußert habe, diese Sache gehöre wohl nach Hannover.
"Aber in Hannover will man die Aemter nicht reluiren, Ew. Majestät!" erwiderte der Gesandte.
Der König schwieg und sagte dann, er wünsche, es solle ein Pro Memoria eingereicht werden. Der Geheime Rath v. Dewitz versprach sich wenig von den Verhandlungen und rieth dem Herzog, er solle sich doch bei den befreundeten großen Höfen nach Unterstützung


|
Seite 30 |




|
umsehen. Auch das Geldnegoce müsse möglichst gefördert werden, denn schließlich werde doch Alles darauf ankommen, daß große Summen auf einem Brette ausbezahlt werden müßten.
Der Geheime Raths=Präsident Graf Bassewitz erwiderte, es solle Alles geschehen, fremde Hülfe und Anleihen, aber die Hauptsache sei doch immer der gute Wille des Königs von England; das dürfe man nie aus den Augen verlieren.
Auch mit dem Geheimen Rath v. Behr hatte Dewitz häufige Unterredungen. Es kam nämlich zunächst darauf an, zu erfahren, wie hoch sich die hannoverschen Forderungen beliefen und ob die geforderten Summen auch durch das Kaiserliche Erkenntniß für liquide erklärt worden wären; ferner, ob nicht die jährlichen Einkünfte der Aemter die zugebilligten Zinsen überstiegen und um wieviel? Behr erklärte aber rund heraus, auf eine Untersuchung betreffs des Ertrags der Aemter und dessen Bilancirung gegen die Zinsen würde man sich nie einlassen, da jene Hypotheken durch Reichshofraths=Conclusa dergestalt übergeben seien, daß die Erträge derselben statt der Zinsen gerechnet werden sollten. Behr hatte hierin Recht, denn die acht Aemter waren im Jahre 1735 in den antichretischen Besitz des Kurhauses übergegangen, und in dem Wesen eines solchen Vertrages liegt es, daß der Schuldner seinem Gläubiger die Benutzung des hingegebenen Faustpfandes anstatt der Zinszahlung zugesteht. Außerdem machte Behr geltend, daß die Einkünfte keineswegs die Zinsen überstiegen. Auf Theilzahlungen würde man sich nicht einlassen, die ganze Summe müsse auf einem Brett ausgezahlt werden.
In dem Pro Memoria, welches der Geheimrath v. Dewitz am 8. November dem Könige einreichte, war besonders die Bitte ausgesprochen, der Regierung in Hannover aufzugeben, mit Meklenburg in Verhandlungen über die Höhe der Schuldforderung zu treten und einem meklenburgischerseits zu ernennenden Commissar eine Einsicht in die in der Aemterfrage erwachsenen Documente und Abrechnungen zu gestatten, um auf Grund derselben die wirklichen Verhandlungen demnächst beginnen zu können. Der König ging auf diese Bitte ein und schickte das Memoire nach Hannover, mit dem Wunsche, daß die Sache nun in Fluß kommen möge. Dewitz schloß den Bericht an seine Regierung mit der Bitte, nunmehr recht eifrig diplomatische fremde Hülfe nachzusuchen, und mit den Worten: "Aut nunc - aut nunquam."
Dieser Stand der Dinge war dem Edlen v. Schmidt in Wien mitgetheilt worden, und dieser hatte es durch seine unablässigen Bemühungen zu Wege gebracht, daß der österreichische Gesandte am Londoner Hofe, der Graf von Seilern, angewiesen wurde, dem meklenburgischen Gesandten seine Unterstützung angedeihen zu lassen.


|
Seite 31 |




|
So verlief das Jahr 1763. Endlich, im März des folgenden Jahres, konnte Dewitz seinem Hofe melden, daß der Geheimrath v. Albedyll von der hannoverschen Regierung angewiesen sei, einem von Meklenburg zu ernennenden Deputirten die Rechnungen in Boizenburg vorzulegen. Der Herzog ernannte den Oberhauptmann von Warnstedt zu seinem Commissarius.
Letzterer hatte erhebliche Erinnerungen und Einwendungen gegen die vorgelegten Rechnungen und die sich daraus ergebenden Forderungen nicht zu machen; nur die Höhe der sogenannten Tumultskosten - ca. 75,000 Rthlr. - beabsichtigte Warnstedt herunterzuhandeln, da das hannoversch=braunschweigische Executionscorps im Jahre 1733 stark genug gewesen sei, um den Herzog Karl Leopold mit seiner jämmerlichen Miliz niederzuschlagen und so den Aufstand im Entstehen zu unterdrücken. Statt dessen aber seien die Executionstruppen im terreur panique bis an die Elbe zurückgewichen, der Aufstand habe sich weiter ausgedehnt, und nun hätte das hannoversche Ministerium neue Regimenter nach Meklenburg schicken müssen; daher die hohen Kosten, die selbst vom Kaiser beanstandet seien. Da aber eine Bemängelung der hannoverschen Waffenehre der denkbar unklugste Schritt gemesen wäre, um die Einlösung der Aemter von der hannoverschen Regierung zu erlangen, wurde Warnstedt angewiesen, diese Sache ruhen zu lassen, und Ende Mai war die Sache zu beiderseitiger Zufriedenheit beendet.
Nachdem so auf directe Veranlassung des Königs ein Vorspiel der Verhandlungen stattgefunden, kam es in der Folge darauf an, letztere wirklich zu beginnen. Hierzu vernothwendigte es sich aber wiederum, den König zu einer Kundgebung seines Willens zu bewegen, und das war für Dewitz nicht leicht, da das hannoversche Ministerium, um die Vortheile, welche dasselbe aus dem Besitz der Aemter zog, nicht aufzugeben, auf alle Weise versuchte, die Sache in die Länge zu ziehen. Behr setzte Alles daran, den König zu bewegen, jedenfalls nur in Hannover zu verhandeln, da die Sache dort den persönlichen Einflüssen des Königs und der Königin entzogen war; Graf Bassewitz dagegen wollte den Schwerpunkt der Verhandlungen nach London verlegen.
"In Hannover wartet man immer auf Instructionen aus London, die je nach Belieben kommen oder ausbleiben; wenden Sie sich immer direct an den König," schrieb er dem Gesandten.
Dewitz fing an ungeduldig und nervös zu werden. Immer und immer wieder sich mit nicht ernstlich gemeinten Versprechungen vom König hinhalten zu lassen und die Verlegenheit der herzensguten Königin zu sehen, war nicht angenehm und vollends das Benehmen


|
Seite 32 |




|
seines Freundes Behr machte ihn ärgerlich und verstimmt. "Behr ist ein sonst sehr würdiger Mann," schrieb Dewitz, "aber sowie ich auf das Negoce komme, wird er ängstlich und weicht aus. Er ist immer jüngster Minister gewesen und daher gewohnt, zu gehorchen." Dieser Vorwurf war ungerecht; würde Behr als Delegirter des Geheimen Raths=Collegiums in Hannover dem König in der Aemterfrage andere Vorschläge gemacht haben, als die ihm von dem Präsidenten von Münchhausen übermittelten, so würde seine Stellung in sehr kurzer Zeit eine völlig unhaltbare geworden sein.
Unter diesen Umständen mochte es dem Geheimrath v. Dewitz sehr erwünscht kommen, daß der Herzog Adolf Friedrich seiner dringend bedurfte und auf seine Rückkehr drang. Da aber Graf Bassewitz sich viel von dem Einfluß versprach, den Dewitz namentlich auf die Königin und somit, da das Königspaar in glücklichster Ehe lebte, indirect auch auf den König ausübte, schickte Herzog Friedrich seinen Gesandten in Berlin, den Baron v. Lützow, an den Strelitzer Hof mit der Bitte, zu gestatten, daß Dewitz noch einige Wochen in London verbleibe, welche Bitte auch von dem Herzog genehmigt wurde.
Dewitz hatte, um vorwärts zu kommen, seine bisherige reservirte Haltung aufgegeben und Behr von dem Briefe erzählt, welchen die Königin an den Herzog von Strelitz geschrieben hatte. Behr sprach eindringlich die Hoffnung aus, man werde von diesem Briefe keinen Gebrauch machen; der Brief sei gänzlich ohne Wissen der hannoverschen Regierung geschrieben und könne der Königin große Unannehmlichkeiten bereiten.
"Gewiß werden wir den Brief benutzen, wenn wir Vortheil aus demselben ziehen können," erwiderte Dewitz, "die Königin hat in demselben die Rückgabe der Aemter gegen Theilzahlung in Aussicht gestellt, und Ihre Majestät hat mir selbst gesagt, daß ihr der König den Brief in die Feder dictirt habe."
"In Theilzahlungen werden wir nie willigen", entgegnete Behr.
"Und wir werden niemals darein willigen, die Hoheitsrechte auch nur über ein einziges Amt wegzugeben," schloß der Gesandte die recht lebhaft geführte Unterhaltung.
Dewitz berichtete seiner Regierung sehr verstimmt: "Nichts als bodenlose Einwendungen, glatte Worte und leere Verheißungen giebt es hier; nicht das Recht, nur das utile gilt!" Auch bat er den Herzog in dringlicher Weise, Alles daran zu setzen, um die ganze Pfandsumme zu schaffen, wenn er auch alles Gold und Silber zu Gelde machen und alle Kleinodien verkaufen müsse. Graf Bassewitz aber bat den Gesandten dringend, den Geheimrath von Behr nicht


|
Seite 33 |




|
zu erzürnen; da der König ganz in den Händen seiner Minister sei, so käme ja Alles auf deren guten Willen an.
Ende November trug der Gesandte in einer Audienz, welcher die Königin - wie immer, wenn Dewitz beim Könige war - beiwohnte, dem Letzteren ausführlich und ungeschminkt die ganze Aemter=Angelegenheit vor, und betonte besonders, daß der Herzog niemals in die Abtretung der Landeshoheit willigen würde; er habe auch nicht das Recht dazu und weder der Herzog von Strelitz, als nächster Agnat, noch die meklenburgischen Stände würden jemals ihre Zustimmung geben. Schließlich bat Dewitz den König, zu gestatten, daß nunmehr, nachdem die Rechnungslage klar gestellt, die Verhandlungen eröffnet werden könnten, der Herzog sei gerne erbötig, einen Bevollmächtigten nach Hannover zu entsenden. Der König hüllte sich in Schweigen;
schneller aber, als man vermuthete, antwortete das hannoversche Ministerium. In einem längeren Pro Memoria theilte dasselbe der Schweriner Regierung mit, wie es lediglich bei dem Bescheide, den es im Jahre 1756 gegeben habe, sein Bewenden haben müsse. Der König verlange die Zahlung der Summe auf einem Brett oder wenn Theilzahlung beliebt würde, die Abtretung der Hoheitsrechte über vier Aemter, deren Auswahl sich der König vorbehalte.
Dieser in sehr bestimmten, fast groben Ausdrücken gehaltenen Kundgebung gegenüber, verlor Dewitz allen Muth. "Wenn die Hoheitsrechte erst einmal weggegeben sind, giebt der König von England Ew. Durchlaucht dieselben ebensowenig wie die Aemter niemals wieder," schrieb er und gab dabei anheim, zu erwägen, ob es den ungemessenen Prätensionen Englands gegenüber nicht gerathener sei, sich dem König von Preußen in die Arme zu werfen, denselben um Vorstreckung der nöthigen Summen zu bitten und seine Vermittlung anzurufen.
Der Graf von Bassewitz hatte aber den Muth nicht verloren; vielmehr setzte er mit großer Energie alle Kräfte in Bewegung, um zu seinem Ziele zu gelangen. In einem Schreiben an den Herzog sagte er: "Wir dürfen dem Pro Memoria des Königs von England, welches von einer recht boshaften und unbilligen Feder verfaßt ist, gegenüber den Muth keineswegs sinken lassen, sondern müssen jetzt, ut ita dicam, Sturm laufen. Endlich muß der König doch den bösen Sophistereien seiner Minister ein Ende machen und seine Minister müssen erröthen.
Gelingt es jetzt nicht, dann wird es nie gelingen, denn nun ist der König doch in den Armen einer Königin, die er zärtlich liebt und die eine meklenburgische Prinzessin ist, welcher das Herz für


|
Seite 34 |




|
ihr altfürstliches Stammhaus auf dem richtigen Flecke sitzt. Endlich muß ihr Einfluß zur Geltung kommen. Was sollen wir aber nun thun? Das Pro Memoria mit Gründen widerlegen, was ja leicht wäre? Mit solchem Dispüt würden wir ihnen nur einen Gefallen thun und kommen nicht weiter. Deshalb meine ich, wir schreiben an den König von England, nicht im geschäftsmäßigen Styl, sondern in dem Tone eines Hofmannes, der bittet. Ferner muß ein Pro Memoria an die Kaiserlichen Minister nach Wien gesandt und der Kaiser von Oesterreich ersucht werden, die Sache des Herzogs durch ein Handschreiben an den König von England zu empfehlen. Dieselbe Bitte ist an den König von Dänemark zu richten, und der Graf Bernstorff 1 ) muß für die Sache interessirt werden, wobei zu erwähnen ist daß alle seine Güter in den Hypothek=Aemtern liegen. Dies alles muß dem Geheimrath von Dewitz mitgetheilt werden mit der Mahnung zur Geduld und ehrerbietigen Sprache. Endlich müssen wir fördersamst eine geschickte Person nach Hannover absenden, ohne dazu erst die Erlaubniß des Königs oder der Minister einzuholen und, daß dies geschehen, mit Ostentation allen Höfen mittheilen. Alles cito citissime!"
Wie Graf Bassewitz es dem Herzog gerathen, geschah es. Nach Hannover wurde Anfang Januar des Jahres 1765 der Landrath v. Barner=Bülow abgesandt mit der Instruction, zunächst vor allen Dingen, durch mündlichen Verkehr mit den Ministern, zu verhüten, daß der Geheimraths=Präsident v. Münchhausen eine Antwort des Königs beibringe, wodurch er der Nothwendigkeit überhoben würde, mit Barner in Verhandlung zu treten.
Die Wahl Barner's war eine durchaus glückliche. Seit längerer Zeit mit dem Geheimen Raths=Präsidenten persönlich bekannt, hatte er als Vertreter der meklenburgischen Ritterschaft mit Münchhausen im geschäftlichen Verkehr gestanden; dazu verband gleiche politische Gesinnung die Mitglieder der beiden streng feudal gegliederten Staatswesen eng mit einander. Barner wurde persönlich in Hannover sehr gut aufgenommen, trotzdem blieb seine Lage eine ungewöhnlich schwierige, denn es fehlten eben alle Vorbedingungen für das Gelingen seiner Anfgabe. Wie Graf Bassewitz wiederholt betonte, waren die hannoverschen Minister von einem fast feindseligen Vorurtheil gegen die meklenburgische Regierung beseelt, welches wohl noch aus der Zeit herstammen mochte, in der bei den immerwährenden Streitigkeiten zwischen dem Herzog und seinen Ständen, Hannover Partei für letztere ergriffen hatte. Ferner hatte der König von England seinen Ministern


|
Seite 35 |




|
überhaupt noch nicht erlaubt, in Verhandlungen einzutreten und endlich war es dem meklenburgischen Unterhändler sehr wohl bekannt, daß man in Hannover von einer Rückgabe der Aemter überhaupt nichts wissen wollte. Daß es dem Landrath v. Barner unter diesen Umständen gelang, die Unterhandlungen zu beginnen, ist nur seiner persönlichen Beliebtheit und seinem klugen und tactvollen Benehmen zuzuschreiben.
In der ersten Unterredung war der Präsident v. Münchhausen sehr zurückhaltend und bat Barner, ein Memoire einzureichen. Auch bei den nächsten Zusammenkünften war er schwierig; er habe den Befehlen des Königs zu gehorchen, nur gegen die Bezahlung der Summe bis auf den letzten Heller seien die Aemter zu haben. Als nun am 15. Februar auch die schriftliche Antwort des Ministers auf sas Memoire Barner's einlief, daß es bei den früheren Bescheiden lediglich sein Bewenden haben müsse, schien ein Abbruch der Verhandlungen unabwendbar.
Da der Landrath v. Barner die Bemerkung gemacht hatte, daß die Minister in Hannover darüber verletzt waren, daß der Herzog es vorgezogen hatte, anstatt mit ihnen in Verbindung zu treten, einen Gesandten an den König Georg zu senden, so benutzte der Graf Bassewitz diese Gelegenheit, dem Präsident v. Münchhausen den Grund dieser Abschickung zu erklären. Er schrieb Ende Februar:
"Den Weg der directen Verhandlung zwischen Hannover und Schwerin hätten wir gleich erwählt, wenn der König nicht auf eine so gnädige Art den Weg gewiesen und auch der deutsche Kaiser dazu gerathen hätte, so daß der Herzog, wenn er nicht die Ehrfurcht gegen diese beiben Monarchen hätte verletzen wollen, einen Gesandten an den Hof von St. James schicken mußte. In dem Briefe der Königin Sophie Charlotte an den Herzog von Strelitz, den ihr der König in die Feder dictirt, ist gesagt, daß der König eine partielle Reluition gestatten will. In seinem Schreiben an den König hat sich der Herzog aus Delicatesse aller Andeutungen auf das Schreiben der Königin enthalten, aber den Herrn von der hannoverschen Regierung müssen wir es jetzt sagen, damit sie wissen, warum wir uns mit Umgehung ihrer direct nach Lonbon gewandt haben." Der Graf erbot sich sodann zur Zahlung einer runden Summe von 1 471 560 Rthlr., aber in Theilzahlungen, gegen ebenfalls partielle Rückgabe der Aemter.
Inzwischen mochten die Briefe des Herzogs an den König und die Königin von England denn doch ihre Früchte getragen haben. Dewitz berichtete, die Königin sei beim Lesen des Briefes zu Thränen gerührt gewesen, auch seien die Gesandten des deutschen Kaisers und des Königs von Dänemark instruirt, Vorstellungen zu Gunsten des Herzogs von Meklenburg zu machen; kurz, der König hatte am


|
Seite 36 |




|
19. Februar dem Herzog mitgetheilt, er habe seinen Ministern befohlen, nunmehr ernstlich mit Barner in Unterhandlung zu treten.
Die Wirkungen dieses Königlichen Befehls zeigten sich schon in der nächsten Unterredung; denn als Barner wiederum betonte, daß sein Herr, der Herzog sich nie dazu verstehen würde, die Hoheitsrechte über die 4 Aemter abzutreten, sagte der Geheimrath v. Münchhausen: "Sie kennen mich seit Jahren, Herr Landrath, und wissen, daß ich keine Finessen mache. Ich werde wegen der Hoheitsrechte an den König berichten und sehen, ob hiervon nicht abgestanden werden kann. Wenn Sie nur ein Pro Memoria eingeben wollen, in welchem Sie zugestehen, daß Sie die rückständigen Zinsen gegen Rückgabe einiger Aemter und dann nach einiger Frist das Kapital gegen Rückgabe der übrigen Aemter, welches sich wie bisher mit 5 % verzinsen muß, auf einem Brett zurückzahlen wollen." Barner rieth seiner Regierung dringend, auf dieser Grundlage weiter zu verhandeln.
Graf Bassewitz konnte sich nicht entschließen, sein Mißtrauen gegen Münchhausen, den er für geradezu feindselig gegen die meklenburgische Regierung gesonnen hielt, aufzugeben. Er traute dem Passus, betreffend die Hoheitsrechte, nicht, denn er war fest überzeugt, daß die hannoverschen Minister darauf ausgingen, sich definitiv in den Besitz einiger der verpfändeten meklenburgischen Aemter und zwar der besten, zu setzen. Die günstige Wendung in der Sprache des Ministers schrieb Graf Bassewitz außer dem Einfluß der Königin Sophie Charlotte dem Wiener und Kopenhagener Hofe zu, welche durch ihre Gesandten in London - der König von Dänemark außerdem durch ein eigenhändiges Schreiben an den König Georg - Vorstellungen zu Gunsten des Herzogs von Meklenburg erhoben hatten; dann aber auch der politischen Lage, welche mit ihren kriegerischen Aussichten, für die von Hannover verfolgten Zwecke der Vergrößerung des Kurstaates wenig günstig war. Abgesehen von der Abtretung der Hoheitsrechte über die 4 noch im Besitz Hannovers verbleibenden Aemter, war Graf Bassewitz mit den Propositionen des Geheimrath v. Münchhausen ganz einverstanden, denn die Einnahmen aus den 4 an Meklenburg zurückzugebenden Aemtern, selbst wenn Hannover die schlechtesten zurückgab, überstiegen die Zinsen des zurückzuzahlenden Kapitals, auch wenn diese zu 5 % gerechnet wurden, immer noch um ein Erhebliches. Der Landrath Barner wurde angewiesen, in mündlichen Conferenzen weiter zu verhandeln.
Was Graf Bassewitz befürchtete, trat ein. In der ersten Conferenz erklärte der Geheime Secretair Meyer, welcher Referent in der Aemterfrage war, wenn Barner nicht die Hoheitsrechte zugestehen wolle, könne er auch nichts verlangen und äußerte einige Tage später:


|
Seite 37 |




|
"Drängen Sie nicht, Herr Landrath! Wollten wir den Befehlen aus England pünktlich nachkommen, so wäre Alles zu Ende. Warten Sie aber und lassen uns Zeit, zu berichten."
In London war es nicht anders. Dewitz berichtete: "Behr weicht mir scheu aus, und wenn ich seiner habhaft werde, sagt er, es sei Alles in Münchhausens Hände gelegt. Aber von dem im Jahre 1756 Projectirten ginge man nicht ab und scheue selbst den Weg Rechtens nicht. Graf Seilern giebt sich alle erdenkliche Mühe, Behr zu bereden, daß es bei den augenblicklichen sehr kriegerischen Aussichten doch für Hannover vortheilhaft sei, mit Meklenburg in Freundschaft zu leben, aber vergebens, die Habsucht überwiegt alle vernünftigen Schlüsse, alle politischen Gründe und verfinstert Aller Einsichten. Man hat sich einmal in Hannover die Idee der acquisition und Incorporirung eines Striches meklenburgischen Landes von der Elbe bis an die Ostsee in den Kopf gesetzt und darauf gehen alle Absichten, Zuschnitte und Maßregeln." Endlich hatte der dänische Gesandte seine Vorstellungen beim Geheimen Rath v. Behr gethan und ihm ein Handschreiben seines Souverains zur Weitergabe an den König gegeben. Behr hatte das Schreiben mit vielen leeren Complimenten und affectirten Freundschaftsversicherungen entgegengenommen, aber erwidert, daß die Rückgabe der Aemter nur gegen Baarzahlung der ganzen Summe zu erwarten sei; eine solutio particularis aber könne nicht statthaben. Es sei unbillig, solche von einer Privatperson zu verlangen, aber noch unbilliger von einer Macht, deren ganzer status militaris darauf eingerichtet sei. Wenn der König die ganze Schuld auf einem Brett ausbezahlt bekäme, so wäre er dadurch in den Stand gesetzt, seine sehr erheblichen Privatschulden abtragen und die hierdurch ersparten hohen Zinsen zum Unterhalt seiner Truppen in Hannover anwenden zu können. Bei einer Theilzahlung fiele nicht allein dieser Vortheil hinweg, sondern es erwüchse außerdem noch das der ganzen Nachbarschaft nachtheilige Uebel, daß der König gemüssigt sein würde, so viele Truppen abzudanken, als jetzt von den Revenüen der 8 meklenburgischen Aemter erhalten würden. Dies, meinte der Geheime Rath v. Behr, wäre genug, um des Königs von Großbrittannien Majestät Betragen völlig zu rechtfertigen.
"Ich hatte zwar nicht die Instruction," hatte Graf Bothmer weiter an Dewitz berichtet, "politische Gründe für mein Anliegen anzuführen, aber ich ließ doch die Frage einfließen, ob es Chur=Hannover nicht angenehm sein würde, wenn durch Wiedereinlösung der 4 an Preußen verpfändeten Aemter - deren Einlösung doch sofort nach der Reluirung der hannoverschen Aemter erfolgen solle - dem Könige von Preußen die Gelegenheit genommen würde, in


|
Seite 38 |




|
Meklenburg Truppen zu werben, corps d'armées zu formiren, die Cavallerie gu remontiren und Magazine anzulegen? Ob ferner die hannoversche Regierung nicht zu befürchten hätte, daß durch eine gar zu große Härte, der Herzog von Meklenburg bewogen werden möchte, sich dem König von Preußen in die Arme zu werfen, von diesem Monarchen ein Paar Millionen anzunehmen und dagegen einen dem König von Preußen gelegenen Theil des Herzogthums z. B. das Amt Dömitz, mit der Festung und dem Elbzoll zu verschreiben?" 1 )
"Ihren ersten Vorwurf", hatte Behr erwidert, "halte ich für gegründet, glaube aber, daß hierin ein gemeinschaftliches Interesse aller Nachbarn besteht, und daß es Chur=Hannover doch nicht anzurathen ist, sich zum Besten der ganzen Nachbarschaft aufzuopfern. Den zweiten Vorwurf kann ich aber nicht ernst nehmen," schloß Behr lachend, "denn man kann mit Vernunft nicht vermuthen, daß der Herzog von Meklenburg einen solchen Schritt thun wird."
Als Dewitz wußte, daß das Handbillet des Königs von Dänemark in den Händen des Königs war, bat er um Audienz. Nach einigen einleitenden Worten sagte er:
"Ew. Majestät haben sich bis jetzt zu weiter nichts erklärt, als was der hochselige König auch gethan, höchstwelcher doch dem Herzoglichen Hause nicht eben günstig gesonnen war. Ew. Königliche Majestät sind aber demselben mit Gunst und Gnade zugethan und darf sich deshalb der Herzog, mein Herr, doch bessere und günstigere Bedingungen versprechen, als vormals. Auch das hannoversche Ministerium ..."
Hier unterbrach der König, welcher ganz in Händen der hannoverschen Minister und gegen alle Vorstellungen hart und taub gemacht war, den Gesandten ungeduldig:
"Den König von Dänemark werde ich höflichst ersuchen, sich nicht in meine affaires zu meliren! Ich kann in der Meklenburgischen Sache weiter nichts thun, als was mein seeliger Großvater gethan, dessen pecuniäre Verhältnisse, doch viel besser waren, wie die meinigen. Auch der Kaiserliche Ambassadeur hat mir von der Sache gesprochen. Ja, was will denn der?! Ich habe ihm erwidert, ich wolle weiter nichts, als was mir durch Kaiserliche Conclusa zugesprochen ist. Der Wiener Hof will nun doch nicht gar gegen die Gültigkeit und Autorität seiner eigenen Decrete sprechen?! Hierauf wußte der Graf Seilern auch nicht ein Wort zu erwidern. Kurz! Ich habe zwar alle


|
Seite 39 |




|
Freundschaft für Ihren Herzog, kann aber dabei doch nicht meinen eigenen Vortheil vergessen."
"Aus allem diesen folgt", schrieb Dewitz niedergeschlagen seiner Regierung, "daß ihnen nur die ganze Summe genügt. Das Vorgeben Behrs, daß der König der ganzen Summe bedürfe, um seine Schulden zu bezahlen, ist nur ersonnen, um doch in etwas den bösen Willen und die heimlichen Absichten des hannoverschen Ministeriums zu beschönigen, denn als ich dem Geheimen Rath von Behr erwiderte, er solle uns die hauptsächlichsten Gläubiger des Königs nennen, der Herzog wolle mit ihnen direct unterhandeln, wich derselbe aus: das ginge nicht an, auch würden die Gläubiger dies nicht thun.
Sollten nun Ew. Durchlaucht die ganze Schuldforderung und zwar in N. 2/3 nicht aufbringen können, so weiß ich kein anderes Mittel, die Aemter wieder zu bekommen, als sich an den König von Preußen zu wenden. Ich gestehe, die Sache ist mißlich, aber Ew. Durchlaucht können sich ja billige Bedingungen ausmachen und haben dabei die Hoffnung, daß der künftige preußische Regent christlichere und billigere Gesinnungen hegen werde. Bei Hannover ist keine Besserung zu hoffen, wohl aber ist noch Schlimmeres zu befürchten. Denn geschieht dergleichen jetzt während der Regierung eines der würdigsten Regenten, was wird geschehen, wenn sein Nachfolger zur Regierung kommt?!
Ob ich ferner hier von Nutzen sein kann, überlasse ich Ew. Durchlaucht erleuchtetem Ermessen."
Die Meklenburgische Regierung sah ein, daß nach dem Resultat der letzten Audienz der Gesandte in London nichts mehr nutzen konnte und berief ihn ab. Ende Mai wurde Dewitz in Abschiedsaudienzen vom König und von der Königin empfangen.
Auch in Hannover waren die Unterhandlungen völlig ins Stocken gerathen. Im April war der Landrath von Barner zum Osterfest in die Heimath gereist, war dort von Podagra befallen und erst im Juni nach Hannover zurückgekehrt. Er suchte nun zwar die Verhandlungen wieder aufzunehmen, aber dieselben beschränkten sich auf Unterredungen, die er mit den einzelnen Mitgliedern der Regierung hatte. Graf Bassewitz war aber vorläufig auch hiermit zufrieden; was er am meisten fürchtete, war ein gänzlicher Abbruch der Verhandlungen. Da Barner wiederholt berichtete, daß der Präsident von Münchhausen es übel empfunden habe, daß man außer in Hannover auch in London Verhandlungen pflege, so beauftragte Graf Bassewitz Barner, dem Präsidenten vertraulich zu eröffnen, Dewitz habe aus London berichtet, er wisse es aus sicherster Quelle, daß der gute Ausgang der Verhandlungen lediglich von ihm - dem


|
Seite 40 |




|
Präsidenten - abhinge. Man würde sich auch sicher nicht nach London, sondern nach Hannover direct gewendet haben, wenn nicht der Brief der Königin an den Herzog von Strelitz dies veranlaßt hätte. Münchhausen zuckte die Achseln; er habe gehofft, daß seine Berichte nach London besseren Erfolg gehabt hätten, der König sei so daran gewöhnt bei Verpfändungen die Hoheitsrechte mit abgetreten zu erhalten, da es ihm bei der Erwerbung von Bentheim, Henneberg und Delmenhorst so geglückt sei, daß er davon wohl schwerlich abgehen würde.
"Wenn nur Ihr Herzog wenigstens die Gründe angeben wollte, warum er die Hoheitsrechte nicht abtreten will."
Barner erwiderte, auf diesen Punkt habe der Herzog von Anfang an bestanden.
"Ja, das weiß ich wohl," sagte Münchhausen, "aber wir haben hier gebundene Hände."
Nach dieser Unterredung verlor Graf Bassewitz alle Hoffnung. Er wollte den Landrath von Barner anweisen, keine weiteren Vorschläge in Hannover zu machen, bis Münchhausen die bestimmte Erklärung abgegeben habe, der König wolle von den Hoheitsrechten abstehen. Herzog Friedrich faßte die Sache praktischer auf. Er hatte das Gefühl, daß der Präsident von Münchhausen in der eben erzählten Unterredung habe einlenken wollen und daß Barner nicht gewandt genug auf dessen Intentionen eingegangen sei.
"Ich sehe den Grund nicht ein", schrieb der Herzog an Graf Bassewitz, "warum ich darauf bestehen soll, mir erstlich die Versicherung geben zu lassen, daß sie die Hoheitsrechte fallen lassen wollen, da sie doch schon ein Nachgeben äußern, wenn man ihnen nur die Gründe zeigte, warum man diesen Punkt nicht eingehen zu können glaubt. Die Gründe sind:
Ich halte es gerade wider das Gewissen, die Sorgfalt, so mir von Gott über das christliche und leibliche Wohl von Menschen aufgetragen ist, Anderen zu überlassen und zwar um einigen Gewinnstes willen."
Graf Bassewitz erwiderte, er sei ganz der Ansicht des Herzogs, nur habe er sich gescheut, diese Gründe anzuführen, aus Besorgniß, den König von England, der seine Unterthanen für die denkbar glücklichsten der Welt halte, dadurch zu verletzen und Handlungen, welche große Herrn fortwährend begehen, für gewissenlos zu erklären. Es wurde nun ein Pro Memoria mit den vom Herzog angeführten Gründen abgefaßt und dem Landrath von Barner zur Uebergabe an die hannoversche Regierung übersandt.


|
Seite 41 |




|
Der Herzog hatte Recht gehabt, das hannoversche Ministerium zeigte sich nachgiebig. Allerdings nicht in Folge dieses Pro Memoria's, denn dasselbe wurde erst am 20. Juli in Hannover übergeben, und schon am 30. desselben Monats kam mit der englischen Post der günstige Bescheid aus London. Es mußten sich also schon vor Uebergabe des Memoires am Hofe von St. James Einflüsse geltend gemacht haben, welche dem Wunsche des Herzogs günstig waren, oder - und dies ist das Wahrscheinlichere - Münchhausen hatte in dieser Sache plein pouvoir vom Könige und fühlte das Unhaltbare seiner Position. Wie dem auch sein möge, Barner wurde am 1. August von den Ministern in so liebenswürdiger und zuvorkommender Weise empfangen wie nie zuvor und ihm in einem Pro Memoria, datirt vom 31. Juli, eröffnet, daß der König aus besonderer Hochachtung für den Herzog Friedrich beschlossen habe, von der Erwerbung der Hoheitsrechte gänzlich abzusehen. Im Uebrigen bestand man auf den Propositionen vom Jahre 1752 in der Weise, daß die hannoverschen Forderungen zu einer runden Summe zu der ungefähren Höhe, wie sie früher von Meklenburg genannt waren, fixirt, daß vier Aemter gleich an Meklenburg zurückgegeben werden, dagegen aber die übrigen vier Aemter nach freier Auswahl Hannovers solange verpfändet bleiben sollten, bis die zu 4 % zu verzinsende Schuldforderung von der meklenburgischen Regierung getilgt sein würde. Da aber die Zinsen für die ganze Schuldsumme nicht durch die Einkünfte der vier im Besitz von Hannover zurückbleibenden Aemter aufgebracht würden, sollte Meklenburg schon jetzt den überschießenden, sich nicht verzinsenden Theil der ganzen Forderung zurückzahlen. Die ganze Summe betrug nämlich pr. pr. 1 500 000 Rthlr., zu deren Verzinsung zu 4 % jährlich 60 000 Rthlr. erforderlich waren. Nun betrugen aber die Einkünfte der vier Aemter, welche die hannoversche Regierung zurückbehalten wollte, nämlich Boizenburg mit dem Elbzoll, abzüglich der Strelitzer Quote, Grevesmühlen, Rehna und Gadebusch, nach Abzug der Ausgaben für die Justizpflege, die Verwaltung, die Bau= und Reparaturkosten ca. 48 000 Rthlr. Daher war es erforderlich, daß wenigstens ein Kapital von 300 000 Rthlr. gleich baar ausbezahlt werden mußte. Zum Schluß des Memoires wurde die bestimmte Erwartung ausgesprochen, daß der Herzog diese für ihn so günstigen Bedingungen nun auch pure et simpliciter annehmen würde.
Durch den Verzicht der hannoverschen Regierung auf die Hoheitsrechte, d. h. auf die völlige Abtretung der vier Aemter, war die größte Schwierigkeit beseitigt. Es blieb nun nur noch der Versuch übrig, die Herabminderung der Schuldsumme zu erreichen und die Zahlung in der Weise zu regeln, daß der Herzog in jeder Münzsorte


|
Seite 42 |




|
zahlen durfte, welche ihm beliebte, besonders auch in Gold. In diesem Sinne wurde der Landrath Barner instruirt. Dieser that sein Möglichstes, der Präsident v. Münchhausen war aber so zähe, daß Barner so gut wie nichts erreichte und endlich seiner Regierung dringend rieth, unter allen Umständen jetzt abzuschließen, sonst laufe man Gefahr, daß die Verhandlungen völlig abgebrochen würden. So wurde denn am 14. December 1765 eine Punctation von den hannoverschen Ministern und dem Landrath v. Barner unterzeichnet und später von König Georg und dem Herzog ratificirt, die in den Hauptpunkten folgendermaßen lautete:
"Unter der Schuldforderung ist diejenige Summe zu verstehen, welche der Kaiser dem König Georg II. und dessen Erben durch die Erkenntnisse vom 30. October 1732 und vom 23. September 1734 mit Zinsen adjudicirt hat und wofür demselben am 18. November 1734 die Kammergefälle der acht Aemter und des Elbzolles, incl. des auf Strelitz fallenden Theils desselben, als eine auf Rechnung zu nutzende und zu genießende Special=Hypothek verpfändet sind. Die Forderung besteht theils in Kapitalsummen, theils in Zinsen. Die Kapitalsummen sind:
| 1) | 864 061 | Rthlr. | 27 ß. | 2 Pf. | Executionskosten, |
| 2) | 75 437 | Rthlr. | 43 ß. | 8 Pf. | Tumultskosten (der Aufstand im Jahre 1733), |
| 3) | 50 000 | Rthlr. | Mobilmachungsgelder für die vom Herzog Christian Ludwig angeworbenen Regimenter | ||
|
|
|||||
| Sa. | 989 499 | Rthlr. | 22 ß. | 10 Pf. | |
Die Zinsen sind alte, d. h. solche, welche vor Erlaß der Kaiserlichen Decrete fällig gewesen sind, und neue, d. h. solche, welche später alle Jahr fällig geworden und noch rückständig geblieben sind:
| 1) | Auf die Kapitalsumme 1 | 464 958 | Rthlr. | 28 ß. | 1 Pf. |
| 2) | auf die Kapitalsumme 2 | 70 133 | Rthlr. | 2 ß. | 5 Pf. |
| 3) | auf die Kapitalsumme 3 | 15 000 | Rthlr. |
| Ferner an Zinsen noch soviel, daß die ganze Zinsensumme | 698 534 | Rthlr. | 29 ß. | 6 Pf. |
| beträgt. |
| Davon sind abgetragen | 151 350 | Rthlr. | ||
| Bleibt an Zinsen | 547 184 | Rthlr. | 29 ß. | 6 Pf. |
| Diese zum Kapital gerechnet | 989 499 | Rthlr. | 22 ß. | 10 Pf. |
| Giebt Totalsumme: | 1 536 684 | Rthlr. | 4 ß. | 4 Pf. |


|
Seite 43 |




|
und zwar meklenburgisches valeur, da nach diesem das Kapital vorgeschossen und daher auch nach demselben adjudicirt ist. Da aber ein Theil des Mobilmachungs=Kapitals in anderen schlechten Münzen angeliehen ist, so soll die ganze Summe rund zu 1 535 000 Rthlr. angenommen werden, und zwar in ausgeprägten N. 2/3=Stücken nach dem Leipziger Fuß, die Mark fein Silber zu 12 Rthlr. gerechnet.
Diese Summe soll in zwei Theile zerschlagen werden. Zuerst wird bezahlt, was über eine Million ist und ungefähr die Zinsen beträgt. Dafür werden die Aemter Bakendorf, Meklenburg, Wittenburg und Zarrentin zurückgegeben.
In Bezug auf die Zinsensumme ist man dahin übereingekommen, daß dazu gute vollwichtige Pistolen, davon 35 Stück auf die Cöllnische Mark gelten und 21 Karat 9 Gran fein halten, das Stück zu 5 Rthlr. gerechnet, und gute vollwichtige Dukaten, davon 67 Stück auf die Cöllnische Mark gehen, das Stück zu 2 Rthlr. 18 Groschen gerechnet, aber mit einem agio von 6 2/3 Rthlr. auf die Pistolen und 3 1/8 Rthlr. auf die Dukaten für jede 100 Rthlr. zu beschaffen sind.
Man ist erbötig, die erste Zahlung auf Johannis 1766 anzunehmen. Da der meklenburgische Bevollmächtigte jedoch nicht bestimmt erklären konnte, ob seine Regierung zu diesem Termin werde zahlen können, so ist man übereingekommen, daß, wenn drei Monate vor Johannis 1766 nicht gekündigt ist, dann die Zahlung erst zu Johannis 1767 geschehen kann; und wenn in diesem Jahr nicht zwei Monate vorher gekündigt ist, erst zu Johannis 1768. Geschieht es dann nicht, so gilt der ganze Vergleich nicht.
Bis zur Rückzahlung der Million bleiben die vier
Aemter - Gadebusch, Rehna, Grevesmühlen und
Boizenburg mit dem Elbzoll - im unveränderten
Besitze Hannovers. Statt der in den Kaiserlichen
Erkenntnissen zugesprochenen und laut der
Hypotheken=Rechnungen bisher genossenen 5 % will
der König von dem Termin an, in welchem die
erste Zahlung erfolgt, mit vier vom Hundert
zufrieden sein. Es werden dadurch nämlich die
Zinsen der Million gedeckt, da der
Durchschnittsertrag der vier im Besitz des
Königs bleibenden Aemter 43 605 Rthlr. jährlich
betragen hat. Da aber von diesen 43 605 Rthlr.
noch manche Dinge zu bezahlen sind, wie
Besoldung der Forstbedienten, Zollbeamten
 , so sollen die über die Zinsen
für die Million überschießenden 3605 Rthlr. dazu
verwendet werden. Die Strelitzer Elbzoll=Quote -
9000 Rthlr. - zahlt Hannover, so lange es im
Besitz der vier Aemter ist. Wird die Reluition
der vier Aemter beliebt, so soll ein volles Jahr
vorher gekündigt werden, und zwar zu Johannis.
, so sollen die über die Zinsen
für die Million überschießenden 3605 Rthlr. dazu
verwendet werden. Die Strelitzer Elbzoll=Quote -
9000 Rthlr. - zahlt Hannover, so lange es im
Besitz der vier Aemter ist. Wird die Reluition
der vier Aemter beliebt, so soll ein volles Jahr
vorher gekündigt werden, und zwar zu Johannis.


|
Seite 44 |




|
Endlich sollen alle Pachtcontracte ausgedient und die bisherigen Pächter nicht ohne besonders erhebliche Gründe entlassen werden."
Am 31. December ratificirten der König und der Herzog den Vergleich und wurden die Urkunden am 20. Februar 1766 durch den Landrath von Barner und den Landdrost von Alvensleben ausgetauscht. Dem hannoverschen Geheimen Secretair Meyer, welcher die Vergleichs=Verhandlungen hauptsächlich geführt hatte, ließ der Herzog ein Douceur von 1000 Dukaten auszahlen.
Die meklenburgische Regierung hatte sich erboten, die 535 000 Rthlr. Zinsen schon im Johannis=Termin des folgenden Jahres, also 1766, auszuzahlen und hatte sich die hannoversche Regierung bereit erklärt, diese Summe, welche überall in Meklenburg und Hannover in kleinen Posten aufgeliehen war, in Boizenburg entgegen zu nehmen. Als meklenburgischer Commissar fungirte der Oberhauptmann, Geheime Rath von Warnstedt, als hannoverscher der Geheime Rath von Albedyll. Ganz so glatt, wie man in Schwerin gehofft, ging diese Sache indeß nicht von statten. Der Herzog, welcher der Ansicht war, daß sich die Summe in acht Tagen bequem würde zählen lassen, hatte, da sich in Boizenburg Niemand gefunden, der die Küche für den herzoglichen Commissar übernehmen konnte, seinem Hofmarschall 1 ) befohlen, einen Koch= und Küchenwagen in der Weise dorthin zu senden, daß acht Tage lang eine Tafel von ca. 6 und einmal von 12-14 Personen hergerichtet werden könnte. Der Hofmarschall kam aber in arge Verlegenheit, weil sich die Zahlung und Uebergabe der vier Aemter nicht eine Woche, sondern volle vier Wochen lang hinzog, und weil, wie er dem Graf Bassewitz meldete, die im Hofkeller befindlichen Weine nicht von der Güte seien, daß mit denselben bei den fremden Commissarien Ehre einzulegen wäre; auch könne er bei dem gänzlichen Geldmangel in seiner Kasse keine Weine von auswärts beziehen, da die Lieferanten in Lübeck und Hamburg ihm keine Weine ohne sofortige baare Bezahlung mehr verabfolgen wollten.
Da die meklenburgische Regierung hoffte, auch die Million in Jahresfrist anleihen zu können, so kündigte sie dieselbe in einem Schreiben vom 21. Juni zum Johannistermin des folgenden Jahres, also zu 1767. Hierbei beging die Regierung die Unvorsichtigkeit, daß sie nicht eine rein geschäftliche Kündigung aussprach, sondern daß der Herzog, dem es unsicher erschien, ob sich die Million in so kurzer Zeit beschaffen ließe, hinzufügte, er setze sein fürstliches Wort zum Pfande, daß man sich alle erdenkliche Mühe geben wolle, die Zahlung rechtzeitig zu leisten; wenn es wider Erwarten jedoch fehlschlüge, so


|
Seite 45 |




|
hoffe er, der König würde großmüthig sein und gestatten, daß der Rest nachträglich, gegen Zurückhaltung eines Theils der vier Aemter bezahlt würde.
Der Präsident von Münchhausen, welcher der Rückgabe der Aemter von vornherein feindselig gegenüber gestanden hatte, war sehr ungehalten darüber, daß die Meklenburgische Regierung schon im nächsten Jahre die vier letzten Aemter auslösen wollte. Er hatte gehofft, wenigstens bis zum Jahre 1769 im ungestörten Besitz der Aemter bleiben zu können. Begierig ergriff er daher die ihm gebotene Gelegenheit, die Rückgabe der Aemter noch hinauszuschieben. Er erwiderte am 27. Juni, er könne die Aufkündigung nicht gelten lassen, dieselbe sei gegen die abgeschlossene Convention, da sie keine reine, sondern eine mit Vorbehalt und mit Bedingungen verknüpfte sei, welche gerade dasjenige, was Se. Majestät beständig nicht eingehen zu können erklärt hatte, nämlich eine getheilte Zahlung und getheilte Reluirung der vier Aemter auf den Kopf stelle.
"Ich hoffe, die Herren in Schwerin entbinden mich von der Nothwendigkeit unsere Ansicht weitläufiger zu erweisen," schloß das im groben Ton gehaltene Schreiben.
Graf Bassewitz, welcher einen großen Theil der anzuleihenden Million bereits zu Johannis 1767 aufgesprochen hatte und ungern ein ganzes Jahr Zinsen verlieren wollte, beschloß noch einen Versuch zu machen; er schrieb nach Hannover, man hätte große Besorgniß gehabt, ob man wohl das Geld habe aufbringen können; jetzt sei diese Besorgniß völlig gehoben und er bäte sein Schreiben vom 21. Juni als eine reine Loskündigung anzusehen.
Am 15. Juli antwortete die hannoversche Regierung ganz in dem früheren Ton: "Wir können nicht darauf sehen, was Ew. Durchlaucht intendirt haben, sondern darauf, was sie wirklich geschrieben haben. Mit Umschreibung haben Ew. Durchlaucht weiter nichts beantragt in Ihrem Schreiben vom 21. vorigen Monats als eine particulare Reluition, und die ist gegen die Convention. Uebrigens ist jetzt die Kündigungsfrist abgelaufen."
Graf Bassewitz beschloß die Sache vorläufig ruhen zu lassen, zumal der Geheime Rath von Warnstedt zu dieser Zeit noch mit dem Auszahlen der 535 000 Rthlr. beschäftigt war, da der Geheime Rath von Albedyll, in äußerst aigrirter Stimmung, daß seine Herrlichkeit als Dictator in Boizenburg nun bald ein Ende haben sollte, Schwierigkeit auf Schwierigkeit beim Auszahlen des Geldes und bei der Uebergabe der Aemter machte. "Lassen wir die Sache beruhen," schrieb Bassewitz unter den Brief Münchhausens, "bis wir erst


|
Seite 46 |




|
wirklich im Besitze der vier ersten Aemter sind. Mit Wechselschreiben contra potentiorem stehet öfterer etwas zu verderben, als gut zu machen. Schlimmsten Falls warten wir noch ein Jahr."
Im Januar des folgenden Jahres, 1767, machte dann der Herzog noch einen Versuch. In einem Brief an den König Georg - auch an die Königin Charlotte schrieb er - bat er in sehr beweglichen und herzlichen Ausdrücken, die Auszahlung der Million, welche von Johannis 1767 an in der Reluitionskasse bereit liegen würde, zu diesem Termin zu gestatten, damit er nicht 50 000 Rthlr. an Zinsen verlöre. "Nein!" lautete die Antwort aus London.
Nunmehr beeilte sich die meklenburgische Regierung eine Kündigung zum Johannis=Termin 1768 in aller Form Rechtens nach Hannover zu senden. -
In unserem Zeitalter der Milliarden und der Checks bietet die Auszahlung einer Million Thaler keinerlei Schwierigkeit. Anders war es im vorigen Jahrhundert.
Am 23. Juni des Jahres 1768 wurde die Million Thaler, in N. 2/3 und in Gold von Schwerin nach Boizenburg übergeführt. Voran der Rittmeister Diestler mit einem Detachement seiner Husaren, dann in einer sechsspännigen Karosse der Oberhauptmann von Warnstedt; hierauf die Gelder in Tonnen verpackt, auf 10 theils mit Marstall=, theils mit Postpferden bespannten vierspännigen Wagen, zur Seite von Husaren und Infanteristen escortirt, zum Schluß, - die Seele des Geschäfts, - der Zahlcommissar Schroeder in vierspänniger Kalesche, dann wieder Husaren. so bewegte sich der feierliche Zug am ersten Tage bis Wittenburg, wo ein Officier mit einem Detachement Infanterie die Bewachung für die Nacht übernahm. Am nächsten Tage erreichte man Boizenburg. Der Rittmeister zog aber nicht in das nächstgelegene Thor, in dessen unmittelbarer Nähe die Wohnung des Meklenburgischen Commissars lag, ein, sondern machte einen Umweg um die ganze Stadt und rückte in das entgegengesetzte Thor ein, um das Vergnügen zu haben, dem Geheimen Rath von Albedyll durch einen Triumphzug an seinen Fenstern vorbei einen Aerger zu bereiten. Diese menschenfreundliche Absicht gelang dem Rittmeister auch vollkommen. Durch das laute Trompetengeschmetter sämmtlicher Postillone, welche lustige Aufzüge und Fanfaren bliesen, aus seinem Nachmittagsschlaf geweckt, trat der Geheime Rath an das Fenster. Kaum erblickte ihn der Rittmeister, so commandirte er mit lauter Stimme den militärischen Salut, ritt eine Volte und stellte sich militärisch grüßend neben dem Fenster auf, bis die Million ihren Parademarsch beendet hatte.


|
Seite 47 |




|
Der Herr Commissarius verstand aber diesen harmlosen Spaß schlecht. An und für sich ein galliger Herr und dadurch nicht milder gestimmt, daß er nunmehr seinen selbstständigen und einträglichen Posten als General=Administrator der Aemter aufgeben mußte, schrieb er noch an demselben Tage einen giftigen Brief an Graf Bassewitz, in welchem er sich bitter über das impertinente Gebahren des Husaren=Rittmeisters beschwerte.
Der Graf Bassewitz war durch das widrige und feindselige Benehmen, welches der Präsident Münchhausen in der ganzen Reluitionssache gegen Meklenburg an den Tag gelegt hatte, sehr nervös geworden. Tag und Nacht befürchtete er Diebstahl und Feuersbrunst, besonders aber, daß die Entgegennahme der Gelder noch in letzter Stunde verweigert werden möchte. Er schrieb deshalb einen Entschuldigungsbrief an den Geheimen Rath von Albedyll und insinuirte dem Rittmeister, "er verbäte sich für die Zukunft solche Possen."
Nach endlosen Formalitäten und viel Zeitverschwendung gelangte man endlich - am 5. Juli! - dahin, das Zählen der Million zu beginnen; nicht ohne daß der Graf Bassewitz den Geheimen Rath v. Warnstedt, welcher schon alt und sehr methodisch war und 8 Wochen zur Abwickelung der Geschäfte beansprucht hatte, in mehreren Monitorien ernstlich zur Eile angetrieben hatte.
Der Zahlcommissar Schroeder hatte die Million aufzuzählen, Stück für Stück. Ihm waren zur Hülfe ein Kassenbeamter und als Sachverständiger ein Hebräer beigegeben. Der Kammerschreiber Rabius, welcher von hannoverscher Seite zur Uebernahme der Gelder bestimmt war, hatte nur einen Hebräer als Rechtsbeistand. Dies war aber ein äußerst streitbarer Held, gewandt, gerieben, mit allen Hunden gehetzt, während sein meklenburgischer Glaubensgenosse alt, gebrechlich und ohne alle Energie war. Da nun Ersterer, der Convention gemäß, das Recht hatte, jedes Geldstück in Bezug auf seinen Gold= ober Silbergehalt, sein Gepräge und sein Gewicht zu prüfen und von diesem Recht den ausgiebigsten Gebrauch machte, gerieth der Zahlcommissar Schroeder bald in Nachtheil und mußte sich in Hamburg nach einer Geld=Reserve umsehen, um die zahlreich ausgeschossenen Stücke rasch wieder durch neue ersetzen zu können. Es wurde ihm aber klar, daß auch diese Reserve, die er sich schon früher bei Hamburger Bankiers aufgesprochen hatte, auf die Dauer nicht ausreichen würde. Er erließ einen Nothschrei nach dem andern nach Schwerin und bat dringend um einen besseren Sachverständigen. Ein solcher erschien denn auch alsobald in der Person des Sohnes des Schweriner "Hofjuden" Nathan Aaron. Der junge Herr Aaron war ein so verschmitzter, schneidiger Geschäftsmann, wie je einer am Wechseltisch


|
Seite 48 |




|
gestanden hat. Nun bekam die Sache einen anderen Charakter. Das Auge bewaffnet mit der Lupe, in der einen Hand die Goldwage, in der andern den Probirstein, so standen sich die beiden Gegner kampfgerüstet gegenüber, keiner gewillt, dem anderen auch nur um eines Zolles Breite zu weichen; getrennt durch einen langen und breiten Tisch, um alle Eventualitäten zu verhüten. Das Schauspiel, welches diese beiden Sachverständigen boten, muß sehr ergötzlich gewesen sein, denn wir lesen in den Acten, daß der Geheime Rath von Albedyll, der für Humor sonst wahrlich keinen Sinn hatte, in den Nachmittagsstunden dem bewegten Treiben schmunzelnd beiwohnte.
Sechs Wochen hindurch zogen sich diese täglichen Schlachten hin. Bei dem vielen schlechten Gelde, welches in damaliger Zeit umlief, neigte sich der Sieg aber in bedenklicher Weise auf die Seite Hannovers. Mehr als einmal mußte der Zahl=Commissar Schroeder mit Extrapost nach Hamburg eilen, um Succurs herbeizuholen. In Summa wurden 90 000 Stück N. 2/3 als unbrauchbar ausgeschossen.
Am 12. August meldete Rabius dem Oberhauptmann v. Warnstedt, daß die Million richtig bezahlt sei, und am 19. desselben Monats erfolgte dann die Uebergabe der Aemter.
Während dieser sechs Wochen war täglich Tafel beim meklenburgischen Commissar gewesen; in der Regel weniger, mitunter bis zu 10 Personen. Für Diejenigen, welche es interessirt, wie in damaliger Zeit die Gäste bewirthet wurden, diene zur Nachricht, daß bei den Diners in Summa ausgetrunken wurden: 122 Flaschen Pontac, 96 Flaschen Rheinwein, 80 Flaschen Franzwein, 21 Flaschen Burgunder, 18 Flaschen Champagner, 5 Flaschen portugiesischer und 5/2 Flaschen Ungar=Wein.
Endlich sei noch der Geschenke erwähnt, die bei dieser Gelegenheit vom Herzog an die Persönlichkeiten, welche bei den Verhandlungen besonders in den Vordergrund getreten waren, gemacht wurden. Der Geheime Rath von Dewitz und der Landrath von Barner bekamen Jeder einen überaus kostbaren Brillantring - "kleine Wagenräder" nennt sie Graf Bassewitz - mit dem Bildniß des Herzogs, eingefaßt mit 48 großen Diamanten. 1 ) Der Geheime Rath von Albedyll erhielt eine Dose mit dem Bildniß des Herzogs; ebenso der Geheime Raths=Präsident Graf von Bassewitz. 2 )


|
Seite 49 |




|
Im August des Jahres 1763 - am 14. Februar desselben Jahres war der Hubertsburger Friede abgeschlossen - schickte der Herzog Friedrich seinen Geheimrath Baron von Lützow als envoyé extraordinaire an den Hof von Berlin, mit der Instruction:
1) die Wohlgewogenheit des Königs und der Staatsminister und deren nachbarliche Freundschaft zu suchen;
2) freundschaftlichen Umgang mit allen Gesandten, sowohl denjenigen, die dem preußischen Hof besonders freundlich gesonnen, als auch mit denen, die es nicht seien, zu pflegen, also sich außer allem Verdacht der beiden Parteien zu halten; hauptsächlich aber Umgang mit den Gesandten zu cultiviren, welche als völlig neutral anzusehen seien;
3) um dies thun zu können, solle er es sein erstes Geschäft sein lassen, die jetzigen Absichten der Höfe zu entdecken und darüber zu berichten;
4) sich bei dem preußischen Ministerium zu erkundigen, ob der König nicht geneigt sei, sich bei dem König von England dahin zu verwenden, daß Letzterer die zur hannoverschen Special=Hypothek gehörigen 8 Aemter zurückgebe;
5) Zu versuchen, ob nicht der König die an Preußen verpfändeten 4 Aemter zurückgeben wolle, oder doch die Zusage ertheilen, daß er die Aemter zurückgeben wolle, wenn Hannover einen Theil der Aemter zurückgebe.
Die Berichte sollten in Chiffreschrift geführt werden; obgleich diese Schrift sehr einfach war - für jeden Buchstaben wurde eine Zahl, nur für oft wiederkehrende Worte wurde für das Wort eine Zahl gesetzt - wurde dem Baron von Lützow ein Dechiffrirbeamter mitgegeben. Der meklenburgische Minister=Resident in Berlin, Legationsrath Hövel wurde angewiesen, dem Gesandten in allen Stücken zur Seite zu stehen.
Der Baron von Lützow war schon vielfach zu diplomatischen Sendungen in Petersburg, Kopenhagen, Stockholm u.s.w. verwendet worden, hatte sich eine genaue Personal=Kenntniß unter den leitenden Staatsmännern an den verschiedenen Höfen und durch sein gewandtes Wesen und seinen geraden Charakter viele Freunde in der diplomatischen Welt erworben. Am preußischen Hof war er persona gratissima.
So wurde er denn von den beiden Kabinets=Ministern, dem Graf von Finckenstein und dem Graf von Hertzberg überaus freundlich aufgenommen und ihm mitgetheilt, der König empfinde es als eine


|
Seite 50 |




|
Besondere Aufmerksamkeit seitens des Herzogs, daß er gerade ihn an seinen Hof abgeschickt habe.
Ebenso war der König in der Antritts=Audienz ungemein gnädig gegen Lützow. "Seine Majestät", berichtet er, "beantworteten meine französische Anrede mit den verbindlichsten Ausdrücken und haben mir sehr viele Freundschaftsversicherungen für Eure Durchlaucht und die Durchlauchte Herzogin aufgetragen. Ueberhaupt muß ich gestehen, daß ich bei meinen verschiedenen Verschickungen noch niemals mit einer solchen ausnehmenden Gnade empfangen wurde, als von diesem großen König."
Tags darauf wurde Lützow von der Königin und der Königlichen Familie empfangen. Wenn auch die Aufnahme des Baron Lützow am Berliner Hofe nichts zu wünschen übrig ließ, so war er doch vor der Hand nicht im Stande, in dem Hauptzweck seiner Mission, nämlich der Einlösung der verpfändeten Aemter, auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Zwar kam Graf Finckenstein in der ersten längeren Unterredung, die Lützow mit demselben hatte, auch auf die Pfandämter zu sprechen, da er die Absendung des Geheimraths von Dewitz nach London erfahren hatte; aber seine Aeußerung war nicht gerade ermuthigend. "Der König", sagte er, "setzt ein point d'honneur darin, die Aemter nicht eher herauszugeben, als bis England es gethan." Nach dieser Unterredung hielt es Lützow für das Beste, die Sache vorläufig nicht weiter zu treiben.
Es war überhaupt keine günstige Zeit für derartige Unterhandlungen im kleinen Stile am Berliner Hofe. Die hohe Politik überwog noch zu sehr und hielt die Gemüther der Minister und der Gesandten aller Mächte in hohem Grade in Spannung.
Wir wissen aus der Geschichte, daß aus mancherlei Gründen die Kriegsfurie wieder entfesselt zu werden drohte und daß es nur der allgemeinen Erschöpfung und dem absoluten Friedensbedürfniß der Völker zuzuschreiben war, daß die Schwerter in der Scheide blieben. Zündstoff war reichlich vorhanden.
Baron Lützow war ein scharfer Beobachter; seine Berichte geben uns ein sehr anschauliches Bild der politischen Lage in Europa, und wurden besonders fesselnd, als der am 6. October erfolgte Tod des Königs von Polen die Gemüther mächtig aufregte und im Mai 1764 zwischen Rußland und Preußen ein Freundschafts= und Vertheidigungstractat abgeschlossen wurde. Vor Allem aber verstand dieser liebenswürdige Diplomat es, sich das Vertrauen der preußischen Minister und der fremden Gesandten in hohem Maße zu erwerben. In geschickter Weise näherte er sich zunächst den Gesandten Rußlands und Oesterreichs, um sie für das Interesse seines Herrn zu gewinnen.


|
Seite 51 |




|
Schon im September berichtete er nach Schwerin, daß der österreichische Gesandte ihm gesagt habe, er habe den Auftrag, Meklenburg in Berlin zu unterstützen, fügte jedoch hinzu, daß er sich von dieser Hülfe nicht viel verspreche. Kurz darauf kam der Großkanzler Graf Woronzow aus Petersburg auf der Durchreise nach Italien nach Berlin; dieser theilte Lützow im Vertrauen mit, daß er aus eignem Antriebe dem Graf Finckenstein gesagt habe, der König könne der Czarin keinen größeren Gefallen thun, als wenn er sich recht freundschaftlich zu dem Herzog von Meklenburg=Schwerin stelle. Auch der englische Gesandte versicherte Lützow, er wolle die meklenburgischen Wünsche unterstützen.
Große Sorge machte dem leitenden meklenburgischen Minister, dem Graf von Bassewitz, der Geldmangel im Lande, für den Fall, daß die ganze Summe zur Auslösung der Aemter auf einmal ausbezahlt werden mußte. Auch hier weiß Lützow Rath. Der ehemalige Strelitzische Hofagent Marcus in Berlin hatte sich ihm gegenüber anheischig gemacht, bis zu 2 000 000 Rthlr. in neuen 2/3 Stücken an einem Tage auszuzahlen; derselbe will diese Summe in Leipzig ober in Braunschweig prägen lassen.
Nachdem um die Mitte des Jahres 1764 der Friede gesichert erschien, widmete sich der König ganz seinen finanziellen Unternehmungen, um aus den Ueberschüssen den Staatsschatz wieder zu füllen.
Uebernahme der Münze auf den Staat, Verpachtung der Tabacksregie, Errichtung einer Bank in Berlin; auch für die Einkünfte der Stempelkammer, der Post und der Accise wurde ein Generalpächter gesucht; alles dies umfaßte die unermüdliche Thätigkeit des Königs, um Geld für den völlig ausgesogenen Staat zu schaffen. Lützow berichtete sogar, daß der König große Massen Getreide für schlechtes Geld aufgekauft und im Clevischen aufgespeichert habe, um dasselbe bald darauf für gutes Geld nach auswärts zu verkaufen;
bei diesem Handel habe der König 200 000 Rthlr. lucrirt. Völlig unerträglich war es dem König, einen Ausfall in irgend einer Kasse zu haben und er litt nie Uebertragungen von einer Kasse in die andere. Wir sehen, es war ein schlechter Zeitpunkt, welchen die meklenburgische Regierung gewählt hatte, die Aemter einzulösen, da hierdurch ein erheblicher Ausfall in den Einnahmen des preußischen Staates eingetreten wäre.
Da in der Reluirung der Aemter vorläufig nichts zu machen war, kehrte Baron Lützow nach Schwerin zurück und ging nur zeitweise so lange nach Berlin, als nöthig war, um dort seine Stellung als Gesandter zu behaupten. Hierzu zwang nämlich den Herzog der Zustand seiner Finanzen, welcher kostspielige permanente Gesandtschaften


|
Seite 52 |




|
schlechterdings verbot. Es wurde dem Herzog nicht leicht, dem Baron Lützow außer seinem Gehalt, monatlich 100 Louisd'or Zulage zu geben, abgesehen von den Reisekosten, welche - die Reise hin und zurück währte 10 Tage - jedesmal 189 Rthlr. kostete.
Im Jahre 1766 bot sich eine günstige Gelegenheit, um Verhandlungen wegen Einlösung der Aemter anzuknüpfen, dadurch, daß zum Johannis=Termin dieses Jahres die Hälfte der an Hannover verpfändeten Aemter an Meklenburg zurückgegeben werden sollte. Der Baron Lützow mußte sich sofort auf seinen Posten in Berlin begeben und wurde angewiesen, zunächst discursive, als geschähe es ohne Auftrag, den Grafen Finckenstein und Hertzberg von der Rückgabe der Aemter zu sprechen. Beide Minister waren der Ansicht, der König würde keine Schwierigkeiten machen. Derselbe habe schon geäußert, als ihm die zwischen Hannover und Meklenburg abgeschlossene Convention vorgelegt sei: "Nun werden sie mich in Meklenburg wohl auch bald auslösen!" Das Mißliche bestehe nur darin, daß aus den Einkünften der Aemter, der König für seine Chatulle 1500 Thlr. bestimmt habe und mehrere Generale ebenfalls Summen aus diesem Fonds bezögen, welche der Herzog sich schon entschließen müsse, nach der Auslösung weiter zu zahlen. Bei der ökonomischen Denkungsart des Königs sei hiervon nicht abzukommen. Die Entfernung der Husaren aus Meklenburg würde vielleicht weniger Schwierigkeiten machen, denn bei der letzten Revue sei das in Meklenburg stehende Husaren=Bataillon so verwildert und schlecht exercirt gewesen, daß der König ausgerufen habe:
"Das kommt daher, weil die Kerle allzugute Tage im Lande Gosen haben!"
Im Ganzen gewann Lützow aber doch den Eindruck, als wenn die Minister auswichen und Ausflüchte suchten. Er schlug deshalb seiner Regierung vor, sich des Obersten Quintus Icilius - vormals Professor Guiscard - zu bedienen, welcher anfangs durch seine Kenntniß in den morgenländischen Sprachen, dann aber durch seine Gewandtheit in Commerz= und Finanzsachen sich die besondere Gunst des Königs erworben hatte. Diesem eigennützigen Mann, der jede Gelegenheit sich zu bereichern suchte, hatte Lützow gesagt, der Herzog würde ihn ansehnlich belohnen, wenn er den König bewege, die vier oder vorläufig wenigstens doch zwei Aemter zurückzugeben. Der Oberst hatte erwidert, die Gelegenheit sei gerade jetzt günstig, da er 200 000 Rthlr. aufleihen solle, um Handelsbeziehungen in Cadix und Livorno anzuknüpfen; er wolle den König gerne sondiren.
Dies Anerbieten wurde aber vom Grafen Bassewitz kurz abgewiesen; solche Privatbemühungen von mercenairen favoriten kenne


|
Seite 53 |




|
er aus Erfahrung zur Genüge; sie kosteten nur Geld und verliefen in der Regel unglücklich. Wenn dann die Minister die Sache zum Vortrag beim König brächten, fänden sie einen praeoccupirten Herrn!
Dagegen richtete Graf Bassewitz im Juli ein Schreiben an die preußischen Minister, mit der Bitte, nunmehr, da die Hälfte der hannoverschen Aemter reluirt sei, auch zwei der an Preußen verpfändeten Aemter an Meklenburg zurückzugeben, gegen Rückzahlung der Hälfte der im Ganzen 140 000 Rthlr. betragenden Forderung.
Auf dies Schreiben kam Ende August eine völlige abschlägige Antwort aus Berlin, mit der Bemerkung, daß man übel berichtet sei; nicht 140 000 Rthlr. betrüge die Pfandsumme, sondern 153 830 Rthlr. Dabei habe der König nur die Zinsen von seinem Kapital genutzt, der Rest sei für die Administration und zur Instandsetzung der Gebäude in den Aemtern, also zu Nutzen des Herzogs verwendet. Ein zweites Schreiben der meklenburgischen Regierung hatte keinen besseren Erfolg. So endete das Jahr 1766.
Im April des folgenden Jahres schickte Graf Bassewitz die zu Johannis 1768 geschehene Kündigung der vier übrigen hannoverschen Pfandämter, an den Baron Lützow, damit er dieselbe in origine den preußischen Ministern vorlege und dabei die Bitte ausspreche, daß zu demselben Termin auch alle vier an Preußen verpfändeten Aemter zurückgegeben und alle drei Garnisonen von den Husaren geräumt werden möchten. Graf Finckenstein versprach, die Sache sofort dem Könige vorzutragen; dann aber machten beide Minister Ausflüchte: die Sache sei ja nicht so eilig und endlich erklärte Graf Herzberg, der König habe beim Vortrag gesagt: "Das hat noch ein Jahr Zeit!"
Dem Grafen Bassewitz blieb nichts anderes übrig, als sich zu gedulden; er schrieb an die preußischen Minister, daß er zu Johannis 1768 sicher auf Erfüllung seiner Bitte rechne. Den Baron Lützow aber wies er an, er solle nur in Berlin gar nicht davon erzählen, daß seine Regierung sich ernstlich um die Wiedergewinnung der Aemter bemüht habe und nun die Flinte ins Korn werfe; er solle, wenn er gefragt würde, sagen, man habe in Schwerin mit der Reluition der hannoverschen Aemter gerade genug zu thun und habe wegen Einlösung der preußischen Aemter nur flüchtig seine Gedanken mit dem Berliner Gouvernement ausgetauscht! Sonst verscherze man sich noch die Achtung der anderen Mächte, des Reichshofraths in Wien und der eigenen Landstände. Baron Lützow verließ hierauf Berlin auf längere Zeit.


|
Seite 54 |




|
Nachdem Johannis 1768 die letzten vier der an Hannover verpfändeten Aemter zurückgegeben waren, dankte der Herzog dem König Georg für seine in der Reluitions=Angelegenheit bewiesene Coulanz und bat, seinen Gesandten Mitschel in Berlin anzuweisen, die nunmehr bevorstehenden Unterhandlungen zur Wiedererlangung der an Preußen verpfändeten Aemter beim König von Preußen zu unterstützen. Zu seinem großen Erstaunen erhielt er aber im October die kurze und bündige Anwort:
"Ebensowenig wie ich es liebe, daß sich ein fremder Hof in meine Angelegenheiten mischt, mag ich mich auch nicht in die Angelegenheiten Preußens mischen!"
Im November desselben Jahres begab sich Lützow wieder auf seinen Posten in Berlin. Er erhielt die Instruction, nunmehr die Reluitionsfrage mit allem Eifer zu betreiben und zu dem Ende wenigstens einmal wöchentlich bei beiden Ministern vorzusprechen. Auch wurde ihm ein Schreiben des Herzogs an König Friedrich mitgegeben für den Fall, daß die Minister ihn direct an den König verweisen sollten. Dies Schreiben zeigte Lützow im December dem Graf Finckenstein mit der Bitte, ihm zu sagen, ob er das Schreiben in Audienz dem Könige übergeben oder ob er einen formellen Antrag beim Ministerium wegen Rückgabe der Aemter stellen solle. Der Graf sagte, er wolle sich mit dem Graf Herzberg besprechen und bat den Gesandten um Geduld; er suche nur nach einer passenden Gelegenheit, der Sache eine günstige Wendung zu geben.
Inzwischen kamen aber im Februar des Jahres 1769 Aeußerungen des Königs zu Lützows Ohren, welche ihm die Sache nicht in so rosigem Lichte erscheinen ließen, als die Minister ihn glauben machen wollten. Ein guter Freund Lützow's hatte, um den König zu sondiren, Letzterem gegenüber geäußert, der Herzog von Meklenburg bemühe sich ja jetzt, wieder in den Besitz seiner Aemter zu kommen.
"Das ist mir bekannt", hatte der König trocken und ohne die Miene zu verziehen, erwidert, "das Geld ist dazu bereits schon in Holland negocirt". 1 )
Dieselbe ausweichende Antwort erhielt der Oberst Quintus Icilius:
"Die Hannoveraner hatten Geld nöthig, ich brauche aber keins!" sagte der König. Ebenso sollte der König auf eine Andeutung hin,


|
Seite 55 |




|
erstaunt geäußert haben: "Ich denke gar nicht daran, meine Husaren aus Meklenburg herauszuziehen; ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat!"
Der Herzog war sehr verstimmt, als Lützow dies berichtete und ließ demselben seine Ungeduld ausdrücken. Auch fing man jetzt in Schwerin an, zu erwägen, ob man nicht durch Hinterthüren weiter komme, wie durch offene Unterhandlung mit den Ministern. Lützow wußte, daß ein officieller Bericht der Minister an den König überhaupt noch nicht abgegangen war, und so wollte man denn auf alle Fälle auf diejenigen Personen einwirken, welche im Cabinet des Königs die Aemterangelegenheiten bearbeiteten. Zu diesem Geschäft verwandte der Herzog den Oberjägermeister v. Brandt auf Wangelin, welcher das Amt Plau in Pacht hatte. Ihm sollte die Pacht prolongirt werden und er hatte die Erlaubniß, Douceurs in der Höhe von 2000 Ducaten denjenigen Personen zu versprechen, welche zu der Reluition der Aemter mitwirken würden. Nach 11monatlichem Bemühen in Potsdam, hatte derselbe aber - nichts erreicht und ihm wurde die Unzufriedenheit des Grafen Bassewitz in sehr ungnädiger Weise insinuirt, zumal, da man Grund zu haben glaubte, daß er doppeltes Spiel getrieben habe.
In Folge des Drängens von Schwerin aus, pressirte Baron Lützow die Sache jetzt ebenfalls mehr. Er bat den Grafen Finckenstein dringend, ihm endlich Bescheid zu geben, der Herzog, sein Herr fange schon an, ihm alle Schuld beizumessen, worauf der Minister erwiderte: "Mein Gott, was können dem Herzog denn einige Wochen ausmachen!?" Und als nun Graf Hertzberg, der an diesem Morgen übellaunig und zerstreut war, gar äußerte, die Sache sei doch nicht von so großem Belang, ließ sich Lützow hinreißen, heftig zu werden, was freilich keinen anderen Effect hatte, als daß er am nächsten Tage höflichst um Entschuldigung bitten mußte.
Am 27. Mai konnte endlich Lützow dem Herzog Friedrich bestimmt melden, daß die Minister ihren schriftlichen Bericht, von dem er das Beste hoffe, in das Cabinet des Königs gesandt hätten.
Schon vor längerer Zeit hatte Graf Bassewitz dem Baron Lützow ans Herz gelegt, sich nunmehr ernsthaft um die Hülfe der fremden Gesandten zu bewerben. Bei dem russischen Botschafter waren Lützow's Bemühungen auf den fruchtbarsten Boden gefallen. Der Erstere hatte die Erlaubniß der Czarin Katharina, welche auch von Schwerin aus um Unterstützung angegangen war, erbeten und erlangt, für den Herzog von Meklenburg am Berliner Hofe wirken zu dürfen. Im Juli (1769) besuchte der Fürst Dolgorucki den Grafen von Finckenstein und gab in dringlichen Redewendungen den


|
Seite 56 |




|
Wünschen seiner Herrin Ausdruck. Finckenstein war sichtlich um die Antwort verlegen.
"Warum eilt der Herzog von Meklenburg so mit der Sache?"
"Jeder will doch Herr in seinem Lande sein! Ich muß der Kaiserin berichten, wie die Sachen stehen", erwiderte Dolgorucki.
Da wurde der Graf offenherziger und sagte, der Bericht der Minister in der Aemterfrage liege seit Monaten auf dem Schreibtisch des Königs; Letzterer schiene aber nicht sehr pressirt zu sein. Der Botschafter bat, nach einiger Zeit wieder anfragen zu dürfen.
Auch bei Graf Hertzberg sprach Fürst Dolgorucki vor. Der sagte, der König werde sich nicht weigern, die Aemter zurückzugeben, aber die Sache müßte noch hinausgeschoben werden, der König habe auch noch verschiedene Ansprüche an den Herzog.
Im August war der russische Botschafter zum zweiten Male beim Grafen Finckenstein.
"Der König hat noch keine Zeit gehab", wich Letzterer aus.
"Das bedaure ich lebhaft", erwiderte der Fürst; "die Czarin hat mich schon erinnert, ob denn noch keine Antwort da sei?"
Letzteres war zwar nicht der Fall; die Czarin hatte ihren Botschafter nicht erinnert, hatte die Sache vielleicht ganz vergessen, aber auf Anregung des englischen Gesandten war dieser Coup zwischen Lützow und Dolgorucki verabredet worden, um eine größere Wirkung zu erzielen.
Um den großen Diensteifer des Fürsten Dolgorucki zu erklären, müssen wir hier einschalten, daß Baron Lützow auf eigne Verantwortlichkeit dem Fürsten eine namhafte Erkenntlichkeit seitens des Herzogs versprochen hatte, wenn er reüssire; ebenso dem General Lentulus, welcher den König in dessen Wagen zur Revue nach Schlesien begleiten sollte.
"Das hätte ich nicht geglaubt, daß man das dem Fürsten bieten dürfe!" bemerkt Graf Bassewitz unter dem Bericht des Gesandten.
Das coulante Benehmen des Herrn Mitschel in Berlin brachte den Graf Bassewitz auf die Idee, nochmals die englische Hülfe anzurufen und zwar die der Königin Sophie Charlotte. Obgleich der Herzog Friedrich seine Ansicht dahin aussprach, daß wenn durch die Intervention der mächtigen und mit dem Berliner Hofe damals eng liirten Czarin nichts erreicht wäre, die der Königin von England auch nichts helfen würde, gab er doch den Vorstellungen seines geschäftskundigen Ministers nach und schrieb an die Königin. Die Antwort der Letzteren, welcher der Brief, den sie im Jahre 1763 an ihren Bruder, dem Herzog Adolf Friedrich von Meklenburg=


|
Seite 57 |




|
Strelitz bei Gelegenheit der Reluirung der an Hannover verpfändeten meklenburgischen Aemter geschrieben und der ihr manchen Verdruß bereitet hatte, noch in zu frischer Erinnerung sein mochte, ließ nicht lange auf sich warten: "Ihre Majestät bedaure sehr; sie wisse nichts von den Aemtern, glaube auch nicht, daß ihr Fürwort nützen würde", war der in äußerst verbindliche Worte gekleidete Bescheid von "des Herzogs freundwilliger Muhme Charlotte."
Während der Revue im Jahre 1769 in Schlesien, hatte König Friedrich mit dem Kaiser Joseph eine Zusammenkunft in Neisse gehabt und war in die freundschaftlichsten Beziehungen zu diesem Monarchen getreten. Graf Bassewitz beschloß, diesen Umstand auszunutzen und den Kaiser um seine Intercession bei dem König von Preußen zu bitten.
Der General Lentulus rieth ebenfalls dazu, und so wurde der meklenburgische Geschäftsträger am Wiener Hofe, der Hofrath Edle von Schmidt beauftragt, die kaiserlichen Minister zu sondiren und ihnen zu insinuiren, die Fürsprache des Kaisers schiene dem Herzog der beste und sicherste Weg zu sein, da doch die meklenburgischen Aemter lediglich durch die Schuld des Wiener Reichshofraths in fremde mächtige Hände gelangt seien. Schmidt schrieb zurück, daß die beiden Monarchen, bei ihrer Zusammenkunft in Neisse verabredet hätten, die lästige Form der Handschreiben in ihrem gesellschaftlichen Verkehr ganz fallen und statt dessen Alles in Audienzen durch ihre Gesandten erledigen zu lassen. Zu diesem Zweck sei es aber nöthig, daß der Herzog seine Sache dem Reichs=Vice=Kanzler Fürsten Colloredo schriftlich eingebe. Dadurch hätte die ganze Angelegenheit jedoch nicht den Schein der Intercession eines mit Preußen befreundeten Monarchen, sondern den Charakter einer Klage bei Kaiser und Reich angenommen und gerade dies war es, was man unter allen Umständen vermeiden wollte. Man hatte in Schwerin während des 7jährigen Krieges gar zu traurige Erfahrungen mit der Reichshilfe gemacht! Man ließ die Sache lieber ganz fallen.
Nun rieth der General Lentulus zu einem Handschreiben des Herzogs an den König, mit der Bitte um Rückgabe der Aemter und Herausziehung der preußischen Garnisonen. Der Herzog war hierzu bereit. Den Vorschlag des Baron Lützow, dem Begleitschreiben an den General Lentulus einen Wechsel von 100 Louisd'or beizulegen, verwarf Graf Bassewitz mit dem Bemerken, daß Letzterer, wenn er reüssire, mehrere 1000 Ducaten sicher bekommen solle. Dies vom 30. September 1769 datirte Handschreiben konnte Lentulus aber erst im December dem Könige übergeben, da der General längere Zeit dienstlich bei seinem Regimente in Magdeburg anwesend war.


|
Seite 58 |




|
Der König las das Schreiben, legte es auf den Schreibtisch und sagte: "J'y repondrai." Schon in den nächsten Tagen erhielt der Herzog ein Antwortschreiben aus dem Cabinet des Königs. Dasselbe floß von Wohlwollen= und Freundschaftsbezeugungen über; von der Aemter=Angelegenheit enthielt es aber keine Sylbe.
Der Baron Lützow sah es schon als ein nicht ungünstiges Zeichen an, daß der König nicht entschieden "Nein" gesagt hatte. Er schlug deßhalb dem Herzog vor, ob er nicht sofort eine Audienz erbitten und die Sache dem König persönlich vortragen solle? Dem widersetzte sich aber der Graf Bassewitz: "Sagt der König dann "Nein", so dürfen wir ihm mit der Sache überhaupt nicht wieder kommen." Der Graf war weiter der Ansicht, daß der König nur deßhalb keine rein abschlägige Antwort gegeben hatte, weil er hoffte, die meklenburgische Stimme auf dem Reichstage zu Regensburg zu erlangen, wo in einer Visitations=Angelegenheit des Reichskammergerichts in Wetzlar gerade jetzt die Höfe von Berlin, Hannover und Dresden Oesterreich und seinen Anhängern gegenüberstanden und sich lebhaft um die Stimme Meklenburgs bewarben.
Am 8. März des nächstfolgenden Jahres - 1770 - versuchte es der Herzog mit einem nochmaligen Handschreiben an den König. Es erfolgte keine Antwort. Ein drittes Schreiben, datirt vom 28. Mai, in welchem der Herzog um Antwort bat und den König ersuchte, die Aemter Plau und Wredenhagen, deren Pächter, der Oberjägermeister von Brandt, gestorben war, nicht wieder zu verpachten, hatte keinen besseren Erfolg. Auch die meklenburgische Regierung schrieb noch einmal an das preußische Ministerium. Dann erfolgte eine lange Pause, bis zum Sommer 1771; Lützow schrieb, der König habe dem General Lentulus schließlich den Mund verboten; und den Grafen Finckenstein und Hertzberg war nicht undeutlich zu verstehen gegeben, der König wolle nichts mehr von den Aemtern hören. Baron Lützow war in diesem Jahr selten in Berlin, nur wenn der König dort war; er entschuldigte sich mit häuslichen Geschäften. Eine permanente Anwesenheit des Gesandten in Berlin, verbot, wie früher, auch jetzt noch, der schlechte Stand der herzoglichen Kasse.
Als der Herzog den Baron Lützow im April 1772 zu seinem Oberhofmarschall ernannt hatte, unterblieb dessen Reise nach Berlin in diesem Jahre ganz; er entschuldigte sich mit den Geschäften seiner neuen Charge. Anfang des Jahres 1773 übergab Baron Lützow dem Könige ein Beurlaubungsschreiben in einer Audienz. "Sr. Majestät war äußerst gnädig, erwähnte aber die Aemterfrage mit keinem Wort," berichtete der Gesandte an seine Regierung.


|
Seite 59 |




|
Der Graf Bassewitz sah ein, daß ein wiederholtes, lebhaftes Drängen den König, welcher so offensichtlich abgeneigt war, die Aemter zurückzugeben, vielleicht dazu bewegen könnte, ein definitives "Nein" auszusprechen. Dann war bei dem Charakter des Königs, während seiner Lebenszeit auf eine günstige Erledigung der Angelegenheit überhaupt nicht mehr zu rechnen und auch sein Nachfolger konnte durch diese abschlägige Antwort leicht ungünstig beeinflußt werden. Deßhalb sann man auf andere Mittel.
In Hannover commandirte der Bruder der Königin Sophie Charlotte von England, der Prinz Carl von Meklenburg=Strelitz die hannoverschen Truppen. An diesen wandte sich der Herzog und bat ihn, nach Berlin zu reisen, um dort, als geschähe es aus eigener Initiative, beim König für die Rückgabe der Aemter zu plaidiren. Man sieht aus der Antwort des Prinzen, daß er sich sehr ungern auf diese Sache einließ; er dürfe ohne Erlaubniß seines Schwagers nicht nach Berlin reisen, er müsse sich am dortigen Hofe auf den Wunsch seiner Schwester berufen können, der englische Gesandte müsse zuvor instruirt werden; indessen habe er sich mit dem preußischen Minister von Horst durch den früheren hannoverschen Oberst=Lieutenant von Scheither, der ein Schwager des Ministers war, in Verbindung gesetzt, der solle im herzoglichen Interesse wirken. Bald kam denn auch ein längeres Schreiben des genannten Oberst=Lieutenants; sein Schwager wolle, obgleich die Sache nicht zu seinem Ressort gehöre, unter der Hand Schritte thun; dann bittet er, ob der Herzog nicht die Veräußerung einiger tausend Loose einer in Hannover gestatteten Zahlen=Lotterie, bei der er interessirt war, in Meklenburg erlauben wolle. Der Oberst=Lieutenant ward abschläglich beschieden und enttäuscht und degoutirt ließ Herzog Friedrich die Vermittelung des Prinzen fallen.
Nun wurde die Sache in anderer Weise versucht. Im Cabinet des Königs von Preußen befand sich ein alter 80jähriger Cabinetsrath, welcher zwar nicht mehr im Dienst war, aber doch vom König die Erlaubniß erhalten hatte, die Verwaltung und Verpachtung der an Preußen verpfändeten Aemter in seiner Hand zu behalten; "um das damit verknüpfte utile nicht aus seinen Klauen zu lassen", wie sich Graf Bassewitz drastisch ausdrückte. 1 ) Man hatte in Schwerin die sichersten Anzeichen, daß dieser "böse Mensch" es sei, welcher den König durch seine Intriguen verhindere, die Aemter zurückzugeben. Graf Bassewitz hatte auch schon versucht, durch den Oberjägermeister


|
Seite 60 |




|
von Brandt auf denselben einwirken zu lassen, aber vergebens. Mit Ungeduld hatte die meklenburgische Regierung den Tod dieses Mannes erwartet. Nun war derselbe gestorben und man beeilte sich, Nutzen aus diesem Umstande zu ziehen.
Zu Ivenack wohnte Herr von Maltzan, Graf von Plessen, welcher früher als Diplomat in preußischen Diensten gewesen, und durch seine Begüterung zugleich preußischer und meklenburgischer Vasall war. Er kannte das Terrain in Berlin aus dem Grunde und stand in den freundschaftlichsten Beziehungen zum Grafen Finckenstein. Im Kabinet des Königs hatte er einen Secretair an der Hand, der früher, als Maltzan vom König als Gesandter gebraucht wurde, als Secretair unter ihm gestanden und der ihm allein sein Glück zu verdanken hatte.
Graf Plessen ließ sich bereit finden nach Berlin zu gehen, aber seiner früheren Stellung wegen, nur als Privatmann. In einer Unterredung mit dem Herzog zu Ludwigslust verspricht er demselben, sein Möglichstes zu thun, räth aber, als er vernimmt, daß der General von Anhalt, der in hoher Gunst beim Könige stand, in Schwerin um Ueberlassung einiger hundert Rekruten, welche in Meklenburg angeworben werden sollten, gebeten hatte, dem Herzog dringend, diese Bitte zu gewähren; einen besseren Anknüpfungspunkt für seine Unterhandlung gäbe es in der Welt nicht. Dies war aber ein wunder Punkt bei Herzog Friedrich; nichts war diesem frommen Fürsten verhaßter als dieser Menschenhandel; er konnte sich nicht entschließen die Rekrutenanwerbung zu bewilligen. Nach vierwöchentlichem Aufenthalt kam Graf Plessen im März 1773 aus Berlin zurück; ohne Bewilligung der Rekruten sei überhaupt nichts zu machen. Im nächstfolgenden Jahre fuhr er dann noch einmal auf 4 Wochen nach Berlin, kam aber völlig unverrichteter Sache zurück. Graf Finckenstein sowohl wie Graf Hertzberg hatten ihm gesagt, es sei unmöglich, etwas in der Sache auszurichten.
Da der Graf Plessen jegliche Reisekosten und Diäten zurückwies, schenkte ihm der Herzog einen Degen mit goldenem Griff, den ein, meklenburgischer Diplomat, welcher jüngsthin nach Stralsund geschickt war, um daselbst den König von Schweden zu begrüßen, von Letzterem zum Geschenk erhalten, aber wieder veräußert hatte. In damaliger Zeit war das Geld äußerst knapp und es war sehr vielfach Sitte, daß die Regierungen dergleichen kostbare Präsente, welche die Besitzer, um sie zu verkaufen, nach der Leipziger Messe schickten, dort durch ihre Agenten aufkaufen ließen. Der Schweriner Kaufmann Bernascone kaufte diesen Degen, dessen Werth 500 Rthlr. betrug, dort für


|
Seite 61 |




|
225 Rthlr. für seine Regierung; eine Dose, welche 1500 Francs gekostet hatte, wurde von einem anderen Agenten für 700 Francs angekauft.
Im Mai des Jahres 1774 schien ein günstiger Umstand dem Herzog zu Hülfe kommen zu wollen. Ein Herr von Grawert, Günstling und Vertrauter des Kronprinzen von Preußen schrieb an den Kammerrath von Dorne und ein Rittmeister von Kirchhoff von der Garde du corps aus Hannover an den Kassier Pauli in Schwerin; Beide sprechen die Bitte aus, der Herzog möge dem Kronprinzen, der in Geldverlegenheit sei, mit einem Darlehen von vorläufig 10 000 Rthlr. helfen. Der Rittmeister, an die Correspondenz mit dem Prinzen Carl von Meklenburg=Strelitz, die man für streng vertraulich gehalten hatte, anknüpfend, läßt nicht undeutlich durchblicken, daß, wenn man dem Kronprinzen Geld leihe, dies eine günstige Gelegenheit sei, für später die Reluirung der Aemter anzubahnen.
Man erwog die Sache in Schwerin reiflich; aber der Gedanke, daß man, wenn der Kronprinz vor dem König stürbe, das Geld verliere und daß es für den Herzog eine höchst unangenehme Sache sei, wenn der König den Handel erführe, gewann die Oberhand. Der Kammerherr von Dorne und der Kassier Pauli wurden angewiesen, als aus eigener Initiative beiden Herren in der höflichsten Weise zu erwidern, die Kammer habe kein Geld und es sei unmöglich, noch mehr Geld auf die herzoglichen Domainen anzuleihen.
Damit war die Sache vorläufig zu Ende. Nach 10 Jahren aber - im Jahre 1784 - erhielt der Herzog ein Schreiben eines Herrn Heinrich Wilhelm Bramigk zu Dessau, in welchem derselbe bittet, dem Kronprinzen ein Darlehen - jetzt von 200 000 Rthlr. - zu bewilligen.
Dieser Vorschlag war einer ernsten Erwägung werth. Der König war alt und kränklich; es war nicht klug, den Erben der preußischen Krone durch eine Ablehnung vor den Kopf zu stoßen. Auf der anderen Seite war es für den Herzog schwer, eine so große Summe aufzubringen. Als daher Herr Bramigk, der zunächst ohne Antwort vom Herzog geblieben war, in einem Schreiben an den Minister von Dewitz, welcher seit dem 13. April an Stelle des verstorbenen Ministers Grafen von Bassewitz zum Geheimen Raths=Präsidenten ernannt war, dringlicher wurde und sagte, der Kronprinz habe ihn schon zweimal zur Eile gemahnt, wich man zwar zunächst aus und entschuldigte sich mit dem schlechten Stand der herzoglichen Finanzen, willigte dann aber ein, als der Agent behauptete, unbedingte Vollmacht zu haben und ein eigenhändiges Schreiben des Kronprinzen vorzuzeigen bereit war, in welchem Letzterer sich verpflichtete, nach


|
Seite 62 |




|
seinem Regierungsantritt dieAemter zurückzugeben; mit 100 000 Rthlr. könnten seine Finanzen allenfalls geregelt werden, wenn alle Vierteljahr 15 - 20 000 Rthlr. gezahlt würden. Dewitz war der Ansicht, daß man dem Kronprinzen, "welcher sehr in Angst vor seinem alten, ihm überaus ungnädig gesinnten Oheim sei und der später aus Intriguen, Rachgier, Caprice und Hartnäckigkeit" die Herausgabe der Aemter ganz verweigern könne, helfen müsse und schrieb zurück, daß man bereit sei, von sechs zu sechs Monaten die Summe von 10 000 Rthlr. gegen 4 % aus der Reluitionskasse zu zahlen. Bramigk erwiderte, Anfang September werde er mit der Vollmacht und einem Begleiter aus der Umgebung des Kronprinzen in Schwerin erscheinen.
Weiter reichen die Acten in dieser Angelegenheit nicht. Der Handel scheint aber nicht zu Stande gekommen zu sein, denn in den Listen der Reluitionskasse dieses, sowie der nachfolgenden Jahre finden sich desbezügliche Zahlungsposten nicht. 1 )
Als im Jahre 1777 der Kurfürst Maximilian Joseph von Baiern gestorben und mit ihm der Mannesstamm des Wittelsbacher Hauses erloschen war, machte Oesterreich Anspruch auf einen großen Theil des Kurfürstenthums. Friedrich der Große war entschlossen, dies nicht zu dulden und machte sich zum Sachwalt der Interessen vieler Reichsfürsten, welche in diesem Vorgange einen bedenklichen Präcedenzfall sahen. Zugleich erhoben der Kurfürst von Sachsen für seine Gemahlin Anspruch auf die Allodial=Erbschaft Maximilian Josephs und Meklenburg auf die zu Baiern gehörige Landgrafschaft Leuchtenberg.
Die Absicht des Herzogs Friedrich war von vorne herein, den Besitz der ihm eventuell zufallenden Landgrafschaft nicht anzutreten, sondern sich durch Cession derselben an Preußen den Weg zu ebnen, die Einlösung der Aemter vom König zu erlangen. Leider mißlang dieser Plan. Die Landgrafschaft wurde Meklenburg nicht zugesprochen, und der Herzog erhielt als Ersatz dafür das jus de non appellando, d. h. die meklenburgischen Unterthanen verloren das Recht, von dem höchsten Gericht des Landes an den Reichshofrath in Wien - in


|
Seite 63 |




|
politischen Sachen - und an das Reichskammergericht in Wetzlar - in Privatangelegenheiten - Berufung einlegen zu dürfen.
Der Graf Bassewitz ersann nun einen anderen Plan.
Der Herzog besaß - cum omni effectu dominii et
superioritatis territorialis - das von der
Priegnitz und dem Ruppiner Kreise gänzlich
umschlossene Domanialdorf Rossow c. p., und
daneben liegen, gleichfalls von preußischen
Territorien ganz eingeschlossen, die unter der
Landeshoheit des Herzogs stehenden
ritterschaftlichen, vormals Barnewitzschen Güter
Netzeband
 ., welche damals dem General v.
Königsmark gehörten. Von diesen Gütern aus wurde
von Juden und Christen viel Schmuggelhandel in
das Preußische hinein betrieben, zum großen und
wiederholten Aerger des Königs, der in Sachen
der Regie keinen Spaß verstand. Dies
Domanialdorf Rossow c. p. mit der Landeshoheit
sollte der Herzog dem König zum Tausch
vorschlagen und sich dabei zugleich erbieten,
die Netzebander Güter gegen die damals unter
meklenburgischer Hoheit stehenden, aber von
meklenburgischem Land umschlossenen Güter
Rotmannshagen
., welche damals dem General v.
Königsmark gehörten. Von diesen Gütern aus wurde
von Juden und Christen viel Schmuggelhandel in
das Preußische hinein betrieben, zum großen und
wiederholten Aerger des Königs, der in Sachen
der Regie keinen Spaß verstand. Dies
Domanialdorf Rossow c. p. mit der Landeshoheit
sollte der Herzog dem König zum Tausch
vorschlagen und sich dabei zugleich erbieten,
die Netzebander Güter gegen die damals unter
meklenburgischer Hoheit stehenden, aber von
meklenburgischem Land umschlossenen Güter
Rotmannshagen
 . zu vertauschen, d. h. nur soweit
es die Landeshoheit beträfe. Freilich ging dann
ein Domanialdorf verloren; "aber die Sache
ist so", sagte Graf Bassewitz, "als
wenn ich durch Abnahme eines Fingers die Hand
oder den ganzen Arm vom kalten Brand rette."
. zu vertauschen, d. h. nur soweit
es die Landeshoheit beträfe. Freilich ging dann
ein Domanialdorf verloren; "aber die Sache
ist so", sagte Graf Bassewitz, "als
wenn ich durch Abnahme eines Fingers die Hand
oder den ganzen Arm vom kalten Brand rette."
Baron Lützow wurde im October 1779 wieder nach Berlin geschickt, aber, um Kosten zu ersparen, nicht als Gesandter, sondern als Privatmann, um sich mit dem Minister von Görne, zu dessen Ressort die Handels= und Zollsachen gehörten, in Verbindung zu setzen. Der Agent Marcus, welcher im Geldverkehr mit Görne stand, sollte die Sache vermitteln. Der Minister wollte sich aber auf nichts einlassen.
Es wurde nun von Lützow ein Secretair des
Tabacks= und Accisegerichts gewonnen, durch den
ein Bericht an den König gelangen sollte, daß
von Netzeband
 . aus stark geschmuggelt würde.
Als sich auch dieser Plan als unthunlich erwies,
schlug Lützow auf Betreiben des Secretairs
seiner Regierung vor, es solle eine Fuhre von
2000 Pfund geringen Caffees von Netzeband aus
durch einen Juden den preußischen Zollwächtern
in die Hände gespielt werden. Wenn dies dem
König gemeldet wäre, könne Lützow bei den
Ministern, unter der Hand, mit seinem Plan hervortreten.
. aus stark geschmuggelt würde.
Als sich auch dieser Plan als unthunlich erwies,
schlug Lützow auf Betreiben des Secretairs
seiner Regierung vor, es solle eine Fuhre von
2000 Pfund geringen Caffees von Netzeband aus
durch einen Juden den preußischen Zollwächtern
in die Hände gespielt werden. Wenn dies dem
König gemeldet wäre, könne Lützow bei den
Ministern, unter der Hand, mit seinem Plan hervortreten.
Graf Bassewitz erklärte dies aber für ein unwürdiges, mit dem König getriebenes Spiel, welches außerdem, wenn es durch Zufall entdeckt würde, die unangenehmsten Folgen haben könne. Um die Sache aber nicht ganz fallen zu lassen, wurde Baron Lützow nunmehr mit einem Creditiv an die Minister versehen, "daß er einen bestimmten


|
Seite 64 |




|
Auftrag zu erfüllen habe", und stellte nun den Grafen Finckenstein und Herzberg einen förmlichen Antrag wegen des Umtausches der genannten Güter und der Reluirung der Aemter. Die Minister erwiderten, sie würden eine gute Gelegenheit wahrnehmen, um dem Könige Bericht zu erstatten; bisher sei Letzterer widerwillig gewesen, vielleicht stimme ihn der vorgeschlagene Tausch um; Lützow möge ein kurzes Memoire in französischer Sprache eingeben. Dies geschah. Als Lützow wieder mit den Ministern zusammentraf, sagte Graf Finckenstein, er könne nichts ausrichten; die Abneigung des Königs beruhe auf einer vorgefaßten Meinung. Dies bestätigte Graf Hertzberg und fügte hinzu, es sei das Princip des Königs, von dem von seinem Vater überkommenen Lande auch nicht einen Daumenbreit wegzugeben. Wahrscheinlich hatte Keiner der Minister es gewagt, dem Könige von dem Project überhaupt nur zu sprechen.
Somit waren denn alle Wege erschöpft; der meklenburgischen Regierung blieb nichts Anderes übrig, als die Einlösung der Aemter zu verschieben, bis ein anderer Monarch zur Regierung gekommen war.
Am 17. August des Jahres 1786 starb der große König und sein Neffe Friedrich Wilhelm bestieg den preußischen Königsthron.
Es liegt nicht in dem Rahmen dieser Geschichtserzählung auf die Veränderungen und Wandelungen in der Politik und in der Verwaltung des Landes einzugehen, welche der Regierungsantritt dieses Monarchen in seinem Gefolge hatte. Wir wollen nur dasjenige herausheben, was aus den Berichten des Baron Lützow hervorgeht und was zum Verständniß der ferneren Darstellung der Verhandlungen zwischen beiden Höfen erforderlich ist.
Die Berichte des Gesandten geben uns in mancher Beziehung ein anschauliches Bild der Zeit, unmittelbar nach dem Tode Friedrich des Großen und gewähren dadurch einen besonderen Reiz, daß der Leser in den eigenhändigen Aufzeichnungen eines Augenzeugen, welcher den Verlauf der Dinge in unmittelbarer Anschauung mit erlebt hat und zwar in der hervorragenden Stellung eines außerordentlichen Gesandten, vor seinen Blicken ein Zeitgemälde entrollt sieht, dessen Colorit um so lebhafter ist, als man überzeugt sein kann, daß die dienstlichen Berichte des Gesandten an seine Regierung aus zuverlässiger Quelle geschöpft, also wahr sind. Aber auch diejenigen seiner Mittheilungen, welche er "als Vermuthungen oder als Gerüchte an seine Regierung schreibt und welche sich später durch den Gang der Ereignisse oder durch die Berichtigungen des Gesandten selbst als unwahr erweisen, entbehren eines gewissen Interesses nicht, denn sie geben uns ein Bild, wie man in damaliger Zeit in Regierungs= und diplomatischen oder auch in den Kreisen


|
Seite 65 |




|
der Bevölkerung die in der Entwicklung begriffenen Ereignisse, die uns jetzt als geschichtliche Thatsachen vorliegen, beurtheilt und kritisirt hat.
In der meklenburgischen Regierung waren in den letzten Jahren mehrfache Veränderungen eingetreten. Der Geheime Raths=Präsident Graf von Bassewitz, der seine gewandte und geschäftige Feder im Dienste seines Fürsten und seines Vaterlandes geführt hatte, bis heftiges und anhaltendes Chiragra ihn gezwungen hatte, dieselbe niederzulegen, war im Jahre 1784 gestorben. An seine Stelle war der Geheime Rath von Dewitz aus dem Hause Kölpin getreten - derselbe, welchem wir bei Gelegenheit der hannoverschen Aemter=Reluirung als Diplomat begegnet sind. Später war er leitender Minister in Strelitz gewesen und dann im April 1784 in die Dienste des Herzogs Friedrich übergetreten. An seiner Seite wirkte noch in geistiger und körperlicher Rüstigkeit und Frische, der hochbetagte Minister, der Geheimrath Johann Peter Schmidt und als sehr arbeitstüchtige Kraft der Regierungsrath und spätere Minister Graf Bassewitz, aus dem Hause Prebberede. Am 24. April des nächstfolgenden Jahres starb Herzog Friedrich und sein Neffe Friedrich Franz folgte ihm in der Regierung.
In Schwerin hatte man, als die Nachricht von dem Ableben Friedrichs des Großen eingegangen war, sofort die Absendung des Baron von Lützow als außerordentlichen Gesandten nach Berlin beschlossen. Schon am 7. September traf derselbe, wohl versehen mit Beglaubigungs= und Condolenz=Schreiben, dort ein. Seine Instruction lautete wörtlich: "Ueber die Einlösung der Aemter vorerst nicht officiell zu verhandeln, sondern mit allergrößter Behutsamkeit und Vorsicht, ohne sich zu übereilen, an dienlichen Orten und bei bekannten, vertrauten, sicheren, von des jetzigen Königs Majestät Gesinnung, sowie von der Lage der Sache Kenntniß habenden Männern ins Haus zu horchen, wenn es Zeit ist."
Baron Lützow fand in Berlin ein völlig verändertes Terrain vor. Als der Gesandte im Jahre 1784 Berlin verlassen, war keine Aussicht vorhanden, die verpfändeten Aemter wieder zu erlangen. Dem alten König war der Gedanke völlig unerträglich gewesen, dasjenige herauszugeben, von dem er einmal Besitz ergriffen hatte, und dadurch Einbuße in seinen Einnahmen zu erleiden. Er hatte es in seinem langen, arbeitssamen Leben, im Kampfe mit fast übermenschlichen Schwierigkeiten, mit Aufbietung aller seiner Kräfte des Geistes und des Körpers dahin gebracht, daß Preußen in die Reihe der Großstaaten eingetreten war, und nun war es die Aufgabe seines Lebens gewesen, seinem Lande diese Großmachtsstellung zu bewahren. Um dies aber zu können, kam es vor Allem darauf an, nicht allein


|
Seite 66 |




|
die Fäden der Politik in wachsamer Hand zu halten, sondern auch die Hülfsquellen dieser künstlich erschaffenen Großmacht zu erweitern, eine große, schlagfertige Armee zu unterhalten und den Staatsschatz zu füllen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, arbeitete der König vom frühen Morgen bis zum späten Abend, ließ sich, von schwerer Krankheit kaum genesen, zur Truppenschau aufs Pferd heben, war sparsam bis an die Grenze des Geizes und konnte hart sein bis zur Ungerechtigkeit.
Aber nicht um einen Tadel auszusprechen, erwähnen wir Letzteres, sondern um das Widerstreben des Königs zu erklären, dem Herzog die Aemter zurückzugeben. Wir müssen uns überhaupt wohl hüten, den großen König nach einzelnen Regierungshandlungen und Charakter=Eigenschaften zu beurtheilen, sondern müssen den Totaleindruck seiner Persönlichkeit auf uns wirken lassen. Thun wir dies, so können wir nicht umhin, bewundernd zu der antiken Größe seiner glühenden Vaterlandsliebe und seiner großartigen Regenteneigenschaften empor zu blicken.
Wie anders gestalteten sich die Verhältnisse beim Regierungsantritt des neuen Königs. Ohne die geringste Mühe und Arbeit in den Besitz aller der Güter gelangt, welche sein großer Oheim und dessen Vater geschaffen und endlich befreit von der strengen Vormundschaft des mißtrauischen Königs, berauschte ihn der Glanz seiner Stellung und sein edelmüthiger Geist dachte vorerst nur daran, sich die Herzen seiner Unterthanen und das Vertrauen Europas zu gewinnen. In dieser Gesinnung erfreute sich der König der vollen Zustimmung des Grafen Herzberg, welchem er unbedingtes Vertrauen schenkte, und so ging die Parole in alle Welt hinaus, der König habe sich als Regierungs=Maxime die strengste Gerechtigkeitsliebe vorgesetzt, um die unter der früheren Regierung vorgekommenen Härten auszugleichen und dadurch Ehre und Ruhm zu erwerben.
Es war undenkbar, ein günstigeres Terrain für das dem Gesandten aufgetragene Negoce zu finden.
Am 7. September kam Baron Lützow in Berlin an und wurde sofort zu den Ministern beschieden. Beide waren ganz außerordentlich liebenswürdig und noch an demselben Abend meldete Graf Herzberg seine Ankunft dem Könige.
Am nächsten Morgen 8 Uhr schickte der König den General=Lieutenant Graf Görtz und beschied den Gesandten auf 11 Uhr zur Privat=Audienz. Lützow übergab die Schreiben des Herzogs dem Könige, welcher äußerst gnädig war und sich erkundigte, ob denn der Herzog nicht selbst nach Berlin komme? Er reise doch so gerne.


|
Seite 67 |




|
Am 9. September war die feierliche Beisetzung in Potsdam und am 12. reiste der König mit dem Grafen Herzberg zur Huldigung nach Preußen, darauf nach Schlesien.
Bis zur Rückkehr des Königs konnte von Geschäften nicht die Rede sein. Baron Lützow benutzte diese Zeit auf's beste, um sich bei einflußreichen Personen seiner Bekanntschaft über die Situation zu orientiren. Der Minister Geheime Rath von Steck sagte, Alles hänge jetzt vom Grafen Herzberg ab und daß dieser dem Herzog günstig gesonnen sei, wäre bekannt. Auch Lützow wußte dies; der Graf hatte ihm noch bei Lebzeiten des alten Königs im Vertrauen oft Aeußerungen in diesem Sinne gemacht; leider hatte aber Herzberg auf seinen Königlichen Herrn, welcher ihn lediglich als allerdings sehr geschickten Vollstrecker seiner Befehle verwendete, nicht den geringsten Einfluß gehabt.
Der General=Lieutenant von Prittwitz, unter dem, als Inspecteur der Cavallerie, die Husaren in Parchim standen, versprach, er wolle, wenn er Gelegenheit habe, für den Herzog sprechen und der Graf v. d. Hordt, ein am Berliner Hofe sehr angesehener Privatmann, bot dem Gesandten sogar eine hohe Wette an, daß er nicht ohne die Aemter wieder abreisen würde. Der König habe ihm nämlich als Kronprinz, mehr als einmal, in erregter Weise gesagt, daß die Zurückhaltung der Aemter die größte Ungerechtigkeit sei.
Lützow schloß seinen ersten Bericht an den Herzog mit den Worten: "Außer der Gerechtigkeitsliebe des Königs setze ich noch einen Grund zur Hoffnung in das System, welches Se. Majestät angenommen, nämlich: sich das Vertrauen des ganzen deutschen Reichs zu erwerben."
Bei so günstigen Aussichten wurde Baron Lützow für die demnächst zu erwartenden formellen Verhandlungen auf Wunsch der preußischen Minister mit einem besonderen Creditiv versehen und erhielt seine speciellen Instructionen. Diesen zufolge sollte er dem Könige in Audienz ein Handschreiben des Herzogs übergeben und mündlich die Bitte um Rückgabe der Aemter aussprechen. In den Fürstenbund, für dessen Ausbau der König und Graf Herzberg sich lebhaft interessirten, wollte der Herzog ungerne eintreten, um Oesterreich nicht zu erzürnen. Man hatte nämlich vor nicht langer Zeit dem Kaiserlichen Gesandten von Binder, welcher Meklenburg zum engeren Anschluß an den Kaiser aufgefordert hatte, erwidert, man wünsche gänzlich außer Einmischung in die Welthändel zu bleiben.
Eine heikle Frage war es, unter welchen Bedingungen die Rückzahlung des Kapitals erfolgen sollte, ob mit Liquidation oder ohne dieselbe. Ersteres wäre für Meklenburg überaus vortheilhaft


|
Seite 68 |




|
gewesen; die Sache hätte sich dann folgendermaßen gestaltet: Preußen forderte von Meklenburg an Executionskosten die Summe von 153 000 Rthlr. Wäre diese Summe von der Meklenburgischen Regierung zu dem damals üblichen Zinsfuß von 5 % verzinst worden, so hätte Preußen außer dem Kapital jährlich 7650 Rthlr., oder in 53 Jahren 405 450 Rthlr. an Zinsen zu fordern gehabt. Statt der Zinsen waren aber 4 Aemter verpfändet worden, deren Einkünfte einen Reinüberschuß von 16 000 Thlr. jährlich, oder in 53 Jahren 848 000 Rthlr. ergeben hatten. Die preußische Regierung hätte also bei einem Liquidations=Verfahren zu fordern gehabt
| 153 000 | Rthlr. | an Kapital | ||
| + | 405 450 | Rthlr. | an Zinsen | |
| in Summa | 558 450 | Rthlr. |
während Meklenburg als Gegenforderung aufgestellt haben würde:
| 848 000 | Rthlr. | |
| - | 558 450 | Rthlr. |
| 289 550 | Rthlr. |
Preußen hätte also nicht allein die 4 Aemter zurückgeben, sondern dazu noch eine Summe von 289,550 Thalern baar zahlen müssen.
Nun lag die Sache für Preußen insofern anders, wie für Hannover, als der Kaiser durch ein Decret des Reichshofraths dem König Georg 8 Aemter in den antichretischen Besitz gegeben hatte, während Friedrich Wilhelm I., um auf seine Kosten zu kommen, aus eigener Machtvollkommenheit sich in den Besitz von 4 Aemtern gesetzt hatte. Auf der anderen Seite hatte der König von Preußen aber auch stets erklärt, er wolle vom Herzog von Meklenburg genau auf demselben Fuße behandelt sein, wie Hannover. Also würde Preußen auf eine Liquidation unter keinen Umständen eingegangen sein. Das lag auf der Hand. Man entschloß sich daher in Schwerin, allerdings schweren Herzens, auf einer Liquidation nicht ernstlich zu bestehen, wohl aber mit Nachdruck von dem schweren Schaden zu sprechen, welcher durch die große Devastirung der Waldungen für Meklenburg entstanden sei, um dadurch möglichst günstige Bedingungen zu erzielen.
Baron Lützow hatte den Rath seiner Freunde befolgt und sich eng an Graf Herzberg angeschlossen, welcher denn auch in der That seinem Vorhaben äußerst günstig gesonnen war. Auf einer Cour bei der Königin hatte ihm derselbe gesagt:
"Il faut avoir patience, j'arrangerai tout, j'en fais mon affaire!"


|
Seite 69 |




|
Am 11. November wurde Lützow in Audienz vom König empfangen und übergab das Handschreiben des Herzogs, in welchem Letzterer, im Vertrauen auf die Beweise der Gerechtigkeit, welche der König täglich gebe und unter Hinweis auf den Artikel VIII des Hausvergleiches vom 14. April 1752 bat, nunmehr die Aemter einlösen zu dürfen. Nachdem der König das Schreiben gelesen, wiederholte Baron Lützow mündlich die Bitte seines Herrn. Der König, welcher den Gesandten äußerst gnädig empfangen hatte, erwiderte darauf:
"Je suis bien aise, de prévenir les voeux du Duc votre maître; j'ai entendu tant de bien de lui, et on m'a si fort flatté de son amitié, que je lui donne avec plaisir unc preuve de la mienne."
Der König äußerte sodann noch, daß er ein Cartell zur gegenseitigen Auslieferung der Deserteurs wünsche und den Umtausch gewisser Grenzdörfer. Lützow erwiderte, daß der Herzog ihn darüber im Voraus instruirt habe, um seiner Majestät seine Devotion und Dankbarkeit zu bezeugen. Der König schloß die Audienz mit der Bemerkung, daß er der Form wegen die Sache seinem Justiz=Collegio zur Begutachtung übergeben müsse. Hätte dieses, wie sicher zu erwarten stände, nichts einzuwenden, so habe er den Ministern befohlen, mit dem Gesandten in Conferenz zu treten.
Graf Finckenstein erwartete Baron Lützow im Vorzimmer des Königs und war sehr betreten, als Letzterer ihm von der Begutachtung durch das Justiz=Collegium erzählte. Noch verlegener war Graf Herzberg bei seiner nächsten Zusammenkunft mit Lützow. Der König sei sehr bedenklich gewesen, sagte er, über das, was er in der Audienz versprochen habe; ob man es ihm nicht im Lande verdenken würde, gleich bei seinem Regierungsantritt ein so wichtiges, von seinen Vorfahren überkommenes Stück Land so leichtsinnig wegzugeben? Er - Graf Herzberg - habe den König indessen beruhigt.
Dann sprachen Beide noch näher über die Sache. Der Minister bezifferte die von Meklenburg zu zahlende Summe auf 153 000 Rthlr. Lützow bemerkte, bei den großen Ueberschüssen, die der König gehabt und die sich, wie man in Schwerin zu wissen glaube, auf 26 000 Rthlr. jährlich belaufen hätten, wäre es wohl nicht unbillig, wenn er um detaillirte Abrechnung bäte.
"Das ist ganz unmöglich", erwiderte Herzberg, "der König hat nur 16 000 Rthlr. reinen Ueberschuß gehabt; auch hat er die Aemter, bona fide auf vollen Genießbrauch besessen und die Verbindlichkeit zur Liquidation oder Abrechnung fällt daher ganz fort. Dagegen


|
Seite 70 |




|
wird der König auch keinen Ersatz für Bauten und Meliorationen auf den Gütern beanspruchen."
Graf Herzberg äußerte sich des Weiteren sehr erregt über die Intriguen der Kabinetsräthe, die ärgerlich wären, daß die Sache ohne sie ihren Fortgang nähme. Ihm würfen sie vor, daß er den König veranlaßt habe, die Gerechtigkeitsliebe als die einzige Richtschnur seiner Handlungen zu proclamiren, nur um sich einen Namen in der Geschichte zu machen. "Willigen Sie ja rasch in Alles, man wartet nur auf Schwierigkeiten Ihrerseits, um die Sache völlig zu rumpiren", fügte er hinzu.
Als Lützow entgegnete, früher sei die ganze Summe doch nur auf 140 000 Rthlr. fixirt, sagte Herzberg:
"Der Unterschied ist nicht so groß; kommen Sie über den Hund, kommen Sie auch über den Schwanz."
Später stellte es sich heraus, daß die Schwierigkeiten, die der König erhob, dadurch entstanden waren, daß der König dem Kabinetsrath v. Beyer versprochen hatte, er solle an der Conferenz theilnehmen. Dem hatte sich Graf Finckenstein widersetzt, da dies nicht gebräuchlich sei, und nun war Beyer wüthend, daß ihm das nicht unbeträchtliche Geldgeschenk entging, welches bei Abschluß eines Tractats oder einer Convention gewährt zu werden pflegte.
Baron Lützow bemerkt bei dieser Gelegenheit: "Wieviel Menschen mischen sich hier jetzt in die Geschäfte; unter dem alten König Niemand!" 1 )
Nachdem der Großkanzler über die Aemterfrage Bericht erstattet hatte, befahl der König den Ministern, mit dem Baron Lützow zur Conferenz zusammenzutreten. Der Graf Herzberg war hierüber so erfreut, daß er gleich nach Empfang des Befehls an den König schrieb, er werde nun mit doppeltem Eifer und Vergnügen seine Pflicht thun, da der König soeben ganz Deutschland gezeigt habe, daß seine Nachbarn die strengste Gerechtigkeit von ihm zu erwarten hätten. Die Gesandten aller Staaten beeilten sich, Lützow ihre Glückwünsche darzubringen und priesen den König mit Ostentation. Aber - es wurden auch andere Stimmen laut, wie uns Lützow berichtet.
Der erste Rausch, welcher den König gleich nach der Thronbesteigung in Prosa und in gebundener Rede in den Himmel erhoben


|
Seite 71 |




|
hatte, war verflogen. Das preußische Volk, in der harten Schule des thatkräftigen Soldatenkönigs und des großen Friedrich so eminent practisch erzogen, fand an der prunkenden Zurschaustellung schöner Gefühle auf die Dauer keinen Gefallen. Beide Herrscher hatten in gewissenhafter und schwerer Arbeit für das Wohl und das Emporsteigen ihres Staates gesorgt; aber sie hatten auch von ihren Unterthanen, von Vornehm und Gering, mit Strenge, ja oft mit Härte verlangt, daß Jedermann seine "verfluchte Pflicht und Schuldigkeit" im vollsten Maße thue. Dadurch war eine Generation mit so scharf ausgeprägtem Pflichtgefühl, mit so regem Thätigkeitsdrang emporgewachsen, daß H. Treitschke sie und ihre Nachkommen später nicht mit Unrecht die Spartaner Deutschlands genannt hat, die man bald anfing, im Deutschen Reiche mit Besorgniß und Mißtrauen anzusehen, die aber gerade dadurch an Selbstvertrauen und an Liebe zu ihrem preußischen Vaterlande mächtig erstarkte. So konnte es nicht ausbleiben, daß man in Berlin und auch im Lande bald anfing, Vergleiche zu ziehen zwischen sonst und jetzt; namentlich hatte man dafür im Volke kein Verständniß, daß der König ohne Noth Land und Leute und große Summen Geldes weggeben wollte, um Sünden gut zu machen, die er doch nicht verschuldet hatte.
Das harte Wesen des alten Königs war mehr nach dem Geschmack dieser in schneidiger Thätigkeit erzogenen Bevölkerung gewesen, und wenn den kernigen märkischen Bauern Sonntags in der Schenke die Aeußerung des alten Fritze, die uns Lützow berichtet: "Nicht einen Daumenbreit des von meinen Vätern überkommenen Besitzes gebe ich wieder heraus!" mitgetheilt wurde, dann schlugen sie die schwieligen Fäuste auf den Tisch, daß die Gläser klirrten und riefen trotzig durcheinander: "Des darf der König ooch nich! Wofor is er denn unser König?!"
Außer dieser Stimmung der öffentlichen Meinung drangen fortwährend noch die bösen Einflüsse des Eigennutzes auf den König ein, um die Rückgabe der Aemter zu verhindern.
""Die Bosheit im Kabinet und in der Garderobe des Königs ist um so gefährlicher, je versteckter sie ist!" schrieb Lützow.
Die Partei aber, welche dem Herzog entgegen arbeitete, war nicht nur im Kabinet des Königs, sondern auch in Meklenburg vertreten.
Die vier an Preußen verpfändeten Aemter waren: Eldena, Plau, Wredenhagen und Marnitz. Der Modus der Verpachtung war in damaliger Zeit der, daß ein Pächter das ganze Amt, welches aus mehreren Gütern und Dörfern bestand, pachtete und die einzelnen Ortschaften, in der Regel mit Ausnahme desjenigen Gutes, welches er selbst bewohnte und bewirthschaftete, an Unterpächter wieder


|
Seite 72 |




|
verpachtete. Die vier Pächter der obengenannten Aemter hatten dieselben unter sehr günstigen Bedingungen von Preußen in Pacht bekommen. Die Pachtsummen waren verhältnißmäßig gering; die Pächter, welche den Titel Amtmann, Ober=Amtmann, auch Kammerrath führten, hatten das Recht, Brennereien anzulegen und bekamen dazu das Brennholz in sehr reichlichem Maße aus den Forsten geliefert. Außerdem wurden ihnen alle auf den Gütern auszuführenden Bauten in Entreprise gegeben, wodurch sie sehr erkleckliche Vortheile erzielten. Wie hoch die Pächter die einzelnen Güter an die Unterpächter verpachteten, war lediglich ihre Sache; auch flossen die Abgaben, welche die Unterthanen - dieselben waren sämmtlich Leibeigene - zu entrichten hatten, in ihre Tasche.
Zur Verwaltung dieser Aemter war in Parchim, wo der Bataillons=Stab und drei Escadrons vom Ziethenschen Husaren=Regiment - je eine Escadron lag in Plau und Lübz - in Garnison stand, eine KöniglicheAdministration unter einem Directorium eingerichtet. In diese Administrationskasse flossen die Pachtgelder, welche die Amtspächter zahlten, und das Directorium schickte die reinen Ueberschüsse in das Kabinet des Königs ein, in welchem ein Kabinetsrath die Aemterangelegenheiten bearbeitete und dem König directen Vortrag hielt. Diese Ueberschüsse aus allen vier Aemtern hatten im Durchschnitt jährlich 16 000 Rthlr. betragen; der König nutzte also das Kapital, welches er an Executionskosten von Meklenburg in der Höhe von 153 000 Rthlr. zu fordern hatte, zu ca. 10 %, während dasselbe, wenn es zurückgezahlt worden wäre, nach dem damals üblichen Zinsfuß dem Könige nur 5 % Zinsen getragen hätte. Insbesondere war aber hierbei der vortragende Kabinetsrath interessirt. In seiner Hand allein lag die Vergebung der Aemter an die Pächter, und da es in damaliger Zeit keine Schande war, auch nicht für hochgestellte Personen, dons gratuits anzunehmen, so war der Posten desselben ein recht einträglicher. Auch die Mitglieder des Administrations= Directoriums zu Parchim zogen manchen Vortheil aus ihrer Stellung. Ebenso standen die Husaren gern im Meklenburgischen in Garnison, wo sie außer dem Naturalquartier ihren Service in Geld bezogen und wo es den Escadronchefs leicht wurde, ihre Schwadronen durch Werbung vollzählig zu halten. Zieht man hierzu in Betracht, daß die Pächter bei den guten Pachtbedingungen und bei der großen Selbstständigkeit, welche ihnen das Directorium in Parchim in der Ausnutzung der Güter und Forsten zum steten großen Aerger des Kammer=Collegii in Schwerin ließ, in der Regel wohlhabende Leute wurden; erwägt man ferner, daß alle die genannten Personen in Berlin Gönner und Fürsprecher im Civil und in der Generalität


|
Seite 73 |




|
hatten, so kann man sich wohl denken, daß der König, der Summe dieser Einflüsse gegenüber, die alle einen Zweck verfolgten, nämlich die Herausgabe der Aemter zu verhindern, einen sehr schwierigen Stand hatte.
Noch bei Lebzeiten Friedrichs des Großen hatten die Pächter, deren Contracte nur noch wenige Jahre liefen, versucht, eine Verlängerung derselben auf 24 Jahre zu erlangen, aber vergeblich. Nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms setzten sie sofort alle Hebel an, um, bei der nunmehr unvermeidlich erscheinenden Rückgabe der Aemter an Meklenburg, vorn Könige die Zusage der Prolongation ihrer Contracte auf 24 Jahre unter den früheren Bedingungen zu bekommen. In einer Versammlung, zu welcher der Pächter des Amtes Eldena, der Kammerrath Hahn, Anfang October alle Pächter nach Parchim einlud, sollten im Verein mit dem Secretair des Administrations=Directorii, Krause, die einzuschlagenden Mittel und Wege berathen werden, wie dies Ziel zu erreichen sei. Aber nicht alle Pächter sahen in dem engen Anschluß an die preußische Verwaltung ihren Vortheil. Der Pächter des Amtes Marnitz, der Ober=Amtmann Suckow, ein ungemein kluger, aber auch intriguanter Mann, glaubte sicherer sein Schäfchen ins Trockene zu bringen, wenn er die Collegen heimlich verließ und sich ganz der meklenburgischen Regierung in die Arme warf. Er hatte es erreicht, mehrfach von dem Herzog in Privat=Audienz empfangen zu werden und von demselben die Zusage zu erreichen, daß ihm, wenn er dazu beitrage, daß den Pächtern die fast abgelaufenen Contracte nicht wieder von Preußen prolongirt würden, das Gut Fahrenholz auf 21 Jahre in Pacht und dem Bruder seiner Frau eine Anstellung im herzoglichen Dienste gegeben werden sollte. Dem Minister war die Hülfe des geschickten Mannes, der in besonders hoher Gunst auch beim Grafen Herzberg stand und enge Fühlung in den weitesten Kreisen in Berlin hatte, hoch willkommen.
"Nach dem Grundsatz divide et impera kommt uns der Mann sehr gelegen", schrieb Dewitz dem Herzog.
Suckow besuchte zwar auch die Parchimer Versammlung, aber nur in der Absicht, das Zustandekommen jeglichen Beschlusses zu verhüten, was ihm auch vollkommen gelang.
Der König war diesen Einflüssen, diesen Rathschlägen pro et contra, diesen offenen und versteckten Intriguen, die sich täglich an ihn drängten, gegenüber völlig schwankend geworden. Wenn sich nur Jeder so unverblümt ausgesprochen hätte, wie der ehrliche Möllendorff!


|
Seite 74 |




|
"Wenn Ew. Majestät Ihr gegebenes Königliches Wort nicht halten, so entehren sich Ew. Majestät vor ganz Europa!" hatte der General mit soldatischem Freimuth gesagt.
Der König wurde unsicher, horchte hierhin und dorthin und der Beginn der Conferenz verschob sich von einem Tage zum anderen.
Da beschloß der Baron Lützow sich nach einer wirksamen Hilfe umzusehen. Er sondirte Graf Finckenstein, ob ein Besuch des Herzogs am preußischen Hofe erwünscht sei und bekam zur Antwort, der Herzog würde mit offenen Armen in Berlin empfangen werden. Hieraufhin stellte Lützow seinem Herrn vor, welch günstigen Einfluß seine Anwesenheit am Berliner Hof auf den Fortgang der Verhandlungen haben würde, und als nun der preußische Minister einen eigenhändigen Einladungsbrief nach Schwerin schrieb, entschloß der Herzog sich rasch und langte am 8. December in Berlin an. In seiner Begleitung befand sich der Regierungsrath Graf von Bassewitz, welcher dem Baron Lützow während der Verhandlungen mit seinem Rath zur Seite stehen sollte. 1 )
Der König empfing den Herzog mit der größten Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit und machte ihm, unter Hinweis auf die Inschrift des Schwarzen Adlerordens die positivesten Zusagen in Bezug auf die Rückgabe der Aemter. Die erste Conferenz fand noch während der Anwesenheit des Herzogs am 16. December statt. An derselben nahmen der Graf Finckenstein, der Graf Herzberg und Baron Lützow theil.
Graf Finckenstein eröffnete die Verhandlungen mit der Erklärung, Se. Majestät sei bereit, ein großes Opfer zu bringen und die Aemter unter folgenden Bedingungen zurückzugeben:
1) Meklenburg müßte nicht allein die im Jahre 1733 bei der Occupation des Landes erwachsenen Executionskosten mit 153 000 Rthlr., sondern auch die Differenz zwischen dem im Jahre 1733 gangbar gewesenen Leipziger N. 2/3 Münzfuß und dem jetzigen zahlen, so daß also die ganze preußische Forderung im preußischen Courant 172 000 Rthlr. betrüge. Diese Summe sei baar und ungetrennt zu entrichten.
2) Den jetzigen Pächtern sollten die ihnen von Sr. Majestät gegebenen Contracte gehalten und die Königlichen Administrations=
 . kostete 12 000 Rthlr.
. kostete 12 000 Rthlr.


|
Seite 75 |




|
und Forst=Bediensteten auf demselben Fuß beibehalten event. ihnen ihr Gehalt auf Lebenszeit belassen werden.
3) Sr. Durchlaucht der Herzog sollte es mit Strelitz und anderen Interessenten abmachen, daß der Müritz=See ohne Kosten des Königs, soweit die Meklenburgischen Lande gehen und soweit es für die Schifffahrt nöthig und dienlich sei, in die Havel abgelassen werde, was für die Adjacenten sehr nützlich sein würde. Das Project, den Müritz=See in die Elbe abzuleiten, solle man fahren lassen, da dasselbe weniger nützlich und kostbarer sei, auch einige Märkische Aemter der Ueberschwemmung aussetzen würde.
4) Die Enclaven sollten durch Umtausch beseitigt werden. Zu dem Ende könnte Sr. Durchlaucht die in der Priegnitz gelegenen Dörfer Netzeband, Schöneberg, Grünberg und Rossow, Sr. Majestät dagegen, die in Meklenburg liegenden von Maltzan'schen Dörfer Rottmannshagen, Zettemin, Duchow, Pinnow und Rützenfelde dergestalt abtreten, daß der Tausch in Bausch in Bogen gegen einander aufginge.
5) Ebenso sollte das Meklenburgische Amt Wredenhagen die an sich bestrittene und unbedeutende Servituts=Gerechtigkeit, welche es bisher in der Wittstocker Heide prätendirt, fahren lassen.
6) Meklenburg sollte die kleinen Hebungen und
Prätensionen, welche es an einigen Pommerschen
Dörfern, als Tützpatz, Heinrichshagen
 . habe, aufgeben.
. habe, aufgeben.
7) Sr. Durchlaucht der Herzog sollte ein Cartell zur Auslieferung der beiderseitigen Deserteurs und Militair=Personen abschließen und freiwillige, unschädliche Werbungen in Meklenburg gestatten.
8) Da es nöthig sein würde, über diese Punkte eine Convention zu schließen, so sollte derselben der, am 14. April 1752 geschlossene Erb= und Successions=Vergleich zu Grunde gelegt werden.
Hierzu erklärte der Minister, daß Sr. Majestät hoffe, Sr. Durchlaucht der Herzog würde sich alles dies um so mehr gefallen lassen, da es sowohl auf Recht und Billigkeit und beiderseitiger Convenienz gegründet sei, da Sr. Majestät mit der Abtretung der Aemter ein so großes Opfer bringe und da derselbe noch verschiedene Dörfer und ganze Districte zurückfordern könnte, welche Meklenburg in alten Zeiten von Pommern abgerissen und auf welche Preußen niemals renoncirt habe.
Der Baron Lützow hörte diese Propositionen mit Erstaunen an und beklagte dieselben auf das Lebhafteste. Die Minister versicherten, von diesen Bedingungungen sei nicht abzukommen.
"Aber ich bin doch zur Conferenz geladen und nicht um die Befehle des Königs in Empfang zu nehmen!" erwiderte Lützow scharf.


|
Seite 76 |




|
Darauf wurden die Punkte einzeln durchgegangen; man einigte sich indessen über keinen einzigen.
Mit einem Bericht Lützow's über den Verlauf des ersten Conferenztages kehrte der Regierungsrath Graf Bassewitz am Tage darauf nach Schwerin zurück. Die Minister waren außer sich, namentlich auch darüber, daß Baron Lützow die Instruction, welche ihm Graf Bassewitz mit nach Berlin gebracht hatte und in welcher ausdrücklich stand, der Gesandte sollte nicht dulden, daß irgend welche Nebenbedingungen mit in die Verhandlungen gezogen würden, so gänzlich außer Acht gelassen hatte. Sie würden ihn auch sicher dementirt haben, wenn die Conferenz nicht gewissermaßen unter den Augen des Herzogs stattgefunden hätte. So begnügten sie sich damit, demselben ihr Mißfallen schriftlich auszudrücken.
Die Anwesenheit des Herzogs in Berlin verfehlte übrigens ihren Zweck nicht. Am Tage nach der Conferenz, auf der Cour bei der Königin, theilte Graf Herzberg dem Herzoge mit, der König habe befohlen, den Artikel, betreffend die Regulirung der Müritz fallen zu lassen. Baron Lützow schloß aus dieser Nachgiebigkeit, daß der König noch mehr zugestehen würde.
"Die lauten Klagen des Herzogs und seiner Diener helfen viel," schrieb er an den Minister Graf Bassewitz, "namentlich der Vergleich mit der Reluition der hannoverschen Aemter, die ohne jegliche Nebenbedingung vollzogen wurde, trotzdem es sich um 15 Tonnen Goldes handelte."
Lützow erbat sich und erhielt vom Herzog die Erlaubniß, vorläufig Alles ablehnen zu dürfen.
Tags darauf kam der Herzog von Weimar, welcher sich auf das Lebhafteste für den Ausbau des Fürstenbundes interessirte und zu diesem Zweck in Berlin anwesend war, zum Herzog und sagte ihm, der König werde ihm ein "vorzügliches Präsent" machen. Vor der Tafel überreichte denn auch der König dem Herzog den Schwarzen Adlerorden mit den liebreichsten und verbindlichsten Ausdrücken und fügte vertraulich hinzu, daß die bewußte Sache ihren ungestörten Fortgang haben werde, wenn auch seine Minister einige Vortheile für Preußen zu erlangen suchen müßten.
Am 22. December reiste der Herzog Friedrich Franz nach Schwerin zurück; mit ihm Baron Lützow, mit welchem die Minister, vor weiterem Fortgang der Verhandlungen, mündlich conferiren wollten.
Der Regierungsrath Graf Bassewitz, welcher einige Tage vor dem Herzog Berlin verlassen, hatte die ungünstigsten Eindrücke von dort mit zurückgebracht; es schiene, berichtete er, als ob die Partei des Geheimen Rath von Beyer, welcher selbst oder dessen Verwandten,


|
Seite 77 |




|
durch Rückgabe der Aemter in ihren Einkünften leiden würden, völlig dominire und durch ihren Einfluß, durch Einmischung von Dingen, welche gar nicht zur Sache gehörten, Alles rückgängig zu machen suchte. Der Beweis davon sei, daß die preußischen Minister in der ersten Sitzung übertriebene und auffallende Forderungen gestellt hätten, deren Zweck offenbar der Abbruch der Verhandlungen gewesen wäre. Er rathe, lieber den Verlust der Aemter oder die Hinausschiebung der Reluition derselben zu ertragen, als diese Bedingungen anzunehmen.
So sehr auch die Minister im Uebrigen mit den Ansichten ihres Regierungsraths harmonirten, so blieb ihnen doch nicht verborgen, daß sie diesen günstigen Augenblick, wieder in den Besitz der lang ersehnten Aemter zu kommen, nicht ungenutzt vorüber gehen lassen durften. Lützow kehrte daher mit neuen Instructionen nach Berlin zurück, welche es ermöglichten, in der am 2. Januar 1787 gehaltenen zweiten Conferenz Folgendes zu stipuliren:
Ad 1. Der preußischerseits aufgestellten Forderung bewilligte Meklenburg die Summe von 172 000 Rthlr.
Die zweite Forderung, daß den jetzigen Pächtern die ihnen vom König gegebenen Contracte gehalten werden sollten, gestand Lützow zu, wollte aber die Prolongation der Pacht des Kammerraths Hahn, dessen Pachtzeit nur bis zum Jahr 1791 lief, bis zum Jahre 1803 nicht bewilligen.
Den dritten Punkt, betreffend die Müritz, wollte der König fallen lassen, da auch die meklenburgischen Stände vor Kurzem noch geltend gemacht hatten, "man solle dies Gewässer doch laufen lassen, wohin es Gott und die Natur hingewiesen, nämlich nach der Elde zu, und sollte diesen Fluß mit der Zeit schiffbar machen; außerdem würden ja durch Ablassung der Müritz nach dem Strelitzischen zu die mit vielen Tausenden und mit Grabung meilenlanger Kanäle beschafften Wasserfälle in Ludwigslust zu Grunde gehen."
Zum vierten Punkt, der die Enclaven durch Umtausch beseitigen sollte, beantragte Lützow, ob nicht der König die enclavirten Güter, deren Werth ca. 100 000 Rthlr. betrage, zu seinen Domänen an sich kaufen möchte, wodurch aller Widerspruch der Besitzer und des meklenburgischen Adels fortfiele.
Den fünften Punkt, die Servituts=Gerechtigkeit in der Wittstocker Heide, wollten die preußischen Minister nicht fallen lassen.
Ad 6 walte ein Mißverständniß ob; es sollten nur kleine meklenburgische Hebungen und Prätensionen gegen preußische compensirt werden.


|
Seite 78 |




|
Ad 7 sollte keine preußische Werbung in Meklenburg erlaubt, wohl aber ein Cartell geschlossen werden.
Endlich waren ad 8 beide Theile einverstanden, nämlich daß eine Convention auf Grund des Hausvertrags vom 14. April 1752 abzuschließen sei.
Dabei wurde mündlich, als nicht in den Rahmen dieser Verhandlung gehörig, von Baron Lützow zugestanden, daß Meklenburg dem Fürstenbunde beitreten wollte.
Inzwischen war es den Bemühungen des Geheimen Finanzraths v. Beyer gelungen, noch einen unangenehmen Zwischenfall in Scene zu setzen.
Am 12. Januar kam Graf Herzberg in großer Erregung zum Baron v. Lützow und sagte ihm, die nächste Sitzung müsse um circa eine Woche aufgeschoben werden, da Beyer dem Könige vorgetragen habe, nach den Acten über den Vertrag von 1752 müßten drei in der Nähe von Dargun gelegene Güter als zu Preußen gehörig betrachtet werden; dies sei bisher nicht beachtet worden. Nun habe der König, der ängstlich besorgt sei, daß ihm seine Nachkommen dermaleinst den Vorwurf machen könnten, er habe zu Preußen gehöriges Land leichtsinnig weggegeben, die Sache dem Großkanzler zur Begutachtung übergeben. 1 )
Baron Lützow hatte den Grafen Herzberg nie so außer sich gesehen. Letzterer hatte dem König sofort geschrieben und demselben seine Empfindlichkeit bezeugt, daß der König dem Departement und namentlich ihm sein Vertrauen entzöge, was er doch durch seine nützlichen Dienste bei dem Hubertsburger und dem Teschener Frieden nicht verdient habe.
Diese Wolke verflog übrigens sehr bald. Schon am nächsten Tage erhielt der Minister ein überaus gnädiges Handbillet des Königs.
"Sie können dem Herrn v. Lützow sagen," schrieb der König, "daß er ganz ruhig sein kann und daß er seine Aemter wieder haben soll, die ich nicht behalten kann, da dieselben rechtmäßig seinem Herrn gehören. Was die drei Dörfer betrifft, so ist es nicht meine Absicht, sie als Entschädigung zu fordern, aber ich habe mein Justiz=Departement


|
Seite 79 |




|
zu Rathe gezogen, um zu wissen, ob sie mir gehören oder nicht? Sie können sich meines vollen Vertrauens und meiner Hochachtung versichert halten."
Graf Herzberg war so gerührt über die Güte des Königs, daß er Lützow bat, nun auch seinerseits dem König einen Gefallen zu thun und die freiwillige Werbung in Meklenburg zu erlauben. Als Lützow dies jedoch entschieden ablehnte, bat der Minister, dann doch wenigstens den König darin zufrieden zu stellen, daß die meklenburgische Regierung die Kaffee= und Taback=Depots - anders könne man es nicht bezeichnen -, die auf vielen der Grenzgüter angelegt seien, um zu schmuggeln, aufhöbe. Lützow versprach, hierüber nach Schwerin zu berichten.
Da nun vorerst der Bericht des Großkanzlers abgewartet werden mußte und der Baron Lützow acht Tage krank darnieder lag, verzögerte sich der Abschluß bis Ende Januar. Am 29. besuchte Herzberg Lützow, und Letzterer las ihm ein Rescript seiner Regierung vor, worin dieselbe ihre Freude über das vorhin angeführte Handbillet des Königs ausdrückte und zum Schluß besonders "dem würdigen Graf Herzberg für seine in dieser Angelegenheit bezeugte, auf Recht und Billigkeit gegründete und freundschaftliche Verwendung und Bemühung ihren aufrichtigsten Dank aussprach."
Der Minister war bis zu Thränen gerührt und erwiderte: "Ich habe aus Ueberzeugung gehandelt und als ehrlicher Mann. Um Ihnen aber in Ihrer Krankheit eine kräftige, herzstärkende Arznei zu geben, will ich Ihnen im Namen Sr. Majestat Folgendes eröffnen:
Der König verzichtet gänzlich auf die drei Darguner Güter und auf das Müritz=Project, ebenso auf den Umtausch der enclavirten Güter. Der Contrebande wegen wünscht der König, daß Netzeband, Schönberg und Rossow ihm gegen Taxe und Abrechnung von der Pfandsumme cedirt werden."
Lützow erwiderte, er glaube nicht, daß dies von seiner Regierung genehmigt werden würde, er wolle aber sofort einen Courier dieserhalb nach Schwerin senden, und las hierauf dem Minister aus einem Briefe des Grafen Bassewitz vor, daß die meklenburgische Regierung Alles thun wolle, um den Schmuggelhandel zu inhibiren. Dann wurde der 3. Februar zur dritten Conferenz festgesetzt; Graf Herzberg und Lützow beglückwünschten sich und sahen ihr Geschäft als erledigt an.
Ganz einigte man sich in dieser Conferenz übrigens nicht. Es bestanden noch Differenzen wegen der Prolongation der Pachtcontracte und wegen der Güter Tützpatz und Wolde. Dadurch zogen sich die Unterhandlungen bis zum 20. Februar, also noch fast drei Wochen, hin. An diesem Tage war Conferenz bei Graf Finckenstein. Graf


|
Seite 80 |




|
Herzberg legte den Entwurf der Convention vor und drängte den Baron Lützow ernstlich, die Genehmigung seines Hofes bald herbeizuführen. Auch sprach er die Bitte aus, daß die Juden, die arg schmuggelten, aus den Netzeband'schen Districten entfernt werden möchten; Lützow versprach dies, indem er sagte, Juden dürften ja in Meklenburg ohnehin nicht auf dem platten Lande sich aufhalten. Ferner machte Graf Herzberg geltend, daß der Pächterin des Amtes Wredenhagen, der Hauptmannin v. Pauli, welche noch vom verstorbenen König eine Prolongation ihrer Pachtzeit, allerdings ohne Unterschrift des Monarchen, erhalten und die sehr viel lamentirt hatte, die Pachtung bis zum Jahre 1791 gelassen und ihr außerdem eine Entschädigung von 1000 Stück Dukaten ausgezahlt werden sollte. Nach mancherlei Verhandlungen hin und her kam dann endlich eine Convention zu Stande; dieselbe lautete folgendermaßen:
1) Der König verspricht die Aemter zum Johannis=Termin 1787 zu räumen und die Husaren aus den drei Garnisonen zurückzuziehen.
2) Der Herzog verspricht dagegen in der Woche vom 24. bis 30. Juni 172 000 Rthlr. in Friedrichsd'or, à 5 Rthlr. gerechnet, zu zahlen und begiebt sich aller Gegenrechnungen wegen etwa von preußischer Seite aus den Aemtern genossener höherer Einkünfte.
3) Der Herzog verpflichtet sich, die bei der
Administration vorhandenen Acten
 . bona fide auszuliefern, den
Pächtern ihre Contracte, soweit sie bis zum
Absterben des hochseligen Königs solche erhalten
haben, bis zu Ende auswohnen zu lassen, und den
Administrations=Bedienten in Parchim, sofern sie
in meklenburgische Dienste nicht übernommen
werden, ihre Gehalte, Emolumente auf Lebenszeit
zu belassen und ihnen wegen ihrer vorigen
Dienste keine Ungnade zu erweisen.
. bona fide auszuliefern, den
Pächtern ihre Contracte, soweit sie bis zum
Absterben des hochseligen Königs solche erhalten
haben, bis zu Ende auswohnen zu lassen, und den
Administrations=Bedienten in Parchim, sofern sie
in meklenburgische Dienste nicht übernommen
werden, ihre Gehalte, Emolumente auf Lebenszeit
zu belassen und ihnen wegen ihrer vorigen
Dienste keine Ungnade zu erweisen.
4) Der König erklärt nach Zahlung von 172 000 Rthlr. keine weiteren Forderungen wegen der früheren Execution machen zu wollen und erklärt sich für sich und seine Erben für völlig befriedigt.
5) Um das freundschaftliche Vernehmen und die gute Nachbarschaft zwischen den beiderseitigen Ländern und Unterthanen immer mehr zu befestigen, soll eine eigene Commission sobald als möglich eingesetzt werden, um die Differenz wegen der Landeshoheit über das Gut Wolde und die Grenzstreitigkeiten zwischen Reckenzien und dem meklenburgischen Gute Balow, wie auch von anderen Orten, wo sich dergleichen Irrungen finden, in loco zu untersuchen. Vorjetzo begeben sich der Herzog aller Ansprüche an die zu Pommern gehörigen Dörfer Rützenfelde und Tützpatz und cediren Sr. Majestät alle landesherlichen Rechte, welche Sie in dem letzten Dorfe etwa gehabt haben möchten, dagegen der Besitzer des Gutes Tützpatz die darauf etwa haftenden


|
Seite 81 |




|
Landesschulden und Anlagen bis Johannis cr. berechnen und berichtigen muß. Da auch das Amt Wredenhagen gewisse Holzungs= und Hütungs=Gerechtigkeiten in der bei der Stadt Wittstock belegenen Kötzer Heide prätendirt, so wird hierdurch festgesetzt, daß diese Differenz durch einen gütlichen Vergleich abgemacht werden soll und man sich meklenburgischerseits etwa mit dem achten Theil der Kötzer Heide begnügen will. Die Abgrenzung soll durch eine Local=Commission geschehen, auch die etwaige Grenzstreitigkeit mit dem Dorfe Below regulirt werden.
6) Da man preußischerseits gegründete Beschwerde
zu führen hat, daß aus den in der Mark
enclavirten Dörfern Netzeband, Schönberg,
Grünberg, Rossow
 . ein sehr nachtheiliger
Contrabande=Handel nach den königlichen Landen
geführt wird, so wollen Se. Durchlaucht diesen
Handel nicht allein ernstlich verbieten, sondern
auch nicht erlauben, daß in gedachten Dörfern
Kaufleute, Juden und Höcker ansässig sind, die
mit Kaffee, Zucker, Taback und anderen
Materialien und Ellenwaren, ingleichem Brod und
Branntwein nach den benachbarten preußischen
Landen handeln, und auch die Verfügungen
treffen, daß die preußischen Contrabandiers,
welche sich in diesen Dörfern aufhalten, auf
preußischerseits geschehene Requisition an die
Gerichts=Obrigkeit ausgeliefert werden, auch daß
die in solchen Fällen nöthigen
meklenburgischerseits zu verfügenden
Visitationen in den besagten Dörfern, ohne
Anstand und bona fide, geschehen mögen. Endlich
wollen Se. Durchlaucht über die weiter etwa
erforderlichen Maßregeln mit der preußischen
Regierung sich verstehen und allen billigen, mit
der meklenburgischen Verfassung vereinbaren
Anträgen Gehör geben.
. ein sehr nachtheiliger
Contrabande=Handel nach den königlichen Landen
geführt wird, so wollen Se. Durchlaucht diesen
Handel nicht allein ernstlich verbieten, sondern
auch nicht erlauben, daß in gedachten Dörfern
Kaufleute, Juden und Höcker ansässig sind, die
mit Kaffee, Zucker, Taback und anderen
Materialien und Ellenwaren, ingleichem Brod und
Branntwein nach den benachbarten preußischen
Landen handeln, und auch die Verfügungen
treffen, daß die preußischen Contrabandiers,
welche sich in diesen Dörfern aufhalten, auf
preußischerseits geschehene Requisition an die
Gerichts=Obrigkeit ausgeliefert werden, auch daß
die in solchen Fällen nöthigen
meklenburgischerseits zu verfügenden
Visitationen in den besagten Dörfern, ohne
Anstand und bona fide, geschehen mögen. Endlich
wollen Se. Durchlaucht über die weiter etwa
erforderlichen Maßregeln mit der preußischen
Regierung sich verstehen und allen billigen, mit
der meklenburgischen Verfassung vereinbaren
Anträgen Gehör geben.
7) Beide Theile verpflichten sich beiderseits, wirkliche Soldaten auszuliefern, die aus einem Land in das andere desertirt sind, auch daß baldigst ein förmliches Cartell wegen Auslieferung von Deserteurs geschlossen und öffentlich bekannt gemacht werden soll.
8) Der zwischen dem König Friedrich und Herzog Christian Ludwig am 14. April 1752 geschlossene Erbvereinigungs= und Successionstractat wird hierdurch in allen Punkten und Artikeln erneuert und bestätigt, so als wenn derselbe hier wörtlich eingerückt wäre.
Die Ratificationen sollen in vier Wochen, spätestens sechs Wochen oder früher ausgewechselt werden.
Berlin, den 13. März 1787.
Joh. Joachim Freiherr v. Lützow.


|
Seite 82 |




|
Da die Hauptmännin v. Pauli und der Kammerrath Hahn als Pächter der Aemter Wredenhagen und Eldena wegen einer erhaltenen Prolongation ihrer Pacht=Contracte noch verschiedene Ansprüche machen, so hat man sich dahin verglichen, daß der Witwe Pauli der vom hochseligen König unterschriebene Contract, der bis Johannis 1788 gehet, prolongirt wird bis Johannis 1791 in allen seinen Punkten. Für Hahn aber findet keine Prolongation statt, sondern demselben wird sein bis 1791 gehender Contract gehalten. Beide erhalten als Entschädigung Jeder 1000 Dukaten, welche ihnen beim Abzuge baar ausgezahlt werden sollen; dagegen müssen sie Johannis 1791 abziehen und sich jeder Ansprüche enthalten, auch sollen sie während ihrer Pacht ihre Aemter wirthschaftlich nutzen und sich aller willkürlichen Holzverwüstungen enthalten.
Bevor man zur Unterschrift des Vertrages schreiten konnte, hatte sich eine neue Schwierigkeit erhoben. Die preußische Regierung kam noch mit einer Nachtragsforderung von 3733 Rthlr. Baugelder, welche Summe von den Pächtern ausgelegt war und nun von der Regierung zurückgezahlt werden mußte. Die meklenburgische Regierung bestritt die Richtigkeit dieses Anspruchs auf das Entschiedenste und weigerte sich, diese Summe zu zahlen. Da aber Graf Herzberg dem Baron Lützow erklärte, der König würde von dieser Forderung nicht abgehen und würde sich sehr wundern, wenn der Herzog nicht einmal diese kleine Summe für alle Vortheile, die ihm geboten wären, zahlen wollte, so verstand sich Lützow dazu, einen zweiten Separat=Artikel zu unterzeichnen sub spe rati, d. h. in der Hoffnung, daß der Herzog ihn ratificiren werde. Graf Herzberg erleichterte ihm die Sache dadurch, daß er ein Privatbillet an Herzog Friedrich Franz schrieb und ihn in der verbindlichsten Weise bat, auch diese. Summe noch zu bewilligen. "Wegen ein paar Tausend Thaler darf die Sache doch nicht scheitern, rieth Graf Bassewitz, und der Herzog ertheilte seine Genehmigung.
Von der Administration der Pfandämter ist angezeigt, daß die Pächter dieser Aemter zu verschiedenen nothwendigen Bauten und Reparaturen im Jahre 1786 einen Vorschuß gethan, welcher in den vier Aemtern zusammen 3733 Rthlr. 47 ß. 2 2/3 Pf. beträgt und daß den Beamten eine Vergütung versprochen ist, wenn die Baukasse dazu im Stande sein würde, daß ferner zum Wiederaufbau der im Amte Eldena abgebrannten Gebäude aus den herzoglichen Forsten


|
Seite 83 |




|
für 857 Rthlr. 39 ß. 3 Pf. Bauholz habe gekauft werden müssen, wovon die Bezahlung noch rückständig sei, so versprechen Se. Durchlaucht, den Pächtern die Summe von 3733 Rthlr. zu vergüten und die Summe von 857 Rthlr. für geliefertes Holz gänzlich schwinden zu lassen.
Dieser Vertrag wurde am 16. März vom Herzog, am 23. März vom König ratificirt und die Ratificationen am 27. März ausgetauscht.
Im Juli theilte die meklenburgische Regierung den Abschluß dieses Tractats dem Kaiserlichen Minister am Niedersächsischen Kreise, dem Baron von Binder unter dem Hinzufügen mit, daß Meklenburg leider dem Fürstenbunde habe beitreten müssen, was aber jetzt nicht bedenklich sei, da nach dem Tode Friedrich II. die Gesinnungen der Regenten und die Umstände in Europa sich so verändert hätten, daß alle gegründete Hoffnung zur Erhaltung eines guten Einvernehmens unter ihnen vorhanden sei. Baron Binder gratulirte höflichst zu dem erreichten Resultat, so befremdlich und auffallend übrigens auch dasjenige Mittel gewesen sei, welches sich der Herzog habe gefallen lassen müssen, um wieder zu seinem Eigenthum zu gelangen.
Von Seiten der preußischen Regierung war der Geheimrath von Moers nach Parchim gesandt, um die Administration der Pfandämter aufzulösen. Derselbe hatte 15 000 Rthlr., welche sich noch in der Kasse befunden hatten, nach Berlin übergeführt und rühmte die Generosität des Herzogs und die Coulanz der meklenburgischen Behörden. Eine sehr erregte Scene hatte sich dort zwischen ihm und dem Kammerrath Hahn ereignet, welcher Letzterer eine Entschädigung gefordert hatte, da ihm der hochselige König versprochen habe, er solle sein Amt bis zum Jahre 1803 behalten. Als der Geheimrath von Moers ihn schließlich mit harten Worten abgewiesen, hatte Hahn gedroht, er werde den König beim Kaiser verklagen und im Amt Eldena solle kein Baum stehen bleiben, da er ja die Brennerei= und Brauerei=Berechtigung bis zum Ablauf seiner Pacht habe.
Nach Unterzeichnung des Vergleichs war Graf Herzberg über das Gelingen seines Werkes so gerührt, daß er den Baron Lützow mit Thränen im Auge zärtlich umarmte, zugleich aber, auch im Namen des Grafen Finkenstein die dringende Bitte aussprach, der Herzog möchte ihnen kein Geschenk machen, wie dies sonst beim Abschluß eines Vergleichs oder Staatsvertrags gebräuchlich sei und als Baron Lützow befremdet nach dem Grunde dieser Bitte fragte, hinzufügte, ihre Feinde im Lande würden ihnen sonst den Vorwurf machen, sie hätten diesen Vergleich ihres persönlichen Vortheils wegen abgeschlossen.


|
Seite 84 |




|
Dagegen nahmen die Minister das übliche Geschenk von 100 Dukaten für den Kriegsrath, der das Protocoll geführt und 100 Dukaten für die Canzleibeamten an.
Besser wie den übrigen Pächtern erging es dem Oberamtmann Suckow. Derselbe hatte schon bei Lebzeiten des großen Königs enge Fühlung mit den Berliner maßgebenden Kreisen, besonders auch mit dem Chef der Administration der Pfandämter in Parchim, dem Geheimrath von Moers genommen und hatte es durch sein kluges und gewandtes Benehmen verstanden, sich in ganz besondere Gunst, nicht allein bei dem Grafen Herzberg, sondern auch bei seinem Landesherrn und dem Minister von Dewitz zu setzen. Es ist nicht zu leugnen, daß durch seine geschickte Vermittlung und durch seine Intriguen die Verhandlungen über die Reluition der Aemter unter der Hand oft wesentlich gefördert wurden und daß die von den Pächtern mit allen Mitteln, erlaubten und unerlaubten, so eifrig angestrebten Pachtverlängerungen besonders durch seine Bemühungen hintertrieben wurden. Wir wissen, daß der Herzog ihm bedeutende Vortheile in Aussicht gestellt hatte. Suckow sollte sein Amt Marnitz bis Johannis 1788 behalten, sollte dann die Geschäfte eines Beamten im Amt Marnitz mit einem jährlichen Gehalt von 800 Rthlr. versehen und von Johannis 1789 an die Pachtung Fahrenholz erhalten. Von diesem Termin an, sollte er 600 Rthlr. beziehen und ihm dafür als "tüchtigen, einsichtsvollen und geschäftskundigen Mann" auch anderweitige Commissionen, besonders bei der Regulirung der Verhältnisse der jetzigen Pfandämter übertragen werden. Hiergegen remonstrirte das Kammer=Collegium, welches von der nützlichen Thätigkeit, die der Oberamtmann Suckow bei der Reluition der Aemter entwickelt hatte, keine Kenntniß hatte und welches ihn nur als einen intriguanten Mann, der dem Collegium als Pächter viel zu schaffen gemacht, kennen gelernt hatte, auf das Lebhafteste, aber ohne Erfolg. Die hohe Kammer wurde von der Regierung mit dem Bemerken ab und zur Ruhe verwiesen, daß dem Mann werden müsse, was der Herzog ihm versprochen habe und daß die Kammer das als wahr annehmen dürfe, was Serenissimus und beide Minister ihr als richtig versicherten.
Baron Lützow hatte den ratificirten Vertrag nach Ludwigslust überbracht und kehrte im April nach Berlin zurück, woselbst er noch bis zum 1. Juli 1791 als Gesandter blieb.
In seinem nächsten Bericht beglückwünscht er den Herzog, daß er die Reluition der Pfandämter so unmittelbar nach der Thronbesteigung des Königs betrieben habe; später wäre der Zeitpunkt äußerst ungünstig gewesen, denn von allen Seiten würden Ansprüche erhoben,


|
Seite 85 |




|
die unter dem hochseligen König nicht zu realisiren gewesen wären; z. B. der Fürst von Anhalt=Bernburg verlange 3 Aemter nach dem Testament des Markgrafen Karl; der Herzog von Kurland 900 000 Rthlr. als Entschädigung des Sequesters der Herrschaft Wartenberg und des Amtes Greven in Schlesien; von Zerbst werde ein Minister mit einer Forderung kommen. Unzählige Particuliers, besonders die in Westpreußen aus den Starosteien vertriebenen Polen, stellten enorme Rechnungen auf. Der König solle sehr verlegen und verdrießlich sein und solle die Gerechtigkeits=Proclamation, die er beim Antritt seiner Regierung mit so viel Geräusch in Scene gesetzt, sehr bereuen.
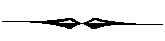


|
Seite 86 |




|



|


|
|
:
|
II.
Die Schiffergesellschaft in Rostock.
Von
Professor Dr. Wilh. Stieda zu Rostock.
~~~~~~~~
D ie mittelalterliche Organisation des Handels in Rostock zeigt uns neben einander verschiedene Compagnieen von Kaufleuten, die sich je nach dem Hafen, nach dem sie hauptsächlich Handel trieben, zusammengefunden und benannt hatten. So hatte man die Gesellschaften der Rigafahrer, der Schonenfahrer, der Bergenfahrer, der Wykfahrer. Zwei von ihnen, die Compagnieen der Rigafahrer und der Wykfahrer, haben sich im Laufe der Jahre, unbekannt wann, aufgelöst und leider sind sehr geringe Spuren ihrer einst sicherlich außerordentlich bedeutsamen Wirksamkeit hinterlassen. Die beiden anderen Vereinigungen dagegen leben bis auf den heutigen Tag fort,. freilich unter einem anderen Namen und mit einander verschmolzen. Es ist die altehrwürdige Schiffergesellschaft, die, aus der Asche der beiden genannten Brüderschaften im Jahre 1566 erstehend, ein rühmliches Dasein bis auf die Gegenwart geführt hat und der hoffentlich noch eine recht lange Existenz beschieden sein wird.
Durch die Ungunst der Zeit geriethen die Compagnieen der Schonenfahrer und Bergenfahrer in Verfall. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zeigte sich der Hering nicht mehr in gewohnter Menge an den Küsten der Halbinsel Schonen und sein vermindertes Auftreten bedang einen Rückgang in der Zahl der Personen, die sich mit dem Einsalzen und dem Vertrieb des leckeren Fisches befaßten. In ähnlicher Weise muß zur gleichen Zeit auch der Fischfang und der Fischhandel vor Bergen nachgelassen haben, wenngleich dieser Proceß noch nicht durch die wissenschaftliche Forschung vollkommen klar gestellt ist. So kamen denn die beiden Genossenschaften auf


|
Seite 87 |




|
den Gedanken, sich zu einer Gesellschaft zu vereinigen. "Nach dem die gabe des herrenn" - heißt es in dem Entwurfe zu den neuen Statuten - "mit dem heringesfange inn Schonne vnnd anderwegen nun lange zeidt, Godt sei geclaget, nicht wol zugegangenn ist, das auch dardurch die algemeynne koffleute der Schonenfarer seindt abgestorbenn unnd zum teile sich anderwegenn zu segelenn vorgenomenn und also hirdurch ire gerechtigkeit in Schonnseittenn und anderwegenn, auch ir hauss bynnen Rostock, das Schonfarrergelach, unnd companey, der name beynhahe erloschet wer worden ...," schien es den noch vorhandenen Genossen am zweckmäßigsten, durch Zuführung neuen Bluts das alte Gelag wieder lebensfähiger zu machen. Schonenfahrer und Bergenfahrer, Schiffer und Kaufleute traten zu einem Verbande zusammen und sagten sich gegenseitig das Halten gewisser, in ihrer aller Interesse liegenden Bestimmungen zu, deren Genehmigung sie vom Rathe erbaten.
Die Physiognomie der Gesellschaft wurde nun eine andere. Hatten die früheren Compagnieen ihre Thätigkeit auf einen einzelnen Platz in der Ostsee oder Nordsee beschränkt, so ersah der neue Verband das Gesammtgebiet der Ost= und Nordsee zum Schauplatz seiner Thätigkeit aus. Aus einer ursprünglichen Compagnie von Kaufleuten, auf deren Rechnung die Schiffe für eine bestimmte Fahrt ausgerüstet zu werden pflegten und die nicht immer ihre Waaren in Person begleiteten, wurde ein Verband von Schiffern, die, meist Eigenthümer der von ihnen befehligten Fahrzeuge, diese in den Dienst von Rhedern oder Kaufleuten stellten. Wie zahlreich letztere überhaupt je in der Gesellschaft vertreten waren, bleibt dahingestellt. Seit 1735, wo sie eine eigene Gesellschaft begründeten, erscheinen sie nicht mehr als Mitglieder und die Schiffer stehen im Vordergrunde der Interessen.
Zwei in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft befindliche Petschafte legen von der Verschmelzung Zeugniß. Das eine Siegel weist den kopflosen gekrönten Stockfisch, - das Symbol der Bergenfahrer, - drei Heringe, d. h. den Hinweis auf die Schonenfahrer, und in der Mitte zwei übers Kreuz gelegte Bootshaken, die Andeutung an die Schiffer, auf. Die Inschrift aber lautet: "Der Schiffer=Gesellschaft zu Rostock ihr Signet." In dem anderen, jedenfalls neueren Siegel ist die Erinnerung an die einstigen Bestandtheile, die den Grundstock zu der Verbindung gelegt haben, geschwunden, insofern ein stolzes Schiff an die Stelle der drei Zeichen getreten ist. Mag das dahin gedeutet werden, daß für den Verband nunmehr die Vertretung der Schifffahrtsinteressen allein maßgebend geworden war, so taucht dafür in der Inschrift: "Siegel des Schonenfahrer Gelags


|
Seite 88 |




|
zu Rostock" der Anklang an die den meisten wohl kaum mehr geläufige Entwickelung auf. Die Benennung "Schonenfahrergelag" hat unsere Gesellschaft in ihren verschiedenen Statuten dann beibehalten, während sie im gewöhnlichen Leben und officiell, ich weiß nicht seit wann, den Namen "Schiffergesellschaft" führt.
Das älteste Statut der Schiffergesellschaft, dessen Entwurf im Jahre 1566 dem Rathe zur Bestätigung unterbreitet wurde, enthält in der Hauptsache eine Regelung des geselligen Verhaltens der Mitglieder zu einander im Geschmacke der damaligen Zeit. Jährlich einmal wurden vier Aelterleute gewählt, die das Gelag nach außen vertraten und auf dessen Bestes im Allgemeinen zu wachen hatten. Die gleichfalls jährlich neu berufenen Schaffer waren dazu bestimmt, die gesellschaftliche Ordnung im Gelagshause selbst aufrecht zu erhalten, in dem man sich zu gemeinsamen Trünken zu versammeln pflegte. Kein Compagniebruder soll auf den anderen Groll hegen, alle sollen sich gegenseitig mit geziemenden Worten begegnen. Für gutes Getränk im Gelagshause ist jederzeit zu sorgen; die Beobachtung des Anstandes bei Vertheilung der Plätze, im Gespräche, beim Trunke versteht sich von selbst, wird aber doch ausdrücklich empfohlen und eingeschärft. In diesem Tone sind so ziemlich alle 28 Artikel abgesandt und nur wenige Bestimmungen verrathen, daß die Erwerbsinteressen nicht vergessen waren.
Dahin gehört vor allen Dingen der Beitrittszwang. Jeder, der nach Bergen, Schonen oder anderswohin von Rostock aus Schifffahrt treiben will, muß sich für eine gute Mark als Compagniebruder einschreiben lassen (Art. 4) 1 ), und keiner darf von Rostock aus ein Schiff frachten oder verfrachten, ehe er Mitglied der Compagnie geworden ist (Art. 24). Fremde Schiffer aber, die nicht in Rostock zu Hause sind, können überhaupt hier keine Fracht bekommen, so lange sich gute, taugliche, große oder kleine Rostocker Schiffe im Hafen befinden. Insbesondere aber war es auf die Warnemünder Fischer abgesehen. Sie sollten sich an ihrer Fischerei in Falster, Schonen und Gjedser genügen lassen und man verbot ihnen, sich mit Schifffahrt abzugeben, weil sie auf diese Weise "in der stadt burger und schiffer nerunge fallen." (Art. 27.) Namentlich aber sollte in Warnemünde kein Schiff gelöscht werden. Keiner war berechtigt, Pferde, Ochsen, Kühe, Schweine, Schafe, Gänse, Hühner und Enten oder Fleisch, Hering, Lachs, Getreide "in suma nichtes ausgenomen" aus den Schiffen oder Schuten in Warnemünde an Land


|
Seite 89 |




|
zu bringen; vielmehr mußten alle Schiffe an die Rostocker Schiffsbrücken anlegen und erst am städtischen Strande ausladen (Art. 28). Der Grund für diese Maßregel war, "weil den anders nicht von oldinges her zu Wernemunde denn eynn fischerleger unnd fischerbudenn gestundenn" (Art. 27).
Aus Gründen, die sich unserer Kenntniß entziehen, erhielt der Entwurf erst am 26. September 1576 die Genehmigung des Raths. Wesentlich der Vorlage gleich, ist diese Ordnung doch etwas umfangreicher als jene ausgefallen, indem sie aus 41 Artikeln besteht. Sie ist geblieben, was der Entwurf war, eine "Ordnung", wie der Eingang besagt, "wo idt van olders unnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn copluden, der Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werden." Zu zwei Exemplaren im hiesigen Stadtarchiv erhalten, weichen diese doch von einander ab, insofern die Artikel 31, 38, 39, 40, 41 der einen Ausfertigung, die wir mit A. bezeichnen wollen, in der anderen, die wir mit B. benennen, fehlen. Dafür aber sind wieder in letzterer einige Bestimmungen enthalten, die der ersteren mangeln. Den Vermerk, daß das Statut vom Rathe genehmigt ist und publicirt wurde, trägt nur die Ausfertigung A., an die wir uns somit ausschließlich halten wollen.
Die Bestätigung des Raths, der redactionell allerdings verschiedene Aenderungen vornahm, brachte in das Statut der Gesellschaft doch keinen anderen Charakter. Es war eben darauf abgesehen, einen Sittencodex aufzustellen, der für den Verkehr der Genossen unter einander, für die Begegnungen beim Trunke oder Spiele die Richtschnur bilden sollte. Von einem Bestreben, die Erwerbsinteressen zur Geltung kommen zu lassen, zeigen sich eigentlich gar keine Spuren und bei den beiden einzigen Maßnahmen, die wirthschaftliche Bedeutung haben, ist mir fraglich, ob sie überhaupt je in Kraft gewesen sind. Denn einmal fehlen sie in der Ausfertigung B. und sind in der anderen ausgestrichen. Dahin sind zu rechnen die Bestimmungen, einmal daß alle Verträge über Frachten nur im Gelagshause abgeschlossen werden durften (Art. 39) und zweitens, daß überhaupt kein hiesiger Schiffer regelmäßig seinem Berufe nachgehen dürfe, ohne die Mitgliedschaft des Gelages erworben zu haben (Art. 41). Zu der ersteren hat eine andere Hand bemerkt: "der sich im Schonevarlage wil frachten laten, ist frey" was doch nur so viel heißen kann, daß Jeder sich frachten lassen kann, wo er will. Die andere aber ist einfach durchstrichen und an ihrer Stelle - sie war der Schlußpassus des Statuts - steht der Vorbehalt des Raths, das Statut beliebig jederzeit nach seinem Sinne zu ändern.


|
Seite 90 |




|
Ueber die Vorlage hinaus greift die Errichtung einer Hülfskasse. Bei einem so gefährlichen Berufe, wie der der Seeleute ist, der der Familie nur zu oft den Ernährer unvermuthet raubt oder ihn zu weiterer Ausübung der Thätigkeit unfähig macht, legt es nahe genug, in besseren Zeiten für schlechtere zu sammeln, von den Vermögenden Gaben zum Unterhalt Armer oder Kranker zu heischen. Zweifellos huldigten auch die Rostocker Schiffer diesem Gebrauche, den in den Entwurf ihres Statuts einzufügen sie freilich nicht für erforderlich erachtet hatten. Es war aber doch gut, daß die Einrichtung einen etwas formelleren Anstrich erhielt. Daher bestimmte man, daß alles Armengeld, das an Bord der Schiffe gesammelt wurde oder sonst einging, den Aelterleuten übermittelt würde, damit diese die Vertheilung an die armen Schiffer und die Hausarmen in die Hand nehmen könnten (Art. 31). Das ist der Anfang des später verzweigteren Kassenwesens, das durch die Auszahlung von Leichengeldern und die Unterstützung bedürftiger Schiffer bezw. deren Wittwen so vielen in bedrohter Lage befindlichen Personen zu helfen vermocht hat.
Sehr bemerkenswerth erscheint die Thatsache, daß die auf die Zurückdrängung der Warnemünder berechneten Maßregeln des Entwurfes in der Bestätigung fehlten. Der Punkt ist wichtig genug, um etwas ausführlicher bei ihm zu verweilen.
Bereits am 11. April 1567 klagten die Rostocker Schiffer beim Rathe über die Schifffahrt der Warnemünder, "datt se mit schuten und bothen der kopmans gud vorforden und ehn ehre narunge entogen." Wenn sie sich "der Segelation gebruken" wollten, so möchten sie in die Stadt ziehen und hier die gleichen Lasten wie sie tragen. Die Warnemünder erwiderten, daß sie arme Leute seien, die großen Schaden erlitten hätten und sich zu ernähren suchen müßten, so gut es ginge, beriefen sich auch darauf, daß ihre Väter schon Schifffahrt getrieben hätten. Der Rath, der die Richtigkeit der Warnemünder Aussagen einsehen mochte, kam mit dem Vermittelungsvorschlage heraus, daß die Warnemünder zu ihren Fahrten sich keiner größeren Fahrzeuge als solcher von 8 Lasten bedienen sollten, fand aber damit keinen Anklang. So blieb ihnen denn nichts anderes übrig, als den Warnemündern die Benutzung von Schuten und "vorbueden Boten" zu untersagen und sie auf die von kleineren Fahrzeugen ("böthe mit einem upgesetteden spoleborde") zu beschränken. Was sie in diesen an Kaufmannsgütern fassen könnten, sollte ihnen frei stehen zu verschiffen.
Wenn die Rostocker Schiffer mit dieser Entscheidung ganz zufrieden waren und sich dafür bedankten, so waren die Warnemünder natürlich keineswegs davon erbaut, lagen vielmehr der verbotenen


|
Seite 91 |




|
Seefahrt nach wie vor mit Erfolg ab. Daher sahen sich nach sieben Jahren 1 ) unsere Rostocker genöthigt, von Neuem beim Rathe vorstellig zu werden, jene Verordnung den Warnemündern besser einzuschärfen. Bitter beschwerten sie sich, daß "de nering und foding, de wy armen sehefaren lude hebben scholden, dat unss de van Warnemunde uth der nesen und under den handen genamen werth." Auch die Stadt leide darunter, denn seit die Warnemünder nicht mehr fischen wollten, gingen die Preise für Dorsche und andere Fische beträchtlich in die Höhe.
Es läßt sich heute nicht mehr feststellen, ob der Rath gegenüber dem Beginnen der Warnemünder machtlos war oder es im Interesse der Stadt für richtiger hielt, sie gewähren zu lassen. Für die Kaufleute war es natürlich bequemer, nicht ausschließlich auf die Rostocker Schiffer angewiesen zu sein. Je mehr Fahrzeuge zu ihrer Verfügung vorhanden waren, desto wohlfeiler werden wohl die Frachten gewesen sein. Die Mitglieder der Schiffergesellschaft, die damals zum Theil selbst noch Kaufleute waren, sprachen die Ansicht aus, daß der Rath die Warnemünder stärke und befördere, beruhigten sich aber dabei nicht, sondern ließen sich angelegen sein, den Rath zu ihren Gunsten umzustimmen.
Daher reichten sie einige Jahre später, nachdem ihre Beschwerden unberücksichtigt geblieben waren, eine neue Eingabe ein 2 ) die darauf hinauskam, daß die Warnemünder, solange sie Schiffer und Kaufleute sein wollten, nach Rostock ziehen möchten, damit sie die gleichen städtischen Kosten trügen. Warnemünde sei eben als Fischerlager gegründet worden. Dem gegenüber wiesen die Warnemünder darauf hin, daß die Fischerei in neuerer Zeit überall sehr zurückgegangen wäre. Man müsse weit hinausfahren "bis zum Darss uber die funff meilen" und brächte nur ungenügende Erträge heim. Durch ihre Thätigkeit als Schiffer litte die Kaufmannschaft in Rostock keineswegs. Sie führten Bier und andere gute Waaren nach Kopenhagen, Helsingör und Ellenbogen und brächten von dort Korn, Butter, Fleisch, Talg, Oel, Fett, Häute und "was sonst dabei furfallen mag" zurück. Sie seien es ja auch, die zu den Unterhaltskosten "der leuchten zu Warnemunde, so allen sehefarenden leuten zum besten angesteckett wird," Beiträge zahlen müßten, während die Rostocker Schiffer für diesen Zweck nichts zahlten. Daher hoffen sie, daß der Rath sie bei ihrer Schifffahrt schützen und für sie sorgen würde. Anders geriethen sie mit Weib und Kindern an den Bettelstab.


|
Seite 92 |




|
Mittlerweile trat am 31. December 1583 in den Verhandlungen der Stadt mit Herzog Ulrich das Collegium der Hundertmänner als Vertreter der Gemeinde ins Leben. 1 ) Ursprünglich nur ausersehen, im Namen der Gemeinde mit dem Rathe über die 20 Punkte zu verhandeln, die der Herzog Ulrich hatte vorschlagen lassen, wurde sie doch von vornherein zu einer ständigen Einrichtung. Fortan sollten die Hundertmänner bei den "hochwichtigsten Ratschlägen, daran der ganzen stadt gelegen." anwesend sein und was sie beschließen würden, erklärte der Rath sich gefallen lassen zu wollen. In einer besonderen Weise zusammengesetzt, nämlich so, daß der Rath drei Brauer, drei Kaufleute und vier Handwerker erwählte und diesen den Auftrag gab, je neun zu cooptiren, doch wohl in erster Linie aus ihren Berufsgenossen, schien das Collegium allen Ansprüchen auf eine geeignete Vertretung der verschiedenartigen Interessen vollkommen zu entsprechen.
Das neue Collegium faßte seine Aufgabe ernst und reichte bereits zwei Monate, nachdem es sich gebildet hatte, am 6. März 1584 dem Rathe eine Supplication ein, die gewisse abzustellende Mängel aufzählte. Unter ihnen war auch der Warnemünder Concurrenz gedacht. §.15 lautete: "Item tho gedencken der Warnemunder wegen des segellnss, datt se mogen dattsulve instellen, denn idt iss ein Fischleger und keine kopstadt; wer by de sehwart bliven wil, den schal idt frey sin in de stadt tho thende."
Indeß Vorschläge zur Besserung waren leichter gemacht als ausgeführt, und der Rath that zunächst keine Schritte, den Wünschen der Bürgerschaft entgegenzukommen. Die Hundertmänner warteten mehrere Monate, dann aber griffen sie zum Mittel der Steuerverweigerung, um den Rath willfähriger zu machen. Sie verweigerten am 12. Januar 1585 die Zulage so lange, bis die von ihnen gerügten Mängel abgestellt worden seien. So wurde denn der Rath gezwungen, zu den Reformen Stellung zu nehmen und that dies in Bezug auf den §.15 mit folgender Erklärung: "Der Warnemünder Segelation belangend, wolle man nach gelegenheitt dieser zeitt und deroselben umbstende, ob dieselbe gantz und gar fuglich abgeschaffet werden könne und ob solchs dieser stadt und gemeiner burgerschafft zutreglich sein würde, wol behertzigen und erwegen und daruff ihre gruntliche und einhellige erclerung nicht allein, sondern auch in specie die ursachen ihrer erclerung einem erbarn rahte einbringen, daruff sich dan gemelter raht weiter mit gebührlicher resolution vornehmen lassen wolle."


|
Seite 93 |




|
Hiermit erklärten sich die Hundertmänner einstweilen einverstanden und wünschten nur, daß die Fischerei in Warnemünde nicht völlig vernachlässigt werden sollte. Daher sollten bis zur Entscheidung die Warnemünder wenigstens angehalten werden, starke Knechte zu miethen, die für sie fischen könnten, wenn sie aussegeln würden. Außerdem verlangten sie, daß die Warnemünder die nach Rostock gebrachten Waaren hier sogleich verkaufen und die Unpflicht gleich anderen Bürgern tragen sollten.
Der Rath, der hierauf wahrscheinlich nicht eingehen wollte, legte sich nun auf das Vermitteln, aber ohne etwas zu erreichen. Die erbitterten Schiffer wandten sich vielmehr, der vergeblichen langjährigen Gesuche müde, bald darnach 1 ) direct an den Herzog Ulrich mit der Bitte, den Rath zur Durchführung des im Jahre 1567 ergangenen Entscheides zu veranlassen. Dieser entsprach fast unmittelbar dem Ansinnen der Petenten und erließ, kaum nachdem die Beschwerde der Schiffer in Güstrow eingetroffen gewesen sein kann, am 5. März ein Schreiben an den Rath des Inhalts, daß er in dieser Angelegenheit die Billigkeit nicht außer Acht lassen und die Supplicanten schützen möge und "ihr umb etzlicher wenig leute privatnutzes willen nicht gestattet, dass die supplicanten uber erhalten urtheil und recht beschwert werden mugen."
Es mochte schwer genug sein, zu entscheiden, was billig war. Wenn die Rostocker Schiffer eine unliebsame Concurrenz sich vom Halse halten wollen, so kann man es vom Standpunkte der damaligen Zeit, die Freiheit des Handels und der Schifffahrt nicht anerkennen wollte, sondern sich an wohl erworbene ausschließende Privilegien hielt, nicht verurtheilen. Aber man kann es ebensowenig den Warnemündern verargen, wenn sie weiterstrebten und, nachdem die Erwerbsquelle der Fischerei versiegte oder gar ganz versagte, sich der Schifffahrt zuwandten, bei der sich ein gut Stück Geld verdienen ließ. Der Fehler lag nur darin, daß man die Warnemünder nicht als voll ansah und sie nicht die gleichen Abgaben und Lasten tragen ließ, die den Rostocker Schiffern auferlegt waren. Dadurch erhielten sie einen wirthschaftlichen Vorsprung, der in jener Zeit, die einer etwas engherzigen und kleinbürgerlichen Politik gehuldigt zu haben scheint, besonders übel vermerkt wurde.
Zu einer Gleichstellung der Warnemünder mit den Rostockern kam es indeß nicht. Der Rath versuchte aufs Neue gütliche Vergleiche und konnte nicht umhin, da sie fehlschlugen, herzoglicher Weisung gemäß, ein früheres zu Gunsten der Rostocker Schiffer ergangenes


|
Seite 94 |




|
Urtheil vom 15. März 1585 zu bestätigen. Bei 50 Thalern Strafe wurden die beklagten Warnemünder angewiesen, in 14 Tagen ihre Schuten und Böte abzuschaffen.
Daß diese sich hierbei nicht beruhigen würden, war anzunehmen und richtig appellirten sie an das Hofgericht in Güstrow zur Erlangung besseren Rechts. Indeß von hier aus erging schon am 12. October des folgenden Jahres der Bescheid, daß "in voriger Instanz woll geurtheiltt und ubell davon appelliret und die sache zum vorigen richter zu remittiren sey." Die Warnemünder, vielleicht hierauf vorbereitet, wandten sich bereits acht Tage später an das Kaiserliche Kammergericht. 1 ) Aber hier hatte ihre Beschwerde das Schicksal mancher andern; sie gerieth langsam in Vergessenheit, und am 28. Juni 1593 konnte daher das Hofgericht in Güstrow verfügen, daß das in erster Instanz gesprochene Urtheil nunmehr in Kraft treten solle, da die Appellation an das Kammergericht vorlängst erloschen wäre. Doch die Warnemünder verstanden die Vollstreckung noch für längere Zeit hinauszuschieben. Es gelang ihnen auf Wegen, die sich unserer Kenntniß entziehen, nach nahezu 60 Jahren, am 23. Mai 1604, eine abermalige Versendung der Acten nach Speyer zu erwirken.
Was das Kammergericht erwiderte, ist leider nicht bekannt, da die von mir für vorstehende Darstellung benutzten Acten im Haupt=Archiv zu Schwerin an dieser Stelle aufhören. Aus einem Rostocker Rathsprotocoll aber vom 1. Februar 1606, dessen Kenntniß ich Herrn Dr. Koppmann verdanke, erhellt, daß die Warnemünder schließlich nachgegeben haben. Der betreffende Bürgermeister berichtet, daß die Warnemünder "liti renuntiirt" haben und in die Stadt ziehen wollen. Bis die Renuntiation formell vollzogen sei, sollen für die Schifffahrt genannte Bestimmungen, d. h. wohl die Verfügung von 1567, gelten.
So hatten denn die Rostocker Schiffer schließlich den Sieg davongetragen und war die Lösung glücklich gefunden worden, die als die natürlichste erscheinen mußte. Ob die Rostocker wirklichen Vortheil davon zogen, ist eine andere Frage. Es läßt sich eher vermuthen, daß sie nicht viel Freude daran gehabt, denn das 17. Jahrhundert war mit seinem großen Kriege Handel und Gewerbe wenig geneigt. Wenn auch leider über diese Zeit nur spärliche Nachrichten vorliegen und die in der Lade der heutigen Schiffergesellschaft noch vorhandenen Acten das Dunkel fast gar nicht zu lichten vermögen, so wird es doch kaum bestritten werden können, daß es im Allgemeinen der Schifffahrt in Rostock nicht zum Besten ging.


|
Seite 95 |




|
Bei dem großen Brande, der im Jahre 1677 Rostock heimsuchte, scheinen auch die Papiere der Schiffergesellschaft in Unordnung gerathen zu sein. Jedenfalls wurden ihre Statuten, vielleicht schon früher etwas vernachlässigt, seit dieser Zeit nicht mehr gehörig anerkannt, und so kamen am 7. Februar 1714 die Gelagsbrüder zusammen, um sich auf eine neue Redaction ihrer "sehr alten leges" zu vereinigen. Anfangs scheinen sie nicht die Absicht gehabt zu haben, sich die Genehmigung dieser Statuten vom Rathe zu erbitten, und es dauerte nahezu ein volles Jahr, bis sie sich zu diesem Schritte entschlossen. 1 ) Anlaß, den Rath um seine Unterstützung anzugehen, war in mehrfacher Beziehung gegeben.
Abweichend von dem bisherigen Gebrauch, hatte ein Rostocker Kaufmann, Chr. Rudolf Stolte, einen fremden Schiffer zu einer Fahrt nach Stockholm gedungen, wogegen die Schiffergeseltschaft Einsprache erhob. Der Handel, der schon im 17. Jahrhundert ins Stocken gerathen war, wollte sich zu Anfang des 18. durchaus nicht bessern. Allgemein klagten die Schiffer über die "nahrlose Zeit" und schon einige Jahre vorher - am 17. März 1710 - hatte das Gelag sich über den Wettbewerb kleinerer Holsteinscher Schiffer beschwert, die für "gar geringen Preis" Korn auszuschiffen bereit waren. Um so empfindlicher mußte es ihnen jetzt sein, sich in der Führung größerer Fahrzeuge bedroht zu sehen.
Ferner hatte der Artikel 40 der älteren Statuten von 1576 vorgesehen, daß bei Streitigkeiten der Schiffer mit ihren Leuten und der Kaufleute mit den Schiffern zunächst die Aeltesten der Gesellschaft um ihre Vermittelung ersucht werden sollten und erst, wenn diese versagte, die Streitenden an die ordentliche Obrigkeit zu gehen befugt waren. Aber den Kaufleuten gefiel dieser Modus, sich zunächst an die Schiffer wenden zu müssen, auf die Dauer nicht, und sie hielten sich von vornherein an die ordentlichen Gerichte. Die Schiffer dagegen, die sich bei der Schiffergesellschaft in Lübeck erkundigt hatten, wie es dort gehalten werde, 2 ) legten Gewicht darauf, daß die alte Bestimmung in Kraft blieb.
Endlich lag den Schiffern am Herzen, die dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer gesetzlich gleichmäßig festgesetzt zu sehen.
Diese drei Gründe hauptsächlich werden die Schiffer veranlaßt haben, den Rath um die Bestätigung der neu aufgesetzten Artikel


|
Seite 96 |




|
anzugehen, an die sich "die Vorfahren in letzter Zeit wenig gekehret hätten."
Es hat den Anschein, als ob der Rath sowohl auf die Bitte überhaupt als auch auf die Regelung der drei angezogenen Punkte in dem von den Schiffern gewünschten Sinne einzugehen geneigt war. Speciell mit der Art, wie die Beilegung von Streitigkeiten vorgesehen wurde, erklärte er sich grundsätzlich vollkommen einverstanden. Er hielt es sogar für heilsam und nützlich, in dieser Weise vorzugehen, damit "hernach bey unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich daselbst melden, man so viel besser und promter aus der Sache kommen könne." Man erkannte eben die Aeltesten einer Schiffergesellschaft gerne als diejenigen Sachverständigen an, die sich in Seeangelegenheiten zurechtzufinden wissen würden.
Bei alledem bleibt es fraglich, ob die Bestätigung wirklich stattgefunden hat. Eine formelle Ausfertigung hat mir nicht vorgelegen. Nur ein Brouillon der Statuten, das den Genehmigungs=Vermerk des Raths von Schreiberhand aufweist, in der bekannten Form, daß gelegentliche Aenderungen vorbehalten werden, hat sich finden lassen. Aber dieses Exemplar ist ohne Datum, und ich glaube daher, daß eine wirkliche Anerkennung der Statuten aus irgend welchen Gründen unterblieben ist.
In dieser Auffassung werde ich bestärkt durch die auf uns gekommene Erzählung von einer Differenz des Großhändlers Herrn Johann Allwardt mit einem Schiffer Hans Töpcken, der ersteren im Jahre 1750 vor das Gelag forderte. Als der Kaufmann sich weigerte, der Ladung Folge zu leisten, erkannte der Rath, daß die Angelegenheit "in loco Judicii tanquam ordinario foro" ausgemacht werde. Gewiß hätte er nicht so entschieden, wenn die Vorlage von 1715 in der That gesetzliche Sanction erhalten hätte. Ihrerseits rühmten sich die Schonenfahrer bei Gelegenheit einer andern Streitsache wegen eines angeblich zu hohen Eintrittsgeldes, 1 ) daß sie seit unvordenklichen Zeiten Statuten und Ordnungen gehabt und gemacht hätten, ohne daß sie confirmiret wären oder deren Confirmation auch nur erheischet wurde.
Die unbestätigten Statuten von 1714 oder 1715 haben den gleichen Charakter wie die älteren. Sie bieten im Wesentlichen Vorschriften über die bei den Verhandlungen im Gelagshause und beim Verkehr der Mitglieder unter einander zu beobachtende Ordnung. Die von den Einzelnen zu leistenden Beiträge, die Aufgaben des Vorstandes im Hinblick auf das Gebäude und das darin befindliche


|
Seite 97 |




|
bewegliche Inventar, endlich die Leichenfolge, d. h. wer Recht und Anspruch darauf hat, von den Genossen zu Grabe getragen zu werden, wie das Gefolge zusammengesetzt und gekleidet sein soll - dies und Aehnliches ist Gegenstand ausführlicher Darlegung.
Tiefer geht der 16. Artikel, der von den sog. Vorsetzschiffern handelt. Als solche pflegte man diejenigen Seeleute zu bezeichnen, die im Auftrage eines anderen Schiffers, falls dieser krank ober sonst verhindert war, die Fahrt für ihn machten. Jener Artikel verlangte von Jedem, der Vorsetzschiffer benutze, daß er das Gelag gewonnen habe. Ich kann mir diese Bestimmung nicht anders erklären, als daß es mit ihr darauf abgesehen war, die Dienstleistung fremder Schiffer unmöglich zu machen. Kein Rheder oder Kaufmann konnte bei dieser Anordnung einen Schiffer in seine Dienste nehmen, der nicht Mitglied des Gelags war. Für Rostocker Schiffer verstand sich ja der Eintritt in die Genossenschaft von selbst, zu Vorsetzschiffern aber mochten mehrfach Fremde gewählt worden sein, die seither an die Mitgliedschaft nicht gebunden waren, falls sie auf Rostocker Schiffen in See gehen wollten.
Wirthschaftliche Gesichtspunkte kommen darin zum Vorschein, daß die Seeleute verpflichtet waren, alle außerhalb Landes erfahrenen Thatsachen, deren Kenntniß das Gelag fordern konnte, dem Vorstande mitzutheilen (Art. 25), sowie in dem Versuch, die Matrosenheuer nach den verschiedenen Plätzen gleichmäßig anzusetzen, damit kein Schiffer mehr als der andere bezahlte.
Noch einmal hat die Verfassung der Schiffergesellschaft einen Neuguß, keine eigentliche Aenderung erfahren - am 10. Januar 1825. Von diesen Statuten wissen wir sicher, daß sie nicht bestätigt sind. Denn §. 20 besagt ausdrücklich: Es sollen diese Statuten noch nicht bey E. E. Rathe zur Confirmation eingereicht werden, weil die Gesellschaft zuvor durch die Erfahrung davon sich überzeugen will, dass selbige zweckmässig und vollständig sind, folglich keiner Abänderung bedürfen.
Dann aber hat die Frage vor Kurzem ihre Erledigung dahin gefunden, daß am 3. August 1891 die Schiffergesellschaft ihre "Revidirten Statuten" vom Rathe hat bestätigen lassen. Diese jetzt die Grundlagen der Verfassung bildenden Bestimmungen sind wesentlich kürzer gehalten als das Statut von 1825. Da sie in einer besonderen Ausgabe veröffentlicht sind, nehme ich davon Abstand, sie unter den Beilagen mitzutheilen.
Das Bild, wie wir es nun von der Organisation der Seefahrenden Bevölkerung Rostocks auf Grundlage dieser Statuten von 1567 bis 1825 erhalten, ist in seinen Hauptzügen folgendes:


|
Seite 98 |




|
Alle selbständigen Schiffer Rostocks, die ein Schiff zu führen im Stande waren, gehörten dem Schonenfahrer=Gelag an, dessen Mitgliedschaft durch ein zu zahlendes Eintrittsgeld ohne weitere Förmlichkeiten zu erlangen war. Erhalten wurde die Mitgliedschaft durch regelmaßige Beiträge, die in der Form des sog. Lastengeldes, d. h. nach Maßgabe der Größe des Schiffes, in Lasten gemessen, von jeder ausgeführten Reise zu entrichten war. Seit 1716 war der Beitrag auf einen Schilling für die Last der Ladung angesetzt und wurde vom Schiffer dem Rheder in Rechnung gestellt.
An die Stadt entrichteten die Schiffer gleichfalls ein Lastengeld, das sie nach einem Eide von 1616 sogar völlig uncontrolirt in den dafür bestimmten Kasten zu legen hatten. 1 ) Sie übernahmen dabei die Verpflichtung, die sie durch den Schwur bekräftigten, kein fremdes Gut als Rostocker Waare zu veräußern, insbesondere kein an fremdem Orte eingeladenes Bier für Rostocker Bier auszugeben ober fremde Tonnen mit Rostocker Bier zu füllen.
Durch die Mitgliedschaft erwarben die Gelagsbrüder das Recht, im Gelagshause, wo einer der älteren Schiffer eine Schankwirthschaft führte, zu verkehren und an den am Fastnachtstage oder sonst daselbst zu veranstaltenden Festlichkeiten sich zu betheiligen. Die hierbei erwachsenden Unkosten wurden durch Vertheilung unter die Anwesenden gedeckt. Außerdem hatten sie Anspruch darauf, gemeinsam von allen Genossen, Männern und Frauen, zur letzten Ruhe bestattet zu werden; aus einer Kasse wurde den Hinterbliebenen für die Beerdigung eine gewisse Summe ausgeworfen. Die Statuten dieser bereits im vorigen Jahrhundert bestehenden Todtenlade wurden am 1. December 1821 obrigkeitlich bestätigt. Wann die Wittwenkasse und die Unterstützungskasse für nicht erwerbsfähige, mittellose Mitglieder dazu kamen, läßt sich beim Mangel an Nachrichten nicht feststellen. Die Anfänge dieser Kassen sind in das 16. Jahrhundert zurückzuverlegen und 1825 bestanden sie alle drei in der vollständigen Ausbildung, wie sie noch gegenwärtig functioniren.
Der Verkehr im Gelag hatte die Bedeutung, daß hier gewissermaßen die Börse für den Abschluß von Frachtverträgen war. Ein Rheder, der einen Schiffer brauchte, war sicher, dort Erkundigungen über die zur Zeit verfügbaren Persönlichkeiten einziehen zu können.
Die Gesellschaft besaß ein eigenes Haus, dessen schon im 15. Jahrhundert Erwähnung geschieht und das in der heutigen großen Bäckerstraße belegen war. Neben ihm befand sich der Schütting der Haken, den die Schiffergesellschaft am 27. April 1700 käuflich erwarb und


|
Seite 99 |




|
mit ihrem bisherigen Besitze vereinigte. Bei irgend einer Gelegenheit ist dann wohl durch einen größeren Ausbau dasjenige Gebäude geschaffen worden, das heute noch steht und in dem gegenwärtig die Wirthschaft zum Franziskaner betrieben wird. Im Jahre 1855 wurde dieses Haus verkauft, und damals war die Erinnerung noch rege, daß es sich ursprünglich um zwei Gebäude gehandelt hat, da von den "Gelaghäusern" die Rede ist. Das Gelag entschloß sich, sein Haus zu verkaufen, um die Wittwenkasse, mit deren Mitteln es spärlich bestellt war, mit einem größeren Fonds auszustatten. Den 45 Wittwen, die damals existirten, konnten jährlich nur je 5 Thaler verabfolgt werden.
Die Regelung der gemeinsamen Erwerbsinteressen beschränkte sich auf wenige Punkte. Man suchte sich die auswärtige Concurrenz vom Halse zu halten und ließ nur Mitglieder der Genossenschaft zur Ausübung der Schifffahrt zu. Fremden und denjenigen Schiffern, die nicht aus hiesigen Schifferfamilien hervorgegangen waren, forderte man das doppelte Eintrittsgeld ab. Im Laufe der Jahre, vermuthlich in dem Maße, als der Verdienst nachließ, wollte man auch die Vorsetzschiffer veranlassen, die Mitgliedschaft zu erwerben. Der hierauf im Statut von 1714 bezügliche Artikel scheint nicht genügend berücksichtigt worden zu sein. Daher beschloß man im Jahre 1767, daß den kranken Gelagsbrüdern und den Wittwen nur zweimal gestattet sein sollte, andere nicht zum Gelag gehörende Schiffer für sich fahren zu lassen. Vor der dritten Reise, die ein solcher Setzschiffer machen wollte, mußte er Mitglied des Verbandes geworden sein. Diese Beliebung aber erregte solche Verstimmung, daß der Rath sich veranlaßt sah, den Beweggründen, welche die Schiffer zu diesem Beschlusse gebracht hatten, nachzugehen. Indeß ergab das mit mehreren Deputirten des Gelags zwei Mal abgehaltene Verhör kein positives Ergebniß, und man scheint die Angelegenheit schließlich haben auf sich beruhen zu lassen.
Die Seefahrt erstreckte sich regelmäßig und vorzugsweise nach allen Plätzen der Ost= und Nordsee. Die für die einzelne Reise dem Schiffsvolke zu zahlende Heuer war je nach der Entfernung verschieden. Im Uebrigen aber hatten die Schiffer vereinbart, daß Keiner mehr als der andere zahlte. So wurde für eine Fahrt nach Stockholm oder Kurland 6 bis 7, nach Riga 7 bis 8, nach Holland 10, nach Lübeck 3 bis 4, nach der holsteinschen Küste 4 bis 5 Thaler bewilligt. 1 ) Wie es auf den nach Frankreich, England oder ins Mittelmeer segelnden Schiffen gehalten wurde, melden die Statuten nicht


|
Seite 100 |




|
und hat es daher den Anschein, daß diese Fahrten nur ausnahmsweise vorzukommen pflegten.
Die Gesellschaft wurde verwaltet durch einen Vorstand, der aus vier Aeltesten und ebensoviel Deputirten gebildet wurde. Der Zusammensetzung des Gelages aus verschiedenen Elementen entsprechend, mußten zwei Aelteste dem Kaufmannsstande, zwei dem Schifferstande entstammen. Als später die Kaufleute nicht mehr Mitglieder waren, wurde es üblich, die zwei kaufmännischen Aeltesten aus der Kaufmanns=Compagnie zu nehmen, und zwar unter denen die Auswahl zu treffen, die gleichzeitig Großbrauer waren. Ihre Wahl mußte vom Rathe bestätigt werden, der unter drei ihm vorgestellten Candidaten einen zu ernennen hatte.
Ein Verzeichniß der Aelterleute läßt sich für die ältere Zeit nicht mehr aufstellen. Nur einige Namen stoßen gelegentlich auf der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert auf, ohne daß wir angeben können, wie lange die Amtsdauer war, beziehungsweise welcher der beiden Kategorien der Aelteste entstammte. Dahin gehören:
Hinrick Paschen, gestorben 1699;
Hans Dettloff, 1699-?
Jacob Wögener, gestorben 1699;
Arent Petersen;
Clauß Tönings, gestorben 1702;
Hinrich; Degener, 1702-?
Peter Nemtzow, 1699-?
Hinrich Dose, gestorben 1713;
Hinrich Mantzel, 1705-12;
Hinrich Pegelau, 1712-?
Hans Stüdemann, 1718-?
Jacob Fredelandt, 1705-?
Jochim Davietzen, 1705-?
Seit 1714 haben wir zuverlässige Nachrichten, aus denen sich folgende Namen ergeben:
Aelteste der Schiffer waren:
Jacob Frädtlandt, 1714-1723;
Johann Davids, 1714-1717;
Hans Stüdemann, 1723-1742;
Carsten Frädlandt, 1724-1736;
Joachim Grundt, 1736-1742;
Peter Krepplin, 1742-1752;
Martin Töppe, 1742-1754;
Andreas Block, 1752-1756;


|
Seite 101 |




|
Joachim Jenßen, 1754-1770;
Peter Mauer sen., 1757-1780;
Andreas Bähr, 1770-1776;
Joachim Brinckmann, 1776-1793;
Ibe Rohde, 1781-1795;
Hans Stüdemann, 1793-1806;
Joh. Gustav Jenßen, 1795-1808;
Peter Gerdeß, 1807-1813 1 )
Heinrich Frädlandt, 1813-1823;
Martin Hinrich Töppe, 1815-1817;
Friedr. Bernhard Jenßen, 1817-51; 2 )
Jacob Maack, 1823-1837;
Joh. Heinr. Maack, 1837-1853;
Fritz Gottlieb Rentz, 1851--1860;
H. J. F. Bercke, 1853-1857; 3 )
Hans Heinr. Frädland, 1857-?
Heinrich Alwardt, 1860-?
Wilh. Ahrens, 1889-?
Aelteste von Seiten der Kaufleute waren:
Hinrich Pegelau, 1714-1725;
Hans Goltermann, 1713-1717; 4 )
Jacob Ernst Stever, 1717-1722;
John Wilh. Schulz, 1722-1755;
Johann Bauer, 1726-1731; 5 )
Heinrich Goldstädt, 1731-1745; 6 )
Diedrich Harms, 1746-1752;
Joh. Dietrich Dörcks, 1752-1765;
Johann Hinrich Tarnow, 1755-1772;
Carl Friedrich Bauer, 1765-1793;
Johann Danckwarth, 1772-1777; 7 )
Cord Hinrich Stubbe, 1777-1785; 8 )
David Hävernick, 1785-1811;
Jochim Siegmund Mann, 1793-?
Joh. Gottlieb Neuendorff, 1799-1805;


|
Seite 102 |




|
J. C. Janentzky, 1805-1819;
Johann Bauer, 1811-1836;
Chr. Fr. Koch, 1819-1854;
J. C. Heydtmann, 1837-1842;
Ernst Pätow, 1842-1855; 1 )
Ludwig Capobus, 1854-1857; 2 )
N. H. G. Witte, 1855-?;
Eduard Burchard, 1857-1860; 3 )
C. Ahrens, 1860-1889.
Die Aeltesten hatten die Aufsicht über die Ausführung und Beobachtung der Statuten, die es darauf absahen, einen angemessenen kameradschaftlichen Ton unter den Mitgliedern einzubürgern und aufrecht zu erhalten. Sie bildeten bei Streitigkeiten der Genossen unter einander die Spruchbehörde erster Instanz, und nur, wenn sich eine Einigung nicht erzielen ließ, konnte das ordentliche Gericht angerufen werden. Es war der Wunsch der Schiffer, sie auch bei Zerwürfnissen mit den Kaufleuten in gleicher Vertrauensstellung wirken zu sehen, der indeß, wenn überhaupt, nicht auf die Dauer Verwirklichung fand.
Die Aeltesten galten im Allgemeinen als Respectspersonen, denen unbedingt Gehorsam zu leisten war. Bei den festlichen Zusammenkünften hatten sie Anspruch auf besondere Ehrenplätze. Nicht immer mag gegenüber den etwas eigenwilligen Seeleuten, die ihren eigenen Kurs zu segeln vorzogen, ihre Stellung eine ganz leichte gewesen sein. Es hat sich z. B. Kunde von einer Beschwerde der Aeltesten beim Rathe aus dem Jahre 1699 erhalten, in der sie bitten, die Gelagsbrüder anweisen zu wollen, künftig sich bescheidentlicher gegen sie zu verhalten.
Weniger wichtig waren die Aemter der Deputirten und der Schaffer oder Schenken, wie sie im 16. Jahrhundert genannt werden. 4 ) Die Aufgabe der ersteren ist nicht recht durchsichtig. Sie dienten im Wesentlichen dazu, den Vorstand zu erweitern, wenn es sich um Ahndung der Verstöße gegen die Statuten oder um Einigungsversuche in ernsteren Fällen handelte. Sie waren es auch, die zusammen mit den Aeltesten die Schaffer wählten, deren Thätigkeit die von Festordnern bei den Zusammenkünften war. Die Schaffer sollen - heißt es in dem Statut von 1714 5 ) - bey solcher Zusammenkunft im


|
Seite 103 |




|
Fastlabend Fleisch, Brodt, Bier und andere nothdürftige einschaffen und dahin sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch gesetzet werde und überall kein Mangel sein möge. Außerdem hatten sie die Sorge für die Instandhaltung des Hauses und des Inventars. Die Wahl zum Schaffer konnte nur aus triftigen Gründen abgelehnt werden; jedenfalls aber mußte der Gewählte sich loskaufen, im 16. Jahrhundert mit einer halben Last Bier, 1 ) später durch Erlegung einer gewissen Geldsumme, 2 ) deren Betrag zu Anfang des vorigen Jahrhunderts 14 Fl. 10 Sch. zu sein pflegte. Strenge wurde geahndet, wenn hiergegen sich Jemand auflehnen wollte. Ein Protocoll hat uns den Namen eines derartigen Renitenten aufbewahrt. Es lautet in klassischer Kürze: "Anno 1713, den 21. Februar, ist Jacob Priess zum Schaffer gewält und auffgeruffen worden. Alss er hat dass gehört, ist er weckgegangen und ist nicht wiederkommen. Darauff ist ihm sein Nahm aussgethan worden und soll nicht mehr hinführo vor Gelachsbruder angenommen werden."
Selbstverständlich ging es bei diesen Zusammenkünften mit größter Feierlichkeit her. Gravitätisch zog man auf und setzte sich in steifer Ordnung zu Tisch an die angewiesenen Plätze. An das Mahl, bei dem Wein in karger Ration, Bier nach Belieben die Zunge lösten, schlossen sich Kaffee und Thee für die mittlerweile sich einstellende Frauenwelt - nur Hausfrauen und Bräute der Schiffer durften erscheinen -, und gemeinsam wurde nun bis in die sinkende Nacht oder gar bis an den grauenden Morgen ein Tänzchen gemacht. Ich kann mich nicht enthalten, die behagliche Schilderung eines solchen Festes durch einen Theilnehmer aus dem Jahre 1780, die sich glücklich erhalten hat, hier einzuschalten.
Es war das Ehrsame Gelag am 20ten Januar 1780 versamlet, um wegen des Schaffens zu stimmen, und es ward mit 18 Stimmen gegen 16 Stimmen beschlossen, daß man öffentlich am Mittag und warm Essen schaffen wolle.
Auf die Anfrage was das Gelag zu legen ged
 chte, wurden 5 Propositiones,
nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.
und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;
da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1
Rthlr. und 16 Stimmen
chte, wurden 5 Propositiones,
nemlich einen Zutrag von 32 Sch., von 1 Rthlr.
und von 1 Rthlr. 16 Sch. zu machen beschlossen;
da dann 2 Stimmen auf 32 Sch., 9 Stimmen auf 1
Rthlr. und 16 Stimmen


|
Seite 104 |




|
auf 1 Rthlr. 16 Sch. kamen. Mithin der Zutrag von
Rthlr. 1 : 16 Sch. bestimmt w
 rde.
rde.
Der 10. Februar an, der erste Donnerstag in der
ersten Fastnachtswoche w
 rde hiezu anberahmet, und die
Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen
Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage
vorgenommen wird, wegen des Aufr
rde hiezu anberahmet, und die
Aufnahme der Rechnung, welche bey nicht großen
Schaffen sonst gewöhnlich an folgende Tage
vorgenommen wird, wegen des Aufr
 umens und Reinigung des Hauses,
und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag
Montage eintrat, bis zum n
umens und Reinigung des Hauses,
und da am nechsten Montag darauf der Kaufschlag
Montage eintrat, bis zum n
 chsten Dinstag den 15. Febr.
verschoben und festgesetzet.
chsten Dinstag den 15. Febr.
verschoben und festgesetzet.
Dem gelag w
 rde dieses bekant gemacht und
ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere
Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender
Woche einfordern w
rde dieses bekant gemacht und
ersuchet mit dem Zutrag, welchen die Schaffere
Jacob Topp und Jochim Brinckmann in kommender
Woche einfordern w
 rden, nicht s
rden, nicht s
 umig zu seyn. Diese Schaffere
forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den
Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von
welchem Zutrag keiner weder Ausw
umig zu seyn. Diese Schaffere
forderten in couleurter Kleidung ohne Mantel den
Zutrag an den 24. und 25. Januar ein; von
welchem Zutrag keiner weder Ausw
 rtiger als Krancken als blos die
Herren Aeltesten und der Secretarius frey.
rtiger als Krancken als blos die
Herren Aeltesten und der Secretarius frey.
Am 8. und 9. Februar invitirten gedachte
Schaffere die Geselschafft in Kleidung ohne
M
 ntels um den 10ten Februar halb 11
Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und
da das Gelag beschlossen auch die drey Herren
des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu
bitten, so würden auch der Herr Senator D
ntels um den 10ten Februar halb 11
Uhr Vormittags sich in dem Gelag zu finden; und
da das Gelag beschlossen auch die drey Herren
des Gericht mit Ausschluß des Secretarii mit zu
bitten, so würden auch der Herr Senator D
 rcks als Pr
rcks als Pr
 ses, der Herr Senator Hille als
Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am
8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer
invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am
10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g
ses, der Herr Senator Hille als
Assessor und Herr Doctor Behm als im Gange am
8ten Februar zu allererst von diesen Schaffer
invitiret, um dem Gelage um 12 Uhr Mittags am
10. Februar die Ehre ihrer Gegenwart zu g
 nnen, wozu ihnen, diesen drey
Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.
nnen, wozu ihnen, diesen drey
Herren, ein Wagen gesandt werden sollte.
Die Musicanten der Stadt w
 rden von denen Schaffern auch
pr
rden von denen Schaffern auch
pr
 cise ümb halb 11 Uhr zum
Empfangblasen beordert, welche f
cise ümb halb 11 Uhr zum
Empfangblasen beordert, welche f
 r dieses Blasen und der
Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,
sondern stat dieser Bezahlung wird w
r dieses Blasen und der
Tafelmusick sein gewisses Geld empfangen,
sondern stat dieser Bezahlung wird w
 render Mahlzeit zwey Mahl ein
T
render Mahlzeit zwey Mahl ein
T
 ller zur Samlung f
ller zur Samlung f
 r sie bey allen Tischen umgetragen.
r sie bey allen Tischen umgetragen.
Am 10ten Februar
 m halb 11 Uhr war die Einkunfft
auf dem Gelag, und
m halb 11 Uhr war die Einkunfft
auf dem Gelag, und
 m ein Viertel auf 12 Uhr w
m ein Viertel auf 12 Uhr w
 rde der Anfang mit der Dancksagung
f
rde der Anfang mit der Dancksagung
f
 r das Erscheinen gemacht, darauf
die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen
Deputirten bey der Todtenlade und der neuen
Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage
bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am
Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit
dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.
r das Erscheinen gemacht, darauf
die Leges vorgelesen und die Wahl der neuen
Deputirten bey der Todtenlade und der neuen
Schaffere beschaffet, und dem Ehrsamen Gelage
bekandt gemacht, und sie gleich zu Mittage am
Regiments Tische zu speisen, eingeladen, womit
dann nun 3/4 auf 12 Uhr alles geendiget.
Die Tische waren gedecket, und zwar der Regiments Tisch unten in der Stube war auf Bitten der Schaffere von dem Mit=


|
Seite 105 |




|
Aeltesten
Herrn Brinckmann durch seiner Frauen
Veranstaltung gedecket, obgleich sonsten von den
Schaffern solches nach alten Gebraucht besorget
werden muß. Er war auf 24 Persohnen
eingerichtet, es saßen aber nur 19 Persohnen
daran, als die 3 Herren des Gericht, die 4
Herren Aeltesten, der Secretarius, die 4
Gelags=Deputirten, 2 Deputirten der Todtenlade
(NB. es waren nur 2, sonsten sind 4), die 2
neuen Schaffer (NB. die beyden alten Schaffers
besorgen die Aufwartung und Anstalten), Schiffer
Frantz Ruht, Schiffer Johan Jenssen und Schiffer
Hans Bey, zusammen 19 Persohn. Es w
 rden noch mehr altere Schiffer
soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam
keiner herein.
rden noch mehr altere Schiffer
soweit Raum war, zu invitiret, allein es kam
keiner herein.
Nun saßen die Schiffere nach ihrer Ordnung im
Gelage und zwar die Aeltere im Aeltesten Gelage,
darnechst an den langen Tischen, und die J
 ngeren soweit die langen Tischen
nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster
nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.
ngeren soweit die langen Tischen
nicht reichten, an dem Tisch, so vor dem Fenster
nach der Gassen zu am Ende des Gelages stehet.
Die Musicanten hatten einen besondern Tisch auf
der Diele, worauf dieselben bewirthet wurden.
Gleich nach 12 Uhr kamen die Herren des Gerichts
gefahren, und wie solche beysammen, die Suppe
aufgetragen, darauf mit der Glocke das Zeichen
zum Gebet gegeben, welches stille verrichtet
w
 rde.
rde.
Der Regiments=Tisch ward bedienet mit Perlgraupen
im Wein, darnach Schincken mit langen Kohl,
ger
 uchert Fleisch, Ochsenzunge und
Mettw
uchert Fleisch, Ochsenzunge und
Mettw
 rste, alles gekocht, darauf Fisch,
zuletzt einen Wildbraten und einen K
rste, alles gekocht, darauf Fisch,
zuletzt einen Wildbraten und einen K
 lberbraten, dabey Gurcken,
Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war
Herrenbrodt und K
lberbraten, dabey Gurcken,
Tittebirn und Kohlsallat vorhanden. An Brodt war
Herrenbrodt und K
 mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch
Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother
nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.
mmelbrodt. Zum Beschluß ward auch
Butter umgegeben. An Wein war weißen und rother
nach Belieben, auch Rostocker starckes Bier.
Die Tische in der Geselschaft waren ebenso
servirt, nur kein Wildbraten, daran aber weil
Vorrath, von den Regiments=Tische ein guter
T
 ller voll nach dem Aeltesten
Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath
geblieben, von dort in der Gesellschaft
gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß
ller voll nach dem Aeltesten
Gelage gereichet, und da auch hier Vorrath
geblieben, von dort in der Gesellschaft
gereicht. Wein war nach der Gesellschaft Schluß
 der der Mahlzeit je 2 und 2 eine
Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da
hiezu das Rostocker Bier angeschafft.
der der Mahlzeit je 2 und 2 eine
Bouteille aufgesetzt und Bier nach Belieben; da
hiezu das Rostocker Bier angeschafft.
W
 rend der Mahlzeit wurde der
obbenandter T
rend der Mahlzeit wurde der
obbenandter T
 ller für die Musicanten zweimahl
bey gesamte Tischen rund praesentirt.
ller für die Musicanten zweimahl
bey gesamte Tischen rund praesentirt.
An Gesundheiten w
 rde
rde
 der der Mahlzeit ausgebracht: E.
E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,
welche von den Herren des Rathes bedancket w
der der Mahlzeit ausgebracht: E.
E. Rath Gesundheit von den Herren Aeltesten,
welche von den Herren des Rathes bedancket w
 rde. 2) w
rde. 2) w
 rde von diesen
rde von diesen


|
Seite 106 |




|
Herren des Raths die Gesundheit und Wohlfahrt des
Gelags ausgebracht, welche von denen Herren
Altesten bedancket werde. 3) wurde der
Abwesenden Gesundheit getruncken. Diese
Gesundheiten waren mit Blasinstrumenten
begleitet und mehrere Gesundheiten auch nicht
getruncken. Die Musicanten aber machten w
 hrend der Tafel allerhand Concerte.
hrend der Tafel allerhand Concerte.
Wie man ges
 tiget und zum Gebet das Zeichen
mit der Glocke gegeben, so w
tiget und zum Gebet das Zeichen
mit der Glocke gegeben, so w
 rde wieder
rde wieder
 mb solches in der Stille
verrichtet, und darauf der Gesang "Nun
dancket alle Gott"' mit der
Instrumentalmusic abgesungen.
mb solches in der Stille
verrichtet, und darauf der Gesang "Nun
dancket alle Gott"' mit der
Instrumentalmusic abgesungen.
Hierauf w
 rde, wie sonsten gew
rde, wie sonsten gew
 hnlich, der Willkom mit der
Armb
hnlich, der Willkom mit der
Armb
 chse umhergetragen, und da w
chse umhergetragen, und da w
 rend der Zeit die Frauens
angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag
rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb
rend der Zeit die Frauens
angekommen, auch solche, nachdem er ins Gelag
rund gewesen, denen Frauen zusamt der Armenb
 chse von den Schaffer zugebracht.
Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln
aber die Frauens solches gerne haben wollten, so
ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.
Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie
sonst gebräuchlich von einen Deputirten und
Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb
chse von den Schaffer zugebracht.
Es ist dieses sonsten nicht geschehen, weiln
aber die Frauens solches gerne haben wollten, so
ist ihnen darinnen mit Vergnügen gewilfahret.
Wie nun dieses geschehen, wurde der Willkom wie
sonst gebräuchlich von einen Deputirten und
Schaffer nebst den Bohten mit der Armenb
 chse nach den darauffolgenden
Aeltesten seinen Hause gebracht. In w
chse nach den darauffolgenden
Aeltesten seinen Hause gebracht. In w
 render Zeit wurden die Tische zum
Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die
vereheligten Frauen eigefunden. Br
render Zeit wurden die Tische zum
Coffe und Thee zubereitet, zu welchen sich die
vereheligten Frauen eigefunden. Br
 ute waren keine in diesem Jahre in
der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br
ute waren keine in diesem Jahre in
der Gesellschafft, sonsten solche ihrem Br
 utigam nachkommen. Unverheyrathete
M
utigam nachkommen. Unverheyrathete
M
 nner, so keine Braut haben, k
nner, so keine Braut haben, k
 nnen weder andere Frauens oder
Wittwen noch weniger T
nnen weder andere Frauens oder
Wittwen noch weniger T
 chter an der Frauen Stelle zum
Coffee und Tantz nachkommen lassen.
chter an der Frauen Stelle zum
Coffee und Tantz nachkommen lassen.
Nachdem nun der Coffee verzehret, so w
 rde der Schaffer Tantz in
schwartzer Kleidung und M
rde der Schaffer Tantz in
schwartzer Kleidung und M
 ntel
ntel
 m dem Cr
m dem Cr
 tzbaum mit dem Willkom gemacht,
und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern
zugleich, darnechst von denen beiden neuen
Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei
jeden den Willkom in H
tzbaum mit dem Willkom gemacht,
und zwar zuerst von denen beiden alten Schaffern
zugleich, darnechst von denen beiden neuen
Schaffern auch zugleich, davon der Aeltere bei
jeden den Willkom in H
 nden hat. F
nden hat. F
 lt ihnen der Deckel vom Willkom
ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine
Tonne Bier Strafe.
lt ihnen der Deckel vom Willkom
ab, so gibt die Parthey, der es betroffen, eine
Tonne Bier Strafe.
Wegen dieser Tantze vertragen sich die Schaffere
mit den Musicanten und k
 nnen nun ihre schwarze Kleidung
und M
nnen nun ihre schwarze Kleidung
und M
 ntel ablegen.
ntel ablegen.
Wie nun dieses vorbey, so ging das Tantzen auf
dem Saal an, und wurden die Herren Aeltesten von
denen Schaffers gebeten mit das Tantzen den
Anfang zu machen; weiln nun dieselben alt und
schw
 chlich w
chlich w
 ren, so danckten die Aeltesten vor
dismahl f
ren, so danckten die Aeltesten vor
dismahl f
 r die Ehre und sie m
r die Ehre und sie m
 chten nur den Anfang machen; weiln
die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so
resolvirten 2 Aelteste
chten nur den Anfang machen; weiln
die Schaffere aber nicht ablassen wolten, so
resolvirten 2 Aelteste


|
Seite 107 |




|
in Gottes Nahmen den Anfang zu machen. Darnechst folgten die Schaffers und alsden die erste Tour nach der Ordnung des Alters im Gelage; wer sich vorbey gehen lassen will, der kan es thun.
Ist die erste Tour rund, so kan tanzen, wer da
will aus der Gesellschafft und Platz findet,
ohne weitere Beobachtung der Rangordnung. Die
Music kostet f
 r einen Tantz mit der Violin 4
Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten
8 Sch., welcher ein jeder T
r einen Tantz mit der Violin 4
Sch., mit den Zincken 6 Sch., und mit Trompeten
8 Sch., welcher ein jeder T
 nzer selbst bezahlt.
nzer selbst bezahlt.
Gegen Abend, wenn der Schaffer Tantz angehet, so kam der Wachtmeister mit 4 Mann und hielt die Wache.
Nach 10 Uhr Abends ward auch in der untern Stube getantzt.
Die Bewirthung zu Abend war ein belegtes Butterbrodt, Wein und Bier, auch Pfeiffen und Toback. In der Nacht beim Tanz war Limonade, Coffee und Thee und endigte sich dieses Fest des Morgens nach 6 Uhr.
Weiln die Zeit verging, mit dem Willkom der Frauens zu trincken, so wurden die Frauen nach der Schaffer Tantz erstlich mit Caffe, Thee und Kuchen bewirthet.
Wie zahlreich die Genossenschaft war, wissen wir leider nur unvollkommen; insbesondere fehlt jede Angabe über die Größe der Compagnie aus den Tagen ihrer Blüthe während des 16. Jahrhunderts. Offenbar wird je nach den kaufmännisch wechselnden Conjuncturen die Mitgliederzahl geschwankt haben. Im Jahre 1676 zählte die Schiffergesellschaft 57 Mitglieder; nahezu 100 Jahre später, 1767, ungefähr ebensoviel. Der in diesem Jahre gefaßte Beschluß über die Setzschiffer wurde von 34 Schiffern unterzeichnet, aber es stellte sich bei der nachherigen Vernehmung durch den Rath heraus, daß etwa 14 Schiffer aus unbekannten Gründen an jener Sitzung nicht theilgenommen hatten und etwa 11 zur Zeit auf Reisen abwesend gewesen waren. Für die Zeit von 1678 bis 1713 und wieder von 1723 an bis auf die Gegenwart läßt sich die Zahl der jährlich in die Gesellschaft aufgenommenen Schiffer nach dem "alten Hauptbuch des ehrbahren Schonfahrer=Gelages, worin alle Schiffers ihre Nahmen stehen, so das Gelag gewonnen haben," angeben. Dic Maximalziffer von 70 wurde im Jahre 1856 erreicht; in nicht wenigen Jahren wurde nur einer aufgenommen, und in manchen Jahren meldete sich gar keiner. Indem man die Angaben der einzelnen Jahre zu Perioden zusammenfaßt, die freilich wegen dazwischen


|
Seite 108 |




|
fehlender Jahre nicht ganz gleichmäßig gebildet werden können, erhält man folgende Uebersicht.
Es wurden in die Schiffergesellschaft aufgenommen:
| 1678-1697 | zusammen | 59 | Pers., | durchschnittlich | jährl. | 2,85 | Pers. |
| 1698-1713 | " | 51 | " | " | " | 3,28 | " |
| 1773-1793 | " | 60 | " | " | " | 2,29 | " |
| 1796-1815 | " | 93 | " | " | " | 4,65 | " |
| 1816-1835 | " | 84 | " | " | " | 4,20 | " |
| 1836-1855 | " | 117 | " | " | " | 5,85 | " |
| 1856-1875 | " | 121 | " | " | " | 6,05 | " |
Die vollständige Eintragung vorausgesetzt, findet man, daß die heutige Frequenz die des vorigen Jahrhunderts um ein Beträchtliches übertraf, und die Hauptblüthe würde in den uns bekannten Jahren auf die Mitte unseres Jahrhunderts fallen.
Wie es scheint, haben die Schiffer sich bemüht alle irgend zu ihnen gehörenden Persönlichkeiten wirklich in ihrem Gelag zu vereinigen. Von der Engherzigkeit bei der Aufnahme, wie sie bei den Zünften früherer Tage nur zu häufig war, haben sie sich alle Zeit ferngehalten. Nur ein Fall ist mir aufgestoßen, daß Jemand zurückgewiesen wird, obwohl er bereits 23 Jahre Bootsmann gewesen, weil er unehelich geboren. Es ist nicht wahrscheinlich, daß derartige Zurückweisungen öfter vorkamen, denn es fehlt in den Statuten ganz die Aufzählung zu erfüllender Bestimmungen, wie sie in den Rollen der Handwerker gewöhnlich aufstoßen. Fremde und Söhne von Nichtschiffern behandelte man allerdings weniger freundlich, indem man von ihnen das Doppelte des sonst üblichen Eintrittsgeldes verlangte, aber man wies sie doch nicht ab, und es lag im Geiste der Zeit, daß man sich gegen Fernerstehende ablehnend verhielt.
Die Höhe des Eintrittsgeldes, das ursprünglich auf eine Mark bemessen war, stieg mit der Zeit. Nach dem Statut von 1714 war es auf 11 Thaler 4 Sch. angesetzt für Einheimische und auf das Doppelte für Fremde. Das erwähnte "Hauptbuch" giebt sogar einen noch höheren Betrag an, nämlich 16 Thaler 20 Sch. Diese Summe bestand nach dem im Hauptbuch eingetragenen "Verzeichniss was ein Gelagsbruder geben muss" aus folgenden Posten:
| 12 | Rthlr. | - | Sch. | Gelagesgelt | |
| 2 | " | 16 | " | zum Proceß | |
| 1 | " | - | " | so bewilliget ist | |
| - | " | 12 | " | vor Marckt | |
| Thut | 16 | Rthlr. | 4 | Sch. | kumpt daß gelag zu gewinnen. |
| - | " | 16 | " | dem Gelagesdiener. |


|
Seite 109 |




|
Die Einnahmen und Ausgaben des Gelags hielten sich, wie der in den Beilagen abgedruckte Bericht ausweist, 1 ) in bescheidenen Grenzen. Mit Ausnahme weniger Jahre darf man der Gesellschaft nachrühmen, daß sie gut hauszuhalten und auszukommen verstand.
Reichthümer konnte sie freilich nicht sammeln. Immerhin weist die Aufstellung eines Inventars aus dem Jahre 1691 auf eine gewisse Behäbigkeit. Nach einem "Verzeichniss wass Anno 1691 auff Fastenacht beim Gelage gewessen ist," besaß die Gesellschaft:
"2 Leiche-Laeken in einer führen Lade,
"4 lange Manteln.
"An Silbergeschirr ist vorhanden wie folget:
"Einen grossen weissen Willkommen mit der Deckell,
"Einen kleinen weissen Wihllkommen mit der Deckell,
"Eine verguldte Traube mit Puckeln, so sehl. Jacob Wulff verehret.
"Eine verguldte Traube, so Sehl. Hinrich Schlüter verehret.
"Ein klein verguldeter Becher ohne Deckell,
"Ein missingscher verguldeter Ochsse, worin man ein Glas schrauben kan, so zerbrochen ist.
"Bey diesem Silbergeschirr ist eine Lade bey von führen holtz.
"24 Kannen, undt mussen noch gegeben werden wie folgt:
"1 Kanne Clauss Schmidt undt Jacob Fredelandt,
"1 Kanne Herrn Dettloff undt Daniell Moller,
"1 Kanne Hinrich Davietzen undt Karsten Druhll,
"1 Kanne Jochim Kadauw undt Jacob Kohll.
"Noch 5 zinnerne Leuchter 2 )
"Noch 1 missingschen Arm mit einer Plate,
"Noch 1 Klocke so am Kreutzbauhm hanget,
"Noch ein eissern Fahnstangen, ein eissern Offenfuess, einige eissern Fensterschranken. 3 )
Ein solches Inventar konnte schon gelegentlich dazu benutzt werden, um aus der Noth zu helfen. In der That läßt ein im Protocollbuche liegender Zettel ohne Datum erkennen, daß Verpfändungen vorkamen. Es heißt auf ihm: "sind 6 Stuck ohn die Deckel bey Herrn Gabriel Muller, darauf 200 Rthlr. Kapital genommen von sehl. Hans Dettloffs Kinder Gelder."


|
Seite 110 |




|
Ein Rest des einstigen Schatzes hat sich in Gestalt eines schönen, großen, silbernen Willkommens erhalten, angeblich ein Geschenk des Herzogs Christian Ludwig.
Wie es sich mit demselben verhält, in welcher Veranlassung Serenissimus ihn den Schiffern verehrt hat, ist mir leider trotz eifrigen Nachforschens im Schweriner Archiv zu entdecken nicht gelungen. Doch habe ich wenigstens mit Hülfe des Herrn Archivars Dr. Saß feststellen können, daß in einer Kabinets=Ausgabe=Rechnung des Herzogs Christian Ludwig von 1748 unter dem Monat September eingetragen ist: "An Konow für den Pocal, welcher nach Rostock gekommen - 251 Rthlr. N. 2 / 3 ." Ob diese Notiz sich auf den erhaltenen Pokal bezieht, weiß ich so wenig, als ich anzugeben vermag, wer Konow war. Aus den am Willkommen befindlichen Merkzeichen "S" und "ALK" läßt sich schließen, daß Konow ein Goldschmied in Schwerin war, dem der Herzog die Anfertigung übertragen hatte.
In dem Maße, als das Silbergeschirr abhanden kam, trat Zinngeschirr, das in jenen Tagen gleichfalls ein Kapital repräsentirte, an seine Stelle. Von diesem besaß das Amt im Februar 1707:
| 40 | Potkannen, |
| 19 | Stuckkannen, |
| 4 | zinnerne Leuchter. |
Außerdem nannte es damals einen messingenen Leuchter (Arm) und eine "Klocke am Kreutzbaum" sein eigen.
Verhältnißmäßig wenig Nachrichten haben sich von dieser wichtigen und angesehenen Gesellschaft erhalten. Bei dem Verkauf des Gelagshauses ist das ganze damals reichhaltige Archiv in alle vier Winde gegangen und nur drei Rechnungsbücher haben sich erhalten, zur Zeit im Besitz des Herrn Stadtarchivars Dr. Koppmann. Die Lade der Schiffergesellschaft birgt gar keine Original=Urkunden, nur einige Abschriften und vereinzelte, für die Geschichte der Gesellschaft nicht immer erhebliche Nachrichten. Die Aufzeichnung der älteren Statuten fand sich unter Papieren des Gewetts vor, und gestattete Herr Senator Paschen freundlichst die Einsichtnahme. Ueber den Streit der Schiffer mit den Warnemündern ergab das Haupt=Archiv in Schwerin die nöthigen Anhaltspunkte, während das Rostocker Stadtarchiv, bis auf die in der Darstellung benutzte Mittheilung, keine darauf bezüglichen Acten besitzt, wie Herr Dr. Koppmann mir mitzutheilen die Güte hatte.


|
Seite 111 |




|
Auch aus der unvollständigen Erzählung wird man, so hoffe ich, den Eindruck gewinnen, daß es sich um einen tüchtigen, gesunden Kern in der Organisation eines ansehnlichen Berufszweiges handelte, die bis auf den heutigen Tag lebensfähig zu sehen nur erfreulich sein kann.
Beilagen.
Der Rostocker Rath beschränkt die Warnemünder in ihrer bisherigen Gewohnheit, Kaufmannsgüter in grösseren Fahrzeugen zur See zu verschiffen. 1567, April 14.
Nach einer Abschrift im Schweriner Geheimen und Haupt-Archiv.
In saken der Rostocker schippern clegern an einem gegen und wedder de Warnemunders beclageden am andern dele, erkennen wir burgermeister und raht der stadt Rostogk, dat de Warnemunder alle schuten und vorbuede bote, darmit se dess kopmanss guder thor schwart fohren, up didtmahl scholen affstahn und keine andere böthe gebruken, den mit einem upgesetteden spoleborde, wat se alsden darmit an kopmanss gudern fohren konnen, schal en hirmit unverbaden sundern frey und nagegeven sin, dess sick also de schippern kegen einem erbaren raht bedancket und hebben tho mehrer orkundt der warheit dat sulve mit unser stadt secret vorsegelt. Actum den 14. Aprilis anno foffteinhundert soven und sostich.
Die Ordnung des Rostocker Schonenfahrer - Gelags. 1576, September 26.
Rostocker Stadt-Archiv. Pap.-Orig. Auf der Aussenseite steht von anderer Hand: Eines erbarn rhadts der stadt Rostock ordnung, wie es ihm Schonfarerlage bei den Kauffleuten, den Schonenfarer, Börgerfarer und schiffergeselschop soll geholden werden; vorbessert und publicirtt ahm 26. Septembris anno 1576. Die Hand, welche die ganze Ordnung selbst schrieb, setzte auf die Aussenseite: "Schonefahrerlages ordnüng."
Ordenüng und statüt wo idtt van olders vnnd henfürder inn dem Schonevarlage tho Rostock by denn coplüden der


|
Seite 112 |




|
Schonefarer Bargenfarer unnd schipper geselschop schall geholden werdenn, ock also van einem erbaren rade sampt den oldesten der gemeine vorsamling des gelages upt nie belevet, bewilliget unnd ahngenamen wordenn getrüwelich tho holdenn unnd ernstlich tho straffenn bi pene, who up einem ideren articüll vorvatet ist.
1. Idt schall ein ider, die hir in dissem gelage will sittenn unnd drincken, he sy, wehr he will, hoges edder nederigs standes, die schall sick aller erbarheit beflitigen unnd siner wordt in acht hebben unnd gedencken ahn die börgersprake, datt he nicht böslich rede up fürsten unnd herrn up riddermessige lüde, up einen erbaren wolwisenn radt disser stadt, up früwen unnd jünckfrüwen keine böse tünge hebben unnd einen ideren in sinem stande nicht boses nareden; werdt dar woll aver beslagen, die schall na gelegenheidt der saken darümb gestraffet werdenn.
2. Idt schall ock ein erbar radt disser güden stadt Rostock ahn erem gerichte unnd gerechticheiden nicht verletzet edder verkortet, ock ahn erem güden namen nicht ahngegrepen werden by pene unnd straffe, de darop geborrth.
3. Item idt schall ock ein ider, die hir drincket sick alle tücht ahnnhemen, datt he bi dem düren nhamen des heren alse sinen hilligen viff wünden, vorsetzlicher weise nicht floke edder schwere, dardorch Gottes nhame werdt gelastert unnd geschendett; so offt einer darover werdt beschlagen, die schall den armen in die büsse 1 sch. Lüb. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven ohne gnade.
4. Item im gelicken valle, dede vorsetzlicher wise den bösen mhan nomet unnd hitziger wise flöke unnd schendet, de schall einen schilling in die armenbüsse unnd 2 sl. Lub. in des lages büsse vorvallen sinn sünder gnade. Würde he sick der dinge nicht entholden unnd sick straffen laten, so schall men ehm thom lage uthwisen sünder gnade unnd des lages henfürder nicht mehr werdt sin.
5. Item idt schall ock nemant de gave gottes, alse der unnd kost, nicht modtwilliger wise vorgeeten, noch under die tafell werpen; worde einer daraver begrepen, de schall in de armenbüsse 1 schill. unnd in des lages büsse 2 sl. Lub. geven.
1 ) Ein später von anderer Hand sehr unleserlich an den Rand geschriebener Zusatz lautet: dar aver die lesterung tho groff whare, soll dan ein jeden richten unnd zuglich solchs antogen.


|
Seite 113 |




|
6. Item idt schall ock ein den anderen, he sy wehr he will, hir im lage nicht legen heten; well sülkes deit, die schall den armen 1 sl. unnd dem gelage 2 sl. Lüb. vorfallen sinn.
7. Item idt schall einer den anderen mit erenrorigen wörden in dissem lage nicht angripen; so jemandt, he sy wehr he will, de sülckes deidt, de schall dem lage 2 tunnen behr unnd den armen 2 sl. Lüb. in die büsse sünder gnade vorfallenn sinn.
8. Item allent wadt wünden unnd blodtrode saken
sin, de ahn den radt horen, de scholen idt
soeken, dar idt van rechte geboret tho s
 ken.
ken.
9. Item bede dar well van den lachbroderen einen
gast in dath gelach unnd de gast worde
brockfellich, de w
 rdt, de ene darinne gebeden hefft,
schall beteren vor den gast.
rdt, de ene darinne gebeden hefft,
schall beteren vor den gast.
10. Item were hir ein gast ungehorsam, de hir in ditt lach nicht gebeden were, deme schall men kein behr tappen unnd uth dem gelage wisen, dar schall he so lange uthebliven, datt he der oldesten unnd des lages willen maketh.
11. Item idt schall bi aventiden, wehn datt licht werdt angesticket, idt sy winter edder sommer, in dissem gelage nemant in der worptafel mit worpelen edder karten umb gelt edder geldes gewehr spelen, by pene einen ortes gülden, den he in des lages büssen schall vorfallen sinn.
12. Item wehn die lachbröder thosamende vorbadet werden, de dar nicht enkümpt, de schall dem gelage 2 sl. Lub. vorbraken hebben in des lages büsse, he hebbe den eine ehrhebliche orsake uthethobliven edder late sick entschüldigen.
13. Item wol tho einem schenken gekaren werdt, wehn freybehr vorhanden is, unnd datsülvige nicht don will, de schall dem gelage einen ortesgülden in die büsse geven.
14. Item welker lachbroder sick mit einem anderen vorünwilgede im gelage unnd ginge daruth, unnd halede dodtlige wehre up denn anderen, de schall nicht mehr werdich wesen unses gelages unnd geselschop, so lange sick de lachbroder darumme bespraken hebben, watt he darvor breken schall na lages gerechticheit.
15. Item wel hir im gelage by aventiden sitt unnd drincket, de schall darahn sin, datt he up den slach negen in der nacht sin vath lehr hebbe, den nemandes etwas mehr schal getappet werden by pene 2 sl. Lüb. in de büsse.
16. Item weren daröverst welcke, de so vele vadt lehr maken wolden, datt sie die gantze nacht darahn tho drinken


|
Seite 114 |




|
hedden, so schall densülvigen datt nicht vorgündt werden ohne der oldesten unnd schaffer willen.
17. Im geliken valle werret datt koplüde unnd schipper vorhanden, de undereinander gefrachteth edder gerekent, ock sünst ein lachbroder fromde ehrlicke lüde in datt gelach beden, so schall einem ideren nha gelegenheit der tidt unnd festenn, sülkes van den oldesten unnd schafferen vorgündt werdenn.
18. Idt schall ock de brede disck vor der lücht sick nemant ahnsetten, sünder schall vor die oldestenn frey bliven, idt sy denne datt he van den oldesten unnd schafferen dar worde by genodiget.
19. Item de hir im gelage will sitten unnd drincken unnd mordtliche wehre alse redderspete, degen, swerde, rappire, büssen, handtbile unnd dergelicken bi sick hedde, de schal diesülvigen van sick in vorwaring dohn, dewile datt he sittet und drincket, will he datt nicht don, so schal mehnn ehme thom lage uthstöten unnd kein behr tappen.
20. Item de hir ein lachbroder is, unnd he tho einem schaffer gekaren werdt, will he des nicht don, so schall he dem gelage eine halve last behr geven sünder gnade. 1 )
21. Item so van den lachbroderen edder anderen gesten sick miteinander haderden unnd ehn worde van den oldesten unnd schafferen frede gebaden, unnd sie wolden nicht thofreden sin edder gehör geven, so schall man densülvigen thom lage uthrüllen 2 ) unnd des lages hinfort 3 ) nicht mehr 3 ) werdt sein. 4 )
22. Item so dar jemant were, he were broder edder fromder unnd dem lagesknechte edder den sinen ohne alle gegevene ursake in unwillen etwas tho nha dede, de schall van den oldesten umb einen ortesgülden in des lages büsse tho geven gestraffet werden.
23. Item were dar woll, de modtwilliger wise im gelage ahn vinster, porten, benken, kannen, potte entwey sloge edder worpe, de schall dem gelege datt wedderümme so güdt maken laten, alse idt gewesen is, unnd dem gelage 1 tunne behr unnd den armen 2 sl. Lub. in de büsse darvor tho bröcke geven.


|
Seite 115 |




|
24. Item wehr modtwilliger wise den hof beflemmet unnd unreiniget, de schall in eine ider büsse 1 sl. Lub. geven sünder gnade.
25. Item idt scholen de schaffer up des lagesknecht güde achtinge geven, datt alle dische, kannen, bencken unnd potte reine unnd klahr sin, so offte he sülckes vorsümet, schall he dem gelage 2 sl. Lub. in beide büssen vorvallen sin.
26. Item des lages knecht edder sin volck scholen idermanne inn gelage güde worde geven unnd bereidt idermanne behr tho holen, worde he overst jemande unnütte edder zanckesche wordt geven, so schall he gelickest einem anderen gestraffet werden.
27. Item so des lages knecht ein anderwegen tho behr geidt, dobbelt edder speldt unnd sin bevalen hüss leddich ledt unnd up sine geste nicht wardt, so offte he daröver beslagen wert, schal he dem gelage einen halven daler vorvallen sin.
28. Item so im hüse edder have amptknechte seten edder sünst ander volck unnd sick unnütte makeden edder andere vor dem schorsteine breden unnd rokerden unnd des lagesknecht edder sin volck ehn over vorbaden artickell behr haleden unnd nicht vorboden, so schall he dübbelde straffe geven.
29. Im gelicken valle, so sick well im have unnütte makede, worpe edder sloge, dat sülve is mit in den 4 palen des hüses, de schal gelicke straffe geven nha eines ideren vorbrecking.
30. Item idt is ein oldt gebrück unnd van den oldesten also belevet, wehn einer under eren lachbroderen starvet edder einen doden hefft, dar schal men de lachbröder sampt ehren früwen dartho vorbaden laten dorch des lages knecht; im valle sie dorch nodige gescheffte halven werden vorhindert, datt sie nicht beide kamen konden, so schall dennoch einer van ehnn dem like volgen; worde de mahn, im valle he nicht thor see wart were, uthebliven, so schall he in de büsse 2 sl. Lub. geven ahne gnade unnd de früwe einen sl. Lub.
31. Item idt hebben sick ock de oldesten des lages mit den lachbroderen gentzlick geslaten, datt alle der armen geldt, so sie binnen schepes bordt edder sünst bekamen, schall den oldesten överantwordet werden, darmit henverner de armen schiplüde sampt anderen hüssarmen mogen ein weinich 1 ) bedt


|
Seite 116 |




|
vorsorget werden, alse süslange geschen; dede Jemandt darbaven, de schall van den oldesten darümme gestrafet werden.
32. Item idt willen ock de oldesten van wegen des gantzen gelages den schafferen ernstlick upehrlecht unnd bevalen hebben up datt gantze hüss ahm regimente in güder ordening bi idermanne tho holden, ock güdt behr in datt hus schaffen. So dem hüse dorch ere vorsümenisse schade geschege, den scholen sie vorböten, unnd dem gelage 2 tunnen behr darvor thor straffe geven.
33. Item idt schall sick ein iderman, he sy lachbroder edder nicht, des winraden 1 ) mit afritinge der bleder, stangen edder windrüfe 2 ) entholden; so offte einer dar wert over beslagen, de schal 3 ) dem gelage 2 tunnen behr thor straffe geven; so he nicht will recht don, so schall men ehm ein straff cordia geven unnd thom lage uthwisen.
34. Item idt schall de kleine dischk im have vor den vinsteren gelick wo ihm hüse de brede disck vor die oldesten im gelage frey geholden werden, unnd van des lages knechte nemandt ahne der oldesten willen bigestadet.
35. Item wehn vor de lachbröder frey behr vorhanden, so scholen dejennen, de nicht lachbroder sint, sick ahn einen ordt allein setten, so offte sick einer indrengede unnd mitdrincken wolde ahne vorloff der oldesten, den schall men umb einen halven daler straffen, 4 ) edder sine straffe cordia geven.
36. Item were idt sake, datt unwille twischen lachbroderen vorfille unnd die eine wolde dem anderen up der straten mit mordtlicker were overfallen, daröver ein ander konde tho schaden kamen, welckes die hogeste unfrede is, des schal sine straffe bi dem rade unnd gerichte sin unnd unses lages nicht werdich wesen.
37. Item idt willen de oldesten des lages im gelicken valle, de sy lachbroder edder nicht, getrüwelich vormanet hebben, de up der pilckentafell midt dem bosel spelen, de willen den düren nhamen des heren nicht unnütte gebrücken, ock sick marteren flokendes unnd schelden ock schenden entholden. So offte einer daraver vorbreken werdt, men will ehnn ernstlich straffen, wo de artickell vormogen unnd inholdenn.


|
Seite 117 |




|
38. Item idt schall ock nemant eine den anderen im gelage bi freyem bere edder sünsten in drünckenem mode manen, worde einer darover beslagen, de schall darümme erenstlicken gestraffet werden.
39. Idt hefft sick ock ein erbar radt midt den olderlüden disses lages ernnstlicken beslaten, dat dejennigen, de de sick hir willen frachten laten, he sy lachbroder edder nicht, idt sy van schepen, schüten efft böten, datt sülvige schal alhir in dissem lage gesehen, dede einer darbaven unnd sick ungehorsamlich worde anstellen, densülvigen schal men hir edder tho Warnemünde so lange arrestieren laten, beth he dem gelage darvor afdracht gedan, up dat de armen henferner darvan dat ehre mogen bekamen unnd nicht mehr so gentzlick vorgeten werden, who vormals geschehn. 1 )
40. Ock süth ein erbar radt sampt den oldesten disses lages vor nützsam ahn, so entwedder ein schipper midt sinen gesellen effte volcke, ock sünsten mit sinen koplüden worde in twist geraden unnd sie dattsülvige under sick nicht konden vorgelicken edder vordragen, so schal sülckes den oldesten des lages kündt gedan werden, alse denne scholen sie sick eine gelegene tidt bestemmen, darinne de sake moge vorgenamen unnd vorgelicket werden; im valle sie sülckes im gelage nicht konden vorgelicken, so mogen sie sülckes vor ere geborlicke overicheit söken.
41. Lestlich hebben sick ock de oldesten des lages mit ehren lagesbroderen beslaten, datt alle dejennigen, de de schippers sin und noch. nicht lages gerechticheidt gedan hebben, unnd sick henferner thor sewart willen begeven, datt dejennigen lages gerechticheit unnd bürden scholen dragen helpen unnd lachbroders werden; dede jemandt darwedder, de schal thor sehe wart van hir tho segelen nicht thogelaten werden bedt so lange he dem gelage darvör afdracht gedann. 2 )


|
Seite 118 |




|
Ein anderes, wie es scheint, zeitgenössisches Exemplar dieser Ordnung weist folgende Abweichungen auf.
Im Eingange ist die Erwähnung der Bestätigung durch den Rath (van einem erbaren rade) ausgelassen.
Art. 1 hat am Schlusse die Worte: jedoch einem erbarn rade eren broeke vorbeholden.
2=2.
3=3.
4=4.
5=5.
6=6.
7. Item schloge einer den ander mith unwyllen up de mundt, edder thöge syn mest up den andern, de schall den ungehorsam deme lage bethernn midt 2 tunnen bher und den armen 4 sl. Lub., worde he syck dariegen settenn, men schal ehne uth deme lage wisen und des lages nicht werth synn.
8=7.
9. Item idt schollen alle hadersaken, de hyr im gelage geschein, vor de olderlude und oldesten vor ersteu geclagett, und nha eines idern vorbrekynge vhan den oldesten nha gelegenheidt gestraffet werdenn.
10=8.
11. Item were dar wol ander parthyen, datt erenrorige wordt vorfallenn, de vhan den oldesten konden vordragenn werden und datt eine partt dar nicht inne bewilligen wolden, sunder vor de rychtter lepe, so schall desulve, de vor de hern wyl, unse lachbroder nicht mher wesen, edder he geve dem gelage 3 tunnen biher thor affdracht und den armen 6 sl. Lubsch in de busse.
12=9.
13=10.
14=11.
15=12.
16=13.
17=14.
18=15.
19=16.
20=17.
21=18.
22. Item idt wyllen de oldesten dess lages nicht
lyden und na disser tidt vorbaden hebben datt
bradent und r
 kenent vor dem schorsteine bhy
straffe ein ordtsgulden in des lages busse.
kenent vor dem schorsteine bhy
straffe ein ordtsgulden in des lages busse.


|
Seite 119 |




|
23=19.
24=20.
25=21.
26=22.
27=23.
28=24.
29=25.
30=26.
31=27.
32=28.
33=29.
34. Item idt is ein oldt gebruck und vhan den oldesten des lages belevet, wen einer under eren lachbrodern stervet edder einen doden hefft, dar schall men de lachbroder dorch des lagesknecht dartho vorbhaden lathen bhy brocke 2 sl. Lubss deme lyke tho grave folgenn (ähnlich §. 30).
Art. 31 der vorstehend abgedruckten Redaction fällt weg.
35=32.
36=33.
37=34.
38=35.
39=36.
40=37.
Art. 38, 39, 40, 41 der vorstehend abgedruckten Redaction fallen weg.
Schluss: Vor dissem allem wyl syck ein jeder wethen vhor schaden tho wachtenn, denn fuersehenn helpet nichtt.
Schiffer-Eid. 1616.
Nach einer Abschrift unter Papieren in der Lade der Schiffer-Gesellschaft.
Ich lobe und schwere, das ich in diese kiste das Lastgelt vor vorgangenen Jahre richtig und vollenkommen eingesteckt habe und das ich das kunfftige Jar von newen zu jeder zeit, so offt ich ausssegeln werde, die Ruder und Manzeichen von eines erbahren Raths Zolner richtig abfurdern und dem vorordenten Voigt oder in dessen Abwesen Jochim des Raths Diener zu Warnamundedieselbe uberandtworten, kein frembd Gutt vor Rostocker Gutt ansagen, noch frembde Bier an anderen


|
Seite 120 |




|
Orttern geladen vor Rostocker Bier verkauffen, noch einige frembde tunnen ohne eines erbahren Raths Wissen und Willen selbst brennen oder brauen lassen will, so war mir Gott helffe.
Ordnung der Schonenfahrer-Gesellschaft zu Rostock. 1714, Februar 1.
Ein kleines Buch in der Lade der Schiffergesellschaft, wie es scheint ursprünglich das Notizbuch eines der Aeltesten der Gesellschaft. Auf dem 2. Blatte steht: Anno 1823 ist dieses Buch von mir selbst angeschafft zu meiner Nachricht. Jacob Maack.
1
) Articuli, wornach ein jeder
Gelagsverwandter des l
 blichen Schonenfahrgelags bey
Zusanmenkünften und in Gelagssachen sich zu
richten hatt.
blichen Schonenfahrgelags bey
Zusanmenkünften und in Gelagssachen sich zu
richten hatt.
1. Vor allen Dingen soll ein jeder Gelagsbruder
sich eines ehrbahren und aufrichtigen Wanndels
und Lebens befleißigen, damit er keine b
 se Nachrede ihm und dem gantzen
Gelage verursache.
se Nachrede ihm und dem gantzen
Gelage verursache.
2. Bey des Gelags Zusammenk
 nften soll ein jeder Gelagsbruder
nach der Ordnung, als er ins Gelag gekommen,
seinen Sitz und Ort nehmen, und was von denen
Aeltesten proponiret wird, in der Stille anh
nften soll ein jeder Gelagsbruder
nach der Ordnung, als er ins Gelag gekommen,
seinen Sitz und Ort nehmen, und was von denen
Aeltesten proponiret wird, in der Stille anh
 ren.
ren.
3. Auch nach angehörter Proposition und Vortrage
der Aeltesten nicht sofort anfangen zu rufen
noch zu antworten, sondern es sollen die
gesambte Gelagsbr
 der einen Abtritt nehmen, sich
unter einander wegen dessen, waß die Aeltesten
vorgetragen ohne weitleuftig und verdrießlichen
Gezanck besprechen, und ordentlich ihre Meinung
davon gebenn.
der einen Abtritt nehmen, sich
unter einander wegen dessen, waß die Aeltesten
vorgetragen ohne weitleuftig und verdrießlichen
Gezanck besprechen, und ordentlich ihre Meinung
davon gebenn.
4. Wann alsdan die Gelagsbr
 der unter sich einig worden, waß
auf der Aeltesten Vortrag zu antworten, sollen
sie einen unter ihnen erw
der unter sich einig worden, waß
auf der Aeltesten Vortrag zu antworten, sollen
sie einen unter ihnen erw
 hlen, der im Nahmen der gesambten
Gelagsbr
hlen, der im Nahmen der gesambten
Gelagsbr
 der und in der Gegenwart
daßjenige, waß sie auf einen jeden vorgetragenen
Punckt resolviret und beliebet, wieder
andtworten, damit die Antword fein ordendlich
kan zu Papier gebracht werden.
der und in der Gegenwart
daßjenige, waß sie auf einen jeden vorgetragenen
Punckt resolviret und beliebet, wieder
andtworten, damit die Antword fein ordendlich
kan zu Papier gebracht werden.


|
Seite 121 |




|
5. W
 rde aber einer oder ander sich
unterstehen demjenigen, so in Nahmen der
gesampten Gelagsbr
rde aber einer oder ander sich
unterstehen demjenigen, so in Nahmen der
gesampten Gelagsbr
 der Relation abstatte, ins Word zu
fallen oder denen Aeltesten mit hartem Rufen
oder ungezemenden Reden zu begegenn, derselbe
soll mit eine Tonne Bier oder nach Befinden
h
der Relation abstatte, ins Word zu
fallen oder denen Aeltesten mit hartem Rufen
oder ungezemenden Reden zu begegenn, derselbe
soll mit eine Tonne Bier oder nach Befinden
h
 rter gestraft werden.
rter gestraft werden.
6. Ein jeder ehrliche Gelagsbruder soll
dasjenige, was die gesampte Gelagsbrüder oder
die meisten, so auff beschehene Beruffung des
ganzen Gelags erscheinen, belieben und schließen
werden, ohne Wiederrede ihren gefallen lassen,
und denselben sich nicht wiedersetzen bey w
 lk
lk
 hrlicher Straffe des Gelags.
hrlicher Straffe des Gelags.
7. Da auch zu des Gelags Besten etwaß an Gelde
bewilliget w
 rde, soll ein jeder Gelagsbruder
solches unweigerlich dennen Aeltesten erlegen
und sollen die Aeltesten, waß sie empfangen,
alles specificiren und zu Rechnung bringen.
rde, soll ein jeder Gelagsbruder
solches unweigerlich dennen Aeltesten erlegen
und sollen die Aeltesten, waß sie empfangen,
alles specificiren und zu Rechnung bringen.
8. Solle aber einer oder ander sich darin seumig bezeugen, den oder denenselben sollen keine Freyzettel gegeben werden, bis sie alles bezahlet. Wehren es aber keine Seefahrende, so sollen deren Leichen von dem Gelag nicht getragen noch gefolget werden, bis das alle Restanten bezahlet.
9. Ein jeder Gelagsbruder soll bey Gewinnung des
Gelages sofort sein Gelagsgeld richtig erlegen
und nachgehendes die Leichen tragen und folgen,
wenn ihn die Ordnung trift, auch wan er zum
Schaffer von denen Aeltesten und Deputierten
erw
 hlet und aufgeruffen wird, sich
sofort gestellen dem Gelage zum Besten schaffen,
wie es von Alters her gebrauchlich gewesen, es
w
hlet und aufgeruffen wird, sich
sofort gestellen dem Gelage zum Besten schaffen,
wie es von Alters her gebrauchlich gewesen, es
w
 hre den, daß die Aeltesten und
Deputirten geschehen lassen wolten, daß einer
oder ander gegen Erlegung der Gebühr wegen der
Schafferey sich abkaufen wolte, alßden er zur
Schafferey nicht kann gezwungen werden.
hre den, daß die Aeltesten und
Deputirten geschehen lassen wolten, daß einer
oder ander gegen Erlegung der Gebühr wegen der
Schafferey sich abkaufen wolte, alßden er zur
Schafferey nicht kann gezwungen werden.
10. Ein jeder Gelagsbruder soll bey Gewinnung des Gelags, eine Bricke dem Gelagswirth zustellen, die ihm allemahl wann er folgen, ins Haus gebracht werden soll, bey Strafe 1 Tonne Biers.
11. Wer einer Leuche nicht folget oder aber schon folget und die Bricke dem Gelagswirth oder dessen Leuten in der Kirche nicht einwirft, soll 4 ßl. Straffe geben; imgleichen, wenn daß Gelag gefordert wirdt und einer ausbleibet, soll ebenfallß mit 4 ßl. gestraft werden.
12. Welcher Gelagsbruder, wann ihm die Ordnung
trift, und es ihm angesaget wird, eine Leiche zu
Grabe zu tragen, vers
 umet oder keinen Andern in seine
Stelle verschafft, soll mit 5 Fl. gestraft
werden, die Aeltesten aber sollen von zwölf Per=
umet oder keinen Andern in seine
Stelle verschafft, soll mit 5 Fl. gestraft
werden, die Aeltesten aber sollen von zwölf Per=


|
Seite 122 |




|
sohnen mit langen M
 nteln getragen, und noch von 4
Gelagsbr
nteln getragen, und noch von 4
Gelagsbr
 dern bey der Leiche her geleitet
werden.
1
)
dern bey der Leiche her geleitet
werden.
1
)
13. Und sollen diejenigen, so die Leiche tragen,
mit schwarzen Flohren und M
 nteln erbahrlich erscheinen, daß
das Gelag desfals keinen Schimpf habe, bei 5 Fl. Strafe.
nteln erbahrlich erscheinen, daß
das Gelag desfals keinen Schimpf habe, bei 5 Fl. Strafe.
14. Wenn ein Schiffer im Fr
 hjahr, zum ersten mahl zur See
gehet, soll er von dem Aeltesten, so bey
derAdministrazion ist, einen Zettel abfordern,
auch zugleich seine Restanten alle bezahlen; wer
dawieder thut, soll willk
hjahr, zum ersten mahl zur See
gehet, soll er von dem Aeltesten, so bey
derAdministrazion ist, einen Zettel abfordern,
auch zugleich seine Restanten alle bezahlen; wer
dawieder thut, soll willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
15. Diejenigen, welche sich der Gelagsbeliebung
und Gewohnheiten freventlich entgegen setzen,
oder in ein oder ander sich ungehorsam bezeugen
w
 rden, der oder dieselben sollen
nach Befindung von den Aeltesten und Deputirten
bis auf 1/2 Last Bier zur Straffe gesetzet
werden, w
rden, der oder dieselben sollen
nach Befindung von den Aeltesten und Deputirten
bis auf 1/2 Last Bier zur Straffe gesetzet
werden, w
 rde er aber sich in der G
rde er aber sich in der G
 te nicht bequemen wollen, soll die
gerichtliche H
te nicht bequemen wollen, soll die
gerichtliche H
 lfe dazu ersuchet werden.
lfe dazu ersuchet werden.
16. Es soll keiner Vorsetzschiffer sich
gebrauchen lassen, der das Gelag nicht gewonnen,
wiedrigenfals sol derjenige, so solches thut,
nicht vor redlich gehalten, noch hink
 nftig zum Gelagsbruder angenommen werden.
nftig zum Gelagsbruder angenommen werden.
17. Bei des Gelags Zusammenkünften in Fastlabend
soll ein jeder Gelagsbruder mit ehrbahre
Kleidung erscheinen, keiner dem Andern mit
spitzigen, hönischen noch ehrenrührigen Worten
nicht begegnen, weniger alten Groll
hervorsuchen, sondern an seinen Ohrt fein stille
und sittsahm besitzen bleiben und mit den
aufgetragenen Speisen und Trinken sich bedienen
lassen; wer dawieder thut und Zanck, Schlagerey
und andere Unlust verursacht, soll nach
Befindung willk
 hrlich und hard gestrafet werden.
hrlich und hard gestrafet werden.
18. Wer einen Gast alsdan mit sich f
 hren will, der soll auch f
hren will, der soll auch f
 r ihm soviel, als ein jeder
Gelagsbruder sonsten giebt, an die Schaffer bezahlen.
r ihm soviel, als ein jeder
Gelagsbruder sonsten giebt, an die Schaffer bezahlen.
19. Die Schaffer sollen bey solcher Zusammenkunft
in Fastlabend Fleisch, Brodt, Bier und andere
nothd
 rftige einschaffen und dahin
sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch
gesetzet werden und
rftige einschaffen und dahin
sehen, daß alles wohl zubereitet auf den Tisch
gesetzet werden und
 berall kein Mangel sein m
berall kein Mangel sein m
 ge.
ge.
20. Jedoch sollen die Schaffer mit denen
Gelagsbr
 dern sich zu vergleichen, wieviel
ein jedweder ihnen zu solcher Aus=
dern sich zu vergleichen, wieviel
ein jedweder ihnen zu solcher Aus=
 dern bey der Leiche
hergeleitet werden und ein Gelagsbruder wird
von 14 Persohnen, 12 bei Abendzeit, beliebed
16. Februar 1781, aber kein mehrer f
dern bey der Leiche
hergeleitet werden und ein Gelagsbruder wird
von 14 Persohnen, 12 bei Abendzeit, beliebed
16. Februar 1781, aber kein mehrer f
 r Geld.
r Geld.


|
Seite 123 |




|
richtung zulegen wollen, und waß also den beliebet, soll ein jeder Gelagsbruder zu erlegen schuldig sein.
21. Die Schaffer sollen auch auf das Gelagsgebeude Achtung geben, das es in Bau erhalten bleibe, jedoch soll ihnen vom Gelage wieder gutgethan werden, waß sie dazu verwenden.
22. So sollen auch die Schaffer die Leichlacken
und zinnen Geschirr nach dem Inventario j
 hrlich einer dem andern liefern
und also, wenn j
hrlich einer dem andern liefern
und also, wenn j
 hrlich zwey abgehen, solches denen
antretenden wieder liefern.
hrlich zwey abgehen, solches denen
antretenden wieder liefern.
23. Eines jeden verstorbenen Gelagsbruders Wittwe
soll j
 hrlich 6 ßl. Tiedgeld erlegen,
hiegegen sollen auch solche Wittwen und deren
Kindern, wann sie unverheurathet st
hrlich 6 ßl. Tiedgeld erlegen,
hiegegen sollen auch solche Wittwen und deren
Kindern, wann sie unverheurathet st
 rben, mit dem Gelage getragen und
gefolget werden; der Herrn Aeltester Wittwen
aber sind von solchen Tiedegeld frey und werden
dennoch zu Grabe getragen und gefolget.
rben, mit dem Gelage getragen und
gefolget werden; der Herrn Aeltester Wittwen
aber sind von solchen Tiedegeld frey und werden
dennoch zu Grabe getragen und gefolget.
24 Wan unter den Gelagsbr
 dern wegen einiger Frachten,
Havereyen, Kaufmanschaften oder sonsten wegen
der Seefahrt als Docksheuren und dergleichen
Irrungen entstehen, k
dern wegen einiger Frachten,
Havereyen, Kaufmanschaften oder sonsten wegen
der Seefahrt als Docksheuren und dergleichen
Irrungen entstehen, k
 nnen sie dieselbe bey denen
Aeltesten in der G
nnen sie dieselbe bey denen
Aeltesten in der G
 ute abthun oder in Entstehung
derselben, dero Bedenken was in solchen Sachen
den Seerechten gem
ute abthun oder in Entstehung
derselben, dero Bedenken was in solchen Sachen
den Seerechten gem
 ß erfordern und begehren, worin
ihnen alsden soll willfahret werden.
ß erfordern und begehren, worin
ihnen alsden soll willfahret werden.
25. Wan auch ein oder ander Seefahrender
außerhalb Landes etwas erfahren sollte, waß zu
der Seefahrenden und des Gelags Besten und
Aufnehmen dienen k
 nnte, so soll er alsdan solches
dem Aeltesten hinterbringen, um darauf bedacht
zu sein, wie es zuwerk k
nnte, so soll er alsdan solches
dem Aeltesten hinterbringen, um darauf bedacht
zu sein, wie es zuwerk k
 nnte gesetzet werden.
nnte gesetzet werden.
26. So sollen auch die Seefahrenden in den
Volk=Heuren und F
 hrung eine Gleichheit halten und
einer nicht mehr als der andere an Heuer und
F
hrung eine Gleichheit halten und
einer nicht mehr als der andere an Heuer und
F
 hrung auf einen Platz geben, auch
keiner dem andern sein Volk entheuern. Wer da
wieder thut und darüber betroffen wird, soll
willk
hrung auf einen Platz geben, auch
keiner dem andern sein Volk entheuern. Wer da
wieder thut und darüber betroffen wird, soll
willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
27. Welcher Gelagsbruder von denen Aeltesten zum
Deputirten erw
 hlet wird, soll allemahl, wan er
gefordert wird, und insonderheit bey Aufnahme
der Gelagsrechnung sich einfinden, auch da in
Abwesenheit eines der Aeltesten streitige Sachen
unter den Gelagsbr
hlet wird, soll allemahl, wan er
gefordert wird, und insonderheit bey Aufnahme
der Gelagsrechnung sich einfinden, auch da in
Abwesenheit eines der Aeltesten streitige Sachen
unter den Gelagsbr
 dern wegen der Seefahrt und
Kaufmannschaft zu verh
dern wegen der Seefahrt und
Kaufmannschaft zu verh
 ren, wen er gefordert wirdt,
erscheinen und solchem mit beywohnen.
ren, wen er gefordert wirdt,
erscheinen und solchem mit beywohnen.
Anno 1714 den 1. Februar in Rostock sind die
uhralten Leges des l
 blichen Schonfahrergelags zur
Aufnahme des Gelags
blichen Schonfahrergelags zur
Aufnahme des Gelags


|
Seite 124 |




|
und mehrere Verbindlichkeit von denen Herren
Aeltesten, Deputirten Schaffers und s
 mtlichen Gelagsbr
mtlichen Gelagsbr
 der eigenhändig unterschrieben und
best
der eigenhändig unterschrieben und
best
 ndigs darauf zu halten versprochen worden.
ndigs darauf zu halten versprochen worden.
| Als |
Jochim
Danil
Hinrich Pegelau Jacos Fr  dlandt
dlandt
Hans Goltermann |

|
als Aeltesten. |
Sowie auch die Nahmen der Gelagsbr
 der 1714:
der 1714:
Ch. St
 demann
demann
Hinr. Meyer Hinr. Kreplien Pet. Krempien |

|
als Deputirten. |
|
Hans
Brinckmann
Mich. Kr  ger
ger
Hinr. Evers jun. Joh. Dawitz Joch. Brinckmann Mich. T  ppe
ppe
Joch. Meyer Claus Meyer Steff. Behn Joch. Grund Hans Heydemann Jb. Rohde |
Leonhard
Reus
Hans Redepenning Mart. St  demann
demann
Dav. Heytmann Hans Meyer Martin T  ppe
ppe
Peter Mackenaus Pet. Allwardt Abrah. Jentzen Hans Reis Lorentz Fehn Hinr. Krempien. |
Und wen ein neuer Wirth aufkompt, der daß Gelag nicht hat, der muß vorerst daß Gelag gewinnen, giebt 11 Rthlr. 4 ßl. mit daß Todtengeld, vor das Schaffent 7 Rthlr. 10 ßl., vor sein Contrackt den Herrn Aeltesten 4 Speciy = 5 Rthlr. 16 ßl., den Bothen in sein Beliebung, die Heur alle Jahr vorauß 36 ßl.
Gesuch des Schonenfahrer-Gelags beim Rath um Bestätigung seiner alten Statuten. 1715, Januar 23.
Rostocker Stadt-Archiv. Pap.-Orig. Adresse: Denen Hoch= und Wolledlen, Vesten, Hochachtbahren, Hoch= und Wollgelahrten, Hoch= und Wollweisen sonders Hochzuehrenden Herren Herrn Burgermeister und Rath der Stadt Rostock. Dazu von anderer Hand: Elteste und sämmtliche Verwandte deß hiesigen Schonfahrer=Gelags


|
Seite 125 |




|
wegen Confirmation oder Renovation ihrer Reglements. Product. den 11. Februar 1715, auch bereits in einigen vorhergehenden sessionibus amplissimi senatus.
Hoch= und Wolledle, Veste, Großachtbare, Hoch= und Wollgelahrte, Hoch= unnd Wollweise insonders Hochgeneigte Herren.
Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise Gestrenge
geruhen von Ihro Magnifici dem Herrn
Burgermeister Tieleken großgeneigt zu vernehmen,
welcher gestalt ohngefehr den 16. Octobris jetzt
verwichenen Jahres einige Deputirte von unserem
Gelage sich nach gedachter Ihro Magnifici alß
damals worthabenden Burgermeisters verf
 get und bey demselben wegen des
von seinem Herrn Stieffsohn Christian Rudolph
Stolten verschriebenen und nach Stockholm
gesanten fremden Schiffers protestiret, da sie
auch zur Antwort erhalten, daß solche
Protestation angenommen werden solte und m
get und bey demselben wegen des
von seinem Herrn Stieffsohn Christian Rudolph
Stolten verschriebenen und nach Stockholm
gesanten fremden Schiffers protestiret, da sie
auch zur Antwort erhalten, daß solche
Protestation angenommen werden solte und m
 chten die Eltesten nur deßwegen
mit einem Memorial zu Rathe einkommen. Gelanget
demnach an Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrengen hiemit unser dienstliches Bitten,
dieselben geruhen hochgeneigt die Verordnung zu
machen, daß hinf
chten die Eltesten nur deßwegen
mit einem Memorial zu Rathe einkommen. Gelanget
demnach an Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrengen hiemit unser dienstliches Bitten,
dieselben geruhen hochgeneigt die Verordnung zu
machen, daß hinf
 hro keinem Kauffman zugelassen
seyn solle, zumahlen wen er hier t
hro keinem Kauffman zugelassen
seyn solle, zumahlen wen er hier t
 chtige Leuthe haben kan,
anderwerts fremde zu verschreiben, es sei dan,
daß sie zuvor das B
chtige Leuthe haben kan,
anderwerts fremde zu verschreiben, es sei dan,
daß sie zuvor das B
 rgerrecht und unser
Schonenfahrer=Gelag gewonnen haben, denn da
dieses solte in Folge gezogen werden, w
rgerrecht und unser
Schonenfahrer=Gelag gewonnen haben, denn da
dieses solte in Folge gezogen werden, w
 rden ja nothwendig unsere eigene
Schiffer crepiren und consequenter unser Gelag
ohnfehlbaren Schaden nehmen müssen; zudem ja
auch solches an keinem einzigen Orte, alwo
Seehandel getrieben wird, gebr
rden ja nothwendig unsere eigene
Schiffer crepiren und consequenter unser Gelag
ohnfehlbaren Schaden nehmen müssen; zudem ja
auch solches an keinem einzigen Orte, alwo
Seehandel getrieben wird, gebr
 uchlich ist. Und da man auch in
sicherer Erfahrung gebracht, wie nicht nur in
L
uchlich ist. Und da man auch in
sicherer Erfahrung gebracht, wie nicht nur in
L
 beck, von wannen das vor einigen
Jahren hier
beck, von wannen das vor einigen
Jahren hier
 ber eingeholte Attestatum sub A in
copia hiebey gehet,
1
) Hamburg,
sondern auch in allen Seest
ber eingeholte Attestatum sub A in
copia hiebey gehet,
1
) Hamburg,
sondern auch in allen Seest
 dten von Alters her der l
dten von Alters her der l
 bliche Gebrauch gewesen, daß
gleichwie ein Schiffer, wen er in Seesachen vor
dem Gelage von einem Kauffmanne verklaget wird,
er sich allerdings vor dem Gelage auch stellen
m
bliche Gebrauch gewesen, daß
gleichwie ein Schiffer, wen er in Seesachen vor
dem Gelage von einem Kauffmanne verklaget wird,
er sich allerdings vor dem Gelage auch stellen
m
 sse, also auch ein Kauffmann, wenn
er Seesachen betreffend von einem Schiffer vor
das Gelag verklaget wird, er ohneweigerlich
seine Klage in prima instantia anh
sse, also auch ein Kauffmann, wenn
er Seesachen betreffend von einem Schiffer vor
das Gelag verklaget wird, er ohneweigerlich
seine Klage in prima instantia anh
 ren und g
ren und g
 tliche Handlung pflegen muß,
welches ja auch mit dem jure communi gar
deutlich übereinkomt (vid. Rubr. Tit. 2, Lib. 2 seq.).
tliche Handlung pflegen muß,
welches ja auch mit dem jure communi gar
deutlich übereinkomt (vid. Rubr. Tit. 2, Lib. 2 seq.).
Nach dem aber die Herrn Kaufleuthe sich hieran wenig oder gar nicht bis dato kehren wollen, alß ersuchen wir gleichfalls


|
Seite 126 |




|
hiedurch Ew. Hochedle, Herrliche und Hochweise
Gestrenge, dieselbe wollen uns hierin
hochgeneigt erscheinen und die Verordnung
machen, daß ein Kauffman, wenn er hink
 nftig von einem Schiffer wegen
Seesachen vor das Gelag gefordert wird, er
daselbst in prima instantia zu erscheinen
gehalten seyn solle.
nftig von einem Schiffer wegen
Seesachen vor das Gelag gefordert wird, er
daselbst in prima instantia zu erscheinen
gehalten seyn solle.
So haben wir auch nicht
 bergehen konnen drittens
vorzustellen, welchergestalt unsere Leges durch
den ungl
bergehen konnen drittens
vorzustellen, welchergestalt unsere Leges durch
den ungl
 cklichen großen Brand Anno 1678
zimlich l
cklichen großen Brand Anno 1678
zimlich l
 cherich geworden und nur diese
wenige, welche sub L. B. in copia hiebei
geben,
1
) noch
cherich geworden und nur diese
wenige, welche sub L. B. in copia hiebei
geben,
1
) noch
 brig behalten haben, wan aber
unsere Vorfahren an denenselben sich wenig
gekehret, alß ersuchen wir Ew. Hochedle,
Herrliche und Hochweise Gestrenge wollen unß
hierin hochgeneigt erscheinen und gegenw
brig behalten haben, wan aber
unsere Vorfahren an denenselben sich wenig
gekehret, alß ersuchen wir Ew. Hochedle,
Herrliche und Hochweise Gestrenge wollen unß
hierin hochgeneigt erscheinen und gegenw
 rtig unsere Leges in 27 Puncten
bestehent mit dem Rathsinsiegel de novo zu
confirmiren, auch denenselben vorhergehende 2
Puncte entweder zugleich mit oder auch per
decretum absonderlich zu confirmiren und also
diese jenen g
rtig unsere Leges in 27 Puncten
bestehent mit dem Rathsinsiegel de novo zu
confirmiren, auch denenselben vorhergehende 2
Puncte entweder zugleich mit oder auch per
decretum absonderlich zu confirmiren und also
diese jenen g
 tigst beyzulegen.
tigst beyzulegen.
Wan auch letztens oftermahlen wegen gar zu großer
Ungleichheit in denen Volcksheuren wieder den
26. Artikel der uhralten Gelagsgesetze vor unß
Klage gef
 hret worden, da der eine mehr alß
der ander an Heuer und F
hret worden, da der eine mehr alß
der ander an Heuer und F
 hrung auf einem Platz giebet und
dahero der Seehandlung großer Schade zuw
hrung auf einem Platz giebet und
dahero der Seehandlung großer Schade zuw
 chset, alß ist hierin unsere
dienstliche Bitte Ew. Hochedle, Herrliche und
Hochweise Gestrenge wollen großgneigt geruhen
gegenw
chset, alß ist hierin unsere
dienstliche Bitte Ew. Hochedle, Herrliche und
Hochweise Gestrenge wollen großgneigt geruhen
gegenw
 rtiges Project sub L. C., welches
sich bloß auf die Billigkeit gr
rtiges Project sub L. C., welches
sich bloß auf die Billigkeit gr
 ndet und nur nach alter Gewohnheit
gesetzet ist
2
) zu confirmiren und mit
dem gew
ndet und nur nach alter Gewohnheit
gesetzet ist
2
) zu confirmiren und mit
dem gew
 hnlichen Raths= auch unseres
Gelages=Insigel best
hnlichen Raths= auch unseres
Gelages=Insigel best
 rcken lassen, umb solches in
unserm Gelage zu jedermanlichen Notitie
aufzuhengen, damit hink
rcken lassen, umb solches in
unserm Gelage zu jedermanlichen Notitie
aufzuhengen, damit hink
 nftig hier
nftig hier
 ber weiter Klage zu f
ber weiter Klage zu f
 hren vermieden werde. Wann dieses
und obiges alles sich auf die Billigkeit gr
hren vermieden werde. Wann dieses
und obiges alles sich auf die Billigkeit gr
 ndet, alß getr
ndet, alß getr
 sten wir unß auch desto mehr
geneigter Erh
sten wir unß auch desto mehr
geneigter Erh
 rung verharrende
rung verharrende
|
Ew.
Hochedlen, Herrlichen und
Hochweisen
Gestrengen Aeltesten des hiesigen Schonfahrer=Gelages. |
Rostock, d. 23. Januar 1715.


|
Seite 127 |




|
Beliebung des Schonenfahrergelags über die Höhe der dem Schiffsvolke zu bewilligenden Heuer. 1715, Januar 23.
Rostocker Stadt-Archiv. Als Beilage C zum vorhergehenden Schreiben.
Demnach wir Elteste des Schonfahrer=Gelages in
Rostock erfahren, daß die Seefahrenden, zum
großen Schaden der Seehandlung wieder den 26.
Articul der uhralten Gelagsgesetze keine
Gleichheit in deren Volckheuren und F
 hrung halten und einer mehr alß
der ander an Heuer und F
hrung halten und einer mehr alß
der ander an Heuer und F
 hrung auf einen Platz giebet, so
haben wir Aelteste zu Abschaffung solcher
Unordnung und sch
hrung auf einen Platz giebet, so
haben wir Aelteste zu Abschaffung solcher
Unordnung und sch
 dlicher Ungleichheit nachfolgende
Ordonance gemacht, was und wieviel ein jeder auf
jechlichem Platz in der Nord= und Ost=See an
Volckheuer geben soll, wornach sich ein jeder
Gelagsbruder und Seefahrender bey wilk
dlicher Ungleichheit nachfolgende
Ordonance gemacht, was und wieviel ein jeder auf
jechlichem Platz in der Nord= und Ost=See an
Volckheuer geben soll, wornach sich ein jeder
Gelagsbruder und Seefahrender bey wilk
 hrlicher Straffe des Gelages zu
richten haben soll. Solchem nach soll denen
Sedfahrenden an Volcksheuren gegeben werden:
hrlicher Straffe des Gelages zu
richten haben soll. Solchem nach soll denen
Sedfahrenden an Volcksheuren gegeben werden:
| Auf | Holland | 10 | Rthlr. | ||
| " | Drontheim | 12 | " | ||
| " | Bergen | 8 | " | ||
| " |
Norwegen
 berall
berall
|
8 | " | ||
| " | Gottenburg | 6 | à | 7 | " |
| " | Jevel | 8 | " | ||
| " | Stockholm | 6 | à | 7 | " |
| " |
Nordk
 ping
ping
|
6 | à | 7 | " |
| " | Westerwyck | 6 | " | ||
| " | Walmerswyck | 6 | " | ||
| " | Calmar | 6 | " | ||
| " | Carlskrohn | 5 | " | ||
| " | Carlshaven | 5 | " | ||
| " | Gottland | 6 | " | ||
und an F
 hrung
hrung
|
2 | " | |||
| " | Riga | 7 | à | 8 | " |
| " | Narva | 8 | " | ||
| " | Reval | 7 | " | ||
| " | Parnaw | 7 | " | ||
| " | Curland | 6 | à | 7 | " |
| " | Libau und | à | 7 | " | |
| Windau | à | 7 | " |


|
Seite 128 |




|
| Auf | Memel | 6 | à | 7 | Rthlr. |
| " |
K
 nigsberg
nigsberg
|
6 | " | ||
| " | Dantzig | 6 | " | ||
| " | Colberg | 6 | " | ||
| " | Hinterpommern | 6 | " | ||
| " | Stralsund | 4 | " | ||
| " | Copenhagen | 4 | à | 5 | " |
| " |
Helsing
 r
r
|
5 | à | 6 | " |
| " |
Malm

|
5 | à | 6 | " |
| " |
L
 beck
beck
|
3 | à | 4 | " |
| " |
Holstein
 berall
berall
|
4 | à | 5 | " |
| " | Ahlburg | 6 | " | ||
in den Belt
 berall
berall
|
5 | à | 6 | " |
Und auff alle obspezificirte Pl
 tze soll das Volck
tze soll das Volck
 ber der obigen Heuer seine
ordinaire F
ber der obigen Heuer seine
ordinaire F
 hrung wie von Alters her gebr
hrung wie von Alters her gebr
 uchlich gewesen, haben und genießen.
uchlich gewesen, haben und genießen.
Angebliche Bestätigung der Statuten des Schonenfahrergelags durch den Rath zu Rostock. 1715, ? Februar.
Rostocker Stadt-Archiv. Brouillon ohne nähere Angabe des Datums.
Nachdem uns B
 rgermeistern und Rath der Stadt
Rostock die Aeltesten des hiesigen Schonfahrer
Gelages per supplicationem zu vernehmen gegeben,
wie das von unseren Antecessoribus confirmirte
Exemplar ihres Reglements, durch die Anno 1677
entstandene große Feuersbrunst mit verbrannt,
sie aber noch einige den vorigen conform seyende
Articulos wieder aufgefunden und beybehalten
h
rgermeistern und Rath der Stadt
Rostock die Aeltesten des hiesigen Schonfahrer
Gelages per supplicationem zu vernehmen gegeben,
wie das von unseren Antecessoribus confirmirte
Exemplar ihres Reglements, durch die Anno 1677
entstandene große Feuersbrunst mit verbrannt,
sie aber noch einige den vorigen conform seyende
Articulos wieder aufgefunden und beybehalten
h
 tten, die sie uns zugleich
tten, die sie uns zugleich
 bergeben und dabey, um sie sich
derselben in Sachen ihres Gelagses zu dieses
Aufnahme n
bergeben und dabey, um sie sich
derselben in Sachen ihres Gelagses zu dieses
Aufnahme n
 tzlich gebrauchen k
tzlich gebrauchen k
 nnten, uns ersuchet: Wir solche,
nebst eines dabey mit eingelieferten sogenannten
Ordonnanze, was das Schiffsvolck oder
Schiffsleute an Heuer und Führung von hier auf
andere Oerter zu genießen haben sollten, damit
nnten, uns ersuchet: Wir solche,
nebst eines dabey mit eingelieferten sogenannten
Ordonnanze, was das Schiffsvolck oder
Schiffsleute an Heuer und Führung von hier auf
andere Oerter zu genießen haben sollten, damit
 berall hierunter Gleichheit
gehalten, ein jeder um so viel mehr und promter
vergn
berall hierunter Gleichheit
gehalten, ein jeder um so viel mehr und promter
vergn
 glich bedient werden und deswegen
unter Kaufleuten, Schiffern und Bothsleuten kein
Streit entstehen m
glich bedient werden und deswegen
unter Kaufleuten, Schiffern und Bothsleuten kein
Streit entstehen m
 gte, zu genehmigen und zu
confirmiren m
gte, zu genehmigen und zu
confirmiren m
 gten geruhen, so haben
gten geruhen, so haben


|
Seite 129 |




|
wir beydes (wovon wir jedoch die sogenannte Ordonnanze nichts anders, dann für ein Bedenken und Vorschlag hiesigen Schonfahrer=Gelags=Aeltesten angenommen) mit Fleiß durchgelesen wohl erwogen und, da wir befunden, daß verhoffentlich dasjenige, was in den Articulis verfasset, der Gestalt wie sie folgend lauten:
Articuli des Schonfahrer=Gelags=Reglements.
Es folgen nun die 27, von uns unter No. IV abgedruckten Artikel, indem jedoch Art. 16 und 26 geändert sind. Diese lauten nämlich in der Bestätigung des Rathes:
Art 16: Es soll hinfüro keiner, er sey fremder
oder einheimischer, als Setzschiffer hier
admittiret, noch mit dem Gef
 ß, worauf er gesetzet, von hier
aus dem Baum eher gelassen werden, bis
derselbige das hiesige Schonfahrer=Gelag
gewonnen hat. Dagegen sollen aber auch
diejenigen, so im hiesigen Gelage seyn, und kein
eigen Gef
ß, worauf er gesetzet, von hier
aus dem Baum eher gelassen werden, bis
derselbige das hiesige Schonfahrer=Gelag
gewonnen hat. Dagegen sollen aber auch
diejenigen, so im hiesigen Gelage seyn, und kein
eigen Gef
 ß haben, wenn sie vom Kaufmann auf
dessen Gef
ß haben, wenn sie vom Kaufmann auf
dessen Gef
 ß zu Setzschiffern verlangt
werden, sich dazu unweigerlich von der Heuer und
F
ß zu Setzschiffern verlangt
werden, sich dazu unweigerlich von der Heuer und
F
 hrung, so hieselbst durch die
Ordonanze gesetzt, gebrauchen lassen. Wer sich
dawider ohne jenige von den Aeltesten und
Deputirten des Gelags erheblich befundenen
Ursachen setzet, soll dem Kaufmanne dasselbe
bezahlen, was er vor einen außerhalb dem Gelage
seyenden Setzschiffer dem Gelage erlegen muß.
hrung, so hieselbst durch die
Ordonanze gesetzt, gebrauchen lassen. Wer sich
dawider ohne jenige von den Aeltesten und
Deputirten des Gelags erheblich befundenen
Ursachen setzet, soll dem Kaufmanne dasselbe
bezahlen, was er vor einen außerhalb dem Gelage
seyenden Setzschiffer dem Gelage erlegen muß.
Art. 26. So sollen auch die Seefahrende in den
Volcksheuren und F
 hrungen allerdings der Ordonnanze,
welche von E. E. Hochw. Rath nach der Aeltesten
des Gelags Vorschlage gefertiget, nachgehen, und
nicht mehr noch weniger geben dann in derselben
verordnet, und also hierunter Gleichheit halten,
auch solche selber in ihrer eigenen Heuer und
F
hrungen allerdings der Ordonnanze,
welche von E. E. Hochw. Rath nach der Aeltesten
des Gelags Vorschlage gefertiget, nachgehen, und
nicht mehr noch weniger geben dann in derselben
verordnet, und also hierunter Gleichheit halten,
auch solche selber in ihrer eigenen Heuer und
F
 hrung nicht
hrung nicht
 berschreiten; daneben keiner dem
andern sein Volck entheuern; wer dawieder thut
und dessen
berschreiten; daneben keiner dem
andern sein Volck entheuern; wer dawieder thut
und dessen
 berf
berf
 hret wird, soll willk
hret wird, soll willk
 hrlich gestraft werden.
hrlich gestraft werden.
An Art. 27 schliesst sich an:
Zu des Gelags Frommen und Nutzen, so wir zu
gemeiner Stadt Wohlseyn gerne gef
 rdert sehen, ein nicht geringes
contribuiren werde, als haben wir dieselbe
Articulos vorstehenden Inhalts Kraft dieses
wissentlich confirmiret und wollen, daß
denenselben allerdings gelebet werde, wie wir
dann auch darüber feste zu halten gemeynet sein.
rdert sehen, ein nicht geringes
contribuiren werde, als haben wir dieselbe
Articulos vorstehenden Inhalts Kraft dieses
wissentlich confirmiret und wollen, daß
denenselben allerdings gelebet werde, wie wir
dann auch darüber feste zu halten gemeynet sein.
Nun kommt die von uns unter No. VI abgedruckte Beliebung über die Höhe der Heuer und dann wird fortgefahren:


|
Seite 130 |




|
Die Schiffer, wie es fast überall, bevorab in der Nachbarschaft gebrauchlich, genießen an Heuer noch eins so viel als einer vom Volcke und ist also auch hierunter nach Verschiedenheit der Oerter, das Quantum der Heuer der Schiffer zu rechnen.
Wegen des F
 hrung wird, wie oben gedacht, nach
Gottland jedem des Volckes an Gelde gegeben 2 Rthlr.
hrung wird, wie oben gedacht, nach
Gottland jedem des Volckes an Gelde gegeben 2 Rthlr.
Sonsten aber soll ein Schiffer, wann er ein
Schiff f
 hret, so an freyen Kaufmanns=Gut
h
hret, so an freyen Kaufmanns=Gut
h
 lt unter 20 Last nur 1 Last, wann
es aber 20 Last frey Kaufmanns=Gut und dar
lt unter 20 Last nur 1 Last, wann
es aber 20 Last frey Kaufmanns=Gut und dar
 ber h
ber h
 lt, 2 Last F
lt, 2 Last F
 hrung haben, nicht aber mehr.
hrung haben, nicht aber mehr.
Jeder von dem Volck hat, außer was die Reisen auf
Gottland seyn, an F
 hrung eine halbe Last, ist aber
darunter ein Kochsjunge, nur nach Proportion der
F
hrung eine halbe Last, ist aber
darunter ein Kochsjunge, nur nach Proportion der
F
 hrung die Heuer haben soll, wobey
zu observiren, daß, wann die F
hrung die Heuer haben soll, wobey
zu observiren, daß, wann die F
 hrung in Brettern bestehet, f
hrung in Brettern bestehet, f
 r 1 Last 8 zw
r 1 Last 8 zw
 lfter Bretter gerechnet werden.
lfter Bretter gerechnet werden.
Wir behalten uns aber expresse bevor obiges alles
nach Gelegenheit der Zeiten und des Publici
Besten zu
 ndern, zu mindern, zu mehren oder
auch wieder abzuthun. Und weil uns daneben die
Aeltesten des Schonfahrer=Gelags ersuchet, wir
auch nach dem Exempel benachbarter Seest
ndern, zu mindern, zu mehren oder
auch wieder abzuthun. Und weil uns daneben die
Aeltesten des Schonfahrer=Gelags ersuchet, wir
auch nach dem Exempel benachbarter Seest
 dte bevorab der Stadt L
dte bevorab der Stadt L
 beck verordnen m
beck verordnen m
 gten, daß wann zwischen Kaufmann
und Schiffern in Seesachen Streit entstehet, der
Kaufmann, wenn er ad instantiam des Schiffers
vor das Schonfahrer=Gelag gefordert wird, allda
sowohl als wenn er den Schiffer solcher Sachen
halber dahin citiren l
gten, daß wann zwischen Kaufmann
und Schiffern in Seesachen Streit entstehet, der
Kaufmann, wenn er ad instantiam des Schiffers
vor das Schonfahrer=Gelag gefordert wird, allda
sowohl als wenn er den Schiffer solcher Sachen
halber dahin citiren l
 sset, sich gestellen und daselbst
entweder g
sset, sich gestellen und daselbst
entweder g
 tliche Handlung pflegen oder auch
in deren Entstehung des Schonfahrer=Gelags
Bedencken zuf
tliche Handlung pflegen oder auch
in deren Entstehung des Schonfahrer=Gelags
Bedencken zuf
 rderst abwarten m
rderst abwarten m
 sse, und wir dieses nicht
unbillig, vielmehr heilsam und dazu n
sse, und wir dieses nicht
unbillig, vielmehr heilsam und dazu n
 tzlich erachten, daß hernach bey
unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich
daselbst melden, man so viel besser und promter
aus der Sache kommen k
tzlich erachten, daß hernach bey
unseren ordinairen Gerichten, wenn Partes sich
daselbst melden, man so viel besser und promter
aus der Sache kommen k
 nne, so verordnen wir kraft
dieses, daß, wann auf Anhalten eines Schiffers
ein Kaufmann vor die Aeltesten des
Schonfahrer=Gelags in vorerwehnten Sachen
gefordert wird, derselbe sich dahin einzufinden
und seine Nothdurft, zu dem Ende, damit in
Entstehung der G
nne, so verordnen wir kraft
dieses, daß, wann auf Anhalten eines Schiffers
ein Kaufmann vor die Aeltesten des
Schonfahrer=Gelags in vorerwehnten Sachen
gefordert wird, derselbe sich dahin einzufinden
und seine Nothdurft, zu dem Ende, damit in
Entstehung der G
 te die Gelags
te die Gelags
 ltesten nach richtiger Erkundigung
aller Umstände ihr ertheilendes Bedenken desto
besser fassen und so viel gr
ltesten nach richtiger Erkundigung
aller Umstände ihr ertheilendes Bedenken desto
besser fassen und so viel gr
 ndlicher geben k
ndlicher geben k
 nnen, allda geb
nnen, allda geb
 hrend vorzutragen, schuldig seyn
soll: gestallt dann dieses, gleich in L
hrend vorzutragen, schuldig seyn
soll: gestallt dann dieses, gleich in L
 beck, nur blos um der Aeltesten
des Gelages als der Seesachen kundiger Leute
Bedencken vorher und ehe sie zu den ordentlichen
Gerichte gelangen, einzuholen, allhier
concediret wird, daher dann auch in solchen und
dergleichen Sachen
beck, nur blos um der Aeltesten
des Gelages als der Seesachen kundiger Leute
Bedencken vorher und ehe sie zu den ordentlichen
Gerichte gelangen, einzuholen, allhier
concediret wird, daher dann auch in solchen und
dergleichen Sachen


|
Seite 131 |




|
die Aeltesten des Schonfahrer=Gelags den Partibus
Strafe zu dictiren, und solcher wegen die
aussegelnden Seefahrenden von ihren Reisen
zurückzuhalten, nicht befugt sein: gestalt dann
der Artikel 14 des Reglements allein von dem zu
verstehen, was in dem Reglement den Aeltesten
des Schonfahrer=Gelags zu bestrafen verg
 nnet werden oder auch sonsten dem
Gelage selbst von ihren Gelags=Genossen geb
nnet werden oder auch sonsten dem
Gelage selbst von ihren Gelags=Genossen geb
 hret.
hret.
Dessen alle zur Urkunde haben wir diese unsere
resp. Confirmation, Ordonnanze und Verordnung
mit der Stadt gr
 ßeren Insiegel bedrucken und unter
unsers Protonotarii Subscription dem
Schonfahrer=Gelage, um solche auff dem Gelage
ßeren Insiegel bedrucken und unter
unsers Protonotarii Subscription dem
Schonfahrer=Gelage, um solche auff dem Gelage
 ffentlich zu affigiren,
ausfertigen lassen. So geschehen in Rostock den
? Februar 1715.
ffentlich zu affigiren,
ausfertigen lassen. So geschehen in Rostock den
? Februar 1715.
Uebersicht der Rechnungen des Schonenfahrer-Gelages, 1725 bis 1800.
Zusammengestellt aus einem alten Rechnungsbuch des Schonenfahrer-Collegiums, gegenwärtig im Besitz des Herrn Stadtarchivars Dr. K. Koppmann.
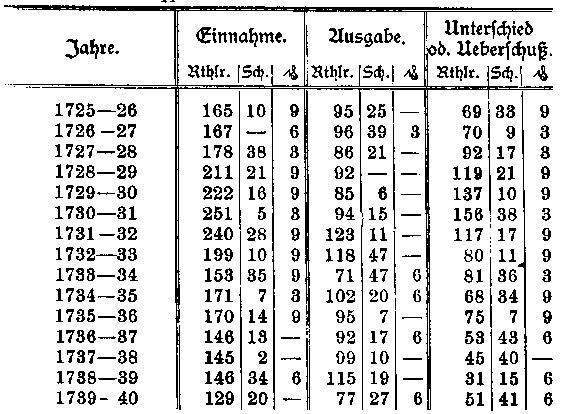


|
Seite 132 |




|
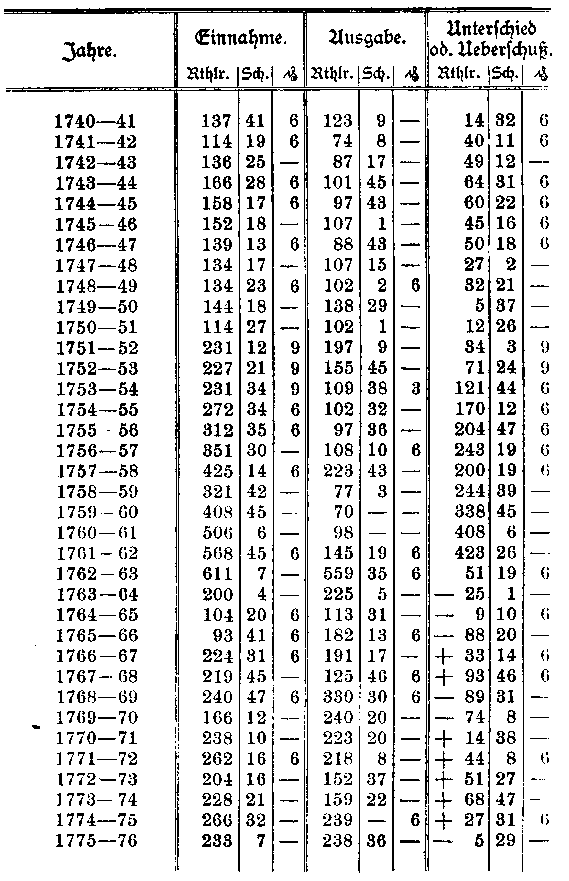


|
Seite 133 |




|

1) Außerdem 94 Rthlr.
N.
2
/
3
und 15 Thlr.
Pommersch Courant.
2) Außerdem 7 Thlr.
18 Sch. Pommersch Courant.
3) Außerdem
94 Rthlr. N.
2
/
3
und 75
Thlr. 34 Sch. Pommersch Courant.
4)
Außerdem 33 Thlr. 15 Sch. Pommersch
Courant..
5) Außerdem 28 Thlr.
Pommersch Courant.
6) Außerdem 5 Thlr.
15 Sch. Pommersch Courant.


|
Seite 134 |




|
Beliebung des Schonenfahrergelags über die sog. Vorsetzschiffer. 1767, Februar 17.
Rostocker Stadt-Archiv.
Anno 1767 den 17. Februar des Nachmittags um 2
Uhr war das l
 bliche Schonfahr=Gelag convociret
und versammlet, und von s
bliche Schonfahr=Gelag convociret
und versammlet, und von s
 mtlichen unterschriebenen
Gelagsbr
mtlichen unterschriebenen
Gelagsbr
 dern beliebet worden, daß einen
krancken Gelagsbruder oder einer Witwen
freystehen solle, zwey Reisen für sich thun zu
lassen und soll ihm nicht frey gelassen werden
vor Gewinnung des Gelags die dritte Reise anzutreten.
dern beliebet worden, daß einen
krancken Gelagsbruder oder einer Witwen
freystehen solle, zwey Reisen für sich thun zu
lassen und soll ihm nicht frey gelassen werden
vor Gewinnung des Gelags die dritte Reise anzutreten.
Dessen zu Urkund ist diese Beliebung von s
 mmtlichen Anwesenden zu mehrerer
Festhaltung eigenh
mmtlichen Anwesenden zu mehrerer
Festhaltung eigenh
 ndig in
mei
subscripti praesentia unterschrieben worden.
Actum Rostochii ut supra.
ndig in
mei
subscripti praesentia unterschrieben worden.
Actum Rostochii ut supra.
Jochim Jenßen, Eltester
Johann Heinrich Tarnau, Eltester
Peter Meyer, Eltester
Johan Johanßon, Dobertirter
Christoffer Heidtmann, Deputirter
Claus Johanßen, Deputicrter
Johann Christoph Tppe
Frantz Ruht
Jacob Rohde
Peter Bey
Joachim Meyer
Jochim Brinckmann
Jochim Bockholdt
Hinrich Davids
Peter Kembs
Jacob Bockholdt
Hans Jacob Seyer
Jochim Holtz
Jochim Busch
Johann Hinrich Krempien
Hans Jrges
Andreas Hudder
Hans Kadau
Christian Schmidt
Hinnerich Radeloff
Emanuel Otto Junius


|
Seite 135 |




|
Peter Harder
Hinrich Flindt
Michel Wichmann
Christian Jochim Mohnsen
Johann Jochim Hußfeldt
Ulrich Kemp
Hans Jochim Frdland
Lorentz Hanßen.
Statuten des Schonenfahrer-Gelags zu Rostock. 1825, Januar 10.
Nach dem in der Lade der Schiffergesellschaft erhaltenen Exemplar.
§ 1. Dem Schonenfahrer=Gelage stehen 4 Aeltesten
vor, deren zwey aus den Mitgliedern der hiesigen
Kaufmanns=Compagnie und die andern zwey aus den
Mitgliedern des Schonenfahrer=Gelags erw
 hlet werden; die aus der
Kaufmanns=Compagnie zu erw
hlet werden; die aus der
Kaufmanns=Compagnie zu erw
 hlenden Aeltesten müssen zugleich
Großbrauer seyn. Die Wahl der Aeltesten geschiet
in der Art, daß bey eintretender Vacanz eines
Aeltesten 3 Kaufleute und Großbrauer oder 5
Schiffer, je nachdem ein Schiffer oder ein
Kaufmann als Aeltester abgegangen ist, E. E.
Rath von den verschiedenen Aeltesten
vorgeschlagen werden, worauf dann E. E.Rath aus
diesen 3 M
hlenden Aeltesten müssen zugleich
Großbrauer seyn. Die Wahl der Aeltesten geschiet
in der Art, daß bey eintretender Vacanz eines
Aeltesten 3 Kaufleute und Großbrauer oder 5
Schiffer, je nachdem ein Schiffer oder ein
Kaufmann als Aeltester abgegangen ist, E. E.
Rath von den verschiedenen Aeltesten
vorgeschlagen werden, worauf dann E. E.Rath aus
diesen 3 M
 nnern einen Aeltesten w
nnern einen Aeltesten w
 hlet. Der solcher gestalt erw
hlet. Der solcher gestalt erw
 hlte Aelteste bekleidet dies Amt
auf seine Lebenszeit. Zwischen den 4 Aeltesten
alternieret j
hlte Aelteste bekleidet dies Amt
auf seine Lebenszeit. Zwischen den 4 Aeltesten
alternieret j
 hrlich die Administration und es
bestehet diese Administration 1) in F
hrlich die Administration und es
bestehet diese Administration 1) in F
 hrung der Gelagsbücher 2) in
Vortragung der n
hrung der Gelagsbücher 2) in
Vortragung der n
 tigen Propositionen in der
Versammlung 3) in Aufbewahrung der Lade und der
darin geh
tigen Propositionen in der
Versammlung 3) in Aufbewahrung der Lade und der
darin geh
 rigen Gelagsschriften 4) in
Ausfertigung der erforderlichen Zettel bey der
Abreise eines Schiffers von hier.
rigen Gelagsschriften 4) in
Ausfertigung der erforderlichen Zettel bey der
Abreise eines Schiffers von hier.
Der neuerwählte Aelteste wird von E. E. Rath beeydiget und zahlet:
| a. |
an jeden
 brigen 3 Aeltesten 7
Rthlr. 24 Sch. N
2
/
3
, Summa
brigen 3 Aeltesten 7
Rthlr. 24 Sch. N
2
/
3
, Summa
|
22 | Rthlr. | 24 | Sch. |
| b. |
an den Gelagssecret
 r
r
|
- | " | 32 | " |
| c. | fürs Buch | - | " | 16 | " |
| ------------------ | ----- | ----- | ------ | ----- | |
| Zu übertragen | 23 | Rthlr. | 24 | Sch. |


|
Seite 136 |




|
| Übertrag | 23 | Rthlr. | 24 | Sch. | |
| d. | den Bothen | - | " | 8 | " |
| e. | für daß Decrett E. E. Rath | - | " | 9 | " |
| f. | für seine Beeidigung | - | " | 40 | " |
| g. |
an die Armb
 chse
chse
|
- | " | 8 | " |
| h. |
an den B
 rgermeisterdiener
rgermeisterdiener
|
- | " | 32 | " |
| ------------- | ----- | ----- | ------ | ----- | |
| Rthlr. N 2 / 3 | 25 | Rthlr. | 25 | Sch. |
Die beyden Kaufm
 nnischen Aeltesten zahlen außerdem
jeder 2 Rhtlr. 24 Sch.
N
2
/
3
an die Todtenkasse
und leisten außerdem die gew
nnischen Aeltesten zahlen außerdem
jeder 2 Rhtlr. 24 Sch.
N
2
/
3
an die Todtenkasse
und leisten außerdem die gew
 hnlichen j
hnlichen j
 hrlichen Beytr
hrlichen Beytr
 ge.
ge.
§ 2. Außer diesen 4 Aeltesten bestehet das
Regiment noch aus 10 Deputirten, n
 mlich a) 2 Schaffers, welche
ja
mlich a) 2 Schaffers, welche
ja
 hrlich so wie die Sache nach dem
Alter sie trift, eintreten und hiefür jeder 12
Rthlr. N
2
/
3
an die
Gelagskasse und zusammen eine zinnerne Kanne
zahlen müssen. Sie haben darauf zu sehen, daß
die beiden Gelagshauser in guten baulichen
Stande erhalten bleiben und n
hrlich so wie die Sache nach dem
Alter sie trift, eintreten und hiefür jeder 12
Rthlr. N
2
/
3
an die
Gelagskasse und zusammen eine zinnerne Kanne
zahlen müssen. Sie haben darauf zu sehen, daß
die beiden Gelagshauser in guten baulichen
Stande erhalten bleiben und n
 thige Reparaturen, welche einzeln
10 Rthlr. N.
2
/
3
der dr
thige Reparaturen, welche einzeln
10 Rthlr. N.
2
/
3
der dr
 ber betragen, dem administrirenden
Aeltesten anzeigen, bey allen Zusammenk
ber betragen, dem administrirenden
Aeltesten anzeigen, bey allen Zusammenk
 nften und namentlich am Fastlabend
auf Ordnung zu halten und die Schl
nften und namentlich am Fastlabend
auf Ordnung zu halten und die Schl
 ssel zu den Gelagsger
ssel zu den Gelagsger
 thschaften an sich zu nehmen. Wenn
sie das Schafferamt ein Jahr verwaltet haben, so
treten sie
thschaften an sich zu nehmen. Wenn
sie das Schafferamt ein Jahr verwaltet haben, so
treten sie
b. als Deputierte bey der Todtenlade ein, und normiren dieserhalb die am 1. December 1821 obrigleitlich confirmirte Statuten. Wenn sie ein Jahr bey der Todtenlade gewesen sind treten sie
c. als Gelagsdeputirte ein.
d. Außerdem werden von der ganzen Geselschaft zwey Deputirte zur Wittwencasse und
e. zwey Deputirte zur Unterst
 tzungscasse erw
tzungscasse erw
 hlet, welche ihr Amt 3 Jahre
verwalten, so daß immer derjenige abgeht,
welcher im letzten Jahre die Rechnung geführt hat.
hlet, welche ihr Amt 3 Jahre
verwalten, so daß immer derjenige abgeht,
welcher im letzten Jahre die Rechnung geführt hat.
Alle diese Deputirte nehmen in Gemeinschaft mit
den Aeltesten die Rechnung des administrierenden
Aeltesten und der Deputirten auf, wozu besonders
die beiden Gelagsdeputirten concuriren m
 ssen, weil sie selbst keine
Rechnungen zu f
ssen, weil sie selbst keine
Rechnungen zu f
 hren haben. Die 4 Aeltesten, die
10 Deputirten und der Secret
hren haben. Die 4 Aeltesten, die
10 Deputirten und der Secret
 r erhalten f
r erhalten f
 r die Aufnahme gesammter
Rechnungen jeder 2 Rthlr.
N
2
/
3
, mithin zusammen
N
2
/
3
Rthlr. 30.
r die Aufnahme gesammter
Rechnungen jeder 2 Rthlr.
N
2
/
3
, mithin zusammen
N
2
/
3
Rthlr. 30.


|
Seite 137 |




|
Hierzu tragen bey
| a. | die Gelagscassa | 12 | Rthlr. | 24 | Sch. |
| b. | die Todtencassa | 12 | " | 24 | " |
| c. |
die Unterst
 tzungscassa
tzungscassa
|
2 | " | - | " |
| d. | die Wittwencassa | 3 | " | - | " |
§ 3. Der Consulent des Schonenfahrergelags wird
von der ganzen Geselschaft gew
 hlet und derselbe erh
hlet und derselbe erh
 lt seine Bem
lt seine Bem
 hungen nach specificirter Rechnung bezahlt.
hungen nach specificirter Rechnung bezahlt.
§ 4. Der Secretair wird von den Aeltesten erw
 hlet, und erh
hlet, und erh
 lt ein j
lt ein j
 hrliches Salair von 25 Rthlr.
N.
2
/
3
, zahlbar in
Quartalratis. Hief
hrliches Salair von 25 Rthlr.
N.
2
/
3
, zahlbar in
Quartalratis. Hief
 r muß er in allen Zusammenk
r muß er in allen Zusammenk
 nften das Protocoll f
nften das Protocoll f
 hren, die Protocolle in das
Protocollbuch eintragen, gesamte Papiere in
Ordnung bringen und erhalten, auch alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird. Es
h
hren, die Protocolle in das
Protocollbuch eintragen, gesamte Papiere in
Ordnung bringen und erhalten, auch alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird. Es
h
 ngt von dem Ermessen der Aeltesten
ab, ob einzelne besondere und ungew
ngt von dem Ermessen der Aeltesten
ab, ob einzelne besondere und ungew
 hnliche Arbeiten ihm außerdem
bezahlet werden sollen.
hnliche Arbeiten ihm außerdem
bezahlet werden sollen.
§ 5. Der Bothe wird von den Aeltesten gew
 hlet. Er erh
hlet. Er erh
 lt aus der Gelagscasse j
lt aus der Gelagscasse j
 hrlich 9 Rthlr.
N
2
/
3
in halbj
hrlich 9 Rthlr.
N
2
/
3
in halbj
 hrigen Ratis und außerdem
daßjenige, was ihm aus den einzelnen Cassen
zugestanden ist. Dagegen muß er nicht blos alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was ihm in
Beziehung auf die einzelnen Cassen obliegt,
sondern auch alle Mitglieder der Geselschaft zu
den Zusammenk
hrigen Ratis und außerdem
daßjenige, was ihm aus den einzelnen Cassen
zugestanden ist. Dagegen muß er nicht blos alles
dasjenige unentgeldlich ausrichten, was ihm in
Beziehung auf die einzelnen Cassen obliegt,
sondern auch alle Mitglieder der Geselschaft zu
den Zusammenk
 nften einladen und alles
nften einladen und alles
 brige ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird,
ohne daß ihm hief
brige ausrichten, was der
administrierende Aelteste ihm auftragen wird,
ohne daß ihm hief
 r irgend etwas vergütet werde.
r irgend etwas vergütet werde.
§ 6. Das alte Gelagshaus wird alle 6 Jahre zur
Vermietung an einen hiesigen Schiffer
meistbietend zumAufbot gebracht. Es wird Niemand
zum Both zugelassen als wer ein Gelagsmitglied
ist, und muß der Meistbietende dies Haus selbst
bewohnen, auch die geh
 rige Aufsicht
rige Aufsicht
 ber das neue Haus f
ber das neue Haus f
 hren ohne einige Benutzung
desselben sich anmaaßen zu dürfen. Der
Miethsmann zahlet 6 Rthlr.
N
2
/
3
Contractsgebühr außer
dem Stempelsatze, welche zwischen den 4
Aeltesten und dem Secret
hren ohne einige Benutzung
desselben sich anmaaßen zu dürfen. Der
Miethsmann zahlet 6 Rthlr.
N
2
/
3
Contractsgebühr außer
dem Stempelsatze, welche zwischen den 4
Aeltesten und dem Secret
 r vertheilet werden, so daß Jeder
1 Rthlr. 16 Sch. erh
r vertheilet werden, so daß Jeder
1 Rthlr. 16 Sch. erh
 lt. Wenn Jemand zu B
lt. Wenn Jemand zu B
 llen, Conzerten,
Kunst=Ausstellungen oder sonst, die S
llen, Conzerten,
Kunst=Ausstellungen oder sonst, die S
 le in dem neuen Hause zu miethen
w
le in dem neuen Hause zu miethen
w
 nscht, so h
nscht, so h
 ngt die desfallsige Bewilligung
allein vom administrirenden Aeltesten ab, und
bekommt der Gelagswirth wegen der auch f
ngt die desfallsige Bewilligung
allein vom administrirenden Aeltesten ab, und
bekommt der Gelagswirth wegen der auch f
 r ihn hiemit verbundenen Bel
r ihn hiemit verbundenen Bel
 stigung den sechsten Theil der Miethe.
stigung den sechsten Theil der Miethe.
§ 7. Es ist vor einigen Jahren eine
Unterstützungscasse für h
 lfsbed
lfsbed
 rftige Mitglieder des hiesigen Schonenfahrer=Gelages
rftige Mitglieder des hiesigen Schonenfahrer=Gelages


|
Seite 138 |




|
errichtet, welche einen besonders verwalteten
Fond hat, und normiren dieserhalb folgende
Grunds
 tze:
tze:
a. Ein jeder Schiffer, er mag ein Seeschiff oder
ein Leuchterschiff fahren, zahlet von den
Monatgelde oder
 berhaupt von seiner Heuer, wenn er
bey der Reise f
berhaupt von seiner Heuer, wenn er
bey der Reise f
 hrt, welche er von Neujahr bis
Ende December eines jeden Jahres [macht], von
jedem Thaler einen Schilling an die Unterst
hrt, welche er von Neujahr bis
Ende December eines jeden Jahres [macht], von
jedem Thaler einen Schilling an die Unterst
 tzungscasse der hiesigen h
tzungscasse der hiesigen h
 lfsbed
lfsbed
 rftigen Schiffer.
rftigen Schiffer.
b. Jeder Schiffer, der in einem Jahre nicht
gefahren hat, und keiner Unterst
 tzung bedarf, bezahlet j
tzung bedarf, bezahlet j
 hrlich im December Monat 16 Sch.
an die Unterstützungscasse.
hrlich im December Monat 16 Sch.
an die Unterstützungscasse.
c. Im December Monate eines jeden Jahres werden
die Beytr
 ge, durch ein Circul
ge, durch ein Circul
 r eingefodert, wor
r eingefodert, wor
 ber Jeder seine zu zahlenden
Beytrag gewissenhaft anzugeben und die geschehen
Abgaben an den Bothen zu bemerken hat.
ber Jeder seine zu zahlenden
Beytrag gewissenhaft anzugeben und die geschehen
Abgaben an den Bothen zu bemerken hat.
d. Der bey dieser Casse angestellte Deputirte
kann aufs Neue wieder gew
 hlet werden.
hlet werden.
e. Die Lade der Unterst
 tzungscasse befindet sich beym
administrirenden Aeltesten und der Deputirte hat
den Schlüssel zu derselben.
tzungscasse befindet sich beym
administrirenden Aeltesten und der Deputirte hat
den Schlüssel zu derselben.
f. Im Schlusse eines jeden Jahres bestimt die
ganze Gesellschaft, welche hülfsbed
 rftige Schiffer unterst
rftige Schiffer unterst
 tzt werden sollen und wie groß
solche Unterst
tzt werden sollen und wie groß
solche Unterst
 tzung für jeden Einzelnen seyn
soll, da dann der Administrant hiernach die
Zahlung zu leisten hat.
tzung für jeden Einzelnen seyn
soll, da dann der Administrant hiernach die
Zahlung zu leisten hat.
g. Die abgelegte Rechnung wird der ganzen
Gesellschaft j
 hrlich vorgelegt.
hrlich vorgelegt.
h. Der Bothe erh
 lt für das Einfodern der Beyträge
2 Rthlr. N
2
/
3
.
lt für das Einfodern der Beyträge
2 Rthlr. N
2
/
3
.
i. Wenn ein Ueberschuß in dieser Casse sich befindet, so soll derselbe thunlichst zu Capital geschlagen werden.
§ 8. Es ist ferner ein Fond vorhanden, welcher zur1 Bildung einer Wittwencasse bestimmt ist, und es ist wegen solcher Wittwecasse Nachstehendes bestimmt.
a. Es soll darauf Bedacht genommen werden den
jetzigen Capitalfond thunlichst zu vergr
 ßern, daher von der j
ßern, daher von der j
 hrlichen Einnahme mindestens 25
Rthlr. N
2
/
3
j
hrlichen Einnahme mindestens 25
Rthlr. N
2
/
3
j
 hrlich zum Capital geschlagen und
hiemit so lange fortgefahren werden soll, bis
ein hinreichender Capitalfond gesammelt sein wird.
hrlich zum Capital geschlagen und
hiemit so lange fortgefahren werden soll, bis
ein hinreichender Capitalfond gesammelt sein wird.
b. Diejenigen Schiffer, welche vor den Anfang
dieses Instituts, also vor den 24. Febr. 1816,
Mitglieder des hiesigen Schonfahrergelags
gewesen sind, und ihren Beytritt zu dieser
Einrichtung nicht schon erkl
 rt haben, haben freye Wahl, ob sie
rt haben, haben freye Wahl, ob sie


|
Seite 139 |




|
hieran theilnehmen wollen oder nicht, und sind auch berechtiget für den Fall auszutreten, daß sie als Wittwer leben. Jeder, welcher aber nach dem 24. Februar 1816 in das Schonenfahrergelag eingetreten ist, und noch eintreten wird, ist verpflichtet, an dieser Einrichtung Theil zu nehmen, er mag verheyrathet oder unverheyrathet sein.
c. Jeder Schiffer, welcher Mitglied dieser
Errichtung ist, ist verpflichtet j
 hrlich im December Monath einen
Rthlr. N
2
/
3
an die
Wittwencasse zu zahlen und außerdem bey seinem
Eintritte den Receptionsschein mit 1 Rthlr.
N
2
/
3
zu l
hrlich im December Monath einen
Rthlr. N
2
/
3
an die
Wittwencasse zu zahlen und außerdem bey seinem
Eintritte den Receptionsschein mit 1 Rthlr.
N
2
/
3
zu l
 sen, welcher der Casse zu Guthe
berechnet wird.
sen, welcher der Casse zu Guthe
berechnet wird.
d. Dieser j
 hrliche Beitrag, Receptionsgeb
hrliche Beitrag, Receptionsgeb
 hren und die Zinsen des Kapitals
werden dazu verwendet, um zuerst einen j
hren und die Zinsen des Kapitals
werden dazu verwendet, um zuerst einen j
 hrlichen Betrag von wenigstens 25
Rthlr. N
2
/
3
zu Capital zu
machen und der Ueberrest wird nach Abzug der
Administrationskosten zwischen denjenigen
Wittwen nach dem Ermessen der Gesellschaft
vertheilet, deren M
hrlichen Betrag von wenigstens 25
Rthlr. N
2
/
3
zu Capital zu
machen und der Ueberrest wird nach Abzug der
Administrationskosten zwischen denjenigen
Wittwen nach dem Ermessen der Gesellschaft
vertheilet, deren M
 nner zu dieser Casse beygetragen
haben, und erh
nner zu dieser Casse beygetragen
haben, und erh
 lt vorl
lt vorl
 ufig und so lange die Kr
ufig und so lange die Kr
 fte der Casse dies verstatten,
jede Wittwe 5 Rthlr. N
2
/
3
.
Wenn diese Zahlung aus der Casse nicht weiter
geleistet werden kann, so muß der Betrag von 5
Rthlr. N
2
/
3
herabgesetzet werden.
fte der Casse dies verstatten,
jede Wittwe 5 Rthlr. N
2
/
3
.
Wenn diese Zahlung aus der Casse nicht weiter
geleistet werden kann, so muß der Betrag von 5
Rthlr. N
2
/
3
herabgesetzet werden.
e. W
 re aber eine Frau von ihrem Mann
geschieden oder durch einen Rechtspruch auch nur
von Tisch und Bett getrennt, so hat sie an diese
Casse kein weiteres Recht; auch f
re aber eine Frau von ihrem Mann
geschieden oder durch einen Rechtspruch auch nur
von Tisch und Bett getrennt, so hat sie an diese
Casse kein weiteres Recht; auch f
 lt ihre Theilnahme an der j
lt ihre Theilnahme an der j
 hrlichen Erhebung weg, wenn sie
zur zweyten Ehe schreiten m
hrlichen Erhebung weg, wenn sie
zur zweyten Ehe schreiten m
 gte.
gte.
f. Dagegen macht es kein Unterschied, ob die
Wittwe dieser Erhebung bed
 rftig ist oder nicht.
rftig ist oder nicht.
g. Es ist gleich, ob die theilnehmende Wittwe ihren Ehemann auf der See oder sonst durch den Tod verlohren hat.
h. Diejenigen Schiffer, welche nicht mehr zur See
fahren, müssen einen v
 llig gleichen Beytrag leisten.
llig gleichen Beytrag leisten.
i. Die Zahlung an jede einzelne Wittwe kann nie
h
 her wie auf 30 Rthlr.
N
2
/
3
steigen, und wenn der
Fall eintreten m
her wie auf 30 Rthlr.
N
2
/
3
steigen, und wenn der
Fall eintreten m
 gte, daß so wenige Wittwen
vorhanden w
gte, daß so wenige Wittwen
vorhanden w
 ren, daß von dem j
ren, daß von dem j
 hrlichen Geld
hrlichen Geld
 brig bliebe, so soll dasselbe zur
Vergr
brig bliebe, so soll dasselbe zur
Vergr
 ßerung des Capitals angewendet werden.
ßerung des Capitals angewendet werden.
k. Wenn das jetzige Capital sich merklich
vergr
 ßert hat, so sollen die j
ßert hat, so sollen die j
 hrlichen Beytr
hrlichen Beytr
 ge vermindert werden oder ganz aufhoren.
ge vermindert werden oder ganz aufhoren.
l. Diejenige Dividende, welche jede Wittwe
erh
 lt, darf nicht cedirt und nicht
mit Arrest beleget werden.
lt, darf nicht cedirt und nicht
mit Arrest beleget werden.


|
Seite 140 |




|
m. Zur Berechnung dieser Casse sind 2 Deputirten
angestellet, welche von der Gesellschaft gew
 hlet werden. Der abgehende
Deputirte kann wieder gew
hlet werden. Der abgehende
Deputirte kann wieder gew
 hlet werden.
hlet werden.
n. Die Lade ist bey dem administrierenden
Aeltesten und der administrierende Deputirte hat
den Schl
 ssel zu derselben. Die beyden
Deputirten und der Secret
ssel zu derselben. Die beyden
Deputirten und der Secret
 r erhalten für ihre Bemühungen aus
dieser Casse nichts.
r erhalten für ihre Bemühungen aus
dieser Casse nichts.
o. Der Bothe erh
 lt aus dieser Casse für daß
Einfodern der Beytr
lt aus dieser Casse für daß
Einfodern der Beytr
 ge 2 Rthlr. N
2
/
3
.
ge 2 Rthlr. N
2
/
3
.
§ 9.
1
)
Von umstehende Fremde, welche Schiffer werden,
ist Folgendes. Von denjenigen 4 Rthlr. 18 Sch.,
welche die 4 Aeltesten erhalten, bekommt der
administrierende Aeltester 10 Sch. mehr, wie die
 brigen. Ist der Fremder mit der
Tochter eines Gelagsmitglieds bereits
brigen. Ist der Fremder mit der
Tochter eines Gelagsmitglieds bereits
 ffentlich verlobet, so hat er zu
bezahlen 25 Rthlr. N
2
/
3
,
welche so vertheilet werden, wie ad b bemerkt ist.
ffentlich verlobet, so hat er zu
bezahlen 25 Rthlr. N
2
/
3
,
welche so vertheilet werden, wie ad b bemerkt ist.
§ 10. Jeder Schiffer muß seine Erlegnisse an die
einzelnen Cassen allersp
 tens dan bezahlen, wenn er vom
administrierenden Aeltesten sich den Freyzettel
holet, um von hier auszugehen. Der Freyzettel
wird ihm nicht eher verabfolget, als bis er alle
etwaigen R
tens dan bezahlen, wenn er vom
administrierenden Aeltesten sich den Freyzettel
holet, um von hier auszugehen. Der Freyzettel
wird ihm nicht eher verabfolget, als bis er alle
etwaigen R
 ckst
ckst
 nde bezahlet hat. F
nde bezahlet hat. F
 r diesen Freyzettel bezahlet er 2
Sch. f
r diesen Freyzettel bezahlet er 2
Sch. f
 r jede Last, wozu sein Schiff
taxirt worden ist. Durch dies Erlegniß macht er
sein Schiff f
r jede Last, wozu sein Schiff
taxirt worden ist. Durch dies Erlegniß macht er
sein Schiff f
 r 2 Ladungen, welche er auf den
Boden seines Schiffes nimmt, frey, so daß es
einerley ist, ob er diese beyden Ladungen
entweder in Rostock einnimmt und dahin zur
r 2 Ladungen, welche er auf den
Boden seines Schiffes nimmt, frey, so daß es
einerley ist, ob er diese beyden Ladungen
entweder in Rostock einnimmt und dahin zur
 ckbringt oder ob er diese beyden
Ladungen im Auslande einnimmt oder l
ckbringt oder ob er diese beyden
Ladungen im Auslande einnimmt oder l
 scht, da im allgemeinen der
Grundsatz gilt, daß durch diese 2 Sch.
Lastengeld 2 Ladungen frey werden. Es macht
keinen Unterschied, ob Jemand eine complete
Ladung gehapt hat, oder ob die Ladung nicht voll
gewesen ist. H
scht, da im allgemeinen der
Grundsatz gilt, daß durch diese 2 Sch.
Lastengeld 2 Ladungen frey werden. Es macht
keinen Unterschied, ob Jemand eine complete
Ladung gehapt hat, oder ob die Ladung nicht voll
gewesen ist. H
 tte der Schiffer
tte der Schiffer
a. aber nur eine Ladung auf den Boden seines
Schiffes gehapt, so erh
 lt er von den 2 Sch. Lastengeld
nichts zur
lt er von den 2 Sch. Lastengeld
nichts zur
 ck,
ck,
b. gar keine Ladung auf dem Boden seines Schiffes
gehapt und w
 re er also mit Ballast
ausgegangen, und [ohne] erhaltene Fracht mit
Ballast zurückgekommen, so werden ihm die 2 Sch.
Lastengeld zur
re er also mit Ballast
ausgegangen, und [ohne] erhaltene Fracht mit
Ballast zurückgekommen, so werden ihm die 2 Sch.
Lastengeld zur
 ckgegeben.
ckgegeben.
c. F
 r jede Ladung, welche er mehr wie
2 auf den Boden seines Schiffes gehapt hat,
zahlet er bey seiner Zuhausekunft 1 Sch. Lastengeld.
r jede Ladung, welche er mehr wie
2 auf den Boden seines Schiffes gehapt hat,
zahlet er bey seiner Zuhausekunft 1 Sch. Lastengeld.


|
Seite 141 |




|
Wer nach Stettien, innerhalb Bornholm, innerhalb
des Sundes, innerhalb der beyden Belten oder bis
L
 beck, jedoch nicht weiter als bis
Holtenau eine Reise macht, wird als K
beck, jedoch nicht weiter als bis
Holtenau eine Reise macht, wird als K
 stenfahrer angesehen und bezahlet
die H
stenfahrer angesehen und bezahlet
die H
 lfte des Lastengeldes mithin bey
seinem Abgange von hier 1 Sch. per Last, und
f
lfte des Lastengeldes mithin bey
seinem Abgange von hier 1 Sch. per Last, und
f
 r eine etwanige weitere als die
zweyte Ladung 1/2 Sch. pro Last.
r eine etwanige weitere als die
zweyte Ladung 1/2 Sch. pro Last.
Alle Zahlungen, welche 16 Sch. oder dar
 ber betragen, m
ber betragen, m
 ssen in N
2
/
3
bezahlet werden und es wird pommersches Curant
nur auf Summen angenommen, welche unter 16 Sch. betragen.
ssen in N
2
/
3
bezahlet werden und es wird pommersches Curant
nur auf Summen angenommen, welche unter 16 Sch. betragen.
Die Gesellschaft beh
 lt es sich vor dieses Lastengeld
zu erhöhen und zu erniedrigen oder auf eine
Zeitlang ganz abzuschaffen.
lt es sich vor dieses Lastengeld
zu erhöhen und zu erniedrigen oder auf eine
Zeitlang ganz abzuschaffen.
§ 11. Die Mitglieder des Schonenfahrer=Gelags
bestimmen j
 hrlich durch Stimmenmehrheit, ob
ein Fastelabend gehalten werden soll und wird es
dieserhalb bey der bisherigen Ueblichkeit
bleiben. In derjenigen Zusammenkunft, worin
hrlich durch Stimmenmehrheit, ob
ein Fastelabend gehalten werden soll und wird es
dieserhalb bey der bisherigen Ueblichkeit
bleiben. In derjenigen Zusammenkunft, worin
 ber den Fastelabend beschlossen
wird, werden diese Statuten verlesen.
ber den Fastelabend beschlossen
wird, werden diese Statuten verlesen.
§ 12. Wenn der administrirende Aelteste die
Mitglieder fodern l
 ßt, so sind selbige verpflichtet
sich zur angesagten Zeit einzufinden, und wenn
wichtige Sachen zur Besprechung und
Beschlußnahme vorzutragen sind, so ist der
administrirende Aelteste berechtigt bey 4 Sch.
Straffe fodern zu lassen. Als zul
ßt, so sind selbige verpflichtet
sich zur angesagten Zeit einzufinden, und wenn
wichtige Sachen zur Besprechung und
Beschlußnahme vorzutragen sind, so ist der
administrirende Aelteste berechtigt bey 4 Sch.
Straffe fodern zu lassen. Als zul
 ssige Entschuldigung gelten nur
Krankheit, Abwesenheit, Noth= und Ehrenf
ssige Entschuldigung gelten nur
Krankheit, Abwesenheit, Noth= und Ehrenf
 lle, wohin Hochzeit, Kindtaufe,
Wochenbett der Frau, Begr
lle, wohin Hochzeit, Kindtaufe,
Wochenbett der Frau, Begr
 bniß eines Anverwandten geh
bniß eines Anverwandten geh
 ren, entschuldigen auf 8 Tage,
L
ren, entschuldigen auf 8 Tage,
L
 schen und Laden seines Schiffes,
anderweitige gleichzeitige Gesch
schen und Laden seines Schiffes,
anderweitige gleichzeitige Gesch
 fte, welche nicht ausgesetzet
werden k
fte, welche nicht ausgesetzet
werden k
 nnen.
nnen.
Wer einen solchen Entschuldigungs=Grund für sich
nicht anf
 hren kann und gleichwohl
ausbleibt, wenn bey Strafe gefodert ist, muß 4
Sch. Strafe bezahlen und außerdem dem Bothen für
die Eincassirung 1 Sch. geben.
hren kann und gleichwohl
ausbleibt, wenn bey Strafe gefodert ist, muß 4
Sch. Strafe bezahlen und außerdem dem Bothen für
die Eincassirung 1 Sch. geben.
§ 13. In allen Zusammenkünften haben gesammte
Mitglieder des Schonenfahrer=Gelags sich
fernerhin eben so ruhig und anständig zu
betragen, wie dies bisher der Fall gewesen ist.
Sollte es sich gegen alle Erwartung ereignen,
daß Jemand sich auf eine unpassende Weise in den
Versammlungen betr
 ge, so ist das Regiment
berechtigt, ihn um 8 Sch., h
ge, so ist das Regiment
berechtigt, ihn um 8 Sch., h
 chstens 16 Sch. zu straffen.
Sollte eine Vorkommenheit eine gr
chstens 16 Sch. zu straffen.
Sollte eine Vorkommenheit eine gr
 ßere Straffe nach sich ziehen, so
ist gerichtliche Einleitung n
ßere Straffe nach sich ziehen, so
ist gerichtliche Einleitung n
 thig. Die Strafgelder fallen zur
H
thig. Die Strafgelder fallen zur
H
 lfte der Witwencasse anheim.Jedes
Mitglied wird nach wie vor sich befleißigen
durch Ruhe und Ordnung in den Versammlungen der
Gesellschaft Ehre zu machen.
lfte der Witwencasse anheim.Jedes
Mitglied wird nach wie vor sich befleißigen
durch Ruhe und Ordnung in den Versammlungen der
Gesellschaft Ehre zu machen.


|
Seite 142 |




|
§ 14. Die Propositionen des administrirenden
Aeltesten werden, so oft dies angehet, auf eine
Frage gestellet, welche mit Ja und Nein
beantwortet werden kann, und dann der Reihe nach
durch Striche auf dem Brette für Ja und Nein
gestimmet. Bey Wahlen wird per Schedulas
gestimmet Er[fordert]
1
) ein
Gegenstand eine n
 here Besprechung und Ueberlegung,
so stehet es allerdings einem jeden Mitgliede
frey seine Meinung und Ansichten vorzutragen,
wozu jeder in der Reihenfolge aufgefordert wird,
worin er im Eingange des Protokolls aufgef
here Besprechung und Ueberlegung,
so stehet es allerdings einem jeden Mitgliede
frey seine Meinung und Ansichten vorzutragen,
wozu jeder in der Reihenfolge aufgefordert wird,
worin er im Eingange des Protokolls aufgef
 hret ist. Es gilt allenthalben
Stimmenmehrheit und die abwesenden Mitglieder
sind an den gefaßten Beschl
hret ist. Es gilt allenthalben
Stimmenmehrheit und die abwesenden Mitglieder
sind an den gefaßten Beschl
 ssen gebunden. Wenn ein Mitglied
im Auslande oder sonst etwas erf
ssen gebunden. Wenn ein Mitglied
im Auslande oder sonst etwas erf
 hrt, was zur gr
hrt, was zur gr
 ßern Aufnahme und Nutzen des
Gelages gereichen kann, so ist er verpflichtet
dies dem administrirenden Aeltesten anzuzeigen
und berechtigt dieserhalb einen Vortrag an die
Gesellschaft bei der n
ßern Aufnahme und Nutzen des
Gelages gereichen kann, so ist er verpflichtet
dies dem administrirenden Aeltesten anzuzeigen
und berechtigt dieserhalb einen Vortrag an die
Gesellschaft bei der n
 chsten Zusammenkunft zu halten.
chsten Zusammenkunft zu halten.
§ 15. Jeder Schiffer mit Ausnahme der K
 stenfahrer, der mit Musterrolle
f
stenfahrer, der mit Musterrolle
f
 hrt, ist es bey 1 Rthlr. Strafe
durchaus verboten dem Schiffsvolke mehr Heuer zu
geben oder sonst andre Bedingungen zuzugestehen,
wie in der Musterrolle aufgeführet sind.
hrt, ist es bey 1 Rthlr. Strafe
durchaus verboten dem Schiffsvolke mehr Heuer zu
geben oder sonst andre Bedingungen zuzugestehen,
wie in der Musterrolle aufgeführet sind.
§ 16. Kein Schiffer darf dem andern sein Schiffsvolk abwendig machen.
§ 17. Kein Schiffer darf seinen Namen dazu
hergeben, daß ein Schiff auf seinen Namen
ausclariret und hern
 chst von einem andern, der noch
nicht Schiffer und Mitglied des Gelages ist,
chst von einem andern, der noch
nicht Schiffer und Mitglied des Gelages ist,
 ber See gebracht werde.
ber See gebracht werde.
§ 18. Die geringf
 gigen Ausgaben des Regiments bey
den Versammlungen f
gigen Ausgaben des Regiments bey
den Versammlungen f
 r Pfeifen, Taback, Bier, werden
aus der Gelagscasse bestritten.
r Pfeifen, Taback, Bier, werden
aus der Gelagscasse bestritten.
§ 19. Da oftmalen der Fall vork
 mmt, daß Jemand entweder von den
Aeltesten oder nach Beschaffenheit der Sache von
den Aeltesten und Deputirten, ein Erachten
mmt, daß Jemand entweder von den
Aeltesten oder nach Beschaffenheit der Sache von
den Aeltesten und Deputirten, ein Erachten
 ber einen einzelnen Fall begehret,
so werden die deßfallsigen Kosten für ein
Erachten der Aeltesten zu 2 Rthlr. 28 Sch. und
Deputirten aber um 10 Sch. h
ber einen einzelnen Fall begehret,
so werden die deßfallsigen Kosten für ein
Erachten der Aeltesten zu 2 Rthlr. 28 Sch. und
Deputirten aber um 10 Sch. h
 her f
her f
 r jeden anwesenden Deputirten
hiedurch festgesetzet. W
r jeden anwesenden Deputirten
hiedurch festgesetzet. W
 re aber der zum Erachten
aufgestellte Fall so umst
re aber der zum Erachten
aufgestellte Fall so umst
 ndlich; und verwickelt, daß eine
besondere Auseinandersetzung nothwendig w
ndlich; und verwickelt, daß eine
besondere Auseinandersetzung nothwendig w
 rde, so sind die deßfallsigen
Kosten nach Verh
rde, so sind die deßfallsigen
Kosten nach Verh
 ltniß auch gr
ltniß auch gr
 ßer. F
ßer. F
 r die Verzehrung in solchen
Zusammenk
r die Verzehrung in solchen
Zusammenk
 nften darf der Gelagscasse nichts
berechnet werden.
nften darf der Gelagscasse nichts
berechnet werden.


|
Seite 143 |




|
§ 20. Es sollen diese Statuten noch nicht bey E.
E. Rathe zur Confirmation eingereicht werden,
weil die Gesellschaft zuvor durch die Erfahrung
davon sich
 berzeugen will, daß selbige
zweckm
berzeugen will, daß selbige
zweckm
 ßig und vollst
ßig und vollst
 ndig sind, folglich keiner Ab
ndig sind, folglich keiner Ab
 nderung bed
nderung bed
 rfen, und es ist festgesetzet, daß
derjenige Schiffer, welcher w
rfen, und es ist festgesetzet, daß
derjenige Schiffer, welcher w
 hrend vier Jahre seine Beytr
hrend vier Jahre seine Beytr
 ge an die einzelnen Cassen
verweigert, f
ge an die einzelnen Cassen
verweigert, f
 r sich und respective f
r sich und respective f
 r seine Wittwe kein Mitglied
solcher Casse weiter bleibt, sondern von solcher
Casse ausgeschlossen wird.
r seine Wittwe kein Mitglied
solcher Casse weiter bleibt, sondern von solcher
Casse ausgeschlossen wird.
Rostock den 10. Januar 1825.
C. F. Koch. Jacob Maack
Aeltesten des Schonenfahrer=Gelags.
Eintrittsgelder eines jungen Schiffers:
| 1. | Klasse | 17 | Rthlr. | N 2 / 3 |
| 2. | " | 26 | " | " |
| 3. | " | 49 | " | " |
| 4. | " | 26 | " | " |
| 1. | Klasse: |
Schifferssohn oder Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
| 2. | " |
Inl
 nder, der nicht
Schifferssohn und nicht Br
nder, der nicht
Schifferssohn und nicht Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
| 3. | " |
Ausl
 nder (Verord. 13. Aug. 1810).
nder (Verord. 13. Aug. 1810).
|
| 4. | " |
der Br
 utigam einer Schifferstochter.
utigam einer Schifferstochter.
|
Nach erneuerten Statuten:
| 1. | Klasse | 9 | Thlr. | 40 | Sch. | Courant |
| 2. | " | 30 | " | 16 | " | " |
| 3. | " | 58 | " | 16 | " | |
| 4. | " | nicht angegeben. | ||||
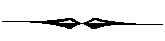


|
Seite 144 |




|



|


|
|
:
|
III.
Dr. Johann Kittel,
Professor der Theologie und
Superintendent zu Rostock,
1561-1563.
Von
Karl Koppmann.
D en Streitigkeiten, welche in Rostock aus dem Widerstand der Prediger gegen die Sonntagstrauungen hervorgegangen waren, hatte der Rath dadurch ein Ende machen zu können gemeint, daß er am 1. October 1557 den Dekan der theologischen Facultät, Dr. Johannes Draconites zum Superintendenten ernannte, am 9. October die beiden Hauptgegner Andreas Eggerdes und Tilemann Heshusius aus der Stadt ausweisen ließ, am 11. October dem Andreas Martinus seine Stellung kündigte und am 15. October ein Mandat veröffentlichte, in welchem den Bürgern und Einwohnern befohlen wurde, sich der Verbindung mit den auf den Rath schmähenden Predigern zu enthalten. Diese Hoffnung schlug aber fehl; die Prediger standen in ihrer Erbitterung fest zusammen, sowohl dem Dr. Draconites, den sie am 10. März 1559 als Superintendenten nicht anerkennen zu können erklärten, als auch dem Rathe gegenüber, und als am 18. Februar 1560 eine durch die Prediger veranlaßte herzogliche Commission in Rostock eingetroffen war, um in deren Streitsachen mit Draconites zu entscheiden, ertheilte der Rath an demselben Tage, an dem die Commission ihre Thätigkeit begann (19. Februar), dem Dr. Johannes Posselius den Auftrag, nach Wittenberg zu Melanchton zu ziehen und nach dessen Rath einen anderen Doctor der Theologie zum Professor und Prediger zu gewinnen, ließ also, um das von ihm beanspruchte Recht zur Ernennung


|
Seite 145 |




|
eines Superintendenten besser bewahren zu können, die Person des bisherigen Superintendenten fallen. 1 )
Am 5. März bezeichnete Melanchton in einem Schreiben an den Rath 2 ), das auf seine Unterredung mit Posselius Bezug nimmt, Lukas Bacmeister, Johannes Posselius und Mathias Casselius als Männer, die für das betreffende Amt geeignet seien; des Weiteren machte er, vielleicht nur mündlich dem Posselius gegenüber, auch Christopher Stymmelius in Stettin und Johannes Kittelius in Brandenburg namhaft: "Philippus hefft 2 vorgeslagen up erforderen M. Posselii einen Stummelium, den andern Kittelium." 3 )
In einem undatirten Schreiben des Raths an Christopher Stymmelius 4 ) heißt es folgendermaßen: "da wi eines treffelichen Theologen, godtfruchtige to Gotzs ere und unsere gemente tom besten dath hillige Evangelion, mit frommeder lere unvorfelschlich, vortodragende, in dessenn swinden tiden hochnodich hadden," so habe er deshalb den Mag. Johannes Posselius mit einem Credenzbriefe ausgesandt, und von diesem sei ihm berichtet worden, daß er nicht abgeneigt sein würde, einer Vocation nach Rostock Folge zu leisten; er ersuche ihn deshalb, "up unser unkost an uns to kamende," "de gelegenheit hir bi uns allenthalven to vornemende und, so idt Got uthvorsehen hedde, dadt J. W. u. G. hir bi uns to blivende bedacht edder geneget, henfurder to beredende, wes J. G. und Werden in denn officio tho donde uperlecht werden solde." Darauf antwortete Stymmelius am 11. April, 5 ) zwar enthalte das Vocationsschreiben die drei Artikel nicht, die er mit Johannes Posselius besprochen und als nothwendig bezeichnet habe, doch sei er sich zum Rath alles Guten versehen und wolle in der Woche nach Jubilate (Mai 5) nach Rostock kommen, um die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Aber die Verhandlungen mit ihm zerschlugen sich: "Stummelius were bedacht (gewesen) (hirher tho thende, overst hefft gedrungen umb mehr besoldinge, de he (nicht) erlanget; derwegen he ock dar (in Stettin) gebleven." 6 )


|
Seite 146 |




|
Ueber Kittels Berufung erzählt dieser selbst am
26. Februar 1562 nach dem leider nicht ganz
verständlichen Bericht des Rathsprotokolls
folgendermaßen: Der Rath habe dem Posselius eine
"fulmacht gegeven, einen gelerden man
anthonemen; an Philippum gewisen worden; hatt
Philippus gesecht, dat he so einen hir tho
Wittenberch (nicht) wete, aber tho
Nien=Brandenborch einen, Kittel, de dar duchtich
tho were. Dar Possel gekamen, des Rades breve
getoget
 .
.
 . Darna ein handel sich
thogedragen, darmith hertoch Ulrich tho donde
hebbe; hertoch Johan Albrecht kende ehn wol;
item der Cantzler. Do se Rostock besehn, D.
Roseler hedde ehn tho gaste geladen. Der borger
Goldenisse tho ehm gekamen und ehn thom deinste
gefordert. D. Kittel es nicht entlich angenamen,
sondern der Radt und de gemeine solben Gott
bitten; so es sein solde, konde es geschein.
Darna einen boden geschicket. Item anderthalff
Jahr up Simonis et Judae (October 28) hefft de
Radt ehne thom 3. mall beropen thom
Superintendenten und Professoren in der
Universitett. Hefft gedacht, dath de Vocation
christlich; den sonnavent na Simonis et Judae
(November 2) alhir geprediget; darna sick
vorgeliket der bestellinge."
. Darna ein handel sich
thogedragen, darmith hertoch Ulrich tho donde
hebbe; hertoch Johan Albrecht kende ehn wol;
item der Cantzler. Do se Rostock besehn, D.
Roseler hedde ehn tho gaste geladen. Der borger
Goldenisse tho ehm gekamen und ehn thom deinste
gefordert. D. Kittel es nicht entlich angenamen,
sondern der Radt und de gemeine solben Gott
bitten; so es sein solde, konde es geschein.
Darna einen boden geschicket. Item anderthalff
Jahr up Simonis et Judae (October 28) hefft de
Radt ehne thom 3. mall beropen thom
Superintendenten und Professoren in der
Universitett. Hefft gedacht, dath de Vocation
christlich; den sonnavent na Simonis et Judae
(November 2) alhir geprediget; darna sick
vorgeliket der bestellinge."
Johannes Kittel war 1519 zu Jüterbogk geboren, hatte in Wittenberg studirt und war 1539 zum Baccalaureus der Philosophie promovirt worden. Pastor zu Brandenburg war er seit dem Jahre 1550. 1 ) Auf ein Schreiben des Raths zu Rostock, "darin sie mich zu einem Lectorn unnd professorn der heiligen gotlichen schrifft in ewer loblichen Universitet, deßgleichen auch zu einem Superattendenten ewer christlichen kirchen ordentlich vociren und beruffen," antwortete er am 21. October 1560, er habe sich entschlossen, binnen etwa 3 Wochen in Rostock zu erscheinen. 2 ) Am 2. November hielt er seine Probepredigt. Darauf bezieht es sich, daß Bacmeister berichtet, 3 ) er sei auf die Vocation des Rathes nach Rostock gekommen, habe sie non praemisso colloquio cum Ministerio angenommen und am Nachmittag des 3. November zu St. Marien die Kanzel bestiegen, wodurch das Ministerium schwer verletzt worden sei. Am 4. November wurde im Rath beschlossen, daß Johann Kittel pro superintendente angenommen werden solle. 4 ) Am 6. November


|
Seite 147 |




|
ertheilte ihm der Rath seine Bestallung zum Superintendenten, Professor und Lector in der h. Schrift, verpflichtete ihn zum sonntäglichen Predigen in der Marienkirche, versprach ihm ein von Ostern 1561 an zu zahlendes Gehalt und legte ihm die Bedingung auf, daß er in der Zwischenzeit in Wittenberg den theologischen Doctorgrad gewinne. 1 )
Um diese Bedingung zu erfüllen, hatte sich Kittel bereits nach Wittenberg begeben, als der Rath den Beschluß faßte, ihn nicht dort, sondern in Rostock promoviren zu lassen: "De Radt revocerede ehne; he solde hir promoveren mith D. David (Chyträus) und D. Simon (Pauli), denne wo he dar wurde promoveren, wolde men ehne nicht vor ful erkennen." 2 ) Am 2. März 1561 schrieb "Magister Johan Kittels eheliche Hausfraw" an Dr. Matthäus Röseler, 3 ) ihr Herr sei zur Zeit aus Gründen, die ihm wohl bekannt sein würden, in Wittenberg, doch wolle sie ihm das Schreiben, das ihr heute durch den Ueberbringer zugestellt worden sei, alsbald zuschicken, und am 12. März meldete Kittel dem Rath aus Brandenburg, er sei "unserer abredung und meiner Zusagung nach" Februar 26 nach Wittenberg gereist, um dort zum Doctor Theologiae zu promoviren; in Gemäßheit des ihm durch seine Hausfrau zugesandten Schreibens aber sei er unpromovirt nach Brandenburg zurückgekehrt und gedenke "auf beschehene verheißhung" in Rostock zu promoviren und am 5. Mai dorthin aufzubrechen. 4 ) Wegen des bevorstehenden Theologen=Convents zu Lüneburg, auf dem man sich wegen des Naumburger Abschiedes schlüssig machen wollte, wird aber der Rath auf eine frühere Abreise gedrungen haben, denn Kittel, der am 26. Februar erklärt hatte, er könne, wie er dem Rath schon mündlich gesagt, vor dem 5. Mai nicht abkommen, wurde bereits am 15. April als Joannes Kittelius Jutterbochiensis, magister artium, immatrikulirt 5 ) und am 29. April bei der ersten theologischen Promotion Rostocks seit der Reformation durch die Greifswalder Professoren Dr. Georg Venetus und Dr. Jakob Runge mit David Chyträus und Simon Pauli zusammen zum Doctor der Theologie promovirt. 6 ) Als Doctor und Professor der Theologie wurde er in das Concilium recipirt, 7 ) und Venetus und


|
Seite 148 |




|
Runge vermittelten es, daß er auch vom Ministerium, wenn auch nicht als Superintendent, recipirt wurde. 1 )
Ueber diese letztere Reception sagt Kittel am 26. Februar 1562 nach dem Rathsprotokoll: "D. Runge in Steinkamps huse, dar se vorordent: Sidt ji ock des gemotes, dath gi broderlich mith ehnen willen leven? Darup he geantwortet, ehm gefalle de anflach wol;. dat (he dat) ehnen mochte antogen und D. Venetum darbinemen. De prediger gesecht, dewile idt so widt gekamen, mostens geschen laten. Is tho unser leven frowen up de Wedeme gekamen, dosulvest ock M. Lucas (Randow) bii gewesen."
Bereits am 9. Mai (1561) schrieb oder sagte ihm der Rath, 2 ) man "wolde ehn geschicket hebben am vergangen Donnerdage (Mai 8)," aber es mangele noch an dem Sattelzeug, an Wagen und an 10 Pferden. Ohne Zweifel ist dies von der Zusammenkunft in Lüneburg zu verstehen, in Bezug auf welche der Rath am 3. August an Herzog Ulrich berichtete, "dath fast alle unsere perde tho Luneborch up der Stede dach und sunst uthgeschicket sindt." 3 ) An dieser Zusammenkunft nahm Kittel im Auftrage des Raths, inscio et inconsulto reliquo Ministerio, 4 ) als Superintendent theil und unterschrieb die vereinbarten Artikel 5 ) als Johannes Kittelius Sacrae Theologiae Doctor et Superintendens ecclesiae Christi Rostochiensis.
Das Ministerium hatte, erbittert darüber, daß es gar nicht befragt worden war, an Tilemann Heshusius, der als Superintendent zu Magdeburg an dem Convent theilnahm, am 25. Juli geschrieben, 6 ) Kittel sei nobiscum consiliis non communicatis nach Lüneburg gezogen, und Heshusius möge ihm, wenn er irgend etwas im Namen der Rostockischen Kirche, cujus statum ac conditionem parum novit, unterschreiben wolle, die Frage vorlegen, ob er auch die Zustimmung der übrigen Prediger habe, und ihn ernstlich ermahnen, ne deinceps in negotiis adeo arduis ita inconsiderate agat. Nach Kittels Rückkkehr wurde beschlossen, daß die Prediger zu St. Marien ihm die Absolution verweigern sollten, wenn er nicht einräumen wolle, dadurch Unrecht gethan zu haben, daß er die


|
Seite 149 |




|
Kirche zu Brandenburg verlassen, das Predigtamt zu Rostock ohne Genehmigung des Ministeriums angetreten und ohne dessen Vorwissen am Lüneburger Convent theilgenommen und die Artikel als Superintendent der Rostockischen Kirche unterzeichnet habe. 1 ) Als Kittel am 16. August bei dem Diakonus Berthold Detharding seine Beichte ablegte, verfuhr dieser dem Beschlusse gemäß und verweigerte ihm die Absolution, 2 ) wie es ihm die Brüder befohlen hätten. "Die Brüder?" antwortete ihm Kittel, "die Buben!"
Am 18. August beschwerte sich Kittel beim Rath über die drei Punkte, "derwegen Her Bartoldus uth befele der anderen Mithbrodere de absolution nicht hefft spreken edder thom disch des Heren stadenn willenn." 3 ) Am 19. August standen Kittel und die Prediger vor dem Rath einander gegenüber und Kittel ließ sich zu den Ausdrücken Judasbrüder und Kainsbrüder hinreißen, was Dr. Simon Pauli, der Pastor zu St. Jakobi, für schlimmer erklärte, als wenn er sie Schelme und Diebe gescholten hätte. 3 ) Am 29. August erschien das Ministerium vor dem Rath und antwortete durch Simon Pauli auf die Anschuldigungen Kittels; es wurde der Brief verlesen, den die Prediger an Heshusius geschrieben hatten, und Berthold Detharding erklärte, er habe nicht gesagt, die Brüder hätten ihm befohlen, ihn vom Abendmahl abzuweisen, sondern ihn auf die drei Artikel zu befragen. 3 )
Am 4. September fragte Kittel beim Rathe an, ob er den Predigern antworten solle, und erklärte sich bereit dazu, die Superintendentur niederzulegen. 3 ) Der Rath fürchtete aber, daß eine Antwort Kittels die Uneinigkeit nur noch ärger machen würde, und ließ deshalb am 11. September den Predigern durch den Syndikus Dr. Röseler "des Rades meininge unnd Rathschlag" wegen eines Friedens zwischen ihnen und Kittel vorlesen. 4 ) Die drei Punkte, über die Kittel sich habe erklären sollen, insbesondere wegen der Reise nach Lüneburg, gingen den Rath an, und zur Erhaltung ihrer Gerechtigkeiten würden Rath und Bürgerschaft Kittel nicht in Stich lassen; die heftigen Worte Kittels möchten sie damit entschuldigen, daß es einem Manne, der so lange im Predigtamt gewesen sei, wohl habe weh thun müssen, "umb so liederliche zugenötigte ursachenn von einem jungen Sacristen vom Testament


|
Seite 150 |




|
gewiesen" zu werden; Dr. Simon Pauli und andere, die daran unschuldig sein wollten, könnten sich durch die Worte Kittels nicht betroffen fühlen; die übrigen Prediger hätten jenen Beschluß nur deshalb gefaßt, weil sie es nicht leiden könnten, daß der Superintendent durch den Rath und nicht durch die Herzöge bestellt werde; der Rath aber gestehe das Recht, einen Superintendenten in Rostock einzusetzen, den Herzögen nicht zu und würde Alles eher leiden. 1 ) Am 2. October baten Simon Pauli, Joachim Schröder von St. Petri und Matthäus Flege, der Archidiakonus zu St. Marien, den Rath um Entschuldigung, daß sie auf Dr. Röselers Vortrag noch nicht geantwortet hätten, und theilten ihm mit, sie hätten den Lübischen Predigern erwidern müssen, daß sie die Lüneburger Artikel nicht unterschreiben könnten, weil Kittel dieselben als Superintendent unterzeichnet habe. 2 )
Am 22. October sollen einige fürstliche Räthe, vermuthlich dieselben, die am 16. October mit dem Rath wegen der Universität verhandelten, 3 ) von der Streitsache Kittels mit dem Ministerium Kenntniß genommen und beiden Parteien auferlegt haben, auf der Kanzel davon stillzuschweigen. 4 )
Im November bot sich der Professor Andreas Wesling dem Ministerium gegenüber zur Vermittelung an. Das Ministerium ging darauf ein, überreichte ihm fünf Artikel 5 ) und erklärte, wenn Kittel dieselben annehmen wolle, so sei es bereit, sich mit ihm auszusöhnen. 4 ) Davon wollte aber der Rath so wenig wissen, wie Kittel. Am 10. November hatte er Kittel und fünf räthliche Prediger vor sich: Hinrich Strevius von St. Jacobi, Matthäus Flege und Berthold Detharding von St. Marien, Joachim Bansow von St. Nicolai und Lukas Randow vom heil. Geist, und erklärte ihnen, er sähe es nicht für gut an, "artickelswise tho disputeren," sie möchten sich "ahne Disputation" mit Kittel vertragen, Simon Pauli "hedde sich mith dem Juramento ercleret, dath he unschuldich were der affwisinge vam Sacramente." Strevius erwiderte, ohne Vorwissen der übrigen Prediger könne er nichts vornehmen; Flege antwortete, er habe in der Sache nicht mehr gethan, als Dr. Simon, und wenn Kittel einräumen wolle, "dath he darin gesundiget, dat he na Luneborch gereiset,"


|
Seite 151 |




|
so wolle man sich ebenso wohl mit ihm vertragen, wie Dr. Simon, und auch Detharding erklärte, was die Abweisung vom Sakrament belange, so "is der Doctor Simon jo so dep inn, alß de andern," und ihm sei befohlen worden, Kittel abzuweisen, wenn er nicht bekenne, "dath he sich in den dren puncten gesundiget;" Kittel seinerseits aber meinte: "bekent he sich, wo se begeren, so schrien se ehne uth, bekent he sich nicht, so erkennen und schrien se ehne uth alß einen hereticum, dath is der prediger vorhebbent." 1 )
Durch eine Predigt, die Kittel am 3. Advent (December 14) hielt, reizte er seine Gegner zu dem Beschlusse, am nächsten Sonntage den (Gegenstand ihrer Streitigkeit auf der Kanzel vorzutragen. Der Rath, der von Kittel die Nachricht erhalten hatte, "dath Flege den dach im Junckfrouwenkloster gesecht, de thovorer solden komen am thokamenden Sondage inn unser leven frouwen karcken, wolde he alles vam anfange beth thom ende ertellen," besprach sich darüber am 16. December mit Simon Pauli, der aus anderer Veranlassung zu ihm gekommen war, und Pauli sagte, von Kittel, dem er zum Stillschweigen gerathen, sei es unweise gewesen, dagegen zu handeln, "de Man is tho hefftich." Am 19. December forderte der Rath die Sechziger vor sich, ermahnte sie bei ihren Eiden, über das, was verhandelt werden solle, zu schweigen, und ließ ihnen, weil "de prediger up der Cantzel vormaninge gedahn, se solden am thokamenden sondage kamen, so wolden se alle ercleringe dohn," durch Dr. Röseler die Geschichte der Streitigkeit ausführlich berichten. 2 ) Am 20. December fanden lange Verhandlungen zwischen dem Rath, den Sechzigern und den Predigern statt. 2 ) Die Prediger begehrten zu wissen, ob der Rath und die Bürgerschaft sie für solche Leute hielten, wie sie von Kittel gescholten worden seien, oder für rechte Diener Christi, und zu Kittel "uth sinem egenwilligen koppe edder uth des Rades gehete gedahn." Der Rath antwortete, er halte sie für treue evangelische Prediger, könne aber auch Kittel nicht anders beurtheilen und vermöge dessen Abweisung vom Sakrament und die fünf Artikel nicht zu loben; von Kittels Schelten habe er vorher nichts gewußt und würde es andernfalls verhindert haben. Die Bürger erklärten, sie hielten die Prediger für ehrliche, aufrichtige, treue Diener Christi und ihre Seelsorger und bäten sie, des Festes wegen auf Kittels Schelten nicht einzugehen. Damit waren die Prediger nicht zufrieden, sondern verlangten, daß Kittel sich der


|
Seite 152 |




|
Kanzel enthalte, bis er für seine Behauptungen Beweise bringe, und die Bürger baten, daß der Rath darauf eingehe; der Rath erklärte aber nur, er wolle Kittel bei Verlust des Predigtstuhls Stillschweigen gebieten und begehre ernstlich, daß die Prediger entweder nach der Bitte des Raths und der Bürgerschaft von der Sache ganz stillschwiegen oder nur erklärten, sie seien Willens gewesen, ihre Unschuld darzulegen, aber Rath und Bürgerschaft hätten begehrt und gebeten, daß sie eine Zeitlang damit warteten. Die Prediger sperrten sich zuerst noch dagegen, gaben aber endlich dahin nach, daß sie sagen wollten, Rath und Bürgerschaft hätten sich des Handels angenommen und hätten anerkannt, daß sie tüchtige Personen und getreue Diener wären, sie hätten sich genugsam verantworten wollen, aber Rath und Bürgerschaft hätten sie gebeten, es nicht zu thun.
Im Januar 1562 1 ) müssen die Prediger auf die Sache zurückgekommen sein, denn der Rath antwortet ihnen Februar 4. durch Dr. Röseler: "Men hefft begeret ein stillestandt vor winachten; darna hebben de prediger anroginge gedahn, dath de sake mochte vorgenamen werden; wo de radt es nicht dohn wurde, wurden


|
Seite 153 |




|
se vororsaket, von der Cantzel sich tho entschuldigen." 1 ) Durch diese Drohung sah sich der Rath veranlaßt, den Rathmann Franz Quant zu Herzog Ulrich zu schicken und, wie es scheint, um Absendung von Kommissarien und ein Gebot des Stillschweigens anhalten zu lassen. Die Herzöge Johann Albrecht und Ulrich zogen aber bei den Predigern Erkundigung ein und wurden berichtet, daß Kittel sich "selber zu erhohenn unnd fur einenn Superintendenten eintzudrengen undernemen" solle und sich auch zu Lüneburg, obwohl er vorher gewarnt worden, als solcher unterzeichnet habe, und daß der Streit dadurch entstanden sei, daß Kittel "vorerst auf dem Cantzell außgefaren unnd unsere prediger Judasbrudere geschuldenn." Demgemäß erließen sie Januar 21 an den Rath den Befehl, 2 ) "das ihr demselbenn Kittelio aufferlegt unnd von unserntwegenn gebietett, das ehr sich hinfuro des predigamts und Cantzels inn unser Stadt Rostock enthalten solle." Darauf antwortete der Rath Januar 25, 3 ) Kittel sei von ihm zum Theologen und Lehrer an der Universität "unnd aver de predigernn allein, so wi in deinstbestellinge holdenn unnd besoldenn, nicht so J. F. G. ahne middel vorwant, Superintendenten edder upseher" angenommen worden, "darumb wi dan ock ehne als unsern overstenn prediger und Superintendentenn nach Luneborch geschicket unnd dat he sich darvor uthgevenn und schriven solde, befalenn;" was aber den Streit betreffe, so hätten die Prediger den Herzögen auch berichten sollen, "dath J. F. G. prediger thom andernn mahll ane alle billiche christliche orsakenn denn Doctor vam hochwerdigen Sacrament gewiset unnd dartho vele Sondage lange thovorne bemelten Doctor unverschuldet geschulden, vornichtet unnd, dem gemeinen Man vorstendichlich genoch, dath he darmit gemeint, taxeret;" auch sei es nicht wahr, daß Kittel sie Judasbrüder gescholten habe, sondern, wenn er sich verantworten könnte, "wurden J. F. G. des Doctors bescheidenheit und lanckwilige gedult jegen de prediger, ere overst tho em nodiginge, clarlich vormerckenn;" der Rath bitte deshalb die Herzöge, ihn mit dem ihm ertheilten Befehl zu verschonen, "unnd were wol der christlichen kerckenn alhir thodrechlicher, es gebode J. F. G. solches dem oldenn unruigen Magistro Georgio, 4 ) alßdann solde de uneinicheit der prediger balde gestillet sin."
Am 4. Februar beschwerten sich die Prediger beim Rath darüber, daß er sie bei den Herzögen verklagt und sich dadurch als


|
Seite 154 |




|
Partei gerirt habe, da er doch Richter in der Sache sein wolle, und Georg Reiche sprach von "duvelschen gedancken," die der Rath fahren lassen solle, und von "schandtbreven", die auf Kittel zurückgehen würden, da er allein darin gelobt, das ganze Predigtamt aber gelästert würde. 1 ) Darauf antwortete ihnen der Rath Februar 5 durch Dr. Röseler, er habe durch Franz Quant nur darum anhalten lassen, daß ihnen Stillschweigen bis zum Austrag der Sache auferlegt werde, das scharfe Schreiben der Herzöge aber sei durch sie veranlaßt worden. Dr. Simon Pauli entgegnete für sich und die übrigen Prediger, was Franz Quant ausgerichtet, ließen sie auf sich beruhen; von ihnen sei keiner "tho have gefordert," der Rath habe aber eine Gesandtschaft dorthin geschickt, "se willen den Radt laten judiceren, wol de orsake (des Schreibens) si, offt se idt sin, edder de Radt;" in seiner Antwort aber habe der Rath sie angeklagt und durch die Behauptung, Kittel sei ohne christliche Ursache vom Sakrament abgewiesen worden, bereits das Urtheil gesprochen; die Prediger wollten deshalb nicht ihn, sondern die Bürgerschaft zu Richtern haben. Die durch 16 Personen vertretene Bürgerschaft erklärte, daß der Rath um fürstliche Kommissarien gebeten habe, sei ihr sehr leid und mache ihn den Predigern verdächtig, und da die Prediger die Gemeinde als Richter gelten lassen wollten, so schlüge sie vor, die Sache durch einige Personen aus ihrer Mitte und einige andere gelehrte Leute entscheiden zu lassen. 2 ) Am 6. Februar erklärte der Rath, er könne sich von den Verhandlungen nicht ausschließen lassen; er wolle 5 bis 6 Rathsmitglieder dazu abordnen, die Bürgerschaft könne sich durch die 4 anwesenden und 6 weitere Personen vertreten lassen. Die anwesenden Bürger meinten, die Nichtbetheiligung an den Verhandlungen könne den Rath nicht kränken, da ihm ja die Bürger "mit Eiden verwandt" seien; im Uebrigen sähen sie es lieber, daß der ganze Rath daran theilnähme und sie mit der Sache verschont würden. Die Prediger erwiderten, wenn es ein freundlicher Handel sein solle, so sei die Betheiligung des Raths nicht nothwendig; "so Doctor Roseler darbi und de Mundt ehm thogebunden, wurde he se upriten;" zu Richtern aber wollten sie nicht den parteiischen Rath, sondern unparteiische Leute aus der Bürgerschaft. Schließlich wurde die Sache auf Wunsch der Prediger bis zur nächsten Woche vertagt. 3 )


|
Seite 155 |




|
Am 10. Februar antworteten die Herzöge auf das Schreiben des Raths von Januar 25, da ihnen das Patronatsrecht an allen Kirchen zuständig sei, so gezieme es dem Rath nicht, einen Superintendenten zu ernennen; er solle deshalb Kittel befehlen, sich bis zum Eintreffen der fürstlichen Räthe der angemaßten Superintendentur und der Kanzel zu enthalten. 1 ) Der Rath theilte Februar 13 Kittel dieses Schreiben mit, befahl ihm, mit der Predigt fortzufahren, des Scheltens jedoch sich zu enthalten, 2 ) und richtete Februar 14 ein Erwiderungsschreiben an die Herzöge, 3 ) in dem er darauf hinwies, daß sie in 40 Jahren - abgesehen von Dr. Venetus, den er mit gutem Rechte gehindert 4 ) - keinen Prediger an St. Marien bestellt hätten, und daß er auch Kittels Vorgänger Draconites zum Superintendenten ernannt habe, während "kein Minsche seggen kan edder gedencket, dath J. F. G. einen Superintendenten in Rostogk gesettet und verordent hebben."
Am 20. Februar erschienen die Prediger mit einer größeren Anzahl Bürger auf der Schreiberei. Der Rath erklärte ihnen zunächst, daß nach einer Beliebung der Bürgerschaft nicht mehr als neun Personen vor ihm aufzutreten hätten; die Prediger meinten zwar, es seien auch früher wohl mehr, wohl an sechzig Bürger zugegen gewesen, der Rath bedeutete sie aber, daß es seine Sache sei, viele oder wenige Personen vor sich zu fordern. Dann berichtete Simon Pauli, Kittel habe am vergangenen Sonntag gesagt, "de prediger wolden ein nie pabstthum anrichten," und da er dadurch das beiden Parteien auferlegte Verbot des Schmähens verletzt habe, so müßten die Prediger fordern, daß ihm die Kanzel verboten würde, oder ihrerseits die Predigt einstellen. 2 ) Am 21. Februar hatte der Rath etwa 60 Bürger auf der Schreiberei bei sich, denen er den Stand der Sache mittheilte, und die Bürger begehrten, daß Kittel sich vor ihnen über seine Worte vernehmen lasse, da ihm, wenn er sich rechtfertige, die Kanzel nicht verboten werden könne. Demgemäß erklärte Kittel, er habe gepredigt, daß das Predigtamt nicht verächtlich behandelt werden dürfe, daß man aber auch, wenn die Prediger eine neue Tirannei oder ein neues Papstthum errichten wollten, wissen müsse, die Fürsten seien von Gott verordnet. Die Bürger hielten diese Rechtfertigung für ausreichend, und die Prediger fügten sich darein,


|
Seite 156 |




|
nahmen auch die Erklärung des Rathes an, daß die Entscheidung ihrer Streitsache Februar 25 oder 26 vor sich gehen sollte. 1 )
Am 26. Februar ging beim Rath ein Gutachten des Dr. David Chyträus ein, 2 ) in welchem er dringend davon abrieth, daß die Streitsache "vor einer solchen menge ungleicher und uneiniger Bürger" verhandelt werde, und es empfahl, daß jede Partei erkläre, sie sei zu Frieden und Einigkeit geneigt, wisse von der andern nichts als Gutes und wolle, wenn man sich wegen der Abweisung vom Abendmahl nicht einigen könne, sich vor dem Concilium vernehmen lassen, damit dieses einen Bericht aufnehme, der an die benachbarten Kirchen oder Universitäten versandt werden könne; eventuell sei es besser, die Kosten nicht zu scheuen und vornehme Männer aus den benachbarten Kirchen zur Entscheidung der Sache hierher kommen zu lassen, "denn das sie fur den Bürgern oder sunst in grösser weitleuffickeit gefüret würde." An demselben Tage aber kam die Sache wirklich zum Austrag. Der Rath hatte etwa 50 Bürger auf die Schreiberei fordern lassen, die Prediger brachten deren ebenfalls viele, vornehmlich Sechziger, mit sich; um die Leitung der Verhandlungen hatte der Rath den Licentiaten Paselich gebeten. Nachdem dieser eine Einleitungsrede gehalten, traten zunächst die Prediger vor und erklärten, sie seien durchaus bereit, sich, selbst in diesem Augenblick, mit Kittel zu vergleichen; die Uneinigkeit rühre aus zweien Ursachen her: erstens sei Kittel vom Abendmahl abgewiesen worden, zweitens habe er Schmähworte gegen sie gebraucht; wegen des Ersteren könne er, wenn er sich mit ihnen nicht gütlich vereinigen wolle, appelliren und wegen des Letzteren seien sie zur Versöhnung willig, wenn er nur sagen wolle, daß er sie für ehrliche, aufrichtige Leute halte, wozu auch sie in Bezug auf ihn bereit seien. Dann erklärte Kittel, nachdem er ausführlich die Geschichte seiner Berufung und seiner Streitigkeiten mit den Predigern vorgetragen, er hoffe die Abweisung vom Sakrament nicht verdient zu haben, wolle sie aber den Predigern nicht nachtragen, wenn sie dazu auch in Betreff der Injurien willens seien, die er justo dolore gegen sie ausgesprochen habe. Dann bekräftigten beide Parteien einander mit Handschlag, daß Alles vergeben sein solle, und versprachen, Gott auf der Kanzel für die Aussöhnung zu danken. Am Nachmittag aber verlas Licentiat Paselich einen Abschied, dem zufolge ein vom Rath besiegelter Vertrag beiden Parteien zugestellt und auf den Kanzeln verlesen werden, die Frage nach der Super=


|
Seite 157 |




|
intendentur offen bleiben und Kittel in das Ministerium mit den Worten wieder eingeführt werden solle: Offerimus vobis fratrem, habete illum vobis commendatum. 1 )
Der Friede zwischen Kittel und dem Ministerium war damit vereinbart, die Frage nach der Superintendentur aber war offen und die herzoglichen Mandate von Januar 21 und Februar 10 waren wirkungslos geblieben.
Nach langen Verhandlungen über die Beisteuer, welche Rostock zu der auf dem Landtage zu Güstrow 1560, September 25, bewilligten Landeshülfe zur Abtragung der fürstlichen Schulden leisten sollte, hatte der Rath am 22. April 1561 eine Schuldverschreibung über 80000 Gulden ausgestellt. 2 ) Im Maimonat 1562 wurde Herzog Ulrich hinterbracht, daß Kittel über diese Angelegenheit unziemlich auf der Kanzel gesprochen habe. 3 ) Am 26. Mai 4 ) erließ er darauf zwei Schreiben an den Rath und an die gemeine Bürgerschaft mit den Sechzigern. Daß der Rath, heißt es in dem ersteren, 5 ) trotz seines Befehls Kittel auf der Kanzel gelassen, habe er in der Hoffnung dulden müssen, dereinst die Gelegenheit zu erhalten, ihn wiederum zu gebührlichem Gehorsam zu bringen, "darzu uns ungezweivelt der Almechtiger stercke und kreffte verleihen wirt, und werdet ihr gewißlich erfahren, daß unsere große gedult euch alsdhan desto beschwerlicher sein und furfallen werde." Neulich aber habe Kittel ihn und Herzog Johann Albrecht "mit ungeburlichen, unzimblichen, ehrenrurigen, schimpflichen und undienstlichen reden offentlich auf der Cantzel vergessentlich angegriffen," "derenthalben, das wir unsere underthenige gehorsame Landtschafft, davhon ihr auch ein gelid sein soldet, zu ablegung unser Lande und Furstenthumbe beschwerlichen Schulde, die wir doch nicht gemachet, sondern einstheils auf uns vererbet, einstheils der beschwerliche Zustandt deß gemeinen Vaterlandes Deutscher Nation negst verschiener Jare unumbgenglich verursachet." Da er nicht leiden könne, "daß derselbe unrichtiger, mutwilliger Man in unsernn landen und Furstenthumben lenger geduldet oder ihme zu


|
Seite 158 |




|
unserm nachteill und verkleinerung einiger underschleiff von unsern underthanen gestattet werden solte," so gebiete er dem Rathe "bei vermeidung unser straff und hohesten ungnad, auch bei verlust aller Ewerer in unsern Furstenthumben und Landen, auch in unser Statt Rostogk habenden Privilegien und freiheiten," ihn binnen acht Tagen nach Empfang dieses Schreibens aus der Stadt zu verweisen; eventuell aber sei er entschlossen, "Ewere mitburger, unsere underthanen, und euch, auch ihre und ewere guetere in unsern Furstenthumben und Landen nach ausgange bestimbter zeit zu hemmen, zu arrestiren und anzuhalten, bissolange wir euch einsmaels zu schuldigem geburlichen gehorsam gebracht."
An die gemeine Bürgerschaft und die Sechziger sandte der Herzog eine Abschrift des Schreibens, damit "Ihr oder die gennigen, so Ihr zu der behueff aus Ewerm mittell verordenen mögen, gemelten Rath dahin vermugett, das sollichem unserm gebott unnd bevelich inn bestimbter Zeit wurckliche Folge geschehe." 1 )
Da der Rath dem Befehle keine Folge leistete, so wurde das herzogliche Schreiben an die Bürgerschaft und die Sechziger, das vorläufig zurückgehalten worden sein muß, abgesandt und am 23. Juni dem Valentin Niemann bei dessen Abwesenheit ins Haus gebracht. Am 25. Juni kamen die vornehmsten Bürger auf das Rathhaus und baten, nachdem ihnen der Rath das von ihm erhaltene herzogliche Schreiben hatte vorlesen lassen, um Zusammenberufung der ganzen Bürgerschaft; der Rath antwortete ihnen, Kittel werde sich rechtfertigen, und wenn der Herzog sich dadurch nicht zufriedenstellen lasse, so solle alsdann die Gemeinde versammelt werden; die Bürger beriefen sich aber darauf, daß das Schreiben an die ganze Bürgerschaft gerichtet sei, und der Rath versprach ihnen die verlangte Zusammenberufung. 2 ) Am folgenden Tage, Juni 26, kam die Bürgerschaft in der Marienkirche zusammen; als sie durch 20 Abgesandte die schon oft gestellte Forderung nach Bestätigung des Bürgerbriefes erneuerte, sah sich der Rath zum Nachgeben veranlaßt. 3 ) Am 27. Juni beriethen sich der Rath und die Sechziger, von denen aber nur 36 Personen erschienen waren, über die fürstlichen Schreiben. Valentin Niemann erklärte, die Bürger hielten dafür, daß es besser sei, Kittel zu entlassen, als die Stadt in Gefahr zu setzen; "solchen heren is


|
Seite 159 |




|
ein dorp woll so leff, alß ein prediger, wowol he den fursten nicht wil tho na treden." Herr Thomas Gerdes antwortete, der Rath habe nicht erwartet, "dath men sich dorch solck ein schrivent solde vorferen laten," man wolle appelliren und protestiren, "dath solch schrivent wedder recht und alle billicheit is," "se sindt fursten und heren, moten dennoch Recht dohn," und Herr Hans von Herverden fügte hinzu: "wen men sich alletidt solde mith einem breve schrecken laten, wolde mehr inriten; men wodt sich up dat Recht lenenn; wen men jo wolde bitter wesen, werden se dennoch mith erenn Rederen radtschlagen unnd bedencken, dath se nicht mith eigener gewalt konen vorfaren; wen de Radt mith den Borgeren eins is, werden se, de fursten, sich wol bedencken." Alsdann wurde Appellation eingelegt. Die Sechziger erklärten, ihrerseits seien sie mit der Ansicht des Rathes einverstanden, hätten aber versprochen, ohne Vorwissen der Gemeinde nichts Beschwerliches zu unternehmen, und bäten deshalb, etwa hundert Bürger berufen zu lassen. Am Nachmittag begehrte Klaus Hamel, daß Kittel, nachdem man ihm die Briefe vorgelesen, sich in ihrer Gegenwart verantworte: "Wo he unschuldich befunden wurde, willen de Burgere vor ehne schriven und ehne entschuldigen." Demgemäß erschien Kittel und erklärte: "Was he geredet, wolde he wol vor dem gantzen Romischen Rike reden; de schulde sind gemaket, van den burgeren mith gudem willen angenamen; dath Gott der overcheit ock den Burgeren wille wisheit geven, dath de schulde (betalet werden); he disputeret nicht, wer de schulde gemaket;" "de overcheit solde mith eren stipendiis thofreden sin." Dann fragte Herr Thomas Gerdes die anwesenden Bürger, ob einer von ihnen etwas Anderes in Kittels Predigt gehört hätte; die Bürger antworteten, sie wüßten Kittel nicht zu beschuldigen, bäten aber, daß die beiden anwesenden Prediger sich darüber aussprächen. Demgemäß erklärte Lukas Bacmeister, Professor und Pastor zu St. Marien, es sei in der Predigt nichts Anderes geredet, als was billig und recht sei; wenn Kittel gesagt habe, Herren und Fürsten sollten bedenken: Estote contenti stipendiis vestris, so sei das im Allgemeinen und der ganzen Gemeine zum Besten geredet; Matthäus Flege, der bei der Predigt nicht zugegen gewesen war, bestätigte es, daß Lukas Bacmeister bei seinem Heimgange zu ihm gesagt habe, Kittel habe eine ernste, treue Ermahnung gethan, daß die Mittel gefunden werden möchten. Zum Schlusse - es war darüber 11 Uhr geworden - einigten sich der Rath und die Bürgerschaft dahin, daß von beiden Seiten an den Herzog geschrieben, daß das Schreiben der Bürgerschaft dem Rath und dessen Schreiben den Sechzigern mitgetheilt und daß beide Schreiben einem Boten anvertraut werden sollten,


|
Seite 160 |




|
"de dar düchtich tho wehre, up dath es der Stadt nicht tho schaden kome." 1 )
Die alsdann an Herzog Ulrich erlassenen Schreiben sind uns leider nicht erhalten. 2 ) In demjenigen des Raths vom 29. Juni hatte dieser erklärt, er habe Kittel in Gegenwart von Bürgern vor sich gehabt und über das, was er gepredigt, eine Erklärung von ihm entgegengenommen, nach welcher die fürstliche Reputation durch seine Rede ungeschmälert geblieben sei; im Uebrigen berufe er sich den herzoglichen Drohungen gegenüber auf den Erbhuldigungsrevers und seinen vom Kaiser erhaltenen Geleitsbrief. Darauf erwiderte der Herzog am 7. Juli, 3 ) er habe dem Rath nicht befohlen, Kittel zu vernehmen, "viell wehniger euch zu richtern oder obmennern in sollicher unser sachen verordnett noch erwelett," und rühmlicher wäre es gewesen, wenn er seinem Befehle gehorcht hätte; was er zugesagt und verschrieben, habe er bisher gehalten und werde er halten; wenn aber der Rath meine, sich mittels des kaiserlichen Geleitsbriefes seinem schuldigen Gehorsam zu entziehen und sein eigener Herr zu sein, so solle ihm das "wills Gott, nicht gelingen, welches ir auf den fahll ewers beharrlichen ungehorsams ungezweifelt zu spuren haben werdet;" er wolle deshalb nochmals seine Befehle, "ehe wir die in denselben euch gedrawethe rechtmeßige straffe geburlich zu exequiren befehlen, hiemitt ernewertt, auch zu volziehung derselben euch abermals acht tage befristet haben, damitt unsere gemeine und ir zu spurenn, das wir euch zur ungepur zu ubereylenn nicht gemeynnt;" "unnd wollen wir auch hirauf keyner andern antwurdt oder wechsellschrift, dan alleyn ewers geburlichen gehorsams von euch gewertig seyn." In der gleichzeitigen Antwort des Herzogs an die Bürgerschaft und ganze Gemeine 4 ) heißt es, er habe zwar gern vernommen, daß nach einem löblichen Statut der Stadt Rostock Niemand ohne richterliches Erkenntniß beschwert werden dürfe, habe aber auch aus dem Vorgehen des Raths befunden, "zu den Zeiten, alß sie unsere christliche prediger unnd Kirchendiener Doctorenn Tilemannum Heshusium und M. Petrum Eggerdes ohne vorgehende rechtliche erkantnuß bei nechtlicher weile tyrannischer weise vonn ihrem weib


|
Seite 161 |




|
und kindern, haab unnd guttern, ja auch in der heiligen Nacht, von ihren betten durch ihre bottele und haschere auß unser Stadt Rostock hinwegkfuhren lassen," daß der Rath sich weniger nach den löblichen Statuten, als nach seiner eigenen Willkür richte; was zur Entschuldigung Kittels von ihnen angeführt werde, wolle er ihnen alß gut gemeint nicht verübeln, doch habe er über das, was Kittel geredet, so gründlichen Bericht erhalten, daß er sich mit ihm wegen einer Sache, an der er ebensowenig zweifeln könne, wie es zu leugnen sei, daß er alle Prediger in Rostock Judasbrüder gescholten habe, in langwierige Disputation nicht einlassen könne.
Am 9. Juli "hora 10. sundt avermals breve van den fursten gelesen worden van Dr. Kittels wegen, ein de Radt und 1 de gemeine Borgerschop." Die Sechziger waren zugegen. Herr Bernd Pawel erklärte, die Schreiben seien durch die Neider des Raths, insbesondere Dr. Boucke, veranlaßt; es handle sich dabei nicht um Dr. Kittel, sondern um das Patronatsrecht an der Marienkirche und um die Universität, und eine Zusammenberufung der Gemeine sei unnöthig, da die Sechziger von ihr bevollmächtigt worden seien. Die Sechziger erwiderten aber, die Sache sei zu wichtig, als daß sie sich allein darin zu handeln getrauten, und da sie darauf bestanden, daß die Gemeine versammelt werden müsse, so gab der Rath wenigstens soweit nach, daß er die vornehmsten Bürger zu berufen versprach. 1 ) Am folgenden Tage, Juli 10, erschienen "de vornemestenn unnd vormogenstenn Burgerenn" auf dem Rathhause, aber die Aelterleute der Aemter waren nicht gekommen, weil nicht alle Amtsbrüder gefordert worden seien, und die Anwesenden baten, daß der Rath die ganze Gemeine berufen möge. Am Nachmittag entsandte der Rath Herrn Henning Beselin und einen Rathssecretair zu den Sechzigern und ließ sie bitten, sich noch einige Tage zu gedulden, "do etliche gesecht, se weren darmith thofredenn, etliche woldenn idt bespreken; do under anderen Jochim Krakow uthgefarenn unnd gesecht van Dr. Kittel: Latet ehne lopen vor dusent Duvel, so werden wi siner quidt; welches he noch einmall repeteret." 1 ) Am 13. Juli erschienen Abgeordnete der Sechziger vor dem Rath und erklärten, wenn die Gemeine wegen des fürstlichen Schreibens nicht durch den Rath zusammenberufen würde, so müsse sie von sich aus zusammentreten; Bürgermeister Pawel erwiderte ihnen jedoch, da Herzog Ulrich nicht einheimisch sei, so habe die Sache keine große Eile, und der Rath, der auf das gemeine Beste verteidigt worden sei, werde Bedacht darauf


|
Seite 162 |




|
nehmen, was der Stadt zum Besten gereiche, und als die Abgeordneten sich zwar damit entschuldigten, daß die Frist bald abgelaufen sei, aber auf der Zusammenberufung bestanden, bemerkte Dr. Röseler: "Desse heren mogen men upstahn und geven den Burgerenn dath Regiment." 1 ) Am folgenden Tage, Juli 14., trat die Bürgerschaft auf die Berufung der Sechziger hin zusammen; das herzogliche Schreiben wurde verlesen, und im Auftrage der Bürgerschaft kam Klaus Kröger mit andern Sechzigern zu Bürgermeister Hans von Herverden ins Haus und sagte ihm: "So der Stadt schade wedderfore dorch de vorsumenisse, dath de furste nicht beantwordet, wolden se entschuldiget sin und den schaden bi dem Rade wreken bi live und gude. 2 )
Während dessen hatte der Rath Gesandte an Herzog Johann Albrecht abgeordnet und um seine Vermittelung bei Herzog Ulrich bitten lassen. Am 15. Juli 3 ) schrieb der Herzog an seinen Bruder, 4 ) er erachte es für billig, daß Dr. Kittel vorher gehört werde, "damit sich niemandt uber uns mit billigkeit zu beclagen, allß soltenn wir unerhorter sachen Jemandt zur unbilligkeit beschweren, wie wir dann E. L. auch nicht zu thun gesinnet wissenn," und bitte ihn deshalb, den angedrohten Arrest auszusetzen bis zu einer Zusammenkunft ihrer beiderseitigen Räthe am 17. August zu Güstrow; "alßdann wollen wir samptlich Doctor Kittel vor uns bescheiden unnd seine entschuldiginge anhoren; do wir dieselb fur genugsam befinden, sol er sich in dieser Sachen derselbenn zu erfrewen haben; wo nicht, wollen wir zu E. L. tretten unnd die Sachen neben E. L. widder D. Kittel unnd diejenigen, so sich in seinem unbillichen furnhemen seiner annemen wurden."
Im Besitz einer Abschrift dieses Schreibens, ließ der Rath am 21. Juli die Sechziger vor sich kommen, warf ihnen vor, daß sie ohne seine Genehmigung die Bürgerschaft zusammenberufen und ihn durch Klaus Kröger hätten bedrohen lassen, und ließ ihnen, damit sie erführen, "dath mith allem flite dem dinge nagestanden," das herzogliche Schreiben vorlesen. Die Sechziger antworteten durch Johann Chriso, da Herzog Ulrich sein Schreiben an die ganze Gemeine gerichtet habe, so hätten sie diese damit bekannt machen müssen, und


|
Seite 163 |




|
was Klaus Kröger belange, so sei er damit nicht allein von ihnen, sondern von der ganzen Bürgerschaft beauftragt worden; wegen der Besendung Herzog Johann Albrechts aber und der Erwirkung seines Schreibens dankten sie dem Rath für dessen Fleiß. Der Rath erwiderte ihnen, die früheren Sechziger hätten auch wohl fürstliche Briefe erhalten, sie aber niemals erbrochen, sondern ihm übergeben; sie sollten bedenken, "dath solch schrivent men gereikt thom fuhr anstickende." 1 )
Dann ruhten die Verhandlungen wegen Kittels bis zum 10. September. Das von Herzog Johann Albrecht für den 17. August in Aussicht genommene Verhör war nicht zu Stande gekommen. Am 10. September aber ließ Herzog Ulrich die zum Jahrmarkt nach Güstrow gekommenen Rostocker Bürger praeter omnem exspectationem mit Arrest belegen. 2 ) - Am folgenden Tage, September 11, verhandelte der Rath mit den Sechzigern "van der Arresteringe der Kramer unnd Wandtschnider tho Gustrow wegen D. Kittels." Herr Hinrich Goldenisse erklärte, er wolle an Herzog Ulrich, der nach Bützow gereist sei, Gesandte abordnen; "men hedde sich wol verhopet, idt solde solches vorbleven sin; men hefft geschreven umb Geleide vor D. Kittel, hefft nichts erlangen konen; es iß jo nicht billich, dath solches vorgenamen werde; es iß nicht Kittel alleine, sondern der Stadt friheit daranne gelegen; wo de Borger und Radt nicht einich, wert der Stadt groth ungefall weddervaren; men wil sich erbeden, dath D. Kittel moge tho vorhoer kamen." Darauf antwortete im Auftrage der Sechziger Klaus Kröger, er habe Bürgermeister Hans von Herverden im Auftrage der Bürger gesagt, daß der Rath das herzogliche Schreiben nicht so leicht nehmen möge; sie hätten es gern gesehen, wenn die Sache beigelegt worden wäre; "wile idt nicht geschein, weten sich de Borger nicht in dessen handel intholaten; hebben se sich vorsumet, mogen sich daruth riten." 1 ) Am 12. September entgegnete Hinrich Goldenisse auf dieses Vorbringen, der Rath sei sich wohl eines bessern Trostes versehen gewesen; die arrestirten Güter ließen sich wohl befreien, wenn aber dabei der Stadt Gerechtigkeit Abbruch geschähe, "willen se vor Gott entschuldiget sin." Der Wortführer der Sechziger, Valentin Niemann, erwiderte aber, auch die Bürger seien sich von dem Rath eines Andern versehen gewesen; "es sindt breve gekamen van den fursten; de sindt ere erffheren; hebben ehnen gehuldiget und geschwaren; achtens darvor, dath he derwegen desulven der gemeine vorlesen moge; dath ein Radt nicht hefft gestaden willen,


|
Seite 164 |




|
wowol sich de gemeine aller billicheit stedes verholden;" "es hebben de gemeine ein beschwer gehabt, dat se so geringe vam Rade geholden werden; verhopen, de Stadt werde middel finden, dath es desser Stadt ahne schaden und nachdeil geschege;" "so schade daruth wedderfaret, hefft ein Radt tho bedencken, dath des ein Radt orsake hefft." Als er endlich noch hinzusetzte, man sage, der Arrest sei dadurch verursacht, daß Kittel zu erscheinen aufgefordert und nicht erschienen, entgegnete ihm Bürgermeister Goldenisse, man habe auf Geleit gewartet, und als dann Niemann meinte, aus dem Ausbleiben desselben hätte man merken müssen, "dath es nicht gudt gemeint," sah sich Goldenisse veranlaßt, den Sechzigern "vortruweder wise" die Ansicht des Rathes über die Angelegenheit folgendermaßen darzulegen: "Wen D. Kittel schon vorloff krege, konde he angenamen werden van hertoch Johanß Albrecht, so sit he in der kercke, in concilio, in Universität und in dem Theologen=Huse." 1 )
Noch am 11. September hatte der Rath den Bürgermeister Thomas Gerdes, den Syndikus Dr. Kommer und den Rathsherrn Laurentius Breide an Herzog Ulrich abgeordnet. 2 ) Am 12. September schrieb er "an unsere gesanten, de an hertoch Ulrich affgeferdiget," er sei einverstanden mit dem von Bürgermeister Gerdes gemachten Vorschlage, "dath bi f. g. van wegen juwer overen unnd oldestenn ... in underdenicheit gebeden werde, dath up genochsame Caution unnd Borgeschop de guder uth der arrest gnedichlich loßgelaten werden mogen beth up wider Rechtes erorteringe." Am 13. September schrieben die Gesandten aus Güstrow, 3 ) bisher hätten sie sich vergeblich um Audienz bemüht; es scheine ihnen aber, daß durch die Bitterkeit, die man zeige, der Rath nur in Schrecken gesetzt werden solle, und es sei vielleicht gut, wenn die Bürgermeister einigen vornehmen Bürgern auf der Schreiberei eröffnen lasse, "weil die fursten der erbhuldungh, reverßen, keiserlichem geleit und anderen ewren privilegien, auch den gemeinen rechten hierin zuwidder handelten, daß ihr auch die zugesagte sum geldes ihnen zu halten und zu geben nicht schuldig weret, wollet auch den fursten und den edeleuten, so an euch vorwiesen, dieselbe widder auffsagen," denn wenn auch vielleicht die Bürger damit nicht einverstanden sein würden, so wäre es doch gut, daß das Gerücht davon, "dan die post von euch nicht


|
Seite 165 |




|
feyret," den Landesherren kund würde, damit sie erkennten, "daß E. E. W. so gar kleinmütig nicht weren und Ihr F. G. mit dem unbilligen dinghe bey euch nichts erhalten konnen;" eine Verstärkung der Erbitterung sei nicht zu befürchten, "dieweil sie nicht großer sein kan." Von demselben Tage datirt noch ein anderes Schreiben der Gesandten, 1 ) in dem sie berichten, der Stadtvogt habe heute 7 Uhr auf Befehl des Herzogs "die Faust von unß genommen," d. h. sich Einlager von ihnen versprechen lassen; 2 ) sie rathen deshalb, an der Gesandtschaft, die sie an Herzog Johann Albrecht abzuordnen empfehlen, weder einen Bürgermeister noch Dr. Röseler theilnehmen zu lassen, "dan sie gleichesvals mochten besatet werden, E. E. W. dadurch allen rath zu entzihen."
Am 14. September bat der Rath Herzog Ulrich, daß er Kittel mit Rücksicht auf seine schwangere Frau und seine kleinen Kinder gestatten wolle, bis Ostern in Rostock zu bleiben und mit Unterlassung der Predigt seine Lehrthätigkeit auszuüben. 3 ) An demselben Tage legte er wegen der Arrestirung seiner Gesandten Protest und Appellation an das Reichskammergericht ein. 3 ) Am 15. September warnte er die Sechziger wegen der Zuträgereien über die hiesigen Verhandlungen nach Güstrow und meldete Herzog Johann Albrecht das Geschehene. 4 ) Am 16. September antwortete der Herzog aus Ribnitz, 5 ) er habe Herzog Ulrich um Auskunft ersucht, ob er "allein des gemelten Doctor Kittels halbenn oder sonsten wegenn anderer ursachen die ewern arrestiren und zu Güstrow anhalten thut." Am 19. September dankte ihm der Rath und bat ihn, sich auch seiner verstrickten Gesandten, "de doch vermöge der Volcker Rechte sancti und in allen Historien sekerheit gehatt" und des arrestirten Bürgergutes annehmen zu wollen. 3 ) Am gleichen Tage übersandte er der Gemahlin Herzog Ulrichs, Elisabeth von Dänemark, eine Supplikation der Bürger, deren Gut arrestirt worden, und bat auch sie um ihre Verwendung. 3 ) Am 25. September dankte er Herzog Johann Albrecht für dessen Versprechen, "dath I. F. G. unsers Rades verwantenn und unser Borger guder bestrickinge unnd arresteringe tho Gustrow in gnadenn ingedenck sin willen." 3 )
Auf ein uns nicht erhaltenes Schreiben des Raths an Herzog Ulrich erwiderte dieser am 23. September aus Dargun. 5 ) es sei


|
Seite 166 |




|
unnöthig gewesen, "unß der gemeinen beschriebenen, viel weiniger der Volcker Rechte im selbigen fhall so gar geschicklich zu erinneren, dhan wir unß derselbigenn und waß uns denenn nach zu thuenn gepueren will, Godt lob, selbst woll wissen zu berichtenn;" der Rath hätte besser gethan, wenn er "auß den allegirten rechtenn einen andern subtileren verstanndt" gefaßt "und unns so groblich das jenne, waß euch als getreuwenn Unnderdhanen uns zu leisten gebuert, nicht hettet auffgeruckt;" er als Landesfürst und gebührliche Obrigkeit habe an den Rath "pilliche unnd gleichmeissige beveliche außgehen lassenn; wie dennselben aber vonn euch alß denn getreuwenn underthanen gehorsamet und nachgelebett, geben wir euch selber zu bedencken." An Herzog Johann Albrecht berichtete der Herzog am 28. September aus Dobbertin 1 ); "Daß wir furnemblich der ursachenn halbenn derselben Rostocker kramer und kauffleute gueter zu Gustrow angehalten, arrestiren unnd in kummer nemen lassen, daß der Rath unser Stadt Rostogk etliche unsere ernste und rechtmessige beveliche wegen der erlaubung D. Johan Kittels, ires Theologen, ein Zeitlang vorechtlich gehaltenn, unß auch etlich Silber und geldt, in unser Closter Dargun gehorig, dazu sie doch mit nichtenn befugtt, kurtz vorschiener Zeit in kummer genommen unnd uns dasselbig biß daher uff unsers Amptmans zu Dargun erfordern nichtt folgenn lassen wollen. Unnd obwoll gemelter Rath zu Rostogk denselben D. Kitteln vor E. L. und uns zu rechttlicher verhoer zu stellen sich erbotten, so achten wir doch derselbigen verhoer gantz und gar von unnöten sein, denn wir dermassen unparteiliche kundtschafftt und genugsamen beweiß uber seine, D. Kittels, wider E. L. unnd uns ausgegossene schmeewortt kurtzer tage durch unsern Rath Jochim Woperßnouw inn der Stadt Rostogk von furnemen Burgern, auch des Radts eigenen Professorn unnd andern auffnemen lassen, daß wir deß Kittels handlung numher fur notori und unzweiffelhafftich achten mussen." Dieses Schreiben sandte Herzog Johann Albrecht September 30. aus Dobbertin an den Rath, indem er schrieb 1 ): "Dieweill wir nun die sachenn unnd derselben umbstende dermaßen geschaffenn befundenn, daß wir darin allerdinge mit S. L. einig sein mussen, alß will die notturfft erfordern, sofer(n) ir wollett, daß sollicher Arrest widderumb solle cassiret unnd auffgehoben wherden, daß ir S. L. vorigen unnd itzigenn schreiben pariret."
Ein Schreiben des Raths an Herzog Ulrich vom 30. September ist uns wieder nicht erhalten. Etwa gleichzeitig meldete der Rath dem Professor Dr. David Chyträus, er habe fünf seiner Mitglieder dazu abgeordnet, die bisherigen Streitigkeiten mit den herzoglichen


|
Seite 167 |




|
Professoren zu vergleichen und einen Vertrag zu vereinbaren, durch welchen die herzoglichen und die räthlichen Professoren Ein corpus würden, und bat ihn, dies den Herzögen mitzutheilen, sie um die Abordnung versöhnlich gestimmter Professoren zu ersuchen und sich bei ihnen für Dr. Kittel zu verwenden. 1 ) Am 2. October antwortete Herzog Ulrich, 2 ) sobald der Rath und Dr. Kittel seinen Befehlen parirt haben würden, so werde er sich des Arrestes wegen gebührlich erklären; er erwarte aber, daß der Rath es mit seinem Erbieten wegen der Universität ernstlich meine und die Sache nicht, wie bisher, nur hinhalte; auch sei es billig, daß der Arrest des Klostergutes, "mit wellichem arreste ir uns denn wegk zu unserm furgenommenen arrest gezeigett," ebenfalls aufgehoben werde, und was die Bitte um eine Verlängerung des Aufenthaltes für Kittel anlange, so solle dieser hiermit auf 14 Tage in sicheres Geleit genommen sein. Darauf antwortete der Rath October 3, da er aus des Herzogs Schreiben erkenne, "dath I. F. G. nicht anders tho bewegenn edder cho beweikenn, dann Doctor Kittel vann hir solle, so konenn J. F. G. in underdenicheit nicht vorentholdenn, dath desulve Doctor Kittel am negstvergangenn Donnerdage (October 1) umb soven Uhrenn fro in ein ander furstendohm verreiset unnd wechgetagenn is;" auch das Darguner Klostergut, das auf Begehren einiger Bürger, "denen de Monneke schuldhafftich," arretirt worden, solle hiermit freigegeben werden und "mith der Universitett handelinge in wedderkumpft D. Davidis willen wi vortfarenn."
Am 2. October begehrten die Sechziger zu wissen, ob der Rath geeignete Maßregeln wegen des Arrestes ergriffen habe; widrigenfalls müßten sie schreiben, da der Herzog ohne ihre Schuld auch auf sie erbittert sei. Der Rath antwortete Ihnen, "wath de unhulde des fursten belanget, se sollen sich wol vorsehen mith dem schrivende an de fursten;" die vorigen Sechziger hätten die fürstlichen Briefe niemals weder erbrochen, noch von sich aus beantwortet; "de 60 schriven, be Radt schrifft, daruth de fursten mercken, dath 2 Regimente in der Stadt sindt, dath de 60 regeren, item de Radt regeret ock; dardorch is es vorgenamen, dath sunst wol were nableven;" der Arrest sei ihm von Herzen leid und er habe nicht unterlassen, vor der Reise nach Güstrow zu warnen; Kittel sei jetzt fort, aber es sei zu befürchten, daß es nicht Kittel sei, um den es sich handele. 3 )


|
Seite 168 |




|
Am 5. October schrieb Herzog Ulrich aus Dargun an den Rath, 1 ) sein Schreiben besage wohl, daß Dr. Kittel entfernt sei, enthalte aber keine Entschuldigung der bisherigen Nichtbefolgung seines Befehls, "fur wellichem unleugbarenn ungehorsamb unnd mutwillige wiedersetzung wir dann vonn euch geburlichenn abtrag habenn und wissenn wollenn;" auch wegen der Schmach, die ihm der Rath durch die Arrestirung des Darguner Klostergutes angethan, fordere er Buße, und was die Universität anbelange, so begehre er Auskunft darüber, "wie und wasgestalt ir zu unvorkurtzung unnd vorbehaltens darinn unser furstlichen habendenn gerechtigkeit zu vorfharenn bedacht." Am 9. October theilte der Rath den Sechzigern den Inhalt dieses Schreibens mit, indem er erklärte, er wolle sich darüber nicht allein, sondern mit ihnen und mit der ganzen Gemeinde berathen; "wenn einicheit were in der Stadt gewesen, were solches nicht geschein, und wurden mith der wise eigener, alße de buhr up dem dorpe." Die Sechziger antworteten, daß Kittel so lange hier behalten worden sei, habe der Rath zu verantworten, und die Arrestirung des Klostergutes sei nicht ihre Sache. Darauf erwiderte der Rath, er sähe es noch nicht für gut an, daß Kittel abgeschafft würde, sondern habe ihn nur des Friedens wegen verreisen lassen; es sei besser, daß das arrestirte Gut aus Stadtmitteln bezahlt werde, als daß man die Privilegien der Stadt kränken lasse; "dewile denne ein Radt keinen anderen trost bekamen kan, modt de Radt de gantze gemeine darumb thosamenforderen." 2 )
Am 11. October antwortete der Rath an Herzog Ulrich, 3 ) Kittels bisheriges Verbleiben in Rostock sei dadurch verursacht, daß derselbe, da der Herzog die verba formalia, durch die er sich beleidigt fühle, in sein Schreiben nicht aufgenommen, "vor dem sittenden Rath unnd umbstehendenn Borgerenn mith velenn wordenn ercleret, dath he keinem Burger edder Burenn nie sin leventlanck in ehre unnd gelimp mith sinem Redenn effte Predigenn, Gott loff, gegrepenn, vell weiniger dath he solches I. F. G. solde gedahnn hebbenn," daß er sich erboten habe, sich vor den Herzögen zu rechtfertigen und daß ihm von Herzog Johann Albrecht ein Verhör zugesagt worden sei; Abtrag oder andere Strafe sei der Rath deshalb ebenso wenig schuldig, wie Buße wegen des auf das Klostergut gelegten Arrestes, und was die Universität betreffe, so "willen wi nha geholdener besprake mit


|
Seite 169 |




|
unsern Borgern mitt I. F. G. Professorn up underhandelung des Concilii im Namen der hilligen drefalticheitt tho handeln unß undernhemen, mith der trostlickenn hopeninge, dadt Gott de Almechtige einmal sine gnade vorlenen werdt, darmith de saken ock tho godenn wegenn unnd mittel gerathen. Unnd dewile dann tho solckem lofflicken werck unsere angeholdene gesanten tho Gustrow deinstlich und hoch van noden, so bidden whi underthenig, I. F. G. willen desulven nicht lenger upholden unnd aldar up grotern unkosten liggen latenn, darmit de handell der Universitetten desto schluniger moge fohrgenamenn und gefordert werden."
Ebenfalls am 11. October schrieb Herzog Ulrich aus Dargun an die Sechziger und die ganze Gemeinde, 1 ) er habe in glaubwürdige Erfahrung gebracht, daß der Rath ihnen einbilden wolle, der von ihm verhängte Arrest bezwecke nicht die Abschaffung Kittels und die Wohlfahrt der Universität und der Kirchen, sondern die Unterdrückung der Jurisdiction und der Privilegien der Stadt; er wolle deren Privilegien und Freiheiten mit nichten schmälern, verlange aber, daß auch der Rath "unser gerechtigkeiten in dießen sachenn, sonderlich die Gottes Eere unnd der kirchenn unnd Universitet lobliche bestellung belangenn, mit nichten nemen, sonstenn werdenn wir unvorbeygenglich verursacht, den Ernst wider sie zu gebrauchenn."
Am 13. October war die Gemeinde versammelt. Der Rath berichtete ihr, "dath vergangen nacht were ingrepe geschein in der Stadt gudere," und daß man vermuthen müsse, die Stadtgüter sollten eingezogen werden; "dewile se nicht alle thosamen und vele nodige puncte van noden tho beradtschlagen, sal morgen de gantze Burgerschop thosamenkomen." Die Bürger begehrten eine andere Verwaltung der Stadtgüter, empfahlen bestimmte Maßregeln zu deren Schutze und baten, daß ihnen gestattet werde, durch eine Gesandtschaft bei den Fürsten Erkundigung darüber einziehen zu lassen, "worumb F. G. solche ungnade jegen de Stadt vorgenomen, up dath de ahne schaden mochte affgeschafft werden." 2 ) Am 14. October antwortete der Rath, die Abordnung einer Gesandtschaft könne er nicht für räthlich erachten. Die Bürgerschaft beharrte aber auf ihrer Ansicht; da man weitere Maßregeln befürchten müsse, "wen de handelung van der Universitet nicht vor sich ginge," so erachtete sie es für rathsam, "dath de Radt, ock de Borger, dartho huten desse Stunde ... erweledew, de de artikel mit den furstliken professoren under de handt nemen;" durch die


|
Seite 170 |




|
Gesandtschaft sollte um eine Anordnung landesherrlicher Kommissarien nachgesucht werden. 1 ) Der Rath setzte darauf eine neue Versammlung auf den nächsten Tag an: "Den 15. dach Octobris de Borgere wedder thosamen geeschett, sindt nicht gekamenn; derwegen vorwiset beth up eine ander tidt." 2 )
Auf das Schreiben des Raths von October 11 antwortete Herzog Ulrich am 21. October, 3 ) er sei nicht gemeint, sich mit ihm in weitere Disputation einzulassen; über die verba formalia zu streiten, sei überflüssig, die realia, die er gegen ihn und Kittel anzuführen habe, seien die, daß Kittel die Prediger Judasbrüder gescholten und daß der Rath Heshusius und Eggerdes aus der Stadt habe weisen lassen; wenn der Rath ihm den gebührlichen Abtrag verweigere, so müsse er durch seinen Fiskal gegen ihn procediren lassen; daß der Rath die Arrestirung des Darguner Klostergutes vertheidigen wolle, könne ihn nicht genug verwundern, und wenn er den von ihm selbst angeordneten Arrest mit derselben in Beziehung bringen wolle, so lasse er sich darin Nichts vorschreiben, "ir werdett auch unßers verhoffens die negist kommende Jair umb eine gleicheit inn allenn dingenn mit unns nicht streiten, sondern unnß woll gutt sein lassenn, das wir ewere hern und ir unsere Underthanen seidt, und da ir gleich ein anders understehnn whurdet, whurde euch doch sollichs angehenn unnd einen bestandt habenn, alß wan sich der knecht uber seinen Heren oder demselben gleich zu setzen understehenn wolte;" wenn endlich der Rath sich wegen der Universität "ewer altenn gewonheitt nach zweiffelhafftich unnd dunckell erclerett, daß ir im namen der heiligen dreifaltigkeit solliche handtlung furnemen wellett, mussen wir also one ernennung einiger gewissen zeit im ungewissenn auf dießmal beruhen lassen;" die verstrickten Gesandten aber werde er nicht eher freigeben, bis "derselbige punct der Universitet halben der gepuer einsmhals von euch erledigt."
Der Empfang des Schreibens Herzog Johann Albrechts von September 30 wird die Ursache davon gewesen sein, daß Kittel Rostock zeitweilig verlassen hatte. Der Rath hatte ihm diesen Vorschlag gemacht, und von Kittels Anerbieten, die Stadt binnen 12 Tagen mit Frau und Kindern gänzlich zu verlassen, nichts wissen wollen; October 1 war er, curru senatus vectus, nach Greifswald gezogen und hatte bei Dr. Jakob Runge Aufnahme gefunden. 4 ) Auf seine


|
Seite 171 |




|
Anzeige an den Rath, daß er am 10. November nach Rostock zurückzukehren gedenke, antwortete ihm dieser November 7 abrathend und mit dem Ersuchen, sich noch 14 Tage gedulden zu wollen. 1 ) Am 10. November aber traf Kittel dennoch in Rostock ein; der Rath ließ ihn durch Lucas Bacmeister ersuchen, sich auf 14 Tage nach Barth zurückzubegeben, Kittel aber antwortete, er habe seine schwangere Gattin nicht länger allein bleiben lassen können, wolle hier bleiben und, unschuldig wie er sei, alles Kommende Gott anheimgeben.
Eine längere Abwesenheit Kittels von Rostock hatte der Rath deshalb gewünscht, weil er hoffen durfte, in der Zwischenzeit die Streitsache wegen der Universität beilegen und dadurch Kittels Angelegenheit günstiger gestalten zu können. Da die Bürgerschaft am 15. October seiner Zusammenberufung keine Folge geleistet hatte, war er am 16. October mit den Professoren in Verhandlungen getreten 2 ) und hatte ihnen am 19. October einen Vergleichsentwurf überreichen lassen. 3 ) Am 21. October hatte er Kittel eine Abschrift dieses Entwurfs übersandt und ihn gebeten, sich noch eine Zeitlang zu gedulden und ohne sein Vorwissen nicht nach Rostock zu kommen; "wi vorsehen uns noch, Gott, dem Juwer Erwerden unschuldt, ok der gantzen Stadt, kundtbar, werdt Juwe Erwerden und uns bistahn und de sake entlich darhen wenden, dath der gerechte uth siner verleumbder andragent und vordruckinge erreddet und wedder upkamen werde." 4 ) In der That nahmen die Verhandlungen einen günstigen Verlauf: am 9. December konnte der Rath den Professoren versprechen, die vereinbarten Punkte zu besiegeln, sobald sie bei den Herzögen die Freigebung der Gesandten und des arrestirten Gutes, sowie auch die Aussöhnung mit Kittel bewirkt haben würden. 5 ) Vermuthlich an diesem Tage schrieb er "an unsere verstrickten gesandten tho Gustrow", 4 ) er habe den Bürgermeister Heinrich Goldenisse, den Syndikus Dr. Röseler und die Rathsherren Albrecht Dobbin und Franz Quant abgeordnet, um mit den fürstlichen Professoren wegen der Universität zu verhandeln, und diese seien bereit, das ihnen heute übergebene Concept eines Vertrages an Herzog Ulrich zu überbringen und ihn um die Freigebung der Gesandten und des arrestirten Gutes zu bitten.


|
Seite 172 |




|
Der Vereinbarung gemäß reisten die Professoren David Chyträus, Johann Bouke und Johannes Bocerus zu Herzog Ulrich nach Güstrow, und die Gesandten wurden zeitweilig in Freiheit gesetzt; 1 ) da aber December 24 ein Schreiben des Herzogs Johann Albrecht in Güstrow eintraf, durch welches Herzog Ulrich um die Festhaltung der Gesandten bis zu seiner Ankunft ersucht wurde, so mußten sie von Neuem Einlager geloben, und nur der Syndikus Dr. Kommer wurde auf Bitten der Professoren freigegeben. 2 ) Ueber die Verhandlungen mit Herzog Ulrich wegen Kittels haben wir keine Nachricht; dahingegen wird uns berichtet, daß Herzog Johann Albrecht, zu dem Simon Pauli und Johannes Bocerus nach Schwerin reisten, auf deren Gesuch wegen Kittels sich nicht einließ. 3 ) Am 8. Januar 1563 wurden jedoch Bürgermeister Gerdes und Rathsherr Breide auf 14 Tage freigelassen, und am 3. Februar erklärten die Herzöge, 4 ) wenn Kittel entlassen sein und Rostock verlassen haben würde, so wären sie wegen der drei angehaltenen Rathspersonen und wegen des arrestirten Bürgergutes sich "alsodan ferner gebührlich in Gnaden zu erkleren geneigt" und wollten auch Kittel "auf sein Ansuchen einen ordentlichen Verhörtagk ansezen und ihm dasjenige, dazu er in Ausfund seiner berühmten Unschuld im Recht befugt, nicht weigern noch abschneiden."
Die Nichterfüllung der von ihm gemachten Vorbedingungen wird den Rath veranlaßt haben, mit der Ratifikation des Vertragsentwurfes hinzuhalten. Die Herzöge verlangten deshalb die Rückkehr des Bürgermeister Gerdes und des Rathsherrn Breide nach Güstrow; durch die Vermittelung der herzoglichen Professoren erlangten sie aber am 23. März ihre Entlassung, nachdem sie ihr Versprechen, auf Begehren zurückkehren zu wollen, durch die Bürgschaft von sechs Güstrowschen Bürgern hatten bekräftigen lassen müssen. 5 ) Gleichzeitig (März 23) aber forderten die Herzöge unter Androhung weiterer Maßregeln den Rath und die Bürgerschaft auf, die Universitätsangelegenheit binnen vierzehn Tagen zu erledigen. 6 )
Am Ostersonntage (April 11) traf ein Befehl der Herzöge ein, daß die Professoren den neuen Rektor aus der Zahl der herzoglichen


|
Seite 173 |




|
Professoren, und daß, falls dies nicht geschehe, die herzoglichen Professoren einen andern Rektor aus ihrer Mitte erwählen sollten. Simon Pauli und Johannes Bocerus überbrachten diesen Befehl dem Rektor Laurentius Kirchhof; der Rektor benachrichtigte den Rath, der Rath die Bürgerschaft, und das Concilium beschloß in Gegenwart von Abgeordneten beider Körperschaften, keine Neuwahl vorzunehmen, bevor nicht der Ausgleich vollzogen worden sei; der Rath aber versprach, die Bürgerschaft in der nächsten Woche in dieser Angelegenheit zusammenzuberufen. 1 )
Am 27. April erschienen außer den Sechzigern nur wenige Bürger, und es konnte nichts in der Universitätssache gethan werden. Zum 29. April wurde deshalb die Bürgerschaft bei ihrem Bürgereide und bei Androhung von Strafe zusammenberufen; als ihr aber der Rath anderweitige Forderungen abschlug, weigerte sie sich, wegen der Universität mit ihm zu verhandeln und forderte ihm die Schlüssel der Stadt ab. Am folgenden Tage, April 30, beschloß die Bürgerschaft, einen Vierundzwanziger=Ausschuß zu ernennen, der mit dem Rath zusammen der Stadt vorstehen sollte, die Ausführung des Beschlusses wurde aber durch die Gemäßigteren bis Mai 4. aufgeschoben. 2 ) Am 3. Mai wandten sich die Sechziger mit der gesammten Gemeinde durch Vermittelung der Professoren an die Herzöge, indem sie versicherten, die Verzögerung sei nicht von ihnen, sondern von dem Rathe verschuldet, und die Herzöge gewährten daraufhin nochmals eine Frist bis zum 12. Mai. 3 )
Am folgenden Tage, Mai 4, verhandelte die Bürgerschaft fruchtlos mit dem Rath über ihre früheren Forderungen; als sie nach dem Schlusse der Verhandlungen dem Syndikus Dr. Röseler Einlager ankündigte, erklärte ihr dieser, er stehe unter akademischer Gerichtsbarkeit, und kümmerte sich nicht um den Befehl. Am 5. Mai beschloß die Bürgerschaft aufs Neue die Einsetzung eines Vierundzwanziger=Ausschusses und verlangte vom Rath, daß er ihr einen neuen Bürgerbrief bestätige; der Rath forderte Mai 6 eine vierzehntägige Bedenkzeit, die Bürgerschaft gab ihm aber nur eine Frist bis zum 10. Mai. 4 ) Nach Ablauf derselben forderte die Bürgerschaft (Mai 10) die Anerkennung ihres Rechtes, Einlager über die Mitglieder des Raths zu verhängen, und als der Rath diese verweigerte, schlossen ihn die Bürger in der Schreiberei ein. 5 )


|
Seite 174 |




|
Am folgenden Tage, Mai 11, baten die Sechziger zwei Gesandte des Raths zu Wismar, die Mai 9 nach Rostock gekommen waren, zu sich in die Marienkirche; um 11 Uhr wurden, nachdem der Rath hereingeführt worden und die fürstlichen Professoren erschienen waren, die wegen der Universität vereinbarten Artikel, die Formula Concordiae 1 ), von allen Seiten bestätigt, und die Professoren wurden sowohl vom Rath wie von der Bürgerschaft gebeten, sich wegen der arrestirten Güter, wegen der Gesandten und wegen Kittels bei den Herzögen zu verwenden; dann aber wurde der Rath wieder in die Schreiberei geführt und erst Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr in Freiheit gesetzt, 2 ) nachdem er in die von der Bürgerschaft verlangte Anerkennung ihres Rechtes zur Verhängung eines Hausarrestes, jedoch unter dem Vorbehalt seiner Zustimmung in jedem einzelnen Falle, hatte willigen müssen. 3 )
Vorher - wir wissen nicht wann - hatte Kittel auf Anrathen seiner Freunde die Gemahlin Herzog Ulrichs, Elisabeth von Dänemark, um ihre Vermittelung gebeten; sie hatte aber geantwortet, bei dem heftigen Unwillen ihres Gemahls über ihn vermöge sie Nichts in seiner Sache zu thun. 4 ) Jetzt, nach Bestätigung der Formula Concordiae, begab sich David Chyträus, da Herzog Ulrich nach Holstein zum König von Dänemark gereist war, zu Herzog Johann Albrecht, und dieser gestattete es, daß Kittel sich in Rostock aufhalten dürfe. 5 ) Kittel war damals gerade von Rostock abwesend und hielt sich einige Wochen in Berlin auf. Während dessen traf in Rostock ein Urtheil des Reichskammergerichts ein, daß die Herzöge mit Recht wegen Kittels Betheiligung an dem Lüneburger Theologen=Convent ihn aus der Stadt gewiesen und wegen des Ungehorsams des Raths die Güter arrestirt und die Gesandten verstrickt hätten. 6 ) Inzwischen wird aber Kitttel bereits eine anderweitige Stellung angenommen haben, denn als er nun auf Befehl des Königs von Dänemark durch dessen Hofprediger Mag. Paulus Noviomagus an die Universität zu Kopenhagen berufen wurde, lehnte er diesen Ruf ab. 7 )
Am 21. Mai hatte der Rath auf die Drohung der Sechziger hin, daß sie widrigenfalls die gemeine Bürgerschaft aufs Neue


|
Seite 175 |




|
berufen müßten, die Bestätigung des neuen
Bürgerbriefes wegen der Verhängung eines
Hausarrestes
 . annehmen müssen.
1
) Am 28.
Mai drangen die herzoglichen Professoren auf die
Ausführung der Formula Concordiae; der Rath und
die Bürgerschaft verlangten aber, daß ihnen
vorher die arrestirten Güter und die Urkunden,
welche Bürgermeister Gerdes, Syndikus Dr. Kommer
und Rathsherr Breide hatten ausstellen müssen,
zurückgegeben würden, und die Professoren
erwiderten, Herzog Ulrich weigere sich dies zu
thun, bevor nicht die Formula Concordiae
ausgeführt und die herzoglichen Professoren in
das Concilium aufgenommen sein würden. Am
folgenden Tage, Mai 29, einigte man sich nach
langen Verhandlungen dahin, daß der Rath und die
Bürgerschaft die Formula Concordiae vollziehen,
die Professoren aber sich ihnen verpflichten
sollten, die Urkunden von Herzog Ulrich zu
erwirken und sie nach ihrer Reception in das
Concilium dem Rathe auszuliefern. Am 31. Mai
reisten daraufhin David Chyträus und
Bartholomäus Clinge nach Güstrow und erhielten
von Herzog Ulrich die verlangten
Urkunden.
2
)
. annehmen müssen.
1
) Am 28.
Mai drangen die herzoglichen Professoren auf die
Ausführung der Formula Concordiae; der Rath und
die Bürgerschaft verlangten aber, daß ihnen
vorher die arrestirten Güter und die Urkunden,
welche Bürgermeister Gerdes, Syndikus Dr. Kommer
und Rathsherr Breide hatten ausstellen müssen,
zurückgegeben würden, und die Professoren
erwiderten, Herzog Ulrich weigere sich dies zu
thun, bevor nicht die Formula Concordiae
ausgeführt und die herzoglichen Professoren in
das Concilium aufgenommen sein würden. Am
folgenden Tage, Mai 29, einigte man sich nach
langen Verhandlungen dahin, daß der Rath und die
Bürgerschaft die Formula Concordiae vollziehen,
die Professoren aber sich ihnen verpflichten
sollten, die Urkunden von Herzog Ulrich zu
erwirken und sie nach ihrer Reception in das
Concilium dem Rathe auszuliefern. Am 31. Mai
reisten daraufhin David Chyträus und
Bartholomäus Clinge nach Güstrow und erhielten
von Herzog Ulrich die verlangten
Urkunden.
2
)
Am 3. Juni trat endlich die Formula Concordiae dadurch in Wirksamkeit, daß die acht herzoglichen Professoren in das Concilium, das vorher, da die Professur der Medicin vakant war, nur aus sieben räthlichen Professoren, Kittel eingerechnet, bestanden hatte, aufgenommen wurden. "Da aber Kittel fortzugehen gedachte und Herzog Ulrichs Gnade nicht erlangen konnte," so wurde Lukas Bacmeister von Rath und Bürgerschaft an seine Stelle gesetzt und mit den herzoglichen Professoren zugleich recipirt. Der nunmehr zum Rektor erwählte David Chyträus trat dieses Amt als erster herzoglicher Professor am 7. Juni an. 3 )
Im Kampf mit den Herzögen auf der einen, mit der Bürgerschaft auf der andern Seite, war der Rath erlegen. Die Herzöge hatten die Gleichberechtigung ihrer Professoren mit den räthlichen erlangt, hatten die Befolgung ihrer Befehle durchgesetzt und hatten den Rath gezwungen, wenn auch nicht ausdrücklich auf das Recht zur Ernennung eines Superintendenten zu verzichten, so doch zum zweiten Male die Person des von ihm ernannten Superintendenten fallen zu lassen.


|
Seite 176 |




|
Am 10. Juni ersuchte der Rath Herzog Ulrich um sicheres Geleit für Dr. Kittel, seine Familie und sein Gesinde, "weill D. Johann Kittell von Rostoch in andere furstenthumb furderlichst seiner gelegenheit sich uffzumachen und mit weib und kindern anderswo sich wieder heuslich niederzusetzen gentzlich entschlossen." 1 ) Darauf antwortete Herzog Ulrich, 2 ) ein Geleitsbrief sei unnöthig, da Niemand von den Seinen Dr. Kittel schädigen werde.
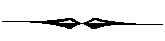


|
Seite 177 |




|



|


|
|
:
|
IV.
Ein Rechnungsbuch des Klosters Dobbertin.
Von
F. v. Meyenn
~~~~~~~~~~
I m Archive des Klosters Dobbertin wird ein Rechnungsbuch aufbewahrt, das um 1491 beginnt und mit dem Jahre 1872 abschließt, das also einen Zeitraum von nahezu vier Jahrhunderten umfaßt.
Die Aufzeichnungen sind während der katholischen Zeit von der jeweiligen Priorin oder Unterpriorin gemacht worden; nach der Reformation von der Domina, und zwar fast durchweg eigenhändig.
Ihr Inhalt besteht, so lange als Dobbertin ein katholisches Nonnenkloster war, vornehmlich in einem genauen Nachweise über die eingelaufenen und ausgeliehenen Kapitalien; späterhin, d. h. nach der Umwandlung des Klosters in ein Stift für adlige Jungfrauen, bildet die Aufnahme der Conventualinnen und deren Ausscheiden - durch Heirath oder Tod - den Hauptgegenstand der Aufzeichnungen.
Mit Genehmigung der Frau Domina v. Schack zu Dobbertin habe ich von dem Rechnungsbuche eine Abschrift nehmen dürfen, die zum größeren Theile - und zwar von 1491 bis 1800 - nachstehend buchstäblich getreu und unverkürzt abgedruckt ist.
Wenngleich dem Rechnungsbuche, wie allen Aufzeichnungen ähnlicher Art, eine gewisse Einförmigkeit anhaftet, so wird man seine Veröffentlichung dennoch nicht mißbilligen, da es eine Fülle wertvollen Materials, namentlich zur Geschichte vieler meklenburgischer Adelsfamilien, enthält.
Auch überliefert uns das Rechnungsbuch in ununterbrochener Folge von 1491 an die Namen der Priorinnen und Unterpriorinnen, die uns bisher allein nach einem Verzeichnisse, das aus dem königlich


|
Seite 178 |




|
dänischen Archiv zu Kopenhagen stammt, bekannt waren. (Vergl. Meklenb. Jahrb. XXII, S. 137 und 171/72.) Nunmehr sind wir im Stande, die Kopenhagener Angaben, die hinter dem Rechnungsbuche als Anlage abgedruckt sind, auf ihre Zuverlässigkeit prüfen zu können.
Dyt nascreuen hebben
de priorne Acre 1 ) vnde Sue 2 )
mede in de Santmytte 3 ) lecht.
Item in dat erste ij mark de gaff Hans Keyman tho Malschow 4 ) vor sick vnde sine vrouwe do se vnse broderschop kosten ! , desset quam mede in den Tzammyt 3 ) do wy de watere efte see vor pandeden.
Item hundert mark, de de priorne Alheyt Kremon vnde Abele Oldenborch iij iare vor vnseme slutende vnsem erwerdygen praelaten her Johan Tune tho louen lent hadden, de he ok lede in den Tzammit.
Item hundert mark, de de seckmesterschen Soffia Veregghe vnde Soffia Plesse van eres ambachtes wegen by sick hadden, de se Helmet van Plessen lent hadden, de vnsem praueste her Johan Thune 5 ) to queme vth tho gheuende, de gaff he vns wedder vp xvj guldene na vnde iij ß., de sin noch by em; desse xvj guldene lede wy dartho van den houetstolen de Hans van Kollensche vthgaff.
Item 1 mark gaff Jochim Lewetzow tho Merchow vth van Hans Cleuena wegen to Gustrow borghermester, de vns Grubenhaghensche in ereme testamente vormals gheuen hadde.
Item 1 mark de Ghilow tho Gustrow krech, dar pacht vor stot in deme Tzammitte, desse 1 mark neme wy ok van Kollenschen houetstole.
Item 1 mark kreghen de gadeshus lude tho Kowalke 6 ), dar ok pacht vor stunt in deme Tzammite, desse 1 mark neme wy ok van Kollenschen houetstole.


|
Seite 179 |




|
Item 1 mark krech Clawes Pinnow tho Gustrow, de gaff Hans Linstow to Bellin vth van Otte Wossen weghen.
Item 1 mark de Soffia Veregghe vnde er suster Mette vthleden in dat olde dorp tome Tzammytte.
Item 1 mark de kreghen de heren to der parrekerken tho Gustrow, dar pacht uor stoth, de gaff mester Andreas vt van des couentes wegen de de priorne Metken van den Werder vnde Alheyt Kremon deme goltsmede Tonnies siner vrouwen vader vp rente dan hadden.
Item twe hundert gulden krech Hermen Pinnow, de wy kreghen van Jacob Cluwen van erue gude van Katrine Cluwen weghen.
Item ij hundert mark de Lutke Moltke vthgaff van Wendelke Cleuena weghen.
Item hundert mark myn xxv van Anna Hanen weghen;
de vyf vnde twyntych marck sin noch by vnsen praueste her Johan Tune.
Item iij hundert mark van Anneke Brokmans weghen.
Item ij hundert mark van Katrine Bremer wegen.
Item hundert mark van Hinrick Bremer weghen, dar wy lyffghedynk vor geuen.
Item hundert mark van Mylekeschen weghen.
Item hundert mark van Jochim Vlotouweschen weghen.
Anno domini dusent v
C
vnde ij hebbe wy
pryorne Saphia Veregge vnde Anna Detzyn
entfangen van Corth Ror iij hundert marck, de he
gaff vor syne dochter Ylseben; ij hundert marck
lede wy in der Kollen g
 t, dat drudde hundert Hans Lynstow
to Gartze.
t, dat drudde hundert Hans Lynstow
to Gartze.
Item hundert mark gaff Segebant van Ortzen vor syne dochter Caterinen.
Item ij hundert marck gaff Hynrick Cleuena vor syne dochter Annen.
Item iij hundert gulden van Katerina vnde Margrete Oldenborch, desse sostehalff hundert mark krech Pryggeniszescke dar for settede se vns dat velt to Krossyn. 1 )
Item hundert gulden gaff Johan Gantz here van Potlyst vor syne beyden dochter Agnes vnde Ipolyten, de lede wy pryoren vorberort in der Kollen gut tome Ludershagen.


|
Seite 180 |




|
Item hundert gude mark gaff Hynrick Wesebom in syneme testamente.
Item xl mark de vns Dyderick Kock gaff in syneme testamente.
Item xxx mark de vns Clawes Hanske gaff, dyt hebbe wy in Weltzen gelecht.
Item hebbe wy pryoren Sophya Veregge vnde Anna Detzyn entfangen hundert mark van Magdalena Quatfasel vnde xxv mark van Katrine Cluwen wegen; dyt is gelecht in Dertze vnde Stralendorpe.
Item 1 mark de her Tun vnse prauest mante van Hans Szamy[t] van wegen syner suster Katrinen; ock gaff Otto Kropelyn 1 mark vor syne dochter Magdalenen moder erue. Item noch xxx mark van der Retzstorpe testamente; quemen in Dertze vnde Stralendorpe.
Item 1 mark van Sophya vnde Mette Veregghen wegen, ock 1 mark van Mechtyldys vnde Katrine Rethen wegen; desse hundert mar[k] quemen in Jochym Kollensken gut to Ludershagen vnde Hoppenrath.
Item gaff Otto Kropelin hundert gulden vor syne dochter Sophyam.
Item ij hundert mark de vns Jochym Flotowske gafF.
Item hundert gulden van vnseme holtfagede Clawes Parsouwen, de he gaff in testamento, dar fan quemen 1 gulden tome kelke.
Item xxx gude mark de Goldenbage vthgaff.
Item x gude mark van her Nycolaus Kroger wegen.
Item hundert mark de vns Cort Ror gaff in eyn testament vor syck vnde syne husfrowe.
Item v gude mark gaff vns Kort Bonowske.
Item lxij Strl. mark van Anna Parsouwen wegen.
Item x gulden de vns Pynnow de vaget van Luptze gaff in syneme testamento.
xx mark van suster Gretke Beneken.
x mark van Katerine Erdwane wegen.
Item 1 mark de vns Mathyas Grabow gaff in eyn testament vor syck vnde syne husfrouwe.
Item iij mark van Stesten vnde synen olderen.
Item iij mark van Hans deme bruwere.
Item hiir hebbe wy tolecht v mark myn wen
 hundertt marck; dyt bauenschreuen
hebbe wy pryoren Sophya Veregge
hundertt marck; dyt bauenschreuen
hebbe wy pryoren Sophya Veregge


|
Seite 181 |




|
vnde Anna Detzyn gelecht in Cytlyste in Reymar Passouwen gut dar wy pechte boren.
Item gaff Achym Lynstow vth hundert mark de he vns schuldych was dar wy pacht vor bort hadden.
Item borde wy lx mark van Katrine Bremer ereme gordel, dar lede wy xl mark tho van older pacht dath ith thosamende hundert gulden worden, de hebbe wy dan Henneke Kropelyn, de hefft syner grotemoder erue vorsettet to Lutken vnde to Groten Grabow vnde tome Ludershaghen.
Item gaff Achym Fyneke hundert gulden vor syne dochter Annen, de borde de bischop her Johan Thun pie memorie, de krech (de krech) Hermen Kotze, dar he vns pechte vorsettede tho Lutken Dersyn.
Item gaff Jochym Stralendorp hundert gude mark vor syne dochter Annen.
Item gaff Cort Ror hundert vnde xxx gulden vor syne dochter Polyten.
Item gaff Lutke Hane hundert gulden vor syne dochter Annen.
Item gaff er Hynrick Plesse vnde er Clawes Lutzow hundert gulden vor syne frundynne Heygelwygys Lutzouwen.
Item gaff Hans Lynstouwen frouwe van Bellyn hundert gulden vor ere beyden dochter Dorothea vnde Anna Velroggen.
Item gaff Henninck Hobe van Wastkow hundert gulden vor syne dochter Agnes.
Item gaff Krassow hundert mark vor syne steffdochter Anne Glowsen.
Item 1 mark van Elyzabet Sassen weghen.
Item lxxv mark gaff Hermen Kremon vth, dar quemen xxiiij aff tho Mette vnde Katherine van Reten. 1 )
Item xx mark de vns Achym Fyneke gaff in syneme testamente.
Item xx mark van Gretke Hyntzen vnde x mark van Ilsebe Morleuer den donaten.
Item iiij hundert gulden hadde vnse prauest vppebort van houetstolen de wy by vns hadden.
Hyr lede wy tho xxxiij gulden van vnser pacht.
Desse bauenschreuen xj C gulden hebbe wy pryoren Sophya Veregge vnde Anna Detzyn gelecht in der yan der Osten gut


|
Seite 182 |




|
Item hadde wy by vns hundert gulden, de Jochim Vlotowske gaff in ereme testamente.
Item iij C mark gaff de bormester Herbrant Smyt vor syne dochter Annen.
Item ij hundert gude mark entfanghen van Anna Neghendanken wegen.
Item Henninck Hobe van Gnogen hundert gulden vor syne broderdochter Elyzabet Hoben.
Item hundert gulden gaff Hermen Kremon ver syne dochter Dortheen.
Item hundert mark Stral. gaff Henninck Detzynske vor er dochter Elyzabet.
Item voranttwerde vns Achym Passow vj hundert gulden de he vorouert hadde.
Item hundert gulden van Anna Thun weghen.
Desse bauenschreuen xij C vnde xxxiij gulden hebbe wy pryoren Sophya Veregge vnde Anna Detzyn gelecht in Lanken, der Tralouwen gut.
Anno domini xv C vnde ix hebbe wy prioren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch entfanghen ij hundert gulden van Hynrick Wangelin, de he gaff vor syne beyden dochter Margreten vnde Lucien.
Item iij hundert gulden van Anna Brockmans weghen.
Desse vyff hundert gulden hebbe wy lecht in Clawes vnde Ewalt Oldenborghes gut.
Item gaff Achim Grabow hundert gulden vor syne dochter Annam.
Item hundert gulden van vnsen vicarien.
Item gaff Reymer Pressentyn hundert gude mark vor syne dochter Catherinam.
Item gaff Hynrick Kropelin hundert gulden vor syne dochter Annam.
Item iij hundert gulden gaff Hennek Rauen vor syne dre dochter Margareten, Catherine vnde Dorotheen.
Item gaff Jochim Stralendorp hundert gude mark vor syne dochter Ermegart.
Item vyff hundert gulden de Achym Passow vorouert hadde van etlyken jaren.
Hijr hebbe wy tholecht lxvij gulden van vnser pacht.
Dusse bauenscreuen xiij hundert gulden hebbe wy pryoren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch gelecht in Lanken,


|
Seite 183 |




|
Item hebben wy entfanghen hundert mark van Dorothea. Vredelant eres vader erue.
Item hundert mark van Hynrick Kollen testament.
Item iij hundert van Margarete vnde Catherina Oldeborch erer moder erue.
Item vorantwerde vns de domina Sophya Veregge 1 gulden.
Item ij hundert gulden van Anna Brockmans wegen.
Item xxxj mark van Sophya vnde Mette Vereggen weghen.
Item hundert mark de Maryn vthgaff vor vnse hus to Robel.
Item hundert mark van Anna vnde Sophya Maryn moder erue.
Item iiij hundert mark geuen de Kollen vth, de se sculdych weren.
Desse bauenscreuen viij hundert gulden sin gelecht in Clawes Hanen gut to Kuchchelmysse.
Item vorantwerde vns Achim Passow vyffhundert mark de he vorouert hadde.
Desse vyffhundert mark hebbe wy pryoren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch gelecht in Greben, 1 ) der Tralouwen gut.
Anno domini xv C vnde xj gaff vth Jacob Weltzyn (vth) dusent vnde vyffhundert gulden, darvan krech Achim Lynstow van Lutkendorpe vij hundert gulden, dar wy pacht vor boren tho Clocksim, vnde vj hundert gulden krech Achim Detzyn, dar wy pacht vor boren to Wangelin vnde Remmerdeshagen. 2 )
Item gaff Henninck Hobe van Wastkow hundert gulden vor syne dochter Elyzabet, de sint wedder lecht in der Hoben gut tho Babbin. 3 )
Item gaff Wedyghe Moltzan hundert gulden vor syne dochter Margreten, de worden lecht in Prytze der Moltzane gut.
Item gaff Achim Bulow hundert gulden vor syne suster Sophyam.
Item gaff Jochim Stoysloff hundert mark vor syne dochter Annen.
Desse iij hundert mark sin gelecht in Lutke Oldenborges gut tome Klaber.


|
Seite 184 |




|
Item anno domini xv C vnde xiiij hebbe wy prioren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch entfanghen vyffhundert mark mastgelt.
Item xv gulden gaff Hermen Kremon in sineme testamente.
Item xv gulden de he vns schuldych was.
Item hundert gulden de Albrecht van der Schulenborch gaff vor syne dochter Annam.
Item iij hundert mark de de Vlotouwen vanme Stur vthgheuen.
Item xxx gulden van der pacht tor Matritze.
Item iiij hundert mark de Baltze[r] Tralow vthgaff.
Item xx gulden olde pacht.
Desse viij hundert gulden hebbe wy prioren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch gelecht in Lalendorpe der Lynstouwen guth.
Item gaff vns Ewalt Fredelant xxv gude mark de sint gelecht in den Badendick.
Item gaff Helmolt van Plesse vth iiij hundert gulden de vns her Hynrick syn broder was schuldych gebleuen.
Item ij hundert gulden de Achim Passow vorouert hadde, dar lede wy to hundert gulden van vnser pacht.
Desse vij hundert gulden hebbe wy prioren Anna Detzyn vnde Catherina Oldenborch gelecht in der van der Osten guth.
Item in deme suluen jar gaff Jasper Weltzynsske vth twe hundert vnde vefftych mark.
Item gaff Jacob Weltzyn hundert mark vor Cristina vnde Anna Weltzyn.
Item 1 mark gaff Achim Dupow vor syne dochter Marg[r]eten.
Item hundert mark gaff Clawes Kremon vth.
Item hundert mark gaff Achym Cleuena vor syne dochter Margreten.
Desse iij hundert gulden hebbe wy prioren Anna Detzyn vnde Anna Metzkow gelecht in Jochym Oldenborges guth.
Anno domini xvij gaff Jochym Detzyn aff iij hundert gulden dar wy pacht vor bort hadden to Wangelin.
Item ij hundert mark yan Ilsebe Sassen vnde Assele Smedes.
Item ij hundert gulden van me houetstole van Tzammytthe;
- desse vj hundert gulden geue wy Achim Kotztzen vor den Derssze vnde Stralendorpe -; scholden em noch en hundert gulden geuen hebben, dat gaff he vns na vor syne dochter Margreten.


|
Seite 185 |




|
Item in deme suluen jar hadde wy by vns ij hundert gulden, de vns Achim Passow vorantwerdet hadde.
Item hundert gulden de Achim Grabow vor syne dochter Dorten gaff, de quemen in Cristoffer Oldenborghes guht.
Item Anno domini xv C vnde xviij hadde wy by vns ij hundert gulden, de vns Achim Passow van ver jaren vorantwerdet hadde, desse quemen in Ghert vnde Clawes Lynstouwen guth.
Item gaff Clawes Kremon aff hundert gulden, de he schuldych was, de worden wedder lecht in Achim Cremons guth.
Item in deme suluen jar borde wy hundert gude mark van Hans Brockmans testamente.
Item xvij gude mark van Ewalt Fredelandes testamente. Desse sint ghekamen in de Sacristie to deme gronen gulden sammith.
Anno domini xv C vnde xix gaff vns Achim Passow ij hundert gulden mastghelt, worden lecht in Hinrick Hanen gut van Basdow.
Item vefftich gulden krech Gert Linstow.
Item gaff vns vnse confessor her Peter Henninghis hundert gulden in syneme testamente.
Item gaff Achim Oldenborch aff hundert gulden.
Item hundert gulden de Bertolt Hoghe gaff vor syne dochter Catherinen.
Item gaff Lutke Restorp aff hundert mark.
Item gaff Reymer Passow hundert gude mark vor syne dochter Annen.
Item gaff Hinri(n)ck Kropelin hundert gude mark vor syne dochter Alheydis.
Desset ghelt bauen schreuen quam in Cristoffer Oldenborges gudt dat wy prioren Anna Detzen vnde Catherina Oldenborch dar in leden.
Anno domini xv C vnde xx borde wy van Gert vnde Clawes Linstouwen viij hundert gulden, dar wy pacht vor bort hadden to Lalendorpe.
Item v hundert mark de vns de prauest her Hinrick Molre vorantwerdet hadde.
Van dessen bauenschreuen ghelde kreghen Baltzer vnde Achim Weltzyn ix hundert gulden vnde Parssowske van der Czene 1 ) iij hundert mark dar wy pechte vor boren tor Czene.


|
Seite 186 |




|
Anno domini xv C vnde xxij vorantwerde vns vnse prauest verhundert mark vnde v gulden.
Item hundert gulden de her Vlrick vamme Haue 1 ) vor syne dochter Elyzabet ghaff.
Item hundert gude mark de Helmolt van Plesse gaff in syneme testamente.
Item xxx gulden de Hinrick Kone gaff in synem testamente.
Desse verhundert gulden quemen in Bernt Prestins gudt de wy prioren Anna Detzyn vnde Anna Metzkow em vorantwerdeden.
Anno domini xv C xxiij gaff Reymer Passow aff twehundert gulden van den v C gulden dar wy pechte vor bort hadden to Czytlyst.
Item gaff Reymer Kremon 1 gulden.
Item gaff Vyt van Retem hundert mark vor syne broder dochter Margareten.
Item gaff Achim Linstow de junghe aff ij hundert gulden vnde xij, dar lede wy tho lxx gulden olde pacht.
Van dessen v hundert gulden krech Clawes Hane van Kuchchelmysse iij hundert vnde lxxx gulden, vnde Achim van der Osten ij hundert gulden de [de] prioren Anna Detzyn vnde Anna Thun en vorantwerdeden.
Item 1 mark, de Achim Hagenow deme kloster tosede, sint noch by em, gyfft dar jarlyke pacht vor.
Anno domini xv C vnde xxiiij hebbe wy pryoren Anna Thun vnde Catherina Ortzen 2 ) (hebbe wy) gebort van Clawes Cremone hundert gulden;
van den hundert gulden neme wy xxv dar wy mosten vnsen prauest mede vorlegghen, do he ersten quam, dar he hoppen vnde molt moste vor kopen vnde de murluden vor lonen vp Johannis do he inne wyset worth, do em nichtes nicht van gelde van synem vorforen her Hynrick Molre vorantwerdet, vnde hebben wy lxxv gulden by vns beholden.
Anno domini xv C vnde xxv hebbe wy prioren vorborort ghebort van Achim Passouwen iij hundert gulden, de vns syn broder Reymer schuldych was, dar wy pechte vor borden to Cytlyste.


|
Seite 187 |




|
Item gaff Cort Butzow hundert gulden vor syne dochter Elyzabeth.
Item gaff Luder Bluchcher hundert gulden vor syne dochter Margareten.
Item gaff Wedyghe Moltzan aff hundert gulden vor syne dochter Margareten, dar wy so lange hadden pechte vor bort to Prytze.
Item gaff Paschen Detzyn 1 mark vor syne dochter Annam.
Item dar lede wy to de lxxv gulden van deme houetstole den Clawes Kremon vthgaff.
Desse souenhundert gulden bauen schreuen hebbe wy wedder anghelecht in Henninck Barldes 1 ) guth to Czytlyste.
Item in deme suluen jar gaff Kersten Pren hundert gude marb vor syne dochter Margareten, de wy wedder anghelecht hebben in Lubbetzyn, Ke[r]sten Prens guth.
Anno domini dusent v hundert vnde xxvij hebbe wy pryoren Anna Thun vnde Catherina Ortzen entfanghen van Hynrick Kotzen ij C vnde 1 gulden, dar dat closter pechte vor bort hadde to Dersyn.
Dat eyne hundert gulden wort gedan Cort Butzouwen, dar wy pechte vor boren tho Poppendorpe.
Dat ander hundert lede wy in Gotschalk Retzstorpes gut tome Boltze dar he suluen pacht vor gyfft.
Anno domini dusent vyjffhundert xxix entfenck vnse prauest her Mychel ij hundert gulden vp den vmmeslach tho Gustrow van den Tralouwen, dar wy pechte vor bort hadden van deme velde to Bekendorpe, desse ij hundert gulden moste vnse prauest hertoch Albrechte tho Gustrow fort vorreken, syne gnade dede em de thosage, wolde vns dar pechte vorsetten tor Below, men syne g[nade] betalde vns wo forsten plegen to betalende.
Anno domini dusent vyffhundert xxxj entfenge wy pryoren Anna Thun vnde Catherina Ortze iij hundert gulden van Passowsken van der Czene.
Item gaff vnse prauest her Mychel xv gulden.
Item x gulden Koneke imme testamente geuen.
Item xxv gulden gaff Achym Haghenow vor syne dochter Inghenborch.
Item hadde wy noch by vns 1 gulden de Hinrick Kotze vthgaff.


|
Seite 188 |




|
Desse iiij C gulden lede wy pryoren vorbenomed by den rat to Gustrow, de vns dar tynse vor geuen.
Anno domini dusent v C vnde xxxiiij entfenghe wy pryoren Catherina Ortzen vnde Ipolyta Gantz iij hundert gulden van den Kollen dar wy pacht vor bort hadden to Grabow vnde Ludershagen.
Item gaff Reymar Kremon hundert gulden vor syne dochter Ermegart.
Desse iiij C gulden lede wy pryoren vorbenomed by den rat tho Gustrow dar se ok wysse pechte vor geuen.
Anno domini etc. xxxv gaff Henninck Gamme hundert mark vor syne dochter Annen.
Item gaff Merten Prytzebur hundert mark vor syne dochter Annen.
Hyr lede wy tho hundert gulden mastgelt;
desse ij hundert gulden dede wy pryoren Catherina Ortzen J. Gantz 1 ) Philippus Pryggenitzen vp dat velt Krossyn.
Item hundert gulden van E. vnde Mag. Hagenouwen, hebben de vedderen noch by sy[ck], geuen pechte dar for.
Item de hundert gulden de Achym Bulow deme closter tosede vor syne dochter Annen, synt noch by em, gyff[t] dar jarlycke pechte vor.
Anno domini m. v C vnde xxxvj hefft Achym Passow geuen iij C gulden vor dath velt tho Kulpynstorp.
Item gaff Cort Butzow hundert gulden vth, dar wi pechte hadden vor ghebort.
Desse iiij hunderth gulden lede wy prioren Catherina van Ortzen vnde Elysabet Ror jn her Mathyas van Ortzen syn gut tomme Molenfelde. 2 )
Anno domini dusent vyff hundert xxxviij gaff Phylyppus Pryggenytze aff iiij C gulden, dar pechte.
Desse iiij hunderth gulden dede wy vorghemelten prioren Dyderick Moltzane, dar wy pechte vor boren in synem gude tho Rothspalck.
Anno domini dusenth v C xlvij gaff Jost P[r]eyn 3 ) vor syne dochter Margareten vefftich gulden.
Item gaff Hynryck Kotze vth vor Fredderyck Hanen vefftich gulden.


|
Seite 189 |




|
Desse hundert gulden hebbe wy prioren Catherina von Ortzen vnde Catheryna Prestyn ghelecht in Hans Lynstouwen gut to Lalendorpp.
Anno domini etc. xliiij gaff de rath van Gustrow aff iiij C gulden, desuluen lede wy prioren Katheryna van Ortzen vnde Anna Dessyn wedder in Crysostomus Moltzan guth tho Radem.
Anno domini etc. xlvij gaff de rath tho Gustrow iiij (C) gulden aff, desuluen lede wy prioren Catheryna van Ortzen vnde Catheryna Prestyn wedder in Jurgen Dessyn guth tho Remmerdeshagen.
Anno etc. lj gaff Cristoffer Gamme aff hunderth gulden, de wi prioren Ippolita Gans vnde Catherina Prestyn in Gottschalck Restorpp (in) synen egen hoff thome Boltze leden.
Anno domini ! gaff Marten Prytzebur syner dochter Ma[r]gareten Prytzebur 1 gulden.
Item lxx gulden de vns de confessor hadde geuen tom testamente.
Item gaff Margareta Domelow x gulden.
Item gaff Vlryck Moltzan vor Fredderyck Hanen vth 1 gulden, tho dessen lxxx gulden vth vnsem register lede wi dar to xx gulden, desse ij C gulden lede wi prioren Ippolita Gans vnde Catherina Prestyn in Hans Bulowen guth tho Prutze.
Item anno lviij gheuen Achym vnde Casten Pren vth hunderth marck vor ere selige suster Margareta Pren prouengelt.
Anno domini lx gaff Vyueentze Kerberch vefftich gulden vor syne suster prouengelth.
Dath hunderth gulden lede wy prioren Elysabeth Hobe vnd Catheryna Prestyn in Achym Battzeuytzen guth tho Lukow.
Item Anno lxj gaff Mathyas Grabowesche xxv gulden vor eyn testamente.
Eodem anno hebbe wy vorgemelten pryoren ock entfangen xxv gulden van Vlryck Detzyn syner dochter Emerencien prouen gelth.
Anno etc. lxij gaff Hans Lynstow tho Bellyn aff iiij gulden dar wy pechte hadden vor gheboreth tho Lalendorpp.
Anno lxiij gaff Reymer Prestynsche aff iiij C gulden.
De iiij C (hunderth) gulden, de Hans Lynstow aff gaff, hebbe wy pryoren Elysabet Hobe vnd Catheryna Prestyn ghedan Magistro Zymoni Lowbolth tho Gustrow vnd ij C gulden van


|
Seite 190 |




|
Reymer Prestynschen eren iiij C gulden dede wy em ock anno lxiij.
Eodem anno brochte wy pryoren Elysabeth Hobe vnd Ermegarth Stralendorp ethlyck suluer werck tho gelde, dar wy vor borden iiij C gulden viij gulden.
In deme suluesten jar gaff Jurgen Wardenberch j C gulden synen beyden dochtren, Margareten vnd Emerencien, prouengelth.
Eodem auno dede wy vorghemelten prioren vnssem houethman Jochym Klenowen iij C gulden myn twyntych van deme suluen gelde vnd der Wardenberge prouen gelth, dar he vorschryuynge heff[t] vp ghedan.
Ock gaff Hennynck Velthberch vefftych gulden syner suster Dorthe Veltberch, de vefftych gulden vnd xxv, de Ylryck Detzyn vor syne dochter Emerencien gaff, vnd de xxv, de Mathyas Grabouwesche in erem testamente gaff, vnd ij C van Prestynschen gelde vnd j C gulden van deme suluerwerke dede wy (pryoren) vorghemelthen pryoren Jochym Batzeuytzeschen, dar se vns wysse vorse[ge]lynge vp ghedan hefft anno lxv.
Anno eodem gaff Baltzar Tralow aff viij C gulden, dar he vns pechte hadde vor geuen;
Van den dede wy pryoren Elysabeth Hobe vnd Margareta Wanghelyn iiij C gulden Achym Hagenow tho Moderytz anuo lxvj.
Anno lxyij dede wy vorghemelten pryoren iiij C gulden van Tralouwen synen gelde Peter Kake tor Wysmar.
Anno eodem lede wy pryoren vorghemelt tho deme houetstol den Reymar Wynterfelth hefft alse nomelyck: v C hunderth vnd lxxij gulden, xxviij gulden, de acht vnde twynchtych hadde wy noch by vns van deme suluergelde, synth nu vj C gulden vul, de he hefft.
Anno eodem gaff Corth Restorp van Mostyn aff lxvj gulden, de lxvj gulden hebbe wy tho der tafeln nemen mothen dewyle se vns j C gulden vamme haue vorbehelden derhaluen dath se by Ipolita Gans eren tyden v C gulden vamme haue hadden geuen mothen in enem jare.
Anno lxvij feria sexta Reminiscere gaff Tralow vth eyn dusenth vij C vnd xxviij gulden, dar wy pechte hadde vor gheboreth tho Lancken;
dar van dede wy prioren Elysabeth Hobe vnd Margareta Wanghelyn v C Caryn Hagenowen, dar he vns vorsegelynge hefft vp ghedan ij.


|
Seite 191 |




|
Item hebbe wy Achym Schonnenberch ij C gulden gedan, synth vorsegelth.
Item j C van den suluyge heff[t] Achym Hagenow ghekregen tho den iiij C de he anno lxvj bequam, hefft nu v C gulden.
Item ij C gulden hefft Eggerth Trebbow dar van gekreghen, is wysse vorse[ge]lynge vp.
Item j C gulden krech Achym Dydten, synth ock vorsegelth.
Eodem anno in vigilia Judica dede wy vorghemelten prioren j C gulden deme kerckheren tho Lancken Caspero Samerfelth, is vorsegelth.
Dominica Palmarum dede wy suluygen prioren ij C fl. Hynryck Passowen tho Czydderke, synth ock wysse vorsegelth.
Item dede wy vorghemelten prioren van deme suluygen gelde j C gulden Luder Detzyn tho Daschow, is vorsegelth.
Noch dede wy Achym Rostken ij C gulden darvan in die Quasimodo, is vorsegelth.
Noch gaff Baltzar Tralow aff j C gulden nastendyger pechte, desuluigen pechte moste wy tho der tafelen wedder nemen.
Anuo eodem lxvij gaff Magister Zymon Lowbolth aff iij C van den vj C gulden, de he van vns entfangen hadde vndt jarlycke pechte dar vor enthrychtet.
De suluyge iij C fl. hebbe wy vorgemelten prioren Elysabeth Hobe vnd Margareta Wanghelin Jochym Batzewytzen selyger wedewen ghedan tho den vyffhunderth fl., de se alrede hadde, ßo hefft se nu viij C gulden;
de andren iij C fl. behelt Andreas (Andreas) Junckhere, heff[t] vorse[ge]lynge dar vpgedan.
Anno lxviij losede Johan Barner de pechte, de wi tho Bulow hadden tho borende, lede vns dar vor hunderth gulden, desuluigen hefft he vns vorsegelth, vj vor hunderth.
Anno lxix gaff Sthoylauesche xl gulden vth vor den acker, de deme closter geuen was tho jarlycken wyten brode vnd ij tunne bers, (van) in xxx jaren nychtes dar van; kume dath wi de xl [fl.J van er kunnen bekamen, dar se de breff mede losede.
Anno eodem feria secunda spiritus domini gaff Chrystoffer Hagenow erffgeseten tho Krossyn vefftych gulden dar he pechte jarlyckes hadde vor geuen, was syner vedderken Elysabeth Hagenow prouen.
Desse vefftych gulden vnd xl gulden, de de Sthoylauesche gaff, vnd x gulden vth de regyster namen hebbe wy priore[n]


|
Seite 192 |




|
Elysabet Hobe vnd Margareta Wanghelyn ghedan Hynryek Rapperoggen, borger tor Wysmar.
Anno domini lxxj geuen de Halue[r]stathe j C , de hebbe wi prioren Elysabeth Hagenow vnd Margareta Ker berch Wulff Langeschen dan.
Eodem anno worth Ilse Butzow vth deme kloster vorwyseth, moste er j C er prouen gelt myt vth deme kloster geuen, welck vus de houeman lenede.
Anno lxxiiij geuen de van Ortzen j C vnd lxx gulden; dath hundert geue vnssen houetman wedder, de lxx moste wy tho der tafel nemen dewyle noch ij C tynse nastendych bi den van deme adel is.
Eodem anno gaff junge Clawes van Oldenborch vth xxx gulden, dede wy vorghemelten prioren Chrystoffer Hanen tho Damerow, dartho noch xx gulden, de wy van den van Ortzen eren summen by vns hadden, hefft vorse[ge]lynge darvp ghedan.
Auno lxxv gheuen de Weltzynen Caspar vnd Hynnryck vth ix C gulden, darvan dede wy vorghemelten prioren Hans Restorpp tho Kammyn viij C , dar he vns vorschrynynge hefft vpp ghedan.
Dorthe Veltberch krech dar ock vefftych gulden aff er prouengelth.
Anno lxxiij brochte wy vorghemelten prioren tho gelde ethlyck suluerwerck, parlen vnde krallen, darv[an] entfenge wy dusenth vnd vj C gulden; de dusenth vnd v C gulden hebbe wy ghedan anno eodem vt tho van der Luhe, dar he vns jarlyke tynse vor gyff; xx fl. van der van Ortzen houetstol, de wi noch bi vns hadden, lede wy dartho; vefftych gulden van deme suluergel[de] dede wy deme buwete tho hulpe, vp dath se de murluden spysen scholden dath morgen vnde vesper broth, geven alle jserwerck vnd ock tho den fynstren tho hulpe.
Anno domini lxxiiij gaff Reymer Wynterfelt aff vj C , dar he vns jarlycke pechte hadde vor geuen.
Desuluygen hebbe wi prioren Elysabeth Haghenow Chym Klenowen, erffgesethen tho Klenow, ...
[Lücke bis 1576; ein Blatt.]
Anno domini lxxvj hebbe wy prioren dath j C , dath wy van der Weltzyne gelde noch by vns hadden, vnd ij C gulden, de Chrystoffer Sthoyseloff yor syne beyden dochter gaff, Anna vnd Elyßabeth, dar noch tho vefftych gulden, de Karyn Hagenow noch by syck hadde van syner vedderken Elysabeth


|
Seite 193 |




|
Hagenow, dar he jarlycke pechte hadde vor gheuen, dyth iiij C hebbe wy eodem anno ghedan Chym Moltzan tho Pentzelyn.
Anno lxxviij gaff Caryn Hagenow aff de v C gulden, dar he vns tynse hadde vor ghegeuen.
Eodem anno gaff Hans Wardenberch j C gulden vor syne suster Barbara Wardenberch.
Dho suluest gaff Hynryck Schonenberch j C gulden vor syne suster Margareta Schonenberch.
Eodem anno lxxviij gaff Chym Wa[n]ghelyn hunderth gulden prouengeldes syner suster Sophya Wangelyn.
De viij C gulden hebbe wy prioren Elysabeth Hagenow vnd Margareta Kerberch vnssem houetman Jochym van der Lue thostan laten, de vorth Elre Grabowen synth vorreketh der dannen haluen, hefft vns dar vorwyssynge myth synem segel vp ghedan.
Des suluesten jars gaff Chym Moltzan tho Pentzelyn aff iiij C gulden houethstols vnd Jurgen Below j C gu[l]den van Lubendorp wegen.
De
 C
hebbe wy Hans Kroger deme
golthsmede tho Gustrow ghedan, wyl vns dar wysse
vorschryuynge vp don.
C
hebbe wy Hans Kroger deme
golthsmede tho Gustrow ghedan, wyl vns dar wysse
vorschryuynge vp don.
Item eodem anno gaff Jurgen Below noch ij C gulden, dat ene eyn houethstol, dath ander in de tynse, dewyle wy noch lxxxx gulden jn den tynsen mosten myssen vnd alle dynck tho ij duren is, dar wy schuldych synth auer worden, hebbe wy dath j C gulden ock in de schulth nemen mothen.
Anno eodem gaff Werner Hane tho Baßdow j dusenth gulden van Lubendorp; dath j m gulden hebbe wy prioren vorghemelth deme rade tho Parchym ghedan, hebben wysse vorschryuynge dar vp entfangen.
Auno dosuluest gaff Chym Hane j dusenth gulden vor Lubendorp, de suluesten synth noch vortynseth by em, hebben wysse vorschryuynge myth borgen dar vp entfangen.
Eodem anno gaff Peter Kock ock j C gulden aff den iiij C , de he vor synen broder Mychyl Kock vthgyfft, dar van hebbe wy vorghemelten prioren Chym Rosteken vefftych gulden ghedan.
Anno 1 ) domini lxxix gheuen aff de Oldenborghe v C gulden vnde 1 gulden, der suluest gaff aff Corth Restorp thom Boltze vj C gvlden xliij fl.


|
Seite 194 |




|
vj C gvlden Cr[i]stoffer Lonstowsche to Lvtendorp 1 );
v C gvlden Vicke Stralendorp to Moderitz.
j C gvlden Wilhelm Below.
ij C gvlden Hinrick Schonenbarch.
ij C gvlden Achim Rostock tho Slone.
iij C gvlden Lvder Dessin.
lxvj gvlden Jvrgen vnde Corth Hobe.
Dusent gvlden Chim Hane to Hinricheshagen, dat he hefft ghegeven vor Lubendorp, iiij C gvlden vnd 1 fl Hans Krogher tho Gvsterow.
L gvlden Peter Kock tho der Wißmer;
j C gvlden Achim Ditdenn;
j C gvlden Lvte Moltzan; dorsulvest gaff aff Henninck Rostock lxvj gulden xvi ß van Ottho Drebbow weghen, ock gaff aff Henninck Hobe xxxiij gulden, dorsvlvest gaff aff de pastore to Lancken Casper Samervest j C gvlden. Desse v dusent gvlden [hebben] de prioren Elizabet Hagenow vnde Margareta Karberch ghedan deme rade tho Rostock, dar se hebben gude vorschriwinghe vp gegeuen.
Anno domini lxxxj hebbe wi prioren Margareta Pritzebvr vnde Margareta Warenbarch vnseme hovetman Jochim van der Lve j C gulden gedan, do gaff aff Peter Kock lxvj gulden xvj ß, noch hadde wi by vns xiiij gulden, dar lede wi xx fl to van der taffelen, dat idt hundert worden, so dat he mi hefft j C fl.
Anno domini lxxxij gaff aff Arenth Mollendorp, arffgheseten tho Darghelvtze, lxvj fl xvj ß van Ottho Drebbovwen weghen, dorsvlvest gaff ock aff Peter Kock xxxiij fl, ock gaff aff de Schackeßche van erer dochteren wegen lxxvij, hir hefft de domina thogelecht iiij fl viij ß, dat idt synt j C lxxx fl.
Wy vorghemelten priorinnen hebben dith ghelt vnseme hovetman ghedan, so dat [he] hefft ij C fl vnde lxxx fl.
Anno domini lxxxiij gaff aff Hans Barendorp xx gulden, dede wy vnseme hovetman tho den twen hundert vnde lxxx fl, dat he krech iij C fl.
Eodem anno quam Vrssula Restorp er hundert fl ock vth, krech he ock.
Anno domini lxxxv quam Eve Restorp er hundert fl ock vth, krech ock vnse hovetman, dat he nu hefft v C fl.
Anno domini lxxxc hebbe wy prioren Margareta Pritzbvr vnde Margareta Wardenbarch Jochym Bastwitze de ollte, arff-


|
Seite 195 |




|
gheseten to Lewetzow, ghedann ij C gvlden to den 1, de he ghekreghe[n] hedde anno domini lxxx, liiij gulden xij ß genamen van vnsen tinsen, lxxxxv gulden xij ß van den lerkinderen kostgelde, dat he nu hefft ij C gulden, dar wy gvde vorschriwinghe vp hebben.
Anno domini lxxxv lepp Jochym Berendorpp schelmersche wech vnd bleff vnseme kloster schuldich ij C fl vnd xxxvij fl xi ß, de [he] myt syck nam.
Anno domini lxxxvj hefft vnse houethman Jochym van der Luehe affghegeuen vp Anthonii v C fl., de krech wedder Vicke van Bvlow.
Eodem anno gaff aff Diderick van der Luehe iiij C fl, de krech Ewalt van der Osten wedder, arffgheseten tho Hynßenhaghen, ock hadde wy in syneme Striggow lxxx fl, dar wy em tho [deden] xx fl van den tinsen. Des svlveten jares gaff aff 1 ) 1 fl; tho den 1 fl hebbe wy priorien ghelecht xxxv fl van den tinsen, ock hadde wy by vns xv fl van der lerkynder kostghelt, dat he nu hefft vj C fl, dar wy gude vorschr[iuin]ghe vp hebben.
Anno domini lxxxvij gaff Peter Kock aff j hundert gulden, dat dede wy vorghemelten prioren wedder Hinrick Schonenbarch, dar he hefft vns gvde vorschriuinghe vp gedan.
Anno domini xcj hefft Vicke Hane affghegeven ij C gvlden, de he hadde van Elyzabeth vnde Anghenes Feregghen, noch gaff aff j hundert gvlden Elizabet Bvtter provenghelt, welcker vorerde vt gnaden v. g. h. herthich Olrick; dorsulvest gaff aff Henninch Veltbarch j C gvlden syner dochter Dortien; desse iiij C gvlden hebben wy prioren Margareta Pritzbvr vnde Margareta Wardenbarch vtgelecht vp Penckow; noch hefft Ghym Wanghelin iij C hundert gvlden vns gheven vor den all ynde brassens fanck in dem Wardesken sez torecke.
Anno domini xcij is affgeven ij C gvlden van Cristoffer Moltzan weghen, de hebbe wy prioren Vicke Hane ghedan.
Anno domini xcij nam Hynryck Kleinnow an syck ix hvndert vnde lxxx gvlden van synes seligen broders weghen Jochym Kleynnow, de he dem kloster schvldich was, dar lede wy prioren Margareta Pritzbvr vnde Margareta Wardenbarch xx gvlden van den tinsen to, dat he so hefft dvsent gvlden, dar wy gode vorschrivinghe vp hebben;


|
Seite 196 |




|
Eodem anno dede wy vorgemelten prioren Jochym Rosten ock j C gvlden tinsen gelth, dar wy vorschrivinghe vp hebben.
Anno domini xcvj gaff Hynrick Sprenghel syner dochter Caterinen j C gvlden (gvlden), de wy Hynrick Schonenbarch hebben ghedan, dar wy tinse vor boren.
Des svlvesten jares is affgheg[e]ven iij C gvlden von Cristoffer Moltzan, de hefft nu Wigant Moltzan.
Anno domini xcvij hefft affgeven Jochom Bersche ij C fl. van weghen Crystoffer Moltzan, dat nam vnse hovetman Jochym Batzevisse.
Anno domini xcviij gaff vnse hovetman de twe hundert gvlden ajff, de se wedder nemen by dat ampt; des svlvesten jares gaff de Diaksche 1 ) j C gvlden erer dochter Caterinen, de se ock nemen by dat ampt dar wy vorschrivenghe vp hebben, dar se vns tinse van gheuen.
Anno domini lxxxxix gaff Davit Hansche aff 1 gulden, de hebbe wi prioren Ghehan Dessin ghedan.
Koffte Leuin Linstouw zu Gartze van dem closter 2 kossathen tho Glaue, dar gaff he vor 1600 fl, dewile dat ampt jn grothen schulden waß, hebben de houedtman Jochim Batzeuitze vndt Barthold Köne Chuchmeister 1000 fl in des amptes schulde gewendet, 600 fl hebbe wy Prioren Ilse Dessins vndt Margretha Warenbarges jns kloster genamen, dar van hebbe wy Hinrich Sprengell tho Lesten 500 fl vp tinse gedan, dar wy vorschriuing vp hebben; de auerigen 100 fl van auengemelten 600 fl vnd 100 fl van der Plutzschouwen prouengelde, wel[c]he vnse (de) houedtman affgaff, deden wy Hinrich Schoneborch tho Froumerke vp eine genochsame vorschriuinge.
<Item: De junge Zacherias Rosteke hefft 100 fl van wegen siner swester Elisabeth Rostken, dar wij vorschriuin vp hebben;
100 fl hefft Arend Mollendorff, Dortia Prenß prouengeldt, dar [wy] gewisse vorschriuinge vp hebben.
100 fl hefft Jurgen Sparling [van] wegen siner swester Elisabeth Sparlinges, dar wij och vorschriuinge vp hebben.
100 fl hefft Hinrich Sprengell van wegen siner dochter Elisabeth Sprengells prouengelt, dar wij ein handtschrifft vp hebben.


|
Seite 197 |




|
100 fl hefft Hinrich Pritzebur seiner Vetterchen, Casper Pritzeburen seliger nachgelathen dochter, Anna Maria Pritzeburen, prouengeldt, dar wij vorschriuinge vp hebben.> 1 )
100 fl prouengeldt gaff Siuert van Pleße siner swester Anna Plessen halben aff, dat dede wij Prioren Ilse Dessins vndt Magdalena Schacken bij dat ampte. <100 fl gaff Cristoffer Berner dessuluigen jares och aff.>
<100 fl pröuengeldt gaff Vlrich Giseler wegen siner swester Margreta Giseler aff.
100 fl pröuengeldt gaff Matthias Pentze wegen siner swester Anna Pentzen aff.>
200 fl pröuengeldt gaff Johim Batzeuitze, vnse höuedtman, wegen seiner beiden dochter Abell vndt Elisabeth Safien; disse 200 fl hebbe wij dem kochemeister Barteld Muchouwen bij dat ampt geleneth, dar se vns tinse vor geuen.
Item 500 fl hefft Ehrenst Linstouw angenamen van den 1000 fl, so vns Hinrich Moltzan schuldich gewesen, der wegen sine buren vorschreuen, worumme wij den lange gerechtet hebben.
Vnd 500 fl hefft Hinrich Moltzan vthgegeuen, welche 500 fl wij Egidius van der Osten wedder vp tinse gedan vnd vns so wol van Egidius van der Osten ene vullenkamene vorschriuinge geben lathen.
200 fl pröuengeldt gaff Hennich Gamme aff wegen siner beiden döchter Catharina vndt Emerentzen; disse 200 fl hebbe wij prioren Ilse Dessins vndt Margretha Warenbarges vnsem höuedtman Jochim Batzeuitzen vndt Barteldt Muchouw kochemeister bij dat ampt geleneth, dat se vns vortinsen.
Item 250 fl hefft Hinrich Moltzansche affgegeuen;
200 fl hebben domalß de Moltzhane affgegeuen; tho dissen 450 fl nemen wij prioren Margrethe Giselers 100 fl pröuengeldt, Cristoffer Berners 100 fl, Anna Plessen 100 fl prouengeldt, vndt 50 fl nemen wij van vnsen tinsen, dat also de summa ist: 800 fl.


|
Seite 198 |




|
Dewile auerst de gewesene kochemeister Bartoldt Köhne van wegen des amptes Jacob Sassen tho Rosteke waß schuldich geworden 1500 fl, so hebbe wij Prioren Ilse Dessins vndt Margaretha Warenbarges de 800 fl dem houethmanne Jochim Batseuitzen vndt Bartelldt Muchouwen kochemeister bij dat ampt gelenet vndt sinth Jacob Sassen gegeuen.
<500 fl gaff Hinrich Sprengell aff> vnd
400 fl gaff Baltzer Passouw aff; tho den
500 fl, so Hinrich Sprengell affgaff, hebbe wij van Baltzer Passouwen sinen gelde genamen 200 fl, dat also de vullenkamene summa jst 700 fl.
Disse 700 fl geuen wij prioren Ilse Dessins vnd Magdalena Schacken Jacob Sassen tho Rostke tho den 800 fl, dat nu also de 1500 fl, de ehme waß Barteldt Köne schuldich gebleuen, richtich affgelecht vndt betalet sinth. Disse 1500 fl scholen se vns vam ampte wedder vortinsen.
De andern 200 fl, so vns Baltzer Passouw affgegeuen, hebben wij Hinrich Schonebarch tho Froumerchede gedan, dar wij eine vorschriuinge vp hebben.
Item des suluigen Jhares, nemlich Anno 1604, vorköfften wij prioren etzlich sulueruerch vth der garuekamer, dar börde wij vor 400 fl.
Van dissem gelde hebbe wij prioren Ilse Dessins vnd Magdalena Schacken dem höuetmanne vnd kuchemeister Bartelld Muchouw bij dat ampt gelenet 250 fl.
Dewile wij auerst Anno 1603 van den tinsen musten nemen 50 fl tho den 800 fl, welche Jacob Sassen gegeuen, musten wij vam suluer gelde thor taffell weddernemen 50 fl.
<100 fl prouengeldt hefft Johan Restorff siner vedderken Elisabeth Restorffen haluen vthgegeuen.
Disse 100 fl hebbe wij Luder Dessin wedder vp tinse gedan, welches vns derwegen eine ander vorschriuinge gesetzet.>
gaff Jochim Patzeuitze vnse houedtman dre hundert gulden aff, de hebbe wij prioren Ilse Dessius vndt Magdalena Schacken Matthyas Smeker wedder vp tinse gedan, dar hebbe wij borgen vor.


|
Seite 199 |




|
In dissem suluigen jhare hebhe wij 2 hunderth gulden bij dat ampte gedan, welher de kochemeister Bartelt Muchouw anno 1605 jst schuldich gebleuen.
gaff Hinrich Schönebarch 2 hunderth gulden aff, de hebbe wij prioren Magdalena Schacken vndt Barbera Warenbarch Jacob Sassen gegeuen van wegen des amptes. Dessuluigen jares gaff Albrecht Blucher siner swester Pollite Plucher pröuengeldt vth, dat geue wij Jacob Sassen tho den 2 hunderth gulden van wegen des amptes.
gaff Jhochim Bulouw tho Kergeß 3 hunderth gulden aff, dar de vorigen priorinnen vor gelauedt van wegen der bur, dar hebbe wij priorinen, Magdalena Schachen vndt Barbera Warenbarch, ehm thogegeuen hunderth vndt 4 vndt fofftich gulden.
Dessuluigen jhars, nömligen 1609, gaff Reimer van der Osten 5 hunderth gulden aff van wegen sines feddern Igijdius van der Osten, dat hebbe wij prioren, Magdalena Schacken vndt Barbera Warenbarch, dem ehrbaren radt tho Perchem gedan, dar wij vorschriuing vp hebben.
<gaff aff Diderick Bulouw van sines fedderen wegen, Vicke Bulouw van Dambecke, fiffhunderth gulden, dar lede wij prioren ein hunderth gulden tho, de Jeronimus van der Osten aff ghaff jn dem suluigen jhar, dat jdt also 6 hunderth gulden full worden, dat hebbe wij Clages Belouw gedan, dar hebbe wij vorschriuinge vp. Ein hunderth gulden hefft 1 ) Jurgen Sparling (aff) van wegen siner swester Mergrethe Sparling, dar wij eine vorschriuinge vp hebben.
Ein hunderth gulden hefft Andrewes Rosteken van wegen siner dochter Emerenze Rosten, dar wij och vorschriuinge vp hebben.
Ein hunderth gulden hefft Gösselich Prehn von wegen siner dochter Kattrina Prehn, dar wij och eine vorschriuinge vp hebben.>


|
Seite 200 |




|
In dem suluen jhar gaff aff Zacarias Rosteken anderthhalff hunderth, fofftich de ehm lendt weren, hunderth waß siner swester Elisabeth Rosten ehr Pröuengeldt, de hebbe wij Sasseschen gegeuen van wegen des amptes.
gaff Jochim Restorff aff fofftich gulden van wegen siner swester Mergrethe Restorff, dar hebbe wij tho gelecht dre vnd achtentich gulden vndt durtein ß., dat nu Sassesche gekregen viff hunderth dre vndt achtentich gulden vndt durtein ß.
<gaff aff ein ehrbar radt tho Parchem viff hunderth gulden.
In dem suluigen jhar gaff aff Johan Dessin tho Pentzelin fofftich gulden.>
Anno 1612 gaff der stadt Par[c]hem viff hunderth gulden aff, dar lede wij 2 hunderth gulden tho, dat hebe wij Jurgen Oldenborch tho Kötell gedan, dar wij eine vorschriuinge vp hebben.
<gaff Johan Albrecht Klenouw dusenth gulden aff, dat hebbe wij priioren Magdalena Schacken vndt Barbera Warenbarch Johan Reimer Prestin wedder gedan, dar wij genochsam borgen vp hebben.
In dem suluen jhar ghaff aff Wolradt Batzeuitze achte hunderth gulden, de hebbe wij Ehrenst Linstouw gedan, dar wij vorschriuing vp hebben.
In dem suluigen jhar ghafF Hartich Bisewanck siner swester Annen ehr pröuen geldt aff.
In dem suluen jhar gaff Andreves Rosteke siner dochter Ehmerentzen ehr pröuengeldt aff.
In dem suluen jhar ghaff Otthe Lesten siner dochter Annen pröuengeldt aff.
gaff Jurgen Nienkarken siner dochter Mergrethen ehr pronungeldt aff.>
Disser 4 Junffren ehr pröuengeldt hebbe wij beiden prioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen der Sasseschen vor nastendige ware na Rosteke gegeuen.


|
Seite 201 |




|
hefft Clages Bareldt söuen hunderth gulden aff gegeuen, dat hebbe wij priioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen bij dat ampt gedan.
<In dem suluen jhare gaff Baltzer Rosteke aff anderthalff hunderth gulden siner beider swestern pröuengeldt.
In dem suluen jhar gaff Zacharias Rosteke fofftich gulden aff.
In dem suluen jhar geue wij prioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen der Saschen dat nastendige geldt aff, also hebbe wij ehr gegeuen achtein hunderth gulden, dat hebbe wij van der junffren pröuengeldt gena.men, alse: Pollithe Blucher, Hinrich Schonebarch gaff och 2 hunderth gulden vth, Arma Bisewanck, Emerenze Rosten, Anna Lesten, Mergrethe Nienkarke, vndt 3 hunderth gulden, de wij kregen vor alle dat wij vorkofft hebben, dat ander hebbe wij van den tinsen genamen, dat se nu also bethalt ist.
hefft dat ampt affgegeuen de souenhunderth gulden, de de Barlthe hedden, de hebbe wij Prioren Magdalena Schacken vnd Katrina Gammen Leuin Linstouw tho Gartze wedder gedan, dar wij gewisse börgen vpp hebben.
Anno 1617 gaff Baltzer vndt Sacharias Rosteke 2 hunderth gulden sampt tinse vndt höuethstholl aff, de hebbe wij Cristoffer Didten wedder gedan, alse hefft he nu 4 hunderth gulden, 2 van siner swester klostergelde vndt 2 de wij prioren ehm dartho gedan.
In dem suluen jhar gaff Johan Reimer Prestin siner dochter pröuengeldt aff.
In dem suluen jhar gaff Hartich Pentze siner dochter Annen ehr pröuen geldt aff; disse beiden hunderth gulden hebbe wij beiden prioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen Melcher Weltzin gedan, dar wij börgen vor hebben.
gaff aff dat ampt sos hunderth gulden, de wij prioren van wegen des amptes bethaleth hedden, de hebbe wij Clages Moltken tho Wolthouw ehr[f]gesethen wedder gedan, dar wij borgen vp hebben.
In dem suluen jhare [gaff] Casper Rappe siner dochter Margreten ehr pröuengeldt aff, dat hebbe wij noch bij vns.


|
Seite 202 |




|
gaff Engelke Belouw siner swester Bir[gi]the Belouw ehr pröuengeldt aff.
In demsuluen jhar gaff dat ampt 2 hunderth gulden aff, dat Bartellt Muchouw was schuldich bleuen; tho den 2 hunderth gulden hebbe wij priören Magdalena Schachken vndt Katrina Gammen hunderth gulden vndt enen gulden thogelecht vndt hebben Brüning Restorff dat sulue gegeuen, dat he also 4 hunderth gulden gekregen hefft, dar vnse voruaren vor gelauedt van wegen der buren. Tho dessen 4 hunderth gulden is Birgethe Belouwen ehr pröuen mith tho gekamen.
gaff Casper Bulouw van Enem Ruse hundert vndt sostich gulden aff; tein gulden hebbe wij tho den renten gelecht.
Hundert vndt föfftich gulden hebbe wij Jochim Carbarch gedan, dar hebbe wij ehm Mergrete Rappen ehr geldt tho gedan, dat he also drudde halff hundert gulden hefft, dar wij börgen vp hebben.>
hebbe wij priören Magdalena Schaken vndt Catharina Gammen thwe vndt twintich pundt suluer vndt acht vndt twintich lodt, dat lodt gerekent tho viff vndt twintich schilling, dat is söuen hundert vndt sos vndt vertich gulden, dar hebbe wij nu so vehl tho gesamleth van corröchken vndt mantelen vth der garue kamer, dat wij also achtehundert gulden hebben.
<hefft Clages Belouw affgegeuen 6 hundert gulden, dar hebbe wij ehn hunderth gulden aff genamen jm sommer, de sinth der vorsamlinge vordelet, de andern viff hunderth gulden hebbe wij priioren Magdalena Schacken vndt Catrina Gammen Hinrich Sprengel ehr[f]gesethen zu Lesten gedan.
In dem suluigen jhar gaff Johan van Oldenborch siner dochter Garderndt ehr Pröuengeldt aff, dat suluige hebbe wij Hinrich Sprengell tho den viff hunderth gulden gedan, dat he nu also hefft achte hundert gulden, dar wij vorschriuinge vp hebben.


|
Seite 203 |




|
gaff Hartich Bulouw tho Plutzkouw ehrffgesethen Maria Batzeuitzen ehr pröuengeldt aff.>
hefft Daniell Gamme siner swester Katrina Gammen ehr pröuengeldt aff, dat hebbe wij ehm gelathen; dat suluige hebbe wij beiden priioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen (hebben) ehm dartho gedan Maria Batzeuitzen ehr geldt (dar tho gedan), dat he nu twe hunderth gulden hefft, dar hebbe wij borgen vor.
<In dem suluigen jhar gaff Hennich Scharpenbarch siner dochter pröuengeldt aff, dat hebbe wij Priioren Magdalena Schacken vndt Katrina Glammen Leuin Linstouw tho Garß erffgesethen gedan, dar hebbe wij börgen vor, vnd hefft nu also achte hunderth gulden vam closter.
gaff Josua van der Luhe ehr[f]gesethen zu Puttelkouw vöfften hunderth gulden aff, dat hebbe wij Leuin Linstouw zu Gartze gedan, de hefft also 2 dusen vnd 3 hunder gulde, dar hebbe wij beiden Priioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen borgen vor.
In dem suluigen jhar gaff Adam RestorfF zu Kummin aff achtehalff hunderth gulden. Zu der zinße lede wij priioren 5 gulden zu, dat also achte hundert gulden worden. Dor jn dem suluigen jhar gaff Viviens Karbarch 2 hunder[t] gulden och aff, dat lede wij dar tho, dat dat dusent gulden worden, dat hebbe wij den Rören tho Pentzelin gedan, dar hebbe wij börgen vör.>
In dem suluigen jhar gaff Casper Belouw (aff) hunderth vndt sostich gulden aff, dat hebbe wij priioren Magdalena [Schacken] vndt Katrina Gammen Cristoffer Voß gedan, dar hebbe wij börgen vör.>
In dem suluigen jhar hebbe wij Prioren Magdalena Schacken vndt Katrina Gammen der lütken Katrina Gammen söuentich gulden affgegeuen, de se jn nasthendigen tinzen vthgegeuen hefft.
1 ) Anno 1626 ist Ingenborch Restorff ehr pröuengelt aff geuen, dar heft Jurgen Lin ? stouw ein schouwer vorkoft, de


|
Seite 204 |




|
koste hvndert 12 fl. In dem suluen jhar is Soffia Dessin ehr prouengelt och vth kamen.
In dem suluen jhar ist Eva Knutten ehr prouen gelt vth geuen, dar hefft de wiinschenk tho Gustrouw Casper Hansen 180 flo. van kregen, de vnse forfaren halen laten, dan sin noch 20 flo. van auer bleuen, dar sin 12 van tho dem schouwer vau kamen.
De priorin heft 2 kenken, dar se den win midt medt, noch ein kenken dar win midt vp altar kumpt vnde ein flasken dar win jn halet wert wen dar lude kranck sin; jn der priorin huse sin och 4 kenken vnde ein helm dar water jn brandt wart vnde sin 3 missing ketel, dar bere midt faret, vnde js ein grape vnde sin 3 moser vnde ein jser degel dar talg jn smoltet, 2 wachschalen, ein vnsel, 9 ? kleine Salserken, wen men waß maket, wert dat dar jn gaten, 2 formen, wen dar peperkoken backet wert, ein verdel ketel, dor den buren jn dem owes roscher jn kaket wert. 1 )
Von diesem allen habe ich nichtteß entfangen als einen Vntzell.
Anno 1652. 2 )
Anna Scharffenberg.
3
) Den 22. Aprilis jst den
H. Cicentiaten Schroder zu Gustrow wegen seines
seligen Schwieger Vater f
 hr vorburgten Wein, so alhie inß
Closter kommen, laut seine Quitung 200 fl
bezalet worden, vndt weil kein bahr gelt beim
Closter gewesen, als ist die Vorschreibung auff
200 fl lautent, damit seliger Helm Pleße zu
Schwerin dieser Vorsamblung vorhafftet gewesen,
zugeschlagen worden, vndt der Wein noch bei der
seligen Domina Jungfer Magdalena Schacken Zeiten
von Gustrow geholet worden.
hr vorburgten Wein, so alhie inß
Closter kommen, laut seine Quitung 200 fl
bezalet worden, vndt weil kein bahr gelt beim
Closter gewesen, als ist die Vorschreibung auff
200 fl lautent, damit seliger Helm Pleße zu
Schwerin dieser Vorsamblung vorhafftet gewesen,
zugeschlagen worden, vndt der Wein noch bei der
seligen Domina Jungfer Magdalena Schacken Zeiten
von Gustrow geholet worden.
4 ) ist J. Anna Sophia von Ditten vor eine kloster junffer hir gejommen vnd hatt ihr 100 gulden richtig zahlen lassen


|
Seite 205 |




|
durch J. f. g. der hertzogin von L
 bse ihr k
bse ihr k
 chenmeister wel(s)chess geldt vort
vnter die vorsamlinge gedeilet ist, vnd ist ihn
s. junffer Anna Bißwang ihr stelle kommen bej
der daumenna Anna Pentzen Zeitten.
chenmeister wel(s)chess geldt vort
vnter die vorsamlinge gedeilet ist, vnd ist ihn
s. junffer Anna Bißwang ihr stelle kommen bej
der daumenna Anna Pentzen Zeitten.
Des Mittwochenß in den Ostern ist Junffer Anna
Magdalena Bibow alhie inß kloster f
 r eine Kloster.Jungfer angenommen
worden vndt hatt die 100 fl Profengeldt ihres
Vaterbruder Hardenack v. Bibow der Vorsamblung
burglich vorsichertt <vnd angelobet auff
kunftigch Antonij solches geldt richtigk zu erlegen.>
r eine Kloster.Jungfer angenommen
worden vndt hatt die 100 fl Profengeldt ihres
Vaterbruder Hardenack v. Bibow der Vorsamblung
burglich vorsichertt <vnd angelobet auff
kunftigch Antonij solches geldt richtigk zu erlegen.>
hefft Jochim Kerbarch 250 flo. vthgeuen vnde hefft Johan Dessin wedder kregen vnde heft vns genochsame burgen gestelt, Domina vnde Priorin Anna Pentzen [vnde] Eua von Ditten em gedan.
Anno 1635 den 24 Februarij ist Jungfer Lucretia Dilliana von Pleßen vor eine Closter Jungfer hieselbst zu Dobbertin eingenommen vnd 100 fl. durch den Prouisori ! Henneke Luzow zu Prizier vnd Schwechow erbsetzen jhrenthalben erleget.
ist junffer Luzia Restorff in dis Closter gekamen
vnd vur ein Closter junffer angenamen worden,
sei ist in die selige Dummina Eua von Ditten
ihre stede gekamen, sie hat auch ihr pr
 uengelt ausgeben, welcher hundert
gulden ich, Katrina Gammen, domals Priorin, den
semptlichen junffern vordelet habe deweile von
wegen des beswerlichen kriges wesen die lude so
vile ausgebent haben, das wir junfferen von
vnsen schuldeners ganz keine zinse krigen kunen
vnd die junffern ganz kein gelt krigen bis die
zinsen weder ausgeben werden, alsden sol diß
hundert gulden wider von den zinsen so vil
genomen werden vnd zum houetstol gedan werden.
uengelt ausgeben, welcher hundert
gulden ich, Katrina Gammen, domals Priorin, den
semptlichen junffern vordelet habe deweile von
wegen des beswerlichen kriges wesen die lude so
vile ausgebent haben, das wir junfferen von
vnsen schuldeners ganz keine zinse krigen kunen
vnd die junffern ganz kein gelt krigen bis die
zinsen weder ausgeben werden, alsden sol diß
hundert gulden wider von den zinsen so vil
genomen werden vnd zum houetstol gedan werden.
hat Baltzer Pluskow seiner Swester Ilse hundert
gulden pr
 vengelt ausgeben, dassulvige ist
auch vordelet worden vnd sol auch von den zinsen
wieder veygeleget werden, wie dies bauen
vorgeschriben ist.>
2
)
vengelt ausgeben, dassulvige ist
auch vordelet worden vnd sol auch von den zinsen
wieder veygeleget werden, wie dies bauen
vorgeschriben ist.>
2
)


|
Seite 206 |




|
jst junffer Katrina Plutzskow jn dis closter
gekamen vnd vur ein kloster junffer angenommen
worden; se ist in sellige Margreta Nigenkirchen
stede gekamen; ihr hundert gulden pr
 uengeldt hatt ihr bruder Baltzer
Plutzskow ehrlecht vnd jst auch den semptlichen
junffren vurdelet worden, deweil wir idtz von
vnßen schuldeners kein zinse bekamen kunen.
uengeldt hatt ihr bruder Baltzer
Plutzskow ehrlecht vnd jst auch den semptlichen
junffren vurdelet worden, deweil wir idtz von
vnßen schuldeners kein zinse bekamen kunen.
ist junffer Anna Maria Sperlinck jn dis kloster
gekamen vnd vur ein kloster junffer angenamen
worden; sie ist jn Soffia Dessin seliger ihr
stede gekamen; ihr hunder gulden pr
 uengelt ist auch ehrlecht worden;
se sulben sindt auch von mir, Catrina Gammen,
pri
uengelt ist auch ehrlecht worden;
se sulben sindt auch von mir, Catrina Gammen,
pri
 rin, den semptlichen junffern
vurdelet worden, weil wir nocht keine zinßen
bekamen kunen vnd sal geleibts god auch wider
von den zinsen erlecht werden.
rin, den semptlichen junffern
vurdelet worden, weil wir nocht keine zinßen
bekamen kunen vnd sal geleibts god auch wider
von den zinsen erlecht werden.
den Sonaben vor Nieg Jahr ist J. Kattrina Barners fuhr eine Kloster Jungfer ihns Kloster gekommen vndt hatt sie ihre 100 fl die Vorsamblung richtich geliefertt. Davon ein jeder J. bekommen 5 /2 fl 1 ß; 10 fl seindt abgerechnet fuhrs Kopgeldt.
ist J. Sophia Elisabeth Restorpen vor eine kloster Junffer ihn kloster gekommen vnd hatt sie ihre 100 fl der Vorsamlung richtig geleifert, davon ein jeder J. bekommen hatt 6 fl vnd 16 ß vnd ist ihn s. J. Ilsche Pluskow ihre stelle gekommen.
ist J. Margaretha von Ditten ihnß kloster hir gekommen vor eine kloster Jungfraw ihn der ehrwurdigen S. Jungfrauw Daumena Cattarina Sprengels ihrer stelle vnd hatt ihr 100 fl richtig geleifert, darvon ein jede Jungfrauw bekommen hat 7 gulden 10 ß.


|
Seite 207 |




|
ist Jungfrauw Luzia B
 low vor eine kloster Junfer ihnß
kloster gekommen vnd hat sie ihr 100 fl der
vorsamlinge richtig geleifert, welsches also
fort der vorsamling ist auch getheilet worden,
vnd ist ihn S. Jungfrauw Ingeborch Restorpen ihr
stette gekommen.
low vor eine kloster Junfer ihnß
kloster gekommen vnd hat sie ihr 100 fl der
vorsamlinge richtig geleifert, welsches also
fort der vorsamling ist auch getheilet worden,
vnd ist ihn S. Jungfrauw Ingeborch Restorpen ihr
stette gekommen.
Anno 1656 ist J. Cahr. Rauen vor eine Closter J. inß hießige Closter gekommen vnd hatt sie ihre 100 fl hießige Versamblung richtich gelieffert vndt daßelbe auch also vordt vnter die Versamblung wieder vertheilet vndt ist in J. Margreta Dietten Sehl. ihre Stelle gekommen.
ist Jungfrauw Christina Ilsche Z
 low vor eine Kloster Jungfrauw
ihnß Kloster gekommen vnd hatt sie ihr hundert
gulden richtig geleiffert, welsches also fort
der Vorsamlinge ist getheilett vnd ist ihn s. J.
Cattarinae Divacken stelle gekommen.
low vor eine Kloster Jungfrauw
ihnß Kloster gekommen vnd hatt sie ihr hundert
gulden richtig geleiffert, welsches also fort
der Vorsamlinge ist getheilett vnd ist ihn s. J.
Cattarinae Divacken stelle gekommen.
ist Jungfrauw Ossella Scharpenberg vor eine kloster Jungfrauw hir ihn gekommen vnd hat ihr geldt 100 gulden richtig außgegeben, welches der vorsamlinge gedeillett vnd hatt Jeder J. darvon bekommen 6 gulden 32 ß und ist ihn S. Jungfrauw Sophige Lische Restorffen ihr stelle gekommen.
ist die J. Lucia Dorothea Barnern in hiesiges
Closter f
 r eine Closter Jungfrau auf vndt
eingenommen worden vndt also ihre 100 fl, so sie
beym Ambte zinßbar stehen gehabt, dieselbe
abgetreten vndt die bemelte 100 fl beym Ambte
annoch vorhanden vndt der Versamblung alle Jahr
die Zinßen gereichet werden sollen, vndt ist die
J. in ihr Vetterchen Sehl. J. Ursula Barnern
Stelle getreten.
r eine Closter Jungfrau auf vndt
eingenommen worden vndt also ihre 100 fl, so sie
beym Ambte zinßbar stehen gehabt, dieselbe
abgetreten vndt die bemelte 100 fl beym Ambte
annoch vorhanden vndt der Versamblung alle Jahr
die Zinßen gereichet werden sollen, vndt ist die
J. in ihr Vetterchen Sehl. J. Ursula Barnern
Stelle getreten.
Ist die J. Dorothea Lische Barnern in dieses
Closter f
 r eine Closter Jungfrau
eingenommen vndt Ihre 100 fl, so ihr geb
r eine Closter Jungfrau
eingenommen vndt Ihre 100 fl, so ihr geb
 hret außzugeben , bey ihrem Bruder
Marschall Barner, Erbherrn aufm Neunhoffe,
annoch bey sich vndt derselbe hiesiger.
Versamblung j
hret außzugeben , bey ihrem Bruder
Marschall Barner, Erbherrn aufm Neunhoffe,
annoch bey sich vndt derselbe hiesiger.
Versamblung j
 hrlich zu verzinßen sich erbotten,
Ist also dieselbe J. in eine w
hrlich zu verzinßen sich erbotten,
Ist also dieselbe J. in eine w
 ste Stelle gekommen, worin in
langer Zeit keiner gewohnet hatt. Ist abgeben,
steht beim guete auf Zinße.
ste Stelle gekommen, worin in
langer Zeit keiner gewohnet hatt. Ist abgeben,
steht beim guete auf Zinße.


|
Seite 208 |




|
<Anno 1670 ist die Junffer Eua Gottleib Gammen vor eine Kloster Junffer hier eingekommen vnd ihr 100 gulden sindt noch bei ihr Vatter, der sie jerlichen vorzinsen wirdt.>
>Dieß gelt ist Anno 1678 von Oberstlendtna[n]t Gamen richtig gemacht, vnd ist vntter die forsamlung gdeilt.
Anno 1671 ist J. Anna Sophia Beren vor eine kloster Junffer hir eingekommen vnd ihr 100 gulden sindt noch bey ihr Mutter zu vorzinßen. Ist richtig ausgeben undt untter der vorsamlunge getheillet.
Anno 1671 ist J. Christina Juliana Dessin vor eine Kloster J. hier einkommen vnd ihr 100 gulden sindt vnter die Vorsamlinge vordellet.
Anno 1672 ist J. Anna Defizen vor eine Kloster J.
hier eingekomen vnd ihr 100 g
 lden stehen noch bey Hennig Örtzen
auff Zinse; hadt es richtig ausgeben und untter
der Vorsamlunge gethelledt.
lden stehen noch bey Hennig Örtzen
auff Zinse; hadt es richtig ausgeben und untter
der Vorsamlunge gethelledt.
Anno 1674 ist J. Anna Maria Drieb
 rgen vor ein Kloster J. hier
eingekommen; ihr 100 g
rgen vor ein Kloster J. hier
eingekommen; ihr 100 g
 lden stehen noch auff Zinse bey
her landraht Pl
lden stehen noch auff Zinse bey
her landraht Pl
 ß[k]auwen; [sindt nuhn aber
abgeben von ihren Mutter Bruder Her Jochin
Andreas Bernstorff undt untter die vorsamlunge
getheillet; in 82 jar.]
1
)
ß[k]auwen; [sindt nuhn aber
abgeben von ihren Mutter Bruder Her Jochin
Andreas Bernstorff undt untter die vorsamlunge
getheillet; in 82 jar.]
1
)
Anno 1677 ist J. Margreta Madalena Holsten for
ein Kloster J. hier eingekohmen; auff ihr 100 fl
hat sie 40 gulden außgeg
 ben, daß ander stehet noch auff
Zinse bey ihrer mutter. [im 82. Jahr ist der J.
Holsten ihr geltt, als nemelich die
ben, daß ander stehet noch auff
Zinse bey ihrer mutter. [im 82. Jahr ist der J.
Holsten ihr geltt, als nemelich die
 berligen 60 gulden, außgeben vnd
ist vntter die Junffer gedeilet.]
berligen 60 gulden, außgeben vnd
ist vntter die Junffer gedeilet.]
Anno 1682 iar ist die J. Ilsebet Luzia von Linstauwen ins Kloster geben undt ihr gelt richtig ausgeben, welges auff dem amte den J. zum besten gethan auff Zinßen.
Anno 1682 ist die J. Sophia Augusta von Plessen ins Kloster kommen undt ihr gelt richtig ausgeben, welges den auch aufft ampte gethan den J. zum besten auff Zinße.
Anno 1682 ist die J. Dorothea Elisabet von Behlouwen 2 ) ins Kloster geben; hadt ihr gelt richtig ausgeben; ist den J. zum besten auff ampt auff Zinße gethan.
Anno 1682 ist die J. Christina Hedewig, von Barneren ins Kloster geben; hatt ihr gelt richtig ausgeben; ist den J. zum besten auff ampt auff Zinsen gethan. [Anno 1699 ist sie wieder darauß gezogen.]


|
Seite 209 |




|
Anno 1685 d. 29. May ist die J. Anna Lucretia Wedemans ins Closter gekommen vndt hatt ihr geldt richtig ausgegeben, undt ist daßelbe unter die jungfreul. Vorsambl. vertheilet.
Anno 1686 den 25. October ist die Junffer Dorotiea Efa von Ollenburgen in dies Kloster fuhr ein Kloster Junffer gekommen, vn ihr Klostergelt stehet auff dem amp auff Zinsen
Anno 1687 auff fastelabent ist die Junffer G
 del Klara B
del Klara B
 hren in diß Kloster f
hren in diß Kloster f
 hr ein kloster Junffer kohmen; ihr
Klostergelt stehet bey ahmt auff Zinsen.
hr ein kloster Junffer kohmen; ihr
Klostergelt stehet bey ahmt auff Zinsen.
Anno 1688 auff Margareten ist J
 nffer Sophia Catarina B
nffer Sophia Catarina B
 lauwen in diß Kloster für ein
Kloster Junffer kohmen; ihr gelt stehet beym
ahmt auff Zinsen.
lauwen in diß Kloster für ein
Kloster Junffer kohmen; ihr gelt stehet beym
ahmt auff Zinsen.
Anno 1688 auff Mahrthini ist J
 nffer Margreta Elisabet Ditten in
diß Kloster kohmen; ihr Kloster gelt stehet beym
ahmt auff Zinse.
nffer Margreta Elisabet Ditten in
diß Kloster kohmen; ihr Kloster gelt stehet beym
ahmt auff Zinse.
Anno 1690 auff Michgelie ist J
 nffer Margreta Doratia Bülauwen
ins Kloster kohmen; ihr gelt stehet beym ahmt
auff Zinse.
nffer Margreta Doratia Bülauwen
ins Kloster kohmen; ihr gelt stehet beym ahmt
auff Zinse.
Anno 1690 auff Trinitatis ist J. Elenora Maria Holsten ins Kloster kohmen; ihr gelt stehet beym ampt auff Zinse.
Anno 1691 auff Trinitatis ist J. Augusta Elisabet Finken inß Kloster kohmen; ihr gelt stehett beym ampt auff Zinse.
Anno 1691 ist J
 nffer Margeta Bulauwen hier ins
Kloster kohmen; ihr gelt stehett beym ampt auff Zinse.
nffer Margeta Bulauwen hier ins
Kloster kohmen; ihr gelt stehett beym ampt auff Zinse.
Anno 1692 ist J
 nffer Cristina Maria B
nffer Cristina Maria B
 hrner hier ins Kloster kohmmen;
ihr gelt stehett noch bey ihrem Vatter auff Zinsen.
hrner hier ins Kloster kohmmen;
ihr gelt stehett noch bey ihrem Vatter auff Zinsen.
Anno 1692 ist J
 nfer Ilsabe Kettenborg hicr ins
Kloster kohmen; ihr klostergelt stehet beym
ahmte auff Zinse.
nfer Ilsabe Kettenborg hicr ins
Kloster kohmen; ihr klostergelt stehet beym
ahmte auff Zinse.
Anno 1693 ist die Jünfer Anganese Pl
 sgauwen hier ins Kloster kohmen;
ihr Klostergelt stehet beym ahmtt auff Zinse.
sgauwen hier ins Kloster kohmen;
ihr Klostergelt stehet beym ahmtt auff Zinse.
Anno 1694 ist die J
 nfer Dortige B
nfer Dortige B
 lauwen hier ins kloster kohmen;
ihr Kloster gelt steht hier beym ahmt auff Zinse.
lauwen hier ins kloster kohmen;
ihr Kloster gelt steht hier beym ahmt auff Zinse.
Anno 1695 ist die J
 nfer Anna Lefecke B
nfer Anna Lefecke B
 lauwen ins kloster kohmen; ihr
gelt ist beym ahmt auff Zinse (8 Tage nach Fastlabent.)
lauwen ins kloster kohmen; ihr
gelt ist beym ahmt auff Zinse (8 Tage nach Fastlabent.)
Anno 1698 ist J. Maria Dortie Knutten hier [ins] kloster kohmen auff Michgelie, ihr gelt stehet auff ahmt.
Anno 1699 ist Junfer Clara Sophia Fincken hir inß kloster kohmen; ihr gelt stehet auff ahmt. Vor Junfer Anna Maria Priebergen.


|
Seite 210 |




|
Anno 1700 ist Junfer Elenora Maria Pleßen inß kloster kohmen, ihr gelt ist auff ahmt. Vor frl. Ilsebe v. der Kettenburch.
Anno 1701 ist Junfer Olgart von Pleßen hier inß Kloster kohmen auff Michgelie; ihr gelt steht beym ahmt. Vor frl. Dorathea Maria v. Knuhten, geheurraht.
Anno 1704 ist die Junfer Örtzen hir ins Kloster kohmen auff Michgelie. Vor frl. Christina Juliana v. Dessin, geheuraht.
Anno 1704 ist die Junfer Elisabet Susahn Behrn hier inß Kloster kohmen auff Wihnachten. Vor frl. Ilsabe Lucia von Linstow.
Anno 1706 den 9. Januwarij ist die freul. Anna Elonora Prenen ins Kloster gekommen, ihr gelt stehet beym ampt. Vor frl. Anna Öhlgart von Plessen, so geheuraht.
Anno 1706 den 16. Martii um klock 12 Uhr in der
Nacht ist gestorben die seel, freul. Domina Anna
Sophia von B
 hren.
hren.
Anno 1706 ist die Freul. Sophia Angenes Baßuitzen hir ins Kloster gekommen den 23. Martij; ihr gelt stehet bey ampt. Vor frl. Domina Ansophia von Behren.
Anno 1706 ist die freul. Elisabeth Dorothe von Schencken ins Kloster gekommen den 4. Mey; ihr gelt ist ausgegeben. Vor frl. Sophia Augusta von Plesen.
Anno 1706 ist die freul. Anna Margreta Sibylle de Lutzow hir ins Kloster gekommen den 28. Nouember. Vor frl Doratia Elisabet von Örtzen, so geheuraht.
Anno 1707 ist frl. Doratia vo[n] B
 low hir ins Kloster gekom in Junij
vor Susana Behren, so geheuraht.
low hir ins Kloster gekom in Junij
vor Susana Behren, so geheuraht.
1711 frl. Magdalena v. Plesen vor frl. Lucia von
B
 low in September.
low in September.
1712 frl. Anna Emerentza v. B
 low vor frl. Eleonora Maria v.
Plesen in Junij.
low vor frl. Eleonora Maria v.
Plesen in Junij.
1714 frl. Engel Katrina von Behren in Feberwarij vor frl. Margreta Helena v. .Holsten.
Den 10. October ist Jungfer W
 deman gestorben, da vor ist
Jungfer St
deman gestorben, da vor ist
Jungfer St
 fer aus Rostock einkom, die
sogleich gefreit; vor der ist Mademosel Beseln gekom.
fer aus Rostock einkom, die
sogleich gefreit; vor der ist Mademosel Beseln gekom.
1719 ist frl. Sophia Elisabet v. B
 low vor frl. Clara Sophia Finken einkom.
low vor frl. Clara Sophia Finken einkom.
1719 ist frl. Anna Margareta v. Zepelin vor frl. Doratia Elisabet v. Bargentin einkom.


|
Seite 211 |




|
1721 d. 1. September frl. Anna Augusta Juliana von Wangelin vor frl. Margareta Elisabet v. Ditten.
1725 in May frl. Doratia Elisabet v. Kamptzen vor
frl. Sophia Elisabet v. B
 low, so geheuraht.
low, so geheuraht.
1723 frl. Anna Sophia v. Plesen vor frl. Domina Augusta Elisabet v. Fineken.
1724 frl. Catarina Doratia v. d. L
 he in Junij vor frl. Anna Sophia
v. Plesen, so geheuraht.
he in Junij vor frl. Anna Sophia
v. Plesen, so geheuraht.
1724 frl. Charlata Amalia von der L
 he im October vor frl. Magdalena
v. Plesen.
he im October vor frl. Magdalena
v. Plesen.
1726 frl. Margareta Doratia v. Ollenborgen in Apriel vor frl. Maria Christina v. Bernern.
1727 frl. Eva Doratea v. Weltzin in Mertz vor frl. Doratea Elisabet v. Camptzen, so geheuraht.
1727 frl. Magdalena Doratea v. Wintterfelten in
Maij vor frl. Domina Sophia Catrina v. B
 low.
low.
1728 frl. Magdalena Juliana v. Plesen vor frl.
Margareta Doratea v. B
 low in Feberwarij.
low in Feberwarij.
1729 frl. Anna Sophia v. Basfitzen in Junij vor frl. Doratea Eva v. Ollenborgen.
1732 frl. Baltazara v. L
 tzow in Apriel vor frl. Doratea v.
B
tzow in Apriel vor frl. Doratea v.
B
 low.
low.
1732 frl. Elisabet Dorotea v. Z
 low in Junij vör frl. Sophia
Angenes v. Basfitzen.
low in Junij vör frl. Sophia
Angenes v. Basfitzen.
1733 frl. Oligart Anna Ilschen v. Krusen vor frl.
Catarina Doratia v. der LZ
 lhe.
lhe.
1733 frl. Ephemia Adelheitt von Molken in October
vor frl. Anna Emmerentz v. B
 low.
low.
1736 frl. Eleonora v. Behren in October vor frl. Maria v. Holsten.
1736 frl. Margareta Elonore v. Plesen vor frl. Elisabet Dorotea v. Schenken.
1740 ist ins kloster kom frl. Riben uor die frl. Maria Elisabet v. Lowtzow von Leiffzo.
1744, 14 Januwari iest Margrita Dorti v.
Öldenborgen gestorben, da vor iest die Oldenborg
uon F
 derow wieder hier gekom.
derow wieder hier gekom.
1744 ist Engel Catrina Behren gestorben, da vor
komdt Caritas (?) Emilia von B
 low diesen Ostern zu h
low diesen Ostern zu h
 bun[g]. Diesen Megeli sindt noch 2
frl. zuer h
bun[g]. Diesen Megeli sindt noch 2
frl. zuer h
 bun[g] gekom, alß A. F. B
bun[g] gekom, alß A. F. B
 low v. Wießendorff und Elenor
Oldenborgen uan Glaffe.
low v. Wießendorff und Elenor
Oldenborgen uan Glaffe.


|
Seite 212 |




|
ist die Frl. Domina Margarete von B
 low aus Haus B
low aus Haus B
 lkow gestorben. In ihren Platz ist
die Frl. Warnstedt aus Haus Sildemow gekommen,
hat das Weihnacht
(?)
=Quartal zur
Hälfte empfangen.
lkow gestorben. In ihren Platz ist
die Frl. Warnstedt aus Haus Sildemow gekommen,
hat das Weihnacht
(?)
=Quartal zur
Hälfte empfangen.
Den 3. October bin ich Ilsabe v. Krusen von der
Versammlung wieder zur Domina erw
 hlt worden. Den 18. dieses nahm
Gott durch einen schleunigen Tod unsern
Beicht[vater] und liebensw
hlt worden. Den 18. dieses nahm
Gott durch einen schleunigen Tod unsern
Beicht[vater] und liebensw
 rdigen Prediger
2
) ganz
unvermuthet zu sich.
rdigen Prediger
2
) ganz
unvermuthet zu sich.
Den 11. November brannte unser Thorhaus und
Werkstatt durch Unvorsichtigkeit des Tischlers
ab, wobei wir viel Schaden erlitten. Gott sei
gedankt, der uns so gn
 dig besch
dig besch
 tzt hat; er wolle ferner mit
seiner Gnade
tzt hat; er wolle ferner mit
seiner Gnade
 ber uns walten, daß wir seinen
Namen preisen k
ber uns walten, daß wir seinen
Namen preisen k
 nnen.
nnen.
im Januar kamen die Preußen hier ins Land und forderten eine Geld=Contribution von drittehalb Millionen nebst unzähligem Korn und Fourage, welches diesem Kloster auf 19tausend Thaler zustehen kam ohne all das Uebrige.
Den 13. April marschirten die Preußen wieder weg.
im Januar ist die Lieferung mit Preußen wieder angegangen, da viel Geldanlag gemacht, da auch die Versammlung von ihrem Quartal hat 15 Thaler abgegeben und noch apart Rest stehen. Die 15 Thaler gaben wir aus mit Leiden.
den 9. April ist unsere liebe Frl. Zeplin
gestorben, in den Platz kam die Frl. B
 low von Elmhorst. Ihr Quartal geht
Michaelis an.
low von Elmhorst. Ihr Quartal geht
Michaelis an.
Den 21. April ist die Frl. Bülow von Wiescgendorf gestorben; in den Platz kam die Frl. Sperling. Das Quartal geht auch Michaelis an.
Den 20. Mai ist die Frl. Plessen gestorben. In den Platz kam die Frl. S[ch]acken.


|
Seite 213 |




|
Den 8. Juni ist die Frl. Lowtzow gestorben. In
den Platz kam die Frl. B
 low von Pokrent. Die Quartale
gehen alle auf Michaelis an.
low von Pokrent. Die Quartale
gehen alle auf Michaelis an.
de 14. November ist die älteste Klosterfr
 ulein Preen gestorben; in ihren
Platz ist die Frl. Lehsten gekommen; ihr Quartal
geht Ostern an.
ulein Preen gestorben; in ihren
Platz ist die Frl. Lehsten gekommen; ihr Quartal
geht Ostern an.
den 18. September ist die Frl. von der L
 he gestorben; in ihren Platz kommt
die Frl. Krakewitz und bekommt selbige das Antoni=Quartal.
he gestorben; in ihren Platz kommt
die Frl. Krakewitz und bekommt selbige das Antoni=Quartal.
den 3. December ist die
 lteste L
lteste L
 tzow gestorben. Sie ist 54 Jahre
im Kloster gewesen; in ihren Platz kommt die
Frl. Gl
tzow gestorben. Sie ist 54 Jahre
im Kloster gewesen; in ihren Platz kommt die
Frl. Gl
 den; ihr Quartal geht Ostern an.
den; ihr Quartal geht Ostern an.
Den 4. December ist der Schluß des Landes, 1 ) daß die Frl. S[ch]acken auf halber Hebung Zeit Lebens bleibt. In deren Platz ist die Frl. Barner zur vollen Hebung gekommen; ihr Quartal geht Ostern 61 an.
den 3. Juni ist die
 lteste Frl. B
lteste Frl. B
 low von Pl
low von Pl
 sch[ow] gestorben; in den Platz
kommt die Frl. Dessin von Wamekow; ihr Quartal
auf Antonii 61.
sch[ow] gestorben; in den Platz
kommt die Frl. Dessin von Wamekow; ihr Quartal
auf Antonii 61.
den 27. M
 rz ist die Frl. Holstein
gestorben; in ihren Platz ist die Frl. Hoben
gekommen und bekommt das Trinitatis=Quartal.
rz ist die Frl. Holstein
gestorben; in ihren Platz ist die Frl. Hoben
gekommen und bekommt das Trinitatis=Quartal.
Den 20. Mai ist die Frl. Moltken gestorben; in ihren Platz kommt die Frl. Preen und bekommt das Michaelis=Quartal.
Den 19 August ist die Frl. B
 low von Niendorf
2
) gestorben; in ihren Platz
kommt die Wangelin. Ihr Quartal geht Antonii an.
low von Niendorf
2
) gestorben; in ihren Platz
kommt die Wangelin. Ihr Quartal geht Antonii an.
Den 11. November ist die Frl. Winterfeldt
gestorben; in ihren Platz kommt die Frl. B
 low von Cloddram. Ihr Quartal geht
Ostern an.
low von Cloddram. Ihr Quartal geht
Ostern an.
hat die Frl. Lehsten geheirathet den 22. Februar.
In den Platz ist die von der L
 hen von Dettmannsdorf gekommen.
Ihr Quartal geht Trinitatis an.
hen von Dettmannsdorf gekommen.
Ihr Quartal geht Trinitatis an.


|
Seite 214 |




|
Den 23. M
 rz ist die Frl. Bl
rz ist die Frl. Bl
 cher gestorben. In ihren Platz
kommt die Frl. Warnstedt, dem Ober=Hauptmann
Warnstedt seine Tochter. Ihre Hebung geht
Trinitatis an.
cher gestorben. In ihren Platz
kommt die Frl. Warnstedt, dem Ober=Hauptmann
Warnstedt seine Tochter. Ihre Hebung geht
Trinitatis an.
den 21. Juni hat die Frl. B
 low von Cloddram geheirathet den
[Oberhofmeister Forstner
?
]. In ihren
Platz kommt die Frl. Scheel
1
) und sie bekommt das Michaelis=Quartal.
low von Cloddram geheirathet den
[Oberhofmeister Forstner
?
]. In ihren
Platz kommt die Frl. Scheel
1
) und sie bekommt das Michaelis=Quartal.
hat die M[amsell] Lemcken den Amtshauptmann Burghoff (?) nach Michaelis im October geheirathet; in ihren Platz kommt die M[amsell]] Stemwede 2 ); ihre volle Hebung geht Ostern 67 an.
ist die Frl. Behr den 3. Mai zu Ludorf gestorben.
Ihren Platz bekommt die Frl.
Restorffen,
3
) welche von 66 bis sieben und
sechszig die volle Hebung genossen, welche das
Land ihr wegen der B
 low von Elmhorst ihr Ausbleiben
zugestanden, die Restorff nun aber 68 auf
Michaelis durch der Frl. Behr ihr Absterben ihre
Wohnung bezieht.
low von Elmhorst ihr Ausbleiben
zugestanden, die Restorff nun aber 68 auf
Michaelis durch der Frl. Behr ihr Absterben ihre
Wohnung bezieht.
den 6. Mai ist die Frl. Sperling gestorben. Den
Platz bekommt die Frl. Pl
 skow und geht ihr Quartal auf
Michaelis an.
skow und geht ihr Quartal auf
Michaelis an.
Den 6. August ist die Frl. Plessen aus dem
Radener Haus gestorben. Ihren Platz bekommt die
Frl. B
 low aus dem Wieschendorfer Hause.
Ihr Quartal geht Antonii an.
low aus dem Wieschendorfer Hause.
Ihr Quartal geht Antonii an.
den 10. Februar ist die Frl. B
 low von Scharbow, die das Haus
hier gekauft und die
low von Scharbow, die das Haus
hier gekauft und die
 lteste Klosterfr
lteste Klosterfr
 ulein schon hier war, gestorben.
Ihren Platz hat die Frl. Knuth
4
) bekommen.
Ihre Hebung geht Trinitatis an.
ulein schon hier war, gestorben.
Ihren Platz hat die Frl. Knuth
4
) bekommen.
Ihre Hebung geht Trinitatis an.
Den 16. M
 rz hat die Frl. B
rz hat die Frl. B
 low von Wieschendorf sich ihres
Klosterplatzes begeben, weil sie im Wunstorfer
Kloster auch begeben war und da bei ihren
Verwandten gelebt. In den
low von Wieschendorf sich ihres
Klosterplatzes begeben, weil sie im Wunstorfer
Kloster auch begeben war und da bei ihren
Verwandten gelebt. In den


|
Seite 215 |




|
Platz ist die Frl. Hagen 1 ) gekommen. Ihr Quartal geht Trinitatis an.
Den 5. April ist die Frl. L
 hen
2
) Morgens um 3 Uhr
gestorben nach 5j
hen
2
) Morgens um 3 Uhr
gestorben nach 5j
 hriger Krankheit. In den Platz
kommt die Frl. Weltzien von Benten.
hriger Krankheit. In den Platz
kommt die Frl. Weltzien von Benten.
Ihre Hebung geht Michaelis an. Sie ist 36 Jahre begebene Klosterfrl. gewesen.
den 28. April hat sich die Frl. Dessin verheirathet. In den Platz kommt die Frl. Dribergen. Ihr Quartal gehtMichaelis an.
Den 18. Mai ist die Frl. Rieben gestorben; in ihren Platz kommt die Frl. Sperling von Rubow. Ihr Quartal geht auf Michaelis an.
Den 20. [Mai?] ist die Frl. B
 low von Elmhorst gestorben; in
ihren Platz kommt die Frl. Oldenburg von
Federow. Ihr Quartal geht Michaelis an.
low von Elmhorst gestorben; in
ihren Platz kommt die Frl. Oldenburg von
Federow. Ihr Quartal geht Michaelis an.
Den 30. December ist die Frl. Hoben gestorben. In
ihren Platz kommt die Frl. von der L
 hen, des Major von der L
hen, des Major von der L
 hen seine Tochter von Kamin; ihr
Quartal geht auf Ostern an.
hen seine Tochter von Kamin; ihr
Quartal geht auf Ostern an.
den 11. April ist die Frl. Peterstorf gestorben; in ihren Platz kommt die Frl. Quitzow; ihr Quartal geht auf Johannis an. Sie ist 24 Jahre zur Hebung gewesen.
ist die Frl. Fineken gestorben den 1. Februar. In ihren Platz kommt die Frl. Krusen. Ihr Quartal geht Trinitatis an.
den 15. Februar ist die
 lteste Frl. Z
lteste Frl. Z
 low gestorben, ganz schleunig. In
ihren Platz kommt die Frl. Sperling vom G
low gestorben, ganz schleunig. In
ihren Platz kommt die Frl. Sperling vom G
 mtower Hause. Ihr Quartal geht
Trinitatis an.
mtower Hause. Ihr Quartal geht
Trinitatis an.
Den 25. October ist die Frl. Plüskow gestorben. Sie ist nur 4 Jahre begeben gewesen; starb an der Schwindsucht. Ihren Platz bekommt Frl. Hoben aus dem Goldebeeer Hause. Das Quartal geht Ostern an.


|
Seite 216 |




|
den 31. Mai hat die Frl. Sperling geheirathet den
Grafen und Domdechanten Bassewitz. In ihren
Platz kommt die Frl. Z
 lowen aus dem Stieter
Hause
1
). Ihr Quartal
geht Michaelis an.
lowen aus dem Stieter
Hause
1
). Ihr Quartal
geht Michaelis an.
den 25. M
 rz ist die Frl. Restorffen
gestorben. In ihren Platz kommt die Frl.
Stralendorff von Keez. Ihr Quartal geht
Trinitatis an.
rz ist die Frl. Restorffen
gestorben. In ihren Platz kommt die Frl.
Stralendorff von Keez. Ihr Quartal geht
Trinitatis an.
Den 22. October ist die
 lteste Frl. Both in Rühn
gestorben; sie ist einige 50 Jahre begeben
gewesen. In ihren Platz kommt die Frl. von der
L
lteste Frl. Both in Rühn
gestorben; sie ist einige 50 Jahre begeben
gewesen. In ihren Platz kommt die Frl. von der
L
 hen von Depzow
2
). Ihr Quartal geht Ostern an.
hen von Depzow
2
). Ihr Quartal geht Ostern an.
den 29. April ist die w
 rdige L
rdige L
 hen aus dem Buschm
hen aus dem Buschm
 hler Hause Morgens um 9 gestorben;
hat viel ausgestanden; ist vern
hler Hause Morgens um 9 gestorben;
hat viel ausgestanden; ist vern
 nftig
(?)
gestorben. In
ihren Platz kommt Frl. Hoben aus [dem]
Wasdower
3
) Hause. Ihr Quartal geht
Michaelis an.
nftig
(?)
gestorben. In
ihren Platz kommt Frl. Hoben aus [dem]
Wasdower
3
) Hause. Ihr Quartal geht
Michaelis an.
den 1. April hat die Mamsell Dethloffen geheirathet. In ihren Platz kommt Mamsell Tieden. Ihr Quartal geht Michaelis an.
den 30. Juni ist die Frl. Dribergen gestorben.
Sie ist zw
 lf Jahre im Kloster gewesen. Ihren
Platz bekommt die Gr
lf Jahre im Kloster gewesen. Ihren
Platz bekommt die Gr
 venitz. Ihr Quartal geht Antonii an.
venitz. Ihr Quartal geht Antonii an.
den 27. November ist unsere w
 rdige und liebe Frl. Wangelin zu
Dockhuhn
4
) gestorben; ist einige 20
Jahre Klosterfr
rdige und liebe Frl. Wangelin zu
Dockhuhn
4
) gestorben; ist einige 20
Jahre Klosterfr
 ulein gewesen. Ihren Platz bekommt
die Frl. Restorffen
5
) und ihr Quartal geht
Ostern an.
ulein gewesen. Ihren Platz bekommt
die Frl. Restorffen
5
) und ihr Quartal geht
Ostern an.
den 21. April ist die
 lteste Frl. Passow gestorben. In
ihren Platz kommt Frl. B
lteste Frl. Passow gestorben. In
ihren Platz kommt Frl. B
 low von Scharstorf. Ihr Quartal
geht Michaelis an.
low von Scharstorf. Ihr Quartal
geht Michaelis an.


|
Seite 217 |




|
Den 28. Mai ist die
 lteste Frl. Oldenburgen gestorben.
In ihren Platz kommt die Frl. Viereck von
Rossewitz. Ihr Quartal geht Michaelis an.
lteste Frl. Oldenburgen gestorben.
In ihren Platz kommt die Frl. Viereck von
Rossewitz. Ihr Quartal geht Michaelis an.
Den 5. December ist die Frl. Preen gestorben. In ihren Platz kommt die Frl. Kettenburg. Ihr Quartal geht Ostern an.
den 22
 Febr. ist die Fr
Febr. ist die Fr
 ul. von Gloeden gestorben. F
ul. von Gloeden gestorben. F
 r ihr bekomt die Fr
r ihr bekomt die Fr
 ul. Lewzow volle Hebung und das
erste Quartal Trinitatis.
ul. Lewzow volle Hebung und das
erste Quartal Trinitatis.
Den 2
 M
M
 rz ist auch die Fr
rz ist auch die Fr
 ul. von der L
ul. von der L
 he von Kranckow verstorben und die
Fr
he von Kranckow verstorben und die
Fr
 ulein von Quitzow aus dem Hause
Kustorf zur vollen Hebung gekommen und erh
ulein von Quitzow aus dem Hause
Kustorf zur vollen Hebung gekommen und erh
 lt Trinitatis ihr erstes Quartal.
lt Trinitatis ihr erstes Quartal.
den 10
ten
August ist die Frau Domina
von Krusen in die Ewigkeit gegangen. Sie war
gebohren den 2
 Febr. 1701 und zur Domina erw
Febr. 1701 und zur Domina erw
 hlt den 3
hlt den 3
 Octbr. 1757. Die volle Hebung hat
die Fr
Octbr. 1757. Die volle Hebung hat
die Fr
 ulein von Holstein bekommen und
das erste Quartal erh
ulein von Holstein bekommen und
das erste Quartal erh
 lt sie Weihnachten.
lt sie Weihnachten.
Den 22
 Aug. ist die Fr
Aug. ist die Fr
 ul. B
ul. B
 low aus dem Hause Pocrent
gestorben. Zur vollen Hebung k
low aus dem Hause Pocrent
gestorben. Zur vollen Hebung k
 mt an ihrer Stelle die Fr
mt an ihrer Stelle die Fr
 ul. Raben
2
) und erh
ul. Raben
2
) und erh
 lt ihr erstes Quartal auf Weinachten.
lt ihr erstes Quartal auf Weinachten.
Den 2
ten
Octbr. bin ich, Magdalene
Elisabeth von Quitzow, von der Versamlung zur
Domina gew
 hlt.
hlt.
den 26
ten
Decmbr. ist die Fr
 ul. von Warnstedt aus dem Haus
Silmo
3
) gestorben. Die Fr
ul. von Warnstedt aus dem Haus
Silmo
3
) gestorben. Die Fr
 ul Linstow aus dem Hause
Vitschow
4
) komt f
ul Linstow aus dem Hause
Vitschow
4
) komt f
 r ihr zur vollen Hebung und bekomt
das erste Quartal auf Ostern.
r ihr zur vollen Hebung und bekomt
das erste Quartal auf Ostern.
den 25. December hat die Fr
 ulein Knuten diese Welt verlassen.
Die volle Hebung bekomt Fr
ulein Knuten diese Welt verlassen.
Die volle Hebung bekomt Fr
 ul. Thomstorf und erh
ul. Thomstorf und erh
 lt Ostern 1797 das erste Quartal.
lt Ostern 1797 das erste Quartal.
den 1
ten
April hat unsre
 ltste Conventualin, die Fr
ltste Conventualin, die Fr
 ul. von Osten, das Zeitliche mit
dem Ewigen verwechselt; sie ist 80 Jahr
ul. von Osten, das Zeitliche mit
dem Ewigen verwechselt; sie ist 80 Jahr


|
Seite 218 |




|
alt geworden und hat die beyden letzten Jahre
ihres Lebens unbeschreiblich an Be
 ngstigung, doch mit großer Gedult,
gelitten. In ihren Platz komt die Fr
ngstigung, doch mit großer Gedult,
gelitten. In ihren Platz komt die Fr
 ul. B
ul. B
 low und erh
low und erh
 lt Pfingsten das erste Quartal.
lt Pfingsten das erste Quartal.
Den 9
ten
August ist die Fr
 ul. Thomstorf Todes verblichen.
Die Fr
ul. Thomstorf Todes verblichen.
Die Fr
 ul. Preßentinen hat ihre Stelle
bekommen und erh
ul. Preßentinen hat ihre Stelle
bekommen und erh
 lt Weinnachten das erste Quartal.
lt Weinnachten das erste Quartal.
den 28
ten
Jan. hat die Fr
 ul. v. Viereggen gantz unerwartet
das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt. Sie
entschlummerte nach einer 3t
ul. v. Viereggen gantz unerwartet
das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt. Sie
entschlummerte nach einer 3t
 gigen Unp
gigen Unp
 ßlichkeit ebenso sanft wie sie in
ihrem Leben gewesen war. Die Fr
ßlichkeit ebenso sanft wie sie in
ihrem Leben gewesen war. Die Fr
 ul. von Rohr von Holzhausen komt
f
ul. von Rohr von Holzhausen komt
f
 r ihr zur vollen Hebung und
bek
r ihr zur vollen Hebung und
bek
 mt Johanni das erste Quartal.
mt Johanni das erste Quartal.
Den 18
ten
M
 rz ist die Fr
rz ist die Fr
 ul. Pentz aus dem Hause Bentz im
78. Jahr ihres Lebens an einer Entkr
ul. Pentz aus dem Hause Bentz im
78. Jahr ihres Lebens an einer Entkr
 ftung gestorben. In ihrer Stelle
kömt die Fr
ftung gestorben. In ihrer Stelle
kömt die Fr
 ulen von Vieregge aus dem Hause
Supsien und bek
ulen von Vieregge aus dem Hause
Supsien und bek
 mt Johanni das erste Quartal.
mt Johanni das erste Quartal.
den 20
ten
M
 rz ist die Fr
rz ist die Fr
 ulein von B
ulein von B
 low aus dem Hause Lutterstorf, die
auf 100 rth. gesetzt war, in einem Han
low aus dem Hause Lutterstorf, die
auf 100 rth. gesetzt war, in einem Han
 verschen Kloster, wo sie sich
aufgehalten, gestorben. F
verschen Kloster, wo sie sich
aufgehalten, gestorben. F
 r ihr k
r ihr k
 mt Johannis zur vollen Hebung die
Fr
mt Johannis zur vollen Hebung die
Fr
 ulein von Thun von Tribohm und
bekomt Johannis das erste Quartal.
ulein von Thun von Tribohm und
bekomt Johannis das erste Quartal.
den 9
ten
April ist die Fr
 ulein Oldenburg aus dem Hause
Federow gestorben im 69. Jahre ihres Lebens an
einer Brust=Kranckheit; für ihr k
ulein Oldenburg aus dem Hause
Federow gestorben im 69. Jahre ihres Lebens an
einer Brust=Kranckheit; für ihr k
 mt Fr
mt Fr
 ulein Hoben von Carlewitz auf
Michaelis zur v
ulein Hoben von Carlewitz auf
Michaelis zur v
 lligen Hebung.
lligen Hebung.
den 20
ten
October ist die Frau Domina
von Quitzow aus dem Hauße Seberin im
68
ten
Jahr ihres Alters, da sie nur 7
jahre Domina gewesen ist, an einer auszehrenden
Kranckkheit in die Ewigkeit gegangen. Durch
diesen Todesfall bek
 mt die Fr
mt die Fr
 ul. von Wenckstern aus Hanover die
volle Hebung und bek
ul. von Wenckstern aus Hanover die
volle Hebung und bek
 mt Anthoni 1800 das erste Quartal.
mt Anthoni 1800 das erste Quartal.


|
Seite 219 |




|
Verzeichniss der Priorinnen zu Dobbertin.
Anno dñj. dusent verhundert lxxxxj vnder deme regemente der dorchluchtsthen hochghebaren forsten vnde heren hertjch Magnus vnde syn her broder hertjch Balthasar js gheslaten dat closter Dobbertjn; tho den tjden js ghewest her Ghohan Tun prauest darsuluest vnde by des bjskoppes tjden her Conrades Los van Swerjn de prjorjne Alhejdes Cremon vnde vnderprjorjnne Abel Oldenborch, de tho den tjden dat kloster regerede. Anno dñj dusent verhundert lxxxxyiij hefft de vorghe prjorjnne Alhejdes Cremon (hefft se) affghedancket van ereme ampte, js wedder erwelt Sofja Veregghe tho eyner prjorjnne vnde hefft by deme amthe ghewest jnt xi jar. Anno dusent v hundert vnde viij hefft affghedancket de vorge prjorjnne van ereme ampte vnde js wedder erwelt tho eyner prjorjnne Anna Detzjn vnde hefft dat ampt xvij jar vorwalttet vnde hefft affghedancket van ereme amptte; js wedder erwelt Anna Tun, hefft dat ampt vorwalttjt jx jar. Anno dnj. mdxxxj hefft Anna Tun affghedancket, js wedder erwelt Caterjna van Orttzen, de dat ampt hefft vorwaltet xviij jar vnde js by deme ampt jn godt vorstoruen jn vjgelja jud(dj) ! ca ann[o] dñj. xl. Anno dñj ! js wedder erwelt H ! polita Gans vnde hefft dat ampt vorwaltjt jx jar vnde js wedder erwelt Elizabet Hobe, hefft dat ampt vorwaltet xj jar, js jn godt vorstoruen. Is wedde[r] erwelt Eljzabet Haghenow, dat ampt hefft vorwaltet x jar vnde js jn godt vorstoruen.
Gedruckt nach einer beglaubigten Abschrift von dem Original im königlich dänischen Reichsarchiv zu Kopenhagen.
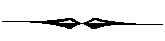


|
Seite 220 |




|



|


|
|
:
|
- Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau
- Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf
- Urnenscherben von Kösterbeck
- Wendische Gefäßscherbe von Petschow
- Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu-Brodersdorf
- Der Lembken-Wall bei Billenhagen
- Urnenfeld, brandgruben und gerippe von der Feldmark Kassebohm
- Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen
- Urnenfelder auf der Feldmark Riekdahl den Cramonstannen gegenüber
- Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl
- Alterthümer von Alt-Bartelsdorf
- Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf
- Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen-Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel
- Wendische Wohn- und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf
V.
Alterthümer in der Umgegend von
Rostock,
östlich der Warnow.
Von
Ludwig Krause
in Rostock.
~~~~~~~~~~~~~~~
S eit dem letzten eingehenderen Berichte über die Alterthümer aus der Rostocker Umgegend im Jahrb. XLVIII, S. 285 ff. sind hier, namentlich in Folge der durch die Eisenbahnbauten und den eingeführten Zuckerrübenbau veranlaßten mannigfachen Erdarbeiten, wieder zahlreiche neue Fundstellen entdeckt. Aber auch die bereits von früher her bekannten Fundorte sind darüber nicht vernachlässigt, sondern in diesen letzten zehn Jahren ebenfalls häufiger abgesucht und haben dabei manche schöne Ausbeute ergeben. In Folge dessen hat sich denn auch der zur Bearbeitung vorliegende Stoff derartig angehäuft, daß ich zunächst eine Trennung der Funde in solche östlich und westlich der Warnow habe vornehmen und aus den ersteren auch diejenigen vom Fresendorfer Schloßberge und Dierkower Burgberge einstweilen habe ausscheiden müssen. So folgen hier denn zunächst nur die übrigen Alterthümer östlich der Warnow, aus deren Aufzählung man ersehen wird, daß das rechte Warnow=Ufer, jedenfalls von Kessin bis zum Breitling hin in fast ununterbrochener Reihenfolge mit prähistorischen Ueberresten bedeckt ist. Die Anordnung ist im Folgenden, abweichend von dem früheren Aufsatze, nicht nach Zeitepochen, sondern, als für einen einfachen Fundbericht practischer erscheinend, nach Feldmarken gemacht, da sich bei so manchem Funde bisher noch nicht hat feststellen lassen, welchem Zeitabschnitte er zuzurechnen ist.
Bezüglich der im Jahrb. XLVIII, S. 293 unter Nr. 7 aufgeführten Groß=Lüsewitzer Burgstätte sei hier noch ein Druckfehler


|
Seite 221 |




|
berichtigt. Dieselbe heißt nicht, wie dort angegeben: Ratswall, sondern Katswall, unter welchem Namen sie auch schon im alten v. Schmettau'schen Atlas von 1788 auf Section III vorkommt. Vergl. über diesen Wall übrigens auch das unten S. 228 beim Lebken=Wall zu Billenhagen Gesagte.



|


|
|
:
|
1. Alterthümer vom sog. Dummerstorfer Pfahlbau.
Vergl. Jahrb. XLIV, O. 4, S. 3, LVIII, S. 203, und Meklenb. Anzeigen vom 3. September 1886 (Nr. 205) unter: * Schwerin, 3. September.)Als ich diesen alten wendischen Packwerkbau im August 1884 zuerst in Augenschein nahm, sah ich in der Wand des ihn durchschneidenden Zarnowkanales einzelne Pfähle schon in einer Tiefe von nur 1/4 m unter der Oberfläche liegen, die eigentlichen Pfahllagen aber begannen erst 3/4 m tiefer. Diese Packung war an den von mir untersuchten Stellen in der Höhe des Wasserspiegels und unter demselben in mindestens zwei Schichten über einander so fest und dicht, daß der Kanal dort wie über Schwellen lief und man mit einem Stocke nicht zwischen den einzelnen Stämmen hindurch in den Grund stoßen konnte. Die noch unter Wasser befindlichen Balken bzw. Stämme waren noch völlig fest, die höher in der Uferwand sitzenden und namentlich die ausgegrabenen und nun am Ufer umherliegenden Stücke jedoch schon sehr morsch. In letztere hatte sich, soweit sie nicht schon völlig zerfallen waren, vielfach eine auf fast allen wendischen Burgbergen in hiesiger Gegend vorkommende kleine gelbe Ameisenart eingenistet. Die von mir untersuchten Stämme waren theils an den Seiten kantig zugehauen, einige auch unten zugespitzt, theils ganz unbehauen und noch mit der Rinde versehen. Auch bei einem zweiten dortigen Besuche im October 1889 beobachtete ich derartig bearbeitete Hölzer, z. B. Reste von einem acht= bis zwölfkantig zugehauenen Kiefernstamme von 20 bis 30 cm Durchmesser sowie Stücke von etwa 4 cm dicken Brettern, welche durch Spalten der Stämme hergestellt waren. An Baumarten bemerkte ich unter diesen Hölzern, soweit sie sich ohne Weiteres noch erkennen ließen, viel Birken und Kiefern (Pinus silvestris L.), aber auch Eichen. Die Dicke der von mir gesehenen Stämme betrug 1884 bis zu 50 cm, 1889 bis zu 30 cm Durchmesser. Ein Theil der Hölzer schien angekohlt zu sein, wie denn auch die am Kanalufer sowie auf der Balkenlage noch im Kanale ziemlich zahlreich umherliegenden Feldsteine zum größten Theile berußt und im Feuer gewesen waren. Unter den letzteren befand sich ein ca. 15 bis 20 cm im


|
Seite 222 |




|
Durchmesser haltender, behauener, runder Granit, wohl ein zufällig in das Feuer gerathener Reibstein einer Quetschmühle (oder ein zum Backen oder dergleichen benutzter Glühstein?). Auch kleine weißgeglühte Feuersteinstücke sah ich mehrfach.
Von sonstigen Altsachen fand ich - von einer Anzahl durch die Moorerde gebräunter, fast sämmtlich zerschlagener Thierknochen, einigen Thierzähnen und etwas Holzkohle abgesehen - nur 50 bis 60 wendische Gefäßscherben und ein Stück (etwa 1/8) eines offenbar doppelkonischen Spinnwirtels. Die zum Theil berußten Scherben sind röthlich, gelblich, grau oder graubraun und bestehen sämmtlich aus gebranntem, mit Steingrus vermengtem Thon. Ihre Dicke wechselt zwischen 3 und 10 mm. Die Böden sind außen platt. Die Seitenwand geht innen allmählig schräge in den Boden über, außen aber setzt sie unten mit deutlicher Kante ab. Von den Randstücken ist eins oben wagerecht glatt abgeschnitten (wie Jahrb. XLVIII, S. 301 sub Nr. 14 b), während fünf einen zum Theil sehr stark nach außen gebogenen Rand mit abgeschrägter bezw. abgerundeter Vorderkante aufweisen. In der Sammlung der Rostocker Großen Stadtschule befindet sich zwischen einigen dort aufbewahrten Dummerstorfer Scherben auch ein nach innen gebogener Rand. Die Verzierung besteht überwiegend aus einfachen Horizontalrillen, doch kommen auch, namentlich auf den Randstücken, eingedrückte Wellenlinien sowie horizontale Kerbenreihen, und zwar fast immer in Verbindung mit den ersteren, vor. Das Spinnwirtelstück besteht aus grauem, hart gebranntem Thon und ist an der konischen Außenwandung mit flachen, schmalen Horizontalrillen verziert. Da das vorhandene Stück drei solche Rillen zeigt, so wird der etwa 20 mm hohe und in der Mitte 30 mm breite vollständige Wirtel mit sechs oder sieben derselben versehen gewesen sein. Das durch die Mitte gehende runde Loch hat glatte Wände und ist augenscheinlich überall gleichmäßig 8 mm weit gewesen.
In westlicher Richtung, nicht weit von dem erwähnten Packwerkbau entfernt, bemerkt man noch eine zweite, dem Aeußeren nach ihm täuschend ähnliche Erhöhung, und ebenso liegt eine solche auch noch östlich von Prisannewitz im Moore dicht am Südufer des Zarnowkanales. Erstere ist eine aus Sand und Kies bestehende runde Insel von 105 bis 110 Schritt Umfang, welche, allmählich zur Mitte hin ansteigend, sich etwas über den sie umgebenden Torfsumpf erhebt. Sie ist über dem Kies vollständig mit großen Findlingsblöcken und Feldsteinen bedeckt. Auf diesen Steinen lagert stellenweise eine 3 bis 4 cm dicke, fest gepreßte Torfschicht von Wasseralgen oder dergl. und darüber eine 30 bis 50 cm mächtige Schicht lockerer brauner


|
Seite 223 |




|
Moorerde mit der Grasnarbe. Die großen Findlingsblöcke sind zum Theil nur eben mit Moos und Gras überwachsen, einige liegen sogar offen zu Tage. In der erwähnten lockeren Moorerde fand sich auch ein Birkenstamm von ca. 15 cm Durchmesser mit Rinde. Irgendwelche Anzeichen dafür, daß auch diese Insel einst bewohnt wurde, waren jedoch nicht zu finden. Die übrigens auch auf dem Meßtischblatt "Hohen=Sprenz" der königlich preußischen Landes=Aufnahme von 1880 (herausgegeben 1882) angegebene Prisannewitzer Erhöhung konnte seiner Zeit leider nicht näher untersucht werden, ist allem Anscheine nach aber von ganz ähnlicher Beschaffenheit, wie die soeben geschilderte. Danach ist anzunehmen, daß auch der Dummerstorfer Packbau eine derartige Sand= und Kies=Insel zur Grundlage hat, wie denn auch Geinitz in seinem XIV. Beitrag zur Geologie Meklenburgs 1 ) wohl mit Recht vermuthet, daß diese durch das Moor sich erstreckende Inselreihe eine Fortsetzung des Hohen=Sprenz=Prisannewitzer Wallbergzuges nach dem Groß=Potremser Wallbergrücken hin bildet.



|


|
|
:
|
2. Urnenfeld, Hünengrab und Steinkeil von Kavelsdorf.
Im Jahre 1888 hörte ich, daß auf dem nach Dummerstorf zu belegenen Acker eines der ausgebauten Höfe von Kavelsdorf beim Tiefpflügen häufig Urnenstücke zu Tage kämen. Doch sei dies, wie erwähnt, nur beim wirklichen Tiefpflügen der Fall, und würden auch hierbei nicht die ganzen Urnen, sondern nur etwa die obere Hälfte derselben vom Pfluge herausgeworfen. Daß irgend etwas von sonstigen Alterthümern hierbei gefunden sei, davon war bisher nichts bekannt geworden.
Im September 1890 unternahm ich in Folge dessen mit meinem jüngeren Bruder zusammen von den Hohen=Schwarfser Tannen ab einen Streifzug die Kavelsdorf=Dummerstorfer Grenze entlang, um zu sehen, ob wir das Urnenfeld auffinden könnten. Ungefähr vor der Mitte des Westrandes der Dummerstorfer Tannen entdeckten wir auch im Acker eine vom Pfluge zerstörte alte Grabstelle. Dieselbe lag 67 Schritte von der Holzkante entfernt am Rande einer kleinen Vertiefung und bestand aus schwarzer Brand= und Kohlenerde, ver=


|
Seite 224 |




|
mischt mit berußten Steinen, Urnenscherben und calcinirten Knochenstücken. Weitere Grabstätten oder auch nur Spuren von solchen, wie auf dem Acker zerstreute Scherben oder dergleichen, waren aber nicht zu bemerken, so daß es einstweilen zweifelhaft bleiben muß, ob hier in der That der Platz des vorhin erwähnten Urnenfeldes gefunden ist. Auf der ganzen übrigen Grenzstrecke wurde nichts Auffälliges wahrgenommen.
Die gefundenen, leider sämmtlich nur kleinen elf Scherben stammen mindestens von zwei, wahrscheinlich aber von vier Urnen bezw. Gefäßen und sind offenbar nicht wendischen Ursprungs.
a. Eine Scherbe: 7 mm dick, roth gebrannt, stark mit Steingrus durchsetzt und, da grade die Außenseite mit den gröbsten Stücken gespickt ist, außen offenbar künstlich rauh gemacht. Die Innenseite ist zwar gleichmäßig geebnet, aber nicht eigentlich geglättet.
b. Eine Scherbe: 7 bis 8 mm dick, grauschwarz, außen braun, hart gebrannt, mit geringerem Steingruszusatz, beiderseits sehr gut geglättet, unverziert.
c. Ein abgesplittertes, 6 bis 7 mm dickes graubraunes Stück, hart gebrannt, wahrscheinlich zu b gehörig.
d. Sechs Scherben: 5 mm dick, aus hart gebranntem, mit weißem Quarzsand vermischtem Thon, beiderseits gut geglättet, unverziert. Der hellgraue Kern ist beiderseits mit einer feinen Thonschicht überzogen, und zwar außen schwarz und innen theils schwarz, theils bräunlich. Ihrer Form nach scheinen diese Scherben von einem kleinen, stark gewölbten Gefäße zu stammen.
e. Zwei Scherben: 5 mm dick, hart gebrannt, unverziert, scheinbar von einem ähnlichen Gefäße, wie die vorigen. Auch hier ist der hellgraue Kern beiderseits mit einer feinen Thonschicht überzogen, und zwar innen mit einer glänzend schwarzen und außen mit einer stark mit feinem Sand vermischten gelbbraunen, welche letztere jedoch durch den umgebenden Ackerboden steIlenweise schon sehr abgescheuert ist
Je nachdem diese elf Scherben nun von zwei oder vier Urnen herrühren, gehören a, b, c zu der einen und d, e zu der anderen, oder a zur ersten, b und c zur zweiten, d zur dritten und e zur vierten.
Daß auch anderweitig schon Alterthümer auf der Kavelsdorfer Feldmark gefunden sind, zeigen einige dorther stammende Gegenstände, welche in der Sammlung der Rostocker Großen Stadtschule aufbewahrt werden. Es sind dies:
1. Ein Hals= oder Kopfring aus Bronce. Vorhanden sind drei zum Theil etwas verbogene, stark oxidirte Stücke desselben, welche


|
Seite 225 |




|
fast den ganzen, nur aus einander gebogenen und zerbrochenen Ring darzustellen scheinen. Jedenfalls kann nur ein kleiner Theil fehlen. Die Unterseite ist platt, die Oberseite dagegen etwas gewölbt und durch kleine Querrillen verziert. Der vom Ringe eingeschlossene Raum scheint 10 cm Durchmesser gehabt zu haben. Die Breite des Reifes wechselt zwischen 5 und 7 mm, während seine Dicke etwa 1 mm beträgt. Gefunden wurden diese drei Stücke in einer mit Asche und gebrannten Knochenstücken gefüllten Urne beim Abtragen eines Hünengrabes. Von der zerbrochenen Urne sind zwei große Stücke, ein Randstück und ein Stück mit dem vollständigen Boden, erhalten, so daß sich ihre Form und Größe noch ziemlich genau erkennen läßt. Das zu ihrer Herstellung verwandte Material besteht aus grauschwarzem, stark mit Steingrus vermengtem Thon, der auf der einen Seite, wie sich an den Bruchstellen zeigt mit einer dünnen rothen Thonschicht überzogen ist. Die Farbe der anderen Seite ist graubraun. Der 4 cm hohe Hals bezw. Rand biegt mit ziemlich scharfem Knick nach außen. Der Bodendurchmesser beträgt außen 7 cm und innen 5 bis 6 cm. Von hier ansteigend erweitert sich die mindestens 20 cm hohe Urne mehr und mehr; 6 cm über dem Boden beträgt ihr Durchmesser bereits 14 cm, während der dicht unter dem wieder etwas engeren Halse befindliche, weit ausladende Bauch etwa 26 cm Durchmesser hält.
2. Ein in drei Theile zerbrochener, zweischneidiger Keil aus hellbräunlich= bezw. grau=blauem Feuerstein, überall polirt, mit Ausnahme der später wieder durch Behauen geschärften hinteren Schneide; Länge: 15 1/2 cm, Breite vorne 5 1/2 cm, hinten: 4 cm, Dicke in der Mitte: 2 bis 2 1/2 cm. Der specielle Fundort ist nicht genauer angegeben.



|


|
|
:
|
3. Urnenscherben von Kösterbeck.
Auf dem Kösterbecker Acker an der Südseite des Kassebohm=Kösterbecker Weges fand ich im Mai 1889 auf der ersten Höhe jenseit des dortigen Hohlweges mehrere alte Urnenscherben. Abgesehen von einigen ganz kleinen Splittern waren es fünf sämmtlich an einander passende Stücke, die auf einem dort zusammengeworfenen Steinhaufen zerstreut lagen. Die Steine waren aus dem die Höhe bedeckenden Acker bei dessen Herrichtung zum Rübenbau zusammengelesen, und dürften somit die gefundenen Urnenreste einem hier durch das Steinbrechen bezw. das tiefere Pflügen zerstörten alten


|
Seite 226 |




|
Brandgrabe entstammen. Die hart gebrannten, schwarz= bezw. graubraunen Scherben sind 1 cm dick und bestehen aus ganz außerordentlich stark mit feinem, rothem Granitgrus vermischtem Thon. Die augenscheinlich mit Hülfe der Töpferscheibe hergestellte Urne war innen sehr sorgfältig geglättet. Außen sind sämmtliche fünf Scherben rauh. Ob diese Rauhheit aber nur auf späterer Verwitterung beruht oder ursprünglich so hergestellt ist, wage ich bei den geringen Ueberresten nicht zu entscheiden. Da ein Theil der Scherben schon ältere Bruchflächen aufweist, so war die Urne, falls sie überhaupt heil in das Grab kam, jedenfalls schon vor dieser letzten Zerstörung zerbrochen. Ihrem ganzen Charakter nach dürften die Scherben der vorwendischen Zeit angehören.



|


|
|
:
|
4. Wendische Gefäßscherbe von Petschow.
An der Südwestseite der Wolfsberger Seewiesen (im Petschower Theile) zieht sich im Moore zwischen der Kösterbeck und dem Dorfe Petschow, etwa 100-300 Schritte vom Festlande entfernt, eine Inselkette von sieben aus Blocklehm bestehenden, ziemlich hohen und wohl 200-300 Schritte im Umfange messenden Inseln hin. Als ich dieselben auf der Suche nach einem in dortiger Gegend vermutheten Burgwalle 1883 besichtigte, waren zwei derselben beackert, während die übrigen, soweit sie nicht zum Lehmabgraben benutzt wurden, gewöhnlicher Graswuchs bedeckte. Auf den nicht beackerten und vor allen Dingen den als Lehmgruben dienenden Inseln lag eine Menge zum Theil schon gesprengter Steinblöcke, von Alterthümern war jedoch nichts zu entdecken. Nur auf der südöstlichsten, die wohl 300 Schritte im Umfang halten mochte und bereits fast rundherum abgegraben war, fand ich am Nordabhange eine alte unverzierte Gefäßscherbe von augenscheinlich wendischem Typus. Es ist ein 5 X 4 cm großes Stück aus hart gebranntem, mit Steingrus durchknetetem Thon, innen röthlich, im Kern und außen graugelb. Die ziemlich rauhe Außenseite ist platt, während die geglättete Innenfläche nach der Mitte zu etwas ansteigt, so daß die im Uebrigen nur 1 cm dicke Scherbe hier 14 mm mißt. Das Stück stammt also offenbar aus der Mitte des Gefäßbodens. Weitere Scherben oder sonstige Altsachen aber waren trotz eifrigen Suchens, wie bereits bemerkt, auch hier nicht zu finden.


|
Seite 227 |




|



|


|
|
:
|
5. Feuersteingeräthe von Sanitz, Hohenfelde und Neu=Brodersdorf.
I. Unter den wenigen mit einem Fundorte bezeichneten Steinsachen der Sammlung der Rostocker Großen Stadtschule befinden sich auch zwei bei Sanitz und bei Hohenfelde gefundene Stücke.
1. Ein Messer aus grauem Feuerstein mit vierkantigem Griff und zweischneidiger Klinge, nur behauen, nicht polirt. Die Spitze ist abgebrochen und fehlt. Das vorhandene Stück mißt in der Länge: 16 cm, der Griff allein: 7 cm. Die am Griff 3 cm breite Klinge wird nach vorne hin allmählig schmäler, so daß sie an der Bruchstelle nur noch 2 1/4 cm breit ist. Der Griff hat einen Durchmesser von 3 cm. Fundort: Sanitz, geschenkt im Schuljahr 1877/78.
2. Eine Pfeil= oder Lanzenspitze aus grauem Feuerstein, 6 cm lang, wovon etwas über 1 cm auf das 1 1/2 cm breite Schaftende kommt. Die eigentliche Spitze ist hinten 3 1/2 cm breit und spitzt sich dann nach vorne hin allmählig zu. Die Dicke beträgt etwa 3 mm. Gefunden im Torfmoore bei dem zu Groß=Lüsewitz gehörigen Vorwerk Hohenfelde, geschenkt im Schuljahr Ostern 1879/1880.
II. Etwas zahlreicher sind die im Rostocker Alterthums=Museum aufbewahrten, im Jahre 1889 vom Gutspächter Herrn Piper geschenkten Steinsachen von Neu=Brodersdorf. Es sind dies:
1. Eine 4 cm lange, 2 1/2 cm breite und 6-6 1/2 mm dicke, am hinteren Ende abgebrochene Lanzen=, Pfeil= oder Messerspitze aus weißlichgrauem Feuerstein.
2. Ein kurzer, breiter Feuersteinkeil, hellgrau, an den beiden breiten Seiten polirt, doch ist die Politur später zum Theil wieder abgesplittert. Länge: 8 cm, Breite an der Schneide: 6 cm und hinten: 43 mm, Dicke hinten: 1 1/2 cm.
3. Ein ganz und gar polirter Keil aus braunem Feuerstein, dessen eine Breitseite flach hohl geschliffen ist. Länge: 9 cm, Breite an der Schneide: 4 1/2 cm und hinten: 1 1/2 cm, Dicke: 18-20 mm.
4. Ein gelblich=grauer Feuersteinkeil von 9 cm Länge und 7-13 mm Dicke. Seine beiden Breitseiten sind ursprünglich polirt gewesen, jedoch fast gänzlich wieder abgesplittert. Die Breite beträgt an der Schneide: 4 1/2 cm und am hinteren Ende: 1 1/2 cm.
5. Die Hälfte eines Hammers aus hartem, grauem Gestein, schön geglättet, aber nicht eigentlich polirt, im Schaftloch gebrochen. Länge: 8 1/2 cm, Breite an der Bruchstelle, also ungefähr in der Mitte des ganzen Hammers: 4 1/2 cm, nach dem Ende zu abnehmend,


|
Seite 228 |




|
Höhe zwischen 5 und 5 1/2 cm. Das runde Schaftloch hat glatte Wände und scheint überall gleich weit gewesen zu sein.
Genauere Fundorte sind nicht angegeben, nur bei Nr. 1: "Lanzenspitze gefunden auf dem Acker zu Neubroderdorf" und bei den übrigen vier Stücken: "Gefunden in Neubroderdorf."



|


|
|
:
|
6. Der Lembken=Wall bei Billenhagen.
Der auf dem Meßtischblatte "Dänschenburg" der königlich preußischen Landes=Aufnahme von 1884 (herausgegeben 1885) im westlichen Theile des Billenhäger Forstrevieres angegebene Lembken=Wall ist ein ähnlicher von einem Graben umgebener Hügel, wie der Katswall bei Groß=Lüsewitz (vergl. Jahrb. XLVIII, S. 293) und der Wallberg bei Gelbensande (ebenda S. 295). Er mißt, an der inneren Grabenkante abgeschritten, 90 Schritte im Umfang, erhebt sich 1-2 Manneshöhen über der Grabensohle und war, als ich ihn im Juni 1889 besuchte, mit acht bis zehn Buchen sowie mit allerlei Gestrüpp von Haselbusch und dergl. bestanden. Der ihn umgebende, damals trockene Graben ist auf der Sohle einen, und von Bord zu Bord fünf bis sieben Schritte breit. Der Hügel hat eine runde Form und ist nicht höher als das Festland, dessen durch den Graben abgetrennten, in eine kleine moorige Wiese sich hinein erstreckenden, südöstlichen Ausläufer er bildet. Irgendwelche Alterthümer habe ich bei meiner Anwesenheit dort nicht bemerkt, wie. denn überhaupt bei Billenhagen bisher nur früher einmal eine alte Schwertklinge aus Bronce gefunden sein soll. Ueber den Ursprung des Namens "Lembken=Wall" habe ich nichts auffinden und auch in dortiger Gegend nichts in Erfahrung bringen können. Jedoch hörte ich, daß ein Erlenkamp neben dem Walle "Hausstelle" heißt. Mir scheint die beste Erklärung sowohl für den Lembken=Wall als auch für den Wallberg und den Katswall die zu sein, sie alle drei als Warthügel aufzufassen, auf denen einst alte, seien es nun gemauerte oder auch nur hölzerne, Wartthürme standen. Eine andere hier ebenfalls zu erwähnende Meinung hält den Lembken=Wall für eine alte Hausstätte im Anschluß an die im Groß=Freienholzer, Billenhäger und Gresenhorster Reviere einst so zahlreichen alten Gehöftsreste, auf welche ich bei einer anderen Gelegenheit noch einmal ausführlicher zurückkommen werde.


|
Seite 229 |




|



|


|
|
:
|
7. Urnenfeld, Brandgruben und Gerippe von der Feldmark Kassebohm.
Südwestlich von der Schraep'schen Steinschleiferei befindet sich in der dortigen Sandgrube, sowie namentlich auf dem benachbarten Kassebohmer Acker am Abhange nach den Oberwarnow=Wiesen hin ein altes, leider durch die Beackerung zerstörtes Urnenfeld, dessen Auffindung ich einer freundlichen Mittheilung des Herrn Rentier Burgwedel zu Rostock verdanke. Von letzterem erfuhr ich nämlich im September 1887, hinter der erwähnten Steinschleiferei liege in einer Entfernung von etwa 75 m von der Wiesenkante auf dem Felde ein Hügel aus weißem Sand, auf dem er verschiedene schwarze Stellen und auch Urnenscherben gefunden habe. Die schwarzen Stellen seien bei Näße nicht ordentlich zu sehen, weil dann das Ganze dunkler gefärbt sei, bei trockenem Wetter träten sie jedoch ganz deutlich hervor. Eine genauere Untersuchung der betreffenden Stelle mußte, theils wegen der Ackerbestellung, theils wegen persönlicher Behinderungsgründe, leider bis zum Sommer 1889 verschoben werden. Seit dem aber ist die dortige Gegend, die Sandgrube sowohl wie der Acker, mehrfach einer eingehenden Besichtigung und sorgfältigen Absuchung unterzogen, wobei sich dann die folgenden Resultate ergaben.
Zunächst ließen sich in der erwähnten Sandgrube während der Zeit vom 4. August 1889 bis 17. October 1891 an drei verschiedenen Tagen im Ganzen zwölf Brandstellen constatiren. Dieselben befanden sich sämmtlich in der Südostwand der Grube und lagen mit ihrer oberen Kante etwa 30 cm und mit der Sohle etwa 60 cm unter der Ackeroberfläche. Das Aussehen und die Zusammensetzung war bei allen gleich: ein Pflaster von im Feuer gewesenen Feldsteinen, umgeben und durchsetzt mit schwarzer, Holzkohlenreste enthaltender Branderde. Sonst wurde in diesen Stellen nichts gefunden, als einmal eine kleine, unverzierte Urnenscherbe und Bruchstücke eines Thierzahnes und ein anderes Mal zwei Thierzähne und Reste eines schon verwitterten dritten, wobei zu bemerken ist, daß sämmtliche Zähne bezw. Zahnreste nicht dem Feuer ausgesetzt gewesen sind. Die Urnenscherbe ist 7-9 mm dick, durch und durch dunkel graubraun, gut gebrannt, beiderseits geglättet, im Bruch aber stark mit Steingrus durchsetzt.
Wichtiger ist ein Fund, den ich am westlichen Ende der Sandgrube machte. Hier sah ich an dem dortigen niedrigen Abhange


|
Seite 230 |




|
einige Urnenscherben auf der Oberfläche liegen. Hierdurch veranlaßt, grub ich nach und fand dabei unmittelbar unter der Oberfläche eine schwarze Brandstelle, ebenso wie die soeben beschriebenen, jedoch ohne Steinpflaster. Zwischen der Branderde aber kamen noch weitere, zum Theil sehr verwitterte und brüchige Urnenscherben zu Tage, ferner calcinirte Knochenstückchen, einige kleine Stückchen Holzkohle und zwei Stücke einer Broncenadel. Letztere lag schon zerbrochen im Grabe. Die beiden vorhandenen Stücke sind das Kopfende und das Mittelstück, während das untere Ende fehlt. Zusammen 73 mm lang, bilden die beiden gefundenen Theile etwa zwei Drittel der ursprünglichen Länge. Die Nadel ist rund und mißt an der unteren Bruchfläche 3 mm, an der mittleren 3 1/2 mm und oben unter dem Kopfe 4 mm im Durchmesser. Der Kopf besteht aus zwei (2 bezw. 3 1/2 mm dicken) runden Wulsten von 5 bezw. 6 mm Durchmesser und einer 1 mm dicken, ebenfalls runden und 6 mm im Durchmesser haltenden Platte. An Urnenscherben wurden im Ganzen zwischen 20 und 30, zum Theil mit den Bruchflächen an einander passende, 6-8 mm dicke Stücke gefunden. Dieselben bestehen aus ganz außerordentlich stark mit Steingrus vermengtem, gebranntem Thon, sind meist röthlich, einzeln jedoch auch graubraun von Färbung und stammen augenscheinlich sämmtlich von ein und derselben, nicht gerade sehr kleinen Urne. Die Außenseite ist völlig rauh bis auf den etwa 2 cm hohen aufrechten Hals und den untersten Theil des Gefäßes, etwa 2-4 cm über der abgerundeten Bodenkante. Diese beiden letzteren Stellen sind ebenso, wie die gesammte Innenseite, geglättet, allerdings theilweise nur recht mangelhaft. Unmittelbar unter dem Halse, dessen obere Kante zum Theil leicht abgeplattet, zum Theil abgerundet ist, befindet sich außen dicht an einer Bruchfläche ein 1 1/2 cm langes und bis zu 7 mm vorspringendes Stück eines Henkansatzes bezw. kleinen horinzontalen Wulstes.
Unmittelbar östlich neben diesem eben erwähnten Brandgrabe fand sich noch eine kleine, beiderseits geglättete Scherbe von einem Gefäßrande, 2 1/2 cm hoch und 2 cm breit, aus fein geschlemmtem, hart gebranntem, mit wenig sehr feinem Steingrus vermengtem Thon. Der Kern ist schwarz, außen und innen aber mit einer dünnen rothen Thonschicht überzogen. Der sich nach oben stark verjüngende Rand biegt erst nach außen und dann wieder ein klein wenig nach oben um. Die oberste Kante ist abgesprungen; sie muß entweder abgerundet gewesen oder in einen Grat ausgelaufen sein.
Auch auf dem sandigen Acker südlich und südwestlich der Sandgrube, namentlich an bezw. auf dem oben erwähnten Hügel (einer flachen, länglichen Anhöhe) zeigten sich noch mehrere schwarze Brand=


|
Seite 231 |




|
stellen, welche beim Nachgraben im Feuer gewesene Steine und mit zergangener Holzkohle vermischte Branderde ergaben. Bei zwei derselben fand sich oben auf der Ackeroberfläche auf einem kleinen Raume in unmittelbarer Nähe der schwarzen Kohlenerde eine größere Anzahl einander ähnlicher Scherben, sowie einige kleine calcinirte Knochenstückchen, so daß anzunehmen ist, daß dieselben diesen beiden durch den Pflug zerstörten Brandgräbern entstammen. Diese Scherben sind:
a. Bei der ersten Stelle gefunden: 17 scheinbar von zwei Urnen herrührende Scherben und zwar von einer beiderseits sehr gut geglätteten und einer außen - abgesehen von Rand und Bodenkante - rauhen und nur innen geglätteten. Zu ersterer gehören sechs Scherben, darunter zwei mit je einer Horizontalrille verzierte, zu letzterer elf unverzierte, darunter ein Rand und vier Bodenstücke, von welchen letzteren zwei an einander passen. Der Rand ist oben abgerundet und bei den Bodenstücken geht die Gefäßwand außen sowohl wie innen allmählich ohne scharfen Absatz in den Boden über. Das Material ist gut gebrannter mit Steingrus durchkneteter Thon.
α. Scherben beiderseits sehr gut geglättet, 4-8 mm dick, graubraun bis chokoladefarben und röthlichbraun. Die auf zwei Stücken vorkommenden Horizontalrillen sind ca. 1 mm tief und 2-2 1/2 mm breit.
β. Scherben nur innen geglättet, außen dagegen künstlich rauh gemacht. Fast sämmtliche Scherben sind außen graubraun, innen röthlich und haben einen grauen, stellenweise etwas bräunlichen Kern. Nur der Rand und zwei Bodenstücke sind durch und durch roth. Diese drei letzten Scherben könnten vielleicht noch zu einem dritten Gefäße gehören.
b. Bei der zweiten Stelle gefunden: 12 Scherben, darunter ein Rand= und zwei Bodenstücke. Der Form dieser beiden letzteren nach stammen die Scherben jedenfalls von zwei Urnen. Welche der zehn übrigen Stücke nun zu dem einen und welche zu dem anderen Boden gehören, läßt sich wegen der großen Uebereinstimmung in Material, Farbe und Arbeit jedoch nicht sagen. Sämmtliche Scherben sind beiderseits geglättet. Material wie bei der vorigen Stelle. Farbe: außen und innen hell= bezw. graubraun, Kern hell= oder dunkelgrau, stellenweise in das Bräunliche übergehend. Rand aufrecht, oben abgerundet. Beide Bodenstücke außen scharf absetzend, innen allmählig von der Wand zum Boden übergehend. Böden außen platt. Beide Bodenstücke sind aber trotzdem in der Form so verschieden, daß es klar ersichtlich ist, daß sie von zwei verschiedenen Gefäßen stammen, auch ist das eine etwas härter gebrannt und nicht so stark mit Steingrus durchsetzt, wie das andere.


|
Seite 232 |




|
Außer an diesen beiden Stellen aber fanden sich hier auf dem Acker zerstreut auch sonst noch mehrfach Urnenscherben und sonstige Altsachen, und zwar:
1. Ein 84 mm langer an der einen Langseite mit zwanzig bis dreißig kleinen bis zu 2 mm langen scharfen Zähnen versehener grauer Feuersteinspahn von länglich ovaler Form, hinten: 1 cm, vorne 1/2 cm und an seiner breitesten Stelle, ziemlich in der Mitte, etwas über 3 cm breit. Trotzdem die fortlaufende Reihe sorgfältig eingehauener Zähne, von denen kurz vor der Spitze leider fünf ausgesprungen sind, viel Aehnlichkeit mit einer Säge hat, so kann das Stück doch nicht gut als solche benutzt sein, da es gegen den Rücken hin 1/2 bis 1 cm dick ist.
2. Fünf Spähne von grauem bezw. schwärzlichem Feuerstein, 3-4 cm lang.
3. Eine graue Feuersteinscheibe von der im Jahrb. XXX, S. 33, abgebildeten Form, 4 X 6 cm groß und 2 cm dick.
4. Acht oder neun Stücke von gebranntem Lehm (ohne Stroheindrücke).
5. Einige kleine calcinirte Knochenstückchen.
6. Die etwa 40-45 Urnen= oder sonstigen Gefäßscherben bestehen sämmtlich aus gut gebranntem mit mehr oder minder grobem Steingrus vermischtem Thon und sind alle nur klein, denn die größte mißt nur 3 X 5 cm. Die Dicke wechselt zwischen 4 und 11 mm. Randstücke wurden fünf gefunden sowie eine völlig platte Scherbe, welche entweder von einem Gefäßboden oder von einem Thonbrette herstammt. Betrachtet man die Gesammtheit dieser bisher dort gesammelten Scherben, so sieht man sofort, daß dieselben von mindestens zwei völlig verschiedenen Gefäßarten herrühren. Die einen, und zwar bei weitem die meisten, stammen offenbar von Urnen, welche nur auf der Innenseite und außen am Hals und an der Bodenkante geglättet, im übrigen außen aber rauh gelassen oder künstlich rauh gemacht waren, ebenso wie die oben erwähnten in der Grabstätte zusammen mit der Bronzenadel gefundenen Scherben. Die anderen sind beiderseits sehr sorgfältig geglättet und gehören augenscheinlich bedeutend sorgfältiger gearbeiteten Gefäßen an.
Die Scherben der ersten Art sind mit ziemlich grobem Steingrus durchsetzt und von gelblicher, bräunlicher, röthlicher, grauer oder schwarzgrauer Farbe, und zwar theils durch und durch gleichfarbig, theils innen und außen von verschiedener Färbung. Hierher gehören 31 Scherben, von denen 18 außen rauh und innen geglättet und 13, darunter 4 Randstücke, beiderseits geglättet sind. Die Glättung ist edoch, und zwar auch bei den letzteren, bei weitem nicht so sorgsam


|
Seite 233 |




|
und gleichmäßig ausgeführt, wie bei den Scherben der zweiten Art. Von den Randstücken sind drei oben abgerundet und eins abgeplattet. Letzteres ist eine der dicksten dort gefundenen Scherben, denn es hat, trotzdem die Oberfläche der Außenseite abgesprungen ist, noch immer eine Dicke von 1 cm. Dieser Stärke der dunkel bräunlichgrauen Scherbe entspricht auch die Grobkörnigkeit des in ihr enthaltenen Steingruses, unter welchem sich Stücke bis zu 5 mm Durchmesser befinden. Sämmtliche Scherben dieser Art sind unverziert, jedoch ist eine derselben mit einem ähnlichen 3 mm vorspringenden, jedoch vertikalen Wulst oder Höcker (und zwar scheinbar auch unmittelbar unter dem Halse) versehen, wie das eine bei der Bronzenadel gefundene Randstück. Der Wulst hat eine Grundfläche von 10 (vertikal) X 7 (horizontal) mm. Vielleicht gehört hierher auch, falls sie nämlich nicht von einem Thonbrett, sondern aus der Mitte eines platten Urnenbodens stammt, die oben erwähnte auf beiden Seiten völlig platte Scherbe. Dieselbe ist hart gebrannt, beiderseits geglättet und durch und durch graubraun.
Die zweite Scherbenart ist, wie bereits bemerkt, beiderseits sehr sorgfältig und fein geglättet, trotzdem sie in ihrem Kern ebenfalls eine ziemlich große Steingrusbeimengung zeigt. Hierher sind neun Scherben zu rechnen, darunter zwei Randstücke mit oben abgerundeter Kante. Die Färbung dieser beiderseits augenscheinlich mit einer dünnen sehr fein geschlemmten Thonschicht überzogenen Scherben ist theils chokoladefarben, theils grau oder graubraun.
Endlich sind hier noch drei kleine Stücke aufzuführen, die zwar auch beiderseits geglättet sind, aber trotzdem nicht zu der vorigen Art gehören. Das eine derselben ist eine außen röthliche, innen schwarzgraue, nach außen gebogene Scherbe, auf deren Innenseite sich, der äußeren Biegung entsprechend, eine flache 1 mm vorspringende und 8 mm breite horizontale Leiste hinzieht. Das andere Stück ist durch und durch graubraun und zeigt außen ein horizontales Band kleiner schräger eingestempelter Reihen von fünf viereckigen Punkten sowie eine flache Horizontalrille. Die dritte durch und durch hellgraue Scherbe ist nur mit einer einfachen Horizontalrille verziert.
Auch auf einer etwas weiter südlich belegenen flachen Erhebung desselben sandigen Ackers, östlich der in den Warnowwiesen befindlichen Kassebohmer Rinder= und Pferdekoppel, wurde noch eine Anzahl alter Urnenscherben gefunden, sowie ferner einige kleine Stücke calcinirter Menschenknochen, ein 4 cm langer grauer Feuersteinspahn und ein bereits stark in Verwitterung übergegangenes 11-12 cm langes abgespaltenes Stück eines Röhrenknochens, dessen Zugehörigkeit zu dem Urnenfelde sich bis jetzt jedoch nicht mit Sicherheit behaupten läßt.


|
Seite 234 |




|
Von den fünfzehn hier gefundenen Scherben gehören sieben zu der vorhin beschriebenen ersten, außen rauhen, Urnenart, darunter drei Bodenstücke. Das eine der letzteren stammt aus dem Boden selbst, ist außen rauh, innen geglättet und beiderseits platt. Die beiden anderen aus der Bodenkante herrührenden Stücke sind in dem lockeren Sande schon ziemlich stark abgerieben, so daß sich ihre ursprüngliche äußere Form nicht mehr genau erkennen läßt. Innen gehen beide allmählig von der Wand zum Boden über, während das eine außen augenscheinlich ziemlich scharf absetzte und das andere unten an der Außenkante mit einem flach vorspringenden Ringe versehen zu sein scheint.
Von der oben erwähnten zweiten Art wurden nur zwei braune bezw. graubraune Stücke gefunden, beide unverziert.
Die übrigen sechs alten Scherben lassen sich unter keine der beiden vorigen Arten unterbringen. Vier derselben sind mit den gewöhnlichen Horizontalrillen verziert, 3-7 mm dick und grau, braun oder röthlich von Färbung. Sie sind sorgsam gearbeitet, beiderseits gut, wenn auch nicht so gut, wie die zweite Art, geglättet, hart gebrannt und zeigen weniger Steingruszusatz, als die bisher erwähnten beiden Arten. Zwei dieser Scherben sind offenbar dicht unter dem Rande abgebrochen, von denen der eine, wie man an dem Ansatz noch deutlich erkennen kann, leicht nach außen gebogen war. Von den beiden anderen Scherben stimmt die eine in Material, Brand und Arbeit mit den vorigen vier sonst völlig überein, doch ist sie außen nur mangelhaft geglättet. Sie ist 4 mm dick, außen und innen röthlich bezw. bräunlich mit grauem Kern, unverziert und scheint von der Bodenkante herzurühren. Die siebte ebenfalls unverzierte Scherbe endlich stammt, ihrer starken horizontalen Krümmung nach zu urtheilen, vielleicht vom Hals eines Kruges. Sie ist gleichfalls nur wenig mit Steingrus durchsetzt, hart gebrannt, durch und durch graubraun, innen gut geglättet und, trotzdem die Oberfläche der Außenseite abgesprungen ist, noch 8-9 mm dick. Größe 1 X 3 cm.
Vergleichen wir nun alle diese Funde mit einander, so scheint es mir zweifellos zu sein, daß beide bisher genannten Fundstellen ihrem Ursprunge nach ein einziges altes Begräbnißfeld bilden, wenn sich auch ein unmittelbarer örtlicher Zusammenhang der Gräber beider Fundorte bisher nicht hat nachweisen lassen, da zwischen beiden seiner Zeit noch Korn auf dem Halme stand und die nähere Untersuchung verhinderte. Auf der zuletzt erwähnten Fundstelle lagen die Scherben und sonstigen Altsachen zwanzig bis fünfzig Schritte von der Wiesenkante entfernt. Ob sich nicht auch noch näher nach der Wiese hin derartige Sachen finden, mußte ebenfalls des seiner Zeit dort noch


|
Seite 235 |




|
stehenden Kornes wegen einstweilen ununtersucht bleiben; ebenso wie überhaupt die gesammte Ausdehnung bezw. Abgrenzung des Urnenfeldes noch einer eingehenden Erforschung bedarf. Schon beim Bau der Zuckerfabrik fiel es bei den zu diesem Zwecke vorgenommenen Erdarbeiten auf, daß die daselbst in der Erde lagernden Steine zum Theil derartig auf einander lagen, als ob sie aufgeschichtet seien. Auch fand sich ebendaselbst im Jahre 1884 zwischen ausgesiebten Steinen bereits ein Stück von einem Urnenboden. Ein bei der nahen Stralsunder Eisenbahnbrücke aus der Oberwarnow ausgebaggertes 15 cm langes Dolchmesser aus grauem Feuerstein wird im Rostocker Alterthums=Museum aufbewahrt. Es hat eine 79 mm lange platte, an der breitesten Stelle, kurz vor dem Griff, 3 cm und vorne an der Spitze 3 mm breite Klinge sowie einen 1 cm dicken vierkantigen Griff. Die Form ist ähnlich wie bei dem im Friederico=Francisceum, Tab. II, Fig. 4 abgebildeten Quastenberger Steinmesser, nur ist das Rostocker Stück, besonders in der Klinge, bedeutend kürzer als dies. Im Jahre 1884 wurde übrigens auch schon in der oben erwähnten Sandgrube hinter der Schraep'schen Steinschleiferei ein in zwei Theile zerbrochener, stark verwitterter Wirbelknochen sowie ein Sandsteinblock gefunden, dessen eine Seite mit einer halbkreisförmigen Ausschleifung von ca. 15 cm Durchmesser und 4 cm Tiefe versehen war (Mühlstein?). Dabei sei hier noch bemerkt, daß damals dort noch eine Dachpappenfabrik an der Stelle der jetzigen Steinschleiferei stand, so daß der Sandstein also nicht, wie man sonst aus der jetzigen Nachbarschaft vermuthen könnte, aus dieser letzteren herstammen kann.
In demselben Acker, welcher unten an den Warnowwiesen das erwähnte Urnenfeld enthält, wurden im März 1887 auch oben an der Rostock=Neubrandenburger Chaussee in einer damals dort angelegten Sandgrube zwei Brandstellen gefunden und zwar die eine in der Nord= und die andere in der Südwand derselben. Beide lagen ungefähr 50 cm unter der Erdoberfläche und enthielten nur schwarze Branderde und Holzkohlenstückchen. Die Sandgrube, welche sich unmittelbar an der Westseite der Chaussee etwa in der Mitte zwischen dem zur Schraep'schen Steinschleiferei führenden Wege und der Kassebohm=Kessiner Grenze befand, ist seit einigen Jahren wieder in Acker gelegt und läßt sich jetzt nur noch an der niedrigeren Lage dieser Stelle dem sie umgebenden Lande gegenüber erkennen.
Die mit der Einführung des Zuckerrübenbaues verbundene Tiefkultur, sowie das infolge dessen sich vernothwendigende Herausbrechen


|
Seite 236 |




|
der Steine aus den Ackerflächen hat, wie an so manchen anderen Stellen, so auch auf dem zwischen der Neubrandenburger Chaussee und dem Petschower Landwege belegenen Theile des Kassebohmer Feldes in den letzten Jahren mehrfach alte Grabstätten zu Tage gefördert, wenn auch längst nicht alles, was an derartigen alten Resten bei dieser Gelegenheit zerstört wurde, bekannt geworden sein dürfte.
Schon im Januar 1884 fanden Knechte beim Steinbrechen dicht an der Chaussee bei der dort nicht weit von der Rostock=Kassebohmer Grenze entfernten Mergelgrube im Feuer gewesene Steine, "schwarzen Dreck" und Urnenscherben, die sie jedoch, ohne weiter darauf zu achten, liegen ließen. Ungefähr in derselben Gegend, jedoch etwas weiter südlich, wurden dann im September 1889 durch den Rübenpflug noch fünf dicht bei einander liegende, aber trotzdem deutlich von einander getrennte Brandgräber zerstört. Alle fünf Stellen waren in dem im Uebrigen lehmfarbenen Acker an der vom Pfluge herausgeworfenen schwarzen Kohlenerde und den berußten, zum Theil ziemlich großen Feldsteinen leicht erkennbar. Die aus ihnen herausgepflügten Urnenscherben wurden von Herrn Rentier Burgwedel gesammelt und dem Rostocker Alterthums=Museum überwiesen. Die fünf Brandstellen lagen unmittelbar nordöstlich neben der dort im Acker befindlichen kleinen sollartigen, aber trockenen Vertiefung südöstlich der an der Westseite der Chaussee erbauten Schraep'schen Arbeiterwohnungen.
Ganz ähnliche Entdeckungen wurden in den beiden eben erwähnten Jahren auch in der Nähe des Petschower Landweges gemacht. Auch hier stießen die Knechte zu Anfang 1884 beim Ausbrechen von Steinen auf eine alte Grabstätte, welche sie nach Entfernen der ersteren einfach wieder zuwarfen. Dieselbe lag ziemlich auf der Höhe des Hohlweges unmittelbar am Wege und bestand aus einer unter einem Steine befindlichen Höhlung mit Urnenscherben, "schwarzem Schmier" und im Feuer gewesenen Steinen. Ende 1889 wurde hier mit dem Herrichten des Ackers zum Zuckerrübenbau fortgefahren, wobei eine derartige Menge von Steinen zu Tage kam, daß das Feld, als ich es am 17. November 1889 besichtigte, förmlich übersät schien mit kleinen Steinhaufen und großen Blöcken, welche aus der Erde theils ausgegraben, theils durch den tief gehenden Rübenpflug ausgehoben waren. Oben auf der Höhe am Petschower Landwege wurden hierbei wiederum einige Urnenscherben gefunden und durch Herrn Burgwedel dem Rostocker Alterthums=Museum übermittelt.
Im Ganzen werden von den beiden 1889er Fundorten sieben Urnenscherben und ein Holzkohlenstückchen in diesem Museum aufbewahrt, leider ohne genauere Bezeichnung, von welchem der beiden Plätze die einzelnen herrühren. Fünf dieser Stücke stimmen mit der


|
Seite 237 |




|
oben beim Urnenfeld beschriebenen ersten Scherbenart vollkommen überein. Sie sind innen sämmtlich und eine auch außen zur Hälfte geglättet, im Uebrigen aber außen alle rauh. Eine gleiche Uebereinstimmung in Charakter, Arbeit und Material zeigt auch eine außen mit sehr schlechten Horizontalrillen verzierte Scherbe. Auch sie ist außen rauh und nur innen geglättet, doch ist es möglich, daß hier die äußere Rauhheit nur vom Verwittern herrührt. Die Horizontalrillen sind schmal und ziemlich tief. Das siebte Stück ist eine unmittelbar unter dem Rande weggebrochene größere Scherbe einer gut gearbeiteten graubraunen Urne, deren ziemlich starke Ausbauchung sich dicht unter dem Halse befand. Sie ist beiderseits geglättet, hart gebrannt und unverziert. Ihre Krümmung beträgt etwa 140°. Der Hals der sich nach dem Boden zu verjüngenden Urne war ziemlich viel enger als die Ausbauchung.
a. Auch auf diesem Theile des Kassebohmer Ackers beobachtete ich im November 1889 fünf durch den Pflug zerstörte Brandgruben. Dieselben bestanden, wie gewöhnlich, aus schwarzer Kohlenerde und berußten, bezw. im Feuer gewesenen Feldsteinen. Von Urnenscherben und sonstigen Alterthümern war nichts zu finden, jedoch enthielt die eine Grube eine ganze Anzahl formloser gebrannter Lehmstücke. Sämmtliche fünf Brandgruben lagen nicht weit vom Wege entfernt zwischen dem Gipfel des Wurmberges und dem Westende des von Rostock ab ersten Hohlweges am Petschower Landwege. Uebrigens soll bereits im Juli 1887 beirn Bau der Rostock=Stralsunder Eisenbahn auf der benachbarten Stadtfeldmark eine Urne, und zwar in Verbindung mit Eisensachen, ausgegraben sein. Auch von einem damals gefundenen Menschenschädel wurde gesprochen. Als Fundort wurde angegeben: zwischen Stadtpark und Ober=Warnow. Stimmt diese Angabe, so müßte die Urne im Durchstich zwischen dem Stadtpark und dem Petschower Landwege gestanden haben, da das Bahnplanum von diesem Wege bis zur Warnow aufgeschüttet ist und hier zu der Zeit noch nicht einmal die Gräben an beiden Seiten des Bahndammes ausgehoben, augenscheinlich also überhaupt noch nicht gegraben war. In dem erwähnten Durchstiche zwischen dem Landwege und der Tessiner Chaussee wurde damals eine große Menge von Steinen, darunter Blöcke von gewaltiger Größe, zu Tage gefördert, jedoch habe ich keine Grabstätten dabei bemerkt, vielmehr lagen die Steine, soweit ich gesehen habe, alle im Urboden.


|
Seite 238 |




|
b. Oben auf der Spitze des Wurmberges fand mein jüngerer Bruder in der 1889 eingeebneten und in Acker gelegten Sandgrube im September 1885 etliche umherliegende Menschenknochen und bei aufmerksamerer Besichtigung in der südlichen Wand der Grube auch das Skelett, von dem sie herstammten. Eine am folgenden Tage vorgenommene genauere Untersuchung ergab, daß das Gerippe, von welchem der Schädel und ein Theil des linken Armes, sowie der linken Rumpfseite schon fehlten, nur etwa 40 cm tief in der sandigen Ackerkrume lag, und zwar auf dem Rücken in der Richtung von WNW (Kopf) nach OSO (Füße). Bis auf die beiden zuweit in den noch bestellten Acker hineinreichenden Unterschenkel wurden alle noch vorhandenen Knochen ausgegraben. Auffällig war die Lage der Knochen der rechten Hand. Dieselben lagen nämlich zwischen dem Becken und den Unterarmknochen in einer Art und Weise, als ob die losgetrennte Hand neben der Innenseite des Unterarmes in die Erde gebettet sei. Zwischen den Fingerknochen dieser Hand fand sich die Hälfte eines dünnen Fingerringes aus Kupfer oder Bronce, sowie irgend ein schwarzer feuchter Faserstoff (Kleidungsreste?). Die Fingerknochen zeigten, offenbar in Folge der Oxidirung des Ringes, zum Theil eine grüne Färbung. Durch das Gewicht der darauf liegenden Erde war der Brustkasten des Gerippes vollständig eingedrückt, so daß die Rippen durch einander gefallen waren. Die Rückenwirbel dagegen befanden sich noch alle dicht an einander gereiht in ihrer ursprünglichen Lage. Sämmtliche Knochen waren bereits sehr morsch, so daß eine ganze Anzahl derselben beim Ausgraben zerbrach. Das gefundene Ringstück stammt von einem mit einer Platte oder dergl. versehen gewesenen Fingerringe. Denn der sonst nur 2 mm breite, ganz einfache Reif verbreitert sich dicht vor der einen Bruchstelle plötzlich bis zu 7 mm. Die Dicke des Reifes beträgt 1/2-3/3 mm, die der Platte höchstens 1/2 mm. Das Ganze ist vollkommen grün oxidirt und nur an einer Stelle auf der Innenseite dicht vor der der Platte entgegengesetzten Bruchstelle dunkelblau angelaufen.
Auch früher kamen in dieser Sandgrube schon einzelne menschliche Skelette bezw. Reste von solchen zum Vorschein. So gruben wir dort schon als Schüler um die Mitte der siebziger Jahre fast an derselben Stelle der Südwand einen wohlerhaltenen Schädel, Wirbelknochen, Rippen, Becken und Oberschenkelknochen aus, die jedoch später verloren gingen. Dies Gerippe lag etwa in derselben Tiefe und, soweit ich mich entsinne, auch ungefähr in derselben Richtung, wie das oben erwähnte, wenigstens wurde auch bei ihm zuerst das Kopfende in der Wand sichtbar. Später wurden, und zwar wiederum in derselben Gegend, im Februar 1882 noch einmal drei menschliche


|
Seite 239 |




|
Arm= bezw. Unterschenkelknochen gefunden, welche vielleicht noch zu dem zuletzt genannten Skelette gehörten, da in der Zwischenzeit nur sehr selten Sand von dort abgefahren war. Daß aber auch anderweitig schon Gerippe daselbst ausgegraben sein müssen, geht aus dem Umstande hervor, daß es der Rostocker Kämmerei damals, als wir das erste Skelett in der Sandgrube entdeckten, schon seit längerer Zeit bekannt war, daß dort Gerippe im Acker lägen.
Sonst wurde in der erwähnten Sandgrube nichts weiter gefunden, als im März 1887 eine kleine, nur 14 X 15 mm große, 5 mm dicke alte Gefäßscherbe; außen roth, innen braun, mit Steingrus durchsetzt, hart gebrannt und unverziert. Dieselbe lag am Abhange unmittelbar westlich von der Stelle, wo wir 1885 die Skelettreste ausgegraben hatten.
Auf dem Acker an der Ostseite des von Kassebohm nach den Cramonstannen führenden Weges fand ich im Februar 1891 etwa 55 Schritte von der Tannenkante entfernt nahe am Wege die abgebrochene Spitze eines Messers oder dergl. aus grauem Feuerstein. Das vorhandene kurz zugespitzte Stück ist 24 mm lang, 15 mm breit und nach dem Rücken hin bis zu 7 mm dick. Es ist nur behauen, nicht polirt.
Einen auf Kassebohmer Feldmark gefundenen 78 mm langen schwarzen Feuersteinspahn besitzt das Rostocker Alterthums=Museum, und einen eben dort gefundenen Steinkeil bewahrte man früher auf dem dortigen Hofe.
Auch hart gebrannte mittelalterliche Gefäßscherben kommen bei Kassebohm mehrfach vor, und zwar sowohl auf dem Urnenfelde an der Oberwarnow als auch auf den Aeckern zwischen der Rostock=Neubrandenburger Chaussee und dem Stadtpark.



|


|
|
:
|
8. Wendische Brandgrube und Feuersteinpfeilspitze in den Cramonstannen.
1. Am Südrande der Cramonstannen zwischen dem Kassebohm=Riekdahler Fahrwege und der Dachpappenfabrik von Diedr. Riedel wurde im November 1887 beim Ausheben von Pflanzlöchern für dort zu pflanzende junge Eichen und Akazien eine alte Brandstelle angestochen. Eine bald darauf vorgenommene genauere Untersuchung und völlige Ausgrabung derselben ergab folgendes Resultat. Die


|
Seite 240 |




|
betreffende Stelle befand sich 199 Schritte westlich von dem erwähnten Fahrwege und 7 Schritte nördlich von der Südkante der Tannen, war nicht sehr groß und bestand aus schwarzer Kohlenerde und im Feuer gewesenen kleinen Feldsteinen sowie einigen Gefäßscherben. Ihre Sohle lag 58 cm unter der Erdoberfläche. Das umgebende Erdreich bestand aus lockerem Sand. Waren in der Grube ursprünglich nicht bloß Scherben, sondern wirklich ganze Urnen oder sonstige Gefäße vorhanden gewesen, so waren diese im Laufe der Zeit schon in der Erde zerdrückt und zum größten Theile verwittert. Denn gefunden wurden nur zehn meist kleine Scherben. Dieselben sind offenbar wendischer Herkunft, stammen mindestens von zwei, wahrscheinlich aber von drei Gefäßen und bestehen aus hart gebranntem mit ziemlich grobem Steingrus vermengtem Thon. Ein etwa 12 mm dickes ziemlich bröckliches Stück ist sogar so stark mit derartiger Steinbeimengung versehen, daß es fast zu gleichen Theilen aus Thon und Steinstückchen besteht (außen graubraun, Kern und Innenseite grauschwarz). Die übrigen Scherben sind etwa 1/2 cm dick, ganz gut gearbeitet und meist durch und durch röthlich oder bräunlich, nur ein Bodenstück ist außen röthlich, im Kern und an der Innenseite aber hellgrau. Verziert sind nur drei Stücke, ein größeres und zwei kleinere. Ersteres zeigt eine horizontale Wellenlinie und darüber drei durch einander laufende Horizontalrillen, das zweite Stück ein horizontales Band schräger von rechts oben nach links unten gerichteter Kerben, welche mit einem zwei= bis dreizahnigen Instrumente eingedrückt sind, und das dritte nur vier einfache Horizontalrillen. Unter den Scherben befinden sich auch zwei Bodenstücke. Beide setzen außen mit scharfer, der eine sogar mit vorspringender Kante ab, während sie innen allmählig schräge von der Seitenwand in den Boden übergehen. Der Winkel zwischen Wand und Boden beträgt innen bei dem einen ca. 125° und bei dem anderen ca. 140°. Die Böden selbst sind, soweit vorhanden, platt.
Diese beiden Bodenstücke gehören offenbar zwei verschiedenen Gefäßen an, auf welche sich auch die übrigen Scherben vertheilen lassen. Nur die erwähnte, 12 mm dicke, steinhaltige Scherbe scheint von einem dritten Gefäße herzurühren, von welchem sie allein erhalten blieb. Sie müßte sonst zu dem Bodenstück ohne vorspringenden Rand gehören und aus der Mitte des Bodens stammen, der dann nach der Mitte zu verdickt gewesen wäre. Doch scheint mir die erstere Ansicht die richtigere zu sein.
2. Eine roh zugehauene Pfeilspitze aus hellgrauem Feuerstein (44 mm lang; am hinteren Ende: 13 mm, in der Mitte: 16 mm und am abgebrochenen vorderen Ende: 7 mm breit; 5-6 mm dick)


|
Seite 241 |




|
wurde von meinem jüngeren Bruder im Juli 1890 im Fußsteige am Eingange der Tannen vom Stadtpark her bei der Riedelschen Dachpappenfabrik gefunden.



|


|
|
:
|
9. Urnenfeld auf der Feldmark Riekdahl, den Cramonstannen gegenüber.
Auf dem den Cramonstannen gegenüber an der Nordseite der Rostock=Tessiner Chaussee auf Riekdahler Feldmark belegenen früheren Exercierplatze nebst angrenzendem Acker ist augenscheinlich durch die Beackerung und die dort bis vor kurzem alljährlich vorgenommenen Pionierübungen der Rostocker Garnison ein altes Urnenfeld zerstört. Es liegt dort nämlich auf der Oberfläche im Sande zerstreut eine Menge theils durch den Haken, theils durch die erwähnten Schanzarbeiten ausgeworfener Urnenscherben. Auch wurden bei den letzteren Arbeiten mehrfach alte Brandstellen angegraben. Der Raum, auf welchem diese Scherben bisher gefunden wurden, erstreckt sich nach Westen bis an die Grenze des seitherigen Exercierplatzes, nach Norden circa 4-5 m über die Nordkante desselben hinaus auf den daranstoßenden Acker. Im Süden bildet die Tessiner Chaussee und im Osten eine von der Ostseite des "Einsiedlers" nach Norden hin quer über den Exercierplatz gezogene grade Linie die Grenze. Ob sich das Urnenfeld noch weiter nach Osten erstreckt, bedarf noch einer genaueren Untersuchung, da 1887 auch an der Ackerkante an der östlichen Seite des Exercierplatzes drei Urnenscherben gefunden wurden. Zwei dieser Scherben bestehen aus gebranntem, mit grobem Steingrus vermengtem Thon und sind grob gearbeitet, die eine durch und durch graubraun, die andere außen roth, innen dunkelgrau. Das dritte Stück ist eine gut gearbeitete, dünne, schwarze Scherbe aus hart gebranntem Thon mit feinem Steingruszusatz, vielleicht jüngeren Alters und von einem "Taterpott" stammend. Außerdem fanden sich dort noch eine der bekannten blaugrauen mittelalterlichen Scherben und ein Knochenstück.
Brandstellen sah ich bis jetzt fünf, sämmtlich in den Seitenwänden dort ausgehobener Schanzgräben. Vier derselben befanden sich an der Westkante des Platzes, lagen etwa 1/2 m unter der Erdoberfläche und bestanden aus einer mehr oder weniger festgefügten Pflasterung von im Feuer gewesenen Feldsteinen, deren Zwischenräume mit schwarzer, mit Holzkohlenstückchen vermischter Branderde ausgefüllt waren. Ueber dieser Pflasterung lagerte ebenfalls eine Schicht derartiger Branderde. Die fünfte, im November 1890 nordöstlich vom


|
Seite 242 |




|
Einsiedler in der Nähe der Südkante des Urnenfeldes entdeckte Stelle zeigte das deutliche Bild einer senkrecht durchstochenen muldenförmigen Brandgrube. Ihre Tiefe betrug 1,5-1,6 m und ihr Durchmesser an der Oberfläche etwa 1,5 m. Sie hob sich durch ihre Färbung deutlich von dem anstehenden gelben Sande ab. Der untere Theil der Grube enthielt röthlich gebrannten Lehm und schwarze Kohlenerde, während der obere Theil mit bräunlichem, jedenfalls auch durch beigemischte Brand= oder Kohlenerde so gefärbtem Sand gefüllt war. Urnenreste oder dergl. wurden in keiner der fünf Stellen beobachtet.
Von den bisher auf diesem Urnenfelde gesammelten Alterthümern sind als sicher prähistorisch anzusprechen nur zwei durch einander vorkommende Sorten von Urnenscherben. Dieselben sind fast sämmtlich nur klein und meist schon mit alten, im Sande abgeriebenen Bruchkanten versehen.
Die Scherben der einen Art sind außen größten Theils roth, seltener grau oder bräunlich, und innen grau, bräunlich oder schwarz, sämmtlich stark mit grobem Steingrus durchsetzt, nicht sehr hart gebrannt und daher bröcklich, grob gearbeitet und vor allen Dingen außen überhaupt nicht und innen nur zum Theil, und dann auch nur schlecht, geglättet. Ihre Dicke beträgt 4-14 mm. Hierher gehören die meisten (140-150 Stück) der gefundenen Scherben, und zwar sind die wenigen größeren Stücke alle außen roth. Von den sonst durch und durch grauen Scherben zeigen fünf, darunter auch eine solche vom Gefäßrande, außen noch Spuren eines dünnen rothen und eine sechste innen noch Reste eines dünnen gelbbraunen Thonüberzuges. Unter den Randstücken kommen vier verschiedene Formen vor, und zwar:
- Rand in eine einfache, abgerundete, aufrechte Kante auslaufend,
- oben abgerundet und nach außen umgebogen,
- nach oben zu verdickt mit abgeplatteter Kante und
- oben abgeplattet und nach außen überstehend.
Von den beiden ersten Formen fanden sich je zwei, von den beiden letzteren je ein Stück. Bei zwei anderen dicht unter dem Rande abgebrochenen Scherben ist nur noch zu erkennen, daß der Rand nach außen umgebogen war. Die sechs hierher gehörigen Bodenstücke sind innen, wenn auch nur schlecht, geglättet, außen rauh und 10-14 mm dick. Der Boden ist innen platt, die äußere Bodenkante, soweit erhalten, abgerundet.
Die zweite Scherbenart ist durch und durch grau bezw. gelbbraun, 4-9 mm dick, ebenfalls mit grober Steingrusbeimengung versehen und meist schlecht gebrannt, aber sorgfältiger gearbeitet und beiderseits geglättet. Die Seitenwandung dieser Urnen scheint, nach


|
Seite 243 |




|
zwei kleinen ziemlich stark gebogenen Scherben zu urtheilen, eine kräftigere Wölbung gehabt zu haben, als die der vorigen Art, deren Reste sämmtlich nur flach sind. Die hierher gehörigen Randformen sind den vorigen sehr ähnlich. Es wurden gefunden: vier nach außen umgebogene Stücke, davon eins mit abgerundeter und eins mit abgeplatteter Kante, während bei den beiden anderen das obere Ende abgebrochen ist, ferner eine Scherbe mit oben abgeplatteter und nach außen überstehender Kante sowie ein abgesplittertes Stück eines oben platten Randes. Bei zwei Scherben endlich verdickt sich der Rand nach oben zu allmählich so, daß die Stärke derselben von 3 mm an der unteren Bruchfläche bis zu 1 cm oben an der im Uebrigen abgerundeten aufrechten Kante zunimmt. Ein aus dem unteren Theile des Halses herausgebrochenes Stück, dessen Rand fehlt, ist unmittelbar unter dem ersteren mit einem rundlichen flach vorspringenden Absatze versehen. Das einzige vorhandene Bodenstück ist beiderseits platt. Die Urnen dieser zweiten Art scheinen übrigens bedeutend seltener gewesen zu sein, als die der ersten. Denn es wurden bisher zwischen den zahlreichen rauhen Scherben zerstreut nur 18-20 beiderseits geglättete Stücke gefunden.
Sämmtliche bisher erwähnten Urnenreste sind unverziert. Mit einer Verzierung, und zwar zwei flachen Horizontalrillen, ist überhaupt nur eine einzige alte Scherbe dort gefunden. Dieselbe ist außen und innen roth mit grauem Kern, besteht aus mit Steingrus vermischtem Thon, ist gut gearbeitet, beiderseits geglättet und stimmt vollkommen mit den Scherben unserer wendischen Burgwälle überein, während sie mit den bisher beschriebenen Urnenresten nur sehr wenig Aehnlichkeit hat. Ich möchte sie deshalb für eine spätere nicht zum Urnenfelde gehörige wendische Scherbe halten, welche entweder irgendwie hierher verschleppt wurde oder einem einzelnen später auf dem älteren Begräbnißplatze angelegten Wendengrabe entstammt.
Ebenfalls zweifelhaft, ob zum Urnenfelde gehörig, ist ein 1883 in dem bei den Schanzarbeiten ausgehobenen Sande gefundenes unverziertes auf der Außenseite zum Theil noch mit einer dicken Rußschicht überzogenes Randstück eines schwarzen Henkeltopfes. Es besteht aus fein geschlemmtem, hart gebranntem grauem Thon, ist außen und innen schwarz, sorgfältig gearbeitet und beiderseits geglättet. Der oben abgerundete 1 1/2 cm hohe Rand ist im Winkel von etwa 135° nach außen umgebogen. Unmittelbar unter der oberen Kante dieses Randes sitzt ein kleiner öhrartiger Henk von etwa 12-17 mm Breite und mit einem Oehrloch von ca. 12 mm Durchmesser. Da dies Stück von den übrigen dort gesammelten Urnenscherben ganz außerordentlich abweicht, und sich sonstige Ueberreste derartiger


|
Seite 244 |




|
schwarzer Henkelgefäße daselbst bisher nicht weiter haben auffinden lassen, so ist es mir, wie gesagt, fraglich, ob wir es hier überhaupt mit einem alten prähistorischen Fundobjecte zu thun haben, oder ob dies Stück nicht vielleicht erst einer viel jüngeren Zeit angehört. Die erwähnte Scherbe hat nämlich mit einigen in Rostock ausgegrabenen Resten sog. "Taterpötte" manche Aehnlichkeit und könnte daher möglicher Weise auch erst von einem solchen herstammen, sei es nun, daß sie mit Müll bezw. Schutt oder sonst irgendwie aus der Stadt an ihren jetzigen Fundort gekommen ist, oder aber von einer der herumziehenden Zigeunerbanden (Tatern) herrührt, welche auf dem dortigen Felde und in den angrenzenden Cramonstannen noch bis in die jüngste Zeit häufiger lagerten.
Sicher jünger, wie das Urnenfeld, aber sind die zwischen den älteren Gefäßresten ebenfalls in ziemlicher Menge (70-80 Stück, darunter Scherben von Rand, Boden, Henken und Füßen sowie auch einige mit Horizontalrillen verzierte Stücke) vorkommenden hart gebrannten blaugrauen, grauen und bräunlichen Scherben ohne Steingrusbeimischung. Sie gehören offenbar erst dem jüngeren Mittelalter an und stammen aus der Stadt, da sie sich auf der Stadtfeldmark fast überall zerstreut finden. Auch eine Anzahl dünner, hart gebrannter, schwarzer und schwarzgrauer Stücke ohne oder mit nur geringem und ziemlich feinem Steingruszusatz dürfte hierher zu rechnen sein. Auch diese Scherbenart findet sich auf den Aeckern um Rostock häufiger und rührt wohl zum Theil von den oben erwähnten "Taterpötten" her. Mit dem gleichfalls oben aufgeführten Randstück eines schwarzen Henkeltopfes stimmen diese Gefäßreste ihrem Charakter nach jedoch augenscheinlich nicht überein.
Von den übrigen auf dem Urnenfelde gemachten Funden können nur die folgenden mit einiger Sicherheit als prähistorisch in Anspruch genommen werden:
1. Die Hälfte einer alten Quetschmühle. Es ist etwa die Hälfte eines mit einer muldenförmigen Ausschleifung versehenen, harten Steinblockes, dessen anderes Stück mit dem Reste der Ausschleifung fehlt.
2. Ein oben und unten abgeplatteter, sonst runder Feldstein von 10-11 cm Durchmesser und 4-7 cm Höhe, der wohl als Reibstein oder dergl. gedient hat.
3. Etwas Holzkohle und röthlich gebrannte Lehmstücke aus den Brandgruben, darunter ein kleines Stückchen mit einer ganzen Anzahl von Grashalm=Eindrücken.
Zweifelhaft wird das Alter schon bei einem kleinen, vollständig oxydirten, in zwei Theile zerbrochenen, scheinbar röhrenförmigen Stückchen Kupfer oder Bronce, während die sonst noch gefundenen


|
Seite 245 |




|
Gegenstände: zwei stark verrostete Eisenstücke, einige kleine Reste von Thier=Knochen und =Zähnen und einige Schlacken, wohl ziemlich sicher der Neuzeit (aus der Stadt angefahrener Müll und Schutt) zuzurechnen sind.
Zum Schluß mag hier noch erwähnt werden, daß auch auf dem in nordwestlicher Richtung nicht weit von diesem Urnenfelde entfernten sog. Lehm= oder Krähenberge früher Urnenscherben gefunden sein sollen. Dieser Hügel liegt links vom Rostock=Riekdahler Wege dicht am Wiesenrande unmittelbar neben der Rahtkens'schen Dachpappenfabrik und sollen jene Scherben daselbst gefunden sein, bevor diese Fabrik hier angelegt wurde.



|


|
|
:
|
10. Wendische Gefäßscherben und Steinkeil von Riekdahl.
Westlich von Riekdahl unmittelbar an dem nach Alt=Bartelsdorf führenden Wege ragt eine kleine beackerte Anhöhe bis dicht an die Carbeck in die Wiesen hinein. Als in den achtziger Jahren die Rostock=Stralsunder Eisenbahn zwischen ihr und dem Dorfe hindurchgeführt wurde, mußte auch von der östlichen Seite dieser Kuppe ein Theil abgegraben werden, um die durch den Bahnbau nöthig gewordene Verlegung der dortigen Wege zu ermöglichen. An dem hierdurch geschaffenen Abhange am Kassebohm=Alt=Bartelsdorfer Fahrwege wurde nun in den Jahren 1887-91 eine Anzahl dabei zu Tage gekommener, offenbar wendischer Gefäßscherben, sowie ein hart gebranntes Stück Lehm oder Thon gefunden. Eine daraufhin vorgenommene genauere Absuchung des ganzen, die Anhöhe bedeckenden Ackers blieb jedoch ohne weiteres Resultat. Selbst an mehreren Stellen, wo Steine ausgebrochen waren, war nichts von Scherben oder sonstigen Alterthümern zu bemerken, so daß anzunehmen ist, daß dieselben, falls es sich hier nicht bloß um ein oder ein Paar alter Gräber handelt, ziemlich tief in der Erde liegen. Das einzige, sonstige Fundobject ist die hintere Hälfte eines grauen Feuersteinkeiles, von dem jedoch nicht nachzuweisen ist, ob er in irgend welcher Beziehung zu den oben erwähnten Scherben steht. Derselbe lag zwar am Wege vor dem Abhange auf dem damals erst abgegrabenen Terrain, aber dicht bei einem ganzen Haufen dort bei dem bezw. für den Bahnbau zusammengeworfener Steine. Das gefundene Stück ist 6 cm lang, hinten 2 1/2 und an der Bruchfläche 3 1/2 cm breit bei etwa l 1/2 cm Dicke. Von der einstigen Politur zeugen nur noch


|
Seite 246 |




|
drei kleine polirte Stellen auf den beiden breiten Seiten, alles Uebrige ist abgesprungen.
Die fast sämmtlich nur kleinen Gefäßscherben, im ganzen 27 an der Zahl, darunter vier Randstücke und ein Bodenstück, haben viel Aehnlichkeit mit den weiter unten näher zu besprechenden vom Südabhange des Fährberges. Sie sind meist nur roh und freihändig gearbeitet, haben einen ziemlich starken grobkörnigen Steingruszusatz, sind 6-10 mm dick und größten Theils von röthlicher oder bräunlicher, einzeln jedoch auch von grauer Farbe. Zehn der Scherben, darunter die sämmtlichen Randstücke, sind verziert und zwar eine mit den gewöhnlichen Horizontalrillen, drei mit eingedrückten horizontalen Wellenlinien, fünf mit den beiden vorigen Arten zusammen und eine mit einem aus vier graden Rillen bestehenden Gitterwerk. Einen Hals scheinen die Gefäße nicht gehabt zu haben. Der Rand ist bei zwei Stücken oben abgerundet, bei einem abgerundet und leicht nach außen gebogen und beim vierten abgerundet und nach außen überstehend. Bei dem einzigen vorhandenen Bodenstücke biegt die Seitenwand beiderseits mit leichter Rundung in den Boden um.



|


|
|
:
|
11. Alterthümer von Alt=Bartelsdorf.
Unmittelbar nördlich des eben erwähnten Riekdahler Fundortes wurden beim Bau der Rostock=Stralsunder Eisenbahn auch auf der Alt=Bartelsdorfer Feldmark mehrfach Alterthümer zu Tage gefördert. Kurz nach Beginn der Durchsticharbeiten jenseit der Carbeckbrücke fand ich im Januar 1888 auf dem zwischen der Carbeck=Niederung und dem ersten Einschnitt aufgeschütteten Bahndamm verschiedene alte Gefäßscherben, welche, der angefahrenen Erde nach, zwischen der sie lagen, nur aus dem Anfange jenes Durchstiches stammen konnten. Es sind im Ganzen 29 Stücke, von denen jedoch 22 zu den hartgebrannten grauen, blaugrauen oder schwarzen Scherben des jüngeren Mittelalters gehören. Sicher prähistorisch sind nur vier. Dieselben haben den üblichen Steingruszusatz, sind 5-8 mm dick und unverziert, aber ganz gut gearbeitet und gebrannt. Der Farbe nach ist die eine außen roth, innen graubraun und die drei anderen durch und durch grau bezw. graubraun. Das einzige darunter befindliche Randstück hat eine oben abgeplattete, nach außen überstehende Kante. Drei Scherben scheinen zwischen diesen eben erwähnten beiden Arten zu stehen. Sie zeigen in der Zusammensetzung des Materials noch


|
Seite 247 |




|
ziemlich viel Steingrus=Beimischung, sind durch und durch grau bezw. schwarzbraun und 4-5 mm dick. Dem harten Brande und der stellenweise außerordentlich feinen Glättung der Außenseite nach zu urtheiten, dürften sie jedoch schon einer jüngeren Periode, als die erwähnten vier prähistorischen Stücke angehören.
Etwas weiter nördlich auf dem Bahnterrain, unmittelbar neben dem Hofe und Dorfe Alt=Bartelsdorf, wurde an demselben Tage ebenfalls eine Anzahl alter Scherben, sowie die Hälfte eines Eberhauers gesammelt. Hier war die Erde damals erst etwa einen Spaten tief aus dem Acker ausgehoben und als Grenzlinie an beiden Seiten des Bahnstreifens zu einem niedrigen Walle aufgeworfen. In diesen beiden Wällen lagen die gefundenen Scherben, und zwar sechs prähistorische und acht aus dem jüngeren Mittelalter stammende. Erstere sind 1/2 bis 1 cm dick, mit Steingrus durchsetzt, gut gearbeitet und hart gebrannt. Ihre Färbung ist theils außen roth, innen graubraun, theils durch und durch graubraun oder schwarzgrau. Verziert ist nur ein hierbei befindliches Randstück, und zwar mit einer nur flach eingedrückten, unmittelbar unter dem Rande sich hinziehenden horizontalen Wellenlinie. Der Rand selbst, dessen obere Kante fehlt, ist nach außen umgebogen; ein Gefäßhals ist nicht vorhanden. Ihrem ganzen Typus nach haben diese Scherben viel Aehnlichkeit mit unseren hiesigen Burgbergfunden und dürften daher grade so, wie diese, als wendische in Anspruch zu nehmen sein.
Später, beim Fortschreiten des Bahnbaues, wurde ungefähr in derselben Gegend eine Sand= und Kiesgrube für die Eisenbahn angelegt. Dieselbe zieht sich in bedeutender Längen=Ausdehnung, neben dem Hofe Alt=Bartelsdorf beginnend und neben der eigentlichen "Bartelsdorfer Kiesgrube" endigend, an der Ostseite des Bahnplanums hin. In der Ostwand dieser Grube fand ich bei einer Besichtigung am 29. Juli 1889 nicht weniger als fünfzehn Brandstellen von ganz derselben Art, wie die oben bei dem Urnenfelde auf der Kassebohmer Feldmark beschriebenen, und zwar zwei derselben östlich von der eigentlichen "Bartelsdorfer Kiesgrube" und dreizehn östlich neben dem Hofe und Dorfe. Alle fünfzehn bestanden aus schwarzer, sandiger, mit Holzkohlenresten vermischter Branderde und einer wie ein Pflaster fest in einander gepackten Schicht von größeren und kleineren Feldsteinen. Letztere zeigten zum Theil deutliche Spuren einstiger Feuereinwirkung und waren infolge dessen stark im Verwittern. Das Steinpflaster lag überall so, daß sich über und unter ihm noch je eine dünne Schicht der schwarzen Kohlenerde befand, mit welcher natürlich auch die Lücken desselben ausgefüllt waren. Die einzelnen Brandstellen lagen 1/4 bis 1 m tief unter der Acker=Oberfläche


|
Seite 248 |




|
und waren in einer Horizontal=Ausdehnung von 0,5-2,5 m in der Wandfläche sichtbar. Wie tief sie noch in die Wand hineinreichten, konnte leider nicht genauer untersucht werden. Gefäßscherben oder sonstige Alterthümer wurden nicht bemerkt.
Einen wohl erhaltenen Thierknochen fand ich 1888 in dem beim Bau der Eisenbahnbrücke über die Carbeck und der Verlegung des Carbeckbettes unter dieser Brücke hindurch ausgegrabenen blaugrauen Sande. Auch unter den Neuerwerbungen des meklenburgischen Geologischen Landesmuseums zu Rostock in Nr. 7 der "Rostocker Zeitung" von 1888 werden beim Bau der Stralsunder Eisenbahn gefundene "Knochen aus dem Moor des Warnow= und Carbeckthales" aufgeführt.
(Vergl. Jahrb. XXVIII-XXX, XLVIII, S. 311, und LVIII S. 218 ff.)
Auch hier wurde in den letzten Jahren wieder eine ganze Reihe neuer Entdeckungen gemacht, die zum Theil unzweifelhaft noch mit dem alten, früher hier aufgegrabenen Begräbnißplatze zusammenhängen. In der Südecke der Grube, der Gegend, welche in diesen Jahren hauptsächlich zum Abfahren von Sand und Kies benutzt wurde, beobachtete ich in der Südwest= sowohl wie in der Südostwand in dem Zeitraum vom 23. Mai 1883 bis zum 7. September 1890 im Ganzen 25 derartige Brandstellen, wie die soeben aus der Eisenbahnsandgrube erwähnten. Dieselben lagen mit ihrer oberen Kante 25-150 cm unter der Erdoberfläche, hatten einen Vertikaldurchmesser von 15-35 cm und einen in der Absturzwand zu Tage tretenden Horizontaldurchmesser von 45-180 cm. Die sich noch in die Wand hinein erstreckende Tiefen=Ausdehnung, welche je nach der Größe des bereits abgegrabenen Theiles der betreffenden Stelle ja übrigens sehr verschieden sein mußte, ließ sich bei den hohen steilen Wänden der Kiesgrube wegen der Ein= bezw. Absturzgefahr nur an einigen wenigen Punkten genauer untersuchen. Bei einer, mit ihrer Oberkante 90 cm unter der Oberfläche belegenen Brandschicht von 20-25 cm Vertikal= und 45 cm sichtbarem Horizontaldurchmesser betrug sie 10 cm, bei einer zweiten, deren Oberkante 1,10 m tief lag, bei 25 cm Vertikal= und 90 cm sichtbarer Horizontal=Ausdehnung 20 cm. Das bei dem Nachgraben herausgebrochene Steinpflaster dieser letzteren Stelle bestand aus ca. 20-30 Feldsteinen. Eine dritte, 75 cm unter der Oberfläche beginnende Schicht von 35 cm Vertikal= und 110 cm Horizontal=Durchmesser wurde bis zu 43 cm Tiefe in die Wand hinein verfolgt, ohne ihr Ende zu erreichen.


|
Seite 249 |




|
In allen diesen 25 Brandschichten wurden außer den erwähnten Holzkohlenresten und Steinpflasterungen nur folgende Gegenstände, und zwar an drei verschiedenen Stellen, gefunden: eine kleine, 8-9 mm dicke, hart gebrannte, alte Gefäßscherbe (stark mit Steingrus durchsetzt, beiderseits, innen allerdings nur mangelhaft, geglättet, durch und durch dunkel graubraun), ein kleines gebranntes Lehmstückchen sowie drei kleine abgesprungene (nicht im Feuer gewesene) Stücke eines Thierzahnes.
Zu bemerken ist übrigens noch, daß sich in der Wand der ganzen Südwestseite sowie der Südecke der Kiesgrube eine ackerkrumenartige Erdmischung bis etwa 1 m Tiefe, also gerade bis zu der Tiefe, in der die Brandschichten liegen, hinab erstreckt, während sich in den übrigen Wänden dieser Grube nur eine dünne (nur so tief, wie der Haken hineingreift) Ackerkrume befindet, unter der dann sofort die verschiedenen Sand= und Kiesschichten beginnen.
In eben dieser Südwestwand entdeckte ich im October 1889 eine mit ihrer oberen Kante etwa 1/2-3/4 m unter der Oberfläche stehende, unverzierte, durch und durch braune Urne. Ihr Rand fehlte, er ist wohl beim Ackern vom Haken erfaßt und abgebrochen. Die Urne stand auf Feldsteinen und war auch von solchen umgeben, nur oben drüber lagen naturgemäß keine. Leider hatte das Gefäß schon in der Erde mehrere Bruchstellen und Risse und zerbrach dann beim Transport so vollständig, daß es sich nicht wieder zusammensetzen ließ. Seine Form war die folgende:

Die Dicke der Seitenwand beträgt 8-10 mm, die des Bodens 20-22 mm und die der Uebergangsstelle von der Wand zum Boden 25 mm. Die Urne besteht aus stark mit Steingrus durchknetetem Thon, ist ziemlich roh gearbeitet, beiderseits nur mangelhaft geglättet und nicht sehr hart gebrannt. Den Inhalt bildeten calcinirte Menschenknochen, Asche und Sand ohne irgendwelche Beigaben.
Sonst wurde von Urnen oder Urnenresten nur noch gleich links vom Eingange, also im nordwestlichen Theile der Kiesgrube, eine kleine, innen rothe, außen gelbbraune, gleichfalls mit Steingrus durchsetzte Scherbe gefunden. Dieselbe ist 6 mm dick, beiderseits gut geglättet und scheint auf der Außenseite mit sehr flachen Horizontalrillen verziert zu sein.
Ebenfalls im October 1889 wurden in der Kiesgrube, und zwar beim Abgraben der Südostwand, dem Eingange gerade gegenüber, von den dort beschäftigten Arbeitern einige menschliche Gerippe zu


|
Seite 250 |




|
Tage gefördert. Leider war es mir nicht möglich, genauere Einzelheiten über diesen Fund zu erlangen. Als ich die betreffende Gegend kurz darauf in Augenschein nahm, fand ich nur noch einen zusammengeworfenen kleinen Haufen menschlicher Gebeine und Schädelreste. Die Knochen sind noch ziemlich fest, durch das Umherwerfen zwischen den Steinen und durch das Hindurchfahren eines Wagens durch den Haufen aber stark zertrümmert. Den Schädelstücken und der Menge der Zähne nach müssen sie jedenfalls von zwei oder drei Leichen stammen.
Auch einige einzelne Thier=Knochen und =Zähne wurden wieder in dieser Grube gefunden, und zwar in der Nordwestwand nicht weit vom Eingange in der Nähe der zuletzt erwähnten Urnenscherbe, darunter ein 1 1/2 m tief unter der Oberfläche aus einer Kiesschicht ausgegrabenes Unterkieferstück von einem Schaf oder dergl. Dabei sei hier noch bemerkt, daß der im Jahrb. XLVIII, S. 311 aufgeführte, 1882 gefundene Gelenkkopf eines großen Beinknochens nach freundlicher Bestimmung des Herrn Professors Dr. Nehring zu Berlin ein humerus, und zwar wahrscheinlich von einem jungen Pferde ist. Ebendaselbst muß es übrigens bei den beiden dort etwähnten Thierknochenfunden in der Ortsangabe bei dem Eberzahne Ost= statt Westseite und bei diesem Gelenkkopfe West= statt Südostseite heißen.
Ueberblicken wir nun noch einmal alle diese in den letzten Jahren in der Alt=Bartelsdorfer Kiesgrube gemachten Funde, so dürfte bezüglich der Urne, der Urnenscherbe und der Brandschichten kaum etwas Anderes anzunehmen sein, als daß sie noch zu dem 1862 hier entdeckten alten Begräbnißplatze gehören. Zweifelhaft ist dies dagegen bezüglich der Gerippe, da hier jeder genauere Fundbericht und somit einstweilen auch jeder feste Anhalt für eine Einordnung derselben fehlt. Für ihre Zugehörigkeit zu den übrigen Funden könnte allerdings der Umstand sprechen, daß die Gegend, in der sie aufgedeckt wurden, ebenso, wie der Fundort der Urne, noch innerhalb des Verbreitungsgebiets der dortigen Brandstellen liegt. Als was endlich diese Brandschichten zu deuten sind, ob vielleicht auch als Gräber, sog. Brandgruben, oder als die Stellen, auf denen die Leichname, deren Reste sich in den Urnen fanden, dem Feuer überliefert wurden, oder als was sonst etwa, darüber kann, wenn überhaupt, wohl nur eine größere planmäßige Aufgrabung Klarheit schaffen.
Zum Schluß mögen hier noch einige Gegenstände aufgeführt werden, welche in den sechziger Jahren in dem Bartelsdorfer Gräber=


|
Seite 251 |




|
felde gefunden sind und nunmehr im Rostocker Alterthums=Museum aufbewahrt werden. Es sind dies:
1. Eine kleine, mit 3-4 flachen Horizontalrillen verzierte, 5 cm hohe Urne aus hart gebranntem Thon, hellgelblich, außen stellenweise von glasurartiger Glätte. Die weiteste, 4 cm im Durchmesser haltende Ausbauchung befindet sich 2 cm über dem auf der Unterseite abgerundeten Boden. Oben am Rande beträgt der Durchmesser 36 mm (im Lichten: 26 mm). Der grade aufrechte Hals hat oben eine abgerundete Kante. Mein verstorbener Vater, Gymnasial=Director Dr. K. E. H. Krause, erklärte das kleine Gefäß für einen römischen Thränenkrug. Leider fehlt hier ebenso, wie bei sämmtlichen folgenden Stücken, ein ordentlicher Fundbericht. Ein in dem Gefäße steckender Zettel besagt nur: "kleines irdenes Gefäß vom Wendenkirchhof auf dem Bartelsdorfer Felde (Gnittgrube)."
2. Ein Stück (etwa 2/3) eines Hals= oder
Schläfenringes von Bronze, beiderseits
abgebrochen. Der Reif ist in der Mitte rund (1/2
cm dick) und wird nach beiden Enden zu flacher
und dünner bis zu 2 X 3, bezw. 3 X 4 mm Dicke.
Die Verzierung besteht aus einem einfachen,
eingravirten Strichmuster:
 .Von Ende zu Ende beträgt der
Durchmesser 14 cm, der größte dagegen ist 16 cm.
.Von Ende zu Ende beträgt der
Durchmesser 14 cm, der größte dagegen ist 16 cm.
3. Ein etwa 5 cm langer und 3 mm dicker, runder Haken von Bronze mit einer Bruchfläche am einen Ende. Scheinbar ein in der einen Biegung abgebrochener Doppelhaken.
4. Zwei an einander passende Stücke eines stark verrosteten eisernen Messers, zusammen 7 cm lang, wovon 37 mm auf die Klinge kommen. Die Breite der letzteren beträgt bis zu 1 1/2 cm, die des Stieles 7-8 mm. Uebrigens sind weder Stiel noch Klinge vollständig erhalten, sondern von beiden fehlen die äußeren Enden. Die Form des ganzen Messers scheint dieselbe gewesen zu sein, wie Jahrb. LVIII, S. 219, Fig. 37.
5. Einige calcinirte Knochenstücke, ein kleines angekohltes Holzstückchen sowie ein kleiner Eisensplitter, der Etikette nach "gefunden in einer Urne in der Sandgrube bei Bartelsdorf. 1862."
6. Ein kleines, eigenthümlich geformtes Feuersteinmesserchen oder Schaber (?) (vielleicht nur Naturspiel), 52 mm lang, wovon 3 1/2 cm auf die Klinge kommen. Die Breite der letzteren beträgt bis zu 2 cm, die des Griffes am Ende 13 mm und sonst 8-9 mm.


|
Seite 252 |




|



|


|
|
:
|
12. Wendische Alterthümer vom Fährberge zu Gehlsdorf.
In der kleinen Sandgrube am Süd=Abhange des Fährberges, d. h. der Höhe, auf welcher die Fährtannen stehen, wurden 1886 im Sande zerstreut einige wendische Gefäßscherben sowie gebrannte Lehmstückchen gefunden, welche auf das Vorhandensein eines alten Wohn= oder Begräbnißplatzes schließen ließen. Bei genauerem Nachsuchen zeigten sich denn auch in der Wand des Abhanges zwei aus schwarzer Kohlenerde, vermischt mit Gefäßscherben, Knochen, Holzkohlenresten und gebrannten Lehmstücken bestehende Brandstellen, denen jene Funde offenbar entstammten, falls sie nicht aus etwa früher schon abgegrabenen ebensolchen Stellen herrührten. Auch auf dem angrenzenden Acker wurden noch einige zerstreute Scherben gesammelt. Weiter war einstweilen nichts festzustellen. Im Mai 1889 wurde nun an der Südwestecke jener Grube in größerer Menge Sand von der Oberfläche abgefahren, wodurch eine gewaltige schwarze Brandschicht in einer Ausdehnung von 25 Schritten von Südwest nach Nordost und von 2-3 Schritten von Südost nach Nordwest zu Tage trat, die sich aber offenbar nach beiden Richtungen hin noch weiter in den Abhang hinein erstreckte. Ob dieselbe vielleicht gar mit den etwas weiter östlich belegenen Brandstellen von 1886 zusammenhängt, in welchem Falle sie sich als fortlaufende Brandschicht fast durch den ganzen Abhang hinziehen würde, bleibt jedoch noch genauer zu untersuchen. Die 1889 bloßgelegte Brandschicht liegt 80 cm unter der heutigen Oberfläche und ist im vertikalen Durchschnitt 15-35-70 cm mächtig. Ueber ihr lagert nur reiner, lockerer Flugsand, welcher scharf gegen die darunter befindliche schwarze Schicht absetzt und vielleicht eine auf den alten Urboden aufgewehte Düne darstellt. Die Sohle der Brandschicht bildet an den meisten Stellen eine Pflasterung von kleinen Feldsteinen, vermischt mit Kohlenerde, Holzkohlenresten und Stücken von gebranntem Lehm. Die Gefäßscherben, Knochen und sonstigen Gegenstände liegen dagegen meistens über oder neben der Pflasterung in der einfachen Kohlenerde.
Die bisher gemachten Funde bestehen hauptsächlich aus alten wendischen Gefäßscherben, von denen etwa hundert gesammelt wurden. Sie sind meist roh gearbeitet und schlecht geglättet und wechseln in der Dicke zwischen 4 und 11 mm. In der Färbung herrscht Roth vor, doch findet sich auch Grau und Braun in verschiedenen Schattirungen. Der dem Thon beigemischte Steingruszusatz besteht meist aus weißem Quarz und ist stellenweise außerordentlich grob. Einzelne der Scherben sind ziemlich gewölbt. Die (8) Bodenstücke haben die


|
Seite 253 |




|
gewöhnliche Form, innen allmählich schräge in den Boden übergehend und außen mit deutlicher Kante absetzend. Die Böden selbst sind platt. Einer scheint unterwärts an der Außenkante auch mit einem etwas erhöhten Ringe versehen gewesen zu sein, und ein anderer zeigt in der Mitte der Unterseite den Rest einer eingedrückten glatten, kreisrunden Fläche von etwa 15-17 mm Durchmesser. Die sämmtlichen (15) Randstücke sind oben abgerundet oder abgeplattet und etwas nach außen umgebogen oder überstehend. Einen eigentlichen Hals scheinen die Gefäße nicht gehabt zu haben, wenigstens lassen die bisher gefundenen Scherben keine Spuren davon erkennen. An Verzierungen überwiegt die Wellenlinie. Ferner kommen vor die gewöhnlichen Horizontalrillen, dann Zickzacklinien, im stumpfen wie im spitzen Winkel zu einander stehende Bänder grader Linien (Gitterwerk), Kerben, eingedrückte Punkte in graden und Zickzacklinien sowie mit Kerben durch einander, ferner Verbindungen von Wellen= und Zickzacklinien, sowie von Horizontalrillen mit Wellenlinien, Kerben oder Punkten allein bezw. mit Wellenlinien und Punkten zusammen. Die Wellenlinien treten stets zu mehreren auf, und zwar meist in horizontalen Bändern von zwei bis sieben Stück, die mit einem gezahnten Instrumente eingedrückt sind. Auf gleiche Weise mit einem derartigen gezahnten Werkzeuge sind auch die Zickzacklinien, das Gitterwerk und ein Theil der Kerben hergestellt. Einzelne der Punkt= und Kerbenreihen befinden sich oben auf oder vorne an der Randkante, alle übrigen Zierrathe außen an der Gefäßwand. Ein großer Theil der Verzierungen, namentlich der Wellenlinien, ist übrigens ebenso, wie die Scherben selbst, nur schlecht gearbeitet, doch kommen auch Stücke von sehr exakter und guter Arbeit und sorgfältiger Verzierung vor. Eine roh gefertigte, außen röthliche, innen schwarzbraune, mit einer Horizontalrille und einer ganzen Anzahl wirr durcheinander laufender Wellenlinien verzierte Scherbe ist künstlich durchlöchert. In derselben befindet sich nämlich ein von außen her durch die Gefäßwand hindurch gebohrtes oder gestochenes rundes Loch von außen 6 und innen 3 mm Durchmesser, sowie 1 cm davon entfernt in der einen Bruchfläche noch die Hälfte eines zweiten etwa gleich großen, das aber, da seine engste Stelle in der Mitte liegt, während es sich nach der Außen= und Innenseite erweitert, von beiden Seiten her hindurch gearbeitet sein muß. Das Verhältniß der verzierten zu den unverzierten stellt sich bei den gewöhnlichen Scherben wie 20 zu 55 und bei den Randstücken wie 7 zu 8.
Auffällig sind zwölf nahe bei einander gefundene und wohl zu ein und demselben Gefäße gehörige Scherben, welche theils durch und durch verschlackt und verschmolzen, theils völlig durchglüht und an


|
Seite 254 |




|
einzelnen Kanten verschlackt sind. Infolge der großen Erhitzung von 7 bis zu 16 mm Dicke aufgequollen, zeigen sie auf der Oberfläche zahlreiche kleine Risse und Sprünge. Unter diesen Scherben befinden sich auch zwei Rand= und zwei Bodenstücke, von welchen letzteren das eine mit der oben erwähnten eingedrückten Kreisfläche versehen ist. Diesem Bodenstücke nach muß das Gefäß ziemlich groß gewesen sein. Von den beiden Randstücken ist das eine mit zwei horizontalen Bändern von je drei Wellenlinien verziert, während das andere so vollkommen verschlackt ist, daß sich nichts mehr auf ihm erkennen läßt. Die durch und durch verschlackten Scherben sind infolge des völligen Ausbrennens so leicht wie Bimsstein geworden. Auch unter den übrigen Scherben befinden sich einige infolge zu großer Hitzeeinwirkung rissig gewordene, sowie einige theilweise angeglühte Stücke.
An sonstigen Gegenständen wurden noch gefunden:
1. Ein stark verrosteter, 3 1/2 cm langer, eiserner Nagel mit Kopf (Kopf 1-2 cm breit), eine kleine, ebenfalls stark verrostete, viereckige Eisenplatte von 2 cm Durchmesser und 2-3 mm Dicke, sowie drei bis vier kleine Eisenroststücke.
2. Ein kleiner Schleifstein, bestehend aus einem sonst nicht weiter bearbeiteten Stück Thonschiefer mit einigen flachen und schmalen Schleifrinnen.
3. Die Hälfte einer in der Mitte mit einem runden Loche versehenen runden Scheibe aus gebranntem Lehm von 24 mm Dicke und 9 cm Durchmesser. Das Loch hält 1-1 1/2 cm im Durchmesser.
4. Ein beim Finden zerbrochenes, kleines, rundliches Stück rohen rothen Bernsteins mit verwitterter Außenfläche.
5. Drei kleine Stückchen Schlacke.
6. Eine Anzahl gebrannter Lehmstücke aus den in den Brandstellen befindlichen Pflasterungen, darunter zwei mit Eindrücken von Gras= oder Strohhalmen.
7. Sechs kleine calcinirte Knochenstückchen.
8. Einige wenige sehr stark verwitterte Thier=Knochen und =Zähne.
9. Eine ganze Anzahl, wenn auch nicht großer, so doch gut erhaltener Holzkohlenstücke.
Eine einzelne, kleine, hart gebrannte, mit Steingrus durchsetzte, außen geglättete, innen ziemlich rauhe, graubraune Gefäßscherbe mit Horizontalrillen=Verzierung wurde auch an der Nordseite des von der Gehlsdorfer Dorfstraße nach den Fährtannen führenden Weges, und zwar ziemlich in der Mitte zwischen den Tannen und der Straße gefunden, vielleicht nur ein vom eben erwähnten Fundorte verschlepptes Stück.


|
Seite 255 |




|



|


|
|
:
|
13. Wendische Gefäßscherbe von Gehlsdorf, sowie einzelne Steinsachen=Funde von Gehlsdorf und Toitenwinkel.
1. Auf dem Gehlsdorfer Acker rechts von dem von der Dorfstraße zur früheren Weigelschen Ziegelei führenden Wege, etwa in der Mitte zwischen Straße und Ziegelei, wurde 1884 eine einzelne kleine Scherbe von wendischem Typus gefunden. Dieselbe ist fast durch und durch roth, gut gearbeitet und hart gebrannt, jedoch mit ziemlich grober Steingrusbeimengung. Die Verzierung besteht aus einem Bande von drei eingedrückten Wellenlinien.
2. Ein in (oder bei) der Kiebitzwiese am Wege von der Fähre nach dem Toitenwinkler Kirchsteige gefundenes Feuersteinmesser von etwa 10 cm Länge wurde im September 1890 in einem Rostocker Restaurant zu Kauf angeboten.
3. Nicht weit von dem unten näher zu beschreibenden Fundort Nr. 1 am Langen Ort zu Gehlsdorf fand ich 1885 auf dem Acker südöstlich vom letzten, am Wege nach Oldendorf belegenen, ausgebauten Gehlsdorfer Bauernhofe Nr. 9, und zwar rechts vom Wege zwischen der Biegung desselben beim Langen Ort und dem erwähnten Hofe einen an den beiden Breitseiten und der oberen schmalen Kante polirten, aber zum Theil wieder abgesplitterten hellgrauen Feuersteinkeil. Länge: 102 mm, Breite hinten: 2 1/2 cm, vorn an der Schneide: 4 cm, Dicke hinten: 15 mm und in der Mitte: 18 mm.
4. Ein 1883 bei Toitenwinkel gefundener dunkelgrauer Feuersteinkeil befindet sich in der Sammlung der Rostocker Großen Stadtschule. Er ist auf den beiden Breitseiten polirt gewesen, aber meist wieder abgesplittert. Länge: 13-14 cm, Breite an den beiden Enden: 3 1/2 und in der Mitte: 4 cm, Dicke hinten: 1 1/2 und in der Mitte: 2 1/2 cm.
5. Drei Stücke von bearbeiteten Feuersteinen fand ich im April 1892 auf dem Toitenwinkler Acker zwischen dem Dorfe und Schwinkuhlen. Eins derselben scheint das hintere Ende eines nicht polirten, schmalen, hellgrauen Keiles oder das obere Ende eines Dolchmesser=Griffes zu sein, 31 mm lang, 29 mm breit und 12 mm dick. Das zweite ist ein fast 4 cm langes und 3-3 1/2 cm breites gelbbraunes Stück von keilartiger Form und das dritte ein Stück eines weißlichen Feuersteinspahnes.


|
Seite 256 |




|



|


|
|
:
|
14. Wendische Wohn= und Begräbnißstätten am Langen Ort, Feldmark Gehlsdorf.
Am sandigen Warnowufer des Langen Ortes oder der Langen Nees, d. h. der am rechten Ufer vor Oldendorf in die Warnow hineinragenden, zur Gehlsdorfer Feldmark gehörigen Landspitze, finden sich auf dem Acker sowie in der Wand des Abbruchufers zahlreiche wendische Gefäßscherben und sonstige Alterthümer. Die bisher gemachten Funde erstrecken sich über das Abbruchufer vom Südrande der am Langen Ort befindlichen Sandgrube bis zu dem beim Kind'schen Hofe (der letzte am Wege nach Oldendorf belegene ausgebaute Gehlsdorfer Bauernhof Nr. 9) in die Warnow mündenden Bache 1 ) (im Folgenden als Fundort Nr. 1 bezeichnet), ferner über die nördlich von diesem Bache gelegene Uferstrecke bis zur Niederung eines daselbst aus dem Acker in die Warnow führenden Grabens (Fundort Nr. 2) und endlich drittens über das Abbruchufer zwischen diesem Graben und der Sumpfniederung der Gehlsdorf=Krummendorfer Scheide (Fundort Nr. 3). Bei Nr. 1 und 3 finden sich auf der Ackeroberfläche Gefäßscherben und dergl. jedenfalls bis zu 75 m und bei Nr. 2 bis zu 25 m von der Kante des Abbruchufers ab landeinwärts. Merkwürdig ist dagegen, daß sich im eigentlichen Ufersande sowie im Wasser vor diesen drei Stellen nichts findet. Dort ist wohl bei dem fortwährenden Wasserstandswechsel und dem Hin= und Herspülen alles zerrieben und zergangen.
Von besonderem Interesse bei diesen Funden ist noch, daß dieselben zum Theil, wenigstens bei Fundort Nr. 1, offenbar aus einer jetzt theilweise fast 1 m hoch mit gelbem Sand überdeckten alten Kulturschicht stammen. Im Abbruchufer dieser Strecke beobachtete ich nämlich (am 11. September 1886) folgende Schichtenlage: Unmittelbar unter der dünnen Grasnarbe befindet sich eine nur 0,10-0,20 m mächtige, magere, aus grauer, sandiger Erde bestehende Ackerkrume. 2 )


|
Seite 257 |




|
Darunter steht etwa 0,20-0,70 m tief gelber Sand und hierunter dann 0,10-0,20 m mächtig eine dunkelgraue bis schwarze Sandschicht in der sich eine Menge zergangener Holzkohle, kleine röthlich gebrannte Lehm= oder Thonstücke, im Feuer gewesene Steine, Gefäßscherben, Knochenstücke, Schlacken, sowie Reste von allerlei Geräthen finden. Dies ist augenscheinlich die alte Kulturschicht, auf der jene Ansiedler lebten, von denen obige Alterthümer herrühren, eine Schicht, welche dann später durch Sandwehen oder Ueberschwemmung mit dem gelben Sande überdeckt wurde, auf dem sich die heutige magere Ackerkrume befindet. Aus dieser alten Schicht stammen auch diejenigen Alterthümer, welche jetzt oben auf der Oberfläche umherliegen. Diese Stücke sind allmählich durch das Beackern an das Tageslicht gebracht an Stellen, wo der obere gelbe Sand nicht mächtig genug war, um das Eindringen des Hakens in die tiefer liegende, ältere Schicht zu verhüten. An manchen Stellen ist auch diese Schicht selbst mit der Zeit wieder mehr oder weniger bloßgelegt durch Sandabfahren, Abspülen des Sandes bei Hochwasser und Abwehen desselben, namentlich bei Schneestürmen, bei denen der Sand an den von der Pflanzendecke entblößten Stellen noch jetzt immer stark in Bewegung geräth. Unter der Alterthümer führenden Schicht liegt etwa 0,10 m mächtig wieder gelber Sand. Darauf folgt 0,20 m stark eine Schicht von grauem Sand von ganz ähnlichem Aussehen, wie die heutige Ackerkrume, dann dunkelgelber Sand und unter diesem fester gelber Lehm. An einer Stelle, an welcher die erwähnte alte Kulturschicht durch besonders viel Holzkohlenreste vorzugsweise dunkel gefärbt war, hatte der unmittelbar darunter befindliche gelbe Sandstreifen eine offenbar von Feuer herrührende röthlichgelbe Farbe, und zwar war diese Färbung in einer horizontalen Ausdehnung von mindestens 1 m Länge außen an der Uferwand sichtbar.
Diese verschiedenen Erd= bezw. Sandschichten ziehen sich mehr oder weniger deutlich (die drei obersten Schichten sind fast immer deutlich erkennbar) durch die Abbruchwand der ganzen mit Nr. 1 bezeichneten Uferstrecke hin und treten an einigen nicht bewachsenen Stellen auch bei Fundort Nr. 2 auf. Beim Fundort Nr. 3 ist das Abbruchufer dagegen fast vollkommen mit einer starken Grasnarbe bedeckt, so daß hier von einer etwaigen Schichtenlage nichts zu sehen ist.
Die Funde von Langen Ort sind folgende:
A. Von Fundort Nr. 1:
1. Ein kleines calcinirtes Knochenstückchen.
2. Thierknochen und =Zähne.


|
Seite 258 |




|
Thierknochen fanden sich bisher nur sehr spärlich, und auch diese wenigen Reste bestehen meist nur aus sehr morschen und zerbrochenen Stücken, darunter drei angekohlte Splitter. Nach Aussage eines auf dem Kind'schen Hofe dienenden Knechtes sollen dort jedoch bei der Ackerbestellung schon häufiger große Thierknochen ausgepflügt sein. Auch Thierzähne kommen nur in geringer Menge vor und sind ebenfalls zum größten Theil verwittert und zerbrochen. Es befinden sich unter denselben solche von Wiederkäuern und acht bis zehn Stücke vom Schwein, darunter auch ein Bruchstück eines Hauers. An Fischresten wurde bisher nur ein Schlundknochen vom Rothauge gefunden. Einige kleine ebendort gesammelte Knochen von Frosch oder Kröte dürften neueren Zeiten angehören.
3. Gebrannte Lehm= und Thonstücke.
Dieselben sind größtentheils völlig verwittert. Es lassen sich daher nur wenige sehr kleine Stücke erhalten. Eins dieser letzteren zeigt den deutlichen Abdruck eines dünnen runden Stockes und ein anderes Eindrücke von Stroh= oder Grashalmen.
4. Im Feuer gewesene bezw. berußte Feldsteine.
Infolge der Einwirkung des Feuers sind dieselben meist stark verwittert. Hierher gehören auch zwei kleine weißgeglühte Feuersteinstückchen.
5. Holzkohle.
Diese ist meistens schon so stark zergangen, daß sie sofort bei der Berührung zerfällt. Doch ließen sich auch einige größere Stücke erhalten.
6. Metall= und Stein= bezw. Thon=Schlacken.
Meist nur Stücke von geringer Größe. Die Metallschlacken überwiegen, denn die übrigen wurden bisher nur in ganz wenigen kleinen Stücken gefunden.
7. Ein hellgrünes Stück Glasfluß, 34 mm lang, 10-17 mm breit, 4-5 mm dick, am breiten und zugleich dickeren Ende abgebrochen. Vielleicht erst aus neuerer Zeit stammend.
8. Steingeräthe und bearbeitete Steine.
a. Ein Netzsenker, Spinnwirtel oder kleiner Schleifstein aus grauem Sandstein, rund, oben und unten platt; Höhe: 17 mm, Durchmesser: 20 mm. An der einen Rundseite befindet sich eine kleine, schmale Schleifrinne. Das durch die Mitte gebohrte runde Loch hat 10 mm Durchmesser im Lichten.
b. Ein keilförmiges, an einer der Schrägseiten glatt geschliffenes Stück braunrothen Sandsteins, 70-80 mm lang, 30-45 mm breit und einerseits 35-40 mm, andererseits 5 mm dick. (Stück von einem Mühl= oder Schleifstein?)


|
Seite 259 |




|
c. Ein 70 mm langer, 15-25 mm breiter und 8-10 mm dicker Griff eines Messers aus grauem Feuerstein, am Klingenansatz abgebrochen. Der letztere ist etwas breiter (30 mm breit) als der Griff.
d. Eine Pfeilspitze aus hellgrauem Feuerstein. Sie ist nur roh zugehauen und augenscheinlich zum Einlassen in einen vorne eingekerbten Schaft bestimmt. Denn die Dicke beträgt am hinteren Ende nur 2 mm und nimmt dann nach der Spitze hin allmählich zu bis zum Maximum von 5 mm. Länge: 32 mm, größte Breite: 17 mm.
e. Eine Anzahl pfeilspitzenartiger Feuersteinsplitter, vorne zum Theil spitz, zum Theil mit breiter Kante.
f. Eine Anzahl Feuersteinspähne.
g. Fünfzig kleine Feuersteinsplitter, fast sämmtlich mit Schlagmarken. Dieselben wurden an einer Stelle des Abbruchufers im Sande der Uferwand unmittelbar bei einander gefunden; vielleicht Abfallsplitter vom Bearbeiten von Steinwerkzeugen?
9. Die Hälfte einer kleinen Silbermünze des Königs Ethelred II. von England (978-1016).
Die Münze ist nur 1/2 mm dick und mißt 2 cm im
Durchmesser. Auf dem Avers der vorhandenen
Hälfte erblickt man im runden Felde den Kopf des
Königs nach links - wie es scheint, ohne
Kopfbedeckung - mit einem oben in ein Kleeblatt
auslaufenden Scepter davor. Die ganze Münze
enthielt also offenbar das Brustbild des Königs
mit dem Scepter in der Hand. Die oben über dem
Scheitel beginnende Umschrift lautet:
 EDELRÆ . . . . . . . . . . .
V
?
M
?
. Die Punkte bedeuten
den fehlenden Theil der Umschrift, der auf der
anderen Hälfte der Münze gestanden haben muß.
Die beiden letzten Buchstaben sind verwischt und
nicht genau zu erkennen. Der Revers zeigt,
ebenfalls im runden Felde, eine ausgereckte Hand
(scheinbar mit sechs Fingern) mit einigen
kleinen Zeichen oder Buchstaben (
EDELRÆ . . . . . . . . . . .
V
?
M
?
. Die Punkte bedeuten
den fehlenden Theil der Umschrift, der auf der
anderen Hälfte der Münze gestanden haben muß.
Die beiden letzten Buchstaben sind verwischt und
nicht genau zu erkennen. Der Revers zeigt,
ebenfalls im runden Felde, eine ausgereckte Hand
(scheinbar mit sechs Fingern) mit einigen
kleinen Zeichen oder Buchstaben (
 ?) an der linken Seite. Von der
Umschrift enthält das vorhandene Stück: . . . .
ANII
?) an der linken Seite. Von der
Umschrift enthält das vorhandene Stück: . . . .
ANII
 OLVN . . . Ob der Anfang dieses
Umschriftrestes ANII oder ANTI oder ANIT heißt,
ist nicht genau zu entziffern. Eine mir durch
das freundliche Entgegenkommen des Herrn Dr.
Hofmeister ermöglichte Vergleichung dieses
Fragmentes mit einigen im Rostocker
Universitäts=Münzkabinet befindlichen,
vollständig erhaltenen ähnlichen Münzen ergab,
daß das gefundene Stück von einer Münze des von
978-1016 regierenden Königs Ethelred II. von
England
1
)
stammt, und daß die volle Umschrift des Averses
OLVN . . . Ob der Anfang dieses
Umschriftrestes ANII oder ANTI oder ANIT heißt,
ist nicht genau zu entziffern. Eine mir durch
das freundliche Entgegenkommen des Herrn Dr.
Hofmeister ermöglichte Vergleichung dieses
Fragmentes mit einigen im Rostocker
Universitäts=Münzkabinet befindlichen,
vollständig erhaltenen ähnlichen Münzen ergab,
daß das gefundene Stück von einer Münze des von
978-1016 regierenden Königs Ethelred II. von
England
1
)
stammt, und daß die volle Umschrift des Averses


|
Seite 260 |




|
offenbar folgendermaßen gelautet hat:
 EDELRÆ(D REX ANGLOR)VM. Die
Umschrift des Reverses ließ sich dagegen wegen
der Verschiedenheit des Gepräges nicht
rekonstruiren, sie enthielt offenbar den Namen
des Münzmeisters und den des Münzortes London.
EDELRÆ(D REX ANGLOR)VM. Die
Umschrift des Reverses ließ sich dagegen wegen
der Verschiedenheit des Gepräges nicht
rekonstruiren, sie enthielt offenbar den Namen
des Münzmeisters und den des Münzortes London.
Sonst war an Münzen trotz eifrigen Suchens nichts weiter zu finden, und auch über anderweitige dort etwa gemachte Münzfunde habe ich bisher nichts in Erfahrung bringen können, als daß ein auf dem dortigen Bauernhofe bediensteter Knecht mir am 4. October 1891 erzählte, er habe an jener Stelle eine alte meklenburgische Münze gefunden, die ihm unbekannt sei. Leider habe ich diese Münze nicht gesehen und muß es daher zweifelhaft bleiben, ob es wirklich ein meklenburgisches oder nicht auch etwa ein bedeutend älteres Stück gewesen ist.
10. Gegenstände aus Bronce oder Kupfer.
a. Eine 20 X 25 mm große und 1 mm dicke Scherbe eines Bronce= oder Kupfergefäßes. Dieselbe ist in der Mitte mit einer 2 mm breiten und 1 mm vorspringenden, horizontal um die Gefäßwand laufenden Rippe oder Kante versehen und beiderseits vollständig mit einer festen schwarzen Rußschicht überzogen.
b. Drei kleine über einander liegende und durch ein Bronceniet fest zusammengehaltene, abgebrochene und verbogene Stücke dünnen Bronceblechs, 14 X 24 mm groß.
c. Ein 30 mm langes und 2 mm dickes rundes Stück Draht.
d. Ein kleines abgebrochenes Schmuckstück. An einem 5 mm langen und 2 mm breiten Stiel befindet sich eine Rosette von 7 mm Durchmesser mit eingestanzter Punktverzierung und fünf durchgestanzten kleinen runden Löchern. Dicke: 1/2 mm.
e. Ein Stück eines kleinen Bronceplättchens mit drei durchgestanzten runden Löchern. Größe: 6 X 16 mm, Dicke: 1/2 mm. (Zerbrochenes Schmuckstück?)
f. Ein Gewichtstück (?).
Es ist eine auf der einen Seite abgeplattete kleine Kugel von 20 mm Durchmesser und 15 mm Höhe. Die abgeplattete Stelle ist kreisförmig (6 mm Durchmesser) und wird von einem eingestanzten Perlenkranze, wie man ihn so häufig auf Münzen findet, umrahmt. In diesem Kranze lassen sich jetzt nur drei einzelne, kleine, ebenfalls eingestanzte, runde Punkte erkennen. Nach der Stellung derselben zu
 ., Jahrg. XXII, Nr. 9, S. 85)
und in einem Normannengrab in Livland
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie
., Jahrg. XXII, Nr. 9, S. 85)
und in einem Normannengrab in Livland
(Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für
Anthropologie
 ., 1876, S. 278).
., 1876, S. 278).


|
Seite 261 |




|
einander aber scheint es, als ob ursprünglich fünf derartige Punkte (zur Bezeichnung der Gewichtszahl?) vorhanden gewesen seien, von denen jetzt jedoch zwei durch Rost verdeckt oder vernichtet sind. An der dieser Abflachung entgegengesetzten Seite ist die Kugel infolge des Eisengehaltes des Bodens am Fundorte stark verwittert und mit Rost bedeckt, so daß es sich nicht mehr erkennen läßt, ob sie auch hier abgeplattet war. Daß die Kugel trotz dieses Rostes aus Kupfer oder Bronce besteht, ist durch leichtes Anfeilen der vom Rost angefressenen Seite festgestellt. Ihr Gewicht beträgt im jetzigen Zustande zwischen 29 und 30 Gramm.
11. Geräthe aus Eisen (sämmtlich stark verrostet):
a. Eine abgebrochene Messerklinge, 76 mm lang, 15 mm breit, Rücken 3 mm dick.
b. Messergriff mit einem Theil der umgebogenen und abgebrochenen Klinge (?). Es ist ein 65 mm langes, plattes Stück Eisen, am hinteren Ende 15-18 mm breit und abgerundet, während es am vorderen, etwas umgebogenen und nur 10 mm breiten Ende abgebrochen ist. Die Dicke beträgt, mit Ausnahme des nur 1 mm starken umgebogenen Stückes, 5 mm.
c. Mittelglied eines Pferdegebisses (?). Dasselbe besteht aus einer 41 mm langen und 5 mm breiten und dicken Eisenstange mit je einer viereckigen Oese an den beiden Enden. Breite der Oesen: 19-20 mm, Dicke derselben: 3 mm, lichter Durchmesser des viereckigen Oesenloches: 8-11 mm. Gesammtlänge des ganzen Stückes: 75 mm.
d.
 =förmiger Doppelhaken, 49 mm lang
und 3-4 mm dick.
=förmiger Doppelhaken, 49 mm lang
und 3-4 mm dick.
e. Ein vierkantiger, 50 mm langer Haken, 7-9 mm breit und 3-9 mm dick. Das umgebogene Ende ist 4 mm hoch.
f. Ein vierkantiger Angelhaken (?), krumm gebogen, 85 mm lang und 3-4 mm dick. Die mit einem Widerhaken versehene Spitze ist 17 mm lang und am hinteren Ende 9 mm breit.
g. Eine Schnalle. Der etwa 3 mm dicke viereckige Bügel ist 2 X 3 cm groß und mit einer 22 mm langen runden Pinne versehen.
h. Zwei Niete. Das eine ist augenscheinlich rund, 38 mm lang und etwa 5 mm dick und hat am oberen Ende einen 19 X 22 mm breiten viereckigen Kopf. Das untere Ende ist etwas verdickt und ebenfalls mit einem, aber nur 9 mm breiten, Kopfe versehen, der jetzt jedoch zur Hälfte abgebrochen ist. Das andere Stück ist 32 mm lang, 2-3 mm dick und ebenfalls scheinbar rund. Es hat einen 15 X 19 mm breiten Kopf und ist am unteren Ende verdickt mit ovalem Querschnitt von 5 X 7 mm Durchmesser.


|
Seite 262 |




|
i. Eine kleine Pinne mit großem, viereckigem Kopf von 20 bis 25 mm Breite und 2-3 mm Dicke. Die vierkantige Pinne selbst ist nur 9 mm lang und am Kopfende 4 mm dick.
k. Sieben vierkantige Nägel bezw. Stücke von solchen, 23 bis 74 mm lang und 3-6 mm dick, drei davon mit Köpfen von 10 bis 20 mm Breite.
l. Kopfstück eines runden Nagels oder Stiftes. Länge: 9 mm, Dicke: 5 mm, Breite des Kopfes: 8 mm.
m. Eine 10 X 25 mm breite und 3-4 mm dicke Eisenplatte (abgesprungener Nagelkopf?).
n. Eine etwas krumm gebogene, vierkantige, durchbohrte Eisenplatte von 21 X 27 mm Durchmesser und 15-30 mm Dicke. Das in der Mitte befindliche Loch ist rund und hält etwa 5 mm im Durchmesser.
o. Ein etwas krumm gebogenes, 50 mm langes, 15-30 mm breites und 10-30 mm dickes Stück Eisen.
p. Kleines abgebrochenes, dreieckiges Stück Eisen. Breite an der Basis: 32 mm, Höhe: 25 mm, Dicke: 2-7 mm.
q. Ein 20 mm langes, 10 mm breites und 2 mm dickes Eisenstück.
r. Zwei kleine, 1 mm dicke platte Stückchen Eisen von 10 X 20 und 15 X 20 mm Durchmesser.
s. Vierzehn kleine Eisensplitter.
12. Ein kleines, dunkelrothes Thonstückchen, 10 X 13 mm groß bei 5 mm Dicke. Vielleicht als Farbe benutzt?
13. Die Hälfte eines unverzierten, glatten Spinnwirtels von doppelkonischer Form aus grauem, hart gebranntem Thon. Höhe: 12 mm, Durchmesser in der Mitte: 30 mm und an beiden Enden: 18 mm. Das senkrecht durch die Mitte gehende kreisrunde Loch mit glatten Wänden mißt 9-10 mm Durchmesser im Lichten.
14. Aeltere Gefäßscherben finden sich in großer Menge, sowohl verziert, wie unverziert.
Alle diese Scherben zeigen in Material, Technik und Verzierung genau denselben Charakter, wie die von den hiesigen wendischen Burgwällen (vergleiche die Funde vom Dierkower Burgberge in Jahrb. XLVIII, S. 300 ff.) und sind daher unzweifelhaft als wendische anzusprechen. Sie bestehen sämmtlich aus Thon, der mit einer größeren oder geringeren Menge Steingrus von verschiedener Feinheit bezw. Grobheit durchmengt ist, zeigen mehrfach deutliche Spuren ihrer Herstellung vermittelst der Töpferscheibe und sind sämmtlich gebrannt, und zwar zum bei weitem größten Theile sehr gut.


|
Seite 263 |




|
Was die Farbe anbetrifft, so sind die meisten Scherben an der Außen= und Innenseite roth oder gelblichroth mit grauem Kern, viele jedoch auch außen roth, röthlich oder gelblich und innen grau bezw. grauschwarz oder außen und innen graubraun mit grauem Kern. Daneben kommen aber auch nicht selten durch und durch graue, grauschwarze oder rothe Scherben vor, sowie einige innen röthliche, im Uebrigen aber graue. Ein braunrother Kern bei sonst grauer Färbung wurde nur bei ganz wenigen, hart gebrannten, ziemlich stark mit Steingrus durchsetzten Scherben beobachtet. Bei manchen Stücken ist es deutlich erkennbar, daß das zunächst aus grauer, mit Steingrus durchkneteter Thonmasse geformte Gefäß dann an der Innen= und Außenseite mit je einer dünnen Lage feineren Thones, meist von rother oder gelbbrauner Färbung ohne Steinzusatz, überzogen ist. Bei zwei oder drei hart gebrannten Scherben mit nur wenig Steingrusbeimengung lassen sich sogar fünf Schichten über einander erkennen: ein grauer Kern ist beiderseits mit je einer dünnen braunen und diese wiederum mit je einer dünnen grauen Thonschicht überzogen. Die am besten gearbeiteten, und mit wenigen Ausnahmen auch die mit dem feinsten Steingrus durchsetzten Scherben finden sich unter den durch und durch rothen, womit aber nicht gesagt sein soll, daß bei allen derartigen Gefäßresten Material und Arbeit von solcher Feinheit sei sondern es kommen daneben auch sehr roh gearbeitete Stücke, sowie solche mit sehr grobem Steingruszusatz vor. Bei weitem die meisten Scherben sind, wie bei fast allen durch den Ackerbau zerstörten hiesigen Fundstellen, nur klein. Größere Stücke wurden bisher nur verhältnißmäßig wenig gefunden, und wenn sich auch mehrfach Scherben, die offenbar zu ein und demselben Gefäße gehören mußten, im Acker unmittelbar bei einander fanden, so haben sich dieselben doch bisher nur in einem einzigen Falle zu einem größeren Stücke zusammensetzen lassen, aus dem sich wenigstens ungefähr die Form des betreffenden Topfes erkennen läßt. Die dicksten der bisher gefundenen Gefäßreste sind 8, 9, 12 und 13 mm, die dünnsten 3-5 mm dick. Die Wölbung der Scherben ist, ein oder zwei stärker gebogene Stücke ausgenommen, sehr flach, so daß die Gefäße durchgehend ohne besondere Ausbauchung gewesen zu sein scheinen. Eine ziemlich dicke, unverzierte, hart gebrannte, graue Scherbe ist so leicht wie Bimsstein, so daß sie auf dem Wasser schwimmt.
An Verzierungen, welche auf manchen Stücken nur roh und verwischt, auf den meisten aber gut und theilweise sogar sehr exakt ausgeführt sind, kommen die folgenden vor:
a. Die gewöhnlichen Horizontalrillen von 1-5 mm Breite und bis zu 3 mm Tiefe, genau wie die im Jahrb. XLVIII, S. 302


|
Seite 264 |




|
sub Nr. 15 a vom Dierkower Burgberge beschriebenen. Dies ist die am häufigsten vorkommende Verzierungsart. Denn es zeigt nicht bloß die bei weitem größte Anzahl der überhaupt verzierten Scherben nur diese Verzierung allein, sondern dieselbe kommt auch in Verbindung mit allen übrigen Ornamenten vor. Fast sämmtliche Rillen sind einzeln ein nach einander aus freier Hand in die Gefäßwand eingegraben; daß sie aber unter Umständen auch mit einem gezahnten oder ausgezackten Instrumente hergestellt wurden, zeigt eine Scherbe, welche mit mehreren völlig gleichmäßigen Bändern von je drei Horizontalrillen und außerdem noch mit einem horizontalen Bande von mindestens zwei Wellenlinien verziert ist. Die Zahl der Wellenlinien läßt sich nicht genau feststellen, da die Scherbe in diesem Bande abgebrochen ist. Bei einigen Scherben sind die ziemlich breiten Rillen so kräftig eingedrückt, daß die schmalen Zwischenräume zwischen denselben wie horizontale, um die Gefäßwand sich herumziehende Rippen aussehen. Bemerkenswerth dürften hier noch zwei Randstücke sein, welche außer den Horizontalen auf der äußeren Gefäßwand auch noch zwei bis drei derartige Linien oben auf der wagerechten bezw. von innen nach außen schräge aufwärts gerichteten Abplattung des etwas nach außen überstehenden resp. umgebogenen Randes aufweisen.
b. Im Winkel zu einander stehende bezw. sich kreuzende eingegrabene grade Linien (vergl. Dierkow l. c., S. 303 und 304, Nr. 15 i-m). Nur vier kleine, gut geglättete Scherben mit sorgfältig ausgeführter Verzierung.
c. Eingegrabene horizontale Wellen= oder Zickzacklinien (l. c., S. 302, Nr. 15 b und c).
Die meisten diese Ornamentirung zeigenden Scherben sind nur mit einer, einige jedoch auch mit zwei einzelnen oder mit einem horizontalen Bande von zwei bis drei Wellen= bezw. Zickzacklinien verziert. Von den überhaupt nur wenig vorkommenden Zickzacklinien sind übrigens manche wohl nur etwas steiler und eckiger gezogene Wellenlinien, so daß mit wirklichem Zickzack=Ornament nur ganz einzelne Stücke übrig bleiben. Besonders zu erwähnen ist hier noch eine kleine, durch und durch braune, gut gearbeitete Scherbe von der oberen Gefäßkante mit abgeplattetem, nach außen überstehendem Rande (der Rand ist 7 mm, die übrige Scherbe nur 3 mm dick). Dieselbe besteht aus feinem, hart gebranntem Thon mit nur ganz geringer und sehr feiner Steingrusbeimengung und ist außer mit einer oben an der Außenseite des Randes angebrachten flachen auch noch auf der Innenseite des Gefäßes unmittelbar unter dem Rande mit einer


|
Seite 265 |




|
ähnlichen, allerdings nur roh eingegrabenen Wellen= oder Schlangenlinie verziert.
d. Kerben (l. c, S. 303, Nr. 15 e).
Alle hierher gehörigen Stücke sind Randstücke oder unmittelbar unter dem Rande weggebrochene Scherben, welche sämmtlich dicht unter demselben mit einer horizontalen Kerbenreihe versehen sind. (Ein Randstück hat ein Band von senkrecht stehenden Kerben von 6-7 mm Durchmesser, die mit einem vierkantigen Instrumente mit stumpfer Spitze eingedrückt sind. Auf allen übrigen Scherben stehen die Kerben schräge, und zwar meistens von links oben nach rechts unten. Reihen, bei denen die Einkerbungen umgekehrt von rechts oben nach links unten gerichtet sind, kommen nur ganz wenig vor. Bei einigen Stücken sind die Kerben mit einem drei= bis sechszinkigen Instrumente eingedrückt in der Weise, daß jede einzelne derselben sich aus den unmittelbar zusammenstoßenden drei bis sechs mehr oder weniger horizontal liegenden Zinkeneindrücken zusammensetzt.
e. Fischgräten=Ornament.
Dies Ornament wurde bisher nur auf einem einzigen Randstücke beobachtet. Oben auf dem 5 mm breiten, platten Rande befinden sich zwei gegen einander gerichtete, durch eine ganz schmale Längsrille in der Mitte getrennte Kerbenreihen, und zwar so, daß die äußere Reihe, deren Kerben etwas stärker sind als die der inneren, noch mit in die Außenseite des Randes eingedrückt und daher nicht bloß von oben, sondern auch an der Außenseite der Scherbe sichtbar ist. Die einzelnen Kerben sind etwa 5 mm lang und die der inneren Reihe ca. 1 mm, die der äußeren 1-2 mm breit. Außerdem ist die Scherbe außen dicht unter dem Rande noch mit einer horizontalen graden und zwei Wellenlinien verziert, und zwar so, daß die erstere sich zwischen den beiden letzteren befindet.
f. Eingedrückte Punkte (l. c., S. 302, Nr. 15 d und S. 304, Nr. 15 p).
Punkte allein als einzige Verzierung fanden sich nur einmal auf einem Randstücke, sonst nur in Verbindung mit den gewöhnlichen Horizontalrillen. Aber auch hiermit wurden bis jetzt nur drei Scherben beobachtet. Alle vier Stücke sind mit je einem horizontalen Bande kurzer schräger Reihen von drei bis vier kleinen Punkten verziert. Bei zwei Bändern sind diese Punktreihen von links oben nach rechts unten, bei den beiden anderen entgegengesetzt von rechts oben nach links unten gerichtet. Die einzelnen Punkte haben auf drei Scherben eine mehr oder weniger runde Form, während sie auf der vierten, dem erwähnten Randstücke, augenscheinlich mit einem spitzen, vierkantigen Gegenstande gemacht sind. Letztere haben bei ca. 1-2 mm


|
Seite 266 |




|
Tiefe einen oberen Durchmesser von 2-3 mm. Bei zwei Scherben bestehen die einzelnen Punktreihen aus je drei Punkten, die ganz offenbar mit einem dreizackigen Instrumente eingedrückt sind. Aus wieviel Eindrücken die Reihen auf den beiden anderen Scherben bestanden, ist nicht genau festzustellen, da diese Stücke grade im Punktbande abgebrochen sind. Die längsten Reihen zählen auf beiden je vier Punkte.
g. Ein um die Gefäßwandung laufender erhöhter oder vorspringender horizontaler Ring oder Wulst (l. c., S. 306, Nr. 15 v.).
Ein derartiger Ring befindet sich auf dreizehn Scherben. Er springt 2-8 mm vor und ist bei zehn Stücken mit schrägen Kerben versehen. Daneben sind alle dreizehn Scherben noch mit den gewöhnlichen Horizontalrillen und außerdem eine noch mit einer Wellen= und eine andere mit zwei Zickzacklinien (die eine über, die andere unter dem gekerbten Ringe) verziert. Bei einer Scherbe mit 3 mm vorspringendem Ringe ist dieser zum Theil abgesprungen und zeigt sich darunter eine völlig glatte, 6 mm breite und 1 1/2 mm tiefe Horizontalrille, so daß es den Anschein hat, als ob der Ring erst später in diese Rille eingefügt sei.
Außerdem kommen noch folgende Zusammensetzungen obiger Verzierungsarten vor:
h. Gewöhnliche Horizontalrillen und Wellen= bezw. Zickzacklinien (l. c., S. 304, Nr. 15 n und o).
Die Hauptverzierung bildet die grade Rille. Denn die meisten Scherben zeigen neben einer größeren oder geringeren Anzahl von graden nur eine einzige Wellenlinie, welche letztere meist über den ersteren dem Rande zunächst angebracht ist. Mit zwei einzelnen Wellenlinien neben den Graden wurden nur zwei oder drei Scherben gefunden und ebenso nur sehr vereinzelt Stücke mit Bändern von zwei bis vier Wellenlinien, die zum Theil mit einem gezahnten Instrumente eingeritzt sind. Bei einer Scherbe von der oberen Gefäßkante ist ein derartiges, mit einem drei= oder vierzinkigen Geräthe hergestelltes schmales Band in die vordere Kante des oben abgeplatteten und nach außen überstehenden Randes eingedrückt, und zwar so stark, daß dieser dadurch von außen ein gekräuseltes oder welliges Ansehen erhalten hat. Auf einem anderen Randstücke liegt die Wellenlinie in einer unmittelbar unter dem Rande befindlichen, 4 mm breiten Graden, während sie auf einer dritten Scherbe drei der sie umgebenden Graden durchschneidet.
i. Gewöhnliche Horizontalrillen und Kerben (l. c., S. 305, Nr. 15 r.).


|
Seite 267 |




|
Alle hierher gehörigen Scherben, von denen über die Hälfte Randstücke sind, sind neben den Horizontalrillen nur mit je einer horizontalen Kerbenreihe verziert. Die Einkerbungen stehen, ebenso wie bei den nur mit ihnen verzierten Scherben, fast sämmtlich schräge, und zwar sind etwa 5/6 von links oben nach rechts unten und nur 1/6 umgekehrt gerichtet. Auf einer Scherbe stehen die Kerben fast und auf einem Randstücke ganz senkrecht, während sie auf einem dritten Stücke wagerecht liegen. Bei fast sämmtlichen Randstücken befindet sich die Kerbenreihe zunächst unter dem Rande, und folgen dann erst die Horizontalrillen. Nur bei sechs bis sieben Scherben steht dieselbe etwas tiefer zwischen den letzteren oder ist sie in dieselben hineingedrückt. Auf einem dieser Stücke sind die Kerben 7 mm breit, 9 mm lang und sehr flach und scheinen durch leichtes Eindrücken des kleinen Fingers in die noch nicht hart gewordene Gefäßwand hergestellt zu sein. Bei dem Randstücke mit den senkrechten Kerben (von 2-3 mm oberem Durchmesser) sind dieselben mit einem spitzen, vierkantigen und bei vier anderen Scherben mit einem gezahnten Instrumente gemacht. Bemerkenswerth sind noch drei kleine hierher gehörige Scherben, die fast einen Uebergang von der Wellenlinie zu den Kerben, bezw. umgekehrt, zu bilden scheinen. Bei zwei dieser Stücke nämlich sind die ebenfalls schräge stehenden Kerben etwas schlangenartig und bei der dritten am einen Ende hakenförmig gebogen, so daß das Kerbenband auf allen drei fast einer regelmäßig unterbrochenen Wellenlinie ähnlich sieht.
k. Wellenlinien und Kerben (l. c., S. 305, Nr. 15 s.).
Nur zwei Scherben, welche beide unter dem Rande mit je einer horizontalen Reihe schräger, von links oben nach rechts unten gerichteter Kerben und einer unmittelbar hierunter angebrachten, ebenfalls horizontalen Wellenlinie verziert sind.
l. Horizontalrillen, Wellenlinien und Kerben (l. c., S. 306, Nr. 15 t.).
Ebenfalls nur zwei kleine Scherben, bei denen zu der soeben unter k aufgeführten Verzierung noch die gewöhnlichen Horizontallinien hinzukommen.
Ueber die Scherben vom Gefäßboden und vom unteren Theile des Gefäßes mit einem Stücke des Bodens daran gilt genau dasselbe, was l. c. S. 301, Absatz 3 über die Dierkower Bodenstücke gesagt ist. Der Winkel zwischen Boden und Gefäßwand wechselt zwischen 96° und 143°. Mit einem an der äußeren Kante sich herumziehenden flachen Ringe auf der Unterseite des Bodens sind nur sechs bis sieben Scherben versehen. Alle übrigen sind völlig platt. Die geringste Dicke der Bodenstücke beträgt 4 mm.


|
Seite 268 |




|
Auch die Randformen stimmen bei den bisher gefundenen 161 Scherben von der oberen Gefäßkante größten Theils mit den l. c., S. 301 ff. beschriebenen Randstücken vom Dierkower Burgberge überein. Denn 42 Scherben haben dieselbe Form wie die daselbst sub Nr. 14 d aufgeführte, 27 sind wie die erste der dort sub Nr. 15 a genannten Arten, 26 wie Nr. 14 f, 19 wie Nr. 14 b, 5 wie Nr. 14 a, 4 wie Nr. 14 c, je 2 wie Nr. 15 b und die erste der sub Nr. 15 r beschriebenen Formen sowie je 1 wie Nr. 14 e und die zweite sub Nr. 15 a genannte Art. Neu sind dagegen die folgenden Formen:
α. oben horizontal oder von innen nach außen schräge auswärts abgeplattet, wie l. c., Nr. 14 b und c, aber nach beiden Seiten hin überstehend (3 Stücke),
β. wie l. c., Nr. 14 d, aber nach oben hin verdickt (1 Stück),
γ. wie l. c., Nr. 14 b, 14 d und die erste der sub Nr. 15 r beschriebenen Randformen, aber mit einer Auskehlung in der abgeplatteten oberen bezw. abgeschrägten vorderen Kante (15 Stücke),
δ. wie die erste der l. c. sub Nr. 15 a beschriebenen beiden Formen, aber mit einer Auskehlung oben in der Biegung bezw. der schräg abwärts gerichteten vorderen Randkante oder in beiden (11 Stücke),
ε. ganz oben abgerundet und dann nach innen hin schräge abwärts abgeplattet (1 Stück),
ζ. Rand von innen und außen nach oben zu allmählich dünner werdend, so daß er oben schließlich in eine ganz schmale Kante ausläuft (1 Stück).
Von den Randstücken ist etwa die Hälfte verziert und die Hälfte unverziert, und zwar herrschen unter den ersteren die mit den gewöhnlichen Horizontalrillen (42 Stück) sowie die mit den Horizontalen und Kerben (21 Stücke) versehenen Scherben vor, während von den übrigen Verzierungsarten gewöhnliche horizontale und Wellen= bezw. Zickzacklinien nur auf zehn, Kerben allein auf sechs, Wellenlinien allein auf vier, Kerben und Wellenlinien zusammen auf einer und Punkte, sowie das oben beschriebene Fischgräten=Ornament ebenfalls nur auf je einer Scherbe vorkommen. Da die unverzierten Randstücke übrigens meist nur klein sind und größere Stücke unter ihnen fast gar nicht vorkommen, so dürften sie wohl zum größten Theile vom unverzierten Halse oder Rande sonst verzierter Gefäße stammen.
Selten sind Reste von Gefäßdeckeln, von denen bisher nur zwei Scherben gefunden wurden. Beide stammen von platten runden Deckeln und sind röthlich mit grauem Kern, hart gebrannt und, ebenso wie alle übrigen Scherben, mit Steingrus durchsetzt. Die Dicke der


|
Seite 269 |




|
einen beträgt 5-8 mm, die der anderen 7-8 mm. Die Oberseite beider Deckel war verziert, und zwar die des einen offenbar vollständig mit eingedrückten, der Deckelrundung entsprechenden concentrischen Kreisen bedeckt. Die andere Scherbe dagegen zeigt nur 5 mm von der Kante entfernt ein Band von zwei bis drei derartigen, übrigens nur roh hergestellten und in einander laufenden Kreislinien, welche radial von einer gleichfalls eingedrückten Graden durchschnitten werden.
Zum Schluß möchte ich hier bei den älteren Scherben noch einige allerdings nur in sehr geringer Anzahl vorkommende Stücke erwähnen, die den Uebergang zu den folgenden jüngeren Gefäßresten zu bilden scheinen. Es sind dies theils graue, theils bräunliche 1 ) Scherben, bei denen sich eine allmähliche Verfeinerung des zur Herstellung benutzten Materials erkennen läßt. Der Thon ist ausgeschlemmt resp. besser ausgeschlemmt, als bisher, und die Steingrusbeimengung ist geringer und feiner. Auch sind diese Scherben zum Theil dünner und schon härter gebrannt, als die älteren. Dennoch aber ist der Brand noch nicht so hart, wie bei der jüngeren Art, namentlich nicht klingend, und ist ferner auch die Arbeit noch nicht so gleichmäßig und exakt, wie wir sie bei diesen letzteren durchweg finden. Vor Allem aber, und dies dürfte wohl den jüngeren Scherben gegenüber das Hauptunterscheidungsmerkmal bilden, zeigen diese Uebergangsscherben noch stets eine, wenn auch schon vielfach bedeutend geringere und verfeinerte Steingrusbeimengung, eine Zuthat, die bei den jüngeren (von einem einzigen, mit feinem, weißem Quarzsand durchsetzten Stücke abgesehen) völlig fehlt. An Verzierungen kommen vor die gewöhnlichen Horizontalrillen, horizontale Wellenlinien und horizontale Kerbenreihen, sowie Zusammensetzungen aus diesen Ornamenten. Die Randformen sind wie Jahrb. XLVIII, S. 301, Nr. 14 b, 14 d und die erste der ebenda S. 302 sub Nr. 15 a beschriebenen Arten (je eine Scherbe). Bei dem einzigen hierher gehörigen Bodenstücke geht die Seitenwand innen allmählich in den Boden über, während sie außen scharf absetzt. Der Boden selbst ist, soweit sich dies bei der Kleinheit der Scherbe erkennen läßt, beiderseits platt.
15. Jüngere Gefäßscherben.
Diese jüngeren Scherben finden sich einzeln zwischen den älteren zerstreut. Sie sind sehr hart und größtentheils klingend gebrannt, nur 2-6 mm dick und von Farbe meist durch und durch hellgrau


|
Seite 270 |




|
oder graublau, einige auch schwärzlich oder bräunlich oder außen und innen grau bezw. graublau, aber mit braunem Kern. Sämmtliche Stücke sind mittelst der Töpferscheibe gearbeitet und bestehen aus fein geschlemmtem Thon ohne Steingrusbeimengung. Nur eine einzige dunkelgraublaue Scherbe ist, wie bereits bemerkt, mit sehr feinen weißen Quarzstückchen oder Quarzsand durchsetzt. Die meisten Scherben sind unverziert, doch kommen einzeln auch Horizontalrillen vor. Andere Verzierungsarten wurden bisher nicht beobachtet. Ebenso wie Material und Technik, sind auch die Randformen dieser jüngeren Gefäßreste fast durchgehend wesentlich anders als bei den älteren Scherben. Die bisher gefundenen Formen sind folgende:
a. Wie Jahrb. XLVIII, S. 302, Nr. 15 b (zwei unverzierte Stücke).
b. Senkrecht stehender, oben abgerundeter oder sich allmählich zu einer schmalen Kante verjüngender Rand. Bei einer der hierher gehörigen Scherben springt die Gefäßwand unmittelbar unter dem Rande etwas nach außen vor, so daß hier ein kleiner Absatz entsteht. (3 dünne Scherben, 2 unverzierte und eine mit Horizontalrillen.)
c. Senkrecht stehender, oben abgerundeter Rand mit verdickter Kante und einem 1/2-1 1/2 cm unter demselben befindlichen flachen nach außen vorspringenden horizontalen Wulste (zwei unverzierte Stücke).
d. Nach außen umgebogener Rand mit stark verdickter und dadurch nach beiden Seiten hin überstehender abgerundeter Vorderkante (4 unverzierte Stücke).
e. Rand erst nach außen und dann nach oben gebogen, obere Kante abgerundet (zwei unverzierte Stücke und ein ähnliches, gleichfalls unverziertes, welches fast den Uebergang von d zu e bildet).
Scherben von Gefäßboden wurden bisher nicht gefunden, wohl aber ein hellgraues Henkelstück.
Ob zu diesen jüngeren Gefäßresten auch die sich ebendort zerstreut findenden, klingend gebrannten, weißlichgrauen oder hellgelblichbraunen, meist mit Horizontalrillen verzierten Scherben (seltener unverziert, zum Theil mit Stellen ganz dünner brauner Glasur) zu rechnen sind oder ob diese einer neueren Zeit angehören, wage ich einstweilen nicht zu entscheiden. Auch von diesen Gefäßen wurden bisher keine Boden=, wohl aber Rand= und Henkelstücke gefunden.
B. Vom Fundort Nr. 2.
1. Ein ganz kleines calcinirtes Knochenstückchen.
2. Thierknochen und Zähne.
Ein humerus vom Schwein, drei kleine Stücke von Rippen, ein kleiner und ein großer Fußknochen (letzterer aus der Warnow


|
Seite 271 |




|
oder dem zwischen den Fundorten l und 2 mündenden Bache) und ein abgesplittertes Stück eines Zahnes.
3. Gebrannte oder doch wenigstens im Feuer gewesene Lehm= und Thonstücke, zum Theil mit Abdrücken von Gras= oder Strohhalmen, im Feuer gewesene Steine, sowie Holzkohle fanden sich hier bisher nur sehr spärlich, Metall= oder Steinschlacken garnicht.
4. Ein kleines schwarzes Stück Harz, Pech oder dergl.
5. Zwei dreikantige Feuersteinspähne von 5 und 7 1/2 cm Länge, sowie ein oder zwei Feuersteinsplitter, welche letztere aber auch auf natürliche Weise abgesplittert sein können.
6. Geräthe aus Eisen, sämmtlich stark verrostet:
a. Eine Messerklinge von 58 mm Länge, 12 mm Breite und 4 mm Dicke.
b. Eine Messerklinge (?) oder dergl., 56 mm lang, bis zu 9 mm breit und bis zu 6 mm dick.
c. Ein ca. 9 cm langes, 24 mm breites, plattes, vierkantiges, an den beiden Enden mit je einem runden Loche durchbohrtes Stück Eisen von 3 mm Dicke. Vielleicht erst aus neuerer Zeit stammend.
d. Ein Nagelkopf von 3 1/2 cm Längen= und 2-3 cm Breiten=Durchmesser.
e. Ein 2 cm langes, 1 cm. breites, 6-10 mm dickes, kantiges Eisenstück.
f. Verschiedene kleine Eisensplitter.
Andere Metallgegenstände wurden nicht beobachtet.
7. Ein unverzierter Spindelstein aus hart gebranntem, graubraunem Thon, 2 cm hoch, mit rundem, 7-8 mm breitem Loch. Er ist oben und unten platt (je 1 1/2 cm Durchmesser), nimmt nach der Mitte hin zu und bildet hier eine scharfe Kante von 27 mm Durchmesser.
8. Aeltere Gefäßscherben.
Auch hier wurden zahlreiche wendische Scherben von demselben Typus, wie die vom Fundort Nr. 1 beschriebenen, gefunden, wenn auch nicht in ganz so reichlicher Menge, wie dort. Auf den verzierten Stücken herrschen auch hier die gewöhnlichen Horizontalrillen entschieden vor (40-45 Scherben). Aber auch die meisten anderen oben aufgeführten Verzierungsarten wiederholen sich hier. So wurden gefunden: vier mit einer nur sehr flach eingedrückten Wellenlinie verzierte Scherben, zwei Randstücke mit je einer horizontalen Reihe schräger, von links oben nach rechts unten gerichteter Kerben unmittelbar unter dem 2 cm hohen, etwas nach außen gebogenen Halse, sowie eine kleine Scherbe mit einem horizontalen Bande schräger,


|
Seite 272 |




|
ebenfalls von links oben nach rechts unten gerichteter Reihen von je drei eingedrückten Punkten. Elf Scherben, darunter drei Randstücke, zeigen die Horizontalrillen in Verbindung mit der Wellenlinie, und zwar kommt ebenso wie beim Fundort Nr. 1 nur auf einer Scherbe ein horizontales Band von zwei, sonst immer nur eine einzige, zum Theil sehr roh hergestellte Wellenlinie vor. Auf den Randstücken befindet sich diese letztere zu oberst über den Horizontalrillen, nämlich auf dem einen vorn an dem durch einen Absatz von der übrigen Gefäßwand getrennten, 2 cm hohen aufrechten Halse, bei den beiden anderen unmittelbar unter dem Rande. Mit Horizontalrillen und je einem horizontalen Kerbenbande fanden sich sechs Scherben, deren Einkerbungen die übliche schräge Richtung von links oben nach rechts unten haben, mit Ausnahme eines einzigen Randstückes, bei dem sich die Kerbenreihe unmittelbar unter dem 24 mm hohen, aufrechten Halse befindet und die 5-6 mm langen und nur 1 mm breiten Kerben fast wagerecht liegen. Bei einem anderen hierher gehörigen Randstücke sind die 6-7 mm langen und 4 mm breiten Einkerbungen oben in die Außenkante des Randes eingedrückt, während sich die Horizontalrillen unmittelbar unter demselben befinden. Besonders zu erwähnen ist auch hier wieder eine Scherbe, welche in ihren schlangen= bezw. hakenartig gebogenen Kerben den Uebergang von diesen zur Wellenlinie zeigt. Ein horizontal um die Gefäßwand laufender, 4-5 mm vorspringender Ring oder Wulst kommt nur auf vier Scherben vor, und zwar stets in Verbindung mit Horizontalrillen. Auf einer ganz gut gearbeiteten und gebrannten, innen grauen, außen röthlichen Scherbe hat der Ring einen dreieckigen Querschnitt und ist nicht gekerbt, während er auf den drei übrigen mit schrägen Kerben versehen ist. Die Richtung dieser Kerben geht bei einem Wulste von rechts oben nach links unten, bei den beiden anderen dagegen, wie gewöhnlich, umgekehrt. Bei einem dieser letzteren Stücke (außen röthlich, innen grau, 3-4 mm dick) zeigt sich an einer Stelle, an welcher der 5 mm vorspringende Ring abgesprungen ist, ebenso, wie bei der einen vom Fundort Nr. 1 erwähnten Scherbe, eine 5 mm breite und 1 1/2 mm tiefe Horizontalrille, in welche der Wulst später eingesetzt zu sein scheint. Auf einer etwas stärker gewölbten Scherbe, bei welcher der Ring sich außen grade an der größten Ausweitung befindet, sind die Kerben mit einem vierzackigen Instrumente eingedrückt. Ein 7-8 mm dickes, röthliches, mit grobem Steingrus durchsetztes, gut gebranntes Randstück, welches unmittelbar unter dem 2 cm hohen, aufrechten Halse ziemlich scharf nach innen umbiegt und außen an dieser Stelle mit einem etwas vorspringenden Absatze versehen ist, trägt am Halse vier und unter jedem Absatze zwei roh


|
Seite 273 |




|
eingeritzte horizontale Wellenlinien. Ob der Absatz außerdem noch mit Einkerbungen verziert war, läßt sich nicht mehr genau erkennen.
Die Scherben vom Gefäßboden sind, ebenso wie die vom Fundort Nr. 1, außen mehr oder weniger scharf absetzend, innen allmählich in den Boden übergehend. Der Boden selbst ist völlig platt und nur bei vier Stücken auf der Unterseite mit einem an der äußeren Kante herumlaufenden, etwas erhöhten Ringe versehen. Nur eine einzige Scherbe zeigt auf der Unterseite den Bruchtheil einer dort in der Mitte des Bodens angebrachten, leicht erhöhten Verzierung, augenscheinlich ein Rad mit Speichen darstellend, ähnlich dem im Jahrb. LVIII, S. 196, Fig. 14 abgebildeten, von dem sich aus der vorhandenen Scherbe jedoch nur ein Stück des äußeren Kreises sowie zwei Speichen befinden.
Von Randformen wurden bisher beobachtet: zwei Stücke wie Jahrb. XLVIII, S. 301, Nr. 14 b (beide mit Horizontalrillen und Kerben verziert) eins wie ebenda Nr. 14 c (das zuletzt beschriebene Randstück mit Wellenlinien und einem gekerbten (?) Absatz unter dem Halse), fünf wie Nr. 14 d (drei unverziert, eins mit Horizontalrillen und eins mit Kerben), drei wie Nr. 14 f (unverziert), vier (zwei unverziert, eins mit Horizontalrillen und eins mit diesen letzteren und Wellenlinien) wie die erste der 1. c., S. 302 sub Nr. 15 a und eins (mit Kerben) wie die letzte der l. c., S. 303 sub Nr. 15 e beschriebenen Formen, ferner drei wie die oben beim Fundort Nr. 1 sub γ aufgeführte Art (eins unverziert, eins mit Horizontalrillen und eins mit letzteren und Wellenlinien), eins wie Fundort Nr. 1 sub δ (mit Horizontalrillen und Wellenlinien) und eins wie Fundort Nr. 1 sub ζ (unverziert) sowie ein oben abgerundeter, doch etwas nach außen überstehender Rand (mit Wellenlinien). Die unverzierten Randstücke sind auch hier sämmtlich nur klein.
Das einzige an dieser Stelle bisher gefundene Deckelstück stammt von einem dicken runden Deckel von ca. 13 cm Durchmesser, ist roh gearbeitet, innen rauh, außen geglättet und nimmt nach der Mitte hin an Dicke zu. Die Farbe ist röthlich, innen jedoch zum Theil grau. Die auf der Oberseite angebrachte Verzierung besteht aus sieben eingeritzten concentrischen Kreisen, von denen die sechs äußeren zu zwei Bändern von je drei zusammengefaßt sind.
Von den oben S. 269 erwähnten Gefäßresten, welche vielleicht den Uebergang zu den jüngeren mittelalterlichen bilden, wurden hier drei gewöhnliche unverzierte Scherben, ein Boden= und drei Randstücke, sowie ein Fuß gefunden, sämmtlich grau resp. bräunlich. Das Bodenstück ist sehr hart gebrannt, außen grau, innen hellbraun, mit feinem, meist aus Quarz bestehendem Steingrus durchsetzt und zeigt


|
Seite 274 |




|
deutliche Spuren der Herstellung vermittelst der Töpferscheibe. Die Dicke der Gefäßwand beträgt 9 mm, die des Bodens 6 mm. Innen geht die Seitenwand allmählich in den Boden über, während derselbe außen völlig platt und an der Kante mit einem etwas erhabenen Ringe versehen ist. Von den drei Randstücken zeigen zwei einen aufrechten, oben etwas nach außen gebogenen Hals von 2 cm Höhe und unmittelbar unter demselben je ein horizontales Band kleiner schräger Kerben (auf der einen von rechts oben nach links unten, auf der anderen umgekehrt gerichtet). Die Randform ist bei beiden dieselbe, wie die erste der im Jahrb. XLVIII, S. 302 sub Nr. 15 a beschriebenen beiden Arten. Das dritte unverzierte Stück stammt von einem 1 1/2 cm hohen aufrechten Gefäßhalse und hat die ebenda S. 301 sub Nr. 14 d angegebene Form. Der Gefäßfuß ist 43 mm lang, vierkantig, mit abgerundeten Kanten, oben etwa 2 cm, unten etwa 1 cm dick, gut geglättet, und besteht aus bräunlich=grauem, mit Steingrus durchmengtem, sehr hart gebranntem Thon.
9. Jüngere mittelalterliche Gefäßscherben:
Zehn 2-6 mm dicke Scherben, darunter eine vom Gefäßboden und zwei vom Gefäßrande.
Das Bodenstück ist hellgrau und hat einen platten Boden mit außen scharf absetzender Kante. Von den Gefäßrändern ist der eine 2-3 cm nach außen umgebogen mit stark verdickter platter Vorderkante, während der andere die im Jahrb. XLVIII, S. 301 sub Nr. 14 d beschriebene Form zeigt. Dies letztere blaugraue, ins Bräunliche spielende Stück ist noch dadurch besonders interessant, daß es 1/2 cm unter dem Rande mit einem scharfkantigen, rautenförmigen Loche von 4-5 mm Durchmesser versehen ist. Dies Loch ist seiner Zeit offenbar von außen her mit einem metallenen Instrumente (Nagel oder dergl.) durch die damals noch weiche Gefäßwand hindurchgestoßen. An Verzierungen kommen nur die Horizontalrillen vor, und zwar auf drei Scherben, darunter auch das zuletzt erwähnte Randstück.
C. Vom Fundort Nr. 3.
I. In den Jahren 1885-91 in resp. auf dem gehakten Acker sowie einzeln auch in oder an der Wand des Abbruchufers zerstreut gefundene Gegenstände:
1. Aeltere wendische Gefäßscherben.
Gefunden wurden 90-100 Scherben von 4-11 mm Dicke, etwa zur Hälfte verziert, zur Hälfte unverziert, unter letzteren vier Rand= und vier Bodenstücke, Material und sonstige Beschaffenheit wie bei den beiden vorigen Fundorten. Die dickste Scherbe ist außen


|
Seite 275 |




|
roth, sonst durch und durch grau, mit grobem Steingrus durchsetzt, aber gut gearbeitet, unverziert. Bei sämmtlichen Bodenstücken geht die Gefäßwand innen allmählich in den Boden über, während sie außen mit scharfer Kante absetzen. Die Böden selbst sind beiderseits platt. Von den Gefäßrändern sind zwei wie Jahrb. XLVIII, S. 301, Nr. 14 d geformt, der dritte ist oben platt, nach innen und außen überstehend, und der vierte scheint, soweit sich dies bei der schlecht gebrannten, schon ziemlich verwitterten und innen abgesprungenen graubraunen Scherbe erkennen läßt, oben abgeplattet und außen mit einer ca. 13 mm hohen und 1 cm vorspringenden Randleiste versehen gewesen zu sein.
Verzierungen wurden, abgesehen von den auch hier häufig (etwa 35 Stücke) vorkommenden Horizontalrillen, wenig beobachtet. Wellenlinien fanden sich nur auf zwei oder drei Scherben. Auf der einen bildet eine einzelne derartige Linie den einzigen Schmuck, während auf einer anderen (außen roth, innen braun) neben zwei sich gitterförmig schneidenden horizontalen Wellenlinien auch noch zwei gewöhnliche Horizontalrillen angebracht sind, in deren eine jene mit ihren Bögen zum Theil hineinreichen. Ein drittes, außen hellbräunliches oder röthliches, innen schwarzbraunes Stück ist mit einem um die Gefäßwand laufenden, 4 mm vorspringenden und 3-4 mm breiten Ringe oder Wulste versehen, über bezw. unter welchem sich noch eine Wellen= oder Zickzacklinie befunden zu haben scheint. Diese übrigens nur kleine, 4-5 mm dicke Scherbe ist ziemlich roh gearbeitet, außen rauh, innen jedoch geglättet. Auch Kerben kommen nur auf zwei Stücken vor. Das eine zeigt unmittelbar unter dem Halse ein horizontales Band schräger, von links oben nach rechts unten gerichteter, langer Kerben und darunter zwei Horizontalrillen, in deren oberste jene noch hineinschneiden. Auf der anderen, ebenfalls vom oberen Theile des Gefäßes stammenden Scherbe befindet sich dicht unter dem etwas nach außen gebogenen Halse nur eine horizontale Kerbenreihe, deren Kerben in der gewöhnlichen Richtung, aber außerordentlich schräge, fast wagerecht liegen. Von den nur mit Horizontalrillen verzierten Stücken seien hier noch zwei besonders erwähnt. Das eine ist etwas stärker gebogen als die meisten übrigen Scherben und außen gerade an dieser Biegung mit einem kleinen Absatze von etwa 2 mm versehen. Das andere dagegen ist eine stark mit Steingrus durchsetzte Scherbe mit unebener Außenfläche, in welche die Rillen augenscheinlich mit einem Strohhalme oder dergl. eingedrückt sind (außen und innen graubraun, Kern grau).
Den Uebergang zu den folgenden jüngeren bildende Scherben wurden sechs gefunden, theils durch und durch grau, theils außen


|
Seite 276 |




|
bräunlich und im Uebrigen grau, drei unverziert und drei mit Horizontalrillen, unter letzteren ein stark gewölbtes, hellgraues Stück.
2. Jüngere mittelalterliche Gefäßreste:
Zwei hell= bezw. bräunlichgraue unverzierte Scherben und ein Halsstück. Letzteres, welches außen sehr schön geglättet ist, hat einen hellgrauen Kern bei sonst dunkelgrauer Färbung. Der Biegung des Halses nach zu urtheilen, hatte dieser einen Durchmesser von 7 1/2 cm. Der nach oben etwas verdickte Rand ist abgerundet. Der Hals ist auf der Außenseite mit drei sehr feinen horizontalen Rillchen versehen und unmittelbar unter demselben befindet sich ein kleiner, abgerundeter, etwas vorspringender Absatz. Die Gefäßwand unter diesem Absatz ist 5 mm, der Absatz 6 mm, der Hals 4 mm und derRand wieder 5 mm dick.
3. Im Uebrigen fanden sich nur noch einige im Feuer gewesene Steine, sowie je ein kleines Stückchen Holzkohle, Schlacke und Lehm oder Thon mit Abdrücken von Stroh= oder Grashalmen.
II. Am 10. October 1891 nach dem ersten Umpflügen dieses bisher nur gehakten Ackers in vier Brandstellen gemachte Funde:
1. Vier größere und eine ganze Anzahl kleinerer, harter, gelber Lehmstücke mit einer Menge von Stroh=Abdrücken darin, einige ganz kleine Holzkohlenstückchen sowie 13 Scherben, darunter zwei Rand= und ein Bodenstück, von mindestens zwei mit Horizontalrillen und Kerben oder Punkten verzierten Gefäßen. Die Scherben sind hart gebrannt, mit Steingrus durchsetzt, röthlich bezw. bräunlich und zum Theil, wie z. B. das Bodenstück, mit grauem Kern. Außer dem auf der Unterseite außen an der Kante mit einem flach erhöhten Ringe versehenen Boden sind noch fünf Scherben unverziert. Vier zeigen nur Horizontalrillen und bei einer fünften kommt zu diesen letzteren noch ein horizontales Band 2 1/2 cm langer, schräger, in die Rillen hineinschneidender Kerben hinzu. Von den beiden Gefäßrändern ist der eine oben wagerecht abgeplattet, aber mit zwei flachen Rillen in dieser Abplattung versehen, während der andere die oben beim Fundort Nr. 1 sub γ beschriebene Form hat. Das letztere Stück trägt unmittelbar unter dem unverzierten, 1 1/2 cm hohen, aufrechten Halse eine Anzahl 2-3 mm breiter und 1-2 mm tiefer Horizontalrillen, in deren oberste vermittelst eines stumpfen Instrumentes eine Reihe von Punkten eingedrückt ist. Das andere Randstück ist unverziert.
2. Zwei kleine Stückchen gebrannten Lehms.
3. Zwei kleine Holzkohlenstückchen.
4. Eine stark gewölbte Scherbe mit nach außen umgebogenem Rande, verziert mit zwei unmittelbar unter diesem befindlichen, mit


|
Seite 277 |




|
einem vier= und einem dreizackigen Instrumente gemachten horizontalen Bändern von vier und drei Wellenlinien, einer dann folgenden horizontalen Reihe schräger Kerben und darauf sich anschließenden Horizontalrillen. Die mit Steingrus durchsetzte Scherbe ist durch und durch roth, gut gearbeitet und hart gebrannt.
Legen wir uns nun die Frage vor, ob wir es an diesen drei Fundstellen mit alten Wohn= oder mit Begräbnißplätzen zu thun haben, so müssen wir meiner Ansicht nach zwischen den beiden ersten und dem dritten Fundorte unterscheiden. Diese letztere Stelle halte ich für einen alten wendischen Begräbnißplatz. Denn als das bisher immer nur mit unserem alten meklenburgischen, nicht tief in den Boben hineindringenden Haken bearbeitete Feld im October 1891 zum ersten Male mit einem ordentlichen Pfluge umgebrochen wurde, konnte man auf demselben deutlich eine ganze Anzahl sich scharf von dem sonst gelben Sande des Ackers abhebender, durch den Pflug an das Tageslicht emporgehobener schwarzer Brandstellen erkennen. Zu finden war in den meisten derselben nur Kohlenerde und graue Asche und nur sehr wenige im Feuer gewesene Feldsteine, jedoch keine Scherben und keine Knochen. Nur in vier Stellen wurden die oben sub II, Nr. 1-4 erwähnten Gegenstände von mir gefunden. Diese Brandstellen nun als die Ueberreste ehemaliger Wohnstätten aufzufassen, dagegen scheinen mir zwei Umstände zu sprechen. Zunächst und vor allen Dingen war die Ausdehnung der einzelnen Brandplätze, als ich das Feld noch während des Umpflügens am 10. October 1891 besichtigte, eine zu geringe, um sie als Wohngruben zu deuten. Denn auch wenn wir sie nur als die Herdstellen untergegangener, aus Flechtwerk mit Lehmbewurf oder dergl. hergestellter Hütten betrachten wollten, so hätte sich doch auch der Boden des übrigen Hüttenraumes in dem durch dies erstmalige Umbrechen nach oben geworfenen reinen gelben Sande neben dem Herdplatze resp. um denselben herum durch eine andere, dunklere Färbung abheben müssen. Davon aber war nichts zu bemerken. Dann aber dürfte hier auch noch das ins Gewicht fallen, daß sich, von den im Vergleich zu den anderen beiden Fundorten auch nur spärlichen Gefäßresten abgesehen, auf dem ganzen Ackerstücke bisher gar keine Reste irgendwelcher alter Gebrauchsgegenstände gefunden haben. Deshalb halte ich dies Feld, wie bereits erwähnt, für einen wendischen Begräbnißplatz und die auf demselben bloß gelegten Brandstellen für sog. Brandgruben=Gräber. Schwierig bleibt es dabei allerdings, das Vorkommen der in der einen Brandgrube gefundenen, harten, mit Stroheindrücken versehenen Lehmstücke zu erklären. Doch dürfte dieser vereinzelte Umstand den angeführten


|
Seite 278 |




|
Gründen gegenüber für die Beurtheilung der gesammten Anlage nicht von Einfluß sein.
Anders liegt die Sache dagegen bei den Fundorten Nr. 1 und 2. Hier hat augenscheinlich einst die alte wendische Ansiedelung gestanden, zu der jenes Begräbnißfeld gehörte. Denn dafür, daß wir es hier mit den Stätten einstiger Wohnungen und nicht mit einem durch den Ackerbau zerstörten Urnenfriedhofe zu thun haben, spricht zunächst die Thatsache, daß sich bisher, von zwei einzelnen kleinen Stückchen abgesehen, gar keine calcinirte Knochenstücke gefunden haben, die doch bei einem Urnenfelde vorhanden zu sein pflegen. Für einen Platz der Leichenbeerdigung aber sind die Gefäßscherben viel zu zahlreich und fehlen auch die Skelette. Ich selbst habe wenigstens bisher dort nie Menschenknochen gesehen und auch über sonstige derartige Funde von dort nur die eine hier folgende Nachricht zu erlangen vermocht. Am 11. September 1886 erzählte mir nämlich der im November 1890 in seinem 76. Lebensjahre verstorbene Büdner und Krugwirth Kobrow zu Oldendorf, als ich ihm "Pottschürr" vom Langen Ort zeigte, dort im Abbruchufer hätten sie auch schon einmal ein Gerippe gefunden. Der Schädel wäre aus der Wand herausgefallen und auch der Oberkörper, von einem großen starken Menschen herrührend, wäre durch Abrutschen der Wand zu Tage gekommen. Nachgegraben hätten sie nicht weiter. Die Beine möchten wohl noch in der Wand drinstecken. Mit der Meinung endlich, daß wir auch hier grade so, wie an der vorigen Stelle, Brandgrubenäcker vor uns haben, dürfte die bereits auf S. 256 angeführte, sich durch das Abbruchufer hinziehende alte Kulturschicht schwer in Einklang zu bringen sein, ebenso wie das an beiden Fundorten beobachtete zahlreiche Vorkommen von Gefäßscherben und anderen Altsachen, während sich in den Brandgruben meist keine oder doch nur spärliche Alterthümer finden.
15. Brandgrube und Gefäßscherben vom Krummendorfer Warnow=Ufer.
Im October 1891 zeigte mir ein in Gehlsdorf bediensteter Knecht nicht weit jenseits der Gehlsdorf=Krummendorfer Grenze ziemlich nahe am Abbruchufer der Warnow im Acker westlich von den ersten dort am Oldendorfer Wege liegenden Krummendorfer Büdnereien eine Stelle, wo er vor einigen Tagen beim Ausgraben von Steinen eine alte Brandstätte gefunden. Er sei beim Graben, so erzählte er, etwa 1/2 m tief unter der Oberfläche auf schwarze, im


|
Seite 279 |




|
gelben Sande des Ackers deutlich sichtbare Kohlenerde und eine kreisrunde Schicht von Feldsteinen gestoßen. Die Steine seien schon stark im Verwittern gewesen, sie fühlten sich so bröckelich an, "as wenn se waßt." - Die Steine lagen noch dort. Es waren gewöhnliche Feldsteine, die im Feuer gewesen und in Folge dessen brüchig und stark in Verwitterung übergegangen waren. In der Grube, die wir untersuchten, zeigte sich deutlich die Kohlenerde. Scherben, Knochenreste oder sonst dergleichen waren jedoch nicht zu finden, wie denn auch der Knecht beim Ausheben der Steine, deren kreisrunde Lage im Verein mit der Kohlenerde ihm sogleich aufgefallen war, nichts derartiges bemerkt hat. Es handelt sich hier augenscheinlich um ein altes Brandgrubengrab von etwa 1/2 m Tiefe und 3/4-1 m Durchmesser.
Ungefähr an derselben Stelle oder doch in deren unmittelbarer Nähe wurde 1886 eine kleine, graue, unverzierte Gefäßscherbe gefunden. Dieselbe ist 3-4 mm dick, hart gebrannt, mit Steingrus durchsetzt und stammt aus dem unteren Ende eines etwas nach außen gebogenen Gefäßhalses. Ihrem ganzen Aussehen nach dürfte sie zu den bei den Funden vom Langen Ort als Uebergang von den alten wendischen zu den jüngeren mittelalterlichen Scherben beschriebenen Gefäßresten zu rechnen sein, falls sie nicht trotz ihrer Steingrusbeimengung gar zu den letzteren gehört. Ob diese Scherbe in irgend welchem Zusammenhang mit der eben erwähnten Brandgrube steht, ist zweifelhaft.
In demselben Jahre fand sich auch etwas weiter nördlich, ebenfalls nicht weit vom Abbruchufer der Warnow entfernt, auf dem dortigen Acker eine kleine, durch und durch rothe, mit grobem Steingrus durchsetzte, hart gebrannte, unverzierte Scherbe, welche sicher noch der prähistorischen Zeit angehört.
Zwei gleichfalls nur kleine Scherben aus grauem, gut geschlemmtem Thon, mit feinem Steingrus vermengt und hart gebrannt, lagen endlich auf dem Acker in der Nähe des Abbruchufers südlich des vom Oldendorfer Kruge zur Warnow führenden Weges. Das eine dicht unter dem nach außen umgebogenen Gefäßrande abgebrochene Stück ist mit Horizontalrillen versehen, das andere unverziert. Beide gehören offenbar derselben Zeit an, wie die 1886 in der Nähe der Brandgrube gefundene graue Scherbe.
16. Alterthümer in den Petersdorfer Tannen, Pferdeschädel als Brücken und Stege.
Im September 1886 erzählte ich einmal, als ich vom Alterthümer=Sammeln am Langen Ort kam, in Oldendorf dem dortigen,


|
Seite 280 |




|
oben S. 278 bereits erwähnten, Büdner und Krugwirth Kobrow, ich sei am Warnow=Ufer entlang gekommen und habe Pottschürr gesammelt. Darauf erklärte er in der Meinung, ich sei vom Breitling her gekommen: "Ja dor in de Petersdörper Dannen (einem Theile der Oldendorfer Tannen) dor sindt sik vel sonn oll Pottschürr. De stammt noch von de Katholschen her. De kemen von Doberan hier räver. Hier stünnen dunnmals Kapellen. De sünd noch in de Petersdörper Dannen in de Ird. De Katholschen kemen von Doberan hierher un güngen von Groten=Kleen hier räver ävern Breetling. Dor söllen dunnmals Pierschädels int Water legen hebben. In de Petersdörper Dannen sindt sik nich blot Pottschürr, ne ok alterhand anner Saken, wurvon man gor nich weet, wat dat egentlich is." Früher sei dort viel gefunden beim Kartoffelhacken, jetzt im Holze könne man ja nicht mehr so graben, aber beim Roden und beim Fuchs=Ausgraben würde noch immer allerlei gefunden.
Ich gebe diese auf einen alten Wohnplatz oder ein zerstörtes Urnenfeld hindeutende Nachricht hier einstweilen ohne weiteren Kommentar, da ich die betreffende Stelle in den Tannen bisher noch nicht aufgefunden habe.
17. Steinkeile, Urne und Rennthiergeweih aus der Rostocker Heide.
Zu den im Jahrb. XLVIII, S. 285 erwähnten beiden Steinkeilen im Besitze des Herrn Sturm sei hier noch bemerkt, daß der eine derselben im Meiershaussteller Revier in Schlag Nr. 6 beim Auswerfen eines Grabens um eine Tannenschonung etwa 3 Fuß tief in bloßer Erde gefunden wurde. Es war ein mit einigen Kreidestellen behaftetes, ziemlich langes und schmales, nicht polirtes, sondern nur behauenes Exemplar.
Ein beim Schnatermann gefundener, schön gearbeiteter Keil wurde 1869/70 der Rostocker Großen Stadtschule geschenkt. Leider war derselbe von einem Knechte gegen einen Stein geworfen und in Folge dessen in mehrere Stücke zersprungen. Auch das Rostocker Alterthumsmuseum besitzt einen 1891 eingelieferten Keil aus der Heide, und zwar aus Willershagen. Derselbe besteht aus bräunlichem Feuerstein und ist 11 1/2 cm lang, 4 cm breit und bis zu 3 cm dick. Seine beiden breiten Seiten sind polirt, doch ist die Politur auf der hinteren Hälfte meist wieder abgesplittert.
Ueber prähistorische Grabstätten im Gebiete der Rostocker Heide habe ich, von den im Jahrb. XXXVIII, S. 147 beschriebenen


|
Seite 281 |




|
Kegelgräbern abgesehen, trotz vielfacher Erkundigungen bisher weiter nichts in Erfahrung bringen können, als daß in einem jetzt mit jungem Nadelholz bestandenen Schlage zwischen der Markgrafenheider Schneise und dem Brandtskreuze früher in einer Sandgrube eine Urne gefunden sei. Dieser Schlag liegt übrigens gar nicht weit von der Stelle jener Kegelgräber entfernt, ebenfalls im südlichen Theile des Hinrichshäger Revieres.
Ein in der Heide ausgegrabenes Rennthiergeweih soll vor Jahren der frühere Förster zu Torfbrücke, Herr Keding, besessen haben.
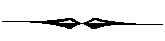


|
Seite 282 |




|



|


|
|
:
|
VI.
Zur Geschichte von Ankershagen.
Von
A. Graf von Bernstorff auf Ankershagen.
~~~~~~~~
A nkershagen, zwischen den Städten Waren, Neustrelitz und Penzlin im Großherzogthum Meklenburg=Schwerin gelegen, hat mit seinen alten Bauten und seiner mehr als sechshundertjährigen Geschichte schon mehrfach die Aufmerksamkeit der Alterthumsforscher auf sich gelenkt und in den "Jahrbüchern für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde" finden sich verschiedene Aufsätze, die sich mit diesem Gegenstande beschäftigen, ihn aber nicht erschöpfen.
Die Geschichte von Ankershagen ist untrennbar von der Geschichte Freidorfs, und wir müssen diese um so mehr in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen, als ein großer Theil der früheren Feldmark Freidorf noch heute zu Ankershagen gehört.
Daß der Ort Ankershagen seinen Namen von einem Ritter Ecgehard von Anker herleite, der es durch Ausroden und Urbarmachen des Waldes (Hag) gegründet habe, wird angenommen. 1 )
Nach Lisch's Ausführung wohnten die v. Anker, einen Anker im Wappen führend, vorher im Lauenburgischen, wo sie dem Ort Anker, unweit Mölln, ihren Namen werden entlehnt haben.
Unter den 33 Ortschaften im Bezirke Chotibanz zwischen der Lips und der Havel, die Fürst Kasimir von Pommern 1170 dem Bisthum Havelberg zur Anlegung des Klosters Broda abtrat (M. U.=B. I, Nr. 95) befinden sich Ankershagen und Freidorf nicht. Im Jahre 1252 aber führten Ankershagen und Freidorf ihre Namen schon. Denn in dem Vergleich des Bischofs von Schwerin mit dem Bischof von Havelberg (M. U.=B. II, Nr. 710) heißt es, daß das


|
Seite 283 |




|
Land Penzlin mit Ankershagen, Freidorf u.s.w. bei Havelberg verbleibe. Im Jahre 1266 wohnte in Ankershagen jener Ritter Ecgehard; denn er wurde als Zeuge der Stiftungsurkunde der Kirche, die er mit zwei Hägerhufen (d. h. aus dem Wald gerodeten Hufen) dotirt hatte, wie damals üblich, nach seinem Wohnsitze: Ecgehardus de Ankershagen angegeben (M. U.=B. II, Nr. 1080).
Neben den Ankers, die mit einem jüngeren Eghard bald nach 1365 ausgestorben sein werden, sollen damals verschiedene andere Adelsgeschlechter schon Grundbesitz in Ankershagen gehabt haben, so die von Ghelder und die Stalbom. 1 ) Urkundlich steht darüber nichts fest. Dagegen besaß sicher die Johannitercomthurei Mirow eine ihr 1273 vom Fürsten Nicolaus von Werle verliehene Hufe in Ankershagen (M. U.=B. II, Nr. 1285).
Freidorf mit 50 Hufen, in denen wahrscheinlich Wendorf und Rethwisch mit enthalten waren, war vom Fürsten Nicolaus 1273 dem Kloster Broda verliehen (M. U.=B. II, Nr. 1284) und 1312 bestätigt worden (M. U.=B. V, Nr. 3563), vom Kloster aber vermuthlich Andern zu Lehn gegeben. Nicht lange nachher finden wir als Pfarrherren zu Ankershagen, Penzlin und demnächst zu Broda die Brüder Walther und Johann von Freidorf, die ihren Namen jedenfalls Freidorfer Besitzungen entlehnt haben, und 1365 verkauft Andreas von Freidorf sein Gut Rethwisch dem Kloster Broda (M. U.=B. XV, Nr. 9351), und in demselben Jahre verkauft Hermann von Plasten dem Kloster Broda seinen Hof in Freidorf mit 4 1/2 Hufen (M. U.=B. XV, Nr. 9340).
Im 15. Jahrhundert kam Ankershagen an die Holsteins, die sich über 300 Jahre in dessen Besitz behaupteten.
Wie in Bd. XXIX der Jahrbücher ausgeführt wird, kommt zuerst im Jahre 1218 ein Hinricus Holsatus im Gefolge des Fürsten Borwin I. bei Bewidmung der Stadt Rostock vor, und derselbe tritt 1222 bei der Stiftung des Klosters Tempzin als Zeuge auf (M. U.=B. I, Nr. 282 und 385). Um 1270 wird ein Lüdeke Holsatus genannt als Zeuge bei Ertheilung von Privilegien an die Stadt Güstrow durch Nicolaus I. von Werle (M. U.=B. III, Nr. 1182), und ein Johann de Holsatia wird bei der Bestätigung der Besitzungen des Klosters Broda im Jahre 1281 als Zeuge aufgeführt (M. U.=B. III, Nr. 1582). Nach v. Pentz war Lüdeke Holsatus schon im Besitz von Ankershagen und nach ihm sein zweiter


|
Seite 284 |




|
Sohn Johann, danach dessen Söhne Heino und Henning. Doch ist diese Behauptung unerwiesen. Urkundlich ist nur, daß Johann im Jahre 1306 mit 20 Hufen in Marin belehnt wurde (M. U.=B. V, Nr. 3121). Mit Unrecht bezeichnet v. Pentz Henning als Inhaber der Burg Penzlin, vielmehr war Heino herzoglicher Vogt und bewohnte als solcher die herzogliche Burg Penzlin von 1328 bis etwa 1342 (M. U.=B. VII, Nr. 5161, 5275; IX, Nr. 5740, 6196). Von Heino's Söhnen Eggerd, Johann und Heino bezeichnet v. Pentz den Heino, Lisch dagegen den Eggerd als in Ankershagen wohnhaft. Von dieses Heino's Söhnen, Heino und Henning, welche nach v. Pentz Beide Antheile in Ankershagen besaßen, während es nur für Henning urkundlich feststeht, soll Heino mit Anna von Mund vermählt gewesen sein, und aus dieser Ehe einen Sohn Henning hinterlassen haben, der ebenfalls Antheile in Ankershagen besessen haben, dann aber unbeerbt verstorben sein soll. Heino's Bruder Henning aus Ankershagen, den v. Pentz schon 1414 in einer - sonst nicht auffindbaren - Verschreibung an das Kloster Broda als Besitzer von Ankershagen nennt, setzte 1436 an Stelle der Almissen der drei Altäre in der Penzliner Kirche aus der sog. alten Mühle zu Ankershagen, im Werthe von 25 Mk., Pächte aus Groß=Lukow, nannte sich 1438 in einer dem Kloster Broda ausgestellten Urkunde über Klein=Lukow Henneke Holste zum Ankershagen und stiftete 1439 mit dem nämlichen Beisatze "zum Ankershagen" bei der Kirche zu Ankershagen eine Vicarei, die er mit 30 Mk. Vinkenaugen dotirte (Urkunden im Auszuge im Archiv zu Schwerin). Er war vermählt mit einer Tochter Vicke Stalbom's, der 1422 dem Kirchherrn zu Ankershagen um seiner und seiner Frau Seligkeit Willen 5 Mk. jährlich aus einem Hof daselbst verlieh und 1434 den Kalandsherren in Penzlin, die das Lehn über den St. Nicolai=Altar hatten, eine Geldhebung und einen Kamp vor der alten Mühle in Ankershagen schenkte (Archiv zu Schwerin). Er kaufte von seinem Schwager Lütke Stalbom 1435 (nicht 1415, wie v. Kamptz behauptet) dessen Besitz in Ankershagen nebst der neuen Mühle, seinen Antheil in Klockow nebst sonstigem Besitz in Lebbin, Woggersin, Hohen=Zieritz, Lütten=Vielen, während er gleichzeitig von den Gebrüdern Henneke und Lütke Hahn zu Basedow für 500 Rheinische Gulden (nicht 5000, wie v. Kamptz berichtet) deren Besitz in Klockow nebst Hölzern und Sundern (d. h. abgesonderten Hölzern), "welche die Herren von dem Brobe daran hebben", erkaufte. Freidorf wird damals auch aus den Händen der Stalboms in die der Holsteins mit übergegangen sein, denn vermuthlich mit Rücksicht auf solchen Besitzwechsel bekennt 1435 Vicke Stalbom: das Gut Freidorf gehöre dem Kloster Broda; der Propst


|
Seite 285 |




|
Johann Osterborgh habe ihm aus Freundschaft vergünstigt, dasselbe so lange zu gebrauchen, als es dem Probst gefalle. (Archiv zu Schwerin.) Hennings Söhne Hans und Claus werden nach v. Pentz zuerst 1455 als Besitzer des Hauses zum Wickenwerder aufgeführt. Auch die Gedenktafel in der Schloßkirche zu Dargun vom Jahre 1464 und eine Urkunde aus demselben Jahr (Archiv zu Schwerin) nennt Claus wohnhaft zu Wickenwerder. Bei der Ableitung des Namens Wickenwerder, der fortan etwa 70 Jahre lang den Herrensitz der Holsteins an der Stelle des heutigen Hofes Ankershagen bezeichnet, dürfen wir nicht auf den Namen Vicke (Friedrich), also weder auf den 1350 genannten Vicco Holste auf Zirzow, noch auf den 1422 und 1435 als Besitzer von Ankershagen genannten Vicke Stalbom recurriren, vielmehr ist anzunehmen, daß der Ort, auf dem das feste Schloß erbaut wurde, schon vorher den Namen Wickenwerder (abgeleitet von wicken = zaubern, spuken, d. i. "Spuk=Insel", oder von wîk = befestigter Ort, also "befestigte Insel") geführt habe. Damals hat das Schloß Wickenwerder jedenfalls auf einer Insel gelegen, oder hat wenigstens durch Aufstauen des Baches bei der alten Mühle rasch in eine Insel verwandelt werden können, wie die den Hof Ankershagen noch jetzt rings umschließenden Wiesen mit dem vermuthlich künstlich nach Norden zu über den Hof, resp. um den Hof herum abgeleiteten Bache erkennen lassen. Die Stelle, an welcher die im dreißigjährigen Kriege zerstörte, sog. alte Mühle gelegen hat, ist noch jetzt erkennbar, nämlich da, wo etwas unterhalb des Hofes, nach der Zahrener Grenze zu, der Bach einen starken Bogen nach Süden beschreibt und das Thal am engsten ist. Im Bette des Baches finden sich noch die eichenen Sohlen der alten Schleuse.
Hans Holste, der landesherrlicher Vogt in Wittenburg von 1452 bis 1470 und von 1459-1473 auch in Boizenburg war, scheint seinen Antheil an Ankershagen nicht auf seine Söhne vererbt zu haben, von denen der eine, Johann, Vicar bei der Domkirche zu Güstrow gewesen sein soll, der andere, Heinrich, von 1485 bis 1494 als herzoglicher Schloßvogt zu Schwaan erscheint. Claus, vermählt mit Ilse von Peccatel, Erbjungfer eines Theiles von Prillwitz, starb 1474, nachdem er 1464 zu der Vicarie der heiligen drei Könige, St. Georgs und der 10000 Ritter in der Kirche zu Ankershagen 20 Mk. jährliche Pacht gegeben hatte (Archiv zu Schwerin). Er hinterließ nach v. Pentz fünf Söhne: Claus, Hans, Jacob, Henning und Joachim, von denen die drei letzten unbeerbt verstarben. Claus und Hans waren jedenfalls schon Besitzer des den Stalboms vom Kloster Broda verliehenen Freidorf, denn 1496 bekennen sie, daß


|
Seite 286 |




|
Freidorf dem Kloster Broda gehöre, dem sie jährlich 2 Wispel Roggen davon geben müßten, und der Probst das Recht habe, sie zu kündigen (Archiv zu Schwerin). Bald wurde aus diesem Verhältniß ein lehnrechtliches, denn 1501 leisteten sie dem Probst zu Broda wegen Freidorf, Rethwisch und der Brandmühle bei Neubrandenburg den Schneid (Archiv zu Schwerin). Claus starb 1506, und es blieb Hans, der mit Anna von Rohr aus dem Hause Neuhaus vermählt war. Mit ihm schloß 1509 der Probst zu Broda nach mehrjährigem Proceß einen Vertrag ab, wonach er die Feldmark Freidorf mit Ausnahme einer Pfarrhufe und des sog. Papenwerders gegen einen Pachtzins von 25 Gulden jährlich haben sollte. Die drei dazu gehörenden Seeen dürfe er jährlich zweimal mit der großen Wade ziehen, einmal zu Kahn und einmal zu Eise, wovon das Kloster die halbe Ausbeute erhalte. Dem Kloster werde Eichen= und Tannen=Bauholz zur Kirche und Bau=, Brenn= und Zaunholz für die Brandmühle, sowie der Eintrieb von Schweinen in die Mast reservirt (Urkunden in dem Archiv zu Neustrelitz, Auszug im Archiv zu Schwerin). Diese Mastgerechtigkeit hat sich auch nach der Säcularisation des Klosters Broda erhalten, und das Broda'er Amtsbuch von 1625 bezeugt, daß die Wulkenziner Bauern für das Recht, 40 Schweine zu Freidorf in die Mast zu treiben, das Mastgeld an das Amt Broda und nicht an die Holsteins zu zahlen hatten. Die 25 Gulden jährlichen Pachtzinsen scheinen später von den Holsteins den Ankershäger Bauern aufgelegt zu sein, denn nach dem Amtsbuch von 1625 haben sie diese Summe an das Haus Broda zu zahlen.
Hans hinterließ nur einen Sohn, den vielgenannten Henning Holste, der der Stammvater aller späteren Holsteins in Meklenburg wurde und großen Grundbesitz in seiner Hand vereinigte. Schon im Besitz von Ankershagen, Möllenhagen, Groß= und Klein=Luckow und dem halben Groß=Vielen, kaufte er mittelst versiegelter Pfandbriefe von den Barenfleths die Güter Zahren, Dambeck, Pieverstorf und die andere Hälfte von Groß=Vielen. Entgegen den Traditionen seiner Vorfahren, die als treue Glieder der Kirche vielfach Stiftungen zu Gunsten der Kirchen in Broda, Penzlin und Ankershagen gemacht hatten, scheint er zu den Ersten gehört zu haben, die sich dem neuen Glauben zuwandten, aber vielleicht weniger aus Begeisterung für die Reformation, als um das lästige Joch der katholischen Kirche abzuschütteln und alle Abgaben an das Kloster Broda einzuziehen. 1518 begehrte der Probst Johann Colberg zu Broda von ihm, daß er etliche Güter (wohl die Freidorfer Besitzungen) von ihm zu Lehn empfange (Archiv zu Schwerin), doch scheint Henning Holste diesem Anverlangen nicht entsprochen zu haben. Henning Holste muß ein


|
Seite 287 |




|
wildes und wüstes Leben geführt haben, davon erzählt nicht nur die Sage, sondern es bezeugen dies verschiedene historische Ueberlieferungen und Proceßakten, wie Untersuchungsakten, welche in den Archiven erhalten sind.
Er war in erster Ehe mit Catharina von Wangelin aus dem Hause Vielist vermählt, aus welcher Ehe ihm vier Söhne: Henneke, Joachim, Jakob und Hans geboren wurden, und in zweiter Ehe mit Anna von der Schulenburg aus dem Hause Löckenitz, die ihm außer zwei Töchtern, Catharina, verehelichten von dem Knesebeck auf Corvin, und Anna, verehelichten von Pentz auf Kritzow, drei Söhne: Matthias, Philipp und Henning den Jüngeren, gebar. Nach v. Pentz würden, entgegen den Acten im Archiv zu Schwerin, nur die beiden Töchter und Philipp Kinder zweiter Ehe gewesen sein.
Der Reformation zugethan, nahm Henning Holste für zwei seiner Söhne, Joachim und Jacob, einen evangelischen Hauslehrer aus Wittenberg an, den später im Dienste Herzog Heinrichs, namentlich bei den Kirchenvisitationen von 1541 und 1553 berühmt gewordenen Simon Leupold, den er 1538 für ein Jahresgehalt von 30 Gulden und einem Kleid engagirte, wie in Bd. V der Jahrbücher erzählt wird.
Dieser scheint seinen religiösen und moralischen Einfluß auf Henning Holste geltend gemacht zu haben, denn derselbe verpflichtete sich ihm gegenüber durch Revers, zwei Jahre lang dem Karten= und Würfelspiel zu entsagen und ihm, im Falle er um Geld spielen sollte, eine Pön von 6 Pfennigen zu zahlen, doch behielt er sich das Recht vor, Abends, wenn sie zu ihrem Wirth zu Tische gingen, zu spielen. Henning Holste muß also allabendlich in Begleitung des Lehrers seiner Söhne einen der Krüge, deren es im Dorfe Ankershagen damals zwei gab, frequentirt haben. Dem Simon Leupold scheint dies Leben nicht gefallen zu haben; so sehr ihm Anfangs der Aufenthalt in dem schönen Ankershagen und die reichliche Naturalverpflegung in Holsteins Hause zugesagt hat, so zeugen seine späteren Briefe von großer Unzufriedenheit. Die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen, den versprochenen Lohn zu erhalten, trieb ihn bald, seine Entlassung zu begehren; nach großen Schwierigkeiten erhielt er sie mit Hülfe seiner Freunde und des Herzogs Heinrich im Jahre 1539, nachdem er selbst noch dem Henning Holste einen Brief an Melanchthon Zwecks Gewinnung eines Ersatzes concipirt hatte. Ein solcher fand sich in der Person des Magisters Indokus Wolthusanus in Wittenberg, doch kam es zu keinem Engagement, und im Herbst 1539 brachte Henning Holste seine Söhne selbst auf die Universität nach Wittenberg.


|
Seite 288 |




|
Liest man Melanchthons Schreiben an Henning Holste im 5. Band der Jahrbücher, welches die größte Hochachtung vor diesem übel beleumundeten Ritter verräth, so gewinnt man die Ueberzeugung, daß die Reformatoren zu manchem Edelmanne, der äußerlich sich zu ihrer Lehre bekannte, ohne innerlich derselben zugethan zu sein, in freundschaftliche Beziehungen haben treten müssen.
Mit dem Kloster Broda gerieth Henning Holste in Streit, da er demselben den Pachtzins von Freidorf verweigerte. Das Kloster beschwerte sich bei Herzog Heinrich, welcher mittelst Rescriptes 1535 Henning Holste anbefahl (Urkunde im Archiv zu Schwerin), dem Propste die vorenthaltene Rente zu entrichten; anscheinend indessen ohne Erfolg. Erst 1547 fand der Streit ein Ende durch einen Vergleich (Urkunde im Archiv zu Neustrelitz), in dem Propst, Prior und Kapitel zu Broda den Holsteins das emphyteutische Recht an der Feldmark Freidorf einräumten unter den Bedingungen von 1509.
Henning Holste kam aber auch mit dem Strafgesetz in Conflict und gerieth in Untersuchung wegen des von ihm geplanten Anschlages wider den Herzog Albrecht VII., den Schönen, den er mit Hülfe eines gewissen Hans Sager gefangen zu nehmen und in Böhmen oder Ungarn interniren zu lassen beabsichtigt haben soll. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Aus dieser Untersuchung ist Henneke Holste zwar freigesprochen, die Sage hat den Fall aber mit einigen daran geknüpften schauerlichen Nachspielen ausgeschmückt und uns seine Person als ein gefürchtetes Abbild eines Raubritters ausgemalt.
Nach Henning Holste's um 1546 erfolgtem Tode setzten sich im Jahre 1551 seine Söhne resp. deren Vormünder wegen der Güter auseinander (Urkunde im Archiv zu Schwerin). Henning der Aeltere, vermählt mit Ilsabe von Stockhausen, war herzoglicher Amtshauptmann zu Fürstenberg und interessirt nicht weiter, da er mit seinen Ansprüchen an Ankershagen abgefunden ist. Joachim, der nach v. Pentz's Angabe Anfangs den Kriegsdienst erwählt und es bis zum Oberst gebracht hatte, stand später als Hof= und Kriegsrath im Dienst des Herzogs Johann Albrecht. Erscheint er uns in verschiedenen Zügen als ein gewissenhafter und der Kirche zugethaner Mann, so hindert dies nicht, daß er, von Eigennutz getrieben, ein doppeltes Spiel spielte, indem er vom Herzog Johann Albrecht und dann von dessen Bruder, Herzog Ulrich, die dem Johanniter=Orden widerrechtlich entzogene Comthurei Nemerow annahm, nachdem der Ordensmeister aber gegen den Herzog beim Reichskammergericht wegen der Usurpation klagbar geworden war, ohne Vorwissen des Herzogs in den Orden eintrat und von dem Ordensmeister Thomas Runge Verzeihung


|
Seite 289 |




|
erbat, welcher nun seinerseits ihm 1553 die Comthurei Nemerow, sowie die Priorei Braunschweig und die Anwartschaft auf die Priorei Goslar verlieh. Herzog Ulrich war damit zufrieden, bestätigte Joachim Holste 1555 als Comthur von Nemerow und 1567 von Neuem als Kriegs= und Hofrath. Der Kirche zu Ankershagen schenkte Joachim Holste ein Kapital von 100 Thalern mit der Bedingung, daß der Pastor die Zinsen davon mit 8 Gulden genießen, aber dafür jeden Mittwoch in der Kirche zu Ankershagen eine Katechismuspredigt halten sollte. In seinem Testament von 1572 (Urkunde im Archiv zu Schwerin) fordert er seine Brüder auf, die von ihnen ohne seinen Konsens eingezogenen Einkünfte der früheren katholischen Pfarrherren und Kaplane der Kirche zu restituiren, und verordnet, daß seine sechs Unterthanen, vier in Ankershagen und zwei in Bök, der Kirche zu Ankershagen, der sie zu seines Vaters und Großvaters Zeit angehört hätten, verbleiben sollten, mit dem Vorbehalt, daß sein Bruder Hans das Recht haben solle, diese Hufen innerhalb Jahr und Tag nach seinem Tode gegen Zahlung von 1000 Thalern wieder an sich zu bringen. Vermählt mit Margaretha Schmecker aus dem Hause Groß=Wüstenfelde, von der er nur eine jung verstorbene Tochter hatte, starb er 1574, ohne Erben zu hinterlassen.
Jacob und Hans hatten bei der Theilung im Jahre 1551 jeder eine der aus Ankershagen gemachten Kaveln erhalten. Dabei war einem von ihnen das alte Haus und ein Theil des neuen Hauses, mit der "gewölbten grünen Dönske" (dem noch heute als Wohnzimmer des Hausherrn dienenden Gemach), Küche, Backhaus u.s.w., dem andern der übrige Theil des neuen Hauses zugefallen, und sie wohnten in Folge dessen auf demselben Hofe in getrennten Herrensitzen, wenn auch theilweise unter einem Dach, nebeneinander. Henning Holste's jüngeren, noch unter Vormundschaft stehenden Söhnen, Matthias, welcher 1570 unbeerbt starb, Henning dem Jüngeren und Philipp, waren bei der Kavelung andere Güter zugefallen, Henning dem Jüngeren Zahren, Pieverstorf, Liepen u.s.w., Philipp, welcher später, 1570, diesen seinen Bruder, Henning den Jüngeren, erschlug und deshalb in die Reichsacht gethan wurde (Acten im Archiv zu Schwerin), die Güter Groß= und Klein=Lukow. Die Theilung aber wurde die Veranlassung zu wiederholten Streitigkeiten und Prozessen. Von 1567 bis in die siebziger Jahre behandeln dicke Acten die Prozesse von Joachim gegen seine Halbbrüder Philipp und Henning, von Henning des Jüngeren Wittwe, geb. von Blücher, zu Zahren gegen ihre Schwäger in Ankershagen, der Gebrüder Hans und Jacob zu Ankershagen gegen einander wegen ungleicher


|
Seite 290 |




|
Theilung, des Philipp Holste zu Klein=Lukow gegen seine Halbbrüder Hans und Jacob zu Ankershagen u.s.w.
Auch mit dem herzoglichen Amt in Broda, welches nach der Säcularisation des Klosters im Jahre 1502 die Lehnsoberhoheit über die Feldmark Freidorf für den Herzog vertrat, geriethen Jacob und Hans in Streit. Sie hatten das Freidorfer Holz, aus dem sie Bau=, Brenn= und Zaunholz für die Brandmühle bei Neubrandenburg abgeben sollten, verhauen und verwüstet, Fischerei und Rohrwerbung auf den Freidorfer Seeen für sich allein ausgenutzt. Gegen dieses Verfahren wurde der fürstliche Amtmann Diederich von Stralendorff zu Stargard und Broda klagbar auf Grund der Vereinbarungen von 1509 und 1547 (Acten im Archiv zu Neustrelitz), und es entspann sich ein Prozeß von vieljähriger Dauer. 1580 war derselbe noch nicht beendet. Ein Wittenberger Rechtsgelehrter rieth dem Herzog, unter Veranschlagung der Holz=, Fischerei= und Rohrabgabe den Holsteins das Gut Freidorf als Lehn oder in Emphyteuse zu geben, damit der Streit ein Ende habe. Es scheint dieser Erfolg indessen erst später erreicht zu sein.
In Jacob und Hans Holste war, vermuthlich durch den Einfluß des Hauslehrers Simon Leupold und durch den Aufenthalt in Wittenberg, ein kirchlicher Sinn geweckt. Sie waren es, die jeder ein Kapital von 100 Thalern stifteten und dem Pastor zu Ankershagen die Zinsen mit je 8 Gulden jährlich überwiesen (Chronik des Pastors Mauritius) mit der Bedingung, daß er Freitags auf dem Hause zu Ankershagen predige, und zwar abwechselnd einen Freitag in Jacob's, den andern in Hans' Hause. Auch bethätigten sie ihren kirchlichen Sinn durch Erbauung gesonderter Stühle in der Kirche im Jahre 1577.
Jacob war vermählt mit Margaretha, der Tochter des weitgereisten, hochgelehrten meklenburgischen Landraths Diederich von Maltzahn auf Grubenhagen und Rothspalk, welcher in Wittenberg und Padua studirt hatte, des eifrigsten Vorfechters der Reformation in Meklenburg. Von den ihm aus dieser Ehe geborenen drei Söhnen Diederich, Jacob und Henning wird uns nur der älteste interessiren. Nach Jacob's Tode, 1585, kavelte Diederich mit seinen Brüdern, vertauschte aber die erhaltene Geldkavel gegen seines Bruders Jacob Antheil am Haus und Gut Ankershagen. Jacob erhielt Grundbesitz in Zahren und Groß=Vielen, und Henning starb schon 7 Jahre nach seinem Vater, nämlich 1592, unvermählt.
Bei seinem Tode, 1619, hinterließ Diederich Alles seinem in der Ehe mit Elisabeth von Zernekow erzeugten Sohne Joachim Friedrich, welcher, geboren 1599, vermählt mit des dänischen Geheimraths und meklenburgischen Landraths von Reventlow auf Ziesendorf


|
Seite 291 |




|
und Reetz Tochter Meta, seinen Antheil an Ankershagen 1638 seinem jüngeren Sohne Henning hinterließ, nachdem der ältere, Diederich, als schwedischer Rittmeister an der Pest verstorben war. Henning fiel nach seines Onkels Adam Holste's Tod und dem unbeerbten Absterben aller anderen Mitglieder der Zahrener Linie 1659 auch Zahren zu. Er war vermählt mit Anna Margaretha von Voß aus Giewitz, die ihm im Jahre seines Todes, 1663, Joachim Friedrich gebar. Ihr proponirte Herzog Christian Louis 1665 vergeblich, ihm Ankershagen zu verkaufen (Urkunden im Archiv zu Schwerin).
Greifen wir wieder 120 Jahre zurück auf Henning Holste's Söhne. Sein vierter Sohn, Hans, war vermählt mit Dorothea von Peccatel aus Klein=Vielen. Von vier, dieser Ehe entsprossenen Söhnen, Claus, Hans, Henneke und Jacob, können wir den dritten, Henneke, mit Stillschweigen übergehen, da er schon früh unvermählt starb. Claus, geboren 1565, herzoglicher Amtshauptmann zu Dargun, war vermählt mit Anna von Cramon aus Borckow. Er und sein Vetter Diederich mit ihren Brüdern brachten den alten Streit wegen der Feldmark Freidorf 1595 zum Abschluß durch einen Vergleich (Urkunde im Archiv zu Schwerin), in welchem sie ihren Anrechten an die Brandmühle gänzlich entsagten, während Herzog Ulrich auf die rückständige Lieferung von Holz verzichtete. Ob bei dieser Gelegeheit oder schon früher die an Broda zu zahlende Abgabe von 25 Gulden für die Feldmark Freidorf den Bauern in Ankershagen auferlegt worden ist, wissen wir nicht. Im Broda'er Amtsbuch von 1625 (im Archiv zu Neustrelitz) wird die Zahlung der 25 Gulden als eine von der gesammten Bauerschaft in Ankershagen zu leistende verzeichnet. Später geschieht ihrer keine Erwähnung wieder. Claus starb 1616, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen, nachdem sein Sohn Reimar jung verstorben war.
Hans, obwohl er Antheil an Ankershagen hatte, würde uns nicht weiter interessiren, wenn er nicht, im Besitze von Möllenhagen und vermählt mit Anna (oder Rosina) Kruse, bei seinem schon 1610 erfolgten Tode einen Sohn Henning hinterlassen hätte, der, vermählt mit Anna Benedicta von Below aus Klinck, der Vater des vielgenannten Caspar Friedrich von Holstein auf Klinck und Möllenhagen wurde, welcher, auf dem Schwerinschen Antheil von Möllenhagen erbgesessen, den Güstrowschen Antheil von der Wittwe des Johann von Holstein, Hedwig, geborenen von Petersdorf, und ihren Söhnen im Jahre 1685 hinzukaufte. Hans Holste's vierter Sohn, Jacob, besaß neben Antheilen in Deven u.s.w. einen Theil von Ankershagen. Unter ihm begann hier mit dem Ausbruch des dreißigjährigen Krieges eine Zeit großer Verschuldung und traurigen Verfalls,


|
Seite 292 |




|
über die es uns an Nachrichten gänzlich fehlt. Nach seinem Tode wurden 1652 die Güter durch land= und hofgerichtlichen Abschied den Gläubigern in solutum zugeschlagen, und zwar eine Kavel seiner Wittwe, Anna, geb. von Krackewitz, die andere den übrigen Gläubigern. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Der Antheil der Wittwe ging an ihren Sohn Hans und nach dessen unbeerbtem Absterben 1668 an ihre Tochter, resp. ihren Schwiegersohn, Otto von Aschersleben auf Chemnitz, über und wurde 1670 Schulden halber an einen Dr. Sturtz verkauft, welcher ihn nebst anderen erworbenen Adjudicaten an seinen Schwiegersohn, den Vicepräsidenten Johann Hauswedel, überließ. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Wir finden in dieser Zeit in Ankershagen, wie auf den Nachbargütern, einen so häufigen Wechsel von sog. Interessenten und Pfandbesitzern in Folge von antichretischen Verpfändungen und Adjudicationen und von Vererbungen und Verkäufen dieser Stücke, daß man Mühe hat, die Besitzverhältnisse zu verfolgen, und in rascher Aufeinanderfolge finden wir als Pfandgesessene in Ankershagen die Namen: Johann Hauswedel, Caspar Putzar, Julius Mörder, Jacob Sturtz, Melchior von Kossebade, Johann Heinrich von Erlenkamp, Clemens von Wangelin, Philipp Brandt, Daniel Block, und an diese Namen knüpfen sich eine Menge von Prozessen wegen Verfall oder Deterioration der Adjudicate, wegen Impensen auf dieselben u.s.w., bis allmählich die alten Lehnmannsfamilien durch Reluitionen wenigstens theilweise wieder in den Besitz ihrer angestammten Güter gelangen. Den Antheil des Vicepräsidenten Hauswedel an einem Drittheil von Ankershagen und Freidorf, welcher zwei Drittel des Hofackers, 9 Drömt Mühlenpacht, 4 Bauern= und 6 Kossatengehöfte umfaßte, erwarb dann der Baron Johann Heinrich von Erlenkamp auf Vielist für 4000 Gulden (Acten im Archiv zu Schwerin), nachdem er einen Theil von Jahren und außerdem eine Menge anderer Güter in seine Hand gebracht hatte. Mit der nöthigen Dreistigkeit und Unverdrossenheit petitionirte er bei Herzog Christian Louis so lange, er möge ihm die zur Conservation und Melioration seiner verschuldeten und fast verödeten Güter nothwendige Allodialität gewähren, bis dieser einwilligte und 1686 neben den Gütern Vielist, Grabow, Schönau, Zahren, resp. Antheilen an denselben, auch Erlenkamp's Antheil an Ankershagen und Freidorf für allodial erklärte und Herzog Friedrich Wilhelm 1696 diese Allodialität bestätigte. (Urkunden im Archiv zu Schwerin.)
Der größere Theil von Ankershagen und Freidorf war in den Händen von Joachim Friedrich von Holstein; es gehörten zu demselben 3 Bauern= und 10 Kossatengehöfte, während 4 Bauern= und 3 Kossatenstellen Caspar Friedrich von Holstein zu Klinck gehörten,


|
Seite 293 |




|
eine Bauern= und eine Kossatenstelle, die Caspar Putzar adjudicirt gewesen waren, in den Pfandbesitz des Daniel Block übergegangen waren. Caspar Friedrich von Holsteins Antheil erhielt Joachim Friedrich von Holstein, als er Caspar Friedrich's Tochter erster Ehe, Anna Margaretha, heirathete, anstatt Brautschatzes. Auch überließ Caspar Friedrich, da er bestrebt war, die bestehenden Gütercommunionen möglichst aufzulösen, seinem Neffen und Schwiegersohne, Joachim Friedrich, Theile von Groß=Vielen und von Möllenhagen, Schwerinschen Antheils, gegen Hergabe anderer Gutspertinenzien in Dambeck, Speck, Bök u.s.w. Joachim Friedrich kaufte 1708 die in Daniel Block's Pfandbesitz befindlichen Pertinenzien (Urkunden im Archiv zu Schwerin) und nach Caspar Friedrich's 1712 erfolgtem Tode von dessen Söhnen Hans Friedrich und Jacob Ernst 1714 den von ihnen erworbenen Erlenkamp'schen Antheil an Ankershagen zu, so daß er nun Ankershagen nebst Freidorf ganz besaß. Groß=Vielen reluirte Joachim Friedrich, nachdem er gegen Adrian Hahn daselbst mit Erfolg prozessirt hatte, verpfändete es aber bald wieder. 1717 legte er eine Glashütte an (Urkunde im Archiv zu Schwerin), deren Spuren sich in zahllosen Glasscherben und Schlacken in der Nähe des Forstgehöftes Ulrichshof noch heute finden.
Er starb 1735 und hinterließ mehrere Söhne, die jedoch alle ins Ausland gingen und meist in dänische Dienste traten. Der älteste, Henning Friedrich, geboren 1694, war dänischer Obristlieutenant und vermählte sich mit Ursula Anna von Flotow aus Groß=Nieköhr. 1743 verkaufte er Ankershagen mit der ganzen Feldmark Freidorf, also ein Areal von 1 126 000 []Ruthen, wovon ein Drittel als Allod, zwei Drittel als Lehn, an den württembergischen Hauptmann Henning Leopold von Oertzen auf Blumenow für 51 000 Rthlr. N. 2/3. (Urkunde im Archiv zu Schwerin.) Dieser, geboren 1703, war dreimal verheirathet: in erster Ehe mit Sophie Charlotte von Mützschefahl, in zweiter mit Elisabeth Eleonore von Jasmund, in dritter mit Ilse Margarethe von Rochow. Er verpachtete Ankershagen und wohnte in Blumenow. In den Kriegsjahren hatte er viel von Werbungen zu leiden. Nachdem seine Leute ein lästiges preußisches Werbe=Commando angegriffen hatten, wurde er zu 2000 Thalern Strafe verurtheilt und deren Zahlung durch Einlegung von 100 Mann Executionstruppen erzwungen. Er starb 1759 mit Hinterlassung von fünf Söhnen, und ihm folgte nach erlangter Majorennität und Kavelung (Acten im Archiv zu Schwerin) 1763 sein Sohn erster Ehe, Hans Sigismund Christoph von Oertzen, geboren 1732, Klosterhauptmann zu Malchow, vermählt mit Christiane Sophie Friederike von Kosboth. Aus dieser Ehe hatte er drei


|
Seite 294 |




|
Söhne, bei denen Johann Heinrich Voß aus Sommerstorf, der bekannte Dichter, Hauslehrer war. 1794 starb Johann Sigismund, und auf seinen Wunsch theilten seine drei Söhne die Güter in zwei Theile, von denen der eine aus Ankershagen mit der Meierei Bornhof, der neuen Mühle, der Meierei Freidorf bestand, der andere aus dem zum Hauptgut erhobenen Hof Wendorf nebst Theilen von Ankershagen und Freidorf gebildet wurde, wobei regierungsseitig von beiden Gütern zwei Drittel als Lehn, ein Drittel als Allod anerkannt wurde. (Urkunden im Archiv zu Schwerin.) Ankershagen c. p. erhielt der älteste Sohn, Adolf Friedrich Theodor, geboren 1761, Wendorf c. p. der zweite, Heinrich, welcher Lieutenant war, der dritte bekam eine Geldkavel.
Unter Adolf Friedrich von Oertzen kam es zu Verhandlungen mit der Pfarre und Kirche wegen Vererbpachtung des Pfarr= und Kirchenackers. Dabei erwies Adolf Friedrich sich als ein sehr wohlwollender, aber wenig einsichtiger Mann. Auf alle Propositionen bereitwilligst eingehend, schloß er den für die Pfarre sehr vortheilhaften Erbpachtcontract ab, der 1802 oberbischöflich bestätigt wurde.
Die Bauern und Kossaten in Ankershagen, deren Anzahl von 33, theils durch Aussterben oder Verarmen der Inhaber, theils durch Legung, im Jahre 1765 schon auf 6, im Jahre 1794 auf drei herabgesunken war, verlegte er im Jahre 1801 nach dem Vorwerke Bornhof, wo sie noch heute wohnen. (Acten im Archiv zu Schwerin.)
Er war verheirathet mit Adolfine Sophie Ernestine von Gamm und hinterließ bei seinem Tode, 1803, einen Sohn, Hans Otto Georg Adolf Philipp, geboren 1799, dessen Vormünder, der Landrath von Oertzen auf Hoppenrade und der Kammerherr von Oertzen auf Groß=Vielen, Mühe hatten, den Besitz ihres Kuranden zu conserviren. Sie petitionirten 1822 bei der Regierung erfolglos um Revision des Pfarracker=Permutationscontractes von 1765 und des Erbpachtcontractes von 1802, indem sie hervorhoben, daß sie ohne Abänderung dieser die Interessen des Gutes übermäßig verletzenden Verträge nicht im Stande sein würden, den Besitz ihres Kuranden zu erhalten. (Acten im Archiv zu Schwerin.) 1817 regulirten sie die drei Bornhöfer Bauern auf ihren verkleinerten Gehöften. (Acten im Archiv zu Schwerin.)
Nach erlangter Volljährigkeit verblieb Hans Otto Georg Adolf Philipp von Oertzen im herzoglichen Hofdienst in Neustrelitz und verpachtete Ankershagen.
Er war vermählt mit Mathilde Julie Friederike von Arnstädt. 1831 verkaufte er Ankershagen an den Glashüttenmeister Ulrich Friedrich Heinrich Strecker zu Klockow.


|
Seite 295 |




|
Zum großen Nachtheil des Gutes theilte dieser das schon einmal durch die Abtrennung des Gutes Wendorf verkleinerte Ankershagen zum zweiten Male, und zwar der Länge nach, ließ die Meierei Friedrichsfelde mit der Bauernpertinenz Bornhof zum Hauptgut erheben und verkaufte Ankershagen 1854 an Ludwig Voß, dieser 1875 wieder an Ernst Winckelmann. Im Jahre 1889 ging das Gut nach geschehener Allodification des lehnbaren Antheils und unter Permutation verschiedener Flächen des Gutes gegen Theile des Gutes Dambeck, durch welche unter Anderem der Dambecker See wieder an Dambeck, der sog. Reiherort an Ankershagen kam, käuflich in den Besitz des Grafen Andreas von Bernstorff über.
So haben sich in Ankershagen in den mehr als 600 Jahren, seit Ritter Eggerd von Anker ihm seinen Namen gab, vielfache Wandlungen und wiederholte Besitzwechsel vollzogen, doch hat Ankershagen wohl mehr, als ein anderes Gut in Meklenburg, seinen alten Charakter als Ritterfeste bewahrt, und durch die Solidität seiner alten Bauwerke sind uns interessante Reste seiner ältesten Baudenkmäler erhalten worden. In Band XXVI der Jahrbücher hat Lisch eine Beschreibung des Hauses und der Befestigungen zu Ankershagen geliefert, auf die wir im Uebrigen verweisen können, der indessen manches hinzuzufügen und in der manches Unrichtige zu berichtigen sein wird.
Wann und von wem das jetzt als Herrenhaus bewohnte, früher sog. "Neue Haus" erbaut ist, darüber fehlt es an Ueberlieferungen. Lisch's und ebenso v. Kamptz's Annahme, daß es zwischen 1550 und 1570 erbaut sei, erweist sich als irrig, indem es in dem Theilungs=Vergleich von 1551 schon erwähnt wird. Der Flügel, in welchem sich die 1551 genannte "gewölbte grüne Dönske" befindet, ist aber offensichtlich nicht mit dem Haupttheil des Hauses gleichzeitig, vielmehr erst später an dasselbe angebaut, wie dieses eine in der Zwischenwand befindliche Schießscharte beweist, welche durch den Anbau des Flügels unbenutzbar werden mußte. Wir dürfen daher die Erbauung des neuen Hauses in seinem Haupttheil noch weiter zurückverlegen. Ob die 1551 erwähnte gewölbte Dönske als Schloßkapelle gedient hat, wissen wir nicht. Dafür spricht ihre von Osten nach Westen gestreckte längliche Konstruktion mit einer großen Wandnische in der östlichen, einer kleineren in der westlichen Wand, welche sehr wohl Altar und Kanzel aufgenommen haben können, und einem tiefen, rechts neben der östlichen Nische befindlichen Wandschrank. Von dem 1551 erwähnten, sog. alten Hause sind erkennbare Reste nicht mehr vorhanden. Für Lisch's Annahme, daß dasselbe sehr groß gewesen sei, finden wir keinen Anhalt, vielmehr läßt der Receß von 1551,


|
Seite 296 |




|
welcher das ganze alte Haus mit einem Theil des neuen Hauses zusammen in eine Kavel legt, eher darauf schließen, daß das alte Haus nur klein gewesen sei. Die südostwärts an das neue Haus sich anschließende Mauer erklärt Lisch mit Unrecht für das Erdgeschoß eines mächtigen, viereckigen Thurmes. Ihrer geringen Fundamentirung und ihrer gleichen Konstruction nach ist sie als Vertheidigungsmauer anzusehen, wie die anderen zum Theil noch wohlerhaltenen Festungsmauern, welche den hohen Erdwall im Garten nach Norden und Osten einfassen. Wie diese ist auch jene auf schwachen Felsenfundamenten bis zur Höhe von 3 Metern wesentlich aus Backsteinen erbaut, dann oben mit einer fast einen Meter starken Lage von Felsenmauerwerk gekrönt, offensichtlich, um derselben mit diesem Abschluß nach oben einen Halt gegen feindliche Geschosse zu geben. Von einem Thurm auf dem Hause zu Ankershagen ist auch in den Untersuchungsacten gegen Henning Holstein die Rede, und da sich etwas weiter nordöstlich, da, wo die an das neue Haus sich anschließende Mauer unterhalb des jetzigen Waschhauses durchläuft, aus der durch die Mauer bezeichneten Linie weit vorspringend bedeutende Felsenfundamente finden, die einem schweren Bau als Unterlage gedient haben, so möchte wohl dort die Stelle zu suchen sein, an der jener alte Thurm gestanden.
Als das älteste, wohl noch aus dem 15. Jahrhundert stammende Denkmal kriegerischer Baukunst auf dem befestigten Hofe Wickenwerder haben wir das von Lisch nicht beschriebene große Rondel, welches aus der den Wall nach Osten deckenden Mauer weit in den Sumpf vorspringt, zu betrachten. Es ist aus riesigen, im Innern mit Felsen unterermischten Ziegeln erbaut, welche eine Länge von stark 29 cm, eine Breite von 14 1/2 und eine Stärke von 12 cm haben. Später sind die in dem Mauerwerk angelegten Schießscharten mit Ziegeln umgebaut, welche denen gleich sind, aus welchen die an das neue Haus sich anschließende und die nordwärts den Wall deckende Mauer hergesteIlt ist, und welche nur 26 1/2 cm lang, 12 cm breit, 9 cm stark sind. Im Innern des Rondels sehen wir zwischen den noch vorhandenen 9 Schießscharten 8 vermauerte Schießscharten, deren Seitenwandungen rechtwinklig durch das Mauerwerk gehen, während die späteren schräge, zu schmalen Schlitzen eng zusammenlaufende Leibungen haben. Den hohen Wall mit seiner Umfassungsmauer und diesem Rondel haben wir als die äußere Vertheidigungslinie auf der östlichen, der dort geringen Breite der Wiesenniederung wegen, angreifbareren Seite der Festung zu denken, von der die Vertheidiger sich dann hinter die innere, das Schloß enger umgebende Mauer zurückziehen konnten. Auf dem Hofe in der nächsten Umgebung des


|




|
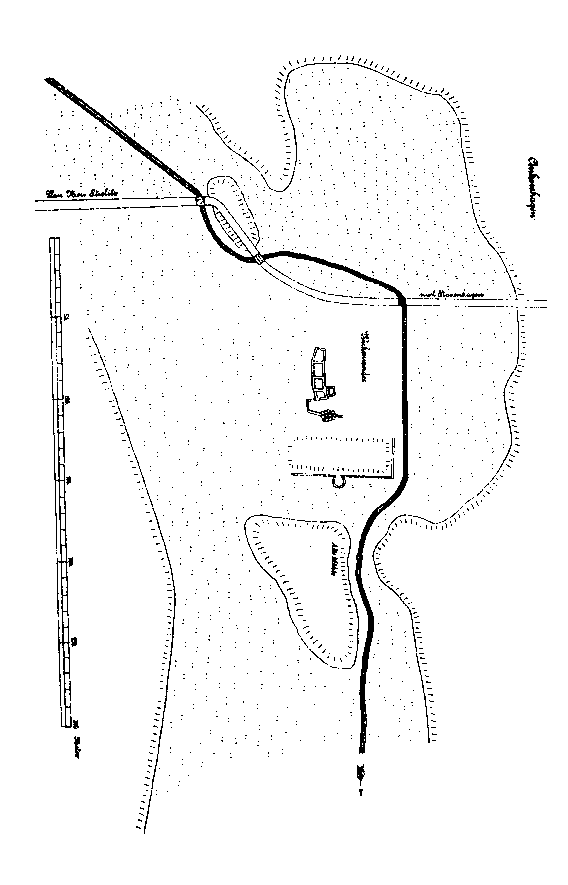


|




|
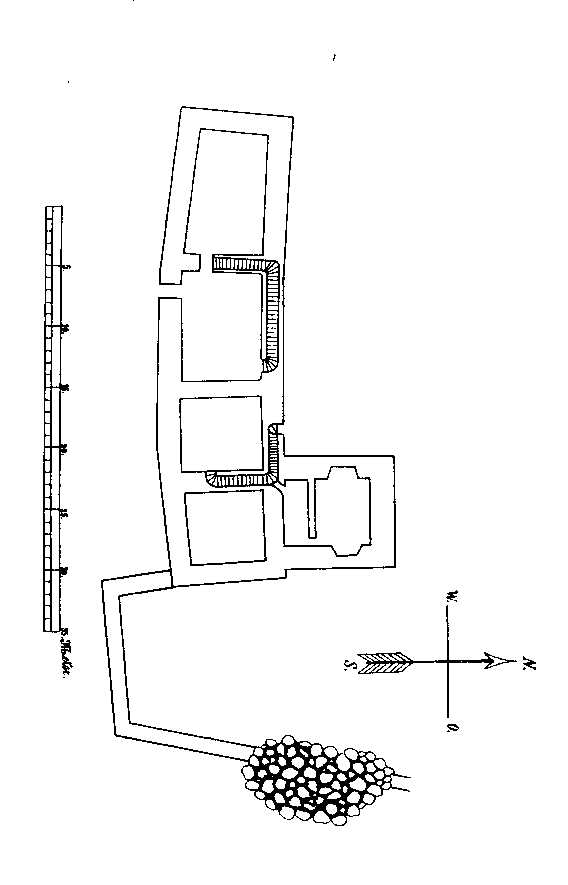


|
Seite 297 |




|
Hauses stoßen wir vielfach auf altes, fest in Kalk liegendes Ziegelmauerwerk, und weitere Nachgrabungen würden voraussichtlich Aufschlüsse über die Gestalt der alten Burg zum Wickenwerder, sowie über den erst in diesem Jahrhundert zugeschütteten unterirdischen Gang geben, welcher einen in Kriegszeiten zu sperrenden Eingang zum Neuen Hause vermittelt haben wird. Ungenau ist in Bd. XXVI der Jahrbücher die Beschreibung des in der südlichen Wand des neuen Hauses über dem noch heute vorhandenen Eingang von der Gartenseite her eingemauerten Reliefbildes, welches, den Schweriner, Wismarer und Gadebuscher Reliefs an Arbeit und Stil sehr ähnlich, mit einem einfachen, aus zwei Hohlkehlen und zwei Rundstäben bestehenden Rand eingefaßt und möglicherweise ebenfalls aus der Werkstatt des Statius von Düren in Lübeck hervorgegangen ist.

Gar keine Erwähnung findet bei Lisch der vermuthlich für ein altes Kegelgrab gehaltene Erdaufwurf jenseits der Niederung neben dem Dorfe Ankershagen. Derselbe ist als eine nordwärts vorgeschobene Warte zu betrachten, welche von Wasser umgeben war. Der von der Kirche herabkommende Wasserlauf wird den Wallgraben gefüllt haben, dessen Abfluß durch eine erst in diesem Jahrhundert abgebrochene Schleuse regulirt worden ist. Die Stelle, an welcher diese Schleuse gelegen hat, ist noch heute, etwa 27 Meter südlich des Erdkegels, erkennbar.
Nordwestlich vom Hofe, durch die Wiesenniederung von ihm getrennt, liegt das Dorf Ankershagen, und am Ende desselben, auf einer Anhöhe, dasselbe beherrschend die uralte Kirche, welche, verschiedenen Zeitaltern entstammend, des Interessanten viel bietet. Wahrscheinlich im Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut und zu wieder=


|
Seite 298 |




|
holten Malen umgebaut, trägt sie das Gepräge verschiedener Zeitalter und repräsentirt verschiedene Baustile, deren Reste bei sorgfältiger Betrachtung auf die Geschichte ihrer Entstehung Schlüsse zu machen gestatten. Bereits im achten Bande der Jahrbücher finden wir eine Beschreibung der Kirche vom Jahre 1843, die jedoch, ein Ergebniß nur oberflächlicher Betrachtung des Bauwerks, vielfach ungenau ist und über das Alter und die Entstehungsgeschichte der einzelnen Theile Angaben enthält, die sich als irrige nachweisen lassen.
Die Kirche besteht aus einem schmäleren, im Innern 7,13 Meter langen, 5,90 Meter breiten (mithin nicht quadratischen) Altar=Chor und einem breiteren, im Inneren 19 Meter langen, 9,70 Meter breiten Langhaus, in dessen Mitte vier Pfeiler stehen, von denen der östlichste sich mit dem Scheitel des Triumphbogens vereinigt. Diese vier Pfeiler tragen nach jeder Seite hin vier Kreuzgewölbe, so daß das Langhaus in zwei gleiche Schiffe mit je vier Gewölben getheilt ist. Diese Gewölbe entstammen offensichtlich einer späteren Bauperiode, als die Außenwände der Kirche. Das ursprüngliche Langhaus ist höher gewesen und hat vermuthlich ein oder zwei größere Kuppelgewölbe getragen, von denen eins in diesem Falle vier der jetzigen Kreuzgewölbe umfaßt haben würde. Die später eingebauten vier Pfeiler, von denen der östlichste, an den Triumphbogen angelehnte, die Spuren romanischer Bildungsweise trägt, während die drei andern schwere vierseitige Prismen darstellen, gestatten den Schluß, daß sie als Entlastung für die Seitenmauer des Langhauses, welche die angenommenen Gewölbe wahrscheinlich nicht tragen konnte, in den Bau aufgenommen wurden. Auf die Konstruction mit zwei Gewölben deutet besonders ein in der Mitte der Südwand vorspringender Mauerpilaster in Höhe von 2,20 Meter mit aufliegendem, alterthümlichem, romanischem Kämpfergesims. An den Langseiten des Langhauses sind die Rippen resp. Quergurtbögen der Gewölbe theilweise vor die früheren Fenster gekommen, und so sind, da man bei Erbauung der Gewölbe die vorhandenen Pfeiler wiederbenutzen, nach ihnen die Gewölbejoche vertheilen wollte, die alten Fenster, sowie das von außen eben noch sichtbare nördliche Eingangsportal ganz, das noch in Gebrauch befindliche südliche Eingangsportal und das westliche Eingangsportal zur Hälfte vermauert. Von den ursprünglichen alten Fenstern sind zwei schmale, nämlich eins grade über dem südlichen und ein gleiches grade über dem nördlichen Eingangsportal, sowie eins an der Südseite des Altarchors 5 1/2 Meter hoch und 1 1/2 Meter breit, mit breiter, eckig abgesetzter Leibung, an der Lichtöffnung nur 2 1/2 Meter hoch, 0,60 Meter breit, äußerst kunstvoll gearbeitet, mit den dreiblättrigen Kleeblattbögen der Uebergangszeit und über diesen


|
Seite 299 |




|
mit Spitzbögen überwölbt gewesen. An den Außenseiten der Wände sieht man noch die Seitentheile dieser ursprünglichen Fenster, die später mit Korbbögen überwölbt sind. An der Innenseite ist an dem Fenster über dem Südportal, wenn man zwischen Gewölbe und
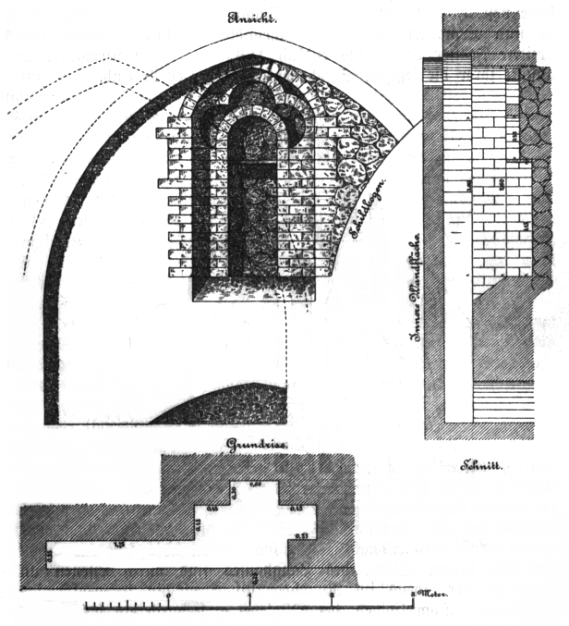
Wand hinabsteigt, der Kleeblattbogen deutlich zu sehen. Oberhalb dieses, sowie des ihm gegenüber in der nördlichen Längswand sichtbaren alten Fensters sieht man an den inneren Kirchenwänden zwei sehr große Spitzbögen von 7 Meter Scheitelhöhe und 6 Meter Spannweite, deren Bestimmung nicht mit Sicherheit angegeben werden kann, die aber möglicherweise den schon genannten, das ganze Lang=


|
Seite 300 |




|
haus überspannenden großen Gewölben als Schildbögen gedient haben, oder dem Projecte solcher zu dienen bestimmt gewesen sind.
Weiter nach dem Altarchor zu bemerkt man in der südlichen und der nördlichen Längswand des Langhauses breitere Bögen, die als Blendbögen gekuppelter Fenster gedient haben, mit einer Scheitelhhöhe von 5,50 Meter und einer Spannweite von 4 Metern. Auch sie sind vermauert und durch flachrundbogige, theils schmale, theils breitere Fenster ersetzt, bis endlich 1864 auch diese vermauert und anstatt ihrer die jetzigen Spitzbogenfenster hergestellt sind.
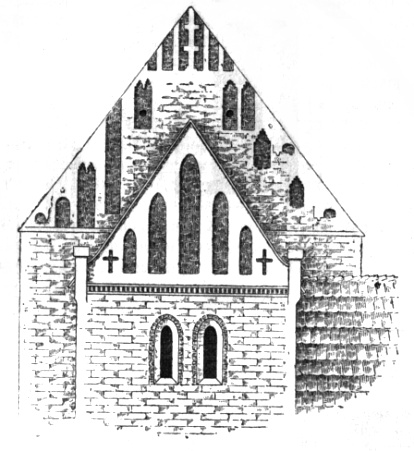
Die beiden Giebel des Langhauses sind durch Lisenen und blinde Fenster, theils im Rundbogenstil, theils in treppenförmigen Spitzen und Doppelspitzen, der Ostgiebel auch durch ein hohes Kreuz mit zwei kurzen Querbalken, zwar unsymmetrisch, doch schön, geziert. Die Rundbögen bestehen aus je drei geformten Bogensteinen und schließen unten mit kleinen, umgekehrten Pyramiden ab, deren Ecken abgebrochen sind (so daß sie halbe Octogone bilden) und deren Spitze abgestumpft ist. Der Ostgiebel zeigt deutlich, daß die Giebel ursprünglich höher waren. Bei der Herunternahme des oberen Theils derselben ist bald mehr, bald weniger von den Giebelverzierungen ab=


|
Seite 301 |




|
geschnitten, je nachdem die Lage der Sparren des neuen, 1698 errichteten Dachstuhles es mit sich brachte.
Auffallend ist, daß die acht Kreuzgewölbe des Langhauses unter sich nicht gleichförmig sind. Die Rippen der vier westlichen Gewölbe sind bis auf kleine Theile derselben aus einfacheren, mit der Hand roh geformten, halbrund vorspringenden Backsteinen hergestellt, ähnlich denen des Altarchors, während die der vier östlichen Gewölbe und einige kleine Theile von den Rippen der vier westlichen Gewölbe aus birnenförmig, zierlicher geformten Backsteinen aufgeführt sind. Möglicherweise sind bei einem Brande des Dachstuhles die westlichen Gewölbe eingeschlagen und dann unter Mitbenutzung noch vorhandener birnenförmiger Rippensteine aus durch Behauen nachgebildeten Steinen wiederhergestellt. Die Kreuzgewölbe des Langhauses stützen sich an den Außenwänden der Kirche auf Schildbögen, die nach den Unebenheiten der Wände bald mehr, bald weniger sichtbar sind, und bald unten, bald oben aus der Wand vorspringen, je nachdem die ausgewichenen Außenwände nach innen überhängen, wie die Südwand, oder nach außen, wie die Nordwand. Wo die Schildbögen gar nicht sichtbar sind, sind sie bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 durch Farbe markirt.
Der Altarchor, der mit dem Langhaus gleichzeitig erbaut, mit dessen Errichtung sogar der Anfang gemacht sein wird, trägt auch ein Gewölbe, welches indessen in oblonger Kuppelform mit vier Diagonalrippen (eine in der Uebergangszeit eingeführte deutsch=romanische Kombination des Kreuz= und Kuppelgewölbes) rings herum aufgemauert ist. Die Diagonalrippen sind aus einfachen, halbrund vorstehenden Ziegeln hergestellt. Sie sind auf 2 Meter hohe, in halber Mauersteinstärke aus den Ecken hervorspringende Eckpilaster gestellt, welche unten auf Platte und Würfel ruhen, oben durch Würfelkapitelle geziert sind. Die Würfelkapitelle verlaufen nach unten, die Basen nach oben dreieckig zur Ecke des Pilasters. In der östlichen Giebelwand sind dicht nebeneinander zwei schmale, selbstständig nebeneinander stehende, in gedrückten Spitzbögen auslaufende Fenster mit schräger, breiter Leibung, die eigentlich nur als Fensterschlitze bezeichnet werden können, wie sie an sehr vielen meklenburgischen Landkirchen aus dem 13. Jahrhundert sich finden.
Die alten Glasfenster, welche 1864 durch farbige Glasfenster ersetzt sind, trugen, wie Pastor Mauritius berichtet, die Jahreszahl 1538 und in merkwürdiger Zusammenstellung die Namen: Jacob Holste, Ilsa Catharina Wangelins, Anna Holste. Denn Jacob Holste war Henning Holste's dritter Sohn, Ilsa, geb. von Stockhausen, die Gemahlin von Henning Holste's ältestem Sohne, dem sog. Henning


|
Seite 302 |




|
dem Aelteren, Amtshauptmann zu Fürstenberg, Catharina geb. Wangelin war Henning Holste's damals schon verstorbene erste Gemahlin, Mutter der genannten Söhne, Anna war die jüngste Tochter zweiter
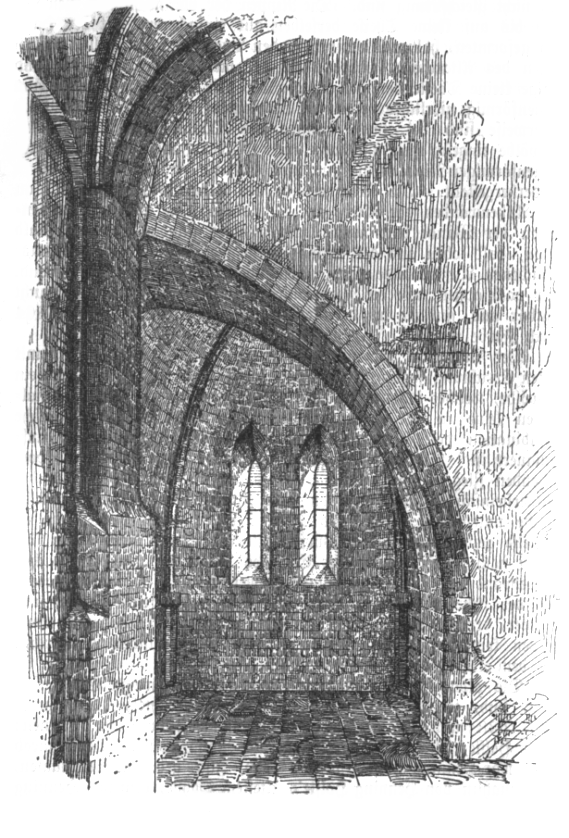


|
Seite 303 |




|
Ehe Hening Holste's, später verehelichte von Pentz, damals noch ein Kind.
Daß auch der Altarchor früher ein höheres, steileres Dach gehabt, ist an dem Ostgiebel des Langhauses deutlich erkennbar, doch erscheint es zweifellos, daß dieser Theil von vorneherein mit einem Gewölbe versehen sei, denn durch einen in der Nordostecke des Altarchors befindlichen Riß in der Mauer gewahrt man deutlich, daß die Außenwände von unten auf als Schildbögen aufgemauert sind, mithin von vorneherein zum Tragen eines Gewölbes bestimmt waren.
Daß aber nicht, wie im 8. Bande der Jahrbücher angenommen ist, der Altarchor an das Langhaus der Kirche erst später angebaut sein könne, beweisen unzweideutig das Fundament des Triumphbogens, welches nicht von einer Wand zur anderen unter dem Bogen durch fortläuft, ferner der im Ostgiebel des Langhauses, oberhalb des Triumphbogens, aus runden Felsen gleichzeitig mit dem Giebel aufgemauerte Bogen, welcher neben der Entlastung des Triumphbogens jedenfalls den Hauptzweck verfolgt hat, vom Dachstuhl des Langhauses in den Dachstuhl des Altarchors zu gelangen, endlich die Verzierungen am Ostgiebel des Langhauses, welche nur den Theil dieses Giebels zieren, der oberhalb der Anschlußlinie des früheren, höheren Altarchordaches liegt. In alter Zeit ist der Altarchor (damals das Langhaus genannt) mit einem Strohdach bedeckt gewesen, und sein östlicher Giebel hat oben aus Fachwerk bestanden. 1699 ist das Dach mit den vom Langhause abgenommenen Dachziegeln umgedeckt.
Leider ist bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 durch spitzbogenförmige Wandmalerei der wesentlich dem romanischen Formkreise in der Zeit des Ueberganges angehörende Charakter des Altarchors verändert und demselben gewaltsam das Gepräge der Gothik aufgedrückt.
Wesentlich jüngeren Datums als Altarchor und Langhaus ist die Erbauung des westlich ganz verbandslos an den Westgiebel des Langhauses angelehnten Thurmes, durch welchen das herrliche, in drei Ecken und drei Rundstäben mit Wulsten reich profilirte Hauptportal des westlichen Kircheneinganges verdeckt ist. Dieses, sowie das bei Errichtung der Kreuzgewölbe halbverbaute, in zwei Ecken und zwei Rundstäben mit Wulsten profilirte südliche Eingangsportal sind in strenger Gothik spitzbogig erbaut, wie dies in der Periode des Uebergange im Gegensatz zu rundbogigen Fenstern nicht selten vorkommt.
Die bei der Restauration der Kirche im Jahre 1864 erbauten Fenster sind spitzbogige, wie denn auch der Ostgiebel des Altarchors in moderner Zopfgothik wiederhergestellt, der neue Altar und die neue Kanzel in demselben Stil gehalten sind. In dem zu Dreivier=


|
Seite 304 |




|
theilen vermauerten Portale der westlichen Giebelwand des Langhauses befindet sich eine kleine, dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts entstammende Thür, auf deren innerer, der Kirche zugewandter Seite ein aus flachem Eisen nachgebildeter Anker mit der Ueberschrift: Ebr. 6, V. 11. Wir begehren aber, daß euer jeglicher denselbigen Fleiß beweise, die Hoffnung veste zu halten bis an's Ende ... welche wir haben als einen vesten und sicheren Anker unserer Seele ..., der Umschrift: Ich ruhe auf Hoffnung. Römer 5, V. 1-5, Kap. 12, V. 11-12, und der Unterschrift des neunten Verses aus dem Paul Gerhardt'schen Liede "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld":
Setzt Teufel, Welt und Sünd' mir zu,
So find' ich bei Dir, Jesus, Ruh'
Als auf dem Bett ein Kranker.
Und wenn des Kreuzes Ungestüm
Mein Schifflein treibet üm und üm,
So bist Du denn mein Anker.
angebracht ist. Ob dieser Anker irgend welchen Zusammenhang mit dem von den Ankers im Wappenschilde geführten habe oder vielmehr zur Erinnerung an die Entstehung des Ortsnamens nachgebildet sei, entzieht sich der Beurtheilung.
Oben in der westlichen Giebelwand des Langhauses, in der Höhe der Balkenlage, mündet in einer Fenster=Oeffnung eine schmale, steinerne, den im Hause zu Ankershagen befindlichen ganz gleiche, Wandtreppe aus, deren Eingang an der nordwestlichen Ecke im Innern des Langhauses vermauert ist. Dieselbe wird vor der Erbauung des Thurmes dem Zwecke gedient haben, durch sie in den Dachstuhl des Langhauses zu gelangen.
Unter dem Langhause der Kirche an dessen östlichem Ende befanden sich die von Holstein'schen Grabgewölbe, welche von außen durch einen unter der nördlichen Kirchenwand durchführenden gewölbten Gang, von innen durch eine Treppe zugänglich und durch einen gewölbten Gang mit einander verbunden waren. Das südliche ist 1864, das nördliche 1892 zugeschüttet.
Die nördlich an den Altarchor angebaute und 1864 umgebaute Sakristei bietet nichts Bemerkenswerthes. Erwähnung verdient nur, daß dieselbe 1727 in baufälligem Zustande für 55 Thaler an den Glashüttenmeister Johann Lucas Gundlach von der Möllenhäger Glashütte, seit 1739 Pächter des Gutes Rockow, welcher sich hatte nobilitiren lassen, als Erbbegräbniß verkauft worden ist. Ihrem ursprünglichen Zweck ist die Sakristei 1864 wiedergegeben, nachdem die Gundlach'schen Särge nach Rumpshagen übergeführt waren.


|
Seite 305 |




|
Die im Thurm hängenden Glocken stammen aus dem 18. Jahrhundert. Von den drei am Ende des 17. Jahrhunderts vorhandenen Glocken berichtet Pastor Mauritius, die größte habe die Jahreszahl 1463, die mittlere die Inschrift: "Ave Maria gratia plena" getragen, die kleinste habe beim Einläuten des Pfingstfestes 1690 einen Riß bekommen und ihren Klang verloren. Noch ein kleines Glöcklein sei 1683 nach Federow verkauft, der Erlös von 8 Gulden 8 Schillingen sei zu Kirchenfenstern verwandt.

Bemerkenswerth ist in der Kirche noch eine kleine, vermuthlich zur Aufnahme eines Heiligenbildes oder einer ewig brennenden Lampe bestimmte Mauernische an der nördlichen Wand des Langhauses in einem Wandpfeiler. Ferner ein an der östlichen Giebelwand des Langhauses hängender alter, aber unschöner Crucifixus in Lebensgröße. Endlich ein herrlicher, aus Eichenholz in reiner Renaissance kunstvoll geschnitzter Taufstein mit der Aufschrift: "Marci am lesten. Wol dar gelovet unde gedofft werdt, de werd salich, wol överst nich gelovet, de werdt vordomet werden. 1618."
An Abendmahlsgeräthschaften sind ein schöner silberner Kelch mit den Initialen der Stifter: Joachim Friedrich von Holstein und Anna Margaretha, geb. von Holstein, der Jahreszahl 1701 und dem Holstein'schen Allianzwappen nebst einer entsprechenden einfachen silbernen Patene vorhanden.
Von den übrigen alten Kunstschätzen der Kirche ist bei der Restauration von 1864 nichts conservirt worden, weder von dem vermuthlich noch aus dem 14. Jahrhundert stammenden Altarschrank, mit einem aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammenden Madonnenbilde, zu dessen Füßen die Schenker Hans von Holstein und seine


|
Seite 306 |




|
Hausfrau Anna, geb. von Rohr, mit ihren Wappenschilden versehen, knieeten, noch von der alten Kanzel, einem Geschenk Diederichs von Holstein und seiner Hausfrau Elisabeth, geb. v. Zernekow, aus dem Jahre 1592 und von den Stühlen der Gebrüder Jacob und Hans Holstein mit der Jahreszahl 1577.
Urkundlich feststehend ist, daß die Kirche als Filiale der Freidorfer Kirche, Broda'er Patronates, am 1. Mai 1266 vom Bischof Heinrich von Havelberg geweiht worden ist (M. U.=B. II, Nr. 1080).
Vermuthlich sind Kirche und Pfarre zu Freidorf bald untergegangen. Eine Pfarre zu Freidorf wird zuletzt erwähnt im Jahre 1365, als Hermann von Plasten dem Kloster Broda und dem Pfarrer Seedorf zu Freidorf seinen Hof in Freidorf verkauft (M. U.=B. XV, Nr. 9340). Von Freidorfer Einwohnern redet zuletzt ein Rescript von 1505 im Schweriner Archive.
Die im M. U.=B. II, S. 452 abgedruckte Urkunde von 1230, in welcher dem Kloster Broda schon damals die Kirche in Ankershagen bestätigt wird, ist jedenfalls eine aus der Urkunde von 1273 fabricirte Fälschung, da es in der Urkunde von 1266 von der mit zwei Hägerhufen dotirten Ankershäger Kirche heißt: "Admisimus ut de novo fundaretur", dieselbe also vorher nicht existirte. Das Patronat über die Kirche zu Ankershagen gehörte mit dem über die Kirche zu Freidorf dem Prämonstratenserkloster Broda, auf dessen Geschichte wir daher einen kurzen Rückblick werfen.
Schon im Jahre 1170 war bei der Restauration des Havelberger Domstiftes diesem zur Anlegung des Klosters Broda (M. U.=B. I, Nr. 95) vom Fürsten Kasimir I. von Pommern und demnächst von seinem Bruder Bugislav I., der Besitz von 33 Gütern abgetreten, resp. garantirt. Zwar kam es 1170 noch nicht zur Anlage des Klosters Broda, aber 1182, nachdem Kasimir I. von Pommern in der Schlacht gegen die Brandenburger gefallen, sein Land, sowie die dem Bisthum Havelberg zur Anlage des Klosters Broda geschenkten Besitzungen an Brandenburg verloren gegangen waren, bestätigte sein Bruder Bugislav I. (M. U.=B. I, Nr. 135) die Besitzungen des nur dem Namen nach existirenden Klosters Broda, soweit er noch darüber verfügen konnte, nämlich die Güter westlich der Tollense und die wüsten Dörfer in Chotibanz, und drang auf die Erbauung des Klosters. Die Kriege wiederholten sich und die Herzöge von Pommern mußten ihre Besitzungen von Brandenburg zu Lehn nehmen, nach dem Vergleich zu Kremmen 1236 (M. U.=B. I, Nr. 457). Barnim und Wartislav von Pommern confirmirten 1244 (M. U.=B. I, Nr. 563) die Stiftung von Broda und 1281 bestätigte Bugislav von Pommern demselben (M. U.=B. III, Nr. 1582)


|
Seite 307 |




|
alle Besitzungen und Rechte, die seine Vorfahren ihm verliehen hatten, obwohl das Kloster zerstört, sein Besitz verwüstet war. Aber die Herren von Werle, denen in den Kriegen zwischen Pommem und Brandenburg das Land westlich der Tollense angefallen war, schenkten Broda viel wieder. 1273 bestätigte Nicolaus I. (M. U.=B. II, Nr. 1284), 1312 Nicolaus II. (M. U.=B. V, Nr. 3563) von Werle die alten Verleihungen, 1354 verlieh Bischof Burchard von Havelberg (M. U.=B. XIII, Nr. 7982) dem Kloster Broda von Neuem die verschiedenen Kirchenpatronate, 1482 bestätigen die Herzöge Magnus und Balthasar von Meklenburg des Klosters Besitz und Rechte, und 1506 confirmirte Papst Alexander VI. Broda's Patronat über die Kirche zu Ankershagen. (Urkunde im Archiv zu Schwerin.) Aber wie ein großer Theil des Grundbesitzes, so ging auch das Patronat über die Kirche zu Ankershagen in den unruhigen Zeiten und bei den Usurpationen des Adels dem Kloster Broda anscheinend wieder verloren. Insbesondere scheinen die Holsteins sich, als mit dem Fortschreiten der Reformation aller geistliche Besitz so zu sagen vogelfrei wurde, das Patronat über die Kirche angemaßt zu haben, bis dann, wie Pastor Mauritius in seiner Chronik erzählt, Jochim von Holstein, der Johanniter, dem Kloster Broda das Patronat in Ankershagen wiederum schenkte, angeblich, um sich seine Bestattung in der Kirche zu Broda zu sichern. Bei der Säcularisation des Klosters Broda, 1052, ging das Patronat über die Kirche zu Ankershagen an die Herzöge über. In der Visitation von 1574 heißt es: Das Kirchlehn gehöret Herzog Ulrich von Güstrow wegen des Klosters Broda; in der von 1582: Jus patronatus gehöre zum Kloster Broda (damals also herzoglichen Amt Broda) 1599 versuchten die Holsteins wieder, sich das Patronat anzumaßen. (Acten im Archiv zu Schwerin.) Nach des Pastors Simon Henrichs Tode präsentirten sie dem Herzog unter Behauptung ihres Compatronatrechtes einen Nachfolger, zuerst den Sohn Joachim Henrichs, dann einen Pastor Nicolaus N. N. aus Röbel. Sie vermochten indessen ihre Prätensionen nicht aufrecht zu erhalten. Nachdem sie das herzogliche Patronat anerkannt hatten, erklärte Herzog Ulrich 1600 sich bereit, ihre Vorschläge zu berücksichtigen, doch wolle er nicht den auswärtigen, mit den localen Verhältnissen unbekannten Pastor aus Röbel, den die Holsteins nur haben wollten, um mit den Kirchengütern nach ihrem Belieben verfahren zu können, sondern den Sohn des früheren Pastors, Joachim Henrichs, zum Pastor ernennen.
Anscheinend verblieb trotz der Landestheilung von 1621, nach der das Land Waren zum Amte Neustadt gehören sollte, das Patronat zu Ankershagen, vermuthlich als von Broda untrennbar, bei Herzog


|
Seite 308 |




|
Johann Albrecht II. von Güstrow, Kirche und Pfarre unter der Superintendentur Neubrandenburg, und nach Johann Albrechts Tode bei seinem Sohne, Herzog Gustav Adolf von Güstrow, dessen gesetzlicher Vormund von 1637 bis 1654 Herzog Adolf Friedrich von Schwerin war. Aber 1662 behauptete Adolf Friedrich's Sohn, Christian Louis, seit 1658 Herzog von Meklenburg=Schwerin, das Recht auf die Kirche zu Ankershagen und verbot dem Herzoglich Güstrow'schen Superintendenten in Neubrandenburg, in den ihm zustehenden Kirchen zu Ankershagen und Groß=Vielen die angekündigten Visitationen vorzunehmen. (Acten im Archiv zu Schwerin und Neustrelitz.) Nach dem Ableben des Pastors Nicolaus Waßmund zu Ankershagen im Jahre 1676 rescribirte Herzog Gustav Adolf von Güstrow dem Superintendenten Franz Clinge zu Neubrandenburg, er solle, da das Patronat in Ankershagen unstreitig ihm zustehe, den Subrector Nicolaus Gading der Gemeinde präsentiren, ungeachtet etwa Schwerinscherseits dem widersprochen werde, und ordnete nach dessen Erwählung durch die Gemeinde seine Examination, Ordination und Introduction an. Es scheint, daß für diesmal Herzog Gustav Adolf seine Rechte erfolgreich behauptet hat, wobei ihm wohl Christian Louis fortgesetztes Leben in Frankreich und dessen Gleichgültigkeit gegen Regierungsangelegenheiten förderlich war, denn von 1676 bis 1692 finden wir die Ankershäger Pfarre in den Händen des neu erwählten Pastors Gading. Nach seinem und dem gleichzeitigen Tode Herzog Christians und dem Regierungsantritt Herzog Friedrich Wilhelms, 1692, scheint der Zwist mit erneuter Heftigkeit entbrannt. Im April 1692 rescribirte Herzog Gustav Adolf an seinen Superintendenten: Nachdem die Predigerstelle in Ankershagen Schwerinscherseits tumultuarie und de facto besetzt sei, solle er mit solchem Prediger reden und ihn zu bewegen suchen, daß er sich der Amtshandlungen enthalte und die Wittwe Gading nicht hindere, das Gnadenjahr ruhig zu genießen, bis die Sache zwischen den beiden Regierungen ausgemacht sei. Und im Juli desselben Jahres rescribirte Herzog Gustav Adolf seinem Superintendenten: Da dem Vernehmen nach von Schwerin aus beabsichtigt werde, die Kapelle zu Möllenhagen zur Filiale der Kirche zu Ankershagen zu machen, deren sie sich factisch anmaßten, so solle er die Verrichtung des Gottesdienstes in der Kapelle zu Möllenhagen dem nächsten Prediger des Herzogthums Güstrow übertragen, bis der Streit gehoben. Gleichzeitig ließ er an Caspar Friedrich von Holstein, den Besitzer von Möllenhagen, den Befehl ergehen, er solle nicht zugeben, daß der factisch eingedrungene Priester in Ankershagen in der Kapelle zu Möllenhagen den Gottesdienst verrichte. Die Schwerinscherseits auf Grund des Erbvertrages


|
Seite 309 |




|
von 1621, nach dem Ankershagen im District Waren zum Amt Neustadt und somit zum Herzogthum Schwerin gehörte, erhobenen Ansprüche müssen schließlich sich behauptet haben, denn der neu ernannte Pastor Mauritius ist in seinem Amt verblieben und die Pfarre hat von 1692 an zur Präpositur Waren und zur Superintendentur Parchim gehört. 1833 ist sie der Präpositur Penzlin zugewiesen, und mit ihr später der Superintendentur Malchin.
Bei dem Fehlen der Kirchenbücher (die älteren Kirchenbücher sollen bei der großen Feuersbrunst in Neubrandenburg 1676 vernichtet sein, die von 1676-1692 jetzt im Archiv zu Schwerin befindlichen, werden Güstrowscherseits dem vom Schwerin eingesetzten Pastor wohl vorenthalten sein) und aller kirchlichen Nachrichten, verfaßte Pastor Mauritius eine Chronik, indem er mittelst Exerpte aus den Kirchenbüchern benachbarter Pfarren und Copirung der aus dem herzoglichen Archiv zu Güstrow ihm mitgetheilten Visitationsprotocolle, sowie durch Vernehmung alter Leute aus der Gemeinde kirchliche Nachrichten sammelte. Wir entnehmen dieser Chronik interessante Mittheilungen über die bürgerlichen und kirchlichen Verhältnisse in Ankershagen vor dem dreißigjährigen Kriege und die traurigen Zustände, die der Krieg mit den in seinem Gefolge das Land verheerenden Drangsalen hinterlassen hat. Vor dem Kriege hat die Kirche zu Ankershagen Filialkirchen zu Klockow, Dambeck und Pieverstorf gehabt, in denen der Pastor den Gottesdienst hat alternirend alle 14 Tage so verrichten müssen, daß immer nur in einer dieser Filialien Küstergottesdienst gehalten ist, indem abwechselnd die Dambecker nach Pieverstorf und die Pieverstorfer nach Dambeck haben gehen müssen. Der Krieg hat mit diesen großen, von vielen Bauern bewohnten Dörfern (Ankershagen hatte 12 Bauern und 21 Kossathen, im Ganzen 64 Feuerstellen, Klockow 11 Bauern, mehrere Kossathen, Dambeck 8 Bauern, mehrere Kossathen, im Ganzen 22 Feuerstellen, Pieverstorf 6 Bauern, mehrere Kossathen, im Ganzen 19 Feuerstellen) auch die Kirchen in Schutt und Asche gelegt, und nur die besonderen Kirchhöfe in diesen Ortschaften bezeugen noch heute, daß sie einst auch Gotteshäuser besaßen.
In der katholischen Zeit haben in Ankershagen ein Pfarrherr und drei Kapläne gewohnt, wie das Testament des Johanniterritters Jochim von Holstein vom Jahre 1572 bezeugt. Schon früh hat in Ankershagen die Reformation Eingang gefunden. Im Jahre 1538 finden wir schon in Hennig Holstein's Hause als Erzieher seiner Söhne einen lutherischen Hauslehrer und um 1540 etwa war das Pfarramt in den Händen eines protestantischen Pastors, des Marcus Varenholt. Ihm folgte etwa 1545 Henning Gercke, und 1556 Simon Henrichs, geboren 1528, gestorben 1599. Aus zwei Ehen hinterließ er


|
Seite 310 |




|
7 Söhne, von denen zwei ihm im Amte folgten, wie ein altes an dem Pfeiler neben dem Eingang in der Kirche befestigtes Gemälde veranschaulicht hat. Auf demselben ist Simon Henrichs nebst zwei Frauen und der ganzen Reihe seiner Söhne dargestellt gewesen. Ueber den Häuptern des ältesten und des fünften, wie über dem des Vaters ist ein rothes Kreuz als Zeichen des geistlichen Amtes angebracht gewesen, und mit dieser Andeutung stimmt die Angabe alter, im Schweriner Archiv befindlicher Gerichtsacten von 1612 überein, in denen es heißt: Joachim und Hans Gebrüder Henrici, Pastoren zu Ankershagen. Die Amtsdauer beider Gebrüder Henrichs fällt in die Zeit von 1600-1616, mit welchem Zeitpunkt Johannes Schlüsselburg, ein Sohn des Superintendenten in Ratzeburg und Halbbruder des Superintendenten Andreas Schlüsselburg in Neubrandenburg das Pfarramt in Ankershagen übernahm. Er war vermählt mit Catharina, geb. Karberg, einer Apothekertochter aus Waren, lebte aber mit ihr in Zwist, so daß sie getrennte Häuser bewohnten. Ihn raffte die Pest im Jahre 1637 mit einem großen Theil seiner Gemeinde hin, während die Wittwe 1660 erfroren an der Zahrener Scheide aufgefunden wurde.
Als eine Folge der Schrecknisse des dreißigjährigen Krieges und der Entvölkerung des Landes trat eine lange Vakanz der Pfarre ein, welche 8 Jahre lang unbesetzt blieb. 1645 endlich wurde Nicolaus Waßmund, geboren 1615 als Sohn des Schusters Jacob Waßmund zu Neubrandenburg, eingeführt. Er war vermählt mit Dorothea Wüstenberg und starb 1676. Ihm folgte in demselben Jahre Nicolaus Gading, der Sohn eines Goldschmieds zu Seehausen in der Altmark, geb. 1640, vermählt mit Ilsabe Müller aus Stralsund, der 1692 als letzter von Herzoglich Güstrowscher Seite ernannter Pastor starb. Von Schwerinscher Seite ernannt, trat 1692 Christoph Mauritius, geboren 1647 als Sohn des Leinwebers Vincenz Moritz zu Schwerin und vermählt mit der Pastorentochter Judith Moller aus Schwaan, ein. Während seiner Amtsthätigkeit wurde am 4. December 1693 in Ankershagen die Zauberin Sophie Schumacher verbrannt. Er verstarb 1699 und ihm folgte von 1700 bis 1715 Arnold Heinzke aus Lenzen als zehnter im Amt. Von ihm berichtet der committirte Archidiaconus Zylius in Parchim, er habe zwar im Examen nur schlecht bestanden; da Krankheit ihn am Studium verhindert und er versprochen habe, weiter zu lernen, so habe er ihn trotzdem introducirt.
Nach ihm Gottfried Schröder, geboren 1680 zu Neu=Röbel, seit 1706 Rector in Penzlin, vermählt mit Margarethe von Preen, dem von 1734 bis 1736 sein Schwiegersohn Josias Andreas Jäger


|
Seite 311 |




|
und von 1740 an sein Sohn Gottfried Heinrich Schröder zunächst abjungirt wurde, später im Amte folgte; letzterer vermählt mit D. C. Schliepsten, Pastorentochter aus Arenshagen in Pommern. Im Jahre 1800 trat als Pastor in Ankershagen an Ludolf Wulfrath Heinrich von Rußdorf, geboren 1773 als Sohn des Pastors zu Basse, vorher Hauslehrer in Rumpshagen, vermählt mit Wilhelmine Müller aus Gr.=Luckow. Er starb 1822 und ihm folgte 1823 Ernst Johann Adolf Schliemann aus Gresse bei Boizenburg, seit 1814 Pastor in Neubukow, vermählt mit Louise Bürger, Vater des Gelehrten Heinrich Schliemann. 1832 trat er zurück und lebte im Auslande, während als Vicar Christian Conradi, Sohn des Kirchenraths Carl Conradi zu Waren, eintrat. Er war vermählt mit Ernestine von Weltzien, wurde 1863 emeritirt und verstarb 1882 in Neubrandenburg. An seine Stelle trat 1863 Hans Becker, Sohn des Pastors Becker zu Granzin bei Boizenburg, geb. 1814, seit 1848 Pastor in Pokrent, vermählt I. mit Auguste Krückmann, II. mit Theodore Schulze.
Von Alters her sind Pfarre und Kirche zu Ankershagen reich mit Grundbesitz sowohl in Ankershagen und Freidorf, als in den Filialdörfern Klockow, Dambeck und vermuthlich auch in Pieverstorf dotirt gewesen. An genauen Nachweisen darüber aber fehlt es, nachdem der dreißigjährige Krieg die Dörfer verödet, die Besitzverhältnisse zerstört hat, und die Pfarracten großentheils verloren gegangen sind. Bei der Kirchenvisitation von 1574 werden in Ankershagen und Freiborf 6 Hufen als der Pfarre und Kirche gehörig aufgeführt, bei der Visitation von 1582 in Ankershagen 5 Hufen, davon 2 ungewiß, in Freidorf 3 Hufen, außerdem der s. g. Papenwerder, 23 Morgen groß, verschiedene Wiesen, Fischerei in den drei Freidorfer Seeen, Rohrwerbung und Holzgerechtigkeit. Noch gehörten dazu im Filialdorfe Dambeck eine Hufe, nämlich ein 10 Ruthen breites, vom Dalmsdorfer Wege bis an den langen See, also durch das ganze Gut durchlaufendes Stück; in Klockow und Bocksee (richtiger wohl Booksee geschrieben) ein 10 Ruthen und ein 5 Ruthen breites von der Rethwischer bis zur Specker Grenze durchlaufendes Stück. In dem zur Mutterkirche Peccatel gehörenden Filialkirchdorf Liepen hat die Ankershäger Pfarre zwei Bauerhöfe mit 5 1/2 Hufen oder 31000 □Ruthen Landes gehabt, die ihr nach des Pastor Mauritius Chronik von zwei adligen Jungfrauen, deren Geschlecht abgestorben, geschenkt sein sollen. Als Veranlassung zu dieser Schenkung berichtet die Sage, daß ein Edelmann, von ansteckender Krankheit befallen, nach vergeblicher Aufforderung anderer Geistlicher, von dem Ankershäger Pfarrherrn die Sterbesacramente erhalten habe.


|
Seite 312 |




|
In den Acten betreffend Austausch der Lieper
Pfarräcker wird erwähnt, die beiden Höfe seien
der Pfarre zu Ankershagen durch letztwillige
Verfügungen der von Stalbom vermacht und in
einer Urkunde von 1437, in welcher Kuneke
Ghelder dem Ankershäger Pfarrherrn für 20 m
 (nicht 70, wie Pentz berichtet)
die ihm von 5 1/2 Hufen in Liepen zuständigen
Zehnten, Dienst und Rauchhuhn verpfändet,
bekennt er, daß diese 5 1/2 Hufen dem
Ankershäger Pfarrherrn eigenthümlich gehören,
wie sie demselben von seinen Vorfahren zu ihrer
Seelen Gedächtniß verliehen seien. Nicht zu
verwechseln mit dieser Urkunde von 1437 ist eine
ähnliche von 1386, in welcher Kuneke Ghelder
bekennt, die 6 Hufen in Liepen seien ihm von
Hermann von Plasten in einer Sühne für seinen
von jenem erschlagenen Vater gegeben, zu dessen
Gedächtniß er Zwecks Haltung einer Seelenmesse
eine jährliche Hebung von 8 m
(nicht 70, wie Pentz berichtet)
die ihm von 5 1/2 Hufen in Liepen zuständigen
Zehnten, Dienst und Rauchhuhn verpfändet,
bekennt er, daß diese 5 1/2 Hufen dem
Ankershäger Pfarrherrn eigenthümlich gehören,
wie sie demselben von seinen Vorfahren zu ihrer
Seelen Gedächtniß verliehen seien. Nicht zu
verwechseln mit dieser Urkunde von 1437 ist eine
ähnliche von 1386, in welcher Kuneke Ghelder
bekennt, die 6 Hufen in Liepen seien ihm von
Hermann von Plasten in einer Sühne für seinen
von jenem erschlagenen Vater gegeben, zu dessen
Gedächtniß er Zwecks Haltung einer Seelenmesse
eine jährliche Hebung von 8 m
 aus diesen Hufen, deren
Wiedereinlösung den Plasten's frei stehe, dem
Pfarrherrn zu Ankershagen verleihe. Es sind
demnach die der Pfarre eigenthümlich gehörenden
5 1/2 Hufen in Liepen nicht dieselben, wie die
von Hermann von Plasten dem Kuneke Ghelder
verpfändeten und von diesem mit der Pfarrhebung
von 8 m
aus diesen Hufen, deren
Wiedereinlösung den Plasten's frei stehe, dem
Pfarrherrn zu Ankershagen verleihe. Es sind
demnach die der Pfarre eigenthümlich gehörenden
5 1/2 Hufen in Liepen nicht dieselben, wie die
von Hermann von Plasten dem Kuneke Ghelder
verpfändeten und von diesem mit der Pfarrhebung
von 8 m
 belasteten 6 Hufen in Liepen.
belasteten 6 Hufen in Liepen.
Die der Pfarre und Kirche gehörigen Aecker auf der Ankershäger und Freidorfer Feldmark, welche in verschiedenen, meist 10 oder 5 Ruthen breiten Stücken in den drei Ankershäger Schlägen: Woldfeld oder Diekfeld, Mühlenfeld und Birkfeld und den drei Freidorfer Schlägen: Mühlenfeld, Eckerpfuhlsche Feld und Hohe Feld, vertheilt lagen, waren meist an die Ankershäger Bauern, an die auch die Freidorfer Hufen vertheilt waren, gegen Geldzins ausgethan, während die Wiesen und die Holzkaveln von der Pfarre selbst genutzt wurden. Als aber der Krieg die Dörfer entvölkert und die Gehöfte zerstört hatte, lagen viele Aecker wüste und die Geistlichen mußten, um sich ernähren zu können, die Aecker theilweise selbst bewirthschaften, oder bei allmählichem Zuzug neuer Bauern die verödeten Felder gegen Einfall (d. h. die Einsaat) vergeben, da sie auch an dem ihnen zuständigen Meßkorn und ihren sonstigen Accidentien große Einbuße erlitten. Bei dem Mangel jeden Rechtsschutzes und der herrschenden Noth gingen der Pfarre auch oft ihre Rechte durch die Usurpationen des Adels verloren und Prozesse und landesherrliche Kommissarien zur Schlichtung von Streitigkeiten und Wiedererlangung verlorenen Besitzes folgen rasch auf einander.
Die Inhaber der beiden Lieper Gehöfte sollen in alten Zeiten dem Pastor in Ankershagen Hofdienst geleistet haben; zur Zeit der Visitationen von 1574 und 1582 gaben sie von jeder Stelle 1 Gulden 3 Schillinge Zins, außerdem ein Zehntlamm, oder statt dessen 3 Schillinge, und ein Rauchhuhn. Nachdem die Gehöfte zerstört


|
Seite 313 |




|
waren, ging auch der Besitz der Hufen verloren, indem die Besitzerin des Gutes Kl.=Vielen sich denselben anmaßte, und erst nach langen Streitigkeiten und Absendung fürstlicher Kommissarien gelangte 1689 der Pastor wieder in den Besitz der wüsten Lieper Pfarrhufen, die er zuerst gegen Einfall, dann aber einem Bauern aus Dalmstorf auf 2 Jahre für einen Jahreszins von 4 Thalern und ferner für 5 Thaler mit der Bedingung verpachtete, daß er Gebäude wiederbaue und wenn der Acker soweit urbar und cultivirt sei, daß 2 Familien sich darauf ernähren könnten, es zulasse, auch die andere Stelle zu bebauen.
Im Jahre 1765 fand auf Antrag des Pastors G. H. Schröder eine Permutation der der Kirche und Pfarre gehörenden auf Ankershäger und Freidorfer Feldmark zerstreut liegenden Ackerstücke gegen zusammenhängende Flächen Hofackers statt, bei der die Pfarre ein gutes Geschäft gemacht zu haben scheint. Zum Umtausch gelangten 28759 □Ruthen Acker und Wiesen. Außer dieser Fläche verblieben die 2200 □Ruthen große s. g. dritte Freidorfer Pachthufe zwischen dem Mühlensee und Bornsee, die 20 Ruthenstücke zwischen Taetchengrund und der Bockseer Scheide von etwa 5000 □Ruthen, der s. g. Pinnieskamp von 357 □Ruthen, der Papenwerder mit etwa 3000 □Ruthen, eine Nachtkoppel von 800 □Ruthen an der Rumpshäger Scheide und einige weitere Ackerstücke, sowie der Priestersee mit etwa 3000 □Ruthen im Besitz der Pfarre. Das gesammte der Kirche und Pfarre gehörige Areal auf dem Ankershäger und Freidorfer Felde umfaßte circa 48000 □Ruthen. Daneben behielt die Pfarre auf der ganzen Feldmark das jus compascui, wie solches der Dorfschaft auf den Pfarrländereien verblieb, und erhielt alles Nutz=, Brenn= und Zaunholz aus den Gutswaldungen. Für die Fischerei in der Langenbek (Priesterbek) erhielt die Pfarre einen jährlichen Kanon von 1 Thaler 24 Schilling N. 2/3. Ein noch besseres Geschäft machte die Pfarre bei den kommissarischen Verhandlungen wegen Vererbpachtung des Pfarrackers im Jahre 1801, nach deren Abschluß und Confirmation im Jahre 1802 das Gut Ankershagen den größten Theil der Pfarrländereien für einen Kanon von 999 Scheffel Korn verschiedener Art in Erbpacht übernahm, während 4000 □Ruthen des besten Bodens, 3000 □Ruthen Wiese und 5000 □Ruthen Sandacker an der Bockseer Scheide, sowie die dritte Freidorfer Pachthufc und der Priestersee im Nutzeigenthum der Pfarre verblieben. Es übersteigt diese Vererbpachtung die höchsten Güterpreise, die in der Mitte dieses Jahrhunderts gezahlt sind, indem der Geldwerth des Kanons nach Mittelpreisen berechnet einen Kapitalwerth von 4 Mk. 50 Pfg. pro □Ruthe der Gesammtfläche, von der die Hälfte Sandboden ist repräsentirt. Der Priestersee mit dem alten Freidorfer Kirchhofe


|
Seite 314 |




|
wurde später gegen einen Kanon von 50 Scheffeln Roggen an Wendorf vererbpachtet, 1864 die dritte Freidorfer Pachthufe für 22 Scheffel Roggen an Friedrichsfelde. Der Papenwerder, dessen Besitz die Holsteins sich angemaßt, für den sie sich aber in der Visitation von 1582 zur Zahlung einer Jahrespacht von 6 Gulden verpflichtet hatten, trägt noch immer auf Grund jener, im Permutationscontract von 1765 auf 6 Thaler N 2/3 erhöheten Vereinbarung der Pfarre jährlich 21 Mk. vom Gute Ankershagen ein, während der Papenwerder zum Gute Wendorf gelegt ist. Die Abgabe von 45 Parchimer Scheffeln Roggen Meßkorn, die das Gut Ankershagen an die Pfarre zu leisten hat, entspricht derjenigen, welche die im Jahre 1582 in Ankershagen wohnenden 12 Bauern und 21 Kossathen mit resp. je 2 und je 1 Scheffel Roggen in großem Parchimer Maße zu leisten hatten.
Die Lieper Bauerhufen sind 1799 an den Besitzer von Kl.=Vielen gegen ein nach Marktpreisen zu berechnendes Geldäquivalent von 35 Scheffeln Roggen, 15 Scheffeln Gerste, 18 3/4 Scheffeln Hafer, 8 Scheffeln Buchweizen, 17 Thalern 34 Schillingen Gold und 2 Faden Bruchholz, deren Haulohn mit je 6 Schillingen zu erstatten ist, vererbpachtet. Die Dambecker Hufe ist noch im Besitz der Pfarre, bringt aber als ein entlegener ganz isolirter Streifen armen Sandbodens und nur mit einzelnen von selbst angeflogenen Kiefern bewachsen, für die Pfarre keine Rente, während sie mit der Gutsforst vereinigt und forstlich bewirthschaftet, ihren Werth haben würde. Die Klockower und Bockseer Hufe scheint der Pfarre ohne wesentliche Entschädigung verloren gegangen zu sein; von Klockow wird, seit es Pertinenz des 1855 von Rethwisch abgetrennten und zum Hauptgut erhobenen Bocksee geworden ist, nichts gegeben, während das jetzt in Möllenhagen eingepfarrte Rethwisch die Geldabgabe von 7 Thalern N 2/3, Bocksee das Meßkorn mit 10 Scheffeln Roggen Parchimer Maßes giebt.
Möllenhagen, welches in alten Zeiten in Ankershagen eingepfarrt war, besaß dort ein Chor an der Nordseite der Kirche. Zu der Zeit, als in Möllenhagen zwei Rittersitze waren, bauete Berend Lüteke von Holstein, der in der Ankershäger Kirche keinen Kirchenstuhl hatte erhalten können, 1632 die Kapelle zu Möllenhagen, welche aber anfänglich das jus filiae nicht hatte und erst bei der Visitation von 1705 als Filiale von Ankershagen genannt wird. Der Pastor erhält jährlich 18 Thaler 17 Schillinge aus Möllenhagen, während in alten Zeiten die dortigen Bauern jeder 2, die Kossaten jeder 1 Scheffel Roggen an Meßkorn gaben, und für den Gottesdienst der alle 14 Tage in der Kapelle zu Möllenhagen stattfand, jährlich 8 Thaler gezahlt wurden.
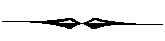


|
Seite 315 |




|



|


|
|
:
|
VII.
Die Wappen des
Großherzoglichen Hauses
Mecklenburg
in geschichtlicher Entwickelung.
Im Allerhöchsten Auftrage S. K. H. des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg=Schwerin bearbeitet und gezeichnet von C. Teske. (Güstrow, Opitz & Co. 1893. 4º.)
Von
Dr. Crull
in Wismar.
~~~~~~~~~~~
B ekanntlich hat Herr C. Teske, früher in Neustrelitz, jetzt in Schwerin in Großherzoglichen Diensten 1 ) 1885 ein Werk herausgegeben, welches die Wappen der beiden Großherzoglichen Häuser zu Meklenburg nach derzeitiger Gestaltung und die Wappen der meklenburgischen Städte Schwerinschen Antheils, wie solche nach den Feststellungen von Dr. Lisch im Thronsaale zu Schwerin angebracht sind, die der Strelitzschen nach eigener Forschung darstellt und erläutert. Der Fleiß, die Umsicht und die Geschicklichkeit, welche Herr Teske darin an den Tag gelegt hat, sind gebührend anerkannt und in einer für ihn höchst erfreulichen und ehrenvollen Weise dadurch belohnt worden, daß S. K. H. der Allerdurchlauchtigste Großherzog von Meklenburg=Schwerin den Allergnädigsten Auftrag ihm zu ertheilen geruhte, das Wappen Allerhöchstseines Großherzoglichen Hauses in geschichtlicher Entwickelung darzustellen. Diese Arbeit liegt jetzt nach mehr als dreijährigem Bemühen in einem glänzend ausgestatteten Quartbande vor, welcher das Wappen, wie solches (oder dessen Bestandtheile) in den verschiedenen Zeiten sich zeigt, mittelst 27 in Gold und Farben hergestellten Tafeln, zu denen dann noch 8 Tafeln mit


|
Seite 316 |




|
photographischen Aufnahmen einschlägiger Denkmäler kommen, zur Darstellung bringt. Ein Text von 94 Seiten, außer der Widmung u.s.w., welcher reich mit Holzschnitten und Zinkotypien, 217 an der Zahl, ausgestattet ist, begleitet commentirend die Tafeln.
Herr Teske ist der erste nicht, welcher sich mit dem meklenburgischen Wappen eingehender beschäftigt hat. Schon unter Herzog Heinrich dem Friedfertigen verfaßte ein Oberländer Georg Rixner eine Geschichte der Herzoge zu Meklenburg mit Erörterungen über deren Wappen, die, wie nach Westphalens Angabe schon Meibom urtheilte, nicht mehr werth als diePhantastereien des Dr. Nicolaus Marschalk, aber doch von nachhaltigem Einfluß gewesen sind; Westphalen hat dieser Arbeit in dem 3. Theile seines Sammelwerks einen Platz vergönnt und sie sogar noch mit drei Kupfertafeln ausgestattet. Fast zweihundert Jahre später schrieb Joh. Dan. Sukow (gest. 1728) eine Abhandlung über das meklenburgische Wappen, die bruchstücksweise in David Francks Werke sich findet. 1 ) und im vorigen Jahrhundert, besser, der Professor A. J. D. Aepinus 2 ), anderer zu geschweigen, welche den Gegenstand nur nebenher behandelt haben, wie Klüver 3 ) und F. A. Rudloff 4 ). Derzeit stand die Kritik aber noch auf recht schwachen Füßen und war die Kunst zu sehen noch sehr unentwickelt; man muß die Siegelbeschreibungen lesen und Abbildungen vergleichen, um den Unterschied zwischen damals und jetzt zu begreifen und um ungerechter Beurtheilung sich zu enthalten.
Nach dem Berichte über die Arbeit an den Allerhöchsten Auftraggeber, einer Inhaltsübersicht, einem Personenregister und einem Verzeichnisse der benutzten Bücher, die citirt sind, giebt Herr Teske im ersten Abschnitte eine Einleitung, welche sich mit dem Wappenwesen überhaupt beschäftigt. Es ist kein Anlaß da, näher auf selbige einzugehen, doch kann ich nicht umhin, meine Meinung dahin auszusprechen, daß Herr Teske zu viel sagt oder sich mißverständlich ausdrückt, wenn er den sel. Dr. Masch als Altmeister der wissenschaftlichen Heraldik bezeichnet. Der liebenswürdige, frische, für die Heraldik (und Numismatik) sozusagen begeisterte Mann besaß eine überaus große Kenntniß von Wappen und war ein Meister im Blasonniren, aber zu einer kritischen Behandlung des Wappenwesens war er nicht geneigt und daher auch auf Karl Mayers von Mayerfels Heraldisches ABC=Buch, welches in der Heraldik wie ein reinigendes Gewitter wirkte, übel zu sprechen. Dankbarer Anerkennung


|
Seite 317 |




|
mehr würdig war m. E. die Thätigkeit des Dr. Lisch, welcher, wenn auch nicht so sehr Heraldiker, doch durch seine Aufmerksamkeit auf die Siegel, insbesondere die landesfürstlichen, sowie durch Sorge für treue Abbildungen im Meklenburgischen Urkundenbuche einen soliden Grund für heraldische Forschung, insbesondere auch für das vorliegende Werk, geschaffen hat.
Die Entstehung des meklenburgischen Wappenwesens, insbesondere den Greifen und den Stierkopf, behandelt der zweite Abschnitt, aus dessen Eingange die treffende Bemerkung hervorgehoben werden mag, daß man die Vorgänge bei dem Uebergange aus dem Heidenthum in die christliche und deutsche Zeit möglichst einfach sich vorzustellen habe, und zwar, wie hinzuzufügen, nicht bloß überhaupt, sondern auch ganz besonders auf dem Gebiete des Wappenwesens, dessen Anfänge nicht gar so viel früher datiren als die Germanisirung unseres Landes. Die Herren des letzteren führten bekanntlich zu Anfang einen Greifen in ihrem Siegel, welcher aber frühzeitig durch den Stierkopf ersetzt wurde. Lisch und Masch sprachen jenen für ein allgemein wendisches Sinnbild an, diesen aber als speciell obotritisches Symbol, 1 ) während Dr. Beyer jenen als ostwendisches Feldzeichen nahm, den Stierkopf aber wie jene als das der Obotriten. Beyer thut dies in jener schönen, demnächst freilich von Dr. Wigger erfolgreich bekämpften 2 ) Abhandlung, in welcher er versucht hat, unser Fürstenhaus von Kruto, dem Könige von Rügen abzuleiten, 3 ) indem er nach einem Hinweise auf den Umstand, "daß die Nachkommen Niclots das Gedächtniß ihrer Verwandtschaft mit den Fürsten von Rügen, sowie mit den Herzogen von Pommern stets bewahrt haben, und umgekehrt," auch die Wappenbilder der drei Fürstenhäuser heranzieht. Wenn ihm dabei hinderlich war, daß die Fürsten von Rügen nicht einen Greifen, sondern im oberen Felde ihres Schildes einen wachsenden Löwen führten - zuerst 1224 nachweislich - und er sich überredete, es sei doch wohl eigentlich ein Greif, so irrte er allerdings, hätte sich aber auf das Contra=Sigill (clipeus) Wizlaws II. - von 1284: ab - sowohl, wie auf das Sigill Wizlaws III. - seit 1302 - und das Secret seines Bruders Zambor berufen können, die allerdings einen Schild mit einem Greifen zeigen, 4 ) eine Thatsache, welche, wenn sie Beyer schon bekannt gewesen wäre, ihn ohne Zweifel veranlaßt haben würde, seine Ansicht viel energischer zu vertreten.


|
Seite 318 |




|
Herr Teske theilt diese nicht und spricht sich sehr entschieden dafür aus, daß Heinrich Burwy I. so, wie die Mehrzahl der Fürsten den Herrscher der Thiere, den Löwen, oder den königlichen Adler als Symbol der Herrschermacht in ihre Siegel gesetzt, den aus beiden zusammengefügten Greifen in eben der Bedeutung als Symbol gewählt habe. Wenn derselbe dann aber noch hinzufügt, man könne (vielleicht) noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Greif sei die bildliche Darstellung des Begriffs "Slavien" (slava, Glanz, Ruhm), so sagt er damit offenbar viel mehr, als wohl seine Absicht ist, und nähert sich bedenklich der von manchen, z. B. Retberg 1 ), ausgesprochenen, von ihm selbst mit Recht bestrittenen Behauptung, der Greif sei allgemein slavisches Sinnbild.
Heinrich Burwy I. nennt sich auf seinem zweiten Siegel - das erste ist bekanntlich in der Umschrift sehr defect - Magnipolonensis und in zehn von ihm ausgestellten Urkunden Herr oder Fürst zu Meklenburg, während er in zwei Doberaner als Magnipolitanorum et Kyzzenorum princeps, in einer Neuklosterschen als princeps Slavorum sich einführt, Urkunden, die aber kaum in der fürstlichen Kanzlei oder vom fürstlichen Schreiber, sondern vermuthlich in den dankbaren Klöstern angefertigt sind. Schon bei Lebzeiten zog er seine Söhne ins Regiment. Heinrich Burwy II., welcher den Greifen in einen Schild setzte und denselben dadurch zu einem Wappenbilde machte, bezeichnet sich auf seinen Siegeln als von Rostock und so auch in vier der von ihm ausgestellten Urkunden 2 ), in einer als von Werle 3 ), wie er auch in den beiden Urkunden genannt wird, in denen er als Zeuge vorkommt. 4 ) Der jüngere Sohn, Nicolaus, nennt sich in den beiden von ihm ausgestellten Urkunden in der einen de Magnopoli, in der anderen Buruini Magnopolensis filius, begegnet zeugend als Burwini filius und wird einmal ebenso, das andere Mal als de Gadebusk genannt. 5 ) Dieser hinterließ keine Nachkommen, ist aber epochemachend für die meklenburgische Heraldik geworden, weil er den Greifen seines Vaters und Bruders verschmähte und statt desselben als erster einen gekrönten Stierkopf in sein Siegel setzte.
Weshalb hat Nicolaus das gethan und weshalb, füge ich hinzu, sind drei Söhne seines Bruders nicht ihrem Vater und ihrem Großvater und ihrer Vormundschaft, sondern ihrem Oheim hierin gefolgt?


|
Seite 319 |




|
Herr Teske sagt, es gebe nur die eine Veranlassung dazu, nämlich "daß Nicolaus durch dasselbe (das Wappenbild des Stierkopfes) seinen Stand oder seine Eigenschaften besser zum Ausdruck bringen zu können" gemeint habe und verwirft m. E. mit Recht die von Wigger aufgestellte Ansicht, es möge der Stierkopf das Feldzeichen des neuerworbenen Landes Gadebusch, das Wappen der Burg und Stadt Gadebusch, sein. 1 ) Ich für meine Person vermag nicht mich für eine dieser verschiedenen Ansichten - die von Lisch, Masch, Beyer sind ja oben bereits erwähnt - bestimmt zu entscheiden. Für Beyer - Lisch begründet seine Ansicht nicht näher - könnte es sprechen, wenn Wagrien einen Stierkopf als Wappenbild oder Symbol gehabt hätte, aber Beyers Meinung, daß ein solcher sich in den Siegeln wagrischer Städte finde, beruht auf einem Irrthum, und wenn Jonas Elverfeld, ein Poet des ausgehenden sechszehnten Jahrhunderts, das Obige auch ausspricht 2 ) und auf der Homannschen Karte von Holstein ein ungekrönter Stierkopf als Wappenbild von Wagrien dargestellt ist, so ist das ohne alle Beweiskraft. Aber auch, was Herr Teske annimmt, scheint mir zu gewagt, und dürfte das, was derselbe aus der citirten Stelle bei Grimm herausgelesen hat, beträchtlich über das hinausgehen, was Grimm gesagt hat; ich meine, wir müssen uns vorläufig mit einem Non liquet begnügen. Uebrigens ist ein Wechsel der Schildfiguren ja keineswegs unerhört und hat sich ein solcher in unserem Lande auch bei den v. d. Lühe, Ummereiseke, v. Zernin u.s.w. vollzogen.
Nach ihres Großvaters Tode und einer kurzen vormundschaftlichen Regierung des Landes übernahmen zunächst die beiden älteren Söhne Heinrich Burwys II. die Herrschaft, Johann über den westlichen Theil des Landes und Nicolaus über den östlichen. Beide setzten, wie bereits gesagt, einen gekrönten Stierkopf in ihre Siegel, von denen das Johanns frühestens von 1229, dasjenige Nicolaus I. von 1235 erhalten ist. Beide Siegel zeigen denselben Typus des Wappenbildes: einen vorwärts gekehrten Stierkopf von der Grundform eines gleichseitigen Dreiecks mit einer Schnauze, die von der


|
Seite 320 |




|
Stirn ab bis zu dem geschlossenen Maule hin kolbig anschwillt, mit zwei abwärts gerichteten Hauern, kleinen Ohren und gedrungenen convergirenden Hörnern, die von einer Krone umschlossen werden. Das Halsfell findet sich auf Johanns Siegel noch nicht und ist erst 1260 auf dem zweiten Siegel Heinrichs des Pilgers nachweisbar, während die Hauer nicht wieder erscheinen.
Wenn ich hier, wie Herr Teske, für das Wappenbild die Bezeichnung Stierkopf, die schon der obengenannte J. D. Sukow hat, gebrauche, so geschieht das allerdings in Abweichung von der alten Benennung. Im 14. und 15. Jahrhundert sagte man Ossenhovet oder Ossenkopp 1 ), und so auch noch Rixner 1530 und der Rostocker Rath 1565, während die nach Lisch dem Anfange des 16. Jahrhunderts zuzuschreibende Copie einer Inschrift zu Doberan buf [felskopp] hat, 2 ) eine Benennung, welche auch Klüver 3 ) und Nettelbladt 4 ) brauchen, obgleich letzterer später wieder Ochsenkopf sagt. 5 ) Gegenwärtig scheint Büffelskopf der allgemeine, vulgäre Name zu sein, aber derselbe widerspricht unserem naturgeschichtlichen Wissen, und auf Ochsenkopf zurückzugreifen ist deshalb nicht thunlich, weil wir heutzutage unter einem Ochsen ausschließlich einen verschnittenen Bullen verstehen, der sich doch zu einer Wappenfigur nicht eignet, während vor Zeiten der Name Osse ebensowohl einen Bullen wie jenen bezeichnete. Ueberblickt man die Reihe der Siegel, so zeigt der Stierkopf die auffälligsten Abweichungen, und während der im Siegel des Nicolaus von Gadebusch fast jovial, derjenige der Herren zu Werle bis auf Nicolaus I., Nr. 69, und Lorenz, Nr. 87, höchst friedfertig und naturalistisch erscheint, als wahrer Ochsenkopf, begegnen auf den Siegeln der Linie Meklenburg die verschiedenartigsten Typen, und einigermaßen feststehend wurde hier die Schildfigur erst mit dem vierten Decennium des 14. Jahrhunderts. Vielleicht läßt sich jene Erscheinung dadurch erklären, daß der Kopf nicht den eines gerwöhnlichen Stieres (Bos taurus) darstellen sollte, sondern den jener Rindergattung, welche man heute - fälschlich - Auerochs nennt, die aber bei den Vorfahren Wisent, niederdeutsch Wesent, hieß; zweifellos ist dies scheue Thier vor der Kultur der deutschen Einwanderer gewichen, und werden die Stempelschneider, Schildmaler u.s.w. kaum je eins zu Gesicht gekriegt haben, so daß es ihrer Phantasie anheim=


|
Seite 321 |




|
fiel, das Bild zu gestalten. Wenigstens wurde das Wappenbild der v. Plesse, welches, wie ich glaube, aus dem landesherrlichen Wappen abgeleitet ist, 1360 gradezu Wesent genannt, 1 ) wozu kommt, daß Brehms Beschreibung 2 ) des Auerochsen mit den Siegelbildern Johanns zu Meklenburg und Nicolaus' zu Werle wohl zusammenstimmt; wäre dies auch bei dem Siegelbilde Nicolaus' von Gadebusch der Fall, würde ich noch entschiedener meine Annahme für richtig halten. Inzwischen würde "Wisentkopf" unverständlich und "Auerochskopf" fremdartig sein, so daß "Stierkopf" doch die passendste Bezeichnung bleibt.
Im dritten Abschnitt schildert Herr Teske die Entwickelung des Wappens der Hauptlinie Meklenburg bis 1358. Die Hauptsache ist schon in dem Vorstehenden berührt und erübrigt nur zu sagen, daß die Krone, deren Futter meist in Form von Borten, Fransen, Troddeln unterhalb der Krone bis Mitte des 14. Jahrhunderts sichtbar bleibt, seit 1300 (Nr. 54) die Hörner nicht mitumfaßt, daß das Maul seit eben der Zeit geöffnet ist, die Zunge in dem Vormundschaft=Siegel von 1329 (Nr. 55) und die Zähne 1349 (Nr. 57) zuerst sich zeigen.
Auf dem 1300 zuerst vorkommenden, von Heinrich dem Pilger und seinem Sohne, Heinrich dem Löwen, gemeinschaftlich gebrauchten Secrete (Nr. 60) sehen wir zum ersten Male den Helmschuck der Linie Meklenburg dargestellt. Herr Teske bezeichnet denselben als "Schirmbrett," m. E. nicht mit Recht, denn ein solches besteht doch nur aus einer Platte, während in unserem Falle die Vorrichtung derartig war, daß ein abgestumpfter und zusammengepreßter Kegel, der nach den Siegeln Nr, 60-62 einen glatten Rand und vielleicht cannelierte oder gefelderte Flächen hatte, eine Reihe Pfauenfedern einschloß, welche jederseits mittelst eines Schildes mit dem Stierkopfe, der dann nur halb vor den Federn hervorsah, gesichert wurden. 3 )
Nach dem Erlöschen der Linie Rostock im Jahre 1314 theilten Heinrich der Löwe und Nicolaus II. zu Werle den Besitz, welcher Nicolaus dem Kinde übrig war, während der größere Theil des Landes zu Rostock in Händen des Königs zu Dänemark verblieb. Heinrich, welcher sich sonst Herr zu Meklenburg oder Herr zu Meklenburg und Stargard nannte, hat seitdem einige Male sich auch als Herrn zu Rostock bezeichnet, 4 ) aber in wirklichen Besitz des Landes kam er erst durch die dänische Belehnung vom 21. Mai 1323. In seinem Siegel traf er deswegen keine Veränderung und bloß in seinem Secrete, welches sich vom Jahre 1328 erhalten hat (Nr. 61),


|
Seite 322 |




|
finden sich die vollen Wappen von Rostock - dies vorne - und Meklenburg schlechthin neben einander gestellt. Seines Sohnes Albrecht II. erstes Secret von 1331, Nr. 62, ist dem älteren des Vaters gleich gebildet, ein zweites, von 1342, Nr. 63, zeigt dagegen bloß den Schild mit dem meklenburgischen Stierkopfe gleich dem, welches sein Bruder Johann von Stargard, 1348, Nr. 67, gebrauchte. Aber das mag ihm doch nicht zugesagt haben, und es erscheinen nach einander 1343, 1348, 1350, Nr. 64-66, Secrete von ihm, auf denen man den meklenburgischen Schild bedeckt sieht von einem Helme mit Hörnern, die mit Pfauenfedern besteckt sind, ohne Zweifel demjenigen der Rostockschen Herren, der erste jedoch derartig modificiert, daß der Grind weggelassen, dagegen aber ein halber meklenburgischer Schild, und zwar kammartig zu denken, auf dem Helme angebracht ist, der dritte (herzogliche) so, daß nicht allein der Grind sich zeigt, sondern auch an jeder Seite des Helms eine Hälfte des Stierkopfes. Wie dieses ist auch das 1349, Nr. 68, sich findende Secret des Bruders gehalten.
Der vierte Abschnitt behandelt das Wappen der Linie Werle. Das älteste Siegel, dasjenige von Nicolaus I., ist dem seines Bruders Johann zu Meklenburg, wie schon bemerkt, völlig gleichend, das zweite aber, Nr. 70, hat die Hauer auch nicht mehr, dagegen aber wie alle folgenden das Maul geöffnet; seit 1287, Nr. 75, zeigt sich fast ausnahmlos die Zunge, und länger als in der meklenburgischen Linie umfaßten die Kronen die Hörner. Die dem Stierkopfe jener gegenüber mehr friedfertige Physiognomie des Werleschen will Herr Teske dadurch erklären, daß wegen des Fehlens des Halsfelles der Kopf habe mehr in die Länge gezogen werden müssen, um den Raum des Schildes angemessen zu füllen, doch zeigt das Siegel des Fürsten Lorenz, Nr. 87, daß auch ohne Halsfell eine Uebereinstimmung mit dem Kopfe der Linie Meklenburg zu erreichen war. Ich bin der Meinung, daß jenes friedfertige Aussehen des Werleschen Stierkopfes nicht auf einem bewußten Gegensatze zu der Linie Meklenburg beruht, wie dies umgekehrt bei dem Halsfelle wohl unzweifelhaft der Fall ist, sondern einfach auf Tradition, auf bereits vorhandene Siegel u. dgl. zurückzuführen ist.
Der Helmschmuck der Herren zu Werle bestand in zwei über dem Helme sich kreuzenden Stangen, deren freie Enden je ein Federrad trugen, wie drei Frauensiegel, Nr. 91-93, und das Teterowsche Secret, auch das Warensche Sigill sie zeigen, wenn schon in dem letzten die beiden Federräder, anscheinend aus Raummangel, die Form von Wedeln erhalten haben; auch das Sigill von Neukalen beweist es, da das einzelne Federrad hier als Compendium dient. Herr Teske


|
Seite 323 |




|
ist der Meinung, daß dieser Helmschmuck aus der Verbindung von Nicolaus I. mit der Tochter des Grafen Heinrich I. von Anhalt herrühre. Fast in demselben Jahre, wo Albrecht II. zu Meklenburg das alte Zimier seiner Linie veränderte, geschah dies auch in der Werleschen Linie, indem Nicolaus III. in seinem Secrete, 1344 nachweislich, den gespaltenen Werleschen Schild mit Pfauenfedern besteckt als "Schirmbrett" auf den Helm setzte. 1 ) Ob dabei die Pfauenfedern noch einen soliden Hintergrund hatten, wie es besonders nach Nr. 100 der Fall gewesen zu sein scheint, läßt sich nicht sagen; auf dem Siegel Balthasars von 1417, Nr. 105, ist von einem solchen nichts zu sehen, wogegen auf ihm unter dem, statt auf einem halben Schilde, auf einer halben Scheibe angebrachten halben Stierkopfe eine dem Kamme der Linie zu Meklenburg ähnliche Anordnung sich findet. Zwei Werlesche Herren auf einem Wandgemälde in der Kirche zu Teterow, die dem zweiten Viertel des 14. Jahrhunderts zuzuschreiben sind und Nicolaus III. und seinen Bruder Bernhard II. darstellen werden, tragen bloß Pfauenfederbüsche, aus einer Krone aufsteigend, auf dem Helme. 2 ) Uebrigens blieben auch die Stangen mit den Federrädern in Gebrauch. Tafel 9.
Am Schlusse dieses Abschnittes giebt Herr Teske eine Abbildung der jetzt (seit 1837?) in S. Nicolai in Rostock aufbewahrten und vordem in S. Johannis befindlichen Holzsculptur, welche halberhaben einen Werleschen Herrn darstellt. Nettelbladt vermuthete, daß sie dem Prediger=Kloster 3 ), Herr Teske, daß sie der Karthause Marienehe entstamme, beide aber sehen darin den Fürsten Wilhelm, welcher die Linie zu Wenden beschloß.
Abschnitt 5 ist dem Wappen der durch den dritten Bruder Heinrich oder Burwy III., der seit 1236 sein Land selbständig regierte, gestifteten Linie Rostock gewidmet, welche 1313 oder 1314, nicht 1316, ausging. Sämmtliche Siegel dieser Linie zeigen nicht den Stierkopf, sondern auffallend genug den väterlichen und großväterlichen Greifen, und halten wir dazu, daß der Stifter vor der Zeit, da er seine Herrschaft überkam, stets Heinrich heißt, dann aber, nachdem er jene angetreten, wie in seinem Siegel Burwy sich nennt und bis auf drei Stellen 4 ) auch so genannt wird, so scheint in der


|
Seite 324 |




|
That fast, als habe er auf sein slavisches Blut besonders Werth gelegt. Das Zimier der Linie Rostock ist durch das Secret Nicolaus' des Kindes und das zweite Secret Heinrichs des Löwen überliefert; dasselbe bestand, wie bereits angegeben, aus Hörnern, mit Pfauenfedern besteckt, sammt dem Grinde mit einer Krone darüber.
Der Abschnitt 6 behandelt das Wappen der Linie Parchim=Richenberg, welche durch Pribislav, den jüngsten Sohn Heinrich Burwys II., gestiftet wurde. Das nur in wenigen und kleinen Bruchstücken an Urkunden von 1238 und 1241 erhaltene 1 ) Siegel desselben zeigt einen, nach dem Siegel seines Sohnes zu urtheilen, wahrscheinlich gekrönten Stierkopf; wenn ein Ring zwischen den Hörnern desselben sichtbar ist, so dürfte, wiederum in Beihalt von des Sohnes Siegel, Nr. 110, solcher ohne Bedeutung sein und bloß zum Füllen des Raumes gedient haben. Nach dem tragischen Ende seiner Herrschaft ging Pribislav nach Pommern, wo er die Herrschaft Wollin erwarb, und verschwindet sammt Söhnen und Enkel aus dem Lande.
Hier schiebt Herr Teske auf Grund von Seylers Geschichte der Heraldik zwei Excurse ein, deren ersteren, das Verwandtschaftsverhältniß Pribislavs mit den Herren zu Friesack betreffend, ich auf sich beruhen lassen muß. Den anderen anlangend, so beschäftigt sich derselbe mit dem Lande Dobere, welches Pribislavs I. älterer Sohn, Pribislav II., inne hatte. Seyler nimmt dasselbe für die terra Dobrinensis, das Land Dobrin, welches mit dem Hauptorte Dobrzin oberhalb Thorn auf dem rechten Weichselufer gelegen ist und einst dem Ritterorden von Dobrin, nach der Vereinigung desselben mit dem deutschen Orden diesem, und in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dem Herzoge Kasimir von Pommern zuständig war. Diese Annahme widerspricht der bisherigen, nach welcher das Land Dobere das zu Daber im Kreise Naugard belegene Land sei, wie das Land Belgard in Kassubien - gegensätzlich zu Belgard an der Leba - das zu Belgard an der Persante und das Land Welsenborg das zu Welschenburg, Kreis Dramburg, gehörige. Mich dünkt, als ob diese Annahme so viel augenfällige Wahrscheinlichkeit für sich habe, daß ich sie gegenüber Seylers Vermuthung, die sich nicht auf eine Gleichheit, sondern nur auf eine entfernte Aehnlichkeit von Namen und Schildfiguren stützt, nicht weiter zu vertreten brauche.
Am Schlusse jeder der vier Abschnitte 2-6 handelt Herr Teske von den Tincturen der Wappen, für die aus dem 13. Jahrhundert kein monumentales oder sonstiges Zeugniß sich erhalten hat, wenn seiner Ansicht gemäß der Werlesche Schild in S. Marien zu Röbel


|
Seite 325 |




|
erst aus dem folgenden Jahrhundert stammt, dem auch, wie oben bemerkt, die Werleschen Schilde in der Kirche zu Teterow angehören, welche ursprünglich den Stierkopf völlig weiß auf gelbem Grunde zeigten. Der meklenburgische Schild, welcher, aus der Mitte oder der zweiten Hälfte des 14. Jahrunderts stammend, in einem Fenster der Klosterkirche zu Doberan sich erhalten hat und den Herr Teske auf Tafel 8 unter C abbildet, dürfte dann die älteste farbige Darstellung des Landeswappens sein. Er zeigt in goldenem Felde den schwarzen Stierkopf mit Halsfell, schwarzen Hörnern, das Maul aufgerissen, die Zunge heraushängend und die Krone golden. Völlig damit überein stimmen sowohl das Gelresche Wappenbuch, von dem Herr Teske S. 82 nähere Nachricht giebt, als auch die Miniatur auf dem Titelblatte der Chronik Ernsts von Kirchberg, welche beide ebenfalls dem 14. Jahrhundert angehören (Tafel 7a und 7b). Nicht minder zeigen dieselbe Tingierung die Schilde an den Schranken der Kapelle des h. Grabes hinter dem Hochaltare zu Doberan, sowie das Donaueschinger Wappenbuch, Nr. 167 und Tafel 9a, die beide der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts entstammen, auch Grünenbergs Wappenbuch, Tafel 10a, und das Glasgemälde zu Dargun, Tafel 8, aus der zweiten Hälfte desselben.
Farbige Darstellungen des meklenburgischen Helmschmucks sind uns überkommen aus dem 14. Jahrhundert durch das Gelresche Wappenbuch, und aus dem 15. durch das Donaueschinger und das Grünenbergsche Wappenbuch, sowie die Glasmalerei in der Klosterkirche zu Dargun. Sie geben sämmtlich den Kamm gestreift, und zwar von Roth und Gold, nur Grünenberg hat roth und weiß, was jedenfalls nur ein Irrthum ist. Die Helmdecken haben Gelre gelb mit roth (weiß eingefaßt), Donaueschingen roth und gelb, Dargun blau, roth, gelb (und schwarz) und Grünenberg schwarz und gelb. Wenn Herr Teske der Meinung ist, daß die Farben Roth und Gelb erst eingeführt seien, nachdem die Grafschaft Schwerin von Herzog Albrecht angekauft wurde, so läßt sich so wenig etwas dafür wie dawider sagen; es ist aber immerhin möglich. Uebrigens sind diese Farben offenbar lange die meklenburgischen gewesen, und das Blau ist erst durch die Verordnung vom 26. März 1813 in die meklenburgische Cocarde gekommen, welche die Farben Roth, Blau und Goldgelb haben sollte.
Der Helmschmuck der wendischen Herren ist in Farben nicht überliefert; in Gelres Wappenbuch sind die Stangen, auf die es nur ankommen kann, golden gegeben. Auch die Farben des Rostockischen Zimiers sind nicht bekannt; das der Linie Parchim ist es überall nicht. Jenes, das Rostockische Zimier anlangend, so hat Herr Teske


|
Seite 326 |




|
auf Tafel 3 nach dem Secrete Nicolaus' des Kindes und nach dem zweiten Secrete Heinrichs des Löwen auf Tafel 5 Darstellungen des Rostockischen Wappens gegeben und beide Male die Hörner sammt der Krone golden, die Ohren blau tingiert, indem er den Tincturen des Schildes folgte, wie das auch geschehen ist, als man im 16. Jahrhunderte die Flügel auf dem dritten Helme des meklenburgischen Wappens für das Rostockische Zimier ansah. Nach dem, was Herr Teske S. 81 zu Tafel 6 sagt, scheint es aber, als ob er bezüglich der Tingierung doch bedenklich geworden sei und, wie er es auf letzterer Tafel ausgeführt hat, Schwarz für Hörner und Ohren für angemessener und wahrscheinlicher halte, worin ich ihm völlig beitreten muß, denn wenn die beiden erstgenannten Secrete noch einen Zweifel übrig lassen möchten: die Secrete Albrechts II., Nr. 65 und 66, sowie das zweite seines Bruders Johann, Nr. 68, bezeugen klärlich, daß das Zimier der Rostockischen Linie dem von den drei übrigen Linien geführten Stierkopfe entlehnt ist und den Zusammenhang mit letzteren, die Zugehörigkeit zu denselben ausdrückt. Die Frage, wie die Helmdecke der Herren zu Rostock zu tingieren sei, bleibt eine offene.
Abschnitt 7 betrifft das Wappen der Grafen von Schwerin, welches in Jahrb. XXXIV von Wigger, Beyer und Lisch eingehend besprochen ist. In den Siegeln dieser Grafen zeigen sich zuerst zwei von einander gekehrte, rückwärts schauende Drachen, getrennt durch eine Art Lilie. Im zweiten Siegel Heinrichs I., Nr. 123, ist letztere schon zu einer Pflanze ausgestaltet und wird im vierten Siegel Günzels III., 1252, Nr. 127, zum Bäumchen. So führen es auch Helmold III., 1270, Nr. 128, Nicolaus I., 1279, Nr. 130, auf seinem ersten und 1289, Nr. 131, auf seinem zweiten Sigill, und endlich noch Günzel VI., 1322, Nr. 138. Während nun also Helmold III. im März 1270 angegebenermaßen noch das Drachensiegel gebraucht, siegelt er im September desselben Jahres mit einem neuen, runden, in dem, ohne Schild, frei im Felde ein trabendes Roß sich zeigt, und gleiche Siegel führen auch seine Söhne Günzel V., 1296, Nr. 132, und Heinrich III., 1298, Nr. 133, wie nicht minder wiederum Otto I. von der Wittenburger Linie, 1353, Nr. 152. Die Drachensiegel sind bis auf das erste, Günzels II., Nr. 121, alle schildförmig, und das runde Nicolaus' I., Nr. 131, hat wenigstens Drachen und Bäumchen auf einen Schild gesetzt. Die Längsdurchmesser der schildförmigen Siegel variiren zwischen 6,2 und 7,6 cm, die Durchmesser der runden zwischen 5,6 und 7,1. Von diesen Siegeln sind Nr. 121-123, 129 und 152 als sigillum bezeichnet, während die übrigen bloß ein Compendium zeigen, welches ebensowohl


|
Seite 327 |




|
sigillum wie secretum bezeichnen kann. Dann hat sich eine Reihe runder Siegel im Durchmesser von 4,5 bis zu 3 cm hinab erhalten - nur von Nicolaus II., Nr. 140, ist es parabolisch oder spitzoval -, welche entweder einen Helm mit einem offenen Fluge oder mit einem Gitter, oder aber einen getheilten Schild oder beide, Schild und Helm mit Flug oder mit Gitter, enthalten. Zweifellos sind dies alles Secrete, obschon nur Nr. 135, das Günzels V., mit dem Rosse im Sigill, in der Umschrift als solches bezeichnet ist. Die sechs Frauensiegel haben sämmtlich den getheilten Schild mit oder ohne Helm, Nr. 137, 139, 141, 142, 144, 149. Die oben genannten Gelehrten sind uneins über diese Wappen, doch entscheidet sich Herr Teske für Lischs Meinung, daß sowohl die Drachen mit der Pflanze, wie das Roß keine Wappenfiguren, sondern nur Siegelbilder sind, und insoweit stimme ich ihm völlig zu, stelle aber dahin, ob letztere auch symbolische Bedeutung haben. Jedenfalls ist die paarweise Darstellung von Drachen, Löwen, Engeln u.s.w. neben einer Pflanze oder einem Baume ein uraltes und im Mittelalter höchst beliebtes Motiv, 1 ) und was das Roß anlangt, so scheint mir die Beziehung auf die ursprüngliche Heimath des Grafenhauses doch die zunächst liegende. Das eigentliche Familienwappen ist dann der getheilte Schild gewesen, welcher mit der Grafschaft auf den Käufer überging, während die Verkäufer, Grafen von Teklenburg, ihn gleichfalls weiter führten.
Der Helmschmuck der Grafen bestand in Flügeln, d. h. in "Schirmbrettern" oder platten Köchern, in welche Federn gesteckt waren - auf zwei Frauensiegeln sind jene weggelassen und nur Federn angebracht - und zwar in 7 Fällen, während zwei andere Siegel, Nr. 136 und 140, ein eigenartiges Zinmer zeigen, welches in rechteckiger Gestalt den ganzen Helm oben und seitlich umgiebt und von Wigger als Decke angesprochen wurde, von Herrn Teske aber glaublicher für Flechtwerk erklärt wird. Vielleicht kann es auch eine Art Netz sein. Dieser Helmschmuck findet sich auf dem Siegel Nicolaus' II. von 1326, aber auf dem Siegel desselben vor 1345, Nr. 146, hat er das Ansehen, als ob er aus (gestutzten) Federn oder dergl. hergestellt wäre. Endlich zeigt desselben Grafen drittes Secret in höchst sonderbarer Anordnung zwei getheilte Schilde, von denen der vordere das Gitter, der hintere das Flügel=Zimier trägt. Seyler hat, wie Herr Teske angiebt, diese Zusammenstellung dadurch erklärt, daß derselben der Anfall der Besitzungen des Schwerinschen Hauses an


|
Seite 328 |




|
das Wittenburgische zu Grunde läge, eine Deutung, welche Herr Teske Bedenken trägt, zu acceptieren, die aber doch als die natürlichste und nächste erscheint. Allerdings findet, wie derselbe bemerkt, keine strenge Sonderung in den Bildern der Siegel der beiden Grafen=Linien statt, aber theils hat der letzte Schweriner den Flug als Zimier gebraucht und Nicolaus II. von Wittenburg, der Erbe, das gitterförmige, theils erscheint jenes auffällige Siegel grade, nach dem eben Nicolaus das Schwerinsche Erbe angetreten hatte.
Das Kleeblatt=Kreuz, mit dem Graf Otto I. den getheilten Schild belegt hat, Nr. 145, deutet Herr Teske ebenso wie den Arm, Tafel 7 c, ohne Zweifel zutreffend als persönliche Beizeichen.
Die gräflichen Schilde auf den Siegeln sind bald oben, bald unten rautenförmig schraffiert. Für Mindererfahrene macht Herr Teske mit Recht darauf aufmerksam, daß eine solche Schraffierung im Mittelalter so wenig Metall bezeichne wie Farbe, sondern allein dazu diene, verschieden tingierte Felder oder Heroldsfiguren schärfer zu trennen. Daß aber der Grafen=Schild von Roth und Gold getheilt war, ist nach allen alten Denkmälern unzweifelhaft. Das älteste Beispiel unberechtigter Umstellung der Tincturen ist vom Jahre 1526, Tafel 12. Wenn dann Herr Teske aber, Tafel 4 und 7, die Flügel von Gold und Roth theilt, die Schirmbretter roth, die Federn golden gegeben hat, so kann ich nicht umhin, dies für einen Mißgriff zu halten, denn erstens ist ein solcher Wechsel in der Tingierung an sich nicht gewöhnlich, zweitens findet er sich (auf den Hörnern) in älterer Zeit nur ein Mal, um 1540, Tafel 13, und dann erst wieder in der neuesten Zeit, Tafel 21 und 22 - auch Masch hat im Mecklenburgschen Wappenbuche noch das m. E. Richtige -, und endlich sind in den Siegeln, welche den Schild und den Flügelhelm zeigen, Nr. 142, 143, 145, wie die untere Hälfte des Schildes so auch die "Schirmbretter" übereinstimmend schraffiert. Ohnehin sind goldene Federn von vorne herein nicht recht wahrscheinlich.
Als die Herren zu Meklenburg vom Römischen Könige am 8. Juli 1348 als Fürsten des Reiches und Herzoge anerkannt worden waren, so trafen sie zunächst keine Aenderung in ihrem Wappen, und erst rund zehn Jahre später, als Herzog Albrecht II. die Grafschaft Schwerin erkauft hatte, fing er an sein Secret zu verändern. Diese Wandlung und die weiteren des 14. und 15. Jahrhunderts behandelt Herr Teske im 8. Abschnitte. Albrechts fünftes Secret, Nr. 68, ist zuletzt 1360 nachweislich. Dann findet sich an einigen zu Alholm auf Laland am 28. Juli 1366 ausgestellten Urkunden ein neues Secret, Nr. 165, das sechste, welches höchst roh und ohne Zweifel nur für die besondere Gelegenheit hergestellt ist. Es zeigt


|
Seite 329 |




|
die Schilde von Schwerin und Rostock und einen nunmehr gekrönten Helm darüber, welcher den meklenburgischen Stierkopf als Zimier trägt. Merkwürdiger Weise ist der Helm in Seitenansicht gegeben, und das ist auch auf dem siebenten und letzten Secret Herzog Albrechts II. vom 28. October desselben Jahres der Fall, Nr. 156, welches bei besserer Ausführung genau dieselbe Anordnung zeigt wie das sechste. Albrechts ältester Sohn, Heinrich III., hat in seinem Siegel, Nr. 158, welches ich oben bei Besprechung von Tafel 7 D schon erwähnte, einfach den meklenburgischen Schild und den Schwerinschen Helm darüber, und der dritte, Magnus I., Nr. 159, ein dem väterlichen letzten Secrete gleichformiertes Siegel; beide siegelten aber zu Alholm mit, wie beim Vater, speciell hergestellten rohen Stempeln. Der Sohn Herzog Heinrichs, Albrecht IV., hat in seinem Siegel als Erbe zu Dänemark den Schild mit den drei Leoparden über einander und als Zimier den meklenburgischen Stierkopf, Nr. 157.
Der zweite Sohn Albrechts II., Albrecht III., König in Schweden, ist der erste in unserm landesherrlichen Hause, welcher einen verschränkten Schild, einen quadrierten, gebraucht hat, indem er die Schilde von Schweden, Meklenburg, Rostock und Schwerin in einen einzigen zusammenfaßte, 1385, Nr. 164. Sodann hat Herzog Johann IV., Magnus' Sohn, die Schilde von Meklenburg, Schwerin und Rostock in einem getheilten und oben gespaltenen Schilde vereinigt, wie sein Siegel von 1390 ausweist.
Leider war Herr Teske nicht in der Lage, auch die Siegel des 15. Jahrhunderts seinem Texte einverleiben zu können, und sind wir in Bezug auf jene nur auf seine Reproductionen angewiesen, deren Treue in allem Wesentlichen freilich nicht zu bezweifeln ist. Seine Tafel 8 bringt das Wappen Herzog Albrechts V., 1413, zur Ansicht, welches ziemlich auffallend ist. Sein Schild ist getheilt und oben gespalten, wie Johanns IV., seines Vetters, aber der Stierkopf nimmt nicht den ihm zukommenden ersten Platz ein, sondern den zweiten, und jenes Stelle Schwerin, vielleicht, wie Herr Teske anzunehmen scheint, um den Stierkopf unmittelbar unter den Helm zu stellen. An den Schranken der h. Grabes=Kapelle in Doberan, deren im Verhältniß zu dem oberen Schnitzwerke spätere Entstehung Herr Teske in glücklicher Beobachtung feststellt, findet sich, Tafel 9 a, ein ebenso auffallend verschränktes Wappen, nur daß hier den ersten Platz nicht Schwerin, sondern Rostock einnimmt; Herr Teske vindicirt auch diesen Schild glaubhaft Albrecht V. Den Helmschmuck anlangend, so hat Albrecht auf die früheren Secrete seines Großvaters zurückgegriffen und auf den Helm die mit Pfauenfedern besteckten Hörner von Rostock, jedoch ohne Grind, gesetzt und dazwischen den Kamm


|
Seite 330 |




|
angeordnet, welcher in der Längenachse des Helms zu denken ist, und aus dem der halbe gekrönte Stierkopf, merkwürdiger Weise nicht auf einem Schilde, sondern frei hervorragt.
Johanns IV. älterer Sohn, Herzog Heinrich IV., der Dicke, begnügte sich nicht mit dem Wappen seines jüngeren Bruders Johann V., Tafel 8 B, der einfach den Stierkopf und auf dem gekrönten (!) Stechhelme das Zimier Heinrichs des Löwen, jedoch den halben Stierkopf frei und nicht auf einen Schild gelegt, führte, sondern vereinigte in seinem großen Siegel zu einer Gruppe die Einzelschilde von Meklenburg, Rostock und Schwerin, die, hier zuerst von Schildhaltern, nämlich einem Greifen und einem gekrönten Stiere, gestützt werden. Der Helm, ein gleichfalls erst jetzt erscheinender Spangen= oder Rosthelm, trägt den alten Kamm mit dem aus demselben hervorragenden halben Stierkopfe - hier aber auf einem Schilde - hinter dem ein Pfauenfederbusch sich erhebt, den Herr Teske jedoch in einen Wedel verwandeln zu sollen geglaubt hat, Tafel 9. Das wichtig gemalte Wappen in dem Fenster zu Dargun, 1474/9, zeigt die drei Schilde verschränkt, und so braucht es auch Herzog Heinrichs jüngster Sohn Balthasar.
Von der Linie Werle theilt Herr Teske ein Wappen nach einem Siegel von 1418, ein zweites nach einem von 1436 auf Tafel 9 mit. Jenes zeigt auf einem seitwärts gekehrten Stechhelme vor einem Pfauenfederbusche den halben gekrönten Stierkopf freiliegend, das andere auf vorwärts gewendetem Helme die alten Werleschen Federräder. Die Herren von Werle oder zu Wenden starben aber, wie erinnert, mit dem Fürsten Wilhelm 1436 aus, und fiel deren Land demzufolge an Herzog Heinrich den Dicken und seinen Bruder, Johann V., (gestorben 1442/3), ohne daß dies jedoch zu einer Aufnahme des Schildes von Werle oder Wenden geführt hätte, was sich naheliegend dadurch erklärt, daß letzterer dem meklenburgischen, wenn auch nicht gleich, so doch äußerst ähnlich war, und ebensowenig wurde Heinrichs Wappen beeinflußt durch den Anfall des Landes zu Stargard im Jahre 1471 (durch welchen das ganze Land in einer Hand vereinigt wurde), denn das Stargardische Haus, welches keinen Antheil an Schwerin hatte, führte nur den meklenburgischen Schild.
Herzog Heinrich starb 1477. Seine Söhne Albrecht VI. (gestorben 1483), Magnus II. und Balthasar, der geistlich und Administrator des Bisthums Schwerin war, aber 1479 dies Amt niederlegte und weltlich wurde und demnächst das Land mitregierte, haben sich zunächst eines kleinen Siegels bedient, welches wie auf dem väterlichen Siegel die drei alten hergebrachten Schilde enthält, die Herzog Balthasar


|
Seite 331 |




|
aber in der Folge wieder zu einem Schilde zusammenfügte. Dann aber, nachweisbar zuerst 1483, nach Herzog Albrechts Tode, erscheinen die Schilde von vier Feldern mit einem Mittelschilde und 1489 ein großes Siegel mit eben dem Wappen, bedeckt von einem seitlich gestellten Spangenhelme, welcher einen Pfauenspiegel über dem Kamme trägt, auf den ein halber gekrönter Stierkopf rechtshin (!) gelegt ist. Im ersten Felde des Schildes zeigt sich der meklenburgische Stierkopf, im zweiten der Greif des Landes Rostock, im dritten, rothen, ein nackter, mit einer Binde (dwele) umschlungener linker Arm, der einen Ring hält, und im vierten der Stierkopf der Linie Werle, während der Mittelschild die Grafschaft Schwerin repräsentiert, eine Wappenvereinigung, welche zwar nicht rationell ist, die aber Herr Teske mit Recht durch Rücksicht auf figürliche und farbliche Wirkung erklärt.
Ueber dies fünffeldige Wappen, welche unsere Landesfürsten bis 1658 von nun an führten, handelt Herr Teske im 9. Abschnitte und bespricht zunächst das dritte Feld mit dem ringhaltenden Arme, welches seit lange das Kreuz der Heraldiker gewesen ist. Daß der Arm das Land Stargard repräsentiert, ist ja zweifellos und die Frage vielmehr die, ob dies Wappenbild dem Siegel der Stadt Fürstenberg entnommen sei, oder ob diese Stadt ihr Wappen dem landesherrlichen entlehnt habe. Herr Teske vertritt die, meines Wissens zunächst von Lisch 1 ) ausgestellte erstere Annahme und verwirft die ältere Ansicht, nach welcher die Erwerbung des Landes Stargard vermittelst Heirath durch den ringhaltenden Arm symbolisiert sein soll. Herr Teske ist der gewiß richtigen Ansicht, Seite 15, daß die Beherrscher eines Landes oder Volksstammes sich nicht nach einem Sinnbilde dieses bei ihren Wappen gerichtet hätten, sondern daß vielmehr das Umgekehrte der Fall gewesen sei, und wenn dem so ist, so ist es, auch wenn man die veränderten Seiten in Anschlag bringt, nicht wahrscheinlich, daß die Herzoge von der Stadt Fürstenberg das Wappen des Landes Stargard entnommen haben sollten, da dieser doch ein minder bedeutender Ort war und zudem von Hause aus gar nicht zum Lande Stargard gehörte, wie Herr Teske auch bemerkt. Dies tritt auch in den zunächst frappierenden, von Lisch mitgetheilten Urkunden von 1405, 1408 und 1475 zu Tage, in denen die Ausstellenden sich nicht bloß Grafen zu Fürstenberg, sondern auch Herren zu Stargard nennen, so daß sie sich offenbar dessen bewußt waren, daß die Grafschaft Fürstenberg etwas Besonderes sei und nicht ein Theil der Herrschaft Stargard. Ein Anderes wäre es, wenn der ringhaltende Arm als Fürstenbergisches Wappenbild vor 1483


|
Seite 332 |




|
nachweisbar wäre, aber es hat sich kein älterer Abdruck eines Siegels der Stadt Fürstenberg erhalten als von 1568, und da könnte doch leicht derselbe Wechsel stattgefunden haben wie bei Grabow, welches ein nichtssagendes Bild an die Stelle des Ritters S. Jürgen setzte, oder bei Stavenhagen, wo ein Stierkopf an Stelle des Pommerschen Greifen trat. Endgültig ist die Frage nur zu entscheiden, wenn sich ein mittelalterliches Siegel der Stadt Fürstenberg finden sollte, wozu freilich wohl kaum Hoffnung ist.
Herzog Magnus starb 1503, Balthasar 1507. Die von ihnen höchst wahrscheinlich gestiftete Tafel des Hochaltars im Dome zu Güstrow zeigt in dem am Fuße des Kreuzes angebrachten herzoglichen Wappen die ersten deutlichen Spuren des Verfalls des Stils, das Eindringen einer willkürlichen, weder an die Ueberlieferung, noch an die Wirklichkeit sich bindenden Formengebung und Ornamentik; der Schild ist beiderseits symmetrisch geschweift, sein oberer Rand ein flacher Kreisbogen und, während der Helm den Kamm trägt, auf welchem vor einem Pfauenbusche der halbe Stierkopf liegt, ist er doch nicht seitlich, sondern vorwärts gerichtet. Endlich hat hier, wie Herr Teske Seite 88 angiebt, der Stierkopf zuerst den Nasenring, welcher demnächst auf Siegeln Herzog Albrechts VII. von 1509 (Seite 55) und 1519, Tafel 12, erscheint und, bald silbern, bald golden, bis 1857 constant geblieben ist. Seit 1516 (!), auf Marschalks Holzschnitt, wird das Halsfell symmetrisch gestaltet, seit 1519 fängt man an den Stargardischen Arm zu bekleiden und 1526 zeigt sich zuerst der Stierkopf des Landes Wenden schräge gelegt und in seitlicher Ansicht, auch der Schwerinsche Schild von Gold und Roth getheilt statt von Roth und Gold. Vielleicht ist schon 1516 das Schirmbrett oder das "Pfahlwerk" auf dem meklenburgischen Helme in mehreren Farben und sind die Kronen der Stierköpfe roth tingiert worden, wenn beides auch erst durch ein 25 Jahre später hergestelltes Werk bezeugt wird, Tafel 12 c und Seite 90. Jedenfalls wird man einen ansehnlichen Posten von Rixners Schuldconto abschreiben müssen und ist es wohl nicht billig, wenn Herr Teske jenen als Betrüger bezeichnet. Die Fabeleien, welche Rixners Schrift enthält, übertreffen ja allerdings noch die Erfindungen Marschalks, aber es scheint doch, als wenn beide ebenso an ihre Phantasmen geglaubt haben, wie die Hexen des 16. und 17. Jahrhunderts an ihr Hexenthum. Gleichzeitig mit Rixner und möglicherweise ihm zuzuschreiben sind nur die weißen Hörner der Stierköpfe und die Verwechslung des Rostockischen und des Schwerinschen Helmes, insofern die Rostockischen Hörner nach Maßgabe des Schwerinschen Schildes, die Schwerinschen Flügel nach den Farben von Rostock tingiert wurden; daß sie überhaupt auf den


|
Seite 333 |




|
Schild gesetzt wurden, wird einem Entschlusse der Herzoge zuzuschreiben sein 1 ).
Für die Folge ist zu bemerken, daß wie die Theilung des Schwerinschen Schildes von Gold und Roth statt von Roth und Gold, so auch die Uebereck=Theilung der Hörner von Gold und Roth die Oberhand gewann und anscheinend bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die herrschende wurde. Die alte Schild=Theilung von Roth und Gold drang aber im 18. Jahrhundert wieder durch, und wurden demgemäß auch, wie es scheint, die Hörner von Roth und Gold getheilt. So hat es auch noch Masch (M. W.=B.), und ist es auch geblieben bis 1857, wo man die Schildtheilung zwar beibehielt, auf den Hörnern aber die Tincturen umkehrte, da Lisch irrthümlich, wie Herr Teske durch seine Abbildungen nachweist, meinte, die Hörner seien so am häufigsten dargestellt. Die Tingierung der Flügel ist abgesehen von Tafel 17 D nur einmal, um 1540, Tafel 13, abgeändert, wo sie sich von Gold und Blau getheilt zeigen.
Am Schlusse dieses Abschnittes folgen noch Mittheilungen über diverse Darstellungen des landesherrlichen Wappens, die jedoch mehr die Kunstgeschichte als die Heraldik angehen, ohne Zweifel aber recht willkommen sind.
Abschnitt 10 giebt die Geschichte der Wappenbilder für die Fürstenthümer, vordem Bisthümer, Schwerin und Ratzeburg, welche im Westfälischen Frieden Meklenburg zur Entschädigung zugesprochen worden waren. Daß die Herzoge nicht gewillt waren die alten Wappen dieser Bisthümer, welche ihnen als Fürstenthümer überwiesen waren, zu übernehmen, ist erklärlich genug. Herzog Adolf Friedrich hat schon, wie es scheint, auf die Einfügung zweier neuer Felder nebst entsprechenden Helmen in das landesherrliche Wappen gedacht, doch ist es bei seinen Lebzeiten nicht dazu gekommen. Sein Sohn und Nachfolger Herzog Christian Louis erörterte bald nach seinem Regierungsantritte diese Angelegenheit mit seinen Räthen, welche vorschlugen für Schwerin "einen außgestrecketen springenden Greiffen im blawen Felde, oben auffm Helm einen halben fliegenden Greiffen (wie Anthyrius)" und für Ratzeburg "ein gelbeß Creutz, auff den Ecken etwaß zerspalten nach Arth, wie eß der Johanniter=Orden gebrauchet, in rohtem Felde, oder dem Creutz ein Fürstenhutt und auff dem Helm 7 estandarden." Herzog Christian Louis war damit aber nicht zufrieden, sondern wollte noch zwei Felder haben, eins wegen Parchim und eines wegen Güstrow, womit er aber bei


|
Seite 334 |




|
seinem Vetter Gustaf Adolf glücklicher Weise keinen Anklang fand, so daß es bei jenen zwei Feldern mit den entsprechenden Helmen verblieb. Lisch hat schon darauf aufmerksam gemacht, Jahrbuch VIII, Seite 34, daß das für Schwerin bestimmte Wappen dem Rixnerschen Werke seinen Ursprung verdanke, wo auch die für Parchim und Güstrow beabsichtigten Wappen sich finden, aber es ist auffallend, daß bezüglich Schwerins in dem Aktenstücke, welches Herr Teske mittheilt, einem Berichte des Hofmarschalls Wackerbart, die untere Hälfte des Feldes nicht erwähnt wird, und der von Lisch, Jahrbuch XXV, Seite 102, angezogene Regierungsbeschluß besagt, der Greif solle auf einem viereckigen grünen Plan mit silberner Einfassung stehen, ohne Quertheilung des Schildes (!?), während doch wohl jenes Actenstück eben den Regierungsbeschluß enthält. Sicher ist, daß der "Plan", eine Doppelleiste, wie Herr Teske sagt, von vorneherein da ist, daß aber die weiße Einfassung, ohne welche die Farbenzusammenstellung abscheulich, erst allmählich sich entwickelt, wie Tafel 17 und die Siegelabbildungen zu Seite 68 klärlich ergeben. Das Kreuz für Ratzeburg haben die Räthe nicht motiviert. Wenn sie es als Johanniter=Kreuz bezeichnen, so haben sie nicht das von graden Linien begrenzte im Auge gehabt, sondern ein dem Ankerkreuze ähnliches. So findet es sich aber eigentlich nur auf Christian Louis' Siegeln. Schon Gustaf Adolf von Güstrow gestaltete es nach Art eines Pattenkreuzes und ließ die Krone darüber fort, tingirte es auch silbern statt golden. Diese Tingierung blieb bei Bestand und wenigstens bis in dies Jahrhundert auch die Form des Kreuzes, wo dasselbe ziemlich unheraldisch durch ein gewöhnliches Lateinisches Kreuz ersetzt wurde. Wenn Lisch a. a. O. sagt, das Kreuz solle das Kreuz Christi sein, so widerspricht dem die erste Form sowohl wie die zweite, und steht davon auch nichts in dem Wackerbartschen Berichte. Oder liegt der Angabe von Lisch noch ein anderes Aktenstück zu Grunde?
Abschnitt 11 handelt von den heraldischen Prunkstücken, Rang= und Würde=Zeichen in vier Kapiteln, deren erstes die Helmkrone, den Helmwulst, das Halskleinod und die Helmdecken bespricht. Eine Helmkrone zeigt sich zuerst 1380 oder 1392 bei Herzog Johann IV., welcher einen Stierkopf als Zimier führte - ebenso ist das Wappen im Codex Seffken (Tafel 7 a) dargestellt - und gleichzeitig bei Herzog Rudolf von Stargard, dessen Helmschmuck Hörner bilden (Tafel 7). Recht unpassend schließt auf dem Helm Herzog Heinrichs d. ä. von Stargard eine Krone den Kamm ein (Tafel 8). Seitdem dann die drei Helme, die um 1530 auf dem Schilde angeordnet wurden, alle Kronen erhalten hatten, sind solche bis auf die Gegenwart beibehalten.


|
Seite 335 |




|
Mit dem 17. Jahrhundert erscheinen die nichtssagenden Halskleinode. Im Allgemeinen richteten sich die Farben der Helmdecke nach denjenigen des Zimiers; - doch ist dies keineswegs ohne Ausnahme - und sind, so weit der Codex Seffken ein Urtheil in dieser Hinsicht zuläßt, namentlich in allen den Fällen, wo Thierköpfe oder Rümpfe von anderer Tinktur, als derjenigen des Schildes, das Zimier bildeten, die Helmdecken in den Farben jener gehalten, ja es finden sich, wenn man auf die Zürcher Wappenrolle in dieser Hinsicht sich verlassen darf, welche die Helmdecken nur andeutet, viele Fälle, wo letztere Tincturen zeigen, die sonst im Wappen gar nicht vorkommen, z. B. 11, 15, 28, 31, 51, 59, 60 u.s.w. Der offenbar höchst zuverlässige Codex Gelre hat die Helmdecken im Anschluß an den Kamm gelb und roth (mit Weiß bordiert) und mit ihm stimmt das Donaueschinger Wappenbuch, während sie im Codex Seffken im Einklange mit Grünenbergs Wappenbuch nach den Schildfarben schwarz=gelb gegeben sind. Vielleicht hat man sich in der Wahl der Farben eben so wenig an das Herkommen gebunden, wie bezüglich der Helmzierden. Herr Teske hat überall Schwarz und Gold für die Helmdecken gewählt, wogegen sich nichts einwenden läßt, und nur bei dem Wappen Herzog Heinrichs III., Tafel 7, eine Ausnahme gemacht, deren Berechtigung nicht in die Augen springt. In den Darguner Fenstern erscheinen dann die Helmdecken in den sämmtlichen Farben des Schildes: (Schwarz), Gold, Blau und Roth, welche auch festgehalten wurden, als man drei Helme auf den Schild von fünf Feldern setzte.
Das zweite Kapitel dieses Abschnittes behandelt die Schildhalter. Die Mittheilungen über diese, welche Herr Teske bringt, bestätigen die allerdings nicht unbekannte Thatsache, daß deren Wahl einzig dem persönlichen Ermessen anheim lag. Die ersten Schildhalter, welche in unserem Fürstenhause begegnen, finden sich, wie bereits angegeben, auf dem großen Siegel Herzog Heinrichs des Dicken im Jahre 1452 und bestehen in einem gekrönten Stiere und einem Greifen. Herzog Magnus, sein Sohn, wählte zwei Engel und dessen Bruder Balthasar zwei Greifen, die auch Herzog Johann Albrecht I. beliebte (Fürstenhof zu Wismar), während für vier von ihm gestiftete Epitaphien im Dome zu Schwerin Schildhalter gewählt sind, welche diejenigen, denen sie gewidmet sind, charakterisieren sollen. Herzog Ulrich bevorzugt dann wiederum Stier und Greifen, wie das wenig erfreuliche Wappen von Cromeney, Nr. 211, beweist. Herzog Christian Louis wählte bald Löwen, bald Stier und Greif, Engel oder Putten, welch letztere auch auf Herzog Adolf Friedrichs II. Siegel sich finden, während Engel auch noch von Karl Leopold gebraucht wurden, doch haben von Friedrich Wilhelm I. an alle


|
Seite 336 |




|
Herzoge einen (ungekrönten) Stier und einen Greifen vorgezogen, für die Stempelschneider, Maler u.s.w. eine ebenso schwierige, wie in der Regel übel genug gelöste Aufgabe.
Zu Kapitel 3, welches von den Rangkronen handelt, möchte ich nur bemerken, daß es mir näher zu liegen scheint die Krone in Nr. 179 und 212 als Huldigungen des Gemahls anzusprechen (Spr. Sal. 12,4), denn als Rangkrone. Abgesehen von der Krone auf dem Wappen der Königin von Dänemark, Tafel 15, dürfte die erste Rangkrone in unserem landesherrlichen Hause die auf einem Siegel des Herzogs Christian Louis von 1650 sein; wenig später erscheint sie auf Siegeln seiner Brüder Gustaf, Rudolf und Friedrich, jedesmal als Reifen, der mit Blättern besetzt ist, als Herzogskrone. Später fügte der Erstgenannte noch Bügel hinzu und Futter; sowie er auch einen Mantel einführte. Er sowohl wie Herzog Gustaf Adolf setzten die Helme in verschiedenen Siegeln auf die Krone, auch die Herzoge Adolf Friedrich II. und III., dann aber enthielt man sich ihrer, und erst 1815 erscheinen sie wieder im Strelitzschen Hause (Tafel 20, D). Dagegen wurde der Mantel seit Annahme der großherzoglichen Würde Seitens unseres Fürstenhauses beliebt und seit 1840 erscheint dieser ebenso wie der Schild mit der Krone bedeckt.
Das vierte Kapitel handelt von Würdezeichen, Orden: Herzog Christian Louis ist der erste, welcher letztere seinem Wappen beigegeben hat.
Abschnitt 12 ist überschrieben: Das Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in der Gegenwart. Während im Mittelalter die Wappen nach wirklichen Vorbildern, mindestens aber nach Siegeln u.s.w., denen solche zu Grunde lagen, hergestellt wurden, gestatteten sich seit dem ersten Viertel des sechszehnten Jahrhunderts die Künstler und Kunsthandwerker allerlei vermeintliche Verbesserungen und Verschönerungen, welche von den Auftraggebern übersehen oder, da auch sie in die Zeitströmung hineingerissen waren, gebilligt wurden. Nicht anders die Herzoge, die kaum sich um die Einzelnheiten gekümmert und vielmehr nur auf die Darstellung des Wappens in seiner Totalität ihr Auge gerichtet haben werden. So mußten Abweichungen und selbst Fehler in das landesherrliche Wappen eindringen, in welchem alle Perioden, Renaissance, Barock u.s.w. ihre Spuren hinterließen, ihre Ballhornisierungen verübten, die zum Theil und zum größeren Theile mit einer gewissen Pietät bis auf die neuere Zeit beibehalten sind. Die Zeit war noch nicht da, die Heraldik kritisch zu behandeln und künstlerisch wieder zu verwerthen. Erst der Bau des Schlosses zu Schwerin, in welchem, und zwar im Thronsaale, das Großherzogliche Wappen angebracht werden sollte, gab Anlaß, daß Lisch, welcher Einzelnheiten bereits früher behandelt hatte,


|
Seite 337 |




|
mit einer Untersuchung und Feststellung desselben beauftragt wurde. Ob bezüglich der Revision etwaige Direktiven ergangen sind, welche die wünschenswerthen, beziehentlich nothwendigen Emendationen einschränkten, oder ob die Vorschläge zu solchen nicht allenthalben die Allerhöchste Billigung fanden, oder ob Lisch die Grenzen selbst sich enger gesteckt hat, ist nicht bekannt, und sicher allein, daß eine Richtigstellung nur in allerbescheidenster Weise stattgefunden hat, Unrichtigkeiten konserviert und selbst neue hineingetragen sind. So aber zurecht gemacht ist das Großherzogliche Wappen 1857 authenticiert und auch 1871 von S. K. H. dem Großherzoge von Strelitz acceptiert worden. Darstellungen giebt Herr Teske auf Tafel 21. Dann hat S. K. H. Großherzog Friedrich Franz III. 1884 eine neue Revision durch Wigger angeordnet, welche ein ziemlich gleiches Resultat hatte. Nach dieser Revision hat Herr Doepler jun. die Wappen, ein Staats= und ein persönliches Wappen, prachtvoll künstlerisch dargestellt, wie Herr Teske sie auf Tafel 22 und 23 zeigt.
Hieran schließen sich Erläuterungen zu den Tafeln, welche durch einen Ueberblick über den Einfluß der verschiedenen Stilrichtungen auf die Formierung der Wappen eingeleitet werden und Auskunft geben, welche Siegel oder sonstige Monumente den einzelnen Darstellungen zu Grunde liegen. Daß Herr Teske, wie man erfährt, bei dem unverhofften Anwachsen des Materials sich veranlaßt gefunden hat, die hervorragendsten heraldischen Kunstdenkmäler in genauester Abbildung einzuschalten, dazu kann man ihn nur beglückwünschen.
Nur einige dieser Erläuterungen geben zu Bemerkungen Anlaß. Das der Mitte des 14. Jahrhunderts angehörige Wappenbuch Gelre hat, wie oben bereits angegeben, die Helmdecken des meklenburgischen Wappens gelb mit einem weiß bordirten rothen Querstreifen in Uebereinstimmung mit der Tingierung des Kammes. Herr Teske vermuthet, wie ebenfalls oben schon bemerkt, daß letztere übernommen sei aus den Farben des gräflich Schwerinschen Schildes, die Darstellung also nach 1358 anzusetzen sei, und mag darin immerhin Recht haben, was sich allerdings nicht entscheiden läßt. Wenn derselbe aber ferner meint, der Streifen sei möglicher Weise der Fahne Herzog Heinrichs des Löwen im Schweriner Stadtsiegel entnommen, so scheint dies doch zu weit hergeholt und steht auch einigermaßen in Widerspruch mit dem, was er der Vermuthung Wiggers bezüglich der Aufnahme des Stierkopfes durch Nicolaus von Gadebusch mit Recht entgegensetzt.
Bezüglich der gestickten leinenen Decke des Claren=Klosters zu Ribnitz hat Herr Teske eine überaus schöne Entdeckung gemacht, indem er, was einem Lisch nicht gelang noch auch anderen, welche nach diesem das Räthsel zu lösen versuchten, ermittelte, auf welche Personen


|
Seite 338 |




|
die auf besagter Decke befindlichen Wappen zu deuten seien, so daß sich nunmehr die Zeit der Anfertigung der Stickerei ziemlich genau bestimmen läßt; Herr Teske ist geneigt, dieselbe in das Jahr 1376 zu setzen. Lischs Beschreibung der Decke 1 ) ist, wie Herr Teske bemerkt, nicht accurat genug, da letztere offenbar aus zwei verschiedenen Stücken zusammengesetzt sei. Um aber ein Urtheil über die ursprüngliche Bedeutung der Decke zu gewinnen, dazu reicht dasjenige, was Herr Teske angiebt, auch nicht hin, doch glaube ich, daß sie wahrscheinlicher ein Vesperale als ein Dorsale war. 2 )
Die Vermuthung, daß die Bilder in der Sakristei (oder Kapitelhaus) zu Schwerin, S. 85, in innerem Zusammenhange mit denen der h. Bluts=Kapelle gestanden hätten, kann ich nicht theilen und bemerke nach bester Quelle, daß die Figur zur Rechten der Muttergottes dort so beschädigt war, daß es unmöglich war zu erkennen, ob dieselbe einen Mann oder ein Weib darstellen solle; Lisch entschied für das weibliche Geschlecht.
Sehr angenehm und schätzenswerth ist die Beigabe der Stammbäume unseres Fürstenhauses und der Grafen zu Schwerin, beide nach Wigger, mit den Angaben der bezüglichen Wappen.
Herr Teske hat durch seine Arbeit nicht bloß hoffentlich die Zufriedenheit seines Allerhöchsten Auftraggebers erworben, sondern auch um die Heraldik, die ein Franzose die Algebra der Geschichte genannt hat, im Allgemeinen, sowie um die vaterländische Kulturgeschichte im Besondern sich verdient gemacht. Das Werk läßt weitere Forschungen, allgemeiner Art wenigstens, auf lange Zeit hinaus überflüssig scheinen, und deswegen, und weil der unvermeidlich hohe Preis Wenigen es ermöglichen wird, sich in den Besitz desselben zu setzen, habe ich geglaubt, eingehend darüber hier berichten und eine Analyse des Buches geben zu sollen. Dadurch, und nicht etwa durch Uebermaß von Widerspruch und Ausstellungen, ist diese Anzeige zu einer auffälligen Länge gediehen. Die Freude an den schönen Abbildungen vermag ich freilich nicht zu übermitteln; solche ist nur durch eigene Anschauung zu gewinnen. Welche Mühe auf die Tafeln verwendet ist, wird man daraus ermessen, daß z. B. zur Herstellung des Titels nicht weniger als ungefähr 20 verschiedene und genau in einander passende Zeichnungen nöthig waren, die wiederum alle einzeln gedruckt werden mußten. Letztere Arbeit ist in der bekannten Starckeschen Anstalt auf das Vorzüglichste ausgeführt und der Buchdruck in der Bärensprungschen Officin tadellos hergestellt.
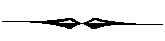


|
Seite 1 |




|



|


|
|
:
|
- Zum Wappen der v. d. Lühe
- Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496
- Zur Geschichte der S. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz
- Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen
- Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock
| LIX, 1 | October 1893. |
Quartalbericht
desVereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
| Inhalt: | Geschäftliche Mittheilungen. II. Wissenschaftliche Mittheilungen: 1) Zum Wappen der v. d. Lühe. 2) Verzeichniß der Pfarrer im Lande Stargard 1496. 3) Zur Geschichte der St. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz. 4) Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen. 5) Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock. |
Die erste Quartalversammlung des 59. Rechnungsjahres konnte wegen mannigfacher Behinderung der Ausschußmitglieder erst am 16. October, dem dritten Montage dieses Monats, abgehalten werden. Gegenwärtig waren alle Mitglieder des Ausschusses mit Ausnahme des ersten Präsidenten und zweier Repräsentanten.
Nach dem Berichte über die Vereinsmatrikel sind im abgewichenen Vierteljahr 7 Mitglieder ausgeschieden, davon 2 durch den Tod. Diese sind:
1) der Geh. Hofrath Mau, Bürgermeister von Neukalen, Mitglied seit 4. October 1853, gest. am 11. Juli;
2) der Hofrath Peters zu Schwerin, Mitglied seit 9. December 1892, gest. am 27. Juli.
Ihren Austritt haben erklärt die Herren: Consistorialrath Praefke=Neustrelitz, Finanzrath Dr. Duelberg=Köln, Professor Dr.Paasche=Marburg, Justizrath Kundt=Schwerin; erloschen ist die Mitgliedschaft des vor einigen Jahren nach Ungarn ausgewanderten Herrn H. Thormann jun.


|
Seite 2 |




|
Neue Mitglieder haben wir 6 gewonnen in den Herren:
1) Steinfatt, Cand. theol. zu Schwerin,
2) Saul, Pastor zu Retgendorf,
3) Gille, Hofkapellmeister zu Schwerin,
4) Dr. Ernst Burmeister in Berlin,
5) Professor Dr. Beeck, Lehrer an der Kadettenanstalt zu Plön,
6) Böhmer, Cand. theol. zu Schwerin.
Der Mitgliederstand ist demnach von 500 auf 499 herabgegangen.
Aus den Verhandlungen der Versammlung ist Folgendes mitzutheilen: Es wurde beschlossen, an Nichtmitglieder des Vereins kein Honorar für gelieferte Beiträge zum Meklenburgischen Jahrbuche zu zahlen, was übrigens auch bisher nicht geschehen ist.
An Stelle des ausgeschiedenen Herrn Geh. Justizraths Schlettwein wurde gemäß der Ermächtigung der General=Versammlung Herr Dr. Voß, Custos an der Großherzoglichen Regierungsbibliothek, zum Bilderwart gewählt. Zugleich wurde beschlossen, die Bildersammlung fortan durch Ankauf zu vervollständigen, den Ankauf jedoch auf Meklenburgica zu beschränken. Im Bibliotheks=Ausschusse wurde der Herr Geh. Justizrath Schlettwein durch den Herrn Geh. Finanzrath Balck ersetzt.
Die Vereinsabende der Schweriner Mitglieder sollen auch im kommenden Winter in der üblichen Weise, möglichst in jedem Monat einmal, an Sonnabenden abgehalten werden.



|


|
|
:
|
1.
Zum Wappen der v. d. Lühe.
Das Gebrauchen eines fremden Siegelstempels ist so selten nicht; Dr. Techen hat aus dem geringen Urkunden=Vorrathe des Wismarschen Rathsarchivs 19 Fälle aus dem 15. Jahrhundert notirt, wo dies ein Mal, 3, wo es zwei Mal, und 3, wo es mehrere Male von ein und derselben Person geschehen ist. Durchstehend sind aber doch, wo fremde Petschafte benutzt wurden, solche von Geschlechts=,


|
Seite 3 |




|
zuweilen auch von Standesgenossen genommen. In drei Fällen wird die Anwendung des fremden Stempels in der Urkunde ausdrücklich bemerkt, und namentlich von Herzog Albrecht 1473 und 1479. 1 ) Sehr viel auffallender und eigenartig ist aber ein anderes im Wismarschen Rathsarchive beobachtetes Vorkommniß. Dort findet sich nämlich ein von einem Achim v. d. Lühe an Wismar 1491 Montags nach Jubilate gerichteter, ersichtlich von einem Schreiber geschriebener Brief, in dem er sich beklagt, daß Wismarsche Einwohner bei nächtlicher Weile seinen Mann Namens Szuel mit Hab und Gut aus Tesmannstorf entführt hätten. Auf dem Briefe ist gut ausgedrückt und wohl erhalten ein Siegel mit Papierdecke befindlich, rund, 27 mm im Durchmesser, welches einen breiten dreieckigen Schild zeigt, aus dessen Ecken je ein Zwiebelgewächs mit drei Blättern zur Mitte gerichtet ist, und zwischen glatten Ringen die Umschrift hat:
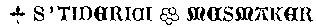

Wer Tideke Mesmaker war, habe ich nicht ermitteln können. Zunächst denkt man, daß der Schreiber des Briefes zum Schließen desselben ein ihm gehöriges Petschaft, welches jedoch nach Form des Schildes und der Schrift sehr viel älter ist und für einen Anderen angefertigt sein müßte, benutzt habe. Aber das ist nach einer zweiten Thatsache denn doch nicht der Fall. Es wird nämlich in dem gedachten Archive auch ein Schreiben des Ritters Heinrich v. d. Lühe zu Buschmühlen vom Tage der h. drei Könige des Jahres 1492 aufbewahrt, welches zweifellos von derselben Hand ausgefertigt ist, die den Brief Achims schrieb, und dieses ist besiegelt mit einem Siegel, rund, 27 mm im Durchmesser, welches einen breiten dreieckigen Schild zeigt, enthaltend einen gestürzten gezinnten Giebel, und zwischen glatten Ringen die Umschrift hat:


|
Seite 4 |




|
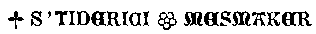

Die Größe dieses Siegels, der Schild, die Umschrift mit ihrer Einfassung sind also genau dieselben, wie bei dem erstgedachten Siegel, und nur die Schildfigur ist verschieden, so daß zwischen 1491, April 25. und 1492, Januar 6. der Stempel umgearbeitet sein muß, wobei die beiden oberen Zwiebeln in Zinnen, die untere in die Giebelblume verwandelt wurden, die Schildfigur freilich auf den Kopf gestellt ist. Mit demselben Stempel hat 1501 der Ritter Hinrich auch die bischöfliche Confirmation der canonischen Horen zu U. L. Frauen zu Wismar besiegelt.
So wenig wie ich Tideke Mesmaker nachweisen kann, ebensowenig habe ich ermitteln können, wie nahe Achim v. d. Lühe dem Ritter Hinrich stand, und muß daher auf jeden Versuch verzichten zu erklären, wie der Stempel von jenem in die Hände dieses kam, und weshalb dieser reiche Mann sich mit einem so elenden, ja, strenge genommen, falschen Petschafte begnügte.
In Jahrbuch 52, S. 20 habe ich die Helmzier der v. d. Lühe besprochen und die bisher bekannt gewordenen Verschiedenheiten desselben mitgetheilt. Nun verdanke ich der Gefälligkeit des Herrn F. v. Meyenn die Nachricht von einer bisher unbekannten Form, welche ein Schreiben überliefert, das von Hennings v. d. Lühe auf Panzow Wittwe Katharina, geb. v. Rantzow, um 1530 an Herzog Heinrich gerichtet ist. Dieselbe sagt darin, Herr (!) Otto v. d. Lühe, der in der Kapelle zu Neubukow mit Schild und Helm begraben sei, habe als rechter Erbe seiner Lehne Panzow, Ilow und Vogelsang diese seinen drei Söhnen hinterlassen, die dann auch alle verstorben seien. Jetzt hätten Kord und Otto v. d. Lühe die Güter eingenommen, die zwar gleichen Schild führten, aber ein anderes Helmzeichen, nämlich


|
Seite 5 |




|
nicht Pfauenfedern wie jene, sondern ein Jungfrauen=Brustbild, und niemand habe ein größeres Recht auf die Güter, als er, der Herzog. Dieser scheint nähere Nachforschungen befohlen zu haben, insbesondere Zeichnungen der Wappen, welche jedoch nicht geeignet gewesen sein werden, um auf Grund derselben die damaligen Inhaber der Güter außer Besitz zu setzen; deren Nachkommen haben sie bis 1784 bezw. 1606 innegehabt. Uebrigens ist auch von einem Herrn - also Ritter - Otto v. d. Lühe im 15. Jahrhundert nichts bekannt und bisher auch kein Siegel oder sonstiges Denkmal aufgefunden, welches als Helmzier des v. d. Lüheschen Wappens Pfauenfedern zeigte, so daß die Aussagen der Wittwe Phantasien gewesen sein werden.



|


|
|
:
|
Verzeichnis der Pfarrer im Lande Stargard 1496.
Bei einer Durchsicht der Bederegister vom Jahre 1496 hat sich ein ziemlich ausführliches Verzeichniß der Pfarrer im Lande Stargard ergeben. Diese haben hier die Abgaben ihrer Beichtkinder selbst eingetrieben und danach die Richtigkeit in den Registern durch eigenhändige Namensunterschrift beglaubigt. Eine Zusammenstellung der Pfarrer dürfte für eine Geschichte der katholischen Kirche in Meklenburg während der letzten Jahrzehnte nicht ohne Wichtigkeit sein.
| Woldegk: | Matthias Sachß. | ||
| Göhren: | Johannes Smydt. | ||
|
Teschendorf
Loiz |

|
Andreas Schallyn | |
|
Käbelich
Petersdorf |

|
Mattheus Platow. | |
|
Schönhausen
Voigtsdorf |

|
Kristianus Landesbarch. | |
|
Lindow
Golm |

|
Gherardus Smidt. | |
|
Schönbeck
Brohm Cosa |

|
Nicolaus Ukermann. | |
|
Badresch
Mildenitz Helpt |

|
Nicolaus Voß. |


|
Seite 6 |




|
|
Ballin
Plat |

|
Thomas Isermenger. | |
|
Sadelkow
Glineke Staven |

|
Nicolaus Kedyngk. 1 ) | |
|
Kublank
Neezka Ruhlow |

|
Hinricus Hoppenrot. | |
|
Herbrechtshagen
Rehberg |

|
Arnoldus Wasmunt. | |
| Kölpin: | Albertus Dewytze. | ||
| Salow: | Johannes Beckmann. | ||
|
Klokow
Schwichtenberg |

|
Johannes Wraneke. | |
|
Wittenborn
Kotelow |

|
Johannes Stregez (?). | |
|
Eichhorst
Lipen |

|
Ebellus Monnick. | |
|
Roga
Bassow |

|
Nicolaus Wulf. | |
|
Genzkow
Jatzke |

|
Christianus Vornym. | |
| Willershagen: | Hermannus Slef. | ||
|
Lübbersdorf
Rattei |

|
Cristofferus Westval. | |
| Bresewitze: | Johannes Gregor. | ||
|
Sponholz
Küssow Trollenhagen Podewall |

|
Hinricus Wulff. | |
|
Neverin
Glocksin Neddemin Ganzkow |

|
Johannes Stoltenborch. |


|
Seite 7 |




|
| Warlin: | Peter Vischer. | ||
| Pragsdorf: | Johannes Schulte. | ||
| Georgendorf: | Georgius Sluter. | ||
|
Neuenkirchen
Ihlenfeld |

|
Hinricus Rosendal. | |
|
Brunn
Roggenhagen |

|
Johannes Smet. | |
|
Dahlen
Beseritz Schwanbeck |

|
Conradus Leppin. | |
|
Pasenow
Holzendorf |

|
Johannes Rutenbarch. | |
| Rowa: | Hinricus Betke. | ||
|
Stargard
Sabel Quastenberg Dewitz |

|
Jacobus Rodekerk. | |
|
Godenswege
Riepke Kammin |

|
Nicolaus Kersten. | |
|
Warbende
Quadenschönfeld Gramelow |

|
Bartholdus Ghilow, viceplebanus. |



|


|
|
:
|
Zur Geschichte der S. Katharinenkapelle zum Heiligen Moor bei Sanitz.
Die erste und bisher einzige Mittheilung über die Kapelle zum Heiligen Moor hat Lisch im Meklenburgischen Jahrbuch Nr. 38, S. 48-52, gemacht. Dort ist Alles zusammengefaßt, was die Forschung bis dahin zu Tage gefördert hatte. Inzwischen sind im hiesigen Großherzoglichen Archiv vier weitere urkundliche Nachrichten aufgefunden worden, die ich an dieser Stelle zum Abdruck bringe. Die erste ist ein undatirter Brief der Priester und Kirchgeschworenen der Kapelle zum Heiligen Moor an die Herzoge Magnus und Balthasar, die von 1480 bis 1503 gemeinschaftlich regiert haben. Aus diesem Briefe, der von gewissen Geldhebungen der Kirche zu Sanitz,


|
Seite 8 |




|
die aber der Kapelle zum Heiligen Moor zugewiesen waren, handelt, geht hervor, daß die Kapelle noch am Ausgange des 15. Jahrhunderts mit Priestern und Kirchgeschworenen versehen war.
Vnßen vnderdanighen steden willighen denst;
ghnedighe leue here, hochgebarene forste, wy
armen lude jwer hochgebarner gnade breff wol
(wol) vornamen hebben scryuende vmme welkes
offers willen edder pensien der kerken to
Zanttze,
1
)
des ßodane pensie edder ghelt nu noch nicht by
vs is vnde wy doch ßunderch anßeghent hebben,
des wy vnberaden ßint myt vßen lenheren vnde
andern erbaren framen luden, de deme gadeshuße
vnde der hilghen ju[n]cfrowen sunte Katrynen
gudes ghunnen, des jwen forstlyken gnaden wol
bericht mochte werden amme anstanden sunte
Marghareten daghe, jwe forstlyke gnade mochte
don dorch god vnde nemen dat arme gadeßh
 s an gude boscherminghe.
s an gude boscherminghe.
Scr[euen] vnder der kapellen sig[illum].
|
Prestere
vnde kerkßuaren der cappellen
tomm
Hilghen More. |
Nach dem undatirten Original auf Papier im Haupt=Archiv zu Schwerin. Das Siegel fehlt.
2. In einem Rechnungsbuche über ausstehende Schuldforderungen der Kirche S. Marien zu Wismar vom Jahre 1500 heißt es: "Tho Clastorpe Seghebant van Ortzen vnde Achym syn sone tho lutken Tessyn by dem hilligen More."
3. Um 1025 bekennt Claus Eckelenberg im gerichtlichen Verhör, daß "Hanne thome Hilligen More" ihn und seine Spießgesellen "gehuset vnde geheget hefft." Es ist demnach zu jener Zeit neben der Kapelle mindestens noch ein Wohnhaus zum Heiligen Moor vorhanden gewesen.
4. Der Kammergerichtsbote Jacob Rüß bescheinigt, daß er die kaiserliche Achtserklärung wider den Ritter Henning v. Halberstadt 1529 "vff den XXII. tag Septembris verkundt vnnd offenntlich angeschlagen [habe] an die Kirchtir zu dem Hailigen mure."


|
Seite 9 |




|



|


|
|
:
|
Wie das Klockengeleutte angefangen und auffgehört über die hochfürstlichen Verstorbenen.
Den 28. Februarj ist über die durchl. Herzogin von Mekl[enburg] Selige 1 ) das geleutte bei den Wöbeliner auffgehöret und fangen ins kunfftige die Hohen Woster und Kronscamper an.
Den 30. Januarj ist angefangen zu leutten wegen des tödlichen absterben der weyandt Durchl. Fürstin von Strelitz 2 ) und soll damit laut hochfürstl. Befehl alle tag 1 Stunde 4 wochen continuiret werden. Noch gestorben Durchl. hertzl. Printzeßin Juliana[ 3 ) zu Rühn und 4 wochen geleutet.
Den 26. Febr. ist angefangen zu leutten über der hochsel. Durchl. Printzeßin Magdalenen 4 ) auß Gustraw.
Den 21. Jun. ist auf ergangenen hochfürstl. Befehl wegen höchstseel. absterbung der in die 47 Jahre regierenden Röm. Kays.Maj. H. Leopoldt I. 5 ) zu leuten angefangen und biß den 4. Jul. incl. damit continuiret, auch Orgel und Music eingestellet worden.
Den 3. Jun. ist nach ergangenem Hochfürstl. Befehl sub dato 30. Maji wegen Höchstseel. Hintrits aus dieser Zeitligkeit pl. tit. Herrn Hertzogs Adolff Fridrichs 6 ) Durchl. zu Strelitz mit allen Glocken Mittags zwischen 12 und 1 Uhr zu laüten angefangen und damit 4 Wochen continuiret worden.


|
Seite 10 |




|
Den 31. May wurde ad mandatum Serenissimi Ihro Kaiserl. Maj. Josephus I. 1 ) glorwürdigsten Andenckens mit allen glocken belaütet und damit biß den 14. Jun. exclus. continuiret, auch das Orgel=Schlagen und Music durchgehents auf 14 tage eingestellet.
Ad mandatum Serenissimi ist die Durchl. Land=Gräfin von Heßen=Kaßel, gloriosissinnae memoriae, Maria Amelia, 2 ) welche den 16. Jun. a. c. zu Weilmünster Höchstseeligst verblichen, auf 4 Wochen mit allen Glocken nebst einstellung der Orgel, auch aller anderen Musik, belaütet und damit den 9. Aug. angefangen und biß den 5. Sept. incl. damit continuiret worden.
Nach Hochseel. Absterben der Durchl. Abtißin Marie Elisabeth 3 ) zu Ganderßheim ist 4 Wochen mit allen Glocken geleütet und am 28. Maji Dom. Exaudj damit angefangen worden.
Den 31. Juli sind Sr. Hochfürstl. Durchl. Herr Hertzog Fridrich Wilhelm, höchstseel. Andencken, in ihrem Erlöser Jesu Christo sanft und seelig in der Chur=Fürstl. Residentz Mayntz eingeschlaffen. Ad mandatum Serenissimi Ducis Caroli Leopoldi wurde der hochseel. Herr belaütet 14 Tage, des Tages 3 mahl, alß Morgens von 8 biß 9, Mittags von 12 bis 1 und Nachmittages von 3 biß 4, womit alhie angefangen am 20. Aug. und biß 2. Sept. incl. continuiret wordenn. Am 3. Sept. wurde nur 1 mahl des Tages gelaütet, nemlich von 12 biß 1 Uhr Mittags, womit biß den 11. Novembr. incl. continuiret ward.
Am 25. Febr. 1714 ging das Gelaüte wieder mit allen Glocken Mittags zwischen 12 und 1 Uhr an und continuirte biß auf den hochfürstl. Begräbnüs=Tag, war der 13. Mart. 1714, an welchem Tage 3 Stunden gelaütet wurde, alß von 8 biß 9 Morgens, war die Stunde vor der Leich=Predigt, eine Stunde nach der Leich=Predigt und Abends zwischen 8 und 9 Uhr, da der verblichene hochfürstl. Cörper beygesetzet wurde. Die Leichpredigt ist alhie von M. Jo. Frid. Frahm, Pastore et p. t. Praeposito, über den letzten vers


|
Seite 11 |




|
im Proph. Daniel gehalten; zu Lübbelow aber, weil es nicht gebräuchlich, nicht geprediget worden, welches denen Hh. Successoribus zur Nachricht hierin verzeichnet ist.
Den 15. Octobr. 1719 ist zum Laüten, ad mandatum Serenissimi, vor die höchstseeligst verstorbene verwittwete Herzogin zu Güstrau, Magdalena Sibilla, 1 ) der anfang gemacht v. auff 6. Wochen täglich 2 Stunden, nemlich von 11 bis 12 uhr, v. Nachmittags von 3. bis 4. continuiret worden.
1722 den 16. Maji ist die verwittwete durchleuchtigste Hertzogin zu Grabow, Cristina Willhelmina, 2 ) höchstseel. Andencken, in ihrem Erlöser J. C. sanft v. seelig entschlaffen. Vor dieselbe ist ad Mandatum Serenissimi anfängl. 6 Wochen im gantzen Lande des Tages 2 mahl rp. von 11 bis 12 v. von 3 bis 4 uhr gelaütet worden. Selbiges gelaüt fing an den 21. Junii v. continuirte bis den 2. August. Anno 1723 den 22. Junii ward wieder des Tages 2 mahl, als von 11 bis 12 v. Nachmittags von 3 bis 4 Uhr vor derselben zu laüten angefangen v. continuirte 8 Tage bis den 30. Junii inclus., als den Tag nach der Bestätigung, da sie denn in der Schloß=Capelle zu Grabow den 29. Jun. abendts, und eine Parentation von Hrn. Präpos. M. Z. Becker gehalten, beygesetzet wardt. Folgenden Tages hielte der Hr. Superintendens D. Engelke die Leichen=Predigt oben in der Schloß=Capelle; in der Stadt=Kirche unten Hr. Past. Hincke, v. im gantzen Grabauschen Ambte hielte an diesem Tage ein jeder Prediger an seinem Orte die Leichen=Predigt.
Anno 1724 den 23. Jan. ist ad Mandat. Sereniss. vor die verwittwete verstorbene Czarin, Ihre Hoheiten Durchl. Mamma, 3 ) zu laüten angefangen, täglich eine Stunde von 12 bis 1 Uhr, v. solches bis nach Verlauff 4 Wochen, den 20. Febr., continuiret worden.
Anno 1726 den 3. Nov. ist ad Mandat. Sereniss. vor die durchl. Hertzogin zu Würtenberg=Juliusburg, Frau Anna Sophia gebohrene Hertzogin von Mecklenburg, 4 ) 4 Wochen täglich eine Stunde von 12 bis 1 Uhr gelaütet worden.


|
Seite 12 |




|
Anno 1733 den 16. Aug. ward vor Ihr Hoheiten Catharina Ivanowna, 1 ) unsers reg. Herrn Hertzogs Cal Leopold Durchl. Fr. Gemahlin, die Trauer und 1stündiges tägl. Gelaüte von 11 bis 12 Uhr intimiret und zugleich das Kirchen=Gebeth mit Auslaßung der Vorbitte vor den durchl. Herren Herzog Christian Ludwig zum ersten abgelessn. Ao. 1733 Festo Natalitiorum ward die Trauer geschloßen.
Anno 1735 den 29. Juli des Morgens um 10 Uhr starb die Allerdurchl. verwittibte Königinn von Preußen Sophia Louysa 2 ) zu Sverin auf dem Schloß, nachdem sie seit dem Febr. ins 23. Jahr mit stiller Einsahmkeit, anfängl. bis Anno 1725 zu Grabau (da der Brand kam) daselbst, hernach einige Wochen hieselbst aufm alten Schloß, und endl. zu Sverin gelebet.
Anno 1746 domin. Jubilate den 1. Maj. fing ad
mandatum Seren. regnantis das Geläute täglich 2
Stunden, als des Morgens von 9 bis 10 und des
Nachmittags von 4 bis 5, an wegen Absterben
unsers durchl. reg. Herren eintziger durchl.
Printzeßinn Tochter, Fürstinn und Frau, Frau
Anna,
3
) vermählete Hertzoginn zu
Braunschweig und Lüneburg, gebohrne Hertzogin zu
Mecklenburg
 . cum pleno titulo. Obiit durch
eine hitzige Kranckheit den 7. Mart.
4
) a. c. [Der durchl. Fürstinn und
Frauen, so Ao. 1718 den 18. Decembr. gebohren,
Tauf=Nahme war Elisabeth Catharina Cristina, als
sie aber am Rußischen Kayserl. Hofe kam, Ao.
1732, bekam sie der damahligen Kayserinn Nahmen
Anna, bekannte sich 1733 zur Griechischen
Religion und führte den Titul Kayserl. Hoheiten.
Dero durchl. Herr Gemahl Antonius Ulricus ist
gebohren Ao. 1714, den 28. Aug.]
. cum pleno titulo. Obiit durch
eine hitzige Kranckheit den 7. Mart.
4
) a. c. [Der durchl. Fürstinn und
Frauen, so Ao. 1718 den 18. Decembr. gebohren,
Tauf=Nahme war Elisabeth Catharina Cristina, als
sie aber am Rußischen Kayserl. Hofe kam, Ao.
1732, bekam sie der damahligen Kayserinn Nahmen
Anna, bekannte sich 1733 zur Griechischen
Religion und führte den Titul Kayserl. Hoheiten.
Dero durchl. Herr Gemahl Antonius Ulricus ist
gebohren Ao. 1714, den 28. Aug.]
Das Geläute hat auf anderweitige hochfürstl. Verordnung, - lief den 17. Maj. ein -, gedauret bis den 23. Maj. Unterm 7. Jun. lieff aus Dömitz hochfürstl. Ordre ein, daß auf Johannis=Tage alle Musique wieder völlig sollte erlaubet seyn.
Anno 1747 den 28. Nov. ist der durchl. reg. Herr Hertzog Carl Leopold zu Dömitz seel. entschlafen, besiehe hohe Verordnung wegen anzustellender Beläutung im Anfange dieses Kirchen=Buchs pag. 8. 5 ) ad annum et diem dictum. Dieses 3=stundige Glocken=


|
Seite 13 |




|
Rühren traf in Weynachten, Neu=Jahr, Heil. 3 Königen ein. Damit nun Neustädter gewöhnl. Gottesdienst, so um 8 Uhr des Morgens anfänget, bleiben könne, so ward der Gemeine angezeiget, daß der Küster dreyviertel auf acht des Morgens den Gottesdienst zu intimiren anfangen, auch die große Glocke getreten werden würde. Wann nun aber Glock 8 hochfürstl. Geläute sich anhübe, so solle gleich nach dem 1sten Puls die Gemeine gegenwärtig seyn und die Schule mit Gesang anheben. Ist auch woll von staten gegangen. Scripsi ob tempora insecutura!
Der hochfürstl. Befehl, datiret den 4. (?) Febr. 1748, lief durch den Hrn. Sup. Pölchowen den 9. Febr. per Currend. hier ein, daß nunmehro in allen Kirchen mit dem vorhin verordneten Geläute bis zu weiterer Verordnung eingehalten werden solle. Allso ward hier und zu Lübb. 1 ) das einstündige Geläute sofort mit 5 Wochen den 10. Febr. geschloßen.
Anno 1748 den 13. Apr. starb in Gott höchstseeligst des jetzt regierenden Herrn Hertzogs Christian Ludwig durchlauchtigste Frau Gemahlin Gustava Carolina. 2 ) Das Geläut ward auff hohe Verordnung Serenissimi regnantis eben also veranstaltet wie Serenissimi regnantis Caroli Leopoldi b. m. Beläutung, neml. 14 Tage hindurch 3 mahl des Tages und nachhero nur einmahl. Von dom. Misericord. Domini biß Dom. II p. Tr[initatis] hatte dieses Gelaut seinen Anfang und Ende. Die hochfürstl. Leiche ist übrigens in der Stille vom hochfürstl. Schloß in der Schelffkirche zu Schwerin beygesetzet.
Anno 1749 den 28. Jan. ward die Leiche des hochseel. Hertzogs Carl Leopolds von Dömitz und nach Dobbran zur Beysetzung in dortiger hochfürstl. Begräbniß abgefahren, so daß die Leiche dicto die erste Station allhie zu Neustadt hatte. Die Glocken wurden bey Ankunfft dieser hochfürstl. Leiche, als auch des andern Morgens bey der Abfahrt geläutet. Es hatte diese Leiche zum Geleit die hertzogl. Gvarde zu Pferde, 12 Trabanten aus denen Städten, 2 Hoff=Marchalle vorauff fahrende, und 9 Nobiles hinter der Leiche folgende. Des Nachts über ward die Leiche ohne aller Pracht in des Schlachter Rabens Hause auff dem Markt placiret und ist des andern Tages von hier gefahren auff Crivitz, Sternberg, Ruhne biß sie endl. den 1. Febr. zu Dobran angelanget. Das Geläut ist nur veranstaltet an denen Ohrten, wo die Leiche durchpassiret, doch höre, daß man


|
Seite 14 |




|
zu Sternberg nicht mit einem Geläut empfangen, wohl aber hat die Leichfolge urgiret, daß bey der Abfahrt die Glocken gezogen worden.
Anno 1749 den 30. May starb des ehemaligen durchl. regierenden Hertzogs Friderich Wilhelm hinterlaßene Gemahlin Wittwe, Ihro Durchl. Sophia Charlotte aus dem land=gräfflichen Hause Heßen=Cassel. 14 Tage hindurch ward dieser hohe Todes=Fall des Tages 3 mahl beläutet und demnegst noch 14 Tage des Tages einmahl. Den 22. Jul. ist der fürstl. Leichnam von Bützow aus nach Schwerin zur stillen Beysetzung in der Schelf=Kirche, wo deroselben durchl. Gemahl seeligst im Herrn ruhet, abgefahren worden.
Anno 1775 starb die durchlauchtigste Prinzeßin Amalia, Schwester Sr. Durchl. des regierenden Herzogs Friederich, am 24. Sept. Mittags um 12 Uhr und ward 4 Wochen, täglich die Stunde von 12 bis 1 Uhr, beläutet.
Anno 1778 am 11. Sept. Vormittags gegen 12 Uhr sturben der durchl. Prinz Ludwig und wurden 6 Wochen hindurch tägl. von 12 bis 1 Uhr beläutet.
Anno 1785 den 23. Aprill wurden unser durchl. regierender Landes=Herr, Herzog Friederich, am 23ten Aprill Vormittags etwan um 9 Uhr von einem Schlag=Fluße so heftig getroffen, daß Sie nach demselben sogleich Besinnlichkeit, Sprache und Empfindung verlohren, auch aller von den Arzten angewendeten Mittel und Versuchen ohnerachtet zur Wiedererlangung des durch den Schlag Verlornen nicht konnten wieder gebracht werden, in diesem traurigen Zustande noch bis am 24ten Morgens gegen 7 Uhr lebeten, aber um diese Zeit ihr theures Leben endigten.
Anno 1791 den 2. Aug. starb zu Hamburg des wail. durchl. Herzog Friedrich nachgel. Frau Witwe, Louise Friederike, geb. Herzogin zu Würtemberg, im 70. Jahre Ihres Alters an den Folgen eines Schlagflusses und ward 6 Wochen beläutet.
Anno 1794 den 2. Jun. starb der durchl. regier. Herzog Adolph Friedrich IV. zu Mecklenburg= Strelitz und ward 14 Tage beläutet.
Anno 1794 am 29. Nov. starb der Frau Erbprinzessin Sophia Friederika von Dänemark 1 ) Königl. Hoheit und ward 4 Wochen beläutet.


|
Seite 15 |




|
Anno 1801 am 4. Jan. starb der Frau Erbprinzessin von Sachsen=Gotha Luise Charlotte 1 ) Durchl. und ward vom 11. Jan. d. J. an 4 Wochen beläutet.
Anno 1803 am 24. Sept. starb der herzogl. Meckl. Schwerin. Frau Erbprinzessin Helena Paulowna Kays. Hoheit und ward 6 Wochen beläutet.
Anno 1808 am 1. Jan. starb die durchl. regierende
Herzogin Luise, geb. Herzogin von Sachsen=Gotha,
im 52. Jahre ihres Lebens, welche seit ao. 1781
bis 1807 incl. durch den Pr. Lorenz an die
hiesigen Armen quartal. 85
 . 24 ßl. N
2
/
3
hatte vertheilen
lassen. Sie ward 6 Wochen beläutet und zwar die
ersten 14 Tage 2 Stunden, nämlich 12 bis 1 und 3
bis 4 Uhr.
. 24 ßl. N
2
/
3
hatte vertheilen
lassen. Sie ward 6 Wochen beläutet und zwar die
ersten 14 Tage 2 Stunden, nämlich 12 bis 1 und 3
bis 4 Uhr.
Anno 1810 am 2. Aug. starb die durchl. Herzogin Fr. Mutter, verwittw. Prinzessin Ludwig, Charlotta Sophia, geb. Herzogin von Sachsen=Coburg, im 79. Jahre ihres Alters und ward wie die vorige beläutet.
Aimo 1813 am 17. Sept. starb des durchl. regier. Herzogs Prinzeß. Tante Ulrike Sophia 2 ) im 91. Jahre ihres Alters und ward 14 Tage beläutet.
Anno 1816 am 20. Januar starb die durchl. Frau Erbgroßherzogin Carolina Luise Königl. Hoheit, geb. Herzogin von Sachsen=Weimar, und ward 3 Wochen tägl. 1 Stunde beläutet.
Anno 1816 am 6. Nov. starb seine Königl. Hoheit Carl, erster Großherzog von Mecklenb.=Strelitz, am Schlagflusse und ward 14 Tage tägl. 1 Stunde beläutet.
Am 29. November 1819 starb seiner Königl. Hoheit der Erbgroßherzog Friederich Ludwig von Mecklenb.=Schwerin, im 42. Jahre seines Alters und ward 6 Wochen hindurch jeden Tag 1 Stunde beläutet.
Aus dem Kirchenbuche von Neustadt. (Mitgetheilt von F. v. Meyenn.)


|
Seite 16 |




|



|


|
|
:
|
Ein Erlaß des Herzogs Adolf Friedrich I. an Bürgermeister und Rath zu Rostock.
Vnsern gnedigen Gmß zuvor. Ersahme liebe Getrewe. Wir werden glaubwurdig berichtet, daß vnter Vnser Burgerschafft in öffentlichen Wirtsheußern, Wein= vnd Bierschencken von itzigen, zwischen beiden benachbarten Cronen entstandenen Irrungen fast unbesonnene Discurse vnd Reden gefuhret werden, da ein jeglicher nach seiner Einbildung, bald von der einen, bald von der andern Parthey, vngebuhrlicher Reden sich vernehmen leßet, welche nachgehends yon Fremden oder Andern, die sie anhören, vbel auffgenommen vnd an solche Örter hinterbracht werden, darauß Vnser erbvnderthenigen Stadt eine große Gefahr vnd vber dem schon aufm Halß liegenden noch mehres Vnheil zuwachsen können; Wann sich dan solches keinesweges geziemet vnd Burgern, von burgerlichen Sachen vnd Handthierung zu reden, von Königen vnd Potentaten vnd derselben Actionibus aber reine Mund zu halten, in allewege gebuhret, - Alß sollet ihr hiemit ernstlich befehliget sein, solche vnd dergleichen vngeziemende Reden durch ein offentliches Befehl bey hochster, auch nach Befindung bey Leib= vnd Lebensstraffe nicht allein ernstlich zu verbieten, besondern auch fleißige Nachfrage deßhalber anzustellen vnd, da jemand ewer Burger von einer oder ander Parthey schimfflicher gefuhrter Reden vberwiesen werden konte, denselben dergestalt exemplariter zu bestraffen, daß ein ander sich drob zu spiegelen, auch die durch solche Unbesonnenheit offendirte Parthey drob ein genugsahmes Contentement haben vnd also durch ein vnd ander leichtfertiges Maul Vnser erbvnderthenige Stadt nicht in besorgliche Vngelegenheit gesetzet werden möge. Habens etc. vnd wir verbleiben etc.
Schwerin, den 3. Febr. Ao. 1644.
Nach dem Concept im Haupt=Archiv zu Schwerin.
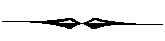
Schwerin, im October 1893.
Der zweite Sekretär:
F. v. Meyenn.


|
Seite 17 |




|



|


|
|
:
|
| LIX, 2. | Januar 1894. |
Quartalbericht
desVereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
| Inhalt: | 1. Geschäftliche Mittheilungen. II. Wissenschaftliche Mittheilungen: 1) Unbekannte meklenburgische Pläne und Ansichten. 2) Die Kapelle zum Heiligen Moor. 3) Die goldenen Freitage. 4) Der Wustrowsche Wassertag. |
Die zweite Quartalversammlung wurde am Montag, den 8. Januar, im Lesesaale der Großherzoglichen Regierungsbibliothek abgehalten. Mit Ausnahme des ersten Präsidenten waren alle Ausschußmitglieder zugegen. Den Vorsitz führte der zweite Präsident, der die Versammlung um 5 1/4 Uhr Nachmittags eröffnete.
Nach dem Berichte des zweiten Sekretärs über die Vereinsmatrikel sind im ersten Quartale 4 Mitglieder ausgeschieden, davon 2 durch den Tod. Diese sind:
1) der Drost von Koppelow zu Grevesmühlen, Mitglied seit dem 15. November 1862, gestorben am 28. October;
2) der Rittergutsbesitzer von Haase auf Wiebendorf und Roggendorf, Mitglied seit dem 2. November 1882, gestorben am 18. November.
Ausgetreten sind:
1) der Medicinalrath Dr. Schröder zu Berlin, Mitglied seit 1882, und
2) der Pastor Lange zu Börzow bei Grevesmühlen, Mitglied seit 1883.
Neue Mitglieder haben wir 4 gewonnen in den Herren:
1) Pastor Brakebusch zu Herzfeld,
2) Baron v. Maltzan auf Puchow,
3) Rentner J. F. Zimmermann zu Wismar und
4) Oberforstmeister Peterson zu Friedrichsmoor.


|
Seite 18 |




|
Die Gesammtzahl unserer ordentlichen Mitglieder bleibt demnach unverändert 499.
Unter den correspondirenden und Ehren=Mitgliedern haben sich Veränderungen nicht zugetragen.
Es wurde beschlossen, mit dem "Vereine für Rostocks Alterthümer" in Schriftenaustausch zu treten.



|


|
|
:
|
Unbekannte meklenburgische Pläne und Ansichten.
Seitdem A. Gloeckler in seinen Berichten über die
Bildersammlung des Vereins (Jahrb. XIX-XXIV)
außer den Mittheilungen über den Bestand der
Sammlung auch eine Uebersicht über die Werke
gegeben hat, in welchen er Bilder
 . von Meklenburgischen Orten und
Personen gefunden hatte, ist für den weiteren
Ausbau einer meklenburgischen Ikonographie wenig
geschehen, obwohl dieselbe in ihren beiden
Zweigen für die Personal= wie für die
Ortsgeschichte oft sich nicht unwichtig erweist.
Nur für die Pläne meklenburgischer Orte giebt
meine "landeskundliche Litteratur" S.
18-29 (und Nachträge S. 487, 488) eine
Uebersicht, deren Vollständigkeit ich aber schon
in den einleitenden Bemerkungen S. IX zu
bezweifeln Anlaß nahm. Gerade bei der relativen
Unvollständigkeit der meisten Sammlungen solcher
Abbildungen,
1
) auf
deren Zusammenbringung öffentliche Anstalten
meist wenig Gewicht legen können, sowie bei der
Zerstreutheit mancher Blätter in größeren
Sammelwerken - theilweise solchen Titels, daß
nur ein Zufall Meklenburgisches darin finden
läßt -, ist hier noch manche Lücke auszufüllen.
Noch mehr, ja fast alles ist bei den Ansichten
zu thun. An eine Bearbeitung des gesammten
meklenburgischen Bildermaterials zu gehen, ist
m. E. überhaupt noch nicht möglich. Ein paar
Bausteine zu einer solchen Zusammenstellung zu
geben, sei mir im Folgenden erlaubt, da die drei
Blätter, welche mir ein glücklicher Fund in die
Hände gab, völlig unbekannt zu sein scheinen.
. von Meklenburgischen Orten und
Personen gefunden hatte, ist für den weiteren
Ausbau einer meklenburgischen Ikonographie wenig
geschehen, obwohl dieselbe in ihren beiden
Zweigen für die Personal= wie für die
Ortsgeschichte oft sich nicht unwichtig erweist.
Nur für die Pläne meklenburgischer Orte giebt
meine "landeskundliche Litteratur" S.
18-29 (und Nachträge S. 487, 488) eine
Uebersicht, deren Vollständigkeit ich aber schon
in den einleitenden Bemerkungen S. IX zu
bezweifeln Anlaß nahm. Gerade bei der relativen
Unvollständigkeit der meisten Sammlungen solcher
Abbildungen,
1
) auf
deren Zusammenbringung öffentliche Anstalten
meist wenig Gewicht legen können, sowie bei der
Zerstreutheit mancher Blätter in größeren
Sammelwerken - theilweise solchen Titels, daß
nur ein Zufall Meklenburgisches darin finden
läßt -, ist hier noch manche Lücke auszufüllen.
Noch mehr, ja fast alles ist bei den Ansichten
zu thun. An eine Bearbeitung des gesammten
meklenburgischen Bildermaterials zu gehen, ist
m. E. überhaupt noch nicht möglich. Ein paar
Bausteine zu einer solchen Zusammenstellung zu
geben, sei mir im Folgenden erlaubt, da die drei
Blätter, welche mir ein glücklicher Fund in die
Hände gab, völlig unbekannt zu sein scheinen.
In einem von mir erworbenen Bande von Klüver's Beschreibung von Meklenburg fanden sich außer der kleinen Schreiber'schen Karte


|
Seite 19 |




|
von Meklenburg (Landesk. Litt Nr. 133) zwei Ansichten von Rostock und ein Plan von Wismar eingeklebt, die bisher nirgends angeführt waren und über deren Herkunft ebenso wenig etwas bekannt war. Alle drei entstammen dem Augenscheine nach aus dem 17. Jahrhundert.
1. Rostock. Bild des Stadtbrandes 1677. Ansicht von der Warnow aus, Inschrift auf einem Bande in der Mitte: ROSTOCK., in der Ecke links oben (vom Beschauer) steht der (heraldisch) nach links gekehrte Greif in mit wehenden Bändern verziertem Schilde, oben rechts in eben solchem Schilde das Rostocker Stadtwappen. Am rechten oberen Rande die Plattennummer oder Seitenzahl des zugehörigen Buches 443. Bildgröße 62 X 241 mm. Das Bild überraschte mich durch manche auffallende Ungenauigkeit neben anderen genau aufgeführten Kleinigkeiten; St. Petri schien ganz zu fehlen, so daß ich schon geneigt war anzunehmen, dieselbe sei von den Rauchwolken völlig umhüllt. Durch den auffälligen Umstand aber, daß alle Kirchen die Thürme im Osten statt im Westen hatten, trotzdem aber das Nordoktogon an St. Marien deutlich zu erkennen war, sah ich mich veranlaßt, das Bild einmal im Spiegel zu betrachten. Sofort ergab sich klar, daß der Stecher den Prospekt nach einem anderen Bilde auf die Kupferplatte übertragen hatte, aber versehentlich richtig, so daß nun derAbdruck die Stadt verkehrt, im Spiegelbilde, zeigt. Den Rauch und die Flammen dagegen hat er an die richtige Stelle gebracht, so daß in Wahrheit die Neustadt in Flammen steht, die auf dem Abdrucke eben den Platz der Altstadt einnimmt.
Auf dem unteren Rande befindet sich der
anscheinend ziemlich gleichzeitig
handschriftliche Vermerk: "Aus des
verunruhigten Hollandschen Lowens. X
 Theil." Nach manchem
vergeblichen Suchen, diese Quelle aufzufinden,
fiel mir durch Zufall in die Hände: "Der
verunruhigte Holländische Löw, worinnen der
völlige Verlauf aller merkwürdigen Begebenheiten
. . . in diesem Holländischen Krieg . . . 1671
bis . . Nov. 1672 . . . beschrieben wird . . .
ins Hochteutsche übersetzt Durch AMADEUM von
Fridleben, Freiburgens. . . . Nürnberg, Zu
finden bey Johann Hoffmann, Kunsthändlern. Anno
1673. 12º. XII. 307 S. m. 20 Kupfern."
Ferner fand ich in einem Antiquariats=Cataloge
angezeigt: "Der wiedererwachte
Niederländische Löw enth. e. Continuation des
Holl. Lowen . . . O. O. 1673." So mögen
noch mehrere Fortsetzungen sich angeschlossen
und während der mir vorliegende Band nur
Holländisches behandelt, später auch
gleichzeitige andere Ereignisse dargestellt
haben, wie das vielfach geschah. Für einen
Nachweis des betr. Bandes wäre ich sehr dankbar.
Theil." Nach manchem
vergeblichen Suchen, diese Quelle aufzufinden,
fiel mir durch Zufall in die Hände: "Der
verunruhigte Holländische Löw, worinnen der
völlige Verlauf aller merkwürdigen Begebenheiten
. . . in diesem Holländischen Krieg . . . 1671
bis . . Nov. 1672 . . . beschrieben wird . . .
ins Hochteutsche übersetzt Durch AMADEUM von
Fridleben, Freiburgens. . . . Nürnberg, Zu
finden bey Johann Hoffmann, Kunsthändlern. Anno
1673. 12º. XII. 307 S. m. 20 Kupfern."
Ferner fand ich in einem Antiquariats=Cataloge
angezeigt: "Der wiedererwachte
Niederländische Löw enth. e. Continuation des
Holl. Lowen . . . O. O. 1673." So mögen
noch mehrere Fortsetzungen sich angeschlossen
und während der mir vorliegende Band nur
Holländisches behandelt, später auch
gleichzeitige andere Ereignisse dargestellt
haben, wie das vielfach geschah. Für einen
Nachweis des betr. Bandes wäre ich sehr dankbar.


|
Seite 20 |




|
2. Rostock. Ansicht von der Warnow aus. Oben: ROSTOCHIVM. Links und rechts oben ähnliche Wappenschilde, aber ohne Bänder, der Greif des Landes Rostock auch hier verkehrt. Den vier Hauptkirchen sind die Namen beigeschrieben, ebenso der Warnow die Bezeichnung: "Varnus Fluvius." Bildgröße 108X131 mm. Ueber die Quelle s. u.
3. Wismar. Plan. Inschrift rechts oben in rechtwinkeliger Kartusche: Stadt vnd Vestung │ WISMAR. (in zwei Reihen.) Bildgröße 108X131 mm. Verkleinerung des Plans nach Merians Topogr. Saxoniae inferioris 1653 (land. Lit. Nr. 324). Links Erklärung der 11 durch Nummern bezeichneten Oertlichkeiten. Ich legte das mir neue Blatt dem bewährten Kenner Wismarscher Litteratur, Herrn Dr. F. Crull, vor; derselbe bezeichnete mir als Quelle "Regnorum Sueciae, Gothiae etc. descr. Amstelodami apud Aegidium Janßonium Valckenier 1656 (v. M. Zeiller). Als ich aber dies Werk erworben und verglichen hatte, ergab sich, daß der darin enthaltene Plan Wismars zwar überaus ähnlich war, aber doch von einer andern Platte gedruckt sein mußte. So erhalten wir denn
4. Wismar. Plan. Inschrift wie oben, nur das "d" in "Stadt" nicht wie bei Nr. 1 gekrümmt, sondern "d" aufrecht stehend. Größe 107 X 130 mm. Kleine Unterschiede in der Zeichnung, z. B. im W. 4 Bäume gegen 9 bei Nr. 1, im O. 4 gegen 5; im S. ist das kleine Fort auf der Insel ein Quadrat (wie bei Merian), in Nr. 1 ein Rhombus, ebenso finden sich eine größere Zahl von Unterschieden in der Rechtschreibung der Zeichenerklärung. Uebereinstimmend dagegen ist bei beiden das Versehen, daß als Fürstenhof das Franziskanerkloster bezeichnet wird. Da die Bezeichnung bei Merian richtig ist, so muß also einer unserer beiden gleichen Pläne ein Nachstich des anderen sein. Durch eine neue Erwerbung der Landesbibliothek ist das mir gelungen genau festzustellen. Herr Landesarchivar Dunkelmann kaufte kürzlich ein Exemplar von Martini Zeilleri itinerarium Germaniae & regnorum vicinorum . . . Amstelodami apud Johannem Janßonium Juniorem Ao. 1658, a. u. d. Ti.: Martini Zeilleri fidus Achates. Dieses kleine, aber dicke Büchlein ist eine Art von Reisehandbuch, mit vielen Ansichten und Plänen geziert. Einige "itinera" desselben berühren auch Meklenburg, und zu deren Illustration befindet sich zu S. 166 die oben unter 2. verzeichnete Ansicht von Rostock, zu S. 196 der an erster Stelle genannte Plan von Wismar. Da die Amsterdamer latein. Ausgabe dieses Büchleins in 12º (eine deutsche kenne ich nur in folio) zwei Jahre nach der Descriptio Sueciae erschien, so muß der Plan aus dem Itinerar


|
Seite 21 |




|
der Nachstich sein, der von 1656 aber als eine originale Verkleinerung nach Merian angesehen werden. Auffällig bleibt immerhin die Anfertigung zweier Platten fast zur selben Zeit am selben Orte.



|


|
|
:
|
Nochmals
Die Kapelle zum Heiligen Moor.
(Vergl. Quartalbericht I, S. 7 und 8.)Von F. v. Meyenn.
Gleich nachdem der vorige Quartalbericht die Presse verlassen hatte, wurde die nachstehend abgedruckte Urkunde über die Kapelle zum Heiligen Moor im hiesigen Archiv aufgefunden.
1514. Jan. 9. Heiligen Moor.
Dietrich Peke, Priester zu Heiligen Moor, an den Ritter Henning v. Halberstadt zu Cambs "von wegen etzlicher Pechte, die jme durch die Tune jn Gnewitz vorpfant sind, vnd nu die Zcepelin jne die loskundung darvff gethan."
(Nach einem Vermerk auf der Rückseite.)
Minen willigen fruntliken dinst vnde ynnige bedt an godt den hern alle thouornn. Erbare duchtighe vnde ghestrenge leue ern Hennigk. Villichte is jwer strengheit wol jndechtich vnde bowust, alto handt gy de ghuder to Czepelin hadden jngenamen, jwe strengheit my fragede, efte ick etlike boringe vnde pechte to borende hadde jm dorpe to Gnewetze, de dat slechte der Tune vorsettet hebben mynen vorfarde thom leene thom Hilligenmor bolegen, dat ick nu tor tyt bositte, dat ick dat woll jwer erbarheit vnde strengheit sede, dath myn breff vnde segell so jnholt, dat ick de boringe hebben van den Thunen vnde nicht van den Czepelinen; so ock jck nu vorghangen ymm samer myt jwer strengheit sede vnde handelde van deme suluen handel to Tessin, alzo myn g. h. den vaget Oesten af settede, dar my datt mall jwe erbarheit sede, gij wolden my dar jnne boschermen vor de Czepeline vnde ock sede gij my furder, ick scholde de Czepeline nicht tor losinge staden. So, ghestrenge leue ern Henningh, foge ick jw weten, dat my de Czepeline hebben de pechte bohindert vnde den luden vorbaden, jck scal van en boren den houetstol. So, gestrenge leue ern Henningk, bofruchte ick my vnwillen vnde


|
Seite 22 |




|
schaden dar an, wen ick den houetstol van den Czepelinen vp bor e de nach dem male mynen vorfarde vnde my van den Thunen vorsettet is, vnde alzodenne jwer strengheit mochte de egendom tokamen, wol kan ick dar nicht vor, auer nachdeme jdt myn pandt is, so modt ick mynen houetstol boren wen my to rechten (?) tiden to secht werdt, alzo myn breff mede bringet vp (?) sunte Merten vnde de tidt is vor by vnde buthen tides, so ghedencke ick my to holden na lude mynes brefs vnde wil my dar nicht van geuen. So, gestrenge leue er Henningk, bidde ick denstliken vnde demodigen, jwe strengheit willet dar nu up dessen vmmeslagh myt den Czepelinen vmme spreken, wo ick myne boringe moge furder boren vnbohindert, vnde willet my dar an boschermen, so ich jwer erbar vnde strengheit wol to truwe vnde willen dat len van gade vnde der hilgen juncfrowen sunte Katherinen nemen. Des, leue er Henningk, bidde ick van jwer ghestrengheit myt dessen suluen baden eyn scriftlik antworde, wor ick my na richten schal. Dar mede gade selich vnde sundt myt langer wolfart boualen. Datum Hilgemor, anno dmni. etc. xiiijº, amm mandage na der hilligen dre koninge.
|
Her
Didericus Peke,
thom Hilgemor, jwe gutwillige. |
Deme erbarnen duchtighen geverten vnde ghestrengen ritter hern Henningk van Haluerstadt to Camptze erfz[eten], mynem leuen juncker vnde bosundern ghunner denstliken vnde demodigen gescr[euen].



|


|
|
:
|
Die goldenen Freitage.
Auf einem Zettel im Schweriner Archive aus dem 15. Jahrhundert, dessen eine Seite mit dem Verzeichniß der Einkünfte des Heil. Geist=Altars in Uelzen (Hannover) beschrieben ist, steht auf der anderen Seite von derselben Hand:
Duth synt de XII gulden vrigdage, dede vastet in brode [vnde] water, schal nicht liden de pynen der helle, dede dat erste jare auheuet, ys so vele, wen he storue, offte he alle XII jare gevastet hedde. De engel schal one apenbaren etc.
Der erste vrigdach der gyld vor der hemmelvart.


|
Seite 23 |




|
De ander vrigdach vor pingesten.
De drudde vrigdach na pinxesten.
De verde vrigdach vor Johannis baptiste (Juni 24.).
De viffte gulden vrigdach na sanctorum Peter vnde Paull (Juni 29.).
De seste gulden vrigdach na sunte Peter in den benden (August 1.).
De seuende gulden vrigdach vor vnser leuen vrowen gebort Marien (September 8.).
De achte vrigdach na aller hilgen dage (November 1.).
De negende gulden vrigdach de quatertemper na sunte Lucien (December 13.).
De X. gulden vrigdach de quatuortemper na asscherdach.
De XI. gulden vrigdach vor vnser leuen vrowen annunctiatien.
De XII. gulden vrigdach in dem stillen vrigdach in der vasten.
De pawest Clemens hefft dusse vrigdage gevunden in libro apostolorum wo salvator noster Jhesus sede: Sunte Peter juwer ys XII; ßo synt dat XII dage der gulden vrigdage, dat itlik mynsche schall vasten in brode vnde water.
Mit dem Beiworte gulden wurde sonst wohl der Freitag und Sonntag der Quatemberfasten ausgezeichnet. Hier liegt eine Ab weichung insofern vor, daß auch anderen Tagen das Beiwort gulden beigelegt ist, während die Herbstquatember nicht sich unter den zwölf Tagen befindet.
Das Bibelwort, auf das der Schluß Bezug nimmt, steht nicht in der Apostelgeschichte, sondern wir müssen die Stelle aus dem Johannes=Evangelium Cap. 6, V. 70 verstehen, die nach der Biblia vulgata des Mittelalters lautete: Nonne ego vos duodecim elegi?
Welcher Papst Clemens der Stelle die mystische Deutung verlieh, ist mir völlig unbekannt.
Grotefend.



|


|
|
:
|
Der Wustrowsche Wassertag.
Im Taufregister des Kirchenbuches von Alt=Gaarz, Amts Bukow, heißt es:
"Anno 1701: den 10. Febr[uar], als am Wustroschen Waßertage, getaufft: Marten Raten des Hirten von Wustro


|
Seite 24 |




|
Töchterlein Nahmens Sophia" u.s.w.; "den 11. Febr[uar], als am Freytage nach dem Wustroschen Waßertage, getaufft Gottfried Schnüfers Töchterlein Nahmens Ursel" u.s.w.
Die Bezeichnung des 10. Februars als "Wustrowscher Wassertag" ist auf die große Sturmfluth vom 10. Februar 1625 zurückzuführen, die für die Halbinsel Wustrow besonders verderblich gewesen sein muß, denn anders würde die Erinnerung an jenes Naturereigniß wohl kaum die nachfolgenden Schrecken des 30jährigen Krieges um ein halbes Jahrhundert überdauert haben.
Die Sturmfluth vom 10. Februar 1625 hat, wie wir aus gleichzeitigen Aufzeichnungen wissen, an den meklenburgischen Küsten kaum minder verheerend gewirkt, als die vom 12./13. November 1872. (Vergl. Jahrb. XVII, S. 202; Rostock. Etwas IV (1740), S. 98 bis 109; Ungnaden, Amoenitates, S. 1323.)
Nicht allgemein bekannt ist die nachfolgende Notiz, die sich im Ribnitzer Kirchenbuche findet:
"Anno 1625. Vom 10. auff den 11. Februarij die Nacht ist eine solche Ergießung oder Außlauffen des Strandes oder Meeres gewesen, wie vorhin bey 2 oder dreyen Menschen Lebetzeiten auch woll nimmermehr magk gewesen sein, welches nicht allein alhie zue Ribnitz, besondern auch an der gantzen Seekanten vnd Orten, an den Stadtmauern vnd sonsten, an Menschen, Viehe, Holtzung vnd dergleichen großen Schaden gethan."
"Anno 1625 den 15. Octob. ist abermalen eine sehr große Wogenfluth gewesen, fast der vorigen im Februario gleich, doch aber - Gott Lob - nicht so großen Schaden gethan."
Der Herzog Adolf Friedrich von Meklenburg bemerkt in seinem Tagebuche zum 10. Februar 1625: "NB. es heut trefflich böse wetter gewesen, so gestürmt vnd gesneiet. Dieses wetter hat diesem landt etlich 1000 schaden gethan."
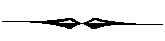
Schwerin, im Januar 1894.
Der zweite Sekretär:
F. v. Meyenn.


|
Seite 25 |




|



|


|
|
:
|
- Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I von Meklenburg : von 1654-1693
- Alterthümer aus der Gegend von Laage
- Schiffs- und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts
- Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart : historisches Spottlied auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock aus dem Jahre 1713
| LIX, 3. | April 1894. |
Quartalbericht
desVereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
| Inhalt: | I. Geschäftliche Mittheilungen. II. Wissenschafliche Mittheilungen: 1) Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I. von Meklenburg. Von 1654-1693. 2) Alterthümer aus der Gegend von Laage. 3) Schiffs= und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts. 4) Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart. |
Die dritte Quartalversammlung wurde am Montage, den 9. April, im Lesesaale der Großherzoglichen Regierungsbibliothek abgehalten. Mit Ausnahme eines Repräsentanten waren alle Ausschußmitglieder gegenwärtig.
Im Laufe des verwichenen Vierteljahrs haben wir zwei Mitglieder durch den Tod verloren:
1) den Geh. Ministerialrath Schröder zu Schwerin, gestorben am 28. Januar, Mitglied seit 29. November 1882;
2) den Landrath v. Plüskow auf Kowalz, gestorben 16. März, der dem Verein seit dem 5. December 1842 angehört hat.
Die nachfolgenden fünf Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten:
1) Oberstlieutenant a. D. von Weltzien zu Rostock,
2) Rittergutsbesitzer von Lützow auf Tessin,
3) Rechtsanwalt Fahrenheim zu Schwerin,
4) Rentner H. Keding zu Schwerin und
5) Pastor Zülch zu Dambeck.
Gewonnen haben wir zwei neue Mitglieder:
1) den Referendar Dr. jur. Wünsch und
2) den Major a. D. Baron von Stenglin, beide zu Schwerin.
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder ist somit von 499 auf 494 herabgegangen.


|
Seite 26 |




|
Im Kreise unserer correspondirenden und Ehren=Mitglieder haben keine Veränderungen stattgefunden.
Auf den Antrag des preußischen historischen Instituts zu Rom wurde beschlossen, der vaticanischen Bibliothek je ein gebundenes Exemplar unsers Jahrbuchs und des meklenburgischen Urkundenbuchs als Geschenk zu übersenden.
Mit der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, sowie mit der Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte der Ober=Lausitz zu Görlitz werden wir in Schriften=Austausch treten.
Die übrigen Verhandlungen und Beschlüsse betrafen geschäftliche Vereinsangelegenheiten und boten kein allgemeines Interesse.



|


|
|
:
|
1.
Kurze Chronik des Klosters Rühn während der Administration der Prinzessin Sophie Agnes, Tochter des Herzogs Adolf Friedrich I. von Meklenburg.
Von 1654-1693.
Mitgetheilt von F. v. Meyenn.Kurtzer nachricht von den Rühnschen umbständen seiter anno 1654.
| Alß anno 1654 die domina Catharina von Moltzanen gestorben, haben die closterfrouwen und jungfrouwen die durchl. princesse Sophie Agnes, hertzogin zu Meckelb[urg], wiederumb | |
| Ao. 54, |
gewehlet, die auch anno
1654 den 31. 8bris alß regentin von
dero herrn vater. hf. d. bestätiget
und introduciret [ward] derogestalt,
daß jhro daß gantze ambt übergeben,
alle ambtsbediente jhrer vorigen
pflicht erlassen und von jhr durchl.
der princesse darin genommen worden;
von der zeit haben jhr durchl. daß
ambt biß anno 1658 ruhig
besessen.
Anno 56 den 27. Aug. haben jhr durchl. die furst-väterl. concession erhalten, daß sie zu keinen alß reichs- und kreißanlagen vom ambte zu contribuiren gehalten, alle contributiones aber, die sonst in die cammer zu. Schwerin fließen, zu reparirung der kloster-gebeuwde anwenden solten. |


|
Seite 27 |




|
Ao. 57 den 21. Junij ist jhr durchl. der hof Hermanshagen mit denen darzu gelegeten diensten auß den dörffern Schlemin und Qualitz mit gewißen bedingen wegen der Guntersber[g]schen hypotheca übergeben.
Ao. 58, den 27. Febr., ist jhr h. f. d. hr. vater gestorben und haben jhr h. f. d. hr. hertzog Christian alß successor daß ambt Rühne wieder eingezogen und die ambtsdiener wiederümb jn jhre pflicht genomen.
Ao. 59 alß jhr h. f. d. die princesse wegen restituirung deß ambtes bei dero hrn. bruder hf. d. vergeblich sollicitiret, haben sie sich außer landes zu dero fr. schwester 1 ) nacher Halle begeben und
Ao. 61 den process in pto. spolii gegeh den hrn. bruder zu Spejr angefangen, der dan biß Anno 65 gewehret, da die restitutions-ma[n]data ervolget und die execution davon der cron Schweden, alß hertzog von Bremen, und hrn. hertzog Augusto zu Brunswig aufgedragen; solche nuhn zu vermeiden haben jhr durchl. der her hertzog daß ambt Rühn hinwieder - abgetreten.
Armo 66 den 29. Augusti seint jhr durchl. die princesse von Halle wieder zu Rühne angelanget; haben von adelichen leuhten niemant mitgebracht alß die cammerjungf[er] Maria Elisabet von Bredowen und den pagen Jochim Ernst von Bernstorf; 3 mätchens und 5 diener.
Den 30. Augusti haben jhr h. f. d. den hofemejster Clas Friderich von Lepel den hofstaten und dem ambte vorstellen lassen.
Weil nuhn das ambthauß jn den gebewden sehr schlecht, die garten, deiche, mühlen und wiesen ruiniret befunden und jhr durchl. also unmüglich subsistiren können, haben sie sofort ein stock außbeßern laßen, ümb den winter darin jn gedult und hofnung zum beßern zuzubringen.
Auß dem holtzhause ist der stal gemachet, auch das brauw- und backhauß und mältzbohden zugerichtet. Unterdessen hatt alles gartengewechse von Neuenkloster gekauffet werden müssen; solchem übel nuhn abzuhelfen, ist auch diesen herbest der lustgarten angeleget. Umb nuhn darzu platz zu gewinen, ist ein stal und ander unanstentliches hauß weg genomen, im garten aber ein deich außgefüllet.


|
Seite 28 |




|
Perner ist anstalt zu erbauwung einer wohnung gemachet und, damit die eichenholtzung beim ambte möchte verschonet bleiben, haben jhr durchl. balcken, sparhöltzer und latten auß dem Gustrowschen gekauffet, theils balcken haben jhr durchl. der hr. hertzog von Gustrow geschencket und anfahren laßen; da nuhn daß meiste holtz den winter angeschaffet, haben jhr durchl.
anno 67 den bauw angefangen und den 28. Martij selber den ersten stein zum fundament geleget und daß werck nach verfließung eines jahres geendet, so daß sie
anno 68 den 8. Maij zu bewohnen angefangen.
In diesem jahre haben auch jhr durchl. die Rünsche mühle, so gantz darnieder gelegen und wüste gewesen, wieder angefangen von grundt auf zu bauwen; haben auch hr. D. Caspar Schwartzkopfen auß Wißmar zu ihrem rahtt bestellet.
Item den Neuenhofe-deich zum stande gebracht. Daß waßer von dem Schmerlinges-deiche durch ein graben in den see zum fortel der mühle geführet.
Noch ist in diesem jahre daß waschhauß gebauwet und der küchengarten am wege gemachet.
Anno 69 haben jhr durchl. daß raaden zur rechten an hiesigem damme, erstlich mit 6, nachgehendes mit 12 schwedischen soldaten angefangen und continuiret. In diesem jahre seint auch die Rostocker vergeblichen tractaten gewesen.
Anuo 70 seint jhr durchl. auf die begräbnuß dero fraw schwester nacher Halle gereiset. 1 )
Im gleichen ist die arbeit zum raaden an der lincken handt deß dammes angefangen.
In diesem jahre haben jhr durchl. auch die trauerfälle von dero zwei herrn bruder erlebet, dan den 13. Maij hr. hertzog Gustaff Rudolph 2 ); den 20. Aug. aber hr. hertzog Carl gestorben.
<eß seint auch in diesem jahre die Lüssowschen tractaten angefangen.> 3 )
Anno 71 ist der deich bei der langen wending angeleget und gemachet.


|
Seite 29 |




|
<In diesem jahre haben jhr h f. d. hr. hertzog Gustaff Adolph dero mediation zu den Rostocker tractaten offeriret, die doch fruchtloß gewesen.> 1 )
NB. Anno 71 ist daß Lüttenzinsche 2 ) moor oder heinholtz unter wasser gesetzet und volglich den winter von ao. 72 daß holtz auf dem eise abgehauen.
Imgleichen ist angefangen den hof Moltenow anzulegen und zu bauwen.
In diesem jahre haben auch jhr durchl. den hof Hermanshagen von dem hrn. von Guntersberg durch 6000 specie Rthlr. reluiret.
Auch ist der Lüssowsche vergleich durch 3 ) mediation des hertzog Gustaff Adolph geschloßen; von Gustrowscher seiten waren dartzu verordenet: der hertzogl. hofmeyster, hr. Adam Otto von Vierecke und D. Johan Levin Ferber; von Schwerinscher seiten: hr. Hinrich Rudolph Redeker und D. Christian Schröder; Rünscher seiten: der hofmeyster Clas Friderich Lepel und der hr. rahtt Ca[s]par Schwartzkopf.
Anno 72 haben jhr durchl. bei denen dörffern alle steten nach dem alten pachtbuch de anno 1579 wieder aufsuchen, alle verlohrne und unrichtige pächte sowol inner- alß außerhalb ambtes wieder herbei und solche ordnung darunter stellen laßen, daß darnach die register eingerichtet und die rechnungen abgelegt werden sollen.
[Lücke bis 1675.]
Anno 75 da die Schwedische armee bei Ratenow und Fehr-Bellin geschlagen und sich nach Pommern reteriret, und der kuhrfurst von Brandenb[urg] ihnen gefolget, hatt er den marsch über Neuwstatt, Crivitz und Sternberg genomen und sich in daß Eickvier 4 ) jenerseiten der Warnow gesetzet, so den 9. Julij geschehen. An selbigem dage seint auch ihre durchl. hertzog Johann Georg gestorben. 5 )
Den 13. ist der kuhrfürst wieder aufgebrochen und haben daß haubtquartier zu Schwan genomen.


|
Seite 30 |




|
Den 11. 7bris haben jhr d. die kuhrfurstin zu Schwan besuchet.
Den 20. ist der kuhrfürsten daselbst aufgebrochen.
Der kuhrfürst hatt auf jhr durchl. der Princesse ansuchen daß ambt Rühne mit einquartirung und alle kriegeslasten verschonet, deßgleichen der keyserl. general Kob auf deß kuhrfürsten ordre auch gethan.
Auf jntercession deß kuhrfürsten hatt daß königl. dänische corpus, so Wismar blocquiret gehalten, daß ambt auch verschonet und seint deßfalß salvaguarden gegeben.
Auch ist auf königl. ordre jn währender belagerung von Wismar verschonet.
Den 12. Xbris haben jhr. durchl. die Prineesse die konig von Dennemarck zu Meckelburg besuchet.
[Lücke.]
Anno 92 seint jhr durchl. H. Christian gestorben und jhr durchl. H. Friedrich Wilhelm zur regierung gekommen, mit welchem der vergleich wegen der erbschaft gemachet.
Ist der vaget Jochim Blumenberg wegen untreuw abgeschaffet und Michel Martens bestellet. Auch ist Chim Warniken scheune abgebrant. Auch ist die verordenung mit Bischoffshagen gemachet; den Luttenzinschen aller abgenommener acker wiedergegeben. Hiergegen der Münchberg oder acker sambt der Olden Hörn wieder an daß ambt genomen, durchgegraben, geraadet und die hecke unter dem Münchberge vom see biß an den Münchhof gepflantzet, die seebecke gereumet.
(Nach dem Original im Haupt=Archiv zu Schwerin.)



|


|
|
:
|
2.
Alterthümer aus der Gegend von Laage.
Von Ludwig Krause=Rostock.
1. Die Dudinghäuser Schanze am Hohen=Sprenzer See.
Auf der Halbinsel, die sich nördlich von der Dudinghäuser Weding in den Hohen=Sprenzer See hinein erstreckt, liegt an ihrer schmalsten Stelle ein gut drei Manneshoher allerseits steil abfallender alter Wall. Derselbe zieht sich von Osten nach Westen von einer Wiesenkante zur anderen quer über den die Halbinsel bildenden


|
Seite 31 |




|
Festlandsrücken, hin und hat von einer Wiesenkante zur anderen eine Länge von 82 Schritt. Auf dem Meßtischblatt "Hohen=Sprenz" der Königl. preuß. Landes=Aufnahme von 1880 (herausgegeben 1882) ist der Wall angegeben, aber ohne weitere Bezeichnung oder Namen, während er in der dortigen Gegend als "Dudinghäuser Schanze" bekannt ist. Der Zweck, dem die Schanze einst gedient hat, ist offenbar der gewesen, die am weitesten in den See hineinreichende, einen kleinen Höhenrücken bildende, nördliche Spitze der Landzunge als Rückzugsort, befestigtes Lager oder dergl. gegen einen vom Festlande, also von Süden her andrängenden Feind zu schützen. Der Wall sowohl als auch der ganze nördliche Theil der Landzunge sind jetzt bewaldet.
Im Museum des Vereins für Rostocks Alterthümer werden folgende zu Dolgen und Diekhof bei Laage gefundene Alterthümer aufbewahrt, über welche leider ein genauerer Fundbericht fehlt.
a) Von Dolgen:
1. Ein 14 1/2 cm langes, schön zugehauenes, aber nicht poliertes Dolchmesser aus graubraunem Feuerstein. Von der Gesammtlänge kommen ungefähr 3 1/2 cm auf den sich am hinteren Ende etwas verbreiternden 11 mm dicken Griff. Genau läßt sich die Griff= bezw. Klingenlänge nicht angeben, da beide Theile allmählich in einander übergehen. Die Klinge mißt an ihrer breitesten Stelle 3 1/2 cm, während der Griff hinten 27 mm, im übrigen aber 2 cm breit ist.
Ein schön polierter Keil aus Feuerstein, vordere Hälfte gelblich, hintere Hälfte schwärzlich. Das hinterste Ende ist abgebrochen und fehlt. Das vorhandene Stück (fast der ganze Keil) ist 107 mm lang, an der Schneide 4 1/2 cm, hinten 2 1/2 cm breit und an der dicksten Stelle, die etwa die Mitte des vollständigen Keiles bilden würde, 17 mm dick. Nach vorne zu endigt der Keil in eine scharfe Schneide, während er hinten an der Bruchfläche noch eine Dicke von 12 mm aufweist.
3. Ein Spinnwirtel aus Stein (?) oder ganz außerordentlich hart gebranntem Thon mit einigen kleinen völlig glatten und blanken Stellen (Politur oder Reste einstiger Glasur?), schön rund und glatt, unverziert, 26 mm hoch, größter Durchmesser (in der Mitte) 41 mm. Das durch die Mitte gehende runde Loch ist durch und durch gleich weit mit glatten Wänden und mißt 1 cm im Durchmesser.
b) Von Diekhof:
1. Ein hakenartig gebogener grauer Sandstein, 20 1/2 cm lang, hinten 4 cm, vorn 8 1/2 cm breit und 3-4 cm dick. Auf der


|
Seite 32 |




|
Oberfläche am vorderen Ende befinden sich auf der einen Seite Schleifmarken, die jedoch erst aus neuerer Zeit zu stammen scheinen und dadurch entstanden sind, daß man mit dem Steine im Kreise herumgerieben hat. Wozu der Stein, der im übrigen scheinbar nicht bearbeitet ist, gedient hat, bleibt zweifelhaft, vielleicht als Reibstein einer Quetschmühle oder dergl.
2. Die Hälfte eines Hammers aus dunkel=blaugrauem Gestein. Die Bruchstelle geht quer durch das Schaftloch. Beim Finden war der Hammer noch vollständig und ist erst später zerschlagen, worauf dann die eine zersplitterte Hälfte wieder verloren ging. Das vorhandene Stück ist 7 1/2 cm lang und am hinteren Ende, also in der Mitte des vollständigen Hammers, 5 cm breit. Die Höhe beträgt an der Schneide 4 cm und beim Schaftloch 29 mm. Die größere Höhe an der Schneide kommt daher, daß die eine Breitseite vom Schaftloch nach der Schneide zu allmählich ansteigt, während die andere eine gleichmäßig horizontale Fläche bildet. Das durch die Mitte des Hammers gebohrte Schaftloch ist durchweg gleich weit mit runder ebener Wandung und mißt 2 1/2 cm im Durchmesser. Der Hammer ist geglättet, aber nicht polirt.
3. Ein Spinnwirtel aus sehr hart gebranntem röthlichem Thon, oben und unten um das durch die Mitte hindurchgehende kreisrunde Loch mit je drei concentrischen Rillen verziert. Größter Durchmesser (in der Mitte) 33 mm, Höhe 17 mm, Durchmesser des Loches 1 cm. Der Wirtel ist gut geglättet, rund und ebenso wie der oben erwähnte Dolgener geformt.
Bei dem Bau der Rostock=Neubrandenburger Chaussee wurden auf der Feldmark Kl.=Lantow vor Laage in einer dort für die Chausseebauzwecke angelegten Sandgrube zwei menschliche Gerippe aufgefunden. Dieselben lagen im lockeren Sande nur etwa zwei Fuß tief unter der Oberfläche. Die Schädel waren noch fest, alle anderen Knochen jedoch schon sehr morsch. Aufgefallen ist damals die Kleinheit der Schädel und die gute Erhaltung der Zähne, von denen nur einer angegangen war. Die Sandgrube liegt an der Nordostseite der Chaussee westlich vom Hofe Kl.=Lantow dort, wo die frühere, von Alt=Kätwin herkommende und hier durch einen Hohlweg führende Landstraße auf die jetzige Chausseelinie traf. Irgend welche Beigaben oder dergl. wurden bei den Gerippen nicht gefunden. Auch sonst ist von irgendwelchen Funden bei Lantow, abgesehen von schon früher, vor dem Chausseebau, an eben dieser Stelle zu Tage geförderten Gerippen, so viel ich weiß, bisher nichts bekannt geworden, so daß


|
Seite 33 |




|
sich einstweilen nicht feststellen läßt, ob wir es hier mit einer prähistorischen Grabstätte oder aber mit den Resten im Mittelalter bezw. in noch jüngerer Zeit dort beerdigter Leichen zu thun haben.
Südöstlich von Depersdorf führt ein auf beiden Seiten von einem Graben begleiteter künstlicher Damm, der sog. Moskowiterdamm, in der Richtung von Nordwest nach Südost quer durch die dortige Wiesenniederung bis zur Recknitz und, am jenseitigen Ufer derselben sich fortsetzend, bis zum gegenüberliegenden Festlande hin. Früher waren die beiden Dammenden durch eine über die Recknitz geschlagene Brücke mit einander verbunden und bildeten so einen bequemen Uebergang durch das Flußthal. Die Brücke ist jetzt jedoch seit längerer Zeit nicht mehr vorhanden. Neben diesem Moskowiterdamm lag nun früher auf Depersdorfer Feldmark ein kleiner Hügel, der im Volksmunde den Namen Kösters=Wall führte, jetzt aber bereits seit Jahren abgetragen ist. Gefunden wurden bei dieser Abtragung nur einige eiserne Ketten und alte "Pottscherben", sonst aber nichts. Auf diesem Wall soll nach einer bei den dortigen Leuten umgehenden Sage früher eine Kapelle gestanden haben, in welcher die Kinder getauft wurden. Eine andere Meinung nimmt an, es werde auf dem Hügel wohl ein Zollwärterhaus gelegen haben. Grade wie noch vor 30-40 Jahren am benachbarten Depzowerdamm für jedes passierende Pferd ein Sechsling als Brückenzoll erhoben sei, werde man auch am Moskowiterdamm ein Damm= bezw. Brückengeld habe zahlen müssen.
Ob eine und dann welche dieser beiden Meinungen das Richtige getroffen oder ob gar die beiden erwähnten Bauwerke nach einander hier gestanden haben, dürfte sich vielleicht noch aus Urkunden oder alten Karten aufklären lassen, wobei jedoch gleich bemerkt sei, daß auf dem alten v. Schmettau'schen Atlas von 1788 weder der Moskowiterdamm noch der Kösters=Wall angegeben sind.



|


|
|
:
|
Schiffs= und Waarenverkehr der meklenburgischen Hansestädte mit Danzig am Ende des 15. Jahrhunderts.
In dem vor Kurzem erschienenen 33. Hefte der Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins hat Victor Lauffer eine interessante


|
Seite 34 |




|
Arbeit "Danzigs Schiffs= und Waarenverkehr am Ende des 15. Jahrhunderts" veröffentlicht. Er hat ihr zu Grunde gelegt zwei Zollbücher, die im Danziger Stadt=Archiv aufbewahrt werden. Von diesen giebt das ältere ein Verzeichniß der 1474-1476 in den dortigen Hafen eingelaufenen Schiffe und ihrer Ladung, das jüngere verzeichnet die von 1490-1492 ausgelaufenen Schiffe und zum Theil die damit exportirten Waaren. In der Erwägung, daß es nicht allen Mitgliedern unseres Vereins möglich ist, obige Zeitschrift einzusehen, möchte ich die auf Meklenburg bezüglichen Tabellen herausnehmen und sie kurz besprechen.
Uebersicht über die in Danzig in den Jahren 1474-1476 eingeführten Waaren.
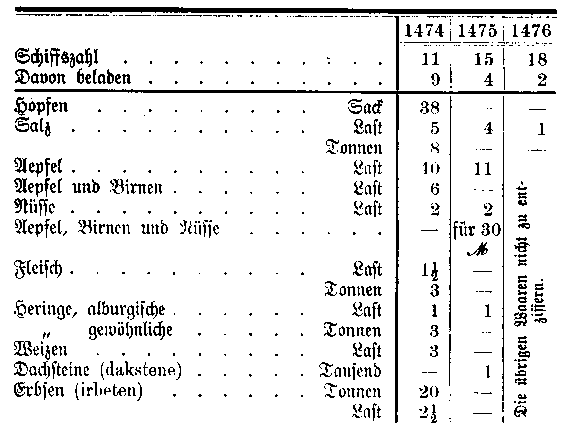
| Schiffszahl | 1475 | 1, beladen 0. |
| 1476 | 1, beladen 0. |


|
Seite 35 |




|
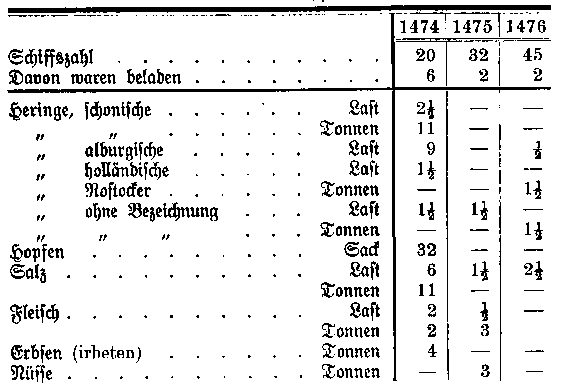
Rostock mit 97 und Wismar mit 44 Schiffen nehmen in den Jahren 1474-1476 eine ganz hervorragende Stellung unter den mit Danzig im Schiffsverkehr stehenden 91 Städten und Ländern ein. Uebertroffen wird Rostock nur von
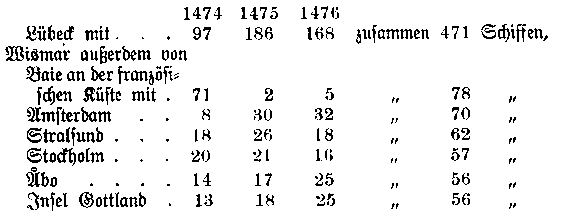
Danach nimmt Rostock die zweite, Wismar die neunte Stelle von 91 Handelsplätzen ein, gewiß ein Zeugniß für die Thatkraft der meklenburgischen Hansestädte. Eingeführt sind nach Danzig durchweg die Natural=Erzeugnisse des Hinterlandes. Der Transitoverkehr ist nicht bedeutend; nur im Jahre 1474 vermittelte Rostock den Heringshandel von Dänemark und Schweden in größerem Maßstabe.


|
Seite 36 |




|
Uebersicht über die von Danzig in den Jahren 1490-1492 ausgeführten Waaren.
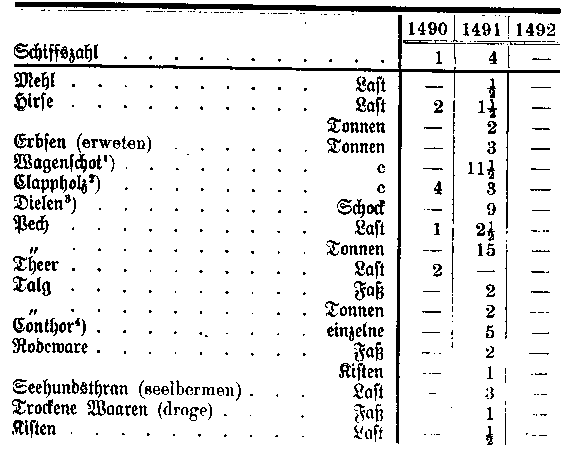
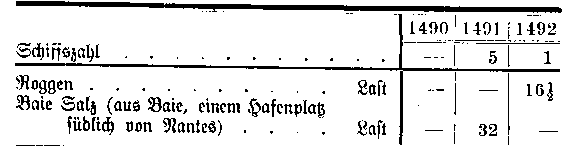
1 ) Wagenschot = Balken aus stärksten Eichenstämmen, hauptsächlich zum Schiffsbau verwandt.
2 ) Klappholz = Balken aus geringer werthigen Eichenstämmen oder auch aus Buchenstämmen.
3 ) Dielen = aus Wagenschot und Klappholz geschnitten, zu Fußböden und Täfelungen dienend
4 ) Conthor = pultartige Rechnungstische.


|
Seite 37 |




|
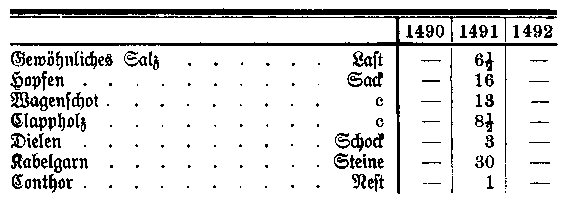
Das zweite Zollbuch, das die von 1490-1492 ausgelaufenen Schiffe und ihre Ladung verzeichnet, ist nicht so gut geführt, wie das ältere. In den meisten Fällen ist bei den ausgelaufenen Schiffen der Bestimmungsort nicht angegeben. Demnach kann man einen Vergleich zwischen Rostocks und Wismars Aus= und Einfuhr nicht anstellen; nur einen Rückschluß auf die hauptsächlich eingeführten Waaren läßt die Tabelle II zu. Danach führte Danzig besonders Holz nach Meklenburg aus, das, wie auch jetzt noch, die dichten Wälder der oberen Weichsel lieferten, und das auf dem Strom bequem nach Danzig geflößt werden konnte. Neben dem Holz war das Getreide Haupthandelsartikel.



|


|
|
:
|
Die große Jammerklage und abgeschorner Bocksbart.
auf den schwedischen Feldmarschall Grafen Stenbock
aus dem Jahre 1713.
Ach! waß hört man nicht vor Klagen
Von vieler Land= und Leute=Plagen
In dieser schwer bedrängten Zeit,
Von Streit und Wiederwärtigkeit.
Kaum hatt die Pest aufgehöret,
Da ein Volk sich wieder das ander empör[e]t,
Der Schwedische Feind dringt mit Macht herein,
Plündert und raubet Alles gemein.


|
Seite 38 |




|
Daß hastu Hollstein jetz wohl erfahren
Wie der stoltze Feind mit dir verfahren
Mit Sengen, Brennen, Plündern, Stehlen,
Daß kein Mensch könt vor ihm waß verhehlen;
Mit seinem grimmigen Heer ist er gezogen
Durch das Land und hat es außgesogen,
Das Altonah 1 ), die schöne Stadt, er abgebrand,
Die sich nicht wehren kont und that kein Wiederstand.
Flenßburg mußte zum Brandschatz geben
Großes Geld 2 ) und dabey in Furchten leben,
Die Schmiede Fußangel ihnen praepariren;
Ist daß nicht listig einen zu vexiren?
Das unbefestigte Cremp wolt er auch betrüben
Und seine Grausamkeit durch Flammen üben,
Das aufgebrachte Geld, so noch zu finden,
Hat endlich ihn gebracht zu andern Sinnen.
Das heist mit Repressalien sich zu beschönen,
Die nicht würdig zu benennen, vielmehr außzuhönen,
Weil wieder alle Raison und Kriegsgebrauch
Unbefestigte Städte laßn fliegn auf in Rauch.
Doch waß soll man sagen? Schwed und Frantzosen
Die machens so und achten es für lauter Chosen
Schlechte Städte abzubrennen, das heist Kriegsraison,
So keinen Wiederstand können thun mit einer Persohn.
Von Kindbettern und von Kranken hat er gefodert sehr
Das Geld, obs gleich gezahlt, dennoch kein Erbarm mehr;
Eß sind die Häuser angestrichn mit brennenden Sachen,
Damit die Flamme(n) sie ergriff, umb sie zu nichte machen.


|
Seite 39 |




|
Der Pluto in der Hölle konts nicht ärger machen,
so haben sie es getrieben mit Unterthanen und ihren Sachen,
Der Bock, der Teuffel, hat die Stein zusammen getragen
Und seinen Helffern gelehrt, wie man die Leut soll plagen.
Gleichwie er das Sachsenland hat außgesogen,
Also wil er das Hollstein bringen um sein Vermögen;
Dreizehn Tonn daß hat er erpreßet rein
Und damit sein dismontirtes Volk gezieret fein.
Nun liegt er in den schlammigten Pohlen, 1 )
Worein er vermeinet sich zu erhohlen,
Darin thut er sich gantz vertrenchementiren,
Daß keiner ihm soll waß vexiren.
Und hat der listige Fuchs sich geleget,
Da er seinen Balg wit Thränenblut gepfleget
Im Schleßwiegischen mit großer Pracht,
Da er wird als ein großer Held geacht.
Die Bauren thun ihn hoch dort loben
Ob seiner Grimmigkeit, die er verübet oben,
Weil er viel Schwäntze mit sich gebracht
Und damit viel Städte anzustecken getracht.
In dem Trenchement hat er gelegt seine Macht
Und mit großer Furie darnach fleißig tracht,
Wie er des Königs Volk mag aufreiben
Und Land und Leut zusammen vertreiben.
Allein du großer Gott wirst wohl verhüten,
Daß des Feindes Heer nicht mehr darf wüten
In Hollstein so sehr und deßen Revier;
Des Königs Macht hat sich ihm wiedersetzt hier.


|
Seite 40 |




|
Sollte der Bock nicht an die Steine lauffen,
Damit die starken Hörner ihm mit Hauffen
Werden abgestoßen, daß er nicht könne stehen
Und mit seinen Horden muß zu Grunde gehen?
Der Bart muß nicht alzu groß ihm werden,
Der Däne, Ruß und Sachs sind kommen abzuscheren
Den Bart, den langen Bart, so von oben her
Abhangt, alß sey er zehn Pfunden schwehr;
Darinnen steckt die Kunst und ist vergraben,
Wornit er sich und seine Horden stets thut laben,
So fast nicht anders seyn, als Finnen und Lappen,
Die nach Geld und sonsten nach nichts anders schnappen.
Der Wittwen Thränen dringen Himmelan,
Daß geschlagen werd der trotzige Mann,
So alle Welt verschlingen wil mit Feuer,
O, hochmühtiger Geist! O, abscheuligs Ungeheu[e]r!
Nun ihr tapfere heldenmühtige Generalen
Von Rußen, Dänen, Sachsen alzumahlen
Ziehet dem Feinde mit Freuden entgegen,
Schlaget, daß er sich für euren Füßen muß legen.
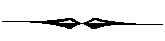
Nach einer Abschrift im Haupt=Archive zu Schwerin.
Schwerin, im April 1894.
Der zweite Sekretär:
F. v. Meyenn.


|
Seite 41 |




|



|


|
|
:
|
| LIX, 4. | Juli 1894. |
Quartal= und Schlußbericht
desVereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
| Inhalt: | Geschäftliche Mittheilungen. Anlage A.: Zuwachs der Vereins=Bibliothek. Anlage B.: Erwerbungen der Bildersammlung 1893/94. Anlage C.: Auszug aus dem zweiten Bericht des Herrn Wossidlo " Waren über die Sammlung meklenburgischer Volksüberlieferungen. P. Groth. Meklenburgische Litteratur vom Juli 1893 bis Juli 1894. - Zur Litteratur, von Dr. R. Beltz. |
N achdem am 2. Juli die ordentliche Quartalversammlung stattgefunden hatte, die sich vornehmlich mit der Vorbereitung der bevorstehenden 59. Generalversammlung beschäftigte, wurde satzungsgemäß am 11. Juli die Generalversammlung zu Parchim abgehalten. Da schon im Laufe des 10. Juli eine Anzahl auswärtiger Mitglieder eingetroffen waren, so hatte am Abend in der Centralhalle eine gesellige Zusammenkunft stattgefunden, deren Zweck war, die Parchimer und fremden Theilnehmer der Versammlung in gemüthlichem Zusammensein einander näher zu bringen. Am Versammlungstage selbst begann schon um 8 Uhr Morgens die Besichtigung der Sehenswürdigkeiten. Es wurden der Judentempel, die älteren Profanbauten der Stadt mit ihren Inschriften, die Kirchen, das Heilig=Geist=Haus, nunmehr im Privatgebrauch, und der alte Burgwall besichtigt. Leider beeinträchtigte der strömende Regen diesen Rundgang nicht unerheblich. Um 11 Uhr wurde die Generalversammlung in der Aula des Gymnasiums durch den 1. Sekretär, Archivrath Dr. Grotefend=Schwerin, mit dem Wunsche eröffnet, daß die Verhandlungen zu allseitiger Zufriedenheit verlaufen und dem Verein neue Freunde erwerben möchten. Bürgermeister Peeck begrüßte sodann die Versammlung Namens der Stadt und sprach zugleich die Befürchtung aus, daß die Stadt Parchim, so alt sie auch sei, doch an Alterthümern nur wenig biete; auch sei das


|
Seite 42 |




|
Interesse für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde bisher hier wohl nicht eben sehr rege gewesen, obwohl ein früheres, langjähriges, thätiges und verdienstvolles Mitglied des Vereins, der Geh. Archivrath Dr. Beyer, ein Kind unserer Stadt und hier längere Zeit practisch wirksam gewesen sei. Hoffentlich werde auch diese Versammlung dazu beitragen, daß die Zwecke des Vereins geweckt und gefördert würden und dauernd blieben. Archivrath Grotefend antwortete hierauf, daß der Verein selbstverständlich von Dank gegen die Stadt erfüllt sei. Bürgermeister Peeck habe des Geh. Archivraths Beyer erwähnt. Wer diesen gekannt habe, wisse, ein wie großes Interesse er der Stadt Parchim bewahrt habe. Unter seinem Nachlasse seien Bruchstücke einer Geschichte Parchims gefunden worden, von denen ein Theil zu einer demnächst zu veröffentlichenden Arbeit über die Einwohnerzahl Parchims mit verwendet werden würde. Freilich werde durch diese Veröffentlichung endgültig mit dem Irrthum aufgeräumt werden, daß Parchim früher eine große Stadt gewesen sei. Die Stadt habe, wie viele Städte des Mittelalters, wohl einen großen Umfang, aber wenig Einwohner gehabt. Die Einwohnerschaft habe sich aber ausgezeichnet sowohl durch bedeutenden Gewerbefleiß als auch durch Tüchtigkeit in militairischer Hinsicht.
Das hohe Contingent Parchims möge der Anlaß gewesen sein, daß die Einwohnerzahl der Stadt um so vieles zu hoch angegeben worden sei. Dies hohe Contingent sei aber auch nöthig gewesen, weil Parchim immer den ersten Anprall der Feinde und noch dazu von zwei Seiten, von der Uckermark und der Priegnitz, habe aushalten müssen. Andererseits sei dies hohe Contingent ein Zeugniß von der Wehrhaftigkeit und ein Beweis von der Tüchtigkeit seiner Bürgerschaft, von der Blüthe des Handels und des Gewerbefleißes, die kräftigen Schutzes bedurft hätte. Man sei im Besitz zweier vollständiger Namensverzeichnisse aller Einwohner, das jüngere derselben auch mit Angabe des Besitzes eines jeden einzelnen an Pferden, Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, ja sogar "Immenstöcken". Das ältere dieser Verzeichnisse stamme aus dem Jahre 1496, das andere aus dem Jahre 1666. Beide gewährten einen wesentlichen Einblick in die Verhältnisse der Stadt zu zwei Seiten, die kritisch für die Entwickelung der Bevölkerung aller Städte Deutschlands gewesen seien, nämlich die Zeit vor der Reformation und die Zeit gleich nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges. Die erste Zeit sei eine Zeit hoher wirthschaftlicher Blüthe für die norddeutschen Binnenstädte, die letztere die Zeit des Wiedererwachens nach der langen Versumpfung des Krieges, die Zeit, wo sich überall in den vom Kriege heimgesuchten Landen die Einwohner wieder zu bürger=


|
Seite 43 |




|
lichen und kirchlichen Gemeinschaften zusammengeschlossen hatten. Die ganze Geschichte der Stadt Parchim aber sei ein Zeugniß für die mannhafte Bürgertreue ihrer Einwohner.
Hierauf erhielt Gymnasialdirector Dr. Strenge das Wort. Er führte aus, daß das Friedrich Franz=Gymnasium die Ehre, den Verein für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde in seinen Räumen versammelt zu sehen, wohl zu schätzen wisse und hieß die Versammlung herzlich willkommen. Das Friedrich Franz=Gymnasium begrüße die Versammelten nicht ohne einen gewissen Stolz darauf, daß es in seinem bescheidenen Theile historisches Interesse und historischen Sinn in der ihm anvertrauten Jugend des Landes zu wecken und zu pflegen sich bewußt gewesen sei, und in dem Bewußtsein, daß es eine eigene Geschichte habe, in welcher die Geschichte der Stadt und die Geschichte des Landes sich wiederspiegeln. Die Schule sei eine Gründung der Reformation. Mit der Gründung sei der Name eines Mannes verknüpft, der von Luther persönlich dem Herzoge empfohlen sei, Johannes Riebling, des bedeutendsten Reformators in Meklenburg. Die Schule habe 1564 schon mit 4 Lehrkräften wirken können. Aus ihrer ersten Zeit sei wenig bekannt geworden, aber aus mancherlei Anzeichen habe man auf eine erfreuliche und gedeihliche Entwickelung schließen können. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts habe ein fünfter Lehrer angestellt werden können. Auch sei durch die Opferwilligkeit der Bürgerschaft ein neues Schulhaus erbaut worden. Im Jahre 1607 sei auf Kosten und im Auftrage der Stadt eine griechische Grammatik für die Schule gedruckt worden. Doch sei das 17. Jahrhundert für die Entwickelung der Schule kein günstiges gewesen. Nach dem dreißigjährigen Kriege sei die Zahl der Lehrer und Klassen von 5 auf 3 gesunken. Der Rector Wolf, abgegangen 1662, habe während seiner fast achtjährigen Wirksamkeit in hiesiger Stadt auch nicht einen Schilling Gehalt bekommen. Hierauf sei das Rectorat volle 6 Jahre, bis zum Jahre 1668, unbesetzt gewesen. Als im Jahre 1708 das Land= und Hofgericht von hier verlegt worden sei, habe man der Stadt eine Entschädigung durch Vergrößerung und Erhöhung der Anstalt gewähren wollen, durch Umgestaltung in eine Art Ritterakademie für den meklenburgischen Adel. Der Plan sei aber schließlich nicht zur Ausführung gekommen. 1827 sei die Schule in ein Gymnasium umgewandelt und 1847 nach Fortnahme des Oberappellations=Gerichts (1840) mit einer Realschule verbunden worden. Durch die Munificenz des regierenden Großherzogs sei das Gymnasium mit dem stattlichen Gebäude beschenkt worden, in dessen schönstem Raume man sich jetzt befinde.


|
Seite 44 |




|
Sodann erhielt der Regierungsrath Dr. Schröder=Schwerin das Wort zu seinem Vortrage "über die Anfänge des Buchdrucks in Schwerin."
Wir können es uns versagen, hier einen Auszug aus diesem Vortrage wiederzugeben, da er im nächsten Jahrbuch ausführlich zum Abdruck gelangen wird. Das gleiche gilt von dem folgenden Vortrage des Bibliothekcustos Dr. Voß=Schwerin über: "Die Pilgerreisen des Herzogs Balthasar von Meklenburg nach dem heiligen Lande."
Zu den Formalien der General=Versammlung übergehend, erstattete dann für den dienstlich behinderten 2. Secretär, Archivar von Meyenn, der 1. Secretär, Archivrath Dr. Grotefend, den Jahresbericht.
Derselbe lautete: "Geehrte Versammlung! Der Jahresbericht über das abgelaufene Geschäftsjahr des Vereins vom 1. Juli 1893 bis dahin 1894 kann Ihnen nur wenig Neues bieten, da sein Inhalt zum weitaus größeren Theile Ihnen aus den veröffentlichten drei Quartalberichten schon bekannt ist. Während des vierten Quartals hat unser Verein 5 Mitglieder eingebüßt und deren nur 4 wieder gewonnen. Einen Todesfall haben wir glücklicher Weise nicht zu verzeichnen. Ihren Austritt haben erklärt die Herren: 1) Landphysikus Dr. Marung in Schönberg, Mitglied seit 17. Januar 1878; 2) Districtsingenieur O. Voß in Schwerin, Mitglied seit 10. September 1890; 3) Maurermeister Krack in Schwerin, Mitglied seit 20. Juni 1892; 4) Präpositus Stahlberg in Neukloster, Mitglied seit 22. November 1886, und endlich 5) Archivar Dr. G. v. Buchwald in Neustrelitz, der dem Verein seit dem 1. Mai 1880 angehört hat. Aufgenommen in den Verein wurden die Herren: 1) Bürgermeister Bicker, 2) Baumeister Ernst Krempien, 3) Realschullehrer Robert Präfcke, alle drei in Schönberg, und 4) der Buchhändler Wehdemann in Parchim."
"Im Laufe des ganzen Rechnungsjahres hat unser Verein sechs ordentliche Mitglieder durch den Tod verloren. Ihre Namen sind in den Quartalberichten mitgetheilt worden. Ausgetreten aus dem Verein sind 17 Mitglieder. Diesem Verluste von 23 Mitgliedern haben wir einen Zuwachs von nur 16 Mitgliedern gegenüber zu stellen. Mit einem Personalbestande von 499 traten wir in das Jahr ein, mit 493 treten wir aus. Im Kreise unserer hohen Beförderer (3), correspondirenden (29) und Ehrenmitglieder (10) sind keinerlei Personalveränderungen vorgegangen. Im Vereins=Ausschusse wurde der Geh. Justizrath und Landgerichtsrath a. D. Schlettwein auf Bandelstorf als Bilderwart durch Herrn Dr. Voß und im Bibliotheksausschusse


|
Seite 45 |




|
durch den Herrn Geh. Finanzrath Balck ersetzt. Die Zahl der mit uns in Schriftenaustausch stehenden gelehrten Gesellschaften ist im Laufe des Jahres um 6 vermehrt worden. Von diesen sind 3 im letzten Quartal neu hinzugekommen. Diese sind: 1) die kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst zu Mitau (Section für Genealogie, Heraldik und Sphragistik), 2) das dänische genealogische Institut zu Kopenhagen und 3) das bosnisch=herzegowinische Landes=Museum in Serajevo, das seine Schriften, wie zur Beruhigung erwähnt sei, in deutscher Sprache erscheinen läßt."
"In Beziehung auf die wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins ist über die Weiterführung des Meklenburgischen Urkundenbuchs zu berichten, daß der Druck des bekanntlich zur Aufnahme aller Register zu Bd. 13, 14, 15 und 16 bestimmten 17. Bandes unlängst seinen Anfang genommen hat. Orts= und Personenregister liegen druckfertig vor; das Wort= und Sachregister wird von Dr. Techen zweifellos rechtzeitig geliefert werden. Von Bd. 18 des Urkundenbuches hat schon der 53. Bogen die Presse verlassen. Der Druck des 59. Meklenburgischen Jahrbuchs ist bis zum 20. Bogen vorgeschritten."
"Von den Sammlungen des Vereins haben die Bibliothek und die Bildersammlung wiederum eine ansehnliche Bereicherung erfahren. (Beide Zugangsverzeichnisse sind in den Anlagen A und B zum Abdruck gebracht.) Ueber die Sammlung meklenburgischer Volksüberlieferungen hat Herr Wossidlo einen ausführlichen Bericht veröffentlicht." (Siehe Anlage C.)
"Abendliche Sitzungen der Vereinsmitglieder haben zu Schwerin im letzten Winter 4 stattgefunden, in denen die nachstehenden fünf wissenschaftlichen Vorträge gehalten worden sind: 1) über historisch=statistische Grundkarten, von Archivrath Dr. Grotefend; 2) über die Wappen des Großherzoglichen Hauses Meklenburg, von Herrn C. Teske; 3) über Grabdenkmäler und Epitaphien, von Archivrath Dr. Grotefend; 4) über die Anfänge der periodischen Presse in Meklenburg, von Professor Dr. Stieda; 5) über die Kämpfe der Hansa mit König Waldemar IV. von Dänemark, von Dr. A. Hofmeister=Rostock."
Den Zahlen der Mitgliederbewegung konnte der Vortragende noch hinzufügen, daß seit dem 1. Juli schon einige neue Mitglieder aus Parchim hinzugetreten seien, und daß er die Hoffnung hege, daß die heutige Generalversammlung im Stande sei, noch neue Freunde dem Vereine zu erwerben.
Bei der hierauf vorgenommenen Wahl des Versammlungsortes für 1896 wurde auf Vorschlag des Vereinsausschusses Waren gewählt.
Nach Schluß der Verhandlungen wurden die im Zeichensaale ausgelegten Alterthümer, alten Urkunden, alten Flurkarten, Ansichten


|
Seite 46 |




|
von Parchim aus verschiedenen Jahrhunderten
 . besichtigt. Auch die von Director
Dr. Strenge erwähnte, für die Parchimer Schule
gedruckte griechische Grammatik war ausgelegt. Sie
ist in Helmstädt gedruckt und von Matthias Marcus
Dabercusius "pro novo gymnasio
Parchimensi" verfaßt.
. besichtigt. Auch die von Director
Dr. Strenge erwähnte, für die Parchimer Schule
gedruckte griechische Grammatik war ausgelegt. Sie
ist in Helmstädt gedruckt und von Matthias Marcus
Dabercusius "pro novo gymnasio
Parchimensi" verfaßt.
Um 2 Uhr fand ein gemeinsames Essen in der Centralhalle statt, das, durch einen Toast auf die beiden erlauchten Protectoren des Vereins, die Großherzoge von Meklenburg=Schwerin und =Strelitz, eröffnet, den fröhlichsten Verlauf hatte und namentlich die in der Sitzung geäußerte Hoffnung des 1. Sekretars in reichem Maße verwirklichte, indem 11 Parchimer Theilnehmer den Wunsch aussprachen, in den Verein aufgenommen zu werden.
Eine Fahrt durch den Sonnenberg nach dem Brunnen beschloß die allen Theilnehmern gewiß unvergeßliche Feier.Anlage A.
1) * Ernst (H.), Meklenburg im 13. Jahrhundert. Cap. I.: Die Vasallen. (Programm des Gymnasiums zu Langenberg.) 1894.
2) Großherzogliches Hoftheater in Schwerin. Uebersicht der während der Spielzeit 1893/94 gegebenen Vorstellungen und Konzerte. Nebst Theaterzetteln.
3) Programm des Gymnasiums zu Friedland. 1894.
1) Analecta Bollandiana. Tom. XII Fasc. 2-4. Tom. XIII Fasc. 1. 2. Paris-Bruxelles 1893/94.
2) Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquierum saeculo XVI qui asservantur in Bibliotheca Nationali Parisiensi edd. Hagiographi Bollandiani. Tom. I. II. III. Bruxelles Parisiis 1889-93.
3) Donner (J. O. E.), Der Einfluß Wilhelm Meisters auf den Roman der Romantiker. Helsingfors 1893.
4) Literarischer Handweiser zunächst für alle Katholiken deutscher Zunge. Jahrg. 32. Münster 1893.
5) * Höfer (P.), Zwei Schriftstücke zur Berichtigung von A. Schierenbergs Drucksache: "Die Rätsel der Varusschlacht" u. dgl. Wernigerode 1893.
6) Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. 1893. Mitau 1894.


|
Seite 47 |




|
7) Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 1892 XVIII. Norden und Leipzig 1893.
8) Neue Heidelberger Jahrbücher. Jahrg. 3, Heft 2. Jahrg. 4, Heft 1. Heidelberg 1893/94.
9) Korrespondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. 41. Jahrg. 1893. Nr. 7-12. 42. Jahrg. 1894. Nr. 1-5. Berlin.
10) Korrespondenzblatt des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 1893. Heft XVII. Nr. 1-3. Hamburg.
11) Monumenta Conciliorum Generalium saeculi XV. Concilium Basileense. Scriptorum Tomi III Pars 2. Vindobonae 1892.
12) Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner= und dem Cistercienser=Orden. Jahrg. XIV (1893), Heft 2-4. Jahrg. XV (1894), Heft 1.
13) Zeitschrift für Ethnologie. 25. Jahrg. (1893), Heft 3-6. 26. Jahrg. (1894), Heft 1. - Ergänzungsblätter IV. Jahrg. (1893), Heft 2-6. V. Jahrg. (1894), Heft 1. Berlin.
14) * Thudichum (Fr. v.), Historisch=statistische Grundkarten. Tübingen 1892.
1) Annalen des historischen Vereines für den Niederrhein, insbesondere die alte Erzdiöcese Köln. Heft 56, 57, Abth. 1. Köln 1893.
2) Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 3. Folge. Bd. 4. Frankfurt a. M. 1893.
3) Archiv des Vereins für die Geschichte des Herzogthums Lauenburg. Bd. IV Heft 1. Mölln 1893.
4) Beiträge zur Geschichte des Niederrheins.Bd. 7. Düsseldorf 1893.
5) Mansfelder Blätter. 7. Jahrg. 1893. Eisleben 1893.
6) Brandenburgia. Monatsblatt der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg zu Berlin Bd. II, Nr. 4-12. Bd. III, Nr. 1-3. Berlin 1893/94.
7) Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte. Bd. VI. VII, 1. Leipzig 1893/94.
8) Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. 28. Jahrg. 1893. Heft 1, 2. Magdeburg 1893.
9) Pommersche Geschichtsdenkmäler. Bd. VII. Th. Pyl, Die Entwickelung des Pommerschen Wappens. Greifswald 1894.
10) Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emden. Bd. 10. Heft 2. Emden 1893.
11) Jahrbücher der Königl. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt. N. F. Heft 19. Erfurt 1893.
12) Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft 94. Bonn 1893.
13) 23. Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie zu Salzwedel, Abtheilung für Geschichte. Heft 2. Magdeburg 1893.
14) 21.-25. Jahresbericht des historischen Vereins zu Brandenburg a. d. H. 1894.
15) Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 69. 70, Heft 1. Görlitz 1893/94.
16) Mittheilungen des Vereins für die Geschichte Berlins. 1893. Nr. 7-12. 1894. Nr. 1-5.
17) Mitteilungen über römische Funde in Heddernheim. I. Frankfurt a. M. 1894.
18) Mittheilungen des Vereins für die Geschichte und Alterthumskunde von Hohenzollern. Jahrg. 26 (1892/93). Sigmaringen.


|
Seite 48 |




|
19) Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln. Heft 23. 24. Köln 1893.
20) Mittheilungen. Herausgegeben von dem Verein für die Geschichte der Neumark. Nr. 10-12. Landsberg a. M.
21) Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Landeskunde von Osnabrück ("Historischer Verein"). Bd. 18. Osnabrück 1893.
22) Mittheilungen des Anthropologischen Vereins in Schleswig=Holstein. Heft 7. Kiel 1894.
23) Mittheilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn. VIII. Heft. Thorn 1893.
24) Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch=antiquarischer Forschungen. Bd. XVIII. Heft 2. Halle 1893.
25) Monatsblätter. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 1893. Nr. 1-12.
26) Altpreußische Monatsschrift. N. F. Bd. 31. Heft 1. 2. Königsberg 1894.
27) Redlich (O. R.), Hillebrecht (Fr.), Wesener, Der Hofgarten zu Düsseldorf und Schloßpark zu Benrath. Herausgegeben vom Düsseldorfer Geschichts=Verein zum 14. August 1893. Düsseldorf 1893.
28) Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark. Heft 1. Landsberg a. M. 1893.
29) Schriften der physikalisch=ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. Jahrg. 33 (1892). Königsberg 1892.
30) Sonder=Veröffentlichungen der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. I. II. Posen 1892/93.
31) Baltische Studien. 43. Jahrg. Stettin 1893.
32) Verwaltungsbericht über das Märkische Provinzial=Museum für die Zeit vom 1. April 1892 bis 31. März 1893. Berlin 1893.
33) Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift. Zeitschrift des Vereins für das Museum Schlesischer Alterthümer. Bd. V, Nr. 10, VI, Nr. 1. Breslau 1894.
34) Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins. 15. Bd. Aachen 1893.
35) Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands. Jahrg. 1892. 1893. Braunsberg 1893/94.
36) Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. 51. Bd. Münster 1893.
37) Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1893. Hannover 1893.
38) Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen. VII. und VIII. Jahrg. Posen 1892/93.
39) Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins. 32. 33. Heft. Danzig 1893/94.
40) Zeitschrift des Historischen Vereins für den Regierungsbezirk Marienwerder. 31. Heft. Marienwerder 1893.
1) Bericht des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde über seine Thätigkeit im Jahre 1892.
2) * Techen (Fr.), Die Grabsteine des Doms zu Lübeck. Lübeck 1894. (S.=A.)
3) Urkundenbuch der Stadt Lübeck. 9. Th., 9.-13. Lief. Lübeck 1893.
4) Bremisches Urkundenbuch. 5. Bd., Lief. 2. Bremen 1893.


|
Seite 49 |




|
5) Mittheilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte. 15. Jahrg. (1892.) Hamburg 1893.
6) Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte. Bd. 9, Heft 2. Hamburg 1893.
1) Schriften des Oldenburger Vereins für Altertumskunde und Landesgeschichte. Bd. 7. 9. 10. Oldenburg 1892/93.
1) Mittheilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde. 6. Bd. Teil 4. Dessau 1893.
1) Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde.14. Bd. Dresden 1893.
2) 20. Bericht des Museums für Völkerkunde in Leipzig 1892. Leipzig 1893.
3) Jahresbericht des Kgl. Sächs. Alterthums=Vereins über das 68. Vereinsjahr 1892/93. Dresden 1893.
4) Mitteilungen vom Freiberger Altertumsverein. 29. Heft (1892). Freiberg 1893.
1) Mitteilungen des Geschichts= und Altertumsforschenden Vereins zu Eisenberg. 9. Heft. Eisenberg 1894.
2) Mittheilungen des Vereins für Geschichts= und Alterthumskunde zu Kahla und Roda. 4. Bd. 4. Heft. Kahla 1894.
3) * Reichl (Ed.), Sorbische Nachklänge im Reussischen Unterlande. Leipzig 1883.
1) Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins in Gießen. N. F. Bd. 4. Gießen 1893.
2) Quartalblätter des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen. N. F. Jahrg. 1893. I. Bd. Nr. 9-12. Darmstadt.
3) J. Fr. Seidenbender's Vorschläge für die Wiederaufrichtung der Stadt Worms nach der Zerstörung derselben durch die Franzosen im Jahre 1689. Herausgeg. von A. Weckerling. Worms 1892.
4) Zeitschrift des Vereins zur Erforschung der Rheinischen Geschichte und Alterthümer in Mainz. Bd. 3. Heft 2-4. Bd. 4,Heft 1. Mainz 1883/93.
1) Württembergischer Alterthumsverein 1843-1893. Denkschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens des Vereins. Stuttgart 1893.
2) Reutlinger Geschichtsblätter. 4. Jahrg. (1893), Nr. 3. 4. 6. 5. Jahrg. (1894), Nr. 1, 2.
3) Mitteilungen des Vereins für Kunst und Altertum in UIm und Oberschwaben. 4. Heft. Ulm 1893.
4) Württembergischer Altertumsverein. Rechenschafts=Bericht für die Jahre 1891-1893, insbesondere Beschreibung der Jubiläumsfeier vom 22. bis 25. Sept. 1893. Stuttgart 1894.
5) Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. N. F. II. Jahrg. Stuttgart 1893.


|
Seite 50 |




|
1) Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. 18. Bd. Heft 3. Bayreuth 1892.
2) Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. 10. Heft. Nürnberg 1893.
3) Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz. XVII. Speier 1893.
4) Monatsschrift des Historischen Vereins von Oberbayern. 1892. Oct. bis Dez. 1893. 1894 Jan. bis Juni. München.
5) Sitzungsberichte der philosophisch=philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1893, Heft 2, 3. Bd. II, Heft 1-4. München 1893/94.
6) Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. 45. Bd. Regensburg 1893.
7) Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. 20. Jahrg. Augsburg 1893.
8) Zeitschrift des Münchener Alterthums=Vereins. N. F. V. München 1893.
1) Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur Elsaß=Lothringens. 9. Jahrg. Straßburg 1893.
2) Paulus, Les Briquetages de la Seille. Metz 1889.
1) Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Tom. II Vol. II. W Krakowie 1892.
2) Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. 1893, Juni bis December. 1894, Januar bis April. Krakau.
3) Archiv für österreichische Geschichte. 78. Bandes 2. Hälfte. 79. Bd. 80. Bandes 1. Hälfte. Wien 1892/93.
4) Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. N. F. 25. Bd. 1 Heft. Hermannstadt 1894.
5) Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. 25. Jahrg. Graz 1893.
6) 51. 52. Bericht über das Museum Francisco=Carolinum. Linz 1893/94.
7) Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata. Anno XVI, Nr. 5-12. XVII. Nr. 1-3. Spalato 1893/94.
8) Carinthia. 83. Jahrg. (1893). Klagenfurt.
9) Hauthaler (W.), Ein salzburgisches Registerbuch des XIV. Jahrhunderts. Salzburg 1893.
10) Izvestja muzejskega društva za Kranjsko. Letnik III Sešitek 1-6. V Ljubljani 1893. Hermannstadt 1893.
11) Jahresbericht des Kärtnerischen Geschichtsvereines in Klagenfurt für 1892.
12) Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde für das Vereinsjahr 1892/93. Hermannstadt 1893.
13) Mittheilungen des Musealvereins für Krain. 6. Jahrg. Laibach 1893.
14) Mittheilungen des Nordböhmischen Excursions=Clubs. 16. Jahrg. (1893), Heft 2-4. 17. Jahrg. (1894), Heft 1. Leipa.
15) Mittheilungen des k. k. österr. Museums für Kunst und Industrie. 8. Jahrg. (1893), Heft 7-12. 9. Jahrg. (1894), Heft 1-6. Wien.
16) Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. 41. Heft. Graz 1893.


|
Seite 51 |




|
17) Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. 23. Bd., 4. 6. Heft. 24. Bd., 1. 2. Heft. Wien 1893/94.
18) Památky archaeologické a místopisné. Dilu XV sešit 9-12. XVI s. 1. 2. V Praze 1892/93.
19) Reissenberger (L.), Die Karzer Abtei. Hermannstadt 1894.
20) Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch=historische Classe. 127-129. Bd. (1892/93.)Wien.
21) Sitzungsberichte der Königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie. Jahrg. 1893. Prag 1894.
22) Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge, 37. Heft. Innsbruck 1893.
1) Bullettino di Paletnologia Italiana. Serie II. Tomo IX. Anno XIX. No. 4-12. Tomo X. Anno XX. No. 1-3. Parma 1893/94.
1) Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgeg. vom Historisch=antiquarischen Verein des Kantons Schaffhausen. Heft 6. Schaffhausen 1894.
2) - - - - Herausgeg. von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel. N. F. Bd. 3, Heft 4. Bd. 4, Heft 2. Basel 1893/94.
3) Der Geschichtsfreund. 48. Bd. Einsiedeln und Waldshut 1893.
4) Jahrbuch für Schweizerische Geschichte. 18. 19. Bd. Zürich 1893/94.
5) Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. LVIII. H. Zeller=Werdmüller, Zürcherische Burgen. Leipzig 1894.
1) Annales de la Société Archéologique de Namur. Tome 20 Livr. 2. 3. Namur 1893/94.
1) Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde. N. F. 4. Deel 3. 4. Afl. 5. Deel 1. 2. Afl. Leiden 1893/94.
2) Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslag van de Handelingen der 71. 72. Vergadering. Zwolle 1893/94.
1) Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. II. Raekke. 8. Bind, 2.-4.II. 9. Bd., 1. H. Kjøbenhavn 1893/94.
2) De danske Provinsarkivers Bygninger. København 1893.
3) Elvius (S.), Interessenter i Urte- og Isenkraemmer- samt Sukkerbager Compagnies i Kjøbenhavn 1693-1814 etc. Aarhus 1893.
4) Kringelbach (G. N.), Den civile Centraladministration 1848-1893. Kjøbenhavn 1894.
5) Meddelelser fra Genealogisk Institut. Hefte 1. Kjøbenhavn 1894.
6) Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord. N. S. 1892, p. 137-224. Copenhague.
7) Rasmussen (C. R.), Til og om Professor Dr. phil. L. F. A. Wimmer som Runolog. Kjøbenhavn 1894.


|
Seite 52 |




|
1) Bergens Museums Aarbog for 1892. Bergen 1893.
2) Bendixen (B. E.), Nonneseter Klosterruiner. Bergen 1893.
3) Berg (G.), Bidrag till den inre Statsförvaltningens Historia under Gustaf I. Stockholm 1893.
4) Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aarsberetning for 1892. Kristiania 1893.
5) Heimer (A.), De diplomatiska Förbindelserna mellan Sverige och England 1633-54. Lund 1893.
6) Inbjudningsskrifter till de Högtidligheter hvarmed Trehundraårsminnet af Upsala Möte kommer att firas i Upsala den 5.-7. Sept. 1893. Upsala 1893.
7) Jansson (II.), Sveriges Accession till Hannoverska Alliansen. Stockholm 1893.
8) Kongl. Vitterhets Historie och Antiqvitets Akademiens Månadsblad. 20. Årgången. 1891. Stockholm 1891/93.
9) Lundström (H.), Laurentius Paulinus Gothus. Hans Lif och Verksamhet (1565-1646). I. II. Upsala 1893.
10) Meddelanden från Svenska Riksarkivet utgifna af C. T. Ohdner. XVII. Stockholm 1894.
11) Norberg (O.), Svenska Kyrkans Mission vid Delaware i Nord-Amerika. Stockholm 1893.
12) Reuterskiöld (C. L. A. A.), Till Belysning af den Svensk-Norska Unionsförfattningen och dess tidigare Utvecklingshistoria. Stockholm 1893.
13) Risberg (B.), Tyska Förebilder till Dikter aff Atterbom. Upsala 1892.
14) Rudbeck (O.), Bref rörande Upsala Universitet utgifna af Cl. Annerstedt. I. Upsala 1893.
15) Samfundet för Nordiska Museets Främjande. 1891 och 1892. Stockholm 1894.
16) Antiqvarisk Tidskrift för Sverige. II. Delen 5. Häftet. Stockholm.
17) Wallgren (H. G.), Den internationale Rättsordningens Problem. I. Upsala 1892.
1) Beiträge zur Kunde Ehst=, Liv= und Kurlands. Bd. 4, Heft 4. Reval 1894.
2) Buchholtz (A.), Beiträge zur Lebensgeschichte Joh. Reinhold Patkuls. Riga 1893.
3) * Hansen (B. v.), Die Codices manuscripti und gedruckte Bücher in der Revaler Stadtbibliothek. (S.=A.)
4) Materialien zur Archäologie Rußlands. Nr. 4-12. St. Petersburg 1890/93. (In russischer Sprache.)
5) Mittheilungen aus der livländischen Geschichte. Bd. 15, Heft 2. Bd. 16, Heft 1. Riga 1893.
6) Rapports de la Commission Impériale Archéologique pour les Années 1882-1888. St. Pétersbourg 1893.
7) Memoiren der kaiserlich russischen Archäologischen Gesellschaft. Bd. 6. 7. 8 Heft 1. 2. St. Petersburg 1893. (In russischer Sprache.)


|
Seite 53 |




|
8) Memoiren der orientalischen Abtheilung der
Kaiserlich Russischen Archäologischen Gesellschaft.
Bd. 7. St. Petersburg 1893. (In russischer Sprache.)
- Arbeiten der orient. Abth.
 . Bd. 21. Ebenda 1892. (In russischer Sprache.)
. Bd. 21. Ebenda 1892. (In russischer Sprache.)
9) Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands aus dem Jahre 1893. Riga 1894.
10) Sitzungsberichte der Gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 1893. Dorpat 1894.
11) Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 16. Bd. Heft 3. Dorpat 1894.
12) Wallin (V.), Suomen Maantiet Ruotsin Vallan Aikana. Kuopio 1893.
1) Cincinnati Museum Association. 12. annual Report for 1892.
2) Contributions to North American Ethnology Vol. VII. Washington 1890.
3) Pilling (J. C.), Bibliography of the Athapascan Languages. Washington 1892.
4) -, Bibliography of the Salishan Languages. ib. 1893.
5) -, Bibliography of the Chinookan Languages. ib. 1893.
6) Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution for the Year ending June 30, 1890. Report of the U. S. Museum. Washington 1891.
7) 7. 8. 9. annual Report of the Bureau of Ethnology by J. W. Powell. 1886/88. Washington 1891.
8) 10. annual Report of the Board of Trustees of the Public Museum of the City of Milwaukee. Milwaukee 1892.
Der Vereinsbibliothekar:
Dr.
Schröder,
Reg.=Rath.
Anlage B.
Erwerbungen der Bildersammlung 1893/94.
1) Die Grabplatte der Herzogin Sophie von Meklenburg zu Wismar. (Zeitschrift für christliche Kunst 1888. Von Dr. Crull, Wismar.)
2) Der Belt der Kirche zu Bützow. (Zeitschrift für christliche Kunst 1889. Von Dr. Crull, Wismar.)
3) Die Wundereiche zu Prestin. (Zeichnung. Von Oberlanddrost von Pressentin, Dargun.)
4) Joh. David Karl Wilhelmi, Pfarrer in Sinseim in Baden, geb. 1786, gest. 1857. (Lithographie. Von Domprediger Wilhelmi, Güstrow.)
5) Ausmarsch des Jägerbataillons aus Schwerin (Verlegung nach Colmar), 30. März 1890. (Photographie.)
6) Die Meklenburger in Friedrichsruh beim Fürsten Bismarck, 18. Juni 1893. (Photographie.)


|
Seite 54 |




|
7) Einweihung des Denkmals Friedrich Franz II. 24. August 1893. (Photographie.)
8) Tableau von Doberan und dem Heiligen Damm. 11 Ansichten. (Colorirte Lithographie.)
9) Schwerin, von Zippendorf gesehen. (Stahlstich.)
Dr. W. Voß



|


|
|
|
Anlage C.
Auszug aus dem zweiten Bericht des Herrn Wossidlo-Waren über die Sammlung meklenburgischer Volksüberlieferungen.
Die andauernde Theilnahme, die dem bekannten, meiner Leitung anvertrauten Unternehmen des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde in weiten Kreisen des Landes entgegengebracht wird, scheint mir die Pflicht aufzuerlegen, nachdem zwei Jahre seit der Veröffentlichung meines ersten Berichts verflossen sind, aufs Neue eine Uebersicht über die Fortschritte und den Stand des vaterländischen Werkes zu geben.
Und da kann ich zunächst mit herzlicher Freude feststellen, daß meine in jenem Berichte ausgesprochene Bitte um weitere Mitarbeit williges Gehör gefunden hat. Wenn ich auch schon damals für eine vielseitige und nachhaltige Unterstützung danken konnte, so hat doch erst das Jahr 1892 die Hoffnungen der Erfüllung nahe kommen lassen, die mir bei Beginn der Arbeit vorschwebten. Zu den 230 Beiträgen aus den früheren Jahren sind im Laufe des Einen Jahres 275 neue hinzugekommen, darunter zahlreiche größere Sammlungen von hervorragendem Werthe. Das Jahr 1893 weist dann freilich einen starken Rückgang auf. Die durch den ablehnenden Beschluß des Landtages und das Zögern der Regierung hervorgerufene Ungewißheit über das Schicksal des Sammelwerkes hat, wie vorauszusehen war, auf den Eifer der Mitarbeiter erkältend eingewirkt. Immerhin sind weitere 45 Zusendungen eingegangen, so daß nunmehr im Ganzen von 270 Helfern 550 Beiträge vorliegen: ein Erfolg, wie er irgend einem ähnlichen Unternehmen in Deutschland bisher nicht geworden ist. Vor Allem der heimischen Lehrerschaft gebührt warmer Dank für opferwillige, treue Hülfe. Auch eine größere Zahl von Frauen hat hingebende Theilnahme bekundet.


|
Seite 55 |




|
Der Stoff nun, der so durch vereinte Arbeit dem heimischen Boden abgewonnen ist, wird der noch immer verbreiteten Vorstellung ein Ende machen, daß das Vereins=Unternehmen zu spät gekommen sei, daß von alter echter Ueberlieferung heutzutage nur kümmerliche Reste übrig seien. Ich kann schon jetzt mit größter Bestimmtheit sagen, daß nie zuvor aus irgend einem deutschen Lande eine solche Fülle werthwoller Volksüberlieferungen ans Licht gebracht ist: selbst Kenner unseres Volkes werden überrascht sein von dem Bilde geistigen Lebens, das das Sammelwerk enthüllen wird.
Ich zähle zur Zeit an Räthseln, Liedern, Reimen, neuen Sagen u.s.w. insgesammt 20 000 Varianten.
Das Räthselbuch ist in den letzten Jahren in erfreulicher Weise gereift und verspricht selbst hochgespannte Erwartungen zu übertreffen. Nach der Veröffentlichung meiner 17. Skizze "zum Räthselbuch" bin ich von Germanisten mehrfach auf die enge Berührung unserer meklenburgischen Volksräthsel mit dem mittelalterlichen Volksthum hingewiesen: eben darin zeigt sich ja der unschätzbare Werth der heimischen Ueberlieferung. Gillhoff's Buch, so tüchtig es ist, hat den Besitz unseres Volkes nicht im Entferntesten erschöpft. Allein durch Hülfe von Schulkindern läßt sich das in Winkeln versteckte Erbgut nicht ans Licht ziehen; dazu bedarf es eigenen Suchens, bei dem man dem Gedächtnisse der Alten nachzuhelfen, schlummernde Jugenderinnerungen hervorzulocken vermag. Das zeigt sich natürlich gerade für die werthvollsten und ältesten Räthsel am deutlichsten: während z. B. die Räthselmärchen und Verbrecherräthsel des Gillhoff'schen Buches in 53 Varianten über die Latendorf'schen Funde nicht wesentlich hinausgehen, liegen nunmehr nahezu 500 verschiedene Fassungen dieser fast ausnahmslos in hohes Alter zurückreichenden Gebilde vor. Noch in der allerletzten Zeit sind mir völlig neue, ungewöhnlich schöne Stücke in die Hände gefallen. Auch an solchen, das Kennzeichen besonderen Alters an sich tragenden Räthseln, an deren Schluß ein Preis für die Lösung ausgelobt wird - z. B. wer dieses kann rathen, der soll's haben, wer dieses kann denken, dem will ich mein herz schenken; wer's kann wissen, der soll die goldne jungfrau küssen; wer's kann erdenken, dem will ich eine weinkalteschale schenken u.s.w. - ist eine große Zahl bekannt geworden.
An Thiersagen, Deutungen von Thierstimmen u.s.w. ist viel Neues und Hübsches hinzugekommen. Sinnvollen Aberglauben aus dem Thier= und Naturleben hat das Strelitzer Land in Fülle geliefert. In den bildlichen Ausdrücken über Wind, Gewitter, Schnee, Wolken, Regen u.s.w. hat sich alte mythologische Auffassung mit wunderbarer Frische erhalten. Für Mittheilungen über die Namen des


|
Seite 56 |




|
Enterichs, ob arpel (erpel) oder waedick, waeding, waenke, waetk, wäpk, und des Sperlings, ob nur sparling oder auch lünink, lünk mit genauer Angabe der Standorte der Namen würde ich sehr dankbar sein.
Meine im ersten Bericht ausgesprochene Bitte, zur Ergänzung des Materials über Stand und Gewerk mitzuhelfen, hat guten Erfolg gehabt.
Auch an allerhand Necksprüchen über die einzelnen Gewerke und sonstigen Reimen ist viel Neues an den Tag gekommen. Neben dem Schäferstand, der sich den ersten Platz bewahrte, ist auch der Schneider als der Held zahlreicher Reime und Lieder hervorgetreten.
Nach Spottversen auf Städte und Dörfer, Teterower Stückchen, gereimten Zusammenstellungen der Bauern, Büdner, Häusler, Tagelöhner eines Dorfes, der Bewohner einzelner Straßen u.s.w. habe ich überall gesucht. Krugnamen, Namen einzelner Gehöfte, Häuser, Ackerstücke u.s.w. sind willkommen: es wird Alles einmal seinen Platz finden.
Werthvolle Leberreime haben verschiedene Herren mitgetheilt.
Die Erntekranzsprüche, 65 an der Zahl, weisen manche neue anmuthende Züge auf. Hervorhebung verdienen die Sprüche, die in Strelitz beim Bringen des Ollen üblich sind. Auch vom Hochzeitsbitterspruch liegen über 50 Fassungen vor. Die Anreden an den Ruklas, klingklas, rumpsack, rumprecker, kinnjees, Kannjees, Hele Christ verdienen sorgfältigste Sammlung. Die Bettellieder, wie sie früher überall von armen Kindern bei ihren Umzügen auf dem Lande gesungen wurden, bergen bemerkenswerte Reste alter geistlicher Liederdichtung. Fastelabendlieder scheinen sich nur auf Poel und dem Fischlande erhalten zu haben. Eine vollständige Aufzeichnung des alten Wettgesangs zwischen Winter und Sommer, von dem bisher nur kleine Bruchstücke aufgefunden sind, würde mit lebhaftem Dank begrüßt werden.
Kinderreime, Reime aus der Kinderstube, Spielreime, Abzählreime u.s.w. sind durch etwa 1000 Nummern in nahezu 4000 Varianten vertreten. An Tanzliedern, soweit sie mir als solche ausdrücklich bezeichnet wurden, zähle ich 180.
An sonstigen mundartlichen Liedern und Reimen der verschiedensten Art sind etwa 500 Stück in ca. 2500 Fassungen zusammengekommen. Da sind neben den alten Volksreimen und Volksliedern Kalender=Reime, Umgestaltungen bekannter Kirchenlieder, Reimsprüche aus der Land= und Hauswirthschaft, Dienstboten=Reime, Spinnstuben=Reime, Trinklieder, Kettenreime, Häufungsreime, Kinderpredigten, Neckmärchen u.s.w., u.s.w. Das Gemisch der Abarten der älteren


|
Seite 57 |




|
werthvolleren Reime zu entwirren, wird ernste Schwierigkeiten bereiten. So sind von dem Verwunderungslied nunmehr 137, von dem Hausstandsreim 128 Fassungen in meinen Händen, d. h. mehr als bisher aus dem ganzen übrigen Deutschland zusammengenommen veröffentlicht sind. Eine reinliche Scheidung der einzelnen Reime wird vielfach unmöglich sein. Das greift hinüber und herüber, oft hat man ein seltsames Gemisch zertrümmerter Reste altererbter Dichtung vor sich, die sich um einen dem Verderben länger trotzenden Kern crystallisirt haben.
Auf Einem Gebiete ist der Stoff seit der Veröffentlichung meines ersten Berichts um mehr als das Fünffache gewachsen. Durch die Funde der Mitarbeiter in Strelitz, wo die beim Bandelieren der Tabacksblätter üblichen Zusammenkünfte alte Dichtung in lebendigem Gebrauch erhalten haben, aufmerksam gemacht, habe auch ich in den letzten Jahren nach hochdeutschen Volksliedern fleißig geforscht und dabei entdeckt, daß es auch auf diesem Gebiete nur darauf ankommt, die rechten Quellen zu finden. Balladen und Liebeslieder sind bereits in Fülle beisammen. Auch an historischen Liedern und Reimen ist manches Beachtenswerthe zum Vorschein gekommen. Soldaten=, Matrosen=, Fischer=, Handwerksburschenlieder werden weiterer Sammelarbeit zur Beute fallen. Von den Mitarbeitern haben mehrere größere Massen alter Lieder, zum Theil mit den Melodien, deren Hinzufügung sehr erwünscht ist, eingesandt.
Aber auch nach einer anderen Richtung hin haben die letzten Jahre mir große Ueberraschungen gebracht. Das Material an Sagen, Märchen, Erzählungen, abergläubischen Meinungen u.s.w. wächst bei tieferem Eindringen immer mehr über das Werk von Bartsch hinaus. Allein aus dem Munde von vier in Waren und dessen nächster Umgebung gebürtigen Männern konnte ich über 80 belangreiche Sagen aufzeichnen, die bei Bartsch fehlen. Aehnlich wird es an anderen Orten sein; hier ist freilich mehr denn sonst langsames, vorsichtiges Vorgehen von Nöthen, um das Vertrauen der Gewährsmänner zu gewinnen und sie zu rückhaltloser Hergabe ihres Wissens zu bestimmen.
Ich hebe aus den neuen Funden hervor: wichtige Teufel=, Hexen= und Kobold=Sagen, zahlreiche Sagen von der Siebfahrt des Mort nach Engelland, für die sich bei Bartsch kein Beispiel findet, neue Sagen vom drak, vom snakenkönig, vom Pumpfuß, vom Blick ins Paradies, von der Strafe derer, die ewig zu leben wünschten, neue Freischützsagen u. a. m. Auch der aus der Polyphem=Sage bekannte Zug, das Herbeirufen von Helfern seitens des Gegners durch Entstellung des eigenen Namens zu vereiteln, ist in bedeut=


|
Seite 58 |




|
samer Weise mehrfach hervorgetreten. Die Gudrunsage dagegen hat sich bisher noch allen Nachstellungen entzogen.
Die Vertheilung der verschiedenen Namensformen Wold, Waur, Fru Goden, Fru Gosen, Fru Waus u.s.w., die Abgrenzung des Bezirks, in dem ein bestimmter Name für den wilden Jäger überall nicht auftritt, bedarf näherer Feststellung, die sich vielleicht im Zusammenhang mit der Untersuchung über waedick und arpel für die Colonisations=Geschichte unseres Landes bedeutungsvoll erweisen wird.
Auch sinnreiche Erzählungen sind in großer Zahl ans Licht gekommen, so von Gotjed, der sich aufhängen wollte, von dem, der das Weltende suchte, von dem, der die Gottheit ergründen wollte, von Gottlob und Gottsleider, von den drei Christen an der Himmelsthür u.s.w. Auch die Gruppe der lieben "Anekdoten und Schnurren" hat ansehnliche Bereicherung erfahren.
Aus dem Gebiet des Aberglaubens machten verschiedene Freunde der Sache dankenswerthe Mittheilungen. Auch ich selbst traf auf manche bei Bartsch nicht verzeichnete, altüberkommene Vorstellung. An Sympathieformeln, Himmelsbriefen, Diebssegen, Feuersegen u.s.w. liegen etwa 400 Nummern vor, deren größter Theil den reichhaltigen Sammlungen einiger Mithelfer verdankt wird.
Die vorstehende Uebersicht wird gezeigt haben, daß der Erfolg der Sammlung alle Erwartungen übertroffen hat, und daß der Schweriner Verein alle Ursache hat, sich seines Unternehmens zu freuen. Und noch ist ja immer unendlich viel in der Tiefe verborgen und neue Massen werden zuströmen, sobald die den Eifer der Mitarbeiter lähmenden Befürchtungen zerstreut sind und die Bearbeitung der einzelnen Theile begonnen hat.
Daß den auf eine glückliche Vollendung des ganzen Werkes hinzielenden Wünschen Erfüllung werde, ist meine gewisse Hoffnung. Regierung und Landtag werden sich der Einsicht nicht verschließen können, daß es ein unwiederbringlicher Verlust wie für die Wissenschaft so für unser Meklenburg, für die Kenntniß der Geschichte der geistigen Entwickelung unseres Volkes wie für die Pflege echt nationalen Empfindens wäre, wenn dieser Springquell aus der innersten Tiefe deutscher Erbe und deutschen Lebens, eben mühsam erschlossen, nun wieder für immer verschüttet würde.
Freilich die Zeit drängt. Schon droht die Aufgabe, den kaum übersehbaren Stoff zu verarbeiten, das Verhältniß zu den Ueberlieferungen anderer Völker klarzustellen, das Können eines Einzelnen,


|
Seite 59 |




|
der seine beste Kraft ohnehin dem Berufe zu widmen hat, zu überschreiten; und auch die über alle Vorstellung reichen Schätze der Sprache unseres Volkes wollen gesammelt und geborgen sein.
Allein Schwierigkeiten und unerwartete Hemmnisse können die Liebe zu einer guten Sache nicht ertödten. Ich meinerseits werde trotz aller Opfer, die die Fortführung des Werkes mir seit Langem auferlegt, nicht aufhören, mit stiller Freude jedes Goldkorn vom Boden zu lesen, wo ich es finde; es wird auch einmal eine Zeit kommen, wo man denen dankbar sein wird, die mit treuem Bemühen ein unverfälschtes Spiegelbild heimischen Volkslebens in kommende Zeiten zu retten suchten.



|


|
|
:
|
Meklenburgische Litteratur.
Juli 1893 bis Juli 1894.
I. Anthropologie und Alterthumskunde.
1) G. P. Alterthümer im Lande der Circipaner. (Südöstl. Mecklenburg.) Meckl. Nachr. 1893, Nr. 217.
2) Beltz, Dr., berichtet über eine dem Museum vom Herrn von Preen auf Dummerstorf geschenkte Sammlung wendischer Alterthümer, die auf der Feldmark Dummerstorf gefunden sind und der ältesten Zeit unserer Vorgeschichte angehören. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 23.
3) Urnenscherben bei Fürstenberg gefunden. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 264, 267.
4) Dr. Beltz=Schwerin berichtet über die Funde in einem Hügelgrabe bei Schaliß und einem Urnenfelde bei Kl.=Warin. Meckl. Nachr. 1894; Nr. 129.
5) F. Bn. Urnenfeld von Klein=Warin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 276.
6) Ein Bronzefund aus einem Torfstich bei Schönberg (bei Netzeband) wird in Heft 6 der Nachrichten über deutsche Alterthumskunde beschrieben (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 106. - Zur meckl. Litteratur. -)
7) Olshausen, O. Angebliche Funde von Eisen in steinzeitlichen Gräbern. (B. G. Anthr. Berlin) S. 89-121. Mecklenburg S. 107-109.
8) Hausen, N. Limes saxonicus Globus, Bd. 64, S. 178/9. (Nach Bangert - Litteraturbericht 1893, Nr. 6 -, dessen Aufstellung er für "so gut wie zweifellos" erklärt.)
9) Auf der diesjährigen Versammlung der Anatomischen Gesellschaft (zu Göttingen, 21. bis 24. Mai) hielt Prof. Dr. K. v. Bardeleben=Jena einen Vortrag, betreffend Massenuntersuchungen über Hyperthelie (Vorkommen überzähliger Brustwarzen) beim Manne. Zu Grunde liegen seinen Ausführungen die in den verschiedenen Aushebungsbezirken bei der Untersuchung der Gestellungspflichtigen gemachten Befunde, und besonders eingehend beschäftigte er sich mit dem Aushebungsbezirk Rostock, aus dem ihm durch Stabsarzt Dr. Hohnbaum=Hornschuch sehr genaue Aufzeichnungen zugegangen waren. Gerade die außergewöhnliche Sorgfalt, mit der hier das Material zusammengetragen ist, mag Ursache sein, daß der das östliche Mecklenburg


|
Seite 60 |




|
umfassende Bezirk in Bezug auf den Prozentsatz des Vorkommens dieser Abnormität mit 30,6 Prozent allen übrigen weit voraus ist. Professor v. Bardeleben möchte daran anthropologische Folgerungen knüpfen und sieht, da die nächst hohen Prozentsätze Landestheilen mit überwiegend slavischer Bevölkerung zufallen, in der Bevölkerung des Aushebungsbezirk Rostock vorwiegend nur sprachlich, aber nicht körperlich germanisirte Obotriten. Eine solche Auffassung widerspricht der Geschichte der Colonisation unseres Landes ebenso wie den Virchow'schen Erhebungen über Augen und Haarfarbe der Schulkinder; auch die Thatsache, daß die in Frage stehende Anomalie in Posen, Oberschlesien, der Niederlausitz nicht annähernd so häufig vorzukommen scheint, läßt es gerathen erscheinen, vorläufig kein zu großes Gewicht darauf zu legen. Abgedruckt ist der Vortrag im Ergänzungsheft zum Anatomischen Anzeiger, Jahrg. 8 (1893), S. 171-185. - Es mag noch dabei bemerkt werden, daß in der daran anschließenden Discussion Prof. Dr. von Brunn ein besonders häufiges Vorkommen der Hyperthelie auf der Anatomie zu Rostock in Abrede stellte. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 230. - Zur meckl. Litteratur.)
10) Maltzan, J. v., Ein Wort für das ostelbische Deutschtum. "Der Mecklenburger" XIII, Nr. 33. Der Verf. sucht aus allgemeinen historischen Gründen nachzuweisen, daß von beachtenswerthen slavischen Einflüssen auf die östlich der Elbe namentlich in Mecklenburg wohnende deutsche Bevölkerung nicht mehr die Rede sein könne.
11) Hammerich, Angul, Dr., Studier over Bronzelurerne i National-Musaeet i Kjøbenhavn. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. II. Raekke, 8. Bind. 2 Hefte. S. 141-190. Kjøbenhavn 1893. Vgl. Jahrbuch f. mekl. Gesch. III, B, 67 f. (Nach einer Notiz in der Voss. Ztg. vom 25. Juli 1894 sind "in diesen Tagen" sowohl bei Nykjöbing auf Falster als auch bei Stavanger in Norwegen je ein Paar altnordische Bronzehörner neu aufgefunden worden.)
12) Hey, Gustav, Dr. - Döbeln. Die slavischen Siedelungen im Königreich Sachsen mit Erklärung ihrer Namen. Dresden 1893. (H. nimmt vielfach auf mecklenb. Namen Bezug.)
13) Breßlau, H., Bischof Marco. Ein Beitrag zur Helmold=Kritik. Quidde, Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Bd. XI. (1894), S. 154-163. (Bei ihren Angriffen auf die historische Glaubwürdigkeit Helmolds haben sich Lappenberg u. a. darauf besonders gestützt, daß der Bischof Marco von Oldenburg anderweitig als bei Helmold nicht vorkomme. Schon Wigger hat im Mecklenburgischen Jahrbuch 42 dagegen nachgewiesen, daß Marco der zweite Bischof von Schleswig gewesen, daß ihm die Wagrische Mark mit untergeordnet gewesen sei, und daß diese erst nach seinem Tode ein eigenes geistliches Oberhaupt erhalten habe. Br. bekräftigt nun die Richtigkeit der Wiggerschen Forschung durch eingehende kritische Besprechung eines bei Riedel, Cod. dipl. Brandenburg. I, 6. 186 und Pertz, Archiv 11, 773 schon gedruckten, für die Helmoldkritik aber bisher nicht beachteten urkundlichen Zeugnisses aus dem gegen Ende des 11. Jahrhunderts angelegten Liber privilegiorum S. Mauricii, dem ältesten Copialbuch des Erzstiftes Magdeburg.)
14) Hasse, P., Dr. Staatsarchivar. Kaiser Friedrich I. Freibrief für Lübeck vom 19. September 1188. Zum Andenken an das 750jährige Bestehen der Stadt eingeleitet und herausgegeben. Lübeck, 1893. (Auf


|
Seite 61 |




|
Grund der im Lichtdruckbild beigegebenen Urkunde ist das von Mecklenburg bestrittene Hoheitsrecht über die Pötnitzer Wyk und den Dassower See durch Schiedsspruch des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 Lübeck zuerkannt worden.)
15) Der Grabstein des Darguner Abtes Johann Billerbeck. Beilage zum "Oeffentlichen Anzeiger", Nr. 64. Dargun, 12. Aug. 1893. (Nachdem der Verfasser die im Mekl. Urk.=Buch X. 7019 in ihrem jetzigen lückenhaften Zustande abgedruckte Inschrift zu ergänzen versucht, schildert er auf Grund des im Mekl. Urk.=Buch enthaltenen Materials das Eingreifen Billerbecks in den Kampf der sächsischen und wendischen Mönche in Doberan und sucht im Gegensatz zu Pyl, der einen Selbstmord annimmt, die Ermordung B's durch die Hand sächsischer, aus Doberan verbannter Konversen wahrscheinlich zu machen.)
16) Latendorf, Fr., Dr. Zwei mittelalterliche Denksteine in der Nähe der Stadt Schönberg. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 276.
17) Urkunde aus dem Staatsarchiv in Schwerin mitgetheilt von Dr. Saß. Zeitschr. f. schlesw.=holst.=lauenb. Gesch. XXIII, S. 233-4 (Gottorp. 1536 März 1. Die zu Gottorp versammelten Prälaten, Ritter, Mannschaft und Adel der Lande Schleswig=Holstein u.s.w. richten an die Prälaten und Mannen der Herzogthümer Mecklenburg die Bitte, den Herzog Albrecht von M. "dorthin zu vermugen und wyßenn," daß er von seinen Feindseligkeiten gegen ihren Landesherrn, den König Christian von Dänemark ablasse. - Die zu Wismar versammelten mecklenb. Stände gaben eine Abschrift dieses Schreibens mit einer kurzen Empfehlung am 13. März 1536 an Herzog Albrecht weiter. -)
18) Urkunde aus dem Rathsarchiv zu Wismar mitgetheilt von Dr. Techen, Zeitschr. für schlesw.=holst.=lauenb. Gesch. XXIII, S. 235. (c. 1400. Der Rath zu Kiel bittet den Rath zu Wismar um Rechtshülfe gegen einen Pantinenmacher, Meister Johann, der von Kiel nach Wismar gezogen und dem Heiligen Geist=Hause 3 1/2 Mark Miethe für eine Bude schuldig geblieben war.)
19) Meddelanden från svenska riksarkivet utgifna af C. T. Odhner. XVII. und XVIII. Stockholm 1893 und 1894. In denselben beginnen und setzen fort B. Taube und S. Bergh ein nach Ländern geordnetes Verzeichniß der im schwedischen Reichsarchiv vorhandenen Sammlung von Originalverträgen. Für Mecklenburg sind folgende von Interesse. * )
Dänemark. Nr. 24. A) Vertrag über Wismar und die Fahrten durch den Oeresund und den Belt. 29. April 1680. B) R. U. Kopenhagen 21. V. 1680. - Nr. 32. A) Friedensvertrag. Fredriksborg, 3. Juli 1720. B) E. V. C) R. U. zu A) 23. VIl. 1720. D) R. U. zu B) 23. VII. 1720. (In diesem Vertrage übernimmt Schweden die Verpflichtung, Wismar nicht zu befestigen. Durch den Beitrag von Malmoe ist dieselbe auf Mecklenburg übergegangen.) - Anhang zu Polen. I. Livland. Nr. 1. Vertrag mit dem Coadjutor des Erzstiftes Riga, Herzog Christoph von Mecklenburg, durch welchen derselbe seine livländischen Besitzungen unter schwedische Oberhoheit stellt Stockholm, 31. Oktobr. 1562. (Schirr=


|
Seite 62 |




|
macher: Johann Albrecht. S. 414.) - Deutschland. I. Nr. 3.Bündniß zwischen Schweden und den vereinigten Reichsständen in den vier oberen Kreisen auf der einen und den beiden sächsischen Kreisen auf der anderen Seite. Frankfurt a. M., 3. Sept. 1634. Zwei N. V. 6. IX. 1634. - Nr. 8. N. n. Herzog Adolf Friedrichs von Mecklenburg=Schwerin Ratificationsurkunde des Osnabrücker Friedens. Schwerin, 31. Oktober 1648. (Die Güstrower Ratificationsurkunde ist nicht aufgeführt) - Nr. 11. Ratificationsurkunden über die in Frankfurt a. M. 4/14. August 1658 zwischen Schweden (für Bremen=Verden und Wismar) und verschiedenen Reichsständen geschlossene Defensivallianz. S. Originalverzeichniß.) - Mecklenburg=Güstrow. Nr. 1. A) Herzog Gustav Adolfs Ratification der in Güstrow am 16. Januar 1666 geschlossenen Defensivallianz. Dat. Güstrow, 31. März 1666. B) R. U. der G.A. - Nr. 2. A) Herzog Gustav Adolfs Erneuerung der Defensivallianz vom J. 1666. Dat. Güstrow, 16. December 1670. B) Erneuerung der G.A. - Nr. 3. A) Herzog Gustav Adolfs Vollmacht für Johan Reuter zur Unterhandlung über eine Erneuerung der Defensivallianz von 1666. Dat. Güstrow, 1. Aug. 1674. B) Desselben Herzogs fernere Erneuerung der Defensivallianz von 1666. Dat. Güstrow, 22. September 1674. C) Erneuerung der G.A. - Nr. 4. Herzog Gustav Adolfs Ratification der vom König Karl XI. am 22. Febr. 1690 in Stockholm gegebenen Erklärung über die Succession im Herzogthum Sachsen=Lauenburg. Dat. Güstrow, 27. März 1690. - Nr. 5. Herzog Gustav Adolfs Ratification der im J. 1666 geschlossenen, vom König Carl XI. am 22. Febr. 1690 erneuerten und erweiterten Defensivallianz. Dat. Güstrow, - 27. März 1690. - Nr. 6. Herzog Gustav Adolfs fernere Erneuerung der Defensivallianz von 1666. Dat. Güstrow, 26. Febr. 1695. - Mecklenburg=Schwerin. Nr. 1. A) Defensivallianz. Dat. Stockholm, 13. April 1700. B) G.A. C) R. U. Herzog Friedrich Wilhelms. Dat. Schwerin, 5. Juni 1700. - Nr. 2. A) Die dem Herzog Karl Leopold ertheilte Zusicherung betreffend die Ueberlassung des Warnemünder Zolls an Mecklenburg. Dat. Rostock, 13. März 1714. B) Protokoll denselben Gegenstand betreffend. Dat. Rostock, 15. März 1714. C) Des mecklenburgischen Ministers Wolffradts Bescheinigung, betreffend denselben Gegenstand. Dat. Rostock, 16. März 1714. - Nr. 3. A) Kartel, betreffend Auslieferung von Deserteuren. Dat. Hauptquartier Pasewalk, 22. Oktobr. 1759. B) König Adolf Friedrichs R. U. Dat. Stockholm, 26. Nov. 1759. - Nr. 4. A) Herzog Friedrichs Ratification der Convention, betreffend den ungehinderten Marsch mecklenburgischer Truppen nach Schwedisch=Pommern und Rügen. Dat. Schwerin, 26. Nov. 1759. B) König Adolf Friedrichs R. U. Dat. Stockholm, s. d. - Nr. 5. Vertrag über die Erwerbung von Wismar, Poel und Neukloster. Dat. Malmö, 26. Juni 1803. Französisch. Unterz.: Jean Christophe Baron de Toll (für Schweden); Auguste Baron de Lützow, Conrad Wilhelm Brüning (für Mecklenburg). Papier, 26 Seiten Text, Siegel. B) N. V. zu Litt. A. Papier, 4 Seiten Text, Siegel. C) G.A. zu Litt. A. Papier, 3 Seiten Text, Siegel. D) Des Herzogs Friedrich Franz Vollmacht für die mecklenburgischen Unterhändler. Dat. Schwerin, 4. Juni 1803. Französisch. Papier, 2 Seiten Text, Siegel. E) Desselben Herzogs Ratification von Litt. A - C. Dat. Schwerin. 26. Juli 1803. Französisch. Pergament, 89 Seiten Text. Gebunden in blauem Sammet. Rothes Wachssiegel in einer silbernen, zum Theil vergoldeten Kapsel, Schnüre von Golddraht und blauer Seide - Nr. 6. Kartelkonvention, betreffend Auslieferung von entlaufenen Leib=


|
Seite 63 |




|
eigenen und entflohenen Verbrechern. Dat. Stralsund, 10. Aug. und Schwerin, 31 Aug. 1805. - Nr. 7. A) Konvention, betreffend den Marsch schwedischer Truppen durch Mecklenburg. Dat. Stralsund, 14. Nov. 1805. B) Des Herzogs Friedrich Franz Ratification von Litt. A. Dat. Schwerin, 25. November 1805. - Nr. 8. A) Konvention betreffend das Verbleiben des schwedischen Hauptquartiers und schwedischer Truppen in Mecklenburg. Dat. Lüneburg, 26. Dec. 1805. B) Des Herzogs Friedrich Franz Ratification von Litt. A. Dat. Schwerin, 28. Dec. 1805. - Nr. 9. Des Herzogs Friedrich Franz Ratification der am 13. Juni 1813 in Schwerin abgeschlossenen Konvention, betreffend die Verpflegung schwedischer Truppen. Dat. Schwerin, 14. Juni 1813. - Braunschweig=Lüneburg (incl. Hannover). - Nr. 23. A) Receß betreffend den Gang der Post zwischen Wismar und Hamburg durch das Herzogthum Lauenburg. Hamburg, 26. Aug. 1747. - B) R. U. der hannoverschen Regierung. Hannover, 20. Sept. 1747. - Nr. 24. Ratification der hannoverschen Regierung über einen am 31. März 1768 in Hamburg geschlossenen Receß. betr. den Gang der Post zwischen Wismar und Hamburg durch das Herzogthum Lauenburg. Hannover, 15. Juni 1768.
20) Hansen, Gotthard von, Die Codices manuscripti und gedruckte Bücher in der Revaler Stadtbibliothek. Sep. Abdr. a. d. "Rev. Beob." 1893, Nr. 189 und 191. Außer verschiedenen Handschriften des lübischen Rechts aus d. 13. und 14. Jahrh. auch 7) Jus Nautarum per civitates stagnales confirmatum. Lüb. 1482 des mandages na misericordia domini (Mai 7) H. Bersenbr. scripsit. Von den wendischen und anderen Städten getroffene Bestimmungen über die Seeleute enthaltend. 8 Bl. Perg. geh. 4º.
21) Hofmeister, Ad. Dr., giebt in den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaften", Berlin 1893, eine Uebersicht der mecklenburgischen historischen Litteratur aus dem Jahre 1892.
22) Hofmeister, * ) Ad., Dr., Berichte "Zur mecklenburgischen Literatur." Meckl. Nachr. 1893: Nr. 173, 183, 209, 235, 263, 301. 1894: Nr. 35, 71, 81, 109, 136. (Die Berichte enthalten auch die von Mecklenburgern herrührenden Arbeiten, sowie ein ausführliches Verzeichniß von Recensionen.)
23) Glöde, O., die Stellung des niederdeutschen Dialekts und seiner Werke zur hochdeutschen Schriftsprache und Litteratur. Zeitschr. f. deutschen Unterricht. 1894. Ergänzungsband.
24) Schröder, C., Dr. Regierungsrath. Mecklenburgs Antheil an der deutschen National=Litteratur bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Vortrag. Schwerin. (Bärensprung) 1894. (Der Vortrag war zuerst abgedruckt: Meckl. Nachr. 1894, Nr. 87-103.)
25) Das Studium der ausgestorbenen polabischen (elbslawischen) Sprache, die auch die Sprache der mecklenburgischen Wenden war, wird zur Zeit von polnischen Philologen eifrig betrieben. Dem vor etwa zwei Jahren wieder aufgefundenen Wörterbuch Johann Parum Schulze's hat A. Kalina in


|
Seite 64 |




|
den Abhandlungen der philologischen Classe der Akademie der Wissenschaften zu Krakau, Bd. 21, S. 75-178 eine sehr eingehende Untersuchung gewidmet und S. Ramult hat bei Gelegenheit der Bearbeitung eines Wörterbuchs der kassubischen Sprache festgestellt, daß die Sprache der Kassuben und anderer slavischer Volksreste in Hinterpommern sowie die der Elbslaven Dialecte einer und derselben Sprache sind, die er als die pommer'sche bezeichnet. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 261. - Zur meckl. Litteratur. -)
26) Schöne, A. Zum Redentiner Osterspiel. Zeitschrift für Deutschen Unterricht. Bd. 7. 1893 S. 17-30.
27) Freybe, A. Dr. Ein Ratmannen Spiegel von Johann Oldendorp, Dator und Syndicus zu Rostock. Herausgegeben und bevorwortet von - -. Facsimile=Druck der Bärensprung'schen Hofbuchdruckerei in Schwerin. Bespr. "Der Mecklenburger" XIII. 44 und 49. Litterar. Beibl. - Rost. Anz. 1894, Nr. 86.
28) Um den berühmten Rostocker, später Marburger Juristen Joh. Oldendorp hat sich Dr. A. Freybe in Parchim ein Verdienst erworben, indem er dessen, soweit bekannt, nur in dem einzigen Exemplar der Rostocker Universitätsblibliothek erhaltene, 1530 bei Dietz in Rostock gedruckte Abhandlung "Wat billick unde recht ys" in der Zeitschrift der Savigny=Stiftung für Rechtsgeschichte Bd. 14, Romanistische Abtheilung, S. 97-114, wieder zum Abdruck bringt. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 261. - Zur meckl. Litteratur. -)
29) Wie die Conowburg unterging. Eine altwendische Geschichte. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 7. ff. (Feuilletonistische Ausschmückung.)
30) Dau, Albrecht. John Brinkmann. Gegenwart. 1893, Nr. 44.
31) John Brinkmann. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 288. Rost. Ztg. 1893, Nr. 571.
32) B. Plattdeutsche Meister=Erzählungen von John Brinkmann. Aus der Wochen=Rundschau für dramat. Kunst, Litteratur und Musik. Frankfurt a. M. 1893, Nr. 48. Abgedr. Rost. Anz. 1893, Nr. 289.
33) Maria Günther, Christian Ludwig und seine Hofcomödianten. Historisches Original=Charakterbild in 4 Aufzügen.Bespr. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 247. Der Mecklenburger XIII, Nr. 36. Litt. Beibl.
34) Raatz, Gustav, Wismar, veröffentlicht im Hamburger Fremdenblatt in erweiterter und umgearbeiteter Gestalt seine vor ca. 8 Jahren in der "Deutschen Lesehalle" erschienenen Studien über Figuren in Fritz Reuters Dichtungen. * ) Nr. 164. (15. Juli 1893) Triddelsitz. - Nr. 226. (26. Sept. Unkel Herse. - Nr. 281. (30. Nov.) Amtshauptmann Weber. - Nr. 47. (24. Febr. 1894) Moses. - Nr. 75. (31. März) Droz. - Nr. 93. (21. April) Franzoß- Z. - Nr. 121. (26. Mai) Möller Voß. - Nr. 145. (23. Juni) Konrektor Aepinus. -
35) Corleis, F. Meckelnborgsche Revolutschon (Schauspiel). Altona o. J.
36) Glöde, O. Jochen Nüßler, Fritz Triddelsitz. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 129. (Gl. weist den Namen Triddelsitz als einen altmecklenb., schon im 15. Jahrh. in Wismar vorkommenden Namen nach)
37) Wagtsmitgott, L. - Wiedow -, Söß plattdütsche Geschichten. Stavenhagen.


|
Seite 65 |




|
38) Wossidlo, Zweiter Bericht über die Sammlung mecklenburgischer Volksüberlieferungen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 116. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 61, 63 u. 64. Auszug: in diesem Schlußbericht, auch im Correspondenzblatt des Gesammtvereins 1894, Nr. 7.
39) Glöde, O. Das Besprechen von Krankheiten. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 129.
40) Eine Probe seiner Sammlungen auf dem Gebiete der mecklenburgischen Volksüberlieferungen veröffentlicht R. Wossidlo=Waren in Heft 2 der Zeitschrift des Vereins für Volkskunde unter dem Titel: "Der Tod im Munde des mecklenburgischen Volkes." (Aus Rost Anz. 1894, Nr. 134. - Zur meckl. Litteratur.)
41) Eine auch Mecklenburg berührende Sage "Der Roland zu Wolde" theilt Dr. A. Haas=Stettin in den Blättern für Pommer'sche Volkskunde, Jahrg. 2, Nr. 1 mit.
42) Glöde, O. Volkslieder aus Mecklenburg. Am Urquell. Bd. 4, S. 71/72.
43) Gillhoff, Johannes. Ueber Alter und Art des Volksräthsels. Tägliche Rundschau, Unterhaltungsbeilage Nr. 86 und 87. Berlin 14. und 15. April 1894.
44) In Bd. 7 der Zeitschrift für Deutschen Unterricht, S. 688-691 zeigt Dr. O. Glöde=Wismar, auf Gillhoff's und Wossidlo's Veröffentlichungen fußend, an den niederdeutschen Storch=, Floh= und Entenräthseln, wie groß der Reichthum unseres Volkes an alten und gehaltvollen Räthseln ist. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 296. - Zur meckl. Litteratur. -)
45) Haase, K. Ev. Sagen aus Mecklenburg. Am Urquell Bd. 4 (1893) Hft. 1.
46) Glöde, O. Blaumäntelchen, ein Geist in Mecklenburg. Am Urquell, Bd. 4, S. 213/4.
47) Glöde, O., Petermännchen, Chimmeken, Wolterken und Hödeke als gute Hausgeister. Zeitschrift für Deutschen Unterricht, Bd. 7, S. 194-199.
48) Wossidlo, R., Volksthümliches aus Mecklenburg, aus dem Volksmunde gesammelt. (Vom Tanzen.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 252.
49) Düsser, Aug., Ringreiten, Ländliche Skizze. Vossische Ztg. 1893, Nr. 467. (Wahlstorf im Fürstenthum Ratzeburg.)
50) Dr. O. Glöde in Wismar giebt in der Monatsschrift fürVolkskunde "Am Urquell", Bd. 5, H. 1, eine kurze Beschreibung des Tonnenabschlagens in Wustrow. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 46. - Zur meckl. Litteratur. -)
51) Stieda, W., Studien zur Geschichte des Buchdrucks und Buchhandels in Mecklenburg Archiv zur Gesch. des deutsch. Buchhandels XVII. Auch Sep.=Abdr. Leipzig 1891.
52) Stieda, W., Dr. Prof., Der Buchhandel Rostocks im 17. Jahrhundert. Rost. Ztg. 1894, Nr. 58, 64. (Professor Stieda schätzt den jetzigen Bestand der Rost. Universitäts=Bibliothek auf über 300000 Bde., s. dagegen die wohl zutreffendere Schätzung in Nr. 56 dieser Uebersicht.)
53) Stieda, Dr., Hamburger Avisen in Mecklenburg. Mittheilungen d. Ver. f. hamb. Gesch. Bd. VI, Nr. 8. Abgdr. auch Rost. Ztg. 1894, Nr. 312.
54) Stieda, W. Dr. Prof. Die Anfänge der periodischen Presse in Mecklenburg. Vortrag, Bericht darüber: Rost. Ztg. 1894, Nr. 116.
55) Schröder, Dr., Regierungsrath, Die Anfänge des Buchdrucks in Schwerin. Vortrag. Bericht über deus.: Meckl. Ztg. 1894, Nr. 320.
56) Schwenke, Paul, Dr., Adreßbuch der deutschen Bibliotheken. Leipzig 1893. (Mecklenburgische Bibliotheken: S. 74 Bützow. Bibl. d. städt. Realgymnasiums. Begr. 1860. 4165 Bde. Kein fester Etat. - S. 89. Doberan. Bibl. d. großh. Gymnasiums. Begr. 1881. 1200 Bde. u.


|
Seite 66 |




|
4000 Progr. Etat 400 Mk. - S. 130. Friedland. Bibl. d. städt. Gymnasiums ca. 2000 Bde., 12000 Progr. Etat 200 Mk. - S.151-152 Güstrow. 1) Bibl. d. großh. Domschule. Begr. ca. 1662. 16800 Bde. (8 Inkun.), ca. 13000 Progr.; einige handschriftliche Mecklenburgica; Hansensche Bildersammlung in 193 Kapseln u. 36 Mappen; Musikaliensammlung a. d. 16. u. 17. Jahrhundert. Etat 500 Mk. 2) Bibl. des großh. Landgerichts. Begr. 1865. ca. 2300 Bde. Etat 470 Mk. - S. 234. Ludwigslust. Bibl. d. großh. Realgymnasiums. ca. 1500 Bde. u. ca. 3000 Progr. Etat 360 Mk. - S. 244. Malchin. Bibl. des städt. Realgymnasiums. Begr. 1866. Wenig über 1000 Bde; kein Etat. - [Malchow. Rathsbibliothek, ca. 1500 Bde.; Etat 400 Mk] * ) - S. 275. Neubrandenburg. Bibl. d. städt. Gymnasiums. Begr. 1830, 2400 Bde. und ca. 3500 Progr. Etat 200 Mk. - S. 278. Neustrelitz. 1) Großh. Bibliotek. Begr. 1796. ["Die Bibliothek ist an Büchern, Inkunabeln, Karten, Stichen und Notenwerken, ca. 110 000 Bde. u.s.w. - geb. und ungeb. - stark. Ein jährlicher Etat, der zur unumschränkten Disposition des Bibliothekars steht, ist für die Bibliothek und die großherzogl. Sammlungen gemeinschaftlich und vertheilt sich auf diese je nach Bedürfniß. Größere Kostenaufwände werden von Fall zu Fall höheren Orts, von wo aus auch bedeutendere Zuwendungen an größeren und werthvolleren Werken jährlich erfolgen, zur Zahlungsanweisung beantragt.] ** ) 2) Bibl. d. großh. Gymnasiums. Begr. 1806, 5300 Bde. und ca. 9000 Progr. Etat 345 Mk. 3) Bibl. d. großh. Landgerichts Begr. 1879, ca. 200-300 Bde. Etat 400-450 Mk. - S. 292. Parchim. Bibl. d. großh. Gymnasiums. Begr. 1783, ca. 6500 Bde. und 8000 Progr. Etat 600 Mk. - S. 305. Ratzeburg. Dombibliothek. Begr. 1769, ca. 5200 Bde. (6 Bde. Inkun.). 18 Bde. meist neuerer Handschriften und ca. 60 ältere handschriflliche Motetten und Cantaten. Etat 60 Mk. - S. 311-313. Rostock. 1) Großh. Universitätsbibliothek. Begr. 1569, ca. 175 000 Bde. u. Fasc. (606 Bde. Inkun.), 1356 meist neuere Handschr. [Nach Stieda - Nr. 53 dieser Litteratur=Uebersicht - über 300 000 Bde.]; Etat 29 170 Mk. (sachl.: 19 270 Mk, pers.: 9900 Mk.) 2) Bibl. d. städt. Gymnasiums [Große Stadtschule!]. Begr. 1833, ca. 8000 Bde. und ca. 9000 Progr., 5 Handschr. Etat 600 Mk. 3) Landesbibliothek (Bibl. d. meckl. Ritter= und Landschaft.) Begr. 1740. 31 000 Bde. (5 Inkun.), 12 900 Jurist. Dissert. und ca. 5000 kleine Schriften über Meklenburg, ca. 300 Handsch. Außerdem Samml. kl. genealog. Schriften, Leichenprogr., Nachrichten über ca. 1200 mekl. Familien. Etat 3000 Mk. 4) Bibl. d. großh. Ob.=Landesgerichts. ca. 2500 Bde. Etat 700 Mk. 5) Bibl. d. großherzogl. Landgerichts. Begr. 1879, ca. 1400 Bde. Etat 500 Mk - S. 324-325. Schwerin. 1) Großh. Regierungsbibl. Begr. 1779., reorg. 1886, ca. 125 000 Bde. (12 Inkun.) und 1242 Kapseln. ca. 100 Handschriften. Etat wechselt. 1891/92: 27 050 Mk. (sachl.: 13 100 Mk., pers.: 13 950 Mk.) Einverleibt 1886: Großh. Bibliothek in Ludwigslust; von Schweriner Bibl. die d. Gymnasiums, Realgymn. (beide Anstalten haben nur kleine Handbibliotheken behalten), Oberkirchenraths, Landgerichts (theilweise!) Statist. Büreaus, Kammer= und Forst=Collegiums, der Central=Bauverwaltung, des Gewerbe= und des jurist Vereins. Zur Aufbewahrung und Verwaltung wurden übergeben: die Bibliothek des


|
Seite 67 |




|
Magistrats und die des Vereins für meklenb. Geschichte und Alterthumskunde; (vergl. Jahrb. 1886, Quart.=Ver. IV., S. 5-7.) die Bibliothek des Herzogs Paul Friedrich und die Musikaliensammlung S. K. H. des Großherzogs; neuerdings auch die der Hennemann'schen Stiftung. 2) Bibliothek des großh. Landgerichts Begr. 1840, 1716 Bde. Etat 500 Mk. 3) Militairbibliothek im Büreau der 17. Division. Begr. 1866. Benutzungsberechtigt nur die Garnisonen Lübeck, Ratzeburg und sämmtliche in Mecklenburg. 2190 Bde. Etat 700 Mk. - S. 358. Waren. Bibl. d. städt. Gymnasiums. Begr. 1869. 2620 Bde. Etat 300 Mk. - S. 367. Wismar. Bibl. der großen Stadtschule, ca. 4000 Werke. Etat 500-600 Mk - S. 148. Greifswald. Odebrecht'sche Familien=Bibliothek. Ueber 1000 Bde. Drucke und ca. 300 Nrn. bez. Handschr., Urkunden und Acten. Drucke und Handschr., zumeist aus dem 18. Jahrh. betreffen hauptsächl. schwedisch=pommersche und meklenb. Geschichte und Genealogie. Die Bibliothek steht unter Verwaltung des Magistrats.
57) Verzeichniß der von der Großherzoglichen Regierungs=Bibliothek in der Zeit vom 1. Decbr. 1892 bis zum 30. Novbr. 1893 erworbenen neuen Bücher. Schwerin 1893.
58) Verzeichniß der Bücher und Kupferwerke des Vereins der Künstler und Kunstfreunde zu Schwerin. Schwerin 1893.
59) Raabe, Wilhelm, Mecklenburgische Vaterlandskunde. 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis zur Gegenwart verbessert und vervollständigt von Gustav Quade. Lief. 11-17. Wismar 1893 und 1894. Lief. 11-13. Schluß der Ortskunde, Nachträge, Berichtigungen und Register. Lief. 14. Landeskunde beider Großherzogthümer. Volkskunde beider Großherzogthümer; Bevölkerungsverhältnisse. - Landwirthschaftliche Verhältnisse. - Lief. 15. Landwirthschaftliche Verhältnisse. - Gewerbethätigkeit. - Verkehrsmittel zu Lande. Chausseen, Eisenbahnen. - Post und Telegraphen. - Handel und Schifffahrt. - Münzen, Maße und Gewichte. - Das Steuer= und Zollwesen. - Lief. 16 und 17. Städtisches Steuer= und Finanzwesen. - Unterrichts= und Bildungs=Anstalten. -
60) v. Bomsdorff=Baade, Topographische Specialkarte der Großherzogthümer Mecklenburg=Schwerin und Mecklenburg=Strelitz. 1: 200 000. Rostock 1894.
61) v. Bomsdorff=Baade, Orographisch=Topographische Wanderkarte durch das nordöstliche Mecklenburg. 1:100 000. Rostock 1894.
62) Grotefend, Dr., Archivrath. Historisch=statistische Grundkarten. Vortrag, Bericht darüber Rost. Ztg. 1894, Nr. 58.
63) Das Fischland und seine Verkehrsverhältnisse. Rost. Ztg. 1893, Nr. 570.
64) Aus der Rostocker Haide. Rost. Anz. 1894, Nr. 74.
65) Eine Bootreise von Berlin nach dem Müritzsee. (Aus d. "N. Pr. Ztg.") Meckl. Nachr. 1893, Nr. 211, 212 und 214.
66) Friedländer Moorcultur. Besuch derselben seitens der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft am 11. Juni 1894. Rost. Ztg. 1894, Nr. 270.
67) Renard, O., Moorculturen, deren Erträge und Fortschritte im westlichen Mecklenburg. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 4, 5, 7, 8 (Kolbow, D.=A. Grabow), 9 (Volzrade b. Lübtheen), 11 (Hof Jamel und Kirchstück b. Schwerin).
68) Uebersicht über die (1892 gebildeten) landwirthschaftlichen statistischen Bezirke. Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. Bd. XII., Hft. 2, S. 126-135. Gesammtfläche, Forst= und Seenfläche in Quadrat=Kilometern, ebda. S. 186-193.


|
Seite 68 |




|
69) Peltz, W. Die Flächenverhältnisse der mecklenburgischen Flußgebiete. Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. XII. Bd., 3. Hft., 1. Abthlg. Schwerin 1894.
70) Die Rittergüter in Mecklenburg=Schwerin. Rost. Anz. 1893, Nr. 301. 1894, Nr. 5, 11. 17, 23, 29, 35. (Nach Aemtern geordnete, tabellarische Uebersicht der Rittergüter in Mecklenburgs=Schwerin. Anscheinend auf Grundlage des Dr. Müller'schen Handbuches und der von G. Quade herausgegebenen 2. Auflage der Raabe'schen Vaterlandskunde beruhend.)
71) Zu den Bevölkerungsverhältnissen in Mecklenburg. Meckl. Ztg. 1893. Nr. 587.
72) Zusammenstellung der Adventsberichte aus einigen meckl. Städten. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 286.
73) Grotefend, H., Dr. Archivrath, Ein Fortschritt in der Bevölkerungsstatistik. Frankfurter Ztg. 1893, Nr. 346. (Der Referent bespricht ebenso wie im Correspondenzblatt des Gesammtvereins d. deutsch. Gesch.=Ver. 1894, Nr. 2 und 3 die im Jahrb. 58 veröffentlichte Arbeit "die Bevölkerung Mecklenburgs am Ausgang des Mittelalters" von Dr. Fr. Stuhr und fordert unter Hinweis auf das im Frankfurter Archiv liegende ähnliche Material zu weiteren Nachforschungen in anderen Archiven und zur Bearbeitung des aufgefundenen Materials auf.)
74) Quade, G., Wie geht es den mecklenburgischen Auswanderern in Amerika? Meckl. Nachr. 1893, Nr. 172, 174, 177, 186, 190 und 191.
75) Vertouch, E. v., Die großen nordischen Fluthen und deren Folgen. Wiesbaden, 1893.
76) Möckel, Dr., Die Entstehung des Plauer Sees. Vortrag, Bericht darüber: Meckl. Nachr. 1894, Nr. 112.
77) Hoeck, F. Begleitpflanzen der Kiefer in Norddeutschland.B. d. Bot. Ges. Bd. XI. (1893), S. 242-248.
78) Ueber neue Ergebnisse der schwedischen Quartärforschung, soweit sie für die Vorgeschichte der europäischen Flora von Wichtigkeit sind, berichtet Dr. E. H. L. Krause im Globus Bd. 64, Nr. 17. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 261. - Zur meckl. Litteratur. -)
79) Die Viehzählung im Großherzogthum Mecklenburg=Schwerin am 1. December 1892. Beiträge zur Statistik Mecklenburgs. Bd. XII., Hft. 2.
80) Flaum, Fr. Das Großherzoglich Mecklenburg=Schwerinsche Landgestüt Redesin. Leipzig 1893.
81) "Programme (franz. Hengst) für Redesin angekauft." (Abdruck eines Aufsatzes aus der "Sport=Welt", der den Werth dieses Ankaufes für die meklenb. Pferdezucht darlegt.) Rost. Ztg. 1893, Nr. 592.
82) Vanselow, Major a. D. Zur Pferdezucht in Mecklenburg. Aus dem Landw. Vereinsblatt: Meckl. Nachr. 1893, Nr. 201.
83) v. T.=K. Unsere Landespferdezucht. Rost. Anz. 1893, Nr. 265.
84) Nach einer aus der "Sport=Welt" in der Rost. Ztg. 1893, Nr. 598 abgedruckten Notiz haben im Jahre 1893 48 aus mecklenburgischen Gestüten (Basedow: 22, Ivenack: 8, Remlin; 6, Zierow: 6, Warnkenhagen: 3, Briggow: 2, Gottin: 1) hervorgegangene Pferde Preise im Gesammtbetrage von 341 634 Mk. gewonnen und somit ein besseres Resultat erzielt, als die gleiche Zahl Graditzer Abstammung (48:315 616 Mk.)
85) Vollbluthengste in Mecklenburg (Fincken b. Stuer, Nustow b. Tessin). Rost. Ztg. 1894, Nr. 70.
86) Schlagsdorf, E. Ueber den Nutzen der Ziegenhaltung. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 145.


|
Seite 69 |




|
87) Beyer, C., Zur Fürsorge für den kleinen Mann. Meckl. Nachr. Sonntagsblatt Nr. 19 und 20, 13. und 20. Mai 1894. (Pastor Beyer tritt warm für die Hebung der Ziegenzucht im Lande ein.)
88) Evers, Senator in Parchim, Ueber den am 12. Februar 1894 stattgehabten Sturm. Vortrag, Bericht darüber Meckl. Nachr. 1894, Nr. 112. (Ueber die Sturmschäden vgl. die zahlreichen Notizen in den Tagesblättern vom 12. Februar u. folgenden Tagen.)
89) Die Blitzschäden des Jahres 1893 in Mecklenburg=Schwerin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 10.
90) Die Feuerversicherung der ausgebauten Erbpächter. Rost. Ztg. 1894, Nr. 142.
91) Sitzung des mecklenburgischen Landwirthschaftsrathes am 28. Mai 1894. Berathungsgegenstände: 1) Verordnung über die Einführung einer obligatorischen Bollenkörung; 2) Verordnung über das Feuerlöschwesen; in der Ritterschaft. Bericht über die Verhandlungen: Meckl. Nachr. 1894, Nr. 122.
92) Thätigkeits=Bericht der landwirthschaftlichen Versuchstation Rostock für das Jahr 1892. Rost. Ztg. 1894, Nr. 8.
93) Heinrich, R., Dr., Professor. Dünger und Düngen. Anleitung zur praktischen Verwendung von Stall= und Kunstdünger. Von dem Mecklenburgischen Patriotischen Verein gekrönte Preisschrift. 2. umgearbeitete Auflage. Berlin 1894.
94) Der landwirthschaftliche Verein kl. Landwirthe in Meckl.=Schwerin im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1893, Nr. 34.
95) Der mecklenburgische Fischereiverein, Thätigkeit desselben im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894. Nr. 154.
96) Krause, L. "Aus Peter Laurembergs Tagebuche, ein Beitrag zur Geschichte des Garten=, namentlich des Obst=Baues zu Rostock während des dreißigjährigen Krieges." Vortrag, Bericht darüber: Rost. Ztg. 1894. Nr. 110.
97) Stötzer, Dr., Jubiläumsfeier eines um den Obstbau verdienten Mecklenburgers, (d. i. des Cantors a. D. D. G. B. Müschen=Belitz, jetzt in Teterow). Meckl. Nachrichten 1893. Nr. 151. (1. Juli 1893.)
98) D. Zur Hebung des Obstbaues im Lande. Meckl. Nachr. 1893. Nr. 196.
99) Obstplantagen der Herren Beerbaum und Krause in Tessin. (Stadt.) Rost. Zeitg. 1893. Nr. 319.
100) Stötzer, Dr. Die Lage des Obstbaues in Mecklenburg. Bericht über einen Vortrag. Rost. Ztg. 1893. Nr. 524, 526.
101) Stötzer, Dr. Bützow, Obstsortiment zum Anbau in Mecklenburg. Rost. Ztg, 1894. Nr. 92. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 47 und 48.
102) Liegt in Mecklenburg die Landwirtschaft darnieder? Unter dieser und ähnlichen Ueberschriften wurden im letzten Jahre verschiedene Fälle von Verkäufen und Ertragsergebnissen ländlicher Grundstücke öffentlich besprochen. 1) Blankenberg D.=A. Warin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 54. Rost. Anz. 1894, Nr. 11. - 2) Botelsdorf D.=A. Gadebusch, Hufe Nr. 5. Rost. Anz. 1894, Nr. 118; Meckl. Nachr. 1894, Nr. 119 und 123, wo Geh. Finanzrath Balck=Schwerin unter Beibringung von statistischem Material über Zwangsverkäufe bäuerlicher Grundstücke nachweist, daß zur Beurtheilung des Werthes von Erbpachtgrundstücken nicht das Ergebniß der Zwangsversteigerungen, sondern das der freihändigen Verkäufe heranzuziehen sei. Bei denselben seien auch in den letzten Jahren die Kaufpreise nicht hinter denjenigen früherer Zeit zurück=


|
Seite 70 |




|
geblieben und 3 Mk. für die [] R. waren und seien bei Gehöften in gutem Stande keine Seltenheit. - 3) Katelbogen, R A. Mecklenburg. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 105, 106, 114 und 117. (Ankündigung zur Zwangsversteigerung mit Gutsbeschreibung!) Rost. Anz. 1894, Nr. 106 108 und 113, "der Mecklenburger" XIV, Nr. 7, Meckl. Ztg. 1894 Nr. 254. (A. d. Teterower Ztg.) - 4) Rabenhorst, R. A. Güstrow Rost. Anz. 1894, Nr. 156, 158 und 160. - 5) Wolde, R. A. Grevesmühlen, Rost. Anz. 1894, Nr. 10, 15, 20 und 25. -
103) Ritter, Gutspächter, Damerow. Einige Erfahrungen über Anerbenrecht und Verschuldung in Mecklenburg. "Das Land" II. Nr. 10. (15. Febr. 1894.)
104) Credit= bezw. Verschuldbarkeitsverhältnisse der Mecklenburgischen Erbpächter. Rost. Ztg. 1894. Nr. 276.
105) Landwirthschaftlicher Nothstand? C. W. berichtet über die gedrückte Lage eines Erbpächters auf einem meklenb. Rittergute. Meckl. Nachr. 1894. Nr. 126.
106) Der Großgrundbesitz im deutschen Reich. Der Mecklenburger XIII, Nr. 35, 39, 40 und 41, 45.
107) Einige Streiflichter auf die sogenannte Agrarreform. Rost. Ztg. 1894. Nr. 68, 77, 78, 82, 86, 88 und 90. I. Allgemeines. II. Anerbenrecht. III. Heimstätten. IV. Verschuldungsform, Rentenschuld. V. Vermeidung des Concurses durch Verwaltung der Rentengläubiger. VI. Zwangsgenossenschaften bei der Rentenschuld. VII. Rentengüter.
108) Das Dictamen des Herrn von Müller=Gr.=Lunow vom 9. Dec. 1893. Der Mecklenburger XIII, Nr. 44. (v. Müller erneuert seinen Antrag vom 25. Nov. 1890 betr. die Förderung der Seßhaftigkeit der ländlichen Bevölkerung in Mecklenburg durch Neubildung kleineren und mittleren Grundbesitzes.)
109) Dictamen des Grafen v. Bernstorff=Ankershagen vom 20. December 1893. Der Mecklenburger XIII, Nr. 46. (Graf B. wendet sich gegen die Neubildung mittleren Grundbesitzes und sieht nachhaltige Hülfe gegen den Mangel ländlicher Arbeitskräfte nur in einer über das ganze Land ausgedehnten Hingabe kleinen Grundbesitzes an Familien, die, um sich zu ernähren, in den ländlichen Betrieben der Umgegend Arbeit suchen müssen. Er befürwortet ein Gesetz, das den ritterschaftlichen Gutsbesitzer ermächtigt, ohne Zustimmung des Lehnsherrn oder der Gläubiger einen bestimmten Theil des Areals in kleinen Parcellen von nicht über 2 Morgen in Erbpacht weg zu geben.)
110) Bericht der Polizeicommitte über das Dictamen des Herrn v. Müller auf Gr.=Lunow, betr. Maßnahmen gegen die Abnahme der ländlichen Bevölkerung in Meklenburg. Erstattet durch Herrn Vedoua=Laase am 20. Dec. 1893. (Beschluß: Die Dictamina v. Müller und v. Bernstorff sollen der Regierung zur Kenntnißnahme mitgetheilt und von derselben Mittheilungen erbeten werden über die Höhe des Fonds, der dadurch entstanden sein soll, daß die Wiederaufrichtung ohne Consens gelegter Bauernhufen gegen Zahlung einer Geldsumme erlassen ist.) Der Mecklenburger XIII, Nr. 47.
111) Ein Artikel in Heft 8 (S. 369-374) des "Grenzboten" vom 22. Februar behandelt die Landarbeiterfrage in Meklenburg und tritt dabei warm für die Anträge des Herrn v. Müller=Gr.=Lunow auf den Landtagen von 1890 und 1893 ein. Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 68. - Zur mekl. Litteratur.


|
Seite 71 |




|
112) Hintze, Ulrich, Dr., Die Lage der ländlichen Arbeiter in Mecklenburg. Ein Beitrag zur Landarbeiterfrage. Rostock 1894. (H. giebt zunächst eine Darstellung der Lage der ländlichen Arbeiter, und zwar der einzelnen Kategorien, des Gesindes, der Tagelöhner, der Hofgänger, Deputatisten, freien Arbeiter und Wanderarbeiter. Dann folgen Kritik und Reformvorschläge. Die letzten laufen darauf hinaus, das der Domanial=Capital=Fonds geeignete Rittergüter kaufen und parcelliren soll, damit mehr Kleingrundbesitz geschaffen und dem ländlichen Arbeiterstand mehr Gelegenheit geboten werde, sich seßhaft zu machen. Dem Großgrundbesitz andererseits würde das dadurch vermehrte Angebot von Arbeitskräften zu Gute kommen. Nach den Meckl. Nachr. a. a. O.) Bespr.: Rost. Ztg.1894, Nr. 148, Meckl. Nachr. 1894, Nr. 74, Rost. Anz. 1894, Nr. 92 und 98, Der Mecklenburger XIV, Nr. 4, 5, 6, 7.
113) Die Landfrage in Mecklenburg. Rost. Anz. 1894, Nr. 120. "Von einem hochgestellten mecklenburgischen Geistlichen", der zwar mit dem Recensenten der Hintzeschen Schrift in Nr. 98 a. a. O. das Schwinden des "patriarchalischen Regime" beklagt, dasselbe aber für "antiquirt" hält und sich ganz mit Hintze auf dessen "modern=sozialreformerischen Standpunkt" stellt.
114) Die Bauerngemeinde und die Arbeiter=Ordnung der mecklenburgischen Tagelöhner. Aus Mecklenburg. I, II und III. Hessische Blätter 1894, Nr. 2046, 2047 und 2048. (Nach einer eingehenden Besprechung des Hintze'schen Buches - Nr. 112 -, des v. Müller'schen Dictamens - Nr. 108 - und des darauf erstatteten Committenberichts - Nr. 110 - führt der Vf. seine Wünsche in Betreff der inneren Colonisation auf: Das zu theilende Rittergut - möglichst ein solches mit Kirche und Schule - muß von mehreren Rittergütern umgeben sein. Die Theilung geschieht durch eine gemischte Commission. Als Vorbilder für die Ordnung ritterschaftl. Bauerngemeinden sind hannoversche und holsteinische Ordnungen heranzuziehen. Die Aufsicht über die ritterschaftliche Bauerngemeinde führen die interessierten Rittergutsbesitzer. Als Ansiedler sind solche zu bevorzugen, die noch unter dem von Riehl - Bürgerliche Gesellschaft - charakterisierten deutschen Bauernstande stehen. Die Bauernstellen sind unverkäuflich. Zur Bestreitung der Kosten des ersten Versuches ist der Domanial=Capital Fonds heranzuziehen.)
115) Vidal=Klausdorf. Zur Frage der Errichtung von Häuslerstellen in Mecklenburg. Vortrag. Bericht über denselben: Mecklenb. Ztg. 1894, Nr. 138. (V. weist die Nothwendigkeit der Errichtung von Häuslerstellen zum Zwecke der intensiven Wirthschaftsführung nach, er befürwortet nöthigenfalls unter Aenderung des Rechtszustandes die Theilbarkeit der Rittergüter und die Gründung einer Agrarbank. - Die V.'schen Vorschläge werden zur Berathung einer Commission des Teterower Kreisvereins kleiner Landwirthe überwiesen.
116) k.-S. (Geh.Finanzrath Balck=Schwerin), Arbeitermangel und Güterparcelirung. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 95. - Der Verf. zählt kurz die Gründe für die Entvölkerung des platten Landes auf. Er geht sodann näher auf die bis in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts zurückreichenden Bestrebungen der Regierung ein, dem Lande die nöthigen Arbeitskräfte zu erhalten und zuzuführen und hebt besonders die Verordnung vom 20. Mai 1868 hervor, durch die es den Rittergutsbesitzern unter wesentlicher Erleichterung hinsichtlich der Zustimmung des Lehnsherrn und der Gläubiger ermöglicht wird, bestimmte Theile der Gutsfläche auf Erbpacht wegzugeben. Wegen der befürchteten Gemeindelast namentlich im


|
Seite 72 |




|
Armen= und Schulwesen sei von dieser gesetzlichen
Freilassung aber fast gar kein Gebrauch gemacht
worden. Dagegen werde jetzt directe Abhülfe
durch den Staat gefordert. Derselbe solle
geeignete Güter ankaufen, sie auftheilen und die
neugebildete Gemeinde unter die Aufsicht der
Großherzoglichen Aemter stellen. Diesem
Verlangen widerstreite außer anderen Gründen
nicht nur die Rücksicht auf die Grundlagen der
landständischen Verfassung, sondern auch vor
allem die mit der Ausführung des Vorschlages
verbundenen finanziellen Schwierigkeiten. An
einer Reihe für unbebaute Erbpachthufen wirklich
gezahlter Kaufpreise weist B. nach, daß durch
die Auftheilung eines Rittergutes der
Ankaufspreis bei Weitem nicht wieder
herausgebracht werde. Zur Deckung des Ausfalls
dürfte der vermeintliche Bauernlegungs=Fonds
wohl nicht ausreichen und der
Domanial=Capital=Fonds sei dazu nicht bestimmt,
auch anderweitig vollauf in Anspruch genommen.
Er empfiehlt den Rittergutsbesitzern Selbsthülfe
auf Grund der Verordnung vom 20. Mai 1868, zur
leichteren Tragung der Gemeindelasten aber
größere Verbände zu bilden.
Nachdem nun
noch -e- in R (in Meckl. Nachr. 1894, Nr. 104)
den Vermittelungsvorschlag gemacht, zur
Verminderung der finanziellen Schwierigkeiten
auf den anzukaufenden Gütern, einen größeren
Pachthof bei Bestand zu lassen und die kleinere
Hälfte nach und nach aufzutheilen und zu
besiedeln, und k-S in Nr. 105 a. a. O. diesen
Vorschlag als im Princip annehmbar hingestellt
hat, greift in Nr. 106 und 107 der Meckl. Nachr.
v. M.-L. (von Müller=Lunow) in die Verhandlung
ein. Er erklärt sich zunächst mit dem vom
Domprediger Wilhelmi=Güstrow (Meckl. Nachr.
1894, Nr. 99) ausgesprochenen Satze
einverstanden, daß es bei der Besiedelungsfrage
sich nicht um eine Betriebserleichterung für den
Großgrundbesitz handele, sondern um ein Stück
socialer Frage. Das Verlangen nach Vermehrung
des kleinen und mittleren Grundbesitzes sei
keine Interessenfrage eines Standes, vielmehr
eine Angelegenheit, die das ganze Land angehe.
Die Balck'schen Vorschläge würden nicht zum
Ziele führen. Die von den einzelnen
Gutsbesitzern anzusetzenden Häusler würden stets
in eine so abhängige Lage von dem Gutsherrn
gerathen, daß der Erwerb einer solchen Stelle
auf die arbeitende Bevölkerung durchaus keinen
Reiz zur Ansiedelung ausüben könne. Auch würde
die Einrichtung von Arbeiter=Kolonien auf dem
Gute ohne Aenderung der Hypothekengesetzgebung
nicht möglich sein und auch sonst großen
Schwierigkeiten begegnen. v. M. beharrt auf
seinen Vorschlägen, für deren Ausführung, die
nach und nach geschehen könne, die nöthigen
Mittel vom Lande bereit zu stellen seien, zumal
die Ausführbarkeit derselben durch mannigfache
Beispiele außerhalb Meklenburgs dargethan
sei.
Demgegenüber betont k.-S. (Meckl.
Nachr. 1894, Nr. 110) daß, wenn auch aus
öffentlichen Mitteln und aus den beiden
angezogenen Fonds die erforderlichen Gelder zur
Verfügung gestellt würden, doch durchaus keine
Garantie für die Schaffung eines lebenskräftigen
kleineren und mittleren Grundbesitzerstandes
gegeben sei. In dieser Ansicht sieht er sich
bestärkt durch einen von v. M. L. im Rost. Anz.
1894, Nr. 171 und Meckl. Nachr. 1894, Nr. 173
veröffentlichten Aufsatz über die preußischen
Rentengüter, besonders über die Besiedelung von
Grammendorf bei Demmin. B. stellt fest (Rost.
Anz. 1894, Nr. 174 und Meckl. Nachr. 1894, Nr.
176), daß selbst v. M.-L. die schwersten
Bedenken gegen diese Art der Auftheilung habe,
wo die [] R. ohne Gebäude mit 2 1/2 Mk.


|
Seite 73 |




|
bezahlt sei, während bis jetzt in Meklenburg nur
die besten bebauten Hufen einen solchen Preis
erreicht hatten.
Schließlich sei noch
bemerkt, daß in Nr. 123 der Meckl. Nachr. (1894)
Pastor Romberg in Brunow den Vorschlag macht zur
Ueberwindung der finanziellen Schwierigkeiten,
namentlich im Osten des Landes
Darlehenskassenvereine nach Raiffeisenschem
Systeme zu gründen. Gestützt durch seine
eigenartige Organisation könne und solle ein
solcher Verein nach Statut und bewährter Praxis
in seinem Bezirke überall da größere und
kleinere Höfe ankaufen, wo er durch
Wiederverkauf und Parzellirung einen
wirthschaftlichen Nutzen für seinen Bezirk sich
versprechen könne und Verluste für die
Vereinskasse nicht zu besorgen seien. In Nr. 125
der Meckl. Nachr. (woran sich noch in Nr. 127
und 130 von beiden Seiten Auslassungen
anschließen) weist jedoch k-S darauf hin, daß
bei Neubildungen von ganzen Gemeinden, und auf
solche komme es ja gerade an, bedeutende
pekuniäre Einbußen nach schon gegebenen
Nachweisungen unausbleiblich seien. Zum Schluß
macht er die Mitteilung, daß die Regierung die
Frage wegen Besiedelung namentlich des
ritterschaftlichen Landestheils aufgegriffen und
zunächst zum Erachten des Landwirthschaftsraths
verstellt habe.
117) Die Rostocker Zeitung hat im letzten Jahre mehrfach Artikel gebracht, in denen die Frage der inneren Colonisation und Schaffung kleinen Grundbesitzes erörtert wird. Dieselben sind enthalten in folgenden Nummern der Zeitung: 1894. Nr. 590. 1894. Nr. 18. (Hier wird die Behauptung aufgestellt, daß in Meklenburg, namentlich im ritterschaftlichen Landestheile bisher fast nichts in dieser Beziehung geschehen sei. Demgegenüber verweist M. in Nr. 32 (20. Jan. 1894) auf die Bestrebungen der Regierung in den 20er Jahren, auf die VO. vom 30. Jan. 1855 und 20. Mai 1868 hin und führt weiter aus, daß vor einigen Jahren der Distrikt Neubuckow den Plan gehabt habe, auf gemeinsamen Credit ritterschaftlicher Verbände eine Anzahl ritterschaftlicher Güter anzukaufen, diese in Dörfer zu verwandeln mit Bauern, Büdnern und Häuslern. Der bei der Gen.=Vers. d. patriot. Ver. gestellte Antrag sei aber als eine politische Maßregel betreffend von der Verhandlung zurückgewiesen. - In Nr. 38 (1894) wird dagegen bestritten, daß der Neubuckower Antrag das angegebene Ziel verfolgt habe. Derselbe habe nur die gesetzliche Möglichkeit zur Einrichtung von Häuslereien - Arbeiterkolonien - schaffen wollen. Als erste Vorbedingung dazu sei die Erlassung einer Gemeindeordnung für die Ritterschaft besprochen, damit durch dieselbe die Armenversorgung geregelt werden könne. - Ferner 1894, Nr. 190, Nr. 196, Nr. 258, Nr. 264 (wo k-S unter Anführung von Kaufpreisen verschiedener Erbpachtgüter bestreitet, daß durch die in Nr. 258 vorgeschlagene Auftheilung eines Gutes der Ankaufspreis desselben gedeckt werden könne), Nr. 274, Nr. 288, Nr. 308.
118) Sohnrey. Der Zug vom Lande und die soziale Revolution. Leipzig, 1894. (Berührt auch vielfach meklenburgische Verhältnisse.)
119) Wie ist dem Zuge der Arbeiter vom Lande in die Stadt zu begegnen? Rost. Anz. 1894, Nr. 85.
120) Wilhelmi=Güstrow. Zur sozialen Bedeutung des Kleinbesitzes. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 2.
121) Wilhelmi, H. Friede auf Erden und der Kampf ums Dasein. - Predigt. - Güstrow 1894. (Vgl. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 3.)


|
Seite 74 |




|
122) Wilhelmi, (Domprediger in Güstrow.) zur inneren Colonisation. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 99.
123) Wilhelmi=Güstrow. Soziale Ziele. Güstr. Ztg. 1894, Nr. 17-49. Monatsschrift für innere Mission 1894, April.
124) Wilhelmi=Güstrow. Zur Lösung der sozialen Frage in Mecklenburg. Mecklenb. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 36. (W. hebt die kirchliche Seite der Landarbeiterfrage hervor und tritt sodann warm für die v. Müller=Lunow'schen Bestrebungen ein.)
125) Behm=Ivenack. Fürsorge für die konfirmierte Jugend. Mecklenburger Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 11.
126) Bernhardt=Gr.=Salitz. Ueber die Pflege der konfirmierten männlichen Jugend in der Landgemeinde. Mecklenb. Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 4.
127) Fürsorge für die Knechte und Tagelöhner auf dem Lande. (Kurze Notiz über die vergebliche Bemühung zweier Pastoren.) Mecklenb. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 34.
128) Hofmeister, A., Dr. Der Antheil Rostocks an den Kämpfen gegen Waldemar IV. Atterdag von Dänemark. Vortrag, Bericht darüber Rost. Ztg. 1894, Nr. 76.
129) Daenell, E. R. Die Kölner Konföderation vom Jahre 1367 und die schonischen Pfandschaften. Leipzig 1894.
130) Opel, J. O. Der niedersächsisch=dänische Krieg, III. Bd. Der dänische Krieg von 1627 bis zum Frieden von Lübeck 1629. Magdeburg 1894. (I. Bd. 1621-1623. Halle, 1872. II. Bd. 1624-1626. Magdeburg 1878.)
131) Ein deutsch=böhmisches Reiter=Regiment im 30jährigen Kriege 1625-1635. Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XXXII. Nr. IV. Prag 1894. S. 357-383. (Darstellung der Kriegszüge des 1625 im Egerlande gebildeten Wallensteinischen Kürassier=Regiments "Neu=Sachsen" oder "Herzog Franz Albert von Sachsen=Lauenburg", von dem 1628-1629 drei Compagnien unter Major Sirot's Commando in Güstrow lagen.)
132) Meyer, Hermann. Der Plan eines evangel. Fürstenbundes im siebenjährigen Kriege. Dissertation. Bonn 1893. (Vergleiche Jahrbuch 53, S. 205 ff. und 54 S. 1 ff.)
133) Lettow=Vorbeck, v. Die Verfolgung von Jena bis Prenzlau. Mit einer Uebersichtskarte. Beihefte zum Militair=Wochenblatt 1893, Heft 1, S. 25-42.
134) Natzmer, G. E. v. Zur Geschichte des preuß. Reservekorps im Jahre 1806. Von Magdeburg bis zur Kapitulation von Prenzlau. Neue Milit. Blätter. Herausgegeben von G. v. Glasenapp, Dievenow 1893. Bd. 42, S. 22-35, 103-111. - Natzmer, G. E. v. zur Geschichte des preußischen Reservekorps unter Blücher. Von Prenzlau nach Lübeck. a. a. O. S. 193-201, 302-310, 393-398.
135) Natzmer, G. E. v. Eine Skizze zur Schlacht von Lübeck. Neue Milit. Blätter. Herausgegeben von G. v. Glasenapp, Dievenow 1893. Bd. 43, S. 49-67, 192-209, 307-316, 412, 478-491.
136) Quistorp, B. v. Geschichte der Nordarmee im Jahre 1813. 3 Bde. Berlin 1894.
137) Französische Lügen über Loigny. Rost. Ztg. 1893, Nr. 442.


|
Seite 75 |




|
138) Koenig, Fritz.Der Volkskrieg an der Loire im Herbst 1870. Nach amtlichen Quellen und handschriftlichen Aufzeichnungen von Mitkämpfern dargestellt. II. Bd. Berlin 1893.
139) Grenest, L'armée de la Loire. Relation anecdotique de la campagne de 1870-71, d'après de nombreux temoignages oculaires et de nouveaux documents. (Toury. Orléans. Coulmiers. Beaune la Rolande. Villepion. Loigny) Paris, Garnier frères 1893.
140) Lehautcourt, Campagne de la Loire en 1870-71. Coulmiers et Orléans. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1893.
141) Kunz, die Schlacht von Orléans am 3. und 4. Dec. 1870. Berlin 1894.
142) Krickel, G., Deutschlands Heer und Marine in Bildern. Berlin 1893. (Enthält auch die mit Bärenmützen ausgestattete meklenb. Schloßwache, wie sie bei feierlichen Gelegenheiten noch jetzt aufzieht.)
143) Die neue Uniform des 2. mecklenburgischen Dragoner=Regiments Nr. 18. Rost. Ztg. 1894, Nr. 204.
144) O. L. (Oertzen=Leppin?) Beiträge zur mecklenburgischen Geschichte von 1832-1852. (Enthält Auszüge aus dem Tagebuch Leopold's von Gerlach, General=Adjutanten des Königs Friedrich Wilhelm IV.) Der Mecklenburger XIII, Nr. 26 und 27.
145) Dreesen, W., Bilder aus Mecklenburg. Ut Stadt un Land. - Von de Waterkant. - Wismar 1893.
146) Quade, Ueber städtische Abgaben und Vermögensverhältnisse in Mecklenburg. Vortrag, Bericht über denselben Meckl. Ztg. 1894, Nr. 100.
147) Von den Brandfällen im zweiten Vierteljahr 1893. Rost. Ztg. 1893, Nr. 339. Die Brandfälle des dritten Vierteljahres. das. 1893, Nr. 482.
148) Die Ausübung der Jagd auf den Feldmarken der mecklenburgischen Städte. Rost. Ztg. 1893, Nr. 387.
149) Krankenhäuser in den mecklenburgischen Städten. Rost. Ztg. 1893, Nr. 363.
150) Hübbe, Wasserversorgung und Abflußverhältnisse in den mecklenburgischen Städten. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 157.
151) J. v. W. Eine Wanderung nach den Ostseebädern. (Mit 6 Ansichten: Heiligendamm, Haus in Wismar, Mole in Warnemünde, Stahlbad Doberan.) Ueber Land und Meer, 1893, Nr. 52.
152) Von dem Besuche der Seebadeorte Mecklenburgs im Sommer 1893. Rost. Ztg. 1893 Nr. 494. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 251, 252.
153) Bericht über die Jubiläumsfeier in Doberan und Heiligendamm. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 164, 165.
154) Neues Abgaben=Regulativ für die Stadt Bützow. Rost. Ztg. 1893, Nr. 534.
155) Das neue Krankenhaus in Fürstenberg. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 226.
156) Gielow, das größte Dorf in Mecklenburg. Rost. Anz. 1894, Nr 27, 69.
157) Der neue Bahnhof in Güstrow. Rost. Ztg. 1893, Nr. 520.
158) Erbbegräbniß der Familie Hünecken in Kaarz bei Brüel. Mecklenburger Nachr. 1893, Nr. 197.
159) Etat der Stadt Malchow für das Jahr 1894. Rost. Ztg. 1894, Nr. 14. (Einnahme 73 849,87 Mk., Ausgabe 71 963,41 Mk.)
160) Pensions=Verhältnisse der Magistratsmitglieder der Stadt Malchow. Rost. Ztg. 1894, Nr. 48.


|
Seite 76 |




|
161) Mettenheimer, C., Dr., Das Seebad (Groß=) Müritz an der Ostsee und das Friedrich Franz=Hospiz daselbst. Mit einem Anhange über das Ostseebad Graal von Dr. Wagner=Ribnitz. 2. Aufl. Ribnitz, 1894.
162) Mettenheimer, C., Dr., Nachrichten über das Friedrich Franz=Hospiz in Müritz. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 193. (Erholungshaus für Diakonissen in Müritz.) Meckl. Nachr. 1893, Nr. 194.
163) Mittheilungen aus dem neuen Communalsteuerregulativ der Stadt Parchim. Rost. Ztg. 1894, Nr. 180.
164) Der Brand des Ratzeburger Doms am Sonnabend d. 19. August 1893. Berichte a. d. Eisenb.=Ztg. und Lübecker Ztg. abgedruckt Meckl. Ztg. 1893, Nr. 390.
165) Der Dom zu Ratzeburg vor und nach dem Brande am 15. Aug. 1893. (Mit Abbildungen). Gartenlaube 1893, Nr. 39. - Daheim XXIX (1893), Nr. 52.
166) Koppmann. Beiträge zur Geschichte d. Stadt Rostock. Hft. 3. Rostock, 1893. Enthält I. Dr. Johannes Draconites, Professor der Theologie und Superintendent zu Rostock. Von Dr. K. Koppmann. II. Die Prediger zu Rostock im 16. Jahrhundert. Von Dr. K. Koppmann. III. Landesherrliche Gevatternbriefe. Mitgetheilt von Dr. K. Koppmann IV. Die Glocken zu St. Nikolai. Von L. Krause. * ) V. Zur Geschichte des Botanischen Gartens. Von Dr. K. Koppmann. VI. Der Schütting und die Festlichkeiten des Amtes der Bruchfischer. Von Dr. F. Crull in Wismar. VIl. Kleinere Mittheilungen und Notizen: 1. Der Bau des Thurms auf dem Rammsberge und Hans Runge. Von K. K. 2. Kontrollmarken der Bürgerschaft. Von L. Krause. 3. Stadt=Hebamme. Von K. K. 4. Oculisten, Stein= und Bruchschneider. Von K. K. 5. Pockenarzt. Von K. K. 6. Pestarzt. Von K. K.
167) Krogh, Christian. Aus und über Rostock. Aus dem Norwegischen übersetzt von A. Lenschow=Rostock. Rost. Anz. 1893, Nr. 282.
168) Karus, Otto. Der Rostocker Pfingstmarkt vor 80 Jahren. Rost. Anz. 1894, Nr. 120.
169) Koppmann, K. Dr. Vom Rostocker Geschützwesen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 70 und 80.
170) Baupolizeigesetze für die Stadt Rostock, deren Vorstädte und Stadtfeldmark. Rostock 1894. Angezeigt Rost. Ztg. 1894, Nr. 274.
171) Bauwesen in Rostock. Rost. Ztg. 1893, Nr. 478, 480.
172) Die Rostocker Bahnhofsfrage. Der Mecklenburger XIV, Nr. 13.
173) Die Rostocker Brandkasse. Rost. Anz. 1894, Nr. 43.
174) Grundstück=Bewegungen in Rostock im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 42.
175) Etat der Stadt Rostock pro 1893/94. (Einnahme: 2,631,660 Mk., Ausgabe: 2,666,549,53 Mk.) Meckl. Nachr. 1893, Nr. 200.
176) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben der Stadt Rostock für die Zeit vom 1. Juli 1893 bis 30. Juni 1894. Rost. Ztg. 1893, Nr. 391, 393, 399 und 442.
177) Bericht der Steuer=Erhebungskasse zu Rostock pro 1892/93. Zum Schluß: Uebersicht der Entwickelung der Steuer=Erhebungskasse in den letzten


|
Seite 77 |




|
20 Jahren. Rost. Ztg. 1893, Nr. 324. (Es handelt sich hier um städtische Steuern einschl. der Hafenabgaben.)
178) Der Entwurf eines Gesetzes betr. die Einkommensteuer in Rostock. Rost. Ztg. 1894, Nr. 212, ferner Nr. 246 und 248, Rost. Anz. 1894, Nr. 170, 172 und 174.
179) Vom städtischen Witwen= und Waisenfonds. Rost. Ztg. 1893, Nr. 446.
180) Zur Verlegung der Schießstände der beiden Schützen=Compagnien in Rostock von der Fähre nach den Barnstorfer Tannen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 148 und 178.
181) Vom Schlachthofbetrieb in Rostock und in Schwerin im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 196.
182) Kirchner, E. Die Verbindung des Bades Warnemünde mit der Rostocker Heide. Rost. Ztg. 1894, Nr. 18, 20.
183) Die Bahn Warnemünde=Rostocker Haide. (Aus Kreisen der Repräsent. Bürgerschaft.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 38.
184) Geinitz, Bemerkungen über die Beschaffenheit der Wässer aus Bohrbrunnen. (Matersen bei Schwaan und Marktbrunnen in Schwaan.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 54.
185) Zum Gedächtniß der Weihe der St. Paulskirche in Schwerin vor fünfundzwanzig Jahren. Meckl. Nachr. 1894, Sonntagsblatt Nr. 25 (24. Juni 1894) und Nr. 145 u. 147.
186) Wittstock, G. Zum Gedächtniß der Weihe der St. Paulskirche in Schwerin vor fünfundzwanzig Jahren. Schwerin 1894.
187) Verwaltungsbericht der Stadt Schwerin 1892. Schwerin 1893.
188) Tackert, Bürgermeister, die Neupflasterung Schwerins. Vortrag, ausführlicher Bericht über denselben: Meckl. Ztg. 1894, Nr. 170 und 171. (Mit der Neupflasterung ist der Anfang gemacht worden in der Schmiedestraße am 26. Juli 1894.)
189) Bericht der bürgerschaftlichen Commission über die Neupflasterung der Stadt Schwerin. Meckl. Ztg. 1893, Nr. 549. (Ausführliches Referat.)
190) Zum 100jährigen Jubiläum des Maler=Amts zu Schwerin. 1893.
191) Die städtischen Steuern in Teterow. Rost. Ztg. 1894, Nr. 212.
192) Schmidt, Bruno, Dr., Ueber einige Ansprüche auswärtiger Staaten auf gegenwärtiges deutsches Reichsgebiet. Leipzig 1894. (Vergl. Der Mecklenburger XIV, Nr. 7.)
193) Stichert, Dr., Die Verfassung der Stadt Wismar. Vortrag, Bericht über denselben Meckl. Nachr. 1894, Nr. 52. (Ueber die Vertretung Wismars auf dem Landtage vergl. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 55.)
194) Wismar als deutscher Kriegshafen. Rost. Ztg. 1893, Nr. 544, 550. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 248.
195) Regierungs= und Lebensdauer der mecklenburgischen Fürsten. Rostocker Anz. 1893, Nr 279.
196) Erhard, B., Niclot. Ein Gang aus Mecklenburgs Vorgeschichte. Der Bär, XX. Jahrg., Nr. 14 (April 1894) ff.
197) Das Grab Herzog Erichs von Mecklenburg auf Wisby. Mittheilungen des Vereins für Hamb. Gesch. H. 15, (1892) S. 437/8.
198) Die Herzogin Sophie Charlotte, Wittwe des Herzogs Friedrich Wilhelm von Mecklenburg=Schwerin, wird von ihrem Bruder, dem König Friedrich von Schweden, durch Urkunde vom 19. Aug. 1720 zum Oberjägermeister


|
Seite 78 |




|
im Herzogthum Pommern und in der Herrschaft Wismar ernannt. Berliner Neueste Nachrichten 1893, Nr. 472.
199) Denkmal der Aebtissinnen Christine (gestorben 1693) und Maria Elisabeth (gest. 1713), geb. Herzoginnen von Mecklenburg=Schwerin, in der Stiftskirche zu Gaudersheim. Rost. Ztg. 1893, Nr. 379.
200) Gekrönte Häupter. Zur Naturgeschichte des Absolutismus. Nr. 4. Karl Leopold, Herzog zu Mecklenburg=Schwerin. Berlin o. J. (1894) - Socialdemokratische Veröffentlichung.
201) Aus Goethes Freundeskreise. Erinnerungen der Baronin Jenny von Gustedt. Herausgegeben von Lily von Kretschmann. Braunschweig, 1892. (S. 56-63: Helene Herzogin von Orleans, geb. Herzogin von Mecklenburg. Mit einem Bilde der Herzogin Helene nach einem Gypsrelief. S. 309-312: Briefe in Auszügen an die Herzogin Helene.)
202) Vom Grafen Schack. Meckl. Nachr. Sonntagsblatt Nr. 20. (20. Mai 1894.) - Nach einer Berichtigung des Geh. Medizinalraths Mettenheimer ist die Photographie, die unter der Bezeichnung "Mittagsruhe vor Damaskus" den hochseligen Großherzog mit Gemahlin und Gefolge darstellt, nicht in Damaskus, sondern in Cairo angefertigt. Sonntagsblatt Nr. 21.
203) Die Wiener Neue Freie Presse über Großherzog Friedrich Franz II. und über Herzog Ernst von Coburg. Der Mecklenburger XIII, Nr. 26.
204) Labadie-Lagrave, Le grand-duc de Mecklenbourg-Strelitz. Figaro 1893, Nr. 272.
205) Herzogin Georg von Mecklenburg=Strelitz †. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 110.
206) Großfürstin Katharina von Mecklenburg. Der Mecklenburger XIV, Nr. 7.
207) Das Hinscheiden I. K. H. der Großfürstin Katharina Michailowna. St. Petersburger Ztg. 1894, Nr. 122 und 123, 1./14 und 3./15 Mai 1894. (Die Artikel heben hauptsächlich die in Rußland von der verstorbenen Großfürstin bis zu ihrem Tode ausgeübte philantropische Thätigkeit hervor.)
208) Stern, Bernhard, Ein fürstlicher Distanzreiter. Aus dem Berl. Tgbl. abgedr. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 298. (Distanzritt des Herzogg Adolf Friedrich von Mecklenburg=Schwerin von Damaskus bis Constantinopel im Mai 1894.)
209) Meyer=Elbing. Ueber den Ritt Sr. Hoh. des Herzogs Adolf Friedrich von Mecklenburg=Schwerin und des Premier=Lieutenants G. v. Rauch. Deutsche Warte. Abgedr. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 179, Meckl. Ztg. 1894, Nr. 360.
210) Ernst, Dr. Mecklenburg im 13. Jahrhundert. (Die mecklenburgischen Vasallengeschlechter.) Programm des Gymnasiums in Langenberg (Rheinland). 1894.
211) Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 36. Leipzig, 1893. - S. 32/33. Hofmeister, Tilemann Stella (eigentlich Stoltz) geb. 1524 (25?) zu Siegen, gest. 1589. Hervorragender Geograph und Ingenieur. - S. 44. Hofmeister, Petrus Stenbeke, erster Rector der Universität Rostock 1419. - S. 93. Eisenhart, Lorenz Stephani. Geb. 1588 zu Greifswald, gest. 1657 zu Sternberg als Vice=Präsident des mekl. Hof= und Landgerichts. - S. 294. Hofmeister, die im 16. u. 17. Jahrh. in Rostock lebende Gelehrtenfamilie Stockmann. - S. 459/60. Hofmeister, Klaus Störtebeker, Anführer der Vitalienbrüder. - S. 493/5. Stieve, Leopold, Frhr. v. Stralendorf, geb. zu Preensberg b. Wismar.


|
Seite 79 |




|
1605-1612. Vicekanzler des Reichs unter Kaiser Rudolf II., gest. wohl bald nach 1612. - S. 573/5. Hofmeister, Joh. Karl Friedr. Strempel, geb. 1800, gest. 1872. Seit 1826 Professor d. Medicin in Rostock. - S. 762/3. Klenz, Rudolf Stürenburg, geb. 1811 zu Aurich, gest. 1856 zu Hildburghausen. 1834-1839 Lehrer an der großen Stadtschule in Wismar. - S. 784/5 Natzel, Daniel Friedr. Sotzmann, geb. 1754 zu Spandau, gest. zu Berlin 1840. Kartograph (S. Bachmann, Landeskundl. Litteratur, Nr. 215, 219-221). -
212) Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien. III. Bd. Herausgegeben unter Leitung eines Redaktions=Komités des Vereins Herold. Berlin, 1894. - S. 11-30. Baetcke (mit Wappen). - S. 171-182: Moennich.
213) Dachenhausen, v., Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser, 1893. Brünn, XVIII. Jahrg. (Enthält u. a. Genealogie der Familie v. Sell mit Ausnahme der jetzt in Meklenburg als Freiherren anerkannten Glieder der Familie.)
214) Huth, W.=Güstrow, Buch berühmter Landwirthe. Güstrow, 1893. (U. a. Biogr. von Dr. Alban=Plau, Brüssow=Schwerin, Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg, Graf Plessen=Ivnack, Karsten=Rostock, Gebr. Pogge, Graf Schlieffen, Siebeth, Schultz Lupitz, Thünen=Tellow.)
215) Mecklenburger im Reichstag. 1893. (Biogr. über v. Buchka, Freiherr v. Hammerstein, v. Kardorff, Kropatscheck, Freiherr v. Maltzan=Molzow, Nauck, Paasche, Rettich, Graf von Schlieffen, Schultz=Lupitz, v. Viereck.) Der Mecklenburger XIII, Nr. 44.
216) Die Mecklenburger des Göttinger Corps Hannovera. Der Mecklenburger XIII, Nr. 44.
217) Geburtsorte berühmter Landsleute. Rost. Ztg. 1834, Nr. 272, Meckl. Nachr. 1894, Nr. 138.
218) Nekrologe mecklenburgischer Pastoren im Meckl. Kirchen= und Zeitblatt von September 1893 bis einschl. Juni 1894. 1893, Nr. 26; Voß=Levin, Präpositus Gabert in Dargun. Gb. 1838 in Niederwildungen (Walbeck) 1869 P. in Kirch=Mummendorf, 1875 P. in Bützow, 1889 P. in Dargun. gest. 26. Aug. 1893 in Gifhorn (Hannover). - 1893, Nr. 27:
Pastor Becker, gest. 19. Aug., 44 Jahre alt. Seit 1882 P. in Pokrent. - 1894, Nr. 1: Kliefoth, Kirchenrath Dr. Maßmann, Pastor in Wismar, gest. daselbst am 28. November 1893, 90 Jahre alt.
219) Der Zug des Todes, umfassend die Großherzogthümer Mecklenburg=Schwerin und =Strelitz im Jahre 1893. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 304.
220) Mecklenburgisches Nekrologium 1893. Der Mecklenburger XIII, Nr. 41 und 42.
221) Eckardt, Rudolf, Lexicon der niedersächsischen Schriftsteller von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Osterwieck a. Harz 1893.
222) Irmer, Georg, Dr., Hans Georg von Arnim. Lebensbild eines protestantischen Feldherrn und Staatsmannes aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Leipzig 1894.
223) Eggers, H. K. Die Bahlcke zu Lindow in Mecklenburg=Strelitz. Vierteljahrsschrift für Geschlechts=, Siegel= und Wappenkunde. Bd. 21 (1893), S. 436-440.
224) Cohn, Hermann. Georg Bartisch, ein Starstecher des Mittelalters. Fleischer, Deutsche Revue, 18. Jahrgang (1893, August), S. 214 ff. (Vergl. Grotefend, Archivrath: Ueber Okulisten, Bruch= und Steinschneider. Vortrag: Rost. Ztg. 1892, Nr. 147.)


|
Seite 80 |




|
225) Gymnasial=Professor Dr. Bastian in Schwerin, gest. 21. Juni 1894. Nekrolog. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 143.
226) Werckshagen, C. Michael Baumgarten, ein theologischer Charakter für unsere Zeit. Vortrag, Bericht über denselben: Voss. Ztg., Nr. 94.
227) Senator Behm=Rostock, gest. 21. Okt. 1893. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1893, Nr. 495.
228) Seyler, Gustav A., Allgemeines Register zu den Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechts Behr von Dr. G. C. Friedrich Lisch. Bd. I - IV. Berlin, (I. A. Stargardt) 1893.
229) Die Weihnachtsnummer der Allgemeinen Modenzeitung enthält eine Biographie und ein Stahlstich=Portrait des Bildhauers Hugo Berwald. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 23. - Zur meckl. Litteratur.)
230) Bethe, Dr., Prof. in Rostock. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 223.
231) Rulef Bley, Custos der Rost. Univ.=Bibliothek, gest. 12. Jan. 1894. Nr. 12. Erbschafts=Aufgebot. Rost. Ztg. 1894, Nr. 320.
232) Graf Adolf v. Blücher (a. d. H. Finken. - Wigger, Gesch. der Familie v. Blücher II. Bd. 2. Abth. S. 101 f.) auf seinem Gute Wietzow in Pommern am 16. Oktober 1893 ermordet. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 245, 246, 248.
233) Both, v. Einige Nachrichten über die Geschichte derer von Both. Vierteljahrsschrift für Wappenkunde u.s.w. XXII. Heft 1, S. 43-51. (Berlin 1894.)
234) Both, v. Einige Nachrichten über die Familie von Both, ihre Stiftungen und ihre Geschichte. Vierteljahrsschrift f. Wappenkunde u.s.w. XXI. Jahrg. Heft 2, S. 207-238. (Berlin 1893.) - Nachtrag bezw. Berichtigung dazu: a. a. O. XXII. Heft 1, S. 52-54. (Berlin 1894.)
235) Dreyer, J. L. E. Tycho Brahe. Ein Bild wissenschaftlichen Lebens und Arbeitens im 16. Jahrhundert. Deutsche Uebersetzung M. Bruhns. Karlsruhe 1894.
236) Brugsch, H. Mein Leben und Wandern. Vossische Zeitung 1893. Auch in Buchform. (Für Meklenburg sind von Interesse die im Anfang der 50er Jahre stattgehabten Begegnungen B.s mit dem Weinhändler Langfeld in Alexandrien [Cap. XIV. V. Z., Nr. 373], dem preußischen Generalkonsul v. Pentz=Toddin [Cap. XV. und XVI. V. Z., Nr. 375, und 377] und dem Grafen v. Schlieffen=Schlieffensberg - dem jetzigen Reichstagsabgeordneten vgl. Nr. 215 d. Uebers. -, der mit seiner Mutter sich längere Zeit in Aegypten aufhielt und schon in jungen Jahren das Glück gehabt hatte, in Dongola eine umfangreiche, historisch wichtige Steininschrift aus den Zeiten des Aethiopierreiches zu entdecken, die jetzt eines der werthvollen Besitzthümer des Berliner Museums ist. [Cap. XIX. V. Z. Nr. 385.]
237) Ludwig Brunow, Bildhauer. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 197.
238) Birkmeyer, Fr., Dr. Dem Andenken Sr. Exellenz, des Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Johann Friedrich Budde. Persönliche Erinnerungen. Meckl. Zeitschrift für Rechtspflege und Rechtswissenschaft. Bd. XII, Heft 4. (Vgl. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 7.)
239) Hirschfeld, Ludwig v. Aus dem Tagebuche einer Hofdame. Vom Fels zum Meer. Stuttgart 1892/93, Heft 12 und 13. (Tagebuch der Sophie von Campenhausen, die als Hofdame mit der Großfürstin Helene, der Gemahlin des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig, im Jahre 1800 nach Ludwigslust kam und sich hier am 24. Mai 1802 mit dem nachmaligen


|
Seite 81 |




|
Cabinetsminister des Großherzogs Friedrich Franz I., von Plessen, vermählte. - Vgl. Nr. 274 dieser Uebersicht. -
240) Medicinalrath Dr. Ellis in Wittenburg, gest. am 17. October 1893, 66 J. alt. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 245.
241) Hevesi, L., Zerline Gabillon. Ein Künstlerleben. Stuttgart, 1893. (Z. G. geb. 1835 in Güstrow, Gem. des 1828 ebendaselbst geborenen Wiener Schauspielers Gabillon.)
242) Mittheilungen über die Familie Grotefend. I. II. III. Schwerin 1890/93.
243) Lehrer Wilhelm Grünberg=Wismar. (Schriftführer des Elbe=Ostsee=Kanalvereins.) Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 188.
244) Baurath a. D. Heß in Hannover, gest. 12. März 1894. (Bekannt durch seine Bearbeitungen meklenb. Canal=Projecte.) Nekrolog. Rost. Anz. 1894, Nr. 63.
245) F. Hornemann, Kaufmann und Fabrikant in Wismar, gest. 27. Jan. 1894. Rost. Ztg. 1894, Nr. 48)
246) Lebensbild des Professors Georg Kannengieß[Setzfehler]r in Neustrelitz zum achtzigsten Geburtstage. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 120.
247) Professor Georg Kannengießer, Historien= und Portraitmaler in Neustrelitz. Biogr. Not. Rost. Anz. 1894, Nr. 123.
248) Zur Würdigung Friedrichs von Klinggräff. (Vgl. Quartal= und Schlußbericht 1893 S. 82, Nr. 130) Der Mecklenburger XIII, Nr. 24.
249) Koch, F. E, Dr., Baurath, früher in Güstrow, jetzt in Schwerin. Biogr. Notizen, Meckl. Nachr. 1893, Nr. 164.
250) Professor Dr. med. Franz König in Göttingen. (1860-1875 Professor in Rostock) Biogr. Notizen Rost. Ztg. 1894 Nr. 184.
251) Herre, H., Ueber Hermann Korner's Herkunft und Universitätsjahre. Quidde, Zeitschrift für deutsche Geschichtswissenschaft. Bd. IX, S. 295 bis 303. (H. tritt gegenüber Voigt und Lorenz für die norddeutsche Herkunft Korners ein und sucht die Zugehörigkeit desselben zu der im Meklenburgischen und Holsteinischen vorkommenden Familie K., deren einer Zweig auch in Lübeck ansässig war, wahrscheinlich zu machen. - In Nr. 20 dieser Uebersicht wird unter Nr. 27 erwähnt: Reynoldus Korner - - Lubicensis civitatis clericus 1509.)
252) Raatz, Gustav, Der Vater des Dichters Kosegarten (Präpositus Kosegarten in Grevismühlen, gest. 1803). Meckl. Nachr. 1894, Nr. 59 u. 60.
253) Professor Dr. August Kundt in Berlin, geb. in Schwerin 18. Nov. 1839, gest. in Israelsdorf bei Lübeck 21. Mai 1894. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 234. Meckl. Ztg. 1894, Sonntagsbeilage Nr. 21 - 27. Mai -. (Mit Abbildung.)
254) Karl Freiherr von Ledebur, Hoftheaterintendant in Schwerin. Biogr. Meckl. Nachr. Sonntagsblatt Nr. 17 (29. April 1894). Meckl. Ztg. 1894, Sonntagsbeilage Nr. 17 (29 April).
255) Professor Dr. med. O. Lubarsch=Rostock. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 152.
256) Ein v. Lützowsches Grabdenkmal. Deutscher Herold 1893, S. 76/77. Mit Abb. (Zu Diehsa in der Oberlausitz, des 1687 gestorbenen Asche Claus v. L.)
257) Professor Dr. Madelung, Rostock. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 246. Meckl. Nachr., Nr. 123, 125.
258) Martini, Dr., Landgerichts=Präsident in Schwerin. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 224.


|
Seite 82 |




|
259) Professor Dr. Friedrich Maaßen in Wien, (geboren 1823 in Wismar, betheiligte sich 1848-1851 lebhaft an den politischen Kämpfen in Meklenburg.) Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 276.
260) Kirchenrath W. Maßmann. Wismar, geb. 22. Dec. 1802 zu Bützow, gest. 29. Novbr. 1893. Rost. Ztg. 1893, Nr. 565.
261) Mau, Joh. Gottfr. Ludwig, Geh. Hofrath, Bürgermeister in Neukalen, gest. am 11. Juli 1893 im 82. Lebensjahr. Biogr. Notizen. Mecklenb. Nachr. 1893, Nr. 161.
262) Consistorialpräsident Dr. Mejer, gest. in Hannover 25. December 1893. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 302.
263) P. Obergerichts=Präsident a. D., Dr. v. Monroy Güstrow, gestorben 15. April 1894. 86 Jahre alt. Nekrolog. Mecklenburger Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 14.
264) Eine kurze Biographie des berühmten, am 6. Februar 1639 zu Wismar geborenen, als Professor der Dichtkunst und der Beredsamkeit in Rostock und Kiel thätigen, am 30. Juli 1691 zu Lübeck verstorbenen Universalgelehrten Daniel Georg Morhof und eine sehr eingehende Würdigung seines bedeutendsten Werkes, des von 1688 bis 1744 in vier Auflagen erschienenen dreibändigen "Polyhistor" aus der Feder von Professor W. Eymer bringt das vorjährige Programm des Kaiserl. Königl. deutschen Staatsgymnasiums in Budweis. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 23. - Zur meckl. Litteratur. -)
265) Maltzan, J. v. Aus dem Leben eines alten Revolutionärs. (Erinnerungen an den am 14. Aug. 1893 in London verstorbenen Dr. Hermann Müller=Strübing.) "Der Mecklenburger" XIII, Nr. 30.
266) In Nr. 265 und 266 der Beilage zur (Münchener) Allgemeinen Zeitung findet sich eine Lebensbeschreibung des bekannten, 1812 zu Neubrandenburg geborenen, im August dieses Jahres in London durch einen unglücklichen Fall um's Leben gekommenen Gelehrten Dr. Hermann Müller=Strübing von Ad. Buff. Ein weiterer, in Nr. 271 enthaltener Artikel von E. Dietz behandelt Müller=Strübing's Stellung in der Heidelberger Burschenschaft und seinen Antheil an dem berüchtigten Frankfurter Attentat von 1833. M.=Str. war ein Bruder der früher vielgelesenen Schriftstellerin "Louise Mühlbach", Frau Klara Mundt, geb. Müller. (Aus Rost. Anz. 1893, Nr. 296. - Zur meckl. Litteratur. -)
267) Professor Dr. med. Friedrich Neelsen. Profector am Stadtkrankenhaus in Dresden, gest. das. 11. April 1894. (N. war von 1877-1885 Assistent von Prof. Dr. A. Thierfelder in Rostock.) Biogr. Not. Rost. Ztg. 1894, Nr. 170.
268) Albertus Freiherr von Ohlendorff, Besitzer der Fideicommißherrschaft Gresse bei Boizenburg, gest. das. 20. Jan. 1894. Biogr. Mecklenburger Nachr. 1894, Nr. 19.
269) Im 2. Heft der Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1894, giebt Rud. Schwartz=Greifswald nähere Nachrichten über den als Musiker wie als Schulmann seiner Zeit hochangesehenen Magister Statius Olthof aus Osnabrück, der von der Gründung der Großen Stadtschule zu Rostock im Jahre 1580 an zuerst als Cantor, dann als Subconrector und Conrector 34 Jahre hier wirkte und 1625 als hochbetagter Emeritus verstarb. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 156. - Zur meckl. Litteratur. -)
270) Osten gen. Sacken, O., Frhr. v. d. Nachricht über Herkunft, Verzweigung und Wappen derer v. d. Osten und v. d. Osten gen. Sacken. Berlin 1893.


|
Seite 83 |




|
271) Peters Hofrath, Rechtsanwalt in Schwerin, gestorben 27. Juli 1893. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 174.
272) Karl Peters, Geh. Medicinalrath, Neustrelitz. Nekrolog. Correspondenzblatt des allgem. mecklenb. Aerzte=Vereins, Nr. 159 (25. Juni 1894).
273) Professor Dr. med. Ludwig Pfeiffer=Rostock. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 160.
274) Hirschfeld, Ludwig v., Ein Staatsmann der alten Schule. Aus dem Leben des mecklenburgischen Ministers Leopold von Plessen. Nach Staatsacten und Correspondenzen. Deutsche Rundschau, Berlin 1893, October=, November=, December=Heft. 1894, Januar= und Juni=Heft. (Vergl. Nr. 239 dieser Uebersicht.)
275) Maltzan, J. v., zur Erinnerung an den Landrath Josias v. Plüskow auf Kowalz. Der Mecklenburger XIV, Nr. 2. (Auch Sonder Abdruck.) Gegen die Besprechung in Meckl. Nachr. 1894, Nr. 101. Graf Bernstorff=Beseritz im Mecklenburger XIV, Nr. 6. (Vergl. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 67.)
276) Landsyndicus Dr. Pries, Rostock, gest. am 30. December 1893 in Sternberg. Biogr. Not. Rost. Ztg. 1894, Nr. 1.
277) Gaedertz, K. Th., Dr., Neue Erinnerungen von und an Fritz Reuter. Vossische Ztg. 1894, Nr. 288, 290, 294, 296, 300, 302, 304. (Vergl. Der Mecklenburger XIV, Nr. 13, 14, 16.)
278) Zwei Briefe Fritz Reuters an seine Luise 1851 und 1854. Aus der Magdeb. Ztg. abgedr. Rost. Ztg. 1894, Nr. 272.
279) Luise Reuter. die Wittwe Fritz Reuters, gest. am 9. Juni 1894 in Eisenach. Meckl. Nachr. 1894. Nr. 133, 136, 137 und 238.
280) Rohlfs Gerhard, Frau Reuter und die Schillerstiftung. Aus der Köln. Ztg. abgedr. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 295, Meckl. Nachr. 1894, Nr. 149.
281) Ein Brief von Fritz Reuter und seiner Luise. Vossische Ztg. 1894, Nr. 320. (Enthält einen kurz gehaltenen Lebensabriß des Dichters. Vgl. Mecklenburger XIV, Nr. 16, Anm. auf Sp. 132.)
282) Dragendorff, Hedwig, Erinnerungen.Zehn Jahre aus meinem Jungendleben. v. O. u. J. (H. Dr. war Erzieherin im Hause der Eltern des Grafen A. Fr. v Schack.)
283) Fulda, Ludw., Adolf Friedrich Graf von Schack. Vossische Ztg. 1894, Nr. 198. Sonntagsbeilage.
284) Herzfelder, J. Graf Adolf Friedrich v. Schack. Münchener Neuesten Nachrichten 1894, Nr. 176.
285) Graf Adolf Friedrich v. Schack. Nekrolog. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 173. - Aus dem Leben des Grafen v. Schack. Das. Nr. 175. - Meckl. Nachr. 1894, Nr. 87, Nr. 96. (Beisetzung in Stralendorf b. Schwerin.)
286) Die Schack'sche Galerie in München. Aus der Köln. Ztg. Mecklenburger Nachr. 1894, Nr. 114 und 115.
287) Schlie, Fr. Die Schenkung der 1894 von Prof. Gerhard in Rom angefertigten Marmorbüste des Grafen v. Schack an das Großherzogliche Museum. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 109.
288) Professor Dr. Schirrmacher=Rostock. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 214.
289) Schlettwein, C. A. H. Geh. Justizrath. Biogr. Notizen. Mecklenb. Nachr. 1893, Nr. 224.
290) Litzmann, B. Friedrich Ludwig Schröder. 2. Theil. Hamburg und Leipzig 1894.


|
Seite 84 |




|
291) Schönbeck, Joh., Pastor emer., gest. 12. October 1893 in Neustrelitz 80 Jahre alt. (1851-57 Pastor in Gaarz bei Mirow, 1857-1888 Pastor in Feldberg.) Meckl. Nachr. 1893, Nr. 241.
292) Lier, H. A., Dr, Richard Steche. Ein Nekrolog. (St. war 1863-67 bei der meklenburgischen Friedrich Franz=Eisenbahn als Architekt thätig. Er baute die Bahnhöfe in Neubrandenburg und Oertzenhof. Er restaurirte die Kirche zu Lübberstorf und erbaute die Kirche zu Sadelkow. Er plante ein Werk über die Neubrandenburger Thore. Da er keinen Verleger fand, begnügte er sich, die Hauptergebnisse seiner Untersuchung in einem Artikel in Lützows Zeitschrift Bd. 12, Leipzig 1877, S. 374 bis 380 niederzulegen. - St., 1837 zu Leipzig geboren, starb am 3. Januar 1893 zu Niederlößnitz.) Neues Archiv für Sächsische Geschichte. 14. Bd. Dresden 1893, S. 125-138.
293) Oberamtsrichter Stypmann=Rostock, gest. 24. Febr. 1894. Nekrolog. Rost. Anz. 1894, Nr. 46.
294) Tiele=Winckler, v., Oberst a. D., gest. 12. Sept. 1893. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 217, 223.
295) In Nr. 9 (1894) der Berliner klinischen Wochenschrift widmet Prof. Dr. Ewald=Berlin dem kürzlich verstorbenen Prof. Dr. Uffelmann einen warmen Nachruf, in welchem er besonders die hohen Verdienste des Dahingeschiedenen um seine Wissenschaft in helles Licht stellt. - Einen kürzeren Nekrolog enthält die Wiener medicinische Presse Nr. 9. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 68. - Zur meckl. Litteratur. -)
296) Professor Dr. Uffelmann, gest. 17. Febr. 1894. Biogr. Notizen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 82.
297) Dr. med. Georg Winter, a. o. Professor in Berlin, geb. in Rostock 1856. Biogr. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 9.
298) Witte, Fr., Dr. Senator a. D. in Rostock, gest. in Warnemünde am 31. Juli 1893. Rost. Ztg. 1893, Nr. 352, 353, 357, 358.
299) Winzendorff v. Geh. Kammerrath. Biogr. Notizen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 224.
300) (Hofmeister, A. Dr.) macht im Rost. Anz. 1894, Nr. 156 - Zur meckl. Litteratur - auf Grund der Angaben eines im Druck erschienenen Werkes über die Wirksamkeit der "Händel und Haydn Gesellschaft" in Boston Mittheilungen über den Lebensgang des am 28. Juli 1826 zu Malchow geborenen Carl Zerrahn, der seit 40 Jahren die Uebungen des genannten Vereins leitet.
301) Von Wappen und Siegeln. Rost. Ztg. 1894, Nr. 228.
302) Teske, C. Die Wappen des Großherzoglichen Hauses Mecklenburg in geschichtlicher Entwickelung. Im Allerhöchsten Auftrage S. K. H. des Großherzogs Friedrich Franz von Mecklenburg=Schwerin bearbeitet und gezeichnet. Güstrow 1893. Bespr. Rost. Ztg. 1893, Nr. 518. (Dolberg) Rost. Anz. 1893, Nr. 278 (Dr. A. Hofmeister), daraus abgedr. Mecklenburger XIII, Nr. 36. Meckl. Ztg. 1893, Nr. 527. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 266. - Rost. Ztg. 1894, Nr. 184 a. d. Herold (v. Mülverstedt=Magdeburg.)
303) Teske, C. Das mecklenburgische Wappen von Lucas Cranach d. Ü, die Bücherzeichen (ex libris) des Herzogs Ulrich zu Mecklenburg und Anderes. Mit 22 Abbildungen. Berlin 1894.
304) Gritzner, Max. Handbuch der Ritter= und Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt. Leipzig 1893. - Mit Abbildungen. - Mecklenburg S. 229-239. Wendische Krone, Greifenorden, Militär=Verdienstkreuz,


|
Seite 85 |




|
Medaille für Kunst und Wissenschaft. Es fehlt Medaille für Rettung aus Lebensgefahr.
305) Gritzner, Maximilian, Landes= und Wappenkunde der Brandenburgisch=Preußischen Monarchie. Geschichte ihrer einzelnen Landestheile, deren Herrscher und Wappen. Berlin 1894.
(Herzogthum Mecklenburg, S. 152/3. "Wegen des Herzogthums Mecklenburg: Im goldenen Felde ein vorwärts gekehrter, abgegriffener schwarzer Büffelskopf mit rother Zunge, silbernen Hörnern, silbernem Nasenringe und rother Krone. Auf dem gekrönten Helme, mit schschwarz=goldenen Decken, ein Schirmbrett von 5 Stäben, blau, golb, roth, silbern, schwarz, aus dem ein mit dem Stierkopf im Profil belegter dreireihiger Pfauwedel hervorgeht. Auf Grund des Vertrages von 1442 (bestätigt von Mecklenb.=Schwerin und =Strelitz 1693 und 1701) beschloß König Friedrich I. 1708 die Wappenfelder des Herzoglich Mecklenburgischen Hauses seinem großen Staatswappen einzuverleiben. Mecklenburg=Schwerin ertheilte seine Zustimmung, Strelitz widersprach; trotzdem nahm der König Titel und Wappen an und Kaiser Karl VI. bestätigte d. d. Wien, 3. Oktober 1712 die geschehene Beilegung. Seitdem wurden die Wappen und Titel von Mecklenburg im Range stets hinter denen von Lauenburg geführt; auch die übrigen mecklenburgischen Landestheile waren im großen königlich preußischen Wappen und Titel vertreten, bis die Kabinetsordre vom 16. August 1873 bestimmte, daß diese fortan wegfallen und nur Wappen und Titel des mecklenburgischen Stammhauses zu führen seien. - Die Fränkischen Fürstenthümer haben seit 1724 alle Felder des Mecklenburger Wappens und außer obigem Helm auch die anderen geführt. -)
306) Raspe, H., Gesetzsammlung für die Mecklenburg=Schwerinschen Lande. III. Folge. 1. Januar 1857 bis auf die Gegenwart. II. Band: Justizsachen. Wismar 1894.
307) Buchka, v. Dr., Ueber die örtliche Zuständigkeit der Vormundschaftsgerichte, Zeitschrift für Rechtspflege und Rechtswissenschaft. 12. Bd. 2 Hft.
308) Buchka, v. Dr., Die landesherrliche Verordnung vom 18. März 1891, betr. den Fischereibetrieb. Vortrag, Bericht über denselben Rost. Ztg. 1894, Nr. 12.
309) Pressentin, v., Oberlanddrost, Die Umzugszeiten in Mecklenburg. Vortrag, Landw. Annalen 1894, Nr. 16.
310) Techen, Fr., Wismars Beziehung zum Femgericht. Vortrag, Mittheilung darüber von O. Glöde in der Zeitschrift f. deutschen Unterricht, H. 8, S. 562.
311) Deutsche Justiz=Statistik, 6. Jahrg., Berlin 1893. Auszug der aus derselben für beide Meklenburg in den Jahren 1890 und 1891 sich ergebenden Resultate. Rost. Ztg. 1893, Nr. 482, 486, 492.
312) Bunsen, Amtsrichter, Der Rostocker Erbvertrag von 1788. Vortrag, Bericht darüber Rost. Ztg. 1894, Nr. 166.
313) Der Staatsvertrag der beiden mecklenburgischen Regierungen, betreffend die käufliche Erwerbung der Neustrelitz=Warnemünder Eisenbahn. Abdruck des Vertrages, Rost. Anz. 1894, Nr. 112.
314) Staatsvertrag der beiden mecklenburgischen Regierungen, betreffend Erwerbung der mecklenburgischen Südbahn. Abdruck des Vertrages, Rost. Anz. 1894, Nr. 113.


|
Seite 86 |




|
315) Aus der Forstverwaltung (Der Uebergang zum Oberförstersystem). Meckl. Nachr. 1894, Nr. 119, Rost. Ztg. 1894, Nr. 240.
316) Der Uebergang zum Oberförstersystem. "Der Mecklenburger" XIV, Nr. 9. Nochmals der Uebergang zum Oberförstersystem, a. a. O. XIV, Nr. 11 und 12. Nochmals u.s.w. a. a. O. XIV, Nr. 13 und 14.
317) Einige Betrachtungen über die bisherige Ausnutzung der Jagd in Mecklenburg. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 277. Dagegen "Der Mecklenburger" XIII, Nr. 36.
318) O. B. (Graf Oeynhausen=Brahlstorf?), Das Wildschadengesetz. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 279, 280.
319) Das Recht auf Ersatz von Wildschaden nach der einheimischen Verordnung vom 14. Februar 1894. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 188, 194.
320) Oertzen=Kotelow, L. v., Landrentmeister, Darstellung des am 1. Mai 1894 in Kraft tretenden Wildschadengesetzes erläutert durch - - -, mit Textabdruck, Sachregister, sowie dem vollständigen Verzeichniß der vom Ministerium ernannten Schiedsmänner. Schwerin, 1894.
321) Zur Wildschadenfrage. (Betr. die Jagdverpachtung auf den Domanial=Feldmarken.) Meckl. Nachr. 1894, Nr. 131.
322) v. A. Die Jagdverhältnisse Mecklenburgs. Zeitschrift "St. Hubertus" (Cöthen) 1893, Nr. 47. (Eine scharfe Kritik dieses Aufsatzes unter dem Titel: "Junker und Bauer. Ein Beitrag zu dem Kapitel von der Solidarität der Großen und Kleinen": Berliner Volkszeitung 1893, Nr. 286.)
323) Metterhausen, Wilhelm, Dr. Die directen Landessteuern im Großherzogthum Mecklenburg Schwerin seit dem landesgrundgesetzlichen Erbvergleich vom 18. April 1755. Güstrow 1894.
324) Auskunft an Zöllen, Verbrauchssteuern und Aversen in den Großherzogthümern Mecklenburg für das Jahr 1894/95. Rost. Ztg. 1893, Nr. 552.
325) Steuerauskunft im Jahre 1893/94 in Mecklenburg=Schwerin. Rostocker Ztg. 1894, Nr. 246.
326) Bernstorff=Beseritz, Graf v. Vom letzten Landtage. (Der Verfasser sieht sich aus bestimmten Gründen "leider darauf beschränkt, mit wenigen Strichen die Hauptergebnisse der Verhandlungen zu skizzieren.") Der Mecklenburger, XIII, Nr. 48 und 49.
327) Landtags=Ergebnisse. Rost. Ztg. 1893, Nr. 602 und 604.
328) Einführung des Landraths von Flotow auf Kogel am 20. Jan. 1894. Rost. Ztg. 1894, Nr. 34.
329) Von den Fideicommißgütern in Mecklenburg=Schwerin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 276.
330) Balck, C. W. A. Die Vererbpachtung der Domanialbauern. Schwerin, 1894.Bespr. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 42. Rost. Anz. 1894, Nr. 44. Der Mecklenburger, XIV, Nr. 6. Nordd. Allgem. Ztg. 1894, Nr. 42. Abgedr. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 52.
331) Verordnung, betr. Umgestaltung der oberen Domanial=Verwaltungsbehörde. Reg.=Bl. 1893, Nr. 17. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 225.
332) Gnadengelder für Dorfschulzen. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 75.
333) Jahresbericht der Medicinal=Commission in Rostock für das Jahr 1892. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 152, 153 und 154.
334) Jahresbericht der Medicinal=Commission zu Rostock pro 1893, Auszug aus demselben Meckl. Nachr. 1894, Nr. 142.


|
Seite 87 |




|
335) Von den Berufsprüfungen in Mecklenburg=Schwerin 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 22.
336) Statistik der Reichstagswahlen von 1893 in Mecklenburg=Schwerin und Strelitz. Rost. Ztg. 1893, Nr. 562.
337) Schnell, Heinrich, zur Geschichte der mecklenburgischen Kirchenordnung. Aus Handschriften des Rostocker geistlichen Archivs mitgetheilt. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 28. Vgl. dazu, Wilhelmi=Güstrow, a. a. O. 1893, Nr. 36.
338) Kliefoth, Zur Synodalordnung. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 8. (Kl. charakterisirt die Thätigkeit der Synoden und bringt eine Aenderung des §. 24 der Syn.=Ordn., der von den Initiativ=Anträgen der Synoden handelt, in Anregung.)
339) Volz, Großherzog Friedrich Franz II. von Mecklenburg=Schwerin. (Vgl. Nr. 116 der vorigjährigen Uebersicht.) In den Meckl. Nachr. 1893, Nr. 157 und 158 veröffentlicht Dr. v. D. sen. Hamburg, Hallerstr. 18 eine Besprechung des genannten Werkes, in der er eine Auslassung im letzten Kapitel "Gottseliges Ende", hauptsächlich aber "in der Mitte des Buches" - II. Buch, drittes Kapitel - "eine unrichtige Auffassung des Verhaltens der Stände in Betreff des Oberkirchenraths" tadelt.)
340) Rieker, Carl, Dr. jur. u. Lic. theol., Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen Entwickelung bis zur Gegenwart. Leipzig 1893 (?) (Mecklenburg. Verhältnisse, S. 348, 419-22. Rost. Ztg. 1893, Nr. 526.)
341) Rische, B., Unser Hauptgottesdienst nach Anordnung und Bedeutung. Vortrag. Stavenhagen 1894.
342) Albrecht, Pastor in Gielow, Unser Kirchengesangbuch. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 25. (A. bespricht die redactionellen Veränderungen, die dasselbe in den letzten Jahren erfahren hat.)
343) Albrecht=Gielow, Ein neues Gesangbuch. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1894, Nr. 8. (A. berichtet über das Weihnachten 1893 in Wismar eingeführte neue Gesangbuch.)
344) Bestätigung der Statuten des Pfarraufbesserungsfonds vom 11. Oct. 1893. Reg.=Bl. 1893, Nr. 20. Rost. Ztg. 1893, Nr. 576.
345) 10. Versammlung der kirchlichen Landeskonferenz und 6. Versammlung des Landesausschusses für innere Mission am 10., 11. und 12. October 1893 in Parchim. Programm: Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 26. Thesen zur kirchlichen Konferenz in Parchim: a. a. O. Nr. 28. (I. D. v. Oertzen, Die Nothwendigkeit freier Vereinigungen in unsern christlichen Gemeinden. - Vortrag desselben über dasselbe Thema: a. a. O. 1893, Nr. 34. Dagegen: a. a. O. 1894, Nr. 6. II. Pistorius, Die Organisation der kirchlichen Armenpflege. Vortrag: a. a. O. 1893, Nr. 35.) Bericht (von Pastor Mau in Mecklenburg): a. a. O. 1893, Nr. 31, 32, 33.
346) Der Kampf wider den Meineid. Vorträge auf der am 12. October 1893 zu Parchim gehaltenen Jahresversammlung des Landesausschusses für innere Mission in Mecklenburg. Rostock 1894.
347) Reimpell, Pastor in Lassahn, Der Anfang der inneren Mission in Mecklenburg vor 50 Jahren. Bremen 1893. Bespr.: Rost. Anz. 1894, Nr. 60. Ferner hat die kleine Schrift die Veranlassung zu einem


|
Seite 88 |




|
lebhaft geführten litterarischen Kampfe gegeben. Meckl. Kirchen und Zeitblatt 1894, Nr. 9, 10, 11, 12, 14 und ff. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 54, 87 und 91.
348) Karsten, Herm., Pastor in Schlieffenberg, Die Geschichte der evangelisch=lutherischen Mission in Leipzig, von ihrer Entstehung bis auf die Gegenwart dargestellt. I. Theil. Güstrow 1893. Bespr.: Kreuzzeitung 1893, Nr. 485. Abgedr.: Der Mecklenburger XIII, Nr. 31, Litter. Beiblatt. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 235.
349) Meyer, A., Pastor in Rittermannshagen, Welche Mittel sind in unserer Zeit neben der ordentlichen Predigt des Worts und der Verwaltung der Sacramente vorgeschlagen worden und in Anwendung gebracht, um die Schäden der Kirche zu heilen? Meckl. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 22-24.
350) Maltzan, J. v., Der Fortgang des Superintendenten Hardeland aus Mecklenburg. Der Mecklenburger XIII, Nr. 45. Entgegnungen: Nr. 46, 47 (Oberkirchenrath), Erwiderung J. v. M's Nr. 48, 50.
351) Maltzan, J. v., Politischer Unitarismus, kirchliche Union und Mecklenburg. Der Mecklenburger XIII, Nr. 50. Dazu XIV, Nr. 1.
352) Einen Beitrag zur Geschichte des evangelischen Gottesdienstes liefert Gymnasiallehrer H. Gebler in Ratzeburg in der "Siona". Bd. 18, S. 179-188: Das Organistenamt an der Domkirche zu Ratzeburg. Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 2. - Zur meckl. Litteratur.
353) Orgel in der Marienkirche zu Rostock. Rost. Ztg. 1893 Nr. 366.
354) Die Glocken in Rostock, Schwerin und Wismar. Meckl. Nachr. Sonntagsblatt Nr. 48, 26. Novbr. 1893.
355) Die Glocken der Marienkirche zu Rostock, und zwar vorläufig die zweitgrößte derselben, macht Prof. W. Effmann in Freiburg im Schw. zum Gegenstand einer längeren Ausführung in der Zeitschrift für christliche Kunst, Heft 3. Die Glocke, die Effmann - unseres Erachtens zu früh - der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts zuschreibt, trägt am oberen Rande die Inschriften: Consolor viva, fleo mortua, pello nociva und O rex glorie veni cum pace in überaus reich und geschmackvoll verzierten gothischen Majuskeln, wie solche dem Verfasser in gleicher Schönheit der Ausführung noch nicht weiter vorgekommen sind. Aus Rost. Anz. 1894 Nr. 156. - Zur meckl. Litteratur. -
356) Wiedereröffnung der St. Nikolai=Kirche zu Rostock am 17. Decbr. 1893. Rost. Ztg. 1893, Nr. 589.
357) Pries, Diaconus in Rostock. Kirchenplätze und Interimskirche. Rost. Anz. 1894. Nr. 23. (Pr. tritt für den Bau einer Interimskirche vor dem Kröpelinerthor in Rostock ein.) Constituirung eines Kirchenbau=Vereins, a. a. O., Nr. 29. Rost. Ztg. 1894, Nr. 212.
358) Vollendung des Domthurmes und Uebergabe desselben an die Domkirche. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 153. (4. Juli 1893.)
359) Stuhr, Dr. Die Kirchenbücher Mecklenburgs. Vortrag. Ber. darüber. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 162. Rost. Ztg. 1893, Nr. 323.
360) Erlaß des Oberkirchenraths über die Benutzung der Kirchenstühle, wie auch über ein angebliches Erkenntniß des Reichsgerichts. Mecklenb. Kirchen= und Zeitblatt 1893, Nr. 19. Vgl. a. a. O. 1893, Nr. 26, S. 499. - 1894, Nr. 2, S. 36 u. 37. Rost. Ztg. 1893, Nr. 307.
361) Neue Kirchenheizungsanlagen in Städten und Dörfern Mecklenburgs i. J. 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 4, Nr. 12. (Tessin). Mecklenburger Nachr. 1894, Nr. 5.


|
Seite 89 |




|
362) Von den milden Stiftungen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 206.
363) Verzeichniß von Privatstiftungen in Wismar. Rost. Ztg. 1893, Nr. 379.
364) Oscar Borchert, Mittheilungen über das Kinderhospital Marienstift in Jerusalem. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 301. Vgl. Nr. 281.
365) Der Jünglingsverein zu Rostock, Einweihung des neuen Vereinshauses. Rost. Ztg. 1894, Nr. 266.
366) Einweihung des christlichen Vereinshauses in Schwerin. Meckl. Nachrichten 1893, Nr. 243. Beschreibung des Hauses, Meckl. Nachr. 1893, Nr. 247.
367) Bericht über die Thätigkeit des Stephanusstiftes in Schwerin während des Jahres 1893. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 37.
368) Hofmeister, A., Dr., Die Matrikel der Universität Rostock, III. Bd., 1. Hälfte. Rostock 1893. (Enthält die Einzeichnungen von Ostern 1631 bis Michaelis 1651.)
369) In Nr. 23 der "Akademischen Blätter" (des Verbands=Organs der Vereine deutscher Studenten) vom 1. März d. J. findet sich ein F. E. unterzeichneter Artikel über Rostock, der den Zweck verfolgt, den Commilitonen einen Einblick in das studentische Leben und Treiben an der hiesigen Hochschule zu gewähren. (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 134 - Zur meckl. Litteratur. -)
370) Stieda, W., Dr., Bericht, betreffend die Anstellung des akademischen Quästors. Als Manuskript gedruckt Rostock 1893.
371) Schulze, L., Jubiläumsbericht über das hundertjährige Bestehen der Wittwen=Kasse Rostocker Professoren. Rostock, Adlers Erben 1893, 4, 3 S. (Die Kasse wurde begründet durch ein Legat von 300 Thlrn. N 2/3 am 24. Nov. 1783, landesherrlich bestätigt 8. Jan. 1794. Sie besitzt jetzt ein Vermögen von 80 000 Mk.)
372) Lemcke, Chr. Dr., Bericht über die Universitäts=Poliklinik für Oren=, Nasen= und Kehlkopfkrankheiten in Rostock vom 1. Juli 1891 bis dahin 1893. Archiv für Ohrenheilkunde, Bd. 36, S. 55-70. (Voran geht eine Uebersicht über den Entwickelungsgang dieser Disciplinen an der Universität Rostock.)
373) Stieda, Dr., Prof., bespricht unter vielfacher Bezugnahme auf Rostocker Verhältnisse unter dem Titel: Liv=, Est= und Kurländer auf der Universität Frankfurt a. O., die von Friedländer herausgegebene Frankfurter Universitäts=Matrikel. (Publikationen der preuß. Staatsarchive, Bd. 32, 36 und 49.) Mittheilungen für livländ. Gesch., Bd. 15 (1893), S. 353-397.
374) Die Balten auf der Universität Rostock. (S. B., Kurländ. Geschichte 1892/3, Anhang S. 43-62.) Aus Hofmeister, Matr. d. Rost. Univ,. Bd. I und II werden für die Jahre 1319-1610 665 Einzeichnungen baltischer Studenten gezählt.
375) Keil, Robert und Richard, Die deutschen Stammbücher des sechszehnten bis neunzehnten Jahrhunderts. Ernst und Scherz, Weisheit und Schwank in Original=Mittheilungen zur deutschen Kulturgeschichte. Berlin 1893. Enthält auch Stammbücher von der Rostocker Universität. (Nr. 722-29. Darunter Einzeichnungen einiger Docenten - Jac. Fabricius, Med. P. 1638, .Jerem. Nigrinus, Pom. 1641, Herm. Schuckmann, Th. P. 1656, Casp. Mauritius, Th. P. 1656.)
376) Mecklenb.=Strelitz Reglement für die Naturitätsprüfung der Gymnasialabiturienten. Oeff. Anz. 1893, Nr. 43. Rost. Ztg. 1893, Nr. 584.
377) Schulwesen in Rostock. Rost. Ztg. 1893, Nr. 452.


|
Seite 90 |




|
378) Der Bericht der räthlichen und bürgerschaftlichen Commission für Verbesserungen im (Rostocker) städtischen Schulwesen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 322.
379) Die Umgestaltung der Großen Stadtschule in Rostock. Rost. Ztg. 1893, Nr. 470.
380) Holle, C., Direktor, Kurzer Rückblick auf den 25jährigen Bestand des Gymnasiums. Gymnasial=Programm. Waren 1894. (Enthält auch ein Verzeichniß der Lehrer und Abiturienten von 1869-1894.)
381) Einweihung des neuen Schulhauses der großen Stadtschule in Wismar. Meckl. Nachr. 1893. Nr. 241.
382) Beschreibung des neuen Schulhauses in Wismar. Rost. Ztg. 1893, Nr. 389, Einweihung desselben. Rost. Ztg. 1893, Nr. 480.
383) Seeger, H. Director. Der Unterricht in der mathematischen Geographie auf dem Güstrower Realgymnasium. Güstrow 1894.
384) Wiechmann, E. Zum 25jährigen Jubiläum des Großherzoglichen Realgymnasiums zu Ludwigslust. Ludwigsluster Wochenblatt 1893, Nr. 121. - Kurzer Ueberblick über die Geschichte der am 15. Okt. 1868 eröffneten Anstalt mit einem Verzeichniß der Lehrer und Abiturienten - 100 -.
385) Von der Zählung der städtischen Schulen im Staatskalender. Rost. Ztg. 1894 Nr. 184.
386) Aus der Schulstatistik der Städte in Mecklenburg 1892/93. Meckl. Nachr. 1893 Nr. 288.
387) Vom Schulfonds. Rost. Ztg. 1894 Nr. 336. (Es handelt sich um den aus den französischen Kriegsentschädigungsgeldern 1876 gebildeten Fonds im Betrage von 1 200 000 Mk., aus dessen Erträgen an die Gemeinden Zuschüsse gezahlt werden sollten, die sich in Betreff der Lehrerbesoldung den Normativbestimmungen vom 28. Februar 1874 unterwerfen würden.)
388) Landtagsvorlage betreffend Gehaltsaufbesserung der seminaristisch gebildeten Lehrer an städtischen Volks= und Bürgerschulen. Im Auftrage der Landschaft ausgearbeitet von den Bürgermeistern Schlaaff=Waren und Süsserott=Güstrow. Bericht über dieselbe aus der Meckl. Schulzeitung abgedruckt Meckl. Nachr. 1893, Nr. 284, 285. Rost. Anz. 1893, Nr. 286. Hieran knüpfte sich eine lebhafte Preßfehde über die Einnahmen und die Ausbildungskosten der Lehrer einer= und der Subalternbeamten insbesondere der Forstbeamten andererseits. Rost. Anz. 1893, Nr. 289, 292, 298. Vgl. dazu Meckl. Nachr. 1894, Nr. 53.
389) Voß H. Die Lehrerbildung wie sie ist und wie sie sein soll. Vortrag, abgedr. Meckl. Schulzeitung XXIV (1893) Nr. 48.
390) Das Recht der Landschullehrer im Domanium auf freie Weide u.s.w. unter den Kühen des Pachthofes. Entsch. d. O.=L.=G. Rost. Ztg. 1893, Nr. 526.
391) Kliefoth. Das Aufhören der Konrektorate im Lande. Meckl. Kirchen= und Zeitblatt, 1894, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 7. (Zur Rektoratsfrage und Kl.'s Entgegnung auf die in der Meckl. Schulzeitung 1894, Nr. 6 u. 7 enthaltenen Artikel). Die Zahl der Conrectorstellen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 191.
392) Die Zahl der mecklenburgischen Volksschullehrer. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 220.
393) Die Beschäftigung weiblicher Lehrkräfte an den städtischen Bürgerschulen. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 152. 2. Juli 1893.
394) Rückblick auf das Jahr 1893. Personal=Veränderungen an den evangelischen Kirchen und Schulen in den Städten und auf dem Lande. Meckl. Nachr. 1893. Nr. 305.


|
Seite 91 |




|
395) Bohn, Festschrift zur Jubelfeier des 25jährigen Bestehens des Landes=Lehrer=Vereins in Mecklenburg=Schwerin. Schwerin 1893.
396) Jubiläumsfeier des Mecklenburgischen Landes=Lehrer=Vereins. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 231, 232, 233, 234. Rost. Ztg., Nr. 462, 464, 466, 467, 468.
397) Kosten der städtischen Schulen in Güstrow. (Realschule, höhere Bürgerschule und Freischule.) Rost. Ztg. 1893, Nr. 529.
398) Die Entwickelung des Elementarschulwesens in Rostock. Rost. Ztg. 1894, Nr. 124.
399) Die öffenttiche Prüfung in der hiesigen (Rostock) Taubstummen=Schule. Rost. Ztg. 1894, Nr. 128.
400). Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart. Herausgegeben von der Vereinigung Berliner Architecten. Berlin 1893.
401) Hübbe, Baudirector, Wismar, Zum Kirchenbau des Protestantismus. Nach dem Meckl. Kirchen= und Zeitblatt. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 102.
402) F. Bn., Die St. Marienkirche zu Doberan. Rost. Ztg. 1893, Nr. 323.
403) Grotefend, Dr., Archivrath, Grabdenkmäler und Epitaphien. Vortrag, Bericht darüber: Rost. Ztg. 1894, Nr. 58. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 37.
404) Das Denkmal Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Friedrich Franz II. im Schloßgarten zu Schwerin. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 183.
405) Urkunde zum Denkmal Friedrich Franz II. von Ludwig Brunow. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 222.
406) Die Enthüllungsfeier des Denkmals für den hochseligen Großherzog Friedrich Franz II. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 198, 199, 201.
407) Das Einzugs Relief am Denkmal des Großherzogs Friedrich Franz II. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 202.
408) Schlie, Fr., Das Denkmal Friedrich Franz II. von Ludwig Brunow. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 217, 218 und 219.
409) Schlie, Fr., Das Denkmal des Großherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg Schwerin. Mit 7 Abbildungen. Zur Erinnerung an den 24. August 1893.
410) Das Denkmal des Großherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg=Schwerin. Illustrierte Zeitung Bd. 101, S. 317/18.
411) Blücher=Denkmäler in Rostock, Breslau, Berlin, Caub. Rost. Anz. 1894, Nr. 139.
412) Ueber Neubauten von Posthäusern in Mecklenburg=Schwerin. Rost. Ztg. 1893, Nr. 337, Nr. 494. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 171.
413) Der Schweriner Postneubau. Mit Abbildungen. Meckl. Ztg. 1894, Sonntagsblatt Nr. 13 (1. April), Nr. 14 (8. April).
414) Schlie, Fr. zeigt die Ausstellung der "Pläne zu dem theilweise bereits zur Ausführung gelangten Neubau des Badedower Schlosses von Dr. Haupt=Hannover" an. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 248.
415) Das neue Ständehaus zu Rostock. Beschreibung desselben. Rost. Ztg. 1893, Nr. 458. Die feierliche Eröffnung desselben. Rost. Ztg. 1893, Nr. 460. Protokoll der Einweihung. Rost. Ztg. 1893, Nr. 464.
416) Die Urkunde zur Einweihung des Ständehauses. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 234.
417) Das Ständehaus in Rostock. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 230, 233.


|
Seite 92 |




|
418) Ueber die feierliche Eröffnung des neuen Ständehauses. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 232.
419) Vom Ständehaus (Glasmosaik). Rost. Anz. 1893, Nr. 265.
420) Koppmann, K., Das Steinthor in Rostock und dessen Bau. Bericht über einen Vortrag. Rost. Ztg. 1893, Nr. 536.
421) Das neue Stadttheater zu Rostock. Rost. Ztg. 1894, Nr. 24.
422) Jubiläumsfeier des im Jahre 1842 eröffneten städtischen Theatergebäudes in Wismar am 29. Dec. 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 2.
423) Kade, Otto. Die Musikaliensammlung des Großherzoglich Mecklenburg=Schwerin'schen Fürstenhauses aus den letzten 2 Jahrhunderten.Verzeichnet und ausgearbeitet von - -. 2 Bde. Wismar 1893.
424) Hoftheater, Großherzogliches, zu Schwerin. Uebersicht der während der Spielzeit 1893/94 gegebenen Vorstellungen und Konzerte. Schwerin 1894.
425) Zur Geschichte der Sondervorstellungen am Großherzoglichen Hoftheater in Schwerin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 208. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 102. Berichte über die Vorstellungen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 220, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244. Rost. Anz. 1894 Nr. 104, 110, 112, 114, 115, 117, 118, 121, 126, 133. Meckl. Nachr. 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121. Der Mecklenburger, XIV, Nr. 8 und 9.
426) Großherzogliches Museum. Geschenke während des Jahres 1893. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 304.
427) Schlie, Fr., Dr. Großherzogliches Museum. Möbel des Mittelalters. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 32, 33. - Kirchen=Möbel. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 35, 36.
428) Schlie, Fr. Dr. Großherzogliches Museum. Alt=Meißen in Schwerin. Zweite Ausstellung altsächsischer Porzellane aus den Beständen des Großherzoglichen Schlosses. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 154. 155 und 156.
429) Schlie, Fr. Alt=Meißen in Schwerin. 1. und 2. Ausstellung altsächsischer Porzellane im Großherzoglichen Museum. Schwerin 1893.
430) In Heft 5 des Kunstgewerbeblattes behandelt Fr. Schlie in Schwerin alte mecklenburgische Fayencen im Großherzoglichen Museum, theils aus der Appelstedt'schen Fabrik zu Schwerin (etwa 1760-1780), theils aus der von Hagenschen zu Groß=Stieten (1753). (Aus Rost. Anz. 1894, Nr. 68. - Zur meckl. Litteratur. -)
431) Ferenczi, Max, Dr. Zur mecklenburgischen Ofenkachel=Fabrikation des XVI. Jahrhunderts. Aus dem Leitmeritzer "Central=Anzeiger" abgedr. Deutsche Töpferzeitung (Leipzig) 1892, Nr. 31. (24. Juli.)
432) Der im Jahre 1600 vom Goldschmied Jakob Eggeler zu Wismar für die dortige Krämerzunft angefertigte große silberne Willkomm sowie der von einem unbekannten Meister gearbeitete silbervergoldete Schützens=Papagei derselben Zunft sind für das Museum in Schwerin erworben. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 92.
433) Schwetzky, W., Zur Erinnerung an den Anschluß der Großherzogthümer Mecklenburg=Schwerin und Mecklenburg=Strelitz an den deutschen Zollverein am 11. August 1868. Schwerin 1893. (Rückblick auf das vor


|
Seite 93 |




|
1868 in Meklenburg bestandene indirecte Steuerwesen, sowie Darstellung der Entwickelung der einzelnen Abgabenzweige seit 25 Jahren und der Einwirkung der Zoll= und Steuergemeinschaft während dieser Zeit auf Handel und Industrie in Meklenburg.)
434) Baumann, Fr., Mecklenburgische Landes Gewerbe und Industrie. Austellung in Rostock 1892. Rostock 1893
435) Die Mecklenburger in Chicago. (Betheiligung Mecklenburgs an der Ausstellung in Chicago 1893.) Rost. Ztg. 1893, Nr. 554.
436) Ausstellung von Chicago 1893. Berichte der Delegirten des Verbandes mecklenburgischer Gewerbevereine. Schwerin 1894.
437) Hennemann, Gewerbe=Inspector, Landbaumeister in Güstrow, Jahresbericht betreffend Ausführung der Gewerbeaufsicht im Großherzogthum Mecklenburg Schwerin. Jahrgang 1893. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 95.
438) Von den Genossenschaften in Mecklenburg=Schwerin. Rost. Ztg. 1894, Nr. 146, 148.
439) Die Zunahme der industriellen Betriebe in Mecklenburg=Schwerin im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 240.
440) Die Dynamitfabrik bei Dömitz. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 230 u. 269.
441) Mecklenburgische Zuckerfabriken. Rost. Ztg. 1893, Nr. 466.
442) Von den Zuckerfabriken beider Mecklenburg. Rost. Ztg. 1894, Nr. 128.
443) Schuhmacher=Zarchlin, Rübenbau und Zuckerfabriken in Mecklenburg= Schwerin. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 32 und 92.
444) Die zeitweilige Lage der Zuckerindustrie. Vortrag gehalten im Patriotischen Verein zu Güstrow den 19. Febr. 1894. Güstrow, 1894.
445) Die Zuckerfabrik zu Dahmen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 164.
446) Mittheilungen aus dem Bericht über die Verwaltung der Großherzoglichen Friedrich Franz=Eisenbahnen. Rost. Ztg. 1893, Nr. 538, 540, 542.
447) Mittheilungen über den Post= und Telegraphenverkehr im Ober=Post=Direktionsbezirk Schwerin im Jahre 1892. (Nach der Statistik der Reichs=Post= und Telegraphenverwaltung). Rost. Ztg. 1893, Nr. 554, 556.
448) Landgerichtsdirektor Lindenberg=Berlin berichtet auf Grund der Akten der Schweriner Ober Postdirektion über die 1868 vorgenommene Ueberklebung mecklenburgischer Briefumschläge mit norddeutschen Freimarken. Nach der Berliner "Volks=Zeitung", Mecklenb. Nachr. 1894, Nr. 41. (Vergl. C. Lindenberg. Die Briefumschläge der deutschen Staaten. Hft. 2. Die Briefumschläge von Mecklenburg=Schwerin und Mecklenburg=Strelitz. Berlin 1892.)
449) Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Bezirksverein der Mecklenburgischen Küste zu Rostock. Jahresbericht pro 1893 erstattet von O. Ludwig. Rost. Ztg. 1894, Nr. 154.
450) Lauffer, Victor, Danzigs Schiffs= und Waarenverkehr am Ende des XIV. Jahrhunderts. (1474 und 1476. Auch Nachrichten über den Handelsverkehr mit Rostock und Wismar!) Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins. Heft XXXIII. Danzig 1894. S. Quartalberichte 1893/94, S.
451) Rhederei Angelegenheit. (Nach dem Erlaß der deutschen Reichsverfassung - §. 54 - und des Freizügigkeitsgesetzes vom 1. November 1867 - §. 1 - giebt es meklenburgische Seeschiffe, welche die meklenburgische Nationalflagge führen und welche nur von meklenburgischen Unterthanen - §. 56, Nr. 1 der meklenburgischen Verordnung zum allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuche vom 28. December 1863 - geführt werden dürfen, nicht mehr. Erachten des


|
Seite 94 |




|
Rostocker Magistrats, bestätigt vom Ministerium des Innern.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 128.
452) Die mecklenburgische Rhederei. (Nach der Zusammenstellung von D. Wiggers 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 72.
453) Ein wirklicher Nothstand. (Betr. die Schiffsrhederei in Rostock.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 70.
454) Von den Rostocker Schiffen. Rost. Ztg. 1894, Nr. 92.
455) Schiffsverkehr in Warnemünde und Wismar im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 6.
456) Schiffsverkehr zu Warnemünde. (Erläuternde Bemerkungen!) Rost. Ztg. 1894, Nr. 34.
457) Der neue Hafen zu Wismar. Meckl. Nachrichten 1893, Nr. 191, 221.
458) 100jähriges Jubiläum der Lemm'schen Schiffswerft in Boizenburg. Rost. Ztg. 1894, Nr. 217.
459) Vereinbarung der Stadt Schwerin mit der
Großherzoglichen Flußbau=Verwaltungskommission
betr. Neubauten
 . im Bereiche der die Stadt
Schwerin umgebenden Seen und Canäle. Meckl. Ztg.
1894, Nr. 112.
. im Bereiche der die Stadt
Schwerin umgebenden Seen und Canäle. Meckl. Ztg.
1894, Nr. 112.
460) Mensch, Oberbaudirektor, Die Süd=Mecklenburgischen Wasserstraßen. Vortrag, Bericht über denselben. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 280. Meckl. Nachr. 1894, Nr. 141.
461) Verkehr auf den Wasserstraßen des Großherzogthums Mecklenburg=Schwerin im Jahre 1893. Rost. Ztg. 1894, Nr. 214.
462) Projekt zur Regulirung des Durchstiches bei Warnemünde im Jahre 1894 vom Rath zu Rostock der repräsentirenden Bürgerschaft vorgelegt. Rost. Ztg. 1893, Nr. 570. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 288.
463) Von der Warnowschleuse bei Rostock. Rost. Ztg. 1894, Nr. 68 (Vgl. Nr. 34: Zusammenstellung betr. den Verkehr im Jahr 1893).
464) Das Projekt des Lenz=Güstrow=Bützower Schifffahrtskanals als Theilstrecke des Rostock=Berliner Schifffahrtkanals. Rost. Ztg. 1893, Nr. 315. Meckl. Nachr. Nr. 162.
465) Der Elbe Ostsee=Kanal. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 190, 240, 255, 271, 1894, Nr. 37, 81. Rost. Anz. 1893, Nr. 115, 190, 240, 1894, Nr. 53, 81. Mittheilungen des Centralvereins 1893, S. 78, 218, 243, 244. 1894, S. 83, 89, 90.
466) Möller, P., Kanal=Projekt Schwerin=Wismar.
Mit Karte, Zeichnungen
 ., Schwerin 1893.
., Schwerin 1893.
467) Grünberg, W., Wismar, Der Elbe=Ostsee=Kanal und seine wirthschaftliche Bedeutung. Bearbeitet und gedruckt im Auftrage des Elbe=Ostsee=Kanalbau=Vereins. Schwerin 1893.
468) Schregel, E., Der Elbe=Ostsee=Kanal. Vortrag. Bericht über die 19. ordentliche General=Versammlung des allgemeinen meklenburgischen Handels=Vereins 1893, S. 18-20. Rost. Ztg. 1893, Nr. 356.
469) Senator Brunnengräber=Schwerin berichtet im Schweriner Local=Handelsverein über eine Besichtigungsfahrt der Elbe=Stör=Kanal=Arbeiten. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 285.
470) Wasserbau=Inspector Sympher=Holtenau, Gutachten über das Kanalproject Wismar=Elbe. A. d. Meckl. Ztg. abgedr. Meckl. Nachr. 1893, Nr. 289.
471) Kanal Wismar=Schwerin=Dömitz. (Bericht über die Versammlung des Kanalbau=Vereins am 3. März 1894.) Rost. Ztg. 1894, Nr. 109.
472) Verhandlungen des Central=Vereins zur Hebung der deutschen Fluß= und Kanalschifffahrt über den Kanal Elbe=Ostsee (Wismar) am 9. Mai 1894. Mittheilungen u.s.w., Maiheft 1894, S. 139-145.


|
Seite 95 |




|
473) Grünberg, W., Wismar, Der Elbe=Ostsee=Kanal und seine wirthschaftliche Bedeutung. Vortrag, mit Uebersichtskarte, abgedr. Mittheilungen des Central=Vereins für Hebung der deutschen Fluß= und Kanalschifffahrt, Mai 1894, S. 160-165. (In der Anordnung des Materials verschieden von Nr. 467.)
474) Möller, Marine=Baumeister, Der Kanal Schweriner See=Wismar. (Der Elbe=Ostsee=Kanal und seine wirthschaftliche Bedeutung.) Vortrag mit Uebersichtskarten abgdr. a. a. O. (Nr 473), Maiheft 1894, S. 154-159.
475) Kropatscheck, Der Elbe=Ostsee=Kanal. Kreuzzeitung 1894, Nr. 38.
476) Kanalausflug vom Schweriner See zur Elbe. Kanalfahrt von Mitgliedern des Ostsee=Elbe=Kanal=Vereins am 23. und 24. Juli 1894. Meckl. Ztg. 1894, Nr. 343.
477) Staatsvertrag zwischen Lübeck und Preußen betr. den Bau des Elbe=Trave=Kanals vom 4. Juli 1893, Schlußprotokoll zu demselben und Denkschrift. - Vertrag zwischen Lübeck und dem Kreise Herzogthum Lauenburg, 10. Juli 1893. Lübeckische Anzeigen Nr. 48 (27. Jan. 1894).
478) Vom Elbe Trave=Kanal. (Betr. die von der meklenburgischen Regierung versagte Erlaubniß zur Wasserentnahme aus dem Schaalsee.) Meckl. Nachr. 1894, Nr. 37.
479) Die Entwürfe zu einem Elbe=Trave=Kanal. Sep.=Abdruck aus Nr. 84 des Meckl. Tagesblattes (1894?).
480) Schrader, Theodor, Dr., Zur Kritik von Kaiser Friedrich Barbarossas Privileg für Hamburg, 1189, Mai 7. Mittheilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte, Bd. VI, Heft 1, Nr. 7. - Auch Sonder=Abdruck. - (Bemerkungen zu dem von Hasse in Bd. 23 der Zeitschrift für schleswig holstein=lauenburgische Geschichte veröffentlichten Aufsatz gleichen Titels.)
481) Ehrenberg, R., Dr., Geschriebene Hamburger Zeitungen im 16. Jahrhundert. Mittheilungen des Vereins für hamburgische Geschichte, Bd. VI, Heft 1, Nr. 8.
482) Wohlwill, A., Dr., Hamburg während der Pestjahre 1712-14. Jahrbuch der Hamburger Wissenschaftlichen Anstalten, X, 2. Auch Separat=Abdruck. Hamburg 1893. (Ausführliche Mittheilungen über die Anordnungen der benachbarten Staaten, auch Meklenburgs, in Bezug auf den Verkehr mit Hamburg.)
483) Hasse, P., Dr., Die Anfänge Lübecks. Vortrag, gehalten bei der Feier des 750jährigen Bestehens. Lübeck 1893.
484) Techen, F., Dr., Die Grabsteine des Doms zu Lübeck. Zeitschrift des Vereins für Lüb. Geschichte und Alterthumskunde, Bd. VII, Heft 1. Lübeck 1894. Auch Separat=Abdruck.
485) Hanserecesse. 3. Abtheilung Hanserecesse von 1477-1530. Bearbeitet von D. Schäfer 5. Bd. Leipzig 1894.
486) Koppmann, K., Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256 bis 1490. Bd. VII. 1419-1425. Leipzig 1893.
487) Otto Blümcke, Berichte und Akten der Hansischen Gesandtschaft nach Moskau im Jahre 1603. Hansische Geschichtsquellen, Bd. 7. Halle 1894.
488) Bindel, Zum Andenken an Hermann Bonnus und die von ihm vor 350 Jahren vollzogene Einführung der Reformation in seiner Vaterstadt Quakenbrück. Quakenbrück 1893. (Bonnus war Superintendent in Lübeck.)


|
Seite 96 |




|
489) Hammer, Dr., Märkische Ortsnamen. Vortrag. Abgedr. Monatsschrift der Gesellschaft für Heimathskunde der Provinz Brandenburg. 1894, Juni.
490) Pyl., Theodor, Dr., Die Entwickelung des Pommerschen Wappens im Zusammenhang mit den Pommerschen Landestheilungen, nach den urkundlichen Quellen des Greifswalder Raths= und Universitäts=Archivs dargestellt. Pommersche Geschichtsdenkmäler, Bd. VII. Greifswald 1894.
491) Wiesener, W., Die Grenzen des Bisthums Cammin. Baltische Studien, Bd. 43, S. 117-127.
492) Wiesner, W., Eine Entdeckungsreise. Stralsunder Ztg. 1893, Sonntags=Beilage Nr. 39. (Werthvoller Beitrag zur Topographie des Klosters Neuenkamp.)
493) König Karls XII. eigenhändige Briefe. Gesammelt und herausgegeben von S. Carlton. Deutsch von R. Mevins. Berlin 1894.
494) Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Utgifna af kongl. vitterhets-historie och antiquitets-akademien. Senare afdelningen. Sjette bandet. Johan Baners bref 1624-1641. Stockholm 1893. (Mecklenburgica, s. Register.)
Zur Litteratur.
K. Bissinger, der Bronzefund von Ackenbach. Beilage zum Programm des Progymnasiums zu Donaueschingen. Karlsruhe 1893.
Die sorgfältige und gut ausgestattete Monographie behandelt einen Depotfund, welcher schon im Jahre 1821 gemacht, aber bisher wissenschaftlich noch nicht verwerthet ist. Derselbe stammt von Ackenbach in Baden (Kreis Constanz) und befindet sich zum größten Theile in der fürstlich Fürstenbergischen Sammlung in Donaueschingen. In einem großen, ziemlich rohen Thongefäße, wie es scheint, von "birnenförmiger" Gestalt, lagen "an die 100 Pfund" Bronze, meist verbogene oder zerbrochene Gegenstände und Gußklumpen. Die Gegenstände waren: Lanzenspitzen mit Schafttülle; Reste von Schwertern und Dolchen, zum Theil mit hohem Mittelgrate mit Griffdorn 1 ) oder breiten flachen Nieten; Sicheln; Bronzeäxte, die sog. "Celte" und zwar in drei Arten: Flach= oder Randcelte, Schaftcelte mit spitz abschließender Schaftöffnung oder Parallelleisten und Lappencelte; Streifen von Bronzeblech mit eingepunzten Verzierungen, Gürtel oder Besatzstücke; Zierscheiben; zwei Vogelgestalten zum Aufstecken, Reste von Ringen, darunter ein tordirter mit zurückgebogener Oese; zurück=


|
Seite 97 |




|
gebogener Oese; zusammengeschmolzene Bronzestücke, darunter eins mit einer größeren Zierscheibe.
Die Deutung des Fundes als des Vorrathes eines herumziehenden Händlers, der alte Bronzen zusammenkauft, um sie als Metall zu verwerthen, ist ohne Zweifel richtig, doch möchte ich nicht so scharf, wie der Verfasser Seite 17 und 18 zwischen Gußstättefund und Depotfund scheiden. Sicherlich waren es dieselben Personen, welche Bronzen zusammenkauften, zerbrochene reparierten und neue einfach herstellten; in den Meklenburgischen Funden analoger Art fehlen geflickte Stücke oder Gußformen selten. In der zeitlichen Stellung greift Verfasser zu hoch. Da nicht die ältesten, sondern die jüngsten Typen zu Grunde zu legen sind, müssen die Vogelfiguren und das Bronzeband als Zeitformen dienen. Diese weisen in die ältere Hallstadtzeit, eine Periode, welcher im Norden die fünfte nach Montelius entspricht und für welche dieser Gelehrte ca. 750 bis 550 annimmt.
Für die Meklenburgische Vorgeschichte sind Funde, wie der besprochene, von größter Bedeutung wegen der Analogien, welche unsere Funde bieten. Es ist bekannt, daß in den älteren Perioden der Bronzezeit der Norden eine eigenartige und glänzende Entwickelung aufzuweisen hat; in den jüngeren Perioden unterliegt er einer starken Beeinflussung von Südosten her, einer Strömung, welche man nach der berühmtesten Fundstelle kurz als "Hallstadtkultur" bezeichnet, wenn es auch klar ist, daß das entlegene Gebirgsstädtchen der Ausgangspunkt jener Bewegung nicht gewesen sein kann. In dieser Zeit haben wandernde Händler und Gießer den Norden wie den Süden bereist und die Reste ihrer Thätigkeit finden wir an den Alpen so gut wie an der Ostsee. Die in Schwerin aufbewahrten Funde von Holzendorf, Ruthen, Karbow, Gr.=Dratow (besprochen zuletzt Jahrbuch 1889, S. 109) ähneln dem Ackenbacher in Beziehung auf ihre Niederlegung, den Zustand der Gegenstande und diese selbst. Wir haben dieselben Lanzenspitzen, wie Fig. 1-5, z. B. in den Funden von Ruthen, Holzendorf und Glasin, wie Fig. 11 in einem Moorfunde von Woosten; Sicheln in sämmtlichen oben aufgezählten Funden; eine Vogelfigur wie Figur 32 und 33 auf einem Tutulus; Zierscheiben in Gr.=Dratow; Halsringe wie Figur 34 gehören zu den häufigsten Stücken der jüngeren Bronzezeit. Doch finden sich auch wesentliche Unterschiede; begreiflicher Weise ist von "Hallstädter" Einfluß in dem süddeutschen Funde mehr zu bemerken, als in den unseren; Blechstreifen wie Figur 13-18, Zierscheiben wie Figur 20 flgd. fehlen in Meklenburg gänzlich und Celte wie Figur 37 treten ganz vereinzelt auf. Gerade die Leistencelte des Fundes aber


|
Seite 98 |




|
sind von besonderer Bedeutung. Es geht daraus hervor, daß diese Celtform, welche man mit gutem Grunde als die älteste ansieht, bis in die Hallstadtzeit hineinreicht, sei es, daß sie immer in Gebrauch geblieben, sei es, daß sie in jüngeren Perioden, als sie lokal schon außer Gebrauch gekommen war, mit auswärtigen Importgegenständen neu eingeführt ist. Das letztere scheint mir nicht nur für den Ackenbacher Fund wahrscheinlich, sondern auch für einige Meklenburgische. In Funden von Glasin und Schwerin treten Leistencelte neben Lanzenspitzen mit Schaftöffnung auf, typologisch ganz verschiedenen Zeiten angehörend. Wir haben in dieser Zeit einen starken Import "ungarischer" Bronzen; damals werden auch Celte wie Hampel, Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn Tafel VII, Figur 1, eingeführt sein. Die weiteren Ausführungen bleiben einer anderen Stelle vorbehalten; es genüge heute, auch aus dem Actenbacher Funde den Schluß zu ziehen, daß der Leistencelt allein keine Leitform für die zeitliche Stellung eines bronzezeitlichen Fundes abgeben kann, wie er denn in der That den Verfasser der Abhandlung zu einer falschen Ansetzung geführt hat.
| Schwerin, Juli 1894. | Dr. Beltz. |
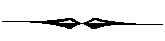
Schwerin, im August 1894.
Der zweite Sekretär:
F. v. Meyenn.
