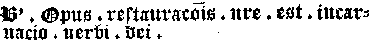|




|


|
|
|
-
Jahrbuch für Geschichte, Band 9, 1844
- Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme
- Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin
- Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow
- Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow
- Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen; mit Rückblick auf das frühere Verwandtschaftsverhältniß zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause
- Die Reichstags-Fahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im Jahre 1582
- Aberglauben in Meklenburg
-
Miscellen und Nachträge
- Canzler-Insignien im Mittelalter
- Gude manne
- Söldner im Mittelalter
- Nordische Verhandlungen im J. 1363
- Der Taufkessel zu Gadebusch
- Zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Kraak
- Der Ritter Friedrich Spedt
- Des Herzogs Johann Albrecht I. Reisen zum Kaiser
- Die Fürstl. Mekl. Apologia vom J. 1630
- Ueber den Charakter des Herzogs Christian I. Louis
- Urkunden-Sammlung
-
Jahrbuch für Alterthumskunde, Band 9, 1844
-
Chemische Analysen antiker Metalle aus
heidnischen Gräbern Meklenburgs
- Framea von Goldberg
- Handberge von Prislich
- Schwert von Tarnow
- Heftel mit zwei Spiralplatten
- Metallspiegel von Sparow
- Diadem von Wittenmoor
- Urne von Ruchow
- Framea von Satow
- Fingerring von Ruchow
- Fingerring von Friederichsruhe
- Krater von Groß-Kelle
- Commandostab von Hansdorf
- Beschlagring von Ludwigslust
- Armring von Ludwigslust
- Heftel mit Spiralfeder
- Heftel mit Spiralfeder von Camin
- Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier
- Heidnische Gräber bei Neu-Bukow an der Ostsee
- Heidnische Gräber zu Carow und Leisten
- Alterthümer in der Gegend von Gnoyen
- Alterthümer im Luche bei Fehrbellin
- Feuerstein-Manufactur bei Brunshaupten
- Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Nr. 1
- Hünengrab von Remlin, Nr. 2, Nr. 3
- Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz)
- Hünengrab von Roggow
- Hünengräber von Vietlübbe bei Plau
- Hünengrab von Lage
- Hünengrab von Püttelkow
- Kegelgrab von Peccatel
- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1, Nr.2.
- Kegelgrab von Retzow Nr. 3
- Kegelgräber und Begräbnißplatz zu Ganzlin bei Plau
- Kegelgrab von Grebbin
- Goldring von Bresegard bei Eldena
- Bronze-Schwert von Schmachthagen
- Bronze-Schwert von Kreien bei Lübz
- Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen
- Wendische Silbergeschmeide und Münzen aus der Gegend von Schwerin
- Wendischer Silberschmuck und wendische und altdeutsche Münzen von Remlin
- Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau
- Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow
- Römische Bronze-Vase von Vorland bei Grimmen
- Urnen aus der Lausitz
- Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden
- Henkelkrug von Böhlendorf
- Fingerring von Beckerwitz
- Schwert von Schwaan
- Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel
- Der Hart
- Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf
- Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe
- Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf
- Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg
- Blätter zur Geschichte der Kirche zu Doberan, niedergeschrieben in Doberan im August 1843 und revidirt in Doberan im September 1843
- Die Marien-Kirche zu Rostock
- Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow
- Die Glocke zu Westenbrügge
- Die Glocke zu Alt-Karin
- Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz
- Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen
- Denktafel in der Kirche zu Dambeck
- Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock
- Römische Münzen
- Der Münzfund von Remlin aus dem 10.-11. Jahrhundert
- Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
- Familie von Maltzan
- Geschlecht von Hobe
- Das Petschaft des letzten von Lübberstorf
- Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato
- Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter
- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506
- Manus Mortua, die Todte Hand, der blinkende Schein (Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94)
- Die Einziehung der Güter der Selbstmörder
- Strafe auf Kindesmord und Sodomie im 18. Jahrhundert
- Ein Horn eines Urochsen
-
Chemische Analysen antiker Metalle aus
heidnischen Gräbern Meklenburgs
- Jahresbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 8. Januar 1844
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, den 15. April 1844
Jahrbücher
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Arbeiten des Vereins
herausgegebenvon
G. C. F. Lisch,
großherzoglich=meklenburgischem
Archivar und Regierungs=Bibliothekar,
Aufseher der großherzoglichen Alterthümer=
und Münzensammlung zu Schwerin,
auch
Ehren= und correspondirendem
Mitgliede der geschichts= und
alterthumsforschenden Gesellschaften zu
Stettin, Halle, Kiel, Salzwedel, Voigtland,
Leipzig, Sinsheim, Berlin, Kopenhagen,
Hamburg, Breslau, Würzburg, Riga und
Leiden,
als
erstem Secretair des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Neunter Jahrgang.
Mit drei Steindrucktafeln und zwanzig Holzschnitten.
Mit angehängtem Jahresberichte
Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.
Schwerin, 1844.


|




|


|




|
Inhaltsanzeige.
| Vorwort. | ||||
| A. | Jahrbücher für Geschichte. | Seite. | ||
| I. | Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme, vom Pastor Boll zu Neu-Brandenburg | 1 | ||
| II. | Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin, vom Archivar Lisch zu Schwerin | 18 | ||
| III. | Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow, von demselben | 28 | ||
| IV. | Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow, von demselben | 97 | ||
| V. | Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen, von Werlauff, aus dem Dänischen übersetzt vom Gymnasial-Lehrer Masch zu Neu-Ruppin | 111 | ||
| VI. | Die Reichstagsfahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im J. 1582, vom Archiv-Registrator Glöckler zu Schwerin | 166 | ||
| VII. | Aberglauben in Meklenburg, vom Advocaten Dr. Beyer zu Parchim | 215 | ||
| VIII. | Miscellen und Nachträge, vom Archivar Lisch | 227 | ||
| 1) | Canzler-Insignien im Mittelalter | 227 | ||
| 2) | Ueber Gude Manne | 230 | ||
| 3) | Söldner im Mittelalter | 233 | ||
| 4) | Nordische Verhandlungen im J. 1363 | 233 | ||
| 5) | Der Taufkessel zu Gadebusch | 238 | ||
| 6) | Zur Geschichte der Comthurei Kraak | 238 | ||
| 7) | Der Ritter Friederich Spedt | 238 | ||
| 8) | Des Herzogs Joh. Albrecht I. Reisen zum Kaiser | 239 | ||
| 9) | Die Apologie vom J. 1630 | 241 | ||
| 10) | Ueber den Charakter des Herzogs Christian Louis | 244 | ||
| IX. | Urkunden-Sammlung, vom Archivar Lisch | 247 | ||
| 1) | Urkunden der Johanniter-Comthurei Nemerow | 249 | ||
| 2) | Urkunden zur Geschichte der Kirche zu Doberan | 289 | ||


|




|
| B. | Jahrbücher für Alterthumskunde. | ||||
| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne | ||||
| 1) | der vorchristlichen Zeit | Seite | |||
| a. | im Allgemeinen | 317 | |||
| b. | der Hünengräber | 362 | |||
| c. | der Kegelgräber | 369 | |||
| d. | der Wendengräber | 388 | |||
| e. | auswärtiger Völker | 393 | |||
| 2) | der unbestimmten Vorzeit | 394 | |||
| 3) | des Mittelalters | 396 | |||
| II. | Zur Ortskunde | 399 | |||
| III. | Zur Baukunde | ||||
| 1) | der vorchristlichen Zeit | 403 | |||
| 2) | des Mittelalters | ||||
| a. | weltlicher Bauwerke | 406 | |||
| b. | kirchlicher Bauwerke | 407 | |||
| 3) | der neuern Zeit | 457 | |||
| IV. | Zur Münzkunde | ||||
| 1) | der vorchristlichen Zeit | 460 | |||
| a. | auswärtiger Völker | 460 | |||
| b. | einheimischer Völker | 460 | |||
| 2) | des Mittelalters und der neuern Zeit | 467 | |||
| V. | Zur Geschlechter- und Wappenkunde | ||||
| 1) | zur Geschlechterkunde | 469 | |||
| 2) | zur Wappenkunde | 472 | |||
| VI. | Zur Sprachkunde | 473 | |||
| VII. | Zur Schriftenkunde | ||||
| 1) | der Urkunden | 475 | |||
| 2) | der Bücher | 478 | |||
| VIII. | Zur Buchdruckkunde | 480 | |||
| IX. | Zur Rechtskunde | 485 | |||
| X. | Zur Erd- und Naturkunde | 496 | |||


|




|
Vorwort.
N ach den Statuten und der Richtung des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde sollten die Jahrbücher des Vereins die wichtigeren Abhandlungen und Forschungen aufnehmen, der Jahresbericht aber über den Zustand und die Thätigkeit des Vereins, sowohl des Ausschusses, als der Mitglieder, im Allgemeinen Bericht erstatten. In den ersten Jahren, als die Bemühungen des Vereins sich noch auf ein kleineres Feld beschränkten und der Blick der Arbeiter noch nicht weit genug reichte, wurden einzelne, nothwendig erscheinende Erläuterungen den Berichten über die Thätigkeit der Mitglieder hinzugefügt. So wie sich aber im Fortschritte der Bestrebungen der ganze Stoff reicher gestaltete, in allen Theilen höhere Bedeutung gewann und unter den Händen selbst zur Wissenschaft ward, nahm auch der Jahresbericht, über seine Grenzen hinausschreitend, unwillkührlich mehr und mehr den Charakter der wissenschaftlichen Forschung an, welche sich oft unter den einfachen Berichten über Zustand und Thätigkeit verlor. Es konnte dadurch nicht vermieden werden, daß das wissenschaftliche Material häufig zerrissen und da versteckt ward, wo man es nicht suchte. Der Ausschuß des Vereins hatte schon längere Zeit diesem Uebelstande seine Aufmerksamkeit gewidmet, bis er


|




|
im vorigen Jahre, auf Antrag des zweiten Secretairs, beschloß, die Vereinsschriften auf ihre ursprüngliche Bestimmung zurückzuführen. Die Jahrbücher werden demnach fortan alle wissenschaftlichen Forschungen enthalten, und zwar, nach dem Namen des Vereins, in zwei Bücher vertheilt: in Jahrbücher für Geschichte und in Jahrbücher für Alterthumskunde; der Jahresbericht wird dagegen, mit Weglassung der Forschungen, über den Zustand und die gesammte Thätigkeit des Vereins den Mitgliedern berichten. Wird auch in den ersten Zeiten eine strenge Ordnung und Scheidung schwer durchzuführen sein und eine Wiederholung der Thatsachen sich nicht gut vermeiden lassen, so wird doch so viel erreicht werden, daß alle wissenschaftlichen Forschungen und wenn auch nur dem wissenschaftlichen Systeme nach bedeutsamen Ereignisse an Einer Stelle und nach Einem Plane zusammenkommen. Die Eröffnung aller Rubriken der Thätigkeit für Alterthumskunde möge den Mitgliedern Gelegenheit geben, dieselben fleißig mit Forschungen zu füllen.
Schwerin, im Julius 1844.
G. C. F. Lisch.


|




|



|


|
|
|
- Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme
- Ueber die wendischen Burgen Rostock und Kessin
- Geschichte der Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow
- Neuere Geschichte der Johanniter-Comthurei Mirow
- Sophia von Meklenburg, Königin von Dänemark und Norwegen; mit Rückblick auf das frühere Verwandtschaftsverhältniß zwischen dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause
- Die Reichstags-Fahrt des Herzogs Ulrich von Meklenburg im Jahre 1582
- Aberglauben in Meklenburg
-
Miscellen und Nachträge
- Canzler-Insignien im Mittelalter
- Gude manne
- Söldner im Mittelalter
- Nordische Verhandlungen im J. 1363
- Der Taufkessel zu Gadebusch
- Zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Kraak
- Der Ritter Friedrich Spedt
- Des Herzogs Johann Albrecht I. Reisen zum Kaiser
- Die Fürstl. Mekl. Apologia vom J. 1630
- Ueber den Charakter des Herzogs Christian I. Louis
- Urkunden-Sammlung
A.
Jahrbücher
für
Geschichte.


|




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
I.
Ueber
die Volkssprache der nordwestlichen
Slavenstämme,
von
F. Boll
,
Prediger zu Neu=Brandenburg.
S chon oft ist den Gelehrten, welche mit der älteren Geschichte der slavischen Länder zwischen der Oder und Elbe an der Ostsee sich beschäftigt haben, die Erscheinung aufgefallen, daß, nachdem in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Mecklenburg, in den anstoßenden Marken, zum Theil in Pommern und auf Rügen das Heidenthum mit Waffengewalt war ausgerottet worden, in verhältnißmäßig kurzer Zeit die slavische Nationalität fast spurlos verschwunden ist und diese Länder so vollständig germanisirt erscheinen, daß die deutsche Sprache, und zwar niedersassischen Dialekts, in ihnen die herrschende ist. Früher suchte man diese Erscheinung einerseits durch eine geflissentliche Vertreibung und Ausrottung der Slaven, andrerseits durch Einwanderung deutscher Colonisten in die verödeten Länder zu erklären. Wenn nun auch eine solche absichtliche Vertilgung der Slaven und Einführung deutscher Ansiedler durch urkundliche Zeugnisse und Nachrichten gleichzeitiger Schriftsteller für gewisse Gegenden mit historischer Sicherheit feststeht: so ist doch beides nicht in dem Grade und der Ausdehnung nachzuweisen, ja auch nicht einmal als wahrscheinlich anzunehmen, daß hieraus allein schon hinreichend es sich erklären ließe, wie in diesen Provinzen die slavische Sprache so schnell bis auf geringe Ueberbleibsel aussterben und der niedersassische Dialekt dafür allgemein gebräuchlich werden konnte.


|
Seite 2 |




|
Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, hat man in neueren Zeiten eine Hypothese aufgestellt, die sich allerdings dadurch sehr empfiehlt, daß sie diese Schwierigkeit sehr einfach löset. Man hat das ganze Slaventhum des ehemaligen Obersachsens und des ostelbischen Niedersachsens, so wie es gewöhnlich verstanden wird, mit zu den vielen Fabeln gehörig erklärt, die sich in unsern Geschichtsbüchern von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt haben. Am Ende der sogenannten Völkerwanderung, sagt man, war das Land zwischen der Oder und Elbe von dem deutschen Volksstamme der Warner bewohnt. Im 6. Jahrhunderte kamen zwar diese Länder (Holstein, Meklenburg, Vorpommern, die Chur=Mark u. s. w.) unter die Botmäßigkeit der sich ausbreitenden Sachsen, welche die Warner unterjochten. Als aber die Sachsen mit ihren westlichen Nachbaren, den Franken, in Kampf geriethen, waren sie nicht im Stande, ihre östlichen Eroberungen hinlänglich zu schützen und so konnten von jenseits der Oder her, besonders im 8. Jahrhunderte, die Slaven in die von den Warnern bewohnten Länder eindringen und sich zu Herren derselben machen. Seitdem standen die Länder an der Südseite der Ostsee bis mitten in Holstein hinein unter slavischer (wendischer) Herrschaft; die slavischen Fürsten und Edlen vertheilten den Grundbesitz unter sich; nur in einzelnen Gegenden wurden auch slavische Unfreie, - meistens nur Hirten und Fischer, - angesiedelt. Aber der Hauptstock der Bevölkerung, die uralten Landbauer, war und blieb echt germanisch und bewahrte deutsche Sitte, Recht und Sprache. Immer mehr neigten sich die slavischen Herren dem Volksthume der Unterthanen zu, und als endlich das Christenthum dauernd eingeführt ward und die meklenburgischen, rügenschen und pommerschen Fürsten Stände des deutschen Reichs geworden waren, verschwand in kurzer Zeit auch die letzte Spur des Slaventhums. - Demnach hätten wir uns im Wendenlande ein ähnliches Verhältniß zu denken, wie heutiges Tages in Kurland und Liefland stattfindet. Der Adel auf dem Lande und die Bürger in den Städten sprechen deutsch, denn sie stammen von eingedrungenen Deutschen; das unterjochte Landvolk aber spricht noch nach Jahrhunderten die Sprache seiner lettischen Vorfahren; im Verkehr mit demselben bedienen sich die Herren der Sprache ihrer Unterthanen, denn hierin muß sich der Einzelne nach der Menge richten. Gleicherweise wäre denn auch im Wendenlande zwischen der Oder und Elbe die Sprache der herrschenden Adelsgeschlechter zwar die slavische gewesen, ihre deutschen Unterthanen hätten aber ihre deutsche Sprache behalten;


|
Seite 3 |




|
natürlich müßten die slavischen Herren aber auch die deutsche Sprache gesprochen haben, denn sonst wäre eine Verständigung und Verkehr mit ihren Unterthanen unmöglich gewesen. Das rasche Verschwinden der slavischen Sprache nach Ausrottung des Heidenthums hätte dann in der That nichts Auffallendes mehr, denn nachdem mit dem Heidenthume auch die slavische Herrschaft gebrochen, wäre die deutsche Sprache nur in ihre alten Rechte wieder eingetreten.
Allerdings erklärt diese Hypothese die rasche Germanisirung des Wendenlandes auf eine leichte und genügende Weise. Das aber ist nach meiner Meinung auch Alles, was man von ihr rühmen kann. Allerdings ist es das Amt der Kritik, das Gebiet der Historie von Fabeln, die sich in den Geschichtsbüchern von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt haben, zu reinigen und aus dem Bereich der Geschichte wieder in das Gebiet der Mährchen zu verweisen. Aber es ist auch eben so sehr Pflicht der Kritik, das Gebiet der Geschichte von Hypothesen frei zu halten, welche vielfachen historischen Zeugnissen schnurstracks zuwider laufen.
Wir wollen uns nicht auf die mißliche Untersuchung über den Volksstamm der Warner und ihre Wohnsitze im Nord=Osten Deutschlands, so wie über ihr Verhältniß zu den Thüringern einlassen. Wir wollen auch nicht untersuchen, ob, als die Slaven von den Ländern zwischen der Oder und Elbe Besitz ergriffen, ein Theil der früheren deutschen Einwohner zurückgeblieben sei. Kann sein, kann auch nicht sein. Wer nein dazu sagt, hat wenigstens eben so viel Recht, als wer ja dazu spricht, denn an historischen Zeugnissen fehlt es so gut für das eine, wie für das andere. Das aber läßt sich durch genügende Zeugnisse gleichzeitiger und mit der Sachlage hinreichend bekannter Schriftsteller beweisen, daß, nachdem seit Karls d. Großen Eroberungszügen der Vorhang allmälig aufrollt, der bis dahin die Volksstämme zwischen der Elbe und Oder verbarg, bis zur Ausrottung des Heidenthums in diesen Ländern, die Muttersprache ihrer Einwohner ausschließlich die slavische war. Ich werde deßhalb zunächst diejenigen Beweisstellen beibringen, in denen von gleichzeitigen Geschichtschreibern den Volksstämmen zwischen der Oder und Elbe als ihre Sprache die slavische beigelegt wird. Damit man mir aber nicht einwende, daß sich diese Zeugnisse nur auf die Muttersprache der slavischen Herren bezöge, keineswegs aber dadurch bewiesen werde, daß nicht die Muttersprache ihrer Unterthanen fortwährend die deutsche geblieben sei: so werde ich Stellen in hinreichender Anzahl aufführen, aus denen unwiderleglich hervorgeht, daß die


|
Seite 4 |




|
deutsche Sprache in diesen Ländern jener Zeiten eine gänzlich fremde war und nicht verstanden wurde, vielmehr die slavische Sprache allgemein herrschende Volkssprache, sowohl der herrschenden edlen Geschlechter, als auch ihrer Unterthanen war.
1.
Meine Beweisführung beginne ich mit einer Stelle, in der man sonderbarer Weise eine Andeutung hat finden wollen, daß unter jenen in Ostdeutschland wohnenden Völkerschaften, obwohl wir sie zur slavischen Nation zu zählen pflegen, dennoch die deutsche Sprache die vorherrschende gewesen sei. Sie ist dem berühmtesten unter den ältern Geschichtsschreibern der Deutschen entlehnt, dem Einhard, aus der Lebensbeschreibung Karls d. Großen, der zuerst in die Länder am rechten Elbufer vordrang und die Volksstämme jener Gegenden seiner Botmäßigkeit unterwarf. Er zählt cap. 15. die Eroberungen auf, welche dieser Kaiser zum fränkischen Reiche hinzugefügt habe: Aquitanien, Wasconien, Spanien bis zum Ebro, dann ganz Italien, dann das große Sachsenland, dann Pannonien und die Länder südlich von der Donau bis zum Adriatischen Meere. Deinde, fährt er fort, omnes barbaras ac feras nationes, quae inter Renum ac Visulam fluvios, oceanumque ac Danubium positae, lingua quidem paene similes, moribus vero atque habitu valde dissimiles, Germaniam incolunt, ita perdomuit, ut eas tributarias efficeret. Inter quas fere praecipue sunt Welatabi, Sorabi, Aboditri, Boemanni - cum his namque bello conflixit - ; caeteras, quarum multo major est numerus, in deditionem suscepit. Offenbar versteht Einhard unter diesen barbaris ac feris nationibus slavische Stämme, und zwar nur sie allein, keinesweges aber begreift er deutsche Stämme mit darunter, denn die von Karl unterworfenen deutschen Stämme, die Sachsen, hatte er bereits erwähnt. Zwar ist in der Bestimmung "zwischen dem Rhein und der Weichsel" die Westgränze sehr ungenau angegeben, weil bis zum Rhein die Slaven sich niemals ausgedehnt haben, aber was ihn zu dieser vagen Bestimmung bewogen hat, ist nicht schwer einzusehn. Die Elbe konnte er nicht als Westgränze setzen, weil zu seiner Zeit die Slaven sich weit über diesen Strom hinaus dem Rheine zu erstreckten. Nicht allein die Sorben, die Böhmen wohnten noch westwärts der Elbe; auch die Gegend, wo später das Bisthum Bamberg entstand, war damals noch von Slaven bewohnt. Dadurch nun, daß er die Welataben (im östlichen Meklenburg und


|
Seite 5 |




|
Vorpommern), Sorben (zwischen Elbe und Saale), Abodriten (im westlichen Meklenburg) und Böhmen als die vornehmsten unter diesen Völkerschaften aufzählt, bezeichnet er sie hinlänglich deutlich genug als die slavische Nation. Von diesen Völkerschaften nun versichert er ausdrücklich: sie sind lingua paene similes. Kann unter dieser Sprache eine andere als die slavische gemeint sein? Wie es möglich gewesen ist, in dieser Stelle eine Andeutung zu finden, daß die deutsche Sprache damals unter diesen Völkerschaften die herrschende gewesen sei, ist mir freilich unbegreiflich. Denn die Erwähnung der Boemanni hätte doch sogleich jeden Gedanken an deutsche Sprache niederschlagen sollen. Es zeigt sich hier vielmehr deutlich, daß die neue Hypothese offenbar über ihr eignes Ziel hinausreicht. Denn was für die andern Stämme zwischen der Oder und Elbe geltend gemacht wird, müßte auch eben so sehr für die Böhmen gelten. Auch hier müßte der Hauptstock der Bevölkerung deutsche Sitte und Sprache bewahrt haben, und auch in Böhmen heutiges Tages deutsch statt slavisch gesprochen werden. Denn warum es sich mit Böhmen allein anders verhalten solle, ist ohne Beweis nicht füglich abzusehen.
Ein gleiches Zeugniß wie Einhard legen für die Herrschaft der slavischen Sprache im Wendenlande die beiden Männer ab, die unter allen Geschichtschreibern des Mittelalters mit den Volksstämmen dieser Gegenden am genauesten bekannt waren, ich meine Adam von Bremen und Helmold. Adam theilt uns in seiner Geschichte des Erzbisthums Hamburg, zu welchem die nördlichen Slaven bis gegen die Oder hin gehörten, sehr genaue Nachrichten über diese Volksstämme mit. An dem Orte, wo er am ausführlichsten von ihnen handelt, lib. II, cap. 10, schreibt er: nos autem, quoniam mentio Slavorum totiens incidit, non ab re arbitramur, si de natura et gentibus Slavaniae historico aliquid dicamus compendio, eo quod Slavi eo tempore studio pontificis nostri Adaldagi ad Christianam fere sint omnes religionem conversi. Slavania igitur amplissima Germaniae provincia a Winulis incolitur, qui olim dicti sunt Wandali, dec ies major esse dicitur, quam nostra Saxonia, praesertim si Boëmiam et eos, qui trans Oddoram sunt, Polanos, quia nec habitu, nec lingua discrepant, in partem adjeceris Slavaniae. - Wo ist nun hier eine Spur davon, daß der Haupttheil der Bevölkerung dieser Länder der deutschen Nation angehörte und deutsch redete? Es sind Wenden, in Sprache und Tracht nicht verschieden von den Böhmen und Polen, also die Sprache bei ihnen eben sowohl die slavische,


|
Seite 6 |




|
wie bei den Böhmen und Polen. Einhard erklärte zwar Sitten und Tracht unter den einzelnen Völkerschaften für sehr verschieden, nur in der Sprache seien sie sich fast ähnlich, durch welchen Ausdruck offenbar die dialektischen Verschiedenheiten bezeichnet werden. Was aber die abweichende Angabe über ihre Tracht bei Einhard und Adam betrifft, so müssen wir entweder annehmen, daß in den drittehalb Jahrhunderten, die zwischen beiden liegen, eine größere Ausgleichung in der Tracht unter den verschiedenen Stämmen stattgefunden habe, oder lieber, daß Adam die Verschiedenheit der Tracht bei den verschiedenen Stämmen nicht in Anschlag brachte, insofern der allgemeine Typus ihrer Tracht die Wenden von den Deutschen unterschied.
Die vollständigste Bestätigung erhält Adams Angabe durch Helmold, der eben zu der Zeit schrieb, als Herzog Heinrich der Löwe, Markgraf Albrecht der Bär und König Waldemar mit seinem streitbaren Bischof Absalon ihre vereinten Kräfte aufboten, um dem Heidenthum und der Freiheit der Slaven ein Ende zu machen, und der uns in seiner Slaven=Chronik eine ausführliche Schilderung dieses düstern Dramas hinterlassen hat. Er lebte unter einer slavischen Völkerschaft (in Wagrien), als schon Waffengewalt dem Christenthum bei derselben den Sieg verschafft hatte, und geflissentlich durch deutsche Colonisation das Slaventhum unterdrückt ward 1 ). Er entwirft zu Eingang seiner Chronik eine Uebersicht der slavischen Völkerschaften, meistens nur Adams Angaben wiederholend, zum Beweise, daß er ihre Richtigkeit anerkannte. Dani siquidem, schreibt er, ac Sueones, quos Northmannos vocamus, septentrionale littus (Baltici maris) et omnes in eo obtinent insulas. At littus australe Slavorum incolunt nationes, quorum ob oriente primi sunt Ruzi, deinde Poloni, habentes a septentrione Pruzos, ab austro Bojemos et eos, qui dicuntur Morahi sive Carinthi, atque Sorabi. Quod si adjeceris Ungariam in partem Slavoniae, ut quidam volunt, quia nec habitu nec lingua discrepat, eo us que latitudo Slavi cae linguae succrescit, ut paene careat aestimatione.


|
Seite 7 |




|
2.
Diese drei Auctoritäten, Einhard, Adam und Helmold, wären nun eigentlich hinreichend, um die Herrschaft der slavischen Sprache im Wendenlande zwischen der Oder und Elbe zu beweisen, denn sie legen den hier sitzenden Volksstämmen die slavische Sprache ohne alle Einschränkung bei. Wie hätten sie dieses thun dürfen, wenn der Hauptstock der Bevölkerung nur deutsch redete, und die deutsche Sprache deßhalb auch den slavischen Herren des Landes nicht fremd war!
Aber auch dafür, daß die deutsche Sprache im Wendenlande wirklich eine gänzlich fremde war und von der gesammten Bevölkerung nicht verstanden ward 1 ), die slavische Sprache dagegen die ausschließlich herrschende Muttersprache dieser Völkerschaften war, lassen sich Beweisstellen in genügender Anzahl aufführen.
Der Bischof Thietmar von Merseburg hatte seinen Sprengel in einer Gegend, deren Bewohner Slaven (Sorben) waren, die das Christenthum erst unlängst angenommen hatten. Er erzählt uns in seiner Chronik, lib. II, cap. 23, daß seinem Vorgänger im Amte, dem Bischof Boso, quiä in Oriente innumeram Christo plebem predicacione assidua et baptismate vendicavit, der Kaiser die Wahl zwischen 3 Bisthümern im Slavenlande gelassen habe, zwischen Meißen, Zeitz und Merseburg. Pre hiis omnibus, eo quod pacifica erat, Merseburgensem ab Augusto exposcens aecclesiam, quamdiu vixit, studiose eandem rexit. Hic ut sibi commissos eo facilius instrueret, Sclavonica scripserat verba, et eos Kirieleison cantare rogavit, exponens eis hujus utilitatem. Qui vecordes hoc in malum irrisorie mutabant Ukrivolsa, quod nostra lingua dicitur: Aeleri stat in frutectum; dicentes: sic locutus est Boso, cum ille aliter dixerit. Also auch in diesen Gegenden, in denen wenige Generationen später die deutsche Sprache die allein herrschende ist, war damals die slavische die Volkssprache, denn nicht deutsch, sondern slavisch hatte Boso geschrieben, um ihnen das Christenthum leichter zugänglich zu machen; nicht deutsch, sondern slavisch war die verspottende Verdrehung des Kyrieleison. Wie kam es, daß hier die slavische Sprache so rasch der deutschen wich, da eine gewaltsame Ausrottung der slavischen Nationalität in diesen Gegenden weder statt fand, noch nöthig war, weil keine gewaltsame Reactionen gegen die


|
Seite 8 |




|
Einführung des christlichen Kirchenthums seit jener Zeit unter ihnen mehr vorkamen? So viel ist wenigstens klar, durch jene neue Hypothese kann diese Erscheinung nicht erklärt werden. - Weiter erzählt Thietmar lib. VII, cap. 44, daß der Kaiser auf einem Feldzuge gegen Bolizlav von Polen im Jahre 1017 gekommen sei ad urbem Nemzi 1 ), eo quod a nostris olim sit condita dictam, wozu Herr Archivar Lappenberg, der Herausgeber des Thietmar in den Monumentis Germaniae die Anmerkung macht: vox Niemez Slavis est mutus sive peregrinus, qui eorum linguam non intelligit, ideoque praesertim Teutonicus, wie denn heutiges Tages noch die Russen mit diesem Namen die Deutschen bezeichnen. So hieß also eine Colonie, welche die Deutschen früher, wahrscheinlich auf einem ihrer Feldzüge gegen die Polen, als Grenzfeste, angelegt hatten. Wie paßt das zu der Hypothese, nach welcher der Hauptstock der Bevölkerung dieses Landes aus Deutschen bestand?
Zu den Zeiten Adams von Bremen herrschte Godschalk über die Abodriten und war ein vertrauter Freund seines Erzbischofs. Er hatte die sogenannten nördlichen Slavenstämme bis zur Peene seiner Herrschaft unterworfen und war eifrig bemüht, das Christenthum unter ihnen auszubreiten; bekannt ist es, daß er seinen Eifer für das Christenthum mit dem Märtyrertode büßte. Von ihm schreibt Adam lib. III, cap. 22: tanto religionis exarsit studio, ut ordinis sui oblitus, frequenter in ecclesia sermonem exhortationis ad populum fecerit, ea quae mystice (lateinisch) ab episcopis et presbyteris dicebantur, Slavanicis verbis cupiens reddere planiora 2 ). Wäre die, Hypothese richtig, nach welcher der Hauptstock der Bevölkerung deutsch sprach, hätte nicht auch Goldschalk in seinen Ermahnungen an das Volk sich der deutschen Sprache bedienen müssen? Geht nicht viel mehr klärlich aus dieser Stelle hervor, daß, weil Godschalk sich zu diesem Zwecke, um nämlich die Reden der Geistlichen dem Volke verständlich zu machen, der slavischen Sprache bediente, eben diese und nicht die deutsche die herrschende Volkssprache war?
Auch Helmold liefert uns für unsern Zweck sehr schlagende Beweisstellen. Er erzählt, lib. I, cap. 25, wie die nordalbingischen Sachsen, d. i. die Holsaten, Stormarn und Dietmarsen, dem slavischen Fürsten Buthue, Godschalks Sohn, der von seinen eigenen Landsleuten und Unterthanen unter Krukos An=


|
Seite 9 |




|
führung in Plön belagert ward, zu Hülfe zogen; cumque pervenissent ad rivulum, qui dicitur Suale, quique disterminat Saxones a Slavis, praemiserunt virum gnarum Slavi caelinguae, qui exploraret, quid Slavi agerent, aut qualiter expugnationi urbis instarent. - Lib. I, cap. 83 berichtet er, wie Bischof Gerold von Oldenburg das dortige Bisthum wieder herstellte, welches bei der Empörung unter Godschalk zerstört worden. Gerold beruft den Bruno, der früher den Vicelin bei seiner Bekehrung der Slaven begleitet, dorthin; eine Kirche zu Oldenburg wird wieder aufgebaut und im Beisein des Grafen Adolph von Schauenburg durch Gerold am Tage Johannis des Täufers 1156 eingeweiht. Et praecepit Comes populo Slavorum, ut transferrent mortuos suos tumulandos in atrium ecclesiae et ut convenirent in solennitatibus ad ecclesiam, audire verbum dei. Quibus et sacerdos dei Bruno juxta creditam sibi legationem sufficienter administravit verbum dei, habens sermones conscriptos verbis slavicis, quos populo pronunciaret opportune. - Wozu braucht man einen Kundschafter, welcher die slavische Sprache verstand, wenn das gemeine Volk deutsch sprach? Wie konnte Bruno seine Predigten dadurch dem Volke verständlich machen, daß er sie slavisch hielt, wenn die Muttersprache desselben die deutsche war?
Von außerordentlicher Wichtigkeit für die Kenntniß der nordöstlichen Slaven sind die Lebensbeschreibungen des Pommern=Apostels, Bischofs Otto von Bamberg, über deren Werth und Gebrauch ich mich hier zunächst etwas ausführlicher verbreiten muß. Mir sind diejenigen zugänglich, welche Ludewig im ersten Theile seiner Scriptorum rerum Germanicarum mitgetheilt hat. - Im Jahre 1487 verfaßte Andreas, Abt des Michaelisklosters zu Bamberg, eine Lebensbeschreibung Ottos. Er legte 2 Quellen dabei zu Grunde: 1) das Leben Ottos von dem Mönche Ebbo, der es nach der Erzählung des Priesters Udalrich aufgezeichnet hatte. Diesen Priester Udalrich hatte sich Otto schon, als er das erste Mal nach Pommern ging, zu seinem Begleiter erkoren, aber Udalrich erkrankte und mußte damals zurückbleiben. Allein als Otto 1128 seine zweite Reise nach Pommern unternahm, begleitete ihn Udalrich und spielte so zu sagen als Bekehrer der Pommern die zweite Rolle. 2) Einen Dialog zwischen Sefried oder Sifried und Tiemo, und wahrscheinlich von dem ersteren concipirt. Sefried begleitete den Otto auf Udalrichs Empfehlung als eine Art Cancellist auf beiden Reisen, und erzählt in diesem Dialog dem Tiemo ihre


|
Seite 10 |




|
Begegnisse im Pommerlande. - Diese beiden Quellen hat, wie gesagt, Andreas zum Grunde gelegt, indem er den Styl etwas besserte. Er war dazu von Johann Makarius, Guardian des Convents zu Bamberg, und dem Bischofe Benedict von Camin aufgefordert, und erklärt sich über die Abfassung seines Buches in 2 Zuschriften an diese Männer. Es heißt in der ersten: quia id mihi maxime fuit studii in opere isto, ut sententiam eandem verbis apertioribus proferrem, exceptis his, quae ob suam difficultatem et obscuritatem investigare penitus nequivi. In tantum autem, faciliora sequebar, ut, sicuti probari potest, alicubi eadem verba ponerem. Und in der zweiten: quocirca, beatissime pater, vobis placuit, bujusmodi onus mihi imponere, ut inter utrosque medius incedens etc. - Jener Dialog ist noch vorhanden und bei Ludewig pag. 632 seqq. abgedruckt; viele Capitel daraus hat Andreas fast wörtlich aufgenommen. Dasselbe hat er denn auch ohne Zweifel mit dem aus Udalrichs Erzählung entstandenen Werke Ebbos gethan, besonders da, wo Udalrich als mithandelnde Person der zuverlässigste Referent war, nämlich bei den Zurüstungen zur ersten Reise und über die zweite Reise. Diese wird vom 3ten Buche an mit Ebbos eigenen Worten erzählt, wie denn auch Ebbo auf dem Rande immer als Quelle angegeben ist. Das 3te Buch beginnt: cum infatigabilem domini ac patris nostri, pii Ottonis episcopi affectum, quo gloriam et cultum Christi non solum in Teutonicis, sed et in remotis barbarorum finibus euangelizando propagavit, assidua meditatione revolverem, nefas judicavi, tam laudabilia ejus gesta in fructuoso tegi silentio; unde non praesumptionis, sed potius intimae charitatis spiritu ductus, de secundo ejus apostolatu in Pomerania, sicut fidelis cooperator ejus Udalricus presbyter S. Aegidii mihi innotuit, scripto tradere curavi. Das können nicht des Andreas Worte, sondern nur Ebbos Worte sein. Ich werde also Zeugnisse von 2 Begleitern Ottos beibringen können, vom Sefried im Dialog und vom Udalrich in der nach seiner Erzählung von Ebbo aufgesetzten und vom Andreas seinem Buche einverleibten Lebensgeschichte Ottos.
Otto hatte, nachdem er seine Studien vollendet, längere Jahre in Polen zugebracht und dort die Landessprache erlernt: Dial. pag. 632: linguam quoque terrae illius apprehendit. Er ward hier Capellan des polnischen Herzogs Wladislav, der mit der Schwester Kaiser Heinrichs IV. verheirathet war, und ward oft zu Sendungen an den Kaiser gebraucht, der


|
Seite 11 |




|
ihn später ebenfalls als Capellan in seine Dienste nahm, und endlich zum Bischofe von Bamberg erhob. Als nun Bolislav, der seit 1102 seinem Vater Wladislav als Herzog von Polen gefolgt war, die Pommern besiegt hatte, wandte er sich an Otto mit der Aufforderung, sich der Bekehrung der Pommern zu unterziehen, weil unter den Geistlichen seines Landes keiner diese gefährliche Aufgabe übernehmen wollte (Dial. p. 653). Otto war bereit dazu, und sah sich nach passenden Begleitern bei dieser Unternehmung um. Er forderte den Udalrich dazu auf: Andreas pag. 465: ad quod praecipue te, frater compresbyter carissime, idoneum esse censeo necnon et Werinherum, sacerdotem de Erenbach, virum sapientia et pietate ornatum, Adelbertum quoque, linguae barbaricae sciolum, interpretem habere possumus. Udalrich schlug noch den Sifrid vor: Andreas p. 466: tunc Udalricus est, inquit, adolescens, officio clericus, nomine Sifridus, ingenio acutus, strenuus et fidelis, qui etiam chartis in itinere, cum necesse est, scribendis promptus et impiger erit. Hunc meo judicio idoneum huic peregrinationi, tuae, pater, dilectioni offero. - Man könnte nun fragen, wozu gebrauchte Otto einen interpres, wenn er selbst die slavische Sprache verstand? War sie ihm vielleicht in dem langen Zeitraume, seitdem er Polen verlassen, außer Uebung gekommen? Dieses muß der Fall gewesen sein, wenn es überhaupt mit seiner früheren Erlernung der slavischen Sprache viel auf sich hatte. Denn als Otto, vom Hauptmann Paulitius, den ihm der Polenherzog zum Schutze beigesellt, geleitet, am Ufer des Flusses, der die südliche Grenze Pommerns bildete, lagerte und ihm hier der Pommernherzog Wartizlav zu seiner Begrüßung entgegen kam, hatten beide eine geheime Unterredung in Beisein eines Dolmetschers: Episcopo antem et duce cum interprete et Paulitio seorsum in colloquio demorantibus etc., Dialog. p. 656. Erst später, bei seiner zweiten Anwesenheit in Pommern, scheint Otto die slavische Sprache wieder soweit in seiner Gewalt bekommen zu haben, daß er zu Stettin auf der Straße spielende Knaben sich grüßen und mit ihnen sich unterreden konnte, Dialog. p. 713. Auch scheint er seine Reden an das pommersche Volk in der klerikalischen, d. i. lateinischen Sprache, gehalten zu haben, denn es wird an mehreren Stellen erwähnt, daß er sich dabei eines Dolmetschers bedient habe. So bei seiner ersten Predigt an die Pommern, als er bei Piritz an 4000 Menschen zur Feier eines heidnischen Festes aus der Umgegend versammelt fand, Dialo. 6 9: d e loco editiori populum cupientem


|
Seite 12 |




|
ore alloquitur interpretis, ita dicens etc. Desgleichen, als Otto bei seiner zweiten Anwesenheit zu Stettin auf öffentlichem Markte von einer Stiege herab eine Anrede hält, um die Einwohner, die in das Heidenthum zurückgefallen waren, zu strafen, bedient er sich wieder eines Dolmetschers. Ein heidnischer Priester unterbricht ihn, Dialog. p. 712: dein clamore magno et verbis nescio quibus contumeliose prolatis, silentium mandat loquenti, suaeque vocis gras situdine magnum tonans, sermonem interpretis et episcopi pariter oppressit.
Um aber überhaupt dem Otto und seinen Begleitern (er trat schon diese erste Reise mit einer großen Gefolgschaft an, Dial. p. 653 und 654) ihr Unternehmen und namentlich den Verkehr mit den Pommern so viel als möglich zu erleichtern, hatte ihnen Boleslav, als sie bei ihm zu Gnesen eingetroffen waren, Begleiter mitgegeben, die sowohl slavisch, als deutsch sprachen, Dial. p. 655: Deditque domino meo de gente illa tam Sclavicae, quam Teutonicae linguae gnaros satellites ad diversa ejus ministeria, ne quid incommoditatis per linguae ignorantiam in gente extrema pateretur. . . . Tres etiam sacerdotes capellanos de latere suo princeps episcopo sociavit coadjutores verbi, et centurionem quendam nomine Paulitium, virum strenuum et catholicum, qui etiam naturali facundia idoneus esset concionari ad populum. Die Absicht Boleslavs kann nur gewesen sein, durch diese Dolmetscher zwischen Otto's Begleitern, die deutsch sprachen, und den Pommern, die slavisch sprachen, eine Verständigung möglich zu machen. Wäre die Hypothese richtig, nach welcher der Mehrtheil der Bevölkerung von den Pommern deutsch redete, diese Sprache also auch von den slavischen Herren wenigstens verstanden ward: so wären diese Dolmetscher ganz unnütz gewesen. - Auch in der Rede, die Otto zum Abschiede hielt, als er von Pyritz weiter zog, kommt eine Aeußerung vor, die in Bezug auf unsere Untersuchung sehr wichtig ist. Unde, heißt es im Dial. p. 665, adhortor vos et invito, quia cogere non debeo, ut de liberis vestris ad clericatum tradatis liberalibus studiis prius diligenter instructos, ut ipsi per vos, sicut aliae gentes, de lingua vestra latinitatis conscios possitis habere clericos et sacerdotes, d. h. sie sollen von ihren Kindern einige zum Klerikat bestimmen, damit sie ebenfalls, so wie die andern Völker, aus ihrer eigenen Sprache des Lateins kundige Priester haben. Hätte er dazu auffordern können,


|
Seite 13 |




|
wenn das eigentliche Volk nicht slavisch, sondern deutsch sprach? Hätte es dann Sinn gehabt, von ihnen zu verlangen, sie sollten sich aus ihrer eigenen Sprache Priester erziehen lassen, die Lateinisch verständen? Ich halte diese Stelle für eine der einleuchtendsten, um daraus zu beweisen, daß die slavische Sprache allein und ausschließlich die Muttersprache der Pommern war.
Als Otto zum zweiten Male in Pommern war, scheint er noch mit größerem Gefolge dorthin gegangen zu sein; dieses mal begleitete ihn auch Udalrich, und hatte nächst Otto die meisten Verdienste um die Bekehrung der Pommern. Jetzt kommen sogar 2 Dolmetscher vor, deren sich Otto bediente, nämlich außer Adelbert noch ein Priester Albinus. Andreas lib. III, cap. 4: affirmante domino Albino, interprete viri Dei, paganorum Luticensium adesse catervam. Ibid. cap. 6: Udalricus, religiosus presbyter S. Aegidii, et supradictus Albinus, interpres viri Dei, opulentissimam civitatem Hologast dictam adierunt. Vergleiche damit Dial. lib. III, cap. 4: contigit ergo Udalricum et Albuinum duos, presbiteros simul pergentes Hologastam intrare . . . . Albuinus Sclavicae linguae gnarus matronae adhuc ignoranti rem omnem secreto aperit etc., aus welcher Vergleichung deutlich hervorgeht, daß unter dem interpres ein der slavischen Sprache Kundiger zu verstehen sei. - Andreas, lib III, cap. 10, erzählt, wie Otto zu Chozegowa (Gützkow) im Beisein des Häuptlings des Ortes, mit Namen Mizlav, eine Kirche einweihte: his eum beatus pontifex verbis per interpretem suum Adelbertum postea episcopum allocutus est etc. Er fordert den Mizlav auf, seine Gefangenen loszugeben; dieser verspricht es und giebt auch einige Dänen los. Udalrich, der Asche zur Weihung des Altars sucht, findet an einem verborgenen Orte noch einen gefesselten Mann, et accersito interprete haec ab eo audivit, und weiter: Udalricus itaque assumpto interprete suo Adalberto de turba eduxit Mizlaum principem, et primum pacis Christi verbum salutans requirit, si omnes captivi ejus relaxati essent? quo dicente etiam Adalbertus interpres: cur fallere conaris Christum, qui falli non potest etc. - Ibid. cap. 12 wird erzählt, wie Udalrich zu Uznoim (Usedom) vom Otto Erlaubniß erhält, unter den Veranen auf Rügen das Christenthum zu predigen: Adalbertus autem viri Dei interpres tunc non aderat, sed postea haec addiscens, dominum episcopum omnino ab hac


|
Seite 14 |




|
intentione conabatur avertere. Udalrich hat in der Nacht vor seinem Aufbruch einen Traum, quod cum expergefactus Adalberto interpreti retulisset etc. Servus autem Dei nullo modo . . . a bono proposito revocari consensit, sed mane facto . . . . navi cum comitibus suis et interprete quodam Poloniense religioso viro impositus . . . . navigium est aggressus, muß aber, durch Sturm an der Ueberfahrt gehindert, sein Unternehmen aufgeben. Auch der Dialog lib. III, cap. 11, erwähnt, daß Adalbert das Beginnen Udalrichs gemißbilligt mit den Worten: Adalbertus autem interpres, cui maxime factum displicuerat etc. - Im folgenden cap. erzählt Ebbo (Andreas lib. III, cap. 13), wie Otto nach Stettin ziehen will, wo das Christenthum bei dem größten Theile der Einwohner dem Heidenthume wieder hatte Platz machen müssen, wie aber seine Begleiter ihn von diesem Unternehmen abzurathen suchen. Otto verläßt sie nun heimlich des Nachts, um sich allein nach Stettin zu begeben. Als aber am Morgen seine Entfernung von den Seinigen bemerkt wird, eilen sie ihm nach, und holen ihn zurück: illi pernici cursu eum insequuntur, primusque Adelbertus interpres eum comprehendens etc. Sie begeben sich darauf mit ihm zusammen nach der Stadt, und zunächst in die Kirche, die er bei seiner ersten Anwesenheit auf einem freien Platze vor dem Thore hatte bauen lassen (Dial. lib. III, cap. 13). Einige aus der Stadt erspähen ihn und rufen ihre Mitbürger zu den Waffen, um ihre Götter an Otto zu rächen: Quod famulus Dei cum per interpretem agnovisset, intrepidus ac calore fidei armatus crucis vexillum erexit etc. - Endlich wird noch Adalbertus interpres bei Ebbo erwähnt (Andreas lib. III, cap. 16), als Otto zu Stettin einen einem Götzen geweihten Nußbaum umhauen will. Der Besitzer des Grundstücks schlägt mit einer Streitaxt nach ihm, fehlt ihn aber: Quo viso Adelbertus interpres nimio terrore concussus perniciter frantiseam barbari manibus eripit etc.
Absichtlich habe ich alle diese Stellen 1 ) aus den Lebensbeschreibern Ottos gesammelt, weil sie meiner Ansicht nach keinen Zweifel darüber lassen, daß zu den Zeiten, als Otto den Pommern das Christenthum predigte, die slavische Sprache hier die ausschließliche Sprache des Volkes war. Grade für Pommern und Rügen hat es die meiste Schwierigkeit, die Ein=


|
Seite 15 |




|
führung der deutschen Sprache zu erklären, weil für diese Länder eine Colonisation durch Deutsche sich am wenigsten nachweisen läßt. Und doch muß eine solche angenommen werden, weil ohne dieselbe es nicht möglich gewesen wäre, daß auch hier so bald der niedersassische Dialect zur Herrschaft gelangte. Einzelne Beläge für die Colonisation durch Deutsche sind aber auch für diese Länder vorhanden. Dahin rechne ich die merkwürdige Urkunde bei Dreger Cod. diplom. No. 55 (Schröder's papistisches Mecklenburg, pag. 2911), die Uebereinkunft des Fürsten Wisicßlav von Rügen mit dem schweriner Bischofe wegen des Landes Tribsees. Zwar hat man grade diese Urkunde dazu benutzen wollen, um das Vorhanden sein einer deutschen Bevölkerung unter slavischer Herrschaft in Pommern daraus zu erhärten, aber dabei einen Umstand über sehen, der diese Auslegung unmöglich macht. Die in dieser Urkunde erwähnten Theutonici coloni sollen nicht deutsche Einwanderer, sondern die unter der slavischen Herrschaft im Lande seßhaften deutschen Bauern bedeuten. Nun heißt es aber in der Urkunde: "Praeterea dominus episcopus de collectura Slavorum, qui Biscopounizha dicitur, illorum videlicet qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt ex alia parte castri Tribuzes, tertiam partem decime pheodali jure mihi concessit. Illorum autem, qui adhuc cum Theutonicis resident, tota decima in usus cedet domini episcopi memorati. Si vero sinistro succedente casu, quod Deus avertat, terra pretaxata in pristinum fuerit statum reversa, ita quod Theutonicis expulsis recolere terram Slavi incipiant, censum, qui Biscopounizha dicitur, episcopo persolvant totaliter, sicut ante." Hier sollen die Slavi qui Theutonicis agros illos colentibus cesserunt die slavischen Herren sein, die vertrieben worden und deren Aecker nun ihren früheren unterthänigen deutschen Bauern zu Theil geworden; illi qui adhuc cum Theutonicis resident sollen die slavischen Herren bedeuten, die sich noch im Besitz ihrer Güter und ihrer Herrschaft über die deutschen Bauern erhalten haben. Wie paßt dazu aber der Schluß: "wenn aber durch unglückliche Umstände, was Gott verhüten möge, das vorbenannte Land in seinen alten Zustand zurückkehren sollte, so daß nach Vertreibung der Deutschen die Slaven wieder anfingen das Land zu bebauen" u. s. w.? Wenn nur die slavischen Herren die Zurückkehrenden wären, warum sollten dann die deutschen Bauern vertrieben werden? Sollten dann etwa die Herren mit höchsteigener Hand den


|
Seite 16 |




|
Acker bauen? Vielmehr geht aus diesen Worten deutlich hervor, daß durch Theutonici coloni eigentliche deutsche Colonisten, so wie unter Slavi die eigentliche slavische Bevölkerung zu verstehen sei. - Einen andern Belag geben zwei zusammengehörige Urkunden bei Ludewig script. rer. Germanic. Tom. I, p. 1130 vom Bischofe Sigfried von Kamin vom Jahre 1187 und seinem Nachfolger Sigwin, aus denen erhellt, daß damals schon ein großer Theil der Einwohner von Stettin aus Deutschen bestand, von denen doch bei den Lebensbeschreibern Ottos noch keine Spur zu finden ist. Ein gewisser Beringer in civitate Bambergensi bene natus, sed multo tempore in nostro castro Stetin honeste conversatus hatte mit Erlaubniß des Bischofs Conrad (von 1158-85) und des Herzogs Boguzlav eine Kirche außerhalb der Stadt erbaut. Idem vero Beringerus eandem ecclesiam assensu nostro et optimatum terrae nostrae pro salute animae suae coram eisdem optimatibus, multo populo Teutonicorum et Sclauorum coram posito, Deo et b. Michaeli archangelo in Bamberg obtulit etc., sie ward deshalb auch nach Sigwins Urkunde die ecclesia Teutonicorum genannt. - Mehr Beläge für Einführung deutscher Ansiedler in Pommern sind mir aus Urkunden nicht bekannt; doch gestehe ich auch gerne, daß ich mit den zur pommerschen Geschichte gehörigen Urkunden wenig vertraut bin. Nur so viel erinnere ich noch, das die ältern Geschichtschreiber Pommerns eine Colonisation des von Slaven entvölkerten Landes durch Deutsche unbedenklich annahmen.
Völlig nichtig ist endlich dasjenige, was man aus den deutschen Namen slavischer Orte u. s. w. zu Gunsten jener Hypothese hat argumentiren wollen; selbst die mächtige Slavenburg sagt man, von welcher späterhin das ganze Obotritenland benannt ward, Meklenburg, führt einen rein deutschen Namen. Aber es ist gar nicht ausgemacht, daß diese Orte bei den Slaven wirklich jene deutschen Namen geführt haben. Bei der mehrere Jahrhunderte hindurch bald feindlichen, bald friedlichen Berührung der Deutschen mit den Slaven hatten sich für Völkerschaften und Ortschaften Doppelnamen gebildet, die Slaven hatten ihre slavischen, die Deutschen ihre deutschen Namen. Beläge dafür sind in Menge vorhanden. Thietmar lib. I, 2: "provintiam, quam nos teutonice Deleminci vocamus, Sclavi autem Glomaci aappellant"; idem IV, 20: Stoderaniam, quae Hevellun dicitur. Coll. annal. Quedlinburg. ad annum 997: Zodoraniam, quam vulgo Heveldum vocant. Helmold nennt gewöhnlich den Hauptort des slavischen Landes Wagrien


|
Seite 17 |




|
Aldenburg, aber lib. I, 12 sagt er ausdrücklich: est autem Aldenburg ea , quae Slavica lingua Starigart, h. e. antiquar civitas, dicitur. Idem I, 58 in proximo oppido, quod Slavice Cuzalina, Teutonice Hagerestorp dicitur etc. Eine ähnliche Bewandtniß wird es denn auch wohl mit Meklenburg haben. Adam v. Bremen nennt sie bald mit dem lateinisch=griechischen Namen: lib. I, 11: deinde sequuntur Obodriti, qui altero nomine Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis; idem III, 22: in Magnopoli vero, quae est civitas Obodritorum, tres deo servientium dicuntur fuisse congregationes; idem lib. IV, 12: episcopus senex cum caeteris christianis in civitate Magnopoli servabatur ad triumphum, und bald darauf in demselben Capitel mit dem deutschen Namen: filia regis Danorum apud Michilinburg, civitatem Obodritorum, inventa etc. Auch Helmold schreibt abwechselnd Miklinburgk und Magnopolis. Wahrscheinlich war der slavische Name des Ortes: Miklegard, wie sie bei Opitz ad poet. anon. not. 9 (Frisch Lex. s. v. Michel) wirklich heißt, oder wenn Mikle nicht für slavisch gelten darf, Welikogard.


|
[ Seite 18 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Ueber
die wendischen Burgen Rostock
und Kessin,
von
G. C. F. Lisch.
S o viel auch über die wendische Burg (castrum, urbs) Rostock vermuthet und geschrieben ist, so wenig Kritisches und Zuverlässiges ist doch bisher über den Ort geliefert, welcher bald und rasch der bedeutendste in Meklenburg ward. An dem untern Laufe der Warnow, des bedeutendsten Flusses des Landes, lagen zur wendischen Zeit viele fürstliche Burgen und wichtige Ortschaften: Werle 1 ) beim Dorfe Wiek in der Nähe von Schwan, Kessin beim Dorfe Kessin in der Nähe von Rostock, Rostock, Goderak 2 ) bei Goorstorf am Breitling.
Gewöhnlich verlegt man die Stelle der alten wendischcn Burg oder Stadt Rostock auf die Höhe, auf welcher die Petri=Kirche steht. Dagegen läßt sich aber mit Recht sagen, daß die Stelle durchaus nicht den Charakter einer wendischen Feste trägt; die Höhe des Petrikirchhofes ist gewissermaßen das höchste Vorgebirge einer großen natürlichen Hochebene mit festem Boden, welches an der Ausbreitung der Warnow am Petrithore schroff und tief in die Flußniederung abfällt. Nur an dieser Seite ist die Höhe von Natur fest; landeinwärts hängt sie, wenn auch durch das ziemlich tiefe Thal der Grube von der Neustadt geschieden, doch mit dem festen Boden der landeinwärts liegenden Hochebene zusammen. Wäre diese Stelle eine wendische Burg gewesen, so würde sie für jene Zeit ganz


|
Seite 19 |




|
ungewöhnlicher Befestigungsmittel bedurft haben und sehr bedeutend gewesen sein; Rostock nimmt aber unter den fürstlichen Burgen die letzte Stelle ein, denn Kessin war in diesen Gegenden die wichtigste Feste, welche damals dem ganzen Landestheile den Namen und den Landesfürsten den Titel gab.
Die wendischen Burgen lagen dagegen immer in tiefen Sümpfen, Morästen oder Wiesen 1 ) oder waren von tiefen Wiesen her in Seen hinaus gebauet. Diese Burgen waren aufgeschüttete, gewöhnlich länglich=viereckige Wälle, deren Hauptbefestigungsmittel die Lage im Sumpfe war. Diese Burgwälle sanken mit der Zeit immer tiefer in den Sumpf hinein und bedurften fortwährender Ausschüttung und Erhöhung; daher war der in den wendischen Ländern übliche Unterthanendienst des Burg= und Brückenbaues bei weitem der wichtigste, daher er auch am häufigsten genannt wird. Es gingen ohne Zweifel Jahrhunderte darauf hin, ehe ein großer Burgwall fest stand und hoch genug war; es giebt Fälle, daß man Menschenalter hindurch an Legung von Dämmen durch tiefe Wiesen gearbeitet hat, die oft in ganz kurzer Zeit wieder so sehr versunken sind, daß man sie in einer Tiefe von 30 Fuß noch nicht hat wiederfinden können. Aber in Sümpfen lagen alle wendischen Festen, und daher müssen wir auch die wendische Burg Rostock in einem Sumpfe suchen.
Bei der Untersuchung sind jedoch für die alte Burg Rostock mehrere Perioden anzunehmen, welche sie durchmachen mußte, ehe die jetzige Stadt Rostock vollendet war.
Diesen Sumpf, in welchem die alte Burg Rostock gelegen haben kann, finden wir nun allerdings am Petrithore, jedoch vor demselben, am rechten Ufer der Warnow der Höhe der Petrikirche gegenüber. Hier breiten sich am rechten Warnowufer der ganzen Ausdehnung der Stadt Rostock gegenüber sehr weite, tiefe Wiesen aus, welche fast immer wässerig sind und welche so große Ausdehnung haben, daß sie von den Uferhöhen der Stadt Rostock von einer und der Dörfer Bartelsdorf und Riekdahl von der anderen Seite mit den Angriffsmitteln der alten Zeit nicht beherrscht werden konnten. Durch diese Wiesen geht vom Petrithore der künstliche Damm zur Landstraße nach Ribnitz, welcher wohl erst seit Gründung der neuen Stadt gelegt ist. Rechts an diesem Damme entlang, in kurzer Entfernung von demselben, von Rostock aus, liegen in dem Wiesengrunde mehrere aufgeschüttete Wälle, welche


|
Seite 20 |




|
jetzt zwar sehr versunken, aber wohl ohne Zweifel die Stelle der ältesten Burg und Stadt Rostock sind; sie sind mit den Höfen mehrerer Ackerwirthe besetzt, welche jetzt einen Theil der Petri=Vorstadt bilden. Im Ganzen sind es drei aufgeschüttete Wälle, von denen die Bleiche der Warnow, der Stadt und der Petrithorbrücke am nächsten ist. Von der Petrithorbrücke führt nämlich am rechten Ufer der Warnow ein schmaler Damm zu einem viereckigen Plateau, auf welchem jetzt die Bleiche ist. Hinter diesem Plateau liegt an der Landstraße entlang ein zweites, und hinter diesem ein drittes, welches noch jetzt den Namen "Wik" führt. Diese drei Wälle sind jetzt nur einige Fuß hoch, aber für wendische Burgwälle weit genug und haben sehr viel Schutt und Scherben; die Bewohner versicheren, daß sie zuweilen bei Urbarmachung des Landes, welches ihr Erbe ist, an manchen Stellen auf große Scherbenlager gestoßen seien und ganze Fuder Scherben fortgefahren hätten. Während der Local=Untersuchung hat es jedoch nicht gelingen wollen, Scherben aus der heidnischen Zeit aufzufinden, da man tief graben muß, indem diese Stellen seit Einführung des Christenthums bewohnt gewesen, also immerfort erhöhet worden sind.
Stadtwärts wird diese Wallreihe an der Bleiche von der Warnow begrenzt nördlich von dem Damme der Landstraße nach Ribnitz und an der entgegengesetzten Seite von einem kleinen Flusse, der jetzt sehr versumpft, jedoch breit genug ist und in alten Zeiten tief genug gewesen sein mag, um nicht zu kleine Fahrzeuge zu tragen; dieser Fluß heißt noch jetzt der "Witingstrang", kommt von den Höhen von Bartelsdorf und Rikdahl und ergießt sich bei der Bleiche in die Warnow.
Außer diesen Wällen ist in den Warnow=Wiesen in der Nähe von Rostock keine Aufschüttung zu entdecken. Daß aber diese Sumpfinseln am Witingstrang vor dem Petrithore die Stellen der alten Burg Rostock seien, dafür redet auch die Geschichte.
Die wendische Burg Rostock kommt im J. 1161 zuerst in der Geschichte vor. Saxo erzählt 1 ) nämlich: der Dänenkönig Waldemar habe auf seinen Verheerungszügen im


|
Seite 21 |




|
Wendenlande die Burg (urbem) Rostock, welche er von den Einwohnern feige verlassen gefunden habe, so wie das Götzenbild daselbst verbrannt; Saxo sagt dabei ausdrücklich, daß die Gegend sumpfig gewesen, und fügt hinzu, daß eine Brücke über den Fluß geschlagen worden sei. Es geht aus dieser Beschreibung hervor, daß Rostock in einer sumpfigen Gegend an der Warnow und zwar an der Oberwarnow vor der Erweiterung des Flußbettes gelegen habe, und daß an dem andern Ufer festes Land gewesen sei, weil eine Brücke die Stadt Rostock mit dem Heere Heinrichs des Löwen, der zu Lande angekommen war, vereinigte.
Nachdem Pribislav sich in den neuen Zustand der Dinge gefügt hatte, baute er im J. 1170 die Burgen Meklenburg Ilow und Rostock wieder auf und besetzte sie mit Wenden 1 ). Nach dem Tode Pribislavs erhielt dessen Sohn Borwin während der durch seinen Vetter Niclot erregten Unruhen, im J. 1183 die Burgen Rostock und Meklenburg 2 ). Nach Herstellung des Friedens trat Borwin dem Niclot Rostock ab 3 ) und begnügte sich mit dem westlichen Landestheile, welches er von den Burgen Meklenburg und Ilow regierte. Und wirklich sehen wir den "Wendenfürsten" Niclot oder Nicolaus in Urkunden von Rostock aus regieren, indem er dem im J. 1186 von Borwin wieder hergestellten Kloster Doberan im J. 1190 mehrere Begünstigungen ertheilte. Die beiden bekannten Urkunden 4 ) hierüber sind von Rostock aus datirt; der Fürst hielt damals Märkte in Rostock, hatte zu Rostock und noch zu Goderac Kapellane, jedoch kommen noch keine Pfarrer vor.
Wahrscheinlich ist bis hierher die Burg Rostock noch immer die alte wendische Burg in den Wiesen, da nur von der Wiederaufbauung des alten Rostocks und überhaupt nur von wendischen Verhältnissen die Rede ist. Auch Borwin bedauerte die alten Burgplätze wieder, und Städte neuern Styls waren noch nicht gegründet.
Hiemit stimmt auch die bei Kirchberg aufbewahrte Tradition einigermaßen überein, indem er sagt, die Burg Rostock sei wieder aufgebauet gegen die Burgmänner,


|
Seite 22 |




|
welche auf der Höhe der Petri=Kirche eine Burg gehabt hätten:
In der czid der furste alsus
von Kyssin Nycolaus
Rodestok irnuwete,
daz borgwal her do buwete,
daz waz wider dy borgman da,
den buwete her syne borg zu na,
dy hattin eyne burg zu der czid,
da sante Petirs kirche lyd,
doch kunden sy mit keynre schicht
des buwes ym weren nicht.
Kirchberg CIII.
Man könnte annehmen, daß Kirchberg unter "borgwal" nicht den alten wendischen Burgwall in der Wiese, sondern den noch jetzt als Straße so genannten "Borgwall" bei der Marienkirche, mitten in der jetzigen Stadt, also an der entgegengesetzten Seite der Petri=Kirche, verstanden habe. Dies ist allerdings auch möglich; aber dann bleibt doch so viel gewiß, daß auch die Anlage der Burgmänner auf dem Berge der Petri=Kirche eben so ein junger Bau war, als des Fürsten Burg auf dem "Borgwall".
Die deutsche Stadt Rostock ward erst am 24. Junii 1218 gegründet 1 ). Der alte Borwin zog sich seit dieser Zeit zurück und gönnte seinen Söhnen, von denen Heinrich, Borwin II, Herr von Rostock ward, thätigen Antheil an der Landesregierung. Seit dieser Zeit nennen sich die Fürsten: Herren von Rostock; aber noch im J. 1218 nannte sich der alte Borwin Herr der Kissiner (Magnopolitanorum et Kyzenorum princeps).
Diese neu gegründete Stadt Rostock ist die jetzige Altstadt, der alten Burg Rostock gegenüber, auf der Höhe um die Petri=Kirche. Ob Borwin innerhalb dieser Stadt sich eine Burg erbauet habe, ist nicht zu bestimmen; die alte Sage weiset ihr die Stelle bei S. Petri an; aber diese Sage ist durch nichts begründet und hat wohl darin ihre Veranlassung, daß man die alte wendische Burg auf diese Höhe versetzen zu müssen meinte, weil man keine andere Stelle dafür finden konnte. Es ist freilich wahrscheinlich, daß die Fürsten, wie seit dem Durchdringen der neuern Bildung alle Bewohner des Landes, sich aus den Sümpfen entfernten und ihre Burgen nach


|
Seite 23 |




|
deutscher Weise erbaueten; aber es ist auch eben so wahrscheinlich, daß sie die Burg von Rostock, wie an andern Orten, dicht vor die Stadt setzten. Daher mag denn die älteste deutsche Burg bei der Marien=Kirche gestanden haben; denn hier trägt eine Straße auf der Höhe noch den Namen " auf dem Burgwall", wo nach dem Vorstehenden vielleicht schon Nicolaus eine Feste gegen seine Burgmänner anlegte. Doch fanden auch hier die Fürsten nicht lange Ruhe. Die Neustadt wuchs so schnell und mächtig, daß schon am 18. Junius 1262 die Alt= und Neustadt zu Einer Verwaltung vereinigt 1 ) wurden. Durch die Vollendung der Stadt kam der Burgwall mitten in der Stadt zu liegen. Der Fürst Borwin III. von Rostock hatte es zwar versucht, am bramower Thore am äußersten Ende der Neustadt, eine Burg anzulegen. Aber am 27. October 1266 mußte sich sein Sohn Waldemar verpflichten, diesen Burgwall wieder abzutragen 2 ); ja im J. 1278 gab er sogar das Versprechen, eine Meile weit keine Burg anzulegen, und verkaufte die bei Schmerle gelegene Hundsburg an die Stadt 3 ). Wie zu Wismar, wollten die Bürger Rostocks keine feste Fürstenburg auf ihrem Gebiete dulden; im ganzen Mittelalter ist daher von einem Schlosse zu Rostock nicht die Rede. Wahrscheinlich hatten die Fürsten zu Rostock, wie zu Wismar, nur einen Hof zu Stadtrecht, welcher vermuthlich beim Johanniskloster in der Nähe des Steinthores lag 4 ), da hier auf einer Abbildung der Stadt aus dem 16. Jahrh. ein großes Prachthaus mit vielen fürstlichen Wappen abgebildet ist und die Unternehmungen der Fürsten gegen Rostock im 16. Jahrh. sich häufig um die Localitäten am Steinthore drehen.
Nach dieser geschichtlichen Entwickelung werden wir also den Wall der alten wendischen Burg Rostock in den Wieseninseln vor dem Petrithore zu suchen haben. Und hierfür reden außerdem noch besondere Urkunden.
Als im J. 1264 die Stadt abgebrannt war, schenkte der Fürst Borwin den Bürgern die freie Mühlenfuhr und außerdem:
den fürstlichen Besitz auf dem Bruche zwischen dem festen Lande und der Warnow auf der einen, und dem St. Clemens=Damme


|
Seite 24 |




|
und dem bartelsdorfer Flusse auf der anderen Seite 1 ).
Dies sind wohl der Fischer= und der Gärberbruch (brôk) außerhalb der Stadtmauer an der linken Seite der Warnow, zwischen dem Mühlen= und dem Petri=Thore.
Durch die Bestimmung der Lage zwischen dem festen Lande und der Warnow ist die Breite des Landstriches angegeben. Durch die andere Bestimmung: vom St. Clemens=Damme bis zum bartelsdorfer Flusse, wird wohl die Länge bezeichnet: von dem Damme vom Mühlenthore zum Fischerbruche bis zur Mündung des Witingstranges gegenüber. Denn die letztere Bezeichnung von den dem Bruche am rechten Warnowufer gegenüberliegenden Wiesen, unmittelbar am Witingstrang, zu verstehen, dazu ist kein Grund vorhanden.
Es geht aus dieser Verleihung hervor, daß die Fürsten ihren alten Besitz in der Nähe ihrer alten Burg noch lange festzuhalten suchten, ja selbst dann noch, als sie im J. 1266 den Burgwall am Bramower Thor wieder abzutragen sich verwillkührten. Denn erst am 27. Febr. 1286 verkaufte der Fürst Nicolaus der Stadt
sein Dorf Wendisch=Wik mit den angrenzenden Wiesen und den Burgwall mit der angrenzenden Wiese, bis zum Mühlendamme 2 ),
d. h. den Wiesen an dem rechten Warnow=Ufer von der Bleiche (dem Burgwall) am Petrithore bis zum Mühlendamme am Mühlenthore.
Durch diese beiden Urkunden veräußerten die Landesherren ihren ganzen aus der wendischen Zeit stammenden Besitz zu Rostock.
Das Wort palus ist niederdeutsch: Brôk (Bruch), wie noch heute die Gegend heißt. Der bartelsdorfer Fluß ist der Witingstrang, der an der Wik vorbeifließt. Der St. Clemens=Damm muß der Mühlendamm sein oder in der Nähe desselben gelegen haben, vielleicht der Damm, der zum Brôk führte."Ceterum in palude quicquid ad nos pertinere videtur, iacento inter aridam et fluuium ex una parte, et inter aggerem sancti Clementis etamnem, qui decurritab amne (?) Bartoldes dorfie ex parte altera eorundem (burgensium ciuitatis Rostoc) vsibus assignamus."
"Notum esse uolumus, - - nos dilectis nobis burgensibus de Rozstock - - villam nostram Wendischwic cum omni utilitate, proprietate, iudicio, cum pratis adiacentibus vendidisse, vallem castri insuper cum prato adiacente et ad dammonem molendinorum ascendente, cum aliis eorum pascuis, pratis et aquis infra dictos terminos constitutis, - - libere perpetuo possidendum."


|
Seite 25 |




|
Es leidet also durchaus keinen Zweifel, daß
die alte wendische Burg Rostock an dem rechten Ufer der Warnow rechts vor dem Petrithore an der Stelle der jetzigen Bleiche, zwischen der Warnow und dem Dorfe Wendisch=Wik, beide am bartelsdorfer Flusse oder dem Witingstrang gelegen,
zu suchen sei.
Der Fluß führt jedenfalls einen bezeichnenden Namen. Alle anwohnenden Ackerleute nennen ihn "Witingstrang", genau wie hier geschrieben steht: in der Mitte ist nach dem -g- nur Ein -s- zu hören und am Ende ein -g; auch sprechen die Leute den dritten Buchstaben jetzt deutlich wie ein -t-. Es liegt nun nahe, wenn man diesen Namen hört, an Wikings=Strand, Strang oder Strom zu denken und an die Seeräuber= oder Wikings 1 ) =Züge zur Zeit der Dänen und Wenden.
Eine besondere Unterstützung giebt dieser Untersuchung das Dorf Wendisch=Wik, da dieses noch mit gartenbauenden Eigenthümern am Ende der Petri=Vorstadt unter dem Namen "de Wik" existirt. Seit dem Ankaufe des Dorfes führte die Stadt über die Verwaltung desselben besondere Rechnungen 2 ),
"Anno domini MCCCXXV infra octavas pasche iste liber inceptus est de redditibus, quos habet annuatim in pratis versus Warnemunde et de agris, qui Wich in vulgo dicuntur, et de ortis singulis.
Civitas locauit antiquo Rever carnifici quoddam spacium agrorum supra Wich, ubi quondam fuerat locus ville, pro quinque marcis denariorom.
Civitas locauit Johanni Beschalow pratum foris valvam sancti Petri secus dammonem pro XI marcis.
Notandum sit, quod civitas redemit a Hinrico de Dulmen octo marcarum redditus, quos habuit in ortis ciuitatis extra portam sancti Petri et in ortis supra Wich sitis; memorandum, quod ciuitas habet extra valuam sancti Petri quadraginta iugera ortorum cum dimidio iugero in vno tramite secus dinstinctionem ville Derckowe situata.
Ciuitas liberauit pratum situm snper Wych iuxta pratum Boltonis ad usus suos perpetuo disponendum.
Viceman ortulanus dabit ciuitati duarum marcarum redditus de quodam agro supra Wich iuxta pratum secus dammonem."


|
Seite 26 |




|
welche die angegebene Lage noch mehr bestätigen, indem sie genau und ausdrücklich angeben, daß das Dorf vor dem Petrithore am Damme in der Wiese gelegen habe. Im J. 1325 existirte das Dorf nicht mehr.
Auffallend ist es, daß die alten Wohnstätten neben den wendischen Fürstenburgen nach deren Untergange den Namen Wik tragen. So liegt z. B. unmittelbar neben dem alten Burgwalle von Werle auch ein Dorf, jetzt Hof Wik 1 ). Dies waren gewiß die alten "Orte des Verkehrs" oder die "Städte" neben den Burgen 2 ).
Die alten wendischen Wohnstellen in den Sümpfen wurden nach Anlegung der deutschen Städte zuerst gewöhnlich noch von Wenden bewohnt; daher heißt noch heute ein zu den Wiesen und der Warnow führendes Thor Rostocks: das wendische Thor.
Man kann sich also die Verhältnisse der Lage so denken:
das Plateau rechts vor dem Petrithore, wo jetzt die Bleiche ist, unmittelbar an der Warnow, ist die alte wendische Burg Rostock;
das dahinter am Petri=Damm liegende Plateau gehörte noch zur Burgstätte (Vorburg);
das dahinter liegende dritte Plateau zwischen dem Petri=Damm und dem einst für kleinere Fahrzeuge schiffbaren Flusse Witingstrang war die alte wendische Stadt Rostock 3 ) oder das spätere Dorf Wendisch=Wik.
Vermuthlich ist der Ausdruck nordischen Ursprungs: vik=Bucht, Hafen; - vielleicht rein deutschen Ursprunges, da althochdeutsch wich=Dorf (vicus) heißt; vgl. Graffs Ahd. Sprachschatz.


|
Seite 27 |




|
Die wendische Burg Kessin
hat sich bei einer Untersuchung nicht finden wollen. Bei dem Dorfe Kessin, unweit Rostock, treten die Höhen hoch, steil und zerrissen weit in das Warnow=Thal hinein. Wahrscheinlich ist die Burgstätte in dem Dorfe untergegangen und in diesem Falle schwer und nur durch fortgesetzte Aufmerksamkeit zu finden.


|
[ Seite 28 ] |




|



|


|
|
:
|
III.
Geschichte
der
Johanniter=Comthureien Nemerow
und Gardow,
von
G. C. F. Lisch.
D ie Wirksamkeit des Johanniter=Ordens ist für die Cultivirung Meklenburgs von bedeutendem Einflusse gewesen; seine Wirksamkeit äußert sich in ritterlicher Kriegshülfe, verständiger Benutzung des Bodens und höherer Pflege des Gottesdienstes; zu allem diesen mochten die Ritter, die in fremden Ländern Erfahrungen gesammelt hatten, vorzüglich befähigt sein, und neben dem Cistercienser=Orden dürfte der Johanniter=Orden im Mittelalter die größten Verdienste um die Germanisirung unsers Vaterlandes haben.
Nach dem Tode Pribislavs (1178) erhob sich das Volk der Wenden wieder in Aufruhr und unterdrückte auf lange Zeit die mühsam gelegten Keime der Cultur; sicher bis zum J. 1216 lag fast das ganze Land in wüster Verwirrung und selbst die reich fundirten Cistercienser=Mönchsklöster Doberan und Dargun krankten oder standen öde. Nur das Bisthum Schwerin fristete unter dem Schutze der Grafen von Schwerin ein beengtes Dasein. Hierher wandten sich auch die Johanniter zuerst, indem sie im J. 1200 die Comthurei Kraak und die Priorei Eixen stifteten 1 ). Den friedlichen Bemühungen des alternden Borwins, welche in der aufblühenden Kraft seines Sohnes Heinrich Borwin eine kräftige Stütze fanden, gelang es , die Keime zum Wachsthum zu bringen: der Friede ward nach langem Kampfe hergestellt und die Kirche durch zahl=


|
Seite 29 |




|
reiche, wichtige Stiftungen gesichert. Während dieser Bestrebungen ward auch die Comthurei Mirow gegründet 1 ), welche nach der Schlacht bei Bornhövd (1227, in welcher wahrscheinlich die Ritter sich Ansprüche auf die Dankbarkeit der wendischen Herren erwarben, immer mehr an Festigkeit gewann; diese Stiftung entwickelte auf ihrem großen Grundbesitze im 13. Jahrhundert eine große Thätigkeit, welche, an der Grenze des gänzlich verödeten Redarierlandes, hohe Achtung abnöthigt 2 ).
Eine andere Veranlassung hat die Stiftung der Johanniter=Comthurei Nemerow; diese entstand, nach der Erstarkung der fürstlichen Macht während des 13. Jahrhunderts, durch das Streben der Fürsten, würdige Diener zu belohnen und in Stiftungen dieser Art sich Stützen ihrer Macht und Regierung zu verschaffen. Und wirklich zeigen die wenigen Urkunden der blühenden Comthurei Nemerow Spuren einer besondern Vorliebe der Fürsten für diese Stiftung.
Das Dorf Nemerow hat vor der Gründung der Comthurei vielerlei Schicksale gehabt, welche die Forschung um ein Bedeutendes erschweren. Das Dorf Nemerow oder Nimirow am See Tollenze, nicht weit von der Stadt Stargard, gehörte zur Zeit der Wenden zum Lande der Redarier. Im Anfange der Germanisirung dieses Landes gehörte es zu den Gütern, welche im J. 1170 von dem Fürsten Kasimir von Pommern, dem damals das Land Stargard gehörte, dem Bisthume Havelberg zur Stiftung des Klosters Broda geschenkt wurden 3 ). Als im J. 1182 die Pommernherzoge das Land Stargard durch eine unglückliche Schlacht an die Markgrafen von Brandenburg verloren, büßte das Kloster Broda auch alle Güter ein, welche es im Lande der Redarier geschenkt erhalten hatte: es behielt nur diejenigen, welche im späteren Gebiete der Herren von Werle lagen 4 ). Wiederholte Confirmationen nützten dem Kloster, das gewaltsam aus dem Besitze gedrängt war, nichts; die Markgrafen behielten die Güter, als Kriegsbeute, für sich zum Eigenthume. Während des 13. Jahrhunderts blieb das Land Stargard bei der Mark Brandenburg; mit dem 14. Jahrhunderte kam es durch das


|
Seite 30 |




|
Aussterben der brandenburg=stargardischen Linie und durch die Vermählung des meklenburgischen Fürsten Heinrich des Löwen mit der brandenburgischen Prinzessin Beatrix an das Haus Meklenburg.
Während des 13. Jahrhunderts war die Feldmark Nemerow getheilt 1 ) worden. Der cultivirtere Theil war zu einem Rittersitze umgeschaffen und hieß Groß=Nemerow; auf den waldigeren, wenn auch schöneren Theil waren die Ueberreste der wendischen Bevölkerung zurückgedrängt, welche hier ein Dorf, Wendisch= oder Klein=Nemerow, bewohnten; neben diesem wendischen Dorfe entstand während der Cultivirung des Bodens ein Hof Nemerow 2 ). Um dem hart mitgenommenen Kloster Broda etwas aufzuhelfen, schenkten die Markgrafen Otto und Albert von Brandenburg demselben am 10. April 1273 das Dorf Wendisch=Nemerow, wie sie es bis dahin besessen hatten 3 ). Bei der Stiftung der Comthurei Nemerow im J. 1298 besaß aber die Familie von Warburg sämmtliche Güter Nemerow als Lehngüter 4 ). Hiernach scheint die Schenkung der Markgrafen an das Kloster Broda nicht viel mehr werth gewesen zu sein, als die pommersche Confirmation der ersten Verleihung. Das Kloster Broda hatte zwar vor dem 15. Aug. 1306 das Dorf Klein=Nemerow nebst den Dörfern Mechow und Küssow an das Kloster Wanzka verkauft 5 ), aber es ist keine Spur weiter davon vorhanden, daß die Comthurei Nemerow seit 1298 je aus dem Besitze eines Theils von Nemerow gekommen sei. Wahrscheinlich mußten die beiden Klöster der begünstigten Comthurei weichen oder sie verglichen sich mit dieser über Ansprüche, welche vielleicht nicht bedeutend waren, wenn nicht das
und,"Meychildis relicta Pulleman vendidit Hermanno de Papendorp molendinum iuxta Nemerowe, sicut suum fuit et illud sibi racionabiliter coram consilio resignauit",
Pactus in Nemerov VIII mr."


|
Seite 31 |




|
an Broda abgetrennte Gut Nemerow ein anderes wendisches Nemerow am südlichen Ende von Gr. Nemerow war, wo das Kloster Wanzka (bei Nonnenhof) Besitzungen hatte; es ist aber glaublich, daß die Rechte der Klöster an dem Gute nicht bedeutend waren, da das Kloster Wanzka im J. 1290 bei seiner Stiftung auch das Dorf Mechow mit 64 Hufen und in Küssow 8 Hufen erhielt und dennoch darauf die Güter von dem Kloster Broda kaufte. Es müssen hier, wie dort, untergeordnetere Verhältnisse zum Grunde liegen, die wir nicht mehr kennen.
Der Stifter der Johanniter=Comthurei Nemerow war der Ritter Ulrich Swabe oder Swave 1 ), aus einem alten Geschlechte, das aus Schwaben stammte. Schon bevor er in den Orden trat und auch als Comthur, hatte er dem Margrafen Albert von der stargardischen Linie sehr angenehme Dienste geleistet und der Fürst hatte ihn stets fest und treu befunden 2 ); nach dem Tode Alberts besaß er (vir honorabilis, famiharis nobis specialiter et dilectus) 3 ) nicht minder des Markgrafen Hermann Liebe und Dankbarkeit, um so mehr, da er im J. 1302 als Comthur dessen geheimer Rath (secretarius) war 4 ), und auch der Fürst Heinrich von Meklenburg wandte ihm (viro prediscreto nobis sincere predilecto domino Ulrico dicto Swaf) 5 ) seine ganze Liebe zu. Schon im J. 1292 ist er in einer zu Lichen ausgestellten Schenkungsurkunde des Markgrafen Albert für das Cistercienser=


|
Seite 32 |




|
Nonnenkloster Wanzka der erste Ritter im Gefolge des Fürsten 1 ). Wahrscheinlich war er der Mann, der alle wichtigen Verhandlungen zwischen Meklenburg und Brandenburg und im brandenburgischen Fürstenhause, z. B. bei dem Aussterben der stargardischen Linie, bei der Vermählung der Beatrix, u. s. w., leitete.
Ulrich Swave war schon vor dem J. 1292 in den Johanniter=Orden getreten 2 ). Er ward bald Comthur zu Braunschweig 3 ) und Gardow 4 ). Als solcher kaufte er für den Orden von dem Ritter Hermann von Warburg die Güter Groß=Nemerow, Klein= oder Wendisch=Nemerow und Hof=Nemerow für 630 brandenb. Pfund. Nachdem H. v. Warburg diese Güter dem Comthur vor dem Lehnsherrn ausgelassen hatte, übertrug der Markgraf sie zu Soldin am 15 Mai 1298 auf den Johanniter=Orden und befreiete sie aus besonderer Liebe zu demselben von Bede, Dienst und Heerfolge, kurz von allen Lasten, so daß der Orden unbeschränkte Herrschaft über die Bewohner der Dörfer ausüben könne; zur besonderen Ehre und Dankbarkeit bedung der Markgraf für Ulrich Swave, daß dieser für die Zeit seines Lebens Comthur für diese Güter bleibe und daß dieselben erst nach seinem Tode zur Verfügung des Ordensmeisters stehen sollten. Diese Stiftung der Comthurei Nemerow geschah bei Gelegenheit einer feierlichen Begebenheit, indem außer dem Markgrafen Albert die Fürsten Heinrich von Meklenburg, Otto von Pommern=Stettin, Nicolaus von Rostock und Nicolaus von Werle gegenwärtig waren; vielleicht feierte Nicolaus das Kind seine erste Verlobung, die mit der brandenburgischen Prinzessin Margaretha, die ungefähr in diese Zeit gefallen sein muß 5 ).
Zum Sitze der Comthurei ward der Hof Nemerow bei Wendisch=Nemerow in einer höchst reizenden und fruchtbaren Gegend auf den hohen Ufern des Tollenze=Sees erwählt. Bald ward hier ein Conventhaus und eine Kirche erbauet 6 ),


|
Seite 33 |




|
welche Gebäude beide noch stehen; die Dienste leisteten die Bewohner der Dörfer Groß= und Klein=Nemerow. Nachdem dies, dem Anscheine nach, geschehen war, bestätigte der Markgraf Herman, sei es bei den noch schwankenden Verhältnissen über den Besitz des Landes Stargard als Landesherr, sei es als Schutzherr des Ordens 1 ), am 8. November 1302 die Stiftung und bestimmte sie zum Sitze eines Comthurs, für Ulrich Swave auf die ganze Zeit seines Lebens, und dreier Ordenspriester 2 ). So entstand zu Nemerow, wie zu Mirow, eine Priester= Priorei neben der Comthurei, während in der Grafschaft Schwerin die Priorei Eixen von der Comthurei Kraak getrennt blieb. Und wirklich kommt auch im J. 1392 "Martin von dem Berge" als "prior des huses S. Johannis baptistae to Nemerow" vor 3 ). Wahrscheinlich nahm das Ordenshaus mit dem wachsenden Reichthum der Stiftung mehr Brüder aus dem Priesterstande auf. In der eben angeführten Urkunde vom J. 1392 in Hacke Gesch. der Stadt Neu=Brandenburg verhandeln mit dieser Stadt außer dem Comthur und dem Prior 5 Brüder ("brödere dessuluen ordens S. Johannis vnde huses "to Nemerow") nämlich: Jacob vom Sunde, Claus Luno, Gerd Went, Henning Picht und Gerhard Lubbin.
Zunächst suchte die Comthurei die ursprüngliche Stiftung abzurunden. Im Anfange des 14. Jahrhunderts verkaufte der Fürst Heinrich von Meklenburg der Comthurei das Eigenthum eines Feldes am Tollenze=See, welches bis dahin zu den Burglehen von Stargard gehört hatte, und die stargardischen Burgmänner gaben hiezu ihre Einwilligung 4 ). Und am 19. Aug. 1355 verkaufte der Herzog Johann von Meklenburg an die Comthurei das Holz zwischen dem Holze von Nemerow, dem Holze des Burglehns von Stargard, dem See Tollenze und dem Dorfe Rowa, welches nach jüngern Aufzeichnungen die "Burgkavel" genannt ward, mit allen Freiheiten und Gerechtigkeiten 5 ).
Das schwankende Verhältniß des Landes Stargard zu den Markgrafen von Brandenburg und den Fürsten von Meklenburg konnte für die Unterthanen nicht erfreulich sein; die Unsicherheit


|
Seite 34 |




|
des Eigenthums beweisen die Confirmationen, die von beiden Seiten eingeholt wurden. Dieser Ungewißheit machte zwar der Wittmansdorfer Vertrag vom 15. Jan. 1304 ein Ende, nach welchem Heinrich von Meklenburg 5000 Mark Silbers für die Abtretung des Landes Stargard an die Markgrafen zu zahlen sich verpflichtet hatte; dadurch ward aber der Fürst Heinrich, dessen Schatz bei seinen vielen großen Unternehmungen nicht immer gefüllt war, in die größte Verlegenheit gesetzt, welcher er dadurch zu kehren suchte, daß er eine außerordentliche Bede ausschrieb. Er wandte sich in "seiner dringenden Verlegenheit, in die er durch die Markgrafen gesetzt" war, auch an den Comthur von Nemerow, der ihm mit freundlicher Gesinnung zur Beihülfe 40 Mark Silbers schenkte 1 ), welche der Fürst als eine freiwillige Gabe annahm und deren Zahlung er nie zur Geltendmachung eines etwanigen Rechtes gebrauchen zu wollen versprach. Dagegen versicherte er der Comthurei völlige Freiheit von Bedezahlung von ihren Gütern 2 ).
Eine interessante Erscheinung ist es, daß die nemerowschen Brüder das Patronatrecht über die Pfarrkirche der Stadt Lichen erwarben. Am 30. Jan. 1302 schenkte der Fürst Heinrich von Meklenburg der Comthurei dieses Recht 3 ) und am 14. Aug. d. J. ließ Ulrich Swave derselben das Recht von dem Markgrafen Hermann von Brandenburg bestätigen 4 ), weil dieser damals noch annahm, daß Heinrich von Meklenburg von ihm "Land und Stadt Lichen zu Lehn habe." Die Comthurei ließ nun die Pfarre sogar durch Priester ihres Ordens verwalten, wie im J. 1316: "Nicolaus presbyter, rector ecclesie in Lychen, ordinis "sancti Johannis Jherosolimitani" 5 ). Aus den Comthureigütern erhielt die Pfarre zu Lichen von dem Dorfe Dabelow jährlich einen brandenburgischen Schilling Zins von jeder Hufe 6 ).
Der Comthur Ulrich Swave lebte noch längere Zeit in seinem Wirkungskreise: Ostern 1315 war er in Dänemark zu Worthingborg, wo er mit mehreren dänischen Edlen eine Urkunde vidimirte; 1318 war er mit dem erfurter Comthur Paul von Mutina zu Cremmen. Am 24. Mai 1322 war schon Georg


|
Seite 35 |




|
von Kerkow Comthur 1 ). Auf jeden Fall verdienen die Lebensumstände des Stifters der Comthurei auch für die politischen Verhältnisse der damaligen Zeit hohe Beachtung.
Die Dörfer Nemerow bildeten den zusammenhangenden Boden der Comthurei Nemerow. Schon früh erweiterten aber die Ritter ihre Besitzungen in der Nähe, indem sie die Dörfer Staven und Rowa erwarben und zur Comthurei legten.
Schon am 23. Junius 1303 verlieh der Fürst Heinrich von Meklenburg der Comthurei das Eigenthum von 8 Hufen in Staven, wie sie die Brüder Henning und Hartmann von Staven bis dahin besessen hatten, und schenkte ihnen dazu die Bede 2 ), die ganze Gerichtsbarkeit und alle Dienste von dem Dorfe 3 ).
Im J. 1322 erwarb die Comthurei 37 1/2 Hufen im Dorfe Staven. Der Fürst Heinrich von Meklenburg verkaufte dem Orden für 150 Mark stendalscher Münze das Eigenthum über diese Hufen und der Heermeister verschrieb mit den Comthuren von Mirow und Nemerow am 24. Mai 1322 zu Neubrandenburg dem Fürsten den Wiederkauf dieses Eigenthumsrechtes 4 ). Die Comthurei blieb jedoch im Besitze und Eigenthum dieser Hufen, da das ganze Dorf der Comthurei bis zu deren Säcularisirung gehörte. - Im J. 1356 brachte die Comthurei das Letzte an sich, was ihr von dem Dorfe Staven noch fehlte. Am Tage Martini 1356 verkaufte nämlich der Ritter Vicke von Godenswegen, mit Einwilligung seiner Söhne Heinrich, Vicke und Albrecht, dem Orden das Schulzengericht, den Krug, die fünf Seen, 9 brandenb. Pfennige von den Hufen, welche sie zu Lehn trugen, und das Kirchen=Patronat zu Staven dem Orden 5 ) und am 25. Jan. 1358 verkaufte der Herzog Johann von Meklenburg der Comthurei die landesherrlichen Gerechtsame an diesen Gütern in Staven, nämlich das Eigenthum von 9 1/2 Hufen, von welchen der Schulze 4 im Besitz hatte, und von dem Kruge, den Vicke von Godenswegen zu Lehn getragen hatte, alle Gerichtsbarkeit, Bede und Dienste, für 201 1/2 Mark und 40 Pfennige, unter der Bedingung, daß die Brüder das Gedächtniß der Landesherren


|
Seite 36 |




|
feierten 1 ). - Dies sind im Ganzen 55 Hufen, welche die Ritter zu Staven erwarben; zur Zeit der Säcularisirung hatten die Bewohner des Dorfes noch 52 Hufen unter dem Pfluge und die Pfarre besaß 4 Hufen.
Ferner erwarb die Comthurei das Dorf Rowa, welches an den Grenzen derselben liegt. Dieses Dorf hatte der Fürst Heinrich von Meklenburg am dritten Sonntage nach Martini (26. Nov.) 1318 an die Stadt Neubrandenburg verkauft 1 ). Diese Stadt verkaufte das Dorf wieder an die Comthurei Nemerow und der Herzog Johann von Meklenburg bestätigte am 4. Jan. 1356 den Verkauf dieses ganzen Dorfes mit aller Gerichtsbarkeit, Bede und Freiheit, wie die Stadt dasselbe besessen hatte, ohne irgend eine Last 2 ).
Die Comthurei Nemerow bestand also aus dem Hofe Nemerow mit dem Ordenshause und aus den ganzen Dörfern Groß=Nemerow, Klein=Nemerow, Rowa und Staven mit allen Rechten und Freiheiten.
Außerdem hatte die Comthurei noch einige Gerechtsame, von denen die Lehnsherrlichkeit der Fischerei auf dem Tollenze=See die wichtigste ist. So dunkel und häufig angefochten die Fischerei auf diesem See ist, so dunkel ist das Recht der Comthurei darüber. Es ist bisher nichts weiter darüber bekannt geworden, als was Hacke in seiner Geschichte der Stadt Neubrandenburg darüber S. 52 sagt:
"Die Comters zu Nemerow machten den Brandenburgern das alleinige Eigenthumsrecht der Fischerei auf der Tollense auch streitig; dieser Zwist wurde aber 1392 unter ihnen dadurch verglichen, daß die Brandenburger den Rittern die Ehre erzeigen mußten, die Fischerei auf der Tollense bei ihnen zu Lehn zu suchen, laut Reverses des Herrn Comters zu Nemerow wegen der verlehnten Fischerei auf der Tollense Anno 1392."
Ferner hatte die Comthurei ein Patronat, wahrscheinlich von Neuenkirchen, indem es in einem Urkunden=Protocolle aus dem 16. Jahrhunderte heißt:
"Die zu Ilfeldt vnd Kloxin haben einen hoff zur Pfarr gelegen, daruon der Pfarrherr die zinse, die Ilfelder aber die straffen nehmen, hinkegen hat der Comther vnd das haus Nemerow einen


|
Seite 37 |




|
Pfarherr zu verordnen macht, mit dem die Ilfelder zuefrieden sein müßen."
Der Antheil an den "Vipperowschen Wassern" der Müritz, welche am 20. December 1330 den Comthureien Mirow und Nemerow zusammen verschrieben wurden 1 ), muß in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, bei den Güter=Regulirungen zwischen beiden genannten Comthureien, an die Comthurei Mirow übergegangen sein.
Der Comthureihof Nemerow
liegt hart am Ufer des Tollenze=Sees auf hohem Gestade, vielleicht in der schönsten Gegend des strelitzer Landes, die überhaupt zu den reizendsten der Ostseeländer gehören dürfte; die Aussicht auf den See und die hohen waldbewachsenen Ufer, namentlich nach Neubrandenburg und dem Kloster Broda hin, ist wahrhaft entzückend. Der mit Laubholz geschmückte Boden ist äußerst fruchtbar, da nicht allein alle Feldfrüchte gebauet werden können, sondern auch im hohen Grade üppig und fruchtreich gedeihen. Dazu ist das Feld ungemein quellenreich; die ganz in der Nähe des Hofes aus den zerklüfteten Waldhügeln hervorstürzenden Quellen sind so stark, daß sie vereinigt sehr bald die nemerowsche Mühle treiben; überdies sind die Quellen verschiedenartig mineralhaltig und "sollen" die wirksamsten von allen Quellen in beiden Großherzogthümern Meklenburg sein.
Von den Comthurei=Gebäuden ist nicht viel übrig, jedoch noch mehr, als von den andern Comthureien im Lande. Es war zu Kl. Nemerow am 11. August 1836 noch Folgendes vorhanden.
Der neuere Wohnsitz des Comthurs stand an der Stelle des jetzigen Pächterhauses. Im J. 1655 stand dort:
"Ein altes haus vngefehr von 10 gebinden, ist vbell gebawet vnd sehr zerfallen, darin ein back= vnd brauwhauß.
Ein newes haus hart dabey vngefehr von 9 gebinden, taugt auch nicht viel, in demselben ist eine staube vnd Kammer vnd ein stal darinnen 8 Pferde stehen konnen."
Neben dem Wohnhause steht die alte Ordenskirche, welche jetzt in eine Scheure umgewandelt ist. Sie steht hart


|
Seite 38 |




|
am Ufer des Sees und ist ganz aus Feldsteinen erbauet. Ein Gewölbe existirt nicht mehr. Um die Kirche zur Scheure einzurichten, ist an der langen, östlichen Seite eine Auffahrt mit einem niedrigern Dache angebauet. An dieser Seite gehen zwei im Spitzbogen gewölbte Thüren in die Kirche; außerdem sind noch einige viereckige Fensteröffnungen vorhanden. Die Kirche ist ein reines Oblongum und steht mit der schmalern Seite gegen N., mit der längern, östlichen Seite parallel mit dem See, der auch wohl diese Lage der Kirche bestimmt. Nach dem See hin hat die Kirche noch Strebepfeiler, welche aber zum großen Theile in den See gestürzt sind. Daß dieses Gebäude die Ordenskirche gewesen sei, beweisen Inventarien vom J. 1655, in denen es heißt:
"Eine scheune vor dem hause, welches eine alte kirche zuvor gewesen, darinnen man hew legen kan."
Und schon im J. 1612 heißt es:
"In der Kirche ist nichts. 2 Glocken hangen an St. Johans Kirche vor dem Thor."
Außerdem spricht dafür der ganze Bau und vorzüglich der Leichenstein von dem Grabe des Comthurs Ludwig von der Gröben, der aus diesem Gebäude genommen und mitten auf dem Hofe aufgerichtet ist. Auf demselben ist das geharnischte Bild eines Ritters in Relief ausgehauen; um her steht die Inschrift:
ANNO 1620 DEN 20 AUGUSTI IST DER WOLWÜRDIGER, EDLER, GESTRENGER UND ERNUESTER HER LUDWIG V. D. GRÖBEN DES MALTHESER ORDINIS S. JOHANNIS UND HOSPITALIS ZU HIERUSALEM RITTER, COMMENDATOR ZU NEMEROW, ALHIE SEHLIGLICH ENDSCHLAFEN ZWISCHEN 6 UND 7 UHREN VORMITTAGE UND ZUR ERDEN BESTETIGET IM GEWELBE, SEINES ALTERS IM 49 JHARE, DERO SEHLEN GODT GNEDICH IST.
An seiner linken Schulter und an einer Kette um den Hals steht ein Maltheserkreuz. An jeder Seite sind 8 Wappenschilde seiner Ahnen ausgehauen. - Auf der Rückseite der Mauer, an welcher dieser Leichenstein aufgerichtet ist, ist ein kleinerer Stein mit zwei Wappen eingemauert; unter diesen steht:
LUDOWIG VON DER GROBEN COMPTOR
und
SABINA VON BREDOW. ANNO 1605.


|
Seite 39 |




|
Damals verheiratheten sich also auch die Comthure.
An der schmalen, südlichen Seite der Kirche, in gleicher Richtung mit derselben, steht ein anderes schmaleres und kleineres, altes Gebäude, aus großen, mittelalterlichen Backsteinen, dessen Ringmauern jetzt zum Viehstalle benutzt sind. Wahrscheinlich war dies das Conventhaus. In dem Inventarium von 1655 heißt es:
"Ein schaffstal daneben (neben der Kirche), darein werden die lemmer getriben."
Außerdem stand damals noch eine ältere Kirche auf dem Hofe; denn es heißt weiter:
"Die kirche, so auffem hoffe stehet, ist gantz. gahr zurißen, zerbrochen vnd zerfallen, daß sie gar nichts mehr tüchtig;"
worauf auch das oben angeführte Inventarium vom J. 1612 hinzudeuten scheint.


|
Seite 40 |




|
Die Johanniter=Comthurei Gardow,
der
Comthurei Nemerow einverleibt.
Häufig ist von der Johanniter=Comthurei Gardow oder Gartow die Rede gewesen, ohne eine bestimmte Vorstellung von der Lage derselben zu haben. Gewöhnlich glaubt man, daß diese Comthurei aus dem Städtchen Gartow im Dannebergschen bei Schnakenburg an der Elbe bestanden habe. Allerdings hat diese Annahme viel Wahrscheinliches für sich, da die Johanniterritter in dem nahen Werben eine bekannte Comthurei hatten, Crummendiek erwarben 1 ) und im 14. Jahrhunderte auch im Besitze des Städtchens Gartow waren 2 ). Es ist sogar möglich und wahrscheinlich, daß im 14. Jahrhundert eine Comthurei Gartow an der Elbe bestand, und es liegt die Annahme ziemlich nahe, daß die in meklenburgischen Urkunden vorkommende Comthurei Gardow diese gewesen sein möge, da der als Comthur von Gardow und Nemerow vorkommende Ordensbruder Ulrich Swave auch Comthur oder Prior zu Braunschweig war. Dennoch sind triftige Gründe dafür vorhanden, daß die meklenburgische Comthurei Gardow eine andere, als die danneberg=braunschweigische gewesen sei.
Im J. 1298 wird Ulrich Swave, der Stifter der Comthurei Nemerow, Comthur von Braunschweig und Gardow genannt 3 ). Nach der Stiftung der Commende Nemerow heißt er am 14. Aug. 1302 schon Comthur von Braunschweig, Nemerow und Gardow 4 ). Hier ist


|
Seite 41 |




|
es schon auffallend, daß die ältere Comthurei Gardow der jüngern Nemerow nachgesetzt wird; jene war also schon wahrscheinlich Bestandtheil der letztern geworden. In der Confirmations=Urkunde vom 3. April 1304 wird aber ausdrücklich gesagt, daß Gardow in der, so eben meklenburgisch gewordenen, Herrschaft Stargard liege: der Fürst Heinrich von Meklenburg erließ nämlich den Johanniter=Rittern von Nemerow und Gardow alle Bedezahlung von Nemerow, Gardow und den übrigen in seiner Herrschaft liegenden Gütern, wie sie zu den beiden genannten Ordenshäusern gehörten und bis auf ihn gebracht seien 1 ). Diese Worte können unmöglich von andern, als im Lande Stargard liegenden Gütern verstanden werden. Daher heißt es auch in einem Urkunden=Inventarium aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als die Comthurei noch ungeschwächt bestand, von dieser Urkunde:
"Herzogk Heinrich bestettigt dieselben güter zue großen vnnd kleinen Nemerow und Gardow, darauf vor zeitten die Comptorei gestanden, ungefähr 2 1/2 meil von Nemerow gelegen."
Diesen Ort giebt nun ein altes Inventarium vom J. 1583 über die Güter der Comthurei an, wo es bei dem Dorfe Wokuhl, nicht weit nordwestlich von Lichen, sagt:
"Wokuhl. Dazu eine wüste Feldmark Gardow. - - Die Feldmark Gardow grenzt mit Godendorf und Brakentin."
Der Johanniter=Orden hatte nämlich an der südlichen Grenze des Landes Stargard, zwischen Strelitz und Lichen, nördlich an das jüngere Kloster Himmelpfort und Stadt und Land Lichen grenzend, in abgesonderter Begrenzung die Dörfer Dabelow, Wokuhl, Gnewitz und Kl. Karzstavel, in deren Mitte der Hof Gardow lag, an dessen Stelle jetzt der jüngere Hof "Comthurei" liegt, nahe bei den Seen Groß= und Klein=Gardow. Hiedurch wird es auch erklärlich, daß der Comthur von Nemerow und Gardow das Patronat über die Pfarrkirche der Stadt Lichen erhielt 2 ). Seit
"Damus eisdem fratribus ("sacre domus hospitalis Jerosolimitani de Nemerowe et de Gardowe") nunc presentibus et futuris bona in maiori Nemerowe etins lauicali Nemerowe necnon in Gardeowe et cetea bona in dominio nostro sita, ad iam dictas duas domos pertinencia, sicut ea ad nos perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores a precaria libera et exempta."


|
Seite 42 |




|
dem Anfange des 16. Jahrh. lag aber der Hof Gardow wüst bis auf die neuern Zeiten.
Der Comthur Joachim von Holstein (1552-1572) that zuerst den Acker des Gutes an die Bauern von Wokuhl zur Pacht aus. Dies beweisen die Beschwerden des Comthurs L. v. d. Gröben vom J. 1611, in denen es heißt:
"Die Heidtdörfer vndt erstlich den Hoff vndt die Feldtmarcke Gerdow betreffende, dauon gebrauchet der Schultze vndt Krüger zur Wohkuel den Hoff=Acker, dafur thuen dieselben eine Außrichtunge, wan vndt so offte Sie auff die Heide kommen; den andern Acker aber gebrauchen die Wohkulischen Pawren, welche dafur der Comptorey einen Wiespel Rogken geben, welchen obgedachten Hoff vndt allen andern Acker ihnen den Wohkulschen von Joachim Holstein eingethaen worden, da doch dieselben der Comptorey daß gantze Jahr vber nur mit drey Fuhren dienen, wan sie zusammenspannen, dieweiln also solches der Comptorey wenig zu nutzen kompt, aber dajegen der ort also beschaffen, daß daselbst eine Schefferey oder Viehoff fuglich woll gelegtt werden konne."
Noch am 26. Febr. 1718 heißt es 1 ): "Die sogenannte alte Comterei im Ambte Nehmerow ist eine wüste Feldmark zwischen Wokuhl, Brüggentin, Dabelow und Godendorf belegen."
Die Geschichte dieser Güter bedarf jetzt einer besondern Darstellung und einer neuen Mittheilung der Urkunden, obgleich sie schon bei der Geschichte der Comthurei Mirow in Jahrb. II, S. 64 und 73 berührt ist. Am 13. März 1285 schenkte der Markgraf Albert von Brandenburg dem Johanniter=Orden das Eigenthum des Dorfes Gnewetiz 2 ) und am 17. Dec. 1286 das Eigenthum der Dörfer Dobelow und Kl. Karzstavel 3 ), welche bis dahin Lehngüter gewesen waren, und übergab sie zu Händen der Comthurei Mirow. Gnewetiz ist das Dorf Gnewitz, Dobelow das Dorf Dabelow. Das Dorf Karzstavel existirt nicht mehr; es lag nach den Stiftungs=Urkunden des im J. 1299 gestifteten Klosters Himmelpfort zwischen der Stadt Lichen und dem Dorfe Dabelow, wie noch


|
Seite 43 |




|
jetzt der Kastavische See die Grenze zwischen den Ländern Meklenburg=Strelitz (Stargard) und Lichen (zur Ukermark) bildet. Schon vor der Stiftung der Comthurei Nemerow (1298) und des Klosters Himmelpfort (1299) war zu diesen Gütern die Feldmark Gardow gekommen und aus allen diesen Gütern eine Commende gebildet, mit welcher Ulrich Swave belehnt ward.
Das Gut Gardow kam wohl als Ersatz für das Gut Karzstavel an die Comthurei, da dieses Dorf zum Kloster Himmelpfort gelegt ward, in dessen Besitzungen es auch untergegangen ist. Die Comthurei Mirow besaß aber im Anfange des 14. Jahrhunderts die Güter der Comthurei Gardow nicht mehr, da derselben sowohl Nicolaus von Werle am 18. Jan. 1301 1 ) nur die Güter Mirow, Gramzow, Peetsch, Lenst, Fleth, Roggentin, Loissow und Garz, als auch Heinrich von Meklenburg am 15. Aug. 1303 2 ) und am 3. April 1304 3 ) nur die Güter Mirow, Zirtow, Peetsch, Lenst, Fleeth und Repent bestätigte. Die letztere Urkunde vom 3. April 1304 beweiset wiederum die abgetrennte Existenz der Comthurei Gardow, da sonst der Fürst Heinrich der Comthurei Mirow die Comthurei Gardow, d. h. die Güter Gardow, Dabelow und Gnewitz bestätigt haben würde; statt dessen bestätigte er sie unter demselben Datum dem Comthur von Nemerow. - Bald darauf muß der Orden noch das Dorf Wokuhl dazu erhalten haben 4 ); denn am 10. October 1337 schenkte der so eben volljährig gewordene Fürst Albrecht von Meklenburg, für sich und seinen unmündigen Bruder Johann dem Orden, bei seiner ersten Reise in das Land Stargard den Brüdern das Eigenthum und den Grundzins von den Dörfern Wokuhl, Gnewitz und Dabelow, wobei er jedoch den Zins von Dabelow zur Pfarre von Lichen legte, die aber wiederum dem Orden gehörte.
Der Fürst machte diese Schenkung dem Orden im Allgemeinen, ohne eine bestimmte Comthurei zu nennen. Damals ungefähr, nach dem Tode des Ulrich Swave, wird die Comthurei Gardow der Comthurei Nemerow incorporirt worden sein, was um so paßlicher war, da beide Comthureien sämmtliche Güter des Ordens im Lande Stargard in sich faßten.
Seit dieser Zeit verschwindet die Comthurei Gardow aus der Geschichte der Comthurei Mirow, wenn auch das


|
Seite 44 |




|
Dorf Gardow noch im J. 1493 neben Nemerow und Dabelow genannt wird, und kommt nur als Bestandtheil der Comthurei Nemerow vor. Im Inventarium von 1641 wird ausdrücklich gesagt, daß die Feldmark Gardow unmittelbar zur Comthurei gehöre und nicht zum Hufenschlag von Wokuhl. Die Güter der ehemaligen Comthurei Gardow, welche im 16. Jahrhunderte die Haidedörfer genannt werden, waren aber nach Inventarien aus dem 16. Jahrhunderte:
1) Dabelow mit der wüsten Feldmark Brüggentin, welche nordöstlich an Dabelow grenzte und zwischen Dabelow, Gardow, Wokuhl, Gnewitz und den Seen Linow und Brüggentin (nach der Ukermark hin) lag; der Hof Brückentin war am Ende des 17. Jahrhunderts aufgebauet;
2) Wokuhl mit der wüsten Feldmark Gardow, welche zwischen Wokuhl, Brüggentin, Dabelow und Gudendorf lag; jetzt steht an der Stelle desselben der Hof Comthurei;
3) Gnewitz, östlich an Brüggentin und Wokuhl grenzend;
4) Gudendorf, westlich an die Feldmarken von Dabelow und Gardow grenzend; dieses Dorf hieß früher Minnow:
"Minnow, tho diser tidt (1583) Godendorf geheten 1 )."
Dazu gehörte später die Feldmark Dreffin:
"(1583) haben diese Pauern (von Gudendorf) semptlich ein wüste feltmarkt Dreffin genannt, so nach Strelitz belegen, zur huer."
Bemerkenswerth ist in Beziehung auf diese Besitzungen noch das Grenzverhältniß zum Kloster Himmelpfort. Dieses grenzte mit seinen Besitzungen an die nemerowsche Comthurei Gardow, und die Grenzen beider Stiftungen bildeten zugleich die nördlichen Grenzen des ukermärkischen Landes Lichen gegen das Land Stargard. Bei der Stiftung und bei der Confirmation im J. 1305 durch den Fürsten Heinrich von Meklenburg erhielt das Kloster Himmelpfort im Lande Stargard 100 Hufen, nämlich die Dörfer Neddemin und Warbende, und 10 Hufen in Vlatow, und im Lande Lichen die Dörfer Karstavel, Gr. Thimen, Kl. Thimen, Garlin, Linow und Brusewald und alle Gewässer, die zum Lande Lichen gehörten, namentlich aber auch die Seen Dabelow, Brüggentin, Linow und Karstauel, von denen die drei


|
Seite 45 |




|
letzten in der Grenze zwischen den Ländern Stargard und Lichen liegen. Da diese Seen theils ganz, theils zum Theil von dem Gebiete der Comthurei umschlossen waren, so gab ihr Besitz Veranlassung zu langwierigen Streitigkeiten, welche endlich am 9. Julii 1480 durch die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg dahin beigelegt wurden, daß das Kloster Himmelpfort in den ungestörten Besitz der Seen Dabelow, Brüggentin und Linow gesetzt ward 1 ), wie die ältesten Urkunden dem Kloster denselben verliehen hatten. Jedoch wollte der Johanniter=Orden dem Kloster die Seen im Anfange des 16. Jahrh. wieder streitig machen.


|
Seite 46 |




|
Die Comthurei Nemerow bestand also aus folgenden Gütern :
Comthurei=Hof Klein=Nemerow.
a. Comthurei Nemerow:
1) Groß=Nemerow.
2) Klein= oder Wendisch=Nemerow.
3) Rowa.
4) Staven.
b. Comthurei Gardow, Nemerow einverleibt, unter dem Namen der Haidedörfer:
5) Gnewitz.
6) Dabelow mit der wüsten Feldmark Brüggentin.
7) Wokuhl mit der wüsten Feldmark Gardow.
8) Gudendorf (früher Minnow genannt).
Alle Güter mit Eigenthumsrecht und aller Freiheit und Gerechtigkeit.


|
Seite 47 |




|
Die Comthurei Nemerow hatte sich im 14. Jahrhunderte vollständig gebildet. Im 15. Jahrhunderte scheint ihr Dasein dem ruhigen Genusse zugewandt gewesen zu sein, da kaum viel mehr vorkommt, als die Namen einiger Comthure. Am Ende des 15. Jahrh. begann der Heermeister zu Sonnenburg mit den Herzogen von Meklenburg einen langwierigen Proceß, der schon in den Jahrbüchern, Jahrg. I, S. 17 flgd., dargestellt ist und der vorzüglich die Comthureien Nemerow und Kraak und die Priorei Eixen betraf. Die Commenden Kraak und Eixen gingen, wenn auch nicht in Folge, doch in Veranlassung dieses Processes unter, jene im J. 1533, diese im J. 1552. Für die Comthurei Nemerow blieb der Heermeister siegreich, bis die unwiderstehliche Macht des westphälischen Friedens im J. 1648 der Stiftung ein Ende machte; bis dahin aber giebt die Existenz der Comthurei Nemerow mehr als irgend eine andere Stiftung im Lande ein lebendiges Bild von dem zähen Festhalten der altkatholischen Institutionen, gleichviel ob die Verwaltung einen Genuß verdiente oder nicht.
Die nächste Veranlassung zum Streite gab der Besitz der Mühle zu Wesenberg nach dem Tode des Herzogs Albrecht VI. und dessen Gemahlin Catharine im J. 1483. Die Mühle mit Zubehör war ursprünglich fürstliches Besitzthum gewesen 1 ). Im J. 1355 am Tage vor Elisabeth erhielten Busso von Dolle zu Neddemin, Busso von Dolle zu Arnsberg und Busso von Dolle der Lange die Mühle zu Wesenberg mit 40 Morgen (partes siue mensuras) Ackers von dem Herzoge Johann zu Lehn. Am 4. Jan. 1361 ging dieses Lehn auf den Johanniter=Orden, und namentlich auf die Comthurei Mirow, über, indem die v. Dolle es vor dem Lehnsherrn aufließen und dieser es durch Verkauf für 240 Mark Vinkenaugen auf den Orden übertrug. Es gehörte damals zu der Mühle und dem Mühlenacker noch das Recht des Fisch= und Aalfanges auf dem Woblitz=See und das unbeschränkte Stauungs= und Baurecht an der Mühle und dessen Dämmen und Wehren. Der Johanniter=Orden verkaufte nun am 9. Nov. 1376 auf einem Ordenstage zu Quartzan für 300 Mark brand. die Mühle an die Brüder Wedege und Henning Plate, als ein Erblehn zu gesammter Hand, behielt sich jedoch die Lehns=


|
Seite 48 |




|
herrlichkeit vor 1 ). Dies konnte der Orden nicht mit Recht, da der oberlehnsherrliche Consens der Fürsten nicht ertheilt ward, auch wohl dem Orden nie das unbeschränkte Eigenthumsrecht, also auch nicht das Verleihungsrecht geschenkt war. Die Plate blieben, als Vasallen der Herzoge von Meklenburg, im Besitze der Mühle zu Wesenberg und der Fischereigerechtigkeit auf dem Woblitz=See, wozu sie noch den Pfandbesitz der Burg, Stadt und Vogtei Wesenberg erworben hatten, bis der Letzte der Linie, Joachim Plate 2 ), ungefähr um das Jahr 1460 ohne männliche Leibeserben starb und das gesammte wesenbergische Lehn an die Landesherren, als Lehnsherren, zurückfiel. Der Orden machte damals und späterhin keine Ansprüche, vielmehr blieb der Herzog Heinrich II. von Stargard und dessen Sohn Ulrich im ruhigen Besitze der Mühle. Der Herzog Ulrich verschrieb Wesenberg mit der Mühle seiner Gemahlin Katharina zum Leibgedinge. Nach dem Aussterben der stargardischen Linie ging das Eigenthum an das schwerinsche Fürstenhaus über; der Herzog Heinrich IV. besaß es ruhig und hinterließ es seinen Söhnen von denen es der älteste, Albert, wiederum seiner Gemahlin Catharine zum Leibgedinge verschrieb. Die beiden ältesten Söhne Heinrichs, Albrecht und Johann, starben, und Magnus und Balthasar waren, nach dem Tode Albrechts und seiner Gemahlin im J. 1483, im alleinigen Besitze. Bis dahin hatte der Orden geschwiegen; jetzt erhob er plötzlich seine Stimme und machte Ansprüche, welche wenigstens sehr zweifelhaft waren.
Heftiger noch, als über die angebliche Entziehung der wesenberger Mühle klagte der Orden über die widerrechtliche Auflegung einer großen Menge von Lasten aller Art aus den Comthureidörfern. Lieset man die Urkunden der Comthurei genau, so läßt sich nicht leugnen, daß diese ihre Güter völlig frei von allen Lasten, namentlich von Beden und Diensten, erhalten hatte. Während sich aber gegen das Ende des 15. Jahrh. die ganze Gestaltung der Staatsverfassungen umzuwandeln begann, entstanden manche neue Auflagen, von denen im 13. Jahrh. freilich nicht die Rede gewesen war; das Ansehen der Landesherrschaft stieg, während Ritterschaft und Geistlichkeit erschlafften: es fehlte die Opposition und die Landesherrn erlaubten sich manches, was früher mit Gewalt abgewehrt


|
Seite 49 |




|
worden wäre. In Beziehung auf die Comthurei Nemerow machten die Fürsten vorzüglich ihr landesherrliches Recht zur Grundlage neuer Forderungen. Die alten Urkunden wurden am Ende des Mittelalters nicht recht mehr benutzt, und dazu lagen die Urkunden der Comthureien wohl eingepackt in dem Ordens=Archive beim Heermeister; gewiß ist, daß die Fürsten über die Vorrechte der Comthurei nicht durch schriftliche Zeugnisse belehrt waren: und so erlaubten sie es sich wohl, von den Comthureigütern Leistungen zu fordern, die damals unmittelbar mit der Landeshoheit in Verbindung standen, und die auch von den befreieten Klöstern gethan wurden. Dahin gehörten die beschwerlichen Ablager für die Reisen der Fürsten und ihres Gefolges, die Naturallieferungen bei den fürstlichen Jagden; Roßdienst und Landfolge begehrten die Fürsten, weil die Comthure Ritter waren; - und da die Comthure immer nachgaben, so zahlten sie endlich auch Beden von ihren Gütern, die allerdings bedefrei waren. Dies hatten die Comthure selbst versehen. Da ihre kirchliche Kraft aber erschlaffte und die Herzoge es als ein Recht begehrten, daß die Comthure als Räthe bei den Herzogen in unentgeltlichen Dienst träten, so mag ihnen der Widerstand freilich wohl schwer geworden sein. Daher kam es denn auch, daß Achim Wagenschütte, der zugleich Comthur zu Mirow und Nemerow war und bei den Herzogen in Rathspflicht stand, am 5. Jan. 1474 die Bede aus seinem freien Dorfe Groß=Nemerow, des Betrages von 100 Mark Vinkenaugen, von dem Herzoge Heinrich für ein Darlehn zu Pfande nahm 1 )! Nach solchen Vorgängen mußten freilich die Herzoge glauben, daß sie ein unbezweifeltes Recht an allen landesüblichen Abgaben von den Comthureidörfern hätten und dazu ward die Auszeichnung der geistlichen Stiftungen durch den persönlichen Verkehr mit den Fürsten eine Last, die kaum zu tragen war, vorzüglich als die Feld= und Forstwirthschaft sank und der Ertrag der fetten Güter unglaublich geringe ward. Ja dies ging am Ende so weit, daß im Jahre 1619 der Comthur den Herzogen vorrechnete, er habe jährlich noch 211 fl. und etliche Schillinge zuzubezahlen!
Als nun die Last beschwerlich zu werden anfing und die Abgaben sich häuften, erhob der Orden, unter dem Heermeister Georg von Schlaberndorf, im Jahre 1493 Beschwerde und ließ endlich vor dem päpstlichen Stuhle seine Klagen erschallen. Die der Comthurei aufgebürdeten Lasten, welche aus den noch vor=


|
Seite 50 |




|
handenen Registern 1 ) zu ermessen sind, waren wirklich nicht unbedeutend. Aber dennoch brachten die Herzoge es durch Sachwalter, wie Peter Wolkow und Zutpheldus Wardenberg, dahin, daß nach achtzehnjährigem Streit am 5. Julii 1514 der Orden mit seinen Ansprüchen abgewiesen und in die Kosten verurtheilt ward 2 ). Der tragische Untergang der Comthurei Kraak erregte neuen Streit 3 ). Bei dieser Gelegenheit kamen die Herzoge im Jahr 1534 mit ihren Ansichten zum ersten Male klar zum Vorschein, daß nämlich die Fürsten das alte Recht hätten, bei Erledigung einer Comthurei einen tüchtigen Mann vom eingebornen Adel zur Einweisung vorzuschlagen, damit sie ihn als Rath gebrauchen könnten; deshalb grade seien die Comthureien, deren Ordenspatrone im Lande sie seien, gestiftet, und es sei ein Mißbrauch, daß in neuern Zeiten fremde Personen eingeschwärzt würden, welche die Comthureien ausplünderten und die Leute schindeten; Steuern anzulegen, sei unbezweifeltes Recht der Landesfürsten 4 ). Diese Aeußerungen, welche fortan die Hauptgrundlage aller Verhandlungen wurden, zeigen klar die Gesinnungen der Fürsten, mit der Entwickelung der Reformation das weltliche Wohl der Unterthanen zu fördern und das im Verderben begriffene und übel angewandte Kirchengut zur Hebung ihrer Diener und Familienglieder für rein politische Zwecke, namentlich seit Entwickelung des Staatsgrundsatzes der Primogenitur, zu benutzen.
Die Reformation nahm in Meklenburg ihren ruhigen, aber festen Gang. Als endlich die "Abgötterei" in den bevorzügten Stiftern kein Ende nehmen wollte oder die geistlichen Herren die verarmten oder verödeten Stiftungen feige verließen, hob der kräftige und einsichtsvolle Herzog Johann Albrecht I. sie im Jahre 1552 zum größten Theile auf. Bei dieser Gelegenheit nahmen die Johanniter=Priorei Eixen 5 ) dem Wesen und die Comthurei Mirow 6 ) der Form nach ein Ende.
Von allen katholischen Stiftungen im Lande wehrte sich die Comthurei Nemerow am längsten gegen die weltliche Macht und giebt ein lebendiges Bild von dem Uebergange der ältern Verhältnisse zu einem neuen Zustande.
Im Jahre 1545 hatte der Herzog Albrecht den Joachim Queiss für den Todesfall des als fehdelustig und ränkevoll geschilderten Aschwin von Kramm zur Comthurei empfohlen,


|
Seite 51 |




|
hatte jedoch mit seiner Bitte keine Erhörung bei dem Heermeister gefunden.
Die Comthurei war im Anfange des Jahres 1552 erledigt. Da starb der Herzog Heinrich von Meklenburg und sein ältester Neffe, Herzog Johann Albrecht, ergriff auf einige Zeit allein das Steuerruder der Regierung, mit dem festen Vorsatze, der "Abgötterei" überall ein Ende zu machen. Zu gleicher Zeit sah er klar ein, daß auch seine politische Existenz durch den Kaiser bedrohet sei. Kaum war er zur Regierung gelangt, als er mit seinem Bruder Georg im März des Jahres 1552 dem Kurfürsten Moritz zuzog und durch den siegreichen Feldzug in Tyrol dem darauf erfolgenden Vertrage von Passau den "wirksamsten Nachdruck" gab. Ehe er den Feldzug eröffnete, gab er (am 29. Febr.) seinem Canzler Johann von Lucka, der ihn auf der Heerfahrt begleiten sollte, die Johanniter=Priorei Eixen, hob die beiden wichtigsten Klöster, die Cistercienser Mönchs=Feldklöster Dargun (am 6. März) und Doberan (am 7. März) auf, und begann bald darauf den Heereszug, während dessen er nach Schwerin hin die allgemeine Kirchenvisitation vom Jahre 1552 anordnete 1 ). Kurz vor seinem Abzuge hob er, nach seinem Willen, am 14. März auch die Comthurei Nemerow auf, indem er sie mit kurzen Worten seinem Lehnmann Joachim von Holstein auf Ankershagen, der ihm als Hof= und Kriegsrath diente, auf drei Jahre einthat, ohne auch nur des Ordens zu erwähnen 2 ). Als der Herzog wieder heimgekehrt war, gerieth er bald mit seinem nächstfolgenden Bruder Ulrich in Streit wegen der Landestheilung; namentlich entspann sich ein besonderer Streit wegen der Comthureien, die sie nicht länger bestehen lassen wollten und factisch aufgehoben hatten. Beide Herzoge schickten Gesandte nach Nemerow, um Besitz zu ergreifen; H. Ulrich behauptete sich in demselben und H. Johann Albrecht stand ab, indem er sich mit Kraak und Eixen begnügte. Der H. Ulrich ließ nun ein Inventarium von der Comthurei aufnehmen und verlieh sie ebenfalls dem Joachim v. Holstein, der sich an die Herzoge hing, um die Superiorität des Ordens zu umgehen und die vom Herzoge Johann Albrecht durch die unbedingte Verleihung an ihn decretirte Säcularisirung ganz wahr zu machen. Da klagte der Heermeister gegen den Herzog beim Reichskammergericht. Nun ließ sich Holstein in den Orden einkleiden und bat, durch die Fürsprache des Kurfürsten


|
Seite 52 |




|
von Brandenburg unterstützt, bei dem Heermeister um Verzeihung. Alles dies geschah, wie es scheint, ohne Vorwissen des Herzogs; durch diese Schritte wurden aber, vor der Ordensbehörde die Handlungen der Landesfürsten vereitelt. Um nicht viel Aufhebens von der Sache zu machen, war der Heermeister Thomas Runge, nachdem er im December 1552 "zehn Reuter" ohne Erfolg nach Mirow und Nemerow geschickt hatte, klug genug, dem J. v. Holstein am 17. April 1453 die Comthurei Nemerow und die Priorei Braunschweig zu verleihen und ihm die Anwartschaft auf die Priorei Goslar nach dem Ableben des Hans Rohr zu geben 1 ). Holstein that hierauf stets getreu seine Ordenspflicht, erlegte die jährlichen Responsgelder an den Heermeister und zog zum Ordens=Capital, so oft er gefordert ward. Der Herzog Ulrich, der den genauern Hergang nicht wußte, war mit der Verleihung der Comthurei an J. v. Holstein zufrieden und bestätigte am 3 Febr. 1555 den J. v. Holstein im Besitze von Nemerow 2 ), unter Reservirung der dem Fürsten gebührenden Gerechtigkeiten; Holstein war nun auch fürstlicher Rath und der Herzog erneuerte Ostern 1567 seine Bestallung zum Kriegs= und Hofrath zu Geschäften innerhalb und außerhalb Landes, wobei er ihm auch die Ablager von Nemerow abtrat. Aber es erlosch in der That mit der Verleihung an Holstein das Wesen der Comthurei, indem ihre geistliche Verfassung aufhörte, die Ordensregel wegfiel und der Bruder=Convent mangelte; die Comthurei ward weltlich 3 ) und eine Pfründe für einen fürstlichen Diener, so sehr sich auch Holstein dem Heermeister unterwarf und ihm selbst mit Rath diente 4 ).
Dieser Hergang ward für die Folge sehr wichtig. Die Herzoge behaupteten, sie hätten durch Annahme der Comthurei vor dem Vertrage von Passau (Julii 1552) dieselbe säcularisirt und durch den ruppinschen Machtspruch (vom 1. Aug. 1556) seien die säcularisirten Commenden unter ihnen getheilt. Factisch verhielt sich allerdings die Sache so: die Comthurei
und"Es sei keine Compterei rechthengig, da Mirou; die andern seien vorm passowischen vertrag eingenommen,
ausgenommen Myrow, die andern alle vorm passowischen Vertrag eingezogen worden, daran nunmehr niemandt keine Forderung oder "gerechtigkeit weiter hat."


|
Seite 53 |




|
Nemerow war vor dem passauer Vertrage von den Herzogen vergeben, darauf auf Lebenszeit mit ihrem Rath besetzt, den sie wiederholt in Rathspflicht nahmen, und bei der Theilung der geistlichen Güter zwischen den Herzogen Johann Albrecht I. und Ulrich durch den unter Leitung des Kurfürsten von Brandenburg gefällten ruppinschen Machtspruch an den Herzog Ulrich von Meklenburg=Güstrow gefallen. Der Heermeister sah dagegen die Sache so an, daß er einen Comthur zu Nemerow habe, den er zur Erfüllung der Ordenspflicht anhielt.
Joachim v. Holstein, der ein ruhiges Regiment führte, starb im Julii 1572 mit Hinterlassung einer Wittwe. Der Herzog Ulrich war nach Dänemark gereiset und hatte die Regierung des Landes seinen heimgelassenen Räthen anvertraut. Sogleich ward den Amtleuten zu Stargard Befehl gegeben, die Comthurei einzunehmen 1 ), bis auf weitern Bescheid einen Vogt einzusetzen, jedoch fremde Habe und Holsteins Nachlaß zu schützen. Bald, am 9. August, erschienen auch Gesandte des Ordens, die beiden Ordens=Secretaire Joachim v. Hondorf und Valentin Paulin; sie gaben zuerst vor, daß sie Responsgelder holen wollten, als sie aber mit erheucheltem Erstaunen erfuhren, daß der Comthur gestorben sei, baten sie um Herberge, da sie nur sehen wollten, wie die Sache eingerichtet werde; auf ihr "freundliches und fleißiges Anhalten ward ihnen für eine kurze Zeit Herberge zu Nemerow gegönnt"; doch verschloß man ihnen das Haus. Sie begnügten sich zuerst mit allem, und als die Lebensmittel zu Nemerow beim Mangel einer Wirthschaft ausgingen, verschafften sie sich dieselben von Neu=Brandenburg, endlich aber erklärten sie, "sie würden nicht eher weichen, als bis sie von ihrem gnädigen Herrn dem Heermeister abgefordert oder mit lauter Gewalt davon geschlagen und verjaget würden; aber bevor sie wichen, wollten sie sich eher in Stücke zerreißen lassen." Jetzt gestattete der stargardische Amtmann, auf den Befehl des Herzogs Ulrich, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, ihnen nicht das geringste, nicht einmal weder Brot und Bier, noch Stroh und Hafer, und verhinderte sogar, daß sie sich für ihr Geld Lebensmittel aus der Stadt holen ließen, mit dem Hinzufügen, "das Haus Nemerow sei kein Wirthshaus". Der Herzog Ulrich wiederholte den strengen Befehl einer gänzlichen Absperrung, da er vermuthe, daß von seinem Bruder Herzog Johann Albrecht "allerhandt Practiken darunter versucht würden". Also wurden sie am 12. Sept. 1572 "nicht durch oder mit


|
Seite 54 |




|
"Gewalt, sondern durch den Hunger und Durst wieder von dem Hofe gejagt." Sie zogen nach Gr. Nemerow zum Schulzen, um hier des Herzogs eigenen Bescheid abzuwarten, mit dem Vorsatze, nicht eher den Grund und Boden der Comthurei zu verlassen, bis sie nach ihrem Sinne befriedigt seien. Eigentlich aber erwarteten sie den neuen Comthur in wenig Tagen "mit 30 Pferden", um ihn mit Güte oder Gewalt an die Comthurei zu weisen. Der Ritter J. v. Hondorff erklärte auch, "wenn man sich etwa bedünken lasse, sie seien zu schwach, so werde er sich zum Heermeister (Grafen Martin von Hohenstein) begeben, der wohl 300 Pferde zusammenbringen werde", um die Einweisung des Comthurs durchzusetzen. - Man sollte dergleichen Vorgänge im Jahr 1572 kaum für möglich halten. Der Orden war damals aber in bedrängten Verhältnissen. In Meklenburg waren die Comthurei Kraak und die Priorei Eixen unrettbar verloren und den Comthureien Mirow und Nemerow drohete ein gleiches Schicksal, wie jenen Stiftungen. Schuld hieran war das Regiment der letzten Heermeister Thomas Runge und Franz von Nauman (1564-1569), von denen der letztere durch Schwäche und Unredlichkeit dem Orden vielen Schaden that. Auch mit Pommern waren über Form der Huldigung und Nomination Streitigkeiten entstanden, in Folge deren der Herzog Barnim alle Ordensgüter mit Beschlag belegte. Aus dieser Noth rettete den Orden der tüchtige Heermeister Graf Martin von Hohenstein, Herr zu Schwedt (9. Jan. 1569 - 5. Mai 1609), der im J. 1571 dem Orden auch die pommerschen Besitzungen wieder gewann. (Vgl. (v. Medem) Gesch. der Stadt Schwedt in Balt. Stud. IV, 2, S. 116 flgd.)
Während der Zeit war vom Orden alles aufgeboten, um wirksame Mittel für die Erhaltung der Comthurei aufzufinden. Den Ordens=Gesandten war auch der Aufenthalt zu Gr. Nemerow verboten. Da schritt der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg am 14. Sept. 1572 bei dem Herzoge Ulrich ein, zeigte ihm an, auf seine Fürbitte habe der Heermeister seinem Hofmarschall Georg von Ribbeck vor zwei Jahren die Anwartschaft auf die Comthurei gegeben, und bat, diesen redlichen wohlverdienten Mann aufzunehmen; der Herzog Ulrich aber hatte Nachricht, daß J. v. Holstein die Comthurei, die er in den letzten Jahren ganz abgenutzt und verwüstet hatte, an G. v. Ribbeck verhandelt habe. Der Heermeister aber protestirte am 19. Sept. mit aller möglichen Feinheit und Höflichkeit gegen das Verfahren der Regierung und entschuldigte es mit der Abwesenheit des Herzogs, mit dem Bemerken, daß die Comthurei nicht dem Herzoge, sondern dem Orden gehöre.


|
Seite 55 |




|
Der Herzog Ulrich - schickte dagegen den Rentmeister Gabriel Brüggemann zur Administrirung der Comthurei nach Nemerow; dieser rückte auch dort ein, beeidigte sämmtliche Bewohner der Comthurei auf den Herzog Ulrich und wies die Amtleute von Stargard an die Verwaltung. Auch der Herzog Johann Albrecht I., der schon im August die Hälfte der Comthurei hatte in Besitz nehmen lassen, wandte ein Auge auf die Comthurei für seinen Sohn Johann, "der nächstens in die Comthurei Mirow eingesetzt werden sollte"; ja es erschien sogar sein Hauptmann von der Osten aus Strelitz mit dem Ordens=Secretair vor den Amtleuten zu Stargard, mit der Anzeige, der Herzog Johann Albrecht habe ihm befohlen, die Ordensgesandten in die Comthurei einzuweisen: auch gegen diese Anmaßung erließ der Herzog Ulrich den Befehl, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Gegen alles dies repräsentirte der Heermeister bei dem Herzoge Ulrich und erinnerte, daß die Entscheidung des Reichskammergerichts über die gewaltsame Aneignung der Comthureien, namentlich der Comthurei Kraak, noch nicht erfolgt sei, mit dem Vorwurfe, die Herzöge hätten sich seit 1550 bemühet, sich die Comthureien Nemerow und Kraak "zuzuhandeln", was nicht nöthig gewesen wäre, wenn sie ein besseres Recht, als er daran gehabt hätten. - Durch Vermittelung des Kurfürsten ward am letzten Tage des J. 1572 ein Tag zur Verhandlung in Wismar angesetzt. Der Kurfürst schickte seine Räthe Dr. Andreas Zoch und Hans von Kötteritz, der Heermeister den Comthur Peter Runge von Werben und den neumärkischen Syndicus Johann Beier, der Herzog Johann Albrecht I. seinen Canzler Husan und seinen Rath Andreas Mylius und der Herzog Ulrich alle seine Räthe. Der Kurfürst ließ auf Restituirung der Comthurei dringen und gestand den Herzogen nichts weiter als Ablager und Folge zu. Die Herzoge behaupteten die Possession, weil die Comthurei vor dem Vertrage von Passau "aus beweglichen und erheblichen Ursachen" eingezogen, J. v. Holstein von den Herzogen nach einem Inventarium eingewiesen sei, nach der fürstbrüderlichen Theilung die Klöster und Comthureien zwischen den Herzogen gleich getheilt und durch den ruppinschen Machtspruch ihnen zugesichert seien, so daß Kraak an den H. Johann Albrecht und Nemerow an den H. Ulrich gekommen, welcher letztere den J. v. Holstein in Rathspflicht genommen habe. Der Herzog Ulrich kenne übrigens gar kein urkundliches Recht des Ordens auf die Comthurei. Des Ordens Gesandte protestirten gegen diese Behauptungen, und - die Gesandten reisten unverrichteter Sache wieder ab.


|
Seite 56 |




|
In einer Sitzung, welche der Herzog Ulrich persönlich mit seinen sämmtlichen Räthen hielt, ward aber anerkannt, daß der Vertrag von Passau sich wohl nicht auf die Güter erstrecke, welche "weltlichen Standes Personen" gehört hätten; man rieth daher, die Intercession des Kurfürsten beim Orden in Anspruch zu nehmen, sich die Nomination eines Comthurs und dessen Beeidigung auf Rathspflicht, so wie die herkömmlichen Leistungen vorzubehalten und hierauf eine Erklärung an den Kurfürsten abzugeben. Diese gab denn auch der wohl meinende Herzog Ulrich am 16. Jan. 1573 dahin, "daß, da die Herzoge von Meklenburg von der Comthurei Nemerow Ablager, Jagden, Folge, freie Nomination des Comthurs und Verpflichtung desselben auf Rathsdienst, also eine quasi possessio der Comthurei hätten, er in Grundlage dieser Bedingungen seine Intercession annehmen wolle, jedoch bemerken müsse, daß die Holzungen und Gebäude der Comthurei sehr verwüstet seien, und er hoffe, daß der Heermeister den Vorschlag um so eher annehmen werde". - Die Wittwe Holsteins ließ sich zu einem billigen Vergleiche willig finden, da sie bei der schlechten Bewirthschaftung der Comthurei keine Aussicht hatte, viel zu erhalten, und noch viele Responsgelder rückständig waren. Der Heermeister ging nachgebend auf des Herzogs Vorschlag ein, so viel die Abgaben und Leistungen von der Comthurei betraf; aber die Nomination des Comthurs durch den Herzog erkannte er nicht an, "da er keinem Herrn und Fürsten im Reiche dergleichen Anmuthen bewilligen könne, jedoch werde er sich auf Fürbitten des Herzogs, wenn der Vorgeschlagene dem Orden sonst leidlich sei und nicht erhebliche Ursachen im Wege ständen, bei seinen Lebzeiten gerne willfährig finden lassen". Hierauf wolle er den Marschall Georg von Ribbeck einweisen lassen.
Jetzt entstand ein neuer Streit, der sich allein darum drehete, ob der Herzog oder der Heermeister die Comthure nominiren solle.
Der Kurfürst entschuldigte den Heermeister, daß dieser nicht in die Nomination durch die Herzoge willigen könne; er selbst maße sich in seinem Lande das Recht der Nomination nicht an, ungeachtet der Heermeister seine Residenz unter ihm habe; wenn auch der Heermeister aus Gutwilligkeit nachgebe, so werde er selbst, als des Ordens Schutzherr und Patron, es nicht gerne sehen. Er schlug nun vor, seinen zum Comthur erwählten Marschall zu nominiren; dann erhielten beide Partheien freilich ihr Recht. Der Herzog lehnte diesen Vorschlag mit dem Bemerken ab, auch der Kurfürst habe dem Orden nie "freie


|
Seite 57 |




|
Wahl" gelassen; Holstein habe sich ohne sein Wissen dem Orden verwandt gemacht: wäre es bei seinen Lebezeiten bekannt geworden, es würde nicht Ungestraft hingegangen sein. Der Herzog Johann Albrecht gab seine Anrechte an Nemerow, welches dem Herzoge Carl hatte zuwenden wollen, auf; dies "kam dem Herzoge Ulrich fast befremdlich vor", und er erbat sich für den Fall, daß Nemerow bei dem Orden bleiben würde, von seinem Bruder die Hälfte der Comthurei Kraak.
Da schrieb der Kurfürst am 16. Julii 1573 sehr barsch an den Herzog Ulrich: "er sehe es in Wahrheit nicht gerne, daß man den ritterlichen Orden mit undienstlichen Vorwendungen hin halte und dessen Prälaten das Ihrige vorenthalte, was ja dem Herzoge zum eigenen Unglimpf und dem Kurfürsten selbst zum Nachtheil gereiche; mit der brüderlichen Theilung werde er sich hoffentlich nicht entschuldigen, da diese Niemand präjudicirlich sein könne". - Doch der Herzog Ulrich gab nicht nach, vielmehr zürnte er darüber, daß "die Comthurei verkauft worden sei"; jedoch wenn er mit seinen Nachkommen durch einen Revers seiner Rechte versichert werde, so wolle er denjenigen, den der Meister vorschlage, in die Comthurei einweisen, sofern er zum Rathe geschickt sei. - Hierauf schickte der Kurfürst am 10. Aug. 1573 seine Räthe Otto v. Arnim und Hans Bueck nach Güstrow; der Herzog wiederholte hier sein letztes Anerbieten und willigte diesmal in die Annahme des Marschalls G. v. Ribbeck, unter der Bedingung, daß ihm für den nächsten Fall die Nomination zustehen solle.
Hierauf schickte der Kurfürst am 22. Aug. seine Räthe, Dr. Andreas Zoch, Professor der Rechte zu Frankfurt, und Andreas Greifenberg, zur Verhandlung, und am 30. August reversirte sich der Heermeister, Graf Martin v. Hohenstein, nach dem Ableben des Comthurs G. v. Ribbeck die Comthurei Nemerow demjenigen zu verleihen, den der Herzog von Meklenburg ernennen und binnen sechs Monaten zur Aufnahme in den Orden nach Sonnenburg schicken werde, vorausgesetzt, daß er paßlich sei, jedoch ohne Präjudiz für den Orden, versprach auch dem Herzoge Jagd, Ablager, Roßdienst, Steuer und Landfolge 1 ).
Am 15. März 1574 erschienen zu Güstrow der brandenburgische Gesandte A. Zoch, der Comthur Martin v. Wedel von Wildenbruch, der Comthur Abraham v. Grüneberg von Lago, der Ordens=Canzler Balthasar Reimar und der kurfürstliche Marschall Georg v. Ribbeck. Man verglich sich hier dahin, daß der Herzog sich die Einweisung als ein Recht vorbehalte;


|
Seite 58 |




|
Ribbeck leistete dem Herzoge den gewöhnlichen Eid und die Verabredung wegen des nächsten Nachfolgers ward angenommen. Am 1. April 1574 rückten des Heermeisters Gesandte mit dem neuen Comthur in Nemerow ein; es ward durch die Amtleute von Stargard, den Rentmeister Gabriel Brüggemann und einen Notarius über das Wenige, was von der langen Verwüstung übrig geblieben war, ein Inventarium aufgenommen, und der Comthur nach demselben eingewiesen; die Bauern wurden ihrer Pflicht gegen die Herzoge erlassen und dem Comthur vereidet.
So endigte der Streit, wie es - vorauszusehen gewesen war; jede Parthei erhielt der Form nach ihren Willen, jedoch in der That nicht ganz; und, was das Schlimmste war, für die Zukunft über den nächsten Fall hinaus war nichts festgesetzt. Die Hartnäckigkeit beider Partheien verlor die Hauptsache aus den Augen, in dem Bemühen, die Rechtsform für den Augenblick zu retten.
Während der letzten Jahre der Regierung Holsteins und während der Streitigkeiten war die Comthurei sehr verwüstet; der Orden machte an den Herzog Ansprüche auf die Restituirung der Abnutzung. Aber alle Verhandlungen und Gesandtschaften führten zu nichts.
Georg v. Ribbeck war reich und blieb in Berlin wohnhaft, ohne sich um die Verwaltung der Comthurei viel zu kümmern. Der Herzog Ulrich dachte daher ernstlich an die Vorbereitung zur nächsten Wiederbesetzung der Comthurei; er schickte also, auch in Folge der Bedingung des heermeisterlichen Reverses, seinen Rath Dr. Martin Bolfras mit seinem "Kammerdiener" 1 ), d. h. Kammerjunker Andreas Hünicke an den Heermeister nach Sonnenburg, um den letztern für den nächsten Successionsfall in den Orden einzukleiden. Der Heermeister verweigerte die Aufnahme Hünicke's in den Orden, weil erst die Comthure zu dieser Feierlichkeit verschrieben werden müßten, überhaupt aber die ganze Angelegenheit nicht in Ordnung, besonders die Abnutzung der Comthurei Nemerow zu restituiren sei. Endlich ward Hünicke aufgenommen:


|
Seite 59 |




|
"nachdem indeß her Abraham Grüneberg Comptor zu Lagow ankommen, als hatte S. G. zu der einkleidunge den andern Tag frühe vmb fünf schläge in der Kirchen ernandt, weill S. G. anderer Geschäfte halben eiligk verreisen müssen. Da man nun den 10. Sept. frühe in die Kirche kommen, hat sich der Her meister 1 ) in seinem Ordenshabit uff einen grossen Stuhl gesetzt gegen dem Altar über, der Pastor aber ist vor dem Altar gestanden und hat angefangen das Veni sancte spiritus zu singen. Unter dem Singen da hat Andreas Hünecken neben Her Abraham von Grünenberg vor den Altar knien müssen. Da sich nun solcher gesang geendigt, da hat Er Abraham von Grünenberg Andream Hünecken vor den Herrn Meister geführet, da er vor S. G. niederknien müssen, hat ihn der Herr Meister gefraget, was er begehrte; er geantwortet, daß er begehrte, in den ritterlichen Orden genommen zu werden, darauf er ihn acceptatione manus angenommen und ist ihm darauf das juramentum vorgelesen, das er auch öffentlichen vor dem hohen Altar schweren müssen. Darnach hat man das Ritterkleidt hergebracht und ihm das angeleget, darmit er abermalen neben Her Abraham vor dem Altar gekniet und Gott für solche Dignität gedanket. Darauf der Herr Meister von seinem Stuhl aufgestanden, sich das gulden Schwert reichen lassen und hat so knieend vor dem Altar Andreas Hünecken dreimal darmit über die schultern geschlagen und ihn darmit neben der Einkleidung zu einem Ritter des ritterlichen S. Johannes Ordens geschlagen und darzu gesagt: Das leidet von mir wegen des ritterlichen Ordens zu einer Einkleidunge und Aufnehmunge und sonsten von Niemandes Und gebrauchet den ritterlichen Standt und Schwerdt zu Gottes Ehren, Vertheidigung seins göttlichen Worts und zu allen ritterlichen Sachen. Darauf er wieder aufgestanden und ist ihm zu solcher Dignität vom Hern Meister, Her Abraham von Grünenberg und allen umstehenden Glück und Heil gewünschet worden, ita extemplo ad convivium discessum, ubi novo commendatori supremus


|
Seite 60 |




|
"locus in mensa datus et mecum prolixe satis acceptus est. Der Her Meister ist aber bald, wie er von der Einkleidung aus der Kirchen gegangen, ins Schiff gesessen und darvon gefahren und hat vices suas in prandio Her Abraham von Gronenberg befohlen, der es an nichts mangeln lassen."
Da G. v. Ribbeck sich um die Comthurei nicht kümmerte, so schlug ihm jetzt der Herzog vor, dem in den Orden aufgenommenen Andreas Hünecke, als seinem Successor, die Comthurei ganz oder gegen ein Miethgeld abzutreten. Obgleich Ribbeck noch nicht wieder in der Comthurei gewesen war, so lehnte er das Ansinnen doch ab.
Georg von Ribbeck starb im Jahr 1593 (vor Oct.). Der Heermeister berichtete am 8. Oct. an den Herzog Ulrich, daß er zwar seinen alten Kammerdiener Andreas Hünecken, zu Eickstädt erbgesessen, dem Fürsten zu Gefallen in den Orden aufgenommen und mit der Comthurei Nemerow providirt, diesem aber die Zeit bis zur Erledigung zu lange gedauert habe. Wirklich hatte Hünecke am 7. Jan. 1593 zu Berlin der Comthurei entsagt und Ludwig von der Gröben, des ältern Ludwig von der Gröben auf Cosseband (oder Cossebrad) Sohn, nach seiner Aufnahme in den Orden, die Anwartschaft auf die Comthurei erhalten. Da Hünecke jetzt gegen Erlegung einer gewissen Summe Geldes seinen Anrechten entsagen wollte, so bat der Heermeister den Herzog um die Einweisung des L. von der Gröben und bestimmte dazu sehr eilig den 22. Oct. 1593. Jetzt ging der Streit wieder an; der Herzog hatte durch die Einkleidung des A. Hünecke sein Recht erhalten, es aber durch dessen Resignation, die dieser freilich ohne des Herzogs Vorwissen nicht vornehmen durfte, zum Theil wieder verloren; es stand jetzt zur Frage, wer nominiren solle. Der Herzog Ulrich protestirte auch wirklich gegen diese Abtretung, von der er nichts wisse, da ihm die nächste Ernennung zustehe, und befahl den Amtleuten zu Stargard, die so eilig angesetzte Immission auf keine Weise zu gestatten. Diese fanden am 21. Oct. schon des Heermeisters Gesandte, den Ordens=Kanzler Dr. Balthasar Römer und den Secretair Joachim Niemann, mit dem Comthur L. von der Gröben zu Nemerow vor. Auf die Protestation der Beamten erklärten die Gesandten, sie wollten, da ihr Meister verreiset sei und daher des Herzogs Schreiben noch nicht erhalten habe, mit der Immission einstweilen einhalten. Die Gesandten blieben in Nemerow, bis dem Canzler Römer mündlich am 28. Oct. zu Güstrow erklärt ward: 1, die Abtretung von Hünecke an v. d. Gröben sei ohne Wissen des Herzogs


|
Seite 61 |




|
geschehen, 2, müsse v. d. Gröben erst die Rathspflicht leisten, 3, sei die Einweisung ein fürstliches Hoheitsrecht. Hiergegen erklärte der Canzler, daß 1, er den Vertrag mit Hünecke vorzeigen, 2, v. d. Gröben sich zur Rathspflicht willig zeigen wolle, 3, er aber das fürstliche Immissionsrecht bestreiten müsse. Ja, der Heermeister nannte am 9. Nov. die Abnahme der Rathspflicht vor der Immission und die Immission selbst eine Neuerung. Dennoch ließ man alles zu, wenn nur die Form gerettet ward, um den Frieden zu erhalten. Hünecke erhielt 1500 Thaler Abfindung, und Ludwig von der Gröben, der kaum 22 Jahr alt war, leistete am 17. Nov. 1593 dem Herzoge die Rathspflicht 1 ) und reversirte sich am 24. Nov. gegen den Heermeister 2 ), nachdem er am 22. Nov. von den Amtleuten zu Stargard in die Comthurei, als eine Prälatur des Fürstenthums Meklenburg, eingewiesen war; der Ordens=Canzler protestirte zwar formell gegen diese Immission, nahm jedoch den Comthur in Ordenspflicht.
Während der Regierung des Comthurs L. von der Gröben, welche ziemlich matt gewesen zu sein scheint, entstand ein neuer Streit wegen des Ablagers. Der Comthur offerirte dafür nach Herkommen jährlich 40 fl., welche die Herzoge nicht annehmen wollten. Der Comthur appellirte deshalb an das Reichskammergericht. Manche andere Streitigkeiten, z. B. über die Leistung der Rathspflicht an einen Fürsten oder an beide Herzoge, über die Ablehnung geforderter Ehrendienste bei Hofe, udgl. blieben ohne bedeutende Folgen, da L. von der Gröben sehr kränklich und die Comthurei so verwüstet war, daß der Comthur am 26. Julii 1619 die Zahlung der Ablagergelder verweigerte, weil er zu der Comthurei noch - 211 fl. und etliche Schillinge zuzubezahlen habe 3 ).
Ludwig v. d. Gröben starb am 20. Aug. 1620 im 49sten Jahre seines Alters.
Im August des J. 1621 nominirten des "Kurfürsten Johann Georg des Aeltern Statthalter" des Heermeisterthums Sonnenburg den Grafen Heinrich Vollrath von Stolberg zum Comthur. Der Orden stand jetzt auch in der Mark schon unter dem unmittelbaren Einflusse des fürstlichen Hauses, seitdem (1609-1625) die Markgrafen Friederich, Ernst, Johann Georg und Joachim Sigismund hintereinander und


|
Seite 62 |




|
darauf der Graf Adam v. Schwarzenberg, kurfürstlich=brandenburgischer "vornehmster Geheimer=Rath und Ober=Kammerherr" zu Heermeistern - erwählt wurden. Die neue Nomination des Comthurs von Nemerow war von Seiten des Nominirenden und des Nominirten wichtig genug, und der Vertrag mit dem Orden konnte so ausgelegt werden, daß dies Mal dem Orden das Nominationsrecht zustehe, da die Herzoge das letzte Mal nominirt hatten. Es geschah also diese Immission ohne irgend einen Widerspruch. Der Graf leistete am 20. Aug. 1621 zu Güstrow vor versammeltem Hofe den Rathseid. Am 22. Aug. erschien der Rath Dr. Johann Oberberg, vom Herzoge Adolph Friederich I., und der Canzler Dr. Johann Cothmann, vom Herzoge Johann Albrecht II. gesandt, da die Comthurei damals beiden Herzogen gehörte, zu Nemerow und immittirten mit den alten, herkömmlichen Reservationen und Protestationen den Ordens=Secretair Hieronymns Lindener, der dann den gegenwärtigen Grafen in Besitz setzte. Am 19. Oct. 1621 erließ der Herzog Johann Albrecht dem Grafen auf Lebenszeit das Ablager aus besondern Gnaden und der Graf reversirte sich, diese Erlassung als "ein besondere favor" zu betrachten.
Die Begebenheiten des dreißigjährigen Krieges äußerten ihre Wirkungen auch auf die Comthurei Nemerow. Kaum war Wallenstein im Jahre 1628 mit dem Herzogthume Meklenburg belehnt worden, als er auch von den Comthureien Mirow und Nemerow Besitz nahm. Die Veranlassungen der Besitznahme von Nemerow mochten verschiedener Art sein. Von Anfang an intendirte der Friedländer, im Geiste des bevorstehenden Restitutions=Edicts, alle geistlichen Stiftungen wieder zurückzufordern, welche nach dem Vertrage von Passau säcularisirt oder unter fürstliche Obhut gekommen waren, und zu diesen konnte man die Comthurei Nemerow rechnen, wenn man wollte. Dann betrachtete man die Johanniter=Commenden schon zu sehr als rein fürstliche Prälaturen und Lehne, und der Comthur Graf v. Stolberg hatte sich stets zu den Evangelischen gehalten. Gründe genug, um die Comthurei, die keinen Verfechter hatte, einzuziehen, obgleich der Comthur durch seinen Hauptmann Heinrich von Bissing dem neuen Herzoge bei der allgemeinen Huldigung auch hatte huldigen lassen. Noch ehe Wallenstein seinen Einzug in Güstrow hielt (27. Julii), erschien der herzogl. friedländisch=meklenburgische Regierungsrath Balthasar von Moltke (auf Toitenwinkel) mit dem Notarius Andreas Wedel zu Nemerow und nahm am 4. Julii 1628 "urplötzlich" von der Comthurei Besitz, weil sie "eine Pertinenz des Herzogthums Meklenburg" sei. Er hatte dabei laut bemerkt, der Herzog


|
Seite 63 |




|
von Friedland habe gutes Recht zur Einziehung, weil der Kaiser dem Herzoge das ganze Land Meklenburg mit allen Stiftern und Klöstern, wozu auch die, Comthurei gehöre, geschenkt und der Graf sich zu bösen Anschlägen gegen die Kaiserliche Majestät habe gebrauchen lassen. Der Hauptmann und der Küchenmeister der Comthurei wurden augenblicklich und ohne Ablohnung ausgewiesen, die übrigen Beamten auf den neuen Herrn beeidigt und alle Unterthanen zum Eide genöthigt. Der Bürger Lampert Went ward wieder zum Küchenmeister bestellt. Der Graf v. Stolberg wandte sich mit ohnmächtigen Bitten an die Herzoge von Meklenburg, die auch "auf gleiche Weise und unerhörter Maaßen ihrer Fürstenthümer und Lande entsetzt" seien, und wiederholt mit vergeblichen Vorstellungen an den Herzog von Friedland, ohne von dessen Räthen Antwort zu erhalten. Wallenstein ließ sich die Verwaltung seiner neuen Domainen auf das genaueste angelegen sein; er schickte daher auch seine Räthe nach Nemerow, welche hier am 1. Dec. eine sehr genaue und scharfe Verwaltungs=Instruction bekannt machten. Eine Bitte des Comthurs an den Herzog Georg von Braunschweig um Intercession nützte natürlich auch nichts.
Das feindliche friedländische Regiment bestand nicht lange; doch standen sich im Verlaufe des dreißigjährigen Krieges die Unterthanen bei der Gewalt der Freunde wahrlich nicht besser. - Nach dem Abzuge der Wallensteiner nahmen sich die Beamten von Stargard der Comthurei an. Kaum hatte aber der König Gustav Adolph von Schweden in Deutschland festen Fuß gefaßt, als er am 7. Novbr. 1630 zu Stralsund die Comthurei - dem Obristen Melchior Wurmbrand schenkte 1 ), weil


|
Seite 64 |




|
es königlich sei, Verdienste zu belohnen, und weil Wurmbrand seiner Comthurei von des Königs Feinden beraubt sei! Wurmbrand war freilich Johanniter=Ritter und auf die Comthurei Werben investirt worden; er hatte aber niemals den Anwartschaftsbrief (primarias preces) ausgelöset, noch beim Wechsel der Heermeister Confirmation nachgesucht: Wurmbrand hatte also so wenig Ansprüche auf den Besitz der Comthurei Nemerow, da der Comthur Graf v. Stolberg noch lebte, als der König von Schweden ein Recht, Güter in Meklenburg zu verschenken. Wurmbrand erschien erst am 2. April 1632 zu Nemerow, ließ den Bürgermeister D. Krauthof von Neubrandenburg kommen, zeigte diesem die Schenkungs=Acte des Königs von Schweden vor und forderte Gehorsam gegen dieselbe, d. h. die Ueberweisung der Comthurei, indem er meinte, der König habe durch seine siegreichen Waffen Meklenburg erobert, also nach Kriegsrecht Fug und Recht zur Verschenkung gehabt, um so mehr, da der König den Herzogen und den Ständen von Meklenburg wieder zu ihren Rechten verholfen habe. Auf erstatteten Bericht gaben die Herzoge eine abschlägige Antwort, hinzufügend, daß sie dem Obersten eine viel bessere Recompense gerne gönnten, diese Schenkung auch schnurstracks gegen die geschlossene Allianz gehe. Der Graf von Stolberg wandte sich an den Kurfürsten Georg Wilhelm von Brandenburg, der für ihn beim Könige Fürbitte that und dem Grafen das Vorschreiben zur persönlichen Einantwortung übermittelte. Auch an den Canzler Oxenstierna wandte sich der Graf. Da starb der König. Jetzt ward Wurmbrand noch halsstarriger und der Graf von Stolberg erklärte gegen die Herzoge, daß er sein Recht bis auf den letzten Blutstropfen vertheidigen werde. Erst am 15 Junii 1634 wurden auf Vermittelung des schwedischen Reichs=Canzlers beide Partheien zu Mainz dahin verglichen, daß der "Herr Melchior Wurmbrand, Freiherr zu Juleta, Ritter, der Königl. Majestät zu Schweden und des evangelischen Bundes bestallter Obrister, Commandant zu Donauwerth und Lauingen" auf geschehene Vertröstung dem Grafen von Stolberg die Comthurei wieder abtrat. Und doch machte im Jahr 1636 Wurmbrand wiederholte Ansprüche auf die Comthurei! Doch es kam noch schlimmer. Schon im Jahr 1635 hatte der Oberst


|
Seite 65 |




|
Forbes die Comthurei geplündert; darauf hatte der Oberst Douglas sie gebrandschatzt, der Oberst Plato alles Vieh ohne Ausnahme wegtreiben lassen, und endlich nahmen die Einquartirungen und Requisitionen kein Ende. Als aber des General=Majors Pfuel 3 Compagnien Reuter von Wrangels Heer die Comthurei gänzlich erschöpft hatten und mit Forderungen nicht abließen, da flehte der Amtsschreiber Ulrich Preuss den Herzog Adolph Friederich am 30. Junii 1637 "um Gottes Barmherzigkeit willen" um Beistand an. Und der Herzog konnte nichts weiter antworten: "können aber bei uns nicht absehen, wodurch solch Uebel noch zur Zeit abzuwenden, zumal Wir für Augen selbst ansehen müssen, daß Unsere und Unsers jungen Vettern und Pflegesohns Aemter und Unterthanen ebenergestalt auf den äußersten Grad erschöpft und zu Grunde gerichtet werden", - mit dem Hinzufügen, wenn er Mittel an die Hand zu geben wisse, wodurch der Comthurei geholfen werden könne, der Herzog sich gerne gnädig erzeigen wolle.
Als der Graf v. Stolberg am 4. Oct. 1641 zu Frankfurt a. M. gestorben war, empfahl zwar der Herzog Adolph Friederich den güstrowschen Räthen am 5. Nov. eine angemessene Verwaltung der Comthurei während der Sedisvacanz zu Sonnenburg und Nemerow; in der That aber kehrte sich über Jahr und Tag niemand an die Comthurei, sondern sie lag "gleichsam pro derelicto". Da nahm sich endlich im Jahre 1643 der Herzog Adolph Friederich I., in Vormundschaft für seinen Vetter und Pflegesohn, den jungen Herzog Gustav Adolph von Güstrow, der Comthurei an, damit sie nicht ganz zu Grunde gehe, und setzte einen Küchenmeister, Sigismund August Gildemeister, ein, die Pfründe zu administriren, damit die "noch hin und wieder steckenden wenigen Unterthanen nicht gar wegkämen, sondern wieder herbeigebracht und beibehalten würden", auch die Comthurei dem "Orden conservirt würde". In dieser Zeit 1 ) war auch vom Fürsten ein Prediger nach Gr. Nemerow berufen, obgleich dem Orden das Patronatrecht zustand. - Dennoch fanden sich mehrere Liebbaber zu der Comthurei: der Herzog Adolph Friederich hatte schon um die Exspectanz auf Mirow für seine Söhne in der Altersfolge und um Nemerow für seinen Neffen Gustav Adolph gebeten; jetzt aber bewarb er sich besonders für seinen zweiten Sohn Carl (damals 14 Jahre alt) um Nemerow, und der Ober=Commandant, Oberst Conrad von Burgstorff zu Berlin, der beim Kurfürsten in


|
Seite 66 |




|
großem Ansehn stand, auch bei dem Herzoge Adolph Friederich viel galt, hatte auch Empfehlungen darauf. Der Oberst Henning von Gristow hatte jedoch schon bei Lebezeiten des Grafen von Stolberg Anwartschaft auf die Comthurei erhalten und war vom Orden zum Comthur von Nemerow erwählt worden. Der Grund der Verzögerung der Wiederbesetzung der Comthurei lag aber darin, daß damals im Heermeisterthum Sedisvacanz war. Endlich nahm sich der Senior des Johanniter=Ordens, Georg von Winterfeld auf Neuhaus, Comthur und Landvogt zu Schievelbein, der Sache an und reiste mit einem Empfehlungsschreiben des Kurfürsten Friederich Wilhelm vom 22. Nov. 1644 zum Herzoge Adolph Friederich. Der Kurfürst und der Ordens=Senior stellten, wie es auch in der That war, die Ansprüche der beiden Mitbewerber als ziemlich grundlos dar und baten um die Einweisung des Obersten Gristow. Der Herzog gab unter der Voraussetzung, daß nach seinem Tode der Orden seinem Sohne die Comthurei Mirow verleihen werde, leicht nach und ließ dem Obersten am 3. Dec. 1644 durch den güstrowschen Canzler Johann Cothmann die gewöhnliche Rathspflicht zu Doberan abnehmen. Am 9. Dec. 1644 trafen von Seiten des Herzogs der Canzler Johann Cothmann und der Geheime=Kammer= und Lehns=Secretair Simon Gabriel zur Nedden, von Seiten des Ordens der Senior und Comthur Georg von Winterfeld und der Oberst Henning von Gristow zu Nemerow ein, um die Ueberweisung der Comthurei an Gristow auf die gewöhnliche Weise zu bewerkstelligen. Der Küchenmeister Gildemeister blieb aus der Comthurei. Aber der neue Comthur Gristow erfreuete sich des Glücks nicht lange; er starb vor dem Monat April 1646, und nun begann wieder eine Sedisvacanz, die von Streitigkeiten mit dem Ordens=Senior v. Winterfeld ausgefüllt ward. Der Herzog bewarb sich jetzt sehr eifrig um die Comthurei Mirow für seinen Sohn Carl und um Nemerow für seinen minderjährigen Neffen Gustav Adolph von Güstrow, für die sich auch die Königin Christine von Schweden beim Kurfürsten Friederich Wilhelm verwandte. Der schwedische Feldmarschall Torstensohn hatte jedoch nach Gristow's Tode die Comthurei Nemerow wieder occupirt und dort den Obersten Müller eingesetzt. Jetzt war die Ordensregierung geneigt, die Comthurei dem güstrowschen Prinzen einzuthun, wenn sich der Herzog Adolph Friederich zur Leistung der Ordenspflichten reversiren wolle. Bald aber ward allem Streit ein Ende und alle Bemühung überflüssig gemacht, indem durch den zwölften Artikel des westphälischen Friedens von 1648 "zu mehrer


|
Seite 67 |




|
Begnüg= und Erstatung aber des Hauses Mecklenburg sollen demselben die Commentureyen des ordens St. Johannis Hierosolymitani, Mirow und Nemerow, so in selbigem Herzogthum liegen, vermöge der Verordnung, so im V. Art. §. 9. exprimiret, zu ewigen Tagen, biß der Zwiespalt wegen der Religion im H. Römischen Reich beygelegt, abgetreten werden, und zwar der Schwerinschen linie Mirow, der Güstrowschen linie aber Nemerow, mit diesem beding, daß Sie besagten ordens bewilligung selbst zu Wege bringen, und demselben, wie auch dem Herrn Churfürsten zu Brandenburg, als dessen Patron, so oft sich der Fall begeben wird, was bißher geleistet worden, auch forthin leisten." Meklenburg mußte an Schweden die Stadt Wismar, die Insel Pöl und das Amt Neukloster abtreten, so schwer dies große Opfer auch dem Herzoge ward; es erhielt dafür, freilich in der Form Rechtens, was es schon besaß: die Bisthümer Schwerin und Ratzeburg und dazu die Comthureien Mirow und Nemerow. Die Bedingung, unter welcher die Comthureien abgelassen wurden, war, daß das Haus Meklenburg dem Orden und dem Kurfürstenthum Brandenburg die hergebrachte Pflicht leiste. Das Kurfürstenthum hatte weniger Rechte an den Comthureien, als vielmehr Pflichten gegen dieselben; denn der Kurfürst war nur Patron des Heermeisterthums, und daß das kurfürstliche Haus seine Glieder oder höchsten Diener längere Zeit hindurch zum Heermeisterthum verholfen und dadurch dieses indirect säcularisirt hatte, konnte das Kurfürstenthum nicht veranlassen, Rechte geltend zu machen. Der Kurfürst hatte jedoch in den Friedensverhandlungen wirklich der Säcularisirung der Comthureien widersprochen, bis er den Entschädigungsforderungen der Krone Schweden und der Verwendung sämmtlicher Reichsstände weichen mußte. Das Heermeisterthum hatte aber Rechte an den Comthureien: das Eigenthum, die Ernennung der Comthure und die Forderung der jährlichen Responsgelder. Das Eigenthum und die Comthurwahl gingen dem Heermeisterthume durch den Friedensschluß verloren; Meklenburg sollte die Einwilligung des Ordens in die Abtretung verschaffen: daß dieser die Einwilligung nicht geben würde, war vorauszusehen. Aber Meklenburg war durch den Friedensschluß zur Leistung der herkömmlichen Pflicht verbunden (ut ordini, quotiescunque casus evenerit, hactenus praestari solita porro quoque praestare teneantur). Wort und Sinn des osnabrücker Friedens bestimmten die Säcularisirung der Comthureien, reservirten jedoch dem Orden die Responsgelder und die Einwilligung. Die Verweigerung der Einwilligung von Seiten des Ordens konnte den Anfall der Comthureien an


|
Seite 68 |




|
das herzogliche Haus Meklenburg nach bestehenden Verhältnissen nicht hemmen. Die Zahlung der Responsgelder war aber eine nicht minder ungeschickte Bedingung, als die Forderung zur Herbeischaffung der Einwilligung des Ordens. Aber die Entrichtung der Responsgelder war einmal bestimmt.
Der Orden gab seine Einwilligung nicht, sondern setzte in der Form das frühere Verhältniß zu Meklenburg fort. Schon im April 1649 forderten Senior und Comthure des Heermeisterthums, bei dessen dauernder Sedisvacanz, nicht nur die seit 1622 rückständigen, sondern auch die laufenden Responsgelder, und droheten, auf Anforderung und Eingebung des Ordens=Receptors in Oberdeutschland, Wilhelm Herrmann von Metternichs, des Ordens=Groß=Balley zu Malta und des Meisterthums in Deutschland Statthalters, mit dem Kaiser und mit dem Könige von Frankreich, als General=Protector des ganzen Ordens; auch der Kurfürst Friederich Wilhelm und der Landgraf, nachherige Cardinal Friederich von Hessen, der im Jahre 1649 deutscher Meister geworden war, forderten an. Mirow restirte im Jahre 1650 29jährige Responsgelder mit 2900 rh. GG., Nemerow 26jährige mit 780 rh. GG. Der Herzog Adolph Friederich forderte dagegen vom Orden die Einwilligung zur Abtretung der Comthureien und versicherte, er habe die Zahlung der Responsgelder nie verweigert. Als nun im J. 1652 der Prinz Johann Moritz von Nassau=Liegen († 1679), des großen Kurfürsten Geheimer=Rath und Statthalter in Cleve, Minden, Mark und Ravensberg, Heermeister geworden war, forderte dieser die fälligen Responsgelder sogar mit dem Hinzufügen, daß "vermöge Vergleichs der Herzog die Comthureien auf Lebenszeit zu genießen habe"! Ja, dieser Heermeister ward immer kühner; nachdem der Herzog Adolph Friederich im J. 1658 gestorben war, forderte er, den westphälischen Frieden ignorirend, von dem Herzoge Christian I. Louis die Restituirung der Comthureien, indem er sich auf die frühern Verträge berief, nach welchen die Prälaturen nach dem Ableben des Herzogs an das Heermeisterthum zurückfallen sollten. Auf einem General=Capitel des Heermeisterthums zu Cölln an der Spree am 7. April 1662 forderte der Orden in einem vom Heermeister und allen Comthuren und Capitularen unterzeichneten Schreiben die Restituirung der Commende Mirow und die Zahlung der rückständigen Responsgelder. Zu gleicher Zeit begehrte auch der Kurfürst die Restituirung, da das Haus Meklenburg sich bei mangelndem Consense des Ordens durch den westphälischen Friedensschluß in dem Besitze der Comthureien nicht zu schützen vermöge. Diese Forderungen wiederholten sich bis zum J. 1671,


|
Seite 69 |




|
ja noch weiter, ohne daß der Orden Consens gab und der Herzog Respons entrichtete. Erst nach dem Tode des Kurfürsten Friederich Wilhelm und des Herzogs Christian Louis versprach der Kurfürst Friederich dem Herzoge Friederich Wilhelm am 12/22. Julii 1693, das Haus Meklenburg "von des Johanniter=Ordens Compterey=praetension in Ansehung des meklenburgischen, mit Cedirung der Stadt und Seehafens Wißmar, Pöl, Neu=Closter und Walfisch und vor alß auch nach dem Westphälischen und Nimwegischen Friedens=Schluß erlittenen großen Verlusts und Kriegs=Schadens liberiren und befreien zu helfen", für sich aber wolle er "diejenigen praestanda remittiren," welche er "als patronus ordinis schon jetzt oder noch künfftig von dem fürstlichen Hause Meklenburg fordern könnte". Durch den hamburger Vergleich von 1701 kamen die beiden Comthureien an die Linie Meklenburg=Strelitz. Seitdem schwieg der Orden; die neueren Vorgänge haben ihm den Mund gänzlich geschlossen.


|
Seite 70 |




|
Comthure von Nemerow.
| 1298-1318 | Ulrich Schwabe. |
| 1322 | Georg von Kerkow. |
| 1341 | Hermann von Warberg. |
| 1351-1355 | Graf Adolph von Schwalenberg. |
| 1358 | (Graf) Ulrich von Regenstein. |
| (1358-1365) | Albert von Warberg. |
| 1366 | Nicolaus von Lankow. |
| 1376 | Heinrich vom Kruge. |
| 1392 | Gödeke von Bülow. |
| 1404 | Partze. (Pentze?) |
| 1465-1466 | Engelke von Warburg. |
| 1474 | Joachim Wagenschütte. |
| 1480-1488 | Heinrich Buste. |
| (Bernhard) Rohr. | |
| 1506-1515 | Otto Sack. |
| 1523-1546 | Aschwin von Kramm. |
| 1552-1572 | Joachim von Holstein. |
| 1572-1573 | Sedisvacanz. |
| 1574-1593 | Georg von Ribbek. |
| 1593-1620 | Ludwig von der Gröben |
| 1621-1641 | Graf Heinrich Volrath von Stolberg. |
| 1641-1644 | Sedisvacanz. |
| 1644-1645 | Henning von Gristow. |
| 1645-1648 | Sedisvacanz. |


|
Seite 71 |




|
Erläuterungen
zu der Reihe der Comthure von Nemerow.
Der Stifter der Comthurei Nemerow, Ulrich Schwabe, kommt seit 1298 in den Urkunden der Comthurei Nemerow öfter vor. Zuletzt erscheint er Ostern 1315 zu Worthingborg als frater Olricus dictus Swawe commondator hosp. S. Johannis Jerosol. de Nemerow (Original=Urkunde im schweriner Archive) und 1318 als cummendur bruder Ulrich der Swawe tů Gardow unde tů Nemerow in Urk. bei Beckmann Joh. Orden S. 202 und in Höfer Deutschen Urk. S. 125. - Darauf kommt am 24. Mai 1322 der Comthur Georg von Kerkow in einer nemerowschen Urkunde vor. - Im Jahre 1341 war "Hermannus de Werberge commendator domorum Werben et Nemerowe, locum tenens reuerendi domini fratris Bertoldi de Henneberg, generalis praeceptoris Alemanie per Saxoniam, Marchiam, Slaviam, ordinis sancti Johannis", nach Riedels Diplomat. Beitr. zur Gesch. der Mark=Brandenb. I, S. 145. Dieser ist mehr als wahrscheinlich derselbe, welcher nach der nemerowschen Urkunde Nr. XIII. im Jahre 1347 Heermeister war und am 29. Sept. 1347 als solcher Nemerow besuchte und hier das Kloster Wanzka in die Fraternität des Ordens aufnahm. Vgl. Jahrb. II, S. 263. Der Name ist hier sicher Werberg, nicht Warburg. - Wahrscheinlich sein Nachfolger war der Graf Adolph von Swalenberg. Daß dieser Comthur ein Graf von Swalenberg war, geht aus einer Original=Urkunde des Klosters Wanzka im schweriner Archive vom ersten Sonntage des Advents 1353 hervor, in welcher die Zeugenreihe also beginnt: "greue Adolf van Swalenberghe eyn kummeldůr thů Nemerow, greue Otto van Vorstenberghe, her Herman Warborch" u. s. w. Die Urkunde stellt aus: "her Albrecht Warborch ridder vnde hoverichter des eddelen vortsten Johannes hertoghen thu Mekelnborch." Zuerst kommt er vor als Zeuge in einer mirowschen Urkunde vom 18. Dec. 1351: "broder Adolphus von Swalenberch cůmmendůr to Nemerowe", vgl. Jahrb. II, S. 263, und zuletzt erscheint er am 19. Aug. 1355 in einer nemerowschen


|
Seite 72 |




|
Urkunde Nr. XIV., auch in einer Urkunde des
Klosters Wanzka aus demselben Jahre:
"dominus Adolphus commendator in
Nemerow". - Am 25. Jan. 1358 war nach der
Urk. Nr. XVI. "broder Olrik van Regensten
cummendur to Nemerowe"; wahrscheinlich
stammte dieser aus der gräflichen Familie, da er
in der Zeugenreihe dem Grafen von Fürstenberg
jüngern Geschlechts vorgeht. - Nach Latomus vom
meklenb. Adelstande soll in den Jahren 1358 und
1365 Albrecht von Warberg, ein Bruder des
obenerwähnten Heermeisters Hermann von Warberg,
Comthur zu Nemerow gewesen sein; Latomus sagt
nämlich: "Herrmann Warburg ist ein gemeiner
Beter in Sachsen
 . und sein Bruder Albrecht Comthur
zu Nemerow worden ao. 1358 und 1365;" vgl.
Schröder P. M. I, 1379. Latomus, der allerdings
viel aus Quellen schöpfte, verwechselt hier aber
ohne Zweifel die Warburg mit den Warberg. Das
stargardische Geschlecht der Warburg blühete zu
der Zeit, und Albert Warborch kommt als Ritter
sehr häufig vor, aber nie als Ordensbruder oder
Comthur, es könnte denn sein, daß der Hofrichter
des Herzogs Johann in den Orden getreten wäre.
Aber die Verwechselung
1
) beruht gewiß darauf, daß neben dem
. und sein Bruder Albrecht Comthur
zu Nemerow worden ao. 1358 und 1365;" vgl.
Schröder P. M. I, 1379. Latomus, der allerdings
viel aus Quellen schöpfte, verwechselt hier aber
ohne Zweifel die Warburg mit den Warberg. Das
stargardische Geschlecht der Warburg blühete zu
der Zeit, und Albert Warborch kommt als Ritter
sehr häufig vor, aber nie als Ordensbruder oder
Comthur, es könnte denn sein, daß der Hofrichter
des Herzogs Johann in den Orden getreten wäre.
Aber die Verwechselung
1
) beruht gewiß darauf, daß neben dem
Die v. Warburg gehören zu einem meklenburgischen Geschlechte, welches seit dem 13. Jahrhunderte bis auf die neuern Zeiten wohl ausschließlich im Lande Stargard angesessen gewesen ist und dessen Glieder namentlich im 14. Jahrh. häufig vorkommen. Sie führen im Schilde: einen Queerbalken mit drei Rosen belegt.
Die v. Warberg gehörten zu einem alten braunschweigischen Geschlechte, deren Burg zu Warberg, nicht weit von Helmstädt, stand. Die Glieder dieser Familie kommen in den Gütern und Stiftern nördlich vom Harze häufig vor. Sie führten einen verhauenen Lindenstock mit drei Wurzeln und zwei Blättern im Schilde. Das Geschlecht starb 1654 aus. Vgl. Lenz Historische Abhandlung von den edlen Herren von Warberge, in den Hannoverischen Gelehrten Anzeigen, 1751, Nr. 37 und 38, (vgl. 1750, Nr. 32 und 33), wiederabgedruckt in A. F. Schott Jurist. Wochenbl., Th. IV, und in dessen Magazin für Rechtsgelehrs. und Geschichtsk. I, S. 252. Vgl. Meding III, S. 911.
Zu diesem letztern Geschlechte der von Warberg gehörte der ehemalige Comthur von Nemerow und nachmalige Heermeister zu Sonnenburg, Hermann von Warberg, und dessen muthmaßlicher Bruder, der spätere Comthur von Nemerow, Albert von Warberg. Noch mehr wird diese Ansicht dadurch unterstützt, daß Hermann von Warberg, der im J. 1371 gestorben sein soll, auch Comthur zu Supplenburg gewesen ist; vgl. Lenz a. a. O., S. 478. Ihm folgte in der Comthurei Supplenburg ebenfalls, wie in der Comthurei Nemerow, Albert v. Warberg; vgl. Lenz a. a. O., S. 480. Die v. Warberg kommen nur durch den Johanniter=Orden und besonders durch die Comthurei Nemerow in die meklenb. Geschichte, und werden dadurch, daß gleichzeitig neben ihnen auch ( ... )


|
Seite 73 |




|
Albert Warburg auch ein Hermann Warburg vorkommt, grade wie bei den Warbergen. Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, daß des ehemaligen Comthurs von Nemerow und Statthalters des Heermeisters und des nachmaligen Heermeisters Bruder wieder Comthur zu Nemerow geworden sei. - Dieser Comthur Albert von Warberg wird derselbe sein, der nach der Urk. Nr. XVII. am 9. Nov. 1376 Comthur zu Supplenburg war. Im 14. Jahrhundert kommt nach den deutlichen Original=Urkunden kein Warburg als Comthur vor. Ebenfalls nach Latonus war im Jahre 1366 Claus von Lankow aus einem stargardischen Geschlechte Comthur. - Nach der nemerowschen Urk. Nr. XVII. war Heinrich vom Kruge am 9. Nov. 1376 Comthur. - Im Jahre 1392 war Götke von Bulow Comthur, nach Hacke Gesch. der Stadt Neubrandenburg S. 53. - Im Jahre 1404 war "Partze compter zu Nemerow" nach v. Westphalen Spec. p. 186, Klüver II, 651, und v. Behr Rer. mecl., L. III. p. 437; Pistorius im Geschlechte der v. Warburg macht Penze daraus. Ein Achim Pentze kommt in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. im Lande Stargard öfter vor. - Im 15. Jahrhundert werden die Comthure selten genannt. Im Jahre 1466 war ein Engelke Warburg (nicht Marburg) Comthur zu Nemerow, nach Schröder Pap. Mekl. S. 2180. Diese Nachricht hat Schröder aus Latomus. Unwahrscheinlich ist dies nicht; in den Jahren 1421 und 1429 war nach Original=Urkunden im schweriner Archive in Engelke von Warburg Comthur von Mirow; die Namen Hermann, Albert und Engelke waren in der Familie Warburg vorherrschend. - Im Jahre 1474 war der Comthur Joachim Wagenschütte (vgl. Jahrb. II, S. 84.) von Mirow zugleich Comthur von Nemerow nach der Urk. Nr. XIX. Nach der Urk. Nr. XX. war im Jahre 1480 Heinrich Bust Comthur. Im J. 1506, am Sonnt. nach Vis. Mar., trat Otto Sack, "comptor to Nemerow", nach einer Original=Urkunde, in Neu=Brandenburg als Bürge für den Herzog ein. Auf ihn folgte oder ihm ging vorauf ein Comthur Rohr; wenigstens geht aus der Beschwerdeführung vom J. 1529, beim Dorfe Wokuhl, hervor, daß nicht lange vor dem J. 1529 ein Comthur dieses Namens in Nemerow existirte; vielleicht ist dies Claus Bernhard Rohr, Dr. des kanonischen Rechts, der im J. 1490 auch Comthur zu Wildenbruch war, wie Latomus nach Cramer chron.
Hiernach werden alle die vielen in unserer Geschichte vorkommenden Verfälschungen zu berichtigen sein.


|
Seite 74 |




|
eccl. berichtet. - In der Zeit von 1523 - 1546 stand Asche oder Aschwin von Cramm(e), der drei Lilien im Siegel führt, nach Actenstücken, der Comthurei vor. Nach der Beschwerdeführung vom J. 1529, Beil. Nr. 3, beim Dorfe Gnewitz, war er damals gewiß 6 Jahre Comthur, und am 1. Aug. 1523 unterschrieb er die Union; denn der "Asche Kammerwetter", wie in dem Abdrucke steht, kann kein anderer als "Asche Kramme comter" sein. Es ist die Frage, welcher Aschwin von Cramm Comthur von Nemerow gewesen sei. Bekannt ist der Kriegs=Oberst Aschwin von Cramm 1 ), einer der gewaltigsten Kriegshelden seiner Zeit. Er stammte aus der alten, mit Gütern und Würden begabten, braunschweigischen Familie von Cramm (zu Cramme bei Wolfenbüttel) und war um das J. 1480 geboren. In der Pfingstwoche 1510 sandte "Aske von Kram" der Stadt Goslar einen Fehdebrief 2 ). Schon früh dem Kriegsdienste ergeben, führte er dem Könige Franz I. 6000 deutsche Söldner zu und half mit diesen am 14. Sept. 1415 die Schlacht bei Marignano entscheiden. Heimgekehrt führte er in der Schlacht auf der Soltauer Haide am 29. Junii 1519 die Reiterei zum Siege 3 ) und im J. 1523 zog er mit dem Herzoge Friederich von Holstein zur Eroberung der dänischen Krone nach Kopenhagen. Von 1524 - 1528 lebte Aschwin am sächsischen Hofe. Als er im J. 1528 mit dem Herzoge Heinrich d. J. von Wolfenbüttel dem Kaiser Carl V. eine Schaar nach Italien zuführte, floh das Heer vor der Seuche auseinander; auch Aschwin floh, von dem Pesthauche berührt, und erlag in Chur im J. 1528, an demselben Tage, als er erfuhr, daß seine Frau, Margarethe von Brandenstein, im Kindbette gestorben sei. Er hinterließ 2 Söhne, Heinrich und Aschwin, von denen Heinrich im jugendlichen Alter zu Padua 1545 starb. Aschwin d. J. diente unter dem Kurfürsten Moritz von Sachsen. Dieser hinterließ einen Sohn gleiches Namens, welcher im, J. 1578 die Aschwinsche Linie der Cramm beschloß.
Nach diesen Begebenheiten kann von 1528-1546 nur der jüngere Aschwin (IV.) von Cramm, des Kriegs=Obersten Sohn, Comthur von Nemerow gewesen sein, und es wäre nur möglich, daß der Vater von 1523-1528 sein Vorgänger gewesen sei, was jedoch nicht wahrscheinlich ist. Die Unterschriften seiner Briefe sind fast alle verschieden, so daß man


|
Seite 75 |




|
glauben muß, er habe sie mit der Unterschrift immer von Schreibern ausstellen lassen. Auch war der Comthur Aschwin gewöhnlich im Lande.
Es kann auch des ältern Aschwin Bruder, der ebenfalls Aschwin hieß, Comthur zu Nemerow gewesen sein. Auf dem Turnier zu Lüneburg 1518 kommen beide wiederholt vor, einmal auch zusammen: "Asch von Kram Ritter vnd Asch von Kram gebruder gerent, beid gern gfallen;" wenn sie einzeln vorkommen, heißen sie: "Asch von Kram Ritter" und "Asch von Kram der jünger."
Der Name seines Nachfolgers, Asche von Holl, läßt sich nicht ganz bestimmt verbürgen: wahrscheinlich soll dies schon Achim oder Joachim von Holstein sein.
Die Comthure von 1552 bis 1648 sind actenkundig und finden ihre Geschichte oben in der Erzählung.
Das Siegel der Comthurei (Vgl. Urk. Nr. XIII.) ist elliptisch und klein, 1 1/2'' lang: im leeren Siegelfelde steht St. Johannes der Täufer und neben ihm das Lamm; Umschrift:



|
Seite 76 |




|
Beilagen
zur
Geschichte der Comthurei Nemerow.
Nr. 1.
Nachuorzeigente
vnplicht
wird Sanct Johans huse im
eigenthumb
zu Nemerow
uffgelegt vnd genommen.
(Ungefähr vom J. 1500).
Im dorpe Groten Nemerow.
I
c
marck vinckenougen penning.
II
vette kw islich.
IIII schape.
II w.
Rocken.
II w. Habern.
XI gense.
XXIIII honer.
Item den vogten, so offte sy kamen, vthrichtung to thunde.
Item ock muten de armen lude dienen gegen Strelitz,
wen in geboden wird, vnd welcher nicht kumpt, wird up dat alleruterste gepandet.
Item den jhegern, so offt sy komen, uthrichtung to thun.
IIII schapel habern muten sie ock geben von ieder houen, wen
en dat geboden wird.
Item ock muten sie geben vette offen, wenn en dat geboden wirdt.
Im dorpe Wucule.
I w. habern.
 w. rocken.
w. rocken.
XVI marc
vinckenougen penning.
II schape.
II
lemmer.
I veth rinth.
I virtel puttern
mus de schulte geben.
Im dorpe Gudendorpe.
I w. habern.
 w. rocken.
w. rocken.
I veth Rinth.


|
Seite 77 |




|
II schape.
II lemmer.
I schog
eier.
IX marc vinckenougen penning.
I
virtel puttern mus de schulte geben.
Im dorpe Dabelow.
XIII
 marc vinckenougen penning.
marc vinckenougen penning.
I
vetten ossen.
IIII schape.
I w.
habern.
I w. Rocken.
I hun
iederman.
I schog eier.
I virtel puter
mus de schulte geben.
Im dorpe Gnewise.
XIII
 marc vinckenougen penning.
marc vinckenougen penning.
I
veth rinth.
II schape.
II w. habern.
 w. rocken.
w. rocken.
I schog
eier.
I hun iederman.
I virtel puter
mus de schulte geben.
Im dorpe Rouen.
L marc vinckenougen penning.
XVIII marc de
se ock muten geben.
I vat biern.
XV
schape.
X gense.
XI huner.
Item wen die fursten gegen stargard oder strelitz
kamen, muten de lude geben, so uil eier von in
gefordert werden.
1 vette kw.
Im dorpe Stouen
mussen die armenlude ock geben de bede, de sy vor
ny gegeben hebben,
(von einer andern Hand,
wahrscheinlich eines fürstlichen Dieners,
ist hinzugefügt:
In den vorgescreuen dorppe hebben myne g. h. dat affleger mit den Jegern hatt vnd by myner g. h. vaders tiden ouer XC jaren vnd noch darinne hebben.)


|
Seite 78 |




|
Nr. 2
Gnedigenn furstenn
vnnd Hernn.
Onangesehenn des
Ordenns Irer Dorffer vnnd gutter
freiheit, begnadungk vnnd Eigenthumb
sein
folgende beswerungk
vff
die gutter kommen.
(Am 4. Jan. 1515 von dem Heermeisterthume Sonnenburg eingereicht.)
Inn der Comptorey Nemerow.
Inn denn Dorffernn Grossen Nemerow, Roue, Dabelow, Gudenndorff, Gnewiczt vnnd Wokule mussenn die Armenleutt dienenn so offt als man inenn zwsagtt, gemeiniglich alle wochenn vier tage kommenn. E. f. g. abnehmenn, ob es gleich sey, vnd was ein Comptor von inenn magk haben, vnd ob sie es die Lennge ertragenn konnenn.
Darzw mussen sie gebenn die ketzter bethe, Ist
eins mals auffbracht im Nahmen wieder die
ketzter zu ziehenn vnd bleibett nu vmmer fordt,
wiewoll die Armenn Lewtt dar soldenn frey sein,
nach anzeigunge der Priuilegienn.
Vnnd
mussenn gebenn Sunderlich wihe folgett:
Grossenn Nemerow.
XXIII fl. 1 ortt Bede.
XLII scheffel
Rogkenn.
XLII scheffel haffernn.
Einen
kochenn ochsenn.
IIII schaffe.
VIII Genße.
Denn Jegernn Eine thunne byr, IIII pfundt
bottern, IIII hunre aus dem Hauese,
 scheffel haffern, X brot, ein
vierdenteyl von einem Schaffe.
scheffel haffern, X brot, ein
vierdenteyl von einem Schaffe.
Zw Roue.
V fl. Bede.
III
 margk dem kwre.
margk dem kwre.
Einen
ochsenn.
III schaffe.
II tonnen byr.
Den Jegernn I Tonne byr, III pfundt bottern, Irer zwey
ein hun, 1 firtel haffern, IIII garffenn, X brott aus dem haueß,
Sweinskop, der schultze
tonne Byr.


|
Seite 79 |




|
Zw Dobelow.
XIII
 margk Bede.
margk Bede.
ein Wispill
Rogkenn.
I w. haffernn.
I
Ochsenn.
IIII Schaffe.
I schogk
Eyher.
aus dem Hauese ein Hun.
Der
Schultze I firteyl bottern.
Den Jegerenn die Pawern
 tonne byr, der Schultze
tonne byr, der Schultze
 firtel Byher, viher I pfunt,
bottern, Zwe I hun,
firtel Byher, viher I pfunt,
bottern, Zwe I hun,
 Sweinskop,
Sweinskop,
 scheffel haffernn, Aus dem hause
X brott.
scheffel haffernn, Aus dem hause
X brott.
Zw der wiltjacht alle jar mit achtt pferdenn die netzte zw furenn acht tage langk.
Der Schultzte vihr groschen zw dem wulwaghenn.
Zw Gudendorff.
IX margk Bede.
Die Pawer:
Ein dromet Rogkenn.
I winspill haffernn.
einen kochenn ochsenn.
II Schaffe.
Aus dem Hause:
ein hun.
I schogk Eyher.
I vyrteyl Bottern.
IIII Gr. zw dem wulwaghenn.
Den Jegernn Eine halbe tonne byr, Aus dem Hause X
broth,
 scheffel haffernn, I stugke
fleisches, I hun, Aus dem gantzenn dorffe II
pfundt bottern. Zw der wylth Jacht acht pferde
scheffel haffernn, I stugke
fleisches, I hun, Aus dem gantzenn dorffe II
pfundt bottern. Zw der wylth Jacht acht pferde
 .
.
Zw Gnewitz.
XIIII margk Bede.
 winspil Rogkenn.
winspil Rogkenn.
I winspill
Haffernn.
Einen kochenn Ochsenn.
II
Schaffe.
Aus dem Hawse X Eyer, I hun.
Der Schultze IIII groschenn zw dem wulwagenn.
Denn Jegernn: der Schultze ein fierteyll byr. Die
Pauer Eine halbe tonne byr. Aus dem Hawse X
broth,
 pfundt bottern, 1 Hun,
pfundt bottern, 1 Hun,
 scheffel haffernn, I stugke
fleisches, VII pferde zw der hirsche Jacht.
scheffel haffernn, I stugke
fleisches, VII pferde zw der hirsche Jacht.


|
Seite 80 |




|
Zw Wockule.
Jtzlicher Pawer: XV gr. Bede.
 Winspill Rogkenn.
Winspill Rogkenn.
Die
Pawernn:
Ein kochen Rindt.
II
Schaffe.
Aus dem Hawse ein Hun.
Der
Schultze ein vierteyl bottern.
Den Jegernn: aus dem Hawse: X broth, 1 stugke
fleysches,
 scheffel haffern; aus dem dorffe:
1 Schogk Eyher, II pfundt bottern. Zw der
Wildtjacht acht pferde.
scheffel haffern; aus dem dorffe:
1 Schogk Eyher, II pfundt bottern. Zw der
Wildtjacht acht pferde.
Der Schultze viher groschenn zw dem wulwaghenn.
Darzw inn der Comptorey.
Swerliche ablager nicht alleine E. f. g. pferde, sunder alles was mitt zwschlet, dem Hawse ein ganz jar nachteitigk vnd ein groß abgangk.
Nr. 3.
Dyt is eyn vtoch
der besweringe,
de dar hebben an g.
h. arme lude
jegen Claus van
Oldenborch,
de sulue is
geklaweth
Anno XXIX.
1
).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
Gudendorpp.
De arme lude klagen, wo dat se nu IIII jare lanck here weren dorch den lanthrider voruordeth, dat se moten dat velt tom hertzwolde vthraden vnde begaden vnde seyghen myth I drameth haueren vnde III sc. boeckweyten, dat se touorn nicht plegen to donde.
Item vorder klaget de gantze burscopp, dat se nu
moten geuen II
 gulden to deme afflegere rynde,
dar se doch oldynges allene I gulden vnde I orth
vor geuen.
gulden to deme afflegere rynde,
dar se doch oldynges allene I gulden vnde I orth
vor geuen.


|
Seite 81 |




|
Item vorder klagen se, dat se beswerth werden dorch den Comptor van Nemerow, de en nu unwenlyke plichte vppleggen will, dat se nu mastgelt geuen scolen vor ere swyne, dat se oldes nicht here gedan hebben.
Item vorder klagen se, dat se moten dem Compter vele mennige vnwanlyke denste don, de se nen werle gedan hebben, besondergen moten se em viskerwaden voren von eyneme see to deme anderen.
Item ok in korten vorscreuen jaren hadde de Compter de lude beden, dat se em muchten roer stoten, so se don dan hadden, vnde he en dar plach auer beer to geuende, vnde wen se em dat roer affgestoeth hadden, so vorede se idt em wente to der Wokule, dat se em nu moten voren beth to Nemerow, vnde nu will he dath vor eyne plicht holden vnde gyfft em nichtes tho bere.
Item vorder klagen se, dat se em howen sageblockke vnde de suluen en thor stede voren, dat se van oldes her neyn werlle gedan hebben, vnde also dat se nicht don wolden vppe eyne tydt, darumme hefft he ere swyne laten affpanden anno XXIX vp sunte dionysius dach, wowol dat em vorgunth was durch synen dener, dat se ere swyne in de masth mochten ghan laten.
Item vorder klagen se, dat se vele grote, lange vore vnde reysen don moten, nu soes jare lanck her, dat se oldinges nicht plegen to donde m. g. h.
Wokule.
Klagen de arme lude, wo dat se moten alle gelick den anderen dorperen vthraden, begaden dat velt thom hertzwolde vnde beseygen dat myth I drameth haueren vnde III scepele boeckweyten; dyt hebben se nu IIII jare lanck her vnuerlyken gedan vnde touorne nicht, dar se de lanthrider to voruordert hadde.
Item vorder klagen se, dat se oldes vor I rinth
geuen allene V orth gulden, dar se nu moten vor
geuen II
 gulden.
gulden.
Item ok klagen se, dat so nu moten grote vele lange reysen don, de se oldynges nicht so plegen tho donde.
Item vorder klagen se, dat em de vorbueth to howende ere egen holt, dat van oldes her to deme dorppe gelegen hefft, to ereme tymmer behoeff.
Item vorder klagen se auer her Roer den Comptor to Nemerow, de en hadde vorbaden, ere gadeshus holth to houende, so se plegen to donde, dar dorch he den schul=


|
Seite 82 |




|
ten Thewes mantel I offen van IIII gulden affgepandeth hadde, den he ok nicht wedderkregen hadde.
Item vorder klagen se, dat se vrig plegen tho wesende to malende ere korne in eyne male van des Comptors male, wor se wolden, vnde nu moten se malen by dwange in der Dabellowesken male, dat ock des comptors male is; dardorch hefft Bartelt Nigeman de kroger geuen moten III gulden, vnde de schulte vorgesechte Thewes mantel hefft moten ok III gulden geuen III jare unuerlick vorgangen.
Item vorder klagen se, dat se plegen van oldes her ethlike orde to hebbende vrig roer weruinge, wan de Compter syn roer wech plach to hebbende; dat sulue werth em nu gantz vorbaden dorch den Compter.
Item vorder klaget de schulte Thewes mantel, dat syn vadere hedde hath eynen vrigen see auer XX jaren to syneme schultenrichte, de noch harde achter syneme huse licht, de were em fedder der tydt dorch de Compters vorentholden.
Dabellow.
Pawel Peltz de schulte hefft sich horen laten myt syner naberscop, wo dat de burscopp moth bearbeyden dat velt thom hertzwolde, wo dat vorgenante dorpp thor wokule deyth, vnde des geliken der vernen reysen vnde des afflegere ryndes.
Item beklaget sick kesten lulow, dat he hefft
moten geuen deme Compter Assem von krampen
III
 gulden vmme den willen, dat he in
des Compters male to Gudendorpp korne maleth
hadde vnde nicht in des Compters male to Dabelow.
gulden vmme den willen, dat he in
des Compters male to Gudendorpp korne maleth
hadde vnde nicht in des Compters male to Dabelow.
Item klaget Hans Cynow, dat he werth beswerth dorch den kerckheren to Lichen, de em vorhogeth de tynse des jares myt eynem Gr.
Item klaweth pawel peltz, dat he hefft moten
geuen X gulden deme Compter vnde synem scryuere
I gulden vor dat schulten ampt Anno XXVIII,
desgelyken hefft he em moten geuen I wispel
haueren vnde
 vath bere Anno XXVIII vmme den
willen, dat he hadde syn sustere to der ee
beraden vnder eyns anderen hern guth; den
haueren rekenth he vor II gulden vnde I orth
gulden vnde dat bere vor I gulden.
vath bere Anno XXVIII vmme den
willen, dat he hadde syn sustere to der ee
beraden vnder eyns anderen hern guth; den
haueren rekenth he vor II gulden vnde I orth
gulden vnde dat bere vor I gulden.
Gnewitze.
De armen lude mogen bearbeyden den hertzewolth, alse de wokulesken.
Item oldynges I gulden geuen se vor dat afflegere
ryndt vnde nu moten se geuen II
 gulden.
gulden.


|
Seite 83 |




|
Item ok klagen se auer vnwanlyke Denst, den se deme Compter don moten in sage blockke to vorende na vostenberge vnde de brede wedder na Nemerow voren, so se in desseme Jare XXIX gedan hebben vnde nicht touorne.
Item ok klagen se, dat de Compter nicht will gunnen, dat se holt mogen hawen to erme tymmer behoff, so se oldynges her gedan hebben.
Item ok klaget Jachim Hane, dat so Anno etc. XXVIII hefft moten geuen eyn wispel haueren, den sc. gerekenth vor IIII gr., dat synt III gulden, deme Compter vmme den willen, dat he hadde eyn geuelde eke also eyn legere holt in syn hus geuoreth, vnde he was erst nyge tho wanende kamen, dat he nicht en wuste, dat de Compter dat vorbaden hadde, vnde sodane holt plach den buren stedes vrig to wesende in ere nutthe.
Item vorder klagen se, dat se moten hebben dem Compter geuen I wispel gersten vor de mast Anno etc. XXVIII, dar se nicht plegen vor to geuende, men stedes vrig hath hebben, den wispel gersten gerekenth vor III gulden.
Item vorder klageth Symon Dabelow, dat he dorch
des Compters vorheth moten myt Achim Kryn lauen
by dwange vor Hans Hyngest den Molre, dat wolde
de Compter so hebben vnde de moller is vorlopen,
darumme hefft eyn islick van se moten deme
Compter geuen IIII gulden ane I orth gulden, dat
maketh VII
 gulden.
gulden.
Item vorder klagen IIII schulten, alse to Gudendorpp, Wokule, Dabelow vnde Gnewitze, dat in korten jaren de Comptere van Nemerow se myth vnwanlyke aflegere beswerth hebben, so dat erst Otto Sackken erst sulff andere quam, wan he de pacht borede, vnde lach I nacht, dar na II nacht, dar na III nacht; dat hadde werth III jare lanck, vnde desse Compter schal en nu kamen sulff VIII offte VII vnuerlyken vnde schal liggen des jares myt en III nacht myth eyneme schulten, dat sulue hefft he by IIII jaren her gedan.
Groten Nemerow.
Syuerth Werneke de schulte klageth, dat he plach den Compter to Nemerow vthrichten myth eyner haluen tunne bere vnde VI scepele haueren synen perden vnde plach des auendes wech tho reysen, vnde nu desse Comptere Askem van Krammen plegen nu vnwantyke terynge vpptoleggende, in deme he en moste vthrichtinge don dre vulle dage


|
Seite 84 |




|
vnde vrachte myth em to liggende myt XIIII perden, dar oldynges syn voruarth plach to kamende allene myth VI offte VII perden; vor sodane afflegere hefft he sick vnderstan, dat em mot de schulte geuen I wispel haueren.
Item beklageth sick Jacob Branth, dat auer III jare vnuerlyken hadde em de Compter III tunne bere myth wagen vnde perde, alse he van Branbenborch na synem huse wolde wedder varen, genamen, wowol he en hadde em venklick vorth in den staken, dar he in seten hadde III dage vnde III nachte; dar na eyn verendeell jares hadde em noch eyn maell vencklick vorth to Nemerow in den staken, dar he inne saeth I dach vnde nacht, vnde schal em namen hebben I gulden vmme den willen, dat he scholde ackkere in brukynge hebben, de dem Comptere scholden ankamen, dat he doch dem Compter nicht will bestan vnde nicht is. Dar na schal m. g. h. den armen man in geleyde genamen hebben, vnde de sake is Marquart Beren vnde Claus von Oldenborch beualen dorch m. g. h. vnde he de sulue schal besoch hebben, de em doch nicht hebben wolt syner sake behulpelick syn.
Item klageth Claus Vrolick, wo IIII jare vorgangen, dat de Compter was to em ridende kamen sulff veffte vnde hadde den armen man vorweldigeth vnde vorwundeth in syn houeth, don he der bure vee gehoth hedde vnde he scholde lyke woll an syn korne meygen, dat he nicht so plichtich was, indeme de bure plegen vrig den holden, de ere quick hodeth, dat he nenen hauedenst don dorffte.
Item ok klageth de sulue, dat em hadde de Compter
swyne affgepandeth Anno XXVIII; don hadden em
syne knechte afgeschattet VI groschen erstmael
vnde dar na IIII groschen vnde
 wispel haueren, den scepel
gerekenth VII sund. witte.
wispel haueren, den scepel
gerekenth VII sund. witte.
Item ok hefft he ene dar to dwungen, dat he em hefft moten I morgen akkers plogen ok vor de vpgenamen swyne.
Item ok hebben em syne knechte syne perde ane orsake affgepandeth vnde mosten den knechten IIII gr. geuen.
Item ok klageth Hans Rode Curth, dat he syn egen
holt hefft affhowen willen, bauen dat kamen des
Compters knechte vnde grepen den man vnde vorden
syne perde vnde wagen myt sick vnde em hadden se
in de venkenisse gefettet vnde hadde em mosth
lauen
 wispel haueren to geuende, den he
moste reth vthgeuen, den sc. to rekende vor VIII
witte sund., wolde he anders vth der venkenisse
gevrygeth syn, IIII jare vnuerlick vorgangen.
wispel haueren to geuende, den he
moste reth vthgeuen, den sc. to rekende vor VIII
witte sund., wolde he anders vth der venkenisse
gevrygeth syn, IIII jare vnuerlick vorgangen.
Item klageth Drewes Dylges, dat de Compter hofft


|
Seite 85 |




|
grepen em vnde vencklick maketh vmme den willen, dat he em scholde ellerenholt affgehowen hebben, dat he nicht schal dan hebben, vnde he hadde em mosth lauen III dage to hakende, wolde he der venkenisse gevrygeth syn, vnde dar auer schal he syn gesunth verloren hebben vnde syne knaken scalen em dar auer tobraken syn; dyth were IIII jare vnuerlick vergangen.
Item Hans Balen klageth, dat he is vorwundeth vnde vencklick gesettet is dorch den Comptor vnde worth dorch em beschattet, dat he hefft moten geuen VIII sc. haueren Anno XXIX in den owesth, den sc. gerekent XII witte.
Item klageth Thewes Gateke, dat he hefft moten geuen V mr. vynkenow vmme den willen, dat he sick slagen hadde myth des schulten sane.
Item ok lecht em de Comptor vnwanlyken denst vpp, kakenholt to vorende vnde ok moten se em mer messes voren, wen se plegen.
Item ok schal he en vpleggen vnwanlyke arbeyth in der hauern sadeltydt eynen dach vnde to wenden vnde to der saeth, vnde wen se idt nicht en don, so schal he en groth auerlasth darvmme don.
Item ok scalen se em vnwanlyken in der gersten sadeltydt plogen, dar he em de koye auer namen hadde.
Item ok hadde he en namen eynen bullen, den he affgeslachtet schal hebben, gerekenth vor III gulden vnuerliken.
Item ock schalen se em vnwanliken arbeyt don in den owesth II dage, alse eynen dach byndende vnde I dach to meygen.
Item ok hebben se II dage messeth, dat vor hen
 dach allene plach to wesende vnde
don plegen II vnde II to hope spannen.
dach allene plach to wesende vnde
don plegen II vnde II to hope spannen.
Item ok hebben se em Buwholth moten voren, dat se nicht plegen to vorende.
Item ok klagen de armen lude des gantzen dorppes, wo nu I jar vorgangen, Claus van Oldenborch schal den armen luden I ossen affgeslagen hebben vmme den willen, dat scholden eyn ethlike frowe wech voren, dat m. g. h. densth nicht schal anbelangeth syn, welkeren ossen se achten IX mr. vynkenow, vnde III mr. scholden se geuen dem portnern pantgelt.
Item beklageth sick de schulte, dat he hefft moten korth na den pasken Anno XXIX synen knecht don myt I wagen vnde II perden, vnde de schulte to Czynow hadde mosth myt em tho hope spannen, Claus van Oldenborch tho vorende en nach deme Gremmelyn harde by Güstrow.


|
Seite 86 |




|
Item oldynges geuen se VII mr. alle vor dath afflegere ryndt vnde nu moten se III offte IIII gulden dar vor geuen.
Item ok moten de armen lude, de kotzen, darsuluest erer IIII eyn islick dem Comptere vthdösken XII scepel roggen in der sadeltydt, dat se oldinges nicht plegen to donde.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Dyt is eyn vtoch der
besweringhe,
de dar hebben m. g. h.
arme lude
gegen Jurgen Pawel
lantrider
to Strelitze,
de
sulue is geklageth Anno XXIX.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Groten=Nemerow ,
klageth Lauerentze Blome, wo de lanthrider Jurgen Pawel em - - waltzeme (?) beschattet schal hebben vmme III mr. vynkenow vmme den willen, dat he scholde tegelholth voren, so he dan hadde. Ok klageth auer sodane Hans Tubbe, de dar ok hefft moten geuen III mr. vynkenow.
Item vorder klaget de burscopp, wo de lanthrider Jurgen Pawel se beschattet hatte VIII jare vnuerlick vorgangen to geuende en IX mr. vynkenow vmme den willen dat se scholden m. g. h. denst vorsumeth hebben.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Dyt is eyn summe des
vppgehauen
vnde affgeschatteden
geldes
van m. g. h. arme lude
dorch den Compter van Nemerow,
Anno
XXIX gerekenth.
Wokule.
IIII gulden gerekent I ossen Thewes mantel.
III gulden Bertelt Nigeman, dat malen hadde syn
korne in des Compters male.


|
Seite 87 |




|
III gulden Thewes mantel ok vor sodane
malenth.
III
 gulden kasten lulow ok vor sodane
malenth.
gulden kasten lulow ok vor sodane
malenth.
XI gulden pawel peltz schulten
gelt.
III gulden gerekent vor hauern vnde
bere de sulue heff geuen, dat he syn sustere vth
gaff in eyn andere guth.
Gnewetze.
III gulden gerekent vor hauere Jochim Hane, dat
he vorbaden scholde gehowen hebben.
III
gulden de burscopp vor de mast.
| IIII gulden ane I orth | │ |
| Symon Dabelow | │ |
| IIII gulden ane I orth | │ gelofftes haluen. |
| Achim Kryn | │ |
Groten Nemerow.
I gulden Jacob Branth, don he venlick namen
was.
I gulden VII
 lub. s. Clawes Vrolick.
lub. s. Clawes Vrolick.
I
gulden Hans Rode kurdt gerekent vor hauere.
I gulden Hans Balen gerekent vor hauere.
III gulden gerekent I ossen, den he schal eynem
man affgeschlachtet.
Summa lateris XLV
 gulden
gulden
vnde III gulden.


|
Seite 88 |




|
Nr. 4.
Auszug 1 )
aus
dem Amtsbuche der Comthurei Nemerow 2 )
vom Jahre 1572,
welches
im Jahre 1641 bei der Inventirung zum
Grunde
gelegt und vervollständigt ist.
DasDorff Staven .
Daß Dorff Staven gehört zur Comtorey Nemerow mit gerechtigkeit, gerichten vnd diensten, hogst vnd seidst, vber halß vnd handt, auff und ablaße.
In diesem dorffe ist ein pfarkirche, die hatt die Comptorey zu verleihen.
Der Dienst gehoret nach Lütken=Nemerow mit Pferde vnd wagen, daselbst die bawleute pflügen, mist vnd holzfuhren vnd das Augstkorn zu meyen vnd einzuführen.
In demselben dorff wohnen neun Pauwers=Leute mit dem schultzen vnd sechs Kotzen 3 ), haben vnterm pflugk 52 hueffen. Der Acker ligt in drey feldern oder Brackschlegen.
Der Schulte hans Budde. Das schultzen Ampt erbet Sohn vnd Tochter vnd entfenget die Lehen vom hauße Nemerow, die muß er mit 10 fl. lösen, hatt zum schultzen Ampt vier hufen vnd zwo wurden. Imgleichen gebrauchet er noch eine halbe wueste Huesen.
Das Dorff Großen Nemero.
Diß Dorff gehoret zum Hause vnnd Comptorey Nemero mit den strasen gericht, Kirchen Lehen, hogst vnnd seidst, vber hals vnd handt, auff vnd ablaß.


|
Seite 89 |




|
In diesem Dorffe ist eine Pfar Kirche, die hat die Comtorey zu uorlehnen.
Die Pauleute, welcher 17 seint, pflügen nach
Lütken Nemerow den hoffacker
 .
.
In diesem Dorffe wohnen 17 Bawleute oder Husener mit dem schultzen, haben unter ihrem Pflugen 42 Hufen Landes vnd Kotzen haben ihre worde 1 ). Der Acker liegt in drey Brackschlegen oder feldern.
Der Schulthes Chim Spolenholtz. Das schulzen Ampt erbet auff sohn vnd tochter, vnd empfangen die Lehen vom hause Nemerow, die mus er losen mit 15 fl., hatt zum schulzenampt drei huesen.
Hernach folget, was Hertzog Johanns Albrecht in
diesem Dorff für gerechtigkeit hatt. Erstlich
mußen die Bauwleute semptlichen nach Strelitz
vnd sonsten außerhalb Landes ein jeder mit einem
pferde die wochen woll zwey mall dienen, also
das man sie zu Dienste erfordert, mussen sie
vier wagen zu dienste ausmachen
 .
.
Die Kotzen dienen vmb 14 Tage nach Strelitz mit der handt.
Darnach mus der Schultze mit vier persohnen vnnd einen Wagen, uff der Ampt leute zu Strelitz erfordern, nicht weiter als Strelitz vnd Brandenburgk dienen.
Geben Strelitz semptlich:
1 Pacht ochsen.
4 Schnit schaffe
7 Gense.
3 Drompt 7 scheffel meide habern.
3 Drompt 7 sch. Bede Korn.
3 Drompt 4 sch. schwein ablager habern.
Vnd gibt ein ieder hufener, so dritehalbe hufen
hatt, 5 Marck 7 1/2 witten Ritterbede nach
Strelitz, vnd der Schultze von einer hueffen
 fl.
fl.
Auch wan hertzogk Hans Albrecht nach Strelitz kompt, geben sie Eyer vnd huner.
Der Linnweber Jochim Meister Knecht, so vff vorwillgunge des sehl. Herrn Comptoren ein häußelein für seines Vatern hofe an der straßen gebauwet, muß jehrlich geben 1 (unbekannte Maßeinheit vermtl. Pfund) pfeffer vnd muß vnterzeiten nach der heiden oder


|
Seite 90 |




|
sonsten kurze Reisen thun bey seiner vncosten, Item nebst den andern einliegern alhie handt dienst thun.
Das Dorff Rouenn.
Das Dorff Rouen gehöret zum Hause vnd Comtorey Nemero mit den Straßen gerichten, hogst vnd seidst, vber halß, handt, auff vnnd ablaß.
In diesem Dorff ist ein pfarkirche, die vorleyen alle Ilenfelde.
Die Bauwleute, welche zehen sein, pflügen zwey
tage zur Bracke
 .
.
In demselbigen Dorffe wohnen 11 Bauwleuthe mit dem schultzen vnd haben unter ihren pflugen 30 hueffen Landes vnd zwe Kotzen gebrauchen ihre wurden 1 ).
Der Acker ligt in dreyen feldern, sint nicht gleich groß, seyen in einen ieden morgen gemistet land 2 scheffel.
Daß schultzen ampt erbet auff sohn vnnd tochter, aber muß die Lehen vom Hause Nemero gleich wie Andere empfangen vnnd mit 15 fl. losen, hatt zum schultzen Ampt 4 hueffen. - Der Schultze dienet hertzogen Johannes Albrecht mit einem lehen pferde, auch wol mit pferden vnnd wagen, wan man ihme erfordertt.
Viedt Bheann, Claus Gerdeloff, Chim Roloff, Hans
Voß, diese obgemelte Bauren dienen hertzog
Johannes Albrechten nach Stargardt borchdienst,
wan man ihrer bedurfftig
 .
.
Das Dorff Lütken Nemero.
Dieß Dorff gehoret zum Hause vnd Ambt Nemero mit allem recht, hohest vnd siedest, vber halß vnd handt, auff vnd ablaß, vnd der dienst mit aller gerechtigkeit vnd zubehorunge.
In diesem dorffe ist ein Kirche, die leute müßen
die Kinder nach großen Nemero tragen vnd
daselbst taufen lassen. Ihre todten werden
bisweilen auf den Kirchhoff zu Lütken Nemero
begraben
 .
.
Holen alle Quartal die Mühlenpacht von der heide auß den dreyen Mühlen daselbst, wirt ihnen zu essen vnd zu trinken gegeben.
Die Cosseten dienen mit dem Leibe, wan vnd worzu
man sie bedürfftig
 .
.
In dem Dorffe wohnen vier bawleute vnnd vier kotzen.


|
Seite 91 |




|
Haben auch freie mast zu ihren schweinen zur notürfftigen Haußhaltunge, vnd wan mast vorhanden, spinnet ein jeder ein pfundt heden garn.
Der Acker, so zum Hause belegen vnd gebrauchet wirt, ist ein herlicher, guter boden, daruff guter Rocken, Gersten vnd Haber vnd ander Korn kan gebawet werden, vnd wirt ordentlichen in drey felder oder brackschlege getheilet.
Die Bauwleuthe zu Großen Nemero, welcher 13 sein,
pflügen zu dem Rockenfelde
 .
.
Eß pflügen die 11 Bawleuhte zu Roua zwey gantze
tage zu allen dreyen fahren
 .
.
Waß nun die vorbenandten Bawren an diesem acker nicht begaten oder vmbbringen, müßen die Bawleuthe vnd Coßaten zu Stauen mit ihren pfluegen und hacken pflügen vnd vmbringen, vnd auch von alters hero bei den alten Comtorn Zeitten ein jeder mit einer eggen den Acker zu eggen helffen.
Die Lütken Nemeroschen, welche vier bawleuthe vnd
vier Coßeten sein
1
),
müßen in obgemelten acker alles Korn winter= und
sommer saet seyen, die bawleute zu aller saet
eggen
 .
.
Die großen Nemeroschen semptlich meyen vnd binden
einen tagk in Rocken
 .
.
Ein fertig wassermuelle mit einer glinde liegt vor dem hoffe, ist ziemblich gebawet. Die Metzen dauon kommen dem hause zum besten, tregt jehrlich vngefehr 15 Wispel alles Korn.
Das Dorff Dabelow 2 ).
Dis dorff gehoret zuer Compterey vnnd hause Nemero mit dem straßen gericht, Kirchenlehen, hogst vnd sidest, vber hals vnd handt, auff und ablaß.
In diesem Dorffe ist eine pfar Kirche, die hatt die Comptorey zu uerleihen.
Die Pauren in diesem Dorffe dienen deß Jahr drey mahl mit pferde vnd wagen nach L. Nemero, entweder sie führen Rohr, so auff der heide geworben, oder Bawholz, Latten oder Bahlen.
Die Coßate dienen nicht mehr, dan das sie, wo eß notig, bawholtz abhawen vnd daß rohr abwinnen helffen vnd die Fischerreisen bestellen.


|
Seite 92 |




|
Der Schultze in diesem Dorff muß alwegen, wan die reiße an ihme, die Fische, so auff der heide gefangen, nach Nemero führen.
In diesem Dorffe wohnen 13 Bawleute mit dem schultzen, vnd ein müller, vnd ein schmidt, ein schneider, haben vnter ihren pfluegen 15 huefen landeß; so sie nach Strelitz verlandbeden, vnd zwey Coßeten höffe.
Keine sonderliche wischen, jedoch berichten die Pauren semptlich, daß eine wische, die Kastagelichsche wische genandt, zu dem Dorffe belegen, welches sie von alters hero alle wegen gebrauchett, vnd konnen des Jahrs vngefehr 2 Fuder heugraß vnd eine pahr stiege schoffe rohr werben vnd waß sie vffm Brackentin werben können.
In dieser Dabelowschen Feltmarkt liegt noch ein
wüste Feltmarkt, Brockentin
1
) genandt, dieselbe wirt
was von Acker darauff vorhanden, von den pauren
zu Dabelow vmb die geburliche Pacht gebrauchet
 .
.
Diese Pauren zur Mühlen nach Dabelow, welche Mulle nur einen ganck hatt, nach Nemerow gehöret, vnd wirt jherlich die pacht dan dahin gegeben.
Das Schulzengerichte erbet auff manliche leibes
erbenn, nur die lehen von der herschafft von
Lütken Nemero entfangen vnd mit 10 fl. lösen,
hatt zum schultzengerichte I
 hueffen, mus sie nach Strelitz
vorlandbeden vnd was noch vor Acker vormuge des
Lehnbrieffes zu dem schultzengerichte gelegen,
giebt pacht: V mr. für ein Lehenpferdt, 1 W. Habern.
hueffen, mus sie nach Strelitz
vorlandbeden vnd was noch vor Acker vormuge des
Lehnbrieffes zu dem schultzengerichte gelegen,
giebt pacht: V mr. für ein Lehenpferdt, 1 W. Habern.
Das Dorff Wokuhl.
Daß Dorff gehoret zum Hause vnd Comptorey Nemero mit den straßen gerichte, Kirchen lehen, hohesten vnd seidtsten, vber hals vnd handt, auff vnd ablaß.
In diesem Dorffe ist eine pfarkirche, die hatt die herschaft zu L. Nemero zu verleihen, die leute haben alldar ihre Tauffe vnd begrebnus.
Die pauren in diesem Dorffe dienen der Herschaft zu L. Nemero dreimahl im Jahre mit wagen vnd pferden, wortzu
Vff dem bräckentin liget ein Acker im holtze vnd ein grandt sandigt landt; selbiges ist vor langen jahren von pauersleuten die Bötinen genannt von der Compterey verlenet gewesen, selbiges hatt einer an sich gekaufft mit nahmen Ziman Meineke, derselbe hat vff befehl des sehl. Commendators Henninck von Gristow
 . vff selben Acker eine
geringe wohnung gebauwet, derselbe gibet vor
die wohnung alle jahr 12 sch. roggen. (Inv.
v. 1641).
. vff selben Acker eine
geringe wohnung gebauwet, derselbe gibet vor
die wohnung alle jahr 12 sch. roggen. (Inv.
v. 1641).


|
Seite 93 |




|
sie erfodert werden
 . Der Kotze zu Wokuhl dienet
nichts den das er die Fischereisen vormeldet
. Der Kotze zu Wokuhl dienet
nichts den das er die Fischereisen vormeldet
 .
.
In diesem Dorffe wohnen neun Pawleuhte mit dem Schultzen, haben vnter ihren pflügen 17 1/2 huefen landes, vnd einen Koßeten hoff 1 ).
In dieser feltmarkt ist noch eine wüste feltmarkt, der Gardo genandt, belegen, der acker, so darauff vorhanden, wirt von den Pauren zur huer gebrauchet 2 ).
Auf dieser feltmarkt Gardow liegen drey sehen, zwei groß vnd ein klein, werden nach Nemerow befischet.
Haben Straßenbringk darauff man lien sehen kan.
Diß Dorff sampt der Feltmarkt grenzett mit den nach beschriebenen dorffern, als nemlich mit den Grammertinschen vnd Hertzwoldschen Feltmarken, auch mit der wüsten feltmarkt Gardow; die wüste feltmarkt Gardow grenzet mit den Godendorffschen, mit den Brackentinschen feltmarkten, haben keine irrung.
Gehoren zur mühlen nach Dabelow.
Erstlich Schultze Chim Mantzell. Das
Schultzengerichte erbet auff Sohn vnd Tochter,
mußen die Lehen von der herschafft zu Nemerow
entfangen vnd mit 10 fl. losen, hatt zum
Schultzen hoffe zwey hueffen landes vnd waß
sonsten vor acker mehr zum Schultzengerichte
vormuge des Lehenbrieffes belegen
 .
.
Die Pauren semptlich geben nach Nemerow von dem hoffacker auf dem Gardow 1 wispel rocken, 2 sch. buchweitzen, es wirt der acker beseet oder nicht.
Das Dorff Gudendorff.
Dieß Dorff gehoret zur Comptorey vnd hauße Nemerow mit den Straßen gerichte, Kirchenlehen, hochst vnd seidst, vber hals vnd handt, auff vnd ablaß.
In demselbigen Dorffe ist ein pfar kirche. hatt
die herschafft zu Nemerow zu uorleihen, die
Leute haben aldar ihre Tauffe vnd begrebnuß,
geben dem Predicanten, so zu Dabelow wohnet, den
vierzeittenpfennig
 .
.
Dir Pauren in dießem dorff dienen des Jahrs
dreimahl mit Pferdt vnd Wagen nach L. Nemero
 .
.


|
Seite 94 |




|
In dießem Dorffe wohnen acht Pauleute mit dem
Schultzen, darnach der Moller vnd des Pastorn
Pawer, haben vnter ihren Pflugen neuen Hueffen
1
). Ob sie wol etwas mehr an Acker
haben, so ist derselbe doch mit holtz bewaren
vnd liegen viel sehepfuze vnd Mohre darauff, das
man ihne nicht gebrauchen kan vnd werden nicht
mehr alß achte hueffen nach Strelitz
verlandbedet. Der Acker liegt in dreyen Schlegen
 .
.
Uff dießer feltmarckt liegt ein waßermulle mit einem glinde, gehoret nach Nemero, gibt alle jahr 36 sch. Rocken Pacht.
Haben keine straßen brinke, darauff man lein sehen kann.
Das Schultzenampt erbt auf menliche leibeserben,
muß die lehen von der herschaft zu Nemero
empfangen vnd mit 10 fl. losen, hatt zum
Schultzengerichte eine huefen, so nach Strelitz
verlandtbedet wert
 .
.
Coßeten wohnen in diesem Dorfe nicht.
Hernach volget, was hertzogk Johannes Albrecht in dießem Dorfe hat.
Erstlich haben dieße Pauren semptlich ein wuste
feltmarckt, Dreffin genandt, so nach Strelitz
belegen, zur huer
 .
.
Das Dorff Gnewitz.
Das Dorff gehoret zur Comptorey vnd dem hauße Nemerow, mit dem Straßen gerichte , Kirchen lehn, hochst vnd siedest, vber halß vnd handt, auff vnd ablaß.
In demselben dorffe ist ein Pfarkirche, die hatt
die herschaft Nemerow zu uorleihen, die leute
haben aldar ihre tauffe vnd begrebnuß, geben den
prädicanten, so zu Dabelow wohnet, den
vierzeitenpfennigk
 .
.
Die Pauren in diesem dorffe dienen des Jahres 3
tage mit Pferde vnd wagen, wan sie erfordert
werden, nach Nemerow
 .
.
In dießem dorffe wohnen acht Bawleute mit dem
Schultzen,
2
) haben vnter ihren Pflugk 16
huefen, werden nach Strelitz verlandbedet
 .
.
Auff dieser feltmarckt ligt eine waßer Mulle mit einem glinde, gehoret zur Comptorei Nemerow, gibt jehrlich 60 sch. Roggen.
Haben keine Straßenbrinke.


|
Seite 95 |




|
Das Schultzengerichte erbet vff menliche Leibeslehnserben, muß die lehn von der herschaft zu Nemerow empfangen vnd mit 10 fl. lößen, hatt zum Schultzen Ampte zwei huefen landes, so nach Strelitz verlandtbedet werden, vnd was er mehr vermuge des lehnbrieffes bei dem Schultzengerichte hat, gibt 20 gr. vor ein Lehnpferdt
1 wispel Ablager Haber
l 1/2 Pfd. wachs zum Gottes Hauße Lütken Nemerow.
Dem Schultzen in dießem Dorffe werden jehrlichen von der Nachbarschafft, welches in dem Dorffe vmbgeht, vier Hüner gegeben, vnd welcher das Jahr dem Schultzen gibt, derselbe gibt kein Huenergelt nach Nemerow etc
Folget die gerechtigkeit, so hertzogk Hans Albrecht in diesem Dorffe hatt.
Erstlich haben die Pauwren ein wueste feltmarke
die Lebbe genannt, darauff sie ihre Hütunge
haben, gehoret nach Strelitz
 .
.
Summa Sumarum
aller
jehrlichen Einkommen
der Comptorei Nemerow.
175 fl. 18 1/2 s. 3 pf. an gelde.
22 drombt
5 sch. Roggen, wan er gantz eingenommen.
2
drombt 5 sch. gersten.
14 drombt 7 sch.
habern.
1 Pacht Ochsen.
4 schnitt
schaffe.
1 sch. Weitzen.
3 sch.
Buchweitzen.
1 sch. hampffsaat.
1
stein hampff.
10 gense.
163
huener.
IX schock eyer, 38 Eyer.
14
Pfd. wachs.
2 becker honigk..


|
Seite 96 |




|
Volget was vngefehr
van
der Comptorei vnd derselben
Einkommen
jehrlichen abgehet.
Erstlich 2 tage vnd Nacht beiden Fursten Ablager, so starck sie mit Ihrme gantzen hoffgesinde kommen.
32 goltgulden Respons den hern.
20 fl.
hulffgelt.
50 fl. vngefehr gesinde
Lohn.
25 fl. den Pastorn vnnd
1 demselben.
Bericht vom Ablager.
Es berichtet Johannes Koch der Alte, bei Hertzogk Heinrichs Zeiten gewesener Kuchmeister zue Stargart, itzgemelter hertzogk alle jahr 40 fl., dergleichen 40 fl. Hertzogk Hanß Albrecht von der Comptorei, wan Ihr f. g. die Ablager nicht bezogen, zu haben gehabt vnd bekommen haben, welche er zu etlichen mahlen selbsten von den vorigen Comptors empfangen vnd zu Register gebracht.


|
Seite 97 |




|



|


|
|
:
|
IV.
Neuere Geschichte
der
Johanniter=Comthurei Mirow,
von
G. C. F. Lisch .
I n Jahrb. II, S. 51, ist die ältere Geschichte der Comthurei Mirow, so weit sie aus ihren eigenen Urkunden geschöpft werden konnte, so vollständig als möglich dargestellt, einzelne spätere Entdeckungen, welche die Comthurei berühren, wie die Verhältnisse zu der Comthurei Gardow und zu der Mühle zu Wesenberg sind bei der Geschichte der Comthurei Nemerow, oben S. 40 flgd. und S. 47, beleuchtet. - Die Geschichte des Ueberganges der Comthurei Mirow von der mittlern Geschichte zu der neuern ist in der Geschichte der Comthurei Kraak und der Priorei Eixen Jahrb. I, S. 53 flgd. und 17 flgd. entwickelt.
Es ist hier noch nachzutragen, daß nach einer Urkunde in Riedel's Nov. cod. dipl. Brand. III, S. 394, im Jahre 1362 die Comthurei Mirow durch die Kriege der Landesherren sich in einem so ärmlichen und gedrückten Zustande befand, daß die Brüder nicht bequem mehr erhalten werden konnten. Der Bischof Burchard von Havelberg kam ihnen daher dadurch etwas zu Hülfe, daß er die Pfarre zu Freienstein, deren Patronat schon der Comthurei gehörte, der Comthurei incorporirte, um einen Theil der Einkünfte derselben zur Unterstützung der Brüder zu verwenden.
Vom Ende des 15. Jahrhunderts bis gegen das Jahr 1551 war die Comthurei Mirow mit in die vielfachen Streitigkeiten verwickelt, welche der Orden für seine meklenburgischen Commenden mit den Herzogen hatte; jedoch beschwerte sich der Orden in Beziehung auf die Comthurei Mirow über keine andere Belästigung, als über die Forderung der Ablager, und


|
Seite 98 |




|
stritt mit den Herzogen um nichts weiter, als um die gegenseitige Beeinträchtigung von einzelnen örtlichen Gerechtsamen, wie sie bei Privatgrundstücken nicht selten vorkommen, wie um unbestimmte Gutsgrenzen, streitigen Mahlzwang, udgl. Vermehrt wurden in der Zeit von 1533 bis 1549 die Irrungen noch durch Streitigkeiten über die Fischerei auf den Müritz=Gewässern, über Erhöhung der Landbede und Vergrößerung der Dienste von den Haidedörfern. Von der Reformation bis zum westphälischen Frieden bestand dem Namen nach freilich die Comthurei Mirow, theilte aber das Schicksal der hohen Prälaturen in Meklenburg, d. h. der Domstifter, welche als Pfründen für apanagirte Prinzen des herzoglichen Hauses benutzt wurden, seitdem das Recht der Primogenitur geltend gemacht worden war; es hat die neuere Geschichte dieser Comthurei nicht viel mehr Bedeutung, als den Uebergang von einem Fürsten zum andern nachzuweisen.
Der letzte wirkliche Comthur von Mirow, Liborius von Bredow, starb im Anfange des Jahres 1541. Da erschien in Meklenburg eine Person, welche dringend Hülfe heischte, der "verarmte und flüchtige" Herzog Wilhelm von Braunschweig.
Der Herzog Wilhelm von Braunschweig war ein Bruder des regierenden Herzogs Heinrich des Jüngern, dessen Leben nicht wenig von Kriegsstürmen bewegt ward. Noch mehr bedrängt aber ward sein Bruder Wilhelm. Schon im J. 1519 gerieth er in der hildesheimischen Stiftsfehde in der Schlacht bei Soltau in Gefangenschaft, aus der er, nach einer kurzen Zwischenfrist, erst im J 1523 entlassen ward 1 ). Nach seiner Befreiung gerieth er in Streit mit seinem Bruder wegen der Erbfolge, da er, auch nachdem er den Primogenitur=Vertrag beschworen hatte, dennoch hartnäckig einen Landesantheil forderte. Um Ruhe zu haben, setzte ihn sein Bruder wieder gefangen und hielt ihn 12 Jahre eingeschlossen, bis er sich mit dem Hause Gandersheim und einer Apanage von 2000 Gulden begnügte 2 ).
Gleich nach dem Tode des Comthurs Liborius von Bredow trat der Herzog Wilhelm von Braunschweig, der eine sichere Zufluchtsstätte vor seinem Bruder und ein besseres Auskommen suchte, bei dem Herzoge Albrecht von Meklenburg werbend um die Comthurei auf, obgleich dieser die katholischen Gesinnungen mit dem Herzoge Heinrich von Braunschweig theilte. Ueber die Veranlassungen zu diesem Schritte ist alles


|
Seite 99 |




|
dunkel, da die Verhandlungen mündlich gepflogen wurden. Der Herzog Wilhelm war persönlich in Meklenburg, um die Sache bei dem Herzoge Albrecht abzumachen. Man ward einig, daß der braunschweigische Herzog eine Reise zu dem Markgrafen Johann von Brandenburg machen und seinen Weg über Mirow nehmen sollte; dieser Fürst hatte eine Nichte des Braunschweigers zur Gemahlin und war ein Schwager des Herzogs Albrecht. Man wollte 12 Pferde mit den dazu nöthigen Knechten als Relais ("auf die Post") nach Mirow vorausschicken, der Herzog sollte nachfolgen, - wahrscheinlich um dort zu - bleiben. Am 4. Febr. 1541 mußte des Herzogs Wilhelm Secretair auch den Herzog Heinrich von Meklenburg zur Ergreifung dieser Maaßregel bewegen. Schon am 3. Febr. erließ Albrecht und am 10. Febr. Heinrich die dazu nöthigen Befehle an den derzeitigen "Verwalter" von Mirow.
Zwar war ein neuer Ordenscomthur, Sigismund von der Marwitz, schon im Anfange des Monats Februar in Mirow eingezogen und hatte den Herzogen seines Heermeisters Veit von Theumen Credenzbrief vom 27. Jan. überreicht. Aber die Pferde und Knechte für den Herzog Wilhelm gingen schon am 14. Febr. nach Mirow ab, Marwitz mußte sie, wiewohl ungerne, annehmen und der Herzog Wilhelm, der sich diesen "Rathschlag wohl gefallen ließ", folgte am 19. März in Person "mit seinem Haufen", angeblich um ein Nachtlager in Mirow zu halten, und ihm sogleich das Gerücht, daß Marwitz der Comthurei entsetzt werden sollte. Am andern Tage ließen die Herzoge dem Comthur erklären, daß sie geneigt seien, dem Herzoge Wilhelm die Comthurei auf ein oder zwei Jahre einzuthun. Mit Bewilligung der Herzoge von Meklenburg, welche die rückständigen Ablager und das Vorschlagsrecht bei der Besetzung der Comthurei zum Vorwande ihres Einschreitens machten, nahm nun Herzog Wilhelm Besitz, ward von herzoglichen Gesandten eingewiesen und - Marwitz zog zum Heermeister zurück. Dieser aber verklagte die Herzoge Albrecht und Wilhelm wegen Landfriedensbruches beim Reichskammergericht. Wilhelm vermochte den Kurfürsten Joachim von Brandenburg, die Sache im Jahre 1542 beim Reichstage vorzubringen, wobei ihm als Grund an die Hand gegeben war, daß es
"kund und menniglichen bewust, in waser elend und armuth hertzog wilhelm gefallen, auch s f. g ihres leibes nicht sicher, numer ihre volkhomende jare erreicht, keinen unterhalt haben; haben die hertzoge zu Meckelnborg sein f. g. als iren freund bedenken vorsehn vnder in irer f. g. elendt zu hülff kho=


|
Seite 100 |




|
men wollen, all die weil oder gleich die Zeit sich die Comptorei zu miro vorlediget durch den meister ein vormeinter Comptor ohne vorwissen hochgemelter fürsten von Mekelborg wider alt herkomen eingedrungen, hat sich also hertzog wilhelm in die selbe Compterey nicht mit gewapener handt eingesetzt, oder den landfriden vorlezt, sondern ist in die selbe von dem landfürsten eingeweist vnd dem Compter mit willen abgehandelt worden."
Doch beriefen sich die Fürsten dabei auch hier auf den regensburgischen Reichstagsabschied, bei dessen Publication Herzog Wilhelm in Posseß gewesen sei. Dagegen verwandte sich der Landgraf Philipp von Hessen bei dem Herzoge Albrecht für den Herzog Wilhelm, diesen im Besitze der Comthurei zu schützen, da es ein Werk der Liebe sei. Wilhelm erreichte auch seinen Zweck: er blieb im Besitze der Comthurei, - und der Proceß ging seinen gewöhnlichen, langsamen Gang fort. Dem jungen Herzoge Johann Albrecht von Meklenburg machte sich der Herzog Wilhelm dadurch verbindlich, daß er ihn im Jahre 1552 auf dem denkwürdigen tyroler Feldzuge begleitete, und so behauptete er sich desto fester in seinem Besitze, obgleich des Herzogs Johann Albrecht Bruder Ulrich seit dem Jahre 1553 in Veranlassung des Streites um die Landestheilung über ihn "sogar fuchswild" war und ihn "nirgend im Lande wissen wollte". Am 23. Dec. 1552 hatte nämlich der Herzog Johann Albrecht, der doch wohl des Herzogs Wilhelm überdrüssig ward, zu Gunsten seines jüngern unmündigen Bruders Christoph die Comthurei einnehmen 1 ) lassen, jedoch so, daß Wilhelm einst=
Interessant ist, im Auszuge, folgendes:
inuentiret vnnd verzeichnet durch
Hansen von der Osten vnnd
Andresen Hoe den 23
Decembers
Anno
1552.
Erstlich vff Hertzogk Wilhelms gemach.
3 betten.
2 heuptpfuell.
1
Spanbeth.
1 grunes Ledlein.
1
gemahltenn Tisch.
36 Bücher groß
vnnd klein.
1 ledig kleider
kasten.
1 kasten darin die
Hoffkleidung gewesen, als nemlich zwey
grawe Tucher vnnd etzlich elln
rottes.
2 ledig laden.
1 kasten
darinne etzlich pfund Zucker vnd pfeffer.


|
Seite 101 |




|
weilen im Genusse bleiben sollte. Der Heermeister schien auch nicht übel Lust zur Occupirung zu haben und der Kurfürst Joachim legte Fürbitte für den Herzog Wilhelm ein; der Herzog Ulrich wollte die Comthurei aber ungerne aus den Händen lassen, auf Fürsprache des Kurfürsten gab er jedoch endlich nach unter der Bedingung, daß Herzog Wilhelm sich zuvor verpflichte, nicht wider "die Herzoge (vns) zu dienen oder zu practiciren, noch auch einigs Kriegsvolk auf derselben Comptorey und den dazu gehörigen gütern ohne landesherrliches wissen und willen zu keinen zeiten versammeln zu lassen". Unter manchen kleinen Hemmungen behauptete sich der Herzog Wilhelm dennoch auf der Comthurei Mirow, wo er auch wohnte, bis er sein mühseliges Leben im Jahre 1558 beschloß.
Die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich hatten früher daran gedacht, ihren nächstfolgenden Bruder Christoph mit der Comthurei Mirow zu versorgen. Mittlerweile war dieser aber (1554) zum Bischofe von Ratzeburg erwählt und (1555) zum Coadjutor von Riga angenommen, woraus ihm jedoch ein ganzes Heer von Leiden erwuchs. Auch waren während der Zeit die meklenburgischen Lande zwischen beiden Brüdern durch den ruppinschen Machtspruch (1556) getheilt, so sehr der Herzog Johann Albrecht zum Besten des Staats die Primogenitur
1 Schapp darinne gewesen ein weidemesser,
ein pahr Reusche Stiefelnn, ein kese,
ein Schacht=Tafell vnnd zwey venedische
gleser.
5 Spiess.
2 sthelern
Bogen, ein Schiesskocher vnnd etzlich
boltzen.
3 Laternen.
- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
2 Huete vnd sonnsten
allerley generalia juris.
1 kuritzer.
5 blanke harnsch.
1
buntter harnsch.
13 bogen.
32
Sattel alt vnnd new.
1 Tonne doch
nicht gar voll Ossmund.
1 Fass voll
hinter vnnd vor ezeugk.
1 schwartzer
beschlagener kasten darinnen Mundstück
und Stangen.
4 Bartten.
13 Winde
zum Armbrosten vnnd 18 kocher.
- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
Item etzliche
Mundstück an der wand hangend.
25 fass weins, gross vnnd klein, ist aber
mehrenteill Myrowischer sawrer
wein.
1 fass alt bier.
1 tisch.
25 fass bier.


|
Seite 102 |




|
einzuführen strebte; aber er hatte dem Andringen seines Bruders Ulrich nicht widerstehen können, sondern sich zu einer Theilung entschließen müssen. Von dieser Theilung war die Comthurei Mirow bis zur Erledigung ausgenommen. Durch den Tod des Herzogs Wilhelm von Braunschweig eröffneten sich für die noch nicht versorgten Prinzen, welche bei der Landestheilung leer ausgegangen waren, Aussichten zur Versorgung und die beiden regierenden Herzoge nahmen jeder zur Hälfte von Mirow Besitz. Herzog Ulrich wollte seinen jüngsten Bruder Carl damit bedenken; der Herzog Johann Albrecht hatte aber große Neigung, die Comthurei seinem Sohne Johann (geb. 7. März 1558) "zuzuhandeln". Jeder hatte die Comthurei eingenommen, jeder, der Form nach, zur Hälfte, weil der Heimfall des Ganzen streitig war; bis in das Jahr 1565 ward die Comthurei von den Herzogen administrirt. Der Orden hatte auf Restitution geklagt; im Jahre 1565 legte sich aber alles zum gütlichen Vergleiche an. Leider ward er durch höchst unangenehme Intriguen vereitelt. Im Jahre 1564 war durch Verwendung des Markgrafen Johann Franz Naumann (oder Franz von Naumann) Heermeister zu Sonnenburg geworden 1 ). Jeder der beiden fürstlichen Brüder gewann den alten, schwachen, vielleicht gar unredlichen Mann sehr leicht für seine Absichten. Der Herzog Johann Albrecht schloß schon Ostern 1564, unter Vermittelung des Markgrafen Johann zu Cüstrin, der sehr für diesen Herzog lebte, einen einseitigen Vergleich mit dem Heermeister dahin, daß die von den Herzogen eingezogene Comthurei dem Orden restituirt, dem Prinzen Johann auf Lebenszeit verliehen und dafür dem Heermeister auf diese Zeit ein jährliches Responsgeld von 300 rheinischen Goldgulden zugesagt ward, obgleich früher die Comthure nur 40 Goldgulden Respons entrichteten. Dieser Vergleich ward aber erst am 22. Mai 1565 ratificirt und dabei sogleich dem Heermeister die erste fällige Respons mit 300 rh. GG. bezahlt. Nicht viel schwerer ward es dem Herzoge Ulrich, den Heermeister für sich zu gewinnen. Dieser hatte den Comthur J v. Holstein von Nemerow zu seinem Fürsprecher und Agenten. Holstein rieth dem Heermeister dringend, die Comthurei dem Herzoge Carl zu verleihen, um dadurch die unangenehme Sache aus der Welt zu schaffen, Mirow ganz wieder zu gewinnen und sich dem Herzoge Ulrich geneigt zu machen, zu


|
Seite 103 |




|
dem der Orden alle Zuversicht haben könne, wogegen der Herzog Johann Albrecht dem Orden "je und allewege zuwider gewesen sei". Während der Markgraf Johann von ihm die Ablieferung der Comthurei an den Herzog Johann Albrecht forderte, verhandelte er mit dem Herzoge Ulrich auf ganz andere Weise. Er forderte nämlich die Comthurei, ehe er sie einem Herzoge einthat nicht nur in ihrem damaligen Zustande zurück, sondern verlangte auch Erstattung der Abnutzung und der Unkosten seit dem Jahre 1544 oder doch wenigstens seit dem Jahre 1557, wenn er die Zeit, daß der Herzog Wilhelm von Braunschweig die Comthurei inne gehabt, nicht rechnen wolle. Der Herzog Johann Albrecht hatte freilich den Abnutzungspunct einer gütlichen Vereinbarung überlassen, machte aber jetzt, da der Meister wenigstens 24000 Gulden forderte, auf nicht mehr Hoffnung, als auf höchstens 2000 Gulden von jedem Herzoge. Nun beredete der Herzog Ulrich für sich und seinen Bruder Johann Albrecht mit Naumann im Jahre 1565 ebenfalls einen Vergleich dahin, daß die Comthurei dem Orden restituirt, dem Herzoge Carl als Comthur eingethan und dem Heermeisterthum eine Entschädigung von 4000 fl. gezahlt werden solle. Naumann nahm auch vom Herzoge Ulrich Geld vorweg: aber aus den Vergleichen ward nichts. Zunächst trat im Jahre 1565 die Belagerung von Rostock hemmend in den Weg, durch welche der Unfriede zwischen beiden Herzogen neue Nahrung erhielt; die Feindschaft ward durch die mirowsche Angelegenheit bedeutend vermehrt, da grade während dieser Zeit jeder der Brüder hinter des Andern einseitige Verhandlung mit dem Heermeister kam. Herzog Carl hatte schon früher Exspectanz auf die Comthurei erhalten; er bewarb sich jetzt selbst um die Comthurei und forderte, nachdem er volljährig geworden war, seinen Landesantheil. Darüber zürnte Herzog Ulrich wieder, da er die einmal eingezogene Comthurei nicht wieder vom Hause Meklenburg lassen wollte. Der Orden setzte seine Klage über Gewaltthätigkeit beim Reichskammergericht fort; der Markgraf Johann zürnte; Vergleichsvorschläge und Termine wurden zum Schein angekündigt und abgesagt: kurz es häuften sich alle denkbaren Schwierigkeiten, bei denen auch der Ritter Friederich Spedt seine Hand im Spiele hatte. Die Chomthurei ward dabei nach wie vor von den Herzogen administrirt. Am 16 Mai 1566 klagte der Herzog Ulrich zu Augsburg beim Kaiser über seinen Bruder Johann Albrecht und bat ihn, seinen Bruder Carl mit der Comthurei zu belehnen und den deutschen Meister zur Bestätigung zu vermögen. Im Jahre 1567 willigte auf Naumanns


|
Seite 104 |




|
Vortrag das Provinzial=Capitel zu Speier in die Nomination des Herzogs Carl und Naumann versprach, ihn zum Comthur zu ernennen und ihm nicht allein zu des Herzogs Ulrich, sondern auch zu des Herzogs Johann Albrecht Hälfte von Mirow zu verhelfen. Hierauf ließ er sich vom Herzoge Ulrich 177 rh. GG. und 361 Thaler zahlen und sicher Geleit geben. Als dies alles und vieles Andere der Markgraf erfuhr, gerieth er in heftigen Zorn; er stellte den Heermeister zur Rede und dieser - leugnete allen Verkehr mit dem Herzoge Johann Albrecht ab; hinter dem Rücken des Markgrafen sagte er jedoch aus, er habe von diesem überredet und "mit lauter Gewalt gezwungen" mit dem Herzoge Johann Albrecht unterhandelt, Reverse unterschrieben und besiegelt und - Geld genommen, - worauf er - freiwillig quittirt hatte. Der Markgraf nannte ihn einen "vergessenen und losen Buben". Da hielt sich Naumann nicht sicher und entfloh, vorzüglich im Vertrauen auf die Unterstützung des Herzogs Ulrich. Der Markgraf schalt ihn hinterher noch einen "verflüchtigen, abtrünnigen, entlaufenen, ehrlosen Mann". Naumann starb nicht lange darnach auf der Flucht im Jahre 1568. Die Comthure hielten wiederholt zu Sonnenburg Capitel, ohne zur Einigung zu gelangen. Während der Zeit suchten der Markgraf Johann und der Herzog Johann Albrecht nicht allein den Herzog Johann zur Comthurei Mirow zu bringen: sie gingen noch weiter, indem der Herzog Johann Albrecht mit aller Kraft darnach strebte, seinem jüngsten, siebenjährigen Sohn Sigismund August zum Heermeisterthum zu verhelfen! Er bat daher durch Vermittelung des Ritters Fr. Spedt, der sich damals in Wien aufhielt, den Kaiser um ein Empfehlungsschreiben an den Markgrafen Johann, dem die Nomination zur Wahl zustand, und schickte seinen Rath Andreas Mylius zur Betreibung der Sache zum Markgrafen. Der Kaiser schlug die Bitte ab, da er auf Ersuchen des Markgrafen schon dem Grafen Martin von Hohenstein ein Vorschreiben ertheilt habe; der Markgraf war jedoch nicht abgeneigt, wenn der Herzog sich zur Leistung aller Gebühr verpflichte, und versprach, die Wahl hinzuhalten. Das Wahlcapitel war auf den 9. Nov. angesetzt; die anwesenden Comthure (Andreas v. Schlieben auf Lago, Joachim v. Holstein auf Nemerow und Peter Runge auf Werben, für sich und in schriftlicher Vollmacht oder durch Bevollmächtigte der Comthure: Martin v. Wedel auf Wildenbruch, Christoph v. Bredow auf Supplinburg und Hans v. Hering auf Witersen) konnten sich aber nicht entschließen, ein Kind zum Meister zu wählen, und faßten am 15. Nov. den Capitularbeschluß, daß alle Comthure die


|
Seite 105 |




|
Capitel ohne Ehehaften nicht sollten versäumen dürfen 1 ). Am 6. Jan. 1569 wählte das Capitel den Grafen Martin von Hohenstein zu Schwedt zum Heermeister; ganz zu gleicher Zeit ward er nach dem Tode seines Bruders Wilhelm wirklicher Herr von Vierraden und Schwedt 2 ). Dieser zeigte den Herzogen sogleich die geschehene Wahl an und erklärte alle Verhandlungen seines Vorgängers für nichtig, weil dieser damals "keine Regierung gehabt" habe, auch die Verleihung nicht capitelmäßig geschehen sei. Der Herzog Johann Albrecht schickte jedoch Gesandte nach Cüstrin und Sonnenburg und diese und der Markgraf bewirkten es, daß am 20. Jan. 1569 auf einem Capitel die Einweisung des Herzogs Carl abgelehnt, dem Herzoge Johann aber nicht allein die Comthurei zugesichert ward, wenn er nach Zurücklegung des vierzehnten Jahres die Aufnahme in den Orden begehren und sein Vater bis dahin die Administration der Comthurei nach Ordens Brauch übernehmen würde, unter der Bedingung, daß der Herzog die rückständige vierjährige Respons mit 1200 rh. GGulden entrichte, sondern ihm auch die Anwartschaft auf die Coadjutorei des Heermeisterthums gegeben ward. Der Herzog Ulrich hatte ebenfalls seinen Hofrath Zacharias Wels zum Capitel nach Sonnenburg gesandt und hier vergebens um Vollziehung der alten Verträge gebeten. Der Herzog Johann Albrecht nahm den Capitular=Beschluß natürlich an und verpachtete am 15. April 1569 zur Sicherung seiner Rechte seine Hälfte der Comthurei an Henneke von Holstein. Der Herzog Ulrich beruhigte sich nicht, klagte laut über die Practiken seines Bruders und setzte alle Hebel in Bewegung, den Herzog Carl in die Comthurei einzusetzen. Der Herzog Carl war vom brandenburgischen Hofe, wo er einen Theil seiner Jugend zubrachte, heimgekehrt, längst mündig geworden und verlangte einen Landesantheil. Es wurden ihm auch im Jahre 1571 die Aemter Wredenhagen und Neukalden abgetreten und er residirte seitdem zu Wredenhagen, nachdem er schon im Jahre 1569 von der andern Hälfte von Mirow Besitz genommen hatte, wo er sich auch seit der Zeit hin und wieder aufhielt. Am 24. Febr. 1572 vermittelte er


|
Seite 106 |




|
einen Vergleich zwischen allen Partheien dahin,
daß die Processe niedergeschlagen wurden, er den
Besitz der einen Hälfte der Comthurei, der
Herzog Johann den Besitz der andern Hälfte
erhielt, Herzog Carl sich jedoch des
Comthurtitels enthalten solle, bis Johann zum
Heermeisterthum gelangen werde, wo dann dem
Herzoge Carl die ganze Comthurei überwiesen
werden solle; die Comthurei ward, nach Aufgebung
aller Ansprüche, dem Orden restituirt. Am 8.
Aug. 1572 nahmen die Gesandten des Heermeisters,
des Kurfürsten von Brandenburg und der Herzoge
Johann Albrecht und Carl das Inventarium der
Comthurei auf, welche sogleich diesen beiden
Herzogen verliehen ward. Im Jahre 1572 zog der
Herzog Carl dem Prinzen Wilhelm von Oranien
gegen den Herzog von Alba zu Hülfe und stand ihm
vor Bergen bei. Der Herzog Ulrich zürnte aber
wieder über den einseitigen Vergleich und
beklagte sich über die factische Entziehung des
Roßdienstes, des Rathsdienstes,
 . von der Comthurei.
. von der Comthurei.
In dem Processe vor dem Reichskammergericht war von 1554-1569 jährlich nicht viel mehr als eine Schrift gewechselt, in manchen Jahren gar nichts gethan, da es im Interesse der Fürsten lag, dafür zu sorgen, daß möglichst wenig geschehe.
Der Herzog Carl hatte seit dem J. 1572 Besitz von Mirow genommen und hielt dort Hof. Im Jan. 1572 war der Markgraf Johann I. seinem Bruder, dem Kurfürsten Joachim II., in die Ewigkeit gefolgt. Im J. 1576 starb auch der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg. In seinem Testamente hatte er seinem Sohne Sigismund August die eine Hälfte der Comthurei vermacht, welche ihm auch in der Erbschaftsregulirung von seinem Bruder Johann zuerkannt ward. Jedoch blieb der Herzog Carl, der im J. 1575 die Coadjutorei des Bisthums Ratzeburg erhalten hatte, im Besitze von Mirow. Zwar versicherte der Herzog Ulrich im J. 1577 seinem Bruder Carl eine jährliche Zulage von 1500 fl. zur Verbesserung seines Unterhalts; Herzog Carl aber wich nicht von der Comthurei. Erst am 20. Mai 1586 wurden die häuslichen Irrungen dahin verglichen, daß der Herzog Sigismund August das ihm vermachte Amt Ivenack frei überliefert erhalten, statt des ihm auch vermachten, damals aber für 50000 fl. verpfändeten Amtes Strelitz die Pfandsumme und statt der halben Comthurei Mirow die Hälfte des jährlichen Ertrages derselben mit 1000 fl. empfangen solle. Im J. 1587 trat nun auch Herzog Carl die Aemter Wredenhagen und Neukalden an den Herzog Ulrich ab und erhielt dafür die Aemter Broda und Wesenberg und die Comthurei Mirow.
Die Verhandlungen mit dem Orden sind bis zum J. 1592


|
Seite 107 |




|
sehr unerfreulich, Der Orden forderte die Ratification der Verträge, förmliche Restitution der Comthurei und Zahlung der Responsgelder, die freilich oft genug rückständig blieben und im J. 1592 neunzehn Jahre lang nicht erlegt waren; - die Herzoge forderten Einkleidung des Herzogs Johann in den Orden und Versicherung der Coadjutorei des Heermeisterthums für denselben, - beides vergeblich.
Endlich machte der Tod den Wirren ein Ende. Der Herzog Christoph starb am 3. März 1592; ihm folgte sein Neffe Johann am 22. März. Durch Christophs Tod erhielt Carl das Bisthum Ratzeburg, und Johanns Tod hob die Verlegenheit des Ordens, das Heermeisterthum zu einer bloßen Versorgungsanstalt zu machen und gewissermaßen mit zwei Herren von Mirow zu verhandeln; so lange Herzog Johann Albrecht lebte, war an eine Einigung wegen der Comthurei nicht zu denken. Jetzt aber ward durch die friedliche Vermittelung des Herzogs Carl alles wieder ins Geleis gebracht. Schon am 23. Oct. 1592 wurden zu Güstrow die Friedensbedingungen verhandelt. Am 27. März 1593 ward endlich der Vergleich, unter Beistand des kurfürstlich=brandenburgischen Raths Dr. Johann Köppen d. J., zwischen dem Herzoge Ulrich und den Gesandten des Heermeisters: dem Comthur Michael von Hagen zu Werben, dem Rath Dr. Christoph Rademann, Professor zu Frankfurt, und dem Ordenscanzler Balthasar Römer, geschlossen: daß die Comthurei Mirow dem Orden restituirt, der Herzog Carl mit der Eidesleistung verschont, jedoch durch Handschlag dem Orden verwandt gemacht und dann mit der Comthurei belehnt werden, ferner daß, so lange die Herzoge Ulrich, Sigismund August, Adolph Friedrich und Johann Albrecht am Leben, vom Orden kein Fremder zur Comthurei Mirow erwählt, sondern die Nomination auf eine dieser fürstlichen Personen, wofern diese sich dem Orden verwandt mache, nach der Ordnung des Alters fallen, nach deren Ableben aber die Comthurei wieder dem Orden mit aller Freiheit anheim fallen solle; die Herzoge sollten ihre alten Rechte behalten, dagegen dem Heermeister jährlich 100 Goldgulden Respons zahlen, auch die rückständigen 2000 GG. entrichten. Am 28. März reversirte sich der Herzog Carl schriftlich gegen den Orden, erhielt die feierliche Anweisung an die Comthurei, welche dann auch dem Orden durch Inventur, Eidesleistung der Unterthanen auf den Heermeister und andere Formalien feierlich restituirt ward.
Hierauf bleibt die Comthurei einige Zeit hindurch in Ruhe. Der Herzog Carl starb am 22. Julii 1610 als re=


|
Seite 108 |




|
gierender Landesherr, nachdem sein Bruder Ulrich im J. 1603 geschieden war. Auch der Heermeister Graf Martin von Hohenstein starb am 5. Mai 1609 zu Sonnenburg und es folgten ihm in der Meisterwürde hinter einander mehrere Mitglieder des kurfürstlichen Hauses, zuerst Markgraf Friederich bis 1612, darauf Markgraf Ernst. Dem Herzoge Carl folgten in der Landes=Regierung seine Neffen, Adolph Friederich I. und Johann Albrecht II. Die Comthurei Mirow blieb von der Landestheilung im Vertrage zu Fahrenholz 1611 ausgeschieden, da sie nach dem Vertrage von 1593 auf den ältesten Landesfürsten fiel. Der junge Herzog Adolph Friederich I. nahm daher sofort von der Comthurei Besitz und bat demnächst den Markgrafen Ernst um Erlassung des Ritterschlages, der Eidesleistung und der Investitur und um Einweisung in die Comthurei in der Art und Weise, wie sie dem Herzoge Carl überlassen war. Dies ward jedoch nicht bewilligt, vielmehr die Investitur noch vom Heermeister Grafen A. von Schwarzenberg seit 1625 wiederholt gefordert: aber es blieb beim Alten, Responsgelder blieben auch rückständig, um so mehr, da bald der dreißigjährige Krieg seine Verwüstungen auch über Meklenburg erstreckte.
Da ward Wallenstein mit dem Herzogthume Meklenburg begnadigt. Der Heermeister hatte schon am 25. Sept. 1627 von Wallenstein eine "Salvaguardia" für die Comthureien Mirow und Nemerow erhalten und wies hierauf am 22. April 1628 die "Beamten" von Mirow an, diese Comthurei in ihren Rechten für den Orden zu schützen, da sie vacant geworden und dem Orden anheimgefallen sei. Der Herzog Adolph Friederich protestirte dagegen von Mirow aus am 4. Mai 1628 nach Sonnenburg, weil er die Comthurei als Ordensgut besitze, ersuchte auch die friedländischen Räthe am 2. Sept. d. J. von Torgau aus, die Vorräthe, die er seiner Mutter Sophie verkauft habe, dieser verabfolgen zu lassen: jedoch alles umsonst, da Wallenstein die Comthurei nur geschützt hatte, um sie für sich selbst zu nehmen. Nachdem Adolph Friederich am 12. Mai Mirow und sein Land verlassen hatte, erschienen der friedländische Secretair Heinrich Neumann ("ein Jurist"), der Lieutenant Adam Meisner, der Secretair Johann Sturm, ein Corporal und ein Bürger aus Güstrow, um, als friedländische Commissarien, die Comthurei "einzuziehen, weil der Herzog sie etliche Jahre lang gebraucht vnd sich doch darnach habilitirt, Item die Gebühr nicht alle Jahr erlegt" habe. Heinrich Neumann setzte einen " Inspector oder Hauptmann" ein und - die Comthurei war friedländisch geworden. Der Burgvogt von Mirow und der Hofprediger Caspar Wagner, der sich


|
Seite 109 |




|
damals zu Mirow aufhielt, verlangten Commissorium und Vollmacht zu sehen; dies ward ihnen nicht gewährt. Vielmehr mußten sie, nachdem mehrere Boten nach Güstrow gesandt waren, plötzlich die Comthurei verlassen. Alle Verwendungen des Herzogs, daß ihm die Comthurei bleiben möge, fruchteten nichts.
In der Mitte des Monats Julii 1631 nahmen die Herzoge von Meklenburg wieder Besitz von ihren Landen und Herzog Adolph Friederich gelangte mit bewaffneter Hand auch wieder zur Comthurei Mirow, welche er in den nächsten Jahren durch eine Garnison beschützte. Als nun sein Bruder, Herzog Johann Albrecht II., am 23. April 1636 starb, war Adolph Friederich, der jetzt für sich und in Vormundschaft seines Neffen Gustav Adolph alleiniger Landesherr war, der letzte Herzog, dem die Succession in die Comthurei durch den Vertrag von 1593 zugesichert war. Nicht lange vor der wallensteinschen Zeit (im J. 1625) war der letzte Heermeister (Sigismund August) in der Reihe der brandenburgischen Prinzen gestorben, und der Graf Adam von Schwarzenberg, Herr zu Hohen=Landsberg und Gimborn, kurfürstlich=brandenburgischer erster Geheimer=Rath, der seinen Wohnsitz zu Cölln an der Spree hatte, hatte die Regierung des Heermeisterthums erhalten. Dieser, wenn auch des Kurfürsten Georg Wilhelm Minister, ein katholisch=kaiserlicher Mann, begann mit dem Herzoge Adolph Friederich wieder den alten Streit, grade zu einer Zeit (1636), als Meklenburg von kaiserlichen und schwedischen Kriegsvölkern gleich stark heimgesucht ward. Er verlangte, daß der Herzog 1) persönlich im Ordens=Capitel zu Sonnenburg den Ritterschlag und die Investitur, der sich nie ein Fürst, selbst aus dem kaiserlichen Hause, entzogen habe, annehme und den gewöhnlichen Comthur=Eid leiste, 2) die gewöhnliche Bestallung löse, 3) sich auf herkömmliche Weise bei den Unterthanen als Comthur anweisen lasse, 4) die rückständigen Responsgelder von 1622 bis 1636 mit 1500 GG. nachzahle und 5) dem Orden fortan die gewöhnliche Gebühr erzeige. Der Herzog dagegen verstand sich zu nichts weiter, als zur Annahme der Comthurei durch Handschlag und Anweisung derselben durch eine Deputation, zur Erhaltung der Comthurei für den Orden und Erlegung der laufenden, auch zur Nachzahlung der rückständigen Responsgelder, mit Ausnahme der während der wallensteinschen Occupation aufgelaufenen Summe, welche er jedoch für den Fall eines gütlichen Vergleichs nach seinen Wünschen auch zu entrichten sich bereit erklärte. Der Herzog machte verschiedene Vergleichsversuche,


|
Seite 110 |




|
zu denen er den Hauptmann Daniel von Plessen auf Hoikendorf in den Jahren 1636 und 1637 zu verschiedenen Malen zum Grafen nach Berlin sandte und hier vorzüglich durch die beim Kurfürsten "viel geltende Auctorität" des Obersten von Burgsdorf, der auch dem Herzoge freundlich gesinnt war, zu wirken suchte. Jedoch war alles vergeblich; der Heermeister wollte nicht einmal die Responsgelder erlassen, welche während der wallensteinschen Zeit fällig gewesen waren, auch nicht die Investitur an einem Substituten vornehmen. Vielmehr erhob er im Sept. 1637 beim Reichshofrath Klage gegen den Herzog und begann einen Proceß, in welchem bis in das J. 1641 sehr umfangreiche Schriften bis zur Duplik gewechselt wurden. Da starb der Graf von Schwarzenberg am 4. März 1641 und im Heermeisterthume trat Sedisvacanz ein; der Ordens=Senior Georg von Winterfeld führte in Nothfällen die Regierung unter der Aegide des Kurfürsten, als Patrons des Ordens. Der Proceß beim Reichshofrath schlief ein. Dagegen trug am 26. August 1642 der Herzog beim Kurfürsten Friederich Wilhelm darauf an, bei des Landes Meklenburg "sehr schlechtem und kläglichem Zustande" dahin bei dem Orden zu wirken, daß der Vertrag von 1593 erneuert und auf die fünf Söhne des Herzogs erweitert, ebenfalls auch die erledigte Comthurei Mirow seinem Neffen Herzog Gustav Adolph von Güstrow überlassen werde. Es war mit dem Kurfürsten und dessen Ministern und mit dem Ordens=Senior und einigen Comthuren bis in das Jahr 1645 hin und her gehandelt: der Herzog bat während der Zeit endlich um Verleihung von Mirow an seinen zweiten Sohn Carl und von Nemerow für seinen Neffen Gustav Adolph; aber es kam kein Ordens=Capitel zu Stande und im Heermeisterthum, wie in den Comthureien blieb es beim Alten. Die Comthurei Nemerow erhielt im J. 1644 der Oberst Henning von Gristow. Als dieser schon im J. 1645 starb, erneuerte der Herzog Adolph Friederich seine Anträge. Ja die Königin Christine von Schweden legte, bei ihrer nahen Verwandtschaft mit den meklenburgischen und brandenburgischen Höfen, für die Prinzen Carl und Gustav Adolph beim Kurfürsten Fürbitte ein. Man verhandelte noch im J. 1646. Da aber schließen die Acten der Comthurei, und der westphälische Friede machte allem Streite ein Ende, indem er die beiden Comthureien den Herzogen von Meklenburg zuschrieb, wenn auch unfruchtbare Forderungen sich bis zum J. 1693 hinschleppten 1 ).


|
Seite 111 |




|



|


|
|
:
|
V.
Sophia von Meklenburg,
Königin von Dänemark und Norwegen;
mit
Rückblick auf das frühere Verwandtschaftsverhältniß
zwischen
dem dänischen und meklenburgischen Regentenhause.
Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte 1 )
von
Dr. E. C Werlauff,
Ober=Bibliothekar und
ordentlichem Professor der Geschichte
 . zu Kopenhagen,
. zu Kopenhagen,
aus dem Dänischen übersetzt
von
A. G. Masch,
Gymnasial=Lehrer zu Neu=Ruppin.
D er Theil des nördlichen Deutschlands, welchen die Oder, die Elbe und die Weser begrenzen, ward schon vom 6. Jahrhundert an von slavischen Völkern, den Wilzen, Obotriten, Polabiern und Wagriern bewohnt, die aber erst einige Jahrhunderte später durch ihr Abhängigkeits=Verhältniß zu Carl dem Großen hi=
erschien als Einladungsschrift zur Universitätsfestlichkeit bei der Vermählung des Kronprinzen Friederich Carl Christian von Dänemark mit der Herzogin Caroline Charlotte Mariane von Meklenburg=Strelitz am 10. Junii 1841, alsSophia af Meklenborg, Dronning til Danmark og Norge; med Tilbageblik paa de tidligere Slaegtskabsforhold mellem det danske og meklenborgske Regentghuus. Et Bidrag til Faedrelandets Historie af Dr. E. C. Werlauff, Conferentsraad, Overbibliothekar, ordentlig Professor i Historien, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand, Ridder af Nordstiernen.
Seitdem ist diese Abhandlung noch einmal gedruckt in: Historisk Tidsskrift udgivet af den danske historiske Forening, III, 1842 p. 1.Indbydelsesskrift til Universitetsfesten i Anledning af deres Kongelige Höiheders Kronprinds Frederik Carl Christian og Kronprindsesse Caroline Charlotte Marianes höie Formaeling. Kjöbenhavn, 1841.
Die nachstehende Uebersetzung erscheint hier mit Bewilligung des Herrn Verfassers; jedoch sind von den zahlreichen Noten diejenigen weggelassen, deren Inhalt in Meklenburg mehr bekannt und auf die Hauptabhandlung von geringerm Einflusse ist. D. Red.


|
Seite 112 |




|
storisch bekannt wurden. Dies hörte nach und nach unter Carls Nachfolgern zwar auf, in der That aber ward nur die schwächere und entferntere Herrschaft der fränkischen Regenten gegen die nähere und drückendere Uebermacht der sächsischen Herzoge vertauscht.
In den jetzigen meklenburgischen Ländern hatten damals von den genannten Völkern die Obotriten und Wilzen ihren Sitz. Diese Völker standen bald in einem feindlichen, bald in einem freundschaftlichen Verhältnisse zu ihren Nachbaren und Stammverwandten, den Polabiern im jetzigen Lauenburgischen, den Wagriern im östlichen Holstein. Im Norden vor diesen Völkern erstreckte sich die jütische Halbinsel; dem Lande der Obotriten grade gegenüber lagen in einer Entfernung von wenigen Meilen die dänischen Inseln. Grundverschieden waren die Bewohner dieser Lande an Ursprung, Sprache, Religion und Sitten, aber lange standen beide Völker auf einer und derselben Entwickelungs=Stufe; denn fehlte den Slaven auch nicht eine frühere eigenthümliche Cultur, so war dagegen das Licht des Christenthums früher zu den Dänen gedrungen; Natur und Lage bildeten überdies beide, Dänen und Slaven, zu Seefahrern. In der ersten Periode unserer historischen Zeit finden wir einen Verkehr verschiedener Art zwischen diesen Völkern. Früher mögen sie durch Handel und Seeräuberei sich einander kennen gelernt haben. Lange vorher ehe die christliche Lehre beim Volke selbst Eingang fand, hatten aber einzelne slavische Regenten sie angenommen und waren dadurch veranlaßt, Zuflucht bei ihren Glaubensverwandten in Dänemark zu suchen. Doch war es vorzüglich der Länder gegenseitige Lage, nach der alten Erfahrung, daß das Meer Völker mehr verbindet, als trennt, die einen ununterbrochenen, freundlichen oder feindlichen Verkehr fast unumgänglich herbeiführten, und dieser Verkehr übte wieder zu allen Zeiten einen wirksamen und bedeutenden Einfluß auf beider Völker Stellung und Verhältniß. Das ganz Mittelalter hindurch war, bei den steten Volksbewegungen, den nie festen Grenzen zwischen den Staaten und dem ziemlich rechtlosen Zustande, das Verhältniß der Dänen und Slaven öfter feindlich als freundlich; beide Zustände wechselten häufig und nicht selten lagen sie fast neben einander. In einer frühern Periode trafen politische Reibungen in den Ländern der Wagrier und Polabier oft mit den gemeinschaftlichen Interessen bei den Bekehrungs= und Eroberungs=Plänen der fränkischen und sächsischen Regenten zusammen. Seeräuberei und Plünderung der Küsten ward zugleich mit friedlichem Handel getrieben. Späterhin als die dänischen Könige


|
Seite 113 |




|
ihre Macht jenseit der Ostsee auszubreiten versuchten, konnten die obotritischen Länder zwischen Nordalbingien und Pommern, zwei Hauptzielpuncten der dänischen Eroberungsversuche, dem Schicksale nicht entgehen, mit in das Bereich derselben hineingezogen zu werden, wie es denn vielleicht jene Länder selbst waren, die den dänischen Königen zunächst Veranlassung zu ihren Ansprüchen nach außen gaben. Nachdem dieses künstliche, selbst von dem Oberhaupte des deutschen Reichs anerkannte Gebäude unter Waldemar II. zusammengestürzt war, blieben doch in der Lehnshoheit oder in höherer Stellung anderer Art Ueberbleibsel zurück, welche dänische Könige hinsichtlich der [S. 2.] meklenburgischen Länder sich anmaßten und welche auch dann nicht aufhörten, als diese Länder von 1348 an ein erbliches Herzogthum im deutschen Reiche auszumachen begannen, sondern, wenn auch mehr dem Namen nach, als in der That, noch bis zur Zeit Waldemars Atterdag dauerten.
Dieses Verhältniß, das schon an und für sich zu keinem dauernden guten Vernehmen führen konnte, hinderte dessen ungeachtet nicht, daß nicht bisweilen Annäherungen friedlicher und freundlicher Art, sowohl zwischen Herrschern, als Völkern, in gewissen Beziehungen Statt gefunden hätten. Eheliche Verbindungen knüpften sich zwischen beiden Regentenhäusern; meklenburgische Fürsten erhielten dadurch feste Besitzungen in Dänemark; Klöster wurden von Dänen im Meklenburgischen gestiftet oder dotirt. Daß Rostock und Wismar Privilegien und Handelsvortheile von dänischen Königen erhielten, kann dagegen weniger in Betracht gezogen werden, wenn von Verhältnissen zwischen Dänemark und Meklenburg die Rede ist, da jene Hansestädte sich für ganz selbstständig und unabhängig von den Landesherren hielten, in deren Grenzen sie lagen.
Nachdem Dänemark die veralteten politischen Forderungen an Meklenburg aufgegeben hatte, bildeten sich, wie der Zeitgeist fortschritt, neue Berührungen mit stetigern und fruchtbringendern Resultaten, nämlich wissenschaftliche. Die Universität zu Rostock, 60 Jahre älter als die kopenhagener, ward häufig von dänischen Studirenden besucht; selbst nachdem Dänemark und Norwegen eine eigene Universität erhalten hatten, wählten auswärtig studirende Dänen und Schweden vorzugsweise die Hochschule zu Rostock, so wie man wieder vom 17. Jahrhundert an rostocker Studenten beständig auf der kopenhagener Universität antrifft, vielleicht weil in der größern Hauptstadt mehr Gelegenheit zum Privatverdienst war, als in der kleinern Universitätsstadt. Daß rostocker Gelehrte nicht selten zu Leh=


|
Seite 114 |




|
rerstellen an unserer Universität oder zu weltlichen Aemtern in Dänemark berufen, daß mehrere dänische Bücher in rostocker Officinen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts oder später gedruckt wurden, daß namentlich ein rostocker Buchdrucker berufen ward, das bedeutendste Werk, welches damals herauskam, die von Christian III. veranstaltete dänische Bibelübersetzung, zu drucken, darf auch nicht unbemerkt bleiben; und hierin hatte zweifelsohne die Nähe des Landes keinen geringen Antheil.
So ist also nicht allein in politischen Verhältnissen und dem Privatleben der Regenten, sondern auch in mercantilischen und wissenschaftlichen Richtungen die Geschichte Dänemarks und Meklenburgs 1000 Jahre hindurch tief und genau verbunden. Jedes dieser Verhältnisse bietet Gelegenheit zu lehrreichen Untersuchungen, zu denen die Materialien nicht fehlen und von welchen man interessante Ergebnisse erwarten könnte. Zeit und Umstände haben jedoch dem Verfasser nicht erlaubt, als Gegenstand dieser Gelegenheitsschrift irgend eine Untersuchung zu wählen, die ein tiefes Erforschen der Quellen forderte. Dagegen hat er als zweckmäßig angesehen, sich auf diejenige Art der bezeichneten Verhältnisse zu beschränken, bei welchen die Gedanken im gegenwärtigen Augenblicke vorzugsweise verweilen müssen, und deren bedeutendes historisches Interesse man nicht verkennen kann, nämlich bei den Verwandtschaftsverhältnissen, welche 8 Jahrhunderte hindurch die dänischen und meklenburgischen Regentenhäuser vereinigt haben.
Unter diesen Verhältnissen giebt es eine Ehe, die besonders des Historikers und Vaterlandsfreundes Aufmerksamkeit verdient, die Friederichs II. und bei dieser, wie überhaupt bei den 16 letzten Jahren des Lebens und der Regierung dieses Königs, wird keiner ohne tiefe Bewunderung seiner edlen, hochherzigen und liebenswürdigen Gemahlin verweilen können. Wäre Sophie von Meklenburg auch nicht Christians IV. Mutter gewesen: ihr langer, ehrenvoller Wittwenstand, ihr ehrwürdiges Alter und ihre ganze Persönlichkeit würden sie stets als einen [S. 3.] der hervortretendsten Charaktere in unserer vaterländischen Geschichte gezeigt haben. Doch die Zeit erlaubt uns auch nicht, Sophie auf ihrer langen, ehrenvollen Lebensbahn zu folgen. Nur die erste und kürzeste, obgleich die in mehrerer Hinsicht wichtigste Periode ihres Hierseins vermögen wir hier zu umfassen, indem wir versuchen, sie als Gemahlin, Theilnehmerin der königlichen Würde, zärtliche Mutter und verständige Erzieherin ihrer Kinder darzustellen.


|
Seite 115 |




|
I.
Svend Estrithsen (1047-76), der Stammvater des dänischen Königshauses, war der erste König, der sich schon mit einem Fürsten der jetzigen meklenburgischen Länder verschwägerte 1 ). Gottschalk, der Sohn eines slavischen Fürsten, hatte in Knud des Gr. Heere gedient, nahm die christliche Lehre an, heirathete Sigrid, Svends Tochter, und stiftete ein Reich, welches das Land der Wagrier, Polaben und Obotriten, oder das östliche Holstein, Lauenburg und Meklenburg umfaßte 2 ). Er fiel in einem Aufruhr seiner heidnischen Unterthanen 1066, welche darauf, ohne das Erbrecht seiner Söhne anzuerkennen, sich dem Fürsten von Rügen Kruko unterwarfen, der nach der Eroberung Nord=Albingiens, dem wendischen Reiche eine größere Ausdehnung gab. Heinrich, Gottschalks Sohn, ungefähr 1059 geboren, der seit des Vaters Tode seine meiste Zeit bei seinen mütterlichen Verwandten in Dänemark zugebracht hatte, stieß Kruko vom Throne und heirathete seine Wittwe, Slavina 3 ). Um dem eigentlichen slavischen Reiche den nationalen Umfang zwischen der Elbe, Oder und Ostsee zu sichern, verwandelte er die unmittelbare Herrschaft über Nord=Albingien in ein freundschaftliches Bündniß, aber zugleich scheint es, daß er seine Länder unter einem höhern Titel 4 ) beherrscht habe. Er bekriegte seinen Mutterbruder, den dänischen König Niels, der ihm sein mütterliches Erbe in
*) Die lateinischen Buchstaben bezeichnen die Anmerkungen des Originals.


|
Seite 116 |




|
Dänemark vorenthielt; es gelang ihm jedoch zuletzt, mit Hülfe seines Geschwisterkindes Knud Lavard, für dieselbe Vergütung zu erhalten.
Da Heinrich an der Tüchtigkeit seiner jüngern Söhne, zur Regierung zweifelte, scheint er seinem ebengenannten Verwandten eine Art Aufsicht oder Vormundschaft über sie übertragen 5 ) und ihn sogar, falls sein Stamm aussterben sollte, [S. 4.] zum Beherrscher seines Landes ernannt zu haben 6 ). Nach seinem Tode 1126 7 ) traten seine Söhne, Sventepolk und Knud, die Regierung an, bekriegten sich aber untereinander, und schon 1129 existirte kein Nachkomme Heinrichs mehr 8 ). Knud Lavard erhielt nun die Königswürde über die wendischen Lande, theils vielleicht in Folge einer früheren Uebereinkunft mit Heinrich, theils durch Belehnung des Kaisers Lothar 1129 9 ); ob das Verwandtschaftsverhältniß hiebei auch in Betracht gekommen sei, muß als unentschieden betrachtet werden 10 ). Inzwischen ist es höchst wahrscheinlich, daß Waldemars Ansprüche an


|
Seite 117 |




|
diese wendischen Länder, ja sogar die nachherigen Bestrebungen der folgenden dänischen Könige, die Oberherrschaft zu erhalten, größtentheils auf ein vermeintliches, ihnen als Nachkommen von Knud Lavard zustehendes Recht sich gegründet haben mögen. In den zwei Jahren, die er nach seiner neuen Würde noch lebte, mußte er einen Aufruhr seiner heidnischen Unterthanen bekämpfen, welcher von zwei eingebornen Häuptlingen Pribislav und Niclot geleitet ward.
Nach Knuds Tode, 1131, theilten diese die wendischen Länder unter sich. Pribislav erhielt Wagrien und Polabien, Niclot das Land der Obotriten. Der erste, ganz gewiß ein Brudersohn Heinrichs 11 ), verfolgte die Christen und führte längere Zeit mit seinen Nachbaren, besonders den Nordalbingiern, einen Krieg, der mit dem Ende des wagrischen Reiches aufhörte und Polabien zu einem deutschen Staate, unter dem Namen der Grafschaft Ratzeburg, umwandelte. Pribislav verschwindet ungefähr mit dem Jahre 1156 aus der Geschichte; ob er Nachkommen hinterlassen habe, weiß man nicht.
Niclot, der wie Pribislav an seiner Väter Glauben hielt, setzte den Krieg mit den Dänen und Heinrich dem Löwen nicht unglücklich fort, fiel aber 1160 im Kampfe mit [S. 5.] ihnen. Da das gesammte meklenburgische Fürstenhaus seine Ahnen von ihm, oder richtiger von seinem Sohne Pribislav herleitet, so ist seine Herkunft ein Gegenstand älterer und neuerer Untersuchungen gewesen, die aber nur auf Vermuthungen hinauslaufen oder auf verschiedene Erklärungen des Ausdrucks, mit welchem Helmold, hier der einzige Quellenschriftsteller, nachdem er Pribislav als fratruelem Henrici bezeichnet hat, den Niclot als majorem terrae Obotritorum (I. c. 49.) aufführt. Unter dem Ausdrucke major verstehen die Schriftsteller des Mittelalters im allgemeinen einen höhern Grundbesitzer Dynasten); aber es fehlt auch nicht an Stellen, wo er gebraucht wird, Personen von fürstlicher Herkunft zu bezeichnen 12 ). Fügt man als historisch erweis=


|
Seite 118 |




|
lich hinzu, daß wenn auch nicht ein strenges Erblichkeits=Princip, doch eine größere oder geringere Rücksicht auf das herrschende Fürstengeschlecht deutlich durch die ganze älteste Geschichte des obotritischen Landes geht; sehen wir ferner als ausgemacht an, daß Pribislav diesem Fürstengeschlechte angehörte, so bleibt es immer wahrscheinlich, daß Niclot, der mit ihm zugleich zum Regenten erwählt ward, ihm auch nicht ganz fremd gewesen ist, entweder als Sohnessohn von Gottschalks ältestem Sohne Buthue 13 ), oder in irgend einem andern Verhältnisse, welches näher zu bezeichnen Helmold sich nicht hat die Mühe geben wollen oder welches er vielleicht selbst nicht einmal gewußt hat. Wie viele Verwandtschaftsverhältnisse jener Zeit, selbst einer spätern, liegen nicht noch im Dunkeln 14 )!
Von Niclots ehelichen oder dergleichen Verhältnissen weiß man nichts 15 ); er hinterließ jedoch drei Söhne, Pribislav, Wartislav und Prislav. Der letzte würde historisch ganz unbekannt geblieben sein, wenn die dänischen Geschichtsquellen nicht von ihm und seinen Nachkommen Kunde bewahrt hätten. Von diesen weiß man nun, daß Prislav schon bei des Vaters Lebzeiten das Christenthum angenommen hatte und deshalb nach Dänemark flüchten müßte, wo er Catharina, eine Tochter Knuds Lavard, ehelichte. Hier erhielt er auch Belehnungen von Waldemar I. und muß wenigstens bis 1164 16 ) gelebt


|
Seite 119 |




|
[S. 6.] haben. Zwei Söhne kennt man von ihm. Knud starb 1183 17 ) hier in Dänemark, vermuthlich ohne Nachkommen 18 ), und Waldemar ein Jahr später als Kanonikus am St. Genofeva=Kloster zu Paris 19 ). Daß er auch Töchter sollte hinterlassen haben, beruhet nur auf unbegründeten Vermuthungen 20 ).
Pribislav führte gleich seinen Vorgängern mehrere Jahre Krieg mit dem sächsischen Herzoge Heinrich dem Löwen, welcher sich zuletzt mit ihm aussöhnte und ihm das obotritische Reich übertrug. Vermuthlich nahm zu derselben Zeit, ungefähr 1164, Pribislav die christliche Lehre an; 1170 stiftete er ein Kloster in Alt=Doberan 21 ); 1171-72 folgte er Heinrich dem Löwen auf einer Wallfahrt ins heilige Land; 1178 soll er gestorben sein. Zuverlässige Nachrichten von einer Ehe Pribislav's giebt es nicht. Die ältern, eben nicht kritischen meklenburgischen Schriftsteller nehmen an, daß er drei Mal vermählt gewesen sei: mit Pernille, Tochter Knuds Lavard, Herzogs von Schleswig, mit Woislava, Tochter eines norwegischen Königs Borwin, und mit Mathilde, Tochter des polnischen Fürsten Boleslav. Die erste Angabe muß unbezweifelt aus einer Verwechselung mit der Ehe seines Bruders Prislav herrühren, die dritte von


|
Seite 120 |




|
dem Sohne Heinrich Borwins, dem auch, obgleich unrichtiger Weise, eine polnische Gemahlin zugesellt wird. Was die zweite betrifft, so hat man schon einen etwas besseren Beweis, da der älteste meklenburgische Chronikenschreiber, Ernst v. Kirchberg, der seine Chronik 1378 schrieb, berichtet, Pribislav sei 1164 mit einer norwegischen Königstochter Woyslava - deren Vater nicht von Ihm, sondern von neueren Quellen Borwin genannt wird - verheiratheten worden, die ihn zum Christenthume bekehrte, nach der Geburt Heinrich Borwins 1172 starb [S. 7.] und in Alt=Doberan begraben ward. Bei diesen chronologischen Angaben muß hier ein Irrthum sich eingeschlichen haben, da nämlich Heinrich Borwin 1178, als sein Vater starb, sowohl verheirathet, als mündig war. Daß aber die Sage von einer Woizlava als Stifterin des Klosters Alt=Doberan (claustri fundatrix, richtiger, als derjenigen, die die Stiftung veranlaßte und beförderte, welche historische Quellen dem Pribislav selbst zuschreiben,) und als Landesbeherrscherin (terrae domina) älter sein muß, als Kirchbergs Chronik, geht aus einigen in neuester Zeit entdeckten Inschriften des erwähnten Klosters hervor 22 ).
Daß kein norwegischer König Borwin existirt hat und Woizlava kein norwegischer Name war, bedarf keines weitern Beweises. Nehmen wir indeß an, daß etwas Factisches dennoch hier zum Grunde liegen muß, so kann man sich denken, daß Pribislav vermählt gewesen sei mit einer Tochter des Buris, des Sohns von Heinrich Skadelaar, (Svend Estridsons Enkel), dessen mütterliches Geschlecht aus Norwegen stammte, dessen slavischer Name in einen andern ähnlichen verwandelt ward, wie der norwegische Name der Tochter in das slavische Woizlava (Kriegsehre), und dessen Sohn nachher die Namen des Großvaters mütterlicher Seite und des Eltervaters in den Namen Heinrich Borwin vereinigte, 23 ). Wenigstens fehlt es nicht an dergleichen Verunstaltungen des Verwandtschaftsverhältnisses, indem die Schriftsteller die Identität der Personen und des Landes unrichtig auffaßten 24 ). Könnte jene Muthmaßung je zur historischen Gewißheit erhoben werden, so würde


|
Seite 121 |




|
die Abstammung des meklenburgischen Fürstenhauses von dem Stammvater des dänischen dadurch bewiesen sein. Auf der andern Seite wäre es wohl denkbar, theils wegen der chronologischen Schwierigkeiten, die jene Erklärung an sich hat, sowohl in Hinsicht des Alters Heinrich Borwins, als des dänischen Buris 25 ), theils wegen gänzlichen Stillschweigens Helmolds und des lübecker Arnold hierüber, daß, selbst in den älteren Quellen der meklenburgischen Geschichte, eine Verwechselung der Gebrüder Pribislav und des an eine dänische Herzogstochter vermählten, in seinem Vaterlande nur wenig gekannten Prislav, [S. 8.] statt gefunden habe, wobei man zugleich annehmen muß, daß die ganz slavischen Namen Borwin und Woizlava willkührlich untergeschoben seien 26 ). Meklenburgs neuere Geschichtschreiber, Rudloff und v. Lützow, scheinen diese Ansicht zu adoptiren, indem sie weder von Woizlava, noch sonst von der Ehe Pribislav's sprechen 27 ). Wer nun Heinrich Borwins Mutter war, weiß man nicht gewiß; aber ist er von mütterlicher Seite auch nicht mit dem dänischen Königshause verwandt gewesen, so war er wenigstens doch damit verschwägert, da der dänische König Knud VI. und er Schwiegersöhne des Herzogs von Sachsen, Heinrichs des Löwen, waren.
Als Heinrich der Löwe dem Pribislav das obotritische Land übertrug, ward Schwerin ausgenommen und zu einer Grafschaft gemacht, die in späteren Zeiten den meklenburgischen Landen einverleibt ward. Von jener Grafschaft war die einzige, - man kann sie eine meklenburgische Fürstentochter nennen, - welche im Mittelalter in das dänische Königshaus verheirathet ward, Ida, die Tochter des Grafen Gunzel II. von Schwerin. Sie ehelichte den Grafen Niels von Halland, den natürlichen Sohn Waldemars II., und zu ihrer Mitgift ward die halbe Grafschaft nebst Schloß verschrieben. Als nun Graf Niels ungefähr 1219 starb, nahm Waldemar II. von der Hypothek für seinen unmündigen Enkel und im Falle dessen


|
Seite 122 |




|
Ablebens für sich Besitz 28 ). Des Königs Verfahren bei dieser Gelegenheit, sein immer deutlicher hervortretender Plan, mit den übrigen an die Ostsee grenzenden slavischen und deutschen Ländern sich auch das schwerinsche Land zuzueignen, brachte den Grafen Heinrich, den Oheim der inzwischen auch verstorbenen Gräfin, nach seiner Heimkehr von einer Wallfahrt und nachdem er vergebens in den König gedrungen, ihm das Land seiner Väter wiederum zurückzustellen, zu dem dreisten und verzweifelten Schritte, 1223 den König und dessen ältesten Sohn gefangen zu nehmen. Diese Katastrophe stürzte Dänemarks Principat im Norden, obgleich die folgende Zeit darthut, daß dessen Oberherrschaft über mehrere norddeutsche Länder, namentlich die meklenburgischen, bei dieser Gelegenheit nicht ganz aufhörte. Uebrigens ging Nielsen's und Ida's Geschlecht hier in Dänemark sehr tragisch zu Grunde. Der Enkel, Graf Jacob von Halland, trat als ein Haupttheilnehmer in der Verschwörung gegen Erich Glipping (den Blinzler) auf; seine zwei einzigen Söhne wurden 1314 hingerichtet.
Die meklenburgischen Historiker sind darüber einig, daß der Enkel Borwins I., Heinrich oder Borwin III., Herr zu Rostock († ungefähr 1278), zum zweiten Male 29 ) mit einer dänischen Prinzessin, Sophia (bei andern Margarethe), entweder einer Tochter Erichs Plovpenning, oder Abels, verheirathet gewesen sein soll 30 ). Mehrere Gründe machen [S. 9.] indessen wahrscheinlich, daß vielmehr der genannten Könige älterer Bruder Waldemar, gekrönter König und Mitregent seines Vaters, ihr Vater gewesen sei, und man kann


|
Seite 123 |




|
annehmen, daß nach diesem Heinrich Borwins zweiter Sohn genannt ward 31 ).
Unter den verschiedenen Linien, in welche die meklenburgischen Länder im Mittelalter getheilt waren, verdient die werlesche unsere besondere Aufmerksamkeit. Nicolaus I., der ältere Bruder Heinrich Borwins III., stiftete sie 1237: sie blühete 200 Jahre (bis 1436), und ein Abkömmling dieser Linie gründete einen neuen, über den ganzen Norden verbreiteten Herrscherstamm. Der Enkel des Stifters, Nicolaus II. (ungefähr 1284), heirathete ungefähr 1293 Richiza oder Rixa, die Tochter Erichs Glipping, mit welcher er in ihrem vierten Jahre verlobt und welche nachher im Kloster Dobbertin erzogen ward 32 ). Zur Mitgift bekam er viele Güter in Dänemark, auch, wie es scheint, Falster und Mön 33 ), und sein Ansehen ward durch diese Ehe nicht wenig vermehrt. Er soll am 27. Octbr. 1308 34 ) gestorben sein, und hinterließ zwei Kinder, einen Sohn Johann, welcher dem Vater in der Regierung über den Werle=Parchimschen Antheil († 1352) folgte, und eine Tochter Sophia. Diese ward 1310 mit dem schwedischen Herzoge Magnußen verlobt, und nachdem diese Verlobung 1311 wieder aufgehoben ward 35 ) und ihr Vater sich verpflichtet hatte, sie nicht ohne Einwilligung ihres Onkels, des Königs Erich Menved, zu verheirathen 36 ), ehelichte sie den Grafen Gerhard den Großen von Holstein 37 ). Durch den ältesten Sohn dieser Ehe, Heinrich (den eisernen), ward Sophia von


|
Seite 124 |




|
Werle, oder richtiger ihre Mutter, Richiza von Dänemark, Stammmutter des oldenburgischen Königshauses. Unter anderen Verhältnissen hätten Abkömmlinge von Richiza's Sohn, Johann von Werle=Parchim (Goldberg), möglicher Weise den dänischen Thron besteigen können.
Aber schon vor dieser Periode hatten sich, wie es schien, bereits nähere Aussichten für das rneklenburgische Haus eröffnet, den Fürstenhut mit der dänischen Königskrone zu vertauschen. Die älteste Tochter Waldemars Atterdag, Margarethe (geb. 1345), ward, kaum 5 Jahre alt, mit Herzog Heinrich (Suspensor), Bruder des schwedischen Königs Albert, verlobt, beide Söhne von Albert, dem ersten Herzoge von Meklenburg, und Euphemia, Schwester des schwedisch=norwegischen Königs Magnus Smeck. Da sie in demselben Jahre starb, trat ihre jüngere Schwester Ingeborg (geb. 1347) an ihre Stelle, und die Hochzeit [S. 10.] ward 1362 gefeiert 38 ). Ein Sohn und drei Töchter waren die Frucht dieser Ehe, und da Waldemars Atterdag ältester Sohn Christoph 1363 starb, ward Albert von Meklenburg als präsumtiver Thronfolger angesehen. Nach dem Tode der Mutter 1370 ward im folgenden Jahre zwischen dem dänischen Könige und Herzog Albrecht ein Uebereinkommen getroffen, wodurch das Recht des jungen Albert zum Throne anerkannt ward, wenn der König keine männlichen Leibeserben hinterlassen sollte 39 ). Dies traf bei Waldemars Tode 1375 ein; doch die Partei für Albert war in Dänemark nur schwach, obgleich Kaiser Carl IV. seine Forderungen unterstützte 40 ). Durch seiner Mutter Einfluß ward Oluf, der Sohn Margarethens, der jüngern Tochter Waldemars, 1376 zum dänischen Könige gewählt, und durch einen Vergleich zwischen den meklenburgischen Herzogen und dem dänischen Machthaber die Wahlfreiheit der Stände anerkannt, Oluf bestätiget, zugleich aber auch die Zusicherung gegeben, daß Albert, dem Tochtersohne


|
Seite 125 |




|
Waldemars, diese Wahl an seinen Rechten nicht schaden solle, alles nach dem nähern Erkenntnisse der ernannten Schiedsrichter 41 ). Diese Rechte scheinen jedoch weder gefordert, noch erfolgt zu sein, und eine praktische Anerkennung der Rechte der dänischen Königstöchter und ihrer Nachfolger zum Throne war also das einzige wichtige Ergebniß dieser ganzen Verhandlung. Als Alberts Großvater väterlicher Seite 1379 gestorben war, legte er den Königstitel nieder, führte bloß den Namen eines Erben von Dänemark, so wie er auch fortfuhr, das dänische Wappen in seinem Siegel zu gebrauchen 42 ). Er selbst starb ohne Erben 1388, ein Jahr nach Oluf, seinem Geschwisterkinde und Mitbewerber um den Thron. Wenige Jahre nachher kam indessen die dänische Krone auf die weibliche Linie dieses Hauses, als Erich von Pommern, ein Sohn Marias, der Schwester Alberts, die an den Herzog Wratislav von Pommern verheirathet war, den Thron bestieg und sein Schwestersohn Christoph von Bayern nach ihm folgte.
Das Wahlrecht, welches 1376 von den Reichsständen bestätigt worden war, ward von ihnen geltend gemacht, als der letztgenannte König ohne Leibeserben gestorben war (1448). Sie wählten den Grafen Christian von Oldenburg, einen Sohn Dietrichs des Glücklichen und Hedewigs 43 ), die im fünften Gliede aus Nikolaus des Ersten von Werle [S. 11.] Ehe mit Richiza, Tochter Erichs Glipping, herstammte. So wurden durch das meklenburgische Fürstenhaus die Dänenkönige der oldenburgischen Dynastie an den alten Königsstamm gebunden, welcher fünf Jahrhunderte das Reich beherrscht hatte.


|
Seite 126 |




|
Läßt sich jene Abstammung zwar unwiderruflich beweisen 44 ), so treten doch immer noch Zweifel auf, ob nicht politische mehr als verwandtschaftliche Rücksichten die Wahlen zu einer Zeit geleitet haben, wo kein bestimmtes Successionsgesetz existirte, und überhaupt ob jene die mehr als anderthalb Jahrhunderte alten Verhältnisse so ganz klar und richtig erkannt haben. Gleich allen Studien waren damals auch die genealogischen sehr unvollkommen, die dazu nöthigen Quellen sehr mangelhaft, und historische Kritik gab es nicht. Die Art und Weise, wie Herzog Adolph selbst seines Schwestersohns Christian des Ersten Abstammung aus dem alten dänischen königlichen Geschlechte herleitete 45 ), beweiset eben so wenig, als die Erklärung des norwegischen Reichsrathes über Christians Verwandtschaft mit dem alten norwegischen Königsstamme, daß jenes gewiß ziemlich verwickelte Verhältniß richtig aufgefaßt worden.
II.
Sophia, die erste meklenburgische Prinzessin, die in das oldenburgische Königshaus eintrat, kam nicht als eine ganz Fremde her. Durch ihre Mutter nicht nur, sondern auch durch andere Verwandte stand sie dem Königshause nahe. Ueber dieses Verhältniß, welches gewiß nicht ohne Einfluß, sowohl auf die Wahl des Königs, als auch auf ihre eigene Stellung und ihr Auftreten in der folgenden Zeit war, sind die wesentlichsten Momente hier vorangeschickt.
Herzog Albert der Schöne, im 5ten Gliede von dem ersten Herzoge Meklenburgs stammend, war bekannt als der schönste und stärkste unter den Fürsten seiner Zeit, tapfer und thätig, doch mehr in einer abentheuerlichen, als nützlichen Weise.


|
Seite 127 |




|
Verlobt 1521 und vermählt 1524 mit Anna von Brandenburg, Tochter des Kurfürsten Joachim I. und Elisabeth, Schwester Christians II., hatte er schon lange der Sache seines unglücklichen Mutterbruders sich eifrig ergeben gezeigt. Hauptsächlich wohl dieser Verwandtschaft wegen wählte ihn Lübeck 1535 zum Anführer seiner Kriegsmacht im Norden, und eine Partei in dieser Hansestadt bot ihm und seinem älteren, ver= [S. 12.] ständigeren Bruder Heinrich, die drei nordischen Kronen an, die, wie Albert wenigstens glaubte, ihnen ohne Schwierigkeit zu Theil werden mußten 46 ). Bekanntlich schlug diese Hoffnung fehl. Obgleich aber Christian III., sowohl während Kopenhagens Belagerung, deren Schrecken der Herzog mit seiner Gemahlin theilen mußte 47 ), als auch bei der darauf folgenden Capitulation dem Herzoge viel Aufmerksamkeit und Schonung gezeigt hatte; obgleich dieser ferner während seiner 11 übrigen Lebensjahre nicht im Stande war, von dem Schwager Christians II., dem Kaiser Carl V., etwas anderes als Verheißungen und leere Hoffnungen für die in diesem Kriege von ihm selbst aufgewandten bedeutenden Kosten zu erhalten, eine Forderung, welche als Erbschaft auf seine Nachkommen überging und beim


|
Seite 128 |




|
westphälischen Frieden noch zur Sprache kam 48 ), fuhr er dennoch fort, selbst nachdem er mit Christian III. verschwägert worden war, zum Theil wohl wegen seiner Ergebenheit für den Katholicismus, die Pläne des Kaisers gegen die nordischen Reiche, namentlich gegen Dänemark, zu unterstützen. Da sein zweiter Bruder jung starb und des ältesten, Heinrich des Friedlichen, Nachkommenschaft schon im zweiten Gliede erlosch, so war er es allein, der das meklenburgische Fürstenhaus in seinen verschiedenen Linien fortpflanzte.
Die erste dieser ehelichen Verbindungen, die drei Jahrhunderte hindurch dieses Fürstenhaus so nahe mit dem dänischen Königsstamme verknüpfte, ward 1543 geschlossen, als Alberts Brudersohn, Herzog Magnus, Bischof von Schwerin, Elisabeth, Friedrichs I. zweite Tochter, heirathete. Nach Alberts Tode (1547) ehelichte sein ältester Sohn, Johann Albrecht I., (1555) Anna Sophia, Tochter des ersten Herzogs von Preußen, Markgrafen Alberts von Brandenburg, und Dorothea's, Friedrichs I. Tochter. Magnus' Vetter Ulrich, Herzogs Albert jüngerer Sohn, ward sein Nachfolger in der Ehe mit Elisabeth, so wie Herzog Christoph, Bischof von Ratzeburg, Ulrichs jüngerer Bruder, sich 1573 mit Elisabeths, damals 45 Jahre alten, Schwester Dorothea ver= [S. 13.] mählte 49 ). Herzog Johann, Johann Albrechts Sohn, vermählte sich 1588 mit Sophia, einer Tochter Herzog Adolphs, Sohnes Friedrichs, I., des Stammvaters des holstein=gottorpschen Hauses, und so wurden in einem Zeitraume von


|
Seite 129 |




|
45 Jahren fünf Ehen zwischen vier weiblichen Nachkommen Friedrichs I. und Fürsten des meklenburgischen Hauses geschlossen, aus welchem in derselben Zeit eine Fürstentochter in das dänische Königshaus überging und Stammmutter eines ausgebreiteten und glänzenden Geschlechts ward.
Von den genannten Personen muß Elisabeth, Friederichs des ersten Tochter uns vor Allen interessiren, theils wegen ihrer eigenen Persönlichkeit, theils als Mutter einer so ausgezeichneten und bedeutenden dänischen Königin, auf deren Erziehung und Bildung sie einen so entschiedenen Einfluß übte, auf welche ihr Geist, ihre ganze Eigenthümlichkeit sich vererbt zu haben scheint.
Elisabeth ward am 14. Octbr. 1524 geboren; ihre Mutter war Sophia von Pommern. Erst 9 Jahre alt, als ihr Vater starb, soll sie, obgleich ihre Mutter noch bis 1568 lebte, ihre Erziehung vorzüglich von Christian III., ihrem Halbbruder, erhalten haben 50 ). In ihrem 19ten Jahre ward sie mit Herzog Magnus, einem gelehrten Fürsten und dem ersten Bischofe von Schwerin, der sich verheirathete 51 ), vermählt; aber, schwächlich von Gesundheit, starb er nach 7 Jahren (1550) ohne Leibeserben. Seine Wittwe ging zurück nach Dänemark 52 ), wo sie sich 6 Jahre später (1556) mit Herzog Ulrich vermählte 53 ), dem Geschwisterkinde und Nachfolger


|
Seite 130 |




|
ihres Gemahls in der schweriner Bischofswürde. Die einzige Frucht dieser Ehe war Sophia.
Elisabeths Aeußeres wird als schön und anmuthig beschrieben; auch Herzog Ulrich soll, wie sein Vater, durch Schönheit und würdigen Anstand sich unter den deutschen Fürsten der Zeit ausgezeichnet haben 54 ). Nach dem einstimmigen [S. 14.] Zeugnisse der Zeitgenossen, dessen Wahrhaftigkeit nicht mit Grund zu bezweifeln ist, vereinte sie die besten Eigenschaften des Herzens und des Verstandes. Fromm und gottesfürchtig, las sie täglich in der Bibel und in Luthers Schriften und ging fleißig zur Kirche. Mit dem Gedanken an ihren Tod war sie ganz vertraut und schon bei ihren Lebzeiten hatte sie Sarg und Grabkleider fertig. Sie war mäßig in Essen und Trinken und nahm nicht gerne neue Moden an. Dürftigen Kranken, besonders Wöchnerinnen, half sie mit Geld und Arzenei; arme, hoffnungsvolle Studenten unterstützte sie von ihrem Leibgedinge. Ihr Hof war eine Schule der Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und strenger Sittlichkeit; junge adelige Fräulein, besonders solche, die ihr nicht in guten Verhältnissen und Umgebungen zu leben schienen, nahm sie zu sich, sorgte für ihre Erziehung und Bildung, hielt sie zur häuslichen Arbeit, besonders zum Spinnen und Weben an und trug dann Sorge, durch eine passende Heirath ihre Zukunft zu sichern. Gegen ihre Untergebenen zeigte sie Freundlichkeit mit Ernst verbunden. Durch ihre haushälterische Thätigkeit erleichterte sie ihres Gemahls Regierungsbürde in wichtigen Stücken und machte sich hoch verdient um sein Land. Nicht allein die zu ihrem Leibgedinge gehörenden Güter kannte sie, sondern auch mit den Schlössern und Höfen des Herzogs machte sie sich genau bekannt; sie verbesserte Ackerbau und Viehzucht, pflanzte Wälder, legte Stutereien an, die sehr nützlichen Einfluß auf die meklenburgische Pferdezucht hatten, und sorgte für die Instandehaltung der Wege. Im Sommer stand sie zeitig auf und besuchte, begleitet von wenigen Hofdamen, die nahen Höfe, um nachzusehen, ob das Gesinde zur rechten Zeit bei der Arbeit und Alles in Ordnung war; die Frauen und Töchter der Bauern mußten auch für sie spinnen. Alle herzoglichen Höfe wurden durch sie mit Betten und Hausgeräthe versehen, welches herbeizuschaffen, wenn der Hof umherreiste, sonst den Unterthanen auflag. Sie interessirte sich eifrig für alle vorkommenden Bauten; die Domkirche zu Güstrow ward durch ihr Bestreben


|
Seite 131 |




|
ausgebaut und mit prachtvollen genealogischen Monumenten des meklenburgischen Fürstenhauses geschmückt; eben so die Klosterkirche in Doberan, in welcher die alten Fürsten ihre Ruhestätten hatten, die aber nach der Reformation verfallen war; mehrere Klöster für adelige Wittwen und Jungfrauen, Hospitäler, Armenhäuser und Schulen ließ sie theils erbauen, theils im Stande halten und verbessern 55 ). So bewahrt das meklenburgische Land noch viele Andenken von dem heilbringenden Wirken dieser edlen Frau.
Elisabeth hatte die Freude, ihre einzige Tochter glücklich mit dem Sohne eines Bruders vermählt zu sehen , dessen Andenken ihr lieb und theuer war. Ihr Verhältniß zum Schwiegersohne und dessen Hause werden wir in der Folge kennen lernen. Im Jahre 1586 starb sie während eines Besuches in Dänemark. Ihre Leiche ward wenige Tage darauf nach Meklenburg hinübergeführt und in der Domkirche zu Güstrow beigesetzt. Ein prachtvolles Mausoleum daselbst zeigt sie, Herzog Ulrich und seine andere Gemahlin, Anna von Pommern, knieend, in Lebensgröße aus weißem Marmor 56 ).
III.
[S. 15.] Sophia von Meklenburg, UIrichs und Elisabeths Tochter, ist in Wismar am 4. Septbr. 1557 geboren 57 ). Von ihren früheren Jugendjahren weiß man nichts; aber auf ihre Erziehung und Bildung können wir von ihrer Mutter Charakter und ihrem eigenen späteren Wandel schließen. Unsere Aufmerksamkeit zieht sie erst seit der Zeit auf sich, wo sie, noch nicht volle 15 Jahre alt, den Thron des Zwillingsreiches bestieg. Die lange Reihe von fast 60 Jahren, welche die


|
Seite 132 |




|
Vorsehung ihr vergönnte, für ihr neues Vaterland zu wirken, zerfällt in zwei Zeiträume. Im ersten lernen wir sie kennen als Gemahlin und regierende Königin, im zweiten als Wittwe, Verwalterin beträchtlicher Güter, als des Königs und Landes weise Rathgeberin; ihr mütterliches Wirken umfaßte beide Zeiträume und endete erst mit ihrem Leben.
Friedrich II. entschloß sich erst zur Ehe, nachdem er sein 37stes Jahr vollendet und 13 Jahre regiert hatte. Die Ursache, warum er diesen für das Volk und die Dynastie gleich wichtigen Schritt länger als irgend einer seiner Vorgänger auf dem Throne aussetzte, soll vornehmlich der Krieg mit Schweden gewesen sein, der erst durch den Frieden zu Stettin 1570 endigte. Ob nun, so lange des Königs Mutter, die verwittwete Königin Dorothea, lebte, andere Hindernisse und Bedenklichkeiten, z. B. das doppelte Leibgedinge, im Wege gewesen, ist unbestimmt; gewiß ist, daß er einen Monat nach dem Tode seiner Mutter (7. Octbr. 1571) seinen Entschluß gefaßt hatte 58 ). Daß aber außer den erwähnten ostensiblen Gründen noch einige nicht allgemein bekannte Ursachen vorhanden gewesen sein müssen, daß Friedrich II. so lange unverheirathet blieb, gehet deutlich aus folgender bemerkenswerthen Stelle in A. S. Vedels Leichenpredigt auf den König hervor (fol. C. I.), die in wörtlicher Uebersetzung also lautet:
"Indessen hatte Sr. Gnaden auch in ein gottselig Bedenken genommen, daß es nun beinahe hohe Zeit sei, daß S. G. zur Ehe nehme eine gottesfürchtige Person von gutem Stamme und guter Herkunft, damit Gott der Allmächtige segnen möge S. G., daß er hinterlasse Leibeserben und auch den, der nach ihm zu seiner Zeit vorstehen könne Land und Reich. Was für Anschläge hiezu gemacht wurden, wissen die am besten, die dabei gebraucht wurden und nun mehrentheils bei dem Herrn sind. Es muß aber Jedermann, zu Gottes heiligen Namens Ehre und zu Anderer gottseligem Nachstreben, bekannt sein, daß wenn Sr. K. Majestät nicht Gott den Allmächtigen mehr zu Rathe gezogen, als Menschen, und Gott Sr. G. durch einige wenige fürnehme getreue Räthe nicht ernstlich hätte ermahnen lassen, man überzeugt sein kann, daß es etwas anders gekommen sein würde,
postquam materno justas a funere curas
rex revocat, primis iterum sese ignibus infert,
conjugio animum advertit.


|
Seite 133 |




|
"als es, Gott Lob, nachher kam. Ein Beispiel, daß der= jenige, welcher ernstlich sich auf den allmächtigen Gott im Himmel verlässet, nie zu Schanden wird, sondern wunderbar, wie Gott mit seinen Heiligen zu thun pflegt, auf den rechten Weg geführt wird, vor den Augen aller seiner Feinde."
Es ist klar, daß Vedel besser unterrichtet gewesen ist, als er es für rathsam gefunden hat drucken zu lassen. Ohne [S. 16.] Zweifel werden die Gedanken an die Neigung sich heften, die, nach dem Berichte Neuerer, der König für eine Tochter seines Hofmeisters, während er in Malmö residirte, nachherigen Reichs=Hofmeisters Eiler Hardenberg, gefaßt hatte, und die er sogar hätte heirathen wollen, wenn der Vater selbst es nicht abgewehrt hätte 59 ). Für dies vermeintliche Factum, oder richtiger Mährchen, giebt es keine Auctorität, so wie mehrere Umstände für die Unwahrscheinlichkeit sprechen, wenigstens so, wie es von den genannten Verfassern dargestellt ist. Herr Eiler Hardenberg, welcher von 1544-51 Gulland zu Lehn gehabt hatte und 1552 in Dänemark war, ward 1554 wiederum Lehnmann auf Malmöhuus und zugleich des Prinzen Hofmeister, d. h. der, welcher seinem Hofhalte in Malmö vorstand. Bei der Krönung des Königs 1559 ward er Reichshofmeister und erhielt die Ritterwürde; 1562 ging er an der Spitze einer Gesandtschaft nach Rußland. Bei dieser Gelegenheit mochte er sich aber des Königs Mißvergnügen zugezogen haben, denn von diesem Jahre an erhielt er davon wiederholte Beweise in stets ernsteren, ungnädigeren Briefen, bis er denn am 3. Julii 1563, wegen Altersschwäche, wie es hieß, im Grunde aber in halber Ungnade, seinen Abschied als Reichshofmeister und Reichsrath erhielt und ein halbes Jahr nachher gestorben sein soll. Wedel hat also Unrecht, wenn er sagt: "er war S. G. Hofmeister bis zu seinem Sterbetage 60 )." Allgemein giebt man ihm zwei Töchter, Mette und Kirstine: jene starb auf Gulland, diese in Dänemark gegen 1570, beide sehr jung. Sollte der König nun an eine Ehe mit letzterer gedacht haben, so


|
Seite 134 |




|
müßte es doch wohl vor 1562 gewesen sein, wo die Ungnade des Vaters begann, die man aber auch als durch dessen Nichteinwilligung entstanden sich denken kann; doch hatte damals der Krieg mit Schweden noch nicht begonnen und noch weniger konnte man dessen lange Dauer vorhersehen, daß also von dieser Seite keine Nothwendigkeit für den König vorhanden war, seine Verheirathung noch 10 Jahre auszusetzen. Nach den bisher bekannten Quellen muß man also diese Sage als nicht aufgeklärt betrachten, obgleich man auch nicht denken kann, daß sie jedes historischen Grundes baar gewesen sein sollte. Und hat Vedel nicht auf diesen Vorfall gedeutet, so hat er an eine Ehe Friederichs II. mit Maria Stuart gedacht, die gleich nach des Königs Regierungsantritt auf der Bahn gewesen sein soll 61 ).
[S. 17.] Nach reiflicher Ueberlegung zog der König es endlich vor, sich nach Meklenburg, dem nächsten fremden Fürstenthume, zu wenden, dessen Regentenhaus mit dem dänischen verschwägert war, dessen damals regierender Herzog Ulrich, vereint mit seinem älteren Bruder Johann Albrecht, in dem Kriege mit Schweden sich so freundlich gegen Dänemark gezeigt hatte und unverdrossen Theil genommen an der schwierigen Vermittelung zwischen dem Könige und den schleswig=holsteinschen Herzogen in Betreff des schleswigschen Lehnsverhältnisses. Im November stellte sich der Herzog nebst Gemahlin und Tochter auf des Königs Einladung ein. Sie nahmen den nächsten und gewöhnlichsten Weg über Falster, wo der König auf Nyköping=Schloß sie empfing und wobei die Prinzessin Gelegenheit hatte, die Gegenden kennen zu lernen, die einst so viel Bedeutung und Werth für sie erhalten sollten. Nachdem sie sich hier einige Tage mit der Jagd vergnügt hatten, begaben sie sich über Lolland und Wardingborg nach Seeland, wo sie besonders auf Friedrichsborg sich aufhielten; nach Kopenhagen kamen sie das Mal nicht 62 ). Der König lernte die anmuthige Sophia kennen 63 ), die einige Monate vorher ihr 14. Jahr erreicht hatte, und seine Wahl, von welcher er gegen


|
Seite 135 |




|
seine Umgebungen bisher nichts geäußert hatte 64 ), ward von ihm bei sich bestimmt. Die Prinzessin erhielt den Antrag und die Eltern gaben ihre Einwilligung; nur hegte man in Folge der Zeitansichten einige Bedenklichkeiten wegen des nahen Verwandtschaftsverhältnisses, da, wie angeführt, des Königs Vater und die Mutter der Prinzessin Halbgeschwister, sie selbst also Geschwisterkinder waren. Der König sandte deshalb seinen Hofprediger und Vertrauten, Niels Kolding, nach Kopenhagen, um das Bedenken des Bischofs und der theologischen Fakultät einzuholen, und erst als er mit der einstimmigen Erklärung, daß die gewünschte Verbindung zulässig sei, zurückkam, ward die Verlobung bekannt gemacht und die Vermählung zum nächsten Sommer hier in Dänemark festgesetzt 65 ). Nach einigen Wochen reiste der Herzog mit seiner Familie der vorgerückten Jahrszeit wegen zu Lande zurück; der König [S. 18.] begleitete sie durch Fühnen nach Kolding, von wo sie durch die Herzogthümer in ihre Heimath zogen.
Zum Vermählungsfeste im Sommer 1572 fand sich hier in Kopenhagen eine zahlreiche und glänzende Versammlung ein 66 ). Zuerst, am 4. Juli, kam die Braut mit ihrer Mutter und weiblichem Gefolge 67 ), kurz darauf der Braut Vater mit dem Schwager des Königs, dem Kurfürsten August von Sachsen, und der Kurfürstin Anna, des Königs Schwester, von Warnemünde über Falster. Dann kamen zwei der schleswig=holsteinschen Herzoge, nämlich des Königs Onkel, Johann der Aeltere, und dessen Bruder, Johann der Jüngere, nebst ihren Gemahlinnen, desgleichen die Gesandten fremder Fürsten und, der Gewohnheit gemäß, die Gesandten der Hansestädte,


|
Seite 136 |




|
welche köstliche Brautgeschenke brachten. Auch viele Adelige des Reichs denen es angesagt worden war, stellten sich mit ihren Frauen und Töchtern ein, und vierzehn Tage währte es, bevor alle Hochzeitsgäste versammelt und die nächsten Vorbereitungen geschehen waren.
Die Hochzeit ward am Sonntage, dem 20. Juli, auf dem Schlosse zu Kopenhagen gefeiert, die Trauung von dem deutschen Hofprediger Christoph Knopf verrichtet. Die Krönung der Königin fand am Tage darauf in der Frauenkirche statt, wo alle dänischen Krönungen von der Reformation an bis zur Souveränität geschehen sind. Das bei ähnlichen Gelegenheiten gewöhnliche Ceremoniell, die unter ihrer Last sich beugenden Tafeln auf dem Schlosse und der Flotte, die sogenannte "Fechtschule" (ein eigentliches Turnier oder "Rennen und Stechen" fand nicht statt), die bei Fredriksborg, Kronborg und an anderen Stellen veranstalteten Jagden bieten keinen uninteressanten Beitrag zu den Sitten und der Hofgeschichte damaliger Zeit, können aber um so mehr hier übergangen werden, da es an umständlichen Beschreibungen aus damaliger Zeit nicht fehlt 68 ).
Bereits vor der Ankunft der Königin waren die nöthigen Bestimmungen hinsichtlich ihrer Stellung und Rechte hier im [S. 19.] Reiche, wenn sie den König überleben sollte, getroffen.
Die Tapeten ("det Engelst"), womit das Chor in der Frauen=Kirche zur Krönung überzogen war, wurden den Schülern der kopenhagener Schule geschenkt "det var dem Hielp, og end fuld stor" (welches ihnen eine große und volle Hülfe war). Bei der Krönungsmahlzeit vertheilte die Königin an den Reichsrath, die Hofleute und die andern adeligen Gutsbesitzer
Aehnliche Geschenke vertheilte der König an das meklenburgische Gefolge; fünf von den herzoglichen Räthen erhielten goldene Ketten mit des Königs Bild; Ryge P. Oxe's Levnet S. 264. Endlich wurden auch mehrere Verbrecher aus den Gefängnissen entlassen. Joh. Slangendorpii oratio funebris in obitum Friderici II, recitata in academia Hafniensi (Hafn. 1588. 8.) fol. D. I."skiönne Krandse vor giordt udaf puurt Guld
af Perler og Aedelstene vore de fuld."


|
Seite 137 |




|
Zu ihrem Leibgedinge wurden ihr Laland und Falster ausgesetzt, mit Ausnahme der Handelsstädte Naskow, Saxkoping, Nystadt und Stubköping, des Fleckens und Klosters Maribo, und behielt die Krone sich die Landeshoheit, den Zoll und die Accise, die Roßdienste des Adels, u. a. m. vor. Der Adel auf den Inseln behielt seine Freiheiten und Privilegien; die Aemter wurden nach alter Gewohnheit von eingebornen Adeligen besetzt; von den Beständen (Substanz) der Güter sollte nichts veräußert, Holz nur zum Bedarf gefällt werden. Ihre Kleinodien, ihre fahrende Habe und ihr baares Geld, nach dem darüber aufgenommenen Verzeichnisse, ihr eventuelles Erbtheil nach dem Ableben der Eltern und endlich was sie aus ihrem jährlichen Einkommen ersparen oder selbst erwerben könnte, sollte ohne Ausnahme ihr allein gehören. Verheirathe sie sich wieder, so solle das Leibgedinge an die Krone zurückfallen, ihre eingebrachte Mitgift ihr wieder ausgeantwortet werden. Sterbe sie ohne Leibeserben, so behalte der König oder dessen Nachkommenschaft ihre Mitgift; alles übrige ihr Zugehörende falle an ihre Erben. Zur Mitgift erhielt sie 30,000 Thaler, eine anständige Aussteuer ungerechnet 69 ).
Die anfänglich nicht bedeutende Appanage der Königin ward nachher erhöht. Zuerst erhielt sie aus dem Zolle zu Helsingör 1000 "gute, gangbare und unverfälschte Thaler", welche nach dem königlichen Briefe, Hörsholm, den 23. Aug. 1572, der Zolleinnehmer zu Helsingör jeden Bartholomäi=Tag (24. August) ihr zahlen mußte. Drei Jahre später ward durch ein Schreiben des Königs (Frederiksborg, den 8. März 1575) an denselben Zolleinnehmer, Hans Mogensen, bestimmt, daß sie jährlich 2000 "gute, gangbare und unverfälschte Thaler" haben solle. Unter dem 13. Juni 1581 erhielt derselbe Beamte ferner Befehl, außer jenen 2000 Thalern an jedem St. Johannis=Tage aus derselben Casse annoch 400 alte Thaler "als Handgeld" an sie auszuzahlen. Endlich erhielt der Zolleinnehmer zu Helsingör unterm 6. Decbr. 1584 ein Schreiben, daß, so wie der König seiner Gemahlin vorher 2400 Thaler "zu Handgeld" und verschiedenen Ausgaben für ihren eigenen Bedarf verschrieben, er ihr nun volle 3000 alte Thaler jährlich auf Bartholomäi=Tag bewillige.


|
Seite 138 |




|
Mit dem Leibgedinge und der Appanage der Königin ward auch zugleich ein Hofstaat für sie eingerichtet. Kurz vor ihrer Ankunft erging am 15. Juni 1572 ein königlicher Befehl an neun Edelfrauen, ihre Töchter oder sonst ihnen verwandte Jungfrauen in das "Frauengemach" der zukünftigen Königin zu senden. Ihre erste Hofmeisterin war Frau Inger Oxe, des verdienten Reichshofmeisters P. Oxe's Schwester und Wittwe Jürgen Brahe's (1565), welcher dem Könige einmal das Leben gerettet hatte, beide unvergeßlich als zärtliche Pflegeeltern des großen Tycho Brahe 70 ), des Letztern Brudersohns. Sie stand diesem Ehrenposten 12 Jahre vor, und als sie Alters wegen abging, ward Frau Beate Bilde, R. R. Otto Brahe's [S. 20.] Wittwe und Tycho Brahe's Mutter, zur Hofmeisterin der Königin ernannt u. s. w.
Als Beitrag zur Charakteristik jener Zeit kann angeführt werden, daß zum Hofpersonale der Königin auch eine Hofzwergin gehörte. Unterm 22. Juli 1584 schrieb der König von Lundegaard (in Schonen) an Absalon Göye zu Lögtved (in Fühnen) wegen "einer kleinen Zwergin, eines Predigers Tochter dort in Unserm Lande Fühnen" bei einer Frau Anna, Nachgebliebenen des Peter Lauridsen (Straale) zu Torpe oder Torpegaard, sie an den Hof zu senden, da die Königin "nach einer solchen verlustigt sei und der König gnädigst sich versehe, daß vorgemeinte Frau und des Mädchens Vater sich nicht weigern würden oder Unserm gnädigsten Willen und Begehr es versagen, besonders da Wir gnädigst gesinnt sind, sie, wenn es ihre Gelegenheit sein könnte, anständig zu unterhalten." (Fyenske og smaalandske Tegnelser 71 ).
In ihrer ungefähr 16jährigen Ehe ward Sophia Mutter von sieben Kindern: 1) Elisabeth, geboren auf Koldinghuus am 25. August 1573. 2) Anna, geboren auf Skanderborg am 12. December 1574. 3) Christian (IV.), geboren auf Frederiksborg am 12. April 1577. 4) Ulrich, geboren auf Koldinghuus am 30. December 1578. 5) Auguste, geboren ebendaselbst am 8. April 1580. 6) Hedwig, geboren auf


|
Seite 139 |




|
Frederiksborg am 5. August 1581. 7) Hans, geboren auf Haderslevhuus am 26. Juli 1583.
Die Geburt dieser sieben Kinder außerhalb Kopenhagen an verschiedenen Orten erinnert an die Zeit, wo unsere Könige, [S. 21.] obgleich sie lange schon eine feste Residenz hatten, sich dennoch bald auf dem einen, bald auf dem andern Schlosse aufhielten, theils wegen der damaligen Regierungs=Einrichtung und Verwaltung, theils um sich Kunde zu verschaffen von dem Verhalten und Bedarf jeder Provinz, theils vielleicht der Jahreszeit wegen. Die Königinnen aber, namentlich Sophia, scheinen bei vorgenannten Veranlassungen doch die Schlösser in der Provinz der hauptstädtischen Königsburg vorgezogen zu haben, vielleicht der gesundern Luft und Ruhe wegen, vielleicht aber auch um einer jeden Provinz gleich viel Aufmerksamkeit zu bezeigen. Als einen andern charakteristischen Zug führen wir an, daß außer den bestellten Hebammen mehreren adeligen Frauen befohlen ward, sich auf dem betreffenden Schlosse einzufinden, wenn die Königin ihre Niederkunft erwartete, damit "Ihro Liebden einige gute und verständige Frauen um sich haben möge, von welchen J. L. in solchem Anliegen Rath und That erwarten könne 72 )". Vermuthlich ist auch die Königin Mutter bei der Tochter Entbindung meist zugegen gewesen. Gewiß wenigstens weiß man es bei der Geburt Christians und Hedwigs 73 ).
Da die ersten Kinder des königlichen Paares Töchter waren und die Machthaber aus früheren, schwer erkauften Erfahrungen es für nöthig fanden, jedem Successionsstreite, wenn


|
Seite 140 |




|
der König ohne männliche Leibeserben sterben sollte, vorzubeugen, stellte der Reichsrath ungefähr 1575 eine Erklärung aus, daß in diesem Falle des Königs älteste Tochter gewählt werden und der, welchem sie sich vermählen würde, die Krone haben solle 74 ): eine bemerkenswerthe Bestimmung, welche, wenn sie auch als einzelne Ausnahme kein eigentliches Erbprincip bestimmt, doch allemal beweiset, daß die Betreffenden in keinem Falle aus dem königlichen Hause zu gehen wünschten. Diese Zusage aber ward überflüssig, als Christian 1577 geboren ward.
Christian IV. war gewiß der letzte dänische König, dessen Geburt auf eine übernatürliche Weise verkündet sein soll. "Im Nachherbste (1576)" - erzählt man - "kam ein alter, einfältiger Bauer von Samsöe herüber zu den allgemeinen "Herrentagen", die damals zu Kallundborg gehalten wurden, meldete sich bei Hofe und berichtete, daß zu verschiedenen Malen in dem Felde am Strande auf Samsöe, wo er wohne, ein schmuckes, schönes Weibsbild, das an den Füßen aber wie ein Fisch gestaltet gewesen, zu ihm gekommen sei, und ernstlich und strenge ihm anbefohlen habe, zum Könige hinzuziehen und ihn wissen zu lassen, daß, da Gott seine Königin gesegnet, sie nun mit einem Sohne schwanger sei, der sein Leibeserbe in Dänemark, zur königlichen [S. 22.] Krone erhoben und ein vorzüglicher Herr unter allen Königen und Fürsten in dieser Nordwelt werden werde; und da Sünde und Bosheit, Völlerei, Hurerei, Hochmuth und Unbändigkeit fast in seinen Reichen überhand nehme, so solle er zu Ehr und Dank des hohen Herrn und Gottes, welcher ihn so segne, das mit Fleiß und Ernst abschaffen, auf daß Gott seine große Wohlthat und Langmuth nicht in desto größeren Zorn und Strafe umkehre 75 )." Späterhin sagte der Bauer dies vor dem Könige selbst aus, auf welchen die Prophezeihung einen ernstlichen Eindruck machte, und welcher dann dem Bauern "einen fürstlichen Zehrpfennig verehrte und nach Hause zurückzukehren befahl". Als aber der Bauer nach der Taufe des Prinzen sich wieder bei Hofe einfand, auf vorgeblichen Befehl der Meerfrau seine Ermahnungen wiederholte, dem Hofprediger und mehreren Edelleuten sehr umständlich das Aussehen derselben beschrieb, erzählte, was sie von ihrem Namen und ihrer Wohnung gesagt habe, und


|
Seite 141 |




|
daß ihre Mutter dem Könige Waldemar Atterdag Margarethens Geburt verkündigt u. a. m., faßte der König Argwohn gegen den neuen Bußprediger, der übrigens kein Betrüger zu sein schien, ließ ihn wegweisen und verbot ihm wiederzukommen. "Als er abgereiset war", - fügt Resen hinzu =, "stritten im Pöbel Gelehrte und Ungelehrte viel und weitläuftig über dieses Meerweib. Viele vermeinten, sie sei des Bauern eigene Erdichtung; andere ließen sich hören, Gott sei ein wunderbarer Gott in seinem Thun und habe nicht allein das Erdreich, sondern auch Luft und Meer mit seinen Geschöpfen vielfältig erfüllt, die ihren Schöpfer kennten, ihm dienten, ihn ehrten".
Das Factische, was diese Sage vielleicht veranlaßt haben kann, läßt nach so manchem verflossenen Jahrhundert sich nicht ermitteln 76 ); man muß sie indessen nicht zu den Wundern rechnen, mit welchen die Vorzeit die Geburt merkwürdiger Personen gerne verband, da die Prophezeihung vor letzterer geschah, sondern sie eher als einen Ausdruck des allgemeinen Verlangens ansehen, mit welchem das Volk der Geburt eines Königssohnes entgegen sah 77 ).
Was man recht innig wünscht, hofft man auch gerne. Nach einem derzeitigen, wohl unterrichteten Schriftsteller 78 ), ward durch das ununterbrochene Wohlbefinden und gute Aussehen der Königin, durch ihre stets heitere Stimmung, ihre Lust zum Reisen u. s. w. die allgemeine Erwartung geweckt, daß sie einen Prinzen gebären werde. Der König selbst theilte diese Hoffnung, indem er bemerkte, daß das Erstgeborne seiner


|
Seite 142 |




|
Eltern eine Tochter, wie seine beiden ältesten Kinder, gewesen [S. 23.] sei. In frommer Erwartung der Erfüllung seiner Wünsche, suchte er schon vorher Freude um sich zu verbreiten, indem er den Bauern in Kopenhagens Lehn ihre bedeutenden Steuerrückstände erließ. Die Zubereitungen zur bevorstehenden Niederkunft entsprachen den allgemeinen Hoffnungen. Da die zwei ersten Kinder in Jütland geboren waren, so wählte er diesmal die Hauptprovinz Seeland und dort namentlich Frederiksborg, einen ruhigen und im Frühjahr zwischen Wäldern und Seen sehr heitern und gesunden Ort. Die Mutter der Königin ward ersucht, zugegen zu sein, und sie kam den 19. März nach Frederiksborg; hier erfolgte die glückliche Niederkunft den 12. April 1577, Nachmittags 4 Uhr 79 ), und fast nach Verlauf eines Jahrhunderts ward den Reichen zum ersten Male eines regierenden Königs ältester Sohn und präsumtiver Thronfolger geboren 80 ).
Für äußerst wichtig und folgenreich hielten die königlichen Eltern diese Begebenheit, und sie zeigten es durch die ungewöhnliche Pracht und Festlichkeit, welche am heil. Dreifaltigkeits=Sonntage (2. Juni) in Unserer Frauen Kirche zu Kopenhagen die Taufe des Prinzen, am Tage nach dem Kirchgange der Königin zu Frederiksborg begleitete 81 ). Auch die Wahl jenes Ortes bezeichnet etwas Ungewöhnliches, da keines der andern Kinder Friederichs und Sophiens in der Hauptstadt getauft worden war. Unter den Gevattern befanden sich des Königs Schwiegerältern und sein Onkel, Herzog Hans; der Königin Mutter hielt den Prinzen zur Taufe. Nach der Kirchenfeier folgte Tafel, Tanz, Feuerwerk, "Fechtschule" und Jagd, nebst anderm "löblichen Zeitvertreib", die ganze Woche hindurch. Eine umständliche Beschreibung der ganzen Festlichkeit mit allen die Zeit


|
Seite 143 |




|
und deren Geist charakterisirenden Lustbarkeiten gehört nicht hierher, nur eine dürfen wir nicht vorübergehen, daß nämlich am zweiten Tage des Festes nach der "Mahlzeit" einige der Hochgelehrten (Professoren an der Universität) "mit ihren Studenten aufgefordert wurden, eine Comödie sehen zu lassen, die zu agiren ihnen befohlen war, und ward die Historie von Susannä Unschuld angenommen und anmuthiglich agiret. Dienstag Nachmittag sind die vorigmal befohlenen Hochgelehrten wiederum aufgefordert worden und haben gespielt den merkwürdigen Sieg, welchen König David über den mächtigen Riesen und Philister Goliath erfochten, worauf [S. 24.] der Krieg der Pygmäen mit den Kranichen 82 )" "aufgeführt ward". Die Vorstellung begann stets Nachmittags 1 Uhr; der Schauplatz war im Schloßgarten unter freiem Himmel 83 ), und zu bemerken bleibt noch, daß die Väter und Söhne der Universität die Probe ihres scenischen Talents mit lohnendem Beifalle des Hofes und aller Anwesenden nicht in der Muttersprache, sondern - lateinisch, ablegten 84 ).
Von den Tauffesten der anderen königlichen Kinder hat man nicht so umständliche Nachrichten. Man hat aber Grund, anzunehmen, daß sie, mit Ausnahme der Taufe der Erstgebornen, der Prinzessin Elisabeth 85 ), und der fünften Prinzessin, Auguste, den 29. Juni 1580, zu welcher letzteren mehrere deutsche Fürsten zu Gevattern gebeten waren 86 ), mit weit ge=


|
Seite 144 |




|
ringerem Pomp begleitet gewesen sind. Christian ausgenommen, ward jedes der königlichen Kinder auf seinem Geburtsschlosse getauft. Die Zeit, welche sie ungetauft blieben, war verschieden, 2 Monate bis 14 Tage; ersteres geschah nur mit Prinzessin Elisabeth (geb. am 25. Aug. 1573, getauft am 25. October), letzteres mit Prinz Ulrich (geb. am 30. Decbr. 1578, getauft am 11. Jan. 1579).
Es gehört zur Charakteristik des häuslichen Lebens nicht allein im Mittelalter, sondern auch in neuerer Zeit, daß Eltern in höheren Stellungen ihre Kinder in andern untergeordneten oder in verwandten Häusern pflegen und erziehen ließen, wie denn ein solches Opfer von Seiten der Eltern entweder in pädagogischer Hinsicht oder durch politische Gründe gebracht ward. [S. 25.] Auch in unserer Landesgeschichte finden wir Beispiele 87 ). Unter diesen geht uns vorzüglich an, daß Friederichs vier älteste Kinder von ihrer frühesten Kindheit an der Aufsicht der Mutter der Königin anvertraut wurden und daß diese namentlich den kaum 2 Monate alten Christian mit nach Meklenburg nahm 88 ). Ungeachtet die Eltern überzeugt sein


|
Seite 145 |




|
mußten, daß die Kinder bei den zärtlichen und einsamen Großältern die väterliche und mütterliche Sorgfalt nicht vermissen würden 89 ), konnten sie doch zuletzt die Lieben nicht länger entbehren, die sie beinahe von Geburt an nicht bei sich gehabt hatten; auch machte der Reichsrath besonders hinsichtlich des ältesten Prinzen dem Könige deshalb Vorstellungen. Am 12. April 1579, dem Tage, wo Christian sein zweites Jahr vollendete, schrieb der König seinem Schwiegervater, daß er wenigstens seine drei ältesten Kinder wieder bei sich sehen möchte; das vierte, Prinz Ulrich, damals ein Vierteljahr alt, war also vermuthlich gleich nach seiner Geburt an den meklenburgischen Hof gekommen. Die königlichen Kinder wurden von Warnemünde zu Schiffe abgeholt 90 ).
Daß mit Aufopferung eigener Freuden die Vater= und Königs=Pflichten den Eltern der Mutter übertragen wurden, zeugt von dem herzlichen und vertrauensvollen Einverständnisse beider Häuser, von dem glücklichen innern Verhältnisse des königlichen Ehepaares und von dem besondern Einflusse der Königin auf die Angelegenheiten der Kinder von deren frühestem Alter an. Daß aber von der Zeit an, wo diese in der väterlichen Heimath versammelt wurden, jene eine bedeutende Stimme bei Allem hatte, was deren Erziehung und Bildung betraf, können wir theils aus ihrem eigenen Charakter schließen, theils aus der Art und Weise, wie die Kinder im reiferen Alter auf den hohen Schauplatz traten, den die Vorsehung ihnen anwies.


|
Seite 146 |




|
Derzeitige wahrhafte Quellen bekräftigen dies. "Sobald", [S. 26.] sagt Vedel in seiner Leichenpredigt, die zugleich eine höchst anziehende Charakteristik Friederichs II. giebt, "die königlichen Kinder etwas zu Jahren und Alter gekommen waren, wurden feine, gelehrte und verständige Männer berufen, welche sowohl die jungen Fürsten, als die Fräulein unterrichten und zur wahren Gottesfurcht anhalten sollten. Ja, was ist das, wenn Zuchtmeister und Präceptor ihrerseits aufbauen sollen und die Eltern es wieder niederreißen wollen durch Verzärtelung und Nachlässigkeit ihrerseits! - Deshalb dürfen wir nicht verschweigen, daß Ihre Fürstliche Gnaden soviel Fleiß und Aufsicht mit Mund und Hand, mit gutem Unterrichte und zeitiger Strafe auf ihre liebenswürdigen Kinder verwendet hat, als nur irgend ein Bürger oder Edelmann aufs höchste und beste an seinen Kindern. Damit hat Ihro Gnaden Ihrem Amte völlig genüget und Ihren lieblichen Kindern die pflichtmäßige, gebührende Erziehung gegeben". Die verständige Königin erkannte, - eine der Gedächtnißreden über sie bezeugt es 91 ), - daß die Könige ihrem Reiche nicht geboren werden, wie der Bienenweisel, in einem Bienenstocke, ausgezeichnet durch gewisse äußerliche Kennzeichen, sondern daß Erziehung hier das Wesentlichste sei und daß deren Wirkungen für die ganze Folge sich zeigen, entweder zum Glück oder zum Unglücke des Volkes, welches zu beherrschen sie berufen wurden. Ihr wohlthuender Einfluß mußte besonders hinsichtlich ihrer zwei ältesten Söhne von Wichtigkeit sein, namentlich Christians, des künftigen Lenkers des Reichs, der, drei Jahre alt, vom Reichsrathe bereits zum Thronfolger erklärt war, und in dieser Eigenschaft in seinem siebenten Jahre die Huldigung empfangen hatte. Der edle und anspruchslose Friedrich erkannte selbst, daß ihm der Grad der Geistesbildung fehle, den man damals schon einem Regenten nothwendig erachtete, obgleich er diesen Mangel durch vortreffliche Eigenschaften des Herzens und durch Tapferkeit ersetzte. "Waren Se. Gnaden auch nicht sonderlich bewandert im Lateinischen oder in andern fremden Sprachen oder im Bücherwissen" - sagt A. S. Vedel - so ist das ersetzt durch fürstliche Tüchtigkeit und gute, christliche Sitten. Und in Wahrheit, in diesen beiden Fällen ist es ungleich besser, daß junge Fürsten von Kind an zu wahrer Gottesfurcht und guten Sitten angehalten werden, als daß sie mehrere Sprachen lernen und darüber die Gottesfurcht


|
Seite 147 |




|
und die Ausübung der Tugend versäumen. . . . . Hiebei aber muß nicht vergessen werden, daß Gelehrsamkeit und Wissen einen Fürsten oder König mehr zieren als Gold, Perlen und Edelgestein; denn die geben nur ein äußerliches Ansehen, das Andere aber erfreuet und schmücket das Herze, so es Verstand und Erfahrung giebt, und wenn gleich ein Prinz oder Fürst jung ist an Jahren und Alter, so wird er doch alt und klug durch Gelehrsamkeit und kluge Künste, absonderlich durch das Lesen von Historien, welche Anweisung geben, wie ein Herr Land und Leuten vorstehen soll". Alles was wir von Christians Erziehung wissen, zeigt genügend, daß sein Vater - und in dieser, wie in anderer Hinsicht können wir beide Eltern für einverstanden halten - nicht bloß eifrig [S. 27.] strebte, dem Sohne die Bildung zu verschaffen, welche Zeit und Umstände ihm nicht vergönnt hatten, sondern auch ernstlich darauf sah, daß Lehrer und Vorgesetzte ihn in nöthiger Zucht hielten und vor allen Dingen ihm nicht seinen eigenen Willen ließen.
Diese älterlichen Bestrebungen wurden durch die glückliche Wahl der Hofmeister und Lehrer kräftig unterstützt. Heinrich Rammel, ein pommerscher Edelmann, des Königs deutscher Kanzler, ward zum Hofmeister erwählt. In ihm fand man alle Eigenschaften vereint, welche eine solche Stellung erforderte, wie alle Zeitgenossen anerkannten, und obgleich man wohl lieber einen Edlen des Reichs auf diesem wichtigen Posten gesehen hätte, so ist doch allenthalben zugestanden, daß seine ausländische Herkunft durchaus keinen hemmenden Einfluß auf Christians Bildung zum dänischen und norwegischen Könige gehabt hat 92 ). Nach dem Tode des Königs mußte er wohl diesen Posten einem dänischen Adeligen abtreten 93 ), aber die feste Freundschaft zwischen ihm und dem Kanzler des Königs, N. Kaas, diesem edlen Vaterlandsfreunde, dauerte fort und beweiset eben so sehr sein ungeheucheltes Interesse für den Staat, der ihn aufnahm, als


|
Seite 148 |




|
die Achtung, in welcher er während der Minderjährigkeit Christians IV. bei den Machthabern stand, die seinen Rath annahmen und befolgten, und seine Ernennung zum Reichsrathe bei der Krönung 1596 zeugt für seine politische Tüchtigkeit 94 ).
[S. 28.] Auch der eigentliche Lehrer Christians, Zuchtmeister, wie er genannt ward, Meister Hans Mikkelsen, der 1582 angestellt ward und bis zur Mündigkeit des Königs verblieb, scheint dem wichtigen Berufe ganz vollkommen gewachsen zu sein. Zu Christians gründlicher Religionskenntniß, zu der Fertigkeit, mit welcher er lateinisch (vom 7. Jahre an), italiänisch und französisch sprach, hat genannter Mann wohl den Grund gelegt; in den mathematischen und mechanischen Studien, die er nachher bis zu einem Grade hoher Meisterschaft sich aneignete, erhielt er die Anleitung anderer Lehrer 95 ). Als der elfjährige Königssohn beim Tode des Vaters zum Throne berufen ward, versprachen seine Bildung und Entwickelung die glänzendste Hoffnung für die Zukunft. "Wenn nicht alle Merkmale täuschen", sagt Vedel ferner (fol. B. 1), "so sieht man bereits, daß Se. Gnaden unser erwählter Prinz zu einem ausgezeichneten Wissen in allen guten Künsten kommen wird; ja, schon ist S. G. so weit gekommen, daß er nicht länger für ein Kind gehalten werden kann, sondern täglich aufwächst und zunimmt in Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen, wie auch an Jahren und Alter. Zu welchem Vorsatze S. G. Ihro Gnaden die Frau Mutter und die zu Dänemarks Reich verordneten Regenten und Rath durch alle die guten und rathsamen Mittel, die daran und dazu gehören, verhelfen werden." Die Folge der Zeit bewies, daß die Königin auch als Wittwe die Erwartungen des Volkes vollkommen erfüllte. Erkennen also die ehemals vereinigten Reiche in Christian IV. stets einen ihrer verständigsten und kraftvollsten Regenten, so muß man auch nicht


|
Seite 149 |




|
vergessen, wie viel man in dieser Hinsicht der hohen Mutter schuldigt, und nicht übersehen, welchen bedeutenden Antheil sie namentlich an seiner Erziehung hatte 96 ).
Nicht mindere Sorgfalt ward auf die Erziehung des jüngern Sohnes, Herzogs Ulrich, verwendet und mit nicht geringerem Glücke. Beide Brüder hatten ihren eigenen Lehrer, aber beide wurden dennoch zusammen erzogen und waren zu einer und derselben Zeit zu Soröe 97 ); Ulrich ward in seiner Kindheit schon wegen seines guten Kopfes gelobt, beide ihres vortrefflichen Gedächtnisses wegen 98 ). Als jüngerer Prinz mit ferneren Aussichten zum Throne, aber mit früher Hoffnung auf ein auswärtiges Bisthum, welches er auch erhielt, scheint er späterhin durch Studiren, Reisen und Aufenthalt auf fremden Universitäten sich eine ungewöhnliche Bildung erworben zu haben 99 ).
[S. 29.] Der jüngste Sohn, Herzog Johann, bei des Vaters Tode noch nicht 5 Jahre alt, ist, wie man vermuthet, allein von der Mutter während ihres Wittwenstandes erzogen worden.
Von der Töchter Erziehung sind weniger Nachrichten vorhanden. Daß sie von Kind auf zum fleißigen Lesen in der Heiligen Schrift angehalten wurden, können wir ohne ausdrückliches Zeugniß annehmen 100 ); aber interessant ist es, wie Sophiens Charakter und eigenthümliche Neigungen sich bei ihren Söhnen und Töchtern wieder kund gaben, wie man in ihr selbst denn auch die Mutter leicht wieder erkennt. Sophiens Neigung zum Reisen und ihre lebendige Baulust hatte Christian IV. gemein mit seiner jüngsten Schwester Hedwig, Kurfürstin von Sachsen 101 ); die dritte Schwester, Auguste, Herzogin von Schleswig=Holstein, zeichnete sich aus durch


|
Seite 150 |




|
Einfachheit in Kleidung und durch stetige Reisen: aber die strenge Oekonomie der Mutter scheint bei den Töchtern ein wenig zu weit gegangen zu sein 102 ). Von allen Töchtern Sophiens scheint aber die zweite, Anna, Königin von Großbritannien, allein der Mutter an Verstand und kräftigem Willen gleich gewesen zu sein. Wohl loben einige englische Historiker sie als fromm und tugendhaft 103 ), von mehreren wird sie aber getadelt wegen ihres übertriebenen Hanges zur Pracht und zu Vergnügungen 104 ) und wegen zu thätiger Theilnahme an den politischen Bewegungen und Intriguen, die derzeit am englischen Hofe herrschten. Daß zwischen ihr und Jakob I. kein gutes Verständniß waltete, erklärt sich leicht, da sie einen Gemahl übersah, welcher weder bei Verwandten, noch bei Unterthanen besondere Achtung genoß oder fordern konnte. Merkwürdiger würde es sein, wenn die Tochter so streng protestantischer Eltern die katholische Lehre angenommen hätte 105 ); doch ist dies wohl nur eine Erdichtung, veranlaßt durch ihre Vorliebe für die spanischen Interessen und das Wohlwollen, welches sie vielleicht aus politischen Gründen den Katholiken bewies 106 ).
Von dem herzlichen Verhältnisse zwischen den verschwägerten Regentenhäusern haben Stimmen jener Zeit ein glaubwürdiges und ehrendes Andenken bewahrt, und der Geschichtschreiber kann nur mit Theilnahme und Wohlbehagen dabei verweilen. Schon die Erziehung der königlichen Kinder und [S. 30.] deren mehrjähriger Aufenthalt bei den Großältern erwecken eine Vorstellung von einer in höhern Ständen seltenen Vertraulichkeit, die auch aus andern Thatsachen zweifellos


|
Seite 151 |




|
hervorgeht 107 ). Beide Häuser schienen nur Eine Familie zu sein; der Ton zwischen dem Dänenkönige und dem meklenburgischen Fürstenpaare war wie zwischen Eltern und Kindern. Der König war nur 7 Jahre jünger, als sein Schwiegervater, und 10 Jahre jünger, als seine Schwiegermutter; dafür aber war er auch der Sohn eines lieben und unvergeßlichen Bruders. Im Umgange hörte man nur die Namen Vater, Mutter und Sohn 108 ). Kein Monat ging vorüber ohne Briefe und selten ein Jahr ohne gegenseitigen Besuch 109 ), und die Lage beider Länder bot leicht und sicher die Gelegenheit dazu dar. Von Warnemünde bis Gedsör auf Falster sind nur 7 Meilen, und mit günstigem Winde geschah die Ueberfahrt in wenigen Stunden 110 ). Oft begleitete auch der König seine Gemahlin, und die meisten Besuche hatten durchaus einen Privat=Charakter; die Herzogin war oft bei der Niederkunft ihrer Tochter zugegen; beide Eltern waren auch Pathen. Die Tochter sehnte sich nach ihren Eltern, bei denen ihre Kinder sich oft lange aufhielten, und die Schwiegerältern waren froh, von Zeit


|
Seite 152 |




|
zu Zeit ihre Tochter in ihrer Heimath zu sehen, umringt von einem stets größer werdenden Kreise von Kindern, auf deren Erziehung und Entwickelung sie selbst einen so wichtigen, wohlthuenden Einfluß hatten 111 ). Oft aber auch wurden bei [S. 31.] solchen Besuchen wichtige Staatsangelegenheiten auf die Bahn gebracht. Nicht wegen seines Landes Umfang, oder wegen der Volksmenge, sondern durch eine für die Zeit ausgezeichnete Bildung und politische Erfahrung, durch seine anerkannte Rechtlichkeit war Herzog Ulrich, den seine Zeit den deutschen Nestor nannte, einer der bedeutendsten protestantischen Fürsten Deutschlands, dessen Rath und Vermittelung bei mehreren Bewegungen der Zeit in Staat und Kirche oft gesucht und benutzt wurden. Der Dänenkönig und der Herzog achteten ihre Interessen genau verbunden; sie strebten deshalb, einig zu sein in ihren Ansichten von der Zeit und deren Ereignissen: sie unterstützten sich gegenseitig. Bei Dänemarks weiter sich erstreckenden Beziehungen und schwierigern Verhältnissen war es natürlich, daß der Herzog seinem Schwiegersohne nützlicher werden konnte, als dieser ihm. Die wichtigste Angelegenheit war unläugbar der so lange zwischen dem Könige und den schleswig=holsteinschen Herzogen obschwebende Streit wegen der Belehnung mit dem Herzogthume Schleswig, welchen der Herzog Ulrich mit des Königs Schwager, dem Kurfürsten von Sachsen, und dem Landgrafen von Hessen schon seit 1567 beizulegen versucht hatten und der endlich 1579 durch den Vergleich zu Odensee geschlichtet ward 112 ). Durch Vermittelung derselben Fürsten ward 1581 zu Flensburg ein Vergleich zwischen dem Könige und seinem Onkel, Herzog Adolph, die Beerbung dessen Bruders, Herzogs Johann des Aelteren, betreffend, abgeschlossen 113 ). Weniger glücklich waren der Herzog von Meklenburg und der Kurfürst von


|
Seite 153 |




|
Sachsen in der Streitigkeit des Königs und der holsteinschen Herzoge einerseits und der Stadt Hamburg andererseits wegen des Handels auf der Elbe. Der Vergleich kam weder zu Flensburg (1579), noch zu Kiel (1580) zu Stande und ward ausgesetzt 114 ); dahingegen ward Lübeck durch Mitwirkung des Herzogs, als er in Hadersleben beim jüngsten Kinde des Königs 1583 Gevatter stand, mit letzterem ausgesöhnt, und der für Lübeck erhöhte Sundzoll wieder herabgesetzt 115 ).
Der einzige wichtige Anlaß, der dem Könige zur Vergeltung sich bot, wo er thätig für seines Schwiegervaters Interessen sich zeigen konnte, waren die Streitigkeiten zwischen diesem und der Stadt Rostock, die sich größere Freiheiten nahm, als der Herzog dieser reichen, in seinen Grenzen belegenen Hansestadt einräumen konnte, und die, zur Entscheidung dem Kammergerichte vorgelegt, bis ins Unendliche gedauert haben würden. Der König, welcher noch nicht vergessen hatte, wie unfreundlich Rostock gegen ihn im Kriege mit Schweden sich gezeigt, bot dem Herzoge bei seinem Besuche in Dänemark (1583) seine Vermittelung an. Er ließ die rostocker Schiffe im Sunde und in den dänischen Häfen festhalten, verbot ihnen den Handel in seinen Staaten und blockirte Warnemünde mit einer kleinen Flotte. Nachdem die Stadt mit dem Herzoge sich ausgesöhnt hatte, wurden auf seine Fürbitten ihre Schiffe freigegeben und ihr der Handel wieder gestattet 116 ). Einmal veranlaßten auch Gegenstände von umfassenderem politischen Interesse eine Art Congreß in Güstrow; es war 1576 im Sommer, als der König und die Königin, ein Theil des [S. 32.] Reichsraths, der Kurfürst von Sachsen und mehrere deutsche Fürsten sich in Herzog Ulrichs Residenz versammelten, "woselbst die Religionssachen, die schwedischen, liefländischen und viele andere geheime dringende Angelegenheiten verhandelt wurden 117 )". Die Gegenstände für die Unterhandlungen waren vermuthlich die damals hinsichtlich des Religionsfriedens in Deutschland herrschenden Bewegungen, die Unruhen in Schweden bei Einführung der neuen Liturgie, die Streitigkeiten in der deutschen Kirche wegen des Abendmahls, die auch auf die dänische Kirche einwirkten, und endlich die Stellung in


|
Seite 154 |




|
Liefland, wo zwischen den Dänen und Schweden noch lange nach dem stettiner Frieden die Feindseligkeiten fortdauerten und wo die Russen Reval hart drängten.
Die Mutter der Königin starb während eines solchen Besuches bei ihren Kindern. Im Sommer 1586 reiste das Fürstenpaar mit dem Neffen des Herzogs, Sigismund August, an den dänischen Hof 118 ), und einige Monate schwanden, wie gewöhnlich, unter Gelagen, Jagden, Musik und Ballspiel, Spazierritten und vertrauten Gesprächen hin. Obgleich der König seine Gäste so lange als möglich aufhielt und die Herzogin, welche dieses Mal mehr als je in der Gesellschaft ihrer Tochter und ihrer Enkel froh war, bedeutungsvoll äußerte, daß es ungewiß sei, wann sie sich wieder würden versammeln können, ward dennoch endlich die Abreise auf die letzten Tage des Septembers festgesetzt. Der Abschied der Großmutter von den Enkeln war ernstlicher, als er sonst zu sein pflegte; sie ahnte gewiß, daß sie sie zum letztenmale sehe. Der König und die Königin geleiteten sie nach Gedsör 119 ). Hier wurden sie durch widrigen Wind aufgehalten; die Herzogin ward krank und nach vierzehn Tagen gab sie, umringt von ihrem Gatten, ihrer Tochter, ihrem Schwiegersohne, an ihrem Geburtstage, am 14. Octbr. 1586, ihren edlen, liebevollen Geist auf 120 ).


|
Seite 155 |




|
Einigkeit, Hingebung und gegenseitige Hochachtung bereiteten Friederich II. und Sophien ein ununterbrochenes eheliches Glück. Es ist nicht die geringste Spur des leichtesten Mißverständnisses, irgend eines Streites zwischen beider Wünschen und Neigungen zu finden, die man bei den 23 Jahren, die sie [S. 33.] im Alter verschieden waren, wohl hätte erwarten können. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß die Königin bei ihrem Verstande und ihrer in gewisser Hinsicht geistigen Ueberlegenheit irgend einen Einfluß auf die Regierungs=Angelegenheiten gehabt hat; was wir wissen von ihrem Auftreten nach des Königs Tode, von ihrem öffentlichen Wirken während ihres langen Wittwenstandes, scheint dafür zu sprechen; gewiß ist es aber auch, daß sie ihren Einfluß stets mit Klugheit und Vorsicht angewendet hat, um ihren Gemahl in keiner Art zu compromittiren und das Mißtrauen der mächtigen und stolzen Aristokratie zu wecken. Diese Darstellung des gegenseitigen Verhältnisses des Königspaares, besonders des eben so liebevollen, als klugen Benehmens der Königin gründet sich auf das ausdrückliche Zeugniß mehrerer gleichzeitiger Quellen, und wenn diese auch zu einer Schriftsteller=Classe gehören, die in der Regel wenig Vertrauen genießt, nämlich Leichen= und Gedächtnißredner, so äußern sie sich dennoch über des Königs häusliche und persönliche Angelegenheiten im Ganzen mit so viel Einstimmigkeit, Freimuth und innerem Gepräge von Wahrhaftigkeit, daß sie nur das allgemeine Urtheil aufgenommen zu haben scheinen. Der Verfasser dieses trägt daher kein Bedenken, von einigen dieser Stimmen nach mehr als dem Verlaufe zweier Jahrhunderte die Erinnerung an das glückliche Verhältniß jenes Königspaares erneuen zu lassen. Hören wir zuerst den ehrwürdigen, um unsere Sprache und Litteratur so hochverdienten A. S. Vedel 121 ).
"So hat der Herr ihre Verheirathung und Ehe begonnen in wahrer Gottesfurcht und unter ernstlichem flehen zu Gott nach seiner heiligen und wahrhaften Verheißung gesegnet in vielerlei Weise. Des Königs Majestät hat sein Leben hindurch eine treue, gehorsame und verständige Helferin in Ihro Gnaden gehabt, die niemals ihm entgegen gewesen oder sich mit dem


|
Seite 156 |




|
"befasset, was zum königlichen Geschäfte gehörte, sondern fleißig Acht hatte auf ihren lieben Herrn, daß sie Alles ihm zu Dank mache mit absonderlicher Geschicklichkeit und Munterkeit und Ihro Gnaden ist sowohl in Wort und Rede, als im Umgange nicht nur eine demüthige Fürstin gewesen, sondern auch ganz verständig, um sich in Zeit und Gelegenheit zu fügen 122 ).
Drei und vierzig Jahre nach dieser Rede Vedels über Friederich II. in der Domkirche zu Riebe hielt der königliche Hofprediger, Christen Jensen, eine Gedächtnisrede über Friederichs betagte Wittwe, als sie zu ihrer Ruhestätte in der Domkirche zu Roeskild gebracht ward. Das eheliche Zusammenleben des Königpaares erhielt hier folgendes Zeugnis 123 ):
"Während ihrer Ehe, Scepter und Krone mit dem Könige theilend, bewies sie in ihrem Verhalten zu diesem, zum Reichsrathe, zum Adel und zu allen andern Ständen so viel Freundlichkeit, Wohlwollen und Klugheit, daß durch ihr Helfen, Rathen und Fördern sie Allen wohl that und Niemand beleidigte: deshalb auch Alle sie ehrten als einen Gott vom Himmel 124 )".
[S. 34.] Mit einer rührenden Wahrheit sprechen, mehr als jedes andere äußere oder symbolische Zeichen 125 ), die Tage=


|
Seite 157 |




|
bücher 126 ), welche der König eigenhändig geführt hat, die Beweise aus, daß die königlichen Gatten glücklich zusammen lebten, und bezeugen des Königs treue Ergebenheit, mit welcher er an seiner Sophie hing, wie er sie nannte. Aus diesen Tagebüchern, die zwar beinahe nichts weiter enthalten, als die Aufzählung der steten Reisen des Königs von Stadt zu Stadt,
Deutsch:"Hvor Fred og Biisdom de ere tilsammen
Det er stor Lyst, stor Gläde og Gammen.
Den Konge han haver af Fred fit Navn,
Han er hver Mand til Nytte og Gavn.
Sophia det er paa Danske Visdom,
Saa kaldes den Dronning gudfrygtig og from".
Noch muß bemerkt werden, daß Stadagergaard auf Falster, welches der König von L. Wenstermann bekam, von 1574 ab Sophienholm genannt ward; Historisk Tidsskrift, udg. af danske hist. Forening, II. S. 31.Wo Friede und Weisheit zusammen sind, ist große Lust, Freude und Vergnügen. Der König hat vom Frieden den Namen; er ist jedermann zu Nutz und Frommen. Sophia ist auf dänisch Weißheit; so heißt die gottesfürchtige und fromme Königin.


|
Seite 158 |




|
von Schloß zu Schloß, von Provinz zu Provinz, sieht man, daß er sie fast nie ohne die Königin und einige ihrer Kinder unternahm. Wurden sie getrennt, so war es nur auf einige Tage, und nie unterläßt der König zu bemerken, wo die Königin sich aufhielt und wann und wo sie sich wieder sahen. In diesen einfachen, oft naiven, Bemerkungen heißt sie nie Königin, sondern beständig meine Sophie (mynt Soffye) 127 ). Des Königs Zärtlichkeit auch für seine Kinder leuchtet ebenfalls aus mehr als einem Zuge hervor.
Einem ehelichen Leben, wie dem Friederichs und Sophiens, möchte man hinsichtlich beider Alter eine längere Dauer gewünscht haben und zutrauen können. Des Königs tägliche Lebensweise war der Art, daß sie den Körper abhärten und [S. 35.] stärken konnte. "Im Sommer war er gewöhnlich um 3, 4 Uhr schon auf der Jagd und übte und bewegte seinen Körper mit großer Lust. Er nahm vorlieb mit kalter Küche, Schinken oder Speck und Roggenbrot, und trank dänisches Bier dazu, bis die Zeit ihn wieder nach Hause rief; wenn er nicht unwohl war - und das kam selten - , achtete er keineswegs Gesellschaft mehr, als Genesung und Gesundheit, sondern bezwang und verhielt sich nach der Stärke und Bequemlichkeit 128 ) seiner eigenen Natur". Deswegen war sein Gesundheitszustand auch, wie Vedel (Fol. C. 4.) ihn beschreibt: "Se. Gnaden war stets von Natur ein großer, kerngesunder und reifer Mann und hatte nie eine besonders große Krankheit, die ihn aufs Krankenbett warf, außer daß das viertägige Fieber ihn letzthin ein oder zwei Jahre plagte." Noch viele Jahre würde also der König ohne Zweifel für seines Volkes und seiner Familie Glück haben wirken können, wenn es ihm mehr möglich gewesen wäre, sich von den derzeitigen Gesundheit zerstörenden Gewohnheiten und den schwelgerischen Gelagen, die die Etikette


|
Seite 159 |




|
beim Empfange fremder Fürsten und Gesandten erforderte und bei so vielfältigen Anlässen so häufig stattfanden, loszureißen und mehr Maaß und Ziel zu halten. "Man meint wohl", sagt Vedel ferner, "daß wenn Se. Gnaden Ursach gehabt haben könnte, wegen täglichen Umganges mit fremden Fürsten, auswärtigen Gesandten und andern guten Männern sich des gewöhnlichen schädlichen Trinkens zu enthalten, was jetzt überall in der Welt unter Fürsten, Herren und dem gemeinen Manne allzusehr im Gange ist, es vor menschlichen Augen und Gedanken scheinen werde, daß Se. Gnaden noch manchen guten Tag länger leben können". So unverhohlen dieser Zug von des Königs Persönlichkeit in mehreren über ihn gehaltenen Leichenpredigten hervorgehoben wird, in welchen seine sonstigen vielen herrlichen und liebenswerthen Eigenschaften mit eben so viel Wahrheit, als Gefühl geschildert werden, zeugt es von einem Freimuthe, der unläugbar dem Zeitalter zur Ehre gereicht, beweist aber auch zugleich, daß man jene Schwachheit für unschuldig, wenn nicht für unumgänglich hielt 129 ). Aehnliche Aeußerungen über fremde Fürsten 130 ) kommen bei ähnlichen Gelegenheiten auch vor, und noch bemerkenswerther möchte man es finden, sogar in den Reden bei Christians III. und Friederichs II. Krönungsfesten, daß die Ordinatoren es nothwendig fanden, die Anwesenden ernstlich zur Mäßigkeit in den bevorstehenden Genüssen der Tafel zu ermahnen 131 ). Aber auf dieser Seite des häuslichen Lebens unserer Väter geschah, wie bekannt, keine [S. 36.] wesentliche Veränderung eher, als weithin im achtzehnten Jahrhunderte; man denke nur an die Schilderungen der Hoffeste Christians IV. und des Czaaren Peter. In Betreff Friederichs II. aber haben die Zeitgenossen ausdrücklich von ihm bemerkt, daß dieser leutselige und gastfreie König bei solchen Gelegenheiten mehr anderer, als seiner eigenen Neigung folgte und selbst in der aufgeregtesten Stimmung nie den gut=


|
Seite 160 |




|
müthigen und liebevollen Charakter verläugnete, der ihm eine so hohe Popularität verschaffte.
Schon im Sommer 1586, als der König mit den Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg einem Congresse in Lüneburg, betreffend die Stellung der Protestanten, besonders in Frankreich, beiwohnte, schien sein Gesundheitszustand sich verschlimmert zu haben 132 ); doch ein Jahr vor seinem Tode bekam er einen trockenen Husten und fing besonders an zu kränkeln. Auch mögen die häufigen Todesfälle, die in den letzteren Jahren mehrere seiner nächsten Angehörigen ihm entrissen, niederschlagend auf seine Gemüthsstimmung gewirkt haben 133 ). Die Schwester des Königs, die Kurfürstin von Sachsen, war am 1. Octbr. 1585 gestorben; ihr Gemahl, Kurfürst August, am 11. Febr. 1586; sein Onkel, Herzog Adolph, in demselben Jahre am 1. October; seine Tante und Schwiegermutter, Herzogin Elisabeth, am 14. October desselben Jahres; Prinzessin Elisabeth, Herzog Adolphs Tochter, am 13. Jan. 1587 und ihr Bruder, Herzog Friederich, am 15. Juni 1587. Zu einer Zeit, wo ungewöhnliche Naturerscheinungen leicht ängstliche Vorstellungen hervorriefen, sogar bei Personen höheren Standes, ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Mißgeburten, Meteore u. dgl. m., die grade in der letzten Lebenszeit des Königs die allgemeine Aufmerksamkeit rege machten, auch bei Ihm ähnliche Wirkungen hervorbrachten 134 ).
Im Jahre 1588 am 14. Februar vermählte sich zu Sonderburg des Königs jüngerer Bruder, Herzog Hans, zum


|
Seite 161 |




|
zweiten Male mit Agnes Hedwig von Anhalt, Wittwe des Kurfürsten August von Sachsen. Der König war gegenwärtig mit der Königin, ihren Kindern und einem großen Gefolge, wie auch mehrere Fürsten und Herren eingeladen waren, und gleich nach Neujahr muß er sich auf die Reise begeben haben 135 ). [S. 37.] "Ungeachtet er fast ein ganzes Jahr vorher nicht bei rechter und voller Gesundheit und Stärke gewesen, ihm mitunter auch schwer und lästig im Körper war", war er doch bei der Trauung und der Abendtafel gegenwärtig 136 ). Die übrige Zeit des Hochzeitsfestes hielt er sich ein und begab sich bald nach Hadersleben, wohin er die fremden Fürsten von des Bruders Vermählung zu einer Feier einlud, die er selbst zur Vermählung des Halbbruders der Braut, des Fürsten von Anhalt, mit einer Gräfin von Mansfeld veranstaltete 137 ). An diesem Feste, das einen neuen Beweis von der leutseligen Gesinnung des Königs und der Zufriedenheit gab, die er trotz seiner Krankheit empfand, wenn er Anderen Freude bereitete, konnte 138 ) er persönlich wenig Theil nehmen. Nachdem die Fremden abgereiset waren und das Wetter anfing schön zu werden, glaubte er, daß eine Veränderung seines Aufenthaltsortes und die gewohnte Bewegung sein Befinden bessern würden. Er ging deswegen mit der Königin und den zwei ältesten Prinzessinnen nebst zweien, der fremden Fürsten, den Herzogen Philipp von Grubenhagen und Christian von Anhalt, nach Seeland. Mit stets abnehmenden Kräften und verändertem Aussehen kam er am 6. März da an, konnte aber nicht weiter, als bis Antvorskov, wo die Krankheit mit Husten, Fieber und Mattigkeit zunahm. Nach dem Gebrauche der Arzeneien schien sein Befinden sich zu bessern, aber er verlangte nach seinen andern Kindern, die in Hadersleben geblieben waren, und die Königin mußte selbst, obgleich gegen ihren Willen, hinreisen, sie


|
Seite 162 |




|
zu holen. Wenige Tage darauf nahm jedoch die Krankheit eine so beunruhigende Wendung, daß der König seinen Zustand nicht verkennen konnte und sich das Abendmahl reichen ließ. Die Königin, an welche nun in aller Eile ein Bote abgefertigt war, kam nach einer schnellen, aber gefährlichen Schifffahrt über den Belt Nachts in Antvorskov an. Als der König nach einem kurzen Schlummer erwachte, stand sie an seinem Lager, pflegte und tröstete ihn, betete für ihn und mit ihm, enthielt sich aber aller Klagen und Aeußerungen ihres tiefen Herzenskummers, da sie wußte, daß ihm diese die Scheidestunde noch schmerzlicher machen würden 139 ). Er starb mit vollkommenem Bewußtsein und mit gottergebenem Muthe am 4. April 1588.
Am 5. Juni erfolgte die feierliche Beisetzung in der roeskilder Domkirche. Der königlichen Leiche unmittelbar folgten der erwählte König mit seinem Großvater m. S., dem Herzoge Ulrich, und den beiden jüngeren Prinzen. Nach dem Gebrauche der damaligen Zeit war die verwittwete Königin nebst dem weiblichen Theile der königlichen Familie und Gefolge die [S. 38.] letzte im langen Trauerzuge. Herzog Hans und ihr Onkel, Herzog Carl von Meklenburg, führten die königliche Wittwe 140 ).
Die traurige Gemüthsstimmung der Königin und die trüben Aussichten, welche ihre Zukunft bot, gehen am deutlichsten aus einem Briefe hervor, den sie wenige Tage nach des Königs Tode an ihren Vater aus Antvorskov schrieb. Mit diesem charakteristischen und selbst in der Form merkwürdigen Briefe soll passend dieser Abschnitt in Sophiens Geschichte geschlossen werden 141 ).
"Hertzliebe Her Fatter, ich habe E. G. Schreiben bei Jochim Bazewitzen 142 ) bekommen vnd darauß für standen das E. G. leider mein elende Schreiben bekommen haben, vnd E. G. ein hertzlich mittleiden mitt mihr tragen, dafür ich E. G. als die Dochter freundt=
Der Königin Hand ist undeutlich, aber nicht ohne Charakter; einzelne Danismen zeigen, daß sie ihre Muttersprache nicht mehr richtig schreiben konnte.


|
Seite 163 |




|
lich dancke. Godt weis wie hertzlich betrobett ich mitt meinen kleinen Kinderen sitze und nun fast keinen trost mehr habe, ach keine Zuflucht ahne zu Godt und zu E. G. Ich hofe E. G. werden mich och in meinem elende darh ich leider in bin nicht fürlassen werden, sonderen mich beistehen, den ich nicht weis wie ich es anfangen sol oder was ich don sol, den ich nich(t) fil mit sonnchen (solchen?) hendelen vmgangen habe vnd och sonst fon keinen sachen weis, den mich der Konigk nichts hatt bei seinen leben wissen lassen fon seinem handel, och begeren E. G. tzu wissen, ob der Konigk och für seinem Abscheitt fürordeninge gedahn hatte wie es mitt mich vnd meine Kinder geholden werden solde nach seinem Dotte, so kan ich E. G. nicht fürhaltten das er sich nirgens angekertt hatt ach fon keinem dinge auf der Welt gesagett, sonderen den dach tzuforen eh er fürscheidett, do hede ihm der Docktter 143 ) vnd Herr Kristoffer 144 ) der Prediger gefragett ob er nicht fürordenen wolde wie es mith mich vnd mitt meinen Kinderen scholde geholden werden, so hette er geanttworttet er konde es nu nicht thun aber er wolde mich vnd die Kinder Godt vnd seine Vnderthanen besellen, er wüste wol die wurden mich vnd meine Kinder nicht fürlassen. Was nu die Rette don werden das wirtt die Tzeit geben. Ich habe Jochim Batzewitzen alles berichtet wie es sich mitt seiner Kranckheitt hatt angelassen vnd was er für ein Ende genommen hatt, der wertt es E. G. wol berichten. Godt weis das mich ein klegelicher Fall ist das ich doch nur begere das ich mochte dott sein den das ich leben sol es ist mich ein hertzlicher trost, das er sonnchen (solchen?) schönen herlich ende genomen hatt vnd hatt geredett bis in sein letzette vnd wahr bei alle seinem Fürstande bis das er fürscheidette. Ich hede nicht gemendet (gemeint?) das mich Godt so hartt straffen solde doch wahr mich wol allezeitt bange dafür ehr ist nicht wol tzufriden gewesen disen gantzen Wintter auch


|
Seite 164 |




|
"nicht eher soder (seit?) das er von Luneburck kam, das werden sich E. G. wol tzu erinnern wissen wie vbel das er da aus sach die Farfe hatte er bis nu behalten wiewol er nich wolde das er schwach wahr ich leider nu mitt schmertzen wol weis geworden. ich dancke E. G. freundlich für die fürschreibige fan dem rade tzu Lubecke den es mich nu leider wol unütze werden wertt vnd nicht fil in den Henden habe. Was den leinwandt belangett das E. G. gekofett hatt bide ich das E. G. das nach Kopenhagen wollen bringen lassen. was ich E. G. nicht geschrieben habe, das habe ich Batzewitzen mundtlich berichtet vnd will E. G. Godt dem allmechtigen befolen haben vnd bide E. G. mochten sich ach in disem ckreuze messigen das E. G. mich vnd meinen kleinen Kindern zu troste leben mugen da wil ich Godt getrewlich vm bitten vnd will E. G. ihm ach befolen haben. Dattum Anderscho den 14. April Anno 1588.
E. G. getrewe tochter
die
weil ich lebe."
Aufschrift:
Dem hochgebornen Fürsten, vnserm freundtlichen Hertzvielgeliebten Herrn Vatern vnd Geuattern, Herrn Vlrichen, Herzogen zu Mecklenburg, Fürsten zu Wendenn, Graffen zu Schwerin der Lande Rostock vndt Stargardt Herrn.
Folgendes ist vom Herzoge darauf geschrieben:
"Schreiben von unser Dochteren, der Kunniginnen, bei Jochim Bassewitzen, den 20. Aprilis zue Gustrau empfangen."
[S. 39.] Wir haben Sophia von Meklenburg als Gattin, Mutter und Königin kennen gelernt. Umstände gebieten uns, bei ihrem Wittwenstande, dem längsten, den eine dänische Königin verlebte, einem Zeitraume von drei und vierzig Jahren stehen zu bleiben, in welchem ihr Leben und Wirken in mehreren bemerkenswerthen, in des Landes innere Verhältnisse eingreifenden, zum Theil noch nicht völlig aufgeklärten Richtungen sich entfaltete. Sophia's selbstständiges Auftreten, ihre Theilnahme an öffentlichen Angelegenheiten, ihr kräftiges, tüchtiges Verwalten ihrer Güter und das dabei erworbene beträchtlich Vermögen


|
Seite 165 |




|
und endlich ihr lebendiges Interesse für die Wissenschaft und ihre eigenen wissenschaftlichen Beschäftigungen verdienen in gleichem Grade die forschende Aufmerksamkeit des Historikers und die Bewunderung der Nachwelt. Der weitere Verfolg aber dieses weitläuftigsten und unläugbar anziehendsten Theils ihrer Geschichte in allen ihren einzelnen Momenten verbleibe einer anderen Zeit und Feder.


|
[ Seite 166 ] |




|



|


|
|
:
|
VI.
Die Reichstags=Fahrt
des
Herzogs Ulrich von Meklenburg
im Jahre 1582,
von
A. F. W. Gloeckler.
E s erweckt Freude und befruchtende Theilnahme bei Betrachtung der Vorzeit, wenn man die Geschichte gefeierter Menschen, deren Ruhm vor unbefangener und gründlicher Forschung besteht, bis in Einzelnheiten, selbst des häuslichen Lebens, verfolgt. Wer das Bild großer Männer nur auf der Schaubühne des öffentlichen Lebens, nur auf der Höhe des Ruhmes - nicht selten eines zweideutigen - erblickt hat, dem wird es oft wenig klarer erscheinen, als ein Bild, welches gewaltig oder seltsam gestaltet in der Ferne an ihm vorüberzieht. Erst wenn sich der forschende Blick den geschichtlichen Menschen nähert und einzelne Züge ihres Wesens scharf erfaßt; erst wenn man in den eigenthümlichen Gedankenkreis und in das häusliche Leben derselben eindringt, wird ihr Bild dem Beschauer belebt und eindrücklich, ihr geschichtliches Wirken, dem Forscher verständlich werden.
Eine solche, in geschichtlichen Werken seltene, Betrachtung berühmter Männer ist zugleich aufklärend für die Sittengeschichte und erscheint besonders erfreulich in Bildern aus den Zeiten des sechszehnten Jahrhunderts 1 ). Dieses hat fast gleichmäßig die Schlußsteine des alten und die Keime des neuen Lebens des deutschen Volkes entwickelt. Der Kampf


|
Seite 167 |




|
um die Freiheit des Glaubens und der Forschung ließ in dem deutschen Volke viele kräftige und würdige Männer erstehen, welche mit regem Ernste für Volkswohl strebten und zum Theil in herrlicher Eigenthümlichkeit des Geistes hervortreten. Das Männliche und Naturwahre der deutschen Sitte wich damals nur langsam dem Fremden und Gekünstelten - in Kleidung und Schmuck war schon längst das Ausländische nachgeahmt - und die Geltung des Mittelalters tritt auch hier, wie im Staatswesen, noch mannigfaltig auf. Ohne Zweifel erhöht es die Theilnahme beim Anblicke denkwürdiger Menschen, wenn man in Verfolgung ihres persönlichen und häuslichen Wesens, ihrer Neigungen und Genüsse die heitere Seite des Lebens gewahrt und das Unverstellte der menschlichen Natur bewahrheitet sieht. Dies gilt zumal da, wo der Handelnde sich in den höchsten Kreisen des Lebens bewegt.
In Meklenburg regierte die ganze zweite Hälfte dieses Jahrhunderts hindurch Herzog Ulrich zu Meklenburg=Güstrow (1555-1603). Seit dem J. 1590 der Nestor der deutschen Fürsten, führte er sein preiswürdiges Leben nahe an 80 Jahre in fast ungeschwächter Kraft hinauf. Er war ein Mann von strenger religiöser Gesinnung, festhaltend am Rechte, bedachtsam, vorsichtig und friedfertig, sowohl von Natur, als in Folge ein es langen, bitteren Haders mit seinem älteren Bruder, Herzog Johann Albrecht I., und einer mehrfachen Theilnahme an den deutschen Staatshändeln. Obgleich er durch eine unfreundliche und nicht gefahrlose Schule der Erfahrung gegangen war, bewahrte er sich heiteren Frohsinn, ohne in dessen Uebung die Grenzen haushälterischer Mäßigung zu verlassen. Ferne vom Streben nach den großen Dingen der Welthändel, war er in Geschäften unverdrossen, oft zögernd, Vieles selbst thuend. Er ehrte Kunst und Wissenschaft und bewies Männern, wie David Chyträus, achtungsvolle Auszeichnung. Noch mehr suchte er überall Tugend und gute Sitte zu schützen und war gegen Unglückliche ohne Schaugepränge milde und hülfreich 1 ).
Ein den Mann und die Sitte der Zeit bezeichnender Auftritt im Leben diesses Fürsten ist seine Fahrt aus den


|
Seite 168 |




|
Reichstag zu Augsburg im J. 1582, - die letzte und wohl auch die glänzendste, welche von meklenburgischen Fürsten vollführt ist 1 ).
Seit dem schmalkaldischen Kriege begannen der Ruhm und die alte Bedeutung der Reichstage zu erlöschen. Die inneren Zwiste der Deutschen wurden bitterer, ihre religiöse und politische Parteiung schärfer, als je zuvor; daheim mehrten sich mit den Staatsgeschäften die Sorgen der Herrschenden und viele Fürsten wurden durch Geldmangel bedrückt. Da überdies persönliche Reibungen, besonders Rangstreitigkeiten - Zeichen der Erschlaffung des deutschen Volksgeistes - auf den Reichstagen häufiger wurden, so stellten die Fürsten nach und nach den persönlichen Besuch der Reichstage ein, die sie nun durch Gesandte beschickten. Schon der gewaltige Kaiser Carl V. konnte im Jahre 1554, freilich in einer stürmischen Zeit, nur erst nach drei Aufforderungen einen Reichstag zu Stande bringen, auf welchem doch nur wenig Fürsten erschienen 2 ). Bald ward es aber Grundsatz der kaiserlichen Staatskunst, den Besuch und die Wirksamkeit der Reichstage zu beleben. Dies geschah, theils um den kaiserlichen Einfluß auf die inneren Reichssachen, der wachsenden Landeshoheit gegenüber, nicht fortgehend sinken zu lassen, theils um die reichsständische Hülfe zum Schutze der von den Türken bedrängten österreichischen Erbländer leichter zu gewinnen oder gar, um die Türkenkriege als Vorwand begehrter Reichshülfen erfolgreicher zu nutzen.
Der vorsichtige und milde Kaiser Maximilian II. hielt zu Speier und Regensburg (1570, 1576) ansehnliche Reichsversammlungen nicht ohne Erfolg. Auch Rudolph II., obgleich bis zur Schlaffheit und Theilnahmsloigkeit an der Außenwelt eine mit Lieblingsstreben, besonders mit natur= und geheimwissenschaftlichen Forschungen erfüllte Ruhe liebend, verfolgte in dieser Hinicht die Bahn des Vaters. Er entschloß sich zum persönlichen Besuche der Reichstage, deren ersten er auf den Juni 1582 nach Augsburg ausschrieb. Die Absicht war,


|
Seite 169 |




|
Hülfsgelder zum Türkenkriege zu gewinnen, die Niederlande in Ruhe und gegen Frankreich geschützt zu erhalten, auch wohl die Religions= und Handelsbeschwerden mancher Reichsstände nach Umständen beizulegen 1 ). Schon um das kaiserliche Ansehen durch den Glanz der Versammlung zu erhöhen, wurden fast alle Fürsten von Macht und Einfluß, unter den protestantischen namentlich der Kurfürst August von Sachsen und der Herzog Ulrich von Meklenburg, dringend und wiederholt ersucht, persönlich zu erscheinen.
Herzog Ulrich scheute zwar als eifriger Protestant die auf dem Reichstage vielleicht entstehenden katholischen "Practiken", nicht minder die Mühen einer so weiten Reise und die Kosten des Prunklebens zu Augsburg. Indessen veranlaßten ihn doch dringende kaiserliche Schreiben noch im Winter mit seiner Gemahlin Elisabeth, aus dem dänischen Königshause, der würdigen Mutter der edlen Königin Sophie von Dänemark, zum Kurfürsten August nach Dresden zu reisen. Diesem stand er durch Verschwägerung und Uebereinstimmung in Staatssachen nahe, was schon seit den Zeiten der Grumbachschen Händel eine persönliche Befreundung, häufige Besuche, lebhaften Briefwechsel und Austausch von Geschenken an Pferden, Hunden, Wildgehörn, Meermuscheln, Steinen vom heiligen Damme zu Doberan, Güstrower Bier, Gemälden, Waffenstücken und andern Kunst= und Naturerzeugnissen herbeigeführt hatte.
Am 19. Februar 1582 verließ Herzog Ulrich mit 127 Pferden Güstrow und traf am 1. März zu Dresden ein. Hier verweilte er bis zum 9. d. M. unter vielem "Pankettiren". Es wurden auch mit Ernst die Staatssachen berathen und nach mehrfacher Besprechung ward der persönliche Besuch des Reichstages durch beide Fürsten beschlossen. Gleich nach der Rückkunft des Herzogs Ulrich von Dresden begannen in Meklenburg (21. März) die Zurüstungen zu seinem Zuge.
Zuerst wurden die Räthe und höheren Hofdiener des Herzogs nebst einigen Vasallen einzeln aufgefordert, sich zur Reise zu bereiten. Unter jenen ward dem Heinrich Husan, früher Canzler Joh. Albrechts, I., jetzt Syndikus der Stadt Lüneburg und zugleich des Herzogs Rath von Haus aus 2 ), Urlaub vom Magistrate erwirkt. Obgleich dieser ihn wegen vielfacher Reisen, zumal er eben erst mit dem Herzoge nach Dresden gezogen war, ungerne auf Monate von Neuem entließ, ward doch demnächst der ertheilte Urlaub mit dem


|
Seite 170 |




|
Geschenke eines stattlichen Hengstes begleitet, indem damals die reicheren und freieren Städte Norddeutschlands noch eigene Marställe hielten. Hierauf wurden die Räthe Vicke von Bülow auf Rensow, Joachim von Oertzen auf Wustrow, Dr. Esaias Hoffmann und der Canzler Dr. Jacob Bording zur Begleitung beschieden. Außer diesen sollten folgen: der Hofmarschall Joachim von der Lühe, der Rath und Lehnmann Henning Krause auf Varchow als Reisehofmeister der Herzogin Elisabeth, der Hofprediger Andreas Celichius, Superintendent zu Güstrow, und der Leibarzt Dr. Johann Heine. Als Ehrenbegleiter und Gesellsschafter wurden verschrieben die Vasallen: Joachim Wangelin auf Vielist, Dietrich Bevernest auf Lüsewitz 1 ), Joachim Kossebade der Jüngere auf Torgelow und Joachim Bassewitz auf Levezow, wie auch der Amtmann Andreas Hüneke zu Malchow. Die Vasallen und die Räthe aus diesem Stande wurden gleichmäßig aufgefordert, "mit einem Kotzkenn (Kutsche) vnd dreien Pferden dafür, sambt noch einem guten reisigen Pferdt, welches euch, wann Wir selbst zu Roß sein, zu reiten tuglich vnd vnuerweislich ist, auch euren Ehrkleidern auffs beste staffiret" zu erscheinen. Die Begleitung des Lehnsherren bei Beziehung der Landtage und bei Reichstagsfahrten gehörte zu den Ehrendiensten der Vasallen. Länge und vielfach geübt war die verwandte Pflicht des Geleites bei Durchzügen fremder Fürsten und bei Vermählungen des Lehnsherrn oder Eines aus seinem Hause. In solchen Fällen mußten die Vasallen sich und ihre Diener auf eigene Kosten mit Ehrenkleidern, d. h. mit der üblichen, oder vorgeschriebenen Hofkleidung - so weit sie nicht besonders kostbar war - und mit stattlichen Rossen ausrüsten. Eine bloß berittene Begleitung war die gewöhnliche. Auch ward den aufgebotenen Vasallen vom Lehnsherrn Futter und Mahl gereicht, so wie freies Lager gewährt 2 ). - Dagegen erhielten zu dieser Fahrt der Hofmarschall, der Leibarzt, der Superintendent und die gelehrten Räthe jeder 40


|
Seite 171 |




|
Gulden zu Ehrenkleidern von Sammet und Atlas, Husan sogar 58 Gulden aus herzoglicher Renterei; auch die ihnen beigegebene oder angehörige Dienerschaft ward zum Theil auf herzogliche Rechnung neu gekleidet. Aus landesherrlichen Mitteln mußten auch die Wagen und Pferde für die Hofräthe und die übrigen Hofdiener geschafft werden, indem diese Reisemittel damals selbst von hohen Beamten nur ausnahmsweise besessen wurden und zu Miethe nur selten brauchbar zu erhalten waren. Jedoch wurden hier die nöthigen Fuhrwerke nicht dem herzoglichen Marstalle entnommen, welcher so große Vorräthe noch nicht darbot, sondern sie mußten von den Städten des Landes für solche Ehrenfälle nach herkömmlicher oder ausdrücklich bestimmter Pflicht geliefert werden. Die Verzeichnisse des herzoglichen Gefolges nennen weiter zwanzig Hof= und Landjunker: Joachim Stralendorf, Henning Lützow, Ulrich Penz, Otto von der Lühe, Eler Voß, Joachim Fineke, Vicke Wangelin, Lutke Bülow, Eler Ratlow, Christoph Schack, Heinrich Rieben, Mathias Heine und Levin Linstow, Joachim Levetzow, Franz Prignitz, Jürgen von Hagen, Mathias Vieregge, David und Hans Hahn. Fast alle diese waren meklenburgische Vasallen oder Söhne derselben, jedoch zu verschiedenen Dienstleistungen bestimmt. Sieben von ihnen, Mathias, Heine und Levin Linstow, Joachim Levetzow, Franz Prignitz, Jürgen von Hagen und David Hahn werden als Hengstreiter bezeichnet, welche wohl theils mit an der Spitze des Zuges reiten, theils die Kutsche des Lehnsherrn umgeben und dessen unmittelbare Aufträge bei der Reise voll=


|
Seite 172 |




|
führen sollten 1 ). Ulrich Penz sollte dem Herzoge als Stallmeister und Joachim Stralendorf als Kämmerer, Henning Lützow der Herzogin Elisabeth als Kämmerer aufwarten. Die Uebrigen scheinen als Kammerjunker und Edelknaben gedient zu haben; wenigstens werden die in den Entwürfen und Rechnungen vorkommenden "edelen Knaben" nicht weiter persönlich aufgeführt. Außerdem sollten an sonstigen Hofdienern folgen: 3 Canzleischreiber mit einem Jungen, der Rentschreiber Johann Isebein 2 ), 1 Einkäufer und Küchenschreiber, 1 Wagenmeister, 1 Futtermarschall, 1 Hufschmied, 3 Schenken, 3 Fürstenköche, 1 Pastetenbäcker, 1 Ritterkoch, 3 Küchenknechte, 2 Silberknechte, 1 Saalknecht, 2 oder 3 Trompeter, 4 Einspännige, mehrere Hengstreiter= und andere Jungen. Auch drei "Spieß=Jungen" - mit in Perlen gestickten Sturmhauben =, 1 Schneider, 1 "Balbierer" und noch mehreres Gesinde kommen in den Rechnungen vor.
Seit dem 28. März wurden von den Städten "Rustwagen, Gutschen vnd Pferde" verschrieben. Die Rüstwagen sollten das persönliche Reisegeräth der Fürsten und ihrer höheren Diener, so wie die Einrichtungen und Bedürfnisse der Küche, des Kellers und der Silberkammer aufnehmen. Alles dies ward damals bei großen Staats=Reisen gewöhnlich mitgeführt, weil für Fürsten geeignete Gasthöfe gar nicht oder sehr selten gefunden wurden. Es waren zwar einige solcher Wagen im herzoglichen Marstalle vorhanden, aber man bedurfte deren etwa acht bis neun. Die fehlenden wurden herzoglicher Seits von den Städten Wismar, Rostock, Parchim, Neu=Brandenburg, Malchin und Friedland begehrt. Es ward dabei bestimmt, daß diese Wagen mit dunkelem Tuche bedeckt, mit vier Pferden bespannt und von einem schwarzgekleideten Führer gelenkt werden sollten. Wegen der für die gelehrten Räthe und sonstigen Hofdiener, wie Köche, Canzleischreiber u. s. w., erforderlichen Reisekutschen ward an die Städte Güstrow, Schwerin, Boizenburg, Röbel und Waren geschrieben. Ein solcher Wagen sollte Raum für vier Personen darbieten, an beiden Seiten Thüren haben und mit vier Pferden bespannt sein. Auch waren diese Wagen mit einem anscheinend in Holz gebaueten Verdecke, welches wohl mit Leber überzogen war,


|
Seite 173 |




|
aber jedenfalls nicht mit Druckfedern und Glasfenstern, Erfindungen des siebenzehnten Jahrhunderts versehen. Von den Städtchen Woldeck, Gnoien, Wesenberg und Sternberg wurden bloß Pferde gefordert. Allein bei dieser Gelegenheit trat schon der ärmliche Zustand mancher kleineren Landstädte scharf hervor, Die meisten klagten in ihren Antworten über Verarmung, Noth und "vmb sich fressende Schultbeschwerung". So erklärten sich Boizenburg und Röbel für ganz unfähig, "einen Gutschen zu bereiten", oder einige Pferde zu stellen; auch Waren, Wesenberg und Woldeck wollten kaum die zu ihrem Ackerbau nöthigen Pferde haben. Es mußten deshalb einige von diesen Städten für dieses Mal ganz von der Leistung befreiet, die Kräfte anderer, wie Röbel, Waren und Woldeck durch wiederholte Erlasse dahin vereinigt werden, daß eine Stadt den Wagen, die andere drei Pferde und die dritte zwei Pferde mit einem Führer stellte u. s. w., bis ein Fuhrwerk vollständig erschien. Dagegen brachten die Seestädte Rostock und Wismar auf dringendes Ansuchen des Herzogs, mit Beziehung auf die Mitreise des jungen, noch bevormundeten meklenburg=schwerinschen Landesherrn, zusammen 4 stattliche Rüstwagen mit 16 Pferden und 4 neu eingekleideten Führern auf. Jede Seestadt verdoppelte demnach die gewöhnliche Leistung in diesem besonderen Falle, wenn gleich erst nach mehrfacher Verhandlung und nicht ohne ausdrücklichen Vorbehalt.
Nachdem diese Vorbereitungen, an deren Betreibung Herzog Ulrich bisweilen persönlich Antheil nahm, gegen Ende April vollendet waren, geschahen die vorläufigen Anmeldungen und Geleitsgesuche des Herzogs bei denjenigen Fürsten, durch deren Gebiet die Reise nach Augsburg führte. Zunächst bei den verwandten und befreundeten Häusern von Brandenburg, Braunschweig und Sachsen, dann auch bei dem Grafen Günther von Schwarzburg, dem Bischofe von Bamberg und Anderen ward um "lebendig Geleidt" - im Gegensatze des bloß brieflichen, zur Vermehrung der Sicherheit und des Glanzes - von einer Landgrenze zur andern, auch um "Nachtlager vnd Lieferung für die Gebühr" nachgesucht. Diese Schreiben bezeichneten zugleich den Tag des Eintreffens des Reisezuges und die Zahl der Pferde und wurden durch besondere Eilboten bis nachb Franken hinauf versandt. Von den meisten Fürsten trafen bald freundlich=willfährige Antworten und herzliche Glückwünsche ein.
Inzwischen war schon am 24. März der Hofküchenmeister Andreas Ihlefeld mit einigen Dienern nach Augsburg vorweg gesandt, um die nöthigen Vorräthe für die erste Einrichtung des Hoflagers einzukaufen, Wohnungen zu miethen


|
Seite 174 |




|
und sonst die Aufnahme des Herzogs vorzubereiten, der ihn zu diesem Zwecke an den Reichs=Vice=Marschall Grafen von Pappenheim empfahl.
Hierauf wurden 8 Vasallen und Räthe, unter denen die alten gewiegten Staatsmänner Werner Hahn und Joachim Krause waren, zu Statthaltern für die Zeit der Abwesenheit des Herzogs ernannt und am 1. Mai mit einer Anweisung für ihre Wirksamkeit versehen. Zugleich erging an die benachbarten Fürsten, namentlich an Brandenburg, Pommern, Braunschweig und Holstein, das übliche Gesuch: sie möchten des Herzogs Land und Leute während dessen Reise "sich treulich lassen beuholen sein" und den verordneten Statthaltern im Falle der Gefahr mit Rath und Beistand an die Hand gehen. Die Fürsten erklärten sich sofort bereitwillig zur etwanigen Hülfsleistung; der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg und Herzog Adolph von Holstein, Oberster des niedersächsischen Kreises, beschenkten überdieß unter herzlichen Glückwünschen den Herzog mit edlen Rossen zur Reise.
Während dieser letzten Vorbereitungen erhielten seit dem 24. April die Vasallen und Hofjunker die endliche Aufforderung, am 7. Mai reisefertig zu Güstrow zu erscheinen. Gleichzeitig sollten die Städte ihre Rüstwagen und Kutschen zur Musterung ebendahin absenden.
Nachdem die ersten Nachtlager für den Zug zu Schwerin und Dömitz bestellt waren, brachte am 4. Mai ein Eilender von Dresden die Kunde, daß der Kaiser von Wien am 11., der Kurfürst von Dresden am 18. Mai nach Augsburg abzureisen gedächten. Demnach brach Herzog Ulrich am 9. Mai von Güstrow auf. Ihn begleiteten aus dem Fürstenhause seine Gemahlin Elisabeth, "aus königlichem Stamme zu Dänemark", mit ihren Damen und Dienerinnen in vier Kutschen, und seine beiden Neffen, die Herzoge Johann, bevormundeter Landesherr von Meklenburg=Schwerin, und dessen jüngerer Bruder, Sigismund August, Jünglinge von 24 und 21 Jahren. Das zahlreiche Gefolge, in welchem sich die Vasallen mit vielen Pferden und Dienern "wol staffiret" zeigten, war durch einen großen Troß bis auf etwa 112 Personen angewachsen. Den Zug eröffneten gewöhnlich zwei Einspännige und zwei Trompeter, letztere mit rothen und gelben Federn, ihnen folgten einige "Hengstreiter" und andere Berittene mit einem der Marschälle und auf diese ungefähr 16 Kutschen mit etwa 60 Pferden, die Reihe von einzelnen Reitern umgeben oder getheilt, die Karosse des Herzogs mit sechs Pferden bespannt. An die Kutschen des höhern Gefolges schlossen sich die Wagen der Canzlei, der Köche, Schenken und


|
Seite 175 |




|
anderer Hofdiener und diesen folgten 10 Rüstwagen mit 40 Pferden, das Gepäck und die dazu gehörige Dienerschaft führend. Einspännige und andere Reiter schlossen den langen Reisezug. Der ganze Zug bestand aus 220 Pferden, unter denen 150 Wagen= und etwa 70 Leibpferde sein mochten. Die letztern wurden meistens durch Marstallbediente und Diener des höheren Gefolges geführt.
Die Wegstrecke von Güstrow bis Augsburg war zu 97 Meilen berechnet. Die Reise sollte über Salzwedel, Wolfenbüttel, Erfurt, Bamberg und Nürnberg gerichtet werden. Durchschnittlich wollte der Herzog nur vier Meilen des Tages zurücklegen und jeden vierten Tag rasten, so daß die Dauer der Reise auf 35 Tage, vom 9. Mai bis 13. Juni, bestimmt ward. Gewöhnlich gingen dem Zuge ein Fourier mit einigen Küchenbeamten und diesen wieder ein Eilbote vorauf, der die schließliche Anmeldung des Herzogs und den "Fourier=Zettel" an die nächsten Fürsten oder Städte überbrachte.
Am 9. Mai ging die Reise bis Sternberg, am 10. bis Schwerin, am 11. bis Grabow und am 12. bis Dömitz. Hier ward am 13. d. M. gerastet. Das erste Nachtlager in der Fremde bezog Herzog Ulrich zu Salzwedel. Hier traf derselbe, wie auch am 15. zu Steineke, mit kurbrandenburgischem Geleite ein und empfing die "Ausrichtung" von den Dienern des nahe verwandten Kurfürsten. Bei ansehnlichen Gaben des Herzogs an jene wurden die Reisekosten durch die "freie Ausrichtung" wenig gemindert. Auch wurden schon nach wenig Tagen die Ausgaben für Huf= und Wagenbeschläge, neue Räder, Thüren und Achsen an den Wagen, Besserungen am Sielengeschirr und dergleichen, welche übrigens schon in Schwerin begannen, beträchtlich, namentlich hinsichtlich der städtischen Fuhrwerke. Hierzu kam, daß während größerer Tagereisen die Voraufgesandten, so wie einzelne Nachzügler, gewöhnlich starke Zechen machten und zumal die Rüstwagen=Knechte und Andere vom Troß sich nicht selten übermäßig in Bier labten. - Eine sich häufig wiederholende Unterhaltung auf der Reise veranlaßten in den Städten "die Cantores vnd Instrumentisten, so fur seiner furstlichen Gnaden gesungen vnd aufgewartet". Dies geschah z. B. zu Grabow und zu Salzwedel, an welchem letztern Orte der Cantor dem Herzoge "ein Stuck dediciret vnd 4 Thaler empfangen" hatte. Meistens waren es geistliche Lieder und Psalmen, welche bei solchen Gelegenheiten vorgetragen wurden. Der Herzog hörte diesen Leistungen anscheinend mit wirklicher Theilnahme zu, was theils in der religiösen Richtung der Zeit lag, theils darin, daß die Tonkunst noch vorherrschend und nicht


|
Seite 176 |




|
selten glücklich von Geistlichen geübt ward. - Außerdem stellten sich öfter glückwünschende Abgesandte der vom Zuge berührten Städte und umliegenden Ortschaften ein, um Anreden zu halten und zuweilen um Festgeschenke darzubringen. Dies geschah auch von einzelnen Vasallen. So ließen die von Bartensleben dem Herzoge zu Forsfeld einige Karpfen und Hasen überreichen. - Es wurden dergleichen Gaben freundlich aufgenommen, zumal der Verbrauch der Reisenden an Lebensmitteln sehr groß war. Dies zeigt gleich die Rechnung vom Nachtlager zu Forsfeld, wo die herzogliche Küche die Mahlzeiten für die Fürsten und einen Theil des Gefolges bereitete. Es wurden zu demselben außer vielem Geflügel und einer Menge von Fischen u. A. ein halber Ochse, 1 Kalb, 3 Hammel, 5 Lämmer, 1 halbes Schwein, 2 Seiten Speck, 24 Pfund Butter, 2 Fässer Bier u. s. w. eingekauft und anscheinend zu Forsfeld beim Nachtmahl und der Frühkost verzehrt. Dabei betrugen die Zechen für die Vorausgesandten und das Gesinde, so wie die Trinkgelder noch die Summe von 100 Gulden.
Mit braunschweigischem Geleite erreichten die Reisenden am 17. Mai Abends das Hoflager des Herzogs Julius zu Wolfenbüttel. Dieser war persönlich der Gäste gewärtig und that ihnen an diesem und dem folgenden Tage "die Außrichtung stadtlich, auch vber die Gebuer". Dagegen wurden "vffm Schloß in Kuchenn vnd Keller vorehret 60 Rthlr., item den Trommetern 10 Rthlr., den Instrumentisten 3 Rthlr., item den Drabanten 6 Rthlr., den Berggesellen 4 Rthlr." u. s. w. Zugleich waren für Huf= und Wagenbeschläge und ähnliche Bedürfnisse, für Zechen des Hofgesindes, gemachte Auslagen der Räthe und Diener und dergleichen wieder an 100 Gulden verwandt. Zwei Fässer des berühmten Eimbecker Biers, wie es scheint ein Geschenk des Herzogs Julius, wurden nebst zwei Tonnen Schinken einem "Kerner von Meiningen" gegen eine Frachtgebühr von 36 Rthlrn. zur Besorgung nach Augsburg übergeben. Die Herzogin Elisabeth kaufte von einem Goldschmiede aus der kunst= und gewerbreichen Stadt Braunschweig für 500 Rthlr. Kleinodien und 14 goldene Ringe für 84 Gulden, vermuthlich zu Geschenken während der Reise. Die ganze Ausgabe zu Wolfenbüttel betrug über 700 Rthlr.
Am 19. Mai ging der Zug nach dem Schlosse Hessen und gelangte am 20. d. M. nach Halberstadt, woselbst Herzog Ulrich und die Seinigen von dem Bischofe Heinrich Julius, aus dem Hause Braunschweig, gastlich empfangen wurden. Der Bischof entschuldigte sich dabei als ein junger Hauswirth mit dem Mangelhaften der Ausrichtung. Es wurden hier u. A.


|
Seite 177 |




|
"den Chorschulern, so gesungen, 5 Rthlr., den Cantoribus, so auffgewartet, 2 Rthlr., Einem, Andreas Gallus genannt, so seiner furstlichen Gnaden etliche deutsche Versch vorehret, 1 Rthlr. vnd einem armen Pastorn, so keinen Dienst gehabt, 2 Rthlr. vorehret". Ueberhaupt pflegte Herzog Ulrich auf der ganzen Reise die geistlichen Sänger, die Religions=Flüchtlinge und ähnliche Nothleidende vorzugsweise reichlich zu bedenken. Wiederholt ließ er sich auch kleine Münze an Dreilingen und Groschen von dem Rentschreiber Johann Isebein geben und verabreichte bisweilen persönlich armen Wandersleuten oder Abgebrannten milde Gaben. - Unter den Gegenständen des Reisegeräthes, welche hier einer Ausbesserung bedurften, befand sich auch eine im Wagen des Herzogs Ulrich angebrachte Uhr mit einem Schlagwerke. Dieselbe scheint umfänglich und kunstvoll gewesen zu sein 1 ), litt aber wohl beträchtlich bei der zuweilen heftigen und schwerfälligen Bewegung des Wagens; wenigstens mußte sie schon nach wenig Tagen, zu Sangerhausen, abermals gebessert werden.
Nach einem Rasttage zu Halberstadt erreichten die Reisenden am 22. Mai Ermbsleben und am 23. d. M. Sangerhausen, wo wiederum gerastet ward. Der sächsische Kurfürst hatte hier für Geleite und Bewirthung der Gäste Sorge getragen. Herzog Ulrich bezog das Schloß; einen Theil der Räthe und Junker nahm der Burgemeister auf. Der Kurfürst bat, wie üblich war, "mit der geringen Tractation freuntlich vorlieb zu nehmen", wogegen diese von den Gästen für über die Gebühr reich erklärt ward. Zu dem festgesetzten Rasttage kam noch ein zweiter, weil die von Zeit zu Zeit eintreffenden Eilboten schwankende Nachrichten über den endlichen wirklichen Aufbruch des Kaisers und des Kurfürsten August zum Reichstage überbrachten. Herzog Ulrich, der das Haus und die Heimath liebte und des katholischen Wesens der Länder und Fürsten, denen er nahete, mißtrauisch gedachte, war zur Rückkehr entschlossen, falls der Kaiser und der sächsische Kurfürst persönlich vom Reichstage ausbleiben würden. Deshalb war schon seit dem Eintreffen zu Wolfenbüttel die Reise mit Absicht verzögert. So ward auch wieder zu Weissensee, wo der Zug


|
Seite 178 |




|
am Abend des 26. Mai anlangte, am 27. gerastet. Von hier aus meldete Herzog Ulrich sein und seiner Gemahlin Wohlergehen dem Kurfürsten von Sachsen, zeigte aber zugleich an, ihm sei von Augsburg geschrieben, der Reichstag könne wegen Krankheit des Kaisers, der das warme Bad brauchen wolle, möglicher Weise bis auf den Herbst ausgesetzt werden. Vielleicht, fügt der Herzog bei, seien auch "allerlei papistische Practiken vnder diesem Reichstage zu befaren", weshalb er, Herzog Ulrich, um eilige Benachrichtigung über die Reise des Kurfürsten auf der von Dresden nach Erfurt verordneten Post 1 ) bitte.
Den Einzug des Herzogs in die Stadt Erfurt, wohin der Zug am 28. Mai aufbrach, begleitete ein kurzweiliger, halb ärgerlicher Auftritt. Es bestanden damals, vorzugsweise in Mittel=Deutschland, viele Geleitsstreitigkeiten zwischen benachbarten Staaten. Dies war unter Andern auch zwischen Sachsen=Weimar und der Stadt Erfurt der Fall. Letztere hatte deshalb schon am 18. Mai den Herzog Ulrich ersucht, von Sachsen=Weimar kein Geleit zu begehren. Der Herzog ging auch zur Vermeidung von Irrungen hierauf ein, jedoch so, daß er am 25. Mai beide Parteien ersuchte, ihn für dies Mal mit dem Geleite zu verschonen. Allein keine Partei wollte sich etwas vergeben und es erschien am 28. d. M. ein weimarscher Geleitsmann. Als aber dieser den Herzog in die Stadt Erfurt geleiten wollte, ließ der Rath ihm den Schlagbaum vor dem Johannis=Thore sperren Der ganze Reisezug mußte halten. Es erfolgten nun von den Geleitsleuten auf beiden Seiten lange, feierliche Verwahrungen und Gegenerklärungen, bis endlich auf freundliches Ansuchen des friedlich gesinnten Herzogs der weimarsche Geleitsmann zurückwich. Doch mußte demselben ein förmliches, von dem Rathe Husan abgefaßtes Zeugniß über seine geübte Pflicht und sein Bemühen, die Gerechtsame Weimars aufrecht zu erhalten, ausgestellt werden. Inzwischen war der Herzog vom Rathe empfangen und in die besten Wohnungen am Markte geführt, wo alsbald Diener des Rathes eine "Verehrung vberantworteten vnd Cantores vnd Instrumentisten aufwarteten". Von der Hofküche waren


|
Seite 179 |




|
bereits stattliche Einkäufe zu den Mahlzeiten gemacht, wie unter Andern von 44 Hühnern, 61 Pfund Fischen, 2 Kälbern, 7 Lämmern, 8 Gänsen, 37 Pfund Speck, 417 Pfund Rindfleisch, 4 Tonnen Bier u. s. w. Ein Theil dieser Vorräthe ward indessen für die nächsten Tage vorausgesandt. Unter den sonstigen Speisen kommen wilde Enten, Krebse, junge Erbsen, holländischer Käse und für 4 Rthlr. Confect vor. Erfurt erwies sich als ein theurer Ort, indem die Gesammtausgabe für den Unterhalt der Reisenden daselbst etwa 200 Rthlr. betrug. Hiebei wirkte indessen auch der Umstand ein, daß zu jener Zeit selbst in größeren, blühenden Städten wenig räumliche Gasthöfe bestanden. In Folge dessen mußte sich die Reisegesellschaft in vielfache Herbergen zerstreuen. Manche vom Gefolge, ohne die nöthige Ueberwachung und ferne vom Gebieter, führten dann ein mehr fröhliches und üppiges Leben, als in der Regel gestattet war. Zu Erfurt bezogen z. B. der Hofmarschall und einige Vasallen, die gelehrten Räthe, die Hengstreiter, das "Frawenzimmer", die Canzlei, die Schenken und Köche u. s. w. besondere Herbergen, wobei denn auch manche Wirthe die Gelegenheit des Verdienstes reichlich wahrnahmen.
Die Erhaltung der Wagen, Pferde und des Geschirres machte fortgehend dem Marschalle, dem Wagenmeister und dem Rentschreiber große Sorge, zumal nun von Erfurt ab die Reise durch gebirgige Gegenden führte. Weil das Städtchen Arnstadt in Folge einer vor Kurzem erlittenen Feuersbrunst sich zum Nachtlager nicht eignete, mußte der Herzog am 29. Mai eine ungewöhnlich starke Tagereise auf dem thüringer Walde machen. Neun gemiethete Führer mußten an mehreren Stellen die Wege aufräumen und erst spät Abends langte man in Ilmenau auf dem Walde an. Nachdem Herzog Ulrich am nächsten Morgen das Bergwerk, den Eisenhammer und die Schmelzhütten in der Nähe des Ortes besichtigt hatte, begab sich der Zug auf Einladung des Grafen Georg Ernst zu Henneberg nach Schleusingen. Hier rasteten die ermüdeten Reisenden und ergötzten sich in fröhlichen Banketten, so wie an den gewohnten Leistungen der geistlichen Sänger, Trompeter und anderer Musiker. Es traf nun auch ein erwünschtes Schreiben des sächsischen Kurfürsten ein, nach welchem der Kaiser am 31. Mai, dem Rasttage des Herzogs zu Schleusingen, von Wien und der Kurfürst gleichzeitig von Dresden zuverlässig nach Augsburg aufbrechen wollten. In dessen Voraussicht waren bereits am 28. Mai des Herzogs schließliche Gesuche um Geleit und Nachtlager an den Bischof von Bam=


|
Seite 180 |




|
berg (für den 2-4. Jun.), an den Markgrafen Georg Friederich von Brandenburg=Onolzbach (für den 5-8. d. M.) und an den Pfalzgrafen Philipp Ludwig bei Rhein (für den 9-11. d. M.) abgesandt. - Auch zu Schleusingen wurden unter Andern "den Instrumentisten 6 Rthlr., den Cantoribus 10 Rthlr., vnd den Trommetern 2 Rthlr., vffs Schloß in Kuchen vnd Keller 60 Rthlr. vorehret". Unter den fast gleichmäßig bei jedem Nachtlager vorkommenden Ausgaben wiederholte sich auch hier die eines Trinkgeldes von 4 Groschen für jeden der Vasallen, Hofjunker und Edelknaben, welches an die Wirthe der verschiedenen Herbergen erlegt ward. Die Taxe für die Marschälle und Räthe stieg auf 6 bis 8 Groschen für den Kopf. Im Ganzen erreichten oder überstiegen die täglichen Ausgaben auch zu Ilmenau und Schleusingen die Summe von 100 Rthlrn., obgleich der Werth des Geldes im Verhältnisse zu dem Preise der Lebensbedürfnisse in diesen Gegenden wohl unstreitig höher war, als in den größern Städten des Flachlandes.
Am 1. Juni zog man nach Coburg, wo die unmündigen Herzoge Johann Casimir und Johann Ernst, so wie der Graf Burchard zu Barby an der Spitze des Vormundschafts=Rathes die Gäste empfingen. Der Herzog ward auf dem Schlosse bewirthet, "wie es der Allmechtige gnediglich bescheret vnd nach itziger Gelegenheit muglich gewesen". Weil das Geleitsrecht zwischen Sachsen=Coburg und der Grafschaft Henneberg streitig war, hatte Herzog Ulrich sowohl die Vormünder zu Coburg, als den Grafen zu Henneberg ersucht, zur Vermeidung neuer Irrungen das Geleit für dieses Mal einzustellen, welches auch, wiewohl anscheinend ungerne, geschehen war.
Am Abend des 2. Juni empfing der Herzog zu Bamberg von den Dienern des Bischofs, welcher persönlich nicht anwesend war, und vom Rathe der Stadt die herkömmlichen Ehrengeschenke gegen ansehnliche Gegengaben. Ferner wurden wieder den "Geigern und Instrumentisten, so aufgewartet, 3 Rthlr. 12 Gr., einem armen Manne, der 106 Jahr alt sein sollte, 8 Gr. vnd einem Kerl, der seiner fürstlichen Gnaden ein Carmen dediciret, 1 Rthlr. vorehret". Die Küchenrechnung vom Nachtlager daselbst führt u A. über 100 Stück Geflügel an Tauben, Hühnern, Gänsen u. s. w. auf, welches noch nicht völlig 14 Rthlr. kostete, und 625 Pfund verschiedenen Fleisches im Betrage von 26 Rthlrn. Ein Theil dieser Vorräthe ward wieder für die nächsten Tage vorweg geschickt. Zu Bamberg ward ein Rasttag gemacht. Die Reisenden feierten das Pfingstfest durch einen von dem Hofprediger Andreas Celichius in der Herberge des


|
Seite 181 |




|
Herzogs gehaltene Gottesdienst, dem eine Besichtigung des bischöflichen Schlosses und Gartens und ein reiches Mahl folgte.
Der Pfingsmontag war zu Forchheim, auf der großen Herrstraße des fränkischen Hochlandes, gehalten, wohin man am 4. Juni gelangte. Der Rat ließ den Herzog mit einer Verehrung an
"Haberrn vnd Fisch" begrüßen. Zu den Mahlzeiten, welche die herzogliche Küche für die Fürsten und das höhere Gefolge bereitete, wurden u. A. 50 Stücke trefflichen Geflügels an Kapaunen, Wachteln, wilden Hühnern u. s. w., sowie 158 Pfund Rindfleisch, zusammen im Betrage von etwa 10 Rthlrn., nebst 21 Maaß Wein zu 2 Rthlrn. und 7 Eimer Bier zu 12 Rthlrn. 12 Gr. eingekauft.
Folgenden Tags, am 5. Juni zog Herzog Ulrich in Nürnberg mit markgräflichen Geleite ein, an dessen Spitze des Bischofs zu Bamberg Trompeter bliesen. Die Fürsten stiegen in der großen "Herberge zum Ochsenfelder" bei Balthasar Müller ab, wo Trabanten des Rathes die Ehrenwache bezogen, die Chorschüler sangen und der berühmte "Organiste Paull Lautensack" seine Kunst bewährte. Zugleich machte der Rath dem Herzoge ein Geschenk mit zwei Ehrenbechern. Die Vasallen und Junker lagen bei den Wirthen "zum Bitterholze" und "zum rothen Rosse", die gelehrten Räthe in der Herberge "zum wilden Manne". In Rücksicht auf die Sehenswürdigkeiten der Stadt und zur Erholung der Reisenden ward ein halber Rasttag gemacht. Der Herzog besuchte unter Andern einige geschickte Goldschmiede der Stadt. Bei einem derselben kaufte er eine goldene Halskette, "so gewogen 200 1/2 Goltgülden, jeden zu 27 Groschen gerechnet, thuett 225 Rthlr. 12 Gr.; item Macherlohn 8 Rthlr. 18 Gr." Bei einem andern Goldschmiede ward des Herzogs Gürtel neu übergoldet. - In Nürnberg gab es auch damals schon stattliche Gasthöfe, unter denen mehrere der genannten großen Ruf genossen. Nicht minder bot der Waarenmarkt der gewerbreichen Stadt manche damals noch seltene Gegenstände, wie Früchte und Kunsterzeugnisse der Südländer, dar. In den Rechnungen werden neben Kapaunen, Wachteln und Waldhühnern, Krebsen, Schmerlen und Gründlingen auch Capern, Limonien, Pommeranzen, Rosinen, Baumöl, Gewürze, "Rosatzer Wein" u. s. w., wie Confect und Lebkuchen aufgeführt. Um 10 Gulden und 13 Batzen wurden 70 Maß weißen und rothen Weines gekauft. Unter 100 Maaß Bier kommt böhmisches und Rothbier vor. Ein zerbrochenes venetianisches Trinkglas ward dem Wirthe mit 1 Gulden vergütet.


|
Seite 182 |




|
Am 6. Juni ging die Reise über Schwabach nach dem markgräflichen Schlosse Rota, wo man am 7. d. M. rastete und die Ausrichtung von Dienern des Markgrafen empfing. Manche Wagen mußten hier ausgebessert werden, viele Pferde erhielten neuen Hufschlag und einige auch Arzeneimittel. Ein Büchsenmeister, der dem Herzoge ein schönes Gewehr überreichte, ward mit 15 Rthlrn. belohnt. - Als der Zug am Freitage, den 8. Juni, zu Weissenburg anlangte, ward wieder einmal am Uhrwerke in der Kutsche des Herzogs eine Nachhülfe vorgenommen. Der Rath brachte ein Ehrengeschenk an Wein dar, nach dessen Genuß auch in den Herbergen noch wacker vom Gefolge gezecht ward, wie es denn in der Rechnung heißt: "Noch in der Räthe Herberge fur ein Schlafftrungk betzalt laut des Zettels 1 Rthlr.; item vf die (3) Jungkern der Schlafftrungk mitgerechnet 2 1/4 Rthlr."
Sonnabends, den 9. Juni, traf der Herzog zu Monheim ein, wo der folgende Sonntag begangen ward. Die Ausrichtung ward von den Köchen und Schenken des Pfalzgrafen Philipp Ludwig bei Rhein besorgt. Der Bürger, bei welchem Herzog Ulrich abtrat, hatte sein Haus mit einem stattlichen meklenburgischen Wappen geziert, wofür ihm der Herzog 5 Rthlr. reichen ließ. Dieser nahm übrigens regen persönlichen Antheil an den Leistungen des fremden Kunst= und Gewerbfleißes, dessen Fortschritte er für sein Land nutzbar zu machen suchte. So hatte er auf dieser Reise in der Gegend des Harzes, unferne von Wolfenbüttel, mancherlei Eisen= und Messinggeräthe und im Thüringer Walde verschiedene Metalldrähte zur Probe und Nacheiferung für das heimische Gewerbe einkaufen lassen 1 ). Die Hauptrechnung vom Aufenthalte des Herzogs zu Monheim sagt in dieser Beziehung: "dem Nateler, so in meines gnedigen Hern Gegenwertigkeitt die Nateln gemacht, geben 1 Rthlr.; fur Nateln, so m. g. Her (zur Probe) kaufen lassen 4 Patzen".
Am 11. Juni näherte man sich dem Ziele der Reise bis auf wenige Meilen, indem man Donauwörth erreichte. Hier traf eine erfreuliche Botschaft von dem Wohlbefinden des eben


|
Seite 183 |




|
auf Nürnberg anziehenden Kurfürsten von Sachsen ein, an dessen Gemahlin die Herzogin Elisabeth eigenhändig geschrieben hatte. Auf ein damals noch seltenes Hülfsmittel bei dieser Beschäftigung bezieht sich anscheinend die folgende Angabe in der Rechnung des Rentschreibers: "Fur Brillen, so der Hofemeister meiner gnedigen Frauw gekaufft, 1 Rthlr." Kurz zuvor, zu Monheim, wiederholte sich eine ebenfalls die Herzogin Elisabeth betreffende Angabe der Rechnung zum dritten oder vierten Male: "Vor Erdtbheren, welche m. g. Frauw bekommen, Vhrban (dem) Sahelknecht widergebenn 2 Patzen". Auch bei Donauwörth heißt es in der Küchenrechnung: "vor Erdtberen 7 Patzen 2 Kr.; vor Sucker (damals noch selten und bisher in der Rechnung nicht vorgekommen) vnd klein Rossin 1 Gulden". - Des Herzogs Ulrich Uhr wird nochmals mit den Worten erwähnt: "fur Besserung an dem Vhrwerck in m. g. Hern Wagenn 4 Patzen".
Das letzte Nachtlager vor Augsburg bezog der Herzog am 12. Juni zu Westendorf. Daselbst machte sich schon die Nähe der großen, von Fremden überflutheten Reichstags=Stadt in ungewöhnlich hohen Preisen mancher Bedürfnisse geltend. So ward z. B. jedes Maaß Hafer zu 6 Batzen (in Weissenburg noch zu 4 Batzen) und die Stallmiethe für jedes Pferd zu 1 Batzen berechnet. Entsprechend sind andere Angaben: "Vor 4 1/2 Eimer Wein, idern 5 Gld. 7 1/2 Ptz., macht 23 Gld. 3 Ptz.; vor 110 Maß Wein, idern 6 Krz., macht 11 Gld.; vor 2 (Pfund) Sucker, ider 7 1/2 Ptz., 2 (Pfund) Mandeln vnd 2 (Pfund) Rossin, ider 4 Ptz., macht 2 Gld. 3 Ptzen" Nächsten Tages suchte sich Jeder zu Westendorf oder auf den folgenden Anhaltspunkten auf das beste zum Einzuge in Augsburg zu "staffiren". Die Perlenhauben der "Spießjungen" waren kurz zuvor gebessert und, wie die Hüte der Trompeter und Einspänniger, mit neuen Federn geziert. An den Wamsen und Pluderhosen des Herzogs hatte der Hofschneider Hans Bolte nicht bloß zu Güstrow vier Wochen lang vor der Abreise, sondern auch unterweges fleißig die Kunst geübt, indem die Rechnungen mehrmals Seide und Seidenband als zu den herzoglichen Kleidern verwandt aufführen. Die Köche und Schenken waren vorweg gesandt. Ihnen folgte in der Frühe des Morgens der Stallmeister Ulrich Penz. Dieser ordnete unferne von Augsburg den herzoglichen Zug, an dessen Spitze blasende Trompeter ritten und in dessen Mitte Herzog Ulrich, wie es scheint zu Roß, gegen Abend des 13. Juni wohlbehalten in Augsburg einzog.


|
Seite 184 |




|
Vollzählig hatte der Zug die alte Reichsstadt erreicht. So war denn diese damals langwierige, beschwerliche und nicht ganz gefahrlose Reise des Herzogs ohne wesentlichen Unfall und in der voraus bestimmten Zeit von 35 Tagen zurückgelegt. Daß zu jener Zeit selbst einem so stattlichen Reisezuge, wie dem des Herzogs, Gefahr begegnen konnte, beweist eine demselben zugegangene Mittheilung der nach Augsburg vorausgeschickten kursächsischen Räthe vom 4. Junius. Nach Inhalt dieser Botschaft zog gerade damals ein Kriegsvolk von 700 Mann zu Fuß und zu Roß aus Böhmen nach den Niederlanden. Weil nun bei schwacher Mannszucht in dessen Reihen freche Zügellosigkeit, wie um diese Zeit gewöhnlich bei den Söldnern, selbst wenn Führer, wie Alexander von Parma, an ihrer Spitze standen, herrschte, so warnten die Räthe vor einem Zusammentreffen mit diesem Haufen, der jedoch eine andere Straße zog, als jene vermutheten. - Das Beschwerliche der Reise war durch die steigende Wärme der Jahreszeit und die Berührung des Gebirgslandes vermehrt. Dies ward besonders in Erschöpfung der Pferde bemerkbar. In den Rechnungen kommen wiederholt Ausgaben für das Aderschlagen und Waschen der kranken Klepper mit Branntwein und Eiern, für das "Brechen der Fibel" u. s. w. vor. Schon von Erfurt her wurden mehrmals und von Bamberg aus beständig Pferde für die Wagen mit dem Getränke, dem Fleische und einem Theile des Küchengeräthes gemiethet. Auch einzelnen städtischen Rüstwag en mußten zeitweise Hülfspferde verschafft werden. Am zahlreichsten und während der zweiten Reisehälfte auffallend gehäuft erscheinen die Ausgaben für die Hufschläge - täglich ein Dutzend reichte nicht! - und die Besserungen an den Wagen und am Geschirre, obgleich zu deren Erhaltung eine unglaubliche Masse von Theer und Fett verbraucht ward, wie z. B. in Bamberg auf einmal "für 86 Pfd. Wagenschmiere vff die 10 Rustwagen 3 Rthlr. 14 Gr." bezahlt wurden.
Zu Augsburg, wo der Rath ebenfalls die herkömmliche Begrüßung des Gastes durch ein Ehrengeschenk an Fischen und Wein thun ließ und die Musiker aufwarteten, bezog Herzog Ulrich das stattliche Haus des Bürgers Melchior Heinhofer. Dasselbe konnte jedoch nur die Fürsten selbst und ihre nächste Umgebung aufnehmen. Es enthielt unter Andern einen Bankettsaal, so wie ein anderes großes Gemach, welches zu einem Betsaale mit Canzel und Altar eingerichtet ward. Der ernste, geschäftsgewohnte Herzog ließ sich auch sofort "in seinem Losement von einen Schnitzker ein klein


|
Seite 185 |




|
Schreibstublein bauwen vnd dazu einen Tisch machen". Am Eingange des Hauses sah man das meklenburgische Wappen erhöht. An die Thüren der verschiedenen Gemächer im Innern ließ der Hofmarschall Namen und Titel des Herzogs, der Herzogin und der jungen Herzoge schreiben. Neben einem Thürwärter wurden sechs Trabanten in Dienst genommen, deren jeder monatlich sechs Gulden und freien Unterhalt empfing.
Die Hofküche, der Hofkeller, die Silberkammer und die Waschküche waren nahe der herzogl. Wohnung bei Wilhelm Zitzinger eingerichtet. Aus der Hofküche wurden in der Regel nur die Räthe, Vasallen, Junker und einige aufwartende Hofdiener gespeist. Das übrige Gefolge ward größten Theils bei Daniel Jenitz beköstiget. Die Stallungen für die herzoglichen Kutsch= und Wagenpferde mußten in verschiedenen Herbergen gemiethet werden. Die Rüstwagen wurden mit etwa 20 Knechten und 40 Pferden in dem von Augsburg wenig entfernten Orte Oberhausen untergebracht und erst in den letzten Wochen der Anwesenheit des Herzogs in die Stadt berufen, als diese wieder von vielen Fremden verlassen war. Der Hofmarschall, der Leibarzt und der Hofprediger, die gelehrten Räthe, die Vasallen, die Hengstreiter und übrigen Hofjunker, die Canzlei und das sonstige Gefolge hatten besondere Herbergen in der Stadt bezogen.
Herzog Ulrich war einer der ersten unter den Fürsten, welche zum Reichstage in Augsburg eintrafen. Erst am 17. Juni, vier Tage später, langte Kurfürst August von Sachsen an. Er war begleitet von seiner Gemahlin, dem Kurerben Herzog Christian und, wie Herzog Ulrich, von zwei jungen, noch bevormündeten Fürsten, den sächsischen Herzogen Friedrich Wilhelm und Johann Casimir. In seinem Gefolge erschienen sieben Grafen und mehr als 150 Vasallen, Räthe und höhere Hofdiener. Der ganze Zug des Kurfürsten, aus 1146 Pferden bestehend, unter denen 700 Leibrosse waren, galt als der zahlreichste und glänzendste unter allen später versammelten Fürsten, den des Kaisers ausgenommen. Herzog Ulrich und seine Neffen ritten dem Kurfürsten zur freundlichen Begrüßung entgegen und beide Häuser hielten sich während des Reichstags in vertraueter Nähe. Am 17. Junius kam der päpstliche Legat, Cardinal Onophrius, von Trient an. Ihm folgten am 18. d. M. der Erzbischof Wolfgang (von Dallberg), Kurfürst von Mainz und am 19. der Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg, Administrator des Stifts Magdeburg. Er erschien an der Stelle seines Vaters, des Kurfürsten, und ritt mit 4 Grafen, vielen Vasallen und Räthen,


|
Seite 186 |




|
im Ganzen mit 362 Pferden ein. Am 24. hielt der Bischof von Würzburg seinen Einzug und folgenden Tags langte der Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg mit seiner Gemahlin und seinen beiden Brüdern, zusammen mit 200 Pferden an.
Inzwischen gab Herzog Ulrich schon am 21. Juni dem Herzoge Friederich Wilhelm zu Sachsen, den Grafen von Barby, Schaumburg und Pappenheim, so wie den lübeckischen Gesandten ein Bankett. Denselben Tag waren alle sächsischen, brandenburgischen und meklenburgischen Fürsten in den Schießgarten, vor dem Geckinger Thore, geritten. Kurfürst August und der Markgraf schossen mit dem Grafen Maximilian Fugger aus Armbrüsten nach dem Blatte und gewannen von dem Grafen vier vergoldete silberne Becher.
Endlich, am 27. Juni, ertönte der Ruf vom Einzuge des Kaisers 1 ). Rudolph der Zweite brach in Gesellschaft des Erzherzogs Carl von Oesterreich und der Herzoge Wilhelm und Ferdinand von Baiern um Mittag vom nahen Friedberg auf und näherte sich um 2 Uhr Nachmittags der Stadt. Fast alle anwesenden weltlichen und geistlichen Fürsten, namentlich auch die Bischöfe von Würzburg und Eichsstädt, ritten mit ihrem reichgeschmückten Gefolge dem Oberhaupte des Reiches entgegen. In einer Aue stiegen sie von ihren Pferden und harrten des Kaisers. Als dieser sie von Weitem erblickte, stieg auch er vom Rosse, ging ihnen entgegen und bot den älteren vortretenden Fürsten die Hand. Darauf begrüßte ihn der Kurfürst von Mainz im Namen Aller mit einer feierlichen Anrede. Als nach kurzem Danke des Kaisers inmittelst der gewaltige Zug eilig geordnet war, stiegen die Fürsten mit dem Kaiser wieder zu Roß.
Voran zogen der Reichsfourier mit 3 Trabanten, ein Glied sächsischer Knechte, 3 kaiserliche Lakaien, der Reich=Vicemarschall Graf Pappenheim, allein reitend, dann an 80 Glieder sächsischer Knechte, Spießjungen und Junker, die Heerpauker, 3 Glieder Trompeter und ein Gl. Jungen mit


|
Seite 187 |




|
Federspießen und Sturmhüten mit gelben Federn. Alle diese waren dem Kurfürsten oder den Herzogen von Sachsen zuständig. Ihnen folgten 3 Glieder brandenburgischer Kammerjungen, die beiden ersten mit weißen, das dritte mit schwarzen und weißen Federn geschmückt, 1 Glied meklenburgischer Kammerjungen mit rothen und gelben Federn, 13 Gl. brandenburgischer Knechte, Trompeter und Handpferde, 19 Gl. brandenb. Junker mit weißen Federn, 16 Gl. kurmainzischer und 10 Gl. pfalzgräflich neuburgischer Junker, alle mit schwarzen Binden, 8 Gl. meklenburgischer, 15 Gl. würzburgischer, 8 Gl. eichsstädtischer und 15 Gl. österreichischer Junker, wobei die Edlen der verschiedenen Länder je durch 1 oder 2 Gl. Trompeter getrennt erschienen. Auf die Oesterreicher folgten einzeln 11 Pferde, von Edelknaben des Erzherzogs Carl geritten, dessen Stallmeister, dann 3 Gl. baierscher Trompeter mit blauen Fähnlein, 24 Gl. baierscher Junker und 56 Gl. baierscher Knechte, 9 Gl. Ungarn in Oberwamsen mit Pelz verziert und mit gekrümmten Schwertern, 42 Pferde, Knechte und Jungen des deutschen Ordens mit langen Federn, 5 Gl. in gelbem Zeuge den Grafen Fugger zuständig und an 60 Gl. Knechte, Jungen und Handpferde von verschiedenen Reichsständen. Darauf kamen 3 kaiserliche Jäger, deren jeder einen zur Jagd abgerichteten Leoparden hinter sich auf dem Pferde führte, 12 Leibrosse des Kaisers, von so viel edlen Knaben in welschen Röcklein geritten; von den letzten beiden trug Einer den mit hohen schwarzen, gelben und weißen Federn gezierten Helm, die Blechhandschuhe und den Rennspieß, der Andere den Küraß des Kaisers. An sie schlossen sich 2 Gl. kaiserlicher Junker, die Heertrommeln und 15 Gl. kaiserl. Trompeter, "die herrlich zusammen bliessen", und 21 Gl. Knechte "durch einander gemenget."
Diejenige Abtheilung des Zuges, in welcher die Fürsten selbst erschienen, eröffneten 4 Glieder Kammerherren, oder nach einer anderen Nachricht Ehrenherolde, demnächst der kaiserliche Hofmarschall, allein reitend, und 2 böhmische Herolde. Dann folgten die Fürsten. Im ersten Gliede ritten die beiden jungen Herzoge von Meklenburg Johann und Sigismund August, im zweiten der junge Pfalzgraf Friederich von Neuburg und der minderjährige Herzog Johann Casimir von Sachsen=Coburg, im nächsten Pfalzgraf Otto von Neuburg, der Erbe von Kursachsen Herzog Christian und in der Mitte der junge Herzog Friederich Wilhelm von Sachsen=Weimar. Ihnen zunächst sah man, ebenfalls


|
Seite 188 |




|
in einem Gliede, den Herzog Ulrich zu Meklenburg, den regierenden Pfalzgrafen Philipp Ludwig in der Mitte und den Herzog Ferdinand von Baiern, im fünften Gliede den Erzherzog Carl zur Rechten, in der Mitte den Markgrafen Joachim Friederich von Brandenburg und zur Linken den regierenden Herzog Wilhelm von Baiern. Auf diese folgten 2 Reichsherolde, dann der Kurfürst von Sachsen mit dem entblößten Reichsschwerte, und endlich der Kaiser, allein reitend. Demnächst erschienen in einem Gliede der Kurfürst von Mainz in der Mitte, rechts der Bischof von Würzburg und links der von Eichsstädt. Allen Fürsten zur Seite schritten Leibtrabanten einher, in den Landesfarben geputzt. Alsdann kamen die kaiserlichen Würdenträger: der Canzler Dr. Viehäuser, mehrere Geh. Räthe, der Hofmeister von Dietrichstein, Gilius, der Hauptmann der kaiserlichen Hatschiere und der Oberkämmerer Rumpf, einer von Rudolphs Vertrauten. An sie reiheten sich 3 Glieder kaiserliche Kammerjungen, 28 Gl. Hatschiere in Harnischen und Pickelhauben und 158 Gl. Knechte und Gesinde. Den Schluß machte der kaiserliche Profoß mit etlichen Knechten 1 ).
Unferne des rothen Thores der Stadt empfing der Augsburger Rath den Kaiser. Der Stadtpfleger Anton Rehlinger hielt eine Anrede an ihn und überreichte ihm die Schlüssel der Stadt. Darauf traten sechs jüngere Rathsherrn hervor; sie trugen einen Thronhimmel, mit gelbem Dammast bekleidet und mit dem schwarzen Adler des Reiches geschmückt. Unter diesem ward der Kaiser von ihnen in die Domkirche geleitet, wo ihm der Bischof von Augsburg die begrüßende Weihe ertheilte. Neben dem hohen Altare sitzend, hörte dann Rudolph das "Te Deum laudamus", von dem Italiäner Orlando gesungen. Sobald die Feier geschlossen war, erhob sich der Kaiser und stieg wieder mit den sämmtlichen Fürsten zu Roß. Mit allem Gefolge, an 3000 Pferde stark, geleiteten sie ihn nach dem Pallaste der Fugger, am Weinmarkt gelegen, woselbst der Kaiser sein Hoflager nahm.
Seit dem kaiserlichen Einzuge häuften sich die Feste, welche an Geschmack der Einrichtung denen anderer Zeiten nachstehen mochten, an Umfang und Ueppigkeit vielen früheren und


|
Seite 189 |




|
späteren gleich kamen oder sie übertrafen. Am 1. Juli hatte Herzog Ulrich die Grafen von Hardegg und von Barby nebst einigen Gesandten zu Gaste. Folgenden Tags gab Erzherzog Carl allen anwesenden Fürsten ein Bankett, durch die Zahl der aufgetragenen Speisen, wie der zur Unterhaltung der Gäste wirkenden Tonkünstler ausgezeichnet. Den 3. d. M. hielt Herzog Ulrich zu Ehren der Pfalzgrafen von Neuburg Bankett, auf welchem ebenfalls Trompeter, Geiger und Pauker zahlreich aufwarteten. Am 4. d. M. bewirtheten die Pfalzgrafen den Herzog und sein ganzes Haus. Das reichste Gastmahl gaben am 5. Julius die Grafen Maximilian und Hans Fugger. Alle anwesenden weltlichen und mehrere geistliche Fürsten verherrlichten dieses Bankett, in dessen Verlaufe 247 Essen den Gästen aufgetragen wurden. - Herzog Ulrich ließ zu solchen Festen unter Andern seinen Pastetenbäcker durch einen kunstgeübten Maler, Christoph Giltinger, unterstützen, der die Pasteten und die verschiedenen Backwerke aus Zucker, Mandeln, Milch und Eiern mit Farben oder mit Gold und Silber verzierte. Der außerordentliche Verbrauch an Wein und Fleisch den Banketten wird aus den Angaben der Rechnungen hervorgehen. Auch den Musikern und Trabanten, welche bei den Festen und sonst aufwarteten, wurden stattliche Belohnungen gereicht, wie z. B. "der Kays. Mayt. Trommetern vorehret 20 Rthlr.; item des Hertzogen von Wirtembergk Trommetern 8 Rthlr.; item S. F. Gn. Drabanten 10 Rthlr.; des Pfaltzgrauen Trommetern 6 Rthlr. Den Instrumentisten, so fur m. gn. H. aufgewartet, wie s. f. G. den jungen Hern von Weimar zu Gaste gehabt, gebenn 4 Rthlr.; noch den Augspurgischen Instrumentisten für 3 Mall aufzuwarten aus beuehl des Marschalks geben 12 Rthlr. Des Churfursten zu Sachsen Drabanten 20 Rthlr., item S. churf. Gn. Trommetern 12 Rthlr.; des Administratoris zu Magdeburgk Trommetern vorehret 6 Rthlr.; item S. F. G. Drabanten 13 Rthlr." u. s. w. Daß es somit an kriegerischem Prunke und an geräuschvollen Kunstübungen bei den Festen und überhaupt im Hause des Herzogs nicht fehlte, ist nicht zu bezweifeln.
Herzog Ulrich selbst, obwohl nach eigener Sinnesweise nicht prachtliebend und reich an Jahren, wußte sich doch zu solcher Zeit auch persönlich prächtig und geschmückt zu zeigen, wie es die Sitte gebot So kommen in Beziehung auf seine Staatskleider, jedoch sehr zerstreut, die Angaben vor: "Fur 2 Federn, so m. gn. H. bekommen, 2 Rthlr.; einem Goldtschmiede, so vber meines gn. H. Wehre eine sammitten Scheide gezogen 1 Rthlr.; Chim Stralendorffen - dem herzogl. Kämmerer =


|
Seite 190 |




|
wieder gebenn für Handtschen, so er m. gn. H. gekaufft, 1 Rthlr. 3 Patz. Chim Stralendorffen vorlegt Geldt fur ein Par seidenn Strumpffe, so m. gn. H. bekommen 8 Rthlr.; fur 3/4 Ellen Karteck zu meines gn. H. seiden Strumpffen 3 Patz. Fur meines gn. H. Gurtell zu bessern dem Goldtschmiede gebenn 6 Patz; für 1/2 Elle Sammit zu meines gn. H. Stiefeln Clauß dem Schneider zugestellt 1 Rthlr. 9 Patz. Einem Schneiderknechte, der meines gn. H. Schneider geholffen, weil er m. g. H. ein new Kleidt machen mussen, geben 1 Rthlr.; für ein Rubin vf meines gn. H. Mantel zu setzen, auß Beuel Stralendorfs geben 3 Rthlr."
Inmittelst war am 3 Juli die feierliche Eröffnung des Reichstagsgeschehen. Der Kaiser hatte zu dem Zwecke alle anwesenden Fürsten und Gesandte in sein Hoflager am Weinmarkte beschieden. Von hier ging der Zug, unter Andern von vier Ehrenherolden des Reiches geführt, Morgens sieben Uhr nach alter Sitte in die Domkirche, wobei wieder der Kurfürst von Sachsen das entblößte Reichsschwert dem Kaiser vortrug. Im Dome hielt der Bischof von Augsburg das Hochamt, doch unter Abtritt der protestantischen Reichsstände, welche nach der Meinung der Zeit durch Anhören der Messe ihr Gewissen beschwert hätten. Alsdann zog man auf das Rathhaus. In einem weitem Saale setzten sich die regierenden Fürsten und die Botschafter von solchen innerhalb Schranken zu Füßen des kaiserlichen Thrones nieder; theils neben diesem zur Rechten und Linken, theils vor demselben in gerader Richtung und an zwei Seiten, wobei Herzog Ulrich auf der vierten Seite allein saß, wie es, vermuthlich aus besonderer Rücksicht gegen ihn und um Rangstreit zu meiden, angeordnet war. Die jungen Fürsten umstanden die Schranken nach innen. Die Reihenfolge in der Stellung unter den Gesandten der Städte und der Grafen und Herrn ward mit Mühe von dem Reichs=Vicemarschall Grafen Pappenheim geordnet. Darauf begrüßte der Bischof von Würzburg, weil der kaiserliche Vicekanzler unwohl war, im Namen des Kaisers die Reichsversammlung. Dann las der Geheimschreiber des Reichshofraths, Andreas Erstenberger, die kaiserlichen Anträge vor, deren Hauuptpunkte die Türkenhülfe, die niederländischen Unruhen und andere auswärtige Händel des Reiches betrafen, wogegen des innern Religionszwistes, zum Mißfallen der evangelischen Stände, nicht gedacht ward. Nachdem der Kaiser, unter einem vergoldeten Thronhimmel sitzend, einige Worte der Gnade und Ermahnung gesprochen hatte, dankte der Kurfürst von Mainz Namens der Stände, mit dem Erbieten, nunmehr zur Berathung zusammen


|
Seite 191 |




|
zu treten. Als der Kaiser den Saal verließ, ward er von den Fürsten und Gesandten in den Pallast der Fugger zurück geleitet, wo er am Eingange "den Kurfürsten freundlich abdankte" und von den übrigen Fürsten die Begleitung bis zu seinem Gemache annahm.
Mehrere durch Rang und persönliches Ansehn ausgezeichnete Fürsten trafen noch nach der Eröffnung des Reichstags zu Augsburg ein. So Herzog Ludwig von Würtemberg am 6. Juli und der Erzbischof, Kurfürst Johann von Trier am 16. d. M. In der Mitte des Juli waren 3 Kurfürsten, 7 Bischöfe, 2 Erzherzoge, 16 Herzoge und andere Fürsten, nebst einer großen Zahl von Grafen und Herren um den Kaiser versammelt. Seit langer Zeit war kein so glänzender Reichstag gehalten. Niemand erinnerte sich, einen so prächtigen Einzug des Kaisers, selbst Carl's V. nicht, gesehen zu haben. Die Blicke von ganz Deutschland richteten sich nach Augsburg 1 ).
Bald jedoch gab es auch Hader und Verdruß. Die Fürsten waren sich eine Zeit lang über die Größe der dem Kaiser zu gewährenden Türkenhülfe nicht einig und gegen den endlichen Schluß legten die Reichsstädte eine feierliche Verwahrung ein. Von den Städten Aachen, Lübeck und selbst von Augsburg liefen bittere Klagen über Religions= und Handelsbedruck und Kränkung wichtiger Gerechtsame ein. Um den Wucher und die Theurung zu mäßigen und möglichst abzuschneiden, hatte der Graf von Pappenheim eine Polizei= und Tax=Ordnung für die Preise der Lebensbedürfnisse, der Wohnungen u. s. w. während des Reichstages erlassen. Die Stadt beschwerte sich heftig gegen sein eigenmächtiges Verfahren in dieser Sache, so wie bei Austheilung der Quartiere und es entstand zwischen beiden ein förmlicher Prozeß 2 ). Außerdem war viel Zankens über die Rangordnung beim Sitzen


|
Seite 192 |




|
und Stimmen. Es ward deshalb auch zwischen Meklenburg, Würtemberg und Jülich, Pommern und andern Ständen gestritten; doch nur von Gesandten und Räthen, nicht von den Fürsten, die dem Herzoge Ulrich, "dem Alten", Verehrung erwiesen 1 ). - Ueber die Vermittelung in den niederländischen Kriegsunruhen konnten sich die Reichsstände nicht einigen. - Auch an aufregenden Beschwerden einzelner evangelischer Stände fehlte es nicht; ja von den Reichsstädten und, von Würtemberg und Kurpfalz ward des Kaisers Geneigtheit, sie zu heben, gegen Ende des Reichstags bitter verdächtigt. Sogar in Augsburg selbst hatte sich eine Anzahl meist bettelnder Religions=Flüchtlinge - einige mochten sich freilich fälschlich als solche bezeichnen! - zur Schau gestellt.
Dieses Alles, später schärfer hervortretend, hinderte nicht den Gang der Festlichkeiten und die Entwickelung mannigfachen Lebensgenusses unter den hohen Gästen zu Augsburg. Einer der glücklichsten Beförderer heiteren Fürstenlebens war Herzog Ulrich z. M. Am 11. Juli hielt er ein herrliches Bankett, auf welchem außer vielen protestantischen verwandten und befreundeten Fürsten der Erzherzog Carl von Oesterreich mit Gemahlin, Herzog Wilhelm von Baiern mit Gemahlin, Herzog Ferdinand von Baiern, Herzog Ludwig von Würtemberg mit Gemahlin und zwei Fräulein von Baden erschienen. Desselben Tages hielt Herzog Ferdinand von Baiern mit den Grafen und Herren aus Böhmen und Ungarn auf dem Weinmarkt unter den Augen des Kaisers ein Ringelrennen, in welchem "der von Baiern das Beste" that. Den 12. d. M. gab der Erzherzog Carl von Oesterreich ein glänzendes Bankett, welches fast sämmtliche anwesende Fürsten ohne Unterschied des Ranges oder der Religion um den Kaiser vereinigte. Auch die katholischen Bischöfe waren zugegen. Hierauf folgten am 13. Juli das Fest der Pfalzgrafen zu Neuburg, am 15. d. M. das Ringelrennen (die letzten Zeiten der Turniere waren eben vorüber!) der Herzog von Baiern, von Sachsen und Würtemberg mit den ungarschen und böhmischen Edlen vor dem Hoflager des Kaisers, und am 16. d. M. das große Bankett des Kurfürsten von Sachsen. Nächst dem der Fugger hielt man es für das reichste; alle anwesende Fürsten und Grafen waren zu demselben geladen und der Kaiser verherrlichte es durch seine Gegenwart. Unter den Bischöfen hielt der von Würzburg


|
Seite 193 |




|
am 18. Juli Bankett. Einer seiner Gäste, Herzog Ulrich z. M. veranstaltete folgenden Tages ein Gegenfest zu Ehren der Kurfürsten von Mainz und Trier und der Bischöfe von Würzburg, Lüttich und Hildesheim. Gewöhnlich bestanden diese Feste in Mittagsmahlzeiten, welche um 12 Uhr oder noch früher begannen, sich oft bis in den Abend erstreckten, zuweilen mit Tanz endigten und in der Regel von geräuschvoller Musik begleitet waren. Bisweilen hatten jedoch die Gastgeber am Abend eines Banketts schon wieder andere Gäste, wie Herzog Ulrich nach dem Feste am 19. d. M. den Herzog Franz zu Sachsen.
Um diese Zeit veranlaßte der langsame, von den Kaiserlichen oft einseitig geleitete Geschäftsgang des Reichstages, bei der Kostbarkeit des Aufenthaltes, einzelne Reichsstände zur Vorbereitung der Abreise. Es kam hinzu, daß manche protestantische Fürsten in dem Benehmen des Kaisers etwas Rückhaltiges und Schwankendes erkennen wollten und daß auch von vermeintlichen "katholischen Practiken" die Rede ging 1 ). Ueber dies hatte das unablässige ,,Panckettiren" manche der kräftigen Naturen jener Zeit ermüdet, so daß Einzelne zur Stärkung in das warme Bad ziehen oder Tage lang das Lager hüten mußten. Im Beginne des Jahrhunderts hatte selbst ein meklenburgischer Fürst, H. Erich II, die Schwelgereien eines Reichstages, zu Costnitz, mit frühzeitigem Tode (24. Dec. 1508) gebüßt. Des kräftigen und Maaß haltenden Herzogs Ulrich Gesundheit blieb unerschüttert und nur einmal ließ er sich "von dem Medicus etzliche Kuchlein bereiten". Allein der Herzog, unzufrieden mit dem Schneckengange der Reichstags=Geschäfte und dem großen Aufwande an Geld und Zeit, gedachte am 21. Juli von Augsburg aufzubrechen. Als er sich aber Tags zuvor schriftlich, in ziemlich derben Ausdrücken, bei dem nicht leicht zugänglichen und selten aufgeräumten Kaiser beurlaubte, forderte ihn dieser in so dringenden und huldvollen Vorstellungen zur Verlängerung seines Aufent=


|
Seite 194 |




|
haltes auf, daß er die Abreise um acht Tage verschob. 1 ) In dieser Zeit wurden, mehr als zuvor, manche Reichsstände zur Förderung der Staatshändel durch kaiserliche Vertraute beschickt, während jene ihrer Seits durch geschäftsgewandte, erfahrene Räthe, nicht immer auf dem geradesten Wege, ihre besondern Geschäfte, wie Erlangung von Freibriefen, Vorschreiben, Zöllen und dergleichen, am kaiserlichen Hofe betrieben. Auch Herzog Ulrich stand wegen rückständiger Reichsanlagen, Rangstreitigkeiten, Verleihung von Zöllen und Freibriefen in ähnlicher Verbindung mit den kaiserlichen Dienern, wobei er die üblichen Rücksichten beachtete, indem es in der Rechnung heißt: "der Röm. Keys. Maitt. Vice=Cantzlern Dr. Vieheuser vorehret 200 Goldtgulden, jeden zu 36 ßl., thut 225 Taler."
Am 27. Juli gab Herzog Ulrich den protestantischen Fürsten aus den brandenburgischen und sächsischen Häusern und dem Pfalzgrafen Friedrich von Neuburg ein Abschieds=Bankett, auf welchem neben andern Künstlern von vier "Berggesellen gesungen vnd aufgewartet" ward. Folgenden Tages, da die Stadt Augsburg dem Kaiser huldigte, sah man Herzog Ulrich und seine Neffen nochmals in dem glänzenden Fürstenkreise. Der berittene Zug derselben, geführt von den böhmischen, ungarischen und zwei Reichsherolden in goldgeschmückten Kurkleidern, wandte sich vom Pallaste der Fugger nach dem Rathhause. Der Kaiser, der ein prächtiges gelbes Roß ritt, verfügte sich auf einen ausgebaueten, mit einem goldgewirkten Teppich bekleideten Erker Neben ihm standen die Kurfürsten von Sachsen und von Mainz. Etwas tiefer 2 ) sah man die übrigen Fürsten nach ihrem Range zur Rechten und Linken stehen, den Herzog Ulrich, wie schon früher, auf der letztern Seite allein, nahe dem Kaiser und nächst


|
Seite 195 |




|
ihm Trautson, den viel bewährten kaiserl. geh. Rath mit dem goldenen Vließ. Der Vice=Canzler trat zur Seite des Kaisers, hielt ein kurzes Zwiegespräch mit diesem und hiernach mit dem ersten Pfleger der Stadt. Dann verlas er mit kräftiger Stimme den Huldigungs=Eid, den der unten stehende Rath und das Volk mit erhobenen Fingern und entblößeten Häuptern nachsprachen, worauf ein gewaltiger Ruf der Trompeten und Pauken und wechselseitige Dankreden die Handlung schlossen.
Die Betrachtung des Aufenthaltes des Herzogs Ulrich zu Augsburg bietet im Einzelnen mehrfache interessante Seiten dar. Die Einrichtung und Erhaltung eines fürstlichen Hofhaltes zu Augsburg war umfänglich und kostspielig. Die Stadt blieb längere Zeit mit hohen Gästen und andern Fremden überfüllt. Eine nicht selten überreichliche Ausstattung der Feste an Tafelgenüssen ward von dem herrschenden Sinne des Volkes und der Zeit geboten. Die verausgabten Summen für die eigentlichen Bedürfnisse des meklenb. Hofhaltes erscheinen daher beträchtlich, auch wenn man den Unterschied des Geldwerthes zwischen damals und heute geringe schätzt. Die meisten Vorräthe für die Küche während eines sechswöchentlichen Aufenthaltes zu Augsburg lieferte der Metzger Jürgen Gilrede und zwar: 26 Schweine, 3019 Pfd. wiegend, jedes Pfd. 1 Batzen, zu 201 Gld. 4 Btz., 171 Kälber zu 350 Gld., 313 Hammel zu 487 Gld. 7 1/2 Btz., 108 Lämmer zu 79 Gld. 10 Btz., 9 Tonnen Schmalz, 1240 Pfd. wiegend, zu 100 Gld. 5 Btz. und 1250 Pfd. Speck zu 156 Gld. Im Ganzen erhielt Jürgen Gilrede 1375 Gld. 1 Btz. Mathias Schmiede lieferte 16 1/2 Ochsen, 8347 Pfd. wiegend, zu 357 Gld. 11 Btz., 7 Scheffel Salz zu 10 Gld. 7 Btz. und 100 Pfd. holländischen Käse zu 8 Gld. Ein Fischer bekam für nach und nach zur Küche gebrachte Fische 279 Gld. Von einem Händler Peter Gaffel, wurden u. A. 699 Pfd. Stockfisch zu 69 Gld. 14 Btz., 1600 Schollen zu 24 Gld. 1 Btz. und für 27 Gld. Lachs gekauft, ferner 14 1/2 Eimer Weinessig von demselben zu 101 Gld. 4 Btz. Außerdem betrug der tägliche Einkauf an Gemüse, Eiern, Milch, Geflügel u. s. w. noch durchschnittlich 16 bis 18 Gld. Gewürze und Confect wurden bei Mathias Stengler, Friedrich Stockler und Sabina Schleicherin auf besondere Rechnung ausgenommen und mit 306 Gld. bezahlt. Ebenso Brot bei dem Bäcker Jacob Wiedemann im Betrage von 481 Gld. Eben so bedeutend waren die Bedürfnisse des Hofkellers, nämlich an rothen und weißen Wein aus Franken, den Rheinlanden u. s. w. 429 Eimer, in 84 Fässern, zu 1781 Gld., und 54


|
Seite 196 |




|
Fässer Bier, 203 Eimer haltend, zu 374 Gld., wozu noch zeitweise kleine Einkäufe und ein von dem Küchenmeister Andreas Ihlefeld besorgter Vorrath von 21 Eimern Wein und 39 Eimern Bier kamen. Für Küchengeräthe und kleine bauliche Einrichtungen wurden an 300 Gld. und für 45 Klafter Brennholz 100 Gld. verausgabt. Die Unterhaltung der Pferde des Marstalls und des Gefolges, mit Ausschluß der Rüstwagen, betrug an Hafer, Heu und Stroh 1543 Gld. und machte manche Sorge, indem der Marschall zwei oder drei Mal Leute ziemlich weit über Land schicken mußte, um "etlichen Habern zu Wege zu bringen".
Die Küchenrechnung führt außer den großen Vorräthen mannigfache, zum Theil in allen Zeiten geschätzte Gerichte und Gaben auf. So unter dem Wilde: Hirsche, zu 8 Gld. das Stück, Rehe, zu 3 Gld. 6 Btz., Hasen, zu 6 Btz., und Kaninchen; an Geflügel: Wachteln, wilde Enten, Lerchen, Spreen, Birkhühner, Kapaunen und Kalekuten; an Fischen: Hechte, Lachse, Forellen, Salmen, Schollen und kleinere Arten, frisch und getrocknet; an Früchten: Zitronen, Pommeranzen, Oliven, Limonen, Muskatellerbirnen und anderes Stein= und Kernobst. Die Südfrüchte waren auch in Augsburg nicht häufig; mehrmals wurden sie von Niederländern oder Italiänern gekauft am billigsten im Preise von 1 Gld. für 20 Zitronen und ebensoviel für Pommeranzen; besonders große und wohlriechende wurden als Seltenheit bisweilen von Hofjunkern für den Herzog Ulrich herbeigebracht. Dagegen kommen fast täglich in der Rechnung Erdbeeren vor, welche die Herzogin Elisabeth liebte. Selten waren die Artischocken und so geschätzt, daß die Herzogin einmal 10 solcher Früchte oder Pflanzen dem Kurfürsten August von Sachsen schenkte. Der Zucker, schon seit der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts in Siedereien zu Venedig bereitet, ward im Ganzen noch wenig gebraucht. Die ersten Siedereien in Deutschland waren um d. J. 1574 zu Augsburg entstanden. Aber hier blieben, bei sehr hohem Preise, Erzeugung und Verbrauch in diesen Zeiten geringe. Die herzogl. Küchenrechnung führt ihn fast nur zu besondern Zwecken auf. Daß die Speisen gewöhnlich noch mit Honig bereitet wurden, geht u. A. aus dem Rechnungssatze hervor: "vor 30 Maß Honnigk, jeder 5 Patzen, 16 Gld." Dagegen heißt es weiter: "vor 5 Pfd. Suckerkanden 1 ), jdern 11 Ptz.,


|
Seite 197 |




|
zum Wein vor m. gn. H. 3 Gld. 10 Ptz.; vor 3 Pfd. Suckerkanden, so m. gn. Fraw bekommen, 2 Gld. 3 Btz." Nur zu dem Confect ward der Zucker häufiger verwandt. In der Silberkammer war ein eigener, mit doppelten Schlössern versehener Confect=Kasten. Den kostbaren Inhalt lieferten meistens die oben genannten Gewürzkrämer und Kuchenbäcker. Wie das Confect und die Pasteten des herzoglichen Koches gewöhnlich zierlich ausgestattet wurden, deutet die Rechnung des Malers Christoph Giltinger an: "den 22. Junii habe ich dem Bastetten=Koch vonn Zuckher=Confect verguldt und gezieret 8 Stuckh von Geiadt=Werk (Jagdstücke) vnndt runden Scheiben vonn Historienn, ist für ein Stuckh 4 Kr. thuen alle 32 Kr. - Den 1. Jullii habe ich dem Pasteten=Koch 5 Stuckh vonn Zuckher vnndt Mandell mit Goldt und Silber gezieret, ist für ein Stuckh 4 Kr., thuen alle 20 Kr. - Den 9. Jullii 12 Pastetenn klein vndt gross verguldt vnndt versylbert, ist für ein Past. 12 Kr., thun alle 2 Gld. 24 Kr. Mer 12 Sultzenn von Fisch vnndt Krebsenn gemacht, ist fur aine 12 Kr. thuenn alle 2 Gld. 24 Kr. Mer 3 Modell vonn Ayr, Milch vnndt Zucker verguldt, ist für ain 4 Kr., thuenn alle 12 Kr." - Derselbe Meister bemalte ferner zwei große Butten, in denen man alle Speisen zur Tafel brachte, grün mit rothen Reifen und mit dem meklenb. Wappen. Ein solches war auch für den Gebrauch des Pastetenbächers in Holz geschnitzt worden. Gespeist ward stets an mehreren Tafeln, am Fürstentisch, am Rittertisch u. s. w., wobei die Gesammtzahl der Speisenden, außer an Bankett=Tagen, etwa 50 Personen täglich betragen mochte. Die Anordnung der Mahlzeiten geschah nach strenger alter Hofsitte. Die Rechnung führt u. A. 3 Kr. für Stäbe auf, "damit der Marschalck vor dem Essenn gehet." Jeder Koch hatte Knechte und Mägde zur Hülfe erhalten, außer denen noch drei Bratenwender auf 6 Wochen gemiethet waren.
Das geräuschvolle Leben des Reichstages hielt den Herzog Ulrich weder von der Fortführung seiner gewohnten Tagesgeschäfte zurück, noch hinderte es ihn, den Sehenswürdigkeiten der Stadt und dem dort blühenden Gewerbewesen Theilnahme zu schenken. Wie bemerkt, hatte sich der Herzog ein kleines Arbeitsgemach einrichten lassen, welches mit schönen neuen Schreibgeschirren und verschiedenem Zubehör versehen ward. In diesem Gemache vollzog der Herzog in den Frühstünden die Geschäfte seines hohen Berufes; las die Berichte der heimgelassenen Statthalter, vernahm die Vorträge seiner Hofbeamten und Räthe und gab Dienern des Kaisers


|
Seite 198 |




|
oder einzelner Reichsfürsten Gehör. Er pflegte noch, wie seit früher Jugend, Vieles mit eigner Hand zu schreiben; auch manche der zu Augsburg eingekauften oder als Geschenk ihm überreichten Bücher prüfte er selbst im "Schreibstublein."
Daß der Herzog auch die Zeit gewann, Kunstwerke, milde Stiftungen und dergleichen zu besichtigen, thun die Rechnungen dar. So heißt es: "dem Kerl vff der Wasserkunst, welche m. gn. H. besichtigt, Trinckgeldt gebenn 1 Goldfl. item den Armen im Armenhause daselbst einen Goldfl. Noch dem Gardner, da die Hern im Garten gewesenn, 1 Goldfl. Dem Haußmann vfm Thurmb vorehret 3 Taler."
Mit großer Theilnahme betrachteten Herzog Ulrich und seine Gemahlin Elisabeth die Leistungen des Gewerbfleißes und die Vorräthe der reichen Waarenlager des von Krämern, wie von Garköchen und Weinschenken zahlreich besuchten Augsburg. Es wurden vom Herzoge beträchtliche Summen zu mannigfachen Einkäufen verwandt, wobei er in der Wahl der Gegenstände Geschmack und Neigung, wie Bedürfniß und Nutzen verfolgte. Reich wurden die Goldschmiede bedacht, in deren Gewerbe die künstlerische Behandlung der gediegenen Masse mit Hammer, Meißel und Feile noch vorherrschte, wie überhaupt das Gewerbe noch von der Kunst befruchtet war. Dem entsprechend sind öfter die Angaben in den Rechnungen gefaßt: "Einem Goldschmiede Christoph Leonhard Opffenhausen für einen Maulkorb vermuge seines Zettels 83 Gld. 14 Btz. Item einem Goldschmiede von Nurnbergk Wolff Möringer fur ein Gießbecken vnd eine Gießkanne, so gewogen 17 Mk. 4 1/2 Lott, jedes Lott fur 1 Gld. betzalt, vermuge seines Zettels 283 Gld. 6 Btz. Dem Goldtschmiede Bartolomeo Vesemair fur außgenommenn Silbergeschier 58 Tal. Dem Goldtschmiede Niclaus Leucker fur den Munch (Trinkbecher), so gewogen 7 Mk. 6 Lott, auß Beuell m. g. H. betzalt 145 Gld. Item noch Demselben fur ein ander Trinckgeschier, so er m. gn. H. gemacht, betzalt laut seines Zettels 242 Gld. Demselben Goldtschmiede fur die beiden Kussen sampt den Instrumentisten, so darin gemacht, welche m. gn. Fr. bekommen, betzalt 40 Gld. Item dem Goldtschmiede, dabei I. f. G. den Bachum (Trinkgeschirr? bestellet, vff Rechnung gebenn 100 Gld." Außerdem kommen noch ansehnliche Einkäufe an Ketten, Armbändern und in Gold gegossenen Bildnissen bei den Augsburger Meistern Heinrich Beust und Boldewin Drontwedt vor. Die oben angeführten Werke waren fast alle gediegene Silbergeschirre von deutschen Meistern. In der Fertigung der mit Edelsteinen geschmückten goldenen Kleinodien behaupteten die


|
Seite 199 |




|
welschen Meister, namentlich zu Venedig, den Vorrang 1 ). So heißt es von den Einkäufen der Herzogin Elisabeth: "Fur eine Schmaralle (Goldschmuck mit Smaragd), so m. gn. Fr. von einem Italienischen gekaufft, gebenn 25 Tal. Meiner gnedigen Frauwenn zu Bezahlung der Kleinodien, so Ihre f Gn. von denn Italianischen Jubilierern gekauft, auß Beuel meines gn. H. zugestellet 1300 Taler. Nota, fügt der Rentschreiber am Rande bei, dieß Geldt will m. gn. Furstin vnd Fraw m. gn. Hern wieder erstadten."
Bei den Seidenkrämern 2 ) und Gewandschneidern wurden u. A. ausgenommen: "Hans Gengers, Seidenkramers zu Augspurgh seligen Erbenn fur allerlei Wahren, so m. gn. H. außnehmen lassen, betzalt laut des Zettels 90 Gld. Fur 131 Stuck Parchim, so m. gn. H. gekaufft, jedes Stuck zu 2 Gld. 19 Kr., betzalt 303 Gld. 12 Kr. Fur außgenommen Gewandt, so in die Silber=Cammer gekommen, laut Zettels 108 Gld. Hans Gengers Seidenkramers seligen Erbenn fur 20 Ellen gruenen Tobin, die Elle zu 28 Patzen, und 1/2 Lott Seide betzalt vormuege seines Zettels 37 Gld. 6 Btz. Fur 94 Lott guldene und silberne Borten, jedes Lott zu 14 Patzenn, thut 88 Gld."
Zahlreich und zum Theil auf des Herzogs Eigenthümlichkeit deutend, sind die bei Krämern mit kurzen Waaren, bei Schmieden, Drechslern, Büchsenmachern u. s. w. geschehenen Einkäufe: "Fur eine Lade mit Feurtzeug vnnd 300 Buchsensteine, so m. gn. H. bekommen, 3 Gld. 8 Btz. Fur eine Lade mit vielen kleinen Schaubladechen, so mein gn. Her s. F. G. Gemahl vorehret, geben 11 Gld. Fur ein groß Buch Brillen, so m. gn. H. bekommen 10 Btz. Fur 2 kleine


|
Seite 200 |




|
Brillen 3 Gld. Fur eine Schreibtaffel mit Sammit vberzogen vnd vorsilberten Pockeln, so m. gn. H. bekommen, 3 Gld. Fur 12 Messer in einem Futter mit Goldt vnnd Silber gedammastiniret, gebenn 4 Gld. Für Federmesser, so. m. gn. H. gekaufft, 14 Ptz. item fur ein Feurtzeug 6 Ptz. it. fur ein klein eisen Ladechen 2 Gld. Fur 400 Buchsensteine 4 Gld. it. fur ein Streichstein 1 Tal. Noch fur 2 Wettsteine 1 Tal. Fur ein Schreibzeugh, welches m. gn. H. bekommen, durch Strallendorpffen kaufft, 1 Gld. 2 Ptz. Fur 5 Bucher klein weiß Papier fur m. gn. H. 10 Ptz. Fur ein groß vnd ein klein Compaß 1 ), so m. gn. H. bekommen 4 Tal. Fur ein Rohr vnd ein Schloß, so m. gn. Herr gekaufft, 7 Tal. item fur Puluer vnd Blei ein Rohr zu beschießenn 2 Ptz. Dem Uhrmacher Galle Messmer fur ein Futter vmb eine grosse Vhr 2 ) zu machen vnd ein Wapenn daran, item fur die Vhr außzuputzen, lautt seines Zettels 17 Gld. Fur eine schwarze Buchsenlade, so m. gn. H. machen lassen, 7 Gld. Fur eine Schreibtaffel, so m. g. H. bekommen, 1 Goldfl. Fur ein Fudter mit Schreibmessern 3/4 Taler."
Der Herzog ließ ferner einige Kunstwerke und Werkzeuge, so wie damals noch seltenere Naturerzeugnisse zum eigenen Gebrauche oder zur Förderung des heimischen Gewerbes, vielleicht auch zu geheimwissenschaftlichen Arbeiten 3 ),


|
Seite 201 |




|
denen er zwar mißtrauete, sie jedoch nicht ganz verwarf, auswählen. "Fur einen kupffern Brenhelm, so gewogenn 6 Pfd. minus 1/4, das Pfd. 2 Ptz., thuett 1 Gld. 3 Ptz. Fur eine Kolbe, so m. gn. H. gekauft, 1 Gld. 9 Ptz. Fur 1 Pfd. vngerischen und 1 Pfd. romischen Victriol, so mein gn. H. zur Proba vonn Munchen bringen lassenn, den vnger. das Pfd. zu 2 Ptz., den romischen das Pfd. 3 Kr., thuet 2 Ptz. 3 Kr. Fur eine Wasserkunst, so mein gn. H. gekauft, gebenn 15 Gld. Fur 9 1/4 Pfd. Kupffer zu Brenhelmen, jedes Pfd. 5 ptz. betzalt 3 Gld. 1 Ptz. Fur 4 Pfd. Boemwulle, so m. gn. H. bekommen, jedes Pfd. 5 Ptz. 1 Tal. 3 Ptz. Fur ein Distilier=Ofen vnd ein Helm laut des Kleinschmidts Hans Kovels Zettel betzalt 4 Gld. 4 Ptz. Fur 50 Pfd. Victriol, so mein gn. H. bekommen, 6 Gld. 10 Ptz. Fur ein Windentzeug, so m. gn. H. gekaufft, 5 Tal. Fur eine Lampe, welche m. gn. H. selbst außgenommen, 6 Ptz. Fur den Karren, so mein gn. H. machen lassen, sammt dem Kombt vnd anderer Notturfft 67 Gld."
Es ist erwähnt, daß der Herzog aus Neigung und Einsicht für die Pflege der Wissenschaft Sorge trug. Er nahm, wie Herzog Albrecht von Preußen, an der geistigen Regsamkeit seiner Zeit ungekünstelten Antheil, namentlich an dem Schriftenwesen über die kirchlichen Dinge. Er schrieb selbst in dieser Beziehung und wechselte mit Männern, wie David Chytraeus, vielfach Briefe. Zu Augsburg kaufte er Werke aus den verschiedenen Fächern an und unterstützte großmüthig arme Gelehrte und Künstler, welche ihm ihre Schriften und Dichtungen widmeten, mochten diese immerhin zuweilen werthlos und nur die Erzeugnisse eines nach Verdienst gehenden Gewerbes sein 1 ). "Dem Buchführer Tobias Lutz fur allerlei außgenommene Bucher vormuege seines Zettels betzalt 151 Gld. 4 Ptz. Item fur die Bucher zu binden laut des Zettels 7 Gld. 2 Ptz. Fur ein Futter zu der Wappenn wegen der Schiffaert, so M. Tilemannus Stella 2 ) gemacht, gebenn 3 Tal. Item fur ein Stock,


|
Seite 202 |




|
damit die Mappe auffgewunden wirt, 3 Ptz. Einem Kerl, der m. gn. H. ein Buch vom Feuerwerk dedicirt, geben 3 Tal. Einem Componisten, Georg Rosenberger genant, der meinem gn. H. ein Stuck vorehret, geben 1 Tal. M. Johanni Schillero, der m. gn. H. ein Carmen dedicirt, geben 7 Ptz. Einem Bereiter, so meinem gn. H. ein Buch vorehret, auff s. f. G. beuehll 3 Tal. Des Churfursten zu Sachsen Cappelmeister vff seine Supplication gebenn 4 Taler."
Außer Solchen Hülfsbedürftigen war der milde Sinn des Herzogs Nothleidenden aus allen Gegenden, Ständen und Altern ohne Unterschied der Person zugänglich. Selbst bei übermäßiger und bisweilen mißbräuchlicher Ansprache - die deutschen Reichstage zogen damals, wie einst bei nahendem Verfalle die olympischen Spiele und später die Wallfahrten des Mittelalters neben Händlern aller Art auch viele Glücksritter und Betrüger herbei - blieb derselbe unermüdet, oft aus eigenem Antriebe wirkend. Bezeichnend ist dabei für die Zeit, daß die, welche das Mitleid des Herzogs ansprachen, hauptsächlich in drei verschiedenen Formen auftraten: entweder als Religions=Flüchtlinge, oder als ehemalige Türken=Gefangene oder endlich als an auffallenden Gebrechen Leidende. So heißt es: "Zweyenn Personen, so in der Türckey gefangen gewesen, auff ihre Supplication geben 2 Rthlr.; Item 2 Andern, der eine Jacobus Moserus, der andere Rudolphus Gallicus genant, vf Doctor Hoffman's Beuehl 1 Rthlr.; einem Ungerischen von Adell, mit Namen Lucas Wornemissa von Raab, so in der Turckey gefangen gewesen, vff seine Supplication 1 Rthlr.; noch einem Gefangenen Johann Kowachi 1 fl. - Einem armen Manne, so sich einen Bruch schneiden lassen, auß Beuel Dr. Hofman's geben 1/2 Rthlr.; einem Manne, der wegen seines Glieder=Schadens ins warme Bad ziehen wollen geben 4 Patzen; einem armen Manne, so auf Steltzenn gehet, 4 Patz., einem blinden Manne, Christoph Paur genannt, vff seine Supplication gebenn 5 Patz. - Einem armen Pastorn, Johannes Steinberger genant, geben 1 Rthlr.; noch 2 Studenten 4 Patz. Einem griechischen Prediger vff seine Supplication geben 3 Rthlr.; einem Studenten, M. Hinricus Lustrius genannt, 1 fl. - Zweyen gefangenen Ungerischen von Adell, dauon der eine Albrecht Wallog genant, geben 1 Rthlr.; noch einem armen


|
Seite 203 |




|
vortriebenen Eddelman auß Niederlandt Adam von Hupschort 1 Rthlr.; einem armen Weibe Barbara Scheilin, so wegen ihrer Religion vom Hertzogen von Beyern vortrieben worden, 1 Rthlr. Einem Gefangenen aus Cypern, Benedicto Fasilio, gebenn 1 Rthlr." Wiederholt wurden auch Abgebrannte und Kriegsleute, so wie an jedem Sonntage auf besonderen Befehl der mitleidigen und sorgsamen Herzogin Elisabeth die Chorschüler bedacht und zuweilen gespeist.
Im Uebrigen kommen noch einige zum Theil seltsam lautende Angaben vor, welche die Sitte der Zeit beleuchten und über Liebhabereien der Fürsten Auskunft geben. "Fur ein Spiegel, so des Churfursten Narre bekommen, 2 Patzen; des Hertzogen vonn Beyernn Drabanten, der m. gn. Fraw etliche Zähnenstecker vorehret, auff J. f. G. Beuel geben 1 Thaler; Item fur 6 silberne Becher, so s. f. G. (Herzog Ulrich) den Jungffern gegeben, jeder Becher 19 Patzen 2 1/2 Kr., thuet 7 Gld. 12 Ptz. Vor ein Tuch in m. g. Fraw Flasschen=Futter 1 Ptz. 2 Kr.; vor einen Kam, zu m. g. Fraw Hunde 3 Kr.; Fur einen Huenerhund vnd ein Netze, so mein g. H. mittgenommen, auß Beuehl Stralendorffs gebenn 20 Gld." Hinsichtlich der letztern Liebhaberei heißt es schon in der Reise=Rechnung bei Erfurt: "Fur einen weissen Hundt, welchen Stralendorf m. gn. H. zu Wege gebracht, 12 Gr."; und noch früher bei Dömitz: "Valtin (dem) Netzknecht zur Zehrung an Hertzog Philips zu Braunschweig und Hertzog Heinrichen von Luneburg, dahin er funff Koppel Hunde gebracht, gebenn 2 Gld" - Daß der Austausch von Bildnissen damals auch am meklenburgischen Hofe schon üblich war 1 ), beweist eine im Anfange der Rechnung vorkommende Ausgabe: "Fur Stricke, damit Otto der Bote meines gn. H. Contrafeth nach dem Lande zu Hessen (vermuthlich an den Landgrafen Wilhelm IV.) getragen, 1 ßl.


|
Seite 204 |




|
Wie Herzog Ulrich als einer der Ersten zum Reichstage einzog, so war er unter den Ersten, welche Augsburg wieder verließen, da eine weite Rückreise, wie sie kaum irgend ein anderer Reichsfürst zu machen hatte, seiner wartete. Er hatte Freitags, den 27. Juli, die befreundeten brandenburgischen und sächsischen Fürsten auf einem Abschiedsfeste bei sich versammelt und folgenden Tages der Huldigung der Stadt Augsburg mit seinen beiden Neffen noch beigewohnt. Er befand sich an dem Tage in der Nähe des Kaisers und benutzte, wie es scheint, die Gelegenheit, sich bei demselben zu beurlauben. Am Sonntage feierte er den letzten Gottesdienst zu Augsburg, den der Hofprediger Andreas Celichius im Betsaale hielt. Der Herzog bevollmächtigte einige Räthe zur Führung der Geschäfte am Reichstage und ließ die schließlichen Vorbereitungen zu der auf den Montag fest bestimmten Abreise treffen. Mit Huld und Freigebigkeit verabschiedete sich der Herzog bei seinen Wirthen, Melchior Heinhofer, Wilhelm Zitzinger und Daniel Jenitz. Nicht minder bei deren Frauen, denen er goldene Halsketten mit seinem Bildnisse schenkte. Es heißt hierüber: "Fur die Ketten, so mein g. H. den 3 Wirtinnen neben den Contrafehten vorehret vnd sonsten ein Par Armbende vnd ein Türcksringk, betzalt lautt des Goldtschmidts Heinrich Beust Zettels, 165 Gld. 9 Ptz. Dem Goldschmidt Boldewin Drontwedt fur die 3 Contrafeht 1 ), so mein g. H. den 3 Wirtinnen vor=


|
Seite 205 |




|
ehret, vnd dann fur etliche vmbtzugießen, betzalt vormuge seiner Vortzeichnuß 78 Thaler. Meines gnedigen Herrn Wirte Melchior Heinhofer neben dem verguldeten Schower vorehret 300 Taler, item seinen 3 Gesellen, Idern 10 Tal. thuet 30 Tal. Dem andern Wirte Wilhelm Zitzinger, da die Kuchen gewesen, neben dem Becher, 200 Tal. Item seinen Megden 4 Tal. Dem dritten Wirte Daniel Jenitzen, da das Gesinde gegessen, neben dem Becher 100 Tal. Item desselben Megden 4 Taler".
Ebenso wurden die Wirthe von elf oder noch mehr verschiedenen Herbergen, welche das herzogliche Gefolge aufgenommen hatten, durch Austheilung von 200 Thalern nach Verhältniß ihrer Leistungen bedacht. Umfänglich und mühsam wurde die Berechnung und Nachweisung der Zehrungskosten eines Theils des Gefolges und der Pferde. Diese ,,Ausquitung" brachte unter Andern auch Forderungen für bauliche Einrichtungen zur Aufnahme der Pferde und für die von demselben "entzwei gebissenen Krippen vnd Röpen" zu Tage. Die Einrichtungen und theilweise der Unterhalt für die 50 bis 60 Marstallpferde des Herzogs und seiner Neffen auf 46 Tage wurden mit 356 Gulden bestritten. Zu Oberhausen waren für die Rüstwagen ebenfalls "sonderliche Stallungen zugerichtet". Die Kosten derselben, so wie des Unterhaltes der Pferde und des zugehörigen Trosses daselbst betrugen auf etwa vier Wochen 360 Thaler. Zu Augsburg wurden noch besonders "vorehret dem Becker, davon man das Brodt genommen, 5 Tal. vnd dem Reichs=Furirer 20 Taler". Die Gesammtausgabe für den herzoglichen Hofhalt zu Augsburg belief sich für Küche und Keller vom 13. Juni bis 30 Juli auf 7980 Gulden, der Betrag aller übrigen Ausgaben daselbst, die Geschenke und Einkäufe des Herzogs mitgerechnet, auf etwa 6300 Thaler.


|
Seite 206 |




|
Herzog Ulrich verließ Augsburg am Morgen des 30. Juli, an welchem Tage dort ein großes kaiserliches Bankett stattfand. Der Herzog ward von einigen befreundeten Fürsten und Herren bis über das Weichbild der Stadt, von den Sechs Trabanten, die zu Augsburg an seinem Hoflager dienten, bis nach Norendorf geleitet, wo er mit Gemahlin und Neffen im Hofe der Fugger abstieg und wohin die herzoglichen Köche und Schenken nebst einem Theile des Trosses vorausgesandt waren. Die Rückreise ward beschleunigt und folgte im Ganzen der Richtung des Anzuges, von der sie nur auf einer Strecke in Franken und besonders in Niedersachsen abwich. Vermuthlich auf Einladung des Markgrafen Georg Friedrich von Brandenburg zog der Herzog von Donauwerth nicht, wie früher, auf Nürnberg, sondern auf Anspach und von da über Neustadt nach Bamberg. Der Herzog hatte wieder Geleits=Gesuche an die Fürsten und Städte, deren Gebiet die Reise durchschnitt, seit dem 23. Juli von Augsburg aus ergehen lassen, wobei der verlängerte Aufenthalt daselbst eine wiederholte Beschickung veranlaßte. Fast überall ward Herzog Ulrich zuvorkommend und gastfrei empfangen. Dies geschah auch von Katholischen. So ließ ihn zu Bamberg der Bischof in den Domhof einladen und daselbst bewirthen. In Folge solcher Gastfreundschaft bezog der Herzog nur zu Donauwerth, Ilmenau und Erfurt in Herbergen das Nachtlager. Nur hier und zu Norendorf war die herzogliche Küche für den Fürsten= und Rittertisch thätig. Deshalb wurden auch von der Küche auf der Rückreise nur 203 Gulden und 14 Batzen für Einkäufe verausgabt, unter denen bei jedem Nachtlager vier Eimer Wein oder so viel Bier angeführt sind. Nach dem Schlusse der Rechnung belief sich die ganze Ausgabe für Küche und Keller während der Hin= und Rückreise und des Aufenthalts zu Augsburg auf 8842 Gulden und 5 Batzen.
Durch Verringerung des Gefolges und der Rasttage, Abkürzung des Weges und Hülfe gemieteter Pferde ward die Rückreise beschleunigt. Der Herzog ließ zu Augsburg einige Diener zur Geschäftsführung zurück. Obgleich er sie, da sich ein anderer Geschäftsträger fand, bald wieder abrief, mußte doch einer von ihnen, Heinrich Husan, der in Folge vielen Festgenusses erkrankt war, in Augsburg verweilen. Etwas erkräftigt, verfehlte er auf der sehr beeilten Rückreise den Gebieter. Von den Vasallen und Hofjunkern waren anscheinend zwei beurlaubt. Mehrere von der Küche und dem Trosse und zwei Einspännige wurden nach und nach


|
Seite 207 |




|
mit entbehrlichem Gepäcke und als Boten vorausgesandt. Die Rasttage, auf der Hinreise etwa 12, wurden auf 6 bis 7 beschränkt und auf den Schlössern oder Höfen zu Anspach, Bamberg, Weißensee, Schandersleben, Wollmirstädt und Werben gemacht. Die Wegstrecke ward merklich gekürzt, indem der Herzog von dem kursächsischen Orte Sangerhausen auf dem nächsten Wege durch das Anhaltische und Magdeburgische der Elbe zuzog, von der die Hinreise über Wolfenbüttel ziemlich weit abgeleitet hatte. In Folge dessen betrug der Rückweg nur 77 Meilen. Diese legte der Herzog in 26 Tagen zurück. Schon am 10. August war er zu Erfurt, am 17. d. M. zu Wollmirstädt, nahe der Elbe, überschritt diese am 21. August bei Werben und traf am 24sten d. M. zu Grabow ein 1 ), während auf dem Anzuge die Wegstrecke zu 97 Meilen berechnet war und die Reise 35 Tage erfordert hatte. - Die Hitze der Jahreszeit ward auf der Rückreise sehr lästig. Wiederholt konnten Einzelne vom Trosse dem Zuge nicht folgen und mußten in meilenweiter Ferne hinter demselben auf eigene Faust rasten. Die hohen Reisenden selbst erreichten mehrmals, wie zu Coburg, erst in dunkler Nacht, um die zehnte Stunde, das Ziel des Tages. Der Hitze wegen wurden schon von Augsburg her, die ganze Gebirgsgegend hindurch, bis nach Weißensee hinunter fast täglich 12 bis 16 Pferde zur Hülfe für einzelne Rüst= und Kutschwagen gedungen und bisweilen noch überdieß weitere Hülfen von anwohnenden Bauern der Heerstraße in Anspruch genommen.
Zu dem Uebel der Hitze kam die Gefahr einer pestartigen Krankheit, welche um diese Zeit in einigen Gegenden von Niedersachsen hervortrat. Sie richtete u. A. zu Wittenberg Verheerung an und griff im Laufe des August rasch um sich. Der Markgraf Joachim Friedrich von Brandenburg, Administrator des Stifts Magdeburg, war am 13. August des Herzogs und seiner Gemahlin als "gantz liber willkommener Geste" gewärtig. Doch konnte er ihnen nicht verhalten, daß in vergangener Woche zu Wollmirstädt, wo H. Ulrich rasten wollte, "die itzo regirende bose Seuch in etzlichen Heußern sich ereuget" habe. Der Markgraf bot deshalb seinen Gästen für den Nothfall das kleine Jagdhaus zu Kolbitz an. Nach einem zweiten Schreiben desselben vom 15. d. M. war indessen die Gefahr noch nicht dringend, weshalb sich der Mark=


|
Seite 208 |




|
graf selbst nach Wollmirstädt verfügte und dort folgenden Tages die meklenburgischen Fürsten empfing. Diese rasteten daselbst 2 Tage und zwar in ungestörter Fröhlichkeit, wobei die im voraus entschuldigte "geringe Tractation" reichlich und glänzend gewesen sein mag. Die Rechnung sagt nämlich: "Vfm Schloß in Kuchen vnd Keller vorehret vf 3 Nacht 60 Taler. Den Instrumentisten 8 Tal.; den Trommetern 6 Tal. den Lakayen 3 Tal. Dem Breutgam, so vfm Schloß Hochtzeitt gehaltenn, wegen meines gn. H. vorehret an 2 Rosenobeln, thuet 7 Taler 15 Gr." Dabei blieben die Reisenden sämmtlich hier und auf der weiteren Fahrt von der Krankheit verschont, welche übrigens sich wirklich sehr verbreitete und in gewisser Weise als ansteckend erschien. Denn Herzog Ulrich fand bei seiner Ankunft zu Grabow die Kunde vor, sie habe sich bereits an dem Orte seines Hoflagers zu Güstrow bedrohlich gezeigt 1 ), weshalb er das Jagdhaus zu Kraak bezog.
Die Eile der Reise hatte dem Herzoge wenig Zeit gelassen, seiner Neigung zur Länder= und Gewerbskunde zufolgen. Indessen versäumte er doch nicht, an einzelnen Orten wiederum Einkäufe machen zu lassen oder Sehenswürdiges zu besichtigen. So heißt es bei Neustadt in Franken: "Fur 3 Pfd. Tiriac (Heilmittel), so mein gnediger Her vonn Nurnberg bringenn lassenn, jedes Pfd. zu 4 Gld. betzalt, thuett 12 Gld. fur ein Stuck Eibenholtz 1 Gld. fur 2 1/2 Pfd. Wisem (Wismuth?) 12 Patzen". Weiter bei Bamberg: "Fur Leckritzenholtz, so mein gn. H. gekaufft, aus Beuel Stralendorffs betzalt 3 Tal. 4 Gr. Item. fur 2 Feßlein dartzu 7 Gr." Bei Ilmenau: "Fur 2 missingische Rullen, so mein gn. H. gekaufft, 17 Gr., fur Galmei, so Dietrich (der) Buchsenschmid m. gn. H. vonn der Schmeltzhuttenn geholet, dem Schreiber, der es ime zugestelt, geben 7 Gr." Ferner bei Erfurt: "Fur ein Feßlein Weethe 2 ) (Waid, Farbestoff) 1 Tal. 12 Gr.; item fur 1/2 Centner Weet=Asche, so m. gn. H. gekaufft, 1 Tal. Fur 2 Dutzt Goldtfelle (Blattgold?), so


|
Seite 209 |




|
m. gn. H. auch bekommen, gebenn 8 Gr.; fur 1/8 Centner Schwebell, so der Medicus m. gn. H. gekaufft, 1 Tal. 3 Gr." Endlich bei Sangerhausen: "Fur ein Kruegk, darin m. gn. H. vonn der Sultze zu Ortern Sale bringenn lassenn, geben 1 Gr."
Auch die Wohlthätigkeit des Herzogs ermüdete nicht. Er beschenkte von Neuem arme Prediger und Studenten, Abgebrannte und Kranke; ließ sich kleine Münze geben, um Nothleidenden selbst eine Gabe zu reichen und erwies sich, wie zuvor, den "Instrumentisten, Cantoribus vnd Berggesellen" als ein williger und erkenntlicher Zuhörer.
Seiner ritterlichen Liebe zur Jagd folgend, hatte der Herzog nicht bloß Feuerrohre, Hunde und Netze zu Augsburg gekauft, sondern auch einen schwäbischen "Weidejungen" in Dienst genommen, den er unter Weges einkleiden ließ. Nach den eigenen gleichzeitigen Vorbereitungen des Herzogs zu schließen, gedachte derselbe alsbald des Knaben Fertigkeit zu erproben. Die Reise=Rechnung sagt in dieser Beziehung: (Sangerhausen.) " Fur 4 Ellen gruen Gewandt dem schwebischen Jungen zum Mutzen vnd Hosen 20 Gr. (Staffurt.) Einem Schneiderknechte, der geholffen, - dem kleinen Weidejungen seine Kleider zu machen, geben 3 Gr. (Grabow.) Fur ein Leidtbandt zum Wachtelhunde 6 ßl; fur 1/4 Elle Futtertuch zu meines gn. H. Patronen=Taschen und 3 schmal Ellen Leinwandt zu m. gn. H. Strumpffen 17 ßl. Dem Goldtschmiede Adam Prentzelowen fur meines gn. H. Jegerhornn rein zu machen 16 ßl. Einem Lifflendischenn armen von Adell, so an m. gn. H. vorschrieben worden vnd f. f. Gn. 2 Winde vorehret, 8 Tal.; fur 2 Windtstricke 10 ßl."
Der glücklichen Heimkehr des Herzogs, am Abend des Tages von den Tonkünstlern des Ortes gefeiert, folgte die Auflösung des Reisezuges. Nach einigen Rasttagen wurden die Ehrenbegleiter und Hofjunker beurlaubt, wobei den Meisten eine für Trinkgeld in den Herbergen auf 25 Nächte gemachte Auslage mit 4 Thaler 5 Schilling und 4 Pfennig, den Einzelnen gleichmäßig, erstattet ward. Die von den Städten des Landes gestellten Rüstwagen und Reisekutschen wurden mit einem Dankschreiben an die Städte entlassen. Dabei erhielten die Knechte außer dem Zehrpfennig, von jedem Rüstwagen 2 Thaler und von jeder Kutsche 1 Thaler als Ergötzlichkeit


|
Seite 210 |




|
auf den Heimweg. Andere, welche zum Marstall gehörten oder für diese Reise bei den Hofwagen gedient hatten, wurden noch freigebiger beschenkt. Außerdem heißt es: "des Konnigs Trommeter vorehret 50 Taler", wahrscheinlich des Königs Friedrich von Dänemark Diener, der den Reisezug des Herzogs verherrlicht hatte 1 ) oder als Eilender an diesen zur Begrüßung vom Könige abgesandt war. - Vom Rentschreiber Johann Isebein 2 ) ward nun die Hauptrechnung dahin abgeschlossen: "Summa alles empfangenen Geldts vff dieser gantzen Reise: 20,248 Taler 28 ßl 6 pf. Summa der gantzen Ausgabe 20,105 Taler 23 ßl. Dieselbe von der Einname abgetzogen, so bleiben in Vorrath 143 Taler 5 ßl. 6 Pf. Die sein in meinem Jarregister, geschlossen Michaelis anno 82, zur Einnahme gesetzt vnd m. gn. H. berechnet worden." Wobei zu bemerken, daß die eigentlichen Kosten der fast viermonatlichen Reise nur etwa 15,000 Thaler betrugen, von denen die Hälfte für Küche und Keller aufgewandt war. Gegen 5000 Thaler beliefen sich die verschiedenen, vom Reiseaufwande meistens unabhängigen Einkäufe, namentlich an Kleinodien und Silbergeschirren, von welchen der Rechnungsschluß noch 13 Becher als mit 560 Thaler an Matz Hauge zu Augsburg bezahlt aufführt.
Des Herzogs Ulrich Reichstags=Fahrt, vielen der Seinigen genußreich, auch wohlbildend, ward ihm rühmlich. Auf dem Reichstage, im Kreise hoher Genossen, wurden sein fürstlicher Sinn und seine würdige Haltung in Staatssachen ehrend erkannt. Obwohl ein eifriger Anhänger der neuen Lehre und den "Papisten" mißtrauend, und obwohl er sich zu Augsburg der bedrängten Stadt Aachen "auß furstlichem christlichem Eifer vnd Mitleiden" annahm, war er doch gut kaiserlich gesinnt und abhold jeder ränkevollen Parteiung gegen das Haupt des Reiches. Kursachsen sich anschließend, half er gleichsam die Abstände zwischen den sich allgemach schroffer gestaltenden Parteien zu mildern. Als ein erfahrener und gemäßigter Mann, aus dessen Wesen Biedersinn und Wohlwollen klar hervorleuchteten, flößte er auch anders Denkenden Vertrauen ein, wie er denn


|
Seite 211 |




|
mit einzelnen katholischen Bischöfen mehrfachen Verkehr auf dem Reichstage pflegte. Ueberdieß war er den meisten altfürstlichen Häusern mehr oder minder nahe verwandt und namentlich in Beziehung zu den sächsischen, brandenburgischen und pfälzischen der Erbe altfreundschaftlicher Verbindungen. Diese Fürsten erwiesen ihm zu Augsburg und auf der Reise zwanglose Achtung und getreue Freundschaft; andere ihm gleichstehende, wie Herzog Ludwig von Würtemberg, ließen ihm, "als einem alten und verehrungswürdigen Fürsten" 1 ) den Vorsitz. Auch Kaiser Rudolph II., gewöhnlich verschlossen, wortkarg und trübe, erwies ihm Gnade, obgleich der Herzog einige Unzufriedenheit mit dem Treiben am Reichstage nicht verhehlte 2 ). Die Geneigtheit des Kaisers zeigte sich in einer anscheinend vertraulichen Besprechung am 30. Juni, im Ansuchen, länger zu Augsburg zu weilen, in der Anordnung des Rangwesens, in Gnade gegen einige herzogliche Diener und in besonderen Verleihungen. Das Rangwesen ward sowohl in Beziehung auf die Person des Herzogs bei feierlichen Handlungen, als auch im Geschäftsgange hinsichtlich des gesandtschaftlichen Streites mit Pommern und jülich (seit 23. Juli) mit einiger Rücksicht auf das stattliche Wesen und die Stellung des Herzogs bestimmt. Unter den meklenburgischen Räthen durften sich die bewährten Staatsmänner Heinrich Husan und der Canzler Jacob Bording mehrmals dem Kaiser nahen, der angeblich sich erbot, Bording zu adeln, was dieser abgelehnt haben soll 3 ). Gewiß ist, daß Beide am Hofe des Kaisers geschätzt wurden, daß insbesondere Husan einigen der ersten kaiserlichen Vertrauten nahe stand und Freundschaft von diesen erfuhr 4 ).
An Verleihungen erhielt der Herzog vom Kaiser einen vierjährigen Freibrief auf die zollfreie Durchfuhr der damals


|
Seite 212 |




|
beliebten Gubenschen oder Lausitzer Weine. Schon früher war zeitweise ein solcher "Paßbrief" zur Befreiung von den kaiserlichen Zöllen in der Lausitz den meklenb. Fürsten ertheilt. Der Verbrauch an Wein für das Hoflager war so ansehnlich, daß z. B. im Herbste 1581 auf einmal 41 Fuder und ein Ohm Wein im Preise von 1116 Thalern zu Guben eingekauft wurden und nebenher gleichzeitig zu Helsinghoer 73 Ohm Rheinwein für 893 Thaler. Herzog Ulrich erhielt noch im Laufe des August den neuen, auf 4 Jahre für 30 Fuder Wein jährlich ausgestellten Freibrief 1 ), den er mit 9 Goldgulden aus der kaiserlichen Canzlei löste. - Wichtiger und von dauernder Bedeutung war es, daß der Kaiser zu Augsburg auf des Herzogs Wunsch der Juristen=Facultät zu Rostock die Pfalzgrafen=Würde verlieh, mit der bestimmten Befugniß, Notare zu ernennen. Diese Erwerbung, durch Bedürfniß herbeigeführt, ward dem Lande heilsam. Denn bis zu dieser Zeit waren die meisten im Lande wirkenden Notare im Auslande ernannt. Dies geschah oft sehr unregelmäßig, indem die fremden Pfalzgrafen, bei gewerblichem Streben, die sogenannten Rechtsschüler dürftig prüften und nicht selten auch Unfähige zu Notaren erhoben. Es gab zwar unter den herzoglichen Canzlern und Räthen von Zeit zu Zeit Einzelne, die mit der (päpstlichen) Pfalzgrafen=Würde bekleidet


|
Seite 213 |




|
waren 1 ), allein diese weilten entweder nur kurze Zeit im Lande, oder wurden in Folge ihrer Stellung und ihres vielleicht strengeren Rufes von den Rechtsschülern vermieden. Gewiß ist, daß die amtliche Thätigkeit der Notare um das J. 1570, als der gerichtliche Geschäftsgang umfänglicher und vorherrschend schriftlich ward, sich im Ganzen schlecht bewährte, wie es aus manchen gleichzeitigen Prozeß=Acten klar hervorgeht. In Folge dessen bestimmten die Landesherren im J. 1575 in einer Verordnung, daß fortan eine Prüfung und Einzeichnung aller im Lande ihr Amt ausübenden Notare bei dem Hof= und Landgerichte stattfinden solle. Am 6. Juni des folgenden Jahres beauftragten die Herzoge, unter Beifügung von Vorschriften über die Prüfung, drei Räthe mit der Ausführung dieser Verordnung. Doch war dieselbe vermuthlich nicht von wesentlichem Erfolge.
Am 5. Mai 1582 wünschten die Rechtslehrer der Hochschule zu Rostock dem Herzoge Ulrich zum Besuche des Reichstages in einem schriftlichen Vortrage Glück. Zugleich erbaten sie, vielleicht dem Beispiele anderer Hochschulen folgend, des Herzogs Verwendung beim Kaiser wegen Verleihung der Pfalzgrafen=Würde, indem sie unter Anderm anführten, daß die im Auslande geprüften Notare sich oft wenig befähigt zeigten, wogegen deren Prüfung bei der Hochschule fleißig geschehen würde. Herzog Ulrich, auf dieses Gesuch eingehend, überreichte am 30. Juni dem Kaiser persönlich einen Vortrag des Inhalts: es komme in Meklenburg viele Unordnung in Zeugenverhören, letzten Willenserklärungen, Verträgen und anderen Schriften der Notare vor, indem die meisten vom Fremden "unrichtig" ernannt seien, da im Lande Niemand eine Befugniß zu solcher Ernennung besitze. Zu Rostock seien sechs tüchtige Lehrer im Fache der Rechtswissenschaft; der Kaiser möge dem Decane derselben die Pfalzgrafen=Würde zu jenem Zwecke ertheilen und darüber dem Herzoge eine Urkunde zustellen. In einem Beschlusse vom 23. Juli 1582 gewährte Rudolph II., in Betracht der ersprießlichen Dienste, welche das meklenburgische Haus dem Kaiser und dem Reiche geleistet habe, die Bitte des Herzogs, in Voraussetzung, daß die Decane das Recht der Pfalzgrafen gewissenhaft, den Reichsgesetzen gemäß ausüben würden. Demnächst ward die Verleihungs=Urkunde, ebenfalls unter dem 23. Juli, in der


|
Seite 214 |




|
kaiserlichen Canzlei ausgestellt. Bald hierauf ward die neue Würde von den Rechtslehrern zu Rostock angetreten. Die ihnen ertheilte Befugniß, in den J. 1743 und 1744 durch neue Verleihungen auf die übrigen, zahlreichen Gerechtsame eines kaiserlichen Pfalzgrafen ausgedehnt, ist seitdem vielfach ausgeübt worden und bis auf den heutigen Tag der heimischen Hochschule verblieben 1 ).


|
[ Seite 215 ] |




|



|


|
|
:
|
VII.
Aberglauben in Meklenburg,
vom
Advocaten Dr. Beyer zu Parchim.
(Die beigefügten Zahlen beziehen sich auf das von J. Grimm, Deutsche Mythologie, Anhang S. LXVII. flgd. gelieferte Verzeichnis von Aberglauben in verschiedenen Gegenden Deutschlands.)
1) W er die Wäsche, besonders das Hemd, verkehrt anzieht, ist gegen Hexerei sicher; vgl. Nr. 3 (bei Chemnitz) u. Nr. 750 (im Lande ob der Ens), und dagegen Nr. 1082 (bei Bunzlau).
2) Wenn ein Meineidiger während der Eidesleistung die Strümpfe verkehrt anhat, so schadet ihm der Meineid nicht (kann ihm der Teufel nicht beikommen?), ebenso wenn er die linke Hand in die Tasche steckt, oder den Knopf seines Rockes anfaßt.
3) Der Saame der Dille schützt den, welcher ihn bei sich trägt, gegen Hexerei. Vgl. Nr. 7. (In den Pyrenäen glaubt man, daß das Beisichtragen von Fenchel gegen böse Geister schütze. Vgl. das Ausland, 1837, Juni, Nr. 173, aus dem Werke A Summer in the Pyrenees). Der Kreuzdorn schützt gegen böse Geister. (Mussäus, Ueber die niedern Stände in Meklenburg in Jahrb. des Vereins f. m. G. u. A. II. S. 133, Note. Vgl. Jahresbericht II. S. 36, Not. 1).
4) In der ersten Mainacht ziehen die Hexen nach dem Blocksberge. Um sich gegen sie zu schützen, bezeichnet man Abends die Thür mit einem Kreuze. Vgl. Nr. 90. Mussäus a. a. O. S. 133.
5) Wenn die Frauen Licht ziehen, sollen sie lügen, damit die Lichter gerathen. Vgl. Nr. 7.


|
Seite 216 |




|
6) Wenn man Kinder oder junges Vieh Ding nennt, haben sie in 9 Tagen keine Däge (gedeihen nicht). Auch Kröte (Krät) und Krabbe (Krav) darf man sie nicht nennen. Vgl. Nr. 9 u. 289.
7) Wenn dem Reisenden ein Hase über den Weg läuft, so hat er Unglück auf der Reise. Vgl. Nr. 10 u. 654.
8) Das Begegnen eines alten Weibes gleich nach der Abreise ist übler, das eines jungen Mädchens guter Vorbedeutung. Vgl. Nr. 58, 380, 791, 1015 u. S. 649.
9) Schaafe auf der rechten Seite des Weges bedeuten dem Reisenden einen freundlichen Empfang am Ziel der Reise, auf der linken Seite freundlichen Abschied bei der Rückkehr; Schweine dagegen mit gleicher Unterscheidung unfreundlichen Empfang oder Abschied. Vgl. Nr. 882 (in Betreff der Schweine widersprechend). Ueber die Beachtung der rechten und linken Seite s. Grimm S. 657.
10) Wenn man im Frühjahr den ersten Kukuk rufen hört, fragt man: Kukuk van'n Heben, wo lange sall ick noch leben? So oft er darauf ruft, so viel Jahre hat der Fragende zu leben. Vgl. Nr. 197.
11) Wer beim ersten Kukuksruf ohne Geld ist, hat das ganze Jahr Mangel daran. Vgl. Nr. 374 u. 668. Mussäus S. 134. Krähenzüge bedeuten nahen Krieg. Mussäus a. a. O. S. 134, ebenso das Erscheinen der Seidenschwänze (bombycilla gerrula), welche nach Andern einen strengen Winter verkünden. Vgl. Zander Naturgesch. der Vögel Meklenburgs I. S. 220. Auch wenn die Kinder Soldat spielen, giebt es Krieg.
12) Wer im Frühjahre den ersten Storch im Fliegen sieht, hat Wachsthum, wer ihn im sitzen sieht, Abnahme seines Glückes zu erwarten. Vgl. Nr. 1086 und schwedischer Aberglaube Nr. 130 und S. 658.
13) Das Haus, auf welchem der Storch genistet hat, brennt nicht leicht ab; steht dennoch ein Brand bevor, so trägt der Storch einige Tage vorher sein Nest weg. - Schon Attila und sein Heer schlossen aus dem Abziehen der Störche aus dem belagerten Aquileja auf den Untergang der Stadt (Ciconiae aves futurorum praesciae). Histor. Misc. c. XV.
14) Auch Schwalbennester am Hause bringen Glück. Vgl. Nr. 609.


|
Seite 217 |




|
15) Auch eine kleine Spinnenart ist glückbringend (die Glücksspinne). Vgl. Nr. 134. Flatterndeß Spinnengewebe an der Stubendecke bedeutet eine Hochzeit. Mussäus S. 134.
16) Der Ruf der Eule ist Tod verkündend (Kumm mit!) Vgl. Nr. 789, auch 120, 493, 496 u. S. 660.
17) Ebenso das Pickern des Holzwurms (Todtenuhr). Vgl. Nr. 901 u. S. 660 u. Helmuth gemeinnützige Naturgeschichte. Bd. 5. §. 151, 54 u. 236. Auch der Gesang des Heimchens ist Todtenklage. Mussäus S. 134. Vgl. auch Helmuth a. a. O. §. 67 u. Grimm Nr. 1128. u. dagegen Nr. 609.
18) Wenn der heulende Hund die Nase aufwärts hält, bedeutet es Feuer, abwärts einen Todesfall. Vgl. Nr. 1019 u. 493.
19) In wessen Hand ein Maulwurf stirbt, der hat Glück. Vgl. S. 660. Maulwurfshaufen im Hause bedeuten einen Todesfall. Mussäus a. a. O.
20) Wenn man jemanden in seinem Hause besucht, soll man sich bei ihm setzen, sonst nimmt man ihm die Ruhe mit. Vgl. Nr. 15.
2l) Eine leere Wiege soll man nicht schaukeln, sonst hat das Kind keine Ruhe. Vgl. Nr. 22. (Nach Andern stirbt das Kind.)
22) Wer das Kind zur Taufe hält, darf es nicht schaukeln, sonst verbraucht es viele Kleider. Mussäus a. a. O. zu Nr. 106.
23) Die Nägel an den Händen neugeborner Kinder müssen das erste Mal nicht abgeschnitten, sondern abgebissen werden (sonst lernt es stehlen?). Vgl. Nr. 23.
24) Die Wäsche des Kindes soll man in dessen ersten Lebensjahre nicht nach Sonnenuntergang draußen hangen lassen, sonst stirbt das Kind. Vgl. Nr. 406.
25) Ein Kind soll man nicht durch's Fenster reichen, dann wächst es nicht; doch wird diese Wirkung wieder aufgehoben, wenn das Kind auf demselben Wege zurückgegeben wird. Vgl., Nr. 345, 675, dagegen aber 265 u. 843.
26) Die Nachgeburt ist an die Wurzel eines jungen Baumes zu schütten, dann wächst das Kind mit dem Baume.
27) Ein Kind, das noch nicht sprechen kann, darf ein neugeborenes nicht küssen, sonst lernt letzteres schwer sprechen. Vgl. Nr. 831.


|
Seite 218 |




|
28) Ein Mädchen muß die Mutter, einen Knaben der Vater zuerst küssen, sonst bekommt das Mädchen einen Bart, der Knabe aber nicht.
29) Eine Schwangere darf nicht Gevatter stehen, sonst stirbt entweder der Täufling oder das Kind, welches sie trägt.
30) Man soll die Kinder nicht nach Verstorbenen benennen. Vgl. Nr. 31.
31) Bei der Taufe muß der Prediger der Thür den Rücken zuwenden, sonst geht der Segen zur Thür hinaus.
32) Unter den (drei) Taufzeugen muß derjenige das Kind zur Taufe halten, welcher dem Geschlechte nach allein steht.
33) Wenn man einer lebenden Maus einen Zwirnfaden durch beide Augen zieht und sie dann wieder laufen läßt, den blutigen Faden aber einem neugebornen Kinde um den Hals bindet, so zahnt es leicht. Vgl. Nr. 581 u. 873.
34) Wenn Kinder die Zähne wechseln (schichten), soll man die ausgefallenen in ein Mauseloch stecken. Vgl. Nr. 631.
35) Auch ist es gut, sich den ausgefallenen Zahn über den Kopf zu werfen. (Ueber dies über Kopf werfen vgl. Grimm S. 359. S. auch unten Nr. 43 u. 123.)
36) Das Zahnen der Kinder wird auch befördert, wenn sich die Mutter mit dem Säugling auf einen Stein setzt, um ihm zum letzten Male die Brust, zureichen.
37) Die Kinder zu entwöhnen, wählt man am besten den Johannistag.
38) Am Johannistage hängt beim Sonnenaufgang an der Wurzel des Johanniskrautes (?) ein Blutstropfen.
39) An demselben Tage, Mittags 12 Uhr, findet sich unter der Wurzel eines andern Krautes (?) eine Kohle, welche man aufbewahren muß, denn sie bringt Glück.
39 b) In der Johannisnacht darf kein Zeug draußen hangen, sonst setzt sich der böse Krebs darauf. Mussäus a. a. O. zu Nr. 106, S. 134.
40) Am Ostermorgen tanzt die Sonne beim Aufgange. Vgl. Nr. 813 u. Aberglaube in Frankreich Nr. 3. Vgl. auch S. 182.
40 b) Fließendes Wasser am ersten Ostertage vor Sonnenaufgang geschöpft, bleibt das ganze Jahr frisch und ist gut gegen Hautkrankheiten. Vgl. Nr. 1014. Ueber den Aberglauben in Bezug auf die Zwölften s. unten Nr. 113 flgd.
41) Wenn ein Obstbaum nicht tragen will, so lege man in der Neujahrsnacht ein Stück Geld zwischen seine Zweige. Vgl. Nr. 1103.


|
Seite 219 |




|
42) Ein Strohkranz in derselben Nacht um den Baum gebunden, schützt denselben gegen Raupenfraß.
43) In dieser Nacht um 12 Uhr setze man sich mitten in dem Zimmer auf den Boden mit dem Rücken gegen die Thür und werfe mit dem Fuße seinen Schuh über den Kopf; steht dann die Spitze gegen die Thür, so verläßt man im folgenden Jahre das Haus. Vergl. Nr. 101 und 773, auch S. 649.
44) Wer in dieser Nacht geschmolzenes Blei in ein Gefäß mit Wasser gießt, kann an der Gestalt des erkalteten Bleies seine Zukunft erkennen. Vergl. Nr. 97 u. S. 649.
45) Ebenso wer in derselben Nacht im Dunkeln und ohne zu wählen ein Gesangbuch öffnet; der Inhalt des angezeichneten Lieder=Verses deutet die Zukunft des Forschenden an.
46) Martini kann man aus der Farbe des Gänsebeins (Bocks, d. h. des Rückenknochens) erkennen, ob ein strenger oder gelinder Winter folgt. Die weißen Flecke bedeuten Schnee und mildes Wetter, die rothen Frost. Vgl. Nr. 341 u. 911 u. S. 645. Mussäus a. a. O. S. 134.
46 b) Am alten Marientage dürfen die Mädchen nicht nähen. Jahrbücher II, S. 188.
47) "Grön Wihnacht, witt Ostern; witt Wihnacht, grön Ostern". Vgl. Nr. 142.
48) Wenn es am 7 Brüder=Tage regnet, so regnet es 7 Wochen hindurch.
49) Die 3 Tage Pancratius, Liberatus und Servatius (die strengen Herren) sind rauh und kalt.
50) Wird die aufgetragene Speise rein aufgegessen, so wird's am folgenden Tage gut Wetter. Vgl. Nr. 279.
51) Wer sich das Zeug am Leibe flicken läßt, verliert das Gedächtniß. Vgl. Nr. 42, 276 u. 945.
52) Wer während der Rede vergißt, was er sagen wollte, war im Begriff, eine Unwahrheit zu sagen.
53) Wenn Jemand niest, während ein anderer spricht, so ist die Erzählung wahr. Vgl. Nr. 266.
54) Wer einen Abwesenden belügt, bekommt Blasen auf der Zunge. Vgl. dagegen Nr. 311.
55) Wer Jemandem ein Unglück klagt, der setze hinzu: "Sten und Ben to klagen", sonst klagt er ihm das Uebel an.
56) Wer sein Glück rühmt, verruft es, wenn nicht hinzu setzt: "nich to verropen", oder den Namen Gottes dabei nennt.


|
Seite 220 |




|
57) Wenn man einen Sterbenden (Menschen oder Thier) bedauert, so erschwert man ihm den Todeskampf. Vgl. Nr. 297 (u. 208?)
58) Wer während des Schlages der Betglocke lügt, bekommt ein schiefes Maul.
59) Dem Meineidigen wächst die Hand aus dem Grabe.
60) Wem die Nase juckt, der erfährt selbigen Tages etwas Neues. Vgl. Nr. 1138.
61) Wem die Ohren klingen, von dem wird auswärts gesprochen, und zwar Gutes, wenn das rechte, Uebles, wenn das linke klingt. Vgl. Nr. 82, 537, 802 u. S. 648.
62) Wenn man lebhaft an Jemand denkt, so ist er nicht weit.
63) Wem die Haut schauert (kalt überläuft), dem läuft der Tod über's Grab. Vgl. Nr. 1037.
64) Wenn in einer muntern Gesellschaft eine plötzliche Pause eintritt, so fliegt ein Engel durch das Zimmer.
65) Wer Sonntags geboren ist, kann Geister sehen.
66) Nach dem Blitze soll Niemand mit dem Finger zeigen; er sticht dem lieben Herr Gott in die Augen. Vgl. Nr. 334, 597, 937, 947, 1021 u. 1123.
67) Die Donner=Neffel (Hirrn=Nettel, urtica dioica) widersteht dem Donner und wird daher zu frischem Bier gelegt damit es sich nicht brechen soll. (Franck A. und N. M. I. 59). Vgl. Nr. 336.
67 b) Donnerkeile schützen gegen den Blitz. Mussäus a. a. O. S. 134.
68) Während eines Gewitters darf man nicht essen.
69) Wenn beim Neubau eines Hauses die Axt des Zimmermanns beim ersten Schlage Funken giebt, so brennt das Haus ab. Vgl. Nr. 411, 500, 707, 778.
70) Wo man in der Nacht eine blaue Flamme auf dem Boden brennen sieht, da liegt ein Schatz vergraben. Vgl. Nr. 1026.
71) Ebenso da, wo der Regenbogen auf der Erde sieht. Vgl. Nr. 598.
72) Knisterndes Feuer bedeutet Freude. Vgl. dagegen Nr. 322, 534 u. 1134.
73) Wenn das Feuer bullert, giebt es Zank.
74) Eine Blume am Lichte verkündet Nachricht von einem Abwesenden (einen Brief). Vgl. Nr. 252.
75) Ein Hobelspan am Lichte bedeutet den Tod eines Angehörigen.


|
Seite 221 |




|
76) Wer ein ausgeblasenes Licht wieder anblasen kann, ist noch Junggeselle. Vgl. Nr. 306.
77) Wem der Feuerschwamm nicht fangen will, zeugt keine Kinder mehr.
78) Wer ins Feuer pißt, bekommt schneidend Wasser.
79) Wer ein Getränk mit dem Messer umrührt, bekommt Leibschneiden. Vgl. Nr. 1052.
80) Einem Freunde soll man kein schneidendes oder spitzes Instrument schenken; dasselbe zerschneidet und durchlöchert die Freundschaft. Vgl. Nr. 87.
81) Abgeschnittene oder ausgekämmte Haare muß man ins Feuer werfen; wenn die Vögel damit nisten, bekommt der Eigenthümer Kopfschmerz. Vgl. Nr. 676 u. 1027 und dagegen Nr. 557. (Auch in den Niederlanden spuckt man in das Haar und wirft es dann ins Feuer.)
82) Wenn man die Erde, worin sich die Fußspur eines Menschen befindet, in den Rauch hängt, so stirbt derselbe. Vgl. Nr. 524 u. 556, auch 876.
83) Ein Sargnagel, in die Fußspur eines Pferdes gesteckt, macht das Pferd lahm. Vgl. Nr. 1011 u. 1040.
84) Todten muß man keine Kleidungsstücke mitgeben, die ein Lebender getragen (überhaupt nichts, woran sich Thränen, Schweiß oder dergleichen eines Lebenden befindet), sonst bekommt dieser die Auszehrung. Vgl. Nr. 1063, und umgekehrt Nr. 546 u. 700. Auch den, der sich auf die Todtenbahre setzt, holt der Todte nach. Mussäus a. a. O. S. 129.
85) Bekommt der Todte etwas von seiner Kleidung in den Mund, so zieht er das ganze Kleid nach. Vgl. Nr. 551, 665, 709 u. 828. Man legt ihm deshalb ein Rasenstück auf die Brust, um die Kleider festzuhalten. Mussäus a. a. O. S. 129.
86) Ein Muttermal kann man vertreiben, wenn man mit einer Todtenhand darüber streicht. Nr. 1024.
87) In dem Zimmer, wo ein Todter liegt, verhängt man die Spiegel. Vgl. Aberglaube der Litthauer Nr. 2.
88) Dagegen darf des Nachts das Licht nicht erlöschen.
88 b) Vom Sarge bis zur Thür des Todtenhauses streut man Asche. Mussäus a. a. O. S. 129.
88 c) In dem Hause, wo ein Todter liegt, darf nicht gewaschen werden, sonst schwitzt der Todte.
88 d) Wer schläft, während ein Hausgenosse stirbt, bekommt den Todtenschlaf (und ungewöhnlich= und krankhaft=festen und schweren Schlaf).


|
Seite 222 |




|
89) Wer sich selbst sieht, stirbt.
90) Auch sein eigen Bild zu zeichnen ist gefährlich.
91) Wenn es in einem Hause spukt, muß man eine Trauung oder Kindtaufe darin vornehmen lassen. Dadurch wird der Geist gebannt.
92) Sturm bei der Brautwäsche bedeutet Unfrieden in der Ehe.
93) Regen in den Brautkranz bedeutet Wohlstand in der Ehe. Vgl. Nr. 198, 498 u. 1066 u. dagegen Nr. 1051.
94) Wer bei der Trauung zuerst an den Altar oder Trautisch tritt, erhält die Herrschaft in der Ehe. Vgl. dagegen Nr. 390.
95) Nach der Trauung suchen die Junggesellen der Braut den Kranz zu entreißen, während die Mädchen sie vertheidigen. Wer den Kranz gewinnt, heirathet zuerst.
96) Wem es gelingt, die Schale von einem harten Ei zu lösen, ohne das Fleisch des Eies zu verletzen, bekommt einen glatten Mann (eine glatte Frau).
97) Wenn die Köchin das Essen versalzt, ist sie verliebt; vergißt sie das Salz, so ist sie fromm.
98) So viel senkrechte Falten sich zwischen den Augenbrauen bilden, wenn man die Brauen zusammenzieht, so viel Mal heirathet man.
99) Wem die Zähne weit auseinander stehen, der kommt weit in der Welt herum. Vgl. Nr. 1070.
100) Blumen (d. h. weiße Flecke) auf den Nägeln sind bedeutsam, auf dem Daumen bedeuten sie Geschenke, (vgl. dagegen Nr. 1070), auf dem Zeigefinger Kränkung, auf dem Mittelfinger Haß, auf dem Ringfinger Liebe, auf dem kleinen Ehre.
101) Der Blick des Menschen hat großen Einfluß auf die Kinder und das junge Vieh, auch auf das Glück eines Spielenden. Manche Menschen haben einen guten, andere einen bösen Blick. Vgl. Nr. 874 u. 1108.
102) Geliehenes Geld bringt dem Leiher Glück im Spiele. Vgl. Nr. 52 u. S. 661.
103) Ebenso ein zufällig gefundenes Vierblatt (Kleeblatt mit 4 Fingern). Vgl. Nr. 119, auch S. 633.
104) Glück im Spiel, Unglück in der Ehe.
105) Wenn man eine neue Wohnung bezieht, soll man eine Katze voran in das Haus setzen. Steht ein Unglück in dem Hause bevor, so trifft es die Katze. Vgl. Nr. 499.
106) Der Traum in der ersten Nacht, die man auf einer neuen Schlafstelle schläft, trifft ein. Vgl. Nr. 123.
107) Wer verkehrt (mit dem linken Fuße zuerst) aus dem Bette steigt, dem geht den ganzen Tag alles verkehrt. Vgl. Nr. 61.


|
Seite 223 |




|
108) Wenn 13 an einem Tische speisen, stirbt derjenige, welcher sich zuletzt gesetzt, im Laufe des Jahres. Vgl. Nr. 553.
109) Wenn zwei zu gleicher Zeit dieselbe Rede beginnen, bleiben sie noch ein Jahr beisammen.
110) Wenn sich die Katzen putzen, bekommt man Gäste. Vgl. Nr. 72 u. S. 661.
111) Eben so, wenn man zufällig ein Messer fallen läßt, so daß es mit der Spitze im Boden stecken bleibt.
112) Einem Jäger darf man kein Glück wünschen, wenn er zur Jagd geht, sonst trifft er nicht. (Ist vielleicht nur der Glückwunsch der Frauen unheilbringend? Vgl. S. 653 über das Darreichen des Schwertes durch ein Weib.)
113) In den Zwölften hat man besondere Regeln beim Jagen zu beobachten (welche?). Vgl. die Constitution Gustav Adolph's vom 14. Decbr. 1683.
114) In dieser Zeit darf man den Namen des Wolfes nicht nennen. Daselbst. Vgl. Nr. 121. In den Zwölften darf nicht gewaschen werden, sonst stirbt einer im Hause. Mussäus a. a. O. S. 134. Auch das Vieh darf dann nicht aus dem Stalle. Jahrbücher II. S. 188.
115) In dieser Zeit läßt sich die Witterung des ganzen Jahres vorher bestimmen (wie?). Vgl. o. a. Const.
116) Pflanzen und säen soll man beim zunehmenden Monde; dann sind auch die Bäume zu fällen, welche aus der Wurzel wieder austreiben sollen, Haare zu schneiden und dgl. Bauholz dagegen ist beim Neumonde (in den dunklen Nächten) zu fällen; dann haben auch die meisten Sympathien bessere Wirkung. Vgl. Nr. 245 u. 973. u. dagegen Nr. 492. - Über den Mond=Wadel vgl. Grimm Nr. 307. Das Wort scheint Wandel, Wechsel zu bedeuten, und gilt bei uns hauptsächlich vom Neumonde. Vgl. Franck A. u. R. M. I. S. 73. In den Parchimschen Statuten v. J. 1622, §, 22 heißt es jedoch: Niemand soll sich unterfangen, - - - die Weichhölzung außer dem Mond=Wandel zu werden.
117) Erbsen und Bohnen müssen schweigend gepflanzt werden, weshalb der Pflanzer gerne etwas von der Saat in den Mund nimmt; dann fressen die Vögel sie nicht. Vgl. Nr. 934.
118) Mittwoch und Sonnabend sind die besten Pflanztage.
119) Wird die erste Frucht von einem Baume gestohlen, so trägt er in 7 Jahren nicht wieder. Vgl. Nr. 857.


|
Seite 224 |




|
120) Die Früchte eines Baumes darf man nicht zählen, sonst fallen sie ab.
121) Wer eines Andern Warzen zählt, zählt sie ihm ab und sich an.
122) Wenn man über der Warze einen Knoten schlägt (als wolle man sie abbinden) und den Faden unter dem Tropfenfalle, unterm Schweinstroge oder überhaupt an einem Orte, wo weder Sonne, noch Mond scheint, vergräbt, so vergeht die Warze mit dem Faden.
123) Ebenso, wenn man sie mit dreien, in dem Knoten zerbrochenen Strohhalmen drei Mal von verschiedenen Seiten berührt, diese über den Kopf wirft und vom Winde wegtreiben läßt.
124) Wenn das Blut einer Wunde nicht stehen will, verbindet man einen mit dem Blute bestrichenen Stock (wobei wahrscheinlich auch Zaubersprüche gemurmelt werden).
125) Wem die Nase blutet, lege ein Kreuz von Strohhalmen auf die Erde und lasse die Blutstropfen darauf fallen.
126) Der vom Blitze abgerissene Baumsplitter als Zahnstocher gebraucht, schützt gegen Zahnschmerz.
127) Die Schalen der verzehrten Eier muß man zerbrechen, sonst bekommt man das Fieber.
128) Sympathien müssen sich Männer von Frauen, Frauen von Männern mittheilen lassen, wenn sie wirksam sein sollen. Vgl. Nr. 857.
129) Ein 7jähriger Hahn legt ein Basilisken=Ei. Vgl. Nr. 583.
130) Wenn eine Frau an einem Tage gebiert, auf welchen im Kalender noch mehrere Tage mit demselben Himmelszeichen folgen, so folgen noch so viele Kinder desselben Geschlechts. Vgl. Nr. 648.
Nach Mussäus a. a. O.
131) Die Bauern bestreichen der Mutter die Brustwarzen oder in anderen Gegenden die Brust und das Gesicht mit der Nachgeburt. Hin und wieder wird diese auch verbrannt und die Asche Kranken eingegeben.
132) Wenn die Nachgeburt ausbleibt, wird der Wöchnerin der abgeschorene Bart des Mannes mit der Seife eingegeben.
133) Ein Beinkleid auf das Bett der Wöchnerin gelegt, schützt gegen Nachwehen.
134) Bis zur Taufe des Kindes muß Nachts die Lampe brennen, damit die Unterirdischen das Kind nicht stehlen und einen Wechselbalg hinlegen.


|
Seite 225 |




|
135) Vor der Taufe verstorbene Kinder hüpfen als Irrlichter umher (böse Geister?). Sie gehören dem Teufel. Vgl. Grimm Nr. 660 und 936.
136) Eine Schüssel mit kaltem Wasser unter das Bett eines Kranken gestellt, schützt gegen wund liegen.
137) Phantasirenden Kranken legt man einen Pferdekopf unter das Kissen; das beruhigt sie.
138) Sterbenden zieht man das Kopfkissen weg, um ihnen das Sterben zu erleichtern, besonders weil man fürchtet, daß einzelne Federn darin sein möchten, die den Tod abhalten. Wenn ich nicht irre, sollen Hühnerfedern diese Wirkung haben.
139) Junge Gänse werden durch ein Beinkleid gesteckt, dann holt die Krähe sie nicht.
Ein Erbschlüssel dient zur Entdeckung der Diebe. Grimm Nr. 932 u. S. 642 u. 47. Der Schlüssel wird nämlich, daß der Griff hervorsteht, in eine Erbbibel gelegt und diese fest zugebunden, worauf zwei Personen ihren Finger durch den Griff des Schlüssels stecken und die Bibel daran aufheben. Sodann nennen sie die Namen der verdächtigen Personen; treffen sie den rechten, so dreht sich die Bibel um.
Zu vergleichen ist auch: Ueber den Aberglauben in Meklenburg, von Flörke, Freimüthiges Abendblatt, 1832, Nr. 698 flgd.
Folgende 3 Zaubersprüche stammen von einer vor kurzem im 9Osten Jahre in Parchim verstorbenen Frau, welche wegen ihrer sympathetischen Kuren sehr berühmt war. Das Bemühen, sie zur Mittheilung der dabei angewandten Sprüche zu bewegen, war lange vergeblich, bis es endlich kurz vor ihrem Tode, gelang, ihr die nachstehenden Formeln abzuschwatzen. Mehr wollte sie jedoch nicht mittheilen. Nach den Reimen zu urtheilen, sind die Formeln ursprünglich plattdeutsch gewesen.
Gegen die Gicht.
1) Im Namen Gottes seh' ich das Licht,
Damit
still' ich die Fluß und reißende Gicht.
Im
Namen Gottes des Vaters,
Gottes des Sohnes
und Gottes des heil. Geistes.


|
Seite 226 |




|
2) Petrus und Paulus gingen zu Holz und zu
Bruch,
(to Holt unn to Brôk)
Unser Herr Christus der sprach
(de sprôk)
Kehret um, die Glocken haben geklungen, gesungen, gerungen,
Die Gicht ist verschwunden.
††† Im Namen
 .
.
Gegen die Kolik.
Kopf (Bauch?) du sollst rasten,
Kopf
(Bauch?) du sollst nicht bersten, (basten)
Ehe wir kommen in die Stadt,
Da Christus
geboren ward.
Im Namen
 .
.
(Bethlehem die Stadt, da Jesus drinne geboren ward. Vgl. Grimm Beschwörungen Nr. XXXIX.)


|
Seite 227 |




|



|


|
|
:
|
- Canzler-Insignien im Mittelalter
- Gude manne
- Söldner im Mittelalter
- Nordische Verhandlungen im J. 1363
- Der Taufkessel zu Gadebusch
- Zur Geschichte der Johanniter-Comthurei Kraak
- Der Ritter Friedrich Spedt
- Des Herzogs Johann Albrecht I. Reisen zum Kaiser
- Die Fürstl. Mekl. Apologia vom J. 1630
- Ueber den Charakter des Herzogs Christian I. Louis
VIII.
Miscellen und Nachträge.



|


|
|
:
|
1.
Canzler=Insignien im Mittelalter.
Die Würde eines Canzlers war im Mittelalter die höchste im Staate und entspricht der Würde eines Ministers oder Regierungs=Präsidenten. Das ganze Mittelalter hindurch war das Canzler=Amt in den Händen von Geistlichen, weil diese allein im Besitze der Gelehrsamkeit und der erforderlichen technischen Fertigkeiten waren. Die Canzler=Würde an den kleineren Höfen Deutschlands entstand im 14. Jahrhundert aus der Nachahmung dieser Würde am kaiserlichen Hofe, wie in Norddeutschland alle Hofämter, wie die eines Marschalls, Kämmerers, Truchsessen u. s. w., in dieser Zeit den kaiserlichen Hofämtern nachgebildet wurden. Im 12. und 13. Jahrhundert gab es dem Range und Titel nach keine Canzler; tüchtige, gewandte Geistliche, oft aus edlen Geschlechtern, dienten als "Schreiber, Notarien, Protonotarien" an den fürstlichen Höfen und beriethen und entwarfen nicht allein die fürstlichen Urkunden, sondern fertigten sie auch aus. Als aber im 13. Jahrhundert die Geschäfte sich mehrten und ein größeres Schreiber=Personale erforderlich war, ward ein fähiger Mann an die Spitze der Canzlei (Canzler) gestellt, um die Staatsgeschäfte mehr zu leiten. Die Räthe der Fürsten waren nach, wie vor, Ritter, welche in den fürstlichen Urkunden als Zeugen oder Räthe (consiliarii, secretarii) auftreten; zur endlichen Bestimmung der fürstlichen Entscheidung war aber der vertraute Canzler beiräthig, welcher auch die Staatsurkunden entwarf, jedoch nicht mehr ausfertigte, sondern die Geschäftsführung in der fürstlichen Canzlei und überhaupt alle fürstlichen Geschäfte nur leitete. In Meklenburg behauptete der Canzler lange diese Stellung; erst im 17. Jahrhundert ward Geschäftstheilung eingeführt.


|
Seite 228 |




|
Die eigentlichen Insignien oder Amtszeichen des Canzlers waren die fürstlichen Siegel, welche der Canzler nothwendig allein und mit Verantwortlichkeit führen mußte, indem in den ersten Jahrhunderten des Mittelalters die Schreibkunst in den höhern Ständen wenig verbreitet war und ein Mann vorhanden sein mußte, der sich im Namen des Fürsten von der Richtigkeit der ausgestellten Urkunden zu überzeugen hatte.
Um die Mitte des 14. Jahrhunderts (1339-1351) war Barthold Rode Protonotarius am meklenburgischen Hofe des Fürsten Albrecht; dieser wird wohl zuerst Canzler genannt. Ihm folgte Bertram Bere aus der im 16. Jahrhundert ausgestorbenen adelichen Familie, welche drei Schwanenhälse im Wappen führte. Sein Nachfolger war der Magister Johannes Cröpelin (in einem und demselben Jahre "protonotarius, cancellarius, kenzeler, schriver" genannt). Von diesem besitzt das großherzogliche Archiv noch einige Conceptbücher auf Papier, eines von Baumwollen=, ein anderes von Linnen=Papier, wie es scheint. Diese Bücher beweisen unzweifelhaft, daß die Insignien des Canzlers in Führung der fürstlichen Siegel bestanden. Der Canzler Bertram Bere hatte im J. 1358 eine Urkunde entworfen, aber nicht ausgefertigt; als sie ausgegeben werden sollte, nahm der Canzler Johann Cröpelin eine Abschrift von derselben in sein Conceptbuch auf, jedoch mit dem alten Datum aus Bertram Bere's Amtsführung:
In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCC°LVIII°, feria quarta infra octauas corporis Christi,
und hing das fürstliche Siegel an dieselbe, bemerkt jedoch bei dem Concepte, obgleich der Canzler Bertram Bere die Urkunde noch hätte besiegeln müssen, so habe er doch auf besondern Befehl seines Herrn in dem Jahre, als er dieses Conceptbuch angelegt, das fürstliche Siegel angehängt:
Licet ista littera debuisset per dominum Bertrammum Beren sigillasse anno quo supra, tamen ex iussu et mandato speciali domini mei eam sigillaui feria quinta infra Penthecostes anno quo registrum incepi.
Das Conceptbuch legte Johann Cröpelin im J. 1361 an:
Incipit registrum, inchoatum per Johannem Cröpelin, protonotarium illustris principis domini Alberti ducis Magnipolensis etc., sub anno in-


|
Seite 229 |




|
carnationis domini M°CCC°LX primo, sabbato ante dominicam Palmarum.
Es geht hieraus unwiderleglich hervor, daß der Canzler das fürstliche Siegel führte. Es soll damit nicht gesagt sein, daß der Canzler nach neuern constitutionellen Ansichten für die Verhandlungen verantwortlich gewesen sei, denn die meisten fürstlichen Urkunden beweisen, daß die Urkunden auf fürstlichen Befehl besiegelt wurden (scriptum sigillo nostro duximus oder iussimus communiri); aber er war für den rechtmäßigen Gebrauch des Siegels und die Richtigkeit der besiegelten Urkunde nach den voraufgegangenen Verhandlungen verantwortlich. Die Führung des Siegels durch den Canzler dauerte das ganze Mittelalter hindurch; noch zur Zeit der Reformation ließ sich der Herzog Heinrich der Friedfertige auf einer Reise von seinem Canzler Caspar von Schöneich einige "Presseln", d. i. Siegelbänder oder Siegeldecken mit aufgedruckten Siegeln zur Ausstellung von Urkunden nachsenden. Die Fingereindrücke auf der Rückseite der Wachssiegel aus dem 13. und 14. Jahrhundert sind wahrscheinlich von des Canzlers eigener Hand zum Zeugnisse der richtigen Anhängung; denn die Anhängung und Ausprägung der Wachssiegel war gewiß ein mühsames, mechanisches Geschäft, welches der Canzler wohl nicht eigenhändig verrichtete. Es läßt sich zwar nicht beweisen, daß die Fingereindrücke eine bestimmte Bedeutung gehabt haben; aber die Beobachtung an vielen tausend Urkunden führt am Ende darauf, daß eine gewisse Regelmäßigkeit hierin herrschte, die nicht zufällig sein kann. Und in schwierigen Zeiten, z. B. in den ersten Zeiten nach einer unruhigen fürstlichen Vormundschaft, ließen die Fürsten beständig ihr kleineres Secretsiegel, welches sie persönlich führten, da sie es auf Reisen bei sich hatten, wenn auch der Canzler nicht gegenwärtig war, statt der Fingereindrücke auf die Rückseite der Siegel setzen. Diese Besiegelung der Urkunde und die Bezeichnung der Rückseite der Siegel mit Fingereindrücken ist im Mittelalter wahrscheinlich das, was man "Hand und Siegel" nannte.
Hiernach scheint Riedel in den "Märkischen Forschungen, II, 1, S. 62, nicht Recht zu haben, wenn er meint, daß "die Aufbewahrung des markgräflichcn Siegels keinem bestimmten Beamten übertragen gewesen, sondern der Person der Fürsten vorbehalten geblieben sei". Die Formeln in den Urkunden beweisen für diese Ansicht nichts, da die Urkunden auch im Namen der Fürsten geschrieben wurden. Es fehlt nur an bestimmten Aeußerungen darüber, wer die Urkunden besiegelt habe. Die meklenburgischen Urkunden sind den märkischen in der Form


|
Seite 230 |




|
gleich, und doch besitzen wir nur die vorstehende Aeußerung, ohne welche wir keinen bestimmten Schluß machen könnten, über die Besiegelung der Urkunden.
Das Datum der Urkunden scheint sich nach dem Vorstehenden auf die schriftliche Ausfertigung, nicht auf die Besiegelung derselben zu beziehen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
2.
Gude manne.
Der Ausdruck "gude manne" kommt in den Urkunden des Mittelalters zu häufig vor und ist für die Entwickelung des meklenburgischen Staatsrechts von zu großer Wichtigkeit, als daß nicht eine möglichst scharfe Bestimmung des Begriffs willkommen sein sollte. Grimm in seinen Deutschen Rechtsalterthümern, I, S. 294, hat den Begriff noch nicht scharf festsetzen können; er sagt: "gude man heißen im 15. und 16. Jahrh. auch edelleute, die keine ritter waren; es scheint Benennung ehrenwerther männer unter edlen und freien." Ohne Zweifel ist aber der Begriff zu verschiedenen Zeiten verschieden und Grimm scheint nur von der Geltung desselben in der ältesten Zeit, vor dem 13. Jahrhundert, geleitet worden zu sein. In Norddeutschland scheint aber der Begriff vorzüglich im 14. Jahrhundert am bestimmtesten ausgeprägt zu sein und am häufigsten vorzukommen.
Das Wort "man" bezeichnet in dieser Zeit im staats= und lehnrechtlichen Sinne bekanntlich einen Vasallen (vasallus, fidelis, = lieber getreuer); dies bedarf keines Beweises und keiner Ausführung, da das Wort in dieser Bedeutung sowohl im Rechte, als in der Dichtung zu häufig vorkommt. Das Wort man ist in diesem Begriffe ein lehnrechtlicher und gebührt der Person von dem Grundbesitze.
Mit dem Worte ritter (miles) oder knappe (famules) wird eine bestimmte kriegerische Würde und ein Ordensverhältniß, später zugleich ein erblicher Stand bezeichnet. Zwar ist der Ritter oder Knappe zugleich Vasall (man); aber nicht jeder Vasall, Lehnträger, ist Ritter; es giebt selbst Schulzen= und Mühlenlehne. Ward auch im Verlaufe der Zeit die ritterliche Herkunft (Ritterbürtigkeit) Bedingung der Ritterwürde, so hat doch der Begriff des Ritterthums mehr staatsrechtliche Natur, wenn er auch im Lehnrecht bedeutendes Gewicht hat.


|
Seite 231 |




|
Nun fehlt es aber in den wendischen Ostseeländern im Mittelalter (1200-1500) an der Ausprägung eines Begriffes für eine andere persönliche Würde, welche in der That bestand, eines Begriffes für Adel, d. h. für den Begriff einer vornehmen Herkunft, abgesehen von Lehn und Ritterdienst, also für den Geburtsstand. Während der Christianisirung und Germanisirung dieser wendischen Ostseeländer am Ende des 12. Jahrhunderts bildete sich in Deutschland der Ritterstand aus und wanderte in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ausgebildet in Meklenburg ein. Es bestand in den Wendenländern ein alter, hoher Adel oder Dynastenstand, dessen Mitglieder die Ritterwürde annahmen. Da nun die Ritterwürde im Mittelalter eine höhere Geltung hatte, als der persönliche Adel, da selbst regierende Fürsten sich mit dem Titel eines Ritters schmückten, so trat der Begriff des Adels so lange hinter den Begriff der Ritterwürde zurück, als diese noch wirklichen, innern Werth hatte: so lange es noch Ritter giebt (1200-1500), gilt der Ritterstand mehr, als der Adel; sobald die Ritterwürde mehr bloßer Titel wird, das Ritterthum nicht mehr allgemein bedeutsame Ordenssache ist und die Ritter so selten werden, daß sie sich leicht aufzählen lassen, antiquirt der Begriff des Ritterthums und der Begriff des Adels tritt wieder hervor.
Das Wesen des Adels hört aber durch das Vorwalten des Ritterthums im Mittelalter nicht auf. Vielmehr scheint im Mittelalter die Formel: "gude man" das zu bezeichnen, was jetzt die Form Adel bezeichnet. Die "guden manne" sind also: "gute Vasallen", zum Unterschiede von Vasallen (man) überhaupt, d. h. Vasallen höhern Geburtsstandes, rittermäßige Vasallen, welche wieder adelicher Herkunft oder durch Erhebung in den Ritterstand adelichen Ranges waren: das was englisch mit gentleman bezeichnet wird. Der Beweis wird schwierig, da, so häufig die Formel selbst vorkommt, es doch an erklärenden Umschreibungen fehlt. Am bedeutsamsten scheint das Vorkommen des Begriffes in dem nachstehenden Auszuge aus dem Land frieden zwischen Pommern und Meklenburg vom 21. April 1371 (gedruckt in Lisch Urk. z. Gesch. des Geschl. von Maltzahn, II, S. 223) zu sein:
Wêre ouk dat desser misdeder iênnich wêke tŏ ênem andern heren eder gûden manne eder eyn slot eder stad, de in dessen vrede nicht ensint, vnd de misdeder dâr heget vnd entholden worde, wêre dat de sulue misdeder vt des heren lande vnd slote eder vt des


|
Seite 232 |




|
guden mannes slote eder veste eder vt der stad iênghen mannen, de binnen dessen vreden sint, schâden totôghen des heren eder der gûden lûde eder der stede, de de misdedere entholden, de vs den schâden tŏ thiet, scole wi alle viende werden, beide wi heren, man, stede, land vnd lûde alle, de in desse vrede sint, - - vnd vser eyn schal sik - - van dem andern nummer vrêden, - - eir de here vnd de gûden lûde eder de stede de de misdeder vntholden, dem misdeder vorlaten hebben. - - - - Vortmer der heren vogede scôlen vorantwerden ere frunt vnd ere dênere, de se in der heren dênst vôren edder hehben vnd eyn ander gût man, de vp synen eyghen sloten vnd vesten sittet, scal den heren vnd ouk den steden, de in dessen vreden sint, syne vrund vnd dêner, de he in synem brôde hebben wil vnd vorantwerden wil, bescreuen geuen. - - Welk misdeder âuer vse belêghene man nicht enis, - - ieghen den scal men dessen vôrbenômeden vreden - -volvolgen in alre wys; wêre âuer iênnich misdeder de van vsem vôrbenômeden ohime iênnich gůt tŏ rechte tŏ lêne hebben scal, de scal dat gůt van vsem ôhem to lêne êschen.
Hier werden offenbar: "gude man" und "man" überhaupt oder "belêghene man", d. i. (belehnte) Vasallen, unterschieden. Lehnträger konnte auch ein nicht rittermäßiger Mann sein. Im Allgemeinen werden als Hauptgegenstände: heren (Fürsten), man (Vasallen) und stede (Städte) unterschieden. Der gude man aber wird neben die heren gestellt und als solcher bezeichnet:
"(gut man,) de up synen eyghen sloten vnd vesten sittet".
Der "gut man" hatte also eigene, feste Burgen (des guden mannes slote eder veste). Und hiemit scheint es klar ausgedrückt zu sein, daß der "gut man" ein rittermäßiger Vasall war, da der Bürger, wenn er auch Lehn besaß, doch keine eigentlichen Ritterlehen hatte und nicht auf seiner Burg saß, da von den gewöhnlichen Lehen, d. h. solchen, welche nicht Ritterlehen waren, keine Ritterdienste geleistet wurden.


|
Seite 233 |




|
"Gude man" scheinen auch in dem rostocker Landfrieden vom 13. Junii 1283 (in Lisch Urk. z. Gesch. des Geschl. von Maltzahn, I, S. 68) diejenigen zu sein, welche hier lateinisch
"potiores et meliores de parentela militum et armigerorum siue famulorum"
(die Vornehmern und Bessern von der Verwandtschaft der Ritter) genannt werden, wenn es heißt:
"si miles est, armiger siue famulus quin que pociores et meliores de tota pa rentela sua et amicis assumet, et sic ipse sextus existens, se ab obiectis huius expurgabit".
Hier ist offenbar von den Geburts= und Familienverhältnissen rittermäßiger Männer die Rede, und wenn auch pociores et meliores de parentela nicht gradezu durch gude man übersetzt werden kann, so werden doch beide Formeln einander ziemlich nahe liegen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Söldner im Mittelalter.
Söldner werden im Mittelalter sehr selten erwähnt. In einer Original=Urkunde des Klosters Dobbertin vom J. 1349, myddewekens vor ligdmissen, verkauft der Fürst Johann von Werle an Gert Butzel und seinen Sohn Gert das Dorf Butzelsdorp mit allem Rechte und Eigenthum:
"vor ses hunderth marck lubescher penninghe, de he vns to vnsen solderen mith redeme ghelde vntwurren heft, do wy dat orloghe hadden ghehat mith deme herteghen van Stedtyn, mith iungheren Niclawese van Wenden vnseme vedderen vnde mith greuen Otten van Zweryn".
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Nordische Verhandlungen im J. 1363.
Die nordischen Verhandlungen des J. 1363, in welchem der meklenburgische Prinz Albrecht König von Schweden ward, sind in hohem Grade wichtig. Von nicht geringer Be=


|
Seite 234 |




|
deutung war für die Begebenheiten dieses Jahres der Friede, welchen die Hansestädte Pfingsten (21. Mai) 1363 zu Nyköping mit dem Könige Waldemar von Dänemark schlossen (vgl. Rudloff Mekl. Gesch. II, S. 462, und v. Lützow Mekl. Gesch. II, S. 198). Die Friedensurkunde ist in den Rostocker Wöchentl. Nachr. 1754, St. 20, S. 78 flgd. abgedruckt. Durch einen Zufall ist mir die hiedurch wieder gerettete Handschrift aus dem rostocker Archive, nach welchem der Abdruck besorgt ist, in die Hände gekommen. Diese gleichzeitige Handschrift auf Papier enthält das Concept der Friedens=Urkunde, ohne Datum, wie der Abdruck; über der Urkunde steht aber von einer gleichzeitigen Hand, jedoch mit anderer Dinte, geschrieben:
Anno domini
°CCC°LXIII° in festo penthecostes in Nykopinghe.
Von Interesse sind die Friedensverhandlungen, welche auf der zweiten Hälfte des Bogens niedergeschrieben sind und nicht nur manches in ein helleres Licht setzen, sondern auch einen Blick in die Verhandlungsweise der damaligen Zeit gönnen. Hinter der Urkunde enthält die Handschrift zuerst die Protocollirung der Verhandlungen:
 °CCC°LXIII° in festo penthecostes
in Nycopinghe.
°CCC°LXIII° in festo penthecostes
in Nycopinghe.
Negocia in Dacia.
- Primo Rycmannus, notarius regis Dacie, petiit ex parte domini sui, vt nuncii ciuitatum consulares transirent Vordynborgh ad placitandum regi in occursum.
- Postea misit rex suas apertas litteras nunciis ciuitatum, vt illic transirent, in quibus eos in exitu et reditu securauit.
- Post hec misit ad eos aliam litteram apertam, in qua constituit plenipotentes suos commissarios, cum dictis nunciis consularibus placitare.
-
Item dominus Hermannus Ossenbrůgghe,
consul Lubicensis, egit hec negocia ad reges
Swecie et Norwegie, que explicauit dictis
ciuitatibus, videlicet
primo: de refectione dampnorum ciuitatibus per ipsos facienda; - 2°: permutacione Godlandie et Olandie;
- 3°: de emenda, quam placitauit inter regem Dacie et ciuitates, vti ipsis asscripsit;


|
Seite 235 |




|
- Super hec iidem reges Swecie et Norwegie petierunt, cum ipsis obseruari diem placitorum in Suderkopynghe per ciuitates, vbi de omnibus causis in festo beati Jacobi responsum asserebant dare eisddem ibidem.
- Item de captiuis Prutzie, ad quos dominus Mathias Ketelhut respondebat, quod ipsos captiuasset pro hereditate sua paterna.
- Item feria sexta incipiebantur placita inter regem et ciuitates.
- Item de littera aperta domini archiepiscopi Lundensis, pro qua monitus fuit dominus Vicko Molteke.
- Item Johannes Hoyecinch conductus est in quamcunque primo aduenerit ciuitatem per quindenam.
- Item negocium Nicolai Vemerlyngh.
Hierauf folgt auf der zweiten Hälfte des Bogens:
Dit is dat antworde, dat des kônynghes râd van Denemarken (hus) van greue Hinrikes weghene vnde Clawes sînes brôders heft ghegheuen, dat greue Hinrich vnde syn brôder vnde de kônyngh vnde de synen von syner weghene vnder en tůschen sunderghe dâghe hebbet ghewyssent, dâr se zyk wol ane bewêten, vnde we hebben ôch sunderghe dâghe wyssent, dâr wy vns an beyden tzyden wol ane bewêten; wil greue Hinrich vnde greue Clawes vnde de ere den kônyngh vnde de syne gherghen vmme schuldeghen van der dâghe weghene, de ghewyssent synt, vmme welk ghebrek, dâr willet se gherne tho antworden.
Vortmer van syner suster weghene antworden se aldůs: dat ên echtescop ghemâket wêre vnde geschên tůschen des kônynghes sône van Sweden vnde des kônynghes dochter van Denemarken, dâr ertzebyskope, leyen vnde pâpen hebbet ôuer wesen, dâr see ghetrůwet worden, vnde ifte des kônynghes dochter van Denemarken ghestoruen wêre, êr se in syn bedde ghekômen wêre, so hadde de mâghetshop tůschen des kônynghes dochter van Denemarken vnde greue Hinrikes sůster dogh also grôt ghewesen, dat he se na der ee nicht moghte ghenômen hebben,


|
Seite 236 |




|
de sulue greue Hinrikes sůster wart vtghesant, de echtteskop to stôrende; des drêf se god vnde dat yeghenwedder to deme bêde des ertzebiskoppes van Lunden, de vôre ôuer desser echteskop ghewesen hadde. Des behêlt de byscop greue Hinrikes sůster, de desse vôrbenômeden echteskop breken wolde, vppe dat yeghen god vnde de ee nicht ghedân worde, men nu desse echteskop tůschen des kônynghes sône van Sweden vnde des kônynghes dochter van Denemarken gheschên is, so hôpe wy, dat de byskop dâr by wol dû(m) schole: dâr wil wy to helpen, so wy best môghen.
Vortmer vmme Wlf Rychstorpe, de is hîr vp gheschůttet, dat he hadde wol XVIII brêue vnde êne credencien to deme kônynghe van Sweden vnde syme sône vnde eres rykes râde, de em gheantwordet wêren van greue Hinrike; dâr ynne stund, dat hertoghe Albert van Mekelenborch, de marchgreue van Mytzen vnde de ertzebyscop van Meydeborgh vnde andere heren de wêren mid em ên, vnde na deme kônynghe van Denemarken hebben gheswôren vnde lôuet steden vrede vnde vruntzscop, so is Wulf dâr vp gheholden, also langhe bet men irvâren kan, ver syn bôdescop wârheyt hebbe ed der nicht.
Vortmer vmme de van Prutzen, dâr antworden se aldus tu, dat de kônyngh hadde ghesant her Mathies Ketelhude to deme hômêstere vnde lêt ene schuldeghen, dat be vnde de syne hadden gûd ghegheuen dâr tho, dat me dat ryk to Denemarken vorderuen scholde, dâr antworde he aldus tho, dat he des nicht ghedân hadde, men he vnde syne stede hadden ênen tollen ghesat van den pund [gůt] IIII or penninghe enghels, de sê tho bevretende tho des mênen kôpmannes behûf, vnde anders nicht, vnde hîr tho syne dâghe ghenômen tuschen deme kônynghe vnde deme hômêstere, vnde hôpen, dat se syk wol vorênen schôlen.
Vmme de osterschen stede vnde de van westen antworden se aldůs, wo we iw, de vnse nâbere syn, tho vronden môghen hebben,


|
Seite 237 |




|
de stede van osten vnde van westen, willen se vns yerghen vmme schuldeghen, wy willen en wol antworden.
In dem Bogen liegt ein loser Viertelbogen Papier mit folgenden Verhandlungen, von einer gleichzeitigen, jedoch andern Hand geschrieben:
Dit scal me zegghen den schônevâren, dat de stede des ênghedreghen hebben, dat de schêlinghe, de dâr steyt twischen den van Rozstokke vnde den van deme Sunde van der schlachtinghe wegen, de vnder en schach vppe Schone, schal in gŏde stân, bet de stede nv nêghest to zâmende kômen, vnde dat zyk mâlk dâr ane bowâre by lyue vnde by gôde, vnde datzyk mâlk in lyke vnde in rechte nôghen lâte vnde ôk nynen crych enmâke, dat de stede ân bezwârnizze môghen vmbe kômen.
Vordmer vmbe de lûde, de bynnen der stad edder in des stâdes êghendôme lûde dôet slâen, dâr schalme vmbe spreken in dem raade.
Dit scal men zegghen den Norwegensvaren, dat de kônyngh van Norwegen vnde de Normannes clâghent, dat me dâr ind land vôred vnde bringht lâkene, de valsch vnde tŏ kort zyn, vnde ôk valsch vnde snôde meel, dat zyk m[âlk] dâr vôre wâre, dat he dâr ind land nyn gôed envôre, dâr he nicht vul mede dôen mach.
Ok clâghent de konyngh vnde de Normannes ôuer mannigerleye walt vnde schlachtinghe, de dâr schût, dâr nicht ôver gerichtet enwert, vnde dat de lûde, de de walt vnde schlachtinghe dôen, werden mid macht wech ghevôret. Hiir vmbe hebben de stede sprôken vnde synt des ên worden vnder zyk: Dêde iênich côpman efte sciphere edder schipman wald edder schlachtinghe in Norwegen, dat me dâr schal rechtes ôver pleghen, vôrde iênich scyphere den man, de se walt vnde schlachtinghe ghedân hadde, witliken wech van dem lande, de schal dat wedden vnde beteren na der stad rechte, dâr he inne beclâghet wert.
G.C. F. Lisch


|
Seite 238 |




|



|


|
|
:
|
5.
Der Taufkessel zu Gadebusch.
In Jahrb. III, S. 129 ist die bronzene Fünte oder
Taufe zu Gadebusch beschrieben, welche nach der
Inschrift einen "Herrn Heinrich Koppelman
zum Gründer" hatte ("Orate deum pro
domino Hinrico Coppelmann fundatore). Dieser war
ohne Zweifel ein Priester, da er Herr genannt
wird. Er war im J. 1450 schon gestorben. Im J.
1474 war aber wieder ein "her Hinrik
Koppelman vicarius in kerspel kerken to
Gadebusz". Daher mögen denn auch wohl die
a. a. O. S. 128-130 angeführten Monogramme
 auf den Priester Heinrich
Koppelman den Aelteren deuten, der die ganze
Ausstattung des Chors besorgt haben wird, welche
mit der Restauration der Kirche im J. 1842
verschwunden ist.
auf den Priester Heinrich
Koppelman den Aelteren deuten, der die ganze
Ausstattung des Chors besorgt haben wird, welche
mit der Restauration der Kirche im J. 1842
verschwunden ist.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
6.
Zur Geschichte der Johanniter
Comthurei Kraak.
Nach Jahrb. I, S. 23 u. 27, ist während des Streites über die Dienste und die Besetzung der Comthurei Kraak vom J. 1504-1521 kein Comthur von Kraak bekannt gewesen. In einem vom Canzler Caspar von Schöneich geschriebenen, wie gewöhnlich von demselben nicht datirten Concepte eines Befehls der Herzoge Heinrich und Erich in einer reinen Privatschuldsache wird im J. 1507 oder 1508
"Er Hans Glawbitz Comptor zu Crakaw"
aufgeführt. Die Schrift stammt ohne Zweifel aus der ersten Zeit des Canzlers. Caspar von Schöneich ward nach 4. März 1507 Canzler (vgl. Jahrb. IV, S. 95); der Herzog Balthasar, welcher nicht mehr genannt ist, starb am 7. März 1507; der Herzog Erich starb am 24. Dec. 1508. Also war Hans Glaubitz sicher im J. 1507 oder 1508 Comthur von Kraak.



|


|
|
:
|
7.
Der Ritter Friederich Spedt.
In Leuckfeldi antiquit. Michaelsteinenses, p. 110 ist eine Vollmacht abgedruckt, durch welche der Administrator der Abtei Michaelstein, Ernst, Graf von Blankenburg,


|
Seite 239 |




|
den Ritter Friederich Spedt (vgl. Jahrb. I, S. 33 flgd.) am 29. Nov. 1557 beauftragte, für ihn einige Geschäfte zu Rom beim Pabste auszurichten, namentlich wegen seiner Minderjährigkeit, wegen seiner Residenz, u. s. w.; vgl. p. 69. Er nennt ihn hierin:
strenuum nobilem et equitem auratum Fridericum à Sped et S. Petri et Pauli militem Romanaeque Curiae Comitem Palatinum et Protonotarium.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
8.
Des Herzogs Johann Albrecht
I. Reisen zum Kaiser.
1.
Der Herzog Johann Albrecht I. führte in kleinen Taschenkalendern eigenhändig Tagebücher und ein solches auch über seine Reise nach Ungarn im J. 1560, ebenfalls in einem kleinen Taschenkalender, über die Tagereisen und Ausgaben; außerdem sind noch umfänglichere wissenschaftliche Arbeiten über die Beobachtungen auf dieser Reise vorhanden, namentlich ein großes Diarium von des Herzogs eigener Hand (bei den Reichstags=Acten, Vol. 2). In dem kleinen Tagebuche sind während der Reise (vom 12. Julii bis 14. Septbr.) nur Ortsnamen und Entfernungen aufgezeichnet, außerdem auch einige interessante Begebenheiten:
| Julii | 21. | Wittenberge. Da das begrebnis Lutheri et Philippi besehen in der Schloskirchen. |
| Julii | 29. | Gen Praga. |
| 30. | Die 2 tage alda still gelegen beim Ertzhertzog | |
| 31. | Ferdinand, der mir vill gutts erzeiget. | |
| Aug. | 1. | Von Praga mitt dem Ertzhertzogen vff der jagt, da ich 4 hirs vnd 1 phasan geschossen. |
| 7. | Bis Wien in Osterreich. Dem Hern sey Dank. | |
| 11. | Bin ich von der kay. Maj. gehort worden. | |
| 12. | Hab ich die feste Wien inwendigk vnd den 8 auswendig gesehen. | |
| 16. | Von Preßburgk bis Wien. | |
| 18. | Hatt die kays. Maj. mir einen Hirs geschicket, der die beiden Hinderschenkel zerbrochen. |


|
Seite 240 |




|
| Aug. | 19. | Hab mitt der kays. Maj., kö. w. vnd Ertzhertzog ich gessen |
| 20. | Mit der kays. Maj. gejagt. | |
| 29. | Von Wien. |
In der Ausgabe=Rechnung heißt es hiezu:
147 Thaler ausgeben vnd dem Joannes kuchenschreiber lassen zustellen, davon der kays. Maj. Stalmeister zu Zerunggelder vor die 2 türkische Roß, so Ihr Maj. mir g. verehret, 54 Thaler bekomen. Actum Wien am 26. Augusti.
300 goldfl. für ketten dem Zazio vnd Seldio, Wien am 24. augusti.
250 Thaler dem Graffen Bernhardt von Hardeck, davor ehr mir vngerische stutten kauffen wirdet. Actum im Vffsein von Wien am 29. Augusti.
150 Thaler Peter Schreibern geben zu ablegung der kutzen von Wien, auch zerung, die wilden herausserzubringen von Wien.
Ueber eine andere Reichstagsfahrt des Herzogs Johann Albrecht zur Wahl und Krönung des Königs Maximilian zu Frankfurt a. M., über welche ein ausführlicheres Tagebuch des Herzogs in Rostock. Monatsschrift II, 1793, S. 321 flgd. gedruckt ist, berichtet ein anderes kleines, eigenhändiges Tagebuch:
| Oct. | 23. | Ist die ko. M. zu Behmen Maximilianus, dem wir entgegengeritten, ankommen zu Franckfordt. |
| 24. | Den Tag ist die kai. Mai. zu Franckf. ankomen. | |
| 26. | Den tag hab ich die kai. Mai. angeredet. | |
| Nov. | 5. | Den tag hab ich den konig Maximilianum vnd alle Chur= vnd fürsten geistlich vnd wedlich zu gaste gehabt. |
| 8. | den Tag hatt vns alle die kai. Mai. zu gaste gehabt. | |
| 9. | haben wir alle vnd vornemlich die kai. Mai. bei Brandenburgk Curf. essen. | |
| 12. | hab ich etzliche keyserische vnd königische Rette zu gast gehabt | |
| 15. | Haben wir vnd die kai. Mai. ko. w. vnd konigin mitt dem H. z. Julich gessen. | |
| 27. | hab ich sampt den protestirenden Chur= vnd fürsten die recusation schr. gein das Concilium kai. Mai. lassen überantworten. |


|
Seite 241 |




|
| Nov. | 28. | hab ich die Churfursten . . . . . . vffen rathaus |
| 29. | mit Julich gessen und dem von Lotringen entgegen geritten. | |
| 30. | Ist des Maximiliani kronung geschehen zu Frankfurt am Meine. | |
| Dec. | 1. | hatt man nach dem ringe gerantt. |
| 2. | hatt vns all die kai. Mai. zu gast gehabt. | |
| 3. | die ko. Mai. hatt vns geladen. | |
| 4. | Von Franckford bis Butzbach. |
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
9.
Die Fürstl. Meckl. Apologia
vom J. 1630,
von
G. C. F. Lisch.
Der Verfasser dieser berühmten Schrift, welche die Herzoge Adolph Friederich und Johann Albrecht zu ihrer Vertheidigung an den Kurfürstentag nach Regensburg sandten und zu Lübeck am 26. Mai 1630 im Druck erscheinen ließen, ist noch nicht mit Bestimmtheit ausgemittelt, wenn auch alle Zeichen und Andeutungen darauf hinausgehen, daß sie von dem Rathe, nachherigen Canzler Johann Cothmann verfaßt sei. V. Lützow III, S. 252, Note 1. eröffnet für diese Ansicht neue Archiv=Quellen, hält jedoch dafür, daß des Herzogs Adolph Friederich Secretair Simon Gabriel zur Nedden, der die Apologie nach Regensburg überbrachte, bei der Ausarbeitung derselben thätig gewesen sei. Daß v. Lützow in der Hauptsache Recht, zur Nedden jedoch keinen Theil an dieser Schrift hat, untergeordnete Dienstleistungen etwa ausgenommen, geht aus folgenden Bemerkungen aus des Herzogs Adolph Friederich eigenhändig geführten Tagebüchern hervor:
1630 A. St. 19. Januar. Item Johan Cotman wegen seines herrn vorbracht wegen einer protestation zu vertigen wegen der Erbhuldigung eins an die Landschafft, eins an Kaiser vnd einß coram notariis et testibus.
20 Februar haben mit D. v. hagen scharff geredet wegen vnser apologia.


|
Seite 242 |




|
1 März haben an den Sindicum Schabbelt mit eigen handen geschrieben vnd ihn ersuchet, mir schrifftlich auff zu setzen, wie die Apologia bequem abzufaßen zu meiner Information.
10 April Mein Bruder, Otte Pren, Johan Cotman zu mir komen vmb 2 Vhre. Ich habe Otte Tanken den Sindicum bey mir hatt vnd haben zusammen verlesen die apologia, welche Cotman abgefaßet, habe sie gutt befunden.
22 Junii habe meinen Secretarium Simon Gabriel zur Nedden mit vnser apologia nacher Regenßburgk abgefertiget.
Daß der Canzler Johann Cothmann 1 ) der alleinige Verfasser sei, geht schon aus der auch bei v. Lützow a. a. O. citirten Belehnung desselben mit vier Bauhöfen im Gute Bansow, A. Güstrow, (d. d. Güstrow den 11. Dec. 1645) hervor, in welcher der Herzog Adolph Friederich sagt, daß dem Kanzler diese Schenkung gemacht sei, nachdem er
"dem weiland hochwürdigen, hochgebornen Fürsten Herrn Hanß Albrechten Hertzogen zu Mecklenburg
. - nicht alleine viele Jahre her getrew vnd redlich gedienet, sondern auch bei Vnsern vnd S. Ld. furgangenen vnrechtmeßigen verstoßung von Vnsern Landen vnd Leutten, mit S. Ld. in das Exilium sich begeben vnd in wehrender solcher Zeit viel beschwerliche müehe vnd arbeit über sich gehabt, vnd sonderlich in verfertigung vnser durch offenen Drueck publicirten außführlichen Apologi einen solchen sonderbahren getreuwen fleiß angewendet, daß wir damit in allen gnaden content vnd friedlich gewesen vnd dauon bey jedermenniglichen ruhm vnd Ehr gehabt haben".
In einem Gnadenbriefe vom 25. Jan. 1637, durch welchen der Herzog Adolph Friederich dem "zu der Gustrowischen Regierung bestalten geheimbten Regiments=Raht vnd Canzler


|
Seite 243 |




|
Johan Cotman" völlige Freiheit von allen öffentlichen Lasten ertheilt, wird vorzüglich als Grund der fürstlichen Gnade hervorgehoben, daß er
"bei Vnsers geliebten Bruders L. hoch sel. gedechtnuß in vnserm betrubten schweren exilio in vntertheniger lieb vnd trewe vnaußgesetzet vnd bestendig verharret, wie viel beschwer= vnd gefährliche reisen, mühe vnd arbeit er verrichtet vnd auf sich gehabt, vnd waß maßen er sonderlich zu Vnser vnd Vnsers hohen fürstlichen Standes Nahmen, Ehren vnd reputation vnvmbgenglichen defension vnd Verthetigung Vnsere außgangene vnd in offenem truck publicirte Apologiam zu vnser beiderseits gnedigem Contentement dermaßen grundlich vnd wohl abgefasset vnd außgeführet, daß Wir Unß derselben fur Ihrer Kayserlichen Mayt, allen Chur=, Fursten vnd Stenden des Reichs vnd jedermenniglichen mit bestande, ruhmb vnd Ehren haben gebrauchen vnd bedienen konnen".
Noch mehr aber wird dies durch ein feierliches Bekenntniß des Herzogs Adolph Friederich bestätigt. Der Dr. Christoph v. Hagen, Assessor beim Hof= und Land=Gericht zu Güstrow, ein weitschweifiger und peinlicher Mann, hatte auch über die Abfassung einer Apologie berichten müssen; seine Ansichten gefielen aber so wenig, daß ihm sein Referat sogleich zurückgeschickt ward. Als ihn der Herzog Adolph Friederich nach seiner Rückkehr in seine Lande im J. 1632 zum Geheimen=Rathe von Haus aus ernennen wollte, war der Doctor, der gerne in Person eine große Rolle spielen wollte, so unzufrieden mit der Bestallung, daß er sie nicht annahm, sondern allerlei Einwendungen und Vowürfe machte, namentlich auch den Vorwurf, daß er eigentlich die Apologie gemacht habe. Er verscherzte hiedurch das Amt und die fürstliche Gnade völlig und erhielt endlich auf seine vielen Schreibereien am 24. Febr. 1634 folgende Antwort, welche die ganze Angelegenheit völlig aufklärt:
 .
.
Vnsern gnedigen gruß zuuor. Ehrnfester vnd hochgelahrter Raht, lieber getrewer. Wir haben auß eurem vnter dato den 1 February anhero gelangten Schreiben mit großer Verwunderung vernommen, daß Ihr Euch nochmals für den authorem vnser in offentlichen truck außgefertigten vnd der Rom. Kay. May. vnd den zu Regenspurg Ao. 1630 versambleten Chur= vnd Fürsten


|
Seite 244 |




|
des Heil. Rom. Reichs vbergebener Apologiae rühmen vnd außgeben vnd vnß dessen wieder vnser, vnser Rähte vnd menniglichs wissen zu persuadiren Euch unterstehen dürfftet. Wir empfinden solches mit gantz vngnedigem mißfallen vnd erachten eure deßwegen eingeschickte weitleufftige vnnutze schrifft der würdigkeit nicht, daß sie von vnß beantwortet werden solte, Befehlen Euch derwegen hiemit gnedigs ernsts, daß Ihr obgenante vnsere von dem Ehren festen und Hochgelahrten vnserm geheimbten Raht Johan Cothman ohn einige eure hulff vnd zuthun loblich vnd wol außgefertigte Apologiam, wie nicht allein wir vnd vnsers freundlichen vielgeliebten Bruders L. vnd vnser beiderseits Rähte, sondern auch die vornembste gelahrte leute in Lübeck Ihme dessen ein ruhmbliches zeugnuß geben konnen, mit eurer vnnutzen feder vnd reden vnangefaßet laßet vnd euch davon daß geringste nicht zuschreibet, sondern dessen versichert seid, da es diesem vnserm mandato zuwieder vorsetzlich vnd ehrsuchtiger weise von euch ferner geschehen solte, daß wir solches dergestalt an euch zu anden vnd zu eiffern wissen werden, daß ihr darauß vnsern fürstlichen ernst zu erspuren haben sollet.
Was eure bestallung anbelanget, lassen wir es bei voriger vnser erklerung bewenden, Inmaßen euch auch in Vnser Regierungs=Cantzlei in euren Schuldforderungssachen auf gebuhrliches anhalten die Justitz nicht soll verweigert werden. Wornach ihr euch zu richten und geschieht hieran. Datum Schwerin den 24. Febr. Ao. 1634.
An
D. Christoph vom Hagen.



|


|
|
:
|
10.
Ueber den Charakter des
Herzogs Christian I. Louis,
von
G. C. F. Lisch.
Der Charakter des Herzogs Christian I. Louis ist in vielen Beziehungen eben so auffallend, wie seine Stellung zum Lande einzig in ihrer Art in der Geschichte Meklenburgs dasteht. Sein Wirken ist wohl vertheidigt, da seine guten


|
Seite 245 |




|
Absichten und ein guter Grundzug in seinem Willen nicht zu verkennen sind; aber seine Handlungsweise wirft stets wieder einen Schatten auf ihn, so oft und gerne man geneigt sein möchte, seine guten Absichten anzuerkennen; schon sein Verhältniß zu seinem Vater, dem ausgezeichneten Herzoge Adolph Friederich I, muß dahin führen, in der Beurtheilung seines Charakters sehr vorsichtig zu sein. Das Leben der Herzoge Christian I. Louis, Friederich Wilhelm, Carl Leopold und Christian Ludwig II. ist aber für die Geschichte und Verfassung des Vaterlandes von der allergrößten Wichtigkeit; bei der Schwierigkeit, das bedeutende Material zu ihrer Geschichte zu übewinden, und bei dem Mangel gründlicher und erschöpfender Darstellungen ihres Lebens muß jedoch jeder zuverlässige Fingerzeig als eine bedeutende Bereicherung unserer Geschichte betrachtet werden.
Eine solche Bereicherung gewährt die folgende Mittheilung, welche hier gemacht wird, da zu einer umfassenden Würdigung der Regierungszeit des Herzogs Christian Louis wohl fürs erste noch keine Aussicht vorhanden ist. In der so eben erschienenen (nur für die wenigen Subscribenten gedruckten) "Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart" (für den Abdruck seltener Geschichtsquellen), VI, 1843, S. 470, enthaltend die "Briefe der Princessin Elisabeth Charlotte von Orleans an die Raugräfin Louise, 1676-1722", herausgegeben von Wolfg. Menzel, steht ein Brief der Princessin Elisabeth Charlotte von Orleans, welche den Charakter des Herzogs Christian auf eine treffende Weise schildert. Die Princessin, eine Tochter des Kurfürsten Carl Ludwig von der Pfalz, war im J. 1671 gegen ihren Willen mit dem Herzoge Philipp von Orleans, Bruder des Königs Ludwig XIV. von Frankreich, vermählt und mußte in ihrer Stellung den Herzog genau kennen. W. Menzel sagt, S. VIII, über diese Princessin:
"Die Princessin besaß einen hellen Verstand und große Munterkeit. Sie war stets um die Person Ludwigs XIV, der sie hoch in Ehren hielt. Nach seinem Tode beherrschte ihr eigener Sohn als Prinz=Regent das französische Reich. Bei so viel Geist und in einer solchen Stellung war sie von allem unterrichtet, was am Hofe vorging. Ihre Schreibseligkeit aber bewog sie, von allen Hof= und Staatssachen an ihre Verwandten und Freunde, namentlich in Deutschland, zu schreiben, was ihr oft Unannehmlichkeiten zuzog".
Der Brief lautet also:
Der Hertzog Von mecklenburg wen Er In gedancken saß undt man Ihn fragte woran Er dächte sagte Er


|
Seite 246 |




|
je donne audiance à mes pensées seine Zweyte gemahlin Konte Es beßer thun, den sie hatte mehr Verstandt als Er, Es war doch Eine wunderliche sach mitt dießem Herrn, Er war woll Erzogen, Konte über die maßen woll sprechen Man Konte Ihm Kein unrecht geben wen man Ihn hörte aber In alles was Er that war arger als Kein Kindt Von 6 Jahren thun Könte, Er Klagte mir Ein mahl sein leydt Ich andtwortete nichts drauff, Er fragte mich warumb Ich nicht andtwortete, Ich sagte blat herauß (waß solle Ich E. L. sagen sie sprechen über die Maßen woll, aber sie thun nicht wie sie reden undt ihre ganze conduitte ist Erbarmlich, undt machen In gantz frankreich außlachen) Er wurde böß undt ging weg, aber Ich sagte Ihm dießes weillen Er wenig tag Vorher dem König Eine audientz gefordert hatte der König meinte Er hatte von affairen mitt Ihm Zu tractiren, ließ Ihn In sein Cabinet allein Kommen so sicht Er den König ahn undt sagt sire je vous trouve cru depuis que je n'ay eüe l'honneur de vous voir der König andtwortete, je ne croyes pas estre en age de croitre (den der König war damahlen 35 Jahr alt) darnach sagte Er sire vous aVes bien bonne mine tout le monde trouve que je vous ressemble mais que j'ay encore mellieure mine que vous, der König lacht und sagt cela peust bien estre damit ging Er wider weg, war daß nicht Eine schönne audientz - - -


|
[ Seite 247 ] |




|



|


|
|
:
|
IX.
URKUNDEN-SAMMLUNG.


|
[ Seite 248 ] |




|


|
[ Seite 249 ] |




|



|


|
|
:
|
A.
Urkunden
zur
Geschichte der Johanniter-Comthurei Nemerow.
Nr. I.
Der Markgraf Albrecht von Brandenburg verleiht dem Johanniter-Orden das befreiete Eigenthumsrecht des Dorfes Gnewitz (zur stargardischen Comthurei Gardow, später Nemerow) zu Händen der Comthurei Mirow.
D. d. Lychen. März 13. 1285.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin
Albertus, Dei gratia marchio Brandenburgensis, uniuersis Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem in domino sempiternam. Ad omnem boni operis consummationem adeo nobis expedit intendere vigilanter, ut, dum districtus iudex in die nouissimo cunctorum examinare venit actiones, non formidanda sint nobis gehenne supplicia pro delictis, sed quomodo eterne beatitudinis premia possimus pro bonis operibus adipisci. Hinc est quod notum esse volumus tam presentibus, quam futuris, quod nos proprietatem ville, que Gnewetiz dicitur, damus liberaliter seu donamus commendatori et fratribus s. domus hospitalis Jerosolimitani b. Johannis baptiste et eorum ordini pro remedio anime nostre et nostrorum progenitorum libere possidendam. Excipimus seu eximimus predictam [villam?] ab omni exactione seu petitione, angaria, parangaria, constructione urbium, pontium seu munitionum, et generaliter ab omni vexatione et molestia, quibus predicti fratres et eorum homines in predictis bonis a nobis vel a nostris here-


|
Seite 250 |




|
dibus possent in perpetuum grauari vel aliqualiter impediri. Hec predicta bona cum proprietate et omni libertate et omni iusticia et iudicio et aduocatia et omni illo, quod vulgariter Recht vel Unrecht dicitur, cum omnibus terminis suis hucusque habitis, cum aquis, aquarum decursibus, molendinis, pratis, pascuis, terris cultis et incultis, et omnibus pertinentiis sibi adherentibus de consuetudine, gratia vel de iure, damus seu donamus antedictis commendatori et fratribus in Myrou ac eorum ordini perpetuo, quiete ac pacifice possidenda. Preterea exdudimus, quod in crastino b. Martini annis singulis nobis de domo villici predicte ville Gnewetiz duo talenta cum dimidio denariorum Brandenb. census nomine omni procul dubio persoluentur. Et ne hec nostra donatio a nostris successoribus vel a quibuslibet aliis in perpetuum valeat irritari, presentem paginam damus memoratis commendatori et fratribus sigilli nostri munimine roboratam. Acta sunt hec in Lychen anno domini M°CC°LXXXV°, III idus Martii, presentibus: domino Ludolpho de Plote, domino Henrico [Soneke?], domino Friderico et domino Chotemir Dargaz, domino J. et domino ... de Loweberch, domino Hermanno et domino ...., domino Friderico de Osterwalde et domino Wichmanno Glude .... aduocato, domino Johanne fratre ipsius et quam pluribus.
Die mit . . . . bezeichneten Stellen sind im Pergament der Urschrift vermodert. Gedruckt ist diese Urkunde auch in Gercken Cod. dipl. III, p. 82, und Jahrb. II, S. 232.
Nr. II.
Der Markgraf Albrecht von Brandenburg verleiht dem Johanniter-Orden das befreiete Eigenthumsrecht der Dörfer Dabelow und Kl. Karzstavel (zur stargardischen Comthurei Gardow, später Nemerow).
D. d. Werbelin. 1286. Dec. 17.
Aus einem Diplomatarium auf Papier aus dem 15. Jahrhundert im grossh. Haupt-Archive zu Schwerin.
In nomine domini Amon. Nos Albertus deigracia marchio Brandenburgensis omnibus in perpetuum.


|
Seite 251 |




|
Humana memoria assidua mortis cogitacione negociorumque ac tractatuum multitudine infirmam mentem habet; ut adiuuetur vocibus testium ac testimonio litterarum, ad hoc ut acta mortalium robur alicuius obtineant firmitatis: hinc est quod notum esse volumus tam presentibus, quam futuris protestando, quod proprietatem villarum Dobelow et Karztauel minoris, quarum villarum possessio fuerat Chotemar et Ottonis fratrum, damus seu donamus liberaliter commendatori et fratribus sancte domus hospitalis Jherosolimitani beati Johannis baptiste et eorum ordini libere perpetuo possidendam. Excipimus seu eximimus predicta bona ab omni exactione seu petitione, angaria, parangaria constructione vrbium, poncium seu municionum, et generaliter ab omni vexacione uel molestia, quibus predicti fratres et eorum homines in predictis bonis a nobis uel a nostris heredibus possent in perpetuum grauari uel aliqualiter impediri. Hec predicta bona cum proprietate et omni libertate et omni iusticia et iudicio et aduocacia et omni illo, quod vulgariter Recht uel Vnrecht dicitur, cum omnibus terminis suis hucusque habitis, cum aquis, aquarum decursibus, molendinis, pratis, pascuis, lignis, terris cultis et incultis, et omnibus pertinenciis, sibi adherentibus de consuetudine, gracia uel de iure, damus seu donamus antedictis commendatori et fratribus in Mirow et eorum ordini perpetuo, quiete ac pacifice possidenda, illo tamen excluso pariter et excepto, quod de talento quolibet uel frusto duro nobis et nostris heredibus soluentur duo solidi denariorum Brandenb. in crastino beati Martini census nomine annuatim. [Ne] hec nostra donacio a nostris successoribus uel a quibtislibet aliis in perpetuum valeat irritari, presentem paginam damus memoratis commendatori et fratribus sigilli nostri munimine roboratam. Acta sunt hec in Werbelino anno domini M°CC°LXXXVI°, XV kal. Decembris, presentibus domino Henrico de Wildenhagen, Henrico de Sankow tunc temporis aduocato, et domino Chotemar Dargaz et aliis fide dignis.


|
Seite 252 |




|
Nr. III.
Der Markgraf Albrecht von Brandenburg schenkt dem Comthur Ulrich Swave das freie Eigenthum der beiden Dörfer Gross= und Klein=Nemerow, welche dieser zur Stiftung einer Johanniter=Comthurei gekauft hat.
D. d. Soldin. 1298. Mai 15.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats= und Cabinets=Archive zu Berlin
[In nomine] sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Cum rerum gestarum certissima representatio sit scriptura, que de verborum serie redactorum in ipsam nichil [minuit, neque] mutat, sapientum decreuit industria, vt ea, que aguntur debite, litterarum serie et fidelium testimonio roborentur, ne posteris dubium oriatur. Proinde nos Albertus [dei gartia m]archio Brandenburgensis recognoscimus et tenore presentium in publicam notitiam deuenire cupimus singulorum, quibus presentes fuerint recitate, quod miles noster strennuus et [fidelis He]rmannus de Warborch B. 1 ) dictus villas subscriptas, videlicet Magnam Nemerow et Paruam Nemerow, cum omnibus agris cultis et incultis, lignis, siluis, rubis, [aquis, mole]ndinis B. 2 ), ascuis, pratis, cum integris distinctionibus, et generaliter cum omnibus B. 3 ) ipsarum pertinentiis et iuribus sicut eas a nobis habuit, viris religiosis et in Christo reuerendis, [videlicet fratri] Vlrico Swaf dicto, commendatori domorum in Bruneswich et Gardow ordinis sancti Johannis hospitalis Iherosolimitani et omnibus suis confratribus eiusdem ordi[nis pro] sexcentis et triginta talentis Brandeburgensium denariorum cum nostro consensu vendidit et dimisit, et idem frater B. 4 ) Vlricus eadem sexcenta et triginta talenta [eidem] Hermanno persoluit, qui ea suscepit, et B. 5 ) dictas [villas] Nemerow et Nemerow nobis ad


|
Seite 253 |




|
manus dicti fratris Vlrici et suorum confratrum eiusdem ordinis voluntarie et libere resignauit. Nos igitur attendentes dictorum fratrum [vitam cele]bem, bonorum operum frequentiam, ordinis sanctitatem, sperantesque in anima et corpore apud Deum piis ipsorum meritis adiuuari, ad laudem dei omnipotentis eiusque matris Marie virginis gloriose B. 6 ) et beati Johannis, pro salute animarum nostre videlicet et progenitorum ac filiorum et heredum ac successorum nostrorum, proprietatem eorumdem bonorum eidem fratri Vlrico et suis confratribus eiusdem ordinis dedimus et presentibus damus: ita quod easdem duas villas B. 7 ) cum omnibus suis pertinentiis libere perpetuo possidebunt, ab hominibus enim in eisdem bonis habitantibus ex nunc et deinceps per nos vel nostros successores, aut nostros aut ip[sorum aduo]catos vel bodellos, vel ipsorum nuncios, nunquam precaria, nunquam curruum vel alia seruicia requirentur, et ad custodienda propugnacula, vel viarum transitus, qui wlgariter [land]were dicuntur, nunquam de cetero tenebuntur, sed quicquid idem frater Vlrieus et sui confratres predicti cum ipsis hominibus fecerint, gratum tenebimus atque ratum. Insuper [qu]ia idem frater Vlricus, cum adhuc secularis esset, [nobis] exhibuit seruicia valde grata et ipsum in omnibus fidelem inuenimus et constantem, ipsum censemus B. 8 ) specialiter honorandum, ut ipsa bona regat et possideat ad [tempora vite] sue, nec ipsum absque suo consensu ab eisdem volumus aliquatenus amoueri, post mortem autem ipsius disponat magister [Ordinis de] illis, [sicut] de aliis bonis, prout [ordini nouerit] expedire. Ne igitur hec nostra gratia eidem fratri Vlrico vel ordini in posterum violari valeat vel infrin[gi, presentes inde conf]ectas sigil[li nostri appen]sione iussimus communiri. Testes etiam huius sunt: nobiles viri, videlicet dominus Heinricus Magnopolensis gener noster dilectus, [domi]n[us dux] O[tto] Stetynensis B. 9 ), gener noster dominus Nycholaus de Rozstoc B. 10 ), domicellus Nycholaus de Werle,


|
Seite 254 |




|
incliti; reuerendus pater dominus Dythmarus abbas ecclesie C[olba]z[ensis], dominus Nycholaus prepositus in Vredeland, dominus Johannes prepositus in Soldyn B. 11 ), dominus Hermannus prepositus in Landesberghe, cappellani nostri; Reyneke [. . . . . . .]w B. 12 ), [Ro]dolfus de Lyeuendale, Albernus de Bruncow et Wernerus Splinter, milites, et quam plures alii fide digni. Actum et datum in Soldyn [per manum] Johannis nostri notarii, anno domini millesimo ducentesimo nonagesimo octauo, die ascensionis eiusdem B. 13 ).
Von dieser Urkunde sind zwei
Exemplare vorhanden:
A) Eine Urkunde
auf quadratischem Pergament, weitläuftig in
den Zeilen, in Minuskel geschrieben.
Angehängt ist eine grüne seidene Schnur, an
welcher aber kein Siegel mehr hängt; jedoch
sind noch geringe Spuren davon vorhanden.
Diese Urkunde war zusammengefaltet und durch
Moder so zusammen geklebt, dass die linke
Durchlöcherte Seite, sehr gelitten hat. Bei
sorgfältiger Entfaltung liessen sich jedoch
noch die einzelnen auseinanderfallenden
Stückchen zusammenstellen, und so die
Stellen durch Autopsie ergänzen, welche mit
[ ] bezeichnet sind. Alle diese Stellen habe
ich im Zusammenhange theils ganz, theils
stückweise noch gesehen; später wird eine
Entzifferung schwerlich mehr möglich
sein.
B) Das zweite Exemplar ist auf
gleichem Pergament mit gleicher Schrift
geschrieben, aber ohne Siegelband dieses
Pergament ist zwar nicht vermodert, aber
stark verschimmelt, jedoch noch zu
entziffern. Die oft bedeutenden Varianten
sind unter dem Texte mit B aufgeführt.
Nr. IV.
Die Burgmänner von Stargard treten der Johanniter-Comthurei Nemerow ein Stück Acker an dem Tollense-See ab, welches der Fürst Heinrich von Meklenburg an dieselbe verkauft hat.
D. d. (13..).
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin
Nos milites et armigeri castellani Stargardenses recognoscimus et ad pupplicam noticiam cupimus


|
Seite 255 |




|
deuenire singulorum, quibus presentes littere fuerint recitate, quod nobilis dominus noster Henricus Magnopolensis proprietatem agro rum a stagno dicto Tholenze, prout dominus Borchardus de Dolle et dominus Echardus de Dewisz ore domini nostri Henrici Magnopolensis et nostro co[n]sensu assignando distinctiones diffinierunt, cum lignis, pascuis, pratis, agris cultis et incultis et cum omnibus attinenciis suis, sicuti iacent sub certis distinctionibus, cum omni libertate et utilitate, sacre domui hospitalis sancti Johannis Jerosolimitani et fratribus in Nemerow pro X marcis argenti vendidit et nostra bona uoluntate dimisit, perpetuis temporibus duraturam, verum eciam predictos a gros cum lignis et attinenciis suis coram nobili domino nostro Henrico Magnopolensi ad manus predictorum fratrum uoluntarie resignauimus et manifeste, ita ut predicti fratres a nobis et a nostris successoribus nunc et in euum in predictis agris, lignis, pascuis non debeant molestari, sed quidquid cum eisdem agris fecerint et ordinauerint, gratum tenebimus atque ratum. Vt autem hec recognitio et nostra resignatio inconuulsa permaneat et ne ad irritum a nobis et a nostris successoribus reuocetur, sigilla nostra nos
Hier hört diese merkwürdige Urkunde plötzlich auf. Dennoch ist sie gewiss vollzogen gewesen. Denn es sind acht Siegelbänder von Pergament angehängt, welche zwar keine Siegel mehr tragen, aber doch alle noch Spuren von Siegeln und Wachs haben. Die Schrift ist eine gewöhnliche Minuskel des 14. Jahrhunderts.
Nr. V.
Der Fürst Heinrich von Meklenburg schenkt der Johanniter-Comthurei Nemerow das Patronatrecht über die Pfarr-Kirche der Stadt Lichen.
D. d. Wismar. 1302. Jan. 30.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Omnibus Christi fidelibus presencia visuris seu audituris Hinricus deigratia dominus Magnopolensis, salutem in domino sempiternam. Quoniam diuersiflue rerum occupaciones, humanum animum inuoluentes, necnon con-


|
Seite 256 |




|
tinue temporum reuoluciones cogunt aliquando acta iam pridem nota a memoria hominum relabi et euanere, dignum duximus, acta nostra memorie digno proborum virorum testimonio et priuilegii nostri patrocinio apud memorias hominum perpetuo conseruare. Reco noscimus igitur, quod, sano corpore, prouido ducti consilio, anime nostre et anime uxoris nostre, domine Beatricis, eterne salutis viam preparare volentes, et celibem vitam sacri ordinis fratrum sacre domus hospitalis sancti Johannis Baptiste Jherosolimitani deuotis mentibus intuentes, pro remedio animarum parentum nostrorum et domini nostri karissimi marchionis Alberti pie memorie, necnon pro remedio anime nostre et anime uxoris nostre domine Beatricis iam dicte, ius patronatus ecclesie ciuitatis Lichen cum omnibus suis attinenciis, sicut nos habuimus, reuerendis viris fratri Ulrico Swaf ceterisque predicti ordinis fratribus perpetuis temporibus habendum pure donauimus propter deum, et etiam vt in oracionibus suis omnium nostrum iam dictorum sint memores et vt oracionum, ieiuniorum, missarum, elemosinarum, castigacionum et omnium sanctorum operum simus apud deum participes, que sepedicti ordinis fratres perpetuis temporibus per mundum exercent seu faciunt vniuersum. Ut autem hec nostra donacio, corde procedens a deuoto, perpetua et inuiolabilis perseueret, dedimus eiusdem ordinis fratribus presens priuilegium inde confectum sigillo et tytulo nostri nominis et vasallorum nostrorum nominibus, qui huic donacioni nostre affuerant, insignitum. Nomina militum sunt: Johannes decernin, Marquardus de Loo, Conr[adus] Wlf, Busso de Dolla, Hermannus de Modentin, Vikko Mund, Tedwicus de Oriz et Hermannus de Oriz; nomina famulorum sunt: Vikko et Wedego de Plothe, et alii quam plures clerici etlayci fide digni. Datum Wismarie anno domini M°CCC°II°, tercia kalendarum Februarii.
Die Urkunde ist auf Pergament in einer kräftigen Minuskel geschrieben, aber durch Fettigkeiten so verdorben, dass die Schrift sehr verblichen und aufgelöst ist. Angehängt ist eine dicke, rothe seidene Schnur, welcher jedoch das Siegel fehlt.


|
Seite 257 |




|
Nr. VI.
Der Markgraf Hermann von Brandenburg bestätigt der Johanniter-Comthurei Nemerow den Besitz des Patronatrechts über die Pfarre der Stadt Lichen.
D. d. Spandow. 1302. Aug. 14.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hermannus dei gracia marchio Brandeburgensis omnibus, ad quos presentes peruenerint, in perpetuum. Quum ex fragilitate condicionis humane memoria hominum sit labilis, vita brevis, expedit, ut ea, que aguntur debite et debent memorie commendari, litterarum serie et fidelium testimonio roborentur. Recognoscimus igitur presentibus publice protestantes, quod vir honorabilis frater Ulricus Swaf dictus, commendator domorum ordinis hospitalis sancti Johannis Jherosol[omitani] in Brunswich, Nemerow et Gardow, familiaris nobis specialiter et dilectus, nos veraciter exp[osuit], quod vir nobilis dominus Heinricus Magnopolensis inclitus, sororius noster dilectus, ius patronatus ecclesie parochialis ciuitatis Lychen dicto ordini seu fratribus ordinis sancti Johannis fid[e] pur[e] propter deum [d]ed[erit] perpetuis temporibus possidendum; et quia dictus noster sororius dominus Heinricus Magnopolensis terram et ciuitatem Lychen predictam a nobis tenet in feodo, idem frater Ulricus Swaf, volens sibi et suo ordini predicto, sinistra veludsapiens, dubia precauere, donationem ipsam a nobis petiit confirmari, cuius precibus inclinati, ad laudem dei omnipotentis einsque matris Marie virginis perpetue et sancti Johannis, ad salutem quoque animarum nostre videlicet ac patris nostri et patrui aliorumque progenitorum ac successorum nostrorum, dictam donationem dicti nostri sororii, si facta est debite, presentibus confirmamus, et si dicta ciuitas Lychen ad nos processu temporis diuoluta fuerit, donationem ipsam gratam tenebimus atque ratam. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Testes quoque huius sunt: Gheuehardus senior de Aluensleue, Lodewicus de Wantsleue, Boldewinus Stormer et Droy-


|
Seite 258 |




|
seko tunc curie dapifer et plures alii fide digni. Datum Spandow, anno domini millesimo tricentesimo secundo, vigilia annunciationis, per manum Conradi.
Die Urkunde ist auf Pergament mit sehr kleiner Schrift geschrieben und sehr verblichen, daher schwer zu entziffern. Für das Siegelband sind 2 Löcher eingeschnitten, in welchen aber kein Siegel mehr hängt.
Nr. VII.
Der Markgraf Hermann von Brandenburg bestätigt dem Comthur Ulrich Swave die Stiftung der Johanniter-Comthurei Nemerow und bestimmt für die Zukunft dieselbe für einen Comthur und drei Priester des Ordens.
D. d. Werbelin. 1302. Nov. 8.
Nach einer Abschrift im
grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu
Schwerin.
(Original im königl.
Archive zu Berlin.)
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hermannus dei gracia Brandeburgensis marchio et dominus de Henneberg omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis seu audituris salutem in perpetuum. Gloria et honor dei viuentis in seculo est, inter tot mundi pericula in valle huius miserie fideles suos in suo seruicio confortare. Recognoscimus igitur presentium serie litterarum ac publice protestamur, quod, inclinati donis dei omnipotentis meritisque sancte matris Marie virginis perpetue et sancti Johannis hospitalis Jherosolimitani, ad preces eciam fidelis nostri secretarii fratris Olrici dicti Swaf, commendatoris domus in Nemerow, qui nobis et nostris progenitoribus multimoda sepius inpendit seruicia, propter que ipsum et ordinem ipsius prosequi cupientes speciali stipendio gratiarum, curiam seu domum dicti ordinis in Nemerow cum omnibus habitatoribus et possessionibus suis promouebimus et ad queque prospera dirigemus, volentes enim eandem curiam et fratres cum proprietatibus et libertatibus eorum singulis in vigore stabili perpetuo permanere, omnia ipsorum bona mobilia seu


|
Seite 259 |




|
immobilia per illustrem marchionem Albertum Brandeburgensem, nostrum patruum, clare memorie, ipsi et suis confratribus data et concessa, in terra domini Magnopolensis sita, necnon omnia et singula priuilegia eisdem pernos uel per patrem nostrum Ottonem uel dictum patruum nostrum Albertum uel alios nostros progenitores seu predecessores nostros quoscumque super lignis, siluis, pratis, pascuis, nemoribus, paludibus, aquis, aquarum decursibus, stagnis, piscacionibus, molendinis, agris cultis et incultis et generaliter omnibus vsufructibus, donacionibus seu concessionibus quibuscumque data vel concessa duracione perpetua liberaliter in nomine domini presentibus confirmamus, et quod institucionem seu fundacionem dicte curie seu elemosine in Nemerow idem frater olricus noster specialis apredicto patruo nostro Alberto inclito et confirmacionem eiusdem anobis fieri suis seruiciis et meritis procurat, statuimus, volentes omnimode, ut nullus magistrorum ordinis predicti ipsum fratrem Olricum a dicta amoueat curia, sed ipse cum elemosinarum largicione et trium sacer dotum ordinis diuini officii celebracione eandem regat cum libertatibus curiam quiete temporibus vite sue, cum autem decesserit ab hac luce, tunc magister et successores sui diuinum officium per tres sacerdotes ordinis et elemosinam eodem modo obseruare perpetuo tenebuntur, sicut idem frater Swaf suis temporibus tenuit et possedit. Testes huius sunt: Hinricus de Aluensleue et Geuehardus senior de Aluensleue, Bernhardus de Ploczke, Droyseko nostre curie dapifer, Gerekinus de Molendorp, nostri milites, et alii plures fide digni. Actum et datum in Werbelino, anno domini M°CCC° secundo, quinta feria ante festum beati Martini episcopi.


|
Seite 260 |




|
Nr. VIII.
Der Fürst Heinrich von Meklenburg schenkt der Johanniter-Comthurei Nemerow die Freiheit des Dorfes Staven und das Eigenthumsrecht von 8 Hufen in demselben Dorfe, mit Bede, Gericht und Diensten.
D. d. Stargard. 1303. Junii 23.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Hinricus dei gracia Magnopolensis Stargardieque dominus vniuersis Christi fidelibus presencia visuris vel audituris salutem in domino sempiternam. Humanarum multitudo et varietates actionum angustias nostre mentis excedit; propterea ita ordinauit sapiencium prouidencia, vt, quod in nobis memoria capere non potest, ad firmam futurorum noticiam eueniret. Quapropter notum esse volumus vniuersis presentibus et futuris, quod nos, cum maturo consilio discretorum consiliariorum nostrorum, ob remissionem peccaminum nostrorum progenitorum simul et nostrorum, dimisimus, dedimus, contulimus et donauimus viro prediscreto nobis sincere predilecto domino Vlrico dicto Swaf, fratri sacre domus hospitalis Iherosolimitanorum ordinis sancti Johannis, commendatori domus Nemerow, necnon eius successoribus commendatoribus predicte domus et omnibus fratribus ordinis et domus eiusdem pure propter deum omnem libertatem et vtilitatem, necnon et proprietatem in octo mansis cum eorum curiis in nostro domineo ville Stouen, quos habent prout nunc et possident Hennighus et Hartmannus fratres dicti de Stouen in isto latere, sicut aduenitur de opido dicto Vredeland in Stouen villam predictam, cum omnibus eorum attinentiis et prouentibus, cum precaria maiori et minori, scilicet in festo beati Martini episcopi de quolibet manso viginti quatuor solidos leuium denariorum, duos modios siliginis, duos modios ordei et duos modios auene, et in festo beate Walburge virginis de quolibet manso duodecim solidos predictorum denariorum, vnum modium siliginis, vnum modium ordei et vnum modium auene, cum omni iure


|
Seite 261 |




|
maiori et minori, manus et colli, cum omni seruicio et angario libere perpetuis temporibus possidendam. Iniungimus eciam nostris successoribus et heredibus firmiter et committimus, vt, quod per nos est ordinatum et adictum, dictis commendatori et fratribus domus Nemerow teneant gratum atque ratum. Testes sunt: Johannes de Cernyn, Busso de Dolla, Wyllekynus Zoneke et Vycko Munt, milites nostri, et Hermannus de Ortze, noster marschalkus, et alii fide digni. In cuius rei euidens testimonium nostrum sigillum presentibus duximus apponendum. Datum et actum in nostro castro Stargardia, anno domini M°CCC° tercio, in vigilia natiuitatis sancti Johannis baptiste.
Auf Pergament in einer flüchtigen cursivischen Minuskel. An dem Siegelbande von Pergament hängt ein Drittheil des Siegels des Fürsten Heinrich.
Nr. IX.
Der Fürst Heinrich von Meklenburg versichert für die Zahlung einer ausserordentlichen Geldhülfe den Johanniter-Comthureien Nemerow und Gardow die Befreiung ihrer Güter von aller Bedezahlung, obgleich die Comthureien ihre Güter schon zu voller Freiheit besitzen.
D. d. Lychen. 1304. April 3.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- u. Cabinets-Archive zu Berlin.
Hinricus dei gracia dominus Magnopulensis omnibus Christi fidelibus presens scriptum visuris seu audituris salutem in domino sempiternam. Facta memorie digna scriptis commendare decreuit antiquitas, ne ea obliuione vel aliqua temeritate futuris temporibus contingat in dubium reuocari. Nouerint igitur presentes et posteri, quod preillibati fratres sacre domus hospitalis Jerosolimitani de Nemerowe et de Gardowe omnia bona villarum seu mansorum et eorum cum omni iure, proprietate et libertate, terris cultis et incultis, lignis, paludibus, aquis aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, pratis et pascuis, cum


|
Seite 262 |




|
suis pertinenciis, sub certis terminationibus sicut iacent, ad nos absque precaria perduxerunt; cum autem necessitas debitorum magna ex parte illustris principis marchionis Hermanni nobis incumberet, iam dicti fratres in subsidium de bonis eorum quadraginta marcas argenti nobis animo beniuolo donauerunt, quam donacionem argenti nec modo in presenti, nec vnquam in futuro nos et nostri heredes seu successores reputare volumus pro iure, set pro gratie et beneficii inpensione. Preterea nos dictorum fratrum considerantes vitam celibem, bonorum operum frequenciam, ordinis sanctitatem, sperantes in anima et corpore apud deum ipsorum deuotis precibus adiuuari, ad laudem dei omnipotentis et beate Marie, pro salute anime nostre et vxoris nostre ac progenitorum et successorum nostrorum, damus eisdem fratribus, nunc presentibus et futuris, bona in maiori Nemerowe et in slauicali Nemerowe, necnon in Gardowe et cetera bona in dominio nostro sita, ad iam dictas duas domos pertinencia, sicut ea ad nos perduxerunt, per nos et nostros heredes seu successores a precaria libera et exempta. Vt autem omnia predicta a nobis et a nostris successoribus perpetua maneant et inconwlsa, dedimus sepedictis fratribus hospitalis Jerosolimitani de Nemerowe et Gardowe et omnibus eorum subditis presentem paginam nostri sigilli munimine firmiter roboratam. Testes sunt milites nostri: Busso de Dolla, Willekinus Soneke, Ekhardus de Dewiz, Hinricus Soneke, Krowel aduocatus, Vikko Munt et Henninghus de Plawe, Rodolfus de Dolla, Rodolfus de Wodensweghe, et famuli: Vikko et Wedeko de Plote, Hinricus de Heydebrake, Hermannus de Reberghe et quam plures alii fide digni. Datum Lychen, anno domini M°CCC° quarto, non. Aprilis III.
Auf Pergament in einer etwas verblichenen und flüchtigen, cursivischen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt das schon beschädigte Siegel des Fürsten Heinrich; Umschrift:
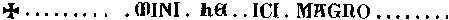


|
Seite 263 |




|
Nr. X.
Das Kloster Broda vergleicht sich mit dem Kloster Wanzka über die Zahlung des Restes des Kaufgeldes für die von jenem an dieses verkauften Dörfer Klein-Nemerow, Mechow und Küssow.
D. d. 1306. Aug. 15.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Cunctis Christi fidelibus tam presentibus, quam futuris presens scriptum inspecturis 1 ) Walwanus dei gracia prepositus in Broda atque conuentus generalis cenobii eiusdem oraciones in domino sempiternas. Datur intelligi aperte uiris ydoneis vniuersis, quod facta est multa temporis petericio, dum vendidimus bona nostra claustro Wanceke nominato, scilicet uillam Nemerowe minorem, uillam Mechowe et octo mansos in uilla Cussowe, cum omni iure, pro centum talentis monete Brandeburgensis; de huiusmodi denariis nunc sunt vigenti quinque talenta persoluta, denarii autem residui nobis adhuc debent persolui secundum hunc modum, quod quolibet anno quinque talenta nobis debent in octaua apostolorum Philippi et Jacobi finaliter presentari, quousque illa summa plenarie fuerit terminata. Datum anno domini M°CCC°VI, in assumptione beate virginis Marie, ad cuius manifestationem presens scriptum nostrorum sigillorum munimine fecimus communiri.
Auf Pergament in einer grossen
kräftigen Minuskel. An Pergamentstreifen
hangen zwei Siegel:
1) des Propstes von
Broda rundes Siegel: vor einem links
stehenden Altar, auf dem ein Kelch steht,
knieet rechts eine betende Person; hinter
dem Rücken derselben stehen die Buchstaben:
OD[I], vor dem Gesichte derselben der
Buchstabe: S., - welche Buchstaben, da sie
in der Folge hinter einander stehen, den
Schluss der unvollendeten Umschrift bilden,
welche lautet:
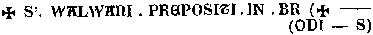
Der Name des Klosters
BBO│DI│S│steht in den
Anfangsbuchstaben BR am Ende der Umschrift
vor dem
 , die Buchstaben: ODI│S
sind, wie oben angegeben, in das Siegelfeld gesetzt.
, die Buchstaben: ODI│S
sind, wie oben angegeben, in das Siegelfeld gesetzt.


|
Seite 264 |




|
2) des Convents rundes Siegel:
unter einem dreifachen runden Bogen sitzt
der Apostel Petrus mit dem Schlüssel in der
rechten Hand; zu seiner Linken steht:
S.│P
 T│RVS│ in drei
Zeilen; Umschrift:
T│RVS│ in drei
Zeilen; Umschrift:

Nr. XI.
Der Johanniter-Orden verschreibt dem Fürsten Heinrich von Meklenburg den Wiederkauf von 37 1/2 Hufen im Dorfe Staven innerhalb zweier Jahre.
D. d. Neu=Brandenburg. 1322. Mai 24.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Nos frater Gheuehardus de Wantzleue, domini fratris Pauli de Mutina locum tenens per Slauiam et Marchiam, frater Hinricus de Wesenberch commendator in Myrow, necnon frater Georgius de Kercow commendator in Nemerow vniuersis, quibus presens referetur scriptum, cognoscimus esse notum: si dominus Magnopolensis proprietatem, quam ordini sacre domus hospitalis supra triginta septem mansos cum dimidio dimisit in villa Stouen, pro centum et quinquaginta marcis argenti Stendaliensis infra duos annos, scilicet a festo penthecostes nunc proximo venturo vltra ad duos annos redemerit, uel ab ista parte Albie vbicumque elegerint, fratribus eiusdem ordinis talem proprietatem demonstrauerit uel demonstrari fecerit, uel pecuniam premissam finaliter exposuerit, extunc predicta proprietas illorum mansorum vna cum litteris suis super hiis confectis ad manus et vsus dicti nobilis viri domini Magnopolensis reueniet velud prius. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa. Data Noua Brandenborch anno domini M°CCCXXII°, feria secunda ante festum penthecostes.
Auf Pergament in kleiner, cursivischer Minuskel. Die Siegel, welche an drei aus der Charte geschnittenen Pergamentstreifen hingen, sind abgerissen.


|
Seite 265 |




|
Nr. XII.
Der Fürst Albrecht von Meklenburg schenkt den Johanniter-Rittern (zu Nemerow) das Eigenthumsrecht und den Zins von ihren Gütern Gnewitz, Wokuhl, Dabelow, verwandelt jedoch den Zins aus Dabelow in eine Abgabe an die Pfarre zu Lychen.
D. d. Stargard. 1337. October 10.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
We Albrecht von der gnàde godes ên here thu Mekelenborch, thů Stargharde vnde thů Rostok, beghêren ôppenbare thů wesen alle den, dhe nů syn vnd noch thů cômen môghen, dat we met râde vser wîsen riddere, dorch dhe sâlicheit vser elderen sêle vnd dorch êwighes lônes, des we vnd vse erfnamen warden syn, lůterliken dorch dhe lêue godes hebben ghegheuen vnd gheuen den êrbaren gheistliken lůden den brûderen des ordenes sente Johannes des hospitalis von Jherusalem vnd eren orden den êghendôm vnd den tyns, von iôwelker hůue ênen brandebůrgeschen scilling, in eren dorpen thů Wůcůlen, thů Gnewize vnd thu Dobelowe, dâr se inne hebben den êghendům, vnd vortygen al des rechtes, al der plicht vnd al des dênestes, den we went an desse tyd dâr an hebben ghehat, dat we vnd vse bruder Johannes, de vns lêf is in Gode vnd noch vmmundich is, noch vse erfnâmen, dhe na vs cômen, noch nênerlege ammachtman von vns nênerleyge plicht, noch recht dâran êschen môghe; vnde dhe tyns, also he hîr vôre bescreuen ist, von dem dorpe thů Dobelowe, dhe scal blîuen thů der wedemen thů Lychen. Alle desse vôrscreuene dinc vnd iôwelk stůcke besunderen, de bestede we êwelichen thů besitten sunder allerleyge hinder vnd allerleyge weddersprâke met ganzer macht den vôrbenômeden brůderen vnd orden. Dat alle desse dinc, de hîr vôrebesereuen syn, stede vnde vast blîuen, so hebbe we vse ingheseghel ghehangen an dessen gygenwordyghen brief. Tûghe alle desser vôrbescreuen dinge synt: her Gercke von Berthecowe, her Vritze syn sône,


|
Seite 266 |




|
her Lyppolt Bere, Vicke Munt, riddere, vnd ander êrbare lûde ghenůch, de des ghewerdich weren. Desse brief is ghegheuen op dem hûs thů Stargharde vnder den iâren godes dûsent iâr drêhundert iâr in dem sêuenen dritteghesten iâre, in dem neysten vrîdaghe na sente Dyonysius dâghe.
Charte: Pergament.
Schrift:
wie gewöhnlich im 14. Jahrh.
Siegelband: ein Pergamentstreifen.
Siegel: von runder Form, noch halb
vorhanden. Auf einem Schilde steht der
gekrönte Stierkopf. Von der Umschrift ist
noch vorhanden:
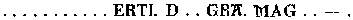
Das grössere Siegel hat ein Rücksiegel: ein rundes Feld mit Sternen besäet; in der Mitte ein Helm. Umschrift:
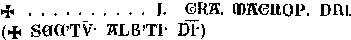
Nr. XIII.
Hermann von Warberg, Präceptor des Johanniter-Ordens im östlichen Niederdeutschland, nimmt den Convent des Klosters Wanzka in die Fraternität des Johanniter-Ordens auf.
D. d. 1347. Sept. 29.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Frater Hermannus de Werberghe, preceptor generalis per Saxoniam, Marchiam, Slauiam ac Pomeraniam ordinis sacre domus hospitalis sancti Johannis Jherosolimitani, dilectis sibi in Christo sanctimonialibus Engelradi de Lubeke abbatisse, Alheydi de Lychen priorisse totique conuentui monasterii in Wantzeke ordinis Cysterciensis salutem et pacem in domino sempiternam. Deuocionem ac dilectionem, quam ob dei reuerenciam ad ordinem nostrum didiscimus vobis habere, cupientes refundere vicissitudine salutari, recepimus vos in fraternitatem nostram, dantes vobis plenam participacionem missarum, vigiliarum, oracionum, castigacionum, sanguinis effusionum ac omnium aliorum bonorum operum, que per totum ordinem nostrum fieri permiserit et concesserit clemencia


|
Seite 267 |




|
saluatoris, addicientes eciam, quod, quandocumque obitus vester nobis nunciatus fuerit, pro vobis fiet, sicut pro fratribus nostris defunctis fieri est consuetum in officiis diuinis. In huius rei firmius testimonium sigillum domus Nemerowe ex sciencia omnium inibi fratrum presentibus est appensum. Datum anno domini M°CCCXLVII°, ipso die beati Michaelis archangeli.
Auf Pergament in einer kleinen, festen Minuskel. An einem Pergamentstreifen hängt ein kleines, 1 1/2 Zoll langes, elliptisches Siegel, mit eingelegter rother Wachsplatte: im leeren Siegelfelde steht St. Johannes der Täufer und neben ihm das Lamm; Umschrift:

Nr. XIV.
Der Herzog Johann von Meklenburg verkauft an die Johanniter-Comthurei Nemerow ein Holz zwischen Rowa, Stargard und der Tollense (später die Burgkavel genannt), mit Beden, Eigenthum, Gericht, Weide und allen andern Rechten.
D. d. Stargard 1355. Aug. 19.
Nach dem Originale im königl. Geh. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
Wy Johan van der gnâde godes hertoghe tů Mekellenborch, tu Stargard vnd Rozstok bekennen vnde betûghen ôpenbar in desseme ieghenwardighen brîue, dat wy mit râde vnser trûwen râtgheuen vnd mit gantzer vulbort hebben vorkoft den gheystlyken lûden brûder Adolphe van Swalenberghe deme kummeldûre vnde deme couente tu Nemerow der brůdere des ordens des hilleghen hûses des hospitales sunte Johannes tu Jerusalem, dat holt vnde dy stede des suluen holtes, dat dar licht tusschen ereme holte vnde tusschen Heydenrykes holte van Werbende, vnses borchmannes des hûses tu Stargard, vnde der see der Tollense vnde der marcscheydinge des dorpes tů Růue mit alleme eyghendůme, vryheyt, richte, in deme hôghesten vnde in deme sydesten, vnde mit aller nůt, vnde bynâmen


|
Seite 268 |




|
mit der weyde, alse wy vnde vnse olderen in gûder dechtnisse it vryest ghehat hebben vnde beseten, âne iênnygherleye ansprâke, êne hůue vôr vyf mark vnde hundert wendesscher penningh, dy uns dy vôrsprôkene kummeldůr vnd dy brûdere redeleken betâlet hebben. Wêret âuer dat dâr mêr ghevůnden worde, wen men dat vôrbenûmede holt vnde dy stede des holtes mête, so schal de kummeldůr vnd dy brůdere vôr yslike morghen also vele betâlen, alse he ghůlde an der hůue. Hîr vmme vorsâke wy des vôrsprôkenen holtes vnde syner stede vnde vorlâtent in desseme ieghenwardighen brîue den vôrsprôkenen kummeldůre vnde brûderen tu erer hant vnde behûue, vnde lôuen en ôk in desseme brîue, dat wy willen wêren en vnd vthstân vp vnse koste alle recht vnde ansprâke, wôr vnd wenne vnd vôr weme dat vôrbenůmed holt vnde syne stede anghesprôken wert. Wy hebben ôk den suluen kummeldůr vnde brûdern lâten wysen vnde synt ghewyset in de wêre des vôrbenûmeden holtes vnde der stede van den êrbaren lûden Dedewyghe van Ortze vnde Heydenrike van Werbende, vnsen mannen, dy sy van vnseme heyte ghewyset hebben in dat vôrbenûmede holt vnde in dy stede des suluen holtes, dat sy dy besitten vnde hebben schôlen, alse wy dy beseten vnde ghehat hebben an eyghendůme vnde an richte in deme hôghesten vnde in deme sydesten myt aller nůt, also vôrgheschreuen is. Dat wy vnde vnse eruen desse vôrbenůmeden stucke vast, ganz vnd vntůbrôken scôlen vnd willen holden, so hebbe wy vnse yngheseghel an dessen brîf lâten hengen tu êner grôteren betûghinghe. Tûghe desser dingh sint vnse trůwen: greue Otte van Vorstenberghe, Albrecht vnd Herman Wareborch, Lyppold Bere vnde Vicke Munt, riddere, Herman van Gudensweghe, Enghelke vnde Albrecht Warborch, knapen, vnde meer lůde nůch dy lôuen werdich syn. Desse brîf is ghegheuen vnde gheschreuen tů Stargarde na godes bôrt drůtteyn hundert iâr in deme vyf vnde veftyghesten iâre, des nêghesten middewekens [n]a der hemmeluârt unser lêuen [urû]wen.
Auf Pergament in einer kleinen cursivischen Minuskel, welche an mehrern Stellen verblichen ist. Das Siegelband ist von grüner Seide; das Siegel fehlt. Nach einem Urkunden-Protocolle ward im 17. Jahrhundert das Holz Burgkafel genannt.


|
Seite 269 |




|
Nr. XV.
Der Herzog Johann von Meklenburg verleiht der Johanniter-Comthurei Nemerow das Dorf Rowa, welches diese von der Stadt Neu-Brandenburg gekauft hat, mit denselben Rechten, mit denen es die Stadt besass, und mit Befreiung von allen Lasten.
D. d. Neu-Brandenburg. 1356. Jan. 4.
Aus einem Diplomatarium auf Papier aus dem 15. Jahrhundert im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Vniuersis Christi fidelibus presencia visuris uel audituris. Nos Johannes, dei gracia dux Magnopolensis, Stargardie ac Rotstok, salutem in domino sempiternam. Tenore presencium publice recognoscimus protestantes, quod constituti in nostra presencia dilecti nostri consules ciuitatis Noue Brandenborch de consensu et beneplacito omnium suorum, quorum intererat uel interesse poterat, et matura deliberatione prehabita , iusta vendicione vendiderunt coram nobis resignando commendabilibus viris ac dominis fratribus conuentus domus Nemerow fratrum ordinis domus hospitalis beati Johannis Jerosolimitani totam villam Ruue, prout in suis distinctis terminis existit situata, cum iudicio supremo, videlicet manus et colli, et imo, cum precariis omnibus et omnibus pertinenciis, cumomni iure et fructu, vtilitate, libertate et cum omni proprietate, quibus predicti consules antedictam villam a patre nostro pie memorie et nobis liberius hucusque noscimus habuisse, sicut eciam in littera patris nostri antedicti super hoc confecta lucidius continetur. Nosque vendicioni ac resignacioni predictorum consentientes atque litteram predicti patris nostri iam tactam gratificantes et ratificantes, villam prefatam cum omnibus condicionibus prescriptis, precibus parcium vtrarumque inclinati, fratribus antedicte domus Nemerow fratrum antedicti ordinis donauimus et dimisimus, et presentibus donamus et dimittimus, sine omni impedimento nostri uel successorumnostrorum, aduocatorum uel officialium nostrorum, qui pro tempore fuerint, et sine onerequocumque, perpetuis tem-


|
Seite 270 |




|
poribus pacifice possidendum. In cuius rei euidenciam pleniorem sigillum nostrum presentibus duximus appendendum, presentibus nostris fidelibus: domino Ottone comite de Vorstenberge, Alberto Warborch, Lippolto Beren, Viccone Munt, Alberto de Peccatil, militibus, Enghelkino et Alberto fratribus dictis de Warborch, et aliis pluribus fide dignis. Datum Brandenborch anno domini M°CCC° quinquagesimo sexto, feria secunda proxima ante festum Epiphanie domini nostri Jesu Cristi.
Nr. XVI.
Der Herzog Johann von Meklenburg verkauft der Johanniter-Comthurei Nemerow das Eigenthumsrecht über 9 1/2 Hufen und den Krug im Dorfe Staven mit hoher und niederer Gerichtsbarkeit, Bede und Dienst und allen andern Rechten.
D. d. 1358. Jan. 25.
Nach dem Originale im königl. Staats- und Cabinets-Archive zu Berlin.
Wy Johan van der genâde godes hertoge to
Mekelenborch, to Stargarde vnde to Rozstocke
bekennen vnde betûgen ôpenbar in desseme
iegenwardigen brêue, dat wy myt râde vnser
trûwen râtgheuen vnde myt gantzer vůlbort
hebben verkoft den geystliken lûden dem orden
des hylgen hûses des hospitalis sente Johannis
to Jherusalem, den brôderen des hûses to
Nemerowe, den êgend
 m ôuer teyndehalue hôuen, de dâr
licgen binnen vnser herschap in dem dorpe to
Stouen, der seluen hôuen heft de schulte vêre
vnde sestehalue hebben de bûre dârsulues, vnde
den krôch, de her Vicke van Gudenswegen heft van
vns to lêne gehat vnde vôr uns verlàten heft dem
vôrsprôken orden vnde brôderen to Nemerowe.
Desse vôrbeschreuenen hôuen schôlen desse
vôrebenômeden brôdere hebben vnde besitten
êwilken myt alleme êghene, myt alleme rechte,
myt dem hôgesten richte vndemyt deme sydesten,
myt bêde, myt dêneste, mit beschattinghe, myt
m ôuer teyndehalue hôuen, de dâr
licgen binnen vnser herschap in dem dorpe to
Stouen, der seluen hôuen heft de schulte vêre
vnde sestehalue hebben de bûre dârsulues, vnde
den krôch, de her Vicke van Gudenswegen heft van
vns to lêne gehat vnde vôr uns verlàten heft dem
vôrsprôken orden vnde brôderen to Nemerowe.
Desse vôrbeschreuenen hôuen schôlen desse
vôrebenômeden brôdere hebben vnde besitten
êwilken myt alleme êghene, myt alleme rechte,
myt dem hôgesten richte vndemyt deme sydesten,
myt bêde, myt dêneste, mit beschattinghe, myt


|
Seite 271 |




|
manschap, vnde vertygen aller herschap, de wy an den vôrsprôkenen hôuen gehat hebben vnde vnse elderen vôr uns dàr an hebben gehat. Hyr vôre hebben se vns gegeuen vnde rêde betâlet twê hundert marc vnde anderhalue marc vnde vêrtich vinkenôgen penninghe. Ok schôlen se vnser elderen vnde vns, hertogen Albrechte vnde hertogen Johan brůdere, vnde alle vnse elderen vnde nakômelinghe in êner êwighen dechtnisse hebben. Vnde desser brêue hebbe wy entwê besegelet ghegheuen in êner wys. Vppe dat alle desse vôrbeschreuenen dinc stede, vast vnde vntobrôken blîuen, so hebbe vnse ingesegel an dessen brêf ghehenget. Dêdinges lûde desser vôrsprôkenen stucke hebben gewest: brôder Olrik van Regensten, cummendur to Nemerowe, vnde greue Otte van Vorstenbergher vnde her Lyppolt Bere. Tûghe desser dinghe sint: her Albrech t Waborch, her Vicke Munt, her Jacob van Dewiz, riddere, her Jan Woldecker vnde her Klawes van Arneborch, prystere, her Tzanderus vnde Hinricus Rode, vnse schrîuere, vnde anderer gûden lûde vele, den to gelôuende is. Desse brèf is ghegheuen na godes bôrt dûsent iàr drêhundert iàr in deme achte vnde veftigesten iàre, in deme dâge der bekêringhe sente Paules des hylgen apostoles.
Auf einem oblongen Pergament in einer fetten, grossen Minuskel; das Siegel ist von dem Pergament-Siegelbande abgefallen. Auch der zweiten ähnlichen Original-Ausfertigung fehlt das Siegel.
Nr. XVII.
Der Johanniter-Orden, und im besondern die Ordens-Comthurei Mirow, verkauft den Brüdern Wedege und Henning Plate die Mühle zu Wesenberg zu einem rechten Erblehn.
D. d. Quartzan. 1376. Nov. 9.
Nach einer alten Copie im grossherzogl. Geh. u. HauptArchive zu Schwerin.
Wii b(e)ruder Bernd van der Schulenborgh, ordens sunte Johannes des hilgen hûses des hospitals van Jerusalem, meyne bidiger in Sassen,


|
Seite 272 |




|
in der Marke, in Wentlande vnde in Pamern, bokenne vôr al, de dessen brêff anseen edder hôren lesen, dat wii hebben angeseen mennichvaldigen grôten dênst, den de êrnbarn knechte Wedeghe Plate vnde Henninck syn brôder vnse vorvàren sêlige vnsen orden vnde vns dicke gedàn hebben vnde sunderliken dem hûse to Myrow vnde noch dûn môgen, na gantzem râde vnde vulbort brûder Hinrick van Heynborg vnde der meynen brûdere to Myrow vnde alle vnser cumpter, de bii vns wêren in vnsen gespreke, dat wii hêlden in vnses orden hûse to deme Quartzan des mândages vnde in der weken vôr sunte Martens dâge in deme nascreuen iâre: Hinrick van Wedel to Lagow, Henningh van Wedel to deme Quartzan, Henninck van Guntersberge to Tzocham, Hinrick van deme Kruge to Nemerow, Hinrick van Aluenscleueto Tempelborch, Wilhelmus Holsten to den Rorik, Ditleues van Walmedento der Litzen, Albrechtes van Werbergheto Supplenborch, Hinrick Dossekento Tempelhaue, Reyneke Trammen to Brak 1 ), vnde hebben en vorkofft rekkelken vnde redelken vnse molne to Wesemberghe myt aller tobehôringe, vrîheit, nuth vnd aller rechticheit, also wii vnde vnse orde de wente an dessen iegenwerdigen dagh beseten vnde gehat hebben, to eyneme rechten erfflêne vôr drêhundert brandeborgesche mark suluers, der twêhundert mark gekâmen is in de schult to Myrow vnde hundert to deme gelde, dat wii den meyster van dûdesschen lande geuen musten, vnde hebben gensliken van der vôrgenanten mâlen gelâten vnde lâten âue myt dessem brêue van aller rechticheit, frucht, nuth, vnde tobehôringe de wii vnde vnse orde dàr ane gehat hebben, sunder dat wii vns vnde alle vnsen nakâmeren hebben bohalden dat leen der vôrscreuen mâlen êwichliken to lîende, also dat vôrgenante Wedego vnde Hennink syn brûder vnde ere rechte eruen de vôrgnante molne schâlen entfân to leyne van vns edder alle vnsen nakâmern, wo dicke see des boderuen vnde id em van rechte nôt is, vnde Willen vnde schâlen ender vôrgenanten


|
Seite 273 |




|
mâlen eyn recht gewêre syn vôr al den gênnen, de sick dâr myt rechte to teen môgen. Ok schal de vôrgerôrte mâlen der vôrgenanten Wedigens, Henninck synes brûders vnde erre rechten eruen êwighe rechte sàmende hant blîuen vnde schal nynerleye dêlinge, noch gesundert rôk offte brôt dâr ane hinderen, krenken edder de sâmede hant tobreken, dâr wii edder alle vnse nakâmern sii edder ere eruen iummer vmme bodêdingen, boschuldigen edder anverdigen môgen. Wêre ôck dat de vôrgenante Wedegho vnde Henninck syn brôder edder ere eruen de vôrgerôrte mâlen vorkôpen wolden dorch nôt edder dorch ênger ander sâke willen, so schâlen see vns edder al vnsen nakâmern den kôp kundigen vnde âpenbârn; wôr see denne de vôrgerôrte mâlen andern lûden vmme geuen, dâr schôle wii edder alle vnse nakâmern de vôrgerôrte mâlen wedder vmme kôpen, offte wii willen; wêr âuer offte wii edder vnse nakâmern den weddercôp nicht endôn mochten edder dôn wolden, so schâle wii de vôrscreuen mâlen lyen, weme sy see vorkôpen myt sodânem rechte, also hîr vôr screuen is. Vnde hebben dorch eyner gantzen vasticheit vnde vnbrekelken to holden, alle vôrscreuen stucke van vns vnde alle vnsen nakâmern vnde dorch eyner mêr botûgunge vnde gantser bokentsnisse dessen brêff bosegelt myt vnsen ingesegelen vnde des hûses to Myrow vnde myt al vnser vôrscreuen cummedûre vnde is gegeuen na gâdes bôrt dûsent iâre drêhundert in deme sos vnde sêuentichsten iâre, des sôndâges vôr sunte Mertens dâge des hilgen bigtegers.
Auf Papier in einer ungefähr gleichzeitigen Abschrift.


|
Seite 274 |




|
Nr. XVIII.
Der Herzog Ulrich von Meklenburg verleiht der Johanniter-Comthurei Nemerow das Schulzengericht zu Bargenstorf, welches diese von den von Oertzen wiederkäuflich gekauft hat.
D. d. 1409. Febr. 2.
Nach einer Abschrift aus dem 17. Jahrh. im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Wy Vlrick van godes gnâden hertoge to Mecklenborch, Stargarde vnde Rostock der lande here bekennen âpenbahr in dissem brêve, dat Clawes van Ortzen vnde [sîne sôns] Hermen, Dreves, Ficke êndrechtiglick vôr vns hebben vorlâten dat schultenrichte to Bargenstorp mit richte vnde dênste hôgeste vndt sîdeste vnde mit soss marck pacht, so idt licht in sînen enden vnde schêden mit veer hûfen vnde aller gerechticheit, nich dâvan to beholdende, allêne den wedderkôp. Dit gerichte hebbe wy vort vorlênt, wo bâwen berôrt, na erer bede vndt willen den gadeshûszlûden [to] Nemerow, de nu sunt vnde nakâmende sunt, to êner lampe vndt to deme lichte, dat me holden vnde hebben schall dârsulvest vor hilligem lichenam vnde in de ehre gâdes vnde sîner lêuen môder vnde de ehre Johannis Baptistae, also mede beschêden, dat de van Ortzen vôrbenômt vndt ere eruen macht hebben schôlen, dat vôrbenômede schultenrichte mit sînen pechten vndt aller gerechticheit wedder to kôpende vndt tho lôsen van den vôrbenômden heren tho Nemerow vôr sostig mark vinkenôgen penninge, welkere munte als de heren van Nemerow dâr vôr hebben gegeben vnde hebben des to ênem anwîser geven Berent Beren vnsern man. To thûge vndt tho mêr bewâringe, so hebbe wy vnse ingesegel hengen lâten vôr dissen brêff, de geven vndt schreven isz dûsent iahr veerhundert dârna in dem negeden iahr, in dem sunnâvende vnser lêven frûwen lichtmisz.


|
Seite 275 |




|
Nr. XIX.
Der Herzog Heinrich von Meklenburg verpfändet der Johanniter-Comthurei Nemerow für 250 rheinische Gulden die Bede aus dem Comthurei-Dorfe Gr. Nemerow.
D. d. Neu-Brandenburg. 1474. Jan. 5.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geb. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Wy Hinryk van godes gnâden hertoge to
Mekelenborch, forste to Wenden, greue to Swerin,
Rostock vnd Stargarde etc. der lande here
bokennen âpenbare, betûgende vôr vns, vnse eruen
vnde vôr alsweme, dat wy rechter witliker schult
schuldich sint deme strengen, êrbaren vnde
duchtigen vnsem lêuen getrûwen her Jochim
Wagenschutten, comptor to Mirow vnde to Nemerow,
druddehalfh
 ndert v
ndert v
 lwichtige rînsche gulden, de he
vns rêde an rêden golde gelênet vnde an eyneme
summen berêt vnde âuergetellet heft, de wii vort
in vnse vnde vnser eruen nůth vnde frâmen
vnde in vnser lande beste gekêrt hebben, dâr vôr
wii eme settet vnde vorpandet hebben, vorsetten
vnde vorpanden eme ieghenwardigen vnse bêde alse
hůndert mark vinkenôgen des gadeshûses
dorpe to Groten Nemerow to êneme brûckliken
pande in kraft desses brêues, so dat de genante
her Jochim, alle syne nakômelinge des gadeshûses
to Nemerow vnde de gantze orden sodâne h
lwichtige rînsche gulden, de he
vns rêde an rêden golde gelênet vnde an eyneme
summen berêt vnde âuergetellet heft, de wii vort
in vnse vnde vnser eruen nůth vnde frâmen
vnde in vnser lande beste gekêrt hebben, dâr vôr
wii eme settet vnde vorpandet hebben, vorsetten
vnde vorpanden eme ieghenwardigen vnse bêde alse
hůndert mark vinkenôgen des gadeshûses
dorpe to Groten Nemerow to êneme brûckliken
pande in kraft desses brêues, so dat de genante
her Jochim, alle syne nakômelinge des gadeshûses
to Nemerow vnde de gantze orden sodâne h
 ndert marck bêde rouweliken alle
iâr van iâren to iâren so qwît so vrîgh vpheuen,
hebben, brûken vnde bositten schôlen vnde môgen,
alse de hôchgebârnen fursten zêligen here
Hinrick vnde here Olrick vnse lêuen vedderen,
den god gnêdich sy, vorheen vnde wii nâ bethe
hêrtho de alderquîtest vnde frîgest gehath,
gebrûket vnde boseten hebben, vns edder vnsen
eruen dâr nichtes ane to beholdende, vnde wy
edder vnse eruen schôlen vnde willen deme
genanten her Jochim, synen nakômelingen des
gadeshûses to Nemerow vnde deme gantzen orden
sunte Johannes baptisten der bêde eyn gantze
wêre wesen vôr alle ansprâke geystliker edder
werliker persônen, de vôr recht
ndert marck bêde rouweliken alle
iâr van iâren to iâren so qwît so vrîgh vpheuen,
hebben, brûken vnde bositten schôlen vnde môgen,
alse de hôchgebârnen fursten zêligen here
Hinrick vnde here Olrick vnse lêuen vedderen,
den god gnêdich sy, vorheen vnde wii nâ bethe
hêrtho de alderquîtest vnde frîgest gehath,
gebrûket vnde boseten hebben, vns edder vnsen
eruen dâr nichtes ane to beholdende, vnde wy
edder vnse eruen schôlen vnde willen deme
genanten her Jochim, synen nakômelingen des
gadeshûses to Nemerow vnde deme gantzen orden
sunte Johannes baptisten der bêde eyn gantze
wêre wesen vôr alle ansprâke geystliker edder
werliker persônen, de vôr recht


|
Seite 276 |




|
kâmen, recht geuen vnde nemen willen; doch hebbe
wy vns vnde vnsen eruen beholden den wedderkôp,
alse wannêr wii edder vnse eruen de lôsen
willen, so schôle wii eme edder synen
nakômelingen toseggen vp ênen sunte Johannis
baptisten dach, vnde gheuen eme edder synen
nakômelingen denne sodâne druddehalfh
 ndert gûde vulwichtige rînsche
gulden myt der bedâgheden bêde wedder vppe den
nêgest folgeden sunte Martens dach ofte in den
achte dâgen to sunte Marten an êneme summen
bynnen Brandenborch edder vpp eyner andern stede
in deme lande to Stargarde, wôr id eme edder
synen nakômelingen alderboquêmest is; vnde desse
vôrgescreuen bêde schal vnde mach de genante her
Jochim edder syne nakômelinghe panden edder
panden lâten, so vâkene en des nôth vnde behôff
dônde wert sunder brôke der herschopp vnde
vorbêdynghe vnser edder vnser eruen amptmannen
vnde vogeden, vnde we dessen brêff heft myt des
êrbenômeden her Jochimes edder syner nakômelinge
willen, deme schal he so behulplick sîn de bêde
to bôrende, gelîck ift he eme van worden to
worden togescreuen wêre. Hiir an vnde âuer sint
gewesen de strenge vnde duchtige her Lutke Hane
ritter vnde Herman Haghenow vnde de êrsame vnde
werdige Hermen Glineke borgermeister to
Brandenborch vnde Laurencius Stoltenborch vnse
scrîuer. Alle desse bâuenscreuen stucke vnde
articule vnde eyn îslik by sick lâuen wii
vpgenante here vnde furste vôr vns vnde vnse
eruen deme obgenanten her Jochim Wagenschutten,
alle synen nakômelingen, deme gantzen orden vnde
deme hebbere desses brêues myt ereme willen in
gûden trûwen stede vnde vaste wol to holdende
sunder argelist vnde alle gefêrde, vnde hebben
des to ôrkunde vnse secrete ingesegel witliken
hengen hêten an dessen brêff. Geuen vnde screuen
to Brandenborch na Cristi gehôrt
vy
e
rteyn hundert iâr dâr na amme vêr
vnde sôuentigesten iâre, ame âuende der hilgen
drîer kôninghe.
ndert gûde vulwichtige rînsche
gulden myt der bedâgheden bêde wedder vppe den
nêgest folgeden sunte Martens dach ofte in den
achte dâgen to sunte Marten an êneme summen
bynnen Brandenborch edder vpp eyner andern stede
in deme lande to Stargarde, wôr id eme edder
synen nakômelingen alderboquêmest is; vnde desse
vôrgescreuen bêde schal vnde mach de genante her
Jochim edder syne nakômelinghe panden edder
panden lâten, so vâkene en des nôth vnde behôff
dônde wert sunder brôke der herschopp vnde
vorbêdynghe vnser edder vnser eruen amptmannen
vnde vogeden, vnde we dessen brêff heft myt des
êrbenômeden her Jochimes edder syner nakômelinge
willen, deme schal he so behulplick sîn de bêde
to bôrende, gelîck ift he eme van worden to
worden togescreuen wêre. Hiir an vnde âuer sint
gewesen de strenge vnde duchtige her Lutke Hane
ritter vnde Herman Haghenow vnde de êrsame vnde
werdige Hermen Glineke borgermeister to
Brandenborch vnde Laurencius Stoltenborch vnse
scrîuer. Alle desse bâuenscreuen stucke vnde
articule vnde eyn îslik by sick lâuen wii
vpgenante here vnde furste vôr vns vnde vnse
eruen deme obgenanten her Jochim Wagenschutten,
alle synen nakômelingen, deme gantzen orden vnde
deme hebbere desses brêues myt ereme willen in
gûden trûwen stede vnde vaste wol to holdende
sunder argelist vnde alle gefêrde, vnde hebben
des to ôrkunde vnse secrete ingesegel witliken
hengen hêten an dessen brêff. Geuen vnde screuen
to Brandenborch na Cristi gehôrt
vy
e
rteyn hundert iâr dâr na amme vêr
vnde sôuentigesten iâre, ame âuende der hilgen
drîer kôninghe.
Auf Pergament mit schlechter Schrift. An einem Pergamentstreifen hängt des Herzogs Heinrich dreischildiges Siegel mit eingelegter rother Wachsplatte. Die Urkunde ist zum Zeichen der Einlösung durchschnitten.


|
Seite 277 |




|
Nr. XX.
Die Herzoge Magnus und Balthasar von Meklenburg entscheiden die Streitigkeiten des Klosters Himmelpfort und der Johanniter-Comthurei Nemerow über die Seen von Dabelow, Brengentin und Linow dahin, dass das Kloster Himmelpfort dieselben auch fernerhin in ungestörtem Besitze behalten soll.
D. d. Friedland. 1480. Julii 9.
Nach dem Concept im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Wy Magnus vnnd Baltzar gebrûdere vonn gotes gnnâden hertogenn to Meckelenborg, furstenn to Wenden, grauen tho Zwerin, Rostock vnnd Stargarde etc. der lande herenn, dônn kundt vnnde bekennen ôpenbar, dy dessen vnsern ôpen brîff sehen oder hôren lesin, also denn de wirdige vnnde andechtige her Johann abbeth des clôsters Hemmelporte vnnde er Hinrick Bust comptor des hûses vnnd hôues Nemerow, vnse getrûwenn, vmme ethlike stânde wâtere vnnde sêhe benômeliken den sêhee to Dabelow, sêhe Brengentin vnde dy sêhe Lynow langetîde lang in twydracht vnnde erdom gestân hebben, hebben wy dy vôrgnanten an beiden parten vôr vns vnnde in iegenwardicheith vnser rêde so vôrschreuen vnnde enthricht na vtwîsunge erer vôrsegelden bryue an beiden parten vôr vnns getôget, also dath dy vôrgemelten her Johann abbeth des clôsters Hemmelporte vnnde syne nakômelinge sodâne vôrbenômeden dree sêhen vredesam beroweliken vnnd vnuorhinderth gebrûken schâlen, in mâthen so sy van olders gebrûket vnnd in wêrunge gehardt hebben, ôck so des ere vorsegelde bryue inholden vnnde vthwysen. Hîr by an vnnd ôuer synth gewesth dy gestrengen vnnd duchtigen vnnse rede vnnd lîuen getrûwen: er Nicolaus Hane ritter, Ludeke Moltzan marscalk, Hinrick vnnde Vicke gnanth dy Riben vnnde Hans van Hellppte. Geschên bynnen vnser stadt Fredelande vnnder der octauen visitacionis vnder vnsem vpgedruckeden ingesegel vorsegelt anno etc. LXXX°.


|
Seite 278 |




|
Nr. XXI.
Der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg giebt seinem Lehnmann Joachim Holstein die Comthurei Nemerow auf drei Jahre.
D. d. 1552. März 14.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geb. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Von gottes gnaden Wir Johans Albrecht hertzogk zu Meckelnburgk etc. Bekennen hiemit offentlich, das wir dem erbarn vnserm Lehenmann vnd lieben getrewen Joachim Holstein in betrachtunge seiner getrewen dienste, die er vns bereits geleistet vnd gethan, auch hinfurter noch thun kan, soll vnd will, das haus vnd Comptorey Nemerow mit alle seiner ein- vnd zubehorunge, vfkommen vnd nutzung drei Jhar lang die nechstfolgenden eingethan haben, Thuen auch dasselbe hiemit in kraft vnd macht dieses vnsers brieues wissentlich, Doch haben wir vns vnser gewonliche ablager vnd Ritterdienst darhan vorbehalten. Dess zu vrkundt mit vnserm vfgedruckten Pitzschir vorsiegelt vnd geben zu Schwerin den vierzehenden tagk Martii Anno etc. 1552.
Nr. XXII.
Thomas Runge, Meister des Johanniter-Ordens zu Sonnenberg, verleiht dem Joachim von Holstein die Comthurei Nemerow, das Priorat Braunschweig und die Anwartschaft auf das Priorat Goslar.
D. d. Sonnenberg. 1553. April 17.
Nach einer vidimirten Abschrift im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Wir bruder Thomas Runge sant Johans ordens des heiligen hauses hospitals zu Jerusalem in der Marcke, Sachsen, Pommern vnnd Wendtlandt meister vnnd gemein gebietiger Bekennen in diesem vnnsernn offenen brieff vor vnns vnnd vnsere nachkom-


|
Seite 279 |




|
mende meister vnd orden vnnd sonst iedermenniglich, Demnach wir hiebeuorn vnserm lieben gehorsamen, dem wirdigen vnd erenvesten Ern Joachim Holstein vff sein vleissigs bitten für ein gliedtmass vnsers ritterlichen ordens haben vffgenomen vnd inen nach geleisteter pflicht, alten hergebrachten gebrauch vnnd vnsers ritterlichen Ordens Stabiliment ordenunge nach haben eingekleidet, Als habenn wir ime zu erhaltunge dieses seines angenomenen standts vnnsers ritterlichen ordens haus vnd Compturei Nemerau sampt dem priorat zu Brunschwigk vnd nach absterben Ern Hansen Rohr das priorat zu Goslar mit allen iren ein vnnd zubehorunge, in massenn wie sie von Alters dem orden zustendigk vnd von den vorigen Ern Comptore besessen vnnd innegehabt, vorliehen, eingereumbt vnnd eingethan, Vorleihen, einreumen vnnd thun ein vorgemelten dem von Holstein obberurte Compturei vnd priorath wie vorerwent, für vnns vnd vnsere nachkommen meister vnnd gantzen Orden in Crafft dieses Brieffs, also das nuhe vnnd hinfurtt ehr als ein volmechtiger regierender vnd bestettigter Compter aller, herligkeitt vnd nutzunge gedachter Compturei vnnd priorats des zu Brunschweigk, auch vff den fall der vorledigunge des priorats zu Gosslar vnserm Ritterlichen Orden vnd sich selbst zu Ehrenn vnnd besten, vff Zeitt vnnd Lauff seins lebens gebrauchen vnd geniessen soll vnnd magk, Jedoch mit dieser Condition vnnd vorbehaltunge, das ehr sich gegen vnns, vnsern nachkommenden Meistern vnd gantzem Orden schuldigs gehorsams nach gethaner vorwandtnus vorhalte vnnd gelebe, sein schuldigk Respons ahm volwichtigenn reinischen golde jerlichen vff Johans Baptista gehn der Sonnenburgk zur Stedte vorordne, der Compturei vnd Priorats getreulichen vnnd woll vorstehe, die armen Leute, so darzu gehörigk, wieder alt herkommen nicht beschwere, noch belestige, auch die gebeuden in baulichen wirden vnnd wesen erhalte vnnd sonsten alles das jenige, was einem Rittermessigen gehorsamen Comptorn gegen seinen vbern vnd gantzem Orden zu thune eigent vnd geburtt, leiste vnnd pflege. Alles getreulich vnd ohn alle gefehrde. Des in vrkundt haben wir vnser Insiegil hier vntenn anhangen lassen vnnd gegeben zur Sonnenburgk nach Christi vnsers


|
Seite 280 |




|
lieben hern geburt im funffzehen hundersten vnd drey vnd funffzigsten jare, montags nach Misericordias domini.
Praesentem hanc copiam cum suo vero ac sigillato originali de verbo ad verbum concordare, Ego Jacobus Kroegerus S. Imp. auctoritate Notarius publicus propria hac mea subscriptione attestor.
Nr. XXIII.
Der Herzog Ulrich von Meklenburg verleiht dem Joachim von Holstein die Comthurei Nemerow.
D. d. Bützow. 1555. Febr. 3.
Nach einer vidimirten Abschrift im grossherzogl. Geb. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Von Gottes gnaden Wir Ulrich, hertzogk zu Meckelenburgk etc. Bekennen unnd thun kundt hiemit offentlich, als uns der erbar, vnser lieber getreuer Achim Holstein vnderthenig berichten lassen, wie das ime der erwirdiger vnser besonder lieber herr Thomas Runge, sanct Johans Ordens in der Marcke, Pommern vnnd Wendland meister, die compturei Nemerow die zeit seins lebens sich der zu gebrauchen vnnd zu geniessen, inmassen seine vorfarn daselbst die Comptorn dieselben auch innegehat vnnd genossen, vermuge derhalben auffgerichteter vnnd ime gegebener vorschreibunge, belehnet vnd vorschrieben, mit vndertheniger pitt, das wir als der Landesfurst, darunter dieselbe berurte Compturei inn, vnserm lande zu Stargart gelegen, unsere, bewilligunge vnd Consens Brieff ime darüber auch, jedoch ihn allewege vnsernn daran habenden ablegern vnnd alt hergebrachten gerechtigkeiten vnabbruchlich, gnediglich mitteilen wolten: Demnach so haben wir solche seine vnderthenige pit als zimlich, in gleichen auch seine vnderthenige treuhe dinste, die ehr vns kunfftiglich wol thun kan, sol vnd wil, erwogen vnnd ime darauff dissen vnsernn offentlichen wille brief gnediglichen gegeben, Bewilligen vnnd befulboren kraft desselbigen hiemit offentlichen ime solche vorberurte compturei zu Nemerau in der bestendigsten form, masse vnd weise, als solchs am krefftigsten zu rechte oder nach art vnnd natur dieses handels ge-


|
Seite 281 |




|
schehen sol, kan oder magk, dieselbigen vorgemelten compturei Nemerow die zeit seines lebens als seine vorfarn die Comptorn die auch gehat, ohne einigen vnsern eintragk oder vorhinderunge geruiglich vnnd friedesam zu besitzenn, zu geniessen vnd zu gebrauchen, jedoch vns an vnsernn geburlichen ablegern vnnd gerechtigkeiten volkomlichen vnd in aller massen, was die vnsere freuntliche liebe hernn vater vnnd vetter, her Albrecht vnd herr Heinrich, gebruder, weilandt hertzogen zu Meckelnburg etc. loblicher milter gedechtnus, vnnd vnsere lobliche vorfarn, die hertzogen zu Meckelnburg etc. daran allenthalben gehabt vnd vf vns gefellet vnd gebracht, die wir vns hiemit austrucklichen vorbehalten, vnnd auch einem jedernn an seiner gerechtigkeit vnschedtlich. Vrkundtlichen mit vnserm Pitzschier in rechter wissenschaft versiegeltt. Datum Butzau den dritten Februarii na Cristi vnsers lieben hern geburt der weniger Zall im fünf und funftzigsten jare.
Quod hoc praesens Exemplar cum suo uero subcripto ut patet ac sigillato originali de uerbo ad uerbum concordat, go Jacobus Kroegerus S. Caesarea auctoritate publicus Tabellio propria hac mea subscriptione affirmo.
Nr. XXIV.
Martin Graf von Hohenstein, Meister des Johanniter-Ordens zu Sonnenburg, reversirt sich gegen den Herzog Ulrich von Meklenburg, diesem die Nomination zur Comthurei Nemerow für den nächsten Erledigungsfall zu überlassen und die landesherrlichen Gerechtsame an der Comthurei anzuerkennen.
D. d. Sonnenburg. 1573. Aug. 30.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Wir Martin Graffe von Honstein, her zu Vierradenn vnnd Schwedt, des Ritterlichen S. Johans Ordens, in der Marck, Sachsen, Pommern vnnd Wenden Landen Meister, Bekennen an diesem Brieffe vor vns, vnsere Nachkommen am Ritterlichen Orden


|
Seite 282 |




|
Meister, dass wir vff gnediges ersuchen des durchlauchtigen, hochgebornen Fürsten und hern hern Vlrichen hertzogen zu Meckelenburg, Fürsten zu Wenden, Grauen zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargardt hern, gewilliget haben, auff absterben des itzigenn hern Comptors zu Nemerow Jorgen von Rebekens einem andern die Comptorei Nemerow einzuthun, domit zu begnaden vnd vor einen Cumpter auffzunehmen, welchen s. f. g. benennen wirdt, doch sol solche zu diesem mhal beschehene bewilligung vns vnd dem Ritterlichenn Orden zu keiner einfürung oder nachteil gereichen, sondern wir sollen nach wie vor doselbst so wol als in andern Cumptereien einen Cumpter zu setzen vnd domit zu begnadenn haben, wie vor alters, vnnd was zu diesem mhal geschicht, soll keinen andern verstandt haben, dan das es vff vorbit des kurfürsten zu Brandenburg etc. hochgedachtem hertzogen Vlrichen zu vnderdienstlichem gefallenn geschehen. Wan nhun s. f. g. innerhalb sechs monaten ein benennen vnd vns darauff ersuchen werden, denselben vff des itzigen Cumpters Georg von Rebecken Todesfal domit zu begnaden vnd derselbig zu solcher Cumptereien wie sichs gebürt gnugsam qualificirt sein wirdet, so wollen wir denselben domit begnaden, doch dass ehr sich alsbaldt einkleiden lasse vnd dem orden mit Pflichten verwant mache, auch sich verpflichte, wan ehr die Compterei wircklichen einbekombt, als dan vns, vnsern Nachkommen vnd dem Ritterlichen Orden mit verreichung der Respons vnd Anderm gepürlichen gehorsam zu leisten. Wan dan auch hochgedachter hertzog Vlrich darüber begert, s. f. g. bei alle demjennigen, so dieselbige als der Landesfürst an solcher Comptorei, nemblich an Jacht, Ablager, Rossdienst, Steur vnd Landtfolge vnnd das der Cumpter s. f. g. mit ratspflicht verwant, befugt, geruiglichen bleiben zu lassen vnd solches an ihme selbst pillich, wir auch nie gemeint gewest, seiner f. g. etwas zu entziehen oder durch inhabende Cumptores entziehen zu lassen, dass s. f. g. befugt sein, sein f. g. vnnd derselben Vorforn in Besitz gehabt vnnd hergebracht: So wollen wir vns desselben zum vberfluss hiemit auch erclert vnd verpflichtet habenn, auch so viel an vns ist vnd vns gepuren will, keine verhinderung


|
Seite 283 |




|
thun, dass auch die Cumpterei Crakow in vorigen standt kommen moge. Alles getreulich vnnd ohne gefher. Zu Vrkundt habenn wir die Recognition mit vnsers Ritterlich Ordens Insiegell becrefftigett vnd mit eigen handen vnderschrieben. Datum Sonnenburg den 30. Augusti Anno etc. LXXIII.
Martin Graff von Honstein, her zu Vierraden vnd Schwedt, des Ritterlichen S. Johans Ordens etc. Meister, mein handt.
Nr. XXV.
Der Comthur Georg von Ribbeck zu Nemerow verleiht dem Hans Röggelin das Schulzengericht zu Gudendorf.
D. d. Nemerow. 1583. Mai 25.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ick Georg von Ribbeck comthor tho Nemerow, orden sancti Johannis, bekenne vor my, mynem gantzen orden nakamenden idermenniglich, das ich angesehen vnde erkandt habe meinige truwe flitige denste, die de ersame Hans Röchelin my, mynen vorfahren sehlige vnd minem orden gedahn hefft vnd noch woll dohn schall vnd mag, derhaluen vnd van besundriger gunst wegen hebbe ick dem genanten Hans Röchelin vnd sinen rechtun liues lehns eruen dat Schultzengerichte zu Minnow (to disser tidt Godendorff geheten) gelegen mit allen vnd iglichen sinen thobehorigen vnd gerechtigkeiten, als nemlichen mit 8 Hofen Landes, ock eine Grasswische, lande vnd holte, de dar heth de Thoneize hinder sienen hafe belegen, alse dat ehme nemandt darinne an grase, korne vnd holte hindern edder schaden tofugen schal, id si einem dat mit des vorgenanten Hans Rochelin weten vndt willen vergunt vnd togelaten worden, dartho ock ein wurde achten dem herdenkaten belegen. Furder befrige ick Georg von Ribbeck comptor tho Nemerow gedachten Hans Rochelin vnd sine erben mit einer freien wehr vor dem Broelschen dicke sambt frien Fischereyen vff des ordens watern vmme


|
Seite 284 |




|
Minnow belegen, ock die kruchlage by dem Schultzengerichte quit vnd frei, Darneuenst ock dat ick en gerne gebetert sehe, hebbe ick en vnd sine liues lehns eruen tho wolfart vnd beterunge des haues dat Rohr vp dem Rohrpuele vnd tho erhaldinge siner timmer vnd thune thelikeholtunge 1 ) frei gelehnt, alse solcke alle sine oldenvader, grotevader vnd vader quit vnd fri siedes beseten vnd im gebruch gehat hebben, vnd liehe ock solches alles dem vehlgenomeden Hans Rochelin vnd sinen rechten liues lehns eruen ick Georg von Ribbeck comptor tho Nemerow jegenwerdiglich vnd in crafft dieses briefes in aller mathen vnd form, so lehens recht is, vor my, mynem orden, nakamlingen vnd sonsten vor idermenniglichen vngehindert, doch my, minen Orden vnd einen jedermanne vnschetlichen an sinen rechten. Hiuor schall vndt will my, minem orden vnd nakamelingen de offt gemelte Hans Rochelin vnd sine eruen alle jahr iedes vnd alwege vff den ersten sondach na sanct Dionysii vngefehrlich geuen vnd thor nuge woll bethalen vehr marck Finckenogen 2 ) gangkhafftiger müntze vor ein Lehnpferdt. Des tho vrkundt, vester haltunge vnd wahrer bekentnusse hebbe auergedachter Georg von Ribbeck min angeborne Insiegell vnden an dissen breff dahn hangen, de gegeuen vnd geschreuen is tho Nemrow im jahr dusent viff hundert vnd dre vnd achtig, am dage Urbani.
Diese Urkunde ist wohl eine der letztern der in niederdeutscher Sprache ausgefertigten.


|
Seite 285 |




|
Nr. XXVI.
Der Comthur Ludewig von der Gröben von Nemerow leistet dem Herzoge Ulrich von Meklenburg den Rathseid.
D. d. Güstrow. 1593. Nov. 17.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ich schwere dem durchleuchtigenn, hochgebornenn Fursten vnnd hernn hernn Ulrichenn, hertzogenn zu Meckelnburgk etc., meinem gnedigen Fursten vnnd hernn, Nachdem ich durch ordentliche mittel zu einem Commendor zu Nemerow ewehlet vnd eingesetzet werden soll, vnd desswegen s. f. g. als dem fürstlichen meckelburgischen Landesfürsten für dero Interesse vorwandt vnd schuldig worden, raetspflicht zu leisten, Dass s. f. g. ich getreu, holdt vnd raetspflichtig sein will, seiner f. g. frommen vnd bestes jederzeitt wissen vnd vortsetzen, Derselben schaden vnnd nachteill meines eussersten vermugens hindern, abwehrenn vnd verwarnenn, will mich der radtschlege, so wider s. f. g. sein vnd dagegen ergehen mochten, enthalten vnd eussern, auch keinesweges dar in gehelfen, Wass mir auch von s. f. g. Radtsweise vnd auff geheim vertrawet, ohne vorwissen s. f. g. Niemandts offenbaren, sondernn solchs bey mir bis inn meine gruebe verschwiegenn behalten, s. f. g. auch von obgedachter Compterei alle vnd jede gebuer, inmassenn solche denn Landtsfürsten vonn alters gebüret, zu idertzeitt nach muglichen leisten vnd folgen lassenn vnd mich durchaus in solcher raetspflicht gegen s. f. g., wie einem ehrliebenden eigenen rad wol anstehet, verhalten, Als mir Godt helffe vnd sein heiligs wordt.
Diesen vorhergehenden Eidt hat Ludowig von der Groben von wegen der Comptorei Nemerow vnserm gnedigen Fursten vnd Herrn Hertzogk Ulrichen zu Meckelnnburgk In dero Vorgemach alhie zu Güstrow in beisein s. f. g. Räthe Herrn Hinrici Bergii vnd Herrn Laurentii Müllers, beide der Rechte Doctoren, vnd fast aller anwesenden Hoffjunckern vnderthenig geleistet. Signatum et Actum Güstrow 17. Nouembris Ao. 1593. L. Mörder.


|
Seite 286 |




|
Nr. XXVII.
Der Comthur Ludwig von der Gröben zu Nemerow leistet dem Heermeister zu Sonnenburg den Ordenseid.
D. d. Nemerow. 1593. Nov. 24.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ich Ludewig von der Gröben der jünger, Comptor zue Nemerow, bekenne an diesem Briefe vor mich, meine Erben vnndt Erbnehmen, kegen iedermenniglich, Nachdem der hochwürdige, wohlgeborne vndt edle herr, herr Martin Graff von Hoenstein, des Ritterlichen Sanct Johannis Ordens in der Mark, Sachsen, Pommern vndt Wendlandt Meister, herr zue Vierahden, vnndt Schwedt, mein gnediger herr, auf mein vnterthenigk anhalten vnd bitten nicht allein gnedig consentiret, dass mir Andreas Huenicke zue Eckstedt Erbsessen sein jus vnndt Gerechtigkeit, so er vf des durchlauchtigen, hochgebornen Fürsten vnd Herrn, Herrn Vlrichen, Herzogen zue Meckelnburgk etc., meines gnedigen Fürsten vnndt Herrn, gnedige Intercession, im vorschienen vier vnndt siebenzigsten jahre von S. G. an der Comtorei erlanget, mihr cediren vnd resigniren muegen, sondern mich auch in den Ritterlichen Orden gnediglich auf und angenommen vnd mir auf meines vorfahren an dieser Comptorey herrn Georgen von Ribbecks sehligen todtlichen Abgang solche Comptorey gnediglich conferiret vnnd vorschrieben, mich auch ferner durch S. G. Cantzler Balthasar Römern, wie im Orden herbracht, immittiren, einweisen vnd im Besitz derselben constituiren vnndt setzen lassen, davor dan S. G. ich vnterthenig danckbahr bin, Das ich demnach zuegesaget vnndt vorsprochen, zuesage vnnd vorspreche auch hiermit in krafft dieses meines Reverses uor mich, meine Erben vnndt Erbnehmen, hochgedachten meinen gnedigen Herrn S. G. nachkommenden Meistern vnndt Ritterlichen Orden getrew, gehorsam vnnd gewertigk zue sein, S. G. vnnd des Ritterlichen Ordens ehre, nutz vnnd bestes zue wissen, schaden vnd nachtheill zuewenden, mich auch auff S. G. vnndt dero Nachkommen am Ritterlichen Orden erfordern iederzeit gehorsamblich einzue-


|
Seite 287 |




|
stellen vnd das zu leisten vnndt zue thuen, was einem gehorsamen vndt getreuwen Ritter vnnd Ordenssbruder zu thuen eigenet vndt gebühret, S. G. auch meinen schuldigen Responss, alls jährlichen Zwei vndt Dreissigk Reinische Goldtgulden, allewege auf den Tagk Jhohannis Baptistae in des Ordens residenz zu erlegen, Vnndt weill solche Comtorey gantz bawfelligk befunden, von dato innerhalb zweyer Jahresfrist darein fünf hundert Thlr. zu uerbawen vnd solche gebeude am Hause, Vorwergen, Schäffereien, Stellen, Scheunen vnndt Mühlen nicht allein in Bawlichen wirden zu erhalten, sondern auch von Jahren zue Jahren zu vorbessern, die Vnterhanen darzue wieder alt herkommen nicht zue beschwehren, noch zue belestigen, oder von andern beschweren oder belestigen lassen, vnd alles das bei der Comptorei zu lassen, was das Inventarium, darauff mihr die Comptorei eingeandtwortet, besaget, Do auch einiger Mangell nach meinen Absterben befunden wurde, so sollen meine Erben vnnd Erbnehmen dem Anschlage nach alles, das an solchem Inventario mangelln würde, gelten vnndt zahlen, Da ich mich dan vor mich vnndt meine Erben bey verpfändung meiner Lehen, Haab vnndt gueter, das ich vor alles das wie obengemeldet hafften soll vnd will, vnnd das dem Allem aufrichtigk soll gelebet werden, hiemit vorpflichte, vnndt das alles bey adelichen Ehren vnnd Truwen, stet, fest vnd vnvorbruchlich zu halten vnnd dahin zu geleben, vor mich vnndt meine Erben will vorsprochen haben. Zue vhrkundt habe ich diese vorpflichtung mit meinem angebohrnem Pitschaft besiegelt vnnd mit eigenen Handen vnterschrieben. Geschehen vnd gegeben zu Nemerow den 24. Nouembris Ao. 93.


|
Seite 288 |




|
Nr. XXVIII.
Der König Gustav Adolph von Schweden schenkt dem Obersten Melchior Wurmbrand die Comthurei Nemerow.
D. d. Stralsund. 1630. Nov. 7.
Nach einer Abschrift im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Wir Gustav Adolph von Gottes gnaden der Schweden, Gothen vndt Wenden Könningk, Grossfürst in Finlandt, hertzogk zu Ehesten vndt Carelen, Herr ober Ingermanlandt, thun kundt hiemit vnd bekennen, allse vnser konnigl. Hocheidt nichtes mehr gezimen will, allse diejenige, so sich vmb vns vnd vnsere Crone woll meritiren, hinwidervmb vnsere konningl. niegung zu erweisen, das wir demnach in ansehung der guten vnd getreuen dienste, so vns vnd vnsere Crone der Wollgeborne vnser Obrister und lieber getreuwer Melcher Wurmbrandt, Freyher, des Johanniters Ordens Ritter, ein Zeitthero gethan vnd weiters thun sol, kan vnd magk, ihm besagten Obristen aus sonderbahrer konninglichen bewegnus vnd gnaden die Comptorey Nemerow, bey Neuwenbrandeburgk belegen, gegönnet, verehret vnd geschencket, massen wir ihme solche, zumahlen weill er für diesen von vnseren widerwertigen seiner eingehapten Compterey wider alle billickeitt vnd fug entsetzet worden vnd er hiezu ritterlichen zuspruch zu haben vermeinet, hiemit vnd in Crafft dieses mit allen pertinentien vnd dependirten rechten vnd gerechtigkeiten, wie die Nahmen haben mügen, nichtes dauon ausgenommen vnde allermassen die vorige Commendatores solche eingehapt, genützet vnd gebrauchet haben, zu possediren, zu nützen vnd zu gebrauchen gegönnen, vberlassen, gechenken vnd verehren wollen, ihm auch dessen ein sicher gewehr prestiren. Vhrkundt haben wir dieses mit eigener handt vnterschrieben vnd konniglichen Insigell beglaubigtt. Signatum Stralsundt den 7. 9bris 1630.
(L. S.) Gustavus Adolphus.


|
Seite 289 |




|



|


|
|
:
|
B.
Urkunden
zur
Geschichte der Kirche zu Doberan.
Nr. XXIX.
Der Bischof Brunward von Schwerin bestätigt dem Kloster Doberan die vom Bischofe Berno verliehenen Zehnten und geistlichen Gerechtsame und schenkt demselben die Zehnten aus den Dörfern Glin, Stäbelow, Redentin, Polas, Farpen, Schulenberg und Conardam bei Gelegenheit der Einweihung der Kirche zu Doberan.
D. d. Doberan. 1232. Oct. 3.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Brunwardus dei gracia Zwerinensis episcopus omnibus in perpetuum. Ex iniuncto nobis episcopatus officio cum ipsarum ecclesiarum profectu tanta cura nos prospicere condecet et inuigilare, quatinus et in nobis crescant spiritalibus et progressum habeant in mundanis: sanelicet hec ipsa vigilantia et sollicitudo ad omnium profectum spectet ecclesiarum et subditorum omnibusque generalis esse debeat et communis, altiori tamen consilio et quadam beniuolentia singulari illorum vtilitati potissimum prospicere tenetur et profectui, qui uel maiori officio caritatis, seu humanitatis studio sunt intenti, quippe qui etiam preter uictum simplicem et uestitum omnia sua hospitalitati et aliis piis operibus officiosissime tribuunt et exponunt. Considerans igitur nostre sollicitudinis discretio per Marthe sollicitudinem prouidendum esse Marie quieti, vt orantis Marie suffragiis satagentis Marthe sollicitudo ministerii iuuaretur,


|
Seite 290 |




|
ne alicuius temeritatis incursus sancte contemplacionis otium perturbaret, sicut ex apostolice sedis indulgentia monasteriis et fratribus Cysterciensis ordinis, per vniuersam ecclesiam constitutis, salubriter in multis et racionabiliter est prouisum, taliter et nos dyocesis nostre dilectis filiis eiusdem ordinis abbati Doberanensi eiusque fratribus tam presentibus, quam futuris, regularem vitam professis, in posterum prouidemus presentis auctoritate priuilegii et banno pontificali, quascumque possessiones, quecumnque bona in presentiarum possident, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis procurante domino poterunt adipisci, vt sibi suisque successoribus firma et illibata permaneant in uirtute sancti spiritus confirmantes. Preterea libertates omnes et inmunitates, a Romanis pontificibus ordini eorum concessas, necnon libertates et exemptiones secularium exactionum, a dominis et principibus uel aliis fidelibus rationabiliter ipsis indultas, auctoritate pontificali, qua fungimur, confirmamus et presentis scripti priuilegio communimus, nolentes alicuius modi uexationibus eorum sabbati amaricari quietem, sed vt securi sint et liberi a perturbatione hominum et dolore pro statu totius ecclesie nostraque salute, eo deuotius, quo securius domino offerant suorum uitulos labiorum; sed et ea specialiter, que in primordio eidem monasterio succrescenti predecessoris nostri felicis memorie domini Bernonis episcopi munificentia sunt oblata, sicut in ipsius priuilegio pretlicti monasterii fratribus concesso plenius continetur et etiam a nobis inferius describetur, inviolabili cautione vna nobiscum a successoribus nostris, ecclesie Zuerinensis episcopis, eiusque canonicis ob diuinam reueremmtiam et mutuam in Christo caritatem fratribus exhibendam rata haberi volumus et conseruari perhenniter inconcussa. Nam cum Pribslaus, Slauie dominus et princeps Magnopolensis, iam dicti pontificis consilio et instinctu, pro suorum qualitate delictorum ad dei omnipotentis seruitiunt eiusque piissime genitricis famulatum abbatie Doberan construende circumquaque possessiones et predia designasset, quoniam ad episcopum decime spectabant et iura ecclesiastica, pro uoluntate pii principis Heinrici ducis Saxonie et consensu ecclesie Zwerinensis de prediis et possessionibus decimas obtulit, tali nimirum


|
Seite 291 |




|
interposita cautione, si forte processu temporis quicquam ex ipsis prediis abalienari contingeret, decime tamen fratribus et iura ecclesiastica perpetuo permanerent, in quibus hec propriis uocabulis duximus exprimenda: decimam loci ipsius, in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinentiis suis; decimam Doberan, Domastiz, Parkentin, Wlisne, Putechowe, Stvlouwe, Radekle, decimam quatuor villarum in Cobanze, scilicet Crupelin, Brusouwe, et duarum uillarum Brunonis, estque terminus ad occidentem collis, que slauica lingua dicitur Dobimerigorca, ad aquilonem terminum facit mare; ecclesiarum vero dispositio infra terminos constitutos et sacerdotum constitutio uel baptismus et ius synodale, quod bannum uocant, ad abbatis prouidentiam pertinebit. At nos memorato pontifici diuina fauente gratia succedentes, quia predictos fratres speciali prerogativa dilectionis et gratie amplexamur, utpote qui iugitur offerentes deo holocaustum propiciationis et sacrificium laudis non solum nobis, sed etiam uniuersali ecclesie piis intercessionibus suffragantur, ipsorum vtilitati et indigentie libenter, prout possumus, prouidemus, predecessoris nostri exemplo prouocati, in quorundam decimis pred iorum eis curauimus subuenire, exinde illi complacere propensius nos credentes, qui, quod vni exminimis suis fit, sibi reputat esse factum; prediorum autem ista sunt uocabula: Glyne, Stubolowe, Radentin, Polas, Verpene, Sculenberch, Conardam, cum omnibus pertinentiis et finibus suis. Decernimus ergo, ut nulli hominum liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere, minuere seu quibuslibet uexacionibus fatigare, sed omnia integra conseruentur eorum vsibus, pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, omnimodis profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre confirmationis et constitutionis paginam sciens contra eam venire temptauerit uel contra tenorem apostolicorum priuilegiorum et indulgentiarum uel huius auctentici de predictorum fratrum possessionibus uel prediis iam descriptis decimas exigere uel extorquere presumpserit, nisi condigne de reatu suo iam dictis fratribus satisfaciat, omnipotentis domini iudicio et beatorum apostolorum Petri et Pauli et domni pape Gregorii et nostro anathe-


|
Seite 292 |




|
mati subiacebit; sed qui eidem monasterio iura sua seruauerit, in sanctorum numero conscribatur et eterna beatitudine perfruatur. Ego Brunwardus, Zwerinensis episcopus, hoc decretum manu mea confirmavi et sigilli mei munimine roboraui, ad maius stabilimentum testibus etiam infra appositis personis nobilibus, quarum ista nomina sunt: domnus Balduinus, Semigalliensis episcopus et Romane curie legatus, domnus Johannes, Lubecensis episcopus, domnus Godescalcus, Raceburgensis episcopus, domnus Thetmarus, abbas dergu domnus Theodericus, abbas de Dunemunde, domnus Johannes, abbas de Lubeke, Jerizlaus, prepositus in Tribuses, P(r)etrus, prepositus in Raceburch, Daniel, prepositus in Dymin, Sifridus, decanus in Zwerin, Petrus, sacerdos in Bntzvowe, Walterus, sacerdos in Rotstoc, Pertolldus, sacerdos in Siuuan; laici: milite: Johannes de Magnopoli, Nycolaus et Heinricus de Roztoc, principes et fratres, Tethlephus de Godebuz, Heinricus dapifer, Johannes de Snakenborg, Brunwardus, Bertrammus, Heinricus Grubo et alii quamplures.
Datum Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie, V to nonas Octobris, per manum Petri, capellani et notarii nostri, indictione V a , incarnationis dominice anno M°CC°XXX°II, pontificatus vero nostri anno XL°II°, domno Fredherico Romanum imperium et regnum Sycilie feliciter gubernante.
Die Urkunde ist auf einem grossen
Pergament in einer sehr schönen Minuskel
geschrieben. Angehängt sind 4 Schnüre von
weissen linnenen Fäden, von denen die letzte
das Siegel verloren hat; die drei ersten
Siegel sind:
1) ein kleines
elliptisches Siegel mit einem stehenden
Bischofe mit der segnenden Rechten und mit
dem Stabe in der linken Hand; Umschrift:

2) ein grösseres elliptisches Siegel mit einem auf einem Sessel mit Hundsköpfen sitzenden Bischofe mit der geöffneten Bibel in der Rechten und dem Stabe in der Linken; Umschrift:

3) ein elliptisches Siegel mit einem auf einem nicht verzierten Sessel ohne Rücklehne sitzenden Bischofe mit dem Stabe in der


|
Seite 293 |




|
Rechten und der geschlossenen Bibel in der ausgestreckten Linken; Umschrift:
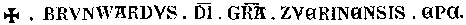
Dies ist ein drittes, bisher unbekanntes Siegel des Bischofs Brunward von Schwerin, welches in Jahrb. VIII, S. 11, nicht aufgeführt ist: auf dem ältesten Siegel Brunwards ist der Bischof sitzend mit dem Buche auf den Knieen, auf dem jüngsten stehend mit dem Buche auf der linken Brust, hier aber mit dem Buche in der ausgestreckten Linken dargestellt; dieses Siegel fällt also zwischen das erste und letzte.
Nr. XXX.
Der Fürst Heinrich der Löwe von Meklenburg schenkt dem Kloster Doberan mehrere Hebungen von der Insel Poel zu einer ewigen Wachskerze auf seinem Grabe, zu zwei Spenden, jede von 10 Mark, an den Kloster-Convent und zur Erbauung eines Messaltars und anständiger Fenster in der Begräbniss-Kapelle seiner Vorfahren.
D. d. Wismar. 1302. Jan. 18.
Nach dem Original-Transsumte im grossherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin.
Omnibus Christi fidelibus presencia conspecturis consules vniuersi ciuitatis Rozstok salutem in domino. Recognoscimus tenore presencium publice protestantes, nos vidisse ac diligenti auscultatione peraudiuisse priuilegium nobilis domini Hynrici Magnopolensis et Stargardie non cancellatum, non abolitum, non rasum, nec in aliqua sui parte viciatum, sed perfectum et integrum, in hec verba:
In nomine sancte et indiuidue trinitatis Amen. Hynricus dei gracia dominus Magnopolensis omni generacioni que ventura est in perpetuum. Quoniam omnes morimur et quasi aque dilabimur in terram, ideoque actiones hominum a memoria excidunt, nisi sigillorum et testium subcriptionibus roborentur: notum igitur facimus tam presentibus, quam futuris, quod nos de mera liberalitate animi nostri heredurn ac fidelium


|
Seite 294 |




|
militum nostrorum consilio et assensu mediante, pro salute animarum nostrarum, scilicet predilecti patris nostri domini Hynrici Magnopolensis felicis memorie et matris nostre domine Anastasie et nostre vxorisque nostre domine Beatricis ceterorumque heredum nostrorum contulimus ecclesie Doberanensi in terra Půle redditus et prouentus infra distinctos cum omni proprietate ac libertate iure perpetuo possidendos, scilicet in villa Malchowe triginta tremodia siliginis et ordei et viginti vnunm tremodium auene et quatuor marcas et dimidiam denarioum de peticione porcorum, item in villa Wanghere decem et nouem tremodia ordei et siliginis et viginti tremodia auene et sex modios et tres modios pise et duas marcas et quatuor solidos denariorum de porcorum peticione, item in villa, Theymmendorpe viginti tremodia et quatuor modios siliginis et ordei et quindecim tremodia auene et quatuor modios et septem modios pise et Sex marcas denariorum, de peticione porcorum. Omnes hos redditus in redempcionem peccatorum nostrorum sinceriter ac deuote obtulimus omnipotenti deo et gloriose virgini Marie et ecclesie Doberanensi, vt ipsa eisdem redditibus, eo iure ac iudicio, quo cetera abbacie sue hactenus possedit, pacifice iugiter perfruater, hoc addicientes, quod de omni pecuniaria satisfactione capitalis sentencie abbas Doberanensis terciam tollat partem, tali nichilominus nostra ordinacione mediante: volumus enim et inuiolabiliter ordinamus, quod de iam dictis redditibus ardens cereus et perpetuus in loco sepulture nostre a domino abbate Doberanensi fideliter procuretur; insuper duo seruicia conuentui, vnumquodque de decem marcis denariorum, annis singulis laudabiliter ministrentur; preterea vnum altare cum omnibus necessariis inmissarum celebracione et fenestras laudabiles in capella vbi progenitores nostri requiescunt, abbas de prelibata annua pensione tenebitur studiosius comparare. Reliquos vero redditus ecclesia Doberanensiss pro omni dampno suo, quod recepit a nobis siue a nostris, et de castro Rethcekowe habebit in restaurum. Vt autem hec nostra racionabilis donacio, quam fecimus annuente nobis nobili ac dilecto nostroconsanguineo Nycolao domino de Werle perpetua, rata et inconwlsa per-


|
Seite 295 |




|
seueret, ipsi ecclesie Doberanensi presentem paginam munimine sigillorum nostrum dedimus roboratam. Huius rei testes sunt: Johannes de Cernyn, Hynricus de Stralendorpe, Hynricus de Stenhus, Otto de Lu, milites, et alii quamplures fide digni. Datum in Wismaria anno domini millesimo trecentesimo secundo, quintodecimo kalendas Februarii.
Auf einem kurzen und breiten Pergament in einer gedrängten, kräftigen Minuskel aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
Nr. XXXI.
Das Kloster Doberan verpflichtet sich zur Entrichtung der Einkünfte dreier Altäre, welche aus den Einkünften des von Peter Wise für das Kloster Doberan eingelöseten Dorfes Adamshagen gestiftet sind.
D. d. Doberan. 1341. Oct. 23.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Amen. Nos frater Jacobus abbas totusque conuentus monasterii Doberanensis vniuersis Christi fidelibus presens scriptum visuris inperpetuum. Memorie hominum, que fragilis est, prouide consulitur, dum res gesta scriptis autenticis commendatur, ut mortalium deficiente recordacione scriptura testimonium perhibeat veritati. Ad noticiam igitur singulorum tam presencium, quam futurorum litteris presentibus cupimus peruenire, quod dilecti nobis in Christo confratres nostri Johannes et Hinricus dicti Sapientes, nostri monasterii sacerdotes et monachi, debonis, que Petrus Sapiens, ciuis Lubicensis, germanus ipsorum, in morte sua eis in elemosinis conuertenda dereliquit, indaginem nostram Adammeshaghen dictam ab ecclesia nostra pro mille marcis Rozstoccensibus expositam domino Arnoldo dicto Copman, proconsuli in Rozstok, libere redemerunt ad manus nostras et nostrorum successorum, mediantibus condicionibus infrascriptis, videlicet vt de antedicta indagine Adammeshaghen sorori


|
Seite 296 |




|
eorum Gertrudi redditus XXII marcarum Lubicensium denariorum, quamdiu vixerit, expedite annis singulis ab eclesia nostra tribuantur ac in remissionem pecca torum fratris ipsorum prenominati Petri ceterorumque progenitorum suorum et parentum ac consangwineorum tria seruicia in anniuersariis dedicacionis trium altarium, que in monasterio nostro fundauerunt, scilicet vndecim virginum, corporis Christi et Andree, conuentui per subcellerarium, qui pro tempore fuerit constitutus, perpetuis temporibus seruiantur, ita quod quodlibet seruicium ad minus de decem marcis denariorum Rozstokcensibus habeatur, quas semper ille frater, qui bursarius fuerit, presentare tenebitur, subcellerario de prouentibus sepedicte indaginis ad octo dierum spacium ante quocienscunque aliquod dictorumu trium seruiciorum extitit seruiendum. Nos insuper eciam propter predicta seruicia conseruanda et in suo robore perpetue perduranda astrinximus nos et nostros successeres presentibus astringimus sub anathemate gehennali, vt nulli nostrorum quoquo modo liceat antedictam indaginem Adammeshaghen deinceps obligare uel alienare aut ipsa seruicia aliis bonis adaptare. Ut autem hec inconuulsa perpetue maneant et illesa, presentem paginam inde confectam sigilli nostri et sigilli conuentus nostri municionibus fecimus roborari. Testes premissorum nominatim sunt isti fratres nostri sacerdotes et monachi: Johannes Braghen, prior, Hinricus de Tremonia, camerarius, Hermanus Puella, cellerarius, Johannes Abnehusen, Jacobus de Brunswich, cantor, Hermanus Pape, magister hospitalis, Wedego de Oldendorp, Tymnio de Brunswich, Johannes de Zwerin, subcellerarius, Thidericus Leo, magister conuersorum, Hermanus Lasche, supprior, Ludolphus et Johannes de Tremonia cum aliis vniuersis. Datum Doberan, anno domini M ° C ° C ° C ° XL primo, decimo Kal. Nouembris.
Nach dem Originale auf Pergament
in einer kleinen, festen Minuskel. An
Pergamentstreifen hangen zwei Siegel mit
aufgelegten Platten aus grünem Wachs:
1) das elliptische Siegel des Abtes Jacob
von Doberan mit der Figur eines Abtes in
einer Nische; Umschrift:
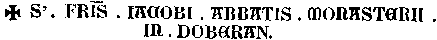


|
Seite 297 |




|
2) das runde Siegel des Convents von Doberan, mit einem sitzenden Marienbilde; links daneben steht das Christkind auf dem Stuhle; rechts hat der Stuhl eine thurmartige Seitenlehne, an welcher ein Weihrauchfass, wie es scheint, hängt: Umschrift:

Nr. XXXII.
Der Bischof Friederich von Schwerin weihet die Kirche zu Doberan und verleihet derselben und der Heil. Bluts-Kapelle daselbst Ablass.
D. d. Doberan. 1368. Junii 4.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Fredericus miseracione diuina de Bulowen genere quartus Zwerinensis episcopus vniuersis Christi fidelibus, ad quos presentes littere perueniunt, salutem in omnium saluatore. Ne de vite gestis temporis processu obliuio dubiumve veniat aut vertetur, fidelium mos laudabilis consueuit ea scripti testimonio perhennare; quocirca presentes nouerint et futuri, quod nos ad eius illibate virginis et matris, que de latere crucifixi profluxit, ecclesie, cum materialis ecclesia typum gerat ecclesiarum tam militantis, quam triumphantis, quarum quidem fundamentum et superedificatorum parietum capud, connexio, lapis angularis ab hominibus reprobatus, a deo autem electus, sacerdos sacrificium, pontifex et consecrator est mediator dei et hominum Christus Jhesus deus et dominus noster, qui valido clamore emisso cum lacrimis in omnibus exauditus est pro sua reuerencia, semel per sacrosanctum sangwinem suum introiens in sancta eterna redempcione imouenta, decorem ac laudem et gloriam eiusdem domini nostri Jhesu Christi ac in honorem perpetue virginis genitricis dei Marie sanctorumque Johannis Baptiste, Johannis ewangeliste, Fabiani et Sebastiani martirum, Benedicti et Bernardi confessorum, ecclesie Doberanensis, ordinis Cysterciensis, nostre Zwerinensis diocesis, bene fundate et edificiis perfecte sub anno eiusdem domini millesimo tricentesimo sexagesimo octauo, in festo sancte trinitatis occurrente, in presenciarum mensis Junii


|
Seite 298 |




|
die quarta, principibus illustribus Alberto patre ac Hinrico filio eius, ducibus Magnopolensibus, Rozstokcensem et Stargardensem terras ac comiciam Zwerinensem tenentibus, venerabilique patre domino Godschalco abbaciam in Doberan laudabiliter gubernante, eiusdem domini nostri Jhesu Christi auctoritate et adiutorio et nostro humilitatis ministerio munus consecracionis impendimus gloriosum, assistentibus nobis et presentibus reuerendissimo in Christo patre et domino domino Gozwino Euelonensis ecclesie episcopo ac venerabilibus patribus ac dominis Enghelhardo de Amelunghesborne, Godschalco de Doberan pretacto, Hermanno de Betzsingherode, monasteriorum abbatibus, Johanne magistro et Alberto Foysan, in Parchim et Warne archidiaconis, Godzwino, thezaurario in ecclesia Zwerinensi, Bernardo, preposito monasterii monialium in Runa, magistro Hinrico de Reuele, decretorum doctore, magistro Johann Borghermester, canonico ecclesie Butzowensis, ac aliorum clericorum et populorum multi tudine copiosa. Insuper ex causis statuimus, volumus et ordinamus, vt anniuersarius dedicacionis dies prefate Doberanensis ecclesie acvisitacio sacramenti, que in capella porte monasterii Doberanensis feria secunda post festum penthecostes fieri consueuit, singulis annis in dominica infra octauam festuitatis corporis Christi occurrente, in quam huius dedicacionis et visitacionis diem presentibus transferimus, perpetuis temporibus celebretur. Et vt huius anniuersarius dies maiore deuocione fidelium frequentetur, omnibus vere penitentibus, contritis et confessis, qui in dicto anniuersario prefatas ecclesiam Doberanensem et capellam uisitauerint, ac eis feminis in porta remanentibus, que de more et obseruancia Cysterciensis ordinis maiorem non intrant ecclesiam, XLa dierum indulgencias de iniunctis ipsis penitenciis in domino misericorditer relaxamus. In quorum testimonium presentes litteras per Albertum Leoni[s], notarium nostrum, conscribi fecimus sigilloque nostro sigillari. Datum et actum Doberan anno et die mensis, quibus supra.


|
Seite 299 |




|
Auf einem grossen Pergament in einer sehr grossen, fetten Minuskel. An einer Schnur von gelber Seide hängt das in Jahrb. VIII, Tab. II, Fig. 2 abgebildete Siegel des Bischofs Friederich von Schwerin.
Nr. XXXIII.
Der Abt Gerhard von Clairvaux, als päpstlicher Commissarius, giebt Erlaubniss, dass am Kirchweihfeste und bei dem Begräbnisse vornehmer Personen edle und anständige Frauen Kirche und Kloster zu Doberan auf Erlaubniss des Abtes betreten können.
D. d. 1385. Sept. 18.
Gerardus permissione diuina abbas monasteriorum Clareuallis et Bodelo, commissarius apostolicus, venerabilibus in Christo nobis dilectis abbati et conuentui monasterii de Doberan salutem et in sancte religionis feruore continuum incrementum. Ad ea libenter intendimus, per que paci vestri monasterii salubriter prouidetur ac eciam deuotio Christi fidelium excitatur; cum itaque, sicut accepimus, exequie nobilium et potentum in vestro monasterio sepius fiant et in eisdem exequiis nonnulle mulieres nobiles ac alie interesse volent, vestrum monasterium, et ecclesiam interdum introire presumpserint per violentiam et minas secularium personarum; cupientes igitur premissa aliqualiter moderare, ne ex predictis violentiis aut similibus maiora scandala in posterum oriantur, vt tempore dedicationis ecclesie in primis et secundis vesperis ac in missa, necnon in exequiis dominorum temporalium seu nobilium aut potentum, de quibus abbati cum suo consilio visum fuit, mulieres nobiles ac honeste deuotionis causa monasterium et ecclesiam ingredi valeant de licentia dicti abbatis seu locum eius tenentis, vobis concedimus auctoritate generalis capituli presentium facultatem, non obstantibus diffinitionibus et statutis in contrarium editis quibuscunque. Datum


|
Seite 300 |




|
sub nostri appensione sigilli anno domini millesimo CCC°LXXX° quinto, die XVIIIa mensis Septembris.
Auf Pergament in einer kleinen, scharfen Minuskel. Das an einen Pergamentstreifen angehängt gewesene Siegel ist abgerissen.
Nr. XXXIV.
Der Bischof Rudolph von Schwerin, Herzog von Meklenburg, verleiht für das Kloster Doberan Ablass, indem er zu seinem Begräbnisse das Begräbniss seiner Vorfahren in der Klosterkirche erwählt.
D. d. Bützow. 1400. Nov. 15.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Uniuersis et singulis sancte matris ecclesie filiis presentes litteras intuentibus Rodolphus dei et apostolice sedis gracia ecclesie Zwerinensis episcopus duxque Magnopolensis graciam in presenti et in futuro consequi gloriam felicium eternorum. Etsi omnibus, presertim fidei domesticis simus ad benefaciendum ex iniuncto nobis nostri pastoratus officio debitores, potissime tamen illis spiritualem thezaurum nobis creditum tenemur habundancius impartire, quos propria virtutum merita ac loci insignitas preferunt et extollunt. Sane interne contemplacionis oculo profundius considerantes, quanta militari fortitudine alma illa congregacio personarum scilicet conuentualium monasterii in Doberan, Cisterciensis ordinis, nostre diocesis, velut ad bella doctissima contra spiritales et tenebrarum potestates dimicat et procedit, quarum plerumque acies in fugam conuertit, sysaram ultimo tradit exterminio ac versipelles phylistimorum insidias a finibus Israel procul eicit et repellit, elemosinis quoque et oracionibus, hospitalitati ac aliis piis et pietatis operibus indesinenter deseruit, laudibus inhiat diuinis ipsamque tocius religionis et sanctimonie magnificat et amplectitur inclita celsitudo, cuius siquidem bono odore tracti, nostri patres et progenitores mox vt primum de ferrea formace Babilonice gentilitatis ac egip-


|
Seite 301 |




|
tiaca ydolorum seruitute egredi et ad illam incircumspectibilem orthodoxe fidei lucem peruenire meruerunt, apud eandem congregacionem, que quasi nouella plantacio et iniciatrix Christiane religionis in terra horroris et vaste solitudinis extiterat, vepres viciorum seu spinas ydolatrice supersticionis surculosque errorum radicitus euulserat, sibi locum Doberan in ius sepulture proinde elegerunt, ex quibus quidem nostris patribus postmodum dilatata posteritas principum ac dominorum Obotricie, Circipanie, Kytune, Magnopolitanie atque tocius Slauie vigore electionis huiusmodi in dicto loco communiter meruit inhumari, prout et nos prestolaturi aduentum futuri iudicis ibidem penes eosdem nostros progenitores, quibus altissimi clemencia requiem et lucem perpetuam largiatur, elegimus et presentibus eligimus sepeliri. Non inmerito premissorum intuitu adeo insignem et dilectum nobis locum Doberan intima karitate amplectimur, fauore precipuo prosequimur et in domino iugiter confouemus, desiderantes igitur, ut dictus locus Doberan, quem taliter dominus in benedictione preuenit, ad laudem et gloriam omnipotentis dei ac gloriose genitricis eius virginis Marie, necnon omnium sanctorum et presertim eorum, quorum venerande reliquie illic recondite continentur, ampliori gracia et donis spiritualibus augeatur turbeque fidelium eo auidius ad dictum monasterium Doberan visitandum et frequentandum et ad preciosa stipendia spiritualis thezauri promerenda propensius inuitentur, vniuersis et singulis Christi fidelibus vere penitentibus, corde contritis et ore confessis, qui spe consequende gracie dictum locum accesserint ipsamque ecclesiam diebus quibuslibet festiuitatum aut dedicacionis aliisve sanctorum nataliciis seu sollempnitatibus aut simplicibus feriatis diebus per anni circulum occurrentibus deuote visitauerint vel sermonem diuinum audierint aut dictum monasterium eiusque personas inibi altissimo famulantes, necnon possessiones, res et bona ad dictum monasterium spectantes et spectantia protexerint, seu eos aut eorum res, possessiones, aut bona inuadentibus seu vastantibus se gracia protexionis obiecerint et opposuerint et qui ad dicti loci et structure conseruacionem manus porrexerint adiutrices, elemosinas suas erogauerint aut quociens cimiterium dicti


|
Seite 302 |




|
monasterii aliqui circuierint aut ante aliquod altare dicte ecclesie in honorem domini nostri Jhesu Christi et suorum sanctorum intitulatum humiliter orando et qum hora serotina campana pulsabitur venialis genua flexerint, totiens quotiens aliquod premissorum deuote fecerint, quadraginta dies indulgenciarum vna cum vna karena de iniunctis eis in confessione penitenitiis de omnipotentis dei misericordia et beatorum apostolorum eius Petri et Pauli auctoritate confisi in domino misericorditer relaxamus, similes eciam indulgencias illis de qualibet particula reliquiarum inibi copiose contentarum, qui ad eandem pro venerandis huiusmodi sanctorum reliquiis accesserint, modo vt premittitur, misericorditer indulgemus. In quorum omnium euidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in castro nostro Butzowe anno gracie millesimo quadringentesimo, feria secunda post festum beati Brictii, confessoris domini gloriosi.
Das Original ist in einer festen Minuskel auf Pergament geschrieben. An einer Schnur von rother Seide hängt des Bischofs kleineres, rundes Siegel: zwischen zwei Nischen, in welchen Engel stehen, der rechts gelehnte meklenburgische Schild mit dem meklenburgischen Helme darüber; Umschrift:

Nr. XXXV.
Der Knappe Sivert von Oertzen zu Roggow macht vor seiner Reise in das gelobte Land sein Testament für das Kloster Doberan, indem er 200 lüb. Mark Capital in Detershagen oder Zwedorf zu Seelenmessen und Almosen fundirt und sein Begräbniss im Kloster bedingt.
D. d. 1431. Dec. 21.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Zyuerd van Ortzen, knape, wânachtich to Roggowe, bekenne vnde betûghe ôpenbare an desseme brêue vôr allesweme, dat ik myt mynen


|
Seite 303 |




|
rechten eruen na râde vnde na vulbort alle der
yênnen, der ere râd vnde vulbort van rechtes
weghene hîr to êschende was, hebbe reckelliken
rechtuerdighen rechtuerdigher ghâue gheuen vnde
vorlâten, vorlâte vnde vorgheue yeghenwardighen
deme gheystliken yn god vâdere vnde heren hern
Bernd ahbete vnde deme ghantzen conuente des
munsters Dobberan vnde eren nakômelinghen to
zêligher, êwigher dachtnisse twêhundert lubische
mark lubischer penninghe, de ik hebbe ghedâen to
der nûghe Henneke Moltken, wânachtich to der
Nyghenkerken, vppe dat ghûd to deme
Deterdeshaghen to sunderghen, de ze schôlen
hebben vthe deme alderrêdesten ghûde na
vtwynsinghe des brêues, den my Henneke Moltke
vôrbenômet dâr vp heft ghegheuen. Vôr desse
twêhundert lubische mark lubischer penninghe
schal de abbet to Dobberan vnde dat conuent
dârsulues alle iâr iârliker renthe vpbôren vt
dessen êrbenômeden alderrêdesten gûderen
twintich lubische mark lubischer penninghe, dâr
ze alle iâr schôlen mede tûghen strazeborgher to
monnike kaghelen, dâr me gôde missen ane lest,
vmme der sâlicheit willen myner zêle vnde myner
olderen. Vortmer zo schal vnde wil de abbet to
Dobberan dâr af tûghen ên grawe lâken alle iâr,
dat he schal gheuen armelûden an de êre godes,
den des n
 t vnde behûff is, vmme de lêue
godes. Ok zo schal vnde wil de abbet dâr af
tûghen lâten zo vele nygher pâ
e
r
schô
e
, alse me vmmme êne lubische
mark lubischer penninghe kan tûghen, vnde lâten
deme portheren de gheuen armen lûden efte
pelegrymen an de êre godes. Vurdermer so schal
vnde wyl de êrbenômede here vnde abbet to
Dobberan edder syne nakômelinge dâr af tûghen II
tunne Butzowesches bêrs syme conuente, wannêr
dat my dat couent begheyt mit vyllien vnde mit
zêlemissen to twên tiiden yn deme iâre, I tunne
schal he gheuen dem couente, wen se my vyllie
zynghen yn myner iârverst, de anderen schal he
gheuen dem couente, wen my dat couent to deme
anderen mâle begheyt yn deme suluen iâre mit
vyllien vnde myt zêlemissen vmme de tiid, als
myne eruen mit deme abbete vnde couente dâr vmme
êndregen. Vortmer den brêf, den
t vnde behûff is, vmme de lêue
godes. Ok zo schal vnde wil de abbet dâr af
tûghen lâten zo vele nygher pâ
e
r
schô
e
, alse me vmmme êne lubische
mark lubischer penninghe kan tûghen, vnde lâten
deme portheren de gheuen armen lûden efte
pelegrymen an de êre godes. Vurdermer so schal
vnde wyl de êrbenômede here vnde abbet to
Dobberan edder syne nakômelinge dâr af tûghen II
tunne Butzowesches bêrs syme conuente, wannêr
dat my dat couent begheyt mit vyllien vnde mit
zêlemissen to twên tiiden yn deme iâre, I tunne
schal he gheuen dem couente, wen se my vyllie
zynghen yn myner iârverst, de anderen schal he
gheuen dem couente, wen my dat couent to deme
anderen mâle begheyt yn deme suluen iâre mit
vyllien vnde myt zêlemissen vmme de tiid, als
myne eruen mit deme abbete vnde couente dâr vmme
êndregen. Vortmer den brêf, den


|
Seite 304 |




|
my Henneke Moltke vôrbenômet heft ghegeuen vnde vôrantwardet vppe dat vôrscreuen, gûd to deme Deterdeshaghen vôr desse êrbenômede twêhundert lubische mark lubischer penninghe vnde XX lubische mark iârliker renthe der suluen munthe, den hebbe ik ghegeuen vnde vôrantwardet vnde gheue ieghenwardighen deme gheistliken yn god vâdere vnde heren hern Bernd abbete vnde deme gantzen couente to Dobberan myt aller kraft vnde macht, alse he is screuen vnde bezeghelt mit aller ynholdinghe an al synen worden vnde articulen, vnde mâke den heren abbet to Dobberan vnde syn couent to vullenkômenen hôuetlûden desses vôrbenômeden brêues, se dâr mede to mânende, to dônde vnde to lâtende yn aller macht, na vtwysinghe des brêues, lyke alse my suluen, also langhe wen Henneke Moltke vôrbenômet edder syne rechten eruen de twêhundert lubische mark lubischer penninghe vnde XX lubische mark der suluen munthe iârliker renthe dem abbete vnde couente to Dobberan wedder gheuen vnde to êner nûghe, na vtwysinghe des êrbenômeden brêues, de vppe dyt vôrbenômede gûd to deme Deterdeshaghen is sprekende vnde vtwysende, wol to der nôghe heft berêth, vppe êne tiid, sunder schâden vnde hynder. Vurdermêr wannêr dat Henneke Moltken, to der Nyghenkerken wânachtich, edder syne rechten eruen na vtwîsinghe des vôrbenômeden brêues, den ik van em hebbe entfanghen, desse vôrscreuen twêhundert lubische mark lubischer penninghe vnde XX lubische mark iârliker renthe wedder lôsen, zo schal vnde wil de abbet to Dobberan vnde couent dârsulues, de denne synt to der tiid, desse vôrbenômede twêhundert lubische mark lubischer penninge wedderlegghen vnde êwighen stedighen an de gûdere to den Twendorpen vppe deme Bughe, dâr ze deme couente to Dobberan êwich schôlen blyuen, van welken vôrbenômeden twênhundert lubischen marken lubischer penninghe denne an den tiiden de abbet to Dobberan, dede denne to der tiid ys, alle iâr dar vor schal vnde wyl vtgheuen XV lubische mark lubischer penninghe êwigher renthe vthe den Twendorpen êwigher zeligher dachtnisse to gôde myner zêle vnde myner olderen, alsodâner wyse, alse hîr na screuen steyt: to deme ersten male so schal vnde wyl de here abbet to Dobberan alle iâr


|
Seite 305 |




|
zyneme couente gheuen VIII lubische mark
lubischer penninghe êwigher iârliker renthe, dâr
me mede schal tûghen strazeborgher to monnike
koghelen, dâr me gôde missen ane lest; vortmer
zo schal vnde wil de êrbenômede here abbet to
Dobberan syme couente gheuen hîr af II tunne
Butzowesches bêres, wen my dat couent dârzulues
begheyt myt vyllyen vnde mit zêlemissen, twye
des iâres, êne tunne to der ênen tiid vnde de
anderen to der anderen tiid, wem my dat couent
villye vnde zêlemissen zinget des zuluen iâres,
wente myne andachtlike gheistlike boghêringhe
also is to gode, dat my dat couent to Dobberan
des iâres twye boghaa mit villyen vnde mit
zêlemissen, dat ze my also dat schôlen êwighen
holden; vurdermer so schal vnde wil de abbet to
Dobberan IIII lubische mark lubischer penninge
êwiger iârliker renthe legghen yn dat ampt des
kâmerhôues to Dobberan, dâr schal de
kâmermeyster alle iâr vôr gheuen I grâwe lâken,
dat schal de porthere to Dobberan mit willen des
heren abbetes to Dobberan armen, nôttroftighen,
krancken lûden dêlen vnde gheuen yn de êre
godes, den des alderbest bohûf is; ôk zo schal
vnde wil de abbet vâkenghenômet van dessen
suluen vôrbenômeden XV lubischen marken
lubischer penninghe iârliker êwigher renthe deme
schômeyster to Dobberan alle iâr gheuen êne
lubische mark lubischer penninghe, dâr schal de
êrbenômede schômêster vôr gheuen yn de porten
alle iâr VI pâr nygher sch
 , de de porthere schal gheuen
armen lûden edder pelegrymen, den des is bohûf
na râde des heren abbetes to Dobberan vmme
zâlicheit willen myner zêle vnde myner olderen.
Vnde desse vôrscreuene ghâue vnde almissen
schôlen myne eruen to êwigen tiiden nummer
krenken edder hynderen, men io dâr behulpelik to
wesende, ze mede to beschermende, vppe dat dat
myner zêle de êwighe zêlighe dachtnisse vnde
myner olderen to gode nicht werde krencket ofte
hyndert. Ysset ôk zâke, dat ik Zyuerd vôrbenomed
vormyddelst hulpe vnde gnâde des almechtighen
godes wedder kôme van desser zâlighen reyse to
hûs, zo schal desse brêf mit der vôrscreuenen
ghâue vnmechtich, qwyd vnde lôes wesen alse
verne, alse yd myn wille ys, vnde ik Zyuerd van
Ortzen êrbenômet
, de de porthere schal gheuen
armen lûden edder pelegrymen, den des is bohûf
na râde des heren abbetes to Dobberan vmme
zâlicheit willen myner zêle vnde myner olderen.
Vnde desse vôrscreuene ghâue vnde almissen
schôlen myne eruen to êwigen tiiden nummer
krenken edder hynderen, men io dâr behulpelik to
wesende, ze mede to beschermende, vppe dat dat
myner zêle de êwighe zêlighe dachtnisse vnde
myner olderen to gode nicht werde krencket ofte
hyndert. Ysset ôk zâke, dat ik Zyuerd vôrbenomed
vormyddelst hulpe vnde gnâde des almechtighen
godes wedder kôme van desser zâlighen reyse to
hûs, zo schal desse brêf mit der vôrscreuenen
ghâue vnmechtich, qwyd vnde lôes wesen alse
verne, alse yd myn wille ys, vnde ik Zyuerd van
Ortzen êrbenômet


|
Seite 306 |




|
dat nicht wedder êske van deme heren abbete to Dobberan vnde van syme couente. Vurdermer wen ik na der schikkinghe godes vorsterue van desser vorengliken werlde vnde dat schûde bynnen deme lande der heren to Mekelenborch, zo schal vnde wyl de abbet vnde couent to Dobberan my hâlen lâten yn ere klôster mit ereme wâghen vnde eren perden vppe myne kosten vnde vppe myn gûd, wes ik nâlâte mynen eruen: alle west dat kostet, dat schôlen myne nêghesten eruen gantzelken bekostighen vnde vtrêden vnde nicht dat godeshus. Wêret ôk sâke, dat my god almechtich my Zyuerd van Ortzen vormiddelst syner gotliken gnâde nême van deme myddele desser vorghengliken werld, also dat ik na der schikkinghe godes storue vppe desser reyse, zo schal desse ieghenwardighe brêff yn al syner ynholdinghe vnde bezeghlinge êwighen mechtich vnde vast blyuen vnde nummer to brekende van den mynen edder van mynen eruen an nynerleye wîse gheistliken efte werliken. Alle desse vôrscreuen stucke vnde ên iêwelk articul bysunderghen lôue vnde segghe ik Zyuerd van Ortzen myt mynen rechten eruen deme heren abbete vnde couente to Dobberan stede vnde vast to holdende an ghûden trûwen sunder iênigherleie arghelist, ze syn gheistlik efte werlik. To hôgher betûchenisse vnde mêrer bewâringhe aller desser vôrscreuen dinghe zo hebbe ik Zyuerd van Ortzen mit mynen rechten eruen, alse Hermen van Ortzen, myn brôder, vnde Clawes van Ortzen, knapen, her Mathias Axkowe, ridder, vnse inghezeghele witliken henghen lâten an dessen brêf, de gheuen vnde screuen ys na godes bôrt vêrteynhundert iâr dar na yn deme ên vnde dortighesten iâre, yn deme dâghe sunte Thomas, des hilghen aposteles.
Auf einem grossen Pergament, in
einer festen Minuskel. An Pergamentstreifen
hangen 3 Siegel mit eingelegten grünen
Wachsplatten:
1) ein Siegel mit dem von
örtzenschen Schilde und der Umschrift:
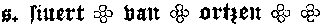
2) ein Siegel mit dem von
axekowschen und
3) ein Siegel mit dem
von örtzenschen Schilde, beide mit
zerbrochener und unleserlicher
Umschrift.
Vgl. Urk. vom 4. März 1441.


|
Seite 307 |




|
Nr. XXXVI.
Der Knappe Siverd von Oertzen d. A. zu Roggow bestellt für den Fall, dass er von seiner Wallfahrt nicht heimkehrte, den Abt Bernhard von Doberan und den Ritter Matthias von Axecow zu Testamentsvollstreckern, giebt dem Abte sein Geld und seine Urkunden in Verwahrung und stiftet Almosen in Folge seines Testaments und eine ewige Lampe im Kreuzgange.
D. d. Roggow. 1441. März 4.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. und Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Syuerd van Ortzen de older, knâpe, wônaftich to Rogghowe, bekenne, vôr alle den iênnen, de dessen brêff seen edder hôren lesen, vôr my vnde myne eruen, dat ik an trûwen vnde vppe lôuen hebbe vorantwordet deme êrwerdighen in god vâdere vnde heren heren Bernde, abbete to Dobberan, dessen naghescreuen summen goldes vnde gheldes, meer nicht ôk myn nicht, alze sos nobelen, hundert lubesche gulden, sostich rînsche gulden, vêrtich arnamesche gulden, sos biscoppes gulden, hundert lubesche marc gûder munte vnde viif vnde vêrtich marc lubesche munthe an golde vnde lubeschen ghelde, vnde myne lâden myd mynen brêuen, dâr dit vôrghescreuen gold vnde pennynghe inne beslâten sint. Vorbat beghêre ik Syuerd van Ortzen vôrbonômet, hôchliken biddende den êrghenanten heren Bernde, abbete to Dobberan, vnde den strenghen ridder her Mathias Axkowen vmme godes willen, wêre id dat ik nach deme willen godes nablêue vppe der reysen, de ik an der schikkinghe vnses heren godes denke to důnde, dat se van desseme vôrghescreuen summen goldes vnde gheldes betâlen myne schuld, so verne alze dâr borst vnde brôke worde an mynen eruen, so dat se er nicht betâlen konden ofte wolden, vnde dâr nêghest schal de vôrbenômede her abbet vnde sîn conuent van deme golde, dat dâr blift na der betâleden schuld, so vele afftellen vnde nemen, dâr men môghelken mede holden mach vnde schal de almissen, de ik


|
Seite 308 |




|
ghemâket hebbe mid deme suluen heren Bernde abbete vnde sîneme conuente, de dâr scheen schôlen an de êre godes vmme myner zêlen zâlicheit an deme godeshûse to Dobberan to êwighen tîden, alze dat clârliken holt de brêff, den ik en dâr vp ghegheuen hebbe. Ok schal de sulue her Bernd, abbet, vnde sîn conuent van desseme suluen golde afftellen vnde hebben druttich lubesche mare lubescher pennynghe to den veftich lubeschen marken, de ik en gantzliken vppelâten hebbe vnde lâte se en vpp ieghenwardich vnde wîse se dâr an in craft desses brêues, so dat se alle iâr môghen mânen vnde bôren de rente vnde pacht der vôrbonômeden veftich marken lubesch vte deme Deterdeshaghen na lûde Clawes Moltken brêue, den ik en dâr vpp vorantwerdet hebbe mid myneme gantzen willen vnde wittscop vulmechtighen, lîkederwîse oft he en van worde to worde toghescreuen wêre vnde lůdde, dâr se mede schôlen holden êne êwighe lampen in der brôder ganghe vôr deme parlore se an to stikkende alle nacht to der metten vnde vt to důnde, wan alle missen vte sint des dâghes, in deme suluen godeshûse to Dobberan. Vortmer wes dâr ôuer blift van desseme vôrgherôreden golde vnde pennynghen beuele ik gantzliken den vôrbonômeden heren Bernde abbete vnde her Mathias Axkowen riddere vnde gheue en vulkômene macht in craft desses brêues, dat se dat gheuen an de hende der armen, alze en dat aldernůttest důnket. Desse vorantwerdinghe is ghescheen an des vâkenghenanten heren Berndes abbetes hende to Dobberan vppe sîner kemmenade. Dâr an vnde ôuer wêren de ghêstliken heren: Andreas Bukowe kelre, Johannes Hasselbeke bursarius to Dobberan vnde de beschêdene man Nicolaus Smyd, des suluen heren abbetes notarius, den ik dat sulue gold vnde gheld totellede vppe des heren abbetes hôue to Dobberan in synes kôkenmesters kâmeren, des êrsten vrydâghes in der vasten, na den iâren vnses heren dûsent vêrhundert in deme ênvndevêrtighesten iâre. To hôghere bekantnisse alle desser vôrscreuen stukke vnde vulkômener witscopp mynes beghêres hebbe ik myn ingheseghel henghen lâten mit wittscop vôr dessen brêff, gheuen vnde screuen to Rogghowe


|
Seite 309 |




|
an deme vôrghescreuen iâre der bôrd Cristi, des êrsten sonâuendes in der vasten.
Das Original ist auf Pergament in einer festen Minuskel geschrieben. An einem Pergamentstreifen hängt ein rundes Siegel mit zwei Armen, welche einen Schild halten: Umschrift:
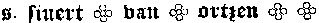
Auf der Rückseite steht:
Computacio testamentariorum ex parte Sifridi
de Ortzen. Siegfried von Oertzen starb am 1.
Julii 1449 im gelobten Lande und ward auf
dem Berge Zion bei den Franziskanern
begraben; vgl. unten sein Kenotaph in den
"Blättern zur Geschichte der Kirche zu
Doberan".
Vgl. Urk. vom 21. Dec. 1431.
Nr. XXXVII.
Der Ritter Matthias Axecow stiftet für sich und sein Geschlecht Seelenmessen und Almissen in dem Kloster Doberan mit 39 Mk. 4 Sch. lüb. Hebungen aus den Dörfern Redewisch, Steinbeck und Nienhagen.
D. d. Doberan. 1439. Febr. 2.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Mathias Axcowe ridder bekenne vnde betûghe âpenbar vôr my, myne hûsfrôwen Ghezen vnde myne rechten eruen an desseme iêghenwardeghen brêue vôr alsweme, de ene zût ofte hôret lezen, dat yk by myneme zunde wolmechteghen lîue myt vrighen, wolbedachten, berâdenen môde, myt vulbôrd der vôrgherûrden myner nêghesten eruen vmme heyls vnde zâlecheyt wyllen myner zêle vnde myner lêuen olderen: heren Werners Axcowen rydders, mynes vâders, vor Greten, myner môder, heren Johannes vnde Vredrekkes, ôk ryddere, Karles, Werners vnde Clawezes, knâpen, myner brôdere, alle hêten Axcowe, vor Gheze, myner hûsfrôwen, vor Bheken vnde Rikkarde, myner zustere, heren Heydenrik Bibowen ridders, myner hûsfrôwen vâders, vor Abelen Bibowen, erer môder, Helmold vnde Hans Bibowen, knâpen, erer brôdere, Beaten, erer zuster,


|
Seite 310 |




|
vor Ghezen, ôk wandâghes myner hûsfrôwen, vnde al
vnzer kindere, vrunde vnde naghebâren, vns allen
to heile, trôste vnde vorlâtynghe vnzer zunde,
deme êwerdeghen an god vâdere vnde heren hern
Bernde abbete vnde gantzen conuente tho Dobbran
vnde allen eren nakômelinghen hebbe
thoghetêkent, lâten vnde gheuen, lâte vnde gheue
iêghenwardych an craft desses brêues
neghenvndedrothech mark lubesch, alzo bynnen
Lubek vnde der Wismer ghenghe vnde gheue zynt,
vnde vêr schillynghe der zuluen můnte
iârlikes ingheldes vnde rente herenbêde an
dessen nascreuen gûderen, alzo thôr Redewysch
vefteyen mark lubesch myn vêr schillinghe, tôr
Stenbeke twelf mark lubesch vnde tôme
Nigenhaghene dortyendehalue mark lubesch
vôrscreuener munte, myt zodâner vryheyt vnde
êghendôme, alzo my vnde mynen rechten eruen de
vôrscreuen neghenvndedorthech mark lubesch vnde
vêr schillinghe iârlikes yngheldes van den
erluchteden hôchgebâren vrôwen vnde heren,
vrôwen Katherinen herteghinnen, heren Hinrike
vnde Johanne, herteghen to Mekelenborch,
vorstinnen vnde fforsten to Wenden, greuinne
vnde greuen to Zwerin, der lande Stargharde vnde
Rostok vrôwen vnde heren, de aldervrighest
vorêghent vnde vorseghelt zynt an der bêde
bynnen den vôrbenômeden gûderen, my edder mynen
eruen ofte nêmende nycht myt alle, âne den heren
wedderkôp, dâr ane to beholdende, na lûde vnde
inholdynghe erer brêue, welleker brêue ik her
Mathias Axcow ridder vôrbenômet deme heren
abbete vnde zyneme conuente to Dobbran myt
vulkâmen wyllen hebbe vorantwardet, en zo
hulpelik, brůkelik vnde nutte to wesende,
ofte ze en van worden to worden, lîkerwis alzo
ze my vnde mynen eruen to lůden, wêren
toscreuen, vnde hebbe ze v
 rt anghewîset myt den zuluen
brêuen an brûkelke besittinghe vnde bôrynghe der
vôrbenômeden rente. Desse zuluen
neghenvndedortech mark lubesch vnde vêr
schillinghe iârlikes ingheldes vnde rente schal
me anlegghen vnde schikken to almissen to deme
dênste godes vnde zâlecheyt der êrbenômeden
zêlen an desse nabescreuen wyze, zo dat de
kelre, de tôr tiid ys, van den XIX marken vnde
vêr schillinghen alle iâr êweghen to twên tiiden
an deme iâre, alzo to sunte Mathias dâghe vnde
sunte Thomas dâghe, der twyer apostele dâghe
rt anghewîset myt den zuluen
brêuen an brûkelke besittinghe vnde bôrynghe der
vôrbenômeden rente. Desse zuluen
neghenvndedortech mark lubesch vnde vêr
schillinghe iârlikes ingheldes vnde rente schal
me anlegghen vnde schikken to almissen to deme
dênste godes vnde zâlecheyt der êrbenômeden
zêlen an desse nabescreuen wyze, zo dat de
kelre, de tôr tiid ys, van den XIX marken vnde
vêr schillinghen alle iâr êweghen to twên tiiden
an deme iâre, alzo to sunte Mathias dâghe vnde
sunte Thomas dâghe, der twyer apostele dâghe
 ns iêwelken schal schikken vnde êr-
ns iêwelken schal schikken vnde êr-


|
Seite 311 |




|
liken vorseen deme conuente myt ême dênste myt
vêr gûden richten vnde myt dr
 n tunnen gûdes Butzowesches bêrs,
dâr vôr schôlen de heren vnzer zêlen denken myt
villyen vnde myt zêlenmyssen vnde êrliken
beghâ
e
n myt eren andachtigen beden
vmme verlâtinghe aller zunde; vortmer XX mark
lubesch schôlen denne des godeshûs kinderen to
kaghelen van berwer, Strâseborgher efte Ysenak,
wes me geddelisch to kôpe kan vinden. Vortmer
ofte de herschop desse rente vôrscreuen to
tokamen tiiden lôzen willen vnde lôzen na lûde
erer brêue, zo schal de here abbet vnde conuent,
de tôr tiid zynt, dâr ghelt wedder anlegghen
vnde zodâne wisse rente mede mâken vnde desse
vôrscreuen stucke to êweghen tiiden dâr van
holden, my ofte mynen eruen edder nêmande dâr
vurder vp to zâkende. Alle desse artikele
vôrscreuen vnde ên êslik by zyk lâue ik Mathias
Axcow ridder vôr my vnde myne hûsfrôwen Gheze
vôrbenômet vnde myne rechten erue stede vnde
vast wol to holdende an gûden trôwen, zunder
alle arch. To grôterme lôuen vnde bewâringhe
hebbe ik myn inghezeghel vôr my, myne hûsfrôwen
vnde mynen rechten eruen vnde wy Henneke tôme
Gnemere vnde Kersten to Blizekowe wânaftich,
ghenômet Axcowen, vedderen, vnde Hans
Stralendorp tôme Gammel hebben vnze ingheseghele
to tûchnysse vnde wytlicheit myt wyllen vnde
vullenkâmener wêtenheyt henghen hêten vnde lâten
vôr dessen brêff, gheuen vnde screuen to Dobbran
na godes b
n tunnen gûdes Butzowesches bêrs,
dâr vôr schôlen de heren vnzer zêlen denken myt
villyen vnde myt zêlenmyssen vnde êrliken
beghâ
e
n myt eren andachtigen beden
vmme verlâtinghe aller zunde; vortmer XX mark
lubesch schôlen denne des godeshûs kinderen to
kaghelen van berwer, Strâseborgher efte Ysenak,
wes me geddelisch to kôpe kan vinden. Vortmer
ofte de herschop desse rente vôrscreuen to
tokamen tiiden lôzen willen vnde lôzen na lûde
erer brêue, zo schal de here abbet vnde conuent,
de tôr tiid zynt, dâr ghelt wedder anlegghen
vnde zodâne wisse rente mede mâken vnde desse
vôrscreuen stucke to êweghen tiiden dâr van
holden, my ofte mynen eruen edder nêmande dâr
vurder vp to zâkende. Alle desse artikele
vôrscreuen vnde ên êslik by zyk lâue ik Mathias
Axcow ridder vôr my vnde myne hûsfrôwen Gheze
vôrbenômet vnde myne rechten erue stede vnde
vast wol to holdende an gûden trôwen, zunder
alle arch. To grôterme lôuen vnde bewâringhe
hebbe ik myn inghezeghel vôr my, myne hûsfrôwen
vnde mynen rechten eruen vnde wy Henneke tôme
Gnemere vnde Kersten to Blizekowe wânaftich,
ghenômet Axcowen, vedderen, vnde Hans
Stralendorp tôme Gammel hebben vnze ingheseghele
to tûchnysse vnde wytlicheit myt wyllen vnde
vullenkâmener wêtenheyt henghen hêten vnde lâten
vôr dessen brêff, gheuen vnde screuen to Dobbran
na godes b
 rt dûsentvêrhundert an deme
neghenvndedrutteghesten iâre, an vnzer lêuen
vrôwen dâghe to lichtmissen.
rt dûsentvêrhundert an deme
neghenvndedrutteghesten iâre, an vnzer lêuen
vrôwen dâghe to lichtmissen.
Auf Pergament in einer festen Minuskel. An Pergamentstreifen hangen 4 etwas undeutlich gewordene Siegel, die ersten mit dem axecowschen, das vierte mit dem stralendorfschen Wappen.


|
Seite 312 |




|
Nr. XXXVIII.
Der Ritter Matthias Axecow stiftet für sich und sein Geschlecht Seelenmessen in dem Kloster Doberan mit 8 Mk. lüb. Hebungen aus dem Dorfe Brusow.
D. d. Doberan 1445. März 25.
Nach dem Originale im grossherzogl. Geh. u. Haupt-Archive zu Schwerin.
Ik Mathias Axcow rydder bekenne vnde betûghe vôr
my vnde myne hûsffrôwen vor Ghesen vnde myne
rechte eruen âpenbar an dessem iêghenwardighen
brêue vor alsweme, dat yk by myneme zunden
wolmechtighen lyue, myd vrygeme, wolbedachteme,
berâdenem môde, myd vulbord der vôrgher
 rden myner nêghesten, vmme heyles
vnde sâlycheyd wyllen myner zêle vnde myner
lêuen olderen, heren Werners rydders, mynes
vâders, vor Greten myner môder, heren Johannis
vnde Ffrederikes, ôk ryddere, Kareles vnde
Claweses, knâpen, myner brôdere, alle hêten
Axcowen, vor Ghezen myner husfrowen, vôr Beken
vnde Rycardien, myner sustere, heren Heydenrikes
Bybowen, rydders, myner hûsfrôwen vâder, vor
Abelen, erer môder, Helmold vnde Hanses Bybowen,
knapen, der genanten myner husfrowen brôdere,
Beaten erer suster, vor Ghesen, ôk wandâghes
myne hûsfrôwe, vnde alle vnser kyndere, vrunde
vnde naghebôren, vns allen to tr
rden myner nêghesten, vmme heyles
vnde sâlycheyd wyllen myner zêle vnde myner
lêuen olderen, heren Werners rydders, mynes
vâders, vor Greten myner môder, heren Johannis
vnde Ffrederikes, ôk ryddere, Kareles vnde
Claweses, knâpen, myner brôdere, alle hêten
Axcowen, vor Ghezen myner husfrowen, vôr Beken
vnde Rycardien, myner sustere, heren Heydenrikes
Bybowen, rydders, myner hûsfrôwen vâder, vor
Abelen, erer môder, Helmold vnde Hanses Bybowen,
knapen, der genanten myner husfrowen brôdere,
Beaten erer suster, vor Ghesen, ôk wandâghes
myne hûsfrôwe, vnde alle vnser kyndere, vrunde
vnde naghebôren, vns allen to tr
 ste vnde vorlâtynge vnser zunde,
deme êrwerdighen vâdere an ghod vnde heren hern
Johanni abbete vnde der ghemeynen zâmmelinge to
Dobberan vnde allen eren nakômen hebbe
toghetêkent, lâten vnde gheuen, lâte vnde gheue
ieghenwardich an krafft desses brêues achte mark
lubesch, alze bynnen Lubek vnde der Wismer
ghenghe vnde gheue zynt, iârlikes ingheldes vnde
bôrynge an der heren bêde bynnen deme dorpe tôr
Brusow myd zodâner vrygheyd vnde êghendôme, alze
my vnde mynen rechten eruen de vôrscreuen achte
mark gheldes von den hôghgebôren vrowen vnde
heren, vrowen Katherynen herteghynnen, heren
Hinrike vnde Johanne, herteghen to Mekelenborgh, ffurstynnen
ste vnde vorlâtynge vnser zunde,
deme êrwerdighen vâdere an ghod vnde heren hern
Johanni abbete vnde der ghemeynen zâmmelinge to
Dobberan vnde allen eren nakômen hebbe
toghetêkent, lâten vnde gheuen, lâte vnde gheue
ieghenwardich an krafft desses brêues achte mark
lubesch, alze bynnen Lubek vnde der Wismer
ghenghe vnde gheue zynt, iârlikes ingheldes vnde
bôrynge an der heren bêde bynnen deme dorpe tôr
Brusow myd zodâner vrygheyd vnde êghendôme, alze
my vnde mynen rechten eruen de vôrscreuen achte
mark gheldes von den hôghgebôren vrowen vnde
heren, vrowen Katherynen herteghynnen, heren
Hinrike vnde Johanne, herteghen to Mekelenborgh, ffurstynnen


|
Seite 313 |




|
vnde ffursten to Wenden, greuynnen vnde greuen to
Sweryn, der lande Stargarde vnde Rostok vrowen
vnde heren, de aldervrygest vorêghend vnde
vorsegheld zynd an den êrbenômeden bêde vnde
dorpe, my, mynen eruen edder iêmande nicht myd
alle dâr ane to beholdende, sunder allênen den
heren den wedderkôp, na lûde erer brêue, welkere
brêue ik Mathias Axcow rydder vôrbenômed deme
heren abbete vnde clôster myd vulkâmenen wyllen
hebbe vorantwerdet, en zo hulplyk, br
 klyk vnde nutte to wesende, alze
my suluen vnde mynen rechten eruen, vnde hebbe
ze vord anghewysed myd den suluen brêuen an
brûkelke besyttynge vnde bôrynge der êrbenômeden
bêde myd zodâner vnderschêde, de here abbet ze
schal anleggen vnde schycken t
klyk vnde nutte to wesende, alze
my suluen vnde mynen rechten eruen, vnde hebbe
ze vord anghewysed myd den suluen brêuen an
brûkelke besyttynge vnde bôrynge der êrbenômeden
bêde myd zodâner vnderschêde, de here abbet ze
schal anleggen vnde schycken t
 r êre ghodes vnde zâlycheyt der
vpgenanten zêlen, nâmelken deme conuente ênen
ghûden dênst myd veer rychten vnde twên tunnen
Butzowesches bêrs vppe sunte Jacobes dach des
hillighen apostels; dar v
r êre ghodes vnde zâlycheyt der
vpgenanten zêlen, nâmelken deme conuente ênen
ghûden dênst myd veer rychten vnde twên tunnen
Butzowesches bêrs vppe sunte Jacobes dach des
hillighen apostels; dar v
 r schal dat sulue conuent myner
vnde der vpgenanten zêlen innyghen denken myd
vigilien vnde zêlmissen vnde êrlyken beghâen,
alze ik en des betrûwe. Vurdermeer wen de
herschop zodâne bêde vnde bôrynge lôzet na lûde
erer brêue, schal de here abbet zodâne gheld
wedder anleggen vnde wysse renthe mede mâken
vnde dat vôrbenômede zêlgherede dâr aff holden
to êwyghen tiiden. Alle desse artikele bôuen
vnde na screuen vnde ên yslyk by syk lâue ik
Mathias Axcow rydder vôr my, myne hûsfrôwen
Ghesen êrbenômed vnde myne rechten eruen stede
vnde vast wol to holdende sunder alle argh an
ghûden trûwen. To grôterem lôuen hebbe ik
Mathias Axcow rydder vôr my, myne hûsfrôwen vnde
myne rechten eruen myn ingheseghel, alze en
hôuetman, vnde wy Ffrederik, Henneke vnde
Kersten, alle nômet Axcowe, vedderen, vnde Hans
Stralendorp, Vicken zône, tôme Gammele, hebben
ôk vnse ingeseghele alle alze witschoppes vnde
tûgheslûde myd vulkâmenem wyllen hengen hêten
vôr dessen brêff, gheuen vnde screuen to
Dobberan dûsent veerhundert amme viif vnde
veertighesten iâre, amme ghûden wytten
donredaghe na der bôrd Christi vnses heren.
r schal dat sulue conuent myner
vnde der vpgenanten zêlen innyghen denken myd
vigilien vnde zêlmissen vnde êrlyken beghâen,
alze ik en des betrûwe. Vurdermeer wen de
herschop zodâne bêde vnde bôrynge lôzet na lûde
erer brêue, schal de here abbet zodâne gheld
wedder anleggen vnde wysse renthe mede mâken
vnde dat vôrbenômede zêlgherede dâr aff holden
to êwyghen tiiden. Alle desse artikele bôuen
vnde na screuen vnde ên yslyk by syk lâue ik
Mathias Axcow rydder vôr my, myne hûsfrôwen
Ghesen êrbenômed vnde myne rechten eruen stede
vnde vast wol to holdende sunder alle argh an
ghûden trûwen. To grôterem lôuen hebbe ik
Mathias Axcow rydder vôr my, myne hûsfrôwen vnde
myne rechten eruen myn ingheseghel, alze en
hôuetman, vnde wy Ffrederik, Henneke vnde
Kersten, alle nômet Axcowe, vedderen, vnde Hans
Stralendorp, Vicken zône, tôme Gammele, hebben
ôk vnse ingeseghele alle alze witschoppes vnde
tûgheslûde myd vulkâmenem wyllen hengen hêten
vôr dessen brêff, gheuen vnde screuen to
Dobberan dûsent veerhundert amme viif vnde
veertighesten iâre, amme ghûden wytten
donredaghe na der bôrd Christi vnses heren.
Auf Pergament in einer festen Minuskel. Die Siegel sind von den 5 Pergamentstreifen sämmtlich abgefallen.
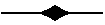


|
[ Seite 314 ] |




|


|
[ Seite 315 ] |




|



|


|
|
|
-
Chemische Analysen antiker Metalle aus
heidnischen Gräbern Meklenburgs
- Framea von Goldberg
- Handberge von Prislich
- Schwert von Tarnow
- Heftel mit zwei Spiralplatten
- Metallspiegel von Sparow
- Diadem von Wittenmoor
- Urne von Ruchow
- Framea von Satow
- Fingerring von Ruchow
- Fingerring von Friederichsruhe
- Krater von Groß-Kelle
- Commandostab von Hansdorf
- Beschlagring von Ludwigslust
- Armring von Ludwigslust
- Heftel mit Spiralfeder
- Heftel mit Spiralfeder von Camin
- Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier
- Heidnische Gräber bei Neu-Bukow an der Ostsee
- Heidnische Gräber zu Carow und Leisten
- Alterthümer in der Gegend von Gnoyen
- Alterthümer im Luche bei Fehrbellin
- Feuerstein-Manufactur bei Brunshaupten
- Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Nr. 1
- Hünengrab von Remlin, Nr. 2, Nr. 3
- Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz)
- Hünengrab von Roggow
- Hünengräber von Vietlübbe bei Plau
- Hünengrab von Lage
- Hünengrab von Püttelkow
- Kegelgrab von Peccatel
- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1, Nr.2.
- Kegelgrab von Retzow Nr. 3
- Kegelgräber und Begräbnißplatz zu Ganzlin bei Plau
- Kegelgrab von Grebbin
- Goldring von Bresegard bei Eldena
- Bronze-Schwert von Schmachthagen
- Bronze-Schwert von Kreien bei Lübz
- Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen
- Wendische Silbergeschmeide und Münzen aus der Gegend von Schwerin
- Wendischer Silberschmuck und wendische und altdeutsche Münzen von Remlin
- Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau
- Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow
- Römische Bronze-Vase von Vorland bei Grimmen
- Urnen aus der Lausitz
- Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden
- Henkelkrug von Böhlendorf
- Fingerring von Beckerwitz
- Schwert von Schwaan
- Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel
- Der Hart
- Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf
- Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe
- Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf
- Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg
- Blätter zur Geschichte der Kirche zu Doberan, niedergeschrieben in Doberan im August 1843 und revidirt in Doberan im September 1843
- Die Marien-Kirche zu Rostock
- Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow
- Die Glocke zu Westenbrügge
- Die Glocke zu Alt-Karin
- Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz
- Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen
- Denktafel in der Kirche zu Dambeck
- Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock
- Römische Münzen
- Der Münzfund von Remlin aus dem 10.-11. Jahrhundert
- Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
- Familie von Maltzan
- Geschlecht von Hobe
- Das Petschaft des letzten von Lübberstorf
- Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato
- Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter
- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506
- Manus Mortua, die Todte Hand, der blinkende Schein (Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94)
- Die Einziehung der Güter der Selbstmörder
- Strafe auf Kindesmord und Sodomie im 18. Jahrhundert
- Ein Horn eines Urochsen
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 316 ] |




|


|
[ Seite 317 ] |




|



|


|
|
:
|
- Framea von Goldberg
- Handberge von Prislich
- Schwert von Tarnow
- Heftel mit zwei Spiralplatten
- Metallspiegel von Sparow
- Diadem von Wittenmoor
- Urne von Ruchow
- Framea von Satow
- Fingerring von Ruchow
- Fingerring von Friederichsruhe
- Krater von Groß-Kelle
- Commandostab von Hansdorf
- Beschlagring von Ludwigslust
- Armring von Ludwigslust
- Heftel mit Spiralfeder
- Heftel mit Spiralfeder von Camin
1. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Der vorchristlichen Zeit.
a. Im Allgemeinen.
Chemische Analysen antiker
Metalle
aus heidnischen Gräbern Meklenburgs,
von
H. L. von Santen,
Senator und Apotheker zu Kröpelin,
mit
antiquarischen Einleitungen und Forschungen begleitet
von
G. C. F. Lisch,
großherzogl. meklenb.
Archivar zu Schwerin.
D ie bronzenen Alterthümer aus den kegelförmigen, mit Rasen bedeckten Gräbern Norddeutschlands, welche wahrscheinlich den Germanen zuzuschreiben sind und welche die Bronze= und Goldzeit, als nicht mehr unvermischtes Kupfer und noch nicht Eisen und Silber in Gebrauch war, charakterisiren, haben so viel Interesse, daß deren allseitige Erforschung dereinst von nicht geringem Werthe für die Urgeschichte Deutschlands sein wird. So viel stellt sich schon jetzt mit Sicherheit heraus, daß alle diese Gräber einer und derselben weitreichenden Cultur=Epoche angehören, welche mit dem epischen Zeitalter in Südeuropa zusammenfallen und im Allgemeinen die beiden nächsten Jahrtausende vor Christi Geburt füllen dürfte, daß die cultivirten europäischen Völker damals auf gleicher Culturstufe


|
Seite 318 |




|
standen, daß die norddeutschen Alterthümer aus dieser Zeit keinesweges hinter den altgriechischen und altitalischen zurückstehen, sondern dieselben an Reinheit der Form oft übertreffen. Nicht nur erregt die Schönheit der Formen Bewunderung, auch die Kunstfertigkeit in der Bereitung 1 ) der Metalle zieht die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich; denn es ist nicht zu bezweifeln, daß die in den Gräbern gefundenen Alterthümer, welche überall und stets denselben Charakter haben und doch nicht einander gleich sind, dort verfertigt wurden, wo man sie findet (vgl. Lisch Friderico-Fraucisceum, Erläut. S. 41 - - 42 und H. C. von Minutoli Topographische Uebersicht der Ausgrabungen - - in den Küstenländern des baltischen Meeres, Berlin, 1843, S. 81 flgd.). Daher ist die chemische Untersuchung der heimischen antiken Bronzen auch wiederholt Gegenstand aufmerksamer Studien gründlicher Forscher gewesen.
Zuerst wandte Klaproth der Analyse der vaterländischen Bronzen seine Aufmerksamkeit zu. Er untersuchte im J. 1807 mehrere alte Bronzen, namentlich diejenigen, welche in der Sammlung der Großen Freimaurer=Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin aufbewahrt werden, und legte die Analysen in Gehlens Journal für Chemie IV, Heft 13, Nr. 15, Julii,
"Durch das Zinn erhält das Kupfer eine hellere Farbe, ein dichteres Gefüge, eine größere Leichtflüssigkeit, mehr Härte und Klang, und widersteht in dieser Verbindung stärker der Atmosphäre und der Feuchtigkeit, als für sich. Es wird jedoch viel spröder, so daß es sich weder kalt noch warm hämmern läßt, besonders wenn das Verhältniß des Zinns gegen das Kupfer wächst. Hieraus wird es wahrscheinlich, das die meisten antiquarischen Gegenstände von dieser Composition gegossen worden sind; - - einige dagegen können gehämmert sein; wo man dies vermuthen kann, spricht auch die Composition dafür; denn dann ist das Kupfer sehr überwiegend".
An einer andern Stelle (Allgem. Anz. d. Deutschen, 1843, S. 935, und Dinglers Polytech. Journ., Jahrg. 24, Heft 10, 1843, S. 320,) heißt es:
"Die Metallcomposition aus 16 Theilen Kupfer und 1 Theil Zinn"
"1) hat eine gewisse Goldlegirungen ähnliche Farbe";
"2) läßt sich sogleich vom Gusse weg gut und lange hämmern und strecken";
"3) zeigt sich sehr geschmeidig und dehnbar";
"4) ist nicht nur härter und elastischer als Kupfer, sondern selbst als Messing, und fast so hart, als Schmiedeeisen";
"5) es fließt leichter und dünner, als Messing, so daß man Kupfer sehr gut damit löthen kann, und es ist vielleicht ein besseres Hartloth für Kupfer, als das bisher gebräuchliche aus Messing und Zink".
"Letztere Eigenschaft wäre aber dennoch zugleich eine Unbequemlichkeit bei Verarbeitung dieses Metalls. Man möchte vielleicht kein wohlfeileres Hartloth für dasselbe haben, was dessen Anwendung auf Fälle und Gegenstände beschränken würde, die nicht hart gelöthet werden. Außer diesem jedoch würden sich Klempner= und Kupferschmiede=Arbeiten, Kessel, Töpfe, aus diesem Metall, von geringerer Stärke, besser in Form halten, als aus Kupfer und Messing, und nicht so bald buckelig und beulig werben".


|
Seite 319 |




|
und in Scherers Journal VI, nieder. Darauf untersuchten Prof. Dr. L. Hünefeld und Ferd. Picht mehrere auf Rügen und in Pommern gefundene Bronzen und theilten die Analysen in "Rügens metallischen Denkmälern der Vorzeit, vorzugsweise chemisch bearbeitet, Leipzig, 1827", mit. Wenn auch gegen das chemische Verfahren bei diesen Analysen nichts zu erinnern sein mag, so fehlt es doch an zuverlässigen, wissenschaftlichen Nachrichten über den antiquarischen Ursprung dieser Bronzen. Die von Klaproth untersuchten Alterthümer haben zwar alle die Form der norddeutschen Alterthümer; aber es ist bekannt, daß während des größern Zuströmens von Alterthümern nach Berlin in frühern Zeiten eine scharfe Scheidung zwischen südeuropäischen und norddeutschen Bronzen nicht geschah, und noch heutiges Tages nicht durchgeführt ist, so daß z. B. in der Sammlung römischer Bronzen viele Stücke aufbewahrt werden, welche ohne Zweifel dem vaterländischen Boden abgewonnen sind; von der andern Seite ist bei dem großen Umfange des preußischen Staats und der aus demselben zusammenströmenden Alterthümer eine scharfe Scheidung der heimischen und fremden Alterthümer oft wohl nicht möglich. Hünefeld und Picht ließen sich zwar die zu analysirenden Bronzen von bekannten Alterthumsfreunden geben und gebrauchten die Vorsicht, die analysirten Bronzen in ihrem Werke abzubilden; aber es sind von ihnen mehrere Bronzen analysirt, von denen es zweifelhaft ist, ob sie der eigentlichen Bronze=Periode angehören, z. B. die getriebenen Bronzeringe. Es gehört nämlich zum Wesen der eigentlichen Bronze=Periode, daß die bronzenen Geräthe derselben gegossen sind; nur einige Gefäße, Urnen, Näpfe etc. bestehen, als seltene Ausnahmen, aus dünne gehämmertem Bronzeblech. Die getriebenen Ringe scheinen nach dem leichtern Roste und nach andern Umständen bei der Auffindung einer jüngern Zeit anzugehören. Das Hämmern der Metalle wird erst allgemeiner, als das Schmieden des Eisens allgemeiner wird, eine Erfindung, welche in den Künsten des Lebens eine der größten Umwälzungen hervorgebracht hat.
Mögen nun auch die frühern antiquarischen Untersuchungen der heimischen antiken Bronzen der antiquarischen Basis entbehren, so geht doch aus der Analyse derjenigen dieser Bronzen, welche mit Sicherheit der eigentlichen Bronze=Periode zugeschrieben werden müssen, wie der Schwerter, Frameen, Lanzen etc. hervor, daß die gewöhnliche Bronze der Kegelgräber Norddeutschlands eine Legirung von Kupfer und Zinn sei und kein anderes Metall


|
Seite 320 |




|
enthalte, als ungefähr 85-90 pCt. Kupfer und 15-10 pCt. Zinn, daß namentlich kein Blei, Zink, Silber und Eisen in dieser Metallmischung gefunden werde.
Darauf veranlaßte die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen den berühmten Chemiker Berzelius zur Analyse mehrerer Bronzen, deren Resultat in Annaler for nordisk oldkyndighed, 1836-1837, p. 104, mitgetheilt ist. Nach den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357, hatte der Ausschuß der Gesellschaft, welcher bekanntlich die verschiedenen Perioden des heidnischen Alterthums mit Sicherheit überschaut, "dem Freiherrn Berzelius zur Untersuchung nur solche Stücke, die aus dem eigentlichen Broncealter herrührten, aber keine weder aus einem frühern, noch aus einem spätern Alter" mitgetheilt. Die Untersuchung gab dasselbe Resultat, daß die antike heimische Bronze nur eine Legirung von Kupfer und Zinn sei.
In den neuesten Zeiten hat Professor Göbel zu Dorpat, in Veranlassung der antiquarischen Untersuchungen des Professors Kruse zu Dorpat, mehrere alte Bronzen, sowohl altgriechische und italische, als in den russischen Ostsee=Provinzen gefundene, analysirt. Zuerst berichtete Kruse über die Resultate in einem Schreiben an die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen vom 19. Oct. 1839, in den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357. Darauf erschien ein eigenes Buch von Göbel: Ueber den Einfluß der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit, Erlangen, 1842, mit einer Menge Analysen, welche bald darauf Kruse in einem großen Werke: Necrolivonica oder Alterthümer Liv=, Esth= und Curlands bis zur Einführung der christlichen Religion in den russischen Ostsee=Gouvernements, Dorpat, 1842, Beilage F, noch ein mal mittheilte und mit antiquarischen Bemerkungen begleitete; Kruse stimmt im Allgemeinen mit Göbel in den antiquarischen Resultaten überein.
Aus der tabellarischen Zusammenstellung bisher bekannt gewordener Analysen bei Göbel ergiebt sich nun, daß
1) die griechischen Geräthe und Bildwerke aus Kupfer und Zinn, die Münzen aus Kupfer, Zinn und Blei,
2) die französischen, deutschen und nordischen heimischen Bronzen des Alterthums aus Kupfer und Zinn,
3) die römischen Bronzen aus Kupfer und Zink, oder Kupfer, Zinn und Blei, oder Kupfer, Zink, Zinn und Blei,


|
Seite 321 |




|
4) die in den russischen Ostsee=Gouvernements gefundenen Bronzen aus Kupfer, Zink, Zinn und Blei bestehen.
Das Resultat ist also, daß die griechischen Bronzen aus Kupfer und Zinn bestehen, mitunter Bleizusatz haben, aber nie Zink enthalten: "was Zink enthält, ist niemals griechisch". Aehnliche Mischung enthalten die deutschen und nordischen Bronzen, nämlich nur Kupfer und Zinn. Die römischen Alterthümer enthalten, zum besondern Merkmale, außerdem Zink, und hiemit stimmen, nach den Mischungsverhältnissen, die Alterthümer der russischen Ostseeprovinzen überein, indem sie außer Kupfer, Zinn und Blei, auch Zink enthalten.
Hieraus ziehen Göbel und Kruse folgende historische Folgerungen:
1) alle Legirungen, die von den Griechen abstammen, bestehen aus Kupfer und Zinn (und Blei); (Kruse Necrolivonica, Beil. F, S. 10, sagt: "Die Scandinavische Legirung der sogenannten Bronzezeit, so wie die der Rügenschen und Norddeutschen Bronzereste von der Ostseeküste, ist größtentheils Alt=Römisch oder Griechisch. Ich erkläre dieses aber lieber dadurch, daß das gothische Volk - - theils mit den alten Griechen unmittelbar, theils mit den Griechischen Kolonien - - in Verbindung war. Von diesen mögen nun die Gothen zuerst diese Bronzesachen erhandelt haben. Dann aber mag auch die Kenntniß der Metallbereitung selbst zu ihnen übergegangen, und mit den Gothen durch Rußland nach Skandinavien gewandert sein".)
2) antike metallische Gegenstände, welche aus Kupfer und Zink bestehen, mit oder ohne Zusatz von Zinn und Blei, sind römischen Ursprungs, oder sie gehören Völkern an, auf welche sie von den Römern übergingen, obgleich auch Bronzen ohne Zinn auch römischen Ursprungs sein können; (Kruse a. a. O. sagt: "Die Skandinavische Legirung der spätern Gräberzeit im X. und XI. Jahrhundert zeigt den spätern römischen Ursprung und eben so diejenige, welche in Thüringen und Sachsen und in unsern Provinzen vorkommt. Diese Römische Legirung der Kaiserzeit kann aber recht wohl durch Handel, Kriege, Raubzüge und Tribute zu den nördlichen Völkern übergegangen sein".)
3) es kann jedoch nicht gesagt werden, daß alle Alterthümer, welche kein Zink enthalten, nur griechischer Abstammung seien;


|
Seite 322 |




|
4) die in den Ostsee=Gouvernements vorkommenden bronzenen Alterthümer, welche wohl die alten Skandinavier gebraucht und getragen haben mögen, sind von römischer Abstammung, oder von römischen Metallarbeitern angefertigt worden.
Es ist im höchsten Grade gefährlich, aus Einem Kennzeichen eines alterthümlichen Geräthes einen historischen Schluß zu machen. Die Alterthumskunde kann und darf nur Stoff für die Geschichte werden, wenn alle Kennzeichen zusammengenommen für eine geschichtliche Wahrheit reden: Bronzealterthümer z. B. können nur für einen geschichtlichen Satz reden, wenn alle Umstände des Auffindens für eine bestimmte Zeit charakteristisch sind und hiemit Metallmischung, Bereitungsweise, Form, Verzierung, Bestimmung, Rost und außerdem noch die Analogie übereinstimmen. Sollte der Satz Wahrheit haben, daß weil römische Bronzen Zinn enthalten, auch die Alterthümer der Ostseeprovinzen römischen Ursprungs seien: so würde sich mit Recht für jede Bronze, welche Zinn enthält, der römische Ursprung behaupten lassen. Ja, es muß gestattet sein, den Satz umzukehren und zu sagen, die Römer haben die Metall=Legirung mit Zink von irgend einem nordischen Volke erhalten: eine Behauptung, welche vom geschichtlichen Standpuncte aus sehr gewagt sein würde; und doch muß man sie machen können, wenn bloß die chemische Analyse einen Maaßstab abgeben soll.
Es ist überhaupt sehr gewagt, zu behaupten, die nördlichen Völker hätten ihre Geräthe und ihre Metallmischungen von den südlichen Völkern Europas erhalten; es ist auch gar keine Veranlassung zu einer solchen Behauptung vorhanden, selbst wenn man noch keine Gießstätten im Norden aufgefunden hätte. Die germanischen Völker und ihre Nachbaren haben ohne Zweifel eben so viel Anlage und Geschicklichkeit zur Verfertigung der nothwendigsten Geräthe und des Schmuckes des Lebens gehabt, als die alten Griechen und Italier. Es ist außer Zweifel, daß im frühesten Alterthume, der eigentlichen und reinen Bronze=Periode, alle civilisirtern Völker Europas, von Klein=Asien bis zu den Lappmarken, auf demselben Standpuncte der Cultur in der Verarbeitung der Metalle gestanden haben, bis sich die südlichen Völker durch Verarbeitung des Eisens auf einen technisch höhern Standpunct stellten; daß die Verbreitung der Eisen=Cultur sehr langsam von Süden nach Norden fortschritt und hier noch spät Eisenschmiede als die größten Künstler, welche Wunderbares verrichteten, angesehen wurden: die Periode des Erzgusses ist in der frühesten Zeit allen alten Völkern gemeinsam,


|
Seite 323 |




|
seien es Griechen oder Germanen. Der uralte Bronzeguß weiset auf eine uralte, gemeinsame Quelle der Cultur zurück, an welcher die griechischen, italischen und germanischen Völker zusammen saßen; der Bronzeguß ist bei dem einen Volke so alt, wie bei dem andern. Man denke nur daran, daß die ganze Vorzeit unsers Vaterlandes überhaupt nur drei, in sich selbst nicht verschiedene Cultur=Epochen aufzuweisen hat! Wahrlich nicht viel seit "Erschaffung der Welt", wenn man so sagen darf. Jedenfalls ist diese Thatsache ein Beweis, daß diese Epochen einen großen Zeitumfang gehabt haben. Will man aber eine Einführung der Bronzen von Griechenland und Rom in den Norden annehmen, so kann fortan von irgend einer Cultur der germanischen Nordländer gar nicht mehr die Rede sein; denn, außer den thönernen Urnen, finden wir durchaus nur Geräthe aus gegossener, höchst selten gehämmerter, Bronze, alle stets von einem und demselben Wesen.
Es kann ferner überhaupt nur davon die Rede sein, daß in den ältern Zeiten die Metallmischungen einfacher waren, daß sie im Fortschritte der Zeit complicirter wurden. In den ältesten Zeiten ward gediegenes Kupfer verarbeitet; die Legirung mit Zinn, welche hierauf folgte, brachte schon eine totale Veränderung des Lebens hervor; die Mischung mit Zink gehört einer jüngern Periode an. Leider ist die griechische und römische Alterthumskunde für die ältesten Zeiten äußerst dürftig. Es werden sich aber genug Bronzen aus Kupfer und Zinn in Italien finden, und Griechenland wird auch jüngere Bronzen mit Zink vermischt haben. Wenn auch die Kegelgräber Klein=Asiens, Griechenlands und Italiens studirt werden, so werden ganz andere Ansichten über das Alterthum verbreitet werden, als man bisher gehabt hat.
Betrachten wir Kruse's Necrolivonica mit den vielen Abbildungen genauer, so stellt sich die Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen noch als in ihren ersten Windeln dar. Die beiden großen Perioden des Alterthums, die Stein= und die eigentliche Bronze=Periode fehlen ganz; es ist in dem ganzen Werke kein einziges Stück abgebildet, welches der eigentlichen Bronze= Periode des Nordens angehörte. Alle abgebildeten Alterthümer tragen das Gepräge der jüngsten Zeit des Heidenthums und fallen ganz in die Eisen=Periode des Nordens. Den Beweis liefern die vielen eisernen modernen Geräthe, die zahlreichen Schmucksachen aus Silber, das endlose Kettenwerk, die hohl getriebenen Ringe, die drachenförmigen, bissigen Thiergestalten, die Brochen mit einer Spiralfeder, die modernen Fingerringe wie Siegelringe, die Sporen mit Bügeln, alle die modernen Schnallen und Spangen: dies alles ist jung,


|
Seite 324 |




|
sehr jung und dem Lande, in welchem es gefunden ist, ziemlich eigenthümlich. Die dünnen Bronze=Spiralen, auf Zwirn gezogen, sind in Meklenburg mit ganz jungen, kaum mit Rost belegten Bronzesachen und mit Eisen zusammen gefunden; dieselben silbernen Fingerringe und silbernes Flechtwerk ist hier mit Münzen aus dem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. Das Einzige, was einigermaßen den Schein eines höhern Alterthums für sich hat, sind die gewundenen Kopf= und Halsringe und einige Hefteln (broches); aber grade diese Ringe und Hefteln sind am längsten von allen Alterthümern in der Mode gewesen und die Ringe werden in allen 3 Perioden des Heidenthums, auch schon am Ende der Steinperiode, gefunden. - Man kann also ohne Scheu annehmen, daß die liefländischen, von Kruse bekannt gemachten Alterthümer etwa in das 10. Jahrhhundert n. C. fallen, also nicht von den Römern herstammen können. Sie enthalten im Durchschnitt nur einige p. C. Zinn und Blei und 18 bis 20 p. C. Zink. Aehnliche Alterthümer mit 20 p. C. Zink, welche in Jütland gefunden wurden, versetzt die königl. dänische Gesellschaft ebenfalls "ungefähr in das 10. Jahrhundert" (vgl. Mémoires, 1838-39, p. 357, Not. 1.) und äußert dabei, daß "die von Göbel untersuchten Metallstücke vermuthlich in ein späteres Alter gehören".
Die Untersuchungen von Göbel und die aus denselben von ihm und Kruse gezogenen geschichtlichen Folgerungen haben also auf die Erkenntniß der Bronze=Periode keinen andern Einfluß, als daß man weiß, daß in den jüngsten Zeiten des Heidenthums, in der Eisen=Periode, die Völker der russischen Ostseeprovinzen die alte Bronzemischung nicht mehr anwandten.
Kruse (z. B. Necroliv. Beil. C, S. 2 flgd.) und Göbel Einfluß etc., S. 20 flgd.) behaupten zwar an mehreren Stellen (z. B. Kruse Necroliv. Generalbericht, Seite 11), "eine große Aehnlichkeit, ja oft die fast völlige Identität der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Gegenstände mit den in Skandinavien und dem nördlichen Deutschland gefundenen Alterthümern in Hinsicht der Form und die Gleichheit in der Legirung der Metalle, welche hier und dort dieselbe ist", - fügen aber einlenkend hinzu: "wenn man den Inhalt der spätern skandinavischen Gräber nimmt, die nicht zu dem frühern Bronzezeitalter gehören". - Aber die von Kruse herausgegebenen und von Göbel analysirten Alterthümer haben gerade das Besondere, daß sie durchaus nicht mit den nordischen Alterthümern übereinstimmen, weder in der Form, noch in der Legirung der Metalle. Die


|
Seite 325 |




|
Metall=Legirung der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer weicht durchaus von der Legirung der nordischen Bronzen ab, indem sich in diesen nie Zink findet; und dies ist hinreichend, eine gänzliche Verschiedenheit zu behaupten. In Skandinavien finden sich einzelne mit Zink legirte Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit; aber diese stehen so isolirt, daß sie nicht eine umfassende Culturepoche, sondern nur in einzelnen Stücken den Uebergang zum Mittelalter bezeichnen. In Norddeutschland werden vollends gar keine mit Zink legirte heidnische Alterthümer gefunden. Einzelne Ausnahmen, die sich überall finden, können aber keine Regel machen und nicht zu dem unbestimmten Satze führen, die russischen und nordischen Alterthümer seien gleich, wenn man dabei die jüngere heidnische Periode im Auge behalte. - Die Formen sind völlig verschieden, einzelne Ausnahmen abgerechnet. Es sind in den russischen Ostseeprovinzen gar keine Alterthümer gefunden, welche mit den nordischen Alterthümern in der Form übereinstimmten; die Formen der norddeutschen und skandinavischen Alterthümer sind durchaus ganz andere, etwa die Aehnlichkeit einiger Helfteln (broches) mit Spiralfedern abgerechnet.
Man kann also nur sagen, die in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer seien von den skandinavischen und nordischen Alterthümern der Bronzeperiode und zum größten Theile der Eisenperiode in Legirung und Form, d. h. in Allem, völlig verschieden, und nur einige nordische Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens hätten einige Aehnlichkeit mit den russischen Alterthümern, welche im Allgemeinen offenbar in den Uebergang zum Mittelalter fallen.
Es geht hieraus hervor, daß eine Anknüpfung der norddeutschen Alterthumskunde mit dem Osten nicht in den russischen Ostseeprovinzen, sondern viel südlicher, etwa durch Polen und Gallizien nach dem schwarzen und caspischen Meere hin, zu suchen, und daß eine Verbindung der russischen Ostseeprovinzen nur mit der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens, nicht Norddeutschlands, statt gefunden habe, daß vielmehr die heidnische Cultur der russischen Ostseeprovinzen erst dann begonnen habe, als die heidnische Cultur des Nordens im Erlöschen begriffen gewesen sei, die älteste, eigentliche Bronzeperiode aber über alle Geschichte hinausreiche. Möglich, daß in den russischen Ostseeprovinzen Reste einer ältern Cultur noch verborgen liegen, zugegeben, daß sich dort häufig griechische und römische Alterthümer finden: aber von einer alten heimischen Cultur in jenen Ländern sind noch keine Beweise geliefert, wenigstens nicht in


|
Seite 326 |




|
dem Umfange, daß sie zu irgend einem Schlusse berechtigen könnten.
Wenn nun auch die aus der Analyse der Bronzen aus der eigentlichen Bronzeperiode Norddeutschlands und Skandinaviens bisher gewonnenen Resultate sicher sind, so dürfte es doch wohl möglich sein, dieselben noch weiter zu führen, wenn die Chemie Hand in Hand mit der Alterthumskunde geht, und beide Wissenschaften, auf sichere und genaue Fundberichte und umfassende antiquarische Forschungen gestützt, zugleich innere und äußere Merkmale über die Zeit und den Ort der Verfertigung der Alterthümer zu gewinnen suchen. Es sind daher im Folgenden mehrere Analysen von charakteristischen Bronzen aus der reinen Bronzeperiode, in welcher sich außer Bronze nur noch Gold findet, nach zuverlässigen Fundberichten, mitgetheilt und von den nöthigen antiquarischen Forschungen begleitet; daneben sind aber auch Analysen anderer Metalle aus andern oder angrenzenden Perioden, nach eben so genauen antiquarischen Forschungen, beigebracht, welche die Metalle der reinen Bronzeperiode in ein helleres Licht zu setzen und die Uebergänge scharf zu bezeichnen vermögen.
Das Verfahren bei der Analyse ist vorzüglich bei Nr. 11., Krater von Gr. Kelle, auseinandergesetzt, da der Verf. diese Analyse zu einem Vortrage in einer gelehrten Gesellschaft wählte.
I. Kupfer der Hünengräber.



|


|
|
|
1. Framea von Goldberg.
Wenn auch im Allgemeinen in den mit großen Steinen umringten und bedeckten Hünengräbern aus der Steinzeit nur Geräthe aus Stein und Schmucksachen aus Bernstein gefunden werden, so sind doch in der Altmark schon einige Gegenstände aus Metall in dieser Art von Gräbern gefunden (vgl. Erster Jahresbericht des Altmärk. Vereins, I, S. 36 und 43, und VI, S. 91), und zwar in solchen, welche wahrscheinlich der Uebergangsperiode aus der Steinzeit in die Bronzezeit anheimfallen. Abgesehen von Urnen mit eisernen Geräthen, dicht unter der Rasendecke dieser Art von Gräbern, da dieselben ohne Zweifel zur wendischen Zeit, der jüngsten heidnischen Periode, aus Pietät in die Gräber der unbekannten Vorfahren nachbestattet


|
Seite 327 |




|
sind, bestehen diese metallenen Geräthe der Hünengräber aus rothem Kupfer, noch nicht aus Bronze, da die Metall=Legirung wohl noch nicht bekannt war. In Meklenburg=Schwerin waren bisher nur zwei Geräthschaften aus Kupfer gefunden, nämlich die zwei Keile, welche Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2. und Tab. X, Fig. 6, (vgl. Erläut. S. 158, 119 und 107) abgebildet sind; ein dritter ähnlicher Keil befindet sich in der großherzogl. Alterthümer=Sammlung zu Neustrelitz (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 158).
Diese kupfernen Alterthümer deuten nicht allein durch ihre Form, da sie sämmtlich Keile nach dem Bildungsstande der Steinzeit sind, sondern auch durch den sehr rohen Guß und den gänzlichen Mangel der Politur, auf eine sehr alte Zeit hin, welche die letzte Periode der Steinzeit sein dürfte. Im J. 1842 ward im Moor von Pampow bei Schwerin ein gewundener Halsring aus Kupfer ohne Politur gefunden. Ganz charakteristisch für die kupfernen Geräthe aus der Steinperiode ist der rohe Guß und der gänzliche Mangel an Nacharbeitung der Oberfläche. (Während des Druckes dieser Bogen ist zu Admannshagen in einem Kegelgrabe eine Krone von reinem Kupfer gefunden, über welche in den nächstfolgenden Jahrbüchern berichtet werden soll.)
Im J. 1841, zur Zeit des Chausseebaues bei Güstrow, ward eine Framea von Kupfer mit Schaftrinne, als in der Gegend von Goldberg gefunden, ungefähr von der Gestalt wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 6, an die Eisengießerei zu Güstrow mit altem Metall zum Einschmelzen verkauft; leider ward das seltene Stück, wohl eine der ältesten, dem Keil nahe stehenden Frameen, durchgeschlagen und zur Hälfte eingeschmolzen (vgl. Jahresber. VII, S. 26). Sie ist am Ansehen des Metalls und an der rohen Oberfläche des Gusses dem kupfernen Keile in Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2, völlig gleich. Die chemische Analyse ergab:
| 98, | 64 | Kupfer, |
| 1, | 190 | Zinn, |
| 0, | 746 | Silber. |
Wahrscheinlich liegt das Vorhandensein des wenigen Silbers und Zinns in dem Mangel an Kenntniß der Metallscheidung, und das Metall dieser Framea ist wohl unstreitig gediegenes Kupfer, wie es in der Natur gefunden wird.
Von dem rothen und glänzenden Metall wurden 52 Gran in Salpetersäure aufgelöst, bis zum Verdunsten der überschüssi=


|
Seite 328 |




|
gen Säure eingeengt, die erstarrte und erkaltete Masse mit wenigem Wasser übergossen, einige Tropfen davon mit vielem Wasser zur Prüfung auf Wismuth verdünnt, aber kein Niederschlag erhalten. Die durch größern Wasserzusatz erhaltene vollständige Auflösung ward zur Trennung des abgeschiedenen Zinnoxyds filtrirt und mit heißem Wasser nachgespült. Es wog getrocknet 0,8 Gran.
Auf die salpetersaure Auflösung blieben alle Reagentien, außer der Salzsäure, die sogleich einen weißen Niederschlag erzeugte, der sich in Aetzammonium vollständig lösete und damit die Gegenwart des Silbers anzeigte, ohne Wirkung. Nach vollständiger Abscheidung des Silbers durch Salzsäure ward die Auflösung erhitzt, der Niederschlag gesammelt, gut ausgewaschen, getrocknet und darauf in einem kleinen Porzellantiegel geglüht, das Filtrum aber auf einem Platinadeckel verbrannt, und damit der Tiegel bedeckt. Das geglühete Chlorsilber wog 0, 458 Gran.
| 0, 8 Zinnoxyd =0, | 63 | Zinn, |
| 0, | 17 | Sauerstoff, |
| 0, | 80 . | |
| 0, 458 Chlorsilber = 0, | 348 | Silber, |
| 0, | 110 | Chlor, |
| 0, | 458 |
52 Gran des Metalls bestehen aus
| 0, | 630 | Zinn, |
| 0, | 348 | Silber, |
| und demnach aus 51, | 22 | Kupfer, |
| 52 | Gran. |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| Zinn, | 1, | 190 |
| Silber | 0, | 746 |
| Kupfer | 98, | 64 |
| 100. |
II. Metalle der Kegelgräber.
A. Bronze der Kegelgräber.



|


|
|
|
2. Handberge von Prislich.
Die meklenburgischen Kegelgräber der Bronze=Periode charakterisiren vorzüglich die sehr häufig gefundenen Schwerter und die besonders hier vorkommenden "Handbergen" oder Arm=


|
Seite 329 |




|
ringe mit zwei auslaufenden großen Spiralplatten.
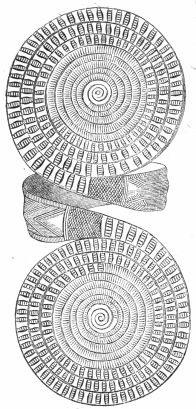
Wir wählten zunächst ein Stück von einer schönen Handberge (Frid. Franc. Tab. IV) aus dem Kegelgrabe von Prislich (Frid. Franc. Erläut. S. 67); die chemische Analyse ergab auch hier:
| 86, | 90 | Kupfer, |
| 13, | 10 | Zinn. |
Analyse.
Von 50 Gran, die ich davon in reiner Salpetersäure löste, blieben 8 1/4 Gran Zinnoxyd zurück.
Die Auflösung ward mit denselben, unten bei dem Bronze=Krater von Groß=Kelle Nr. 11. angegebenen Reagentien versetzt, aber nur vom Aetzammoniak ein darin wieder löslicher, (unleserliches Wort?) vom Aetzkali ein hellblauer und vom Schwefelwasserstoffgas ein schwarzer Niederschlag erhalten, die allein die Gegenwart des Kupfers anzeigten. Alle übrigen Reagentien verhielten sich indifferent.
Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd =
| Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd = 6, | 55 | Zinn, |
| 1, | 73 | Sauerstoffgas, |
| 8, | 21 |
entsprechen, so bestehen die in Untersuchung genommenen 50 Gran aus
| 6, | 55 | Zinn, |
| 43, | 45 | Kupfer, |
 dieser Bronze ist zusammengesetzt aus
dieser Bronze ist zusammengesetzt aus
| 4 Loth | 1 Quent. | Zinn, |
| 27 Loth | 3 Quent. | Kupfer, |
| 32 Loth. |


|
Seite 330 |




|
100 Theile enthalten also
| 13, | 10 | Zinn, |
| 86, | 90 | Kupfer, |
| 100. |



|


|
|
|
3. Schwert von Tarnow.

Eben so charakteristisch für die Kegelgräber, namentlich Meklenburgs, sind die zweischneidigen Schwerter von gegossener Bronze, wie sie im Frid. Franc. Tab. XIV und XV abgebildet sind. Ein solches Schwert, welches zu Tarnow bei Bützow mit goldenen Spiralringen in einem Kegelgrabe gefunden ward, gab
| 84, | 16 | Kupfer, |
| 15, | 84 | Zinn. |
Analyse.
12 1/2 Gran in Salpetersäure gelöst, ließen 2 1/2 Gran Zinnoxyd zurück.
Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 2 1/2 Gran Zinnoxyd = 1, | 98 | Zinn, |
| 0, | 52 | Sauerstoff, |
| 2, | 50 . |
An reinem Metall ist in dieser Bronze enthalten
| 1, | 98 | Zinn, |
| 10, | 52 | Kupfer, |
| 12, | 50. |
In 100 Theilen befinden sich also:
| 15, | 84 | Zinn, |
| 84, | 16 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 331 |




|



|


|
|
|
4. Heftel mit zwei Spiralplatten.
Auch eine Heftel (fibula) mit zwei Spiralplatten der Art,
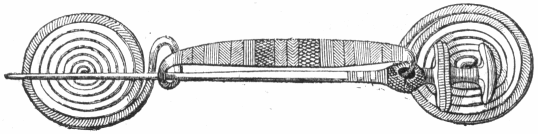
wie sie in Frid. Franc. Tab. XI abgebildet sind, gab ungefähr dasselbe Resultat:
| 84 | Kupfer, |
| 16 | Zinn. |
Analyse.
10 1/2 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 21/8 Gran Zinnoxyd.
Die salpetersaure Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 2 1/8 Gran Zinnoxyd = 1, | 68 | Zinn, |
| 0, | 44 | Sauerstoff, |
| 2, | 12 . |
In 10 1/2 Gran dieser Bronze befinden sich an reinem Metall:
| 1, | 68 | Zinn, |
| 8, | 82 | Kupfer, |
| 10, | 50 . |
In 100 Theilen sind demnach enthalten:
| 16 | Zinn, |
| 84 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 332 |




|



|


|
|
|
5. Metallspiegel von Sparow.
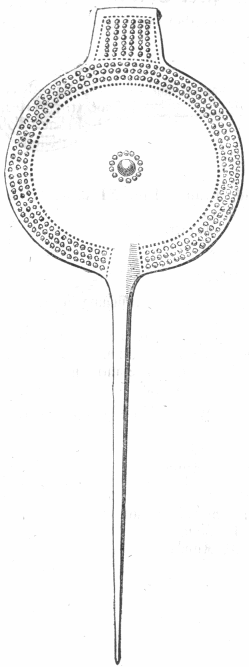
Schon mehr abweichend von der gewöhnlichen Mischung war die Legirung des bei Sparow in einem Kegelgrabe gefundenen Metallspiegels, welcher im Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 20 abgebildet und irrthümlich als eine Nadel beschrieben ist. Die Analyse ergab nämlich:
| 80, | 40 | Kupfer, |
| 19, | 60 | Zinn, |
In dieser Composition ist die Menge des beigemischten Zinns größer, als in den sonst vorkommenden Legirungen der Bronzen der Kegelgräber, wahrscheinlich um dem Metall eine hellere Farbe und eine größere Härte für die nöthige Politur zu geben.
12 1/2 Gran gaben nach der Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 3 1/4 Gran Zinnoxyd.
In der Auflösung ließen die Reagentien nur Kupfer erkennen.
| 3 1/4 Gran Zinnoxyd = 2, | 45 | Zinn, |
| 9, | 68 | Sauerstoff, |
| 3, | 13 . |
Wenn 12 1/2 Gran dieser Bronze aus
| 2, | 45 | Zinn, |
| 10, | 5 | Kupfer, |
| 12, | 50 . |


|
Seite 333 |




|
zusammengesetzt sind, so bestehen 100 Gran aus
| 19, | 60 | Zinn, |
| 80, | 40 | Kupfer, |
| 100. |



|


|
|
|
6. Diadem von Wittenmoor.
Eine ähnliche Metallmischung, wie der Metallspiegel von Sparow, gab ein in der Gegend von Neustadt zu Wittenmoor gefundenes Diadem, wie es in Frid. Franc. Tab. X, Fig. 5, (vgl. Erläut. S. 50 und 55) abgebildet ist.
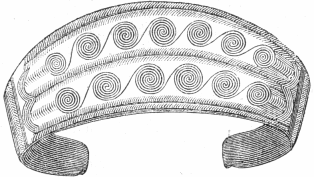
Diese in Meklenburg öfter gefundenen Diademe, ohne Zweifel zum geschmackvollen Kopfputz für vornehme Frauen, sind immer mit eingegrabenen Spiralwindungen verziert. Die Analyse ergab:
| 78, | 08 | Kupfer, |
| 21, | 92 | Zinn, |
Analyse.
Von der sehr verwitterten, bruchigen, mit Grünspan überzogenen Bronze wurden 12 1/2 Gran reine Metallstücke ausgesucht und mit Salpetersäure in Untersuchung gestellt. Die Auflösung hinterließ 3 3/4 Gran Zinnoxyd, und reagirte auf keine fremden Metalle, bestand daher nur aus Kupfer.
| 3 3/4 = 3, 75 Gran Zinnoxyd = 2, | 74 | Zinn, |
| 1, | 01 | Sauerstoff, |
| 3, | 75 . |
| Da in 12 1/2 = 12, 50 Gran Bronze enthalten sind | ||
| 2, | 74 | Zinn, |
| so müssen darin enthalten sein 9, | 76 | Sauerstoff, |
| 12, | 50 . |
In 100 Theilen befinden sich also
| Zinn | 21, | 92 |
| Kupfer | 78, | 08 |
| 100. |


|
Seite 334 |




|



|


|
|
|
7. Urne von Ruchow.
Dagegen gab die Analyse einer fast so dünne, wie ein Laubblatt geschlagenen Bronze=Urne aus dem großen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 45) mehr Kupfer, als die meisten Kegelgräber=Bronzen, nämlich
| 87, | 36 | Kupfer, |
| 12, | 64 | Zinn, |
wohl um das Metall zum Hämmern geschmeidiger zu machen; die gewöhnlich vorkommenden Bronzen sind dagegen alle gegossen. - Eine metallische Urne von Ranzow auf Rügen ergab ebenfalls eine ähnliche Mischung: von etwa 90, 33 Kupfer und 9, 67 Zinn (vgl. Hünefeld u. Picht, S. 17 u. 19), und die Bronze von hohl getriebenen Ringen eine Mischung von 92 Kupfer und 8 Zinn (vgl. das. S. 29).
25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 4 Gran Zinnoxyd.
Die Auflösung enthielt nach Ausweis der bezüglichen Reagentien nur Kupfer.
| 4 Gran Zinnoxyd = 3, | 16 | Zinn, |
| 0, | 84 | Sauerstoff, |
| 4. |
An reinem Metall sind also in 25 Gran enthalten:
| 3, | 16 | Zinn, |
| 21, | 84 | Kupfer, |
| 25. |
In 100 Theilen aber:
| 12, | 64 | Zinn, |
| 87, | 36 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 335 |




|



|


|
|
|
8. Framea von Satow.

Eine zu Satow bei Doberan gefundene framea (Streitmeißel) von der in Meklenburg gewöhnlichen, oft vorkommenden Form, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 5, gab auffallender Weise auch viel Kupfer, nämlich
| 90 | Kupfer, |
| 10 | Zinn, |
wahrscheinlich, weil eine so dicke und voll gegossene Stoß= und Wurfwaffe wie die framea keiner besondern Härte und Schärfe, sondern vorzüglich Gewicht und Festigkeit bedarf.
10 3/4 Gran hinterließen nach der warmen Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 1 3/4 Gran Zinnoxyd. Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 1 3/4 Gran Zinnoxyd = 1, | 38 | Zinn, |
| , | 37 | Sauerstoff, |
| 1, | 75 . |
Die Waffe bestand demnach aus:
| 1, | 38 | Zinn, |
| 9, | 37 | Sauerstoff, |
| 10, | 75 . |
und in 100 Theilen aus:
| 10 | Zinn, |
| 90 | Kupfer, |
| 100. |
B. Gold der Kegelgräber.



|


|
|
|
9. Fingerring von Ruchow.
Zu den charakteristischen Kennzeichen der Kegelgräber aus der Bronzeperiode gehören die Schmucksachen aus Gold, namentlich die Fingerringe von Gold, gewöhnlich aus doppeltem Golddrath (Trauringe) in der Form von Spiral=Cylindern, wie sie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 3 und 4, (vgl. Erläut. S. 51) abgebildet sind.


|
Seite 336 |




|
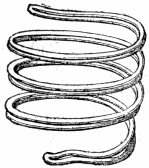
Ein solcher Ring aus dem sehr großen und reichen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 43 und Jahresbericht V, S. 30), welches noch 3 gleiche Goldringe und ein kleines Museum von bronzenen Alterthümern aus der Bronzezeit lieferte, enthielt viel Silber. Die Analyse ergab:
| 81, | 2 | Gold, |
| 18, | 8 | Silber. |
Analyse.
Ein halber Gran ward mit Königswasser übergossen, die sich um den metallischen Kern gebildete Hülle von Chlorsilber mit einem Glasstäbchen zertheilt, und darauf durch Erhitzen vollständig gelöst. Der Ueberschuß des Königswassers ward durch Zusatz von Salpetersäure möglichst zerstört, mit Wasser verdünnt, und das auf dem Filtrum gesammelte Chlorsilber mit heißem Wasser abgewaschen. Nach dem Glühen des scharf getrockneten Chlorsilbers wog dasselbe 1/8 Gran = 0, 125 Gran.
Die bisher auf eine geringe Menge durch Abdampfen concentrirte Goldlösung ward mit einer Lösung von Chlorammonium und Verdünnung mit Alkohol auf Platin, so wie durch die geeigneten Reagentien auf die Gegenwart eines andern Metalles geprüft, aber von allen keine Spur entdeckt.
| Chlorsilber besteht aus 108 | Silber, |
| und 36 | Chlor, |
| 144. |
0, 125 Gran Chlorsilber bestehen daher aus
| 0, | 094 | Silber, |
| 0, | 031 | Chlor, |
| 0, | 125 . |
Wenn in 0, 500 Goldlegirung enthalten sind,
| Silber 0, | 094 |
| so befinden sich darin Gold 0, | 406 |
| 0, | 500 . |
100 Theile bestehen also aus
| Gold 81, | 2, |
| Silber 18, | 8, |
| 100. | . |


|
Seite 337 |




|



|


|
|
|
10. Fingerring von Friederichsruhe.
Ein ganz gleiches Resultat gab auffallender Weise ein gleicher Fingerring aus Gold von Friederichsruhe (vgl. Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 1 - 4, vgl. Erläut. S. 51 und 137), der mit dem Ringe von Ruchow ohne Zweifel denselben Ursprung hat, nämlich
| 81, | 2 | Gold, |
| 18, | 8 | Silber. |
Analyse.
Zwei Gran des Ringes wurden mit Königswasser auf dieselbe Weise wie in Nr. 9. behandelt, und durch Glühen des Rückstandes 1/2 Gran = 0, 500 Gran Chlorsilber erhalten.
Die Goldlösung reagirte auf keine Beimischungen anderer Metalle, war also ebenfalls rein.
| 0, 500 Chlorsilber = 0, | 376 | Silber, |
| 0, | 124 | Chlor, |
| 0, | 500 . |
Befinden sich in 2 Gran Goldlegirung
| 0, | 376 | Silber, |
| so enthält dieselbe 1, | 624 | Gold, |
| 2, | 000 . |
100 Theile dieser Goldlegirung bestehen also aus
| Gold 81, | 2, |
| Silber 18, | 8, |
| 100. |
C. Römische Bronze.



|


|
|
|
11. Krater von Groß-=Kelle.
Um eine Vergleichung mit nicht heimischen Bronzen aus derselben Zeit der Todtenbestattung anstellen zu können, wählten wir ein Stück von dem in Meklenburg gefundenen großen Bronze=Krater oder Kessel aus dem merkwürdigen (römischen) Kegelgrabe von Groß=Kelle, welches nur römische Alterthümer enthielt (vgl. Jahresbericht des Vereins für meklenb. Geschichte etc. III, S. 44 und Abbildung zu Jahrg. V, Lithogr. Tab. III, Fig. 1). Die Analyse ergab hier ein anderes Resultat, nämlich
| 71, | 2 | Kupfer, |
| 15, | 6 | Zinn, |
| 13, | 2 | Blei. |
Analyse.
Ich löste 25 Gran dieses Metall=Fragments kochend in reiner Salpetersäure auf, und erhielt dabei einen 5 Gran


|
Seite 338 |




|
schweren Rückstand, der sich durch sein weiß corridirtes Ansehen schon als Zinnoxyd zu erkennen ab.
Die hellblaue salpetersaure Lösung versetzte ich zur Ermittelung der übrigen darin befindlichen Metalle mit folgenden Reagentien:
1) mit Aetzammoniak. Hiedurch ward die Lösung dunkelblau, und es schied sich ein im Ueberschuß von Ammoniak nicht löslicher weißer Niederschlag ab.
2) mit destillirtem Wasser. Eine starke Verdünnung damit gab keinen Niederschlag.
3) mit Salzsäure. Auch hiedurch entstand keine Trübung.
4) mit Aetzkali. Dieses erzeugte auch im Ueberschuß nur einen blauen Niederschlag.
5) mit schwefelsaurem Eisenoxydul erhielt ich eine flauere Färbung der Lösung, und einen weißen, keinen braunen Niederschlag.
6) mit schwefelsaurem Kali und
7) mit verdünnter Schwefelsäure gab die Lösung weiße Niederschläge;
8) mit Schwefelwasserstoff ward sie aber ganz schwarz präcipitirt. Nach Trennung des Niederschlages gab die Flüssigkeit mit Aetzammoniak keine Trübung.
Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß die salpetersaure Lösung nach den Reagentien 1, 4 u. 8 Kupfer, nach den von 1, 6 u. 7 Blei enthalte, Bismuth, Silber, Quecksilber, Zink und Gold darin aber nicht vorhanden sind.
Um nun das Kupfer vom Blei zu trennen und beides in ihren Mengeverhältnissen zu bestimmen, versetzte ich die salpetersaure Auflösung so lange mit verdünnter Schwefelsäure, als ein Niederschlag entstand, verdampfte darauf die Flüssigkeit sammt dem Niederschlage zur Trockniß und erhitzte die Masse so lange, bis alle freie Schwefelsäure entfernt war. Den Rückstand löste ich in Wasser, trennte das nicht gelöste schwefelsaure Bleioxyd durch ein Filter, süßte es auf, trocknete und glühete es schwach. Es wog 5 1/4 Gran.
Aus der von diesem schwefelsauren Bleioxyd getrennten Flüssigkeit schied ich mittelst Aetzkali das Kupferoxyd, nicht etwa zu dessen Gewichtsbestimmung, da sich seine Menge schon durch die Berechnung des Zinn= und Blei=Oxyds von selbst ergiebt, sondern um aus der davon abfiltrirten Flüssigkeit, welche noch eine kleine Menge von schwefelsaurem Bleioxyd aufgelöst enthält, dasselbe, nachdem die Flüssigkeit mit so viel verdünnter Schwefelsäure versetzt ist, als sie nur noch schwach


|
Seite 339 |




|
basisch reagirt, durch kleesaures Ammoniak zu trennen. Es zeigte sich erst nach Verlauf von mehreren Stunden eine schwache Trübung, die sich nach 24 Stunden als ein höchst geringfügiger Niederschlag am Boden des Gefäßes so fest abgelagert hatte, daß er durch Schütteln mit Wasser nicht davon zu trennen war. Diese geringe Menge kohlensaures Bleioxyd konnte ich daher nicht durch Glühen in Bleioxyd verwandeln und sie deshalb nur annähernd in Rechnung bringen.
Diese Analyse ergab also zum Resultat, daß außer dem
Kupfer 5 Gran Zinnoxyd,
5 1/4 Gran schwefelsaures Blei
erhalten wurden.
| Zinnoxyd besteht aber in 100 Th. aus 78, | 6 | Zinn, |
| 21, | 38 | Sauerstoff. |
| Demnach enthalten 5 Gran Zinnoxyd 3, | 9 | Zinn, |
| 1, | 3 | Sauerstoff. |
| Schwefelsaures Bleioxyd besteht aus 100, | Blei, | |
| 45, | Schwefelsäure. | |
| Darnach enthalten 5 1/4 Gran schwefelsaures Bleioxyd | ||
| 3, | 3 | Blei, |
| 2, | 1 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall sind also diese 25 Gran der analysirten Bronze zusammengesetzt, aus
| 3, | 9 | Zinn, |
| 3, | 3 | Blei. |
| und folglich aus 17, | 8 | Kupfer, |
| zusammen 25 Gran. |
Ein Pfund davon würde also ungefähr enthalten
| 5 | Loth | Zinn, |
| 4 | Loth | Blei, |
| 23 | Loth | Kupfer. |
| 32 | Loth. |
in 100 Theilen aber:
| 15, | 6 | Zinn, |
| 13, | 2 | Blei. |
| 17, | 2 | Kupfer, |
| 100. |
D. Ausländische Bronze.



|


|
|
|
12. Commandostab von Hansdorf.
Die bronzenen Streitäxte oder Commandostäbe mit Bronzestiel, welche an weit entfernten Stellen im Norden gefunden sind (vgl. Klemm german. Alterthk. S. 208 u. Tab. XV und Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 1, Tab. VII,


|
Seite 340 |




|
Fig. 1 u. Tab. XV, Fig. 6, u. Erläut. S. 115 u. 158), haben, namentlich durch den schönen Hohlguß, so viel Eigenthümliches, daß sich an ihrem norddeutschen Ursprunge aus der Zeit der Kegelgräber, um so mehr da sie bis jetzt nur einzeln und nicht in Gräbern gefunden sind, zweifeln läßt. Die Analyse eines zu Hansdorf gefundenen Exemplars (vgl. Jahresbericht des Vereins etc. II, S. 48-48) gab auch allerdings, nach wiederholter, scharfer Analyse, ein erwartetes abweichendes Resultat, vorzüglich durch die unzweifelhafte Beimischung von Silber, nämlich:
| 74, | 80 | Kupfer, |
| 24, | 08 | Zinn, |
| 1, | 12 | Silber. |
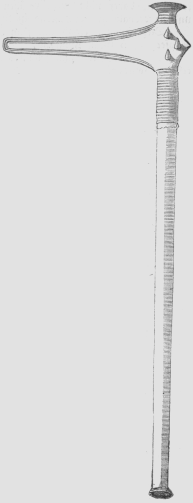
Analyse.
25 Gran der Streitaxt hinterließen in der Salpetersäure 7 3/4 Gran Zinnoxyd.
Die Lösung ward nur von Salzsäure getrübt; sie ward daher damit vollständig präcipitirt, und daraus nach dem Trocknen des Niederschlages 3/8 Gran salzsaures Silber gewonnen.
| 7 3/4 Gran Zinnoxyd entsprechen: 6, | 02 | Zinn, |
| 1, | 73 | Sauerstoff. |
| 3/8 Gran salzsaures Silber 0, | 28 | Silber, |
| 0, | 9 | Chlor. |
In 25 Gran sind also an reinem Metall enthalten
| 6, | 02 | Zinn, |
| 0, | 28 | Silber, |
| folglich 18 | 70 | Kupfer, |
| 25 Gran. |
100 Theile enthalten aber:
| 24 | 08 | Zinn, |
| 1, | 12 | Silber, |
| 74, | 80 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 341 |




|



|


|
|
|
III. Bronze der Wendenkirchhöfe.
13. Beschlagring von Ludwigslust.
Mit den Kegelgräbern verschwindet die Schönheit der Bronze und der edle Rost auf derselben. Die wendische Bevölkerung Meklenburgs oder die Eisenzeit barg ihre Todten nicht mehr unter aufgeschütteten Hügeln, sondern grub die Urnen mit den Resten des Leichenbrandes in die ebene Erde ein. Mit diesem Begraben der Urnen verschwindet das Gold ganz und die Bronze wird selten; dagegen erscheint vorherrschend Eisen, und Silber und Bronze in einzelnen Schmucksachen. Diese wendische Bronze ist aber matter und unedler, als die germanische der Kegelgräber.
Wir wählten einen Beschlagring aus einer bei Ludwigslust gefundenen Urne (Jahresber. II, S. 44 flgd.), in deren Nähe auch eiserne Alterthümer gefunden sind; die vielen Bronzesachen aus diesem Begräbnisse sind weißlich und haben nur an einigen Stellen einen leichten Anflug von Rost. Dennoch müssen die vielen Begräbnisse bei Ludwigslust noch in dem Uebergange von der germanischen zur wendischen Zeit liegen, da in ihnen die Bronze noch vorherrscht und die Formen der Geräthe denen der Kegelgräber sehr nahe kommen, ja ganz ähnliche Sachen, wie die bei Ludwigslust gefundenen, zu Borkow (vgl. Jahresber. II, S. 43) noch in einem Kegelgrabe, dem einzigen bisher in Meklenburg beobachteten, welches Eisen enthielt, gefunden sind, das Eisen bei Ludwigslust auch nur selten erscheint. Da die Zeit dieser Bestattung wahrscheinlich schon in den Anfang der Silber=Periode fällt, so ließ sich Silber in der weißlichen Bronze vermuthen; aber eine wiederholte strenge Prüfung gab nur das Resultat:
| 83, | 6 | Kupfer, |
| 10, | 8 | Zinn, |
| 5, | 6 | Blei. |
Analyse.
25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 3 1/2 Gran Zinnoxyd.
Die salpetersaure Auflösung gab durch Reagentien die Gegenwart von Blei und Kupfer zu erkennen, welche auf die in 11. angegebene Weise abgeschieden wurden.
Das Resultat der Analyse ergab folgende Bestandtheile:
| 3 1/2 Gran Zinnoxyd = 2, | 7 | Zinn, |
| , | 8 | Sauerstoff. |
| 2 Gran schwefelsaures Blei = 1, | 4 | Blei, |
| 6 | Schwefelsäure. |


|
Seite 342 |




|
25 Gran bestehen demnach aus:
| 2, | 7 | Zinn, |
| 1, | 4 | Blei, |
| 20, | 9 | Kupfer, |
| zusammen 25 Gran. |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| 10, | 8 | Zinn, |
| 5, | 6 | Blei, |
| 83, | 6 | Kupfer, |
| 100. |



|


|
|
|
14. Armring von Ludwigslust.
Einer von den in demselben Begräbnisse gefundenen Armringen, welche die seltene Erscheinung gaben, daß die zerbrochenen Exemplare eingebohrte Bindlöcher zum Zusammenflicken der Fragmente für den fernern Gebrauch hatten, gab in der Analyse ein ähnliches Resultat. Diese Armringe sind schon von Blech und hohl getrieben und gleichen den hier abgebildeten, welche im Stargardischen bei den mit Drachenwindungen verzierten Bronzekesseln gefunden werden. (Jahresber. VII, S. 34-36). Die Ringe von Ludwigslust sind dem hieneben abgebildeten, bei Roga gefundenen ähnlich, jedoch auf der Oberfläche glatt und ohne eingehängte Ringel.
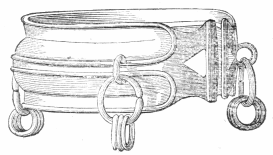
Die Analyse ergab:
| 89, | 44 | Kupfer, |
| 6, | 32 | Zinn, |
| 4, | 24 | Blei. |
Analyse.
12 1/2 Gran des Ringes in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen einen Rückstand von 1 Gran Zinnoxyd.
Die Lösung, mit den in 11 aufgeführten Reagentien versetzt, gab (unleserliches Wort?) nur mit Schwefelsäure und dessen Salzen einen Niederschlag; sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt; darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dieses schwefelsaure Blei 7/8 Gran.
| 1 Gran Zinnoxyd besteht aus 0, | 79 | Zinn, |
| 0, | 21 | Sauerstoff. |


|
Seite 343 |




|
| 7/8 Gran schwefelsaures Blei bestehen aus 0, | 53 | Blei, |
| 0, | 25 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall bestehen demnach 12 1/2 Gran
| 0, | 79 | Zinn, |
| 0, | 53 | Blei, |
| 11, | 18 | Kupfer, |
| 12, | 50 . |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| 6, | 32 | Zinn, |
| 4, | 24 | Blei, |
| 89, | 44 | Kupfer, |
| 100. |
Bei den Berechnungen der Brüche ist eine kleine Divergenz unvermeidbar, und die Resultate in Hunderttheilen können daher selten, wenn man sie nicht approximativ annehmen will, mit der wirklichen Zusammensetzung übereintreffen. Ich glaube daher, daß hier in der Erzcomposition alle Brüche wegfallen und diese dem Kupfer zugerechnet werden müssen, die Composition daher aus 90 Kupfer, 6 Zinn, 4 Blei in runden Zahlen besteht.



|


|
|
|
15. Heftel mit Spiralfeder.
Die Bronze der unzweifelhaften Wendenkirchhöfe, die Bronze der jüngsten Heidenbegräbnisse, welche hier überdies nur selten und zwar nur in einzelnen kleinen Schmucksachen auftritt und dem Eisen Platz macht, weicht ebenfalls an Farbe, Zähigkeit und Rost von der Bronze der Kegelgräber offensichtlich ab. Um diese Abweichung zu erkennen, bestimmten wir die Spirale einer Heftel mit Spiralfeder (broche, Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13) des charakteristischen Kennzeichens der Wendenkirchhöfe, zur Analyse, welche dann auch einen fast reinen Kupfergehalt zeigte, nämlich:
| 97, | 32 | Kupfer, |
| 1, | 96 | Zinn, |
| 0, | 72 | Blei. |
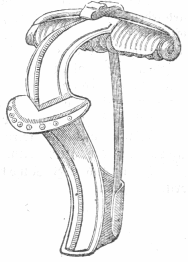


|
Seite 344 |




|
25 Gran in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen 5/8 Gran Zinnoxyd.
Diese Lösung ward nur von Schwefelsäure, und zwar erst nach einigen Tagen auf sehr geringe Weise getrübt. Sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt, darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dies schwefelsaure Blei 1/4 Gran.
| 5/8 Gran Zinnoxyd entsprechen 0, | 49 | Zinn, |
| 14 | Sauerstoff. | |
| 1/4 Gran schwefelsaures Blei 0, | 18 | Blei, |
| 0, | 07 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall enthalten also 25 Gran:
| 0, | 49 | Zinn, |
| 0, | 18 | Blei, |
| folglich 24, | 33 | Kupfer.. |
| 25 Gran. |
100 Theile aber bestehen aus:
| 1, | 96 | Zinn, |
| 0, | 72 | Blei, |
| 97, | 32 | Kupfer, |
| 100. |
Ich bin über die Gegenwart des Bleis fast zweifelhaft geblieben, mußte es aber, da alle Reactionen es zwar sehr schwach, aber bestimmt andeuteten, es auch gelang, den höchst geringfügigen Gehalt abzuscheiden, in seine Bestandtheile mit aufnehmen. Ich glaube aber, daß dasselbe seine Gegenwart mehr einer zufälligen Beimischung, z. B. der Anwendung eines mit Blei vermischten Zinns, als einer absichtlichen verdankt. Seine Menge beträgt noch nicht 1 Procent, und die Zusammensetzung wird daher, bei der Schwierigkeit der Abwägung der Hunderttheile in kleinere Quantitäten, wahrscheinlicher aus 98 Kupfer und 2 bleihaltigem Zinn bestehen sollen.


|
Seite 345 |




|



|


|
|
|
16. Heftel mit Spiralfeder von Camin.
Eine gleiche Heftel (Broche) aus dem Wendenkirchhofe zu Camin (Jahresber. Jahrg. II, S. 63, Nr. 27), welcher reich an Eisen war und in Schmucksachen Bronze und Silber enthielt, gab dagegen:
| 88, | 15 | Kupfer, |
| 11, | 85 | Zinn. |
Analyse.
20 Gran wurden wie gewöhnlich mit Salpetersäure behandelt, die Auflösung zeigte sich auf alle behufigen Reagentien indifferent, der Rückstand wog 3 Gran, war Zinnoxyd, und in der Auflösung nur Kupfer enthalten.
| 3 Gran Zinnoxyd = 2, | 37 | Zinn, |
| 63 | Sauerstoff, | |
| 3. |
Wenn 20 Gran der Bronze enthalten:
| 2, | 37 | Zinn, |
| so befinden sich darin 17, | 63 | Kupfer, |
| 20. |
100 Theile bestehen demnach aus:
| 11, | 85 | Zinn, |
| 88, | 15 | Kupfer, |


|
Seite 346 |




|
Uebersicht der Analysen,
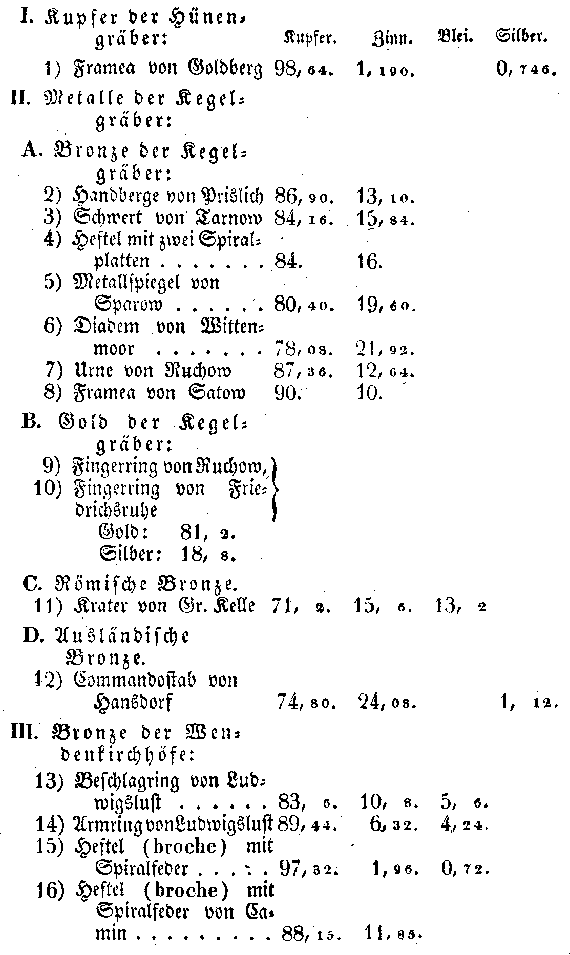


|
Seite 347 |




|
Aus dieser Uebersicht geht zur Beurtheilung der heimischen Bronzen hervor:
1) daß die Bronzen meklenburgischen Ursprunges aus der reinen Bronze=Periode nur aus Kupfer und Zinn bestehen und ungefähr 10-20 p. C. Zinn enthalten;
2) daß die ungefähr gleichzeitige römische Bronze außer 15, 6 Zinn auch noch 13, 2 Blei enthält;
3) daß Zink in meklenburgischen Bronzen gar nicht beobachtet ist;
4) daß Silber in Kupfererzen entweder nur in unvermischtem, gediegenen Kupfer oder in ausländischen, künstlichern Geräthen gefunden ist;
5) daß die Bronze der jüngsten heidnischen Periode, der Wendenkirchhöfe, sehr unregelmäßige Mischungsverhältnisse hat und außer Zinn auch Blei enthält.
So viel steht jedoch fest, daß die Bronze der reinen Bronze=Periode der Kegelgräber nur aus einer Legirung von Kupfer und Zinn besteht.


|
Seite 348 |




|
Von Interesse dürfte nachstehende Uebersicht der Mischungsverhältnisse der Bronzen der am häufigsten vorkommenden Gegenstände der reinen Bronze=Periode sein:
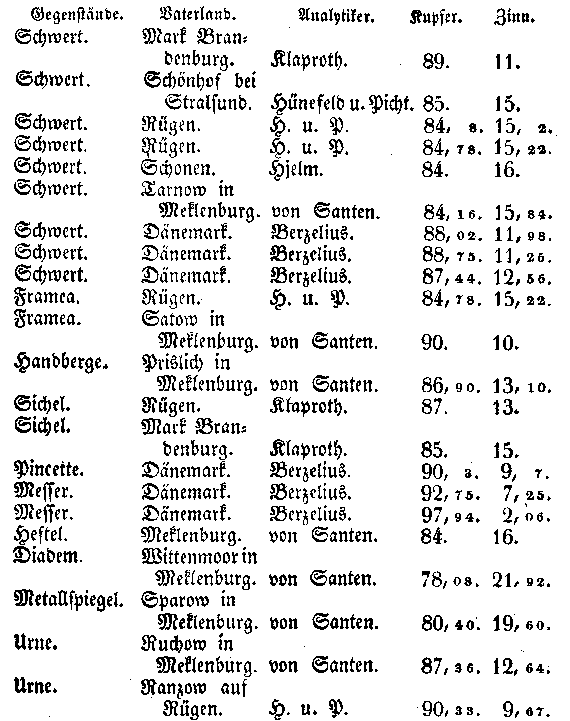
Die Mischungsverhältnisse bleiben daher bei denjenigen Alterthümern, welche die reine Bronzeperiode vorzüglich charakterisiren, ungefähr dieselben; besonders tritt die Gleichheit der Mischungsverhältnisse der Bronze der Schwerter in den verschiedenen Gegenden auffallend hervor.


|
Seite 349 |




|
Die wichtigste Frage, welche auf diese Untersuchungen folgt, ist die:
woher holten die alten nordischen Völker ihre Erze?
Trotz aller Bemühungen hat es nicht gelingen wollen, rohe Erze aus den Gegenden zu erhalten, aus denen die alten Völker ihre Erze muthmaßlich hätten beziehen können; auch Analysen waren nicht zu erreichen. Am nächsten freilich liegt bei dem Kupfer die Annahme, daß es nach dem Namen des Metalles, lat. cuprum, althochdeutsch kuphar, von der kupferreichen Insel Kypros geholt sei; aber es fehlt zur Zeit noch an einer ausreichenden Menge von kupfernen Alterthümern aus dem Norden und an Analysen sowohl dieser Alterthümer, als der kyprischen und anderer griechischen rohen Kupfererze.
Näher liegt es für den Augenblick, den Ursprung des Goldes zu erforschen, welches im Norden als charakteristisches Kennzeichen der eigentlichen Bronzeperiode auftritt. Und bei dieser Nachforschung werden wir auf den Osten, den Ural, als Quelle für die Metalle der alten Nordlandsbewohner hingewiesen und darauf hingeführt, daß in den ältesten Zeiten eine Verbindung des nördlichen Europas mit dem westlichen Asien statt gefunden habe. Ueber das Gold Westasiens besitzen wir nun ausgezeichnete Forschungen von Gustav Rose in Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, XXIII, 1831, S. 161 flgd., unter dem Titel: Ueber die chemische Zusammensetzung des gediegenen Goldes, besonders vom Ural, und in (A. v. Humboldt, Ehrenberg und) Gustav Rose Mineralogisch=geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspischen Meere, Band I, Berlin, 1837.
Das Gold der norddeutschen Gräber zeichnet sich dadurch aus, daß es Silbergehalt (18 p. C. Silber) und eine messinggelbe Farbe hat.
"Nach Rose's Forschungen ist nun das in der Natur vorkommende Gold, soviel man weiß, nicht chemisch rein, sondern enthält immer Silber beigemischt (Ann. S. 161); ganz reines Gold habe ich", sagt Rose, "unter dem gediegenen Golde nicht gefunden" (Ann. S. 190). Das Gold von Schlangenberg am Altai enthält 36 p. C. (Ann. S. 162 flgd.), das Gold von Siränowski am Altai 37 p. C. (Ann. S. 184), das Gold von Siebenbürgen 35 p. C. (Ann. S. 163), das Gold von Verös Patak in Siebenbürgen 38 p. C. (Ann. S. 185), dagegen das Gold von der Grube Bar=


|
Seite 350 |




|
bara zu Füses in Siebenbürgen 14 p. C. (Ann. S. 180) Silber, das Silber von Kongsberg in Norwegen (Ann. S. 161) 28 p. C. Gold.
Ueber den Bergbau am Altai sagt Rose Folgendes:
"Gediegenes Gold, mehr oder weniger silberhaltig, nie krystallisirt, sondern in - - Blättchen oder - - kleinen Blechen, gewöhnlich von lichter messinggelber, doch auch von goldgelber Farbe", findet sich zu Schlangenberg am Altai (Reise S. 534). "Ob aber alles Gold gleiche chemische Zusammensetzung hat, ist nicht untersucht, aber nach der deutlich verschiedenen Farbe des Schlangenberger Goldes - - nicht einmal wahrscheinlich" (Reise S. 535). "Zwar ist in früherer Zeit, wie die sogenannten tschudischen Arbeiten beweisen, auch am Altai ein uralter Bergbau getrieben worden, aber wenn gleich die aufgefundenen Spuren desselben, eingestürzte Schachte und alte Haldenzüge hier so häufig gewesen sind, daß ihrer Auffindung fast alle jetzt bebaueten Gruben ihre Entstehung zu verdanken haben, so war doch die Kunde dieses Bergbaues, so wie des Volkes, welches ihn getrieben, auch hier durchaus verschollen. Nur dunkle Sagen von dem Goldreichthum der goldenen Berge, wie der Altai im Chinesischen und Alttürkischen heißt, hatten sich erhalten" (Reise S. 509). "Wie wichtig aber der Bergbau am Altai ist, ergiebt sich schon aus seiner Production, die vorzugsweise in Silber besteht und größer ist, als die irgend eines andern einzelnen Theiles des alten Continents. - - So groß indessen die Menge des Silbers ist, - - so sind doch die Erze, aus denen dasselbe dargestellt wird, nur sehr arm; sie enthalten im Durchschnitt nur 0, 04 p. C." (Reise S. 503-5).
Wenn die Untersuchungen über die Erze des Altai bisher auch nicht sehr glücklich gewesen sind, so scheint sich doch so viel zu ergeben, daß die Goldverbreitung von hier nicht bedeutend gewesen sei. Günstiger stellen sich für unsere Forschungen die Untersuchungen am Ural, in der Gegend von Katharinenburg. Rose hatte Gelegenheit, den Silbergehalt sowohl vieler einzelner Golderze, als auch des Gesammtgewinnes vom Ural von 1814 - 1828 zu prüfen (Reise S. 240). Daraus ergiebt sich, daß an eine "Verbindung von Gold und Silber nach bestimmten Proportionen nicht zu denken sei" (Ann. S. 188). "Der mittlere Gehalt stellt sich für das Grubengold zu 7, 91 p. C. und für das Waschgold zu 8, 97 p. C Silber" (Ann. S. 194). "Der Silbergehalt der ganzen jährlich gewonnenen Menge des gediegenen Goldes differirt von


|
Seite 351 |




|
"1, 58 bis zu 13, 19 p. C. (am häufigsten 11 p. C.) und beträgt im Mittel der Jahre von 1754 - 1828 = 8, 42 p. C. (Reise S. 226). Der Silbergehalt des gediegenen Goldes aus den, unter dem Bergamte von Katharinenburg stehenden Seifenwerken von 1814 - 1828 war von 1, 22 bis 11, 16 p. C., am häufigsten 7 bis 8 p. C. (Reise S. 240 und S. 158 flgd.). Die Mengen Gold und Silber, welche auf dem Münzhofe zu Petersburg jährlich geschieden werden, bestehen in folgenden:
1) gegen 350 Pud silberhaltiges Gold vom Ural; es enthält im Durchschnitt 7 p. C. Silber;
2) 1000 Pud goldhaltiges Silber vom Altai; es enthält 3 p. C. Gold;
3) 200 bis 250 Pud goldhaltiges Silber von Nertschinsk; es enthält 1/2 p. C. Gold. (Reise S. 625).
Wir werden also in Beziehung auf den bedeutenden Silbergehalt des in Norddeutschland gefundenen Goldes auf die uralischen Bergwerke hingewiesen. Enthält das gediegene Gold derselben durchschnittlich auch nur 7 - 8 p. C. Silber, so sind doch einzelne Analysen in Betracht zu ziehen, welche oft ein ganz anderes Resultat geben, als die durchschnittlichen Berechnungen; und nach einzelnen Funden darf sich eine Vergleichung für das Alterthum nur richten, da hier sicher nicht große Massen zusammengeschmolzen sind. Viele Analysen haben freilich einen geringen Silbergehalt, gewöhnlich 7, oder von 5 bis 10 p. C. Aber gediegenes Gold von Gozuschkoi bei Nischnei=Tagel in mehreren verschiedenen Stücken gab 12, 12 p. C. (Ann. S. 176) und 12, 12 p. C., 12, 30 p. C., 12, 41 p. C. (Reise S. 325), von Alexander Andrejewsk bei Miask 12, 07 p. C. (Ann. S. 176), von Petropawlowsk bei Bogaslowsk 13, 03 p. C. und 13, 19 p. C. (Ann. S. 175) und 13, 19 p. C. (Reise S. 422), von Boruschka 16, 15 p. C. Silber (Ann. S. 174 und Reise S. 324.)
Das gediegene Gold vom Ural kommt also dem in norddeutschen Gräbern aus der eigentlichen Bronze=Periode gefundenen Golde am nächsten.
Ueber das Vorkommen und die Bearbeitung sagt Rose Folgendes: "Das Gold kommt am Ural theils anstehend, theils lose im Sande als Waschgold vor. Vor der Entdeckung des letztern, im J. 1819, wurde das Gold nur durch unterirdischen Bergbau gewonnen. Seit dieser Zeit hat man den beschwerlichen, wenig lohnenden Bergbau größtentheils eingestellt. - In dem Goldsande findet sich das Gold gewöhnlich in kleinen Körnern, gewöhnlich nur von der Größe


|
Seite 352 |




|
einer Erbse (Reise S. 198), und Schüppchen, zuweilen kommen indeß Stücke von bedeutender Größe (von 13, 16, 24 russischen Pfunden) vor (Ann. S. 165), zuweilen auch in Krystallen in der Form von Octaedern (Reise S. 158). Das Grubengold kommt gewöhnlich auf Quarz und Brauneisenstein vor, und es ist schwer, es auf eine mechanische Weise von diesen Begleitern zu trennen; auch das Waschgold findet sich zuweilen mit diesen zusammen (Ann. S. 168); daher der häufige Eisengehalt des Goldes (Ann. (S. 174 flgd. Reise S. 201 flgd., S. 241). Es ergiebt sich ferner aus den Analysen des gediegenen Goldes - -, daß Gold und Silber sich als isomorphische Körper mit einander verbinden können" (Reise S. 207).
"Der Bergbau auf diese Sanderze ist schon sehr alt, - - von einem ältern Volke betrieben, deren alte Halden und abgeteufte Schachte an den Ufern der Sakmara und Dioma sehr häufig Veranlassung zur Entdeckung der jetzt bearbeiteten Gruben gegeben haben. Spuren eines solchen früher betriebenen Bergbaues hat man auch auf der Ostseite des Urals selbst bis zur Breite von Gumeschewsk, ja am ganzen Altai und in der Steppe der Kirgisen gefunden; aber es ist noch ganz unausgemacht, welches Volk es gewesen ist, das diesen ausgedehnten Bergbau getrieben hat. In Rußland schreibt man ihn den Tschuden (Unbekannten) zu und nennt daher diese alten Arbeiter tschudische Arbeiter (Reise S. 118). Aus manchen Anzeigen wird es wahrscheinlich, daß auch die Goldseifen des Urals schon von den Urvölkern des Urals bearbeitet wurden; denn man hat an dem See Irtiasch in der Nähe des Goldseifenwerkes Soimonowskoi bei Kyschtim sogenannte Tschuden=Gräber mit Menschenknochen und neben diesen auch - Armbänder - gefunden, die aus derselben Mischung von Gold und Silber bestanden, von welcher noch jetzt das Waschgold in Soimonowskoi gefunden wird (Reise S. 239).
Diese Forschungen werden schon jetzt bedeutende Fingerzeige für die Verbreitung des Goldes im alten Nordeuropa geben und für die Zukunft wichtig werden können.
Um einen Schluß auf die Verbreitung des Kupfers im Besondern machen zu können, fehlt es noch an hinlänglichen Vorarbeiten. Rose sagt nur: "Kupferwerke kommen im Ural sehr viel vor, z. B. die berühmte Kupfergrube von Boguslowsk (Reise S. 397). Das gediegene Kupfer ist früher zuweilen in bedeutend großen Massen vorgekommen (Reise S. 407). Von allen Kupfererzen findet sich Malachit


|
Seite 353 |




|
"am häufigsten; nächstdem kommt Rothkupfererz; schon seltener findet sich gediegenes Kupfer. - - Das gediegene Kupfer kommt auch ohne Begleitung der übrigen Kupfererze in Letten eingewachsen vor, krystallinische Rinden bildend, deren mehrere gewöhnlich concentrisch über einander liegen und einen Kern von Letten einschließen. Das Rothkupfererz findet sich gewöhnlich mit Malachit zusammen, und zwar so, daß letzterer das erstere bedeckt, welches öfter auch noch einen Kern von gediegenem Kupfer einschließt (Reise S. 270).
Vom Silber sagt Rosen: "Gediegenes Silber - - ist in früherer Zeit dort, eingesprengt und haarförmig auf der Frolowschen Grube vorgekommen; man soll aus diesem gediegenen Silber 1200 Pud ausgeschmolzenes Silber gewonnen haben (Reise S. 415). Gediegenes Silber findet sich auf ähnliche Weise, wie das Gold, ebenfalls nicht krystallisirt, aber aufgewachsen in drath= und meistens haarförmiger Gestalt und eingewachsen in Blechen und in Plättchen. Es ist meistens gelblich angelaufen und matt, besonders wenn es in Blechen vorkommt, erhält aber silberweiße Farbe und Glanz im Strich (Reise S. 535).
Jedoch können die Forschungen über Silber augenblicklich noch keine Andeutungen geben, da Silber in den nördlichen Gräbern erst mit dem Eisen vorkommt und es noch nicht ausgemacht ist, wie weit die Eisenperiode zurückgeht; soviel ist aber gewiß, daß das Silber in Norddeutschland erst mit dem Vorkommen der kufischen und merovingischen Münzen in häufige Anwendung kommt.



|


|
|
:
|
Zerbrechlichkeit des antiken Silbers.
Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier,
welcher Jahresber. VIII, S. 69 beschrieben und abgebildet ist, ist in vieler Hinsicht sehr merkwürdig, besonders weil er so zerbrechlich ist, wie kein Stück der vaterländischen Sammlungen; er ist daher nur mit Mühe gerettet und um Wachs gelegt. Diese Eigenschaft manches alten Stückes Silber ist jüngst in den göttingischen gelehrten Anzeigen, 1843, St. 130 - 131, durch die Gesellschaft der Wissenschaften zur Sprache gebracht. Der Herr Münzwardein Brüel zu Hannover hat


|
Seite 354 |




|
der Societät nämlich die Resultate chemischer Untersuchungen alter Münzen durch den Herrn Hofrath Hausmann vorgelegt, nach welchen viele alte römische und griechische Silbermünzen und niedersächsische Bracteaten aus dem 13. Jahrhundert, welche auffallend leicht zerbrechlich waren, einen Gehalt von Chorsilber haben, welcher erst nach der Vergrabung von außen eingedrungen sein muß. Die Farbe des Ringes von Pritzier ist ebenfalls, wie viele vom Herrn Brüel untersuchte Münzen, "äußerlich graulichweiß mit einem Stich in das Braune, der Bruch körnig, wenig glänzend, dem Erdigen sich nähernd".
Dagegen ist die in demselben Wendenkirchhofe gefundene Spange (Hakenfibel), S. 64. Nr. 14, von grau=bräunlicher Farbe, durchaus fest, gar nicht angegriffen, nicht oxydirt und überaus elastisch. Der Silberstreifen Nr. 15 dagegen, von heller, weißer Farbe, mit Grünspanstellen, mehr biegsam, jedoch auch in Schuppen zerbrechlich.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Heidnische Gräber bei Neu=Bukow an der Ostsee.
Auf dem hohen Uferlande an der Ostsee im alten Lande Meklenburg läßt sich eine Reihe kegelförmiger Hügel verfolgen, welche auf den Rücken der Hohenzüge liegen und frei in die See schauen; vorzüglich lassen sich dieselben im Amte Bukow oder im alten Lande Bug beobachten, wo ich dieselben im Mai 1843 durch die freundliche Unterstützung des Hrn. von Oertzen auf Roggow zu untersuchen Gelegenheit hatte. Diese Hügel sind oft für Warten oder Schanzen, wie die bei Wismar, gehalten; ohne Zweifel sind sie aber alte Gräber, um so mehr, da in der Nähe der Kegelgräber auch Hünengräber stehen.
Diese Gräber gehören zu den bedeutendsten im Lande und zwar:
1) auf dem Felde zu Kartlow bei Neuburg, links am Wege von Wismar nach Neuburg, steht ein sehr großes Kegelgrab.
2) auf den Höhen an der See liegen große Kegelgräber: zu Rakow (2), Roggow, Zweedorf, Westhof, Kägsdorf.
3) auf dem Neu=Gaarzer Bauerfelde, zwischen Alt= und Neu=Gaarz, nach der Ostsee hin, liegt ein sehr großes Hünengrab in Form einer Steinkiste auf einem Hügel mit 4 gewaltigen, jetzt von den Pfeilern herabgesunkenen Deck=


|
Seite 355 |




|
steinen, ohne einen langen Hügel, ganz von der Construction und Größe, wie das bekannte Grab zu Gr. Görnow. Dieses Grab von Neu=Gaarz ist schon angezeigt Jahresber. II, S. 110, als eine "künstliche Steinstellung zwischen Blengow und Meschendorf".
4) auf dem Neu=Gaarzer Hoffelde gegen Kägsdorf hin steht ein ähnliches, sehr großes Hünengrab mit 2 Decksteinen, sehr wohl erhalten.
5) in der Nähe dieser Steinkiste liegt ein langes Riesenbette, wohl 150' lang, mit großen Granitpfeilern umstellt.
6) nicht weit davon steht eine kurze Steinkiste oder ein Steinhaus, ohne Hügel, mit einem großen, jetzt zersprungenen Steine bedeckt;
7) diesen letztgenannten Denkmälern gegenüber liegt auf dem Felde von Mechelstorf ein sehr großes Riesenbette, noch größer, als das von Neu=Gaarz.
Ueber ein aufgedecktes Hünengrab zu Roggow vgl. unten Hünengräber, S. 366.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Heidnische Gräber zu Carow und Leisten.
Am 20. Juni d. J. fuhr ich nach Carow, um im Interesse des Vereins die auf der dortigen Feldmark befindlichen alten Gräber in Augenschein zu nehmen, damit die etwa der beabsichtigten Chausseelinie nahe liegenden Gräber nicht zerstört würden. Es liegen viele Hünengräber in den Tannen nach der Seite von Damerow hin, die aber nicht der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt sind. Eben so wenig wird der Blocksberg, ein Kegelgrab von 20 und einigen Fuß Höhe, ausgezeichnet durch die Masse der angehäuften Steine und Erde, der Chaussee wegen angegriffen werden; doch wünscht der Herr Clewe auf Carow dieses Grab zu öffnen, wenn er zuvor mit den Steinanfuhren zur Chaussee fertig sein wird. Oestlich und südöstlich davon liegen kleinere Kegelgräber, zum Theil halb zerstört, und wird in dieser Gegend auch ein Wendenkirchhof sein. Alle diese Oerter unter meiner Beihülfe genauer zu untersuchen hat der Herr Clewe für den Verein mir gütigst verheißen. - Zu gleicher Zeit machte er mich aufmerksam darauf, daß in dem benachbarten Gute Leisten sich noch Manches finden dürfte. Da auch dieses Gut von der Chaussee durchschnitten wird, so untersuchte ich am folgenden Tage diese Feldmark mit freundlichst gewährter Erlaubniß des Herrn Gutsbesitzers Beust. Aber außer einer noch unversehrten Steinkiste


|
Seite 356 |




|
mit Deckstein fand ich Alles längst zerstört. Eine andere Steinkiste, deren Tragsteine unter der Erdoberfläche lagen, deren aus der Erde hervorragender Deckstein gesprengt und weggenommen war, lag nahe am See zwischen der Mühle und dem Kruge; man hatte den innern Raum, um die Tragsteine auszugraben, durchwühlt und fand ich unter dem Auswurfe Scherben von drei verschiedenen Urnen, deren eine mit Strichen verziert gewesen war. -
Nach der Aernte werde ich die Chausseelinie von Plau bis zur Grenze bei Wendisch=Priborn in Rücksicht auf die Gräber untersuchen und überhaupt ein wachsames Auge darauf haben.
Vietlübbe im Juli 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Alterthümer in der Gegend von Gnoyen.
Bei meiner Anwesenheit zu Gnoyen, um mit dem Herrn von Kardorff auf Remlin das auf seinem Gute befindliche Hünengrab aufzudecken (vgl. unten), machten wir gemeinschaftlich im Interesse des Vereins Ausflüchte in die Umgegend, und besahen zuerst
nordöstlich von der Stadt, welches drei sehr große Kegelgräber sind, deren höchstes über 50' beträgt und mit Gebüsch bewachsen ist; die Aufdeckung eines derselben würde bedeutende Zeit und Kräfte erfordern.
Sodann besuchten wir den
jetzt eine Mergelgrube, zwischen Bäbelitz und Lübchin, wo vor einigen Jahren beim Mergelgraben viele Urnen, Schädel und Gerippe von Menschen zum Vorschein gekommen sind. Wir fanden noch einige Scherben von Urnen, aber eine nähere Untersuchung umher gab das Resultat, daß der Begräbnißplatz, wahrscheinlich ein Wendenkirchhof, in dem bedeutenden Raume, den die Mergelgrube einnimmt, gelegen habe, aber auch mit demselben zerstört sei.
Sodann besuchten wir die
Sie liegen nördlich von dem Gute an der Grenze der ausgebaueten Hauswirthe. Es ist hier ein Platz von 2 parallelen Niederungen eingeschlossen, auf dem noch vor 15 Jahren 32 Kegelgräber in einer Gruppe vereinigt lagen, je 2 und 2 von gleicher Größe; die Stellen sind noch deutlich zu sehen, einige erheben sich noch mit 5 bis 10' Achsenhöhe in Kegelform


|
Seite 357 |




|
über den Acker; eine Nachgrabung bei zwei der größten aber bestätigte die vollkommene Zerstörung durch Herausnahme der Steine. Oestlich von dieser Gruppe einige 100 Schritte entfernt stehen 2 mächtige Kegelgräber von gleicher Größe; das eine ist von Südost bis in die Mitte hineingegraben und eine Nachsuchung daselbst blieb ohne Resultat; das andere aber ist vollkommen erhalten und ist 25 bis 30' hoch; die angehäufte Erde in beiden scheint Mergel zu sein. Der Herr von Blücher auf Quitzenow und Bobbin gab die Erlaubniß, auch das erhaltene Kegelgrab zu untersuchen; da dies aber längere Zeit erfordert, so haben wir einstweilen die Erlaubniß angenommen und die Aufdeckung zu einer andern Zeit uns vorbehalten.
Zu Wasdow an dem Garten des Gutes liegt in der Wiese der sogenannte
ein alter Thurm aus Mauerwerk mit dazwischen gemauerten Granitsteinen; er ist auf der östlichen Seite geborsten und hat von seiner ursprünglichen Höhe wohl vieles durch die Nachlässigkeit der Besitzer verloren; eine Wiederherstellung möchte schon der Lage und seiner Correspondenz wegen mit dem Nehringer Thurme auf der pommerschen Seite wünschenswerth sein. (Sollte Wasdow einmal in Besitz des Herrn von Blücher auf Quitzenow, Bobbin, Lüdershagen etc. kommen, so würde es wohl gewiß geschehen.) Umher liegen noch Trümmer von Mauerwerk.
Ferner besahen wir
welche dicht hinter dem Hofe am See liegt. Sie ist, wie die meisten solcher Stellen, ein runder Hügel im Sumpfe, von einem Wallgraben umgeben.
Der junge Herr von Kardorff auf Granzow zeigte uns in der Mauer des Dorfes einen
einem Weihkessel ähnlich, aber mehr oval und fast rinnenförmig künstlich ausgehöhlt; der Vater soll ihn auf dem Felde mit andern Steinen ausgegraben haben. Ein ähnlicher Stein soll auch noch auf dem gnoyenschen Stadtfelde an einer Wiese liegen und den Namen Opferstein bei den Einwohnern führen. Auf Granzow fanden sich noch einige vom Vater des Besitzers gesammelte und demselben noch gehörende Alterthümer, als: eine bedeutende Steinkugel aus Schiefer, in 2 Hälften zersprungen, ein altes Hufeisen; ein aus einem Torfmoore in der Nähe von zerstörten Kegelgräbern gegrabener kupferner Kessel wurde vergebens gesucht.


|
Seite 358 |




|
Auf der Rückreise fuhr ich noch über Lüdershagen und besah die Feldmark; im Holze liegen
3 fast zerstörte Hünengräber, die Steinhorst genannt; doch dürfte sich noch an einer andern Stelle im Holze ein Wendenkirchhof finden, da der Berg den Namen Hilge Barg führt. Herr von Blücher will nachgraben lassen, da sich Steinlagen zeigen, und Nachricht geben.
Vietlübbe, den 23. Sept. 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Alterthümer im Luche bei Fehrbellin.
Das Luch bei Fehrbellin, oder Linum, wie es auch heißt, - das bekannte große Torfmoor, dessen größte Breite von Tarnow bis Brunnen etwa 3/4 Meilen beträgt und dessen Länge von Flatow bis Fehrbellin zu 2 1/2 geographischen Meilen anzunehmen ist, - liefert sehr interessante Sachen aus der Vorzeit, welche der Herr Oberinspector Steinkopf daselbst aufbewahrt. Der Herr Graf von Zieten, welcher im v. J. dieses Cabinet besucht hatte, machte mich, in der Voraussetzung, daß eine nähere Kenntniß des Inhaltes dem Vereine für meklenburgische Geschichte angenehm sein möchte, darauf aufmerksam und theilte mir ein kleines Verzeichniß derjenigen Gegenstände mit, welche er zu den merkwürdigsten rechnete. Dies ist die Veranlassung zu diesem Berichte.
Der Herr Oberinspector, welcher mit der freundlichsten Bereitwilligkeit mir und meinem Begleiter, Herrn Könitzer, Oberlehrer der Mathematik und Physik am hiesigen Gymnasium, die Ansicht der Sammlung gestattete, hat die ersten Funde an das Oberbergamt in Berlin gesandt, bald aber einen andern Entschluß gefaßt und alle spätern Funde in dem Locale der Inspection aufgestellt. Ist dieser ganz allein aus dem Luche hervorgegangenen Sammlung dadurch auch manches interessante Stück entzogen, so ist sie doch noch nicht wenig reich, wichtig und unterrichtend, wie die häufigen Besuche von Naturforschern und andern Gelehrten, z. B. Alexander von Humboldt u. A., beweisen, und Männer, wie Chamisso, Hoffmann und Poggendorf, haben sie bei ihren Forschungen, welche bedeutende Resultate über das Entstehen des Torfes im genannten Moore geliefert, die Bildung der Torfmoore überhaupt wohl festgestellt haben, sehr benutzt.
Ueberreste aus der Thier= und Pflanzenwelt, als Geweihe, Knochen und Zähne von Hirschen, Elenthieren, Pferden, wilden Schweinen, ganze Gebisse, und mehrere derselben zu einer Masse mit Torf verwachsen, Schädel, Saamen und


|
Seite 359 |




|
Hülsen von Menyanthes trifoliata, minder häufig von Scheuchzeria palustris, noch einigen Galeopsis=Arten und andern Asperifolien, und was dergleichen in beide Reiche sonst noch gehört, in allen Tiefen vorkommend, bilden einen bedeutenden Theil der Sammlung.
Unter diesen fiel uns besonders ein Schädel von scheinbar sehr abnormer Form auf, den wir keinem hier oder uns bekannten Thiere anzupassen wußten. Nach vorläufigen Untersuchungen gehört er keiner unserer bekannten Hausthiergattungen an.
Mineralien, wie sie die Umgegend besitzt, werden selten in dem Moore gefunden, und die Sammlung hat nur etwas Bernstein, einige kreideartig überzogene Feuersteine, ein Stück Kreide, überhaupt nur unbedeutendes davon aufzuweisen.
Reich aber ist sie dagegen an Sachen im Torf verwachsen und davon umwachsen, als kleinen Süßwassermuscheln aus den Gattungen der Cyclostoma, Valvata, Planorbis u. a., und besonders interessant erschienen uns Kohlen vom frischesten Ansehen, ganz vom Torfe umschlossen, die bei einem Bohrversuche aus einer Tiefe von 24' zu Tage gefördert waren. Es ist auch dabei ein noch unverkohltes Stück Holz weicher Art gefunden worden.
Seltener sind die Sachen, die zu den urzeitlichen Geräthen, den eigentlichen Alterthümern gehören; ihnen fehlt aber, wie der Herr Graf auch bemerkt hatte, das Interessante und Merkwürdige nicht. Ich folge ganz seiner mir gütigst mitgetheilten Notiz und habe nur das Verdienst einer etwas größeren Ausführlichkeit. Er führt auf:
1) ein Steinstück, welches vielleicht zum Zerquetschen oder Zerreiben von Körnern etc. gebraucht worden ist, ein Quetschinstrument, ähnlich einer Mörserkeule. Der Herr Graf besitzt ein ganz ähnliches, etwas größeres Exemplar von Grauwacke, gefunden in einem Hünenberge bei Frankfurt a. d. O. Die Güte der Herren Besitzer gestattet mir von beiden eine Zeichnung dem Vereine zu überreichen.
Ersteres, von Granit, ist im Luch auf der sogenannten Sundhorst 2' tief gefunden worden. Der sich spitzende muthmaßliche Obertheil (Griff) ist rund, der Klump (Untertheil) rund gedrückt, an einer Seite sehr ausgebrochen, die Arbeit für die Zeit sehr gut. Größe 5''.
Diese Horste bemerkte der Herr Oberinspector sind kleine, bis zu 10' über das Niveau des Torfes sich erhebende Erhöhungen, vielleicht ehemalige Inseln, und Geräthe finden sich in der Regel nur an ihnen und in ihrer Nähe, weil nur auf ihnen Menschen leben konnten.


|
Seite 360 |




|
Ein Werkzeug von gleicher Beschaffenheit ist in Skandinaviska Nordens Urinvånare af S. Nilsson (Professor in Lund) abgebildet. Der Verfasser erklärt es für ein Quetschinstrument, beharrt aber nicht auf dieser Erklärung, da es in der Erde und nicht in einem Halbkreuzgrabe (Urgrabe) gefunden worden ist, deshalb die Zeit nicht bestimmt werden kann, welcher es angehört, und meint, daß es auch zu einer Art Ambos gedient haben könne.
Da es bei den Erklärungen solcher Geräthe sehr auf die Zeit ankommt, der sie angehören, so wäre diese vielleicht durch den angeführten Fund bei Frankfurt a. d. O. ermittelt.
2) mehrere Stücke von Feuerstein und eines von Diorit, gewöhnlich Keile genannt. Nilsson, so wie die Kopenhagener "Tidskrift for Oldkyndighed" nennen sie Meißel, Geradbeile.
3) eine kleine Framea von Bronze, ungefähr 4'' lüb. lang, aus einer Tiefe von 2 1/2'.
4) ein Hammer von Knochen, der Textur nach Geweih, nach Größe und Stärke von einem Elen, 5' tief im Torfe gefunden. Das Schaftloch, viereckig, unten wenig weiter, als oben, ist sehr regelmäßig und glatt durchgearbeitet; von der Schärfe ist ein Stück abgebrochen; zwei der bekannten kleinen Kreise oder Augen, auf jeder Seite einer, sind, obgleich sehr abgeschliffen, doch deutlich zu erkennen. Man sieht dem Instrumente einen langen Gebrauch an, der auffallender Weise keine Stöße oder Beulen hinterlassen hat, sondern nur durch ein starkes Abschleißen sich zu erkennen giebt. Dadurch mögen denn auch wohl mehrere Kreise, womit es vielleicht verziert gewesen ist, vergangen sein. (Der Verein für meklenburgische Geschichte besitzt ein gleiches Exemplar mit rundem Schaftloche.)
5) ein runder Schnallenring von Bernstein, fast ganz, wie der in Jahresber. VII, S. 43, Nr. 6 abgebildete, nur mit einem stärkern Halter für die Zunge. Die Rinne der Zunge ist an einem hellen, breiten Streife auf der jetzt dunklen Masse deutlich zu erkennen; Größe 7/8'' und 2 1/2'' lüb, Form rundgedrückt, Loch 5/8'' lüb., Dicke im Loche stark 1/4'', nach dem Rande hin nimmt sie bis auf eine Linie ab.
6) eine kleine Pfeilspitze von Feuerstein 5/8'' und 1 1/4'' lüb., 5' tief unter dem Torfe gefunden, wie die, welche nach Nilsson a. a. O. im höchsten Norden in der Erde gefunden werden.
7) ein sehr gut erhaltener Schädel, wie er den Celten oder Germanen zugeschrieben wird. Er ist ganz mit Torf durchwachsen gewesen, welchen zum Bedauern des Herrn


|
Seite 361 |




|
Steinkopf der Finder sehr sorgfältig abgeputzt hat. Farbe schmutzig knochengelb.
8) eine Hirnschale, mit dem Torfe, der darin gewachsen ist, welcher, verglichen mit dem Schädel Nr. 7, als einer ganz andern Race angehörend sich darstellt. Die Stirn ist auffallend flach und nach der Nase hin vorgeschoben und Herr Leopold von Buch hat sie als von einem Lappen herstammend erklärt. Dies stimmt auch völlig mit den Schädelvergleichungen in dem Werke des Professors Nilsson überein.
Diese Hirnschale lag bei Langen, einem Dorfe am Luch, 6' tief, horizontal, mit der Höhlung nach oben gekehrt; sie ist gerade und glatt wie mit einem Messer mitten durch die Augen abgeschnitten, und vergebens hat man mühsam und sorgfältig nach dem Unterkiefer gesucht, wovon man eben so wenig, als sonst irgend eine Spur von Knochen daneben gefunden hat. Die Farbe ist dunkeltorfbraun, die Masse bruchig, weshalb denn auch der erwähnte vollkommen glatte und gerade Schnitt nicht vollkommen mehr sichtbar ist. Ob aus diesem Funde anzunehmen sei, daß Lappen hier in der Urzeit gehauset haben, lasse ich dahin gestellt sein. Die erwähnten Umstände verleiten mich aber zu der Annahme, daß diese Hirnschale ein Trinkschädel gewesen sein dürfte.
Was nun diesen Uralterthümern und Urgeräthen nicht angehört, Geräthe, Waffen, Münzen neuerer Zeit, die diese Sammlung aufzuweisen hat, wird nie im Torfe, sondern in der Bankschicht, der Erddecke über dem Torfe, die regelmäßig 18'' stark ist, gefunden, selten tiefer als 6'' - 8'', Münzen nur 2''. Diese, so wie die andern Gegenstände, bieten des Erwähnenswerthen nichts.
In Meklenburg, wo es doch gewiß auch bedeutende Torfmoore giebt, hört man von dergleichen Funden wenig oder gar nicht; entweder findet man nichts oder es wird nicht darauf geachtet. Es soll mir zur Ehre gereichen, wenn dieser Bericht die Aufmerksamkeit anregt und bessere Beobachtung, bessere Resultate liefert. 1 )
Allenthalben jedoch mag der Torf wohl nicht gleich ergiebig seyn, denn bei 2300 Tagewerken, die in diesem Jahre im Luche abgeräumt sind und bearbeitet werden, hat sich nichts gefunden.
Neu=Ruppin, den 1. Juli 1843.
A. G. Masch.


|
Seite 362 |




|



|


|
|
:
|
b. Zeit der Hünengräber.
Feuerstein=Manufactur bei Brunshaupten.
An der Küste der Ostsee finden sich vorzugsweise oft größere Begräbnißplätze aus der Stein=Periode. Durch die Mittheilungen des Herrn Pastors Bortisch zu Satow ist es nun auch bekannt geworden, daß sich am Meeresufer, besonders in der Gegend von Brunshaupten, zwischen Brunshaupten und Arndsee, große Massen von Feuerstein=Splittern und Spänen finden, welche ihre Entstehung offenbar menschlicher Kunstfertigkeit verdanken. Ihre Menge an einzelnen Stellen hat im Volke die, ganz richtige, Meinung erweckt, als seien hier Manufacturstätten der Feuersteingeräthe alter Zeit gewesen und die hier gefundenen Späne die bei der Arbeit abgefallenen Splitter. Der Herr Pastor Vortisch hat viele Bruchstücke eingesandt: alle sind die bekannten drei= oder vierseitigen Späne, die auch an andern Manufacturstätten im Lande gefunden sind. Auch in der Gegend der Stadt Cröpelin werden öfter dergleichen Späne gefunden, wie die eingesandten Proben beweisen, unter denen sich auch eine noch nicht ganz vollendete, zerbrochene Lanzenspitze befindet.
Betrachtet man die bisher bekannt gewordenen Fundstätten dieser Feuersteinsplitter, zu Klink (Jahresber. III, S. 41, 64 u. 66) und zu Damerow und Jabel (Jahresber. VII, S. 46), alle am Cölpin=See, so drängt sich unwillkührlich die Bemerkung auf, daß sie alle in der Nähe großer Gewässer liegen und daher ihre Entstehung dem Fischfange und den dazu nöthigen Geräthen verdanken, wie auch mehrere nordische Forscher, z. B. Nilsson in Skandinaviska Nordens Urinvånare, sehr viele Feuersteingeräthe der Stein=Periode für Fischerei=Geräthe annehmen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Hünengrab von Remlin bei Gnoyen,
Nr. 1.
Auf der Feldmark des Gutes Remlin liegt, nahe an der schwasdorfer Scheide, am Wege nach Schwasdorf, ein Hünengrab von 80 Fuß Länge und 34 Fuß Breite. Mächtige Felsblöcke umgeben es von allen vier Seiten, nur fehlen, da das Grab der Länge nach von Süden nach Norden liegt, in dem nördlichen Drittheile einige Seitensteine; auch deuten einige nach Norden außerhalb des Grabes liegende Felsblöcke auf eine vielleicht nach dieser Seite größere Länge in früherer


|
Seite 363 |




|
Zeit. Innerhalb dieser Steinsetzung ist grade in der Mitte eine andere Steinsetzung, die die eigentliche Grabstelle bildet und grade den dritten Theil von der ganzen Länge einnimmt. Dieses innere Drittheil ist nicht allein von allen vier Seiten durch dicht neben einander stehende Granitblöcke von 7 bis 9 Fuß Höhe eingeschlossen, so daß es eine Grabkammer von 20' Länge und 6' Breite innerer Weite bildet, sondern sie war auch oben durch 4 Decksteine, deren einer 9' lang, 5' breit und 4' dick war, dicht verschlossen. Daher schien eine Nachgrabung hier besonders günstige Resultate liefern zu müssen, als noch die Lage der Steine die ursprüngliche zu sein schien und dieses Grab also nicht wie so viele andere Hünengräber früher durchwühlt war.
Während die Decksteine gesprengt und abgewälzt wurden, was mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden war, ward das südliche Drittheil, welches verkehrt muldenförmig 5' hoch mit lehmartiger Erde angefüllt war, untersucht, gab aber keinen Erfolg. Im ebenfalls untersuchten nördlichen Drittheile, in welchem die Erde nur 3 Fuß hoch angehäuft war, wurden viele gespaltene rothe Sandsteine von verschiedener Größe gefunden. Besonders aber ergab sich aus der ferneren Untersuchung, daß diese gespaltenen Steine dazu benutzt waren, die zwischen den Granitblöcken befindlichen Oeffnungen und Lücken auszufüllen (zum Auszwicken).
Darauf ward die innere Grabkammer untersucht, welche bis dicht unter die Decksteine, also wenigstens 6' hoch über den Urboden ausgefüllt war. Die obere Schicht war lehmhaltiger Sand, dann folgten mehrere Schichten fast dammartig in Lehm gelegter Dammsteine von etwa 2 1/2' Höhe. Unter diesen Steinen folgte Thon. In diesem lag grade in der Mitte der Grabkammer eine ganze Urne mit 2 Henkeln etwas schräge mit der Mündung gegen Norden und auf der nach oben liegenden Seite etwas durch den Druck von oben geborsten; sie ist 8 1/4'' hoch, hat keinen eigentlichen Boden, sondern sie rundet sich von dem tief liegenden Bauche nach unten flach ab; die Bauchweite ist 8''; der aufrecht stehende 2 1/4'' lange Hals ist 3 1/4'' weit und verziert mit 4 Reihen starker, von rechts nach links gehender Linien, die durch schwächere rundliche Queerlinien ein fast schuppenartiges Ansehen geben. Unter dem Halse sind 3 horizontale und darunter etwa 1'' lange senkrechte Linien, deren jede mit einem stärker eingedrückten Puncte endigt. In der Urne war nichts, als etwas mit Asche vermischter Thon. An der östlichen Seite der Urne lag in der Richtung von Süden nach Norden ein rundes Holz, freilich


|
Seite 364 |




|

Etwas südlich von der Urne fand sich ein Stück Bernstein, scheinbar ein Fragment von einer scheibenförmigen oder beilförmigen Schmucksache. Südöstlich von der Urne fanden sich Trümmer einer ähnlichen Urne, mit einem nur 1 1/2 hohen Halse und mit 4 Reihen paarweise zusammengehöriger, fast halbmondförmiger Eindrücke, welche mit einem Stempel eingedrückt sind; und zwischen diesen Scherben lagen einige Menschenknochen (nach dem Urtheile der gnoyenschen Aerzte aus dem Kiefer eines sehr großen Menschen). Außerdem lag in der Nähe der Urne ein an 2 Seiten deutlich geschnittener Feuerstein, von welchem zwei hakenförmige Späne abgeschnitten waren. Noch wurden im Thone zerstreut einzelne Scherben einer braunen und einer rothgebrannten Urne gefunden, deren Gestalt sich aber nicht erkennen ließ.
Unterhalb der Thonschicht war der ganze Grund auf dem Urboden mit Dammsteinen abgelegt, aber eigenthümlich abgetheilt. Nämlich 3' vom nördlichen und südlichen Ende standen je 4 gespaltene Steine, von 2' Länge, 1' Breite und 1 bis 2'' Dicke, aufrecht im Damme, so daß sie 1' hoch hervorragten und von einander grade 5'' entfernt waren. Diese beiden Abtheilungen von 6' Länge und 3' Breite waren die eigentlichen Brandstellen, über dem Steindamm mit kleinen Steinen, besonders weiß und roth calcinirten Feuersteinen einige Zoll hoch bedeckt, und in der nordwestlichen Ecke war besonders viele braune Modererde. Unter den sonst durchaus ausgeglüheten Feuersteinen lagen einige nicht calcinirte, die fast das Ansehen von spanförmigen Feuersteinmessern haben. - Kohlen wurden in der ganzen Grabkammer zwischen dem Sande, Lehm und Thon gefunden.
Endlich ward der östliche und westliche Raum zwischen der inneren Grabkammer und der äußeren Steinsetzung untersucht, gab aber kein weiteres Resultat, als daß hier der Grund mit jenen gespaltenen Steinen von 1/2'' Dicke abgelegt war.


|
Seite 365 |




|
Bei dieser Aufdeckung war der Herr von Blücher auf Lüdershagen (Mitglied des Vereins), der eigens zu diesem Zwecke gekommen war, zugegen.
Gnoyen, den 8. September 1843.
F. F. E. von Kardorff, auf
Remlin.
J. Ritter, Pastor zu Vietlübbe.



|


|
|
:
|
Hünengrab von Remlin.
Nr. 2.
Im Winter 184 2/3 ließ der Herr von Kardorff auf seinem Gute Remlin ein kleines, unscheinbares Hünengrab in dem abgeräumten "Heller=Tannen"=Kamp aufdecken. Das Grab lag ohne merkliche Erhöhung mit der Oberfläche fast in dem flachen Erdboden und war nur an der Steinstellung erkennbar: in der Mitte lag der Deckstein, umher standen in geringem Umfange die Grenzpfeiler. Unter dem Decksteine standen große Steine, welche eine Kammer bildeten, die mit Erde gefüllt war. Der Grund der Kammer war mit den bekannten, platten Steinen ausgelegt; tiefer unten, gegen 5 Fuß tief, fand sich noch eine Schicht solcher Steine; jedoch ward nichts weiter gefunden. - Das Grab blieb geöffnet liegen. Beim Versenken der Steine und Ebenen des Platzes im Herbste 1843 fanden sich außerhalb der Kammer die Alterthümer des Grabes, nämlich: ein kleiner Streithammer von dunkelgrünlichem Sandstein, 3 1/2'' lang, mit dem gebohrten Loche dicht am Bahnende, einer der wenigen, in einem Grabe gefundenen durchbohrten Steinhämmer in Meklenburg, und die Scherben einer kleinen Urne, unter dem Rande mit vielen feinen, dichten, concentrischen Reifen verziert; diese Verzierung, - das Fehlen der eigenthümlichen kurzen und tiefen Eindrücke, - und die etwas feste Masse der Urne deuten auf eine jüngere Zeit der Steinperiode. Die Urne war mit Asche gefüllt.
Hünengrab von Remlin.
Nr. 3.
Ein anderes ähnliches Grab, welches schon früher angegraben gewesen zu sein scheint, gab gar keine Ausbeute.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 366 |




|



|


|
|
:
|
Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz).
Von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht, daß auf der Hufe des Schulzen zu Wahlstorf, rechts am Wege von Wahlstorf nach Wilsen, ein Hünengrab liege, dem der Untergang drohe, da die großen Decksteine bereits gesprengt und weggenommen seien, und man aus Mangel an Steinen in dortiger Gegend schon anfange, die Steine in der Umfassung loszugraben, begab ich mich im Interesse und Auftrage des Vereins dahin und fand allerdings die Decksteine abgenommen, sonst aber noch alles unversehrt. Der Bau des Grabmals kommt ganz mit dem zu Remlin aufgedeckten Hünengrabe überein: eine Grabkammer von 6 Fuß Breite, aber nur 8 Fuß Länge, umgeben von einer äußeren Steinsetzung, nur mit dem Unterschiede, daß bei der Lage von Nordost nach Südwest die äußeren Steine am südwestlichen Ende ganz nahe an die innere Grabkammer stoßen, die Ausdehnung aber nach Nordost nicht zu bestimmen ist, da hier keine Schlußsteine sich zeigten. Außerhalb der inneren Grabkammer zeigten sich nun, als ich zur Aufdeckung des Grabes schritt, durchaus keine Spuren von Alterthümern; alles war rothgelber Sand, wie der Untergrund des Bodens umher, nur schon früher von Schatzgräbern durchwühlt, wie die Dorfbewohner es auch erzählen. Innerhalb der Grabkammer war aber noch alles unversehrt: Sand mit Schichten von flach gespaltenen Steinen 4 Fuß hoch über dem Urboden; dicht über dem Urboden aber eine etwa 2 Zoll dicke Schicht von kleinen Steinen, worunter eine Masse calcinirter Feuersteine, auch Kohlenreste von Erlen und Tannen. Von sonstigen Alterthümern aber zeigte sich keine Spur, auch keine Urnenscherbe.
Vietlübbe, im October 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Hünengrab von Roggow.
Ungefähr im J. 1822 ward zu Roggow, bei Neu=Buckow, eine große Begräbnißstätte aus der Hünenzeit durch Zufall entdeckt. Der verstorbene Herr Landrath von Oertzen that so viel als möglich, die Reste der Bestattung zu retten. Dem hochseligen Großherzoge Friedrich Franz schenkte derselbe zwei große, breite Keile aus Feuerstein, welche in der großherzoglichen Alterthümer=Sammlung aufbewahrt werden. Es blieb jedoch manches Interessante in Roggow, welches der Sohn des Landraths, der Herr von Oertzen auf Roggow, jetzt bereit=


|
Seite 367 |




|
willigst dem Vereine abgetreten hat. Derselbe hat auch, als Augenzeuge der Aufgrabung, das Geschenk mit den genauesten Nachrichten über den Fund begleitet.
Am Fuße der großen Hügelkette, welche von SO. nach NW. streichend, aus dem Strelitzischen über die malchinsche Gegend herkommt und an Roggow bei Alten=Gaarz am Salzhaf in die Ostsee fällt, stand in der Hügelreihe am Salzhaf auf dem roggowschen Felde, 8 Fuß tief unter der Oberfläche, in sehr trockenem Sande oder Grandboden eine große Begräbnißstätte, in welcher alle Leichen unverbrannt beigesetzt waren. In der Mitte lag der Länge nach ein großes menschliches Gerippe, zur linken Seite des Schädels lagen ein Pferdeschädel und 6 bis 7 spanförmige Messer aus Feuerstein; am Haupte und zu den Füßen standen Urnen. Zu beiden Seiten dieses Gerippes lagen quer wenigstens 12 bis 16 andere Gerippe, unter diesen mehrere kleine, alle mit den alle mit dem Häuptern an dem großen Gerippe und mit den Füßen seitwärts weg. Alle Gerippe und Schädel waren in dem trockenen Sande wohl erhalten. Umher lagen überall viele zertrümmerte Urnen und mehrere Keile. - In der Nähe der Ostsee scheinen sich öfter solche ganze Reihenlager von Gerippen aus der Steinperiode zu finden (vgl. das Hünenbegräbniß zu Hohen=Wischendorf, Jahresber. III, S. 36): vielleicht Ruhestätten von Kriegern, die in Seekriegen geblieben sind?
In Roggow befanden sich nun noch zwei Schädel. Beide sind wohl erhalten und gut gebildet; die Näthe des einen sind noch lose, die des andern mehr verwachsen; die Zähne sind stark und kräftig; kein einziger Zahn ist hohl, obgleich alle Backenzähne des ältern Schädels nach außen hin in großer Tiefe bis zur Hälfte der Krone wie ausgeschliffen sind. Außer dem befanden sich zu Roggow, jetzt ebenfalls in der Vereinssammlung, zwei Keile und ein breites spanförmiges Messer aus Feuerstein; der Feuerstein ist wohl durch die Trockenheit des Bodens hell und ausgedörrt. Von sämmtlichen Urnen ist keine Spur mehr vorhanden. Ueber die großen Gräber an der Ostsee in dieser Gegend vgl. oben S. 354.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Hünengräber von Vietlübbe bei Plau.
Auf dem vietlübber Felde, nahe an der Karbower und Sandkruger Scheide, wo der Acker sich nordwestwärts nach den Wiesen abdacht, liegt von Osten nach Westen ein Hünen=


|
Seite 368 |




|
grab von mehr als 100 Schritt Länge und 16 Schritt Breite; es sind bereits viele Steine weggenommen, aber man unterscheidet noch deutlich 4 Reihen großer Felsblöcke, welche parallel laufen und 3 freie Räume von 5 bis 7 Fuß Breite zwischen sich bilden. Etwa in der Mitte dieser Steinsetzung lag auf 8 Steinen ein Deckstein von 8 Fuß Länge und 6 Fuß Breite, welcher auf der unteren Seite eine ganz glatt und eben gehauene und geglättete Fläche hatte. Dieser Deckstein war gesprengt und ist das eine Stück vor einigen Jahren zum Mundstück in dem Backofen eines Hauswirths benutzt. Die beiden andern abgesprengten Stücke ließ ich abwälzen und untersuchte den innern Raum, der aber nichts als fetten Thon enthielt. Die 8 Tragsteine standen 2 Fuß über und 6 Fuß unter der Erde. Eine nähere Untersuchung ergab, daß der Erdboden umher aus lauter Thon besteht, und daß man bei Anlegung des Grabes Löcher gegraben habe, nicht weiter, als der Umfang des Steines es erforderte, und daß man nach deren Einsenkung den wenigen offenen Raum um die Steine mit Sand zugeschüttet habe. Außerhalb dieser Steinkiste fand sich nur an der westlichen Seite eine kurze Strecke von 4 Fuß mit einem dreifachen Steindamme über einander, bis zu einer Tiefe von 4 Fuß, in gelbem Sande, unter welchem wieder der Thon sich zeigte. Weder von einem Brande, noch von Urnen oder sonstigen Alterthümern war eine Spur zu bemerken.
Grade westlich von diesem Hünengrabe 90 Schritte entfernt, stand auf einem künstlich aufgeworfenen Hügel eine ähnliche Kiste von 6 im Viereck aufgestellten Tragsteinen, von denen der Deckstein früher schon abgenommen ist. Der innere Raum beträgt 4 Fuß in der Länge und in der Breite. In demselben war 2 1/2 Fuß unter der Oberfläche der Boden mit kleinen Steinen, namentlich Feuersteinen, belegt, welche alle offenbar vom Feuer calcinirt waren; einige Zoll tief war die Erde darunter schwarz gebrannt. Aber auch hier fand sich weiter nichts, und eben so wenig in dem umher etwa 4 Fuß hoch angeschütteten Hügel.
Eine ganz ähnliche Erscheinung, daß eine Strecke von dem Hünengrabe getrennt, aber in gleicher Richtung, eine isolirt stehende Steinkammer sich findet, habe ich auf dem Wege von Damerow nach Carow gefunden 1 ), wo


|
Seite 369 |




|
auf dem Damerower Felde nahe an der Krakower Scheide rechts in den Tannen ein Hünengrab von 40 Schritt Länge und 12 Fuß Breite steht, 80 Schritte aber östlich davon am Wiesenrande eine Steinkiste von 7 und 9 Fuß Weite.
Vietlübbe, im Juni 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Hünengrab von Lage.
In einem Grabe in der Gegend von Lage sind nachstehend beschriebene Alterthümer gefunden und durch Vermittelung des Herrn von Kardorff auf Remlin von dem Herrn Kreis=Physicus Dr. Kues dem Vereine geschenkt:
1) ein Keil der größten Art von hellgrauem Feuerstein, wie Frid. Franc. Tab. XXVI, Fig. 1, 9'' lang, 2 1/2 bis 3 1/2'' breit und 1 3/4'' dick;
2) eine Streitaxt aus grünem Hornstein, 8'' lang, von zierlicher, schöner, seltener Form; diese Streitaxt ist dadurch sehr merkwürdig, daß sie noch nicht geschliffen und noch nicht ganz durchbohrt ist: an beiden Seiten ist die Durchbohrung in vertieft kegelförmiger oder trichterförmiger Vertiefung erst angefangen, und zwar an der einen Seite 3/4'', an der andern Seite 1/8'' tief.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Hünengrab von Püttelkow
Nr. 2.
(Vgl. Jahresber. VI, S. 30.)
Auf der Feldmark Püttelkow bei Wittenburg wurden von den Bauern die Steine eines Grabes ausgebrochen. Unter den Scherben mehrerer, zerbrochener Urnen lag eine Streitaxt aus grünlicher Hornblende, von äußerst zierlicher Form und sauberer Arbeit, an allen Seiten geschmackvoll facettirt und im Loche trefflich gebohrt. Leider ließ sich nichts weiter über den Inhalt des Grabes erforschen; die Streitaxt ward dem Vereine von dem Herrn Amtshauptmann Ratisch zu Wittenburg übergeben.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
c) Zeit der Kegelgräber.
Kegelgrab von Peccatel bei Schwerin.
Mit einer Steindrucktafel und zwei Holzschnitten.
Im Anfange des J. 1843 ward dem Unterzeichneten in Schwerin ein S. 376 abgebildeter, gewundener, goldener Arm=


|
Seite 370 |




|
ring, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 2, gezeigt, der zum Verkaufe gestellt war. Da sich aus diesem "am Rande eines Hügels beim Steinbrechen unter Steinen" gefundenen Ringe auf ein bedeutendes Kegelgrab und auf andere in demselben gefundene Alterthümer schließen ließ, so wurden augenblicklich weitere gründliche Nachforschungen angestellt, welche denn auch ergaben, daß beim Steinbrechen aus einem nicht sehr großen Hügel auf dem Felde des Dorfes Peccatel bei Schwerin, am Rande desselben, der goldene Ring und "kupferne" Geräthe gefunden seien; der herbeigerufene Finder versicherte, daß die "kupfernen Geschirre" noch hinter einem Schranke in seiner Wohnung lägen, mit Ausnahme" zweier kleiner, "kupferner Räder", welche er vor zwei Tagen an einen Nagelschmied aus Crivitz für zwei große Nägel verkauft habe: zwei andere, etwas beschädigte Räder derselben Art habe er noch zu Hause. Sogleich ward das weitere Steinbrechen untersagt, das nach Crivitz Verkaufte glücklicher Weise wieder herbeigeschafft; die Auslieferung des ganzen Fundes veranlaßt und die Fundstelle zu Peccatel in Augenschein genommen. Allerdings war der Hügel ein Kegelgrab, aus welchem bisher nur an einer Seite Steine gebrochen waren. Die höchst bedeutenden Alterthümer waren zwar, theils nach den oxydirten Bruchenden zu schließen, schon im Grabe zerbrochen, theils beim Herausziehen aus dem Steinlager beschädigt; dennoch waren sie der höchsten Aufmerksamkeit und Anstrengung werth und es ward vom Ausschusse des Vereins die Aufdeckung des ganzen Grabes beschlossen.
Die Aufdeckung des Grabes, bei welcher JJ. KK. HH. der Großherzog Friederich Franz, die verwittwete Frau Großherzogin Alexandrine und die Prinzessin Louise, so wie mehrere Bewohner Schwerins gegenwärtig waren, geschah am 18. April durch den unterzeichneten Archivar Lisch und den Hofmaler Schumacher aus Schwerin.
Oestlich von dem eine Meile von Schwerin liegenden Dorfe Peccatel, einige tausend Schritte von demselben entfernt, liegen im Anfange der großen, ganz flachen Ebene des Dorffeldes nahe bei einander drei Kegelgräber. Das kleinere, welches auch aufgedeckt ward, gab gar keine Ausbeute; das mittlere war dasjenige, welches die Alterthümer geliefert hatte und abgetragen werden sollte; das größere steht noch unberührt. Von diesem größeren Grabe gehen im Dorfe folgende Volkssagen.
In dem großen Grabe sollen die Unterirdischen wohnen. Diese haben oft, wenn ihnen Kinder geboren sind, dieselben zu den Leuten im Dorfe gebracht und dafür ein Dorfkind mit=


|
Seite 371 |




|
genommen. Ein solches Unterirdischenkind war auch einmal im Dorfe. Es wuchs nicht und gedieh nicht und ward nicht größer und stärker. Einmal sagte es zur Pflegemutter, sie möge ihm einmal ein Stück aufführen, das es noch nie gesehen. Da zerschlug die Frau ein Ei und richtete es so an, wie es der Bauer zu thun pflegt. Da sprach das Kind 1 ):
Ick bün so olt
As Behmer Gold
Aeverst so wat hebb ick
Mîn lëvdâg nich sên.
Darüber züchtigte die Frau das Kind stark. Die Unterirdischen nahmen es aber zurück und haben seitdem keins wiedergebracht.
Eine andere Sage: In dem Berge (Rummelsberge) wohnen die Unterirdischen. Mitunter halten sie Tafel auf dem Berge, wozu sie Kessel und andere Geräthe aus den übrigen Bergen leihen. Einmal kommt ein Knabe aus Peccatel, sieht die gedeckte Tafel und nimmt ein Messer von demselben. Die Tafel kann deshalb nicht wieder verschwinden. Wie der Vater des Knaben das sonderbare Messer in der Hand desselben sieht, fragt er, woher er es habe. Als der Sohn dem Vater Bericht thut, schilt dieser ihn und heißt ihn das Messer wieder hintragen. Also geschehen, verschwindet die Tafel sogleich.
Das mittlere, ausgedeckte Grab hatte 125 Schritt Umfang, gegen 50 Schritt Durchmesser und etwas über 5 Fuß Axenhöhe; die Ansteigung war also bei der großen Ausdehnung des Grabes nicht stark. Rund umher war es von einem wohlgefügten, dichten, regelmäßigen Ringe von ziemlich großen Feldsteinen, wie mit einer Mauer eingefaßt; diese Mauer lag ganz unter dem Rasen, war von außen nicht zu bemerken und einen Stein hoch und einige Steine dick. Der Grabhügel bestand aus Erde; diese war von anderer Art, als die des umliegenden Ackers; nach der Beobachtung der Arbeiter glich sie der sandigen Erde des nach Pinnow hin, entfernt liegenden, waldigen Berges. In dieser Erde standen 3 Steingewölbe, aus handrechten Steinen aufgeführt: zwei neben einander in der Mitte des Grabes ungefähr 20 Schritt vom Rande entfernt, von N. gegen S. sich erstreckend, durch einen Damm verbunden, jedes an 6' lang, 4' breit, 4' hoch; das dritte Gewölbe stand am Südrande des Grabes, zu den Füßen der beiden andern, war an 16' lang und 10' breit gewesen, und dehnte sich von O. gegen W. aus: dieses Gewölbe hatte


|
Seite 372 |




|
die ausgebrochenen Steine und die merkwürdigen Alterthümer geliefert, die beiden andern Gewölbe waren noch nicht berührt. Es wurden nicht allein die beiden noch unberührten Gewölbe abgetragen, sondern auch die Stelle des südlichen Gewölbes genau untersucht und überhaupt alle Räume des Grabes durchforscht.
Dieses konnte theils nur aus den Berichten der Steinbrecher, theils aus der völligen Aufräumung erkannt werden. Hiernach hatte es eine Länge von 16', eine Breite von 10' und eine Höhe von 3 bis 4' gehabt, und erstreckte sich von O. gegen W. Auf dem Urboden stand noch ein Steinpflaster, auf welchem Asche und viele Kohlen lagen. Auf diesem Pflaster, nachdem an 5 Fuder Steine abgefahren waren, hatten folgende Alterthümer gelegen:
1) Eine große Vase von Bronze, Fig. 1, zwischen 7'' und 8'' hoch, 16'' weit in der Oeffnung, ungefähr 14'' weit im Bauchrande, sehr dünne getrieben, über dem Bauchrande mit 4 concentrischen Reihen kleiner, von innen herausgeschlagener Knötchen verziert, an zwei Seiten mit zwei gewundenen, angenieteten Henkeln, im Ganzen also mit vier Henkeln versehen. Die Arbeit im dünnen Bronzeblech, die Verzierung mit ausgeschlagenen Knötchen, die Windung der Henkel gleicht ganz den sonst vorkommenden Arbeiten aus der Bronze=Periode; die Gestalt der Vase ist der Form der thönernen Urnen aus derselben Periode ähnlich.
2) Ein hohler Cylinder oder eine Säule von Bronze mit 4 Füßen, Fig. 2; der Cylinder mit den Füßen ist 6 1/2'' hoch und 3 3/4'' weit, die Füße sind 2 3/4'' hoch. Der Cylinder ist von Bronzeblech, eben so gearbeitet und verziert, wie die Vase, nur etwas stärker im Bleche. Oben ist ein schmaler Rand nach außen umgebogen; in dem Rande sind 7 Nietlöcher und auch noch einige Niete. Einige Stücke Bronzeblech, ganz dem Bleche der Vase gleich, haben Nietlöcher und Niete in denselben Entfernungen, wie der Cylinder, so daß oben auf dem Cylinder oder der Säule eine bronzene Schale festgenietet gewesen sein muß. Die 4 Füße (von denen 3 verloren gegangen, aber beim Steinbrechen noch vorhanden gewesen sind), sind dicke Bronzestreifen, unten etwas nach außen gebogen, oben inwendig an dem Bleche des Cylinders angenietet, unten etwas ausgebreitet und mit einem großen Nietloche versehen, so daß die Füße unten auf etwas festgenietet gewesen sind.


|
Seite 373 |




|
3) Ein Wagen von gegossener Bronze, Fig. 3, unstreitig eine der größten Merkwürdigkeiten des Alterthums überhaupt. Leider fehlen mehrere Stücke, so daß sich die ganze Construction nur schwer beurtheilen, das noch Vorhandene sich aber wohl nur nach der Abbildung gut erkennen läßt. Auf der beigegebenen Steindrucktafel ist Fig. 3 die muthmaßliche Gestalt des ganzen Wagens, jedoch ohne die Füße des Cylinders, in dem Maaßstabe der Vase und des Cylinders, Fig. 3 a. die perspectivische Ansicht der noch vorhandenen Stücke in halber Größe, mit Andeutung der nothwendigen Ergänzungen, Fig. 3 b. eine vollständige Achsenfügung in natürlicher Größe abgebildet. Charakteristisch sind zuerst die vier Räder, 4 1/2'' hoch, mit vier Speichen, aus einem Stücke gegossen, noch mit den Gußnäthen im mittlern senkrechten Durchschnitte, wie aus Fig. 3 b. ersichtlich ist. Dieselben Räder sind auch auf dem wismarschen Heerhorne gravirt, welches aus derselben Zeit stammt und zu Jahresber. III abgebildet und daselbst S. 67 flgd. beschrieben ist; auch kommen dieselben Räder auf dem Kivik=Monument vor, welches in Suhm Historie af Danmark Tom. I, Tab. II abgebildet ist.

Die Achsen, auf welchen die Räder laufen, sind von starken, viereckigen Bronzestäben, wie aus Fig. 3 b. zu erkennen ist, und bogenförmig wie ein Joch gestaltet. Die Enden der Achsen sind ein wenig gespalten und am Ende breit geschlagen, und dadurch sind die Räder auf den Achsen festgehalten gewesen; von Pflöcken oder Schrauben ist keine Spur. Eine ähnliche Achse hat ein Wagen mit zwei vierspeichigen Rädern auf dem Kivik=Monument; hier steht ein Mann auf der Achse, an deren weitester Ausbiegung eine Deichsel befestigt ist. - Vor den Rädern sind die Achsen etwas ausgebreitet und haben große, starke Niete in einem Nietloche. Nach dem bei der letzten Aufräumung gefundenen, Fi. 3 b. mit der Zusammenfügung eines Rades in natürlicher Größe abgebildeten, vollständigen Fragmente der einen Achse waren hier 3 Bronzestäbe auf einander fest zusammengenietet. Ein Stab x bildete die Achse, der zweite o ohne Zweifel an einem Ende den Langbaum oder Langwagen, der die Verbindung zwischen den beiden Achsen herstellte, ebenfalls jochförmig gestaltet, am andern Ende einen kurzen, dünnen Haken; der dritte Stab u scheint quer nach innen gegangen zu sein und die Last (den Cylinder auf seinen angenieteten Füßen) getragen zu haben.


|
Seite 374 |




|
Die Zusammenfügung der drei Bronzestäbe ist Fig. 3 und Fig. 3 a. hinter dem vordern Rade rechts abgebildet. Jeder jochförmige Langwagen hatte nach vorne und hinten einen aufrecht stehenden, am obern Ende nach unten gekrümmten Haken. Die eine Anfügung bei Fig. 3 a. läßt sich in n sicher erkennen; die 3 andern Haken sind bei der letzten Aufräumung auch noch gefunden, lassen sich aber nicht genau anpassen, da sie in alter Zeit gewaltsam abgedrehet sind. So viel ist gewiß, daß der Wagen nach vorne und hinten eine ganz gleiche Einrichtung hatte.
Der folgende einfache Bericht des Finders wird übrigens die Sache noch bedeutend aufklären: Am Ostende des Grabes unter den Steinen stand die Vase oder der "Kessel", mit Henkeln, gewiß noch mit 3 Henkeln; die Vase war aber durch die Steinlast zerdrückt. In der Vase stand der Cylinder, welcher beim Auffinden noch 3 Füße hatte (der vierte ward bei der letzten Aufräumung gefunden). Unter der Vase lagen die Räder mit den Achsen u. s. w.
Zu bemerken ist, daß der Boden der Vase fehlt, dagegen die auf dem Cylinder angenietet gewesene Schale in ihrer ganzen Ausbauchung mit den Nietlöchern noch vorhanden ist.
Höchst wahrscheinlich verhält sich also die Sache folgendermaßen: auf dem Wagen war mit den Füßen der Cylinder, auf dem Cylinder die Vase angenietet, so daß alle drei Stücke Ein Ganzes bildeten. Die Last der Steine drückte nun das Ganze zusammen und den Boden der Vase ein, so daß der Cylinder mit den Fragmenten des Bodens der Vase in die Vase zu stehen kam, der Wagen aber zerbrach und seitwärts auseinander fiel; denn nach den oxydirten Bruchenden zu schließen, zerbrach auch der Wagen schon im Grabe.
Der Wagen war also zum Hin= und Herfahren der Vase bestimmt. Die Vase, der Cylinder und der Wagen, welche Fig. 1, 2 und 3 in demselben Maßstabe unter einander abgebildet sind, bildeten also Ein fest zusammenhangendes Ganzes, welches sich klar erkennen läßt, wenn man die drei Stücke zusammenschiebt, so daß die Bedeckung des Cylinders den Boden der Vase bildet, und die 4 Füße des Cylinders auf den 4 Achsen des Wagens stehen. Dann ragt der Cylinder grade über die 4 jochförmigen Verbindungen des Wagens weg.
Es scheint außer Zweifel, daß dieser Wagen eine gottesdienstliche Bedeutung gehabt habe, da das Fahren auf Wagen uralte Eigenthümlichkeit der Götter, und auch der Helden,


|
Seite 375 |




|
war, - eine Eigenthümlichkeit, die noch bis ins Mittelalter in der Erinnerung ist (vgl. J. Grimm's deutsche Mythologie I, erste Aufl., S. 74, zweite Aufl. S. 96 und 304).
Dies alles stand am östlichen Ende unter dem südlichen Steingewölbe; am westlichen Ende desselben lag:
4) ein Schwert von Bronze, Fig. 5, zweischneidig, im untern Mitteltheile sich ausbreitend, etwas über 2' lang, nach den oxydirten Bruchenden vor der Beilegung in 4 Stücke zerbrochen, mit einem erhabenen Mittelrücken, welcher an jeder Seite durch eine feine, erhabene Linie begrenzt ist. Der Griff ist mit Knopf und Annietung an die Klinge nur 4'' lang. Auf der viereckigen Griffstange stehen 5 ovale Scheiben, zwischen welche wohl Holz und Leder zur Bildung des Griffes befestigt gewesen ist.
Die Anfügung des Griffes ist sehr zierlich. Zwar ist sie, wie bei den Schwertern in Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 1 und 2, an den Seiten halbmondförmig mit 5 Nieten über die Klinge fassend, aber die mittlere Schweifung ist zu einem Oval geschlossen; hiedurch und überhaupt durch die aus Bronze und Leder zusammengesetzte Bildung des Griffes unterscheidet sich dieses Schwert von den sonst in Kegelgräbern gefundenen, mit denen es übrigens gleich ist. Der Knopf, Fig. 5 a, ist rhombisch gestaltet und oben in einer rhombischen Einfassung mit 8 kleinen, erhabenen Kreisen um das Niet der Griffstange, an den Seiten aber durch Stempel und Gravuren sehr hübsch verziert. Unter dem Griffknopfe sind Zickzacklinien durch Einschlagung dreieckiger Stempel gebildet; dieselbe Verzierung findet sich an dem oben erwähnten Horne von Wismar, Jahresber. III, Lithogr. I, 1 und 7, und III, 1, 4, a, c, g, und 6 b. Das Horn von Wismar mit seinen Wagenfiguren scheint überhaupt mit diesem Kegelgrabe von Peccatel aus gleicher Zeit zu stammen. - Inwendig steckt der hohle Knopf voll Eschenholz.
5) Ein kleines Messer von Bronze, Fig. 7, sichelförmig nach innen gebogen, mit Bronzeheft, welches eine Längsöffnung hat und zur Belegung mit Holz oder Leder eingerichtet ist, im Ganzen etwas über 4'' lang, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 9, jedoch zierlicher. Ein kleiner viereckiger Knopf von Bronze, Fig. 7 a, gehört wahrscheinlich zu diesem Messer.


|
Seite 376 |




|
6) Ein in natürlicher Größe hiebei abgebildeter, gewundener Handring von Gold, Fig. 4, an den Enden offen
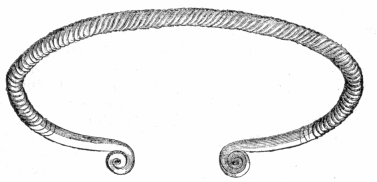
und an jedem Ende mit einer Spiralwindung verziert, ganz wie Frid Franc. Tab. XXII, Fig. 2. Der Ring wiegt gegen 3 Loth; das Gold enthält ungefähr 10 p. C. Silber.
7) Eine Framea, Fig. 6, mit Schaftloch und einem Ringe, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 1. Die Außenseite ist ganz mit gravirten Verzierungen bedeckt; die Schaftöffnung ist, abweichend von der Gestaltung anderer Frameen, etwas viereckig.
Alles dieses ward beim ersten Steinbrechen gefunden.
Bei der letzten, vollständigen Aufräumung fand sich, außer mehrern oben erwähnten Bruchstücken des Wagens, noch
8) eine Pfeilspitze von Bronze, Fig. 9, mit Schaftöffnung, gegen 1 1/2'' lang, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXV, Fig. 5, jedoch mit Wiederhaken.
9) Eine Messerklinge von Bronze, nach außen gebogen, überall von gleicher Breite und Dicke, ohne Griff, 4'' lang, schon im Grabe in drei Stücke zerbrochen.
Von thönernen Urnen war auf dieser Begräbnißstelle keine Spur.
Ungefähr in halber Höhe lag in der Mitte fest zwischen Steinen verpackt und sehr feucht, zwischen Kohlen, welche durch das ganze Gewölbe von hier bis auf den Boden zerstreuet waren:
10) ein lederner Gürtel, Fig. 8, oder ein Pferdegeschirr, von sehr merkwürdiger Beschaffenheit, bei dessen Hebung die fürstlichen Herrschaften gegenwärtig waren. Der Hauptbestandtheil besteht aus einer vierfachen Lage von Leder und Holz. Unten liegt eine Schicht biegsames Holz,


|
Seite 377 |




|
darauf folgt eine Lage dickes Leder, auf dieser liegt eine Lage ganz dünnes Leder, und oben wieder eine Lage dickes Leder. Die obere Schicht ist ganz mit kleinen Buckeln von Bronzeblech Fig. 8 c. beschlagen, welche ganz dicht neben einander stehen; sie sind rund und hohl und sind unten zu zwei Spitzen ausgeschnitten, welche unter der obern Lederschicht umgenietet sind. Die darunterliegende Schicht von dünnem Leder hat Eindrücke von diesen Buckeln erhalten. Es ward ein Stück von ungefähr 1 Fuß lang und 1/2 Fuß breit gefunden; es war der Anfang des Ganzen, an dessen Ecke ein perpendikulairer lederner Riemen befestigt ist, welcher ebenfalls mit Bronzebuckeln beschlagen ist. Oben am Rande, 1/2 Zoll unter demselben, ist ein 1/2 Zoll breiter Riemen aufgeheftet, der am Ende an der Ecke in einer Oese hervorsteht; dieser Riemen liegt am Ende inwendig auf einer Schiene von Bronzeblech. In einiger Entfernung unter diesem aufgehefteten Streifen war Eine Reihe größerer runder Bronze=Buckel, Fig. 8 b, 1/2'' im Durchmesser, von der Beschaffenheit der kleinen, aufgenietet. Außerdem fanden sich einige noch größere Buckel, Fig. 8 c., 3/4'' im Durchmesser, von derselben Beschaffenheit, deren Stelle jedoch nicht ausgemittelt werden kann. - Das Ganze lag in zwei Enden zusammengebogen und nach innen mit den Buckeln zusammengeklappt auf einem großen Steine und konnte nur mit großer Sorgfalt gerettet werden. - Das Geschirr ist sehr merkwürdig. Es beweiset eine große Tüchtigkeit in der Lederbereitung in der Bronze=Periode und eine große Gewandtheit in der Verarbeitung und Anwendung der Bronze. - Wozu das Geschirr gedient habe, ist sehr zweifelhaft; man kann auf einen Gürtel, eine Art Panzer rathen, was nicht unwahrscheinlich ist, da es so sehr mühsam und sorglich und schön gearbeitet ist; vielleicht aber war es eine Art Kappe oder Helm; doch mag man auch immer an die Benutzung zu einem Pferdegeschirr denken.
11) Ein kleiner viereckiger Beschlag von Bronze, wie sich dergleichen öfter finden (vgl. oben Nr. 5), zerbrochen und vom Feuer angegriffen.
welches in gleicher Richtung von N. nach O. neben dem westlichen stand, ungefähr 5 Fuß von demselben entfernt.
Hier ward ebenfalls in mitlerer Höhe eng zwischen Steine (ohne Steinkiste aus platten Steinen) verpackt, gefunden:


|
Seite 378 |




|
12) Eine thönerne Urne, Fig. 12, 5'' hoch, 6 1/2'' weit in der Mündung, von brauner Farbe, mit unbedeutenden Ausbauchungen, ohne Verzierungen, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 13. Die Restaurirung gelang.
13) Eine Nadel von Bronze, Fig. 10, deren Knopf mit mehrern Scheiben verziert ist.
14) Eine Heftel mit zwei Spiralplatten, wie Frid. Franc. Tab XI, Fig. 3, stark vom Feuer angegriffen; es sind nur Reste der Spiralplatten klar zu erkennen.
15) Ein breiter Fingerring, Fig. 11, aus Einem Stücke Bronzeblech, 3/8'' breit, außen mit 6 concentrischen, erhabenen Reifen verziert; der Fingerknochen lag noch wohl erhalten in dem Ringe.
In der Nähe dieses Gewölbes wurden auch zerstreut und ohne Ordnung unverbrannte Schädelknochen gefunden.
stand nicht weit vom Nordende des westlichen Gewölbes als ein kleiner runder Steinhaufen. Unter demselben zeigte sich eine bedeutende Brandstätte mit großen Massen von Kohlen und Asche.
Zerstreut durch dieses Gewölbe lagen mehrere Geräthe, welche vom Feuer stark angegriffen und in viele Stücke zersprengt waren:
16) Ein Paar Handringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXII. Fig. 4.
17) Ein gewundener Hals= oder Kopfring aus Bronze, von gewöhnlicher Form.
18) Eine Heftel mit zwei Spiralplatten aus Bronze, von welcher jedoch nur noch die an dem breiten Ende durchbohrte Nadel zu erkennen war.
19) Ein viereckiger Beschlag, wie Nr. 5 und 11.
Nach der Erzählung der Arbeiter sollte neben dem Grabe schon früher
20) ein Schwert von Bronze gefunden sein. Am 15. Mai 1843 brachte ein Knabe aus Peccatel das obere Drittheil desselben, welches er einige Tage vorher in dem Fußsteige einige Schritte von dem Grabe im Sande gefunden hatte. Es ist ein Schwert ohne Verzierung des Mittelrückens, mit Griffzunge und 4 Nietlöchern zur Befestigung eines hölzernen Griffes.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 379 |




|



|


|
|
:
|
Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1.
Auf der hiesigen Feldmark liegen viele Gräber, sowohl Kegelgräber, als Hünengräber. Der Herr Hauptmann Zink hat die meisten bereits aufgedeckt 1 ), und da die meisten Hauswirthe noch bei der damaligen Aufgrabung zugegen gewesen sind und an derselben Theil genommen haben, so halten sie alle noch vorhandenen Gräber für bereits untersucht und nehmen daher aus denselben die ihnen zu Mauern, Dämmen u. s. w. passenden und nöthigen Steine oder brechen sie der Acker=Cultur wegen aus. Daher habe ich solche bereits angegriffene aber nicht untersuchte Gräber im Interesse des Vereins aufzudecken für nöthig erachtet. - Ein solches Kegelgrab lag hart am Wege von Vietlübbe nach Schlemmin, nahe bei den Tannen, und war von der westlichen Seite bereits angegriffen. Es hatte einen Durchmesser von 50 Fuß und 4 1/2 Fuß Axenhöhe. Die Aufdeckung geschah von Osten nach Westen. Etwa 10 Fuß östlich vom Mittelpuncte zeigte sich eine Steinsetzung, die sich als ein vollkommener Kreis bei fortgesetzter Arbeit auswies. Am südöstlichen Rande dieser Steine, die kaum ein Arbeiter heben konnte, hatte eine braune Urne gestanden, die aber zertrümmert weit verstreuet in Scherben lag. Innerhalb dieser Steinsetzung erhob sich allmählig ein Steinhügel von 3 1/2' Höhe, jedoch so, daß in der Mitte ganz von Osten nach Westen eine Vertiefung von 1 1/2 Fuß vorhanden war, nicht kesselförmig, wie bei andern Gräbern, sondern fast einer breiten Rinne ähnlich. In dieser Rinne lag zwei Fuß östlich von der Mitte: ein kleiner Haufen menschlicher Knochen, besonders vom Hirnschädel und Halswirbel, und nahe dahinter eine Ringschnalle mit Zunge aus Eisen und ein Fragment von einem Messer, gleichfalls aus Eisen, mit Spuren eines hölzernen Griffes. Beide Stücke sind stark oxydirt und haben in der Oxydirung große Blasen aufgetrieben, was nur an alten heidnischen Geräthen bemerkt ist. Wegen des Vorkommens von Eisen hat dieses Kegelgrab besondere Merkwürdigkeit. Jedoch ist dabei zu bedenken, daß diese Bestattung wahrscheinlich eine jüngere ist. In dem Grabhügel unterhalb dieser Alterthümer stand 2 Fuß tiefer auf dem Urboden eine von den Steinen zerdrückte Urne, ohne Inhalt; sie ist hellbraun, in der Basis 4 1/2'', in der Oeffnung 7 1/4'' und im Bauche 8 1/2'' weit, hoch 5 1/4'' ohne alle Verzierung. Mehr Alterthümer fanden sich in dem Grabe nicht.


|
Seite 380 |




|
Wir haben also ohne Zweifel zwei Bestattungen in demselben Hügel, von denen die jüngere in den Anfang der Eisenperiode fällt.
Vietlübbe, im Juni 1843.
J. Ritter.
Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 2.
Zwischen Vietlübbe und Damerow liegen auf der rechten Seite, wo der Boden sich südwestlich nach dem Cheelsbache (Michaelsbache, vgl. Jahrb. VI, S. 176) neigt, 2 Gruppen und einige zerstreute Kegelgräber, die früher noch alle nicht untersucht sind; aber unversehrt ist fast keines, da die Hauswirthe nach Belieben bald dieses, bald jenes angegraben haben der schönen Dammsteine wegen; manche sind schon halb, manche ganz zerstört. Da dem Reste der Untergang droht, weil neue Steindämme und eine neue Kirchhofsmauer nöthig sind, so habe ich bereits eines derselben, welches zum dritten Theile von Südosten durchgraben war, untersucht. Es hatte eine Achsenhöhe von 6 Fuß und einen Durchmesser von 54 Fuß. Der Hügel war aus gelbem Sande aufgeworfen, durchgängig bis zur Oberfläche mit Dammsteinen ziemlich stark versehen; in der Mitte aber bildeten drei ziemlich große Granitblöcke eine Art Kessel oder Kiste. In der Mitte dieser Steine stand eine zertrümmerte braune Urne, ohne Henkel. Sie hat eine Höhe von 9'', der 3 1/4'' lange Hals ist 3 3/4'' weit, die Bauchweite 8 3/4'' und die Basis 3 1/2''. Unter dem Halse ist sie mit einer horizontalen Reihe runder Eindrücke verziert, unter welcher an 5 oder 6 Stellen eben solche Eindrücke ein Dreieck, mit der Spitze nach unten, bilden. Eine ähnliche Reihe im Zickzack ist etwas oberhalb der Bauchweite, und eine horizontale Reihe nahe an der Basis. Die untere Fläche der Basis hat am Rande 6 solcher Eindrücke, durch diametrische Linien verbunden. Einige wenige Knochen waren der Inhalt. Nahe bei der Urne lag im Sande eine bronzene Heftel mit zwei Spiralplatten mit edlem Roste überzogen; die Spitze der Nadel und die unter derselben liegende eine Spiralwindung fehlen. Diese Heftel ist ungewöhnlich lang und schmal. Die Spiralplatten sind nur klein: 3/4'' im Durchmesser, und doch ist das Ganze noch gegen 7'' lang. Der grade lange Bügel ist nicht viel breiter, als die Nadel: 3/16'' breit, in der Mitte mit einer feinen, erhabenen Längslinie, zu beiden Seiten derselben mit feinen, erhabenen


|
Seite 381 |




|
Zickzacklinien, am Rande mit feinen, eingravirten Schräglinien verziert 1 ).
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Kegelgrab von Retzow Nr. 3.
Beim Graben auf dem Felde des Gutes Retzow, Amts Lübz, wurden unter einer Erhöhung folgende Bronzen gefunden und von dem Herrn Gutspächter Dabel dem Vereine geschenkt:
1) eine Framea mit durchgehender Schaftrinne, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 7;
2) ein Armring für den Oberarm, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 3, mit feinen Linien gravirt, in zwei Stücke zerbrochen;
3) zwei Windungen eines spiralförmig gewundenen Armringes, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 7, jedoch von einem viereckigen, etwas platten Bronzestabe.
Alle Alterthümer sind stark mit edlem Roste bedeckt.
Nach Jahresber. V, S. 64, wurden zu Retzow eine Framea mit ganz demselben Roste und von ganz derselben Gestalt, nur etwas größer, und ein Armring von ähnlicher Gestalt, und nach Jahresber. III, S. 64, Armringe und andere bronzene Alterthümer in einem anderen Grabe eben=daselbst gefunden. Formen und Rost reden dafür, daß alle diese Gräber aus derselben Zeit stammen.
Schon früher wurden zu Retzow mehrere Kegelgräber geöffnet: vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 71.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Kegelgräber und Begräbnisplatz zu Ganzlin
bei Plau.
Zwischen dem ganzliner Baueracker und dem zur twietforter Forst gehörigen Acker ist ein neuer Graben gezogen, der eine Gruppe kleinerer Kegelgräber durchschneidet; der größere Theil liegt auf der ganzliner Seite. Bei dieser Ziehung des Grabens ist eine Urne im flachen Boden, wie es scheint, in den Urboden hineingegraben, gefunden und mit dem Inhalte mir übergeben. Diese Urne, hell und dunkelbraun


|
Seite 382 |




|
schattirt, ist mit 2 Henkeln und ohne Verzierung; der Hals fehlt; die jetzige Weite ist an der Oeffnung 4 1/2'', die Basis mißt 3 3/4'' die Höhe 7'', die Bauchweite ist 7 3/4''. Der Inhalt bestand aus lauter Knochen und Sand, so daß sich daraus nicht erkennen läßt, ob sie zu den Kegelgräbern gehört oder in wendischer Zeit beigesetzt ist. Der Wendenkirchhof bei Twietfort liegt nur etwa 300 Schritte weiter nördlich; ich werde auch hier weiter nachforschen.
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Kegelgrab von Grebbin.
Auf dem Felde von Grebbin bei Parchim hatte ein Bauer mehrere Alterthümer von Bronze ausgepflügt. Durch Vermittelung eines Kaufmanns zu Parchim erwarb von demselben der Herr Dr. Beyer zu Parchim für den Verein drei Spiral=Platten von zerbrochenen Handbergen, wie Frid. Franc. Tab. IV, und einen Armring, wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 4, alles mit edlem Rost bedeckt. Auf die angebliche Aussage des Bauern, daß er noch mehr Alterthümer aus dem Funde, namentlich Pferdegeschirr besitze, hat daß großherzogliche Amt Lübz an Ort und Stelle Nachforschung halten lassen, aber nichts in Erfahrung bringen können.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Goldring von Bresegard
bei Eldena.
Ueber dieses seltene und werthvolle Stück des heidnischen Alterthums bringen wir den Freunden alterthümlicher Forschung nachstehenden Fundbericht mit der nachstehenden Zeichnung, - das Einzige, was von dem Funde übrig geblieben ist. Die folgende, genaue Darstellung wird geeignet sein, die Wege klar zu bezeichnen, auf denen so viel Seltenes aus der Vorzeit verschwindet, und die Mitglieder des Vereins veranlassen, diesen Wegen überall nachzuspüren.


|
Seite 383 |




|
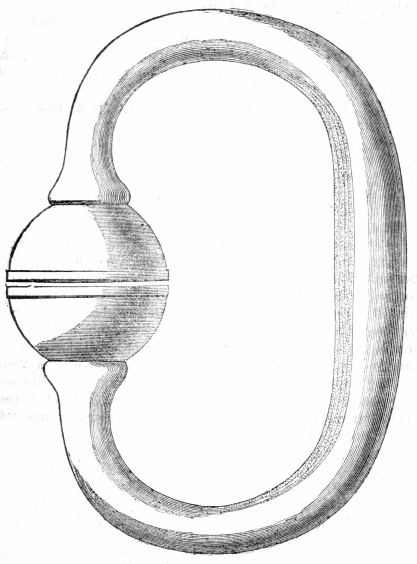
Ungefähr drei Wochen vor Weihnacht pflügte der Hauswirth Schult den auf der sogenannten Fahrenhorst gelegenen Acker des Büdners Pommerencke zu Bresegard bei Eldena. Der Hauswirth Schult pflügte in Gegenwart des Büdners Pommerencke den Ring aus und nahm ihn mit nach Hause. Am andern Morgen ließ sich Pommerencke den Ring zur Ansicht holen, da er auf seinem Acker gefunden sei, gab ihn aber nicht wieder zurück, sondern überließ ihn längere Zeit seinen Kindern zum Spielwerk und erklärte in der Folge späterhin, er habe ihn an den Goldschmied Levy zu Grabow für 170 Rthlr. ver=


|
Seite 384 |




|
kauft. Der Hauswirth Schult machte nun beim großherzoglichen Domanial=Amte Grabow die Anzeige, dieses vereinigte sich mit dem Magistrate daselbst zur Nachforschung, welche von beiden Behörden mit dem rühmlichsten Eifer durchgeführt ward.
Das bestimmt gewonnene Resultat der Nachforschung ist folgendes.
Der Büdner Pommerencke brachte den Ring bald nach der Auffindung desselben zu dem Goldarbeiter Meinhof in Grabow zum Verkaufe, nachdem er den Bot eines Kaufmannslehrlings auf 4 Groschen nicht angenommen hatte. Meinhof probirte, wog und maaß den Ring genau unter Zuziehung seines Gehülfen und beide prägten sich die Form genau ein. Da er mit seiner Goldwage so schwere Sachen nicht wiegen konnte, so benutzte er seine Silberwage und fand, daß der Ring fast 51 Loth wog. Die Masse, welche er sogleich als reines Gold erkannte, probirte er auf dem Probiersteine, welchen er mit den Proben aufbewahrt hat, und fand, daß sie aus 24 karätigem, also reinem Golde bestehe. Er schätzte daher den Werth des Ringes auf etwa 550 Rthlr. N 2/3, kaufte ihn jedoch in Kenntniß der bestehenden Verordnungen und aus Besorgniß nicht, zeigte und hielt den Fund leider aber auch nicht an, sondern rieth nach mehrern Unterhandlungen dem Büdner endlich, den Ring an die Landesregierung zu Schwerin zu bringen. Der Büdner ging aber weder nach Schwerin, noch an seine zunächst vorgesetzte Amtsbehörde, sondern nahm den Ring wieder mit sich nach Hause.
Am 19. Jan. 1844 brachte der Büdner Pommerencke den Ring zum Goldarbeiter Levy in Grabow. Dieser erklärte die Masse für 10 bis 11karätiges Gold und das Gewicht für 46 Loth, gab dem Büdner für das Loth 4 Rhtlr., im Ganzen die Summe von 170 Rthlrn., schmolz den Ring sofort ein, wobei es sich ergeben habe, daß das Gold 19karätig sei, und brachte das Metall sogleich persönlich nach Hamburg, wo er es an den Juden Jonas für 90 Friedrichsd'or verkaufte.
Dieß ist das ungefähre Resultat der angestellten Verhöre. Eine durch den Magistrat zu Grabow veranlaßte Nachforschung durch das Polizei=Amt zu Hamburg, ob der Ring auch wirklich eingeschmolzen sei, hat zu nichts weiter, als zu der Gewißheit geführt: daß der Ring eingeschmolzen und verloren ist.
Dagegen hatte der Goldarbeiter Meinhof, ein geschickter Mann und Zögling der Sonntagsschule für Handwerkslehrlinge zu Schwerin, dessen Darstellung die Stadtbehörden "unzweifelhaft Glauben beimessen", eine Zeichnung und Nachbildung des Ringes aus Messing angefertigt, und begleitete sie mit folgenden Erläuterungen:


|
Seite 385 |




|
1) die oben mitgetheilte Abbildung des Ringes ist ohne Zweifel getreu und zuverlässig;
2) der Ring wog gegen 51 Loth und bestand aus reinem 24karätigem Golde;
3) er war so groß, daß man bequem mit der Hand hineinfassen konnte;
4) die Stärke desselben war den beiden halbkugeligen Enden gegenüber etwa 3/4 Zoll im Durchmesser;
5) die beiden Halbkugeln an den Enden, zwischen denen nur ein schmaler Raum war, waren inwendig hohl, und in den Höhlungen lag ein kleiner gewöhnlicher Kiesel, der durch Zufall hineingerathen sein mußte;
6) der Ring schien gegossen zu sein, war glatt und hatte nur kleine Linien und Puncte zur Verzierung, wie mit einem Punzen eingeschlagen.
Alle diese genauen Nachrichten verdanken wir den unverdrossenen Bemühungen des Herrn Landdrosten von Suckow und des Herrn Burgemeisters Floercke zu Grabow.
Nach dem Mitgetheilten leidet es keinen Zweifel, daß dieser Ring einer jener großen Ringe sei, die in Dänemark öfter, und zwar von reinem Golde, als einzelne Stücke gefunden sind und wie einer im Leitfaden zur Nord. Alterthumskunde, 1837, S. 43, abgebildet ist. Das alte Gold der Gräber (vgl. oben S. 349 flgd.), wie das gediegene Gold Asiens, erscheint messinggelb oder wie Ducatengold, und ist von der Natur mit etwa 10 pCt. Silber legirt, daher es für den ersten Anblick und auf dem Probierstein als reines Gold erscheint. Auch hat der Münzwardein Schlobey zu Hamburg ausgesagt, daß das Gold mit Silber versetzt gewesen sei. Dies allein weiset den Ring schon in die germanische Zeit oder die Bronze=Periode zurück, welche zugleich reich an Gold war. In Dänemark sieht man sie "für heilig" an und "hat man in ihnen die heiligen Ringe wiederzufinden geglaubt, welche als in der heidnischen Zeit bei der Eidesablegung gebraucht erwähnt werden. Es scheint nicht, daß sie um Handgelenke haben gebraucht werden können, wozu zwei gegen einander gekehrte Ausbauchungen, worin sie sich endigen, sie weniger bequem machen; sie sind dabei zu schmal für den Hals oder das Haupt. Ueberdies sind sie oft von reinem Golde und sehr massiv, so daß sie im Alterthume große Kostbarkeiten gewesen sein müssen".
Eine eingeleitete Untersuchung wird nichts Neues für die Alterthumskunde bringen.


|
Seite 386 |




|
Eine an Ort und Stelle am 2. April 1844 in Gegenwart großherzoglicher Domanial=Beamten durch den Unterzeichneten vorgenommene Nachgrabung hat kein Resultat gegeben. Der Acker war ein ehemaliges Erlenbruch und zum ersten Male gepflügt. Der Ring hatte nur wenige Zoll unter der Erdoberfläche gelegen. Die wässerige Brucherde lag weit und breit ungefähr 1 Fuß hoch ganz regelmäßig aus hartem, gelbrothem, eisenhaltigem Sande; die ganze Gegend umher ist völlig flach. Nirgends zeigte sich die geringste Spur von Erhöhung oder Scherben, überhaupt keine Spur irgend einer menschlichen Thätigkeit aus alter Zeit. Es leidet daher keinen Zweifel, daß der Ring einst entweder in dem Erlenbruche absichtlich versenkt oder zufällig verloren sei.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronze=Schwert von Schmachthagen.
In einem Bruche zu Schmachthagen bei Waren ward beim Moderfahren ein Bronze=Schwert gefunden und von dem Herrn von Behr=Negendank auf Torgelow etc. dem Vereine geschenkt.
Das Schwert gehört zu den ausgezeichnetsten Arbeiten der Bronzezeit. Es hat eine Griffzunge mit Nieten, ist länger, als gewöhnlich die Schwerter der Bronze=Periode zu sein pflegen, nämlich 3 Fuß lang, und wird gegen das Ende hin breiter, hat also ganz die antike Form der Bronzezeit. Es ist aber noch besonders geschmückt: dicht unter dem Griffe ist die Klinge 2'' lang ein wenig eingebogen und auf beiden Seiten des Randes jedesmal mit 3 Gruppen eingravirter concentrischer Halbkreise geschmückt, welche auch noch zweimal in senkrechter Stellung sich auf den Rand der Klinge fortsetzen; die Seiten der Griffzunge sind mit eingravirten Schrägelinien in Form von Spitzen verziert. Der erhabene Mittelrücken der Klinge, welcher der Ausbreitung der Klinge folgt, ist an beiden Seiten äußerst schön und regelmäßig von mehreren erhabenen Linien oder Bändern begleitet. Das Ganze ist hiedurch ein äußerst schönes und reinliches Kunstwerk.
Leider haben die Finder auch an diesem Kunstwerke die gewöhnliche Goldprobe versucht und dabei die Klinge in drei Stücke und den Griff so sehr zerbrochen, daß nur noch geringe Reste davon vorhanden sind und der Herr v. Behr=Negendank aus den wenigen Bruchstücken die Gestalt des Griffes nicht mehr zu erkennen im Stande war.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 387 |




|



|


|
|
:
|
Bronze=Schwert von Kreien bei Lübz.
Beim Moderfahren aus einem Loche auf dem Kreier Hoffelde, südlich vom Hofe, ist unter oder auf einem, tief in dem Moder liegenden Eichenstamme ein Schwert gefunden, aus der Zeit der Kegelgräber herstammend. Es ist aus Bronze, die aber etwas heller als gewöhnlich ist, ganz ohne Rost, bloß etwas schwarz angelaufen, zweischneidig und vollkommen scharf, so daß man es sogleich gebrauchen könnte. Auffallend ist die Länge der Klinge, welche 34 Zoll mißt, da sie sonst nur 22-26 Zoll beträgt. Auf beiden Seiten des Mittelrückens laufen 2 erhabene Längsstreifen und nach den Schneiden hin ist es hohl wie ein Rasirmesser geschliffen. Nahe am Handgriffe sind entgegenstehende Reihen concentrischer Halbkreise eingravirt. An den ebenfalls bronzenen Handgriff von 3 Zoll Länge ist die Klinge halbmondförmig angesetzt; wie es scheint, sind beide Theile aus einem Gusse. Der Handgriff hat am Ende einen kurzen viereckigen Dorn und auf demselben nach beiden Seiten hin einen aufwärts gekrümmten, etwas breit und flach gearbeiteten Zierrath, wie eine Parierstange, nur daß sie nicht am Ende der Klinge, sondern am Ende des Griffes sitzt; vielleicht sollte die Stange zum festern Halten mit der Hand dienen; die eine Seite ist abgebrochen und fehlt. An dem Fundorte sollen viele Kohlen in dem Moder gefunden sein. - Das ungünstige Wetter hat das Ausfahren des Moders seit dem Auffinden des Schwertes unterbrochen; sobald der Herr von Plato wieder mit dieser Arbeit beginnen wird, werde ich mich dahin begeben, um eine weitere Nachsuchung anzustellen, und dann über die Localität näher berichten.
Vietlübbe, im März 1844.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen.
Vor einigen Jahren räumte der Herr Schulz, Müller zu Gnoyen, einen auf seinem Felde einige 100 Schritte südöstlich bei der Stadt gelegenen runden Erdhügel ab, in dessen Mitte eine große Menge Steine sich befand, also wahrscheinlich ein Kegelgrab. Ob sich Waffen aus Metall oder Urnen darin gefunden haben, weiß der Herr Schulz nicht, da nur die Menge Steine für ihn Werth hatte. Aber am Grunde dieser Steinmasse zog ein Stein seine Aufmerksamkeit auf sich, den er deshalb sorgsam nach Hause bringen ließ und vor der Thür als einen Sitz benutzt. Hier liegt er


|
Seite 388 |




|
noch vor dem, jetzt von dem dortigen Postmeister bewohnten Hause. Er ist von dem bisherigen Eigenthümer zur Verfügung des Herrn von Kardorff auf Remlin gestellt als Geschenk für den Verein; nur ist der Transport etwas schwierig. Der Stein hat ganz die Gestalt eines dicken Käses, nämlich im Umfange cirkelrund von 3 Fuß Durchmesser, die beiden Seiten flach, wie bei Mühlensteinen, aber an den Ecken wie ein Käse abgerundet; die Höhe beträgt 1 1/2'. Er besteht aus einem gelbgrauen, feinkörnigen und sehr harten Sandstein; seine Gestalt ist offenbar ein Werk der Kunst.
Vietlübbe, im September 1843.
J. Ritter.



|


|
|
:
|
Wendische Silbergeschmeide und
Münzen
aus der Gegend von Schwerin.
Im Juni 1843 fand ein Arbeiter bei einem Dorfe nicht weit von Schwerin, dessen Name dem Unterhändler entfallen ist, vielleicht Sukow, einen "Topf" mit alten Silbermünzen, unter denen auch mehrere Schmucksachen von Silber lagen. Der "Topf" ward sogleich zerschlagen, das Silber aber bei einem Goldarbeiter in Schwerin verkauft, welcher schon früher öfter dem Vereine manchen Fund gerettet hatte. Dennoch schmolz er, indem er die große Masse der gleichartigen Münzen nicht für bedeutend hielt, den größern Theil derselben ein, bewahrte jedoch von jeder der beiden Arten der Münzen 6 Stücke und sämmtlichen Silberschmuck für den Verein auf.
1) Die Münzen sollen eine Masse von ungefähr 20 Loth gebildet haben. Nach der Versicherung des Goldarbeiters bestanden sämmtliche Münzen nach genauer Durchsicht nur aus 2 Arten, von deren jeder er 6 Stücke aufbewahrte. Diese Münzen (vgl. unten Abschnitt IV) sind:
a. 6 sogenannte "wendische Pfennige", von der bekannten Art, mit einem an den Balkenenden mit Perlen gezierten Kreuze auf der einen, und einem Maltheserkreuze auf der andern Seite, auf jener Seite mit der Umschrift CR(quer)V(quer)X, auf dieser mit der Umschrift MCDB, Münzen, von denen man jetzt glaubt, daß sie in Magdeburg für die wendischen Länder geprägt seien. Sie werden in den ehemaligen wendischen Ostseeländern, namentlich in Meklenburg, nicht selten gefunden und fallen wohl ohne Zweifel um das Jahr 1000 oder in den Anfang des 11. Jahrhunderts. Beweise liefern z. B.


|
Seite 389 |




|
die Funde von Sternberg und Warlin, Jahresber. III, S. 103 u. 106, und V, S. 135-136, u. 131 flgd. - Die gegenwärtig gefundenen Pfennige sind ein wenig kleiner, als sie in der Regel zu sein pflegen.
b. 6 niedersächsische Nachbildungen köllnisch=ottonischer Pfennige von dem ebenfalls bekannten Typus, der in Meklenburg auch nicht selten vorkommt, auf der einen Seite mit einem Kirchengebäude, auf der andern mit dem entstellten Monogramm von Cölln: S. COLONIA, wie das Gepräge Jahresber. V, S. 140, genau bezeichnet ist. Diese Münzen sind ganz dieselben, welche schon öfter bei Schwerin und sonst in Meklenburg gefunden sind; vgl. Jahresber. V, S. 140 u. IV, S. 60-61, Not. 2. Nach dem Funde in der Lewitz, Jahresber. IV, S. 57 flgd., und andern Forschungen fallen auch diese Münzen in das 11. und 12. Jahrhundert.
2) Hiernach läßt sich die Zeit, in welche der Silberschmuck fällt, genau bestimmen. Alle Stücke sind gewunden oder Filigran=Arbeit, wie ähnliche Schmucksachen schon früher bei gleichen Münzen gefunden sind; vgl. Jahresber. V, S. 132, und VIII, S. 77. Die silbernen Schmucksachen sind:
a. ein aus zwei Dräthen gewundener, an den Enden offener und nach den Enden hin spitz auslaufender Fingerring, ganz wie ein solcher silberner Ring in Curland gefunden und in Kruse Necrolivonica Tab. 40 u. 42, Fig. d, abgebildet ist.

Bei der weiten Verbreitung dieses Silberschmucks und der silbernen Filigran=Arbeit, der so häufig mit kufischen Münzen zusammen gefunden wird, gegen Osten hin steht ein muhamedanischer Ursprung zu vermuthen.
b. ein großer Ohrring in Form eines dreieckigen Henkelkorbes von geflochtenem Silberdrath.



|
Seite 390 |




|
c. ein etwas kleinerer Ohrring, ganz von derselben Art.
d. ein gewundener Armring, aus zwei feinen Silberdräthen gewunden, an einem Ende am Schließhaken in eine schmale Platte mit einem Haken auslaufend.

e. eine Perle von Silberblech mit Silberdrath verziert; nach der Aussage des Finders sollen mehrere solcher Perlen vorhanden gewesen sein.

G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Wendischer Silberschmuck und wendische
und
altdeutsche Münzen von Remlin.
Wenige Wochen, nachdem der so eben beschriebene Fund von Silbersachen bei Schwerin gemacht war, brachte der Zufall einen ganz gleichen Fund ans Licht. Auf dem Bauerfelde von Remlin bei Gnoyen lag ein einzelner großer Granitblock; als dieser zum Zweck freierer Ackerbenutzung im Frühling d. J. gesenkt werden sollte, fand man unter diesem Steine einen Topf mit ungefähr 13 Loth Silbersachen, welche der Eigenthümer des Gutes, der Herr von Kardorff auf Remlin, dem Vereine zum Geschenke brachte. Der Topf war leider ganz zerbrochen.
Die gefundenen Gegenstände bestehen aus 130 Silbermünzen, theils altdeutschen Münzen, theils sogenannten Wenden=


|
Seite 391 |




|
pfennigen oder andern für die Wendenländer gemachten Nachbildungen, und mehrern Schmucksachen aus Silber. Unter den Schmucksachen befinden sich einige Stücke, welche den bei Schwerin gefundenen völlig gleich sind, also ebenfalls ungefähr in die Zeit um das J. 1000 n. C. fallen; die Münzen, welche unter Abschn. IV näher beschrieben und beleuchtet sind, geben dieselbe Zeitbestimmung. Das Wichtige und Interessante dieses Fundes liegt also in der Möglichkeit einer Zeitbestimmung für gewisse Gegenstände der Vorzeit; überdies waren Schmucksachen dieser Art früher noch nicht in Meklenburg zur Untersuchung gekommen. Die Sachen gehören also ohne Zweifel den Wenden der letzten Periode des Heidenthums an. Hiemit stimmt auch die Aeußerung Helmold's überein, welcher II, cap. 13, §. 8 ausdrücklich sagt, daß die Wenden zur Zeit kriegerischer Unruhen ihre goldenen, silbernen und sonstigen Kostbarkeiten zu vergraben pflegten (Quoties autem bellicus tumultus insonuerit, - - aurum atque argentum et preciosa quaeque fossis abdunt). Die Erfahrung hat auch gelehrt, daß in Pommern die meisten Silbersachen unter große Steine vergraben gefunden sind.
Die Schmucksachen bestehen aus Silber=Filigran und Kettenwerk. Die Filigran=Arbeit gehört der Wendenzeit oder der Eisen= und Silber=Periode an; feines Kettenwerk fällt ebenfalls in die letzte Periode des Heidenthums, wie vorzüglich Kruse's Necrolivonica beweisen, in welchem Werke die meisten Alterthümer aus Kettenwerk bestehen.
Die silbernen Schmucksachen sind folgende:
1) ein Ohrring in Form eines kleinern dreieckigen Henkelkorbes aus geflochtenem Silberdrath, ganz wie dergleichen in dem schweriner Funde vorkommen und einer derselben S. 389 zu Nr. 2. b. abgebildet ist.
2) ein Ohrring, ebenfalls korbartig aus Silberdrath hübsch gearbeitet, wie er hieneben abgebildet ist.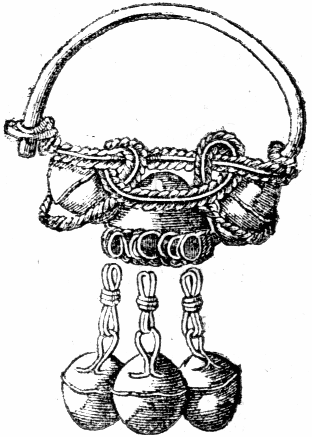
Am Ende des Ringes nach unten hin sitzen zwei hohle Silberperlen; zwischen beiden nach unten hin sitzt eine nach unten geöffnete, halbe Perle oder Glocke, welche am Rande mit feinem Flechtwerk verziert ist. Drei größere Oeffnungen in diesem Flechtwerke deuten darauf hin, daß hier etwas eingehängt gewesen sei. Wahrscheinlich hing in jeder Oeffnung an einem Kettchen eine Perle, wie deren drei unter dem Ohrringe, jedoch nicht in Verbindung mit demselben, ab=


|
Seite 392 |




|
gebildet sind; es ist nur noch eine von diesen an einem Kettchen hangenden Perlen vorhanden, es hat jedoch der Ohrring nach unten hin gewiß drei eingehängte Verzierungen gehabt: die Ergänzung der übrigen ist daher anpassend erschienen.
3) zwei Paar Ohrringe von platter Form, wie einer hineben abgebildet ist.
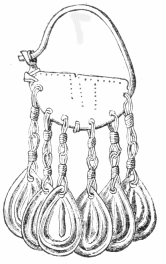
Um die untere Hälfte des Ringes ist ein Silberblech gebogen, welches die untere Hälfte der Ringöffnung füllt. In den Rand sind an kleinen Ketten 6 blätterförmige und mit getriebenen Rändern und Rippen verzierte feine Silberplättchen eingehängt. Einige von diesen Ohrringen sind in den Verzierungen sehr zerbrochen.
Die Münzen sind unten (Abschnitt IV) in der Beschreibung der wichtigern Münzfunde von dem Herrn Pastor Masch näher beleuchtet.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau.
Durch den Küster Lange zu Karbow erfuhr ich, daß zu Twietfort bei der Anlegung neuer Gräben Urnen zum Vorschein gekommen seien. Deshalb begab ich mich im Interesse des Vereins dahin und fand in einem Graben des neu angelegten Weges von Ganzlin nach dem twietforter Forsthause an 2 Stellen die Trümmer von Urnen; die eine war schwarz und fast glänzend; unter den Knochen fand sich noch ein Bruchstück von einer eisernen Broche. Dieses und der Umstand, daß besonders in dem neuen Wege einzelne Stellen eben so mit Dammsteinen belegt sind, wie auf dem Helmer Wendenkirchhofe, spricht dafür, daß auch hier ein solcher Kirchhof sei. Der Boden besteht aus gelbem und rothem Sande. Im Herbste hoffe ich den Platz näher zu untersuchen.
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.


|
Seite 393 |




|



|


|
|
:
|
Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow.
Der Mahnkenberg bei Bützow, in der Nähe der
Strafanstalt Dreibergen, ist ein großer
Wendenkirchhof gewesen; vgl. unten Abschnitt
III, 1 "Die wendische Fürstenburg
Bützow". Unter den vielen Urnenscherben und
andern Alterthümern, welche der Herr Seidel dort
gefunden hat, findet sich auch eine Heftel
(broche), wie sie oben S. 343 abgebildet ist,
auf deren Nadelscheide auf der äußern Fläche mit
kleinen Parallelstrichen ein Kreuz mit
gebrochenen Balken
 , wie es in Frid. Franc. Tab.
XXXIV, Fig. 2 b. steht, eingegraben ist, - ein
Symbol, welches (knezegranitza?) sich in
heidnischen Zeiten bekanntlich öfter findet.
, wie es in Frid. Franc. Tab.
XXXIV, Fig. 2 b. steht, eingegraben ist, - ein
Symbol, welches (knezegranitza?) sich in
heidnischen Zeiten bekanntlich öfter findet.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
e. Vorchristliche Alterthümer auswärtiger Völker.
Römische Bronze=Vase von Vorland bei Grimmen.
Der Herr Dr. von Hagenow zu Greifswald hat dem Vereine einen Gypsabguß von der in seiner Sammlung befindlichen, im J. 1835 zu Vorland bei Grimmen ausgepflügten, äußerst schönen und merkwürdigen Bronze=Vase geschenkt. Der Herr Dr. von Hagenow beschreibt diese kostbare Reliquie im Vierzehnten Jahresber. der Gesellsch. für Pommersche Gesch. u. Alterth. vom 22. Juni 1839, Stettin 1840, S. 58, also: "Ein schönes Gefäß, 4'' 3''' hoch und 4'' weit, von römischer Arbeit. Es ist unten offen und nicht bemerkbar, daß ein Fuß abgebrochen ist. Die untere Oeffnung hält 1'' 5''' im Durchmesser; dann wölbt sich das Gefäß kugelförmig und zieht sich oberwärts plötzlich in einen Hals von 7''' Länge und 2'' 6''' Weite zusammen, mit auswärts umgekrämptem Rande. Dieser Rand hat an einer Seite einen Schlitz und es ist ersichtlich, daß ein Deckel dazu gehörte, mit einem Zahn im Innern, der in den Schlitz eingriff und nach halber Umdrehung den Deckel gegen das Abfallen sicherte. Das Aeußere ist mit vier äußerst schön geformten hoch aufliegenden Köpfen geziert, die an 4 Seiten einander gegenüber stehen. Man erkennt in ihnen den ältern bärtigen Silen und ihm


|
Seite 394 |




|
gegenüber den jüngern Bacchus, zwischen beiden die Köpfe zweier Bacchantinnen von höchst edler griechischer Form. Reben und Weinlaub umgeben die Gruppe oberwärts; unterwärts aber sind die Köpfe durch vier zusammenlaufende architectonische Blätter getrennt. Oberwärts, wo der Hals beginnt, stehen noch 8 vierblätterige Rosetten im Kreise herum, welche in der Mitte durchbohrt sind und zu der Vermuthung berechtigen, daß die Vase mit kostbaren Specereien gefüllt vielleicht bei Bacchanalien gebraucht wurde, wo dann der Duft des wohlriechenden Inhalts sich nach und nach durch diese Oeffnungen verbreitete".



|


|
|
:
|
2. Der unbestimmten Vorzeit.
Urnen aus der Lausitz,
von Königswartha bei Budissin in der
sächsischen Ober=Lausitz.
Der Herr Reichsfreiherr Albert von Maltzan auf Peutsch hat, in dem Streben nach einer comparativen Sammlung von Alterthümern für unsern Verein, 5 Urnen aus der sächsischen Ober=Lausitz erworben und dieselben mit einem Berichte des Finders, Herrn Pfarrers Körnig zu Königswartha, dem Vereine geschenkt.
Der Herr Pfarrer Körnig berichtet über den Fund Folgendes:
Es sind zu Königswartha bei Budissin bis jetzt zwei heidnische Begräbnißplätze entdeckt worden.
Im letzten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts ließ der damalige Besitzer von Königswartha, Johann Friedrich Carl Graf von Dallwitz, auf einem freien Platze an der östlichen Seite von Königswartha, die Winze genannt, zur Verschönerung des Ortes Spaziergänge anlegen. Bei Ausgrabung der Gänge entdeckte man daselbst einen heidnischen Begräbnißplatz und fand eine große Anzahl Aschenkrüge und Urnen. Dieselben wurden sorgfältig gesammelt und in einem eignen Antikencabinet aufbewahrt. Auch ließ der Graf sämmtliche Urnen und die darin befindlichen Gegenstände abmalen und legte diese Gemälde unter dem Titel: Koenigswartha subterranea, nieder. Nach seinem Tode acquirirte die Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz diese Sammlung, in deren Händen sie sich noch bis auf den heutigen Tag befindet.


|
Seite 395 |




|
Nur ein einziger Fall ist mir bekannt, daß in hiesiger Gegend etwas Werthvolles aufgefunden ist. In Wagners Budissiner Chronik vom Jahre 1692 steht nämlich die Nachricht, daß 1596 von einem Hirtenmädchen bei Königswartha ein gewundener Golddrath aufgefunden worden sei.
Als im Jahre 1833 eine neue Chaussee von Budissin über Königswartha bis an die preußische Grenze nach Hoyerswerda zu gebauet ward, stieß man bei Fertigung der Chausseegräben und bei Aufgrabung des Kieses zur Bedeckung der Chaussee, in der Nähe des hierher gehörigen, eine gute Viertelstunde von hier entfernten Dorfes Kamenau, auf eine Menge Aschenkrüge und Urnen. Sie wurden leider von den Chausseearbeitern, welche darin Gold suchten, größtentheils zertrümmert. Nur äußerst selten ließ sich im Fortschritte der Arbeit eine unversehrte Urne auffinden: denn theils waren sie wahrscheinlich beim frühern Fällen der Bäume zertrümmert worden, theils waren sie von Baumwurzeln durchwachsen, theils zerfielen sie, sobald die äußere Luft sie berührte, bei der kleinsten Bewegung in Stücke. Mit vieler Mühe habe ich fünf Urnen ziemlich unverletzt gewonnen.
Der Platz, auf dem die Urnen ausgegraben sind, ist ein bedeutender Sandhügel, in welchem sich viel Kies befindet. Die Urnen, welche ich fand, standen ungefähr 6 Zoll tief.
So weit der Herr Pfarrer Körnig.
Die 5 hellbraunen Urnen tragen im Allgemeinen sehr bezeichnend den Typus der Urnen in Schlesien und in der Lausitz und scheinen der letzten Zeit der Bronze=Periode anzugehören; die in ihnen gefundenen Geräthe sind noch von Bronze mit nicht sehr tiefem, nicht edlem Rost; die Urnen sind sehr wohl erhalten und ihre Formen scharf und rein ausgeprägt. Es sind folgende Urnen:
1) eine Urne, 8'' hoch, von der Grundform der Urnen der Kegelgräber, wie sie in Frid. Franc. Tab. V, Nr. 9 und 10 abgebildet sind, mit 2 kleinen Henkeln; sie war ganz mit Sand gefüllt, in der Nähe lagen verbrannte Knochen von einem erwachsenen Menschen;
2) eine Urne, 7'' hoch, mit schalenförmigem, niedrigen Bauche und hohem Halse, von der eigenthümlichen, schlesischen Form, wie in Büschings Schles. Altth., Titel, Fig. 2, und Klemm Germ. Alterthk. Tab. XIII, Fig. 5, ähnliche abgebildet sind; der Inhalt bestand nur in Sand;
3) eine kleine Urne, gegen 4'' hoch;
4) ein kleiner Krug, 5'' hoch, mit hohem, engen Halse und zugespitztem Boden, nicht zum Stehen eingerichtet;


|
Seite 396 |




|
5) eine kleine Urne, mit Sand und verbrannten Kinderknochen gefüllt. In dieser Urne lagen: der Knopf einer Nadel von Bronze und ein mit den Enden überfassender, dünner Ring von Bronze, 1 1/2'' weit.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
3. Des Mittelalters.
Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden.
Auf dem Burgwalle von Bützow (vgl. Abschn. III, 1), welcher bis zum J. 1263 eigentliche Residenz der Bischöfe von Schwerin war, fand der Herr Seidel zu Bützow eine kleine, hohe Kanne von festem, blaugrauen Thon, mit einem großen Henkel, welche ohne Zweifel aus dem Mittelalter stammt. Auf dem Boden dieses Gefäßes steht im Relief in einem Kreise ein gleicharmiges Kreuz. Ein ähnliches Gefäß ward auch auf dem Burgwalle von Neuburg gefunden; vgl. Jahrb. VII, S. 171. Bekanntlich ward zu Stendal 1826/7 ein ganzer Brennofen voll solcher kugeliger Gefäße, mit einem Kreuze auf dem Boden, gefunden, welche ohne Zweifel dem frühen Mittelalter angehören (vgl. H. v. Minutoli Beschreibung einer zu Stendal aufgefundenen alten heidnischen Grabstätte. 1827).
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Henkelkrug von Böhlendorf,
Geschenk des Herrn Majors von Kardorf auf Böhlendorf. Dieses völlig erhaltene Gefäß ward zu Böhlendorf in dem sogenannten See, einem ansehnlichen Wasserbehälter, bei dem Ausmodden desselben im Herbste 1843 mehr als 20 Fuß tief unter dem gewöhnlichen Wasserstande im Moorgrunde des Sees gefunden. Es ist ein mittelalterlicher Henkelkrug aus blaugrauem, fein geschlemmten Thon, mit schwärzlicher Oberfläche, mit einem kugeligen Bauche mit 3 von innen herausgedrückten Knoten, statt der Füße, mit einem hohen, eingezogenen, quer gereiften Halse, an welchem ein großer, breiter, 5'' hoher Henkel sitzt. Das ganze Gefäß ist gegen 13'' hoch, 10'' im Bauche und 5'' im Halse weit. Es gleicht ganz dem Henkelkruge von Rehna, welcher ebenfalls 8 Fuß tief im Moor gefunden ward; vgl. Jahresber. III, S. 92.


|
Seite 397 |




|



|


|
|
|
Fingerring von Beckerwitz.
Der Herr Pastor Erfurth, früher zu Hohenkirchen, jetzt zu Picher, hat dem Vereine einen Fingerring von Messing übergeben, welchen der Schullehrer Rath zu Beckerwitz, Pfarre Hohenkirchen, in seinem Garten gefunden und ihm früher geschenkt hat. Der Ring ist ein breiter Reif von Messing mit runder Oberfläche, an jeder Seite von einem dünnen Rande begrenzt, der durch eine geperlte Vertiefung von dem Reif abgesondert ist. Auf der Außenfläche steht ohne Unterbrechung:

Der Zwischenraum vor dem Buchstaben M ist beide
Male ein wenig größer, als zwischen den andern
Buchstaben; es steht also zwei mal das Wort
 da. Die Buchstaben sind mit
einem Meißel in einzeln stehenden graden Linien
leicht, jedoch tief genug eingeschlagen; auch
das M besteht aus einer Zusammenstellung gerader
Linien und erscheint dadurch eckig. Durch diese
Art der Einprägung, durch den Mangel einer
schönen und regelrechten Verbindung der Linien
haben die Buchstaben
da. Die Buchstaben sind mit
einem Meißel in einzeln stehenden graden Linien
leicht, jedoch tief genug eingeschlagen; auch
das M besteht aus einer Zusammenstellung gerader
Linien und erscheint dadurch eckig. Durch diese
Art der Einprägung, durch den Mangel einer
schönen und regelrechten Verbindung der Linien
haben die Buchstaben
 und
R
ein runenhaftes
Ansehen und könnten auch leicht für
N
und
K
angesehen werden, müssen aber ohne
Zweifel gelesen werden, wie hier. Der Herr
Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen ist auch
dieser Ansicht.
und
R
ein runenhaftes
Ansehen und könnten auch leicht für
N
und
K
angesehen werden, müssen aber ohne
Zweifel gelesen werden, wie hier. Der Herr
Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen ist auch
dieser Ansicht.



|


|
|
:
|
Schwert von Schwaan.
Bei Schwaan, dicht vor dem Mühlenthore, ward beim Graben in einer Wiese ein eisernes Schwert gefunden und dem Vereine von dem Herrn Gerichtsrath Ahrens geschenkt. Die Klinge ist 2' 7'' lang, von 2 1/4'' bis 1 1/2'' breit, an der Spitze plötzlich im Dreieck abgeschnitten, zweischneidig, an jeder Seite mit einer breiten Längsfurche, welche 2' weit hinabläuft. Der Griff, dem der Knopf fehlt, ist 9'' lang; die Parierstange, in Form einer einfachen, etwas über 1/8'' dicken, viereckigen Stange, ist eben so lang. Das Schwert gleicht ganz dem in Annaler for nord. oldkynd., 1838, p. 111, abgebildeten, in einem heidnischen Grabe jüngerer Zeit gefundenen Schwerte, welches jedoch einen Knopf hat.
Das Schwert von Schwaan ist durch eine Inschrift merkwürdig, welche im obern Theile der Längsfurche an jeder Seite der Klinge mit Bronze eingelegt ist. Die Buchstaben sind 3/8 Zoll hoch und ganz im Charakter des 12. oder 13. Jahr=


|
Seite 398 |




|
hunderts; ich würde sie lieber dem 12. als dem 13. Jahrhundert zuschreiben.
Die Inschriften lauten, ohne Unterbrechung:
1) auf der einen Seite:

2) auf der andern Seite:

Der Herr Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen sieht
hierin einen abgekürzten lateinischen
Segenswunsch und theilt
 . u. s. w. oder ähnlich ab. Diese
Erklärung ist ohne Zweifel richtig und es ist
darnach abzutheilen,
. u. s. w. oder ähnlich ab. Diese
Erklärung ist ohne Zweifel richtig und es ist
darnach abzutheilen,
1) auf der einen Seite:
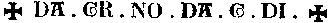
d. i.
 DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam
DeI
(oder deO).
DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam
DeI
(oder deO).
2) auf der andern Seite:

d. i.
 DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam Deo.
DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam Deo.
Nach allen Verhältnissen scheint das Schwert aus der Zeit der Züge der Dänen nach Wenden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, z. B. aus dem J. 1159 (vgl. Jahrb. VI, S. 90) zu stammen, indem die Dänen öfter die Warnow hinauf bis zur Burg Werle bei Wik in der Nähe von Schwaan geschifft sind und hier wohl öfter gekämpft haben.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel,
von schwarzem Kieselschiefer, 1 1/2 " lang
1/2 "breit, 1/4 " dick. An dem einen
Ende ist verkehrt, zum Stempeln,
 , d. i. Tag 3, an dem andern
, d. i. Tag 3, an dem andern
 , d. i. Tag 4, eingegraben. Die
jüdischen Schächter haben für jeden Wochentag
einen Stempel, mit denen sie das an jedem Tage
geschächtete Fleisch stempeln, da es innerhalb
dreier Tage gegessen werden muß. Nach
Kosegartens Ansicht "scheinen die
Schriftzüge grade nicht alt; aber die hebräische
Quadratschrift hat sich überhaupt seit 800 bis
1000 Jahren fast gar nicht verändert".
Daraus aber, daß ein grade nicht regelmäßiger
Stein, der freilich zugleich zu einem andern
Erwerbszweige diente, gewählt ist, möchte sich
auf ein ziemlich hohes Alter schließen lassen;
in neuern Zeiten haben die Schächter förmliche
Pettschafte. Gefunden ist dieser Stein zu Remlin
bei Gnoyen in einer Mergelgrube und geschenkt
von dem Herrn von Kardorff auf Remlin.
, d. i. Tag 4, eingegraben. Die
jüdischen Schächter haben für jeden Wochentag
einen Stempel, mit denen sie das an jedem Tage
geschächtete Fleisch stempeln, da es innerhalb
dreier Tage gegessen werden muß. Nach
Kosegartens Ansicht "scheinen die
Schriftzüge grade nicht alt; aber die hebräische
Quadratschrift hat sich überhaupt seit 800 bis
1000 Jahren fast gar nicht verändert".
Daraus aber, daß ein grade nicht regelmäßiger
Stein, der freilich zugleich zu einem andern
Erwerbszweige diente, gewählt ist, möchte sich
auf ein ziemlich hohes Alter schließen lassen;
in neuern Zeiten haben die Schächter förmliche
Pettschafte. Gefunden ist dieser Stein zu Remlin
bei Gnoyen in einer Mergelgrube und geschenkt
von dem Herrn von Kardorff auf Remlin.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 399 |




|



|


|
|
:
|
II. Zur Ortskunde.
Der Hart.
"in deme dorpe to Panstorpe dat licht up deme Harte",
wie er das Dorf von seinem Vater geerbt habe. - In Rostock lebte, sicher im 13. Jahrh., eine Bürgerfamilie: vom Hart.
Noch im J. 1506 bei der Ausfertigung des Roßdienst=Registers kommt der Hart als ein eigener District des Landes vor. Damals leistete die Ritterschaft des Districts folgende Roßdienste:


|
Seite 400 |




|
2 Eler Levetzow to Gorloess (Gorschendorf?).
3 Otto Wutzen (zu Teschow).
2 Hinrick vom
Hagen to Mistorp.
2 Kersten Passow to
Mistorpe.
2 die Stale to Panstorpe.
Das Land Kalen lag unmittelbar nördlich vom Hart.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf.
Die alte Topographie ist oft von großer Bedeutung für die Geschichte und staatswirthschaftliche und staatsrechtliche Fragen. Besonders interessant ist die Topographie der Abtei Doberan und deren Umgebung, weil sie die ältesten Verhältnisse unserer Geschichte berührt, jedoch viel zu schwierig, als daß sie schon jetzt mit einiger Sicherheit aufgeklärt werden könnte.
Ebenfalls interessant ist die Topographie derjenigen Pfarren, welche an die Abtei Doberan und die Pfarre Satow, den alten Klosterhof des Mutterklosters Amelungsborn, grenzen.
Durch einen Zufall habe ich alte Nachrichten über diese Pfarren aufgefunden und zwar in einem Fragmente eines Heberegisters. Dergleichen alte Register, welche fast alle verschwunden sind, gehören in Meklenburg so sehr zu den Seltenheiten, daß jedes kleine Bruchstück willkommen ist. Das Fragment ist ein fast handbreites Stück Pergament in Folio, welches der Länge nach aus einem Bogen geschnitten und beim Heften als Rücken eines "Auszugs aus dem bützowschen Amtsregister 1616/17" benutzt ist.
Die Handschrift stammt noch aus dem 14. Jahrhundert. Die 3 groß gedruckten Ueberschriften der Pfarren sind ganz roth geschrieben, die Anfangsbuchstaben der Absätze sind roth durchstrichen.


|
Seite 401 |




|
Parrochia Nienkerke.
Parrochia Nygenkerke
1
).
Jordenshagen
2
). III mans.
. . .
. . . . . ord. Item III tre.
Item de palude
III tremod. au
Summa silig. III tre. Summa
o
Summa auene XII tre.
Curia Bletze
3
). I. mans. et di
VI mod.
ordei XVIII a
Wokrente
V mans. qui
tre. ord. II
tre. auene.
Parrochia Indaginis
sancti Spiritus.
Parrochia Indaginis sancti
S.
gestes hagen
4
)
Ipsa
indag
(hilgenghesteshaghen.sec.15.)
I quartale
mansus dat VIII m
mod. ord. II
 tre. auene.
tre. auene.
Summa silig.
V
 tre. Summa
tre. Summa
Summa auene XX
tremod. et VI
Parrochia Johannes-
hag . .
Parrochia
Johanneshag . .
5
)
Villa
Ghorowe
V
mans.
mod. silig. IX mod. ord.
Summa
silig. III tre IIII
Summa ord. III
 tre. III.
tre. III.
Summe auene X tremod.
Hartwighesdorp
6
) IX mans. (Hastorp sec.
16.)
mod. silig. IX mod. ordei
Summa
silig. VI
 tre. m
tre. m
Summa ordei VI
 tre.
tre.
Summa auene XIX tre. et
V
Item ibidem IIII jugera da
I mod.
ordei. IIII m
Konowe
 mans. quilibet d
mans. quilibet d


|
Seite 402 |




|
X mod. ordei XXVI mod.
Summa silig. III
 tre. m
tre. m
Summe ord. III
 tre. m
tre. m
Summa auene
 tre. IIII m
tre. IIII m
Bliscowe I
mansus qui
. . . . . mod. ord. X m.
S. . . . . g. VIII mod. . . ord.
Die Rückseite ist auch beschrieben; da diese aber die rechte Seite des Registers enthält und mit der linken Seite die Namen abgeschnitten sind, so ist hier aus den wenigen Fragmenten nichts zusammenzustellen. Nur in der vierten Zeile von oben steht
unter einer neuen Pfarre
n (rothgeschrieben)
ipsum opidum XVIII mans. quilibet
g. cum pouizen.
In der Mitte steht:
and III tremod. auene
kotland XV mod. auene.
land et kotland IIII tre. et III mod.
Und am Ende
varbrade XVIII mans.
Dies ist das einzige Bemerkenswerthe aus fol. vers.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 403 |




|



|


|
|
:
|
III. Zur Baukunde.
1. Der vorchristlichen Zeit.
Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe.
Die Burg Bützow oder Butissow war eine alte wendische Fürstenburg. Bei der Dotirung des Bisthums Schwerin am 9. September 1171 schenkte der Fürst Pribislav demselben das Land Bützow oder die Burg Bützow mit dem dazu gehörenden Lande (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 25, 35 flgd.). Das Land Bützow ward bischöfliches Tafelgut und der Bischof hatte seine eigentliche Residenz zu Bützow. Schon in den ersten Jahrzehenden ward die deutsche Stadt Bützow gegründet; der Bischof aber wohnte im Anfange auf der alten fürstlichen Burg, bis diese im J. 1263 in einer Fehde gegen den übermüthigen Bischof Hermann I. Grafen von Schladen von den meklenburgischen Landesherren erobert ward (vgl. Lisch Maltzan. Urk. I, Nr. IX.). Zu derselben Zeit ward die neue Bischofs=Residenz neben der Sadt, das jetzige Criminal=Collegium, gegründet.
Die alte Burg Bützow ist nun ohne Zweifel der jetzt sogenannte Hopfenwall. Außerhalb der Umwallung der Stadt, nordwärts, nicht sehr weit von dem Criminal=Collegium oder der mittelalterlichen Bischofs=Residenz, ragt in den Burgsee ein viereckiges Plateau hinein , von der Stadt durch tiefe Moorwiesen getrennt, an der entgegengesetzten Seite vom See bespült; der Wall liegt in der Richtung des Warnowthales, der Burg Werle bei Wiek gegenüber, da man von dem Burgwall Werle die Stadt Bützow sehen kann. Der Wall hat also ganz die Lage und Befestigungsweise der wendischen Festen und gleicht am meisten den Burgwällen von Rostock, Werle und Rahden (bei Sternberg), welche auch von einer Seite von Wasser bespült werden. Der regelmäßige Wall ist ohne Zweifel in dem tiefen Moor durch Kunst aufgetragen. Er ist viereckig, ungefähr 400 Schritt im Umfange und ungefähr 16 Fuß hoch. Vor ungefähr 30 Jahren war er noch nicht beackert, sondern theilweise mit Dornen bewachsen. Ungefähr 1 bis 2 Fuß tief unter der Ackerfläche liegt eine große Brandschicht, bestehend aus Ziegelschutt, Kalk, roth gebranntem Lehm und Kohlen; in dieser Brandschicht, welche oft noch tiefer reicht, finden sich häufig große, mittelalterliche Ziegelsteine


|
Seite 404 |




|
und sehr viele Scherben von blaugrauen, thönernen Gefäßen des Mittelalters, auch allerlei eiserne Geräthe. Der achtbare Schuhmacher Herr F. Seidel, welcher mit Eifer und sehr richtiger Einsicht die Alterthümer Bützow's verfolgt, hat seit vielen Jahren ein wachsames Auge auf alle bemerkenswerthen Stellen der Stadt und der Umgegend gehabt und ununterbrochen geforscht und gesammelt; die vieljährigen Sammlungen und Beobachtungen dieses anspruchslosen Geschichts= und Alterthumsfreundes sind für die gegenwärtigen Forschungen von großem Werthe gewesen. Der Herr Seidel besitzt aus dem Hopfenwalle einen wohlerhaltenen mittelalterlichen Henkeltopf mit einem Reliefkreuze unter dem Boden (vgl. S. 396). Nach dem Berichte desselben sind auf dem Walle öfter große Massen großer Ziegel ausgebrochen. Diese Reste einer zerstörten mittelalterlichen Burg stammen also ohne Zweifel aus der Belagerung der Bischofsresidenz im J. 1263, nach welcher die Residenz vom Walle verlegt ward.
Außer diesen mittelalterlichen Trümmern finden sich auf dem Hopfenwalle aber auch sehr viele Scherben aus der wendischen Zeit, mit zerstampftem Granit und Glimmer durchknetet und mit denselben Verzierungen geschmückt, welche die Scherben auf dem heidnischen Burgwalle von Werle bezeichnen, ferner Lehmklumpen mit Stroheindrücken, glasige Schlaken, eiserne Geräthe aus der Wendenzeit.
Es ist also keinem Zweifel unterworfen, daß der Hopfenwall die ehemalige wendische Fürstenburg sei, welche im 13. Jahrh. auf einige Zeit den Bischöfen zur Residenz diente.
Der Burg gegenüber reicht in den Burgsee eine Halbinsel hinein, welche der Nonnenkamp heißt, auf welcher das vom Bischofe Berno gestiftete, von den Wenden wieder zerstörte Nonnenkloster (vgl. Jahrb. VIII, S. 2 flgd.) gestanden haben soll.
Der Burg nördlich gegenüber auf dem festen Lande, jenseits des Sees, an diesem, zwischen der Stadt Bützow und dem Dorfe Parkow, neben der Feldmark des schon im 14. Jahrh. gelegten Stadtdorfes Zarnin, liegt ein großes Stadtfeld, noch heute der Freiensteinsberg (vgl. Jahrb. VIII, S. 4) genannt. Im vorigen Jahrhundert lagen hier noch auf Pfeilern große Steine (vielleicht ein altes Hünengrab? oder wirklich ein Opferaltar?) (vgl. Mantzels Bützowsche Ruhestunden III, S. 13), von denen einige Höhlungen hatten (vgl. Mantzel Bütz. Ruhest. XI, S. 67. und XIII, S. 22). Schon vor 1761 wurden aber die Steinanhäufungen auseinander gebracht und mehrere große Steine versenkt (vgl. Mantzel a. a. O. III, S. 13); nach dem Berichte des Herrn


|
Seite 405 |




|
Seidel sind nach der Ueberlieferung die letzten Steine zu den Fundamenten der viergängigen Mühle vor dem Wolker Thore verwandt worden.
Westlich von dem Freiensteinsberge, neben der Strafanstalt Dreibergen, liegt der Mahnkenberg, ein beackerter Sandberg, dessen eine Hälfte zum bützowschen Stadtfelde, die andere zum fürstlichen Bauhofe, jetzt zum Dorfe Pustohl gehört. Seit dem J. 1838 ward der Pustohlsche Theil zum Bau der Strafanstalt Dreibergen abgefahren, wobei sich ergab, daß der Berg ein Wendenkirchhof gewesen sei. Es fanden sich sehr viele Urnen, welche aber alle zertrümmert sind, und viele Urnenscherben. Die schüsselförmigen Urnen sind zum größten Theile mit eingedrückten Puncten von einem laufenden gezahnten Rade verziert, mit durchbohrten Knöpfen oder Henkelchen versehen und häufig mit einem schwarzen Ueberzuge bedeckt, haben also alle Merkmale der Wendenkirchhöfe. In den Urnen fanden sich Knochen und Asche, die bekannten Hefteln (broches) der Wendenkirchhöfe, aus Bronze viel und auch aus Eisen, eisern Messer, eine Schnalle aus Bronze etc., welches Alles in der Sammlung des Herrn Seidel aufbewahrt wird (vgl. S. 393).
Westlich von diesem Berge, vor dem rühner Thore, nahe bei Bützow, durch einen Landweg von dem neuen Friedhofe getrennt, liegt ein anderer Berg, Klüschenberg (Klause, Klüschen?) genannt, von welchem seit undenklichen Zeiten Sand nach Bützow gefahren wird. Der Berg ist sehr reich an Versteinerungen, aber auch an Alterthümern. Es finden sich hier sehr viele Scherben von wendischen Urnen mit wendischen Alterthümern, z. B. Hefteln von Bronze, Spindelsteine, Bernsteinperlen, aber auch viele Scherben von mittelalterlichen Gefäßen aus blaugrauem Thon aus der ersten Zeit des Christenthums. Dieser Berg scheint daher ein wendischer Wohnplatz gewesen zu sein, der noch bis in die christlichen Zeiten bewohnt ward.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 406 |




|



|


|
|
:
|
2. Des Mittelalters.
a. Weltliche Bauwerke.
Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf.
Im Jahresber. III, S. 123 hatte der Herr Hülfsprediger Günther einen "Wendenkirchhof" zu Neuenkirchen angezeigt und im Jahresber. VII, S. 32 über denselben berichtet. Im Jahresber. VII, S. 32 war schon die Vermuthung ausgesprochen, daß dieser für einen "Wendenkirchhof" ausgegebene Platz eine mittelalterliche "Burgstätte" sei. Diese Vermuthung ist jetzt durch genauere Nachforschungen bestätigt.
Der Herr Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan hatte im April d. J. durch den Schullehrer Schultz zu Neuenkirchen und durch den Organisten Schultz zu Schwaan Scherben sammeln lassen, und hatte sich am 1. Nov. d. J. selbst nach Neuenkirchen begeben. Der Herr Gerichtsrath Ahrens ließ in Neuenkirchen an der Landstraße 2 bis 3 Fuß tief und tiefer graben und fand überall viel Scherben, Schutt, behauene Steine, Knochen u. s. w.; Scherben wurden auch überall auf dem Felde in Menge gefunden. Alle diese Scherben sind ohne Ausnahme von mittelalterlichen Gefäßen aus fein geschlemmtem, blaugrauen Thon, von kugeliger Gestalt, mit großen und starken Henkeln, mitunter mit drei kurzen Beinen. Es ist unter den Scherben keine einzige heidnischen Ursprunges. Die Stelle ist also ohne Zweifel ein mittelalterlicher Burgplatz.
Der Herr Gerichtsrath Ahrens bemerkt dazu: "Neuenkirchen ist mit Wiesen und Niederungen umgeben, liegt aber etwas erhaben, wie auf einem alten Burgplatze. Nach der Reinstorfer Scheide hin, dem Bache nahe, scheint ein Wall gewesen zu sein. Dort ist eine Salzquelle; das Wasser im Graben hatte einen Niederschlag von Ocker. Auf dem benachbarten Felde von Boldenstorf findet sich auch ein alter, mit Eichen und Gestrüpp besetzter Burgplatz an dem Mühlenbache, nicht weit von dem Hofe Boldenstorf, genannt der Wall".
Unter den Scherben zu Neuenkirchen fand sich auch eine, freilich zerschlagene durchbohrte Scheibe von blaugrauem Thon, gegen 6'' im Durchmesser, der zu Düsterbeck (vgl. Jahresber. VI, S. 44) gefundenen Scheibe ähnlich.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 407 |




|



|


|
|
:
|
b. Kirchliche Bauwerke.
Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg.
Die im Jahresber. VII, S. 66 flgd. beschriebene Kirche zu Lübow ist im höchsten Grade merkwürdig und wichtig, theils weil sie noch in reinem Rundbogenstyl erbauet, theils ganz in der Nähe des alten, in einem großem Sumpfe gelegenen Burgwalles Meklenburg (vgl. Jahresber. VI, S. 79 flgd.) gelegen ist. Das Dorf Lübow scheint daher in näherer Beziehung zu der Burg Meklenburg gestanden zu haben, als das bei der Burg liegende Dorf Meklenburg, welches jüngern Ursprunges zu sein scheint, als das Dorf Lübow.
Diese Ansicht wird durch die polnische Chronik des Bischofs Boguphal II. von Posen (in Sommersberg Script. rer. Siles. II, p. 19, vgl. v. Ledebur in Märk. Forschungen II, 1, S. 120,) in das glänzendste Licht gestellt; trotz der vielen Mährchen über die ältere Geschichte der Slaven, beurkundet dieser Chronist († 1253) doch eine so gründliche Kenntniß von der Lage der Ortschaften in Meklenburg, daß seine Erzählung im höchsten Grade der Beachtung würdig ist, in dem seine Chronik oft mehr sagt, als irgend eine andere Quelle, und das, was sie sagt, durchaus den Stempel der innern Glaubwürdigkeit trägt.
Von Lübow erzählt er:
Der Wendenkönig Mikkol oder Mykel, d. i. Niclot (Dänisch: Mjuklat), habe in dem Sumpfe bei dem Dorfe Lübow in der Nähe von Wismar eine Burg erbauet, welche früher die Wenden, nach dem Dorfe, Lübow, die Deutschen aber, nach dem Könige Miklo, Mykelborg nennten;
mit den Worten der Chronik:
Iste enim Mykel castrum quoddam in palude circa villam, que Lubow nominatur, prope Wissimiram edificavit, quod castrum Slaui olim Lubow nomine ville, Theutunici vero ab ipso Miklone Mykelborg nominabant. Unde usque ad presens princeps illius loci Mykelborg appellatur, latine vero a camporum magnitudine magnus plan (Magnopolis!) nuncupatur, quasi ex Latino et Slawonico compositum, quia in Slawonico Pole campus dicitur.
Diese Etymologie des Namens Meklenburg ist freilich nicht besser, als die Etymologien Nic. Marschalks; aber das Verhältniß der Lage der Ortschaften hat seit - ihrer Gründung niemand so richtig und scharf aufgefaßt, als Boguphal.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 408 |




|



|


|
|
|
Blätter
zur
Geschichte der Kirche zu Doberan,
niedergeschrieben
in Doberan im August 1843
und revidirt
in Doberan im September 1843.
Die Kirche zu Doberan steht durch die Vollendung ihres Baues und den Reichthum ihrer Ausstattung so hoch, daß es eine große Kühnheit sein würde, das Kunstwerk im Ganzen und in allen Einzelnheiten ohne voraufgegangene Untersuchung einzelner Gegenstände darstellen und beschreiben zu wollen. Es ist noch eine wiederholte und gründliche Betrachtung und Untersuchung des Einzelnen nöthig, ehe man das Ganze dem gebildeten Geiste näher bringen kann. Je öfter man die Kirche betrachtet, desto mehr Schönheiten offenbaren sich dem staunenden Auge, welches nimmer satt wird.
Zwar ist in Röper's Geschichte von Doberan, in Schröder's Wismarschen Erstlingen S. 307-344, 365-374 und 393-407 (nach Eddelins Aufzeichnungen), in Klüver's Mecklenburg II und sonst zerstreut an vielen Orten mancherlei über die Alterthümer mitgetheilt, jedoch so sehr ohne Kritik und die nöthige Gelehrsamkeit, daß sich schwerlich darauf fortbauen läßt. Was im Folgenden gegeben ist, soll jedoch ebenfalls nur als Andeutung, als Grundlage weiterer, gründlicherer Untersuchungen gelten.
Der Bau.
Die gewöhnliche Annahme ist, die Kirche sei im J. 1232 vollendet und geweihet worden. Es existirt allerdings eine bischöfliche Bestätigungs=Urkunde vom J. 1232, deren Originale das Datum der Einweihung (3. Oct. 1232) am Ende hinzugefügt ist: 1 )
Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie, V to nonas Oct., incarnacionis dominice anno M°CC°XXX°II°.


|
Seite 409 |




|
Aber die Kirche, welche am 3. Oct. 1232 geweihet ward, kann nicht die noch stehende Kirche sein. Die Kirche zu Doberan ist ein vollendeter Bau im reinsten und schönsten Spitzbogenstyl, der nur seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ausgeführt sein kann. Die Kirche aber, welche im J. 1232 geweihet werden konnte, mußte viele Jahre vorher gegründet worden sein. In jener Zeit herrschte in Meklenburg jedoch noch der Uebergangsstyl mit starken Anklängen an den Rundbogenstyl; ja einzelne Theile von Gebäuden aus der Zeit von ungefähr 1218 sind noch ganz im Rundbogenstyl ausgeführt. Den besten und sichersten Beweis geben die Kirchen des Klosters Neukloster, gestiftet 1219, und des Dom=Collegiat=Stifts Güstrow, gestiftet 1226, deren älteste Theile noch mit einzelnen Rundbogen=Pforten und mit Rundbogen=Friesen und mit Fenstern aus der Uebergangszeit erbauet sind. Die im J. 1232 geweihete Kirche ist also ein ganz anderes Gebäude gewesen, als die noch stehende Kirche.
Man hat überhaupt mehrere Perioden in der Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse Doberans zu beachten.
Die älteste Kirche von Doberan ist die Kapelle zu Alt=Doberan oder Althof, welche im J. 1164 gegründet ward. Bei derselben ward im J. 1170 das Kloster gestiftet, welches im J. 1179 von den Wenden wieder zerstört ward. Im J. 1189 ward die Wiederherstellung des Klosters beschlossen, dasselbe 1192 von Alt=Doberan nach Wendisch=Doberan, dem jetzigen Doberan, verlegt und 1193 vom Bischofe bestätigt. Im J. 1218 ward das Kloster aufs neue bestätigt und im J. 1219 die Leiche Pribislavs von Lüneburg nach Doberan versetzt. Ein regeres Leben beginnt, wie in Meklenburg überhaupt, so auch in Doberan erst mit dem J. 1218. 1 )
Die Rundbogenkirche.
Die älteste steinerne Kirche, ward sie im J. 1192 oder nach einem Interimsbau im J. 1218 gegründet, muß ganz im Rundbogenstyle erbauet gewesen sein, wenn sie 1192, oder im Uebergangsstyle, wenn sie 1218 gegründet ward. Wahrscheinlich ward im J. 1192 eine kleine Kirche gebauet, diese vom J. 1218 an, mit dem Beginnen einer ruhigern Zeit, in größerm Maaßstabe erweitert und am 3. Oct. 1232 geweihet:
Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie, V to nonas Oct., incarnationis dominice anno M°CC°XXX°II°.


|
Seite 410 |




|
Diese alte Rundbogenkirche stand an der Stelle der jetzigen Kirche; denn sie ist zum Theile noch vorhanden. Die Alten liebten es, Theile der ältesten Bauten, wenn sie noch dauerhaft waren, zum Andenken in die Ringmauern der erweiterten Gebäude aufzunehmen. Und so ist die westliche Giebelwand der alten Rundbogenkirche Doberans in die jüngere Spitzbogenkirche aufgenommen. In der westlichen Giebelwand des südlichen Seitenschiffes, nach dem Amte Doberan hin, steht die ganze Giebelwand der alten Rundbogenkirche, aus den alten großen, grau bemoosten Steinen, mit den alten Pfeilern, ja mit bedachtem Giebel. In der Mitte der Wand steht die alte, ganz einfache Rundbogenpforte in einem geringen, viereckigen Mauervorsprunge. Darüber ragen zwei Balkenköpfe aus Granit hervor. In einer angemessenen Höhe steht der Fries von doppelten, sich durchschneidenden Halbkreisbogen aus nicht glasurten Ziegelreliefs. Diese Eigenthümlichkeiten weisen die Wand in das zwölfte Jahrhundert zurück; sie gehört ohne Zweifel zu den ersten Kirchengebäuden von 1192. Um nun die Freude dieser Entdeckung zu vollenden, ist auch noch ein großer Theil des Giebels in die neuere Wand eingemauert; er geht treppenförmig aufwärts und ist mit "Mönchen und Nonnen" gedeckt: selbst die alte Bedachung ist in die jüngere Wand eingemauert. Zu diesem Giebel gehört nun auch noch die daran stoßende südliche Seitenwand des südlichen Seitenschiffes von der Südwestecke bis zum Kreuzschiffe, vier Gewölbe lang, welche von der übrigen Kirche völlig abweicht. Die Fenster reichen lange nicht so weit hinab, als die übrigen Fenster der Kirche, vielmehr reicht die undurchbrochene Mauer so hoch, als die viereckige Wand der Giebelseite; im Innern ist diese Wand in großen Spitzbogenwölbungen von der Breite der Fenster verdickt, um den darauf gesetzten höhern Theil der Wand mit den Fenstern tragen zu können. Dieser Theil der Kirche allein hat keinen behauenen Granitsockel über der Erde. Die Strebepfeiler sind erst in jüngern Zeiten angesetzt. Wir haben also in dieser alten Kirche eine niedrige Rundbogenkirche ohne Strebepfeiler.
Ein eigenthümliches Gefühl überfällt den Beobachter, wenn er diese ganz eigenthümliche, von dem ganzen Bau der neuern Kirche völlig abweichende Reliquie betrachtet, welche von außen eine Kirche in der Kirche bildet. Sonst ist die doberaner Kirche ganz aus Einem Geiste.


|
Seite 411 |




|
Der Kreuzgang.
Das Kloster lehnte sich, zunächst mit dem Kreuzgange, an die Südseite der Kirche und umfaßte einen sehr bedeutenden Raum, welchen noch heute die alten, starken Klostermauern umschließen; am äußersten Ende stehen noch die alten trefflichen Mühlengebäude, welche wohl nicht viel jünger sind, als die Kirche. Von den eigentlichen Klostergebäuden steht nichts weiter mehr, als eine Ruine von dem alten Reventer oder Refectorium. Nahe bei der südlichen Hauptpforte im südlichen Kreuzschiffe lehnt sich an die Kirche eine starke Mauer mit 8 offenen Bogen. Dies ist die mittlere Scheidewand der innern Räume des alten Reventers, des Versammlungs= und Speisesaales der Mönche; man erkennt noch deutlich, wie an beiden Seiten die Gewölbe angesetzt gewesen sind.
Diese Ruine aus uralten, mächtigen Ziegeln gehört zu den ehrwürdigsten Denkmälern Doberans. Sie stammt zweifellos aus der ältesten Zeit des Klosters, aus der Zeit des Rundbogenstyls. Die 8 Oeffnungen sind nämlich im reinen Rundbogen gewölbt; die Gewölbe sind mit zwei runden Wulsten und den dazu passenden Gliedern verziert und verrathen einen durchaus gediegenen Ursprung.
In jüngern Zeiten sind diese Rundbogen mit Spitzbogen ausgemauert und endlich wieder durch den Rundbogen des 16. Jahrhunderts gestützt.
Die Heilige Bluts=Kapelle.
Das Heil. Blut von Doberan ist das älteste im Lande. Die Sage spielt eine Hauptrolle in der Geschichte Doberans und ist bekannt: wie ein Hirte aus Steffenshagen eine Hostie vom Abendmahle im Munde mit nach Hause genommen, in seinem Hirtenstabe verwahrt und seine Heerde fortan damit geschützt habe, bis das Geheimniß entdeckt und die blutende Hostie als wunderthätig ins Kloster zurück gebracht worden sei. Die Geschichte soll sich nach Kirchberg im J. 1201 zugetragen haben. Doberan ward bald ein berühmter Wallfahrtsort und es strömten Pilger in großer Anzahl, selbst aus fernen Gegenden, herbei. Das Heiligthum konnte nicht gut den Weibern verschlossen werden, und doch ward es erst im J. 1385 edlen und ehrbaren Frauen gestattet, bei feierlichen Gelegenheiten Kirche und Kloster zu betreten 1 ); es mußte daher


|
Seite 412 |




|
wohl ein eigenes Gebäude für das Heil. Blut errichtet werden.
Die Hauptpforte der Kirche für die Personen, welche nicht dem Kloster angehörten, war die Pforte im nördlichen Kreuzschiffe. Die Pforte im südlichen Kreuzschiffe, welche jetzt zum gewöhnlichen Eingange dient, führte ins Kloster. Daher ward die Heil. Bluts=Kapelle an der nördlichen Hauptpforte, dem Wirthschaftshofe des Klosters oder dem "Kammerhofe" gegenüber, aufgeführt. Hier steht nämlich ein kleines, sauberes achteckiges Gebäude, wie eine Taufkapelle, in sehr schönem Styl, aber offenbar noch in dem Uebergangsstyle. Die Fenster sind noch schmal, leise gespitzt, schräge eingehend, mit einem runden Wulst eingefaßt. Der Fries besteht aus Relief=Verzierungen, welche aus 3 Halbkreisen oder Kreissegmenten zusammengesetzt sind; der Fries der Kirche besteht schon aus spitzbogigen Verzierungen. Das Gebäude ist ganz aus abwechselnd glasurten und nicht glasurten, sehr großen und kräftigen Ziegeln und überhaupt im Einzelnen äußerst tüchtig aufgemauert; die glasurten Ziegel sind bis zur Augenhöhe grün und werden immer dunkler, je höher die Schichten liegen; über der Augenhöhe sind hin und wieder schwarze Ziegel eingesetzt, welche immer häufiger werden, bis von der Hälfte der Höhe des Gebäudes an regelmäßig eine Schicht um die andere die Ziegel schwarz glasurt sind 1 ). Die Gewölberippen lehnen sich im Schlusse an einen kreisrunden, nicht bedeckten Wulst, wie in andern Kirchen aus der Uebergangsperiode, z. B. der Kirche zu Gägelow. Die Gewölberippen stehen auf Tragesteinen, welche alle verschieden verziert sind. Das Gewölbe hat übrigens noch leichte Deckenmalerei von Heiligenbildern.
Uebrigens ist dieses äußerst zierliche Gebäude wohl das einzige seiner Art in Meklenburg und vielleicht in Norddeutschland.
Diese Kapelle fällt also nach dem Baustyl wohl ohne Zweifel in die erste Hälfte, vielleicht noch in das erste Viertheil, des 13. Jahrhunderts. Und hiemit stimmt auch eine Urkunde vom J. 1248 (in Westph. Mon. III, p. 1491) überein, nach welcher der Fürst Borwin von Rostock den Mönchen eine jährliche Ergötzung an Weißbrot, Wein und Fischen am Tage


|
Seite 413 |




|
der Weihung der an der Pforte gegründeten Kapelle aussetzte:
in festo dedicationis capellulae, quae ad portam est fundata.
Damals muß also schon die Kapelle gestanden haben. Daß sie ein eigenes Gebäude war, geht daraus hervor, daß sie immer capella oder capellulla genannt wird. Die Kapellen in der Kirche werden gewöhnlich nur Altäre genannt.
Die Kapelle erfreute sich fortan auch, neben der Kapelle zu Althof, einer besondern Berücksichtigung der geistlichen Oberhirten; aus den verschiedenen Urkunden über manche Begünstigung geht zugleich hervor, daß diese Kapelle ohne Zweifel die Heil. Bluts=Kapelle ist. Als der Bischof Friederich am Trinitatis=Feste, den 4. Junii 1368, die Kirche zu Doberan weihete 1 ), bestimmte er auch zugleich, daß der jährliche Weihtag der doberaner Kirche und die Verehrung des Heil.=Blutes, welche in der Kapelle an der Pforte des Klosters,
visitacio sacramenti in capella porte monasterii Doberanensis,
am Montage nach Pfingsten geschehen sei, fortan am Sonntage nach der Octave des Frohnleichnamsfestes gefeiert werden sollen und verheißt allen Besuchenden Ablaß. Dieser Ablaß ward in den folgenden Zeiten öfter wiederholt, z. B. 1450 von dem Bischofe Nicolaus und 1461 von dem Bischofe Werner, für alle, welche nicht allein die doberaner Kirche, sondern auch die Kapelle an der Pforte und die Kapelle zu Althof besuchen und deren Bau fördern würden, immer mit denselben Worten:
capellam in porticu ipsius monasterii necnon eciam capellam in antiqua curia, Antiquum Dobberan nominatam.
Die Kirche.
Nach dem Vorgetragenen kann die jetzt stehende Kirche nicht diejenige sein, welche im Jahre 1232 geweihet ward. Die Kirche ist ein überaus schlanker, gleichförmiger, reizender Bau, welcher nur seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. aufgeführt sein kann. Da nun Theile der alten Kirche mit in die Ringmauern der neuern aufgenommen sind, so wird der Ausbau und Fortbau der neuern Kirche allmählig und mit


|
Seite 414 |




|
Rücksicht auf die alte Kirche und die Klostergebäude vorgenommen sein.
Ganz vollendet war die Kirche erst im J. 1368, als der Bischof Friederich von Schwerin am Trinitatis=Feste, den 4. Junii d. J., in Gegenwart vieler hochgestellter Personen und einer großen Menge Volkes "der gut gegründeten und im Bau vollendete doberaner Kirche"
"ecclesie Doberanensi bene fundate et edificiis perfecte"
die Weihe 1 ) ertheilte und den Kirchweihtag fortan auf den Sonntag nach der Octave des Frohnleichnamsfestes verlegte.
Der Brand, welcher im J. 1291 das Kloster verzehrte (vgl. Jahrb. II, S. 28), ergriff die Kirche wohl nicht bedeutend.
Der Grundplan der Kirche muß schon früh festgestellt und einzelne Theile müssen schon früh ausgeführt gewesen sein. Es giebt mehrere Anknüpfungspuncte in der Zeit von 1232-1368, welche dafür reden, daß das Mauerwerk schon im 13. Jahrh. vollendet gewesen sein wird.
Die Leiche Pribislav's ward im J. 1219 von dem lüneburger Michaeliskloster nach Doberan versetzt. Sie kann aber nur in der alten Kirche beigesetzt und später vielleicht wieder versetzt worden sein.
Zuerst ward wohl das Schiff fertig, indem in dieses die Mauern der alten Kirche aufgenommen wurden; man konnte die alte Kirche so lange ganz stehen lassen, bis der neue, höhere Bau über dem alten vollendet war, wie in der Kirche zu Dobbertin noch das Gewölbe des alten Baues als Träger des oberen Nonnenchores ganz in der viel jüngern Kirche steht.
Als die Heil. Bluts=Kapelle gebauet ward, war wahrscheinlich der Plan zu der neuen Kirche schon gemacht, also schon vor dem J. 1248.
Die sichersten Fingerzeige geben die Gräber.
Schon im J. 1276 stiftete Heinrich der Pilger eine ewige Wachskerze an den Gräbern seiner Aeltern und seines Bruders 2 ). Der Fürst Heinrich der Löwe stiftete am 18. Jan. 1302, acht Tage nach der Beisetzung seines Vaters, ebenfalls eine ewige Wachskerze an der Stelle seines Begräbnisses und ordnete an, daß der Abt einen Altar und lobenswerthe Fenstern in der Begräbniß=Kapelle seiner Vorfahren (vnum altare et fenestras laudabiles in capella, vbi progenitores nostri requiescunt) von gewissen Ein=


|
Seite 415 |




|
künften erbauen solle 1 ). Im J. 1400 verordnete der meklenburgische Herzog und schwerinsche Bischof Rudolph, daß auch er in der Kirche zu Doberan, in welcher alle seine Vorfahren und die alten Fürsten des Landes ruheten, beigesetzt werde 2 ).
Diese Begräbnißkapelle war in der Kirche links an der Pforte des nördlichen Kreuzschiffes. Ich erinnere mich, in irgend einer alten Handschrift, welche ich jedoch für den Augenblick nicht wieder auffinden kann, gelesen zu haben, daß Pribislav's Begräbniß "im Norden" der Kirche sei. Hier liegen auch noch die Reliefziegel an der Stelle der ehemaligen Gräber der Fürsten von Meklenburg und von Werle (vgl. unten Fürstengräber); viel ist jedoch von diesen Gäbern nicht übrig, da der Herzog und Bischof Magnus († 1550), mit seiner Mutter Ursula von Brandenburg († 1510), in dieser Kapelle zuletzt beigesetzt ist und hier eine große, hohe Begräbnißgruft über der Erde erhalten hat, welche den ganzen Raum der Kapelle füllt: bei Gelegenheit der Erbauung dieses Begräbnisses wird auch der alte Altar, welcher noch vorhanden ist, in die Höhe gebracht sein. Damit ist jedoch, bis auf die Reliefziegel aus dem 14. und 15. Jahrh., welche einst in einer gewissen Entfernung vor dem Altare lagen, die alte fürstliche Begräbnißkapelle vernichtet.
Vom J. 1267 bis 1302 war also im nördlichen Kreuzschiffe schon die fürstliche Begräbnißkapelle.
Im J. 1301 ward die Glocke gegossen, nach der Inschrift bei Schröder S. 402:
Anno domini MCCCI fusa est hec campana cal. Febr. sub domino Johanne abbate Melonigio (muß de Elbingo heißen).
In dem nördlichen Umgange hinter dem Altare liegen Heinrich von Weser und seine Frau Ida begraben, (vgl. unten Leichensteine), welche einige Zeit nach 1304 gestorben sein müssen.
Der Fürst Heinrich der Löwe liegt schon im hohen Chor begraben; der hohe Chor war also im J. 1329 schon fertig. Neben ihm liegt die Gemahlin des Fürsten Nicolaus I. von Werle, welche am Ende des 13. oder im Anfange des 14. Jahrh. gestorben sein wird. (Vgl. unten Fürstengräber).
Der Steinbau der Kirche muß also in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vollendet worden sein.


|
Seite 416 |




|
Man gebrauchte also zu dem Ausbau, den Wölbungen, den Fenstern, dem Schnitzwerk, u. s. w. an 70 Jahre, bis die Kirche im J. 1368 als ganz vollendet eingeweihet werden konnte.
Das Schnitzwerk.
Wohl selten ist eine Kirche so reich an schönem Schnitzwerk, als die doberaner Kirche. Ist auch manches durch ungestaltete Stuhl= und Chorbauten des vorigen Jahrhunderts entstellt, so ist doch noch fast Alles vorhanden, was zur vollständigen Einrichtung einer alten Kirche gehört: Altäre, Beichtstühle, Tabernakel, Kelchschrein, Crucifix, Reliquienschrein, Chorstühle, u. s. w. und zwar in einer Vollendung, welche eben so selten ist, als der Reichthum. Dieser Reichthum ist natürlich nach und nach entstanden; so stammen z. B. die Schnitzwerke hinter dem Hochaltare aus dem 15. Jahrhundert. Bei weitem der größere Theil des Schnitzwerkes stammt jedoch aus dem 14. Jahrhundert und ist noch das erste Schnitzwerk der Kirche.
Am reinsten im Styl, am edelsten und einfachsten sind jedoch die aus Eichenholz geschnitzten Mönchsstühle, welche auf beiden Seiten des ganzen Schiffes entlang stehen; sie gehören zu den schönsten Kunstwerken der Holzschnitzerei. Und grade von diesen läßt sich das Alter bestimmen.
Auf der westlichen Seitenwand der südlichen Reihe der Mönchsstühle ist nämlich ein humoristisches Bild eingeschnitzt: wie der Teufel einen Mönch verlocken will. Beide Figuren tragen Spruchbänder: der Teufel sagt:

(Quid facis hic, frater vade mecum).
(Was thust Du hier, Bruder? Komm mit mir).
der Mönch antwortet:

(nil in me reperies mali, cruenta bestia).
(Du sollst an mir nichts Böses finden, Du abscheuliches Vieh).
Diese Schriftzüge fallen nun ohne Zweifel in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Mönchsstühle werden also das älteste Schnitzwerk in der Kirche sein.
Lots Frau, die zur Salzsäule geworden.
Die Kirche zu Doberan besitzt viele Reliquien; ohne untersuchen zu wollen, ob die noch vorhandenen die alten sind, ist es doch nach Urkunden gewiß, daß das Kloster schon im


|
Seite 417 |




|
14. Jahrhundert reich an Reliquien war. Unter den Reliquien wird auch "Lots Frau, die zur Salzsäule geworden", gezeigt, auf den ersten Anblick eine unförmliche große Steinmasse. Bei genauerer Untersuchung stellt sich aber heraus, daß "Lots Frau" allerdings eine - Frau, aber keine semitische, sondern eine sehr schöne, nackte, italiänische Frau ist. "Lots Frau" ist nämlich ein sehr schöner antiker Torso einer Venus, einer Danae oder irgend einer andern antiken Person. Es ist die auf einem Gewande oder Wellen und auf dem rechten Ellenbogen ruhende nackte Gestalt eines jungfräulichen Leibes von großer, absoluter Schönheit und unzweifelhaft eine Antike. Es fehlen ihr Kopf, Arme und die Beine von den Knieen an. Sie hat auf dem Schooße etwas, was jetzt ganz unförmlich ist und den Leib vorne verdeckt. Daher ist man nicht zur wahren Erkenntniß der Bildsäule gekommen. Das Ganze ist aus einem Block von kohlensaurem Kalkstein gehauen.
Es ist möglich, daß diese allein werthvolle Reliquie früher wirklich für eine Reliquie galt und dem Kloster als Reliquie, wirklich als Lots Frau, zugeschickt ward, als man in Italien noch nicht nach Antiken jagte und deren Werth noch nicht kannte. Der Sage nach soll Heinrich der Pilger sie mitgebracht haben.
Die frei stehende Säule.
Im südlichen Kreuzschiffe liegt ein großer Säulenschaft aus Kalkstein, an 25 Fuß lang; einige andere Enden sollen im Orte als Prellsteine an den Ecken stehen. Daneben liegt eine schöne Säulenbasis aus demselben Gestein, in byzantinischem Style, mit schönem verzierten Laubwerk an zwei Ecken; die beiden andern Ecken sind nicht verziert. Diese Säule ist dadurch von Interesse, daß ähnliche einzelne Säulen von ganz gleicher Construction auch an andern Orten gefunden werden. So steht im Pfarrgarten zu Lübow eine gleiche Säule und zwei Kapitäler byzantinischen Styls; in Schwerin ward beim Bau des Collegiengebäudes an der Stelle des Franziskanerklosters ebenfalls eine Basis und ein Kapitäl, und beim Dome wurden 2 Kapitäler gleicher Art gefunden. Gehörten frei stehende Säulen, vielleicht Geißelungssäulen (?), etwa zum Ritus der katholischen Kirche?
Peter Wise.
Peter Wise ist eine der mythologischen Personen des Klosters. Die Sage giebt ihn für den Baumeister des Klosters


|
Seite 418 |




|
aus der die beiden bewundernswerthen, schlanken Pfeiler, welche die Gewölbe der Kreuzschiffe tragen, "ohne Loth und Richtmaaß" aufgeführt haben soll (man vgl. Schröder Wism. Erstl. S. 324 flgd.). Peter Wises Andenken ist allerdings in der Kirche mehrere Male verherrlicht und daher wird der Mann ohne Zweifel einige Bedeutung gehabt haben.
An einem Pfeiler im nördlichen Seitenschiffe hängt sein Bild, in ganzer Figur, mit einer Krönung von mittelalterlichem Schnitzwerk. Er ist in kurzem Wamms dargestellt, mit langen Beinkleidern, von denen das rechte Bein weiß, das linke roth ist. Auf dem Kopfe trägt er eine Schaube oder platte Mütze. Mit der linken Hand faßt er in einen Beutel, welcher an dem Gürtel hängt; die rechte Hand faßt einen Wappenschild, der längs getheilt ist, rechts mit einem halben Adler, links mit einem abgehauenen Eichenzweige. Bei diesem Bilde steht eine Inschrift nach mittelalterlicher Weise, halb deutsch und halb lateinisch. Es giebt zwei Recensionen, von denen hier die in Klüver's Mecklb. aufbewahrte mitgetheilt ist.
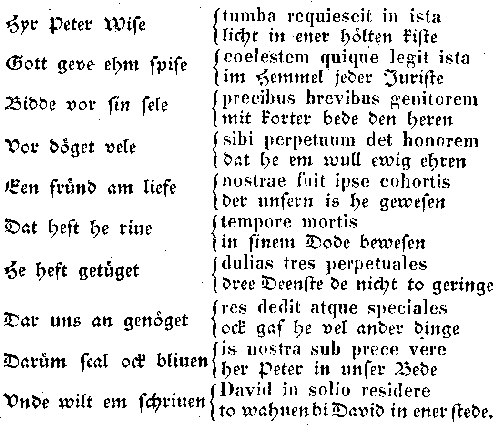
So theilt Klüver die Inschrift mit. Das Original in der Kirche hat nur die deutsche Columne links und die lateinische rechts (vgl. Röper S. 237); eben so lauten ältere Abschriften z. B. bei Schröder S. 324. Die deutsche Uebersetzung des Lateinischen an der rechten Seite steht zwar im Zusammenhange


|
Seite 419 |




|
mit der Columne links, scheint aber doch jünger zu sein, als das ursprüngliche Original, indem der Reimer offenbar den Verfasser und sein Latein nicht verstanden hat. In der zweiten Zeile steht nämlich: leg' ista, d. h. legit ista = wer dieses liest, bitte Gott für seine Seele. Der Reimer hat aber legista gelesen und einen doctor legum: einen "Juristen" daraus gemacht.
Leider sind alle Bilder der Kirche unter dem Herzoge Christian Ludwig II. restaurirt, d. h. ziemlich modern übermalt, so daß sich mit Bestimmtheit nichts über die ursprüngliche Form der Inschrift sagen läßt.
Dem Bilde gegenüber steht an einem Pfeiler ein Altar der "Maria tàr ladinge", deren Dienst erst am Ende des 15. Jahrh. aufkam.
Der Leichenstein von dem Grabe des Peter Wise liegt auf dem Altare mit der Darstellung, wie das "Wort" durch die Mühle geht (vgl. S. 422), an dem Pfeiler rechts von der südlichen Pforte des Kreuzschiffes, rechts vom Eingange zu dem Umgange hinter dem Hochaltare. Die Darstellung auf demselben ist schön gravirt. Unter einer gothischen Nische, deren spitzbogige Wölbung sich in 5 Eichenblätter verliert, steht Peter Wise in langem, einfachen Gewande, mit gescheitelten Haaren, mit gefalteten Händen auf der Brust. Oben steht an jeder Seite sein Wappen auf einem schräge gelehnten Schilde, welcher längs getheilt ist, in einer Hälfte mit einem halben Adler, in der andern Hälfte mit einem geästeten Eichenzweige mit 3 Blättern; die halben Adler stehen beide nach innen, also auf dem einen Schilde links, auf dem andern rechts, die Eichenzweige nach außen. Die Umschrift lautet:
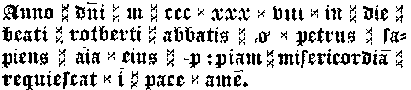
(= Anno domini MCCCXXXVIII in die beati Rotberti abbatis (April 29) obiit Petrus Sapiens. Anima ejus per piam misericordiam requiescat in pace. Amen.)
Dieser Stein lag schon, nach Chemnitz bei Schröder a. a. O. S. 326, im 17. Jahrhundert auf diesem Altare. Daß Leichensteine auf Altären liegen, kommt sonst allerdings vor. So ist in der Kirche zu Rehna der Leichenstein zweier Pröpste des Klosters (Hermann und Heinrich) aus dem Anfange des 14. Jahrh. schon zur katholischen Zeit auf den Altar gelegt,


|
Seite 420 |




|
da in demselben die 5 bischöflichen Weihekreuze eingehauen sind. Chemnitz erzählt, daß außerdem noch ein Leichenstein unter dem Bilde des Peter Wise in der Kirche liege; er erzählt, wie dieser am Rande mit Messing belegt und an den 4 Ecken mit seinem Wappen verziert gewesen sei. Zu Schröder's Zeit fehlte schon das Metall, jetzt fehlt der Stein ganz. Die Inschrift auf beiden Steinen war, nach Chemnitz, gleich.
Die Familie Wise war in alten Zeiten eine angesehene Patricier=Familie, welche in den Hansestädten Rostock, Wismar und Lübeck weit verzweigt war. Wahrscheinlich stammte sie aus Rostock. Heinrich Wise (Henricus Sapiens) war 1266-1278 Bürger und 1276-1286, in der wichtigsten Zeit der Entwickelung der Stadt, Rathsherr zu Rostock. Johann Wise war 1285-1344 Bürger und Rathsherr zu Wismar; es lebten am Ende des 13. Jahrh. zwei Johann Wise (Sapiens) in Wismar; der eine war ein Gerber (cerdo): im Stadtbuche B. fol. XVI b. heißt es? Johannes Sapiens cerdo emit de Johanne Persic V agros in campo Dammenhusen; der andere war ein Schmied (faber): in demselben Stadtbuche fol. VI a. heißt es: Radolfus resignauit domum suam, quam emit erga Johannem Sapientem fabrum uxori sue Margarete et pueris suis. Am Ende des 13. Jahrh. ward Henneke, 1318 Johann, 1327 Henneke, 1339 Hermann Wise zu Wismar als Bürger eingeschrieben. Ein magister Johannes Wise zu Wismar war Rechtsgelehrter und im J. 1344 Procurator (procurator et jurista) des Dom=Capitels zu Ratzeburg. Die Familie scheint sich schon früh dem Kloster Doberan zugewandt zu haben: schon im J. 1244 war ein Hermann Wise Conversbruder in Doberan.
Unser Peter Wise war Bürger in Lübeck und starb nach seinem Leichensteine am 29. April 1338. Er hinterließ zwei Brüder Johann und Heinrich, welche Priester und Mönche zu Doberan waren, und eine Schwester Gertrud: Johann war im J. 1336 Schatzmeister (bursarius) des Klosters Doberan. Peter Wise war während der großen Bewegungen zwischen den sächsischen und "wendischen" Mönchen in der Zeit 1336/7 (vgl. Jahrb. VII, S. 39 flgd.) als ein hülfreicher Retter erschienen. Die Bewegungen zerrütteten das Kloster in den Grundfesten; Peter Wise, von der Partei der wendischen Mönche, d. h. der Mönche aus den wendischen Seestädten, trat dennoch, obgleich die Bewegungen gegen seine Partei gerichtet waren, in der Noth hülfreich ins Mittel, um die ehrwürdige Stiftung nicht sinken zu lassen. Der sächsische Abt Conrad hatte im J. 1336 von dem rostocker


|
Seite 421 |




|
Burgemeister Arnold Kopmann 500 lüb. Mark oder 1000 rostockische Mark aufgeliehen, um mit dem Geschenk derselben den Fürsten Albrecht zu besänftigen; für diese Summe hatte er das Gut Adamshagen an Arnold Kopmann verpfändet (vgl. Jahrb. VII, S. 288, Nr. LVI). Nach einer Urkunde vom 23. Oct. 1341 1 ) hatten die Mönche Johann und Heinrich Wise, aus dem Nachlasse ihres Bruders Peter das Gut Adamshagen für das Kloster wieder eingelöset, jedoch, unter der Bedingung, daß Adamshagen vom Kloster nie verpfändet oder veräußert werden dürfe, drei Dienste 2 ) oder Jahresleistungen (servitia) aus den Aufkünften des Gutes, jede Hebung von wenigstens 10 Mark rostock. Pfen., fundirt, für die Besorgung dreier Altäre: der elftausend Jungfrauen, des Frohnleichnams und des Apostels Andreas, welche sie in der Kirche gestiftet hatten.
Dies sind die Verdienste der Wise um das Kloster, welche während einer bedrängten, unruhigen Zeit, in welcher das Kloster wenig Freunde hatte, bedeutend genug waren.
Der Altar, auf welchem Peter Wise's Grabstein liegt, ist nun keiner von den drei Altären der Familie Wiese. Der Frohnleichnams=Altar steht aber vor dem nächsten Pfeiler hinterwärts links; lag nun der Leichenstein vor diesem , so war er entweder bei der Beschränktheit des Raumes vor dem Frohnleichnamsaltar oder bei der Nähe des Durchganges durch den Umgang hinter dem Hochaltar dem Abtreten sehr ausgesetzt. Daher hob man ihn wohl und legte ihn auf den nächsten Altar, welcher seiner Größe angemessen war.
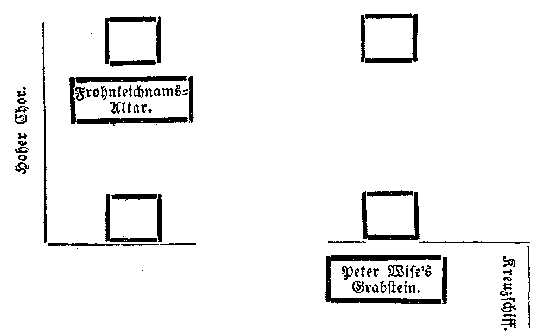


|
Seite 422 |




|
Nebenaltäre.
Der Altar des Heiligen Blutes oder der Offenbarung.
An der östlichen Wand des südlichen Kreuzschiffes, rechts von der Pforte, steht ein Altar, auf welchem Peter Wise's Grabstein liegt, mit einem eigenthümlichen Gemälde: wie das Wort vom Himmel durch eine Mühle in den Kelch geht, weshalb ich ihn einstweilen den Altar der Offenbarung nenne. Die Mitteltafel versinnbildlicht die Lehren: "Im Anfange war das Wort", und: "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns."
Der Altar war schon lange aus Röper, Seite 231, und überhaupt in Meklenburg bekannt. In neuern Zeiten hat Kugler in seiner Pommerschen Kunstgeschichte, Balt. Studien VIII, 1, S. 194 flgd., auf einen ähnlichen Altar in der Kirche zu Tribsees aufmerksam gemacht und denselben a. a. O. einer ausführlichen Betrachtung unterworfen; Kugler hält diesen Altar für eine der Hauptzierden der gesammten deutschen Kunst. Der Altar zu Triebsees ist dem doberaner ziemlich ähnlich, jedoch ist die Anlage des Gemäldes etwas mehr systematisch und berechnet. Der triebseeser Altar fällt ebenfalls, wie der doberaner, in den Anfang des 15. Jahrhunderts. Bekannt ist dieselbe Darstellung in einem Chorfenster des Münsters zu Bern.
Der doberaner Altar ist, wenn auch nicht ausgezeichnet, doch jedenfalls beachtungswerth.
Die mittlere Haupttafel hat folgende Darstellung. In der Mitte schweben oben auf einem Regenbogen auf Goldgrund die vier Genien der Evangelisten, welche aus kugeligen Flaschen mit langem Halse das Wort in einen Mühlentrichter schütten. Das Wort ist dargestellt durch Bänder, welche aus den Flaschen kommen und Inschriften tragen, aus der Flasche
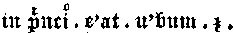
|
|
| des Adlers: | (= In principio erat verbum et: |
| (Johannes): | Im Anfang war das Wort und:) (Joh. I, 1.) |
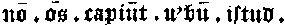
|
|
| des Engels: | (= Non omnes capiunt verbum istud: |
| (Matthäus): | Das Wort fasset nicht Jedermann.) (Matth XIX, 11.). |

|
|
| des Stieres: | (= Videramus hoc verbum quod factum est: |
| (Lucas): | Wir hatten dieses Wort gesehen, welches geworden ist.) |


|
Seite 423 |




|

|
|
| des Löwen: | (= Qui seminat verbum seminat. |
| (Marcus): | Der Säemann säet das Wort ( Marcus IV, 14.). |
Aus dem Trichter kommt ein Band mit dem Worte
(= verbum: Wort),
vielleicht als Fortsetzung von dem Schlusse: et, auf dem Bande des Adlers, und geht auf die Mühlsteine.
Die 12 Apostel, an jeder Seite 6, stehen in einer Reihe neben dem Rumpfe und drehen an einer Stange die Mühlenwelle.
Aus dem Rumpfe kommt ein Band mit der Inschrift:
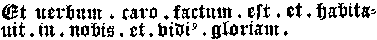
(= Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.) Joh. I, 14.)
Das Band geht mit dem Worte gloriam in einen Kelch, welchen 4 knieende Personen halten: ein Papst, ein Cardinal und zwei Bischöfe, oder ein Erzbischof und ein Bischof, von denen der bei dem Papste knieende alt, der bei dem Cardinal knieende sehr jung ist; beide tragen denselben Ornat.
An jeder Seite von diesen Kirchenfürsten knieet ein Mönch, mit einem Bande:
| links: |
|
| (= Das Werk unserer Wiedergeburt ist die Mensch werdung des Wortes Gottes.) | |
| rechts: |
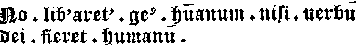
|
| (= Die Menschheit würde nicht erlöset werden, wenn das Wort Gottes nicht Mensch würde.) |
Hinter dem Mönche links knieen zwei weltliche Personen: eine Frau mit rothem Mantel und weißer Schleierkappe und ein Mann in grüner Tracht. Hinter dem Mönche rechts knieen zwei Männer in grünen Gewändern. Neben dem Gesichte des Mönches links ist ein sarkastisches scharfes Gesicht mit einem Schurrbarte.
In der obern Ecke rechts (von dem Beschauer) auf dem Goldgrunde neben den Genien der Evangelisten steht in ganz kleiner Darstellung Maria, mit den Füßen auf dem Halbmonde, mit der Sonne vor dem Schooße und den Sternen auf der Krone, mit dem Christkinde auf den Armen.


|
Seite 424 |




|
In der obern Ecke links in ganz kleiner Darstellung: ein betender, knieender König, in rothem Mantel, mit der Krone auf dem Haupte; neben ihm knieet eine weibliche Figur in einem Gewande von roth und gold, mit langem Haar und Schleier; sie legt die linke Hand auf des Königs Schulter und zeigt mit der ausgestreckten Rechten und mit jubelvollem Antlitz auf die Genien der Evangelisten.
Diese kleine Darstellung ist, trotz ihrer Kleinheit und vieler Fehler, sehr geistreich, und außerdem von historischem Interesse. Der König ist nämlich an Mienen und Tracht ganz dem meklenburgischen Herzoge Albrecht, Könige von Schweden, und dessen Originalbildern in der Heil. Bluts=Kapelle im Dome zu Schwerin und in der Königskapelle zu Gadebusch ähnlich (vgl. Jahresbericht III, S. 133 flgd). Nach dem Geiste dieser Darstellung scheint der König schon gestorben gewesen zu sein und seine Wittwe Agnes zu seinem Gedächtnisse diesen Altar geschenkt zu haben; der König † 1412, seine Gemahlin † 1434. Es würde der Altar also in das erste Viertheil des 15. Jahrhunderts fallen; in diese Zeit müßte man auch nach dem Styl und der ganzen Arbeit den Altar setzen, wenn auch keine historischen Fingerzeige vorhanden wären.
Die Gemälde auf den Seitenflügeln sind sehr schadhaft; auf den Rückwänden ist nichts mehr zu erkennen. Auf den Vorderseiten stehen auf jedem Flügel zwei Bilder unter einander:
| rechts: | oben: ein segnender Bischof vor einem Könige, neben welchem aus einem Viereck Flammen schlagen; |
| rechts: | unten: ein Bischof und vor ihm ein König mit Krone, Scepter und Reichsapfel; vom Bischofe geht ein Spuchband aus: |
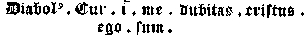
|
|
| links: | oben: ist noch ein segnender Bischof zu erkennen; |
| links: | unten: fehlt die Darstellung schon ganz. |
Der Fronleichnams=Altar
ist einer der drei Altäre, welche aus dem Nachlasse des Peter Wise gestiftet sind. Der Altar steht noch im südlichen Umgange hinter dem Hochaltare an dem zweitern innern Pfeiler am hohen Chor; links lehnt sich der Altar an die Bretterwand der Chorschranken. Ueber dem Altare steht eine Tafel mit der Inschrift:


|
Seite 425 |




|
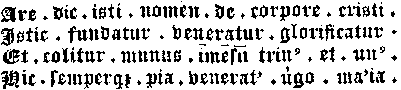
(= Arae dic isti nomen de corpore Cristi.
Istic fundatur, veneratur, glorificatur,
Et colitur munus immensum, trinus et unus, Hicsemperque pia veneratur virgo Maria. (Ein Kelch.)
An der verziert gewesenen Bretterwand links neben dem Altare, der Rückwand der Chorschranken oder vielmehr des Beichtstuhls, steht auf einer Leiste mit Unzialen des 14. Jahrhunderts schwarz auf Kalkgrund in 2 Zeilen übereinander dieselbe Inschrift gemalt:
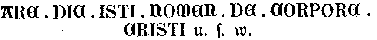
und auf derselben Leiste dieselbe Inschrift noch einmal mit größern Buchstaben aus derselben Zeit.
Das Altarblatt ist klein. Die Haupttafel stellt die Kreuzigung Christi durch gekrönte Tugenden mit Spruchbändern dar. Die Obedientia (Demuth) drückt ihm die Dornenkrone auf, Charitas (Liebe) öffnet ihm die Seite u. s. w. (vgl. Schröder S. 342). In den Seitenflügeln stehen links Isaac und Ezechiel, rechts Jeremias und Daniel; auf den Rückwänden der Seitenflügel sind dargestellt: die Verkündigung Mariä, die Geburt Christi, die Heil. Drei Könige und die Darstellung Christi.
Der Altar der Heil. Dreieinigkeit.
Im nördlichen Theile des Umganges um den hohen Chor steht ein kleiner Altar mit zwei Flügeln. Von den Gemälden ist nur etwas auf der mittlern Haupttafel zu erkennen. Gott der Vater in hochrothem, grün gefutterten Gewande sitzt auf einem Throne mit 4 mit Löwen gekrönten Pfeilern, Christus am Kreuze auf dem Schooße haltend, darüber die Taube; links knieet ein betender Mönch.
Hierunter stehen auf einer Leiste 7 geschnitzte Brustbilder: in der Mitte Christus, das Kreuz im Arme haltend, mit Nägeln und Rohr in den Händen, zu beiden Seiten Maria und Johannes betend, rechts davon Petrus mit Schlüssel und Buch, dann Catharine mit Schwert und Rad, links der Apostel Paulus mit aufgerichtetem Schwerte und Buch, dann die heilige Elisabeth (?) mit einem zugedeckten Korbe. Unter dieser


|
Seite 426 |




|
Leiste steht auf der Altarplatte eine Leiste mit den gemalten Köpfen Christi und der übrigen 10 Apostel, wie es scheint; wenigstens ist der mittlere Kopf ein Christuskopf und an jeder Seite stehen 5 andere Köpfe, alle etwas beschädigt. Die Malerei ist gut, so wenig davon erhalten ist, das Schnitzwerk ist mittelmäßig. Ueber dem Ganzen steht eine Leiste mit einer Inschrift mit lang gezogenen gothischen Buchstaben:

Die rothen Kreuze.
An der Westwand des Mittelschiffes zu beiden Seiten des mittlern Fensters und an der Wand im südlichen Theile des Umganges um den hohen Chor stehen auf viereckigen, weißen Schilden in gothischer Einfassung gemalte rothe Kreuze. Dies sind ohne Zweifel die bischöflichen Weihkreuze. Da sich an andern Orten hinter denselben Trümmer von mittelalterlichen schwarzen Töpfen gefunden haben, welche wahrscheinlich Nachrichten enthielten, so ließ ich im Sept. 1843 die Wand hinter den Kreuzen untersuchen, fand aber nichts, als festes Mauerwerk.
Das fürstliche Erbbegräbniß aus dem Mittelalter.
Die Landesfürsten in allen Linien hatten zu Doberan, als dem gefeierten Quell des christlichen Lichtes in Meklenburg, ihr Erbbegräbniß 1 ). Nach dem voraufgehenden Abschnitte über den Bau der Kirche war dieses Begräbniß in einer eigenen Kapelle, S. 415, mit einem Altare links an der Pforte des nördlichen Kreuzschiffes. Fast die ganze Kapelle wird jetzt von dem großen und hohen, über der Erde aufgeführten Grabdenkmale des Herzogs und Bischofs Magnus († 1550) und seiner Mutter Ursula († 1510) gefüllt; bei Gelegenheit der Erbauung desselben ist der alte Fußboden und mit demselben der Altar viel höher, nämlich über das Grabgewölbe, gelegt.
Links von der Kirchenthür, vor des Bischofs Magnus Begräbnisse, liegen in einer Reihe 5 viereckige Ziegel mit einem Relief=Stierkopfe, welche die Stelle bezeichnen, wo vor dem Altare der Fürsten=Kapelle die alten fürstlichen Leichen der Linien Meklenburg, Werle und Rostock von dem gemeinsamen Stammvater Pribislav an ruhen; es sind früher sechs Steine gewesen,


|
Seite 427 |




|
einer derselben ist bei der Umlegung des Pflasters in den jüngsten Zeiten völlig zerbrochen. Alle Reliefziegel sind übrigens in den neuesten Zeiten gerückt. Dicht an dem Grabdenkmale des Bischofs Magnus innerhalb der Umgitterung der Gedächtnißtafel, liegt noch ein Stein derselben Art. An einem Pfeiler in diesem Raume hängt eine Tafel mit der Inschrift:
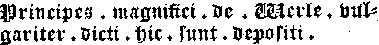
Diese Inschrift, so wie ihr Inhalt, daß die Fürsten von Werle hier begraben seien, rührt von Nic. Marschalk her. Die Steine beweisen aber etwas ganz anderes. Von allen 5 Steinen, welche in einer Reihe liegen, hat nur einer einen alten werleschen Stierkopf (ohne Halsfell); die übrigen 4, wenigstens gewiß 3, haben den bekannten meklenburgischen Stierkopf (mit aufgerissenem Maule und mit Halsfell); der hinter der Vergitterung vor dem Grabe des Bischofs Magnus liegende Stein hat ebenfalls einen meklenburgischen Stierkopf, jedoch aus jüngerer Zeit, weniger schön modellirt, aus dem 15. Jahrhundert. Die Inschrift auf der Tafel ist also nur zum Theil wahr.
Es ist daher außer Zweifel, daß hier nicht allein die Grabstätte der Fürsten von Werle, sondern die berühmte Grabstätte aller Landesherren aus den verschiedenen Linien des Hauses Pribislav's sei.
Jedoch sind nicht alle fürstlichen Personen des Mittelalters hier beigesetzt. So wie Neigungen andere Verbindungen veranlaßten, nahmen andere geistliche Stiftungen die fürstlichen Leichen auf. So ist Heinrich Borwin II. im Dome zu Güstrow, so sind die gefeierten Fürstinnen Anastasia und Beatrix im Franziskaner=Mönchskloster zu Wismar begraben u. s. w.
Auch in der doberaner Kirche liegen einige fürstliche Leichen aus dem Mittelalter nicht in dem alten fürstlichen Erbbegräbnisse. Heinrich der Löwe ruhet im Chor, wahrscheinlich weil er nach vielen kriegerischen Störungen der Klostergüter sich endlich ganz dem Kloster Doberan ergab und der Chor ungefähr unter seiner Regierung und durch seinen Beistand vollendet sein wird. Wahrscheinlich ruht aus dem letztern Grunde auch die Fürstin von Werle neben ihm im hohen Chor.
Eine im Sept. 1843 angestellte Untersuchung des Begräbnißgewölbes des Bischofs Magnus hat gelehrt, daß der ganze Fußboden gegen 1 Fuß, also so tief, als das ehemalige Pflaster der Kirche, gesenkt und mit Hohlziegeln und festem Kalk bedeckt, das kellerartige Gewölbe aber fast bis auf den


|
Seite 428 |




|
Fußboden hinuntergeführt ist. Es ist also jede Hoffnung verschwunden, daß man Pribislav's und der alten Fürsten Gräber einzeln je wieder finden wird; man kennt nur die Stelle. - Die Särge des Bischofs Magnus und seiner Mutter Ursula sind völlig zerfallen und ohne Spur ihrer ehemaligen Bestimmung; auch sind sie in frühern Zeiten offenbar durchwühlt worden.
Seit dem 17. Jahrhundert sind die fürstlichen Leichen hinter dem Altare beigesetzt.
Fürstliche Leichensteine im hohen Chor.
Im hohen Chore sind drei Grabstätten mit schmalen Ziegeln abgegrenzt und mit kleinen glasurten und Mosaikziegeln mit den Bildern von Hirschen, Greisen, u. s. w., weiß in schwarz, von ungefähr 2''□ Größe, mit welchen auch die Altarstellen hier und in der Kapelle zu Althof gepflastert sind, ausgelegt.
1) Das Grab des Fürsten Heinrich des Löwen,
welcher am Tage der Heil. Agnes (21. Jan.) 1329 starb. Der abgegrenzte Raum ist mit kleinen Mosaikziegeln gefüllt. In der Mitte liegen zwei große Ziegel mit den Reliefbildern eines Schildes und eines Helmes, stärker als die übrigen Reliefziegel, welche am Nordeingange vor dem Grabgewölbe des Bischofs Magnus liegen, aber sehr abgetreten. Die Einfassung des Grabes besteht aus 24 langen und schmalen Ziegeln von ungefähr 8'' Länge gegen 3'' Breite und 1 1/2'' Dicke, mit einer Inschrift aus gothischen Buchstaben, welche in dem Thon tief ausgeschnitten sind. Auffallend ist es, daß gothische Buchstaben angewandt sind, da sich diese vor dem J. 1350 kaum zu Inschriften finden; vielleicht aber, da keine Regel ohne Ausnahme ist, wollte man das Grab des gefeierten Helden besonders kunstreich schmücken, oder die Inschrift ist auch etwas später gelegt, da das daneben stehende Grab eine Inschrift mit ganz gleichen Ziegeln und Buchstaben hat. Das Letztere scheint wahrscheinlicher zu sein. Im 14. Jahrhundert ward aber die Inschrift jedenfalls gelegt, wahrscheinlich bei der Vollendung und Einweihung der fertig gebaueten und vollständig geschmückten Kirche im J. 1365.
Daß Heinrich der Löwe im Chor und nicht bei seinen Vorfahren an der nördlichen Pforte begraben ward, ist allerdings auffallend. Aber theils wollte man dem großen Manne, der dem Kloster freilich viel geschadet, aber auch den Schaden wieder abgebüßt hatte, eine besondere Ehre erweisen, theils


|
Seite 429 |




|
lebte er in der Zeit des rüstigsten Baues der Kirche und beförderte denselben ohne Zweifel bedeutend.
Nach neuern Entdeckungen lautet die Inschrift:
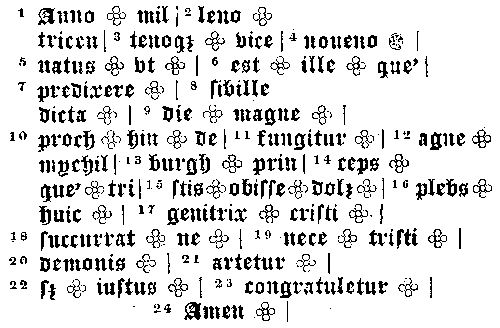
d. i.
Anno milleno
tricentenoque vicenoueno,
natus ut est ille,
quem predixere Sibyllae,
dicta die magnae,
proh! Hinricus defungitur Agnae,
Mychilburgh princeps,
quem tristis obisse dolet plebs,
huic genitrix Christi
succurrat, ne nece tristi
demonis artetur,
sed iustus congratuletur.
Amen.
So auch ist die Inschrift von Nic. Marschalk im ersten Viertheil des 16. Jahrhunderts aufgenommen und auf einer Tafel im nördlichen Kreuzschiffe aufbewahrt. Nur die zweite Zeile bei Marschalk ist nicht richtig; er lieset nämlich: tricen vicenque noueno.
Am Ende des Monats September 1843 ward dem Verfasser der hohe, ehrenvolle Auftrag, den Grund des Chores zur Legung des Fundamentes für den Sarkophag des hochseligen Großherzogs Friederich Franz freizulegen und zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit ward die Platte auf dem Grabe Heinrichs des Löwen gehoben. In einer Tiefe von 5 Fuß


|
Seite 430 |




|
ward unter jungem Bauschutt der fehlende vierte
Stein mit den Buchstaben:
tenoqz
 vice
völlig wie neu erhalten gefunden.
Der Stein muß also schon Jahrhunderte
verschüttet gewesen sein und Marschalk den
Inhalt conjecturirt haben, da er die Lesung
vicenque
hinterlassen hat. - Uebrigens
war die Inschrift schon früher gerückt und
falsch eingesetzt. Zwei Steine mit den Worten
nunc
vice
völlig wie neu erhalten gefunden.
Der Stein muß also schon Jahrhunderte
verschüttet gewesen sein und Marschalk den
Inhalt conjecturirt haben, da er die Lesung
vicenque
hinterlassen hat. - Uebrigens
war die Inschrift schon früher gerückt und
falsch eingesetzt. Zwei Steine mit den Worten
nunc
 postulet
und
nunc
postulet
und
nunc
 quiuis
quiuis
 , welche nach der neuern Legung an der 4.
und 5. Stelle lagen, gehören gar nicht zu dieser
Inschrift. - Der Stein 4
noueno
war in
mehr als 30 Stücke zertreten. Auf dem Steine 10
steht sicher
proch
und auf 21
artetur
. Auf 8 liest man am besten
dicta
, obgleich man auch vielleicht
victa
lesen könnte.
, welche nach der neuern Legung an der 4.
und 5. Stelle lagen, gehören gar nicht zu dieser
Inschrift. - Der Stein 4
noueno
war in
mehr als 30 Stücke zertreten. Auf dem Steine 10
steht sicher
proch
und auf 21
artetur
. Auf 8 liest man am besten
dicta
, obgleich man auch vielleicht
victa
lesen könnte.
Bei Untersuchung des Grundes ward auch das Grab Heinrichs des Löwen freigelegt. Der Löwe ruhet mit dem Kopfende im Chor 4 1/2' von der Stufe zum Chore nach dem Altare hin und 12' von der nördlichen Chorwand. Hier steht 5' 10'' tief unter dem Chorpflaster auf dem sehr nassen Wellsande des Grundes ein Sarkophag von äußerst großen Ziegelsteinen, im innern 2' 2'' hoch, am Kopfende 3' 1 1/4'' breit, am Fußende 2' 10 1/2'' breit, 8' 4'' lang, oben und unten offen. In demselben hat ein hölzerner Sarg gestanden, welcher völlig zu Erde vergangen und nur an einem regelmäßigen Streifen dunkeler Erde zu erkennen ist. In dem Sarkophage, von dem zur Dicke eines Laubblattes vergangenen Sargdeckel bedeckt, ruhen die Gebeine des Löwen gegen Osten schauend, mit den Händen im Schooße, völlig wohl erhalten und ungestört, nur daß der Schädel zerdrückt ist. Die Länge des ausgestreckten Gerippes betrug 6' 3 3/4'', des Oberschenkels 1' 7'', des Unterschenkels 1' 4'', des Oberleibes vom Nacken bis zum Schenkelkopfe 2' 4 1/2''. Die Gebeine waren sehr stark. Die Stirn war niedrig, das Stirnbein ungewöhnlich stark. Die Zähne waren bis auf einen alle vorhanden und vollkommen gesund; die Backenzähne, im Beginnen des Abschleifens, deuteten auf einen Mann hoch in den Vierzigen. Die Zähne in den starken Kinnladen standen grade auf einander und deuteten auf volle Lippen. Alles verrieth aber eine große, kräftige Heldengestalt. Hiemit, namentlich in Beziehung auf Größe und Lippen, stimmt auch ein altes, traditionelles Bild vom J. 1523 im großherzoglichen Archive überein, nach welchem vor einigen Jahren der Hofmaler Schumacher für den Herrn Landrath Reichsfreiherrn von Maltzan auf Rothenmoor zum Geschenke für den hochseligen Großherzog Paul Friederich ein Bild des Löwen entwarf.


|
Seite 431 |




|
Nach Untersuchung des Grundes ist der Sarkophag des Löwen, welcher, bis 3'' über den Gebeinen, mit jungem Schutt gefüllt war, sorgsam gereinigt und am 28. Sept. 1843 mit einem Gewölbe bedeckt worden, was früher nicht der Fall war.
Die Ziegelsteine, aus denen der Sarkophag gemauert war, waren 1' lang, 6'' breit und 4'' dick; gerade so groß sind die Steine, aus denen die doberaner Kirche erbauet ist. Die Ziegel, auf welchen der Sarg des Fürsten in dem Sarkophage gestanden hatte, waren 11'' lang, 5 3/4'' breit und gut 2'' dick.
2) Neben dem Grabe Heinrich's des Löwen, im Grunde 6', von demselben entfernt, ist ein zweites ähnlich ausgestattetes Grab, welches jedoch nur zu Häupten eine Inschrift auf 3 Ziegeln hat:

(= Uxor domini Nicolai de Werle.)
Wahrscheinlich liegt hier Jutte von Anhalt, des Fürsten Nicolaus I. von Werle Gemahlin. Nach Kirchberg c. 173 ward Nicolaus I. im J. 1277 zu Doberan begraben und seine Gemahlin überlebte ihn nach 44jähriger Ehe. Würde hier die Gemahlin eines jüngern Nicolaus von Werle ruhen, so wäre wahrscheinlich der Gemahl schon genauer bezeichnet; nun aber war sie bis dahin die Gemahlin des ersten und einzigen Nicolaus von Werle, also allen als solche bekannt. Da auch die Inschrift in der Form der Inschrift auf dem Grabe Heinrichs des Löwen gleich ist, so werden beide ungefähr in dieselbe Zeit fallen.
Bei Untersuchung des untern Raumes wurden dieselben Verhältnisse, wie im Grabe Heinrichs des Löwen, gefunden. Der Sarkophag von Ziegelsteinen stand nicht grade unter der Grabplatte, sondern mit dem Kopfende 10' von der Stufe zum Chor und 12' von der südlichen Chorwand; auch stand er höher: mit dem Boden 4' tief unter dem Chorpflaster. Der Sarkophag war im Innern 7' 2" lang, überall 2' 5'' weit und 2' hoch. Das Gerippe, gegen Osten gekehrt und mit gefalteten Händen über der Herzgrube, lag ebenfalls vollständig und ungestört in den Resten des gänzlich vergangenen Sarges, nur daß auch hier der Schädel zerdrückt war. Das ausgestreckte Gerippe maaß gegen 6 Fuß und war äußerst zart. Weitere Beobachtungen gestatteten die Umstände nicht.
Auch dieser Sarkokphag ward von Schutt gereinigt und mit einem Gewölbe bedeckt.


|
Seite 432 |




|
In keinem der beiden Sarkophage ward, außer den eisernen Sargnägeln, irgend ein Geräth gefunden. Wahrscheinlich wurden die Leichen, als große Auszeichnung, in Klostertracht beigesetzt.
Genau zwischen beiden sorgsam erhaltenen und geschützten Gräbern liegt das Fundament zu dem Sarkophage des hochseligen Großherzogs Friederich Franz.
3) Etwas weiter nach dem Altare hin, in der Mitte des hohen Chores, liegt eine dritte Grabplatte von kleinen Mosaikziegeln, ohne Inschrift. Nach der Sage soll hier der Herzog Albrecht der Große, Heinrichs des Löwen Sohn, ruhen. Bei der Aufgrabung des Grundes zeigte sich hier aber keine Spur von einem Sarkophage oder der Beisetzung eines Todten. - Vielleicht war diese Stelle eine Asylstätte? Asylstätten pflegten durch ähnliche kleine Steine bezeichnet zu werden.
4) unmittelbar vor dem Altare liegt ein sehr großer Leichenstein mit dem Bilde einer Fürstin in einer Nische, von sehr reicher, zierlicher und mitunter gezierter Arbeit. Die Umschrift, welche sehr geschnörkelt ist, lautet:
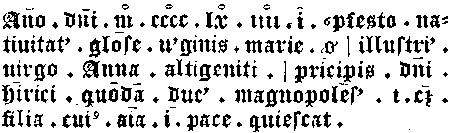
(= Anno domini MCCCCLXIV, in profesto nativitatis gloriosae virginis Mariae (= Sept. 7) obiit illustris virgo Anna, altigeniti principis domini Hinrici quondam ducis Magnopolensis etc. filia, cujus anima in pace quiescat.)
An den 4 Ecken stehen 4 Wappenschilde: neben der Figur oben rechts mit dem meklenburgischen Stierkopfe, oben links mit den rostockischen Greifen, unten links mit dem werleschen Stierkopfe, unten rechts mit dem stargardischen Arme; der letzte Schild zeugt wohl dafür, daß der Stein später nachgelegt ist, sonst wäre dieser Schild von Wichtigkeit für die Heraldik.
Leichensteine.
Leichensteine der Aebte der Abtei Doberan.
In der Kirche zu Doberan liegen auch die Leichensteine von 10 Aebten des Klosters. In der Mitte des Schiffes liegen


|
Seite 433 |




|
die 5 ältern, vor dem hohen Chore die 5 jüngern. Die Inschriften der jüngern Steine sind viel mehr geschnörkelt, so daß sie schwer zu lesen sind; die Inschriften der ältern sind lückenhaft. Uebrigens sind erst in neuern Zeiten diese Leichensteine an die Stellen, wo sie jetzt liegen, versetzt; sie lagen früher an ganz andern Stellen.
Um diese für die Geschichte nicht unwichtigen Inschriften, welche Schröder in den Wismarschen Erstlingen S. 395 flgd. nach alten Handschriften sehr mangelhaft geliefert hat, sicher zu stellen, war eine schon oft gewünschte Uebersicht der doberaner Aebte nöthig. Sie folgt hier, aus den Urkunden des Klosters, Kirchbergs Chronik und den Leichensteinen selbst zusammengestellt; die Erforschung war umfangreich und schwierig. Im Allgemeinen wird die Darstellung richtig sein, namentlich in Beziehung auf die Aufeinanderfolge der Aebte; die Jahreszahlen mögen mitunter eine genauere Bestimmung und Vervollständigung erhalten können, jedoch würde dies der Gegenstand einer sehr umfangreichen Forschung werden müssen. Für die 22 ersten Aebte sind Kirchberg's Nachrichten Cap. 121, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 139 und 144, die Forschungen in den Jahrb. II, S. 174 und die Urkunden des großherzogl. Archivs zum Grunde gelegt; für die folgenden Aebte die Urkunden und die Leichensteine.
Von Bedeutung ist die Nummer der Aebte, welche die Original=Inschriften angeben, Schröder jedoch ausläßt. Auch Kirchberg bezeichnet den zum zweiten Male gewählten Abt Gottfried als den 7ten und den Abt Heinrich als den 10ten. Durch diese Angaben und die Angabe der Regierungszeit der Aebte auf den Leichensteinen haben die Aebte selbst, namentlich wenn mehrere gleiches Namens auf einander folgten, leichter ermittelt und durch alle diese Forschungen die Leichenstein=Inschriften leichter gelesen werden können.
Die Aebte des Klosters Doberan.
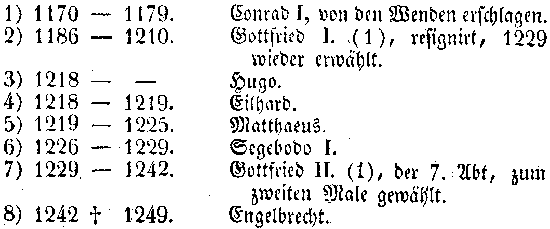


|
Seite 434 |




|
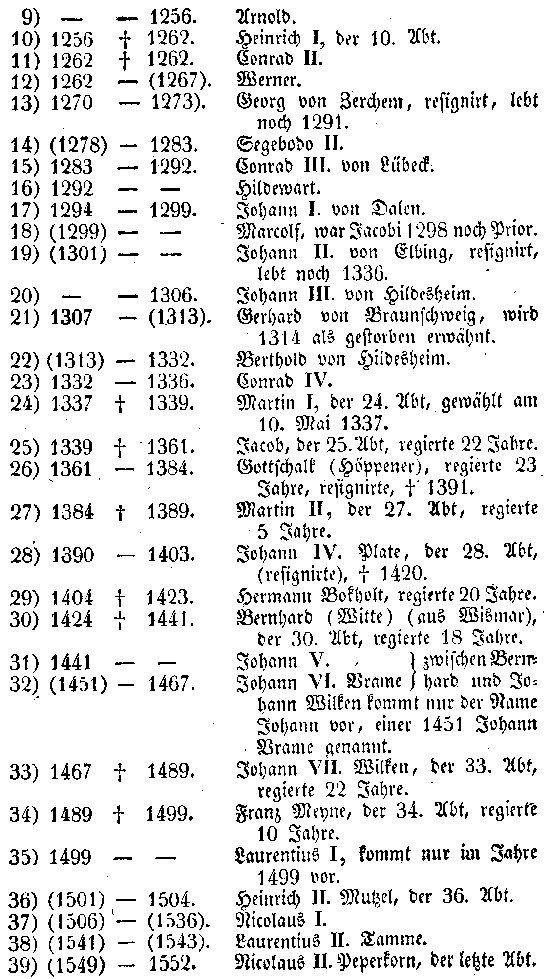


|
Seite 435 |




|
Leichensteine auf den Gräbern der Aebte:
1) im Schiffe: ein Stein mit einem Bischofsstabe, dessen Stab mit Metall ausgelegt gewesen, dessen Krümmung gravirt ist; Umschrift:
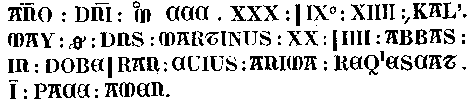
(= Anno Domini MCCCXXXIX, XIV kalendas Maj (= April 17.) obiit dominus Martinus XXIV abbas in Doberan, cuius anima requies- cat in pace. Amen.)
In der Inschrift wird das Jahr
 °
°


 °XXX°IX° = (1339) als das
Sterbejahr des Abtes Martin angegeben. Der Abt
Martin ward zuverlässig am 10. Mai 1337 gewählt
(vgl. Jahrb. VII, S. 45). Hiedurch werden einige
Dunkelheiten in den Schriftzügen beseitigt.
Daher ist sicher XXX°IX° zu lesen, so daß der
Abt Martin am 17. April 1339 gestorben ist.
°XXX°IX° = (1339) als das
Sterbejahr des Abtes Martin angegeben. Der Abt
Martin ward zuverlässig am 10. Mai 1337 gewählt
(vgl. Jahrb. VII, S. 45). Hiedurch werden einige
Dunkelheiten in den Schriftzügen beseitigt.
Daher ist sicher XXX°IX° zu lesen, so daß der
Abt Martin am 17. April 1339 gestorben ist.
Hiemit stimmt auch die Inschrift auf dem Leichensteine des nächstfolgenden Abtes überein, welcher nach einer Regierung von 22 Jahren im J. 1361 starb.
2) im Schiffe: ein Stein mit dem in einer Nische stehenden Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen;
Umschrift:
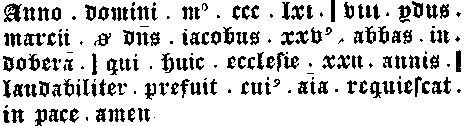
(= Anno domini MCCCLXI, VIII idus Marcii (Mart. 8 ). obiit dominus Jacobus, XXV abbas in Doberan, qui huic ecclesiae XXII annis laudabiliter praefuit, cujus anima requiescat in pace. Amen.)
Man vgl. den Leichenstein des vorhergehenden 24sten Abtes Martin.
3) Schröder in Wismar. Erstl. S. 396 führt noch eine Leichenstein=Inschrift an, welche jetzt fehlt:


|
Seite 436 |




|
Anno domini MCCCXCI dominus Godscalcus abbas in Dobran obiit in festo b. Lucae evan- gelistae (Oct. 18.), qui rexit abbaciam annis XXIII, quam tunc sponte resignavit, IIX annis deo fideliter serviens. Quaerite et orate deum pro eo.
Die Zeitrechnungen treffen zu. Der 25ste Abt Jacob † 1361; der 27ste Abt Martin regierte 1384 † 1389. Wenn also Gottschalk 23 Jahre Abt war, so legte er seine Regierung mit dem J. 1384 nieder; und wirklich erscheint er auch in Urkunden zuletzt 1383 und sein Nachfolger Martin zuerst im J. 1384.
Im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin existirt eine Urkunde des Abtes "Gotschalk Hoppener ("abbet des munsters Dubbraan") von sunthe Angneten daghe drutteynhundert iar in deme vefteghesten" (1350) über den Ankauf des schon 1250 von dem Kloster gekauften Dorfes Benekenhagen und den Wiederverkauf einer Hufe desselben Dorfes an den Verkäufer. Diese Urkunde kann aber unmöglich ächt sein, da der Abt Gottschalk 1361 - 1384 regierte. Ueberdies sieht die Urkunde verdächtig aus. Das Pergament ist kein norddeutsches, sondern weiß durchsichtig, geglättet, und, wie es scheint, von einem Stück gebrauchten Pergaments abgeschnitten; es sind ferner keine Zeugen aufgeführt; endlich ist nicht, wie in der Urkunde verheißen ist, des "kloosters inghezeghel" angehängt, auch kein Abtssiegel, sondern ein gewöhnliches kleines, rundes Civil= oder Privat=Siegel mit einem Schilde, auf welchem 4 nach unten gekehrte Spitzen über einander stehen, und mit der Inschrift:

Uebrigens war Gottschalk Hoppener im J. 1354 (in crast. Gregorii) Unterkellermeister (subcellerarius), im J. 1358 (die Gorgonii) Gastmeister (magister hospitalis) des Klosters.
4) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes, mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
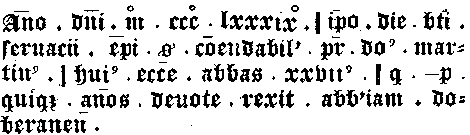


|
Seite 437 |




|
(= Anno domini MCCCLXXXIX ipso die beati Seruacii episcopi (= Mai 13) obiit commenda- bilis pater dominus Martinus, hujus ecclesie abbas XXVII, qui per quinque annos deuote rexit abbaciam Doberanensem.)
5) im Schiffe: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Buch und Stab; Inschrift:
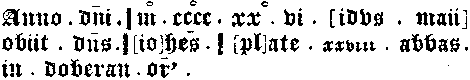
(= Anno domini MCCCCXX' VI [idus Maji] obiit dominus Johannes Plate, XXVIII abbas in Doberan. Orate pro eo.)
Der 28ste Abt war Johannes Plote, welcher in Urkunden 1390, 1396 und 1401 vorkommt. Der nächstfolgende Abt war Hermann, welcher 1415-1423 in Urkunden genannt wird. Johannes Plate kann also als Abt nicht 1420 gestorben sein, und doch scheint die Inschrift diese Jahreszahl zu enthalten. Vielleicht resignirte er vor seinem Tode. Sein Nachfolger war von 1403 oder 1404 bis 1424 Abt.
6) Schröder in Wism. Erstl., S. 397, führt noch eine Leichenstein=Inschrift an, welche jetzt fehlt:
Anno domini MCCCCXXVII, IV kal. Decemb. obiit venerabilis dominus Hermannus Bockholt abbas, qui per annos XX rexit abbatiam Doberanensem.
Hermanns Nachfolger, der Abt Berend, regierte 18 Jahre, 1424-1442; Herrmann muß also resignirt haben, oder es ist die Jahreszahl falsch gelesen und es muß XXIII statt XXVII heißen. Da aber Hermann nach den Urkunden bis 1423 oder 1424 Abt war und 20 Jahre regierte, so wird er ungefähr im J. 1404 Abt geworden sein.
7) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Buch und Stab in den Händen; Umschrift:
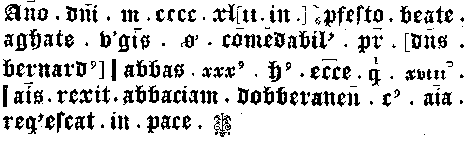


|
Seite 438 |




|
(= Anno domini MCCCCXL[II in] profesto beatae Agathae virginis (= Febr. 4) obiit commendabilis pater dominus Bernardus abbas XXX hujus ecclesiae, qui XVIII annis rexit abbaciam Doberanensem, cujus anima requiescat in pace.)
Die Umschrift ist in dem Namen des Abtes und in
dessen Sterbejahr unleserlich. Schröder Wism.
Erstl., S. 396, liest dominus Henricus mit dem
Sterbejahre 1344. Dies ist aber nicht möglich,
da 1339 - 1361 der Abt Jacob regierte; der
Sterbetag, den Schröder angiebt (beatae Agathae
virginis) und die sonstige Uebereinstimmung der
Inschrift bei Schröder mit der vorstehenden
giebt den Beweis, daß diese gemeint sei. Leider
giebt Schröder die Zahl der Folge der Aebte nie
an. Der 28. Abt war Johann Plate; auf ihn
folgte, nach den Urkunden des Klosters, der Abt
Hermann, welcher sicher 1415 - 1423 vorkommt.
Nach diesem folgt unmittelbar und erscheint in
den Urkunden öfter der Abt Berend 1424 - 1441.
Dies ist also der 30ste Abt, welchen die
Leichenstein=Inschrift hier meint. Da derselbe
nun 18 Jahre regiert hat, so muß sein Sterbetag
in das J. 1441 oder 1442 fallen; der folgende
Abt Johann wird schon am Gregors=Tage 1441
genannt. Daher ist hier ohne Bedenken:
d
 s . bernard
9
ergänzt.
s . bernard
9
ergänzt.
Von der Jahreszahl ist noch etwas zu erkennen. Es steht ungefähr
m.ccccxlıııtt da. Dies muß nun in
m.ccccxlıı. in aufgelöset werden, wie auch dazu stehen scheint. Es könnte auch
m.ccccxlv. in gelesen werden; hiergegen streitet aber die Geschichte. Man kann bei der Lesung diese Zahl der (14) perpendikulairen Linien in Anschlag bringen und dann nach den Urkunden die Lesung feststellen. Da der folgende Abt Johann schon am Gregors=Tage 1441 vorkommt, so wird Bernhard im letzten Jahre seines Lebens resignirt haben.
8) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
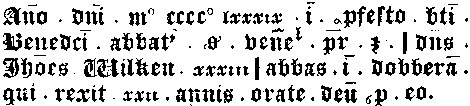
(= Anno domini MCCCCLXXXIX in profesto beati Benedicti abbatis (Mart. 20.) obiit venera-


|
Seite 439 |




|
bilis pater et dominus Johannes Wilken, XXXIII abbas in Dobberan, qui rexit XXII annis. Orate deum pro eo.).
9) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
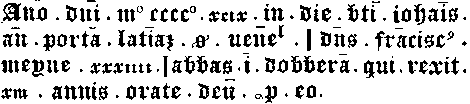
(= Anno domini MCCCCXCIX in die beati Johannis ante portam latinam (Mai 6.) obiit uenerabilis dominus Franciscus Meyne, XXXIV abbas in Dobberan, qui rexit X m annis. Orate deum pro eo.)
Das Sterbejahr (1499) ist ohne Zweifel richtig gelesen, auch die Reihenfolge des Abtes als des 34sten. Eben so ist das Sterbejahr des voraufgehenden 33sten Abtes Johannes Wilken († 1489) richtig gelesen. Zweifel erregt im Originale der vorstehenden Inschrift die Regierungszeit des Abtes Franz Meyne. Es steht da: xııı ; da jedoch die Buchstaben alle an einander hangen, so ist es zweifelhaft, ob ııı oder m zu lesen ist. Da aber das letzte ı lang hinuntergezogen ist ııj (hinuntergezogen) so ist wahrscheinlich m zu lesen, und dies ist dann die Endung der Zahl x m (= decem), da der Abt nur 10 Jahre regiert haben kann.
10) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch; Umschrift:
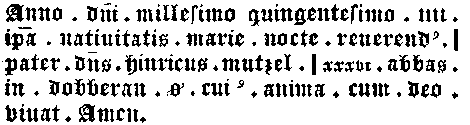
(= Anno domini millesimo quingentesimo IIII
ipsa natiuitatis Mariae nocte (Sept. 8.) reuerendus pater dominus Hinricus Mutzel XXXVI abbas in Dobberan obiit, cujus anima cum deo viuat. Amen.)
Der Zuname des Abtes ist bei der äußerst geschnörkelten Schrift undeutlich: man kann, am wahrscheinlichsten, mutzel , vielleicht aber auch mukel lesen.


|
Seite 440 |




|
3 u. 6?) in der Mitte des Schiffes: liegen zwei trapezoidische Leichensteine mit einem eingehauenen Bischofsstabe in der Mitte, jetzt ohne Inschrift. Vielleicht sind dies die Leichensteine der Aebte Gottschalk († 1391) und Hermann († 1427).
Leichensteine anderer Geistlichen.
Im nördlichen Seitenschiffe: ein Stein mit dem in einer Nische stehenden Priester, welcher den Kelch consecrirt; zu seinen Füßen steht ein Wappen mit einem schräge links bogenförmig gezogenen Bande, unter welchem 2 Lilien, über welchem eine ähnliche, unkenntliche Figur steht; die Umschrift ist nur an den Seiten und unten eingehauen:
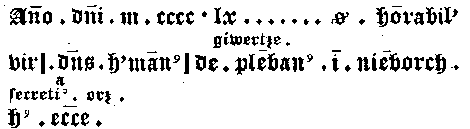
(= Anno domini MCCCCLX . . . . .obiit honorabilis vir dominus Hermannus de Giwertze, plebanus in Nienborch, hujus ecclesie secretarius. Orate pro eo.)
Nach Schröder S. 397 war noch ein Leichenstein in der Kirche mit der Inschrift:
Anno domini MCCCCXXIII, V idus Julii obiit Nicolaus Dunnepeper, qui multum ornauit ecclesiam istam.
Unter dem Kreuzschiffe: ein Stein mit dem Relief=Bilde eines Predigers, zu dessen Füßen ein Wappen mit drei Köpfen steht; Umschrift:
ANNO . 1599 . DEN . 20 . SEPTEMB . IST . IN . GODT . DEM . HERN . SEHLICH . ENTSCHLAFFEN . M . HERMANNVS . KRUSE . DERO . SIELEN . GODT . GENADE . IST . ALHIE . ZV . DOBBERAN . PREDIGER . GOTLICHES . WORDES . GEWESEN . 35 . JHAR . SEINES.
um den Kopf folgt die Fortsetzung in 2 Zeilen:
ALTERS . 63 . JHAR . SEINER . HERKVMST . AVS . DER . GRAVESCHV . OLDENBORCH .


|
Seite 441 |




|
Leichensteine weltlicher Personen.
Hinter dem Altare in dem südlichen Umgange vor einem alten Nebenaltare in einer Capelle ist das Erbbegräbniß der Axecow. Vor dem Altare liegen 4 axecowsche Leichensteine:
a. ein großer Stein: rechts steht die Figur eines Ritters, welcher in der Linken ein großes Schwert hält, rechts neben sich den axecowschen Schild hat; links steht eine betende Matrone. Die Arbeit ist gut. Umschrift:
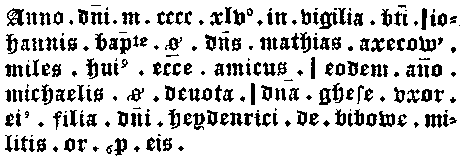
(= Anno domini MCCCCXLV in vigilia beati Johannis baptiste (Junii 23.) obiit dominus Mathias Axecowe miles, huius ecclesie amicus. Eodem anno Michaelis (Sept 29.). obiit deuota domina Ghese, uxor eius, filia domini Heydenrici de Bibowe militis. Orate pro eis.)
Der Ritter Mathias Axecow stiftete schon im J. 1439 für sich, seine Vorfahren und seine nächsten Verwandten Seelenmessen 1 ) im Kloster Doberan und machte sein Testament am 25 März 1445 2 ).
Die Figur des Ritters hat auf dem Helme in der Mitte einen runden Federbusch und an jeder Seite eine aufrecht stehende Schere, in der alten Gestalt, wie eine Schaafschere; der Schild neben dem Ritter ist quer getheilt, unten mit einem Herzen, oben mit zwei aufrecht stehenden Scheren neben einander.
An den 4 Ecken des Leichensteines stehen Wappenzeichen: rechts neben dem Ritter: unten der axecowsche Schild, oben der axecowsche Helm, wie eben beschrieben; - links neben der Matrone: unten der von bibowsche Schild mit einem rechts schreitenden Hahn ohne Kissen, oben der bibowsche Helm: auf einem Helme ein schreitender Hahn auf einem viereckigen Brette oder Kissen mit einem runden Knopfe an jeder Ecke. Dies ist das erste Beispiel, daß der von bibowsche Hahn auf einem Kissen steht.


|
Seite 442 |




|
Dann liegen 3 ganz gleiche Leichensteine neben einander, jeder mit 2 Nischen, in deren jeder ein geharnischter Ritter mit geschlossenem Visir steht, alle mit dem Schwerte in der Hand und den axecowschen Schild neben sich. Diese 3 Leichensteine stammen alle aus derselben Zeit, aus dem 15. Jahrhundert, und sind ohne Zweifel später zugleich nachgelegt worden, vielleicht nach oder kurz vor dem Aussterben des Geschlechts.
Die Umschriften sind jetzt zum Theil unleserlich; die jetzigen Lücken sind mit Hülfe alter Entzifferungen in Schröder's Wismarschen Erstlingen S. 338 und 398 und nach Vergleichung der Originale ergänzt:
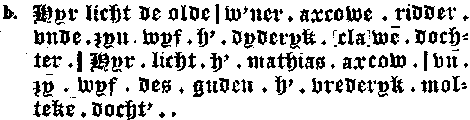
(= Hyr licht de olde Werner Axcow ridder vnde zyn wyf, her Diderik Clawen dochter. Hyr licht her Mathias Axcow vnde zyn wyf, des guden her Vrederyk Molteken dochter.)
Nach den Urkunden vom 2. Februar 1439 und 25. März 1445 waren die Ritter Werner Axecow und Grete die Aeltern des Ritters Mathias, welcher am 23. Junii 1445 starb. Im J. 1445 lebte der Ritter Mathias Axecow auf Neuhof, nachdem sein Vater, der Ritter Werner Axecow, schon gestorben war. Die Wittwe des Werner Axecow hieß 1445 Grete.
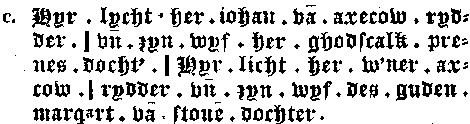
(= Hyr lycht her Johan van Axecow rydder vnde zyn wyf, her Ghodscalk Prenes dochter. Hyr licht her Werner Axcow rydder vnde zyn wyf, des guden Marquart van Stouen dochter.)
Der Ritter Johann v. Axecow war nach den Urkunden ein Bruder am 23. Junii 1445 gestorbenen Ritters Mathias.
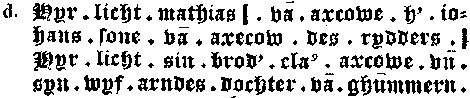


|
Seite 443 |




|
(= Hyr licht Mathias van Axcow, her Johans sone van Axecow des rydders. Hyr licht sin broder Clawes Axcow vnde sin wyf, Arndes dochter van Ghummern.)
Wappen und Jahreszahlen sind auf diesen 3 Leichensteinen nicht befindlich.
An der Wand über diesen Gräbern hangen mehrere, aus Holz geschnitzte alte axecowsche Wappen.
Im südlichen Seitenschiffe liegt ein Leichenstein mit zwei gothischen Nischen in Umrissen; in jeder steht ein Ritter, mit einer Hand ein Schwert, mit der andern den Wappenschild der von Oertzen haltend, auf dem Haupte einen Helm mit zwei Federn. Die Arbeit ist nicht besonders gut. Unten in den Ecken steht zwei mal der von örtzensche Schild, oben in den Ecken zwei mal ein Helm mit den beiden ringhaltenden Armen. Die Umschrift lautet :
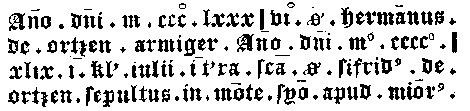
(= Anno domini MCCCLXXXVI obiit Hermannus de Ortzen armiger. Anno domini MCCCCXLIX in kalendis Julii (Julii 1) in terra sancta obiit Sifridus de Ortzen, sepultus in monte Syon apud minores.)
An einem Pfeiler an der Wand hängt ein altes, aus Holz geschnitztes von örtzensches Wappen, im Schilde und auf dem Helme mit den beiden ringhaltenden Armen.
Der Knappe Siverd oder Siegfried von Oertzen auf Roggow hatte schon Weihnacht 1431 den Entschluß zur Pilgerfahrt ins gelobte Land gefaßt, als er dem Kloster Doberan Schenkungen machte 1 ). Er kam aber erst im Jahre 1441 zur Reise, indem er am 4. März 1441 sein Testament machte und dem Kloster Doberan seine Urkunden und sein Geld in Verwahrung gab 2 ).
Im südlichen Seitenschiffe liegt ein schon sehr verwitterter Stein mit einer betenden weiblichen Figur in einer Nische; Umschrift:


|
Seite 444 |




|
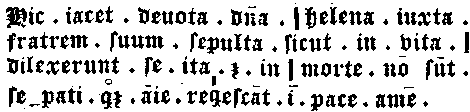
(= Hic jacet deuota domina Helena juxta fratrem suum sepulta: sicut in vita dilexerunt se, ita etiam in morte non sunt separati: quorum animae requiescant in pace. Amen.)
Wer diese Helena und ihr Bruder sei, ist unbekannt. Der Stein liegt in der Nähe der von Oertzenschen Leichensteine. Die Schriftzüge deuten auf das 15. Jahrhundert.
In der Nähe liegt ein anderer, großer Stein, dessen Oberfläche aber ganz verwittert ist.
An der Pforte des südlichen Kreuzschiffes, der jetzigen Hauptpforte, liegt ein großer Leichenstein, 11' lang und 7' breit, mit zwei gothischen Nischen, in denen zwei Figuren in Umrissen stehen; die Arbeit ist sehr gut. Rechts steht ein geharnischter Ritter, vor sich mit der Rechten das Schwert, mit der Linken den moltkeschen Wappenschild mit drei Birkhühnern haltend; auf dem Haupte trägt er einen Helm mit einer Lilienkrone, über welche fächerartig sechs Pfauenbüsche hervorragen. Links steht eine betende Matrone mit gefaltenen Händen. Die Umschrift lautet:
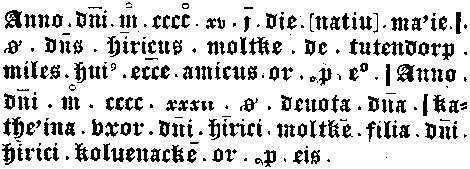
(= Anno domini MCCCCXV in die [nativitatis] Mariae (Sept. 8.) │ obiit dominus Hinricus Moltke de Tutendorp miles, huius ecclesie amicus. Orate pro eo. │ Anno domini MCCCCXXXII obiit deuota domina │ Katherina uxor domini Hinrici Moltken, filia domini Hinrici Koluenacken. Orate pro eis.)
Um das Haupt der Frau liegt ein Band mit der Umschrift:

In den Ecken stehen 4 Wappenschilde: oben rechts neben dem Manne der moltkesche, links neben der Frau der bü=


|
Seite 445 |




|
lowsche, unten umgekehrt rechts der bülowsche, links der moltkesche.
Im Predigergarten neben dem Pfarrhause liegt ein schöner Leichenstein, der neben der Kirche tief in der Erde gefunden und von dem wail. Präpositus Röper an seine jetzige Stelle gebracht ist. Die Darstellung ist dieselbe. Der Ritter hat ebenfalls den moltekeschen Wappenschild vor sich. Umschrift:
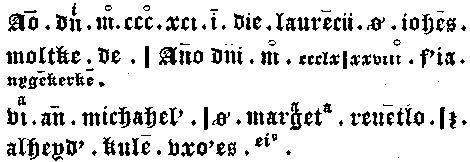
(= Anno domini MCCCXCI in die Laurencii (Aug. 10.) obiit Johannes Moltke de Nygenkerken. Anno domini MCCCLXXXVIII feria VI ante Michaelis (Sept. 25.) obiit Margareta Reventlo et Alheidis Kulen, uxores ejus.)
An den vier Ecken stehen die vier Evangelisten in Symbolen.
In dem nördlichen Theile des Umganges um den hohen Chor liegt ein Leichenstein mit einer gothischen Nische, in welcher ein bekleideter Ritter, ohne Helm, steht, mit dem Schwerte in den Händen und dem Wappenschilde der von der Lühe neben sich. Die Umschrift ist sehr verwittert und ausgesprungen, namentlich ist die Stelle wo der Name stand, ausgebrochen. In Schröder Wismar. Erstl. S. 396 wird die Inschrift also gelesen:
Post M bis duo CCC semel superadde
Martinus in festo Vicentii rem manifesto
Vir bonus Hinricus Dein sincerus amicus
Claustri decessit sub petra qui requiescit
fiat cum pace. Amen.
Diese Lesung kann aber, sicher in Jahreszahl und Namen, nicht richtig sein. Nach wiederholten Studien ist noch zu lesen:
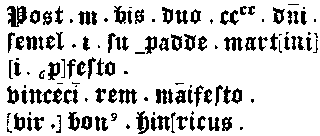


|
Seite 446 |




|
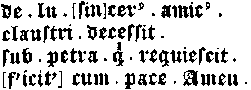
d.i.
Po'st M duo CC domini
semel I superadde Martini
in profesto
Vincencii rem manifesto
vir bonus Hinricus
de Lu, sincerus amicus
claustri, decessit,
sub petra qui requiescit
feliciter cum pace. Amen.
Die Jahrszahl
 c
c
c
c
= 1400 ist sicher gelesen. Eben so steht auf
dem Steine sicher
c
c
c
c
= 1400 ist sicher gelesen. Eben so steht auf
dem Steine sicher
 art
. . . und
Vincēci;
vor dem letztern Worte
steht sicher
festo
und wahrscheinlich
6
pfesto
= profesto, und vor diesem
dem Anscheine nach
i
= in. Man muß dann
den Tag des Heil. Vincentius annehmen, welcher
am 6. Junii gefeiert ward; das profestum
Vicentii war dann der 5. Junii; am 4. Junii ward
die Translation des Heil. Martin gefeiert. Die
Sache ist nicht ganz klar; es handelt sich um
Einen Tag. Aber es mußte der Reim herauskommen,
und so kann hier vielleicht die Nacht von S.
Martini auf das Vorfest S. Vincentii gemeint
sein, also 4/5 Junii.
art
. . . und
Vincēci;
vor dem letztern Worte
steht sicher
festo
und wahrscheinlich
6
pfesto
= profesto, und vor diesem
dem Anscheine nach
i
= in. Man muß dann
den Tag des Heil. Vincentius annehmen, welcher
am 6. Junii gefeiert ward; das profestum
Vicentii war dann der 5. Junii; am 4. Junii ward
die Translation des Heil. Martin gefeiert. Die
Sache ist nicht ganz klar; es handelt sich um
Einen Tag. Aber es mußte der Reim herauskommen,
und so kann hier vielleicht die Nacht von S.
Martini auf das Vorfest S. Vincentii gemeint
sein, also 4/5 Junii.
Der Name
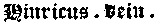
ist in Schröder sicher falsch gelesen; es muß ohne Zweifel
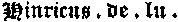
(Heinrich von der Lühe) gelesen werden.
Am Ende steht f'ıııt , vielleicht = feliciter?
In dem nördlichen Theile des Umganges seitwärts hinter dem Altare liegt ein Leichenstein mit einer stehenden, betenden Figur in weitem Gewande, mit vollem Haar, ohne Kopfbedeckung. Die Umschrift liegt in der Linie des umfassenden Spitzbogens um die Gestalt. Oben steht an jeder Seite ein Schild mit einem Wappen, wie Thorzinnen, welches in dem Schildfuße allerdings etwas klein gehalten ist. Die Umschrift lautet:


|
Seite 447 |




|
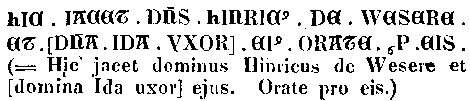
(= Hie jacet dominus Hinricus de Wesere et [domina Ida uxor] ejus. Orate pro eis.)
Die Worte
D

 . ID
. ID
 . VXOR
sind nicht klar
mehr zu lesen; sie sind nach einer ältern Lesung
in Schröder Wism. Erstl. S. 398 ergänzt und nach
der Zahl der Buchstaben auch wahrscheinlich.
. VXOR
sind nicht klar
mehr zu lesen; sie sind nach einer ältern Lesung
in Schröder Wism. Erstl. S. 398 ergänzt und nach
der Zahl der Buchstaben auch wahrscheinlich.
Der Leichenstein ist nicht unwichtig. Die Schriftzüge fallen in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der Stein deckt also ohne Zweifel die Gruft des rostocker Bürgers Heinrich von Weser und seiner Gemahlin Ida. Dieselben: "discretus et honestus vir Hinricus et deuota vxor eius domina Ida, dicti de Wesera, burgenses ciuitatis Rostoc" legirten am 21. Julii 1304 dem Kloster Neukloster 20 Mark jährlicher Hebungen aus dem Dorfe Toldas; vgl. Lisch Mekl Urk II, S. 96. Wahrscheinlich werden sie sich dem Kloster Doberan eben so freundlich bewiesen haben. Im J. 1300 stiftete Heinrich von Weser, oder Klumpsülver, eine tägliche Messe in der Jacobikirche zu Wismar; vgl. Schröder P. M. S. 859. Eine ganze Familie von Weser zu Wismar wird in einem alten Testamente (aus dem 13. Jahrh.) in Burmeister's Alterth. des wismarschen Stadtrechts, S. 39, aufgeführt.
Auffallend und wichtig ist, das der Mann auf dem
Leichensteine Herr (dominus), die Frau in der
erwähnten Urkunde Frau (domina) genannt wird,
Titel, welche sonst nur Rittergeschlechtern
beigelegt werden. Es werden jedoch auch in alten
Urkunden die Rathsherren von Rostock mit diesem
Titel belegt. Bei dem Worte
D
 S.
ist die Lesung ohne Zweifel
richtig, da die Buchstaben völlig klar sind.
S.
ist die Lesung ohne Zweifel
richtig, da die Buchstaben völlig klar sind.
Die Bülowen=Kapelle.
Die Bülowen=Kapelle am nördlichen Seitenschiffe der Kirche zu Doberan ist ein sehr interessantes Denkmal der Vorzeit, Sie ist allgemein bekannt wegen der Inschrift, welche jetzt auf einem in derselben stehenden, wahrscheinlich aber jüngern, backofenförmigen Grabgewölbe steht:
Wieck D
fel wieck, wieck wiet van my,
Ick scheer mie nig een Hahr um die.
Ick bn ein Meckelb
rgsch Edelmann,
Wat geit die Dfel mien Supen an.


|
Seite 448 |




|
Ick sup mit mienen Herrn Jesu Christ
Wenn du Dfel ewig d
sten m
st
Un drinck mitm s
et Kolleschahl,
Wenn du sitzt in der Hellenquahl.
Drum rahd' ich wieck, loop, rnn un gah,
Efft bey dem Dfel ick to schlah.
Diese Inschrift steht gewiß nicht mehr an ihrer ersten Stelle und ist in der alten Orthographie durch die Umschreibungen mannigfach verändert.
Wichtiger ist die Kapelle durch die Wandgemälde, in Wasserfarben, welche die Gewölbe und die Wandflächen unter denselben bedecken. Die Gewölbekappen und Rippen sind mit Blumenranken, Lilien, Palmetten etc. geschmückt, von denen viele in gutem Style des Mittelalters gehalten und wegen der Seltenheit solcher alter Malereien zum Studium zu empfehlen sind. Die spitzbogigen Wandflächen unter den Gewölben enthalten Gemälde zur Geschichte der Familie von Bülow.
An der östlichen Hauptwand steht ein Crucifix, zu beiden Seiten Maria und Johannes, zu jeder Seite derselben ein Heiliger; hinter den Heiligen knieet dem Beschauer rechts ein Ritter mit dem v. Bülowschen Wappenschilde neben sich und der Inschrift
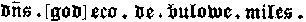
links eine Frau mit einem Schilde, auf welchem ein Bär mit einer Halsfessel (von Karlow) steht. Von dem Vornamen des Ritters sind nur noch die Buchstaben - eco zu erkennen; wahrscheinlich ist [god] eco , = Godefrid, zu ergänzen, ein der Familie von Bülow eigenthümlicher Vorname, und daher wahrscheinlicher, als [Lud] eco , welches überdies gewöhnlich nur in den Formen Lüdeke oder Lüdekin vorkommt. Wahrscheinlich sind die auf diesem Bilde dargestellten Personen die Stammältern des Geschlechts.
Zu den Seiten der beiden Fenster in der Nordwand stehen die 4 Bischöfe von Schwerin aus dem Hause von Bülow, welche alle in das 14. Jahrh. fallen.
Auf der westlichen Wand, der Hauptwand gegenüber, stehen 2 Heilige.
Die südliche Wand kirchenwärts scheint die gleichzeitige Geschichte zu berühren. Unter dem östlichen Bogen dieser Wand knieet ein Ritter zwischen Heiligen; die Inschriften sind undeutlich. Unter dem westlichen Bogen über der Thür steht ein Ritter und neben ihm die Inschrift:



|
Seite 449 |




|
Dieser scheint der Gründer der Kapelle gewesen zu sein. Da die 4 Bischöfe in derselben dargestellt sind, so muß sie nach 1375 erbauet worden sein. Im 14. Jahrh. hatten die von Bülow die Vogtei Schwaan und die landesherrlichen Gerechtsame in der Abtei Doberan zu Pfande. Von diesen haben mehrere, welche mit der Abtei in Berührung kommen, den Namen Heinrich; es kommen z. B. vor: 1324 der Ritter Heinrich v. Bülow auf Ketelhotsdorf, welcher damals schon verheirathet war; vor 1387 war ein Ritter Heinrich von Bülow gestorben und hatte unter seinen Söhnen einen Heinrich.
Diese Zeilen sollen nur das bewahren, was sicher und ohne Schwierigkeiten noch zu erkennen und zu lesen ist. Es sind neben den Bildern überall noch Spruchbänder mit Inschriften angebracht; um diese zu entziffern, würde es jedoch längerer Zeit und besonderer Anstalten bedürfen.
Der Klosterbezirk.
Der Umfang des Klosters selbst wird noch durch die alte Klostermauer bezeichnet, welche noch steht. Aber das Kloster hatte noch außerhalb der Ringmauern unmittelbar zum Kloster gehörende Besitzungen und Anstalten und wahrscheinlich auch das alte Dorf Doberan, welches vor dem Kloster lag. Im Allgemeinen bildet der Haupttheil des jetzigen Fleckens Doberan, nämlich Kirche, Kloster und Kamp, den alten Klosterbezirk. Dieser wird jedoch in einer Urkunde vom 13. Jan. (oct. epiph.) 1350, durch welche die Herzoge Albrecht und Johann dem Kloster Doberan das höchste Gericht innerhalb der nachstehend beschriebenen Grenzen schenken, genau bezeichnet:
1) von der Brücke über den Bach, der aus dem Kŏlbruche (kŏlbràk) kommt,
(a ponte super rivulo a palude dicta Kolenbruch defluente posito),
d. i. von der Brücke an der südöstlichen Ecke Doberans, am südlichen Ende des Buchenberges, wo der Weg am Buchenberge entlang mit dem alten Wege nach Rostock einen rechten Winkel bildet, über den Bach, der aus den noch jetzt kŏlbràk genannten Gärten zwischen dem Buchenberge und dem Wege nach Cröplin oder dem Landkruge kommt;
2) grade aus bis zur Brücke über den Fluß, der die Räder der Mühle im Backhause treibt,


|
Seite 450 |




|
(inde recto itinere progrediendo trans pontem fixum super rivo, qui se rotis molendini in domo pistrina (Backhaus, jetzt Mühle) iacentis superfundit),
d.i. an der südlichen Seite vom Kloster grade aus an den Gärten und Teichen am kŏlbràk entlang bis über die Brücke beim Landkruge, welche über den Fluß geht, der noch heute die alte Klostermühle oder die Backhausmühle treibt;
3) von dort innerhalb des Grabens, durch welchen das Freiwasser abzulaufen pflegt, welches sich in den Ziegelteich ergießt,
(deinde intra fossaturn per quod aqua libera dicta vrîwater decurrere consuevit, que stagno dicto tegheldîk se infundit),
d.i. innerhalb des Grabens für das Freiwasser, der sich kurz oberhalb der Brücke zur Cröpeliner Straße (Ortsbrücke d. i. Eckbrücke) von dem Bache abzweigt und durch den Ort Doberan vor der ersten Hinterreihe hinter der südwestlichen Häuserreihe am Kamp zieht, am Posthause vorbei unter der Brücke wegfließt in die noch heute Ziegelteich genannten Wiesen hinter dem Gasthofe zum Lindenhofe oder zwischen dem Kamp und dem Wege nach dem Heil. Damm, in welchen Wiesen in alten Zeit noch Teiche waren;
4) von dort grade aus um die Zäune des Ziegelhofes durch die Wiese, genannt die Walkmühlenwiese,
(exinde in directum circum sepes curiae laterariae per pratum dictum walkmolenwisch),
d.i. an den gegen Norden des Ortes belegenen Gärten des Posthauses und des Lindenhofes in der Nordseite des Kampes, welche Gärten noch häufig Ziegelschutt in der Tiefe zeigen, wo also die Ziegelei 1 ) für Kirche und Kloster gestanden hat, durch die Walkmühlenwiese, d. h. durch die Wiese, welche sich bis gegen die äußere, nordöstlich vor Doberan gelegene Mühle erstreckt, d. h. zwischen der Kirche und dem Kammerhofe hindurch;
"Der gewesener Ziegelhoff, so vorm Kloster belegen gewesen, ist im Kriege abgebrandt, der Acker zum Cammerhoff geleget und auff der abgebrandten Stette eine geringe Schäfferey geleget."


|
Seite 451 |




|
5) bis zur Ecke der Mauer hinter dem Schuhhause, bis um die Ostecke,
(ad conum sive angulum muri retro prope curiam sutrinam in parte orientali transeundo),
d. i. bis zu der nördlichsten Ecke der Klostermauer, der Nordseite der Kirche gegenüber, wo also innerhalb der Mauern das Schuhhaus des Klosters lag, und von hier nach Osten herumgehend bis an die nahe östliche Ecke der Klostermauer;
6) die Mauer des Klosters und die Zäune des Klosters entlang grade aus wieder bis zu der Anfangs genannten Brücke über den aus dem Kolbruch fließenden Bach,
(exhinc circum muros claustri Doberan ac sepes et septa ejusdem recta via ad pontem predictum positum super rivulo a Kolebruch eftluente redeundo),
d. i. an der Mauer des Klosters und am Buchenberge entlang bis zur Brücke am kŏlbràk, wo die Grenzbeschreibung anfing.
Der engere Bezirk des Klosters, in welchem es alle Gerichtsbarkeit hatte, umfaßte also grade das Kloster mit der Kirche und den jetzigen Kamp mit Zubehörungen und Umgebungen. Bis zu diesen Grenzen reichte noch bis zur Anlegung des Seebades ringsumher Wald.



|


|
|
:
|
Die Marien=Kirche zu Rostock.
In Jahrb. IV, S. 80 sind kurze Andeutungen über den baulichen und antiquarischen Werth der Kirchen zu Rostock gegeben. Es ist dort gesagt, daß die Kirchen Rostocks sich durch Größe und Kühnheit im Bau nicht auszeichnen, daß nur die Marien=Kirche hohe Beachtung verdiene, jedoch "nichts Hinreißendes, nichts Begeisterndes" habe.
Die Bewunderung der Marien=Kirche ist ziemlich allgemein; aber es fühlen sich viele Gebildete von dem Bau nicht befriedigt: es ist ein geheimer Widerspruch in den Ansichten über dieses Kunstwerk vorhanden, welcher irgendwo seinen Grund haben muß. Betrachtet man die gewaltigen Fenster, den höchst tüchtigen Bau, die große Ausdehnung des Chors und des Kreuzschiffes von außen, so hofft man im Innern eine große, imponirende Kirche zu finden, und tritt man ein, so fühlt man sich ohne Zweifel getäuscht, so sehr man auch die bedeutende Höhe und Kühnheit der Pfeiler und Gewölbe bewundern muß, wenn man diese einzeln betrachtet.


|
Seite 452 |




|
Dieser Widerstreit beruht in einem Mißverhältnisse zwischen Höhe und Länge oder vielmehr darin, daß die Kirche nicht vollendet ist: es fehlt ihr noch der bei weitem größere Theil des Schiffes. Daher kommt es, daß man keine Ansicht über den ganzen Bau im Innern gewinnen kann. Der Chor ist allerdings großartig; aber er bildet jetzt den Haupttheil der Kirche, während er nach der ursprünglichen Absicht nur den Altarraum in sich fassen sollte. Das Wenige, was vom Schiffe vorhanden ist, wird dazu noch von einer kolossalen Orgel und von großen Kirchen=Stühlen und Chören gefüllt. - Aber so kam es in den Hansestädten öfter: es wurden etwa in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Kirchen von kolossaler Ausdehnung für den Ziegelbau angefangen, aber nicht vollendet; dasselbe finden wir an den Kirchen Wismars, welche ebenfalls in sehr großem Maaßstabe angelegt, aber nicht in allen Theilen und in demselben Geiste vollendet und ausgeführt sind; man sieht überall, wie jüngere, schlechtere Anbauten die Ausführung des Grundplanes abgeschnitten haben. Dies mag seinen Grund in dem allmähligen Verfall und den innern Unruhen und äußern Kriegen der Hansestädte im Anfange des 15. Jahrhunderts haben. - Dasselbe Gefühl, welches man beim Anblick des Innern der Marien=Kirche zu Rostock empfindet, empfindet man beim Anblick der großen Kloster=Kirche zu Dargun, von welcher ebenfalls das Schiff abgenommen ist (vgl. Jahresber. VI, S. 90). Fehlt das Schiff, so verliert man die Uebersicht über den Chor, so wie man umgekehrt durch das Fehlen des Schiffes unangenehm berührt wird.
Es ist der Zweck dieser Zeilen, der Wahrheit die Ehre zu geben, und Kunstfreunde und Kunstkenner zum genauen Studium der einzelnen Theile der Marien=Kirche aufzufordern, welche in ihrem Grundplane und in der Ausführung einzelner Theile desselben allerdings zu den bedeutendsten Bauwerken des Vaterlandes gehört.
Von Wichtigkeit dabei wäre das Studium des S. Marien=Kirchen=Archivs und des Oekonomie=Archivs überhaupt, welches noch vorhanden ist, aber in einem alten feuchten Gewölbe des ehemaligen S. Johannis=Klosters aufbewahrt wird und in einer so traurigen Verfassung ist, daß es nicht lange mehr ausdauern kann. Die Urkunden sind theils vermodert, theils mürbe geworden und hunderte von Siegeln sind abgefault und abgerissen oder fallen bei der leisesten Berührung ab; eine schleunige Hülfe ist im höchsten Grade nothwendig.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 453 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow.
Diese Kirche hat in ihrem Innern nichts Merkwürdiges und ist, obgleich stark im Mauerwerk, doch ohne Gewölbe. Von den beiden im Thurme hangenden Glocken ist die eine vom Jahre 1463 und hat folgende Inschrift:
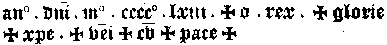
Dann folgt eine Guirlande von Weinranken, ein Blatt und eine Traube abwechselnd. Diese Verzierung geht auch ganz um den untern Rand. Die Glocke ist 3 1/2' weit und 3' Fuß hoch.
Die zweite Glocke ist jünger, mit folgender Inschrift in großen lateinischen Buchstaben:
GODT IM HIMMEL UND UP ERDEN ICH HETE IN MINEM NAMEN MICH GETE. ICH BIN DER ANFANCK VND ENDE STEIDT ALLENS IN MINEN HENDEN. ROM. 8. IS GODT MIDT VNS WOL KAN WEDER VNS CHRISTOFER V KOLLEN ADAMS SOHON ANNO 1607 IS PASTOR GEWESET H. ADAM. PVLLOW.
Darunter steht das herzoglich meklenburgische Wappen mit der Umschrift:
C. H. (Wappen) Z. M.
IS . DESSER . KERKEN . PATRON
Am untern Rande steht:
VORSTENDER HANS KIESER FOS GEHEL HEIDENRICK DER KOSTER HINRICH TESMER,
vor und nach diesen Worten ein dicker Kranz, in dessen Mitte noch steht:
JOCHIM PVLOW ,
wahrscheinlich Name des Gießers. Ein alter Leichenstein, der in neuerer Zeit in die südliche Mauer der Kirche eingemauert ist, zeigt einen geharnischten Ritter in Lebensgröße mit gefaltenen Händen, rechts neben


|
Seite 454 |




|
sich ein Schwert, links den Helm; unter diesem Ritter steht das Wappen der von Köllen, mit den Buchstaben oben und unten:
H. (Wappen) V.
K.
Die Umschrift des Leichensteins ist zum Theil, namentlich unten, ganz zerstört; zu lesen ist noch oben:
ANNO 1580 DEN - 7 MARC
auf der folgenden Längsseite:
IS . DE . EDLE . ERENFESTE . HANS . V . KOLLEN . G . . . .
auf der gegenüberstehenden Seite:
GNEDICH . SI . . . . . . SIN . LEVENT . GEENDICH VN GEFRI.
Vietlübbe, den 20. September 1843.
I. Ritter.



|


|
|
:
|
Die Glocke zu Westenbrügge.
Im Thurme der Kirche zu Westenbrügge hängt eine alte Glocke, über deren Inschrift und Verzierungen der Herr Pastor Priester zu Westenbrügge folgende Nachrichten mit getreuen Zeichnungen mitgetheilt hat.
Oben unter dem Helme steht, über dem Namen Bybowe, ein 6'' hoher Wappenschild mit einem rechts gekehrten Hahn, welcher nicht auf einem Kissen steht, mit ausschreitendem, rechten Fuße, mit zwei großen Schwungfedern im Schwanze, ganz wie das hahnsche Wappen. Die Umschrift lautet:
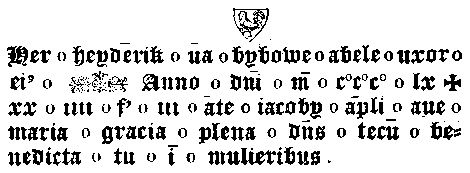
(= Her Heydenrick uan Bybowe. Abele uxor eius. Anno domini MCCCLXXXIIII, feria III ante Jacobi apostoli (= 1384, Julii 19). Aue Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.)


|
Seite 455 |




|
Am Ende steht ein auf einem Sessel ohne Lehnen sitzendes Marienbild, mit dem auf dem Schooße stehenden Christkinde im rechten Arme, 11'' hoch, gut modellirt. Nach den Namen vor Anno steht eine dreiblätterige Blume oder Weinranke mit Wurzel, 8'' hoch. In der mindern Jahrszahl, nach lx steht ein Crucifix.
Links über dem rechten Arme des Crucifixes steht:
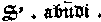
(= Sancti Abundi.)
Der Schenker der Glocke war also der Ritter Heidenrich von Bibow auf Westenbrügge, welcher mit seiner Frau Abele noch im J. 1400 in Lisch Mekl. Urk. II, S. 168 vorkommt.
Wichtig und merkwürdig ist diese Glocke wegen des Wappens, indem hier, wie auf allen alten Siegeln, der von bibowsche Hahn noch nicht auf einem Kissen steht, welches dem Hahn erst um die Mitte des 15 Jahrh. untergelegt wird.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Glocke zu Alt=Karin.
Die Kirche zu Alt=Karin hat 3 Glocken. Die mittlere Glocke hat um den Helm die Inschrift:
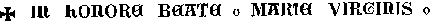
Diese Glocke ist nach den Schriftzügen sehr alt und stammt aus dem Ende des 13. oder dem Anfange des 14. Jahrhunderts.
Die kleinere Glocke hat nur Gießerzeichen und um
den Helm eine ununterbrochene Reihe von

Die größere Glocke ist vom J. 1752.
Westenbrügge.
L. E. Priester.



|


|
|
:
|
Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz.
Im Jahresber. VIII, S. 134 flgd. ist die Kirche zu Lübz mit ihren Denkmälern beschrieben; daselbst S. 135 ist auch des fürstlichen Begräbnisses in der Kirche gedacht. Vor dem Altare, an der Grenze des Chores, 39' von dem Sockel der Epitaphien hinter dem Altare oder ungefähr 42' von der Altarwand und 18' von der nördlichen Seitenwand der Kirche, lag, theilweise von dem Taufkessel bedeckt, die äußerste, nordwestliche Ecke einer Grabplatte von blaugrauem Stuck mit


|
Seite 456 |




|
zwei fürstlichen Wappen und einer Inschrift. Die Platte war völlig abgetreten, zerbrochen und durchaus verfallen. Bei der Restaurirung der Kirche kam im October 1843 diese Platte auch zur Frage. Sie konnte nicht erhalten werden und verdiente es auch nicht. Als die Platte abgeräumt war, ließen sich an den eingelegten, farbigen Schilden zwei fürstliche Wappen erkennen. Heraldisch rechts stand das fünfschildige meklenburgische Wappen, von welchem noch der stargardische Arm in rothem Felde zu erkennen war; links stand ein Wappen, quer getheilt, in der obern Hälfte zwei Mal, in der untern Hälfte drei Mal längs getheilt; der erste und der letzte Schild, so wie der eigenthümlich eingepfropfte mittlere Schild in der untern Hälfte waren roth: das holsteinsche Wappen. Von der Inschrift war in modernen Unzialen des 17. Jahrhunderts noch vorhanden:
- - - EN. GREVIN. - - -
- - - - VND - - - -
- - - ORN. Z - - - - -
Ohne Zweifel ist hier also das Begräbnis der Herzogin Sophie († 1634), Gemahlin des Herzogs Johann. Ihre Tochter Anna Sophie starb im J. 1648 zu Rehna und ward im Dome zu Schwerin beigesetzt.
Die Platte ruhte auf einem Ringe von Ziegeln, einem tief ausgemauerten Begräbnisse, welches mit Sand gefüllt war; in einer Tiefe von etwa 5 Fuß fanden sich die Gebeine in zwei zusammengefallenen Särgen von Eichenholz und von Tannenholz. Nachdem die Ueberzeugung von dem Vorhandensein der fürstlichen Leiche gewonnen war, ward das Grab sogleich wieder bedeckt.
Als die Grabplatte gehoben ward, zeigte es sich, daß der Stuck auf die untere Fläche eines alten Leichensteins gegossen war; die obere, gravirte Seite war nach unten gekehrt. Der Stein war mitten durch gerissen und es fehlte ein kleines Stück, welches grade die Jahreszahl, mit Ausnahme der letzten Ziffer, enthielt. Der Stein ist der Leichenstein von dem Grabe des Präceptors Johannes Cran des Antonius=Klosters zu Tempzin. Der Stein ist 8', 6" lang und 4' 10" breit und reich gravirt. In einer gothischen Nische steht der Präzeptor mit der Tonsur, in reichem Gewande, mit beiden Händen einen Kelch haltend, ohne ihn zu consecriren. Zu seinen Füßen steht ein Wappenschild mit einem rechts gekehrten Kranich, welcher ein T oder Antoniuskreuz mit dem Schnabel


|
Seite 457 |




|
hält; dasselbe Wappen führt der Präceptor auf Monumenten in der Kirche zu Tempzin (vgl. Jahresber. III, S. 158). An dem Fußende ist keine Inschrift. Die Inschrift, welche am rechten Fuße beginnt, lautet in gothischen Buchstaben:
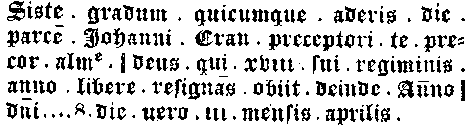
(Siste gradum, quicumque aderis, dic pacem Johanni Cran praeceptori, te precor, alme deus, qui XVIII sui regiminis anno libere resignans, obiit deinde anno domini [152]4, die vero III mensis Aprilis.)
Statt pacē (pacem) steht auf dem Steine irrthümlich parce . Von der Jahrszahl steht nur 8 = 4 da; das Uebrige ist ausgebrochen. Der Inhalt der Inschrift stimmt mit dem Inhalt der Urkunden überein. Johannes Cran ward nach den Urkunden im J. 1500 Präceptor und resignirte im J. 1518, also im 18ten Jahre seiner Regierung (vgl. Jahresber. III, S. 157); er wird also vielleicht im J. 1524 gestorben sein: die Zehner lassen sich jedoch noch nicht bestimmen.
Die Arbeit ist sehr ausgezeichnet und gehört zu dem Besten, was die Sculpturim Vaterlande in dieser Zeit geliefert hat. Der Präceptor Cran war ein verdienstvoller Mann, welchen die Geschichte öfter nennt und der daher auch wohl einen ehrenden Grabstein erhielt. Wie der Stein nach Lübz gekommen sei, ist nicht bekannt; es kommen aber nach der Zeit der Reformation häufig Beispiele vor, daß brauchbare Leichensteine versetzt und anderweitig benutzt werden.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
3. Der neuern Zeit.
Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen.
Das Schloß und Gut Ulrichshusen ward um das J. 1562 von Ulrich Maltzan (1549 † 1578) auf Grubenhagen, wahrscheinlich auf einem Theile der alten Feldmark Papenhagen, gegründet. Das alte Schloß brannte im J. 1624 aus. Das Thorhaus mit der Zingel steht aber noch seit der Zeit der Erbauung unverändert, Es ist im Styl der fürstlichen Schlösser


|
Seite 458 |




|
zu Wismar, Schwerin und Gadebusch mit Reliefbildern aus gebranntem Thon geziert. Neben den Inschriften über die Erbauung steht das maltzansche Wappen und das Wappen der Gemahlin Ulrichs Maltzan, gebornen Margaretha von Kardorff, und über den beiden Wappen zwei Mal ein Medaillon mit demselben männlichen Brustbilde in Relief aus gebranntem Thon; ohne Zweifel ist dies das Bild des Erbauers Ulrich Maltzan. Der Herr Reichsfreiherr A. v. Maltzan auf Peutsch hat von diesem Bilde eine Form nehmen und dem Vereine einen Gypsabguß derselben geschenkt, der auch für die Geschichte der Kunst nicht unerheblich ist da die Reliefplastik des 16. Jahrhunderts hohe Beachtung verdient.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Denktafel in der Kirche zu Dambeck.
Der Herr Pastor Fredenhagen zu Dambeck bei Grabow übergab dem Vereine eine in der dortigen Kirche am Altare befestigt gewesene eichene Tafel, von ungefähr 2 1/2' Länge und 2' Breite, auf welcher mit etwas unförmlichen, großen Buchstaben erhaben eingeschnitzt steht;
1. 5. 4. 9.
J. (N.) D. (N.) D.
AHIM. SKREDER.
HERTEN. STOLTE.
B. D. K. W. S. G. W. B. E.
MESTER. PAWEL.
Die zweite Reihe enthält wohl die Anfangsbuchstaben einer Segensformel, wie: In nomine domini etc., oder dgl. Der zweite und vierte Buchstabe ist undeutlich, vielleicht ein N oder C. - Die beiden folgenden Zeilen enthalten wohl die Namen der Kirchenvorsteher, die letzte Zeile den Namen des Verfertigers (des Altars?). Unten ist die Tafel defect. Die letzte Zeile enthält wohl einen Segensspruch für die beiden Kirchenvorsteher, etwa so:
Befelhebber Desser Kerken Welker Seelen Gott Welle Bewaren Ewigliken
oder dergleichen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 459 |




|



|


|
|
:
|
Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock.
Im Steinthore der Stadt Rostock, im Thorflügel Eingangs der Stadt linker Hand, findet sich folgender Spruch eingeschnitten:
KREDIT. IS. REINE. MVSDOT. IN. DISER.
STAD.
ANO. 1648.
Man erzählte neulich dabei, dieser Einschnitt sei von - Hugo Grotius gemacht.
Stavenhagen.
Dr. Jenning.


|
Seite 460 |




|



|


|
|
:
|
IV. Zur Münzkunde.
1. Der vorchristlichen Zeit.
a. auswärtiger Völker.
Römische Münzen.
Die Sammlung des Vereins besitzt bereits mehrere römische Münzen, welche in Meklenburg gefunden sind, und die eine vorgeschichtliche Verbindung mit den Ländern, die im Besitze der Römer waren, beweisen; auch das letzte Jahr hat wieder eine solche gebracht, ein Geschenk des Herrn Pastors Ritter zu Vietlübbe, welcher aber nur die Nachweisung zu geben vermochte, daß sie bei Wittenburg gefunden sei. Es ist ein sehr wohl erhaltener Denar des Kaisers Gordianus (238-244) und hat auf der HS.
das links gekehrte Brustbild mit einer Strahlenkrone, und auf der RS.
die Göttin rechts gekehrt auf einem Stuhle sitzend, indem sie die rechte Hand ausstreckt und in der zurückgewandten linken eine undeutliche Figur (Spinnrocken?) hält.
G. M. C. Masch.



|


|
|
:
|
b. einheimischer Völker.
Der Münzfund von Remlin aus dem 10. - 11. Jahrhundert.
Dieser Münzfund, enthaltend 124 Stücke und außerdem noch die Bruchstücke von etwa 12 andern, vom Herrn v. Kardorff auf Remlin, zugleich mit den dabei gefundenen Schmucksachen (vgl. oben S. 390 flgd.) geschenkt, gehört unstreitig zu den wichtigsten, welche der Sammlung des Vereins zu gute gekommen sind denn wenn sie auch bereits einzelne in die angegebene Zeit fallende Münzen besitzt, so ward ihr doch noch keine so bedeutende Anzahl derjenigen Gepräge zu Theil, welche in der letzten Zeit des Heidenthums in Meklenburg in Umlauf waren.
Eine große Menge dieser Münzen ist so recht eigentlich zum Gebrauche der noch heidnischen Völker geschlagen, die sogenannten Wendenpfennige, von denen sich hier nur die


|
Seite 461 |




|
kleinere Art, (nach Mader Münzmesser 10, und etwas über 1/16 Loth schwer) findet. Die benachbarten geistlichen Fürsten, besonders Magdeburgs Erzbischöfe brachten ihren heidnischen Nachbaren, wenn auch noch nicht das Christenthum, so doch christliche Formen in dem Kreuze, mit dem sie die Münzen bezeichneten, in dem Worte CRUX, das sie darauf setzen ließen, und in dem Hirtenstabe, den sie so gern über sie hätten strecken wollen, wenn's nur gegangen wäre. Von denen, welche die Andeutung von Magdeburg enthalten, findet sich in diesem Funde, obgleich fast so viele Stempelverschiedenheiten sind, als einzelne Stücke, keines.
Ferner beweiset dieser Fund, wie weit ausgebreitet der Münzverkehr im Innern Deutschlands schon damals war; aus entfernten Gegenden finden sich hier Gepräge vom Rhein und aus Friesland. Dagegen finden sich die, auch bei uns gar nicht selten vorkommenden ottonischen Münzen hier gar nicht, obgleich unser Fund später fällt, als die ottonische Zeit.
Zur Bestimmung der Zeit unseres Fundes geben folgende Münzen einen Haltpunkt, die daher hier zuerst erwähnt werden müssen:
| 1) | HS. | In einem Kreise ein Brustbild rechts gekehrt, von der Umschrift ist nur - - v - x zu erkennen. |
| RS. | im Kreise ein schwebendes Kreuzchen, von der Umschrift nur unkenntliche Spuren. |
Diese Münze des Herzogs Bernhard von Sachsen (973-1011 v Idus Febr.) ist schon längst bekannt und nach einem besser erhaltenen Exemplar bei Seeländer zwölf Schriften t. C. p. 117, abgebildet: da lautet die Umschrift: Bernhardus dux und auf der Rücksseite: in nomine DNI IHC.-
| 2) | HS. | Stehendes Bild im Mantel BRACIS - - DVX |
| RS. | ein stehender Vogel SCSW - LAVS. |
Eine nicht selten vorkommende Münze des Herzogs Bretislaus I. von Böhmen 1037-1055. Jahresbericht V, S. 136.
| 3) | HS. | Eine aufgehobene rechte Hand mit einem Stäbchen durch die Finger - - - NRI - - - |
| RS. | Ein Kreuz mit 4 Kugeln in den Winkeln - - E B V. - - (Hinricus und Luneburg. |
Eine Münze, welche in die Zeit des Kaisers Heinrich II, also 1002-1024, zu setzen ist.


|
Seite 462 |




|
Wir haben also die Zeit von 973-1055 als die erkennbaren Punkte des Anfangs und Endes gegeben, und in diese Zeit fallen demnach die
Diese, welche sich alle durch den hoch aufstehenden, scharfen Rand auszeichnen, zerfallen in folgende Classen:
I. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz in einem Perlenkreise; auf der Rückseite im Perlenkreise ein Kreuz und in jedem Winkel ein Ring.

Abweichungen sind auf der Hauptseite im rechten Oberwinkel ein halber Ring, oder ein Punkt, oder im linken Unterwinkel ein halber Ring, in dem ein Punkt; - auf der Rückseite ist statt des Ringes im linken Oberwinkel ein Kreuzchen, oder die Ringe im rechten Ober= und linken Unterwinkel sind gefüllt.
Die Umschrift der Hauptseite enthält das Wort
crux, jeden Buchstaben von dem andern durch 2
Striche getrennt:
 jedoch folgen sich die Buchstaben
nicht immer in dieser Ordnung, sondern auch
jedoch folgen sich die Buchstaben
nicht immer in dieser Ordnung, sondern auch
 oder
oder
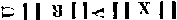 Die Zeichen der Rückseite sind: -
Die Zeichen der Rückseite sind: -
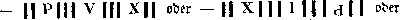
 . Die Zahl der zu dieser Form
gehörenden beläuft sich auf 34 in 13
Stempelverschiedenheiten, 3 Exemplare sind unkenntlich.
. Die Zahl der zu dieser Form
gehörenden beläuft sich auf 34 in 13
Stempelverschiedenheiten, 3 Exemplare sind unkenntlich.
II. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz in geperltem Kreise, auf der Rückseite in gleichem Kreise ein Kleeblattkreuz.

1) Das Ständerkreuz hat kein Beizeichen. Die Umschrift der Hauptseite ist:
,


|
Seite 463 |




|
die der Rückseite ist:
, wo also das Crux deutlich hervortritt. Es sind hiervon 5 Exemplare in 4 Stempelverschiedenheiten vorhanden.
2) Im rechten Ober= und im linken Unterwinkel des Ständerkreuzes ist ein Punkt, in den beiden andern Winkeln ein auswärts gekehrter halber Ring mit einem Punkte darin.
Die Umschrift der Hauptseite ist beständig dieselbe:

Die der Rückseite wechselt:

Zwölf Zeichen sind bei allen auf beiden Seiten.
Davon finden sich 34 Exemplare in 25 Stempelverschiedenheiten, 5 sind zerbrochen oder unkenntlich.
3) Im rechten Ober= und linken Unterwinkel des Ständerkreuzes ist ein auswärts gekehrter Ring mit einem Puncte, in den beiden andern Winkeln ein Punkt.
Die Umschrift ist auf der Hauptseite der der
vorigen gleich, jedoch findet sich auch bei drei
Exemplaren die Abweichung, daß in die 10. Stelle
das E gestellt wird, wogegen in die 4. das
gestürzte R kommt, auch hat ein nicht sehr
deutliches Exemplar in der ersten Stelle ein C
und in der 10. ein
 . Die Rückseite ist
. Die Rückseite ist
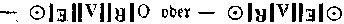 bezeichnet, bei 2 steht in der
ersten Stelle ein liegendes
bezeichnet, bei 2 steht in der
ersten Stelle ein liegendes
 , jedoch sind gerade hier nicht
alle Zeichen erkennbar. Von dieser Form finden
sich 14 Exemplare, von denen 3 zerbrochen und
unkenntlich sind in 9 Stempelverschiedenheiten.
, jedoch sind gerade hier nicht
alle Zeichen erkennbar. Von dieser Form finden
sich 14 Exemplare, von denen 3 zerbrochen und
unkenntlich sind in 9 Stempelverschiedenheiten.
III. Auf der Hauptseite das Ständerkreuz mit den Punkten und Kreisen wie II. 2., auf der Rückseite ein aufrecht gestellter Bischofsstab.
Auf der Hauptseite ist die Umschrift der vorigen
gleich, jedoch ist das erste Zeichen nicht zu
erkennen. Auch die Zeichen der Rückseite sind
nicht alle klar, jedoch ist das
V
in der
7. Stelle deutlich, der Anfang scheint ein
 zu sein. Es sind davon 2
Exemplare desselben Stempels gefunden.
zu sein. Es sind davon 2
Exemplare desselben Stempels gefunden.
Eine Abweichung, wo das Ständerkreuz kein
Beizeichen und der Bischofsstab zwischen
 (verstümmelte Nachbildung des A
Ω
) steht, hat
auf der Hauptseite die Umschrift des vorigen,
auf der Rückseite
(verstümmelte Nachbildung des A
Ω
) steht, hat
auf der Hauptseite die Umschrift des vorigen,
auf der Rückseite
 . Es ist nur ein Exemplar davon vorhanden.
. Es ist nur ein Exemplar davon vorhanden.
IV. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz mit Punkt und Halbkreis in den Vierteln. Auf der Rückseite ein von oben nach unten durch=


|
Seite 464 |




|
gehendes Kreuz, dessen Spitze und Querbalken in
dem obern Umschriftkreise liegen und mit
Knöpfchen geziert sind; in der untern Hälfte
etwa ein Viertel des ganzen Raumes ausfüllend,
hängt an dem Kreuze ein Tuch, welches mit 6
herabhangenden Kugeln verziert ist. In der
rechten Hälfte des innern Raumes ist ein
 und darunter ein
und darunter ein
 in dem linken obern Viertel ein
Halbkreis mit einem Punkte darin.
in dem linken obern Viertel ein
Halbkreis mit einem Punkte darin.
Die Umschrift der Hauptseite ist
 (ein Bischofsstab)
(ein Bischofsstab)
 , die der Rückseite
, die der Rückseite
 (Bischofsstab)
(Bischofsstab)
 . Hievon sind 3 von demselben
Stempel, ein viertes Exemplar von einem andern
Stempel ist sehr undeutlich, ein 5tes
zerbrochenes weicht mehr ab und hat statt des
. Hievon sind 3 von demselben
Stempel, ein viertes Exemplar von einem andern
Stempel ist sehr undeutlich, ein 5tes
zerbrochenes weicht mehr ab und hat statt des
 ein liegendes
ein liegendes
 .
.
V. Ein Ständerkreuz mit Punkt und Halbkreis in den Winkeln. Auf der Rückseite ein Kreuz von 4 Ringen, in denen ein Punkt ist, umgeben darunter A. 0.
Die Umschrift dieser Nachahmung durch einen
benachbarten geistlichen Fürsten ist zu Anfang
verwischt, dann kam
 . Die Rückseite
. Die Rückseite
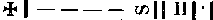
VI. Ein Ständerkreuz im geperlten Rande, auf der Rückseite ein Kirchenportal.
Die Umschriften dieser offenbar Kaisermünzen
nachgeformten Münzen sind verschieden:
 und auf der Rückseite
und auf der Rückseite
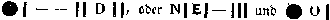 (hakenförmige Figur),
(hakenförmige Figur),
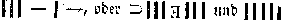 , (Haken)
, (Haken)
 ; bei 5 andern geben sie eben so
wenig einen Sinn und sind überdies sehr verwischt;
; bei 5 andern geben sie eben so
wenig einen Sinn und sind überdies sehr verwischt;
VII.
Ein Kreuz im Kreise; auf der
Rückseite ein Halbmond, darin ein Kreuz,
darneben ein A und darunter ein liegendes
 mit einem Striche durchzogen.
mit einem Striche durchzogen.
Die Umschrift dieser vielleicht im ganzen Funde
seltensten Münze ist auf der Hauptseite
 unverständlich, die Rückseite
aber giebt den Namen
SCS ADAL
unverständlich, die Rückseite
aber giebt den Namen
SCS ADAL
 .
.
Die nicht norddeutschen Münzen, welche dieser Fund enthielt, und deren Bestimmung der Herr Dr. Köhne in Berlin zu übernehmen die Gefälligkeit hatte, sind folgende:
I. Cöln .
| 1) | HS. |
+ (OD). DO
 MRVN Kreuz im Perlenrande
von 4 Kugeln begleitet.
MRVN Kreuz im Perlenrande
von 4 Kugeln begleitet.
|


|
Seite 465 |




|
| RS. | Das bekannte S. Colonia, das letzte A zwischen einem C und einem Kreuzchen (wahrscheinlich Otto I.). |
| 2) | HS. | Ein Kreuz, von 4 Kugeln begleitet, im Perlenrande. Von der Umschrift ist nur ein (Henricus ?) zu erkennen. |
| RS. | S. Colonia. | |
| 3) | HS. | Ein Kreuz im Perlenrande. Von der Umschrift ist zu erkennen O H │ O. |
| RS. | S. Colonia, in jedem der 4 Winkel 3 Punkte (wahrscheinlich rohe niederdeutsche Nachbildung eines cölnischen Originals). | |
| 4) | HS. | +HORVMEO. In einem Kreuze in dem Felde der Münze N ILIGI R |
| RS. | ENVOR. Ein Kirchengebäude, worin LR NA. Eine Nachahmung der Gepräge des Bischofs Piligrim von Cöln; s. Köhne Zeitschrift III. p. 141, b. |
II. Mainz (?).
| 5) | HS. | . . HE . . . X Im Perlenrande ein Kreuz, durch ein Bischofsstab schräg links gesteckt ist, in den beiden andern Winkeln rechts ein O mit einem Punkt in der Mitte, links ein W, unter jeder Figur ein Punkt. |
| RS. |
Züge, welche auf civitas mo -
hindeuten. Im Perlenrande ein
Kirchenportal zwischen C und
 .
.
Ob Original oder Nachbildung, steht dahin. |
III. Speier.
| 6) | HS. | (Nemetis) CIVITAS: eine Kirche auf einem Schiff. |
| RS. | . . . RICVS . . Im Perlenrande, wie es scheint, ein Kreuz mit unkenntlichen Beizeichen. (von Dr. Köhne als höchst selten bezeichnet.) |
IV. Duisburg.
| 7) | HS. | Ein aus doppelten Kreislinien gebildetes Kreuz, in dessen Mitte ein Kreuzchen und in dessen Winkeln DI RG VS AD. |
| RS. |
+AIH
 - AG. Im Perlenrande ein
Kreuz von 4 Punkten begleitet.
- AG. Im Perlenrande ein
Kreuz von 4 Punkten begleitet.
|
V. Deventer.
| 8) | HS. | Im Kreise REX. Die Umschrift scheint die Züge von Henricus zu enthalten. |


|
Seite 466 |




|
| RS. | Ein Kreuz von 4 Kugeln begleitet, die Umschrift scheint auf Daventrie hinzuweisen. | |
| 9) | HS. | HEINRICVS . . Ein bärtiges Gesicht. |
| RS. |
eine Kirchenfahne von 4 Lätzen, von der
Umschrift ist
+ ││ . .
. .
 AH
erkennbar.
AH
erkennbar.
|
|
| 10) | Bild wie voriges, von der Umschrift ist kein Zug erkennbar. Von dieser Form sind noch 3 Exemplare von verschiedenen Stempeln vorhanden. |
VI. Remagen.
| 11) | HS. | HS. RIGIM (ago), Brustbild eines Kaisers. |
| RS. | + SCA COLO MAG (sehr selten). |
VII. Utrecht.
| 12) | HS. | (Bern) OLDS EPI. Ein vorwärts gekehrtes Brustbild. |
| RS. | + BERNOLDS. Im Kreise ein Kreuz von 4 Kugeln begleitet. |
VIII. Thiel.
| 13) | HS. | . . NRICVS gekröntes Brustbild. |
| RS. | . . OLO und darunter ein Strich mit einem Haken daran | |
| 14) | HS. | Brustbild eines Bischofs, an jeder Seite ein Hirtenstab; von der Umschrift ist nichts erkennbar, als OI. |
| RS. | Ein Kreuz mit 4 Kugeln umgeben. In der Umschrift erkennt Herr Dr. Köhne bona Tiel. |
IX. (Deutsche Münzen , fränkischer Fabrik).
| 15) | HS. | ein Kirchengebäude. |
| RS. | Ein Kreuz mit Kugeln, von der Umschrift ist EI zu erkennen. Die Münze ist sehr undeutlich. |
X. Unbekannte Münzen.
| 16) | Die bereits Jahresberich III, p. 105, n. 18. beschriebene Münze. | |
| 17) | HS. |
Eine aus 4 gegen einander gekehrten
Bogen gebildete Figur, in deren Mitte
ein
 ; in den Bogen und in
jedem Zwischenraum derselben ein
; in den Bogen und in
jedem Zwischenraum derselben ein
 .
.
|
| RS. |
Ein Kreuz, in den beiden obern Winkeln
A O
, im dritten 2 Punkte, im
vierten ein Ring; von der Umschrift ist
nur
+ A
 zu erkennen.
zu erkennen.
|
|
| 18) | HS. | ein Kopf über dem ein Halbmond, zur Seite ein Bischofsstab. + O. . . . │ |


|
Seite 467 |




|
| RS. | Ein Brückenbogen mit 2 Thürmen, in dem ein Kreuz. | |
| 19) | HS. |
Im Perlenkreise eine Figur, einem
Krückenkreuze mit Fuß ähnlich, von
dessen Armen zwei Spitzen herabhangen.
HI . . .

|
| RS. | Ein Kreuz mit Kugeln in den Winkeln. Lelewel III, p. 112. | |
| 20) | (Von einer andern Fabrik) ein gehelmtes Brustbild im Profil rechts gekehrt. | |
| RS. | Die Münze ist mit Buchstaben bedeckt, von denen SCA T ││ zu erkennen. |
G. M. C. Masch.
Der Münzfund aus der Gegend von Schwerin, aus dem 10. und 11. Jahrhundert
und das mit demselben gefundene Silbergeschmeide ist oben S. 388 flgd. beschrieben.



|


|
|
:
|
Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Eine Anzahl von 745 Münzen, welche zu Sukow bei Schwerin gefunden und an einen Goldschmid bereits verkauft worden war, wurde von diesem gefälligst zur Disposition gestellt, um daraus auszuwählen, was für die Sammlung des Vereins und für andere Samlungen nützlich sein könnte. Es ist geschehen und der Rest ist darauf eingeschmolzen worden. Dieser Fund bot, wenn auch gleich keine unbekannte Münzform, doch eine große Anzahl Stempelverschiedenheiten dar, und gab der Sammlung einen Zuwachs von 117 Stücken, worunter allein von den Sechslingen des Herzogs Albrecht 19 neue Gepräge sich fanden, von denen sehr viele bei Evers nicht verzeichnet sind, z. B. ein zu Güstrow geschlagener von 1529 und ein in Wittenburg geschlagener von 1528.
Die ältesen mit einer Jahreszahl bezeichneten Münzen dieses Fundes sind die pommerschen Schillinge von Gaarz von 1489. Die jüngste ist ein Groschen der Stadt Braunschweig von 1550. Die Hohlmünzen, welche sich in den Funden dieser Zeit noch immer den zweiseitigen beigemischt finden, waren die größeren meklenburgischen mit dem gereiften Rande und dem Büffelskopfe mit großem Maule, beide Formen mit und ohne heraushangender Zunge (gr. 12 nach Mader, 9 u. 8


|
Seite 468 |




|
Aß schwer), die Lübecker mit dem Doppeladler, die sehr bekannten Hamburger mit dem Nesselblatt und die Lüneburger mit dem Löwen in den Thoren ihrer Stadtzeichen. Von den holsteinischen Pfennigen war der ältere mit den beiden Balken bereits sehr defect, der neuere, welcher ein halbes Nesselblatt neben den Balken hat (S. Grote Münzzeitung II, tab. XIX, Nr. 284 u. 285), war gut erhalten; die brandenburgischen hatten einen Adler, von denen der eine einen Schild mit einem Zepter auf der Brust trägt.
Die Zahlverhältnisse dieses Fundes sind folgende:
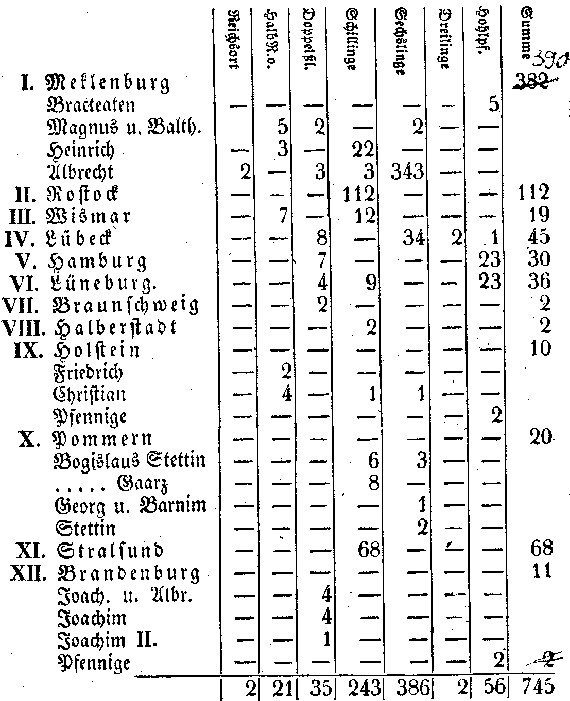


|
Seite 469 |




|



|


|
|
:
|
V. Zur Geschlechter= und Wappenkunde.
1. Zur Geschlechterkunde.
Familie von Maltzan.
Mit zwei Steindrucktafeln.
Die Familie von Maltzan besitzt 2 durch den Verein entdeckte, ausgezeichnete alte Leichensteine, in den Klosterkirchen zu Dargun und Rühn, welche in Lisch Urk. zur Gesch. des Geschlechts Maltzan, II, 1844, in Abbildungen mitgetheilt sind, von denen der Freiherr Albrecht von Maltzan auf Peutsch dem Verein eine Auflage für die Jahrbücher geschenkt hat.
1. Der Leichenstein auf dem Grabe der Ritter Heinrich und Ludolf Maltzan in der Klosterkirche zu Dargun.
Dieser Leichenstein ist zuerst in Jahresber. III, S. 176, zur Kunde gebracht und in Jahresber. VI, S. 97, genauer beschrieben. Die Maltzan hatten schon früh im östlichen Meklenburg und in Vorpommern Güter erworben und besaßen schon im Anfange des 14. Jahrhunderts Cummerow und Loiz, so wie das Dorf Upost bei Dargun, welches theils durch Schenkung, theils durch Kauf bald in den Besitz des Klosters überging. Daher hatten die Maltzan einen Altar in der Kirche zu Dargun und eine Familiengruft vor demselben. Der Altar ist verschwunden, der Leichenstein befindet sich jedoch noch an seiner alten Stelle, jetzt an der Wand aufgerichtet, im südlichen Kreuzschiffe, neben den Leichensteinen der Hahnschen Familie. In diesem Grabe ruhen:
a. der tapfere Ritter Heinrich I. Maltzan (1293 † 22. Dec. 1331), welcher in den wichtigen Begebenheiten im Anfange des 14. Jahrhunderts eine so große Rolle spielte und die Pfandherrschaft von Loiz erwarb;
b. der Ritter Ludolf III. Maltzan (1320 † 1 Junii 1341), Heinrichs I. Brudersohn und Nachfolger in der Herrschaft Loiz, der Stammvater der jetzt noch blühenden maltzanschen Linien; am 12. Nov. 1341 stifteten die Vormünder seiner Kinder Memorien an dem Altare seines Begräbnisses (vgl. Lisch Maltz. Urk. II, Nr. CCXXVIII).


|
Seite 470 |




|
Der Leichenstein ist gegen 12 Fuß lang und enthält innerhalb der Umschrift nur das schön gezeichnete maltzansche Wappen, Schild und Helm, von sehr ausgezeichneter Arbeit; der Leichenstein ist einer der werthvollsten im Lande. Die Umschrift lautet:
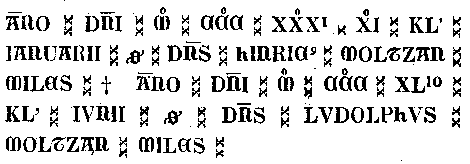
d. i.
Anno domini MCCCXXXI, XI kal. Januarii obiit dominus Hinricus Moltzan miles. Anno domini MCCCXLI, kal. Junii obiit dominus Ludolphus Moltzan miles.
2. Der Leichenstein auf dem Grabe des Ritters Barthold II. Maltzan und seiner Gemahlin Adelheid in der Klosterkirche zu Rühn.
Der Leichenstein ist zuerst in Jahresber. III, S. 161, erwähnt. Er deckt die Gebeine des Ritters Barthold II. Maltzan, des bekanntesten Maltzan aus der alten Linie Trechow. Diese Linie stammte wahrscheinlich von dem Ritter Friederich I. (1280-1314), dem ältesten Bruder des oben erwähnten Ritters Heinrich I.; Friederich I. war schon früh Burgmann zu Bützow und seine Linie besaß die Familiengüter im Lande Gadebusch und hatte Lehen im Lande und in der Stadt Bützow. Im J. 1316 kommt der Ritter Barthold I. vor. Barthold II. (1362 † 6. Dec. 1382 ) besaß unbezweifelt die bedeutenden Trechowschen Güter. Seine Linie starb am Ende des 14. Jahrhunderts mit seinem jungen Sohne Vicke und dessen unmündigen Kindern aus und ward durch eine Linie aus dem Hause Grubenhagen fortgesetzt.
Barthold II. Maltzan war als Knappe lange Zeit im Stifte Bützow wirksam. Nicht lange vor seinem Tode ward er Ritter, wahrscheinlich im Mai 1376, als er am 1. Mai d. J. mit dem Herzoge Albrecht von Meklenburg und dessen Söhnen zu Weiden beim Kaiser Carl IV. war. Daher war er im J. 1382 nach Urkunden unbezweifelt Ritter. Deshalb ist er auf dem Leichensteine noch als Knappe (famulus) aufgeführt, das Wort miles (Ritter) aber nachträglich eingegraben.


|




|
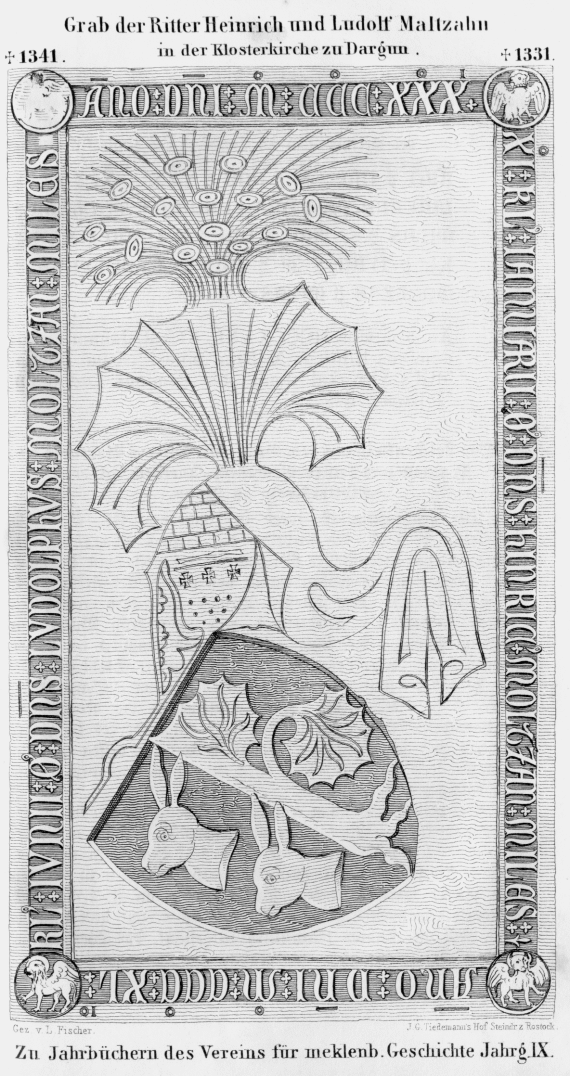


|




|
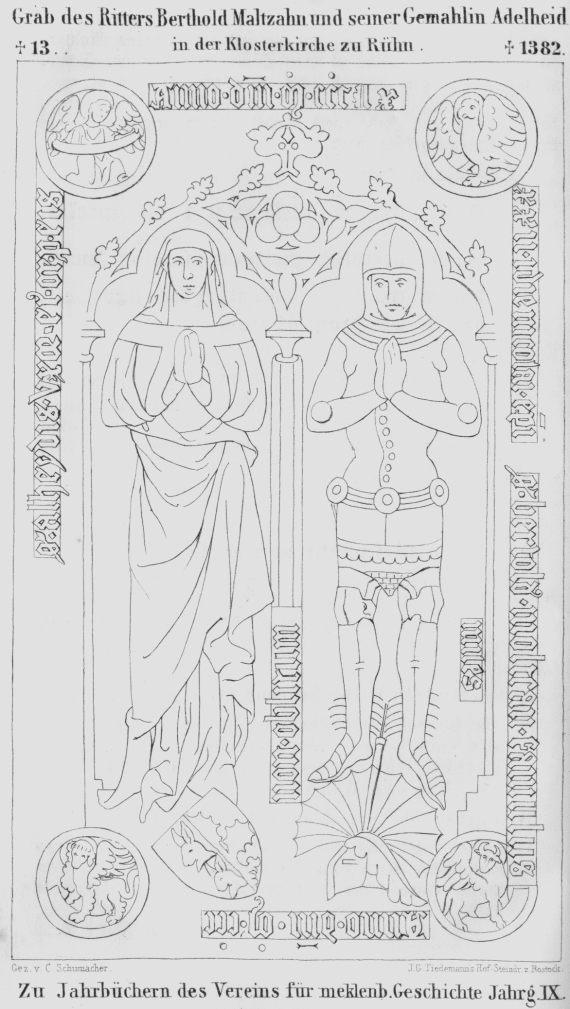


|
Seite 471 |




|
Seine Gemahlin war ohne Zweifel eine geborne Maltzan, da auf dem Leichensteine zu ihren Füßen der maltzansche Schild, zu den Füßen ihres Gemahls der maltzansche Helm steht.
Der Stein ist sicher schon bei Lebzeiten der Frau gelegt, da für Tag und Jahr ihres Todes Raum gelassen ist, der später nicht ausgefüllt ward.
Die Inschrift lautet:
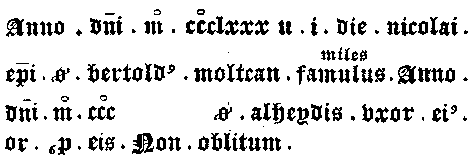
d. i.
Anno domini M°CCC°LXXXII, in die Nicolai episcopi obiit Bertoldus Molcan (famulus) miles. Anno domini M°CCC° obiit Alheydis, uxor ejus. Orate pro eis. Non oblitum.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Geschlecht von Hobe.
Zu den Siegelbändern einer im großherzoglichen Archive zu Schwerin aufbewahrten Urkunde (Verkauf von Siden=Remplin), d. d. fer. IV infra oct. Paschae 1363 , ist eine Urkunde, wahrscheinlich ein Concept, zerschnitten. Der Inhalt der Streifen ist:
1) Ich Dydrik Hůbe bekenne vor allen gůden luden
2) dhe hebben deghedinghet tuschen Vykke Babben vnde synen rechten erfnamen. Dat loue ich Tyteke Hůbe, dese Gories Huben sone was, Vikken Babben
3) moghen, dat ich al dat wil holden, des mynen
4) vnde Volrat Klynte, dese eyn ratman is tůme
Kalande, tů Vykke Babben hand vntrovwen stede vnde (hier hört der Text innerhalb der Zeile auf).
G. C. F. Lisch.


|
Seite 472 |




|



|


|
|
|
2. Zur Wappenkunde.
Das Petschaft des letzten von Lübberstorf
geschenkt vom Herrn von Buch auf Zapkendorf. Ein in einem silbernen Gehänge hangender dreiseitiger Krystall, auf einer Seite mit dem Wappen: einem silbernen Wolfseisen (oder Doppelhaken) in rothem Felde und zwei goldenen Heugabeln zwischen drei silbernen Federn auf dem Helme, auf der zweiten Seite mit den verschlungenen Buchstaben v. L.; die dritte Seite ist leer.
Nach v. Gamm's genealog. Nachrichten war der letzte des Geschlechts: Ludwig Christoph, königl. dänischer Land= und Regierungs=Rath zu Glückstadt, geb. 1712, † 1759.


|
Seite 473 |




|



|


|
|
:
|
VI. Zur Sprachkunde.
Der christlichen Zeit.
Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato,
von
G. C. F. Lisch.
Einem Bande der ehemaligen Bibliothek der Marienkirche zu Rostock, Nr. 232, jetzt auf der Universitäts=Bibliothek, enthaltend: D. Dionysii Carthusiani in quatuor evangelistas enarrationes, Cölln, 1532, ist vorne und hinten ein Bruchstück eines plattdeutschen Gedichts angebunden. Das Bruchstück besteht aus 2 Bogen Pergament kl. Fol., mit 2 Columnen auf jeder Seite, im Ganzen also aus 16 Columnen, jeder von 31 Zeilen, im Ganzen also 496 Versen. Die Schrift stammt aus dem Anfange des 14. Jahrh. Das Gedicht ist eine Uebersetzung der Sprüche des Dionysius Cato (vgl. v. d. Hagen und Büsching Literarischer Grundriß zur Geschichte der deutschen Poesie, S. 396) und das Fragment enthält die Uebersetzung der Sprüche III, 20 und 21. Hier einige Proben:
Inter conuiuas fac sis sermone modestus,
ne ditare loquax, dum uis bonus esse, videri.
Werstu wor, to werscap beden,
so wes houesch in dinen reden,
dat men di clepisch en scriue,
noch neyn vntůch van dinem liue
wert gesecht, wan du vult sin
eyn houesch man in tůchten fin.
Coniugis irate noli tu uerba timere,
nam lacrimis struit insidias, dum femina plorat.
Nym nicht to herten noch to oren
dines wiues bose torn;
wan dat wif sere weynet,
nicht gudes se denne meynet,
so legget se der manne lage
vnde wil dat er de man vrage,
wor se vmme weynet vnde wat er sy.
Ic wil id di beteren, sege my,
he scal spreken, so antwordet se,


|
Seite 474 |




|
O we myn man, my is so we,
dat ic nv steruen mut,
ic hadde dat my were gut,
lutter dranc vnde sote crude.
Aldus seget my delude.
Eine andere Stelle lautet:
Rebus in incensu si non est, quod fuit ante,
fac iuuas contentus co, quod tempora prebent.
Heuestu to voren groten scat
van houen vnde van lande gehat,
is dat alle van di gleden,
bliue io in gůden seden
vnde leue, also di de tid to secht,
so důstu dinem dinge recht,
oc heuestu dicke wol vornomen,
wor was water, dar mach water komen.
Vxorem fuge ne ducas sub nomine dotis,
nec retinere uelis, si ceperit esse molesta.
Nym ein wif nicht vmme gůt,
also mennich mynsche důt;
is dat er en andere voget,
dar mede gif er dine doget;
wil se ut der echtescap treden,
also men leyder vint in vele steden,
du scalt di van er sceyden
vnde kuschliken din leuent leyden.


|
Seite 475 |




|
VII. Zur Schriftenkunde.
1. Der Urkunden.
Der Verein erhielt zum Geschenke an Urkunden:
I. Von dem Herrn von Oertzen auf Roggow eine Urkunden=Sammlung aus dem Nachlasse des wail. Hofmarschalls von Oertzen, bestehend aus folgenden Original=Urkunden :
1) 1387. Julii 2. (in d. dage Processi vnd
Martiniani)
Claus Stüve verkauft an
Gottschalk Bassewitz drei freie Hufen und eine
Hofstätte zu Starkow mit den dazu gehörenden
Kathen zu Lehnrecht.
2) 1390. Junii 2. (in des h. lichemmes
daghe.)
Der Knappe Henneke Bůk
verpfändet an Claus Bassewitz Knappen mehrere
Hebungen aus dem Dorfe Kowalz und der Schmiede
und dem Kruge zu Thelkow.
3) 1392. Sept. 19. (donredages vor s. Matheus d.)
d. d. Wismar.
Der Herzog Johann d. J. von
Meklenburg giebt im Namen des Königs Albrecht
dem Busse von Kalant die Erlaubniß, das halbe
Gut Stove, welches seine Frau, Gottschalks von
Stove Tochter, von ihrem Vater geerbt hat, zu
verkaufen oder zu verpfänden.
4) 1399. Jan. 5. (in d. hilg. drier koninge
avende.)
Der Schweden=König und Herzog
Albrecht und der Herzog Johann von Meklenburg
geben dem Heinrich Bützow für seine Dienste und
den Schaden, den er in denselben genommen, allen
Anfall, den die Fürsten von 6 Hufen in dem Dorfe
Selpin im Lande Gnoyen, welche die Frau
Bonensack besitzt, zu erwarten haben.
5) 1400. Nov. 27. (des sunauendes na. s.
Katherinen.) d. d. Doberan.
Der
Schweden=König Albrecht und Johann, Herzoge von
Meklenburg, bekennen, daß sie Henneke Moltke an
dem Gute, welches dem Ritter Nicolaus Buk gehört
hatte, nicht hindern, ihn bei allen Rechten an
der Mühle zu Gnoyen lassen und ihm 6 Jahre
Geleit geben wollen.


|
Seite 476 |




|
6) 1403. Jan. 5. (in d. heil. drierkoninghe
auende.)
Curt Bützow d. A. verpfändet an
Claus Bassewitz 20 lüb. Mark aus dem Dorfe
(Wurdelstorp) Wohrenstorf.
7) 1405. Mai 13. (in s. Servacius daghe.)
Barold Brytzekow verkauft an den Knappen Curt
Bützow seine Güter zu Rethemisse.
8) 1410. Dec. 14. (mandaghes na s. Lucien daghe.)
d. d. Cummerow.
Der Magister und
Baccalaureus Marquard Westphal leistet Gherd und
Gherd Bassewitz, Claus und Gottschalk's Söhnen,
für seine Gefangennehmung Urfehde und stellt die
Entscheidung über Schuldbriefe der Bassewitze an
ihn auf den Herzog Johann von Meklenburg.
9) 1428. Dec. 13. (in s. Lucien daghe.)
Gherd Bassewitz d. A. zu Bassewitz verpfändet an
Margarethe Kerkhof, Barthold Kerkhofs Wittwe,
die Bede aus Prangendorf.
10) 1435. Febr. 4. (in s. Agathen auende.)
Hermann von Oertzen zu Kl. Tessin verkauft an
Gherd Bassewitz zu Bassewitz die halbe Gheltes=Mühle.
11) 14(4)7. Sept. 29. (am d. s. Michaelis.) d. d.
Schwerin.
Der Herzog Heinrich von
Meklenburg bezeugt, daß Laurentius (Pren) zu
Pantenitz an Lutke und Vicke Bassewitz sein Gut
laut des Kaufbriefes aufgelassen habe.
12) 1448. Julii 25. (in s. Jacopes daghe.)
Werner Marsow und sein Sohn Werner zu
Zahrenstorf im Bisthume Ratzeburg verkaufen an
Gherd Bassewitz das ganze Dorf Schilt zwischen
den Wassern Schale und Dobersche.
13) 1455. April 13. (am sondage Quasimodogeniti.)
d. d. Wismar.
Der Herzog Heinrich von
Meklenburg verpfändet an Johann, Hans, Lüdeke,
Claus und Vicke Bassewitz, Brüdern, 8 Mk. lüb.
aus dem Walle zu Meklenburg.
14) 1455. Nov. 6. (an dem donredage na aller
hilgen d.) d. d. Schwerin.
Der Herzog
Heinrich von Meklenburg erlaubt dem Vicke
Bassewitz, dem Kloster Marienwolde,
Brigitten=Ordens, bei Mölln, das Dorf Wendorf in
dem Kirchspiele Mühlen=Eixen zu versetzen und zu verkaufen.


|
Seite 477 |




|
15) 1458. Oct. 31. (am avende aller godes
hiligen.) d. d. Meklenburg.
Der Herzog
Heinrich von Meklenburg erlaubt seinem Rathe
Vicke Bassewitz, 8 Mk. Bede aus Rugensee von den
Raven zu Stük zu lösen.
16) 1462. Sept. 21. (an s. Matheus daghe.)
Die Brüder Gherd und Joachim Bassewitz, des
seel. Gherd Bassewitz Kinder, verpfänden ihren
Vettern, Johann, Hans, Lütke und Vicke Bassewitz
das Dorf Weitendorf im Kirchspiele Camin, das
Dorf Wohrenstorf in demselben Kirchspiele, das
Dorf Selpin in dem Kirchspiele Vilz und die
halbe Gheltes=Mühle.
17) 1462. Dec. 13. (in s. Lucien daghe.) d. d.
Bützow.
Der Knappe Dedewich Karin zu
Bützow, sonst zu Alt=Karin wohnhaft, verkauft
erblich den Knappen Hardenack Bibow zu Eickhof
und Wipert Bibow zu Westenbrügge seine
altväterlichen Güter zu Alt=Karin.
18) 1471. März 12. (des dinxtedages vor s.
Getruden.)
Die Brüder Hans und Henning
Preen und Henning Preen, alle zu Jesendorf,
vertauschen an Claus Bassewitzen zu Turow ihre
Güter zu Turow gegen seine Güter zu Jesendorf.
19) 1477. März 11. (am avende s. Gregorii.) d. d.
Wismar.
Die Herzoge Albrecht, Magnus und
Balthasar von Meklenburg bestätigen urkundlich
den Verkauf von 64 Mk. Hebungen aus den Gütern
Reinsdorf und Moltekow und das ganze Dorf
Moltekow von den Brüdern Henning und Wipert
Stralendorf an den Burgemeister Dietrich Wilde
zu Wismar, welchen Verkauf der Herzoge Vater ein
Jahr vor seinem Tode bestätigt, aber noch nicht
verbrieft gehabt.
II. Von dem Herrn Bagmihl zu Stettin Abschrift der Urkunde von:
1274. März 12. (die Gregorii p.)
Der Fürst Nicolaus von Werle verleiht den Brüdern Bernhard und Heinrich von Peccatel und ihren Erben zu gesammter Hand ihre Güter in der Vogtei Penzlin: Lupeglow, Zippelow, Zieritz, Stribbow, Peccatel, Vilen, Kolhasen=Vilen, Brusmersdorp und Lankavel mit allen Gerechtigkeiten Patronaten, Seen und Mühlen, mit dem großen und kleinen See von Vilen, mit der Mühle von Penzlin und der Trendecops=Mühle, so wie den Brüdern Bernhard und Heinrich von Peccatel und dem Ritter Raven zu gesammter Hand die Güter Lubbechow, Vilen und Zahren.


|
Seite 478 |




|
III. Von dem Herrn Revisionsrath Schumacher zu Schwerin Abschriften von folgenden Urkunden:
1) 1298. Jan. 24. (vigilia convers. Pauli.)
Der Fürst Nicolaus von Werle verleiht dem
Kloster zum Heil. Kreuz zu Rostock zu
Vasallenrecht das Dorf Dolgen, welches das
Kloster von dem rostocker Bürger von der Mölen
gekauft hat.
2) 1598. Dec. 30.
Visitations=Bericht über
die dem Kloster zum Heil. Kreuz gehörenden Dörfer.
3) 1605. März 6.
Visitations=Beschluß über
die Zahl und die Aufnahme der Jungfrauen in das
Kloster zum Heil. Kreuz.
4) 1659. Junii 30.
Provisorats=Beschluß über
die Aufrechthaltung der revidirten
Kloster=Ordnung vom J. 1630 und die Abstellung
einiger eingeschlichener Mißbräuche.
IV. Von einem Ungenannten Abschrift der Urkunde von:
1473. Dec. 20. (in s. Thomas avende.)
Der Knappe Dethlef Basse verpfändet dem Kloster zum Heil. Kreuz in Rostock 12 Mk. sund. Hebungen aus dem Dorfe (Hohen) Luckow.



|


|
|
:
|
Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter.
Der Herr Ingenieur Lierow aus Parchim hat dem Vereine ein katholisches Gebetbuch aus dem 15. Jahrh., auf Pergament geschrieben, geschenkt. Dasselbe gehörte, den Mittheilungen zufolge, einem französischen Hauptmanne, der es auf dem Rückzuge der Franzosen zurückließ; hierfür redet eine Bemerkung, welche in den neuesten Zeiten auf die 6. Seite des Textes eingeschrieben ist:
Angele, qui meus es costos, pietate superna me tibi commissum serva, defende, guberna. MDCCCXIV, die libertatis Hamb. restitutae, Gallis e Germ. expulsis et tyran. Napoleone dethron. et in insulam Elbam relegato.
Es kam darauf in den Besitz des wail. Superintendenten Block zu Ratzeburg, auf dessen Bücher= Auction Herr Lierow es erstand.


|
Seite 479 |




|
Das Buch ist auf Pergament in 8. fest und hübsch geschrieben und stammt dem Anscheine nach aus dem 15. Jahrh., obgleich, namentlich in der ersten Hälfte die Schrift viel älter erscheint; es ist jedoch schon das spät aufgekommene Fest Compassio Mariae (vgl. Jahrb. IV, S. 47) aufgenommen, und hiernach und nach der ziemlich correcten Zeichnung muß man die Handschrift wohl in das Ende des 15. Jahrhunderts setzen. Es ist an den Eingängen der Hauptabschnitte mit sehr saubern Miniaturen geschmückt. Die großen Buchstaben sind in Gold auf rothen Quadraten geschrieben. Nach einem größern Gemälde, auf welchem eine Leiche von Nonnen begraben wird, scheint das Buch ehemals einem Nonnenkloster angehört zu haben. Voran steht ein Festkalender.
Die Handschrift ist der Malereien wegen nicht ohne Interesse. Die Initial=Miniaturen sind sehr sauber; besonderer Fleiß ist aber auf 3 größere Gemälde verwandt: die Verkündigung Mariä, die Kreuzigung Christi und das oben bezeichnete Begräbniß (zu dem letzten Abschnitte: Incipiunt uigilie mortuorum).
G. C. F. Lisch.


|
Seite 480 |




|



|


|
|
:
|
VIII. zur Buchdruckkunde.
Hinrici Bogher Etherologium
Rostock 1506.
In Jahrb. VI, S. 195 flgd., ward von dem Herrn Bibliothekar Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel die Entdeckung mitgetheilt, daß die Originale der kleinen Chroniken Nic. Marschalks von einem M. Heinrich Boger verfaßt sind und in einer Handschrift auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel aufbewahrt werden.
Seitdem ist eine für Meklenburg noch wichtigere Entdeckung gemacht, indem der Herr Dr. Schönemann ein bisher unbekanntes, gedrucktes Buch des genannten M. Heinrich Boger, und zwar in zwei Exemplaren, aufgefunden und den Austausch eines Exemplars an unsern Verein vermittelt hat. Es wird durch dieses Buch unsere Gelehrtengeschichte nicht wenig bereichert.
Hier zuerst die Beschreibung des Buches. Das Buch
ist in groß 8, jeder Bogen in einer Lage von 6
Bl., mit Sign. A bis Z und
 bis O, mit Folienbezeichnung 1
bis 229, gedruckt; vorangebunden sind 2 Bogen
Einleitungen mit Sign. a und b. Das Papier hat
theils das Wasserzeichen eines Einhorns, theils
eines
p
.
bis O, mit Folienbezeichnung 1
bis 229, gedruckt; vorangebunden sind 2 Bogen
Einleitungen mit Sign. a und b. Das Papier hat
theils das Wasserzeichen eines Einhorns, theils
eines
p
.
Der Titel lautet:
Etherologium Eximii et
disertissimi viri domini et magistri
Hinrici
Boger theologie doctor',
Ecclesie Colle
giate Sancti Jacobi
Rostochiensis
Decani, nō minus ad
legentiū eru
ditōz qz
solatiū ab eodē In ordi
nez
digestum Anno Christia
ne salutis
Quinto supra
Millesimumquingen
tesimum.
Auf der Rückseite des Titelblattes stehen zwei Gedichte:
Magistri Casparis Hoyger legum
doctoris Epigramma ad lectorem
und:
Epigramma magistri Bertoldi Moller
Ad lectorem preseferens argumentum tocius operis


|
Seite 481 |




|
und auf der dritten Seite zwei Gedichte:
Magsistri Johannis Rode Canonici
LubiceEpigramma ad lectorem
und:
Magister Tilemannus Neuerlingk
Ad lectorem.
Auf der vierten Seite beginnt das Register:
Directorium siue tabula in totū opu Hinricsi
Boger intitulatū Etherologium quasi alter
nis et variis carminibus congestum.
welches 16 Seiten einnimmt.
Die erste Seite des Werkes beginnt:
Ad Spectatissimū d
m. d. et magistrz
Nicolaum Scomacharium Decanum
Uerde. ppositūin lune etc. Epigramma.
Auf der letzten Seite steht:
Apologia seu apostrophe.
libri ad lectorem,
und am Ende der letzten Seite:
Finis vberrimi operis Heterologii Hinrici Boger, quod sollicitudine et hortatio ne Clarissimi viri z domini Nicolai Schomaker In lune prepositi etc. In ordinem redactum ē, Impssumqz Rostochii Anno salutis nostre, sexto supra millesimumquin gentesimum.
Das Buch ist zunächst durch den
merkwürdig: es ist im J. 1506 zu Rostock, mit denselben Lettern gedruckt, mit welchen Barthold Möller's Commentar zum Donat vom J. 1505 (vgl. Jahrb. IV, S. 79 und Druckproben das. Taf. II, Nr. 1a) gedruckt ist; das bisher unbekannt gebliebene Buch stammt also ohne Zweifel aus der Druckerei des rostocker Raths=Secretairs Hermann Barckhusen.
Dann hat das Buch durch seinen
einige Bedeutung. Der Verfasser war, nach dem in Jahrb. IV, S. 195, von Schönemann mitgetheilten Titel einer Rede, ein Zögling der Universität Erfurt, und daselbst Magister und Lehrer der Exegese, hatte also ohne Zweifel früher mit Nic. Marschalk in persönlicher Berührung gestanden (Jahrb. IV, S. 93 und 103); nach dem Titel des Etherologium war er


|
Seite 482 |




|
seit dem J. 1505 Lehrer der Theologie und Dechant des Dom=Collegiat=Stiftes an St. Jacobi zu Rostock und stand mit den meisten bedeutenden Männern Meklenburgs und Norddeutschlands in Verbindung. Das im Vorstehenden beschriebene Etherologium ist eine Sammlung der verschiedenartigsten Gedichte in lateinischer Sprache, welche viele Gedichte auf damals lebende Personen enthält.
Besonders interessant ist das Buch dadurch, daß es die Originale von zweien der in Jahrb. IV, S. 89, und VI, S. 195, beschriebenen kleinen Reimchroniken Nic. Marschalk's enthält, nämlich von der Mißhandlung des Sacraments zu Sternberg und von der Dithmarsen=Schlacht; das erste Gedicht, von der Stiftung des Domes zu Rostock, findet sich im Etherologium nicht. Die Reimchroniken Marschalks beginnen:
De dusser ghedichte bist eyn leser
dar vp interste vorwarnet sy
dat er ansettende vorweser
de vor to latine bescriuet dy
dar vth seck denne wol beghifft
na rechtem ordenschen geschicke
dat dusse sulue dudesche scrifft
des to harder is im gheblicke etc.
Der eddelen forsten van hogher boerd
van der groten stad. welker name vord
Am seszstrande Meklnburg is genant
ouer alle lande ock wol bekant
desser heren nuwe ghescheffte klar
denke ik mit dicht don openbar etc.
sacramentes tom Sterneberg.
Id is ghescheen nu eynst der iar
dat de vermaledigede besneden schar
tom Sterneberge is to samde kamen
eyne werscop eliken dar to holden
fruwen vnde man, junck vnde olden
Dar hedde me wol vornamen
dranck vnde kost to sodaneme dissche


|
Seite 483 |




|
wilt vnde tam vleisch vnde vissche
vnde wat dar bevelt dem smake
sedenspel kunstich vnde geringe
scrieken danssen vnde idelke dinghe
sanges gheuel na allem gemake etc.
in deme lande to Dethm'.
My voruerden, van swarheit der ding'
stympet de sin dat ghemote versaghet
stummet de munt vnde beeuet vingher
to scriuende bin eck alse veriaghet
vnder den kelken gades des heren
is eyner den he vaken vorhenget
dar dorch grimmicheide sek meren
wen eyner den anderen enghet
vmmeher wanket hefft de smoeck
mit syneme venynschen dramme
an vnse orde is he ghekamen ock
vil mennighen toch de ramme etc.
Am Schlusse steht:
Des ersten: Ordior acta ducum etc.
Des anderen: Conuolat in monte stelle.
Des dridden: Perculso grauitate rei.
Die Original=Gedichte von H. Boger beginnen:
1) fol. 26b.: von der Mißhandlung des Sacraments zu Sternberg:
Super benedicti sacramenti irreuerenti tractatione per prophanos judeos in Sternebergio querulosa historia.
Convolat in montem stelle maledictus apella,
Facturus ferias mox himinee tibi;
Hic flaue cereris leti quoque munera bacchi
Vidisses gustus pabula dupla tui,
Hic fera multimodi generis sil' altilis omnis
Quodque gule tellus pontus et aër alit
Hic neruos phebi calamos audisseque panos
Fas est silleni stultaque plectra senis
Hic saltus gestusque leues cum mille cachinnis
Et vox et numeris brachia mota suis. etc.


|
Seite 484 |




|
2) fol. 34a.: von der Dithmarsen=Schlacht:
Stragis nouissime in Theomarcia satis vulgata historia.
Perculso grauitate rei vox faucibus heret
Mens ebet et tremulum cor stupet ecce mihi
Est vnus calicum domini datur vnde propina
Gentibus et fecis pocula quando furent
Pridem gorgoneum circum liuescere virus
Expertus nostros sentio adisse lares
Occidua id venisse plaga longos modo tractus
Perrepens certum est alluit arcton iter etc.
Das in Jahrb. VI, S. 196 angeführte Loblied auf das Heil. Blut im Dome zu Schwerin
ist im Etherologium fol. 11 a. gedruckt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 485 |




|



|


|
|
:
|
IX. Zur Rechtskunde.
1.
Manus Mortua, die Todte Hand,
der blinkende Schein.
Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94.
Im Jahre 1838 wurden dem Vereine 5 Todten=Hände und zwei hölzerne Schüsseln zur Aufbewahrung aus der ehemaligen Gerichtsstube des Heil. Geist=Hauses zu Wismar übergeben. Der Jahresbericht III, S. 94, wies dabei auf die alte deutsche Rechtssitte hin, den Leichnam des Erschlagenen nicht vor genommener Rache oder Sühne zu begraben, auch denselben vor Gericht vorzuzeigen, statt dessen später bloß die abgetrennte Hand symbolisch gebraucht ward.
Hiebei sind noch nachträglich zwei Puncte zu erwähnen: zuerst nämlich, daß diese Rechtssitte in Meklenburg sicher noch während des 16. Jahrh. bestand.
Im J. 1559 ward Helmuth von Plessen zu Brüel in Wismar auf der Hochzeit des Daniel von Plessen zu Steinhausen durch Joachim von Stralendorf erschlagen. Nur ungern sandte der Rath zu Wismar, das competente Gericht, dem Mörder eine Wachshand statt der wirklichen Hand des Erschlagenen, als Mahnung, vor Gericht zu erscheinen, zu. Der Rath ließ sich sogar dieserhalb einen Revers von den Angehörigen des Getödteten geben. Vgl. Schröder's Papist. Mecklenburg, S. 670; Franck's A. u. N. Mecklenb. Buch X, S. 76. 77.
Als im J. 1549 Achim Barnekow auf Gustävel einen Bürger Namens Wardenberg aus Pritzwalk erschlagen hatte, vertrug er sich mit den Angehörigen desselben dahin, daß er ihnen 8 Tage nach Antonius 1550 zu Plau 40 Gulden Münze und 5 Mark lübisch "zur Bestettigunge des Entleibten Hand" zu bezahlen verhieß.
Im J. 1566 sollte Lüder Barse zu Stieten den Peter Bützow zu Poppendorf beim Zechgelage getödtet haben. Er behauptete aber, unschuldig zu sein, und bat deshalb die Blutsfreunde des Peter Bützow, dem Todten die Hand abzunehmen und bis zum Austrag der Sachen zu verwahren, indem er sich vor Gericht stellen werde.


|
Seite 486 |




|
Diese Angaben sind den gleichzeitigen Acten entnommen. Auch lassen sich noch mehrere ähnliche Fälle nachweisen.
Der zweite Punct betrifft eine mehrfach und namentlich auch von Franck, A. u. N. M. Buch X, Seite 77, angeführte Nachricht über eine andere Art von Todten=Händen. Man soll auch verarmten Leibeigenen nach ihrem Tode die rechte Hand abgelöst und diese den geistlichen Herren, denen sie Zins oder Arbeit schuldigten, zugesandt haben. Franck meint sogar, daß die zuweilen, wie in Sternberg, sich findenden Knochen von Todtenhänden solchen verarmten Leibeigenen angehören dürften. Er beruft sich dabei auf Lehmann's Speiersche Chronik, Buch IV, Cap. 42, wo allerdings gesagt wird, daß ein Abhauen der Hand in solchen Fällen stattgefunden habe.
Allein diese Behauptung ist eine Fabel oder doch sicher nicht als verbreiteter deutscher Rechtsgebrauch nachzuweisen. Sie beruht wohl auf mönchischem Mißverstande oder Entstellung des "Besthaupts, mortuarium." Dies ist ein in fast allen Gegenden Deutschlands vorkommender Sterbezins, nach welchem der Herr des verstorbenen Eigenmannes unter dessen Fahrniß, besonders dem Vieh, sich ein Stück auswählen darf. In Frankreich und England geben sogar die Vasallen ein "mortuarium" an den König. Vgl. Grimm's deutsche Rechtsalterthümer, Buch I, Cap. 4.
Schon zu Francks Zeiten ward übrigens von manchen Gelehrten, wie von Heineccius (Elementa iuris german.), jene Behauptung als Fabel bezeichnet. Auch in Meklenburg sprach sich z. B. der verdiente Joh. P. Schmidt im J. 1743, damals Rector der Universität Rostock, nachher mekl. schwer. Geheimer Rath, bei Gelegenheit eines Leichenprogramms auf Anna Sophie Eggerdes, des Dr. und Prof. Handtvig zu Rostock Ehefrau, in demselben Sinne aus, indem er die Nachrichten und Grundsätze, "de jure manus mortuae sive der Todten=Hand", d. h. die Lehre vom Besthaupte, erörterte.
Üebrigens findet sich auch noch eine ausdrückliche Bestätigung über den Ursprung der besonders in meklenburgischen Kirchen zuweilen aufbewahrten Todtenhände in einer strafrechtlichen Abhandlung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. "J. F. Stemwede, praeside Mantzel, jus crimin. Meklenburg." sagt nämlich pag. 32:
Et quoniam constat ex antiquis practicis, quod in casibus non succedentis cruentationis, putantes, homicidam non esse praesentem, membrum quod-


|
Seite 487 |




|
dam, maxime manum absciderint, idem obtinuisse in terris Meklenburg, probant relationes, fide omni haud destitutae, de manibus amputatis in templis, v. gr. Petrino Rostoch. ut et Georgiano Wismariensi forte, in hunc etiam diem adseruatis."
Schwerin.
A. F. W. Glöckler.



|


|
|
:
|
2.
Die Einziehung der Güter der Selbstmörder.
Ueber die in den Jahrbüchern, Bd. I, S. 175-76, berührte Einziehung der Güter eines Selbstmörders haben sich weitere Archiv=Nachrichten gefunden, welche diesen landesüblichen Rechtsgebrauch bestätigen, auch dessen Geltung noch etwas näher bestimmen.
Im J. 1521 ward vom Herzoge Heinrich von Meklenburg an seinen Bruder Herzog Albrecht berichtet:
Beke Grundtgriper (zu Parchim) habe angezeigt: ihr Bruder hätte sein Leben im Gefängnisse geendigt, indem er wegen Verbrechen heimlich habe gestraft werden sollen. Des Herzogs Albrecht Beamte zu Lübz hätten aber "von deswegen das derselbe ire bruder, als gesagt werden wolde, aus Mismut im gefengnus sein leben selbest geendiget", sich unterstanden, in der gemeinschaftlichen Stadt Parchim nicht bloß ihres Bruders, sondern auch ihr Vermögen an sich zu nehmen, namentlich die beweglichen Güter in einer verschlossenen Lade. Der Herzog Heinrich bat deshalb, zu erwägen, "das die rechte soliche anders wollen"; möge Grundtgriper im Gefängniß ein Selbstmörder geworden sein, so könnten deshalb "der armen frawen gutter, ir alleine oder zu iren anpart zustendig, derhalben nicht angegriffen werden"; wären ferner des Grundtgriper Güter verwirkt "vnd die obirkeyt dorzu berechtiget" so habe er, Herzog Heinrich, gleiche Rechte an selbige, da die Stadt Parchim und "die Gerichte vbir den Adel, darran Grundtgriper gewest" gemeinschaftlich seien. Schließlich ersuchte Herzog Heinrich seinen Bruder, die genommenen Güter wieder zur Stelle zu schaffen, bis man sich verglichen, was hinsichtlich derselben billig und recht sei, damit keiner "derhalben vorkortzt" werde.


|
Seite 488 |




|
Hierauf erwiederte Herzog Albrecht von Meklenburg, d. d. Wismar Montag nach Concept. Mariä 1521: er "halte es gentzlich darfur" was seine Amtleute zu Lübz in dieser Sache gehandelt, daß sie "solchs nach gelegenheit wol wissenn zue vorantworten" etc.
Henneke Smedes oder Smedt, ein Straßenräuber, aus Lage, ward im J. 1525 ergriffen und, wie es scheint, zu Güstrow in peinliche Untersuchung genommen. Er tödtete sich aber selbst im Gefängnisse. Es berichtet dieserhalb (der Vogt?) Hans Rathsten, d. d. Güstrow, am Abend Michaelis 1525, an den Herzog Heinrich von Meklenburg:
"Ick screff J. F. G. inme Jungesthen to Rostock van de nagelaten guderen Hennicke Smedes, na deme he sick suluest to dode brachte. G. H. so screff ick ehm syne schulde, weß he noch vthgande hadde, so wil syne Husfrowe vnd syn broder de scrift van my hebben, vnd ick der se em nicht don. G. H. so J. F. G. wolden ehm de guder loß geuen, mosten se jo tom ryngesthen 1 tunne Rotschar vthgeuen , wente J. F. G. moste jo 1 gulden geuen den bodel; ock ath vnd dranck he wol XI wecken. G. H. weß J. F. G. nv inne guthgeduchte, my scriflick J. F. G. mochten vormelden." -
Daß noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. der Gebrauch geltend war, scheint die folgende Stelle des Bruch=Registers des Stadtvogtes zu Parchim vom J. 1568 zu beweisen: "Anno 68 in der Vastenn hat sich ein weib gehangenn; das guth ahn mich genohmmen, dauon gemachet 11 fl. 5 ßl."
Es ist zu bemerken, daß die Bambergensis (edit. Rostock 1510, hoch 4., mit Holzschnitten) Tit.: "Straffe eyghener dodynge" folgende Bestimmung hierüber hat:
"Item wener eyn man beclaget vnde in recht gefordert wert, dar dorch (so he ouerwunen de d
t vorschuldet, edder vth frochten syner myssed
t, syck sulues dodet, de schal neyne eruen hebben; wu syk ouers eyner buten vorgemelten orsaken, sunder vth kranckheyt synes liues edder gebrekliheyt der synne, sik sulues dodet, dessulfften eruen scholen an erer erueschop nicht gehyndert werden etc.


|
Seite 489 |




|
Schon das römische Recht unterscheidet (ff. 1. 3, §. 4, 6, 7, de bonis eorum, qui ante sentent. Nov. 134, c. ult.) in ähnlicher Art, wie Art. 135 der P. H. G. O. Nach der Glosse zu B. II, A. 3 des sächsischen Landrechts sollen die Leichname der Selbstmörder verbrannt werden; schimpfliche Bestattung derselben ward in Deutschland gemeinrechtlich. -
In Livland fand um d. J. 1700 eine Einziehung der Güter von Selbstmördern nicht mehr statt; doch ward der Leichnam vom Büttel nach dem Morast gebracht und im Moos vergraben, vor jener Zeit aber verbrannt. War die That in Tiefsinn oder Krankheit geschehen, so fand Vergraben auf dem Kirchhofe nordwärts am Zaun ohne Feier statt. (Vgl. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv=, Ehst= und Kurlands, Bd. II, S. 65.)
Uebrigens erwähnen die meklenburgischen Polizei=Ordnungen des 16. Jahrh. nirgends des obigen Rechtsgebrauchs, obgleich die P. O. von 1562 und 1572 sich über die "Erbschaften und wie einer fur dem andern zu dem Erbe gelassen werde", weitläuftig verbreiten. Gegen das Ende heißt es hier nur: "Also wollen wir auch, wann sich hinfuhro Erbfälle zutragen möchten, so aus vorgesatzten Bericht nicht könnten entschieden oder darunter begriffen werden, so soll darin nach gemeinen Kayser=Rechten geurtheilet und gesprochen werden". Eben so wenig scheint sonstig jemals in Meklenburg eine besondere gesetzliche Bestimmung über die Einziehung der Güter der Selbstmörder erlassen zu sein.
Auch die "Formula, wie das Fahrgericht in Wismar zu halten", Wismar, 1686, 4. deutet nicht auf eine solche Bestimmung hin, obgleich hier wiederholt von dem Verfahren mit Selbstmördern die Rede ist und namentlich festgesetzt wird, daß die Körper von Ruchlosen, die sich wegen Verbrechen entleiben, von dem Frohn im Felde eingescharrt werden sollen.
Schwerin.
A. F. W. Glöckler.



|


|
|
:
|
3.
Strafe auf Kindesmord und Sodomie
im 18. Jahrhundert.
Von dem Herrn von Berg auf Neuenkirchen sind dem Vereine Actenstücke über zwei bei dem dortigen Patrimonial Gerichte vorgekommene peinliche Rechtsfälle mitgetheilt worden. Dieselben sind, wenn auch aus neuerer Zeit,


|
Seite 490 |




|
doch ihrem Inhalte nach wohl schon den Rechtsalterthümern beizuzählen.
Der erste Fall betrifft die im J. 1710 wegen. Kindermordes hingerichtete unverehelichte Marie Westphal und deren Verführer Joachim Drewes. Guts= und Gerichtsherr war damals Balthasar Friedrich von Berg; als Justitiar ward der Burgemeister Casimir aus Neubrandenburg zugezogen Der Prozeß ward eilig und ohne viele Umstände betrieben, aber doch dabei ziemlich kostbar für den Gutsherrn.
Unter dem 17. März 1710 stellen nämlich die Chirurgen Johann Dorn und Carl Friedrich Wilpert aus Neubrandenburg ein visum repertum über den Leichnam eines von der Marie Westphal gebornen Kindes dahin aus: "das es über den ganzen Leib blau war, dannenhero (wir) nicht anders praesumiren können, als das es ersticket". Desselben Tages, so wie am 24. März hielt der Justitiar ein Verhör mit der Inquisitin, welche gleich anfangs eingestand, das Kind bald nach der Geburt unter dem Bette erstickt zu haben. Am 26. d. M. wurden die Acten an die Juristen=Facultät zu Greifswald zum Spruch verschickt. Dieser, auf Hinrichtung der Inquisitin mit dem Schwerte lautend, erfolgte binnen wenig Tagen. Schon am 3. April ward das Schlußverhör gehalten und das Urtheil gesprochen. Am 9. d. M. gingen die Acten mit dem Erkenntnis nach Strelitz zur landesherrlichen Bestätigung, die ebenfalls umgehend am 10. April dahin erfolgte, daß man es "bey der - eingeholeten Urtel billig bewenden lasse" und insbesondere die Vollstreckung der dem Verführer zuerkannten Landesverweisung genehmige.
Die Hegung des peinlichen Gerichts und die Vollziehung des Urtheils geschahen am 25. April zu Neuenkirchen. Der Burgemeister und Notar Casimir, als Vorsitzender, stellte hierüber folgendes Protocoll aus:
"Wann ein Zeichen gegeben ist, still zu sein , wird daß Peinliche Halsgericht geheget folgender Massen. Weil eß so viel Tages, das ein öffentliches Peinliches Halsgericht geheget werden kann, so hege dasselbe im Nahmen Gottes, im Nahmen des wolgebohrnen Herrn, Hern Balzar Friederich von Berg, als ordentlicher Obrigkeit zum ersten, andern und dritten Mahl; und weil dieses öffentliches peinliches Halsgericht genugsahm geheget, so wird erlaubet, wer für demselben zu tuhn hat, hervor zu tretten, seine Klage anzubringen, da denn peinlicher Ahrt nach verfahren und was Rechtens, erkannt werden soll."
Hierauf bringt der Scharfrichter vor:
Ob ihm erlaubt sei, seine peinliche Klage vorzubringen?


|
Seite 491 |




|
Worauf geantwortet wird: Ja, es sei ihm erlaubet. Darauf klaget er an zum ersten, andern und dritten Mahl 1. den Joachim Dreves. 2. die Maria Westfahl. Der Richter schweiget dazu still.
Dann bittet der Scharffrichter, das beiden Uebeltehtern ihre getahnene Bekenntniß moge vorgehalten und dieselben nochmahln darüber vernommen werden.
Hierauf werden vorgelesen:
I. dem Joachim Dreves folgende Artikul.
1. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, die Maria Westfahl geschwängert? Resp. Ja.
2. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, der Maria Westfahl, um die Frucht im Mutterleibe zu vertreiben, das Fett aus der Müllen=Pfanne zu gebrauchen (geben). Resp. Ja.
3. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, der Marien gerahten, das Kind bei der Seite zu bringen? Resp. Ja.
II. der Marien Westfahl folgende Articul:
1. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, ein lebendiges Kind zur Welt gebracht? Resp. Ja.
2. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, solches euer Kind im Bette unter dem Dekbette gebohren. Resp. Ja.
3. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, das Kind nicht so fort, wie eß gebohren, unterm Dekbette hervorgezogen. Resp. Ja.
4. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, das Kind darum nicht so fort unterm Dekbette hervorgezogen, das es erstikken sollte. Resp. Ja.
5. Wahr, das das Kind auch unterm Dekbette daher erstikket. Resp. Ja.
Wann beide Inquisiten über vorgesetzte Articul vernommen und dieselbe zugestanden, bittet der Scharffrichter, das beiden Beklagten ihr Urtel möge offentlich vorgelesen werden.
Hierauf wird die Urteil publicirt:
Auf angestellte und vollführte inquisition wider Johan Dreves und Maria Westfahln, (wegen) beiden Inquisiten begangener Unzucht und Kinder=Mords, spricht der Wolgebohrner Herr, Herr Balzar Friedrich


|
Seite 492 |




|
v. Berg, Obrigkeitlichen Amts halber, auf eingeholten Raht und Belehrung der Rechtsgelehrten vor Recht:
das beide Inquisiten, wegen ihrer begangenen Missetahten, ihnen zur wollvordienten Straffe und Andern zum Abscheu, als der Johan Dreves offentlich zur Staup zu schlagen und mit erhaltenen consens der hohen Landes=Obrigkeit deß Landes auf ewig zu verweisen, die Maria Westfahln aber mit dem Schwert vom Leben zum Tode hinzurichten sei. Wie denn beide Mißtähter in obangedeutete Straffe hiemit verdamt werden. V. R. W.
Der Scharffrichter fraget nach publicirten
Urtheil:
Herr Richter, wer soll die Urtheil
exequiren?
Der Richter antwortet: Das sollt
Ihr thun.
Der Scharffrichter: Herr Richter,
ich bitte umb sicher Geleit.
Der Richter:
Das soll Euch gegeben werden.
Publicirt und vollenzogen Neuenkirchen den 25ten Aprilis 1710.
In fidern subscripsit
Notarius caes. publ. ad hunc actum requisitus.
Die Kosten dieses Prozesses berechnete der Guts= und Gerichtsherr zu 102 Gulden und 20 Schilling, die Fuhren, die Futter= und Speisungskosten nicht mit angeschlagen. Der Justitiar erhielt 29 Gld., der Scharfrichter 32 Gld., der Prediger 4 Gld. Das Urtheil kostete mit dem Botenlohn 11 Gld. Bei der Hinrichtung ward eine halbe Tonne Bier ausgeschenkt. - Der Gerichtsherr schließt die eigenhändig von ihm geführte Rechnung mit den Worten:
"Gott gäbe, das si - die Hingerichtete - sälig worden ist undt beware mir vor mer Ungelück.
B. F. v. Berg."
Im Allgemeinen war das Laster der Unzucht seit Jahrhunderten unter dem meklenburgischen Landvolke sehr verbreitet. Folgeweise waren auch die Kindermorde häufig, jedoch früher wegen härterer Strafen des Verbrechens der Unzucht häufiger, als jetzt.
Die höheren Stände blieben nicht frei davon. Die mekl. Polizei=Ordnung v. J. 1572, Titel: "Von Todschlag, Ehebruch, unehelicher Beywohnung, Kupplerey und Hurerey,"


|
Seite 493 |




|
bestimmt für die vielfältige, auch unter dem Adel einreißende Unzucht harte Strafen. Der Art. 43 der Reversalen v. J. 1621 gestattet die "Vermäuerung" (d. h. häusliche Haft) unzüchtiger adelicher Jungfrauen den Angehörigen derselben. (Vgl. Stemwede, praeside Mantzel, Jus criminale Meklenburg. 1743, 4., pag. 40; Simssen in Beilagen zu den wöchentl. Rostocker Anzeigen v. J. 1817, S. 109). Mehrmals kamen auch um diese Zeit in den Landesklöstern solche Vergehen von Seiten der Conventualinnen vor.
Vielfach ist begangene Unzucht in Meklenburg mit Landesverweisung bestraft, welcher oft Staupenschlag und bisweilen Kirchenbuße, auch Ausstellung am Pranger, Haarabschneiden und dergl., namentlich in einzelnen Städten, vorhergingen. In manchen Fällen genügte man sich mit einer der geringern Strafen in Verbindung mit Geldbußen. Einige Landesherren, wie die Herzoge Ulrich und Gustav Adolph zu Meklenburg=Güstrow, hielten sehr strenge auf Vollziehung der Unzuchtsstrafen. Letzterer schärfte die bisher bestehenden durch ein Edict v. J. 1659. Kindesmörderinnen wurden früher gewöhnlich mit dem Schwerte hingerichtet. Es kommen sogar Andeutungen vor, wie in einem parchimschen Bruchregister beim J. 1572, daß einzelne lebendig begraben worden sind, indem die Bambergensis, die Mutter der Carolina, in Art. 156 bestimmt, daß vorsätzliche Kindesmörderinnen lebendig begraben und gepfählt werden sollen. Die Carolina setzt in Art. 131 das Ertränken an dessen Stelle und gestattet Lebendigbegraben nur dann, wenn das Uebel oft geschieht.
Zur Zeit des oben erzählten Falles, um das J. 1710, war das Verbrechen des Kindermordes häufig in Meklenburg. So kommen z. B. in den im J. 1717 zu Schwerin und Leipzig erschienenen: "Consultationes juris oder rechtliche Belehrungen" von D. J. Scharf in Consult. 36, 58-62 und 79 mancherlei Fälle vor. (Vgl. Stemwede, praeside Mantzel, jus crim. Meklenb. pag. 47.). Doch waren damals in andern deutschen Ostseeländern Unzucht und Kindermord noch viel häufiger, als in Meklenburg. So kamen in Livland in den 15 Jahren v. J. 1695-1709 nicht weniger als 242 Fälle - es war das häufigste Verbrechen! - vor, und 155 schuldige Mütter wurden zum Tode verurtheilt; dort, wie auch in Meklenburg, trat dies hauptsächlich als Folge der Durchzüge der " Soldatesca" und der zu strengen Unzuchtsstrafen hervor. (Vgl. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv=, Ehst= und Kurlands. Bd. II, S. 60.)


|
Seite 494 |




|
Der zweite Fall betrifft das Verbrechen der Sodomie und ereignete sich im Frühling des J. 1748 zu Neuenkirchen.
Der dortige Kuhhirte Michael Kruse, ein schwacher, kurzsichtiger, sehr einfältiger Mensch, hatte sich wiederholt mit einer dreijährigen Starke und einer Kuh fleischlich vermischt, wie zwei Dienstmägde des Hofes als Augenzeugen eidlich aussagen, auch vom Inquisiten selbst schon beim ersten Verhör gerichtlich eingestanden wird. Die erfolgte inmissio seminis ward sicher ermittelt. Nachdem am 20. Mai d. J. das Verhör der Zeuginnen sowohl, wie des Inquisiten in Gegenwart des Gerichtsherrn Ernst August von Berg, des Beisitzers Hauptmanns von Ahrenstorf (auf Sadelkow), des Advocaten Fischer aus Neubrandenburg als Justitiars und des Notars Natorp stattgefunden hatte, ward dem Beklagten in der Person des Advocaten und Senators Klinge zu Neubrandenburg ein Vertheidiger bestellt. Dieser sandte am 4. Junius seine Defensions=Schrift ein, welche wegen freiwilligen Geständnisses und großer Unwissenheit des jedenfalls der Todesstrafe schuldigen Beklagten eine Milderung seiner Strafe dahin nachsuchte, daß er statt des Feuertodes "mit dem Schwerte begnadiget" werden möge, zumal dem Inquisiten "die drohende Feuers=Strafe als sehr schmerzlich und erschrecklich vor Augen schwebe, wodurch er gar leicht in Verzweifelung und folglich die Seele in Gefahr gerathen könne".
Hierauf reichte der Gerichtsherr die Acten bei der Justiz=Canzlei zu Neustrelitz ein. Diese erkannte nach wenig Tagen, am 7. Junius, für Recht:
daß Inquisit nach Inhalt Kaiser Carl's V. Peinl. Halsgerichts=Ordnung seiner unnatürlichen Thaten wegen, ihm selbst zur wohlverdienten Strafe und Andern zum abschreckenden Beispiel mit Feuer vom Leben zum Tode gebracht, die beiden Häupter Vieh aber todtgeschlagen und verbrannt werden sollten.
In den "rationes decidendi" ward darauf hingewiesen, daß der Inquisit das Unnatürliche seiner That von selbst hätte erkennen müssen, das Verbrechen wiederholt habe, sein Bekenntniß Folge der Haft sei, durch strenge Beispiele abgeschreckt werden müsse und über die Strafe eines Falles, wie der vorliegende, die Rechtslehrer einig seien, mit denen auch der Landesgebrauch übereinstimme.
Jedoch ward gleichzeitig in einem zweiten Erlasse des Gerichts eine Milderung der Strafe dahin verfügt:
"daß Inquisitus auf dem Scheiterhaufen zuforderst zu stranguliren und das Feuer nicht eher anzuzünden, bis der arme Sünder ersticket".


|
Seite 495 |




|
Am 21. Jun. 1748 ward das peinliche Halsgericht in Gegenwart der vorher Genannten zu Neuenkirchen öffentlich, jedoch ohne Anwendung der 30 Jahre früher noch üblichen, aber schon damals verstümmelten alten Formen, gehegt. Der Inquisit ward, seiner Banden entledigt vorgeführt, nochmals über die entworfenen Untersuchungs=Puncte befragt und nach deren durchgängiger Bejahung dem Scharfrichter übergeben. Die Hinrichtung ward gleich darauf vollzogen.
Der Scharfrichter J. C. Mühlhausen stellte hierüber folgende Rechnung aus:
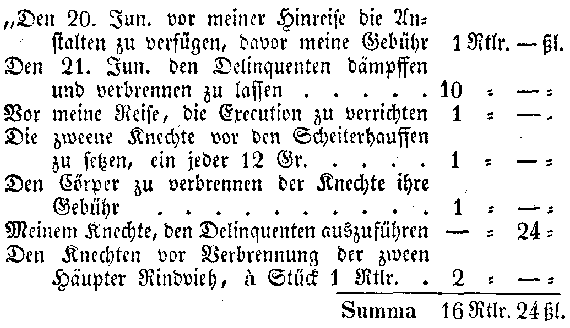
Der Seiler Ch. Winkler in Neubrandenburg stellte eine Rechnung über 16 ßl. für die gelieferte "Dempfleine" aus, mit welcher vermuthlich der Verurtheilte erdrosselt ward.
Aehnliche Fälle des Verbrechens der Sodomie kommen im 17. und 18. Jahrh. unter dem meklenburgischen Landvolke nicht ganz selten vor, so auch Blutschande, selbst zwischen Eltern und Kindern. Denjenigen, welche den damaligen elenden Zustand des meklenburgischen Landvolkes und überhaupt die Sittengeschichte dieser Zeiten aus Acten kennen, wird dies nicht besonders auffallend erscheinen.
Mehrere Fälle von Sodomie obiger Art hat D. J. Scharf, consultationes juris oder rechtliche Belehrungen, consult. 8-10.
Zu bemerken ist, daß Sodomie zwischen Personen desselben Geschlechts, sodomia ratione sexus, in Meklenburg früher fast nur von Ausländern nachzuweisen ist; namentlich gegen Italiäner, Franzosen, Böhmen etc., welche als Musiker, Lehrer der ritterlichen Künste, Barbiere oder dergl. während der drei letzten Jahrhunderte in herzoglichen Diensten


|
Seite 496 |




|
standen, kommen wiederholt actenmäßige Anschuldigungen wegen Ausübung dieses Verbrechens vor.
Auch in andern Ostsee=Ländern, z. B. in Livland, finden sich um d. J. 1700 fast nur Beispiele des Vergehens mit Thieren, vom Landvolke ausgeübt. Das Verbrechen ward dort statt mit dem Feuertode durch Enthauptung und gemeinsames Verbrennen mit dem zuvor getödteten Thiere bestraft. (Vgl. die angef. Mittheilungen, Bd. II, S. 75.)
A. F. W. Glöckler.



|


|
|
:
|
X. Zur Erd= und Naturkunde.
Ein Horn eines Urochsen
(bos urus) oder Wisent (bos bison), slavisch Tur, das an einer äußerst breiten Stirn gesessen hat am Stirnrande rund, mäßig lang, halbmondförmig, wenig gebogen, an der Stirnwurzel 5 1/2'' im Durchmesser, ungefähr 18'' lang im Durchmesser der Biegung, gefunden zu Wokrent bei Schwaan in einer torfigen Wiese am Rande einer Mergelgrube, geschenkt vom Herrn Kammer= Director Baron von Meerheimb auf Wokrent zu Gischow; die Spitze ist abgebrochen. Vgl. Jahresbericht III, S. 68. Es werden dergleichen Hörner, auch andere Knochen dieses Thieres, öfter in Meklenburg gefunden und gehören wohl dem Wisent an, das in ältern Zeiten jagdbares Thier in Deutschland war.
G. C. F. Lisch.
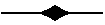


|




|
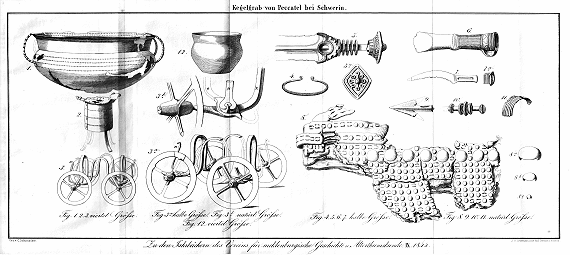


|




|


|




|



|


|
|
:
|
Jahresbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
von
D r. Friedrich Carl Wex,
zweitem Secretär des Vereins.
Neunter Jahrgang.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.
Schwerin, 1844.


|




|


|
[ Seite 1 ] |




|
General=Versammlung
am 11. Julius 1844.
N achdem der Herr Präsident durch eine Anrede an die anwesenden auswärtigen und einheimischen Mitglieder die Versammlung eröffnet und die Beamten zur Berichterstattung aufgefordert hatte, sprach der zweite Secretär folgende einleitende Worte:
Der Tag der General=Versammlung, meine Herren, ist der eigentliche Fest= und Ehren=Tag unseres Vereines. Während des ganzen Jahres arbeitet er in stiller, unbemerkter Thätigkeit, er durchforscht bestäubte Urkunden, durchsucht einsame und entlegene Feldfluren, ja, er steigt hinab in das Dunkel der Gräber; aber an dem heutigen Tage tritt er hervor an das Licht, um in dem milden Scheine Ihrer freundlichen Theilnahme neue Kräfte und neue Stärkung zu sammeln. Nun darf er auch heute manche gereifte Früchte Seiner Thätigkeit, manche Ergebnisse seiner Forschungen und überhaupt viele sprechende Beweise seines innern Gedeihens und seiner fortschreitenden, immer reicher sich entfaltenden Blüthe Ihnen vorlegen; aber die Festfreude ist nicht wenig getrübt durch zwei eingetretene Veränderungen, die, wie sie Ihnen gleich bei Eröffnung unserer Versammlung entgegengetreten sind, so auch in meinem Berichte voranstehen mögen. Sie vermissen den seit acht Jahren gewohnten Sprecher und Berichterstatter unseres Vereines, sie vermissen die gewölbten, alterthümlichen Hallen unseres bisherigen Lokales.
Wegen vermehrter Berufsgeschäfte sprach unser bisheriger zweiter Secretär, Herr Domprediger Bartsch, wiederholt den dringenden Wunsch aus, jener Function enthoben zu werden. Der Ausschuß, welcher erwog, zu welchem Danke der Verein Herrn Bartsch für die achtjährige verdienstvolle Thätigkeit verpflichtet sei, fürchtete begehrlich zu erscheinen, wenn er noch länger seine Dienste in Anspruch nähme, und schritt demnach zur Wahl


|
Seite 2 |




|
eines Stellvertreters, der bis zum heutigen Wahltage das Amt verwalten sollte. Leider handelte es sich hierbei nicht um die Entlassung eines einzelnen Beamten, sondern Herr Bartsch ist einer der Gründer und Stifter unseres Vereines, der wie zu Anfang, so während der ganzen Zeit mit unermüdlichem Eifer für die weitere Ausbildung und formelle Gestaltung desselben thätig mitgewirkt hat. Und darum mußte es scheinen, als sei dem Vereine durch jenen Austritt eine bedenkliche und empfindliche Wunde geschlagen. Aber schon damals, als der Herr Präsident in einer Ausschuß=Sitzung am 6. November 1843, wo Herr Bartsch sein Amt niederlegte, ihm den Dank des Vereines und die bleibende Anerkennung seiner Verdienste aussprach, erhielten wir von ihm die freundliche Zusicherung, daß er dem Vereine nicht blos seine fortdauernde rege Theilnahme, sondern auch, so weit es seine Berufsgeschäfte ihm gestatteten, seine Thätigkeit widmen werde, und er bewährte diese Gesinnung gleich damals dadurch, daß er das vom Ausschuß ihm angetragene, durch die Wahl des provisorischen Secretärs erledigte Nebenamt eines Repräsentanten bereitwilligst annahm.
Eben so unwillkommen ist der zweite Wechsel im Betreff des Lokales. Wenn auch die neuen , durch die Gnade Sr. Königlichen Hoheit uns zugewiesenen Räume 1 ) durchaus geeignet und genügend sind, und bei der ansprechenden Aufstellung unserer alterthümlichen Schätze und der ganzen Einrichtung, welche der Verein ausschließlich der Thätigkeit und Umsicht unseres ersten Secretärs verdankt, allen unseren Wünschen entsprechen; so fehlt doch der alterthümliche Reiz geschichtlicher Erinnerungen, es fehlt der geheimnißvolle Odem, der in den Hallen des alten Wohnsitzes der Grafen von Schwerin uns anwehte.
Aber wie jener Wechsel durch einen Trost uns gemildert wurde, so werden wir hier durch schöne und herrliche Hoffnungen reichlich entschädigt, wenn wir die Ursachen, die jenen Wechsel veranlaßt haben, erwägen, und die daran sich reihenden Aussichten uns vorführen. Das Stammschloß unseres Fürstenhauses wird nun bald zu den Reizen seiner natürlichen Lage und zu der Ehrwürdigkeit seiner geschichtlichen Bedeutung den modernen Glanz und Schmuck hinzufügen, um in dieser verjüngten Gestalt die Wiege eines Fürstengeschlechtes zu werden, das, wie es zurückragt in die graueste Vorzeit, so bis in die entfernteste Zukunft seine Zweige entfalten und sein treues Volk beglücken möge.


|
[ Seite 3 ] |




|
Erster Abschnitt.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
I. Mitglieder.
1. A m Tage der vorigen General=Versammlung zählte der Verein 383 ordentliche Mitglieder. Von diesen verloren wir durch den Tod sieben, nämlich die Herren:
Geheimer Medicinalrath Dr. Hennemann in Schwerin 1 ),
Gymnasial=Director, Professor Dr. Becker in Ratzeburg 2 ),
Drost von Restorf auf Radegast,


|
Seite 4 |




|
Kammerherr von Plessen auf Reez,
Rector Bülch zu Malchin,
Präpositus Brinkmann zu Neukalden,
Pastor Sickel zu Eldena.
Ausgetreten sind sechs, die Herren: von Behr auf Renzow, Kaufmann Hagemann in Neubrandenburg, Candidat Paschen in Sukow, Präpositus Tim in Malchin, Pastor Strecker in Hohenkirchen, Dr. Francke in Wismar. Für diese verlornen 13 Mitglieder gewannen wir 30 neu eingetretene, so daß der Verein heute 400 Mitglieder zählt. Die hinzugetretenen Mitglieder sind:
Herr Advocat Pohle in Schwerin,
- von Kardorf auf Granzow,
- Pastor Mühlenfeld zu Boddin,
- Dr. Meyer in Gnoien,
- Heise auf Vollrathsruhe,
- Lieutenant du Trossel zu Neustrelitz,
- Graf von Blücher auf Fincken,
- von Lowtzow auf Rensow,
- Baron von Bülow auf Emekendorf.
- Pensionär Peters zu Petersdorf,
- Baron von Maltzahn auf Alt=Rehse,
- Major von Barner auf Bülow,
- von Flotow auf Walow,
- von Oertzen auf Repnitz,
- Koch auf Trollenhagen,
- von Müller auf Rankendorf,
- Kammerherr von Stralendorf auf Gamehl,
- Oberappellationsrath von Bassewitz in Rostock,
- Domänenrath Jordan auf Grambzow,
- Freiherr von Maltzan, Amtsauditor in Schwerin,
- Dr. Jenning zu Stavenhagen,
- Pensionär Tack zu Kl. Methling,
- Steuerdirector von Wickede in Rostock,
- Pastor Vortisch zu Satow,
- von Bülow zu Kuppentin,
- Lieutenant von Bülow zu Neustrelitz,
- Pastor Doblow zu Gr. Vielen,
- Pastor Zander zu Barkow,
- Bauconducteur Wachenhusen in Schwerin,
- von Oldenburg auf Glave.
2. Die Zahl der correspondirenden Mitglieder hat sich nicht verändert.


|
Seite 5 |




|
3. Zu den 26 auswärtigen Vereinen, mit denen der unsrige durch Correspondenz und Schriften=Austausch in Verbindung steht, kamen hinzu:
27. die Gesellschaft für vaterländische Alterthümer zu Basel,
28. der historische Verein der Oberpfalz und von Regensburg zu Regensburg,
29. der historischeVerein von Oberfranken zu Bayreuth,
30. die westphälische Gesellschaft zur Beförderung vaterländischer Cultur zu Minden,
31. die Geschichts= und Alterthumsforschende Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg.
II. Finanzielle Verhältnisse.
Vom 1. Julius 1843 zum 1. Julius 1844 betrug
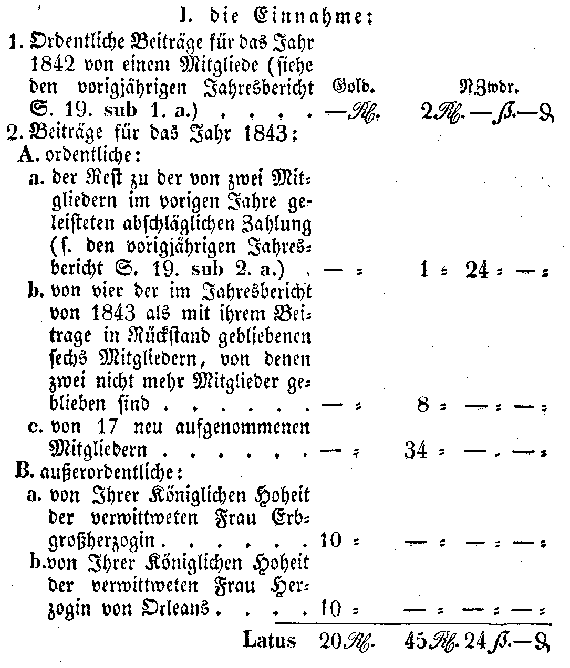


|
Seite 6 |




|
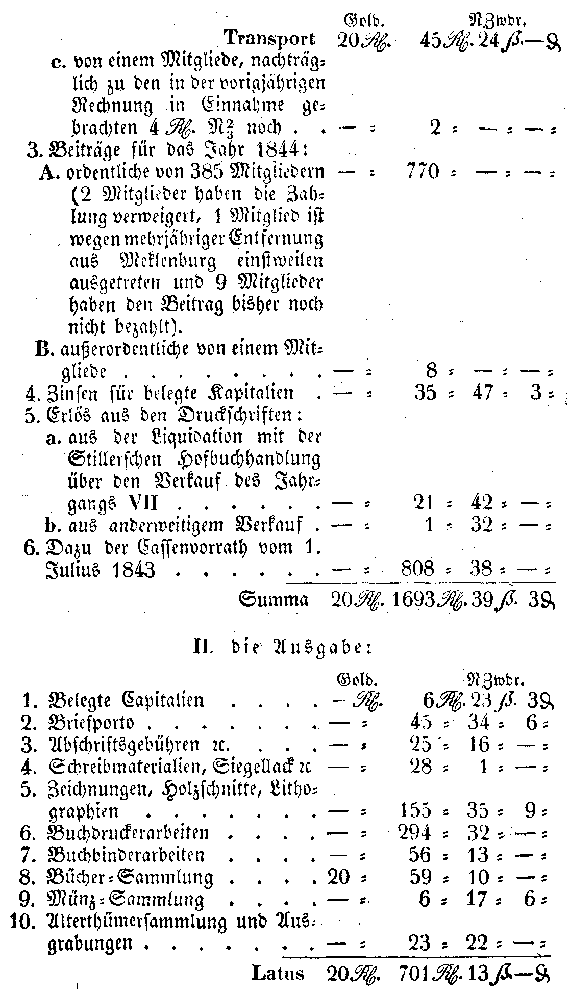


|
Seite 7 |




|
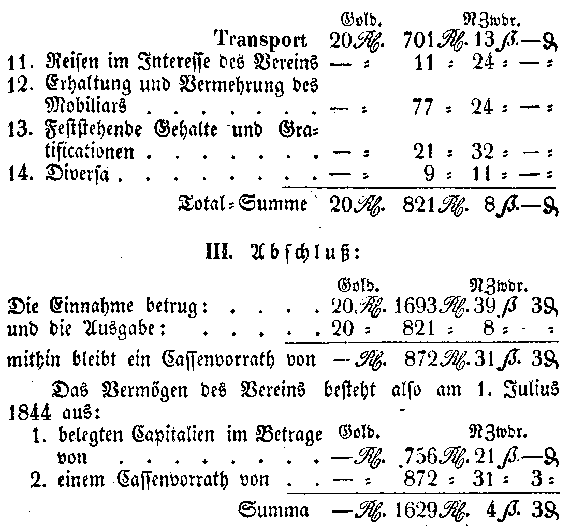
Schwerin, den 1. Julius 1844.
P. F. R. Faull,
p. t. Cassen=Berechner.


|
[ Seite 8 ] |




|
Zweiter Abschnitt.
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
I. Literarische Thätigkeit der Mitglieder.
D ie wissenschaftliche Thätigkeit des Vereins bedarf jetzt keines schriftlichen Berichtes, da die Arbeiten der Mitglieder in den zugleich ausgegebenen Jahrbüchern nun vorliegen. Wir verweisen auf das dort gegebene Inhalts=Verzeichniß der gelieferten Arbeiten, und stellen hier nur die Namen derer zusammen, die theils durch Abhandlungen, theils durch Berichte, Miscellen und anderweitige Mittheilungen die Zwecke des Vereins im Laufe dieses Jahres gefördert haben. Dankbar nennt der Verein die Namen der Herren: Archivar Lisch, Pastor Boll zu Neubrandenburg, Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin, Archiv=Registrator Glöckler zu Schwerin, Advocat Dr. Beyer in Parchim, Senator v. Santen in Kröpelin, Pastor Ritter zu Vietlübbe, Pastor Masch in Demern, v. Kardorff auf Remlin, Dr. Jenning zu Stavenhagen, Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan, Pastor Priester zu Westenbrügge.
Von den correspondirenden Mitgliedern hat vorzüglich Herr Dr. Köhne, Privatdocent in Berlin und Herausgeber der Zeitschrift für Münz= und Wappenkunde, uns mit seiner umfassenden Gelehrsamkeit und seinen numismatischen Schätzen kräftig unterstützt. Auch die übrigen correspondirenden Mitglieder ließen keine Bitte um Hülfe unerfüllt. Mit den correspondirenden Vereinen, welche jetzt zum großen Theil mit Herausgabe von Urkunden=Sammlungen und anderen größeren Werken beschäftigt sind, boten sich in diesem Jahre keine bedeutenderen Berührungspuncte dar.


|
Seite 9 |




|
Die meklenburgischen Regesten.
Nach dem vorigjährigen Berichte (VIII, S. 158) betrug die Anzahl der bereits bearbeiteten Urkunden . . .4398,
| Hinzugekommen sind: | ||
| Vom Herrn Archivar Lisch aus Michelsen Acta judicialia . . . . . | 7 | |
| Gesterding Pommersches Magazin . . . | 1 | |
| ---- | 8. | |
| Vom Unterzeichneten aus | ||
| Zuverlässiger Ausführung cett. . . . . . | 82 | |
| Lisch Gesch. und Urk. des Geschl. Hahn . | 32 | |
| Lisch Jahrbücher VII . . . . . . . . . . . . | 25 | |
| Lisch Jahrbücher VIII . . . . . . . . . . . . | 16 | |
| ---- | 155. | |
| -- | ----- | |
| 4561. |
Die Zahl der durchforschten Werke ist 114.
Demern, den 10.Julius 1844.
G. M. C. Masch.
Um die Benutzung der in den bisherigen Jahrbüchern und Jahresberichten niedergelegten Forschungen und Notizen zu erleichtern, hat Herr Pastor Ritter ein ausführliches Register über die ersten fünf Jahrgänge ausgearbeitet. Dasselbe wird zugleich mit den Jahrbüchern und diesem Berichte den Mitgliedern zugesandt werden. Durch diese verdienstliche Arbeit des Herrn Pastor Ritter wird, hoffen wir, das Unternehmen des Darmstädter Vereins, welcher ein Register über die Jahrbücher der sämmtlichen deutschen Vereine zu liefern gedenkt, bedeutend unterstützt werden.
Wohl darf endlich der Verein auch zwei literarische Arbeiten des Herrn Archivar Lisch, welche die Tendenzen unseres Vereins nahe berühren, und aus den dem Vereine gewidmeten Studien hervorgegangen sind, hier mit aufführen:
Geschichte und Urkunden des Geschlechts Hahn. 1.
Band.
Schwerin 1844.
Urkunden=Sammlung zur Geschichte des Geschlechts
v. Maltzahn. 1. Band. Schwerin 1842.


|
Seite 10 |




|
II. Erwerb der Sammlungen.
A. Bibliothek.
Die Bibliothek des Vereins hat sich im letzten Jahre um 124 Nr. vermehrt, und besteht jetzt aus etwa 1500 Bänden, welche sie meistens der Güte einzelner Mitglieder und auswärtiger Vereine verdankt.
Im Herbste des vorigen Jahres ist die Bibliothek wissenschaftlich geordnet und aufgestellt worden. Auch das bisher beanstandete Binden eines großen Theils der Bücher, namentlich der zahlreichen auswärtigen Vereins=Schriften, ward nach Möglichkeit beschleunigt.
Die Benutzung der Bibliothek ist dadurch erweitert worden, daß zeitweise einzelne Bücher, die von allgemeinerem Interesse zu sein schienen, in Schwerin wohnenden Mitgliedern des Vereins zur Ansicht mitgetheilt wurden. Demnächst wird auch die Einrichtung eines kleinen Lesezirkels geschehen, sobald das Binden und Stempeln der Bücher genügend vorgeschritten sein wird.
Das folgende Verzeichniß der in dem letzten Jahre erworbenen Bücher ist bereits nach dem grundleglichen Systeme der Geschichte und ihrer Hülfswissenschaften abgefaßt.
Verzeichniß
der in dem Vereinsjahre 1843/44 erworbenen
Bücher,
wissenschaftlich geordnet.
I. Allgemeine und classische Alterthumskunde.
(Bemerkung. Ueber solche Alterthumswissenschaftliche Werke, welche ausschließlich oder doch in der Hauptsache ein bestimmtes Land betreffen, sehe man die unten folgende Landesgeschichte der einzelnen Staaten. Weitere Nachweisungen bleiben vorbehalten.)
Nr.
- Dr. Göbel, Ueber den Einfluß der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit, insbesondere in den Ostseegouvernements. Erlangen 1842. 8.
- L. J. F. Janssen, De grieksche, romeinsche en etrurische Monumenten van het Museum van Oudheden te Leyden. Leyden 1843. 8. (Bis jetzt 2 Hefte. Geschenk des Hrn. Verfassers.)


|
Seite 11 |




|
II. Münz= und Wappenkunde.
- J. F. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch, Bd. 1. Lieferung 8 - 12. Stettin 1843. gr. 8. (Schluß des ersten Bandes.)
- Dr. E. H. Toelken, Ueber die Darstellung der Vorsehung und der Ewigkeit auf römischen Kaisermünzen. Berlin 1844. 8.
- Dr. B. Köne, Briefe über die Brandenburgische Münzgeschichte. Berlin 1844. 8. (Nr. 4. und 5. aus Köhne's Zeitschrift für Münz=, Siegel= und Wappenkunde. Bd. IV.)
- Dr. B. Köhne, die auf die Geschichte der Deutschen und Sarmaten bezüglichen römischen Münzen. Mit 3 Kupfertafeln. Berlin 1844. 8. (Nr. 4 bis 6 Geschenke des Hrn. Dr. Köhne.)
III. Sprachkunde.
- Dr. E. G. Graff, Althochdeutscher Sprachschatz. Th. VI. 24 - 26. Lieferung. Berlin 1842. 4. (Geschenk Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin.)
- Njemsko=Serski Slownik. Wot. J. E. Smolerja. Deutschwendisches Wörterbuch von J. E. Schmaler. Bautzen 1843. 8.
- Dr. K. Bernhardi, Sprachkarte von Deutschland. Als Versuch entworfen und erläutert. Kassel 1844. 8. (Geschenk des histor. Vereins zu Kassel.)
IV. Kunst= und Litteratur=Geschichte.
(Vgl. unten die Schweiz und die
Niederlande, auch Thüringen.)
- Joseph Heller, Monogrammen=Lexicon, enthaltend die Zeichen der Zeichner, Maler, Kupferstecher u.s.w. mit kurzen Nachrichten über dieselben. Bamberg 1831. 8.
- Zweites Verzeichniß der Gemälde=Sammlung, so wie anderer Kunstwerke, des Freiherrn v. Speck=Sternburg, Erbherrn auf Lützschena, Freyroda u.s.w. Herausgegeben vom Besitzer derselben. (Mit vielen Abbildungen.) Leipzig 1837. Fol. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- Notizen über Kunst und Künstler zu Basel. Das. 1841. 8. (Geschenk der histor. Gesellschaft zu Basel.)
- Sulpiz Boisserée, Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln. Zweite umgearbeitete Ausgabe mit 5 Abbildungen. München 1842. gr. 4. (Geschenk des Hrn. Regierungs=Directors von Oertzen.)


|
Seite 12 |




|
- A. Brandenburg, Ueber das städtische Bauwesen des Mittelalters in Anwendung auf Stralsund. Das. 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Johann Keppler, kaiserlicher Mathematiker. Denkschrift des histor. Vereins von Regensburg auf die Feier seines zehnjährigen Bestandes. Mit Keppler's Bildniß, Wappen und dem Faksimile seiner Handschrift. Regensburg 1842. gr. 4. (Geschenk des Vereins.)
V. Sammelwerke und allgemeine Geschichte.
16 - 20. J. E. Dähnert, Critische Nachrichten. 5 Bände.Greifswald 1750-1754. 8.
- Dr. W. E. Wilda, Das Gildenwesen im Mittelalter. Eine Preisschrift. Berlin (1831.) 8.
- Dr. Burmeister, Beiträge zur Geschichte Europa's im sechszehnten Jahrh. aus den Archiven der Hansestädte. Rostock 1843. 8. (Geschenk der Erben des Verfassers.)
- Dr. W. Havemann, Handbuch der neueren Geschichte. Dritter Theil. Jena 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
VI. Die Schweiz.
(Vgl. Kunst= und Litteratur=Geschichte.)
24. 25. Beiträge zur Geschichte Basel's, herausgegeben von der histor. Gesellschaft zu Basel. Erster und zweiter Band. Basel 1839. 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Basel. Die römischen Inschriften des Cantons Basel v. Dr. K. L. Both. Das. 1843. gr. 4.
- Antiquarische Mittheilungen aus Basel. Die Grabhügel in der Hardt, eröffnet und beschrieben von Prof. W. Vischer. Zürich 1842. 4. (Nr. 26 und 27 Geschenke der antiquar. Gesellschaft zu Basel.)
- Mittheilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Heft VIII. [ Enthaltend Etwas über die Frauen und die Liebe im Mittelalter. - Die frühern Hefte sind vorzugsweise kunstgeschichtlichen Inhalts.] Zürich 1844. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
VII. Die Niederlande.
- L. J. F. Janssen, Oudheidkundige Ontdekking aangaande den Tempel der Dea Sandraudiga te Zundert in Noord=Braband. (Ohne Druckort. Aus einer holländ. Zeitschrift.)


|
Seite 13 |




|
- L. J. F. Janssen, Over een romeinschen Steen, in heet iaar 1839 te Werkhoven opgegraven. Utrecht 1843. 8.
- L. J. F. Janssen, Oudheidkundige Mededeelingen II. Met twe gekleurde Platen. Leyden 1843. 8 (Nr. 29 bis 31. Geschenke des Hrn. Verfassers.)
- Dr. C. Leemanns, Romeinsche Oudheden te Maastricht. Met 1 Kaart en 5 Platen in 4to. Leyden 1843. 8.
- Prosper Cuypers, Bericht omtrent oude Grafhawels onder Alphan in Noord=Braband (Met 3 Platen.) Arnheim 1843. 8. (Nr. 32 und 33 Geschenke des Hrn. Dr. Leemanns zu Leyden.)
- Dr. Hallmann, die Geschichte des Ursprungs der belgischen Beghinen. Mit Abbildungen auf 3 Tafeln. Berlin 1843. 8.
VIII. Slavische Länder, bes. Böhmen.
- P. J Schafarik's slavische Alterthümer. Deutsch von Mosig von Aehrenfeld, herausgeg. von Heinr. Wuttke. Bd. 2. Leipzig 1843. 8.
- 37. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der 20sten General=Versammlung am 11. Mai 1842 und in der 21sten Ger. Vers. am 8. April 1843. Prag 1842. 1843. 8.
- Das vaterländische Museum in Böhmen im J. 1842. Das. w. o. (Nr. 36 bis 38. Geschenke der Gesellschaft.)
IX. Russische Ostseeländer.
39. 40. Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv=, Est= und Kurland's dienen. Erster und zweiter Band. Riga und Leipzig 1835. 1839. 4. (Geschenk des Hrn. Dr. Deecke zu Lübeck.)
- Desselben Werkes dritter Band, Das. 1842. 4.
- Necrolivonica, oder Alterthümer Liv=, Est= und Kurland's bis zur Einführung der christlichen Religion, von Dr. F. Kruse, Prof. der Geschichte in Dorpat. Mit vielen Abbildungen und Charten. Dorpat und Leipzig 1842. gr. Fol.


|
Seite 14 |




|
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv=, Est= und Kurland's, herausgeg. von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russ. Ostsee=Provinzen. Zweiten Bandes erstes bis drittes Heft. Riga und Leipzig 1840-1842. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
X. Schweden.
- Runographia Gothlandiae revisa, aucta et illustrata, praeside J. H. Schroeder, prof. Upsal. subm. J. N. Cramer. Upsaliae 1835. (Geschenk des Hrn. Bibliothekars Prof. Schröder.)
- 46. A. Fryxell, Erzählungen aus der schwedischen Geschichte. Erster und zweiter Theil. Uebersetzt von F. Homburg. Stockholm und Leipzig 1843. 8. (Geschenk des Hrn. v. Kardorff auf Remlin zu Gnoien.)
XI. Dänemark.
- Dr. E. C. Werlauff, Sophia af Meklenborg, Dronning til Danmark og Norge. Kjöbenhavn. 1841. Fol. (Geschenk des Hrn. Archivar Lisch.)
- C. Molbech, og U. M. Petersen, Udvalg af bidtil utrykte Danske Diplomer og Breve fra det XIV de XV de og XVI de Aarkundrede. Forste Binds forste og andet, Hefte. Kiobenhavn, 1842. 43. 8. (Geschenk des Hrn. Prof. Molbeck zu Kopenhagen.)
49 - 51. Historisk Tidsskrift, udgivet af den danske historiske Forening. Redigiret af C. Molbech. Andet Binds andet Hefte. Kiobenhavn, 1841. Tredie Bind. ibd. 1842. Fierte Binds forste Hefte ibd. 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- C. Molbech, Det Kongelinge Danske Videnschabernes Selskabs Historie, i dets forste Aarhundrede. 1742-1842. Kiobenhavn. 1843. gr. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers)
- J. J. A. Worsage, Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet. Aus dem Dänischen von N. Bertelsen. Kopenhagen 1844. gr. 8.
XII. Deutsche Alterthümer und
Rechts=Geschichte.
(Vgl. Münz= und Wappenkunde, sowie
Kunst=Geschichte und Sammelwerke.)
- Jacob Grimm, Weisthümer. Dritter Teil. Göttingen. 1842. 8. (Geschenk Sr. Exzellenz des Herrn Ministers von Lützow.)


|
Seite 15 |




|
- A. Schrader, Germanische Mythologie. Mit einer kurzen Abhandlung über die sonstigen deutschen Alterthümer. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- Aphoristisches über Zauberei und Magie von Dr. Kirchhoff. Aus der Sundine des J. 1843 (Geschenk des Hrn. Dr. Zober in Stralsund.)
- (W. Meinhold, Maria Schweidler, die Bernsteinhexe. Berlin 1843. 8.)
- G. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. I. Band. Kiel 1844. 8.
XIII. Deutsche Landes=Geschichte.
a. Baiern.
- Abhandlungen der historischen Classe der königl. bayerischen Academie der Wissenschaften. Dritten Bandes dritte Abtheilung. München 1843. 4.
- Almanach der königl. bayerischen Academie der Wissenschaften. München 1843. 8.
61. 62. a. Bülletin der königlichen Academie der Wissenschaften. Num. 1 - 55. München 1843. 4. b. Gelehrte Anzeigen. Herausge. von Mitgliedern der königl. Academie. Jan. bis Jul. 1843. Das. 4. (Nr. 59 - 62. Geschenke der königl. Academie zu München.)
- Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Herausgegeben von dem histor. Vereine von und für Ober=Bayern. Fünfter Band, erstes und zweites Heft München 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Verhandlungen des histor. Vereins der Oberpfalz und von Regensburg. Siebenter Band. Regensburg. 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Bericht, sechster, über das Bestehen und Wirken des historischen Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern. Bamberg 1843. 8. (Geschenk des Vereins)
b. Baden.
- K. Wilhelmi, Neunter Jahresbericht an die Mitglieder der Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmale der Vorzeit. 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
c. Hessen.
- Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Dritter Band, drittes und viertes Heft. Kassel 1843. 8.


|
Seite 16 |




|
- Dieselbe Zeitschrift. Zweites Supplement. Hessische Chronik von Wigand Lauze. Zweiter Theil. Kassel 1843. 8.
- Dieselbe Zeitschrift. Drittes Supplement. Uebersicht der kurhessischen Flora. Abth. I. Heft 1 und 2. Kassel. 1844. 8. (Nr. 67 bis 69. Geschenke des Vereins.)
d. Thüringen und Sachsen.
- Statuten des hennebergischen alterthumsforschenden Vereins zu Meiningen 1838. 8.
- Chronik der Stadt Meiningen von 1676 bis 1834. Herausgeg. von dem henneberg. alterthumsfor. Verein. Erster und zweiter Theil. Meiningen 1834. 35. 4.
- Die ehernen Denkmale Henneberg. Grafen von Peter Vischer in der Stiftskirche zu Römhild. Gezeichnet und beschrieben von A. W. Doebner, herzoglich sächsischem Landbaumeister. München 1840. gr. Fol.
- Programm zur zehnten Jahresfeier des henneberg. alterthumsforsch. Vereins am 14. Nov. 1842. Vom Vereins=Director Bechstein. Meiningen 1842. 4.
- Beiträge zur Geschichte deutschen Alterthums. Herausgeg. von dem henneberg. alterthumsf. Vereine durch A. Gutgesell, Secretair des Vereins. Erste bis vierte Lieferung. Meiningen 1834-1842. 8.
- Hennebergisches Urkundenbuch. Im Namen des henneberg. alterthumsf. Vereins herausgegeben von C. Schöppach. 1. Thl. vom J. 933 bis 1330. Meiningen 1842. 4.
- Einladungsschrift zur elften Jahresfestfeier des Henneberg. alterthumsf. Vereins in Meiningen am 14. Nov. 1843. Das. 1843. gr. 4. (Nr. 70 bis 76 Geschenke des Vereins.)
77. 78. Erster bis dritter Bericht über das Bestehen und Wirken der am 29. Sept. 1838 gegründeten Geschicht= und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, von Dr. K. Back. Altenburg 1841. 1842. 8. - Nebst den Statuten der Gesellschaft und einem Bücher=Verzeichniß. (Geschenke der Gesellschaft.)
- K. Preusker, Blicke in die vaterländische Vorzeit der sächsischen und angrenzenden Lande. Dritter Band. Erstes Heft. Mit 133 Abbildungen auf 2 Steindrucktafeln. Leipzig 1844. 8.


|
Seite 17 |




|
e. Schlesien und die Lausitz.
- Büsching, Die Alterthümer der heidnischen Zeit Schlesiens. Band 1. Breslau 1820. Fol. (Mit vielen Steindrucktafeln.)
81. - 84. Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur vom Jahre 1824-1842. 19 Hefte. Breslau 1825-1843. 4. (4 Bde. - Geschenk der Gesellschaft.)
85. 86. Scriptores rerum Lusaticarum. Sammlung Ober= und Niederlausitzer Geschichtsschreiber. Herausgeg. von der oberlaus. Gesellschaft der Wissenschaften. Neuer Folge erster und zweiter Band. Görlitz 1841. gr. 8.
- J. L. Haupt, Neues Lausitzsches Magazin. Herausgeg. von der Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften. Neunzehnter - neuer Folge sechster - Band. Erstes bis viertes Heft. Görlitz 1841. 8. (Nr. 85-87. Geschenke der Gesellschaft.)
88. 89. J. L. Haupt, Anzeigen der Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz. Neuer Folge erstes bis achtes Stück. Görlitz 1834-1841. 8. (2 Bde. - Geschenk des Hrn. Pastors Haupt, Secretairs und Bibliothekars der Gesellschaft.)
f. Preussen und Pommern.
(Vgl. Münz= und Wappenkunde, auch
Kunst= und Literatur=Gesch.)
- C. W. Grundmann, Versuch einer Uckermärk. Adelshistorie, aus Lehnbriefen und andern glaubwürdigen Urkunden zusammengetragen. (Erster Theil). Prentzlau. 1774. Fol.
91. 92. G. G. N. Gesterding, Pommersches Magazin. Thl. 1-6. in zwei Bänden. Greifswald und Rostock 1774-1782.
- Historisch=critische Untersuchung sämmtlicher Nachrichten von der ehemal. hochberühmten (pommerschen) Seestadt Jemsburg. Copenhagen und Leipzig 1776. 4. (Geschenk des Hrn. Amtshauptm. Ratich zu Wittenburg.)
- G. G. N. Gesterdings, Pommersches Museum. Erster Band. Rostock 1782. 1784. 4.
- Die Feier des dritten Reformations=Jubelfestes zu Stralsund. Das. (1817.) 4.
- Bericht des literar. geselligen Vereins zu Stralsund. während d. J. 1842. und 1843. Stralsund 1844. 8. (Nr. 95 und 96 Geschenke des Hrn. Dr. Zober.)


|
Seite 18 |




|
- v. Kamptz, Staatsminister, Actenmäßige Darstellung der Preussischen Gesetz=Revision. Berlin 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- R. T. W. Hasselbach, die 600jährige Jubelfeier der Bewidmung Stettins mit Magdeburgischem Rechte. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Staatsministers von Kamptz.)
- Dr. Fr. von Hagenow, Grundriß von Greifswald und den Vorstädten. 1843. gr. Royal=Fol. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- Baltische Studien. Herausgeg. von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Neunten Jahrganges zweites Heft. Stettin 1843. 8.
-
Achtzehnter Jahresbericht der Gesellschaft für
Pommersche Geschichte
 . Stettin 1843. 8. (Nr. 101 und
102 Geschenke der Gesellschaft.)
. Stettin 1843. 8. (Nr. 101 und
102 Geschenke der Gesellschaft.)
- F. W. Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Vierter Theil. Erster Band. (1411-1498.) Hamburg 1843. 8.
- Codex Pomeraniae diplomaticus. Herausgeg. von Dr. K. Hasselbach, Dr. J Kosegarten und F. von Medem. Erster Band. 1. Lieferung. Mit Lithographien. Greifswald 1843. gr. 4.
g. Westphalen.
104 - 106. Westphälische Provinzial=Blätter. Verhandlungen der westphälischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Erster und zweiter Band. Minden 1828-1843. (Geschenk der Gesellschaft.)
- Zeitschrift für vaterländ. Geschichte und Alterthumskunde. Herausgeg. von dem Verein für Gesch. u. Alterthumskunde Westphalens durch Erhard und Gehrken. Bd. VI. Münster 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
h. Braunschweig und Hannover.
- Annalen der braunschweig=lüneb. Churlande, herausgeg. von Jacobi und Kraut. Ersten Jahrg. erstes und zweites Stück. Hannover. 1787. 8. (Geschenk des Hrn. Amtshauptm. Ratich zu Wittenburg.)
- Vaterländisches Archiv des historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrgang 1842. Hannover 1842. 8.
- Sechste Nachricht über den historischen Verein für Niedersachsen. Hannover 1843. 8. (Nr. 103 und 104 Geschenke des Vereins.)


|
Seite 19 |




|
i. Lübeck und Hamburg.
- Codex diplomaticus Lubecensis. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgeg. von dem Vereine für Lübeckische Geschichte. Erster Theil. Das. 1843. 4. (Geschenk des Vereins.)
- Dr. E. Deecke, Geschichte der Stadt Lübeck. Erstes Buch. Das. 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- Zeitschrift des Vereins für Hamburg. Geschichte. Ersten Bandes drittes und viertes Heft. Hamburg 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
- A. L. J. Michelsen, Acta Judicialia in causa, quae inter comites Holsatiae et consules Hamburgenses medio saeculo XIV agitata est de libertate civitatis Hamburgensis publica. Jena 1844. gr. 4. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
k. Schleswig, Holstein und Lauenburg.
-
Archiv für Staats= und Kirchengeschichte der
Herzogthümer Schleswig=Holstein, Lauenburg
 . Herausgegeben von der
Gesellschaft für vaterländische Geschichte.
Fünfter Band. Altona 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
. Herausgegeben von der
Gesellschaft für vaterländische Geschichte.
Fünfter Band. Altona 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
Meklenburgica.
- Gentzen, Bibliothekar zu Neustrelitz, Verzeichnis der neuen Erwerbungen für das großh. Georgium das. von Michaelis 1842 bis dahin 1843. 4. (Ohne Druckort und Titel. - Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- von Maltzan, Reichsfreiherr u. s. w. Erbherr auf Peutsch, Beitrag zur Geschichte der Ostenschen Güter in Vorpommern. Schwerin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- von Kamptz, Staatsminister, Geschichte der Familie von Kamptz. Für die Familie entworfen. Berlin 1843. gr. 8. Mit dem Bildnisse des Verf. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- G. C. F. Lisch, Geschichte und Urkunden des Geschlechts Hahn. Erster Band, bis 1299. Mit 1 Steindrucktafel. Schwerin 1844. gr. 8. (Geschenk des Hrn. Herausg.)
-
J. D. W. Sachse, großh. meklenb.=schwer.
Leibarzt
 ., Einige geschichtliche
Bemerkungen zu der Feier des fünfzigjährigen
Bestehens des Doberaner Seebades. Rostock 1843.
4. Mit 2 Plänen.
., Einige geschichtliche
Bemerkungen zu der Feier des fünfzigjährigen
Bestehens des Doberaner Seebades. Rostock 1843.
4. Mit 2 Plänen.
- Großh. meklenburg=schwerinscher Staatskalender. 1844. Schwerin 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Hofbuchdruckers Bärensprung.)


|
Seite 20 |




|
- Dr. K. Hanmann, Warnemünde, dessen Seebad und die Wirkung der dortigen Luft. Ein Handbuch. Rostock 1843. 12.
- J. L. Schumacher, Mittheilungen an seine Landsleute in Mecklenburg über die Versammlung deutscher Land= und Forstwirthe in Altenburg. Parchim und Ludwigslust 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
- Zwei Schulprogramme der Stadtschule zu Wismar, herausgeg. von Prof. M. Crain und Dr. Nölting. Wismar 1843. 4. (Geschenk des Hrn. Prof. Crain. )
A. F. W. Glöckler,
Bibliothekar des Vereins.
B. Urkunden.
An Urkunden erhielt der Verein die p. 475 aufgezählten 19 Originalurkunden von Herrn v. Oertzen auf Roggow, ferner Abschriften von Urkunden von den Herren: Bagmihl zu Stettin, Revisionsrath Schumacher zu Schwerin und Archivar Lisch. Siehe Jahrb. p. 477 sq. p. 249 sq.
C. Alterthümer.
In das Verzeichniß sind diejenigen Alterthümer nicht mit aufgenommen, die oben in den Jahrb. theils bei Gelegenheit der Ausgrabungsberichte, theils als besondere Merkwürdigkeiten bereits ausführlich besprochen worden sind. Eben so ist bei den übrigen Sammlungen das in den Jahrb. Erwähnte nicht wiederholt worden. Nur die Namen der Geber erlauben wir uns vollständig mitzutheilen. Mit unablässigem Eifer und mit großen Aufopferungen bereicherten die Sammlungen Herr Baron von Maltzan auf Peutsch, Herr von Kardorff auf Remlin, Herr Pastor Ritter zu Vietlübbe. Zu nicht geringerem Danke fühlt sich der Verein den übrigen geehrten Gebern verpflichtet, nämlich den Herren: Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan, von Behr=Negendank auf Torgelow, Dr. Beyer zu Parchim, Rittmeister von Blücher auf Rosenow, Landrath von Blücher auf Kuppentin, Präpositus Crull zu Doberan, Pächter Dabel zu Retzow, Pastor Erfurth zu Picher, Senator Fabricius zu Neustadt, Pastor Fredenhagen zu Dambeck, von Flotow auf Walow, Dr. von Hagenow zu Greifswalde, Heise auf Vollrathsruhe, Major von Kardorf auf Böhlendorf, Geheimer Amtsrath Koch zu Sülz, Kreisphysikus Dr. Kues zu


|
Seite 21 |




|
Lage, Ingenieur Lierow in Parchim, Kammerdirector von Meerheimb in Schwerin, Pastor Nahmmacher zu Peccatel, von Oertzen auf Roggow, Amtshauptmann Ratich zu Wittenburg, Kammer=Revisor Sachse zu Schwerin, von Schuckmann auf Gottesgabe, Senator Schultetus zu Plau, Pastor Vortisch zu Satow, Carl Wennmohs in Parchim, Obberbaurath Wünsch in Schwerin, Graf von Zieten in Wustrau bei Neu=Ruppin.
1. Aus vorchristlicher Zeit.
a. Aus der Zeit der Hünengräber.
Außer den oben besprochenen in den Gräbern gefundenen Alterthümern kam zu der Sammlung hinzu:
Ein roh zugehauener, noch nicht geschliffener Keil , ein halbmondförmiges Schabemesser , wie Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 4, ein spanförmiges Messer , wie Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 9., sämmtlich aus Feuerstein, zu Wattmannshagen bei Teterow gefunden und dem Vereine geschenkt vom Herrn Carl Wennmohs zu Parchim.
Eine Streitaxt aus Hornblende,
gefunden bei Schönberg, nicht weit hinter der Ziegelei, geschenkt vom Herrn Oberbaurath Wünsch zu Schwerin.
Ein Streithammer aus grünlicher Hornblende,
3 1/2" lang, auf der Oberfläche, mit Ausnahme einer kleinen Stelle, stark verwittert und ausgespült, gefunden zu Wokrent bei Schwaan in einem Graben, geschenkt von dem Herrn Kammer=Director Baron von Meerheimb auf Wokrent zu Schwerin.
Ein Streithammer aus Hornblende,
von der in Meklenburg gewöhnlich vorkommenden Form, 4 1/2" lang, wie Frid. Franc. Tab. I, Fig. 5, gefunden zu Rosenow bei Stavenhagen, geschenkt vom Herrn Rittmeister von Blücher auf Rosenow.
Ein Schmalmeißel von Feuerstein,
8 1/2" lang, gefunden zu Kuppentin bei Lübz, zwischen zwei großen Steinen unter einer kleinen Erdanhäufung, wahrscheinlich dem Reste eines Hünengrabes, geschenkt vom Herrn Land


|
Seite 22 |




|
rath von Blücher auf Kuppentin. Ein noch längeres Exemplar ward neben diesem gefunden, jedoch von den Arbeitern zerschlagen.
Ein Dolch von Feuerstein,
dunkelgrau, 8" lang, wie Frid. Franc. Tab. XXX, Fig. 2, gefunden in einem Moor bei Sülz, geschenkt vom Herrn Geheimen Amtsrath Koch zu Sülz.
Eine Lanzenspitze von Feuerstein,
bräunlich=durchscheinend, 5" lang, gefunden zu Wendischhof, geschenkt vom Herrn von Schuckmann auf Gottesgabe.
Ein Keil aus Feuerstein,
3 1/2" lang, hohl geschliffen, gefunden auf dem Stadtfelde von Gnoyen bei Ziehung eines Grabens, geschenkt von dem Herrn von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.
Ein Keil aus der Goldenen Aue,
von schwarzem Kieselschiefer, schmal, zur Hälfte vorhanden, geschenkt vom Herrn Kammer= Revisor Sachse zu Schwerin.
b. Aus der Zeit der Kegelgräber.
Eine zu Vollrathsruhe einige Fuß tief im Moor gefundene bronzene Schwertklinge ohne Rost, geschenkt vom Herrn Heise auf Vollrathsruhe. Dieselbe hat eine etwas verbogene Griffzunge mit Nietlöchern, ist spitz auslaufend in der Klinge 2' 4" lang.
Eine beim Graben in einer Wiese nahe bei der Stadt Neustadt gefundene Framea mit Schaftrinne, von der in Meklenburg am häufigsten vorkommenden Art, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 5, von dem Herrn Senator Fabricius zu Neustadt dem Vereine geschenkt.
c. Aus der Zeit der Wendengräber:
Eine eiserne Hakenfibel (Spange),
ganz wie die in Meklenburg in den Wendenkirchhöfen gefundenen, mit vielen eisernen und bronzenen Alterthümern, gefunden zu Krieschow bei Liegnitz, geschenkt vom Herrn Grafen von Zieten auf Wustrow bei Ruppin.


|
Seite 23 |




|
Ein in dem Torfmoor zwischen Vietlübbe und Karbow in der Tiefe von 4 bis 8 Fuß gefundenes Hufeisen, für den Verein erworben vom Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe. Es ist sehr dünn, 4 Zoll lang und eben so breit, und hat nur 6 Nagellöcher. Es beweist, daß die Pferde des Alterthums sehr klein waren (die Torfstecher, die häufig dergl. finden, nennen sie wegen ihrer Kleinheit Hufeisen von Eseln).
2. Aus der Zeit des Mittelalters
Ein Dolchmesser
oder ein Rüting, gefunden in der Nähe von Schwaan, geschenkt vom Herrn Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan.
Auf dem Schloßberge zu Granzow bei Gnoyen wurden
folgende eiserne Geräthe aus dem Mittelalter
gefunden und und von dem Herrn von Kardorf auf
Remlin geschenkt:
ein
Sporn
mit langen
Bügeln,
ein
Sporn
mit kurzen
Bügeln,
ein langes Vorhängeschloß mit dem
Schlüsselloch an einem Ende,
ein kurzes
Vorhänggeschloß
mit dem Schlüsselloch in der Mitte.
Ein eisernes Pferdegebiß
aus dem Mittelalter, geschenkt von dem Herrn von Flotow auf Walow.
Ein eiserner Sporn
zum Anschrauben auf den Harnisch, gefunden zu Peccatel bei Penzlin, geschenkt von dem Herrn Pastor Nahmmacher zu Peccatel.
Eine viereckige Topfkachel,
wahrscheinlich gefunden zu Conow, aus dem Nachlasse des wail. Pastors Mussaeus zu Hansdorf gekauft und geschenkt von dem Herrn Präpositus Crull zu Doberan.
Abformung einer Glocken=Inschrift
aus der Kirche zuWuthenow bei Neu=Ruppin, in unbekannten Characteren, geschenkt vom Herrn Gymnasial=Lehrer Masch zu Neu=Ruppin.


|
Seite 24 |




|
Ein messingener Löffel
mit rundem Blatt, am Ende des Stiels mit einem Wickelkinde, mit einem eingeschlagenen Stempel mit 3 Löffeln und den Buchstaben I. (P.), gefunden im sogenannten "Holländer=Teich" zu Miekenhagen, geschenkt vom Herrn Pastor Vortisch zu Satow.
3. Aus neuerer Zeit.
Eine ovale (Geld=?) Dose von Messing,
an jeder Seite mit 2 Deckeln, welche über einander klappen. Alle Deckel, mit Ausnahme der innern Seite des einen, der als Boden festgelöthet ist, sind an beiden Seiten mit gravirten Bildern geschmückt: die beiden Außenseiten mit: Alexander vor der Tonne des Diogenes, und: dem Brande von Troja, die innern mit Scenen aus dem ehelichen Leben. Alle Darstellungen haben holländische Unterschriften, und die Arbeit ist die bekannte holländische aus dem 17. Jahrhundert. Der Herr von Kardorff auf Remlin hat dieses Stück von einem Kupferschmiede, der es einmal auf einer Auction in Dargun erstand, gekauft und dem Vereine geschenkt.
Eine lange Dose von Kupfer und Messing,
mit gepreßtem Deckel und Boden, auf welchen die Thaten Friederichs des Großen dargestellt sind, Geschenk des Herrn von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.
D. Münzen und Medaillen.
Der Münzvorrath der Sammlung des Vereins bestand am Schlusse des vorigen Geschäftsjahres, wie der Bericht im "8. Jahresbericht, p. 86" nachweiset, aus 3859 Stücken; jetzt ist er zu 4384 angewachsen und besteht aus 557 Hohlmünzen, 20 goldenen, 2954 silbernen, 710 kupfernen zweiseitigen Münzen und 143 Medaillen und Schaumünzen mancherlei Art. Dabei ist aber zu bemerken, daß der wirkliche Bestand mit diesen Zahlenangaben, die dem Accessions=Catalog entnommen sind, nicht mehr übereinstimmt; denn darin sind alle sehr zahlreichen Dubletten begriffen. Von diesen sind, wo sich Gelegenheit dazu darbot, manche vertauscht worden, und wenn gleich die eingetauschten Stücke nicht in jenen Zahlen als Vermehrung


|
Seite 25 |




|
aufgeführt sind, so ist dennoch die Zahl vermindert, da es nicht allemal möglich war, Zahl um Zahl zu tauschen. Durch Austausch aber konnten die Dubletten der Sammlung nur nützlich werden.
Unter den hinzugekommenen 525 Münzen sind 146 angekauft worden, worunter der Münzfund von Sukow (S. Jahrb. IX, p. 467)116 meklenburgische und zu seiner Zeit im Lande cursirende Münzen gab. Desgleichen wurden die Medaillen auf die Vermählung des hochs. Großherzogs Paul Friedrich und des Herzogs Carl von Meklenburg=Strelitz durch Kauf erworben, so wie auch die berliner Medaille auf die Vermählung der Frau Herzogin Helene von Orleans. Die 2 pariser Medaillen und die auf die Geburt und Taufe des Grafen von Paris, alle 4 ausgezeichnet schön, wurden von J. K. H. der Vereinssammlung verehrt. Unter den übrigen angekauften Münzen sind theils einige ältere, theils die neuesten Meklenburgischen Gepräge, dann solche, welche mit Meklenburg in näherer Beziehung standen, als von Lübeck, Pommern, Dänemark, Braunschweig, Hildesheim und Polen, zum Theil hier im Lande gefunden.
Die übrigen Münzen sind der Sammlung als Geschenke zu Theil geworden; die gütigen Geber, deren Namen fast jedes Jahr mit Dank genannt werden, sind folgende:
Herr v. Kardorff auf Remlin überwies nicht allein den schätzbaren, auf seinem Gute gemachten Münzfund von mittelalterlichen Münzen (Jahrb IX, p. 460 ff.) der Sammlung, sondern gab ihr auch einen Thaler des Kurfürsten Moritz von Sachsen von 1552 (v. Madai I, 507), einen Thaler der Herzoge Johann Philipp, Friederich Johann, Wilhelm und Friederich Wilhelm von Sachsen=Altenburg vom Jahre 1624 (v. Madai I. n. 1465), einen Geldernschen Thaler von 1650 (cf. v. Madai I. n. 2132), eine Jubelmünze von 1617, einen Oesterreichischen Thaler des Erzherzogs Leopold von 1632 (v. Madai I. n. 1388), einen lübeckschen Reichsort, und Groschen von Wismar (1652), Brandenburg (1706), Pfalz (1727) und Chursachsen (1695). Herr Postschreiber Rodatz in Schwerin gab eine litthauische Münze des K. Sigismund August von 1557; Herr v. Buch auf Zapkendorf ein Dütchen des G. Philipp Julius von Pommern von 1624; Herr Pastor Zander zu Wosten einen greifswalder Wittenpfennig; Herr Gymnasiallehrer Masch in Neuruppin einen lübeckschen Schilling zwischen 1549 und 1554 geprägt (mit OMENE statt OMNE). Herr D. Köhne, Docent an der Universität zu Berlin, gab die in seinen "Beiträgen" No. 621, 625, 666 beschriebenen hochmeisterlichen Schillinge, dann die daselbst No. 520, 522, 516,


|
Seite 26 |




|
512, 466, 473, 578, 488, 492, 568, 573, 576 verzeichneten Vierchen und Scherfe pommerscher Städte, den Bracteat von Königsberg in der Neumark n. 97 und ein 6 Grossestück von Johann Casimir von Polen von 1668, ein Dütchen von Albrecht von Preußen von 1535, herzogl. pommern=stettinsche Münzen von 1505 und 1516, stralsunder von 1501 und 1515, einen brandenburgischen Kreuzer von 1746 und eine schlesische Münze von 1670. Herr Pastor Ritter zu Vietlübbe schenkte den p. 460 der Jahrbücher beschriebenen, bei Wittenburg gefundenen Denar des Gordianus, einen Scherf von Wolgast von 1592 und mehrere meklenburgische Kupfermünzen. Herr Kirchenöconomus Kleemann in Schwerin verehrte einen brandenburgischen Groschen von 1683; Herr Senator Demmler in Rehna einen lübeckschen Dütchen von 1670 mit Burgermeister David Glorius Wappen (fehlt bei Schnobel) und einen Doppelschilling ohne Jahr, rostocker und wismarsche (1652) und hamburgische (1675) Doppelschillinge, einen holsteinschen Dütchen von 1668, einen Goldabschlag eines braunschweigischen Pfennigs von 1735, dann brandenburgische (1693 und 1703), dänische (1619), lauenburgische (1738) und 4 neue türkische Münzen. Herr Präpositus Eberhard zu Penzlin schenkte 100 theils silberne , theils kupferne Scheidemünzen neuerer Zeit von Meklenburg, Rostock, Wismar, Preußen, Braunschweig und Hannover, Sachsen, Münster, Baiern, Danzig, Dänemark, Oesterreich, Westphalen, Schweden und England. Herr Landbaumeister Hermes in Schwerin überwies einen auf dem Schlachtfelde von Lützen gefundenen Groschen der Gebrüder Ernst und Albert von Sachsen von 1482 (Appel Repert. II, p. 252). Herr Kaufmann Röper in Schwerin gab einen Dreiling des Herzogs Friedrich Wilhelm (Evers 167. 4.). Herr Archivar Lisch einen hinter seinem Hause gefundenen lüneburger Wittenpfennig mit dem Schild auf beiden Seiten (1403 angeordnetes Gepräge). Herr Oberbaurath Wünsch in Schwerin gab eine Münze des Bischofs Ulrich von Federspiel von Chur von 1711 (Appel Repert. I, p. 174. n. 3). Herr v. Berg auf Neuenkirchen verehrte einen preußischen sogenannten Mittelfriedrichsd'or von 1757, einen halben französischen Louisd'or von 1642, einen pommerschen Doppelschilling von 1676 und 1/6 Thaler von Churpfalz von 1714 (Appel Repert. II, p. 241. 3). Herr Pastor Boll in Neubrandenburg schenkte einen Sechsling von Joh. Albrecht von 1549 einen Dreiling von Hans Albrecht von 1624, einen Schilling von 1623 und Sechsling von 1624, einen Düttchen von Albrecht von Preußen von 1535 und einen kupfernen ein=


|
Seite 27 |




|
seitigen Pfennig von Stralsund von 1607. Herr Candidat Paschen in Suckow gab ein belgisches 2 Centimes=Stück von 1834. Herr Gerichtsrath Ahrens in Schwaan sandte von einem daselbst in der Brückenstraße No. 191 beim Ausgraben eines Kellers gefundenen Topf voll Münzen eine Probe, welche aus einem rostocker Düttchen von 1618 und mehreren dänischen Münzen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, so wie auch aus lübeckschen Sechslingen bestand. Ein von ihm eingeschickter Doppelschilling des H. Hans Albrecht von 1618 (Evers 260, 2) war auf dem Felde von Kl. Sprenz von dem Inspector Prestin gefunden. Herr Baron v. Maltzan auf Peutsch schenkte 2 neue preußische Sgr.=Stücke. Herr Pastor Türk zu Güstrow 2 alte meklenburgische Münzen von Herzog Hans Albrecht. Herr Pastor Vortisch zu Satow einen Wittenpfennig von Hamburg (Jahresbericht VI. n. 66) und einen lübecker Düttchen von 1623 (Schnobel p. 58). Herr Bibliothekar Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel verehrte mehrere ganze und durchschnittene Bracteaten der Grafen von Aschersleben, Fürsten von Anhalt, Otto und Heinrich, zwischen 1267 bis 1290 geprägt, aus dem Schadeleber Funde. Herr Präpositus Grimm in Gr. Laasch gab einen lübecker Düttchen von 1624 (Schnobel p. 59) und einen bayreuther Groschen von 1715. Herr Advocat Dr. Jenning zu Stavenhagen schenkte ein meklenburg=strelitzsches Vierschillingsstück von 1756, einen rostocker (1687) und lübecker (1727) Schilling, eine Schaumünze von Achen von 1752, ein Drei=Petermentgenstück von Trier von 1694 (Appel II, p. 315, 2), einen Groschen von Bamberg von 1683 (Appel I, p. 128, 4), ein mindensches halb Reichsort von 1621, brandenburg=preußische Münzen (1695, 1694, 1757, 1775) ein polnisches 6 Groschenstück von 1680, ein dänisches 2 Skillingstück von 1603, und eine päpstliche Münze von Clemens XII. Herr Dr. Dittmer in Lübeck sandte aus einem bei Rehna gemachten und in Lübeck verkauften Funde 29 Münzen, worunter sich außer mehreren Doppelschillingen, Schillingen und Sechslingen des H. Johann Albrecht auch der überaus rare Doppelschilling des H. Albrecht von 1527 mit dem Greif, der den Büffelschild hält, befand. Die übrigen waren: rostocker ohne Jahrszahl, wismaraner von 1538, 1550, 1555, stralsunder von 1538 und Bracteaten von Wismar, Lüneburg und Dänemark, welche sich den Münzstücken aus dem 16. Jahrhundert gewöhnlich beigemischt finden.
G. M. C. Masch.


|
Seite 28 |




|
Abdrücke von Münzen eines zu Grüneberg bei Lippehne in der Neumark gemachten Fundes norddeutscher Münzen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhielten wir von Herrn F. W. Kretschmer zu Berlin.
Zeichnung eines für eine Münze der Stadt Neu=Brandenburg ausgegebenen Bracteaten und des Siegels der Stadt Neu=Brandenburg, vom Herrn F. W. Kretschmer zu Berlin.
E. Siegelsammlung.
Die Siegelsammlung erhielt die Abdrücke von den Siegeln der Städte Crivitz, Gnoien und Güstrow durch den Herrn Baron von Maltzan auf Peutsch und der Stadt Plau durch den Herrn Senator Schultetus zu Plau.
Von dem Herrn Bagmihl zu Stettin Lackabdrücke von dem großen Stadtiegel von Grevismühlen und von acht Stadt= und Zunftsiegeln der Stadt Stettin.
Vom Herrn Pastor Priester zu Westenbrügge ist geschenkt:
1. eine colorirte Abbildung des in der ehemaligen Begräbnißkapelle der Familie von Bibow in der Kirche zu Westenbrügge befindlichen Epitaphiums auf den dänischen General=Major Sivert von Bibow, geb. 1639, † 25.(?) Jan: 167(7?) im Sturme vor Malmö, mit einem rechts hin schreitenden, ganz rothen Hahn auf einem grünen Kissen im silbernen Felde.
2. eine Zeichnung des Wappens des Ritters Heinrich von Bibow zu Westenbrügge auf einer Glocke vom 19. Julius 1384 in der Kirche zu Westenbrügge, mit einem rechts hin schreitenden Hahn ohne Kissen.
Ein Siegelring 9 von Messing mit einem Schilde mit einem Schlachterbeil quer über einem Schleifeisen, über dem Schilde mit dem Buchstaben H o R o , - wahrscheinlich der Ring eines Schlachters, gefunden zu Klein=Lukow bei Penzlin und eingereicht durch den Herrn Inspector Brauer daselbst.
Zur Heraldik diente ferner eine von dem Herrn Baron A. von Maltzan auf Peutsch geschenkte Zeichnung und Lithographie des Leichensteins auf dem Grabe der Ritter Heinrich Maltzan, † 1330, und Ludolf Maltzan, † 1341, in der Kirche zu Dargun (vgl. Jahrb. VI, S. 97) und des Leichensteins aud dem Grabe des Ritters Barthold Maltzan, † 1382, in der Kirche zu Rühn (vgl. Jahrb. III, S. 161).


|
Seite 29 |




|
F. Zeichnungen.
Von dem Herrn Grafen von Zieten auf Wustrau erhielten wir die durch den Herrn Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin gefertigten Zeichnungen:
1. einer Urne und eines in derselben gefundenen eisernen Sporns, gefunden zu Busow, Kr. Anclam,
2. eines bronzenen Schwertes, gefunden bei Mirow,
3. eines bronzenen Kopfringes, eines bronzenen Armringes und eines thönernen Löffels, gefunden zu Krieschow bei Liegnitz,
alles in der Sammlung des Herrn Grafen von Zieten zu Wustrau bei Ruppin.
Den Grundriß des Schlosses zu Plau aus dem Ende des 16. Jahrhunderts schenkte Herr Senator Schultetus zu Plau.
III. Verhandlungen der General=Versammlung.
1. Wahlen. Mit der lebhaftesten Freude wurde die von dem Herrn Präsidenten und dem Herrn Vice=Präsidenten gegebene Erklärung aufgenommen, daß sie auch ferner bereit wären, ihre bisherige Stellung zu dem Vereine beizubehalten. Zu der durch den Abgang des Herrn Dompredigers Bartsch erledigten Stelle des zweiten Secretärs wurde der provisorische Stellvertreter, Gymnasial=Director Dr. Wex, von der Versammlung gewählt. Die übrigen Beamten, welche ihre Bereitwilligkeit zur Fortführung ihrer Aemter ausgesprochen hatten, wurden durch Acclamation in denselben bestätigt. Die Neuwahl von vier Repräsentanten erfolgte durch Stimmzettel. Der Ausschuß besteht jetzt aus folgenden Mitgliedern:
Se. Excellenz Herr Geheimeraths=Präsident und
Minister von Lützow, Präsident des Vereins.
Herr Regierungs=Direktor von Oertzen,
Vice=Präsident.
- Archivar Lisch, erster
Secretär.
- Hofmaler Schumacher,
Antiquar.
- Geheimer Canzleirath Faull,
Rechnungsführer.
- Pastor Masch, Aufseher
der Münzsammlung.
- Archiv=Registrator
Glöckler, Bibliothekar.
Gymnasial=Direcor Dr.
Wex, zweiter Secretär.
Herr Regierungsrath Dr.
Knaudt, Repräsentant.
- Domprediger
Bartsch, Repräsentant.
- Dr. med.
Bartels, Repräsentant Repräsentant.
- Hofrath Wendt, Repräsentant.


|
Seite 30 |




|
2. Besprechungen. Herr Archivar Lisch sprach einige Andeutungen und Wünsche aus im Bezug auf eine comparative Sammlung ausländischer Alterthümer. Für die Stein=Periode, die sich höchst wahrscheinlich nur über den Norden Europa's erstreckt habe, fänden sich analoge Entwickelungsformen der ältesten Cultur nur in Amerika und Australien. Es werde daher ein sehr lohnendes Unternehmen sein, wenn einzelne Mitglieder des Vereins, denen sich Gelegenheit dazu darböte, durch Handelsverbindungen und persönliche Bekanntschaften in Besitz von Alterthümern aus jenen Welttheilen zu gelangen suchten. Die wendische Bronce=Periode biete viele Aehnlichkeiten dar mit der Cultur von Alt=Italien und Alt=Griechenland. Bei dieser Gelegenheit machte Herr Lisch die erfreuliche Mittheilung, daß Se. Königl. Hoheit unser allerdurchlauchtigster Großherzog neulich durch die Bemühungen des Herrn Cabinetsrathes Dr. Prosch eine Anzahl alter italischer Bronzen, welche mit den norddeutschen große Aehnlichkeit haben, in Rom erworben habe. Ferner sei der Herr Baron A. v. Maltzan auf Peutsch unablässig bemüht gewesen, die vorzeitliche Cultur gegen Osten und Westen zu verfolgen, und habe für den Verein bereits in der Lausitz (s. Jahrb. p. 394) einen Fund von Urnen erworben, und hoffe Aehnliches aus Polen zu erlangen.
Herr Revisionsrath Schumacher empfahl die Anlegung Vorschlag wurde gebilligt. Geschenke der Art werden mit Dank angenommen werden.
Herr Archivar Lisch wiederholte die schon früher an die Mitglieder des Vereins, so wie an alle Freunde des vaterländischen Alterthums ausgesprochene Bitte, fleißig bei Metallarbeitern ihres Ortes, als Glockengießern, Gelbgießern, Kupferschmieden, Goldschmieden, Klempnern u. s. w. nach verkauftem alten Metall sich umzusehen, und alles sich etwa vorfindende Alterthümliche für den Verein, der gerne die Kosten erstatten wird, zu erwerben. Mehrere der werthvollsten Alterthümer sind auf diesem Wege in den Besitz des Vereins gekommen, wie noch neulich durch den regen Eifer des Hrn. v. Kardorff aus Remlin. Eine geschärfte Aufmerksamkeit wird gewiß auf diesem Wege noch Vieles retten, was sonst, wie werthvoll auch, spurlos verschwinden würde.
Die neulich mit dem Ringe von Bresegard (Jahrb. p. 382) gemachte Erfahrung gab Veranlassung zu einer ähnlichen Bitte an die Mitglieder in Bezug auf gefundene Sachen. Man bittet nämlich überall Arbeitsleute davon in Kenntniß zu setzen, daß der Verein nicht allein den Metallwerth gefun=


|
Seite 31 |




|
dener Sachen reichlich bezahlt, sondern auch nach Maaßgabe des Fundes anderweitigen Forderungen gern genügen wird. Namentlich wird in denjenigen Gegenden, wo Chausseen gebaut werden, eine solche Bekanntmachung sehr zweckdienlich sein. Herr v. Kardorff auf Remlin äußerte, es werde zu diesem Behufe eine Vervielfältigung und weitere Verbreitung der bisher in unseren Vereinsschriften gegebenen Abbildungen alterthümlicher Gegenstände sehr förderlich sein.
Nach manchen anderen anregenden Discussionen und Berathungen wurde die Versammlung von dem Herrn Präsidenten geschlossen und den Wünschen für das fernere Gedeihen des Vereins noch die erfreuliche Hoffnung hinzugefügt, daß vielleicht in künftigen Jahren den neuen Bauten unserer Residenzstadt auch ein Museum als Zierde sich anreihen werde, in welches dann neben den übrigen jetzt zerstreuten Kunstschätzen auch die Großherzogl. Alterthümer=Sammlung und die Sammlungen unsers Vereins aufgenommen werden würden.
Nachträglich wird der Beachtung noch empfohlen ein neulich erschienenes Werk: Sprachkarte von Deutschland. Als Versuch entworfen und erläutert von Dr. Carl Bernhardi. Kassel 1844. 138 S. nebst einer Karte. Bereits vor neun Jahren, bei Gründung des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, wurde die Entwerfung einer Sprachkarte von ganz Deutschland als eine gemeinschaftliche Aufgabe für sämmtliche deutsche Geschichtsvereine in Anregung gebracht. Der Verf. obiger Schrift hat nun den ersten Versuch gemacht, jene Aufgabe zu lösen. Er hat dabei fast ausschließlich den historischen Gesichtspunct berücksichtigt, d. h. die Frage, ob sich aus den gegenwärtigen Sprachverhältnissen der Völker und namentlich aus der Verschiedenheit der Mundarten des deutschen Volkes, so weit dieselben noch heutiges Tages räumlich abgegrenzt bestehen, ein Schluß auf die ursprünglichen Stammverhältnisse ziehen, oder doch mindestens ein Hülfsbeweis für Forschungen über die Urgeschichte Deutschlands gewinnen lasse. Dieser wohlgelungene Versuch begründet die Ueberzeugung, daß eine planmäßige Durchforschung des deutschen Sprachgebietes nicht nur in sprachlicher, sondern auch in geschichtlicher Hinsicht von der größten Wichtigkeit ist. Zur weiteren Ausführung jener Idee macht der Herr Verf. den deutschen Vereinen folgende Vorschläge:
1) Die gesammten Geschichtsvereine Deutschlands sollten die Ausarbeitung eines Sprachatlasses von ganz Deutschland in Gemeinschaft übernehmen, und einen jeden Bezirk, welcher


|
Seite 32 |




|
als die Heimath einer eigenthümlichen Mundart betrachtet werden kann, vorläufig so genau als thunlich abgrenzen.
2) Für jedes auf diese Weise gefundene Sprachgebiet wäre wo möglich ein eingeborner Sprachkundiger zu gewinnen, dem seine Verhältnisse gestatten, diesen Landstrich Dorf für Dorf sprachlich zu erkunden.
3) Jeder Geschichtsverein hätte außerdem eins seiner Mitglieder mit den einschlagenden historischen Forschungen zu beauftragen, und in Gemeinschaft mit den Sprachkundigen des Vereinsgebietes die zur Erreichung des vorgesteckten Zieles erforderlichen Maaßregeln zu verabreden.
4) Im Jahre 1844 müßte mindestens Ein Mitglied von jedem Vereine sich bei der demnächstigen Versammlung der deutschen Sprachforscher einfinden, um sich über die zu befolgenden Grundsätze, namentlich in Beziehung auf die Lautbezeichnung und die zu wählenden Benennungen, zu vereinbaren.
5) Unterdessen wäre in jeder Vereinszeitschrift eine möglichst vollständige Literatur über die Mundarten der betreffenden Landestheile zu liefern.
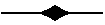


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
IX. 2.
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde.
Schwerin, den 8. Januar 1844.

D er Verein gewann im Laufe des letzten Vierteljahres, einen höchst erfreulichen Zuwachs vom 20 ordentlichen Mitgliedern. Es traten bei die Herren: Advocat Pohle in Schwerin, von Kardorff auf Granzow, Pastor Mühlenfeld zu Boddin, Dr. med. Meyer zu Gnoien, Heise auf Vollrathsruhe, Lieutenant du Trossel zu Neustrelitz, Graf von Blücher auf Finken, von Lowtzow auf Rensow, Baron von Bülow auf Emekendorf, Pensionär Peters zu Petersdorf, Baron von Maltzan auf Alt-Rehse, Major von Barner auf Bülow, von Flotow auf Walow, von Oertzen auf Repnitz, Koch auf Trollenhagen, von Müller auf Rankendorf, Kammerherr von Stralendorf auf Gamehl, Oberappellationsrath von Bassewitz zu Rostock, Domänenrath Jordan auf Grambzow, Amtsauditor Baron von Maltzan zu Schwerin. Durch den Tod verlor der Verein 4 Mitglieder, die Herren: Geheimer Medicinalrath Dr. Hennemann in Schwerin (schon im vorletzten Vierteljahre), Drost von Restorf auf Radegast, Director Prof. Dr. Becker zu Ratzeburg, Kammerherr von Plessen auf Reez. Ausgetreten sind 3: Herr Kaufmann Hagemann in Neubrandenburg, Herr von Behr auf Renzow, Herr Candidat Paschen zu Sukow. Bestand: 396 ordentliche Mitglieder. Zu den 27 auswärtigen Vereinen, mit denen der unsrige durch Correspondenz und Schriftenaustausch in Verbindung steht, kamen hinzu: der historische Verein der Oberpfalz und von Regensburg zu Regensburg und der historische Verein von Oberfranken zu Bayreuth.
Einen grossen Verlust erlitt der Verein durch den Abgang seines zweiten Secretärs. Wegen vermehrter Berufsgeschäfte sprach Herr Pastor Bartsch wiederholt und so dringend den Wunsch aus, jener Function enthoben zu werden, dass der Auschuss nicht länger Anstand nehmen durfte, zu einer provisorischen Wahl zu schreiten. Darauf legte in einer Sitzung am 6. Nov. Herr Bartsch sein Amt nieder, wobei der Herr Präsident ihm den Dank des Vereins und die bleibende Anerkennung seiner ausgezeichneten Verdienste versicherte. Zu gleicher Zeit wurde Herr Bartsch an die Stelle des Unterzeichneten zum Repräsentanten gewählt.
Die Bibliothek , deren systematische Ordnung jetzt grundleglich ausgeführt ist, empfing:
1) K. Wilhelmi, Neunter Jahresbericht an die Mitglieder der Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmale der Vorzeit. Sinsheim. 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
2) Almanach der königl. bayerisch. Akademie der Wissenschaften. München. 1843. 8.
3) Abhandlungen der historischen Classe der königl. bayerischen Akademie
der Wissenschaften. Dritten Bandes dritte Abtheil. München. 1843. 4.
4) a. Bülletin der königlichen Akademie der Wissenschaften. Num. 1 - 55. München. 1843. 4. b. Gelehrte Anzeigen. Herausgeg. von Mitgliedern der königl. Akademie. Jan. bis Juli 1843. Das. 4. (Nr. 2-4 Geschenke der königl. Akademie zu München.)
5) Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Herausgeg. von dem histor. Vereine vom und für Ober-Bayern. Fünfter Band. Erstes Heft. München. 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
6) Verhandlungen des histor. Vereins der Oberpfalz und von Regensburg. Siebenter Band. Regensburg. 1843. 8. (Geschenk - als erste Mittheilung- des Vereins.)
7) J. L. Haupt, Neues Lausitzisches Magazin. Herausgegeben von der Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften. Neunzehnter - neuer Folge sechster - Band. Erstes - viertes Heft. Görlitz. 1841. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)


|
Seite 2 |




|
8) J. L. Haupt, Anzeigen der Oberlausitz. Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz. Neuer Folge erstes bis achtes Stück. Görlitz. 1834-1841. 8. (Geschenk des Herrn Pastors Haupt, Secretärs und Bibliothekars der Gesellschaft.)
9) Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur vom Jahre 1824-1842. 19 Hefte. Breslau. 1825-1843. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
10) Statuten des Hennebergischen alterthumsforschenden Vereins zu Meiningen 1838. 8.
11) Programm zur zehnten Jahresfeier des Hennebergischen alterthf. Vereins am 14. November 1842. Vom Vereins-Director Ludwig Bechstein. Meiningen. (1842.) 4.
12) Beitrage zur Gesch. deutschen Alterthums. Herausgeg. von dem Henneberg. alterthf. Vereine durch August Gutgesell, Secretär des Vereins. Erste-vierte Lieferung. Meiningen. 1834-1842. 8.
13) Hennebergisches Urkundenbuch. Im Namen des Henneberg. alterthumsf. Vereins herausgeg. von Karl Schöppach. 1. Theil vom J. 933 bis 1330. Meiningen. 1842. 4.
14) Chronik der Stadt Meiningen von 1676 bis 1834. Herausgeg. von dem Henneberg. alterthumsf. Verein. Erster und zweiter Theil. Meiningen. 1-34, 35. 4.
15) Die ehernen Denkmale Henneberg. Grafen von Peter Vischer in der Stiftskirche zu Römhild. Gezeichnet und beschrieben von A. W. Doebner, herzogl, sächs. Landbaumeister. München. 1840. Gr. Fol. (Nr. 10-15 Geschenke des Henneberg. Vereins.)
16) R. F. W. Hasselbach, die 600jährige Jubelfeier der Bewidmung Stettins mit Magdeburgischem Rechte. Berlin. 1843. 8. (Geschenk des Herrn Staatsministers v. Kamptz.)
17) A. Brandenburg, Ueber das städtische Bauwesen des Mittelalters in Anwendung auf Stralsund. Das. 1843. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
18) Baltische Studien. Herausgeg. von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Neunten Jahrganges zweites Heft. Stettin. 1843. 8.
19) Achtzehnter Jahresbericht der Gesellschaft für pommersche Geschichte etc. Stettin. 1843. 8. (Nr. 18 und 19 Geschenke der Gesellschaft.)
20) F. W. Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern. Vierter Theil. Erster Band. (1411-1498.) Hamburg. 1843. 8.
21) Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg etc. Herausgeg. von der Gesellschaft für Vaterland. Gesch. Fünfter Band. Altona. 1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
22) Dr. E. Deecke, Geschichte der Stadt Lübeck. Erstes Buch. Das. 1844. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
23) Codex diplomaticus Lubecensis. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeb. von dem Vereine für Lübeckische Geschichte. Erster Theil. Das. 1843. 4. (Geschenk des Vereins.)
24) L. J. F. Janssen, Oudheidkundige Ontdekking aangaaude den Tempel der Dea Sandraudiga te Zundert in Noord-Braband. (Ohne Druckort. Aus einer holländ. Zeitschrift abgedruckt.)
25) L. J. F. Janssen, Oudheidkundige Mededeelingen. II. Met twee gekleurde Platen. Leyden. 1843. 8. (Nr. 24, 25 Geschenke des Herrn Verf.)
26) Prosper Cuypers, Bericht omtrent oude Grafheuvels onder Alphen in Noord-Braband. (Met 3 Platen.) Arnhem. 1843. 8. (Geschenk des Herrn Dr. Leemans zu Leyden.)
27) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Esth- und Kurlands, herausgeg. von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russ. Ostsee-Provinzen. Zweiten Bandes erstes - drittes Heft. Riga und Leipzig. 1840-1842. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
28) Necrolivonica, oder Alterthümer Liv-, Esth- und Kurlands bis zur Einführung der christl. Religion, von Dr. F. Kruse, Prof. der Geschichte in Dorpat. Mit vielen Abbildungen und Charten. Dorpat und Leipzig. 1842. Gr. Fol.
29) Runographia Gothtandiae revisa, aucta et illustrata; praeside J. H. Schroeder, Prof. Upsal. subm. J. N. Cramer. Upsaliae. (1835.) (Geschenk des Herrn Bibliothekars Prof. Schröder.)
30) Annalen der braunschweig-lüneb. Churlande, herausgeg. von Jacobi und Kraut. Ersten Jahrg. erstes und zweites Stück. Hannover. 1787. 8.
31) Historisch-critische Untersuchung sämmtlicher Nachrichten von der ehemal. hochberühmten (pommerschen) Seestadt Jomsburg. Copenhagen und Leipzig. 1776. 4. (Nr. 30 und 31 Geschenke des Herrn Amtshauptmanns Ratich zu Wittenburg.)


|
Seite 3 |




|
32) Zwei Schulprogramme der Stadtschule zu Wismar, herausgeg. von Prof. M. Crain und Dr. Nölting. Wismar. 1843. 4. (Geschenk des Herrn Prof. Crain.)
33) Gentzen, Bibliothekar zu Neustrelitz, Verzeichniss der neuen Erwerbungen für das grossh. Georgium das. Von Michaelis 1842 bis dahin 1843. 4. (Ohne Druckort und Titel. - Geschenk des Herrn Verf.)
34) P. J. Schafarik's slavische Alterthümer. Deutsch von Mosig von Aehrenfeld, herausgeg. von Heinr. Wuttke. Bd. 2. Leipzig. 1813. 8.
35) Dr. Göbel, Ueber den Einfluss der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit - insbesondere in den Ostseegouvernements. Erlangen. 1842. 8.
36) Dr. Hallmann, Die Geschichte des Ursprungs der belgischen Beghinen. Mit Abbildungen auf 3 Taf. Berlin. 1843. 8.
37) Dr. Burmeister, Beiträge zur Gesch. Europa's im XVI. Jahrh. aus den Archiven der Hansestädte. Rostock. 1843. 8.
38) Dr. K. Hanmann, Warnemünde, dessen Seebad und die Wirkung der dortigen Luft. Ein Handbuch. Rostock. 1843. 12.
Zur Urkundensammlung kam:
Abschrift einer Urkunde vom J. 1473 über Verpfändung von Hebungen aus Gr. - Luckow an das Kloster zum Heil. Kreuz in Rostock.
Die Alterthümer-Sammlung empfing:
I. aus vorchristlicher Zeit:
1) aus der Zeit der Hünengräber:
den Inhalt eines zu Remlin durch Herrn von Kardorf aufgedeckten grossen Hünengrabes, in welchem eine wohl erhaltene Urne, eine Keule aus Eichenholz und spanförmige Messer aus Feuerstein gefunden wurden, und den Inhalt eines eben daselbst von demselben geöffneten kleinen Hünengrabes, bestehend in einem kleinen Streithammer und Urnenscherben, geschenkt von Herrn von Kardorf auf Remlin zu Gnoien; den Inhalt eines in der Gegend der Stadt Lage geöffneten Hünengrabes, bestehend aus einer noch nicht völlig durchbohrten grossen Streitaxt von Hornblende und einem grossen Keil aus Feuerstein, von dem Herrn Kreis-Physicus Dr. Kucs zu Lage durch Herrn von Kardorf auf Remlin geschenkt; den Inhalt eines von dem Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe zu Wahlstorf, A. Lübz, eröffneten Hünengrabes; 1 Dolch aus Feuerstein, gefunden in einem Moore bei Sülz, geschenkt von dem Herrn Geh. Amtsrath Koch zu Sülz; 1 Lanzenspitze aus Feuerstein, gefunden zu Wendischhof, geschenkt von Herrn von Schuckmann auf Gottesgabe; 1 Keil aus Feuerstein, gefunden auf dem Stadtfelde von Gnoien, geschenkt von Herrn von Kardorf auf Remlin zu Gnoien; 1 zerbrochener Keil aus schwarzem Kieselschiefer, gefunden in der Goldenen Aue, geschenkt von dem Herrn Kammer-Revisor Sachse zu Schwerin.
2) aus der Zeit der Kegelgräber;
den Inhalt eines durch den Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe aufgedeckten Kegelgrabes, bestehend in Urnenscherben und einer ungewöhnlich langen Heftel aus Bronze; den Inhalt eines von demselben geöffneten Kegelgrabes zu Ganzlin bei Plau, bestehend in einer Urne: den Inhalt eines zu Retzow, A. Lübz, geöffneten Kegelgrabes, bestehend in einer Framea, einem Armringe und einem spiralförmig gewundenen Armringe, durch den Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe von dem Herrn Pächter Dabel zu Retzow geschenkt; 1 Paar zerbrochene Handbergen von Bronze aus einem Kegelgrabe, ausgepflügt zu Grebbin bei Parchim, geschenkt von dem Herrn Dr. Beyer zu Parchim; 1 Framea aus Bronze, gefunden in einer Wiese bei Neustadt, geschenkt von dem Herrn Senator Fabricius zu Neustadt; 1 Schwert aus Bronze von ungewöhnlicher Grösse und ausgezeichneter Arbeit, gefunden beim Moderfahren in einem Bruche zu Schmachthagen bei Waren, geschenkt von Herrn von Behr-Negendank auf Torgelow.
3) aus der Zeit der Wendenbegräbnisse:
Alterthümer aus einem Wendenkirchhofe zu Twietfort bei Plau, von dem Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe.
4) aus unbestimmter heidnischer Zeit:
5 Urnen aus einem Begräbnissplatze zu Königswartha in der sächsischen Ober-Lausitz, erworben und geschenkt von dem Herrn Baron von Maltzan auf Peutsch.
II. aus dem Mittelalter:
1 eisernes Schwert mit eingelegter (lateinischer) Inschrift aus Bronze, aus der frühen Zeit des Mittelalters, gefunden in einer Wiese bei Schwan,


|
Seite 4 |




|
geschenkt von dem Herrn Gerichtsrath Ahrens zu Schwan; 1 eisernes Dolchmesser (Rüting), gefunden bei Schwan, geschenkt von demselben; 1 Fingerring von Messing mit eingeschlagener Inschrift, gefunden zu Beckerwitz, geschenkt von dem Herrn Pastor Erfurth zu Picher; 1 grosser Henkelkrug, gefunden im See von Böhlendorf, geschenkt vom dem Herrn Major von Kardorf auf Böhlendorf; 2 Sporen und 2 Vorhängeschlösser von Eisen, gefunden auf dem Schlossberge zu Granzow bei Gnoien, geschenkt von Herrn von Kardorf auf Remlin; 1 eisernes Pferdegebiss, geschenkt von Herrn von Flotow auf Walow.
III. aus neuerer Zeit:
1 Gypsabguss von dem Reliefbilde Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen, von dem Schlosse zu Ulrichshusen (1562), geschenkt von dem Herrn Baron von Maltzan auf Peutsch; 1 kupferne Dose mit Relief-Darstellungen aus dem Leben des Königs Friederich d. Gr., geschenkt von Herrn von Kardorf auf Remlin.
An Münzem sind geschenkt worden:
1) Vom Herrn Landbaumeister Hermes zu Schwerin 1 Groschen des Kurfürsten Ernst von Sachsen und seines Bruders Ernst vom J. 1482, - mit vielen gleichartigen Münzen auf dem Schlachtfelde von Lützen gefunden.
2) Vom Herrn Kaufmann Röper zu Schwerin: 1 unter dem Herzoge Friedrich Wilhelm von Mekl.-Schwerin geprägter, auf dem Felde von Müss gefundener Dreiling.
3) Vom Herrn Archivar Lisch zu Schwerin: 1 alter Wittenpfennig der Stadt Lüneburg, gefunden hinter dessen Hause in der Paulsstadt.
4) Vom Herrn Oberbaurath Wünsch zu Schwerin: 1 Kupferpfennig des Bischofs Ulrich von Chur v. J. 1711.
5) Vom Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe: 1 wolgaster Scharf vom J. 1590.
6) Von Herrn von Berg auf Neuenkirchen: 1 sogenannter "Mittel-Louisd'or" des Königs Friedrich II. von Preussen v. J. 1758; 1 halber Louisd'or des Königs Ludwig XIII. von Frankreich v. J. 1642; ein Viergroschenstück des Kurfürsten Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg v. J. 1714; 1 pommerscher Groschen des Königs Carl XI. von Schweden v. J. 1676.
7) Von Herrn von Kardorf auf Remlin; 1 österreichischer Thaler v. J. 1632; 1 kurpfälzischer Zehnkreuzer v. J. 1727; 1 kursächsisches Zweigroschenstück v. J. 1695.
8) Von dem Herrn Pastor Boll zu Neubrandenburg: 6 verschiedene kleine Münzen aus dem 16. und 17. Jahrh., einzeln bei Neubrandenburg gefunden.
9) Von dem Herrn Candidat Paschen zu Sukow: 1 belgisches Zwei-Centime-Stück v. J. 1834. gekauft:
10) 1 meklenb. Schilling, 1 meklenb. Silberdreiling, 1 meklenb. Kupferdreiling. sämmtlich vom J. 1843.
Abdrücke von Münzen aus einem zu Grüneberg bei Lippehne gemachten Funde von Münzen aus dem 13. Jahrh. schenkte Herr Kretschmer zu Berlin.
An Zeichnungen erhielten die Sammlungen zum Geschenke: die Zeichnung eines bisher unbekannten Bracteaten und des Stadt-Siegels von Neu-Brandenburg, von Herrn Kretschmer zu Berlin; die Zeichnung des Wappens des Ritters Heidenrich von Bibow und anderer Reliefs auf einer Glocke vom J. 1384 in der Kirche zu Westenbrügge und die Zeichnung des Epitaphiums auf den General-Major Sivert von Bibow († 1677) in derselben Kirche, von dem Herrn Pastor Priester zu Westenbrügge.
Nachrichten wurden eingereicht:
1) von dem Herrn Gerichtsrath Ahrens zu Schwan:
über die mittelalterlichen Burgwälle von
Neuenkirchen und Boldenstorf.
2) von dem Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
über das Kegelgrab von Peccatel; über das in den
Wendenkirchhöfen gefundene Silber; über den
Hart-Wald im Lande Kalen; über den Leichenstein des
Präceptors Johannes Kran von Tempzin.
3) von dem Herrn Pastor Priester zu
Westenbrügge:
über die Glocken in den Kirchen
zu Alt-Karin und Westenbrügge.
4) von dem Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe:
über Alterthümer in der Gegend von Gnoien; über
einen merkwürdigen, im einem Kegelgrabe bei Gnoien
gefundenen Stein; über die Alterthümer der Kirche zu Lüdershagen.
Dr.
C. Wex
,
als provisorischer zweiter Secretär des Vereins.
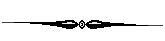


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
IX. 3.
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte und
Alterthumskunde.
Schwerin, den 15. April 1844.

D em Vereine traten bei die Herren: Dr. Jenning zu Stavenhagen, Pensionär Tack zu Kl. Methling, Steuerdirector von Wickede zu Rostock. Der Tod entriss uns 3 Mitglieder, die Herren: Rector Bülch zu Malchin, Präpositus Brinkmann zu Neukalden und Pastor Sickel zu Eldena. Ausgetreten sind die Herren: Präpositus Timm in Malchin, Pastor Strecker in Hohenkirchen und Pastor Tarnow in Güstrow. Mithin Bestand: 393 ordentliche Mitglieder. Zu den 29 auswärtigen correspondirenden Vereinen kam hinzu die westphälische Gesellschaft zur Beförderung vaterländischer Cultur zu Minden.
Die Bibliothek empfing:
1) J. T. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch. Bd. I, Lieferung 9 - 12. Stettin. 1843. gr. 8. (Schluss des ersten Bandes.)
2) Dr. B. Köhne, Die auf die Geschichte der Deutschen und Sarmaten bezüglichen römischen Münzen. Mit 3 Kupfertafeln. Berlin. 1844. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
3) Jacob Grimm, Weisthümer. Dritter Theil. Göttingen. 1842. 8. (Geschenk Sr. Excellenz des Herrn Ministers von Lützow.)
4) A. Fryxell, Erzählungen aus der schwedischen Geschichte. Erster und zweiter Theil. Uebersetzt von F. Homberg. Stockholm und Leipzig. 1843. 8. (Geschenk des Herrn von Kardorf auf Remlin zu Gnoien.)
5) Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung von Chroniken, Berichten, Urkunden und andern schriftlichen Denkmalen und Aufsätzen, welche zur Erläuterung der Geschichte Liv-, Ehst- und Curland's dienen. Erster und zweiter Band. Riga und Leipzig. 1835. 1839. 4. (Geschenk des Herrn Dr. Deecke zu Lübeck.)
6) Desselben Werkes dritter Band. Das. 1842. 4.
7) Dr. W. Havemann, Handbuch der neueren Geschichte. Dritter Theil. Jena. 1844. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
8) Dr. Burmeister, Beiträge zur Geschichte Europa's im sechszehnten
Jahrh. aus den Archiven der Hansestädte. Rostock. 1843. 8. (Geschenk der Erben des Verf.)
9) L. J. F. Janssen, De grieksche, romeinsche en etrurische Monumenten van het Museum van Oadheden te Leyden. Leyden. 1843. 8. (Bis jetzt 2 Hefte. Geschenk des Herrn Verf.)
10) L. J. F. Janseen, Over een romeinschen Steen, in het jaar 1839 te Werkhoven opgegraven. Utrecht. 1843. 8. Geschenk des Herrn Verf.)


|
Seite 2 |




|
11) Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen in der 20sten General-Versammlung am 11. Mai 1842 und in der 21sten General-Versammlung am 8. April 1843. Prag. 1842, 1843. 8. (2 Hefte, Geschenk der Gesellschaft.)
12) Das vaterländische Museum in Böhmen im J. 1842. Das. w. o. (Geschenk der Gesellschaft.)
13) Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem histor. Vereine von und für Ober-Bayern. Fünfter Band, zweites Heft. München. 1843. Gr. 8. (Geschenk des Vereins.)
14) Westphälische Provinzial-Blätter. Verhandlungen der westphäl. Gesellschaft für vaterländische Cultur. Erster und zweiter Band. Dritter Band, erstes und zweites Heft. Minden. 1828-1843. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
15) C. G. N. Gesterdings Pommersches Museum. Erster Band. Rostock. 1782 und 1784. 4.
16) J. C. Dähnert, Critische Nachrichten. 5 Bde. Greifswald. 1750-1754. 8.
17) C. G. N. Gesterding, Pommersches Magazin. Theil 1 - 6, in zwei Bänden. Greifswald und Rostock. 1774 - 1782.
18) Bericht des literar. geselligen Vereins zu Stralsund während der Jahre 1842 und 1843. Stralsund. 1844. 8.
19) Die Feier des dritten Reformations-Jubelfestes zu Stralsund. Das. (1817.) 4.
20) Aphoristisches über Zauberei und Magie, von Dr. Kirchhoff. Aus der Sundine des J. 1843. (Nr. 18 - 20. Geschenke des Herrn Dr. Zober in Stralsund.)
21) Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte. Ersten Bandes drittes und viertes Heft. Hamburg. 1843. 8. (Geschenk des Vereins.)
22) Scriptores rerum Lusaticarum. Sammlung ober- und niederlausitzischer Geschichtsschreiber. Herausgeg. von der oberlaus. Gesellschaft der Wissenschaften. Neuer Folge erster und zweiter Band. Görlitz. 1841. Gr. 8.
23) C. W. Grundmann, Versuch einer Ucker-Märkischen Adels-Historie, aus Lehnbriefen und andern glaubwürdigen Uhrkunden zusammen getragen. (Erster Thl.) Prentzlau. 1774. Fol.
24) J. L. Schumacher, Mittheilungen an seine Landsleute in Meklenburg über die Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe in Altenburg. Parchim und Ludwigslust. 1843. 8. (Geschenk des Herrn Verf.)
25) Dr. Fr. von Hagenow, Grundriss von Greifswald und den Vorstädten. 1843. Gr. Royal-Fol. (Geschenk des Herrn Verf.)
Die Alterthümer-Sammlung gewann:
I. aus vorchristlicher Zeit:
1) aus der Zeit der Hünengräber:
eine schön geformte Streitaxt von Hornblende aus einem Hünengrabe von Püttelkow bei Wittenburg, in welchem sie neben Urnenscherben gefunden war, geschenkt von dem Herrn Amtshauptmann Ratich zu Wittenburg; Späne und Splitter aus Feuerstein von alten Manufactur-Stätten in der Gegend von Brunshaupten und Cröpelin, geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.
2) römische Alterthümer:
einen Gypsabguss von einer äusserst schönen , mit 4, erhabenen Köpfen gezierten, zu Vorland bei Grimmen in Vorpommern gefundenen Bronze-Urne, geschenkt von dem Herrn Dr. von Hagenow zu Greifswald.


|
Seite 3 |




|
II. aus dem Mittelalter:
1 Löffel aus Messing, gefunden zu Miekenhagen, geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow; Abformung von einer merkwürdigen Inschrift auf einer Glocke in der Kirche zu Wuthenow bei Neu-Ruppin, von dem Herrn Gymnasiallehrer Masch zu Neu-Ruppin.
Interessant aber unerfreulich war die Mittheilung über einen vor einigen Monaten gemachten Fund, der in unrechte Hände gerathen und so für den Verein verloren gegangen ist. Auf dem Felde zu Bresegard bei Eldena fand ein Büdner einen grossen goldenen, eigenthümlich gestalteten Ring; verkaufte ihn aber an einen Händler in Grabow, der ihn sofort nach Hamburg schaffte, wo er eingeschmolzen worden ist. Herrn Archivar Lisch, der in den nächsten Jahrbüchern ausführlich hierüber berichten wird, gelang es, nachträglich einen messingenen Abguss davon zu erhalten, welcher der Versammlung vorgelegt wurde. Der Ausschuss findet sich bei dieser Gelegenheit zu der Bitte an alle Mitglieder veranlasst, in ihren Kreisen möglichst dazu beizutragen, dass allgemein bekannt werde, wie der Verein in solchen Fällen nicht allein den Metallwerth gefundener Sachen reichlich bezahlt, sondern auch nach Maassgabe des Fundes anderweitigen Forderungen gern genügen wird.
An Münzen wurden geschenkt:
1) Von dem Herrn Baron von Maltzan auf Peutsch: 1 preußisches 2 1/2 Sgrstück und 1 preussischer 1/2 Sgr., beide v. J. 1843.
2) Von dem Herrn Pastor Türk zu Güstrow: 1 Schilling des Herzogs Joh.
Albrechts II. v. Meklb. Güstrow v. J. 1622; ein Kupferdreiling Desselben v. J. 1621.
3) Von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow: 1 alter hamburger Wittenpfennig, gefunden zu Brunshaupten.
4) Von dem Herrn Bibliothekar Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel: 6 Bracteaten der Grafen von Aschersleben aus der zweiten Hälfte des XIII. Jahrh., aus dem Funde von Schadeleben.
5) Von dem Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe: 5 verschiedene Scheidemünzen aus dem 17. und 18. Jahrh.
6) Von der Frau Herzogin Helene von Orléans, Königl. Hoheit: 4 Bronce-Medaillen: a. auf die Vermählung der Herzogin, gefeiert durch die Feste der Stadt Paris; b. auf dieselbe Vermählung, königliche Medaille; c. auf die Geburt des Grafen von Paris; d. auf die Taufe des Grafen von Paris.
7) Von dem Herrn Präpositus Grimm zu Gr. Laasch: ein lübecker Dütchen v. J. 1624 und ein brandenburg. Groschen v. J. 1710. An Handschriften erhielt der Verein durch Geschenk des Herrn Ingenieurs Lierow aus Parchim ein Gebetbuch aus dem Mittelalter auf Pergament, mit guten Miniaturen.
Zur Sammlung alter Druckwerke kam:
1) Orthographia N(icolai) M(arschalci) T(hurii), Erfurt, 1500,
2) Etherologium magistri Hinrici Bogleri, theologiae doctoris, ecclesiae collegiatae sancti Jacobi Rostochiensis decani, zu Rostock, 1506, in der Druckerei des Hermann Barckhusen gedruckt,
beide (vgl. Jahrb. VI, S. 195. flgd.) durch den Herrn Bibliothekar Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel durch Austausch gewonnen.
Die Siegelsammlung erhielt die Abdrücke von den Siegeln der Städte Crivitz, Gnoien und Güstrow durch den Herrn Baron von Maltzan auf Peutsch und der Stadt Plau durch den Herrn Senator Schultetus zu Plau.


|
Seite 4 |




|
Zu den Zeichnungen kam hinzu ein Grundriss des Schlosses zu Plau aus dem Ende des 16. Jahrh. durch den Herrn Senator Schultetus zu Plau.
Wissenschaftliche Arbeiten und Nachrichten gingen ein:
1) von dem Herrn Dr. Jenning zu Stavenhagen:
a. Rostocker Bürgersprache und Bescheide.
b. Ueber eine Inschrift am Steinthore zu Rostock.
2) von dem Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
a. Ueber einen zu Bresegard bei Eldena
gefundenen, grossen goldenen Ring.
b.
Ueber die Kirche zu Lübow und die Burg
Meklenburg.
c. Ueber Canzler-Insignien im
Mittelalter.
d. Nachträge zur Geschichte
der Comthurei Craak.
e. Ueber den
Verfasser der Apologie der Herzoge Adolph Friederich
I. und Johann Albrecht II.
f. Ueber den
Charakter des Herzogs Christian Louis.
Dr.
C. Wex
,
als provisorischer zweiter Secretär des Vereins.