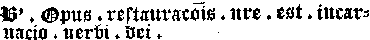|
[ Seite 315 ] |




|



|
|
|
-
Chemische Analysen antiker Metalle aus
heidnischen Gräbern Meklenburgs
- Framea von Goldberg
- Handberge von Prislich
- Schwert von Tarnow
- Heftel mit zwei Spiralplatten
- Metallspiegel von Sparow
- Diadem von Wittenmoor
- Urne von Ruchow
- Framea von Satow
- Fingerring von Ruchow
- Fingerring von Friederichsruhe
- Krater von Groß-Kelle
- Commandostab von Hansdorf
- Beschlagring von Ludwigslust
- Armring von Ludwigslust
- Heftel mit Spiralfeder
- Heftel mit Spiralfeder von Camin
- Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier
- Heidnische Gräber bei Neu-Bukow an der Ostsee
- Heidnische Gräber zu Carow und Leisten
- Alterthümer in der Gegend von Gnoyen
- Alterthümer im Luche bei Fehrbellin
- Feuerstein-Manufactur bei Brunshaupten
- Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Nr. 1
- Hünengrab von Remlin, Nr. 2, Nr. 3
- Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz)
- Hünengrab von Roggow
- Hünengräber von Vietlübbe bei Plau
- Hünengrab von Lage
- Hünengrab von Püttelkow
- Kegelgrab von Peccatel
- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1, Nr.2.
- Kegelgrab von Retzow Nr. 3
- Kegelgräber und Begräbnißplatz zu Ganzlin bei Plau
- Kegelgrab von Grebbin
- Goldring von Bresegard bei Eldena
- Bronze-Schwert von Schmachthagen
- Bronze-Schwert von Kreien bei Lübz
- Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen
- Wendische Silbergeschmeide und Münzen aus der Gegend von Schwerin
- Wendischer Silberschmuck und wendische und altdeutsche Münzen von Remlin
- Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau
- Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow
- Römische Bronze-Vase von Vorland bei Grimmen
- Urnen aus der Lausitz
- Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden
- Henkelkrug von Böhlendorf
- Fingerring von Beckerwitz
- Schwert von Schwaan
- Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel
- Der Hart
- Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf
- Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe
- Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf
- Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg
- Blätter zur Geschichte der Kirche zu Doberan, niedergeschrieben in Doberan im August 1843 und revidirt in Doberan im September 1843
- Die Marien-Kirche zu Rostock
- Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow
- Die Glocke zu Westenbrügge
- Die Glocke zu Alt-Karin
- Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz
- Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen
- Denktafel in der Kirche zu Dambeck
- Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock
- Römische Münzen
- Der Münzfund von Remlin aus dem 10.-11. Jahrhundert
- Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
- Familie von Maltzan
- Geschlecht von Hobe
- Das Petschaft des letzten von Lübberstorf
- Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato
- Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter
- Hinrici Bogher Etherologium, Rostock 1506
- Manus Mortua, die Todte Hand, der blinkende Schein (Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94)
- Die Einziehung der Güter der Selbstmörder
- Strafe auf Kindesmord und Sodomie im 18. Jahrhundert
- Ein Horn eines Urochsen
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 316 ] |




|


|
[ Seite 317 ] |




|



|



|
|
:
|
- Framea von Goldberg
- Handberge von Prislich
- Schwert von Tarnow
- Heftel mit zwei Spiralplatten
- Metallspiegel von Sparow
- Diadem von Wittenmoor
- Urne von Ruchow
- Framea von Satow
- Fingerring von Ruchow
- Fingerring von Friederichsruhe
- Krater von Groß-Kelle
- Commandostab von Hansdorf
- Beschlagring von Ludwigslust
- Armring von Ludwigslust
- Heftel mit Spiralfeder
- Heftel mit Spiralfeder von Camin
1. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Der vorchristlichen Zeit.
a. Im Allgemeinen.
Chemische Analysen antiker
Metalle
aus heidnischen Gräbern Meklenburgs,
von
H. L. von Santen,
Senator und Apotheker zu Kröpelin,
mit
antiquarischen Einleitungen und Forschungen begleitet
von
G. C. F. Lisch,
großherzogl. meklenb.
Archivar zu Schwerin.
D ie bronzenen Alterthümer aus den kegelförmigen, mit Rasen bedeckten Gräbern Norddeutschlands, welche wahrscheinlich den Germanen zuzuschreiben sind und welche die Bronze= und Goldzeit, als nicht mehr unvermischtes Kupfer und noch nicht Eisen und Silber in Gebrauch war, charakterisiren, haben so viel Interesse, daß deren allseitige Erforschung dereinst von nicht geringem Werthe für die Urgeschichte Deutschlands sein wird. So viel stellt sich schon jetzt mit Sicherheit heraus, daß alle diese Gräber einer und derselben weitreichenden Cultur=Epoche angehören, welche mit dem epischen Zeitalter in Südeuropa zusammenfallen und im Allgemeinen die beiden nächsten Jahrtausende vor Christi Geburt füllen dürfte, daß die cultivirten europäischen Völker damals auf gleicher Culturstufe


|
Seite 318 |




|
standen, daß die norddeutschen Alterthümer aus dieser Zeit keinesweges hinter den altgriechischen und altitalischen zurückstehen, sondern dieselben an Reinheit der Form oft übertreffen. Nicht nur erregt die Schönheit der Formen Bewunderung, auch die Kunstfertigkeit in der Bereitung 1 ) der Metalle zieht die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf sich; denn es ist nicht zu bezweifeln, daß die in den Gräbern gefundenen Alterthümer, welche überall und stets denselben Charakter haben und doch nicht einander gleich sind, dort verfertigt wurden, wo man sie findet (vgl. Lisch Friderico-Fraucisceum, Erläut. S. 41 - - 42 und H. C. von Minutoli Topographische Uebersicht der Ausgrabungen - - in den Küstenländern des baltischen Meeres, Berlin, 1843, S. 81 flgd.). Daher ist die chemische Untersuchung der heimischen antiken Bronzen auch wiederholt Gegenstand aufmerksamer Studien gründlicher Forscher gewesen.
Zuerst wandte Klaproth der Analyse der vaterländischen Bronzen seine Aufmerksamkeit zu. Er untersuchte im J. 1807 mehrere alte Bronzen, namentlich diejenigen, welche in der Sammlung der Großen Freimaurer=Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin aufbewahrt werden, und legte die Analysen in Gehlens Journal für Chemie IV, Heft 13, Nr. 15, Julii,
"Durch das Zinn erhält das Kupfer eine hellere Farbe, ein dichteres Gefüge, eine größere Leichtflüssigkeit, mehr Härte und Klang, und widersteht in dieser Verbindung stärker der Atmosphäre und der Feuchtigkeit, als für sich. Es wird jedoch viel spröder, so daß es sich weder kalt noch warm hämmern läßt, besonders wenn das Verhältniß des Zinns gegen das Kupfer wächst. Hieraus wird es wahrscheinlich, das die meisten antiquarischen Gegenstände von dieser Composition gegossen worden sind; - - einige dagegen können gehämmert sein; wo man dies vermuthen kann, spricht auch die Composition dafür; denn dann ist das Kupfer sehr überwiegend".
An einer andern Stelle (Allgem. Anz. d. Deutschen, 1843, S. 935, und Dinglers Polytech. Journ., Jahrg. 24, Heft 10, 1843, S. 320,) heißt es:
"Die Metallcomposition aus 16 Theilen Kupfer und 1 Theil Zinn"
"1) hat eine gewisse Goldlegirungen ähnliche Farbe";
"2) läßt sich sogleich vom Gusse weg gut und lange hämmern und strecken";
"3) zeigt sich sehr geschmeidig und dehnbar";
"4) ist nicht nur härter und elastischer als Kupfer, sondern selbst als Messing, und fast so hart, als Schmiedeeisen";
"5) es fließt leichter und dünner, als Messing, so daß man Kupfer sehr gut damit löthen kann, und es ist vielleicht ein besseres Hartloth für Kupfer, als das bisher gebräuchliche aus Messing und Zink".
"Letztere Eigenschaft wäre aber dennoch zugleich eine Unbequemlichkeit bei Verarbeitung dieses Metalls. Man möchte vielleicht kein wohlfeileres Hartloth für dasselbe haben, was dessen Anwendung auf Fälle und Gegenstände beschränken würde, die nicht hart gelöthet werden. Außer diesem jedoch würden sich Klempner= und Kupferschmiede=Arbeiten, Kessel, Töpfe, aus diesem Metall, von geringerer Stärke, besser in Form halten, als aus Kupfer und Messing, und nicht so bald buckelig und beulig werben".


|
Seite 319 |




|
und in Scherers Journal VI, nieder. Darauf untersuchten Prof. Dr. L. Hünefeld und Ferd. Picht mehrere auf Rügen und in Pommern gefundene Bronzen und theilten die Analysen in "Rügens metallischen Denkmälern der Vorzeit, vorzugsweise chemisch bearbeitet, Leipzig, 1827", mit. Wenn auch gegen das chemische Verfahren bei diesen Analysen nichts zu erinnern sein mag, so fehlt es doch an zuverlässigen, wissenschaftlichen Nachrichten über den antiquarischen Ursprung dieser Bronzen. Die von Klaproth untersuchten Alterthümer haben zwar alle die Form der norddeutschen Alterthümer; aber es ist bekannt, daß während des größern Zuströmens von Alterthümern nach Berlin in frühern Zeiten eine scharfe Scheidung zwischen südeuropäischen und norddeutschen Bronzen nicht geschah, und noch heutiges Tages nicht durchgeführt ist, so daß z. B. in der Sammlung römischer Bronzen viele Stücke aufbewahrt werden, welche ohne Zweifel dem vaterländischen Boden abgewonnen sind; von der andern Seite ist bei dem großen Umfange des preußischen Staats und der aus demselben zusammenströmenden Alterthümer eine scharfe Scheidung der heimischen und fremden Alterthümer oft wohl nicht möglich. Hünefeld und Picht ließen sich zwar die zu analysirenden Bronzen von bekannten Alterthumsfreunden geben und gebrauchten die Vorsicht, die analysirten Bronzen in ihrem Werke abzubilden; aber es sind von ihnen mehrere Bronzen analysirt, von denen es zweifelhaft ist, ob sie der eigentlichen Bronze=Periode angehören, z. B. die getriebenen Bronzeringe. Es gehört nämlich zum Wesen der eigentlichen Bronze=Periode, daß die bronzenen Geräthe derselben gegossen sind; nur einige Gefäße, Urnen, Näpfe etc. bestehen, als seltene Ausnahmen, aus dünne gehämmertem Bronzeblech. Die getriebenen Ringe scheinen nach dem leichtern Roste und nach andern Umständen bei der Auffindung einer jüngern Zeit anzugehören. Das Hämmern der Metalle wird erst allgemeiner, als das Schmieden des Eisens allgemeiner wird, eine Erfindung, welche in den Künsten des Lebens eine der größten Umwälzungen hervorgebracht hat.
Mögen nun auch die frühern antiquarischen Untersuchungen der heimischen antiken Bronzen der antiquarischen Basis entbehren, so geht doch aus der Analyse derjenigen dieser Bronzen, welche mit Sicherheit der eigentlichen Bronze=Periode zugeschrieben werden müssen, wie der Schwerter, Frameen, Lanzen etc. hervor, daß die gewöhnliche Bronze der Kegelgräber Norddeutschlands eine Legirung von Kupfer und Zinn sei und kein anderes Metall


|
Seite 320 |




|
enthalte, als ungefähr 85-90 pCt. Kupfer und 15-10 pCt. Zinn, daß namentlich kein Blei, Zink, Silber und Eisen in dieser Metallmischung gefunden werde.
Darauf veranlaßte die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen den berühmten Chemiker Berzelius zur Analyse mehrerer Bronzen, deren Resultat in Annaler for nordisk oldkyndighed, 1836-1837, p. 104, mitgetheilt ist. Nach den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357, hatte der Ausschuß der Gesellschaft, welcher bekanntlich die verschiedenen Perioden des heidnischen Alterthums mit Sicherheit überschaut, "dem Freiherrn Berzelius zur Untersuchung nur solche Stücke, die aus dem eigentlichen Broncealter herrührten, aber keine weder aus einem frühern, noch aus einem spätern Alter" mitgetheilt. Die Untersuchung gab dasselbe Resultat, daß die antike heimische Bronze nur eine Legirung von Kupfer und Zinn sei.
In den neuesten Zeiten hat Professor Göbel zu Dorpat, in Veranlassung der antiquarischen Untersuchungen des Professors Kruse zu Dorpat, mehrere alte Bronzen, sowohl altgriechische und italische, als in den russischen Ostsee=Provinzen gefundene, analysirt. Zuerst berichtete Kruse über die Resultate in einem Schreiben an die königliche Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen vom 19. Oct. 1839, in den Mémoires de la société royale des antiquaires du nord, 1838-1839, p. 357. Darauf erschien ein eigenes Buch von Göbel: Ueber den Einfluß der Chemie auf die Ermittelung der Völker der Vorzeit, Erlangen, 1842, mit einer Menge Analysen, welche bald darauf Kruse in einem großen Werke: Necrolivonica oder Alterthümer Liv=, Esth= und Curlands bis zur Einführung der christlichen Religion in den russischen Ostsee=Gouvernements, Dorpat, 1842, Beilage F, noch ein mal mittheilte und mit antiquarischen Bemerkungen begleitete; Kruse stimmt im Allgemeinen mit Göbel in den antiquarischen Resultaten überein.
Aus der tabellarischen Zusammenstellung bisher bekannt gewordener Analysen bei Göbel ergiebt sich nun, daß
1) die griechischen Geräthe und Bildwerke aus Kupfer und Zinn, die Münzen aus Kupfer, Zinn und Blei,
2) die französischen, deutschen und nordischen heimischen Bronzen des Alterthums aus Kupfer und Zinn,
3) die römischen Bronzen aus Kupfer und Zink, oder Kupfer, Zinn und Blei, oder Kupfer, Zink, Zinn und Blei,


|
Seite 321 |




|
4) die in den russischen Ostsee=Gouvernements gefundenen Bronzen aus Kupfer, Zink, Zinn und Blei bestehen.
Das Resultat ist also, daß die griechischen Bronzen aus Kupfer und Zinn bestehen, mitunter Bleizusatz haben, aber nie Zink enthalten: "was Zink enthält, ist niemals griechisch". Aehnliche Mischung enthalten die deutschen und nordischen Bronzen, nämlich nur Kupfer und Zinn. Die römischen Alterthümer enthalten, zum besondern Merkmale, außerdem Zink, und hiemit stimmen, nach den Mischungsverhältnissen, die Alterthümer der russischen Ostseeprovinzen überein, indem sie außer Kupfer, Zinn und Blei, auch Zink enthalten.
Hieraus ziehen Göbel und Kruse folgende historische Folgerungen:
1) alle Legirungen, die von den Griechen abstammen, bestehen aus Kupfer und Zinn (und Blei); (Kruse Necrolivonica, Beil. F, S. 10, sagt: "Die Scandinavische Legirung der sogenannten Bronzezeit, so wie die der Rügenschen und Norddeutschen Bronzereste von der Ostseeküste, ist größtentheils Alt=Römisch oder Griechisch. Ich erkläre dieses aber lieber dadurch, daß das gothische Volk - - theils mit den alten Griechen unmittelbar, theils mit den Griechischen Kolonien - - in Verbindung war. Von diesen mögen nun die Gothen zuerst diese Bronzesachen erhandelt haben. Dann aber mag auch die Kenntniß der Metallbereitung selbst zu ihnen übergegangen, und mit den Gothen durch Rußland nach Skandinavien gewandert sein".)
2) antike metallische Gegenstände, welche aus Kupfer und Zink bestehen, mit oder ohne Zusatz von Zinn und Blei, sind römischen Ursprungs, oder sie gehören Völkern an, auf welche sie von den Römern übergingen, obgleich auch Bronzen ohne Zinn auch römischen Ursprungs sein können; (Kruse a. a. O. sagt: "Die Skandinavische Legirung der spätern Gräberzeit im X. und XI. Jahrhundert zeigt den spätern römischen Ursprung und eben so diejenige, welche in Thüringen und Sachsen und in unsern Provinzen vorkommt. Diese Römische Legirung der Kaiserzeit kann aber recht wohl durch Handel, Kriege, Raubzüge und Tribute zu den nördlichen Völkern übergegangen sein".)
3) es kann jedoch nicht gesagt werden, daß alle Alterthümer, welche kein Zink enthalten, nur griechischer Abstammung seien;


|
Seite 322 |




|
4) die in den Ostsee=Gouvernements vorkommenden bronzenen Alterthümer, welche wohl die alten Skandinavier gebraucht und getragen haben mögen, sind von römischer Abstammung, oder von römischen Metallarbeitern angefertigt worden.
Es ist im höchsten Grade gefährlich, aus Einem Kennzeichen eines alterthümlichen Geräthes einen historischen Schluß zu machen. Die Alterthumskunde kann und darf nur Stoff für die Geschichte werden, wenn alle Kennzeichen zusammengenommen für eine geschichtliche Wahrheit reden: Bronzealterthümer z. B. können nur für einen geschichtlichen Satz reden, wenn alle Umstände des Auffindens für eine bestimmte Zeit charakteristisch sind und hiemit Metallmischung, Bereitungsweise, Form, Verzierung, Bestimmung, Rost und außerdem noch die Analogie übereinstimmen. Sollte der Satz Wahrheit haben, daß weil römische Bronzen Zinn enthalten, auch die Alterthümer der Ostseeprovinzen römischen Ursprungs seien: so würde sich mit Recht für jede Bronze, welche Zinn enthält, der römische Ursprung behaupten lassen. Ja, es muß gestattet sein, den Satz umzukehren und zu sagen, die Römer haben die Metall=Legirung mit Zink von irgend einem nordischen Volke erhalten: eine Behauptung, welche vom geschichtlichen Standpuncte aus sehr gewagt sein würde; und doch muß man sie machen können, wenn bloß die chemische Analyse einen Maaßstab abgeben soll.
Es ist überhaupt sehr gewagt, zu behaupten, die nördlichen Völker hätten ihre Geräthe und ihre Metallmischungen von den südlichen Völkern Europas erhalten; es ist auch gar keine Veranlassung zu einer solchen Behauptung vorhanden, selbst wenn man noch keine Gießstätten im Norden aufgefunden hätte. Die germanischen Völker und ihre Nachbaren haben ohne Zweifel eben so viel Anlage und Geschicklichkeit zur Verfertigung der nothwendigsten Geräthe und des Schmuckes des Lebens gehabt, als die alten Griechen und Italier. Es ist außer Zweifel, daß im frühesten Alterthume, der eigentlichen und reinen Bronze=Periode, alle civilisirtern Völker Europas, von Klein=Asien bis zu den Lappmarken, auf demselben Standpuncte der Cultur in der Verarbeitung der Metalle gestanden haben, bis sich die südlichen Völker durch Verarbeitung des Eisens auf einen technisch höhern Standpunct stellten; daß die Verbreitung der Eisen=Cultur sehr langsam von Süden nach Norden fortschritt und hier noch spät Eisenschmiede als die größten Künstler, welche Wunderbares verrichteten, angesehen wurden: die Periode des Erzgusses ist in der frühesten Zeit allen alten Völkern gemeinsam,


|
Seite 323 |




|
seien es Griechen oder Germanen. Der uralte Bronzeguß weiset auf eine uralte, gemeinsame Quelle der Cultur zurück, an welcher die griechischen, italischen und germanischen Völker zusammen saßen; der Bronzeguß ist bei dem einen Volke so alt, wie bei dem andern. Man denke nur daran, daß die ganze Vorzeit unsers Vaterlandes überhaupt nur drei, in sich selbst nicht verschiedene Cultur=Epochen aufzuweisen hat! Wahrlich nicht viel seit "Erschaffung der Welt", wenn man so sagen darf. Jedenfalls ist diese Thatsache ein Beweis, daß diese Epochen einen großen Zeitumfang gehabt haben. Will man aber eine Einführung der Bronzen von Griechenland und Rom in den Norden annehmen, so kann fortan von irgend einer Cultur der germanischen Nordländer gar nicht mehr die Rede sein; denn, außer den thönernen Urnen, finden wir durchaus nur Geräthe aus gegossener, höchst selten gehämmerter, Bronze, alle stets von einem und demselben Wesen.
Es kann ferner überhaupt nur davon die Rede sein, daß in den ältern Zeiten die Metallmischungen einfacher waren, daß sie im Fortschritte der Zeit complicirter wurden. In den ältesten Zeiten ward gediegenes Kupfer verarbeitet; die Legirung mit Zinn, welche hierauf folgte, brachte schon eine totale Veränderung des Lebens hervor; die Mischung mit Zink gehört einer jüngern Periode an. Leider ist die griechische und römische Alterthumskunde für die ältesten Zeiten äußerst dürftig. Es werden sich aber genug Bronzen aus Kupfer und Zinn in Italien finden, und Griechenland wird auch jüngere Bronzen mit Zink vermischt haben. Wenn auch die Kegelgräber Klein=Asiens, Griechenlands und Italiens studirt werden, so werden ganz andere Ansichten über das Alterthum verbreitet werden, als man bisher gehabt hat.
Betrachten wir Kruse's Necrolivonica mit den vielen Abbildungen genauer, so stellt sich die Alterthumskunde der russischen Ostseeprovinzen noch als in ihren ersten Windeln dar. Die beiden großen Perioden des Alterthums, die Stein= und die eigentliche Bronze=Periode fehlen ganz; es ist in dem ganzen Werke kein einziges Stück abgebildet, welches der eigentlichen Bronze= Periode des Nordens angehörte. Alle abgebildeten Alterthümer tragen das Gepräge der jüngsten Zeit des Heidenthums und fallen ganz in die Eisen=Periode des Nordens. Den Beweis liefern die vielen eisernen modernen Geräthe, die zahlreichen Schmucksachen aus Silber, das endlose Kettenwerk, die hohl getriebenen Ringe, die drachenförmigen, bissigen Thiergestalten, die Brochen mit einer Spiralfeder, die modernen Fingerringe wie Siegelringe, die Sporen mit Bügeln, alle die modernen Schnallen und Spangen: dies alles ist jung,


|
Seite 324 |




|
sehr jung und dem Lande, in welchem es gefunden ist, ziemlich eigenthümlich. Die dünnen Bronze=Spiralen, auf Zwirn gezogen, sind in Meklenburg mit ganz jungen, kaum mit Rost belegten Bronzesachen und mit Eisen zusammen gefunden; dieselben silbernen Fingerringe und silbernes Flechtwerk ist hier mit Münzen aus dem 10. und 11. Jahrhundert gefunden. Das Einzige, was einigermaßen den Schein eines höhern Alterthums für sich hat, sind die gewundenen Kopf= und Halsringe und einige Hefteln (broches); aber grade diese Ringe und Hefteln sind am längsten von allen Alterthümern in der Mode gewesen und die Ringe werden in allen 3 Perioden des Heidenthums, auch schon am Ende der Steinperiode, gefunden. - Man kann also ohne Scheu annehmen, daß die liefländischen, von Kruse bekannt gemachten Alterthümer etwa in das 10. Jahrhhundert n. C. fallen, also nicht von den Römern herstammen können. Sie enthalten im Durchschnitt nur einige p. C. Zinn und Blei und 18 bis 20 p. C. Zink. Aehnliche Alterthümer mit 20 p. C. Zink, welche in Jütland gefunden wurden, versetzt die königl. dänische Gesellschaft ebenfalls "ungefähr in das 10. Jahrhundert" (vgl. Mémoires, 1838-39, p. 357, Not. 1.) und äußert dabei, daß "die von Göbel untersuchten Metallstücke vermuthlich in ein späteres Alter gehören".
Die Untersuchungen von Göbel und die aus denselben von ihm und Kruse gezogenen geschichtlichen Folgerungen haben also auf die Erkenntniß der Bronze=Periode keinen andern Einfluß, als daß man weiß, daß in den jüngsten Zeiten des Heidenthums, in der Eisen=Periode, die Völker der russischen Ostseeprovinzen die alte Bronzemischung nicht mehr anwandten.
Kruse (z. B. Necroliv. Beil. C, S. 2 flgd.) und Göbel Einfluß etc., S. 20 flgd.) behaupten zwar an mehreren Stellen (z. B. Kruse Necroliv. Generalbericht, Seite 11), "eine große Aehnlichkeit, ja oft die fast völlige Identität der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Gegenstände mit den in Skandinavien und dem nördlichen Deutschland gefundenen Alterthümern in Hinsicht der Form und die Gleichheit in der Legirung der Metalle, welche hier und dort dieselbe ist", - fügen aber einlenkend hinzu: "wenn man den Inhalt der spätern skandinavischen Gräber nimmt, die nicht zu dem frühern Bronzezeitalter gehören". - Aber die von Kruse herausgegebenen und von Göbel analysirten Alterthümer haben gerade das Besondere, daß sie durchaus nicht mit den nordischen Alterthümern übereinstimmen, weder in der Form, noch in der Legirung der Metalle. Die


|
Seite 325 |




|
Metall=Legirung der in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer weicht durchaus von der Legirung der nordischen Bronzen ab, indem sich in diesen nie Zink findet; und dies ist hinreichend, eine gänzliche Verschiedenheit zu behaupten. In Skandinavien finden sich einzelne mit Zink legirte Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit; aber diese stehen so isolirt, daß sie nicht eine umfassende Culturepoche, sondern nur in einzelnen Stücken den Uebergang zum Mittelalter bezeichnen. In Norddeutschland werden vollends gar keine mit Zink legirte heidnische Alterthümer gefunden. Einzelne Ausnahmen, die sich überall finden, können aber keine Regel machen und nicht zu dem unbestimmten Satze führen, die russischen und nordischen Alterthümer seien gleich, wenn man dabei die jüngere heidnische Periode im Auge behalte. - Die Formen sind völlig verschieden, einzelne Ausnahmen abgerechnet. Es sind in den russischen Ostseeprovinzen gar keine Alterthümer gefunden, welche mit den nordischen Alterthümern in der Form übereinstimmten; die Formen der norddeutschen und skandinavischen Alterthümer sind durchaus ganz andere, etwa die Aehnlichkeit einiger Helfteln (broches) mit Spiralfedern abgerechnet.
Man kann also nur sagen, die in den russischen Ostseeprovinzen gefundenen Alterthümer seien von den skandinavischen und nordischen Alterthümern der Bronzeperiode und zum größten Theile der Eisenperiode in Legirung und Form, d. h. in Allem, völlig verschieden, und nur einige nordische Alterthümer aus der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens hätten einige Aehnlichkeit mit den russischen Alterthümern, welche im Allgemeinen offenbar in den Uebergang zum Mittelalter fallen.
Es geht hieraus hervor, daß eine Anknüpfung der norddeutschen Alterthumskunde mit dem Osten nicht in den russischen Ostseeprovinzen, sondern viel südlicher, etwa durch Polen und Gallizien nach dem schwarzen und caspischen Meere hin, zu suchen, und daß eine Verbindung der russischen Ostseeprovinzen nur mit der jüngsten heidnischen Zeit Skandinaviens, nicht Norddeutschlands, statt gefunden habe, daß vielmehr die heidnische Cultur der russischen Ostseeprovinzen erst dann begonnen habe, als die heidnische Cultur des Nordens im Erlöschen begriffen gewesen sei, die älteste, eigentliche Bronzeperiode aber über alle Geschichte hinausreiche. Möglich, daß in den russischen Ostseeprovinzen Reste einer ältern Cultur noch verborgen liegen, zugegeben, daß sich dort häufig griechische und römische Alterthümer finden: aber von einer alten heimischen Cultur in jenen Ländern sind noch keine Beweise geliefert, wenigstens nicht in


|
Seite 326 |




|
dem Umfange, daß sie zu irgend einem Schlusse berechtigen könnten.
Wenn nun auch die aus der Analyse der Bronzen aus der eigentlichen Bronzeperiode Norddeutschlands und Skandinaviens bisher gewonnenen Resultate sicher sind, so dürfte es doch wohl möglich sein, dieselben noch weiter zu führen, wenn die Chemie Hand in Hand mit der Alterthumskunde geht, und beide Wissenschaften, auf sichere und genaue Fundberichte und umfassende antiquarische Forschungen gestützt, zugleich innere und äußere Merkmale über die Zeit und den Ort der Verfertigung der Alterthümer zu gewinnen suchen. Es sind daher im Folgenden mehrere Analysen von charakteristischen Bronzen aus der reinen Bronzeperiode, in welcher sich außer Bronze nur noch Gold findet, nach zuverlässigen Fundberichten, mitgetheilt und von den nöthigen antiquarischen Forschungen begleitet; daneben sind aber auch Analysen anderer Metalle aus andern oder angrenzenden Perioden, nach eben so genauen antiquarischen Forschungen, beigebracht, welche die Metalle der reinen Bronzeperiode in ein helleres Licht zu setzen und die Uebergänge scharf zu bezeichnen vermögen.
Das Verfahren bei der Analyse ist vorzüglich bei Nr. 11., Krater von Gr. Kelle, auseinandergesetzt, da der Verf. diese Analyse zu einem Vortrage in einer gelehrten Gesellschaft wählte.
I. Kupfer der Hünengräber.



|



|
|
|
1. Framea von Goldberg.
Wenn auch im Allgemeinen in den mit großen Steinen umringten und bedeckten Hünengräbern aus der Steinzeit nur Geräthe aus Stein und Schmucksachen aus Bernstein gefunden werden, so sind doch in der Altmark schon einige Gegenstände aus Metall in dieser Art von Gräbern gefunden (vgl. Erster Jahresbericht des Altmärk. Vereins, I, S. 36 und 43, und VI, S. 91), und zwar in solchen, welche wahrscheinlich der Uebergangsperiode aus der Steinzeit in die Bronzezeit anheimfallen. Abgesehen von Urnen mit eisernen Geräthen, dicht unter der Rasendecke dieser Art von Gräbern, da dieselben ohne Zweifel zur wendischen Zeit, der jüngsten heidnischen Periode, aus Pietät in die Gräber der unbekannten Vorfahren nachbestattet


|
Seite 327 |




|
sind, bestehen diese metallenen Geräthe der Hünengräber aus rothem Kupfer, noch nicht aus Bronze, da die Metall=Legirung wohl noch nicht bekannt war. In Meklenburg=Schwerin waren bisher nur zwei Geräthschaften aus Kupfer gefunden, nämlich die zwei Keile, welche Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2. und Tab. X, Fig. 6, (vgl. Erläut. S. 158, 119 und 107) abgebildet sind; ein dritter ähnlicher Keil befindet sich in der großherzogl. Alterthümer=Sammlung zu Neustrelitz (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 158).
Diese kupfernen Alterthümer deuten nicht allein durch ihre Form, da sie sämmtlich Keile nach dem Bildungsstande der Steinzeit sind, sondern auch durch den sehr rohen Guß und den gänzlichen Mangel der Politur, auf eine sehr alte Zeit hin, welche die letzte Periode der Steinzeit sein dürfte. Im J. 1842 ward im Moor von Pampow bei Schwerin ein gewundener Halsring aus Kupfer ohne Politur gefunden. Ganz charakteristisch für die kupfernen Geräthe aus der Steinperiode ist der rohe Guß und der gänzliche Mangel an Nacharbeitung der Oberfläche. (Während des Druckes dieser Bogen ist zu Admannshagen in einem Kegelgrabe eine Krone von reinem Kupfer gefunden, über welche in den nächstfolgenden Jahrbüchern berichtet werden soll.)
Im J. 1841, zur Zeit des Chausseebaues bei Güstrow, ward eine Framea von Kupfer mit Schaftrinne, als in der Gegend von Goldberg gefunden, ungefähr von der Gestalt wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 6, an die Eisengießerei zu Güstrow mit altem Metall zum Einschmelzen verkauft; leider ward das seltene Stück, wohl eine der ältesten, dem Keil nahe stehenden Frameen, durchgeschlagen und zur Hälfte eingeschmolzen (vgl. Jahresber. VII, S. 26). Sie ist am Ansehen des Metalls und an der rohen Oberfläche des Gusses dem kupfernen Keile in Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 2, völlig gleich. Die chemische Analyse ergab:
| 98, | 64 | Kupfer, |
| 1, | 190 | Zinn, |
| 0, | 746 | Silber. |
Wahrscheinlich liegt das Vorhandensein des wenigen Silbers und Zinns in dem Mangel an Kenntniß der Metallscheidung, und das Metall dieser Framea ist wohl unstreitig gediegenes Kupfer, wie es in der Natur gefunden wird.
Von dem rothen und glänzenden Metall wurden 52 Gran in Salpetersäure aufgelöst, bis zum Verdunsten der überschüssi=


|
Seite 328 |




|
gen Säure eingeengt, die erstarrte und erkaltete Masse mit wenigem Wasser übergossen, einige Tropfen davon mit vielem Wasser zur Prüfung auf Wismuth verdünnt, aber kein Niederschlag erhalten. Die durch größern Wasserzusatz erhaltene vollständige Auflösung ward zur Trennung des abgeschiedenen Zinnoxyds filtrirt und mit heißem Wasser nachgespült. Es wog getrocknet 0,8 Gran.
Auf die salpetersaure Auflösung blieben alle Reagentien, außer der Salzsäure, die sogleich einen weißen Niederschlag erzeugte, der sich in Aetzammonium vollständig lösete und damit die Gegenwart des Silbers anzeigte, ohne Wirkung. Nach vollständiger Abscheidung des Silbers durch Salzsäure ward die Auflösung erhitzt, der Niederschlag gesammelt, gut ausgewaschen, getrocknet und darauf in einem kleinen Porzellantiegel geglüht, das Filtrum aber auf einem Platinadeckel verbrannt, und damit der Tiegel bedeckt. Das geglühete Chlorsilber wog 0, 458 Gran.
| 0, 8 Zinnoxyd =0, | 63 | Zinn, |
| 0, | 17 | Sauerstoff, |
| 0, | 80 . | |
| 0, 458 Chlorsilber = 0, | 348 | Silber, |
| 0, | 110 | Chlor, |
| 0, | 458 |
52 Gran des Metalls bestehen aus
| 0, | 630 | Zinn, |
| 0, | 348 | Silber, |
| und demnach aus 51, | 22 | Kupfer, |
| 52 | Gran. |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| Zinn, | 1, | 190 |
| Silber | 0, | 746 |
| Kupfer | 98, | 64 |
| 100. |
II. Metalle der Kegelgräber.
A. Bronze der Kegelgräber.



|



|
|
|
2. Handberge von Prislich.
Die meklenburgischen Kegelgräber der Bronze=Periode charakterisiren vorzüglich die sehr häufig gefundenen Schwerter und die besonders hier vorkommenden "Handbergen" oder Arm=


|
Seite 329 |




|
ringe mit zwei auslaufenden großen Spiralplatten.
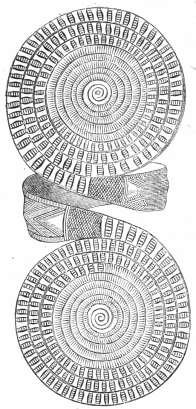
Wir wählten zunächst ein Stück von einer schönen Handberge (Frid. Franc. Tab. IV) aus dem Kegelgrabe von Prislich (Frid. Franc. Erläut. S. 67); die chemische Analyse ergab auch hier:
| 86, | 90 | Kupfer, |
| 13, | 10 | Zinn. |
Analyse.
Von 50 Gran, die ich davon in reiner Salpetersäure löste, blieben 8 1/4 Gran Zinnoxyd zurück.
Die Auflösung ward mit denselben, unten bei dem Bronze=Krater von Groß=Kelle Nr. 11. angegebenen Reagentien versetzt, aber nur vom Aetzammoniak ein darin wieder löslicher, (unleserliches Wort?) vom Aetzkali ein hellblauer und vom Schwefelwasserstoffgas ein schwarzer Niederschlag erhalten, die allein die Gegenwart des Kupfers anzeigten. Alle übrigen Reagentien verhielten sich indifferent.
Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd =
| Da nun 8 1/4 Gran Zinnoxyd = 6, | 55 | Zinn, |
| 1, | 73 | Sauerstoffgas, |
| 8, | 21 |
entsprechen, so bestehen die in Untersuchung genommenen 50 Gran aus
| 6, | 55 | Zinn, |
| 43, | 45 | Kupfer, |
 dieser Bronze ist zusammengesetzt aus
dieser Bronze ist zusammengesetzt aus
| 4 Loth | 1 Quent. | Zinn, |
| 27 Loth | 3 Quent. | Kupfer, |
| 32 Loth. |


|
Seite 330 |




|
100 Theile enthalten also
| 13, | 10 | Zinn, |
| 86, | 90 | Kupfer, |
| 100. |



|



|
|
|
3. Schwert von Tarnow.

Eben so charakteristisch für die Kegelgräber, namentlich Meklenburgs, sind die zweischneidigen Schwerter von gegossener Bronze, wie sie im Frid. Franc. Tab. XIV und XV abgebildet sind. Ein solches Schwert, welches zu Tarnow bei Bützow mit goldenen Spiralringen in einem Kegelgrabe gefunden ward, gab
| 84, | 16 | Kupfer, |
| 15, | 84 | Zinn. |
Analyse.
12 1/2 Gran in Salpetersäure gelöst, ließen 2 1/2 Gran Zinnoxyd zurück.
Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 2 1/2 Gran Zinnoxyd = 1, | 98 | Zinn, |
| 0, | 52 | Sauerstoff, |
| 2, | 50 . |
An reinem Metall ist in dieser Bronze enthalten
| 1, | 98 | Zinn, |
| 10, | 52 | Kupfer, |
| 12, | 50. |
In 100 Theilen befinden sich also:
| 15, | 84 | Zinn, |
| 84, | 16 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 331 |




|



|



|
|
|
4. Heftel mit zwei Spiralplatten.
Auch eine Heftel (fibula) mit zwei Spiralplatten der Art,
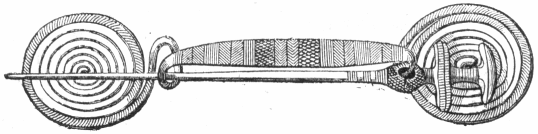
wie sie in Frid. Franc. Tab. XI abgebildet sind, gab ungefähr dasselbe Resultat:
| 84 | Kupfer, |
| 16 | Zinn. |
Analyse.
10 1/2 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 21/8 Gran Zinnoxyd.
Die salpetersaure Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 2 1/8 Gran Zinnoxyd = 1, | 68 | Zinn, |
| 0, | 44 | Sauerstoff, |
| 2, | 12 . |
In 10 1/2 Gran dieser Bronze befinden sich an reinem Metall:
| 1, | 68 | Zinn, |
| 8, | 82 | Kupfer, |
| 10, | 50 . |
In 100 Theilen sind demnach enthalten:
| 16 | Zinn, |
| 84 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 332 |




|



|



|
|
|
5. Metallspiegel von Sparow.
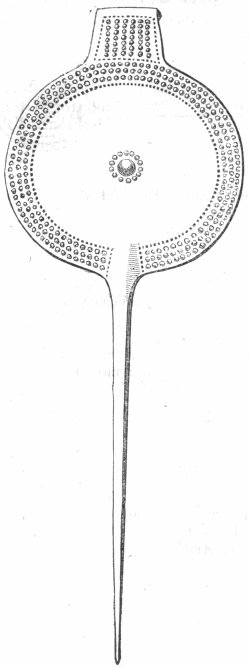
Schon mehr abweichend von der gewöhnlichen Mischung war die Legirung des bei Sparow in einem Kegelgrabe gefundenen Metallspiegels, welcher im Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 20 abgebildet und irrthümlich als eine Nadel beschrieben ist. Die Analyse ergab nämlich:
| 80, | 40 | Kupfer, |
| 19, | 60 | Zinn, |
In dieser Composition ist die Menge des beigemischten Zinns größer, als in den sonst vorkommenden Legirungen der Bronzen der Kegelgräber, wahrscheinlich um dem Metall eine hellere Farbe und eine größere Härte für die nöthige Politur zu geben.
12 1/2 Gran gaben nach der Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 3 1/4 Gran Zinnoxyd.
In der Auflösung ließen die Reagentien nur Kupfer erkennen.
| 3 1/4 Gran Zinnoxyd = 2, | 45 | Zinn, |
| 9, | 68 | Sauerstoff, |
| 3, | 13 . |
Wenn 12 1/2 Gran dieser Bronze aus
| 2, | 45 | Zinn, |
| 10, | 5 | Kupfer, |
| 12, | 50 . |


|
Seite 333 |




|
zusammengesetzt sind, so bestehen 100 Gran aus
| 19, | 60 | Zinn, |
| 80, | 40 | Kupfer, |
| 100. |



|



|
|
|
6. Diadem von Wittenmoor.
Eine ähnliche Metallmischung, wie der Metallspiegel von Sparow, gab ein in der Gegend von Neustadt zu Wittenmoor gefundenes Diadem, wie es in Frid. Franc. Tab. X, Fig. 5, (vgl. Erläut. S. 50 und 55) abgebildet ist.
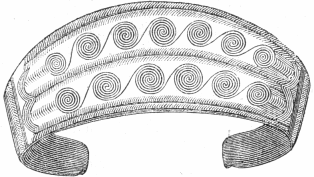
Diese in Meklenburg öfter gefundenen Diademe, ohne Zweifel zum geschmackvollen Kopfputz für vornehme Frauen, sind immer mit eingegrabenen Spiralwindungen verziert. Die Analyse ergab:
| 78, | 08 | Kupfer, |
| 21, | 92 | Zinn, |
Analyse.
Von der sehr verwitterten, bruchigen, mit Grünspan überzogenen Bronze wurden 12 1/2 Gran reine Metallstücke ausgesucht und mit Salpetersäure in Untersuchung gestellt. Die Auflösung hinterließ 3 3/4 Gran Zinnoxyd, und reagirte auf keine fremden Metalle, bestand daher nur aus Kupfer.
| 3 3/4 = 3, 75 Gran Zinnoxyd = 2, | 74 | Zinn, |
| 1, | 01 | Sauerstoff, |
| 3, | 75 . |
| Da in 12 1/2 = 12, 50 Gran Bronze enthalten sind | ||
| 2, | 74 | Zinn, |
| so müssen darin enthalten sein 9, | 76 | Sauerstoff, |
| 12, | 50 . |
In 100 Theilen befinden sich also
| Zinn | 21, | 92 |
| Kupfer | 78, | 08 |
| 100. |


|
Seite 334 |




|



|



|
|
|
7. Urne von Ruchow.
Dagegen gab die Analyse einer fast so dünne, wie ein Laubblatt geschlagenen Bronze=Urne aus dem großen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 45) mehr Kupfer, als die meisten Kegelgräber=Bronzen, nämlich
| 87, | 36 | Kupfer, |
| 12, | 64 | Zinn, |
wohl um das Metall zum Hämmern geschmeidiger zu machen; die gewöhnlich vorkommenden Bronzen sind dagegen alle gegossen. - Eine metallische Urne von Ranzow auf Rügen ergab ebenfalls eine ähnliche Mischung: von etwa 90, 33 Kupfer und 9, 67 Zinn (vgl. Hünefeld u. Picht, S. 17 u. 19), und die Bronze von hohl getriebenen Ringen eine Mischung von 92 Kupfer und 8 Zinn (vgl. das. S. 29).
25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 4 Gran Zinnoxyd.
Die Auflösung enthielt nach Ausweis der bezüglichen Reagentien nur Kupfer.
| 4 Gran Zinnoxyd = 3, | 16 | Zinn, |
| 0, | 84 | Sauerstoff, |
| 4. |
An reinem Metall sind also in 25 Gran enthalten:
| 3, | 16 | Zinn, |
| 21, | 84 | Kupfer, |
| 25. |
In 100 Theilen aber:
| 12, | 64 | Zinn, |
| 87, | 36 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 335 |




|



|



|
|
|
8. Framea von Satow.

Eine zu Satow bei Doberan gefundene framea (Streitmeißel) von der in Meklenburg gewöhnlichen, oft vorkommenden Form, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 5, gab auffallender Weise auch viel Kupfer, nämlich
| 90 | Kupfer, |
| 10 | Zinn, |
wahrscheinlich, weil eine so dicke und voll gegossene Stoß= und Wurfwaffe wie die framea keiner besondern Härte und Schärfe, sondern vorzüglich Gewicht und Festigkeit bedarf.
10 3/4 Gran hinterließen nach der warmen Auflösung in Salpetersäure einen Rückstand von 1 3/4 Gran Zinnoxyd. Die Auflösung reagirte nur auf Kupfer.
| 1 3/4 Gran Zinnoxyd = 1, | 38 | Zinn, |
| , | 37 | Sauerstoff, |
| 1, | 75 . |
Die Waffe bestand demnach aus:
| 1, | 38 | Zinn, |
| 9, | 37 | Sauerstoff, |
| 10, | 75 . |
und in 100 Theilen aus:
| 10 | Zinn, |
| 90 | Kupfer, |
| 100. |
B. Gold der Kegelgräber.



|



|
|
|
9. Fingerring von Ruchow.
Zu den charakteristischen Kennzeichen der Kegelgräber aus der Bronzeperiode gehören die Schmucksachen aus Gold, namentlich die Fingerringe von Gold, gewöhnlich aus doppeltem Golddrath (Trauringe) in der Form von Spiral=Cylindern, wie sie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 3 und 4, (vgl. Erläut. S. 51) abgebildet sind.


|
Seite 336 |




|
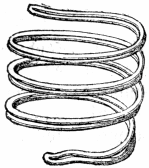
Ein solcher Ring aus dem sehr großen und reichen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 43 und Jahresbericht V, S. 30), welches noch 3 gleiche Goldringe und ein kleines Museum von bronzenen Alterthümern aus der Bronzezeit lieferte, enthielt viel Silber. Die Analyse ergab:
| 81, | 2 | Gold, |
| 18, | 8 | Silber. |
Analyse.
Ein halber Gran ward mit Königswasser übergossen, die sich um den metallischen Kern gebildete Hülle von Chlorsilber mit einem Glasstäbchen zertheilt, und darauf durch Erhitzen vollständig gelöst. Der Ueberschuß des Königswassers ward durch Zusatz von Salpetersäure möglichst zerstört, mit Wasser verdünnt, und das auf dem Filtrum gesammelte Chlorsilber mit heißem Wasser abgewaschen. Nach dem Glühen des scharf getrockneten Chlorsilbers wog dasselbe 1/8 Gran = 0, 125 Gran.
Die bisher auf eine geringe Menge durch Abdampfen concentrirte Goldlösung ward mit einer Lösung von Chlorammonium und Verdünnung mit Alkohol auf Platin, so wie durch die geeigneten Reagentien auf die Gegenwart eines andern Metalles geprüft, aber von allen keine Spur entdeckt.
| Chlorsilber besteht aus 108 | Silber, |
| und 36 | Chlor, |
| 144. |
0, 125 Gran Chlorsilber bestehen daher aus
| 0, | 094 | Silber, |
| 0, | 031 | Chlor, |
| 0, | 125 . |
Wenn in 0, 500 Goldlegirung enthalten sind,
| Silber 0, | 094 |
| so befinden sich darin Gold 0, | 406 |
| 0, | 500 . |
100 Theile bestehen also aus
| Gold 81, | 2, |
| Silber 18, | 8, |
| 100. | . |


|
Seite 337 |




|



|



|
|
|
10. Fingerring von Friederichsruhe.
Ein ganz gleiches Resultat gab auffallender Weise ein gleicher Fingerring aus Gold von Friederichsruhe (vgl. Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 1 - 4, vgl. Erläut. S. 51 und 137), der mit dem Ringe von Ruchow ohne Zweifel denselben Ursprung hat, nämlich
| 81, | 2 | Gold, |
| 18, | 8 | Silber. |
Analyse.
Zwei Gran des Ringes wurden mit Königswasser auf dieselbe Weise wie in Nr. 9. behandelt, und durch Glühen des Rückstandes 1/2 Gran = 0, 500 Gran Chlorsilber erhalten.
Die Goldlösung reagirte auf keine Beimischungen anderer Metalle, war also ebenfalls rein.
| 0, 500 Chlorsilber = 0, | 376 | Silber, |
| 0, | 124 | Chlor, |
| 0, | 500 . |
Befinden sich in 2 Gran Goldlegirung
| 0, | 376 | Silber, |
| so enthält dieselbe 1, | 624 | Gold, |
| 2, | 000 . |
100 Theile dieser Goldlegirung bestehen also aus
| Gold 81, | 2, |
| Silber 18, | 8, |
| 100. |
C. Römische Bronze.



|



|
|
|
11. Krater von Groß-=Kelle.
Um eine Vergleichung mit nicht heimischen Bronzen aus derselben Zeit der Todtenbestattung anstellen zu können, wählten wir ein Stück von dem in Meklenburg gefundenen großen Bronze=Krater oder Kessel aus dem merkwürdigen (römischen) Kegelgrabe von Groß=Kelle, welches nur römische Alterthümer enthielt (vgl. Jahresbericht des Vereins für meklenb. Geschichte etc. III, S. 44 und Abbildung zu Jahrg. V, Lithogr. Tab. III, Fig. 1). Die Analyse ergab hier ein anderes Resultat, nämlich
| 71, | 2 | Kupfer, |
| 15, | 6 | Zinn, |
| 13, | 2 | Blei. |
Analyse.
Ich löste 25 Gran dieses Metall=Fragments kochend in reiner Salpetersäure auf, und erhielt dabei einen 5 Gran


|
Seite 338 |




|
schweren Rückstand, der sich durch sein weiß corridirtes Ansehen schon als Zinnoxyd zu erkennen ab.
Die hellblaue salpetersaure Lösung versetzte ich zur Ermittelung der übrigen darin befindlichen Metalle mit folgenden Reagentien:
1) mit Aetzammoniak. Hiedurch ward die Lösung dunkelblau, und es schied sich ein im Ueberschuß von Ammoniak nicht löslicher weißer Niederschlag ab.
2) mit destillirtem Wasser. Eine starke Verdünnung damit gab keinen Niederschlag.
3) mit Salzsäure. Auch hiedurch entstand keine Trübung.
4) mit Aetzkali. Dieses erzeugte auch im Ueberschuß nur einen blauen Niederschlag.
5) mit schwefelsaurem Eisenoxydul erhielt ich eine flauere Färbung der Lösung, und einen weißen, keinen braunen Niederschlag.
6) mit schwefelsaurem Kali und
7) mit verdünnter Schwefelsäure gab die Lösung weiße Niederschläge;
8) mit Schwefelwasserstoff ward sie aber ganz schwarz präcipitirt. Nach Trennung des Niederschlages gab die Flüssigkeit mit Aetzammoniak keine Trübung.
Aus allen diesen Versuchen geht hervor, daß die salpetersaure Lösung nach den Reagentien 1, 4 u. 8 Kupfer, nach den von 1, 6 u. 7 Blei enthalte, Bismuth, Silber, Quecksilber, Zink und Gold darin aber nicht vorhanden sind.
Um nun das Kupfer vom Blei zu trennen und beides in ihren Mengeverhältnissen zu bestimmen, versetzte ich die salpetersaure Auflösung so lange mit verdünnter Schwefelsäure, als ein Niederschlag entstand, verdampfte darauf die Flüssigkeit sammt dem Niederschlage zur Trockniß und erhitzte die Masse so lange, bis alle freie Schwefelsäure entfernt war. Den Rückstand löste ich in Wasser, trennte das nicht gelöste schwefelsaure Bleioxyd durch ein Filter, süßte es auf, trocknete und glühete es schwach. Es wog 5 1/4 Gran.
Aus der von diesem schwefelsauren Bleioxyd getrennten Flüssigkeit schied ich mittelst Aetzkali das Kupferoxyd, nicht etwa zu dessen Gewichtsbestimmung, da sich seine Menge schon durch die Berechnung des Zinn= und Blei=Oxyds von selbst ergiebt, sondern um aus der davon abfiltrirten Flüssigkeit, welche noch eine kleine Menge von schwefelsaurem Bleioxyd aufgelöst enthält, dasselbe, nachdem die Flüssigkeit mit so viel verdünnter Schwefelsäure versetzt ist, als sie nur noch schwach


|
Seite 339 |




|
basisch reagirt, durch kleesaures Ammoniak zu trennen. Es zeigte sich erst nach Verlauf von mehreren Stunden eine schwache Trübung, die sich nach 24 Stunden als ein höchst geringfügiger Niederschlag am Boden des Gefäßes so fest abgelagert hatte, daß er durch Schütteln mit Wasser nicht davon zu trennen war. Diese geringe Menge kohlensaures Bleioxyd konnte ich daher nicht durch Glühen in Bleioxyd verwandeln und sie deshalb nur annähernd in Rechnung bringen.
Diese Analyse ergab also zum Resultat, daß außer dem
Kupfer 5 Gran Zinnoxyd,
5 1/4 Gran schwefelsaures Blei
erhalten wurden.
| Zinnoxyd besteht aber in 100 Th. aus 78, | 6 | Zinn, |
| 21, | 38 | Sauerstoff. |
| Demnach enthalten 5 Gran Zinnoxyd 3, | 9 | Zinn, |
| 1, | 3 | Sauerstoff. |
| Schwefelsaures Bleioxyd besteht aus 100, | Blei, | |
| 45, | Schwefelsäure. | |
| Darnach enthalten 5 1/4 Gran schwefelsaures Bleioxyd | ||
| 3, | 3 | Blei, |
| 2, | 1 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall sind also diese 25 Gran der analysirten Bronze zusammengesetzt, aus
| 3, | 9 | Zinn, |
| 3, | 3 | Blei. |
| und folglich aus 17, | 8 | Kupfer, |
| zusammen 25 Gran. |
Ein Pfund davon würde also ungefähr enthalten
| 5 | Loth | Zinn, |
| 4 | Loth | Blei, |
| 23 | Loth | Kupfer. |
| 32 | Loth. |
in 100 Theilen aber:
| 15, | 6 | Zinn, |
| 13, | 2 | Blei. |
| 17, | 2 | Kupfer, |
| 100. |
D. Ausländische Bronze.



|



|
|
|
12. Commandostab von Hansdorf.
Die bronzenen Streitäxte oder Commandostäbe mit Bronzestiel, welche an weit entfernten Stellen im Norden gefunden sind (vgl. Klemm german. Alterthk. S. 208 u. Tab. XV und Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 1, Tab. VII,


|
Seite 340 |




|
Fig. 1 u. Tab. XV, Fig. 6, u. Erläut. S. 115 u. 158), haben, namentlich durch den schönen Hohlguß, so viel Eigenthümliches, daß sich an ihrem norddeutschen Ursprunge aus der Zeit der Kegelgräber, um so mehr da sie bis jetzt nur einzeln und nicht in Gräbern gefunden sind, zweifeln läßt. Die Analyse eines zu Hansdorf gefundenen Exemplars (vgl. Jahresbericht des Vereins etc. II, S. 48-48) gab auch allerdings, nach wiederholter, scharfer Analyse, ein erwartetes abweichendes Resultat, vorzüglich durch die unzweifelhafte Beimischung von Silber, nämlich:
| 74, | 80 | Kupfer, |
| 24, | 08 | Zinn, |
| 1, | 12 | Silber. |

Analyse.
25 Gran der Streitaxt hinterließen in der Salpetersäure 7 3/4 Gran Zinnoxyd.
Die Lösung ward nur von Salzsäure getrübt; sie ward daher damit vollständig präcipitirt, und daraus nach dem Trocknen des Niederschlages 3/8 Gran salzsaures Silber gewonnen.
| 7 3/4 Gran Zinnoxyd entsprechen: 6, | 02 | Zinn, |
| 1, | 73 | Sauerstoff. |
| 3/8 Gran salzsaures Silber 0, | 28 | Silber, |
| 0, | 9 | Chlor. |
In 25 Gran sind also an reinem Metall enthalten
| 6, | 02 | Zinn, |
| 0, | 28 | Silber, |
| folglich 18 | 70 | Kupfer, |
| 25 Gran. |
100 Theile enthalten aber:
| 24 | 08 | Zinn, |
| 1, | 12 | Silber, |
| 74, | 80 | Kupfer, |
| 100. |


|
Seite 341 |




|



|



|
|
|
III. Bronze der Wendenkirchhöfe.
13. Beschlagring von Ludwigslust.
Mit den Kegelgräbern verschwindet die Schönheit der Bronze und der edle Rost auf derselben. Die wendische Bevölkerung Meklenburgs oder die Eisenzeit barg ihre Todten nicht mehr unter aufgeschütteten Hügeln, sondern grub die Urnen mit den Resten des Leichenbrandes in die ebene Erde ein. Mit diesem Begraben der Urnen verschwindet das Gold ganz und die Bronze wird selten; dagegen erscheint vorherrschend Eisen, und Silber und Bronze in einzelnen Schmucksachen. Diese wendische Bronze ist aber matter und unedler, als die germanische der Kegelgräber.
Wir wählten einen Beschlagring aus einer bei Ludwigslust gefundenen Urne (Jahresber. II, S. 44 flgd.), in deren Nähe auch eiserne Alterthümer gefunden sind; die vielen Bronzesachen aus diesem Begräbnisse sind weißlich und haben nur an einigen Stellen einen leichten Anflug von Rost. Dennoch müssen die vielen Begräbnisse bei Ludwigslust noch in dem Uebergange von der germanischen zur wendischen Zeit liegen, da in ihnen die Bronze noch vorherrscht und die Formen der Geräthe denen der Kegelgräber sehr nahe kommen, ja ganz ähnliche Sachen, wie die bei Ludwigslust gefundenen, zu Borkow (vgl. Jahresber. II, S. 43) noch in einem Kegelgrabe, dem einzigen bisher in Meklenburg beobachteten, welches Eisen enthielt, gefunden sind, das Eisen bei Ludwigslust auch nur selten erscheint. Da die Zeit dieser Bestattung wahrscheinlich schon in den Anfang der Silber=Periode fällt, so ließ sich Silber in der weißlichen Bronze vermuthen; aber eine wiederholte strenge Prüfung gab nur das Resultat:
| 83, | 6 | Kupfer, |
| 10, | 8 | Zinn, |
| 5, | 6 | Blei. |
Analyse.
25 Gran hinterließen nach der Auflösung in Salpetersäure 3 1/2 Gran Zinnoxyd.
Die salpetersaure Auflösung gab durch Reagentien die Gegenwart von Blei und Kupfer zu erkennen, welche auf die in 11. angegebene Weise abgeschieden wurden.
Das Resultat der Analyse ergab folgende Bestandtheile:
| 3 1/2 Gran Zinnoxyd = 2, | 7 | Zinn, |
| , | 8 | Sauerstoff. |
| 2 Gran schwefelsaures Blei = 1, | 4 | Blei, |
| 6 | Schwefelsäure. |


|
Seite 342 |




|
25 Gran bestehen demnach aus:
| 2, | 7 | Zinn, |
| 1, | 4 | Blei, |
| 20, | 9 | Kupfer, |
| zusammen 25 Gran. |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| 10, | 8 | Zinn, |
| 5, | 6 | Blei, |
| 83, | 6 | Kupfer, |
| 100. |



|



|
|
|
14. Armring von Ludwigslust.
Einer von den in demselben Begräbnisse gefundenen Armringen, welche die seltene Erscheinung gaben, daß die zerbrochenen Exemplare eingebohrte Bindlöcher zum Zusammenflicken der Fragmente für den fernern Gebrauch hatten, gab in der Analyse ein ähnliches Resultat. Diese Armringe sind schon von Blech und hohl getrieben und gleichen den hier abgebildeten, welche im Stargardischen bei den mit Drachenwindungen verzierten Bronzekesseln gefunden werden. (Jahresber. VII, S. 34-36). Die Ringe von Ludwigslust sind dem hieneben abgebildeten, bei Roga gefundenen ähnlich, jedoch auf der Oberfläche glatt und ohne eingehängte Ringel.
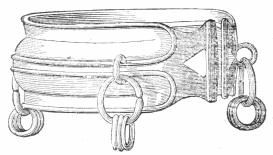
Die Analyse ergab:
| 89, | 44 | Kupfer, |
| 6, | 32 | Zinn, |
| 4, | 24 | Blei. |
Analyse.
12 1/2 Gran des Ringes in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen einen Rückstand von 1 Gran Zinnoxyd.
Die Lösung, mit den in 11 aufgeführten Reagentien versetzt, gab (unleserliches Wort?) nur mit Schwefelsäure und dessen Salzen einen Niederschlag; sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt; darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dieses schwefelsaure Blei 7/8 Gran.
| 1 Gran Zinnoxyd besteht aus 0, | 79 | Zinn, |
| 0, | 21 | Sauerstoff. |


|
Seite 343 |




|
| 7/8 Gran schwefelsaures Blei bestehen aus 0, | 53 | Blei, |
| 0, | 25 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall bestehen demnach 12 1/2 Gran
| 0, | 79 | Zinn, |
| 0, | 53 | Blei, |
| 11, | 18 | Kupfer, |
| 12, | 50 . |
In 100 Theilen sind also enthalten:
| 6, | 32 | Zinn, |
| 4, | 24 | Blei, |
| 89, | 44 | Kupfer, |
| 100. |
Bei den Berechnungen der Brüche ist eine kleine Divergenz unvermeidbar, und die Resultate in Hunderttheilen können daher selten, wenn man sie nicht approximativ annehmen will, mit der wirklichen Zusammensetzung übereintreffen. Ich glaube daher, daß hier in der Erzcomposition alle Brüche wegfallen und diese dem Kupfer zugerechnet werden müssen, die Composition daher aus 90 Kupfer, 6 Zinn, 4 Blei in runden Zahlen besteht.



|



|
|
|
15. Heftel mit Spiralfeder.
Die Bronze der unzweifelhaften Wendenkirchhöfe, die Bronze der jüngsten Heidenbegräbnisse, welche hier überdies nur selten und zwar nur in einzelnen kleinen Schmucksachen auftritt und dem Eisen Platz macht, weicht ebenfalls an Farbe, Zähigkeit und Rost von der Bronze der Kegelgräber offensichtlich ab. Um diese Abweichung zu erkennen, bestimmten wir die Spirale einer Heftel mit Spiralfeder (broche, Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13) des charakteristischen Kennzeichens der Wendenkirchhöfe, zur Analyse, welche dann auch einen fast reinen Kupfergehalt zeigte, nämlich:
| 97, | 32 | Kupfer, |
| 1, | 96 | Zinn, |
| 0, | 72 | Blei. |
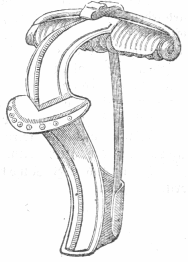


|
Seite 344 |




|
25 Gran in reiner Salpetersäure gelöst, hinterließen 5/8 Gran Zinnoxyd.
Diese Lösung ward nur von Schwefelsäure, und zwar erst nach einigen Tagen auf sehr geringe Weise getrübt. Sie ward daher mit hinlänglicher Schwefelsäure versetzt und in einem Sandbade bis zur Vertreibung eines Ueberschusses derselben eingedickt, darauf in destillirtem Wasser gelöst, der Niederschlag durch ein Filtrum geschieden, getrocknet und gelinde geglüht, wog dies schwefelsaure Blei 1/4 Gran.
| 5/8 Gran Zinnoxyd entsprechen 0, | 49 | Zinn, |
| 14 | Sauerstoff. | |
| 1/4 Gran schwefelsaures Blei 0, | 18 | Blei, |
| 0, | 07 | Schwefelsäure. |
An reinem Metall enthalten also 25 Gran:
| 0, | 49 | Zinn, |
| 0, | 18 | Blei, |
| folglich 24, | 33 | Kupfer.. |
| 25 Gran. |
100 Theile aber bestehen aus:
| 1, | 96 | Zinn, |
| 0, | 72 | Blei, |
| 97, | 32 | Kupfer, |
| 100. |
Ich bin über die Gegenwart des Bleis fast zweifelhaft geblieben, mußte es aber, da alle Reactionen es zwar sehr schwach, aber bestimmt andeuteten, es auch gelang, den höchst geringfügigen Gehalt abzuscheiden, in seine Bestandtheile mit aufnehmen. Ich glaube aber, daß dasselbe seine Gegenwart mehr einer zufälligen Beimischung, z. B. der Anwendung eines mit Blei vermischten Zinns, als einer absichtlichen verdankt. Seine Menge beträgt noch nicht 1 Procent, und die Zusammensetzung wird daher, bei der Schwierigkeit der Abwägung der Hunderttheile in kleinere Quantitäten, wahrscheinlicher aus 98 Kupfer und 2 bleihaltigem Zinn bestehen sollen.


|
Seite 345 |




|



|



|
|
|
16. Heftel mit Spiralfeder von Camin.
Eine gleiche Heftel (Broche) aus dem Wendenkirchhofe zu Camin (Jahresber. Jahrg. II, S. 63, Nr. 27), welcher reich an Eisen war und in Schmucksachen Bronze und Silber enthielt, gab dagegen:
| 88, | 15 | Kupfer, |
| 11, | 85 | Zinn. |
Analyse.
20 Gran wurden wie gewöhnlich mit Salpetersäure behandelt, die Auflösung zeigte sich auf alle behufigen Reagentien indifferent, der Rückstand wog 3 Gran, war Zinnoxyd, und in der Auflösung nur Kupfer enthalten.
| 3 Gran Zinnoxyd = 2, | 37 | Zinn, |
| 63 | Sauerstoff, | |
| 3. |
Wenn 20 Gran der Bronze enthalten:
| 2, | 37 | Zinn, |
| so befinden sich darin 17, | 63 | Kupfer, |
| 20. |
100 Theile bestehen demnach aus:
| 11, | 85 | Zinn, |
| 88, | 15 | Kupfer, |


|
Seite 346 |




|
Uebersicht der Analysen,
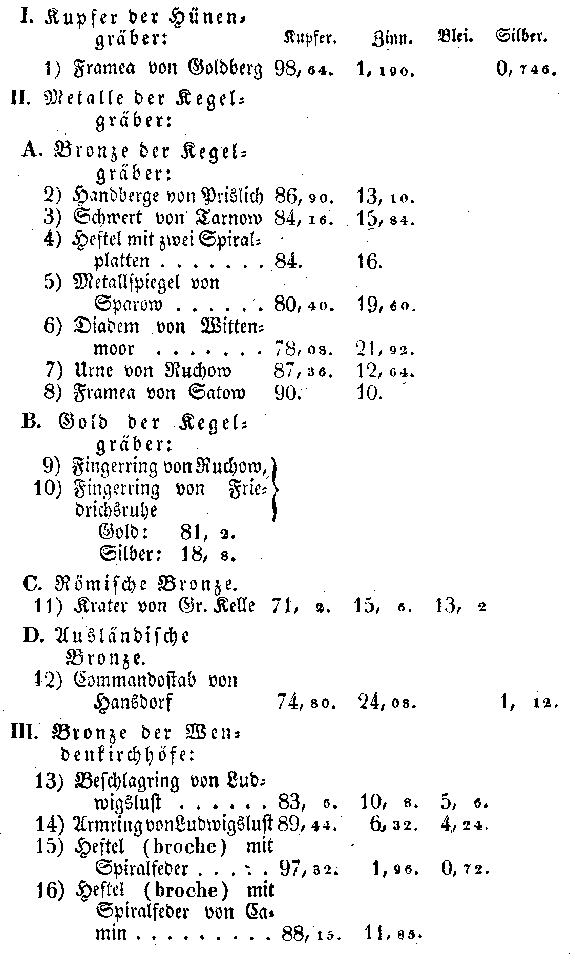


|
Seite 347 |




|
Aus dieser Uebersicht geht zur Beurtheilung der heimischen Bronzen hervor:
1) daß die Bronzen meklenburgischen Ursprunges aus der reinen Bronze=Periode nur aus Kupfer und Zinn bestehen und ungefähr 10-20 p. C. Zinn enthalten;
2) daß die ungefähr gleichzeitige römische Bronze außer 15, 6 Zinn auch noch 13, 2 Blei enthält;
3) daß Zink in meklenburgischen Bronzen gar nicht beobachtet ist;
4) daß Silber in Kupfererzen entweder nur in unvermischtem, gediegenen Kupfer oder in ausländischen, künstlichern Geräthen gefunden ist;
5) daß die Bronze der jüngsten heidnischen Periode, der Wendenkirchhöfe, sehr unregelmäßige Mischungsverhältnisse hat und außer Zinn auch Blei enthält.
So viel steht jedoch fest, daß die Bronze der reinen Bronze=Periode der Kegelgräber nur aus einer Legirung von Kupfer und Zinn besteht.


|
Seite 348 |




|
Von Interesse dürfte nachstehende Uebersicht der Mischungsverhältnisse der Bronzen der am häufigsten vorkommenden Gegenstände der reinen Bronze=Periode sein:
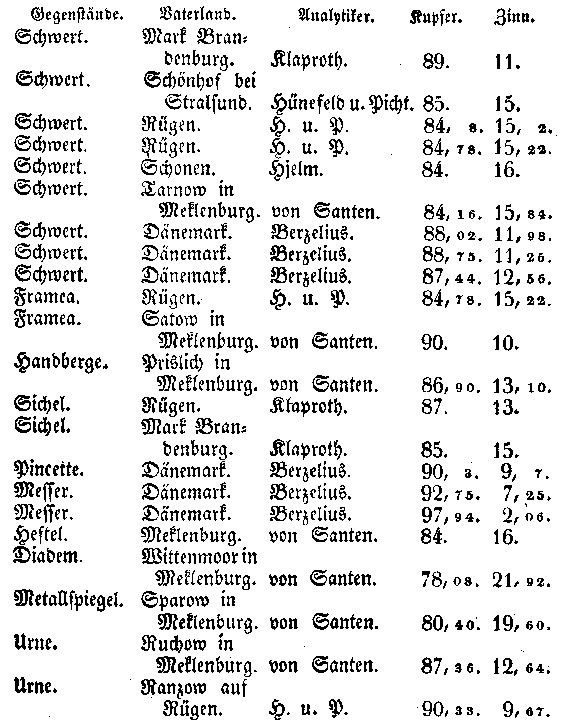
Die Mischungsverhältnisse bleiben daher bei denjenigen Alterthümern, welche die reine Bronzeperiode vorzüglich charakterisiren, ungefähr dieselben; besonders tritt die Gleichheit der Mischungsverhältnisse der Bronze der Schwerter in den verschiedenen Gegenden auffallend hervor.


|
Seite 349 |




|
Die wichtigste Frage, welche auf diese Untersuchungen folgt, ist die:
woher holten die alten nordischen Völker ihre Erze?
Trotz aller Bemühungen hat es nicht gelingen wollen, rohe Erze aus den Gegenden zu erhalten, aus denen die alten Völker ihre Erze muthmaßlich hätten beziehen können; auch Analysen waren nicht zu erreichen. Am nächsten freilich liegt bei dem Kupfer die Annahme, daß es nach dem Namen des Metalles, lat. cuprum, althochdeutsch kuphar, von der kupferreichen Insel Kypros geholt sei; aber es fehlt zur Zeit noch an einer ausreichenden Menge von kupfernen Alterthümern aus dem Norden und an Analysen sowohl dieser Alterthümer, als der kyprischen und anderer griechischen rohen Kupfererze.
Näher liegt es für den Augenblick, den Ursprung des Goldes zu erforschen, welches im Norden als charakteristisches Kennzeichen der eigentlichen Bronzeperiode auftritt. Und bei dieser Nachforschung werden wir auf den Osten, den Ural, als Quelle für die Metalle der alten Nordlandsbewohner hingewiesen und darauf hingeführt, daß in den ältesten Zeiten eine Verbindung des nördlichen Europas mit dem westlichen Asien statt gefunden habe. Ueber das Gold Westasiens besitzen wir nun ausgezeichnete Forschungen von Gustav Rose in Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, XXIII, 1831, S. 161 flgd., unter dem Titel: Ueber die chemische Zusammensetzung des gediegenen Goldes, besonders vom Ural, und in (A. v. Humboldt, Ehrenberg und) Gustav Rose Mineralogisch=geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem kaspischen Meere, Band I, Berlin, 1837.
Das Gold der norddeutschen Gräber zeichnet sich dadurch aus, daß es Silbergehalt (18 p. C. Silber) und eine messinggelbe Farbe hat.
"Nach Rose's Forschungen ist nun das in der Natur vorkommende Gold, soviel man weiß, nicht chemisch rein, sondern enthält immer Silber beigemischt (Ann. S. 161); ganz reines Gold habe ich", sagt Rose, "unter dem gediegenen Golde nicht gefunden" (Ann. S. 190). Das Gold von Schlangenberg am Altai enthält 36 p. C. (Ann. S. 162 flgd.), das Gold von Siränowski am Altai 37 p. C. (Ann. S. 184), das Gold von Siebenbürgen 35 p. C. (Ann. S. 163), das Gold von Verös Patak in Siebenbürgen 38 p. C. (Ann. S. 185), dagegen das Gold von der Grube Bar=


|
Seite 350 |




|
bara zu Füses in Siebenbürgen 14 p. C. (Ann. S. 180) Silber, das Silber von Kongsberg in Norwegen (Ann. S. 161) 28 p. C. Gold.
Ueber den Bergbau am Altai sagt Rose Folgendes:
"Gediegenes Gold, mehr oder weniger silberhaltig, nie krystallisirt, sondern in - - Blättchen oder - - kleinen Blechen, gewöhnlich von lichter messinggelber, doch auch von goldgelber Farbe", findet sich zu Schlangenberg am Altai (Reise S. 534). "Ob aber alles Gold gleiche chemische Zusammensetzung hat, ist nicht untersucht, aber nach der deutlich verschiedenen Farbe des Schlangenberger Goldes - - nicht einmal wahrscheinlich" (Reise S. 535). "Zwar ist in früherer Zeit, wie die sogenannten tschudischen Arbeiten beweisen, auch am Altai ein uralter Bergbau getrieben worden, aber wenn gleich die aufgefundenen Spuren desselben, eingestürzte Schachte und alte Haldenzüge hier so häufig gewesen sind, daß ihrer Auffindung fast alle jetzt bebaueten Gruben ihre Entstehung zu verdanken haben, so war doch die Kunde dieses Bergbaues, so wie des Volkes, welches ihn getrieben, auch hier durchaus verschollen. Nur dunkle Sagen von dem Goldreichthum der goldenen Berge, wie der Altai im Chinesischen und Alttürkischen heißt, hatten sich erhalten" (Reise S. 509). "Wie wichtig aber der Bergbau am Altai ist, ergiebt sich schon aus seiner Production, die vorzugsweise in Silber besteht und größer ist, als die irgend eines andern einzelnen Theiles des alten Continents. - - So groß indessen die Menge des Silbers ist, - - so sind doch die Erze, aus denen dasselbe dargestellt wird, nur sehr arm; sie enthalten im Durchschnitt nur 0, 04 p. C." (Reise S. 503-5).
Wenn die Untersuchungen über die Erze des Altai bisher auch nicht sehr glücklich gewesen sind, so scheint sich doch so viel zu ergeben, daß die Goldverbreitung von hier nicht bedeutend gewesen sei. Günstiger stellen sich für unsere Forschungen die Untersuchungen am Ural, in der Gegend von Katharinenburg. Rose hatte Gelegenheit, den Silbergehalt sowohl vieler einzelner Golderze, als auch des Gesammtgewinnes vom Ural von 1814 - 1828 zu prüfen (Reise S. 240). Daraus ergiebt sich, daß an eine "Verbindung von Gold und Silber nach bestimmten Proportionen nicht zu denken sei" (Ann. S. 188). "Der mittlere Gehalt stellt sich für das Grubengold zu 7, 91 p. C. und für das Waschgold zu 8, 97 p. C Silber" (Ann. S. 194). "Der Silbergehalt der ganzen jährlich gewonnenen Menge des gediegenen Goldes differirt von


|
Seite 351 |




|
"1, 58 bis zu 13, 19 p. C. (am häufigsten 11 p. C.) und beträgt im Mittel der Jahre von 1754 - 1828 = 8, 42 p. C. (Reise S. 226). Der Silbergehalt des gediegenen Goldes aus den, unter dem Bergamte von Katharinenburg stehenden Seifenwerken von 1814 - 1828 war von 1, 22 bis 11, 16 p. C., am häufigsten 7 bis 8 p. C. (Reise S. 240 und S. 158 flgd.). Die Mengen Gold und Silber, welche auf dem Münzhofe zu Petersburg jährlich geschieden werden, bestehen in folgenden:
1) gegen 350 Pud silberhaltiges Gold vom Ural; es enthält im Durchschnitt 7 p. C. Silber;
2) 1000 Pud goldhaltiges Silber vom Altai; es enthält 3 p. C. Gold;
3) 200 bis 250 Pud goldhaltiges Silber von Nertschinsk; es enthält 1/2 p. C. Gold. (Reise S. 625).
Wir werden also in Beziehung auf den bedeutenden Silbergehalt des in Norddeutschland gefundenen Goldes auf die uralischen Bergwerke hingewiesen. Enthält das gediegene Gold derselben durchschnittlich auch nur 7 - 8 p. C. Silber, so sind doch einzelne Analysen in Betracht zu ziehen, welche oft ein ganz anderes Resultat geben, als die durchschnittlichen Berechnungen; und nach einzelnen Funden darf sich eine Vergleichung für das Alterthum nur richten, da hier sicher nicht große Massen zusammengeschmolzen sind. Viele Analysen haben freilich einen geringen Silbergehalt, gewöhnlich 7, oder von 5 bis 10 p. C. Aber gediegenes Gold von Gozuschkoi bei Nischnei=Tagel in mehreren verschiedenen Stücken gab 12, 12 p. C. (Ann. S. 176) und 12, 12 p. C., 12, 30 p. C., 12, 41 p. C. (Reise S. 325), von Alexander Andrejewsk bei Miask 12, 07 p. C. (Ann. S. 176), von Petropawlowsk bei Bogaslowsk 13, 03 p. C. und 13, 19 p. C. (Ann. S. 175) und 13, 19 p. C. (Reise S. 422), von Boruschka 16, 15 p. C. Silber (Ann. S. 174 und Reise S. 324.)
Das gediegene Gold vom Ural kommt also dem in norddeutschen Gräbern aus der eigentlichen Bronze=Periode gefundenen Golde am nächsten.
Ueber das Vorkommen und die Bearbeitung sagt Rose Folgendes: "Das Gold kommt am Ural theils anstehend, theils lose im Sande als Waschgold vor. Vor der Entdeckung des letztern, im J. 1819, wurde das Gold nur durch unterirdischen Bergbau gewonnen. Seit dieser Zeit hat man den beschwerlichen, wenig lohnenden Bergbau größtentheils eingestellt. - In dem Goldsande findet sich das Gold gewöhnlich in kleinen Körnern, gewöhnlich nur von der Größe


|
Seite 352 |




|
einer Erbse (Reise S. 198), und Schüppchen, zuweilen kommen indeß Stücke von bedeutender Größe (von 13, 16, 24 russischen Pfunden) vor (Ann. S. 165), zuweilen auch in Krystallen in der Form von Octaedern (Reise S. 158). Das Grubengold kommt gewöhnlich auf Quarz und Brauneisenstein vor, und es ist schwer, es auf eine mechanische Weise von diesen Begleitern zu trennen; auch das Waschgold findet sich zuweilen mit diesen zusammen (Ann. S. 168); daher der häufige Eisengehalt des Goldes (Ann. (S. 174 flgd. Reise S. 201 flgd., S. 241). Es ergiebt sich ferner aus den Analysen des gediegenen Goldes - -, daß Gold und Silber sich als isomorphische Körper mit einander verbinden können" (Reise S. 207).
"Der Bergbau auf diese Sanderze ist schon sehr alt, - - von einem ältern Volke betrieben, deren alte Halden und abgeteufte Schachte an den Ufern der Sakmara und Dioma sehr häufig Veranlassung zur Entdeckung der jetzt bearbeiteten Gruben gegeben haben. Spuren eines solchen früher betriebenen Bergbaues hat man auch auf der Ostseite des Urals selbst bis zur Breite von Gumeschewsk, ja am ganzen Altai und in der Steppe der Kirgisen gefunden; aber es ist noch ganz unausgemacht, welches Volk es gewesen ist, das diesen ausgedehnten Bergbau getrieben hat. In Rußland schreibt man ihn den Tschuden (Unbekannten) zu und nennt daher diese alten Arbeiter tschudische Arbeiter (Reise S. 118). Aus manchen Anzeigen wird es wahrscheinlich, daß auch die Goldseifen des Urals schon von den Urvölkern des Urals bearbeitet wurden; denn man hat an dem See Irtiasch in der Nähe des Goldseifenwerkes Soimonowskoi bei Kyschtim sogenannte Tschuden=Gräber mit Menschenknochen und neben diesen auch - Armbänder - gefunden, die aus derselben Mischung von Gold und Silber bestanden, von welcher noch jetzt das Waschgold in Soimonowskoi gefunden wird (Reise S. 239).
Diese Forschungen werden schon jetzt bedeutende Fingerzeige für die Verbreitung des Goldes im alten Nordeuropa geben und für die Zukunft wichtig werden können.
Um einen Schluß auf die Verbreitung des Kupfers im Besondern machen zu können, fehlt es noch an hinlänglichen Vorarbeiten. Rose sagt nur: "Kupferwerke kommen im Ural sehr viel vor, z. B. die berühmte Kupfergrube von Boguslowsk (Reise S. 397). Das gediegene Kupfer ist früher zuweilen in bedeutend großen Massen vorgekommen (Reise S. 407). Von allen Kupfererzen findet sich Malachit


|
Seite 353 |




|
"am häufigsten; nächstdem kommt Rothkupfererz; schon seltener findet sich gediegenes Kupfer. - - Das gediegene Kupfer kommt auch ohne Begleitung der übrigen Kupfererze in Letten eingewachsen vor, krystallinische Rinden bildend, deren mehrere gewöhnlich concentrisch über einander liegen und einen Kern von Letten einschließen. Das Rothkupfererz findet sich gewöhnlich mit Malachit zusammen, und zwar so, daß letzterer das erstere bedeckt, welches öfter auch noch einen Kern von gediegenem Kupfer einschließt (Reise S. 270).
Vom Silber sagt Rosen: "Gediegenes Silber - - ist in früherer Zeit dort, eingesprengt und haarförmig auf der Frolowschen Grube vorgekommen; man soll aus diesem gediegenen Silber 1200 Pud ausgeschmolzenes Silber gewonnen haben (Reise S. 415). Gediegenes Silber findet sich auf ähnliche Weise, wie das Gold, ebenfalls nicht krystallisirt, aber aufgewachsen in drath= und meistens haarförmiger Gestalt und eingewachsen in Blechen und in Plättchen. Es ist meistens gelblich angelaufen und matt, besonders wenn es in Blechen vorkommt, erhält aber silberweiße Farbe und Glanz im Strich (Reise S. 535).
Jedoch können die Forschungen über Silber augenblicklich noch keine Andeutungen geben, da Silber in den nördlichen Gräbern erst mit dem Eisen vorkommt und es noch nicht ausgemacht ist, wie weit die Eisenperiode zurückgeht; soviel ist aber gewiß, daß das Silber in Norddeutschland erst mit dem Vorkommen der kufischen und merovingischen Münzen in häufige Anwendung kommt.



|



|
|
:
|
Zerbrechlichkeit des antiken Silbers.
Der silberne Fingerring von dem Wendenkirchhofe zu Pritzier,
welcher Jahresber. VIII, S. 69 beschrieben und abgebildet ist, ist in vieler Hinsicht sehr merkwürdig, besonders weil er so zerbrechlich ist, wie kein Stück der vaterländischen Sammlungen; er ist daher nur mit Mühe gerettet und um Wachs gelegt. Diese Eigenschaft manches alten Stückes Silber ist jüngst in den göttingischen gelehrten Anzeigen, 1843, St. 130 - 131, durch die Gesellschaft der Wissenschaften zur Sprache gebracht. Der Herr Münzwardein Brüel zu Hannover hat


|
Seite 354 |




|
der Societät nämlich die Resultate chemischer Untersuchungen alter Münzen durch den Herrn Hofrath Hausmann vorgelegt, nach welchen viele alte römische und griechische Silbermünzen und niedersächsische Bracteaten aus dem 13. Jahrhundert, welche auffallend leicht zerbrechlich waren, einen Gehalt von Chorsilber haben, welcher erst nach der Vergrabung von außen eingedrungen sein muß. Die Farbe des Ringes von Pritzier ist ebenfalls, wie viele vom Herrn Brüel untersuchte Münzen, "äußerlich graulichweiß mit einem Stich in das Braune, der Bruch körnig, wenig glänzend, dem Erdigen sich nähernd".
Dagegen ist die in demselben Wendenkirchhofe gefundene Spange (Hakenfibel), S. 64. Nr. 14, von grau=bräunlicher Farbe, durchaus fest, gar nicht angegriffen, nicht oxydirt und überaus elastisch. Der Silberstreifen Nr. 15 dagegen, von heller, weißer Farbe, mit Grünspanstellen, mehr biegsam, jedoch auch in Schuppen zerbrechlich.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Heidnische Gräber bei Neu=Bukow an der Ostsee.
Auf dem hohen Uferlande an der Ostsee im alten Lande Meklenburg läßt sich eine Reihe kegelförmiger Hügel verfolgen, welche auf den Rücken der Hohenzüge liegen und frei in die See schauen; vorzüglich lassen sich dieselben im Amte Bukow oder im alten Lande Bug beobachten, wo ich dieselben im Mai 1843 durch die freundliche Unterstützung des Hrn. von Oertzen auf Roggow zu untersuchen Gelegenheit hatte. Diese Hügel sind oft für Warten oder Schanzen, wie die bei Wismar, gehalten; ohne Zweifel sind sie aber alte Gräber, um so mehr, da in der Nähe der Kegelgräber auch Hünengräber stehen.
Diese Gräber gehören zu den bedeutendsten im Lande und zwar:
1) auf dem Felde zu Kartlow bei Neuburg, links am Wege von Wismar nach Neuburg, steht ein sehr großes Kegelgrab.
2) auf den Höhen an der See liegen große Kegelgräber: zu Rakow (2), Roggow, Zweedorf, Westhof, Kägsdorf.
3) auf dem Neu=Gaarzer Bauerfelde, zwischen Alt= und Neu=Gaarz, nach der Ostsee hin, liegt ein sehr großes Hünengrab in Form einer Steinkiste auf einem Hügel mit 4 gewaltigen, jetzt von den Pfeilern herabgesunkenen Deck=


|
Seite 355 |




|
steinen, ohne einen langen Hügel, ganz von der Construction und Größe, wie das bekannte Grab zu Gr. Görnow. Dieses Grab von Neu=Gaarz ist schon angezeigt Jahresber. II, S. 110, als eine "künstliche Steinstellung zwischen Blengow und Meschendorf".
4) auf dem Neu=Gaarzer Hoffelde gegen Kägsdorf hin steht ein ähnliches, sehr großes Hünengrab mit 2 Decksteinen, sehr wohl erhalten.
5) in der Nähe dieser Steinkiste liegt ein langes Riesenbette, wohl 150' lang, mit großen Granitpfeilern umstellt.
6) nicht weit davon steht eine kurze Steinkiste oder ein Steinhaus, ohne Hügel, mit einem großen, jetzt zersprungenen Steine bedeckt;
7) diesen letztgenannten Denkmälern gegenüber liegt auf dem Felde von Mechelstorf ein sehr großes Riesenbette, noch größer, als das von Neu=Gaarz.
Ueber ein aufgedecktes Hünengrab zu Roggow vgl. unten Hünengräber, S. 366.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Heidnische Gräber zu Carow und Leisten.
Am 20. Juni d. J. fuhr ich nach Carow, um im Interesse des Vereins die auf der dortigen Feldmark befindlichen alten Gräber in Augenschein zu nehmen, damit die etwa der beabsichtigten Chausseelinie nahe liegenden Gräber nicht zerstört würden. Es liegen viele Hünengräber in den Tannen nach der Seite von Damerow hin, die aber nicht der Gefahr der Zerstörung ausgesetzt sind. Eben so wenig wird der Blocksberg, ein Kegelgrab von 20 und einigen Fuß Höhe, ausgezeichnet durch die Masse der angehäuften Steine und Erde, der Chaussee wegen angegriffen werden; doch wünscht der Herr Clewe auf Carow dieses Grab zu öffnen, wenn er zuvor mit den Steinanfuhren zur Chaussee fertig sein wird. Oestlich und südöstlich davon liegen kleinere Kegelgräber, zum Theil halb zerstört, und wird in dieser Gegend auch ein Wendenkirchhof sein. Alle diese Oerter unter meiner Beihülfe genauer zu untersuchen hat der Herr Clewe für den Verein mir gütigst verheißen. - Zu gleicher Zeit machte er mich aufmerksam darauf, daß in dem benachbarten Gute Leisten sich noch Manches finden dürfte. Da auch dieses Gut von der Chaussee durchschnitten wird, so untersuchte ich am folgenden Tage diese Feldmark mit freundlichst gewährter Erlaubniß des Herrn Gutsbesitzers Beust. Aber außer einer noch unversehrten Steinkiste


|
Seite 356 |




|
mit Deckstein fand ich Alles längst zerstört. Eine andere Steinkiste, deren Tragsteine unter der Erdoberfläche lagen, deren aus der Erde hervorragender Deckstein gesprengt und weggenommen war, lag nahe am See zwischen der Mühle und dem Kruge; man hatte den innern Raum, um die Tragsteine auszugraben, durchwühlt und fand ich unter dem Auswurfe Scherben von drei verschiedenen Urnen, deren eine mit Strichen verziert gewesen war. -
Nach der Aernte werde ich die Chausseelinie von Plau bis zur Grenze bei Wendisch=Priborn in Rücksicht auf die Gräber untersuchen und überhaupt ein wachsames Auge darauf haben.
Vietlübbe im Juli 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Alterthümer in der Gegend von Gnoyen.
Bei meiner Anwesenheit zu Gnoyen, um mit dem Herrn von Kardorff auf Remlin das auf seinem Gute befindliche Hünengrab aufzudecken (vgl. unten), machten wir gemeinschaftlich im Interesse des Vereins Ausflüchte in die Umgegend, und besahen zuerst
nordöstlich von der Stadt, welches drei sehr große Kegelgräber sind, deren höchstes über 50' beträgt und mit Gebüsch bewachsen ist; die Aufdeckung eines derselben würde bedeutende Zeit und Kräfte erfordern.
Sodann besuchten wir den
jetzt eine Mergelgrube, zwischen Bäbelitz und Lübchin, wo vor einigen Jahren beim Mergelgraben viele Urnen, Schädel und Gerippe von Menschen zum Vorschein gekommen sind. Wir fanden noch einige Scherben von Urnen, aber eine nähere Untersuchung umher gab das Resultat, daß der Begräbnißplatz, wahrscheinlich ein Wendenkirchhof, in dem bedeutenden Raume, den die Mergelgrube einnimmt, gelegen habe, aber auch mit demselben zerstört sei.
Sodann besuchten wir die
Sie liegen nördlich von dem Gute an der Grenze der ausgebaueten Hauswirthe. Es ist hier ein Platz von 2 parallelen Niederungen eingeschlossen, auf dem noch vor 15 Jahren 32 Kegelgräber in einer Gruppe vereinigt lagen, je 2 und 2 von gleicher Größe; die Stellen sind noch deutlich zu sehen, einige erheben sich noch mit 5 bis 10' Achsenhöhe in Kegelform


|
Seite 357 |




|
über den Acker; eine Nachgrabung bei zwei der größten aber bestätigte die vollkommene Zerstörung durch Herausnahme der Steine. Oestlich von dieser Gruppe einige 100 Schritte entfernt stehen 2 mächtige Kegelgräber von gleicher Größe; das eine ist von Südost bis in die Mitte hineingegraben und eine Nachsuchung daselbst blieb ohne Resultat; das andere aber ist vollkommen erhalten und ist 25 bis 30' hoch; die angehäufte Erde in beiden scheint Mergel zu sein. Der Herr von Blücher auf Quitzenow und Bobbin gab die Erlaubniß, auch das erhaltene Kegelgrab zu untersuchen; da dies aber längere Zeit erfordert, so haben wir einstweilen die Erlaubniß angenommen und die Aufdeckung zu einer andern Zeit uns vorbehalten.
Zu Wasdow an dem Garten des Gutes liegt in der Wiese der sogenannte
ein alter Thurm aus Mauerwerk mit dazwischen gemauerten Granitsteinen; er ist auf der östlichen Seite geborsten und hat von seiner ursprünglichen Höhe wohl vieles durch die Nachlässigkeit der Besitzer verloren; eine Wiederherstellung möchte schon der Lage und seiner Correspondenz wegen mit dem Nehringer Thurme auf der pommerschen Seite wünschenswerth sein. (Sollte Wasdow einmal in Besitz des Herrn von Blücher auf Quitzenow, Bobbin, Lüdershagen etc. kommen, so würde es wohl gewiß geschehen.) Umher liegen noch Trümmer von Mauerwerk.
Ferner besahen wir
welche dicht hinter dem Hofe am See liegt. Sie ist, wie die meisten solcher Stellen, ein runder Hügel im Sumpfe, von einem Wallgraben umgeben.
Der junge Herr von Kardorff auf Granzow zeigte uns in der Mauer des Dorfes einen
einem Weihkessel ähnlich, aber mehr oval und fast rinnenförmig künstlich ausgehöhlt; der Vater soll ihn auf dem Felde mit andern Steinen ausgegraben haben. Ein ähnlicher Stein soll auch noch auf dem gnoyenschen Stadtfelde an einer Wiese liegen und den Namen Opferstein bei den Einwohnern führen. Auf Granzow fanden sich noch einige vom Vater des Besitzers gesammelte und demselben noch gehörende Alterthümer, als: eine bedeutende Steinkugel aus Schiefer, in 2 Hälften zersprungen, ein altes Hufeisen; ein aus einem Torfmoore in der Nähe von zerstörten Kegelgräbern gegrabener kupferner Kessel wurde vergebens gesucht.


|
Seite 358 |




|
Auf der Rückreise fuhr ich noch über Lüdershagen und besah die Feldmark; im Holze liegen
3 fast zerstörte Hünengräber, die Steinhorst genannt; doch dürfte sich noch an einer andern Stelle im Holze ein Wendenkirchhof finden, da der Berg den Namen Hilge Barg führt. Herr von Blücher will nachgraben lassen, da sich Steinlagen zeigen, und Nachricht geben.
Vietlübbe, den 23. Sept. 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Alterthümer im Luche bei Fehrbellin.
Das Luch bei Fehrbellin, oder Linum, wie es auch heißt, - das bekannte große Torfmoor, dessen größte Breite von Tarnow bis Brunnen etwa 3/4 Meilen beträgt und dessen Länge von Flatow bis Fehrbellin zu 2 1/2 geographischen Meilen anzunehmen ist, - liefert sehr interessante Sachen aus der Vorzeit, welche der Herr Oberinspector Steinkopf daselbst aufbewahrt. Der Herr Graf von Zieten, welcher im v. J. dieses Cabinet besucht hatte, machte mich, in der Voraussetzung, daß eine nähere Kenntniß des Inhaltes dem Vereine für meklenburgische Geschichte angenehm sein möchte, darauf aufmerksam und theilte mir ein kleines Verzeichniß derjenigen Gegenstände mit, welche er zu den merkwürdigsten rechnete. Dies ist die Veranlassung zu diesem Berichte.
Der Herr Oberinspector, welcher mit der freundlichsten Bereitwilligkeit mir und meinem Begleiter, Herrn Könitzer, Oberlehrer der Mathematik und Physik am hiesigen Gymnasium, die Ansicht der Sammlung gestattete, hat die ersten Funde an das Oberbergamt in Berlin gesandt, bald aber einen andern Entschluß gefaßt und alle spätern Funde in dem Locale der Inspection aufgestellt. Ist dieser ganz allein aus dem Luche hervorgegangenen Sammlung dadurch auch manches interessante Stück entzogen, so ist sie doch noch nicht wenig reich, wichtig und unterrichtend, wie die häufigen Besuche von Naturforschern und andern Gelehrten, z. B. Alexander von Humboldt u. A., beweisen, und Männer, wie Chamisso, Hoffmann und Poggendorf, haben sie bei ihren Forschungen, welche bedeutende Resultate über das Entstehen des Torfes im genannten Moore geliefert, die Bildung der Torfmoore überhaupt wohl festgestellt haben, sehr benutzt.
Ueberreste aus der Thier= und Pflanzenwelt, als Geweihe, Knochen und Zähne von Hirschen, Elenthieren, Pferden, wilden Schweinen, ganze Gebisse, und mehrere derselben zu einer Masse mit Torf verwachsen, Schädel, Saamen und


|
Seite 359 |




|
Hülsen von Menyanthes trifoliata, minder häufig von Scheuchzeria palustris, noch einigen Galeopsis=Arten und andern Asperifolien, und was dergleichen in beide Reiche sonst noch gehört, in allen Tiefen vorkommend, bilden einen bedeutenden Theil der Sammlung.
Unter diesen fiel uns besonders ein Schädel von scheinbar sehr abnormer Form auf, den wir keinem hier oder uns bekannten Thiere anzupassen wußten. Nach vorläufigen Untersuchungen gehört er keiner unserer bekannten Hausthiergattungen an.
Mineralien, wie sie die Umgegend besitzt, werden selten in dem Moore gefunden, und die Sammlung hat nur etwas Bernstein, einige kreideartig überzogene Feuersteine, ein Stück Kreide, überhaupt nur unbedeutendes davon aufzuweisen.
Reich aber ist sie dagegen an Sachen im Torf verwachsen und davon umwachsen, als kleinen Süßwassermuscheln aus den Gattungen der Cyclostoma, Valvata, Planorbis u. a., und besonders interessant erschienen uns Kohlen vom frischesten Ansehen, ganz vom Torfe umschlossen, die bei einem Bohrversuche aus einer Tiefe von 24' zu Tage gefördert waren. Es ist auch dabei ein noch unverkohltes Stück Holz weicher Art gefunden worden.
Seltener sind die Sachen, die zu den urzeitlichen Geräthen, den eigentlichen Alterthümern gehören; ihnen fehlt aber, wie der Herr Graf auch bemerkt hatte, das Interessante und Merkwürdige nicht. Ich folge ganz seiner mir gütigst mitgetheilten Notiz und habe nur das Verdienst einer etwas größeren Ausführlichkeit. Er führt auf:
1) ein Steinstück, welches vielleicht zum Zerquetschen oder Zerreiben von Körnern etc. gebraucht worden ist, ein Quetschinstrument, ähnlich einer Mörserkeule. Der Herr Graf besitzt ein ganz ähnliches, etwas größeres Exemplar von Grauwacke, gefunden in einem Hünenberge bei Frankfurt a. d. O. Die Güte der Herren Besitzer gestattet mir von beiden eine Zeichnung dem Vereine zu überreichen.
Ersteres, von Granit, ist im Luch auf der sogenannten Sundhorst 2' tief gefunden worden. Der sich spitzende muthmaßliche Obertheil (Griff) ist rund, der Klump (Untertheil) rund gedrückt, an einer Seite sehr ausgebrochen, die Arbeit für die Zeit sehr gut. Größe 5''.
Diese Horste bemerkte der Herr Oberinspector sind kleine, bis zu 10' über das Niveau des Torfes sich erhebende Erhöhungen, vielleicht ehemalige Inseln, und Geräthe finden sich in der Regel nur an ihnen und in ihrer Nähe, weil nur auf ihnen Menschen leben konnten.


|
Seite 360 |




|
Ein Werkzeug von gleicher Beschaffenheit ist in Skandinaviska Nordens Urinvånare af S. Nilsson (Professor in Lund) abgebildet. Der Verfasser erklärt es für ein Quetschinstrument, beharrt aber nicht auf dieser Erklärung, da es in der Erde und nicht in einem Halbkreuzgrabe (Urgrabe) gefunden worden ist, deshalb die Zeit nicht bestimmt werden kann, welcher es angehört, und meint, daß es auch zu einer Art Ambos gedient haben könne.
Da es bei den Erklärungen solcher Geräthe sehr auf die Zeit ankommt, der sie angehören, so wäre diese vielleicht durch den angeführten Fund bei Frankfurt a. d. O. ermittelt.
2) mehrere Stücke von Feuerstein und eines von Diorit, gewöhnlich Keile genannt. Nilsson, so wie die Kopenhagener "Tidskrift for Oldkyndighed" nennen sie Meißel, Geradbeile.
3) eine kleine Framea von Bronze, ungefähr 4'' lüb. lang, aus einer Tiefe von 2 1/2'.
4) ein Hammer von Knochen, der Textur nach Geweih, nach Größe und Stärke von einem Elen, 5' tief im Torfe gefunden. Das Schaftloch, viereckig, unten wenig weiter, als oben, ist sehr regelmäßig und glatt durchgearbeitet; von der Schärfe ist ein Stück abgebrochen; zwei der bekannten kleinen Kreise oder Augen, auf jeder Seite einer, sind, obgleich sehr abgeschliffen, doch deutlich zu erkennen. Man sieht dem Instrumente einen langen Gebrauch an, der auffallender Weise keine Stöße oder Beulen hinterlassen hat, sondern nur durch ein starkes Abschleißen sich zu erkennen giebt. Dadurch mögen denn auch wohl mehrere Kreise, womit es vielleicht verziert gewesen ist, vergangen sein. (Der Verein für meklenburgische Geschichte besitzt ein gleiches Exemplar mit rundem Schaftloche.)
5) ein runder Schnallenring von Bernstein, fast ganz, wie der in Jahresber. VII, S. 43, Nr. 6 abgebildete, nur mit einem stärkern Halter für die Zunge. Die Rinne der Zunge ist an einem hellen, breiten Streife auf der jetzt dunklen Masse deutlich zu erkennen; Größe 7/8'' und 2 1/2'' lüb, Form rundgedrückt, Loch 5/8'' lüb., Dicke im Loche stark 1/4'', nach dem Rande hin nimmt sie bis auf eine Linie ab.
6) eine kleine Pfeilspitze von Feuerstein 5/8'' und 1 1/4'' lüb., 5' tief unter dem Torfe gefunden, wie die, welche nach Nilsson a. a. O. im höchsten Norden in der Erde gefunden werden.
7) ein sehr gut erhaltener Schädel, wie er den Celten oder Germanen zugeschrieben wird. Er ist ganz mit Torf durchwachsen gewesen, welchen zum Bedauern des Herrn


|
Seite 361 |




|
Steinkopf der Finder sehr sorgfältig abgeputzt hat. Farbe schmutzig knochengelb.
8) eine Hirnschale, mit dem Torfe, der darin gewachsen ist, welcher, verglichen mit dem Schädel Nr. 7, als einer ganz andern Race angehörend sich darstellt. Die Stirn ist auffallend flach und nach der Nase hin vorgeschoben und Herr Leopold von Buch hat sie als von einem Lappen herstammend erklärt. Dies stimmt auch völlig mit den Schädelvergleichungen in dem Werke des Professors Nilsson überein.
Diese Hirnschale lag bei Langen, einem Dorfe am Luch, 6' tief, horizontal, mit der Höhlung nach oben gekehrt; sie ist gerade und glatt wie mit einem Messer mitten durch die Augen abgeschnitten, und vergebens hat man mühsam und sorgfältig nach dem Unterkiefer gesucht, wovon man eben so wenig, als sonst irgend eine Spur von Knochen daneben gefunden hat. Die Farbe ist dunkeltorfbraun, die Masse bruchig, weshalb denn auch der erwähnte vollkommen glatte und gerade Schnitt nicht vollkommen mehr sichtbar ist. Ob aus diesem Funde anzunehmen sei, daß Lappen hier in der Urzeit gehauset haben, lasse ich dahin gestellt sein. Die erwähnten Umstände verleiten mich aber zu der Annahme, daß diese Hirnschale ein Trinkschädel gewesen sein dürfte.
Was nun diesen Uralterthümern und Urgeräthen nicht angehört, Geräthe, Waffen, Münzen neuerer Zeit, die diese Sammlung aufzuweisen hat, wird nie im Torfe, sondern in der Bankschicht, der Erddecke über dem Torfe, die regelmäßig 18'' stark ist, gefunden, selten tiefer als 6'' - 8'', Münzen nur 2''. Diese, so wie die andern Gegenstände, bieten des Erwähnenswerthen nichts.
In Meklenburg, wo es doch gewiß auch bedeutende Torfmoore giebt, hört man von dergleichen Funden wenig oder gar nicht; entweder findet man nichts oder es wird nicht darauf geachtet. Es soll mir zur Ehre gereichen, wenn dieser Bericht die Aufmerksamkeit anregt und bessere Beobachtung, bessere Resultate liefert. 1 )
Allenthalben jedoch mag der Torf wohl nicht gleich ergiebig seyn, denn bei 2300 Tagewerken, die in diesem Jahre im Luche abgeräumt sind und bearbeitet werden, hat sich nichts gefunden.
Neu=Ruppin, den 1. Juli 1843.
A. G. Masch.


|
Seite 362 |




|



|



|
|
:
|
b. Zeit der Hünengräber.
Feuerstein=Manufactur bei Brunshaupten.
An der Küste der Ostsee finden sich vorzugsweise oft größere Begräbnißplätze aus der Stein=Periode. Durch die Mittheilungen des Herrn Pastors Bortisch zu Satow ist es nun auch bekannt geworden, daß sich am Meeresufer, besonders in der Gegend von Brunshaupten, zwischen Brunshaupten und Arndsee, große Massen von Feuerstein=Splittern und Spänen finden, welche ihre Entstehung offenbar menschlicher Kunstfertigkeit verdanken. Ihre Menge an einzelnen Stellen hat im Volke die, ganz richtige, Meinung erweckt, als seien hier Manufacturstätten der Feuersteingeräthe alter Zeit gewesen und die hier gefundenen Späne die bei der Arbeit abgefallenen Splitter. Der Herr Pastor Vortisch hat viele Bruchstücke eingesandt: alle sind die bekannten drei= oder vierseitigen Späne, die auch an andern Manufacturstätten im Lande gefunden sind. Auch in der Gegend der Stadt Cröpelin werden öfter dergleichen Späne gefunden, wie die eingesandten Proben beweisen, unter denen sich auch eine noch nicht ganz vollendete, zerbrochene Lanzenspitze befindet.
Betrachtet man die bisher bekannt gewordenen Fundstätten dieser Feuersteinsplitter, zu Klink (Jahresber. III, S. 41, 64 u. 66) und zu Damerow und Jabel (Jahresber. VII, S. 46), alle am Cölpin=See, so drängt sich unwillkührlich die Bemerkung auf, daß sie alle in der Nähe großer Gewässer liegen und daher ihre Entstehung dem Fischfange und den dazu nöthigen Geräthen verdanken, wie auch mehrere nordische Forscher, z. B. Nilsson in Skandinaviska Nordens Urinvånare, sehr viele Feuersteingeräthe der Stein=Periode für Fischerei=Geräthe annehmen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Remlin bei Gnoyen,
Nr. 1.
Auf der Feldmark des Gutes Remlin liegt, nahe an der schwasdorfer Scheide, am Wege nach Schwasdorf, ein Hünengrab von 80 Fuß Länge und 34 Fuß Breite. Mächtige Felsblöcke umgeben es von allen vier Seiten, nur fehlen, da das Grab der Länge nach von Süden nach Norden liegt, in dem nördlichen Drittheile einige Seitensteine; auch deuten einige nach Norden außerhalb des Grabes liegende Felsblöcke auf eine vielleicht nach dieser Seite größere Länge in früherer


|
Seite 363 |




|
Zeit. Innerhalb dieser Steinsetzung ist grade in der Mitte eine andere Steinsetzung, die die eigentliche Grabstelle bildet und grade den dritten Theil von der ganzen Länge einnimmt. Dieses innere Drittheil ist nicht allein von allen vier Seiten durch dicht neben einander stehende Granitblöcke von 7 bis 9 Fuß Höhe eingeschlossen, so daß es eine Grabkammer von 20' Länge und 6' Breite innerer Weite bildet, sondern sie war auch oben durch 4 Decksteine, deren einer 9' lang, 5' breit und 4' dick war, dicht verschlossen. Daher schien eine Nachgrabung hier besonders günstige Resultate liefern zu müssen, als noch die Lage der Steine die ursprüngliche zu sein schien und dieses Grab also nicht wie so viele andere Hünengräber früher durchwühlt war.
Während die Decksteine gesprengt und abgewälzt wurden, was mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden war, ward das südliche Drittheil, welches verkehrt muldenförmig 5' hoch mit lehmartiger Erde angefüllt war, untersucht, gab aber keinen Erfolg. Im ebenfalls untersuchten nördlichen Drittheile, in welchem die Erde nur 3 Fuß hoch angehäuft war, wurden viele gespaltene rothe Sandsteine von verschiedener Größe gefunden. Besonders aber ergab sich aus der ferneren Untersuchung, daß diese gespaltenen Steine dazu benutzt waren, die zwischen den Granitblöcken befindlichen Oeffnungen und Lücken auszufüllen (zum Auszwicken).
Darauf ward die innere Grabkammer untersucht, welche bis dicht unter die Decksteine, also wenigstens 6' hoch über den Urboden ausgefüllt war. Die obere Schicht war lehmhaltiger Sand, dann folgten mehrere Schichten fast dammartig in Lehm gelegter Dammsteine von etwa 2 1/2' Höhe. Unter diesen Steinen folgte Thon. In diesem lag grade in der Mitte der Grabkammer eine ganze Urne mit 2 Henkeln etwas schräge mit der Mündung gegen Norden und auf der nach oben liegenden Seite etwas durch den Druck von oben geborsten; sie ist 8 1/4'' hoch, hat keinen eigentlichen Boden, sondern sie rundet sich von dem tief liegenden Bauche nach unten flach ab; die Bauchweite ist 8''; der aufrecht stehende 2 1/4'' lange Hals ist 3 1/4'' weit und verziert mit 4 Reihen starker, von rechts nach links gehender Linien, die durch schwächere rundliche Queerlinien ein fast schuppenartiges Ansehen geben. Unter dem Halse sind 3 horizontale und darunter etwa 1'' lange senkrechte Linien, deren jede mit einem stärker eingedrückten Puncte endigt. In der Urne war nichts, als etwas mit Asche vermischter Thon. An der östlichen Seite der Urne lag in der Richtung von Süden nach Norden ein rundes Holz, freilich


|
Seite 364 |




|

Etwas südlich von der Urne fand sich ein Stück Bernstein, scheinbar ein Fragment von einer scheibenförmigen oder beilförmigen Schmucksache. Südöstlich von der Urne fanden sich Trümmer einer ähnlichen Urne, mit einem nur 1 1/2 hohen Halse und mit 4 Reihen paarweise zusammengehöriger, fast halbmondförmiger Eindrücke, welche mit einem Stempel eingedrückt sind; und zwischen diesen Scherben lagen einige Menschenknochen (nach dem Urtheile der gnoyenschen Aerzte aus dem Kiefer eines sehr großen Menschen). Außerdem lag in der Nähe der Urne ein an 2 Seiten deutlich geschnittener Feuerstein, von welchem zwei hakenförmige Späne abgeschnitten waren. Noch wurden im Thone zerstreut einzelne Scherben einer braunen und einer rothgebrannten Urne gefunden, deren Gestalt sich aber nicht erkennen ließ.
Unterhalb der Thonschicht war der ganze Grund auf dem Urboden mit Dammsteinen abgelegt, aber eigenthümlich abgetheilt. Nämlich 3' vom nördlichen und südlichen Ende standen je 4 gespaltene Steine, von 2' Länge, 1' Breite und 1 bis 2'' Dicke, aufrecht im Damme, so daß sie 1' hoch hervorragten und von einander grade 5'' entfernt waren. Diese beiden Abtheilungen von 6' Länge und 3' Breite waren die eigentlichen Brandstellen, über dem Steindamm mit kleinen Steinen, besonders weiß und roth calcinirten Feuersteinen einige Zoll hoch bedeckt, und in der nordwestlichen Ecke war besonders viele braune Modererde. Unter den sonst durchaus ausgeglüheten Feuersteinen lagen einige nicht calcinirte, die fast das Ansehen von spanförmigen Feuersteinmessern haben. - Kohlen wurden in der ganzen Grabkammer zwischen dem Sande, Lehm und Thon gefunden.
Endlich ward der östliche und westliche Raum zwischen der inneren Grabkammer und der äußeren Steinsetzung untersucht, gab aber kein weiteres Resultat, als daß hier der Grund mit jenen gespaltenen Steinen von 1/2'' Dicke abgelegt war.


|
Seite 365 |




|
Bei dieser Aufdeckung war der Herr von Blücher auf Lüdershagen (Mitglied des Vereins), der eigens zu diesem Zwecke gekommen war, zugegen.
Gnoyen, den 8. September 1843.
F. F. E. von Kardorff, auf
Remlin.
J. Ritter, Pastor zu Vietlübbe.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Remlin.
Nr. 2.
Im Winter 184 2/3 ließ der Herr von Kardorff auf seinem Gute Remlin ein kleines, unscheinbares Hünengrab in dem abgeräumten "Heller=Tannen"=Kamp aufdecken. Das Grab lag ohne merkliche Erhöhung mit der Oberfläche fast in dem flachen Erdboden und war nur an der Steinstellung erkennbar: in der Mitte lag der Deckstein, umher standen in geringem Umfange die Grenzpfeiler. Unter dem Decksteine standen große Steine, welche eine Kammer bildeten, die mit Erde gefüllt war. Der Grund der Kammer war mit den bekannten, platten Steinen ausgelegt; tiefer unten, gegen 5 Fuß tief, fand sich noch eine Schicht solcher Steine; jedoch ward nichts weiter gefunden. - Das Grab blieb geöffnet liegen. Beim Versenken der Steine und Ebenen des Platzes im Herbste 1843 fanden sich außerhalb der Kammer die Alterthümer des Grabes, nämlich: ein kleiner Streithammer von dunkelgrünlichem Sandstein, 3 1/2'' lang, mit dem gebohrten Loche dicht am Bahnende, einer der wenigen, in einem Grabe gefundenen durchbohrten Steinhämmer in Meklenburg, und die Scherben einer kleinen Urne, unter dem Rande mit vielen feinen, dichten, concentrischen Reifen verziert; diese Verzierung, - das Fehlen der eigenthümlichen kurzen und tiefen Eindrücke, - und die etwas feste Masse der Urne deuten auf eine jüngere Zeit der Steinperiode. Die Urne war mit Asche gefüllt.
Hünengrab von Remlin.
Nr. 3.
Ein anderes ähnliches Grab, welches schon früher angegraben gewesen zu sein scheint, gab gar keine Ausbeute.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 366 |




|



|



|
|
:
|
Hünengrab von Wahlstorf (A. Lübz).
Von mehreren Seiten darauf aufmerksam gemacht, daß auf der Hufe des Schulzen zu Wahlstorf, rechts am Wege von Wahlstorf nach Wilsen, ein Hünengrab liege, dem der Untergang drohe, da die großen Decksteine bereits gesprengt und weggenommen seien, und man aus Mangel an Steinen in dortiger Gegend schon anfange, die Steine in der Umfassung loszugraben, begab ich mich im Interesse und Auftrage des Vereins dahin und fand allerdings die Decksteine abgenommen, sonst aber noch alles unversehrt. Der Bau des Grabmals kommt ganz mit dem zu Remlin aufgedeckten Hünengrabe überein: eine Grabkammer von 6 Fuß Breite, aber nur 8 Fuß Länge, umgeben von einer äußeren Steinsetzung, nur mit dem Unterschiede, daß bei der Lage von Nordost nach Südwest die äußeren Steine am südwestlichen Ende ganz nahe an die innere Grabkammer stoßen, die Ausdehnung aber nach Nordost nicht zu bestimmen ist, da hier keine Schlußsteine sich zeigten. Außerhalb der inneren Grabkammer zeigten sich nun, als ich zur Aufdeckung des Grabes schritt, durchaus keine Spuren von Alterthümern; alles war rothgelber Sand, wie der Untergrund des Bodens umher, nur schon früher von Schatzgräbern durchwühlt, wie die Dorfbewohner es auch erzählen. Innerhalb der Grabkammer war aber noch alles unversehrt: Sand mit Schichten von flach gespaltenen Steinen 4 Fuß hoch über dem Urboden; dicht über dem Urboden aber eine etwa 2 Zoll dicke Schicht von kleinen Steinen, worunter eine Masse calcinirter Feuersteine, auch Kohlenreste von Erlen und Tannen. Von sonstigen Alterthümern aber zeigte sich keine Spur, auch keine Urnenscherbe.
Vietlübbe, im October 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Roggow.
Ungefähr im J. 1822 ward zu Roggow, bei Neu=Buckow, eine große Begräbnißstätte aus der Hünenzeit durch Zufall entdeckt. Der verstorbene Herr Landrath von Oertzen that so viel als möglich, die Reste der Bestattung zu retten. Dem hochseligen Großherzoge Friedrich Franz schenkte derselbe zwei große, breite Keile aus Feuerstein, welche in der großherzoglichen Alterthümer=Sammlung aufbewahrt werden. Es blieb jedoch manches Interessante in Roggow, welches der Sohn des Landraths, der Herr von Oertzen auf Roggow, jetzt bereit=


|
Seite 367 |




|
willigst dem Vereine abgetreten hat. Derselbe hat auch, als Augenzeuge der Aufgrabung, das Geschenk mit den genauesten Nachrichten über den Fund begleitet.
Am Fuße der großen Hügelkette, welche von SO. nach NW. streichend, aus dem Strelitzischen über die malchinsche Gegend herkommt und an Roggow bei Alten=Gaarz am Salzhaf in die Ostsee fällt, stand in der Hügelreihe am Salzhaf auf dem roggowschen Felde, 8 Fuß tief unter der Oberfläche, in sehr trockenem Sande oder Grandboden eine große Begräbnißstätte, in welcher alle Leichen unverbrannt beigesetzt waren. In der Mitte lag der Länge nach ein großes menschliches Gerippe, zur linken Seite des Schädels lagen ein Pferdeschädel und 6 bis 7 spanförmige Messer aus Feuerstein; am Haupte und zu den Füßen standen Urnen. Zu beiden Seiten dieses Gerippes lagen quer wenigstens 12 bis 16 andere Gerippe, unter diesen mehrere kleine, alle mit den alle mit dem Häuptern an dem großen Gerippe und mit den Füßen seitwärts weg. Alle Gerippe und Schädel waren in dem trockenen Sande wohl erhalten. Umher lagen überall viele zertrümmerte Urnen und mehrere Keile. - In der Nähe der Ostsee scheinen sich öfter solche ganze Reihenlager von Gerippen aus der Steinperiode zu finden (vgl. das Hünenbegräbniß zu Hohen=Wischendorf, Jahresber. III, S. 36): vielleicht Ruhestätten von Kriegern, die in Seekriegen geblieben sind?
In Roggow befanden sich nun noch zwei Schädel. Beide sind wohl erhalten und gut gebildet; die Näthe des einen sind noch lose, die des andern mehr verwachsen; die Zähne sind stark und kräftig; kein einziger Zahn ist hohl, obgleich alle Backenzähne des ältern Schädels nach außen hin in großer Tiefe bis zur Hälfte der Krone wie ausgeschliffen sind. Außer dem befanden sich zu Roggow, jetzt ebenfalls in der Vereinssammlung, zwei Keile und ein breites spanförmiges Messer aus Feuerstein; der Feuerstein ist wohl durch die Trockenheit des Bodens hell und ausgedörrt. Von sämmtlichen Urnen ist keine Spur mehr vorhanden. Ueber die großen Gräber an der Ostsee in dieser Gegend vgl. oben S. 354.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengräber von Vietlübbe bei Plau.
Auf dem vietlübber Felde, nahe an der Karbower und Sandkruger Scheide, wo der Acker sich nordwestwärts nach den Wiesen abdacht, liegt von Osten nach Westen ein Hünen=


|
Seite 368 |




|
grab von mehr als 100 Schritt Länge und 16 Schritt Breite; es sind bereits viele Steine weggenommen, aber man unterscheidet noch deutlich 4 Reihen großer Felsblöcke, welche parallel laufen und 3 freie Räume von 5 bis 7 Fuß Breite zwischen sich bilden. Etwa in der Mitte dieser Steinsetzung lag auf 8 Steinen ein Deckstein von 8 Fuß Länge und 6 Fuß Breite, welcher auf der unteren Seite eine ganz glatt und eben gehauene und geglättete Fläche hatte. Dieser Deckstein war gesprengt und ist das eine Stück vor einigen Jahren zum Mundstück in dem Backofen eines Hauswirths benutzt. Die beiden andern abgesprengten Stücke ließ ich abwälzen und untersuchte den innern Raum, der aber nichts als fetten Thon enthielt. Die 8 Tragsteine standen 2 Fuß über und 6 Fuß unter der Erde. Eine nähere Untersuchung ergab, daß der Erdboden umher aus lauter Thon besteht, und daß man bei Anlegung des Grabes Löcher gegraben habe, nicht weiter, als der Umfang des Steines es erforderte, und daß man nach deren Einsenkung den wenigen offenen Raum um die Steine mit Sand zugeschüttet habe. Außerhalb dieser Steinkiste fand sich nur an der westlichen Seite eine kurze Strecke von 4 Fuß mit einem dreifachen Steindamme über einander, bis zu einer Tiefe von 4 Fuß, in gelbem Sande, unter welchem wieder der Thon sich zeigte. Weder von einem Brande, noch von Urnen oder sonstigen Alterthümern war eine Spur zu bemerken.
Grade westlich von diesem Hünengrabe 90 Schritte entfernt, stand auf einem künstlich aufgeworfenen Hügel eine ähnliche Kiste von 6 im Viereck aufgestellten Tragsteinen, von denen der Deckstein früher schon abgenommen ist. Der innere Raum beträgt 4 Fuß in der Länge und in der Breite. In demselben war 2 1/2 Fuß unter der Oberfläche der Boden mit kleinen Steinen, namentlich Feuersteinen, belegt, welche alle offenbar vom Feuer calcinirt waren; einige Zoll tief war die Erde darunter schwarz gebrannt. Aber auch hier fand sich weiter nichts, und eben so wenig in dem umher etwa 4 Fuß hoch angeschütteten Hügel.
Eine ganz ähnliche Erscheinung, daß eine Strecke von dem Hünengrabe getrennt, aber in gleicher Richtung, eine isolirt stehende Steinkammer sich findet, habe ich auf dem Wege von Damerow nach Carow gefunden 1 ), wo


|
Seite 369 |




|
auf dem Damerower Felde nahe an der Krakower Scheide rechts in den Tannen ein Hünengrab von 40 Schritt Länge und 12 Fuß Breite steht, 80 Schritte aber östlich davon am Wiesenrande eine Steinkiste von 7 und 9 Fuß Weite.
Vietlübbe, im Juni 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Lage.
In einem Grabe in der Gegend von Lage sind nachstehend beschriebene Alterthümer gefunden und durch Vermittelung des Herrn von Kardorff auf Remlin von dem Herrn Kreis=Physicus Dr. Kues dem Vereine geschenkt:
1) ein Keil der größten Art von hellgrauem Feuerstein, wie Frid. Franc. Tab. XXVI, Fig. 1, 9'' lang, 2 1/2 bis 3 1/2'' breit und 1 3/4'' dick;
2) eine Streitaxt aus grünem Hornstein, 8'' lang, von zierlicher, schöner, seltener Form; diese Streitaxt ist dadurch sehr merkwürdig, daß sie noch nicht geschliffen und noch nicht ganz durchbohrt ist: an beiden Seiten ist die Durchbohrung in vertieft kegelförmiger oder trichterförmiger Vertiefung erst angefangen, und zwar an der einen Seite 3/4'', an der andern Seite 1/8'' tief.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Püttelkow
Nr. 2.
(Vgl. Jahresber. VI, S. 30.)
Auf der Feldmark Püttelkow bei Wittenburg wurden von den Bauern die Steine eines Grabes ausgebrochen. Unter den Scherben mehrerer, zerbrochener Urnen lag eine Streitaxt aus grünlicher Hornblende, von äußerst zierlicher Form und sauberer Arbeit, an allen Seiten geschmackvoll facettirt und im Loche trefflich gebohrt. Leider ließ sich nichts weiter über den Inhalt des Grabes erforschen; die Streitaxt ward dem Vereine von dem Herrn Amtshauptmann Ratisch zu Wittenburg übergeben.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
c) Zeit der Kegelgräber.
Kegelgrab von Peccatel bei Schwerin.
Mit einer Steindrucktafel und zwei Holzschnitten.
Im Anfange des J. 1843 ward dem Unterzeichneten in Schwerin ein S. 376 abgebildeter, gewundener, goldener Arm=


|
Seite 370 |




|
ring, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 2, gezeigt, der zum Verkaufe gestellt war. Da sich aus diesem "am Rande eines Hügels beim Steinbrechen unter Steinen" gefundenen Ringe auf ein bedeutendes Kegelgrab und auf andere in demselben gefundene Alterthümer schließen ließ, so wurden augenblicklich weitere gründliche Nachforschungen angestellt, welche denn auch ergaben, daß beim Steinbrechen aus einem nicht sehr großen Hügel auf dem Felde des Dorfes Peccatel bei Schwerin, am Rande desselben, der goldene Ring und "kupferne" Geräthe gefunden seien; der herbeigerufene Finder versicherte, daß die "kupfernen Geschirre" noch hinter einem Schranke in seiner Wohnung lägen, mit Ausnahme" zweier kleiner, "kupferner Räder", welche er vor zwei Tagen an einen Nagelschmied aus Crivitz für zwei große Nägel verkauft habe: zwei andere, etwas beschädigte Räder derselben Art habe er noch zu Hause. Sogleich ward das weitere Steinbrechen untersagt, das nach Crivitz Verkaufte glücklicher Weise wieder herbeigeschafft; die Auslieferung des ganzen Fundes veranlaßt und die Fundstelle zu Peccatel in Augenschein genommen. Allerdings war der Hügel ein Kegelgrab, aus welchem bisher nur an einer Seite Steine gebrochen waren. Die höchst bedeutenden Alterthümer waren zwar, theils nach den oxydirten Bruchenden zu schließen, schon im Grabe zerbrochen, theils beim Herausziehen aus dem Steinlager beschädigt; dennoch waren sie der höchsten Aufmerksamkeit und Anstrengung werth und es ward vom Ausschusse des Vereins die Aufdeckung des ganzen Grabes beschlossen.
Die Aufdeckung des Grabes, bei welcher JJ. KK. HH. der Großherzog Friederich Franz, die verwittwete Frau Großherzogin Alexandrine und die Prinzessin Louise, so wie mehrere Bewohner Schwerins gegenwärtig waren, geschah am 18. April durch den unterzeichneten Archivar Lisch und den Hofmaler Schumacher aus Schwerin.
Oestlich von dem eine Meile von Schwerin liegenden Dorfe Peccatel, einige tausend Schritte von demselben entfernt, liegen im Anfange der großen, ganz flachen Ebene des Dorffeldes nahe bei einander drei Kegelgräber. Das kleinere, welches auch aufgedeckt ward, gab gar keine Ausbeute; das mittlere war dasjenige, welches die Alterthümer geliefert hatte und abgetragen werden sollte; das größere steht noch unberührt. Von diesem größeren Grabe gehen im Dorfe folgende Volkssagen.
In dem großen Grabe sollen die Unterirdischen wohnen. Diese haben oft, wenn ihnen Kinder geboren sind, dieselben zu den Leuten im Dorfe gebracht und dafür ein Dorfkind mit=


|
Seite 371 |




|
genommen. Ein solches Unterirdischenkind war auch einmal im Dorfe. Es wuchs nicht und gedieh nicht und ward nicht größer und stärker. Einmal sagte es zur Pflegemutter, sie möge ihm einmal ein Stück aufführen, das es noch nie gesehen. Da zerschlug die Frau ein Ei und richtete es so an, wie es der Bauer zu thun pflegt. Da sprach das Kind 1 ):
Ick bün so olt
As Behmer Gold
Aeverst so wat hebb ick
Mîn lëvdâg nich sên.
Darüber züchtigte die Frau das Kind stark. Die Unterirdischen nahmen es aber zurück und haben seitdem keins wiedergebracht.
Eine andere Sage: In dem Berge (Rummelsberge) wohnen die Unterirdischen. Mitunter halten sie Tafel auf dem Berge, wozu sie Kessel und andere Geräthe aus den übrigen Bergen leihen. Einmal kommt ein Knabe aus Peccatel, sieht die gedeckte Tafel und nimmt ein Messer von demselben. Die Tafel kann deshalb nicht wieder verschwinden. Wie der Vater des Knaben das sonderbare Messer in der Hand desselben sieht, fragt er, woher er es habe. Als der Sohn dem Vater Bericht thut, schilt dieser ihn und heißt ihn das Messer wieder hintragen. Also geschehen, verschwindet die Tafel sogleich.
Das mittlere, ausgedeckte Grab hatte 125 Schritt Umfang, gegen 50 Schritt Durchmesser und etwas über 5 Fuß Axenhöhe; die Ansteigung war also bei der großen Ausdehnung des Grabes nicht stark. Rund umher war es von einem wohlgefügten, dichten, regelmäßigen Ringe von ziemlich großen Feldsteinen, wie mit einer Mauer eingefaßt; diese Mauer lag ganz unter dem Rasen, war von außen nicht zu bemerken und einen Stein hoch und einige Steine dick. Der Grabhügel bestand aus Erde; diese war von anderer Art, als die des umliegenden Ackers; nach der Beobachtung der Arbeiter glich sie der sandigen Erde des nach Pinnow hin, entfernt liegenden, waldigen Berges. In dieser Erde standen 3 Steingewölbe, aus handrechten Steinen aufgeführt: zwei neben einander in der Mitte des Grabes ungefähr 20 Schritt vom Rande entfernt, von N. gegen S. sich erstreckend, durch einen Damm verbunden, jedes an 6' lang, 4' breit, 4' hoch; das dritte Gewölbe stand am Südrande des Grabes, zu den Füßen der beiden andern, war an 16' lang und 10' breit gewesen, und dehnte sich von O. gegen W. aus: dieses Gewölbe hatte


|
Seite 372 |




|
die ausgebrochenen Steine und die merkwürdigen Alterthümer geliefert, die beiden andern Gewölbe waren noch nicht berührt. Es wurden nicht allein die beiden noch unberührten Gewölbe abgetragen, sondern auch die Stelle des südlichen Gewölbes genau untersucht und überhaupt alle Räume des Grabes durchforscht.
Dieses konnte theils nur aus den Berichten der Steinbrecher, theils aus der völligen Aufräumung erkannt werden. Hiernach hatte es eine Länge von 16', eine Breite von 10' und eine Höhe von 3 bis 4' gehabt, und erstreckte sich von O. gegen W. Auf dem Urboden stand noch ein Steinpflaster, auf welchem Asche und viele Kohlen lagen. Auf diesem Pflaster, nachdem an 5 Fuder Steine abgefahren waren, hatten folgende Alterthümer gelegen:
1) Eine große Vase von Bronze, Fig. 1, zwischen 7'' und 8'' hoch, 16'' weit in der Oeffnung, ungefähr 14'' weit im Bauchrande, sehr dünne getrieben, über dem Bauchrande mit 4 concentrischen Reihen kleiner, von innen herausgeschlagener Knötchen verziert, an zwei Seiten mit zwei gewundenen, angenieteten Henkeln, im Ganzen also mit vier Henkeln versehen. Die Arbeit im dünnen Bronzeblech, die Verzierung mit ausgeschlagenen Knötchen, die Windung der Henkel gleicht ganz den sonst vorkommenden Arbeiten aus der Bronze=Periode; die Gestalt der Vase ist der Form der thönernen Urnen aus derselben Periode ähnlich.
2) Ein hohler Cylinder oder eine Säule von Bronze mit 4 Füßen, Fig. 2; der Cylinder mit den Füßen ist 6 1/2'' hoch und 3 3/4'' weit, die Füße sind 2 3/4'' hoch. Der Cylinder ist von Bronzeblech, eben so gearbeitet und verziert, wie die Vase, nur etwas stärker im Bleche. Oben ist ein schmaler Rand nach außen umgebogen; in dem Rande sind 7 Nietlöcher und auch noch einige Niete. Einige Stücke Bronzeblech, ganz dem Bleche der Vase gleich, haben Nietlöcher und Niete in denselben Entfernungen, wie der Cylinder, so daß oben auf dem Cylinder oder der Säule eine bronzene Schale festgenietet gewesen sein muß. Die 4 Füße (von denen 3 verloren gegangen, aber beim Steinbrechen noch vorhanden gewesen sind), sind dicke Bronzestreifen, unten etwas nach außen gebogen, oben inwendig an dem Bleche des Cylinders angenietet, unten etwas ausgebreitet und mit einem großen Nietloche versehen, so daß die Füße unten auf etwas festgenietet gewesen sind.


|
Seite 373 |




|
3) Ein Wagen von gegossener Bronze, Fig. 3, unstreitig eine der größten Merkwürdigkeiten des Alterthums überhaupt. Leider fehlen mehrere Stücke, so daß sich die ganze Construction nur schwer beurtheilen, das noch Vorhandene sich aber wohl nur nach der Abbildung gut erkennen läßt. Auf der beigegebenen Steindrucktafel ist Fig. 3 die muthmaßliche Gestalt des ganzen Wagens, jedoch ohne die Füße des Cylinders, in dem Maaßstabe der Vase und des Cylinders, Fig. 3 a. die perspectivische Ansicht der noch vorhandenen Stücke in halber Größe, mit Andeutung der nothwendigen Ergänzungen, Fig. 3 b. eine vollständige Achsenfügung in natürlicher Größe abgebildet. Charakteristisch sind zuerst die vier Räder, 4 1/2'' hoch, mit vier Speichen, aus einem Stücke gegossen, noch mit den Gußnäthen im mittlern senkrechten Durchschnitte, wie aus Fig. 3 b. ersichtlich ist. Dieselben Räder sind auch auf dem wismarschen Heerhorne gravirt, welches aus derselben Zeit stammt und zu Jahresber. III abgebildet und daselbst S. 67 flgd. beschrieben ist; auch kommen dieselben Räder auf dem Kivik=Monument vor, welches in Suhm Historie af Danmark Tom. I, Tab. II abgebildet ist.

Die Achsen, auf welchen die Räder laufen, sind von starken, viereckigen Bronzestäben, wie aus Fig. 3 b. zu erkennen ist, und bogenförmig wie ein Joch gestaltet. Die Enden der Achsen sind ein wenig gespalten und am Ende breit geschlagen, und dadurch sind die Räder auf den Achsen festgehalten gewesen; von Pflöcken oder Schrauben ist keine Spur. Eine ähnliche Achse hat ein Wagen mit zwei vierspeichigen Rädern auf dem Kivik=Monument; hier steht ein Mann auf der Achse, an deren weitester Ausbiegung eine Deichsel befestigt ist. - Vor den Rädern sind die Achsen etwas ausgebreitet und haben große, starke Niete in einem Nietloche. Nach dem bei der letzten Aufräumung gefundenen, Fi. 3 b. mit der Zusammenfügung eines Rades in natürlicher Größe abgebildeten, vollständigen Fragmente der einen Achse waren hier 3 Bronzestäbe auf einander fest zusammengenietet. Ein Stab x bildete die Achse, der zweite o ohne Zweifel an einem Ende den Langbaum oder Langwagen, der die Verbindung zwischen den beiden Achsen herstellte, ebenfalls jochförmig gestaltet, am andern Ende einen kurzen, dünnen Haken; der dritte Stab u scheint quer nach innen gegangen zu sein und die Last (den Cylinder auf seinen angenieteten Füßen) getragen zu haben.


|
Seite 374 |




|
Die Zusammenfügung der drei Bronzestäbe ist Fig. 3 und Fig. 3 a. hinter dem vordern Rade rechts abgebildet. Jeder jochförmige Langwagen hatte nach vorne und hinten einen aufrecht stehenden, am obern Ende nach unten gekrümmten Haken. Die eine Anfügung bei Fig. 3 a. läßt sich in n sicher erkennen; die 3 andern Haken sind bei der letzten Aufräumung auch noch gefunden, lassen sich aber nicht genau anpassen, da sie in alter Zeit gewaltsam abgedrehet sind. So viel ist gewiß, daß der Wagen nach vorne und hinten eine ganz gleiche Einrichtung hatte.
Der folgende einfache Bericht des Finders wird übrigens die Sache noch bedeutend aufklären: Am Ostende des Grabes unter den Steinen stand die Vase oder der "Kessel", mit Henkeln, gewiß noch mit 3 Henkeln; die Vase war aber durch die Steinlast zerdrückt. In der Vase stand der Cylinder, welcher beim Auffinden noch 3 Füße hatte (der vierte ward bei der letzten Aufräumung gefunden). Unter der Vase lagen die Räder mit den Achsen u. s. w.
Zu bemerken ist, daß der Boden der Vase fehlt, dagegen die auf dem Cylinder angenietet gewesene Schale in ihrer ganzen Ausbauchung mit den Nietlöchern noch vorhanden ist.
Höchst wahrscheinlich verhält sich also die Sache folgendermaßen: auf dem Wagen war mit den Füßen der Cylinder, auf dem Cylinder die Vase angenietet, so daß alle drei Stücke Ein Ganzes bildeten. Die Last der Steine drückte nun das Ganze zusammen und den Boden der Vase ein, so daß der Cylinder mit den Fragmenten des Bodens der Vase in die Vase zu stehen kam, der Wagen aber zerbrach und seitwärts auseinander fiel; denn nach den oxydirten Bruchenden zu schließen, zerbrach auch der Wagen schon im Grabe.
Der Wagen war also zum Hin= und Herfahren der Vase bestimmt. Die Vase, der Cylinder und der Wagen, welche Fig. 1, 2 und 3 in demselben Maßstabe unter einander abgebildet sind, bildeten also Ein fest zusammenhangendes Ganzes, welches sich klar erkennen läßt, wenn man die drei Stücke zusammenschiebt, so daß die Bedeckung des Cylinders den Boden der Vase bildet, und die 4 Füße des Cylinders auf den 4 Achsen des Wagens stehen. Dann ragt der Cylinder grade über die 4 jochförmigen Verbindungen des Wagens weg.
Es scheint außer Zweifel, daß dieser Wagen eine gottesdienstliche Bedeutung gehabt habe, da das Fahren auf Wagen uralte Eigenthümlichkeit der Götter, und auch der Helden,


|
Seite 375 |




|
war, - eine Eigenthümlichkeit, die noch bis ins Mittelalter in der Erinnerung ist (vgl. J. Grimm's deutsche Mythologie I, erste Aufl., S. 74, zweite Aufl. S. 96 und 304).
Dies alles stand am östlichen Ende unter dem südlichen Steingewölbe; am westlichen Ende desselben lag:
4) ein Schwert von Bronze, Fig. 5, zweischneidig, im untern Mitteltheile sich ausbreitend, etwas über 2' lang, nach den oxydirten Bruchenden vor der Beilegung in 4 Stücke zerbrochen, mit einem erhabenen Mittelrücken, welcher an jeder Seite durch eine feine, erhabene Linie begrenzt ist. Der Griff ist mit Knopf und Annietung an die Klinge nur 4'' lang. Auf der viereckigen Griffstange stehen 5 ovale Scheiben, zwischen welche wohl Holz und Leder zur Bildung des Griffes befestigt gewesen ist.
Die Anfügung des Griffes ist sehr zierlich. Zwar ist sie, wie bei den Schwertern in Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 1 und 2, an den Seiten halbmondförmig mit 5 Nieten über die Klinge fassend, aber die mittlere Schweifung ist zu einem Oval geschlossen; hiedurch und überhaupt durch die aus Bronze und Leder zusammengesetzte Bildung des Griffes unterscheidet sich dieses Schwert von den sonst in Kegelgräbern gefundenen, mit denen es übrigens gleich ist. Der Knopf, Fig. 5 a, ist rhombisch gestaltet und oben in einer rhombischen Einfassung mit 8 kleinen, erhabenen Kreisen um das Niet der Griffstange, an den Seiten aber durch Stempel und Gravuren sehr hübsch verziert. Unter dem Griffknopfe sind Zickzacklinien durch Einschlagung dreieckiger Stempel gebildet; dieselbe Verzierung findet sich an dem oben erwähnten Horne von Wismar, Jahresber. III, Lithogr. I, 1 und 7, und III, 1, 4, a, c, g, und 6 b. Das Horn von Wismar mit seinen Wagenfiguren scheint überhaupt mit diesem Kegelgrabe von Peccatel aus gleicher Zeit zu stammen. - Inwendig steckt der hohle Knopf voll Eschenholz.
5) Ein kleines Messer von Bronze, Fig. 7, sichelförmig nach innen gebogen, mit Bronzeheft, welches eine Längsöffnung hat und zur Belegung mit Holz oder Leder eingerichtet ist, im Ganzen etwas über 4'' lang, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 9, jedoch zierlicher. Ein kleiner viereckiger Knopf von Bronze, Fig. 7 a, gehört wahrscheinlich zu diesem Messer.


|
Seite 376 |




|
6) Ein in natürlicher Größe hiebei abgebildeter, gewundener Handring von Gold, Fig. 4, an den Enden offen
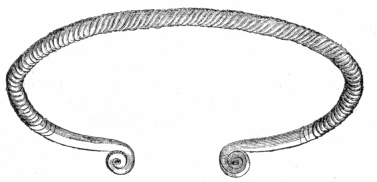
und an jedem Ende mit einer Spiralwindung verziert, ganz wie Frid Franc. Tab. XXII, Fig. 2. Der Ring wiegt gegen 3 Loth; das Gold enthält ungefähr 10 p. C. Silber.
7) Eine Framea, Fig. 6, mit Schaftloch und einem Ringe, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 1. Die Außenseite ist ganz mit gravirten Verzierungen bedeckt; die Schaftöffnung ist, abweichend von der Gestaltung anderer Frameen, etwas viereckig.
Alles dieses ward beim ersten Steinbrechen gefunden.
Bei der letzten, vollständigen Aufräumung fand sich, außer mehrern oben erwähnten Bruchstücken des Wagens, noch
8) eine Pfeilspitze von Bronze, Fig. 9, mit Schaftöffnung, gegen 1 1/2'' lang, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXV, Fig. 5, jedoch mit Wiederhaken.
9) Eine Messerklinge von Bronze, nach außen gebogen, überall von gleicher Breite und Dicke, ohne Griff, 4'' lang, schon im Grabe in drei Stücke zerbrochen.
Von thönernen Urnen war auf dieser Begräbnißstelle keine Spur.
Ungefähr in halber Höhe lag in der Mitte fest zwischen Steinen verpackt und sehr feucht, zwischen Kohlen, welche durch das ganze Gewölbe von hier bis auf den Boden zerstreuet waren:
10) ein lederner Gürtel, Fig. 8, oder ein Pferdegeschirr, von sehr merkwürdiger Beschaffenheit, bei dessen Hebung die fürstlichen Herrschaften gegenwärtig waren. Der Hauptbestandtheil besteht aus einer vierfachen Lage von Leder und Holz. Unten liegt eine Schicht biegsames Holz,


|
Seite 377 |




|
darauf folgt eine Lage dickes Leder, auf dieser liegt eine Lage ganz dünnes Leder, und oben wieder eine Lage dickes Leder. Die obere Schicht ist ganz mit kleinen Buckeln von Bronzeblech Fig. 8 c. beschlagen, welche ganz dicht neben einander stehen; sie sind rund und hohl und sind unten zu zwei Spitzen ausgeschnitten, welche unter der obern Lederschicht umgenietet sind. Die darunterliegende Schicht von dünnem Leder hat Eindrücke von diesen Buckeln erhalten. Es ward ein Stück von ungefähr 1 Fuß lang und 1/2 Fuß breit gefunden; es war der Anfang des Ganzen, an dessen Ecke ein perpendikulairer lederner Riemen befestigt ist, welcher ebenfalls mit Bronzebuckeln beschlagen ist. Oben am Rande, 1/2 Zoll unter demselben, ist ein 1/2 Zoll breiter Riemen aufgeheftet, der am Ende an der Ecke in einer Oese hervorsteht; dieser Riemen liegt am Ende inwendig auf einer Schiene von Bronzeblech. In einiger Entfernung unter diesem aufgehefteten Streifen war Eine Reihe größerer runder Bronze=Buckel, Fig. 8 b, 1/2'' im Durchmesser, von der Beschaffenheit der kleinen, aufgenietet. Außerdem fanden sich einige noch größere Buckel, Fig. 8 c., 3/4'' im Durchmesser, von derselben Beschaffenheit, deren Stelle jedoch nicht ausgemittelt werden kann. - Das Ganze lag in zwei Enden zusammengebogen und nach innen mit den Buckeln zusammengeklappt auf einem großen Steine und konnte nur mit großer Sorgfalt gerettet werden. - Das Geschirr ist sehr merkwürdig. Es beweiset eine große Tüchtigkeit in der Lederbereitung in der Bronze=Periode und eine große Gewandtheit in der Verarbeitung und Anwendung der Bronze. - Wozu das Geschirr gedient habe, ist sehr zweifelhaft; man kann auf einen Gürtel, eine Art Panzer rathen, was nicht unwahrscheinlich ist, da es so sehr mühsam und sorglich und schön gearbeitet ist; vielleicht aber war es eine Art Kappe oder Helm; doch mag man auch immer an die Benutzung zu einem Pferdegeschirr denken.
11) Ein kleiner viereckiger Beschlag von Bronze, wie sich dergleichen öfter finden (vgl. oben Nr. 5), zerbrochen und vom Feuer angegriffen.
welches in gleicher Richtung von N. nach O. neben dem westlichen stand, ungefähr 5 Fuß von demselben entfernt.
Hier ward ebenfalls in mitlerer Höhe eng zwischen Steine (ohne Steinkiste aus platten Steinen) verpackt, gefunden:


|
Seite 378 |




|
12) Eine thönerne Urne, Fig. 12, 5'' hoch, 6 1/2'' weit in der Mündung, von brauner Farbe, mit unbedeutenden Ausbauchungen, ohne Verzierungen, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VI, Fig. 13. Die Restaurirung gelang.
13) Eine Nadel von Bronze, Fig. 10, deren Knopf mit mehrern Scheiben verziert ist.
14) Eine Heftel mit zwei Spiralplatten, wie Frid. Franc. Tab XI, Fig. 3, stark vom Feuer angegriffen; es sind nur Reste der Spiralplatten klar zu erkennen.
15) Ein breiter Fingerring, Fig. 11, aus Einem Stücke Bronzeblech, 3/8'' breit, außen mit 6 concentrischen, erhabenen Reifen verziert; der Fingerknochen lag noch wohl erhalten in dem Ringe.
In der Nähe dieses Gewölbes wurden auch zerstreut und ohne Ordnung unverbrannte Schädelknochen gefunden.
stand nicht weit vom Nordende des westlichen Gewölbes als ein kleiner runder Steinhaufen. Unter demselben zeigte sich eine bedeutende Brandstätte mit großen Massen von Kohlen und Asche.
Zerstreut durch dieses Gewölbe lagen mehrere Geräthe, welche vom Feuer stark angegriffen und in viele Stücke zersprengt waren:
16) Ein Paar Handringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXII. Fig. 4.
17) Ein gewundener Hals= oder Kopfring aus Bronze, von gewöhnlicher Form.
18) Eine Heftel mit zwei Spiralplatten aus Bronze, von welcher jedoch nur noch die an dem breiten Ende durchbohrte Nadel zu erkennen war.
19) Ein viereckiger Beschlag, wie Nr. 5 und 11.
Nach der Erzählung der Arbeiter sollte neben dem Grabe schon früher
20) ein Schwert von Bronze gefunden sein. Am 15. Mai 1843 brachte ein Knabe aus Peccatel das obere Drittheil desselben, welches er einige Tage vorher in dem Fußsteige einige Schritte von dem Grabe im Sande gefunden hatte. Es ist ein Schwert ohne Verzierung des Mittelrückens, mit Griffzunge und 4 Nietlöchern zur Befestigung eines hölzernen Griffes.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 379 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 1.
Auf der hiesigen Feldmark liegen viele Gräber, sowohl Kegelgräber, als Hünengräber. Der Herr Hauptmann Zink hat die meisten bereits aufgedeckt 1 ), und da die meisten Hauswirthe noch bei der damaligen Aufgrabung zugegen gewesen sind und an derselben Theil genommen haben, so halten sie alle noch vorhandenen Gräber für bereits untersucht und nehmen daher aus denselben die ihnen zu Mauern, Dämmen u. s. w. passenden und nöthigen Steine oder brechen sie der Acker=Cultur wegen aus. Daher habe ich solche bereits angegriffene aber nicht untersuchte Gräber im Interesse des Vereins aufzudecken für nöthig erachtet. - Ein solches Kegelgrab lag hart am Wege von Vietlübbe nach Schlemmin, nahe bei den Tannen, und war von der westlichen Seite bereits angegriffen. Es hatte einen Durchmesser von 50 Fuß und 4 1/2 Fuß Axenhöhe. Die Aufdeckung geschah von Osten nach Westen. Etwa 10 Fuß östlich vom Mittelpuncte zeigte sich eine Steinsetzung, die sich als ein vollkommener Kreis bei fortgesetzter Arbeit auswies. Am südöstlichen Rande dieser Steine, die kaum ein Arbeiter heben konnte, hatte eine braune Urne gestanden, die aber zertrümmert weit verstreuet in Scherben lag. Innerhalb dieser Steinsetzung erhob sich allmählig ein Steinhügel von 3 1/2' Höhe, jedoch so, daß in der Mitte ganz von Osten nach Westen eine Vertiefung von 1 1/2 Fuß vorhanden war, nicht kesselförmig, wie bei andern Gräbern, sondern fast einer breiten Rinne ähnlich. In dieser Rinne lag zwei Fuß östlich von der Mitte: ein kleiner Haufen menschlicher Knochen, besonders vom Hirnschädel und Halswirbel, und nahe dahinter eine Ringschnalle mit Zunge aus Eisen und ein Fragment von einem Messer, gleichfalls aus Eisen, mit Spuren eines hölzernen Griffes. Beide Stücke sind stark oxydirt und haben in der Oxydirung große Blasen aufgetrieben, was nur an alten heidnischen Geräthen bemerkt ist. Wegen des Vorkommens von Eisen hat dieses Kegelgrab besondere Merkwürdigkeit. Jedoch ist dabei zu bedenken, daß diese Bestattung wahrscheinlich eine jüngere ist. In dem Grabhügel unterhalb dieser Alterthümer stand 2 Fuß tiefer auf dem Urboden eine von den Steinen zerdrückte Urne, ohne Inhalt; sie ist hellbraun, in der Basis 4 1/2'', in der Oeffnung 7 1/4'' und im Bauche 8 1/2'' weit, hoch 5 1/4'' ohne alle Verzierung. Mehr Alterthümer fanden sich in dem Grabe nicht.


|
Seite 380 |




|
Wir haben also ohne Zweifel zwei Bestattungen in demselben Hügel, von denen die jüngere in den Anfang der Eisenperiode fällt.
Vietlübbe, im Juni 1843.
J. Ritter.
Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 2.
Zwischen Vietlübbe und Damerow liegen auf der rechten Seite, wo der Boden sich südwestlich nach dem Cheelsbache (Michaelsbache, vgl. Jahrb. VI, S. 176) neigt, 2 Gruppen und einige zerstreute Kegelgräber, die früher noch alle nicht untersucht sind; aber unversehrt ist fast keines, da die Hauswirthe nach Belieben bald dieses, bald jenes angegraben haben der schönen Dammsteine wegen; manche sind schon halb, manche ganz zerstört. Da dem Reste der Untergang droht, weil neue Steindämme und eine neue Kirchhofsmauer nöthig sind, so habe ich bereits eines derselben, welches zum dritten Theile von Südosten durchgraben war, untersucht. Es hatte eine Achsenhöhe von 6 Fuß und einen Durchmesser von 54 Fuß. Der Hügel war aus gelbem Sande aufgeworfen, durchgängig bis zur Oberfläche mit Dammsteinen ziemlich stark versehen; in der Mitte aber bildeten drei ziemlich große Granitblöcke eine Art Kessel oder Kiste. In der Mitte dieser Steine stand eine zertrümmerte braune Urne, ohne Henkel. Sie hat eine Höhe von 9'', der 3 1/4'' lange Hals ist 3 3/4'' weit, die Bauchweite 8 3/4'' und die Basis 3 1/2''. Unter dem Halse ist sie mit einer horizontalen Reihe runder Eindrücke verziert, unter welcher an 5 oder 6 Stellen eben solche Eindrücke ein Dreieck, mit der Spitze nach unten, bilden. Eine ähnliche Reihe im Zickzack ist etwas oberhalb der Bauchweite, und eine horizontale Reihe nahe an der Basis. Die untere Fläche der Basis hat am Rande 6 solcher Eindrücke, durch diametrische Linien verbunden. Einige wenige Knochen waren der Inhalt. Nahe bei der Urne lag im Sande eine bronzene Heftel mit zwei Spiralplatten mit edlem Roste überzogen; die Spitze der Nadel und die unter derselben liegende eine Spiralwindung fehlen. Diese Heftel ist ungewöhnlich lang und schmal. Die Spiralplatten sind nur klein: 3/4'' im Durchmesser, und doch ist das Ganze noch gegen 7'' lang. Der grade lange Bügel ist nicht viel breiter, als die Nadel: 3/16'' breit, in der Mitte mit einer feinen, erhabenen Längslinie, zu beiden Seiten derselben mit feinen, erhabenen


|
Seite 381 |




|
Zickzacklinien, am Rande mit feinen, eingravirten Schräglinien verziert 1 ).
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Retzow Nr. 3.
Beim Graben auf dem Felde des Gutes Retzow, Amts Lübz, wurden unter einer Erhöhung folgende Bronzen gefunden und von dem Herrn Gutspächter Dabel dem Vereine geschenkt:
1) eine Framea mit durchgehender Schaftrinne, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 7;
2) ein Armring für den Oberarm, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 3, mit feinen Linien gravirt, in zwei Stücke zerbrochen;
3) zwei Windungen eines spiralförmig gewundenen Armringes, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 7, jedoch von einem viereckigen, etwas platten Bronzestabe.
Alle Alterthümer sind stark mit edlem Roste bedeckt.
Nach Jahresber. V, S. 64, wurden zu Retzow eine Framea mit ganz demselben Roste und von ganz derselben Gestalt, nur etwas größer, und ein Armring von ähnlicher Gestalt, und nach Jahresber. III, S. 64, Armringe und andere bronzene Alterthümer in einem anderen Grabe eben=daselbst gefunden. Formen und Rost reden dafür, daß alle diese Gräber aus derselben Zeit stammen.
Schon früher wurden zu Retzow mehrere Kegelgräber geöffnet: vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 71.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgräber und Begräbnisplatz zu Ganzlin
bei Plau.
Zwischen dem ganzliner Baueracker und dem zur twietforter Forst gehörigen Acker ist ein neuer Graben gezogen, der eine Gruppe kleinerer Kegelgräber durchschneidet; der größere Theil liegt auf der ganzliner Seite. Bei dieser Ziehung des Grabens ist eine Urne im flachen Boden, wie es scheint, in den Urboden hineingegraben, gefunden und mit dem Inhalte mir übergeben. Diese Urne, hell und dunkelbraun


|
Seite 382 |




|
schattirt, ist mit 2 Henkeln und ohne Verzierung; der Hals fehlt; die jetzige Weite ist an der Oeffnung 4 1/2'', die Basis mißt 3 3/4'' die Höhe 7'', die Bauchweite ist 7 3/4''. Der Inhalt bestand aus lauter Knochen und Sand, so daß sich daraus nicht erkennen läßt, ob sie zu den Kegelgräbern gehört oder in wendischer Zeit beigesetzt ist. Der Wendenkirchhof bei Twietfort liegt nur etwa 300 Schritte weiter nördlich; ich werde auch hier weiter nachforschen.
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Grebbin.
Auf dem Felde von Grebbin bei Parchim hatte ein Bauer mehrere Alterthümer von Bronze ausgepflügt. Durch Vermittelung eines Kaufmanns zu Parchim erwarb von demselben der Herr Dr. Beyer zu Parchim für den Verein drei Spiral=Platten von zerbrochenen Handbergen, wie Frid. Franc. Tab. IV, und einen Armring, wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 4, alles mit edlem Rost bedeckt. Auf die angebliche Aussage des Bauern, daß er noch mehr Alterthümer aus dem Funde, namentlich Pferdegeschirr besitze, hat daß großherzogliche Amt Lübz an Ort und Stelle Nachforschung halten lassen, aber nichts in Erfahrung bringen können.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Goldring von Bresegard
bei Eldena.
Ueber dieses seltene und werthvolle Stück des heidnischen Alterthums bringen wir den Freunden alterthümlicher Forschung nachstehenden Fundbericht mit der nachstehenden Zeichnung, - das Einzige, was von dem Funde übrig geblieben ist. Die folgende, genaue Darstellung wird geeignet sein, die Wege klar zu bezeichnen, auf denen so viel Seltenes aus der Vorzeit verschwindet, und die Mitglieder des Vereins veranlassen, diesen Wegen überall nachzuspüren.


|
Seite 383 |




|
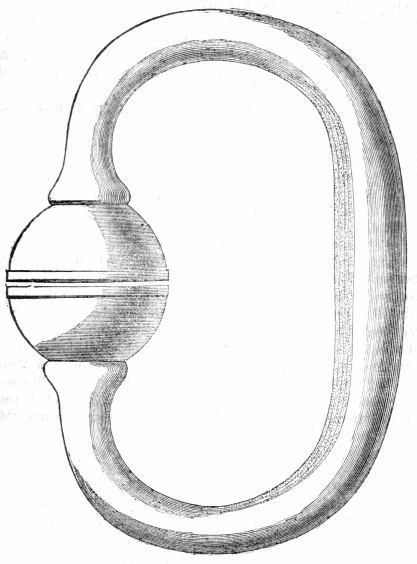
Ungefähr drei Wochen vor Weihnacht pflügte der Hauswirth Schult den auf der sogenannten Fahrenhorst gelegenen Acker des Büdners Pommerencke zu Bresegard bei Eldena. Der Hauswirth Schult pflügte in Gegenwart des Büdners Pommerencke den Ring aus und nahm ihn mit nach Hause. Am andern Morgen ließ sich Pommerencke den Ring zur Ansicht holen, da er auf seinem Acker gefunden sei, gab ihn aber nicht wieder zurück, sondern überließ ihn längere Zeit seinen Kindern zum Spielwerk und erklärte in der Folge späterhin, er habe ihn an den Goldschmied Levy zu Grabow für 170 Rthlr. ver=


|
Seite 384 |




|
kauft. Der Hauswirth Schult machte nun beim großherzoglichen Domanial=Amte Grabow die Anzeige, dieses vereinigte sich mit dem Magistrate daselbst zur Nachforschung, welche von beiden Behörden mit dem rühmlichsten Eifer durchgeführt ward.
Das bestimmt gewonnene Resultat der Nachforschung ist folgendes.
Der Büdner Pommerencke brachte den Ring bald nach der Auffindung desselben zu dem Goldarbeiter Meinhof in Grabow zum Verkaufe, nachdem er den Bot eines Kaufmannslehrlings auf 4 Groschen nicht angenommen hatte. Meinhof probirte, wog und maaß den Ring genau unter Zuziehung seines Gehülfen und beide prägten sich die Form genau ein. Da er mit seiner Goldwage so schwere Sachen nicht wiegen konnte, so benutzte er seine Silberwage und fand, daß der Ring fast 51 Loth wog. Die Masse, welche er sogleich als reines Gold erkannte, probirte er auf dem Probiersteine, welchen er mit den Proben aufbewahrt hat, und fand, daß sie aus 24 karätigem, also reinem Golde bestehe. Er schätzte daher den Werth des Ringes auf etwa 550 Rthlr. N 2/3, kaufte ihn jedoch in Kenntniß der bestehenden Verordnungen und aus Besorgniß nicht, zeigte und hielt den Fund leider aber auch nicht an, sondern rieth nach mehrern Unterhandlungen dem Büdner endlich, den Ring an die Landesregierung zu Schwerin zu bringen. Der Büdner ging aber weder nach Schwerin, noch an seine zunächst vorgesetzte Amtsbehörde, sondern nahm den Ring wieder mit sich nach Hause.
Am 19. Jan. 1844 brachte der Büdner Pommerencke den Ring zum Goldarbeiter Levy in Grabow. Dieser erklärte die Masse für 10 bis 11karätiges Gold und das Gewicht für 46 Loth, gab dem Büdner für das Loth 4 Rhtlr., im Ganzen die Summe von 170 Rthlrn., schmolz den Ring sofort ein, wobei es sich ergeben habe, daß das Gold 19karätig sei, und brachte das Metall sogleich persönlich nach Hamburg, wo er es an den Juden Jonas für 90 Friedrichsd'or verkaufte.
Dieß ist das ungefähre Resultat der angestellten Verhöre. Eine durch den Magistrat zu Grabow veranlaßte Nachforschung durch das Polizei=Amt zu Hamburg, ob der Ring auch wirklich eingeschmolzen sei, hat zu nichts weiter, als zu der Gewißheit geführt: daß der Ring eingeschmolzen und verloren ist.
Dagegen hatte der Goldarbeiter Meinhof, ein geschickter Mann und Zögling der Sonntagsschule für Handwerkslehrlinge zu Schwerin, dessen Darstellung die Stadtbehörden "unzweifelhaft Glauben beimessen", eine Zeichnung und Nachbildung des Ringes aus Messing angefertigt, und begleitete sie mit folgenden Erläuterungen:


|
Seite 385 |




|
1) die oben mitgetheilte Abbildung des Ringes ist ohne Zweifel getreu und zuverlässig;
2) der Ring wog gegen 51 Loth und bestand aus reinem 24karätigem Golde;
3) er war so groß, daß man bequem mit der Hand hineinfassen konnte;
4) die Stärke desselben war den beiden halbkugeligen Enden gegenüber etwa 3/4 Zoll im Durchmesser;
5) die beiden Halbkugeln an den Enden, zwischen denen nur ein schmaler Raum war, waren inwendig hohl, und in den Höhlungen lag ein kleiner gewöhnlicher Kiesel, der durch Zufall hineingerathen sein mußte;
6) der Ring schien gegossen zu sein, war glatt und hatte nur kleine Linien und Puncte zur Verzierung, wie mit einem Punzen eingeschlagen.
Alle diese genauen Nachrichten verdanken wir den unverdrossenen Bemühungen des Herrn Landdrosten von Suckow und des Herrn Burgemeisters Floercke zu Grabow.
Nach dem Mitgetheilten leidet es keinen Zweifel, daß dieser Ring einer jener großen Ringe sei, die in Dänemark öfter, und zwar von reinem Golde, als einzelne Stücke gefunden sind und wie einer im Leitfaden zur Nord. Alterthumskunde, 1837, S. 43, abgebildet ist. Das alte Gold der Gräber (vgl. oben S. 349 flgd.), wie das gediegene Gold Asiens, erscheint messinggelb oder wie Ducatengold, und ist von der Natur mit etwa 10 pCt. Silber legirt, daher es für den ersten Anblick und auf dem Probierstein als reines Gold erscheint. Auch hat der Münzwardein Schlobey zu Hamburg ausgesagt, daß das Gold mit Silber versetzt gewesen sei. Dies allein weiset den Ring schon in die germanische Zeit oder die Bronze=Periode zurück, welche zugleich reich an Gold war. In Dänemark sieht man sie "für heilig" an und "hat man in ihnen die heiligen Ringe wiederzufinden geglaubt, welche als in der heidnischen Zeit bei der Eidesablegung gebraucht erwähnt werden. Es scheint nicht, daß sie um Handgelenke haben gebraucht werden können, wozu zwei gegen einander gekehrte Ausbauchungen, worin sie sich endigen, sie weniger bequem machen; sie sind dabei zu schmal für den Hals oder das Haupt. Ueberdies sind sie oft von reinem Golde und sehr massiv, so daß sie im Alterthume große Kostbarkeiten gewesen sein müssen".
Eine eingeleitete Untersuchung wird nichts Neues für die Alterthumskunde bringen.


|
Seite 386 |




|
Eine an Ort und Stelle am 2. April 1844 in Gegenwart großherzoglicher Domanial=Beamten durch den Unterzeichneten vorgenommene Nachgrabung hat kein Resultat gegeben. Der Acker war ein ehemaliges Erlenbruch und zum ersten Male gepflügt. Der Ring hatte nur wenige Zoll unter der Erdoberfläche gelegen. Die wässerige Brucherde lag weit und breit ungefähr 1 Fuß hoch ganz regelmäßig aus hartem, gelbrothem, eisenhaltigem Sande; die ganze Gegend umher ist völlig flach. Nirgends zeigte sich die geringste Spur von Erhöhung oder Scherben, überhaupt keine Spur irgend einer menschlichen Thätigkeit aus alter Zeit. Es leidet daher keinen Zweifel, daß der Ring einst entweder in dem Erlenbruche absichtlich versenkt oder zufällig verloren sei.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Bronze=Schwert von Schmachthagen.
In einem Bruche zu Schmachthagen bei Waren ward beim Moderfahren ein Bronze=Schwert gefunden und von dem Herrn von Behr=Negendank auf Torgelow etc. dem Vereine geschenkt.
Das Schwert gehört zu den ausgezeichnetsten Arbeiten der Bronzezeit. Es hat eine Griffzunge mit Nieten, ist länger, als gewöhnlich die Schwerter der Bronze=Periode zu sein pflegen, nämlich 3 Fuß lang, und wird gegen das Ende hin breiter, hat also ganz die antike Form der Bronzezeit. Es ist aber noch besonders geschmückt: dicht unter dem Griffe ist die Klinge 2'' lang ein wenig eingebogen und auf beiden Seiten des Randes jedesmal mit 3 Gruppen eingravirter concentrischer Halbkreise geschmückt, welche auch noch zweimal in senkrechter Stellung sich auf den Rand der Klinge fortsetzen; die Seiten der Griffzunge sind mit eingravirten Schrägelinien in Form von Spitzen verziert. Der erhabene Mittelrücken der Klinge, welcher der Ausbreitung der Klinge folgt, ist an beiden Seiten äußerst schön und regelmäßig von mehreren erhabenen Linien oder Bändern begleitet. Das Ganze ist hiedurch ein äußerst schönes und reinliches Kunstwerk.
Leider haben die Finder auch an diesem Kunstwerke die gewöhnliche Goldprobe versucht und dabei die Klinge in drei Stücke und den Griff so sehr zerbrochen, daß nur noch geringe Reste davon vorhanden sind und der Herr v. Behr=Negendank aus den wenigen Bruchstücken die Gestalt des Griffes nicht mehr zu erkennen im Stande war.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 387 |




|



|



|
|
:
|
Bronze=Schwert von Kreien bei Lübz.
Beim Moderfahren aus einem Loche auf dem Kreier Hoffelde, südlich vom Hofe, ist unter oder auf einem, tief in dem Moder liegenden Eichenstamme ein Schwert gefunden, aus der Zeit der Kegelgräber herstammend. Es ist aus Bronze, die aber etwas heller als gewöhnlich ist, ganz ohne Rost, bloß etwas schwarz angelaufen, zweischneidig und vollkommen scharf, so daß man es sogleich gebrauchen könnte. Auffallend ist die Länge der Klinge, welche 34 Zoll mißt, da sie sonst nur 22-26 Zoll beträgt. Auf beiden Seiten des Mittelrückens laufen 2 erhabene Längsstreifen und nach den Schneiden hin ist es hohl wie ein Rasirmesser geschliffen. Nahe am Handgriffe sind entgegenstehende Reihen concentrischer Halbkreise eingravirt. An den ebenfalls bronzenen Handgriff von 3 Zoll Länge ist die Klinge halbmondförmig angesetzt; wie es scheint, sind beide Theile aus einem Gusse. Der Handgriff hat am Ende einen kurzen viereckigen Dorn und auf demselben nach beiden Seiten hin einen aufwärts gekrümmten, etwas breit und flach gearbeiteten Zierrath, wie eine Parierstange, nur daß sie nicht am Ende der Klinge, sondern am Ende des Griffes sitzt; vielleicht sollte die Stange zum festern Halten mit der Hand dienen; die eine Seite ist abgebrochen und fehlt. An dem Fundorte sollen viele Kohlen in dem Moder gefunden sein. - Das ungünstige Wetter hat das Ausfahren des Moders seit dem Auffinden des Schwertes unterbrochen; sobald der Herr von Plato wieder mit dieser Arbeit beginnen wird, werde ich mich dahin begeben, um eine weitere Nachsuchung anzustellen, und dann über die Localität näher berichten.
Vietlübbe, im März 1844.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Merkwürdiger Stein aus einem Kegelgrabe von Gnoyen.
Vor einigen Jahren räumte der Herr Schulz, Müller zu Gnoyen, einen auf seinem Felde einige 100 Schritte südöstlich bei der Stadt gelegenen runden Erdhügel ab, in dessen Mitte eine große Menge Steine sich befand, also wahrscheinlich ein Kegelgrab. Ob sich Waffen aus Metall oder Urnen darin gefunden haben, weiß der Herr Schulz nicht, da nur die Menge Steine für ihn Werth hatte. Aber am Grunde dieser Steinmasse zog ein Stein seine Aufmerksamkeit auf sich, den er deshalb sorgsam nach Hause bringen ließ und vor der Thür als einen Sitz benutzt. Hier liegt er


|
Seite 388 |




|
noch vor dem, jetzt von dem dortigen Postmeister bewohnten Hause. Er ist von dem bisherigen Eigenthümer zur Verfügung des Herrn von Kardorff auf Remlin gestellt als Geschenk für den Verein; nur ist der Transport etwas schwierig. Der Stein hat ganz die Gestalt eines dicken Käses, nämlich im Umfange cirkelrund von 3 Fuß Durchmesser, die beiden Seiten flach, wie bei Mühlensteinen, aber an den Ecken wie ein Käse abgerundet; die Höhe beträgt 1 1/2'. Er besteht aus einem gelbgrauen, feinkörnigen und sehr harten Sandstein; seine Gestalt ist offenbar ein Werk der Kunst.
Vietlübbe, im September 1843.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendische Silbergeschmeide und
Münzen
aus der Gegend von Schwerin.
Im Juni 1843 fand ein Arbeiter bei einem Dorfe nicht weit von Schwerin, dessen Name dem Unterhändler entfallen ist, vielleicht Sukow, einen "Topf" mit alten Silbermünzen, unter denen auch mehrere Schmucksachen von Silber lagen. Der "Topf" ward sogleich zerschlagen, das Silber aber bei einem Goldarbeiter in Schwerin verkauft, welcher schon früher öfter dem Vereine manchen Fund gerettet hatte. Dennoch schmolz er, indem er die große Masse der gleichartigen Münzen nicht für bedeutend hielt, den größern Theil derselben ein, bewahrte jedoch von jeder der beiden Arten der Münzen 6 Stücke und sämmtlichen Silberschmuck für den Verein auf.
1) Die Münzen sollen eine Masse von ungefähr 20 Loth gebildet haben. Nach der Versicherung des Goldarbeiters bestanden sämmtliche Münzen nach genauer Durchsicht nur aus 2 Arten, von deren jeder er 6 Stücke aufbewahrte. Diese Münzen (vgl. unten Abschnitt IV) sind:
a. 6 sogenannte "wendische Pfennige", von der bekannten Art, mit einem an den Balkenenden mit Perlen gezierten Kreuze auf der einen, und einem Maltheserkreuze auf der andern Seite, auf jener Seite mit der Umschrift CR(quer)V(quer)X, auf dieser mit der Umschrift MCDB, Münzen, von denen man jetzt glaubt, daß sie in Magdeburg für die wendischen Länder geprägt seien. Sie werden in den ehemaligen wendischen Ostseeländern, namentlich in Meklenburg, nicht selten gefunden und fallen wohl ohne Zweifel um das Jahr 1000 oder in den Anfang des 11. Jahrhunderts. Beweise liefern z. B.


|
Seite 389 |




|
die Funde von Sternberg und Warlin, Jahresber. III, S. 103 u. 106, und V, S. 135-136, u. 131 flgd. - Die gegenwärtig gefundenen Pfennige sind ein wenig kleiner, als sie in der Regel zu sein pflegen.
b. 6 niedersächsische Nachbildungen köllnisch=ottonischer Pfennige von dem ebenfalls bekannten Typus, der in Meklenburg auch nicht selten vorkommt, auf der einen Seite mit einem Kirchengebäude, auf der andern mit dem entstellten Monogramm von Cölln: S. COLONIA, wie das Gepräge Jahresber. V, S. 140, genau bezeichnet ist. Diese Münzen sind ganz dieselben, welche schon öfter bei Schwerin und sonst in Meklenburg gefunden sind; vgl. Jahresber. V, S. 140 u. IV, S. 60-61, Not. 2. Nach dem Funde in der Lewitz, Jahresber. IV, S. 57 flgd., und andern Forschungen fallen auch diese Münzen in das 11. und 12. Jahrhundert.
2) Hiernach läßt sich die Zeit, in welche der Silberschmuck fällt, genau bestimmen. Alle Stücke sind gewunden oder Filigran=Arbeit, wie ähnliche Schmucksachen schon früher bei gleichen Münzen gefunden sind; vgl. Jahresber. V, S. 132, und VIII, S. 77. Die silbernen Schmucksachen sind:
a. ein aus zwei Dräthen gewundener, an den Enden offener und nach den Enden hin spitz auslaufender Fingerring, ganz wie ein solcher silberner Ring in Curland gefunden und in Kruse Necrolivonica Tab. 40 u. 42, Fig. d, abgebildet ist.

Bei der weiten Verbreitung dieses Silberschmucks und der silbernen Filigran=Arbeit, der so häufig mit kufischen Münzen zusammen gefunden wird, gegen Osten hin steht ein muhamedanischer Ursprung zu vermuthen.
b. ein großer Ohrring in Form eines dreieckigen Henkelkorbes von geflochtenem Silberdrath.



|
Seite 390 |




|
c. ein etwas kleinerer Ohrring, ganz von derselben Art.
d. ein gewundener Armring, aus zwei feinen Silberdräthen gewunden, an einem Ende am Schließhaken in eine schmale Platte mit einem Haken auslaufend.

e. eine Perle von Silberblech mit Silberdrath verziert; nach der Aussage des Finders sollen mehrere solcher Perlen vorhanden gewesen sein.

G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendischer Silberschmuck und wendische
und
altdeutsche Münzen von Remlin.
Wenige Wochen, nachdem der so eben beschriebene Fund von Silbersachen bei Schwerin gemacht war, brachte der Zufall einen ganz gleichen Fund ans Licht. Auf dem Bauerfelde von Remlin bei Gnoyen lag ein einzelner großer Granitblock; als dieser zum Zweck freierer Ackerbenutzung im Frühling d. J. gesenkt werden sollte, fand man unter diesem Steine einen Topf mit ungefähr 13 Loth Silbersachen, welche der Eigenthümer des Gutes, der Herr von Kardorff auf Remlin, dem Vereine zum Geschenke brachte. Der Topf war leider ganz zerbrochen.
Die gefundenen Gegenstände bestehen aus 130 Silbermünzen, theils altdeutschen Münzen, theils sogenannten Wenden=


|
Seite 391 |




|
pfennigen oder andern für die Wendenländer gemachten Nachbildungen, und mehrern Schmucksachen aus Silber. Unter den Schmucksachen befinden sich einige Stücke, welche den bei Schwerin gefundenen völlig gleich sind, also ebenfalls ungefähr in die Zeit um das J. 1000 n. C. fallen; die Münzen, welche unter Abschn. IV näher beschrieben und beleuchtet sind, geben dieselbe Zeitbestimmung. Das Wichtige und Interessante dieses Fundes liegt also in der Möglichkeit einer Zeitbestimmung für gewisse Gegenstände der Vorzeit; überdies waren Schmucksachen dieser Art früher noch nicht in Meklenburg zur Untersuchung gekommen. Die Sachen gehören also ohne Zweifel den Wenden der letzten Periode des Heidenthums an. Hiemit stimmt auch die Aeußerung Helmold's überein, welcher II, cap. 13, §. 8 ausdrücklich sagt, daß die Wenden zur Zeit kriegerischer Unruhen ihre goldenen, silbernen und sonstigen Kostbarkeiten zu vergraben pflegten (Quoties autem bellicus tumultus insonuerit, - - aurum atque argentum et preciosa quaeque fossis abdunt). Die Erfahrung hat auch gelehrt, daß in Pommern die meisten Silbersachen unter große Steine vergraben gefunden sind.
Die Schmucksachen bestehen aus Silber=Filigran und Kettenwerk. Die Filigran=Arbeit gehört der Wendenzeit oder der Eisen= und Silber=Periode an; feines Kettenwerk fällt ebenfalls in die letzte Periode des Heidenthums, wie vorzüglich Kruse's Necrolivonica beweisen, in welchem Werke die meisten Alterthümer aus Kettenwerk bestehen.
Die silbernen Schmucksachen sind folgende:
1) ein Ohrring in Form eines kleinern dreieckigen Henkelkorbes aus geflochtenem Silberdrath, ganz wie dergleichen in dem schweriner Funde vorkommen und einer derselben S. 389 zu Nr. 2. b. abgebildet ist.
2) ein Ohrring, ebenfalls korbartig aus Silberdrath hübsch gearbeitet, wie er hieneben abgebildet ist.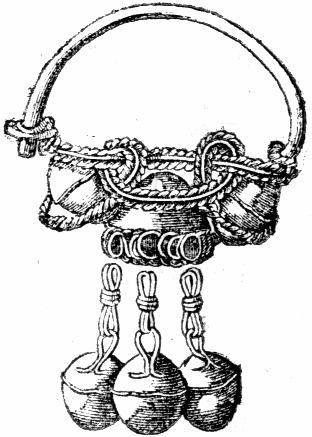
Am Ende des Ringes nach unten hin sitzen zwei hohle Silberperlen; zwischen beiden nach unten hin sitzt eine nach unten geöffnete, halbe Perle oder Glocke, welche am Rande mit feinem Flechtwerk verziert ist. Drei größere Oeffnungen in diesem Flechtwerke deuten darauf hin, daß hier etwas eingehängt gewesen sei. Wahrscheinlich hing in jeder Oeffnung an einem Kettchen eine Perle, wie deren drei unter dem Ohrringe, jedoch nicht in Verbindung mit demselben, ab=


|
Seite 392 |




|
gebildet sind; es ist nur noch eine von diesen an einem Kettchen hangenden Perlen vorhanden, es hat jedoch der Ohrring nach unten hin gewiß drei eingehängte Verzierungen gehabt: die Ergänzung der übrigen ist daher anpassend erschienen.
3) zwei Paar Ohrringe von platter Form, wie einer hineben abgebildet ist.
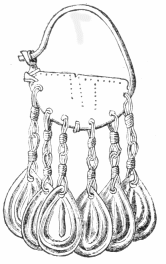
Um die untere Hälfte des Ringes ist ein Silberblech gebogen, welches die untere Hälfte der Ringöffnung füllt. In den Rand sind an kleinen Ketten 6 blätterförmige und mit getriebenen Rändern und Rippen verzierte feine Silberplättchen eingehängt. Einige von diesen Ohrringen sind in den Verzierungen sehr zerbrochen.
Die Münzen sind unten (Abschnitt IV) in der Beschreibung der wichtigern Münzfunde von dem Herrn Pastor Masch näher beleuchtet.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Twietfort bei Plau.
Durch den Küster Lange zu Karbow erfuhr ich, daß zu Twietfort bei der Anlegung neuer Gräben Urnen zum Vorschein gekommen seien. Deshalb begab ich mich im Interesse des Vereins dahin und fand in einem Graben des neu angelegten Weges von Ganzlin nach dem twietforter Forsthause an 2 Stellen die Trümmer von Urnen; die eine war schwarz und fast glänzend; unter den Knochen fand sich noch ein Bruchstück von einer eisernen Broche. Dieses und der Umstand, daß besonders in dem neuen Wege einzelne Stellen eben so mit Dammsteinen belegt sind, wie auf dem Helmer Wendenkirchhofe, spricht dafür, daß auch hier ein solcher Kirchhof sei. Der Boden besteht aus gelbem und rothem Sande. Im Herbste hoffe ich den Platz näher zu untersuchen.
Vietlübbe, im August 1843.
J. Ritter.


|
Seite 393 |




|



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof auf dem Mahnkenberge bei Bützow.
Der Mahnkenberg bei Bützow, in der Nähe der
Strafanstalt Dreibergen, ist ein großer
Wendenkirchhof gewesen; vgl. unten Abschnitt
III, 1 "Die wendische Fürstenburg
Bützow". Unter den vielen Urnenscherben und
andern Alterthümern, welche der Herr Seidel dort
gefunden hat, findet sich auch eine Heftel
(broche), wie sie oben S. 343 abgebildet ist,
auf deren Nadelscheide auf der äußern Fläche mit
kleinen Parallelstrichen ein Kreuz mit
gebrochenen Balken
 , wie es in Frid. Franc. Tab.
XXXIV, Fig. 2 b. steht, eingegraben ist, - ein
Symbol, welches (knezegranitza?) sich in
heidnischen Zeiten bekanntlich öfter findet.
, wie es in Frid. Franc. Tab.
XXXIV, Fig. 2 b. steht, eingegraben ist, - ein
Symbol, welches (knezegranitza?) sich in
heidnischen Zeiten bekanntlich öfter findet.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
e. Vorchristliche Alterthümer auswärtiger Völker.
Römische Bronze=Vase von Vorland bei Grimmen.
Der Herr Dr. von Hagenow zu Greifswald hat dem Vereine einen Gypsabguß von der in seiner Sammlung befindlichen, im J. 1835 zu Vorland bei Grimmen ausgepflügten, äußerst schönen und merkwürdigen Bronze=Vase geschenkt. Der Herr Dr. von Hagenow beschreibt diese kostbare Reliquie im Vierzehnten Jahresber. der Gesellsch. für Pommersche Gesch. u. Alterth. vom 22. Juni 1839, Stettin 1840, S. 58, also: "Ein schönes Gefäß, 4'' 3''' hoch und 4'' weit, von römischer Arbeit. Es ist unten offen und nicht bemerkbar, daß ein Fuß abgebrochen ist. Die untere Oeffnung hält 1'' 5''' im Durchmesser; dann wölbt sich das Gefäß kugelförmig und zieht sich oberwärts plötzlich in einen Hals von 7''' Länge und 2'' 6''' Weite zusammen, mit auswärts umgekrämptem Rande. Dieser Rand hat an einer Seite einen Schlitz und es ist ersichtlich, daß ein Deckel dazu gehörte, mit einem Zahn im Innern, der in den Schlitz eingriff und nach halber Umdrehung den Deckel gegen das Abfallen sicherte. Das Aeußere ist mit vier äußerst schön geformten hoch aufliegenden Köpfen geziert, die an 4 Seiten einander gegenüber stehen. Man erkennt in ihnen den ältern bärtigen Silen und ihm


|
Seite 394 |




|
gegenüber den jüngern Bacchus, zwischen beiden die Köpfe zweier Bacchantinnen von höchst edler griechischer Form. Reben und Weinlaub umgeben die Gruppe oberwärts; unterwärts aber sind die Köpfe durch vier zusammenlaufende architectonische Blätter getrennt. Oberwärts, wo der Hals beginnt, stehen noch 8 vierblätterige Rosetten im Kreise herum, welche in der Mitte durchbohrt sind und zu der Vermuthung berechtigen, daß die Vase mit kostbaren Specereien gefüllt vielleicht bei Bacchanalien gebraucht wurde, wo dann der Duft des wohlriechenden Inhalts sich nach und nach durch diese Oeffnungen verbreitete".



|



|
|
:
|
2. Der unbestimmten Vorzeit.
Urnen aus der Lausitz,
von Königswartha bei Budissin in der
sächsischen Ober=Lausitz.
Der Herr Reichsfreiherr Albert von Maltzan auf Peutsch hat, in dem Streben nach einer comparativen Sammlung von Alterthümern für unsern Verein, 5 Urnen aus der sächsischen Ober=Lausitz erworben und dieselben mit einem Berichte des Finders, Herrn Pfarrers Körnig zu Königswartha, dem Vereine geschenkt.
Der Herr Pfarrer Körnig berichtet über den Fund Folgendes:
Es sind zu Königswartha bei Budissin bis jetzt zwei heidnische Begräbnißplätze entdeckt worden.
Im letzten Jahrzehend des vorigen Jahrhunderts ließ der damalige Besitzer von Königswartha, Johann Friedrich Carl Graf von Dallwitz, auf einem freien Platze an der östlichen Seite von Königswartha, die Winze genannt, zur Verschönerung des Ortes Spaziergänge anlegen. Bei Ausgrabung der Gänge entdeckte man daselbst einen heidnischen Begräbnißplatz und fand eine große Anzahl Aschenkrüge und Urnen. Dieselben wurden sorgfältig gesammelt und in einem eignen Antikencabinet aufbewahrt. Auch ließ der Graf sämmtliche Urnen und die darin befindlichen Gegenstände abmalen und legte diese Gemälde unter dem Titel: Koenigswartha subterranea, nieder. Nach seinem Tode acquirirte die Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz diese Sammlung, in deren Händen sie sich noch bis auf den heutigen Tag befindet.


|
Seite 395 |




|
Nur ein einziger Fall ist mir bekannt, daß in hiesiger Gegend etwas Werthvolles aufgefunden ist. In Wagners Budissiner Chronik vom Jahre 1692 steht nämlich die Nachricht, daß 1596 von einem Hirtenmädchen bei Königswartha ein gewundener Golddrath aufgefunden worden sei.
Als im Jahre 1833 eine neue Chaussee von Budissin über Königswartha bis an die preußische Grenze nach Hoyerswerda zu gebauet ward, stieß man bei Fertigung der Chausseegräben und bei Aufgrabung des Kieses zur Bedeckung der Chaussee, in der Nähe des hierher gehörigen, eine gute Viertelstunde von hier entfernten Dorfes Kamenau, auf eine Menge Aschenkrüge und Urnen. Sie wurden leider von den Chausseearbeitern, welche darin Gold suchten, größtentheils zertrümmert. Nur äußerst selten ließ sich im Fortschritte der Arbeit eine unversehrte Urne auffinden: denn theils waren sie wahrscheinlich beim frühern Fällen der Bäume zertrümmert worden, theils waren sie von Baumwurzeln durchwachsen, theils zerfielen sie, sobald die äußere Luft sie berührte, bei der kleinsten Bewegung in Stücke. Mit vieler Mühe habe ich fünf Urnen ziemlich unverletzt gewonnen.
Der Platz, auf dem die Urnen ausgegraben sind, ist ein bedeutender Sandhügel, in welchem sich viel Kies befindet. Die Urnen, welche ich fand, standen ungefähr 6 Zoll tief.
So weit der Herr Pfarrer Körnig.
Die 5 hellbraunen Urnen tragen im Allgemeinen sehr bezeichnend den Typus der Urnen in Schlesien und in der Lausitz und scheinen der letzten Zeit der Bronze=Periode anzugehören; die in ihnen gefundenen Geräthe sind noch von Bronze mit nicht sehr tiefem, nicht edlem Rost; die Urnen sind sehr wohl erhalten und ihre Formen scharf und rein ausgeprägt. Es sind folgende Urnen:
1) eine Urne, 8'' hoch, von der Grundform der Urnen der Kegelgräber, wie sie in Frid. Franc. Tab. V, Nr. 9 und 10 abgebildet sind, mit 2 kleinen Henkeln; sie war ganz mit Sand gefüllt, in der Nähe lagen verbrannte Knochen von einem erwachsenen Menschen;
2) eine Urne, 7'' hoch, mit schalenförmigem, niedrigen Bauche und hohem Halse, von der eigenthümlichen, schlesischen Form, wie in Büschings Schles. Altth., Titel, Fig. 2, und Klemm Germ. Alterthk. Tab. XIII, Fig. 5, ähnliche abgebildet sind; der Inhalt bestand nur in Sand;
3) eine kleine Urne, gegen 4'' hoch;
4) ein kleiner Krug, 5'' hoch, mit hohem, engen Halse und zugespitztem Boden, nicht zum Stehen eingerichtet;


|
Seite 396 |




|
5) eine kleine Urne, mit Sand und verbrannten Kinderknochen gefüllt. In dieser Urne lagen: der Knopf einer Nadel von Bronze und ein mit den Enden überfassender, dünner Ring von Bronze, 1 1/2'' weit.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
3. Des Mittelalters.
Mittelalterliche Kanne mit Kreuz auf dem Boden.
Auf dem Burgwalle von Bützow (vgl. Abschn. III, 1), welcher bis zum J. 1263 eigentliche Residenz der Bischöfe von Schwerin war, fand der Herr Seidel zu Bützow eine kleine, hohe Kanne von festem, blaugrauen Thon, mit einem großen Henkel, welche ohne Zweifel aus dem Mittelalter stammt. Auf dem Boden dieses Gefäßes steht im Relief in einem Kreise ein gleicharmiges Kreuz. Ein ähnliches Gefäß ward auch auf dem Burgwalle von Neuburg gefunden; vgl. Jahrb. VII, S. 171. Bekanntlich ward zu Stendal 1826/7 ein ganzer Brennofen voll solcher kugeliger Gefäße, mit einem Kreuze auf dem Boden, gefunden, welche ohne Zweifel dem frühen Mittelalter angehören (vgl. H. v. Minutoli Beschreibung einer zu Stendal aufgefundenen alten heidnischen Grabstätte. 1827).
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Henkelkrug von Böhlendorf,
Geschenk des Herrn Majors von Kardorf auf Böhlendorf. Dieses völlig erhaltene Gefäß ward zu Böhlendorf in dem sogenannten See, einem ansehnlichen Wasserbehälter, bei dem Ausmodden desselben im Herbste 1843 mehr als 20 Fuß tief unter dem gewöhnlichen Wasserstande im Moorgrunde des Sees gefunden. Es ist ein mittelalterlicher Henkelkrug aus blaugrauem, fein geschlemmten Thon, mit schwärzlicher Oberfläche, mit einem kugeligen Bauche mit 3 von innen herausgedrückten Knoten, statt der Füße, mit einem hohen, eingezogenen, quer gereiften Halse, an welchem ein großer, breiter, 5'' hoher Henkel sitzt. Das ganze Gefäß ist gegen 13'' hoch, 10'' im Bauche und 5'' im Halse weit. Es gleicht ganz dem Henkelkruge von Rehna, welcher ebenfalls 8 Fuß tief im Moor gefunden ward; vgl. Jahresber. III, S. 92.


|
Seite 397 |




|



|



|
|
|
Fingerring von Beckerwitz.
Der Herr Pastor Erfurth, früher zu Hohenkirchen, jetzt zu Picher, hat dem Vereine einen Fingerring von Messing übergeben, welchen der Schullehrer Rath zu Beckerwitz, Pfarre Hohenkirchen, in seinem Garten gefunden und ihm früher geschenkt hat. Der Ring ist ein breiter Reif von Messing mit runder Oberfläche, an jeder Seite von einem dünnen Rande begrenzt, der durch eine geperlte Vertiefung von dem Reif abgesondert ist. Auf der Außenfläche steht ohne Unterbrechung:

Der Zwischenraum vor dem Buchstaben M ist beide
Male ein wenig größer, als zwischen den andern
Buchstaben; es steht also zwei mal das Wort
 da. Die Buchstaben sind mit
einem Meißel in einzeln stehenden graden Linien
leicht, jedoch tief genug eingeschlagen; auch
das M besteht aus einer Zusammenstellung gerader
Linien und erscheint dadurch eckig. Durch diese
Art der Einprägung, durch den Mangel einer
schönen und regelrechten Verbindung der Linien
haben die Buchstaben
da. Die Buchstaben sind mit
einem Meißel in einzeln stehenden graden Linien
leicht, jedoch tief genug eingeschlagen; auch
das M besteht aus einer Zusammenstellung gerader
Linien und erscheint dadurch eckig. Durch diese
Art der Einprägung, durch den Mangel einer
schönen und regelrechten Verbindung der Linien
haben die Buchstaben
 und
R
ein runenhaftes
Ansehen und könnten auch leicht für
N
und
K
angesehen werden, müssen aber ohne
Zweifel gelesen werden, wie hier. Der Herr
Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen ist auch
dieser Ansicht.
und
R
ein runenhaftes
Ansehen und könnten auch leicht für
N
und
K
angesehen werden, müssen aber ohne
Zweifel gelesen werden, wie hier. Der Herr
Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen ist auch
dieser Ansicht.



|



|
|
:
|
Schwert von Schwaan.
Bei Schwaan, dicht vor dem Mühlenthore, ward beim Graben in einer Wiese ein eisernes Schwert gefunden und dem Vereine von dem Herrn Gerichtsrath Ahrens geschenkt. Die Klinge ist 2' 7'' lang, von 2 1/4'' bis 1 1/2'' breit, an der Spitze plötzlich im Dreieck abgeschnitten, zweischneidig, an jeder Seite mit einer breiten Längsfurche, welche 2' weit hinabläuft. Der Griff, dem der Knopf fehlt, ist 9'' lang; die Parierstange, in Form einer einfachen, etwas über 1/8'' dicken, viereckigen Stange, ist eben so lang. Das Schwert gleicht ganz dem in Annaler for nord. oldkynd., 1838, p. 111, abgebildeten, in einem heidnischen Grabe jüngerer Zeit gefundenen Schwerte, welches jedoch einen Knopf hat.
Das Schwert von Schwaan ist durch eine Inschrift merkwürdig, welche im obern Theile der Längsfurche an jeder Seite der Klinge mit Bronze eingelegt ist. Die Buchstaben sind 3/8 Zoll hoch und ganz im Charakter des 12. oder 13. Jahr=


|
Seite 398 |




|
hunderts; ich würde sie lieber dem 12. als dem 13. Jahrhundert zuschreiben.
Die Inschriften lauten, ohne Unterbrechung:
1) auf der einen Seite:

2) auf der andern Seite:

Der Herr Justiz=Rath Thomsen zu Kopenhagen sieht
hierin einen abgekürzten lateinischen
Segenswunsch und theilt
 . u. s. w. oder ähnlich ab. Diese
Erklärung ist ohne Zweifel richtig und es ist
darnach abzutheilen,
. u. s. w. oder ähnlich ab. Diese
Erklärung ist ohne Zweifel richtig und es ist
darnach abzutheilen,
1) auf der einen Seite:
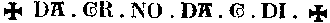
d. i.
 DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam
DeI
(oder deO).
DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam
DeI
(oder deO).
2) auf der andern Seite:

d. i.
 DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam Deo.
DA
GR
atiam
NO
bis,
DA
Gloriam Deo.
Nach allen Verhältnissen scheint das Schwert aus der Zeit der Züge der Dänen nach Wenden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, z. B. aus dem J. 1159 (vgl. Jahrb. VI, S. 90) zu stammen, indem die Dänen öfter die Warnow hinauf bis zur Burg Werle bei Wik in der Nähe von Schwaan geschifft sind und hier wohl öfter gekämpft haben.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Ein jüdischer Probierstein und Schächterstempel,
von schwarzem Kieselschiefer, 1 1/2 " lang
1/2 "breit, 1/4 " dick. An dem einen
Ende ist verkehrt, zum Stempeln,
 , d. i. Tag 3, an dem andern
, d. i. Tag 3, an dem andern
 , d. i. Tag 4, eingegraben. Die
jüdischen Schächter haben für jeden Wochentag
einen Stempel, mit denen sie das an jedem Tage
geschächtete Fleisch stempeln, da es innerhalb
dreier Tage gegessen werden muß. Nach
Kosegartens Ansicht "scheinen die
Schriftzüge grade nicht alt; aber die hebräische
Quadratschrift hat sich überhaupt seit 800 bis
1000 Jahren fast gar nicht verändert".
Daraus aber, daß ein grade nicht regelmäßiger
Stein, der freilich zugleich zu einem andern
Erwerbszweige diente, gewählt ist, möchte sich
auf ein ziemlich hohes Alter schließen lassen;
in neuern Zeiten haben die Schächter förmliche
Pettschafte. Gefunden ist dieser Stein zu Remlin
bei Gnoyen in einer Mergelgrube und geschenkt
von dem Herrn von Kardorff auf Remlin.
, d. i. Tag 4, eingegraben. Die
jüdischen Schächter haben für jeden Wochentag
einen Stempel, mit denen sie das an jedem Tage
geschächtete Fleisch stempeln, da es innerhalb
dreier Tage gegessen werden muß. Nach
Kosegartens Ansicht "scheinen die
Schriftzüge grade nicht alt; aber die hebräische
Quadratschrift hat sich überhaupt seit 800 bis
1000 Jahren fast gar nicht verändert".
Daraus aber, daß ein grade nicht regelmäßiger
Stein, der freilich zugleich zu einem andern
Erwerbszweige diente, gewählt ist, möchte sich
auf ein ziemlich hohes Alter schließen lassen;
in neuern Zeiten haben die Schächter förmliche
Pettschafte. Gefunden ist dieser Stein zu Remlin
bei Gnoyen in einer Mergelgrube und geschenkt
von dem Herrn von Kardorff auf Remlin.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 399 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Ortskunde.
Der Hart.
"in deme dorpe to Panstorpe dat licht up deme Harte",
wie er das Dorf von seinem Vater geerbt habe. - In Rostock lebte, sicher im 13. Jahrh., eine Bürgerfamilie: vom Hart.
Noch im J. 1506 bei der Ausfertigung des Roßdienst=Registers kommt der Hart als ein eigener District des Landes vor. Damals leistete die Ritterschaft des Districts folgende Roßdienste:


|
Seite 400 |




|
2 Eler Levetzow to Gorloess (Gorschendorf?).
3 Otto Wutzen (zu Teschow).
2 Hinrick vom
Hagen to Mistorp.
2 Kersten Passow to
Mistorpe.
2 die Stale to Panstorpe.
Das Land Kalen lag unmittelbar nördlich vom Hart.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Heberegister über die Pfarren Neuenkirchen, Heiligenhagen und Hanstorf.
Die alte Topographie ist oft von großer Bedeutung für die Geschichte und staatswirthschaftliche und staatsrechtliche Fragen. Besonders interessant ist die Topographie der Abtei Doberan und deren Umgebung, weil sie die ältesten Verhältnisse unserer Geschichte berührt, jedoch viel zu schwierig, als daß sie schon jetzt mit einiger Sicherheit aufgeklärt werden könnte.
Ebenfalls interessant ist die Topographie derjenigen Pfarren, welche an die Abtei Doberan und die Pfarre Satow, den alten Klosterhof des Mutterklosters Amelungsborn, grenzen.
Durch einen Zufall habe ich alte Nachrichten über diese Pfarren aufgefunden und zwar in einem Fragmente eines Heberegisters. Dergleichen alte Register, welche fast alle verschwunden sind, gehören in Meklenburg so sehr zu den Seltenheiten, daß jedes kleine Bruchstück willkommen ist. Das Fragment ist ein fast handbreites Stück Pergament in Folio, welches der Länge nach aus einem Bogen geschnitten und beim Heften als Rücken eines "Auszugs aus dem bützowschen Amtsregister 1616/17" benutzt ist.
Die Handschrift stammt noch aus dem 14. Jahrhundert. Die 3 groß gedruckten Ueberschriften der Pfarren sind ganz roth geschrieben, die Anfangsbuchstaben der Absätze sind roth durchstrichen.


|
Seite 401 |




|
Parrochia Nienkerke.
Parrochia Nygenkerke
1
).
Jordenshagen
2
). III mans.
. . .
. . . . . ord. Item III tre.
Item de palude
III tremod. au
Summa silig. III tre. Summa
o
Summa auene XII tre.
Curia Bletze
3
). I. mans. et di
VI mod.
ordei XVIII a
Wokrente
V mans. qui
tre. ord. II
tre. auene.
Parrochia Indaginis
sancti Spiritus.
Parrochia Indaginis sancti
S.
gestes hagen
4
)
Ipsa
indag
(hilgenghesteshaghen.sec.15.)
I quartale
mansus dat VIII m
mod. ord. II
 tre. auene.
tre. auene.
Summa silig.
V
 tre. Summa
tre. Summa
Summa auene XX
tremod. et VI
Parrochia Johannes-
hag . .
Parrochia
Johanneshag . .
5
)
Villa
Ghorowe
V
mans.
mod. silig. IX mod. ord.
Summa
silig. III tre IIII
Summa ord. III
 tre. III.
tre. III.
Summe auene X tremod.
Hartwighesdorp
6
) IX mans. (Hastorp sec.
16.)
mod. silig. IX mod. ordei
Summa
silig. VI
 tre. m
tre. m
Summa ordei VI
 tre.
tre.
Summa auene XIX tre. et
V
Item ibidem IIII jugera da
I mod.
ordei. IIII m
Konowe
 mans. quilibet d
mans. quilibet d


|
Seite 402 |




|
X mod. ordei XXVI mod.
Summa silig. III
 tre. m
tre. m
Summe ord. III
 tre. m
tre. m
Summa auene
 tre. IIII m
tre. IIII m
Bliscowe I
mansus qui
. . . . . mod. ord. X m.
S. . . . . g. VIII mod. . . ord.
Die Rückseite ist auch beschrieben; da diese aber die rechte Seite des Registers enthält und mit der linken Seite die Namen abgeschnitten sind, so ist hier aus den wenigen Fragmenten nichts zusammenzustellen. Nur in der vierten Zeile von oben steht
unter einer neuen Pfarre
n (rothgeschrieben)
ipsum opidum XVIII mans. quilibet
g. cum pouizen.
In der Mitte steht:
and III tremod. auene
kotland XV mod. auene.
land et kotland IIII tre. et III mod.
Und am Ende
varbrade XVIII mans.
Dies ist das einzige Bemerkenswerthe aus fol. vers.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 403 |




|



|



|
|
:
|
III. Zur Baukunde.
1. Der vorchristlichen Zeit.
Die wendische Burg Bützow und die heidnischen Wohnplätze in deren Nähe.
Die Burg Bützow oder Butissow war eine alte wendische Fürstenburg. Bei der Dotirung des Bisthums Schwerin am 9. September 1171 schenkte der Fürst Pribislav demselben das Land Bützow oder die Burg Bützow mit dem dazu gehörenden Lande (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 25, 35 flgd.). Das Land Bützow ward bischöfliches Tafelgut und der Bischof hatte seine eigentliche Residenz zu Bützow. Schon in den ersten Jahrzehenden ward die deutsche Stadt Bützow gegründet; der Bischof aber wohnte im Anfange auf der alten fürstlichen Burg, bis diese im J. 1263 in einer Fehde gegen den übermüthigen Bischof Hermann I. Grafen von Schladen von den meklenburgischen Landesherren erobert ward (vgl. Lisch Maltzan. Urk. I, Nr. IX.). Zu derselben Zeit ward die neue Bischofs=Residenz neben der Sadt, das jetzige Criminal=Collegium, gegründet.
Die alte Burg Bützow ist nun ohne Zweifel der jetzt sogenannte Hopfenwall. Außerhalb der Umwallung der Stadt, nordwärts, nicht sehr weit von dem Criminal=Collegium oder der mittelalterlichen Bischofs=Residenz, ragt in den Burgsee ein viereckiges Plateau hinein , von der Stadt durch tiefe Moorwiesen getrennt, an der entgegengesetzten Seite vom See bespült; der Wall liegt in der Richtung des Warnowthales, der Burg Werle bei Wiek gegenüber, da man von dem Burgwall Werle die Stadt Bützow sehen kann. Der Wall hat also ganz die Lage und Befestigungsweise der wendischen Festen und gleicht am meisten den Burgwällen von Rostock, Werle und Rahden (bei Sternberg), welche auch von einer Seite von Wasser bespült werden. Der regelmäßige Wall ist ohne Zweifel in dem tiefen Moor durch Kunst aufgetragen. Er ist viereckig, ungefähr 400 Schritt im Umfange und ungefähr 16 Fuß hoch. Vor ungefähr 30 Jahren war er noch nicht beackert, sondern theilweise mit Dornen bewachsen. Ungefähr 1 bis 2 Fuß tief unter der Ackerfläche liegt eine große Brandschicht, bestehend aus Ziegelschutt, Kalk, roth gebranntem Lehm und Kohlen; in dieser Brandschicht, welche oft noch tiefer reicht, finden sich häufig große, mittelalterliche Ziegelsteine


|
Seite 404 |




|
und sehr viele Scherben von blaugrauen, thönernen Gefäßen des Mittelalters, auch allerlei eiserne Geräthe. Der achtbare Schuhmacher Herr F. Seidel, welcher mit Eifer und sehr richtiger Einsicht die Alterthümer Bützow's verfolgt, hat seit vielen Jahren ein wachsames Auge auf alle bemerkenswerthen Stellen der Stadt und der Umgegend gehabt und ununterbrochen geforscht und gesammelt; die vieljährigen Sammlungen und Beobachtungen dieses anspruchslosen Geschichts= und Alterthumsfreundes sind für die gegenwärtigen Forschungen von großem Werthe gewesen. Der Herr Seidel besitzt aus dem Hopfenwalle einen wohlerhaltenen mittelalterlichen Henkeltopf mit einem Reliefkreuze unter dem Boden (vgl. S. 396). Nach dem Berichte desselben sind auf dem Walle öfter große Massen großer Ziegel ausgebrochen. Diese Reste einer zerstörten mittelalterlichen Burg stammen also ohne Zweifel aus der Belagerung der Bischofsresidenz im J. 1263, nach welcher die Residenz vom Walle verlegt ward.
Außer diesen mittelalterlichen Trümmern finden sich auf dem Hopfenwalle aber auch sehr viele Scherben aus der wendischen Zeit, mit zerstampftem Granit und Glimmer durchknetet und mit denselben Verzierungen geschmückt, welche die Scherben auf dem heidnischen Burgwalle von Werle bezeichnen, ferner Lehmklumpen mit Stroheindrücken, glasige Schlaken, eiserne Geräthe aus der Wendenzeit.
Es ist also keinem Zweifel unterworfen, daß der Hopfenwall die ehemalige wendische Fürstenburg sei, welche im 13. Jahrh. auf einige Zeit den Bischöfen zur Residenz diente.
Der Burg gegenüber reicht in den Burgsee eine Halbinsel hinein, welche der Nonnenkamp heißt, auf welcher das vom Bischofe Berno gestiftete, von den Wenden wieder zerstörte Nonnenkloster (vgl. Jahrb. VIII, S. 2 flgd.) gestanden haben soll.
Der Burg nördlich gegenüber auf dem festen Lande, jenseits des Sees, an diesem, zwischen der Stadt Bützow und dem Dorfe Parkow, neben der Feldmark des schon im 14. Jahrh. gelegten Stadtdorfes Zarnin, liegt ein großes Stadtfeld, noch heute der Freiensteinsberg (vgl. Jahrb. VIII, S. 4) genannt. Im vorigen Jahrhundert lagen hier noch auf Pfeilern große Steine (vielleicht ein altes Hünengrab? oder wirklich ein Opferaltar?) (vgl. Mantzels Bützowsche Ruhestunden III, S. 13), von denen einige Höhlungen hatten (vgl. Mantzel Bütz. Ruhest. XI, S. 67. und XIII, S. 22). Schon vor 1761 wurden aber die Steinanhäufungen auseinander gebracht und mehrere große Steine versenkt (vgl. Mantzel a. a. O. III, S. 13); nach dem Berichte des Herrn


|
Seite 405 |




|
Seidel sind nach der Ueberlieferung die letzten Steine zu den Fundamenten der viergängigen Mühle vor dem Wolker Thore verwandt worden.
Westlich von dem Freiensteinsberge, neben der Strafanstalt Dreibergen, liegt der Mahnkenberg, ein beackerter Sandberg, dessen eine Hälfte zum bützowschen Stadtfelde, die andere zum fürstlichen Bauhofe, jetzt zum Dorfe Pustohl gehört. Seit dem J. 1838 ward der Pustohlsche Theil zum Bau der Strafanstalt Dreibergen abgefahren, wobei sich ergab, daß der Berg ein Wendenkirchhof gewesen sei. Es fanden sich sehr viele Urnen, welche aber alle zertrümmert sind, und viele Urnenscherben. Die schüsselförmigen Urnen sind zum größten Theile mit eingedrückten Puncten von einem laufenden gezahnten Rade verziert, mit durchbohrten Knöpfen oder Henkelchen versehen und häufig mit einem schwarzen Ueberzuge bedeckt, haben also alle Merkmale der Wendenkirchhöfe. In den Urnen fanden sich Knochen und Asche, die bekannten Hefteln (broches) der Wendenkirchhöfe, aus Bronze viel und auch aus Eisen, eisern Messer, eine Schnalle aus Bronze etc., welches Alles in der Sammlung des Herrn Seidel aufbewahrt wird (vgl. S. 393).
Westlich von diesem Berge, vor dem rühner Thore, nahe bei Bützow, durch einen Landweg von dem neuen Friedhofe getrennt, liegt ein anderer Berg, Klüschenberg (Klause, Klüschen?) genannt, von welchem seit undenklichen Zeiten Sand nach Bützow gefahren wird. Der Berg ist sehr reich an Versteinerungen, aber auch an Alterthümern. Es finden sich hier sehr viele Scherben von wendischen Urnen mit wendischen Alterthümern, z. B. Hefteln von Bronze, Spindelsteine, Bernsteinperlen, aber auch viele Scherben von mittelalterlichen Gefäßen aus blaugrauem Thon aus der ersten Zeit des Christenthums. Dieser Berg scheint daher ein wendischer Wohnplatz gewesen zu sein, der noch bis in die christlichen Zeiten bewohnt ward.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 406 |




|



|



|
|
:
|
2. Des Mittelalters.
a. Weltliche Bauwerke.
Die mittelalterlichen Burgwälle von Neuenkirchen und Boldenstorf.
Im Jahresber. III, S. 123 hatte der Herr Hülfsprediger Günther einen "Wendenkirchhof" zu Neuenkirchen angezeigt und im Jahresber. VII, S. 32 über denselben berichtet. Im Jahresber. VII, S. 32 war schon die Vermuthung ausgesprochen, daß dieser für einen "Wendenkirchhof" ausgegebene Platz eine mittelalterliche "Burgstätte" sei. Diese Vermuthung ist jetzt durch genauere Nachforschungen bestätigt.
Der Herr Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan hatte im April d. J. durch den Schullehrer Schultz zu Neuenkirchen und durch den Organisten Schultz zu Schwaan Scherben sammeln lassen, und hatte sich am 1. Nov. d. J. selbst nach Neuenkirchen begeben. Der Herr Gerichtsrath Ahrens ließ in Neuenkirchen an der Landstraße 2 bis 3 Fuß tief und tiefer graben und fand überall viel Scherben, Schutt, behauene Steine, Knochen u. s. w.; Scherben wurden auch überall auf dem Felde in Menge gefunden. Alle diese Scherben sind ohne Ausnahme von mittelalterlichen Gefäßen aus fein geschlemmtem, blaugrauen Thon, von kugeliger Gestalt, mit großen und starken Henkeln, mitunter mit drei kurzen Beinen. Es ist unter den Scherben keine einzige heidnischen Ursprunges. Die Stelle ist also ohne Zweifel ein mittelalterlicher Burgplatz.
Der Herr Gerichtsrath Ahrens bemerkt dazu: "Neuenkirchen ist mit Wiesen und Niederungen umgeben, liegt aber etwas erhaben, wie auf einem alten Burgplatze. Nach der Reinstorfer Scheide hin, dem Bache nahe, scheint ein Wall gewesen zu sein. Dort ist eine Salzquelle; das Wasser im Graben hatte einen Niederschlag von Ocker. Auf dem benachbarten Felde von Boldenstorf findet sich auch ein alter, mit Eichen und Gestrüpp besetzter Burgplatz an dem Mühlenbache, nicht weit von dem Hofe Boldenstorf, genannt der Wall".
Unter den Scherben zu Neuenkirchen fand sich auch eine, freilich zerschlagene durchbohrte Scheibe von blaugrauem Thon, gegen 6'' im Durchmesser, der zu Düsterbeck (vgl. Jahresber. VI, S. 44) gefundenen Scheibe ähnlich.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 407 |




|



|



|
|
:
|
b. Kirchliche Bauwerke.
Die Kirche zu Lübow und die Burg Meklenburg.
Die im Jahresber. VII, S. 66 flgd. beschriebene Kirche zu Lübow ist im höchsten Grade merkwürdig und wichtig, theils weil sie noch in reinem Rundbogenstyl erbauet, theils ganz in der Nähe des alten, in einem großem Sumpfe gelegenen Burgwalles Meklenburg (vgl. Jahresber. VI, S. 79 flgd.) gelegen ist. Das Dorf Lübow scheint daher in näherer Beziehung zu der Burg Meklenburg gestanden zu haben, als das bei der Burg liegende Dorf Meklenburg, welches jüngern Ursprunges zu sein scheint, als das Dorf Lübow.
Diese Ansicht wird durch die polnische Chronik des Bischofs Boguphal II. von Posen (in Sommersberg Script. rer. Siles. II, p. 19, vgl. v. Ledebur in Märk. Forschungen II, 1, S. 120,) in das glänzendste Licht gestellt; trotz der vielen Mährchen über die ältere Geschichte der Slaven, beurkundet dieser Chronist († 1253) doch eine so gründliche Kenntniß von der Lage der Ortschaften in Meklenburg, daß seine Erzählung im höchsten Grade der Beachtung würdig ist, in dem seine Chronik oft mehr sagt, als irgend eine andere Quelle, und das, was sie sagt, durchaus den Stempel der innern Glaubwürdigkeit trägt.
Von Lübow erzählt er:
Der Wendenkönig Mikkol oder Mykel, d. i. Niclot (Dänisch: Mjuklat), habe in dem Sumpfe bei dem Dorfe Lübow in der Nähe von Wismar eine Burg erbauet, welche früher die Wenden, nach dem Dorfe, Lübow, die Deutschen aber, nach dem Könige Miklo, Mykelborg nennten;
mit den Worten der Chronik:
Iste enim Mykel castrum quoddam in palude circa villam, que Lubow nominatur, prope Wissimiram edificavit, quod castrum Slaui olim Lubow nomine ville, Theutunici vero ab ipso Miklone Mykelborg nominabant. Unde usque ad presens princeps illius loci Mykelborg appellatur, latine vero a camporum magnitudine magnus plan (Magnopolis!) nuncupatur, quasi ex Latino et Slawonico compositum, quia in Slawonico Pole campus dicitur.
Diese Etymologie des Namens Meklenburg ist freilich nicht besser, als die Etymologien Nic. Marschalks; aber das Verhältniß der Lage der Ortschaften hat seit - ihrer Gründung niemand so richtig und scharf aufgefaßt, als Boguphal.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 408 |




|



|



|
|
|
Blätter
zur
Geschichte der Kirche zu Doberan,
niedergeschrieben
in Doberan im August 1843
und revidirt
in Doberan im September 1843.
Die Kirche zu Doberan steht durch die Vollendung ihres Baues und den Reichthum ihrer Ausstattung so hoch, daß es eine große Kühnheit sein würde, das Kunstwerk im Ganzen und in allen Einzelnheiten ohne voraufgegangene Untersuchung einzelner Gegenstände darstellen und beschreiben zu wollen. Es ist noch eine wiederholte und gründliche Betrachtung und Untersuchung des Einzelnen nöthig, ehe man das Ganze dem gebildeten Geiste näher bringen kann. Je öfter man die Kirche betrachtet, desto mehr Schönheiten offenbaren sich dem staunenden Auge, welches nimmer satt wird.
Zwar ist in Röper's Geschichte von Doberan, in Schröder's Wismarschen Erstlingen S. 307-344, 365-374 und 393-407 (nach Eddelins Aufzeichnungen), in Klüver's Mecklenburg II und sonst zerstreut an vielen Orten mancherlei über die Alterthümer mitgetheilt, jedoch so sehr ohne Kritik und die nöthige Gelehrsamkeit, daß sich schwerlich darauf fortbauen läßt. Was im Folgenden gegeben ist, soll jedoch ebenfalls nur als Andeutung, als Grundlage weiterer, gründlicherer Untersuchungen gelten.
Der Bau.
Die gewöhnliche Annahme ist, die Kirche sei im J. 1232 vollendet und geweihet worden. Es existirt allerdings eine bischöfliche Bestätigungs=Urkunde vom J. 1232, deren Originale das Datum der Einweihung (3. Oct. 1232) am Ende hinzugefügt ist: 1 )
Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie, V to nonas Oct., incarnacionis dominice anno M°CC°XXX°II°.


|
Seite 409 |




|
Aber die Kirche, welche am 3. Oct. 1232 geweihet ward, kann nicht die noch stehende Kirche sein. Die Kirche zu Doberan ist ein vollendeter Bau im reinsten und schönsten Spitzbogenstyl, der nur seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ausgeführt sein kann. Die Kirche aber, welche im J. 1232 geweihet werden konnte, mußte viele Jahre vorher gegründet worden sein. In jener Zeit herrschte in Meklenburg jedoch noch der Uebergangsstyl mit starken Anklängen an den Rundbogenstyl; ja einzelne Theile von Gebäuden aus der Zeit von ungefähr 1218 sind noch ganz im Rundbogenstyl ausgeführt. Den besten und sichersten Beweis geben die Kirchen des Klosters Neukloster, gestiftet 1219, und des Dom=Collegiat=Stifts Güstrow, gestiftet 1226, deren älteste Theile noch mit einzelnen Rundbogen=Pforten und mit Rundbogen=Friesen und mit Fenstern aus der Uebergangszeit erbauet sind. Die im J. 1232 geweihete Kirche ist also ein ganz anderes Gebäude gewesen, als die noch stehende Kirche.
Man hat überhaupt mehrere Perioden in der Entwickelung der kirchlichen Verhältnisse Doberans zu beachten.
Die älteste Kirche von Doberan ist die Kapelle zu Alt=Doberan oder Althof, welche im J. 1164 gegründet ward. Bei derselben ward im J. 1170 das Kloster gestiftet, welches im J. 1179 von den Wenden wieder zerstört ward. Im J. 1189 ward die Wiederherstellung des Klosters beschlossen, dasselbe 1192 von Alt=Doberan nach Wendisch=Doberan, dem jetzigen Doberan, verlegt und 1193 vom Bischofe bestätigt. Im J. 1218 ward das Kloster aufs neue bestätigt und im J. 1219 die Leiche Pribislavs von Lüneburg nach Doberan versetzt. Ein regeres Leben beginnt, wie in Meklenburg überhaupt, so auch in Doberan erst mit dem J. 1218. 1 )
Die Rundbogenkirche.
Die älteste steinerne Kirche, ward sie im J. 1192 oder nach einem Interimsbau im J. 1218 gegründet, muß ganz im Rundbogenstyle erbauet gewesen sein, wenn sie 1192, oder im Uebergangsstyle, wenn sie 1218 gegründet ward. Wahrscheinlich ward im J. 1192 eine kleine Kirche gebauet, diese vom J. 1218 an, mit dem Beginnen einer ruhigern Zeit, in größerm Maaßstabe erweitert und am 3. Oct. 1232 geweihet:
Doberan die consecrationis eiusdem ecclesie, V to nonas Oct., incarnationis dominice anno M°CC°XXX°II°.


|
Seite 410 |




|
Diese alte Rundbogenkirche stand an der Stelle der jetzigen Kirche; denn sie ist zum Theile noch vorhanden. Die Alten liebten es, Theile der ältesten Bauten, wenn sie noch dauerhaft waren, zum Andenken in die Ringmauern der erweiterten Gebäude aufzunehmen. Und so ist die westliche Giebelwand der alten Rundbogenkirche Doberans in die jüngere Spitzbogenkirche aufgenommen. In der westlichen Giebelwand des südlichen Seitenschiffes, nach dem Amte Doberan hin, steht die ganze Giebelwand der alten Rundbogenkirche, aus den alten großen, grau bemoosten Steinen, mit den alten Pfeilern, ja mit bedachtem Giebel. In der Mitte der Wand steht die alte, ganz einfache Rundbogenpforte in einem geringen, viereckigen Mauervorsprunge. Darüber ragen zwei Balkenköpfe aus Granit hervor. In einer angemessenen Höhe steht der Fries von doppelten, sich durchschneidenden Halbkreisbogen aus nicht glasurten Ziegelreliefs. Diese Eigenthümlichkeiten weisen die Wand in das zwölfte Jahrhundert zurück; sie gehört ohne Zweifel zu den ersten Kirchengebäuden von 1192. Um nun die Freude dieser Entdeckung zu vollenden, ist auch noch ein großer Theil des Giebels in die neuere Wand eingemauert; er geht treppenförmig aufwärts und ist mit "Mönchen und Nonnen" gedeckt: selbst die alte Bedachung ist in die jüngere Wand eingemauert. Zu diesem Giebel gehört nun auch noch die daran stoßende südliche Seitenwand des südlichen Seitenschiffes von der Südwestecke bis zum Kreuzschiffe, vier Gewölbe lang, welche von der übrigen Kirche völlig abweicht. Die Fenster reichen lange nicht so weit hinab, als die übrigen Fenster der Kirche, vielmehr reicht die undurchbrochene Mauer so hoch, als die viereckige Wand der Giebelseite; im Innern ist diese Wand in großen Spitzbogenwölbungen von der Breite der Fenster verdickt, um den darauf gesetzten höhern Theil der Wand mit den Fenstern tragen zu können. Dieser Theil der Kirche allein hat keinen behauenen Granitsockel über der Erde. Die Strebepfeiler sind erst in jüngern Zeiten angesetzt. Wir haben also in dieser alten Kirche eine niedrige Rundbogenkirche ohne Strebepfeiler.
Ein eigenthümliches Gefühl überfällt den Beobachter, wenn er diese ganz eigenthümliche, von dem ganzen Bau der neuern Kirche völlig abweichende Reliquie betrachtet, welche von außen eine Kirche in der Kirche bildet. Sonst ist die doberaner Kirche ganz aus Einem Geiste.


|
Seite 411 |




|
Der Kreuzgang.
Das Kloster lehnte sich, zunächst mit dem Kreuzgange, an die Südseite der Kirche und umfaßte einen sehr bedeutenden Raum, welchen noch heute die alten, starken Klostermauern umschließen; am äußersten Ende stehen noch die alten trefflichen Mühlengebäude, welche wohl nicht viel jünger sind, als die Kirche. Von den eigentlichen Klostergebäuden steht nichts weiter mehr, als eine Ruine von dem alten Reventer oder Refectorium. Nahe bei der südlichen Hauptpforte im südlichen Kreuzschiffe lehnt sich an die Kirche eine starke Mauer mit 8 offenen Bogen. Dies ist die mittlere Scheidewand der innern Räume des alten Reventers, des Versammlungs= und Speisesaales der Mönche; man erkennt noch deutlich, wie an beiden Seiten die Gewölbe angesetzt gewesen sind.
Diese Ruine aus uralten, mächtigen Ziegeln gehört zu den ehrwürdigsten Denkmälern Doberans. Sie stammt zweifellos aus der ältesten Zeit des Klosters, aus der Zeit des Rundbogenstyls. Die 8 Oeffnungen sind nämlich im reinen Rundbogen gewölbt; die Gewölbe sind mit zwei runden Wulsten und den dazu passenden Gliedern verziert und verrathen einen durchaus gediegenen Ursprung.
In jüngern Zeiten sind diese Rundbogen mit Spitzbogen ausgemauert und endlich wieder durch den Rundbogen des 16. Jahrhunderts gestützt.
Die Heilige Bluts=Kapelle.
Das Heil. Blut von Doberan ist das älteste im Lande. Die Sage spielt eine Hauptrolle in der Geschichte Doberans und ist bekannt: wie ein Hirte aus Steffenshagen eine Hostie vom Abendmahle im Munde mit nach Hause genommen, in seinem Hirtenstabe verwahrt und seine Heerde fortan damit geschützt habe, bis das Geheimniß entdeckt und die blutende Hostie als wunderthätig ins Kloster zurück gebracht worden sei. Die Geschichte soll sich nach Kirchberg im J. 1201 zugetragen haben. Doberan ward bald ein berühmter Wallfahrtsort und es strömten Pilger in großer Anzahl, selbst aus fernen Gegenden, herbei. Das Heiligthum konnte nicht gut den Weibern verschlossen werden, und doch ward es erst im J. 1385 edlen und ehrbaren Frauen gestattet, bei feierlichen Gelegenheiten Kirche und Kloster zu betreten 1 ); es mußte daher


|
Seite 412 |




|
wohl ein eigenes Gebäude für das Heil. Blut errichtet werden.
Die Hauptpforte der Kirche für die Personen, welche nicht dem Kloster angehörten, war die Pforte im nördlichen Kreuzschiffe. Die Pforte im südlichen Kreuzschiffe, welche jetzt zum gewöhnlichen Eingange dient, führte ins Kloster. Daher ward die Heil. Bluts=Kapelle an der nördlichen Hauptpforte, dem Wirthschaftshofe des Klosters oder dem "Kammerhofe" gegenüber, aufgeführt. Hier steht nämlich ein kleines, sauberes achteckiges Gebäude, wie eine Taufkapelle, in sehr schönem Styl, aber offenbar noch in dem Uebergangsstyle. Die Fenster sind noch schmal, leise gespitzt, schräge eingehend, mit einem runden Wulst eingefaßt. Der Fries besteht aus Relief=Verzierungen, welche aus 3 Halbkreisen oder Kreissegmenten zusammengesetzt sind; der Fries der Kirche besteht schon aus spitzbogigen Verzierungen. Das Gebäude ist ganz aus abwechselnd glasurten und nicht glasurten, sehr großen und kräftigen Ziegeln und überhaupt im Einzelnen äußerst tüchtig aufgemauert; die glasurten Ziegel sind bis zur Augenhöhe grün und werden immer dunkler, je höher die Schichten liegen; über der Augenhöhe sind hin und wieder schwarze Ziegel eingesetzt, welche immer häufiger werden, bis von der Hälfte der Höhe des Gebäudes an regelmäßig eine Schicht um die andere die Ziegel schwarz glasurt sind 1 ). Die Gewölberippen lehnen sich im Schlusse an einen kreisrunden, nicht bedeckten Wulst, wie in andern Kirchen aus der Uebergangsperiode, z. B. der Kirche zu Gägelow. Die Gewölberippen stehen auf Tragesteinen, welche alle verschieden verziert sind. Das Gewölbe hat übrigens noch leichte Deckenmalerei von Heiligenbildern.
Uebrigens ist dieses äußerst zierliche Gebäude wohl das einzige seiner Art in Meklenburg und vielleicht in Norddeutschland.
Diese Kapelle fällt also nach dem Baustyl wohl ohne Zweifel in die erste Hälfte, vielleicht noch in das erste Viertheil, des 13. Jahrhunderts. Und hiemit stimmt auch eine Urkunde vom J. 1248 (in Westph. Mon. III, p. 1491) überein, nach welcher der Fürst Borwin von Rostock den Mönchen eine jährliche Ergötzung an Weißbrot, Wein und Fischen am Tage


|
Seite 413 |




|
der Weihung der an der Pforte gegründeten Kapelle aussetzte:
in festo dedicationis capellulae, quae ad portam est fundata.
Damals muß also schon die Kapelle gestanden haben. Daß sie ein eigenes Gebäude war, geht daraus hervor, daß sie immer capella oder capellulla genannt wird. Die Kapellen in der Kirche werden gewöhnlich nur Altäre genannt.
Die Kapelle erfreute sich fortan auch, neben der Kapelle zu Althof, einer besondern Berücksichtigung der geistlichen Oberhirten; aus den verschiedenen Urkunden über manche Begünstigung geht zugleich hervor, daß diese Kapelle ohne Zweifel die Heil. Bluts=Kapelle ist. Als der Bischof Friederich am Trinitatis=Feste, den 4. Junii 1368, die Kirche zu Doberan weihete 1 ), bestimmte er auch zugleich, daß der jährliche Weihtag der doberaner Kirche und die Verehrung des Heil.=Blutes, welche in der Kapelle an der Pforte des Klosters,
visitacio sacramenti in capella porte monasterii Doberanensis,
am Montage nach Pfingsten geschehen sei, fortan am Sonntage nach der Octave des Frohnleichnamsfestes gefeiert werden sollen und verheißt allen Besuchenden Ablaß. Dieser Ablaß ward in den folgenden Zeiten öfter wiederholt, z. B. 1450 von dem Bischofe Nicolaus und 1461 von dem Bischofe Werner, für alle, welche nicht allein die doberaner Kirche, sondern auch die Kapelle an der Pforte und die Kapelle zu Althof besuchen und deren Bau fördern würden, immer mit denselben Worten:
capellam in porticu ipsius monasterii necnon eciam capellam in antiqua curia, Antiquum Dobberan nominatam.
Die Kirche.
Nach dem Vorgetragenen kann die jetzt stehende Kirche nicht diejenige sein, welche im Jahre 1232 geweihet ward. Die Kirche ist ein überaus schlanker, gleichförmiger, reizender Bau, welcher nur seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. aufgeführt sein kann. Da nun Theile der alten Kirche mit in die Ringmauern der neuern aufgenommen sind, so wird der Ausbau und Fortbau der neuern Kirche allmählig und mit


|
Seite 414 |




|
Rücksicht auf die alte Kirche und die Klostergebäude vorgenommen sein.
Ganz vollendet war die Kirche erst im J. 1368, als der Bischof Friederich von Schwerin am Trinitatis=Feste, den 4. Junii d. J., in Gegenwart vieler hochgestellter Personen und einer großen Menge Volkes "der gut gegründeten und im Bau vollendete doberaner Kirche"
"ecclesie Doberanensi bene fundate et edificiis perfecte"
die Weihe 1 ) ertheilte und den Kirchweihtag fortan auf den Sonntag nach der Octave des Frohnleichnamsfestes verlegte.
Der Brand, welcher im J. 1291 das Kloster verzehrte (vgl. Jahrb. II, S. 28), ergriff die Kirche wohl nicht bedeutend.
Der Grundplan der Kirche muß schon früh festgestellt und einzelne Theile müssen schon früh ausgeführt gewesen sein. Es giebt mehrere Anknüpfungspuncte in der Zeit von 1232-1368, welche dafür reden, daß das Mauerwerk schon im 13. Jahrh. vollendet gewesen sein wird.
Die Leiche Pribislav's ward im J. 1219 von dem lüneburger Michaeliskloster nach Doberan versetzt. Sie kann aber nur in der alten Kirche beigesetzt und später vielleicht wieder versetzt worden sein.
Zuerst ward wohl das Schiff fertig, indem in dieses die Mauern der alten Kirche aufgenommen wurden; man konnte die alte Kirche so lange ganz stehen lassen, bis der neue, höhere Bau über dem alten vollendet war, wie in der Kirche zu Dobbertin noch das Gewölbe des alten Baues als Träger des oberen Nonnenchores ganz in der viel jüngern Kirche steht.
Als die Heil. Bluts=Kapelle gebauet ward, war wahrscheinlich der Plan zu der neuen Kirche schon gemacht, also schon vor dem J. 1248.
Die sichersten Fingerzeige geben die Gräber.
Schon im J. 1276 stiftete Heinrich der Pilger eine ewige Wachskerze an den Gräbern seiner Aeltern und seines Bruders 2 ). Der Fürst Heinrich der Löwe stiftete am 18. Jan. 1302, acht Tage nach der Beisetzung seines Vaters, ebenfalls eine ewige Wachskerze an der Stelle seines Begräbnisses und ordnete an, daß der Abt einen Altar und lobenswerthe Fenstern in der Begräbniß=Kapelle seiner Vorfahren (vnum altare et fenestras laudabiles in capella, vbi progenitores nostri requiescunt) von gewissen Ein=


|
Seite 415 |




|
künften erbauen solle 1 ). Im J. 1400 verordnete der meklenburgische Herzog und schwerinsche Bischof Rudolph, daß auch er in der Kirche zu Doberan, in welcher alle seine Vorfahren und die alten Fürsten des Landes ruheten, beigesetzt werde 2 ).
Diese Begräbnißkapelle war in der Kirche links an der Pforte des nördlichen Kreuzschiffes. Ich erinnere mich, in irgend einer alten Handschrift, welche ich jedoch für den Augenblick nicht wieder auffinden kann, gelesen zu haben, daß Pribislav's Begräbniß "im Norden" der Kirche sei. Hier liegen auch noch die Reliefziegel an der Stelle der ehemaligen Gräber der Fürsten von Meklenburg und von Werle (vgl. unten Fürstengräber); viel ist jedoch von diesen Gäbern nicht übrig, da der Herzog und Bischof Magnus († 1550), mit seiner Mutter Ursula von Brandenburg († 1510), in dieser Kapelle zuletzt beigesetzt ist und hier eine große, hohe Begräbnißgruft über der Erde erhalten hat, welche den ganzen Raum der Kapelle füllt: bei Gelegenheit der Erbauung dieses Begräbnisses wird auch der alte Altar, welcher noch vorhanden ist, in die Höhe gebracht sein. Damit ist jedoch, bis auf die Reliefziegel aus dem 14. und 15. Jahrh., welche einst in einer gewissen Entfernung vor dem Altare lagen, die alte fürstliche Begräbnißkapelle vernichtet.
Vom J. 1267 bis 1302 war also im nördlichen Kreuzschiffe schon die fürstliche Begräbnißkapelle.
Im J. 1301 ward die Glocke gegossen, nach der Inschrift bei Schröder S. 402:
Anno domini MCCCI fusa est hec campana cal. Febr. sub domino Johanne abbate Melonigio (muß de Elbingo heißen).
In dem nördlichen Umgange hinter dem Altare liegen Heinrich von Weser und seine Frau Ida begraben, (vgl. unten Leichensteine), welche einige Zeit nach 1304 gestorben sein müssen.
Der Fürst Heinrich der Löwe liegt schon im hohen Chor begraben; der hohe Chor war also im J. 1329 schon fertig. Neben ihm liegt die Gemahlin des Fürsten Nicolaus I. von Werle, welche am Ende des 13. oder im Anfange des 14. Jahrh. gestorben sein wird. (Vgl. unten Fürstengräber).
Der Steinbau der Kirche muß also in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vollendet worden sein.


|
Seite 416 |




|
Man gebrauchte also zu dem Ausbau, den Wölbungen, den Fenstern, dem Schnitzwerk, u. s. w. an 70 Jahre, bis die Kirche im J. 1368 als ganz vollendet eingeweihet werden konnte.
Das Schnitzwerk.
Wohl selten ist eine Kirche so reich an schönem Schnitzwerk, als die doberaner Kirche. Ist auch manches durch ungestaltete Stuhl= und Chorbauten des vorigen Jahrhunderts entstellt, so ist doch noch fast Alles vorhanden, was zur vollständigen Einrichtung einer alten Kirche gehört: Altäre, Beichtstühle, Tabernakel, Kelchschrein, Crucifix, Reliquienschrein, Chorstühle, u. s. w. und zwar in einer Vollendung, welche eben so selten ist, als der Reichthum. Dieser Reichthum ist natürlich nach und nach entstanden; so stammen z. B. die Schnitzwerke hinter dem Hochaltare aus dem 15. Jahrhundert. Bei weitem der größere Theil des Schnitzwerkes stammt jedoch aus dem 14. Jahrhundert und ist noch das erste Schnitzwerk der Kirche.
Am reinsten im Styl, am edelsten und einfachsten sind jedoch die aus Eichenholz geschnitzten Mönchsstühle, welche auf beiden Seiten des ganzen Schiffes entlang stehen; sie gehören zu den schönsten Kunstwerken der Holzschnitzerei. Und grade von diesen läßt sich das Alter bestimmen.
Auf der westlichen Seitenwand der südlichen Reihe der Mönchsstühle ist nämlich ein humoristisches Bild eingeschnitzt: wie der Teufel einen Mönch verlocken will. Beide Figuren tragen Spruchbänder: der Teufel sagt:

(Quid facis hic, frater vade mecum).
(Was thust Du hier, Bruder? Komm mit mir).
der Mönch antwortet:

(nil in me reperies mali, cruenta bestia).
(Du sollst an mir nichts Böses finden, Du abscheuliches Vieh).
Diese Schriftzüge fallen nun ohne Zweifel in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Mönchsstühle werden also das älteste Schnitzwerk in der Kirche sein.
Lots Frau, die zur Salzsäule geworden.
Die Kirche zu Doberan besitzt viele Reliquien; ohne untersuchen zu wollen, ob die noch vorhandenen die alten sind, ist es doch nach Urkunden gewiß, daß das Kloster schon im


|
Seite 417 |




|
14. Jahrhundert reich an Reliquien war. Unter den Reliquien wird auch "Lots Frau, die zur Salzsäule geworden", gezeigt, auf den ersten Anblick eine unförmliche große Steinmasse. Bei genauerer Untersuchung stellt sich aber heraus, daß "Lots Frau" allerdings eine - Frau, aber keine semitische, sondern eine sehr schöne, nackte, italiänische Frau ist. "Lots Frau" ist nämlich ein sehr schöner antiker Torso einer Venus, einer Danae oder irgend einer andern antiken Person. Es ist die auf einem Gewande oder Wellen und auf dem rechten Ellenbogen ruhende nackte Gestalt eines jungfräulichen Leibes von großer, absoluter Schönheit und unzweifelhaft eine Antike. Es fehlen ihr Kopf, Arme und die Beine von den Knieen an. Sie hat auf dem Schooße etwas, was jetzt ganz unförmlich ist und den Leib vorne verdeckt. Daher ist man nicht zur wahren Erkenntniß der Bildsäule gekommen. Das Ganze ist aus einem Block von kohlensaurem Kalkstein gehauen.
Es ist möglich, daß diese allein werthvolle Reliquie früher wirklich für eine Reliquie galt und dem Kloster als Reliquie, wirklich als Lots Frau, zugeschickt ward, als man in Italien noch nicht nach Antiken jagte und deren Werth noch nicht kannte. Der Sage nach soll Heinrich der Pilger sie mitgebracht haben.
Die frei stehende Säule.
Im südlichen Kreuzschiffe liegt ein großer Säulenschaft aus Kalkstein, an 25 Fuß lang; einige andere Enden sollen im Orte als Prellsteine an den Ecken stehen. Daneben liegt eine schöne Säulenbasis aus demselben Gestein, in byzantinischem Style, mit schönem verzierten Laubwerk an zwei Ecken; die beiden andern Ecken sind nicht verziert. Diese Säule ist dadurch von Interesse, daß ähnliche einzelne Säulen von ganz gleicher Construction auch an andern Orten gefunden werden. So steht im Pfarrgarten zu Lübow eine gleiche Säule und zwei Kapitäler byzantinischen Styls; in Schwerin ward beim Bau des Collegiengebäudes an der Stelle des Franziskanerklosters ebenfalls eine Basis und ein Kapitäl, und beim Dome wurden 2 Kapitäler gleicher Art gefunden. Gehörten frei stehende Säulen, vielleicht Geißelungssäulen (?), etwa zum Ritus der katholischen Kirche?
Peter Wise.
Peter Wise ist eine der mythologischen Personen des Klosters. Die Sage giebt ihn für den Baumeister des Klosters


|
Seite 418 |




|
aus der die beiden bewundernswerthen, schlanken Pfeiler, welche die Gewölbe der Kreuzschiffe tragen, "ohne Loth und Richtmaaß" aufgeführt haben soll (man vgl. Schröder Wism. Erstl. S. 324 flgd.). Peter Wises Andenken ist allerdings in der Kirche mehrere Male verherrlicht und daher wird der Mann ohne Zweifel einige Bedeutung gehabt haben.
An einem Pfeiler im nördlichen Seitenschiffe hängt sein Bild, in ganzer Figur, mit einer Krönung von mittelalterlichem Schnitzwerk. Er ist in kurzem Wamms dargestellt, mit langen Beinkleidern, von denen das rechte Bein weiß, das linke roth ist. Auf dem Kopfe trägt er eine Schaube oder platte Mütze. Mit der linken Hand faßt er in einen Beutel, welcher an dem Gürtel hängt; die rechte Hand faßt einen Wappenschild, der längs getheilt ist, rechts mit einem halben Adler, links mit einem abgehauenen Eichenzweige. Bei diesem Bilde steht eine Inschrift nach mittelalterlicher Weise, halb deutsch und halb lateinisch. Es giebt zwei Recensionen, von denen hier die in Klüver's Mecklb. aufbewahrte mitgetheilt ist.
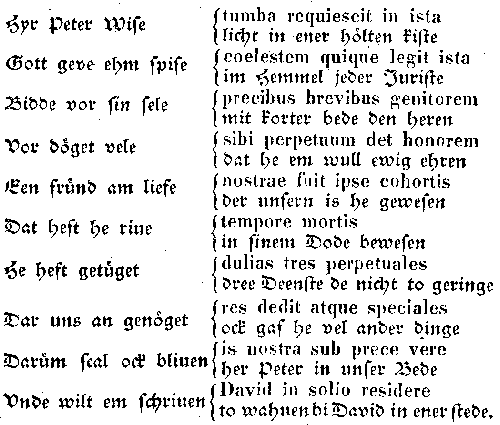
So theilt Klüver die Inschrift mit. Das Original in der Kirche hat nur die deutsche Columne links und die lateinische rechts (vgl. Röper S. 237); eben so lauten ältere Abschriften z. B. bei Schröder S. 324. Die deutsche Uebersetzung des Lateinischen an der rechten Seite steht zwar im Zusammenhange


|
Seite 419 |




|
mit der Columne links, scheint aber doch jünger zu sein, als das ursprüngliche Original, indem der Reimer offenbar den Verfasser und sein Latein nicht verstanden hat. In der zweiten Zeile steht nämlich: leg' ista, d. h. legit ista = wer dieses liest, bitte Gott für seine Seele. Der Reimer hat aber legista gelesen und einen doctor legum: einen "Juristen" daraus gemacht.
Leider sind alle Bilder der Kirche unter dem Herzoge Christian Ludwig II. restaurirt, d. h. ziemlich modern übermalt, so daß sich mit Bestimmtheit nichts über die ursprüngliche Form der Inschrift sagen läßt.
Dem Bilde gegenüber steht an einem Pfeiler ein Altar der "Maria tàr ladinge", deren Dienst erst am Ende des 15. Jahrh. aufkam.
Der Leichenstein von dem Grabe des Peter Wise liegt auf dem Altare mit der Darstellung, wie das "Wort" durch die Mühle geht (vgl. S. 422), an dem Pfeiler rechts von der südlichen Pforte des Kreuzschiffes, rechts vom Eingange zu dem Umgange hinter dem Hochaltare. Die Darstellung auf demselben ist schön gravirt. Unter einer gothischen Nische, deren spitzbogige Wölbung sich in 5 Eichenblätter verliert, steht Peter Wise in langem, einfachen Gewande, mit gescheitelten Haaren, mit gefalteten Händen auf der Brust. Oben steht an jeder Seite sein Wappen auf einem schräge gelehnten Schilde, welcher längs getheilt ist, in einer Hälfte mit einem halben Adler, in der andern Hälfte mit einem geästeten Eichenzweige mit 3 Blättern; die halben Adler stehen beide nach innen, also auf dem einen Schilde links, auf dem andern rechts, die Eichenzweige nach außen. Die Umschrift lautet:
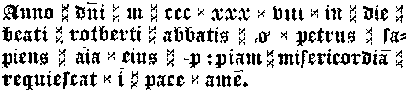
(= Anno domini MCCCXXXVIII in die beati Rotberti abbatis (April 29) obiit Petrus Sapiens. Anima ejus per piam misericordiam requiescat in pace. Amen.)
Dieser Stein lag schon, nach Chemnitz bei Schröder a. a. O. S. 326, im 17. Jahrhundert auf diesem Altare. Daß Leichensteine auf Altären liegen, kommt sonst allerdings vor. So ist in der Kirche zu Rehna der Leichenstein zweier Pröpste des Klosters (Hermann und Heinrich) aus dem Anfange des 14. Jahrh. schon zur katholischen Zeit auf den Altar gelegt,


|
Seite 420 |




|
da in demselben die 5 bischöflichen Weihekreuze eingehauen sind. Chemnitz erzählt, daß außerdem noch ein Leichenstein unter dem Bilde des Peter Wise in der Kirche liege; er erzählt, wie dieser am Rande mit Messing belegt und an den 4 Ecken mit seinem Wappen verziert gewesen sei. Zu Schröder's Zeit fehlte schon das Metall, jetzt fehlt der Stein ganz. Die Inschrift auf beiden Steinen war, nach Chemnitz, gleich.
Die Familie Wise war in alten Zeiten eine angesehene Patricier=Familie, welche in den Hansestädten Rostock, Wismar und Lübeck weit verzweigt war. Wahrscheinlich stammte sie aus Rostock. Heinrich Wise (Henricus Sapiens) war 1266-1278 Bürger und 1276-1286, in der wichtigsten Zeit der Entwickelung der Stadt, Rathsherr zu Rostock. Johann Wise war 1285-1344 Bürger und Rathsherr zu Wismar; es lebten am Ende des 13. Jahrh. zwei Johann Wise (Sapiens) in Wismar; der eine war ein Gerber (cerdo): im Stadtbuche B. fol. XVI b. heißt es? Johannes Sapiens cerdo emit de Johanne Persic V agros in campo Dammenhusen; der andere war ein Schmied (faber): in demselben Stadtbuche fol. VI a. heißt es: Radolfus resignauit domum suam, quam emit erga Johannem Sapientem fabrum uxori sue Margarete et pueris suis. Am Ende des 13. Jahrh. ward Henneke, 1318 Johann, 1327 Henneke, 1339 Hermann Wise zu Wismar als Bürger eingeschrieben. Ein magister Johannes Wise zu Wismar war Rechtsgelehrter und im J. 1344 Procurator (procurator et jurista) des Dom=Capitels zu Ratzeburg. Die Familie scheint sich schon früh dem Kloster Doberan zugewandt zu haben: schon im J. 1244 war ein Hermann Wise Conversbruder in Doberan.
Unser Peter Wise war Bürger in Lübeck und starb nach seinem Leichensteine am 29. April 1338. Er hinterließ zwei Brüder Johann und Heinrich, welche Priester und Mönche zu Doberan waren, und eine Schwester Gertrud: Johann war im J. 1336 Schatzmeister (bursarius) des Klosters Doberan. Peter Wise war während der großen Bewegungen zwischen den sächsischen und "wendischen" Mönchen in der Zeit 1336/7 (vgl. Jahrb. VII, S. 39 flgd.) als ein hülfreicher Retter erschienen. Die Bewegungen zerrütteten das Kloster in den Grundfesten; Peter Wise, von der Partei der wendischen Mönche, d. h. der Mönche aus den wendischen Seestädten, trat dennoch, obgleich die Bewegungen gegen seine Partei gerichtet waren, in der Noth hülfreich ins Mittel, um die ehrwürdige Stiftung nicht sinken zu lassen. Der sächsische Abt Conrad hatte im J. 1336 von dem rostocker


|
Seite 421 |




|
Burgemeister Arnold Kopmann 500 lüb. Mark oder 1000 rostockische Mark aufgeliehen, um mit dem Geschenk derselben den Fürsten Albrecht zu besänftigen; für diese Summe hatte er das Gut Adamshagen an Arnold Kopmann verpfändet (vgl. Jahrb. VII, S. 288, Nr. LVI). Nach einer Urkunde vom 23. Oct. 1341 1 ) hatten die Mönche Johann und Heinrich Wise, aus dem Nachlasse ihres Bruders Peter das Gut Adamshagen für das Kloster wieder eingelöset, jedoch, unter der Bedingung, daß Adamshagen vom Kloster nie verpfändet oder veräußert werden dürfe, drei Dienste 2 ) oder Jahresleistungen (servitia) aus den Aufkünften des Gutes, jede Hebung von wenigstens 10 Mark rostock. Pfen., fundirt, für die Besorgung dreier Altäre: der elftausend Jungfrauen, des Frohnleichnams und des Apostels Andreas, welche sie in der Kirche gestiftet hatten.
Dies sind die Verdienste der Wise um das Kloster, welche während einer bedrängten, unruhigen Zeit, in welcher das Kloster wenig Freunde hatte, bedeutend genug waren.
Der Altar, auf welchem Peter Wise's Grabstein liegt, ist nun keiner von den drei Altären der Familie Wiese. Der Frohnleichnams=Altar steht aber vor dem nächsten Pfeiler hinterwärts links; lag nun der Leichenstein vor diesem , so war er entweder bei der Beschränktheit des Raumes vor dem Frohnleichnamsaltar oder bei der Nähe des Durchganges durch den Umgang hinter dem Hochaltar dem Abtreten sehr ausgesetzt. Daher hob man ihn wohl und legte ihn auf den nächsten Altar, welcher seiner Größe angemessen war.
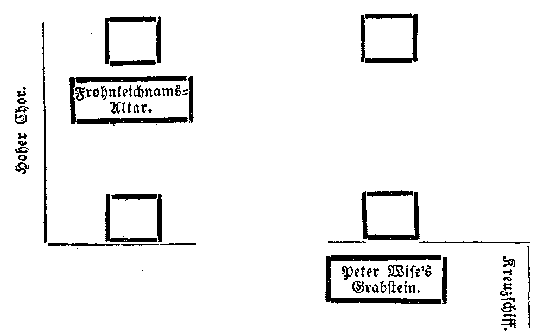


|
Seite 422 |




|
Nebenaltäre.
Der Altar des Heiligen Blutes oder der Offenbarung.
An der östlichen Wand des südlichen Kreuzschiffes, rechts von der Pforte, steht ein Altar, auf welchem Peter Wise's Grabstein liegt, mit einem eigenthümlichen Gemälde: wie das Wort vom Himmel durch eine Mühle in den Kelch geht, weshalb ich ihn einstweilen den Altar der Offenbarung nenne. Die Mitteltafel versinnbildlicht die Lehren: "Im Anfange war das Wort", und: "Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns."
Der Altar war schon lange aus Röper, Seite 231, und überhaupt in Meklenburg bekannt. In neuern Zeiten hat Kugler in seiner Pommerschen Kunstgeschichte, Balt. Studien VIII, 1, S. 194 flgd., auf einen ähnlichen Altar in der Kirche zu Tribsees aufmerksam gemacht und denselben a. a. O. einer ausführlichen Betrachtung unterworfen; Kugler hält diesen Altar für eine der Hauptzierden der gesammten deutschen Kunst. Der Altar zu Triebsees ist dem doberaner ziemlich ähnlich, jedoch ist die Anlage des Gemäldes etwas mehr systematisch und berechnet. Der triebseeser Altar fällt ebenfalls, wie der doberaner, in den Anfang des 15. Jahrhunderts. Bekannt ist dieselbe Darstellung in einem Chorfenster des Münsters zu Bern.
Der doberaner Altar ist, wenn auch nicht ausgezeichnet, doch jedenfalls beachtungswerth.
Die mittlere Haupttafel hat folgende Darstellung. In der Mitte schweben oben auf einem Regenbogen auf Goldgrund die vier Genien der Evangelisten, welche aus kugeligen Flaschen mit langem Halse das Wort in einen Mühlentrichter schütten. Das Wort ist dargestellt durch Bänder, welche aus den Flaschen kommen und Inschriften tragen, aus der Flasche
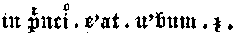
|
|
| des Adlers: | (= In principio erat verbum et: |
| (Johannes): | Im Anfang war das Wort und:) (Joh. I, 1.) |
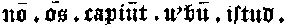
|
|
| des Engels: | (= Non omnes capiunt verbum istud: |
| (Matthäus): | Das Wort fasset nicht Jedermann.) (Matth XIX, 11.). |

|
|
| des Stieres: | (= Videramus hoc verbum quod factum est: |
| (Lucas): | Wir hatten dieses Wort gesehen, welches geworden ist.) |


|
Seite 423 |




|

|
|
| des Löwen: | (= Qui seminat verbum seminat. |
| (Marcus): | Der Säemann säet das Wort ( Marcus IV, 14.). |
Aus dem Trichter kommt ein Band mit dem Worte
(= verbum: Wort),
vielleicht als Fortsetzung von dem Schlusse: et, auf dem Bande des Adlers, und geht auf die Mühlsteine.
Die 12 Apostel, an jeder Seite 6, stehen in einer Reihe neben dem Rumpfe und drehen an einer Stange die Mühlenwelle.
Aus dem Rumpfe kommt ein Band mit der Inschrift:
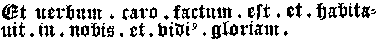
(= Und das Wort ward Fleisch und wohnete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit.) Joh. I, 14.)
Das Band geht mit dem Worte gloriam in einen Kelch, welchen 4 knieende Personen halten: ein Papst, ein Cardinal und zwei Bischöfe, oder ein Erzbischof und ein Bischof, von denen der bei dem Papste knieende alt, der bei dem Cardinal knieende sehr jung ist; beide tragen denselben Ornat.
An jeder Seite von diesen Kirchenfürsten knieet ein Mönch, mit einem Bande:
| links: |
|
| (= Das Werk unserer Wiedergeburt ist die Mensch werdung des Wortes Gottes.) | |
| rechts: |
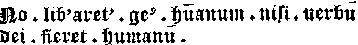
|
| (= Die Menschheit würde nicht erlöset werden, wenn das Wort Gottes nicht Mensch würde.) |
Hinter dem Mönche links knieen zwei weltliche Personen: eine Frau mit rothem Mantel und weißer Schleierkappe und ein Mann in grüner Tracht. Hinter dem Mönche rechts knieen zwei Männer in grünen Gewändern. Neben dem Gesichte des Mönches links ist ein sarkastisches scharfes Gesicht mit einem Schurrbarte.
In der obern Ecke rechts (von dem Beschauer) auf dem Goldgrunde neben den Genien der Evangelisten steht in ganz kleiner Darstellung Maria, mit den Füßen auf dem Halbmonde, mit der Sonne vor dem Schooße und den Sternen auf der Krone, mit dem Christkinde auf den Armen.


|
Seite 424 |




|
In der obern Ecke links in ganz kleiner Darstellung: ein betender, knieender König, in rothem Mantel, mit der Krone auf dem Haupte; neben ihm knieet eine weibliche Figur in einem Gewande von roth und gold, mit langem Haar und Schleier; sie legt die linke Hand auf des Königs Schulter und zeigt mit der ausgestreckten Rechten und mit jubelvollem Antlitz auf die Genien der Evangelisten.
Diese kleine Darstellung ist, trotz ihrer Kleinheit und vieler Fehler, sehr geistreich, und außerdem von historischem Interesse. Der König ist nämlich an Mienen und Tracht ganz dem meklenburgischen Herzoge Albrecht, Könige von Schweden, und dessen Originalbildern in der Heil. Bluts=Kapelle im Dome zu Schwerin und in der Königskapelle zu Gadebusch ähnlich (vgl. Jahresbericht III, S. 133 flgd). Nach dem Geiste dieser Darstellung scheint der König schon gestorben gewesen zu sein und seine Wittwe Agnes zu seinem Gedächtnisse diesen Altar geschenkt zu haben; der König † 1412, seine Gemahlin † 1434. Es würde der Altar also in das erste Viertheil des 15. Jahrhunderts fallen; in diese Zeit müßte man auch nach dem Styl und der ganzen Arbeit den Altar setzen, wenn auch keine historischen Fingerzeige vorhanden wären.
Die Gemälde auf den Seitenflügeln sind sehr schadhaft; auf den Rückwänden ist nichts mehr zu erkennen. Auf den Vorderseiten stehen auf jedem Flügel zwei Bilder unter einander:
| rechts: | oben: ein segnender Bischof vor einem Könige, neben welchem aus einem Viereck Flammen schlagen; |
| rechts: | unten: ein Bischof und vor ihm ein König mit Krone, Scepter und Reichsapfel; vom Bischofe geht ein Spuchband aus: |
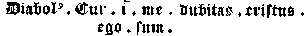
|
|
| links: | oben: ist noch ein segnender Bischof zu erkennen; |
| links: | unten: fehlt die Darstellung schon ganz. |
Der Fronleichnams=Altar
ist einer der drei Altäre, welche aus dem Nachlasse des Peter Wise gestiftet sind. Der Altar steht noch im südlichen Umgange hinter dem Hochaltare an dem zweitern innern Pfeiler am hohen Chor; links lehnt sich der Altar an die Bretterwand der Chorschranken. Ueber dem Altare steht eine Tafel mit der Inschrift:


|
Seite 425 |




|
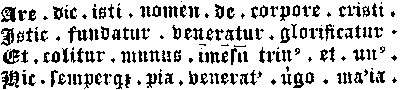
(= Arae dic isti nomen de corpore Cristi.
Istic fundatur, veneratur, glorificatur,
Et colitur munus immensum, trinus et unus, Hicsemperque pia veneratur virgo Maria. (Ein Kelch.)
An der verziert gewesenen Bretterwand links neben dem Altare, der Rückwand der Chorschranken oder vielmehr des Beichtstuhls, steht auf einer Leiste mit Unzialen des 14. Jahrhunderts schwarz auf Kalkgrund in 2 Zeilen übereinander dieselbe Inschrift gemalt:
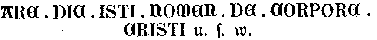
und auf derselben Leiste dieselbe Inschrift noch einmal mit größern Buchstaben aus derselben Zeit.
Das Altarblatt ist klein. Die Haupttafel stellt die Kreuzigung Christi durch gekrönte Tugenden mit Spruchbändern dar. Die Obedientia (Demuth) drückt ihm die Dornenkrone auf, Charitas (Liebe) öffnet ihm die Seite u. s. w. (vgl. Schröder S. 342). In den Seitenflügeln stehen links Isaac und Ezechiel, rechts Jeremias und Daniel; auf den Rückwänden der Seitenflügel sind dargestellt: die Verkündigung Mariä, die Geburt Christi, die Heil. Drei Könige und die Darstellung Christi.
Der Altar der Heil. Dreieinigkeit.
Im nördlichen Theile des Umganges um den hohen Chor steht ein kleiner Altar mit zwei Flügeln. Von den Gemälden ist nur etwas auf der mittlern Haupttafel zu erkennen. Gott der Vater in hochrothem, grün gefutterten Gewande sitzt auf einem Throne mit 4 mit Löwen gekrönten Pfeilern, Christus am Kreuze auf dem Schooße haltend, darüber die Taube; links knieet ein betender Mönch.
Hierunter stehen auf einer Leiste 7 geschnitzte Brustbilder: in der Mitte Christus, das Kreuz im Arme haltend, mit Nägeln und Rohr in den Händen, zu beiden Seiten Maria und Johannes betend, rechts davon Petrus mit Schlüssel und Buch, dann Catharine mit Schwert und Rad, links der Apostel Paulus mit aufgerichtetem Schwerte und Buch, dann die heilige Elisabeth (?) mit einem zugedeckten Korbe. Unter dieser


|
Seite 426 |




|
Leiste steht auf der Altarplatte eine Leiste mit den gemalten Köpfen Christi und der übrigen 10 Apostel, wie es scheint; wenigstens ist der mittlere Kopf ein Christuskopf und an jeder Seite stehen 5 andere Köpfe, alle etwas beschädigt. Die Malerei ist gut, so wenig davon erhalten ist, das Schnitzwerk ist mittelmäßig. Ueber dem Ganzen steht eine Leiste mit einer Inschrift mit lang gezogenen gothischen Buchstaben:

Die rothen Kreuze.
An der Westwand des Mittelschiffes zu beiden Seiten des mittlern Fensters und an der Wand im südlichen Theile des Umganges um den hohen Chor stehen auf viereckigen, weißen Schilden in gothischer Einfassung gemalte rothe Kreuze. Dies sind ohne Zweifel die bischöflichen Weihkreuze. Da sich an andern Orten hinter denselben Trümmer von mittelalterlichen schwarzen Töpfen gefunden haben, welche wahrscheinlich Nachrichten enthielten, so ließ ich im Sept. 1843 die Wand hinter den Kreuzen untersuchen, fand aber nichts, als festes Mauerwerk.
Das fürstliche Erbbegräbniß aus dem Mittelalter.
Die Landesfürsten in allen Linien hatten zu Doberan, als dem gefeierten Quell des christlichen Lichtes in Meklenburg, ihr Erbbegräbniß 1 ). Nach dem voraufgehenden Abschnitte über den Bau der Kirche war dieses Begräbniß in einer eigenen Kapelle, S. 415, mit einem Altare links an der Pforte des nördlichen Kreuzschiffes. Fast die ganze Kapelle wird jetzt von dem großen und hohen, über der Erde aufgeführten Grabdenkmale des Herzogs und Bischofs Magnus († 1550) und seiner Mutter Ursula († 1510) gefüllt; bei Gelegenheit der Erbauung desselben ist der alte Fußboden und mit demselben der Altar viel höher, nämlich über das Grabgewölbe, gelegt.
Links von der Kirchenthür, vor des Bischofs Magnus Begräbnisse, liegen in einer Reihe 5 viereckige Ziegel mit einem Relief=Stierkopfe, welche die Stelle bezeichnen, wo vor dem Altare der Fürsten=Kapelle die alten fürstlichen Leichen der Linien Meklenburg, Werle und Rostock von dem gemeinsamen Stammvater Pribislav an ruhen; es sind früher sechs Steine gewesen,


|
Seite 427 |




|
einer derselben ist bei der Umlegung des Pflasters in den jüngsten Zeiten völlig zerbrochen. Alle Reliefziegel sind übrigens in den neuesten Zeiten gerückt. Dicht an dem Grabdenkmale des Bischofs Magnus innerhalb der Umgitterung der Gedächtnißtafel, liegt noch ein Stein derselben Art. An einem Pfeiler in diesem Raume hängt eine Tafel mit der Inschrift:
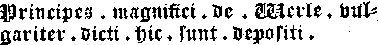
Diese Inschrift, so wie ihr Inhalt, daß die Fürsten von Werle hier begraben seien, rührt von Nic. Marschalk her. Die Steine beweisen aber etwas ganz anderes. Von allen 5 Steinen, welche in einer Reihe liegen, hat nur einer einen alten werleschen Stierkopf (ohne Halsfell); die übrigen 4, wenigstens gewiß 3, haben den bekannten meklenburgischen Stierkopf (mit aufgerissenem Maule und mit Halsfell); der hinter der Vergitterung vor dem Grabe des Bischofs Magnus liegende Stein hat ebenfalls einen meklenburgischen Stierkopf, jedoch aus jüngerer Zeit, weniger schön modellirt, aus dem 15. Jahrhundert. Die Inschrift auf der Tafel ist also nur zum Theil wahr.
Es ist daher außer Zweifel, daß hier nicht allein die Grabstätte der Fürsten von Werle, sondern die berühmte Grabstätte aller Landesherren aus den verschiedenen Linien des Hauses Pribislav's sei.
Jedoch sind nicht alle fürstlichen Personen des Mittelalters hier beigesetzt. So wie Neigungen andere Verbindungen veranlaßten, nahmen andere geistliche Stiftungen die fürstlichen Leichen auf. So ist Heinrich Borwin II. im Dome zu Güstrow, so sind die gefeierten Fürstinnen Anastasia und Beatrix im Franziskaner=Mönchskloster zu Wismar begraben u. s. w.
Auch in der doberaner Kirche liegen einige fürstliche Leichen aus dem Mittelalter nicht in dem alten fürstlichen Erbbegräbnisse. Heinrich der Löwe ruhet im Chor, wahrscheinlich weil er nach vielen kriegerischen Störungen der Klostergüter sich endlich ganz dem Kloster Doberan ergab und der Chor ungefähr unter seiner Regierung und durch seinen Beistand vollendet sein wird. Wahrscheinlich ruht aus dem letztern Grunde auch die Fürstin von Werle neben ihm im hohen Chor.
Eine im Sept. 1843 angestellte Untersuchung des Begräbnißgewölbes des Bischofs Magnus hat gelehrt, daß der ganze Fußboden gegen 1 Fuß, also so tief, als das ehemalige Pflaster der Kirche, gesenkt und mit Hohlziegeln und festem Kalk bedeckt, das kellerartige Gewölbe aber fast bis auf den


|
Seite 428 |




|
Fußboden hinuntergeführt ist. Es ist also jede Hoffnung verschwunden, daß man Pribislav's und der alten Fürsten Gräber einzeln je wieder finden wird; man kennt nur die Stelle. - Die Särge des Bischofs Magnus und seiner Mutter Ursula sind völlig zerfallen und ohne Spur ihrer ehemaligen Bestimmung; auch sind sie in frühern Zeiten offenbar durchwühlt worden.
Seit dem 17. Jahrhundert sind die fürstlichen Leichen hinter dem Altare beigesetzt.
Fürstliche Leichensteine im hohen Chor.
Im hohen Chore sind drei Grabstätten mit schmalen Ziegeln abgegrenzt und mit kleinen glasurten und Mosaikziegeln mit den Bildern von Hirschen, Greisen, u. s. w., weiß in schwarz, von ungefähr 2''□ Größe, mit welchen auch die Altarstellen hier und in der Kapelle zu Althof gepflastert sind, ausgelegt.
1) Das Grab des Fürsten Heinrich des Löwen,
welcher am Tage der Heil. Agnes (21. Jan.) 1329 starb. Der abgegrenzte Raum ist mit kleinen Mosaikziegeln gefüllt. In der Mitte liegen zwei große Ziegel mit den Reliefbildern eines Schildes und eines Helmes, stärker als die übrigen Reliefziegel, welche am Nordeingange vor dem Grabgewölbe des Bischofs Magnus liegen, aber sehr abgetreten. Die Einfassung des Grabes besteht aus 24 langen und schmalen Ziegeln von ungefähr 8'' Länge gegen 3'' Breite und 1 1/2'' Dicke, mit einer Inschrift aus gothischen Buchstaben, welche in dem Thon tief ausgeschnitten sind. Auffallend ist es, daß gothische Buchstaben angewandt sind, da sich diese vor dem J. 1350 kaum zu Inschriften finden; vielleicht aber, da keine Regel ohne Ausnahme ist, wollte man das Grab des gefeierten Helden besonders kunstreich schmücken, oder die Inschrift ist auch etwas später gelegt, da das daneben stehende Grab eine Inschrift mit ganz gleichen Ziegeln und Buchstaben hat. Das Letztere scheint wahrscheinlicher zu sein. Im 14. Jahrhundert ward aber die Inschrift jedenfalls gelegt, wahrscheinlich bei der Vollendung und Einweihung der fertig gebaueten und vollständig geschmückten Kirche im J. 1365.
Daß Heinrich der Löwe im Chor und nicht bei seinen Vorfahren an der nördlichen Pforte begraben ward, ist allerdings auffallend. Aber theils wollte man dem großen Manne, der dem Kloster freilich viel geschadet, aber auch den Schaden wieder abgebüßt hatte, eine besondere Ehre erweisen, theils


|
Seite 429 |




|
lebte er in der Zeit des rüstigsten Baues der Kirche und beförderte denselben ohne Zweifel bedeutend.
Nach neuern Entdeckungen lautet die Inschrift:
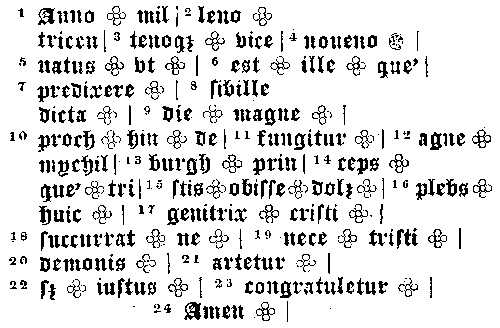
d. i.
Anno milleno
tricentenoque vicenoueno,
natus ut est ille,
quem predixere Sibyllae,
dicta die magnae,
proh! Hinricus defungitur Agnae,
Mychilburgh princeps,
quem tristis obisse dolet plebs,
huic genitrix Christi
succurrat, ne nece tristi
demonis artetur,
sed iustus congratuletur.
Amen.
So auch ist die Inschrift von Nic. Marschalk im ersten Viertheil des 16. Jahrhunderts aufgenommen und auf einer Tafel im nördlichen Kreuzschiffe aufbewahrt. Nur die zweite Zeile bei Marschalk ist nicht richtig; er lieset nämlich: tricen vicenque noueno.
Am Ende des Monats September 1843 ward dem Verfasser der hohe, ehrenvolle Auftrag, den Grund des Chores zur Legung des Fundamentes für den Sarkophag des hochseligen Großherzogs Friederich Franz freizulegen und zu untersuchen. Bei dieser Gelegenheit ward die Platte auf dem Grabe Heinrichs des Löwen gehoben. In einer Tiefe von 5 Fuß


|
Seite 430 |




|
ward unter jungem Bauschutt der fehlende vierte
Stein mit den Buchstaben:
tenoqz
 vice
völlig wie neu erhalten gefunden.
Der Stein muß also schon Jahrhunderte
verschüttet gewesen sein und Marschalk den
Inhalt conjecturirt haben, da er die Lesung
vicenque
hinterlassen hat. - Uebrigens
war die Inschrift schon früher gerückt und
falsch eingesetzt. Zwei Steine mit den Worten
nunc
vice
völlig wie neu erhalten gefunden.
Der Stein muß also schon Jahrhunderte
verschüttet gewesen sein und Marschalk den
Inhalt conjecturirt haben, da er die Lesung
vicenque
hinterlassen hat. - Uebrigens
war die Inschrift schon früher gerückt und
falsch eingesetzt. Zwei Steine mit den Worten
nunc
 postulet
und
nunc
postulet
und
nunc
 quiuis
quiuis
 , welche nach der neuern Legung an der 4.
und 5. Stelle lagen, gehören gar nicht zu dieser
Inschrift. - Der Stein 4
noueno
war in
mehr als 30 Stücke zertreten. Auf dem Steine 10
steht sicher
proch
und auf 21
artetur
. Auf 8 liest man am besten
dicta
, obgleich man auch vielleicht
victa
lesen könnte.
, welche nach der neuern Legung an der 4.
und 5. Stelle lagen, gehören gar nicht zu dieser
Inschrift. - Der Stein 4
noueno
war in
mehr als 30 Stücke zertreten. Auf dem Steine 10
steht sicher
proch
und auf 21
artetur
. Auf 8 liest man am besten
dicta
, obgleich man auch vielleicht
victa
lesen könnte.
Bei Untersuchung des Grundes ward auch das Grab Heinrichs des Löwen freigelegt. Der Löwe ruhet mit dem Kopfende im Chor 4 1/2' von der Stufe zum Chore nach dem Altare hin und 12' von der nördlichen Chorwand. Hier steht 5' 10'' tief unter dem Chorpflaster auf dem sehr nassen Wellsande des Grundes ein Sarkophag von äußerst großen Ziegelsteinen, im innern 2' 2'' hoch, am Kopfende 3' 1 1/4'' breit, am Fußende 2' 10 1/2'' breit, 8' 4'' lang, oben und unten offen. In demselben hat ein hölzerner Sarg gestanden, welcher völlig zu Erde vergangen und nur an einem regelmäßigen Streifen dunkeler Erde zu erkennen ist. In dem Sarkophage, von dem zur Dicke eines Laubblattes vergangenen Sargdeckel bedeckt, ruhen die Gebeine des Löwen gegen Osten schauend, mit den Händen im Schooße, völlig wohl erhalten und ungestört, nur daß der Schädel zerdrückt ist. Die Länge des ausgestreckten Gerippes betrug 6' 3 3/4'', des Oberschenkels 1' 7'', des Unterschenkels 1' 4'', des Oberleibes vom Nacken bis zum Schenkelkopfe 2' 4 1/2''. Die Gebeine waren sehr stark. Die Stirn war niedrig, das Stirnbein ungewöhnlich stark. Die Zähne waren bis auf einen alle vorhanden und vollkommen gesund; die Backenzähne, im Beginnen des Abschleifens, deuteten auf einen Mann hoch in den Vierzigen. Die Zähne in den starken Kinnladen standen grade auf einander und deuteten auf volle Lippen. Alles verrieth aber eine große, kräftige Heldengestalt. Hiemit, namentlich in Beziehung auf Größe und Lippen, stimmt auch ein altes, traditionelles Bild vom J. 1523 im großherzoglichen Archive überein, nach welchem vor einigen Jahren der Hofmaler Schumacher für den Herrn Landrath Reichsfreiherrn von Maltzan auf Rothenmoor zum Geschenke für den hochseligen Großherzog Paul Friederich ein Bild des Löwen entwarf.


|
Seite 431 |




|
Nach Untersuchung des Grundes ist der Sarkophag des Löwen, welcher, bis 3'' über den Gebeinen, mit jungem Schutt gefüllt war, sorgsam gereinigt und am 28. Sept. 1843 mit einem Gewölbe bedeckt worden, was früher nicht der Fall war.
Die Ziegelsteine, aus denen der Sarkophag gemauert war, waren 1' lang, 6'' breit und 4'' dick; gerade so groß sind die Steine, aus denen die doberaner Kirche erbauet ist. Die Ziegel, auf welchen der Sarg des Fürsten in dem Sarkophage gestanden hatte, waren 11'' lang, 5 3/4'' breit und gut 2'' dick.
2) Neben dem Grabe Heinrich's des Löwen, im Grunde 6', von demselben entfernt, ist ein zweites ähnlich ausgestattetes Grab, welches jedoch nur zu Häupten eine Inschrift auf 3 Ziegeln hat:

(= Uxor domini Nicolai de Werle.)
Wahrscheinlich liegt hier Jutte von Anhalt, des Fürsten Nicolaus I. von Werle Gemahlin. Nach Kirchberg c. 173 ward Nicolaus I. im J. 1277 zu Doberan begraben und seine Gemahlin überlebte ihn nach 44jähriger Ehe. Würde hier die Gemahlin eines jüngern Nicolaus von Werle ruhen, so wäre wahrscheinlich der Gemahl schon genauer bezeichnet; nun aber war sie bis dahin die Gemahlin des ersten und einzigen Nicolaus von Werle, also allen als solche bekannt. Da auch die Inschrift in der Form der Inschrift auf dem Grabe Heinrichs des Löwen gleich ist, so werden beide ungefähr in dieselbe Zeit fallen.
Bei Untersuchung des untern Raumes wurden dieselben Verhältnisse, wie im Grabe Heinrichs des Löwen, gefunden. Der Sarkophag von Ziegelsteinen stand nicht grade unter der Grabplatte, sondern mit dem Kopfende 10' von der Stufe zum Chor und 12' von der südlichen Chorwand; auch stand er höher: mit dem Boden 4' tief unter dem Chorpflaster. Der Sarkophag war im Innern 7' 2" lang, überall 2' 5'' weit und 2' hoch. Das Gerippe, gegen Osten gekehrt und mit gefalteten Händen über der Herzgrube, lag ebenfalls vollständig und ungestört in den Resten des gänzlich vergangenen Sarges, nur daß auch hier der Schädel zerdrückt war. Das ausgestreckte Gerippe maaß gegen 6 Fuß und war äußerst zart. Weitere Beobachtungen gestatteten die Umstände nicht.
Auch dieser Sarkokphag ward von Schutt gereinigt und mit einem Gewölbe bedeckt.


|
Seite 432 |




|
In keinem der beiden Sarkophage ward, außer den eisernen Sargnägeln, irgend ein Geräth gefunden. Wahrscheinlich wurden die Leichen, als große Auszeichnung, in Klostertracht beigesetzt.
Genau zwischen beiden sorgsam erhaltenen und geschützten Gräbern liegt das Fundament zu dem Sarkophage des hochseligen Großherzogs Friederich Franz.
3) Etwas weiter nach dem Altare hin, in der Mitte des hohen Chores, liegt eine dritte Grabplatte von kleinen Mosaikziegeln, ohne Inschrift. Nach der Sage soll hier der Herzog Albrecht der Große, Heinrichs des Löwen Sohn, ruhen. Bei der Aufgrabung des Grundes zeigte sich hier aber keine Spur von einem Sarkophage oder der Beisetzung eines Todten. - Vielleicht war diese Stelle eine Asylstätte? Asylstätten pflegten durch ähnliche kleine Steine bezeichnet zu werden.
4) unmittelbar vor dem Altare liegt ein sehr großer Leichenstein mit dem Bilde einer Fürstin in einer Nische, von sehr reicher, zierlicher und mitunter gezierter Arbeit. Die Umschrift, welche sehr geschnörkelt ist, lautet:
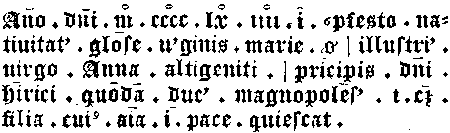
(= Anno domini MCCCCLXIV, in profesto nativitatis gloriosae virginis Mariae (= Sept. 7) obiit illustris virgo Anna, altigeniti principis domini Hinrici quondam ducis Magnopolensis etc. filia, cujus anima in pace quiescat.)
An den 4 Ecken stehen 4 Wappenschilde: neben der Figur oben rechts mit dem meklenburgischen Stierkopfe, oben links mit den rostockischen Greifen, unten links mit dem werleschen Stierkopfe, unten rechts mit dem stargardischen Arme; der letzte Schild zeugt wohl dafür, daß der Stein später nachgelegt ist, sonst wäre dieser Schild von Wichtigkeit für die Heraldik.
Leichensteine.
Leichensteine der Aebte der Abtei Doberan.
In der Kirche zu Doberan liegen auch die Leichensteine von 10 Aebten des Klosters. In der Mitte des Schiffes liegen


|
Seite 433 |




|
die 5 ältern, vor dem hohen Chore die 5 jüngern. Die Inschriften der jüngern Steine sind viel mehr geschnörkelt, so daß sie schwer zu lesen sind; die Inschriften der ältern sind lückenhaft. Uebrigens sind erst in neuern Zeiten diese Leichensteine an die Stellen, wo sie jetzt liegen, versetzt; sie lagen früher an ganz andern Stellen.
Um diese für die Geschichte nicht unwichtigen Inschriften, welche Schröder in den Wismarschen Erstlingen S. 395 flgd. nach alten Handschriften sehr mangelhaft geliefert hat, sicher zu stellen, war eine schon oft gewünschte Uebersicht der doberaner Aebte nöthig. Sie folgt hier, aus den Urkunden des Klosters, Kirchbergs Chronik und den Leichensteinen selbst zusammengestellt; die Erforschung war umfangreich und schwierig. Im Allgemeinen wird die Darstellung richtig sein, namentlich in Beziehung auf die Aufeinanderfolge der Aebte; die Jahreszahlen mögen mitunter eine genauere Bestimmung und Vervollständigung erhalten können, jedoch würde dies der Gegenstand einer sehr umfangreichen Forschung werden müssen. Für die 22 ersten Aebte sind Kirchberg's Nachrichten Cap. 121, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 139 und 144, die Forschungen in den Jahrb. II, S. 174 und die Urkunden des großherzogl. Archivs zum Grunde gelegt; für die folgenden Aebte die Urkunden und die Leichensteine.
Von Bedeutung ist die Nummer der Aebte, welche die Original=Inschriften angeben, Schröder jedoch ausläßt. Auch Kirchberg bezeichnet den zum zweiten Male gewählten Abt Gottfried als den 7ten und den Abt Heinrich als den 10ten. Durch diese Angaben und die Angabe der Regierungszeit der Aebte auf den Leichensteinen haben die Aebte selbst, namentlich wenn mehrere gleiches Namens auf einander folgten, leichter ermittelt und durch alle diese Forschungen die Leichenstein=Inschriften leichter gelesen werden können.
Die Aebte des Klosters Doberan.
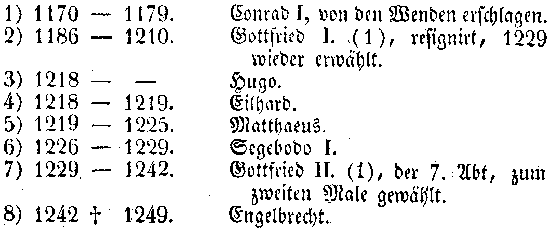


|
Seite 434 |




|
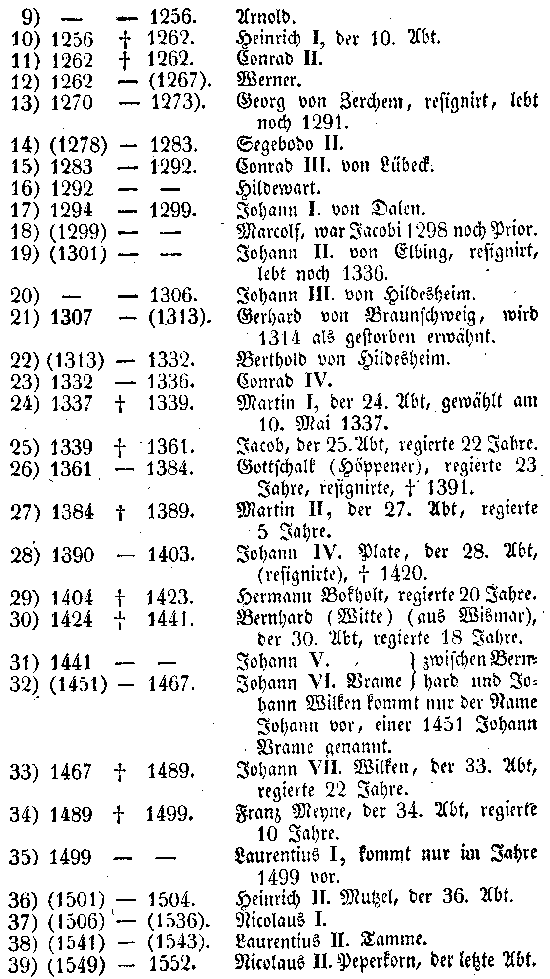


|
Seite 435 |




|
Leichensteine auf den Gräbern der Aebte:
1) im Schiffe: ein Stein mit einem Bischofsstabe, dessen Stab mit Metall ausgelegt gewesen, dessen Krümmung gravirt ist; Umschrift:
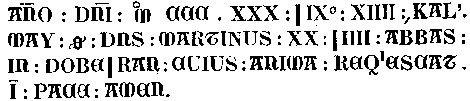
(= Anno Domini MCCCXXXIX, XIV kalendas Maj (= April 17.) obiit dominus Martinus XXIV abbas in Doberan, cuius anima requies- cat in pace. Amen.)
In der Inschrift wird das Jahr
 °
°


 °XXX°IX° = (1339) als das
Sterbejahr des Abtes Martin angegeben. Der Abt
Martin ward zuverlässig am 10. Mai 1337 gewählt
(vgl. Jahrb. VII, S. 45). Hiedurch werden einige
Dunkelheiten in den Schriftzügen beseitigt.
Daher ist sicher XXX°IX° zu lesen, so daß der
Abt Martin am 17. April 1339 gestorben ist.
°XXX°IX° = (1339) als das
Sterbejahr des Abtes Martin angegeben. Der Abt
Martin ward zuverlässig am 10. Mai 1337 gewählt
(vgl. Jahrb. VII, S. 45). Hiedurch werden einige
Dunkelheiten in den Schriftzügen beseitigt.
Daher ist sicher XXX°IX° zu lesen, so daß der
Abt Martin am 17. April 1339 gestorben ist.
Hiemit stimmt auch die Inschrift auf dem Leichensteine des nächstfolgenden Abtes überein, welcher nach einer Regierung von 22 Jahren im J. 1361 starb.
2) im Schiffe: ein Stein mit dem in einer Nische stehenden Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen;
Umschrift:
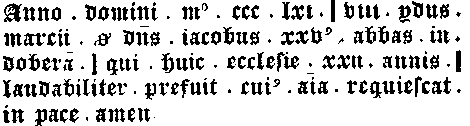
(= Anno domini MCCCLXI, VIII idus Marcii (Mart. 8 ). obiit dominus Jacobus, XXV abbas in Doberan, qui huic ecclesiae XXII annis laudabiliter praefuit, cujus anima requiescat in pace. Amen.)
Man vgl. den Leichenstein des vorhergehenden 24sten Abtes Martin.
3) Schröder in Wismar. Erstl. S. 396 führt noch eine Leichenstein=Inschrift an, welche jetzt fehlt:


|
Seite 436 |




|
Anno domini MCCCXCI dominus Godscalcus abbas in Dobran obiit in festo b. Lucae evan- gelistae (Oct. 18.), qui rexit abbaciam annis XXIII, quam tunc sponte resignavit, IIX annis deo fideliter serviens. Quaerite et orate deum pro eo.
Die Zeitrechnungen treffen zu. Der 25ste Abt Jacob † 1361; der 27ste Abt Martin regierte 1384 † 1389. Wenn also Gottschalk 23 Jahre Abt war, so legte er seine Regierung mit dem J. 1384 nieder; und wirklich erscheint er auch in Urkunden zuletzt 1383 und sein Nachfolger Martin zuerst im J. 1384.
Im großherzogl. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin existirt eine Urkunde des Abtes "Gotschalk Hoppener ("abbet des munsters Dubbraan") von sunthe Angneten daghe drutteynhundert iar in deme vefteghesten" (1350) über den Ankauf des schon 1250 von dem Kloster gekauften Dorfes Benekenhagen und den Wiederverkauf einer Hufe desselben Dorfes an den Verkäufer. Diese Urkunde kann aber unmöglich ächt sein, da der Abt Gottschalk 1361 - 1384 regierte. Ueberdies sieht die Urkunde verdächtig aus. Das Pergament ist kein norddeutsches, sondern weiß durchsichtig, geglättet, und, wie es scheint, von einem Stück gebrauchten Pergaments abgeschnitten; es sind ferner keine Zeugen aufgeführt; endlich ist nicht, wie in der Urkunde verheißen ist, des "kloosters inghezeghel" angehängt, auch kein Abtssiegel, sondern ein gewöhnliches kleines, rundes Civil= oder Privat=Siegel mit einem Schilde, auf welchem 4 nach unten gekehrte Spitzen über einander stehen, und mit der Inschrift:

Uebrigens war Gottschalk Hoppener im J. 1354 (in crast. Gregorii) Unterkellermeister (subcellerarius), im J. 1358 (die Gorgonii) Gastmeister (magister hospitalis) des Klosters.
4) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes, mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
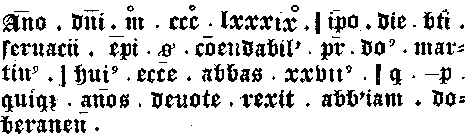


|
Seite 437 |




|
(= Anno domini MCCCLXXXIX ipso die beati Seruacii episcopi (= Mai 13) obiit commenda- bilis pater dominus Martinus, hujus ecclesie abbas XXVII, qui per quinque annos deuote rexit abbaciam Doberanensem.)
5) im Schiffe: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Buch und Stab; Inschrift:
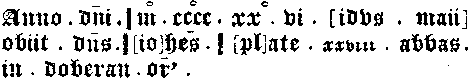
(= Anno domini MCCCCXX' VI [idus Maji] obiit dominus Johannes Plate, XXVIII abbas in Doberan. Orate pro eo.)
Der 28ste Abt war Johannes Plote, welcher in Urkunden 1390, 1396 und 1401 vorkommt. Der nächstfolgende Abt war Hermann, welcher 1415-1423 in Urkunden genannt wird. Johannes Plate kann also als Abt nicht 1420 gestorben sein, und doch scheint die Inschrift diese Jahreszahl zu enthalten. Vielleicht resignirte er vor seinem Tode. Sein Nachfolger war von 1403 oder 1404 bis 1424 Abt.
6) Schröder in Wism. Erstl., S. 397, führt noch eine Leichenstein=Inschrift an, welche jetzt fehlt:
Anno domini MCCCCXXVII, IV kal. Decemb. obiit venerabilis dominus Hermannus Bockholt abbas, qui per annos XX rexit abbatiam Doberanensem.
Hermanns Nachfolger, der Abt Berend, regierte 18 Jahre, 1424-1442; Herrmann muß also resignirt haben, oder es ist die Jahreszahl falsch gelesen und es muß XXIII statt XXVII heißen. Da aber Hermann nach den Urkunden bis 1423 oder 1424 Abt war und 20 Jahre regierte, so wird er ungefähr im J. 1404 Abt geworden sein.
7) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Buch und Stab in den Händen; Umschrift:
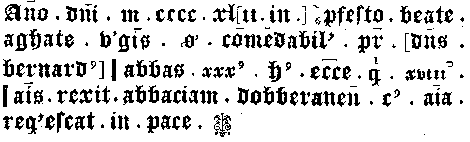


|
Seite 438 |




|
(= Anno domini MCCCCXL[II in] profesto beatae Agathae virginis (= Febr. 4) obiit commendabilis pater dominus Bernardus abbas XXX hujus ecclesiae, qui XVIII annis rexit abbaciam Doberanensem, cujus anima requiescat in pace.)
Die Umschrift ist in dem Namen des Abtes und in
dessen Sterbejahr unleserlich. Schröder Wism.
Erstl., S. 396, liest dominus Henricus mit dem
Sterbejahre 1344. Dies ist aber nicht möglich,
da 1339 - 1361 der Abt Jacob regierte; der
Sterbetag, den Schröder angiebt (beatae Agathae
virginis) und die sonstige Uebereinstimmung der
Inschrift bei Schröder mit der vorstehenden
giebt den Beweis, daß diese gemeint sei. Leider
giebt Schröder die Zahl der Folge der Aebte nie
an. Der 28. Abt war Johann Plate; auf ihn
folgte, nach den Urkunden des Klosters, der Abt
Hermann, welcher sicher 1415 - 1423 vorkommt.
Nach diesem folgt unmittelbar und erscheint in
den Urkunden öfter der Abt Berend 1424 - 1441.
Dies ist also der 30ste Abt, welchen die
Leichenstein=Inschrift hier meint. Da derselbe
nun 18 Jahre regiert hat, so muß sein Sterbetag
in das J. 1441 oder 1442 fallen; der folgende
Abt Johann wird schon am Gregors=Tage 1441
genannt. Daher ist hier ohne Bedenken:
d
 s . bernard
9
ergänzt.
s . bernard
9
ergänzt.
Von der Jahreszahl ist noch etwas zu erkennen. Es steht ungefähr
m.ccccxlıııtt da. Dies muß nun in
m.ccccxlıı. in aufgelöset werden, wie auch dazu stehen scheint. Es könnte auch
m.ccccxlv. in gelesen werden; hiergegen streitet aber die Geschichte. Man kann bei der Lesung diese Zahl der (14) perpendikulairen Linien in Anschlag bringen und dann nach den Urkunden die Lesung feststellen. Da der folgende Abt Johann schon am Gregors=Tage 1441 vorkommt, so wird Bernhard im letzten Jahre seines Lebens resignirt haben.
8) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
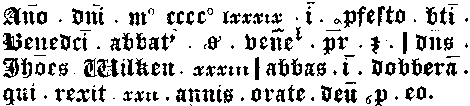
(= Anno domini MCCCCLXXXIX in profesto beati Benedicti abbatis (Mart. 20.) obiit venera-


|
Seite 439 |




|
bilis pater et dominus Johannes Wilken, XXXIII abbas in Dobberan, qui rexit XXII annis. Orate deum pro eo.).
9) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch in den Händen; Umschrift:
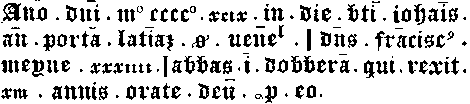
(= Anno domini MCCCCXCIX in die beati Johannis ante portam latinam (Mai 6.) obiit uenerabilis dominus Franciscus Meyne, XXXIV abbas in Dobberan, qui rexit X m annis. Orate deum pro eo.)
Das Sterbejahr (1499) ist ohne Zweifel richtig gelesen, auch die Reihenfolge des Abtes als des 34sten. Eben so ist das Sterbejahr des voraufgehenden 33sten Abtes Johannes Wilken († 1489) richtig gelesen. Zweifel erregt im Originale der vorstehenden Inschrift die Regierungszeit des Abtes Franz Meyne. Es steht da: xııı ; da jedoch die Buchstaben alle an einander hangen, so ist es zweifelhaft, ob ııı oder m zu lesen ist. Da aber das letzte ı lang hinuntergezogen ist ııj (hinuntergezogen) so ist wahrscheinlich m zu lesen, und dies ist dann die Endung der Zahl x m (= decem), da der Abt nur 10 Jahre regiert haben kann.
10) vor dem hohen Chore: ein Stein mit dem Bilde eines Abtes mit Stab und Buch; Umschrift:
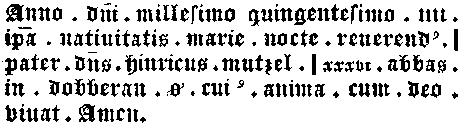
(= Anno domini millesimo quingentesimo IIII
ipsa natiuitatis Mariae nocte (Sept. 8.) reuerendus pater dominus Hinricus Mutzel XXXVI abbas in Dobberan obiit, cujus anima cum deo viuat. Amen.)
Der Zuname des Abtes ist bei der äußerst geschnörkelten Schrift undeutlich: man kann, am wahrscheinlichsten, mutzel , vielleicht aber auch mukel lesen.


|
Seite 440 |




|
3 u. 6?) in der Mitte des Schiffes: liegen zwei trapezoidische Leichensteine mit einem eingehauenen Bischofsstabe in der Mitte, jetzt ohne Inschrift. Vielleicht sind dies die Leichensteine der Aebte Gottschalk († 1391) und Hermann († 1427).
Leichensteine anderer Geistlichen.
Im nördlichen Seitenschiffe: ein Stein mit dem in einer Nische stehenden Priester, welcher den Kelch consecrirt; zu seinen Füßen steht ein Wappen mit einem schräge links bogenförmig gezogenen Bande, unter welchem 2 Lilien, über welchem eine ähnliche, unkenntliche Figur steht; die Umschrift ist nur an den Seiten und unten eingehauen:
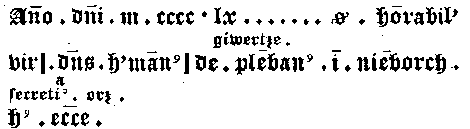
(= Anno domini MCCCCLX . . . . .obiit honorabilis vir dominus Hermannus de Giwertze, plebanus in Nienborch, hujus ecclesie secretarius. Orate pro eo.)
Nach Schröder S. 397 war noch ein Leichenstein in der Kirche mit der Inschrift:
Anno domini MCCCCXXIII, V idus Julii obiit Nicolaus Dunnepeper, qui multum ornauit ecclesiam istam.
Unter dem Kreuzschiffe: ein Stein mit dem Relief=Bilde eines Predigers, zu dessen Füßen ein Wappen mit drei Köpfen steht; Umschrift:
ANNO . 1599 . DEN . 20 . SEPTEMB . IST . IN . GODT . DEM . HERN . SEHLICH . ENTSCHLAFFEN . M . HERMANNVS . KRUSE . DERO . SIELEN . GODT . GENADE . IST . ALHIE . ZV . DOBBERAN . PREDIGER . GOTLICHES . WORDES . GEWESEN . 35 . JHAR . SEINES.
um den Kopf folgt die Fortsetzung in 2 Zeilen:
ALTERS . 63 . JHAR . SEINER . HERKVMST . AVS . DER . GRAVESCHV . OLDENBORCH .


|
Seite 441 |




|
Leichensteine weltlicher Personen.
Hinter dem Altare in dem südlichen Umgange vor einem alten Nebenaltare in einer Capelle ist das Erbbegräbniß der Axecow. Vor dem Altare liegen 4 axecowsche Leichensteine:
a. ein großer Stein: rechts steht die Figur eines Ritters, welcher in der Linken ein großes Schwert hält, rechts neben sich den axecowschen Schild hat; links steht eine betende Matrone. Die Arbeit ist gut. Umschrift:
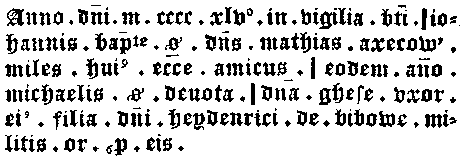
(= Anno domini MCCCCXLV in vigilia beati Johannis baptiste (Junii 23.) obiit dominus Mathias Axecowe miles, huius ecclesie amicus. Eodem anno Michaelis (Sept 29.). obiit deuota domina Ghese, uxor eius, filia domini Heydenrici de Bibowe militis. Orate pro eis.)
Der Ritter Mathias Axecow stiftete schon im J. 1439 für sich, seine Vorfahren und seine nächsten Verwandten Seelenmessen 1 ) im Kloster Doberan und machte sein Testament am 25 März 1445 2 ).
Die Figur des Ritters hat auf dem Helme in der Mitte einen runden Federbusch und an jeder Seite eine aufrecht stehende Schere, in der alten Gestalt, wie eine Schaafschere; der Schild neben dem Ritter ist quer getheilt, unten mit einem Herzen, oben mit zwei aufrecht stehenden Scheren neben einander.
An den 4 Ecken des Leichensteines stehen Wappenzeichen: rechts neben dem Ritter: unten der axecowsche Schild, oben der axecowsche Helm, wie eben beschrieben; - links neben der Matrone: unten der von bibowsche Schild mit einem rechts schreitenden Hahn ohne Kissen, oben der bibowsche Helm: auf einem Helme ein schreitender Hahn auf einem viereckigen Brette oder Kissen mit einem runden Knopfe an jeder Ecke. Dies ist das erste Beispiel, daß der von bibowsche Hahn auf einem Kissen steht.


|
Seite 442 |




|
Dann liegen 3 ganz gleiche Leichensteine neben einander, jeder mit 2 Nischen, in deren jeder ein geharnischter Ritter mit geschlossenem Visir steht, alle mit dem Schwerte in der Hand und den axecowschen Schild neben sich. Diese 3 Leichensteine stammen alle aus derselben Zeit, aus dem 15. Jahrhundert, und sind ohne Zweifel später zugleich nachgelegt worden, vielleicht nach oder kurz vor dem Aussterben des Geschlechts.
Die Umschriften sind jetzt zum Theil unleserlich; die jetzigen Lücken sind mit Hülfe alter Entzifferungen in Schröder's Wismarschen Erstlingen S. 338 und 398 und nach Vergleichung der Originale ergänzt:
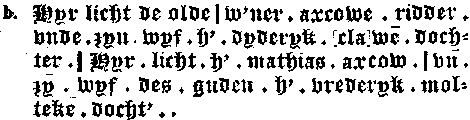
(= Hyr licht de olde Werner Axcow ridder vnde zyn wyf, her Diderik Clawen dochter. Hyr licht her Mathias Axcow vnde zyn wyf, des guden her Vrederyk Molteken dochter.)
Nach den Urkunden vom 2. Februar 1439 und 25. März 1445 waren die Ritter Werner Axecow und Grete die Aeltern des Ritters Mathias, welcher am 23. Junii 1445 starb. Im J. 1445 lebte der Ritter Mathias Axecow auf Neuhof, nachdem sein Vater, der Ritter Werner Axecow, schon gestorben war. Die Wittwe des Werner Axecow hieß 1445 Grete.
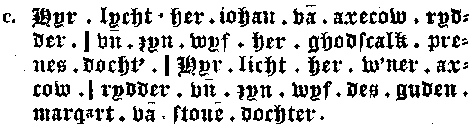
(= Hyr lycht her Johan van Axecow rydder vnde zyn wyf, her Ghodscalk Prenes dochter. Hyr licht her Werner Axcow rydder vnde zyn wyf, des guden Marquart van Stouen dochter.)
Der Ritter Johann v. Axecow war nach den Urkunden ein Bruder am 23. Junii 1445 gestorbenen Ritters Mathias.
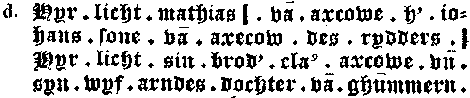


|
Seite 443 |




|
(= Hyr licht Mathias van Axcow, her Johans sone van Axecow des rydders. Hyr licht sin broder Clawes Axcow vnde sin wyf, Arndes dochter van Ghummern.)
Wappen und Jahreszahlen sind auf diesen 3 Leichensteinen nicht befindlich.
An der Wand über diesen Gräbern hangen mehrere, aus Holz geschnitzte alte axecowsche Wappen.
Im südlichen Seitenschiffe liegt ein Leichenstein mit zwei gothischen Nischen in Umrissen; in jeder steht ein Ritter, mit einer Hand ein Schwert, mit der andern den Wappenschild der von Oertzen haltend, auf dem Haupte einen Helm mit zwei Federn. Die Arbeit ist nicht besonders gut. Unten in den Ecken steht zwei mal der von örtzensche Schild, oben in den Ecken zwei mal ein Helm mit den beiden ringhaltenden Armen. Die Umschrift lautet :
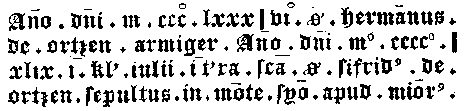
(= Anno domini MCCCLXXXVI obiit Hermannus de Ortzen armiger. Anno domini MCCCCXLIX in kalendis Julii (Julii 1) in terra sancta obiit Sifridus de Ortzen, sepultus in monte Syon apud minores.)
An einem Pfeiler an der Wand hängt ein altes, aus Holz geschnitztes von örtzensches Wappen, im Schilde und auf dem Helme mit den beiden ringhaltenden Armen.
Der Knappe Siverd oder Siegfried von Oertzen auf Roggow hatte schon Weihnacht 1431 den Entschluß zur Pilgerfahrt ins gelobte Land gefaßt, als er dem Kloster Doberan Schenkungen machte 1 ). Er kam aber erst im Jahre 1441 zur Reise, indem er am 4. März 1441 sein Testament machte und dem Kloster Doberan seine Urkunden und sein Geld in Verwahrung gab 2 ).
Im südlichen Seitenschiffe liegt ein schon sehr verwitterter Stein mit einer betenden weiblichen Figur in einer Nische; Umschrift:


|
Seite 444 |




|
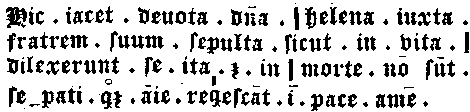
(= Hic jacet deuota domina Helena juxta fratrem suum sepulta: sicut in vita dilexerunt se, ita etiam in morte non sunt separati: quorum animae requiescant in pace. Amen.)
Wer diese Helena und ihr Bruder sei, ist unbekannt. Der Stein liegt in der Nähe der von Oertzenschen Leichensteine. Die Schriftzüge deuten auf das 15. Jahrhundert.
In der Nähe liegt ein anderer, großer Stein, dessen Oberfläche aber ganz verwittert ist.
An der Pforte des südlichen Kreuzschiffes, der jetzigen Hauptpforte, liegt ein großer Leichenstein, 11' lang und 7' breit, mit zwei gothischen Nischen, in denen zwei Figuren in Umrissen stehen; die Arbeit ist sehr gut. Rechts steht ein geharnischter Ritter, vor sich mit der Rechten das Schwert, mit der Linken den moltkeschen Wappenschild mit drei Birkhühnern haltend; auf dem Haupte trägt er einen Helm mit einer Lilienkrone, über welche fächerartig sechs Pfauenbüsche hervorragen. Links steht eine betende Matrone mit gefaltenen Händen. Die Umschrift lautet:
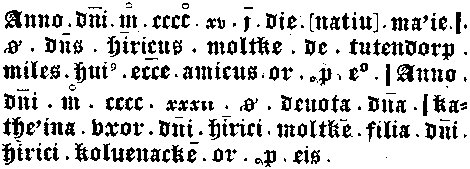
(= Anno domini MCCCCXV in die [nativitatis] Mariae (Sept. 8.) │ obiit dominus Hinricus Moltke de Tutendorp miles, huius ecclesie amicus. Orate pro eo. │ Anno domini MCCCCXXXII obiit deuota domina │ Katherina uxor domini Hinrici Moltken, filia domini Hinrici Koluenacken. Orate pro eis.)
Um das Haupt der Frau liegt ein Band mit der Umschrift:

In den Ecken stehen 4 Wappenschilde: oben rechts neben dem Manne der moltkesche, links neben der Frau der bü=


|
Seite 445 |




|
lowsche, unten umgekehrt rechts der bülowsche, links der moltkesche.
Im Predigergarten neben dem Pfarrhause liegt ein schöner Leichenstein, der neben der Kirche tief in der Erde gefunden und von dem wail. Präpositus Röper an seine jetzige Stelle gebracht ist. Die Darstellung ist dieselbe. Der Ritter hat ebenfalls den moltekeschen Wappenschild vor sich. Umschrift:
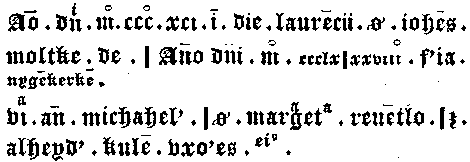
(= Anno domini MCCCXCI in die Laurencii (Aug. 10.) obiit Johannes Moltke de Nygenkerken. Anno domini MCCCLXXXVIII feria VI ante Michaelis (Sept. 25.) obiit Margareta Reventlo et Alheidis Kulen, uxores ejus.)
An den vier Ecken stehen die vier Evangelisten in Symbolen.
In dem nördlichen Theile des Umganges um den hohen Chor liegt ein Leichenstein mit einer gothischen Nische, in welcher ein bekleideter Ritter, ohne Helm, steht, mit dem Schwerte in den Händen und dem Wappenschilde der von der Lühe neben sich. Die Umschrift ist sehr verwittert und ausgesprungen, namentlich ist die Stelle wo der Name stand, ausgebrochen. In Schröder Wismar. Erstl. S. 396 wird die Inschrift also gelesen:
Post M bis duo CCC semel superadde
Martinus in festo Vicentii rem manifesto
Vir bonus Hinricus Dein sincerus amicus
Claustri decessit sub petra qui requiescit
fiat cum pace. Amen.
Diese Lesung kann aber, sicher in Jahreszahl und Namen, nicht richtig sein. Nach wiederholten Studien ist noch zu lesen:
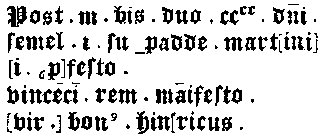


|
Seite 446 |




|
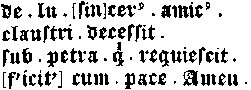
d.i.
Po'st M duo CC domini
semel I superadde Martini
in profesto
Vincencii rem manifesto
vir bonus Hinricus
de Lu, sincerus amicus
claustri, decessit,
sub petra qui requiescit
feliciter cum pace. Amen.
Die Jahrszahl
 c
c
c
c
= 1400 ist sicher gelesen. Eben so steht auf
dem Steine sicher
c
c
c
c
= 1400 ist sicher gelesen. Eben so steht auf
dem Steine sicher
 art
. . . und
Vincēci;
vor dem letztern Worte
steht sicher
festo
und wahrscheinlich
6
pfesto
= profesto, und vor diesem
dem Anscheine nach
i
= in. Man muß dann
den Tag des Heil. Vincentius annehmen, welcher
am 6. Junii gefeiert ward; das profestum
Vicentii war dann der 5. Junii; am 4. Junii ward
die Translation des Heil. Martin gefeiert. Die
Sache ist nicht ganz klar; es handelt sich um
Einen Tag. Aber es mußte der Reim herauskommen,
und so kann hier vielleicht die Nacht von S.
Martini auf das Vorfest S. Vincentii gemeint
sein, also 4/5 Junii.
art
. . . und
Vincēci;
vor dem letztern Worte
steht sicher
festo
und wahrscheinlich
6
pfesto
= profesto, und vor diesem
dem Anscheine nach
i
= in. Man muß dann
den Tag des Heil. Vincentius annehmen, welcher
am 6. Junii gefeiert ward; das profestum
Vicentii war dann der 5. Junii; am 4. Junii ward
die Translation des Heil. Martin gefeiert. Die
Sache ist nicht ganz klar; es handelt sich um
Einen Tag. Aber es mußte der Reim herauskommen,
und so kann hier vielleicht die Nacht von S.
Martini auf das Vorfest S. Vincentii gemeint
sein, also 4/5 Junii.
Der Name
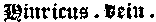
ist in Schröder sicher falsch gelesen; es muß ohne Zweifel
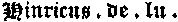
(Heinrich von der Lühe) gelesen werden.
Am Ende steht f'ıııt , vielleicht = feliciter?
In dem nördlichen Theile des Umganges seitwärts hinter dem Altare liegt ein Leichenstein mit einer stehenden, betenden Figur in weitem Gewande, mit vollem Haar, ohne Kopfbedeckung. Die Umschrift liegt in der Linie des umfassenden Spitzbogens um die Gestalt. Oben steht an jeder Seite ein Schild mit einem Wappen, wie Thorzinnen, welches in dem Schildfuße allerdings etwas klein gehalten ist. Die Umschrift lautet:


|
Seite 447 |




|
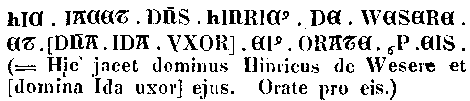
(= Hie jacet dominus Hinricus de Wesere et [domina Ida uxor] ejus. Orate pro eis.)
Die Worte
D

 . ID
. ID
 . VXOR
sind nicht klar
mehr zu lesen; sie sind nach einer ältern Lesung
in Schröder Wism. Erstl. S. 398 ergänzt und nach
der Zahl der Buchstaben auch wahrscheinlich.
. VXOR
sind nicht klar
mehr zu lesen; sie sind nach einer ältern Lesung
in Schröder Wism. Erstl. S. 398 ergänzt und nach
der Zahl der Buchstaben auch wahrscheinlich.
Der Leichenstein ist nicht unwichtig. Die Schriftzüge fallen in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der Stein deckt also ohne Zweifel die Gruft des rostocker Bürgers Heinrich von Weser und seiner Gemahlin Ida. Dieselben: "discretus et honestus vir Hinricus et deuota vxor eius domina Ida, dicti de Wesera, burgenses ciuitatis Rostoc" legirten am 21. Julii 1304 dem Kloster Neukloster 20 Mark jährlicher Hebungen aus dem Dorfe Toldas; vgl. Lisch Mekl Urk II, S. 96. Wahrscheinlich werden sie sich dem Kloster Doberan eben so freundlich bewiesen haben. Im J. 1300 stiftete Heinrich von Weser, oder Klumpsülver, eine tägliche Messe in der Jacobikirche zu Wismar; vgl. Schröder P. M. S. 859. Eine ganze Familie von Weser zu Wismar wird in einem alten Testamente (aus dem 13. Jahrh.) in Burmeister's Alterth. des wismarschen Stadtrechts, S. 39, aufgeführt.
Auffallend und wichtig ist, das der Mann auf dem
Leichensteine Herr (dominus), die Frau in der
erwähnten Urkunde Frau (domina) genannt wird,
Titel, welche sonst nur Rittergeschlechtern
beigelegt werden. Es werden jedoch auch in alten
Urkunden die Rathsherren von Rostock mit diesem
Titel belegt. Bei dem Worte
D
 S.
ist die Lesung ohne Zweifel
richtig, da die Buchstaben völlig klar sind.
S.
ist die Lesung ohne Zweifel
richtig, da die Buchstaben völlig klar sind.
Die Bülowen=Kapelle.
Die Bülowen=Kapelle am nördlichen Seitenschiffe der Kirche zu Doberan ist ein sehr interessantes Denkmal der Vorzeit, Sie ist allgemein bekannt wegen der Inschrift, welche jetzt auf einem in derselben stehenden, wahrscheinlich aber jüngern, backofenförmigen Grabgewölbe steht:
Wieck D
fel wieck, wieck wiet van my,
Ick scheer mie nig een Hahr um die.
Ick bn ein Meckelb
rgsch Edelmann,
Wat geit die Dfel mien Supen an.


|
Seite 448 |




|
Ick sup mit mienen Herrn Jesu Christ
Wenn du Dfel ewig d
sten m
st
Un drinck mitm s
et Kolleschahl,
Wenn du sitzt in der Hellenquahl.
Drum rahd' ich wieck, loop, rnn un gah,
Efft bey dem Dfel ick to schlah.
Diese Inschrift steht gewiß nicht mehr an ihrer ersten Stelle und ist in der alten Orthographie durch die Umschreibungen mannigfach verändert.
Wichtiger ist die Kapelle durch die Wandgemälde, in Wasserfarben, welche die Gewölbe und die Wandflächen unter denselben bedecken. Die Gewölbekappen und Rippen sind mit Blumenranken, Lilien, Palmetten etc. geschmückt, von denen viele in gutem Style des Mittelalters gehalten und wegen der Seltenheit solcher alter Malereien zum Studium zu empfehlen sind. Die spitzbogigen Wandflächen unter den Gewölben enthalten Gemälde zur Geschichte der Familie von Bülow.
An der östlichen Hauptwand steht ein Crucifix, zu beiden Seiten Maria und Johannes, zu jeder Seite derselben ein Heiliger; hinter den Heiligen knieet dem Beschauer rechts ein Ritter mit dem v. Bülowschen Wappenschilde neben sich und der Inschrift
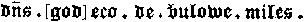
links eine Frau mit einem Schilde, auf welchem ein Bär mit einer Halsfessel (von Karlow) steht. Von dem Vornamen des Ritters sind nur noch die Buchstaben - eco zu erkennen; wahrscheinlich ist [god] eco , = Godefrid, zu ergänzen, ein der Familie von Bülow eigenthümlicher Vorname, und daher wahrscheinlicher, als [Lud] eco , welches überdies gewöhnlich nur in den Formen Lüdeke oder Lüdekin vorkommt. Wahrscheinlich sind die auf diesem Bilde dargestellten Personen die Stammältern des Geschlechts.
Zu den Seiten der beiden Fenster in der Nordwand stehen die 4 Bischöfe von Schwerin aus dem Hause von Bülow, welche alle in das 14. Jahrh. fallen.
Auf der westlichen Wand, der Hauptwand gegenüber, stehen 2 Heilige.
Die südliche Wand kirchenwärts scheint die gleichzeitige Geschichte zu berühren. Unter dem östlichen Bogen dieser Wand knieet ein Ritter zwischen Heiligen; die Inschriften sind undeutlich. Unter dem westlichen Bogen über der Thür steht ein Ritter und neben ihm die Inschrift:



|
Seite 449 |




|
Dieser scheint der Gründer der Kapelle gewesen zu sein. Da die 4 Bischöfe in derselben dargestellt sind, so muß sie nach 1375 erbauet worden sein. Im 14. Jahrh. hatten die von Bülow die Vogtei Schwaan und die landesherrlichen Gerechtsame in der Abtei Doberan zu Pfande. Von diesen haben mehrere, welche mit der Abtei in Berührung kommen, den Namen Heinrich; es kommen z. B. vor: 1324 der Ritter Heinrich v. Bülow auf Ketelhotsdorf, welcher damals schon verheirathet war; vor 1387 war ein Ritter Heinrich von Bülow gestorben und hatte unter seinen Söhnen einen Heinrich.
Diese Zeilen sollen nur das bewahren, was sicher und ohne Schwierigkeiten noch zu erkennen und zu lesen ist. Es sind neben den Bildern überall noch Spruchbänder mit Inschriften angebracht; um diese zu entziffern, würde es jedoch längerer Zeit und besonderer Anstalten bedürfen.
Der Klosterbezirk.
Der Umfang des Klosters selbst wird noch durch die alte Klostermauer bezeichnet, welche noch steht. Aber das Kloster hatte noch außerhalb der Ringmauern unmittelbar zum Kloster gehörende Besitzungen und Anstalten und wahrscheinlich auch das alte Dorf Doberan, welches vor dem Kloster lag. Im Allgemeinen bildet der Haupttheil des jetzigen Fleckens Doberan, nämlich Kirche, Kloster und Kamp, den alten Klosterbezirk. Dieser wird jedoch in einer Urkunde vom 13. Jan. (oct. epiph.) 1350, durch welche die Herzoge Albrecht und Johann dem Kloster Doberan das höchste Gericht innerhalb der nachstehend beschriebenen Grenzen schenken, genau bezeichnet:
1) von der Brücke über den Bach, der aus dem Kŏlbruche (kŏlbràk) kommt,
(a ponte super rivulo a palude dicta Kolenbruch defluente posito),
d. i. von der Brücke an der südöstlichen Ecke Doberans, am südlichen Ende des Buchenberges, wo der Weg am Buchenberge entlang mit dem alten Wege nach Rostock einen rechten Winkel bildet, über den Bach, der aus den noch jetzt kŏlbràk genannten Gärten zwischen dem Buchenberge und dem Wege nach Cröplin oder dem Landkruge kommt;
2) grade aus bis zur Brücke über den Fluß, der die Räder der Mühle im Backhause treibt,


|
Seite 450 |




|
(inde recto itinere progrediendo trans pontem fixum super rivo, qui se rotis molendini in domo pistrina (Backhaus, jetzt Mühle) iacentis superfundit),
d.i. an der südlichen Seite vom Kloster grade aus an den Gärten und Teichen am kŏlbràk entlang bis über die Brücke beim Landkruge, welche über den Fluß geht, der noch heute die alte Klostermühle oder die Backhausmühle treibt;
3) von dort innerhalb des Grabens, durch welchen das Freiwasser abzulaufen pflegt, welches sich in den Ziegelteich ergießt,
(deinde intra fossaturn per quod aqua libera dicta vrîwater decurrere consuevit, que stagno dicto tegheldîk se infundit),
d.i. innerhalb des Grabens für das Freiwasser, der sich kurz oberhalb der Brücke zur Cröpeliner Straße (Ortsbrücke d. i. Eckbrücke) von dem Bache abzweigt und durch den Ort Doberan vor der ersten Hinterreihe hinter der südwestlichen Häuserreihe am Kamp zieht, am Posthause vorbei unter der Brücke wegfließt in die noch heute Ziegelteich genannten Wiesen hinter dem Gasthofe zum Lindenhofe oder zwischen dem Kamp und dem Wege nach dem Heil. Damm, in welchen Wiesen in alten Zeit noch Teiche waren;
4) von dort grade aus um die Zäune des Ziegelhofes durch die Wiese, genannt die Walkmühlenwiese,
(exinde in directum circum sepes curiae laterariae per pratum dictum walkmolenwisch),
d.i. an den gegen Norden des Ortes belegenen Gärten des Posthauses und des Lindenhofes in der Nordseite des Kampes, welche Gärten noch häufig Ziegelschutt in der Tiefe zeigen, wo also die Ziegelei 1 ) für Kirche und Kloster gestanden hat, durch die Walkmühlenwiese, d. h. durch die Wiese, welche sich bis gegen die äußere, nordöstlich vor Doberan gelegene Mühle erstreckt, d. h. zwischen der Kirche und dem Kammerhofe hindurch;
"Der gewesener Ziegelhoff, so vorm Kloster belegen gewesen, ist im Kriege abgebrandt, der Acker zum Cammerhoff geleget und auff der abgebrandten Stette eine geringe Schäfferey geleget."


|
Seite 451 |




|
5) bis zur Ecke der Mauer hinter dem Schuhhause, bis um die Ostecke,
(ad conum sive angulum muri retro prope curiam sutrinam in parte orientali transeundo),
d. i. bis zu der nördlichsten Ecke der Klostermauer, der Nordseite der Kirche gegenüber, wo also innerhalb der Mauern das Schuhhaus des Klosters lag, und von hier nach Osten herumgehend bis an die nahe östliche Ecke der Klostermauer;
6) die Mauer des Klosters und die Zäune des Klosters entlang grade aus wieder bis zu der Anfangs genannten Brücke über den aus dem Kolbruch fließenden Bach,
(exhinc circum muros claustri Doberan ac sepes et septa ejusdem recta via ad pontem predictum positum super rivulo a Kolebruch eftluente redeundo),
d. i. an der Mauer des Klosters und am Buchenberge entlang bis zur Brücke am kŏlbràk, wo die Grenzbeschreibung anfing.
Der engere Bezirk des Klosters, in welchem es alle Gerichtsbarkeit hatte, umfaßte also grade das Kloster mit der Kirche und den jetzigen Kamp mit Zubehörungen und Umgebungen. Bis zu diesen Grenzen reichte noch bis zur Anlegung des Seebades ringsumher Wald.



|



|
|
:
|
Die Marien=Kirche zu Rostock.
In Jahrb. IV, S. 80 sind kurze Andeutungen über den baulichen und antiquarischen Werth der Kirchen zu Rostock gegeben. Es ist dort gesagt, daß die Kirchen Rostocks sich durch Größe und Kühnheit im Bau nicht auszeichnen, daß nur die Marien=Kirche hohe Beachtung verdiene, jedoch "nichts Hinreißendes, nichts Begeisterndes" habe.
Die Bewunderung der Marien=Kirche ist ziemlich allgemein; aber es fühlen sich viele Gebildete von dem Bau nicht befriedigt: es ist ein geheimer Widerspruch in den Ansichten über dieses Kunstwerk vorhanden, welcher irgendwo seinen Grund haben muß. Betrachtet man die gewaltigen Fenster, den höchst tüchtigen Bau, die große Ausdehnung des Chors und des Kreuzschiffes von außen, so hofft man im Innern eine große, imponirende Kirche zu finden, und tritt man ein, so fühlt man sich ohne Zweifel getäuscht, so sehr man auch die bedeutende Höhe und Kühnheit der Pfeiler und Gewölbe bewundern muß, wenn man diese einzeln betrachtet.


|
Seite 452 |




|
Dieser Widerstreit beruht in einem Mißverhältnisse zwischen Höhe und Länge oder vielmehr darin, daß die Kirche nicht vollendet ist: es fehlt ihr noch der bei weitem größere Theil des Schiffes. Daher kommt es, daß man keine Ansicht über den ganzen Bau im Innern gewinnen kann. Der Chor ist allerdings großartig; aber er bildet jetzt den Haupttheil der Kirche, während er nach der ursprünglichen Absicht nur den Altarraum in sich fassen sollte. Das Wenige, was vom Schiffe vorhanden ist, wird dazu noch von einer kolossalen Orgel und von großen Kirchen=Stühlen und Chören gefüllt. - Aber so kam es in den Hansestädten öfter: es wurden etwa in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Kirchen von kolossaler Ausdehnung für den Ziegelbau angefangen, aber nicht vollendet; dasselbe finden wir an den Kirchen Wismars, welche ebenfalls in sehr großem Maaßstabe angelegt, aber nicht in allen Theilen und in demselben Geiste vollendet und ausgeführt sind; man sieht überall, wie jüngere, schlechtere Anbauten die Ausführung des Grundplanes abgeschnitten haben. Dies mag seinen Grund in dem allmähligen Verfall und den innern Unruhen und äußern Kriegen der Hansestädte im Anfange des 15. Jahrhunderts haben. - Dasselbe Gefühl, welches man beim Anblick des Innern der Marien=Kirche zu Rostock empfindet, empfindet man beim Anblick der großen Kloster=Kirche zu Dargun, von welcher ebenfalls das Schiff abgenommen ist (vgl. Jahresber. VI, S. 90). Fehlt das Schiff, so verliert man die Uebersicht über den Chor, so wie man umgekehrt durch das Fehlen des Schiffes unangenehm berührt wird.
Es ist der Zweck dieser Zeilen, der Wahrheit die Ehre zu geben, und Kunstfreunde und Kunstkenner zum genauen Studium der einzelnen Theile der Marien=Kirche aufzufordern, welche in ihrem Grundplane und in der Ausführung einzelner Theile desselben allerdings zu den bedeutendsten Bauwerken des Vaterlandes gehört.
Von Wichtigkeit dabei wäre das Studium des S. Marien=Kirchen=Archivs und des Oekonomie=Archivs überhaupt, welches noch vorhanden ist, aber in einem alten feuchten Gewölbe des ehemaligen S. Johannis=Klosters aufbewahrt wird und in einer so traurigen Verfassung ist, daß es nicht lange mehr ausdauern kann. Die Urkunden sind theils vermodert, theils mürbe geworden und hunderte von Siegeln sind abgefault und abgerissen oder fallen bei der leisesten Berührung ab; eine schleunige Hülfe ist im höchsten Grade nothwendig.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 453 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Lüdershagen bei Güstrow.
Diese Kirche hat in ihrem Innern nichts Merkwürdiges und ist, obgleich stark im Mauerwerk, doch ohne Gewölbe. Von den beiden im Thurme hangenden Glocken ist die eine vom Jahre 1463 und hat folgende Inschrift:
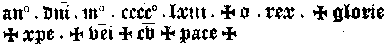
Dann folgt eine Guirlande von Weinranken, ein Blatt und eine Traube abwechselnd. Diese Verzierung geht auch ganz um den untern Rand. Die Glocke ist 3 1/2' weit und 3' Fuß hoch.
Die zweite Glocke ist jünger, mit folgender Inschrift in großen lateinischen Buchstaben:
GODT IM HIMMEL UND UP ERDEN ICH HETE IN MINEM NAMEN MICH GETE. ICH BIN DER ANFANCK VND ENDE STEIDT ALLENS IN MINEN HENDEN. ROM. 8. IS GODT MIDT VNS WOL KAN WEDER VNS CHRISTOFER V KOLLEN ADAMS SOHON ANNO 1607 IS PASTOR GEWESET H. ADAM. PVLLOW.
Darunter steht das herzoglich meklenburgische Wappen mit der Umschrift:
C. H. (Wappen) Z. M.
IS . DESSER . KERKEN . PATRON
Am untern Rande steht:
VORSTENDER HANS KIESER FOS GEHEL HEIDENRICK DER KOSTER HINRICH TESMER,
vor und nach diesen Worten ein dicker Kranz, in dessen Mitte noch steht:
JOCHIM PVLOW ,
wahrscheinlich Name des Gießers. Ein alter Leichenstein, der in neuerer Zeit in die südliche Mauer der Kirche eingemauert ist, zeigt einen geharnischten Ritter in Lebensgröße mit gefaltenen Händen, rechts neben


|
Seite 454 |




|
sich ein Schwert, links den Helm; unter diesem Ritter steht das Wappen der von Köllen, mit den Buchstaben oben und unten:
H. (Wappen) V.
K.
Die Umschrift des Leichensteins ist zum Theil, namentlich unten, ganz zerstört; zu lesen ist noch oben:
ANNO 1580 DEN - 7 MARC
auf der folgenden Längsseite:
IS . DE . EDLE . ERENFESTE . HANS . V . KOLLEN . G . . . .
auf der gegenüberstehenden Seite:
GNEDICH . SI . . . . . . SIN . LEVENT . GEENDICH VN GEFRI.
Vietlübbe, den 20. September 1843.
I. Ritter.



|



|
|
:
|
Die Glocke zu Westenbrügge.
Im Thurme der Kirche zu Westenbrügge hängt eine alte Glocke, über deren Inschrift und Verzierungen der Herr Pastor Priester zu Westenbrügge folgende Nachrichten mit getreuen Zeichnungen mitgetheilt hat.
Oben unter dem Helme steht, über dem Namen Bybowe, ein 6'' hoher Wappenschild mit einem rechts gekehrten Hahn, welcher nicht auf einem Kissen steht, mit ausschreitendem, rechten Fuße, mit zwei großen Schwungfedern im Schwanze, ganz wie das hahnsche Wappen. Die Umschrift lautet:
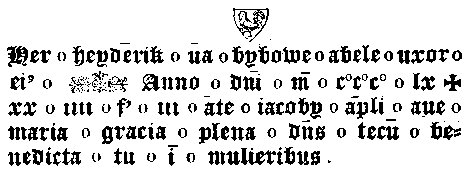
(= Her Heydenrick uan Bybowe. Abele uxor eius. Anno domini MCCCLXXXIIII, feria III ante Jacobi apostoli (= 1384, Julii 19). Aue Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.)


|
Seite 455 |




|
Am Ende steht ein auf einem Sessel ohne Lehnen sitzendes Marienbild, mit dem auf dem Schooße stehenden Christkinde im rechten Arme, 11'' hoch, gut modellirt. Nach den Namen vor Anno steht eine dreiblätterige Blume oder Weinranke mit Wurzel, 8'' hoch. In der mindern Jahrszahl, nach lx steht ein Crucifix.
Links über dem rechten Arme des Crucifixes steht:
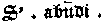
(= Sancti Abundi.)
Der Schenker der Glocke war also der Ritter Heidenrich von Bibow auf Westenbrügge, welcher mit seiner Frau Abele noch im J. 1400 in Lisch Mekl. Urk. II, S. 168 vorkommt.
Wichtig und merkwürdig ist diese Glocke wegen des Wappens, indem hier, wie auf allen alten Siegeln, der von bibowsche Hahn noch nicht auf einem Kissen steht, welches dem Hahn erst um die Mitte des 15 Jahrh. untergelegt wird.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Glocke zu Alt=Karin.
Die Kirche zu Alt=Karin hat 3 Glocken. Die mittlere Glocke hat um den Helm die Inschrift:
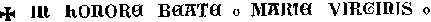
Diese Glocke ist nach den Schriftzügen sehr alt und stammt aus dem Ende des 13. oder dem Anfange des 14. Jahrhunderts.
Die kleinere Glocke hat nur Gießerzeichen und um
den Helm eine ununterbrochene Reihe von

Die größere Glocke ist vom J. 1752.
Westenbrügge.
L. E. Priester.



|



|
|
:
|
Der Leichenstein des Präceptors Johannes Kran von Tempzin in der Kirche zu Lübz.
Im Jahresber. VIII, S. 134 flgd. ist die Kirche zu Lübz mit ihren Denkmälern beschrieben; daselbst S. 135 ist auch des fürstlichen Begräbnisses in der Kirche gedacht. Vor dem Altare, an der Grenze des Chores, 39' von dem Sockel der Epitaphien hinter dem Altare oder ungefähr 42' von der Altarwand und 18' von der nördlichen Seitenwand der Kirche, lag, theilweise von dem Taufkessel bedeckt, die äußerste, nordwestliche Ecke einer Grabplatte von blaugrauem Stuck mit


|
Seite 456 |




|
zwei fürstlichen Wappen und einer Inschrift. Die Platte war völlig abgetreten, zerbrochen und durchaus verfallen. Bei der Restaurirung der Kirche kam im October 1843 diese Platte auch zur Frage. Sie konnte nicht erhalten werden und verdiente es auch nicht. Als die Platte abgeräumt war, ließen sich an den eingelegten, farbigen Schilden zwei fürstliche Wappen erkennen. Heraldisch rechts stand das fünfschildige meklenburgische Wappen, von welchem noch der stargardische Arm in rothem Felde zu erkennen war; links stand ein Wappen, quer getheilt, in der obern Hälfte zwei Mal, in der untern Hälfte drei Mal längs getheilt; der erste und der letzte Schild, so wie der eigenthümlich eingepfropfte mittlere Schild in der untern Hälfte waren roth: das holsteinsche Wappen. Von der Inschrift war in modernen Unzialen des 17. Jahrhunderts noch vorhanden:
- - - EN. GREVIN. - - -
- - - - VND - - - -
- - - ORN. Z - - - - -
Ohne Zweifel ist hier also das Begräbnis der Herzogin Sophie († 1634), Gemahlin des Herzogs Johann. Ihre Tochter Anna Sophie starb im J. 1648 zu Rehna und ward im Dome zu Schwerin beigesetzt.
Die Platte ruhte auf einem Ringe von Ziegeln, einem tief ausgemauerten Begräbnisse, welches mit Sand gefüllt war; in einer Tiefe von etwa 5 Fuß fanden sich die Gebeine in zwei zusammengefallenen Särgen von Eichenholz und von Tannenholz. Nachdem die Ueberzeugung von dem Vorhandensein der fürstlichen Leiche gewonnen war, ward das Grab sogleich wieder bedeckt.
Als die Grabplatte gehoben ward, zeigte es sich, daß der Stuck auf die untere Fläche eines alten Leichensteins gegossen war; die obere, gravirte Seite war nach unten gekehrt. Der Stein war mitten durch gerissen und es fehlte ein kleines Stück, welches grade die Jahreszahl, mit Ausnahme der letzten Ziffer, enthielt. Der Stein ist der Leichenstein von dem Grabe des Präceptors Johannes Cran des Antonius=Klosters zu Tempzin. Der Stein ist 8', 6" lang und 4' 10" breit und reich gravirt. In einer gothischen Nische steht der Präzeptor mit der Tonsur, in reichem Gewande, mit beiden Händen einen Kelch haltend, ohne ihn zu consecriren. Zu seinen Füßen steht ein Wappenschild mit einem rechts gekehrten Kranich, welcher ein T oder Antoniuskreuz mit dem Schnabel


|
Seite 457 |




|
hält; dasselbe Wappen führt der Präceptor auf Monumenten in der Kirche zu Tempzin (vgl. Jahresber. III, S. 158). An dem Fußende ist keine Inschrift. Die Inschrift, welche am rechten Fuße beginnt, lautet in gothischen Buchstaben:
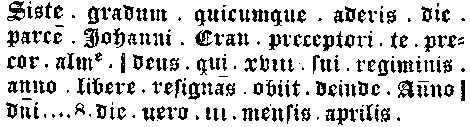
(Siste gradum, quicumque aderis, dic pacem Johanni Cran praeceptori, te precor, alme deus, qui XVIII sui regiminis anno libere resignans, obiit deinde anno domini [152]4, die vero III mensis Aprilis.)
Statt pacē (pacem) steht auf dem Steine irrthümlich parce . Von der Jahrszahl steht nur 8 = 4 da; das Uebrige ist ausgebrochen. Der Inhalt der Inschrift stimmt mit dem Inhalt der Urkunden überein. Johannes Cran ward nach den Urkunden im J. 1500 Präceptor und resignirte im J. 1518, also im 18ten Jahre seiner Regierung (vgl. Jahresber. III, S. 157); er wird also vielleicht im J. 1524 gestorben sein: die Zehner lassen sich jedoch noch nicht bestimmen.
Die Arbeit ist sehr ausgezeichnet und gehört zu dem Besten, was die Sculpturim Vaterlande in dieser Zeit geliefert hat. Der Präceptor Cran war ein verdienstvoller Mann, welchen die Geschichte öfter nennt und der daher auch wohl einen ehrenden Grabstein erhielt. Wie der Stein nach Lübz gekommen sei, ist nicht bekannt; es kommen aber nach der Zeit der Reformation häufig Beispiele vor, daß brauchbare Leichensteine versetzt und anderweitig benutzt werden.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
3. Der neuern Zeit.
Reliefbild Ulrichs Maltzan auf Ulrichshusen.
Das Schloß und Gut Ulrichshusen ward um das J. 1562 von Ulrich Maltzan (1549 † 1578) auf Grubenhagen, wahrscheinlich auf einem Theile der alten Feldmark Papenhagen, gegründet. Das alte Schloß brannte im J. 1624 aus. Das Thorhaus mit der Zingel steht aber noch seit der Zeit der Erbauung unverändert, Es ist im Styl der fürstlichen Schlösser


|
Seite 458 |




|
zu Wismar, Schwerin und Gadebusch mit Reliefbildern aus gebranntem Thon geziert. Neben den Inschriften über die Erbauung steht das maltzansche Wappen und das Wappen der Gemahlin Ulrichs Maltzan, gebornen Margaretha von Kardorff, und über den beiden Wappen zwei Mal ein Medaillon mit demselben männlichen Brustbilde in Relief aus gebranntem Thon; ohne Zweifel ist dies das Bild des Erbauers Ulrich Maltzan. Der Herr Reichsfreiherr A. v. Maltzan auf Peutsch hat von diesem Bilde eine Form nehmen und dem Vereine einen Gypsabguß derselben geschenkt, der auch für die Geschichte der Kunst nicht unerheblich ist da die Reliefplastik des 16. Jahrhunderts hohe Beachtung verdient.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Denktafel in der Kirche zu Dambeck.
Der Herr Pastor Fredenhagen zu Dambeck bei Grabow übergab dem Vereine eine in der dortigen Kirche am Altare befestigt gewesene eichene Tafel, von ungefähr 2 1/2' Länge und 2' Breite, auf welcher mit etwas unförmlichen, großen Buchstaben erhaben eingeschnitzt steht;
1. 5. 4. 9.
J. (N.) D. (N.) D.
AHIM. SKREDER.
HERTEN. STOLTE.
B. D. K. W. S. G. W. B. E.
MESTER. PAWEL.
Die zweite Reihe enthält wohl die Anfangsbuchstaben einer Segensformel, wie: In nomine domini etc., oder dgl. Der zweite und vierte Buchstabe ist undeutlich, vielleicht ein N oder C. - Die beiden folgenden Zeilen enthalten wohl die Namen der Kirchenvorsteher, die letzte Zeile den Namen des Verfertigers (des Altars?). Unten ist die Tafel defect. Die letzte Zeile enthält wohl einen Segensspruch für die beiden Kirchenvorsteher, etwa so:
Befelhebber Desser Kerken Welker Seelen Gott Welle Bewaren Ewigliken
oder dergleichen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 459 |




|



|



|
|
:
|
Inschrift im Steinthore der Stadt Rostock.
Im Steinthore der Stadt Rostock, im Thorflügel Eingangs der Stadt linker Hand, findet sich folgender Spruch eingeschnitten:
KREDIT. IS. REINE. MVSDOT. IN. DISER.
STAD.
ANO. 1648.
Man erzählte neulich dabei, dieser Einschnitt sei von - Hugo Grotius gemacht.
Stavenhagen.
Dr. Jenning.


|
Seite 460 |




|



|



|
|
:
|
IV. Zur Münzkunde.
1. Der vorchristlichen Zeit.
a. auswärtiger Völker.
Römische Münzen.
Die Sammlung des Vereins besitzt bereits mehrere römische Münzen, welche in Meklenburg gefunden sind, und die eine vorgeschichtliche Verbindung mit den Ländern, die im Besitze der Römer waren, beweisen; auch das letzte Jahr hat wieder eine solche gebracht, ein Geschenk des Herrn Pastors Ritter zu Vietlübbe, welcher aber nur die Nachweisung zu geben vermochte, daß sie bei Wittenburg gefunden sei. Es ist ein sehr wohl erhaltener Denar des Kaisers Gordianus (238-244) und hat auf der HS.
das links gekehrte Brustbild mit einer Strahlenkrone, und auf der RS.
die Göttin rechts gekehrt auf einem Stuhle sitzend, indem sie die rechte Hand ausstreckt und in der zurückgewandten linken eine undeutliche Figur (Spinnrocken?) hält.
G. M. C. Masch.



|



|
|
:
|
b. einheimischer Völker.
Der Münzfund von Remlin aus dem 10. - 11. Jahrhundert.
Dieser Münzfund, enthaltend 124 Stücke und außerdem noch die Bruchstücke von etwa 12 andern, vom Herrn v. Kardorff auf Remlin, zugleich mit den dabei gefundenen Schmucksachen (vgl. oben S. 390 flgd.) geschenkt, gehört unstreitig zu den wichtigsten, welche der Sammlung des Vereins zu gute gekommen sind denn wenn sie auch bereits einzelne in die angegebene Zeit fallende Münzen besitzt, so ward ihr doch noch keine so bedeutende Anzahl derjenigen Gepräge zu Theil, welche in der letzten Zeit des Heidenthums in Meklenburg in Umlauf waren.
Eine große Menge dieser Münzen ist so recht eigentlich zum Gebrauche der noch heidnischen Völker geschlagen, die sogenannten Wendenpfennige, von denen sich hier nur die


|
Seite 461 |




|
kleinere Art, (nach Mader Münzmesser 10, und etwas über 1/16 Loth schwer) findet. Die benachbarten geistlichen Fürsten, besonders Magdeburgs Erzbischöfe brachten ihren heidnischen Nachbaren, wenn auch noch nicht das Christenthum, so doch christliche Formen in dem Kreuze, mit dem sie die Münzen bezeichneten, in dem Worte CRUX, das sie darauf setzen ließen, und in dem Hirtenstabe, den sie so gern über sie hätten strecken wollen, wenn's nur gegangen wäre. Von denen, welche die Andeutung von Magdeburg enthalten, findet sich in diesem Funde, obgleich fast so viele Stempelverschiedenheiten sind, als einzelne Stücke, keines.
Ferner beweiset dieser Fund, wie weit ausgebreitet der Münzverkehr im Innern Deutschlands schon damals war; aus entfernten Gegenden finden sich hier Gepräge vom Rhein und aus Friesland. Dagegen finden sich die, auch bei uns gar nicht selten vorkommenden ottonischen Münzen hier gar nicht, obgleich unser Fund später fällt, als die ottonische Zeit.
Zur Bestimmung der Zeit unseres Fundes geben folgende Münzen einen Haltpunkt, die daher hier zuerst erwähnt werden müssen:
| 1) | HS. | In einem Kreise ein Brustbild rechts gekehrt, von der Umschrift ist nur - - v - x zu erkennen. |
| RS. | im Kreise ein schwebendes Kreuzchen, von der Umschrift nur unkenntliche Spuren. |
Diese Münze des Herzogs Bernhard von Sachsen (973-1011 v Idus Febr.) ist schon längst bekannt und nach einem besser erhaltenen Exemplar bei Seeländer zwölf Schriften t. C. p. 117, abgebildet: da lautet die Umschrift: Bernhardus dux und auf der Rücksseite: in nomine DNI IHC.-
| 2) | HS. | Stehendes Bild im Mantel BRACIS - - DVX |
| RS. | ein stehender Vogel SCSW - LAVS. |
Eine nicht selten vorkommende Münze des Herzogs Bretislaus I. von Böhmen 1037-1055. Jahresbericht V, S. 136.
| 3) | HS. | Eine aufgehobene rechte Hand mit einem Stäbchen durch die Finger - - - NRI - - - |
| RS. | Ein Kreuz mit 4 Kugeln in den Winkeln - - E B V. - - (Hinricus und Luneburg. |
Eine Münze, welche in die Zeit des Kaisers Heinrich II, also 1002-1024, zu setzen ist.


|
Seite 462 |




|
Wir haben also die Zeit von 973-1055 als die erkennbaren Punkte des Anfangs und Endes gegeben, und in diese Zeit fallen demnach die
Diese, welche sich alle durch den hoch aufstehenden, scharfen Rand auszeichnen, zerfallen in folgende Classen:
I. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz in einem Perlenkreise; auf der Rückseite im Perlenkreise ein Kreuz und in jedem Winkel ein Ring.

Abweichungen sind auf der Hauptseite im rechten Oberwinkel ein halber Ring, oder ein Punkt, oder im linken Unterwinkel ein halber Ring, in dem ein Punkt; - auf der Rückseite ist statt des Ringes im linken Oberwinkel ein Kreuzchen, oder die Ringe im rechten Ober= und linken Unterwinkel sind gefüllt.
Die Umschrift der Hauptseite enthält das Wort
crux, jeden Buchstaben von dem andern durch 2
Striche getrennt:
 jedoch folgen sich die Buchstaben
nicht immer in dieser Ordnung, sondern auch
jedoch folgen sich die Buchstaben
nicht immer in dieser Ordnung, sondern auch
 oder
oder
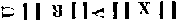 Die Zeichen der Rückseite sind: -
Die Zeichen der Rückseite sind: -
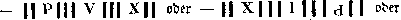
 . Die Zahl der zu dieser Form
gehörenden beläuft sich auf 34 in 13
Stempelverschiedenheiten, 3 Exemplare sind unkenntlich.
. Die Zahl der zu dieser Form
gehörenden beläuft sich auf 34 in 13
Stempelverschiedenheiten, 3 Exemplare sind unkenntlich.
II. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz in geperltem Kreise, auf der Rückseite in gleichem Kreise ein Kleeblattkreuz.

1) Das Ständerkreuz hat kein Beizeichen. Die Umschrift der Hauptseite ist:
,


|
Seite 463 |




|
die der Rückseite ist:
, wo also das Crux deutlich hervortritt. Es sind hiervon 5 Exemplare in 4 Stempelverschiedenheiten vorhanden.
2) Im rechten Ober= und im linken Unterwinkel des Ständerkreuzes ist ein Punkt, in den beiden andern Winkeln ein auswärts gekehrter halber Ring mit einem Punkte darin.
Die Umschrift der Hauptseite ist beständig dieselbe:

Die der Rückseite wechselt:

Zwölf Zeichen sind bei allen auf beiden Seiten.
Davon finden sich 34 Exemplare in 25 Stempelverschiedenheiten, 5 sind zerbrochen oder unkenntlich.
3) Im rechten Ober= und linken Unterwinkel des Ständerkreuzes ist ein auswärts gekehrter Ring mit einem Puncte, in den beiden andern Winkeln ein Punkt.
Die Umschrift ist auf der Hauptseite der der
vorigen gleich, jedoch findet sich auch bei drei
Exemplaren die Abweichung, daß in die 10. Stelle
das E gestellt wird, wogegen in die 4. das
gestürzte R kommt, auch hat ein nicht sehr
deutliches Exemplar in der ersten Stelle ein C
und in der 10. ein
 . Die Rückseite ist
. Die Rückseite ist
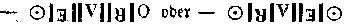 bezeichnet, bei 2 steht in der
ersten Stelle ein liegendes
bezeichnet, bei 2 steht in der
ersten Stelle ein liegendes
 , jedoch sind gerade hier nicht
alle Zeichen erkennbar. Von dieser Form finden
sich 14 Exemplare, von denen 3 zerbrochen und
unkenntlich sind in 9 Stempelverschiedenheiten.
, jedoch sind gerade hier nicht
alle Zeichen erkennbar. Von dieser Form finden
sich 14 Exemplare, von denen 3 zerbrochen und
unkenntlich sind in 9 Stempelverschiedenheiten.
III. Auf der Hauptseite das Ständerkreuz mit den Punkten und Kreisen wie II. 2., auf der Rückseite ein aufrecht gestellter Bischofsstab.
Auf der Hauptseite ist die Umschrift der vorigen
gleich, jedoch ist das erste Zeichen nicht zu
erkennen. Auch die Zeichen der Rückseite sind
nicht alle klar, jedoch ist das
V
in der
7. Stelle deutlich, der Anfang scheint ein
 zu sein. Es sind davon 2
Exemplare desselben Stempels gefunden.
zu sein. Es sind davon 2
Exemplare desselben Stempels gefunden.
Eine Abweichung, wo das Ständerkreuz kein
Beizeichen und der Bischofsstab zwischen
 (verstümmelte Nachbildung des A
Ω
) steht, hat
auf der Hauptseite die Umschrift des vorigen,
auf der Rückseite
(verstümmelte Nachbildung des A
Ω
) steht, hat
auf der Hauptseite die Umschrift des vorigen,
auf der Rückseite
 . Es ist nur ein Exemplar davon vorhanden.
. Es ist nur ein Exemplar davon vorhanden.
IV. Auf der Hauptseite ein Ständerkreuz mit Punkt und Halbkreis in den Vierteln. Auf der Rückseite ein von oben nach unten durch=


|
Seite 464 |




|
gehendes Kreuz, dessen Spitze und Querbalken in
dem obern Umschriftkreise liegen und mit
Knöpfchen geziert sind; in der untern Hälfte
etwa ein Viertel des ganzen Raumes ausfüllend,
hängt an dem Kreuze ein Tuch, welches mit 6
herabhangenden Kugeln verziert ist. In der
rechten Hälfte des innern Raumes ist ein
 und darunter ein
und darunter ein
 in dem linken obern Viertel ein
Halbkreis mit einem Punkte darin.
in dem linken obern Viertel ein
Halbkreis mit einem Punkte darin.
Die Umschrift der Hauptseite ist
 (ein Bischofsstab)
(ein Bischofsstab)
 , die der Rückseite
, die der Rückseite
 (Bischofsstab)
(Bischofsstab)
 . Hievon sind 3 von demselben
Stempel, ein viertes Exemplar von einem andern
Stempel ist sehr undeutlich, ein 5tes
zerbrochenes weicht mehr ab und hat statt des
. Hievon sind 3 von demselben
Stempel, ein viertes Exemplar von einem andern
Stempel ist sehr undeutlich, ein 5tes
zerbrochenes weicht mehr ab und hat statt des
 ein liegendes
ein liegendes
 .
.
V. Ein Ständerkreuz mit Punkt und Halbkreis in den Winkeln. Auf der Rückseite ein Kreuz von 4 Ringen, in denen ein Punkt ist, umgeben darunter A. 0.
Die Umschrift dieser Nachahmung durch einen
benachbarten geistlichen Fürsten ist zu Anfang
verwischt, dann kam
 . Die Rückseite
. Die Rückseite
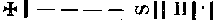
VI. Ein Ständerkreuz im geperlten Rande, auf der Rückseite ein Kirchenportal.
Die Umschriften dieser offenbar Kaisermünzen
nachgeformten Münzen sind verschieden:
 und auf der Rückseite
und auf der Rückseite
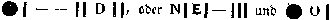 (hakenförmige Figur),
(hakenförmige Figur),
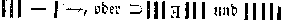 , (Haken)
, (Haken)
 ; bei 5 andern geben sie eben so
wenig einen Sinn und sind überdies sehr verwischt;
; bei 5 andern geben sie eben so
wenig einen Sinn und sind überdies sehr verwischt;
VII.
Ein Kreuz im Kreise; auf der
Rückseite ein Halbmond, darin ein Kreuz,
darneben ein A und darunter ein liegendes
 mit einem Striche durchzogen.
mit einem Striche durchzogen.
Die Umschrift dieser vielleicht im ganzen Funde
seltensten Münze ist auf der Hauptseite
 unverständlich, die Rückseite
aber giebt den Namen
SCS ADAL
unverständlich, die Rückseite
aber giebt den Namen
SCS ADAL
 .
.
Die nicht norddeutschen Münzen, welche dieser Fund enthielt, und deren Bestimmung der Herr Dr. Köhne in Berlin zu übernehmen die Gefälligkeit hatte, sind folgende:
I. Cöln .
| 1) | HS. |
+ (OD). DO
 MRVN Kreuz im Perlenrande
von 4 Kugeln begleitet.
MRVN Kreuz im Perlenrande
von 4 Kugeln begleitet.
|


|
Seite 465 |




|
| RS. | Das bekannte S. Colonia, das letzte A zwischen einem C und einem Kreuzchen (wahrscheinlich Otto I.). |
| 2) | HS. | Ein Kreuz, von 4 Kugeln begleitet, im Perlenrande. Von der Umschrift ist nur ein (Henricus ?) zu erkennen. |
| RS. | S. Colonia. | |
| 3) | HS. | Ein Kreuz im Perlenrande. Von der Umschrift ist zu erkennen O H │ O. |
| RS. | S. Colonia, in jedem der 4 Winkel 3 Punkte (wahrscheinlich rohe niederdeutsche Nachbildung eines cölnischen Originals). | |
| 4) | HS. | +HORVMEO. In einem Kreuze in dem Felde der Münze N ILIGI R |
| RS. | ENVOR. Ein Kirchengebäude, worin LR NA. Eine Nachahmung der Gepräge des Bischofs Piligrim von Cöln; s. Köhne Zeitschrift III. p. 141, b. |
II. Mainz (?).
| 5) | HS. | . . HE . . . X Im Perlenrande ein Kreuz, durch ein Bischofsstab schräg links gesteckt ist, in den beiden andern Winkeln rechts ein O mit einem Punkt in der Mitte, links ein W, unter jeder Figur ein Punkt. |
| RS. |
Züge, welche auf civitas mo -
hindeuten. Im Perlenrande ein
Kirchenportal zwischen C und
 .
.
Ob Original oder Nachbildung, steht dahin. |
III. Speier.
| 6) | HS. | (Nemetis) CIVITAS: eine Kirche auf einem Schiff. |
| RS. | . . . RICVS . . Im Perlenrande, wie es scheint, ein Kreuz mit unkenntlichen Beizeichen. (von Dr. Köhne als höchst selten bezeichnet.) |
IV. Duisburg.
| 7) | HS. | Ein aus doppelten Kreislinien gebildetes Kreuz, in dessen Mitte ein Kreuzchen und in dessen Winkeln DI RG VS AD. |
| RS. |
+AIH
 - AG. Im Perlenrande ein
Kreuz von 4 Punkten begleitet.
- AG. Im Perlenrande ein
Kreuz von 4 Punkten begleitet.
|
V. Deventer.
| 8) | HS. | Im Kreise REX. Die Umschrift scheint die Züge von Henricus zu enthalten. |


|
Seite 466 |




|
| RS. | Ein Kreuz von 4 Kugeln begleitet, die Umschrift scheint auf Daventrie hinzuweisen. | |
| 9) | HS. | HEINRICVS . . Ein bärtiges Gesicht. |
| RS. |
eine Kirchenfahne von 4 Lätzen, von der
Umschrift ist
+ ││ . .
. .
 AH
erkennbar.
AH
erkennbar.
|
|
| 10) | Bild wie voriges, von der Umschrift ist kein Zug erkennbar. Von dieser Form sind noch 3 Exemplare von verschiedenen Stempeln vorhanden. |
VI. Remagen.
| 11) | HS. | HS. RIGIM (ago), Brustbild eines Kaisers. |
| RS. | + SCA COLO MAG (sehr selten). |
VII. Utrecht.
| 12) | HS. | (Bern) OLDS EPI. Ein vorwärts gekehrtes Brustbild. |
| RS. | + BERNOLDS. Im Kreise ein Kreuz von 4 Kugeln begleitet. |
VIII. Thiel.
| 13) | HS. | . . NRICVS gekröntes Brustbild. |
| RS. | . . OLO und darunter ein Strich mit einem Haken daran | |
| 14) | HS. | Brustbild eines Bischofs, an jeder Seite ein Hirtenstab; von der Umschrift ist nichts erkennbar, als OI. |
| RS. | Ein Kreuz mit 4 Kugeln umgeben. In der Umschrift erkennt Herr Dr. Köhne bona Tiel. |
IX. (Deutsche Münzen , fränkischer Fabrik).
| 15) | HS. | ein Kirchengebäude. |
| RS. | Ein Kreuz mit Kugeln, von der Umschrift ist EI zu erkennen. Die Münze ist sehr undeutlich. |
X. Unbekannte Münzen.
| 16) | Die bereits Jahresberich III, p. 105, n. 18. beschriebene Münze. | |
| 17) | HS. |
Eine aus 4 gegen einander gekehrten
Bogen gebildete Figur, in deren Mitte
ein
 ; in den Bogen und in
jedem Zwischenraum derselben ein
; in den Bogen und in
jedem Zwischenraum derselben ein
 .
.
|
| RS. |
Ein Kreuz, in den beiden obern Winkeln
A O
, im dritten 2 Punkte, im
vierten ein Ring; von der Umschrift ist
nur
+ A
 zu erkennen.
zu erkennen.
|
|
| 18) | HS. | ein Kopf über dem ein Halbmond, zur Seite ein Bischofsstab. + O. . . . │ |


|
Seite 467 |




|
| RS. | Ein Brückenbogen mit 2 Thürmen, in dem ein Kreuz. | |
| 19) | HS. |
Im Perlenkreise eine Figur, einem
Krückenkreuze mit Fuß ähnlich, von
dessen Armen zwei Spitzen herabhangen.
HI . . .

|
| RS. | Ein Kreuz mit Kugeln in den Winkeln. Lelewel III, p. 112. | |
| 20) | (Von einer andern Fabrik) ein gehelmtes Brustbild im Profil rechts gekehrt. | |
| RS. | Die Münze ist mit Buchstaben bedeckt, von denen SCA T ││ zu erkennen. |
G. M. C. Masch.
Der Münzfund aus der Gegend von Schwerin, aus dem 10. und 11. Jahrhundert
und das mit demselben gefundene Silbergeschmeide ist oben S. 388 flgd. beschrieben.



|



|
|
:
|
Der Münzfund von Sukow, aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Eine Anzahl von 745 Münzen, welche zu Sukow bei Schwerin gefunden und an einen Goldschmid bereits verkauft worden war, wurde von diesem gefälligst zur Disposition gestellt, um daraus auszuwählen, was für die Sammlung des Vereins und für andere Samlungen nützlich sein könnte. Es ist geschehen und der Rest ist darauf eingeschmolzen worden. Dieser Fund bot, wenn auch gleich keine unbekannte Münzform, doch eine große Anzahl Stempelverschiedenheiten dar, und gab der Sammlung einen Zuwachs von 117 Stücken, worunter allein von den Sechslingen des Herzogs Albrecht 19 neue Gepräge sich fanden, von denen sehr viele bei Evers nicht verzeichnet sind, z. B. ein zu Güstrow geschlagener von 1529 und ein in Wittenburg geschlagener von 1528.
Die ältesen mit einer Jahreszahl bezeichneten Münzen dieses Fundes sind die pommerschen Schillinge von Gaarz von 1489. Die jüngste ist ein Groschen der Stadt Braunschweig von 1550. Die Hohlmünzen, welche sich in den Funden dieser Zeit noch immer den zweiseitigen beigemischt finden, waren die größeren meklenburgischen mit dem gereiften Rande und dem Büffelskopfe mit großem Maule, beide Formen mit und ohne heraushangender Zunge (gr. 12 nach Mader, 9 u. 8


|
Seite 468 |




|
Aß schwer), die Lübecker mit dem Doppeladler, die sehr bekannten Hamburger mit dem Nesselblatt und die Lüneburger mit dem Löwen in den Thoren ihrer Stadtzeichen. Von den holsteinischen Pfennigen war der ältere mit den beiden Balken bereits sehr defect, der neuere, welcher ein halbes Nesselblatt neben den Balken hat (S. Grote Münzzeitung II, tab. XIX, Nr. 284 u. 285), war gut erhalten; die brandenburgischen hatten einen Adler, von denen der eine einen Schild mit einem Zepter auf der Brust trägt.
Die Zahlverhältnisse dieses Fundes sind folgende:
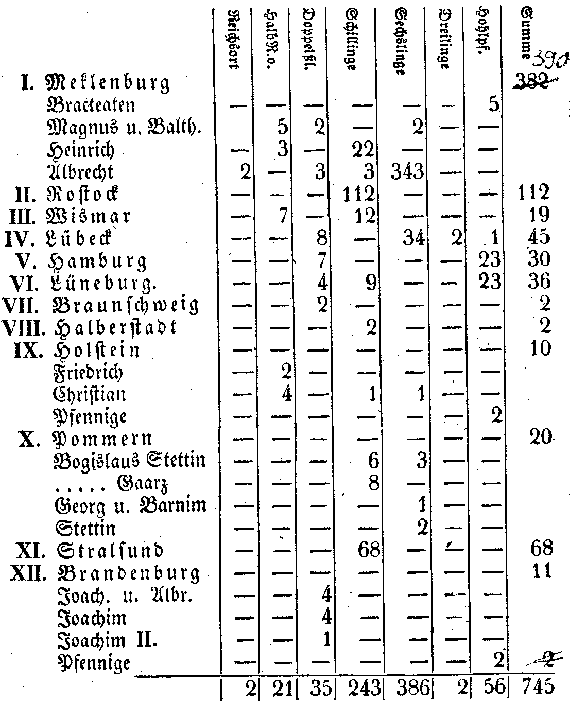


|
Seite 469 |




|



|



|
|
:
|
V. Zur Geschlechter= und Wappenkunde.
1. Zur Geschlechterkunde.
Familie von Maltzan.
Mit zwei Steindrucktafeln.
Die Familie von Maltzan besitzt 2 durch den Verein entdeckte, ausgezeichnete alte Leichensteine, in den Klosterkirchen zu Dargun und Rühn, welche in Lisch Urk. zur Gesch. des Geschlechts Maltzan, II, 1844, in Abbildungen mitgetheilt sind, von denen der Freiherr Albrecht von Maltzan auf Peutsch dem Verein eine Auflage für die Jahrbücher geschenkt hat.
1. Der Leichenstein auf dem Grabe der Ritter Heinrich und Ludolf Maltzan in der Klosterkirche zu Dargun.
Dieser Leichenstein ist zuerst in Jahresber. III, S. 176, zur Kunde gebracht und in Jahresber. VI, S. 97, genauer beschrieben. Die Maltzan hatten schon früh im östlichen Meklenburg und in Vorpommern Güter erworben und besaßen schon im Anfange des 14. Jahrhunderts Cummerow und Loiz, so wie das Dorf Upost bei Dargun, welches theils durch Schenkung, theils durch Kauf bald in den Besitz des Klosters überging. Daher hatten die Maltzan einen Altar in der Kirche zu Dargun und eine Familiengruft vor demselben. Der Altar ist verschwunden, der Leichenstein befindet sich jedoch noch an seiner alten Stelle, jetzt an der Wand aufgerichtet, im südlichen Kreuzschiffe, neben den Leichensteinen der Hahnschen Familie. In diesem Grabe ruhen:
a. der tapfere Ritter Heinrich I. Maltzan (1293 † 22. Dec. 1331), welcher in den wichtigen Begebenheiten im Anfange des 14. Jahrhunderts eine so große Rolle spielte und die Pfandherrschaft von Loiz erwarb;
b. der Ritter Ludolf III. Maltzan (1320 † 1 Junii 1341), Heinrichs I. Brudersohn und Nachfolger in der Herrschaft Loiz, der Stammvater der jetzt noch blühenden maltzanschen Linien; am 12. Nov. 1341 stifteten die Vormünder seiner Kinder Memorien an dem Altare seines Begräbnisses (vgl. Lisch Maltz. Urk. II, Nr. CCXXVIII).


|
Seite 470 |




|
Der Leichenstein ist gegen 12 Fuß lang und enthält innerhalb der Umschrift nur das schön gezeichnete maltzansche Wappen, Schild und Helm, von sehr ausgezeichneter Arbeit; der Leichenstein ist einer der werthvollsten im Lande. Die Umschrift lautet:
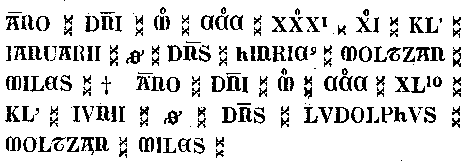
d. i.
Anno domini MCCCXXXI, XI kal. Januarii obiit dominus Hinricus Moltzan miles. Anno domini MCCCXLI, kal. Junii obiit dominus Ludolphus Moltzan miles.
2. Der Leichenstein auf dem Grabe des Ritters Barthold II. Maltzan und seiner Gemahlin Adelheid in der Klosterkirche zu Rühn.
Der Leichenstein ist zuerst in Jahresber. III, S. 161, erwähnt. Er deckt die Gebeine des Ritters Barthold II. Maltzan, des bekanntesten Maltzan aus der alten Linie Trechow. Diese Linie stammte wahrscheinlich von dem Ritter Friederich I. (1280-1314), dem ältesten Bruder des oben erwähnten Ritters Heinrich I.; Friederich I. war schon früh Burgmann zu Bützow und seine Linie besaß die Familiengüter im Lande Gadebusch und hatte Lehen im Lande und in der Stadt Bützow. Im J. 1316 kommt der Ritter Barthold I. vor. Barthold II. (1362 † 6. Dec. 1382 ) besaß unbezweifelt die bedeutenden Trechowschen Güter. Seine Linie starb am Ende des 14. Jahrhunderts mit seinem jungen Sohne Vicke und dessen unmündigen Kindern aus und ward durch eine Linie aus dem Hause Grubenhagen fortgesetzt.
Barthold II. Maltzan war als Knappe lange Zeit im Stifte Bützow wirksam. Nicht lange vor seinem Tode ward er Ritter, wahrscheinlich im Mai 1376, als er am 1. Mai d. J. mit dem Herzoge Albrecht von Meklenburg und dessen Söhnen zu Weiden beim Kaiser Carl IV. war. Daher war er im J. 1382 nach Urkunden unbezweifelt Ritter. Deshalb ist er auf dem Leichensteine noch als Knappe (famulus) aufgeführt, das Wort miles (Ritter) aber nachträglich eingegraben.


|




|
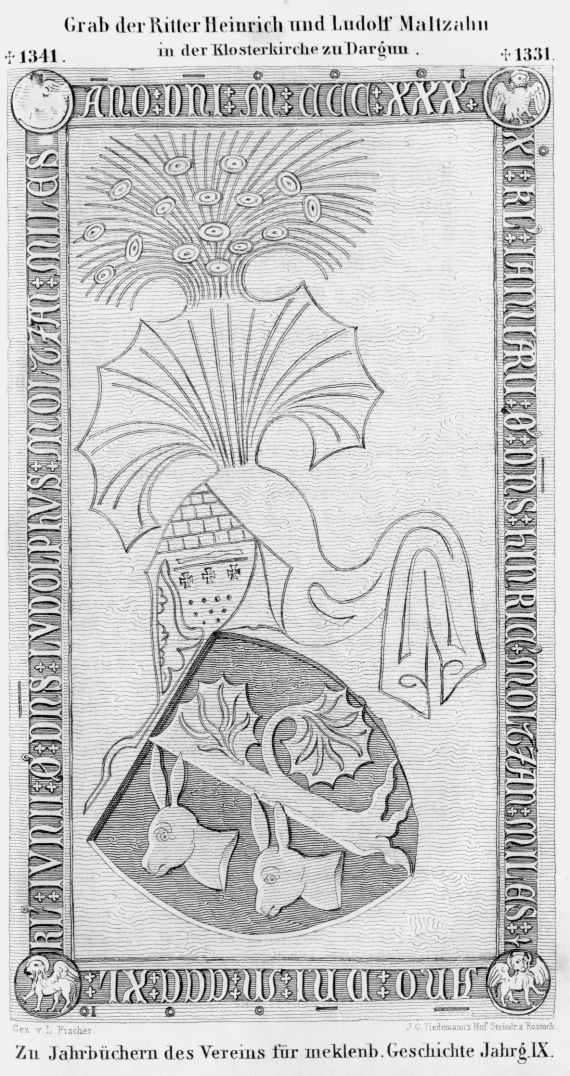


|




|
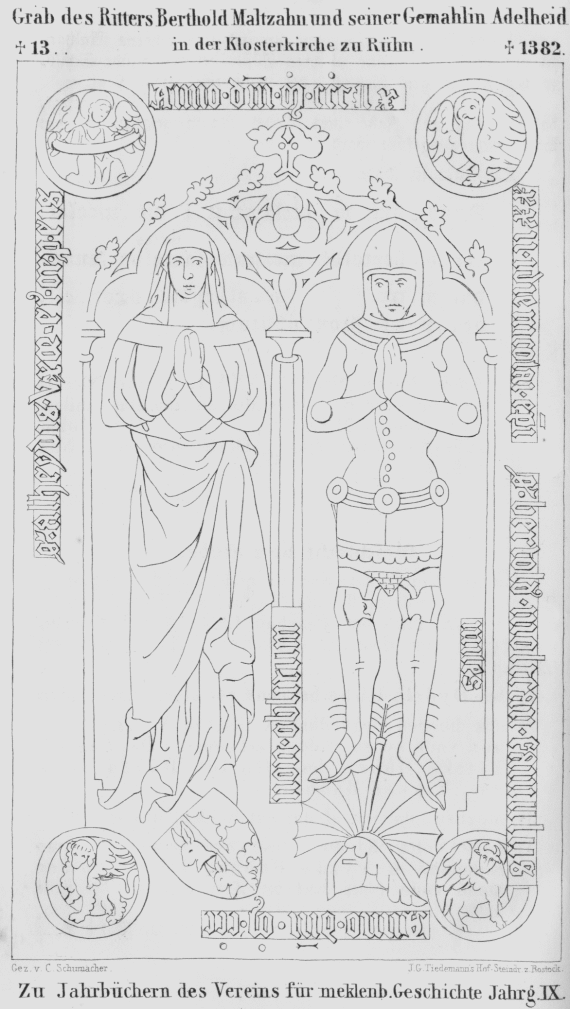


|
Seite 471 |




|
Seine Gemahlin war ohne Zweifel eine geborne Maltzan, da auf dem Leichensteine zu ihren Füßen der maltzansche Schild, zu den Füßen ihres Gemahls der maltzansche Helm steht.
Der Stein ist sicher schon bei Lebzeiten der Frau gelegt, da für Tag und Jahr ihres Todes Raum gelassen ist, der später nicht ausgefüllt ward.
Die Inschrift lautet:
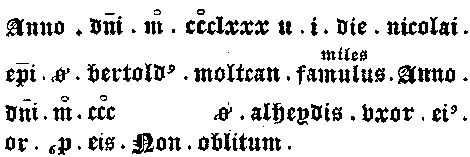
d. i.
Anno domini M°CCC°LXXXII, in die Nicolai episcopi obiit Bertoldus Molcan (famulus) miles. Anno domini M°CCC° obiit Alheydis, uxor ejus. Orate pro eis. Non oblitum.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Geschlecht von Hobe.
Zu den Siegelbändern einer im großherzoglichen Archive zu Schwerin aufbewahrten Urkunde (Verkauf von Siden=Remplin), d. d. fer. IV infra oct. Paschae 1363 , ist eine Urkunde, wahrscheinlich ein Concept, zerschnitten. Der Inhalt der Streifen ist:
1) Ich Dydrik Hůbe bekenne vor allen gůden luden
2) dhe hebben deghedinghet tuschen Vykke Babben vnde synen rechten erfnamen. Dat loue ich Tyteke Hůbe, dese Gories Huben sone was, Vikken Babben
3) moghen, dat ich al dat wil holden, des mynen
4) vnde Volrat Klynte, dese eyn ratman is tůme
Kalande, tů Vykke Babben hand vntrovwen stede vnde (hier hört der Text innerhalb der Zeile auf).
G. C. F. Lisch.


|
Seite 472 |




|



|



|
|
|
2. Zur Wappenkunde.
Das Petschaft des letzten von Lübberstorf
geschenkt vom Herrn von Buch auf Zapkendorf. Ein in einem silbernen Gehänge hangender dreiseitiger Krystall, auf einer Seite mit dem Wappen: einem silbernen Wolfseisen (oder Doppelhaken) in rothem Felde und zwei goldenen Heugabeln zwischen drei silbernen Federn auf dem Helme, auf der zweiten Seite mit den verschlungenen Buchstaben v. L.; die dritte Seite ist leer.
Nach v. Gamm's genealog. Nachrichten war der letzte des Geschlechts: Ludwig Christoph, königl. dänischer Land= und Regierungs=Rath zu Glückstadt, geb. 1712, † 1759.


|
Seite 473 |




|



|



|
|
:
|
VI. Zur Sprachkunde.
Der christlichen Zeit.
Niederdeutsche Uebersetzungen der Sprüche des Dionysius Cato,
von
G. C. F. Lisch.
Einem Bande der ehemaligen Bibliothek der Marienkirche zu Rostock, Nr. 232, jetzt auf der Universitäts=Bibliothek, enthaltend: D. Dionysii Carthusiani in quatuor evangelistas enarrationes, Cölln, 1532, ist vorne und hinten ein Bruchstück eines plattdeutschen Gedichts angebunden. Das Bruchstück besteht aus 2 Bogen Pergament kl. Fol., mit 2 Columnen auf jeder Seite, im Ganzen also aus 16 Columnen, jeder von 31 Zeilen, im Ganzen also 496 Versen. Die Schrift stammt aus dem Anfange des 14. Jahrh. Das Gedicht ist eine Uebersetzung der Sprüche des Dionysius Cato (vgl. v. d. Hagen und Büsching Literarischer Grundriß zur Geschichte der deutschen Poesie, S. 396) und das Fragment enthält die Uebersetzung der Sprüche III, 20 und 21. Hier einige Proben:
Inter conuiuas fac sis sermone modestus,
ne ditare loquax, dum uis bonus esse, videri.
Werstu wor, to werscap beden,
so wes houesch in dinen reden,
dat men di clepisch en scriue,
noch neyn vntůch van dinem liue
wert gesecht, wan du vult sin
eyn houesch man in tůchten fin.
Coniugis irate noli tu uerba timere,
nam lacrimis struit insidias, dum femina plorat.
Nym nicht to herten noch to oren
dines wiues bose torn;
wan dat wif sere weynet,
nicht gudes se denne meynet,
so legget se der manne lage
vnde wil dat er de man vrage,
wor se vmme weynet vnde wat er sy.
Ic wil id di beteren, sege my,
he scal spreken, so antwordet se,


|
Seite 474 |




|
O we myn man, my is so we,
dat ic nv steruen mut,
ic hadde dat my were gut,
lutter dranc vnde sote crude.
Aldus seget my delude.
Eine andere Stelle lautet:
Rebus in incensu si non est, quod fuit ante,
fac iuuas contentus co, quod tempora prebent.
Heuestu to voren groten scat
van houen vnde van lande gehat,
is dat alle van di gleden,
bliue io in gůden seden
vnde leue, also di de tid to secht,
so důstu dinem dinge recht,
oc heuestu dicke wol vornomen,
wor was water, dar mach water komen.
Vxorem fuge ne ducas sub nomine dotis,
nec retinere uelis, si ceperit esse molesta.
Nym ein wif nicht vmme gůt,
also mennich mynsche důt;
is dat er en andere voget,
dar mede gif er dine doget;
wil se ut der echtescap treden,
also men leyder vint in vele steden,
du scalt di van er sceyden
vnde kuschliken din leuent leyden.


|
Seite 475 |




|
VII. Zur Schriftenkunde.
1. Der Urkunden.
Der Verein erhielt zum Geschenke an Urkunden:
I. Von dem Herrn von Oertzen auf Roggow eine Urkunden=Sammlung aus dem Nachlasse des wail. Hofmarschalls von Oertzen, bestehend aus folgenden Original=Urkunden :
1) 1387. Julii 2. (in d. dage Processi vnd
Martiniani)
Claus Stüve verkauft an
Gottschalk Bassewitz drei freie Hufen und eine
Hofstätte zu Starkow mit den dazu gehörenden
Kathen zu Lehnrecht.
2) 1390. Junii 2. (in des h. lichemmes
daghe.)
Der Knappe Henneke Bůk
verpfändet an Claus Bassewitz Knappen mehrere
Hebungen aus dem Dorfe Kowalz und der Schmiede
und dem Kruge zu Thelkow.
3) 1392. Sept. 19. (donredages vor s. Matheus d.)
d. d. Wismar.
Der Herzog Johann d. J. von
Meklenburg giebt im Namen des Königs Albrecht
dem Busse von Kalant die Erlaubniß, das halbe
Gut Stove, welches seine Frau, Gottschalks von
Stove Tochter, von ihrem Vater geerbt hat, zu
verkaufen oder zu verpfänden.
4) 1399. Jan. 5. (in d. hilg. drier koninge
avende.)
Der Schweden=König und Herzog
Albrecht und der Herzog Johann von Meklenburg
geben dem Heinrich Bützow für seine Dienste und
den Schaden, den er in denselben genommen, allen
Anfall, den die Fürsten von 6 Hufen in dem Dorfe
Selpin im Lande Gnoyen, welche die Frau
Bonensack besitzt, zu erwarten haben.
5) 1400. Nov. 27. (des sunauendes na. s.
Katherinen.) d. d. Doberan.
Der
Schweden=König Albrecht und Johann, Herzoge von
Meklenburg, bekennen, daß sie Henneke Moltke an
dem Gute, welches dem Ritter Nicolaus Buk gehört
hatte, nicht hindern, ihn bei allen Rechten an
der Mühle zu Gnoyen lassen und ihm 6 Jahre
Geleit geben wollen.


|
Seite 476 |




|
6) 1403. Jan. 5. (in d. heil. drierkoninghe
auende.)
Curt Bützow d. A. verpfändet an
Claus Bassewitz 20 lüb. Mark aus dem Dorfe
(Wurdelstorp) Wohrenstorf.
7) 1405. Mai 13. (in s. Servacius daghe.)
Barold Brytzekow verkauft an den Knappen Curt
Bützow seine Güter zu Rethemisse.
8) 1410. Dec. 14. (mandaghes na s. Lucien daghe.)
d. d. Cummerow.
Der Magister und
Baccalaureus Marquard Westphal leistet Gherd und
Gherd Bassewitz, Claus und Gottschalk's Söhnen,
für seine Gefangennehmung Urfehde und stellt die
Entscheidung über Schuldbriefe der Bassewitze an
ihn auf den Herzog Johann von Meklenburg.
9) 1428. Dec. 13. (in s. Lucien daghe.)
Gherd Bassewitz d. A. zu Bassewitz verpfändet an
Margarethe Kerkhof, Barthold Kerkhofs Wittwe,
die Bede aus Prangendorf.
10) 1435. Febr. 4. (in s. Agathen auende.)
Hermann von Oertzen zu Kl. Tessin verkauft an
Gherd Bassewitz zu Bassewitz die halbe Gheltes=Mühle.
11) 14(4)7. Sept. 29. (am d. s. Michaelis.) d. d.
Schwerin.
Der Herzog Heinrich von
Meklenburg bezeugt, daß Laurentius (Pren) zu
Pantenitz an Lutke und Vicke Bassewitz sein Gut
laut des Kaufbriefes aufgelassen habe.
12) 1448. Julii 25. (in s. Jacopes daghe.)
Werner Marsow und sein Sohn Werner zu
Zahrenstorf im Bisthume Ratzeburg verkaufen an
Gherd Bassewitz das ganze Dorf Schilt zwischen
den Wassern Schale und Dobersche.
13) 1455. April 13. (am sondage Quasimodogeniti.)
d. d. Wismar.
Der Herzog Heinrich von
Meklenburg verpfändet an Johann, Hans, Lüdeke,
Claus und Vicke Bassewitz, Brüdern, 8 Mk. lüb.
aus dem Walle zu Meklenburg.
14) 1455. Nov. 6. (an dem donredage na aller
hilgen d.) d. d. Schwerin.
Der Herzog
Heinrich von Meklenburg erlaubt dem Vicke
Bassewitz, dem Kloster Marienwolde,
Brigitten=Ordens, bei Mölln, das Dorf Wendorf in
dem Kirchspiele Mühlen=Eixen zu versetzen und zu verkaufen.


|
Seite 477 |




|
15) 1458. Oct. 31. (am avende aller godes
hiligen.) d. d. Meklenburg.
Der Herzog
Heinrich von Meklenburg erlaubt seinem Rathe
Vicke Bassewitz, 8 Mk. Bede aus Rugensee von den
Raven zu Stük zu lösen.
16) 1462. Sept. 21. (an s. Matheus daghe.)
Die Brüder Gherd und Joachim Bassewitz, des
seel. Gherd Bassewitz Kinder, verpfänden ihren
Vettern, Johann, Hans, Lütke und Vicke Bassewitz
das Dorf Weitendorf im Kirchspiele Camin, das
Dorf Wohrenstorf in demselben Kirchspiele, das
Dorf Selpin in dem Kirchspiele Vilz und die
halbe Gheltes=Mühle.
17) 1462. Dec. 13. (in s. Lucien daghe.) d. d.
Bützow.
Der Knappe Dedewich Karin zu
Bützow, sonst zu Alt=Karin wohnhaft, verkauft
erblich den Knappen Hardenack Bibow zu Eickhof
und Wipert Bibow zu Westenbrügge seine
altväterlichen Güter zu Alt=Karin.
18) 1471. März 12. (des dinxtedages vor s.
Getruden.)
Die Brüder Hans und Henning
Preen und Henning Preen, alle zu Jesendorf,
vertauschen an Claus Bassewitzen zu Turow ihre
Güter zu Turow gegen seine Güter zu Jesendorf.
19) 1477. März 11. (am avende s. Gregorii.) d. d.
Wismar.
Die Herzoge Albrecht, Magnus und
Balthasar von Meklenburg bestätigen urkundlich
den Verkauf von 64 Mk. Hebungen aus den Gütern
Reinsdorf und Moltekow und das ganze Dorf
Moltekow von den Brüdern Henning und Wipert
Stralendorf an den Burgemeister Dietrich Wilde
zu Wismar, welchen Verkauf der Herzoge Vater ein
Jahr vor seinem Tode bestätigt, aber noch nicht
verbrieft gehabt.
II. Von dem Herrn Bagmihl zu Stettin Abschrift der Urkunde von:
1274. März 12. (die Gregorii p.)
Der Fürst Nicolaus von Werle verleiht den Brüdern Bernhard und Heinrich von Peccatel und ihren Erben zu gesammter Hand ihre Güter in der Vogtei Penzlin: Lupeglow, Zippelow, Zieritz, Stribbow, Peccatel, Vilen, Kolhasen=Vilen, Brusmersdorp und Lankavel mit allen Gerechtigkeiten Patronaten, Seen und Mühlen, mit dem großen und kleinen See von Vilen, mit der Mühle von Penzlin und der Trendecops=Mühle, so wie den Brüdern Bernhard und Heinrich von Peccatel und dem Ritter Raven zu gesammter Hand die Güter Lubbechow, Vilen und Zahren.


|
Seite 478 |




|
III. Von dem Herrn Revisionsrath Schumacher zu Schwerin Abschriften von folgenden Urkunden:
1) 1298. Jan. 24. (vigilia convers. Pauli.)
Der Fürst Nicolaus von Werle verleiht dem
Kloster zum Heil. Kreuz zu Rostock zu
Vasallenrecht das Dorf Dolgen, welches das
Kloster von dem rostocker Bürger von der Mölen
gekauft hat.
2) 1598. Dec. 30.
Visitations=Bericht über
die dem Kloster zum Heil. Kreuz gehörenden Dörfer.
3) 1605. März 6.
Visitations=Beschluß über
die Zahl und die Aufnahme der Jungfrauen in das
Kloster zum Heil. Kreuz.
4) 1659. Junii 30.
Provisorats=Beschluß über
die Aufrechthaltung der revidirten
Kloster=Ordnung vom J. 1630 und die Abstellung
einiger eingeschlichener Mißbräuche.
IV. Von einem Ungenannten Abschrift der Urkunde von:
1473. Dec. 20. (in s. Thomas avende.)
Der Knappe Dethlef Basse verpfändet dem Kloster zum Heil. Kreuz in Rostock 12 Mk. sund. Hebungen aus dem Dorfe (Hohen) Luckow.



|



|
|
:
|
Ein Gebetbuch aus dem Mittelalter.
Der Herr Ingenieur Lierow aus Parchim hat dem Vereine ein katholisches Gebetbuch aus dem 15. Jahrh., auf Pergament geschrieben, geschenkt. Dasselbe gehörte, den Mittheilungen zufolge, einem französischen Hauptmanne, der es auf dem Rückzuge der Franzosen zurückließ; hierfür redet eine Bemerkung, welche in den neuesten Zeiten auf die 6. Seite des Textes eingeschrieben ist:
Angele, qui meus es costos, pietate superna me tibi commissum serva, defende, guberna. MDCCCXIV, die libertatis Hamb. restitutae, Gallis e Germ. expulsis et tyran. Napoleone dethron. et in insulam Elbam relegato.
Es kam darauf in den Besitz des wail. Superintendenten Block zu Ratzeburg, auf dessen Bücher= Auction Herr Lierow es erstand.


|
Seite 479 |




|
Das Buch ist auf Pergament in 8. fest und hübsch geschrieben und stammt dem Anscheine nach aus dem 15. Jahrh., obgleich, namentlich in der ersten Hälfte die Schrift viel älter erscheint; es ist jedoch schon das spät aufgekommene Fest Compassio Mariae (vgl. Jahrb. IV, S. 47) aufgenommen, und hiernach und nach der ziemlich correcten Zeichnung muß man die Handschrift wohl in das Ende des 15. Jahrhunderts setzen. Es ist an den Eingängen der Hauptabschnitte mit sehr saubern Miniaturen geschmückt. Die großen Buchstaben sind in Gold auf rothen Quadraten geschrieben. Nach einem größern Gemälde, auf welchem eine Leiche von Nonnen begraben wird, scheint das Buch ehemals einem Nonnenkloster angehört zu haben. Voran steht ein Festkalender.
Die Handschrift ist der Malereien wegen nicht ohne Interesse. Die Initial=Miniaturen sind sehr sauber; besonderer Fleiß ist aber auf 3 größere Gemälde verwandt: die Verkündigung Mariä, die Kreuzigung Christi und das oben bezeichnete Begräbniß (zu dem letzten Abschnitte: Incipiunt uigilie mortuorum).
G. C. F. Lisch.


|
Seite 480 |




|



|



|
|
:
|
VIII. zur Buchdruckkunde.
Hinrici Bogher Etherologium
Rostock 1506.
In Jahrb. VI, S. 195 flgd., ward von dem Herrn Bibliothekar Dr. Schönemann zu Wolfenbüttel die Entdeckung mitgetheilt, daß die Originale der kleinen Chroniken Nic. Marschalks von einem M. Heinrich Boger verfaßt sind und in einer Handschrift auf der Bibliothek zu Wolfenbüttel aufbewahrt werden.
Seitdem ist eine für Meklenburg noch wichtigere Entdeckung gemacht, indem der Herr Dr. Schönemann ein bisher unbekanntes, gedrucktes Buch des genannten M. Heinrich Boger, und zwar in zwei Exemplaren, aufgefunden und den Austausch eines Exemplars an unsern Verein vermittelt hat. Es wird durch dieses Buch unsere Gelehrtengeschichte nicht wenig bereichert.
Hier zuerst die Beschreibung des Buches. Das Buch
ist in groß 8, jeder Bogen in einer Lage von 6
Bl., mit Sign. A bis Z und
 bis O, mit Folienbezeichnung 1
bis 229, gedruckt; vorangebunden sind 2 Bogen
Einleitungen mit Sign. a und b. Das Papier hat
theils das Wasserzeichen eines Einhorns, theils
eines
p
.
bis O, mit Folienbezeichnung 1
bis 229, gedruckt; vorangebunden sind 2 Bogen
Einleitungen mit Sign. a und b. Das Papier hat
theils das Wasserzeichen eines Einhorns, theils
eines
p
.
Der Titel lautet:
Etherologium Eximii et
disertissimi viri domini et magistri
Hinrici
Boger theologie doctor',
Ecclesie Colle
giate Sancti Jacobi
Rostochiensis
Decani, nō minus ad
legentiū eru
ditōz qz
solatiū ab eodē In ordi
nez
digestum Anno Christia
ne salutis
Quinto supra
Millesimumquingen
tesimum.
Auf der Rückseite des Titelblattes stehen zwei Gedichte:
Magistri Casparis Hoyger legum
doctoris Epigramma ad lectorem
und:
Epigramma magistri Bertoldi Moller
Ad lectorem preseferens argumentum tocius operis


|
Seite 481 |




|
und auf der dritten Seite zwei Gedichte:
Magsistri Johannis Rode Canonici
LubiceEpigramma ad lectorem
und:
Magister Tilemannus Neuerlingk
Ad lectorem.
Auf der vierten Seite beginnt das Register:
Directorium siue tabula in totū opu Hinricsi
Boger intitulatū Etherologium quasi alter
nis et variis carminibus congestum.
welches 16 Seiten einnimmt.
Die erste Seite des Werkes beginnt:
Ad Spectatissimū d
m. d. et magistrz
Nicolaum Scomacharium Decanum
Uerde. ppositūin lune etc. Epigramma.
Auf der letzten Seite steht:
Apologia seu apostrophe.
libri ad lectorem,
und am Ende der letzten Seite:
Finis vberrimi operis Heterologii Hinrici Boger, quod sollicitudine et hortatio ne Clarissimi viri z domini Nicolai Schomaker In lune prepositi etc. In ordinem redactum ē, Impssumqz Rostochii Anno salutis nostre, sexto supra millesimumquin gentesimum.
Das Buch ist zunächst durch den
merkwürdig: es ist im J. 1506 zu Rostock, mit denselben Lettern gedruckt, mit welchen Barthold Möller's Commentar zum Donat vom J. 1505 (vgl. Jahrb. IV, S. 79 und Druckproben das. Taf. II, Nr. 1a) gedruckt ist; das bisher unbekannt gebliebene Buch stammt also ohne Zweifel aus der Druckerei des rostocker Raths=Secretairs Hermann Barckhusen.
Dann hat das Buch durch seinen
einige Bedeutung. Der Verfasser war, nach dem in Jahrb. IV, S. 195, von Schönemann mitgetheilten Titel einer Rede, ein Zögling der Universität Erfurt, und daselbst Magister und Lehrer der Exegese, hatte also ohne Zweifel früher mit Nic. Marschalk in persönlicher Berührung gestanden (Jahrb. IV, S. 93 und 103); nach dem Titel des Etherologium war er


|
Seite 482 |




|
seit dem J. 1505 Lehrer der Theologie und Dechant des Dom=Collegiat=Stiftes an St. Jacobi zu Rostock und stand mit den meisten bedeutenden Männern Meklenburgs und Norddeutschlands in Verbindung. Das im Vorstehenden beschriebene Etherologium ist eine Sammlung der verschiedenartigsten Gedichte in lateinischer Sprache, welche viele Gedichte auf damals lebende Personen enthält.
Besonders interessant ist das Buch dadurch, daß es die Originale von zweien der in Jahrb. IV, S. 89, und VI, S. 195, beschriebenen kleinen Reimchroniken Nic. Marschalk's enthält, nämlich von der Mißhandlung des Sacraments zu Sternberg und von der Dithmarsen=Schlacht; das erste Gedicht, von der Stiftung des Domes zu Rostock, findet sich im Etherologium nicht. Die Reimchroniken Marschalks beginnen:
De dusser ghedichte bist eyn leser
dar vp interste vorwarnet sy
dat er ansettende vorweser
de vor to latine bescriuet dy
dar vth seck denne wol beghifft
na rechtem ordenschen geschicke
dat dusse sulue dudesche scrifft
des to harder is im gheblicke etc.
Der eddelen forsten van hogher boerd
van der groten stad. welker name vord
Am seszstrande Meklnburg is genant
ouer alle lande ock wol bekant
desser heren nuwe ghescheffte klar
denke ik mit dicht don openbar etc.
sacramentes tom Sterneberg.
Id is ghescheen nu eynst der iar
dat de vermaledigede besneden schar
tom Sterneberge is to samde kamen
eyne werscop eliken dar to holden
fruwen vnde man, junck vnde olden
Dar hedde me wol vornamen
dranck vnde kost to sodaneme dissche


|
Seite 483 |




|
wilt vnde tam vleisch vnde vissche
vnde wat dar bevelt dem smake
sedenspel kunstich vnde geringe
scrieken danssen vnde idelke dinghe
sanges gheuel na allem gemake etc.
in deme lande to Dethm'.
My voruerden, van swarheit der ding'
stympet de sin dat ghemote versaghet
stummet de munt vnde beeuet vingher
to scriuende bin eck alse veriaghet
vnder den kelken gades des heren
is eyner den he vaken vorhenget
dar dorch grimmicheide sek meren
wen eyner den anderen enghet
vmmeher wanket hefft de smoeck
mit syneme venynschen dramme
an vnse orde is he ghekamen ock
vil mennighen toch de ramme etc.
Am Schlusse steht:
Des ersten: Ordior acta ducum etc.
Des anderen: Conuolat in monte stelle.
Des dridden: Perculso grauitate rei.
Die Original=Gedichte von H. Boger beginnen:
1) fol. 26b.: von der Mißhandlung des Sacraments zu Sternberg:
Super benedicti sacramenti irreuerenti tractatione per prophanos judeos in Sternebergio querulosa historia.
Convolat in montem stelle maledictus apella,
Facturus ferias mox himinee tibi;
Hic flaue cereris leti quoque munera bacchi
Vidisses gustus pabula dupla tui,
Hic fera multimodi generis sil' altilis omnis
Quodque gule tellus pontus et aër alit
Hic neruos phebi calamos audisseque panos
Fas est silleni stultaque plectra senis
Hic saltus gestusque leues cum mille cachinnis
Et vox et numeris brachia mota suis. etc.


|
Seite 484 |




|
2) fol. 34a.: von der Dithmarsen=Schlacht:
Stragis nouissime in Theomarcia satis vulgata historia.
Perculso grauitate rei vox faucibus heret
Mens ebet et tremulum cor stupet ecce mihi
Est vnus calicum domini datur vnde propina
Gentibus et fecis pocula quando furent
Pridem gorgoneum circum liuescere virus
Expertus nostros sentio adisse lares
Occidua id venisse plaga longos modo tractus
Perrepens certum est alluit arcton iter etc.
Das in Jahrb. VI, S. 196 angeführte Loblied auf das Heil. Blut im Dome zu Schwerin
ist im Etherologium fol. 11 a. gedruckt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 485 |




|



|



|
|
:
|
IX. Zur Rechtskunde.
1.
Manus Mortua, die Todte Hand,
der blinkende Schein.
Nachtrag zu Jahresbericht III, S. 94.
Im Jahre 1838 wurden dem Vereine 5 Todten=Hände und zwei hölzerne Schüsseln zur Aufbewahrung aus der ehemaligen Gerichtsstube des Heil. Geist=Hauses zu Wismar übergeben. Der Jahresbericht III, S. 94, wies dabei auf die alte deutsche Rechtssitte hin, den Leichnam des Erschlagenen nicht vor genommener Rache oder Sühne zu begraben, auch denselben vor Gericht vorzuzeigen, statt dessen später bloß die abgetrennte Hand symbolisch gebraucht ward.
Hiebei sind noch nachträglich zwei Puncte zu erwähnen: zuerst nämlich, daß diese Rechtssitte in Meklenburg sicher noch während des 16. Jahrh. bestand.
Im J. 1559 ward Helmuth von Plessen zu Brüel in Wismar auf der Hochzeit des Daniel von Plessen zu Steinhausen durch Joachim von Stralendorf erschlagen. Nur ungern sandte der Rath zu Wismar, das competente Gericht, dem Mörder eine Wachshand statt der wirklichen Hand des Erschlagenen, als Mahnung, vor Gericht zu erscheinen, zu. Der Rath ließ sich sogar dieserhalb einen Revers von den Angehörigen des Getödteten geben. Vgl. Schröder's Papist. Mecklenburg, S. 670; Franck's A. u. N. Mecklenb. Buch X, S. 76. 77.
Als im J. 1549 Achim Barnekow auf Gustävel einen Bürger Namens Wardenberg aus Pritzwalk erschlagen hatte, vertrug er sich mit den Angehörigen desselben dahin, daß er ihnen 8 Tage nach Antonius 1550 zu Plau 40 Gulden Münze und 5 Mark lübisch "zur Bestettigunge des Entleibten Hand" zu bezahlen verhieß.
Im J. 1566 sollte Lüder Barse zu Stieten den Peter Bützow zu Poppendorf beim Zechgelage getödtet haben. Er behauptete aber, unschuldig zu sein, und bat deshalb die Blutsfreunde des Peter Bützow, dem Todten die Hand abzunehmen und bis zum Austrag der Sachen zu verwahren, indem er sich vor Gericht stellen werde.


|
Seite 486 |




|
Diese Angaben sind den gleichzeitigen Acten entnommen. Auch lassen sich noch mehrere ähnliche Fälle nachweisen.
Der zweite Punct betrifft eine mehrfach und namentlich auch von Franck, A. u. N. M. Buch X, Seite 77, angeführte Nachricht über eine andere Art von Todten=Händen. Man soll auch verarmten Leibeigenen nach ihrem Tode die rechte Hand abgelöst und diese den geistlichen Herren, denen sie Zins oder Arbeit schuldigten, zugesandt haben. Franck meint sogar, daß die zuweilen, wie in Sternberg, sich findenden Knochen von Todtenhänden solchen verarmten Leibeigenen angehören dürften. Er beruft sich dabei auf Lehmann's Speiersche Chronik, Buch IV, Cap. 42, wo allerdings gesagt wird, daß ein Abhauen der Hand in solchen Fällen stattgefunden habe.
Allein diese Behauptung ist eine Fabel oder doch sicher nicht als verbreiteter deutscher Rechtsgebrauch nachzuweisen. Sie beruht wohl auf mönchischem Mißverstande oder Entstellung des "Besthaupts, mortuarium." Dies ist ein in fast allen Gegenden Deutschlands vorkommender Sterbezins, nach welchem der Herr des verstorbenen Eigenmannes unter dessen Fahrniß, besonders dem Vieh, sich ein Stück auswählen darf. In Frankreich und England geben sogar die Vasallen ein "mortuarium" an den König. Vgl. Grimm's deutsche Rechtsalterthümer, Buch I, Cap. 4.
Schon zu Francks Zeiten ward übrigens von manchen Gelehrten, wie von Heineccius (Elementa iuris german.), jene Behauptung als Fabel bezeichnet. Auch in Meklenburg sprach sich z. B. der verdiente Joh. P. Schmidt im J. 1743, damals Rector der Universität Rostock, nachher mekl. schwer. Geheimer Rath, bei Gelegenheit eines Leichenprogramms auf Anna Sophie Eggerdes, des Dr. und Prof. Handtvig zu Rostock Ehefrau, in demselben Sinne aus, indem er die Nachrichten und Grundsätze, "de jure manus mortuae sive der Todten=Hand", d. h. die Lehre vom Besthaupte, erörterte.
Üebrigens findet sich auch noch eine ausdrückliche Bestätigung über den Ursprung der besonders in meklenburgischen Kirchen zuweilen aufbewahrten Todtenhände in einer strafrechtlichen Abhandlung aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. "J. F. Stemwede, praeside Mantzel, jus crimin. Meklenburg." sagt nämlich pag. 32:
Et quoniam constat ex antiquis practicis, quod in casibus non succedentis cruentationis, putantes, homicidam non esse praesentem, membrum quod-


|
Seite 487 |




|
dam, maxime manum absciderint, idem obtinuisse in terris Meklenburg, probant relationes, fide omni haud destitutae, de manibus amputatis in templis, v. gr. Petrino Rostoch. ut et Georgiano Wismariensi forte, in hunc etiam diem adseruatis."
Schwerin.
A. F. W. Glöckler.



|



|
|
:
|
2.
Die Einziehung der Güter der Selbstmörder.
Ueber die in den Jahrbüchern, Bd. I, S. 175-76, berührte Einziehung der Güter eines Selbstmörders haben sich weitere Archiv=Nachrichten gefunden, welche diesen landesüblichen Rechtsgebrauch bestätigen, auch dessen Geltung noch etwas näher bestimmen.
Im J. 1521 ward vom Herzoge Heinrich von Meklenburg an seinen Bruder Herzog Albrecht berichtet:
Beke Grundtgriper (zu Parchim) habe angezeigt: ihr Bruder hätte sein Leben im Gefängnisse geendigt, indem er wegen Verbrechen heimlich habe gestraft werden sollen. Des Herzogs Albrecht Beamte zu Lübz hätten aber "von deswegen das derselbe ire bruder, als gesagt werden wolde, aus Mismut im gefengnus sein leben selbest geendiget", sich unterstanden, in der gemeinschaftlichen Stadt Parchim nicht bloß ihres Bruders, sondern auch ihr Vermögen an sich zu nehmen, namentlich die beweglichen Güter in einer verschlossenen Lade. Der Herzog Heinrich bat deshalb, zu erwägen, "das die rechte soliche anders wollen"; möge Grundtgriper im Gefängniß ein Selbstmörder geworden sein, so könnten deshalb "der armen frawen gutter, ir alleine oder zu iren anpart zustendig, derhalben nicht angegriffen werden"; wären ferner des Grundtgriper Güter verwirkt "vnd die obirkeyt dorzu berechtiget" so habe er, Herzog Heinrich, gleiche Rechte an selbige, da die Stadt Parchim und "die Gerichte vbir den Adel, darran Grundtgriper gewest" gemeinschaftlich seien. Schließlich ersuchte Herzog Heinrich seinen Bruder, die genommenen Güter wieder zur Stelle zu schaffen, bis man sich verglichen, was hinsichtlich derselben billig und recht sei, damit keiner "derhalben vorkortzt" werde.


|
Seite 488 |




|
Hierauf erwiederte Herzog Albrecht von Meklenburg, d. d. Wismar Montag nach Concept. Mariä 1521: er "halte es gentzlich darfur" was seine Amtleute zu Lübz in dieser Sache gehandelt, daß sie "solchs nach gelegenheit wol wissenn zue vorantworten" etc.
Henneke Smedes oder Smedt, ein Straßenräuber, aus Lage, ward im J. 1525 ergriffen und, wie es scheint, zu Güstrow in peinliche Untersuchung genommen. Er tödtete sich aber selbst im Gefängnisse. Es berichtet dieserhalb (der Vogt?) Hans Rathsten, d. d. Güstrow, am Abend Michaelis 1525, an den Herzog Heinrich von Meklenburg:
"Ick screff J. F. G. inme Jungesthen to Rostock van de nagelaten guderen Hennicke Smedes, na deme he sick suluest to dode brachte. G. H. so screff ick ehm syne schulde, weß he noch vthgande hadde, so wil syne Husfrowe vnd syn broder de scrift van my hebben, vnd ick der se em nicht don. G. H. so J. F. G. wolden ehm de guder loß geuen, mosten se jo tom ryngesthen 1 tunne Rotschar vthgeuen , wente J. F. G. moste jo 1 gulden geuen den bodel; ock ath vnd dranck he wol XI wecken. G. H. weß J. F. G. nv inne guthgeduchte, my scriflick J. F. G. mochten vormelden." -
Daß noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. der Gebrauch geltend war, scheint die folgende Stelle des Bruch=Registers des Stadtvogtes zu Parchim vom J. 1568 zu beweisen: "Anno 68 in der Vastenn hat sich ein weib gehangenn; das guth ahn mich genohmmen, dauon gemachet 11 fl. 5 ßl."
Es ist zu bemerken, daß die Bambergensis (edit. Rostock 1510, hoch 4., mit Holzschnitten) Tit.: "Straffe eyghener dodynge" folgende Bestimmung hierüber hat:
"Item wener eyn man beclaget vnde in recht gefordert wert, dar dorch (so he ouerwunen de d
t vorschuldet, edder vth frochten syner myssed
t, syck sulues dodet, de schal neyne eruen hebben; wu syk ouers eyner buten vorgemelten orsaken, sunder vth kranckheyt synes liues edder gebrekliheyt der synne, sik sulues dodet, dessulfften eruen scholen an erer erueschop nicht gehyndert werden etc.


|
Seite 489 |




|
Schon das römische Recht unterscheidet (ff. 1. 3, §. 4, 6, 7, de bonis eorum, qui ante sentent. Nov. 134, c. ult.) in ähnlicher Art, wie Art. 135 der P. H. G. O. Nach der Glosse zu B. II, A. 3 des sächsischen Landrechts sollen die Leichname der Selbstmörder verbrannt werden; schimpfliche Bestattung derselben ward in Deutschland gemeinrechtlich. -
In Livland fand um d. J. 1700 eine Einziehung der Güter von Selbstmördern nicht mehr statt; doch ward der Leichnam vom Büttel nach dem Morast gebracht und im Moos vergraben, vor jener Zeit aber verbrannt. War die That in Tiefsinn oder Krankheit geschehen, so fand Vergraben auf dem Kirchhofe nordwärts am Zaun ohne Feier statt. (Vgl. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv=, Ehst= und Kurlands, Bd. II, S. 65.)
Uebrigens erwähnen die meklenburgischen Polizei=Ordnungen des 16. Jahrh. nirgends des obigen Rechtsgebrauchs, obgleich die P. O. von 1562 und 1572 sich über die "Erbschaften und wie einer fur dem andern zu dem Erbe gelassen werde", weitläuftig verbreiten. Gegen das Ende heißt es hier nur: "Also wollen wir auch, wann sich hinfuhro Erbfälle zutragen möchten, so aus vorgesatzten Bericht nicht könnten entschieden oder darunter begriffen werden, so soll darin nach gemeinen Kayser=Rechten geurtheilet und gesprochen werden". Eben so wenig scheint sonstig jemals in Meklenburg eine besondere gesetzliche Bestimmung über die Einziehung der Güter der Selbstmörder erlassen zu sein.
Auch die "Formula, wie das Fahrgericht in Wismar zu halten", Wismar, 1686, 4. deutet nicht auf eine solche Bestimmung hin, obgleich hier wiederholt von dem Verfahren mit Selbstmördern die Rede ist und namentlich festgesetzt wird, daß die Körper von Ruchlosen, die sich wegen Verbrechen entleiben, von dem Frohn im Felde eingescharrt werden sollen.
Schwerin.
A. F. W. Glöckler.



|



|
|
:
|
3.
Strafe auf Kindesmord und Sodomie
im 18. Jahrhundert.
Von dem Herrn von Berg auf Neuenkirchen sind dem Vereine Actenstücke über zwei bei dem dortigen Patrimonial Gerichte vorgekommene peinliche Rechtsfälle mitgetheilt worden. Dieselben sind, wenn auch aus neuerer Zeit,


|
Seite 490 |




|
doch ihrem Inhalte nach wohl schon den Rechtsalterthümern beizuzählen.
Der erste Fall betrifft die im J. 1710 wegen. Kindermordes hingerichtete unverehelichte Marie Westphal und deren Verführer Joachim Drewes. Guts= und Gerichtsherr war damals Balthasar Friedrich von Berg; als Justitiar ward der Burgemeister Casimir aus Neubrandenburg zugezogen Der Prozeß ward eilig und ohne viele Umstände betrieben, aber doch dabei ziemlich kostbar für den Gutsherrn.
Unter dem 17. März 1710 stellen nämlich die Chirurgen Johann Dorn und Carl Friedrich Wilpert aus Neubrandenburg ein visum repertum über den Leichnam eines von der Marie Westphal gebornen Kindes dahin aus: "das es über den ganzen Leib blau war, dannenhero (wir) nicht anders praesumiren können, als das es ersticket". Desselben Tages, so wie am 24. März hielt der Justitiar ein Verhör mit der Inquisitin, welche gleich anfangs eingestand, das Kind bald nach der Geburt unter dem Bette erstickt zu haben. Am 26. d. M. wurden die Acten an die Juristen=Facultät zu Greifswald zum Spruch verschickt. Dieser, auf Hinrichtung der Inquisitin mit dem Schwerte lautend, erfolgte binnen wenig Tagen. Schon am 3. April ward das Schlußverhör gehalten und das Urtheil gesprochen. Am 9. d. M. gingen die Acten mit dem Erkenntnis nach Strelitz zur landesherrlichen Bestätigung, die ebenfalls umgehend am 10. April dahin erfolgte, daß man es "bey der - eingeholeten Urtel billig bewenden lasse" und insbesondere die Vollstreckung der dem Verführer zuerkannten Landesverweisung genehmige.
Die Hegung des peinlichen Gerichts und die Vollziehung des Urtheils geschahen am 25. April zu Neuenkirchen. Der Burgemeister und Notar Casimir, als Vorsitzender, stellte hierüber folgendes Protocoll aus:
"Wann ein Zeichen gegeben ist, still zu sein , wird daß Peinliche Halsgericht geheget folgender Massen. Weil eß so viel Tages, das ein öffentliches Peinliches Halsgericht geheget werden kann, so hege dasselbe im Nahmen Gottes, im Nahmen des wolgebohrnen Herrn, Hern Balzar Friederich von Berg, als ordentlicher Obrigkeit zum ersten, andern und dritten Mahl; und weil dieses öffentliches peinliches Halsgericht genugsahm geheget, so wird erlaubet, wer für demselben zu tuhn hat, hervor zu tretten, seine Klage anzubringen, da denn peinlicher Ahrt nach verfahren und was Rechtens, erkannt werden soll."
Hierauf bringt der Scharfrichter vor:
Ob ihm erlaubt sei, seine peinliche Klage vorzubringen?


|
Seite 491 |




|
Worauf geantwortet wird: Ja, es sei ihm erlaubet. Darauf klaget er an zum ersten, andern und dritten Mahl 1. den Joachim Dreves. 2. die Maria Westfahl. Der Richter schweiget dazu still.
Dann bittet der Scharffrichter, das beiden Uebeltehtern ihre getahnene Bekenntniß moge vorgehalten und dieselben nochmahln darüber vernommen werden.
Hierauf werden vorgelesen:
I. dem Joachim Dreves folgende Artikul.
1. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, die Maria Westfahl geschwängert? Resp. Ja.
2. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, der Maria Westfahl, um die Frucht im Mutterleibe zu vertreiben, das Fett aus der Müllen=Pfanne zu gebrauchen (geben). Resp. Ja.
3. Wahr, das Ihr, Joachim Dreves, der Marien gerahten, das Kind bei der Seite zu bringen? Resp. Ja.
II. der Marien Westfahl folgende Articul:
1. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, ein lebendiges Kind zur Welt gebracht? Resp. Ja.
2. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, solches euer Kind im Bette unter dem Dekbette gebohren. Resp. Ja.
3. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, das Kind nicht so fort, wie eß gebohren, unterm Dekbette hervorgezogen. Resp. Ja.
4. Wahr, das Ihr, Maria Westfahl, das Kind darum nicht so fort unterm Dekbette hervorgezogen, das es erstikken sollte. Resp. Ja.
5. Wahr, das das Kind auch unterm Dekbette daher erstikket. Resp. Ja.
Wann beide Inquisiten über vorgesetzte Articul vernommen und dieselbe zugestanden, bittet der Scharffrichter, das beiden Beklagten ihr Urtel möge offentlich vorgelesen werden.
Hierauf wird die Urteil publicirt:
Auf angestellte und vollführte inquisition wider Johan Dreves und Maria Westfahln, (wegen) beiden Inquisiten begangener Unzucht und Kinder=Mords, spricht der Wolgebohrner Herr, Herr Balzar Friedrich


|
Seite 492 |




|
v. Berg, Obrigkeitlichen Amts halber, auf eingeholten Raht und Belehrung der Rechtsgelehrten vor Recht:
das beide Inquisiten, wegen ihrer begangenen Missetahten, ihnen zur wollvordienten Straffe und Andern zum Abscheu, als der Johan Dreves offentlich zur Staup zu schlagen und mit erhaltenen consens der hohen Landes=Obrigkeit deß Landes auf ewig zu verweisen, die Maria Westfahln aber mit dem Schwert vom Leben zum Tode hinzurichten sei. Wie denn beide Mißtähter in obangedeutete Straffe hiemit verdamt werden. V. R. W.
Der Scharffrichter fraget nach publicirten
Urtheil:
Herr Richter, wer soll die Urtheil
exequiren?
Der Richter antwortet: Das sollt
Ihr thun.
Der Scharffrichter: Herr Richter,
ich bitte umb sicher Geleit.
Der Richter:
Das soll Euch gegeben werden.
Publicirt und vollenzogen Neuenkirchen den 25ten Aprilis 1710.
In fidern subscripsit
Notarius caes. publ. ad hunc actum requisitus.
Die Kosten dieses Prozesses berechnete der Guts= und Gerichtsherr zu 102 Gulden und 20 Schilling, die Fuhren, die Futter= und Speisungskosten nicht mit angeschlagen. Der Justitiar erhielt 29 Gld., der Scharfrichter 32 Gld., der Prediger 4 Gld. Das Urtheil kostete mit dem Botenlohn 11 Gld. Bei der Hinrichtung ward eine halbe Tonne Bier ausgeschenkt. - Der Gerichtsherr schließt die eigenhändig von ihm geführte Rechnung mit den Worten:
"Gott gäbe, das si - die Hingerichtete - sälig worden ist undt beware mir vor mer Ungelück.
B. F. v. Berg."
Im Allgemeinen war das Laster der Unzucht seit Jahrhunderten unter dem meklenburgischen Landvolke sehr verbreitet. Folgeweise waren auch die Kindermorde häufig, jedoch früher wegen härterer Strafen des Verbrechens der Unzucht häufiger, als jetzt.
Die höheren Stände blieben nicht frei davon. Die mekl. Polizei=Ordnung v. J. 1572, Titel: "Von Todschlag, Ehebruch, unehelicher Beywohnung, Kupplerey und Hurerey,"


|
Seite 493 |




|
bestimmt für die vielfältige, auch unter dem Adel einreißende Unzucht harte Strafen. Der Art. 43 der Reversalen v. J. 1621 gestattet die "Vermäuerung" (d. h. häusliche Haft) unzüchtiger adelicher Jungfrauen den Angehörigen derselben. (Vgl. Stemwede, praeside Mantzel, Jus criminale Meklenburg. 1743, 4., pag. 40; Simssen in Beilagen zu den wöchentl. Rostocker Anzeigen v. J. 1817, S. 109). Mehrmals kamen auch um diese Zeit in den Landesklöstern solche Vergehen von Seiten der Conventualinnen vor.
Vielfach ist begangene Unzucht in Meklenburg mit Landesverweisung bestraft, welcher oft Staupenschlag und bisweilen Kirchenbuße, auch Ausstellung am Pranger, Haarabschneiden und dergl., namentlich in einzelnen Städten, vorhergingen. In manchen Fällen genügte man sich mit einer der geringern Strafen in Verbindung mit Geldbußen. Einige Landesherren, wie die Herzoge Ulrich und Gustav Adolph zu Meklenburg=Güstrow, hielten sehr strenge auf Vollziehung der Unzuchtsstrafen. Letzterer schärfte die bisher bestehenden durch ein Edict v. J. 1659. Kindesmörderinnen wurden früher gewöhnlich mit dem Schwerte hingerichtet. Es kommen sogar Andeutungen vor, wie in einem parchimschen Bruchregister beim J. 1572, daß einzelne lebendig begraben worden sind, indem die Bambergensis, die Mutter der Carolina, in Art. 156 bestimmt, daß vorsätzliche Kindesmörderinnen lebendig begraben und gepfählt werden sollen. Die Carolina setzt in Art. 131 das Ertränken an dessen Stelle und gestattet Lebendigbegraben nur dann, wenn das Uebel oft geschieht.
Zur Zeit des oben erzählten Falles, um das J. 1710, war das Verbrechen des Kindermordes häufig in Meklenburg. So kommen z. B. in den im J. 1717 zu Schwerin und Leipzig erschienenen: "Consultationes juris oder rechtliche Belehrungen" von D. J. Scharf in Consult. 36, 58-62 und 79 mancherlei Fälle vor. (Vgl. Stemwede, praeside Mantzel, jus crim. Meklenb. pag. 47.). Doch waren damals in andern deutschen Ostseeländern Unzucht und Kindermord noch viel häufiger, als in Meklenburg. So kamen in Livland in den 15 Jahren v. J. 1695-1709 nicht weniger als 242 Fälle - es war das häufigste Verbrechen! - vor, und 155 schuldige Mütter wurden zum Tode verurtheilt; dort, wie auch in Meklenburg, trat dies hauptsächlich als Folge der Durchzüge der " Soldatesca" und der zu strengen Unzuchtsstrafen hervor. (Vgl. Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv=, Ehst= und Kurlands. Bd. II, S. 60.)


|
Seite 494 |




|
Der zweite Fall betrifft das Verbrechen der Sodomie und ereignete sich im Frühling des J. 1748 zu Neuenkirchen.
Der dortige Kuhhirte Michael Kruse, ein schwacher, kurzsichtiger, sehr einfältiger Mensch, hatte sich wiederholt mit einer dreijährigen Starke und einer Kuh fleischlich vermischt, wie zwei Dienstmägde des Hofes als Augenzeugen eidlich aussagen, auch vom Inquisiten selbst schon beim ersten Verhör gerichtlich eingestanden wird. Die erfolgte inmissio seminis ward sicher ermittelt. Nachdem am 20. Mai d. J. das Verhör der Zeuginnen sowohl, wie des Inquisiten in Gegenwart des Gerichtsherrn Ernst August von Berg, des Beisitzers Hauptmanns von Ahrenstorf (auf Sadelkow), des Advocaten Fischer aus Neubrandenburg als Justitiars und des Notars Natorp stattgefunden hatte, ward dem Beklagten in der Person des Advocaten und Senators Klinge zu Neubrandenburg ein Vertheidiger bestellt. Dieser sandte am 4. Junius seine Defensions=Schrift ein, welche wegen freiwilligen Geständnisses und großer Unwissenheit des jedenfalls der Todesstrafe schuldigen Beklagten eine Milderung seiner Strafe dahin nachsuchte, daß er statt des Feuertodes "mit dem Schwerte begnadiget" werden möge, zumal dem Inquisiten "die drohende Feuers=Strafe als sehr schmerzlich und erschrecklich vor Augen schwebe, wodurch er gar leicht in Verzweifelung und folglich die Seele in Gefahr gerathen könne".
Hierauf reichte der Gerichtsherr die Acten bei der Justiz=Canzlei zu Neustrelitz ein. Diese erkannte nach wenig Tagen, am 7. Junius, für Recht:
daß Inquisit nach Inhalt Kaiser Carl's V. Peinl. Halsgerichts=Ordnung seiner unnatürlichen Thaten wegen, ihm selbst zur wohlverdienten Strafe und Andern zum abschreckenden Beispiel mit Feuer vom Leben zum Tode gebracht, die beiden Häupter Vieh aber todtgeschlagen und verbrannt werden sollten.
In den "rationes decidendi" ward darauf hingewiesen, daß der Inquisit das Unnatürliche seiner That von selbst hätte erkennen müssen, das Verbrechen wiederholt habe, sein Bekenntniß Folge der Haft sei, durch strenge Beispiele abgeschreckt werden müsse und über die Strafe eines Falles, wie der vorliegende, die Rechtslehrer einig seien, mit denen auch der Landesgebrauch übereinstimme.
Jedoch ward gleichzeitig in einem zweiten Erlasse des Gerichts eine Milderung der Strafe dahin verfügt:
"daß Inquisitus auf dem Scheiterhaufen zuforderst zu stranguliren und das Feuer nicht eher anzuzünden, bis der arme Sünder ersticket".


|
Seite 495 |




|
Am 21. Jun. 1748 ward das peinliche Halsgericht in Gegenwart der vorher Genannten zu Neuenkirchen öffentlich, jedoch ohne Anwendung der 30 Jahre früher noch üblichen, aber schon damals verstümmelten alten Formen, gehegt. Der Inquisit ward, seiner Banden entledigt vorgeführt, nochmals über die entworfenen Untersuchungs=Puncte befragt und nach deren durchgängiger Bejahung dem Scharfrichter übergeben. Die Hinrichtung ward gleich darauf vollzogen.
Der Scharfrichter J. C. Mühlhausen stellte hierüber folgende Rechnung aus:
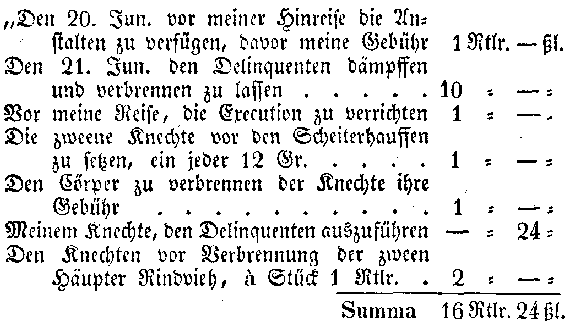
Der Seiler Ch. Winkler in Neubrandenburg stellte eine Rechnung über 16 ßl. für die gelieferte "Dempfleine" aus, mit welcher vermuthlich der Verurtheilte erdrosselt ward.
Aehnliche Fälle des Verbrechens der Sodomie kommen im 17. und 18. Jahrh. unter dem meklenburgischen Landvolke nicht ganz selten vor, so auch Blutschande, selbst zwischen Eltern und Kindern. Denjenigen, welche den damaligen elenden Zustand des meklenburgischen Landvolkes und überhaupt die Sittengeschichte dieser Zeiten aus Acten kennen, wird dies nicht besonders auffallend erscheinen.
Mehrere Fälle von Sodomie obiger Art hat D. J. Scharf, consultationes juris oder rechtliche Belehrungen, consult. 8-10.
Zu bemerken ist, daß Sodomie zwischen Personen desselben Geschlechts, sodomia ratione sexus, in Meklenburg früher fast nur von Ausländern nachzuweisen ist; namentlich gegen Italiäner, Franzosen, Böhmen etc., welche als Musiker, Lehrer der ritterlichen Künste, Barbiere oder dergl. während der drei letzten Jahrhunderte in herzoglichen Diensten


|
Seite 496 |




|
standen, kommen wiederholt actenmäßige Anschuldigungen wegen Ausübung dieses Verbrechens vor.
Auch in andern Ostsee=Ländern, z. B. in Livland, finden sich um d. J. 1700 fast nur Beispiele des Vergehens mit Thieren, vom Landvolke ausgeübt. Das Verbrechen ward dort statt mit dem Feuertode durch Enthauptung und gemeinsames Verbrennen mit dem zuvor getödteten Thiere bestraft. (Vgl. die angef. Mittheilungen, Bd. II, S. 75.)
A. F. W. Glöckler.



|



|
|
:
|
X. Zur Erd= und Naturkunde.
Ein Horn eines Urochsen
(bos urus) oder Wisent (bos bison), slavisch Tur, das an einer äußerst breiten Stirn gesessen hat am Stirnrande rund, mäßig lang, halbmondförmig, wenig gebogen, an der Stirnwurzel 5 1/2'' im Durchmesser, ungefähr 18'' lang im Durchmesser der Biegung, gefunden zu Wokrent bei Schwaan in einer torfigen Wiese am Rande einer Mergelgrube, geschenkt vom Herrn Kammer= Director Baron von Meerheimb auf Wokrent zu Gischow; die Spitze ist abgebrochen. Vgl. Jahresbericht III, S. 68. Es werden dergleichen Hörner, auch andere Knochen dieses Thieres, öfter in Meklenburg gefunden und gehören wohl dem Wisent an, das in ältern Zeiten jagdbares Thier in Deutschland war.
G. C. F. Lisch.
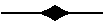


|




|
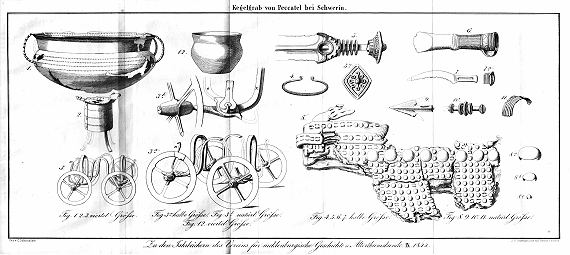


|




|