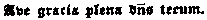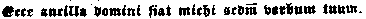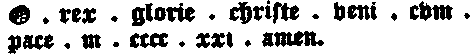|
[ Seite 257 ] |




|



|
|
|
- Steinkisten von Boddin
- Hünengrab von Friedrichsruhe
- Steinerne Altertümer von Boddin
- Kegelgrab von Brunsdorf
- Kegelgräber von Marlow und Alt-Gutendorf
- Kegelgräber von Groß-Methling
- Kegelgräber von Goldberg
- Urne von Satow
- Beiträge zur Erklärung des Heerhorns von Wismar und des Bronzewagens von Peccatel
- Ueber die Hünenhacken und die halbmuldenförmigen Quetschmühlen
- Wendengräber von Wotenitz (Fortsetzung, vgl. Jahrbücher XXIII, S. 288)
- Wendischer Begräbnißplatz von Alt-Gutendorf
- Urne und Wall von Fahrenhaupt
- Wendische Wohnstelle von Boddin
- Wendengräber von Cörlin in Pommern
- Ueber das heilige "Hakenkreuz" der Eisenperiode
- Ueber die Hausurnen
- Römische Alterthümer von Hagenow (Vgl. Jahresbericht VIII, S. 38 flgd.)
- Ueber Urnen von Dresden und Kinderurnen
- Mittelalterliche Alterthümer von Schwerin
- Der Burgwall von Dargun
- Der wendische Burgwall von Krakow
- Die mittelalterlichen Burgen von Dobbin
- Die Burg der Moor-Hoben an der Trebel
- Die Kirchen zu Ratzeburg : Der Dom zu Ratzeburg. Die Georgen-Kirche von Ratzeburg
- Die Kirche zu Neuenkirchen
- Die Kirche zu Bützow
- Die Kirche zu Gägelow
- Der Altar der Kirche zu Bernit
- Kirche zu Marlow
- Die Kirche zu Kölzow
- Die Kirche und das Antipendium zu Dänschenburg
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 258 ] |




|


|
[ Seite 259 ] |




|



|



|
|
|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Zeit der Hühnengräber.
Steinkisten von Boddin.
Auf dem Felde des Gutes Boddin bei Gnoien sind bei der Directorial=Vermessung auf der Charte mehrere Stellen als "Steinhügel" bezeichnet, jedoch alle bis auf eine Steinkiste zerstört.
Beim Steingraben an einer von diesen als "Steinhügel" bezeichneten Stellen, an welcher jedoch die Steinkiste schon zerstört war, fand sich etwa 2 Fuß unter der Erdoberfläche ein unverbranntes menschliches Skelet, welches aber von den Arbeitern so sehr zerstört ward, daß die Reste zu wissenschaftlichen Untersuchungen unbrauchbar sind. Vom Schädel sind nur geringe Bruchstücke übrig geblieben; vom Stirnbein ist nichts vorhanden. Alterthümer wurden bei dem Skelet nicht gefunden. Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin hat die Güte gehabt, diesen Bericht und die Skeletfragmente an den Verein einzusenden.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Friedrichsruhe.
Ueber die Hünengräber im Amte Crivitz ist schon in den Jahrbüchern II, S. 107, und V, S. 101 berichtet. Bei Gelegenheit des gegenwärtigen Chausseebaues wurden die Gräber im Frühling 1858 noch einer Revision unterworfen und dabei neue Entdeckungen gemacht, welche die frühern an Wichtigkeit noch übertreffen.


|
Seite 260 |




|
Bekannt ist die gewaltige Steinkiste von Ruthenbek (vgl. Jahrbücher a. a. O.), des "Teufels Backofen" genannt, welche jetzt auf Büdneracker steht und vor ungefähr 20 Jahren von der Beackerung ausgenommen, abgegrenzt und als unmittelbares Domanialeigenthum conservirt ist. Zwei andere Steinkisten in der Nähe sind aber in frühern Zeiten so sehr zerstört, daß ihre Bedeutung nicht mehr zu erkennen ist.
Fast noch wichtiger ist eine große Gruppe von Gräbern zu Friedrichsruhe, welche der frühern Nachforschung der Beamten entgangen waren. Auf der Feldmark des Domanialhofes Friedrichsruhe, seitwärts hinter der Mühle, auf der Höhe der Ackerebene, von welcher man eine angenehme Aussicht auf die mit Wiese und Wald geschmückte Senkung hat, in welcher die Mühle steht, liegen mehrere Hünengräber der Steinperiode, welche zu den merkwürdigsten gehören, welche noch vorhanden sind.
Auf der Fläche in der Mitte liegt, in der Richtung von Osten nach Westen, ein großes Hünengrab oder Riesenbette, welches eines der größten von allen ist, die bekannt geworden sind. Das Grab ist ungefähr 180 Fuß hamb. Maaß lang, 28 Fuß breit und 4 Fuß hoch, flach gewölbt und zeigt in der Außenfläche nur Rasen. Es ist mit ungefähr 80 großen Granitpfeilern umstellt gewesen, von denen noch ungefähr 70 stehen oder liegen. Die gewöhnlichen vier Decksteine der Grabkammer fehlen schon; oben auf dem Grabe liegen noch ohne erkennbare Ordnung 2 Steine, welche wahrscheinlich nur Bruchstücke von den in frühern Zeiten gesprengten Decksteinen sind. Sonst ist das Grab selbst noch nicht berührt und macht noch jetzt einen großen Eindruck. In der Längenausdehnung und der Zahl der Seitenpfeiler übertrifft dieses Grab also noch das Grab von Naschendorf, welches nur 150 Fuß lang ist und nur 50 Seitenpfeiler hat; jedoch sind hier die Seitenpfeiler größer und die vier Decksteine wohl erhalten. (Vgl. Lisch Friderico - Francisceum, Erläut., S. 164, und Abbildung Taf. XXXVI).
Unmittelbar östlich neben diesem Grabe am Abhange, in gleicher Richtung, liegt ein zweites Grab von ähnlicher Größe und gleichem Bau. Dieses ist aber fast ganz zerstört und vielfach angegraben, so daß die Form schon vernichtet ist; die meisten Pfeiler sind zu Bauten schon weggenommen oder liegen in Unordnung umher.
Nahe südlich an diesen Gräbern liegt ein drittes Grab von bedeutender Größe, welches schon sehr tief ganz aufgegraben und völlig zerstört ist. Es bildet jetzt eine große Grube,


|
Seite 261 |




|
um welche viele große Steine in wilder Unordnung umherliegen, und das Ganze bildet ein Chaos, welches mit Dornen und anderm Gebüsche dicht bewachsen ist.
Westlich von den beiden großen Gräbern liegen an zwei Stellen auf dem Felde noch große Steine, welche offenbar zu Gräbern gehört haben.
Wahrscheinlich sind die zuletzt genannten Gräber in den Jahren 1804 und 1805 von dem Hauptmann Zinck im Auftrage des hochseligen Großherzogs Friedrich Franz aufgedeckt (vgl Lisch Frid. Franc. Erläut. S. 5). Freilich sind diese Nachgrabungen ohne Erfolg gewesen, da sie augenscheinlich nicht umfassend genug gewesen sind; die wenigen Alterthümer aus der Steinperiode, welche aus Friedrichsruhe stammen, zeugen dafür. Dagegen muß Zinck viele Kegelgräber zu Friedrichsruhe abgetragen haben, da sich sehr viele Alterthümer aus dieser Periode, namentlich goldene Fingerringe, in der großherzoglichen Sammlung aus Friedrichsruhe herschreiben (vgl. Lisch Frid. Franc. Erl. S. 50 flgd.). Diese Alterthümer stammen sicher nicht aus den erwähnten Steingräbern.
Wenn auch die Noth gebieterisch fordern wird, daß die unordentlich liegenden und theilweise gesprengten Steine der zerstörten Gräber zu den Brückenbauten der Chaussee in dieser Gegend verwandt werden, da es hier sonst an großen passenden Steinen fehlt, wie die Beamten zu Crivitz schon vor 20 Jahren vorhergesehen haben (vgl. Jahrbücher II, S. 108), so ist doch dafür Sorge getragen, daß die oben erwähnten, erhaltenen Riesenbetten von Friedrichsruhe so wie die Steinkiste von Ruthenbek conservirt werden.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Steinerne Alterthümer von Boddin.
Se. Excellenz der Herr Minister a. D. von Lützow auf Boddin bei Gnoien hat die Freundlichkeit gehabt, dem Vereine von einem zu Boddin gemachten Funde steinerner Alterthümer Bericht zu geben und dem Vereine die gefundenen Alterthümer zu überreichen. Beim Aufgraben eines großen Granitblockes, vielleicht eines Decksteins von einem ehemaligen Hünengrabe, wurden neben dem Granitblocke unter einem schmalen Decksteine gefunden:
1) die obere Hälfte einer im Schaftloche quer durchbrochenen, in der Oberfläche noch nicht polirten, sechsseitigen Streitaxt aus Grünstein=Porphyr oder Diorit=Porphyr,


|
Seite 262 |




|
einem Gesteine, welches äußerst selten zu Streitäxten verwandt ist, obgleich das Gestein in Meklenburg nicht selten ist;
2) ein flacher, zu einem fast ganz regelmäßigen Oblongum an den Seitenflächen zugehauener, wahrscheinlich zu einer Lanzenspitze bestimmt gewesener Feuerstein, von 6" Länge, gut 2" Breite und ungefähr 1" Dicke, mit noch unbehauenen Oberflächen, auf deren einer eine Muschelversteinerung ("Janira quadricostata") sitzt;
3) ein roher Feuerstein, 3 1/2" lang, welcher außerordentlich der Gestalt einer Ente gleicht;
4) ein an einer Ecke angeschlagener flacher, roher Feuerstein, 4 1/2" lang, welcher der Gestalt eines Vogels ähnelt.
Die Reste des Inhalts eines Hünengrabes scheinen diese theils unfertigen, theils zerbrochenen Steine nicht zu sein, wenn man auch annehmen möchte, daß die vogelähnlichen Steine zum Spielzeug gedient haben könnten. Wahrscheinlicher ist es, daß diese Steine Ueberreste von einer Steingeräth=Fabrik sind, welche sich an dieser Stelle befand, um so mehr da das Feld von Boddin reich an Versteinerungen ist und sich auch an andern Stellen der Feldmark abgeschlagene Feuersteinsplitter finden.
Eine Streitaxt von Kieselschiefer,
von reiner, schwärzlicher Farbe, ausgezeichnet schöner und regelmäßiger Form und unübertrefflicher Arbeit, eines der vollendetsten Steingeräthe, die in Meklenburg gefunden sind, schenkte der Herr Hofmaler Schloepcke in Schwerin, der sie in einem Handel von alten Sachen kaufte, wohin sie durch Verkauf gelangt war; der Fundort in Meklenburg ist nicht zu ermitteln.
Eine Streitaxt
aus Grünstein=Porphyr, von der gewöhnlichen Form und mehr als gewöhnlicher Größe, welche überall polirt, deren Schaftloch aber noch nicht ganz vollendet, jedoch der Vollendung nahe ist, schenkte der Herr Amtshauptmann Spangenberg zu Neustadt.
Streitaxt von Groß=Klein.
Beim Bau der Chaussee von Rostock nach Warnemünde ward im J. 1858 auf der Feldmark Groß=Klein bei Warnemünde eine große Streitaxt aus Hornblende von der gewöhnlichen Form gefunden und von dem Herrn Wegebaumeister Düffcke durch den Herrn Oberbaurath Bartning zu Schwerin dem Vereine geschenkt.


|
Seite 263 |




|
Zwei hornblendenartige Steine,
in der Form von Streitäxten, unbearbeitet, gefunden zu Boddin bei Gnoien, wurden von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Rohe Steine dieser Art wählten die Akten zur Verfertigung von Streitäxten.
Keil aus Hornblende von Boddin.
Beim Ausmodden eines Teiches am Dorfe des Hofes Boddin bei Gnoien ward im J. 1859 ein seltener Keil gefunden und von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Der Keil ist von Hornblende, mit spitziger Bahn, und für Keile aus diesem Gestein ungewöhnlich groß, 8 1/2" lang, 3" breit und 2" dick.
Keil aus Feuerstein von Pommern.
Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin schenkte dem Vereine einen in Pommern gefundenen Keil aus Feuerstein von ungewöhnlicher Größe; dieser Keil, welcher überall erst roh zugehauen und nirgends angeschliffen ist, ist 10" lang, 3 1/2" breit und gegen 2" dick. An jeder breiten Seite hat der Keil eine ziemlich tief eingehende natürliche kleine Höhlung, welche jedoch die Vollendung nicht hinderte, wie der unten beschriebene geschliffene Keil von Gnoien beweiset.
Keil von Wulfshagen.
Zu Zepelin's=Wulfshagen bei Ribnitz ward ein schöner, dicker Keil aus Feuerstein mit bräunlicher Oberfläche, überall nur behauen und zum Schleifen zugerichtet, gefunden und von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow erworben und dem Vereine geschenkt.
Keile.
Ein Keil aus Feuerstein, 6 1/2" lang, an beiden breiten Seiten geschliffen, jedoch vielfach ausgesplittert, an der Schneide sehr scharf, gefunden in der Umgegend von Gnoien von einem Steinsprenger, ward von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. Dieser Keil hat an jeder breiten Seite eine natürliche, kleine Höhlung (vgl. oben den Keil von Pommern).
Ein Keil aus grauem Feuerstein an den beiden breiten Seiten ganz, an den schmalen Seiten gar nicht geschliffen, ge=


|
Seite 264 |




|
funden in einem Hünengrabe zu Ruthenbek bei Crivitz, ward geschenkt von dem Herrn Stadtsecretair Bade zu Crivitz.
Ein Keil aus grauem Feuerstein, an der Schneide geschliffen, gefunden zu Kartlow bei Wismar, ward geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.
Ein Keil aus hellgrauem Feuerstein, hohl geschliffen, gefunden zu Granzin bei Parchim, ward gekauft von dem Händler Bergmann zu Parchim.
Ein Keil aus bräunlichem Feuerstein, klein, gefunden in der Gegend von Parchim, ward gekauft von dem Händler Bergmann zu Parchim.
Dolch von Goldberg.
Bei den Kegelgräbern auf der Stadtweide von Goldberg (vgl. unten S. 272) ward ein Dolch von bräunlichem Feuerstein gefunden und durch den Herrn Wiechmann auf Kadow von dem Finder gekauft und dem Vereine geschenkt.
Eine halbe Lanzenspitze aus Feuerstein,
die abgebrochene Spitze, 3 3/4" lang, gefunden zu Boddin bei Gnoien bei einem Drains=Graben 1857, ward von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin dem Vereine geschenkt. - Das andere Ende, welches genau in die Bruchstelle paßte, ist verloren gegangen.
Eine Lanzenspitze
oder Harpunspitze aus Feuerstein, 5" lang, gefunden in der Gegend von Bützow, schenkte der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.
Ein halbmondförmiges Messer
aus Feuerstein fand bei Bützow und schenkte dem Vereine der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.
Eine Pfeilspitze,
aus einem Feuersteinspan gearbeitet, gefunden in Schonen in Schweden, schenkte der Herr Dr. Bruzelius, Lector der Archäologie an der Universität zu Lund, im August 1858 zu Schwerin.
Cylinder aus Hornblende von Boddin.
Im J. 1859 ward auf dem Felde von Boddin bei Gnoien, auf dem Auswurf des Grenzgrabens zwischen Boddin


|
Seite 265 |




|
und Dölitz ein abgeschlagenes Ende eines Cylinders aus Hornblende gefunden. Der Cylinder ist regelmäßig und völlig rund und bearbeitet, jedoch nicht geschliffen, 3" im Durchmesser und an einem Ende etwas zugespitzt abgerundet. Das Bruchstück ist 3 1/4" lang, von einem längern Stücke abgeschlagen und zeigt an dem Bruchende noch die aus neuern Zeiten stammende junge Bruchfläche in völlig kreisrunder Form. Der Stein ist offenbar sorgfältig so, wie er ist, bearbeitet und hat eine bis jetzt nicht bekannte Bestimmung gehabt. Er kann ein Reibstein gewesen sein; er gleicht aber ganz den symbolischen oder mystischen Steinen, welche im Norden aufgerichtet gewesen sein sollen (vgl. Holmboe Traces du Buddhisme en Norvége, 1857, Tab. 2. Fig. 9.); jedenfalls ist er der Beachtung für die Zukunft werth. Der Verein erhielt diesen Stein von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin geschenkt.
Eine Bernsteinperle,
platt, wie ein kleiner Spindelstein geformt, gefunden zu Benz bei Wismar, schenkte der Herr Dr. Crull zu Wismar.
Rollsteine und Schleifstein von Friedrichshöhe.
Fortsetzung zu Jahrbüchern XXIII, S. 276 flgd.
Zu Friedrichshöhe bei Rostock, wo in einem Moderloche 10 Fuß tief 11 Reib= oder Rollsteine aus altem Sandstein gefunden wurden, fand Herr Ritter auf Friedrichshöhe in der Modde nicht allein noch mehrere Rollsteine, sondern auch einen Schleifstein aus weißem alten Sandstein, 8" lang, vierseitig, an jeder Seite 2" breit, an den beiden Enden etwas schmaler, an den Seiten überall geebnet und angeschliffen, an den Enden jedoch noch roh.
G. C. F. Lisch.
Nordöstlich von dem Wasserloche, bei dessen Ausmodden die Reibsteine und der andere Stein gefunden wurden, fanden sich in der sandigen Erde 3 Brandstellen. Die erste, 6 Ruthen vom Wasser entfernt, war mit kleinen Dammsteinen einfach dicht belegt über der Urerde und bildete eine elliptische Fläche von 7 und 4 Fuß Durchmesser, deren Längsrichtung von Nordost nach Südwest ging. Zwischen den Steinen und der 8 Zoll dicken Branderde lag eine kleine Glasscherbe, von grünlichem Glase, auf der Oberfläche stark opalisirt. Oestlich


|
Seite 266 |




|
von dieser Stelle, etwa 4 Ruthen entfernt, fand sich eine andere Brandstelle von kreisrunder Oberfläche und 4 Fuß Durchmesser, 3 Fuß tief in den Untergrund kesselförmig hineingegraben und mit größeren und kleineren Steinen dicht ausgelegt. Eine gleiche Stelle fand sich noch nordwestlich von der ersteren Brandstelle. Alle Steine dieser 3 Brandstellen lagen dicht von schwarzer Branderde eingepackt und umgeben und waren so mürbe, daß sie leicht zerfielen. Sonst fand sich aber nichts, obgleich ich Alles genau durchsuchte.
Friedrichshöhe.
J. Ritter.
Diese Brandstellen sind wahrscheinlich Feuerheerde alter heidnischer Wohnungen.
G. C. F. Lisch.
Ein geschliffener Sandstein,
feinkörnig, ähnlich einer abgebrochenen Lanzenspitze, 4" lang, 2" breit, 3/4" dick, an einem Ende zugespitzt, mit scharfen Kanten, auf einer breiten Seite regelmäßig abgeschliffen, gefunden in der Umgegend von Gnoien, ward geschenkt von dem Herrn Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin.


|
Seite 267 |




|



|



|
|
:
|
b. Zeit der Kegelgräber.
Kegelgrab von Brunsdorf.
Auf der Feldmark des Gutes Brunsdorf bei Marlow ward im Monate März 1858 ein Fund gemacht, welcher für die vaterländische Alterthumswissenschaft von Erheblichkeit ist. In einem Tannengehölze, in welchem mehrere noch nicht aufgegrabene Kegelgräber stehen, sollte zur Wiesenverbesserung ein "Hügel" abgetragen werden. Nachdem die Erde 4 Fuß tief von oben abgegraben war, stießen die Arbeiter im Innern des Hügels auf einen Steinhaufen, in welchen ein "Eingang" geführt haben soll, und nach dessen Aufbrechen auf eine Urne und menschliche Gebeine. Als der Herr Dr. med. Hüen zu Marlow davon hörte, begab er sich am folgenden Tage nach Brunsdorf, um den Hügel an Ort und Stelle zu untersuchen. Der "Hügel" war ein großes Kegelgrab von 150 Schritt im Umkreise, 50 Schritt Durchmesser und 12 Fuß Höhe. Der Hügel war augenscheinlich künstlich aufgetragen, da die Erde überall gemischt und mit Bruchstücken von Kohlen vermengt war. Der Hügel war in der Richtung von Norden nach Süden in einer Breite von 16 Schritt durchgraben, jedoch in dem Durchschnitte nicht überall gleichmäßig bis auf die Basis abgetragen. In einer Tiefe von 4 Fuß unter der Oberfläche des Hügels waren die Arbeiter am Nordende im Innern auf einen großen Haufen von rohen Feldsteinen (Granitgeschiebe) von 1 1/2 bis 2 Fuß Größe gestoßen; dieser Steinhaufen hatte nach der noch stehenden östlichen Seitenwand eine Länge von ungefähr 12 Fuß. Unter diesem Steinhaufen hatten sich menschliche Gebeine und eine thönerne Urne gefunden.
Nach diesem Berichte und den von dem Herrn Dr. Hüen eingesandten Ueberresten läßt sich vermuthen, daß die Leichenbestattung in diesem Kegelgrabe folgende war.
In dem Grabe waren wahrscheinlich zwei Leichen beigesetzt.
Die eine Leiche, wahrscheinlich die Hauptleiche, war unverbrannt beigesetzt, und diese Bestattungsweise ist die merk=


|
Seite 268 |




|
würdige und seltene Erscheinung in diesem Grabe. Die erhaltenen und eingesandten Ueberreste des Gerippes geben den sichern Beweis, daß diese eine Leiche nicht verbrannt war. Es sind noch zum größern Theile vorhanden: zwei Beckenknochen mit den Schenkelhalshölen, ein Oberschenkelknochen, zwei Unterschenkelknochen, ein Oberarmknochen, das Kreuzbein oder Heiligenbein und die beiden Kinnladen mit vollständigen Zähnen. Alle Reste der Ober= und Unter=Schenkelknochen sind noch einen Fuß lang. Die beiden Kinnladen sind noch vollständig und enthalten noch alle Zähne. Merkwürdig ist es, daß von den Schädelknochen nichts gefunden ist; dieselbe Erscheinung zeigte sich auch in dem großen Kegelgrabe von Ruchow (Jahresber. VI, S. 30 flgd.). Alle Zähne sind vollständig vorhanden und vollkommen gesund wohl erhalten, wie dies stets an allen heidnischen Schädeln wahrgenommen werden kann; die Zähne sind schmal, klein, wohlgebildet und schon etwas abgeschliffen. Alle Gebeine sind, wie die Zähne, nur schmächtig und zierlich und lassen nicht auf besondere Größe oder starke Musculatur schließen. Nach der Meinung des Herrn Dr. Hüen gehören die Gebeine einer männlichen Leiche an. Nach den Zähnen stand der Beigesetzte im mittlern Mannesalter.
Neben dieser Leiche war wahrscheinlich eine zweite Leiche beigesetzt, welche verbrannt war. Es fand sich eine leider zertrümmerte, ziemlich große, hellbraune, thönerne Urne, welche ungefähr die Gestalt der Urnen der Kegelgräber hatte, wie sie in Jahrb. XI, S. 357 abgebildet sind; der Boden ist sehr dick und der untere Theil der Außenfläche ist noch nicht mit geschlämmtem Thon überzogen. Dabei wurden viele zerbrannte Menschengebeine gefunden. Die Knochen sind, wie gewöhnlich die Knochen von verbrannten Leichen, durch das Feuer in kleine Stücke zersprengt, welche weiß oder bläulich, hart und hellklingend sind, während die Gebeine der unverbrannt beigesetzten Leichen sehr morsch und faserig sind. Nach den Knochenresten, namentlich nach einem Stücke von dem Schädel, welches noch dünne ist, gehörten diese Knochen einem noch jugendlichen Menschen. Bei der Urne fand sich eine schwarze Steinplatte, 2 Fuß im Quadrat groß und 4 Zoll dick; wahrscheinlich hatte auf dieser die Urne gestanden. Außerdem fand sich noch eine zweite Steinplatte, 3/4 Fuß im Ouadrat groß und kaum einen Zoll dick, mit welcher die Urne zugedeckt gewesen war; sie war auf der untern Seite 2 Linien dick mit einer schmierigen röthlichen Masse bedeckt, welche nach mikroskopischen Untersuchungen aus Sand, Eisen =


|
Seite 269 |




|
ocker und organischen Theilen, wie Fett, Blut
 ., bestand. Wahrscheinlich war
diese Urne mit der verbrannten Leiche in einer
kleinen Steinkiste, wozu die beiden Steinplatten
gehören, neben der unverbrannten Leiche
beigesetzt. Andere Alterthümer, welche wohl
vorhanden waren, sind nicht aufgefunden; sie
sind wohl entweder unbeachtet verworfen oder
liegen noch irgendwo in dem noch stehenden Reste
des Grabes.
., bestand. Wahrscheinlich war
diese Urne mit der verbrannten Leiche in einer
kleinen Steinkiste, wozu die beiden Steinplatten
gehören, neben der unverbrannten Leiche
beigesetzt. Andere Alterthümer, welche wohl
vorhanden waren, sind nicht aufgefunden; sie
sind wohl entweder unbeachtet verworfen oder
liegen noch irgendwo in dem noch stehenden Reste
des Grabes.
Nach den unverbrannten Gebeinen zu schließen, muß das Grab sehr alt sein, da die Gebeine sehr morsch sind.
Dieses große Grab wird dadurch wichtig, daß in demselben eine Leiche unverbrannt gefunden ist; dadurch reiht sich dieses Grab an die drei großen, alten Gräber von Ruchow, Schwaan und Dabel, in welchen ähnliche Verhältnisse beobachtet sind. Ueber diese seltenen Kegelgräber mit unverbrannten Leichen vgl. man Jahrbücher XXII, S. 285.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Marlow und Alt=Gutendorf.
Links an dem Wege von der Stadt Marlow nach Alt=Gutendorf, 1/4 Meile von Marlow entfernt, liegt zu beiden Seiten der Scheide zwischen beiden Feldmarken eine Gruppe von Kegelgräbern, welche zu den größten und ehrwürdigsten Denkmälern der Vorzeit gehören und zu den größten Kegelgräbern Norddeutschlands gezählt werden können, wie aus den folgenden Berichten des Herrn Dr. med. Hüen zu Marlow hervorgehen wird. Auf einem Raume von 800 Schritt Länge und 350 Schritt Breite liegen noch 10 deutlich unterscheidbare hohe Kegelgräber, welche mit Haidekraut und Eichengestrüpp bewachsen und aus weiter Ferne erkennbar sind, zumal da sie auf einer Erhebung der ebenen Gegend liegen. Das größte Grab, welches zu der trigonometrischen Vermessung des Landes benutzt wird, mag an 30 Fuß Höhe und wenigstens 50 Fuß Durchmesser haben. Die größten Gräber liegen auf dem marlower Felde; eine kleinere Gruppe liegt auf dem alt=gutendorfer Felde. Der dazwischen liegende Raum, auf welchem früher eine Windmühle stand, war noch vor 20 Jahren hügelig und mit Haidekraut bewachsen; nachdem er aber seit 16 Jahren in Cultur gebracht ist, sind die schroffen Hügel mehr geebnet, jedoch noch in ihrer Lage erkennbar. Der ganze Raum war früher ein großer Begräbnißplatz, welcher eine bestimmt abgeschnittene und begrenzte oblonge Form hatte; er wird an der einen Seite noch von dem uralten Wege, so wie von einer mit Steinen gefüllten Böschung begrenzt. Von den großen


|
Seite 270 |




|
marlower Gräbern ward eines im J. 1847 an der Westseite untersucht, dabei jedoch nichts weiter als ein Steinbette und Knochen eines menschlichen Gerippes gefunden. Ein daneben stehendes Grab ist auf seiner Spitze wenigstens 12 Fuß im Umkreise und 6 Fuß tief abgetragen.
Das brunsdorfer Kegelgrab, welches oben beschrieben ist, liegt 1/4 Meile von diesen Gräbern entfernt.
Rechts an dem genannten Wege, also außerhalb des Begräbnißplatzes, neben der Schmiede von Alt=Gutendorf, liegt ein anderer Begräbnißplatz, welcher nach den bei der Aufgrabung gemachten Erfahrungen der wendischen Zeit angehören muß. Man vgl. hierüber unten bei den Wendengräbern.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Groß=Methling.
"Oestlich von dem Dorfe Groß=Methling bei Gnoien und nur in geringer Entfernung davon liegt rechts am Wege nach Demmin ein kleiner sandiger Bergrücken, der von Nordwest nach Südost sich erstreckt. Dieser Bergrücken läuft zwischen zwei schmalen Wiesen in südöstlicher Richtung fort und verflacht sich am Ende der Wiesen. Auf diesem Rücken standen einige Kegelgräber, deren Beschreibung und Inhalt durch den Herrn Pastor Günther zu Groß=Methling an den Verein gelangt ist.
Auf diesem Rücken stand ein Kegelgrab, genannt der Doctorberg, von 8 Fuß Höhe, welches im J. 1845 von den Herren v. Kardorff auf Remlin, v. Bülow aus Neu=Strelitz, Pastor Ritter aus Vietlübbe und Pastor Günther zu Groß=Methling aufgegraben ward und beachtenswerthe Ergebnisse lieferte (vgl. Jahrb. XI, S. 374 flgd.).
Etwa hundert Schritte südlich von diesem Kegelgrabe stand ein kleineres Kegelgrab, welches der kleine Doctorberg hieß. Vor zwei Jahren ward dieses Grab abgetragen, als die Feldsteine aus demselben herausgebrochen wurden. Die Feldsteine lagen 1 bis 1 1/2 Fuß unter der Oberfläche in einer etwa 3 Fuß dicken Schicht eng zusammengepackt. Die beiden Arbeiter trugen die Steine von der Südseite her so ab, daß sie immer so viel wie möglich eine senkrechte Wand vor sich zu behalten suchten, von der sie dann von oben herab einzelne Stücke abkeilten. So geschah es, daß sie eine thönerne Urne von oben bis unten mitten durchkeilten, so daß die eine Hälfte mit den Steinen ihnen vor die Füße fiel, die andere


|
Seite 271 |




|
Hälfte in der Wand sitzen blieb. Die Arbeiter besahen die Scherben der sehr mürben Urne, welche ganz zerfiel, genauer und fanden einen bronzenen Handgriff, der an einer Scherbe mit einem Drathende ("Wierende") befestigt war, welcher durch die kleinen Bohrlöcher des Handgriffes und durch die Urnenscherbe ging. Der Drath zerbröckelte ihnen unter den Fingern, als sie ihn herauszogen. Als sie die zweite Hälfte des Topfes aus der Wand hoben, zerbrach sie in lauter kleine Stücke, unter welchen sie den zweiten bronzenen Handgriff fanden, der jedoch nicht mehr an einer Urnenscherbe festsaß. Die Urne mochte 1 Fuß hoch sein und eine Oeffnung von 10 Zoll haben und war mit Asche und Erde gefüllt. Die beiden bronzenen Henkel, welche durch die Bemühungen des Herrn Pastors Günther gerettet und an die Vereinssammlung gekommen sind, sind platte Henkel in Gestalt eines Dreiecks, welches mit einer Spitze auf einer schmalen Platte steht, einer Heftel der Eisenzeit nicht unähnlich, im Ganzen 2 1/2 Zoll hoch und oben eben so breit; auf den drei Spitzen des mit eingravirten Zickzacklinien verzierten Dreiecks stehen drei runde Knöpfe.
Am Ende der Wiesen verflacht sich der Bergrücken. Gleich hinter dieser Verflachung stand ein drittes Kegelgrab, an Höhe und Umfang kleiner, als die beiden Doctorberge. Der eine der beiden Arbeiter, welche den kleinen Doctorberg abgetragen hatten, brach die Steine aus diesem kleinen Hügel, aus welchem er etwa 2 Fuder Steine gewann. Zwischen den Steinen stand eine kleine Urne aus dunkelbraunem Thon, mit zwei durchbohrten, henkelartigen, kleinen Knöpfen auf dem Bauchrande. Der Arbeiter hielt die Urne Anfangs für einen Stein und warf sie zu einem Steinhaufen: er stellte jedoch genauere Untersuchungen an, indem er sie mit seiner großen eisernen Hacke von Erde zu reinigen suchte. Die Urne blieb dabei wohl erhalten und ist durch die Bemühungen des Herrn Pastors Günther mit den vorstehenden Berichten in die Vereinssammlung gekommen. So sehr zerbrechlich mögen die alten heidnischen Töpfe doch nicht gewesen sein, da die Urne trotz der Hackenhiebe und des ziemlich weiten Transports, auf welchem sie gewiß zehn Male umgeladen ist, nur in dünne Pappe gewickelt wohl erhalten in Schwerin angekommen ist; wahrscheinlich verdankt sie dieses Glück ihrer kugeligen Form.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 272 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Goldberg.
In der der Stadt Goldberg gehörigen Viehweide, welche sich nach Dobbertin hin erstreckt, liegen auf einer Anhöhe neben einander etwa zwölf 1 ) runde Grabhügel von geringer Höhe und nicht bedeutendem Umfange. Nahe bei diesen Gräbern wurde vor einiger Zeit eine 6 1/2" lange Lanzenspitze von bräunlichem Feuerstein gefunden, welcher Fund dann bald darauf die Oeffnung zweier Grabhügel veranlaßte. In dem einen Grabe fand man keine Alterthümer, während aus dem andern mehrere menschliche Knochen, Asche und eine Urne zu Tage gefördert wurden. Die Urne zerbrach beim Nachgraben in viele Stücke, jedoch ist so viel von derselben gerettet, daß man im Stande ist, die Verzierung zu beurtheilen. Der obere Rand zeigt nämlich fünf rund um das Gefäß laufende Linien (vgl. die in Jahrb. XI. S. 361 abgebildete Urne der Bronzeperiode); ferner ist die feinere Thonmasse, mit welcher die Urne überzogen, röthlich gefärbt, wogegen die innere Masse schwarz erscheint. Steine sind in den Grabhügeln nicht bemerkt worden.
Die genannten Alterthümer sind von dem Herrn Pastor Schulze zu Goldberg in Schutz genommen und durch mich an die Vereins=Sammlung zu Schwerin befördert; die Lanzenspitze mußte von dem Finder käuflich erlangt werden.
Im September 1858.
Wiechmann = Kadow.
Eine abgebrochene Schwertspitze
oder Dolchspitze aus Bronze, 6 1/2" lang, mit edlem Rost, mit jungem Bruchende, gefunden zu Reetz, ward geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.
Framea von Niex.
Beim Ziehen eines 6 Fus tiefen Drain=Grabens auf der Feldmark Niex bei Rostock ward eine bronzene Framea mit durchgehender Schaftrinne gefunden, welche eine sehr lange und zierliche Form (ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 6 und 7), eine breite, weit ausgebogene Schneide und keinen Rost hat. Der Herr Oberbaurath Bartning zu Schwerin hat dieses wohl erhaltene Stück, welches er im Herbste des J. 1858 in Rostock geschenkt erhielt, dem Vereine zum Geschenk gemacht.


|
Seite 273 |




|
Framea von Zierow.
Auf dem Felde von Zierow bei Wismar ward eine ungewöhnlich kurze, 3" lange, beilartige, mit edlem Rost bedeckte Framea aus Bronze, mit Schaftloch und Oehr, gefunden, in Wismar verkauft und von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar dem Vereine geschenkt. - Vgl. im Nachfolgenden die Framea von Wismar.
Framea von Wismar.
Auf dem Stadtfelde von Wismar beim Rothen=Thor ward eine ungewöhnlich kurze, 3" lange, beilartige Framea, mit Schaftloch und Oehr, ohne Rost, gefunden, an den Gelbgießer Herrn Kalderach zu Wismar als altes Metall verkauft und von diesem dem Herrn Dr. Crull zu Wismar überlassen, welcher sie dem Vereine geschenkt hat. - Vgl. im Voraufgehenden die Framea von Zierow.
Framea von Wismar.
In der Gegend von Wismar ward eine Framea aus Bronze, mit Schaftloch und Oehr, 4 1/2 Zoll lang, ohne Rost, gefunden, an den Gelbgießer Herrn Kalderach zu Wismar als altes Metall verkauft und von diesem dem Herrn Dr. Crull zu Wismar überlassen, welcher sie dem Vereine schenkte.
Diadem von Wotenitz.
Vor einigen Jahren fand der Schulze zu Wotenitz bei Grevismühlen in dem Stepenitz=Flusse ein bronzenes Diadem und dabei acht bronzene "Teller mit Knöpfen", wie es den "Anschein" hatte, von denen einer bei der Reinigung schön gezeichnete "Blumen" zeigte. Der Schulze zeigte die "Teller" "mehrern Herren" und da keiner von ihnen dieselben kannte, so verkaufte er sie an einen Juden in Grevismühlen, welcher bald einen Käufer wieder fand. Diese "Teller mit Knöpfen" sind sicher sogenannte "Hütchen" von Bronze gewesen. Das Diadem, welches mit parallelen Querreifen auf der Vorderseite geschmückt, jetzt aber etwas verbogen und eingebrochen ist, bewahrte der Schulze auf, von welchem es im J. 1858 der Unterofficier Herr Büsch zu Wismar erwarb und darauf dem Verein schenkte. Von den "Tellern" war jedoch, trotz aller Bemühungen des Herrn Büsch, keine Spur zu verfolgen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 274 |




|
Ein Bronzemesser mit Bronzegriff
in colorirtem Gypsabguß schenkte der Herr Wiechmann auf Kadow.



|



|
|
:
|
Urne von Satow.
Zu Satow bei Cröpelin ward eine ungewöhnlich große und eigenthümliche Urne gefunden und von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow dem Vereine geschenkt. Die Urne ist fast cylinderförmig, mit hohem, geradwandigem Halse und geringer Bauchausladung. Sie ist etwas über 13" hoch, 10" weit in der Mündung, 13" weit im Durchmesser des Bauches und im untern Boden 7" im Durchmesser. Sie ist nach Art der heidnischen Urnen zubereitet, bräunlich von Farbe, ohne Verzierungen und gleicht an Gestalt, Masse und Farbe ganz den Urnen der Bronzeperiode. Der Bauch ist vom Bauchrande nach dem Boden hin ganz rauh mit Hand und Spachtel bearbeitet und sehr rauh und höckerig; der obere Rand, der Boden und das Innere sind mit fein geschlämmtem Thon überzogen. Auf dem wenig nach außen gebogenen Bauchrande, 7 1/2" vom Boden und 4 1/2" vom Rande entfernt, stehen vier starke Henkel mit einer Oeffnung von ungefähr 1" Weite, zum Durchziehen eines Seiles, wie es scheint. Nach der Gestalt und Einrichtung dieses Gefäßes scheint dasselbe ein Gefäß zum häuslichen Gebrauche in der Bronzeperiode, ein Tragetopf oder Seiltopf (plattdeutsch: sêlpot) gewesen zu sein, da demselben die Eigenthümlichkeiten der Todtenurnen fehlen. Aus der Eisenperiode finden sich Haustöpfe von ähnlicher Einrichtung, mit vier Henkeln auf dem Bauchrande 1 ). Aus der Bronzeperiode sind aber Gefäße dieser Art äußerst selten.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Beiträge zur Erklärung
des Heerhorns von Wismar
und
des Bronzewagens von Peccatel,
von
G. C. F. Lisch.
Die beiden Denkmäler der Bronzeperiode in der Sammlung des Vereins zu Schwerin, das gravirte Heerhorn aus


|
Seite 275 |




|
Bronze von Wismar (Jahresber. III, B, S. 67 flgd. mit Abbildung) und das auf einem bronzenen Wagen ruhende Wasserbecken von Peccatel (Jahrb. IX, S. 369 flgd. mit Abbildung) sind für die Culturgeschichte durch sich selbst höchst merkwürdig, noch mehr aber dadurch, daß sie sich gegenseitig erläutern. Auf dem Horne von Wismar sind Schiffe und vierspeichige Räder gravirt. Es mußte also sehr überraschend sein, als ein wirklicher kleiner Wagen mit vierspeichigen Rädern in einem Grabe der Bronzeperiode gefunden ward. Ich habe in den Jahrbüchern nach und nach diese Entdeckungen scharf verfolgt und neue Entdeckungen zur Erläuterung beigebracht. Zu diesen füge ich noch eine neue Entdeckung, welche von dem norwegischen Vereine für Erhaltung vaterländischer Alterthümer zu Christiania in dessen Jahresbericht für 1857, Christiania, 1858, S. 21 mit Abbildung, mitgetheilt ist. Nahe bei "Fossum Jernvaerk" finden sich auf einer Felswand Sculpturen, welche denen auf dem Horne von Wismar ganz gleich sind. Bemerkenswerth sind zwei Schiffe über einander und daneben zwei vierspeichige Räder, grade so wie sich dieselben auf dem Heerhorn von Wismar finden; darunter stehen noch drei vierspeichige Räder.



|



|
|
:
|
und
die halbmuldenförmigen Quetschmühlen.
In Meklenburg werden ungemein häufig Mühlen gefunden, welche aus Granit bestehen und in Form einer queer durchschnittenen Mulde ausgehöhlt sind, so daß das eine Ende offen ist. Wir haben diese Steine, welche in den ältesten Kirchen oft zu Weihkesseln benutzt sind, Anfangs für Weihkesseln gehalten, sind aber früh zu der Ansicht gekommen, daß sie Handmühlen sind und der Bronzeperiode angehören, da sie in Meklenburg öfter in Kegelgräbern der Bronzeperiode gefunden sind; vgl. Jahrbücher XVIII, S. 250; solche ausgehöhlte Steine, welche gewiß nach und nach durch langen Gebrauch ausgehöhlt wurden, sind noch heute bei den Wallachen in Gebrauch; vgl Jahrb. XV, 1850, S. 270. In Pommern werden solche Mühlsteine auch häufig gefunden und dort allgemein "Hünenhacken" genannt. Der Herr Rechtsanwalt Ehrhart zu Swinemünde berichtet darüber in den baltischen Studien, Jahrg. XVII, Heft 1, 1858, S. 13 flgd. ausführlich und theilt die Sage der Landleute mit: "Sie waren ur=


|
Seite 276 |




|
sprünglich von Regen erweichte Thonklöße, in welche einer der Hünen, von denen vor Zeiten auch die Insel Usedom bewohnt wurde, mit dem hintern Ende des Fußes getreten und den Eindruck der Hacke bis zur schmalsten Stelle der Fußsohle zurückgelassen hatte, später ist der weiche Thon verhärtet und versteinert". Der Herr Ehrhart hält diese Steine nun ebenfalls für Mühlsteine und beschreibt sie a. a. O. ausführlich. Ueber die Zeit der Entstehung wagt er keine Bestimmung, jedoch sagt er, daß sie auch "theils in Steinhaufen aus abgetragenen "Hünengräbern" zusammengefahren auf "dem Felde liegend" gefunden werden. In Meklenburg sind sicher 4 Male solche Steine aus planmäßig abgetragenen Kegelgräbern der Bronzeperiode gefunden, also sind sie wenigstens so alt wie diese. Wenn Ehrhart schließlich berichtet, daß die Benennung "Hünenhacken" "eine allen Landbewohnern geläufige und die Sage eine allgemein bekannte" sei, so muß ich bekennen, daß diese Sage in Meklenburg schon gänzlich verschwunden oder nie vorhanden gewesen ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 277 |




|



|



|
|
:
|
c. Zeit der Wendengräber.
Wendengräber von Wotenitz.
Fortsetzung.Vgl. Jahrbücher XXIII, S. 288.
Da das heidnische Begräbniß auf dem Schullehreracker zu Wotenitz bei Grevismühlen offenbar der Eisenperiode angehörte, so war zu erwarten, daß sich in der Nähe desselben noch mehr Begräbnißstätten finden würden, wie es auf den sogenannten Wendenkirchhöfen in der Regel zu sein pflegt. Der Unterofficier Herr Büsch zu Wismar unternahm es daher, am 19 - 21. Oct. 1858 zu Wotenitz weitere Nachgrabungen anzustellen, und erhielt dazu von dem Herrn Schullehrer Dreier nicht allein freundlich Erlaubniß, sondern ward auch von demselben und dessen beiden Söhnen bei der Aufgrabung wirksam unterstützt. Zuerst gaben die Nachgrabungen lange kein Ergebniß. Als man jedoch bei einer Sandgrube zu graben anfing, um Erde von der Oberfläche abzuräumen, fanden sich mehrere Begräbnisse von derselben Beschaffenheit, wie sie früher beobachtet war.
1) Zuerst fand sich, als man 2 3/4 Fuß tief gegraben hatte,
eine thönerne Urne, welche zerbrochen und in sehr schwarze Erde gepackt war; die roh und ohne Verzierungen gearbeitete Urne hatte ein grobes Gefüge und dicke Wände und war im Innern durch und durch schwarz. Sie enthielt nur Asche und zerbrannte Knochen und
ein bronzenes Gürtelgehenk, wie es scheint. Dieses bisher noch nicht beobachtete Werkzeug ist dem auf dem Wendenkirchhofe zu Helm gefundenen, in Jahrb. XIV, S. 338 abgebildeten Gürtelgehenk sehr ähnlich, wenn auch in Einzelnheiten anders gestaltet. Es ist eine 8 Zoll lange bronzene Stange, welche an dem einen runden Ende einen Knopf (jedoch keinen beweglichen Ring) hat; an dem andern, breitern Ende ist ein


|
Seite 278 |




|
Blechstreifen in einem ausladenden und wieder eingebogenen Viereck von 2 Zoll Breite und 1 1/4 Zoll Höhe angesetzt oder angegossen und in diesem geschlossenen Viereck hangen 3 Stifte von 1 1/4 bis 2 Zoll Länge, vermittelst deren ohne Zweifel etwas an dieser Stange befestigt gewesen ist. Dieses Instrument hat, wie das Gehenk von Helm freilich eine sehr entfernte Aehnlichkeit mit einem antiken Schlüssel; daß die Werkzeuge dieser Art aber keinen Falls Schlüssel gewesen seien, beweisen die mit einer geschlossenen Oese, jedoch beweglich darin hangenden 3 Stifte, zu denen wahrscheinlich ein vierter gehört hat, welcher verloren gegangen sein wird.
2) Ungefähr 3 bis 4 Fuß von dieser Stelle fand sich wieder
eine thönerne Urne, von feinem Gefüge und brauner Farbe, welche ebenfalls zerbrochen war. In der Urne lagen die Reste
einer bronzenen Heftel, welche die gewöhnliche Gestalt der Hefteln der Eisenperiode hat und durch den Leichenbrand zersprengt und sehr verbogen ist, und
vier Glasperlen, von denen von dem Leichenbrande eine wenig gelitten hat, eine andere mit einem Stück Bronze zusammengeschmolzen, zwei aber an einander geschmolzen sind.
3) Ungefähr 10 Fuß von dieser Stelle stand wieder
eine thönerne Urne, welche dick und grob gearbeitet, ebenfalls zerbrochen und mit Knochen und Asche gefüllt war. Sie enthielt
ein eisernes Messer, von 2 3/4 Zoll Länge in der Klinge, an dessen eben so lange Griffzunge eine Glasperle, wie es scheint, angeschmolzen ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendischer Begräbnisplatz von Alt=Gutendorf.
Bei der großen Gruppe der Kegelgräber von Marlow und Alt=Gutendorf (vgl oben S. 269), welche links an dem Wege von Marlow nach Alt=Gutendorf liegt, liegt rechts vom Wege bei der Schmiede von Alt=Gutendorf ein lang gestreckter Hügel, welcher offenbar nicht zu der großen Gruppe von Kegelgräbern gehört und zur Sandgrube angegraben ist. Der Herr Dr. med. Hüen zu Marlow hatte wiederholt Gelegenheit, an diesem Hügel Forschungen anzustellen, und hat die Güte gehabt, nicht nur die folgenden Ergebnisse seiner Forschungen, sondern auch die dabei gefundenen Alterthümer dem Vereine mitzutheilen.


|
Seite 279 |




|
Der Hügel ist 106 Schritte lang und in der höchsten Erhebung 12 Fuß hoch. Der Hügel ist im Innern eine natürliche Hügelbildung und besteht aus lehmhaltigem und reinem Sande. Dieser Hügel ist von zwei verschiedenen Erdschichten über einander bedeckt, von denen jede zwischen 1 bis 3 Fuß Dicke schwankt. Diese Schichten tragen Spuren von Menschenarbeit, sei es daß Erdschichten aufgetragen sind, sei es daß die Oberfläche zu verschiedenen Zeiten bearbeitet ward. Die in diesem Hügel gefundenen Alterthümer lagen dicht unter diesen obern Schichten und auf der umherliegenden Erdoberfläche 1 bis 2' tief; dies ist also schon ein Beweis, daß dieser Hügel kein aufgetragenes Kegelgrab der Bronzeperiode ist, weil in diesem Falle die Leichen auf dem Urboden beigesetzt worden wären.
Zuerst fand der Herr Dr. Hüen in dem abgegrabenen "Ufer" in der Höhe nicht tief unter den aufgetragenen Erdschichten, eine zertrümmerte heidnische Begräbnißurne von hellbrauner Farbe mit einigen dazu gehörenden verbrannten Knochen.
Späterhin entdeckte er ungefähr 10 Schritte von dem Fundorte einen menschlichen Schädel. Der Schädel ist sehr schmal, die Stirne sehr flach und spitz und das Hinterhaupt auch nicht stark entwickelt; am meisten ist der Schädel nach oben zum Scheitel nach beiden Seiten ausgebuchtet. Die noch vorhandene Naht läßt auf ein Lebensalter von 25 - 40 Jahren schließen, so wie die schwachen Knochenhervorragungen für die Muskelansätze und die Ausbuchtung des Schädels für das Mittelhirn auf ein weibliches Individuum. Merkwürdig und auffallend ist aber die Prävalenz der linken Schädelhälfte gegen die rechte Hälfte, welche auf der innern Seite noch mehr hervortritt, indem der sulcus longitudinalis sich nach rechts wendet und die Furchen für die Gehirnarterien auf der linken Seite stärker entwickelt sind, als auf der rechten. Der Herr Dr. Hüen bemerkt, daß er diese Schädelbildung häufig bei Menschen gesehen habe, die von Jugend auf einen schiefen Kopf hatten. Der Schädel wird mit den Gesichtsknochen, welche vergangen sind, nach oben gelegen haben und war mit einem Feldsteine, etwas größer als ein Mannskopf, bedeckt. Man könnte annehmen, daß der Schädel durch diesen Stein schief gedrückt worden sei, wenn nicht die innere Schädelwand für eine abnorme Bildung von Natur spräche. Uebrigens ist der Schädel dem Anscheine nach ziemlich alt.
Schon früher sind auf der Höhe des Hügels von Arbeitern zwei Schädel ohne andere Knochen gefunden. Noch später fand der Herr Dr. Hüen zwischen diesem Schädel und der


|
Seite 280 |




|
Urne, ungefähr in der Mitte des Hügels auf der Höhe, noch einen Schädel. Der Schädel lag auf der rechten Seite, von Süden nach Norden gekehrt. Der Schädel ist besser gebildet, als der zuerst gefundene, jedoch ist er nur klein und die Stirn nur schmal. Nach der dünnen, fast zahnlosen Unterkinnlade zu urtheilen, scheint der Schädel einer alten Frau von 70 bis 80 Jahren zu gehören. Bei weiterer Nachforschung fand sich auch das Gerippe dieser Leiche in der Richtung des Schädels von Süden nach Norden. Das ganze Gerippe lag in einer 5 Fuß tiefen Grube, und dem Anscheine nach war die Leiche kopfüber in die Grube geworfen. Neben dieser Leiche wurde im Sande eine kleine, schmucklose, bronzene, hakenförmige Heftel von 2 1/2" Länge und 1/2" Breite gefunden; sie hat in der Mitte 4 Nietlöcher, so daß ein Schmuck aufgeheftet werden konnte. Daneben fanden sich kleine, dünne, sehr verrostete Stücke von Eisen, welche nicht mehr zu erkennen sind.
Am Fuße des Hügels fanden sich dicht unter den aufgetragenen Erdschichten drei von Steinen eingefaßte Begräbnisse.
Das mittlere dieser Begräbnisse, welches von dem Herrn Dr. Hüen geöffnet ward, hatte 12 Fuß im Umkreise und war von kleinern Steinen eingefaßt und mit größern gefüllt. Auf dem Erdboden des Grabes lag eine unverbrannte Leiche, welche gegen Osten schauete. Die Knochen waren sehr vergangen; jedoch waren noch Arm= und Beinknochen, Rückenwirbel, Schädel, Kiefern vorhanden, wenn auch sehr mürbe. Unter dem einen Rückenwirbel lag ein zerbrochenes, stark verrostetes eisernes Messer mit Ueberresten einer Scheide von Leder mit bronzenem Beschlage. Dieses Stück reicht offenbar an die Wendenzeit hinan.
In einem andern, auch mit Steinen umsetzten Begräbnisse daneben, von 16' Breite, welches der Herr Dr. Hüen auch aufdeckte, fanden sich nur die "sichtbaren Spuren eines in Asche zerfallenen Körpers und einer gänzlich vergangenen Urne mit Inhalt".
Ein drittes ähnliches Begräbniß daneben, von 12' Breite, ward in der Abwesenheit des Herrn Dr. Hüen aufgebrochen, ohne daß Nachricht darüber eingeholt werden konnte.
Nach allen diesen Forschungen gehört dieser Begräbnißplatz wohl der letzten heidnischen und ersten christlichen Zeit an. Es finden sich noch Urnen und Leichenbrand, daneben jedoch auch Begräbnisse unverbrannter Leichen, bei welchen sich jedoch noch unverkennbar wendische Geräthe aus Bronze und Eisen finden. Die einzeln gefundenen


|
Seite 281 |




|
Schädel sind allerdings auffallend und scheinen etwas jünger, jedenfalls aber alt zu sein. Ob es sich, wie wohl geäußert ist, annehmen läßt, daß hier die Köpfe von Hingerichteten begraben seien, ist wohl schwerlich zu ermitteln. Jedoch ist es immer möglich, daß auf diesem heidnischen Begräbnißplatze auch in jüngern Zeiten hingerichtete Missethäter eingescharrt sind; der Hügel kann auch zu Hexenverbrennungen gedient haben. Die Erinnerung an die alten heidnischen "Kirchhöfe" dauerte beim Volke sehr lange.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Urne und Wall von Fahrenhaupt.
Bei dem Bau der Chaussee von Sülz nach Sanitz ward im Holze von Fahrenhaupt bei Marlow dicht an der Chausseelinie beim Ausgraben von Erde unter einer Buche eine Urne gefunden und von dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow von den Chausseearbeitern erworben und dem Vereine geschenkt. Die Urne ist 5 Zoll hoch, ungefähr 6 Zoll weit im Bauchrande, mit eingezogenem Halse, im Bauche kugelig, von bräunlicher Farbe und auf der obern Hälfte des Bauches mit einer hohen, eingeschnittenen Zickzacklinie zwischen zwei Parallellinien verziert. Die Urne war ganz mit Erde gefüllt, aber in derselben nicht eine Spur von Asche oder Knochen. Dem Anschein nach gehört sie der Eisenperiode an.
Nicht weit von dem Fundorte steht ein Wall, welcher etwa 20 Fuß hoch ist und an 40 Schritte im Durchmesser hat; der Eingang auf der Ostseite ist 10 Schritt breit und demselben entgegengesetzt ist auf der Höhe des Walles eine 4 Fuß breite und 3 Fuß hohe Oeffnung (ein Fenster?). Gegen Süden liegen vor diesem Walle zwei grade, wallartige Erhöhungen parallel neben einander. Vor diesen Parallelwällen liegen im Süden ein kleiner künstlicher Teich und ein etwas größeres Moor, welche sich verengernd gegen den Ringwall hinziehen; beide sind jetzt ausgetrocknet und mit Holz bestanden. Im Westen liegt ein ebenes, ungefähr 10 Scheffel Aussaat haltendes, jetzt mit Holz bestandenes Feld, welches gegen den andern unebenen und hügeligen Boden sehr absticht und in alter Zeit in Cultur gewesen sein muß. Im Süden liegt bebaueter Acker. - Ich halte diesen Berg für eine verfallene germanische Ansiedelung. Er gewährt ganz den Anblick einer verlassenen Chausseearbeiterhütte im Großen. Denkt man sich diesen Berg oben mit langen Bäumen belegt, so kann man kaum ein besseres Bild von den Wohnplätzen unserer Vorfahren


|
Seite 282 |




|
haben. Hier stand auch wahrscheinlich das alte Fahrenhaupt. Beim Volke ward der Wall Taterberg genannt und es soll hier noch am Ende des vorigen Jahrhunderts ein Zigeuner von marlower Einwohnern erschlagen worden sein.
| Marlow, im Septbr. 1858. | Dr. Hüen. |



|



|
|
|
Wendische Wohnstelle von Boddin.
An einer sandigen Stelle des Gutes Boddin bei Gnoien zeigte sich an zwei nicht sehr großen Stellen die Erde beim Umackern ganz schwarz gefärbt und alle Steine, welche sich dort fanden, waren sichtlich einem starken Feuer ausgesetzt gewesen. Auf diesen Stellen fanden sich auch zahlreiche Topfscherben, welche mit Granitgrus oder Kiessand durchknetet, am offenen Feuer gedörrt und vielfach mit wellenförmigen Verzierungen geschmückt sind. Diese Scherben gleichen ganz den oft besprochenen Topfscherben, welche sich in so großen Massen auf allen großen wendischen Burgwällen der letzten heidnischen Zeit finden. Daher sind diese Stellen zu Boddin keine Begräbnißplätze, sondern die Stellen ehemaliger Feuerheerde von Wohnungen aus der letzten wendischen Zeit. Andere Alterthümer haben sich daher an diesen Stellen nicht gefunden. Die Zerstörung dieser Wohnungen wird in die allerletzte Zeit des Wendenthums und in die allererste Zeit des Christenthums fallen, da sich auf den Stellen neben den wendischen Scherben hin und wieder auch schon Scherben von blaugrauen, im Brennofen gebrannten Töpfen der christlichen Zeit finden. Der Herr Staatsminister a. D. von Lützow Exc. auf Boddin hat nicht allein Berichte über diese Stellen, sondern auch eine hinreichende Anzahl von bezeichnenden verzierten Scherben eingesandt.



|



|
|
:
|
Wendengräber von Cörlin
in Pommern.Bei dem Eisenbahnbau in Hinterpommern wurden in der Gegend von Cörlin beim Eröffnen einer Kiesgrube aus Privateigenthum im J. 1858 die unten beschriebenen, werthvollen Alterthümer gefunden, welche der Herr Bau=Conducteur Langfeldt aus Güstrow, der bei dem genannten Eisenbahnbau als Baubeamter fungirt, von dem Besitzer geschenkt erhielt und unserm Vereine wieder zum Geschenke machte. Wenn auch der Unverstand der Arbeiter viel verdorben hat, so ist es doch noch möglich gewesen, diesen Fund zu bestimmen.


|
Seite 283 |




|
An einem Berge in der Gegend von Cörlin wurden ungefähr 30 menschliche Gerippe gefunden, welche ungefähr 3 bis 4 Fuß tief in der Erde lagen; leider ist nicht mehr zu ermitteln gewesen, wie sie lagen. Es wurden jedoch ungefähr 30 menschliche Schädel gezählt, neben welchen viele menschliche Gebeine lagen.
Neben diesen Gerippen wurden folgende ziemlich gut erhaltene Alterthümer gefunden.
Zwei große silberne Ringe, von ungefähr 3 Zoll hamb. Maaß innerm Durchmesser der Oeffnung und ungefähr 3/8 Zoll Dicke. Die Ringe sind von dünnem Silberblech, hohl und an der innern Seite zusammengelegt; die Arbeit ist sehr gut. Diese Ringe lagen an der Seite von Schädeln, theils rechts, theils links, und hatten an den Schädeln einen Grünspanabdruck hinterlassen, gehörten also wohl zum Kopfschmuck. Diese Ringe sind geöffnet, an einem Ende abgestumpft, verjüngen sich ein wenig nach dem andern Ende hin, laufen hier dünne aus und sind zu einem Haken umgebogen. Eben so sind alle andern Ringe eingerichtet.
Zehn silberne Ringe von mittlerer Größe, von ungefähr 3 Zoll Weite. Diese Ringe sind von massivem, rundem Silberdrath von ungefähr 1/10 Zoll Dicke. Sie haben die Größe der Armringe für das Handgelenk. Diese Ringe haben dieselbe Einrichtung wie die beiden großen Ringe: sie sind geöffnet, an einem Ende alle abgestumpft, am andern Ende abgeplattet und zu einem doppelten Haken umgebogen. - Außerdem fanden sich noch zwei verbogene Bruchstücke von ähnlichen Ringen. Diese Ringe lagen zerstreut umher und es konnte über ihre Lage am Körper nichts ermittelt werden.
Zwei kleine silberne Ringe von ungefähr 3/4 Zoll Weite und 1/7 Zoll Dicke. Diese Ringe haben einen Kern von viereckigem Kupferblech und sind mit Silberblech sehr geschickt so umkleidet, daß sie rund sind. Auch diese Ringe sind so gebildet, wie die übrigen; sie sind nämlich geöffnet und an einem Ende abgestumpft und am andern Ende abgeplattet und zu einem doppelten Haken umgebogen.
Ein dünner ringförmiger Silberdrath, der an einem Ende zu einer Oese gewunden und am andern Ende zu einem Haken umgebogen ist. Auf diesen Drath sind 13 Glasperlen von verschiedener Größe gezogen: 3 sind hellbernsteinfarbig oder von Bernstein, 2 hellblau, 2 dunkelgrün mit eingelegten rothen Zickzacklinien, 1 kalkweiß, 5 dunkelgrau mit eingelegten weißen Linien verschiedener Zeichnung. Diese Perlen sind sämmtlich geschmackvoll.


|
Seite 284 |




|
Ein eisernes Messer, 3 1/2 Zoll in der Klinge und gegen 3 Zoll im Griffe lang. Der Griff trägt Spuren von Holzbekleidung.
Eine silberne Spitze, von Silberblech, gut 1 Zoll lang, ist wahrscheinlich der Endbeschlag der Messerscheide.
Eine Klinge von einer eisernen Schere von alter Form (wie jetzt die Schaafscheren), wie es scheint.
Auf einen Theil dieser Schere ist an einer Seite ein Stück Leinewand, ungefähr 1 Quadratzoll groß, festgerostet, so daß das Gewebe sehr deutlich zu erkennen ist.
Nach diesen Alterthümern, ihrer Form und Bearbeitungsweise und den Metallen, aus welchen sie gearbeitet sind, so wie daraus, daß die Leichen schon unverbrannt begraben sind, läßt sich schließen, daß die Leichen in der allerersten Zeit des Christenthums begraben sind.
Dies scheint auch eine Münze zu bestätigen, welche bei diesen Alterthümern gefunden ist.
Die Münze dieses Gepräges ist schon wiederholt der Gegenstand der Aufmerksamkeit der Forscher 1 ) gewesen. Die Münze ist zweiseitig und zeigt auf der Vorderseite einen lockigen, bärtigen Kopf (Christus), neben welchem die beiden Hände mit den deutlichen Wundenmalen in die Höhe gerichtet sind, und auf der Rückseite ein rundes Thor mit drei Thürmen, von denen der mittlere mit drei Zinnen, die beiden andern mit einem Kuppeldache bedeckt sind; in dem Thorbogen steht ein Zeichen, das nicht erkennbar ist. Im J. 1843 ließ B. Köhne in seiner Zeitschrift für Münz =, Siegel= und Wappenkunde, Jahrg. III, Taf. VII, Nr. 10, eine Münze dieser Art abbilden und setzte sie nach Breslau, weil ihm kein ganz deutliches Exemplar vorlag. Späterhin ward ein kleiner Fund solcher Münzen gemacht, von dem gute Exemplare in den Besitz des Assessors Dannenberg zu Berlin kamen. Nach diesen berichtigte Köhne im Kataloge der "Reichelschen Münzsammlung in St Petersburg", Th. IV, Abth. 2, 1842, Vorrede, S. 2, gedruckt 1846, sogleich seine Ansicht und setzte die Münze nach Pommern. Das königliche Münzcabinet zu Berlin und die Sammlung des Herrn Grafen von Schlieffen besitzen auch gute Exemplare. Die Münzen tragen in der Hauptumschrift die Namen der pommerschen Herzoge Bugeslav oder Bugeslav


|
Seite 285 |




|
und Kasimar und in der Umschrift der Rückseite
den Namen einer Burg, einer Stadt oder eines
Stiftes. Eine ähnliche, bei Köhne a. a. O. Taf.
VII, Nr. 9, hat auf der Rückseite den Namen
Perenncelave (Prenzlau). Ein anderes Exemplar
hat die Namen BVDIZL
 V K
V K
 Z
Z


 R und auf der Rückseite den Namen
SCS IOH
R und auf der Rückseite den Namen
SCS IOH
 N
N
 S, des Schutzheiligen der
bischöflichen Kirche zu Camin. Außerdem finden
sich Exemplare mit den Namen der Städte Camin,
Demmin und Stettin, von welchen einige den Namen
des Herzogs Bogislav I. von Pommern († 1188)
haben, mitunter mit dem Titel R
S, des Schutzheiligen der
bischöflichen Kirche zu Camin. Außerdem finden
sich Exemplare mit den Namen der Städte Camin,
Demmin und Stettin, von welchen einige den Namen
des Herzogs Bogislav I. von Pommern († 1188)
haben, mitunter mit dem Titel R
 X.
X.
Unsere Münze hat nach unserm vorliegenden Exemplare, nach Beihalt anderer Exemplare, folgende Inschrift, wie Kretschmer lieset und nach andern Exemplaren ergänzt:
Vorderseite: [B]VGECLOF [F : ECTS :]
Rückseite: SEL
FI . [K
STR]V
.
Ich lese auf der Münze deutlich:
Vorderseite: VGECL[O] . . . . .
Rückseite: SEL
. . . . . . V
.
Kretschmer nimmt, gewiß mit Recht, an, daß Selafi kastrum die hinterpommersche Burg Slauene, Slawe oder Schlage sei, welche in alten Zeiten eine Hauptburg war, und daß Bugeslav ein pommerscher Herzog Bugeslav von Slawe sei, der um das Jahr 1200 vorkommt.
Nach diesen Mittheilungen wird es unzweifelhaft sein, daß die Münze eine pommersche ist und in das Ende des 12. Jahrhunderts fällt. Ueber die alten pommerschen Fürsten vgl. man Quandt in Baltischen Studien, Jahrg. XVI, Heft 2, 1857, S. 56 flg. und 60 flgd.
Hiernach scheint es zweifellos zu sein, daß die Begräbnisse aus der Zeit der Einführung des Christenthums in Pommern stammen, aber noch die wendische Kunstbildung zeigen.
G. C. F. Lisch.
Zwei spiralförmige Fingerringe
von Bronze, von denen der eine weiter ist und 2 Windungen hat, der andere enger ist und gut 1 1/2 Windungen hat, leicht oxydirt, fand der Herr Friedr. Seidel zu Bützow am Mahnkenberge bei Bützow und schenkte sie dem Vereine.


|
Seite 286 |




|
Weiße Glasperle von Bützow.
An dem Klüschenberge bei Bützow fand der Herr Friedr. Seidel zu Bützow eine Glasperle von weißem Glase aus der Eisenperiode, welche er dem Vereine schenkte.
Ein Kamm
aus Knochen, von langer, schmaler Form, gefunden bei Wismar im Seesande, ward geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.
Ein Spindelstein
aus gebranntem Thon, gefunden zu Satow bei Kröpelin, ward geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.



|



|
|
:
|
Ueber das heilige "Hakenkreuz"
der Eisenperiode,von
G. C. F. Lisch.
Ich habe schon früher wiederholt in den
Jahrbüchern und im Friderico - Francisceum
darauf aufmerksam gemacht, daß das
"Hakenkreuz" oder das heilige Kreuz
mit gebrochenen Balken
 welches sich auf vielen
Denkmälern verschiedener Völker der Vorzeit
findet, auch in der heidnischen Periode der
Eisenzeit oder der Wenden in Meklenburg
vorkommt. Namentlich habe ich in den Jahrbüchern
XIII, S. 383 über die drei Fälle berichtet, in
denen es in den norddeutschen Ländern sicher
vorkommt: auf einer zu Kothendorf bei Hagenow
gefundenen wendischen Urne, auf einer in den
Vierlanden gefundenen Urne und auf einer bei
Bützow gefundenen wendischen Heftel. - In neuern
Zeiten hat der Herr Professor Holmboe in
Christiania ein Werk über die Spuren des
Buddhaismus in Norwegen vor der Einführung des Christenthums:
welches sich auf vielen
Denkmälern verschiedener Völker der Vorzeit
findet, auch in der heidnischen Periode der
Eisenzeit oder der Wenden in Meklenburg
vorkommt. Namentlich habe ich in den Jahrbüchern
XIII, S. 383 über die drei Fälle berichtet, in
denen es in den norddeutschen Ländern sicher
vorkommt: auf einer zu Kothendorf bei Hagenow
gefundenen wendischen Urne, auf einer in den
Vierlanden gefundenen Urne und auf einer bei
Bützow gefundenen wendischen Heftel. - In neuern
Zeiten hat der Herr Professor Holmboe in
Christiania ein Werk über die Spuren des
Buddhaismus in Norwegen vor der Einführung des Christenthums:
Traces du Buddhisme en Norvége avant l'introduction du christianisme, par M. C. A. Holmboe, Paris, 1857, imprimerie de Simon Raçon et Co.
herausgegeben und in demselben, S. 34 flgd., auch dieses mystische Kreuz behandelt. Abgesehen von dem sonstigen In=


|
Seite 287 |




|
halte dieses Werkes, in welchem er die Spuren der indischen Religion des Buddha in Norwegen nachzuweisen versucht, theile ich im Folgenden den Abschnitt über das mystische Kreuz in Uebersetzung mit, da dieser Abschnitt bis jetzt für Meklenburg allein von Wichtigkeit zu sein scheint.
Das Kreuz, welches sich aus einigen indischen
Münzen zeigt, findet sich eben so auf mehrern
goldenen Bracteaten, welche in Skandinavien bald
in Grabhügeln (haugs), bald anderswo gefunden
sind. Dieses Kreuz hat eine besondere Form,
indem seine vier Arme an ihren Enden eine
Biegung in dieser Gestalt
 haben. Dieses Kreuz ist sehr
merkwürdig, nicht allein wegen der weiten
Verbreitung desselben, sondern auch wegen der
heilsamen Wirkung, welche ihm die Hindus und
vorzüglich die Buddhisten zuschreiben.
haben. Dieses Kreuz ist sehr
merkwürdig, nicht allein wegen der weiten
Verbreitung desselben, sondern auch wegen der
heilsamen Wirkung, welche ihm die Hindus und
vorzüglich die Buddhisten zuschreiben.
Man bemerkt dieses Kreuz schon auf Münzen, welche sich aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnuug 1 ) herschreiben, und man findet sie von Zeit zu Zeit in dem Zeitraume von mehrern Jahrhunderten wieder.
Die Buddhisten betrachteten dieses Kreuz als eine der wichtigsten von den 65 Figuren, welche sie auf dem Abdruck des Fußes Buddha's gezeichnet zu sehen glaubten; denn es ist nicht allein an die Spitze des Verzeichnisses derselben gesetzt, sondern es ist noch einmal mit wenig Unterschied unter den Nummern 3 und 4 in der Aufzählung derselben wieder aufgeführt, welche Bournouf in seinem Anhange Nr. VIII zu seiner Ausgabe des "Lotus de la bonne loi" (p. 625 - 626) gegeben hat, wo wir lesen:
1. Svastikaya Dies ist das mystische Zeichen,
welches bei mehrern indischen Secten in Gebrauch
ist und also
 dargestellt wird; der Name
bedeutet buchstäblich: Zeichen des Segens oder
der guten Vorbedeutung.
dargestellt wird; der Name
bedeutet buchstäblich: Zeichen des Segens oder
der guten Vorbedeutung.
Das Zeichen svastika ist den Brahmanen nicht weniger, als den Buddhisten bekannt, und der Ramayana spricht davon an einer Stelle über Schiffe, welche mit diesem Glück brin=


|
Seite 288 |




|
genden Zeichen bezeichnet waren. Ich möchte indessen nicht behaupten, daß dieses Zeichen, dessen Name und Gebrauch gewiß alt ist, weil man es schon auf den ältesten buddhistischen Medaillen findet, sich auch eben so häufig bei den frühesten, als bei den folgenden finde. Jedoch ist es gewiß, daß die meisten Inschriften, welche man in den buddhistischen Höhlen des westlichen Indiens findet, im Anfange oder am Ende das heilige Zeichen haben.
3. Nandâvartaya. Dies ist noch ein "Diagramm" von guter Vorbedeutung, dessen eigentlicher Name nandyavarta und dessen Bedeutung: Schnörkel ("enroulement") oder glückbringender Kreis.
Armarakocha macht eben so aus diesem Zeichen den Namen einer besondern Art von Tempeln oder heiligen Gebäuden, jedoch ist zu bemerken, daß das nandyavarta der Djâins auch für eine Art von Labyrinth 1 ) gelten kann.
4. Sôvastekaya.
 . Der einzige Unterschied zwischen
diesem Zeichen und dem, welches oben aufgeführt
ist, ist der, daß die Arme des Kreuzes von der
Rechten zur Linken gehen, während Nr. 1 die Arme
von der Linken zur Rechten kehrt.
. Der einzige Unterschied zwischen
diesem Zeichen und dem, welches oben aufgeführt
ist, ist der, daß die Arme des Kreuzes von der
Rechten zur Linken gehen, während Nr. 1 die Arme
von der Linken zur Rechten kehrt.
Der Biograph von Hiouèn Thsang erwähnt eines Steines mit den Abdrücken der beiden Füße Buddhas, welche an den Spitzen der Zehen Blumen hatten, auf denen das mystische Zeichen Ouan 2 ) stand. Dies ist dasselbe Kreuz, von welchem Orazio della Penna di Billi in seiner Beschreibung von Tibet redet, indem er sagt: "Hanna, eine Art von Kreuz, welches mit Verehrung 3 ) (tengono = gehalten) betrachtet wird." Der Pater Hyacinth berichtet, daß die Weiber in Tibet mit diesem Kreuze ihre Röcke verzieren 4 ). Nach Pallas


|
Seite 289 |




|
zeichnen die Mongolen dieses Kreuz auf Stücke Papier, welche sie auf die Brust der Todten 1 ) legen. Man sieht dieses Kreuz auch oft auf der Brust der Heiligen 2 ). In Hindostan ist es noch ein Gegenstand der Verehrung unter dem Namen Sethia. Taylor sagt in seinem Wörterbuche: ""Sethia ist ein Zeichen in Gestalt eines Kreuzes, dessen vier Arme im rechten Winkel gebogen sind und welches von den Indiern beim Anfange eines neuen Jahres an die Spitze ihrer Rechnungsbücher roth gemalt gesetzt wird. Man bildet dieselbe Figur auch aus Mehl auf dem Boden bei Gelegenheit von Hochzeiten oder andern Feierlichkeiten"".
Wenn wir unsere Blicke nach Skandinavien wenden, so sehen wir, daß es dasselbe Kreuz ist, welches auf den goldenen Bracteaten dargestellt wird, von denen oben die Rede gewesen ist, und welche sich zuweilen in den Grabhügeln finden. Es ist auch dasselbe Kreuz, welches man auf einigen Leichensteinen des Alterthums eingehauen sieht, z. B. auf dem Kirchhofe von Gjerde 3 ), in der Pfarre Etne, in der Diöcese Bergen, und in Schweden 4 ) in der Pfarre Skeftuna, in der Provinz Upland.
Das Kreuz hat zuweilen einige hinzugefügte Linien, in Skandinavien wie in Asien, und es ist sehr überraschend, daß die also vermehrten Kreuze eine so gleiche Gestalt haben, daß die man nicht umhin kann anzunehmen, daß sie ein und dasselbe Vorbild haben; man vergleiche das Kreuz auf einem in Skandinavien gefundenen Bracteaten mit einem Kreuze, welches einer in Indien gefundenen Münze entnommen ist 5 ).
Endlich ist zu bemerken, daß sich dieses Kreuz auch auf den alten gallischen Münzen findet. Mionnet, Combrouce und der Numismatic Chronicle I, pl. I. führen es unter den gallischen Monogrammen auf. Es kann nach Gallien mit der Religion des Odin gekommen sein, welche dort im Norden vor der Einführung des Christenthums 6 ) bekannt ward."


|
Seite 290 |




|



|



|
|
:
|
Ueber die Hausurnen.
Seitdem vor einigen Jahren in den runden, mit Dach und Thür versehenen Graburnen zur Beisetzung der Ueberreste der verbrannten Leichen die Nachbildungen der germanischen Häuser, die Hausurnen, entdeckt sind, haben sich noch mehr Beweise für die Richtigkeit dieser Ansicht, welche in unsern Jahrbüchern XXI, S. 243 flgd. auseinandergesetzt ist, gefunden.
Zuerst hat Einfeld in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen, Hannover, Jahrgang 1855, S. 363, wieder eine römische Darstellung eines germanischen Hauses in die deutsche Literatur eingeführt und eine Abbildung desselben beigegeben. Diese Darstellung findet sich zu Paris im Louvre=Museum auf einem marmornen Relief, welches von einem zu Ehren des Kaisers Trajan aufgeführt gewesenen Triumphbogen herzustammen scheint und einen vor seinem Hause kämpfenden Germanen darstellt. Dieses Relief ist abgebildet in Musée de Sculpture du Musée Royal de Louvre, par le comte de Clarac, Paris 1828 - 1830, Tom. II, PI. 144, Nr. 349: Barbare combattant, und in den hannoverschen Jahrbüchern getreu wiedergegeben. Das Haus des Germanen ist rund, mit einem kuppelförmigen Dache bedeckt, in den Wänden anscheinend aus Pfählen oder Planken und im Dache aus Zweigen gebauet; die Thür ist nicht sichtbar; in der Höhe ist ein Fenster oder eine Luke sichtbar. Diese Darstellung gleicht den Darstellungen auf der Antoninssäule, welche mehr als 20 germanische Häuser von runder Form darstellt.
Eine andere Wahrnehmung hat jüngst der bekannte Alterthumsforscher Troyon zu Bel=Air in der Schweiz gemacht. Bekanntlich sind in den letzten trockenen Jahren bis zum Ende des J. 1858 bei dem niedrigen Wasserstande in den Schweizer=Seen viele Wohnplätze 1 ) aus der heidnischen Vorzeit, welche


|
Seite 291 |




|
auf Pfählen im Wasser nicht weit vom Ufer standen
(Pfahlbauten, Seewohnungen), entdeckt, und auf
ihnen sehr zahlreiche Alterthümer aus den
verschiedenen Perioden, je nach der Zeit ihrer
muthmaßlichen Zerstörung. Unter den Alterthümern
fand Troyon auch durch Feuersbrunst gehärtete
Bruchstücke von Thon, welche zur Bekleidung der
Hütten dienten; die Bruchstücke waren leicht
gebogen und erlauben daher den Schluß, daß die
Hütten rund waren und einen Durchmesser von 10
bis 15 Fuß hatten ("des fragments de
l'argile qui servait de revêtement aux cabanes,
- - cuits par l'incendie, et il est à remarquer
que leur face unie présente toujours une légére
concavité, qui permet de conclure que les
cabanes étaient circulaires
 .); vgl. Fréd. "Troyon
Statistique des antiquités de la Suisse
occidentale, VIII article, le 12 Mars 1858.
.); vgl. Fréd. "Troyon
Statistique des antiquités de la Suisse
occidentale, VIII article, le 12 Mars 1858.
Der Professor Dr. Braun zu Bonn hat den Aufsatz in unsern Jahrbüchern über die Hausurnen in den Jahrbüchern des Vereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande, Bonn, XXV, 1856, (S. 162 flgd., einer ansführlichen Anzeige gewürdigt, ist aber der Meinung Gerhards, daß die Hausurnen vom Albanergebirge den Gräbern rhätischer Soldaten oder germanischer Colonisten angehören und nicht in die altitalische Zeit zurückreichen, sondern einer jüngern Zeit zuzuschreiben sind.
Die geringschätzige und etwas leichtfertige Behandlung dieser Sache durch Hostmann in dessen Doctordissertation "Ueber altgermanische Landwirthschaft", Göttingen, 1855, S. 55, Note 129, wozu auch die damals bekannt gewordenen Hausurnen und die germanischen Hütten von der Antoninssäule abgebildet sind bedarf jetzt keiner Berücksichtigung, besonders da seitdem manche wichtige Entdeckungen gemacht sind.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 292 |




|



|



|
|
:
|
Römische Alterthümer von Hagenow.
(Vgl. Jahresbericht VIII, S. 38 flgd.)Römisches aus Nord - Deutschland * ).
Im Laufe dieses Jahres sind bei Teplitz in Böhmen auf dem Grunde des Fürsten Edmund Clary = Altringen am Bila=Ufer am Rande des Liesnitzer Busches in einem Steinhaufen zwei Bronzegefäße gefunden worden, welche der Sammlung des Besitzers einverleibt und durch Vermittelung des Herrn Wilhelm Grimm zuerst in Zeichnungen, sodann auch im Original den berliner Alterthumsfreunden mitgetheilt worden sind 1 ). Beide Gefäße sind entschieden römischer Arbeit und verdienen Aufmerksamkeit schon durch ihren Fundort außerhalb der Grenzen des römischen Reichs. Das kleinere derselben ist ein kleiner Krug mit Henkel 2 ), welcher oben in einen weiblichen Kopf ausläuft und unten mit einer Maske endigt; er ist ohne Inschrift. Dagegen das größere Gefäß 3 ), eine bronzene Casserolle mit flachem Boden 4 ) und mit geradem horizontalen Stiel, welcher in einen mit schönen Schwanenköpfen verzierten Griff ausläuft, hat auf der oberen Fläche des Griffs zwei römische Stempel mit erhabener Schrift, anscheinend der früheren römischen Kaiserzeit angehörend, von denen der obere lautet:
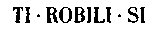
der untere:
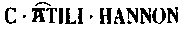 **
).
**
).


|
Seite 293 |




|
Ein gleichartiger Fund wurde vor einigen Jahren zu Hagenow im Mecklenburgischen gemacht und im Jahresbericht des Vereins für mecklenburgische Geschichte für 1843 (Bd. 8) S. 41 bekannt gemacht (Taf. No. I). In dem damals zusammengefundenen Bronzegeräth kam nicht bloß ein jenem Kruge gleichartiges, ebenfalls oben in einen Kopf, unten in eine Maske auslaufendes Gefäß zum Vorschein 5 ), sondern es fand sich auch eine der unsrigen ganz gleichartige, jedoch geringer gearbeitete Casserolle 6 ) mit dem ebenfalls erhaben geschriebenen Stempel:
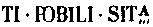 *
),
*
),
welche augenscheinlich von demselben Fabrikanten herrührt, dem der erste Stempel des Teplitzer Gefäßes angehört. Der Name desselben scheint nach Vergleichung beider Stempel Tiberius Robilius ** ) Sitalces gewesen zu sein. Das


|
Seite 294 |




|
B in ROBILI ist auf dem Teplitzer Stempel ziemlich deutlich, während der Hagenower hier beschädigt ist und auch auf RODILI ergänzt werden könnte. Das folgende I ist auf dem Hagenower Stempel deutlich, auf dem Teplitzer fast verloschen. Das Cognomen, das auf dem Hagenower Stempel vollständiger ist als auf dem Teplitzer, kann wohl nur SITA lces gewesen sein, wenn der vierte unten beschädigte und überhaupt erloschene Buchstab wirklich ein A war. Robilii finden sich auf Inschriften von Aeclanum (I. N. 1233. 1234). - Der zweite Fabrikantenname Gajus Atilius Hanno bietet nichts Bemerkenswerthes dar. Wohl aber ist ein merkwürdiger Umstand das Vorhandensein eines Doppelstempels auf dem Teplitzer Gefäß, was auf jeden Fall ungewöhnlich, ja wofür mir augenblicklich kein zweites Beispiel zur Hand ist. Denn daß neben dem Stempel des Fabrikanten noch eingeritzt der Name des arbeitenden Mannes sich findet (I. N. 6307, 8), ist etwas wesentlich Verschiedenes. Bei der Verfertigung dieses Gefäßes müssen also wohl zwei Fabriken zusammengewirkt haben. Es bringt dies eine früher (Edict Diocletians S. 67) geäußerte Vermuthung in Erinnerung. Nach dem Diocletianischen Preistarif wird dem Kupferschmied (aerarius) für Gefäße (bascula diversi generis) das Pfund mit 6, für Bildwerke (sigilla vel statuae) das Pfund nur mit 4 Denaren bezahlt; unmittelbar auf den Kupferschmied aber folgt der Thonformer (plasta imaginarius). Der Gedanke liegt nahe, daß der letztere für Bildwerke dem Kupferschmied die Formen lieferte, nicht aber für Gefäße, und daß dies der Grund war, weshalb dort der Kupferschmied weniger erhielt als hier. Der zwar einfache, aber ungemein zierlich gearbeitete Griff der Teplitzer Casserolle könnte wohl zu den Arbeiten gehören, welche der Kupferschmied Ti. Robilius Sitalces in einer vom Modelleur C. Atilius Hanno verfertigten Form gegossen hat, während bei dem Hagenower Exemplar kein solcher Arbeiter mitwirkte. Es ist das ein Einfall, den unsre archäologischen Freunde prüfen mögen; denn freilich wird nur die Untersuchung der gesammten nur allzu zahlreichen Fabrikstempel des Alterthums über dessen noch so wenig aufgeklärte Fabrikverhältnisse einiges Licht zu verbreiten vermögen. Ebenso mag es hier genügen, die für sich selbst sprechende Thatsache festzustellen, daß Fabrikate derselben römischen, wohl eher südlich als nördlich von den Alpen einst


|
Seite 295 |




|
betriebenen Officin in Böhmen und in Mecklenburg zu Tage gekommen sind und bei dem letzten Congreß der deutschen Alterthumsfreunde sich durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herrn Fürsten Clary in Wien und des Herrn Archivraths Dr. Lisch in Schwerin hier in Berlin auf einem Tische zusammen gefunden haben. Vielleicht wird es möglich sein, was hieraus und aus andern verwandten Thatsachen für die Geschichte des römisch=germanischen Handelsverkehrs gewonnen werden kann, später einmal in einigem Zusammenhange darzulegen.
Berlin, im September 1858.
Th. Mommsen.



|



|
|
:
|
Urnen von Dresden und Kinderurnen.
Auf dem leipzig=dresdener Bahnhofe zu Dresden
ward im J. 1851 beim Bau eine heidnische
Begräbnißstätte
1
) gefunden. Von den dort
gefundenen Alterthümern erwarb der durch mehrere
werthvolle alterthümliche Geschenke um den
Verein verdiente Freiherr Ad. v. Maltzan, früher
auf Duchnow
 . in Polen, jetzt zu Eschdorf, bei
Dresden, durch Geschenk mehrere Grabgefäße und
schenkte dieselben unserm Vereine wieder.
. in Polen, jetzt zu Eschdorf, bei
Dresden, durch Geschenk mehrere Grabgefäße und
schenkte dieselben unserm Vereine wieder.
Dieses in mancher Hinsicht werthvolle Geschenk enthält folgende Stücke:
1) Eine völlig erhaltene, hellbraune Urne, von der in Jahrb. XI, S. 357 und hieneben wieder abgebildeten Form, 9" hamb. Maaß hoch, 11 1/2" weit in der Mündung. Der Bauchrand ist durch senkrechte Einschnitte gekerbt. Dicht über dem Bauchrande laufen 4 eingerissene Parallellinien umher.
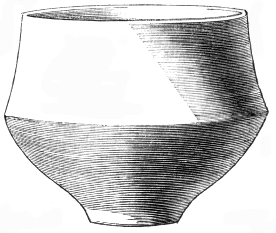


|
Seite 296 |




|
2) Eine kleine, glatte Schale ohne Henkel, 2" hoch, 4 1/2" weit in der Mündung.
3) Eine kleine, glatte Schale mit Henkel, eben so groß.
4) Eine kleine, glatte, gehenkelte Urne, am Rande abgebrochen, gegen 3" hoch und eben so weit in der Mündung, von der in Jahrb. XI, S. 363 oben und hier wieder abgebildeten Form, jedoch ohne Verzierungsreisen auf dem Bauchrande.

Welcher Zeit diese Urnen angehören, läßt sich bei dem Mangel an metallenen Alterthümern nicht bestimmen. Nach den Größen und Formen gehören sie der Bronze=Periode an; da sie aber sehr wohl erhalten und fest sind und die Form der großen Urne bis in den Anfang der Eisen=Periode hineinreicht, so ist es wahrscheinlich, daß diese Gefäße in die letzte Zeit der Bronze=Periode fallen.
Kinderurne.
Diese Gefäße sind durch die kleine gehenkelte Urne sehr merkwürdig. In Norddeutschland werden oft diese kleinen gehenkelten Urnen, welche häufig sehr schöne, antike Formen haben, bei großen Urnen mit Asche und zerbrannten Knochen gefunden; sie sind gewöhnlich in oder dicht neben große Urnen gestellt. Bisher sind aber die in diesen kleinen Urnen gefundenen zerbrannten Knochenreste so sehr durch den Leichenbrand zerstört und an Menge so unbedeutend gewesen, daß sich die Bestimmung dieser kleinen Urnen nicht erkennen ließ. Man kam daher auf den Gedanken, daß diese kleinen Urnen zur Sammlung der Asche von edleren Theilen des Körpers, z. B. der Augen, bestimmt gewesen seien, um so mehr, da diese Urnen zur Aufnahme der Gebeine und Asche eines ganzen Körpers zu klein zu sein schienen.
Diese dresdner kleine Urne giebt aber andere und sichere Aufschlüsse. Der Leichenbrand muß nicht stark genug gewesen sein, und so sind denn mehrere Gebeine in der Urne fast vollständig erhalten, z. B. die Beinknochen fast vollständig, die Augenhöhlen, Stücke von dem Schädel und den Rippen u. s. w. Nach diesen Knochen war die verbrannte Leiche, nach dem Urtheile mehrerer Aerzte, ein neu gebornes Kind. Die Beinknochen sind ungefähr 2 1/2" hamburger Maaß lang, so daß sie


|
Seite 297 |




|
noch horizontal in die kleine Urne gelegt werden konnten. Die Schädelbruchstücke sind nicht viel dicker, als starkes Schreibpapier, jedoch schon fest; eben so sind die Augenhöhlen fest ausgebildet. Von den Knochen der großen Leiche lag nichts in der kleinen Urne, so daß die Kindesleiche allein verbrannt worden ist.
Es ist daher sicher, daß diese kleinen Urnen Kinderurnen waren, und daß, wenn sich eine solche kleine Urne in oder neben einer großen Urne findet, dort eine Mutter mit ihrem neu gebornen Kinde beigesetzt ist, welche beide durch die Geburt gestorben waren.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 298 |




|



|



|
|
:
|
und der neuern Zeit.
Mittelalterliche Alterthümer von Schwerin.
Das erste Haus rechts im Anfange der Verbreiterung der Großen=Moor=Straße, Nr. 827, der Grünen=Straße gegenüber, grade dort wo der Moorboden anfängt und der feste Boden aufhört, mußte im J. 1858 abgetragen und neu gebauet werden. Zu der Fundamentirung untersuchte man den Grund genauer und traf in einer Tiefe von 18 Fuß festen Sandboden, auf welchem der Moor lagerte. Man zog es daher vor, den Grund auszugraben und das Fundament auf den Sand in der Tiefe zu setzen. Man fand beim Ausgraben in der Moorerde viele Thierknochen und Hörner, Holz u. dgl. und auch einige Alterthümer, welche der Hausbesitzer Herr Hübers dem Vereine zu schenken die Güte hatte. Da der Große Moor eine neue Anlage ist, so haben hier an der Grenze des festen Landes und am Ende der alten Straße in alten Zeiten gewiß noch leichte Hintergebäude gestanden, welche die Veranlassung gewesen sind, daß die Sachen hier verloren gegangen sind.
Die Alterthümer, welche 18 Fuß tief, auf dem Sande gefunden wurden, also durch den Moor hindurch gesunken sind, stammen aus dem Mittelalter vor der Reformationszeit und sind folgende:
1 kleiner, unglasurter Henkeltopf von bräunlich gebranntem Thon, 4" hoch;
1 ganz kleiner, grau glasurter Henkeltopf, 2 1/2" hoch;
3 grau glasurte Spindelsteine;
1 eiserne Pfeilspitze;
1 kleines eisernes Hufeisen;
1 kleiner eiserner Hammer;
1 kleiner bronzener Leuchter (?)=Fuß, sechsseitig, mit Klauen, 2" hoch;


|
Seite 299 |




|
1 bronzene Schnalle;
1 Stück oxdirter Bronze von unregelmäßiger Gestalt; mehrere Münzen aus der neuern Zeit und ein alter bronzener Rechenpfennig.
G. C. F. Lisch.
Ein eiserner Sporn,
mit einem Stachel, statt des Rades, ziemlich stark vom Rost angegriffen, gefunden zu Wahrstorf bei Wismar, ward geschenkt von dem Herrn Witt zu Wahrstorf.
Ein eiserner Sporn
undeine eiserne Lanzenspitze,
gefunden im Festungsgraben von Dömitz, wurden geschenkt von dem Unterofficier Herrn Büsch zu Wismar.
Ein Messer
mit zweischneidiger eiserner Klinge und messingenem Griffe, gefunden zu Daschow bei Plau, ward geschenkt von dem Herrn Hauptmann du Trossel zu Wismar.
Ein eiserner Schlüssel,
vielleicht aus dem 16. Jahrhundert, ward zu Wolcken bei Bützow gefunden und von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow geschenkt.
Zwei Hufeisen aus Eisen,
gefunden bei Bützow, schenkte der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.
Ein Teller
aus gelblich=weißem Thon, mit einem Vogel in bunt glasurten Blumen in einer gelb glasurten Randeinfassung, ward gefunden in Wismar und geschenkt vom Herrn Dr. Crull zu Wismar. Der Rand des Tellers umher ist ganz abgebrochen. Nach den Formen der Verzierung der Randeinfassung stammt dieser Teller in Vergleich mit datirten zinnernen Tellern aus dem Ende des 16. oder dem Anfange des 17. Jahrhunderts.


|
Seite 300 |




|
Ofenkacheln von Wismar.
Der Herr Dr. Grull zu Wismar schenkte dem Vereine 22 Bruchstücke von Reliefkacheln aus dem 16. Jahrhundert, von denen die meisten zu Wismar unter einem Hause gefunden sind, welches 1653 an der Stelle eines alten Hauses erbauet war. Die unter diesem Hause gefundenen Kacheln, von denen mehrere öfter vorkommende Brustbilder und andere bildliche Darstellungen enthalten, sind meistentheils hellgrün, einige auch blau und weiß, wenige gelb und schwarz. Einige ganz schwarze, offenbar jüngere Kacheln sind an andern Stellen in Wismar gefunden.
Zehn glasurte Ofenkacheln
aus dem 16. Jahrhundert, in Bruchstücken, schenkte der Herr Dr. Crull zu Wismar.
Vierzehn glasurte Ofenkacheln
in Bruchstücken, meistentheils grün glasurt, aus dem 16. Jahrhundert, gefunden zu Wismar, in der Neustadt, wurden geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.
Eine grünglasurte Ofenkachel,
mit der Reliefdarstellung der FIDES, aus dem 16. Jahrhundert, gefunden im Festungsgraben von Dömitz, ward von dem Unterofficier Herrn Büsch zu Wismar geschenkt.
Ziegelkacheln von Wismar.
Der Herr Dr. Crull zu Wismar schenkte dem Vereine 6 große Reliefziegel von rothem, gebrannten Thon, in Kachelform, von dem seit 15 Jahren nach und nach modernisirten jetzigen Posthause zu Wismar, in der Meklenburger=Straße, nicht weit von dem ehemaligen "Schwarzen=Mönchs=Kloster". Das Haus ist 1672 von dem Tribunalsassessor Klinkow, unter dem Namen v. Friedenschild geadelt, erbauet. Das Haus war an der Außenseite zwischen den Fenstern der beiden Stockwerke mit Blumen= und Frucht=Guirlanden in gebranntem Thon verziert; die geschenkten 6 Kacheln bilden eine solche Guirlande.
Früher schenkte der Herr Dr. Crull dem Vereine auch ein Stück von einer eben so alten Sammttapete, in braunroth und gold, in großen, schönen Mustern, aus demselben Hause, welches noch andere alte Tapeten besitzt.


|
Seite 301 |




|
Eine Gußform
aus Sandstein, gefunden zu Dänschenburg im Amte Ribnitz, an der einen breiten Seite mit einer Knopfform, an der andern Seite mit einem gekrönten Herzen, zu einer Spange, ward geschenkt von dem Herrn Pastor Steinfaß zu Dänschenburg.
Ein Pfeifenkopf
aus geschliffenem Granit, gefunden zu Wismar beim Ausgraben eines Kellers in der Weberstraße, ward geschenkt von dem Unterofficier Herrn Büsch zu Wismar.
Lesepult von Halberstadt.
Der Herr Geheime=Rath von Olfers, General=Director der königl. preuß. Museen, schenkte einen ausgezeichneten Gypsabguß eines großen Adlers von einem Lesepulte, nach dem Originale im Dome zu Halberstadt. Der Adler, welcher mit ausgebreiteten Flügeln das Pult trägt, ist ein sehr merkwürdiges und ausgezeichnet schönes Kunstwerk des frühern Mittelalters.


|
Seite 302 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Baukunde.
Der Burgwall von Dargun
ist zwar im Jahresbericht VI, S. 70 flgd. (vgl. XII, S. 453) beschrieben, bedarf aber noch fortwährend einer scharfen Beobachtung. Mit dem Orte Dargun gleichlaufend erstreckt sich ein schmaler Höhenzug oder Bergrücken, welcher ungefähr 1/3 Meile lang sein mag und beim Kloster anfangend immer höher steigt, bis er bei der Kirche des Dorfes Röcknitz in die Tiefe abfällt. An den beiden langen Seiten und an dem äußersten Ende Röcknitz gegenüber ist der Bergrücken von tiefen Sumpfwiesen umgeben, welche an einer Seite bis gegen das Kloster reichen und in denen das Wasser zu dem darguner See in den alten Klosterzeiten künstlich aufgestauet ist. Nur gegen die Klosterseite hin hängt dieser Höhenzug mit dem festen Lande zusammen. Der ganze Höhenzug ist mit schöner Buchenwaldung besetzt. Auf der höchsten Spitze, Röcknitz gegenüber, liegt der Burgwall, welcher offenbar zuletzt die wendische Burg Dargun gebildet hat; dies beweisen nicht nur der ganze Bau, welcher eine nicht sehr ausgedehnte kesselförmige Vertiefung oder einen kleinen Burgplatz mit hohen Ringwällen bildet, sondern auch die unzähligen wendischen Gefäßscherben, Kohlen und verbrannten Lehmstücke von den Gebäuden, so wie die noch erkennbaren Grenzen der historischen, wendischen Burg.
Es läßt sich aber nicht leugnen, daß die Lage nicht ganz einer wendischen Burg entspricht. Alle bekannten wendischen Burgen in Meklenburg sind so gebauet, daß ein verhältnißmäßig kleiner Burgwall in einen Sumpf oder See hineingeschüttet ist, ohne daß er unmittelbare feste Umgebungen hätte;


|
Seite 303 |




|
dies ist wendische Sitte. Der Burgwall von Dargun hat aber so viel festes, freilich umher durch Wiesen geschütztes Land hinter sich, daß es ein kleines Landgut bilden könnte. Der Burgwall ist freilich durch drei sehr tiefe Gräben mit steilen Böschungen, welche in weiten Entfernungen von einander queer über von Wiese zu Wiese den Höhenzug durchschneiden, und durch einen Laufgraben am Rande des Höhenzuges geschützt; diese Art von Befestigung ist aber durchaus keine wendische.
Ich glaube daher annehmen zu können, daß die Burg Dargun nicht von den Wenden angelegt ist, sondern noch aus der germanischen Zeit stammt und von den Wenden nur benutzt ward, da sie einmal vorhanden und auch ziemlich paßlich war. Für diese Annahme scheint nicht nur die ganze Beschaffenheit und Anlage zu reden, sondern auch der Umstand, daß sich auf dem Rücken des Höhenzuges vor den Queergräben überall viele Kegelgräber aus der (germanischen) Bronzeperiode finden.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Der wendische Burgwall von Krakow.
Es mußte bei der Stadt Krakow irgendwo ein wendischer Burgwall liegen, da die Gegend in alter Zeit nicht ohne Bedeutung ist. In der Nähe von Krakow wurden noch spät Land =, Huldigungs= und Musterungstage für die Ritterschaft des Landes Werle gehalten (vgl. Jahrb. XII, S. 176). Krakow bildete in alter Zeit ein "Land"; jedoch hat dies früh seine Bedeutung verloren, da es schon im 14. Jahrhundert mit der Vogtei Plau zusammen verwaltet ward (vgl. Jahrb. XVII, S. 113). Wenn sich nun auch bei Krakow eine alte fürstliche Gauburg aus der Wendenzeit vermuthen ließ, so war sie doch nicht aufzufinden; erst in den neuesten Zeiten ist durch Befahrung des Sees unter Führung kundiger Leute die Entdeckung 1 ) möglich geworden.
Der wendische Burgwall von Krakow liegt ziemlich versteckt und ist nur durch unmittelbare Anschauung vom See aus zu entdecken. Er liegt im krakower See, an der Seite der Stadt Krakow, auf Stadtgebiet, nicht weit von dem am Seeufer liegenden Dorfe Möllen, dem "Alten Schlosse Dobbin" gegenüber (vgl. unten: die mittelalterlichen Burgen von Dobbin S. 306). Er liegt nahe am Ufer, ist jedoch rings von Wasser


|
Seite 304 |




|
umflossen und hat nur auf der Seeseite etwas niedriges Vorland zur Aufnahme einer Vorburg. Vielleicht steht der Burgwall auf einer kleinen natürlichen Insel und ist durch Kunst nur erhöhet; vielleicht ist er aber auch ganz aufgetragen. Der Burgwall, welcher im Volke noch heute den Namen "Borgwall" führt, ist rund und trägt auf dem Rande umher eine regelmäßige, breite, runde, wallartige Erhöhung, welche sich nach dem Innern hin kesselförmig senkt. Dieser Ringwall hat auf seiner Höhe einen Umfang von 240 Schritten. Die Erde der ganzen Oberfläche ist ohne Zweifel aufgetragen; sie ist sehr leicht und läßt sich beim Gehen tief eindrücken, wenn sie auch ganz trocken ist: dem Anschein nach ist es schwarze Wiesenerde vom Seeufer, mit Sand vermischt. Gegenwärtig ist die Oberfläche beackert und war im J. 1858 mit Kartoffeln bepflanzt. Die Erhebung des ganzen Burgwalles über den Seespiegel mag ungefähr 20 Fuß betragen. Der Beweis dafür, daß dieser Burgwall ein wendischer sei, war überall zu finden: überall wurden ohne Mühe schon auf der Oberfläche, namentlich am innern Rande des Ringwalles, zahlreiche Gefäßscherben gefunden, welche durch die Vermengung des Kerns mit Steingrus sich als heidnische Gefäßscherben offenbarten; nach den wellenförmigen und andern Verzierungen gehören die Gefäßscherben der wendischen Zeit an. Der Burgwall ist also nach Lage, Gestalt und Gefäßscherben ohne Zweifel ein wendischer Burgwall. Auch Thierknochen wurden gefunden. Nachgrabungen würden gewiß viel Scherben und Knochen und auch wohl Alterthümer zu Tage fördern, da dieser Burgwall noch ziemlich in seiner alten Gestalt steht. Scherben aus dem christlichen Mittelalter wurden gar nicht gefunden, so daß sich annehmen läßt, dieser Burgwall sei mit dem Untergange des Heidenthums wüst gelegt worden.
In der Lage und Gestalt gleicht dieser Burgwall ganz dem südlich davon gelegenen Burgwalle von Quetzin (oder Kutsin) bei Plau (vgl. Jahrb. XVII, S. 23 flgd.) und ist dem Burgwalle von Bisdede im gutower See bei Bölkow, in der Nähe von Güstrow, (vgl. Jahrb. XII, S. 453 flgd.) sehr ähnlich.
Es ist also queer durch das Land von Norden nach Süden jetzt eine ganze Reihe ähnlich gebaueter und liegender wendischer Burgen entdeckt, nämlich von Norden nach Süden: Rostock, Kessin, Werle (bei Wiek in der Nähe von Schwaan), Bützow, Bisdede (im gutower See bei Bölkow in der Nähe von Güstrow), Krakow und Quetzin.


|
Seite 305 |




|
Ob das untergegangene Dorf Werle südwestlich vom krakower See bei Horst oder Hahnenhorst (vgl. Lisch Gesch. des Geschlechts Hahn II, S. 374 und Jahrb. VIII, S. 219) in historischer Beziehung zu dem Burgwall von Krakow steht, ist wohl nicht zu ermitteln.
Zu bemerken ist, daß von den vielen Inseln des krakower Sees zwei Inseln im nördlichen Theile des Sees nicht weit von dem Burgwalle: der Schwerin (Thiergarten) und die Lieps heißen; dieselben Namen führen bekanntlich auch zwei Inseln im schweriner See.
An den Ufern des krakower Sees waren alte adelige Familien von offenbar wendischer Herkunft mit großem Grundbesitz angesessen, z. B. am östlichen Ufer dem Burgwalle gegenüber die Barold auf Dobbin, am nördlichen Ufer die Grube auf Grube (jetzt Charlottenthal). Bei Krakow liegt noch ein anderer See, welcher seit alter Zeit der Oldendorper See heißt, sicher von einem alten wendischen Orte Oldendorp so genannt, welches vielleicht mit dem Aufbau der Stadt Krakow unterging; von diesem Orte hatte vielleicht die Familie von Oldenstadt ("de Antiqua Civitate") den Namen, welche um das Jahr 1450 ausstarb und nicht mit der Familie von Oldeburg verwechselt werden darf, welche am südostlichen Ufer des krakower Sees auf Glave saß.
Dem wendischen Burgwalle von Krakow gegenüber liegt das große Gut Dobbin. Der jetzige Hof Dobbin liegt wohl auf der Stelle, wo seit dem Mittelalter der Hof gestanden hat. Aber am nördlichen Ende der sehr großen Feldmark, wohl eine halbe Stunde vom Hofe enfernt, liegt am See ein sehr ausgedehnter Burgwall, auf welchem wohl Dobbin im Anfange des Mittelalters gestanden hat. Der noch mit einem Graben umgebene Burgwall ist mit Holz und Buschwerk dicht bewachsen. Vor diesem Burgwall liegt ein großer Platz, jetzt beackert, auf welchem sich häufig gelblich gebrannte Lehmstücke von Klemstaken, wie aus der heidnischen Zeit, finden, auch ein runder Platz, wo dergleichen gefunden wird. Dies ist wohl das Dorf und die Vorburg gewesen. Vielleicht hat dieser Burgwall aus der heidnischen Zeit in das Mittelalter hineingereicht. Sehr hoch ist er nicht, auch nicht von Sumpfwiesen umgeben, wenn auch von feuchtem Boden. Eine Langseite stößt an den krakower See.
Eine andere Burgstätte, Alt=Dobbin genannt, liegt im südlichen Theile des krakower Sees, in der Gegend des jetzigen Hofes. Hier ward die schöne römische Bronze=Vase im See gefunden.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 306 |




|



|



|
|
:
|
Die mittelalterlichen Burgen von Dobbin.
Das große Gut Dobbin am östlichen Ufer des krakower Sees war ein uraltes Lehn der uralten, sicher wendischen adeligen Familie Barold, welche im J. 1746 ausstarb. Auf diesem Gute, welches mit seinen Zubehörungen ungefähr 3/4 Quadratmeilen groß ist, sind mehrere Burgstellen, welche andeuten, daß der Rittersitz oft verändert ist; vielleicht hangen einige davon noch mit alten wendischen Fürstenburgen zusammen. Auf dem Gute Dobbin liegen folgende Burgstellen 1 ) mit folgenden noch gebräuchlichen Namen:
1) Der jetzige "neue Hof", im Festlande, neben Wiesenflächen gelegen, bei welchem aber keine Spur von einem alten Schlosse mehr vorhanden ist.
2) Der "Alte Hof", welcher in der Nähe des neuen Hofes in der Wiese unterhalb der Kirche gelegen haben soll; von diesem ist keine Spur mehr vorhanden.
3) "Alt=Dobbin", westlich vom neuen Hofe am See. Hier soll in alten Zeiten Dobbin gestanden haben; die Stelle war früher eine Insel, hat aber keine Spur von Ueberresten der Vorzeit.
Hier dicht bei Alt=Dobbin ward im Wasser im Rohr nicht weit vom Lande, die schöne, große römische Bronze=Vase gefunden, welche in Jahrbüchern VIII, S. 50 flgd, beschrieben und abgebildet ist. Nach dem Berichte der Leute stand sie im Wasser im Rohr, ward von einem Ruder berührt und dadurch entdeckt und konnte so gesehen werden, wie sie auf dem Grunde stand.


|
Seite 307 |




|
4) Das "Alte Schloß Dobbin", nördlich weit vom neuen Hofe und "Alt=Dobbin". Dieses "Alte Schloß Dobbin" liegt auf einem Vorsprunge in den krakower See, dem wendischen "Burgwall" von Krakow (vgl. oben S. 303) und dem Dorfe Möllen grade gegenüber, an der Verengung des krakower Sees. Dies ist eine kleine mittelalterliche Burg; sie ist rund, noch von einem Wallgraben umgeben, mit Fundamenten von Granitblöcken und Ziegeln bedeckt, sehr zerstört und mit dichtem Holzgestrüpp bewachsen.
Ueber diese beiden alten Burgen erzählen sich verständige Leute in Dobbin noch folgende Sagen. Zwischen "Alt=Dobbin" und dem "Alten Schlosse Dobbin" lag am Ufer entlang eine große, lange Stadt; davon sollen noch viele Steinkreise zeugen, welche am Ufer entlang zwischen beiden alten Burgen liegen. Diese Stadt hieß die "Kronstadt", welche "die Kronenstadt von ganz Meklenburg gewesen" sein soll. Auf den beiden Schlössern "Alt=Dobbin" und "Alt Schloß Dobbin" wohnten zwei alte Fürsten, welche "Nikolosky" und "Belensky" hießen; diese lagen mit einander im Kriege, welcher endlich durch eine "Vermählung" beendet ward.
Sollte in dieser Sage noch der Name Niklot durchklingen und in dem Namen Belensky das gute Princip des Belbog (weiß, gut)?
Die Familie Barold ist bei den Leuten in Dobbin noch allgemein bekannt.
Jedenfalls sind die vielen Burgstellen und die Sagen in Verbindung mit dem wendischen Burgwalle von Krakow und der Familie Barold von Interesse.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Burg der Moor=Hoben
an der Trebel.In den Trebelwiesen, welche jetzt zu Quitzenow gehören, liegt unterhalb des pommerschen Dorfes Bassendorf an einer halbkreisförmigen Ausbiegung der Trebel eine alte Burgstelle, welche wohl theils durch Versinken des schwereren aufgetragenen Bodens, theils durch Aufwachsen des sie umgebenden Torfmoores sich kaum 2 Fuß hoch über die Wiesenfläche erhebt. Die Burgstelle mit den beiden sie fast kreisförmig umgebenden Wällen ist aber auch an dem verschiedenen Pflanzenwuchs kenntlich. Sie hat eine bedeutende Größe, da die Durchschnittslinie (der Durchmesser) des äußeren Wallgrabens und bis an die Trebel fast 27 Ruthen beträgt; der mittlere Theil, die eigentliche Burgstelle, hält aber nur 2 Ruthen im Durch=


|
Seite 308 |




|
messer. Die Wallgräben sind zwar ebenfalls ausgewachsen, sind aber ebenfalls am Pflanzenwuchs kenntlich. Der äußerste Graben beschreibt nur einen Halbkreis, da er auf beiden Seiten in die Trebel mündet und dieser Fluß zur Ergänzung des Kreises dient. Da nun die Wälle selbst gewöhnlich unterbrochen waren, so konnten kleine Fahrzeuge (Kähne, Böte) von der Trebel bis an die innere Burg gelangen. Von der Burg aus führte ein, aus vier Zoll dicken, geschnittenen eichenen Bohlen gebildeter Weg über die Torfwiesen in südwestlicher Richtung auf das feste Land zu und endigt mit einem Steindamm. Diese Bohlen sind dicht an einander gelegt, aber nicht breiter, als daß grade ein Wagen darauf fahren kann. Eine Unterlage haben die Bohlen nicht; waren einige schadhaft geworden oder tiefer in den Boden gesunken, so wurden andere darauf gelegt. Jetzt ist der ganze Weg ungefähr 2 Fuß mit Torf überwachsen und beim Stechen von Torf entdeckt und seiner Länge nach verfolgt worden.
Von dieser Burg geht in jener Gegend folgende Sage: Die Familie von Hobe besaß in älterer Zeit viele Güter 1 ) rings umher, von welcher die auf der Burg an der Trebel auf dem Gebiet von Quitzenow sitzenden den Namen die Moor=Hoben führten, während ihre Vettern auf der Burg Wasdow die Burg=Hoben genannt wurden. Die Moor=Hoben machten oftmals Raubzüge in das gegenüberliegende Land Pommern, so wie auf Kähnen die Trebel auf= und abwärts, wobei sie oft reiche Beute machten und viele Schätze in ihrer Burg aufhäuften. Als sie aber einmal von einem solchen Zuge heimgekehrt waren, bemerkten sie, daß man ebenfalls auf Kähnen sie verfolge und die Absicht habe, sie auf ihrer Burg anzugreifen. Da an eine erfolgreiche Vertheidigung bei der Ueberlegenheit ihrer Verfolger nicht zu denken war, so beschlossen sie, mit ihren besten Schätzen zu ihren Vettern auf Wasdow sich in Sicherheit zu begeben. Sie packten deshalb ihre Kostbarkeiten in einen großen eisernen Kasten, der auf einem Wagen befindlich war, und traten mit demselben in der Nacht ihre Wanderung auf dem Bohlendamm an. In der Dunkelheit verfehlten sie entweder den Weg, oder trafen eine schadhafte Stelle desselben, oder die Last war zu groß, genug, sie versanken mit ihrem Schatze allesammt ins Moor.
Friedrichshöhe.
J. Ritter.


|
Seite 309 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirchen zu Ratzeburg.
ist schon 1835 von dem Architekten Lauenburg zu Hamburg ziemlich zutreffend beschrieben vgl. Masch Gesch. des Bisth. Ratzeburg, S. 747 flgd.) und von mir in den Jahrb. VII, S. 61, XI, S. 420 und XX, S. 312 ergänzend erläutert. Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich, daß diese Kirche ganz im romanischen Baustyle im letzten Viertheil des 12. Jahrh. nach dem Muster des Domes zu Braunschweig, also seit 1172 (vgl. Masch a. a. O. S. 76 - 77), aufgeführt ist. Die Kirche ist jedenfalls jünger, als die Stiftung des Bisthums, da die Stiftung der ersten Kirche, von der aber wohl nichts mehr vorhanden ist, zwischen 1158 und 1162 fällt (vgl. Masch a. a. O. S. 76, und Jahrb. XX, S. 312). Wahrscheinlich begann der Bau in dem Jahre 1172, in welchem auch die Dome zu Braunschweig und Lübeck gegründet wurden. Im Mai 1858 untersuchte ich die Kirche, welche ich lange nicht gesehen hatte, vorzüglich wegen der Wandmalereien, da von mehrern Seiten geäußert war, daß es sich schwer bestimmen lasse, ob die Wandmalereien alt oder jung seien. Die Wände der Kirche sind ganz mit Wandmalereien in grau bedeckt. Diese sind aber offensichtlich sehr jung und ohne Zweifel in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgeführt, als man anfing, die Kirchen im Innern auszuweißen und, freilich sehr schlecht, wieder zu bemalen. Zum Beweise dient, daß im nördlichen Kreuzschiffe das bekannte siebenschildige meklenburgische Wappen des Herzogs Christian Louis in einem Gemälde angebracht und in der Vierung gegen Norden das Bild des Herzogs in einem marmornen Relief in einen Pfeiler eingemauert ist. Etwas anders verhält es sich mit der Bemalung


|
Seite 310 |




|
der Fenster= und Thüreinfassungen und der Ecken der Pfeiler u. s. w. Diese sind mit spiralförmig gewundenen Bändern in roth, grün oder gelb und schwarz verziert. Diese Bemalung ist freilich auch jung, aber sie ist nach den alten Farben immer wieder aufgemalt, und unter den jungen Tünchen sitzt, nach Lauenburgs Untersuchungen, die erste, alte Bemalung unmittelbar auf den Steinen. Die Wände und Pfeiler der Kirche haben aber urspünglich im Rohbau gestanden, wie dies schon daraus hervorgeht, daß die Kirche nicht geputzt ist. An manchen Stellen ist beobachtet, daß an den Pfeilern Schichten von rothen und grün glasurten Ziegeln wechseln, wie an der Kirche zu Büchen und andern Kirchen. Ob aber in der Höhe, z. B. an den Gurtbogen, nicht noch alte Malereien zu finden sind, ist noch die Frage. Ueberhaupt verdient die Kirche, so wie der Kreuzgang, noch einer längern, gründlichen Untersuchung und Beschreibung und sollen diese Zeilen nur Andeutung und Anregung zur Erforschung geben.
Was den Dom zu Ratzeburg vor allen mir bekannten Ziegelkirchen auszeichnet, ist die Eigenthümlichkeit, daß das Mittelschiff und die eigenthümliche Eingangskapelle von weißlichen oder gelben Ziegeln 1 ) aufgeführt ist.
Besonders war mir die Besichtigung der S. Georgen=Kirche von Werth, welche noch nicht untersucht ist.
Während der Dom auf der Insel der Stadt steht, steht weit vor der Stadt hoch auf dem Ufer des Sees in malerischer Lage eine alte Kirche zum H. Georg, welche mit dem zu Meklenburg gehörenden Dome in engster Verbindung stand. Nach der Analogie unzähliger Beispiele sollte man glauben, die Kirche gehöre einem Georgen=Hospitale an, welches fast jede Stadt vor den Thoren hatte. Dies ist aber nicht der Fall. Zu den Zeiten der Stiftung des Bisthums (1154) war der Bischofssitz auf dem S. Georgenberge vor Ratzeburg, wo schon ungefähr hundert Jahre vorher ein Kloster gegründet gewesen war; es war jedoch schon 1158 beschlossen, auf der Insel eine Kirche zu erbauen, deren Gründung aber wohl erst in das Jahr 1172 fällt (vgl. Masch a. a. O. S. 76).


|
Seite 311 |




|
Der Baustyl der S. Georgen=Kirche ist nun für die Vergleichung mit der Baugeschichte des Doms von großer Wichtigkeit. Die Kirche bildet ein langes, einschiffiges Rechteck und ist im Osten durch eine grade Altarwand geschlossen. Halbkreisförmige Apsiden sind nicht vorhanden. Leider ist an der Kirche überall viel verbauet, zerstört und übertüncht.
Der viereckige Chor, welcher außen mit Kalk übertüncht ist, hat zu beiden Seiten noch Reste von einem doppelten Rundbogenfries, der immer von zwei sich durchschneidenden Halbkreisen gebildet ist. Der Triumphbogen ist rund gewölbt. Wahrscheinlich ist der Chor der älteste Theil der Kirche.
Das Schiff ist von rothen Ziegeln gebauet, hat Lissenen und zwei, jetzt zugemauerte, einfache Rundbogenpforten; die Fenster werden rundbogig gewesen sein, sind aber sehr verbauet und schwer erkennbar. Das Schiff hat jedoch keinen Rundbogenfries, sondern einen Zahnfries aus einer dreifachen Reihe von Zahnschnitten.
Das Thurmgebäude oder das westliche Drittheil der Kirche ist unten zur Kirche gezogen. Dieser Theil ist für die Baugeschichte der ratzeburger Kirchen vielleicht sehr wichtig. Das Gebäude steht auf einem Granitfundament, welches mit rothen Ziegeln erhöhet ist; die Hauptmauern bestehen aber aus denselben gelben Ziegeln, aus denen der Haupttheil des Domes erbauet ist, haben jedoch Ecken aus rothen Ziegeln, welche von den Fundamenten hinaufreichen. Die Fenster sind rundbogig, wie am Dome; ein Fries fehlt. Die westliche Pforte im Thurm ist aber schon altspitzbogig. Dieser Theil der Kirche ist wahrscheinlich der jüngste und in Berücksichtigung der seltenen gelben Ziegel vielleicht in der letzten Zeit des Dombaues ausgeführt.
Diese Beobachtungen sollen nur leitende Andeutungen sein. Wünschenswerth wäre eine genaue Untersuchung, Vergleichung und Beschreibung der beiden Kirchen und der Kreuzgänge, wozu jedoch mehr Zeit gehört, als mir vergönnt war; jedenfalls dürften einige Tage und Vorrichtungen zur Untersuchung der Gurtbogen und Gewölbe dazu gehören.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 312 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Neuenkirchen
bei Bützow oder Schwaan ist schon in den Jahrbüchern X, S. 310 richtig beschrieben, jedoch muß ich nach wiederholter Untersuchung manche Eigenthümlichkeit bestimmter aussprechen und neue Entdeckungen hinzufügen.
Die Kirche, welche aus einem viereckigen gewölbten Chor und einem oblongen Schiffe von zwei Gewölben Länge besteht, ist im Styl und in den Verhältnissen sehr schön, tüchtig und würdig gebauet und gehört zu den schönsten Kirchen gleicher Größe im Lande.
Die Kirche ist aus Feldsteinen gebauet mit Ziegeleinfassungen an Fenstern und Thüren; jedoch sind im Schiffe nach oben hin mehr Ziegel angewandt, als im Chor.
Der Chor ist ganz bestimmt im rundbogigen oder romanischen Baustyle aufgeführt. Alle Fenster, welche mit glatter Laibung schräge eingehen, und die Pforten sind rund gewölbt und das Gewölbe ist ein romanisches Gewölbe ohne Rippen.
Von hohem Interesse ist die Bemalung der Außenwände des Chores. Die natürlich sehr unregelmäßigen Lücken des Feldsteinbaues sind mit altem, festen Kalkputz ausgefüllt, aus welchem die einzelnen glatten Feldsteinflächen hervorsehen. In diesen Kalkputz sind breite Fugen nicht tief eingeritzt, so daß dadurch im Ganzen die Unregelmäßigkeit der Feldsteine ausgeglichen wird; diese eingerissenen Fugen bilden große Quadern, nach Form des Werksteinbaues. Die Feldsteine sind dunkelgrau, der Kalkputz ist gelblichgrau, die eingerissenen Fugen aber sind mit einem schönen Roth bemalt gewesen. Noch wichtiger ist aber, daß oben ein Fries mit weißem Kalk angeputzt ist, welcher mit romanischem Ornament in roth bemalt ist. Leider sind nur noch wenig Ueberreste von dieser äußern Bemalung übrig.
Das Schiff ist ein etwas jüngerer, alter Uebergangsbau mit gespitzten Fenstern und Thüren. Auch der Triumphbogen zwischen Chor und Schiff, welcher immer zum Bau des Schiffes gehört, ist spitzbogig.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 313 |




|



|



|
|
|
Die Kirche zu Bützow.
Die Kirche zu Bützow, welche schon früher in Mantzel's Bützowschen Ruhestunden, 1761 flgd., in verschiedenen Theilen, und in Geisenhayner's Mecklenburgischen Blättern I, 1818, Stück 10 und 11, darauf aber in den Jahrbüchern, III, B, S. 137 flgd. und X, A, S. 302 flgd., auch VIII, S. 4 flgd. und XV, S. 314 beschrieben ist, hat jetzt zwar ihre richtige Würdigung gefunden, verdient aber eine noch genauere Beschreibung und Beurtheilung, welche jetzt theils erleichtert, theils vernothwendigt ist, da die Kirche gegenwärtig (1858 - 1859) in der Restauration begriffen ist.
Die Kirche hat als ein ungewöhnlich schönes Bauwerk in neuern Zeiten oft die Aufmerksamkeit der Kunstkenner und Architekten auf sich gezogen; namentlich hat aber, Essenwein in seinem Werke: "Norddeutschlands Backsteinbau im Mittelalter" die Kirche vor vielen andern der Aufmerksamkeit werth gehalten und mehrere Gegenstände aus derselben beschrieben und abgebildet.
In den Jahrbüchern X, S. 303 ist die Beobachtung auseinandergesetzt, daß die Kirche aus mehrern ganz verschiedenen Theilen besteht. Der Altarraum ist in der Zeit 1365 - 1375 neu angebauet; die übrigen Theile der Kirche sind aber viel älter und zwar fortschreitend von Osten gegen Westen immer jünger.
Die Kirche ist jetzt eine Hallenkirche mit drei gleich hohen Schiffen, von denen das Mittelschiff weit, die Seitenschiffe aber schmaler sind, und einem gleich hohen, weiten polygonen Chorschluß von drei großen Kapellen.
Die Eigenthümlichkeiten des ganzen Baues lassen sich wesentlich nur aus dem Mittelschiffe, abgebildet in Lisch Meklenburg in Bildern, III, zu S. 7 flgd., erkennen, da das Aeußere, von rothen Ziegeln, ziemlich gleichmäßig für den ersten Anblick umgestaltet ist.
Die Kirche besteht nach den Untersuchungen im Innern aus fünf verschiedenen Theilen. Jeder Theil der eigentlichen Kirche hat im Innern zwei Pfeilerpaare, von denen jedoch immer nur ein Paar ganz vollständig ist, das zweite Paar aber nur in je zwei halben Pfeilern, welche sich zu beiden


|
Seite 314 |




|
Seiten an die Hälften der nächstfolgenden jüngern Pfeiler lehnen und mit diesen zusammen einen ganzen Pfeiler aus zwei verschiedenen Hälften bilden. Die ganze Kirche hat jetzt 16 Pfeiler oder 8 Pfeilerpaare.
1) Die alte Kirche. Gegen Osten hin vor dem Chore stehen die Reste der alten Kirche, wie wir sie nennen wollen, im Mittelschiffe ein Raum von zwei Gewölben Länge, welche jetzt auf einem ganzen Pfeilerpaare und zwei halben Pfeilerpaaren ruhen. Dies ist das Schiff der alten Kirche, an welche früher wahrscheinlich eine kleinere, viereckige Altarkirche im Osten angebauet war, welche in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts dem weiten polygonen Chorschluß Platz machen mußte. Diese alte Kirche war sehr niedrig und nur halb so hoch, als die jetzige Kirche. Es sind nicht allein die Pfeiler mit ihren Kapitälern, sondern auch noch ziemlich bedeutende Reste von den Gurtbogen vorhanden. Als ein neuerer Theil angebauet ward, wurden die Gurtbogen zum Theil ausgebrochen und die Pfeiler mit schlichtem, rohem Mauerwerk ohne irgend einen Schmuck bis zur Höhe der neuen Pfeiler erhöhet und beide Theile in gleicher Höhe überwölbt. Die Pfeiler dieser alten Kirche sind an den vier Seiten mit Halbsäulen und eben so an den vier Ecken in den Winkeln bekleidet und haben schön und kräftig modellirte, mit Weinlaub geschmückte Kapitäler aus Ziegel, welche alle gleich sind. Die Gurtbogen in der Länge sind nach den vorhandenen Resten noch im Halbkreise gewölbt gewesen. Dies ist ohne Zweifel die alte Kirche, welche der Bischof Brunward von Schwerin schon vor dem Jahre 1229 geweihet hatte (vgl. Jahrb. VIII, S. 5), welche also im ersten Viertheil des 13. Jahrhunderts erbauet sein muß. Diese alte Kirche hatte dieselbe Breite, welche jetzt noch die ganze Kirche hat; man sieht dies klar an den Resten der alten Pilaster, welche noch im Innern an den Seitenwänden stehen; diese Breite ist also im Laufe der Zeit für die ganze Kirche maaßgebend gewesen. Dieser Theil hat noch keine Strebepfeiler. Die mit Weinlaub schön gezierte, schon spitzbogige Hauptpforte 1 ) in der Nordwand gehört noch zu der alten Kirche; die Fenster sind aber in jüngern Zeiten umgestaltet, erhöhet und erweitert. Von außen ist gewaltig viel Schutt gegen die Kirche gekommen, so daß man jetzt viele Stufen in die Kirche hinabsteigen muß; es liegt jetzt im ganzen Lande wohl keine Kirche so tief, als die bützowsche.


|
Seite 315 |




|
Die Straßen umher und der Marktplatz liegen aber jetzt eben so hoch; es muß also nach den Bränden in alter Zeit der meiste Schutt in die Straßen und auf die öffentlichen Plätze geschüttet sein, vielleicht mit Absicht, weil die Umgebung der Stadt niedrig und sumpfig ist und die Stadt vielleicht nicht ganz auf festem Boden steht. Die Ziegel dieses Theiles sind ausgezeichnet, hart und glatt und in den Verzierungen vortrefflich modellirt. Einzelne ungewöhnliche Erscheinungen kommen sonst in Meklenburg wohl nicht weiter vor. So sind z. B. die starken Dienste oder kleinen Halbsäulen in den Winkeln aus Stücken zusammengesetzt, von denen jedes gegen 6 Fuß lang ist.
2) Das neue Schiff. An den alten Teil lehnt sich gegen Westen hin ein neuerer Bau von gleicher Länge, zwei Gewölbe lang, welcher an jeder Seite in der Längenaxe durch einen Gurtbogen im strengen, alten Spitzbogen mit den angrenzenden Theilen in Verbindung steht. Diese neue Kirche ist der alten Kirche ähnlich gebauet, aber noch einmal so hoch, als die alte Kirche gewesen ist. Die Pfeiler sind ebenfalls mit Halbsäulen bekleidet, welche ebenfalls reich geschmückte, kräftig modellirte Kapitäler tragen; diese Kapitäler sind jedoch nicht mit demselben Weinlaub verziert, sondern haben sehr verschiedenartige Verzierungen aus verschiedenem Laubwerk, grotesken Menschen= und Thiergestalten, Menschenköpfen, alles aus hoch modellirten, gebrannten Ziegeln. Dieser Theil, welcher schon einen hohen, strengen Spitzbogen zeigt, ist ohne Zweifel in der zweiten Hälfte (vielleicht im dritten Viertheil) des 13. Jahrhunderts bald nach der Gründung des Collegiatstiftes im J. 1248 gebauet. Dieser Theil hat schon eine höhere, schlankere Pforte, Strebepfeiler im Aeußern, und sonstige Eigenthümlichkeiten des Spitzbogenstyls.
3) Der alte Thurm. An die neue Kirche ist gegen Westen hin ein alter Thurm angelegt. dessen untere Räume mit zur Kirche gezogen sind. An den Ecken stehen 4 starke rechtwinklige Pfeiler in glattem Mauerwerk ohne allen Schmuck; diese Pfeiler springen weit in das Mittelschiff vor und sind dazu bestimmt gewesen, einen Thurm zu tragen. Zwischen je zwei starken Pfeilern steht ein ähnlicher, viel schmalerer Pfeiler, um die Gewölbe zu tragen. Vielleicht ist die Thurmspitze im Mauerwerk nie zur Ausführung gekommen, vielleicht abgetragen; so viel ist aber gewiß, daß der untere Raum seit alter Zeit, wie jetzt, zur Kirche gezogen ist. Diese Thurmanlage stammt sicher auch noch aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist ohne Zweifel bald nach dem neuen Schiffe erbauet.


|
Seite 316 |




|
4) Der neue Chor. Gegen Osten lehnt sich an die alte Kirche ohne Gurtbogen der neue polygone Chorschluß, in der Gestalt und Anlage der übrigen großen Kirchen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dieser neue Chor ist kurz vor dem J. 1364 gegründet und im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts unter dem Bischofe Friedrich II. v. Bülow, 1365 - 1375, gebauet (vgl. Jahrb. X, S. 304, und XV, S. 315). Dieser Chor hat einen hohen Granitsockel und viele starke Strebepfeiler, welche mit dem Wappen des genannten Bischofs geziert sind.
5) Der neue Thurm. Im Westen ist an die alte Thurmanlage der jetzige dicke Thurm gebauet. Dieser Bau stammt aus jüngerer Zeit, vielleicht aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts. Dies geht schon daraus hervor, daß die Pforte unten mit dem erhöheten Straßenpflaster gleich liegt; der Thurm kann also erst erbauet sein, als die alte Aufschüttung um die Kirche schon vollendet war.
Dies ist ungefähr der Bau der merkwürdigen Kirche. Von noch größerer Merkwürdigkeit ist aber die innere Färbung derselben. Die Ringmauern, welche in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts beim Anbau des neuen Chores vielfach umgestaltet und in eine ziemlich gleiche Form gebracht sind, der neue Chor gegen Osten und der neue Thurm gegen Westen sind von rothen Ziegeln gebauet. Das Innere der alten Theile (1. der alten Kirche, 2. des neuen Schiffes und 3. des alten Thurmes) d. h. die Pfeiler, Kapitäler, Gurtbogen, Gewölbe, sind aber von gelbweißen Ziegeln von ganz ungewöhnlicher Güte ausgeführt. Dies ist eine Merkwürdigkeit, welche die Kirche vor allen andern Meklenburgs auszeichnet. So viel ich mich erinnere, ist nur das Mittelschiff und die Vorhalle des Domes zu Ratzeburg und der alte Theil der S. Georgen=Kirche vor Ratzeburg aus gleichen Ziegeln und die Marienkirche zu Rostock im Aeußern mosaikartig aus gelbweißen und dunkelgrün glasurten Ziegeln gebauet. Die Ziegel von Bützow und Rostock sind wohl gewiß in Schwaan gemacht und auf der Warnow nach Bützow und Rostock gebracht, wie jetzt die Ziegel zur Restauration der bützowschen Kirche wieder in Schwaan verfertigt werden. Die Kirche war in jüngern Zeiten stark mit Kalk verschmiert und die Architektur zur Anbringung von Chören, Stühlen, Epitaphien und Bildern auf eine barbarische Weise mitgenommen. Es gab Pfeiler, an denen unten jede Halbsäule in verschiedenen Höhen und Richtungen abgehauen war; ja man war sogar in den viereckigen Kern der Pfeiler gedrungen. Dies ist die erste "Reparirung" des vori=


|
Seite 317 |




|
gen Jahrhunderts. An der westlich belegenen Wand des nördlichen Seitenschiffes stand folgende Inschrift:
Diese Kirche ist vordem der heiligen Elisabeth geweihet, nun aber dem dreieinigen Gott zu Ehren repariret. MDCCXXIIX.
Die erste Sorge bei der Restauration war, die Architektur von der Kalktünche möglichst zu befreien und alle Gliederungen wieder herzustellen und zur Anschauung zu bringen. Bei dieser Restaurationsarbeit hat sich ergeben, daß die Kirche in alter Zeit ganz im Rohbau stand, nur die natürlichen Farben zeigte und, wie gewöhnlich die Spitzbogenkirchen, nicht mit einer durchgehenden Malerei geschmückt war. Diese eigenthümlichen Farben des Rohbaues werden gegenwärtig bei der Restauration wieder hergestellt.
Die Malereien, welche sich in der Kirche fanden, waren einzelne Stücke, welche besondere Beziehungen hatten. Es wurden bei der Restauration folgende Wandmalereien entdeckt, welche jedoch so verblichen und zerstört waren, daß sie kaum erkannt und nicht erhalten werden konnten. Diese Malereien waren folgende.
An der Südwand der alten Kirche neben dem Fenster
war ein Bild der H. Katharina in Lebensgröße mit
der Inschrift in großen Minuskeln zu beiden
Seiten der Krone:
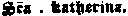 Die rohe Mauer war nur ein Mal
übergetüncht, nicht geputzt, und darauf die
Gestalt in derben Umrissen gemalt. Hier stand
der Altar der H. Katharina; im
Visitations=Protocolle von 1555 heißt es:
"Zur linken Handt am khor Sanct Katharinen
altar". Dieser Altar ward im J. 1365
gegründet; vgl. Jahrb. X, S. 229 und XV, S. 315;
der gestickte schmale Altarbehang ist noch
vorhanden. Um jene Zeit wird der Anbau des neuen
Chores schon begonnen und die Umgestaltung der
Fenster schon durchgeführt sein.
Die rohe Mauer war nur ein Mal
übergetüncht, nicht geputzt, und darauf die
Gestalt in derben Umrissen gemalt. Hier stand
der Altar der H. Katharina; im
Visitations=Protocolle von 1555 heißt es:
"Zur linken Handt am khor Sanct Katharinen
altar". Dieser Altar ward im J. 1365
gegründet; vgl. Jahrb. X, S. 229 und XV, S. 315;
der gestickte schmale Altarbehang ist noch
vorhanden. Um jene Zeit wird der Anbau des neuen
Chores schon begonnen und die Umgestaltung der
Fenster schon durchgeführt sein.
Etwas weiter gegen Westen war eine große Nische mit Ranken und Laubwerk bemalt.
An der südlichen Seite des mittlern Pfeilers des neuen Schiffes, also im südlichen Seitenschiffe, war eine große Figur auf die Wand gemalt. Es war jedoch nur sehr dunkel etwas von den Umrissen zu erkennen; klar war zu den Füßen der Figur ein Kind, ein Hirsch und ein Wasser mit kleinen Fischen. Vielleicht ist diese Figur der H. Christoph gewesen, welcher hier in alten Zeiten der Südpforte gegenüber stand, aber später verdeckt oder an einer andern Stelle gemalt ward, wo sie mehr in die Augen fiel.


|
Seite 318 |




|
An dem correspondirenden nördlichen Mittelpfeiler des neuen Schiffes war auf dessen Südseite, also gegen das Mittelschiff gekehrt, der H. Christoph in kolossaler Gestalt, 11 1/2 Fuß groß, auf die Wand gemalt. Wahrscheinlich war dies eine etwas jüngere Malerei, um das Bild mehr zur Anschauung zu bringen, da im Mittelalter der Glaube herrschte, daß man an dem Tage nicht sterben werde, an welchem man den H. Christoph gesehen habe.
Die dem Mittelschiffe zugekehrte Seite des nördlichen Pfeilers zunächst dem alten Thurmgebäude und die innern Wände der Pfeiler der alten Thurmanlage waren ganz mit figürlichen Darstellungen bemalt, jedoch waren die Farben so verblichen und die Kalktünche ließ sich trotz aller Sorgfalt nicht so entfernen, daß irgendwo ein Zusammenhang erkannt werden konnte.
Der Altar der Kirche zu Bützow, der ehemalige Hochaltar des bischöflich=schwerinschen Collegiatstiftes daselbst, ein großer Flügelaltar mit doppelten Flügeln, ist eines der größten, reichsten und sinnreichsten Altarwerke im Lande und verhältnißmäßig gut erhalten, namentlich in der Malerei der Flügel, welche nur sehr wenig durch die Zeit gelitten hat. Der Altar ist ein Geschenk des thätigen Bischofs Conrad Loste von Schwerin, da er nach der Inschrift über dem Altare im J. 1503 vollendet ward und der Bischof am 24. Dec. 1503 starb; sein Nachfolger im Amte Johann Thun (seit 7. März 1504) vollendete und weihete ihn: beides wird durch die Wappen der beiden Bischöfe auf der Predelle bewiesen. Schon hiedurch wird dieser Altar sehr wichtig für die Kunstgeschichte, indem er eine feste Zeitbestimmung giebt und eine Vergleichung für viele ähnliche Werke zuläßt.
Von großem Interesse wird der Altar aber durch seinen Inhalt, welcher höchst merkwürdig und selten ist. Der Inhalt war, namentlich bei dem großen Reichthum der Darstellung, sehr schwer zu erforschen und bisher weder im Einzelnen, noch im Ganzen erkannt; nur wiederholte, lange Anstrengungen und Forschungen an Ort und Stelle haben es möglich gemacht, den Inhalt bestimmt darzustellen und in Zusammenhang zu bringen.
Die Kirche des im J. 1248 gestifteten Collegiatstiftes zu Bützow war nach der Stiftungs=Urkunde (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 94 flgd.) dem Herrn Jesu Christo, der Jungfrau Maria, dem Evangelisten Johannes und der heiligen


|
Seite 319 |




|
Elisabeth geweihet. Die Weihung für Christus und Maria verstand sich von selbst, da sie allen Kirchen gemein war; Maria und Johannes der Evangelist waren jedoch die Schutzheiligen des Domes und Bisthums zu Schwerin, von welchem das Collegiatstift Bützow abhängig war: der besondere Schutzheilige des Domes zu Schwerin war also der Evangelist Johannes. Die besondere Heilige der Kirche zu Bützow war aber die heilige Elisabeth von Ungarn, welche im J. 1231 starb und im J. 1235 heilig gesprochen ward, also zur Zeit der Gründung des Collegiatstiftes Bützow (1248) noch eine sehr junge Heilige war. Die Kirche zu Bützow war also eine Elisabeth=Kirche. Späterhin ist aber noch eine andere Local=Heilige dazu gekommen, die viel verehrte H. Katharine. Die Verehrung der Maria blieb überall fest und dieselbe. Statt derselben trat oft die heilige Anna, die Mutter der Maria, ein, mit welcher immer zugleich Maria und Christus verehrt ward, da die H. Anna immer die Maria und Christum zugleich auf den Armen oder neben sich hat.
Daher werden im Laufe der Zeit immer die H. Anna, der Evangelist Johannes, die H. Katharine und die H. Elisabeth als besondere Schutzheiligen der bützowschen Kirche dargestellt und hatten auch ihre besonderen Altäre in der Kirche. Daher ist die große Glocke vom J. 1412 der Jungfrau Maria, dem Evangelisten Johannes, der H. Elisabeth und der H. Katharina geweihet ("in honorem Dei et virginis Marie et s. Johannis evangeliste, Elisabeth et Catharine"; vgl. Geisenhayner Mecklenb. Blätter I, 10, S. 566), und daher sind auf den zweiten Flügeln des Hochaltars auch Anna, Johannes Ev., Katharine und Elisabeth als besondere Heilige der Kirche in ganzer Größe dargestellt. Die Kirche blieb im Besondern aber immer der H. Elisabeth geweihet, welche auch immer als die letzte Heilige der Kirche dargestellt wird.
Aus dieser geschichtlichen Entwickelung ist es gekommen, daß der Altar der Kirche zu Bützow fast allein weiblichen Heiligen geweihet ist und den reichsten weiblichen Heiligen=Cultus darstellt, der im Lande zu finden ist. Wenn aber auch die Vorderseite des Altars eine ungewöhnliche Fülle von weiblichen Heiligen zeigt, so enthält doch der ganze Altar eine große Tiefe, indem er sehr weit reicht und, theils nach dem Neuen Testament, theils nach der zur Zeit der Verfertigung des Altars ausgeprägten Legende, die Geschichte des Heils von den ersten Anfängen bis zur H. Elisabeth, der jüngsten Heiligen, in weiblichen Heiligen darstellt, Der innere Zusammenhang ist folgender.


|
Seite 320 |




|
Auf der Predelle sind dargestellt die Mütter der Vorläufer und Stifter des Neuen Bundes: die Elisabeth, die Mutter Johannis des Täufers, die Anna mit ihrer Tochter Maria, der Mutter Jesu, die beiden Schwestern der Maria, beide auch Maria geheißen, die Mütter von 6 Aposteln, Johannes Ev. und Jacobus d. ä., Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j., und die Mutter des Apostels Petrus, alle mit ihren Ehemännern und Söhnen, welche als Kinder dargestellt sind.
Die ersten Flügel enthalten oben die Geschichte der Anna, der Mutter Mariä, bis zur Geburt der Maria, und unten die Geschichte der Maria bis zur Geburt Jesu.
Die Mitteltafel enthält die Verherrlichung der Jungfrau Maria und zugleich Christi, nämlich Mariens Tod, Himmelfahrt und Krönung. Neben diesen Darstellungen sind vier männliche Heilige dargestellt, Ausnahmen von der ganzen Tendenz.
Auf der Vorderseite der Flügel stehen die Bildsäulen von zwölf weiblichen Heiligen, von denen die H. Elisabeth die letzte ist. Dieselben Heiligen, mit Ausnahme von zwei, sind auch auf dem bronzenen Taufkessel dargestellt, stehen also zu der Geschichte und Verfassung der bützowschen Kirche in näherer Beziehung.
Auf den zweiten Flügeln stehen die besonderen Heiligen der Kirche: die H. Anna, der Evangelist Johannes, die H. Katharine und die H. Elisabeth. Die Jungfrau Maria bildet immer den Mittelpunct, die H. Elisabeth den Ausgangspunct.
Erst auf dem Fuße des Altars kommt die Leidensgeschichte Christi, in Beziehung zu dem Abendmahl, zur Darstellung.
Die einzelnen Darstellungen sind nun folgende.
Die vordere Ansicht des Flügelaltars ist ganz mit vergoldeten und bemalten, aus Eichenholz geschnitzten Figuren geschmückt und besteht aus einer Mitteltafel und zwei Flügeln.
Die Mitteltafel enthält ein mittleres Hauptstück und an jeder Seite zwei Nischen über einander mit Heiligenbildern.
Das mittlere Hauptstück der Mitteltafel enthält:


|
Seite 321 |




|
a) unten: Mariä Tod 1 ): umher stehen die zwölf Apostel, von denen Johannes der Maria das Licht hält; einer der Apostel zu den Füßen hält sich eine Brille vor;
b) in der Mitte: Mariä Himmelfahrt: Christus in der vollen Glorie fährt mit der Maria in ganz kleiner Gestalt zum Himmel empor; an jeder Seite schwebt eine Gruppe von singenden Engeln mit Spruchbändern in den Händen;
c) oben: Mariä Krönung: auf einem Throne sitzen in der Mitte Maria, ihr zur Rechten Gott der Vater, ihr zur Linken Christus.
Die Nischen zu den Seiten enthalten:
zur Rechten oben: Johannes den Täufer mit einem Lamm;
zur Rechten unten: den H. Leonhard (?), einen Bischof mit einem Bischofsstabe in der Rechten und einer Kette mit Fußfessel in der linken Hand.
Die Gestalt des H. Leonhard ist nicht ganz bestimmt. Von alten Nebenaltären für männliche Heilige in der Kirche zu Bützow sind nur die Altäre S. Hipoliti, S. Hulperici, S. Laurentii und S. Nicolai bekannt.
Zur Linken oben: den H. Antonius in der Ordenstracht, mit einem offenen Buche und einer Glocke in den Händen und einem Schweine zu den Füßen.
Zur Linken unten: den H. Nicolaus, als Bischof, mit dem Bischofsstabe, an welchem ein Tuch (sudarium) hängt, in der rechten Hand, und einer Kirche mit zwei Thürmen neben einander im linken Arme. - Der H. Nicolaus hatte einen besondern Altar in der Kirche zu Bützow.
Von Bedeutung ist die Vergleichung des alten, jetzt zurückgesetzten Hochaltars der Kirche zu Schwerin, der Mutterkirche des Collegiatstiftes Bützow, welcher ungefähr aus derselben Zeit stammt. Die Mitteltafel enthält in perspectivischer Darstellung in der Mitte die Kreuzigung Christi, in der Ansicht zur Linken die Kreuztragung, zur Rechten das Jüngste Gericht; noch auf der Mitteltafel steht an jeder Seite dieser großen Darstellung eine große, durchgehende Heiligenfigur, zur Rechten Maria, zur Linken Johannes Ev., die Hauptheiligen des schweriner Domes. In den queer getheilten Flügeln stehen die 12 Apostel, und an jedem Ende ein Heiliger:


|
Seite 322 |




|
| oben: | links: | der H. Martin, ein Bischof, neben welchem ein Krüppel mit Holzschuhen liegt; |
| rechts: | der H. Leonhard, ein Bischof, mit Kette und Fessel in der Hand; | |
| unten: | links: | der H. Nicolaus, in einer Kappe, mit drei Broten im linken Arme; |
| rechts: | der H. Georg, mit dem Drachen zu den Füßen. |
Unten auf der Mitteltafel stehen in Rosetten die Brustbilder von sieben Propheten, in der Mitte David mit der Krone, Spruchbänder haltend. - Die Predelle ist jung.
Die Flügel des Altars der bützowschen Kirche enthalten zwölf weibliche Heilige, welche hier so aufgeführt werden, wie sie in der Ansicht von der linken zur rechten von oben nach unten folgen. In der Bestimmung sind der bronzene Taufkessel der Kirche zu Bützow, der Ordinarius ecclesiae Suerinensis vom J. 1519 und der ungefähr gleichzeitige Hochaltar der Marien=Kirche zu Parchim von wesentlichem Nutzen gewesen. Der Taufkessel, welcher nicht viel älter ist, als der Altar, enthält, mit Ausnahme von zwei Figuren, dieselben Heiligen; der Ordinarius enthält viele kleine Holzschnitte von Heiligenfiguren, wie sie im Bisthume Schwerin dargestellt wurden; der Altar zu Parchim enthält unter den Heiligenbildern die Namen der Heiligen.
oben:
1. Die H. Dorothea: gekrönte Heilige, mit einem geflochtenen Korbe mit drei Füßen im linken Arme; die rechte Hand (mit einer Rose) ist abgebrochen. Im Ordinarius hat sie einen Blumenkranz auf dem Haupte, auf dem parchimschen Altare hat sie einen Korb in der Hand und ein Kind zur Seite.
2. Die H. Christine (?) (oder H. Agathe?): gekrönte Heilige, betend mit gefaltenen Händen, ohne ein Attribut, welches sie auch nicht gehabt hat. Häufig wird die H. Apollonia so dargestellt, z. B. auch auf dem parchimschen Altare; da aber die H. Apollonia auf dem bützowschen Altare und auf dem Taufkessel mit der Zange mit einem Zahne zur Darstellung gekommen ist, so muß diese Heilige eine andere, ähnliche sein. Die H. Christine wird oft mit gebundenen, gefaltenen Händen dargestellt, wie sie von Pfeilen durchbohrt wird. Da aber die H. Ursula unten mit dem Pfeile vorkommt, so mag


|
Seite 323 |




|
hier die Wiederholung haben vermieden werden sollen. Auf dem Taufkessel ist diese Heilige nicht dargestellt.
3. Die H. Katharine: gekrönte Heilige mit einem halben Zackenrade im linken Arme; die rechte Hand (mit einem Schwerte) ist abgebrochen. Die H. Katharine war eine der Hauptheiligen der bützowschen Kirche; sie hatte seit 1365 einen eigenen Altar in der Kirche, neben welchem ihr Bild auf die Wand gemalt ist; auf den Flügeln des Altars steht ebenfalls ihr großes Bild.
unten:
4. Die H. Ursula: gekrönte Heilige mit einem geschlossenen Buche im linken Arme; die rechte Hand (mit einem Pfeile) ist abgebrochen. Ebenso, mit Buch und Pfeil, ist die H. Ursula auf dem Taufkessel, auf dem parchimschen Altare und im Ordinarius abgebildet; im Ordinarius fehlt die Krone.
5. Die H. Cäcilie: gekrönte Heilige, mit einer Orgel im linken Arme, die Hauptheilige des benachbarten Collegiatstiftes zu Güstrow und auch (schon 1220) eine Hauptheilige des Domes zu Schwerin (vgl. Lisch Meklenb. Urk. III, S. 67). Auf dem Taufkessel ist diese Heilige nicht dargestellt.
6. Die H. Barbara: gekrönte Heilige mit einem Becher in der rechten Hand; eben so ist sie auf dem parchimschen Altare dargestellt.
oben:
7. Die H. Margarethe: gekrönte Heilige mit einem kleinen Kreuze, welches oben zerbrochen ist, in der rechten Hand; im linken Arme trägt sie ein Buch, auf welchem ein Drache, ein braunes vierfüßiges Thier mit großem Rachen und langem Schwanze, liegt. Grade so ist sie auf dem parchimschen Altare dargestellt. Auf dem Taufkessel hat die H. Margarethe nur ein Kreuz in der Hand.
8. Die H. Agnes: gekrönte Heilige, mit einem offenen Buche im rechten Arme und einem weißen Lamm zu den Füßen.
9. Die H. Maria Magdalene: Heilige mit Kopftuch, mit einer Salbenbüchse im linken Arme und dem Deckel dazu in der rechten Hand. Sie hatte einen eigenen Altar in der bützowschen Kirche.
unten:
10. Die H. Gertrud: Heilige im Kopftuch, mit Hospital im linken Arme.


|
Seite 324 |




|
11. H. Apollonia: gekrönte Heilige, mit einer langen Zange mit einem Zahne in der linken Hand. Eben so ist sie im Ordinarius und auf dem Taufkessel dargestellt. Auf dem parchimschen Altare hat die H. Apollonia kein Attribut, wie sie auch oft dargestellt wird (vgl. oben 2. Agathe).
12. Die H. Elisabeth: Heilige im Kopftuch, mit einem großen Kruge in der rechten Hand und einem Teller mit zwei Fischen im rechten Arme. Eben so ist sie auf dem Taufkessel und auf einem Flügel des Altars dargestellt; vgl. unten bei der Beschreibung der Flügel. Die H. Elisabeth ist die Hauptheilige der Kirche zu Bützow.
Die Flügel.
Die ersten Flügel.
Die ersten Flügel sind einmal queer getheilt, so daß, wenn die vier Flügel geöffnet sind, sich dem Auge 8 Gemäldegruppen darstellen, von denen die 4 obern und die 4 untern je für sich im Zusammenhange stehen. Die 4 obern Gemälde enthalten nämlich die Freuden der H. Anna, der Mutter der H. Jungfrau Maria, die 4 untern Gemälde die Freuden der H. Jungfrau Maria, in letzter Beziehung auf die Geburt Jesu, und zwar in der Ansicht in folgender Reihe:
| 1. Joachims Opferversuch. | 2. Annens Verkündigung. | 3. Annens und Joachims Wiederfinden. | 4. Mariens Geburt. |
| 5. Mariens Tempelbesuch. | 6. Mariens Verlobung mit Joseph. | 7. Mariens Verkündigung. | 8. Christi Geburt. |
Die 4 obern Gemälde beziehen sich ohne Zweifel auf die Aeltern der Jungfrau Maria, Joachim und Anna, mit besonderer Beziehung auf die Freuden der H. Anna, und finden ihre Erklärung in den Legenden, welche zwar spät ausgebildet, aber zur Zeit der Verfertigung des bützowschen Altars allgemein bekannt waren, so daß man die Motive zu den 4 obern Gemälden fast ganz in den derzeitigen "Leben der Heiligen" wieder findet, z. B. in "Dat leuent der hylgen efte dat passionael. Basel. 1517. Samerdel. Fol. CIII".
1. Joachims Opferversuch. Joachim bringt zu einem Altare, an welchem ein Priester abwehrend steht, ein Lamm; hinter ihm kommen Andere mit Lämmern herbei und scheinen erschrocken und erstaunt.


|
Seite 325 |




|
Da Joachims Ehe mit Anna kinderlos war, so ging Joachim zum Tempel, um zu opfern, ward aber mit seinem Opfer von dem Priester zurückgewiesen, weil er wegen seiner Kinderlosigkeit verflucht und nicht würdig sei zu opfern. Joachim entwich daher von Nazareth auf einen Berg und verschwand vor seinem Weibe Anna.
2. Annens Verkündigung. Anna in dunklem, mit Gold verzierten Gewande sitzt in einem Gemache und blättert andächtig in einem Buche, während vor ihr ein Engel knieet.
Anna verschloß sich betrübt in ihrem Hause, zog Trauerkleider an und betete Tag und Nacht, bittend, daß Gott ihr ein Kind schenken und ihren Mann wieder zurückführen wolle, bis ihr der Engel Gabriel erschien und ihr die Erhörung ihrer Bitten verkündigte.
3. Annens und Joachims Wiederfinden unter der goldenen Pforte von Jerusalem. Die H. Anna empfängt umarmend einen Mann vor einer Stadt.
Der Engel Gabriel offenbarte das Geheimniß der Erhörung auch dem Joachim und gebot ihm, wieder heimzukehren, aber zuvor in Jerusalem zu opfern. Auf Geheiß des Engels Gabriel ging auch Anna nach Jerusalem, wo sie ihren Mann unter der goldenen Pforte wieder finden sollte. Beide fanden sich an der bezeichneten Stelle wieder.
4. Freude über Mariä Geburt. Bei einem Gastmahle sitzt am Tische obenan Joachim, rechts neben ihm Anna mit dem Marienkinde im Heiligenscheine auf dem Arme. Maria ist in Gestalt, Haar und Gewand hier eben so dargestellt, wie in den untern Bildern, welche immer sicher die Maria darstellen. Neben ihnen sitzen ein zweiter Mann und eine zweite Frau, hinter ihnen stehen Aufwartende.
Die H. Anna gebar die Maria und noch 2 Töchter, welche auch Maria genannt wurden. Die erste Maria gebar Jesum; die zweite Maria gebar den Evangelisten Johannes und den Apostel Jacobus d. ä.; die dritte Maria gebar die 4 Apostel Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j.
So redet die Legende.
Die 4 untern Gemälde enthalten 4 bekannte freudenreiche Ereignisse im Leben der H. Jungfrau Maria:
5. Mariens Tempelbesuch. Maria als dreijähriges Kind, die 15 Stufen des Tempels allein hinaufsteigend.
6. Mariens Verlobung mit Joseph. Ein Priester legt ein Band über beider Hände. Neben ihnen stehen andere Personen.


|
Seite 326 |




|
7. Mariens Verkündigung. Der Engel hält ein Spruchband mit den Worten:
Maria hält ein Spruchband:
8. Christi Geburt Vor der knieenden Maria liegt das Christkind auf dem Boden; davor knieet Joseph mit einem brennenden Lichte in der Hand; hinter Maria die Krippe mit Ochs und Esel.
Die zweiten Flügel.
Die zweiten Flügel sind nicht queer getheilt, sondern enthalten in jeder der 4 Tafeln ein großes Heiligenbild, jedes mit Landschaft hinter sich. Diese 4 Heiligenbilder werden die besondern Heiligen der Kirche zu Bützow, wie die Bilder auf den letzten Flügeln der Doppelflügelaltäre gewöhnlich die Localheiligen, darstellen. Die Kirche zu Bützow war im Allgemeinen der Jungfrau Maria und dem Evangelisten Johannes geweihet; diese waren die besonderen Heiligen der bischöflichen Hauptkirche zu Schwerin, von welcher das Collegiatstift in der bischöflichen Residenzstadt Bützow gestiftet war. Im Besondern war aber die Kirche zu Bützow der H. Elisabeth von Ungarn geweihet und daher Elisabeth=Kirche genannt.
Die Jungfrau Maria war auf der mittlern Haupttafel und auf den ersten Flügeln schon zur Darstellung gekommen, und daher ist ihre Darstellung auf den letzten Flügeln nicht zu erwarten. Die letzten Flügel enthalten nun folgende 4 Heiligenbilder, für die Ansicht in dieser Reihenfolge:
| 1. H. Katharina. | 2. H. Anna. | 3. Johannes Ev. | 4. H. Elisabeth. |
1. Die H. Katharina, eine gekrönte Jungfrau in voller Schönheit, mit dem offenen Buche in der rechten und dem Schwerte in der linken Hand, mit dem Rade neben dem linken Fuße, mit welchem sie die winzige Gestalt des Kaisers Maximin in den Staub tritt.
2. Die H. Anna mit Kopftuch, mit dem Christkinde auf dem Arme; neben ihr steht eine kleinere weibliche Figur, welche dem Christkinde einen Apfel reicht Die große Figur, Anna, ist bejahrt dargestellt und hat ein weißes Kopf= und Kinntuch. Die kleinere, junge weibliche Figur, Maria, hat langes röthliches Haar. Alle drei Figuren haben Heiligenscheine; im Heiligenscheine ist das bekannte Lilienkreuz.


|
Seite 327 |




|
3. Der Evangelist Johannes, mit einem goldenen Kelche in der linken Hand, aus welchem sich ein grünes Thier, ein Lindwurm, erhebt. Johannes ist in ein rothes Untergewand und ein grünes Obergewand gekleidet.
4. Die H. Elisabeth, als Frau, in braunem Untergewande und grünem Obergewande, mit einem weißen Kopftuche, im rechten Arme eine Schüssel mit zwei röthlichen Fischen, welche am Kopfe ausgekehlt sind, in der linken Hand einen goldenen Krug haltend; im Hintergrunde das Meer mit einem Schiffe.
Diese Heiligenfigur, welche auf meklenburgischen Altären öfter vorkommt, wird jetzt häufig für die Jungfrau Maria ausgegeben, und für eine besondere Symbolisirung der Jungfrau Maria gehalten. Dies ist vielleicht auf Vorgang von A. v. M.(ünchhausen's) Attribute der Heiligen, Hannover, 1843, S. 57, geschehen, weil derselbe hier dieses Heiligenbild für die Jungfrau Maria erklärt, indem er "das Bild des Fisches auf den Messias und die Christen, den Krug vielleicht auf das Wasser des Lebens" deutet. Ich kann mich mit dieser Deutung nicht einverstanden erklären, denn ich kann mich nicht überwinden, zu glauben, daß auf einem und demselben Kirchengeräthe eine und dieselbe Heilige in zwei verschiedenen Gestalten dargestellt worden sei. Nicht allein auf dem Altare, sondern auch auf dem bronzenen Taufkessel der Kirche zu Bützow kommt diese Heilige neben der Maria vor. Auch kann ich nicht annehmen, daß die besondere Heilige der Kirche auf den Flügeln ihres Hauptaltars gar nicht zur Darstellung gekommen sein sollte. Schon aus diesem Grunde kann diese Figur keine andere sein, als die H. Elisabeth. Die H. Elisabeth war zwar erst im J. 1231 gestorben und erst im J. 1235 heilig gesprochen, und das Collegiatstift zu Bützow war schon im J. 1248 gestiftet; aber dennoch war die Kirche zu Bützow der H. Elisabeth geweihet, nach den ausdrücklichen Worten der Stiftungsurkunde: "ad laudem et gloriam sancte Elisabeth" (Lisch Meklenb. Urk. III, S. 95, vgl. Jahrb. VIII, S. 5). Und hiemit stimmt denn auch der Ordinarius ecclesiae Suerinensis vom J. 1519 (vgl. Jahrb. IV, S. 158), eine neu erlassene Richtschnur des Gottesdienstes für das Bisthum Schwerin, überein; dieses enthält bei den Tagen der Hauptheiligen kleine Darstellungen der Heiligen in Holzschnitt, und unter diesen auch Q III. die H. Elisabeth. Diese ist hier fast eben so, wie auf dem Altare, dargestellt, als eine Frau mit einem Kopftuche, mit einem Kruge von derselben Gestalt in der rechten und einem langen Brote in der linken Hand, vor


|
Seite 328 |




|
ihr ein Krüppel. Die Abweichung liegt allein darin, daß sie im Ordinarius ein Brot, auf dem Altare und dem Taufkessel einen Teller mit zwei Fischen in der einen Hand hält; das unterscheidende Attribut scheint der Krug zu sein. Die ausgekehlten Fische sind nach der Gestalt gesalzene Heringe, welche im Mittelalter in den nördlichen Gegenden viel an die Armen vertheilt wurden. Ich kann mich daher nur dahin entscheiden, daß die heilige Frau mit dem Kruge und dem Fischteller die H. Elisabeth sei, indem grade die Kirche zu Bützow lebhaft dafür redet.
Die Predelle
des Altars zu Bützow ist ebenfalls aus Eichenholz geschnitzt und bemalt und ungewöhnlich reich und kräftig gearbeitet. Sie hat 5 Abtheilungen, mit Baldachinen gekrönt; queer durch gehen Sessel oder Bänke mit Rücklehnen, auf denen heilige Frauen mit Kindern sitzen und hinter denen Männer stehen, welche Früchte hinüber reichen. Der Zweck ist die Darstellung der Mütter, deren Söhne den Neuen Bund vorbereiteten, schufen und vollendeten. Der ganzen Darstellung liegt eine tiefe Idee zum Grunde, wenn auch viel Legende eingemischt ist. Die architektonische Darstellung ist so, daß die Predelle durch zwei hervorragende Pfeiler in 3 gleich große Abtheilungen getheilt ist, von denen die mittlere ungetheilt geblieben, jede der beiden Seitenabtheilungen aber durch einen zurückliegenden Pfeiler in zwei schmalere Abtheilungen geschieden ist. Die mittlere größere Abtheilung ist für Maria, die Mutter Jesu, bestimmt; in den andern 4 kleineren Abtheilungen haben andere heilige Frauen Platz gefunden. Die Erkennung und Erklärung war schwierig und mag noch nicht ganz sicher sein. Die folgende Beschreibung nimmt den chronologischen Gang.
In der mittlern, größern Abtheilung sitzt Maria, die Mutter Jesu, als Hauptperson, um welche sich andere Darstellungen drehen.
Maria, die Mutter Jesu, trägt eine Krone; die übrigen Frauen haben eine weiße Mütze oder ein weißes Tuch auf dem Haupte.
1) In der äußersten Nische zur Rechten der Maria sitzt Elisabeth, die Mutter Johannis des Täufers, und hält einen Knaben, der ein Lamm in den Armen hat, also den Johannes den Täufer, auf dem Schooße; hinter der Bank steht der Priester Zacharias in Priestertracht und Priestermütze, der Mann der Elisabeth, und reicht eine Frucht herüber.


|
Seite 329 |




|
2) In der mittlern Nische sitzt die gekrönte Jungfrau Maria, die Mutter Jesu, und hält Jesum als Kind auf dem Schooße. Ihr zur Linken sitzt eine andere weibliche Figur mit weißem Kopftuche, wohl Anna, die Mutter der Maria, und reicht dem Kinde eine Frucht. Hinter der Maria steht ihr Mann Joseph und hält sie; hinter der Anna stehen die Heiligen Drei Könige und sehen über den Stuhl.
In den Nischen zunächst rechts und links von der Maria sitzen die beiden Schwestern der Maria, welche auch Maria hießen, mit ihren Kindern.
3) In der Nische rechts zunächst der Maria sitzt Maria (Salome), die eine Schwester der Maria, der Mutter Jesu, mit ihren beiden Söhnen, Johannes dem Evangelisten und Jacobus d. ä. Sie reicht dem einen Knaben, welcher einen Kelch in der Hand hält, also dem Johannes dem Evangelisten, die Brust, während neben ihr zur Rechten ein Knabe mit Hut und Pilgertasche, also Jacobus d. ä. steht. Hinter der Bank steht ihr Mann Zebedäus, welcher dem Knaben Jacobus eine Frucht reicht.
4) In der Nische links zunächst der Maria sitzt Maria, die andere Schwester der Maria, der Mutter Jesu. Nach der mit dem Altare gleichzeitigen Legende hatte sie 4 Söhne, die spätern Apostel Simon, Judas, Thaddäus und Jacobus d. j. Maria hält auf dem Schooße einen nackten Knaben, der ein offenes Buch auf dem Arme hält. Rechts steht ein Knabe mit rother Kappe und der Walkerstange, also Jacobus d. j. Links hocken vor einem Grapen zwei Knaben, von denen der eine ebenfalls eine rothe Kappe, der andere, mit krausen Haaren, noch Mädchenkleidung trägt. Hinter der Bank steht Alphäus, der Mann der dritten Maria, und reicht eine Frucht herüber.
5) In der äußersten Nische zur Linken sitzt eine weibliche Figur, welche ich für die Mutter des Apostels Petrus halte, da sie einen Knaben auf dem rechten Arme hält, der eine Bischofsmütze auf dem Kopfe hat; ich erkenne hierin den Apostel Petrus, als ersten Bischof von Rom und Gründer der Kirche. Hinter der Bank steht ein Mann mit rother Mütze, welcher eine Frucht herüberreicht; wenn der Knabe der Apostel Petrus ist, so ist der Mann dessen Vater Jonas.
Die ganze Darstellung ist also in der Anschauung:
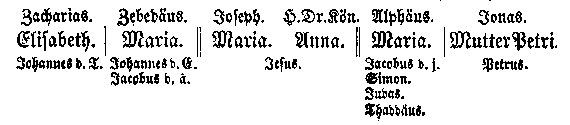


|
Seite 330 |




|
Neben dieser Schnitzarbeit stehen auf den beiden geschweift auslaufenden Enden der Predelle zwei Wappen von Bischöfen zu Schwerin:
zur rechten: das Wappen des Bischofs Conrad Loste: ein grüner Schild mit einem halben goldenen Widder mit einem goldenen Bischofsstabe;
zur linken: das Wappen des Bischofs Johann Thun: ein goldener Schild mit drei wellenweise gezogenen grünen Queerbändern und einem goldenen Bischofsstabe hinter dem Schilde.
Die Farben auf beiden Schilden sind jetzt wirklich grün, auf dem Schilde des Bischofs Conrad mehr dunkelgrün, vielleicht grün geworden, da sie blau sein sollten (vgl. Jahrbücher VIII, S. 26).
Der Altar, welcher nach der Inschrift 1503 verfertigt ist, ward also unter dem Bischofe Conrad Loste († 24. Dec. 1503) gemacht und unter dem Bischofe Johann Thun (seit 7. März 1504) vollendet und aufgestellt.
Der Altarfuß.
Der Altar hat unter der Predelle noch einen Fuß, der mit kleinen Gemälden bedeckt ist, welche das Leiden Christi darstellen und auf das Abendmahl Bezug haben. Diese vier Gemälde enthalten folgende Darstellungen:
| Christi Geißelung. | Christi Dornenkrönung. | Christus vor Pilatus. | Christi Kreuztragung. |
Die Gemälde stammen aus der Zeit des Altars, sind nach alter herkömmlicher Weise und derbe, grade nicht schön, gemalt und ziemlich gut erhalten. Wegen mancher abschreckender Darstellung nennt Mantzel diese Gemälde "blasphemere Gemälde", "daher sie auch verdeckt sind", wie Geisenhayner in den Mekl. Blättern, I, 10, S. 572 sagt; sie waren auch bis zum Abbruch des alten Gestühls verdeckt.
Bekrönung.
Auf dem Altare steht eine Leiste mit folgender erhaben geschnitzter Inschrift in langen gothischen Minuskeln:
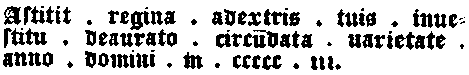
(= Astitit regina a dextris tuis in vestitu deaurato, circumdata varietate. Anno domini 1503).


|
Seite 331 |




|
Die Puncte und Zwischenräume zwischen a dextris und in vestitu fehlen. - Dies ist der Inhalt von Psalm 45, V. 10 und 14:
"Die Braut steht zu deiner Rechten in eitel köstlichem Golde; - - sie ist mit goldenen Stücken gekleidet".
Diese Worte wurden auf die Maria angewendet, wie Offenbarung Johannis 12, V. 1 auf die Umkleidung der Maria mit Sonne, Mond und Sternenkrone.
Ueber diese Leiste ragte eine durchbrochene Bekrönung von Laubwerk empor, welche jetzt fehlt. Wahrscheinlich ist dies dieselbe, welche bis jetzt, in mehrere Stücke zersägt, unter der Orgel angenagelt ist.
Der Taufkessel.
Die Kirche zu Bützow besitzt einen großen bronzenen Taufkessel, 3 1/2 Fuß hoch und 3 Fuß im Durchmesser, aus dem Jahre 1474, von kunstreicher Arbeit, da die ganze Außenseite mit Heiligenfiguren unter Baldachinen, mit Wappen und mit einer Inschrift verziert ist. (Vgl. auch Jahresber. III, S. 140.)
Die Außenseite ist mit zwei Reihen Heiligenfiguren über einander verziert; in der obern Reihe stehen 14, in der untern Reihe 12 Figuren, in jeder Reihe ein Wappen.
In der obern Reihe steht Christus mit 13 Aposteln und einem Wappen, in der Reihenfolge von links nach rechts:
- Christus segnend, mit der Weltkugel.
- Apostel Petrus mit Schlüssel.
- Apostel Paulus mit Schwert und Buch.
- Apostel Johannes mit Kelch.
- Apostel Jacobus d. ä. mit Pilgerstab.
- Apostel Andreas mit Schrägekreuz.
- Wappenschild mit dem meklenburgischen Stierkopfe.
- Apostel Mathias mit Beil.
- Apostel Bartholomäus mit Messer.
- Apostel Thomas mit Lanze und Buch.
- Apostel Matthäus mit Hellebarde und Buch.
- Apostel Jacobus d. j. mit Walkerstange.
- Apostel Philippus mit Doppelkreuz.
- Apostel Thaddäus mit Keule.
- Apostel Simon mit Säge.


|
Seite 332 |




|
In der untern Reihe stehen die Jungfrau Maria, ein männlicher Heiliger, 10 weibliche Heilige und ein Wappen. Die weiblichen Heiligen sind dieselben, welche sich auf der Vorderseite des Hochaltares finden, nur sind auf dem Altare zwei weibliche Heilige mehr, als auf dem Taufkessel.
In der untern Reihe stehen folgende Figuren in der Reihenfolge von links nach rechts:
- Maria mit dem Christkinde auf dem Arme, vor welchem ein kahlköpfiger, bärtiger Mann mit Buch und Kreuz (der H. Franziscus?) knieet.
- Der H. Eduard (?), ein männlicher Heiliger mit Krone und Bart, mit einem Becher mit Deckel.
- Die H. Dorothea mit Korb.
- Die H. Katharina mit Rad und Schwert.
- Die H. Elisabeth mit Krug und Fischteller.
- Die H. Maria Magdalena mit Salbenbüchse.
- Die H. Gertrud mit Hospital.
- Die H. Barbara mit Thurm.
- Die H. Ursula mit Pfeil.
- Die H. Margaretha mit Kreuz.
- Die H. Agnes mit Lamm.
- Die H. Apollonia mit Zange mit einem Zahne.
- Wappen des Bisthums Schwerin: zwei gekreuzte Bischofsstäbe, welche hier beide nach einer Seite hin gekehrt sind.
Es fehlen also auf dem Taufkessel von den weiblichen Heiligen des Altars: 2. die Heilige ohne Attribut (Agathe) und 5. die H. Cäcilie.
Oben um den Rand steht folgende Inschrift über den Aposteln:
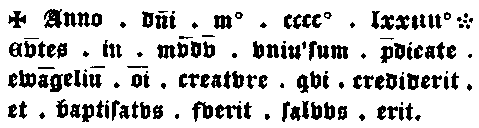
(Anno domini MCCCCLXXIV. Euntes in mundum universum predicate evangelium omni creaturae : qui crediderit et baptisatus fuerit, salvus erit.)
Der Taufkessel ist also ohne Zweifel unter dem Bischofe Balthasar von Schwerin (1473-1479), Herzoge von Meklenburg, gegossen.


|
Seite 333 |




|
Die Kelche
der Kirche zu Bützow sind ebenfalls merkwürdig und sehr selten. Die merkwürdigsten sind folgende:
1) Der älteste Kelch ist ein Kelch vom Altar der Heil. Drei Könige. Dies ist ein kleiner silberner Kelch. Auf dem Fuße sind 4 kleine vergoldete erhabene Figuren angebracht: Maria sitzend mit dem Christkinde und die Heil. Drei Könige Caspar, Melchior, Balthasar stehend, neben welchen die Namen in gothischer Minuskel eingravirt sind, nach Mantzel Bützowschen Ruhestunden, II, S. 8, in einem Hexameter:
An einer Seite auf dem Fuße ist ein Schild mit einem Wolf eingravirt und daneben die Inschrift:

Der Kelch ist also wohl das Geschenk eines Priesters. Auf den sechs Knöpfen des Griffes stehen die Buchstaben
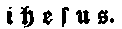
Der Kelch stammt aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche zu Bützow hatte einen Altar der Heil. Drei Könige ("Trium Regum").
2) Ein zweiter Kelch gehörte zu der S. Annen Kapelle. Die H. Anna hatte bei der Kirche zu Bützow eine eigene Kapelle, welche an der Südseite, nach dem Visitations=Protocolle von 1553 "zur linken Hand am Chor, der Schule gegenüber", neben der S. Katharinen=Kapelle angebauet war und erst in neuern Zeiten abgebrochen ist. Dieser Kelch ist ein kleiner, silberner, vergoldeter Kelch. Auf dem Fuße steht die Inschrift:
DESSE KELCK HORT TO BVTZOW IN SANNT ANNA KAPPEL EBIG BELIBEN.
Auf den 6 roth emaillirten Knöpfen des Griffes stehen die Buchstaben:
Dieser Kelch stammt aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, aus den letzten Zeiten des Katholicismus.
3) Der werthvollste Kelch ist aber ein sehr großer, silberner, vergoldeter Kelch, welchen der Herzog Ulrich der


|
Seite 334 |




|
Kirche geschenkt hat. Er ist "über 90 Loth" schwer und außen ganz mit getriebenen, reichen Darstellungen aus der Leidensgeschichte Christi bedeckt. Auf dem Fuße steht das blau emaillirte herzoglich=meklenburgische Wappen und die Inschrift:
1555.
(d. i. Ulrich Herzog zu Meklenburg).
1555.
Dieser Kelch ist wohl von allen Kelchen aus den drei letzten Jahrhunderten, vielleicht von allen überhaupt der schönste im Lande. Es geht (nach dem Visitations=Protocolle von 1651 - 54) die Sage, daß der Herzog Ulrich selbst an diesem Kelche gearbeitet haben soll; jedoch mag dies wohl nicht wahrscheinlich sein. Der Herzog war aber ein Freund und Beförderer solcher Arbeiten: die großherzogliche Münzsammlung besitzt noch zwei vortrefflich gearbeitete Gnadenpfennige (Ehrenmedaillen zum Tragen) mit dem Bilde des Herzogs, auf denen die Rüstung ebenfalls blau emaillirt ist. - Zu dem Kelche gehört eine gravirte Patene.
4) Ein vierter Kelch, welcher ein Seitenstück zu dem Kelche des Herzogs Ulrich ist, befindet sich bei dem "Hospitale" (zum Heiligen Geist) und ward erst im J. 1818 durch den Präpositus Geisenhayner gewissermaßen entdeckt; vgl. Geisenhayner Mecklenb. Blätter, I, 11, 1818, S. 687, Dieser Kelch ist ein kleiner silberner, vergoldeter Kelch, ein Geschenk der Herzogin Elisabeth, ersten Gemahlin des Herzogs Ulrich. Auf dem Fuße steht das dänische Wappen und die Inschrift:
Unter dem Fuße inwendig steht:
DESSE KELCK HEFT MIN GNEDIGE FRAWE HERZOG ULRIGES GEMAL THO BWTZOW DEN HILGEN GEST GEGEVEN TO GADES EHR 1586.
Ich habe diesen Kelch nicht gesehen, sondern nur nach Geisenhayner a. a. O. beschrieben.
Ein silberner Belt.
In katholischen Zeiten wurden die Gaben, welche in den Kirchen eingesammelt wurden, auf einem kleinen horizontalen Brett, auf welchem vor dem Handgriffe der besondere Schutz=


|
Seite 335 |




|
heilige der Kirche stand, eingefordert. Dieses Brett hieß "Velt" (Bild?), an dessen Stelle in protestantischen Zeiten der "Klingebeutel" gekommen ist. An einzelnen Orten blieb der "Belt" noch lange in Gebrauch, in Bützow sogar bis auf die neuesten Zeiten.
Die Heiligenfigur auf diesem Belt von Bützow ist eines der seltensten, vielleicht das einzige alte Kunstwerk seiner Art im ganzen Lande, welches auch in sich Kunstwerth hat. Die Figur mit allem Beiwerk ist nämlich von getriebenem Silber, vortrefflich gearbeitet. Die Hauptfigur ist die Jungfrau Maria mit einer sehr großen, verzierten Krone auf dem Haupte, mit dem Christkinde auf dem linken Arme und mit einer Lilie in der rechten Hand. Hinter ihr ist zwischen 2 Pfeilern ein durchbrochenes gothisches Stabwerk ausgebreitet. Auf den beiden Seitenpfeilern stehen zwei ganz kleine Heiligenfiguren: zur Rechten der Evangelist Johannes mit Kelch, zur Linken die H. Elisabeth mit Fischteller und Krug. Die Figur der Maria ist ohne Krone und Sockel 9 Zoll hamburger Maaß hoch, mit dem Sockel und der sehr hohen Krone 13 Zoll hoch. Die Hinterwand ist 5 Zoll breit - Die kleine Glocke, welche hinten in der Krone aufgehängt ist, ist sicher eine moderne Zuthat, welche den Klingebeuteln nachgeahmt ist.
Einen besondern Werth erhält diese seltene Arbeit dadurch, daß auf der Bodenplatte vor der Maria mit ganz kleinen, feinen Buchstaben eine bisher noch nicht bemerkte Inschrift mit dem Jahre der Verfertigung und dem Gewichte eingeritzt ist.

d. i.
Die nach der Jahreszahl zunächst folgenden
Buchstaben
 sind ohne Zweifel eine Abkürzung
des Wortes valet (= gilt, ist werth, wiegt).
sind ohne Zweifel eine Abkürzung
des Wortes valet (= gilt, ist werth, wiegt).
Nach dieser Jahreszahl ist es gewiß, daß dieser Belt bei der Vollendung des Altars unter dem Bischofe Johann Thun 1504 verfertigt ist.
Dieser Belt ist sehr lange in Gebrauch geblieben. So z. B. heißt es in dem bützowschen Visitations=Protocolle vom J. 1593:
"Ein silbern Marien Bilde damit zum Gotteshause des Sontages gesamlet wird".
Mantzel sagt in den Bützowschen Ruhestunden V, 1762, S.


|
Seite 336 |




|
18, daß dieser Belt "nebst denen Klingebeuteln an denen Festtagen zur Einsamlung der Almosen gebraucht werde". Geisenhayner sagt in den Mecklenburgischen Blättern, I, 11, 1818, S. 663, daß der Belt "an Bettagen, um für die Prediger, und an hohen Festtagen, um für den Organisten zu sammeln, gebraucht wird". In den neuern Zeiten ist er an den Festtagen für die Prediger umhergetragen.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Gägelow.
Im J. 1857 ist die Kirche zu Gägelow einer nothwendigen, vollständigen Restauration unter der Leitung des Herrn Landbaumeisters Voß zu Schwerin unterworfen, bei welcher nicht nur das gesammte Gestühle erneuert ist, sondern auch die Wände eine neue Tünche erhalten haben.
Die bisherigen Gewölbemalereien waren im ganzen Lande sprichwörtlich: "So bunt als die gägelowsche Kirche". Die drei Gewölbe, jedes von 8 Feldern, waren in hellgelb und grau mit Arabesken und Schnörkelwerk verziert; innerhalb der Schnörkel stand in jedem Felde ein Schild mit einem Bilde und über dem Schilde ein Spruch; oft standen auch noch an andern Stellen, wo noch Platz war, große Sprüche, welche jedoch an vielen Stellen ziemlich verblichen waren. Die Malerei, welche ohne Zweifel aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammte, war ganz roh und hatte gar keinen Werth; auch der Inhalt der Malereien war werthlos, da sie sich in einer sinnlichen Allegorie bewegte, um die Macht des Wortes Gottes und der Kirche zu versinnbildlichen. Um dies zu rechtfertigen, mögen hier kurze Beschreibungen der Malereien, mit Hinzufügung einiger Sprüche, folgen, wie sie in der Durchschnittslinie über dem Altare nach der rechten Seite herum folgten.
I. Gewölbe über dem Altare.
1) Ein Prediger (soll wohl den damaligen Pastor der Gemeinde vorstellen), der einen Schild mit dem Namen Jehovah in hebräischer Schrift hält, mit der Ueberschrift:
Ps. XIII, 36.
Daneben in der Landschaft rechts ein Mann mit zwei Windhunden.


|
Seite 337 |




|
2) Eine schlafende, sinnliche Mannesgestalt, in den Armen eines Weibes mit Schlangengliedern, mit der Ueberschrift:
3) Eine Stadt in Brand, mit der Ueberschrift:
4) Ein König auf einem Wagen, von einem Pfeile getroffen.
5) Ein Jäger, welcher einen Vogel schießt.
6) Ein Mädchen, welches die Harfe spielt, während Pfeile auf sie zufliegen.
7) Ein Mann, welcher mit einem Besen eine aus ihrem Netze hangende Spinne wegnimmt.
8) Vier Männer, welche nach der Scheibe schießen.
II. Erstes Gewölbe des Schiffes.
1) Ein Mann, welcher beim Scheine einer Kienfackel Krebse fängt ("blaßt"), mit der Ueberschrift:
2) Ein Prediger vor einem Könige und einem Bauern, mit der Umschrift:
3) Ein unter den Bissen von Hunden verendendes Thier, mit der Ueberschrift:
4) Eine Rose, mit der Ueberschrift:
5) Ein Mann, welcher einen Fisch an der Angel hält.
6) Ein Postament, auf welchem eine Flasche steht, die von Wespen umschwärmt wird.
7) Ein tanzender Mann, zwischen zwei Häusern.
8) Ein Mann mit einem Glase in der Hand, vor einer gedeckten Tafel sitzend.
III. Zweites Gewölbe des Schiffes
am Westende, über der Orgel, enthielt keine Bilder, sondern war nur mit Arabesken gefüllt.
Das ist die im Lande berühmt gewordene Malerei! Es ist gewiß kein Verlust, wenn sie bei der gegenwärtigen Restauration der Kirche untergegangen ist.


|
Seite 338 |




|
Diese junge Malerei stammt jedenfalls aus der Zeit nach 1618. Die Kanzel ist im J. 1618 gebauet. Damals waren die Wände noch nicht getüncht, da die Wand hinter der Kanzel noch im alten, ungetünchten Kalkputze stand. Diese neuern Gewölbemalereien sind aber auf eine jüngere, weiße Kalktünche aufgetragen. Wahrscheinlich ist es, daß die Malereien aus dem Jahre 1683 stammen, da in diesem Jahre auch der Altar "renovirt" und der adelige Stuhl gebauet ward. Darauf deutet auch die Jahreszahl 1684, welche am Chorgewölbe neben dem ersten Gurtbogen stand.
Dagegen ist die alte Malerei der Kirche von sehr großer Wichtigkeit und Bedeutung und um so wichtiger, als sie einen tiefen Blick in das Wesen der Ausschmückung der Kirchen in alter Zeit gönnt.
Die Kirche bildet ein Oblongum von drei Gewölben Länge. Sie ist ganz von grauen Feldsteinen erbauet und in den Seitenwänden sind nur die Thür= und Fenstereinfassungen von rothen Ziegeln. Die drei Gewölbe sind durch zwei Gurtbogen, welche sehr breit sind und weit in die Kirche hineinragen, getrennt; diese Gurtbogen sind, wie die Gewölbe, von Ziegeln aufgeführt. Die Gewölbe haben acht Rippen, welche an einem Kreise um den Gewölbeschluß zusammenstoßen. Die Rippen und Kreise sind sehr stark und massig und haben einen quadratischen Durchschnitt, also eine breite, ebene Fläche nach der Kirche hin. Die Fenster sind kurze, schmale Uebergangsfenster, welche nur eine rechtwinklig eingehende Einfassung haben, ohne Wulste und sonstige Gliederungen.
Wir haben bisher nur Erfahrungen über die Ausschmückung von Ziegelkirchen gehabt, und hier immer den Grundsatz bewährt gefunden, daß das Baumaterial und dessen Farbe für die Färbung des Innern der Kirche maaßgebend war. Derselbe Grundsatz bewährt sich auch in der Kirche von Gägelow. Die Seitenwände der Kirche sind aus grauem Feldstein erbauet. Daher waren die Seitenwände im Innern der Kirche auch nur mit dem alten, festen, natürlichen, grauen Kalkputz des 13 Jahrhunderts bedeckt. Hinter einem alten Chorstuhle fand sich bei der Ausräumung noch der alte Abputz der Kirche in gelblichgrauem, harten, glatten Kalkputze, wie Porcellan. Es waren, wahrscheinlich von alten Priestern, mehrere lateinische Sinnsprüche, einige in Hexametern, eingekratzt. Die Schrift war die alte Urkunden= und Handschriften=Schrift in gothischer


|
Seite 339 |




|
Minuskel. Die meisten Sprüche waren von der Handschrift der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts; ein Spruch war offenbar in der Schrift aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, ungefähr 1280, geschrieben. Dies alles ist ein Beweis, daß die alte Decoration der Kirche aus dem 13. Jahrhundert stammt.
Die Ansicht von der Nachahmung des Baumaterials in der Verzierung des Innern hat sich so weit erstreckt, daß selbst die Einfassungen der Fenster auch nur diese graue Farbe hatten, obgleich sie von rothen Ziegeln gewölbt sind. Die Laibungen der Fenster waren in alter Zeit immer weiß getüncht oder geputzt. Es ist an den Seitenwänden und den Fenstern der gägelower Kirche keine Spur von Malerei gefunden. Daß in der Regel alle innern Wände der Feldsteinkirchen mit Kalk geputzt wurden, setze ich als selbstverständlich voraus. Eine weitere durchgehende Verzierung der Seitenwände war auch unpractisch, da die Feldsteinwände immer etwas kalt und feucht sind und daher im Putz oft leiden.
Eben so ist es allgemein in der Regel, daß die Gewölbekappen geputzt wurden. Auch diese haben in der gägelower Kirche keine Art von Malerei, sondern sind ebenfalls ganz grau. - Die Ränder der Gurtbogen an den Seiten sind nicht geputzt, sondern haben, so weit die wölbenden Ziegel reichen, im Rohbau gestanden, wie auch dies in alter Zeit herkömmlich ist; zuletzt waren diese Ränder mit dünner dunkler Tünche gefärbt.
Der ganze Schmuck der Gewölbe besteht in der Bemalung der Gewölberippen. Da diese einen quadratischen Durchschnitt und grade, breite Flächen zeigen, so waren auch die Oberflächen der Gewölberippen geputzt. Die nach der Kirche hin liegenden breiten Flächen der Gewölberippen waren aber auch bemalt. Da die Gewölbe 8 Rippen haben, so hatte man in der Bemalung oft einen Wechsel in der Farbe eintreten lassen. Es hatten z. B. 4 Rippen, deren 2 in der Mittellinie der Kirche und des Altars liegen und die andern 2 im rechten Winkel an diese stoßen, einen bräunlich rothen Grund, auf welchen stehende, große, bläulich graue Lilien gemalt waren, welche einen Fuß hatten. Die Gewölberippen waren aber sehr verschieden verziert, so daß gewöhnlich nur je zwei Rippen dasselbe Ornament zeigten. Das Ornament bestand aus verschiedenen Lilienformen, Zickzackbändern, Herzen, Vierblättern und andern Verzierungen. Mitunter war auch ein Wechsel der Farbe sichtbar. Die andern 4 Rippen, welche eigentlich das Kreuzgewölbe bilden, hatten


|
Seite 340 |




|
einen gelblich grauen Grund und auf
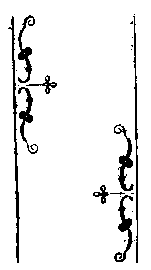 den beiden Rändern
gegenüberstehende, liegende Liniengewinde, auf
denen kleine Lilien stehen, in bläulich grauer
Farbe. Die Seitenflächen der Gewölberippen haben
eine einfache, helle Parallellinie.
den beiden Rändern
gegenüberstehende, liegende Liniengewinde, auf
denen kleine Lilien stehen, in bläulich grauer
Farbe. Die Seitenflächen der Gewölberippen haben
eine einfache, helle Parallellinie.
Der Herr Pastor Böcler zu Gägelow hat die größten Verdienste um die Auffindung und Wiederherstellung der Gewölbe=Decoration, so wie er überhaupt während des ganzen Baues mit großer Hingebung viele Opfer freudig gebracht hat.
Der Hauptschmuck der Kirche befindet sich aber auf den Gurtbogen, welche auf dem naturfarbenen grauem Grunde des Kalkputzes mit Figuren bemalt sind.
Die innere Fläche des ersten Gurtbogens, zwischen Chor und Schiff, des Triumphbogens, war, so weit die Wölbung reicht, mit Scenen aus dem Leben der Heiligen, wie es scheint, bemalt. An jeder Seite der innern Fläche des Bogens standen 6 Bilder über einander, jedes von 5 Fuß Breite und 2 1/2 Fuß Höhe. Die Bilder waren durch Kanten von architektonischen Lilienranken von 1/2 Fuß Breite, weiß auf rothem Grunde, von einander getrennt. Jedes Bild enthielt durchschnittlich 6 Figuren. Auf den meisten Bildern war an der östlichen Seite ein König mit Krone und Scepter erkennbar und neben ihm einige Male ein Mann mit einem Schwerte in der Hand, neben welcher eine enthauptete Figur lag. Dies war z. B. an der südlichen Seite zwei Male über einander zu erkennen. Das unterste Bild an dieser Seite zeigte eine Grablegung, das oberste einen Feuerregen. Der historische Zusammenhang hat nicht ermittelt werden können. - Diese Bilder waren nicht wieder herzustellen, weit sie theils nicht mehr für unsern Gottesdienst paßten, theils schon zu unkenntlich geworden waren. Diese Darstellungen fangen dort an, wo die Wölbung des Bogens beginnt und wo früher ohne Zweifel ein Queerbalken angebracht war, auf welchem, wie gewöhnlich, Christus am Kreuze und Maria und Johannes Ev. in Bildhauerarbeit standen. Die Malereien auf der Bogenlaibung war sicher zur Verherrlichung dieser Darstellung angebracht.
Die der Kirche zugewandten untern Seitenflächen dieses Gurtbogens waren aber auch mit Figuren von ungefähr gleicher Größe bemalt gewesen, so daß die Gemeinde diese Figuren vor Augen hatte. An der Wand zur Rechten, unterhalb des Bogens und der Fenster, war eine Kreuzigung Christi, in


|
Seite 341 |




|
der Mitte Christus am Kreuze und an jeder Seite zwei Figuren, zu erkennen. Die Wandfläche zur Linken war auch bemalt gewesen, jedoch war die Malerei durch Ausbesserung des Kalkputzes so sehr zerstört, daß sich kein Zusammenhang erkennen ließ. Die Wandflächen in der Höhe waren auch mit Figuren bemalt gewesen, welche aber so sehr zerstört waren, daß sie kaum noch wenige, schwache Ueberreste erkennen ließen.
Alle diese kleinen Figuren waren schlank und edel und in schönen, einfachen Farben, welche jedoch schon sehr verblichen waren, und zeugten von einem hohen Alter. Wahrscheinlich stammten sie aus der Zeit der Erbauung der Kirche.
Merkwürdiger noch ist die Bemalung der innern Fläche des zweiten Gurtbogens zwischen den beiden Gewölben des Schiffes. Diese trägt unten auf grauem Kalkgrunde zwei große Figuren, welche ziemlich tief unten anfangen und bis in den Bogen hineinreichen. Zur Rechten, an der Südseite, steht die Figur des Erzengels Michael mit heraldisch gestalteten Flügeln, wie er mit der Lanze den Drachen tödtet und die Wage hält. Zur Linken steht Maria mit dem Christkinde auf dem Arme. Jede dieser beiden Figuren war 8 Fuß hoch und von großer Gesammtwirkung. Die Farben dieser Figuren waren einfacher und nicht so glänzend, wie die der andern Malereien; auch erscheinen die Zeichnungen im Einzelnen nicht so correct und nicht so sauber ausgeführt, wie in den andern Figuren, was wohl theils in der ungewöhnlichen Größe, theils darin Grund hat, daß diese beiden Figuren etwas jünger sein mögen, als die übrigen.
Diese Malereien sind sowohl nach Kunstwerth, als nach den Dimensionen ganz ungewöhnlich, namentlich für eine Dorfkirche, und haben einen hohen Werth für die Kunstgeschichte. Allem Anscheine nach stammen sie zum größern Theile aus der Zeit bald nach der Erbauung der Kirche und gehören wohl dem 13. Jahrhundert an; wenn sie nicht gleichen Alters sein sollten, so mögen die Gemälde des ersten Gurtbogens dem 13. Jahrhundert, die Gemälde des zweiten Gurtbogens der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehören. Jedoch glaube ich, daß alle Gemälde im 13. Jahrhundert zu gleicher Zeit gemalt sind.
Außerdem zeigten sich Spuren, daß auch die Wände des Chores zu den Seiten des Altars oben neben den östlichen Fenstern bemalt gewesen waren; jedoch waren Figuren nicht mehr zu erkennen.
Dieser ungewöhnliche alte Gemäldeschmuck hat sicher die Kirche in den Ruf gebracht, daß sie bunt sei; das Sprichwort: So bunt wie die gägelowsche Kirche, -


|
Seite 342 |




|
ist bestimmt älter, als die junge Malerei, aus der man die Entstehung des Sprichworts herzuleiten Veranlassung genommen hat.
Die Kirche ist nun im J. 1857 so viel als möglich im Geiste des alten Baues, jedoch mit etwas Ziegelbaudecoration um die Fenster und an den Wänden unterhalb der Fenster, restaurirt worden. Zunächst sind aus der Baukasse alle Gewölberippen bloßgelegt, die ältesten Original=Verzierungen ans Licht gebracht und durchgezeichnet und in denselben Linien und Farben wieder aufgemalt. Sodann sind die beiden großen Figuren, Maria und Erzengel Michael, da die Figuren noch zu erkennen waren, in den alten Umrissen mit denselben Farben restaurirt. Endlich hat die Kirche, zum Ersatz der andern alten Wandmalerei, einen neuen, würdigen Schmuck erhalten. Die dem Schiffe, also die der Gemeinde zugewandte, westliche, breite Seite des östlichen Gurtbogens zwischen Chor und Schiff ist mit einem großen Wandgemälde in festen Wasserfarben geschmückt, unsers Wissens das erste Beispiel in einer Dorfkirche unsers Landes. Oben in der Höhe thront Christus (im Brustbilde) in den Wolken, die rechte Hand zum Segnen erhoben, in der linken Hand das offene Buch mit A und O haltend. An jeder Seite schwebt ein anbetender Engel, mit dem Ausdruck der Verehrung und der Demuth in den Zügen. Die Engel sind, nach dem Vorgange der beiden alten Figuren, in einem Maaßstabe von 8 Fuß Größe gehalten. Diese Darstellung ist öfter vorkommenden mittelalterlichen Andeutungen entnommen. Auf meinen Vorschlag übernahm es der eingepfarrte Gutsbesitzer Herr Fabricius auf Rothen sogleich und unbedenklich mit großer Theilnahme und Bereitwilligkeit, nicht allein dieses Gemälde, sondern auch die Restauration der beiden alten großen Figuren auf seine Kosten ausführen zu lassen, während der Herr Erbpächter Schmidt zu Gägelow sich freundlichst erbot, den Maler in sein Haus aufzunehmen. Der Herr Maler Theodor Fischer zu Schwerin, welcher auch im Schlosse und in der Schloßkirche zu Schwerin geschaffen hat, hat unter meinem Beirath die Kartons entworfen und die Gemälde ausgeführt, und zwar mit einer so großen Auffassung und Tüchtigkeit, daß dieses Werk, das ohne besondern Aufwand hergestellt und ohne vorgängiges Beispiel ausgeführt werden sollte und mußte, dem Künstler große Ehre macht und zu den bessern im Lande gehört. Die übrigen Stellen, wo alte Gemälde waren, sind frei geblieben, so daß sie noch immer geschmückt werden können.
Nach Vollendung der Restauration hat auch noch die hohe Kammer zu dem Schmuck der Kirche beigetragen und durch


|
Seite 343 |




|
den Herrn Maler Theodor Fischer auch die Laibung des Triumphbogens nach meiner Angabe malen lassen. Diese enthält in großem, architektonischen Laubwerk in Medaillons die Brustbilder des Moses und des Jesaias (Gesetz und Propheten) der Kanzel gegenüber und des Johannes des Täufers (Bußpredigt) über der Kanzel.
So ist der Kirche zu Gägelow der jetzt wirklich gerechte und sinnreiche Anspruch auf das Sprichwort erhalten worden: "So bunt wie die gägelowsche Kirche".
Die Kirche hatte auch zwei große, aus Eichenholz
gehauene Chorstühle, jeden von sechs Sitzen, je
einen an jeder Wand des Chores neben dem Altare;
der eine an der Südwand ist in der Holzarbeit
noch vollständig und an seiner Stelle erhalten,
der andere ist zu einem Gemeindestuhle im
Schiffe der Kirche benutzt, nachdem 1 1/2 Sitze
abgesägt sind. Der im Chore stehende, noch
ziemlich erhaltene Stuhl hat zu den Häupten eine
hohe, in 6 Felder getheilte Bretterwand, welche
von einem ausgekehlten Gesimse bedeckt wird.
Jedes dieser 6 Felder zeigt noch Spuren, daß auf
demselben eine mit drei Bogen
 gekrönte, schmale Umrahmung
aufgeleimt gewesen ist, in welcher vielleicht
ein Bild gestanden hat. Auf dem Gesimse stehen
die Namen von 7 Aposteln und Christi in großer
gothischer Majuskelschrift in folgender Ordnung:
gekrönte, schmale Umrahmung
aufgeleimt gewesen ist, in welcher vielleicht
ein Bild gestanden hat. Auf dem Gesimse stehen
die Namen von 7 Aposteln und Christi in großer
gothischer Majuskelschrift in folgender Ordnung:
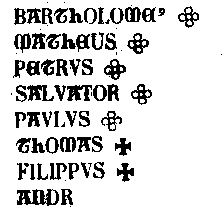
Aus dem Charakter der Schrift geht hervor, daß diese (also auch die (Stühle) vor dem Jahre 1350 und um das Jahr 1325 verfertigt worden ist.
Der Altar ist ein einfacher Flügelaltar aus dem Ende des 15. Jahrhunderts mit ziemlich roh gearbeiteten, aus Eichenholz geschnitzten, in neuern Zeiten übermalten Figuren in folgender Ordnung:
| Petrus mit Schlüssel. | Maria. | Chistus am Kreuze. | Johannes Ev. mit Buch. | Paulus mit Schwert. |


|
Seite 344 |




|
Die Flügel sind im J. 1683 auf Kosten der Dorothea von Halberstadt, Wittwe des Baltzer Friedrich von Zülow, zur Rechten mit einer Auferstehung, zur Linken mit einer Kreuzabnahme in schlechtem Geschmack übermalt; in demselben Jahre sind auch die Altarschranken und der adelige Stuhl vor dem Altare neu gemacht.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Der Altar der Kirche zu Bernit.
Die Kirche zu Bernit ist in den Jahrbüchern XXII, S. 314 - 317, schon gründlich beschrieben. Jedoch bedarf der Altar nach Vergleichung mit mehrern andern ähnlicher Art einer ausführlichern Darstellung. Der Altar zu Bernit ist ein einfacher Flügelaltar von ziemlich großer Ausdehnung und guter Arbeit. In der Mitteltafel stehen vier durchgehende große Figuren, in der Ansicht von der Linken zur Rechten:
1) Der H. Erasmus, ein Bischof, in einem schwarzen Grapen stehend, mit einer Winde in der linken Hand. Diese Figur muß der H. Erasmus sein, da sie als Bischof und mit der Winde dargestellt wird. Diese in Meklenburg häufige Darstellung ist aber dadurch ungewöhnlich, daß die Figur in einem Grapen (dreibeinigen Kessel) steht, welcher in keiner bekannten Ikonographie als ein Attribut des H. Erasmus angegeben, sondern bekanntlich dem H. Vitus zugetheilt wird; dieser war aber nicht Bischof. Diese Darstellung des H. Erasmus gründet sich auf die gleichzeitigen Legenden. z. B. im Levent der hylgen. Basel, 1517, Samerdel, fol. XL: "Erasmus. - - Do bot de keyser synen denren, dat se pick, sweuel, olye, blyg vnde wasz nemen vnde to samende zedendich heet makeden vnde sunte Erasmum dar yn setteden, dat deden de denre. Do quam de engel gades van deme hemmel vnde beschermede ene, dat em neen quaed geschach".
2) Die Jungfrau Maria, auf dem Halbmond mit dem Christkinde auf dem Arme.
3) Die H. Katharina mit Schwert und Rad.
4) Der H. Georg mit Lanze und Drachen.
In den queer getheilten Flügeln stehen die 12 Apostel.
Die Rückwände der Flügel enthalten im Ganzen vier schon verfallene Gemälde, auf jedem Flügel zwei, und zwar:
1) die Heimsuchung Mariä (Visitatio b. Mariae), wie es scheint;


|
Seite 345 |




|
2) die Verkündigung Mariä (Annunciatio b. Mariae);
3) die Anbetung der H. Drei Könige;
4) die Beschneidung Christi.
Die ganze Arbeit an Bildschnitzerei und Malerei ist tüchtig und reich; die architektonische Schnitzerei ist jedoch nur einfach.
Nach dem ganzen Style und manchen Eigenthümlichkeiten gehört der Altar zu Bernit in die Zeit des Altars der Kirche zu Bützow, welcher nach Inschrift und Wappen im J. 1503 verfertigt ist. Zu den besondern Eigenthümlichkeiten gehören z. B. der gemusterte Goldgrund, auf dem die Figuren stehen, der untere wie Franzen gemalte Streifen des Goldgrundes unter jeder Figur, die Baldachine, die durchbrochene Bekrönungsleiste u. s. w. Es ist daher wahrscheinlich, daß der Altar zu Bernit im Anfange des 16. Jahrhunderts von demselben Künstler gemacht ist, der den bützowschen Altar gemacht hat. Aus derselben Zeit und Werkstätte stammen auch die Altäre der Kirchen zu Cambs (bei Schwan) und Witzin (bei Sternberg), in der Nähe von Bützow.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Kirche zu Marlow.
Nach dem Berichte des Dr. med. Hüen findet sich
"an der Außenseite der Kirche südwärts in den sichtbar gleich unter dem Dache gemauerten Steinschichten ein Stein mit der Zahl 1244, in arabischen Ziffern, vielleicht eine Erneuerung einer alten Inschrift".



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Kölzow
bei Sülz und Marlow, eine alte Feldsteinkirche von äußerst solidem Bau, liegt auf einer Anhöhe und ist ziemlich weit sichtbar. Sie hat einen quadratischen Chor mit grader Altarwand, ein oblonges Schiff und einen Thurm, der bis zur Höhe des Schiffes von Feldsteinen, oben aber von Fachwerk erbauet und in neuern Zeiten mit Schiefer gedeckt ist. Die grade Altarwand hat drei, nicht verbundene Fenster, von denen das mittlere höher ist, als die andern beiden; auf der Südseite hat der Chor zwei getrennte Fenster, auf der Nordseite ist die Wand des Chors durch eine angebauete Kapelle von Feldsteinen bedeckt. Das Schiff hat an jeder Seite drei Fenster


|
Seite 346 |




|
in demselben Style, wie der Chor. Die Fenster sind alle gleich und gehen mit glatter Laibung schräge nach innen. Ob die Fenster im Rundbogenstyle oder mit leiser Spitze im Uebergangsstyle überwölbt waren, läßt sich schwer entscheiden: die Fenster zeigen jetzt in der Wölbung eine leichte Abweichung vom Rundbogen und eine kleine Neigung zur Spitze, da die mit Ziegeln überwölbten Fenster nachgewölbt zu sein scheinen und sichtbar ausgebessert sind. Dagegen zeigen die Pforten einen bestimmtern Charakter. Der Chor hat in der Südwand eine Pforte, welche im reinen Rundbogenstyl mit einem doppelten Wulst, so weit die Bogenspannung reicht, erbauet ist. Die Pforte in der Südwand des Schiffes ist dagegen im Spitzbogenstyl mit zwei Wulsten von Ziegeln construirt.
Das Mauerwerk des Chors ist sehr sorgfältig gearbeitet, an den Ecken von behauenen Steinen. Das Mauerwerk des Schiffes ist nicht so gut, wie das des Chores, jedoch besser, als das des Thurms, welcher von Feld= und Ziegelsteinen bunt durch einander ausgeführt ist.
Der Chor hat eine beinahe runde Wölbung mit acht Rippen, welche von einer 2 Fuß im Durchmesser haltenden, mit Brettern verschlossenen runden Oeffnung ausgehen, gleichmäßig nach unten verlaufen und sich nach drei Seiten auf einen runden Bogen stellen; die Rippen sind sehr ungenau gemauert. Der Bogen zwischen Schiff und Chor, der Triumphbogen, ist im Spitzbogenstyl erbauet. Das Schiff ist mit Brettern bedeckt und hat durchaus keine Anlage zu einer Steinwölbung gehabt.
Der Altar ist im Renaissancestyl.
Eine Empore, welche an der Westseite die ganze Länge des Schiffes einnimmt, hat auf der Brüstung 24 gut erhaltene in Oel gemalte Wappen, unter denen z. B. die Wappen der v. d. Lühe, v. Oertzen, v. Hahn, v. Moltke, v. Zepelin u. A.
Nachweisungen über das Alter der Kirche fehlen, jedoch ist sie ihrer Bauart nach wohl mit den Kirchen zu Semlow und Tribohm von gleichem Alter 1 ). So viel bekannt ist,


|
Seite 347 |




|
kommt Kölzow schon 1233 in Urkunden vor; vgl. Jahrbücher XIV, S. 290.
Marlow, im September 1858.
Dr. Hüen.
Der Herr Dr. Hüen zu Marlow schenkte eine saubere Bleizeichnung der im Uebergangsstyle erbaueten Kirche zu Kölzow bei Sülz.



|



|
|
:
|
Die Kirche und das Antipendium
zu Dänschenburg.
bei Marlow ist in der Baugeschichte dadurch wichtig, daß die Urkunde über die Stiftung derselben noch vorhanden ist. Nachdem der Fürst Borwin von Rostock 1247 und 1248 das Dorf Dänschenburg dem Kloster Doberan geschenkt hatte, bauete das Kloster in dem Dorfe eine Kirche; am 14. October 1256 weihte der Bischof Rudolph von Schwerin den Kirchhof, bestätigte die Dotation und bestimmte den Sprengel der Kirche, indem er die "Dörfer Utessendorf, Vriholt und Wendisch Repelin" dazu legte; die Original=Urkunde ist noch im schweriner Archive vorhanden und in Westphalen Mon. ined. III, p. 1499 gedruckt.
Wir verdanken die Entdeckung dieser Kirche und ihrer Eigenthümlichkeiten dem Herrn Dr. Hüen zu Marlow, welchem ich selbst im März 1859 in Dänschenburg an Ort und Stelle, mit freundlicher Unterstützung des Herrn Pastors Steinfaß, nachgeforscht habe.
Die Kirche bildet im Grundrisse ein Oblongum von zwei Gewölben Länge und hat im Westen ein gleich breites Thurmgebäude. Sie ist, mit Ausschluß des Chorgiebels, welcher aus Ziegeln aufgeführt ist, ganz aus Feldsteinen gebauet.
Die Kirche ist aus zwei Gewölbe angelegt, welche jedoch nicht zur Ausführung gekommen sind; statt deren hat sie jetzt eine Bretterdecke. Im Innern stehen an jeder Seite zwei Gewölbeansätze oder Leisten von der Breite eines halben Ziegels in zwei großen, tief hinabgehenden, halbkreisförmigen Bogen, welche auf Platten ruhen, welche für den Fall der Wölbung eingemauert sind. Die Kirche hat unter jedem Gewölbebogen, auch an der Altarseite, zwei Fenster, welche paarweise beisammen stehen und je zwei durch einen Bogen verbunden sind, die Kirche hat also im Ganzen 10 Fenster in 5 Paaren. Die Fenster sind noch im Uebergangsstyle construirt; eben so


|
Seite 348 |




|
die Bogen, welche sie verbinden und einen alten Spitzbogen zeigen; die Fenster der Nordwand sind noch erhalten, die Fenster der Südwand dagegen theils zugemauert, theils erweitert. Die Nordwand hat zwei im strengen Spitzbogen= oder Uebergangsstyle aufgeführte Pforten, von denen die größere zum Chor jetzt zugemauert ist. Der Thurm hat nach außen und nach innen rundbogige Eingänge.
Der östliche Giebel der Kirche ist von Ziegeln aufgeführt und hat fünf hohe, schmale, weiß getünchte Blenden, welche im Uebergangsstyle construirt und spitz gewölbt sind. Das Dach ist ungewöhnlich hoch und steil und hat sicher noch die ursprüngliche Construction, während die Dächer wohl der meisten Kirchen des Landes in neuern Zeiten gesenkt sind. Daher sind auch noch die Blenden und Leisten des Giebels unberührt.
Aus dieser Darstellung ergiebt sich, daß im J. 1256 noch der Uebergangsstyl zur Anwendung kam; vielleicht aber liegt die Kirche zu Dänschenburg schon in den letzten Grenzen dieses Styls.
Uebrigens ist die Kirche grade nicht vorzüglich gebauet und erhalten.
Von großem Interesse ist mancher Gegenstand in der innern Ausstattung der Kirche.
In der Nordwand der Kirche neben dem Altare ist ein Tabernakel in Form eines Schrankes mit einem halben gothischen Thurme, der sich an die Wand lehnt, angebracht. Der durchbrochene Thurm ist im gothischen Style aus Eichenholz geschnitzt, ziemlich gut gearbeitet und stammt ungefähr aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die weiß getünchte Wand hinter diesem Thurme ist noch mit alten Arabesken bemalt. Es wiederholt sich auch hier, daß die Kirchen der Abtei Doberan Tabernakel hatten.
Der Altar, welcher eine schlechte Arbeit des Zopfstyls ist, enthält eine schlecht gemalte Kreuzigung und in der Predelle ein Abendmahl, beide ohne Werth. - Von alten Altarbildern ist nichts weiter übrig, als ein gut geschnitztes Bild der Heil. Anna aus Eichenholz.
Dagegen ist das vor dem Altartische angebrachte, auf Holz gemalte Antipendium , welches der Herr Dr. Hüen entdeckt hat, von großer Bedeutung für unsere Kunstgeschichte und wird unten in einem eigenen Anhange zu diesen Nachrichten beschrieben und gewürdigt werden.


|
Seite 349 |




|
Die Glocke ist sehr hübsch und mit vielen Verzierungen geschmückt und trägt die Inschrift:
Nach der von dem Herrn Pastor Steinfaß mitgetheilten Sage soll unter der Kanzel eine Quelle von wunderthätiger Wirkung gewesen sein und die grünlich gefärbten Ziegel im Fußboden noch für den feuchten Untergrund zeugen. Die Gegend von Dänschenburg hat viel Raseneisenstein oder Morasteisen und daher ist das Wasser wohl oft eisenhaltig.
G. C. F. Lisch.
Die Vorderseite des Altartisches in der Kirche zu Dänschenburg ist mit einem auf Holz gemalten Antipendium bekleidet, welches wohl seit einigen Jahrhunderten von der herabhangenden Altardecke verdeckt gewesen und daher noch recht gut erhalten ist. Mit Bildwerk geschmückte Bekleidungen des Altartisches aus Metall oder Holz waren im Mittelalter wohl nicht sehr selten; jedoch ist diese Art von Antipendien in den nördlichen Gegenden jetzt so selten geworden, daß das Erscheinen eines Exemplares zu den größten Seltenheiten gehört. So viel ist gewiß, daß bis jetzt in Meklenburg kein anderes Antipendium aus Metall oder Holz bekannt geworden ist, als dieses Antipendium von Dänschenburg; überhaupt scheint im nördöstlichen Deutschland bis jetzt kein anderes Antipendium dieser Art bekannt geworden zu sein. Bekannt ist jenseit der Elbe das werthvolle, auch auf Holz gemalte Antipendium aus dem 13. Jahrhundert vor dem Altare der Kirche zu Lüne, welches in den "Alterthümern der Stadt Lüneburg und des Klosters Lüne", 4. Lieferung, Lüneburg, 1857, herausgegeben ist. Gewirkte oder gestickte Antipendien oder Altardecken waren häufiger und sind ganz oder in Ueberresten noch zu finden.
Das hölzerne Antipendium von Dänschenburg ist grade so groß, wie die Vorderseite des steinernen Altartisches, 3 Fuß lang und 1 1/2 Fuß hoch, und von einem schmalen hölzernen Rahmen eingefaßt, welcher jedoch in neuern Zeiten erneuert oder übermalt ist. Die Tafel wird ganz von einem Oelgemälde gefüllt, welches den Tod der Jungfrau Maria darstellt. Unter einem grünen Thronhimmel mit zurückgebun=


|
Seite 350 |




|
denen Vorhängen liegt die sterbende Maria auf dem Bette mit dem Oberleibe halb aufgerichtet. Johannes, zu ihrer Linken hinter dem Bette, hält sie in dieser Lage. Neben ihm steht Petrus, welcher mit seiner rechten Hand der Maria das Licht in den Händen hält und mit seiner linken Hand den Weihwedel in das Weihbecken taucht. Die übrigen zehn Apostel stehen hinter dem Bette und am Fuße desselben hinter einander in die Länge gruppirt, um die lange Tafel zu füllen, während sie sich sonst auf Altarbildern gewöhnlich dicht um das Bett drängen. Zur vordern Seite des Bettes, zur Rechten der Maria, knieet betend vor der Maria eine Frau mit weißem Kopfschleier. Zu dem Haupte der Maria sitzt eine Jungfrau mit einer Mütze bekleidet. Dieses Bild ist ohne Zweifel für den Zweck eines Antipendii gemalt, gut erhalten und noch nicht übermalt. Die Verhältnisse und Stellungen der Figuren passen zu den Verhältnissen des Altartisches.
Wichtig für dieses Bild ist die Zeit, in der es gemalt ist. Und da muß ich bekennen, daß es zwar noch katholisch, aber nicht sehr alt ist, sondern der alterletzten Zeit des Katholicismus und zwar der Mitte der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts angehört. Hiefür redet nicht nur der Styl der Malerei, sondern auch und besonders der architektonische Hintergrund. Der ganze Hintergrund stellt gequadertes graues Mauerwerk dar. An jedem Ende steht ein grauer Pilaster, welcher einen nach innen gekehrten halben Rundbogen trägt, und in der Mitte des Hintergrundes stehen noch zwei Pilaster; diese Pilaster und Bogen sind ganz und genau der Architektur des nördlichen Renaissance=Baustyls nachgebildet und mit den charakteristischen Verzierungen desselben Styls grau in grau geschmückt. Diese ganze Architektur ist dem frühesten Ziegelrenaissancestyl des nordöstlichen Deutschlands, jedoch in grauen Farben, getreu nachgebildet. Auch die Malerei der Figuren spricht für die angegebene Zeit, sowohl im Allgemeinen, als im Einzelnen, z. B. der Styl der gekräuselten Haare und Bärte, welcher an die Zeit des Albrecht Dürer erinnert. Endlich ist die graue Farbe des Hintergrundes, statt eines Goldgrundes, schon ein Zeichen neuerer Zeit. Auch die Composition hat schon Abweichungen vom alten, strengen kirchlichen Styl, z. B. darin, daß der Apostel Petrus Licht und Weihwedel hält, während sonst gewöhnlich Johannes das Licht und Petrus den Weihwedel hält. Dagegen ist der Gegenstand der Darstellung, Mariens Tod, und die Auffassung derselben im Allgemeinen noch katholisch.


|
Seite 351 |




|
Man wird daher nicht fehl greifen, wenn man dieses Antipendium in die allerletzte Zeit des Katholicismus und in den ersten Anfang des Renaissancestyls in Meklenburg setzt und man das Jahr 1520 als das Jahr der Verfertigung annimmt. Die Schwankung kann höchstens wenige Jahre betragen. Im ersten Jahrzehend des 16. Jahrhunderts herrscht in Meklenburg nach datirten Kunstwerken noch der gothische Styl mit Goldgrund; im vierten Jahrzehend ward in Meklenburg gewiß kein katholisches Kunstwerk mehr gemacht. Der weiteste Zeitraum, in welchen dieses Antipendium fallen kann, ist also die Zeit von 1510 bis 1530; ich möchte den Raum auf die Zeit von 1520 bis 1530 beschränken.
Was den Werth des Gemäldes betrifft, so ist dasselbe ziemlich gut zu nennen; einige Köpfe sind sogar recht gut. Der Kopf der sterbenden Maria ist zwar nur unbedeutend, dagegen ist der Ausdruck im Kopfe des Johannes gefühlt und sehr gut; auch die Köpfe einiger andern Apostel sind recht gut, andere Gesichter haben noch die Eigenthümlichkeiten der alten Zeit.
Das Antipendium scheint noch seine ursprüngliche Größe zu haben. Die Länge ist gewiß noch die alte, da die beiden Pilaster mit den beiden einwärts gehenden Bogen noch die beiden äußersten Seiten begrenzen. Oben scheinen die beiden Bogen abgeschnitten zu sein; ob dies nun die ursprüngliche Art der Malerei ist, welche die Bogen an den Seiten nur andeuten und verlaufen lassen wollte, oder ob oben in jüngern Zeiten von der Tafel etwas abgenommen ist, läßt sich wohl nicht mehr bestimmen; es ist jedoch gewiß, daß die Verhältnisse des Ganzen noch gut sind und daß nichts zu fehlen scheint, auch daß sich in der ursprünglichen Malerei die Bogen nicht auf die beiden Pilaster in der Mitte des Gemäldes fortsetzen. Es scheint also, daß ursprünglich nur eine Andeutung einer Halle durch zwei sich verlaufende Bogen hat gegeben werden sollen.
Jedenfalls scheint es sicher zu sein, daß die Bekleidung der Vorderseite des Altartisches der Kirche zu Dänschenburg ein Antipendium ungefähr vom Jahre 1520 ist.
G. C. F. Lisch.
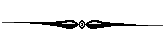


|




|

 in
in
 sind auf der Teplitzer Kelle
zusammengezogen. G. C. F. Lisch.
sind auf der Teplitzer Kelle
zusammengezogen. G. C. F. Lisch.
 in
in
 sind auf der Hagenower Kelle
zusammengezogen. G. C. F. Lisch.
sind auf der Hagenower Kelle
zusammengezogen. G. C. F. Lisch.