

|




|



|
|
|
- Handmühle von Zarrentin
- Kegelgrab von Rosenhagen (bei Dassow)
- Kegelgrab von Goldenitz
- Kegelgrab von Sukow (bei Marnitz)
- Römische und vaterländische Alterthümer von Hagenow
- Römische Bronze-Vase von Dobbin
- Römische Kelle von Schwinkendorf
- Hefteln von Schwinkendorf
- Bronze-Schmuck von Sophienhof
- Bronze-Schmuck von Vogelsang
- Urnen von Böhlendorf
- Wendenkirchhof von Pritzier
- Wendenkirchhof von Lehsen
- Glasperlen von Warkstorf
- Afrikanische Glasperlen
- Silberschmuck von Marlow
- Urnen von Schwerin
- Ein Dollen (scalmus) von Holz
- Eisernes Schwert von Rosenhagen
- Alterthümer von der Wiek bei Marlow
- Alterthümer von Neuburg
- Alterthümer aus den Ruinen des alten Schlosses Basedow
- Holzformen von Malchin
- Steinkiste von Sagel
- Wendenkirchhof von Börzow
- Wendenkirchhof von Vellahn
- Wendenkirchhof von Warlitz
- Gräber im südöstlichen Meklenburg
- Burgstellen im dümmerschen See
- Burgstelle von Lehsen
- Der Burgwall von Klein-Lukow
- Der Dom zu Güstrow
- Die Kirche zu Gägelow
- Die Kirche zu Serrahn
- Die Kirche zu Dreweskirchen (bei Neuburg)
- Die Kirche zu Alt-Gaarz
- Ueber die Kirchen und andere alte Bauwerke im südöstlichen Meklenburg
- Ueber die Kirchen des Klützer-Orts
- Ueber ein parchimsches Götzenbild
- Leichenstein von Marlow
- Glocken-Inschrift zu Rechlin
- Die Kuhsteine
- Geognostisches
- Die alten Schriftwerke der Stadt Güstrow


|




|
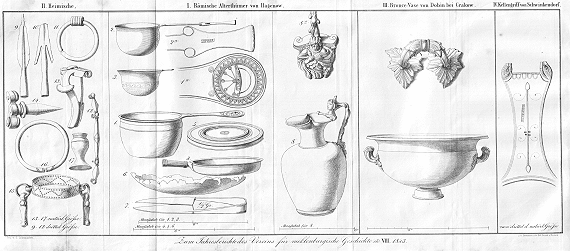


|




|
Jahresbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Arbeiten des Vereins
herausgegebenvon
A. Bartsch,
Domprediger zu Schwerin,
Ehrenmitgliede des historischen Vereins von
Unterfranken und Aschaffenburg und
correspondierendem Mitgliede der
Gesellschaft für pommersche Geschichte und
Alterthumskunde, der
schleswig=holstein=lauenburgischen
Gesellschaft für vaterländische Geschichte,
des altmärkischen Vereins für vaterländische
Geschichte und Industrie und der sinsheimer
Gesellschaft zur Erforschung der
vaterländischen Denkmale der Vorzeit,
als
zweitem Secretair des Vereins für
meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Achter Jahrgang.
Mit einer Tafel lithigraphirter Abbildungen und drei in den Text gedruckten Holzschnitten.
Auf Kosten des Vereins.
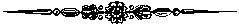
In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.
Schwerin, 1843.


|




|


|




|
Inhaltsanzeige.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
| S. | |
| 1. Veränderungen im Personalbestande und Verzeichnis aller derzeitigen Angehörigen des Vereins | 1 |
| 2. Finanzielle Verhältnisse | 19 |
| 3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung | 21 |
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
| 1. | Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler. | |||||
| A. | Sammlung von Schriftwerken. | |||||
| I. | Bibliothek | 23 | ||||
| II. | Sammlung von Urkunden, anderen alten Handschriften und typographischen Alterthümern | 32 | ||||
| B. | Sammlung von Bildwerken. | |||||
| I. | Alterthümer im engern Sinne | |||||
| 1. | Aus vorchristlicher Zeit | |||||
| A. | Aus der Zeit der Hühnengräber | 33 | ||||
| B. | Aus der Zeit der Kegelgräber | 36 | ||||
| C. | Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse | 58 | ||||
| 2. | Aus unbestimmter Zeit | 78 | ||||
| 3. | Aus dem Mittelalter | 79 | ||||
| II. | Münzen und Madaillen | 86 | ||||
| III. | Siegel | 88 | ||||
| IV. | Zeichnungen | 88 | ||||
| C. | Naturhistorische Sammlung | 89 | ||||
| D. | Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art. | |||||
| I. | Nachrichten von heidnischen Gräbern und andern historisch merkwürdigen Stätten | 90 | ||||


|




|
| S. | ||||||
| II. | Nachrichten über mittelalterliche Kirchen und andere Baudwerke | 97 | ||||
| III. | Verschiedene Nachrichten | 151 | ||||
| 2. | Bearbeitung des historischen Stoffes. | |||||
| A. | Gelieferte Arbeiten. | |||||
| I. | Größere Abhandlungen | 156 | ||||
| II. | Kleinere Mittheilungen | 157 | ||||
| B. | Begonnene und fortgesetzte Arbeiten | 158 | ||||


|
[ Seite 1 ] |




|
Erster Theil.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
1. Veränderungen im Personalbestande und Verzeichniß aller derzeitigen Angehörigen des Vereins.
D ie fortwährend wachsende Anerkennung, deren unser Verein im Auslande wie im Inlande sich zu erfreuen hat, verschaffte ihm auch in dem letztabgelaufenen Jahre eine ansehnliche Erweiterung seiner auswärtigen Verbindungen und Vermehrung seiner heimischen Angehörigen, wiewohl auch dieses Jahr nicht ohne schmerzliche Verlüste vorüberging. Es ward nämlich ein für unsern Verein ebenso ehrenvoller als ersprießlicher Schriftenaustausch angeknüpft mit der königlichen Akademie der Wissenschaften zu München, mit dem königlichen Museum der Alterthümer zu Leyden, mit dem hennebergischen Verein für vaterländische Geschichte zu Meiningen und mit der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau. Dem Kreise der correspondirenden Mitglieder ward durch den Tod entrissen der wirkliche Geheime=Ober=Regierungsrath von Tzschoppe zu Berlin, Director der Archive des preußischen Staates, welcher durch Beförderung unsrer Urkunden=Studien, namentlich zur Geschichte der Johanniter=Comthureien in Meklenburg, Verdienste um unsern Verein sich erworben hat. Einen erfreulichen Zuwachs dagegen erhielt dieser Kreis durch die Herren Bagmihl zu Stettin, Dr. Köhne zu Berlin und Geheime=Archivrath und Professor Dr. Stenzel zu Breslau.
Von seinen ordentlichen Mitgliedern verlor der Verein im Laufe des Jahres durch den Tod 6, nämlich die Herren Dr. Burmeister zu Wismar, Oberappellationsgerichts=Rath Baron von Nettelbladt zu Rostock, Oberappellations gerichts=Vicepräsident von Hobe zu Parchim, Präpositus


|
Seite 2 |




|
Riemann zu Boizenburg, Justizrath Stampe zu Rostock und Apotheker Stockfisch zu Zarrentin; auf andern Wegen schieden aus 8, nämlich die Herren Archivrath Evers, jetzt zu Hamburg, Hofapotheker Krüger, Dr. Dresen und Lieutenant a. D. von Wickede zu Rostock, Kammerjunker von Bülow, jetzt in Schweden, Bürgermeister von Müller zu Malchow, Gutsbesitzer Lancken auf Klein=Luckow und Baumeister von Motz, jetzt in Rußland. Dagegen traten folgende 27 Männer unserm Vereine als ordentliche Mitglieder bei:
1. Herr von Berg auf Neuenkirchen,
2. - Bibliothekar Gentzen zu Neustrelitz,
3. - Bauconducteur Thormann zu Wismar,
4. - Rittmeister von Gundlach auf Möllenhagen,
5. - Baron von Maltzahn auf Mallin,
6. - von Plüschow auf Kowalz,
7. - Geheime=Amtsrath Drechsler zu Lübz,
8. - Klosterhauptmann und Kammerherr von Borck auf Möllenbeck zu Malchow,
9. - von Klinggräff auf Chemnitz,
10. - Hausmarschall von Bülow zu Schwerin,
11. - Kammer= und Jagdjunker von Bassewitz zu Wismar,
12. - Kammerherr von Plessen auf Reez,
13. - von Schuckmann zu Viecheln,
14. - von Blücher auf Lüdershagen,
15. - Amts=Mitarbeiter von Bassewitz zu Schwerin,
16. - Lieutenant Baron von Stenglin zu Schwerin,
17. - von Behr=Negendanck aus Torgelow,
18. - Heise jun. zu Vollrathsruhe,
19. - Graf von Rittberg auf Beselin,
20. - Rudolph von Oertzen zu Rostock,
21. - von Barner auf Klein=Görnow,
22. - von Oertzen auf Woltow,
23. - von Quitzow auf Severin,
24. - von Ferber auf Melz,
25. - Gutsbesitzer Rohrdanz auf Dutzow,
26. - Brigadearzt Hofrath Dr. Frese zu Schwerin,
27. - Advocat Bartning zu Schwerin.
Der reine Gewinn gegen das vorige Jahr betrug also: an correspondirenden Gesellschaften 4, an correspondirenden Mitgliedern 2, an ordentlichen Mitgliedern 13.


|
Seite 3 |




|
Der bisher befolgten, von dem Ausschusse festgestellten Ordnung gemäß, wonach alle zwei Jahre ein vollständiges Verzeichniß sämmtlicher Angehörigen des Vereins in dem Jahresberichte abgedruckt werden soll, folgt auch diesmal (das letzte erschien in dem Jahrgange 1841) ein
Verzeichniß
der Protectoren, hohen Beförderer,
Ehrenmitglieder, correspondirenden Vereine,
correspondirenden Mitglieder und ordentlichen
Mitglieder,
am 11. Julius 1843.
I. Protectoren.
- Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Meklenburg=Strelitz.
- Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Meklenburg=Schwerin.
II. Hohe Beförderer.
- Seine Hoheit der Herzog Gustav von Meklenburg=Schwerin.
- Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Frau Erbgroßherzogin von Meklenburg=Schwerin.
- Ihre Königliche Hoheit die Frau Herzogin von Orleans.
- Ihre Königliche Hoheit die verwittwete Frau Großherzogin von Meklenburg=Schwerin.
- Seine Durchlaucht der regierende Fürst von Schaumburg=Lippe.
- Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Dänemark.
- Seine Durchlaucht der Erbprinz von Schaumburg=Lippe.
III. Ehrenmitglieder.
- Se. Excellenz der Herr Geheime Staatsminister v. Kamptz zu Berlin.
- Der königliche Oberpräsident der Provinz Pommern, Herr v. Bonin zu Stettin.
- Seine Excellenz der Herr Staatsminister v. Dewitz zu Neustrelitz.
- Seine Excellenz der Herr Graf von Reventlow, königlich dänischer Gesandter zu London.
- Die Frau Gräfin von Hahn auf Basedow.


|
Seite 4 |




|
IV. Correspondirende Vereine.
- Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde, zu Stettin.
- Schleswig=holstein=lauenburgische Gesellschaft für vaterländische Geschichte, zu Kiel.
- Königlich=dänische Gesellschaft für nordische Alterthumskunde, zu Kopenhagen.
- Thüringisch=sächsischer Verein für Erforschung vaterländischen Alterthums, zu Halle.
- Voigtländischer alterthumsforschender Verein, zu Hohenleuben.
- Königliche schleswig=holstein=lauenburgische Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, zu Kiel.
- Gesellschaft für vaterländische Alterthümer, zu Zürich.
- Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens, zu Münster
- Wetzlarscher Verein für Geschichte und Alterthumskunde.
- Historischer Verein für Niedersachsen, zu Hannover.
- Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmale der Vorzeit.
- Verein für hessische Geschichte und Landeskunde, zu Cassel.
- Historischer Verein für Oberfranken, zu Bamberg.
- Nassauischer Verein für Alterthumskunde und Geschichtsforschung, zu Wiesbaden.
- Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg, zu Würzburg.
- Altmärkischer Verein für vaterländische Geschichte und Industrie, zu Salzwedel.
- Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der russischen Ostsee=Provinzen, zu Riga.
- Dänischer historischer Verein, zu Kopenhagen.
- Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg, zu Berlin.
- Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, zu Görlitz.
- Verein für hamburgische Geschichte.
- Historischer Verein für Ober=Baiern, zu München.
- Königlich=baiersche Akademie der Wissenschaften, zu München.
- Königlich=niederländisches Museum der Alterthümer, zu Leyden.


|
Seite 5 |




|
- Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, zu Breslau.
- Hennebergischer Verein für vaterländische Geschichte, zu Meiningen.
V. Correspondirende Mitglieder.
| in Baden: | ||
| zu Sinsheim: | 1. | Wilhelmi, Pastor. |
| in Braunschweig: | ||
| zu Wolfenbüttel: | 2. | Schmidt Dr., Archivrath. |
| 3. | Schönemann Dr., Bibliothekar. | |
| in Bremen: | 4. | von Hormayr, Freiherr, Geheimer=Rath und königl. baierscher Gesandter. |
| in Dänemark: | ||
| zu Kopenhagen: | 5. | Finn Magnusen, Dr., wirklicher Etatsrath und Geheimer=Archivar. |
| 6. | Molbech Dr., Justizrath und Professor. | |
| 7. | Rafn Dr., wirklicher Etatsrath und Professor. | |
| 8. | Thomsen, Justizrath. | |
| in Frankfurt a. M.: | 9. | Böhmer Dr., Stadtbibliothekar. |
| in Hamburg: | 10. | Lappenberg Dr., Archivar und Senator. |
| in Hannover: | ||
| zu Göttingen: | 11. | Havemann Dr., Professor. |
| in Holstein=Lauenburg: | ||
| zu Kiel: | 12. | Asmussen Dr., Subrector. |
| 13. | Falck Dr., Etatsrath und Professor. | |
| zu Ratzeburg: | 14. | v. Duve Dr. |
| 15. | von Kobbe Dr., Rittmeister. | |
| in Lübeck: | 16. | Behn Dr. |
| 17. | Deecke Dr., Gymnasiallehrer. | |
| 18. | Dittmer Dr., | |
| in Oesterreich: | ||
| zu Wien: | 19. | Kopitar Dr., Ober=Bibliothekar. |
| zu Prag: | 20. | Hanka Dr., Bibliothekar. |
| in Preußen: | ||
| a. Provinz Brandenburg: | ||
| zu Berlin: | 21. | Friedländer Dr., Bibliothekar. |


|
Seite 6 |




|
| zu Berlin: | 22. | J. Grimm Dr., Professor. |
| 23. | W. Grimm Dr., Professor. | |
| 24. | Höfer, Geheimer=Archivrath. | |
| 25. | Homeyer Dr., Professor. | |
| 26. | Klaatsch, Geheimer=Archivrath. | |
| 27. | Köhne Dr. | |
| 28. | Kretschmer. | |
| 29. | Lachmann Dr., Professor. | |
| 30. | von Ledebur, Director. | |
| 31. | Pertz Dr., Ober=Bibliothekar. | |
| 32. | von Raumer Dr., Geheimer=Ober= Regierungsrath. | |
| 33. | Riedel Dr., Hofrath, Geheimer=Archivrath und Professor. | |
| zu Jüterbock: | 34. | Heffter Dr., Land= und Stadt=Gerichts=Director. |
| zu Neu=Ruppin: | 35. | Masch, Gymnasiallehrer. |
| zu Salzwedel: | 36. | Danneil, Director und Professor. |
| b) Prov. Pommern: | ||
| zu Greifswald: | 37. | Barthold Dr., Professor. |
| 38. | von Hagenow Dr. | |
| 39. | Kosegarten Dr., Professor. | |
| zu Stettin: | 40. | Bagmihl. |
| 41. | Giesebrecht, Professor. | |
| 42. | Hering Dr., Professor. | |
| 43. | von Medem, Archivar. | |
| zu Stralsund: | 44. | Brandenburg Dr., Syndicus und Archivar. |
| 45. | Fabricius, Burgemeister. | |
| 46. | Zober Dr., Gymnasiallehrer und Stadtbibliothekar. | |
| c) Provinz Preußen: | ||
| zu Königsberg: | 47. | Voigt Dr., Geheimer=Regierungsrath und Archiv=Director, Professor. |
| d) Provinz Schlesien: | ||
| zu Breslau: | 48. | Stenzel Dr., Geheimer=Archivrath und Professor. |
| zu Liegnitz: | 49. | von Minutoli, Regierungs=Assessor. |
| e) Provinz Sachsen: | ||
| zu Halle: | 50. | Förstemann Dr., Bibliothek=Secretär. |
| 51. | Leo Dr., Professor. |


|
Seite 7 |




|
| f) Rheinprovinz: | ||
| zu Bonn: | 52. | Dahlmann Dr., Hofrath und Professor. |
| in Sachsen: | ||
| zu Jena: | 53. | Michelsen Dr., Professor. |
| in Schweden: | ||
| zu Stockholm: | 54. | Hildebrand, Archivar und Reichs=Antiquar. |
| zu Upsala: | 55. | Geyer Dr., Professor und Reichshistoriograph. |
| 56. | Schröder M., Ober=Bibliothekar, Professor und Ordenshistoriograph. |
VI. Ordentliche Mitglieder.
A. In Meklenburg.
| zu Boizenburg: | 1. | Martens, Conrector. |
| 2. | von Röder, Domänenrath. | |
| 3. | von Schöpffer, Amtsauditor. | |
| 4. | Wilbrandt, Candidat. | |
| bei Boizenburg: | 5. | von Stern, Gutsbesitzer, auf Tüschow. |
| bei Brüel: | 6. | Schnelle Dr., Gutsbesitzer, auf Buchholz. |
| 7. | Zarncke, Pastor, zu Zahrenstorf. | |
| zu Bützow: | 8. | Bolte, Criminalgerichts=Director. |
| 9. | von Bülow, Criminalrath. | |
| 10. | Carlstedt M., Stiftsprediger. | |
| 11. | Drechsler, Senator. | |
| 12. | Fust, Cantor und Organist. | |
| 13. | Freiherr von Glöden. | |
| 14. | zur Nedden, Rector. | |
| 15. | Reinnoldt, Criminalsecretär. | |
| 16. | von Wick, Criminalrath. | |
| bei Bützow: | 17. | Behrns, Pastor, zu Qualitz. |
| 18. | Buschmann, Pastor, zu Boitin. | |
| 19. | Erhardt, Amtsverwalter zu Rühn. | |
| 20. | von Meerheimb, Drost, Gutsbesitzer, auf Gr. Gischow. | |
| 21. | Paepcke, Inspector, zu Dreibergen. | |
| 22. | Wagner, Pastor, zu Zernin. | |
| zu Crivitz: | 23. | Krüger, Amtmann. |
| 24. | Martini, Ober=Amtmann. | |
| zu Dargun: | 25. | Hase, Amtmann. |


|
Seite 8 |




|
| zu Doberan: | 26. | Crull, Präpositus. |
| bei Doberan: | 27. | Bauer, Pastor, zu Lambrechtshagen. |
| zu Dömitz: | 28. | von Bülow, Drost. |
| 29. | Witt, Amtsverwalter. | |
| 30. | Vogel, Bürgermeister. | |
| 31. | Zinck, Hauptmann a.D., Ober=Zollinspector. | |
| zu Eldena: | 32. | Günther, Hülfsprediger. |
| 33. | Sickel, Pastor. | |
| bei Friedland: | 34. | von Oertzen, Geheimer=Justizrath, Gutsbesitzer, auf Leppin. |
| zu Gadebusch: | 35. | Litzmann Dr., Medicinalrath. |
| 36. | Willhelm, Apotheker. | |
| 37. | von Wrisberg, Landdrost. | |
| bei Gadebusch: | 38. | von Behr, Gutsbesitzer, auf Renzow. |
| 39. | von Döring, Gutsbesitzer, auf Badow. | |
| 40. | Rohrdanz, Gutsbesitzer, auf Dutzow. | |
| zu Gnoien: | 41. | Bölckow, Hofrath. |
| 42. | von Kardorff, Gutsbesttzer auf Remlin. | |
| bei Gnoien: | 43. | von Schuckmann, zu Viecheln. |
| zu Goldberg: | 44. | Zickermann, Bürgermeister. |
| bei Goldberg: | 45. | Baron von Le Fort, Gutsbesitzer auf Boek, Klosterhauptmann zu Dobbertin. |
| zu Grabow: | 46. | Flörke, Kirchenrath. |
| 47. | Heyden, Conrector. | |
| 48. | Krüger, Amts=Mitarbeiter, Advocat. | |
| 49. | Löwenthal Dr. | |
| 50. | Matthesius, Pastor. | |
| 51. | von Pressentin, Amts=Mitarbeiter. | |
| 52. | Römer, Rector. | |
| 53. | Rüst Dr., Amtsarzt. | |
| bei Grabow: | 54. | Müller, Pastor, zu Neese. |
| bei Grevesmühlen: | 55. | Eckermann, Gutsbesitzer, auf Johannsdorf. |
| 56. | Rettich, Gutsbesitzer, zu Rosenhagen. | |
| 57. | von Paepcke, Justizrath, Gutsbesitzer, auf Lütgenhof. | |
| 58. | Willebrand, Candidat, zu Dassow. | |
| zu Güstrow: | 59. | Besser, Dr., Oberschulrath, Director des Gymnasiums. |


|
Seite 9 |




|
| zu Güstrow: | 60. | Brandt, Canzlei=Director. |
| 61. | von Bülow, Justizrath. | |
| 62. | Diederichs, Advocat. | |
| 63. | Krull, Advocat. | |
| 64. | Scheel, Stadtbuchhalter. | |
| 65. | Tarnow, Pastor. | |
| 66. | Türck, Pastor. | |
| 67. | Viereck, Senator. | |
| 68. | Volger Dr. | |
| bei Güstrow: | 69. | von Blücher, Gutsbesitzer, auf Lüdershagen. |
| 70. | von Buch, Gutsbesitzer, auf Zapkendorf. | |
| 71. | Engel, Gutsbesitzer, auf Charlottenthal. | |
| 72. | Kues Dr., Kreisphysicus. | |
| 73. | Graf von der Osten=Sacken, Gutsbesitzer, auf Marienhof. | |
| 73. | Schumacher, Präpositus, zu Parum. | |
| 74. | von Wedemeyer, Hof= und Canzleirath, Gutsbesitzer, auf Langhagen. | |
| bei Hagenow: | 75. | Bruger Dr., Pastor, zu Warsow. |
| zu Laage: | 76. | Kues Dr., Kreisphysikus. |
| 77. | Lüders, Bürgermeister. | |
| zu Lübz: | 78. | Drechsler, Geheimer =Amtsrath. |
| 79. | Schlaaff, Amtsauditor. | |
| bei Lübz: | 80. | von Behr=Negendanck, Gutsbesitzer, auf Passow. |
| zu Ludwigslust: | 81. | Bothe Dr. |
| 82. | Brückner Dr., Ober=Medicinalrath. | |
| 83. | Gerdeß, Rector. | |
| 84. | Kliefoth Dr., Pastor. | |
| 85. | von Schmidt, Geheimer=Legationsrath. | |
| 86. | Sellin, Pastor. | |
| 87. | Zehlicke, Seminardirector. | |
| bei Ludwigslust: | 88. | Erfurth, Pastor, zu Picher. |
| zu Malchin: | 89. | Behm, Cantor. |
| 90. | Büch, Rector. | |
| 91. | Timm, Präpositus. | |
| bei Malchin: | 92. | Graf von Hahn, Erblandmarschall, Gutsbesitzer, auf Basedow. |
| 93. | Baron von Maltzahn, Landrath, Gutsbesitzer, auf Rothenmoor. | |
| 94. | Walter, Pastor, zu Bülow. |


|
Seite 10 |




|
| zu Malchow: | 95. | von Borck, Kammerherr, Gutsbesitzer auf Möllenbeck, Klosterhauptmann. |
| 96. | Engel, Küchenmeister. | |
| 97. | Meyer, Bürgermeister. | |
| bei Malchow: | 98. | Graf von Blücher, Gutsbesitzer, auf Göhren. |
| 99. | Christmann, Candidat, zu Penkow. | |
| zu Mirow: | 100. | Giesebrecht, Präpositus. |
| zu Neubrandenburg: | 101. | Behm, Advocat. |
| 102. | Boll, Pastor. | |
| 103. | Brückner Dr., Rath. | |
| 104. | Friese Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |
| 105. | Frodien, Advocat. | |
| 106. | Hagemann, Kaufmann. | |
| 107. | Hahn, Senator und Camerarius. | |
| 108. | Hahn, Advocat. | |
| 109. | Hoffmann, Gastwirth und Weinhändler. | |
| 110. | Kirchstein Dr., Rath. | |
| 111. | Löper Dr. | |
| 112. | Meyncke, Kreisrendant. | |
| 113. | Müller Dr., Rath, Stadtrichter. | |
| 114. | Müller, Oberlehrer an der Mädchenschule. | |
| 115. | Nicolai, Syndicus. | |
| 116. | Oesten, Advocat und Landsyndicus. | |
| 117. | Roggenbau, Senator. | |
| 118. | Rümker, Advocat. | |
| 119. | Siemssen, Rathssecretär. | |
| bei Neubrandenburg: | 120. | von Berg, Gutsbesitzer, auf Neuenkirchen. |
| 121. | von Dewitz, Gutsbesitzer, auf Kölpin. | |
| 122. | von Engel, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Breesen. | |
| 123. | von Klinggräff, Gutsbesitzer, auf Chemnitz. | |
| 124 | Sponholz, Pastor, zu Rülow. | |
| bei Neubuckow: | 125. | Löper, Pastor zu Mulsow. |
| 126. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Roggow. | |
| 127. | Priester, Pastor zu Westenbrügge. |


|
Seite 11 |




|
| bei Neubuckow: | 128. | von Restorff, Drost, Gutsbesitzer, auf Radegast. |
| zu Neukalden: | 129. | Brinckmann, Präpositus. |
| bei Neukalden: | 130. | von Blücher, Landrath, Gutsbesitzer, auf Teschow. |
| zu Neustadt: | 131. | von Bülow, Landdrost. |
| bei Neustadt: | 132. | Grimm, Präpositus, zu Gr. Laasch. |
| 133. | Schneider, Pastor, zu Herzfeld. | |
| zu Neustrelitz: | 134. | Bahlcke, Hofrath. |
| 135. | Bergfeld, Professor. | |
| 136. | von Bernstorff, Regierungsrath. | |
| 137. | Gentzen, Bibliothekar. | |
| 138. | von Graevenitz, Geheimer=Kammerrath. | |
| 139. | Jahn, Gutsbesitzer auf Langhagen. | |
| 140. | Kaempffer, Consistorialrath und Superintendent. | |
| 141. | von Kamptz, Oberhofmeister. | |
| 142. | Ladewig Dr., Professor am Gymnasium. | |
| 143. | Lingnau, Postdirector. | |
| 144. | Nauwerck, Hofrath. | |
| 145. | von Oertzen, Kammerherr. | |
| 146. | Schröder, Rector der Mädchenschule. | |
| 147. | von Schultz, Geheimer=Justizrath. | |
| 148. | Weber, Geheimer=Justizrath. | |
| 149. | von Wenckstern, Oberstlieutenant. | |
| 150. | Wulffleff, Consistorialsecretär. | |
| zu Parchim: | 151. | Beyer Dr., Advocat. |
| 152. | Flörke, Superintendent. | |
| 153. | Flörke, Senator. | |
| 154. | Grothe, Oberappellationsgerichts=Procurator. | |
| 155. | Koß Dr., Bürgermeister. | |
| 156. | Langfeld, Gerichtsrath. | |
| 157. | Niemann, Collaborator am Gymnasium. | |
| 158. | Schumacher, Apotheker. | |
| 159. | Wilhelms, Advocat. | |
| 160. | Zehlicke Dr., Director des Gymnasiums. | |
| bei Parchim: | 161. | Paschen, Candidat, zu Sukow. |


|
Seite 12 |




|
| bei Parchim: | 162. | von Quitzow, Gutsbesitzer, auf Severin. |
| 163. | Tapp, Candidat der Theologie, zu Jarchow. | |
| zu Penzlin: | 164. | Betcke Dr. |
| 165. | Eberhard, Präpositus. | |
| 166. | Baron von Maltzahn, Erblandmarschall. | |
| 167. | Müller, Bürgermeister. | |
| 168. | Napp, Rector. | |
| bei Penzlin: | 169. | Eberhard, Präpositus. |
| 170. | Flügge, Gutsbesitzer, auf Gr. Helle. | |
| 171. | von Gundlach, Gutsbesitzer, auf Mollenstorf. | |
| 172. | von Gundlach, Rittmeister, Gutsbesitzer, auf Möllenhagen. | |
| 173. | Jahn, Gutsbesitzer, auf Kl. Vielen. | |
| 174. | Lorenz, Candidat, zu Gr. Lukow. | |
| 175. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Peutsch. | |
| 176. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Mallin. | |
| 177. | Nahmmacher, Pastor, zu Peccatel. | |
| zu Plau: | 178. | Dornblüth Dr., Hofrath, Kreisphysicus. |
| 179. | Nevermann Dr. | |
| 180. | Schultetus, Senator. | |
| bei Plau: | 181. | Cleve, Gutsbesitzer, auf Karow. |
| 182. | Ritter, Pastor, zu Vietlübbe. | |
| zu Ratzeburg: | 183. | von Bülow, Landrath, Gutsbesitzer, auf Gorow. |
| 184. | Becker Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |
| 185. | Genzken M., Consistorialrath. | |
| 186. | von Wickede, Forstjunker. | |
| 187. | Zander Dr., Professor. | |
| bei Ratzeburg: | 188. | Arndt, Pastor, zu Schlagsdorf. |
| zu Rehna: | 189. | Bauer, Pastor. |
| 190. | Daniel, Bürgermeister. | |
| 191. | Demmler, Senator. | |
| 192. | Fromm, Präpositus. | |
| bei Rehna: | 193. | Masch, Pastor, zu Demern. |
| 194. | Saalfeld, Pastor, zu Grambow. | |
| zu Ribnitz: | 195. | Crull, Amtmann. |


|
Seite 13 |




|
| zu Ribnitz: | 196. | zur Nedden, Amtsverwalter. |
| zu Röbel: | 197. | Engel, Bürgermeister, Hofrath. |
| 198. | von Lehsten, Drost. | |
| bei Röbel: | 199. | von Ferber, Gutsbesitzer, auf Melz. |
| 200. | von Gundlach, Gutsbesitzer, auf Hinrichsberg. | |
| 201. | Kortüm, Oeconom, zu Cambs. | |
| zu Rostock: | 202. | Ackermann, Oberappellations=Gerichtsrath. |
| 203. | Bachmann Dr., Professor und Director des Gymnasiums. | |
| 204. | Bartsch Dr., Vorsteher einer Mädchenschule. | |
| 205. | Beselin, Advocat. | |
| zu Rostock: | 206. | Crull Dr., Hofrath. |
| 207. | Crumbiegel Dr., Senator und Archivar. | |
| 208. | Diemer Dr., Consistorialrath, Professor. | |
| 209. | Ditmar Dr., Syndicus. | |
| 210. | Fromm, Oberappellationsgerichts=Vicepräsident. | |
| 211. | Iwan von Glöden, Privatdocent. | |
| 212. | Hinrichsen, Rentier. | |
| 213. | Karsten Dr., Bürgermeister. | |
| 214. | Karsten, Diaconus. | |
| 215. | Baron von Nettelbladt, Bibliothekar. | |
| 216. | von Nußbaum, Major. | |
| 217. | von Oertzen Dr., Oberappellationsgerichts=Präsident, Excellenz. | |
| 218. | von Oertzen, Candidatus juris. | |
| 219. | G. W. Pogge, Rentier. | |
| 220. | Reder Dr. | |
| 221. | Schäfer, Candidat. | |
| 222. | Scheel, Oberappellationsgerichtssecretär. | |
| 223. | Schmidt Dr., Canzleirath. | |
| 224. | Siemssen Dr. | |
| 225. | Spitta Dr., Professor, Ober=Medicinalrath. | |
| 226. | Tiedemann, Besitzer der Hof=Steindruckerei. | |
| 227. | Viereck, Oberappellationsgerichtsrath. |


|
Seite 14 |




|
| bei Rostock: | 228. | von Haeften, zu Hohen=Schwarfs. |
| 229. | von Plessen, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Reez. | |
| 230. | Graf von Rittberg, Gutsbesitzer, auf Beselin. | |
| zu Schönberg: | 231. | Bicker, Buchdrucker. |
| 232. | Karsten Dr., Gerichtsrath. | |
| 233. | Kindler, Advocat. | |
| 234. | Reinhold, Justizamtmann. | |
| zu Schwaan: | 235. | Ahrens, Gerichtsrath. |
| zu Schwerin: | 236. | Ahrens, Landrentmeister. |
| 237. | Assur, Privatgelehrter. | |
| 238. | Bärensprung, Hofbuchdrucker. | |
| 239. | Bartels, Dr. | |
| 240. | Bartning, Advocat. | |
| 241. | Bartsch, Pastor. | |
| 242. | von Bassewitz, Regierungsrath. | |
| 243. | von Bassewitz, Amts=Mitarbeiter. | |
| 244. | Boccius, Canzleirath. | |
| 245. | von Boddien, Kammerherr, Vice=Oberstallmeister. | |
| 246. | Bouchholtz, Geheimer=Hofrath. | |
| 247. | Bouchholtz, Regierungssecretair. | |
| 248. | Büchner Dr., Oberlehrer. | |
| 249. | von Bülow, Hausmarschall. | |
| 250. | Demmler, Hofbaurath. | |
| 251. | von Elderhorst, General=Major. | |
| 252. | Faull, Geheimer =Canzleirath. | |
| 253. | Graf von Finckenstein, Kammerherr, zur Zeit in Dresden. | |
| 254. | Fischer, Maler. | |
| 255. | Frese Dr., Brigade=Arzt und Hofrath. | |
| 256. | Glöckler, Archiv=Registrator. | |
| 257. | Grimm, Kriegsrath. | |
| 258. | Groth, Archivar. | |
| 259. | Hennemann Dr., Leibarzt, Geheimer=Medicinalrath. | |
| 260. | Holm, Hofrath. | |
| 261. | Jeppe, Kammer=Registrator. | |
| 262. | Juhr, Senator. | |
| 263. | Kaysel, Justizrath. | |
| 264. | Knaudt, Regierungsrath. |


|
Seite 15 |




|
| zu Schwerin: | 265. | Lenthe, Hofmaler, zur Zeit in Berlin. |
| 266. | von Levetzow, Minister und Kammerpräsident, Excellenz. | |
| 267. | Lisch, Archivar und Regierungs=Bibliothekar. | |
| 268. | von der Lühe, Lieutenant. | |
| 269. | von Lützow, Minister und Geheimerathspräsident, Excellenz. | |
| 270. | von Lützow, Schloßhauptmann. | |
| 271. | von Lowtzow, Lieutenant. | |
| 272. | Mantius, Commerzienrath. | |
| 273. | von Maydell, Canzlei=Vicedirector. | |
| 274. | Baron von Meerheimb, Kammerdirector. | |
| 275. | Mencke, Canzlei=Assessor. | |
| 276. | Meyer, Schulrath. | |
| 277. | Monich, Prorector. | |
| 278. | Müller, Geheimer=Canzleirath, Regierungs= und Lehnsfiscal. | |
| 279. | zur Nedden, Regierungsregistrator. | |
| 280. | Nübell, Münzrath. | |
| 281. | von Oertzen, Regierungs=Director. | |
| 282. | Oldenburg Dr., zweiter Hypothekenbewahrer. | |
| 283. | Peters, Hofcopiist. | |
| 284. | Petterß, Bildhauer. | |
| 285. | Prosch Dr., Geheimer=Legationsrath. | |
| 286. | Prosch Dr., Cabinetsrath. | |
| 287. | Reitz, Subrector. | |
| 288. | Ringwicht, Advocat. | |
| 289. | Baron von Rodde, Gutsbesitzer, auf Zibühl. | |
| 290. | von Santen, Hauptmann. | |
| 291. | Schmidt, Postsecretär. | |
| 292. | Schröder, Amtsverwalter. | |
| 293. | Schröder Dr., Pastor. | |
| 294. | Schultze, Steuerrath. | |
| 295. | Schumacher, Hofmaler. | |
| 296. | Schumacher, Revisionsrath. | |
| 297. | Schweden, Advocat. | |
| 298. | Schwerdtfeger, Advocat. | |
| 299. | Seebohm Dr. | |
| 300. | von Steinfeld, Geheimer=Rath. |


|
Seite 16 |




|
| zu Schwerin: | 301. | Baron von Stenglin, Lieutenant. |
| 302. | Strempel, Senator. | |
| 303. | Walter, Oberhofprediger. | |
| 304. | Wedemeyer, Dr. phil. | |
| 305. | Weir, Wegebaumeister. | |
| 306. | Wendt, Hofrath. | |
| 307. | Wex Dr., Director des Gymnasiums. | |
| 308. | von Wickede, Forstrath. | |
| 309. | Wünsch, Oberbaurath. | |
| 310. | von Zülow, Hauptmann und Flügel=Adjutant. | |
| bei Schwerin: | 311. | Beust, Pastor, zu Plate. |
| 312. | Flemming Dr., Ober=Medicinalrath, zu Sachsenberg. | |
| 313. | von Leers, Landrath, Gutsbesitzer, auf Schönfeld. | |
| 314. | von Schack, Geheimer=Rath, Gutsbesitzer, auf Brüsewitz. | |
| 315. | Schubart, Pensionär, zu Gallentin. | |
| bei Stavenhagen: | 316. | von Blücher, Rittmeister, Gutsbesitzer, auf Rosenow. |
| 317. | von Heyden, Gutsbesitzer, auf Bredenfelde. | |
| 318. | von der Lancken, Kammerjunker, Gutsbesttzer, auf Galenbeck. | |
| 319. | Nahmmacher, Pastor, zu Kastorf. | |
| zu Sternberg: | 320. | Kleiminger, Consistorial=Rath und Superintendent. |
| bei Sternberg: | 321. | von Barner, Gutsbesitzer, auf Kl. Görnow. |
| zu Sülz: | 322. | Koch, Geheimer=Amtsrath. |
| bei Tessin: | 323. | Karsten, Präpositus, zu Vilz. |
| 324. | von Koß, Gutsbesitzer, auf Vilz. | |
| 325. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Woltow. | |
| 326. | von Plüskow, Gutsbesitzer, auf Kowalz. | |
| zu Teterow: | 327. | Burmeister, Präpositus. |
| bei Teterow: | 328. | von Blücher, Landrath, Gutsbesitzer, auf Suckow. |
| 329. | Heise junior, zu Vollrathsruhe. | |
| 330. | Ludwig, Pastor, zu Klaber. | |
| 331. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Gr. Lukow. |


|
Seite 17 |




|
| bei Teterow | 332. | Baron von Maltzahn, Gutsbesitzer, auf Kl. Lukow. |
| 333. | Baron von Möller=Lilienstern, Gutsbesitzer, auf Carlsdorf. | |
| 334. | Pogge, Gutsbesitzer, auf Roggow. | |
| zu Waren: | 335. | Müller, Lehrer. |
| 336. | Pries, Bürgermeister. | |
| 337. | Schmidt, Bürgermeister, Hofrath. | |
| 338. | Sprengel, Dr. juris. | |
| bei Waren: | 339. | von Behr=Negendanck, Gutsbesitzer, auf Torgelow. |
| 340. | Brückner, Präpositus, zu Gr. Gievitz. | |
| 341. | Conradi, Pfarrvicar, zu Ankershagen. | |
| 342. | von Frisch, Gutsbesitzer, auf Klocksin. | |
| 343. | von Oertzen, Kammerherr, Gutsbesitzer, auf Sophienhof. | |
| 344. | von Oertzen, Gutsbesitzer, auf Marxhagen. | |
| 345. | Graf von Voß, Gutsbesitzer, auf Großen=Gievitz. | |
| zu Warin: | 346. | Bartsch Dr., Kreisphysicus. |
| zu Warin: | 347. | Pauly, Pensionär, zu Kl. Warin. |
| zu Wismar: | 348. | von Bassewitz, Kammer= und Jagdjunker. |
| 349. | von Cossel, Buchhändler. | |
| 350. | Crain Dr., Professor, Director des Gymnasiums. | |
| 351. | Crull, Kaufmann, königl. niederländischer Consul. | |
| 352. | Enghardt, Pastor. | |
| 353. | Francke Dr., Lehrer am Gymnasium. | |
| 354. | Frege Dr., Lehrer am Gymnasium. | |
| 355. | Haupt, Lehrer am Gymnasium. | |
| 356. | von Lützow, Erblandmarschall, Gutsbesitzer auf Eickhof. | |
| 357. | Thormann, Bau=Conducteur. | |
| 358. | von Vieregge, Kammerherr, Gutsbesitzer auf Steinhausen. | |
| bei Wismar: | 359. | Albrandt, Pastor, zu Lübow. |
| 360. | Keil, Pastor, zu Gressow. | |
| 361. | Koch, Gutsbesitzer, auf Dreveskirchen. |


|
Seite 18 |




|
| bei Wismar: | 362. | Lampert, Pastor, zu Dreveskirchen. |
| 363. | Strecker, Pastor, zu Hohenkirchen. | |
| zu Wittenburg: | 364. | von Flotow, Amtsverwalter. |
| 365. | von Rantzau, Oberforstmeister. | |
| 366. | Ratich, Amtshauptmann. | |
| 367. | Vaigt, Bürgermeister, Hofrath. | |
| bei Wittenburg: | 368. | Kehrhahn, Pastor, zu Döbbersen. |
| 369. | Krüger, Pastor, zu Gammelin. | |
| 370. | von Lützow, Gutsbesitzer, auf Tessin. | |
| 371. | von Paepcke, Domainenrath, Gutsbesitzer, auf Quassel. | |
| 372. | von Schack, Gutsbesitzer, auf Körchow. | |
| zu Zarrentin: | 373. | Grammann, Pastor. |
| 374. | Paepcke, Amtsverwalter. |
C . Im Auslande.
| in der Mark Brandenburg: | 375. | von Hieronymi Dr., Professor. zu Berlin. |
| 376. | Schadow Dr., Director. zu Berlin. | |
| 377. | Graf von Zieten, Landrath, Erbherr auf Wustrau. | |
| zu Hamburg: | 378. | Krüger, Postsecretär. |
| im Hannöverschen: | 379. | Freytag, Pastor, zu Gartow. |
| 380. | von dem Knesebeck, Geheimer=Justizrath, zu Göttingen. | |
| in Pommern: | 381. | Baron von Krassow, Landrath, zu Franzburg. |
| in Rußland: | 382. | Rußwurm, Ober=Inspector zu Reval. |
| in Sachsen: | 383. | Sabinin M., Hofpropst, zu Weimar. |
| I. | Protectoren | 2 | |
| II. | Hohe Beförderer | 7 | (1841 : 6). |
| III. | Ehrenmitglieder | 5 | (1841 : 3). |
| IV. | Correspondirende Vereine | 26 | (1841 : 20). |
| V. | Correspondirende Mitglieder | 56 | (1841 : 57). |
| VI. | Ordentliche Mitglieder | 383 | (1841 : 360). |


|
Seite 19 |




|
2. Finanzielle Verhältnisse.
Vom 1. Julius 1842 bis zum 1.Julius 1843 betrug
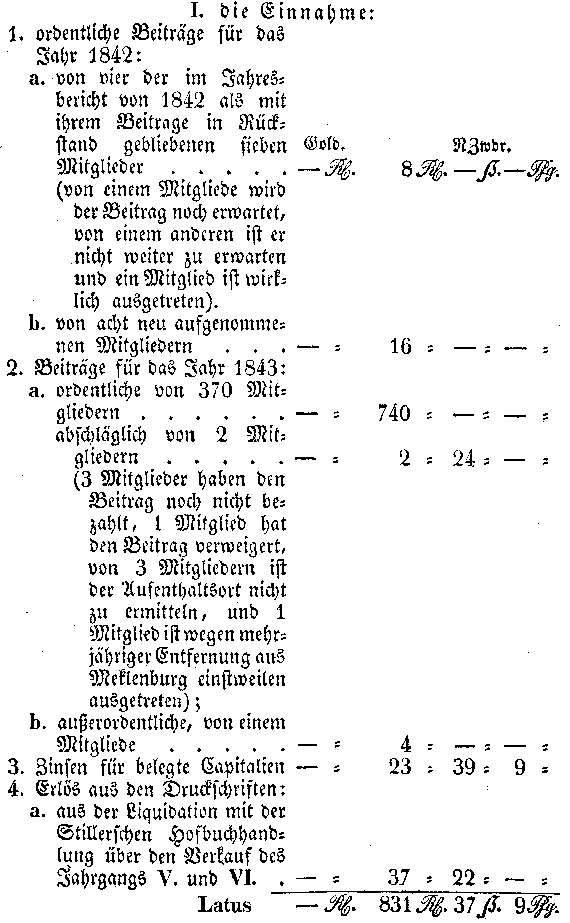


|
Seite 20 |




|
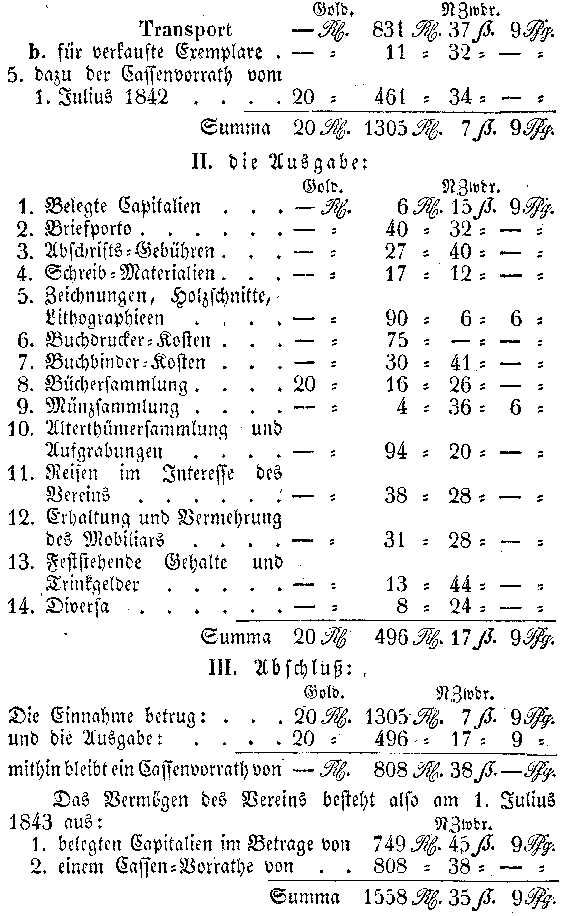
Schwerin, den 1. Julius 1843.
P. F. R. Faull,
Cassen=Berechner.


|
Seite 21 |




|
3. Versammlungen, Verfassung und Verwaltung.
Wie gewöhnlich besprach und berieth auch in diesem Jahre der Ausschuß in vier regelmäßigen Quartalversammlungen und in mehreren außerordentlichen Sitzungen die gemachten oder zu machenden Erwerbungen und Unternehmungen, die eingegangenen und in die Jahresschriften aufzunehmenden wissenschaftlichen Arbeiten, denen in einzelnen Fällen noch eine besondere, genaue Prüfung von Seiten einiger Mitglieder des Ausschusses zu Theil ward, so wie sämmtliche zu seiner Beaufsichtigung und Leitung verstellte Verwaltungsgegenstände. Am Tage der Generalversammlung (11. Julius) waren der Herr Präsident und der Herr Vicepräsident des Vereins auf Reisen abwesend, weshalb von ihnen beauftragt der zweite Secretär die Versammlung, an welcher auch diesmal außer hiesigen mehrere auswärtige eifrige Mitglieder des Vereins theilnahmen, eröffnete und leitete. Seinem allgemeinen Jahresberichte schlossen die übrigen Beamten ihre speciellen an. Nachdem im Namen des Herrn Geheimeraths=Präsidenten von Lützow Exc. und des Herrn Regierungs=Directors von Oertzen die erfreuliche Mittheilung gemacht worden, daß dieselben auch für das nächste Jahr das Präsidium des Vereins führen wollen, wurden, mit Ausnahme des Bibliothekars, die sämmtlichen bisherigen Beamten wiederum für ein Jahr in ihren Aemtern bestätigt. Der zeitherige Bibliothekar, Herr Hofbuchdrucker Bärensprung, hatte leider beim Präsidium die Anzeige machen müssen, daß es ihm fortdauernder Krankheit wegen unmöglich sei, diesem Geschäfte ferner vorzustehen, eine Anzeige, welche den Ausdruck lebhaften Bedauerns über den Verlust eines Beamten hervorrief, der acht Jahre lang mit ebenso großer Umsicht als Emsigkeit und Gewissenhaftigkeit den Bücherschatz des Vereins gemehrt, geordnet und beaufsichtiget hat. Zur Einleitung in die nun vorzunehmende Neuwahl ward der Versammlung von Seiten des Ausschusses eröffnet, daß es seine Absicht sei, durch den neuen Bibliothekar die Büchersammlung des Vereins systematisch ordnen und einen entsprechenden Katalog derselben anfertigen zu lassen, nicht minder auch, um die Benutzung der Bibliothek zu erleichtern und zu fördern, unter den Vereins=Mitgliedern in Schwerin und der Umgegend einen Lesecirkel zu bilden, dem ausgewählte Bücher von allgemein interessantem Inhalt aus der Bibliothek zugewiesen werden sollen und dessen Leitung ebenfalls der Bibliothekar zu übernehmen haben wird. Die hierauf erfolgende Wahl traf den Herrn Archiv=Registrator Glöckler,


|
Seite 22 |




|
der bisher schon aushelfend um die Bibliothek sich verdient gemacht hatte. Die weitere Ergänzung des Ausschusses fand durch die Erwählung der Herren Regierungsrath Knaudt, Vice=Oberstallmeister von Boddien, Director Dr. Wex und Justizrath Kaysel zu Repräsentanten statt. Ein in dem Vereinslocale ausgestellter, dem Herrn Maler Fischer zur Restauration übergebener, an Schnitz= und anderm alten Bildwerk sehr reicher alter Altar (von Lübeck, einst der Kirche zu Neustadt geschenkt) gab sodann dem Herrn Archivar Lisch zu der interessanten Mittheilung einer alten Urkunde über die Anfertigung einer Altartafel für die St. Georgen=Kirche zu Parchim Veranlassung. Hierauf ward die Versammlung geschlossen und die gemeinschaftliche Besichtigung der zahlreichen und wichtigen neuen Erwerbungen für die Vereins=Sammlungen vorgenommen.


|
Seite 23 |




|
Zweiter Theil.
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
I. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler.
A. Sammlung von Schriftwerken.
I. Bibliothek.
V erzeichniß der in dem Vereinsjahre 18 42/43 erworbenen Bücher (vgl. Jahresber. VII, S. 8 - 16):
- - 1260. Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. 1r und 2r Bd. Bd. 3,Abth. 2. München 1830 - 1842. 4. (Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)
- Alberti, Sechszehnter und siebenzehnter Jahresbericht des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. Gera 1841, 1842. 8. [M. s. Nr. 386, 539, 784, 1102.] (Geschenk des Vereins.)
- Anzeigen, gelehrte, der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften. München 1842. Nr. 117 - 122. 4. (Enthaltend: Besprechung von G. C. F. Lisch Meklenb. Urkunden durch von Koch=Sternfeld. - Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)
- - 1265. Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 7ten Bandes 1stes bis 3tes Heft. Würzburg, 1841 - 1843. 8. [M. s. Nr. 827, 1010, 1105.] (Geschenk des Vereins.)
- - 1269. Archiv, Vaterländisches, des historischen Vereins für Niedersachsen. Herausgegeben von A. Brönnenberg u. A. Jahrg. 1841. 4 Hefte. Hannover. 8. [M. s. Nr. 396, 542, 1006, 1106.] (Geschenk des Vereins.)
- - 1272. Archiv, Oberbayrisches, für die vaterländische Geschichte, herausgegeben von dem historischen Verein


|
Seite 24 |




|
von und für Oberbayern. 4ten Bandes 1stes bis 3tes Heft. München 1842, 1843. 8. [M. s. Nr. 1110 flg.] (Geschenk des Vereins.)
- Ausstellung von Schrift= und Kunst=Denkmalen mit besonderer Rücksicht auf die Geschichte Westphalens. Zur Feier der Anwesenheit des Königs und der Königin zu Münster im Aug. 1842, veranstaltet durch den Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Münster 1842. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur (enthaltend: Auszüge aus den Arbeiten der historischen Section). 1839 - 1841. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
- - 1280. J. F. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch. Bd. I. Lief. l - 6. Stettin 1842. 8.
- F. W. Barthold, Geschichte von Pommern und Rügen. Thl. 3. Hamburg 1842. 8. [M. s. Nr. 553 und 1019.]
- Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 9ten Jahrgangs 1stes Heft. Stettin 1842. 8. [M. s. Nr. 11, 224, 400, 550, 841, 1016, 1123.] (Geschenk der Gesellschaft.)
- Baur= und Schäfer=Ordnung, Renovirte und nach itziger läuffte Gelegenheit erweitert und erklärte, Philippsen, Hertzogen zu Stettin Pommern etc. Alten=Stettin, 1616. Jetzo - wieder auffgelegt zu Stargardt 1700. Fol. (Geschenk des Hrn. von Berg auf Neuenkirchen.)
- L. Bechstein, Deutsches Museum für Geschichte, Literatur, Kunst und Alterthumsforschung. 2r Bd. Jena 1843. 8. [M. s. Nr. 1126.]
- Bericht, vorläufig - doch gründlicher vom Adel in Teutschland etc. Francfurt am Main, 1721. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)
- Bericht, fünfter, über das Bestehen und Wirken des historischen Vereins zu Bamberg in Oberfranken von Bayern. Bamberg 1842. 8. [M. s. Nr. 559, 850, 1127.] (Geschenk des Vereins.)
- Bericht, achter, der königlich Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Erstattet von dem Vorstande gedachter Gesellschaft. Kiel 1843. 8. [M. s. Nr. 229, 407, 561, 657, 1023, 1128.] (Geschenk der Gesellschaft.)
- Prof. Bernd zu Bonn, Römische Alterthümer in Meklenburg. 1842. 8. (Aus der Zeitschrift der Freunde


|
Seite 25 |




|
des römischen Altertums zu Bonn. - Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. Ch. S. Th. Bernd, das Wappenwesen der Griechen und Römer und anderer alter Völker, ein Vorbild des mittelalterlichen und neuen. Mit 900 Abbildungen auf 17 Tafeln. Bonn, 1841. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
-
Dr. Ch. S. Th. Bernd, Allgemeine Schriftenkunde
der gesammten Wappenwissenschaft
 . 1r, 3r und 4r Thl. Bonn 1830,
1835, 1841. 8. (Geschenk desselben.)
. 1r, 3r und 4r Thl. Bonn 1830,
1835, 1841. 8. (Geschenk desselben.)
- Dr. Ch. S. Th. Bernd, Beschreibung der im Nachtrage zu dem Wappenbuche der Preuß. Rheinprovinz gelieferten Wappen des immatriculirten Adels. Bonn 1843. 8. (Geschenk desselben.)
- Dr. W. G. Beyer, Betrachtungen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadt Parchim. Parchim und Ludwigslust 1839. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- H. Bolzenthal, Denkmünzen zur Geschichte des Königs Friedrich Wilhelm III. in Abbildungen mit Erläuterung. 2te Ausgabe. Berlin 1842. 4. (Geschenk des Hrn. von Kardorff auf Remlin zu Gnoien.)
- - 1296. S. W. A. Bratring, Statistisch=topographische Beschreibung der gesammten Mark Brandenburg. 3 Bde. Berlin 1804 - 1809. 4.
- Bülletin der königlichen (bayerischen) Akademie der Wissenschaften. München 1842. Nr. 11 - 22. 4. (Geschenk der königl. Akademie der Wissenschaften zu München.)
- H. Carstens, Kirchenordnung für das Lübeckische Landgebiet, für die Stadt Mölln und für Travemünde vom J. 1531. (Bei einer Jubilar=Feier herausgegeben.) Lübeck 1843. 4. (Geschenk des Hrn. Dr. Deecke zu Lübeck.)
- Dav. Chytraei Chronicon Saxoniae etc. Pars prima. Ab anno Chr. 1500 usque ad a. 1524. Rostochii 1588. 8. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)
- Dr. C. F. Crain, Schulprogramm zum 1. October 1842. Wismar 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. E. Deecke, Das Catharineum zu Lübeck vor 1800. Eine Jubelschrift (am 50jährigen Jubiläum des Lübeckschen Ministerii Seniors Dr. Behn) im Namen jener Anstalt verfaßt. Lübeck 1843. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- J. Fr. Danneil, sechster Jahresbericht des Altmärkischen Vereins für vaterländische Geschichte und Industrie. Neu=


|
Seite 26 |




|
haldensleben und Gardelegen 1843. 8. [M. s. Nr. 869, 1041, 1140.] (Geschenk des Vereins.)
- J. G. Eccardi de origine Germanorum etc. libri duo. Ed. Ch. Lud. Scheidius. Goettingae 1750. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)
- C. G. Fabricius, Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingebornen Fürsten. Bd. 2. Erstes Heft der Urkunden von 1193 - 1260. Stralsund 1843. 4. [M. s. Nr. 1146.] (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Förnmanna Sögur. Annat, Fridja, Fimta Bindi. Kaupmannahafn, 1826, 1827, 1830. 8. (Geschenk der Gesellschaft für nordische Alterthumskunde zu Kopenhagen.)
- Dr. Heinrich Francke, Der böotische Bund. (Dem Herrn Director Besser zu Güstrow zum goldenen Amtsjubelfeste am 20. April 1843 gewidmet.) Wismar 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- A. G. F. Frese, Schwedisch=deutsches Wörterbuch etc. mit beständiger Rücksicht auf nordische Geschichte, Altersthumskunde und Mythologie etc. Stralsund, 1842. 8.
- Freyens oder Hochzeit Formular, darinnen allerhand schriftliche, meistentheils aber mündtliche Formulen und Vorträge, so bei Werbungen, Verlöbnussen, Hochzeiten und Heimführungen in vblichem Gebrauch etc. - erstlich durch Friedericum Ortlepium Weinheimensem Palatinum - zusammen getragen, jetzunt aber von M. Georgio Schenkio gemehret vnnd in Druck verfertiget. Zu Frankfurt a. M. bei Cr. Egenolphs Erben. Im Jahr 1594. 4. (Geschenk des Hrn. von Berg auf Neuenkirchen.)
- Gesellschaft, die königliche für nordische Alterthumskunde. Jahresversammlung 1842. Kopenhagen 1842. 8. [M. s. Nr. 1151.] (Geschenk der Gesellschaft.)
- - 1312. Ludwig Giesebrecht, wendische Geschichten aus den J. 780 bis 1182. Bd. 1. - 3. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- A. G. F. Griewank, Ueber den Werth des naturgeschichtlichen Unterrichts auf Gymnasien. Schulprogramm für 1842. Wismar 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Prof. Dr. Crain zu Wismar.)
- J. Grimm, Weisthümer. 2r Theil. Göttingen 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Geheimeraths=Präsidenten von Lützow Exc.)


|
Seite 27 |




|
- Leop. Haupt und Joh. Ernst Schmaler, Volkslieder der Wenden in der Ober= und Nieder=Lausitz. Bd. 1, Hft. 4 und 5, nebst Schluß des ersten Bandes. Grimma 1842. 4. [M. s. Nr. 1154.]
- M. Bernhard Hederichs kurtze Verzeichnus der Bischoffe zur Schwerin in Meckelnburgk. 1585. 4. Mscr. (Geschenk des Hrn. Bäckers Burmeister zu Wismar aus dem Nachlasse seines Bruders, des wail. Dr. Burmeister das.)
- Jos. v. Hefner, Das römische Bayern in antiquarischer Hinsicht. 2te Aufl. München 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- a. Historische Remarques über die neuesten Sachen in Europa. 1704 - 1707. b. Hamburger Verordnungen u. s. w. 1707 - 1709. c. Das Neue der heutigen Welt 1709. 4. (Geschenk des Hrn. Postsecretairs Krüger in Hamburg.)
- Jahrbuch, wissenschaftliches, der Herzogthümer Mecklenburg. Jahrg. 1808. Nr. 1 - 4. 4. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann in Rostock.)
- 1321. Jahresbericht, sechszehnter und siebenzehnter, der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1842. 8. [M. s. Nr. 97, 265, 615, 912, 1159.] (Geschenk der Gesellschaft.)
- 1323. Jahresbericht, vierter und fünfter, des historischen Vereins von und für Oberbayern etc. Für das Jahr 1841 und 1842. München 1842. 1843. 8. [M. s. Nr. 1160.] (Geschenk des Vereins.)
- Janssen, De Germansche en noordsche Monumenten van het Museum te Leyden. Leyden 1840. 8. (Geschenk des Hrn. Verf. Dr. Janssen, Conservators am königl. Museum der Alterthümer zu Leyden.)
- Janssen, Ouer de oudheitkundige ontdekking tusschen den dorpen Beek en Wielderen. 1840. 8. (Von Demselben.)
- Janssen, Oudheitkundige Mededeelingen. I. Leyden 1842. 8. (Von Demselben.) .
- Janssen, Over de oudste vaderlandsche Schansen. Arnhem 1843. 8. (Von Demselben.)
- Janssen, Oudheitkundige ontgravingen by Wyk by Duurstede. 8. (Von Demselben.)
- Janssen, Nieuw ontdecht romeinsch opschrift inde linge, onder hemmen. 8. (Von Demselben.)


|
Seite 28 |




|
- Ritter J. F. von Koch Sternfeld, Topograph. Matrikel, geschöpft aus dem diplomatischen Codex der Juvavia (Salzburg) und aus dem Codex des Chronicon lunaelacense (Mondsee) vom 6. bis zum 11. Jahrhundert reichend etc. München 1841. 4. (Geschenk der königl. bayerischen Akademie.)
- r. B. Köhne, Das Münzwesen der Mark Brandenburg unter Churfürst Friedrich II. Berlin, Posen und Bromberg 1841. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. B. Köhne, Neue Beiträge zum Groschen=Cabinet, oder Verzeichniß mehrerer Münz=Samlungen, welche im April 1843 (in Berlin) versteigert werden sollen. Berlin 1843. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. J. G. L. Kosegarten, Nachricht von der Wiederauffindung der durch Thomas Kantzow eigenhändig geschriebenen zweiten hochdeutschen Abfassung seiner pommerschen Chronik etc. Greifswald 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- J. M. Lappenberg, Hamburgisches Urkundenbuch. Erster Band. Hamburg 1842. 4.
- Conr. Leemans, Horapollinis Niloi Hieroglyphica. Amst. 1835. 8. (Geschenk des Hrn. Herausgebers, Dr. Leemans, Directors des königl. Museums der Alterthümer zu Leyden.)
- Conr. Leemans, Romeinsche Steenen Doodenkisten by Nymegen 1840 opgedolven. Arnhem 1842. 8. (Von Demselben.)
- Conr. Leemans, Asiatische en Amerikaansche Monumenten van het Museum van Outheden te Leyden. Leyden 1842. 8. (Von Demselben.)
- Conr. Leemans, Grafsteen van eenen frieschen Ruiter, gevonden in Engeland. Workum 1843. 8. (Von Demselben.)
- Conr. Leemans, Bydragen tot de geschiedenis der bouw - en beeldhouwkunst in Nederland. 8.(Von Demselben.)
- - 1342. C. L. Liscov's Schriften. Herausgeg. Von Carl .Müchler. Thl. 1.- 3. Berlin 1806. 8.
- G. C. F. Lisch Urkunden=Sammlung zur Geschichte des Geschlechts von Maltzahn. 1ster Band. Vom Jahre 1197 - 1331. Mit zwei Steindrucktafeln. Schwerin 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Landraths von Maltzahn auf Rothenmoor.)


|
Seite 29 |




|
- G. M. C Masch, Die großherz. Alterthümer= und Münzsammlung in Neustrelitz. Leitfaden für den Besucher derselben. 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- - 1347. Dr. M. M. Mayer, Der Nürnberger Geschichts=, Kunst= und Alterthums=Freund. 1ster Jahrgang. 1stes - 3tes Heft. Mit 7 Abbildungen. (Geschenk des Hrn. Archiv=Secretairs Mayer in Nürnberg.)
- A. L. J. Michelsen, Sammlung alt=dithmarscher Rechtsquellen. Namens der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte herausgegeben. Altona 1842. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- A. L. J. Michelsen, Urkundensammlung der Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für vaterländ. Geschichte. Namens der Gesellschaft redigirt. mit einer Wappentafel. Kiel 1842. 4. (Geschenk der Gesellschaft.)
- H. C. von Minutoli, topographische Uebersicht der Ausgrabungen griechischer, römischer, arabischer und anderer Münzen und Kunstgegenstände, wie solche zu verschiedenen Zeiten in den Küstenländern des baltischen Meeres stattgehabt. Berlin 1843. 8.
- Mitteilungen der Zürcherischen Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. 4tes Heft. 1843. 4. (Enthaltend: Geschichte der Inseln Ufenau und Lützelau im Zürichsee. - Geschenk der Gesellschaft.) [Man vgl. unten die Zeitschrift derselben Gesellschaft.]
- 1353. Mittheilungen, neue, aus dem Gebiete historisch=antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem thüringisch=sächsischen Verein für Erforschung des vaterländ. Alterthums. 6ten Bandes 3tes und 4tes Heft. Halle und Nordhausen 1842. 1843. 8. [M. s. Nr. 150, 326, 479, 690, 941, 1068, 1184.] (Geschenk des Vereins.)
- Mooyer, Das Necrologium des hildesheimischen St. Michaelisklosters. Hannover 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- E. F. Mooyer, Beiträge zur Geschichte der vormaligen Benediktiner =Abtei Tegernsee und deren Verbindung mit andern Klöstern. Minden 1843. 8. (Geschenk des Hrn, Verf.)
- Joseph Moritz, Stammreihe und Geschichte der Grafen von Sulzbach. 1r Bd. München 1833. 4. (Geschenk der königl. bayerischen Akademie.)
- Museum van Oudheden te Leyden. 8. (Geschcnk des Hrn. Dr. Leemans.)


|
Seite 30 |




|
- Nederlandsche Staats - Courant 1840, Nr. 64; 1841, Nr. 22; 1842, Nr. 10; 1843, Nr. 17. Fol. (Enthaltend: die Jahresberichte des Museums. - Geschenk des Hrn. Dr. Leemans.)
- Nachricht, fünfte, über den historischen Verein für Niedersachsen. Hannover 1841. 8. (Geschenk des Vereins.)
- Fr. Opitz, Mittheilungen aus dem Leben des ehem. polnischen, jetzt belgischen Generals Langermann. Güstrow 1834. 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)
-
M. Johannes Pomarius, der Magdeburgischen Stadt
Chroniken. Magdeburgk 1587. 4. (Geschenk des
Hrn. Bäckers Burmeister zu Wismar aus dem
Nachlasse seines Bruders, des wail. Dr.
Burmeister daselbst.) Nr. 1361 sind
beigebunden:
a. Breue Chronicon arctoae partis Germaniae et vicinarum gentium ab a. 1581 usque ad a. 1587. Excusum 1587. 4.
b. Itinerarium Hierosolymitanum Bartholomaei de Saligniaco. Anno 1587. 4.
c. Descriptio terrae sanctae et regionum finiti marum, auctore Bernhardo monacho germano. (1283.) Item. Itinerarium Hierosolymitanum Bartholomaei de Saligniaco. Magdeburgi 1587. 4. -
K. Preusker, Blicke in die vaterländische
Vorzeit
 . Bd. 2. Mit Abbildungen. Leipzig
1843. 8. [M. s. Nr. 1081.] (Geschenk des Hrn. Verf.)
. Bd. 2. Mit Abbildungen. Leipzig
1843. 8. [M. s. Nr. 1081.] (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Fr. von Raumer, Historisches Taschenbuch. Neue Folge. 4r Jahrgang. Leipzig 1843. 8. [M. s. Nr. 348, 498, 1082, 1195.] (Geschenk des Hrn. Regierungs=Directors von Oertzen zu Schwerin.)
- (Dr. Reuß,) Walther von der Vogelweide. Eine biographische Skizze. Würzburg 1843. 8. (Geschenk des histor. Vereins zu Würzburg.)
- C. Rußwurm, Nordische Sagen, der deutschen Jugend erzählt und mit einem wissenschaftlichen Anhange versehen. Mit 5 Holzschnitten von L. v. Maydell. Leipzig 1842. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- P. J. Schafarik's slavische Alterthümer. Deutsch von Mosig von Aehrenfeld, herausgegeben von H. Wuttke. Bd. 1. Leipzig 1843. 8.


|
Seite 31 |




|
- Dr. Heinr. Schreiber, Die Feen in Europa. Eine historisch=archäologische Monographie. Freiburg 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. Heinr. Schreiber, Die ehernen Streitkeile, zumal in Deutschland. Eine historisch=archäologische Monographie. Freiburg 1842. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. F. C. Serrius, M. Joachim Schlüter oder die Reformation in Rostock. Rostock 1840. 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)
- Statuta, verbesserte, zur Abstellung der Betteley in der Stadt Güstrow. Rostock 1796. 4. (Von demselben.)
-
(G. Thiele) Beschreibung des Doms in Güstrow
 . Rostock (1726). 4. (Von Demselben.)
. Rostock (1726). 4. (Von Demselben.)
- J. Chr. Ungnaden, Amoenitates diplomaticohistorico-juridicae. 18 Stücke. 1749 - 1754. 4. (Geschenk des Hrn. Stud. med. Crull aus Wismar.)
- a. J. C. Velthusen, Ueber das Gute, welches der Herzogl. Landes=Universität Rostock im ersten Jahre ihrer Wiederherstellung zugeflossen ist. Eine Rede. (Rostock 1790.) 8. b. Derselbe, Nachricht von der Stiftung eines herzogl. Pädagogisch=theolog. Seminariums auf der Universität Rostock. (Rostock 1790.) 8. (Geschenk des Hrn. J. G. Tiedemann zu Rostock.)
-
Joh. K. Wächter, Statistik der im Königreiche
Hanover vorhandenen heidnischen Denkmäler. Im
Auftrage des historischen Vereins für
Niedersachsen
 . bearbeitet. Mit 8
lithographirten Tafeln. Hannover 1841. 8.
(Geschenk des Vereins.)
. bearbeitet. Mit 8
lithographirten Tafeln. Hannover 1841. 8.
(Geschenk des Vereins.)
- L. Weyl, Der Führer durch die Kunstsammlungen Berlins. VI. Die Sammlung vaterländischer Alterthümer. Berlin 1842. 12. (Geschenk des Hrn. Gymnasiallehrers Masch zu Neu=Ruppin.)
- Dr. P. Wigand, Wetzlarsche Beiträge für Geschichte und Rechtsalterthümer. 2ten Bandes 2tes Heft. Frankfurt a. M. 1842. 8. [M. s. Nr. 527, 767, 996.] (Geschenk des Wetzlarschen historischen Vereins.)
- K. Wilhelmi, Achter Jahresbericht an die Mitglieder der Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterländischen Denkmäler der Vorzeit. Sinsheim 1842. 8. [M. s. Nr. 768 - 773.] (Geschenk der Gesellschaft.)


|
Seite 32 |




|
- Zeitschrift für vaterländ. Alterthumskunde, herausgegeben von der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich. 1stes Heft Beschreibung einiger Grabhügel bei Basel. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Zürich 1842. 4. [M. vgl. Nr. 1351.] (Geschenk der Gesellschaft)
- 1380. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. 3ten Bandes 1stes und 2tes Heft. Cassel 1842. 8. [M. s. Nr. 775, 1249.] (Geschenk des Vereins.)
- Zeitschrift desselben Vereins, zweites Supplement. Hessische Chronik von Wigand Lanze. 2ten Theils 3tes bis 6tes Heft. Cassel 1842. 8. [M. s. Nr. 1250.] (Geschenk des Vereins.)
- Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westphalens. Band 5. Münster 1842. 6. [M. s. Nr. 779, 998, 1098, 1253.] (Geschenk des Vereins.)
- Z (ober), Das Annen= und Brigittenkloster und seine Kapelle. Stralsund 1842. 4. (Separatabdruck aus der Sundine. - Geschenk des Hrn. Verf.)
- Dr. E. Zober, Stralsundische Chroniken. 2r Theil, oder: Die Stralsunder Memorialbücher Joachim Lindemanns und Gerhard Hannemanns, zum ersten Male aus den Handschriften herausgegeben. Stralsund 1843. 8. [M. s. Nr. 1255.] (Geschenk des Hrn. Verf.)
(Für H. W. Bärensprung im Auftrage
des Ausschusses A. F. W. Glöckler.)
II. Sammlung von Urkunden, anderen alten Handschriften und typographischen Alterthümern.
Herr von Berg auf Neuenkirchen schenkte:
Codicill derWittwe von Wangelin, geb. Staffeld, vom Jahre 1639, in beglaubigter Abschrift.
Sonstige alte Handschriften und alte Druckwerke sind in diesem Jahre nicht erworben.


|
Seite 33 |




|
B. Sammlung von Bildwerken.
I. Alterthümer im engern Sinne.
1. Aus vorchristlicher Zeit.
A. Aus der Zeit der Hünengräber.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.
Hünengrab in der Gegend von Gnoien.
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Keile.
1 Keil aus gelblich=grauem Feuerstein, dessen Schärfe abgeschlagen ist, gefunden zu Sellin auf Rügen, geschenkt vom Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch.
1 Keil von hellgrauem Feuerstein, gefunden beim Pflügen auf der Feldmark Warkstorf bei Wismar, von dem Herrn Dr. Gertz durch den wail. Herrn Dr. Burmeister zu Wismar geschenkt.
1 Keil aus hellgrauem Feuerstein, 7 " lang, gefunden zu Jördenstorff bei Neubuckow, und
1 Keil aus Hornblende, 6 " lang, 1 1/2 "
dick, mit ausgeschliffenen Seitenflächen, auf
welchen zwei Runen
 offenbar in jüngeren Zeiten
eingekratzt sind, gefunden auf der Insel Rügen, ganz
wie der bei Sülz gefundene (vgl. Jahresber. VI, S.
32 und VII, S. 19), geschenkt von dem Herrn
Studiosus Crull aus Wismar.
offenbar in jüngeren Zeiten
eingekratzt sind, gefunden auf der Insel Rügen, ganz
wie der bei Sülz gefundene (vgl. Jahresber. VI, S.
32 und VII, S. 19), geschenkt von dem Herrn
Studiosus Crull aus Wismar.
1 Keil aus bräunlich=grauem Feuerstein, gefunden zu Malchin, 4 ' tief in der Erde, unter der Torflage, auf dem Seegrunde, geschenkt vom Herrn Rector Bülsch zu Malchin.
Streitäxte und Streithämmer.
1 Streitaxt und 1 Streithammer, gefunden zu Flessenow, am schweriner See, eingereicht durch den Herrn Mechanikus Müller zu Schwerin.


|
Seite 34 |




|
Die Streitaxt, von Hornblende, von der größten Art und trefflich polirt, ist mit altem Bruch quer durch das Schaftloch durchgesprungen und nur in der scharfen Hälfte, gegen 6 " lang, vorhanden.
Der Streithammer, von glimmerigem, dunklem Thonstein, ist kurz und dick und im Ganzen an 4 " lang; die Schneide ist in alten Brüchen mehrfach ausgesprungen, und daher sind die Seiten in graden Flächen offenbar nachgeschliffen.
1 Streitaxt aus Hornblende, von der kleinsten Art, nur 3 " lang, etwa 1 " hoch und im Durchmesser des Schaftloches eben so breit, vortrefflich gebohrt, gefunden 1843 zu Miekenhagen bei Neubuckow, geschenkt vom Herrn Pastor Vortisch zu Satow.
1 Streitaxt von Hornblende, von schlanker, zierlicher Gestalt und sauberer Arbeit, jedoch nur zur Hälfte vorhanden, gefunden zu Gr. Luckow, geschenkt von dem Herrn Baron von Maltzahn auf Gr. Luckow.
1 Streitaxt aus dunkler Hornblende, im Schaftloche durchbrochen, nur in der untern Hälfte vorhanden und an der Schärfe beschädigt, sehr gut polirt, von der allergrößten Art, wie Frid Franc. Tab. XXVIII, Fig. 1, jedoch zierlicher, in dem vorhandenen Bruchstücke 6 " lang, 2 1/2 " dick und 2 1/2 " breit über das Schaftloch gemessen, 2 1/4 Pfund schwer, gefunden beim Abkarren der Ufer des tief aufgegrabenen, zwischen dem Krummen= und Wulwenower=See fließenden Grenzbaches zwischen Roggow und Niegleve, dort wo vor alter Zeit die roggower Mühle stand, geschenkt vom Herrn Pogge auf Roggow.
1 Streitaxt aus Kieselschiefer, von dicker, kugeliger Gestalt, gefunden zu Kölzin beim Mergelgraben 6 Fuß tief im Sande oberhalb des Mergellagers, durch den Herrn Pastor Ritter zu Wittenburg erworben.
1 Streitaxt aus Hornblende, von ganz flacher Gestalt, ganz in Form eines Plätteisenbolzens, überall ungefähr 1 " dick, gefunden auf der Burgstelle im dümmerschen See, durch den Herrn Pastor Ritter zu Wittenburg erworben.
1 Streithammer aus Grünstein, 4 1/4" lang, gefunden zu Meklenburg, geschenkt von dem Herrn Studiosus Crull aus Wismar.
1 Streithammer aus Hornblende, im Schaftloche zerbrocchen, zur vordern Hälfte vorhanden, gefunden zu Satow im See, geschenkt vom Herrn Pastor Vortisch daselbst.
1 Streithammer von Hornblende, wie Frid. Franc. Tab. XXVIII, Fig. 5, wahrscheinlich in der Mark Brandenburg gefunden, von dem Herrn Grafen von Hahn auf Basedow gefunden und Fideicommiß desselben.


|
Seite 35 |




|
Messer.
2 spanförmige Messer aus Feuerstein, gefunden zu Zarrentin, geschenkt von dem Herrn Pastor Masch zu Demern. Es soll zu Zarrentin eine sehr große Masse solcher Messer gefunden sein (vgl. auch Jahresber. V, S. 30), jedoch hat es nicht gelingen wollen, darüber nähere Nachricht zu gewinnen.
1 spanförmiges Messer aus hellgrauem Feuerstein, ganz neu, gefunden zu Meklenburg, und
1 spanförmiges Messer aus dunkelgrauem, durchscheinendem Feuerstein, gefunden auf der Insel Lieps vor Wismar, geschenkt von dem Herrn Studiosus Crull aus Wismar.
Lanzenspitzen.
1 Lanzenspitze aus Feuerstein, 6 " lang, gefunden zu Strietfeld in der Erde beim Ziehen eines Grabens, geschenkt vom Herrn Kammer=Ingenieur Engel zu Dargun.
1 Lanzenspitze von Feuerstein, 5 " lang, gefunden zu Lohmen 6 Fuß tief in dem Torfmoore am lohmer See an der Landstraße nach Güstrow, geschenkt von dem Herrn Pastor Lierow zu Lohmen.
Ein Dolch aus Feuerstein,
4 1/2 " lang, dessen Spitze abgebrochen ist, gefunden zu Schmakentin bei Wismar, geschenkt vom Herrn Studiosus Crull aus Wismar.



|



|
|
:
|
Handmühle von Zarrentin.
Von dem Herrn Amtsverwalter Päpcke erhielt ich zu Zarrentin bei meiner Anwesenheit daselbst eine Handmühle, welche sich bei Ziehung eines Grabens und beim Ausroden von Baumstämmen auf der zarrentiner Feldmark, unweit des Weges nach Testorf, gefunden hat. Sie besteht aus 2 runden, hellfarbigen, an den Rändern vielfach abgestoßenen Granitplatten, von etwa 16 " im Durchmesser, von denen die untere bedeutend convex und die obere concav ausgeschliffen ist und welche genau auf einander passen. Der größere Stein hat eine Höhe von 8 1/2" und in der Mitte der convexen Fläche ein rundes Loch von 1 1/2" Tiefe und 2 1/2" Breite, welches also nicht durchgeht. Der concave Stein ist dünner und hat in der Mitte ein durchgehendes rundes Loch von 3 " Tiefe und 3 1/2" Breite. Die Aushöhlung dieses und die Erhabenheit des andern Steins beträgt gut 1 1/2".
Wittenburg, im October 1842.
J Ritter.


|
Seite 36 |




|
B. Aus der Zeit der Kegelgräber.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Gräber.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Rosenhagen (bei Dassow).
Das Grab fand sich südlich ungefähr 5 Minuten vom hiesigen Hofe entfernt, auf dem vierten der vom Ostseestrande an gerechneten und dann links vom Strandwege liegenden Ackerschläge. Auf dem jenseits des Weges gegenüber gelegenen Schlage, vom genannten Grabe aus in der Richtung von Ost nach West, 150 Schritte von demselben, deutet ein noch ziemlich bemerkbarer Hügel auf ein anderes gewesenes Kegelgrab, welches eingezogenen Nachrichten zufolge vor ungefähr 30 Jahren abgeräumt und zerstört ward. Es soll dasselbe sehr hoch aufgeworfen gewesen sein, und will man in einer sehr mächtigen viereckigen Steinkiste viele Knochen (wovon auch noch jetzt mitunter einige dort ausgeackert werden), besonders aber auch kupfernes oder bronzenes Geräthe gefunden haben, wovon ein hiesiger älterer Gutseinwohner noch eine Art von "Sargbeschlag" namhaft macht, ohne daß sich übrigens Spuren vom Sarge selbst gezeigt hätten. - Doch jetzt zu dem gegenwärtigen Funde, der am 23. Septbr. 1842 gemacht ward. Eine nur sehr unmerkliche, dem Anscheine nach gar nicht mit Absicht aufgeworfene Erhöhung ließ nichts weniger als ein Begräbniß erwarten, als bereits im Frühjahr der Pflug dort auf einem förmlichen Steinlager eine Strecke lang dauernden Widerstand fand. Da sich nun aber dieses Hinderniß nie früher gezeigt, so läßt sich wohl annehmen, daß erst durch Abschwemmung und allmäliges Abackern sich dieser Hügel zur jetzigen unscheinbaren Gestalt erniedrigt habe. Es spricht auch der unzweifelhafte Thatbestand, daß sich in demselben nur ein flach liegendes Begräbniß fand, wohl für die Vermuthung, daß der Hügel nie einen beträchtlich größeren Aufwurf gezeigt habe, besonders wenn die im Jahresber. II, S. 138 gegebene Charakteristik solcher Gräber in Betracht gezogen wird. Wie schon aus Vorigem erhellt, war also die ganze Structur dieses Grabes höchst einfach. In einer Länge von 5 Schritt (Richtung genau von Osten nach Westen) und Breite von 3 1/2 Schritt fand sich ein nur einschichtiger, indeß sehr dichter Steindamm, in dessen Mitte, höchstens von 7 " Erde bedeckt, ein 2' 3 " langer und 2 Fuß breiter, sehr flacher Deckstein von dem schon oft gefundenen körnigen rothen Sandstein bald bemerklich ward. Bei Aufhebung desselben fanden sich, vermischt mit dem gewöhnlichen weißen Streusande, eine ziemliche Menge von mehrentheils angebrannten Menschenknochen und ein im


|
Seite 37 |




|
Jahresber. II, S. 141 als den Kegelgräbern eigenthümlich beszeichnetes, jedoch nur 11 1/2" langes und 1 1/4 " breites Schwert von Bronze, das noch Reste von einem hölzernen Griffe trägt, wie Frid. Franc. Tab. XXV, Fig. 9, jedoch etwas breiter, ferner die Hälfte einer bronzenen Heftel mit Spiralplatte von Größe und Gestalt wie Frid. Franc. Tab. XI, Fig. 3. Das in ganz unversehrtem Zustande gefundene Schwert ward leider durch Ungeschicklichkeit des aufgrabenden Arbeiters an der Spitze zerbrochen. Zu sehr reinlicher Unterlage diente diesem Funde ein dem obern Decksteine in jeder Hinsicht ganz ähnlicher, nur etwas kleinerer Stein von derselben Masse. Von Urnen fand sich nicht die geringste Spur. Am östlichen Ende des Grabes unter dem Steinpflaster fand sich die Stätte des Leichenbrandes, sehr sichtbar durch stark geschwärzte kohlige Erde mit einzelnen verbrannten Knochenresten.
Rosenhagen.
M. W Rettich



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Goldenitz.
Unweit des pritzierschen Wendenkirchhofs (siehe unten "Wendenbegräbnisse") haben auf dem Felde von Goldenitz, nahe an der Grenze von Pritzier, eine Menge kleiner Kegelgräber mit Steinkisten, ähnlich denen zu Perdöhl, gelegen; sie sind bis auf eins der Steine wegen abgetragen. Da dies letzte Grab noch ziemlich gut erhalten schien, so ließ ich es von Osten nach Westen durchgraben, was mir der Herr Landrath von Könemann gütigst gestattete, obgleich der Raum mit Tannen besaamt war. Doch war es schon über die Hälfte durchwühlt und fand sich darin nur eine kleine Urne, welche 3 3/4" hoch ist, 1 3/4" in der Basis und 3 1/2" im Bauche mißt. Sie hat einen kleinen Henkel, von oben nach unten mit einem dünnen runden Instrumente durchbohrt, wodurch ein Eindruck auf der Urne geblieben ist. Weiter fand sich nichts.
Wittenburg, im October 1842.
J. Ritter.



|



|
|
|
Kegelgrab von Sukow (bei Marnitz).
Von den auf der Grenzfeldmark Sukow zahlreich vorhandenen Kegelgräbern ward eins, welches etwa 2000 Schritte nordöstlich vom Dorfe lag, für landwirthschaftliche Zwecke gänzlich abgetragen. Auf die Kunde davon eilte der Herr Cand. theol. Paschen zu Sukow sogleich zu dem Grabe, dessen Westhälfte bei seiner Ankunft bereits abgetragen war. Das in ovaler Gestalt von N. nach S. sich ausdehnende Grab war ursprünglich


|
Seite 38 |




|
etwa 30 Fuß lang, 20 Fuß breit und ungefähr 8 Fuß hoch gewesen. Im Innern des Grabes fand sich ein Gewölbe von Feldsteinen, ungefähr 8 Fuß lang und breit und 3 Fuß hoch; unter den nur mittelgroßen Steinen befanden sich einige gespaltene, deren ursprüngliche Stellung nicht mehr zu ermitteln war. Unter diesem Steingewölbe fand sich auf der Erdoberfläche ein mit schönem, hellgrünem edlen Roste bedecktes bronzenes Schwert mit Griffzunge für einen hölzernen oder ledernen Griff, ganz wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 3; die Griffzunge ist am Ende halbmondförmig ausgeschnitten und hat drei Nietlöcher; an jeder Seite der Anfügung der Griffzunge an die Klinge sind 2 Nietlöcher zum Befestigen des Griffes, welcher in halbmondförmiger Gestalt über die Klinge faßte. Die Klinge ist am spitzen Ende durchbrochen, in den Bruchenden oxydirt und gebogen, so daß es vor der Beilegung zerbrochen ist, wie immer die Bronzeschwerter in Kegelgräbern. Dabei fand sich ein Doppelknopf von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 22, gleich den modernen Hemdknöpfen. Schwert und Knopf sind durch Geschenk des Herrn Cand. Paschen in den Besitz des Vereins gekommen.



|



|
|
:
|
Römische und vaterländische Alterthümer von Hagenow 1 ).
A. Geschichte des Fundes.
Erste Nachgrabung.
Im September 1841 wurden dem Herrn Minister von Lützow, Präsidenten unsers Vereins, mehrere Bronzen von einem Arbeitsmann aus Horst bei Wittenburg, der sie bei Hagenow gefunden zu haben versicherte, gebracht, mit der Behauptung, daß dort noch mehr dergleichen vorhanden sei. Der Herr Minister kaufte sie an und schenkte sie dem Vereine. Die Sachen fielen als sehr ausgezeichnet in die Augen; es war jedoch kein bestimmtes Zeichen vorhanden, daß man sie mit Sicherheit für griechische oder römische Antiken hatte ausgeben können.
Es waren:
1) eine große Kelle aus
Bronze,
2) eine kleine Kelle aus
Bronze,
3) ein Sieb von der Größe der
kleinen Kelle, aus Bronze, allen drei Gefäßen
fehlte der Griff;
ferner:


|
Seite 39 |




|
a. ein aus zwei Schlangen (?) gewundener Henkel aus Bronze, an beiden Enden in menschliche Brustbilder auslaufend, und
b. ein hohl gegossener Cylinder, auf der Oberfläche mit gegossenen Längsreifen verziert, ganz den öfter vorkommenden Leuchterdillen aus den drei letzten Jahrhunderten ähnlich.
Beide Gegenstände paßten nicht zu den gefundenen Gefäßen, und die Gestalt und Verzierung des Cylinders erregte Zweifel gegen ein hohes Alter des Fundes.
Zweite Nachgrabung.
Den Bemühungen des Herrn Burgemeisters Dr. Bölte zu Hagenow gelang es endlich, den Besitzer des Grundstücks, auf welchem die zuerst erworbenen Gegenstände gefunden waren, zu ermitteln. Das Grundstück ist der dritte von den vier Gärten, welche vor der Stadt Hagenow an der Landstraße nach Schwerin und zwar zwischen dem im J. 1818 vor die Stadt verlegten Begräbnißkirchhofe und den Scheuren stadtwärts liegen. Nach einer Tradition sollen hier in alten Zeiten Gebäude gestanden haben, namentlich eine Kapelle, und die angrenzenden Ackerstücke, welche theilweise vom Kirchhofe mit eingenommen werden, heißen noch "auf den Kapellenstücken". - Von diesen vier Gärten ist derjenige, welcher zunächst an der Landstraße liegt, schon vor ungefähr 50 Jahren von dem derzeitigen Besitzer, der dort "vergrabene Schätze" vermuthete, ganz und tief durchgegraben. Ob er etwas gefunden hat, weiß man nicht, glaubt es aber, weil er sonst ein so kostspieliges Nachgraben nicht so fortdauernd fortgesetzt haben würde. Der zweite Garten ist noch nicht durchgegraben, auch der vierte nicht. Der dritte Garten, in welchem die Alterthümer gefunden sind, ist fast ganz durchwühlt theils weil der schon seit 13 Jahren ihn besitzende Miethsmann jährlich Kartoffelgruben, stets auf verschiedenen Stellen, angelegt hat, theils weil sich in der Tiefe von 2 Fuß stets ein Damm von nutzbaren Feldsteinen findet, endlich weil der Besitzer auf Schätze gehofft und gelegentlich gegraben hat. Bis zu der Zeit, wo die oben verzeichneten Alterthümer entdeckt wurden, hat er jedoch nichts als Steine gefunden.
Im Octbr. 1841 wurden beim Graben einer Kartoffelgrube wieder Bronzen gefunden und von dem Arbeiter an den Eigenthümer des Gartens abgeliefert, von diesem durch den Herrn Burgemeister Dr. Bölte für den Verein erworben. Es waren dies:


|
Seite 40 |




|
4) eine große flache Schale aus Bronze,
5) eine Gießkanne aus Bronze, zu welcher der beim ersten Funde unter a. erwähnte gewundene Henkel mit den zwei menschlichen Brustbildern gehört,
6) eine kleinere Schale aus Bronze, zu welcher der beim ersten Funde unter b. erwähnte hohle, mit Längsreifen verzierte Cylinder als Griff gehört, und
7) ein Deckel aus Bronze, der ungefähr zu dieser Schale paßt. Die schöne Gestalt und Arbeit dieser Gegenstände und der treffliche Rost, welcher die Seiten, die nach unten gelegen hatten, bedeckt, bestärkten die Ansicht, daß die Bronzen römische seien, immer mehr, und der Herr Dr. Bölte übernahm mit Aufmerksamkeit und Ausdauer eine weitere Nachforschung im März 1842, welche denn auch mit dem glücklichsten Erfolge gekrönt ward.
Dritte Nachgrabung.
Zuerst wurden in der Tiefe derselben Kartoffelgrube, welche den zweiten Theil des Fundes enthielt, als der wichtigste Theil des ganzen Fundes entdeckt:
8) eine Scheere aus Bronze,
c. der abgebrochene Griff der großen Kelle Nr. 1 mit der römischen Inschrift: TI (P)O(P)ILI SIT , und
d. der abgebrochene Griff der kleinen Kelle Nr. 2 mit der römischen Inschrift: - EPIDIA.
Die Bronzen sind also unbezweifelt römischen Ursprungs. Ferner wurden daneben folgende Sachen gefunden, welche den in den Wendenkirchhöfen gefundenen einheimischen Geräthen gleich sind:
9) eine Heftel aus Bronze,
10) eine Heftel
aus Eisen mit Silber garnirt,
11) ein Sporn
aus Eisen auf Bronzestuhl,
12) eine
Schildfessel aus Bronze,
13) eine
Lanzenspitze aus Eisen,
14) ein Wurfspieß
aus Eisen,
15) 16) zwei Ringe aus Silber
mit 2 seitwärts anhangenden Beschlägen,
17)
ein Beschlagring aus Silber,
18) ein
Endbeschlag aus Silber,
19) ein großer Ring
aus Eisen,
20) ein kleiner Beschlag aus Eisen.
Diese hatten zum größern Theile ohne Zweifel in der großen Schale Nr. 4 gelegen, da dieselbe fast ganz mit Eisen=Oxyd bedeckt war.


|
Seite 41 |




|
B. Beschreibung.
1. Römische Alterthümer.
Die auf Tab. I abgebildeten römischen Alterthümer gleichen in mancher Hinsicht den bei Gr. Kelle gefundenen im Jahresbericht III, 1838, S. 42 - 57 beschriebenen und zum Jahresber. V Anhang abgebildeten römischen Atterthümen; auch hier, wie dort, wurden 1 großes Bronze=Gefäß, 3 Kellen und 1 Scheere gefunden.
1) Eine große Kelle aus Bronze, Tab. I, Fig. 1, 4 1/4" hoch, 7 " weit in der Mündung, mit flachem Boden, zum Stehen eingerichtet, gegossen, innen und außen auf der Drehbank abgedreht und innen mit vertieften, außen mit erhabenen Reifen verziert. Der Griff, Tab. I, Fig. 1 a, ist auch 7 " lang, in den Umrissen geschweift und 1 1/2" bis 2 1/2" breit, am Ende halbkreisrund ausgebogen und mit einer kreisförmigen, eingedreheten Verzierung geschmückt, in deren Rand Blätterverzierungen mit Stempeln eingeschlagen sind. Im untern Theile der Rundung stehen 7 eingeschlagene kleine concentrische Kreise an Strahlen um einen gleichen Kreis. Unter diesen sind 2 größere Kreise eingeschlagen, und weiter hinab ist ein Vierblatt, in jedem Winkel mit einem Kreise eingeschlagen. In dem obern Theile dieser Rundung ist ein halbmondförmig ausgeschlagenes Loch und darüber ist, in der Mitte der Rundung, mit einem Stempel folgende römische Inschrift geprägt:
Diese Kelle ist der bei Gr. Kelle gefundenen, Jahresber. V, Tab. II, Fig. 2 abgebildeten silbernen Schöpfkelle ähnlich, läuft nach dem Boden jedoch weniger spitz zu.
2) Eine kleine Kelle aus Bronze, Tab. I, Fig. 2, 3 1/4", hoch, 5 " weit in der Oeffnung, halbkugelförmig, so daß sie beim Hinsetzen auf den Griff zurückfällt, ebenfalls, wie es scheint, gegossen, auf der Drehbank innen und außen abgedreht und mit vertieften Reifen verziert. Der sehr lange Griff, Tab. I, Fig. 2 a, ist 8 1/4" lang und 7/8 " bis 1 7/8 " breit und an den Seitenrändern mit einer eingegrabenen Linie, am Ende mit einer Reihe concentrischer kleiner Halbkreise, welche mit dem zu der großen Kelle gebrauchten Stempel der kleinen concentrischen Kreise eingeschlagen sind, verziert. Auf der Oberfläche des Griffes ist mit einem Stempel die römische Inschrift eingeschlagen


|
Seite 42 |




|
Der Stempel ist links nicht fest aufgesetzt, und es scheint vor den angegebenen deutlichen Buchstaben ein Buchstabe zu fehlen.
Diese Kelle entspricht der bei Gr. Kelle gefundenen, a. a. O. Fig. 3 abgebildeten Bronzekelle.
3) Ein Sieb oder Durchschlag aus Bronze, Tab. I, Fig. 3, beinahe von der Größe der Kelle Nr. 2, so daß sie gerade in diese hineinpaßt, auf der Drehbank abgedreht, innen mit vertieften Reifen verziert, ebenfalls von runder, jedoch etwas geschweifter Form, mit etwas ausgebogenem Rande. In der untern Hälfte sind Löcher in Mäander= und Spiral=Linien durchgeschlagen. Der Griff fehlt.
Zu Gr. Kelle ward auch eine dritte Kelle gefunden, von der jedoch nur noch ein Theil des Griffes vorhanden ist; vgl. a. a. O. Fig. 4.
4) Eine große flache Schale aus Bronze, Tab. I, Fig. 6, weit und allmählig abgerundet, 1 1/4' weit und nur 4 " hoch, aus sehr dünne geschlagenem Bronzeblech, am Rande vielfach und stark ausgebrochen, so daß sich die Gestalt der Oeffnung durchaus nicht erkennen läßt, außen an einigen Stellen mit edlem Roste bedeckt. Auf der innern Fläche sitzt viel Eisenrost, der fast ganz die innere Fläche bedeckt und wahrscheinlich von den eisernen Geräthen herrührt, die neben der Schale gefunden wurden. Nach den sichtbaren, häufigen Hammerschlägen ist die Schale unbezweifelt getrieben.
Auch bei Gr. Kelle ward ein großes Bronzegefäß, vgl. a. a. O. Fig. 1, gefunden, welches jedoch gegossen ist.
5) Eine Gießkanne aus Bronze, Tab. I, Fig. 8, 9 " hoch, mit stark eingezogenem Halse und an beiden Seiten eingedrückter Mündung, gegossen und auf der Drehbank abgedreht und mit Reifen verziert, an der Seite, welche in der Erde gelegen hat, mit dem schönsten edlen Roste bedeckt, an der entgegengesetzten Seite von Oxyd zerfressen, mit einem schönen Henkel, Tab. I, Fig. 8a, von Ciselir= (oder Cälatur= oder toreutischer) Arbeit; der Griff besteht aus zwei gewundenen Schlangen, wie es scheint, und endigt an beiden Enden in weibliche Brustbilder: oben sitzt ein weibliches Brustbild mit hohem Haarputz und faßt mit beiden Armen um den hintern Rand der Kanne; unten sitzt um den Bauchrand ein weibliches Brustbild (Leda?), mit beiden Armen einen Vogel vor der Brust haltend. - Diese Kanne ist unbezweifelt eins der schönsten Stücke des Alterthums, welches je in nördlichen Gegenden gefunden ist.
6) Eine kleine Schale aus Bronze, Tab. I, Fig. 4, flach, 10 1/2 " weit in der Oeffnung, mit einem 1/2 " breit über=


|
Seite 43 |




|
gebogenem Rande, gegen 2 1/2 "hoch, aus dünnem Bronzeblech, gegossen, auf der Drehscheibe nachgedreht, an einigen Stellen mit edlem Roste, auf dem Boden in einem Kreise von 1 " Breite versilbert; an einer Seite sitzt ein hohl gegossener, mit erhabenen Längsreifen und an den Enden mit Querreifen verzierter Griff von 4 " Länge, welcher mit 3 Nieten angeheftet gewesen ist; da er ganz hohl ist, so ist er wahrscheinlich zur Aufnahme eines Stocks bestimmt gewesen. An dem dem Griffe entgegengesetzten Ende ist eine kreisförmige Zinnlöthung von 3/4" Durchmesser sichtbar, welche hier offenbar auch einen Vorsprung getragen hat.
7) Ein Deckel aus Bronze, Tab. I, Fig. 5, flach, 11 1/4" im Durchmesser und 1 " hoch, gegossen, und auf der Drehbank nachgedreht und mit vielen Kreisen verziert. Auf der Oberfläche ist ein erhabener bronzener Verzierungsreif von 7 1/2 " Durchmesser und 5/8 " Breite aufgelöthet. Die ganze Oberfläche ist mit schönem edlen Rost bedeckt. Der Rand ist auf der äußern Fläche trefflich versilbert. Dieser Deckel paßt grade auf die kleine Schale Nr. 6, Fig. 4; jedoch ist der völligen Ueberstülpung der Griff der Schale etwas hinderlich.
8) Eine Scheere aus Bronze, Tab.I, Fig. 7, 7 1/4"lang, von der antiken Gestalt der heutigen Schafscheeren, an den Rändern mit eingegrabenen Linien verziert, ganz wie die zu Gr. Kelle gefundene, a. a. O. Fig. 6 abgebildete Scheere gebildet, nur daß diese aus korinthischem Erz, die bei Hagenow gefundene aber aus gewöhnlicher Bronze ist.
2. Heimische Alterthümer.
Die folgenden, unmittelbar neben den vorstehend beschriebenen römischen Alterthümern gefundenen, auf Tab. II abgebildeten, Gegenstände sind, mit Ausnahme einiger ganz ungewöhnlicher Gegenstände, denjenigen Alterthümern identisch, welche in den Wendenkirchhöfen, als aus der Eisenzeit stammend gefunden werden.
9) Eine Heftel (broche) aus Bronze, ganz wie sie in Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 13 abgebildet ist und ganz von derselben Gestalt, wie sie in Wendenkirchhöfen äußerst häufig gefunden wird, mit denselben Verzierungen bedeckt.
10) Eine Heftel (broche) aus Eisen, Tab. II, Fig. 13, ganz von derselben Gestalt, wie Nr. 9, an dem Bügelschirm mit feinen Silberperlen garnirt. Dergleichen eiserne Hefteln kommen öfter in den Wendenkirchhöfen neben Silber vor, man vgl. nur Jahresbericht II, S. 60, Nr. 6, 7 und 10.


|
Seite 44 |




|
11) Ein Sporn mit eiserner Spitze auf bronzenem Stuhl, Tab. II, Fig. 14, wie dergleichen in Wendenkirchhöfen öfter vorkommen, wie sie in Jahresber. VI, S. 144 flgd. beschrieben und dort und auf der beigegebenen Lithographie abgegebildet sind.
12) Eine Schildfessel (?) aus Bronzeblech, Tab. II, Fig. 12, 9 " lang und ungefähr 1/2 " breit, mit durchgehenden, beweglichen, an den beiden Enden mit runden Knöpfen bedeckten, 3/4" langen Nieten versehen, mit den Verzierungen der Geräthe aus den Wendenkirchhöfen bedeckt; hin und wieder sitzt Eisenrost von den Alterthümern, welche daneben gelegen haben. Ohne Zweifel diente dieser Beschlag zur Bedeckung und die Vernietung zur Zusammenhaltung eines dicken hölzernen oder ledernen Griffes; man vgl. Frid. Franc. Tab. IX, Fig. 2.
13) Eine Lanzenspitze aus Eisen, Tab. II, Fig. 9, gegen 9 " lang, wie Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 3, eine abgebildet ist und wie dergleichen öfter in Wendenkirchhöfen gefunden werden; man vgl. Frid. Franc. Erl. S. 93 - 94.
14) Ein Wurfspieß oder eine Lanzenspitze aus Eisen, Tab. II, Fig. 10, mit Widerhaken in Harpunenform, ungefähr 9 " lang, wie eine ganz gleiche Waffe auch auf dem Wendenkirchhofe zu Kothendorf gefunden ist; vgl. Frid. Franc. Erl. S. 89 flgd.
15) Zwei Ringe aus Silber, Tab. II, Fig. 15, mit 16, seitwärts anhangenden Silberbeschlägen. Das Silber ist fast ganz rein, ungefähr 14löthig. Diese beiden, ganz gleichen Ringe sind räthselhaft; offenbar sind es Beschlagringe. Sie sind aus dünnem Silberblech von 3/8 " Breite, 1 3/4" weit; die Ränder sind mit Reihen, der Raum dazwischen mit einer Zickzacklinie von Puncten verziert, die von innen mit Punzen herausgetrieben sind. An zwei Seiten sind kleine Oehren, in welchen ein kleiner geschlossener Ring von 1/2" Durchmesser hängt; in jedem Ringe hängt ein doppelter Silber=Blechstreifen, 1 1/8 " lang, auseinanderstehend, an jedem Ende mit einem Niete versehen. Diese Beschläge, welche nur an einer Seite verziert sind, haben offensichtlich dazu gedient, einen ledernen Riemen oder dergleichen aufzunehmen, wobei zu bemerken ist, daß die Ringe mit den Beschlägen nicht grade in der Mitte, sondern mehr nach einer Seite hin hangen. Offenbar hing also in den großen Ringen etwas, was an einem Riemen getragen ward, der mit den Nieten an den Trageringen befestigt war.
17) Ein Beschlagring aus reinem Silber, Tab II, Fig. 16, ebenfalls 1 3/4" weit, hohl, an einer Seite der Länge nach und auch im Querdurchschnitt geöffnet. Ohne Zweifel


|
Seite 45 |




|
diente dieser rundliche Beschlag zum Endbeschlage irgend eines cylinderförmigen Werkzeuges, welches an den beiden eben erwähnten Ringen Nr. 15 und 16, Fig. 15, getragen ward.
18) Ein Endbeschlag aus reinem Silber, Tab. II, Fig. 17, vasenförmig, 1 1/4" hoch, ungefähr wie der zu Gr. Kelle gefundene a. a. O. Fig. 1 b. abgebildete Knopf gestaltet. Vielleicht gehört er als Beschlag zu den eben erwähnten silbernen Beschlägen etwa eines Hifthornes oder dgl.
19) Ein großer Ring aus Eisen, Tab. II, Fig. 11, 4" weit, 1/2 dick, wie ein Pfortenring gestaltet, auf welchem ein 1 1/2 " breiter, überfassender, beweglicher Ring sitzt.
20) Ein kleiner Beschlag aus Eisen, aus 2 Stücken Eisenblech bestehend, 1 1/2 "lang.
C. Antiquarisch=kritische Forschung.
Die Erläuterung dieser Alterthümer und die Benutzung derselben für die vaterländische Geschichte war ernster Gegenstand der Sorge des Ausschusses unsers Vereins. Es ward deshalb eine weit verzweigte Correspondenz eingeleitet, welche gewonnene Ansichten bestärkt und neue hervorgerufen und beigesteuert, jedoch die Hauptsache noch nicht zur Entscheidung gebracht hat. Der Herr Professor Th. Bernd in Bonn brachte nach brieflichen Mittheilungen den Fund in der Zeitschift der Freunde des römischen Alterthums zu Bonn, 1842, S. 75 flgd., schon öffentlich zur Sprache und lieferte dabei, nach einem ihm mitgetheilten galvanoplastischen Facsimile, die Stempelinschrift und die Verzierungen des Griffes der größern Kelle Nr. 1 in Holzschnitt.
1. Römische Alterthümer.
Darüber sind alle competenten Stimmen einig, daß die oben für römisch ausgegebenen, auf Tab. I abgebildeten Bronzen ohne Zweifel römischen Ursprunges seien. Form, Arbeit, Rost, Inschriften u. s. w. reden allein schon eindringlich dafür.
Es wäre aber möglich, daß Inhalt und Form der Inschriften und der Verzierungen auf den beiden Kellen einen festern Anhaltspunct gäben. Und hier muß zunächst die Erklärung der Inschriften zur Sprache kommen. Am vollständigsten ist die Inschrift der größern Kelle, Tab. I, Fig. 1 a. Aber hier ist zu bedauern, daß der dritte und vierte Buchstabe zu enge an einander gerückt und dadurch beide undeutlich geworden sind und in dem fünften Buchstaben der Zirkel zur Anbringung der Kreisverzierungen eingesetzt ist. So viel ist jedoch gewiß, daß der fünfte Buchstabe mit einer Perpendikulair=Linie │ begann. Der dritte und vierte Buchstabe


|
Seite 46 |




|
können nur PO oder RO gelesen werden. Nach allen Zeichen ist daher zu lesen:
Hiefür entscheidet sich auch z. B. der Herr Professor Hermann zu Göttingen. Die Erklärung des Wortes SIT hat Schwierigkeiten, "wenn man es nicht grade als Ausdruck der Bestimmung des Geräthes: " "es soll des Titus Ropilius " "sein" ", auffassen will. In dieser Bedeutung kommt auch öfter die Sigle S, und auch zuweilen die Abbreviatur SI., statt dieser Bezeichnung aber auch der bloße Dativ des Namens des Empfängers vor. Der Herr Professor Hermann meint: "Wäre die Form des Gefäßes dazu geeignet, so läge am nächsten, " SITVLA oder SITELLA zu lesen, was ein Schöpfgefäß "(ìδρiα) bedeutet". Und hiefür dürfte man sich am Ende ohne Wahl entscheiden müssen, da diese " Kellen", wie die bei Gr. Kelle gefundenen, offenbar Kellen zum Schöpfen sind, indem sie hingesetzt auf den Griff zurückfallen, also nur zum Handgebrauche bestimmt waren. Man könnte also einstweilen lesen und erklären:
T
I . POPILI . SIT.
Titi Popilii Sitella.
Des Titus Popilius Schöpfkelle.
Gewöhnlich nimmt man an, daß dergleichen Inschriften Stempel des Fabrikanten seien; es steht aber nichts im Wege, namentlich hier, wo der Genitiv steht, die Bezeichnung des Besitzers aufzufassen, was hier sogar die Wahrscheinlichkeit für sich hat, wenn nicht die Anfertigung eines Stempels für eine Art von Geräthen für einen einzelnen Besitzer Bedenken erregen könnte. Hiemit ist aber noch nichts für die Zeit gewonnen, indem über diesen Mann bis jetzt noch nichts mit Sicherheit erforscht ist.
Auf dem Griff der kleinern Schöpfkelle, Tab. I, Fig. 2 a, steht ohne Zweifel
ohne Punct hinter irgend einem Buchstaben. Im Anfange ist der Stempel nicht scharf aufgesetzt. "Es wäre also leicht LEPIDI . A zu ergänzen"; es steht aber kein Punct hinter dem I. Es kommt aber Epidius als römischer Name vor (vgl. Forcellini Lex. s. h. v.), und es könnte also die Inschrift mit diesem Namen zusammenhangen.
Der Inhalt der beiden Inschriften giebt also für jetzt keine Ausbeute für die Zeitbestimmung. Mehr leistet dafür die Form der Inschrift überhaupt und im Besondern der Buchstaben.
Alle Forscher im römischen Alterthume, so viele deren befragt sind, stimmen darüber ein, daß die Kellengriffe mit ihren Ver=


|
Seite 47 |




|
zierungen und Inschriften in eine frühe Zeit und namentlich in das erste Jahrhundert nach Christi Geburt fallen, " so schwierig auch die Entscheidung sein möge". Namentlich meint z. B. der Herr Professor Gerhardt zu Berlin, seiner Meinung nach würden die Bronzen "in die frühern Jahrhunderte des römischen Alterthums fallen"; und hiemit stimmen viele Alterthumsforscher überein. Der Herr Professor von Hefner zu München glaubt annehmen zu dürfen, daß die Verfertigung dieser Gefäße in die Zeit von 10 vor Chr. G. bis 50 nach Chr. G. falle; die gleichen Schriftzüge auf den Münzen und den Inschriften auf Gefäßen aus dieser Zeit redeten dafür. Der Herr Professor Hermann zu Göttingen schreibt: "Das fragliche Stück kann den Schriftzügen nach in "das erste Jahrhundert der Kaiserzeit fallen, indem die Münzen des Kaisers Augustus ähnliche Gepräge darbieten; insoferne es jedoch in der Natur der Sache liegt, daß solche Fabrikstempel mit den Fortschritten der Münzstempel nicht gleichen Schritt hielten, so steht nichts im Wege, es auch später zu setzen".
Der Herr Professor Th. Bernd in Bonn a. a. O. faßt die übrigen Verzierungen des Griffes der größern Kelle ins Auge und findet in den Strahlen Aehnlichkeit mit bekannt gewordenen römischen Schildbildern, glaubt also annehmen zu müssen, daß diese Verzierungen "keinesweges ohne Bedeutung", also gewissermaßen eine Art von Wappen seien. Demgemäß setzt er das Gebilde in die Zeit der Notitia dignitatum et administrationum in partibus orientalis et occidentalis, deren Abfassung ungefähr in die Zeit des Kaisers Theodosius d. Gr. oder etwa um das Jahr 400 nach Chr. G. fällt. - Wir erblicken aber in diesen Verzierungen nichts anders, als eben Ornamente, welche in jener Zeit üblich waren, wie die Kreisstempel auch zur Verzierung der kleinern Kelle, und dazu für andere Formen benutzt, sind. Der Herr Professor Hermann sagt in Beziehung auf diese Ansicht: "In die Zeit der Notitia dignitatum möchten wir die Gefäße nicht hinabdrücken, weil in jener Zeit die Buchstaben viel dünner und schlanker zu werden anfingen. Die Aehnlichkeit der übrigen Zeichnungen mit den Schilden der Notitia dünkt uns irrelevant, da diese Schilde vielmehr so verziert wurden, weil dergleichen überhaupt üblich war, als daß die Verzierungen irgend einen nähern Bezug auf die Schilde hätten".
Es wäre also durch die Forschung so viel gewonnen, daß anzunehmen ist, die Gefäße aus Bronze seien unzweifelhaft römischen Ursprunges und im ersten Jahrhundert des Kaiserreichs verfertigt worden.


|
Seite 48 |




|
2. Heimische Alterthümer.
Die übrigen, auf Tab. II abgebildeten Alterthümer von Bronze, Eisen und Silber kündigen sich auf den ersten Blick als meklenburgische Alterthümer an. Es sind dieselben Alterthümer, welche sich auf den "Wendenkirchhöfen" oder den Begräbnissen der Eisenperiode finden und welche als die Ueberreste der jüngsten Heidenzeit erscheinen. Und zwar finden sich hier charakteristische Stücke. Die bronzenen Hefteln (broches), durchaus von derselben Gestalt und mit demselben Rost, finden sich auf jedem wendischen Begräbnißorte und sind in Meklenburg in zahllosen Exemplaren gefunden.
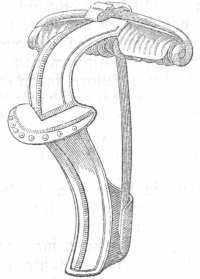
Ja, es kommen auf den Wendenkirchhöfen auch schon eiserne Hefteln von derselben Gestalt vor; die großen Wendenkirchhöfe von Kothendorf (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 89 flgd.), Camin (vgl. Jahr. II, S. 53) und Pritzier (vgl. unten) geben hinreichend Beweise.
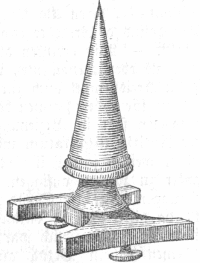
Eben so sind die Sporen, mit der Verbindung von Eisen und Kupfer, charakteristische Kennzeichen der Wendenkirchhöfe (vgl. Jahresber. VI, S. 144 flgd.). Um diesen Theil des hagenower Fundes ganz in die Zeit der Wendenkirchhöfe zu versetzen, ward auch noch Silber gefunden, welches erst seit der muhamedanischen und merovingischen Zeit an den Ostseeküsten aufzutreten
scheint, wie noch in Franken unter den Merovingern die Goldmünzen sehr häufig, die Silbermünzen äußerst selten, dagegen kufische Silbermünzen in den Ostseeländern sehr häufig sind.


|
Seite 49 |




|
Silber ward ebenfalls zu Kothendorf, Camin und Pritzier und in andern Wendenkirchhöfen derselben Art gefunden (vgl. Jahresber. VI, S. 74 und VII, S. 44). Dazu ward bei Hagenow an der mit Silberperlen sehr geschickt garnirten eisernen Heftel gar Silber auf Eisen gefunden! Die Schildfessel und die Lanzenspitzen von dieser Gestalt kommen ebenfalls in Wendenkirchhöfen vor.
Eigenthümlich sind dem hagenower Funde die runden Silberbeschläge, welche ohne Zweifel zusammen und zu einem und demselben (musikalischen?) Instrumente gehören, und der große eiserne Ring. Die Silberbeschläge fallen dem Gehalte des Silbers, da es fast rein ist, und der Arbeit nach, namentlich nach der Art der Vernietung, ebenfalls in die heidnische Eisenperiode. Der große eiserne Ring, der am wenigsten oxydirt ist, sieht ganz aus wie ein mittelalterlicher Pfortenring, wie sich solche Ringe noch an Kirchenthüren finden.
Es entsteht nun die Hauptfrage, ob sich ein historischer Schluß aus dem ganzen Funde und aus einem Theile desselben auf den andern ziehen läßt.
Die römischen Alterthümer fallen in das erste Jahrhundert nach Christi Geburt; Bearbeitungsweise, Formen, Inschriften und Rost reden dafür. In diese Zeit fallen, unserer Ansicht nach, noch die (germanischen) Kegelgräber der Bronze=Periode, welche nur Bronze mit demselben edlen Roste und Gold, nie Eisen und Silber enthalten. In einem solchen Kegelgrabe bei Lehsen (vgl. Jahresber. IV, S. 27) fanden sich neben den bekannten goldenen spiralischen Fingerringen auch unbezweifelt römische Glasperlen von blaugrüner Farbe, ohne Zweifel coeruleus der Römer. Hiernach würden die Kegelgräber der Bronze=Periode gewiß noch in die letzten Jahrhunderte vor Chr. G., also dicht vor die römischen Bronzen von Hagenow, fallen.
Die heimischen Alterthümer von Hagenow fallen dagegen, nach allen Kennzeichen, in die Eisen=Periode der Wendenkirchhöfe. Daß diese die letzte heidnische Periode füllen, leidet keinen Zweifel, da zwischen ihr und dem christlichen Mittelalter keine Spur von einer andern Cultur beobachtet ist und die Geräthe der Eisen=Periode den mittelalterlichen Geräthen christlicher Länder gleichen, auch besondere Zeichen genug vorhanden sind, daß die Wendenkirchhöfe etwa in die Zeit vom 7. bis zum 12. Jahrhundert fallen.


|
Seite 50 |




|
Es ließe sich nun denken, daß die Eisencultur grade bis in die ersten Jahrhunderte nach Chr. G. zurückreiche und ihren Anfang grade in der Zeit genommen habe, als die, vielleicht spät außer Gebrauch gesetzten römischen Bronzen von Hagenow vergraben seien. Eine solche Annahme würde die in Norddeutschland und Skandinavien bisher angenommenen Ansichten von den Perioden der heimischen Alterthümer bedeutend erschüttern oder doch wenigstens die Grenzen der Perioden etwas verrücken. Dagegen aber spricht der Rost der bei Hagenow gefundenen heimischen Alterthümer. Der Rost ist nämlich durchaus jener leichte, mehlartige, nicht tief eindringende Anflug von Oxyd, welcher auf den Bronze=Alterthümern der Wendenkirchhöfe liegt; auch die Oxydation der eisernen Alterthümer geht nicht tief.
Der Rost beider Abtheilungen der hagenower Alterthümer ist zu disparat, als daß man annehmen könnte, alle wären zu gleicher Zeit der Erde anvertraut. Es bleibt daher nichts weiter übrig, als anzunehmen, daß beide Abtheilungen auf einer zu verschiedenen Zeiten bewohnten Stelle durch einen Zufall zusammengekommen seien, um so mehr, da die Fundstelle kein Grab war.
Auf jeden Fall werden die heimischen Alterthümer jünger sein, als die römischen, selbst wenn sie zusammen vergraben worden wären, da man annehmen muß, daß die römischen Alterthümer vor ihrer Versetzung in den Norden im römischen Reiche verfertigt sind, und annehmen kann, daß sie, als seltene Kunstwerke, mehrere Generationen hindurch vererbt sind. Ohne Zweifel fallen also die heimischen Alterthümer der bezeichneten Art mit der Mischung der Eisen= und Silber=Cultur in die Zeit nach der Blüthe der römischen Bronze=Cultur und nach den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Römische Bronze=Vase von Dobbin.
Da im Vorstehenden ausgezeichnete römische Bronzen zur Kunde gebracht sind, so möge hier zugleich Nachricht von einer Bronze=Vase gegeben werden, welche in neuerer Zeit im Vaterlande gefunden ist. Die Hauptsache ist, außer dem Fundorte die Schönheit der Form; daher ist sie mit den hagenower Alterthümern zusammen Tab. III abgebildet; die Form bedarf keines andern Commentars, als der Abbildung, nur so viel sei bemerkt,


|
Seite 51 |




|
daß die Vase gewiß zu den schönsten Bronze=Vasen
gehört, welche überhaupt existiren. Sie ward in
der Zeit von 1830 bis 1836, ungewiß in welchem
Jahre, aus dem krakower See bei Dobbin mit der
Wade beim Fischen aufgezogen und im J. 1840 von
dem Herrn von Jasmund auf Dobbin dem hochseligen
Großherzoge Paul Friederich zum Geschenke
dargebracht, der sie in die großherzogliche
Alterthümersammlung gab. Da sie im Wasser
gefunden ist, so ist sie ohne allen Rost und
vollkommen erhalten. Sie ist aus Bronze ziemlich
dünne getrieben und trefflich und kunstreich
gearbeitet. Die Henkel, auf Weinlaub, sind sehr
kräftig und stark gehalten. Das Ganze ist 9
" hoch, die Randöffnung ist 18 " weit,
die Bauchweite ungefähr 15 ". Der Fuß ist
verhältnißmäßig nur klein. Unter dem Rande des
Fußes ist leicht die Zahl XIII und in der Mitte
unter dem Fuße das Zeichen
 mit römischen Ziffern ohne
Querstriche eingeritzt.
mit römischen Ziffern ohne
Querstriche eingeritzt.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Römische Kelle von Schwinkendorf.
Im Frühling 1842 ward zu Schwinkendorf beim Ausmodden eines Moderloches das Fragment einer Kelle, abgebildet Tab. IV, gefunden 1 ), nämlich ungefähr 1/5 oder 1/6 der obern Seitenwand und des Randes mit dem daran sitzenden Griffe. Die Oeffnung der aus dünnem Bronzeblech gefertigt gewesenen Kelle wird ungefähr 7 " bis 8 " betragen haben; die Gestalt der Kelle läßt sich nicht mehr vermuthen. Der Griff welcher in einer halben Windung schräge nach innen hin verbogen ist, ist an 7 " lang und ungefähr 1 1/2 " breit. Am Rande umher ist er mit einer feinen Relieflinie eingefaßt, in der Mitte entlang mit einem Thyrsusstabe (?) verziert. Das etwas ausgebreitete Ende hat, wie die große Kelle von Hagenow, wahrscheinlich ein ausgeschlagenes halbrundes Loch gehabt, dessen äußerste Wölbung abgebrochen ist; die Enden dieser Umfassung sind mit gravirten Delphinköpfen (?) verziert. In der Mitte des Griffes ist auf der Oberfläche eine römische Stempel=Inschrift eingeschlagen:



|
Seite 52 |




|
d. i. vielleicht:
Titi Papirii libatorium
(des Titus Papirius Gießgefäß);
denn libatorium war ein Gefäß, aus welchem die Spende beim Opfer ausgegossen ward.
Neben diesem Kellengriffe ward auch eine zerbrochene Heftel (broche), wie sie die Wendenkirchhöfe charakterisiren und oben S. 48 in Holzschnitt in den Text gedruckt und Tab. II, Fig. 13 abgebildet sind, gefunden.
Läßt es sich nun nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß beide Alterthümer zu gleicher Zeit im Moor versunken sind, so ist es doch auffallend, daß auch zu Hagenow (vgl. S. 40) neben römischen Kellen solche Brochen gefunden wurden, obgleich auch hier nicht mit Sicherheit behauptet werden kann, daß alle hagenower Alterthümer zusammen vergraben wurden.
Die beschriebenen Alterthümer von Schwinkendorf besitzt der Verein als Fideicommiß des Herrn Grafen Hahn auf Basedow.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.
Kegelgrab von Peckatel.
Im Frühjahre 1843 wurde zuerst durch Zufall, später durch eine auf Veranstaltung des Ausschusses unternommene Aufgrabung in einem Kegelgrabe zu Peckatel bei Schwerin ein höchst interessanter Fund (unter andern ein kleiner vierrädriger Wagen von Bronze) gemacht, dessen nähere Beschreibung und kritische Würdigung aber dem nächsten Jahrgange vorbehalten bleiben muß.
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Bronze=Alterthümer
aus dem Fideicommiß des Herrn Grafen von Hahn auf Basedow, von demselben in Berlin gekauft und wahrscheinlich in der Mark Brandenburg gefunden:
1) eine große Framea mit Schaftkerbe und überfassenden Lappen in der Mitte;
2) und 3) zwei ganz gleiche Frameen mit Schaftkerben, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 7;
4) eine schön gravirte, jedoch etwas beschädigte Lanzenspitze, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VIII, Fig. 4, mit zwei Nagellöchern und tiefem, bräunlichen Rost; im Schaftloche sitzen noch Reste des Schaftes von Eschenholz;


|
Seite 53 |




|
5) ein Messer, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XVI, Fig. 6, jedoch mit sichelförmig gebogener Klinge.



|



|
|
:
|
Hefteln von Schwinkendorf.
Im Frühlinge 1842 wurden zu Schwinkendorf bei Malchin zwei ganz gleiche Hefteln (broches) gefunden; beide stimmen an Gestalt und Verzierungen vollkommen mit einander überein. Sie haben zwar die Grundformen der bekannten Hefteln in den Wendenkirchhöfen, (wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13a), sind aber etwas edler und kräftiger in den Formen gehalten und überdies mit so schönem edlen Roste bedeckt, wie er sich auf den Bronzen der Wendenkirchhöfe noch nicht findet; sie stammen daher gewiß aus einer sehr frühen Zeit und dürften noch in die Bronzeperiode fallen, denen diese Art von Hefteln nicht ganz fremd ist.
Fideicommiß des Herrn Grafen von Hahn auf Basedow.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Bronze=Schmuck von Sophienhof.
Im Herbste des J. 1842 wurden zu Sophienhof, nordwestlich von Waren, im Moore beim Moderfahren auf einer Stelle zusammen mehrere wohl erhaltene Alterthümer von Bronze ohne Rost gefunden und von dem Herrn Kammerherrn von Oertzen auf Sophienhof dem Vereine geschenkt:
1) zwei Diademe mit erhabenen, parallelen Horizontalreifen verziert, wie z. B. eins im Leitfaden zur nord. Alterthumskunde S. 50 abgebildet ist. Gewöhnlich sind die in Meklenburg nicht selten gefundenen Diademe mit eingravirten Spiralwindungen verziert; vgl. Frid. Franc. Tab. X, Fig. 5, und Tab. XXXII, Fig. 2. Das einzige Exemplar mit Horizontalreifen außer dem gegenwärtigen besaß der Verein aus einem Funde bei Malchin (vgl. Jahresber. I, S. 13), welcher mit diesem Funde von Sophienhof, welches auch nicht weit von Malchin liegt, in mancher Hinsicht viele Aehnlichkeit hat. - Auf dem einen Diademe sind die parallelen Horizontalreifen glatt, auf dem andern sind die endenweise unter einander abwechselnd glatt und mit eingravirten Querstrichen verziert;
2) ein Paar cylindrisch=gewundene Armschienen (Springfedern ähnlich) von glatten Bronzestreifen, welche an beiden Enden spitz auslaufen, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 8. Ein gleiches Paar ward auch bei Malchin gefunden (vgl. Jahresber. a. a. O.);


|
Seite 54 |




|
3) ein Paar brillenförmige Haarspangen (?). Jede dieser Zierrathen besteht aus 2 platten, runden Gewinden von dünnem, rundem Bronzedrath, jede Platte von etwa 23/4 " Durchmesser; beide Platten sind durch einen ebenfalls platt liegenden, eben so dicken Bronzedrath, der ganz wie eine alte Brille gebogen ist, dicht neben einander verbunden. Man hält diese Zierrathen von zwei Spiralplatten, welche gewöhnlich paarweise gefunden werden, die aber von den Arm= oder Fußringen mit auslaufenden Spiralplatten ("Handbergen"), von den eben so gestalteten Fingerringen und von den Hefteln mit zwei Spiralplatten durch das Verbindungsglied der beiden Spiralplatten abweichen, nicht mit Unrecht für Haarschmuck. Abgebildet sind sie z. B. in Klemm's german. Altthkde., Taf. II, Nr. 8; vgl. das. S. 61. - In Meklenburg wurden diese brillenförmigen Zierrathen bisher nur bei Rülow bei Neu=Brandenburg gefunden (vgl. Jahresber. VI, S. 108), wo auch die übrigen Alterthümer dieses sophienhöfer Fundes vorkamen.
Alle diese Alterthümer mit ihren Eigenthümlichkeiten scheinen dem östlichen Theile Meklenburgs anzugehören.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Bronze=Schmuck von Vogelsang.
Zu Vogelsang bei Teterow, Pfarre Wattmanshagen, wurden im J. 1842 beim Ackern mehrere Bronzen gefunden, welche von dem Herrn Manecke auf Vogelsang dem Vereine geschenkt wurden. Sämmtliche Gegenstände waren beim Auffinden in einander geschlungen.
Sämmtliche Alterthümer sind ohne allen Rost, mit einem leichten bräunlichen Ueberzuge bedeckt, völlig wie neu erhalten, und haben noch durchaus die alte Biegsamkeit und Federkraft. Die Gegenstände sind:
1) ein Paar Handbergen, durchaus ganz wie die im Friderico - Francisceum Tab. IV abgebildeten, diesen auch an Verzierungen und Größe gleich. Die Spiralplatten sind mit der äußern, obern Fläche an beiden Stücken etwas gegen einander gebogen;
2) zwei Paar oder vier gewundene Hals oder Beinringe, 5 1/2 " im innern Durchmesser, von der Weite wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2, jedoch viel dünner; drei sind ganz gleich, einer ist etwas dicker, in stärkern Reifen gewunden und 1/2 "weiter. Der letztere ist wie die Ringe, die bisher für


|
Seite 55 |




|
Halsringe gehalten sind; die andern 3 werden von dem Herrn Manecke für Lendenringe gehalten, womit auch einige süddeutsche Beobachter übereinstimmen.
Eine Framea aus Bronze
mit Schaftkerbe, ganz von der Gestalt, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 5, jedoch ungewöhnlich groß, nämlich 7 1/2" lang und 1 1/4 Pfund schwer, gefunden in einem Moor bei Gnoien und geschenkt von dem Herrn von Kardorff auf Remlin, der sie bei einem Kupferschmiede unter altem, zum Einschmelzen bestimmten Metalle fand und von demselben acquirirte. Dieses Exemplar ist das größte von allen, die bisher in Meklenburg gefunden sind; im westlichen Pommern sind früher ebenfalls sehr große Frameen, jedoch von anderer Gestalt, gefunden.
Eine Lanzenspitze aus Bronze,
4 1/2" lang, wie Frid. Franc. Tab. VIII, Fig. 3, ohne Rost, wahrscheinlich in einem Gewässer oder Moor gefunden, von dem Herrn von Kardorff auf Remlin bei einem Kupferschmiede zu Gnoien (vgl. oben Framea) gekauft und dem Vereine geschenkt.
Zwei Paar Handringe aus Bronze,
hohl gegossen und an den Rändern nach innen umgelegt, mit Querreifen verziert, wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 7, ohne Rost, einzeln einige Fuß auseinander gefunden im Anfange des Jahres 1843 in dem nach Hohenfelde gehörenden Krummen=See, wo dieser mit Roggow bei dem Alten=Mühlen=Bruche grenzt, geschenkt vom Herrn Pogge auf Roggow. Als der Krumme=See kurz vorher 7 - 8 Fuß gesenkt und dabei ein trocken gelegter Strich Landes von ungefähr 25 Ruthen Breite gewonnen und an Roggow abgetreten ward, fand man diese Ringe am Rande des Wassers 1/2 Zoll hoch mit Wasser bedeckt, zur Hälfte in den festen, blauen Thonmergel=(Schindel=) Boden eingedrückt; vor der Ablassung des Sees hatten die Ringe also 7 Fuß tief im Wasser, 25 Ruthen vom Ufer entfernt, gesteckt.
Ein Spiral=Fingerring aus Gold,
gefunden in der Trebel zwischen Quitzenow und Bassendorf von einem Fischerknechte beim auskrauten des Flusses indem


|
Seite 56 |




|
er auf der Spitze der Sense hangen blieb, geschenkt vom Herrn von Kardorff auf Remlin. Der Ring, an 2 Ducaten werth, besteht aus reinem, messingfarbenem Golde, aus einfachem Golddrath mit 2 1/2 Windungen mit zugespitzten Enden, ist sehr unregelmäßig gearbeitet und gehört ohne Zweifel der Periode der Kegelgräber an.



|



|
|
:
|
Urnen von Böhlendorf.
Zu Böhlendorf bei Sülz war eine unebene Wiese, etwa 240 []Ruthen groß, mit dem Erdboden umher ungefähr in gleichem Niveau. Die Wiese enthielt Moder, welcher 25 Fuß tief reichte und aus verfaulten Wasserpflanzen bestand, welche noch in der größten Tiefe zu erkennen waren. Das Feld umher ist, wie die ganze Gegend, flach; der Boden um die Wiese hat eine eigenthümliche Schwärze, als wenn dort früher Wohnungen gestanden hätten. Der Moder ward aus der Wiese herausgefahren, welche jetzt ein 25 Fuß tiefes Wasserloch bildet.
An der tiefsten Stelle des Moderloches, nahe am Boden, ward
1) eine größere Urne gefunden, von kugeliger Gestalt, mit etwas eingezogenem senkrechten Halse und zwei kleinen Henkeln dicht unter dem Halse. Das ganze Gefäß ist 7 ", der Rand 1 1/2" hoch, die Bauchweite ungefähr 7 ", die Weite des Halses 3 1/2". Die Masse ist mit Glimmer und stark mit Kiessand durchknetet und von schwärzlicher Farbe.
Daneben lagen die Scherben von 2 bis 3 Urnen, dem Anscheine nach von ähnlicher Form und Masse. Eine Scherbe von einer Urne ist sehr stark, hat einen starken, jedoch engen Henkel und eine so weite Bauchung, daß das Gefäß wenigstens 13 " im Durchmesser gehabt haben muß. Angebranntes Holz lag unter der Urne und den Scherben und in der Nähe.
2) Eine kleinere Urne, in allen Dimensionen etwas kleiner, von ähnlicher Gestalt, jedoch mehr abgerundet in den Uebergängen und schlanker, auch mit zwei kleinen Henkeln, lag etwa 6 bis 8 Fuß von der größern entfernt auf der tiefsten Stelle. Umher lagen ebenfalls Scherben von mehrern ähnlichen Gefäßen, auch angebrannte Holzstücke.
Nach Form, Masse und Farbe scheinen die Urnen der letzten Zeit der Bronze=Periode anzugehören.
Die beiden Urnen kamen zuerst in die Hände des Herrn Geheimen=Amtsraths Koch zu Sülz. Demselben fiel der Geruch der kleinern Urne auf und es fand sich kohliger Inhalt in derselben; in der größern Urne fand sich auch noch etwas, jedoch weniger von derselben Masse, da dies Gefäß von den Arbeitern


|
Seite 57 |




|
beim Finden ausgewaschen war. Der Inhalt der kleinern Urne ist offenbar übergekocht gewesen, da die Masse an einer Seite außen übergeflossen ist. Der Herr G.=A.=R. Koch nahm mit dem Herrn Apotheker Bock eine Untersuchung des Inhalts vor, welche folgendes Resultat gab: "Geruch: wie von russischen Juften. Bruch der kohligen Substanz: glänzend. Ins Licht gehalten knistert sie stark, brennt nicht hell, zeigt aber ein Vergehen und Schmelzen mit starkem Geruch. Auf Platinablech geglüht bläht sie sich stark auf, verbrennt mit heller Flamme und sintert in eine kleine Kohle zusammen. Wenn sie ausgelaugt wird, reagirt die Lauge nicht alkalisch, sondern als Säure, ergiebt viel Salzsäure, weniger Schwefelsäure. Substanzen, welche als die kohlige Masse gedacht werden konnten, wie Blutkohle, Benzoe, Bernstein, zeigten nach vorgenommener Verkohlung nichts ähnliches. Fichtenholz, geglüht und verkohlt, gab dagegen eine Kohle von ganz ähnlichem Verhalten und Geruch. Es scheint demnach, als bestände die in der Urne enthaltene Kohle aus einer Mischung von Kochsalz, Fichtenharz und thierischer Substanz.
Nach angestellter Vergleichung mit andern Funden ergiebt sich, daß die Masse dem an andern Orten so genannten Räucherwerk ähnlich ist, welches in Urnen gefunden ward; vgl. Jahresber. II, S. 75. Der Geruch von diesem wie von jener ist gleich, intensiv ungefähr wie die Braunkohle, jedoch ohne den ekelerregenden Beigeruch derselben. Ausgezeichnet ist an der böhlendorfer Masse das starke Knistern in der Flamme; der Bruch zeigt daneben offenbar harzige Bestandtheile. Das Knistern, so wie die Analyse, deutet auf Salz als starken Bestandtheil.
Soll man eine Vermuthung wagen, so dürfte hier etwa eine Salzbereitung statt gefunden haben, da die alten Germanen Salzsoole auf Kohlen gossen, um durch Filtrirung Salz zu gewinnen, und dadurch kohliges, schwarzes Salz gewannen; vgl. Plin. H. N. XXX, 39 und 40 und Tac. Ann XIII, 57. Varro de re rust. I, c. 7, sagt ausdrücklich, daß auch die Gallier, welche kein Stein= oder Meersalz hätten, gesalzene Kohlen statt des reinen Salzes gebrauchten: In Gallia transalpina intus ad Rhenum - - - - ubi salem nec fossicium, nec maritimum haberent, sed ex quibusdam lignis combustis carbonibus salsis pro eo uterentur." - Wir haben in diesen Ueberresten nur den geringen Bodensatz, nicht die Hauptmasse selbst.
3) Endlich ward in der Tiefe neben den Urnen ein Werkzeug wie eine Schaufel von Eichenholz gefunden,


|
Seite 58 |




|
welches etwa zum Graben oder Schöpfen oder Umrühren u. s. w. gedient haben mag.
Die gefundenen Gegenstände sind von dem Herrn Kammerherrn und Major von Kardorff auf Böhlendorf dem Vereine zum Geschenk gemacht.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.
Eine römische Urne,
kugelig, mit spitzem Fuß und eben so engem Halse und einem Henkel, vor 32 Jahren bei Castel unweit Mainz von dem Hofkammerrath Habel zu Schierstein ausgegraben, geschenkt von dem Herrn Geheimen Amtsrath Koch zu Sülz, der sie aus einem Geschenke Habels besaß.
C. Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse.
a. Gesammelter Inhalt ganzer Begräbnißplätze.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Pritzier.
Erste Aufgrabung.
Durch einen Chausseearbeiter wurde mir eine Urne über bracht, welche nach seiner Aussage zu Pritzier gefunden und die einzige erhaltene von vielen an einem einzigen Platze gefundenen Urnen sei; auch seien viele Sachen aus Kupfer und Eisen daselbst ausgegraben, über deren Schicksal er aber nichts angeben könne, da er nur durch Pritzier gegangen und die Urne bei einem Bekannten angetroffen habe. Um für den Verein sichere Kunde zu erhalten und zu retten, was möglich sei, begab ich mich selbst dahin und besuchte mit dem Herrn Pastor Böcler den Fundort. Es zieht sich nur einige hundert Schritte südlich vom Dorfe, links vom Wege nach Lübtheen, eine kleine Hügelkette in der Richtung nach Osten, welche früher mit Tannen bewachsen war, deren Stämme jetzt ausgerodet werden. An der ganzen südlichen Abdachung haben sich nach Aussage eines dort arbeitenden Tagelöhners in dem feinen weißen Sande in einer Tiefe von etwa 3 Fuß sehr nahe stehende Urnen gezeigt, an drei kleinen Stellen habe er selber 42 Töpfe von brauner und schwarzer Farbe ausgegraben; außer den Knochen seien eiserne und kupferne Geräthe darin gewesen, welche er gesammelt und dem Inspector des Herrn Landraths von Könemann übergeben habe; manches sei indeß vielleicht von den Dorfkindern weggenommen. - Scherben von Urnen verschiedener Art lagen auf den bezeichneten Stellen zerstreut, wonach sie alle oben weit geöffnet waren, theils mit, theils ohne Verzierung. Bei


|
Seite 59 |




|
dem noch fortgesetzten Ausroden versprach mir Herr Pastor Böcler darüber zu wachen, daß nichts verloren gehe, sondern entweder dem Herrn Landrath von Könemann oder mir zugestellt werde. Bei näherer Nachfrage im Dorfe erhielt ich noh einen starken bronzenen Ring, ähnlich den so häufig gefundenen eisernen Ringen, 1 3/8" im äußern Durchmesser weit. Die mir überbrachte Urne (Nr. 1) ist dunkelbraun, 8 1/2" hoch, 4 1/2" in derBasis, 11 1/2" im Bauche und 9 5/8" in der Oeffnung haltend. Unterhalb des Halses laufen 2 horizontale, durch Linien begränzte Bänder umher, deren oberster in der Mitte eine Reihe fast dreieckig eingegrabener Puncte enthält, der untere dagegen durch je 3 schräge Linien in Dreiecke zertheilt ist. An drei Stellen werden diese horizontalen Bänder durch senkrechte Linien unterbrochen, unter denen ein Kreis von runden Puncten etwa 1 1/2" im Durchmesser sich findet.
Wittenburg, im Julius 1842.
J. Ritter.
Zweite Aufgrabung.
Auf die mir durch den Herrn Pastor Böcler gütigst ertheilte Nachricht, daß er einige freie Stunden mit seinen Zöglingen dazu angewandt habe, einige Nachforschungen auf dem dortigen Wendenkirchhofe anzustellen, daß ihre Mühe nicht unbelohnt geblieben sei und daß alles Gefundene unserm Vereine gerne überlassen werde, begab ich mich nach Pritzier, um diese Alterthümer in Empfang zu nehmen. Der Reichthum dieses Kirchhofes, wie er aus mehreren Sachen sich auswies, bewog mich, an dem Tage meines Dortseins selbst eine Aufgrabung vorzunehmen. Die Urnen stehen freilich 3 bis 4 Fuß tief, aber eben dadurch sind sie unverletzt geblieben, außer wenn sie durch die Wurzeln der auf dem Platze früher gewachsenen Tannen zersprengt waren. Der Boden besteht aus leichtem gelben Sande, in welchem die Urnen gruppenweise zu 3 bis 10 stehen; weder unter den Urnen, noch an den Seiten finden sich Steine, aber gewöhnlich 1/2 Fuß über dem Rande der Urnen liegt ein Stein, gegen l Fuß lang, mitunter von platter Form wie gespalten, meistens aber wie unsere gewöhnlichen Feldsteine. In den meisten Urnen sind die Reste verbrannter Menschenknochen, in manchen aber nur etwas Asche zwischen dem Sande. Fast jede Urne mit Knochen enthält über und zwischen den Knochen eines oder mehrere der unten angeführten Alterthümer; die Aschenurnen enthalten weiter nichts. Außer den nachstehend beschriebenen, fast vollständig erhaltenen Urnen ist eine Menge zerfallen, aber keine einzige von abweichender Form ist verloren


|
Seite 60 |




|
gegangen; und doch ist auf dem großen Platze kaum mehr als 2 Quadratruthen untersucht. Es wäre gewiß wünschenswerth, wenn der Platz so weit als möglich aufgedeckt würde, da noch immer eigenthümliche Sachen zum Vorscheine kommen, wie unter den Perlen und Brochen.
Eine braune Urne, 7 " hoch, 9 1/4" im Bauche, 8 " in der Oeffnung und 3 1/2" in der Basis haltend, ist oberhalb der Bauchweite mit 2 umherlaufenden Bändern von Linien verziert; in dem oberen sind nach oben offene Halbkreise, deren Enden in runden Eindrücken sich vereinigen, etwas roh gemacht; das untere Band hat je 3 Zickzacklinien. An drei Stellen sind die Bänder unterbrochen, in dem untern mit einem platten, runden Eindrucke.
Eine braune Urne, 6 3/4" hoch, 9 1/2" im Bauche, 8 1/4" in der Oeffnung und 3 1/2" in der Basis haltend, hat nur ein umherlaufendes Band mit Zickzacklinien; an drei Stellen ist eine runde Platte mit erhabenem Rande.
Eine hellbraune Urne, 7 1/4" hoch, 9 " im Bauche, 7 5/8" in der Oeffnung, 3 3/4" in der Basis haltend, hat als Verzierung roh gezogene horizontale Linien über der Bauchweite und dazwischen an 7 Stellen einen Haufen runder Eindrücke.
Eine braune Urne, 6 1/2" hoch, 8 3/4" im Bauche, 7 1/2" in der Oeffnung, 3 1/2" in der Basis haltend, ist mit 2 horizontalen Bändern geziert; das obere ist in der Mitte leer, das untere mit je zwei Zickzacklinien versehen.
Eine braune Urne, 5 7/8" hoch, 8 1/2" im Bauche, 7 1/2" in der Oeffnung, 3 3/4" in der Basis haltend, hat als Verzierung ein horizontales Band mit einer Schlangenlinie dazwischen und an drei Stellen einen runden Eindruck mit kleineren runden Eindrücken im Kreise umgeben.
Eine braune Urne, 5 " hoch, 7 " im Bauche, 6 1/8" in der Oeffnung und 3 " in der Basis haltend, ist mit einem horizontalen Bande und an drei Stellen mit einem runden, von Punkten umgebenen Eindrucke verziert.
Eine hellbraune Urne, 5 1/2" hoch, 7 " im Bauche, 6 3/4" in der Oeffnung und 3 1/4" in der Basis haltend, ist wie


|
Seite 61 |




|
die vorige verziert, nur sind unter dem horizontalen Bande noch je 2 bogenförmige Linien.
Eine braune Urne, 6 " hoch, 8 1/4" im Bauche, 7 5/8" in der Oeffnung, 3 3/4" in der Basis haltend, ist wie die vorige verziert, außer daß statt der Eindrücke an 3 Stellen Knoten mit Puncten im Kreise umher sind.
Eine hellbraune Urne, 6 1/2" hoch, 8 " im Bauche, 7 1/2"in der Oeffnung und 3 " in der Basis haltend, hat über der Bauchweite 4 breite horizontale Linien, an 3 Stellen Knoten mit je 4 umherstehenden runden Eindrücken zur Verzierung.
Eine hellbraune Urne, 5 3/8" hoch, 6 1/2" im Bauche, 6 " in der Oeffnung und 2 3/4" in der Oeffnung und 2 3/4" in der Basis haltend, ist an der Bauchweite mit rohen senkrechten Linien und darunter mit Bogenlinien verziert.
Eine hellbraune Urne, 4 3/4" hoch, 6 1/4" im Bauche, 5 3/4" in der Oeffnung, 3 " in der Basis haltend, hat an 3 Stellen knotenartige Erhöhungen, am Halse 2 horizontale Linien und darunter einfache Zickzacklinien.
Eine dunkelbraune Urne, 5 1/2" hoch, 9 " im Bauche, 8 " in der Oeffnung, 4 " in der Basis haltend, hat über der Bauchweite 3 breite horizontale Linien, an dem Bauchrande tiefe runde Eindrücke und dazwischen an 3 Stellen je 3 knotenartige, länglich=senkrechte Erhebungen als Verzierung.
Eine braune Urne, 4 1/2" hoch, 6 1/2" im Bauche, 6 " in der Oeffnung, 3 " in der Basis haltend, ist über der Bauchweite mit je 3 Zickzacklinien, zwischen denen an 10 Stellen runde mit Puncten umgebene Eindrücke sind, und unter derselben mit je 2 Bogenlinien verziert.
Eine braune, ganz unverzierte Urne, 6 1/2" in der Höhe, 8 1/4" im Bauche, 8 " in der Oeffnung und 4 " in der Basis haltend.
Eine dunkelbraune Urne, 5 " hoch, 7 " im Bauche haltend; von hier geht es gradlinig 2 3/4" bis zur Oeffnung, welche 6 1/8" mißt; die Basis hat 3 1/4" Durchmesser. Der


|
Seite 62 |




|
Hals ist mit 2mal 3 horizontalen Linien verziert, die an 3 Stellen durch je 3 Linien senkrecht durchschnitten werden.
Eine dunkelbraune Urne, 5 5/8" hoch, 7 1/2" im Bauche haltend; die Wände gehen von hier in einer Höhe von 4 " fast senkrecht bis zum Rande, da die Oeffnung noch 7 1/4" im Durchmesser hat; die Basis hält 4 1/2" und hat einen hervorstehenden Rand. Die Verzierung besteht am Bauchrand aus senkrechten Strichen, darunter aus 2 horizontalen Linien und darüber aus 2 horizontalen Bändern.
Eine braune Urne, 6 1/8" hoch, 8 1/4" im Bauchrande weit, die Wände in der Höhe von 3 " etwas ausgeschweift, nach dem Rande sich erweiternd, da die Oeffnung 9 3/4" mißt; die Basis hält 4 ". Als Verzierung sind nur 3 Knoten am Bauchrande.
Eine schwarzbraune Urne, die einzige, welche ganz in ihrer Form von allen übrigen abweicht und an die helmer Urnen erinnert, da sie fast eiförmig nur einen ganz kurzen Hals hat, da Höhe und Breite, Basis und Oeffnung fast gleich sind. Ihre Höhe ist 9 1/4", der Durchmesser im Bauche 9 3/4", in der Oeffnung 5 3/4" und in der Basis 5 1/4". Etwas unter dem Halse sind an 3 Stellen runde mit Puncten umgebene Eindrücke.
Der Inhalt der Urnen bestand:
1) in einer Anzahl eiserner Messer, von denen
- eins in Klinge und Zunge nur 3 " lang ist,
- eins etwas länger,
- fünf mit grader Zunge, jedes 5 1/4" lang, deren eins ganz ohne Rost,
- zwei eben solche von 6 1/4" Länge,
- eins von 5 3/4" Länge mit einer unten nach vorne gekrümmten Zunge.
2) Vier eiserne Nägel, wovon 3 zweimal rechtwinklig gebogen sind, und zwei kurze Nägel mit Köpfen aus Bronze.
3) Mehrere Hefteln (Broches), nämlich:
- zwei ganz aus Eisen,
- zwölf kleine aus Bronze, von denen 7 zerbrochen, wie Frid. Franc. Tab. XX, Fig. 7,
- zwei größere aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XX, Fig. 2, (deren eine zerbrochen), oben mit einem Knopf, mit eingeschlagenen Kreisen verziert; das vollständig


|
Seite 63 |




|
erhaltene Exemplar ist ganz dem auf dem Wendenkirchhofe von Kl. Renzow (A. Wittenburg) gefundenen (vgl. Jahresber. VI, S. 141) gleich.
d. eine aus Eisen, mit Windung und Nadel
aus Bronze,
e. eine Heftel aus
Bronze, statt des Bügels mit einer kreisrunden
dünnen Platte, 1 3/8" im Durchmesser, mit
einem durch die Mitte der Platte gehenden
eisernen Niete, welches dem Anscheine nach eine
kreuzförmige Verzierung auf der Außenfläche
gehalten hat.
4) Zwei große eiserne Haken, am Ende halbkreisförmig gebogen, lang 6 1/2" und 4 3/4".
5) Eine eiserne Nadel, 5 5/8" lang, in 3 Stücken (doch scheint noch ein Stück dazwischen zu fehlen), und das obere Ende einer mit einem Ringe versehenen eisernen Nadel.
6) Zwei Scheeren von Eisen:
- eine kleine Scheere, 2 1/2" lang,
- die obere Hälfte einer größern Scheere, 4 1/2" lang.
7) Ein eiserner Haken, ganz wie ein Fensterhaken.
8) Mehrere Ringe (Beschlag= und Gehenk=Ringe), nämlich:
- ein eiserner Ring, 1 5/8" im Durchmesser, durchbrochen.
- zwei bronzene Ringe, 1 1/2" im Durchmesser, nach 2 Seiten scheinbar durch den Gebrauch stark ausgesschliffen (Gehenk= oder Pferdezaum=Ringe),
- zwei bronzene Ringe, einer 1 1/2" und der andere 1 3/8" im Durchmesser,
- ein bronzener Ring, an einer Stelle etwas verbogen, von 1 7/8" Durchmesser,
- ein länglich gezogener und an 2 Stellen etwas ausgeschliffener Ring aus Bronze, von 2 1/4" und 2 " Durchmesser,
- ein platter Ring aus Bronze; der innere Rand ist nach einer Seite umgebogen, an 2 Stellen ebenfalls ausgeschliffen; 2 1/2" im äußern und 1 3/4" im inneren Durchmesser groß,
- ein Beschlagring von Silber, oval, 1 1/8" und 7/8 " im Durchmesser, aus zwei zusammenhaltenden Reifen bestehend, von denen der innere über den äußern hervorragt und der äußere perlenartig durch Querreifen verziert ist, unten platt,
- ein halber Ring aus Bronze, 2 1/2" im Durchmesser,
- ein ringförmig zusammengebogener Bronzedrath, an beiden Enden übergreifend.


|
Seite 64 |




|
9) Ein ringförmiges Instrument aus Bronze, beide Enden neben einander gelegt, abgeplattet und durch ein Niet verbunden, so daß etwas dazwischen gesessen zu haben scheint, in Form eines gewöhnlichen Brennglases.
10) Drei halbrunde Schnallen mit Zungen, nämlich:
- eine eiserne von 1 1/4" Breite und 1 1/8" Länge,
- zwei bronzene an breiten Streifen doppelten Bronzebleches, mit 2 Nieten zum Halten eines Gurtes; die eine 2 " breit und 1 1/8" lang, die andern 1 1/8" breit und 3/4" lang.
11) Ein Eimerchen aus Bronze (Ohrgehenk?), ganz wie die Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 7, abgebildeten, auf dem Wendenkirchhofe auf der Mooster bei Marnitz unter gleichen Verhältnissen gefundenen (vgl. Frid. Franc. Erläut. S. 98 u. 156); der Boden fehlt hier, scheint auch nicht darin gewesen zu sein. - Die Bronze ist sehr matt. Der obere etwas abgeschmolzene, unregelmäßige Rand ist silbern, jedoch sind nur wenige Spuren von Silber vorhanden.
12) Ein Rundbeschlag aus dünnem Bronzeblech, als wenn er um ein kleines, rundes Gefäß gesessen hätte, mit einer aufrecht stehenden Handhabe, welche oben ein Loch zum Anhängen hat. An einer Stelle ist ein eiserner Nagel angerostet.
13) Ein Instrument aus Bronze, platt, in der Mitte rund mit einem Loche, mit 2 Armen, die nach den Enden breiter werden; an einem Ende ist ein kleines Stück Bronzeblech angenietet. Das Ganze sieht aus wie die Seitenstange eines kleinen Pferdegebisses.
14) Eine Hakenfibel aus Silber, 4 5/8" lang und 5/12" breit, vollkommen wohl erhalten, jedoch in 2 Stücke zerbrochen, ohne allen Rost, obwohl mit einem grau=gelblichen Anfluge. Es ist ein dünner, etwas gebogener, elastischer Blechstreifen, an beiden Enden zu einem stärkern und schmalern Haken umgebogen, und zeigt ganz klar die Beschaffenheit dieser oft in Wendenkirchhöfen vorkommenden eisernen Hefteln, die wir Hakenfibeln genannt haben. Die Außenseite ist mit leicht eingeritzten, sich kreuzenden Schrägelinien verziert.
15) Das Ende eines Streifens Silberblech, 7/8 " breit und 5 1/2" lang, platt, überall gleich breit und an einem Ende rechtwinklig abgeschnitten und mit einem Nietloche versehen, am andern Ende von einem wahrscheinlich längern Stücke abgebrochen, mit den Eindrücken eines gehenden,


|
Seite 65 |




|
schmalen Meißels verziert, nämlich am Rande umher und in der Mitte mit Zickzacklinien, am Ende mit Perpendikulär= und Bogen=Linien. Das Silber ist schlecht geschlagen, mit schuppigen Ausbrüchen und etwas oxydirt.
16) Ein langes Band oder ein Gürtel von dünnem Bronzeblech, an 4 Fuß lang und 3/4" breit, an vielen Stellen mit kleinen Niet= oder Nagellöchern, in deren einem ein kleiner eiserner Nagel steckt; in einem andern Loche hängt in einem Bronzeniet ein kleines Gehenk von schmalem Bronzeblech.
17) Ein bandförmiges Bronzeblech mit ausgeschlagenen Puncten.
18) Ein kleiner bandförmiger Beschlag aus Bronze, mit 3 Löchern in der Mitte und umgebogenen.Enden.
19) Ein etwas größerer ähnlicher aus Bronze, an jedem umgebogenen Ende mit einem außen umgebogenen Stifte versehen, der an einem Ende von Bronze, am andern Ende von Eisen ist.
20) Eine kleine Spange aus Bronze, wie eine Hakenfibel, an den Enden stark umgebogen.
21) Ein unregelmäßiges Stück Bronzeblech, etwa 4 Quadratzoll groß, an einigen Stellen mit kleinen runden Nietlöchern.
22) Mehrere durchlöcherte Perlen, nämlich:
- eine gelb=bräunliche Perle, 6/8" hoch und 7/8" breit, wie es scheint aus Topasfels oder stark rissigem, hellem Glase.
-
mehrere Mosaik=Glas=Perlen, an denen nach
einigen durchsprungenen Exemplaren die
Arbeit unzweifelhaft als Mosaikarbeit
erkannt wird, indem die Verzierungen im
Aeußern als gefärbte Glasschichten durch die
ganzen Perlen gehen; es wird durch diesen
Fund das Zeitalter des Mosaikglases in
Meklenburg als unzweifelhaft der
Eisenperiode angehörig constatirt. Auch auf
der Mooster fanden sich gleiche Glasperlen
(vgl. oben). Die Perlen sind folgende:
eine Perle von milchweißem Glase in der Mitte mit einem rothen Bande, in welchem eine gelbe Ranke liegt, an der umschichtig Blumen und Blätter sitzen;
eine Perle von dunkelgrünem Glase mit rothen, grünen und gelben Zickzackverzierungen, welche fast die ganze Außenfläche bedecken;


|
Seite 66 |




|
eine Perle von smaragdgrünem Glase mit 3 gelben Sternen mit rothem Mittelpunct;
eine Perle von himmelblauem Glase mit 3 gelben Sternen mit rothem Mittelpunct;
eine Perle von dunklem Glase mit gelben und rothen Puncten;
c. mehrere einfache Glasperlen:
eine große Perle von dunkelgrünem
Glase, in zwei Stücke zersprungen;
eine kleine Perle von hellgrünem Glase,
scheibenförmig, an jeder Seite in
4 concentrischen Reifen sich erhebend,
zur Hälfte vorhanden;
eine kleine
Perle von indigoblauem Glase;
23) eine kugelförmige Perle von dunkelgrünem Glase, ohne Loch, mit einer eingeschmolzenen bronzenen Oese zum Anhängen, hoch fast 5/8", breit 4/8 ".
24) Mehrere Fragmente und zusammengeschmolzene Exemplare von Mosaik =, grünen und blauen Glasperlen.
25) Ein Stück brauner bernsteinartiger Masse, wie durch Feuer verbrannt.
26) ein Stück calcinirten Knochens mit einem kleinen bronzenen Niete.
Wittenburg.
J. Ritter.
Dritte Aufgrabung.
Im Auftrage des Vereines begab ich mich im October 1842 nach Pritzier, um den dortigen Wendenkirchhof, der bisher schon einigen Reichthum an Alterthümern gezeigt hatte, ganz aufzudecken. Der Herr Landrath von Könemann gestattete gütigst die Aufgrabung sowohl an dem mir bereits bekannten Orte, als auch an einigen andern Stellen, wo ich noch Alterthümer vermuthete. Der Herr Pastor Böcler nahm theils selber Antheil an der Aufdeckung, theils unterstützte er mich freundlichst mit Rath und That. Bisher war der mittlere Theil des Kirchhofs durchsucht; von hier ließ ich weiter graben, allmälig nach allen Richtungen hin, bis nirgends mehr Urnen sich zeigten, die aufgetragene Erde ganz aufhörte oder im Norden und Westen eine Art Kirchhofsmauer aus Feldsteinen das Ende des Begräbnißplatzes bezeichnete. Darnach betrug die Länge des Platzes von Osten nach Westen etwa 80 Schritte und die Breite am südlichen Abhange der Hügel 50 Schritte. Die Urnen standen darin gleichsam fa=


|
Seite 67 |




|
milienweise, 5 bis 12 nahe an einander; die in der Mitte des Platzes zeichneten sich durch den Reichthum des Inhaltes aus, je weiter nach Osten und Westen, desto ärmlicher und spärlicher war das darin Gefundene; daher wurden die besten Funde gleich zu Anfange gemacht. Die Anzahl der von mir gefundenen Urnen beträgt etwa 200, von denen aber sehr viele schon zerdrückt oder durch Tannenwurzeln gesprengt waren; andere waren von Nässe in dem rothgelben Sande, in dem sie standen, sehr erweicht und zerfielen bei der Berührung. Doch waren unter den zerbrochenen Urnen, keine, die sich durch Eigenthümlichkeit in Form oder Verzierung von den erhaltenen unterschieden. Diese sind:
Eine schwarze Urne mit glänzendem Ueberzuge, 8 " hoch, 4 1/4" in der Basis, 10 " im Bauche und 8 1/2" in der Oeffnung haltend. Sie ist roh mit horizontalen Linien unterhalb des Randes und mit Kreisen und senkrechten Linien unter denselben an 4 Stellen statt der Henkel verziert.
Eine braune Urne ohne Verzierung, 5 1/2" hoch, 4 1/4" in der Basis, 9 " im Bauche und 6 1/4" in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, 5 1/4" hoch, 2 3/4" der Basis, 7 1/2" im Bauche, und 7 1/4" in der Oeffnung haltend; am Rande stehen 3 Knöpfchen statt der Henkel und dazwischen ist eine ganz leichte, rohe Verzierung von horizontalen und senkrechten Strichen.
Eine braune Urne ohne Verzierung, sehr roh gemacht, 4 3/4" hoch, 3 1/2" in der Basis, 6 1/4" im Bauche und 5 1/2" in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, 7 " hoch, 4 " in der Basis, 10 1/4" im Bauche und 9 " in der Oeffnung haltend; an der Bauchweite stehen 3 knopfartige Erhöhungen; über derselben laufen 3 horizontale Eindrücke umher.
Eine braune Urne, 5 3/4" hoch, in der Basis 3 3/4", im Bauche 9 1/4", in der Oeffnung 7 1/4" haltend; sie hat nur an der Bauchweite 7 starke, von oben nach unten länglich gemachte Eindrücke.


|
Seite 68 |




|
Eine braune Urne ohne Verzierung, 7 " hoch, 4 " in der Basis haltend, ohne Bauchung, mit oben wenig auswärts gebogenem Rande, 7 " weit; sie ist nur roh gearbeitet.
Eine braune Urne, 5 1/4" hoch, 3 3/4" in der Basis, 8 1/2" im Bauche und 7 1/4" in der Oeffnung haltend. Um die sehr niedrige Bauchweite laufen 4 horizontale Linien und in der Mitte nach dem Rande zu eine gleiche Anzahl, über denen kleine Schräge Linien eingedrückt sind; an 4 Stellen sind Kreise von Puncten, mit Schräglinien von oben dachförmig eingeschlossen.
Eine braune Urne, 3 3/8" hoch, 2 3/4" in der Basis, 5 1/2" im Bauche und 5 1/4" in der Oeffnung haltend; an der Bauchweite sind 11 tiefe runde Eindrücke.
Eine braune, unverzierte Urne, 5 " hoch, 4 1/4" in der Basis, 7 1/2" im Bauche und 6 " in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, 5 3/4" hoch, 3 1/2" in der Basis, 7 3/4" im Bauche und 6 1/2" in der Oeffnung haltend; unterhalb der Bauchweite sind senkrechte und schräge Striche roh gezogen.
Eine braune Urne ohne Verzierung, 6 " hoch, 4 " in der Basis, 10 1/4" im Bauche und 8 3/4" in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, 6 1/4" hoch, 3 1/4" in der Basis, 8 1/4" im Bauche und 7 1/2" in der Oeffnung haltend; an der Bauchweite laufen 3 Linien umher, über denselben je 3 schräge Linien im Zickzack und über diesen eine Reihe fast dreieckiger Eindrücke; an der Randeinbiegung sind wieder 3 horizontale Linien; noch sind an 3 Stellen über dem Bauche je 4 runde Eindrücke.
Eine schwarze Urne mit glänzendem Ueberzuge, 5 1/2" hoch, 3 3/8" in der Basis, 61/2" im Bauche und 5 1/4" in der Oeffnung haltend; oberhalb der Bauchweite sind 9 Kreise umher eingedrückt; alles ist etwas roh gearbeitet.
Eine schwarz=braune Urne, 5 3/4" hoch, 3 1/4" in der Basis, 8 1/4" im Bauche und 7 3/4" in der Oeffnung haltend; zwischen Bauch und Rand laufen 2 horizontale Linien umher, zwischen denen einzelne Schräglinien im Zickzack stehen.


|
Seite 69 |




|
Eine braune Urne, 8 1/2" hoch, 4 1/2" in der Basis, 10 1/4" im Bauche und 9 1/4" in der Oeffnung haltend; über dem Bauche sind 4 horizontale eingedrückte Streifen umher.
Eine schwarze Urne, 4 1/2" hoch, 2 3/4" in der Basis, 6 3/4" im Bauche und 5 " in der Oeffnung haltend; oberhalb der Bauchweite sind je 3 schräge, im Zickzack stehende Linien, oben durch eine umherlaufende horizontale Linie begrenzt.
Eine braune Urne, 7 " hoch, 3 1/2" in der Basis,9 3/4" im Bauche und 8 1/2" in der Oeffnung haltend; am Bauche stehen 3 Knoten mit rundem Eindrucke in der Mitte.
Eine braune Urne ohne Verzierung, 5" hoch, 3 3/8" in der Basis, 7 1/4" im Bauche, 6 1/2 in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne ohne Verzierung, 5 1/4" hoch, 3 3/4" in der Basis, 6 1/2" im Bauche, 5 1/2" in der Oeffnung haltend.
Eine braune Urne, 3 1/2" hoch, mit einer erhabenen, etwas ausgeschweiften und 2 1/4" im Durchmesser haltenden Basis; die Bauchweite und Oeffnung ist 5 "; unter dem etwas auswärts gekrümmten Rande und unter der Bauchweite laufen je 2 horizontale Linien, zwischen denen mit Schräglinien der Raum ausgefüllt ist; an einigen Stellen laufen je 3 Linien bis zur Basis hinab.
Die Urnen waren größtentheils angefüllt mit Knochen; einzelne enthielten unter dem Sande nur etwas Asche (cineraria), und hin und wieder fand sich eine, in welcher auch keine Spur von Asche und nichts als Sand zu entdecken war.
In den Urnen fand sich:
A. aus Silber: ein Fingerring mit einer ovalen Platte, ganz wie ein Siegelring; er lag zwischen Eisen und einer bronzenen, Heftel; das Metall war aber so spröde, daß er beim Einpacken zerbrach und keine starke Berührung verträgt. An den Seiten der Platte ist der Ring von halbmondförmigen und vierseitigen Verzierungen durchbrochen.

Die Arbeit ist sauber und geschmackvoll. Das Stück ist höchst selten 1 ).


|
Seite 70 |




|
B. aus Stein: ein Spindelstein von grauem Sandstein,ganz mit concentrischen Reifen verziert, 1 3/8" im Durchmesser, 5/8 " in der Dicke groß.
C. aus Bronze:
1) zwei runde Beschläge, wie Stabbeschläge, einer 1 1/8", der andere 1/2" lang, beide ungefähr 7/8" weit;
2) zwei gleiche, zusammengehörende Instrumente aus starkem Blech, 3 3/4" lang und 1/4" breit, an einem Ende zu einer Oese umgebogen, an dem andern Ende gespalten und beide Theile ankerförmig seitwärts gebogen; die Ränder sind mit kleinen, eingeschlagenen Strichen, die einer Nath ähnlich sind, verziert; - nur das eine dieser Instrumente ist ganz vorhanden;
3) ein dünner Ring aus Drath, 3/4" weit, mit 2 daran
Unser Fingerring von Pritzier hat nun ganz die Form eines Siegelringes, wenn sich auch auf der Platte keine Belegung, Zeichnung oder Schrift erkennen läßt. - Zu Warlin ward ebenfalls ein prächtiger silberner Fingerring ungefähr aus derselben Zeit gefunden; vgl. Jahresber. V, S. 132.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 71 |




|
in Oesen hangenden Dräthen, welche viereckig und gewunden sind;
4) ein sehr kleines Stück Blech mit einem einhangenden kleinen Ringe, in allen Dimensionen ungefähr nur 1/4";
5) zwei Enden Drath, ähnlich dem Ringe Nr. 3;
6) ein Stück Blech, dessen Gestalt durch Feuer unkenntlich geworden ist.
Alle diese Sachen von dem Spindelsteine an und mit demselben waren in einer Urne.
7) Eine größere Heftel (Broche), 3 " lang, stark gearbeitet, mit einem Knopfe oben auf dem Bügel; die Nadel fehlt;
8) zwei gut erhaltene kleinere Hefteln von 1 3/4" Länge;
9) eine gleiche Heftel, krumm zusammengebogen, wahrscheinlich durch Feuer;
10) eine kleine Heftel 1 1/4" lang, welche sich durch eine sehr große, fast doppelte Nadelscheide auszeichnet; die Nadel fehlt zur Hälfte;
11) Bruchstücke von wenigstens 12 zerbrochenen Hefteln, welche in diesem Zustande in den Urnen lagen;
12) zwei Hefteln mit runder Scheibe von 2 1/4" Durchmesser (statt des Bügels); 1/4 " vom Rande der Außenfläche ist ein erhabener Kreis; die Hälfte der einen Scheibe ist sehr durch Feuer angegriffen;
13) die Scheibe einer solchen Heftel von fast 2 " Durchmesser; sie hat am Rande 8 hervorstehende kleine halbkreisförmige Vorsprünge; in der Mitte ist eine, von einer kleinen Erhöhung umgebene Kreisfläche von 7/8 " Durchmesser, mit einer kleinen knopfartigen Erhöhung in der Mitte; auf dem 1/2 " breiten Ringe auf dem Rande der Oberfläche sind 8 herzförmige Figuren, welche mit gefärbtem Glas, also mit falschen Steinen, gefüllt sind; das Ganze hat vom Feuer gelitten und die Glasflüsse sind geschmolzen;
14) zwei Fragmente von solchen Scheibenhefteln;
15) ein etwas ovaler Ring (ein Gehenk?) von 3 " und 2 5/8" Durchmesser; die Stärke des Metalles ist über 1/4";
16) ein kleiner Ring von 1 1/8" Durchmesser;
17) ein Fingerring von doppelt gewundenem Bronzeblech, mit offenen Enden, so gearbeitet, daß die beiden äußeren Flächen breiter sind; er hat im Feuer gelitten und zeugt davon auch der daran sitzende Glasfluß;


|
Seite 72 |




|
18) ein Instrument oder Beschlag aus Blech, wie eine Klammer 2 1/2" lang, 3/8" breit, oder wie eine Hakenheftel, mit rechtwinklig gebogenen, zugespitzten Enden;
19) zwei Fragmente ähnlicher Instrumente, eins über 1/2" breit mit 3 Löchern und ausgeschlagenen Zickzacklinien von Puncten,
20) ein gleiches Instrument, 2" lang, mit mehrmals gebogenen Enden, wie eine Hakenfibel;
21) zwei kleine Stifte mit hakenförmig gebogenem Ende, oder Häkchen mit Stiften zum Einschlagen.
D. aus Eisen:
1) ein eisernes Instrument, bestehend aus 2 gleichen Stücken, 4 1/8" lang, 1/4" breit und 1/8" dick, jedes ist an dem einen Ende hakenförmig oder halbkreisförmig gebogen und an dem andern Ende zu einer Oese gearbeitet, wo beide Theile durch einen dünnen eisernen, ringförmig gebogenen Drath zusammen gehalten werden; beide Theile bieten zusammen etwa die Form einer Zange oder eines Kugelmessers dar;
2) der eine Theil eines gleichen Instrumentes, nur stärker gearbeitet und 5" lang;
3) eine große Pfeilspitze oder kleine Lanzenspitze mit Schaftloch, 4 1/4" lang;
4) zwei kleine Scheeren, 1 5/8" und 1 7/8" lang;
5) eine Pincette, 3" lang;
6) ein klammerförmiges Instrument, mit dreimal rechtwinklig gebogenen Enden, 3" lang;
7) ein gleiches von 1 5/8" Länge;
8) ein gleiches, mit nur zweimal gebogenen Enden; es ist ganz ohne Rost und 2 1/8" lang;
9) zwei Hefteln, jede von 2 3/4" Länge;
10) fünf ovale Schnallen von verschiedener Größe; die größte mißt 2 3/4" und 1 3/8" im Durchmesser, die kleinste 1 1/2" und 1 ";
11) eine halbrunde Schnalle, 1 1/4" groß, an einem Blechstreifen;
12) eine oval zusammengebogene Nadel mit einem Kopfe aus Bronze;
13) drei runde Schnallen;
14) dreizehn Messer, von 4 1/2" bis 6 1/2" Länge;
15) ein ganz kleines Messer, 1 7/8" lang, die Klinge ist 1 1/8" lang;
16) zwei zusammengerostete Messer, von denen das eine am Heftende mit einem runden Loche versehen ist; außerdem


|
Seite 73 |




|
sind zusammengeschmolzene Glasperlen daran durch Rost befestigt.
E. aus Knochen: ein nadelförmiges Geräth, an einem Ende knopfartig verziert; es ist ohne Zweifel gedrechselt und in einer Länge von fast 4 " vorhanden, aber in 4 Stücke zerbrochen.
F. aus Glas:
1) eine kleine ziegelrothe Perle, wie von rothem Jaspis, mit feinen schwarzen Adern;
2) eine und eine halbe weiße, helldurchsichtige Perle, wie von Bergkrystall;
3) neun indigoblaue, durchsichtige Perlen;
4) gegen zwölf gleiche, die stenglicht an einander geschmolzen sind;
5) sechs gleiche, die je 2 an einander geschmolzen sind;
6) drei gleiche, mit einander verschmolzen;
7) blaue mit hellgrünen Perlen an einander geschmolzen;
8) blaue mit weißen Perlen an einander geschmolzen;
9) zwei und eine halbe apfelgrüne Perlen, undurchsichtig; die halbe hat feine ziegelrothe Adern;
10) zwei und eine halbe gelbe, undurchsichtige Perlen;
11) zwei weißliche und zwei rothbraune undurchsichtige Perlen, an einander geschmolzen;
12) vier weiße undurchsichtige Perlen; an der einen ist noch ein durchsichtiges weißes Stück Glas angeschmolzen; eine andere scheint violette Verzierungen gehabt zu haben;
13) eine halbe große (7/8" hohe und fast eben so breite) Perle von hellgrünem durchsichtigen Glase, auf der Oberfläche ganz mit Zickzackverzierungen von eingelegten parallelen rothen, weißen und blauen Linien bedeckt;
14) eine ähnliche, oben und unten mit einer hellgelben Zickzacklinie und in der Mitte mit bräunlichen Puncten verziert; sie ist zerbrochen;
15) eine durchsichtige weiße Perle, splitterig wie Quarzkristall, in der Mitte umher mit 4 eingelegten bräunlichen Puncten verziert;
16) eine durchsichtige grünliche, Perle, an drei Stellen mit einem eingelegten braunen Kreise und darin mit einem gelben Puncte verziert;
17) eine durchsichtige hellgrüne Perle, an drei Stellen mit einem eingelegten braunen Kreise und darin mit je 3 gelben Puncten verziert;
18) eine durchsichtige hellgrüne Perle, in der Mitte mit


|
Seite 74 |




|
einer eingelegten braunen Linie, in welcher 4 gelbe Puncte stehen, verziert;
19) eine halbe smaragdgrüne durchsichtige Perle, mit mosaikartig gemachten gelben Sternen, die in der Mitte einen rothen Punct haben, verziert; - diese Perle ist Mosaikarbeit (vgl. unten die Perle aus Afrika), mit durch die ganze Masse gehenden Verzierungen: die vorstehend erwähnten Perlen hatten nur in die Oberfläche eingelegte Verzierungen;
20) eine milchweiße Perle mit einer violetten Zickzacklinie in der Mitte;
21) eine gleiche etwas calcinirte Perle;
22) eine vom Feuer etwas angegriffene, sehr bunte Mosaik=Perle; die fast ganz verschwindende Hauptmasse ist milchweißes Glas; auf der Oberfläche stehen 3 durchgehende Kreuze aus braunen und gelben Streifen; in der Mitte der Kreuze steht ein schachbrettartig, braun und gelb gefärbtes ovales Schild und in dessen Mitte ein gleicharmiges, rothes Kreuz mit einem braunen Puncte in der Mitte;
23) drei Perlen zusammengeschmolzen; die eine größere besteht aus brauner Masse mit gelben und grünen Zickzacklinien und rothen Streifen verziert; die beiden andern gleich großen sind braun mit einem rothen Streifen in der Mitte;
24) eine über 3/4" lange und 1/6" dicke, durchsichtige, stenglichte, gedrehte Perle mit 4 Knötchen, von hochblauer Farbe;
25) eine und eine halbe undurchsichtige, gelbliche, fünfeckige Perle, ähnlich der Frucht des Spindelbaumes;
26) mehrere Bruchstücke von Perlen, zum Theil von mosaikartiger Arbeit;
27) ein Bruchstück von einer durchsichtigen, weißen, stark längs geriefelten Perle, ganz wie die Perlen von Warkstorf (vgl. unten);
28) mehrere zerschmolzene, durchsichtige, weiße Glasflüsse, anscheinend von Perlen;
29) eine Menge zerschmolzener Glasflüsse von verschiedenen Farben;
30) einige größere Stücke von zerschmolzenem grünen Glase, vielleicht von Gefäßen.
G. Ein Stückchen von einer geglüheten, calcinirten, bearbeiteten Knochenplatte von bläulicher Farbe.


|
Seite 75 |




|
H. Eine Kugel und mehrere unregelmäßige, auch ungefähr bohnenförmige Stücke eine braunen, sehr leichten harzigen Masse, welche am Feuer brennt und Wohlgeruch verbreitet; der Geruch ist dem des brennenden Bernsteins ähnlich, nur nicht so strenge; in den Urnen der Eisenperiode ist dergleichen Räucherwerk schon öfter bemerkt (vgl. Jahresber, II, S. 70 u. 75).
Wittenburg, im October 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Lehsen.
Wenn man von Wittenburg nach Lehsen geht, so kommt man zu Anfang des lehsenschen Gebietes durch einen schmalen Wiesengrund; sobald er durchschritten ist, befindet man sich auf einem großen Wendenkirchhofe, der zu beiden Seiten der Chaussee an einer östlichen Abdachung des Landes liegt, aber keine äußerlich kennbare Grenzen hat. Schon bei Anlegung der Chaussee zeigten sich viele Scherben, doch keine bedeutendere Stücke; kleine Nachgrabungen am Wege lieferten auch kein weiteres Resultat als Scherben von braunen und schwarzen Urnen, wie sie auf Wendenkirchhöfen sich zeigen. Im vorigen Herbste wurden daselbst Steine ausgebrochen und es kamen dabei mehrere braune Urnen zum Vorschein, die aber von den Arbeitern zertrümmert waren; nur eine schwarze Urne blieb unversehrt, welche ich von dem Herrn von Laffert auf Lehsen für den Verein erhielt. Sie hat einen schwarzen Thonüberzug und 2 (abgebrochene) Henkel, mißt in der Höhe 5 1/4", in der Basis 2 3/4", im Bauche 7 1/4", in der Oeffnung 4 3/4" und hat an der Basis ein durch 2 Linien gebildetes Kreuz; außer den Knochen war darin eine Heftel aus Bronze gewesen, die aber verloren gegangen ist. Das in andern Urnen gefundene Eisengeräthe war als unnütz von den Arbeitern weggeworfen. Eine weitere Nachgrabung, zu der Herr von Laffert gerne Erlaubniß ertheilt, ist zur Zeit nicht möglich, da der Acker bestellt ist. - Theilweise ist, nach meinen bisherigen Beobachtungen über diesen Platz, wegen des flachen Standes der Urnen keine Ausbeute zu erwarten, da der Pflug alles zerstört hat; indeß kann an einzelnen Stellen, wie sich beim Steinbrechen zeigte, eine künftige Untersuchung noch gute Resultate geben.
Wittenburg, 1842.
J. Ritter.


|
Seite 76 |




|



|



|
|
:
|
b. Einzeln gefundene Alterthümer.
Glasperlen von Warkstorf.
Auf der Feldmark Warkstorf wurden beim Pflügen zwei Glasperlen gefunden, welche großes Interesse haben, da sie vollkommen wohl erhalten sind, und von dem Herrn Dr. Gertz durch den Herrn Dr. Burmeister zu Wismar eingeliefert. Nach der Analogie anderer Aufgrabungen gehören sie der Eisenperiode an; ganz gleiche Glasperlen sind früher in Wendenkirchhöfen gefunden, z. B. zu Rülow (vgl. Jahresber. V, S. 78). Beide Perlen sind mit Längsreifeln verziert (vgl. oben S. 74, Nr. 27).
Die eine Perle ist rund, von weißem Glase, anscheinend etwas bruchig in der Masse, wie Eis oder Marienglas.
Die andere Perle ist länglich oder cylinderförmig und von sehr matt hellgrünem Glase, wie Glas von dieser Farbe den Wendenkirchhöfen vorzüglich eigenthümlich ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Afrikanische Glasperlen.
Im Jahresber. VII, S. 81 ist durch den Herrn Epffenhausen aus Hamburg Nachricht von Mosaikperlen gegeben, welche, aus dem Innern Afrika's oder vielleicht aus Aegypten kommend, an der Goldküste einen nicht unwichtigen Handelszweig bilden, indem sie hier von den Eingebornen stark gesucht und mit dem doppelten Gewichte Goldes, bezahlt werden. Die Eingebornen erkennen die ächten Perlen sehr leicht nicht nur an ihrer ganzen äußern Eigenthümlichkeit, sondern auch an ihrem geringen specifischen Gewichte, und alle mit Mühe und Kosten, selbst in Venedig, nachgemachten Perlen haben keinen rechten Eingang gefunden. Herr Epffenhausen war im Sommer 1841 sehr erstaunt, in unsern Sammlungen ähnliche Perlen zu finden, wie er sie auch in ägyptischen Museen an den Mumien gefunden hatte, und hat später, unserer Sammlung gedenkend, durch Vermittelung des Herrn Zahl=Commissärs Peitzner zu Schwerin eine ächte Perle, welche von den Bewohnern der Goldküste Agrey genannt werden, für diese eingesandt. Diese ächte Perle ist aus porösem Glasflusse, von stenglichter Form, cylindrisch, in scharfen Flächen aus einem längern, gebogenen runden Wulste geschnitten, hochgelb an Farbe in der Grundmasse und mosaikartig mit eingelegten, sich durchkreuzenden Bändern von blauen, rothen und weißen Streifen verziert. Zugleich hat Herr Epffenhausen drei verschiedene nachgemachte Perlen (schwärzlich mit gelben, blau mit weißen


|
Seite 77 |




|
und braunen, weiß mit blauen Verzierungen) eingesandt, welche allerdings sehr leicht von den ächten zu unterscheiden sind.
Die ächte afrikanische Perle ist Mosaikarbeit: die Verzierungsbänder sind tief eingelegte Massen. Unsere heimischen Perlen sind ebenfalls Mosaikarbeiten und gehören nach neuern, beglaubigten Funden der Eisenperiode an; vgl. oben den Wendenkirchhof von Pritzier S. 65 und 74.
G. C. F Lisch
Ein Spindelstein
aus grauem Thon, gefunden in einem Moderloche zu Satow bei Doberan, geschenkt von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow.



|



|
|
:
|
Silberschmuck von Marlow.
Im Jahre 1841 ward im Recknitz=Moore bei Marlow vom Herrn Senator Schlie daselbst ein Stück Schmuck von Silber gefunden und später vom Herrn Dr. Huen daselbst dem Vereine geschenkt. Das Ganze ist ein zusammengerolltes Stück dünnes Silberblech ohne Ende, 1 1/4" breit und 7/8 " hoch in zwei zusammenhangende Rollen geformt, von denen die eine (die untere) fast noch einmal so groß ist, als die obere; die obere Rolle ist an beiden Seiten offen, die untere, größere an einem Ende geschlossen, war es jedoch wohl auch am andern Ende. Die eine Seite ist ohne alle Verzierungen; die andere, mehr gebogene Seite hat aufgelöthete Relief=Verzierungen mancherlei Art. Die Hauptverzierungen bilden vier aufgelöthete Verzierungen, wie Schlangen= oder Pferdeköpfchen, welche mit Filegran=Arbeit nicht nur bedeckt, sondern auch nach oben und unten hin mit gleicher Arbeit in graden und gewundenen Linien abgegrenzt sind. Wahrscheinlich diente das Stück zu einem Schmuck, welches vor der Brust getragen ward.
Nach dem Metalle, der Filegran=Arbeit und der ganzen Gestaltung dürfte der Schmuck alt=arabischer Herkunft sein und in die Zeit der im Lande häufig gefundenen kufischen Münzen, also in das 10te Jahrhundert, oder, wenn er von einheimischer oder nordischer Arbeit sein sollte, ungefähr in dieselbe Zeit fallen.
Ein ganz gleicher Schmuck, abgebildet in v. Ledebur Königl. Museum vaterländ. Alterth. zu Berlin, Tab. IV,Nr. II, 273, und beschrieben das. S. 81, ward 183 1/2 zu Göritz bei Prenzlau mit vielen schönen Schmucksachen von


|
Seite 78 |




|
Silberdrathgeflechten gefunden; sowohl nach diesen Schmucksachen, als nach den vielen dabei befindlichen arabischen Münzen, stammt dieser Fund ohne Zweifel aus dem Orient. Auch Berlocks mit Pferdeköpfchen waren in dem Funde. Aehnliche Sachen wurden 1835 bei Eickstedtswalde gefunden; vgl. v. Ledebur a. a. O. S. 20.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
2. Aus unbestimmter Zeit.
Urnen von Schwerin.
Beim Ausgraben von Erde hinter dem Hause des Herrn Mundkochs Schack zu Schwerin, in der Paulsstadt an der Alexandrinenstraße am Pfaffenteiche, dem vorletzten Privathause vor dem großherzoglichen Amte nach Norden zu, fanden sich einige Fuß tief auf einem Pflaster von Feldsteinen neben groben Kalkstücken und Knochen mehrere Urnen, welche nach der Mischung der Masse aus heidnischer Zeit stammen, leider aber alle zertrümmert wurden, nämlich:
1) eine hellbraune Urne der größten Art. Sie wird gegen 2' hoch, fast eben so weit im Bauche, von fast senkrechten Linien in den Wänden und wenig eingezogenem Rande und Fuße gewesen sein. Die Scherben sind ungefähr 1/2" dick, die Masse ist grob und mit zerstampftem Granit durchknetet, der Rand einige Finger breit hoch. Hin und wieder ist die Außenseite geschwärzt. Das Gefäß wird der großen bei Wittenburg gefundenen Urne (vgl. Jahresber. V, S. 64) gleich gewesen sein und Aehnlichkeit mit einer andern daselbst gefundenen Urne (vgl. das. S. 62) gehabt haben. Da in den wittenburger Urnen und in der Nähe derselben Metallschlacken gefunden wurden, so scheint die Bestimmung dieser Gefäße auf Schmelztiegel zu deuten.
2) eine kleine, schwarze Urne, ohne Verzierungen, beinahe in einer senkrechten Hälfte vorhanden, schwarz mit gelben Glimmerfünkchen durchsprengt, ungefähr 7 " hoch, unten sehr spitz, oben weit geöffnet, mit hoch liegendem, scharfem Bauchrande, mit einem Henkel.
3) Scherben von 2 bis 3 kleinen hellröthlichen und gelben Urnen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Ein Dollen (scalmus) von Holz,
6 Fuß tief im tribseer Moore beim Torfstechen im J. 1842 gefunden, geschenkt vom Herrn Geh. Amtsrath Koch


|
Seite 79 |




|
zu Sülz. Das Werkzeug, ein Pflock, der in den Kahnrand gesteckt wird, um das Ruder daran zu legen, ist von Holz aber schwarz und fest, wie Ebenholz oder Horn, und glatt, wie polirt; es hat in der Mitte durch Einschnitte eine Abtheilung und ist offenbar viel gebraucht. Auf dem untern Theile sind 2 Paar kleine concentrische Augen, wie Würfelaugen, eingeschnitten; durch den obern Theil geht schräge ein Loch zum Einknüpfen einer Schnur zum Anbinden.
Der Dollen ist ohne Zweifel sehr alt. Nach der Mittheilung des Herrn G.=A.=R. Koch werden in den dortigen Mooren drei Schichten starker Tannenwurzeln übereinander gefunden, und doch findet man Spuren von Wasserfahrt unter denselben. So ward vor etwa 65 Jahren bei Errichtung des Friederichs=Gradirbaues in der Tiefe beim Ausgraben der Reservoirs für Soole ein Schiffskiel gefunden, der damals nach Ludwigslust geschickt ward.



|



|
|
|
Eisernes Schwert von Rosenhagen.
Im Holze von Rosenhagen bei Dassow ward beim Holzroden dicht bei einer jungen Buche, nahe unter der Erdoberfläche, ein eisernes Schwert gefunden und von dem Herrn Rettich auf Rosenhagen geschenkt. Es ist in der Klinge 22 1/2" lang, zweischneidig und allmählig spitz auslaufend, mit einer 5 " langen Griffzunge, nicht bedeutend von Rost angegriffen, jedoch von den Arbeitern, welche es fanden, abgeputzt. Das Alter desselben läßt sich schwer bestimmen.



|



|
|
:
|
3. Aus dem Mittelalter.
Alterthümer von der Wiek bei Marlow,
mit Berichten eingesandt vom Herrn Dr. Huen zu Marlow. - Herr Dr. Huen schreibt:
"Unsere Stadt wird von der Westseite durch einen ziemlich hohen Hügel eingeschlossen, dessen Fuß an der Os t= und Nordseite mit Häusern bebaut ist und welcher schon oft Alterthümer geliefert hat. Der Hügel führt den Namen Wiek und ist noch deshalb merkwürdig, daß die Hälfte desselben zu dem fürstlichen Amte Sülz gehört. Die Anwohner dieses - Theils müssen noch jetzt einen jährlichen Canon für Haus und Garten an das Amt entrichten und stehen unter gemeinem Rechte während die ihnen gegenüberstehenden Häuser unter lübischem


|
Seite 80 |




|
Rechte stehen. Da ich in Ermangelung eines andern Bauplatzes mir ein 110 Fuß breites und 65 Fuß langes Terrain abgraben lassen mußte und dabei 20 Fuß tief in den Hügel hineingehend, fand ich, daß nach der Nordseite des abgegrabenen Platzes die Erde aufgeschüttet war, indem schwarzer Humus auf dem ursprünglichen Mergelboden lag. Zugleich fand ich eine Steinmauer von ungefähr 2 Fuß Dicke und und 3 Fuß Höhe, neben derselben einen eingesunkenen Töpfer= oder Backofen und sechs Fuß von diesem entfernt eine Sichel, einen Sporn und eine Pfeilspitze von Eisen. Früher sollen auch Schwerter und andere Alterthümer auf der Wiek gefunden sein.
Die Wiek scheint allerdings durch Aufschüttung erhöhet worden zu sein; jedoch hat die Natur hier mehr zur Bildung einer Veste beigetragen, als Menschenhand. Die ganze Stadt ist bergig und auf Hügeln erbauet; jedoch erhebt sich der Hügel der Wiek über alle andern. Mit Wasser scheint die Wiek aber nur an einer Seite umgeben gewesen zu sein.
Von Marlow zieht sich ein Damm durch das Moor, der noch 1/8 Meile weit sichtbar ist, und eine Brücke über die Recknitz soll den Damm mit Pommern verbunden haben; bei niedrigen Wasserstande sieht man noch die Pfähle".
Marlow ist bekanntlich ein uralter Ort. Schon im 12. Jahrhundert wird desselben als einer fürstlichen Burg gedacht; bei Marlow war das Landding, und die Saline zu Sülz gehörte in den ältesten Zeiten zu Marlow, bis im 13. Jahrhundert bei der Saline die Stadt Sülz entstand.
Die vom Herrn Dr. Huen eingesandten, auf der Wiek 1 ) gefundenen Alterthümer sind offenbar, mittelalterlich, nämlich:
1) eine schmale eiserne Sichel, 10 " in der Rundung weit;
2) ein eiserner Sporn, der auf einem Harnisch getragen ist.
Die verloren gegangene Pfeilspitze war viereckig und zugespitzt, 3 " lang und 1/2" dick.
Mehrere auf dem alten Kirchhofe in der Stadt gefundene Scherben sind von mittelalterlichen Töpfen aus blaugrauem Thon.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 81 |




|



|



|
|
:
|
Alterthümer von Neuburg.
Der Herr Pastor Kehrhahn zu Döbbersen überliefert für den Verein zwei in den Wallbergen zu Neuburg (vgl. Jahrg. VII, S. 169 flgd.) gefundene Sachen, n?ich
1) ein sehr kleines, zierliches bronzenes Hähnchen zum Zapfen; die darin befindliche Zwicke breitet sich oben in zwei Enden hörnerförmig aus, wovon eins abgebrochen ist; wo beide Hörner sich vereinigen, ist als Stempel ein Greif eingeschlagen (also wohl zu Rostock gemacht); nach der hübschen und antiken Bildung des Greifen und der Metallcomposition gehört das Hähnchen wohl der bessern Zeit des Mittelalters an;
2) eine eiserne Pfeilspitze mit Schaftloch, 3 1/4" lang; die eigentliche Spitze ist viereckig gearbeitet und hinten 3/8" dick, ihre Länge ist 1 3/4".
Wittenburg, im August 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Alterthümer aus den Ruinen des alten Schlosses Basedow.
Unmittelbar neben dem jetzigen Schlosse Basedow, welches in den ältern Theilen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts stammt, stehen noch Ruinen des alten Schlosses. Als im J. 1842 zur Erweiterung von Wasser=Bassins Ausgrabungen vorgenommen wurden, stieß man auf den Rost der alten Ringmauern, auf welchem noch die Fundamentsteine lagen. Die Familie Hahn gelangte im J. 1337 zum Besitze von Basedow; die letzten bedeutenden Bauten am alten Schlosse waren im J. 1467 vollendet. In die Zeit vor diesem Jahre werden die Alterthümer fallen, da sie innerhalb der ehemaligen Ringmauern gefunden sind; wahrscheinlich sind sie durch Brand verschüttet, da sich in den Gefäßen viele röthlich gebrannte Lehmstücke von "Klemstaken" mit Stroheindrücken fanden. Die Gefäße gleichen denen in der im J. 1480 zerstörten Burg Ihlenfeld gefundene (vgl. Jahresber. V, S. 87 flgd.).
Die Alterthümer sind folgende:
1) ein vasenförmiges Gefäß von blaugrauem Thon mit zwei Henkeln, von denen der eine abgebrochen ist;
2) ein kugelförmiges Gefäß von blaugrauem Thon mit drei kleinen Füßen, nur zur Hälfte vorhanden;
3) ein hoher, enger Krug von festem, weißem Thon mit einer weißgelblichen Glasur;


|
Seite 82 |




|
4) ein Paar eiserne Sporen mit sehr kunstreich gearbeiteten Rädern;
5) ein schlichter eiserner Steigbügel;
6) ein eisernes Hufeisen;
7) eine eiserne Pflugschaar;
8) ein eisernes Deichselgehenk, wahrscheinlich zu dem Pfluge gehörig;
9) ein kleiner eiserner Kesselhaken, und viele andere werthlose Gegenstände, wie Maueranker, Klammern u. s. w.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.
Eine zinnerne Altarflasche.
Durch Vermittelung des Herrn Apothekers von Santen zu Cröpelin ist eine zinnerne Weinflasche erworben, welche wohl zum Altargebrauche bestimmt gewesen ist. Die Flasche ist viereckig, 8 " hoch, 4 1/2" breit, mit einem Schraubenstöpsel. Auf jeder Seite ist ein Evangelist, sitzend und schreibend, eingravirt; über jedem Bilde steht der Name. auf dem Fußrande ist eingegraben:
Ein gothisches Thürmchen
von vergoldetem Kupfer, in 4 Stücken, im Ganzen etwa 1 Fuß hoch, wie die Krönung eines gothischen Stuhlpfeilers, wahrscheinlich aber die Spitze eines Sacramenthäusleins oder Kelchschreins oder einer Monstranz; der mittlere Haupttheil ist wie ein Kelchfuß gestaltet, hat, wie dieser gewöhnlich, 6 Knöpfe, auf denen die Buchstaben ıhesus stehen; gefunden auf einer wüsten Dorfstätte zwischen Boitin und Witzin bei Sternberg und geschenkt vom Gymnasiasten Zarnekow aus Witzin zu Wismar.



|



|
|
:
|
Holzformen von Malchin.
Beim Abbruch des alten Rathhauses zu Malchin im J. 1841 ward in dem noch im Spitzbogen gewölbten Keller desselben ein auf einer Seite mit eingeschnittenen Formen bedecktes Brett gefunden, welches durch Geschenk des Herrn Rectors Bülch in Malchin in den Besitz des Vereins gekommen ist. Das Brett ist 1 1/4" dick, 2' 4" lang und 8" breit. Links ist der ganzen Länge nach ein Stück abgebrochen, welches jetzt nicht aufzufinden gewesen ist; es muß das Stück aber schon zur Zeit, als das Brett verloren ging, abgebrochen gewesen


|
Seite 83 |




|
sein, da auf der Bruchseite verschiedenfarbige Wachstheile, mit denen die Formen ausgedrückt wurden, kleben. Sonst ist das Brett auf allen übrigen Seiten gehobelt und an beiden Enden stark wurmstichig und von dem Ansehen eines sehr hohen Alters. Der Bruch geht der Länge nach mitten durch mehrere Formen, welche bei der Aufzählung als vollständig mitgerechnet werden sollen.
Das Brett enthält 42 Formen, welche dicht neben einander stehen und von oben nach unten hin immer kleiner werden; alle sind rund und die größten 3 1/2", die kleinsten 1 1/2" im Durchmesser. Sie sind nach Art, Größe und Tiefe der Siegel des 14. Jahrhunderts geschnitten, jedoch nicht zu Siegeln gebraucht worden, da keine einzige Umschrift vorhanden ist; der Rand ist bei allen mit kleinen halbrunden Stichen ausgestochen. Auch sind nur wenige Wappen unter den Formen. Die Formen haben dazu gedient, Reliefbilder zu Verzierungen abzudrücken; in vielen sitzen noch Reste von den Massen, mit denen abgeformt ward, in den größern von grünem, in den mittlern von rothem Wachs, in einigen kleinern von ungefärbtem Harz. Alle Formen sind kräftig und schön geschnitten, gehören wohl der bessern Zeit der Holzsculptur an, und fallen wahrscheinlich in das 15. Jahrh. oder doch in den Anfang des 16. Jahrhunderts.
Die Gegenstände der Darstellung sind theils Wappen, theils Naturbilder, theils architektonische Ornamente.
Die Wappen, fast alle im größten, nur einige im mittlern Durchmesser, sind: das kursächsische Wappen, längs getheilt: links 8 mal schrägerechts gestreift mit der Rautenkrone, rechts die beiden gekreuzten Kurschwerter auf quergetheiltem Schilde; - zwei Male der pommersche Greif; - der doppelte Reichsadler; - das Wappen der Stadt Nürnberg, längs getheilt: rechts ein halber Doppeladler, links 8 mal schrägerechts gestreift; ein einfacher Adler. Vielleicht gehören noch zu den Wappen: eine heraldische Lilie, der Stadt Demmin, und ein sechsstrahliger Stern, der Stadt Perleberg, beide sehr ausdrucksvoll geschnitten; - ferner: eine gekrönte, zweigeschwänzte Meerjungfer, das Druckerzeichen des Dr. Nicolaus Marschalcus Thurius, ganz wie Jahrb. IV, Lithogr. Tab. III, Nr. 5, welche auch im Wappen der nürnberger Patricierfamilie Rietter und sonst vorkommt; - endlich Reste eines Pfauenwedels u. dgl.
Die Naturbilder sind z. B. ein Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blute ätzt; - ein Bär, ein Hund, ein


|
Seite 84 |




|
Hase, ein fliegender Adler, ein Pfau, ein Fasan, ein Kranich, zwei unbestimmte Blumenstöcke, ein Rosenstock, ein Vergißmeinnicht, zwei Trauben, eine Eichel.
Die symbolischen Darstellungen und architektonischen Ornamente sind: eine Darstellung der Versuchung Christi in der Wüste (?), eine flammende Sonne, zwei Seraphinenköpfe, zwei Widderköpfe, fünf Rosetten aus Perlen gebildet.
Aus der Aufnahme der gekrönten Meerjungfer in die Reihe der Darstellungen könnte man schließen, daß die Formen von dem Holzschneider Melchior (Schwarzenberg) herrühren, welcher in dem ersten Viertheil des 16. Jahrh. für Marschalk und Dietz zu Rostock arbeitete (vgl. Jahrb. IV, S. 108 flgd.).
G. C. F. Lisch.
Ein kleines eisernes Messer,
gefunden auf der Feldmark Warkstorf bei Wismar, von dem Herrn Dr. Gertz durch den Herrn Dr. Burmeister zu Wismar geschenkt.
Ein Sporn und ein Nagel von Messing,
letzterer 4 " lang, beide gefunden zu Parchim im Bette der Elde, beim Abbruch der alten Lohmühle, geschenkt vom Herrn Dr. Beyer zu Parchim.
Ein Beschlag von Messing,
in Gestalt eines graden Streifens, 4 " lang, 3/4" breit, mit Reliefverzierungen, geschenkt vom Herrn Bildhauer Petterss zu Schwerin.
Sechs mittelalterliche Pfeile aus Bamberg,
von dem historischen Vereine für Oberfranken zu Bamberg mit einem gedruckten Begleitschreiben eingesandt, welches hier im Auszuge folgt.
"Der Ausschuß des historischen Vereins dahier hat das Vergnügen, dem verehrlichen Vereine sechs Pfeile aus dem fünfzehnten Jahrhunderte, welche die hiesige Stadtkämmerei am 20. October dieses Jahres versteigern ließ, als Andenken an Bamberg zur Vermehrung der jenseitigen Sammlung mit folgenden Nachrichten zu senden:
Gegen 20,000 der beiliegenden Pfeile, von welchen bereits in mehreren Blättern erwähnt wurde,


|
Seite 85 |




|
sind im Sommer dieses Jahres bei Aufräumung eines Kellergewölbes in der bamberger Stadtkämmerei gefunden worden. Das Merkwürdigste daran mögen wohl die befiederten Schafte sein. Ueber dieselben einige historische Notizen zu erfahren, wird dem verehrlichen Vereine willkommen sein, indem diese Auszüge aus städtischen Acten genommen sind, von welchen früher nur wenige durch den Druck bekannt wurden.
Im Jahre 1435 empörten sich die Bewohner der Stadt Bamberg gegen ihren Fürstbischof Anton von Rotenhan, welcher Alles aufbot, die kaiserlichen und päpstlichen Rechte und Privilegien für das Aufblühen der Stadt zu unterdrücken. Die vorzüglichsten Anführer des Aufstandes waren selbst Rathsherren, und gehörten den bürgerlich=edlen Familien der Tockler, Lorber, Zollner, Haller, Oertlein, Wetzel, Lautenschlager und Schick an. Der Tumult nahm so sehr überhand, daß die Abtei Michelsberg und mehrere Domherrenhöfe geplündert wurden, und die höhere Geistlichkeit mit dem Bischofe die Stadt verlassen mußte. - -
Nur durch päpstliche und kaiserliche Einwirkung wurde die Stadt zum Nachgeben bewogen. Es vergingen jedoch einige Monate, bis dieses geschah. Während dieser Zeit schaffte die städtische Behörde bedeutende Vorräthe von Wurfgeschossen, Pulver, Blei und Pfeilen an. In keiner städtischen Rechnung kommen so viele Ausgaben für Anschaffung von Waffenvorrath vor, als in der vom Jahre 1435. Unter andern heißt es:
6 fl. - dem Pfeilsticker an Viti, dem Büchsenmeister Ulrich Straßmeier eod. die. (bezahlt).
6 fl. den Pfeilstickern, an Petri P.
4 fl. - dem Conz Ortlein für Bley in Kugeln zu gießen.
80 Groschen dem Niklasen Dorn Büchsenmeister. fer. 2. p. Kil.
6 Gr. für Bley dem Cons Ortlein.
310
für 50
Fleisch den Söldnern auf dem Münchberg in der Raiß (Krieg).
8 fl. - dem Ulrich Cymont Büchsenmeister zu Lohn, an Magdalene.
3 fl. - dem Ulrich N. N. Pfeilschmied.
283
Fritzen Gloncker für Wein und Brod dargeliehen, als man den Turm einnam auf dem Münchberg.
9 1/2 fl. - dem Ulrich Pfeilsticker aber (abermals) an 6000 Pfeile.
Item 6000 Pfeile angeschaftet, 2000 abgestabet, 2000 gefiedert.


|
Seite 86 |




|
23 fl. - Meister Hans Pricken, Büchsenmeister für Büchsenpulver, Bleykugeln, Pfeile und um Wein den Gesellen zum vertrinken.
70Fritzen Erbeiter jüngeren für 4 Ztr. Bley zu Kugel und anderer Nothdurft.
110 Groschen für eine Büchsen, die Conz Ortlein in ein Laden von Fritz Erbeiter genommen hat.
Peter Stan, Kandelgießer des Huenkramers, giebt in der Reise Bley zu Kugeln.
8 fl. 10Seitz Büchsenmeister an der eisernen Büchsen, die die Stadt vmb ihn kauft hat
4 fl. - Seitz Büchsenmeister auf 1/4 Jahr Sold.
39 fl. 13 Schill. für 3 Ztr. 13Salpeter.
4 fl. 2für 1 Ztr 10
Schwefel.
11 fl. - für 4 Armbrüst, ein Senn und Schlüssel, die Fritz Zollner in der Reise der Stadt kauft hat.
20 Gr. für einen alten Mühlstein zu Büchsensteinen.
Dem Seitz Büchsenmeister 12 fl. Jahreslohn.
Da es zu keinem förmlichen Gefechte gekommen, sondern die Stadt dem Fürstbischofe sich wieder unterworfen hatte, so ist alle Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß diese Pfeile dem Jahre 1435 angehören."
II. Münzen und Medaillen.
Nach dem vorigjährigen Berichte bestand der Münzvorrath aus 3336 Stücken, die sehr zahlreichen Dubletten mit eingerechnet; mit diesen ist er jetzt zu 3859 angewachsen und besteht aus 539 Hohlmünzen, 17 goldenen, 2527 silbernen, 654 kupfernen Münzen und 131 Medaillen und Schaupfennigen mancherlei Art.
Von den hinzugekommenen 523 Stücken, unter denen sich nur wenige Dubletten befinden, sind 77 angekauft worden, unter diesen 47 meklenburgische und norddeutsche aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts, aus einem Funde bei Goldberg; die übrigen sind dem Vereine als Geschenke geworden. Einzelne zum Theil sehr werthvolle Münzen schenkten die Herren Facklam, Hofkellermeister Wöhler, Kaufmann Zegelin, Kammerlakai Müller, Schloßküster Putzky, Hausvogt Jantzen in Schwerin; die Pastoren Kehrhahn in Döbbersen, Ritter in Wittenburg, Nahmmacher in Peccatel; Boldt in Bützow; Rector Dehn in Brüel; Apotheker Stockfisch in Zarrentin; Präpositus Prahst in Kloster Malchow; Gymnasiallehrer Masch in Neu=ruppin; Epffenhausen in Hamburg (worunter mehrere sehr alte portugiesische Münzen von K. Sebastian und Philipp); Dr. Beyer in Parchim; von Kardorf auf Remlin; Rector


|
Seite 87 |




|
Bülch in Malchin; Klosterhauptmann B. Lefort (polnische Münzen aus dem 17. Jahrhundert); Amtsverwalter Zur Nedden in Ribnitz; Consistorialrath Dr. Diemer in Rostock; v. Dewitz auf Kölpin; Baron von Maltzahn auf Kl. Lukow; Landdrost von Wrisberg in Gadebusch; Hauptmann von Maydell in Sternberg; von Berg auf Neuenkirchen; Professor M. Crain in Wismar; Geh. Amtsrath Koch in Sülz; eine Sammlung von 276 neueren Münzen, sowohl deutschen als außerdeutschen, unter denen auch der Ducaten aus der letzten polnischen Revolution (Blätter für Münzkunde I, Tab. 14, Nr. 159) sich befand, schenkte der Herr Baron von Maltzahn auf Peutsch. Die Sammlung der einheimischen Münzen ist verhältnißmäßig am wenigsten vermehrt, aber die Münzsysteme der meisten Staaten Europas sind, wenn freilich hin und wieder erst in einzelnen Stücken, zur Anschauung gebracht, und die Sammlung wird in sich immer mehr, besonders in Hinsicht auf die Scheidemünzen, abgerundet. Manche Staaten, besonders die, welche uns am nächsten liegen und deren Münzen sich hier Geltung verschafft hatten, z. B. die Hansestädte, Pommern und Dänemark, geben bereits einen ziemlich vollständigen Ueberblick.
Das Einzelne, was gewonnen ward und das oft erst durch die Verbindung, in welcher es zu dem bereits Vorhandenen steht, seine völlige Bedeutung erhält, aufzuzählen, scheint nicht erforderlich zu sein, es mag die Angabe genügen, daß von etwa 90 verschiedenen Ländern und Städten sowohl ältere wie neuere und neueste Münzen eingelegt werden konnten. -
Merkwürdig durch den Umstand, daß sie in Meklenburg gefunden wurden, sind zwei römische Münzen, welche die Sammlung erhielt. Die erste (ein Geschenk des Herrn Dr. Beyer in Parchim) wurde im Holze bei Hagen bei Goldberg von Tagelöhnern beim Holzroden gefunden und ist leider zerbrochen worden; sie ist ein bekannter (Molan. Boehmer. I, p. 145, 2) Denar des K. Decius (249 - 251 p. Chr.) und hat auf der Hauptseite das mit einer Strahlenkrone gekrönte Brustbild mit der Umschrift: IMP CN M Q TRAIANVS DECIVS AVG und auf der Rückseite unter VBERITAS AVG eine weibliche Figur, welche in der Rechten einen Geldbeutel und in der Linken ein Füllhorn hält. - Die zweite Münze ist ein Denar des K. Commodus (183 p. Chr.), vom Herrn Pageninformator Dehn in Schwerin geschenkt und unfern Brüel beim Bau der Chaussee gefunden. Auf der Hauptseite ist das Brustbild mit der Umschrift: M COMM ANT P FEL AVG BRIT, auf der Rückseite ist eine weibliche Figur, welche in der


|
Seite 88 |




|
Rechten einen Zweig hält und mit der Linken an einen Baum sich stützt. Die Umschrift: HILARITAS . . . TR P VIII CO VI 1 ).
Von einem sehr ansehnlichen Bracteatenfunde (die Masse soll etwa 1/2 Cubikfuß betragen haben), der bei Stintenburg gemacht ward, erhielt die Sammlung 12 Exemplare, 3 durch Herrn Smith von Niendorf und 9 durch die Vermittelung Sr. Exc. des Herrn Geheimeraths=Präsidenten von Lützow. Diese Bracteaten, aus dem Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrh. (Größe nach Mader 12, Schwere 10 - 13 Aß), sind kräftig und deutlich in ihren Figuren, aus einem stärkeren Bleche geschlagen, theils mit glattem, theils mit geperltem Rande. Die meisten von denen, die zu uns gekommen, (8,) sind Städte=Münzen, auf welchen entweder ein Thurm mit Kugeln, statt der Zinnen, begleitet von Sternen oder Kugeln auf einem spitzen Giebel steht, oder auch 2 Thürme auf einem Rundbogen stehen, in welchem bei dem einen eine unten gestümmelte Lilie (Demmin?), bei einem andern ein Mühleisen (Hameln?) erscheint. Die übrigen 4 haben in einem geperlten Rande ein vorwärts gekehrtes Brustbild mit offner Krone. Alle haben keine Umschrift.
Demern, den 10. Julius 1843.
G. M. C. Masch.
III. Siegel.
Herr Baron A. von Maltzahn auf Peutsch schenkte ferner (vgl. Jahresber. VII, S. 55) die abgedrückten Siegel der Städte: Neubuckow, Bützow, Cröpelin, Krakow, Lage, Malchow, Marlow, Sülz, Tessin, Waren, Warin, Wesenberg und Woldeck.
IV. Zeichnungen.
1) Zeichnung von mehreren in der Priegnitz gefundenen Alterthümern, vom Herrn Gymnasiallehrer Masch zu Neu=Ruppin.
2) Zeichnung von dem großen Reitersiegel des Grafen Otto von Fürstenberg (von Dewitz) nach einer Original=Urkunde der Kirche zu Neubrandenburg vom J. 1353, durch Vermittelung des Herrn Pastors Boll zu Neubrandenburg.
3) Eine lithographirte Tafel mit den Siegeln des schweriner Bischofs Hermann II. Maltzahn, aus Lisch Urkunden=Sammlung zur Geschichte des Geschlechts von Maltzahn Bd. I, in einer Auflage für den achten Band der Jahrbücher vom Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch geschenkt.


|
Seite 89 |




|
C. Naturhistorische Sammlung
Ein fossiler Elephantenzahn,
gefunden 1843 zu Liepen, Kloster=Amts Malchow, 2 bis 3 Fuß tief unter der Erdoberfläche in einer Mergelgrube auf der Hufe des Erbzinsmanns Heimburg, nicht weit vom Hohen=Wangeliner=See, eingereicht vom Herrn Klosterhauptmann von Borck, zu Kloster=Malchow. Nach der Bestimmung des Herrn Professors Stannius zu Rostock gehört dieser Zahn, 5 " lang, 4 " breit, 2 " dick, einer untergegangenen Art von Elephanten an; die Species des Thieres genau zu bestimmen dürfte aber nach diesem isolirten Bruchstücke nicht möglich sein. Offenbar aber gehörte der Zahn einem sehr jungen Thiere an. In Rostock werden übrigens noch andere fossile Elephantenzähne, welche zum Theil in Meklenburg gefunden sind, aufbewahrt.
Zähne eines Wisent.
Aus Düssin, ritterschaftlichen Amts Wittenburg, wurden mir 4 Zähne eines Wisent (Auerochsen) gebracht, welche dort in einer Wiese beim Ausroden eines Busches gefunden worden, mit dem Beifügen, man habe nicht weiter gegraben, sondern wünsche, daß ich selbst einmal die Stelle weiter untersuchen möchte. Im Anfang dieses Monats begab ich mich dahin und bezeichnete man mir die Stelle auf einer moorigen Fläche am sukower Wege, die dem dortigen Gutsjäger zugetheilt ist. Wahrscheinlich ist dort das ganze Thier versunken und werden sich die übrigen Knochenreste noch daselbst finden; eine Untersuchung war aber jetzt nicht möglich, da der Ort bestellt war. - Zugleich erhielt ich hier einen Wisentzahn, der auf dem höher liegenden Acker gefunden und dem Ansehen nach von einem jungen Thiere ist.
Wittenburg, im Julius 1842.
J. Ritter.
Ein Stück Braunkohle
mit sichtbaren Holzfasern, von rundlicher Gestalt, von der Größe einer kleinen Melone, gefunden 36 Fuß tief in einer Mergelgrube zu Sukow bei Marnitz, geschenkt von dem Herrn Candidaten Paschen daselbst.
Ein Feuerstein
von der Gestalt einer Rübe mit einer an dem stumpfen Ende sitzenden großen sogenannten Kamm=Muschel, gefunden zu Panzow bei Neubuckow auf dem Felde, geschenkt vom Herrn von Winterfeld zu Döbbersen.


|
Seite 90 |




|
Versteinerungen
verschiedener Art aus der Gegend von Zarrentin, geschenkt vom Herrn Apotheker Stockfisch daselbst.
D. Gesammelte Nachrichten von Alter=
thümern aller Art.
I.
Nachrichten von heidnischen
Gräbern und andern
historisch=merkwürdigen Stätten.



|



|
|
|
Steinkiste von Sagel.
Auf einer der Höhen der Feldmark Sagel bei Rothenmoor steht eine Steinkiste oder ein Steinhaus aus 5 starken Granitblöcken, welche an 3 Fuß aus der Erde hervorragten; einige Steine waren ausgewichen und der Deckstein herabgeglitten. Der Herr Baron A. von Maltzahn auf Peutsch öffnete dieselbe, um sie wieder aufzurichten, und fand darin 2 kleine Kinderskelette, jedoch nichts weiter. Das eine Skelett gehörte einem Kinde von ungefähr 10, das andere einem Kinde von ungefähr 5 Jahren; die aus den Näthen gegangenen Schädel waren durch den Druck der zum Boden geneigten Steine in mehrern Beinen rechtwinklig gebogen. Einige Knochen deuteten darauf hin, daß die Kiste noch den Leichnam eines dritten, ganz jungen Kindes aufgenommen habe.
Das Hünengrab beim Plaatzer=Kruge,
Amts Güstrow, eine Steinkammer, deren gewaltiger Deckstein auf acht hohen Steinpfeilern ruht, ist abgebildet in Wächter's Statistik der im Königreiche Hannover vorhandenen heidnischen Denkmäler, Hannover 1841, Tab. VII
Kegelgrab von Satow (bei Neu=Bukow) 1 )
In einem niedrigen Kegelgrabe fand sich in einer kleinen Steinkiste eine zerbrochene Urne und in derselben ein zerbrochenes kleines Messer von Bronze und eine verbogene und zer=


|
Seite 91 |




|
brochene Nadel von Bronze, ungefähr 9 " lang, unter dem kleinen Knopfe in 3 1/2 Windungen von Golddrath von der Dicke des Drathes der Spiralfingerringe umwunden. Der Fund, von dem Herrn Pastor Vortisch zu Satow eingesandt, ist in die großherzogliche Alterthümersammlung gegangen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Börzow.
Dicht vor Börzow bei Grevismühlen am Ende der Tannen, welche vor dem Dorfe an dem Wege von Grevismühlen nach Schönberg liegen, steht rechts am Wege ein weiter, abgegrabener Sandhügel. Als dieser im J. 1841 zur Wegebesserung nach und nach abgegraben werden sollte, fand man ein menschliches Gerippe. Es ward daher eine Untersuchung eingeleitet; da sich aber bei dem Gerippe viele heidnische Urnenscherben fanden, so ward von dem großherzogl. Domanial=Amte zu Grevismühlen nur die weitere Arbeit untersagt und von dem Funde Anzeige an das großherzogliche Alterthums=Cabinet gemacht. Im Sommer 1842 untersuchte der Unterzeichnete daher die Stelle und leitete die erforderlichen Nachgrabungen.
Die Stelle erwies sich als der letzte, kleine Rest eines Wendenkirchhofes. Nach Aussagen der Dorfbewohner war der einige Fuß hohe Sandrücken früher über den jetzigen ganzen, breiten Weg gegangen; seit vielen Jahren war er nach und nach ausgegraben, um den Weg, der früher umher gegangen war, grade zu legen und zu ebenen, und man hatte dabei immer sehr viele Urnenscherben gefunden; man war dabei bis unter die Standfläche der Urnen gekommen, so daß im Wege nichts mehr zu erwarten stand. In dem noch stehenden, auf der Oberfläche sichtbar etwas erhöheten "Ufer" standen nun die Urnen in zwei Schichten über einander; die Urnen in der obern Schicht waren zertrümmert, die in der untern Schicht standen noch in ihrer Form im festen Sande, waren jedoch so stark gerissen, daß nur eine ganz gerettet werden, mehrere jedoch in ihren Formen erkannt werden konnten. Im Ganzen mag wohl noch der Standpunct von 2 Dutzend Urnen erkannt worden sein.
Der Charakter des Begräbnißplatzes war der eines Wendenkirchhofes, wie sie bisher im westlichen Meklenburg (im Obotritenlande) in neuern Zeiten häufiger beobachtet sind; er gleicht in allen Stücken dem Wendenkirchhofe von Camin bei Wittenburg (vgl. Jahresber. II, S. 53). Die Urnen


|
Seite 92 |




|
sind gewöhnlich groß und weit, obgleich sich auch, wie zu Camin, einige kleinere Gefäße fanden, dunkel, oft mit schwarzem Ueberzuge versehen und mit den bekannten Punctlinien verziert. Die Geräthe bestehen vorherrschend aus Eisen und Bronze. Dieser Wendenkirchhof ist von den bisher beobachteten der nördlichste und die Verbreitung dieser Art von Wendenkirchhöfen läßt sich jetzt durch das Dreieck zwischen Sternberg (Gägelow), Grevismühlen (Börzow) und Lübtheen (Pritzier und Leussow) bestimmen.
Der Fund von Börzow hat folgendes geliefert:
eine fast ganz erhaltene, große, weite, dunkelbraune Urne mit mäanderförmigen Verzierungen von Punctlinien, wie Frid. Tranc. Tab. XXXIV, Fig. 6;
eine kleine, schwarze Urne mit Zickzacklinien um den Bauchrand verziert und mehrere Fragmente von ähnlichen Urnen, welche noch die Gestalt erkennen lassen;
ein eisernes Beil, ganz wie Frid. Franc. Tab. VII, Fig. 4, durch dessen Stielloch eine kleine eiserne Lanzenspitze gesteckt ist, welche darin festgerostet ist;
zwei Hefteln von Bronze und eine gleiche eiserne Heftel, wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13;
eine viereckige Schnalle von Eisen;
drei gewöhnliche eiserne Messer, welche hölzerne Griffe gehabt hatten;
zwei eiserne Sicheln, wie Frid. Franc. Tab. XVII, Fig. 12;
mehrere fast ganz zu Kügelchen zerschmolzene Geräte von Bronze, namentlich ein Gefäß von ganz dünnem Bronzeblech, siebartig von kleinern Löchern durchschlagen, und ein stärkeres, fingerbreites Band. Auf einige nicht geschmolzene Stücke dieses Bandes ist noch wohl erhaltene weiße Leinwand gerostet, welche sehr lose gewebt und nicht zusammengeschlagen ist, so daß dem Weber der Kamm gefehlt zu haben scheint.
Das Interessante bei der Aufgrabung war, daß sich unmittelbar neben den Urnen am Rande des Begräbnißplatzes, in derselben Tiefe, noch ein altes menschliches Gerippe, außer dem oben erwähnten, fand, so daß sich auch hier die Erfahrung, wie auf dem Wendenkirchhofe von Helm (vgl. Jahresber. IV, S. 46), bestätigte, daß in der ersten Zeit des Christenthums die alten Bewohner ihre Todten, wahrscheinlich heimlich, aus Anhänglichkeit auf den alten heidnischen Begräbnißplätzen unverbrannt beisetzten. Nicht weit davon, ebenfalls am Rande des Begräbnißplatzes nach


|
Seite 93 |




|
dem Dorfe hin, fand sich eine große, wahrscheinlich gemeinschaftliche Brandstätte mit vieler schwarzer Kohlenerde und Asche.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Vellahn.
Es ward mir gemeldet, ein Büdner zu Vellahn habe auf seinem Acker viele Urnen ausgegraben, von denen einige erhalten seien. Um sie wo möglich zu retten und genauere Kunde über den Ort und die näheren Verhältnisse des Fundes zu erhalten, begab ich mich dahin, traf aber den Büdner nicht zu Hause; indeß erfuhr ich, daß der Ort, wo er sie gefunden, der sandige südliche Abhang des Kreuzberges sei, östlich vom Dorfe in der Richtung nach der wittenburg=vellahner Chaussee; nur zwei Urnen unter vielen waren gerettet: die eine hatte der Herr Pastor Tarnow erhalten, war aber später zerbrochen; die andere, angefüllt mit Knochen und einem kupfernen Geräthe, hatte der Herr Kreischirurgus Pfeiffer an sich genommen, aber später dem Herrn Kreisphysicus Sanitätsrath Richter zu Boizenburg übergeben. Der Herr Kreischirurgus Pfeiffer versprach mir, im Herbste, wenn der Büdner auf dem jetzt bestellten Acker weiter nach Steinen graben und Urnen finden würde, sie für den Verein sorgfältig zu bewahren.
Wittenburg, im Julius 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Warlitz.
Auf dem Wege von Pätow nach Warlitz, in den Tannen bei Warlitz, ist ein großer Wendenkirchhof. Bei Ebenlegung des Weges, der über denselben führt, sind einige hundert Urnen zertrümmert.
Wittenburg, 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Gräber im südöstlichen Meklenburg.
Im südöstlichen Meklenburg finden sich äußerst viele Gräber, besonders aber sind reich:
1) die Feldmarken von Gr. und Kl. Dratow,
2) die Feldmark von Vielist,
3) die Feldmark von Sommersdorf, auf denen sich zahllose Kegelgräber, sehr viele schon unter Ackercultur, finden.
4) Die Gegend von Kelle bei Röbel, namentlich zwischen Kelle, der Schamper=Mühle und Röbel, ist sehr reich an Hünengräbern und Kegelgräbern, die sich bis vor die Stadt Röbel hinziehen. Bei der Schamper=Mühle liegt ein schönes Kegelgrab und bei Sietow ein schönes Hünengrab.


|
Seite 94 |




|
5) Auf der Feldmark Carow bei Plau sind mehrere Gräber, namentlich ein großes Kegelgrab und im Holze, Damerow gegenüber, zwei bedeutende Riesenbetten; gegenüber auf der Feldmark Damerow sind auch sehr große Riesenbetten.
6) Auf der Feldmark Serrahn bei Krakow finden sich viele klar ausgeprägte Gräber.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Burgstellen im dümmerschen See.
Am 14. d. M. begab ich mich in Begleitung der Herren Pastor Kehrhahn, Pastor Seidel und von Winterfeld nach dem dümmerschen See, der seit etwa 5 Wochen bedeutend abgelassen ist und etwa 5 Fuß an seiner Wasserfläche verloren hat. In diesem See, geht die Sage, sei eine Stadt 1 ) versunken und die höchste Stelle, der Schloßberg genannt, zeige zwischen dem Rohre, womit er bewachsen, noch die Trümmer der Burg. Dieser Schloßberg war jetzt bei dem niedrigen Wasserstande sichtbar geworden und wir begaben uns zu Kahn dahin, um die Localität genauer zu untersuchen. Die Stelle liegt in der Richtung zwischen Kowahl und dem südlichen Ende des Dorfes Dümmer, einige hundert Schritte von dem Ufer des letzteren Dorfes entfernt. Als wir durch das Rohr hindurch gefahren waren, betraten wir den Schloßberg, der kaum 1 Fuß über das Wasser hervorragt in einer Länge von 14 Schritten und einer Breite von 9 Schritten. Auf dieser Spitze, die sich kegelförmig in die Tiefe des Sees hinab abrundet (welche Tiefe nach Aussage der Fischer einige 40 Fuß beträgt), stehen noch mehrere starke eichene Pfähle, früher vom Wasser bedeckt, jetzt etwa 3 Fuß hoch hervorragend. Diese Pfähle bilden 2 Vierecke und haben wahrscheinlich das eigentliche Haus (die Burg) getragen. Die Oberfläche war mit Feldsteinen von mittlerer Größe bedeckt, zwischen denen auch Stücke von alten Ziegelsteinen lagen. Unter diesen Trümmern fanden wir Scherben von alten irdenen Töpfen, welche drei verschiedenen Gefäßen angehörten. Die Scherben des einen sind aus blaugrauem Thone, wie sie an andern mittelalterlichen Burgstellen gefunden sind; die der beiden andern haben die gewöhnliche rothbraune Farbe: das eine
Mitteilung des Herrn Archivars Lisch.


|
Seite 95 |




|
Gefäß hatte einen dicken Rand mit darunter laufenden horizontalen Linien, das andere einen dünnen stark gebogenen Rand. Geich bei Ablassung des Wassers soll hier auch ein Porcellan=Gefäß gefunden sein, welches der Jäger zu Perlin wieder herbei zu schaffen versprach. Etwa 80 Schritte von dem Schloßberge ragen in der Richtung nach dem Ufer 4 eichene Pföste ebenfalls 3 Fuß hoch aus dem Wasser empor, gerade so weit von einander entfernt, daß sie eine Zugbrücke getragen zu haben scheinen. Bis dahin wäre dann vom Lande her ein Damm gewesen, wovon aber jede weitere Spur verschwunden ist. - Auch die Pfähle dürften bald alle verschwinden, da die Fischer einen derselben schon ausgebrochen hatten.
Ein zweites Pfahlwerk befindet sich nahe am Ufer etwa gegen die Mitte des Dorfes Dümmer, aber sehr weit von dem Schloßberge, so daß es keinen Zusammenhang damit gehabt haben kann. Es umschließt einen runden Platz, der vielleicht auch eine kleine Burg getragen hat. Hierüber existirt keine Sage.
Eine dritte Stelle im dümmerschen See am westlichen Ufer scheint ebenfalls eine alte Burgstelle zu sein. Vor Ablassung des Wassers war es eine Insel von etwa 80 Schritt Länge und 40 Schritt Breite, mit Ellern bewachsen; jetzt hängt sie mit dem Lande nahe an der perliner Grenze zusammen. Bis in jüngster Zeit war Streit darüber, ob diese Stelle zu Perlin oder zum Domanium, gehöre. Auf diesem Platze trocknen die Fischer ihre Netze unter den Bäumen; der See umher ist sogleich ziemlich tief; auch fanden sich hin und wieder Stücke alter Mauersteine. Doch weiß man in der Gegend nichts davon, daß hier eine Burg oder ein Haus gestanden habe; die Insel trägt nur den Namen: der kleine Werder.
Wittenburg, im September 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Burgstelle von Lehsen.
Einige hundert Schritte seitwärts von dem Dorfe liegt die alte Burgstelle von Lehsen, nahe am Bache, wohin früher ein Steindamm ungefähr von dem jetzigen Holländerhause führte, der aber jetzt einige Fuß unter dem erhöheten Boden liegt und wovon man viele Steine ausgebrochen hat. Die Burgstelle ist jetzt mit starken Buchen und anderem Gebüsch dicht bewachsen, hat oben eine Höhe von etwa 24 Fuß und in der Grundfläche einen Durchmesser von etwas über 7 Ruthen. Die


|
Seite 96 |




|
Form ist ganz rund und kegelförmig. Auf der Oberfläche finden sich Stücke von alten Ziegelsteinen, besonders von den starken, schmalen und sehr gebogenen Dachpfannen, Kalkschutt und Feldsteine. Besonders war vieles dieser Art aus einem Fuchsbau hervorgescharrt, worunter ich ein Stück Rüsternholz (1 3/4 Pfd. schwer) fand, so von Eisenoxyd durchdrungen, daß es zu Stein verhärtet ist, weshalb ich vermuthe, daß unter dem Schutte noch viele Eisengeräthe liegen mögen. - Um die Burg ist noch ein Graben von ungefähr 24 Fuß Breite. Vor einigen Jahren ließ Herr von Laffert diesen Graben ausmodden, und bei dieser Gelegenheit wurden in dem Graben eine eiserne Kugel, die aber verloren gegangen, und ein Grapen mit 3 Füßen von Bronze gefunden, der seitdem zum Theerkochen gebraucht ist. - Außerhalb des Grabens ist noch ein Wall von fast 3 Ruthen Breite in der Basis und etwa 6 Fuß Höhe über dem Wasser; er umgiebt die Burg noch zur Hälfte gegen die Wiesen an der südlichen und westlichen Seite; auf der andern Hälfte ist er abgetragen und mit dem Acker gleich.
Wittenburg, 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Der Burgwall von Klein=Lukow
bei Grubenhagen (nicht bei Penzlin, vgl. Jahresber. IV, S. 93) ist von bedeutender Ausdehnung und Höhe, und weithin sichtbar. Es ist wahrscheinlich weder eine wendische Burgstelle, da er nicht unmittelbar von Moor umgeben ist, noch ein mittelalterlicher Burgwall, da er eine ungewöhnlich große Ausdehnung hat. Er liegt am Rande eines Gehölzes, an einer Seite von Ackerland, an der andern von Bruch umgeben und am Rande von einem Walle umgürtet, der, in der Gestalt eines Oblongums oder einer Ellipse, auf der Höhe einen Umfang von 350 Schritten hat. Nach der Ackerlandseite laufen von den Enden nach einem kleinen Teiche ("Augangssee") zwei kleinere Wälle in die Tiefe hinab, deren Entfernung von einander 125 Schritte beträgt. Er gleicht dem Burgwalle von Sagel bei Rothenmoor (vgl. Jahresber. IV, S. 92) und scheint den Charakter des Burgwalles in der hohen Waldung bei Ilow (vgl. Jahresber. VII, S. 167) zu haben. Die Bestimmung der Zeit dieser großen, waldbewachsenen Wälle muß einem glücklichen Funde oder einer Nachgrabung vorbehalten bleiben.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 97 |




|



|



|
|
:
|
II.
Nachrichten über
mittelalterliche Kirchen und
andere Bauwerke.
Der Dom zu Güstrow.
Die Kirche des Collegiat=Stiftes zu Güstrow 1 ) ist für die Geschichte der Baukunst in Meklenburg von Wichtigkeit, da die Zeit der Erbauung (1226) bekannt ist und der Bau in die letzte Zeit der Uebergangsperiode fällt; wahrscheinlich ist sie die letzte Kirche, welche noch Spuren des Rundbogenstyls enthält. Sie schließt sich zunächst an die Kirche zu Neukloster.
Die Kirche ist durch Anbaue und Umbauungen sehr verunstaltet, und es hält schwer, ihre ursprüngliche Gestalt zu erkennen. Sie ist eine Kreuzkirche und hatte ursprünglich im Chor zwei, im Schiffe zwei, in jedem Kreuzschiffe ein und im Mitteltheile ein Gewölbe. Charakteristisch für den ganzen Bau sind zunächst Gestalt und Stellung der Fenster: die Fenster sind nämlich im Uebergangsstyl gebaut, sehr eng, ziemlich hoch, ohne Gliederung schräge eingehend und fast unmerklich spitz gewölbt; es stehen ihrer an jeder Seite eines Gewölbes immer drei neben einander, von denen das mittlere höher ist, als die andern beiden 2 ). Auf diese Weise sind der Chor und die beiden Seitenschiffe ausgestattet. Das Schiff hat an jeder Seite nur zwei größere, weite, gewöhnliche Spitzbogenfenster, deren eins an jeder Seite eines Gewölbes steht. Jene Construction einer Stellung von je drei Fenstern zusammen, welche sich sonst gewöhnlich nur in der Altarwand findet, ist nur im Chor und in den Kreuzschiffen durchgeführt; am klarsten ist sie in den Kreuzschiffen, namentlich an den beiden Seitenwänden des nördlichen Kreuzschiffes, zu erkennen. Sonst ist diese Construction theils, durch den Anbau langer Seitenschiffe, Capellen und durch Epitaphien, theils durch Einbrechung großer Spitzbogenfenster sehr verdunkelt; so z. B. haben die Hauptwände der Kreuzschiffe über den Eingangspforten statt


|
Seite 98 |




|
der drei schmalen Fenster jetzt Ein großes Spitzbogenfenster; es sind aber die Wölbungen der alten Fenster neben den neuen noch klar in der Mauer zu erkennen.
Das Innere der Kirche ist nicht hoch; es ist in leisem Spitzbogen in den Rippen und in den Scheidebogen gewölbt; das Aeußere hat keine Strebepfeiler.
Betrachten wir jetzt die einzelnen Haupttheile der Kirche.
Der Chor hatte ursprünglich die Größe von 2 Gewölben und wahrscheinlich eine rechtwinklig angesetzte, grade Altarwand. In Jüngern Zeiten, wahrscheinlich um den Anfang des 15. Jahrhunderts, ist der Chor um 2 Gewölbe mit großen Fenstern im jüngern Spitzbogenstyl verlängert; es ist zunächst ein Gewölbe und dann eine dreiseitige Altarnische, welche Strebepfeiler an der Außenwand hat, im Ganzen also der Raum von 5 großen Spitzbogenfenstern, angesetzt: man erkennt diese Ansetzung sehr deutlich an den Außenwänden. Mit dieser Ansetzung, da die Altarwand abgebrochen ward, war es nöthig, auch das erste Gewölbe über dem alten Altare neu zu bauen. Es sind daher bei der Ansetzung des neuen Altarraumes von 2 Gewölben 3 Gewölbe in gleichem Style neu gebauet; zugleich sind in die Seitenwände des ersten alten Altar=Gewölbes zwei große Spitzbogenfenster eingebrochen. Es trägt daher der Chor im Innern nur noch in dem Gewölbe zunächst dem Kreuzschiffe die ursprüngliche Gestalt; aber auch hier sind die 3 Fenster an jeder Seite, links durch die großen fürstlichen Epitaphien und rechts durch den hohen Fürstenstuhl, sehr verbauet. - Der Chor liegt mehrere Stufen hoch und hat ganz das Ansehen, als wäre eine Krypte oder Gruftkirche unter derselben, was wohl gewiß nicht der Fall ist; der alte Altarraum, so wie die neue Verlängerung des Chors, liegt noch um 2 Stufen höher. Im Anfange dieser letzten Erhöhung steht auch das vom Herzoge Ulrich restaurirte Grabmal des Fürsten Heinrich Borwin II., des Gründers der Kirche; denkt man an die jüngere Verlängerung des Chors, so lag Borwins Grab unmittelbar vor dem alten Altare, während es jetzt eine ganze Strecke von dem neuen entfernt ist. - Das einzige alte Gewölbe im Chor, zunächst dem Kreuzschiffe, also das Gewölbe zunächst vor dem ehemaligen Altargewölbe, ist ein Sterngewölbe von 8 Rippen und das höchste Gewölbe in der Kirche. Dieses Gewölbe ruht auf reichen Pilastern, welche aus Säulenbündeln bestehen. Die 3 Gewölbe der Verlängerung ruhen auf einfachen, mit Weinlaub in den Kapitälern verzierten Säulen.


|
Seite 99 |




|
Die Kreuzschiffe sind noch am besten erhalten und, wenn auch theilweise von außen verbauet, doch im Innern noch klar zu erkennen. Namentlich ist das nördliche Kreuzschiff nach dem Kirchhofe hin im Innern und Aeußern der am besten erhaltene und kunstvollste Theil der ganzen Kirche. Die Pforte in der nördlichen Wand des nördlichen Kreuzschiffes ist mit Wulsten in reinem Rundbogenstyl gewölbt; darüber steht der bekannte Fries von Halbkreisbogen, und auch der Giebel hat einen gleichen Fries mit andern passenden Verzierungen im Giebelfelde; im Giebel standen 3 schmale, schräge eingehende Fenster, statt deren ein großes, weites Spitzbogenfenster eingebrochen ist. - Gleich ist das südliche Kreuzschiff; nur ist die Pforte in demselben im Spitzbogen, wenn auch eigenthümlich, gewölbt und es fehlt der Rundbogenfries und sonstige Verzierung.
Hiernach dürfte zuerst der Chor, dann das nördliche Kreuzschiff, dann das südliche Kreuzschiff, hierauf das Schiff und zuletzt der Thurm gebauet sein. Das erste Gewölbe im Chor zunächst dem Mittelgewölbe und das nördliche Kreuzschiff sind daher wohl die ältesten Theile der Kirche.
Das Schiff ist einfach und hatte ursprünglich an jeder Seite 2 große Fenster, welche an der Südseite ganz, an der Nordseite in der untern Hälfte zugebauet sind. Das Schiff hat an jeder Seite ein sehr niedriges Seitenschiff und vor diesen eine gleich lange und hohe Reihe von (4) Kapellen an jeder Seite. Alle diese Räume sind in jüngern Zeiten angebauet. Das nördliche Seitenschiff scheint zu gleicher Zeit mit den Capellen angebauet zu sein; die Gewölbe des Seitenschiffes und der Capellen ruhen nämlich in der Mitte auf denselben kurzen Granitsäulen und es fehlt dem Seitenschiffe die Außenmauer. Das südliche Seitenschiff ist dagegen, da es eine jetzt nach den Capellen hin durchbrochene Seitenmauer hat, früher allein als Seitenschiff angebauet und die Capellen sind später vorgesetzt. Die Capellen haben an dieser Seite einen zweiten gewölbten Stock, der jetzt das Superintendentur=Archiv enthält. - Durch diese Seitenschiffe und deren hoch hinauf reichende Dächer ist das Schiff von außen fast gar nicht zu erkennen. - So scheint sich die Sache zu verhalten. Urkundliche Nachrichten bezeugen jedoch, daß alle Seiten=Cappellen nach und nach erbauet und die letzten am Ende des 14. Jahrhunderts vollendet wurden. Zur Erbauung der letzten Capelle an der Nordseite, natürlich vorausgesetzt, daß der Bau der Capellen von Osten nach Westen fortge=


|
Seite 100 |




|
schritten sei, ward im J. 1388 Anstalt gemacht; in D. Clandrians Regesten der güstrowschen Dom=Urkunden (die Urkunden selbst sind verloren gegangen) heißt es:
"1338. Sept. 28. giebt Hennekinus von Bülow, Canonicus zu Güstrow, durch sein Testament mehreres zur erbawung einer Capellen an den Torm der Thumbkirchen an der Nordseite."
Die letzte Capelle an der Südseite war im J. 1394 schon fertig; in denselben Regesten heißt es:
"1394. Des güstrow. Decani Nicolai von Güstrow Fundation einer Vikarei in der Thumbkirchen in seiner Capellen nehist dem Torm gegen Mittage."
Das Thurmgebäude ist ein hohes, treffliches Gebäude, welches jetzt nur ein Hausdach hat. Es ist in der Zeit des ausgebildeten Spitzbogenstyls, etwa um 1300, erbauet. Da die Kirche nicht groß und nicht sehr hell ist, so ist der Raum im Thurme gewölbt und mit zur Kirche gezogen. Ein großes Spitzbogenfenster in der Westwand über einer trefflichen Pforte im Spitzbogenstyl giebt der Kirche jetzt viel Licht.
Vor dieser Turmpforte liegt ein gewaltiges Taufbecken von Granit mit hübschen architectonischen Ornamenten. Dieses Granitbecken ist wohl bei weitem das größte im Lande.
Von alten Mobilien bewahrt die Kirche nur wenig. Bemerkenswerth ist der geschnitzte Hauptaltar mit ziemlich freiem Laubwerk. In der Mitte ist die Kreuzigung dargestellt. Am Kreuzesstamme knieen zu beiden Seiten des fünfschildigen meklenburgischen Wappens zwei kleine Figuren: die eine im weiten geistlichen Gewande, neben sich ein Baret, die andere im Harnische, neben sich einen Helm haltend. Ohne Zweifel sollen diese Figuren die Herzoge Magnus und Balthasar vorstellen; der Altar wird also ungefähr 1490 - 1500 vollendet sein. (Das fünfschildige meklenburgische Wappen ist seit 1494 im Gebrauche.) Neben dem Altare stehen zwei trefflich geschnitzte Beichtstühle, mit sehr schönen Rosetten und Palmetten; der Stuhl rechts vom Altare ist in den Seitenwänden sehr reich mit geschnitzten Figuren geschmückt.
Von alten fürstlichen Begräbnissen findet sich nur das Grab Heinrich Borwin's II. in der Kirche; dasselbe ist vom Herzoge Ulrich 1574 mit einem steinernen Sarkophage überdeckt worden. Die auf Borwin folgenden Herren von Werle hatten ihr Begräbniß in der Kirche zu Doberan.
In dem südlichen Seitenschiffe liegen einige alte Leichensteine. Auf dem einen ist noch zu lesen:


|
Seite 101 |




|
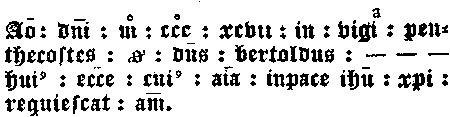
(Anno domini MCCCXCVII in vigilia pentecostes obiit dominus Bertoldus [scholasticus?] 1 ) hujus ecclesiae, cujus anima in pace Jesu Christi requiescat. Amen.)
Da es den Anschein hat, daß diese Leichensteine noch an ihrer ursprünglichen Stelle liegen, so würde das südliche Seitenschiff vor 1397 gebauet sein.
In den Zeiten der neuern Geschichte war der Dom vorzüglich Gegenstand der Sorge des Herzogs Ulrich und seiner Gemahlin Elisabeth, in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Diese ließen die prächtigen Epitaphien mit den Bildsäulen und Genealogien setzen, welche die ganze Nordwand des Chors zieren; ferner stammen aus dieser Zeit der Fürstenstuhl, Borwins Grabmal, die Kanzel, der Taufstein und mehrere Epitaphien u. dgl. Der Herzog Gustav Adolph liebte den Dom ebenfalls. Von ihm stammt z. B. das Denkmal auf den Rath Günther Passow und die Glasmalerei in dem Fenster hinter dem Altare, welche die Kreuzigung darstellt und für Glasmalerei aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr beachtenswerth ist.
Neben dem Grabe Borwins im Chor ist das Grabgewölbe für die Familie des Herzogs Ulrich, vor dem Altare das Grabgewölbe für die Familie des Herzogs Johann Albrecht II., in einer Seiten=Capelle an der Südwand das Grabgewölbe für die Familie des Herzogs Gustav Adolph. - An alten Grabsteinen ist die Kirche jetzt sehr arm.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Gägelow (bei Sternberg).
Wer hat nicht von der Kirche zu Gägelow gehört! In ganz Meklenburg, selbst über die Grenzen des Landes hinaus, ist die Vergleichung allbekannt: "so bunt wie die gägelowsche Kirche". Und doch kennen sie gewiß wenige, da sie nicht an einer sehr befahrenen Landstraße liegt.


|
Seite 102 |




|
Die Kirche ist ein altes, äußerst fest und dauerhaft gebauetes Gebäude, sorgsam aus zum Theil behauenen Feldsteinen und in den Oeffnungen und Gliederungen aus trefflichen Backsteinen aufgeführt. Sie bildet ein Oblongum und besteht aus Chor und Schiff, die zu gleicher Zeit gebaut sind, und einem neuern, schwachen Thurmgebäude. - Der Chor bildet ein Viereck mit einem Gewölbe und mit rechtwinklig angesetzter grader Altarwand und hat in dieser 3 und in jeder Seitenmauer 2 Fenster; hierin stimmt sie mit den ältesten Kirchen überein. - Das Schiff ist ein Oblongum von 2 Gewölben und hat unter jedem Gewölbe 3 Fenster, wie in der Altarwand, also im Ganzen 4mal 3 Fenster. Unter der westlichen Fensterstellung ist an jeder Seite eine Pforte, von denen die südliche zugemauert ist. - Alle Fenster sind schmal, ohne Gliederung schräge eingehend, je 3 durch einfache Pilaster ohne Gliederungen zu Einem architectonischen Ganzen verbunden und nur sehr leise spitz gewölbt, so daß sie einer frühen Zeit des Uebergangsstyls angehören. In Hinsicht der Fensterstellung zu dreien in den Seitenwänden des Schiffes gleicht sie dem Dome zu Güstrow (vgl. S. 97) und den Kirchen von Güstrow und Ruchow bis Schwaan (vgl. Jahresber. VI, S. 88), mit denen sie ohne Zweifel gleichzeitig ist. - Die Gewölbe in Chor und Schiff sind alle gleich und sicher mit der Kirche zugleich gebauet. Sie sind hoch, rein und ernst und machen einen sehr wohlthätigen Eindruck, haben aber eine Eigenthümlichkeit: statt des Schlußsteins haben alle nämlich einen Reliefkreis von einigen Fuß Durchmesser, von dem nicht nur die 4 Hauptrippen, sondern zwischen diesen noch 4 Rippen auf die Mitte der Seiten hinablaufen, so, daß jedes Gewölbe 8 Rippen hat, welche nicht abgerundet, sondern viereckig sind. In Beziehung des kreisförmigen Gewölbeschlusses gleicht die gägelowsche Kirche den Kirchen von dem benachbarten Ruchow bis Schwaan (vgl. Jahresber. VI, S. 88); die gägelowsche scheint aber von diesen die ältere zu sein, weil diese Eigenthümlichkeit sehr strenge, consequent und in Harmonie mit dem ganzen Bau durchgeführt ist.
Ihren Ruf hat die Kirche von der Bemalung der Gewölbe. Bald nach dem Anfange des vorigen Jahrhunderts wurden sehr viele Kirchen von Stuben= und Tapetenmalern mit Malereien verziert, die in der Regel, oder wohl alle, schlecht genug sind. Die Gewölbe der gägelowschen Kirche sind nun nicht auffallender oder bunter bemalt, als die mancher anderer Kirchen; vielmehr liegt in ihren Malereien mehr Sinn, als vielleicht in allen andern. Die Felder der Gewölbe sind mit sehr dicht gewundenen Arabesken angefüllt, in denen runde


|
Seite 103 |




|
Schilder stehen, auf welchen der Weg von der Sünde zum Heil allegorisch und oft sehr irdisch dargestellt ist, z. B. durch ein Gastmahl u. dgl. Der Grundton dieser Malereien ist ockergelb und nicht sehr scharf. Es zeichnen sich diese Malereien grade nicht durch Schönheit aus, sie sind aber etwas reicher gehalten, als gewöhnlich die Gewölbemalereien, so daß die Gewölbe ganz damit bedeckt sind. Dieser größere Reichthum der Arabesken und Darstellungen wird wohl nicht zu dem Sprichworte Veranlassung gegeben haben, weil er grade nicht sehr auffallend ist; wahrscheinlich kommt das Sprichwort wohl daher, daß die Kirche eine der ersten, oder vielleicht die erste war, welche in neuern Zeiten, wahrscheinlich schon im 17. Jahrhundert, bunt bemalt ward.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Serrahn
ist ein Oblongum, bestehend aus Chor, Schiff und Thurm, alle gleich breit, großes Oblongum. Chor und Schiff gleich groß, jedes ein Gewölbe; die beiden Gewölbe sehr gut, in der Form des Uebergangsstyls, und zierlich; der Thurm ohne Gewölbe.
Der Chor ist der ältere Theil. Die Altarwand ist gerade und rechtwinklig angesetzt. Sie hat hinter dem Altare ein dreigetheiltes Fenster, welche im Uebergangsstyl gewölbt sind, mit Säulen aus abwechselnd glasurten Steinen, sehr kräftig und schön, außen und innen gleich. Der Giebel ist mit Kreuz und vielen andern vertieften Verzierungen geschmückt. In der Südwand ist ein gleiches Fenster gewesen, das aber sehr verbauet ist; die Nordwand hat kein Fenster gehabt. In der Südwand des Chors ist eine treffliche, gegliederte Pforte im Uebergangsstyl aus abwechselnd glasurten Steinen.
Das Schiff hat außen noch Reste von einem Rundbogenfries, der aber bei der Zusammensetzung schon etwas gespitzt ist; die Kreisabschnitte bestehen nämlich aus zwei Segmenten, welche zwar aus dem Kreise geschnitten, aber kürzer sind, als ein Viertelkreis.
Die Glocken sind jung. Sonst nichts Merkwürdiges.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Die Kirche zu Dreweskirchen (bei Neuburg),
in der Nähe der Ostsee, ist ein treffliches Gebäude im Uebergangsstyl vom Rundbogen zum Spitzbogen, noch mit Fensterstellungen von 3 schmalen Fenstern in der rechtwinklig angesetzten Altarwand.


|
Seite 104 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Alt=Gaarz,
bei Neu=Buckow, auf hohem Meeresufer, ist der Kirche zu Dreweskirchen ähnlich, nur daß das Schiff 4 Fensterpaare hat.
Die Kirche zu Dreweskirchen ist dadurch interessant, daß sie einen chronologischen Anhaltspunct in der Geschichte der Baukunst giebt. Die Kirche ist bald nach dem Jahre 1229 gebauet; vgl. Lisch Meklenb. Urk. III, S. 77 - 78. Die Kirchen des 12. Jahrhunderts sind noch im Rundbogenstyl aufgeführt. Die Kirchen zu Neukloster (1219) und zu Güstrow (1226) haben noch Giebel im Rundbogenstyl, die Fenster jedoch schon im Spitzbogenstyl. Gegen die Mitte des 13. Jahrh. Ist der Spitzbogenstyl schon vollständig ausgebildet, wie in den Kirchen zu Doberan (?) (1232), zu Dargun (um 1230) und zu Bützow (1248), auch zu Schwerin (1248). - Der Uebergangsstyl in Meklenburg wird also ungefähr in die Zeit von 1218 bis 1230 fallen, in welcher die deutsche Cultur nachhaltig Wurzel schlug und die meisten Ortschaften gegründet sind. Daher finden sich so sehr viele Kirchen im Uebergangsstyle in Meklenburg.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Ueber die Kirchen und andere alte
Bauwerke
im südöstlichen Meklenburg,
vom
Archivar Lisch.
So wie im nordwestlichen Meklenburg durch den Einfluß der Bisthümer Ratzeburg und Lübeck der Rundbogenstyl am längsten vorwaltet und im nordöstlichen Meklenburg durch den Einfluß der Klöster Doberan und Dargun der ausgebildete Spitzbogenstyl vorherrschend ist, so schien im südöstlichen Meklenburg bei den alten Residenzen der Fürsten von Werle, von Güstrow und Parchim bis an die Grenze von Meklenburg=Strelitz, der Uebergangsstyl zwischen Rundbogen= und Spitzbogen=Styl nach manchen Anzeichen vorzuwalten. Der Unterzeichnete unternahm es daher im Anfange Septembers 1842, zum Theil in Begleitung des Herrn Baron A. von Maltzahn auf Peutsch und durch dessen liberalste Beförderung unterstützt, eine Reise durch das südöstliche Meklenburg, welche die Vermuthung bestätigte und manches Wichtige in den folgenden Berichten für die Landesgeschichte ans Licht brachte. Es sind freilich nicht alle Kirchen besucht und es mag noch hin und wieder etwas Interessantes verborgen sein, auch sind


|
Seite 105 |




|
gewöhnliche an Alterthümern arme Spitzbogenkirchen, wie zu Crivitz, Goldberg, Crakow, Penzlin, Stavenhagen, Neukahlden, Malchin u. s. w. mit Stillschweigen übergangen: aber die Bahn mag gebrochen und dadurch Gelegenheit gegeben sein, manche Specialuntersuchung an diese zusammenhangende Forschung zu knüpfen.



|



|
|
:
|
Die Kirchen zu Parchim
sind nach 1218 gebauet, d. h. nach der Gründung der Stadt, welche sich aus diesem Jahre datirt.
a. Die St. Marien=Kirche auf der Neustadt
ist im Ganzen in ihrer jetzigen Gestalt die ältere. Sie ist nur klein und besteht im Grundplane aus einem viereckigen Chore, aus einem oblongen Schiffe und einem Thurmgebäude. Chor und Schiff haben noch eine Friesverzierung von halben Kreisbogen unter einem Gesimse von übereck eingesetzten Ziegeln; die Kirche wird also schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. vollendet gewesen sein, obgleich im J. 1229 nur Ein Pfarrer von Parchim vorkommt (vgl. Clemann S. 109).
Der Chor ist viereckig, mit rechtwinkelig angesetzter, grader Altarwand, ohne Strebepfeiler, mit dünnen Wandstreifen an den Ecken. Von allen Fenstern der Kirche sind nur die 2 südlichen Fenster des Chors aus der Zeit des Baues: sie sind schmal, ohne gegliederte Wandung, schräge eingehend, oben nur ein wenig spitz gewölbt und mit abwechselnd schwarz glasurten Ziegeln an den Ecken eingefaßt: der Bau der Kirche fällt also in die Uebergangs=Periode. An der Altarwand finden sich noch Reste von Abgrenzung der (jetzt zu Einem großen Fenster umgestalteten) alten Fenster durch säulenförmige Pilaster. Der Styl gleicht in dieser Hinsicht ziemlich dem Styl der Kirche zu Grevismühlen. - Der hausähnliche Giebel über der Altarwand ist wohl im 14. Jahrhundert aufgesetzt.
Im Ganzen ist die Kirche im Aeußern sehr verbaut und hat außer der Friesverzierung und den angedeuteten Ueberresten am Chor keine andere Zeichen des Alterthums mehr.
Das Schiff hat schon weite, große Fenster, erhalten. Im Innern hat es ein Mittelschiff und zwei gleich hohe, schmalere Seitenschiffe, alle im Spitzbogen überwölbt. Die Gewölbe mit ziemlich starken Rippen sind kräftig und alt; jedoch der Länge der Kirche nach viel mehr lang, als breit, was allerdings eigenthümlich ist. Die Kapitäler der Pfeiler und überhaupt die Verbindung zwischen Pfeilern und Gewölben ist überall stark mitgenommen und kaum erkennbar. - An der Nordseite ist, wahr=


|
Seite 106 |




|
scheinlich im 15. Jahrhundert, ein Raum von 2 großen, weiten Gewölben mit weiten Fenstern zur Vergrößerung des Raumes angesetzt. Am Eingange dieses Anbaues, namentlich an der Schwelle, sind auch einige von den berühmten jüdischen Grabsteinen aus der zweiten Hälfte des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts verbauet, aus denen die Fundamente des äußern Kreuzthores aufgeführt sind. Der jüngste jüdische Grabstein ist vom J. 1346, im J. 1435 sollte das neue Kreuzthor gebauet werden, und im J. 1482 hieß der Anbau schon "dat nyghe buwet (das neue Gebäude)" (vgl. Cleeman S. 316). Der Anbau ist also auch nach urkundlichen Zeugnissen im 15. Jahrhundert ausgeführt. - Die alte Südseite des Schiffes hat zwar 2 Strebepfeiler; sie scheinen jedoch zum Nothbehelfe für die jüngere Wölbung angesetzt zu sein.
Die Kirche ist 18 41/42 im Innern renovirt. In ihrer jetzigen Verfassung hat sie fast allen alterthümlichen Schmuck verloren; von alten Bildern ist keine Spur mehr vorhanden. Die Kirche ist mit Ausnahme von Altar, Kanzel, Orgel, Taufkessel, Stühlen und Chören ganz leer.
Die Orgel aber ist ein ausgezeichnetes Kunstwerk von Schnitz= und Tischlerarbeit, (etwa aus dem 17. Jahrh.), mit sehr schönem Laubwerk und trefflichen eingelegten Zeichnungen.
Der Altar ist von leichtem gothischen Schnitzwerk aus der letzten katholischen Zeit. Im Mitteltheil steht ein Marienbild in einer Glorie, von einem Blumenkranze (Rosen und Lilien?) umgeben, auf welchem 2 Hände und 2 Füße mit den Nägelmalen und ein Herz mit dem Lanzenstiche in gleichmäßigen Entfernungen angebracht sind. Die ganze Darstellung ist der am Hauptaltare zu Gadebusch völlig gleich.
Der Taufkessel von Bronzeguß ist alt. Er wird von 4 menschlichen Figuren getragen, hat unten eine Verzierung von Weinlaub, darüber eine Reihe von Heiligenbildern unter Bogenverzierungen und unter dem Rande folgende Inschrift von sehr großen mittelalterlichen Unzialen:

welche, wenn auch keine Abbreviaturenvorhanden sind, wahrscheinlich so abzutheilen und zu lesen ist:
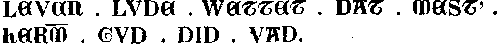
d. h.
Lieben Leute wisset daß Meister Hermen goß dies Vaß. (= Hermann)


|
Seite 107 |




|
Cleeman lieset S. 310 an der schwierigen Stelle der imUebrigen sehr klaren Inschrift:
und interpretirt:
"Lieben Leute, wisset das meiste hiemit aus diesem Faß".
Unter dieser Inschrift steht neben den Figuren:

(anno domini 1365. Est (?) oder: ecclesia (?) Maria.
Vor dem Altar liegt nach ein alter Leichenstein, dessen innere Fläche zu einer neuen Inschrift benutzt ist, mit der unversehrt erhaltenen Inschrift:
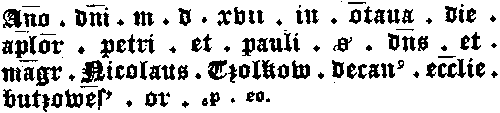
(= Anno domini MDXVII in octava die apostolorum Petri et Pauli obiit dominus et magister Nicolaus Tzolkow, decanus ecclesiae Butzowensis. Orate pro eo.)
b. Die St. Georgen=Kirche
auf der Altstadt ist im Ganzen in ihrer jetzigen Gestalt jünger als die Marienkirche. Das Schiff ist eine große, hübsche Spitzbogenkirche, etwa aus dem 14. Jahrhundert, den wismarschen Kirchen ähnlich.
Die Kirche besteht aus einem Schiffe mit einem Seitenschiffe an jeder Seite, einem Chor mit Umgang und 2 Kreuzflügeln und einem Thurmgebäude.
Die eigentliche Kirche ist das Schiff mit den beiden Seitenschiffen, in dem würdigen Spitzbogenstyl des 14. Jahrhunderts 1 ) erbauet. Das Schiff war früher im Osten geschlossen und hatte sicher eine kleine Altartribune. Im 15. Jahrhundert öffnete man die Ostseite und baute nicht allein einen Chor mit Umgang, sondern auch 2 Kreuzflügel an die Seiten des Chors an. Man sieht diese Erweiterung ganz klar; die Eckwände sind


|
Seite 108 |




|
überall abgehauen und die Pfeiler am Ende aus den Wänden modellirt. - Dieser Chor ist in einem sehr schlechten Styl des 15. Jahrhunderts aufgeführt. Der innere Chorraum oder die Altartribune ist eng; die Gewölbe werden von nahe stehenden, vieleckig gestalteten Pfeilern getragen. Der Umgang ist dagegen übermäßig weit, in der buntesten Grundform von vielen Strebepfeilern aller Art aufgeführt und von weiten, unschönen Fenstern durchbrochen; so z. B. bestehen die beiden Fensterpaare neben dem mittlern Fenster hinter dem Altare aus zwei halben Fenstern von großer Dimension, welche durch einen großen dreieckigen Strebepfeiler ganz regelmäßig geteilt sind, u. dgl. mehr. Die an die Seiten des Chors angelehnten Kreuzschiffe sind von gleichem Styl. Die beiden Giebel derselben sind hausähnlich construirt, reich mit Verzierungen aus schwarz glasurten Ziegeln bedeckt und gleichen ganz dem alten Wohnhause am Markte zu Wismar.
In dem Thurmgebäude besitzt die Kirche eine große architectonische Merkwürdigkeit, indem dasselbe ohne Zweifel und klar das älteste Kirchengebäude in sich aufgenommen hat, und dadurch zur Vergleichung ähnlicher Bauten sehr dienlich ist. Das älteste Kirchengebäude war nämlich eine Kirche oder Kapelle von 2 kleinen, niedrigen Gewölben Länge, bestehend aus einem Mittelschiffe, das zwei Stockwerke hoch war und zwei Seitenschiffen von der Höhe eines Stockwerkes. An diesen alten Bau ward das Schiff der eigentlichen Kirche angesetzt und über denselben der Thurm gebauet, und die alten Seitenschiffe gingen in die Seitenschiffe der jüngern Kirche über. Dies alles ist noch klar zu sehen. Der alte Bau war im schönen Uebergangsstyl in den ersten Zeiten der Stadt ausgeführt. Die Gewölbe sind eingeschlagen, aber es sind noch überall die Träger und Anfügungen zu sehen; die Kämpfergesimse aus Granit stehen in den jetzigen Mauern noch klar und kräftig. Man hat die Mauern, wo es nöthig war, verdickt, um den Thurm tragen zu können, und z. B. an der Nordseite (jetzt im Innern) einen gewaltigen Strebepfeiler gegengeschoben. An der südlichen Wand des zweiten Stocks dieses alten Gebäudes steht (jetzt innerhalb des jetzigen südlichen Seitenschiffes) noch der ganze Fries aus halben Kreisbogen. In der äußern, westlichen Wand des Thurms kann man diesen alten Bau klar erkennen, und sehen, wie und wo die jüngern Theile angesetzt sind. Alte Bogenöffnungen sind vermauert; das Fenster über der Thurmpforte ist noch ein schmales, glatt und schräge eingehendes Fenster aus der Uebergangsperiode; ein gleiches, kleineres Fenster steht noch daneben in der Wand des ehemaligen Seitenschiffes, und dar=


|
Seite 109 |




|
über stehen auf Wandstreifen noch Reste des Rundbogenfrieses. - Dieser Theil der Kirche ist bestimmt noch älter, als der 1289 abgebrannte Theil gewesen sein mag.
Eben so verhält es sich mit dem Dome zu Schwerin 1 ). Dieser ist 1222 - 1248 erbaut; aber in der Westwand des Thurms stehen ebenfalls noch die Reste eines ältern Baues. Zwei schmale Fenster mit leiser Andeutung des Spitzbogens sind hier zu Einem großen Fenster umgeschaffen und über demselben steht noch der Rundbogenfries. Im Innern sind hier ebenfalls noch Spuren alter Gewölbe.
Uebrigens war der Thurm schon früh baufällig. Am 25. Aug. 1473 ertheilte der Bischof Werner von Schwerin allen denen Ablaß, welche zur Besserung des Thurmes (campanile), namentlich der baufälligen Spitze desselben, beitragen würden.
Die St. Georgen=Kirche zu Parchim hat ebenfalls wenig alterthümliches Mobiliar. Der geschnitzte Altar aus der ersten Hälfte des 15. Jahrh. ist bemerkenswerth, aber grade nicht ausgezeichnet. Die Chorschranken sind noch ganz vorhanden, mit vielem Schnitzwerk, welches zwar nicht ausgezeichnet ist, jedoch eine Reihe verschiedener, hübscher, wenn auch nicht überall sehr sauber gearbeiteter Rosetten enthält.
Die Kanzel ist dagegen ein ausgezeichnet schönes Schnitzwerk, das seines gleichen sucht, jedenfalls noch viel schöner ist, als die schöne Kanzel zu Bützow (vgl. Jahresber. III, S. 139). Sie enthält viele biblische Scenen, die in Zeichnung und Ausführung von seltener Vollkommenheit sind. Sie ist im J. 1580 vollendet und trägt die Dedications=Inschrift:
IN . DEI . HONOREM . AC. PATRIAE . SUAE .ORNAMENTUM . D. . D. . JOHANNES . GRANSIN . CIVIS . LUBICENSIS.
Das Crucifix auf dem sogenannten Triumphbogen ist, wie gewöhnlich, sehr mittelmäßig.



|



|
|
:
|
Die Kirchen zu Röbel.
Röbel hat zwei Kirchen, welche aus der Zeit des Uebergangsstyls stammen und einander ähnlich sind. Am besten ist
a. Die St. Nikolai=Kirche zu Neu=Röbel
(Neustadt Röbel) erhalten, daher die Beschreibung hier vorangeht. Die Kirche hat einen Chor von 2 Gewölben, ein Schiff von 3 Gewölben Länge und einen Thurm.


|
Seite 110 |




|
Der Chor hat die Gestalt eines Oblongums mit rechtwinklig angesetzter, grader Altarwand. Die Altarwand hat 3 Fenster, die Seitenwände des Chors an jeder Seite 2 Fensterpaare; die Fenster sind eng, schräge eingehend, ohne weitere Gliederung, als daß die äußere Ecke einen Wulst hat. Der Altargiebel ist sehr gut und besser als gewöhnlich erhalten. Ueber den 3 Fenstern steht im Friese eine Reihe von Halbkreisbogen; in der unteren Hälfte des Giebels sind die Ziegel im Zickzack aufgemauert. Die Seitenwände des Chors haben einen Fries, der aus einer doppelten Reihe von Halbkreisen besteht, was sehr selten ist.
Das Schiff besteht aus einem Mittelschiffe von der Breite des Chors und zwei schmalern Nebenschiffen. Die Gewölbe, welche 44 ' hoch sein sollen, werden von 4 gerippten Säulen getragen. Jede Wand hat 3 Fensterpaare, gleich den Fensterpaaren des Chors, und an jedem Ende der Seitenschiffe ein gleiches Fenster. Die Ostwandecke des Schiffes hat noch einen Fries von einer Reihe von Halbkreisen. Die Friese stehen auf dünnen Wandstreifen; einige Strebepfeiler sind jüngeren Ursprunges und stehen nicht regelmäßig. Das Innere der ganzen Kirche, wie das Aeußere, trägt den Charakter eines sehr strengen Spitzbogenstyls, des Uebergangsstyls.
Der Thurm, der bis zur Spitze an 250' hoch sein soll, ist dem Ganzen angemessen.
An Mobiliar besitzt die Kirche nicht viel. Vor der Kirche liegt ein sehr großer, schön geformter und verzierter Taufstein aus Kalkstein und ein unregelmäßig geformter Weihkessel aus Granit. Einige alte Leichensteine sind abgetreten und in neuern Zeiten wieder benutzt. Auf dem Boden des nördlichen Seitenschiffes stehen die gut geschnitzten, großen Bildsäulen des h. Georg zu Roß mit dem Lindwurme und der Maria mit dem Christkinde auf dem linken Arme der rechte Arm umschlingt eine daneben stehende kleinere weibliche Figur, welche einen gefüllten Korb oder eine Tasche in der Hand empor hält. Der Altar ist ohne Werth. Einige geschnitzte, alte Kirchenstühle sind nicht ganz ohne Werth.
Von hohem Interesse sind die alten Chorstühle, welche aus dem Dominikaner=Kloster hierher versetzt sind und welche die beiden Seiten des Chors füllen. Sie sind aus Eichenholz einfach geschnitzt und haben nur an den äußersten Seitenwänden einige Verzierungen. Sie haben im Ganzen 30 Sitze; an jeder Seite ist ein Sitz etwas schmaler, weil, da es hier bei der Versetzung etwas an Raum fehlte, ein Stück von einigen Zollen Länge herausgenommen ist; da-


|
Seite 111 |




|
durch haben die unten erwähnten Inschriften an zwei Stellen etwas gelitten.
Jeder Stuhl hat auf der Rückwand ungefähr über dem Haupte des Sitzenden eine erhaben geschnitzte Inschrift; diese Inschriften sind in Schröder's P. B. S. 644, jedoch mit vielen Fehlern und Lücken mitgetheilt.
Sieht man zum Altare hinauf, so haben die Stühle folgende Inschriften:
Der erste Stuhl rechts hat die Inschrift:
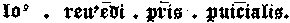
Der Stuhl rechts in der Mitte hat mit größeren Buchstaben die Inschrift:
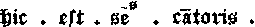
Daneben eine gleiche Inschrift:
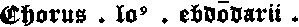
An der linken Seite steht in der Mitte die Inschrift:
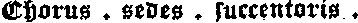
Daneben:

Ueber den meisten übrigen Stühlen stehen die Nachrichten über die Sitze der Provinzial=Capitel des Dominikaner=Ordens, z. B. die für Norddeutschland interessante Nachricht:
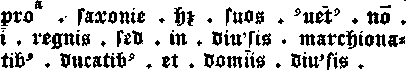
(Provincia Saxoniae habet suos conuentus non in regnis sed in diversis marchionatibus, ducatibus et dominiis diversis.)
An dem kleinen Stuhle rechts steht:
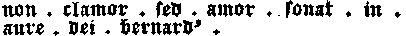
und daneben:
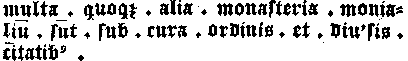


|
Seite 112 |




|
Am vierten Stuhle links die Nachricht über die Verfertigung der Stühle:
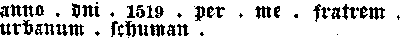
Die Inschriften wurden also im J. 1579 von dem Dominikaner=Mönch Urban Schuman geschnitzt.
Ueber diesen zwei Reihen Stühlen stehen 2 Leisten, auf welchen die Jahre der Stiftung vieler Dominikaner=Klöster ohne Rücksicht auf die Zahl der Stühle in ununterbrochener Folge mit großen Unzialen eingeschnitten stehen. Sie folgen hier unter einander gesetzt von oben nach unten, wie sie an den Stühlen vom Schiffe nach dem Altare hinauf geschrieben sind:
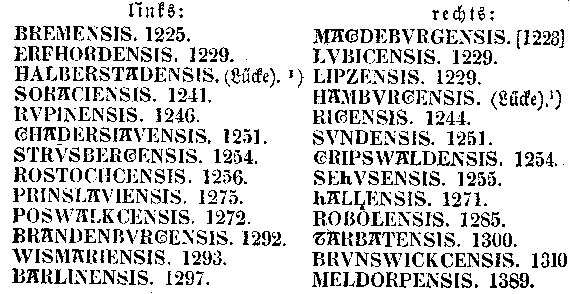
b. Die St. Marien=Kirche zu Alt=Röbel
ist ganz wie die neustädter Kirche gebaut, nur
sind die Pforten und Fenstergliederungen mehr
mit Kapitälern
 . verziert und die Wandöffnungen
überhaupt mehr gegliedert. In der Altarwand sind
schön gebaute Fenster und darüber noch Reste vom
Rundbogenfries; sonst ist am Gesimse bei
Dachrestaurationen das Alte viel durch Neues
verdrängt, auch sind Strebepfeiler angesetzt.
Die Kirche ist auch kürzer, als die Neustädter,
indem die zwei Fensterpaare des Thurmes nicht
zur Kirche genommen sind. Im Thurme hat die
Kirche eine sehr hübsche Vorhalle im
Spitzbogenstyl, mit Gliederungen und Kapitälern
aus gebranntem Thon.
. verziert und die Wandöffnungen
überhaupt mehr gegliedert. In der Altarwand sind
schön gebaute Fenster und darüber noch Reste vom
Rundbogenfries; sonst ist am Gesimse bei
Dachrestaurationen das Alte viel durch Neues
verdrängt, auch sind Strebepfeiler angesetzt.
Die Kirche ist auch kürzer, als die Neustädter,
indem die zwei Fensterpaare des Thurmes nicht
zur Kirche genommen sind. Im Thurme hat die
Kirche eine sehr hübsche Vorhalle im
Spitzbogenstyl, mit Gliederungen und Kapitälern
aus gebranntem Thon.
--------
1) Die Jahrszahl 1228 bei Magdeburgensis hat Schröder; in dem Schnitzwerke fehlt sie jetzt.


|
Seite 113 |




|
Der Altar ist aus der letzten Zeit des Katholicismus. Im mittlern Altarfenster ist ein kleines Glasgemälde mit einem Marienbilde, jedoch schon etwas beschädigt.
Die Kirche hat noch zwei alte Leichensteine:
a. in einer gothischen Nische steht ein den Kelch consecrirender Geistlicher mit einer zu beiden Seiten herabhängenden schleierartigen Kopfumhüllung, welche im Verein mit dem übrigen weiten Gewande dem Bilde ein weibliches Ansehen giebt, mit der Umschrift:
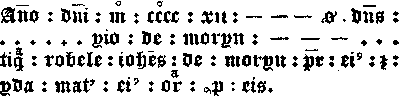
(= Anno domini MCCCCXII [in die . . . . . . . . ] obiit dominus [reuerendus] Yo de Moryn 1 ), [plebanus in Anti]qua Robele. Johannes de Moryn pater ejus et Yda mater ejus. Orate pro eis.)
Zu den Füßen steht der morinsche Wappenschild mit 2 gekrümmten Lanzenspitzen mit einem Widerhaken (Sturmhaken?).
b. in einer gotischen Nische steht ein den Kelch consecrirender Geistlicher mit bloßem Haupte, mit der Umschrift:

(= Anno domini MCCCCXII [in die . . . . . . . .] obiit dominus Petrus Rod[emolner│, perpetuus vicarius in Antiqua Robele. Ejus anima requiescat in pace.)
Zu den Füßen steht ein Wappenschild mit zwei concentrischen Drittheilkreisen (Mühleisen?), mit der Oeffnung nach Außen gekehrt.
Die mittlere Glocke hat die Inschrift:

An einem Pfeiler in der Kirche hängt zum Andenken eins der viel besprochenen Taufbecken. In der Mitte ist der Sündenfall dargestellt. Um diese Darstellung steht im Kreise


|
Seite 114 |




|
die räthselhafte Inschrift. Um diese Inschrift
steht, ebenfalls mehrere Male wiederholt, die
zweite besprochene Inschrift:
REKOR † DE †
N
 RSE
RSE

 .
.
Auf dem Rande stellt die Inschrift eingegraben:
JOHANNES . BRALLIN . PAST .
ANNA . MARGARETA . HASSEN.
Die kirchlichen Verhältnisse sind für die Geschichte der Stadt und der Gegend von hoher Wichtigkeit.
Die Stadt Röbel wird in die Altstadt gegen Norden und in die Neustadt gegen Süden getheilt. Innerhalb der Stadt lag die Grenze zwischen den Bisthümern Schwerin und Havelberg; die Altstadt gehörte zur schweriner, die Neustadt zur havelberger Diöcese; die nördlichen Grenzen der havelberger Diöcese sind wahrscheinlich die Grenzen des südlich gelegenen Landes Vipperow. - Die altstädter Kirche steht auf einem ziemlich hohen Plateau mit schroffen Abfällen am Nordende der Stadt, und man genießt von dort eine schöne Aussicht; dieses Plateau soll, was auch nicht unwahrscheinlich ist, der alte heidnische Burgwall von Röbel sein.- Die Stiftung der Stadt fällt in die Zeit, als der alternde Fürst Borwin I. gemeinschaftlich mit seinen beiden Söhnen und zuletzt wieder allein regierte (1218 - 1227). Das älteste Stadt=Privilegium ist wahrscheinlich vom J. 1226; die Neustadt Röbel soll der Fürst Nicolaus II. schon im J. 1217 (oder 1227?) angelegt haben, vgl. Schröders P. M. S. 517; in der Confirmation vom J. 1261 wird der Neustadt das schweriner Recht so confirmirt, wie es ihr Heinrich Borwin II. verliehen. Der Styl beider Kirchen, welche der Domkirche in Güstrow ähnlich sind, redet ebenfalls für diese Zeiten. Im 13. Jahrhundert war Röbel auch fürstliche Residenz und seit dem J. 1227 kommen fürstliche Burgmänner zu Röbel vor (vgl. Jahrb. II, S. 215, 217, 219, 226, 227, 231 u. s. w., Rudloff Urk. Lief., S. 37 und Lisch Mekl. Urk. III, S. 98, 107). In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wird das Land Vipperow, also auch die Neustadt Röbel wohl noch zum Sprengel des Bischofs von Schwerin gehört haben; da die Streitigkeiten des Bischofs von Schwerin mit den Bischöfen von Havelberg und Camin, welche ungefähr, mit dem J. 1252 aufhörten, zum Nachtheil des erstern ausfielen, so wird die Neustadt Röbel in dieser Zeit an das Bisthum Havelberg gekommen sein.
Schon in den frühesten Zeiten der Stadt ward in der Neustadt ein Augustiner=Nonnenkloster (sanctimonia-


|
Seite 115 |




|
les de ordine poenitentium novae civitatis Robele, 1298) gegründet. Ein Propst Nicolaus (prepositus in Robele) kommt 1239 einige Male, darauf Stephanus (prepositus de Robele) eine lange Zeit hindurch häufig vor, sicher seit 1249, (vgl. Jahrb. II, S. 282, 233, Lisch Mekl. Urk. I, S. 107, 112, 118, Rudloff Urk. Lief. S. 75), und nach demselben 1291 Johannes Stormen prepositus in Robele (vgl. Riedel cod. nov. Brand. I, S. 451). Ob dieser Propst aber ein Klosterpropst und nicht vielmehr einer der unten erwähnten Archidiakone, welche in Röbel auch Pröpste genannt wurden, gewesen sei, steht sehr zur Frage; das Letztere ist wahrscheinlicher, da im J. 1255 Stephanus archidiaconus in Robele beim Bischofe zu Havelberg war. Diese Erwähnung eines Propstes, wenn sie anders aus das Kloster zielt, und die Aufhebungs=Acte sind jedoch die einzigen Nachrichten, welche über dieses Kloster vorhanden sind.
Im J. 1285 ward, nach der Inschrift über dem Kirchenstuhle, in der Altstadt, schweriner Diöcese, ein Dominikaner=Mönchskloster gestiftet. Diesem Kloster waren die werleschen Landesherren, welche häufig in Röbel Hof hielten, sehr gewogen, so daß selbst 2 Prinzen, Bernhard und Heinrich, Johann's I. von Werle Söhne, Mönche dieses Klosters waren (z. B. nobilis dominus frater Bernardus de Slavia ordinis fratrum majorum: Jahrb. II, S. 256). Auch die Fürstin Sophia von Werle († vor 1308), Wittwe des Fürsten Johann I. († 1283) und längere Zeit thätig in der Landesregierung, war häufig in Röbel (vgl. z. B. Jahrb. II, S. 238) und soll (nach Latomus in Schröder P. M. S. 858) in dem Dominikaner=Kloster begraben worden sein.
Zwei Klöster waren aber für die kleine Stadt zu viel, um so mehr, da die bettelnden Dominikaner die Mildthätigkeit in Anspruch nahmen und noch kein anständiges Kloster hatten, und das Nonnenkloster arm war 1 ), vielleicht weil es kein Cistercienser=Kloster war, wie die meisten Klöster Meklenburgs. Daher verlegte der Fürst Nicolaus I. (IV.) um Pfingsten 1298 das Nonnenkloster von der Neustadt Röbel nach dem alten Orte Malchow, um der Armuth des Klosters zu Hülfe zu kommen und überwies den auf der Altstadt wohnenden Dominikanern den Hof der Nonnen, um auf demselben ein Kloster zu bauen 2 ). Seit 1298 war also das Do=


|
Seite 116 |




|
minikaner=Kloster auf der Neustadt, havelberger Diöcese, das einzige Kloster in Röbel, an dessen Spitze ein Prior stand. Zu gleicher Zeit ward 1298 das Hospital zum Heil. Geist dotirt (vgl. Mantzel Bütz. Ruhest. St. 23, S. 27) 1 ).
Außerdem war zu Neu=Röbel noch ein Archidiakonus, als Stellvertreter des Bischofes in gewissen Angelegenheiten, zur Verwaltung des Norddistricts des havelberger Bisthums (Vipperow, oder Röbel, oder Wredenhagen); so kommt z. B. 1293, 1298, 1305, 1318 Johannes archidiaconus noue ciuitatis Robele vor (vgl. Mantzel Bütz. Ruhest. St. 23, S. 27 und 29). Wahrscheinlich führte er den Titel eines Propstes und die oben bei dem Nonnenkloster genannten Pröpste sind wahrscheinlich die Archidiakonat=Pröpste.
Vielleicht hatte das Nonnenkloster zu Neu=Röbel noch keine eigene Kirche gehabt, sondern sich an die Pfarrkirche gelehnt, deren Pfarrer zugleich Propst des Klosters war. Daher behielt der Pfarrer von Neu=Röbel die Würde eines Präpositus, dem z. B. die Pfarren von Leitzen, Dambeck und Meltz untergeordnet waren: de provestige to Nigen - Röbel - - als de wendeschen heren de provestige to Nigen Röbel - - bestediget hetten; vgl. Mantzel Bützow. Ruhest. XIX, S. 28 und 38. Jedoch mag die Jurisdictions=Propstei schon seit Alters her von der Kloster=Propstei verschieden und ein Archidiakonat gewesen sein, da der Johannes Stormo prepositus in Robele 1291 (Riedel nov. cod. Brand. I, S. 451) im J. 1294 plebanus nove civitatis Robele (Rudloff Urk, Lief., S. 151) genannt wird. Im J. 1320 erwarben die Fürsten von Werle von dem Bischofe von Havelberg für das Patronat von Cambs die Propstei von Neu=Röbel, so daß sie fortan die Präpositur zugleich mit der Pfarre als Ein Lehn verliehen (vgl. v. Raumer Cod. contin. Brand I, p. 22), und 1330 kommt Arnoldus prepositus in Nouo Robele und


|
Seite 117 |




|
1350 Thydericus dei gracia prepositus in Nova Robele - - in ecclssia parrochiali Nove Robele vor und später: de provestige to Nigen Robele - - in der parkerken to Nigen Robele Havelberger Stiffts (vgl. Mantzel Bütz. Ruhest. XIX, S. 35, 39 - 41). Nach der Visitation von 1534: "Item noch hefft ock dysse prauest "(yn der nygenstath) Jurisdictionem synodalem auer XXXIII parkerken vnder em belegen."
Außerdem wird schon frühe auch noch ein Präpositus von Alt=Röbel genannt, z. B. 1294 Johannes prepositus antique ciuitatis in Robele (Rudloff Urk. Lief., S. 151), 1454 Herman Lotzeke tho olden Röbel prauest (Schröder P. M. S. 2077) und 1447 prepositura Robelensis, Zwe rinensis diocesis, - und sogar auch ein Archidiakonus zu Alt=Röbel als delegirter Richter des Bischofs von Schwerin 1330: Johannes archidiaconus in antiqua Robele (in einer ungedruckten Urkunde). Jedoch sind diese Verhältnisse noch zu dunkel, als daß sie ohne große Studien aufgeklärt werden könnten. In dem Visitations=Protocolle von 1534 heißt es:
"Item noch hefft de pravest (in der oldenstath) auer VI parkerken buten Robell dat geystlyke rychte van olders her".
Mehr als wahrscheinlich hatten beide Bischöfe in Röbel einen Archidiakonus mit dem Titel eines Propstes.
Endlich wohnte in Röbel auch ein Geschäftsführer des Klosters Dobbertin für die im südöstlichen Meklenburg gelegenen, entferntem Güter Laerz, Schwarz und Diemitz (Hinter=Propstei) und Lexow, Roez und Sietow (Vorder=Probstei), welcher deshalb Haus und Speicher in der Stadt hatte; derselbe ward der Sandpropst des Klosters Dobbertin, und davon der ihm anvertrauete District Sandpropstei genannt, vielleicht ursprünglich scherzweise, weil es mehrere Pröpste in Röbel gab und die Güter der Hinter=Propstei sandig sind. Der Dobbertiner Klosterhof lag bis gegen das Ende des 14. Jahrh. neben dem Dominikanerkloster 1 ). Im J. 1389 legte der Rath das Haus zu Bürgerrecht und Stadtpflicht und gab dem Kloster dafür eine Hausstätte neben der von Bune Stätte, der von Morin Stätte gegenüber, zum freien Besitze. Die von Morin hatten ein Haus neben der Pfarre. In dieser Gegend wohnten also die ritterlichen Familien.


|
Seite 118 |




|
Das Dominikanerkloster zu Röbel lag in der Neustadt an der Stadtmauer und "des Klosters Balken waren in die Stadtmauer gefaßt." Es bestand aus dem "Mönchhofe" mit Kirche, Kirchhof, Kloster und Baumgarten; vor dem Kloster hatte es eine "Stätte", 3 Buden, an der Ecke der Mühlenstraße eine Bude und außerdem in der Stadt noch 3 Buden, (von denen 5 Buden im J. 1620 abbrannten), einen Teich (Mönchteich) und mehrere Ländereien und Holzungen in der Gegend der Stadt. Wann das Kloster säcularisirt sei, ist ungewiß, wahrscheinlich zwischen 1530 - 40. Als im J. 1558 (nach Latomus in Westph. Mon. ined. IV, 234) der letzte Prior Thomas Lamberti gestorben war, ward das Kloster allmälig abgebrochen und die Steine wurden nach Wredenhagen zum Bau gefahren. Im J. 1568 stand (nach Archiv=Acten) das Kloster wüste, es wurden Steine davon verschenkt und verkauft; 1577 grenzte noch eine Scheure an den Chor der Kirche, 1602 lag auf dem Platze, wo die Kirche gestanden hatte, noch Steingrus. In dieser Zeit werden die Chorstühle in die neustädter Kirche geschafft worden sein. Von Leichensteinen und andern Alterthümern, da das Kloster auch ein fürstlich=werlesches Begräbniß war, ist wohl manches untergegangen; die Urkunden fehlen ganz. Am 17. Mai 1587 schenkte der Herzog Carl seinem Hofprediger Mag. Johannes Andreae zu Mirow aus Dank für seine gute Amtsführung "eine wüste Stätte auf dem Mönchhofe,wo zuvor das Kloster gestanden hatte," zum erblichen Eigenthum. Am 15. April 1589 verkaufte M. Andreae das Haus, welches er auf dem Mönchhofe zu Röbel gebauet hatte, nebst der dazu gehörigen Stätte an den Amtmann Joachim Schröder zu Mirow, und am 24. Febr. 1605 verkauften J. Schröders Erben, zu Röbel wohnhaft, " die wüste Klosterstätte zu Röbel, so weit das ganze Gebäu des Mönchklosters in seiner Circumferenz begriffen gewesen und gestanden, mit aller Gerechtigkeit, ausgenommen den Theil, den der Zimmermann Berend bewohnte", an Joachim von Below auf Hinrichsberg. Die von Below baueten hier einen Hof und besaßen denselben mit alter klösterlicher Freiheit. Gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts war Hieronymus Gerlach Sandpropst des Klosters Dobbertin geworden; im dreißigjährigen Kriege war des Klosters Kornhaus ganz "heruntergerissen" und Below's Mönchhof "sehr ruinirt". Weil nun die Below den Hof nicht benutzen konnten und Gerlach gerne seinen Verpflichtungen nachkommen wollte, so verkaufte am 16. April 1651 Igen von Below seinen "in


|
Seite 119 |




|
Röbel belegenen Klosterhof mit dem Hause mit Kirchstühlen und Begräbniß in der Altstadt und Neustadt, mit allen Freiheiten und Gerechtigkeiten, als eine unstreitige fürstliche Freiheit und Gerechtigkeit" an Hieronymus Gerlach zu einem Erbkaufe. So kam der Hof in bürgerlichen Besitz, wenn auch noch lange über die Freiheiten desselben gestritten ward. Im J. 1702 besaß den Hof noch Gerlachs Sohn, der Burgemeister Hieronymus Christoff Gerlach, und die von Below machten einen vergeblichen Versuch, den Hof zu reluiren.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Plau
ist ein altes, würdiges Gebäude aus der Zeit des Ueberganges vom Rundbogen zum Spitzbogen und schließt sich im Baustyl zunächst an die Domkirche zu Güstrow. Plau erhielt im J. 1228 das erste Stadt=Privilegium.
Die Kirche besteht aus Chor, Schiff und Turmgebäude.
Das Schiff ist ein reines Oblongum ohne Kreuzschiffe und besteht aus einem Mittelschiffe und zwei schmalern Seitenschiffen. Die 9 Gewölbe werden von 4 Pfeilern in strengem, ernstem Style gehalten. Die beiden östlichen Pfeiler sind aus 4 starken, schweren, runden Säulen zusammengesetzt und werden von großen, kräftigen Kapitälern gekrönt, die nach unten zu aus dem Viereck geschnitten sind. Gleiche Kapitäler haben die 2 westlichen Pfeiler, welche aus 4 Pfeilern zusammengesetzt sind, welche die Form der Kapitälerflächen haben, also an jeder Seite gleichmäßig dreiseitig sind. Die Pfeiler sind von abwechselnd rothen und schwarz glasurten Ziegeln aufgeführt, jedoch, wie die ganze Kirche, mit Kalktünch bedeckt. Die Hauptgurtbogen und die Gewölberippen sind in der Wölbung des Uebergangsstyls aufgeführt. Das Schiff hat unter jeder Wölbung 3 Fenster, deren mittleres höher ist, als die beiden andern, also im Ganzen 3mal 3 Fenster. Die Fenster sind hoch, schmal, ohne Gliederung schräge eingehend, fast rundbogig, oben in eine leise Spitze ausgehend., also ganz wie die Fenster und Fensterstellungen der Domkirche zu Güstrow. Drei dieser Fensterstellungen sind in Ein weites Fenster des 15. Jahrh. umgewandelt. An jedem Ende der Seitenschiffe befindet sich Ein Fenster von derselben Construction. Alle Fenster sind mit abwechselnd schwarz glasurten Ziegeln überwölbt. Im Aeußern hat die Kirche keine Strebepfeiler; dagegen einen Fries von halben Kreisbogen, welche an beiden Enden auf dünnen Wandstreifen stehen. An jeder Seite führt eine Pforte ins Schiff; beide sind im Uebergangs=Spitzbogen, die südliche mit abwechselnd schwarz glasurten Ziegeln gewölbt.


|
Seite 120 |




|
Der Chor im reinen Oblongum von der Breite des Seitenschiffes ist von Feldsteinen aufgeführt. Die Basis, die Fensterwandungen sind von behauenen Granitquadern. Die Altarwand ist grade und rechtwinklig angesetzt und hat ebenfalls drei Fenster. Die Seitenwände des Chors haben 4 Fenster, wie überhaupt alle Fenster des Chors vielfach verändert sind. An der Südseite des Chors ist im Aeußern ein drittes Fenster zugemauert; hiernach scheint der Chor in den Seitenwänden 6 Fenster gehabt zu haben. Die Chorfenster sind jetzt, jedoch wohl aus jüngern Restaurationen, ganz im Rundbogen gewölbt. Der Chor ist im Innern nicht gewölbt, sondern mit Brettern belegt; jedoch sind Ansätze zu den Gewölben im Spitzbogenstyl an den Wänden vorhanden. An der Südseite hat der Chor eine jetzt von einem gewölbten Vorbau verdeckte Pforte im Rundbogenstyl, mit schwer, jedoch schon gegliederten Pfeilern aus behauenem Granit. (vgl. unten Gr. Giewitz.)
Das Interessanteste an der Kirche ist eine colossale, ausgezeichnet schöne und würdige Granitpforte in der Westwand des Thurms, der, im untern Stockwerk aus Granit aufgeführt, im obern Theile aus Ziegeln, etwas verfallen ist. In 5 Gliederungen ist diese ganze, hohe Pforte im Uebergangsstyle aus behauenen Granitquadern auf Granitpfeilern gewölbt. Etwas Aehnliches ist bisher nur von der Kirche zu Dassow bekannt (vgl. unten), deren Wölbungen dieser Pforte sehr gleichen.
An bemerkenswerthem alten Mobiliar besitzt die Kirche nur einen gegossenen Taufkessel (Fünte) aus Bronze vom J. 1570, welcher durch die späte Zeit seiner Entstehung bemerkenswerth ist; er ist von allen bekannten der jüngste im Lande. Er hat noch ziemlich antike Formen und sehr viele Reliefbilder, jedoch ohne Plan und Geist, z. B. mehrere ganz hervorragende Köpfe, das fünfschildige meklenburgische Wappen, ein Crucifix, Marienbilder, Heilige, ein ziemlich gutes Brustbild Johannis d. T. mit dem Lamme auf der Schulter, einen Stierkopf und viele andere Reliefs. Die Inschriften lauten:
oben:
ICK BADEDE DI MIT WATER UND WUSCH DI VAN DINEM BLODE UND SALVEDE DI MIT BALSAM VND KLEDEDE DI MIT GE STICKEDEN KLEDERN.
darunter:
ANNO DOMINI MDLXX. EVERT WICHTENDAL ME FIERI FECIT.


|
Seite 121 |




|
unten:
GAT HEN UND LERET ALLE VOLKER VND DOPET SE IN DEM NAMEN DES VADERS DES SONS VND DES HILLIGEN GEISTES. MAT.
.



|



|
|
:
|
Von dem Schlosse zu Plau
an der Nordseite der Stadt ist nur noch ein ziemlich hoher Wall im Viereck mit einem gewölbten Durchgange und der Rest eines runden Thurmes mit einem anstehenden, langen Stück Mauerwerkes vorhanden. Der Thurm ist rund, noch in 2 Stockwerken und Gewölben vorhanden und jetzt als Ruine oben offen.
Das Schloß zu Plau ist am Ende des 13. Jahrhunderts (1285 - 87) gegründet; in zwei Urkunden der Kirche zu Kuppentin heißt es:
Datum in castro Plawe tempore primae fundacionis eiusdem castri anno domini millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, X cal. Marcii,
und
Datum in castro Plawe tempore primae fundacionis eiusdem castri anno MCCLXXXVII, II. non Maii.
Das letzte Schloß, von dem der Thurm mit dem übrigen Mauerwerke noch herstammt, ward um die Mitte des 15. Jahrhunderts von Grund aus neu gebauet.
Der ehemalige Weinberg des 16. Jahrhunderts liegt unter Ackercultur auf einer Höhe südlich von der Stadt.



|



|
|
:
|
Die Kirchen zu Waren.
Die Stadt Waren hat 2 Kirchen:
oder die Pfarr=Kirche zu St. Georg, welche einen alten viereckigen Chor und ein oblonges Schiff hat, auf dessen Westende der Thurm steht.
Das Schiff ist im ausgebildeten Spitzbogenstyl, wahrscheinlich noch im 14. Jahrhundert, erbauet, denn die Jahrszahl 1414, welche früher auf einem Steine unten am Thurme gelesen ward 1 ), deutet wohl auf die Fundamentlegung


|
Seite 122 |




|
des Thurmes, nachdem die Kirche schon vollendet war. Viel älter als der Thurm wird aber die Kirche nach dem Baustyl nicht sein. Das Schiff hat ein Mittelschiff und zwei Seitenschiffe. Das Mittelschiff ist hoch, jedoch nicht gewölbt, mit reinen Spitzbogenfenstern in der Höhe über den Seitenschiffen. Die Fester sind an der Außenwand gegliedert und mit Sperberköpfen verziert und von kleinen ähnlichen Nischen, als Darstellung einer Gallerie, begleitet. Die Seitenschiffe sind viel niedriger und gewölbt.
Der Chor aus Feldsteinen, im Uebergangsstyle erbauet, also viel älter als die Kirche, bildet ein Quadrat mit grader, rechtwinklig angesetzter Altarwand, welche drei schräge eingehende, schmale Fenster hat, mit 2 gleichen Fenstern in jeder Seitenwand des Chors und mit einem Rundbogenfriese. Der Chor ist im höchsten Grade baufällig und kaum noch durch starke Pfeiler gehalten.
Das Mobiliar der ganzen Kirche ist ohne Bedeutung und ebenfalls sehr verfallen, wie denn die ganze Kirche, aus welcher, mit Ausnahme des Chors, etwas sehr Gutes gemacht werden kann, ein durchaus unerquickliches Ansehen hat.
oder Marien=Kirche ist der sogenannten alten Kirche ähnlich. Sie hat einen quadratischen Chor aus der Uebergangszeit mit 3 schmalen, schräge eingehenden, leise gespitzten Fenstern in der Altarwand und eben so in jeder Seitenwand. Das Schiff bildet ein Oblongum, ohne Seitenschiffe, aus der Zeit des ausgebildeten Spitzbogenstyls, mit 4 großen Spitzbogenfenstern in jeder Seitenwand.
Die ganze Kirche ist nicht gewölbt, sondern mit
einer flachen, gerohrten Decke bedeckt; sie ist
mit den Goldleisten
 auf dem flachen, weißen Grunde
einem großen, modernen Gesellschaftszimmer nicht
unähnlich. Der Anblick dieser reinlichen
Restauration ist eben so unerfreulich, als der
moderne "schlafmützenähnliche" Thurm.
Die Kirche war schon im J. 1568 bei dem großen
Brande ausgebrannt. Bei einem anderen Brande
1637 brannte sie ganz aus und seitdem blieb sie
wüste liegen, ward dazu im J. 1671 von einem
andern großen Brande wieder ergriffen. Erst
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts dachte
man an ihre Wiederherstellung; im J.
auf dem flachen, weißen Grunde
einem großen, modernen Gesellschaftszimmer nicht
unähnlich. Der Anblick dieser reinlichen
Restauration ist eben so unerfreulich, als der
moderne "schlafmützenähnliche" Thurm.
Die Kirche war schon im J. 1568 bei dem großen
Brande ausgebrannt. Bei einem anderen Brande
1637 brannte sie ganz aus und seitdem blieb sie
wüste liegen, ward dazu im J. 1671 von einem
andern großen Brande wieder ergriffen. Erst
gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts dachte
man an ihre Wiederherstellung; im J.


|
Seite 123 |




|
1740 war sie wieder unter Dach gebracht, hatte jedoch noch keine Fenster und Stühle. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts nahm man die oben berührte Restauration vor, welche im J. 1792 vollendet ward (vgl. Warener Wochenblatt, 1841, Nr. 22).
Für die Geschichte der Stadt sind die beiden Kirchen von großer Wichtigkeit. Sämmtliche Urkunden der Stadt sind nämlich verbrannt und es existiren nur einige derselben in alten Abschriften. Die älteste derselben ist vom J. 1271. Aber nach dem Bau der Chöre beider Kirchen ist die Stadt bei weitem älter, als die ältesten vorhandenen Urkunden. Jene quadratischen Chöre mit den schmalen, schräge eingehenden Fenstern, 3 in der Altarwand und 2 in jeder Seitenwand, mit dem Friese aus halben Kreisbogen, mitunter noch mit rundbogigen Pforten zum Chore und zu andern alten Theilen des Baues, wie zu Neukloster (1219), Güstrow (1226), Plau (1228), gehören im südöstlichen Meklenburg ungefähr der Zeit an, als nach der letzten Bezähmung der Wenden der alternde Borwin I. mit seinen Söhnen gemeinschaftlich regierte, also ungefähr der Zeit von 1218 bis 1227 und etwas später.
Auf jeden Fall wird der Chor der St. Georgen=Kirche zu Waren nicht viel jünger sein, als die ebenso consstruirten Chöre der Kirchen zu Parchim, Plau und Röbel welche ohne Zweifel aus der angegebenen Zeitperiode stammen. Die wenigen Ueberreste an diesem baufälligen Chore sind daher von großem Werthe für die Geschichte der Stadt. Die St. Georgen=Kirche war übrigens die einzige Pfarrkirche der Stadt und es stand an ihr allein ein Pleban oder Pfarrherr (rector ecclesiae s. plebanus d. i. Pastor). Das Patronat gehörte dem Kloster Broda (vgl. Jahrb. III, S. 207) und gehörte zu den ältesten Patronaten des Klosters, woraus sich ebenfalls auf das angegebene Alter der Stadt schließen läßt.
Nicht viel jünger wird der Chor der St. Marien= oder Neuen Kirche sein; der Unterschied dürfte nur wenige Jahre betragen. Sie war in ihrer ältesten Gestalt Hofkapelle der Fürsten von Werle, da sie in der Nähe des fürstlichen Schlosses 1 ) lag (unser lieven frowen capelle bynnen Warne up


|
Seite 124 |




|
der Nienstadt 1458). Das Schiff wird zur Blüthenzeit des werleschen Hauses, als Waren Residenz einer Linie war, also um die Mitte des 14. Jahrhunderts vorgebauet sein.
Ein Kloster hat Waren historisch nie gehabt. Im 15. Jahrhundert hatte es eine Kalandsbrüderschaft; die Kalandsbrüderschaften hatten aber nie eigene Kirchen, sondern nur ein Versammlungshaus, und waren mit ihren religiösen Festen an eine Hauptkirche gebunden. Daß Waren Sitz eines der 5 Archidiakonen des Bisthums Schwerin war, ist bekannt.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Ankershagen 1 )
bei Penzlin ist im hohen Grade interessant, da sie in dem seltenen Style gebauet ist, wie die Kirche zu Schlagsdorf bei Ratzeburg (vgl. Jahresber. VII, S. 63). Die Gewölbe werden nämlich von Pfeilern getragen, welche in der Mitte der Kirche stehen.
Die Kirche besteht aus einem viereckigen Chor und einem breiten, oblongen Schiffe.
Im Schiffe stehen in der Mitte vier Pfeiler, von denen der östlichste zwischen Schiff und Chor, also an der Grenze des Schiffes, steht; diese tragen nach jeder Seite hin 4 Gewölbe, so daß das Schiff mit seinen 8 Gewölben in zwei gleiche Schiffe neben einander getheilt wird.
Es ist aber an der Kirche ein zweifache Bauperiode zu unterscheiden. Der jetzige Zustand ist ohne Zweifel sehr alt; aber es ging diesem offenbar ein älterer vorauf, der noch in die Zeit des Rundbogenstyls fällt. Die eine Hälfte des Pfeilers, welcher zwischen Chor und Schiff steht, ist nämlich ein Säulenbündel, denen in dem Schiffe der Kirche zu Gadebusch (vgl. Jahresber. III, S. 125) ähnlich. Dieses Säulenbündel besteht nämlich aus 4 schlanken Säulen, in deren Zusammenfügungen 4 Säulchen stehen; das ganze Säulenbündel steht auf einer Basis, welche von unten auf aus Platte, Wulst,
 . zu sehen.
. zu sehen.


|
Seite 125 |




|
Platte, Hohlkehle und Platte besteht und sehr sauber profilirt ist. Diese alten Säulen waren sehr hoch und schlank; der letzte eben beschriebene Rest (der hinter der Kanzel, vor dem Altare steht,) ragt noch mit seinem Schafte weit in die jetzigen Gewölbe hinein. Eben so waren die Fenster nach einigen Resten sehr schön gegliedert; auch sie waren sehr hoch, denn die Anfänge ihrer Wölbung stehen jetzt höher als die Kirchengewölbe.
Dies Alles ist aber vernichtet. Man hat die Säulenbündel zu viereckigen Pfeilern umgeschaffen und nur die dem Chor zugewandte Hälfte des östlichsten Säulenbündels in seiner ursprürglichen Gestalt gelassen, die dem Schiffe zugewandte Hälfte aber zum Viereck umgebauet; man hat auf diese Pfeiler Spitzbogengewölbe gebauet und diese viel tiefer angesetzt; man hat endlich nach Westen hin eine andere Abtheilung der Gewölbe genommen und die Pilaster an den Wänden vor die Thüren und Fenstern gesetzt und diese dadurch mehrere Male zur Hälfte vermauert. Dies alles ist noch im strengen Spitzbogenstyle, also in früher Zeit ausgeführt. Der spitze Scheidebogen des Chors zwischen Chor und Schiff ist ebenfalls östlich vor den ersten Säulenschaft gesetzt. Diese unerhörte, beispiellose Umbauung des Innern der Kirche ähnelt der Verbauung des Aeußern der Kirche zu Klütz (vgl. unten).
Der quadratische Chor ist in sich regelrecht und alt, aus der Zeit des Uebergangsstyls, mit zwei schmalen, schräge eingehenden, leise gespitzten Fenstern in der Altarwand, ist also offensichtlich in sehr früher Zeit vor den Rundbogenbau vorgebauet, da er vor das Säulenbündel gelegt ist. Die Rippen des Chorgewölbes verlaufen sich zur Erde hin in eine mit zwei Flächen eines dreieckigen Prismas hervorstehende Rippe, welche an der Stelle des Kapitals abgekantet und durch einen kleinen Würfel mit den Rippen vermittelt ist (vgl. unten das Schiff der Kirche zu Schlön). Daß nur 2 Fenster in der Altarwand stehen und gestanden haben, beweiset, daß man sich des Styls nicht mehr klar bewußt war.
Unter dem angesetzten Thurmgebäude führt eine halb verbauete, schön geformte Pforte im strengen Spitzbogenstyle mit 3 Ecken und 3 Wulsten in die Kirche.
Der Altar besteht aus ziemlich gutem Schnitzwerk aus dem Ende des 15. Jahrh. In der Mitte steht ein Marienbild in Kranz und Glorie. Unten knieen die Schenker, Mann und Frau, die Frau mit dem Rohrschen oder Kirchbergschen (Karberg) Wappen; der Schild des Mannes, eines Ritters,


|
Seite 126 |




|
ist nicht mehr erkennbar. Zu den Seiten des Marienbildes stehen Heiligenbilder.
Hinter dem Altare ist der Rest einer Darstellung der Dreieinigkeit von sehr alter und guter Schnitzarbeit angenagelt: Gott der Vater hält Gott den Sohn am Kreuze vor sich. Der obere Theil von Gott dem Vater und die Taube des Heiligen Geistes fehlen jetzt. Gott der Vater sitzt auf einem Stuhle mit graden Seitenlehnen, in dessen Vorderseiten ein schmaler Spitzbogen geschnitzt ist und auf denen 2 Löwen stehen. Auf einem solchen Sessel mit denselben eingeschnitzten Spitzbogennischen sitzen um das Jahr 1300 die Bischöfe auf ihren großen Siegeln, z. B. der schwerinsche Bischof Gottfried von Bülow (1300), in dessen Zeit oder etwas später diese alte Arbeit fallen dürfte.
Außerdem finden sich Epitaphien und Wappen der von Holstein, deren altes Lehn Ankershagen war, in der Kirche.
Der Bau der Kirche wird noch interessanter durch die darüber vorhandenen Urkunden. Die älteste Kirche, von der nur noch ein halber Säulenschaft und ein halbes Fenster vorhanden ist, fällt ohne Zweifel in die ersten Zeiten des Christenthums in Meklenburg und mag eine der frühesten Stiftungen des Klosters Broda (wohl noch aus dem 12. Jahrhundert) gewesen sein, welches das Patronat über diese Kirche hatte. Der Fürst Nicolaus von Werle versicherte nämlich in einer Urkunde vom 23. April 1273 dem Kloster das Patronat der Kirche (mit 4 1/2 Hufen), welche das Kloster seit der Einführung des Christenthums besessen habe (ecclesiam in Ankershagen, quam ecclesia Brodensis a prima plantatione 1 ) tenuit: Jabrb. III, S. 219; vgl. S. 27 u. 32). - Nach einer vom Herrn Pastor Sponholz zu Rülow im Allgem. meklenb. Volksbuch, 1842, S. 13 mitgeteilten Urkunde aus dem Archive des Klosters Broda zu Neu=Strelitz, weihete der Bischof Heinrich von Havelberg am 1. Mai 1266 die "neu gegründete Kirche" zu Ankershagen, welche der Ritter Eckhart von Anker mit 2 Hägerhufen dotirt habe und welche Filial der (nicht mehr existirenden) Pfarre Freidorf sein solle. Diese Bewilligung des competirenden Bischofes: "daß im Dorfe Ankershagen eine Kirche neu gegründet (in der Original=Urkunde wahrscheinlich: "de novo fundanda") werde", deren "Altar" der Bischof geweihet habe, deutet


|
Seite 127 |




|
ohne Zweifel auf den innern Umbau der Kirche, wenigstens auf den Anbau des Chors, der auch schon vor das alte Säulenbündel vorgesetzt ist. Die alte Kirche war aber wahrscheinlich nicht so groß, als die jetzt noch stehende, da diese zu den größern Landkirchen Meklenburgs gehört, wie die Pfarre eine der reichsten im Lande ist.
Die Kirche zu Schwinkendorf.
Die Kirche zu Schwinkendorf bei Malchin schließt sich im Baustyl an die Kirche zu Ankershagen, indem sie dieselbe seltene Bauart hat. Sie war schon am Ende des 13. Jahrhunderts eine der älteren Kirchen der Gegend. Die Kirche besteht aus einem oblongen Schiffe und einem quadratischen Chore. Der Chor ist der ältere Theil; er ist mit Einem großen Gewölbe bedeckt. Obgleich die Fenster der Kirche sehr verbaut sind, so ist es doch unbezweifelt, daß jede der drei Seiten 3 schmale Fenster aus dem Uebergangsstyle hatte. Das Schiff ist ebenfalls gewölbt und zwar mit 6 Gewölben, an jeder Seite 3. Das Ausgezeichnete der Kirche besteht nun darin, daß die 2 Säulen, welche die Gewölbe tragen, in der Mitte des Schiffes stehen, wie in der Kirche zu Ankershagen (und zu Schlagsdorf bei Ratzeburg). Die Gewölbe sind sehr scharfe und spitze Sterngewölbe und die Säulen sind den Gewölberippen entsprechend geriefelt.
Die Kirche besitzt zwei Leichensteine:
1) des Dietrich von dem Werder, † 1589, mit dem sehr erhabenen Reliefbilde des Verstorbenen;
2) des Otto Hahn auf Hinrichshagen, † 1596. Sonst hat die Kirche nichts Merkwürdiges.
Die Kirche zu Schlön 1 )
bei Waren, an die Pfarre Ankershagen grenzend, hat, wie diese, ebenfalls einen merkwürdigen Bau. Die Kirche besteht aus Chor, Schiff und Thurm von gleicher Breite.
Der älteste Theil der Kirche ist das Schiff, welches im Uebergangsstyl aufgeführt ist. Das ganze Schiff bildet ein großes Viereck, welches mit einem einzigen hohen und


|
Seite 128 |




|
schönen Gewölbe bedeckt ist. Dieses Gewölbe wird von einem schlanken, achteckigen Pfeiler getragen, der in der Mitte der Kirche unter dem Schlußstein des Gewölbes steht. Nach dem Ansehen des Ganzen könnte dieser Pfeiler zum Grundplan der Kirche gehören und ursprünglich sein; er erinnert an die Pfeiler der Kirche zu Ankershagen, welche in der Mitte der Kirche stehen und die Gewölbe tragen, und hat zu seinen Umgebungen etwas Eigenthümliches, das keineswegs sehr stört. Dennoch wird der Pfeiler in jüngern Zeiten zur Erhaltung des Gewölbes untergebracht sein. Denn nachdem die Kirche im J. 1628 abgebrannt war, stand sie über 25 Jahr wüste und ward erst um 1662 unter Strohdach gebracht, damit sie nicht ganz untergehe. Dennoch klagte man noch bis 1673 Jahre lang über die Baufälligkeit des "feinen Gewölbes", das den Einsturz drohe. Der Bau stammt ohne Zweifel mit dem Chor der Kirche zu Ankershagen aus derselben Zeit und von demselben Baumeister, denn die Gewölberippen verlaufen sich hier im Schiffe genau so, wie dort im Chor. In der Südwand des Schiffes stehen drei schmale, schräge eingehende Fenster aus der Zeit des Uebergangsstyls, mit einem Wulste in der äußern Ecke, das mittlere ist höher als die beiden andern; alle drei sind im Innern und Aeußern durch schöne Pilaster und Reliefbogen zu einem Ganzen verbunden. Die Fenster an der Nordseite sind vermauert. In gleichem Styl ist die Pforte am Westende der Südwand aufgeführt.
Der viereckige Chor ist im ausgebildeten Spitzbogenstyl erbauet, in jüngern Zeiten vorgesetzt und mit einem rundbogigen Gewölbe, ohne Zweifel einem Werke jüngerer Zeit, bedeckt. In jeder der drei Wände des Chors befindet sich ein dreigetheiltes, weites Spitzbogenfenster. Unten an der östlichen Ecke der Nordwand ist ein großer Mühlstein aus blaugrauem Granit und oben an der östlichen Ecke der Südwand ein kleiner Mühlstein aus röthlichem Granit bei der Aufführung des Gebäudes eingemauert. Nach der Sage soll ein Müller zu Plasten den Chor haben erbauen und diese Mühlsteine zum Andenken mit einmauern lassen.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Groß=Gievitz
bei Waren, an die Pfarre Schlön grenzend, ist im Uebergangsstyle erbauet. Der Chor hat in der graden Altarwand 3 schmale, schräge eingehende Fenster aus der Zeit des Uebergangsstyls und in der Südwand eine Rundbogenpforte aus Granit mit Pilastern, genau so wie die Chorpforte der Kirche zu Plau.


|
Seite 129 |




|
Die Seitenfenster des Chors, welche jetzt verbauet sind, wurden von großen, weitbogigen Wulsten eingefaßt. Das Schiff hat an jeder Seite 3 Fenster von gleicher Bauart, welche jetzt verbauet sind, und in der Südwand eine gleiche Pforte aus abwechselnd rothen und schwarz glasurten Ziegeln.
Der Chor ist mit einem jüngern rundbogigen Gewölbe ohne Rippen überdeckt, das Schiff, welches durch starke Scheidebogen in zwei Gewölbe geteilt ist, hat ebenfalls rundbogige Gewölbe, wie Tonnengewölbe, mit an die Seitenwände gelehnten Rippen, welche in den Ecken auf ausgehauenen flachen Menschenköpfen stehen.
Das große Thurmgebäude hatte früher auch ein
Gewölbe und zwei Fensterpaare von gleicher
Construction, wie die Fenster der Kirche.
Außerdem hat das Thurmgebäude innerhalb der
Ringmauern im Westende noch eine Vorhalle mit
einem Sterngewölbe, dessen Rippen sich in der
Mitte an einen Kreis setzen (vgl. die Kirche zu
Ruchow
 . Jahresber. VI, S. 88), und eine
Eingangspforte mit schön gebildeten Pfeilern an
der Seite.
. Jahresber. VI, S. 88), und eine
Eingangspforte mit schön gebildeten Pfeilern an
der Seite.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Grubenhagen,
ohne Zweifel eine Stiftung der Familie Grube, und demnächst seit dem 14. Jahrhundert der Familie Maltzahn gehörig, ist ganz von Feldsteinen im Uebergangsstyle gebaut und hat namentlich in der Altarwand die schmalen, leise gespitzten Fenster mit den schräge eingehenden, ungegliederten Wänden.
Die Kirche hat viele maltzahnsche Epitaphien und Wappen und eine maltzahnsche Familiengruft, aber außer dem Folgenden nichts Altes mehr von historischer Bedeutung.
In der Mitte der Kirche liegen zwei Leichensteine, Auf dem einen ist ein Ritter im Harnisch mit Schwert neben einer Frau unter einer Nische dargestellt, mit der Inschrift:
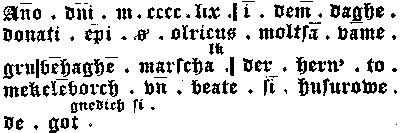
(= Anno domini MCCCCLIX in deme daghe Donati episcopi (Aug. 7) obiit Olricus Moltsan vamme Grubenhaghen, marschalk der heren


|
Seite 130 |




|
to Mekelenborch, vnle Beate sin husvrowe, de got gnedich si.)
Zu den Füßen des Ritters steht das maltzahnsche Wappen, zu den Füßen der Frau das Wappen der von Viereck (3 Jagdhörner).
Unmittelbar neben diesem Steine liegt ein anderer, ähnlicher, der aber so sehr ausgebrochen ist, daß im Zusammenhange nur der Anfang gelesen werden kann:
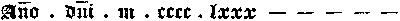
Vor dem Altare liegt ein Leichenstein mit dem Relief=Bilde einer Matrone mit der Inschrift:
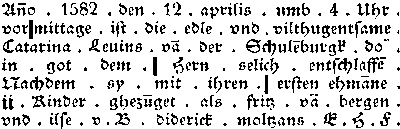
Ueber dem Haupte des Bildes steht ein Bogen mit der Inschrift:
CHRISTUS IST MEIN LEBEN . STERBEN IST MEIN GEWIN . RO . XI .
An den Ecken stehen vier Wappen und über dem Haupte 3 Wappen mit folgenden Beischriften:
| D. V. D. | D. | |
| SCHULENBURGK. | VON QUlTZOW. | |
| VICKE | CATRINA | CHRISTOFFER |
| V. B. | V. D. S. | M. |
| (Wappen der | (Wappen der | (Wappen der |
| vom Berge.) | v. d. Schulenburg.) | von Maltzahn.) |
| D. | D. . | |
| ROHR. | V. ARNIM. |
Das Wappen des Vicke vom Berge ist ein Schild mit 3 gewässerten Ouerbändern und 2 Hörnern auf dem Helme.



|



|
|
:
|
Die Kirche und das Kloster zu Dobbertin.
Die Kirche zu Dobbertin, deren Aeußeres bekanntlich gegenwärtig in reich verziertem Spitzbogenstyl restaurirt wird und einen ganz neuen Mantel erhält, fordert deshalb zu schärferer Betrachtung auf. Das Aeußere der alten Kirche mit dem grauen Abputz hat nichts Merkwürdiges, sondern die Gestalt des gewöhnlichen, sehr einfachen Spitzbogenstyls. Das Innere ist dagegen merkwürdiger. Die Kirche ist ein sehr langes Ob=


|
Seite 131 |




|
longum, ohne Seitenschiffe und Kreuzschiffe, mit dreiseitig abgeschnittener Altarnische, wie in der Regel die Spitzbogenkirchen. Die ganze Kirche ist gleichmäßig gewölbt und ziemlich hoch. In der westlichen Hälfte befindet sich in der Höhe seit alter Zeit eine Empore oder ein oberer Nonnenchor, der noch jetzt eingerichtet ist und vor welchem nach der Kirche hin die Kirchenstühle der Conventualinnen angebracht sind. Dieser obere Chor wird von einer Doppelreihe niedriger Gewölbe getragen, welche in der Mitte auf Pfeilern ruhen. Dieses untere Gewölbe in der Kirche, mit seinen Pfeilern in der Mitte, ist in hohem Grade interessant; es erscheint wie eine Krypte oder Gruftkirche, welche freilich mit der Kirche in gleicher Höhe liegt und nach dem Altare hin geöffnet ist. Gegenwärtig ist es 3 Gewölbe lang; früher hatte es eine Länge von 5 Gewölben und war in sich abgeschlossen, wie noch die nach innen hin gerichteten Gewölbeträger, wie am Westende der Kirche, beweisen. In den Seiten=Wänden stehen jetzt 5 niedrige Bogen; diese führten ehemals in Seitenschiffe, wie noch die nach der Nordseite weiter hinausgehenden Fensternischen beweisen, an deren Rückseite man noch die Ansetzung der Gewölbe und die äußern Verzierungen der Hauptgurtbogen erkennt. Das Ganze bildete also einen in sich abgegrenzten Raum von 5 Doppel=Gewölben, an deren Ende noch ein Raum zu einem Gewölbe vorhanden ist, an den sich dann der Chor schließt. Die Pfeiler, welche, in der Mitte stehend, die niedrigen Gewölbe tragen, sind kurze Granitpfeiler mit hohen Basen und Kapitälern. Ausgezeichnet sind die ehemaligen Bogen, die zu den Seitenschiffen führten und welche die Gewölbe an den Seiten tragen. Dies sind sehr starke, sehr niedrige, reich gegliederte und sehr reich mit Laubwerk verzierte Pfeiler, auf denen die alten Hauptgurtbogen in einem sehr ernsten und würdigen Spitzbogen aus der frühesten Zeit desselben stehen. Ohne Zweifel ist dies ein sehr alter Bau, in seiner Art wohl einzig in Meklenburg, und stammt wohl aus der frühesten Zeit des Klosters, welches zur Zeit der Borwine 1 ) ursprünglich für


|
Seite 132 |




|
Mönche gegründet ward; dazu paßt es auch, daß die Südseite der Kirche, so weit dieser Unterbau geht, außen keine Strebepfeiler hat. Wahrscheinlich ist dieser Unterbau die älteste Kirche selbst, welche vielleicht an der Ostseite eine Altarnische hatte, oder der Unterbau mit seinen ehemaligen Seitenschiffen war für eine viel größere, vielleicht für eine große Kreuzkirche angelegt. In spätern Zeiten, etwa im 14. Jahrhundert, bauete man einen großen Chor mit 3 Fenstern an jeder Seite und 1 Fenster hinter dem Altare an, wie es an der Anfügung ziemlich deutlich gesehen werden kann, führte die Seitenwände über den Unterbau auf und überwölbte alles in gleicher Höhe. Dieser ganze neuere Bau der Hochkirche ist überall gleichförmig und im gewöhnlichen Spitzbogenstyl des 14. Jahrhunderts ohne viel Schmuck ausgeführt. - Der Unterbau aber verdient für die Geschichte der Baukunst die höchste Aufmerksamkeit.
Der Kreuzgang, welcher viereckig ist und einen inneren Hof einschließt, ist mit einer Ecke an die Südwestecke der Kirche angebauet, hat also nur Einen Eingang in die Kirche. Die beiden Gänge am Westende der Kirche dem obern Chore zunächst sind im Rundbogenstyl, die beiden andern Gänge im Spitzbogenstyl gewölbt. Der östliche Gang hat runde Gewölbe mit tief herabgehenden Rippen und mit viereckigen Schlußsteinen und eine mit einem Wulst rund gewölbte Pforte, welche in den innern Hof führt. Der nördliche Gang ist ebenfalls rund gewölbt und von runden, auf breiten Pilastern ruhenden Scheibebogen an den Enden begrenzt; die Rippen gehen nicht so tief hinab, wie in dem östlichen Gange. Der südliche Gang ist im hohen, ausgebildeten, schönen Spitzbogenstyl ausgeführt; die Gewölbeträger stehen hoch und sind mit kräftig ausgebildetem, verschiedenartigem Laubwerk, wie Weinlaub, Eichenlaub, Lilien, bedeckt; die runden Schlußsteine sind mit verschiedenartigen Rosetten und mit Laubwerk verziert:
 . Das Nonnenkloster scheint
also erst durch die Confirmation des
Bischofs Brunward vom J. 1238 zur
Wirklichkeit gelangt zu sein.
. Das Nonnenkloster scheint
also erst durch die Confirmation des
Bischofs Brunward vom J. 1238 zur
Wirklichkeit gelangt zu sein.


|
Seite 133 |




|
dieser Gang verdient ebenfalls Beachtung und läßt sich in Meklenburg nur mit dem Kreuzgange von Zarrentin vergleichen (vgl. Jahresber. IV, S. 85). Der westliche Gang ist im gewöhnlichen, nicht kühnen Spitzbogenstyl ausgebildet und hat eine Spitzbogenpforte zum innern Hofe.



|



|
|
:
|
Stadt und Kloster Malchow
besitzen gar nichts von antiquarischem oder artistischem Werthe.
Die Stadtkirche ist ein ganz neues Gebäude.
Die Klosterkirche ist unbedeutend: ein oblonges Schiff mit einem oblongen Chor aus Feldsteinen, ohne Seitenschiffe und Gänge, ohne Pfeiler und Wölbung, ohne architectonischen Schmuck. Das einzige Bemerkenswerthe sind die 3 ohne Gliederung schräge eingehenden schmalen Fenster aus der Zeit des Uebergangsstyls in der graden Altarwand. - Das Innere ist in den letzten Jahrhunderten im Renaissancestyl nicht geschmackvoll aufgeputzt. Von dem Kreuzgange steht ungefähr noch die Hälfte in den Grundmauern, jedoch ohne architectonische Eigenthümlichkeiten, vielmehr schon mit Gebälk überlegt und modernisirt.
Wo die alte wendische Burg Malchow gelegen hat, ob an der Stelle der Stadt oder des Klosters oder anderswo, ist wohl schwer zu bestimmen. Ungefähr eine Viertelstunde östlich von Malchow, auf einem Vorsprunge des laschendorfer Feldes in den malchower See, der Stadt rechts und dem Kloster links grade gegenüber, steht ein mit einem erhöheten Rande umgebener, jedoch nach der Seeseite geöffneter Wall, von der gewöhnlichen Größe und Höhe alter Burgplätze, mit einigen niedrigen Vorplätzen, an einer Seite vom See, sonst rings von Wiese und Moor umgeben. Dieser Wall, der von dem Volke "Wiwerbarg" (Weiberberg), von den Gebildeten Werleburg, auch wohl Pritzburg genannt wird, weil hier der erste Pritzbur mit dem Fürsten Wartislav von Heinrich dem Löwen gehenkt sein soll, könnte noch von der alten Burg Malchow stammen, jedoch finden sich nicht jene zahlreichen Gefäßscherben und Strohlehmstücke, welche sonst die alten Burgwälle erkennen lassen.
Glaublicher ist es, daß das Kloster an der Stelle der ehemaligen Burg steht, wie öfter Klöster auf oder bei alten Burgstellen von den Fürsten errichtet wurden, schon deshalb, weil dieselben disponibles Eigenthum der Fürsten waren, wie z. B. Neukloster und Dargun. Denn als der Fürst Nikolaus von Werle im J. 1298 das Kloster von Röbel nach Malchow verlegte, gestattete er den Nonnen, sich bei der Kirche von Alt=Malchow das neue Kloster


|
Seite 134 |




|
zu bauen (se transferentes apud ecclesiam antiquae Malchow - se locantes claustrum aedificent). Dieses alte Malchow ist gewiß die alte Burg Malchow und von der Altstadt Malchow neben der Neustadt auf dem gegenüberliegenden Ufer verschieden. Aus dieser Erlaubniß geht aber auch hervor, daß schon vor der Erbauung des Klosters daselbst eine Kirche stand und daß, wenn auch das Schiff später angebauet sein sollte, der jetzt in seinen Gliederungen nicht mehr ganz klare Chor aus einer frühen Zeit, vielleicht noch aus den Zeiten des Uebergangsstyls in Meklenburg stammt, da die Stadt Malchow schon im J. 1235 Stadtrecht erhielt.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Lübz
ist ein großes, regelmäßiges Oblongum, ohne irgend eine Abweichung von dieser Grundform und ohne einen An= oder Ausbau, ohne Strebepfeiler und Gewölbe, mit vier großen, weiten Fenstern an jeder Seite und einem hinter dem Altare. Die Kirche stammt aus dem Ende des 14. Jahrhunderts, da die Stadt erst seit 1370 existirt, und ist in baulicher Hinsicht durchaus nicht der Erwähnung werth.
Die Stadt Lübz hat aber ein geschichtliches Interesse als Wittwensitz zweier ausgezeichneter Fürstinnen: der Herzogin Anna Sophie, Gemahlin des Herzogs Johann Albrecht I., (1576 - 1591), und der Herzogin Sophie, Gemahlin des Herzogs Johann, (1592 - 1634). Und hierauf bezieht sich manches Denkmal in der Kirche. Zu beiden Seiten des Fensters hinter dem Altare stehen in der Höhe über dem Altare an jeder Seite 3 Bilder in Lebensgröße auf Leinewand gemalt: nämlich links (von dem Beschauer) die Bilder des Herzogs Johann Albrecht I. († 1576), seiner Gemahlin Anna Sophia († 1591 zu Lübz) und des Herzogs Johann († 1592), rechts die Bilder der "Fürstin Sophie, geb. von Schleswig=Holstein († 1634 zu Lübz), des Herzogs Adolph von Schleswig=Holstein († 1586) und der geb. Landgräfin Christine von Hessen († 1604)", der Eltern der Herzogin Sophie zu Lübz, Gemahlin des Herzogs Johann. Die Bilder links beziehen sich theilweise auf das Witthum der Herzogin Anna Sophie, die Bilder rechts auf das Witthum der Herzogin Sophie. Die Bilder rechts sind ziemlich gut erhalten; das Bild der Christine ist ohne Namen und Jahrszahl, jedoch durch das darüber stehende Wappen bestimmt. Die Bilder links sind aber sehr mitgenommen. Das Bild des Herzogs Johann Albrecht I., mit der Jahrszahl 1574, hat mehere Risse; von dem Bilde der Horzogin Anna Sophie, mit derselben Jahrszahl, ist nur


|
Seite 135 |




|
noch ein Fetzen mit Stirn und Augen vorhanden; das seltene Bild des Herzogs Johann ist fast ganz von der Leinewand abgefallen, so daß sich wohl kaum eine Copie davon nehmen läßt.
Ueber diesen Bildern steht an jeder Seite die Abstammung oder "Herkunft" der Fürstinnen, in Schilden aus gebranntem Thon, auf welche die Wappen von 5 Geschlechtern gemalt sind; darunter stehen die Namen. - Das große Fenster hinter dem Altare, zwischen den beiden Genealogien, ist ganz mit ovalen, gemalten Wappen aus der Abkunft der Herzogin Sophie geschmückt.
Hinter dem Altare, unter dem Fenster, steht ein marmornes Monument der Herzogin Sophie. Unter einem von 4 röthlichen Säulen getragenen Gebälk knieet auf einem Unterbau die Herzogin Sophie in Lebensgröße, Kopf und Hände aus weißem, das übrige aus schwarzem Marmor: eine ungemein kräftige, ausdrucksvolle Gestalt, wie das viel bewegte Leben der seltenen Frau. Hinter ihr knieet, in gleicher Ausstattung, ihre unvermählt gestorbene Tochter Anna Sophie ? († 1648). Der Raum zwischen den beiden Säulen vor ihr ist leer und hat eine Inschrift auf ihre während der wallensteinschen Zeit geborne und gestorbene Enkelin, Hedwig (1630 † 1631 zu Lübz), des Herzogs Adolph Friederich Tochter.
Das fürstliche Begräbniß ist wahrscheinlich vor dem Altare und jetzt theilweise von dem Taufsteine bedeckt. Hier ist eine Stelle mit einem weichen, bläulichen Kalkgusse bedeckt, in welchen an der einen Seite das meklenburgische Wappen in farbigen Kalkmassen eingelassen ist; das andere Wappen daneben ist nicht erkennbar. Da die Herzogin Anna Sophie neben ihrem Gemahle im Dome zu Schwerin ruht, so wird dies das Begräbniß der Herzogin Sophie und ihrer Tochter Anna Sophie sein.
Altar, vom J. 1574, Taufstein, Kanzel und Orgel haben keinen architectonischen Werth.
Außerdem hat die Kirche mehrere Epitaphien und Begräbnisse adelicher Familien und von Pfandträgern und Hauptleuten des Amtes Crivitz, z. B. folgende:
a. ein Epitaphium auf Heinrich von Stralendorf auf Goldebee, Hauptmann zu Lübz, von den Brüdern Adolph Joachim von Stralendorf, Kaiser Ferdinands II. Rath und Kämmerer, und Johann Albrecht von Stralendorf gesetzt "anno Christi XXX";
b. ein Epitaphium auf Hans Friederich von Lehsten, Landrath, auf Wardow und Dölitz, 1666 gesetzt, mit den Wappenschilden seiner Ahnen;


|
Seite 136 |




|
c. ein großes, glänzendes Epitaphium auf Christian von Bülow, königl. dänischen Kammerherrn und General=Adjutanten, Pfandherrn der Aemter Lübz und Crivitz, † 10 Oct 1692 zu Rostock.
Dieser Christian von Bülow ruht in dem von bülowschen Grabgewölbe vor dem Altare in einem sehr reichen zinnernen Sarge; außer diesem stehen in diesem Gewölbe noch viele zinnerne und hölzerne Särge mit Leichen aus der Familie von Bülow.
Auf diese Begräbnisse und die Ehrendienste und Pfandschaften in dem Witthumsamte beziehen sich auch die vielen, kleinen, gemalten Wappen aus dem 17. Jahrhundert, mit denen die großen Fenster gefüllt sind. Die zahlreichen Wappen der Familien von Maltzan, von Bülow, von Stralendorf, von Thun füllen fast ganze Fenster.
Neben dem Altare steht noch ein geschnitztes Chor ohne Zeichen, wahrscheinlich der Kirchenstuhl der Herzoginnen.
Das Amt Lübz
hat manche Ueberreste früherer Anlagen.
Ungefähr tausend Schritte vom Amte stromaufwärts liegt in einer großen Wiesenfläche an jeder Seite der Elde ein nicht sehr ausgedehnter Wallberg von ungefähr 16' Höhe, mit niedrigen Vorburgplätzen an jeder Seite. Dies ist wahrscheinlich die alte Eldenburg, aus welcher Lübz entstand.
Von dem mittelalterlichen Schlosse steht nur noch ein runder Thurm, wahrscheinlich derselbe, den der Herzog Heinrich der Friedfertige im Jahr 1509 durch den Baumeister Andreas Techel bauen ließ; vgl. Anlage und Jahrbücher V, S. 48, Note 4. Das Aeußere hat zwei Stockwerke, von denen das obere von durchschneidenden Halbkreisen, das untere durch treppenförmige Consolen abgegrenzt ist. Das Aeußere ist kräftig und hübsch. Das Innere hat 4 Gewölbe über einander. Das oberste Gemach, welches wohl zu einem Erholungssaale diente und zu welchem von der Höhe eines andern Gebäudes ein Gang führte, hat ein eigenthümliches, sehr schönes und kräftiges Gewölbe, in Form eines Sterns, der ganz aus kräftigen, dreiseitigen Rippen besteht, die noch mit gefälliger Malerei auf Kalkgrund bedeckt sind. Ein Kamin und weitere Fensteröffnungen zeichnen dieses Stockwerk aus.
Die untern Gewölbe sind alle durchbrochen, um das Gewicht der Stadtuhr durchzulassen, welche in diesem Thurme angebracht ist. Die große Glocke ist von der Herzogin Sophie 1602. Die kleinere Glocke hat die Inschrift:


|
Seite 137 |




|
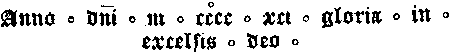
Zwischen den Worten stehen, wie es scheint, Abdrücke von Münzen, die nicht mehr zu erkennen waren.
Das jetzige, vor ungefähr 100 Jahren aufgeführte Amtshaus steht auf den Fundamenten des alten Schlosses der Herzogin Sophie. Es sind aber alle Gedächtnißtafeln des alten Baues in diesen neuen Bau aufgenommen. An der Vorderseite sind 2 Tafeln mit Inschriften eingemauert; links:
VON GOTTES GNADEN SOPHIA [GEB. ZU] SCHLESWICK HOLSTEIN HER[TZ]OGIN ZU MECKLENBURG, FUR[STIN] ZU WENDEN, GRE[FIN] ZU [SCHWERIN] DER LANDE ROSTOCK UND STARGARD FRAW WITTWE. ANO. 1605.
rechts:
VON GOTTES GNADEN JOHANS HERTZOGK ZU MECKLENBURG, FÜRST ZU WENDEN, GRAF ZU SCHWERIN, DER LANDE ROSTOCK UND STARGART HERR.
An der Hinterseite stehen zweimal, rechts und links, das fünfschildige meklenburgische und das holsteinsche Wappen, und an den Ecken Laubverzierungen, sehr hübsch aus Stein gehauen. Die Wetterfahnen tragen noch dieselben Wappen. Eine eiserne Thür im Thurme hat dasselbe aus Eisenblech auch sehr hübsch getriebene meklenburgische Wappen.
Contract der Herzoge Heinrich und Albrecht mit dem Maurermeister Andreas Techel über den Bau des Thurmes am Schlosse zu Lübz.
Zu wissenn das wir Heinrich vnnd Albrecht
gebruder vonn gots gnadenn hertzogenn zu
Meckelnborg, Furstenn zu Wendenn, Grauenn zu
Swerin
 . vnns mit Andresen Techell
murmeister voreinigt vnnd vordragenn haben, alzo
das er auff mitfastenn nestuolgend zu Luptze vff
vnsers amptmans daselbst ansukent sol irscheinen
vnnd geschickt sein, an gemeltem Sloes einen
neuen Thurm anzufahenn, denselbenn zehen fueß
dick vnnd dreyer Rutten hoch nach seinem
hochstenn vleis den Sumer vber mit einem gewelbe
auffzurichtenn vnnd zu mauren, auch
. vnns mit Andresen Techell
murmeister voreinigt vnnd vordragenn haben, alzo
das er auff mitfastenn nestuolgend zu Luptze vff
vnsers amptmans daselbst ansukent sol irscheinen
vnnd geschickt sein, an gemeltem Sloes einen
neuen Thurm anzufahenn, denselbenn zehen fueß
dick vnnd dreyer Rutten hoch nach seinem
hochstenn vleis den Sumer vber mit einem gewelbe
auffzurichtenn vnnd zu mauren, auch


|
Seite 138 |




|
alle maur vnnd denstknecht, so er darzu bedarff,
selbst zu haltenn vnnd zu uorlonen, darkegenn
sollen wollen vnnd wir ehme sybentzig guldenn
vnd eyn erlich vnnd zymlich kleyt vorreichen
vnnd ehme vnnd all sein knechtenn essenn,
trincken vnnd freye herberge sampt den betten
vorschaffen vnnd das fundament des Thurms auff
vnnser kost machenn vnnd alles, was man von
kalck vnnd Stein zu solchem Bawe bedorffenn
wirt, auffs allernest so es geschen mag zu der
Maurstat vnd ehme vnd sin knecht, wen es ehme
not ist, hin vnd hir weder bey vnser fur furen
vnd schicken lassen, Das ich berurter meister
Andreas alle wie berurt ist fur gemelte Sum
gelts vnnd ein kleit den Sumer vber alzo zu thun
vnnd zu uorbrengen angenomen vnd bewilliget
habe, getreulich vnnd vngeferlich, mit vrkunt
dis breues, der zwen gleichs lauts gemacht vnd
auseinander gesniten vnnd eim itzlichen dheil
einer vberandwort vnd geben sint zu Luptze am
Dinstag nach Conuersionis Pauli Anno
 nono.
nono.
Nach dem Concept im großherzogl. Archive zu Schwerin.



|



|
|
:
|
Ueber die Kirchen des Klützer=Orts
von
G. C. F. Lisch.
Die Untersuchungen über kirchliche Bauwerke aus der Zeit des byzantinischen oder Rundbogenstyls in Meklenburg (vgl. Jahresber. VII, S. 59 ff.) gaben das Resultat, daß dieser Styl vorzüglich von den Domen zu Ratzeburg und Lübeck ausgegangen, und zumeist in deren Nähe zu suchen sei, sich dagegen gegen Osten hin immer mehr verliere und im östlichen Meklenburg schwerlich ein Bauwerk dieses Styls aufzufinden sein dürfte. In die Zeiten des Ueberganges, nach der endlichen Beruhigung der Wenden um das J. 1218, fallen noch die Klosterkirche zu Neukloster (1219) und die Collegiatkirche zu Güstrow (1226). Hiemit scheint die Ausbreitung dieses Baustyls abgeschlossen zu sein.
Die Kirchen an der Stätte und in der Nähe der alten Residenzen und Bischofssitze im nordwestlichen Meklenburg (denn im südwestlichen Meklenburg lebte noch Jahrhunderte lang das Wendenthum und fand nur allmählig christliche Cultur Eingang) waren erforscht und es waren interessante Entdeckungen gemacht. Nur die Kirchen an der nordwestlichen Ostseeküste, zunächst an Lübeck, in den Ländern Dassow, Klütz und Bresen, welche jetzt wohl mit dem allgemeinen Namen des Klützer=Orts (= Klützer=Ecke) bezeichnet werden,


|
Seite 139 |




|
schienen noch der Aufmerksamkeit werth, da sie, im Bisthume Ratzeburg liegend, schon früh vorkommen, so lange auch der Wald Klütz (silva Clutze), wie diese Gegend in alter Zeit heißt, gestanden haben mag.
Der Verein beschloß also noch eine Nachforschung in diesen Gegenden. Sie ist nicht unbelohnt geblieben, indem zu Klütz noch eine Kirche im reinen Rundbogenstyl, zu Grevismühlen eine Kirche mit klar ausgebildeten Resten dieses Styls, zu Proseken eine Kirche aus der Uebergangsperiode, zu Dassow ein Granitbau aus der ersten Zeit des Spitzbogenstyls entdeckt ist.
Das Nähere wird die folgende Beschreibung ergeben.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Klütz.
Die Kirche zu Klütz ist in ihrer jetzigen Gestalt eins der merkwürdigsten alterthümlichen Gebäude Meklenburgs und für die Kunstgeschichte des Landes von entschiedener Bedeutung.
Es wird zur klaren Erkenntniß einmal angemessen sein, das Bauwerk in seiner ursprünglichen Gestalt zu beschreiben und alle Veränderungen und Verunzierungen an demselben nach der Beschreibung aufzuzählen.
Die Kirche besteht aus einem oblongen Schiffe, einem Chor im Osten und einem Thurmgebäude im Westen.
Das Schiff ist eins der ältesten und würdigsten Gebäude Meklenburgs. Es ist im reinen Rundbogenstyl erbaut und schließt sich zunächst an das Schiff der Kirche zu Gadebusch, welches aus derselben Zeit, nämlich ohne Zweifel aus dem 12. Jahrh. (vgl. Jahresber. III, S. 125 u. VII, S. 65), stammt und mit der Kirche zu Klütz gleiche Schicksale gehabt hat. Das Schiff der Kirche zu Klütz besteht wie das gadebuscher Schiff aus einem Mittelschiffe und zwei gleich hohen, jedoch etwas schmälern Seitenschiffen, jedes von 3 Gewölben bedeckt; das Schiff hat also im Ganzen 9 Gewölbe. Die Gewölbe werden von 4 frei stehenden Säulen und 12 entsprechenden Pilastern getragen, von denen die 8 an den Wänden einer halben Mittelsäule, die 4 in den Ecken einer halben runden Säule gleichen Die 4 Säulen in der Mitte des Schiffes sind Säulenbündel, jedes aus vier rechtwinkligen, großen, viereckigen Pfeilern und vier kleinern rechtwinkligen Streifen in den Winkeln zusammengesetzt, und haben entsprechende Deckplatten; alle Pfeiler und Pilaster sind gleich. Die Hauptgurtbogen sind im reinen Halbkreise von Träger zu Träger geführt. Die Gewölbe sind im reinen Rundbogenstyl gebaut, ohne Rippen, nur mit


|
Seite 140 |




|
feinen Näthen, welche sich schneiden. Das Ganze macht einen sehr wohlthuenden Eindruck. - An jeder Seitenwand hat das Schiff 3 Fensterpaare, in der Mitte eines jeden Gewölbes ein Paar. Die Fenster stehen in Mauernischen, welche im reinen Rundbogen gewölbt sind. Die Fenster sind eng, schräge eingehend und rund gewölbt; die Fensterpaare sind durch eine runde Säule mit Kapitäl, auf welchem der runde Schlußbogen ruht, geschieden. Unter dem Dache steht ein Fries von Relief=Halbkreisen, welche auf Consolen ruhen, welche sehr hübsch und abwechselnd verschieden sind. Die Pforten, in der Mitte jeder Seitenwand eine, waren ohne Zweifel rundbogig. Die Wände hatten keine Strebepfeiler.
So war der Bau dieser "byzantinischen Basilika", einfach, klar, würdig und schön, ein seltenes Werk aus der Zeit des nordischen Ziegelbaues des 12. Jahrhunderts. So ist er leider jetzt nicht mehr ganz. Im Innern ist der Bau, mit Ausnahme der Fenster, vollständig und unversehrt erhalten. Das Aeußere ist dagegen so entstellt und verändert, daß es unmöglich ist, aus dem Aeußern das Innere zu erkennen, und wohl mancher durch das Aeußere abgeschreckt wird, einen Blick in das Innere zu werfen; die Ueberraschung für den, der dennoch den Schritt thut, ist allerdings sehr bedeutend. Kommt man nämlich vor eine Seitenwand des Schiffes, namentlich vor die südliche, der Straße zugewandte, so sieht man eine Kirche aus der schlechtesten Zeit des Spitzbogenstyls. Man hat es nämlich, wahrscheinlich im 15. Jahrhundert, für gut gefunden, was ohne weiteres Beispiel sein dürfte, alles Alterthümliche und den Bau Charakterisirende gänzlich zu vernichten und die Außenwand dem damaligen Geschmack anzupassen. Zuerst vernichtete man die Wölbungen der Fenster und bedeckte die Fensterpaare im Innern fast horizontal oder doch nur mit einem wenig gekrümmten Bogen. Dann machte man aus einem Fensterpaare Ein Fenster, wölbte die äußern Fensternischen spitz und weit und führte die Fensterwölbung spitzbogig zur Spitze der Nische hinauf, wölbte die Pforten spitzbogig, ersetzte den rundbogigen Fries durch einen treppenförmigen und baute unregelmäßige Strebepfeiler an die Wände, - alles unsauber und untüchtig. Und damit war der Rundbogenstyl im Aeußern ganz vertilgt. Die Gestalt der Pforten ist ganz verwischt; von der Gestalt der Mauernischen für die Fenster zeugt nur noch das mittlere und für die Gestalt der Fenster dieses und das östliche Fenster in der Nordwand. Von dem rundbogigen Fries existiren nur noch einige Reste an der Südwand des Schiffes.


|
Seite 141 |




|
An die Ostseite des Schiffes ist ein Chor jüngeren Styls von der Breite des Mittelschiffes und von der Länge zweier Gewölbe angebaut; ob diesem Chor eine alte halbrunde Altartribune hat Platz machen müssen oder ob der Rundbogenstyl grade seine Endschaft erreicht hatte, als der Chor angesetzt ward, läßt sich nicht mehr ermitteln. Der Chor ist ein durchaus regelmäßiges, rechtwinkliges Oblongum aus der Zeit des Ueberganges vom Rundbogen zum Spitzbogen. Die grade, rechtwinklig angesetzte Altarwand hat 3 tief hinabgehende Fenster, von denen das mittlere höher ist, als die beiden andern; jede Seitenwand hat zwei, nicht verbundene, höher liegende Fensterpaare, der Chor im Ganzen also an den Seiten 8 Fenster. Zur Zeit der Ansetzung des Chors sind auch wohl die mit den Chorfenstern correspondirenden 2 Fenster an die östlichen Wände der Seitenschiffe eingebrochen. Alle Fenster des Chors sind noch eng, schräge eingehend, fast unmerklich zugespitzt, mit Wölbungen aus zwei Kreissegmenten, wie sie die kurze Zeit des Ueberganges charakterisirt. In demselben Style ist eine Pforte in der Südwand des Chors erbaut. Die Ränder und Wölbungen der Fenster, so wie die Gliederungen der Pforte sind aus abwechselnd grün glasurten und rothen Backsteinen aufgeführt. Die Mauern krönt ein Fries von Halbkreisen, welche jedoch nicht mehr so sauber gearbeitet sind, als dieselben Reliefs am Schiffe. Die zwei Gewölbe des Chors, von der Breite des Mittelschiffes, sind in dem Geiste der Fenster und der Pforte aufgeführt, im ernsten Style zugespitzt, jedoch noch ohne Rippen. Von Bedeutung ist, daß der Chor noch keine Strebepfeiler hat. - An der Nordwand des Chors ist in gleichem Styl mit demselben eine gewölbte Sakristei (Gervekammer) angebaut.
So haben wir in der Kirche zu Klütz zwei sich berührende Perioden des Baustyls, des Rundbogenstyls und des Uebergangsstyls, vollständig neben einander.
Der Thurm scheint ein Werk aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu sein.
An alterthümlichem Geräth in der Kirche zu Klütz ist ein alter geschnitzter Stuhl ("Römerstuhl" oder Juratenstuhl genannt), welcher die ganze Südwand des Chors einnimmt, bemerkenswerth. Die treffliche Arbeit ist aus der bessern Zeit der Schnitzkunst; die Rosetten und Palmetten sind sehr wacker gearbeitet. Die Figuren an den Seitenwänden sind nicht schlechter: rechts ein heiliger Bischof mit Mitra, Buch und Stab und die h. Katharine mit Rad und Schwert, - links vor einer Heiligen mit einem Buche im Arme ein segnender


|
Seite 142 |




|
Engel mit Flügeln (Verkündigung Mariä ?); in den Giebeln dieser Seitenwände sitzt ein Affe. - Außerdem hat die Kirche mehrere gewöhnliche Kirchenstühle mit geschnitzten Wappen, z. B.
| B. v. P. | 1564 mit dem von plessenschen Wappen, |
| A. v. P. | mit dem von penzschen Wappen. |
| anno . |
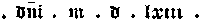 . mit dem von
tarnewitzschen Wappen (Schild mit
gewässertem Querbande),
. mit dem von
tarnewitzschen Wappen (Schild mit
gewässertem Querbande),
|
| daneben | das von penzsche Wappen. |
| Hinrick | Tarnevitz, mit dem gewässerten Bande auf dem Schilde und am Helme zwei Flügel mit demselben Bande, |
| Dorote | Brocktorpt, mit einem fliegenden Fische auf Schild und Helm. |
Vor dem Altare liegen einige alte Leichensteine; die Inschriften sind aber nicht mehr ganz zu entziffern. Auf einem steht ein Priester, der den Kelch consecrirt; der Kelch war mit Messing ausgelegt gewesen, fehlt jetzt aber; von der Umschrift ist noch zu lesen:
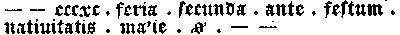
Nach der Mittheilung des Herrn Professors Dr. Crain zu Wismar sind von 4 Glocken 2 alt. Die eine große Glocke hat auf der einen Seite den h. Nicolaus, auf der andern Seite die h. Katharina mit Schwert und Rad, auf einer liegenden Figur (dem Kaiser Maxentius) stehend, mit der Umschrift:
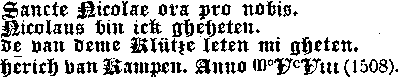
Eine andere Glocke mit der Jahrszahl 1513 ist ähnlich. Beide sind von demselben Meister und mit ähnlichen Verzierungen, wie eine Glocke auf dem Schelfthurme zu Schwerin (vgl. Jahresber. III, S. 193).



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Grevismühlen.
Die Kirche zu Grevismühlen ist nicht weniger merkwürdig, als die Kirche zu Klütz, indem die Anfänge des Baues im östlichen Theile desselben noch in der Zeit des


|
Seite 143 |




|
Rundbogenstyls liegen, der Fortschritt des Baues von Osten gegen Westen aber allmälig den Uebergang zum Spitzbogenstyl bezeichnet 1 ).
Die Kirche besteht aus einem oblongen Schiffe mit zwei Seitenschiffen, einem Chor und einem Thurmgebäude von der Breite des Mittelschiffes. Die Ecken zu beiden Seiten des Thurmes sind schon früh ausgefüllt; eine kleine Vorhalle an der Nordseite und eine kreuzähnliche Erweiterung im reinen Spitzbogenstyl an der Südseite des Schiffes sind jüngere Bauten und können nicht in Betracht kommen.
Der Bau begann ohne Zweifel mit dem Chor und schritt von hier gegen Westen vor. Fehlt auch schon die halbkreisförmige Altartribune, so bezeichnet doch die ganze Architectur des Chors die Zeit des Rundbogenstyls. Die Altarwand ist grade abgeschnitten und rechtwinklig an die Seitenmauern angesetzt. Sie hat neben einander drei Fenster, deren mittleres größer ist, als die beiden andern; sie sind schmal und in drei rechtwinkligen Absätzen tief eingehend, dennoch von kräftigen Verhältnissen, im reinen Rundbogen gewölbt, umgeben und abgegrenzt von Wulsten, welche von abwechselnd dunkelrothen und schwarz glasurten Ziegeln aufgebaut und in den perpendikulären Linien durch Basen und Kapitäler zu Säulen gestaltet sind. Der Giebel ist neuern Ursprungs. Jede Seitenwand des Chors hat ein sehr großes, auffallend breites Fenster, in flachem Rundbogen weit gewölbt; jetzt sind sie dreifach getheilt, Reste von Säulen an der Wand in der Mittellinie der Fenster deuten aber darauf hin, daß in dem Hauptbogen ursprünglich ein Doppelfenster stand. Westlich in dem südlichen Chorfenster führt eine Pforte in den Chor, welche ebenfalls in reinem Rundbogen und in den Gliederungen von abwechselnd rothen und schwarz glasurten Ziegeln aufgeführt ist. Die Mauern krönt ein Fries von glasurten Halbkreisen. Strebepfeiler fehlen am Chor und an allen alten Theilen der Kirche.
Die Architectur des Schiffes ist nur in der Nordwand erhalten; die ursprüngliche Gestalt der Südseite ist durch den Anbau des jüngern Kreuzesarms und durch andere Reparaturen verwischt. Die Südwand hat eine Pforte aus der Zeit des strengen Spitzbogenstyls, von abwechselnd glasurten und nicht glasurten Ziegeln, und darüber ein jetzt verbauetes


|
Seite 144 |




|
kleines, durch eine Säule geteiltes, sehr hübsches Doppelfenster in demselben Style. Zu jeder Seite steht ein großes, jetzt dreifach getheiltes, früher rund gewölbtes Fenster ganz von der Gestalt und Größe der großen Seitenfenster des Chors. An jeder Seite dieser großen Fenster steht zur Verzierung eine große Mauernische, von der Größe der großen Fenster in Kleeblattform in der Wölbung, wie sie an den reinen Rundbogenkirchen zu Ratzeburg und Lübow (vgl. Jahresbericht VII, S. 62 und S. 68) beobachtet sind, daß nämlich die runde Wölbung durch einen aufgesetzten kleineren Halbkreis unterbrochen wird. An dem östlichen Ende fehlt eine Nische, weil sich hier der Chor unmittelbar anschließt. Die Mauer des Schiffes krönt ebenfalls ein Fries von Halbkreisen, der sich auch an der Eckfüllung am Thurme, die zwei schmale Fenster aus der Zeit des Uebergangsstyls hat, fortsetzt. Strebepfeiler fehlen. - Die Südseite des Schiffes hat noch zwei große Fenster, wie der Chor, sonst aber keine Spur mehr von dem alten Bau; auch der Rundbogenfries ist in eine palmettenartige Verzierung umgewandelt. Die südliche Eckfüllung am Thurme hat jedoch noch den Rundbogenfries und ebenfalls zwei schmale Fenster aus der Zeit des Uebergangsstyls. - Die östlichen Ecken des Schiffes zu beiden Seiten des Chors haben kleine Spitzbogenfenster aus der Uebergangszeit.
Im Innern ist die ganze Kirche im ernsten, strengen Spitzbogenstyle gewölbt. Die Gewölbe des Schiffs ruhen auf 4 schönen Säulenbündeln mit geknäuften Kapitälern und auf entsprechenden Pilastern, und machen einen sehr wohlthuenden Eindruck, so unangenehm auch die Verbauung der Kirche durch Chöre ins Auge fällt.
Das Thurm gebäude mit den beiden Eckfüllungen ist ohne Zweifel unmittelbar nach der Kirche aufgeführt. Pforten und Fenster sind im strengsten Spitzbogenstyl. In der Höhe der Westmauer steht eine große Rosette in Relief und unter derselben ein Doppelschalloch von ernsten und schönen Verhältnissen.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Proseken.
Auf die Kirche zu Grevismühlen folgt die Kirche zu Proseken. Wenn auch zu Proseken keine Spur mehr davon übrig ist, daß nach der allgemeinen, grade nicht unwahrscheinlichen Sage Carl der Große im J. 789 hier die Wenden habe taufen lassen, so ist doch die Kirche in der Geschichte der Baukunst interessant genug, um sie der Aufmerksamkeit zu würdigen. Die


|
Seite 145 |




|
ganze Kirche ist nämlich im Style des Ueberganges vom Rundbogen zum Spitzbogen erbauet 1 ). Das Eigenthümliche dieses Uebergangsstyls besteht nämlich darin, daß alle Wölbungen sich dem Spitzbogen nähern, indem sie aus zwei Kreissegmenten im strengen, ernsten Style construirt sind und noch nicht jene weite Oeffnung des ausgebildeten Spitzbogens haben, welche den Seitendruck nöthig machen; die Oeffnungen würden Rundbogen bilden, wenn nicht eine fast unmerkliche Spitze an den jüngern Styl erinnerte. Es fehlen daher in der Regel die Strebepfeiler, welche den Spitzbogen charakterisiren. Die Fenster sind eng, klein, schräge eingehend und häufig paarweise gestellt. Der Rundbogenfries findet sich in der Regel noch und Pforten im Rundbogenstyl kommen noch mitunter vor. Als Muster dieses Styls kann die Kirche des Klosters Sonnenkamp oder Neukloster (vgl. Jahresber. III, S. 142 u. 147), welche im J. 1219 gegründet ward, aufgestellt werden. Die im J. 1232 geweihte Kirche des Klosters Doberan (vgl. Jahresbericht II, S. 27) und die von demselben erbaueten Kirchen, so wie die Kirche des Tochterklosters Dargun sind schon im ausgebildeten Spitzbogenstyl aufgeführt.
Die Kirche zu Proseken gleicht nun am meisten der Kirche zu Neukloster und charakterisirt mit dieser die Zeit des Ueberganges. So sehr sie auch verbauet ist, gewährt sie doch einen sehr würdigen, ernsten Anblick und gehört zu den ausgezeichnetern Landkirchen des Vaterlandes. Sie hat einen oblongen Chor, ein etwas breiteres oblonges Schiff und ein kräftiges Thurmgebäude im Westen desselben. Der Chor hat eine grade, rechtwinklig angesetzte Altarwand, welche früher 3 schmale Fenster hatte, die jetzt zu Einem großen Fenster umgewandelt sind. An jeder Seitenwand des Schiffes sind zwei schmale Fenster aus der Uebergangsperiode; die beiden südlichen sind zu Einem großen Fenster umgebauet. Das Schiff hat an jeder Seite zwei Fensterpaare in demselben Styl, welche an der Nordseite, jedoch nicht an der übrigens gleich construirten Südseite, mit abwechselnd glasurten Ziegeln eingefaßt sind. Die Kirche hatte also ursprünglich die alte Zahl der Fenster in den Rundbogenkirchen: 3 in der Altarwand, 4 im Chor und 8 im Schiffe. Der Fries, der an mehrern Stellen verunstaltet ist, besteht aus Halbkreisen. Eine Pforte in dem strengen Styl der Fenster, von abwechselnd glasurten und nicht


|
Seite 146 |




|
glasurten Ziegeln erbauet, ist jetzt zugemauert und hoch mit Erde bedeckt. - Die Kirche hat keine Strebepfeiler.
Die Wölbung des Chors ist im Styl der ganzen Architectur: ernst, hoch, spitz, wie die Wölbung des Chors zu Brüel (vgl. Jahresber. VII, S. 75). Die zwei Gewölbe des Schiffes sind, wie häufig jüngere Gewölbe, etwas gedrückt, mehr rund und leichter.
Die Giebel des Thurms sind mit verschiedenartigen, großen Reliefs geschmückt, namentlich der Giebel der Nordseite, an welchem sich reine Halbkreise, auf perpendikulären Pfeilern stehend, in gewissen Entfernungen schneiden. Durch diese Schneidungen entstehen von selbst ganz klar die Formen des Spitzbogens aus der Uebergangszeit mit den Kreissegmenten in den Wölbungen.
Der Altar ist mit einem Leichensteine bedeckt, der, nach den 5 eingemeißelten bischöflichen Weihkreuzen, schon früh aufgelegt sein muß. Von der Inschrift läßt sich noch lesen:

(= Anno domini - - - Johannes Helmstede rector huius ecclesie [durantibus?] LVIII annis [donec?] [in pace] obiit.)
Die Schrift stammt ungefähr aus dem Ende des 14. Jahrhunderts. So viel sagt die Inschrift unbezweifelt, daß um diese Zeit der Pfarrer Helmstädt nach achtundfunfzigjähriger Amtsführung gestorben sei.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Dassow.
Die Kirche zu Dassow, welche in der Mitte der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut sein mag, findet wohl wenige ihres gleichen im Lande und verdient die Aufmerksamkeit im höchsten Grade. Ist sie auch nicht in einem besondern Style erbauet, so ist sie dagegen dadurch merkwürdig, daß sie ganz von Granit aufgeführt ist. Es giebt zwar viele Kirchen im Lande aus Granitblöcken; bei allen andern aber sind die Blöcke weniger gewählt, wie auch bei den häufigen Granitbauten neuerer Zeit, höchstens sind Eck= und Fundamentsteine gewählt und behauen, die Gliederungen dagegen von Backsteinen aufgeführt, überhaupt sind auch hin und wieder


|
Seite 147 |




|
oft Backsteine angewandt. Die Kirche, zu Dassow aber ist ein Bau, dessen Grundplan für einen Granitbau berechnet ist: alle Fenster= und Thüröffnungen sind nämlich aus behauenen Granitblöcken sehr sauber und regelmäßig, ohne Beihülfe von Backsteinen, gewölbt. Was bisher gesagt ist, gilt nur vom Schiffe. Das Schiff ist ein großes Oblongum, an jeder Seite mit 3 großen Fenstern und einer Pforte in der Mitte, unter dem mittlern Fenster. Die Fenster und Pforten sind durchaus in jenem weiten Spitzbogen gewölbt, der die obern Chorfenster des Domes zu Schwerin charakterisirt, und es läßt sich wohl mit Gewißheit annehmen, daß der Chor des schweriner Doms und das Schiff der Kirche zu Dassow aus demselben Geiste, vielleicht von demselben Baumeister stammen; ähnlich, jedoch nur ähnlich, sind die Fenster der Kirche zu Schönberg. - Das mittlere Fenster der Nordseite ist etwas kürzer, als die beiden andern, weil die Thür unter derselben steht. An der Südseite steht über der Pforte statt des Bogenfensters ein großes Rosenfenster mit einer Rundung aus Granit und einer fünfblätterigen Rosette. Die Fenster sind dreifach im Spitzbogen geteilt. Die innern Fenstergliederungen und Theilungssäulen sind jetzt von Backsteinen eingesetzt; nach einigen Resten am mittlern Fenster der Südseite sind ursprünglich die Theilungsstäbe und Wölbungen der Fenstergliederungen aus gehauenem Kalkstein oder Stuck, wie an der Kirche zu Gr. Salitz (vgl. Jahresber. VII, S. 79), gewesen; auch waren die Stuck=Wölbungen der Fenstertheilungen palmettenartig gebildet. - Das Schiff ist nicht gewölbt und, wie der Chor, ohne Strebepfeiler.
Der Chor, schmaler und niedriger als das Schiff, ist ein Quadrat von Einem Gewölbe und aus Ziegeln gebauet. Der Chor hat in der graden, rechtwinklig angesetzten Altarwand eine große Fensternische, von der Gestalt der Fenster des Schiffes, mit drei Fenstern im Spitzbogen, welche durch Säulen mit hübschen Laubkapitälern aus Thon getrennt sind. Die Chorfenster gingen auch hier früher tiefer hinab. - Im Innern ist der Chor von Einem Gewölbe im ernsten Geiste im Style der Fenster, bedeckt; das Gewölbe ruht auf vier Ecksäulen, deren Kapitäler ebenfalls mit Laubwerk geschmückt sind. - Die Nordwand des Chors hat noch einen Fries von Halbkreisen.
Die übrigen Kirchen des Klützer=Orts, nämlich:
die Kirchen zu Hohenkirchen, Gressow, Kalkhorst, Damshagen, Elmenhorst, Bössow, Börzow und Mummendorf,


|
Seite 148 |




|
sind im gewöhnlichen Spitzbogenstyl erbaut und haben für die Baukunst kein besonderes Interesse. Einige derselben, wie die Kirchen zu Bössow, Börzow und Elmenhorst, sind dazu noch klein und unansehnlich gebauet, auch vielfach verbauet. Andere derselben verdienen jedoch wegen ihrer Größe und Tüchtigkeit und einiger Eigenthümlichkeiten Erwähnung, wie die Kirchen zu Hohenkirchen, Kalkhorst und Gressow. Im Allgemeinen muß bemerkt werden, daß diese Kirchen alle Eigenthümlichkeiten des ausgebildeten Spitzbogens haben, groß, freundlich und gewölbt sind; die Gewölbe des Schiffes sind in der Regel nicht aus der ältern Zeit, sondern mehr gedrückt und weit gesprengt, so daß die Gurte sich dem Rundbogen nähern. Man darf sich jedoch nicht verführen lassen, dergleichen Gewölbe, die sich das 14. und 15. Jahrhundert hindurch finden, für Rundbogenstyl zu halten.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Gressow
hat z. B. ein solches Gewölbe im gedrückten Spitzbogenstyl, mit großen weiten Fenstern aus dem 14. Jahrhundert im Schiffe. Der Chor hat noch zweifach geteilte enge Fenster im ältern Spitzbogenstyl und an der Nordseite eine zugemauerte Pforte im Rundbogen, jedoch überall schon Strebepfeiler und ganz den Charakter des Spitzbogenstyls.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Hohenkirchen,
welche schon im Jahresber. III, S. 180 flgd. beschrieben ist, ist ebenfalls im ausgebildeten Spitzbogenstyl mit gedrückten Gewölben, wie die Kirche zu Gressow, aufgeführt. Der Herr Pastor Erfurth ist dadurch a. a. O. S. 180 verleitet worden, diese Gewölbe für Rundbogen zu halten. Es fehlen ihnen jedoch sämmtliche Eigenthümlichkeiten des sogenannten byzantinischen Styls; im Gegentheil trifft man dergleichen Gewölbe aus einer jüngern Zeit, da die Wölbungen oft viel später, als die Ringmauern gebaut wurden, sehr häufig. Auch ist die Anführung der Kirchen und Pfarren in alten Urkunden nicht immer ein Beweis, daß die jetzt stehenden Kirchen schon damals vollendet gewesen seien.
Dagegen hat die Kirche eine andere Eigenthümlichkeit, welche sehr interessant ist. Die Kirche besteht aus Chor, Schiff und Thurm von gleicher Weite. Der Chor hat die Strebepfeiler des Spitzbogenstyls, dem Schiffe fehlen sie dagegen im Aeußern. Das Schiff ist drei Gewölbe lang und hat die Eigenthümlichkeit, daß die Strebepfeiler innerhalb der


|
Seite 149 |




|
Kirche stehen. Man hat nämlich die Pfeiler, welche die Gewölbe tragen, und die Strebepfeiler zu kurzen Querwänden umgeschaffen, die Seitenwände des Schiffes an die Enden dieser Querwände hinausgerückt und die Längsenden durch kurze Mauern geschlossen. Dadurch hat die Kirche an jeder Seite des Schiffes drei viereckige Kapellenräume, welche mit kleinen Gewölben bedeckt sind, erhalten, welche durch undurchbrochene Scheidewände von einander getrennt sind und sich nach der Kirche hin in der ganzen Höhe derselben öffnen. Diese Wände sind aber in der That keine Scheidewände, sondern die Strebepfeiler, welche durch Hinausrückung der Seitenmauern in die Kirche versetzt sind; sie sind daher wesentliche Grundbestandtheile des ganzen Baues.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Kalkhorst
ist ebenfalls eine grotze Kirche mit zwei Seitenschiffen, im Spitzbogenstyl gewölbt, und wohl eine der schönsten Landkirchen in Meklenburg.
Im Thurme hangen 4 Glocken von schönem Klange, von denen 2 alt sind.
1) Die größere Glocke hat um den Helm zwei Reihen Inschriften. Die erste Reihe lautet:

(=Anno domini MCCCCXVII in festo Jacobi haec osanna est facta per Bartholomaeum.)
Am Ende der Zeile steht ein Doppeladler; daher ist die Glocke wohl ohne Zweifel in Lübeck gegossen. Der Ausdruck Osanna für Glocke scheint selten zu sein. 1 )
Die zweite Zeile lautet:
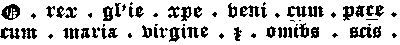
(= O rex gloriae Christe veni cum pace, cum Maria virgine et omnibus sanctis.)
Die etwas undeutliche Form gl'ie (abbrevirt für glorie ) möchte ich lieber lesen, als gese (corrumpirter Vocativ für


|
Seite 150 |




|
Jesu ?), welches da zu stehen scheint. Am Ende dieser Zeile stehen Abdrücke von 6 Bracteaten, 3 größern, von denen einer einen gekerbten Rand hat, und 3 kleinern, welche jedoch alle im Gepräge undeutlich sind.
In der Mitte des Mantels stehen 3 Gruppen Reliefbilder, nämlich: a. Gott der Vater mit der Weltkugel, die betende Maria segnend, beide gegenüber sitzend, eine häufige Altardarstellung, namentlich auf lübeckischen Altären aus dem Anfange des 15. Jahrh.; b. Maria stehend mit dem Christkinde auf dem linken Arme und einem Lilienstengel in der rechten Hand; c. St. Georg den Lindwurm durchbohrend.
2) Die kleinste Glocke hat die Inschrift:
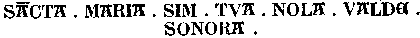
(= Sancta Maria, sim tua nola valde sonora).
Nach den Schriftzügen stammt die Glocke aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist also eine der ältesten Glocken im Lande. Verzierungen fehlen ganz. Nola ist bekanntlich der mittelalterliche Ausdruck für kleine Glocke.
Links vor dem Altare liegen 2 alte Leichensteine, mit eingravirten Bildern von Priestern, welche den Kelch consecriren; die Kelche sind früher mit Messing eingelegt gewesen.
Der eine läßt nur noch die Worte erkennen:
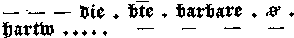
Der andere hat die Inschrift;
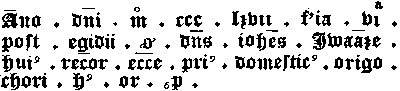
(= Anno domini MCCCLXVII feria VI ta post Egidii obiit dominus Johannes Iwaanze, hujus rector ecclesiae pri[m]us domesticus. Origo chori huius. Orate pro [eo].)
Die Inschrift ist am Ende so sehr zusammengedrängt, daß das letzte Wort eo ganz ausgelassen ist. - Die Inschrift hat große Schwierigkeiten in der Entzifferung , und zwar in den Worten: hujus rector ecclesiae pri(m)us domesticus origo chori hujus. Daß rector ecclesiae = Kirchherr, Pfarrherr, Pfarrer heißt, ist bekannt. Die Form


|
Seite 151 |




|
pri 9 kann das volle Wort prius oder das abbrevirte Wort primus sein. Das Wort domesticus ist dunkel. Es bedeutet im mittelalterlichen Latein im Besondern die kirchliche Würde eines Vorsängers. Es könnte also, wenn man dazu primus liest und rector domesticus zusammennimmt, heißt: "dieser Kirche erster Vorsänger." Dagegen möchte aber der stereotype Ausdruck rector ecclesiae für Pfarrer streiten und das Bild des Verstorbenen mit dem Kelche in der Hand. Dann heißt domesticus im Allgemeinen: vertraut, geneigt, treu (: domesticus fidei); in diesem Falle wäre das Wort ein ehrendes Epitheton und der Satz hieße: "erster" - oder: "früher sorglicher Pfarrer dieser Kirche." - Die Worte: origochorihujus bilden dann, wegen Beschränktheit des Raumes auf dem Leichensteine, einen abgekürzten, selbstständigen Satz = "Die Gründung dieses Chors", nämlich: "stammt von ihm", oder: Gründer des Chors. Auf jeden Fall ist durch den Stein die Erbauung des Chors um das J. 1367 gesichert, und giebt derselbe einen Beleg für die Erweiterung der Kirchen im 14. Jahrhundert.
Der Pfarrer Iwanze oder Iwan zu Kalkhorst ist wahrscheinlich der in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts öfter vorkommende Iwan von Klütz.



|



|
|
:
|
III. Verschiedene Nachrichten.
Ueber ein parchimsches Götzenbild.
Vor etwa 2 Jahren hatte Herr Archivar Lisch zu Schwerin die Güte, mir mitzutheilen, daß der Kaufmann Heyden hieselbst bei seiner Anwesenheit in Schwerin erzählt habe, er besitze ein metallenes Götzenbild, welches er vor einigen Jahren im Sonnenberge gefunden habe. Ich begab mich hierauf sogleich persönlich zu Herrn Heyden, welcher mir als ein sehr glaubwürdiger Mann bekannt ist, um mich nach der Wahrheit dieser Erzählung zu erkundigen. Derselbe versicherte aber, daß er gar nichts von einem solchen Funde wisse, auch seit mehreren Jahren nicht in Schwerin gewesen sei, so daß hier eine Verwechselung zum Grunde liegen müsse.
Vor einiger Zeit indeß erfuhr ich durch eine Tochter des Herrn Heyden, daß es mit dem Funde dennoch seine Richtigkeit habe. Vor etwa 8 - 10 Jahren nämlich habe ihr Vetter, Sohn des Kaufmanns Heyden zu Sternberg, welcher damals die hiesige Schule besuchte, mit andern Knaben im Sonnenberge gespielt und dort am Fuße des Vitingsberges


|
Seite 152 |




|
eine kleine, etwa 6 " hohe Figur von Metall - sie meine Eisen - gefunden. Sie habe diese Figur öfter gesehen und sei dieselbe nach ihrer Erinnerung der Abbildung des Götzen Parchum sehr ähnlich gewesen, welche sich in Cleemanns Chronik finde, namentlich habe sie eben solche Zacken (Strahlen) um den Kopf gehabt. Ob sich eine Inschrift darauf befunden, wisse sie nicht mehr.
Auf diese interessante Nachricht wendete ich mich sofort an die Mutter des Knaben, - der Vater war inzwischen gestorben -, nach Sternberg, welche aber nichts von der Sache wußte, und eben so erfolglos waren meine Erkundigungen bei dem Sohne selbst, welcher zur Zeit Handlungsdiener in Hamburg ist. Die Figur ist also wahrscheinlich für immer verloren, doch bleibt ihre spätere Wiederauffindung möglich, und daher gegenwärtige Nachricht über ihren ersten Fundort vielleicht nicht ohne Interesse.
Ueber den obgedachten Vitingsberg vgl. Cordesii Chronik (bei Cleemann S. 12 u. 13) und Cleemann S. 576 (im Index). Es ist dies ein fast kegelförmig zugespitzter Hügel in dem Sonnenberge bei Parchim von bedeutender Höhe und mit alten Buchen bestanden, an dessen Fuße im vorigen Jahre auf Betrieb einer Actiengesellschaft ein Braunkohlenwerk angelegt ist. Grade auf der Spitze desselben befindet sich eine etwa 12' tiefe Senkung, welche von der Sage für die Höhle eines Räubers, Viting, erklärt wird, und daher von Alters her den Namen Vitings=Keller führt. Der Name des Räubers erinnert an die Withingi bei Adam. Brem. de situ Daniae c. 212: Aurum ibi (in Seeland) plurimum, quod raptu congeritur piratico. Ipsi enim piratae, quos illi Withingos appellant, nostri Ascommannos, regi Danico tributum solvunt, ut liceat eis praedam exercere a barbaris etc. Diese Räubereien fallen hauptsächlich in das Ende des 10. Jahrh. Unser Viting scheint also kein eigentlicher Personen=Name zu sein, sondern bezeichnet im Allgemeinen einen Räuber, und die jedenfalls sehr alte Sage, welche sich an diesen Namen knüpft, stammt vielleicht aus der Zeit der Verdrängung des slavischen Heidenthums durch die siegenden Sachsen, als die Reste der Slaven häufig gezwungen waren, sich und ihre Heiligthümer in die Wälder zu flüchten, von wo aus sie die sächsischen Ansiedler durch Räubereien beunruhigten.
Zu einem solchen Schlupfwinkel scheint unser Vitingsberg nach seiner Lage wohlgeeignet, und hat es daher gar nichts Unwahrscheinliches, daß die auf seinem Gipfel befindliche Grube wirklich einst Räubern, namentlich flüchtigen, dem Dienste ihrer


|
Seite 153 |




|
alten Götter ergebenen Wenden zum Aufenthaltsorte gedient habe. Dann aber könnte es auch nicht weiter auffallen, wenn grade hier ein altes Götzenbild gefunden sein sollte.
Cleemann ist zwar geneigt, diese Grube für einen Erdfall zu halten, allein der Augenschein läßt keinen Zweifel darüber zu, daß sie von Menschen=Händen gegraben ist, wie dies namentlich die am Rande der Grube wallartig aufgeworfene Erde beweist. Uebrigens hat eine nähere Untersuchung, welche der Herr Bergbau=Conducteur Mengebier im vorigen Jahre auf meinen Wunsch im Innern dieser Grube durch tieferes Ausgraben derselben anstellen ließ, nichts von Interesse zu Tage gefördert.
Parchim, im November 1842.
W. G. Beyer.



|



|
|
:
|
Leichenstein von Marlow.
Bei der vor ungefähr 2 Jahren vorgenommenen Restauration der Kirche zu Marlow wurden sämmtliche Leichensteine aus derselben hinausgeschafft. Von diesen liegt einer jetzt auf dem Kirchhofe hart an einem vermauerten Kircheneingange; über denselben hat der Herr Dr. Huen zu Marlow folgende Nachricht gegeben. Der Stein ist von röthlichem Granit, 6 Fuß lang, 3 1/2 Fuß breit und fast 5 Zoll dick; durch den untern Theil geht ein Riß, der jedoch nur zwei Buchstaben beschädigt hat. Das innere Feld enthält kein Bild oder Wappen; nur im obern Drittheil rechts ist eine Vertiefung, ungefähr von der Gestalt einer kleinen Fahne; es ist jedoch ungewiß, ob sie von natürlicher Verwitterung oder Aussprengung herrührt, oder ob sie eine künstliche Vertiefung zum Einlassen einer Messingplatte ist. Die Umschrift mit Buchstaben von 3 " Länge und etwa 6 ''' Tiefe lautet:
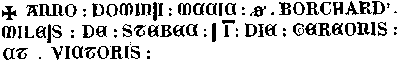
d. i. Anno domini MCCIC (1299) obiit Borchardus miles de Stebec in die Gereonis et Victoris (10. Oct.).
Ueber dem Namen Stebec sleht kein Abbreviaturstrich; vielleicht soll er Stebec, d. i. Stênbek (Steinbek) heißen. In Lisch Mekl. Urk. I, S. 130 kommt bei dem Herzoge Barnim von Stettin am 17. October 1265 ein rittermäßiger Mann:


|
Seite 154 |




|
Johannes de Stembeke vor; wahrscheinlich ist die Familie eine pommersche 1 ). Leichensteine aus so früher Zeit sind ziemlich selten.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Glocken=Inschrift zu Rechlin.
Auf der größten Glocke zu Rechlin bei Röbel steht der Engelsgruß:
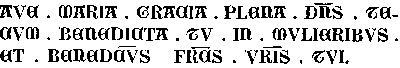
(= Ave, Maria, gracia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.)
Unter der Krone steht, auf den Kopf gestellt, und von der Rechten zur Linken zu lesen:

Nach der Mittheilung des Herrn Candidaten Paschen zu Sukow bei Parchim.



|



|
|
:
|
Die Kuhsteine.
Diesen Namen gab man vorzeitlich einer Art Feuersteinen, welche von der Natur mit einem Loch versehen sind; man findet sie ziemlich häufig, sowohl in der Kreide, als auch auf den Feldern. Diese Steine wurden noch vor nicht langer Zeit häufig, sowohl in Meklenburg als auch in den angrenzenden Ländern, als ein zuverlässiges Heilmittel bei Augenkrankheiten, besonders des Rindviehes, angewandt, und zwar auf folgende Art: durch das Loch wurde ein Band oder ein Metalldrath gezogen, und dem Haupt Vieh, das an einer Augenkrankheit litt, um den Hals gebunden, und - binnen drei Tagen und Nächten war das Augenübel des Thieres verschwunden. Da Feuersteine von oben beschriebener Art selbst von Mineralogen mit dem Namen "Kuhstein" bis in neuere Zeit bezeichnet worden, so ist nicht


|
Seite 155 |




|
unwahrscheinlich, daß diese Benennung entweder von der Anwendung oder auch umgekehrt entstanden.
Zarrentin, im August 1842.
Stockfisch.



|



|
|
:
|
Geognostisches.
In einem Tannengehölze zwischen Soddin, Gramnitz und Schwaberow liegt ein großer Granitblock, von dem in der ganzen Umgegend viel geredet wird wegen der darauf enthaltenen Spuren von Menschen und Thieren; er sollte schon früher zum Chausseebau gesprengt werden, auch ist dies an einer Seite geschehen, aber die dortigen Bewohner legten bei den Arbeitern Fürbitte für den Stein ein, so daß auch das abgesprengte Stück zur Stelle blieb. Da ich vermuthete, daß vielleicht Runenschrift darauf sei oder daß es ein Opferstein oder dergleichen sein möchte, so begab ich mich dahin. Es ist ein rings herum frei gegrabener Granitblock, cubusförmig, aber an den Kanten und Ecken abgerundet, wie man alle Granitsteine bei uns findet, anscheinend 4 Fuß hoch, aber 7 Fuß breit und 8 Fuß lang (also gegen 224 Cubikfuß haltend), mit der Oberfläche nur wenig über die Erdoberfläche hervorstehend. Der erste Anblick spricht allerdings für die Meinung der Leute und es gehört eben keine Phantasie dazu, um Fußspuren namentlich von Kühen darin zu sehen, dann von Menschen, Schafen, runde Spuren wie von Füchsen, Hunden, etwas längliche wie von Hasen u. s. w. Aber eine genauere Untersuchung belehrt bald von dem Ungrunde, es für wirkliche Abdrücke von Fußtritten (und dazu im Granit!) oder für ein Erzeugniß der Kunst zu halten. Es ist nichts als ein Naturspiel, da die Masse des Gesteins sehr ungleich ist und an den weicheren Stellen ausgewittert solche Vertiefungen gebildet hat; die Seiten sind eben so gut als die obere Fläche mit solchen Figuren bedeckt.
Wittenburg, 1842.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Die alten Schriftwerke der Stadt Güstrow.
Die Stadt Güstrow besitzt in einer alten, eichenen Archivlade mit aufgeklebten Inhaltsverzeichnissen aus dem 15. Jahrhundert noch alle ihre Urkunden im Originale, mit Ausnahme der Verleihung des schwerinschen Rechts vom J. 1228 (in Besser's Beitr. z Gesch. der Vorderstadt Güstrow, S. 243). welche nur in einer Original=Bestätigungs=Urkunde vom J. 1305 vorhanden ist. Die älteste Original=Urkunde ist


|
Seite 156 |




|
die Urkunde vom J. 1248 (in Besser's Beitr. S. 121). Die Urkunden sind in den Siegeln und sonst wohl erhalten. Die Existenz dieser Originale scheint lange Zeiten hindurch nicht bekannt gewesen zu sein, wenigstens sind sie seit langen Zeiten nicht benutzt.
Außerdem bewahrt das Stadt=Archiv noch folgende alte Handschriften (vgl. Besser's Beitr. I, S. 241 flgd.):
1) ein Diplomatarium der Stadt=Privilegien, auf Papier, im J. 1522 begonnen und späterhin fortgesetzt (bisher nicht ganz zuverlässige Hauptquelle der Forschungen).
2) ein Diplomatarium der Stadt=Privilegien, auf Papier, aus dem 18. Jahrhundert.
3) ein Diplomatarium der Urkunden der Pfarrkirche, des Heil. Geistes und des St. Georg, auf Papier, im J. 1522 angelegt.
4) ein Rechnungsbuch des St. Georg, auf Papier, aus dem 15. Jahrhundert, mit der Einleitung:
Dyt is dat gud vnde de iarlike rente der brodere vnde der sustere des houes sunte Iuriens dat se hebben an der stad to Gustrowe.
5) ein Buch des Kalandes oder der Brüderschaft St. Gregorii und St. Augustini, enthaltend Statuten, Einrichtungen, Hebungen, Messen, kurz alle Nachrichten über den Kaland, auf Pergament, aus dem 15. Jahrhundert bis 1525.
6) ein Rechnungsbuch der Brüderschaft St. Kathrinen, auf Pergament und Papier, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts bis ins 16. Jahrhundert.
7) zwei Bücher der Kaufmannsgilde, das eine auf Pergament und Papier von 1436 - 1587, das andere auf Papier von dem herzoglichen Secretär M. Simon Leupold 1552 angelegt und bis Ende des 18. Jahrhunderts reichend.
8) die Gerichts=Protocollbücher vom J. 1536 an bis in das 18. Jahrhundert.
G. C. F. Lisch.
2) Bearbeitung des historischen Stoffes.
A. Gelieferte Arbeiten.
I. Grössere Abhandlungen
(außer den im vorstehenden Jahresberichte Abgedruckten):
Vom Herrn von Berg auf Neuenkirchen:
1) Ueber
das Codicill der Wittwe von Wangelin vom J. 1639.


|
Seite 157 |




|
Vom Herrn Pastor Boll zu Neu=Brandenburg:
2)
Ueber die Volkssprache der nordwestlichen Slavenstämme.
Vom Herrn Hülfsprediger Günther zu Eldena:
3)
Meklenburgische Volkssagen.
Vom Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
4) Ueber,
die Kirchen und Klöster zu Bützow und Rühn.
5)
Ueber die evangelische Kirchen=Visitation in
Meklenburg vom J. 1535.
6) Ueber den
Regierungs=Antritt des Herzogs Johann Albrecht I.
von Meklenburg.
7) Ueber altniederländische
Gedichte.
8) Ueber die Wallfahrt des Fürsten
Heinrich des Löwen von Meklenburg nach
Roccamadonna.
9) Ueber die älteste Form der
weltlichen Belehnung.
10) Ueber adeliche
Stammlehen und Familiennamen.
11) Ueber
Maireiten und Bürgerbewaffnung im Mittelalter.
Vom Herrn Landbaumeister Virck zu Sülz:
12)
Geschichte der Saline zu Conow.
Der rege wissenschaftliche Verkehr unter den Arbeitern auf dem Felde der deutschen Geschichts= und Alterthumsforschung, ein großes Kleinod in dem Schatze deutscher Wissenschaft, liegt so tief in dem Wesen derselben begründet, daß jener Verkehr erst mit diesem Wesen aufhören kann.
Er war mit den correspondirenden Mitgliedern und Vereinen im abgelaufenen Jahre nicht minder lebhaft, als in den frühern Jahren. Zwar verlor der Verein den wirklichen Geheimen=Ober=Regierungs=Rath von Tzschoppe zu Berlin, den bekannten Mitherausgeber der Urkunden zur Geschichte der schlesischen Städte, der, als Archiv=Director des preußischen Staates, unserm Vereine die Erlaubniß zur Abschrift der Urkunden der meklenburgischen Johanniter=Comthureien gab. Ersatz fand der Verein jedoch dadurch daß er den Herrn Bagmihl zu Stettin, Herausgeber des pommerschen Wappenbuchs, den Herrn Dr. Köhne zu Berlin, Herausgeber der Zeitschrift für Münz= und Wappenkunde, und den Herrn Geheimen=Archivrath und Professor Dr. Stenzel zu Breslau zu correspondirenden Mitgliedern gewann. - Alle Staaten des nordöstlichen Deutschlands haben jetzt die Verausgabe ihrer Urkunden=Schätze in möglichster Vollendung so begonnen, daß diese Art der Forschung, die einzig sichere Grundlage der


|
Seite 158 |




|
Geschichte, schwerlich je überflügelt werden wird. In dieser Beziehung war der Verkehr mit Pommern, namentlich mit dem Herrn Professor Dr. Kosegarten zu Greifswald und dem Herrn Bagmihl zu Stettin, so wie mit dem Herrn Burgemeister Fabricius zu Stralsund wechselseitig sehr lebhaft; den besten Beweis giebt die so eben erschienene erste Lieferung der pommerschen Urkunden=Sammlung, welche alle frühern Arbeiten ähnlicher Art weit hinter sich läßt. Im Felde der Numismatik wirkten besonders der Herr Dr. Köhne zu Berlin, welcher mit der uneigennützigsten Liberalität die hiesigen Sammlungen förderte, und der Herr F. W. Kretschmer zu Berlin. Im Felde der Alterthumsforschung nahmen besondern Theil die Vereine zu München und Zürich, welche in Süddeutschland zuerst ein festes Augenmerk auf die Erforschung einheimischer Gräber gerichtet und diese von den römischen schärfer geschieden haben. Die Vorsteher des königlichen Museums zu Leyden beobachteten höchst aufmerksam die disseitigen Alterthumsforschungen und nahmen einen Theil derselben in ihre Schriften auf. Der Herr Gymnasial=Lehrer Masch zu Neu=Ruppin verfolgte unausgesetzt die Alterthümer der Priegnitz und machte häufige Mittheilungen.
Von den ordentlichen Mitgliedern lieferten kleinere Mittheilungen über alterthümliche und historische Gegenstände: die Herren Pastor Boll zu Neu=Brandenburg, Dr. Huen zu Marlow, Baron von Maltzahn auf Peutsch, Pastor Masch zu Demern, Candidat Paschen zu Sukow, Pastor Ritter zu Vietlübbe, Apotheker Stockfisch zu Zarrentin, Graf von Zieten zu Wustrau, u. A.
G. C. F. Lisch.
B. Begonnene und fortgesetzte Arbeiten.
Die meklenburgischen Regesten.
Nach dem vorigjährigen Berichte (VII, S. 89) betrug die
| Anzahl der bereits bearbeiteten Urkunden | 3770. | |
| Hinzugekommen sind: | ||
| Vom Herrn Professor Dr. Crain aus | ||
| Wöchentl. Rostock. Nachrichten 1757 u.1758 | 100 | |
| Desgleichen. 1759 u. 1760 | 78 | |
| ---- | 178. | |
| Vom Herrn Dr. Duve aus | ||
| Erath. Cod. diplom. Qued | 2 | |
| Landbuch der Mark Brandenburg | 1 | |
| ---- | 3. |


|
Seite 159 |




|
Vom Unterzeichneten aus
| Hamburger Urkundenbuch | 10 | |
| Lisch Urkundensammlung der v. Maltzan | 95 | |
| Desselben Mecklenb. Urkunden I. | 93 | |
| Desgleichen II. | 105 | |
| Desgleichen III. | 12 | |
| Rudloff de nat. jur. usufruct. fil. nob | 4 | |
| Dähnerts Bericht von H. Adolph Friedrich IV. | 1 | |
| (Ludwig) Eventual=Sucessionsrecht | 24 | |
| Facti Species des jus primogeniturae | 10 | |
| Ausführl. Bericht des Ungehorsams der Ritterschaft | 16 | |
| Lübeckisches Urkundenbuch | 77 | |
| ---- | 447. | |
| ------ | ||
| 4398. |
Die Zahl der durchforschten Werke ist 108.
Demern, den 10. Julius 1843.
G. M. C. Masch.
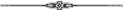


|
[ Seite 160 ] |




|
