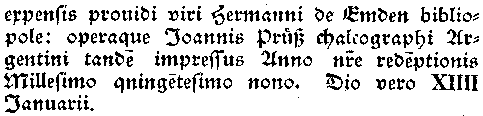|
[ Seite 235 ] |




|



|
|
|
- Untersuchungen über die heidnischen Grabgefäße
- Die Graburnen der Hünengräber
- Die Schädel erschlagener Feinde als Trinkschalen bei den nordischen Völkern benutzt
- Menschenschädel von Langsdorf
- Feuersteinmesser-Manufactur von Jabel
- Hünengräber und andere alte Grabstätten zu Moltzow (Vgl. Jahresber. VI, S. 133 und 134)
- Hünengräber von Kuppentin
- Hünengrab von Hoikendorf
- Streitaxt von Hoikendorf
- Schleifstein von Rambow bei Malchin
- Steinerne Quetschkeule (?)
- Ueber die spina des Tacitus
- Kegelgrab und Krone von Admanshagen
- Kegelgrab von Peccatel bei Penzlin
- Kegelgrab von Retzow Nr. 4
- Kegelgrab von Kreien bei Lübz
- Kegelgrab von Sternberg
- Begräbnißplatz bei Schwerin
- Gold- und Bronze-Geräthe von Parchim
- Bronze-Geräthe von Dahmen
- Spiralcylinder von Moltzow
- Kupfernes Pferdebild von Varchentin
- Commandostab von Glasin
- Bronzewaffen von Glasin bei Neukloster
- Armring von Gnoien
- Goldenes Diadem von Schwasdorf
- Glasperlen vom Diadem von Putbus
- Grab von Sembzin
- Wendenkirchhof von Kuppentin
- Wendenkirchhof von Vietlübbe (Stievendorf)
- Wendenkirchhof zu Liepen bei Penzlin
- Wendenbegräbniß von Pleetz
- Wendischer Silberschmuck von Schwerin und Remlin
- Tragetopf von Gnoien
- Urnen vom Mörderberge bei Neubrandenburg
- Römische Thonmaske von Friedrichsdorf bei Bukow
- Römische Münzen
- Mittelalterliche Alterthümer von Mühlengeetz
- Burgwall von Weisdin bei Neu-Strelitz
- Die Kirche zu Klütz
- Die Kirche zu Bützow
- Der Dom zu Schwerin
- Die Kirche zu Eldena
- Die Kirche zu Satow und der Uebergangsstyl
- Die Kirche zu Neuenkirchen bei Schwan
- Die Kirche zu Reinshagen bei Güstrow
- Die Kirche zu Alt-Gaarz
- Die Kirchen des Landes Stargard
- Die Kirche zu Wanzka
- Die lübecker Altäre in den Kirchen zu Neustadt und Grabow
- Die Bülowen-Kapelle in der Kirche zu Doberan
- Die Schlösser zu Wismar und Schwerin und deren Baumeister
- Die neuern meklenburgischen Denkmünzen
- Familie von Plessen
- Familie von Bülow
- Familie von Pentz
- Denkstein von Selow
- Personennamen in Beziehung auf Meklenburg aus dem Lübecker Oberstadtbuche
- Hanenzagel und Hanenstert
- Niederdeutsches Evangelienbuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts
- Novum Testamentum per Desiderium Erasmum Roterodamum 1530
- Hermann Barckhusen und das hamburger Brevier von 1508
- Die Straßengerechtigkeit in Meklenburg
- Ueber die Aussteuer der Töchter aus dem Lehn, eine Urkundenmittheilung
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 236 ] |




|


|
[ Seite 237 ] |




|



|



|
|
:
|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Im Allgemeinen.
Untersuchungen
über
die heidnischen Grabgefäße,
von
G. C. F. Lisch.
U eber die Art der Verfertigung der thönernen Gefäße, welche in den heidnischen Gräbern Norddeutschlands und überhaupt in den vorchristlichen Begräbnissen der Länder germanischer Bevölkerung gefunden werden, sind bisher die abweichendsten Meinungen laut geworden. Es ist darüber so viel geschrieben und oft so viel mit der sonderbarsten Kleinlichkeit zusammengetragen, daß es ermüden muß, eine Recension aller dieser Meinungen, welche nichts weiter sind als Meinungen, nur durchzulesen. Das Resultat der frühern Ansichten geht aber im Allgemeinen dahin, daß die Urnen in den heimischen Grabhügeln nicht auf der Töpferscheibe verfertigt und nicht gebrannt, vielmehr aus freier Hand geformt und durch Luft und Sonne gehärtet oder gedörrt seien. Es fragt sich, ob dies möglich, wahrscheinlich und wirklich gewesen sei.
Ehe diese Fragen beantwortet werden können, wird es nicht unzweckmäßig sein zu bemerken, daß sich bei fortgesetzter Forschung die Scheidung der Begräbnisse im nordöstlichen Deutschland in drei Hauptclassen:
1) in die steinernen Hünengräber des unbekannten vorgeschichtlichen Volkes mit Steinwerkzeugen, ohne Kenntniß der Metalle,
2) in die Kegelhügel der Germanen mit Geräthen aus Bronze und mit Schmuck aus Gold,


|
Seite 238 |




|
3) in die Begräbnißplätze der Wenden mit den in den natürlichen Erdboden eingegrabenen Urnen, welche Werkzeuge aus Eisen und Schmuck aus Silber enthalten,
als unzweifelhaft richtig bewährt hat und daß jetzt sogar schon Uebergangsperioden beobachtet werden können.
So verschieden nun diese Hauptclassen von Gräbern nach ihrem Inhalte an Waffen, Werkzeugen und Schmuck sind, so sehr übereinstimmend ist die Art der Verfertigung der Urnen, welche in allen drei Classen von Gräbern gefunden werden. Die Art der Verfertigung, ja selbst die Masse ist bei allen Urnen aus allen Arten von heidnischen Gräbern durchaus gleich und die Urnen der verschiedenen Perioden der Vorzeit unterscheiden sich vorzüglich nur durch Gestalt und Verzierung.
Die Frage über die Härtung der heidnischen Gefäße läßt sich kurz beantworten. Denn daß die Urnen nicht gebrannt, sondern nur von Luft und Sonne gedörrt, der Erde anvertraut sein sollten, ist nicht möglich, da sie sich in diesem Falle nicht so viele Jahrhunderte, ja Selbst Jahrtausende lang in feuchter Erde fest und unverletzt erhalten haben könnten. Die tägliche Erfahrung lehrt schon, wie wenig Formungen von ungebranntem Thon der Feuchtigkeit widerstehen, wenn man es auch nicht in Anschlag bringen will, daß die ältesten Urnen so häufig hell klingend der Erde entnommen werden. Bloß getrockneter Thon würde in der Erde wieder zu einer feuchten Masse erweichen. Die Erfahrung lehrt dagegen, daß wenn Thon auch nur durch ein offenes Feuer, z. B. einer Feuersbrunst, ein wenig gehärtet ist, er seine Form Jahrhunderte lang behält; daher sind die Reste der im 12. Jahrh. durch Brand untergegangenen Lehmwände auf den wendischen Burgwällen meistens noch so gut erhalten, daß sich noch klar die Stroheindrücke unterscheiden lassen, obgleich die Masse nur leicht geröthet ist.
Schwieriger ist die Frage zu beantworten, auf welche Weise die heidnischen Urnen geformt sind. Zwar hat es den Anschein, daß die Gefäße auf der Scheibe gedrehet sind, so daß selbst erfahrene Töpfer an der Verfertigung aus freier Hand zweifeln; die Regelmäßigkeit und Cohärenz aller einzelnen Theile derselben zu einem festen Ganzen, die Schönheit und völlig runde Schwingung der Formen, die gleichmäßigen Linien der Ränder, die ebenen Flächen des Bodens lassen starke Zweifel an der Bildung aus freier Hand entstehen. Dazu kommt, daß die Töpferscheibe ein sehr altes Hülfsmittel zur


|
Seite 239 |




|
Verfertigung von Gefäßen ist. Schon im Homer 1 ) ist die Töpferscheibe bekannt, und die Cultur der alten Griechen und Germanen war zu einer gewissen Zeit, wo die Bronze allein herrschend war (Bronzezeitalter) 2 ) nach allen Aufgrabungen so übereinstimmend, daß sich die Germanen vor den Griechen nicht zu schämen brauchen, indem beide eine völlig identische Cultur besitzen. Beide schöpften ihre Bildung gewiß vielmehr aus einer und derselben Quelle, welche im epischen Zeitalter lange Zeit reichlich floß, bis die Ausbildung der Baukunst der Cultur der Griechen eine andere Richtung gab. Die Unbekanntschaft der Wenden mit der Töpferei im heutigen Sinne des Gewerbes scheint auf den ersten Blick ebenfalls unglaublich, da ihre Berührung mit den germanischen Völkern des Mittelalters ihnen wohl ein wichtiges gewerbliches Hülfsmittel zugeführt haben dürfte.
Ehe sich jedoch beide Untersuchungen, über
Formung und Härtung der Urnen, zu Ende führen
lassen können, steht es hauptsächlich zur Frage:
wie wurden die Urnen denn wirklich gemacht?
Bevor diese Frage beantwortet werden kann, muß
aber jedem noch die Frage in den Sinn kommen:
woher denn diejenigen, welche die Bekanntschaft
der alten Völker Deutschlands mit der
Töpferscheibe leugnen, ihre Gründe genommen
haben? - Diese letztere Frage läßt sich durch
nichts beantworten. Es giebt keine andern Gründe
dafür, als daß die Verfechter der bisherigen
Meinung sagen: "der Augenschein lehre es, -
es sei klar, - es lasse sich nicht bezweifeln
 ., daß die Urnen aus freier Hand
geformt und nicht gebrannt seien"; - oder
man sagt auch schlechthin: "es sei eine aus
freier Hand geformte und nicht gebrannte Urne
gefunden",
., daß die Urnen aus freier Hand
geformt und nicht gebrannt seien"; - oder
man sagt auch schlechthin: "es sei eine aus
freier Hand geformte und nicht gebrannte Urne
gefunden",
 . Mit solchen zuversichtlichen
Angaben, welche nur aus dem
. Mit solchen zuversichtlichen
Angaben, welche nur aus dem
Vergl. K. O. Müller Archäologie der Kunst, §. 62.Kreisend hüpfdten sie bald mit schön gemessenen Tritten
Leicht herum, so wie oft die befestigte Scheibe der Töpfer
Sitzend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch laufe.

 (ein ehernes Geschlecht) nennt
und so treffend schildert:
(ein ehernes Geschlecht) nennt
und so treffend schildert:
Und von seiner Zeit sagt er v. 159:Damals formte man Erz; noch gab's kein dunkeles Eisen.
Jetzt nun lebt ein eisern Geschlecht. -


|
Seite 240 |




|
ersten flüchtigen Anblick weniger Gefäße gezogen sein können, ist es aber nicht allein gethan. Daß eine Urne hin und wieder einige unbedeutende Erhöhungen und Vertiefungen auf ihrer Außenseite hat, berechtigt noch nicht zu der Annahme, sie sei aus freier Hand gebildet und nur gedörrt.
Es steht daher nun hauptsächlich zur Frage: Wie bildeten die Alten Deutschlands ihre Gefäße?
Ein flüchtiger Anblick des Aeußern einer Urne allein führt zu gar keiner bestimmten Ansicht von der Verfertigung des ganzen Gefäßes. - Alle heimischen Urnen sind ohne Unterschied der Zeit aus einem Gemenge von Thon und zerstampftem Granit, oder dem Ansehen nach aus Thon, Glimmerblättchen und zerstampftem Feldspath und Kies verfertigt, aus einem Teige, der nach Zeit oder Umständen mehr oder weniger grobkörnig ist. Die grobkörnigsten Urnen werden in den ältesten Gräbern beobachtet, wenn auch in jeder Art von Gräbern feinkörnige Urnen gefunden werden. In Hünengräbern sind oft so grobkörnige Urnen gefunden, daß sie fast ganz aus grob zerstampftem Feldspath zu bestehen scheinen. Im Fortschritte der Zeit wird das Gemenge immer feinkörniger; an die Stelle des zerstampften Granits tritt nach und nach öfter mehr gleichkörniger Kiessand; so viel ist sicher, daß man in den Wendenkirchhöfen nicht mehr so grobkörnige Urnen findet, wie in den Hünengräbern.
Betrachtet man nun eine unverletzte Urne in ihrer äußern und inneren Oberfläche, so ist ihr freilich die Art ihrer Verfertigung nicht anzusehen: alles an der Oberfläche ist geglättet und mitunter etwas leise hügelig; auch der Boden ist glatt und es fehlen demselben beständig die Streifen, welche das Abschneiden von der Töpferscheibe verrathen und häufig als die sichern Kennzeichen der Anwendung derselben betrachtet werden; der Granitgrus tritt an den Außenwänden der Urnen fast ganz in den Hintergrund. Ganz anders gestaltet sich aber die Sache, wenn man eine hinreichende Menge von Urnenscherben aller Art vor sich hat. An diesen macht man dann die auffallende Entdeckung, daß die gröbere, mit Steingrus vermengte Masse den Kern der Urnenscherbe, den inneren Haupttheil der Wand bildet und dieser Kern nach der Außenfläche und Binnenfläche hin allmählig feiner wird, bis die äußersten Flächen ganz in reinen Thon übergehen; nur einzelne Sandkörner, Feldspathstückchen und Glimmerfünkchen haben sich noch durch die Oberfläche durchgedrängt. Diese Art der Verfertigung muß gar Wunder nehmen. Wie, wird man fragen, haben die Leute es


|
Seite 241 |




|
möglich gemacht, den innern Theil der Scherbe regelmäßig ganz grobkörnig zu bilden und ihn nach den Außenflächen hin allmählig in eine feine, unvermischte Thonmasse übergehen zu lassen? - Einige neuere Entdeckungen werden diese Erscheinung völlig aufzuklären im Stande sein. In der großherzogl.=meklenburgischen Sammlung und in der Sammlung des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, beide zu Schwerin, befinden sich nämlich ganze Urnen und Scherben von Urnen, welche noch nicht vollendet sind, und diese zeigen völlig klar das bei der Anfertigung der Urnen beobachtete Verfahren, das sich nur durch Ansicht dieser Urnen oder durch Annahme der folgenden Beschreibung beweisen läßt. Man bildete nämlich zuerst die Urne aus der mit zerstampftem Granit vermengten Thonmasse. War diese Masse sehr grobkörnig, so wurden die Außenflächen sehr rauh; war die Masse, wie die der Urnen in den Wendenkirchhöfen, feiner, so waren die Wände für das weitere Verfahren nicht rauh genug und man machte sie durch vertiefte Einkratzungen oder auch durch viele und schmale Abschabungen rauh, damit eine feinere Masse auf diesen rauhen Flächen haften konnte. Auf diesen rauhen Kern der Urne trug man dann eine feinere Thonmasse, bis die Urne im Innern und Aeußern glatt und wieder rund war, und zwar so, daß man zuerst die innere Fläche ganz und den äußern Theil des Halses oder Randes überzog und dann, nachdem der Rand trocken war, die Urne umstülpte und die Außenwand und den Boden überzog. Dann wurden die Verzierungen eingegraben, eingeschnitten oder eingedrückt. Mit diesem Ueberziehen der Urnen verschwindet denn freilich jedes äußere Merkmal von der Art der Verfertigung der Gefäße.
Nur wenige Gefäße zeigen unten auf dem Boden einen runden Eindruck, welcher sicher dadurch entstanden ist, daß man das Gefäß bei der Ueberziehung mit reinem Thon auf dem Daumen herumgedreht hat wenn man dieselbe von Außen begann.
Diese Art der Verfertigung der heidnischen Gefäße ist zu allen Zeiten ohne Ausnahme dieselbe; und sie allein kann Aufklärung darüber geben, ob die Töpferscheibe angewandt worden sei oder nicht. Auf den ersten Blick ergiebt sich nun ohne Zweifel, daß die heidnischen Völker des nördlichen Europas zu keiner Zeit die Anwendung der Töpferscheibe gekannt haben. Es ist unmöglich, daß ein Gefäß von einer durchgehends stark mit Granitgrus gemengten Masse auf der Töpferscheibe habe gedreht werden können, da die Töpferscheibe eine durchaus feine und gleichförmige Masse fordert. Alle einzelnen Sandkörner oder Feldspathstücke, deren sich Tau=


|
Seite 242 |




|
sende in einer Urne finden, würden tiefe parallele Furchen gebildet, die Wände zerrissen, ja die Formung derselben unmöglich gemacht haben. Es ist daher ohne Zweifel, daß alle heidnischen Urnen aus freier Hand gebildet sind. Der Anblick einer noch nicht mit feinem Thon überzogenen Urne zeigt dies unwidersprechlich; man sieht klar die einzelnen Theile der Oberfläche in rundlichen Flächen gebildet, so daß es klar ist, die ganzen Gefäße seien durch kreisförmige Bewegung der Hand, durch Drücken und Wischen gebildet. Zwar erscheint eine solche Fertigkeit wunderbar, und es giebt in den Sammlungen zu Schwerin Gefäße von den größten Dimensionen, welche in der Regelmäßigkeit der Form den besten Töpfer= und Porzellanarbeiten unserer Tage nicht nachstehen. Aber die Sache hat sich einmal nicht anders machen lassen und man muß den Alten diese große Fertigkeit und Sicherheit zugestehen, so dünne und regelmäßig auch viele Gefäße gebildet sind.
Diese Bildung des Teiges, aus welcher die Gefäße geformt sind, führt uns denn wieder auf die Art der Härtung derselben zurück. Die Mengung der Masse mit Granitgrus geschah wahrscheinlich, um die Form der Gefäße beim Brennen zu bewahren; denn es geschieht bei nicht gehöriger Regulirung des Brennfeuers häufig, daß die Form der thönernen Gefäße nicht stehen bleibt, sondern sich wirft, ja ganz vernichtet wird. Die Vermischung des Thons mit Granit war also zur Erhaltung der Form der Gefäße notwendig.
Ueberdieß lehrt auch der bloße Anblick, daß die alten Gefäße durch Feuer gehärtet sind.
Die kleinen, becherförmigen Gefäße der Hünengräber, welche in der Regel von reinerer und feinerer Thonmasse sind, und die größern urnenförmigen Gefäße, welche in der Regel aus einer mehr grobkörnigen Masse bestehen, sind fast in der Regel röthlich oder rothgelb gebrannt. Thon wird aber bekanntlich nur durch Brennen roth; die genannten Urnen oder die Scherben derselben sind nun oft ganz den gebrannten, feinern Ziegeln an Farbe gleich. Die größern topfförmigen Urnen in den Hünengräbern und die kleinern Henkelgefäße in den Kegelgräbern sind in der Regel schwärzlich oder schwarzbraun; dieselbe Farbe haben hin und wieder, neben seltenen, ziegelroth gebrannten Urnen, auch Urnen in den Wendenkirchhöfen. Alle diese schwärzlichen Urnen tragen nun vollends die unverkennbaren Zeichen des Brandes; sie sind nämlich wolkig oder geflammt gefärbt, indem neben hellere Flächen sich


|
Seite 243 |




|
schwarze, wolkige Stellen legen, welche nur durch das russige Anschlagen der Flammen entstanden sein können. Die schwarze Färbung der wendischen Urnen ward ohne Zweifel wohl deshalb gewählt, um diese Unregelmäßigkeit der unvollkommenen Brennung zu verdecken.
So unzweifelhaft nun die Härtung der Urnen durch Feuer ist, so wenig darf man wohl den Gebrauch eines künstlichen, ganz verschlossenen, feuerfesten Ofens annehmen. Gebrannt sind die Urnen ohne Zweifel, aber nicht gar gebrannt, nicht ganz fest. Dieser Mangel, die Unregelmäßigkeit der durch die Brennung entstandenen natürlichen Farben der Urnen, die russigen Wolken der Färbung scheinen vielmehr darauf hinzudeuten, ja es gewiß zu machen, daß man die Urnen in einer hellen Gluth härtete, welche mehr frei brannte und vielleicht nur an den Seiten durch Stein= und Rasenschichtungen zusammengehalten ward.
Der Brennofen ist überhaupt und unzweifelhaft in den nordöstlichen Ländern Deutschlands nur eine Folge christlicher Cultur; erst mit der Einführung des Christenthums erscheinen in diesen Ländern gebrannte Ziegel und gar gebrannte Töpfergefäße. Selbst die fürstlichen Burgen waren nur aus Holz und rohem Lehm gebauet.
Es ist daher ohne Zweifel, daß alle heidnischen Gefäße
1) aus freier Hand geformt,
2) an offenem Feuer gehärtet sind.
Den besten Vergleichungspunct geben die bekannten schwarzen jütischen Töpfe, welche durch ganz Dänemark und Norddeutschland ausgeführt werden. Nach sorgfältigen Nachforschungen bei mehrern in Jütland geborenen und erzogenen Töpfern werden diese Töpfe nicht von Töpfern, sondern in ganz Jütland in den armem Gegenden von allen Bauerfamilien, von Personen männlichen und weiblichen Geschlechts, gemacht, und zwar ohne Ausnahme aus freier Hand, durch Drücken, Schmieren und Wischen mit kleinen Ballen und Steinen, und an einem offenen Feuer von Torf, wie Kohlen in einem Meiler, halb gar gebrannt, wodurch sie die schwarze Farbe erhalten 1 ). Der Herr Professor Ehrenberg zu Berlin teilte mir mit, daß er gesehen habe, wie die Nubier neben ihren Hütten Töpfe, höher als die Hütten, zur Aufbewahrung des Getreides aus freier Hand formten. Diese Art der Gefäßbereitung giebt den


|
Seite 244 |




|
besten Beweis für die Möglichkeit der Verfertigung der alten Urnen aus freier Hand, obgleich der Kunstsinn und die Fertigkeit der Alten auf einer unendlich viel höhern Stufe stand, als jetzt selbst bei unsern geschicktern Töpfern.
Hat man die Art der Verfertigung der Graburnen erkannt, so ist es demnächst eine verzeihliche Frage, ob man nicht Kennzeichen habe, aus denen man bestimmen könne, welcher der verschiedenen Perioden die Urnen angehören, auch wenn man nichts von den Umgebungen weiß, unter denen sie gefunden sind. Die Art der Verfertigung giebt, wie dargelegt ist, kein Kennzeichen ab; auch die eingesprengten Glimmerfünkchen verstatten keinen Schluß auf ein Volk, dem solche Urnen angehören könnten, da sie sich an allen Urnen finden. Man muß daher nach andern Kennzeichen suchen. Das trüglichste Kennzeichen ist die Masse, aus der die Urnen bestehen; dennoch kann ein durch Uebung geschärftes Auge es in Anwendung bringen. Im Allgemeinen wird nämlich die Masse im Fortschritte der Zeit feinkörniger. Es ist damit nicht der Schluß gestattet, als gehörten alle Urnen aus feinkörniger Masse einer jüngern Zeit an, da man auch in Hünengräbern feinkörnige Urnen findet; aber so viel ist gewiß, daß sich Urnen mit sehr grobem Feldspathgemenge in der Regel nur in Hünengräbern, Urnen, mit starkem Kiessande und feinen Quarzkörnern versetzt, in der Regel in Kegelgräbern, Urnen von mehr gleichmäßiger Masse vorherrschend in Wendenkirchhöfen finden. Jedoch läßt sich dergleichen nur nach Proben beurtheilen und schwer beschreiben. - Ein mehr sicheres Kennzeichen geben die Formen der Urnen. In den Hünengräbern der Steinperiode kommen kannen=, birnen= und kugelförmige Urnen, oft mit ganz kleinen Henkeln versehen, häufig vor; ganz eigentümlich sind ihnen die kleinen becherförmigen Gefäße mit fast senkrechten Wänden, - Formen, die ganz charakteristisch sind und späterhin nicht wieder vorkommen, wenn auch zuweilen in ähnlichem, größern Maaßstabe. Im allgemeinen sind die Gefäße der Hünengräber immer nur klein. -In den germanischen Kegelgräbern ist die Mannigfaltigkeit der Urnen sehr groß. Vorherrschend sind jedoch zweierlei Arten von Urnen: diejenigen, welche man vasen= oder urnenförmige nennen kann, von allen Größen, oft von bedeutender Höhe, mit geringen Ausbauchungen, ähnlich den Krateren der Griechen und Römer, und die feinen Henkelgefäße von allen Größen, mit stark eingezogenem, hohen Halse und großen Henkeln im Verhältniß zur Urne; man findet die letztere Form auch aus ge=


|
Seite 245 |




|
schlagener Bronze. Einige Formen, wie die eines Bienenkorbes, mit einer kuppelförmigen Wölbung statt der Oeffnung und mit einer Thüröffnung in der Seitenwand, - ferner wie die einer antiken Schale mit Seitenhenkeln, ähnlich einer Amphore, u. a. sind dieser Art von Gräbern ganz eigenthümlich.
Die Urnen in den Wendenkirchhöfen sind regelmäßig fast von derselben Gestalt und sind auf den ersten Blick an der Form zu erkennen; man kann sie schüsselförmig nennen; der Reichthum der Formen weicht in dieser Zeit einem allgemeinen Typus, der über ganze Länder verbreitet ist. Sie sind im Verhältnisse zur Oeffnung in der Regel nur niedrig; sie sind nach oben hin stark ausgebaucht und sehr weit geöffnet und laufen nach dem Boden von sehr geringem Durchmesser sehr spitz zu, so daß sie oft bei der geringsten Berührung umfallen. Große Henkel fehlen ihnen ganz; dagegen zeichnen sie sich durch angesetzte kleine, durchbohrte Knötchen oder Knöpfchen aus, welche wahrscheinlich dazu dienten, mehrere zusammengehörende Urnen zusammenzubinden, da eine Urne zum Bergen aller Gebeine des verbrannten Leichnams zu klein war. Vielleicht waren diese Knötchen auch nur Styl, da die Gefäße zum häuslichen Gebrauche auch ähnliche Knöpfe hatten, zum durchziehen einer Schnur (eines Seils), um sie an dieser zu tragen (Seiltopf, plattd. sêlpott).
Die verschiedenen Urnen lassen sich folgendermaßen beschreiben. Die Urnen der Hünengräber sind klein und in den Formen mannigfaltig, becher=, birnen= und kugelförmig; der Bauchrand liegt tief. Die Urnen der Kegelgräber sind groß und haben mehr senkrechte Formen, welche sich den sogenannten antiken Formen nähern; der Bauchrand liegt mehr in der Mitte. Die Urnen der Wendengräber sind schüsselförmig, weit geöffnet und unten spitz; der Bauchrand liegt hoch oben.
Das sicherste Kennzeichen des Alters der Urnen liegt jedoch ohne Zweifel in den Verzierungen derselben, welche zugleich bedeutende Beiträge zur Kenntniß der Geschmacksbildung desjenigen Volkes geben, von dem sie herstammen. Es ist freilich schwer, ohne bildliche Darstellungen Zeichnungen charakteristisch zu beschreiben; jedoch läßt sich Manches andeuten, was überall leicht wieder zu erkennen ist. - Die Verzierungen der Urnen in den Hünengräbern sind sehr charakteristisch; sind sie auch tief eingegraben und steif in den Linien, so zeigen sie doch eine sehr selbstständige, nicht unedle Geschmacksbildung. Die Verzierungen bestehen stets in kurzen Linien, welche gewöhnlich in sehr großer Menge, zu=


|
Seite 246 |




|
weilen auf die ganze Außenseite des Gefäßes, mit einem ziemlich groben Griffel tief in das Gefäß eingedrückt sind. Häufig sind Verzierungen aus perpendiculairen Linien, welche gruppenweise parallel neben einander stehen. Andere häufig vorkommende Verzierungen sind im Allgemeinen schuppenförmig, oft mit nach unten gekehrten Spitzen, wie kleine, gemaschte Franzen; oft bestehen sie nur aus Gruppirungen von kurzen senkrechten Linien. - Die Verzierungen der Urnen in den Kegelgräbern sind viel mannigfaltiger und freier und größer, erscheinen jedoch viel seltener, als auf allen andern Arten von Urnen; gewöhnlich bestehen sie in den mannigfaltigsten Gruppirungen aus flach eingeschnittenen, concentrischen Halbkreisen, welche auf Linien stehen, die rings um den Bauch der Urne laufen, oder aus mehrern concentrischen Kreisen, welche über dem Bauche der Gefäße eingeschnitten sind; alle Verzierungen an dieser Art von Urnen sind leichter und großartiger gehalten. Gewöhnlich finden sie sich nur an den Henkelgefäßen und weiten antiken Schalen, seltener an den hohen, urnenförmigen Gefäßen, die in der Regel roh und grob gearbeitet sind. - Die Verzierungen der Urnen in den Wendenkirchhöfen sind nie zu verkennen: sie sind wie mit einem kleinen, laufenden, gezahnten Rade, welches kleine, dicht stehende, vierseitige Puncte bildet, eingedrückt; diese Eindrücke laufen in parallelen, graden und in rechten Winkeln gebrochenen Linien, dem Mäander ähnlich, um die hoch liegende, weite Bauchung der Urne; nach dem Boden hin bilden sie allerlei gradlinige Figuren in verschiedenen Winkeln. Die Anwendung des Kammrades machte eine freie Behandlung der Verzierungen unmöglich oder doch sehr schwierig; daher ist eine immer wiederkehrende Grundform in der Verzierung leicht erklärlich. Die Ueberziehung der wendischen Urnen mit einer dunkelschwarz erscheinenden Masse, vielleicht nur schwarz gefärbtem Thon, ist den wendischen Urnen eigenthümlich.
Es bleibt nur noch übrig, die Bestimmung der in den heidnischen Gräbern niedergesetzten Gefäße zu erforschen. Die Zeit ist nicht ferne, wo man alle vorchristlichen Gefäße für Opfergefäße ausgab, wie alle alten Geräthe für Opfergeräthe. In Meklenburg ist nie ein Fall vorgekommen, daß man hätte versucht sein können, irgend ein Gefäß als zum gottesdienstlichen Gebrauche bestimmt anzusehen; vielmehr gehören alle hier gefundenen Gefäße dem Todten=


|
Seite 247 |




|
Cultus an. Es scheint, als wenn die Leichen der ältesten Hünenzeit in Meklenburg regelmäßig unverbrannt beigesetzt wurden; aber so viel ist gewiß, daß in Meklenburg schon in den Hünengräbern häufig Leichenbrand vorkommt, der in der Bronzezeit der Kegelgräber herrschend und allgemein wird, indem aus dieser nur sehr wenig Beispiele von Beisetzung der unverbrannten Leiche vorkommen; in den Wendenkirchhöfen ist nur Leichenbrand erkennbar, von Beisetzung der Leichen ist keine Spur, als etwa in den letzten Zeiten des Heidenthums an den Rändern der großen Begräbnißplätze (Wendenkirchhöfe). Es werden nun auch in den Hünengräbern, welche unverbrannte Leichen enthalten, Gefäße gefunden; diese waren wohl ohne Zweifel die Trink= und anderen Gefäße des Bestatteten und wurden ihm, wie seine steinernen Waffen und sonstigen Geräthschaften, nach uraltem Gebrauche mit ins Grab gegeben. Alle Gefäße aus den Brandhügeln und großen Begräbnißstellen waren aber dazu bestimmt, die Ueberreste des verbrannten Leichnams aufzunehmen. Die Gefäße der Kegelgräber scheiden sich dabei in zwei Gattungen, welche ziemlich klar zu beobachten sind: in Beinurnen (ossuaria) und Aschenurnen (cineraria). Die größern, gröbern, urnenförmigen Gefäße dienten, wenn mehren Gefäße in einem Grabe gefunden werden, zur Aufbewahrung der Gebeine (ossuaria) des verbrannten Leichnams; in die kleinern, feinern, gehenkelten Gefäße ward die Asche der Leiche (cineraria) gesammelt; auch die ganz kleinen, zierlichen Gefäße und Näpfe, welche den Kegelgräbern eigenthümlich sind, sind häufig mit Asche gefüllt und scheinen dazu bestimmt gewesen zu sein, die Asche von einzelnen Theilen der Leiche aufzunehmen, wie z. B. von der Stelle, wo das Herz der verbrannten Leiche auf der Brandstätte gelegen hatte. Auch die großen, niedrigen Schalen der Kegelgräber dienten nicht zum gottesdienstlichen Gebrauche; sie wurden dazu gebraucht, sie umgekehrt auf die Urnen zu stülpen und diese damit zu bedecken, wenn die Urnen keine eigenen Deckel hatten oder nicht mit Steinen zugedeckt wurden. Auch dienten die Schalen zu Untersatzschalen der Urnen. In den Wendenkirchhöfen ist freilich kein äußerer Unterschied zwischen Beinurnen und Aschenurnen bemerkbar. Jedoch ist es sicher, daß, wo, wie es häufig der Fall ist, die Urnen paarweise oder nesterweise beisammenstehen, die eine Knochen, die andere Asche enthält.
Sind nun die verschiedenen Perioden der Völker, denen die vorchristlichen Gräber in Meklenburg angehören, im Allge=


|
Seite 248 |




|
meinen erkannt, - sind selbst hiernach, wenigstens für Meklenburg, Holstein, die brandenburgischen Marken und Pommern, untrügliche Kennzeichen für die Urnen der verschiedenen Perioden gewonnen: so ist es nicht zu gewagt, jetzt schon versuchsweise einen Schritt weiter zu gehen und die Uebergangsperioden zwischen den verschiedenen Hauptepochen aufzusuchen. Hiebei muß aber wiederum bevorwortet werden, daß die Aufhäufung von Alterthümern in Museen ohne zuverlässige Aufgrabungsberichte zur unmittelbaren, reinen Erkennung der ethnographischen Fragen nichts hilft, und daß diese Aufhäufung von alterthümlichen Schätzen erst dann für den höchsten Zweck einige Ausbeute gewähren kann, wenn die ethnographischen Fragen gelöset sind und die Beantwortung derselben nur noch der Vervollständigung und Anwendung bedarf 1 ).
Die älteste Classe der Gräber, die der Hünengräber, besteht entweder aus viereckigen Steinbauten (Steinkammern) ohne Erdhügel, oder aus sehr langen, nicht hohen, mit großen Granitpfeilern umstellten Hügeln (Riesenbetten), in welchen sehr häufig an einem Ende eine Grabkammer steht, die mit großen Granitplatten bedeckt ist. Diese Classe von Gräbern unterscheidet sich vor allen andern ohne Zweifel durch gänzlichen Mangel an Metall: alle Geräthe sind aus Stein, vorherrschend aus Feuerstein, Hornblende und Grünstein; der Schmuck ist aus Bernstein gearbeitet. Dennoch soll Eisen in den Gräbern dieser Classe gefunden sein. Diese Wahrnehmung ward zuerst in Meklenburg gemacht (vgl. Friderico-Francisceum, Erläuterung S. 74 u. 76 flgd.). Diese Erscheinung war im Gegensatze zu andern Beobachtungen allerdings höchst auffallend und konnte nicht aufgeklärt werden. In den neuesten Zeiten ist Danneil (vgl. Erster Jahresbericht des altmärkischen Vereins, 1838, S. 44) so glücklich gewesen, diese Erscheinung aufklären zu können. Auch in der Altmark ward in Urnen Eisen in Hünengräbern gefunden, jedoch keineswegs, wie in der Regel in aufgeschütteten Hügeln die Alterthümer geborgen


|
Seite 249 |




|
sind, in der Tiefe der Hügel auf dem Urboden, sondern dicht unter der Rasendecke und an den Seiten der Grabhügel; die Urnen, in denen diese eisernen Altertümer aufbewahrt sind, sind die Urnen mit den unverkennbaren Kennzeichen, welche sich in den jüngsten Wendenkirchhöfen finden. Nach Gewinnung dieses Resultats erhalten denn auch die in den meklenburgischen Hünengräbern gefundenen eisernen Alterthümer Aufklärung, indem sie denen gleichen, welche unter ganz andern Umständen in den Wendenkirchhöfen gefunden werden. - Wir haben es in solchen Fällen also mit einer zweiten, jüngern Bestattung zu thun, indem Slaven ihre Todten in den "Gräbern der Vorzeit" ("sepulchris antiquorum", wie die Slaven die Hünengräber selbst nennen: vgl. Lisch Mekl. Urkunden. Bd. I an mehrern Stellen und Frid. Franc. S. 10 flgd.) beisetzten, wie noch heute die kirgisischen Völkerschaften am Altai ihre Begräbnisse an die uralten, heiligen Tschudengräber lehnen, welche den Kegelgräbern in den Ostseeländern in jeder Hinsicht gleich sind (vgl. Ritters Erdkunde von Asien, zweite Ausgabe, I, S. 761, 764 flgd., 778, u. a. a. O.). In Meklenburg sind in den letzten Jahren solche jüngere Bestattungen in uralten Gräbern, zuweilen aus mehreren Perioden über einander, öfter beobachtet. In einigen Fällen ist es aber auch zur unbezweifelten Gewißheit geworden, daß alte Hünengräber schon früher durchwühlt sind und die in ihnen gefundenen eisernen Geräthe aus den allerneuesten Zeiten stammten, indem sie bei der Durchwühlung verloren oder abgebrochen waren.
Ganz außer dem Bereiche der Forschung über den Inhalt der Hünengräber liegen gewöhnlich die Münzen, welche in norddeutschen Hünen= und Kegelgräbern gefunden sein sollen. Gewöhnlich sind es altdeutsche Dickpfennige aus der ottonischen Kaiserzeit oder noch ältere deutsche Münzen, welche unter dem Namen der wendischen Pfennige bekannt sind; in Meklenburg sollen dergleichen in einem Kegelgrabe gefunden sein, welches nach dem übrigen Inhalte sicher der Blüthe der germanischen Bronzezeit angehört (vgl. Evers Betrachtung über eine in Rostock geprägte alte Münze, 1785), und auch aus der Mark wird über einen ähnlichen Fund berichtet (vgl. v. Ledebur: Das königl. Museum Vaterländ. Alterth. zu Berlin, 1838, S. 86). Aber über solche Funde ist so wenig Zuverlässiges und Genaues aufgezeichnet, daß sich aus denselben gar nichts anders schließen läßt, als daß die Münzen, wie häufig, zur größern Sicherheit hinter großen Steinen und im heiligen Grabesring verborgen werden. Zu solchen jüngern Eingrabungen gehören denn auch jene kugeligen, langhalsigen und gehenkelten, hell klingend ge=


|
Seite 250 |




|
brannten Töpfe aus blaugrauem Thon, welche ohne Zweifel dem frühern Mittelalter, vom 12. bis 15. Jahrhundert, angehören und in denen öfter Münzen vergraben wurden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß man solche Töpfe mit Münzen und andern Kostbarkeiten auch an und neben Grabhügeln eingrub. Wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß in der letzten Zeit des Slaventhums in Slavenländern, aber auch nur in diesen, solche Töpfe zu Graburnen benutzt sein mögen, so gehören doch solche Fälle gewiß zu den höchst seltenen und bedürfen zur Beglaubigung der genauesten Nachrichten und Zeichnungen.
Dennoch lassen sich von der Zeit des Ueberganges
von den Hünengräbern zu den germanischen
Kegelgräbern Beispiele nachweisen. In den
meisten Hünengräbern des gesammten Nordens sind
die Leichen beigesetzt; Leichenbrand ist selten.
Diese Gräber in der Gestalt der Steinkisten und
langgestreckten Betten werden vorzüglich durch
Geräthe aus Stein bezeichnet. Hin und wieder
finden sich jedoch Hünengräber mit Leichenbrand;
diese werden schon einer etwas Jüngern Zeit
angehören. Diese Riesenbetten mit Brandstätten
verlieren denn auch an ihrer alten Form, indem
sich das Oblongum des Steinringes oft mehr dem
Kreise nähert. Und in solchen Hünengräbern
werden denn auch die ersten Spuren von Metall,
und zwar von rothem, unvermischten Kupfer
gefunden (vgl. Erster Jahresbericht des altmärk.
Vereins S. 43 und Jahrb. des Ver. f. meklenb.
Gesch.
 . IX, S. 326 flgd.).
. IX, S. 326 flgd.).
Diese Uebergänge lassen sich auch in den
germanischen Kegelgräbern verfolgen, denen die
Belastung mit Steinen ganz fehlt und welche,
gleich den alten südeuropäischen und
nordasiatischen Gräbern (vgl. Ritters Erdkunde
a. a. O. S. 649-733, 761, 901, 1103, 1134
 .), in Kegelform aufgeschüttet
sind. Die Geräthe, welche in diesen Gräbern
gefunden werden, sind durchaus nur aus Bronze,
d. h. mit Zinn oder Blei legirtem Kupfer, die
Schmucksachen aus reinem Golde; Silber und Eisen
fehlen, Stein dürfte höchstens nur in
Streitäxten vorkommen, deren Form sich bis auf
die neuern Zeiten erhalten hat. Diese Periode
der germanischen Kegelgräber charakterisirt sich
durch den Leichenbrand; jedoch kommen, wiewohl
höchst selten, einzelne Leichenbestattungen vor,
wie z. B. in einem Familienbegräbnisse die
zuerst und am tiefsten bestattete Leiche ohne
Verbrennung beigesetzt war, die später und höher
bestatteten Leichen verbrannt und in Urnen
beigesetzt wurden (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 43
flgd.). Solche Grabhügel stammen aus der Zeit
des Ueberganges von der unbekannten
.), in Kegelform aufgeschüttet
sind. Die Geräthe, welche in diesen Gräbern
gefunden werden, sind durchaus nur aus Bronze,
d. h. mit Zinn oder Blei legirtem Kupfer, die
Schmucksachen aus reinem Golde; Silber und Eisen
fehlen, Stein dürfte höchstens nur in
Streitäxten vorkommen, deren Form sich bis auf
die neuern Zeiten erhalten hat. Diese Periode
der germanischen Kegelgräber charakterisirt sich
durch den Leichenbrand; jedoch kommen, wiewohl
höchst selten, einzelne Leichenbestattungen vor,
wie z. B. in einem Familienbegräbnisse die
zuerst und am tiefsten bestattete Leiche ohne
Verbrennung beigesetzt war, die später und höher
bestatteten Leichen verbrannt und in Urnen
beigesetzt wurden (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 43
flgd.). Solche Grabhügel stammen aus der Zeit
des Ueberganges von der unbekannten


|
Seite 251 |




|
Hünenzeit zum ehernen Zeitalter. - Die Zeit der
germanischen Kegelgräber bleibt sich in zahlen
Beispielen immer gleich. So wie sich aber die
Form der Begräbnisse verändert, wird auch der
Inhalt ein anderer. Merkwürdig sind in dieser
Hinsicht die nächsten Umgebungen von
Ludwigslust. Hier finden sich, vorzüglich an
Stellen, welche eine natürliche Erhebung haben,
überall in einiger Tiefe Urnen. Alle diese Urnen
sind in den natürlichen Erdboden eingegraben;
nirgends ist ein Hügel aufgeschüttet: dies ist
die vorzüglichste Abweichung dieser Begräbnisse
von den aufgeschütteten Kegelgräbern, eine
Abweichung, welche dieselben schon mit den
jüngsten slavischen Begräbnißstätten gemein
haben. Die Urnen haben eine andere Gestalt: sie
sind viel niedriger und weiter, als die Urnen
der Kegelgräber, laufen nach unten spitz zu und
haben viel Kubikinhalt. Sie gleichen der Masse
und den senkrechten Wänden nach den Urnen der
Kegelgräber, entfernen sich aber von den Urnen
der Wendenkirchhöfe noch durch den Mangel an
eingedrückten Verzierungen, an färbendem
Ueberzug und an Abrundung der Form. Das Metall
in dieser Art von Urnen ist vorherrschend noch
Bronze und es finden sich, wenn auch Waffen gar
nicht beobachtet sind, doch noch hin und wieder
Schmucksachen von Bronze, welche denen aus der
besten Zeit der Kegelgräber nichts nachgeben und
die Bronzeperiode noch durch das Vorkommen der
Spiralplatten in Fingerringen charakterisiren.
In manchen Urnen ist der Mangel an Bronze
auffallend: unter einer Menge von Handringen war
kein einziger ganz; alle waren zerbrochen und
die zusammenpassenden Bruchenden waren
durchbohrt, um die Enden zusammenzuhalten: eine
Erscheinung, welche sonst ihres gleichen nicht
findet (vgl. Jahresbericht des Vereins für mekl.
Gesch. II, S. 45). Aber nicht allein der Mangel
an Bronze, auch die Composition der Bronze ist
auffallend: sie hat nicht mehr jene dunklere,
glühende, edle Farbe; sie ist fast weiß und
ähnelt dem Zinn (vgl. Jahresber. II, S. 47,
Frid. Franc. Erl. S. 138; Jahrb. IX, S. 342
flgd.); der Rost ist nur leicht und mehlartig:
kurz alles von dieser matten Bronze hat ein sehr
unedles Ansehen. Dazu kommt noch das Erscheinen
von Eisen; in neuern Zeiten wurden in diesen
weiten Urnen bei Ludwigslust eiserne
Geräthschaften neben denen aus matter Bronze
gefunden, namentlich eine knieförmig gebogene
Nadel aus Eisen, wie dergleichen sonst nur in
vollkommen ausgebildeten Kegelgräbern gefunden
werden (vgl. Jahresber. des Ver. für mekl.
Gesch. II, S. 45). - Diese Wahrnehmung ward
durch die Oeffnung eines Grabes bei Borkow (vgl.
Jahresbericht
 . II, S. 43)
. II, S. 43)


|
Seite 252 |




|
kräftig unterstützt. Unter einer Steinanhäufung, einem Kegelgrabe ähnlich, fand sich eine weite Urne, den großen Urnen der Kegelgräber sehr ähnlich. In derselben fanden sich Bruchstücke von einem Handringe aus jener matten, weißlichen Bronze mit dem mehlartigen Anfluge von Oxyd, ganz wie die zerbrochenen Handrine von Ludwigslust; dabei lag ein Bruchstück von einem Messer aus Eisen. So täuschend ähnlich das borkower Grab dem Inhalte nach den ludwigsluster Begräbnissen ist, so war jenes doch durch die Aufwerfung eines Hügels noch der germanischen Zeit näher gerückt. - Die flach eingegrabenen, weiten und niedrigen Urnen mit Geräthen aus weißlicher Bronze zusammen mit Geräthen aus Eisen werden also aus der Zeit des Ueberganges von dem Germanenthum zum Slaventhum stammen.
Die Wendenkirchhöfe zeichnen sich, außer daß ihre Urnen charakteristisch sind, durch Leichenbrand, Vergrabung der Urnen in den Urboden, durch Mangel an Gold, durch Zurückdrängung der Bronze und durch Vorherrschen von Eisen, Silber und Glas aus.
Westlich von der lüneburger Haide wird kein Eisen mehr in heidnischen Grabstätten gefunden (vgl. Wildeshausen in alterthümlicher Hinsicht 1837, S. 36); die alte Bronzecultur hört hier plötzlich mit der Verbreitung des Christenthums auf.


|
Seite 253 |




|



|



|
|
|
Die Graburnen der Hünengräber.
Es ist Absicht des Ausschusses des Vereins, nachdem jetzt hinreichend Erfahrungen gesammelt sind, nach und nach die Charakteristik der Urnen der verschiedenen Perioden zur Kenntniß und Anschauung zu bringen. Und so sollen denn hier zuerst die Urnen der Steinperiode oder der sogenannten Hünengräber vorgeführt werden.
Die Hünengräber, welche in neuern Zeiten in Meklenburg bei der Aufgrabung vorzüglich beobachtet sind und den werthvollsten Stoff zur Forschung liefern, sind:
1) das Hünengrab von Prieschendorf bei Dassow, Jahresber. II, S. 25 flgd. und IV, S. 20-21;
2) das Hünengrab von Lübow bei Wismar, Jahresber. 111, S. 36 flgd.;
3) das Hünengrab von Helm bei Wittenburg, Jahresber. V, S. 22-23;
4) die Hünengräber von Moltzow bei Malchin, Jahresber. VI, S. 134-136 und unten bei den Hünengräbern;
5) das Hünengrab von Remlin bei Gnoyen, Jahrb. IX, S. 362-365;
6) das Hünengrab von Tatschow bei Schwan, dessen Inhalt in der großherzoglichen Sammlung aufbewahrt wird, Erster Bericht über das Antiquarium zu Schwerin, 1843, S. 5, Nr. 1.
Die Urnen der Hünengräber haben eine ganz bestimmte, nicht zu verkennende Individualität, welche von dem Kenner selbst an einzelnen Scherben auf den ersten Blick erkannt wird. Diese Individualität ist in Deutschland bisher noch nicht nachgewiesen; um so mehr mögen die folgenden Darstellungen Interesse erwecken. Im Allgemeinen sind die Urnen der Hünengräber klein, mannigfaltig in Form und in Form und Verzierung eigenthümlich. Die Urnen sind, jedoch bei aller Verschiedenheit der Gestalt, in der Regel kugelförmig, birnenförmig oder becherförmig. Häufig haben die Urnen einen engen, sehr hohen Hals mit senkrechten Wänden und oft große Henkel, aber auch kleine, durchbohrte Knötchen, welche jedoch nicht so winzig sind, wie die kleinen Knötchen an den Urnen der Wendenkirchhöfe. Am bezeichnendsten sind jedoch die Verzierungen; diese sind in der Regel aus kurzen, kräftigen, graden Linien


|
Seite 254 |




|
gebildet, welche mit einem spitzen Werkzeuge tief in die Oberfläche eingedrückt und wenn auch etwas steif, doch geschmackvoll sind und zu dem ganzen Gefäße im Einklange stehen; viele Urnen der Hünengräber haben freilich gar keine Verzierungen, in manchen Gräbern finden sich dagegen desto mehr Verzierungen an den Urnen.
Die Verzierungen der Urnen der Hünengräber lassen sich bis jetzt sicher wenigstens in mehrere Classen bringen. Die Verzierungen bestehen nämlich:
1) in Gruppen senkrechter Parallellinien, welche

vom Halse bis an den Bauchrand hinablaufen, oder auch senkrechter Parallellinien, welche den ganzen Bauch bedecken; diese Verzierungen finden sich z. B. an den drei wohl erhaltenen Urnen aus dem Hünengrabe von Moltzow No. 2 (Jahresber. VI, S. 135), welche zugleich die Grundformen der Hünenurnen darstellen:
a. an einer becher= oder schalenförmigen Urne:
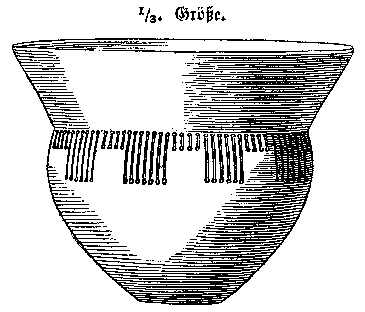
eine ganz gleich geformte und verzierte Urne aus der Steinperiode ward in dem merkwürdigen Grabe von Waldhausen bei Lübeck gefunden und abgebildet in den von dem Vereine für lübeckische Geschichte herausgegebenen Beiträgen zur nordischen Alterthumskunde, Heft I, 1844, Bl. V, Fig. III.


|
Seite 255 |




|
b. an einer Urne mit hohem, engen, senkrechten Halse und kleinen durchbohrten Knoten oder
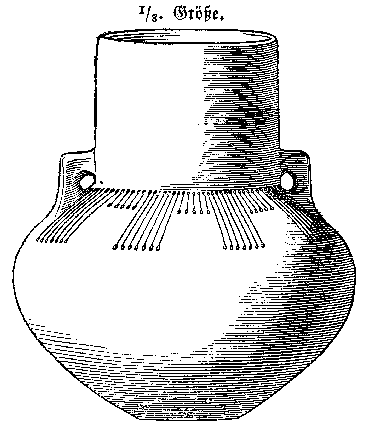
Henkelchen; ganz dieselbe Form mit ganz denselben Verzierungen hat sich an einer andern Urne aus einem ebenfalls zu Moltzow aufgedeckten Hünengrabe Nr. 3 (vergl. unten) gefunden, jedoch hat diese einen etwas größern Henkel; sowohl hierin stimmt diese Urne fast ganz mit der in dem Hünengrabe von Helm



|
Seite 256 |




|
gefundenen Urne herein, als auch in den Verzierungen; jedoch hat diese helmer Urne, nach vorstehender Abbildung, außer den senkrechtem Linien auch noch kleine Verzierungen von Zickzacklinien zwischen Bauch und Hals; der Bauch ist ganz kugelig;
c. an einer birnenförmigen Urne, mit hohem, jedoch

weit ausgebogenen Halse; von dieser Art von Form haben sich noch mehrere Urnen in dem Hünengrabe von Moltzow Nr. 4 (vergl. unten) gefunden, jedoch mit etwas andern, aber doch ähnlichen Verzierungen.
Diese Art von Formen und Verzierungen war also sicher von Malchin bis Lübeck und Wittenburg, also von der Peene bis an die Trave und Elbe, herrschend.
Die Verzierungen die Hünenurnen bestehen ferner:

2) in Gruppen von ganz kurzen senkrechten Strichen unter einander. Diese Gruppen haben wieder oft die Dreieckform, welche überhaupt oft an den Verzierungen der Hünenurnen gefunden wird. Verzierungen dieser Art wurden an einer Urne


|
Seite 257 |




|
in dem Grabe von Prieschendorf gefunden, und ganz dieselben in dem Grabe von Lübow, also ungefähr von der Trave bis Wismar.
Eine auffallende Verzierung ähnlicher Art fand sich an einer Urne aus dem Grabe von Prieschendorf, indem die senkrechten Striche rechts einen schräge hinab gehenden Beistrich

haben, so daß man versucht sein könnte, diese
Verzierung für ein runisches
 zu halten, wenn in so fernen
Zeiten überall Schriftzeichen zu vermuthen ständen.
zu halten, wenn in so fernen
Zeiten überall Schriftzeichen zu vermuthen ständen.
3) Oft stehen diese kurzen Striche, einzeln oder in Gruppen unter einander, in Zickzackform neben einander. Solche Gruppen zeigt namentlich die seltene, leider nicht ganz erhaltene Urne aus dem großen Hünengrabe von Tatschow,

die größte, bekannte Urne aus der Steinperiode, und eine ganz zertrümmerte Urne aus dem Hünengrabe von Lübow, in welchem sich außerdem noch eine Urne mit umherlaufenden einfachen Zickzacklinien fand.


|
Seite 258 |




|
4) Ganz charakteristisch sind endlich die schuppenförmigen Verzierungen. Diese zeigen sich bezeichnend an zwei Urnen aus dem reichen Grabe von Prieschendorf. Auf der einen dieser Urnen bestehen die Verzierungen aus zwei Reihen

von Halbkreisen, so daß die Verzierungen wie runde, sich deckende Schuppen aussehen; darunter stehen Gruppen von längern, mit kurzen Stichen gebildeten Linien. Auf der andern Urne erscheinen diese Verzierungen als Reihen zusammenhängender
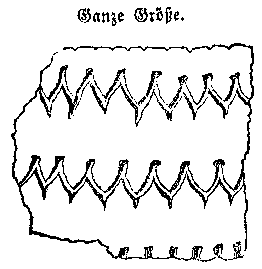
Spitzen oder als einzelne Reihen von spitzen Schuppen. Aehnliche Verzierungen in ganz kleinen Mustern, welche die Urnen fast ganz bedecken, kommen noch an einigen Urnen in der großherzoglichen Sammlung vor; leider ist der Fundort dieser Gefäße nicht bekannt.
Wie Schuppen erscheinen auch die Halsverzierungen der seltenen Urne aus dem Hünengrabe von Remlin, welche die Gestalt einer hangenden Birne und einen im Verhältnisse zu dem Bauche der Urne ungewöhnlich stark eingezogenen Hals


|
Seite 259 |




|

hat; um den obern Theil des Bauches laufen auch die bekannten Gruppen von senkrechten Parallellinien. Die schuppenförmigen Verzierungen erscheinen bei genauer Betrachtung in natürlicher Größe als rautenförmige Schraffirungen, jedoch im

ganzen und aus der Ferne durchaus als Schuppen. Auch diese Verzierung findet sich in ähnlichen Gestalten an Fragmenten anderer Urnen, namentlich an einer ganz damit bedeckten Urne in der großherzoglichen Sammlung, deren Fundort jedoch ebenfalls nicht bekannt ist. Diese Verzierungen verrathen eine ungewöhnliche Fertigkeit und Geschicklichkeit.
Die gewöhnlichen, nicht verzierten Urnen der Hünengräber haben oft die Becherform, wie eine Urne aus dem Grabe von Prischendorf, die einzige, welche von den vielen Urnen des


|
Seite 260 |




|

Grabes in einer senkrechten Hälfte zur vollen Ansicht erhalten ist. Mehrere Urnen, sowohl aus diesem Grabe, als aus anderen Gräbern, zeigen diese Form, mit ziemlich senkrechten Wänden, oft mit einem leisen Bauchrande, oft nur wenig in den Wänden gebogen, zuweilen ohne alle Abweichung von der graden Linie in den Wänden.



|



|
|
:
|
Die Schädel erschlagener Feinde als Trinkschalen bei den nordischen Völkern benutzt.
Von der kannibalischen Sitte, Menschenfleisch zu essen, weiß die Geschichte der nordischen Völker nichts, wenn gleich bei wichtigen Angelegenheiten einmal ein Mensch, sei es ein Gefangener oder ein Sclave, den Göttern geopfert ward, wie es z. B. Tacitus von dem heiligen Haine der Semnonen erzählte daß dort bisweilen nach alter Sitte, wenn Gesandte aller Sweven sich versammelt hätten, ein Mensch getödtet werde. Eben so wenig als man nun das Fleisch eines, sei es im Kampfe oder beim Opfer getödteten Menschen aß und sein Blut trank, eben so wenig wird man sich aus seinen Gebeinen Geräthe und aus seinem Schädel ein Trinkgefäß gemacht haben. Mögen die Germanen auch an Tapferkeit andere Völker übertroffen und ihnen dadurch oft einen Schrecken bei bloßer Nennung ihres Namens eingejagt haben; von kannibalischer Rohheit findet sich keine Spur, weder daheim, noch wenn sie in fernen Ländern kämpften. Das Betragen gegen die Frauen, die Behandlung der Sclaven und viele andere Züge verrathen


|
Seite 261 |




|
im Gegentheile eine gewisse Anerkennung der Menschenwürde und ein zartes Menschengefühl. Woher stammt denn jener fast allgemein herrschende Glaube, den noch im letzten Jahrgange unserer Jahrbücher (S. 361) der Herr A. G. Masch in seinem sonst so schätzbaren Berichte über das Moor bei Fehrbellin ausgesprochen hat? Die Aufklärung finde ich bei Dahlmann Geschichte von Dänemark I, 33, wo es in einer Anmerkung also heißt:
"Nicht wie Kannibalen tranken die alten nordischen Völker aus den Hirnschädeln erschlagener Feinde. Die Stelle im Krakumaal Regner Lodbroks, die man so gemißdeutet hat:
Dreckom bjór at bragdi
Or bjúdvidomhausa
heißt wörtlich:
bald aus den Krummhölzern
der Köpfe (oder Schädel), -
das will nach der metaphorischen Weise der alten Skalden sagen:
aus den Hörnern der Thiere. -
Siehe Raffn: Einiges über die Trinkgefäße in Walhalla, in Falck's neuem staatsb. Magazin I, 840
.
Vietlübbe, 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Menschenschädel von Langsdorf.
In dem Torfmoore von Langsdorf bei Sülz ward 7 Fuß tief ein Menschenschädel gefunden und von dem Herrn Geheimen=Amtsrath Koch zu Sülz zum großherzoglichen Antiquarium eingereicht, der jedoch zu merkwürdig ist, als daß er nicht eine besondere Erwähnung verdiene Der Schädel muß aus den allerfernsten Zeiten stammen, da er, obgleich er in dem lange erhaltenden Moor gelegen hat, dennoch sehr mürbe geworden ist; andere Gebeine wurden trotz des sorgfältigsten Forschens in der Nähe nicht gefunden. Der sonst ausgewachsene Schädel ist nicht dick; die Näthe sind alle klar zu erkennen und noch nicht verwachsen. Auffallend ist an demselben die höchst geringe Ausbildung: die Stirn ist ganz ungewöhnlich schmal und niedrig, kaum einen Daumen breit und in dieser geringen Ausdehnung völlig abgerundet; die Augenhöhlen liegen nahe an einander, die Erhöhungen über den Augenhöhlen sind auffallend hoch, berühren sich fast unmittelbar über der Nase und sind stark auswärts nach oben gewandt; das Hinterhauptbein hat bei einer ziemlich abgerundeten Oberfläche einen sehr


|
Seite 262 |




|
starken Höcker, wie wenn Jemand mit dem Daumen die Knochenmasse nach unten stark fortgeschoben hätte; die Modellirungen im Innern des Stirnbeins und des Hinterhauptbeins sind äußerst geringe ausgeprägt, vielmehr überall mehr abgerundet und glatt. Der Schädel wird also wohl in den fernsten Zeiten einem Menschen angehört haben, welcher auf der niedrigsten Stufe menschlicher Bildung stand.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Feuersteinmesser=Manufactur von Jabel.
Nach Mittheilungen des Herrn Klosterhauptmanns von Borck zu Malchow findet sich auf dem Felde von Jabel, am Ufer des Cölpin=Sees, eine Sandscholle, welche eine große Masse von Resten von Alterthümern bewahrt und auf eine große Wohn=, Begräbniß= und Manufacturstätte alter Zeit schließen läßt. Man findet daselbst unzählige Scherben von Urnen, Knochenfragmente und Feuerstein=Splitter und Späne. Schon früher waren ähnliche Stellen in dem benachbarten Damerow und in dem gegenüberliegenden Klink, an den Ufern desselben Sees, entdeckt (vgl. Jahresber. VII, S. 46). Alle solche Stätten haben das Eigenthümliche, daß sich an denselben außer großen Massen von Ueberbleibseln aus der Steinperiode Alterthümer aus allen Perioden der heidnischen Vorzeit finden. Der Herr Klosterhauptmann von Borck hat außer dieser Nachricht auch, nach aufmerksamer Sammlung, mehrere dort gefundene Stücke eingesandt:
1) eine Menge der bekannten vierseitigen Feuersteinsplitter oder Messer;
2) mehrere Feuersteinblöcke, von denen diese Späne abgehauen sind, und unter diesen einen, welcher zu einer Pfeilspitze hat gestaltet werden sollen, wie sich grade solche Stücke in Meklenburg und in andern Ländern schon öfter gefunden haben;
3) einen zerbrochenen, halben Schmalmeißel aus Feuerstein;
4) ein Stück sehr dickes, grünes Glas;
5) eine eiserne Pfeilspitze.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 263 |




|



|



|
|
:
|
Hünengräber und andere alte Grabstätten zu Moltzow.
(Vgl. Jahresber. VI, S. 133 und 134).
Der Theil der in der Nähe des malchiner Sees bei Rothenmoor gelegenen Feldmark Moltzow, welcher östlich vom Hofe in einer hohen Gegend mit einer erhebender Aussicht gelegen ist, zeichnet sich auffallend durch seinen Reichthum an alten Gräbern aus, zumal im Gegensatze zu den angrenzenden Feldern. Zwar sollen auf dem nahen Felde des Gutes Klocksin viele alte Gräber gewesen und bei dem Fortrücken der Steine oft alte Gefäße ausgepflügt sein; aber hier hat die Ackercultur längst alles dieser Art zerstört. Auf der andern Seite, zu Rambow und Rothenmoor, finden sich nur sehr vereinzelt Kegelgräber. Die zahlreichen Gräber von Moltzow liegen auf einem mit vielen Grand= und Mergelkuppen bedeckten Höhenrücken, welcher sich nördlich von Ilkensee bis zu der Wiesenniederung bei Dahmen erstreckt, mit westlicher Abdachung nach dem klocksiner Grenzbache und östlicher Senkung nach dem rambowschen Grenzbache. Die prachtvolle Aussicht, welche man von den meisten der Gräber genießt, scheint bei der Wahl der Grabstätten berücksichtigt zu sein. Alle in den Jahresberichten bisher als moltzower gedachte Gräber liegen auf dem bezeichneten Raume, in dessen Nähe überdies die Ruine der papenhäger Kirche, einer der ältesten Kirchen dieser Gegend, sichtbar ist, deren Lage vielleicht zu einem Orte in Beziehung steht, welcher den Heiden heilig gewesen ist.
Vier Hünengräber, von denen drei bereits untersucht sind, machen sich als solche kenntlich; an zwei andern Stellen muß die Aufgrabung entscheiden.
Kegelgräber sind in großer Anzahl über die ganze Fläche zerstreut; doch zeichnen sich drei Stellen aus, an denen mehrere nahe bei einander gelegen sind:
1) der in Jahresber. VII, S. 25 unter der Ueberschrift "Kegelgräber von Rambow" bezeichnete Ort gehört hierher, da er innerhalb der jetzigen Grenzen von Moltzow liegt; auch gehören die in Jahresber. VII, S. 22-23 aufgeführten Gräber dazu;
2) finden sich nahe an dem rambower Grenzbache unterhalb des Schliesees in den sogenannten Kämpen fünf Kegelgräber nahe bei einander; die beiden kleinsten sind 8' hoch, bei etwa 70 Schritt Umfang;
3) die dritte Gruppe liegt auf der westlichen Abdachung über dem Torfmoore, welches an den moltzower Hof stößt.


|
Seite 264 |




|
Es sind hier noch sechs Steinringe deutlich zu erkennen, die Hügel aber alle, bis auf einen, fortgeackert; von mehrern Stellen ist es wahrscheinlich, daß sie auch Steinringe gewesen sind, sie sind aber sehr zerstört und große Haufen aufgethürmter Steine liegen daneben. Die Ringe haben ungefähr 16 ' - 20 ' Durchmesser.
Hünengrab von Moltzow Nr. 3.
Einer dieser Steinringe, welcher in gelbem Sande stand, ward abgetragen. In dem Steinringe stand eine Kiste aus platten, rothen Sandsteinen von hier gewöhnlicher, Bauart, in ein Viereck gesetzt, genau von Osten nach Westen, etwa 5 ' lang und 3 1/2 ' breit. In der Steinkiste, welche mit Sand ausgefüllt war, stand in der nordwestlichen Ecke eine zwar zerborstene, jedoch noch kenntliche und erhaltene, gehenkelte Urne, in Größe, Form und Verzierung ganz wie die S. 255 abgebildete Urne Nr. 1 aus dem Hünengrabe von Moltzow in Jahresber. VI, S. 135, nur mit dem Unterschiede, daß unsere Urne Einen größern Henkel statt zwei kleiner hat, und ähnlich der ebendaselbst abgebildeten Urne aus dem Hünengrabe von Helm. Sie ist im Bauche fast kugelförmig und hier gut 5 " hoch, hat einen engen Hals mit senkrechten Wänden von gut 3 " Höhe und einen großen Henkel von 2 " Höhe. Sie ist am obern Bauchrande rings mit den charakteristischen Verzierungen der Steinperiode verziert, wie die beiden oben genannten Urnen: vom Anfange des Halses laufen nämlich

ringsumher bis auf ein Viertheil des Bauches senkrechte, kräftig eingegrabene Linien hinab, welche in Gruppen abwechselnd von 6 und 2 mal 2 Linien in Zwischenräumen neben einander stehen. Neben der Urne lagen Stücke von dem Schädel eines erwachsenen Menschen, welche jedoch fast ganz vergangen und so zerbrechlich waren, daß sie beim Herausnehmen zerfielen. Im Uebrigen fanden sich in der Kiste nur Bruchstücke von rothem Sandstein, welche von dem Deckel der Kiste herrühren mögen.
Hünengrab von Moltzow Nr. 4.
Links am Wege von Moltzow nach Rambow, dem in Jahresber. VI, S. 133 beschriebenen Hünengrabe gegenüber, lag auf einer sandigen Anhöhe ein an einer Seite schon angegrabenes Hünengrab von NW. nach SO. streichend, im Um=


|
Seite 265 |




|
fange ungefähr 27 Schritt messend. Am nordwestlichen Ende standen vier große Granitblöcke, das Grab selbst einschließend, und bildeten ein Viereck von ungefähr 4 ' Länge und 2 ' Breite. Am südöstlichen Ende lagen mehrere platte Steine, welche vielleicht einen Ring um das Grab gebildet haben mögen. Das Steingrab war mit Erde und Steinen ausgefüllt; oben darauf stand ein Dornbusch. Nachdem dieses abgeräumt war, wobei sich Stücke von ausgedörrtem, schwarzen Eichenholze fanden, zeigten sich unverbrannte Menschengebeine und unter diesen sechs Menschenschädel, ohne Ordnung in Lehm und Sand so fest verpackt, daß man alle in Stücken mit der Hacke losbrechen mußte; alle Schädel standen auf ihrer untern Fläche Mitunter zeigten sich auch schon einige Scherben, die alle unbezweifelt einer und derselben Urne (unten Nr. 15) angehören, welche offenbar aus der jüngsten heidnischen Zeit stammt.
Auch stand in diesem obern Raume:
Urne Nr. 1: eine flache Schale, ohne alle Verzierungen, 3 " hoch, 5 " weit im Bauchrande, 3 1/2 " weit in der Oeffnung, mit einem kleinen Boden von ungefähr 2 " Durchmesser, mit eingezogenem Halse von 1 1/4 " Höhe; vom Rande zum Bauche schwingt sich ein großer, etwas zusammengedrückter Henkel mit 1 1/2 " weiter Oeffnung. Gefäße dieser Form und Arbeit kommen in diesen Gegenden öfter in Kegelgräbern vor.
Nachdem die Knochen zur obern Hälfte abgeräumt waren, zeigte es sich, daß das Grab im Fundamente durch eine Reihe kleiner, aufrecht stehender, platter Steine in die Quere getheilt war, welche den Grund und Boden des Grabes in zwei Fächer theilte, wie eine ähnliche Scheidung auch in dem Hünengrabe von Remlin (Jahrb. IX, S. 363) beobachtet ist. Unter den Knochen und dem mit diesen aufgefüllten festen Thonmergel lag eine fest gepackte Schicht von weiß und röthlich ausgeglüheten kleinen Feuersteinen; dazwischen zeigten sich Spuren von Brand. Unter dieser festen Feuersteinschicht fand sich auf dem Urboden eine Lage von Urnenscherben, genau Scherbe an Scherbe gelegt, alle, bis auf 3 Stücke, mit der Außenseite nach oben; an einigen Stellen war die Lage durch Druck von oben etwas verschoben, so daß einige Scherben schräge zu stehen schienen.
Die Lage dieser verschiedenen Schichten ist unbezweifelt, wie hier berichtet ist. Unter den kleinern Feldsteinen innerhalb des Grabes lagen die Gebeine, unter diesen die Feuersteine, unter diesen die Urnenscherben: alles in fester Ord=


|
Seite 266 |




|
nung, wenn auch das Grab in den Ringsteinen und in der obern Auffüllung schon berührt war.
Nachdem die Urnenscherben alle sorgfältig gesammelt waren, zeigte es sich nach ganz genauer Prüfung, daß sie einer ganzen Menge von Gefäßen angehörten, wie in dem prieschendorfer Grabe (Jahresber. II, S. 25) sich eine ähnliche Erscheinung zeigte.
Urne Nr. 2. Die meisten Scherben hatten einer ungewöhnlich großen, dickwandigen, schwärzlichen Urne angehört, welche ungefähr die Gestalt der oben, S. 256, abgebildeten größern, birnenförmigen Urne von Moltzow Nr. 2 gehabt hatte; jedoch war der 3 1/2 " hohe Hals mehr senkrecht. Oben am Bauche unter dem Rande standen 4 durchbohrte Knöpfe oder Henkelchen. Der obere Theil des Bauches war mit langen,

senkrechten Streifen von Verzierungen aus graden, kräftigen Linien geschmückt, welche tief hinab reichten. Zwischen je 2 solcher Streifen stand oben unter dem Rande über dem nicht verzierten Streifen, ein nach unten gerichtetes, aus Parallellinien gebildetes, kleines Dreieck oder eine Spitze. Eine große Merkwürdigkeit an dieser Urne ist, daß die tief eingedrückten Linien mit weißem Kalk ausgelegt sind; dies ist ohne Zweifel eines der ältesten musivischen Ornamente, welche existiren, und, wie es scheint, bisher noch nicht beobachtet.
Urne Nr. 3. Andere Scherben gehören einer ähnlichen, großen Urne an. Der Rand ist jedoch 4 " hoch und mehr nach außen geschwungen und die Farbe ist hellbraun; die Verzierungen sind ähnlich, nur laufen die Querstriche in den beiden äußern die Linien begleitenden Streifen schräge nach unten; die durchbohrten Knöpfe sind sehr flach und kaum bemerkbar. Zwischen je 2 Streifen stehen unter dem Rande zwei nach unten gerichtete, kleinere Dreiecke. Auch die vertieften Verzierungen dieser Urne sind mit Kalk ausgefugt.
Urne Nr. 4. Eine andere große Urne war ebenfalls mit Längsstreifen von Verzierungen versehen, welche auch mit Kalk ausgestrichen waren. Die Verzierungen dieser Urne haben abwechselnd Streifen der Urnen Nr. 2 und 3 und Streifen, welche aus weit auseinander stehenden, einzelnen Linien bestehen, zwischen denen gruppenweise schräge Querstriche umschichtig nach oben und unten laufen, so daß die Gruppen von Querlinien zickzackförmig erscheinen. Der senk=


|
Seite 267 |




|
rechte Hals ist gegen 4 " lang. Die durchbohrten Knöpfe sind sehr flach.
Urne Nr. 5. Von einem andern, dickwandigen, ähnlichen Gefäße, dessen gleichartige Verzierungen auch mit Kalk ausgefugt sind, sind nur wenig Bruchstücke vorhanden. Zwischen je zwei Längsstreifen der Verzierungen stehen am Halse zwei, etwas längere Dreiecke.
Urne Nr. 6. Einige dickwandige Scherben gehören einer andern Urne an, da die Verzierungen ganz eigenthümlich sind, indem die zwischen den senkrechten Hauptlinien stehenden Querlinien umschichtig bald senkrecht, bald wagerecht stehen; auch sind die Henkel größer, als an den andern verzierten Urnen.
Urne Nr. 7. Eine andere große, dickwandige Urne, ohne Henkel, nur mit Fingereindrücken an der Stelle derselben, mit sehr hohem und weitem, senkrechten Halse, war ohne alle Verzierungen, ebenso
Urne Nr. 8: eine kleinere, von ähnlicher Beschaffenheit.
Außer diesen charakteristischen, großen Urnen waren in dem Grabe
Urne Nr. 9-14: noch 6 kleine Gefäße ohne Verzierungen, wie die verschiedenen vollständigen Boden= und mehrere Randstücke beweisen.
Endlich kommen bei diesem Grabe noch
Urne Nr. 15: die Scherben der hellbraunen, weit geöffneten Urne mit fast senkrechten Rändern in Betracht, welche oben in der Einleitung zu diesem Grabe erwähnt ist und welche in dem obern Raume des Grabes gestanden hatte. Die unregelmäßigen Verzierungen sind leichtfertig mit einem Span eingekratzt und die Masse ist hart. Dadurch gleicht diese Urne ganz den aus den jüngsten wendischen Zeiten (aus den Burgwällen) stammenden Gefäßen zum häuslichen Gebrauche. Es sind solche Gefäße schon einige Male in Hünengräbern beobachtet worden, so daß auch hier die Erscheinung eintritt, daß Gefäße der ältesten und der jüngsten Zeit in demselben Grabe jedoch in vermiedenen Höhen stehen.
Es ist daher ohne Zweifel, daß dieses Grab in jüngern Zeiten außerdem noch zwei Male (Urne Nr. 1 und 15) zu Bestattungen oder andern Zwecken benutzt ist.
Der mitunterzeichnete Pastor Ritter zu Vietlübbe war bei der Aufgrabung gegenwärtig.
| A. v. Maltzan. | J. Ritter. | G. C. F. Lisch. |


|
Seite 268 |




|



|



|
|
:
|
Hünengräber von Kuppentin.
Auf der südöstlichen Seite der kuppentiner Feldmark, auf einer sandigen Anhöhe die, nach Westen sich abdachend, früher mit Tannen bestanden und diesen Frühling wieder mit Tannen besäet war, auch deshalb nur der Tannenkamp heißt nahe den Schäferei=Tannen, zwischen Hof Malchow und der kuppentiner Schleusenwärterei, ragen an mehreren Stellen ziemlich große Steine etwas aus dem Sande hervor. Gewöhnlich liegen 2 bis 4 solcher Steine neben einander und ist der Sand dazwischen erhöhet, so daß alle diese Stellen wahrscheinlich Reste von Hünengräbern oder Steinkisten sind. Zwei solche Stellen wurden von dem Herrn von Bülow zu Kuppentin, der die Arbeiter dazu hergab, dem Herrn von Kardorff auf Remlin und mir untersucht.
Nr. 1.
Die eine Stelle zeigte an der Oberfläche zwei große Steine, die 8 Fuß von Süden nach Norden aus einander lagen; aber etwa 6 Zoll unter der Oberfläche lag ein dritter Stein der Länge nach zwischen beiden, und an der südlichen Ecke dieses Steins lag 10 Zoll tief ein hohl geschliffener Keil aus Feuerstein, 4 1/2 " lang, an der Schneide hellgrau, am entgegengesetzten Ende schwarz. Von diesem Steine an zog sich westlich eine Brandstelle, nur 8 Zoll unter der Oberfläche, etwa 6 Fuß lang und breit, auf einer Unterlage von grobem Kies und ausgeglüheten Feuersteinen; unter Kohlen fanden sich noch angebrannte Stücke Eichenholz, aber keine Spuren von Urnen.
Nr. 2.
Eine zweite Stelle, welche untersucht ward, zeigte 3 hervorragende Steine, nämlich so, daß sie ein rechtwinkliges Dreieck bilden und an der quadratischen Gestalt nur der nordwestliche Stein fehlte. Beim Nachgraben zeigten sich in der Mitte noch zwei große Steine und am östlichen Rande derselben ward das Fragment einer kleinen Urne gefunden, deren Rand mit 5 horizontal laufenden Linien, wie mit einem zusammengedrehten Drath eingedrückt, verziert war. Weiter fand sich nichts; auch war keine Brandstelle sichtbar.
Mit den gefundenen Alterthümern hat der Herr Landrath von Blücher auf Kuppentin dem Vereine ein Geschenk gemacht.
| Vietlübbe, im Mai 1844. | J. Ritter. |


|
Seite 269 |




|



|



|
|
|
Hünengrab von Hoikendorf.
Auf der Feldmark von Hoikendorf bei Grevismühlen ward ein ziemlich großes Hünengrab abgetragen, welches der Länge nach von Steinpfeilern eingefaßt war und innerhalb des Hügels eine Steinkammer hatte, welche in den Seitenwänden von großen Steinen aufgebaut und mit einem großen Steine bedeckt war. In dem Grabe fanden sich mehrere Keile aus Feuerstein von gewöhnlicher Form, von denen der Herr Dreves auf Hoikendorf einen dem Vereine geschenkt hat.



|



|
|
|
Streitaxt von Hoikendorf.
Zu Hoikendorf bei Grevismühlen ward eine kleine, ungefähr 6 " lange, an mehrern Stellen angeschlagene Streitaxt aus Hornblende gefunden und von dem Herrn Dreves auf Hoikendorf geschenkt. Dieser Streithammer hat ein ovales Schaftloch und ist an einem Ende beilförmig, hervorstehend zugeschärft und abgerundet und am andern Ende spitzig auslaufend. Ein fast ganz gleicher Streithammer ist im J. 1832 zu Kl. Woltersdorf, nicht weit von Hoikendorf, beide eine kleine Stunde von Ostseebuchten entfernt, gefunden (vergl. Jahresber. IV, S. 24) und ein sehr ähnlicher der Angabe nach bei Güstrow (vgl. Jahresber. III, S. 39). Diese 3 Streithämmer sind die einzigen, welche bisher mit ovalem Schaftloche entdeckt sind.



|



|
|
:
|
Schleifstein von Rambow bei Malchin.
In einem Teiche zu Rambow neben dem neuen Hofe
ward neben vielen dicken, grobkörnigen, mit
zerstampftem Granit durchkneteten Gefäßscherben,
ein großer Schleifstein von der Art, wie sie zum
Schleifen der steinernen Keile und Beile
gebraucht wurden, gefunden und von dem Herrn
Landrath Reichsfreiherrn von Maltzan auf
Rothenmoor, Rambow
 . dem Vereine geschenkt.
Schleifsteine dieser Art gehören zu den
allerseltensten Alterthümern; gewöhnlich sind
sie aus einem sehr dichten, harten, rothen
Sandstein. In Meklenburg=Schwerin ward bisher
erst ein solcher Stein zu Dabel bei Sternberg in
einem großen Hünengrabe gefunden (vgl. Frid.
Franc. Erl. S. 77, Nr. 13, und Erster Bericht
über die Vermehrungen des großherzogl. Antiq. A.
Nr. 5, S. 6) und in der großherzoglichen
Sammlung zu Neu=Strelitz befindet sich ein
ähnlicher Stein von geringerer Größe. Der zu Rambow
. dem Vereine geschenkt.
Schleifsteine dieser Art gehören zu den
allerseltensten Alterthümern; gewöhnlich sind
sie aus einem sehr dichten, harten, rothen
Sandstein. In Meklenburg=Schwerin ward bisher
erst ein solcher Stein zu Dabel bei Sternberg in
einem großen Hünengrabe gefunden (vgl. Frid.
Franc. Erl. S. 77, Nr. 13, und Erster Bericht
über die Vermehrungen des großherzogl. Antiq. A.
Nr. 5, S. 6) und in der großherzoglichen
Sammlung zu Neu=Strelitz befindet sich ein
ähnlicher Stein von geringerer Größe. Der zu Rambow


|
Seite 270 |




|
gefundene Stein ist ein sehr dichter, feinkörniger, fast quarzähnlicher Sandstein von weißgrauer Farbe und so hart, daß er zum Schleifen von Metallen nicht tauglich ist; er hat ungefähr die Gestalt eines viereckigen, jedoch an einer Seite etwas zugespitzten Prismas, und gehört daher zu der Gattung von Schleifsteinen, welche in Dänemark "keulenförmige" genannt werden; "diese haben wohl ursprünglich die Form eines mehrteiligen Prismas gehabt, sind aber durch den Gebrauch in der Mitte dünner geworden und auf den Seiten zugleich ausgehöhlt" (vgl. Histor. antiq. Mittheilungen S. 66, I, b. und Tab. II, Fig. 2.) Unser rambowsche Schleifstein ist 12 " lang und an jeder Seite durchschnittlich 4 " breit und an jeder Längsseite und auch an einer Ecke sehr glatt, wenn auch noch nicht tief, hohl ausgeschliffen; die beiden Enden sind unbearbeitet.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Steinerne Quetschkeule (?).
Zu Sternberg beim Hausbau ward ein Instrument,
einer Mörserkeule ähnlich, beinahe in Form einer
Flasche, gefunden und vom Reichsfreiherrn A. von
Maltzan auf Peutsch geschenkt. Es ist aus dem
vulkanischen Gesteine der rheinischen Mühlsteine
(!), 6 1/2 " im Ganzen, 4 " im Klump,
2 1/2 " im Griffe lang; es ist rund, sich
etwas nach oben zuspitzend, im Klump etwa 3
", im Griffe etwa 1 1/2 " im
Durchmesser. An beiden Enden des Klumps geht
eine etwas unregelmäßige Rille, wie zum Umbinden
eines Bandes. Ähnliche Instrumente sind in
Skandinavien gefunden (vgl. Nilsson
Skandinaviska Nordens Urinvånare), auch in
Deutschland, z. B. in einem
"Hünenberge" bei Frankfurt a. O. und
im Luch bei Fehrbellin (vgl. Jahrb. IX, S. 359).
Nordische Forscher, namentlich Nilssen, halten
diese Instrumente, für Quetschwerkzeuge
(krossningsinstrument) zum Zermalmen des
Getraides
 ., "beharrt jedoch nicht auf
dieser Erklärung", da die Instrumente nicht
mit Sicherheit aus Hünengräbern stammen. Das
Exemplar aus dem fehrbelliner Luche ist aus
Granit, das frankfurter Exemplar aus Grauwacke,
das nordische Exemplar aus "schonischem
Uebergangsstein". - Unser Exemplar sieht
freilich in Masse und Form etwas modern aus und
es steht, mit Nilsson, noch zur Frage, wohin
diese Instrumente gehören und welche Bestimmung
sie gehabt haben.
., "beharrt jedoch nicht auf
dieser Erklärung", da die Instrumente nicht
mit Sicherheit aus Hünengräbern stammen. Das
Exemplar aus dem fehrbelliner Luche ist aus
Granit, das frankfurter Exemplar aus Grauwacke,
das nordische Exemplar aus "schonischem
Uebergangsstein". - Unser Exemplar sieht
freilich in Masse und Form etwas modern aus und
es steht, mit Nilsson, noch zur Frage, wohin
diese Instrumente gehören und welche Bestimmung
sie gehabt haben.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 271 |




|



|



|
|
:
|
Ueber die spina des Tacitus.
Durch die Entdeckungen, welche auf dem Gebiete der Alterthumskunde in neuerer Zeit gemacht sind, schwindet mehr und mehr das Vorurtheil, als seien die Germanen zu den Zeiten der blühenden Römerherrschaft noch so roh und ungebildet gewesen, daß sie in bloße Thierhäute sich gehüllt hätten. Die in den Gräbern sich findenden Waffen, Geräthe und Schmucksachen aus Bronze zeigen einen schon höhern Grad der Kultur und ausgebildeteren Kunstsinn. Wenn nun Tacitus in seiner kleinen Schrift "über die Lage, Sitten und Völker "Germaniens" eine ziemlich richtige Kenntniß der Germanen zeigt und sie keinesweges als rohe Barbaren darstellt, wenn gleich nicht durch übermäßigen Luxus verdorben, wie die Römer seiner Zeit, so haben, so viel ich weiß, doch die Erklärer eine Stelle im Tacitus (cap. 17: Tegumen omnibus sagum, fibula aut si desit spina consertum: die Bedeckung für Alle ist ein Oberkleid mit einer Spange, oder wenn die fehlt, mit einem Dorn zusammengefügt) so ausgedeutet, als hätten die Germanen in Ermangelung der fibula einen wirklichen Dorn, von einem Dornbusch gebrochen, zur Befestigung gewählt, und daraus wieder umgekehrt den Schluß gemacht: die Germanen seien noch im Naturzustande gewesen.
Wenn Tacitus als das gewöhnliche Befestigungsmittel die fibula nennt und im Nothfalle die spina, so wird es Jedem, der eine germanische fibula gesehen hat, einleuchten, daß als Ersatzmittel dafür kein hölzerner Dorn gemeint sein könne. Die fibula ist nämlich eine Art Broche oder Tuchnadel, deren Verfertigung sehr künstlich war (abgebildet noch im letzten Jahrgange der Jahrbücher, Seite 331), eine Nadel mit einem Bügel, der an beiden Enden in eine Spiralplatte auslief. Fragen wir nun: welches Geräth findet sich in Gräbern der Germanen, daß es statt der fibula gebraucht werden könnte, so ist es allein die Nadel mit einem Knopfe, theils grade, theils knieförmig gebogen, wie sie z. B. in den Kegelgräbern von Ruchow, Wittenburg, Goldenbow, Gallentin, Borkow, Klink (Jahresber. II, 40, 43; III, 65; V, 32, 33, 44, 61) und sonst häufig gefunden sind. Der Abstand zwischen der fibula und der Nadel mit einem Knopfe ist noch immer groß genug, aber nicht so unbegreiflich, wie zwischen der fibula und einem hölzernen Dorn. Die Heftel (fibula) ist eine Ausbildung des Dorns (spina), da jene eine künstliche Vor=


|
Seite 272 |




|
richtung zum Gebrauche dieser ist, da jede fibula als Hauptgrundbestandtheil einen Dorn (spina) oder eine Nadel enthält. - Warum aber Tacitus das Wort spina gebraucht, mag daraus erklärbar sein, daß diese Nadeln allerdings Aehnlichkeit mit einem Dorn haben und wir auch ähnliche metallene (drathförmige) Spitzen Dornen nennen, vielleicht also die alte deutsche Benennung auch dem lateinischen Ausdrucke spina entsprach. Sonst heißt die Nadel bei den Römern acus; aber die acus hatte wohl eine schärfere Spitze und war zum Stechen bestimmt. Den Bronzenadeln mit Köpfen gleichen außerdem die Stacheln der Igel und Stachelschweine, welche der Römer ebenfalls mit spina benannte. Wenn nun die bisherigen Aufgrabungen häufiger die fibula als die bezeichnete Nadel zu Tage gefördert hat, so dient auch das zur Bestätigung dessen, was Tacitus sagt, daß nämlich die fibula das Gewöhnliche, die spina nur das Aushelfende sei. Daß die reicheren Gräber die fibula, die ärmeren dagegen die spina enthalten, liegt in der Sache selbst; doch beide zusammen können auch in den reichsten Gräbern gefunden werden.
| Vietlübbe 1845. | J. Ritter. |



|



|
|
:
|
Kegelgrab und Krone von Admanshagen.
Admanshagen, 1/2 Meile von Doberan, liegt in der weiten, flachen Gegend, welche sich nordöstlich von Doberan ausbreitet. Nirgends sind auf diesen Feldern Höhen und alte Gräber zu erblicken. Nur dort, wo der Boden gegen Lambrechtshagen hin sich etwas erhebt, liegen auf der Hufe des Bauern Harms, grade zwischen den Dörfern Admanshagen und Lambrechtshagen, mehrere niedrige, jetzt unter den Pflug gebrachte Kegelgräber, welche dem Boden nur ein stark wellenförmiges Ansehen geben, übrigens klar und scharf genug aufgesetzt sind. Sie sind sehr weit, ungefähr 20 Schritt im Durchmesser, und haben dabei jetzt nur etwa gegen 2 Fuß Erhebung; sie sind mit einem Kreise von Steinen, welche unter der Erdoberfläche stehen, eingefaßt und die Urnen stehen mit Steinen verpackt in der Mitte der Gräber. Der Bauer ist seit einigen Jahren beschäftigt, zu gelegenen Zeiten diese "Steine aus dem Acker zu brechen." In einem solchen Hügel, welchen der Unterzeichnete bei der Besichtigung an Ort und Stelle noch als ein Kegelgrab erkannte, fand der Bauer im Herbste des J. 1843 eine Urne mit Asche und Knochen, welche noch zerstreut umherlagen; die Urne zerfiel unter seinen Händen. Zwischen den Knochen lag in der Urne aber die hiebei


|
Seite 273 |




|
abgebildete, uralte, voll gegossene Krone von Kupfer,

welche er dem Herrn Ernst Brockelmann zu Rostock überließ, der dieses werthvolle Stück des Alterthums wieder dem Vereine freundlichst schenkte. Leider fehlt der Zierrath (bijou) und ein Stück des Reifes, welches vor der Aufschüttung des Grabhügels abgebrochen gewesen sein muß, da das Bruchende alten Rost hat.
Diese Krone ist theils durch sich selbst von Wichtigkeit, theils durch Vergleichung mit der in der großherzoglichen Alterthümersammlung aufbewahrten, in Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 1. abgebildeten, zu Trechow gefundenen Krone (vgl. Jahresber. VI, S. 112), welche bisher die einzige, auf dem Continent bekannt gewordene war. Beide Kronen sind nämlich völlig gleich: beide sind voll und noch etwas roh gegossen, mit einem Charniere, durch welches ungefähr ein abgeschnittenes Viertheil des Reifes geöffnet und geschlossen werden kann, indem es an einer Seite um einen Stift geht und am andern Ende in einen Zapfen an dem andern Ende des Reifes paßt; beide sind in kleinen Zacken ausgeschnitten, beide sind der Länge nach mit 3 eingegrabenen Parallellinien eingefaßt. Die trechowsche Krone wiegt 2 Pfund 8 Loth, die admanshäger ist von gleicher Größe, ist also ungefähr eben so schwer gewesen; jene ist in 16 Zacken ausgeschnitten, auf dieser sind die Zacken etwas enger und kürzer, und es sind ihrer wahrscheinlich einige mehr gewesen.
Auffallend bleibt die völlige Gleichheit beider Kronen, welche ungefähr in dieselbe Zeit fallen. Bemerkenswerth ist ferner der tiefe Rost, welcher beide bedeckt. Die Krone von Trechow, welche von der bekannten antiken Bronze (Kupfer mit Zinn legirt) ist, hat einen so tiefen, glänzenden, dunkel=


|
Seite 274 |




|
grünen, edlen Rost, wie keine einzige Bronze der großherzoglichen und der Vereins=Sammlung, gehört also ohne Zweifel zu den ältesten Alterthümern der (germanischen) Bronze=Periode. Die Krone von Admanshagen hat einen gleich tiefen und edlen Rost, ist aber noch aus rothem Kupfer; nach der chemischen Analyse des Herrn Pharmaceuten, Provisors Witte zu Schwerin ist das Metall reines Kupfer, welches nichts weiter enthält, als eine kaum merkliche Beimischung von Eisen. Der ebenfalls mit Rost bedeckte Stift des Charnieres, um welchen sich das ausgeschnittene, bewegliche Vierteil dreht, ist aber schon von gelber Bronze. Dieser Stift kann in jüngern Zeiten der alten Zeit erneuet sein. Reines Kupfer aber fällt in die Zeit des Ueberganges von der Stein= zur Bronzeperiode; vgl. Jahrb. IX, S. 327. Der rohe, unebene Guß stimmt ebenfalls zu den wenigen kupfernen Altertümern aus der Uebergangsperiode; vgl. Jahrb. a. a. O. Die Form aber, in Vergleichung mit der trechowschen Krone von Bronze, der Stift von Bronze in dem Charniere, die Form des Kegelgrabes, in welcher die Krone gefunden ist, deuten auf die Bronzeperiode. Man kann daher unbedenklich annehmen, daß die Krone von Admanshagen in die ersten Zeiten der Bronzeperiode, kurz nach der Steinperiode, fällt, also ein sehr hohes Alter hat.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Peccatel bei Penzlin.
Auf der westsüdwestlichen Seite der Feldmark Peccatel (in der Richtung nach Liepen), da wo auch die Grenzen von Adamsdorf (früher Kustal) und Klem=Vielen zusammentreffen, liegt auf einem Hügelrücken, der fast von Norden nach Süden läuft und sich etwas steil nach Osten abdacht, ein Kegelgrab von 25 Fuß Höhe und 120 Fuß Durchmesser, mit Eichen, Buchen und Gebüsch bewachsen. Es wird der große Geldberg genannt (ein Name, welcher auch zu Lehsen vorkommt). Zur Aufdeckung dieses Grabes im Interesse des Vereins hatte mich der Herr Baron A. von Maltzan auf Peutsch, der schon früher einen Versuch gemacht hatte, von Osten und Westen in den Grabhügel hineinzudringen, freundlichst eingeladen, gab auch die erforderliche Mannschaft und Anspannung dazu her. Bei der früher versuchten Aufgrabung waren an der Oberfläche, die überall 3 bis 4 Fuß hoch mit größeren und kleineren Steinen bedeckt ist, im Osten viele Urnen, aber nur in Scherben, mit Knochen zum Vorschein gekommen, hatten aber kein bestimmtes Resultat geliefert, ob sie der Zeit


|
Seite 275 |




|
der Kegelgräber oder einer spätem Periode angehörten 1 ). Indem ich nun in der angefangenen Richtung von Osten nach Westen die Arbeit fortsetzte und einen Durchschnitt von 24 Fuß Breite durch den ganzen Hügel machte, fand ich noch 8 Fuß östlich von der Spitze des Hügels, 5 Fuß tief, eine Brandstelle mit einer doppelten Schicht mittelgroßer Steine, aber keine Spur von Urnen oder sonstigen Alterthümern. Außer der Steindeckung über dem ganzen Hügel fand sich eine zweite innere Wölbung aus einer einfachen Schicht ziemlich großer Steine, die aber nur etwa ein Drittheil des Hügels im Süden und Südosten bis zur Mitte umfaßte und 12 Fuß tief unter der Oberfläche sich hinzog. Grade in der Mitte des Kegels fanden sich erst wieder Steine, sonst war alles Sand, und zwar war es der eigentliche Begräbnißplatz mit der Brandstelle und den darüber backofenförmig gelegten Steinen, aber nur sehr klein. Ueber dem Urboden, der aus Lehmmergel besteht, war 2 Fuß hoch Sand angehäuft, 5 1/2 Fuß lang und 4 1/2 Fuß breit. Darauf war die Leiche verbrannt und so weit auch mit Steinen, in der Mitte etwa 2 Fuß hoch, belegt. Auf der Brandstelle lag eine fast harte Decke von Asche, fast 2 Linien dick und darüber eine Menge Kohlen, von Eichen und Überreste von Knochen. Zwischen den Kohlen fanden sich in der ganzen Fläche zerstreut:
1) etwa 14 hellblaue oder meerblaue Glasperlen, von denen aber nur 8 erhalten und im Brande etwas zusammengeschmolzen sind; die übrigen zerfielen in sandartige Stücke. Sie sind bedeutend größer, als die zu Lehsen gefundenen (Jahresbericht IV, 28). An eine Perle ist ein Stückchen Gold angeschmolzen, so wie an eine andere ein Stück von einem Zahne. Außerdem lagen zwischen den Kohlen und besonders in der Asche
2) Stückchen Gold, ohne Zweifel Reste eines spiralförmig gewundenen Fingerringes, wie Jahrb. IX, S. 336, von welchem mehrere Enden Drath ganz unversehrt, andere ganz klar zusammengeschmolzen sind; das Gewicht des Goldes betrug 50 Gran Apothekergewicht.
Außerdem fanden sich viele zerschmolzene Stücke Bronze; von diesen ist klar zu erkennen:
3) eine Heftel mit zwei Spiralplatten, wie die in Jahrb. IX, S. 331 abgebildete;
G. C. F. Lisch.


|
Seite 276 |




|
4) drei Enden dünner Spiralen, vielleicht Halsschmuck, 1/4 " im Durchmesser und bis 1 " lang;
5) sechs Ringe, wahrscheinlich Beschlagringe, ungefähr 1/2 " im innern, 3/4 " im äußern Durchmesser;
6) mehrere Stücke Bronzeblech, ungefähr 3/4 " breit, wie von einem großen Ringe;
7) eine ziemlich große Menge kleiner Bronze=Fragmente.
Der Inhalt dieses Grabes ist in den auszeichnenden Hauptsachen, Gold und meerblauem (caeruleus) Glase, ganz dem Kegelgrabe von Lehsen (Jahresber. IV, S. 28) gleich, und geben diese beiden Gräber durch die Glasperlen einen wichtigen Anhaltspunct für die Zeitbestimmung der ausgebildeten Kegelgräber.
Bei dieser Auffindung waren zugegen die Herren Baron A. von Maltzan, von Kardorff auf Remlin, Bibliothekar Genzen, Lieutenant von Bülow, Lieutenant du Trossel aus Neustrelitz, Gutsbesitzer Dudy auf Adamsdorf und Pastor Nahmmacher zu Peccatel.
Westlich von dieser Stelle war in einer Entfernung von 8 Fuß eine mauerförmige Steinsetzung von 4 Fuß Höhe und Breite in einem Kreisbogen, dessen Mittelpunct die Brandstelle war. Oestlich war sie nicht zu entdecken, vielleicht liegt sie wegen des steilen Abhanges des Urbodens noch tiefer, als es augenblicklich möglich war hineinzugraben.
Etwa 400 Schritte westlich von diesem Kegelgrabe liegt ein anderes von 20 Fuß Höhe und etwa 100 Fuß Durchmesser in der Scheide zwischen Adamsdorf und Klein=Vielen; es heißt der kleine Geldberg.
Ferner befindet sich südwestlich nahe bei dem großen Geldberge auf einem runden, aber flachen Hügel ein Steinkreis von 30 Fuß Durchmesser, wie der Ring um ein Kegelgrab. Hier soll ein früherer Besitzer von Adamsdorf nachgegraben und Urnenscherben gefunden haben.
Vietlübbe, im Juni 1844.
J. Ritter.
Der Inhalt dieses großen Grabes ist in den auszeichnenden Hauptsachen, Gold und meerblauem (caeruleus) Glase, ganz dem Kegelgrabe von Lehsen (Jahresber. IV, S. 28) gleich. Es können diese beiden Gräber durch die Glasperlen einen wichtigen Anhaltspunct für die Zeitbestimmung der ausgebildeten Kegelgräber geben.
Nach dem Werke "Ueber die Anfertigung und Nutzanwendung der farbigen Gläser bei den Alten, von H. C.


|
Seite 277 |




|
von Minutoli, Berlin 1836", ist bis jetzt Folgendes gewiß. Farbige Gläser und Glaspasten wurden schon seit den ältesten Zeiten, schon vor Herodots Zeit, in Asien und Afrika, vorzüglich in Phönicien und Aegypten, angefertigt und namentlich waren Theben und später Alexandrien durch Anfertigung farbiger Gläser berühmt (Min. S. 8, 11 u. 24); in den Ruinen von Pompeji wird viel farbiges Glas, oft von hohem Kunstwerth, gefunden, wie noch heute die alten Aggrys oder Aigries in Afrika sehr geschätzt werden (vgl. Minutoli S. 21 und Jahresber. VIII, S. 76) "Allen schriftlichen Ueberlieferungen zu Folge scheinen die Römer seit den ältesten Zeiten alle feinen Glaswaaren aus der Fremde bezogen zu haben, denn nach Plinius (XXXVI, c. 26) ward erst unter dem Nero die erste Glasfabrik in Rom eingerichtet. Zur Zeit jenes Schriftstellers wurden zwar bereits viele Glaswaaren in Rom angefertigt, allein deren Material war grünlich, wenig durchsichtig und sehr zerbrechlich, während die aus der Fremde eingeführten Kunstproducte dieser Art die Durchsichtigkeit des Krystalls besaßen. Nach Caylus machte aber diese Kunst in der Zwischenzeit von Nero bis zu Galerius Regierungsantritt große Fortschritte und erreichte einen hohen Grad von Vollkommenheit" (Min. S. 20).
Es ist wahrscheinlich, daß das in den heidnischen Gräbern Meklenburgs gefundene Glas aus römischen Staaten stammt. Nehmen wir dies an, so läßt sich schon eine ungefähre Zeitbestimmung geben. Mehrfach gefärbtes und Mosaikglas kommt in meklenburgischen Gräbern erst in der Eisenperiode vor, (vgl. Jahresber. VIII, S. 65 und 73). In den rein ausgebildeten Kegelgräbern ist bisher nur dasselbe bläuliche oder meerblaue Glas gefunden, welches "wenig durchsichtig, sehr zerbrechlich" und splitterig im Bruche ist. Die Farbe gleicht den hellblau gefärbten Eisenschlacken, welche die bei Hochöfen vorüberströmenden Flüsse führen, z. B. im Haarz die Selke; nach Klaproth's Analyse ist das blaue Glas der Alten mitunter durch Eisen gefärbt (vgl. Minutoli S. 33), jedoch auch durch Kupfer und Kobalt (Min. S. 35 und 37).
Kommen nun diese mattblauen Glasperlen der nordischen Kegelgräber aus Rom, so dürfte sich einstweilen der Schluß machen lassen, daß diese Gräber aus der Zeit vor Nero stammen, da sich sonst in so ausgezeichnet großen und schönen Gräbern auch wohl andere Gläser gefunden haben würden. Zugleich scheint dann der Schluß gewagt werden zu dürfen, daß die Kegelgräber mit Bronze, Gold und meerblauem


|
Seite 278 |




|
Glase in die Zeit vor Christi Geburt fallen, die Eisenperiode mit Eisen, Bronze, Silber, Mosaikglas und römischen Gefäßen (vgl. Jahresber. VIII, S. 38 flgd. und 49) in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt beginnt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Retzow Nr. 4.
Nordwestlich vom Dorfe Retzow, Amts Lübz, liegen drei Kegelgräbergruppen, deren größere Hügel früher von dem Herrn Hauptmann Zinck aufgedeckt sind; vgl. Jahrb. IX, S. 381. Sie werden allmählig von den Besitzern der Ackerstücke abgetragen, um den Acker besser benutzen zu können; doch ward mir gesagt, daß in den kleineren Hügeln noch Manches gefunden werde. Im Interesse des Vereins wandte ich mich an die Ackerbesitzer und erklärte ihnen, daß sie von dem Zerstören der kleineren Hügel abstehen sollten, deren Aufdeckung ich, so wie es nöthig erschiene, übernehmen würde. Eine Gruppe von acht unversehrten kleinen Hügeln ist der Zerstörung am meisten ausgesetzt, und ließ ich einen derselben wegräumen, ohne etwas zu finden; er war etwa 2 1/2 Fuß hoch und 20 ' breit im Durchmesser, aus Dammsteinen mit Erde vermischt aufgetragen. In einem zweiten von gleicher Größe lagen fast nach der Mitte unter Steinen dicht über dem Urboden eine Speerspitze aus Bronze, an der kaum merklichen Schaftzunge kurz abgerundet, mit 2 Nietheften, 5 1/2 " lang und 1 1/4 " breit, und darüber ein in mehrere Stücke zerbrochener, siralcylindrischer Armring aus dreieckigem Bronzedrath, 3 " weit und mit etwa 5 Windungen. Spuren von Urnen und sonstigen Alterthümern zeigten sich nicht.
Vietlübbe, im September 1844.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Kreien bei Lübz.
Südöstlich von dem Hofe Kreien hat unfern des Moderloches, in welchem das lange Bronzeschwert (Jahrb. IX, S. 387) gefunden ist, eine Gruppe Kegelgräber gelegen; man kann noch die Stelle von 8 derselben erkennen. Von diesen Gräbern ist nur eins unversehrt geblieben, zweien aber droht der Untergang, da zu wirthschaftlichen Zwecken, besonders von den Bauern, die zu Tage liegenden Steine weggefahren und nur die Grundsteine nach der Mitte zu vorhanden sind. Um so nötiger schien es, das, was in diesen beiden, fast zum größten Theile zerstörten Gräbern noch etwa vorhanden sein möchte,


|
Seite 279 |




|
für den Verein zu retten. Auf mein Ersuchen erlaubte der Herr von Plato nicht nur eine Untersuchung der Hügel, sondern stellte auch die erforderlichen Leute. Für die erste Ausgrabung wählte ich den am meisten angegriffenen Hügel. Derselbe war in der Mitte noch über 5 ' hoch und hatte einen Durchmesser von 3 Ruthen; von dem früheren Steinkreise um den Hügel waren noch einzelne Steine vorhanden. Die Erde, aus welcher der Hügel aufgeschüttet war, zeigte dieselbe Beschaffenheit wie der Boden umher, nämlich humusreichen Sand, jedoch so mit Dammsteinen vermischt, daß kaum hineinzudringen war. Die Aufgrabung geschah von Osten und es fand sich in dem Hügel eine Steinkiste, welche erst mit der westlichen Wand den Mittelpunct des Hügels berührte, also noch in der östlichen Hälfte des Grabes lag. Diese viereckige Steinkiste war aus großen, nach innen etwas glatt gespaltenen Steinen aufgesetzt, 3 1/2 ' hoch und 4 ' im Quadrate weit; der obere Deckstein fehlte schon. In dieser Steinkiste standen 2 Reihen Urnen über einander, welche aber sämmtlich zerdrückt waren; sie waren alle unverziert und von dunkelbrauner Farbe. Die oberen Urnen standen 2 ' über dem Urboden; es waren ihrer drei, zwei mit Knochen und eine mit Sand und Asche angefüllt. Gleich in der ersten, östlich stehenden Urne lag über den Knochen eine bronzene Nadel, mit edlem Rost überzogen, 4 3/4 " lang, vom Knopfe an in der Länge von 1 1/4 " knieförmig oder wie ein S gebogen. - Auf dem Urboden standen 4 Urnen, 2 große, eine mit Knochen und die andere mit Asche und Sand gefüllt (ossuarium und cinerarium), und ebenso 2 kleinere, mit Knochen eines Kindes. An Altertümern fand sich aber nichts darin. - Der Boden, auf dem diese Kegelgräbergruppe steht, dacht sich südöstlich ab. Vietlübbe, im Juli 1844.
J. Ritter.



|



|
|
|
Kegelgrab von Sternberg.
In einem Grabe bei Sternberg wurden in einer zerbrochenen Urne unter Knochen und Asche mehrere Bronze=Alterthümer gefunden und von dem Herrn Burgemeister, Hofrath Schlüter erworben. Derselbe schenkte aus diesem Funde vor dem J. 1834 dem Gymnasium Fridericianum zu Schwerin 2 Handringe aus Bronze welche später zur Sammlung des Vereins kamen (vgl. Jahresber. V, S. 64); gegenwärtig hat derselbe dem Vereine den Rest des Fundes, bestehend aus einem Handringe und einem Fragment eines gewundenen Halsringes geschenkt.


|
Seite 280 |




|



|



|
|
:
|
Begräbnißplatz bei Schwerin.
Bei der Bepflanzung eines Theils des Exercierplatzes bei Schwerin ward ein Begräbnißplatz entdeckt, dessen Stelle allein von Interesse sein kann, da der Inhalt zerstört ist. Der Begräbnißplatz liegt am Wege von Schwerin nach Zippendorf auf der letzten, noch zu Schwerin gehörenden, etwas isolirten Höhe des Höhenrückens, welcher sich am großen See entlang zieht und der "Hals" oder der Exercierplatz genannt wird, kurz vor der zippendorfer Grenze, zwischen dem Wege am Großen See und dem Mittelwege am Faulen See, zwischen der Wiese am südlichen Ende des Faulen Sees (und der äußersten Spitze des Haselholzes) von der einen und dem Kaninchenwerder von der andern Seite, dort wo auf der großen schmettauischen Charte am Großen See der "Born=Berg" verzeichnet steht. Diese Höhe ward zur Bepflanzung mehrere Fuß tief ganz umgegraben oder rajolt und es zeigten sich bei dieser Arbeit an mehrern Stellen viele Scherben von Urnen, welche alle zertrümmert wurden. Die Urnen waren alle einfach von Form, ohne Verzierungen, sehr dickwandig und röthlich, schwarz oder bräunlich von Farbe gewesen. Auch waren zwei Brandstellen erkennbar. Bei der völligen Umwälzung war aber keine Möglichkeit vorhanden, etwas zu retten; auch zeigte sich keine Spur von Alterthümern. Die Urnenscherben hatten den Charakter der Bronzeperiode.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Gold= und Bronze=Geräthe von Parchim.
Im Herbste des J. 1844 fanden zwei Arbeiter beim Steinsprengen die im Folgenden beschriebenen Alterthümer, welche durch den Herrn Dr. Beyer für den Verein durch Kauf erworben und gerettet sind. Als die Arbeiter nahe am Ufer der Elde in einem Eichenholze am Fuße des Sonnenberges, ganz in der Nähe des Brunnens bei Parchim, einen 3 Fuß dicken und 7 Fuß im Umfange haltenden Stein, welcher noch etwa 1 1/2 Fuß tief in der Erde lag, lösen wollten, drang die Hacke eines Arbeiters plötzlich durch den sehr fest gelagerten Stein= und Kiesgrund unter dem Steine in eine Höhlung, welche sich bei näherer Untersuchung als eine regelmäßig, von flachen Steinen gebildete viereckige Kiste von etwa 1 Kubikfuß Inhalt zeigte. In dieser Kiste lag:


|
Seite 281 |




|
1) ein Bronzegefäß, welches die übrigen Alterthümer enthielt.

Dieses Gefäß ist der Bestimmung nach eine Büchse von der Art, wie in Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3 und 4, einige abgebildet sind und wie dergleichen in Meklenburg schon einige Male beobachtet sind: die Hauptverzierungen sind nämlich, nach der unten mitgeteilten Abbildung, auf der untern Seite angebracht und die Oeffnung ist durch einen Deckel verschlossen, welcher oben ein Oehr hat, durch welches ein Riegel geht, der an beiden Seiten durch zwei auf den Seitenwänden des Gefäßes stehende Oehren geht. Der Form nach ist das Gefäß eine sogenannte "Hängeurne", wie solche im Strelitzischen öfter gefunden sind und eine im Jahresber. VII, S. 34 abgebildet ist, nur mit dem Unterschiede, daß die strelitzischen Hängeurnen sehr große, ganz anders verzierte und viel jüngere, auch nicht mit einem Deckel verschlossene, jedoch ganz gleich construirte Gefäße sind. - Unser Gefäß ist aber ganz klein, so groß, wie die erwähnten gradwandigen Riegelbüchsen der Kegelgräber, 2 " hoch und 4 " weit im weitesten Durchmesser. In der Mitte des Bodens unter dem scharfen Bauchrande ist ein durch den Guß vertieftes sogenanntes Krücken=Kreuz mit 1 " langen Balken; umher läuft eine Verzierung von



|
Seite 282 |




|
Augen, jedes bestehend aus 3 erhabenen, concentrischen Kreisen, welche durch eine Schlangenlinie verbunden sind, so daß diese Verzierung als ein Vorläufer der wahrscheinlich etwas spätern Spiralverzierungen erscheint. Diese Verzierung ist nach innen durch eine Linie begrenzt, auf welcher nach innen gekehrt Halbkreise stehen, nach außen durch mehrere einfache Linien, welche durch Reihen von Schrägelinien begrenzt sind. Auf dem obern Rande des Bauches sind Parallellinien im Zickzack eingravirt, wie sie auf Handringen öfter vorkommen. - Das Ganze ist mit tiefem, edlen Rost bedeckt. Auch ist das ganze Gefäß aus ziemlich röthlicher Bronze, also aus einer schwachen Legirung mit Zinn verfertigt und scheint daher auf ein hohes Alter zu deuten. - Als das Gefäß gefunden ward, hatte der Rand zwei breite, niedrige Oehren und war durch einen bronzenen Riegel verschlossen, welcher durch diese Oehren und das Oehr des Deckels ging; da der Rand des Gefäßes aber sehr morsch war, so zerbrachen die beiden Oehren beim Oeffnen und auch der Riegel ging verloren; jedoch sind die Grenzen des Riegels in dem Rost des Deckels noch sichtbar.
In diesem Gefäße lagen folgende Alterthümer:
2) ein gewundener goldener Armring, wie der in Jahrb. IX, S. 376 abgebildete, bei Peccatel gefundene, jedoch nicht wie dieser an jedem Ende mit einer Spiralwindung, sondern im gespaltenen Ende mit zwei Spiralwindungen, wie der im Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 1 abgebildete. Er war bei der Auffindung vollkommen erhalten und glänzend, grade so groß, wie der Bauchrand des Bronzegefäßes, und in diesen eingeklemmt, so daß er nur durch Zusammendrücken herausgenommen werden konnte. Er ward später bei der Untersuchung des Metalls, welches lange Zeit nicht als Gold erkannt ward, mitten durchbrochen, und so ist mit der Zeit die eine Hälfte verloren gegangen, angeblich durch Kinder verspielt; über den Werth der noch vorhandenen Hälfte wurden die Finder erst durch den Herrn Dr. Beyer unterrichtet.
Die Art der Verfertigung der gewundenen goldenen Armringe, welche jedenfalls der Aufmerksamkeit würdig ist und manches Räthselhafte zu bergen scheint, ist durch das Auseinanderbrechen dieses Ringes klar ans Licht getreten. Mit den Reifen sind diese Ringe nicht gegossen, auch sind die Windungen nicht eingefeilt; eben so wenig können sie aus einer runden Stange gedreht sein. Nach vielen Spuren, welches unser Ring zeigt, sind diese Ringe aus mehreren zusammengelegten, dünnern Stangen gedreht: man sieht an


|
Seite 283 |




|
vielen aus dem Verbande gekommenen Stellen ganz klar die Fugen zwischen den einzelnen Dräthen und am Bruche die Enden dieser Dräthe selbst. Die große Frage ist nun, wodurch eine so innige Verbindung erzeugt ist, daß die Ringe aus Einem Stücke zu bestehen scheinen. Dies scheint völlig räthselhaft zu sein.
Ferner lagen in dem Gefäße:
3) 12 kleine sogenannte Hütchen oder Buckel aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 10, jedoch nur ungefähr 1 " hoch, und
4) 11 flache runde Knöpfe aus Bronze, etwas über 1 " im Durchmesser, unten mit einem kleinen Oehr zum Aufheften; einer ist verloren gegangen.
Der Fund gehört in allen seinen Theilen zu den seltenen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Bronze=Geräthe von Dahmen.
Zu Dahmen am malchiner See wurden beim
Modergraben 6 Fuß tief in einem Moderloche
mehrere höchst interessante, völlig wie neu
erhaltene, von Rost freie Bronzen gefunden,
durch die Aufmerksamkeit des Herrn Barons A. von
Maltzan auf Peutsch zu Rothenmoor gerettet und
von dem Herrn Landrath Baron von Maltzan auf
Rothenmoor, Dahmen
 . dem Vereine geschenkt. Der Fund
besteht aus einer Schale und zwei paar Spiralringen.
. dem Vereine geschenkt. Der Fund
besteht aus einer Schale und zwei paar Spiralringen.
Das Interessanteste des Fundes ist eine
Bronzeschale

von einfacher, ernster, sehr schöner Form, aus Bronzeblech getrieben und mit getriebenen Verzierungen geschmückt, 2 3/4 "hoch,


|
Seite 284 |




|
6 3/4 " weit in der Oeffnung, mit einem 3/4 " hohen, eingezogenen und nach außen gelehnten Rande, welcher auf dem ebenfalls 6 3/4 " weiten Bauchrande steht, mit einem Boden von 1 3/4 " Durchmesser. Vom Bauche bis zum Rande liegt ein breiter Henkel von der Weite eines starken Zeigefingers. Die Verzierungen bestehen vorzüglich aus erhabenen, kleinen, runden Buckeln von 3/16 " Durchmesser, welche von innen heraus getrieben sind, ähnlich den Buckeln, mit welchen die Lederrüstung von Peccatel (Jahrb. IX, Lithogr., Fig. 8 und 8c.) beschlagen ist; um den eingezogenen Rand läuft eine Reihe solcher getriebener Buckel; um den obern Theil des Bauches laufen zwei Reihen, welche zwischen drei Reihen getriebener Knötchen von der Größe eines Stecknadelkopfes liegen. Der kreisrunde Boden ist von einem von innen heraus getriebenen, erhabenen Rande von beinahe 1/2 " Breite begrenzt. Die Schale ist von alter Bronze. Der an jeder Seite mit drei Furchen verzierte Henkel aber ist an jedem Ende mit zwei Nieten von rothem Kupfer befestigt. Das Gefäß gehört zu den großen Seltenheiten; wenigstens ist in Meklenburg noch keine ähnliche Schale aus Bronze beobachtet. Uebrigens zeugt der durchfressene Boden vom Gebrauche über dem Feuer. - Die Form des Gefäßes gleicht ganz den Formen der in den reinen Kegelgräbern, namentlich auf der benachbarten Feldmark Moltzow öfter gefundenen kleinen Schalen.
Schalen von allen Größen sind nämlich den aus der Bronzeperiode stammenden Kegelgräbern eigenthümlich. Oft sind die Schalen groß und weit, wie die in Frid. Franc. Tab. XXXV, Fig. 13 und 14 abgebildeten; dann haben sie zur Bedeckung der großen Knochenurnen gedient, wie dies in dem Kegelgrabe von Meyersdorf (vgl. Jahresber. V, S. 47) und in mehrern Kegelgräbern von Perdöhl (vgl. Jahresber. V, S. 50, Nr. 5, S. 52, Nr. 17 und 18, und S. 54, Nr. 23 und 24) sicher beobachtet ward. Andere Schalen sind klein; auch diese haben zuweilen zur Bedeckung von Urnen mit engen Mündungen gedient, wie dies in einem Kegelgrabe von Gallentin (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 2) und in einem Kegelgrabe von Moltzow (vgl. Jahresber. VI, S. 137) ebenfalls sicher der Fall war. Diese beiden Schalen von Moltzow sind der hier abgebildeten Bronzeschale ganz ähnlich. Zuweilen sind ähnliche kleinere Schalen auch nicht zur Urnenbedeckung gebraucht gewesen, wie eine kleine Schale, welche in einer in einem Kegelgrabe von Moltzow stand (vgl. Jahresber. VII, S. 22) und in der Grundform unserer Bronzeschale gleich ist. Die in dem Hünengrabe von Moltzow gefundene Schale aus


|
Seite 285 |




|
der Bronzeperiode (vgl. oben S. 265, Nr. 1, und S. 267) ist ebenfalls der Bronzeschale ähnlich. Ueberhaupt ist die gleiche Gestaltung der Gefäße auf der Feldmark von Moltzow (vgl. oben S. 264) merkwürdig.
In dieser Schale und unter einer Sandsteinplatte wurden
zwei Paar Spiralcylinder
gefunden, in jeder Hinsicht ebenfalls von seltener Beschaffenheit.

Das eine Paar ist 4 1/2 " hoch und 3 " weit, das andere 3 " hoch und 2 3/4" weit. Als sie aufgefunden wurden, steckte immer eine kleine Spirale in einer größern.
Die Grundform und Arbeit an beiden Paaren ist gleich. Die Hauptmasse besteht nämlich aus einer Spiralwindung von breiten, flachen und glatten Bronzestreifen, welche an beiden Enden in ganz schmale, halbrunde Drathenden auslaufen. Die breiten Enden sind mit einer ununterbrochenen Zickzacklinie verziert, welche aus eingegrabenen kurzen, senkrechten Parallelstrichen gebildet ist. Die Spiralen ähneln daher der in Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 5 abgebildeten Spiralen, jedoch mit den hier angegebenen Abweichungen. Der Herr Baron A. von Maltzan auf Peutsch fand im römischen Antiquarium zu Berlin ein Paar ganz gleiche Spiralen, welche der Angabe nach in Süditalien gefunden sein sollen.
Die großen Spiralen, deren jede aus einem 9 Fuß langen Bronzestreifen besteht, haben 6 Windungen aus breitem Blech und an jedem Ende 2 Windungen aus Drath; die kleinen Spiralen haben 4 Windungen aus breitem Blech und an jedem Ende 2 Windungen aus Drath.
Die kleinen Spiralen gehören wohl zur Bedeckung der Unterarme, die großen zur Bedeckung der Oberarme oder der Beine über dem Fußknöchel.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Spiralcylinder von Moltzow.
In einem Moderloche zu Moltzow, nicht ferne vom malchiner See, ward beim Modergraben ein gewöhnlicher, vom Roste nicht befallener Spiralcylinder von halbrundem Bronze=


|
Seite 286 |




|
drath, wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 8, von 15
Windungen, gefunden und von dem Herrn Landrath
Baron von Maltzan auf Rothenmoor, Moltzow
 . dem Vereine geschenkt.
. dem Vereine geschenkt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kupfernes Pferdebild von Varchentin.
Der Herr Dr. Jenning zu Stavenhagen hat ein kleines Pferdebild geschenkt, welches sichern Erkundigungen zufolge vor mehreren Jahren zu Varchentin bei Stavenhagen beim Mergelgraben in einer kleinen Steinkiste zwischen den Scherben einer zertrümmerten Urne gefunden ist. Das Bild ist vorne gut 1 1/2 ", hinten nur 5/8 " hoch und ungefähr 2 " lang. Es ist einfach und roh gearbeitet; die Beine sind zusammengegossen und nur unten an der Stelle der Füße getrennt und auseinander gebogen; die vordern Beine sind noch einmal so hoch, als die hintern; die Ohren stehen wie kleine Hörner aufwärts;

ein Schwanz fehlt. Der Rost ist nur leicht. Dicht unter dem Kopfe ist der Hals durchbohrt und das regelmäßige Loch zeigt Spuren, daß das Bild an einem Ringe getragen ist. Der Leib des Ringes ist voll gegossen und aus rothem Kupfer, die Ohren sind jedoch aus Bronze.
Die Verbreitung und Bedeutung solcher Thierbilder ist noch sehr wenig zur Sprache gekommen. In Meklenburg=Schwerin ist unser varchentiner Bild das erste, welches bekannt geworden ist. - In der großherzoglichen Sammlung zu Neustrelitz werden 3 gleich große Bilder ähnlichen Styls aufbewahrt; eines von diesen ist zu Warbende beim Pflügen gefunden, der Fundort der andern ist nicht bekannt. Diese 3 Bilder sind offenbar Stierbilder, nach ihrer kurzen, gedrungenen Gestalt und den langen Hörnern. Alle drei sind voll aus Bronze gegossen und alt; namentlich hat das bei Warbende gefundene schönen edlen Rost. Ein viertes, ganz gleiches Exemplar eines kleinen Stierbildes ward, nach den zuverlässigen Mittheilungen des Herrn Gymnasiallehrers Masch zu Neu=Ruppin, der dasselbe mehrere Male gezeichnet und auch dem Vereine eine Zeichnung geschenkt hat, dem längst verstorbenen Kammerrath Mende zu Neustrelitz gebracht; dasselbe war zu Rödlin


|
Seite 287 |




|
bei Neustrelitz beim Pflügen unter einer Menge kleiner, feiner Knöchelchen gefunden. Der Drath, der die Hörner bildete, war in einem Loche beweglich. Nach Mende's Tode ward das Bild mit dessen Münzsammlung in Dresden verkauft. - In der Sammlung des Herrn Grafen von Zieten auf Wustrau bei Neu=Ruppin befindet sich ein gleich großes metallenes Bild, welches nach dem langen, runden Leibe, dem langen Rüssel, der Stellung der Beine und dem Mangel an Hörnern einem Schweine gleicht. Der Fundort ist unbekannt. - Bei Schlieben ward in der Urne eines Grabhügels ein dem varchentiner ähnliches Pferdebild gefunden, welches jetzt in der Sammlung vaterländischer Altertümer zu Berlin aufbewahrt wird; vergl. Klemm Handbuch der germanischen Alterthumskunde S. 366 und Abbildung T. XXII, und Bericht der deutschen Gesellschaft in Leipzig, 1831, S. 8 flgd. und Abbildung Fig. 1. - Klemm besitzt nach seiner Mittheilung a. a. O., Not. 5, zwei dem schliebenschen ähnliche Pferdebilder, welche auf dem Rücken ein Oehr haben.
Dies sind, so weit unsere Nachrichten reichen, die bisher bekannt gewordenen, in Norddeutschland gefundenen Thierbilder. Alle sind von gleicher Arbeit und gleichem Styl und gehören offenbar einer sehr alten Zeit an. Der edle Rost, welchen mehrere tragen, weiset sie in die Zeit der reinen Kegelgräber aus der Bronze=Periode zurück, und zwar in eine sehr frühe Zeit derselben, da unser varchentiner Bild noch aus rothem Kupfer gegossen, die Ohren aber später aus Bronze angesetzt sind. Die Bildungen sind Stiere oder Pferde, eines vielleicht auch ein Eber, also Darstellungen heiliger Thiere der Germanen. Offenbar waren es Votivbilder oder vielmehr Amulete, da die meisten zum Tragen eingerichtet und alle sehr klein und von derselben Größe sind.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Commandostab von Glasin.
Die sogenannten Commandostäbe aus Bronze, bestehend aus einer beilartigen Waffe mit langem Stiel aus Bronze, sind im germanischen Norden eine auffallende Erscheinung, sowohl wegen ihrer Gestalt, als wegen der Erzcomposition, da dieselbe auch etwas Silber enthält man vergl. Jahrb. IX, S. 340. Schon früher wurden in Meklenburg zu Blengow drei gefunden (vergl. Frid. Franc. Erl. S. 115 und Tab. XXIII, Fig. 1), von denen ein Exemplar im großherzoglichen Antiquarium aufbewahrt wird; später ward zu Hans=


|
Seite 288 |




|
dorf ein anderes Exemplar gefunden (vgl. Jahresber. II, S. 47), welches in der Vereinssammlung aufbewahrt wird.

Zufall und Theilnahme führten dem Vereine ein drittes Exemplar zu. Ein unbekannter, hausirender Nagelschmied hatte es mit altem Eisen an den Schmied zu Glasin bei Neukloster verkauft, der es beim Probiren zerschlug. Hier fand es der Herr Hülfsprediger Born zu Neukloster, der es nach den letzten Jahrbüchern des Vereins sogleich erkannte, erwarb und dem Vereine zum Geschenk darbrachte. Das Exemplar ist, wenn auch in 5 Stücke zerschlagen, doch bis auf die Beilspitze ganz vollständig und gewährt durch die Zertrümmerung einen Blick in das Innere. Es ist fast ganz so gebildet, wie das zu Blengow gefundene, nur ein wenig größer in allen Dimensionen, und offenbar von demselben Künstler gearbeitet; vielleicht ist es eines der drei bei Blengow im J. 1808 gefundenen Exemplare, welche bisher spurlos verschwunden gewesen sind. Das zu Hanstorf gefundene Exemplar ist in den Verzierungen von anderer Art. Der Stiel des glasinschen Exemplars ist bis ans Ende ganz hohl gegossen; jedoch hat die Höhlung nicht zur Aufnahme irgend eines Gegenstandes dienen können, da an einigen Stellen in der Mitte der Stiel durch Unvollkommenheit des Gusses voll gegossen und an einer Stelle zur Füllung einer Lücke in der Oberfläche ein Stift quer durch getrieben ist. Das Beil ist in der Richtung des Stiels auch hohl gegossen. An der Stelle der Zusammenfügung des Beils und des Stiels geht dieselbe verzierte Verbindung, welche jetzt durchbrochen ist, über beide Theile.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Bronzewaffen von Glasin bei Neukloster.
Im Sept. 1844 fand der Schullehrer Elbrecht zu Glasin in einer Wiese 1 1/2 Fuß tief beim Torfstechen an einer Stelle


|
Seite 289 |




|
beisammen 1 Framea von Bronze, wie Frid. Franc. Tab. XIII, Fig. 7, und 23 Lanzenspitzen aus Bronze, mit Schaftloch und zwei Nagellöchern, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. VIII, Fig. 5; die Lanzenspitzen sind alle von gleicher Größe und ungefähr gleicher Form, jedoch in den Umrissen etwas von einander abweichend, also alle in verschiedenen Formen gegossen; alle sind sehr angegriffen und braun tief verwittert und theils sehr zerbrechlich, theils zerbrochen. Durch Vermittelung des großherzoglichen Amtes zu Warin sind diese Bronzewaffen in das großherzogliche Antiquarium abgeliefert.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Armring von Gnoien.
Der Herr von Kardorff auf Remlin kaufte bei dem Kupferschmiede Stolzenburg zu Gnoien einen Armring und schenkte ihn zu den Sammlungen des Vereins. Der Ring, welcher in einem Moor oder Gewässer gefunden sein muß, ist ohne allen Rost und zeigt manche bemerkenswerthe Eigenthümlichkeit. Er ist geschlossen, 3 " im Durchmesser, 3/4 " breit, hohl, aus dünnem Bleche. Das Blech ist nicht getrieben sondern gegossen, wie man auf der innern Fläche dieses von Rost nicht angegriffenen Ringes deutlich sieht, indem auf dieser noch alle und viele Erhöhungen und Unregelmäßigkeiten des Gusses stehen; auch ist eine ganze Stelle des Ringes auf der Außenseite sehr porös. Man kann daher annehmen, daß die hohlen Ringe der Bronzezeit wie alle übrigen Geräthe ebenfalls gegossen sind, wenigstens als Blech. Uebrigens ist die Bronze ziemlich roth und hat daher wohl wenig Zinn. An der Stelle der Zusammenfügung ist der Ring zierlich geschweift und mit einem breiten Querbande und an jeder Seite mit vielen schmalen Querlinien verziert.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Goldenes Diadem von Schwasdorf.
Goldene Diademe sind in Dänemark öfter gefunden; auch in Meklenburg hat der Unterzeichnete einige Male Gerüchte von der Auffindung solchen Schmuckes hieselbst vernommen, jedoch nie bestimmte Nachricht darüber gewinnen können. Jetzt bringt der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoien sichere Kunde über die Auffindung eines goldenen Diadems, welches, wie so viel Wertvolles, wiederum in Hamburg's Schmelztiegeln den Untergang gefunden hat.


|
Seite 290 |




|
Vor etwa zehn Jahren fanden nämlich Steinbrecher, welche für die rostock=neubrandenburger Chaussee Steine sprengten, unter einem Haufen von Steinen (also wahrscheinlich in einem Kegelgrabe) zu Schwasdorf bei Gnoien, mit Remlin grenzend, ein Stück gelbes Metall, welches sie zu sich und am nächsten Sonntage mit nach Gnoien nahmen, um es hier zu verwerthen. Der israelitische Kaufmann Beer zu Gnoien kauft den Gegenstand und schickt ihn zum Einschmelzen nach Hamburg, wo er 80 Thaler Gold dafür erhält. Nach der Aussage und Beschreibung des Kaufmanns Beer, welcher in dem Rufe eines zuverlässigen, achtungswerthen Mannes steht, ist der Gegenstand wie ein kleiner "Mützenschirm" gestaltet gewesen, also ohne Zweifel ein aus der Bronze=Periode stammendes Diadem, wie es in Jahrb. IX, S. 333 abgebildet ist.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Glasperlen vom Diadem von Putbus.
Im J. 1824 ward bei Putbus durch den sogenannten Tannenberg ein Weg gegraben und dazu die Erde etwa 16 Fuß tief weggeräumt. Hiebei ward ein Diadem gefunden, an welchem Menschenhaar und etwas verbranntes Zeug hingen. An dem Diademe saßen ungefähr 100 Perlen, etwas größer als Erbsen, weiß, roth und grün. Die weißen zerfielen, als sie an die Luft kamen. Das Diadem ist verloren gegangen. Von den Perlen hat der Herr Dr. Jenning zu Stavenhagen eine undurchsichtige rothe und eine durchsichtige grüne mit der vorstehenden Nachricht eingesandt.



|



|
|
:
|
d. Zeit der Wendengräber.
Grab von Sembzin.
In einer Sandgrube auf dem Felde von Sembzin, an der Landstraße von Röbel nach Waren, an der Müritz, wurden im Sommer des J. 1843 folgende Alterthümer gefunden und von dem Herrn Klosterhauptmann von Borck zu Malchow dem Vereine überliefert:
1) die Scherben einer heidnischen Urne, hellbraun, ohne Verzierungen, stark mit zerstampftem Granit durchknetet, dem Anscheine nach aus der ältern Zeit der Eisenperiode; die Scherben, so wie die in der Urne befindlich gewesenen verbrannten Knochen haben Spuren von Eisenrost.
In der Urne hatte gelegen:


|
Seite 291 |




|
2) eine Kette von Bronze, aus einfachen, runden, schräge durchschnittenen Gliedern, 2 ' 9 " lang, welche in besondern, eingehängten Gliedern blaue Glasperlen trägt, ganz wie sie in Wendenkirchhöfen gefunden werden; zu dieser Kette scheinen zu gehören:
3) zwei Nadeln von Bronze, beide gleich, ungefähr 4 " lang, am Kopfende breit geschlagen, etwas gebogen und in zwei entgegengekehrte platte Spiralen von ungefähr 1 1/4 " Durchmesser auslaufend; in Kruse Necrolivonica Tab. 12, Fig. 5 ist eine ähnliche Kette ebenfalls mit 2 Nadeln abgebildet; ferner war in der Urne gewesen:
4) eine etwas beschädigte, kleine Heftel von Bronze mit einem zu einem hohlen, runden Knopfe gestalteten Bügel von ungefähr 3/4 " Durchmesser, und
5) ein großer, breiter, hohler, wulstförmiger Armring aus Bronzeblech, wie ein Wulst, nach innen der Länge nach offen, 3/4 " hoch in der Rundung, 1 " breit, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXI, Fig. 4, nur schmaler in den Dimensionen. Der Ring ist leider in mehrere Stücke zerbrochen; in drei Stücke zerbrochen war er jedoch schon bei der Beisetzung.
Alle Alterthümer, welche nur leichten, nirgends edlen Rost haben, sind in Meklenburg durchaus eigenthümlich und selten. Die Spiralen an den Nadeln sind zwar in den Ostseeländern gewöhnlich, aber sie sind bisher noch nicht an Nadeln bemerkt; der in Frid. Franc, abgebildete hohle Armring ist der einzige seiner Art in den Sammlungen Meklenburgs; Ketten und Hefteln, wie sie dieser Fund enthält, sind aber noch nie in Meklenburg beobachtet worden. Dem Roste und dem Charakter nach haben diese Alterthümer Aehnlichkeit mit den auf dem benachbarten Gute Klink (vgl. Jahresber. III, S. 64 flgd.) und bei Ludwigslust (vgl. Frid. Franc. Erl. S. 63 flgd.) gefundenen, wahrscheinlich aus der Uebergangsperiode von der Bronze= zur Eisenperiode stammenden Alterthümern; die bei Ludwigslust gefundenen Fingerringe mit 2 Spiralen (Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 16) gleichen an Arbeit und Rost ganz den Spiralen der Sembziner Nadeln. Das Kettenwerk ist aber vorzüglich mehr nach Norden und Osten hin (vgl. Kruse Necrolivonica) aus der jüngern heidnischen Periode beobachtet worden, wenn auch die kobaltblauen Glasperlen die Eisenperiode in Meklenburg charakterisiren.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 292 |




|



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Kuppentin.
Nahebei dem Dorfe Kuppentin, etwa 85 Ruthen von der Kirche in südöstlicher Richtig, erstrecken sich auf beiden Seiten des Weges nach Plau, nördlich und südlich mehrere hundert Schritte lang und etwas weniger breit, sandige Hügel, die zum Theil vom Winde zusammengewehet scheinen und jetzt mit Tannen bestanden sind. In einer Sandgrube zwischen dem Daschower und Plauer Wege waren, nach dem Berichte der Einwohner, schon oft Urnen, mit Knochen angefüllt, zum Vorschein gekommen. Auf Einladung des Herrn von Bülow zu Kuppentin und des Herrn von Kardorff auf Remlin begab ich mich dorthin und stellten wir, besonders da am Plauer Wege Steinkreise beim Grabenziehen sichtbar geworden Nachforschungen an. In der bezeichneten Sandgrube fanden wir Urnenscherben verschiedener Art und nach vielen Versuchen entdeckten wir am nördlichen Rande der Grube
1) eine Urne von hellbrauner Farbe, halb angefüllt mit kleinen, feinen Knochen, offenbar von einem Kinde. Die Urne maß 6 1/2 " in der Höhe, 3" in der Oeffnung, 7 1/2 " in der Bauchweite und 2 3/4 " in der Basis, war aber zerbrochen. -Lohnender war die Untersuchung am Plauer Wege, wo drei kleine Steinkreise von etwa 6 ' Durchmesser in der Richtung von Osten nach Westen, jeder gegen 10 Schritte von dem andern entfernt, sich zeigten. Von Osten stand
2) eine Urne von 6 1/4 " Höhe, 6 1/2 " in der Oeffnung, 7 3/4 " in der Bauchweite und 3 1/2 " in der Basis haltend. Darüber war ein überfassender Deckel mit einem Henkel. Die Urne war zerbrochen, aber ganz von Gestalt der erhaltenen unter Nr. 4 ähnlich. Der Inhalt bestand aus Knochen.
3) Die folgende Urne war 7 " hoch, maß in der Oeffnung 7 ", im Bauche 10 " und in der Basis 3 ". Oben war die Wand der Urne 4 " hoch, fast senkrecht, und der Bauch so spitz ausgebogen, daß er unter dem Drucke der Steine gänzlich zerbrochen war. Der überfassende Deckel war eine Schale mit einer Basis von 3 ". Die Urne war voll Knochen und Asche und stand auf einem platten, ganz glatten Steine.
4) Die letzte Urne ist wohl erhalten, 9 1/2 " hoch, hält 10 " in der Oeffnung, 12 " in der Bauchweite und 5 " in der Basis; ihre Gestalt ist ähnlich der im Frid. Franc. Tab. VI, 1 abgebildeten. Darüber war ein überfassender Deckel, einer Schale ähnlich, mit einer Basis, die wie bei gewöhnlichen Flaschen von unten hohl und nach innen erhaben eingedrückt ist. Ueber den fast bis zum Rande der Urne reichenden Knochen


|
Seite 293 |




|
lag in der Mitte ein Ring von sehr heller Bronze, fast 1 " weit, aus dickem Drath, dessen Enden zusammengelöthet sind.
Die gefundenen Alterthümer sind als Geschenk des Herrn Landraths von Blücher auf Kuppentin in die Sammlung des Vereins gegangen.
Ein weiterer Versuch, einen der Sandhügel zu untersuchen, ließ uns im Westen des Begräbnißplatzes, fast in der Mitte der Länge, eine Brandstelle entdecken, die voll Asche, Kohlen und Knochenfragmenten eine Länge von 8 Fuß in der Richtung von Osten nach Westen und eine Breite von 3 bis 4 Fuß hatte; die Steine waren schwarz gebrannt und waren dammförmig gelegt.
Vielleicht dürfte dieser Ort noch künftig manche Ausbeute geben, so wie schon vieles verloren gegangen ist, z. B. eine kupferne Kapsel oder großer Nadelknopf, wie er zu Helm gefunden ist, mit dem lange die Kinder eines Tagelöhners gespielt haben. Für's Erste läßt sich nicht weiter, als etwa in der Nähe der Sandgrube nachsuchen; das Nachgraben aber hält schwer, weil der Sand über den früheren tragbaren Boden bis zu 5 Fuß angehäuft ist.
Vietlübbe, im Mai 1844.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Vietlübbe (Stievendorf).
Auf der südwestlichen Seite von Vietlübbe, auf dem Acker des untergegangenen Dorfes Stievendorf, an der südöstlichen Seite eines vom Dorfe aus sich hinziehenden Hügels wurden auf mehreren Stellen Urnenscherben, wie die Wendenkirchhöfe sie zeigen, von brauner und schwarzer Farbe, gefunden. Da ich zugleich an einigen Stellen Setzungen von Dammsteinen, ähnlich denen auf Wendenkirchhöfen, fand, so ließ ich an zwei verschiedenen Orten nachgraben. Zwar fand ich Urnenscherben genug, auch noch zwischen Steine gepackt Boden von mehreren Urnen, aber der Inhalt war schon mit dem Haken überall zerstreuet und die Urnen zertrümmert. Doch hoffe ich noch an einigen Stellen, die ich augenblicklich der Ackerbestellung wegen nicht untersuchen kann, einige Ausbeute zu erhalten. Der Urboden ist abwechselnd Sand und sandiger Lehm.
Vietlübbe, im August 1844.
J. Ritter.


|
Seite 294 |




|



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof zu Liepen bei Penzlin.
Von dem Herrn Pastor Nahmmacher zu Peccatel darauf aufmerksam gemacht, daß bei dem Dorfe Liepen sich kleine, flache Gräber befänden, aus denen schon hellrothe Scherben bei Anlegung eines Weges zum Vorschein gekommen seien, begaben in seiner Begleitung der Herr von Kardorff auf Remlin und ich uns dahin, bei Gelegenheit der Aufgrabung des großen Kegelgrabes von Peccatel. Die Stelle liegt einige hundert Schritte nördlich vom Dorfe, am östlichen Ufer des Sees, mit einer Abdachung nach Süden. Auf demselben liegen anscheinend flache Kegelgräber, allein sie sind nicht rund und das Ganze hat das Ansehen eines Wendenkirchhofes, welches sich auch dadurch bestätigt, daß zwischen den kreisförmigen Gräbern auch längliche und andere unförmliche Steinlagen sich befinden. Diese Steine liegen hier nicht von Natur, da es ein weicher, fast wehsandartiger Boden ist, ohne Spuren von Gerölle; auch fehlen umher überall Steine. Eine der kreisförmigen Stellen öffneten wir und fanden am südöstlichen Rande neben einander 2 Urnen. Die eine fast erhaltene Urne ist schwarzbraun, 12 1/2 " hoch, 10 " in der Oeffnung, 12 " in der Bauchweite und 4 3/4 " in der Basis haltend. Der Inhalt bestand aus Knochen und schwarzgebrannter Erde nebst Asche. Ueber der Urne war ein schalenförmiger Deckel von röthlicher Farbe, verziert mit sich schräg durchschneidenden Linien, Bändern und einem Henkel. Die daneben stehende Urne war klein, ganz zertrümmert, mit feinen Knochen angefüllt, unter denen eine flache, dünne, runde Scheibe aus Sandstein, mit einem Loche in der Mitte (Spindelstein?), 1 1/8 " im Durchmesser haltend, sich fand. Auffallend war noch, daß die Erde um die Urnen hier mit Branderde und Kohlen angefüllt war. Die Urnen waren bis an den obern Rand in den Urboden eingesenkt, und die Auftragung von Sand und Steinen betrug 2 bis 2 1/2 Fuß.
Ein anderer Wendenkirchhof liegt am Wege von Liepen nach Kl. Vielen links, nicht weit von der Stelle, wo der Weg nach Adamsdorf davon abgeht. Eine Untersuchung war wegen Kürze der Zeit nicht möglich. Der Platz aber trägt den Charakter des Helmer Kirchhofes; besonders sind kleine Steinkreise zu Tage liegend.
Vietlübbe, im Juni 1844.
J. Ritter.


|
Seite 295 |




|



|



|
|
:
|
Wendenbegräbniß von Pleetz.
Auf dem gräflich=hahnschen Gute Pleetz bei
Friedland wurden links hart am Wege vom Hofe
nach der sogenannten Tannenschäferei auf einem
Stücke ebenen, sandigen Ackers beim Sandgraben
ungefähr 4 Fuß tief in einer schwarzen Urne,
welche jedoch zertrümmert war, folgende
Alterthümer gefunden und von dem Herrn
Erblandmarschall Grafen Hahn auf Basedow, Pleetz
 . dem Vereine überwiesen:
. dem Vereine überwiesen:
eine Lanzenspitze aus Eisen;
ein Messer aus Eisen;
ein kleiner Beilhammer aus Eisen, an einem Ende mit einem Hammer, am andern mit einem Querbeile, 4 1/2 " lang und ungefähr 1/2 bis 3/4 " Durchmesser im Quadrat;
eine Heftel aus Bronze von der gewöhnlichen Art der Hefteln der Wendenkirchhöfe, abgebildet Jahrb. IX, S. 343.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendischer Silberschmuck von Schwerin und Remlin.
In Jahrb. IX, S. 388-392 und 460 flgd. sind zwei ganz gleiche Funde von Silberschmuck und Silbermünzen beschrieben und abgebildet, welche nach den Münzen aus der Zeit um das J. 1000 n. Chr. fallen. Ein ganz gleicher Fund ward ungefähr zu gleicher Zeit zu Obrzycko an der Warthe im Oborniker Kreise des Regierungs=Bezirks Posen gemacht und ist beschrieben und abgebildet von Dr. Julius Friedländer: Der Fund von Obrzycko, Silbermünzen aus dem zehnten christlichen Jahrhundert, Berlin, 1844. Aehnliche Funde sind bekanntlich schon früher mehrere Male gemacht. Es läßt sich daher die Verbreitung einer gewissen Art von Silberschmuck zu einer bestimmten Zeit über einen großen Raum verfolgen. Interessant ist, daß zu dem Funde von Obrzycko auch noch der Topf erhalten und a. a. O. abgebildet ist, in welchem der Schatz gefunden ward; es ist ein Topf von 10 " Höhe, welcher "vier kleine Henkel zum Durchziehen von Schnüren" hat, also grade ein solcher Topf, wie einer auf folgender Seite als bei Gnoien gefunden und zum häuslichen Gebrauche bestimmt gewesen, beschrieben ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 296 |




|



|



|
|
:
|
Tragetopf von Gnoien.
Im Torfmoor bei Gnoien ward 8 Fuß tief ein thönernes Gefäß gefunden und von dem Herrn von Kardorff auf Remlin, welcher es durch gütige Vermittelung des Herrn Kämmerei=Berechners Francke zu Gnoien erhalten hatte, dem Verein geschenkt. Dieses Gefäß ist im hohen Grade interessant, weil es keine Todtenurne ist, sondern ein zum häuslichen Gebrauche bestimmtes Gefäß; Gefäße der letztern Art aus dem Heidenthume gehören aber zu den allerseltensten Alterthümern. Daß es nicht, wie fast alle aus heidnischer Zeit stammenden Gefäße, zum Todten=Cultus gebraucht ward, beweiset nicht allein die Auffindung im Torfmoor, sondern auch Gestalt und Beschaffenheit. Das Gefäß, welches 10 " hoch ist und 10 " im Bauchdurchmesser mißt, hat nämlich eine unten abgeplattete, eiförmige Gestalt und einen eingezogenen, 2 1/2 " hohen und 6 " weiten Hals; auf dem Obertheile des Bauchrandes stehen entgegengesetzt je 2 und 2, also 4 starke, mit 2 Stützen aufgesetzte Knoten, durch welche ein ziemlich großes Loch gebohrt ist, um eine starke Schnur durchziehen zu können; und wirklich sollen beim Auffinden noch Fäden einer Schnur (eines Seils) in den Löchern gehangen haben. Das Gefäß ist also zum Tragen von Flüssigkeiten bestimmt gewesen und die älteste Form von dem, was noch heute in Meklenburg ein Seiltopf (sêlpott) genannt wird. Die Form des Gefäßes ist übrigens schön; die Farbe desselben ist schwarz und über jedem Knopfe ist eine viereckige Gruppe von 9 runden Löchern zur Verzierung eingeschnitten. Daß das Gefäß aus dem Heidenthume stammt, beweisen nicht allein Form und Einrichtung, sondern auch die Masse, welche stark mit zerstampftem Granit und Glimmerfünkchen durchknetet ist. Das Gefäß hat Aehnlichkeit mit den zu Böhlendorf in einem Moraste gefundenen Gefäßen (vgl. Jahresbericht VIII, S. 56) und dem zu Obrzycko mit Silbergeräth angefüllten Topfe (vgl. vorhergehende Seite).
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Urnen vom Mörderberge bei Neubrandenburg.
Auf dem Mörderberge in der Nähe der Krappmühle bei Neubrandenburg wurden bei einer Nachgrabung viele Scheren von heidnischen Urnen gefunden, welche offenbar Mäntel oder Umkleidungen hatten. Diese Urnenmäntel sind 3/4 " dicke, sehr leicht und hellklingend gebrannte oder vielmehr durchbrannte, ganz roh geformte Bildungen von der gewöhnlichen Masse der Urnen. Einige Stücke verdankt der Verein der Güte des Herrn Pastors Boll zu Neubrandenburg.


|
Seite 297 |




|



|



|
|
:
|
e. Vorchristliche Alterthümer auswärtiger Völker.
Römische Thonmaske von Friedrichsdorf
bei Bukow.Zu Friedrichsdorf bei Bukow, Pfarre Drevskirchen, ward in einer Mergelgrube ein merkwürdiges Thongebilde gefunden und dem Vereine von dem Herrn Hülfsprediger Born zu Neukloster geschenkt, welcher es von dem Besitzer des Gutes, Herrn Koch, geschenkt erhalten hatte. Auf angestellte weitere Forschungen hat auch Herr Koch gütigst berichtet, daß die Terracotta in einer Mergelgrube zu Friedrichsdorf, etwa eine Stunde vom Strande der Ostsee, von einem Tagelöhner gefunden sei. Der Fund ist also sicher constatirt.
Die Terracotta ist ein Reliefgesicht aus gebranntem, röthlichen Thon, unten abgebrochen und grade bis unter das Kinn reichend. Das Ganze ist 1 3/4 " hoch. Das Gesicht, gut 1 " hoch, ist ein fein gearbeitetes Mädchengesicht, mit jugendlichen, runden, heitern und kräftigen Zügen, auf dessen Stirn horizontal und an dessen Schläfen hinab ein faltiger Schleier liegt. Das Haupt umgiebt ganz, gegen 3/4 " breit, eine Bildung, wie eine Glorie, von 4 parallel laufenden, erhabenen Zickzacklinien.
Die Erklärung des Ursprunges und der Bedeutung dieser seltenen und schönen Terracotta ist äußerst schwierig. Es sind kundigen Kreisen in Berlin Gipsabgüsse vorgelegt, ohne jedoch eine bestimmte Ansicht oder auch nur eine Andeutung über die Heimath gewinnen zu können. Im königlichen Antiquarium zu Berlin befinden sich einige ähnliche Bildungen, namentlich eine, welche in Panofka Terracotten des königlichen Museums zu Berlin, Taf. 62, Nr. 3, abgebildet ist; aber Panofka giebt auch keine Auskunft und räth auf eine Meduse oder Selene, freilich ohne Begründung und Wahrscheinlichkeit, um so weniger, da auf dem berliner Kopfe die Hauptumgebung wirklich wellenförmig, nicht gezackt ist. Am meisten scheint die Ansicht des Herrn Dr. B. Köhne zuzutreffen, nachdem er im Herbste 1844 von einer Reise nach Italien heimgekehrt war; dieser schreibt: "Mittelalterlich ist der Kopf nicht; dagegen spricht sein Styl durchaus. Römisch ist der Kopf aber auch nicht; dafür ist der Styl zu strenge. Ich finde den Kopf sehr ähnlich den Bildungen griechischer Terrakotten der mittelitalienischen Niederlassungen. Namentlich habe ich gesehen und besitze selbst verschiedene im alten Pästum gefundene Terracotten ganz desselben Styls und möchte ich den


|
Seite 298 |




|
in Meklenburg gefundenen Kopf für ein Werk der unter griechischem Einfluß ausgebildeten Kunst der in der Gegend Campaniens wohnenden sabellischen Völker halten; namentlich hat eine meiner Terracottenfiguren fast genau denselben Ausdruck. Die Verzierung, welche den Kopf umgiebt, ist sehr sonderbar: sie scheint aus Strahlen zu bestehen; jedoch scheint mir der Kopf ein weiblicher, kein Helios zu sein. Die Verzierung scheint mir hier zum Kopfputze zu gehören und ist vielleicht ein mit Tänien (Haarbinden) verzierter Kalathos (Kopfaufsatz aus Flechtwerk), welcher ohne Bänder häufig die Köpfe der pästanischen Terracotten schmückt. Denn für den pästanischen Ursprung dieses interessanten Stückes möchte ich mich auch ferner erklären. Die Frage, wie dieses Stück nach Meklenburg gekommen, ist nicht schwer zu beantworten. Pästum, am Meere gelegen, verdankte seinen alten Reichthum seinen Handelsverbindungen. Pästanische Kaufleute können zur Ostsee gekommen sein, und sollte es mich wundern, wenn Meklenburg nicht noch mehr Stücke besäße, in denen sich pästanischer Ursprung wieder erkennen läßt. Unser Kopf ist zwischen 250 und 150 v. Chr. angefertigt."
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Römische Münzen.
Von dem Herrn Dr. Jenning zu Stavenhagen ist dem Vereine ein römischer Denar geschenkt, welcher im J. 1844 in der Kirche zu Gr. Varchow in den Klingebeutel geworfen, also muthmaßlich daselbst gefunden ist:
| Av. | Links gekehrter Kopf; Umschrift: |
| Rev. | Rechts gekehrte, stehende Figur mit einem Zweige in der ausgestreckten rechten Hand und einem Füllhorn im linken Arme; Umschrift: |
Die Silbermünze ist also von dem Kaiser Marcus Aurelius vom J. 145.
Zu Bössow bei Grevismühlen ward ein römischer Denar auf den Kaiser Antoninus Pius vom J. 161 gefunden:


|
Seite 299 |




|



|



|
|
|
2. Mittelalter.
Mittelalterliche Alterthümer von Mühlengeetz.
Der Herr von Zülow zu Bülow bei Güstrow hat dem Vereine nachstehende Alterthümer übersandt, welche zu Mühlengeetz in einem Moore, Namens Sumpfsee, gefunden sind:
einen Schädel von einem Thiere (Wolf oder Hund), welcher in der Mitte von 3 Menschengerippen lag, zwei Sicheln von Eisen und
einen sogenannten Hechtstecher von Eisen.
Von dem Herrn von Zülow aufmerksam gemacht, untersuchte der Herr Dr. Schnelle auf der Hufe des Bauern Schwarz zu Mühlengeetz eine im Mittelalter bewohnt gewesene Stelle und erstattete über dieselbe nachstehenden Bericht, unter Einreichung von Proben von Alterthümern. Auf der Hufe befand sich ein kleiner Hügel, der auf seiner Abdachung gegen Osten auf einem Raume von einigen Quadratruthen eine Menge von Scherben enthielt, welche dort bis einen Fuß tief liegen. Alle Scherben stammen von den bekannten großen, bläulich schwarzen, festen Henkelkrügen des Mittelalters und bestehen aus Wandscherben, Beinen und Henkeln; auch fand sich eine durchbohrte und am Rande zugeschärfte Scheibe aus derselben Thonmasse der Töpfe, wie sich solche Scheiben schon mehrere Male an mittelalterlichen Wohnstätten gefunden haben; wahrscheinlich sind es Netzsenker.
Die Taufbecken
von Messing, mit den viel besprochenen "räthselhaften" Inschriften sind in Jahrb. II, S. 78, III, S. 86 und V, S. 93 Gegenstand der Untersuchung gewesen. Es ist namentlich Jahrb. III, S. 87 des Umstandes erwähnt, daß sich an manchen Orten sehr viele Becken dieser Art finden. Dieser Umstand läßt sich mit einer sehr interessanten Thatsache vermehren. In dem sogenannten Krusen=Convent, einem im 13. Jahrhundert von einem Bürger Kruse gestifteten Armenhause (domus baginarum Crispi oder conventus Crispi=Kruse, d. i. Krause), wie Lübeck solcher Wohlthätigkeitsanstalten sehr viele hat, wird eine ganze, große Lade voll solcher Becken, unter denen viele mit der "räthselhaften" Inschrift, aufbewahrt; auch finden sich noch an anderen Orten diese Becken. Es geht daraus wohl hervor, daß die Becken im Allgemeinen nichts weiter waren, als überhaupt - Schüsseln, deren man sich sowohl zum häuslichen Gebrauche, als auch zu Taufbecken bediente.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 300 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Baukunde.
1. Mittelalter.
a. Weltliche Bauwerke.
Burgwall von Weisdin bei Neu=Strelitz.
Außer den jetzt noch bebaueten mittelalterlichen
Burgwällen bei den Orten Stargard, Prillwitz,
Wesenberg (wo noch eine Thurmruine steht).
Fürstenberg, Feldberg (vgl. Jahresber. III, S.
185), Alt=Strelitz
 . giebt es im Lande Stargard nicht
viele Burgwälle aus dem Mittelalter. Einer der
bedeutendsten, vielleicht der bedeutendste im
Lande ist der Burgwall von Weisdin. Er liegt dem
jetzigen Hofe von Weisdin gegenüber, am andern
Ufer des kleinen Sees, an dem der Hof liegt. Er
ist mit hohen Buchen bewachsen und von der
Chaussee von Neu=Brandenburg nach Neu=Strelitz
klar zu erkennen. Er ist ungefähr 60 Fuß hoch,
mit sehr steilen Seiten und hat oben am Umring
ungefähr 200 Schritt und unten am Fuße ungefähr
380 Schritt Umfang. Dann folgt am Fuße ein
Graben, dann ein Wall, welcher sich an eine
Wiesenniederung am See lehnt. - Oben stehen noch
die Fundamente und das Souterrain eines alten
Thurmes, aus Feld= und Mauersteinen mit Kalk,
Asche und Kohlen gemauert.
. giebt es im Lande Stargard nicht
viele Burgwälle aus dem Mittelalter. Einer der
bedeutendsten, vielleicht der bedeutendste im
Lande ist der Burgwall von Weisdin. Er liegt dem
jetzigen Hofe von Weisdin gegenüber, am andern
Ufer des kleinen Sees, an dem der Hof liegt. Er
ist mit hohen Buchen bewachsen und von der
Chaussee von Neu=Brandenburg nach Neu=Strelitz
klar zu erkennen. Er ist ungefähr 60 Fuß hoch,
mit sehr steilen Seiten und hat oben am Umring
ungefähr 200 Schritt und unten am Fuße ungefähr
380 Schritt Umfang. Dann folgt am Fuße ein
Graben, dann ein Wall, welcher sich an eine
Wiesenniederung am See lehnt. - Oben stehen noch
die Fundamente und das Souterrain eines alten
Thurmes, aus Feld= und Mauersteinen mit Kalk,
Asche und Kohlen gemauert.
Dieser alte Burgwall war, wie Prillwitz, ein Hauptsitz der Ritter von Peccatel.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
b. Kirchliche Bauwerke.
Die Kirche zu Klütz.
Jahresber. VIII, S. 139 flgd. ist die Kirche zu Klütz als ein durch die Unbill jüngerer Zeiten verunstalteter Bau aus der Zeit des Rundbogenstyls in die Geschichte der Baukunst Meklenburgs eingeführt. Leider muß diese Kirche aus der Zahl der Rundbogenkirchen wieder ausscheiden. Der Herr Professor


|
Seite 301 |




|
Dr. Crain zu Wismar, welcher die Kirche gleich nach mir besah, äußerte sogleich gegründete Zweifel gegen das behauptete hohe Alter der Wölbung und der Kirche überhaupt und erklärte die Wölbung des Schiffes für ein Werk der neuesten Zeiten; eben so äußerte sich der Herr Bau=Conducteur Thormann zu Wismar, welcher ebenfalls die Kirche später untersuchte. Nachdem ich im Sommer 1844 die Kirche mit dem Herrn Professor Dr. Crain noch einmal einer Prüfung unterworfen habe, muß ich die a. a. O. aufgestellten Behauptungen zurücknehmen.
Zwar ist das Schiff ganz im Rundbogenstyl gewölbt und auch die Pfeiler stehen im Einklange zu der Wölbung, so daß das Ganze auf den ersten Blick als ein byzantinischer Bau aus dem 12. Jahrhundert erscheinen kann. Bei näherer Betrachtung schwindet aber der Schein und es wird bald zur Gewißheit, daß die Wölbung des Schiffes ganz jungen Ursprunges sei.
Die ganze Kirche ist nämlich ein Bau aus der Zeit des Uebergangsstyls mit starken Anklängen an den Rundbogenstyl. Der sehr gut gebauete Chor hat schräge eingehende, nicht gegliederte, leise gespitzte Fenster, eine eben so construirte Pforte und einen Fries von Halbkreisen, welche sich auch sonst noch als Verzierungen an den Seitenwänden finden; die Wölbung aus alten, großen Ziegeln stammt wahrscheinlich aus der Zeit der Erbauung der Kirche. - Das Schiff war ungefähr in gleichem Style erbauet. Es hat Pforten aus der Zeit des Uebergangsstyls und Reste eines Rundbogenfrieses an der Nordwand; die Fenster, von denen in derselben Wand noch zwei stehen, waren jedoch Doppelfenster, welche durch eine Säule von Ziegeln mit einem kleinen Kapitäle aus Ziegelstein geschieden sind: ein Doppelfenster ist im Rundbogen, das andere im Uebergangsspitzbogen gewölbt, jenes mit einer spitzbogigen, dieses mit einer rundbogigen Mauernische, also grade entgegengesetzt, eingesetzt, so daß man bei den Restaurirungen aus verschiedenen Zeiten nicht bestimmen kann, welcher Baustil eigentlich vorwaltet.
So viel ist aber außer Zweifel, daß das Schiff ebenfalls im Uebergangsstyle, entweder zugleich mit oder bald nach dem Chore, und zwar wohl bald nach der Kirche zu Grevismühlen (vgl. Jahresber. VIII, S. 142 flgd.), vielleicht von demselben Baumeister, erbauet ist.
Die ganze Nordseite des Schiffes ist im spätern Mittelalter, etwa um das Jahr 1400 ganz und im Style des ausgebildeten Spitzbogens mit weiten Fenstern umgebaut und trägt keine Spur des alten Baues. Wahrscheinlich ward um diese Zeit die Kirche auch zuerst oder auch neu gewölbt.


|
Seite 302 |




|
Die jetzige Wölbung im Rundbogenstyl ist aber in den neuern Zeiten ausgeführt, wie im mittlern Deutschland im Anfange des vorigen Jahrhunderts, bei dem Vorwalten des Rundbogens des französischen "Rococostyls" im Prachtbau und in Schmucksachen, oft Kirchen im Rundbogen gewölbt wurden. Darauf deuten schon im Innern die inwendig oben unfertig verkürzten und überdachten alten Fenster. Der sichere Beweis liegt aber oberhalb des Gewölbes, indem hier die alten, weiten Fensternischen und die frühern Gewölbeansätze bedeutend über das jüngere Gewölbe hinausreichen. Auch deuten auf einen jüngern Bau schon die kleinen Steine und der sorgsame Abputz des Gewölbes. Diese Ansicht wird durch die im großherzoglichen Archive aufgefundenen Nachrichten unwiderleglich bestärkt, indem aus den Acten hervorgeht, daß die neue Wölbung im Rundbogenstyl in der Zeit vom März bis August 1701 ausgeführt ist 1 ).
In der letzten Zeit, 1843/4, ist das Mobiliar der Kirche ganz neu hergestellt; bei dieser Gelegenheit sind die viereckigen Pfeiler abgerundet und die in Jahrb. VIII, S. 142 erwähnten alten Kirchenstühle mit den Wappen verkauft und untergegangen, dagegen unter dem alten Gestühle zwei von plessensche Leichensteine aus dem 16. Jahrhundert aufgefunden, welche an der südlichen Wand ausgerichtet sind.
Der ursprüngliche Bau stammt also ganz aus der Uebergangsperiode. Dagegen sind bei der Beurtheilung des Baues 3 Restaurationen: von ungefähr 1400, von 1701 und von 1844, zu berücksichtigen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Bützow.
Die Kirche des ehemaligen bischöflich=schwerinschen Collegiatstifts zu Bützow ist als ein ausgezeichnetes Bauwerk schon in Jahresber. III, S. 137 und 162 flgd. und Jahrb. VIII, S. 1 flgd. zur Sprache gebracht, hat auch sonst in architectonischer
Am 9. Aug. 1701 war die Wölbung vollendet, indem der Prediger bekannt machte, daß die Stühle wieder in die Kirche gesetzt werden könnten."Daß die H. Patronen der Kluetzer Kirche nächstverwichenen Sonntag von der Kanzel publiciren lassen, daß sie gesonnen, selbige Kirche zu bauen oder gewölben zu lassen, als würden alle Eingepfarrte damit zu wissen gemacht, daß sie ihre Stühle aus der Kirche schaffeten".


|
Seite 303 |




|
Hinsicht so viel Aufmerksamkeit erregt, daß sie die genauere Prüfung verdient, welcher sie wiederholt unterworfen ist. Hiezu forderte besonders eine glückliche Entdeckung, nämlich die Entdeckung einer oben Nr. XIV, S. 226, abgedruckten Urkunde vom 26. Aug. 1364 auf, in welcher ausdrücklich von der Erbauung eines neuen Chores die Rede ist. Hiedurch aufmerksam gemacht, mußte das in Jahresber. III, S. 165 angeführte von bülowsche Wappen an der Außenwand des Chors eine strengere Beobachtung veranlassen, welche Aussicht zur Gewinnung anderweitiger Ergebnisse verhieß.
Die Stadt Bützow stand schon vor dem Jahre 1229 und hatte natürlich seit der Erbauung eine Kirche (vgl. Jahrb. VIII, S. 5). Das Dom=Collegiat=Stift ward im J. 1248 gegründet. Der jetzt stehende hohe Chor ward nach der Urkunde vom 26. Aug. 1364 gegründet und in der nächsten Zeit darauf erbauet. Hiernach ist auch die Kirche zu Bützow, wie sie jetzt steht, aus drei zu vermiedenen Zeiten gebaueten Theilen zusammengesetzt. Die Kirche besteht aus Chor, Schiff und Thurm; das Schiff besteht aber offenbar aus zwei zu verschiedenen Zeiten erbaueten Theilen, aus dem zunächst an den Chor grenzenden mittlern Theile und dem westlichen Theile mit dem Thurme.
Der dem Chore zunächst liegende östliche Theil des Schiffes ist ohne Zweifel der älteste Theil der Kirche, und zwar der Chor der alten Kirche oder der alte Chor. Der Raum ist zwei Gewölbe groß. Die Gestalt der alten Kirche muß eine ganz andere gewesen sein. Die Pfeiler der frühern Kirche stehen noch: sie sind nur halb so hoch, als die jetzige Kirche. In der Mitte der Höhe der Kirche stehen noch die Kapitäler der alten Pfeiler, schön mit Weinlaub verziert. Als der westliche Theil des Schiffes in viel höherm Maaßstabe angelegt ward, wurden diese Pfeiler erhöhet und auf die Kapitäler sehr rohe Verlängerungen aus schlichtem Mauerwerk aufgesetzt, um die Gewölbe zu tragen. Der alte Scheidebogen steht noch jetzt an der westlichen Grenze dieses alten Chors, jetzt innerhalb des Schiffes. Auch von außen ist dieser Theil der Kirche als der älteste zu erkennen. Er hat noch nicht die dem Spitzbogenstyl eigenthümlichen Strebepfeiler. Die äußerst niedrige, im strengen Spitzbogenstyl aufgeführte Pforte in diesem Theile des Schiffes ist freilich durch Aufschüttung des Kirchhofes etwas in die Tiefe gebracht; aber sie ist auch an und für sich niedrig und stimmt ganz zu der ursprünglichen Höhe des alten Chors, ist auch ebenso mit Weinlaub verziert, wie die Kapitaler im Innern. Dieser ehemalige alte Chor stammt also ohne Zweifel


|
Seite 304 |




|
aus der Zeit der Gründung der Kirche und der Stadt, aus dem ersten Viertheil des 13. Jahrhunderts.
An den alten Chor schließt sich im Westen das alte Schiff von 3 Gewölben Länge oder jetzt der westlich e Theil de s Schiffes. In diesem ruhen die Gewölbe auf zierlichen Säulenbündeln mit Kapitälern aus allerlei humoristischen Menschen= und Thier=Gestalten. Dieser Theil der Kirche, mit einer höhern, schlanken Pforte und mit Strebepfeilern, ist ohne Zweifel in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, zugleich mit dem Thurme, erbauet und bei der Stiftung des Dom=Collegiat=Stifts im J. 1248 gegründet.
Der jetzt stehende Chor aber ist kurz vor dem J. 1364 gegründet und in der Zeit von 1365-1375 vollendet. Man sicht von außen und innen sehr deutlich die Anfügung. Der ganze Bau ist auch in einem ganz andern Style gehalten, als die übrigen Theile der Kirche. Der innere Chor ist von einem Gewölbe überdeckt, welches hohe, schlanke Pfeiler halten; der Umgang hinter demselben ist aber zu 3 großen Kapellen weit über die Ringmauern der Kirche hinausgerückt. Im Aeußern trägt dieser Bau ganz den Charakter der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wie die Kirchen der wendischen Hansestädte, etwa wie die Marien=Kirche zu Rostock. Das Mauerwerk ist glatt und tüchtig und zierlich; die vielen Strebepfeiler sind gut geordnet; die Gesimse haben durchbrochene Ziegelarbeit; die weiten Fenster sind hoch und schlank. Besonders charakteristisch ist es für große Chorbauten aus dieser Zeit, daß oft enge Winkel zwischen nahe stehenden Strebepfeilern an der Außenseite überwölbt sind. Ueberdies wird der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ausgeführte Bau noch durch eine besondere Urkunde verbürgt. Die oben angeführte Urkunde vom 26. Aug. 1364 sagt ausdrücklich, daß der Senior Dietrich von Bülow und das Capitel des Collegiatstiftes Bützow dem Thesaurarius des schweriner Doms, Vicke von Bülow, dem nachmaligen Bischofe Friederich II. von Bülow, welcher schon 1363 vom Dom=Capitel gewählt war, wegen seiner Verdienste um das Stift Bützow, und nachfolgend allen und jeden aus dem Geschlechte von Bülow
den obern, östlichen Theil des neuen Chores der Kirche zu Bützow, in welchem der Bau einer Capelle begonnen und ein Altar errichtet war,
(locum superiorem novi chori in parte orientali in summo, in quo jam inceptum est capellae aedificium et altere erectum)


|
Seite 305 |




|
mit 2 dazu gestifteten Vicareien verleihen Im J. 1364 war also der Bau noch nicht vollendet, der unter dem bützowschen Senior Dietrich von Bülow und unter dem schwerinschen Thesaurarius Vicke, dem nachmaligen Bischofe Friederich von Bülow begonnen war. In der Zeit von 1365 bis 1375 war dieser Friederich von Bülow Bischof zu Schwerin; nach langen und harten Leiden, welche das Bisthum Schwerin, vorzüglich in Folge der Regierung der von Bülow, fast ein Jahrhundert hindurch erduldet hatte, ward es durch den Bischof Friederich von Bülow und seine Verwandten in kurzer Zeit wieder gehoben und zur Blüthe gebracht. Man findet daher überall Spuren von einer angestrengten, tüchtigen Thätigkeit aus der Zeit des Regiments dieses Bischofes, welcher in mancher Hinsicht eine bedeutende Person in der Geschichte unsers Vaterlandes ist. Unter ihm ist der neue Chor der bützowschen Kirche vollendet und geweihet; denn nicht an einem Pfeiler, sondern an allen 5 Pfeilern des neuen Chors ist an der Außenseite das von bülowsche Wappen angebracht welches ohne Zweifel die Vollendung durch einen Bischof von Schwerin aus dem Hause von Bülow bezeichnet; der letzte Bischof aus diesem Haufe und zugleich der erste, welcher sein Familienwappen in Amtsgeschäften geltend machte (vgl. Jahrb. VIII, S. 18), war aber Friederich II., 1365-1375. Die Strebepfeiler an der Verbindung des alten und des neuen Chors haben kein Wappen, weil sie nicht allein den neuen Bau berühren.
Die Kirche zu Bützow ist dem Dom zu Lübeck in der Geschichte des Baues am ähnlichsten. Der Dom zu Lübeck ist bekanntlich eine Stiftung des 12. Jahrhunderts. Von dem alten Gebäude steht aber nur noch das Schiff im Rundbogenstyl mit seinen alten Gewölben und vielleicht das Thurmgebäude; die Seitenschiffe sind schon jünger. Der Chor ist der jüngste Theil und dadurch für die Geschichte der Baukunst wichtig, daß er dem Chor der Kirche zu Bützow auffallend gleich und in einer historisch zu bestimmenden Zeit erbauet, nämlich von dem Bischofe Heinrich von Bokholt (1317-1341) gebauet und ungefähr im J. 1335 vollendet ist. Seine Grabschrift auf dem aus Erz gegossenen Leichensteine mit seiner liegenden Bildsäule im Chore des Domes, deren so wie der folgenden Nachrichten Mitteilung ich dem Herrn Dr. Deecke zu Lübeck verdanke, sagt dies ausdrücklich:
Anno domini MCCCXLI, kalendis Marcii, obiit dominus Hinricus cognominatus de Bocholte, huius ecclesie episcopus duodecimus. Orate


|
Seite 306 |




|
pro eo dominum Jhesum Christum. Iste fuit magister in artibus et in medicina, deinde huius ecclesie decanus, postea prepositus, ad ultimum episcopus, qui fecit construi hunc chorum et instauravit tres prebendas et sex vicarias in ista ecclesia multisque redditibus et bonis ditavit eandem, quam eciam in episcopatu rexit fere viginti quatuor annis.
Man vgl. dazu Alberti Krummendyk chron. ep. Lub. bei Meibom Script. Germ. II, p. 398; Alb. Krantz Metrop. IX, c. 13, p. 243; des Minoriten=Lesemeisters Chronik zum J. 1341. Besonders sagt der "Codex Eglensis" (vgl. Archiv für Staats= und Kirchengeschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein, Lauenburg, II, S. 253 flgd.):
Item anno episcopatus sui XIII, cum dictus episcopus vidisset opus chori ecclesie sue maioris circa sexaginta annos inceptum et omni spe perfectionis seu consummacionis destitutum, confidens de adiutorio diuino, operarios conduxit et dictum opus anno pontificatus sui XVIII cum ambone, fenestris, pauimento, sedilibus et aliis necessariis consummavit, cui operi impendit vltra duo milia marcarum et quadringentas marcas denariorum lubicensium, ac in circuitu eiusdem chori noui fundauit vnam prebendam etc.
Sind diese Beobachtungen schon für die Geschichte der Kirche zu Bützow interessant, so führen sie doch noch weiter und gestatten Schlüsse auf andere wichtige Bauwerke, namentlich auf den Dom zu Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Der Dom zu Schwerin.
Der älteste Dom des Bisthums Schwerin steht nicht mehr. Die jetzt noch stehende Kirche soll am St. Veits=Tage 1248 geweihet (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 93) und seit dem J. 1222 durch die dem Heil. Blut gebrachten Opfer gegründet sein. In Jahrb. VIII, S. 29, Anm., ist nachgewiesen, daß das Thurmgebäude einen alten Bau aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts enthält, der mit in die neue Kirche aufgenommen ist. Aber auch das jetzt stehende eigentliche Kirchengebäude kann nicht ganz aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts stammen, also nicht im J. 1248 als fertig geworden


|
Seite 307 |




|
geweiht sein; der Styl der Kirche ist in vielen Theilen der vollkommen ausgebildete, hohe Spitzbogenstyl des 14. Jahrhunderts, während in Meklenburg in der ersten Hälfte des 13. Jahrh. der niedrige Uebergangsstyl mit den schmalen Fenstern herrschte. Es soll zwar nicht behauptet werden, daß die Kirche eines reichen Bisthums im Anfange des Spitzbogenstyls nicht in einem großen Maaßstabe angelegt worden sei; aber was von der Kirche im J. 1248 geweihet ward, war gewiß noch nicht viel. Als alt erscheinen nur die obern Fenster des hohen Chors mit ihren einfachen, weiten Bogen; die obern Fenster des Schiffes stehen nicht mehr in ihrer Reinheit da, indem sie, wahrscheinlich bei der Ueberwölbung des Schiffes durch die Stralsunder, welche sie zur Lösung vom Banne ausführen mußten, im 15. Jahrh. in einem Dreieck mit graden Linien überdacht sind. Die Seitenschiffe mit dem Umgange hinter dem Altare sind aber mehr als wahrscheinlich erst im 14. Jahrhundert gebauet und unter dem Bischofe Friederich II. von Bülow, 1365-1375, vollendet und geweihet worden. Hiefür redet nicht nur der Styl der Pforten, Fenster und Pfeiler, welche durchaus den Charakter des 14. Jahrhunderts tragen, sondern auch dieselben, an den beiden südlichen Pforten marktwärts angebrachten Wappenschilde des Bischofs Friederich II. (vgl. oben S. 306 und Jahrb. VIII, S. 19-20), welche an dem aus der Zeit dieses Bischofs stammenden neuen Chor der Kirche zu Bützow befestigt sind und ohne Zweifel die Zeit der Vollendung des Baues bezeichnen. Daher kam es auch, daß der älteste Theil des Kreuzganges, das Refektorium, das die jetzigen Lehrzimmer des Gymnasiums enthält, erst im J. 1392 an die Kirche angebauet werden konnte.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Eldena.
In der Zeit 1230-1235 ward zu Eldena ein Cistercienser=Nonnen=Kloster gegründet. Ein großer Brand verzehrte im J. 1290 Kirche, Kloster, alle Wirthschaftsgebäude und alle Urkunden (vgl. Rudloff Urk. Lief. Nr. LI). Im J. 1514 am Sonntage Esto mihi brannte wieder das eigentliche Klostergebäude (grôt slâphûs) ab. In den neuern Zeiten ward am 9. Aug. 1835 der Ort wieder von einer bedeutenden Feuersbrunst heimgesucht, in welcher wiederum die Kirche ganz ausbrannte.


|
Seite 308 |




|
Von dem Kloster ist auch nicht die geringste Spur mehr zu finden.
Die Kirche ist im Innern durchaus neu; kein Leichenstein, kein einziges altes Geräth oder Ornament zeugt von alter Zeit. Der Thurm ist in den letzten Jahren nach dem letzten Brande neu aufgeführt. Die Ringmauern der Kirche sind jedoch ohne Zweifel die ursprünglichen aus der Zeit der Gründung des Klosters, und die Kirche ist sowohl 1290, als 1835 nur ausgebrannt. Die Kirche ist ein nicht großes, einfaches Oblongum, welches im Osten dreiseitig abgekantet ist, ohne Seiten= und Kreuzschiffe, ohne besondere Altartribune und hohen Chor, ohne Anbaue. Das Material besteht aus sehr großen, festen Ziegeln. Der Styl fällt in die allererste Zeit des Spitzbogenstyls; die Fenster sind schon weit und spitzbogig, jedoch noch nicht schön und kühn. An den Rundbogenstyl erinnert noch der eigenthümliche Fries, welcher aus sich durchschneidenden Halbkreisen besteht; jedoch ist dieses Ornament sehr groß, viel größer, als gewöhnlich, und es sind die Halbkreise nicht aus geformten Reliefs zusammengesetzt, sondern durch gewöhnliche hervorstehende Mauersteine gebildet. Dies ist das einzige Bemerkenswerthe an der Kirche für die Geschichte der Baukunst und des Klosters.
Der Kreuzgang stand nach den Spuren von angelehnten Gebäuden und vermauerten Eingängen an der Südseite der Kirche.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Satow
und
der Uebergangsstyl.
Satow hatte im Mittelalter eine gewisse Wichtigkeit, da es seit früher Zeit dem Kloster Amelungsborn gehörte, dessen Mönche die Abtei Doberan stifteten und dessen Abt Oberaufseher, Vater und Visitator, des Klosters Doberan war und blieb; es war daher das ganze Mittelalter hindurch ein Klosterhof, eine Art Kloster, zu Satow, wo auch die Landesherren oft Ablager hielten. Von diesem Klosterhofe ist keine Spur mehr vorhanden; die prachtvolle, reiche Gegend aber, über welche man namentlich von dem Pfarrhofe aus eine weite Aussicht genießt, zeugt von der richtigen Einsicht der amelungsborner Mönche, sich einen ergiebigen, schönen Boden zu wählen.


|
Seite 309 |




|
Die Kirche, der einzige Ueberrest aus alter Zeit, ist, wider Erwarten, nicht bedeutend und gehört der Zeit an, in welcher Satow cultivirt ward: sie ist nur klein und im Uebergangsstyle erbauet. Jedoch hat der Bau derselben einige wichtige Merkwürdigkeiten für die Kunstgeschichte des Vaterlandes. Der Chor ist mit Einem Gewölbe bedeckt. Die Fenster des Chors sind, nicht zum Vorteil, sehr verbauet. Nach einigen, im Innern der Kirche zu erkennenden Ueberresten hatte der Chor ursprünglich Rundbogenfenster. Das südliche Fenster ist ein hübsches, kurzes Fensterpaar, durch eine Säule mit einem Kapitäl geteilt, auf welcher die im Rundbogen gewölbten Fensterbogen ruhen. An die Nordseite des Chors stößt eine gewölbte Sacristei. - Das Schiff hat 2 Gewölbe und unter jedem 3 schmale, schräg eingehende, leise gespitzte Fenster im Uebergangsstyl. Jedes Gewölbe ist nicht durch einen Stein, sondern durch einen großen Reliefkreis von einigen Fuß Durchmesser geschlossen; von diesem kreisförmigen Gewölbeschluß laufen 8 Rippen hinab. Hiernach stimmt die Kirche zu Satow durchaus mit den Kirchen in der Mitte des Landes von Satow bis Güstrow und Schwan überein, namentlich, so viel bis jetzt bekannt ist, mit den Kirchen zu Neuenkirchen, Gägelow, Ruchow, Witzin, Lüssow, Cambs, Großen=Grenz, Hohen=Sprenz, Güstrow und Schwan (vgl. Jahresber. VI, S. 87 flgd.; VII, S. 74; VIII, S. 97 flgd. u. 101). Die Kirche zu Satow hat jedoch noch eine Eigenthümlichkeit. Die Pforten der Kreuzschiffe des Doms zu Güstrow, der im J. 1226 gegründet ward, sind ganz eigenthümlich: die nördliche Pforte ist noch im Rundbogenstyl erbauet, die südliche Pforte aber ist schon spitzbogig, jedoch noch sehr eigenthümlich und im Uebergangsstyl; außerdem hat diese südliche Pforte ganz eigenthümliche Verzierungen, indem in der Zusammenfügung und in der Mitte der Kreissegmente der Wulste, welche die Pforte verzieren, in der Richtung des Mittelpunctes zugespitzte Scheiben in rechtwinkliger Stellung angebracht sind (vgl. Jahresber. VIII, S. 99). Ganz dieselbe Pforte mit 3 Wülsten, jeden mit 3 Scheiben, hat die Kirche zu Satow und es ist durch dieselbe der Schluß gestattet, daß beide Kirchen denselben Baumeister hatten und dieser entweder von dem Kloster Amelungsborn (zu Satow) oder aus dem Bisthume Hildesheim nach welchem das Dom=Capitel zu Güstrow eingerichtet ward, gekommen war.
Vor der Kirche liegt ein großer behauener Taufstein aus Granit


|
Seite 310 |




|
Von den Glocken ist die mittlere alt; sie stammt nach der Umschrift:
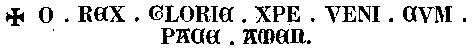
aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Neuenkirchen bei Schwan.
ist ein alter, tüchtiger Bau aus Granit, mit den
Oeffnungen und Gliederungen aus Ziegeln; an den
Pforten, Ecken
 . sind die Granitquadern
regelmäßig behauen und geebnet. Die Kirche
besteht aus einem Chor mit einem Gewölbe, einem
Schiffe von zwei Gewölben und einem Thurmgebäude.
. sind die Granitquadern
regelmäßig behauen und geebnet. Die Kirche
besteht aus einem Chor mit einem Gewölbe, einem
Schiffe von zwei Gewölben und einem Thurmgebäude.
Der Chor hat an jeder Seite 2 schmale Fenster (oder ein Fensterpaar), welche alle rund gewölbt sind; auch das Gewölbe ist rund und ohne Rippen. Das Schiff ist im Uebergangsstyl aufgeführt und hat unter jedem Gewölbe an jeder Seite 3 schmale, leise gespitzte Fenster im Uebergangsstyl mit Wulsten, also im Ganzen 12 Fenster, alle wohl erhalten. Die Hauptpforte ist ebenfalls im Uebergangsstyl und spitzbogig. Der Schluß der Gewölbe besteht aus einem großen Reliefkreise, von welchem 8 Rippen hinablaufen, wie in der Kirche zu Satow (vgl. oben). Die Kirche gehört also auch dem Baustile der Kirchen in der Mitte des Landes an.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Reinshagen bei Güstrow.
So wie die Kirchen zwischen Sternberg, Güstrow und Schwan einen bestimmten, ausgeprägten Baustil haben, welcher wahrscheinlich aus der Zeit der Stiftung des Doms zu Güstrow stammt, so scheinen nach allen Berichten die Kirchen östlich von Güstrow nach Gnoien und Neukalden hin wieder einen bestimmten Charakter zu haben, namentlich die Kirchen zu Reinshagen, Watmanshagen, Warnkenhagen, Belitz, Jördenstorf; namentlich scheinen diese Kirchen alle aus Ziegeln und sehr groß und zierlich gebauet zu sein.
Die Kirche zu Reinshagen ist ein großes, schönes Ziegelgebäude, welches auf einer geschmackvoll behauenen Granitbasis ruht. Sie besteht aus einem Chor und einem breitern Schiffe, welches zwei Seitenschiffe hat, und ist ganz gewölbt, im Schiffe drei Gewölbe lang. Die 9 Gewölbe des Schiffes ruhen in


|
Seite 311 |




|
der Mitte auf 4 Saulenbündeln, ohne Kapitäler. Die Pilaster, welche die Chorgewölbe tragen, sind mit Weinlaub verziert.
Der Bau stammt aus den ersten Zeiten des ernsten Spitzbogenstyls. Die grade Altarwand des viereckigen Chors hat ein großes, von einem Wulst eingefaßtes Spitzbogenfenster; über dem Fenster steht ein Fries von halben Kreisbogen; ebenso ist der Giebel der Altarwand mit emporsteigenden Halbkreisen eingefaßt. Jede Seite des Chors hat 2 Fenster.
Die Pforte in der südlichen Chorwand ist ganz mit Weinlaub belegt. Die Pforten in der südlichen Schiffwand und im Thurme haben Kapitäler aus Weinlaub.
Der mittelalterliche Altar von Schnitzwerk ist recht gut gearbeitet.
Die Inschrift der großen Glocke ist seit einem Jahrhundert als räthselhaft besprochen. Sie ist der im Jahresber. VII, S. 74 beschriebenen Glocke zu Neuburg völlig gleich: sie ist nämlich recht modellirt, also verkehrt gegossen und lautet:

Zur Veranschaulichung ist die Inschrift hier von
der Rechten zur Linken gesetzt. Einige
Buchstabenvarianten scheinen beide Glocken von
einander zu unterscheiden, namentlich steht auf
der reinshäger Glocke ganz bestimmt
 ORT
ORT

 statt mortua; auch ist die Folge
der 3 Sprüche auf beiden Glocken wohl
verschieden. Uebrigens sind beide Inschriften
ohne Irrthum deutlich zu lesen.
statt mortua; auch ist die Folge
der 3 Sprüche auf beiden Glocken wohl
verschieden. Uebrigens sind beide Inschriften
ohne Irrthum deutlich zu lesen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Alt=Gaarz.
Auf hohem Meeresstrande, noch berührt von dem ewigen Rauschen der Wogen, steht die Kirche zu Alt=Gaarz, ein alter, tüchtiger Bau aus den Zeiten der Verbreitung des Christenthums, ähnlich den Kirchen von hier bis Neukloster, wie z. B. Neubukow, Neuburg, Drewskirchen u. a. Die Kirche stammt aus der Zeit des Uebergangsstyls und mag noch in das erste Viertheil des 13. Jahrh. fallen; der Bau ist im ernsten und strengen Styl aufgeführt und hat, trotz der Verunstaltungen durch die vielen weit hervorspringenden Chöre, etwas Imponirendes. Die durchaus und schön gewölbte Kirche besteht aus Chor, Schiff und Thurm. Der Chor, mit einem Gewölbe bedeckt, hat im Süden eine kleine, nicht verzierte, im Rund=


|
Seite 312 |




|
bogen überwölbte Pforte und in jeder Wand drei
schmale Fenster aus der Zeit des
Uebergangsstyls. Das Schiff, von zwei Gewölben
bedeckt, hat gewölbte Seitenschiffe und unter
jedem Gewölbe 2 und an jedem Ende der
Seitenschiffe 1, also im Ganzen 12 Fenster von
derselben Construction und im Norden eine
Hauptpforte in demselben Styl. Alle
Gliederungen, Bogen, Gurte
 im Innern sind sehr ernst und würdig.
im Innern sind sehr ernst und würdig.
Im Thurmgebäude liegt die Schale eines großen, granitenen Taufbeckens (Fünte) mit ausgezeichnet schön und flach gearbeiteten architektonischen Verzierungen, so daß diese Taufschale ohne Zweifel zu den schönsten und merkwürdigsten des Landes gehört. Der schmucklose Fuß ist an die Außenwand gelehnt.
Vor dem Altare liegt ein Leichenstein mit 2 in Linien in guter Manier eingegrabenen Figuren, rechts dem Bilde eines Ritters, der die Rechte auf das Schwert stützt und mit der Linken den Wappenschild der von Oertzen hält, - links dem Bilde einer Frau, zu deren Füßen der Schild der von Stralendorf steht. Die Umschrift lautet:
Nördlich daneben liegt eine zweite Grabplatte, welche jedoch im Innern ganz abgetreten ist. Es sind nur noch einige Buchstaben der Inschrift zu erkennen:
Die Schrift stammt aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Gruft ist wahrscheinlich ebenfalls eine von örtzensche (Tidericus Orde[ssen]).
Im Thurme hangen 4 alte, schöne Glocken:
1) die große Glocke hat in Umrissen auf der einen Seite das Bild eines den Kelch haltenden Heiligen (Sct. Johannes des Evangelisten), auf der andern Seite das Bild des Sct. Johannes des Täufers mit dem Agnus Dei. Inschrift:


|
Seite 313 |




|

(= Anno domini MCCCCLX, in die sancti Jacobi. O rex gloriae Jesu Christe veni cum pace. Osanna. O Maria ora pro nobis.)
Wahrscheinlich hieß die Glocke Osanna=Hosianna; vgl. unten die Kirche zu Russow und Jahresber. I, S. 68 und VIII, S. 149.
Diese Glocke ist also zur Zeit des Vicke von Oertzen gegossen, der unter dem oben beschriebenen Leichensteine liegt.
2) Die mittlere Glocke hat die Inschrift:

(= O rex gloriae Jhesu Christe veni cum pace. Amen. Anno domini MCCCCLXXX jare. Help Jesus, Maria, Anna, Johannes.)
3) Die kleine Glocke hat die Inschrift:

(= Anno 1519 Catherinae mihi nomen perdulce dicatur.)
4) Die kleinste oder Beierglocke hat keine Inschrift.
G. C. F. Lisch.
Die Kirche zu Russow
ist im Spitzbogenstyl erbauet und hat nichts Bemerkenswerthes, als daß sie im Süden ein Kreuzschiff und im Norden die Spuren von der Verzahnung eines zweiten Kreuzschiffes hat.
Die Glocken haben folgende Inschriften:
1) Die große Glocke:
Vor dem Worte
anno
steht ein
Antonius=Kreuz, auf dessen Querbalken mit
kleinen Buchstaben steht:
S.


 O
O
 y
IVS.
y
IVS.


|
Seite 314 |




|
Dann folgt ein Schild mit dem Gießerzeichen: zwei über einander gelegten Winkeln. Darunter steht auf dem Mantel der Glocke in einem runden, oben verzierten Schilde ein Marienbild, rechts daneben ein Schild mit dem lübischen Adler, links das Gießerzeichen noch ein Mal. Die Glocke hieß also unbezweifelt Osanna; vgl. oben Alt=Gaarz.
2) Die zweite Glocke hat die Inschrift:
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirchen des Landes Stargard.
Für den, der die Kirchen in dem jetzigen Großherzogthume Meklenburg=Schwerin kennt, sind die Kirchen in dem meklenburg=strelitzischen Lande Stargard eine auffallende Erscheinung, um so mehr, als der Uebergang von einem Baustile zum andern auf der Landesgrenze ohne Vermittelung fast plötzlich ist. Während die Kirchen in Meklenburg=Schwerin vorherrschend aus Ziegeln und nach Zeiten und Ansichten der Baumeister in den mannigfältigsten Formen und Größen und fast immer individuell und sinnreich erbauet sind, haben die Granit=Kirchen des Landes Stargard fast eine und dieselbe Gestalt, so daß sie sich summarisch behandeln und ohne Nachteil unter Einen Baustil zusammenbringen lassen.
Dagegen ist es wieder überraschend, daß im Stargardischen in der Regel jedes Dorf oder Landgut, möge es eine Pfarre haben oder nicht, eine Kirche besitzt, während im Meklenburg=Schwerinschen gewöhnlich nur am Orte der Pfarre und hin und wieder in einem andern Dorfe der Gemeinde eine Filial=Kirche steht, also bei weitem die wenigsten Ortschaften Kirchen besitzen.
Diese Wahrnehmung über den Bau der Kirchen im Lande Stargard läßt sich wenigstens an den meisten Kirchen im nördlichen Theile des Landes machen, namentlich an den
| Kirchen | |
| zu Reddemin, Neverin, Staven, Roga, | |
| Dahlen, Salow, Lübberstorf, Broma, | |
| Golm, Holzendorf, Helpte, Käbelich, | |
| Cölpin, Teschendorf und Warbende, |
welche unmittelbar hinter einander von dem Berichterstatter unter freundlicher Beförderung und Begleitung des Herrn Reichsfreiherrn A. von Maltzan auf Peutsch untersucht sind.


|
Seite 315 |




|
Bei weitem die meisten Kirchen des Landes bilden nämlich ein einfaches Oblongum mit rechtwinklig angesetzter grader Altarwand, ohne äußere Gliederungen, Strebepfeiler und Ausbaue; die Glocken hangen sehr häufig in einem neben der Kirche gehenden, niedrigen Glockenstuhle, selbst oft wenn Thürme da sind. Der ganze Bau dieser Kirchen besteht aus sorgfältig gewählten und an den Wandecken behauenen Granitblöcken; Sockel, Ecken und Pforten sind aus sorgfältig und in künstlerischen Linien behauenen Graniten ausgeführt, besonders sind die Pforten schön und sorgfältig errichtet; die Fensteröffnungen sind mit Ziegeln ausgekleidet. Kalktünch bedeckt von innen und außen die Kirchen. Die Fenster sind schmal, ohne Gliederungen schräge eingehend, im Uebergangsstyle leise gespitzt; am häufigsten stehen in der Altarwand drei, und in jeder Seitenwand, nach der Größe der Kirche, drei oder zwei mal drei Fenster. Gewölbe sind selten zu finden. Charakteristisch für den Styl ist die Wölbung der Kirche zu Lübberstorf, welche mit zwei Gewölben, je einem für Chor und Schiff, bedeckt ist: der Gewölbeschluß besteht nämlich aus einem großen Reliefkreise, von welchem 8 Rippen hinablaufen; diese Gewölbe finden wir auch in den aus der Zeit des Uebergangsstyls stammenden Kirchen zwischen Sternberg, Güstrow und Schwan (vgl. Jahresber. VIII, S. 102 und oben S. 310).
Alle diese charakteristischen Merkmale sprechen dafür, daß die Kirchen des Landes Stargard zur Zeit des Uebergangsstyls, etwa seit der Besitznahme des Landes durch die Markgrafen von Brandenburg nach dem Vertrage von Kremmen vom J. 1236, und zwar nach märkischen Mustern, erbauet sind, da sich Kirchen dieses Styls auch in der Mark öfter finden; jedenfalls sind alle diese Kirchen zu einer und derselben Zeit gebauet und die ersten steinernen Kirchen der Gemeinden. Noch die größere Kirche der im J. 1248 gegründeten Stadt Friedland hat eine Pforte von behauenem Granit, wie die genannten Landkirchen, obgleich sie von Ziegeln erbauet ist.
Ebenfalls für diese Zeit des Baues redet noch die Kirche zu Golm, welche im Schiffe noch Ansätze zu 2 Gewölben neben einander und daher auch in der Altarwand zwei Fenster hat; vgl. Jahresber. VII, S. 124 und 127.
Die größte und fast einzige Zierde dieser Kirchen sind die oft sehr schön construirten Pforten aus behauenen Granitquadern. Häufig sind sie nur einfach, jedoch oft auch gegliedert, und zwar in drei rechteckigen, eingehenden Gliederungen. Eine der schönsten und am schärfsten ausgeprägten Kirchen ist die


|
Seite 316 |




|
Kirche zu Dahlen. Die Pforte im Thurme hat eine dreifache, rechteckige Gliederung; die innere und äußere sind aus behauenem Granit, die mittlere aus großen Ziegelstücken mit sehr kräftig und schön modellirtem Laubgewinde über den ganzen Bogen. Außerdem hat die Kirche in der Südwand noch zwei kleinere Pforten im Uebergangsstyl, von denen die westliche Kapitäler aus eingesetzten Reliefziegeln hat.-Ganz dieselbe dreifach gegliederte Thurmpforte aus Granit und Ziegel mit demselben Laubgewinde hat die Kirche zu Holzendorf.
Die Kirche zu Holzendorf hat übrigens außer dieser Pforte nichts dem Bau der übrigen Kirchen Aehnliches; sie ist nämlich ganz, auch im Thurme, von Ziegeln gebauet, hat auch, außer der Thurmpforte, Kirchenpforten aus Ziegeln, etwas weitere, jedoch noch einfache Fenster und Strebepfeiler.
Die Kirche zu Staven hat eine Eigenthümlichkeit, welche sich noch an andern Kirchen des Landes finden soll. Obgleich die Kirche aus Granit ist, so hat sie doch im Aeußern zwischen den Seitenfenstern und am Westgiebel mit Ziegeln ausgemauerte Nischen, welche in zwei Rundbogen gewölbt sind, die im Zusammenstoßen auf einem Tragsteine ruhen.
Aeußerst arm sind die stargardischen Kirchen an alten Geräthen und Denkmälern. Alte Taufkessel (Fünten) finden sich zu Lübberstorf (zerbrochen), Broma und Dahlen, letzterer mit starken Gesichtern verziert, wie die Fünte von Rülow (vgl. Jahresber. V, S. 123), welche jetzt im Schloßgarten zu Neustrelitz aufgestellt ist (vgl. Gentzen Verzeichniß der Gegenstände, um welche das Georgium zu Neustrelitz vermehrt ist, 1843, S. 4). Alte halbmuldenförmig ausghöhlte Weihkessel aus Granit (oder zu Weihkesseln benutzte heidnische Handmühlen?) finden sich an den Kirchen zu Wanzka, Helpte und Warbende. Geschnitzte Altäre sind selten und ohne Bedeutsamkeit; ein altes Bild der schmerzensreichen Mutter Maria (Maria tôr lâdinge) liegt noch im Thurme zu Salow.
Auf den Glocken ist nichts von Bedeutung bemerkt. Von Interesse könnten 2 Glocken zu Staven sein, beide mit gleichen Inschriften:
auf der einen Seite:
JOGIM FRIEDERICH CANS FÜRSTLICHER MECKLENBURGISCHER OBER UND GEHEIMBTEN RATHS PRAESIDENT HAT DIESE KLOCKE UMBGIESSEN LASSEN DATUM DEN 14 JUNIUS 1690.


|
Seite 317 |




|
auf der andern Seite:
oben:
SOLLI DEO GLORIA
unten:
M. VITES SIEBENBAUM GOSS MICH IN SCHWERIN.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Wanzka.
Das im J. 1290 von den Markgrafen von Brandenburg gestiftete Cistercienser=Nonnen=Kloster Wanzka war das einzige Kloster seiner Art im jetzigen Großherzogthume Meklenburg=Strelitz oder im Lande Stargard, ja neben den Johanniter=Comthureien Mirow und Nemerow das einzige Feldkloster im Lande, wenn man nicht die an den oft streitig gewesenen und zweifelhaften Grenzen des Landes liegenden Klöster Himmelpfort und Broda noch dazu rechnen will; das Kloster, in einer ziemlich angenehmen, jedoch in unmittelbarer Nähe nicht sehr reizenden Gegend, 1 Meile von Neustrelitz, war groß und begütert.
Von den Klostergebäuden ist keine einzige Spur vorhanden.
Die Kirche steht noch in den Ringmauern, ist jedoch vor einigen Jahren ausgebrannt und hat dadurch die letzten Reste ihrer frühen Einrichtung verloren; selbst Leichensteine fehlen gänzlich, so daß die Kirche gar keine Ausbeute giebt. Die neuere Restaurirung ist auch nur ganz schlicht und ohne Geschmack.
Das Kirchengebäude ist ein sehr langes, hohes Gebäude im ausgebildeten Spitzbogenstyle und eine der bedeutendern Kirchen im Lande Stargard; es ist jedoch nur ein einfaches Oblongum ohne Seiten= und Kreuzschiffe, also ohne Säulen= oder Pfeilerstellungen, ohne Gewölbe, kurz ohne bemerkenswerthe Eigentümlichkeiten, jedoch ganz von Ziegeln aufgeführt. Die Kirche gleicht den Kirchen mancher anderer Nonnenklöster, namentlich z. B. ganz der Kirche zu Dobbertin. In alter Zeit war der dreiseitig abgeschnittene Chorschluß gewölbt; der westliche Theil, der den hohen Nonnenchor hatte, ist wohl nie gewölbt gewesen. Eine Eigenthümlichkeit des Baues ist, daß die sehr hohen Fensternischen nur in der obern Hälfte Glasfenster enthalten, in der untern Hälfte schon zur Zeit des Baues zugemauert und diese Füllungen flach überwölbt und weiß getüncht sind, so daß man von dem hohen Nonnenchor noch nicht die Fenster erreichen kann.


|
Seite 318 |




|
An der westlichen Pforte liegt einer der bekannten halbmuldenförmigen Weihkessel aus Granit.
In der Kirche zu Wanzka ist der Herzog Ulrich, mit welchem die Linie Meklenburg=Stargard im J. 147l ausstarb, begraben, jedoch ohne Spur des alten Begräbnisses. Bei der jüngsten Restauration ist ihm im Chor ein Kenotaph gesetzt, auf welchem eine Platte mit der auf Befehl des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow von Andreas Mylius in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. für die Kirche verfaßten lateinischen Inschrift in elegischem Versmaaße liegt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die lübecker Altäre in den Kirchen zu Neustadt und Grabow.
Große Brände verzehrten im J. 1725 die Stadt Grabow und im J. 1728 die Stadt Neustadt und vernichteten zugleich das Innere der Kirchen dieser Städte. Bei den Sammlungen für diese Städte schenkten, nach überlieferten Nachrichten, die Lübecker jeder dieser Kirchen einen alten Altar.
Der an die Kirche zu Neustadt geschenkte Altar, welcher jedoch nie in der Kirche aufgestellt ist, sondern bis vor einigen Jahren, wo er in die großherzogliche Alterthümer=Sammlung genommen ward, in dem Materialienhause lag, ist ein Kunstwerk erster Größe, von ausgezeichneter Schönheit und so großer Vollendung, daß er selten seines gleichen findet. Dieser Altar wird, da er an seinem frühern Aufbewahrungsorte sehr gelitten hat, gegenwärtig in Schwerin restaurirt. Wahrscheinlich stammt er aus der Marienkirche zu Lübeck, da im Mitteltheile Maria und Christus als Hauptbilder stehen und sich außerdem unter den Heiligenbildern der H. Olaf findet, dessen Verehrung durch die Bergenfahrer, nach der Mittheilung des Herrn Dr. Deecke zu Lübeck, in der Marienkirche zu Lübeck charakteristisch ist. In einer Urkunde im großherzoglichen Archive zu Schwerin findet sich auch eine Vicarien=Urkunde vom J. 1436 für die "olderlude des kopmans vnde de gemeyne kopman van Berghen to Lubeke wesende - - to behuff der lichte vor sunte Olausbilde neddene in Vnser Vrowen kerken hangende."
Es war zu vermuthen, daß der der Kirche zu Grabow geschenkte Altar ebenfalls Kunstwerth habe. In den neuesten Zeiten ist der Altar geschlossen und ein neues, grade nicht an=


|
Seite 319 |




|
sprechendes Bild darüber gehängt. Der Unterzeichnete ließ daher bei einer Anwesenheit zu Grabow das Bild abnehmen und die Flügel des alten Altars öffnen. Aber sowohl Bildhauerei und Schnitzwerk, als Malerei sind durchaus gewöhnlich und nicht besser, als wie es sich häufig und überall findet, so daß die Hoffnung auf ein großes Kunstwerk gescheitert ist. Jedoch ist der Altar ziemlich groß und wohl erhalten: er enthält, außer den Mittelgruppen und vielen kleinen Brustbildern der Propheten udgl., 56 Heiligenbilder. Die Mittelgruppe stellt den Berg Golgatha dar. Hinter dem Berge, der nur lose eingeschoben ist, steht auf dem weißen, nicht vergoldeten Kreidegrunde der Altarwand mit gleichzeitiger Schrift:

so daß doch wenigstens die Zeit der Verfertigung (1379) für das Werk gewonnen ist. - Auf der Rückseite des Berges Golgatha steht:
AO. 1596.
Es schien notwendig, für künftige Zeiten diese Erfahrungen hier niederzulegen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Bülowen=Kapelle in der Kirche zu Doberan
ist als ein seltenes Bauwerk wegen ihrer mittelalterlichen Malereien in Jahrb. IX, S. 447 flgd. beschrieben. Interessant würde es sein, wenn man die Zeit der Erbauung kennte; sie läßt sich jetzt nach Auffindung einer Urkunde im großherzoglichen Archive zu Schwerin wahrscheinlich genau bestimmen. Sie ist ohne Zweifel von dem Bischofe Friederich von Schwerin im J. 1372 gegründet und in den nächsten Jahren vollendet. Es verkaufen nämlich am 20. Dec. 1372 die von Oertzen 30 Mark aus Schmadebeck, welche der Bischof Friederich von Schwerin zu seinem, seines Bruders und seiner übriger Lieben (carorum) Gedächtniß der Kirche zu Doberan schenkte. Nach der Geschichte des Geschlechts der von Bülow waren des Bischofs Brüder: Johann, Reimar und Heinrich auf Schepekendorf. Dieser Heinrich von Bülow ist also wahrscheinlich derjenige, welcher über der Thür in der Kapelle abgebildet ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 320 |




|



|



|
|
:
|
2. Neuere Zeit.
Die Schlösser zu Wismar und Schwerin
und deren Baumeister.
Der Baumeister des wismarschen Schlosses ist der Maurermeister Gabriel von Aken (vgl. Jahrb. V, S. 20-22), und der Steinbrenner Statius von Düren fertigte die Verzierungen aus gebranntem Thon, mit welchen auch die alten Gebäude des Schlosses zu Schwerin aufgeputzt sind (vgl. Jahrb. V, S. 18 und 36). Diese Bauten wurden in dem Zeiträume von 1552-1555 ausgeführt. Gabriel von Aken war mit der Oberleitung des Baues unzufrieden und zog am Ende des J. 1553 von Wismar nach Lübeck (vgl. Jahrb. V, S. 20, Not. 1 und S. 21) und Statius von Düren folgte ihm nach Lübeck (vgl. Jahrb. V, S. 18 und 36) ungefähr im J. 1557. In Lübeck stehen nun noch hin und wieder viele Häuser, welche ohne Zweifel durch die Wirksamkeit beider Männer entstanden sind. Namentlich stehen in der Wahmstraße Nr. 450 bis 453 vier tüchtige, sehr wohl erhaltene Giebelhäuser neben einander, welche ganz in dem Geiste dieser Männer gebauet sind, namentlich sind sie ganz mit allen und denselben Ornamenten aus gebranntem Thon (gedruckten Steinen) verziert, welche an den Schlössern zu Wismar und Schwerin angebracht sind: es finden sich hier nicht allein alle die menschlichen Brustbilder und Thiergestalten aus denselben Formen, auch die Köpfe der wahrscheinlich fürstlichen Personen, sondern auch die beiden Brustbilder mit den Spruchbändern GOT. HEF. und INAG. ELIS., welche nur ein Mal am Schlosse zu Schwerin sich finden (vgl. Jahrb. V, S. 41-42).
Es ist also ohne Zweifel, daß beide Meister noch lange Zeit ihre Wirksamkeit in Lübeck fortsetzten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 321 |




|



|



|
|
:
|
III. Zur Münzkunde.
Die
neuern meklenburgischen Denkmünzen,
zusammengetragen
von
G. M. C. Masch,
Pastor in Demern.
Die meklenburgische Münzkunde besitzt in dem bekannten Werke des ehemaligen Geheimen Archivraths Carl Friedrich Evers "Meklenburgische Münzverfassung" eine Arbeit, welche, obgleich sie fast ein halbes Jahrhundert alt (1798, 1799) ist, großen Werth behalten hat und als eine recht tüchtige Grundlage betrachtet werden muß. Bei der Stellung des Verfassers zum Archive und bei seinem umsichtigen Fleiße ist nur wenig Hoffnung vorhanden, daß sich mehr Materialien für den ersten, allgemeinen, geschichtlichen Theil in meklenburgischen urkundlichen Quellen finden werden, als er bereits und im Ganzen recht zweckmäßig ausgebeutet hat. Um aber die norddeutsche Numismatik als ein Ganzes im Auge zu fassen und sie aus diesem Gesichtspuncte zu bearbeiten, was sich immer mehr als nothwendig herausstellt, liegen die Urkunden von Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Stralsund noch nicht in ihrem ganzen Reichtum vor, wenn gleich für Hamburg schon früher von Langermann und für Lübeck später von Grautoff sehr Erfreuliches geleistet ward.
Mehr läßt sich für die Vervollständigung des zweiten, speciell beschreibenden Theiles des Eversschen Werkes thun; denn bei allem unverkennbaren Fleiße, der darauf verwandt


|
Seite 322 |




|
ward, läßt dieser in der Bearbeitung aller derjenigen Münzen, welche keine Jahreszahl haben, sowohl der Hohlmünzen, als der zweiseitigen Münzen, sehr viel zu wünschen übrig. Die Hohlmünzen sind von ihm unverhältnißmäßig schwach behandelt worden und sind gewiß vor allen einer neuen, umfassenden Untersuchung bedürftig; die Solidi der meklenburgischen Städte aber ermangeln bei einer, dem Zweifel sehr unterliegenden Grundansicht, aller nähern Zeitbestimmung, welche er freilich auch in der Gewißheit nicht geben konnte, wie es jetzt, nachdem Grautoff so viele Münzrecesse ans Licht gezogen hat, die ihm unbekannt bleiben mußten, möglich geworden ist. (vgl. Jahresber. VI, 53). Jedoch auch abgesehen hievon, hat Evers, indem er diese alten Münzen einem modernen Münzschematismus unterlegte, Alles unter einander gemengt, und nicht einmal die Perioden, welche sich schon bei dem Anschauen herausstellen, bemerkt.
Die Sammlungen, welche zu seiner Zeit vorhanden waren, hat er allerdings treulichst benutzt, aber es sind nach ihm mehrere neue Typen und sehr viele Stempelverschiedenheiten bereits bekannter Gepräge der ersten Herzoge, welche Münzen schlagen ließen, in den verschiedenen Funden zum Vorschein gekommen, so daß sich aus den großherzoglichen Sammlungen in Schwerin und Neustrelitz, aus der Vereinssammlung und aus der Universitätssammlung in Rostock eine reiche Nachlese veranstalten ließe.
Bei allen diesen, gewiß nicht unbegründeten Ausstellungen, die sich auch wohl noch vermehren ließen, wenn man einzelne Parthien vornehmen wollte, und die hier nur darum angegeben werden, um auf das hinzuweisen, was zunächst für meklenburgische Münzkunde geschehen könne, bleibt Ever's Werk doch immer in solcher Bedeutung, daß eine Fortsetzung desselben bis auf die neueste Zeit nur wünschenswerth erscheinen kann, und so ist denn in dieser Hinsicht die Zusammenstellung der neuern Denkmünzen wohl nicht zwecklos.
Um einen festen Anfangspunct zu gewinnen, ward mit dem Regierungsantritte des Großherzogs Friederich Franz 1785 begonnen, und so wurden denn die wenigen Denkmünzen der ersten Zeit, welche Evers bereits hat, mit aufgenommen. Da sein Plan der Fortsetzung zum Grunde liegen muß, so mußten, wie er es gethan hat, auch die Meklenburger, welche im Auslande groß geworden, berücksichtigt werden, jedoch sind die Denkmünzen auf Daries, Theden und Graf Bernstorff, welche in die Zeit dieser Sammlung fallen, hier nicht wiederholt worden, da sie bereits von ihm genügend beschrieben sind.


|
Seite 323 |




|
Von allen hier beschriebenen Denkmünzen lagen (mit sehr wenigen Ausnahmen) die Originale oder Stanniolabdrücke vor, bei denen, welche Bolzenthal herausgegeben hat, bedurfte es derselben nicht, denn die Abbildungen sind so treu, wie möglich; ihre Vollständigkeit aber verdankt diese Arbeit der freundlichen Hülfe der Herren Archivar Lisch, Universitäts=Bibliothekar Baron von Nettelbladt in Rostock und F. W. Kretschmer in Berlin, denen öffentlich Dank zu sagen eine Freude ist.
Die
neueren meklenburgischen Denkmünzen.
A. Das Haus Meklenburg=Schwerin.
I. Friedrich Franz. (Geboren den 10. Dec. 1756, folgte seinem Oheim Herzoge Friedrich in der Regierung den 24. April 1785, nahm die großherzogliche Würde an den 14. Juni 1815, feierte sein fünfzigjähriges Regierungsjubiläum den 24. April 1835 und starb 1. Febr. 1837).
1.
Auf den Antritt der Regierung.
24. Apr. 1785.
In Gold und Silber. 2 1/2
Loth. Größe nach Mader 29.
| HS. | In einem Kranze, von Lorbeer und Palmzweigen gebildet: |
FRANCISCUS
D : G : DUX MECKLENBURG :
POST OBITUM
SERENISSIMI PATRUI
ET DUCIS FRIEDERICI
PATRIS PATRIAE
FASCES REGIMINIS
CAPESSIT
ANN : M. DCC. LXXXV.
D : XXIV. APRIL.
| RS. | Eine aus Wolken ragende Hand hält an einem Bande ein ovales Medaillon mit dem Bildniße des Herzogs Friedrich, worunter im Hintergrunde die Vorderseite der Kirche in Ludwigslust sich zeigt. An der linken Seite |


|
Seite 324 |




|
| sitzt das weinende, mit einem langen Schleier vom Haupt bis zu den Füßen verhüllte Meklenburg, mit der Rechten sich ein Tuch vor die Augen, mit der Linken den ovalen, vollständigen Wappenschild haltend. Zu den Füßen A: A: (Abraham Aaron) Im Abschnitt: |
TALIS PATRUI
SEQUOR
Evers Mecklenb. Münzverf. II, S. 210. Die Erfindung ist vom Archivrath Evers und sollen in Gold 50, in Silber 500 St. geprägt sein.
2.
Auf das Regierungs=Jubiläum.
24. Apr. 1835.
In Gold, Silber (3 1/4 Loth)
und Bronze Größe 31.
| HS. |
FRIEDR. FRANZ GROSSHERZOG V.
MECKLENBURG SCHWERIN
Das rechtsgekehrte Brustbild des Großherzogs, mit einem Hermelinmantel um die Schultern, darunter F. A. NÜBELL FEC : Unten im Rande der Umschrift: |
ZUM GEDÄCHTNIS . FÜNFZIGJÄHRIGER REGIERUNG
| RS. | Clio, sitzend, hält mit der Linken eine auf ihren Schooß gestützte Tafel, worauf sie schreibt: |
1756.
D 24 APRIL
1785.
D 24 APRIL
1835.
Jahresber. I, S. 28.
II. Friedrich Ludwig. (Aeltester Sohn des Großherzogs Friedrich Franz, geb. 13. Jun. 1778, vermählte sich am 23. October 1799 mit Helene Paulowna, Großfürstin von Rußland, kehrte mit ihr im Febr. 1800 ins Vaterland zurück, vermählte sich nach ihrem, am 24. Sept. 1803 erfolgten Tode mit Herz. Caroline Luise von Sachsen=Weimar am 1. Juli 1810, und nach ihrem Tode mit Auguste Friederike, Landgräfin von Hessen=Homburg, † 29. Nov. 1819.)


|
Seite 325 |




|
1.
Auf die Ankunft mit der
Gemahlin in Meklenburg,
Febr. 1800.
In Gold und Silber. Größe 25.
| HS. |
SERI IN COELVM REDEATIS DIVQVE
LAETI INTERSITIS POPVLO
Im
Meere Felsen, auf denen links im
Hintergrunde ein Tempel steht; im
Vordergrunde steht ein Obelisk,
welcher bis gegen den obern Rand in
Wolken hinein reicht, aus denen
Lichtstrahlen hervorgehen. In der
Mitte des Obelisken=Schaftes sind 2
ovale Schilder angebracht, auf dem
rechten steht der Buchstabe
 auf dem linken
auf dem linken
 Auf der Basis des Obelisken:
Auf der Basis des Obelisken:
|
PATRIÆ
| unten am Rande: C F |
| RS. | In einem Kranze von Eichenlaub: |
CONNVBIO FELIX
REDIT
PATRIA IVBILANTE
MENS. FEBR
MDCCC.
In Gold und Silber. Größe 19.
| HS. | FRIEDRICH U. CAROLINE Eine brennende Fackel und ein Bogen mit Pfeil kreuzweise über einander gelegt. Unten: |
| RS. | Zwischen einem Myrthenzweige rechts und einem Lorbeerzweige links, welche unten mit einer Schleife zusammen gebunden sind: |
IN
WEIMAR
D. I. IULI
MDCCCX.
Appel Repert. III, p. 610, n. 2157.


|
Seite 326 |




|
III. Paul Friedrich. (Sohn des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig aus erster Ehe, geb. 15. Sept. 1800, vermählte sich am 25. Mai 1822 mit Fpriedr. Wilh. Alexandrine Helene, Prinzessin von Preußen, folgte seinem Großvater 1. Febr. 1837 in der Regierung und starb 7. März 1842.)
Größe 28.
| HS. | Die beiden rechts gekehrt Brustbilder, die Prinzessin mit einem Blumenkranze im Haar. Ein dicker Blumenkranz umgiebt die Bilder und auf ihm liegen unten 2 Schilde, von denen der erste den Stierkopf, der zweite den preußischen Adler hat. |
| RS. |
Die beiden Vermählten,
der Prinz mit Bügelkrone auf dem
Haupte und einen Stab in der Hand,
die Prinzessin, welche mit der
königlichen Krone geschmückt ist,
umfassend, sitzen in antiker
Kleidung auf einem zweiräderigen
Wagen, der von einem Viergespann
gezogen wird, welches der
voraufgehende Hymen, die Fackel in
der Hand, leitet.
Im Abschnitt: |
| Auf dem Boden: BRANDT. F. |
Bolzenthal Denkmünzen zur Gesch. des Königs Friedrich Wilhelm III, p. 36, t. XXII. n. 108.
Silber 7/32 Loth. Größe 15.
| HS. | PAUL FRIEDR. GROSSHERZOG V. MECKLENBURG SCHWERIN. Das links gekehrte Brustbild. |
| RS. | In einem von 2 Cypressenzweigen, welche durch eine Schleife gebunden sind, gebildeten Kranze, unter einem Stern von 5 Strahlen: |
D. 7. MAERZ
1842.
Köhne Zeitschrift II, S. 322, mit Abbildung.
Die Hauptseite dieses Jettons ist mit dem Stempel des Paulsd'or geprägt. Eine kleinere (1/8 Loth, Gr. 12) ist dieser hinsichtlich des Bildes und der Schrift ganz gleich und dazu ist der Stempel des halben Paulsd'or benutzt worden.


|
Seite 327 |




|
IV. Helene Luise Elisabeth. (Tochter des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig aus zweiter Ehe, geb. 24. Jan. 1814, vermählt am 30. Mai 1837 mit Ferdinand Philipp Ludwig Carl Heinrich Joseph, Herzog von Orleans, welcher 13. Juli 1842 starb.)
Größe 39.
| HS. | LVDOV. PHILIPPVS. I FRANCORVM. REX. Das rechts gekehrte Brustbild des Königs mit einem Eichenkranze und davon herabhangender Schleife; unter dem Arme: E. GATTEAUX |
| RS. | DOMESTICA. FELICITAS. SPES. PVBLICA |
| Die Herzogin im Spitzenkleide, einen Rosenkranz im Haar mit herabhangendem Schleier und der Herzog in reich gestickter Uniform mit 2 Ordenssternen und übergehängtem Ordensband reichen sich über einem Altar die Hände. Im Abschnitt: |
HEL. LVD. ELIS. PRINC. MEGALOPOL.
SACRIS NVPTIAL. IVNCTI
MDCCCXXXVII.
Größe 28.
| HS. |
* FERD. PH. L. C. H. IOS. DUX
AURELIANI *
HELENA LOD. ELIS. PRINC. MEGALOPOL. SUERIN |
| Die beiden rechtsgekehrten Brustbilder, das der Prinzessin hat einen Schmuck mit herabhangenden Perlen um den Hals, unter dem Arme des Herzogs steht: BRANDT F -AN C PENS RE D.L'AC D. FRAN. A ROM. |
| RS. | Ein Blumen= und ein Lorbeerkranz, in einander geschlungen, und oben mit einer Schleife gebunden, in der Mitte: |
D. 30 MAII
1837
Größe 28.
| HS. | Die Brustbilder des Herzog und der Herzogin über einander links gekehrt, letzteres mit einem Perlenhalsbande; unten: MONTAGNY. F. |


|
Seite 328 |




|
| RS. |
DUC D'ORLEANS
PRINCE ROYAL,
MARIÉ LE 30 MAI 1837.
A HÉLÈNE, PRINCESSE
DE MECKLENBOURG
SCHWERIN.
Größe 17.
| HS. | LE DUC ET LA DUCHESSE D'ORLEANS Die beiden links gekehrten Brustbilder über einander, unten: MONTAGNY. F. |
| RS. | In einem geperlten Rande: |
DUC D'ORLEANS
PRINCE ROYAL,
MARIÉ LE 30 MAI 1837.
A HÉLÈNE PRINCESSE
DE MECKLENBOURG
SCHWERIN.
Größe 26. Zinn mit Oehse, sehr schlechte Arbeit.
| HS. |
* LE DUC D'ORLEANS LA PRINC
ESSE
HELENE *
Die beiden Brustbilder über einander links gekehrt. |
| RS. |
* UNIS A FONTAINEBLEAU LE 30. MAI *
Frankreich als gehelmte weibliche Figur, die Rechte auf einen Schild gestützt, in der Linken eine Lanze haltend, steht zwischen der knieenden Herzogin in moderner Kleidung und dem knieenden Herzoge in Uniform. Im Abschnitt: 1837 |
Größe 28.
| HS. | LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS. FERD. P. L. C. H. J. DUC D'ORLEANS. HEL. L. E. DE MECKLEMBOURG SCH. DUCH SSE D'ORLEANS. Die drei Brustbilder: des Königs mit einem Eichenkranze, des Herzogs mit Lippen=, Backen= und Gurgelbarte, und der Herzogin mit glattem Haar, wor= |


|
Seite 329 |




|
| über eine Schnur, und Perlenreihe um den Hals, über einander und rechts gekehrt. Auf dem Abschnitte des Halses des Herzogs: BARRE. F. |
| RS. |
DE LA SEINE INFERIEURE
FELICITE LE ROI
SUR LE MARIAGE
DE S. A. R.
LE DUC D'ORLEANS
AVEC LA PRINC SE> . HÉLÈNE.
DE. MECKLEMBOURG SCHWERIN
CÉLÉBRÉ A FONTAINEBLEAU
LE 30 MAI 1837

P. D. F. MIN E DE L'INTÉRIEUR

PRÉFET
Größe 26. Zinn, wie Nr. 5.
| HS. |
* LE DUC
 . Stempel von Nr. 5.
. Stempel von Nr. 5.
|
| RS. | Aus einem Triumphbogen, in dessen Thor ein Reiter sichtbar, ist eben ein vorn und hinten zurückgeschlagener, mit 2 Pferden bespannter Wagen gefahren, in dem 4 Personen einander gegenüber sitzen. Im Hintergrunde 3 Bäume. Im Abschnitt: |
LE 4 JUIN
1837
Größe 36.
| HS. |
HELÈNE L. E. DE MECKLENB.
SCHWERIN
* FERDINAND P. L. C. H. DUC D'ORLEANS. Die beiden Brustbilder rechts geehrt, unten: BARRE FECIT |


|
Seite 330 |




|
| RS. |
FÊTES DONNÉES PAR LA VILLE DE
PARIS.
JUIN MDCCCXXXVII Die Stadt Paris mit der Mauerkrone, sitzend, neben sich einen Schild mit dem Stadtwappen (im rothen Felde ein antikes Schiff unter einem blauen Schildeshaupt), legt die linke Hand auf die Brust und streckt die rechte über einen Altar aus, auf dem Früchte liegen, dessen Seiten 2 Fackeln bilden und der mit F. H. bezeichnet ist. Im Abschnitt: |
24. Aug. 1838.
Größe 35.
| HS. |
FERDINAND P. L. C. H. DUC
D'ORLEANS
* HÉLÈNE L. E. DE MECKLENB. SCHWERIN. Die Brustbilder des Herzogs und der Herzogin gegen einander gekehrt, das der Herzogin mit einem Schmuck im Ohre. Unten: BORREL FECIT |
| RS. |
LOUIS PHILIPPE ALBERT COMTE DE PARIS
Das rechts gekehrte Brustbild des Kindes. Unten: |
LE 24 AOUT. 1838.
| unter dem Halse: BORREL. F. |
Anm. Eine sehr schöne, große (nach Mader 47) Denkmünze auf die Geburt besitzt die großherzogliche und die Vereinssammlung, resp. in Silber und Bronze, durch die Gnade der Frau Herzogin.
A. LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS
Das links gekehrte Brustbild mit einem von Eichenlaub und Oelzweig gemischten Kranze mit herabhangender Schleife. Unter dem Abschnitt: DOMARD F.
R. LOUIS PHILIPPE ALBERT COMPTE DE PARIS.
Frankreich, als eine gekrönte und geharnischte weibliche Figur dargestellt, mit einem über die Schultern geworfenen Mantel, sitzt auf einem Stuhl, setzt die Linke in die Seite und streckt die Rechte mit einem Zepter der mit einem Hahn gegipfelt ist, über die mit einer Grafenkrone gezierte Wiege, in welcher, jedoch so, daß es sich zugleich auf den Schooß von Frankreich lehnt, das unbekleidete Kind schlummert. Den rechten Fuß setzt die Figur auf einen Schemel und rechts neben dem Stuhle liegt auf einem Kissen die Grafenkrone und darüber ein Degen, links ein Füllhorn und Merkurstab, und ein Oelzweig hebt sich über diese in die Höhe. Daneben DOMARD. Im Abschnitt:
NÉ A PARIS LE 24 AOUT 1838.


|
Seite 331 |




|
Größe 17.
| HS. |
LE DUC
 . Stempel von Nr. 4.
. Stempel von Nr. 4.
|
| RS. | LOUIS PHILIPPE ALBERT D'ORLEANS COMTE DE PARIS Das rechtsgekehrte Brustbild des Kindes im Hemdchen. Unten: |
1838.
MONTAGNY. F.
2. Mai 1841.
Größe 35.
| HS. | FERDINAND P. L. C. H. DUC D'ORLEANS * HÉLENE L. E.DE MECKLENBOURG SCHWERIN Die beiden links gekehrten Brustbilder: der Herzog mit Lippen=, Backen= und Gurgelbarte, die Herzogin in schlichtem Haar, mit einer Perlenschnur um den Hals Unten: BORREL FECIT. |
| RS. | BAPTEME DE L IS PHIL E ALB T COMTE DE PARIS. Die Religion im faltenreichen Gewande, Schleier auf dem Haupte, ein Kreuz haltend, tauft das Kind, welches ihr Frankreich, in Gestalt einer gehelmten weiblichen Figur, über einen Taufstein, der vorn mit einem geflügelten Engelskopfe geziert ist, entgegen hält. Ueber dem Täufling schwebt der heilige Geiste wie eine Taube, von dem 11 Strahlen herabschießen. Zwischen der Religion und dem Taufsteine, zu dessen Füßen ein Oelzweig liegt, steht auf einem einfach behangenen Taburet eine Gießkanne und ein Kästchen, hinter Frankreich liegt auf einem Tischchen eine Grafenkrone und ein Degen mit einem Bande; daneben: BORREL. F. Im Abschnit: |
Größe 17.
| HS. | FERD. P. L. C. H. DUC D'ORLEANS * HELENE L. E. DE MECKLENB. SCHWERIN. Die beiden links gekehrten Brustbilder. Unten: BORREL. |
| RS. | BAPTEME DE L. P. ALB. COMTE DE PARIS Die Darstellung der Taufe wie auf der vorigen Münze. Unten: |


|
Seite 332 |




|
Anm. Die der großherzoglichen und der Vereinssammlung resp. in Silber und Bronze von der Frau Herzogin verehrte Denkmünze (Größe 39) hat die heilige Handlung schöner symbolisirt.
| HS. | LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS Das links gekehrte, bekränzte Brustbild. Im Abschnitt: PETIT F. |
| RS. | COMES PARISIENSIS. SACRO. LAVACRO. ABLVTVS. Ueber einem in Vasenform gebildeten, von einem Engelskopfe getragenen, reich verzierten Taufstein hält die zur linken Seite desselben stehende Stadt Paris, mit der Mauerkrone geziert, und neben sich zum Fuße den Hintertheil eines antiken Schiffes (Stadtwappen) das königliche Kind, auf einem Kissen sitzend, zur Taufe, welche die an der rechten Seite stehende Religion, die mit einem Rosenkranze gekrönt ist und ein Kreuz im Arme hat, aus einer Muschel vollzieht. Auf dem Taufsteine, neben der Religion, steht eine Vase, und der heilige Geist als Taube schwebt von oben hernieder, von 7 Strahlen umgeben. Im Abschnitt: |
|
II. MAII. M. DCCC. XLI.
PETIT INV. ET F. |
Größe 28.
| HS. |
LOUIS
 . Stempel von Nr. 6.
. Stempel von Nr. 6.
|
| RS. | AVG TE ENFANT VIVEZ POUR LE BONHEUR DE LA FRANCE ET LE MAINTIEN DES LIBER TÉS PUBLIQUES. Das rechts gekehrte Brustbild des Kindes, im Arme: CAQUE. F. Unten: |
DE M R LE COMTE DE PARIS
A LA METROPOLE LE 2 MAI 1841.
Größe 35.
| HS. |
FERDINAND
 Stempel Nr. 9.
Stempel Nr. 9.
|
| RS. | ROBERT PHILIPPE LOUIS EUGÈNE FERDINAND D'ORLÉANS DUC DE CHARTRES (zweite Reihe) NÉ A PARIS LE 9 9 BRE BAPTISÉ LE 14 9 BRE. Das rechts gekehrte Brustbild des Kindes im Hemdchen mit übergeschlagenem Spitzenkragen. Darunter: 1840. Im Abschnitt des Bildes: BORREL. |


|
Seite 333 |




|
B. Das Haus Meklenburg=Strelitz.
I. Carl Ludwig Friedrich. (Geboren 10. Oct. 1741, succedirt seinem Bruder Adolf Friedrich IV. am 2. Juni 1794, nahm die großherzogliche Würde an 28. Juni 1815, starb 6. Nov. 1816.)
2. Juni 1794.
Gold und Silber (1 1/2 Loth). Größe 26.
| HS. | CARL LUDE. FRID. HERZOG ZU MECKLENBURG Das rechts gekehrte ältliche Brustbild in toupirtem Haar mit Zopf, bekleidet mit der landständischen Uniform mit Epaulette, Ordensband und Stern des schwarzen Adlerordens, im Arm H (Hein). |
| RS. | In einem Kranze von Lorbeer und Palmzweigen: |
10 TEN OCTOBER
1741 U. SUCCEDIRT
NACH ABSTERBEN
SEINES HERRN
BRUDERS DEN
2 TEN IUNI
1794.
Evers Münzverf. II, S. 337.
Silber. Größe 27.
| HS. | CAROLUS MEGAPOLITANORUM DUX. Das rechtsgekehrte Brustbild mit gekräuseltem Haar und Zopf, in landständischer Uniform mit Epaulette, Ordensband und Stern. Unter dem Arm H (Hein). |
| RS. |
SUO
LAETA GENS
MEGAPOLITANA
MDCCXCIV.
Evers Münzverf. II, S. 337. Der Stempel ist nach wenigen Abdrücken unbrauchbar geworden.


|
Seite 334 |




|
Silber 1 7/8 Loth. Größe 31.
| HS. | CARL GROSSHERZOG VON MECKLENBURG STRELITZ (zweite Reihe) GEB. D. 10 OCTBR. 1741 GEST. D. 6 NOV. 1816. Das rechts gekehrte Brustbild in bürgerlicher Kleidung, mit dem Stern des Andreas= und schwarzen Adler=Ordens, um den Hals ein Band mit einem Winkelmaße. Unten: LOOS. |
| RS. |
FÜRSTEN
UND FREIMAURER;
DIE LOGEN
MECKLENBURGS:
ZU DEN DREI STERNEN,
TEMPEL DER WAHRHEIT,
PHOEBUS APOLLO,
HARPOCRATES
ZUR MORGENRÖTHE,
UND ZUM
FRIEDENSBUNDE.
1817.
II. Luise Auguste Wilhelmine Amalie. (Tochter des Herzogs Carl, geb. 10 März 1776, vermählt am 24. Dec. 1793 mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen, ward durch die Thronbesteigung desselben am 16. Nov. 1797 Königin, reisete im Juni 1798 mit dem Könige nach Schlesien, wohnte am 19. August 1800 einem Ritterspiele in Fürstenstein (Vorstinburg) bei, das von schlesischen Edelleuten auf der wiederhergestellten Burg ausgeführt wurde, feierte am 18. Januar 1801 die Säcularfeier der preußischen Königswürde, besuchte Thüringen im Mai 1803, kehrte nach den Unfällen der Jahre 1806 und 1807 am 23. Dec. 1809 mit ihrem Gemahle nach Berlin zurück und starb am 19. Juli 1810 in Hohenzieritz bei Neustrelitz. Ihre Leiche ward am 22. Dec. 1810 im Mausoleum zu Charlottenburg beigesetzt.)
Silber (2 Loth). Größe 28.


|
Seite 335 |




|
| HS. | FRIEDRICH WILHELM KRONPRINZ VON PREUSSEN (zweite Reihe) LUISE AUGUSTE WILHELMINE AMALIE PRINZESS. V. MECKLENB. STREL. Beide rechts gekehrte Brustbilder, der Kronprinz in der Uniform seines Regimentes. Unten LOOS. |
| RS. | GESEGNET SEY DURCH IHN EIN GANZES VOLK! Die Fruchtbarkeit, als Göttin personificirt, sitzend, hält in der linken Hand einen aufgebrochenen Granatapfel, in der rechten Myrtenkranz und Pfeil. Zu der Göttin führt der Kriegsgott, bloß mit Helm, Lanze und Schild bewaffnet, einen jungen Helden in römischer Kriegstracht, der mit dem Lorbeerkranze auf dem Helme geziert ist. Im Abschnitt: |
DEN 24 DECEMB.
1793.
Bolzenthal Denkmünzen, p. 2, t. II n. 4.
Evers Münzverf. II, p. 338.
Silber 1 15/16 Loth. Größe 27.
| HS. | FRIDERICVS PRINC. HERED. BOR. LVDOVICA PRINC. MEGALOPOL. Die beiden Bildnisse neben einander gestellt und links gewandt unten A / S (Abramson). |
| RS. | MEDIA INTER ARMA HYMENAEO. Ein hoher Altar mit Myrten und Rosengewinden verziert, auf dessen Vorderseite der Gott Hymen, in der einen Hand seine Fackel, in der andern 2 Myrtenkränze tragend, zu sehen ist. Auf dem Altare lodert eine Flamme und um denselben liegen Waffen in römischer Form. Im Abschnitt: |
D. XXIV DEC.
MDCCXCIII.
Bolzenthal Denkmünzen p. 2, t. II, n. 5, Idee von Rammler.
Evers Münzverf. II, p. 339.
Zugleich auf die Vermählung der Schwester Friederike mit dem Prinzen Ludwig, 24. und 26. Dec. 1793.
Silber (2 Loth). Größe 30.


|
Seite 336 |




|
| HS. | PARES SANGUINE VIRTUTE AMORE. Kastor und Pollux, neben einander stehet, in griechischer Tracht, mit Sternen auf dem Haupte, legen Myrtenkränze auf Hymens Altar, auf welchem ein Medaillon mit zwei jungfräulichen Köpfen sich befindet. An den Altar lehnt sich eine mit Rosen umwundene brennende Fackel. Unten STIERLE. |
| RS. |
REGNI BOR. HERES
LUDOVICUS
HERED. REG. FRATER
CUM SORORIBUS
LUDOVICA ET FRIDERICA
FILIABUS
HEREDIS DUCATUS
STRELITIO MEGALOP.
FAUSTIS. MATRIM.
IUNCTI
BEROLINI
D. XXIV ET XXVI DEC.
MDCCXCIII.
| Darunter zwei Zweige mit blühenden Rosen. |
Bolzenthal Denkmünzen p. 2, t. III, n. 3.
Evers Münzverf. II, p. 339.
10. März 1794.
Silber 15/16 Loth. Größe 24.
| HS. | LUISE AUGUSTE WILHELMINE AMALIE KRONPRINZESSIN V. PREUSSEN (zweite Reihe) GEBOHREN D. 10 MÆRZ 1776. Das links gekehrte Brustbild mit lockigem Haar; unten: LOOS. |
| RS. | DES DIADEMS DES KRANZES WERTH. Auf einen behauenen Stein ist ein mit Kronen und Adlern bestreueter Purpurmantel gelegt, auf welchem ein Diadem mit einem Kranze umwunden liegt. Im Abschnitt: |
IN BERLIN
1794.
Bolzenthal Denkmünzen p. 3, t. II, n. 6.
Evers Münzverf. II, p. 340.


|
Seite 337 |




|
nach der Thronbesteigung und völligen Genesung, 10. März 1798.
Silber 15/15 Loth. Größe 24.
| HS. | LUISE AUGUSTE WILHELMINE AMALIE KŒNIGIN V. PREUSSEN Das links gekehrte Brustbild mit einem Tuche um Kopf und Hals. Unten: LOOS. |
| RS. | Ein Kranz von Rosen, Lilien und Convolvulus, der die Worte einschließt: |
TREUEN VOLKES
LIEBE
WAND DANKBAR
DIESEN
KRANZ
1798
Bolzenthal Denkmünzen p. 8, t. IV, n. 18.
Evers Münzverf. II, p. 340.
Appel Repert. II, p. 741, n. 4.
Silber. Größe 31.
| HS. | LUISE PREUSSENS SCHMUCK Der Königin Brustbild links gekehrt. Unten: ABRAMSON. |
| RS. | In einem Kranze von Rosen= und Eichenblattern: |
FRAUEN
HOECHSTER
STOLZ
Bolzenthal Denkmünzen p. 9, t. IV, n. 22.
Silber. Größe 20.
| HS. | Die Brustbilder des Königs in Uniform mit Ordensband, und der Königin mit einem Bande im Haar, einem Tuch um den Hals, neben einander links gekehrt. Unten: K. |
| RS. | Ein strahlender Stern, darunter: |
KOENIGLICH PAAR
IN
DEINEM SCHLESIEN
JUN. 1798
| Zwei kreuzweise gelegte Lorbeerzweige. |
Bolzenthal Denkmünzen p. 9, t. III, n. 23.


|
Seite 338 |




|
Silber. Größe 36.
| HS. | FR. WILH. III. LUISE K. U. K. V. PREUSSEN Des Königs und der Königin Brustbilder auf einem gemeinschaftlichen, mit einem Kranze von Eichenlaub und Rosen geschmückten Postamente neben einander stehend und rechts gewandt, das des Monarchen in Uniform mit Ordensstern. Auf dem Postamente der Tag der Ueberreichung dieser Denkmünze. |
1798
| RS. |
WAS KUNST UND FLEISS IN TARNOWITZ GEWANN
In der Unterschrift fortgesetzt: BRINGT SCHLESIEN DEM KŒNIGLICHEN PAARE Die Natur, als Göttin vorgestellt, auf einem Würfel sitzend, zu dessen Seiten 2 Löwen ruhen; sie hält auf ihrem Schooße eine große silberhaltige Bleiglanzstufe; der Genius der Bergbaukunst steht vor ihr, entschleiert ihr Angesicht und beleuchtet es mit der Grubenlampe. Unten: LOOS. |
Bolzenthal Denkmünzen p. 9, t. XXVIII, n. 24. In Breslau überreicht und aus dem in Tarnowitz gewonnenen Silber geprägt.
Größe 35.
| HS. | Die Brustbilder des Königs Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luise in alter Rittertracht neben einander gestellt und rechts gekehrt. Unten: KÖNIG |
| RS. |
DEN XIX AUGUST
MDCCC.
Bolzenthal p. 10, t. I, n. 26. Den 4 Siegern von der Hand der Königin in 2 an Ketten und 2 an Bändern hangenden goldenen und silbernen Medaillen überreicht.
Größe 28.


|
Seite 339 |




|
| HS. | FRIEDR. WILH. III. LUISE K. U. K. V. PREUSSEN Des Königs und der Königin neben einander gestellte Brustbilder, rechts gewandt, das des Monarchen in Uniform und mit Ordensstern. Unten: LOOS. |
| RS. | Die Königskrone in den Strahlen der Sonne. Darunter: |
KÖNIGLICHEN PAARE
HEIL UND DANK
UND NEUE HULDIGUNGEN
DES TREUSTEN VOLKS
DES ZWEITEN SÄCULUMS
DER MONARCHIE
1801
Bolzenthal Denkmünzen p. 10, t. IV, n. 30.
Größe 30.
| HS. | FRIEDR. WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN (zweite Reihe) LUISE AUG. WILHELMINE AMALIE KÖNIGIN Das Brustbild des Königs in Uniform mit Ordensstern und das der Königin neben einander gestellt und rechts gewandt. (Im Arm: LOOS) |
| RS. |
ALLGELIEBTEN
KŒNIGL. PAARE
WELCHES
DIE NEUEN UNTERTHANEN
DURCH SEINE GEGENWART
BEGLÜCKTE
BEI DER ANKUNFT
IN
THÜRINGENS HAUPTSTADT
ERFURTH
DEN 30 MAI 1803
IN TIEFSTER EHRFURCHT
ÜBERREICHT
VON
F. A. RESCH
UND
A. SCHERNITZ.
Bolzenthal Denkmünzen p. 14, t. XIV, n. 35.


|
Seite 340 |




|
23. Dec. 1809.
Größe 25.
| HS. |
FR. WILH. III.
 LOUISE
LOUISE
 KŒNIG. U.
KŒNIGIN V. PREUSSEN
Des Königs und der Königin
Brustbilder neben einander gestellt
und links gewandt. (Im Arme:
LOOS)
KŒNIG. U.
KŒNIGIN V. PREUSSEN
Des Königs und der Königin
Brustbilder neben einander gestellt
und links gewandt. (Im Arme:
LOOS)
|
| RS. | DES VOLKES FLEHN KRÖNT WIEDERSEHN Die Personification der Stadt Berlin mit einer Mauerkrone auf dem Haupte und neben sich einen liegenden Bär, bringt, vor einem mit dem königlichen Adler gezierten Altare stehend, Dankopfer. Im Abschnitt: |
1809
Bolzenthal Denkmünzen p. 19, t. IX, n. 51.
Größe. 19.
| HS. |
HS.
FR. WILH. III
 LOUISE
LOUISE
 KŒNIG. U.
KŒNIGIN V. PREUSSEN
Des Königs und der Königin neben
einander gestellte Brustbilder links
gekehrt, das des Königs in Uniform
und mit Ordensband. Unten:
LOOS.
KŒNIG. U.
KŒNIGIN V. PREUSSEN
Des Königs und der Königin neben
einander gestellte Brustbilder links
gekehrt, das des Königs in Uniform
und mit Ordensband. Unten:
LOOS.
|
| RS. | HEIL DEN HEIMKEHRENDEN Die Stadt Berlin in derselben Darstellung wie die vorige. Im Abschnitt: |
1809
Bolzenthal Denkmünzen p. 19, t. IX, n. 53.
"Der Stempel zu der Vorderseite findet sich auch mit einem ganz abweichenden Typus auf der Kehrseite verbunden: nämlich mit der Umschrift: SIE KEHREN ZURÜCK und mit der Personification der Zeit, welche an ein Denkmal schreibt: 1809 - NEUE - GLÜCKLICHE - ZEIT - KEHRT - WIEDER - ZU - UNS. Endlich ist jener Stempel zu der ans der Medaillen=Münzanstalt von Loos hervorgegangenen sogenannten Kalender=Medaille für das Jahr 1809 benutzt worden."
Größe 26.
| HS. | FRIDERICI GUILELMI III ET LOVISAE Des Königs und der Königin neben einander gestellte Bildnisse links gewandt. Unten: ABRAMSON |


|
Seite 341 |




|
| RS. | FORTVNAE REDVCI DESIDERATISSIMORVM Die Fortuna, das Füllhorn in der linken Hand und das Steuerruder in der Rechten, vor einem Altare stehend und opfernd. Im Abschnitt: |
CI
 I
I
 CCCVIIII
CCCVIIII
Bolzenthal Denkmünzen p. 19, t. IX, n. 52.
Größe 29.
| HS. | LOUISE PREUSSENS SCHMUCK Das links gewandte Brustbild der Königin mit Diadem. Unten: ABRAMSON. |
| RS. |
ACH! IST FÜR UNS DAHIN
Eine Pyramide, über derselben ein strahlender Stern. Im Abschnitt: |
D. 19. IUL. 1810
IM 35 IAHRE
Bolzenthal Denkmünzen p. 20, t. IX, n. 55; "mit unwesentlicher Abweichung auch in kleinerer Ausführung vorhanden."
Größe 19.
| HS. | LUISE AUG. WILH. AMAL. KÖNIGIN VON PREUSSEN (zweite Reihe) DER ERDE GEGEBEN DEN 10 MERZ 1776 Das Bild der Königin ohne allen Schmuck (im Arme L.) Unten: VERMÆHLT D. 24. DEC. 1793 |
| RS. | SIE IST DAHIN DIE KŒNIGIN DER HERZEN Das Vaterland unter dem Bilde einer weiblichen Figur und an der königlichen Krone und dem Wappenschilde kenntlich, sitzt trauernd an einem Aschenkruge, der mit dem Namen LUISE und darüber mit einem Sternenkranze bezeichnet ist. Neben dem Aschenkruge liegt auf einem Tabouret die Königskrone. Im Abschnitt: |
1810
Bolzenthal Denkmünzen p. 20, t. IX, n. 56


|
Seite 342 |




|
Größe 28.
| HS. | LUISE AUG. WILH. AMAL. KŒNIGIN VON PREUSSEN Zweite Reihe: DER ERDE GEGEBEN D. 10 MÆRZ 1776 Das Bildniß ohne allen irdischen Schmuck, über dem Haupte schwebt eine Strahlenkrone. (Loos.) Unten: VERMÆHLT D. 24 DEC. 1793 |
| RS. | AUS DER ERDE NEBEL ZURÜCK ZUM EWIGEN LICHT Die mit trüben Wolken bedeckte Erde wird als das in tiefe Trauer versetzte Königreich an dem mit dem preußischen Adler bezeichneten Steine erkannt. Durch die Nebel hebt sich eine Lichtflamme und steigt zum Urquell des Lichts empor, welchen der oben in Sonnenstrahlen prangende Name des Ewigen bezeichnet. Im Abschnitt: |
1810
Bolzenthal Denkmünzen p. 20, t. XIII, n. 57.
Größe 24.
| HS. | LUISE AUG. WILH. AMAL. KŒNIGIN VON PREUSSEN Zweite Reihe: ENTSCHLIEF DEN 19 JULI 1810 Die verstorbene Königin Luise auf dem Paradebette. Im Abschnitt: |
ALS ENGEL DES LICHTS
WIEDER
ZU ERWACHEN.
| Auf dem Sockel des Bettes: LOOS FEC. |
| RS. | DEIN TREUES VOLK WEINT UM DICH UND SEGNET DICH Ansicht des im Schloßgarten zu Charlottenburg errichteten Mausoleums der Königin Luise. Im Abschnitt: |
SEIT
DEM 23 DECEMB.
1810
Bolzenthal Denkmünzen p. 20, tab. IX, n. 58.


|
Seite 343 |




|
III. Friederike Caroline Sophie Alexandrine. (Tochter des Herzogs Carl, geb. 22. März 1778, vermählte sich am 26. December 1793 mit Friedrich Carl Ludwig, Prinzen von Preußen, nach dessen Tode († 28 Dec. 1796) am 10. Dec. 1798 mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Solms und als der am 13. April 1814 gestorben war, am 29. Mai 1815 mit Ernst August, Herzog von Cumberland, demnächst König von Hannover, und starb 29. Juni 1841.)
Silber 2 Loth. Größe 28.
| HS. | FRIEDRICH LUDWIG KARL PRINZ VON PREUSSEN Zweite Reihe: FRIEDRIKE KAROLINE SOPHIE PRINCESS. V. MECKLENB. STREL. Die beiden Brustbilder rechts neben einander, beide mit gekräuselten Haaren. Der Prinz in Uniform mit Ordensband. Unten LOOS. |
| RS. | DEM IUNGEN HELDEN AUCH DER MYRTHENKRANZ. Ein junger Held in altdeutscher Tracht mit einem Lorbeerkranze um das Haupt, sitzt auf eroberten Trophäen und empfängt mit der linken Hand, die rechte auf einen Schild gelehnt, von der in einem durch 2 Tauben in den Wolken gezogenen Göttin der Liebe einen Myrthenkranz. Im Abschnitt: |
DEN 26 DECEMB.
1793
Evers Münzverf. S. 341.
zugleich auf die Vermählung der Schwester Luise mit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm.
S. B. II, 3.
Silber (1 7/12 Loth). Größe 24.
| HS. |
FRIEDERIKE KAROL. SOPHIE
(2te
R.)
PRINZESSIN LUDW. V.
PREUSSEN
Das rechtsgekehrte
Brustbild mit gelocktem Haar,
darunter
LOOS.
Unten: |
D. 2 MÆRZ 1778


|
Seite 344 |




|
| RS. | IHREM FESTE DIESE FRÜHLINGSROSE Ueber einem viereckten Stein ist ein Purpurmantel ausgebreitet, worauf eine Rose am Stengel liegt. Im Abschnitt: |
2 MÆRZ 1794.
Evers Münzverf. II, p. 341.
Auf die folgenden Vermählungen ist eben so wenig, wie auf den Tod der Königin von Hannover bis jetzt eine Denkmünze geschlagen worden. (Nachricht vom Herrn Dr. Grote, Conservateur des Königl. Münzcabinets in Hannover.)
IV. Carl Friedrich August. (Sohn des Herzogs Carl, geb. 30. Nov. 1785, trat 1799 in preußische Kriegsdienste, ward 1805 Major, 1810 Obristlieutenant, 1812 Obrist, im Juni 1813 Generalmajor und 8. Dec. 1813 Generallieutenant, 1825 General der Infanterie, 9 Dec. 1827 Präsident des Staatsraths und starb 21. Sept. 1837. Am 25. Sept. ward die Leiche in der Gruft zu Mirow beigesetzt, wo der Sarg später von dem Officiercorps mit einem silbernen Lorbeerkranz geschmückt ward.
Silber. Bronze. Größe 29.
| HS. |
 CARL HERZOG VON
MECKLENB. STREL.
CARL HERZOG VON
MECKLENB. STREL.
 Das links gekehrte Brustbild,
unten
GEB. 30 NOV. 1785 GEST. 21
SEPT. 1837.
Das links gekehrte Brustbild,
unten
GEB. 30 NOV. 1785 GEST. 21
SEPT. 1837.
|
| RS. | Die Darstellung des Sargschmuckes. Auf einem Kissen, worauf die Worte: DEM FELDHERREN DEM HERZOG CARL V. MECKLENB. STRL. stehen, liegt oben die Herzogskrone, dann der Säbel mit Degenquast und darüber ein Lorbeerkranz, aus 2 Zweigen durch ein Band verbunden, dessen Blätter mit der Angabe der Schlachten bezeichnet sind und zwar auf dem obern Zweige bei der Schleife anfangend: G 21 A 3 (Gröditzberg den 21. August 1813), L G 19. A 3 (Löwenberg 19. August 1813), G 23 A 3 (Goldberg 23. August 1813), K 26 A 3 (Katzbach 26. August 1813), M 16 O 3 (Möckern 16. Oct. 1813), W 3 O 3 (Wartenburg 3. Oct. 1813), H 2 A 3 (?) Auf dem untern Zweige: A 16 O 6 (Auerstädt 16. Oct. 1806?), G 5 M 3 (?) H 26 M 3 (Haynau 26. Mai 1813), |


|
Seite 345 |




|
| B 21 M 3 (Bautzen 21. Mai 1813), GG 2 M 3 (Groß=Görschen 2. Mai 1813). Unten G. LOOS DIR. L. HELD FEC. |
Abendblatt. 1839 Nr. 1064.
V. Caroline Charlotte Mariane. (Tochter des Großherzogs Georg, geboren 10. Januar 1821, vermählt am 10. Juni 1841 mit Friedrich Carl Christian, Kronprinzen von Dänemark.)
Gold. Silber. Bronze. Größe 30.
| HS. | FREDERICUS REGNI DANICI HERES * CAROLINA PRINC: MEGALOPOLIT. Beider Brustbilder neben einander links gekehrt; das der Kronprinzessin ist mit einem Blumenkranze geschmückt; darunter: |
| CHR : CHRISTENSEN FC. |
| RS. | * HIS DUCIBUS JUNCTI * Der bekränzte Hymen zündet die Hochzeitsfackel an; neben ihm ein fliegender Eros, welcher in der Linken den Bogen hält, von dem er so eben ein Geschoß entsendet hat. Unten D. X JUN. A. MDCCCXLI. Darunter THORVALDSEN INV. KROHN FEC. |
Köhne Zeitschrift II, p. 186.
C. Anstalten.
I. Universität Rostock.
Silber (1/2 Loth). Größe 1 1/4 Zoll.
| HS. | ACADEMIA ROSTOCHIENSIS. Die schräge Seite eines Säulentempels der Minerva mit einem schrägen Dache auf steinigem Grunde. Im Abschnitt: |
ART. LIB.


|
Seite 346 |




|
| RS. | In einem Kranze von Lorbeer und Palmzweigen: |
MCCCCXIX



RESTAURATA
MDCCLXXXIX



FAUSTUMQOUE
SIT
Evers Mecklenb. Münzverf. II, p. 556. Vom Strelitzischen Hofmedailleur Hein gestochen und in Strelitz 1799 (?) geprägt. (Kostet 1 Rthl. 8 ßl.)
Silber 3 1/2 Loth. Größe 32.
| HS. | ALBERTUS & IOANNES ACADEMIAE ROSTOCHIENSIS CONDITORES MCCCCXIX. Die Brustbilder der beiden Herzoge übereinander, links gekehrt. Albert jugendlich und mit einer Krone, Johann im langen Barte und einer Schaube, beide in Haustracht, mit Ketten um den Hals, an denen Kleinode hangen. Unter den Bildern: A. AARON |
| RS. | FRIDERICUS FRANCISCUS ACADEMIAE ROSTOCHIENSIS (zweite Reihe): INSTAURATOR MDCCLXXIX. Das Brustbild des Großherzogs, rechts gekehrt, in gestickter Uniform, mit Epaulett, 2 Ordenssternen und einem blauen Ordensbande. Im Arme L. A. AARON. Unter dem Bilde: |
SAECULARIBUS
12. NOVBR. 1819
II. Badeanstalt Doberan.
Silber 1 Loth. Größe 22.
| HS. | BALINEVM DOBERANENSE CONDITVM. Das Badehaus zu Doberan mit 2 Blitzableitern auf dem Dache. Im Abschnitt: |


|
Seite 347 |




|
| RS. | CIVIVM EX SALVTE GLORIAM PETIT Auf einem Fußgestelle eine viereckte Pyramide mit einer Kugel auf deren Spitze, und dem Namenszuge FF. , worüber eine Krone, auf der Vorderseite. Auf der Leiste: M. Löser. & S. |
Evers Münzverf. II, p. 211, ist 1798 in der Herzogl. Münze geprägt.
III. Münze in Schwerin.
Fünfthalerstück. Größe 15.
| HS. | FRIEDR. FRANZ V. G. G. GR. HERZOG V. MECKLENBURG SCHW. Der rechtsgekehrte Kopf des Großherzogs. |
| RS. | Das vollständige, schraffirte Wappen mit einem offnen Helm, welcher eine Königskrone trägt, unter einem Fürstenmantel; unten: |
Silber 2 3/4 Loth. Größe 29.
| HS. | FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG VON MECKLENBURG SCHWERIN. Das rechtsgekehrte Brustbild. |
| RS. | DIE MÜNZE Abbildung des Münzgebäudes mit der Inschrift: GRHZL. MÜNZE und unter derselben: |
1829.
Die Hauptseite ist die zu den Verdienstmedaillen (D. I. B.) geschnittene.
IV. Loge zur Vaterlandsliebe in Wismar.
Größe 27.
| HS. | An einer Bandschleife ein neuneckiger strahlender Stern mit einem runden Schilde, in dessen Mitte Zirkel und Winkelhaken übereinander, auf dessen Rande umher die Zeichen und Buchstaben |
![[]](/file/mvdok_derivate_00000699/img/symbol_quadrat_14x14.gif) Z V L Z W
Z V L Z W
(Die Loge zur Vaterlands Liebe zu Wismar)


|
Seite 348 |




|
| stehen; unter dem Sterne streben links ein Eichen=, rechts ein Akacienzweig empor; darunter |
| In der durch eine Randlinie vom Felde getrennten Umschrift steht unten: |
| Oben rechts von unten anfangend: |
| RS. | Eine aufgerichtete brennende Fackel, darunter 2 Rosenzweige, rechts mit Knospen, links mit Blüthen; oben zu beiden Seiten der Fackel: |
| In dem Rande, wie auf der Hauptseite rechts von unten nach oben: |
| links von oben nach unten: |
D. Verdienst=Medaillen.
I. Civil=Verdienst=Medaille.
A. Die ältere.
| HS. | FRIEDERICH FRANZ HERZOG ZU MECKLENBURG. Das rechts gekehrte Brustbild im bloßen Haupte mit Zopf, in Uniform mit Ordensband und Stern; unter dem Arm: A. AARON |
| RS. |
 DEM
DEM

REDLICHEN MANNE
UND DEM
GUTEN BÜRGER
S. v. Biedenfeld Ritterorden t. XVIII, n. 1. 2. II, p. 262. Eves II, p. 211. Im J. 1798 nach dem Entwurfe des Reg.=Raths v. Brandenstein geprägt.


|
Seite 349 |




|
B. Die neuere.
| HS. | FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG VON MECKLENBURG SCHWERIN. Das rechtsgekehrte Brustbild mit kurzen Haaren und bloßem Halse. |
| RS. | In einem dicken Eichenkranze, der oben und unten einmal kreuzweise mit einem an den Rändern mit einer Linie versehenen Bande zusammengebunden ist: |
REDLICHEN MANNE
UND DEM
GUTEN BÜRGER
Beide werden an einem blauen, roth und gelb eingefaßten Bande getragen.
II. Medaille für Wissenschaft und Kunst.
A. Die ältere.
| HS. | FRIEDERICH FRANZ HERZOG ZU MECKLENBURG. Das rechtsgekehrte Brustbild in bloßem Haupte mit Zopf, in Uniform mit Ordensband und Stern; unter dem Arm: A. AARON |
| RS. |
 DEN
DEN

WISSENSCHAFTEN
UND
KÜNSTEN.
Evers Münzverf. II. auf dem Titel abgebildet und S. 211. Der Stempel der HS. ist der der Civil=Verdienstmedaille.
B. Die neuere.
| HS. | FRIEDRICH FRANZ GROSSHERZOG VON MECKLENBURG SCHWERIN. Das rechtsgekehrte Brustbild mit kurzen Haaren und bloßem Halse. |
| RS. | In einem dicken Eichenkranze, der oben und unten einmal kreuzweise mit einem an den Rändern mit einer Linie eingefaßten Bande zusammengebunden ist: |
WISSENSCHAFTEN
UND
KÜNSTEN
Der Stempel der HS. ist der der neueren Civil=Verdienstmedaille.


|
Seite 350 |




|
III. Militair=Verdienstmedaille. (Vom Herzoge Friederich Franz am 23. Juli 1814 "zu rühmlicher Anerkennung der muthvollen Thaten und des ausgezeichneten Benehmens der Truppen in dem ewig denkwürdigen Kriege gegen fremde Unterjochung" gestiftet und wird nach ihren beiden Classen in Gold und Silber an einem blauen Bande mit gelber und rother Einfassung im Knopfloche getragen.)
| HS. | Ein aufgerichtetes antikes Schwert mit einem Lorbeerzweige umschlungen zwischen der Jahrzahl 18 13. |
| RS. | Unter dem Namenszuge FF steht |
Streitern.
S. v. Biedenfeld Ritterorden II, p. 262, tab. XVIII, fig. 2 u. 3.
IV. Kriegsdenkmünze (vom Großherzoge Paul Friederich für die in den Jahren 1808-1815 im Felde geleisteten Kriegsdienste durch das Statut vom 30. April 1841 (S. Officielles Wochenblatt Nr. 15., v. Biedenfeld Ritterorden II. p. 264.) gestiftet, wird aus Geschützmetall an einem gelben Bande mit rother und blauer Einfassung auf der linken Brust getragen und ist auf dem Rande mit dem Namen des Inhabers bezeichnet.)
| HS. | Unter der großherzoglichen Krone die Buchstaben PF M in einander geschlungen. Darunter 1841. |
| RS. | In einem Lorbeerkranze, der oben offen ist und unten durch eine Schleife verbunden: |
TREUEN DIENST
IM
KRIEGE.
V. Ehrenpreis des patriotischen Vereins.
Größe 29. (Wird in Gold und Silber vertheilt und der Name des Empfängers eingravirt.)
| HS. | Minerva sitzend, den Speer neben sich gestellt und sich auf den Schild stützend, hält in der erhabnen Rechten einen Zweig, der sich in 3 Theile theilt, hinter ihr auf einer Säule sitzt die Eule und neben ihr steht ein Hakenpflug, liegt ein Hirtenstab und Weberschiff und Faden und Knäuel. |


|
Seite 351 |




|
| RS. | In einem vollen Eichenkranze |
MECKLENBURGISCHE
PATRIOTISCHE
VEREIN
FÜR
ACKERBAU INDUSTRIE:
ERTHEILT DIESEN
EHRENPREIS
E. Meklenburger.
I. Gebhard Lebrecht Fürst Blücher von Wahlstatt. (Geboren zu Rostock den 16. Dec. 1742, unterm 3. Jun. 1814 zum Fürsten erhoben, starb 12. Sept. 1819 zu Krieblowitz in Niederschlesien.)
Silber 15/16 Loth. Größe 29.
| HS. | FÜRST BLÜCHER V. WAHLSTATT Das links gekehrte, mit einem Lorbeer bekränzte, sehr ähnliche Brustbild mit einer Löwenhaut; unten IACHTMANN. |
Diese Medaille ist einseitig.
Silber 5/8 Loth. Größe 19.
| HS. | In einem Lorbeerkranze das Brustbild links gewendet, mit der Ueberschrift: |
| Unter dem Kranze: LOOS. |
| RS. | Ohne Umschrift das Wappen des Fürsten. Ein quadrirter Schild mit Mittelschild, worin im rothen Felde 2 silberne auswärts gekehrte Schlüssel. Im 1. und 4. silbernen Felde ein schwarzer, königlich gekrönter Adler mit goldenem Schnabel, Kleestengeln in den Flügeln und Fängen; im 2. goldnen: Schwert und Marschallstab durch einen Lorbeerkranz gesteckt; im 3. goldnen: das schwarze eiserne Kreuz mit seiner silbernen Einfassung. 4 gekrönte Helme stehen auf dem Schilde, der mittlere rechts trägt 2 überschränkt gelegte silberne Schlüssel, der mittlere links das Bild des 2ten Feldes; der äußere rechts hat den Adler und der |


|
Seite 352 |




|
| äußere links ein goldnes Banner mit dem eisernen Kreuze am goldnen Stabe. Schildhalter sind 2 königlich gekrönte Adler. Die Kette des schwarzen Adler=Ordens umgiebt den Schild und das Ganze steht unter einem aus einem Fürstenhute hervorfallenden Mantel. |
Silber 1/8 Loth. Größe 9.
| HS. | V. BLÜCHER FÜRST V. WAHLSTATT Brustbild in Uniform mit Stern und Ordensband. |
| RS. | In einem Lorbeerkranze |
ALLER
WELT
VEREHRTE
HELD
AN. 1813=14
GEB 16 DC.
1743.
Schraubenmedaille von Zinn mit einliegenden Bildern, welche die vom Fürsten Blücher gelieferten Schlachten vorstellen. Größe 19.
| HS. | FELD=MARSCH: FÜ: V.BLÜCHER. Das rechts gekehrte Brustbild in Uniform mit Orden um den Hals, Ordensband, 2 Sternen und einem Kreuze auf der Brust. Unten STETTNER. |
| RS. | SEIN NAHME GLAENZ SO LANG DIE ERDE SCHWEBT Der Kriegsgott ohne Helm, vorwärts gekehrt mit gesenktem Schwerte auf Armaturen stehend. |
Messing. Größe 16.
| HS. | FELDMAR : FÜRST VON BLÜCHER. Brustbild in Uniform mit Ordensband und Stern ; unten L. (Lauffer in Nürnberg). |
| RS. | DEM SIEGE SEIN LORBER. Ein Held mit gesenktem Schwerte wird bekränzt von der Siegesgöttin. Im Abschnitt: IETTON |
Silber. Größe 5.
| HS. | PRINCEPS BLUCHER. Der Kopf von der linken Seite mit Schnurrbart. |


|
Seite 353 |




|
| RS. | Zwischen 2 Lorbeerzweigen die Fasces mit dem Beile. |
Appel III, S. 74, Nr. 241.
Silber 1. Größe 5.
| HS. | PRINCEPS BLUCHER. Vom Stempel der vorigen. |
| RS. | Ein Palmzweig und eine Posaune liegen kreuzweise. |
Appel III, S. 74, Nr. 242.
Silber 1/8 Loth, mit Oehre zum Tragen als Schmuck bestimmt. Größe 10.
| HS. | GOTT SEGNETE DIE VEREINIGTEN HEERE Eine rechtshin gekehrte, geflügelte Siegesgöttin, die in der ausgestreckten Linken einen Kranz und in der Rechten ein flammendes Schwert hält. |
| RS. |
HAYNAU
DURCH
BLÜCHER
D. 26 MAI
1813
Appel IV, S. 371, Nr. 1388.
Silber 15/82 Loth. Größe 15.
| HS. | GEBH. LEBER. V. BLÜCHER FÜRST V. WAHLSTATT. Rechtsgekehrtes Brustbild in Uniform mit Stern und Ordensband. Am Arme C. L. (Lesser in Breslau). Unten GEB. D. 16. DECB. 1743. |
| RS. | DAS BEFREITE SCHLESIEN. Silesia mit ihrem Wappenschilde sitzend, rechtsgekehrt, hält mit der ausgestreckten rechten Hand vor sich eine Victoria. Im Abschnitt |
26. AUG.
1813.
Appel III, S. 74, Nr. 239, hat diese RS. mit der HS. von Nr. 10. verbunden.
Silber 1/2 Loth. Größe 17.
| HS. | ALBR. LEOP. V. BLÜCHER K. P. GENER. FELDMARSCHALL Rechtsgekehrtes Brustbild in Uniform |


|
Seite 354 |




|
| mit 2 Kreuzen am Halse, mit Ordensband, jedoch ohne Ordensstern und Schleife auf der Schulter. Im Arme C. L. Unten: GEB. 16. DECB. 1743. |
| RS. | DAS BEFREITE SCHLESIEN. Silesia sitzend und Sich stützend auf ihren Wappenschild, rechts gekehrt, hält mit der ausgestreuten rechten Hand vor sich eine Victoria. Im Abschnitt |
1813
Wie Nr. 8.
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
KATZBACH
DURCH
BLÜCHER
D. 26. AUGUST
1813
Wie Nr. 8.
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
BLÜCHERS
ÜBERGANG
ÜBER DIE
ELBE
BEI
WARTENBURG
D. 3. OCT.
1813
Appel IV, S. 1017, Nr. 3738.
Wie Nr. 8.
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
MÖCKERN
DURCH
BLÜCHER
D. 16. OCT.
1813
Appel IV, S. 599, Nr. 2167.


|
Seite 355 |




|
Messingcomposition. Größe 23.
| HS. | FELDMARSCHALL VON BLÜCHER. Das rechts gekehrte Brustbild in Uniform mit einem Orden um den Hals, 3 auf der Brust und Ordensband. Im Arme STETTNER. Unten IETTON. |
| RS. | DIE SCHLACHT V: BRIENNE. Vorstellung der Schlacht, rechts Infanteriequarree, 2 Kanonen neben sich, auf welche eine Cavallerie=Colonne zusprengt, hinter welcher, mehr im Vordergrunde, Infanterie marschirt; ganz hinten ein brennendes Dorf. Im Abschnitt: |
1814
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
LAON
DURCH
BLÜCHER
D 9 U. 10 MÆRZ
1814
Appel IV, S. 502, Nr. 1837.
Zinn. Größe 28.
| HS. | (Erste Reihe) DES DEUTSCHEN VOLKS UNSTERBLICHE HELDEN UND ZIERDEN (Zweite Reihe) KATZBACH MÖCKERN LEIPZIG BRIENE LAON KULM LEIPZ-BAR SUR AUBE FERE CHAMP MONTM: Ein Lorbeerkranz, nächst dem die einzelnen Buchstaben P A R I S außerhalb stehen und in demselben die beiden gegen, einander gekehrten nackten Brustbilder, welche die Ueberschrift über jedem bezeichnet: BLÜCHER SCHWARZENBERG |
| RS. | DIE DEUTSCHEN BRÜDER FÜR FRIEDEN U. VATERLAND SIEGER: Ein großes Thor, auf dessen Enden eine Spitzsäule, auf dessen Mitte eine Figur mit einer Fackel steht, bezeichnet mit P.TE DE PARIS, hat drei Eingänge, durch deren beide äußern Soldaten |


|
Seite 356 |




|
| einziehen, in der Mitte empfängt ein Held von einer knieenden Stadt einen Schlüssel. Ueber dem Thor schweben 3 fünfstrahlige Sterne, bezeichnet W. F. A. (Wilhelm, Franz, Alexander), ein Comet sinkt an der rechten Seite nieder. Im Abschnitt |
DEN 31. MAERZ
1814
| Auf dem Abschnitt PFEUFFER. |
Messing. Größe 17.
| HS. | F. MAR. G. L. VON BLUCHER. Rechts gekehrtes Brustbild in Uniform. |
| RS. |
LIBERTIES
OF EUROPE RESTD.
BY THE UNITED
EFFORTS OF ENGLAND
AND HER
AUGUST ALLIES.
THE
PRELIMINARIES
OF PEACE SIGNED
MAY 30
1814
In England gefertigt.
6. Junius 1814.
Bronze. Größe 37.
| HS. | CASTRENSIS PRAEFECTVS PRINCEPS WAGSTADT. MDCCCXIV. Das nackte rechts gekehrte Brustbild. Unten: |
DIREXIT.
| RS. | In einem unten mit einer Schleife gebundenen Lorbeerkranze |
A REGE SVO
APVD DVBRIM
IVNII VI MDCCXIV.


|
Seite 357 |




|
Bronze. Größe 36.
| HS. | G. L. VON BLUCHER und nach unten PRINCE OF WAGSTADT Das rechtsgekehrte nackte Brustbild; in dessen Abschnitt HALLIDAY F. |
| RS. |
BRITANNIARVM
MDCCCXIV
18. Jun. 1815.
Silber 15/16 Loth. Größe 25.
| HS. | Des Fürsten Blücher von Wahlstatt und des Herzogs Wellington gegen einander gestellte Bildnisse, die ein Lorbeerkranz umschließt, mit der Beischrift: BLÜCHER WELLINGTON Unter dem Kranze: LOOS. |
| RS. |
SIEGGEWOHNTEN
HELDEN
HERRLICHSTER SIEG
VON GOTT GEGEBEN
ZUM UNVERWELKLICHEN
LORBEERKRANZ.
MEINEIDIGEN FEINDES
NACH VIERTÆGIGER SCHLACHT
BEI
LA BELLE ALLIANCE
D. 18 IUNI 1815
Bolzenthal Denkmünzen p. 27, t. X. n. 77.
Silber 13/16 Loth. Größe 23.
| HS. | Die Bildnisse des Herzogs Wellington und des Fürsten Blücher auf einem mit Fahnen gezierten Schilde; über den Bildnissen ein Lorbeerkranz, unter denselben LA BELLE ALLIANCE. Umschrift: HERZOG VON WELLINGTON FÜRST VON BLÜCHER. ; unten ist ein Theil der Erdfläche sichtbar mit S. JOAN-WATERLOO und darauf liegt ein Schild mit den französischen Farben über einem Degen und zerbrochenen Adler. Am Rande F. STUCKART. F. |


|
Seite 358 |




|
| RS. | Unter einem auf Wolken schwebenden Genius, der Schwert und einen Schild mit den Fascees und der Inschrift M. S. JOAN-WATERLOO hält, die Aufschrift: |
ANDENKEN
DER FÜR DIE
VERBÜNDETEN HEERE
SO SIEGREICHEN,
FÜR EUROPAS WOHL
SO ENTSCHEIDENDEN
TAGE
DES 16 : 17 : 18 : JUNI.
1815.
| und im Rande ST . (Die Schrift steht rund niederwärts gekehrt.) |
Bolzenthal p. 27 beschreibt in der Note * ) diese durch Sauberkeit ausgezeichnete Arbeit des F. Stuckart in Wien.
Appel IV, S. 1018, Nr. 3742.
Messingcomposition mit Oehr. Größe 23.
| HS. | (Von unten nach oben) * HERZOG VON WELLINGTON (von oben nach unten) * FÜRST VON BLÜCHER Die beiden Brustbilder gegen einander gekehrt, beide in Uniform mit Ordensband, Blücher mit 2 Kreuzen und Stern auf der Brust. Unter beiden IETTON. |
| RS. | SCHLACHT BEI LA BELLE ALLIANCE. Vorstellung der Schlacht, rechts ein Generalstab zu Pferde, dem eine Colonne preußischer Infanterie mit fliegender Adlerfahne folget, im Hintergrunde aufgestellte Militairmassen und ein brennender Ort. Im Abschnitt |
1815.
Wie Nr. 8.
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
LA BELLE
ALLIANCE
DURCH
BLÜCHER
UND
WELLINGTON
D. 18 JUNI
1815


|
Seite 359 |




|
Silber 1/16 Loth. Größe 17.
| HS. | Ein querliegendes Schwert mit umwundenem Lorbeer, darauf liegt ein Helm, auf welchem eine Nachteule sitzt. |
| RS. |
BEI BELLE
ALLIANCE
DURCH HERZOG
V. WELLINGTON
UND FÜRSTEN
V. BLÜCHER
AM 18. IUNI
1815.
Appel IV, S. 97, Nr. 401. Eine kleinere (Gr. 8. wiegt 15 Gr.) wurde von einem Münzgraveur in Siebenbürgen nachgemacht.
Silber 15/16 Loth. Größe 25.
| HS. | Des Fürsten Blücher von Wahlstatt und des Herzogs Wellington gegeneinander gestellte Bildnisse, von einem Lorbeerkranz umschlossen, mit der Beischrift: BLÜCHER WELLINGTON. Unten LOOS. |
| RS. |
ENTSCHEIDENDEN
HELDEN-SCHLACHT
GLORREICHE
VOLLENDUNG
DER
PREUSSISCHEN
UND
ENGLISCHEN
SIEGER
IN
PARIS
D. 7 JULIUS
1815
Bolzenthal Denkmünzen p. 28. t. X. Nr. 79. (HS. von Nr. 20.)


|
Seite 360 |




|
Wie Nr. 8.
| HS. | GOTT SEGNETE u. s. w. Der Stempel von Nr. 8. |
| RS. |
DEN
SIEGREICHEN
EINZUG
BLÜCHERS
UND
WELLINGTONS
IN
PARIS
D. 7 JULIUS
1815
Messingcomposition. Größe 22.
| HS. | AUFS NEUE SIEGTEN SIE ZU ALLER VÖLKER GLÜCK Ueber einem Altar, auf dem eine Flamme brennt, reichen sich die zu den Seiten desselben stehenden Blücher und Wellington, beide in Uniform, die Hände und werden von einem in Strahlen herabschwebenden Engel mit einem Lorbeerkranze geschmückt. Im Abschnitt: |
IETTON
| RS. | ZWEITER EINZUG DER ALLIERTEN MONAR. IN PARIS. Zwei Reiter, gefolgt von einer Schaar Uhlanen, ziehen zur Stadt und werden am Thore von einem Manne, der den Hut in der Hand hat, empfangen. Im Abschnitt: |
1815
Silber 9 3/4 Loth. Größe 3 1/16 Zoll.
| HS. | In einem ovalen Rahmen, der mit einem Bande umschlungen ist, an der rechten Seite mit einem Lorbeer, an der linken mit einem Palmzweige, welche unten mit einer Schleife an dem Rahmen befestigt sind, geschmückt, ist Wellingtons halb vorwärts gekehrtes Brustbild in reicher Uniform mit Epauletten, Ordensband und Stern. Der Rahmen wird oben von einem Engel gehalten und dar= |


|
Seite 361 |




|
| über schwebt im Strahlenglanze eine englische Herzogskrone. Unter dem Rahmen ist eine Draperie mit der Inschrift: |
| Unten T. H. F. |
| RS. | Blücher, in Feldmarschalls=Uniform mit 3 Orden, auf dem Kopf einen Hut, in der erhobenen Rechten einen Commandostab, reitet auf einem mit Schabracke und Fliegennetz geschmückten Pferde rechts hingewandt und das Pferd tritt auf einen zu Boden liegenden Krieger in gestickter Uniform, der eine Brille trägt, die linke Hand flehend emporhebt und die Rechte auf die Brust hält und dessen Commandostab neben ihm zerbrochen da liegt. Im Hintergrunde rechts eine befestigte Stadt mit wehenden Fahnen, zu der 3 Menschen flehend aufsehen, links im Meere ein Felsen und davor ein Schiff, vor welchem 2 Menschen, ein stehender und ein sitzender, sich befinden. Ueber dem Reiter ein Band, in dessen Mitte BLÜCHER rechts davon auf dem herunterhangenden Ende, über der Stadt und dem zu Boden geworfenen Krieger:> |
TYRANT DAVOUST
| links auf dem Bande: |
EMPEROR.
| Ueber dem Bande in kleiner Schrift: |
| Im Abschnitt: |
Silber. Größe 9.
| HS. | V. BLÜCHER FÜRST V. WAHLSTATT. Brustbild in Uniform mit Stern und Ordensband. |
| RS. | In einem Lorbeerkranze: |
FRIED-
FEIER D. 18.
IAN. 1816
ZU
OHLAU.


|
Seite 362 |




|
Dem Fürsten zu Karlsbad am 3. Juli 1816 überreicht in Gold 150 Duc. schwer, in Silber 15 1/2 Loth. Größe 3 3/8 Zoll.
| HS. | Dem Fürsten Blücher von Wahlstatt die Bürger Berlins im Jahr 1816. Das rechtsgekehrte Bildniß des Fürsten, mit um die Schultern geworfener Löwenhaut, darunter Schinkel inv. König fec. Unten in der Umschrift ein Schild mit einem Bären, dem Wappen der Stadt Berlin. |
| RS. | Der gepanzerte Erzengel Michael mit entfalteten Flügeln, auf dem Haupte einen mit dem eisernen Kreuze gezierten Helm, mit der Linken das Gefäß des umgürteten Schwerts erfassend, mit der Lanze in der Rechten dem unter seinen Füßen liegenden, menschlich gestalteten Ungeheuer, an dessen Extremitäten man den Drachen erkennt, den Todesstreich versetzend. Die Umschrift besteht aus den 3 Jahreszahlen: .1813. und .1814. zu den Seiten, .1815. oben. |
Bolzenthal Denkmünzen p. 29. t. XXV. Nr. 85.
Bronze. Größe 27.
| HS. | FÜRST BLÜCHER VON WAHLSTATT. Das links gekehrte Brustbild, über demselben ein Kreuz in der Form des eisernen Kreuzes. Im Armabschnitt BRANDT. F. |
| RS. | Fürst Blücher als Jupiter, den flammenden Donnerkeil in der Rechten, auf einem mit vier Rossen bespannten Wagen stehend, und mit der Linken das Gespann lenkend; voran schwebt Victoria; über der Vorstellung schwebt der königliche Adler, Zepter und Reichsapfel haltend, unter den Jahreszahlen 1813 1814 1815. Im Abschnitt: |
GES T : 12 SEP: 1819
| Darunter ein Lorbeerzweig. |
Bolzenthal Denkmünzen p. 32 t. XII. Nr. 96.
Silber 1 3/16 Loth. Größe 28.
| HS. | GEBHARD LEBERECHT V. BLÜCHER FÜRST VON WAHLSTATT. Das linksgekehrte Brustbild. |


|
Seite 363 |




|
| RS. | Neben einend Altar, der die Inschrift trägt: |
SAH
UND
SIEGTE
| steht rechts der Kriegsgott mit gesenktem Schwerte, neben sich den Schild und legt einen Lorbeerkranz auf den Altar. An der linken Seite schwebt über Ruinen der Engel des Friedens herbei, mit einer Palme in der Linken und einem Sternenkranz in der Rechten, den er über den Altar hält, auf den aus an beiden Seiten zerteilten Wolken Strahlen herabschießen. Im Abschnitt: |
GEST: 12 SEPT:
1819
| Auf der Leiste LESSER. |
26. Aug. 1819.
Silber 3 7/8 Loth. Größe 35.
| HS. | DENKMAL DES FÜRSTEN BLÜCHER VON WAHLSTATT Die Abbildung des Denkmals; unter dem Fuße: IACHTMANN. F. |
| RS. |
IN SEINER
VATERSTADT
ROSTOCK
VON
MECKLENBURGS
FÜRSTEN
UND
VOLK
1819.
Abendblatt Nr. 88.
1827.
Silber 2 Loth. Größe 28.
| HS. | FÜRST BLÜCHER V. WAHLSTATT - MARSCHAL VORWÄRTS GENANNT. Das links ge= |


|
Seite 364 |




|
| kehrte Brustbild. Im Achselabschnitt H. GUBE FEC. Darunter G. LOOS DIR. |
| RS. | DEM FELDHERRN UND DEM HEERE DIE SCHLESIER Abbildung des Denkmals, unter ihm auf einer Leiste STATUAR. C. RAUCH. Im Abschnitt die Jahrzahlen |
1815
Bolzenthal Denkmünzen p. 42. t. X. Nr. 130.
II. Balthasar Ludwig von Wendessen. (Geboren zu Lichtenberg in Meklenburg=Strelitz 1721, trat 1739 in Preußische Kriegsdienste, zog als Premierlieutenant in den siebenjährigen Krieg und beendigte ihn als Major; ward 1770 Commandeur bei dem Renzelschen Regiment, 1783 Commandant in Breslau, 1789 Generallieutenant, 1791 Gouverneur zu Neiße, 1792 erhielt er den rothen Adler=Orden, 1793 übertrug ihm der König das breslauische Gouvernement und 1796 das warschauische, in Warschau starb er den 5. Dec. 1797.)
vom Officiercorps.
In Silber 1 7/8 Loth.
| HS. | BALTHASARI LUDOVICO A WENDESSEN WRATISLAVIAE REGUNDAE PRAEFECTO (2te Reihe) ARMIS VIRTUTE FIDE CLARO CARO CIVIBUS ET MILITIBUS Brustbild von der linken Seite in Generals=Uniform, mit der Decoration des großen rothen Adler=Ordens. Unten KOENIG (in Breslau) |
| RS. | VARSOVIAM UT IDEM MUNUS SUBIRET PETENTI D. 2 IANUAR 1796 (2te Reihe) GRATUS DUCUM LEGIONIS CUI PRAEEST ANIMUS. Ein Kranich, stehend auf den Fasces, worunter eine Löwenhaut ausgebreitet ist, hält in seiner rechten Klaue ein Steuerruder von einem Lorbeerzweige umwunden. |
III. Gabriel Christoph Lembke. (Königl. Schwedischer Landrath, Dr. der Rechte und Bürgermeister von Wismar, geboren am 19. Dec. 1734, ward am 2. Mai


|
Seite 365 |




|
1759 Dr. der Rechte in Jena, am 30. Juni 1762 in den Rath und am 18. Jun. 1777 zum Bürgermeister in Wismar erwählt und nachher königl. schwedischer Landrath und starb am 16. Mai 1825.)
Größe 30.
| HS. | DEM FREUND UND KENNER DER GESETZE. Neben einem vierseitigen Altar, dessen Vorderseite mit einer Waage zwischen 2 Eichenzweigen geschmückt ist, steht zur linken Seite eine antik gekleidete weibliche Gestalt mit der Mauerkrone auf dem Haupte, welche durch den mit der Linken gehaltenen Schild, worauf das Wappen der Stadt mit seinem Helm steht, als Wismar bezeichnet wird, und gießt mit der rechten Hand aus einer Schale in die auf dem Altare brennende Flamme. Hinter der Figur neben dem Stadtwappen steht ein rückwärts gewendeter Storch und rechts am Altare liegt ein linksgelehnter, ovaler Schild mit dem Lembkeschen Familien=Wappen, im Schilde und auf dem Helm ein Lamm mit einer Fahne. Im Abschnitte |
1812.
| Auf dem Fußboden links LOOS. |
| RS. |
FUNFZIGJÄHRIGEN
AMTS-JUBELFEIER
DES BÜRGERMEISTERS
K. SCHWED. LANDRATHS
UND
DOCTORS DER RECHTE
HERRN
GABRIEL CHRISTOPH
LEMBKE
ALS DENKMAL
DER HOCHACHTUNG
UND FREUDE
GEWIDMET
VON DER STADT
WISMAR


|
Seite 366 |




|
IV. Olaus Gerhard Tychsen. (Geboren zu Tondern 14. Dec. 1734, erhielt 1760 einen Ruf nach Bützow, wurde daselbst 1763 Professor der orientalischen Sprachen, 1789 Professor, Oberbibliothekar und Vorsteher des Museums, ward 1813 bei seinem Jubiläum Vicekanzler und starb am 30. Dec. 1815. - S. Olaf Gerh. Tychsen oder Wanderungen auf die mannigfaltigsten Gebiete der bibl. Asiat. Literatur. Ein Denkmal von A. Th. Hartmann. Bremen 1820.)
Größe 32.
| HS. |
FRUCTUS TULIT UBERRIMOS.
Ein
mit Früchten behangener Palmbaum
steht in einer Wüste, rechts von dem
Stamme steht das Wort Talmud in
rabbinischer Schrift ( ), links
eine jüdische Bezeichnung der Bibel
durch die drei hebräischen
Buchstaben Tav Nun, Kaph (
 ) und vor demselben
weiter unten das Wort Alkoran in
kufischer Schrift ( ). Im Abschnitt:
) und vor demselben
weiter unten das Wort Alkoran in
kufischer Schrift ( ). Im Abschnitt:
|
MDCCCXIII
| RS. |
 FRIDERICUS
FRANCISCUS DUX MEGAPOLITANUS
FRIDERICUS
FRANCISCUS DUX MEGAPOLITANUS
|
| Im Felde: |
GERHARDO TYCHSEN
DE
UNIVERSITATIBUS
LITTERARIIS
BUTZOVIENSI ET
ROSTOCHIENSI
PER
DIMIDIUM SAECULUM
OPTIME MERITO

O. G. Tychsen. 2 Bd. 3 Abth. p. 358 - 60. Das goldene Exemplar des Jubilars, 15 Duc. schwer, besitzt jetzt das acad. Münzkabinet in Rostock.
Beschreibung des Jubelfestes findet sich auch im Freimüthigen 1813 Nr. 283. Leipz. Lit. Zeit. 1814 Nr. 103.


|
Seite 367 |




|
V. Peter Johann Hecker. (Geboren zu Stargard in Hinterpommern den 18. Oct. 1747, ward 1778 von Berlin, wo er seit 1767 den Lehrvortrag der Mathematik in dem Friedrich=Wilhelms=Gymnasium übernommen, als ordentlicher Professor der Mathematik nach Bützow berufen, ward 1789 nach Rostock zur restaurirten Universität versetzt, feierte 1828 sein Jubiläum und starb den 17. Sept. 1835. - S. Abendbl. 1836 Nr. 911, wo auch 1828 Nr. 521. die Beschreibung der Jubelfeier.)
Größe 33.
| HS. | ORNAMENTA DOCTRINAE PIETATE ILLUSTRAVIT ET FIDE. Ein großer Eichenkranz. |
| RH. |
MEGAPOLEOS MAGNUS DUX
PETRO IOANNI HECKERO
MUNERE ACADEMICO
PER QUINQUAGINTA ANNOS
FIDELISSIME FUNCTO
D. XII. M. DECEMBRIS
A. MDCCCXXVIII.
Abendblatt Nr. 911 enthält die Beschreibung dieser von Nübell in 2 Exemplaren in Gold zu 25 Duc. und 50 Exemplaren in Silber geprägten Denkmünze, welche auch in Bronze vorhanden ist.
VI. Moritz Joachim Christoph Passow. (Geboren am 13. Mai 1753, ward er 1779 Rector in Ludwigslust, 1783 Instructor des Erbprinzen Friedrich Ludwig, 1784 Hofdiaconus, 1793 wirklicher Hofprediger, 1794 Superintendent in Sternberg und Consistorialrath, 1818 Oberhofprediger in Ludwigslust, 1819 Dr. der Theologie, feierte 1829 sein Jubiläum (Abendblatt 1829, Nr. 547) und starb 28. Jul. 1830. (S. Abendblatt 1830, Nr. 586.)
| HS. | PROPTER NOMEN DOMINI LABORAVIT NEQUE DEFATIGATUS EST. Auf einem Boden steht ein Kelch, hinter dem ein Kreuz liegt und vor dem eine aufgeschlagene Bibel, bezeichnet mit I. COR. I. 18. I. COR. X. 16. |


|
Seite 368 |




|
| RS. |
MEGAPOLEOS MAGNUS DUX
VIRO OPTIME MERITO
MAURITIO IOACHIMO CHRISTOPHORO
PASSOVIO
TH. D. CONCIONATORI AULICO PRIMARIO
CONSISTORIO A CONSILIIS
MUNERIBUS IN SCHOLA ET ECCLESIA
PER L ANNOS
D. XXVI APRIL. MDCCCXXIX
EGREGIE FUNCTO
D.
Abendblatt Nr. 547 hat die Beschreibung der Münze.


|
Seite 369 |




|



|



|
|
:
|
IV. Zur Geschlechter= und Wappenkunde.
1. Zur Geschlechterkunde.
Familie von Plessen.
Im südlichen Seitenschiffe des Doms zu Lübeck liegt ein Leichenstein mit den Umschriften:
Anno domini M. CCC. L. in die Marthe obiit dominus Johannes de Plesse, Lubicensis et Hamburgensis ecclesiarum canonicus. Anno domini M. CCC. LXVII. sequenti die Tiburcii obiit dominus Antonius de Plesse canonicus huius eeclesie. Orate pro eis.
| Lübeck. | Dr. E. Deecke. |



|



|
|
:
|
Familie von Bülow.
Im südlichen Seitenschiffe des Doms zu Lübeck steht:
Anno 1660 hat der Hochedelgebohrenn
. Herr Curth von Bülau, fürstl. Mechl. Pfandhauptman zu Gadebusch, auf Stintburg, Dronnewitz und Ostfeld Erbgesessen, diese Begräbnis erblich und zu ewigen Zeiten erkaufft und bewölben lassen.
Der Hochedelgebohrenn
. Herr Currth von Bülow ist auff diese Welt gebohren anno 1601 den 24 Martii, anno 1622 im Dec. mit seiner hertzlieben Frauen der Hochedelgebohrenn
. Fr. Hedewich von Dalwitz verehelicht und anno 1660 den 21 Decembris im Herrn selig entschlaffen.
Victor von Bülow, Curths Sohn, obiit an. 1624, die 3 Januarii.


|
Seite 370 |




|
In der St. Rochus=Capelle im Dom zu Lübeck liegt ein Leichenstein mit der Inschrift:
Anno domini M. CCCC. XC., die veneris, undecima Januarii, obiit venerabilis et egregius vir dominus Hartwicus de Bulow, decretorum doctor, huius lubicensis, hildesiensis et swerinensis, hamburgensis ecclesiarum canonicus - - -Orate pro eo.
| Lübeck. | Dr. E. Deecke. |



|



|
|
:
|
Familie von Pentz.
Im nördlichen Seitenschiffe des Domes zu Lübeck ist ein Epitaphium mit folgender Genealogie und Inschrift:
ANNO MDLXVI DEN XIII AUGUSTI STARF DER ERBARE UND EHRNVESTE JASPER PENTZE, ARFSETEN TO NUTZKOW.
|
BALTZER PENTZ
ZU REDVIN. | ULRICH PENTZ ZU REDVIN. | VOLRHAT PENTZ ZU REDVIN. | JASPER PENTZ ZU NUTZKOW. | BALTZER PENTZ ZU NUTZKOW. | MARQUART PENTZ ZU NEUENDORF UND WARLITZ. |
MAGDALENE VON
BASSEWITZ.
| | SOPHIA VON VIEREGGEN. | | MARGARETE SEESTADEN. | | ANNA VON BOECWOLT. | | ANNA POWISCHE. | | ANNA VON THINEN. |

|
|
| CHRISTIANUS PENTZE | |
| REGIAE MAJESTATIS DANICAE ET NORWEGICAE CONSIL. FORTALITII GLÜCKSTADTENSIS GUBERNATOR, DOMINUS IN NEWENDORF ETC. IN AVORUM SUORUM MEMORIAM RENOVARI CURAVIT | |
| A. CHR. MDCXXXIII. | |
| Lübeck. | Dr. E. Deecke. |


|
Seite 371 |




|



|



|
|
:
|
Denkstein von Selow.
Auf dem Felde des Dorfes Selow bei Bützow steht ein Denkstein, welcher in der Gegend sehr bekannt und in der Literatur öfter besprochen ist. Zuerst beschrieb ihn Mantzel in den Bützowschen Ruhestunden, XIII, S. 16 flgd., darauf Günther im Jahresber. III, S. 190. Die Entzifferung der Inschrift war bisher nicht gelungen. Mantzel hatte jedoch den Anfang derselben ziemlich richtig gedeutet, konnte aber den Namen nicht lesen und brach bei demselben ab; auch sah er auf dem Wappenschilde 3 Hasenköpfe, und daher hat man den Stein für einen hasenkopfchen oder maltzanschen Denkstein gehalten, um so leichter, als in dem Kriege mit dem Fürsten Heinrich die bischöfliche Parthei der Maltzan mit der Ritterschaft des Landes Bukow hier ein Treffen bestand (vgl. Rudloff II, S. 244).
Der Stein steht gegen das Ende der Feldmark Selow, links dicht am Wege von Bützow nach Doberan, "auf der dritten Hufe des Dorfes", nahe bei dem Bauerhofe, mit der Hauptseite gegen Norden gekehrt. Er ist von hellem, quarzreichen Granit und dem zu Jahresber. II in Abbildung beigegebenen von bernstorffchen Denksteine ganz ähnlich, enthält aber weder ein hasenkopsches Wappen, noch ist die Inschrift unleserlich; vielmehr ist alles sehr gut erhalten und klar.
Auf der nördlichen Hauptseite knieet in der Mitte eine betende männliche Figur, ohne Kopfbedeckung, in kurzem Wams, ohne Waffen und Schmuck; vor derselben steht ein Schild mit 3 Schaafs= oder Lammesköpfen.
Oben in der Rundung ist ein Crucifix ausgehauen. Am Rande umher steht die Inschrift, oben von der rechten Seite beginnend:

(= Anno domini MCCCIC (= 1399) in die beati Viti martiris (= Junii 15) obiit Hermannus Lameshovet.)
Ueber der Figur steht ein geschlungenes Band mit der Inschrift:

(= Misere mei deus.)
Auf der Rückseite steht dieselbe Darstellung, jedoch ohne Umschrift; auf dem Bande steht dieselbe Inschrift:
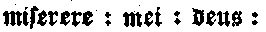


|
Seite 372 |




|
Der Stein ist also zum Gedächtniß eines gewissen Hermann Lammeshaupt oder Lammeshovet errichtet, welcher nach der Kleidung und dem Mangel an Würdenbezeichnungen ein Bürger, vielleicht ein reisender Kaufmann, war, der hier seinen Tod fand. In einer im Archive der Stadt Gadebusch aufbewahrten Urkunde vom 1. Oct. 1411 wird ein lübecker Bürger Hermann Lammeshovet (Hermannus Lammeshouet ciuis Lubicensis) als Testamentsvollstrecker eines andern lübecker Bürgers genannt; vielleicht war dieser ein Sohn des bei Selow gestorbenen Mannes. - Zu dem Namen Lammeshovet stimmt auch das redende Wappen auf dem Steine. - Die Volkssage von dem hier vorgefallenen Kampfe zweier Ritter ist also nichts weiter, als eine Sage.
Wir verdanken diese Aufklärung der Beförderung des Herrn Reichsfreiherrn A. von Maltzan auf Peutsch.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Personennamen
in Beziehung auf Meklenburg,
aus dem lübecker Oberstadtbuche
mitgetheilt
vom
Dr. Deecke zu Lübeck.
| 1) | Geistliche: | |
| 1295. |
dominus
Johannes, prepositus et plebanus in
Robele
1
).
(Sein Bruder heißt: Ludwig, beider Vater: consul Hinricus Storm.) |
|
| 1285. | dominus Hermannus, plebanus in Malchowe. | |
| Nonnen: | ||
| 1289. | Wibe, filia Werneri de Stella, in claustro Cernentin | |
| 1292. | Wibe, filia Werneri de Stella, in claustro Cernentin | |
| 1299. | Dhitburgis, monialis in Dobbertin. | |
| 1308. | Heylewich de Dule, monialis in Campo Solis. | |


|
Seite 373 |




|
| 2) | Städtebewohner: | |
| Rostock: | ||
| 1295. | Hermannus Lyse cives in Rostock. | |
| Bertrammus Damen cives in Rostock. | ||
| Wismar: | ||
| 1287. | Johannes dictus Vette Knecht, institor de Wismaria. | |
| 1303. | Hinricus Bodin de Wismaria. | |
| Parchim: | ||
| 1288. | Johannes Thidemannus dicti Stuten, cives in Parchem. | |
| Gadebusch: | ||
| 1294. | Johannes de Hamelen, civis in Godebuce. Item 1309 et 1310. | |
| 1295. | Hinricus Roggenbuc de Godebuce. | |
| 1312. | Johannes de Godebuce, frater Nicolai de Molendino. | |
| Sternberg: | ||
| 1312. | dominus Thidericus Ketelhod et uxor eius Walburga, Sternenbergenses. | |
| Röbel: | ||
| vid. 1295. | dominus Johannes plebanus in Robele. | |



|



|
|
:
|
2. Zur Wappenkunde.
Hanenzagel und Hanenstert.
In Lisch Geschichte und Urkunden des Geschlechts Hahn I, A., S. 54 flgd., sind auch die Geschlechter Hanenzagel und Hanenstert behandelt und auf der beigegebenen Lithographie Fig. 5 und 6 auch die Siegel beider Geschlechter abgebildet: Hennekin Hanenzagel hat 1360 einen rechts schreitenden Hahn mit zwei Füßen, ohne Hals, der Knappe Willekin Hanenstert 1302 drei Hahne mit einem Fuße, ohne Hals im Wappen. An einer Urkunde im Archive zu Stettin vom 3. Februar 1324 hängt nicht allein das oben erwähnte Siegel des Knappen Willekin Hanenstert, sondern auch das Siegel seines Bruders, des Knappen Conrad Hanenstert, dieser hat ganz das Wappen des Hennekin Hanen=


|
Seite 374 |




|
zagel: einen rechts schreitenden Hahn ohne Hals jedoch steht der Hahn nur auf einem Fuße, wie die Hähne in dem Wappen seines Bruders.
G. C. F. Lisch.
Siegel des Martin Kalsow.
Der Verein kaufte ein messingenes Siegel aus dem 14. Jahrhundert. Es ist rund und hat im Siegelfelde ein Hauszeichen wie ein römisches V, an dessen rechten Balken eine Linie rechtwinkelig angesetzt ist, wahrscheinlich ein mißverstan=
K; die Umschrift lautet:
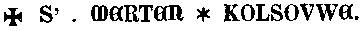


|
Seite 375 |




|



|



|
|
:
|
V. Zur Sprachkunde.
Christliche Zeit.
Niederdeutsches Evangelienbuch
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts,
von
G. C. F. Lisch.
Die niederdeutsche Sprache wartet noch immer auf die verdiente historische Entwickelung ihrer Formen und ihres Ganges. Noch sind aber nicht einmal ihre Denkmäler erforscht. Freilich ist es nicht viel, was sie aus alter Zeit aufzuweisen hat, aber doch genug, um ihren Werken einen Platz in der Entwicklungsgeschichte der allgemeinen deutschen Literatur zu gönnen. Die dichterischen Werke haben sich von jeher einer besondern Berücksichtigung zu erfreuen gehabt; wie in allen Sprachen, ist auch von der Prosa der ältern niederdeutschen Mundart bisher wenig die Rede gewesen, und doch ist ihre Kenntniß im höchsten Grade wichtig.
Die ältesten niederdeutschen Sprachdenkmäler in Prosa sind die Rechtsbücher und die Particularrechte, wie die Stadtrechte, Morgensprachen, Gildensatzungen udgl. Ihnen folgen die Urkunden; diese waren bis zum Ende des 13. Jahrh., mit sehr wenigen Ausnahmen, lateinisch abgefaßt; erst mit dem Anfange des 14. Jahrh. kommen deutsche Urkunden einzeln vor, bis sie in der Mitte des 14. Jahrh. häufig und bald, mit Ausnahme der geistlichen Urkunden, allgemein werden. So reiches Material die Rechtssatzungen und die Urkunden auch geben, so bewegen sie sich doch in bestimmten, beschränkten Kreisen und in gewissen Formen. Mit dem Durchdringen der deutschen Sprache für die Urkunden treten im 14. Jahrh. auch die niederdeutschen Chroniken in Prosa hervor, unter denen die Chroniken der Stadt Lübeck die erste Stelle


|
Seite 376 |




|
einnehmen, welche sich freilich schon freier, aber doch auch in einem gewissen, herkömmlichen Style bewegen.
Man muß daher zur vollen Würdigung der niederdeutschen Sprache nach andern Geisteswerken suchen, welche eine andere Richtung haben, als eine juristische und historische. Zugleich mit den Urkunden und Chroniken erscheinen geistliche Bücher, wie Bibelübersetzungen, Evangelien, Gebetbücher u. s. w., welche zum Theil bis zum Anfange des 15. Jahrh. in neuen Redactionen fortleben. Im Meklenburgischen sind bis jetzt ganze Bücher dieser Art nicht bekannt geworden; aber einige Fragmente geben doch einen vollständigen Begriff von der geistlichen Sprache des 14. Jahrh.
Das älteste Fragment eines Andachtsbuches ist aus einem alten Evangelienbuche. Es ist ein im großherzogl. Geh. und Haupt=Archive aufgefundenes Blatt Pergament in kl. Fol., mit gehaltenen Columnen, mit rothen Anfangsbuchstaben und Ueberschriften. Die kleine, stumpfe Minuskel deutet auf die Mitte des 14. Jahrh., für welche Zeit auch die Sprachformen reden, wie z. B. der durchgehende Gebrauch der enklitischen Negation en -, deren regelmäßige Anwendung mit der Mitte des 14. Jahrh. in den Urkunden aufhört, die abgekürzten Verbalformen, einzelne alte Sprachformen, wie stempne (Stimme) u. s. w.
Fragment eines Evangelienbuches.
Pergament=Handschrift
im großherzogl. Geh. u.
Haupt=Archive zu Schwerin aus der Mitte
des 14. Jahrh.
In der tyd weren gemâket ghemeyne wertschop to Jherusalem, vnde it was winter; men Jhesus wanderde an den tempel an de porten Salomonis. Dâr vmme vengen ene de iôden vnde sprêken: wo lange krokestů vnse sêle; bistů Cristus, dat segge vns âpenbâr. Do sprak Jhesus: ik spreke mit iů vnde gy en lôuet des nicht; de werk, de ik dô in dem nâmen mynes vâders, de betûget van my; men gy en lôuet des nicht, wente gy en sîn van mynen scâpen nicht. De myne scâpe sîn, de hôret myne stempne, vnde ik bekenne se, vnde se volget my vnde gheue en dat êwige leuent, vnde se vorderuen nicht vnde nêmant nympt se von mynen handen vnd nêmant mach se nemen van mynes vâder henden. Ik vnde myn vâder sîn eyn. Do hâlden de iôden steene, vp dat se ene steenden.


|
Seite 377 |




|
Do sprak Jhesus: vele gûder werk hebbe ik bewîset van mynem vâdere; vôr welke desser werk steene gy my? Do sprêken de iôden: vmme dîne gûden werk steene wy dy nicht, men dor dîne blasfemighen, dat du ên mynsche bist vnde mâkest dy got. Do sprak Jhesus: en is nicht gescreuen in iůwer êe, wente ik gesprôken hebbe, gy sîn gode, do sprak he, dat gy gode weren, to den, den godes wort gesprôken wart, vnde de scrift mach nicht vorstôret werden, den de vâder heft gehilghet vnde ghesant an de werlt, vnde gy spreken, wente du blasphemest, wente ik sprak, ih bin godes sône. Is it dat ik nicht en dô mynes vâders werk, so en lôuet my nicht; is it âuer dat ik. se dô, en wil gy my denne nicht lôuen, so lôuet mynen werken, vp dat gy lôuen bekennen vnde gy glôuet, wante de vâder an my is vnde ik an dem vâdere.
In der tyd do etlyke van der schâere hôrden de wort Jhesu, do sprêken se: he is wêrliken ên prophete; de anderen sprêken: he is Cristus, vnde etlike sprêken: is echt Cristus ghekômen van Galylea? En sprekt nicht de scrift: van Dauites slechte vnde van Bethlahem dem castelle is Cristus gekômen. Aldus was twîuel vnder der schâr, vnde etlike wolden ene vanghen, vnde nêmant lede sîne hand an em. Do quêmen de dênstknechte to den biscopen vnde to den glyseners, vnde se sprêken to den dênstlûden: wôr vmme en hebbe gy enen nicht gebracht? Do antwardeden de dênslûde: ny ên mynsche redede also wol, alse de mynsche. Do sprêken de glyseners: sêe gy icht also de propheten edder de vorsten oder de glyseners an em lôuende, sunder de schâren, de nicht hebben bekannt; de êe is vorvůllet. Do sprak to em Nychodemus, de des nachtes to Jherusalem kômen was, de ôek eyn der glyseners was, de ordêl vnser êe: de richtet nicht den mynschen, êr he se hebbe hôrt vnde bekam wert. Do sprêken se: Bistu ôk ên Galileus? He wâre de scrift vnde syk suluen; wente de prophete van Galylea nicht vp en steit. Dâr na ghink mâlk in sîn hûs.
In der tyd hadden de biscope vnde de glyseners ênen rad vnde sprêken: wat dô wy dessen mynschen,


|
Seite 378 |




|
wente he vele têkene dôet? Lâte wy ene aldus? Al dat voelk lôuet an em, vnde so kômen de Romere vnde nemen vnse herscop vnde vnse voelk. Do sprak eyn vnder en, de hêt Cayphas, ên byscop des iâres:
gy en wêten nicht, noch kônet denken; it temet yo wol vnde is beter, dat eyn mynsche sterue vôr dat volk, wen dat alle mynschen vorderuen. Dit en sprak he nicht van sik suluen, men he was ên biscop des iârs vnde prophetirede dat, dat Jhesus was staruende vôr dat voelk, nicht allêne vôr dat voelk, men dat godes kindere, de dâr weren verschuchtert, worden in ein gesamelt. An deme suluen dâghe weren se denkende, wo se ene dôdeden. Vnde Jhesus wanderde nicht âpenbâr by den iôden, men he ghink in êne stad, de hêt Efferem, vnde dâr blêf he mit sînen iungeren.
VI. Zur Schriftenkunde.
1. Urkunden.
Der Verein gewann an Urkunden;
I. Von dem Herrn Bagmihl zu Stettin Abschriften von folgenden Urkunden aus dem pommerschen Provinzial=Archive zu Stettin:
| 1) | 1289. |
Jan. 27. (sexto kal.
Febr.)
d. d. Stolp. |
Der Fürst Pribislav von Wenden, Herr zu Daber und Belgard, schenkt dem Kloster Bukow 200 Hufen im Lande Belgard, sich jedoch für seine Lebenszeit die Hälfte des Ertrages vorbehaltend.
| 2) | 1304. |
Jan. 28. (fer. III ante
purif. Mariae.)
d. d. Stettin. |
Der Herzog Otto von Pommern bestätigt die von seiner Mutter Mechthild dem Nonnenkloster vor Stettin zunächst zu Gunsten ihrer Enkelinnen Mechthild und Beatrix, Gräfinnen von Schwerin, Nonnen in demselben Kloster, gemachte Schenkung von 8 Hufen in dem Dorfe Daber.
| 3) | 1306. |
Aug. 15. (fer. II post
domin. Deus in adj.)
d. d. Stettin. |
Die Herzogin Mechthild von Pommern schenkt, unter Zustimmung ihres Sohnes Otto, dem Nonnenkloster vor Stettin 8 Hufen im Dorfe Daber, zunächst zum lebenslänglichen Gebrauch ihrer beiden Enkelinnen Mechthild und Beatrix Gräfinnen von Schwerin, Nonnen in demselben Kloster.
| 4) | 1324. |
Febr. 3. (in crast.
purif. Mar.)
d. d. Wismar. |
Vogt und Rathmänner der Stadt Wismar bezeugen, daß vor ihnen die Brüder Conrad und Willekin Hanenstert, Knappen, eine Hebung von 1 1/2 Wispel Roggen dem Nonnenkloster zu Stettin übertragen haben.


|
Seite 380 |




|
II. Von dem Herrn Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg 12 aus dem Nachlasse des vor bereits 20 Jahren verstorbenen Professors Hartmann zu Hamburg gekaufte Urkunden über die Vicareien der Pfarrkirche zu Sternberg;
| 1) | 1317. |
März 4. (fer. VI ante
dominicam Oculi.)
d. d. Vicheln. |
Der Fürst Heinrich von Meklenburg bestätigt eine von Berthold Wamekow und dessen Brüdern, Bürgern zu Sternberg, mit 20 Mark jährlicher Hebung aus dem Dorfe Torgelow gestiftete Vicarei in der Kirche zu Sternberg.
| 2) | 1373. |
Nov. 4. (des
vrygedaghes na alle ghodes hilghen
daghe.)
d. d. Sternberg. |
Der Herzog Johann von Meklenburg erlaubt den sternberger Bürgern Bernd von Rüst und Thideke von Parem, 6 1/2 Mark und 2 1/2 Schill. lüb. Pfenn. Hebungen aus den Dörfern Pastin und Zülow zu Vicareien zu bestimmen.
| 3) | 1437. |
Aug. 21. in assumptione
b. virginis.)
d. d. Sternberg. |
Behende Hans errichtet sein Testament in der Art, daß er sein Vermögen seiner Ehefrau vermacht, diese jedoch vier Wallfahrten, nach Aachen, Golm, Wilsnack und Kenz, für sein Seelenheil thun lassen soll.
| 4) | 1443. |
Mai 27.
d. d. Sternberg. |
Der sternberger Bürger Hermann Berch verpfändet den Vicarien zu Sternberg 8 lüb. Schill. jährlicher Hebung aus seinem Hopfenhofe und 1 1/2 Morgen Ackers, bei dem Hopfenhofe gelegen.
| 5) | 1470. |
Julii 22.
d. d. Sternberg. |
Der sternberger Bürger Martin Volbrecht verpfändet dem Vicar Dietrich Bruno zu Sternberg und seinen Nachfolgern 1 lüb. Mark jährlicher Hebung aus seinem Hopfenhofe auf dem Reimerskamp.
| 6) | 1470. |
Julii 22.
d. d. Sternberg. |
Auszug aus dem Testamente des Heinrich Wredenhagen, insoferne er die Vicarien zu Sternberg betrifft.


|
Seite 381 |




|
| 7) | 1482. |
März 12.
d. d. Sternberg. |
Henning Tengel verpfändet den Vicarien zu Sternberg 8 lüb. Schill. jährlicher Hebung aus 3 Morgen Ackers auf dem lucower Felde.
| 8) | 1495. |
Oct. 13.
d. d. Sternberg. |
Der Vicar Heinrich Stolpe zu Sternberg, im Namen der Erben des Drewes Barendorf, verkauft dem Ritter=Kaland zu Sternberg 8 lüb. Schill. jährlicher Hebung aus einem Acker auf der Dömelow.
| 9) | 1502. |
Julii 14.
d. d. Sternberg. |
Die Wittwe Katharine Langhannes zu Sternberg verpfändet dem Priester Heinrich Mormann 12 lüb. Schill. jährlicher Hebung aus 3 Morgen Ackers vor dem lukower Thore hinter dem Buchholze.
| 10) | 1502. |
Aug. 21.
d. d. Sternberg. |
Der sternberger Bürger Henneke Bockholt verpfändet der Wittwe Anna Restorf 4 lüb. Schill. jährlicher Hebung aus seinem Kohlgarten.
| 11) | 1517. |
Febr. 17.
d. d. Bützow. |
Zutpheldus Wardenberg, Administrator des Bisthums Schwerin, confirmirt eine an dem Martins=Altare in der Kirche zu Sternberg mit einem Hause in der Ritterstraße, 5 Morgen Ackers und 14 Mark lüb. Hebungen fundirte Vicarei.
| 12) | 1561. |
Mai 29.
d. d. Bützow. |
Der Dechant Johann Dalhusen zu Bützow verleiht dem Jacob Netzeband ein Lehn am Maria=Magdalenen=Altare in der Pfarrkirche zu Sternberg.


|
Seite 382 |




|
2. Bücher.
Chronik von Schwerin
1600 - 1710,
unter dem Titel:
Annales einiger Mecklenburgischer mehrentheils die Stadt Schwerin betreffender Geschichte, aus eigenhändigen Diariis Schwerinscher Gelehrten zusammengetragen
. von ao. 1600 bis 1728,
ein handschriftliches Heft in 4., erwarb der Verein durch Geschenk des Herrn Burgemeisters Daniel zu Rehna. Am Ende ist etwas ausgerissen, so daß die Chronik für die Jahre 1711 - 1728 fehlt. Die ältern Aufzeichnungen haben natürlich wenig Werth, da sie nichts Neues bringen; die jüngern Berichte enthalten aber als gleichzeitige Aufzeichnungen manche schätzenswerthe Nachricht über die Stadt und den Fürstenhof.
Voran gebunden sind Nachrichten über die
Einweihung der Schelfkirche, fürstliche Einzüge
und Leichenzüge, Illuminationen bei feierlichen
Gelegenheiten
 . aus dem 18. Jahrh., von denen
Abschriften nicht selten sind.
. aus dem 18. Jahrh., von denen
Abschriften nicht selten sind.


|
Seite 383 |




|



|



|
|
:
|
VII. Zur Buchdruckkunde.
Novum Testamentum
per Desiderium Erasmum Roterodamum.
1530.
Das in Jahrb. IV, S. 177, Nr. 48, nach Panzer aufgeführte lateinische Neue Testament nach der rostocker Ausgabe von 1530, welches dort nicht beschrieben ist, weil kein Exemplar zu finden war, ist von dem Vereine auf der schildenerschen Auction zu Greifswald erstanden.
Das Buch ist in klein 8, jeder Bogen in Lagen von 8 Bl., mit Sign. A-ZZ, mit Folienbezeichnung 1 - 366 und Columnentiteln gedruckt; auf dem Bogen ZZ beginnt ein Index, welcher sich durch aa-bb fortsetzt; vorangeheftet sind Einleitungen auf Bogen signirt a-c. Der ganze Satz ist in kleinen gothischen Lettern ausgeführt.
Der von Holzschnitt=Typen eingefaßte Titel lautet:

Auf der Rückseite beginnt auf 7 Seiten:

Dann folgt auf 16 Seiten:
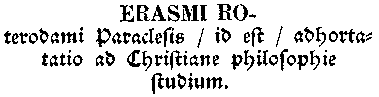


|
Seite 384 |




|
Darauf folgt auf 1 1/2 Seiten:

datirt: Basilee. VI Idus Februarii / Anno XXVI, woran sich unmittelbar schließt und bis zum Texte fortgeht:

u. s. w. für die vier Evangelien.
Hierauf folgt der Text von fol. 1 bis fol. 360a.; diesem ist angehängt
von fol. 360 b. an:

von fol. 362 a. an bis 366:

Das Ganze schließt, ohne Folienbezeichnung, auf 27 Seiten, mit:
Auf der letzten Seite steht das größere, runde Druckerzeichen von Ludwig Dietz, wie es am Ende des Katechismus von 1540 steht und Jahrb. IV, S. 183-184 beschrieben ist, mit der Umschrift:
und darunter:

G. C. F. Lisch.


|
Seite 385 |




|



|



|
|
:
|
Hermann Barckhusen
und
das hamburger Brevier
von 1508
In der ältern Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg, Jahrb. IV, S. 66 flgd., 69-71 und 81, ist nachgewiesen, daß Hermann Barckhusen im Jahre 1508 den Druck eines hamburger Breviers übernommen habe. Von diesem Brevier war bis dahin kein einziges Exemplar aufgefunden und es ward daher angenommen, daß das im Verlage des Hermann von Emden von Johann Prüß zu Straßburg im J. 1509 gedruckte Meßbuch dasjenige sei, dessen Verlag Hermann Barckhusen übernommen habe; es ward dabei vermutet, daß der Name Hermann von Emden ein anderer Name des Hermann Barckhusen sei. Diese Vermuthung fällt aber fort, nachdem von beiden Büchern ein Exemplar aufgefunden ist, dieselben also verschieden sind: man vergl. Lappenberg Zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg, 1840, S. XXIX, S. 11 und 120. Das Brevier, welches nur in Einem Exemplare in der Bibliothek des Herrn Seniors Dr. Rambach zu Hamburg aufzufinden gewesen ist, ist ohne Druckort, Druckernamen und Jahreszahl und der Beschreibung nach dasjenige Werk, welches Hermann Barckhusen in Verlag nahm (vergl. Lappenberg a. a. O. S. 11 und XXIX). Das Meßbuch dagegen (vergl. Lappenberg das. S. 120) ist auf Kosten des Buchhändlers Hermann von Emden zu Straßburg durch Johann Prüß gedruckt:
Beide Werke sind also zu gleicher Zeit gedruckt.
Für Meklenburg bleibt hiervon das von Interesse, daß Hermann Barckhusen nicht den zweiten Namen Hermann von Emden führte; daß er aber den Beinamen Petri (Sohn) von Wertborg führte, bleibt nach Jahrb. IV, S. 71, unbestritten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 386 |




|



|



|
|
:
|
VIII. Zur Rechtskunde.
Die Straßengerechtigkeit in Meklenburg.
Von
A. F. W. Glöckler.
1. Einleitung.
In Meklenburg sind manche heimische Rechts=Institute von den frühern Romanisten wenig nach Ursprung, Bedeutung und localem Herkommen erörtert worden. Hiedurch haben unter Anderm auch die bäuerlichen Rechtsverhältnisse gelitten[ 1 ), auf deren Entwickelung freilich auch durch manche politische Umstände wesentlich eingewirkt worden ist. Es fehlt in Meklenburg, wie in Norddeutschland überhaupt an Weisthümern und Bauersprachen, welche die altherkömmlichen Rechte des Landvolks nachweisen, fast gänzlich 2 ). Dies ist wesentlich wohl darin begründet, daß ein freier, mit vollem Eigenthum dotier Bauernstand ohne Herrendienst in unsern Gegenden geschichtlich so gut wie unbekannt ist. Diese Thatsache hat jedoch eine mannigfaltige, zum Theil sehr erfreuliche, mehr oder minder günstige Entwickelung der Colonats=Verhältnisse im Einzelnen während des Mittelalters nicht ausgeschlossen. Namentlich gilt dies von manchen geistlichen Besitzungen. Die neuere Wissenschaft des einheimischen Rechts hat fast ausschließlich für Lehn= und Lübisches Recht Quellen eröffnet oder Zerstreutes gesammelt und bearbeitet. Schon aus diesen Gründen wird eine Nachweisung über die Straßengerechtigkeit in Meklenburg, als bezeichnend für das Wesen früherer ländlicher Rechtsverhältnisse, hier Platz finden.


|
Seite 387 |




|
Es kommt aber hinzu, daß überhaupt die Geschichte des meklenburgischen Landvolks, namentlich die Frage der Entstehung und Ausbildung der Leibeigenschaft, sehr im Dunkeln liegt, obgleich die Frage der Aufhebung der Leibeigenschaft bei uns eine Literatur hervorgerufen hat. , Leider haben auch v. Wersebe's treffliche Forschungen über die in Norddeutschland gestifteten niederländischen Colonien des 12. Jahrhunderts keine für uns fruchtbare Fortführung gefunden. Es ist bei uns hinsichtlich der Leibeigenschaft noch ein Grundirrthum: als habe das Mittelalter die harte Leibeigenschaft gehabt, fast allgemein vorherrschend. Für Meklenburg ergiebt sich mit Sicherheit so viel, daß der Zustand unsers Landvolkes im Mittelalter blühender gewesen ist, als in den beiden letzten Jahrhunderten. Ganz sicher hat bei uns die Leibeigenschaft in ihrer härteren Gestalt erst im 16. und 17. Jahrhunderte ihre Entwickelung gefunden. Es geschah dies wesentlich durch das Lehnwesen ohne Kriegsdienst, durch den Einfluß des römischen Rechts, durch die Säcularisationen der Klöster, durch die reversalmäßige Einengung der landesherrlichen Souverainetät nach innen, durch die öfteren zeitweisen Faustpfand=Veräußerungen oder Verpachtungen[ 1 ) ganzer umfänglicher Domanialämter an Privatpersonen, durch den starken Verlust des den alten einheimischen ritterlichen Geschlechtern zuständigen Grundbesitzes an Ausländer, besonders im Kriege Emporgekommene, endlich durch die mannigfachen Leiden des Krieges selbst und innerer Zwietracht. Durch diese Umstände haben die bäuerlichen Verhältnisse eine nachhaltige Zerrüttung erst im 17. und 18. Jahrhunderte erfahren.
Durch Monographien über einzelne ländliche Rechtsverhältnisse wird wohl die Aufmerksamkeit berufener Forscher auf die verschiedenen Seiten der staatswirthschaftlich so wichtigen Geschichte des Landvolkes und des großen Grundbesitzes mehr hingeleitet werden.
2. Begriff der Straßengerechtigkeit in Meklenburg.
Die Straßengerechtigkeit umfaßte nach den Acten zweierlei:
1) das Straßenrecht, d. h. die Befugniß des Grundherrn oder gewisser Colonisten, auf und am Rande der


|
Seite 388 |




|
Dorfstraßen Lein oder Getreide zu säen oder einen sonstigen wirthschaftlichen Betrieb daselbst zu treiben, jedoch ohne Nachtheil für das Gemeinwesen oder die Privatrechte einzelner Colonisten;
2) das Straßengericht, d. h. die Befugniß eines oder mehrerer Grundherren, Verbrechen, die auf und unmittelbar an der Dorfstraße, (oder auf Feld= und Kirchwegen,) begangen wurden, zu untersuchen, den Uebelthäter zu richten und die Strafgefälle (Brüche) zu erheben.
Besonders in Acten des 17. Jahrhunderts umfaßt der Ausdruck: Straßengerechtigkeit häufig diese beiden Begriffe und den Besitz beider Befugnisse. Später deutet er meistens nur noch auf die Gerichtsbarkeit, indem das Besäen der Dorfstraßen mehr und mehr aufhörte. Im Laufe der frühern Zeit ist aber der Ausdruck: Straßenrecht fast allein üblich, und zwar vorherrschend als auf den Anbau, auf die ökonomische Benutzung der Dorfstraßen gerichtet. Bisweilen jedoch, namentlich etwa von 1480 bis um 1560, deutet das Wort: Straßenrecht ebenmäßig auf Anbau und auf Gerichtbarkeit der Straßen, bezeichnet gleichsam den Inbegriff der Rechte und Befugnisse hinsichtlich der Dorfstraßen.
Da in vielen Prozeßacten des 16. Jahrhunderts die Bezeichnung Straßenrecht für das Besäen der Dorfstraßen typisch ist und der wirkliche Anbau der Straßen damals gewöhnlich den eigentlichen Gegenstand des Streites bildete, so wird der Ausdruck in diesem Sinne auch in der folgenden Erörterung durchweg gebraucht werden.
3. Quellen und Literatur.
Unsere heimische Gesetzgebung hat sich nirgends über die Straßengerechtigkeit ausgelassen, man müßte denn einige Stellen von Landtags=Resolutionen und landesherrlich mit der Stadt Rostock geschlossener Verträge, einzelne Streitpuncte über die Gerichtsbarkeit auf den Straßen betreffend, hierher rechnen 1 ). Die Gesetzgebung ging in Meklenburg selten über das dringendste Bedürfniß der Zeiten hinaus, ergriff gewöhnlich nur einzelne zur Zeit wichtige und unabweisliche Verhältnisse, ohne auch diese immer zu erschöpfen.


|
Seite 389 |




|
Die allerdings hin und wieder vorkommenden Spuren von ländlichen Gewohnheits= und autonomischen Rechten sind fast gar nicht bekannt gemacht und jeden Falls nirgends gesammelt. Schon der alte, fleißige Mantzel fragte vor etwa 100 Jahren vergeblich von seiner Studierstube zu Rostock aus nach "Bauern=Gerichten und Dorfsgewohnheiten" 1 ).
Die Quellen der vorliegenden Untersuchung sind ausschließlich Archivacten, meistens Prozesse des 16. Jahrhunderts, welche theils bei den Acten der einzelnen Domanial=Aemter, theils der Lehn= und Allodialgüter niedergelegt sind.
In der verwandten juristischen Literatur ist die Straßengerechtigkeit nicht ganz unbekannt, ohne jedoch Erhebliches zu gewähren. Stryck 2 ) berührte sie in der Abhandlung über die pommerschen Lehne. Dies rief im J. 1702 eine Dissertation des J. W. Reichel 3 ) zu Greifswald hervor, welche nach römischen Grundsätzen geschrieben ist und auf die heimischen Quellen wenig eingeht. Westfalen 4 ) fand in einer Urkunde das "Stratenrecht". Es ist für Manches in der Literatur jener Zeit bezeichnend, daß der berühmte Herausgeber der "Monumenta inedita" in einer Note das Wort unbedenklich für das corrumpirte "Brakenrecht", Recht der Gerichtsgefälle oder Brüche erklärt!-Franck[ 5 ), der heimische Geschichtschreiber, giebt den Begriff der Straßengerechtigkeit bei Gelegenheit derselben Urkunde mit den Acten übereinstimmend an. Dagegen scheint Mantzel 6 ) die Sache nicht gekannt oder doch nirgends erörtert zu haben.
Da übrigens der Stoff der gegenwärtigen Abhandlung in vielen Acten zerstreuet ist und nicht vollständig für alle Beziehungen zu erlangen war, auch Vorarbeiten noch zu sehr fehlen, so hat auf das Streben nach gleichmäßiger Vollständigkeit und Klarheit zur Zeit verzichtet werden müssen.
4. Ueber die Straßen im Allgemeinen.
Die Straßen wurden in Deutschland seit Alters in viae regiae und viaeprivatae unterschieden.


|
Seite 390 |




|
Die via regia oder "gemeine kaiserliche freie Straße", umfaßte alle öffentlichen Wege des Reichs, welche zum allgemeinen Verkehr dienten und Städte und Länder, wie Land und Meer verbanden. Später sind diese öffentlichen Wege, mehr von der Theorie, als der Gesetzgebung, in Heer=, Handels= und Poststraßen bisweilen unterschieden. Die Begründung und Unterhaltung, der Schutz und Ertrag derselben, nicht minder die Gerichts= und Polizeigewalt über sie, gehörten durchweg in Deutschland zur Reichs= und später zur Landeshoheit. Der Inbegriff dieser Befugnisse bildete das Straßen=Regal, jus viarum regale 1 ). Schon frühzeitig wurden einzelne Beziehungen dieses Regals durch Gesetze und Herkommen (z. B. Goldene Bulle, I, 17, Sachsenspiegel II, 27) genauer bestimmt.
Auf seinem Grundstücke konnte jeder Freie Wege nach Willkühr anlegen und über deren Bau, Benutzung und Erhaltung verfügen, so weit nicht die Rechte Dritter in Frage kamen. Zwischen diesen eigentlichen Privatwegen und den "gemeinen kaiserlichen Straßen" standen die Gemeindewege und Dorfstraßen, deren Begründung, Erhaltung und Nutzung den Grundherren und Gemeinden zukommt. Die Privat= und Gemeindewege waren in Deutschland seit Alters auch hinsichtlich der Gerichts= und Polizeigewalt ganz oder theilweise im Besitze der Grundherren. Ja bisweilen war deren Patrimonialgewalt sogar auf die öffentlichen, ihren Grundbesitz durchschneidenden Wege ausgedehnt. Es lag dies begründet in dem eigentlichen Rechtsbegriffe des deutschen Grundeigenthums, welcher, im Gegensatze des römischen, ursprünglich fast überall Besitz und Ausübung gewisser Hoheitsrechte, namentlich des Schirmrechts und der Gerichtsbarkeit über die Hintersassen, einschloß. Dies führte da, wo die Grundherren als Stand der Ritterschaft mächtig waren, zu manchen Beschränkungen auch des Straßenregals.
5. Das Straßenregal in Meklenburg.
In Meklenburg ist das Straßenregal, wie manche andere Regalien, durch altherkömmliche große Ausdehnung der Privatrechte an Grund und Boden, wesentlich durch eine mächtige Ritterschaft und die Seestädte vertreten, auffallend beschränkt.


|
Seite 391 |




|
Es gab hier zwar seit Alters "kaiserliche freie Straßen", die frühzeitig in Urkunden vorkommen 1 ); auch mag das in der Landeshoheit begründete Straßenregal zu Zeiten umfänglich geübt, oder doch hinsichtlich des Rechts der landesherrlichen Oberaufsicht im ganzen Lande damals schon zuweilen nachdrücklich vertreten sein. Indessen ist nicht zu leugnen, daß bereits im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts in einzelnen Fällen eine ausdrückliche Verleihung der vollen Gerichtsbarkeit und Polizeigewalt an größere Städte und Grundbesitzer, als auf die ihr Gebiet etwa berührenden Landstraßen 2 ) mit gerichtet, urkundlich dem Wortlaute oder Sinne nach zu entnehmen sein dürfte. Dies ist z. B. wohl unzweifelhaft hinsichtlich der Stadt Rostock der Fall, indem ihr im J. 1358 durch den Herzog Albrecht II. die volle, unbeschränkte Gerichtsbarkeit nicht bloß in den Stadtmauern, sondern auch innerhalb ihrer ganzen "Markscheide" und auf Wegen und Umwegen verliehen worden ist 3 ). Noch ausdrücklicher ist später, in dem Erbvertrage vom J. 1584, dem Rathe die Straßengerichtsbarkeit auf den Dorf=, Feld= und Landstraßen im Gebiete der Rostock zustehenden Hospital=Dörfer bestätiget 4 ).
Seit den Zeiten des ewigen Landfriedens (1495) wurden Gesetzgebung und Regierung in vielen deutschen Territorien durchgreifender von den Landesherren geübt. Manche Fürsten suchten ihre Landeshoheit über den factischen Zustand der bloßen Lehnsherrlichkeit hinauszuführen. Dieses zunächst gegen die Landstände und deren Privilegien oder doch gegen manche der großen Innehaber des mit einzelnen Hoheitsrechten ausgestatteten Privat=Grundbesitzes sich richtende Streben fand auch in Meklenburg einigermaßen statt. So trat Herzog Heinrich der Friedfertige


|
Seite 392 |




|
wiederholt mit Nachdruck gegen den Mißbrauch der
ritterschaftlichen Patrimonial=Gewalt von Seiten
einzelner Vasallen, wie z. B. des Heinrich
Smeker zu Wüstenfelde, auf. Auch in Beziehung
auf das Straßenregal suchte er die
landesherrliche Hoheit in mehrfachen
Streitigkeiten, z. B. mit Wismar, aufrecht zu
erhalten. Dieser Stadt lag es herkömmlich ob,
die von dort in das Land nach Proseken,
Beidendorf u. s. w. führenden
Landstraßen=Steindämme zu erhalten, wogegen sie
die Ausübung der Jurisdiktion daselbst
ansprach
1
). Herzog
Heinrich und später Herzog Ulrich wollten der
Stadt eine solche Befugniß nicht zugestehen,
sondern übten zeitweise Gerichtsbarkeit und
Geleitsrecht auf jenen Dämmen aus, ließen auch
wohl hierin nachlässige Diener ihres Amtes
entsetzen. Vom Herzog Ulrich ward bei einer
solchen Gelegenheit im J. 1575 ausdrücklich
erklärt: "es sei löblich und wohl
hergebracht, "daß der hohen Obrigkeit die
gemeinen Landstraßen, und so weit man auf beiden
Seiten mit einem langen Spieße reichen könne,
mit den Obergerichten zuständen; auch die von
Adel gestatteten den Landesherren ohne Widerrede
die Gerichte und Brüche auf den Heerstraßen, wie
noch bei Hans Preen's Zeit zu Modentin geschehen
sei". Eben so hieß es in dem auf dem
Sternberger Landtage des J. 1572 dem v. d. Lühe
auf Panzow wegen einer Beschwerde über
vermeintliche Eingriffe in dessen
Straßengerichtsbarkeit ertheilten Bescheide:
"der Fall betreffe einen auf der Landstraße
erschlagenen Bauern; weil nun die Gerichte auf
allen Landstraßen zu den fürstlichen Regalien
gehörten und der hohen Obrigkeit durch das ganze
Land zuständig wären, so sei von dem
herzoglichen Amte nach Gebühr verfahren"
 .
2
).
.
2
).
Durch die Reversalen der J. 1572 und 1621 ward jedoch die nachdrückliche Vertretung mancher landesherrlichen Hoheitsrechte überaus erschwert. Die Bestimmung der Polizeiordnung vom J. 1572, Titel: "Von Besserung der Brücken, Wege und Stege" ist in ihrem Sinne auf eine entschiedene Regalität der Landstraßen wohl nicht auszudehnen. Die unheilvollen Zeiten des 17. Jahrhunderts führten, besonders seit dem J. 1648 3 ), zu offenem Kampfe zwischen der nach


|
Seite 393 |




|
Souverainetät strebenden Landeshoheit und den bevorrechteten Landständen. In den Beschwerden vom J. 1701 suchen die Stände oder vielmehr die Ritterschaft nach: daß die Landesherrschaft sich "der auf denen Strömen und Bächen, welche durch adeliche Felder fliessen, wider das Herkommen angemasseten Jurisdiction und Fischerei gnädigst begeben möge" 1 ). Demgemäß ist auch durch den §. 419 des Erbvergleichs vom J. 1755 "denen von der Ritterschaft, den Landbegüterten und Städten die Gerichtsbarkeit über die durch ihre Güter gehende Landstraßen, Feld= und Holzwege, auch Bäche und Ströme, so weit sie selbige berühren, gelassen" worden 2 ). Dies hat jedoch eine zu Zeiten umfängliche und eingreifende Handhabung des, der Landesherrschaft auf allen "unstreitigen öffentlichen Landwegen und Heerstraßen" zustehenden, polizeilichen Oberaufsichtsrechts keineswegs ausgeschlossen 3 ).
6. Vorkommen des "Straßenrechts" in Meklenburg.
Seit dem 15. Jahrhundert läßt sich das Straßenrecht, dem mehrfachen oben bezeichneten Begriffe nach, in den meisten Gegenden des Landes als im Privatbesitze der großen Grundherren und Colonisten befindlich nachweisen. Auch hat dabei hinsichtlich des Besäens der Dorfstraßen der Umstand, daß eine Dorfstraße zugleich als Heerstraße diente, einen wesentlichen Unterschied, wenigstens in der älteren Zeit, wohl nicht begründet.
Im J. 1473 verkaufen Henning und Arnd von der Molen auf der Steinburg dem Bürger Simon Smede zu Parchim die halbe Feldmark Berkow mit dem halben Straßenrechte daselbst. Heinrich Riebe auf Galenbeck verlieh im J. 1500 der Pfarre zu Klockow 4 Hufen mit dem Straßenrechte 4 ). Im J. 1511 verkaufte, Hans Holstein auf Ankershagen unter Andern


|
Seite 394 |




|
"dre Del am Stratenrechte tho Passentin" dem Kloster Broda. Gleichzeitig besaß der Bauer Drewes Krasemann zu Kl. Helle "dat Stratenrecht na Antall der Houen". Dem Herzog Heinrich zu Meklenburg stand 1520 das Straßenrecht in den Comthurei=Dörfern Kraak und Sülstorf zu 1 ). Um das J. 1540 beschwerte sich das Kloster Dargun unter Andern über Volrath Preen, der sich unterstehe, "im Dorpe Kusserowe vp der Strate Lin tho seyende, dar he die Buren tho dwang, datt sie idt em ploegen mußten; item tho Warsow vndersteit he sick, vp der Straten tho seyende". Seit dem J. 1550 werden in Verträgen über Lehn= und Allodialgüter als Pertinenzen derselben häufig "Lienbrincke, Strassenrecht, halbe Leinsaat auf der Strassen" aufgeführt. In selbstständigen Prozeßacten wird der Gegenstand z. B. bei den Gütern Chemnitz, Danneborth, Kieve, Kittendorf, dem Kloster Dobbertin, mehreren Aemtern, bei Warlin, Wessin, Woggersin, Zehna, hinsichtlich der Gerichtsbarkeit auch auf Landtagen, wie im J. 1572 2 ) verhandelt. Das Straßenrecht zu Proseken wird damals als der Kirche und später als der Pfarre daselbst zuständig bezeichnet. Georg Maltzahn auf Penzlin verpfändet 1609 an Bertram Smiterlow zu Greifswald seinen Antheil Mallin nebst dem "halben Flachsbau auf der Straßen". Gleichzeitig klagte Christoph Moltke zu Strietfeld über das Amt Dargun, welches die Straße zu Walkendorf mit Lein besäe. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wird das Straßenrecht immer seltener genannt. Indessen ward z. B. im J. 1654 der Straßenplatz zu Stove auf Ansuchen der dortigen Bauern, gemäß einem Befehle des Herzogs Adolph Friedrich zu Meklenburg, vermessen und unter die einzelnen Colonisten ausgetheilt. Um das J. 1700 fanden Prozesse zwischen der Kirche zu Petschow und der Gutsherrschaft von Lüsewitz wegen Bebauung und oekonomischer Benutzung der Petschower Dorfstraße statt. Endlich beschwerte sich u. A. noch 1702 der Pächter zu Vorder=Bollhagen gegen die Bauern zu Röddelin wegen des daselbst von ihnen auf der Dorfstraße vorgenommenen Leinsäens, und einzelne ähnliche Vorträge gingen um diese Zeit noch von Pächtern der Aemter Meklenburg, Doberan und Ribnitz ein.
Sonach erhellt, daß das Straßenrecht, und zwar vorherrschend im Sinne der wirthschaftlichen Benutzung der Dorfstraßen, Jahrhunderte lang in Meklenburg üblich war. Es war auch nicht einzelnen, wie etwa den südöstlichen, Theilen des


|
Seite 395 |




|
Landes eigenthümlich, sondern kommt auch nicht selten in anderer Richtung, wie zu Grebbin, Kothendorf, Meklenburg, Proseken u. s. w. vor. Jedoch mußten Umfang und Bodenart der Feldmarken, wie besonders die Räumlichkeit der Dorfstraßen wesentlich dabei einwirken. So heißt es in dem Landtheilungs=Register vom J. 1610 beim Amte Neukloster: "bey diesem Amte wird kein Leinsame auff Brincke vnd Strassen, besondern in den sadigen (tragbaren) Acker geseet". - Auch in den Aemtern Rühn und Schwaan scheint etwas Aehnliches der Fall gewesen zu sein. In manchen Dörfern mag überhaupt niemals irgend eine wirtschaftliche Benutzung der Straßen stattgefunden haben. Mehrere Amtsbücher, wie das der Comthurei Nemerow aus den J. 1572 und 1641, sagen bei manchen Dörfern ausdrücklich: "haben keine Straßenbrinke, darauff man "Lein sehen kann" 1 ).
7. Die Dorffreiheiten.
Es gab seit Alters in den meklenburgischen Dörfern und auf deren Feldmarken besondere Gemeindeplätze und freie Aecker, an denen in der Regel die ganze Dorfschaft gemeinsame Nutzungsrechte hatte. Solche Plätze und Aecker werden in älteren Acten gewöhnlich als "Freiheiten, Trifften, Brinke, Gilde= vnd Lienlender" bezeichnet. Vieler Orten mögen sie altherkömmlich gewesen, und mehr willkührlich in Folge bloß localer Verhältnisse, als durch besondere Dotationen der Grundherren entstanden sein, obgleich auch das Letztere von einigen Dörfern, wie z. B. Neukirchen, Wessin u. A. einigermaßen nachzuweisen sein dürfte. Brincke kommen nicht selten, wie zuweilen noch jetzt, in der Mitte der Dörfer nahe an der Kirche vor. Sie scheinen vorzugsweise unter der Bezeichnung "Freiheit" verstanden zu werden. Mitunter lagen auch Brinke dicht vor den Dörfern, so daß sie die Straße nahe berührten. Auf solchen Brinken - und hier vielleicht ursprünglich - hat bisweilen eine Ausübung des Straßenrechts durch Besäung mit Lein stattgefunden; oder die Freiheit und die Straße wurden zugleich bebauet, wie noch um 1586 in Woggersin.
Bei größeren, wohlhabenden Dorfschaften werden, namentlich im 16. Jahrhundert, ,,Gilde= vnd Lienlender" häufig erwähnt. Sie wurden von allen oder vielmehr von einer größern Zahl zu dem Zweck verbundener Colonisten gemeinsam angebaut. Den Ertrag der Saat, die zuweilen auf Stoff zur Bier=


|
Seite 396 |




|
brauerei berechnet war, pflegten die Gildegenossen zur Zeit der Erndten und großer Festtage, besonders des Pfingstfestes, in fröhlichen Gelagen zu verthun. Solche "Gildenbiere" dauerten oft 3 bis 4 Tage lang und führten zu allerlei Ueppigkeit und Unordnung. Bezeichnend ist für das alte Verhältniß zwischen Grundherren und Colonisten, daß noch um d. J. 1560, anscheinend nicht ganz selten, manche Vasallen mit Familie und Gesinde, auch einigen Nachbarn, die "Gildenbiere" der Hintersassen persönlich besuchten, oder wenn sie behindert waren, einen guten Antheil Festbiers sich auf den Hof bringen ließen, wie dies z. B. die Restorf auf Wessin und Radepohl im J. 1560 selbst bezeugen. Um diese Zeit ergingen öfter Beschwerden über manche Ausschweifungen des ländlichen Gildewesens. Hier und da, so wird behauptet, seien die Bauern mit den gewöhnlichen Gildeländern nicht zufrieden, machten allerlei Weideplätze und Aecker zu Gildeländern und trieben Todtschlag und Unzucht bei den Festen. Bei einzelnen Dörfern wird von 5, ja von 7 Gildeländern, unter denen bisweilen auch Wiesen vorkommen, geredet. Die Polizeiordnung von 1572, Titel: "Von den Gilden und Abenddäntzen auff den Dörffern" verbietet deshalb alle "gemeine Gilden" und gestattet nur die Pfingstgilden in den Dörfern, "da sie vor Alters vnd bis anhero eine Gewohnheit gewesen." Jedoch soll das Gildenbier nicht, wie bisher gewöhnlich, aus dem Ertrage der freien gemeinen Aecker und Gründe genommen, sondern um baares Geld aus den Städten geholt werden; die Zechen sollen nicht länger als 2 Tage dauern. - Solche Verbote und Beschränkungen haben sich vielfach in späteren Kammer= und Amtsordnungen wiederholt. Das ländliche Gildenwesen scheint aber nicht so sehr durch polizeiliche Verbote, als vielmehr durch das starke Sinken des Landvolks überhaupt im Laufe des 17. und besonders im 18. Jahrhundert fast gänzlich verschwunden zu sein. Ohne Zweifel stand es, als von der Nutzung gewisser gemeinsamer Räumlichkeiten ausgehend, in einiger Verbindung mit dem Besäen der Dorfstraßen, oder fiel gar mit diesem zusammen, indem die in der Mitte der Dörfer gelegenen Brinke zeitweise wohl ziemlich willkührlich von den Colonisten genutzt wurden. Später ist das letztere hier und da auch von den Grundherren geschehen, indem sie auf der "Freiheit" Gebäude errichteten, wodurch zuweilen die Brinke ganz eingingen. Uebrigens sind solche Brinke noch jetzt in manchen meklenburgischen Dörfern, besonders auf früheren geistlichen oder städtischen Besitzungen anzutreffen und werden als Trocknenplatz, Gänseweide oder ähnlich benutzt.


|
Seite 397 |




|
8. Der Ursprung des Leinsaens auf den Dorfstraßen.
Sehr viele Nachrichten setzen die Sitte des Leinsäens auf den eigentlichen Dorfstraßen als im 16. Jahrh. bereits weit verbreitet außer Zweifel. Der Ursprung dieser Sitte dürfte sich wesentlich auf die räumliche Anlage der Dörfer und das Wesen des älteren ländlichen Wirthschaftsbetriebs, auf das Eigenthümliche des Flachsbaues und dessen frühere, größere Verbreitung, endlich auf die Umfänglichkeit der Flachsabgabe der Colonisten in älterer Zeit zurückführen lassen.
In der Anlage mancher Dörfer ward ursprünglich weder strenge Regelmäßigkeit noch sorgliche Raumbenutzung erstrebt. Ein großer Theil derselben hat sich allmälig und weniger planmäßig, als vielmehr nach den zeitweisen Umständen gestaltet, wie diese durch die wachsende Zahl der Colonisten, allerlei Unfälle, das Interesse der Grundherren, das Verhältniß zwischen diesen und den Hintersassen, die Bodenbeschaffenheit, und durch andere Thatsachen sich bildeten. Noch nach 1290 treten die Dörfchen ("villulae") öfter urkundlich auf. Wie sehr Brand= und Kriegsunglück, Naturereignisse, innere Zwiste u. s. w. selbst auf die ungleich fester und planmäßiger begründeten Städte hier und da wirkten, ist bekannt und nicht weniger Orten nachzuweisen. So sind denn in vielen Dörfern mehr oder minder unregelmäßige und ausgedehnte Straßen und Plätze entstanden.
Zu einer wirthschaftlichen Benutzung derselben wurden einzelne Colonisten wohl schon frühzeitig um so mehr veranlaßt, als manche Dörfer durch den Landstraßenverkehr gar nicht berührt und die localen Zwecke der breiten Dorfstraße durch theilweisen Anbau nicht beeinträchtigt wurden. Zudem war überhaupt in allem bäuerlichen Betriebe des frühern Mittelalters wie an gemeinschaftlicher Benutzung einiger Theile der Feldmark, so besonders daran gelegen, das zu bebauen, was den Hof des einzelnen Colonisten zunächst umgab, was der Pflegende vor Augen hatte, leicht überwachen konnte 1 ). Die ursprüngliche Beschränkung oder zeitweise durch Fehden, Räubereien und Patrimonialdruck herbeigeführte Unsicherheit des ländlichen Betriebes und die mancherlei Dienstverhältnisse der erwachsenen männlichen Colonisten mußten nothwendig hierauf hinleiten.
Uebrigens ist jedoch mit mehrfachem Grunde anzunehmen, daß das Besäen der Dorfstraßen erst im 15. und 16. Jahrh. sich verallgemeinerte, ein Umstand, der neben manchen


|
Seite 398 |




|
andern Thatsachen auf eine reichere und betriebsamere Bevölkerung dieser Zeiten, besonders im Vergleiche zu der des 18. Jahrh. unverkennbar hindeutet.
Zum Anbau der Dorfstraßen ward vorzugsweise die Leinpflanze verwandt. Die Straßen erschienen zum Besäen mit Getreide wohl schon deshalb weniger geeignet, weil es den bebauten Plätzen in den meisten Fällen an genügendem Schutze gegen die Einwirkung mancherlei localen Verkehrs und des umlaufenden Vieles fehlte, indem ein Umzäunen der Saatplätze in der Regel nicht statthaft war, während die starke, zähe Leinpflanze sich für eine weniger gesicherte Lage mehr schickte. Hiezu kam, daß der Flachsbau früher ein wichtiger Betriebszweig und sehr verbreitet im Lande war. Fast aller Bedarf an Leinewand, selbst für die Hofhaltungen, ward aus dem heimischen Naturerzeugnisse und durch inländische Verarbeitung gewonnen. Während schon englische und niederländische Wollengewebe (im 15. und 16. Jahrh.) den Bedarf der Wohlhabenderen und besonders der Reichen befriedigten, ward die Leinewand noch vorherrschend im Lande selbst erzeugt. Die Zahl der Leinenweber war im 16. Jahrh. in einzelnen Städten und Aemtern ungleich bedeutender, als jetzt. Noch im 17. Jahrh. kommen "Flachs= und Leingewands=Register" bei den fürstlichen Hofhaltungen vor. Die herzoglichen Aemter, die damals öfter über Mangel an Leinsaamen oder mißrathene Erndten klagten, mußten alljährlich oder zeitweise "zu Hofe" ansehnliche Massen Flachs liefern. Hier ward der Flachs nach der Güte gesondert und zur bestimmten Bearbeitung meistens wieder an die Amtshäuser verteilt.
Insbesondere mußte aber der Bauer nicht bloß das eigene Bedürfniß befriedigen, sondern durchweg auch eine Abgabe in Flachs an die Grundherren entrichten. Für die meisten Gegenden Meklenburgs läßt sich seit dem Beginne der urkundlichen Zeit hinsichtlich der Lasten der Colonisten unter den Fruchtzehnten an Lämmern, Hühnern u. s. w. die Flachsabgabe nachweisen. In der Regel ward von jeder Hufe Landes ein Topp Flachs (toppus lini, ligatura lini), bisweilen mehr, je nach dem Hufenmaaße 1 ) oder nach Uebereinkunft


|
Seite 399 |




|
entrichtet. Diese Abgabe 1 ) hat sich, wie die des Rauchhuhns, welches dem Gutsherrn für jede Feuerstelle (domus, area) in Anerkennung des Obereigenthums zukam, bis in die neueren Zeiten erhalten, ja im 16. Jahrh. scheint der Betrag derselben bisweilen willkürlich gesteigert zu sein.
9. Erwerbung des Straßenrechts Besitztitel der Colonisten.
In frühester Zeit ward das Straßenrecht - die Besäung der Dorfstraßen - wohl nur von einzelnen Colonisten ausgeübt, denen die Benutzung der nahen Straße besonders gelegen schien. Von einem Rechte mag dabei selten die Rede gewesen sein, indem der mit dem Blute oder mit Rath dienende Lehnmann, das ferne und zuweilen noch wenig organisirte, fast immer milde verwaltete Kloster und die wenigen herzoglichen Vögte das Treiben der Colonisten im Einzelnen zu überwachen wenig befähigt und wohl selten geneigt waren, so lange jene ihre Verpflichtungen erfüllten.
Nach Zeugenaussagen in Prozeßverhandlungen des 16. Jahrh. hatten viele ritterschaftliche Colonisten das Straßenrecht im Laufe der Zeit nicht so sehr vertrags= und spruchmäßig, als durch Verjährung erworben, indem es heißt: sie hätten herkömmlich, und ungestört seit Alters die Straße besäet. Actenmäßig ist es, daß noch während des 16. und 17. Jahrh. sich ritterschaftliche Colonisten und Domanialbauern hie und da in einem solchen herkömmlichen Besitze des Straßenrechts erhalten haben. Im Allgemeinen scheint aber besonders seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. und noch entschiedener in der folgenden Zeit eine besondere, ausdrückliche Verstattung der Grundherren der herrschende Rechtstitel für die Ausübung des Straßenrechts der Colonisten geworden zu sein 2 ).


|
Seite 400 |




|
Dies mußte auch wohl der Fall sein, als mit der härteren Gestaltung der Leibeigenschaft und mit dem steigenden Einflusse des römischen Rechtes alle Verhältnisse sich änderten. Seitdem der Vasall nicht wesentlich mehr mit dem Blute diente, sein Rathsdienst durch Gelehrte verdrängt und sein Leben meistens auf dem ländlichen Rittersitze in oft allzu großer Muße verbracht ward, mußte er um so mehr zur eigenen oekonomischen Ausbeutung des Grundbesitzes und zu größerer Strenge gegen die Colonisten geneigt werden, als seine Bedürfnisse durch den Einfluß fremder und höfischer Sitten und das Streben, das Ritterliche in glänzenden äußeren Formen zu erhalten, sich steigerten, während die Mittel zu deren Befriedigung durch fortgehende Theilungen des Grundbesitzes, ja durch ererbte Schulden geringer wurden. Dem entspricht es, wenn schon um die Mitte des 16. Jahrh. einzelne große Grundherren unter andern auch die Ausübung des Straßenrechts für sich in Anspruch nehmen. Hierauf gerichtet erscheinen z. B. die oben (unter 6) erwähnten Beschwerden des Klosters Dargun über Volrath Preen um d. J. 1540; die Restorf auf Wessin und Radepohl standen um 1570 mit ihren Vettern auf Bolz und Kritzow darüber in Prozeß, daß sie die gemeinsamen Lein= und Gildeländer der Unterthanen zu Wessin angeblich für sich selbst willkührlich nutzten. - Ein solches Streben der Grundherren veranlaßte, bei den vielfachen planlosen Theilungen des Grundbesitzes, manche derartige Streitigkeiten, in denen die Vasallen gewöhnlich mit Eifer oder gar Erbitterung gegen einander auftreten, obgleich die Sache selbst zuweilen noch wesentlich im Interesse der Hintersassen geführt werden mochte. Denn durchweg betreffen die Prozesse solche Dorfschaften, deren Insassen nach verschiedenen Rittersitzen oder Aemtern pflichtig waren.
In den geistlichen und Domanialbesitzungen ward das Besäen der Dorfstraßen in den früherrn Zeiten ebenfalls mehr blos herkömmlich, als mittelst eines besondern ursprünglichen Rechtstitels ausgeübt. Als aber im Gefolge der Kirchenverbesserung die großen Feldklöster aufgehoben, und die Landesherren, den namentlich im Puncte der Steuern altherkömmlich und auch ausdrücklich privilegirten Ständen gegenüber, wesentlich auf die neu entstandenen oder bedeutend vergrößerten Domanialämter zur Bestreitung fast des ganzen rasch steigenden Aufwandes für den Hof= und Staatshaushalt angewiesen wurden, mußten auch hier die Colonats=Verhältnisse tief ergriffen werden. Auf die Dauer konnten sich die meisten Colonisten mit ihren alten, großen, meistens erbzinslichen Hufen=


|
Seite 401 |




|
dotationen, den milder festgestellten Diensten und Pächten und manchen herkömmlichen Befugnissen an Holzhieb, Torfstich, Fischerei und Rohrwerbung, Straßenrecht u. s. w. gegen den Drang mächtiger, neuer Zeitbedürfnisse und neuer Rechtslehren nicht in alter Weise erhalten. Nachhaltig wirkte hier auch der Umstand, daß in Folge landesherrlichen dringenden Bedürfnisses zeitweise ganze große Domanialämter als Faustpfand oder pachtweise in die Hände von Privatpersonen, selbst von Ausländern, gelangten, gewöhnlich mitsammt der vollen Patrimonialgewalt. Unmöglich konnte dies der Stellung der Colonisten förderlich sein. So wurde denn im Domanial=Gebiete unter den herkömmlichen Befugnissen derselben auch das Besäen der Dorfstraßen allmälig aufgehoben oder nur besonders und ausnahmsweise grundherrlich gestattet. Mitunter ward es, schon vor 1600, ausdrücklich für eine Amtssache erklärt. In der folgenden Zeit ließen die Amtleute zuweilen die Straße für Amtsrechnung nutzen, wie z. B. zu Meklenburg; mitunter die Saat der Bauern, als ungehörig auf der Straße, zerstören. Unter den Herzogen Christian I, Louis und Friedrich Wilhelm erklärte die Kammer mehrmals, z. B. im J. 1685 wegen Klockenhagen, im Amte Ribnitz, das Besäen der Dorfstraßen und die Nutzung der Brinke und Trifften für ein "Reservat der Aemter." Anderer Seits wurden bisweilen die Colonisten in dem herkömmlichen Besitze des Straßenrechts von der Kammer gegen die Pächter der Kammerhöfe geschützt, wie noch im J. 1702 die Bauern zu Röddelin.
10. Ausübung des Straßenrechts; Beschränkungen.
Seit Alters durfte bei Ausübung des Straßenrechts weder der gemeine Fahrweg gesperrt, noch die Auf= und Abfahrt für die Höfe der einzelnen Colonisten gehindert werden. Demgemäß ward das Einzäunen der bebauten Stellen in der Regel nicht gestattet oder doch strenge überwacht, indem es allzu leicht mißbraucht ward und öfter zu Gewalttätigkeiten führte.
Im J. 1565 war Streit zwischen den nach verschiedenen Landestheilen gehörenden Aemtern Wredenhagen und Mirow wegen des Leinsäens in dem getheilten Dorfe Kieve. Die Amt=Wredenhagenschen Unterthanen hatten ihre Leinsaat auf der gemeinen Freiheit daselbst so eingezäunt, daß mehreren Amt=Mirowschen Einwohnern der nöthige Wirthschaftsraum beengt ward "und sie kaum eine Gans oder ein Huhn bei


|
Seite 402 |




|
ihren Höfen mehr halten konnten." Auf Befehl des Herzogs Ulrich ward der Zaun umgehauen und das Säen auf der Straßenbreite eingeschränkt. - Um d. J. 1573 hatten die Passow zu Zehna die ökonomische Nutzung der Dorfstraße so ungebührlich ausgedehnt, daß die Amt=Güstrowschen Unterthanen daselbst nicht mehr frei zu ihren Höfen ein= und ausfahren konnten; ein Theil der Straße war eingezäunt, ein anderer zur Wiese gemacht worden. Nach geschehener Untersuchung ward zwar den Passow, weil sie seit Alters das Straßenrecht zu Zehna geübt hatten, das Leinsäen auch ferner gestattet, jedoch mit der Beschränkung, die Straße zum gemeinen Gebrauche frei zu lassen und die Wiese ganz einzuziehen. - In einem Prozesse der Holstein mit den Linstow wegen des Dorfes Woggersin werden Jene im J. 1586 unter anderm beschuldigt: sie hätten daselbst einen neuen Graben "angerichtet und die alte Straße eingezogen." Nach späteren Acten eines Streites zwischen den Peccatel und den Maltzan wegen Blumenholz hatten die Hintersassen jener den maltzanschen Unterthanen daselbst "durch Beseyung der Straßen die gehorliche Fahrwege, Vff= vnd Abgenge vff ihre Hoffe nicht benommen vnd gehemmt." Die Dorfschaft Meklenburg verklagte noch im J. 1685 bei der Kammer das dortige Amt, welches die Dorfstraße, angeblich zur Erhaltung der Straßengerechtigkeit, mit Lein besäen lasse und die Unterthanen dadurch an der Auf= und Abfahrt behindere.
Ebenso war es gegen das Straßenrecht, Gebäude, besonders zu dauernden Zwecken, auf der Straße und gemeinen Freiheit zu errichten. Selbst den einzelnen, auf derselben Feldmark berechtigten Grundherren ward dies früher in der Regel nicht gestattet. Um das J. 1552 hatte ein Bauer zu Woosten, Joachim Krell, auf der Straße daselbst "eigens Freuels" eine Scheure erbauet. Er mußte sie alsbald abbrechen und auf seinen Hof setzen. Joachim Krause, der Antheil an Varchentin besaß, ward auf Antrag des Amts Stavenhagen im J. 1570 gezwungen, ein auf der Straße daselbst erbautes Haus niederzureißen. Als Joachim Kleinow 1630 auf der Straße zu Karstorf ein "Pforthaus" gebauet hatte, erwirkte das Amt Stavenhagen in Kurzem dessen Abbruch. Etwas Aehnliches war zu Krümmel vorgekommen. Zu Petschow hatte der Gutsbesitzer von Lüsewitz um d. J. 1680 die "gemeine Straßenbreite" durch mehrere Bauten eingeengt, ein Umstand, der zu einem langwierigen Prozesse zwischen der Kirche zu Petschow und der Gutsherrschaft von Lüsewitz die Hauptveranlassung gab. - So ward die Errichtung von Gebäuden auf den Straßen und Freiheiten der Dörfer fast durchweg für un=


|
Seite 403 |




|
zulässig erklärt und zuweilen noch besonders bestraft. Es konnte dies jedoch füglich nur da vorkommen, wo der Grundbesitz getheilt war. Die Rechtsbegründung des Verfahrens gegen solche Bauten ward übrigens nicht so sehr in dem Wesen öffentlicher Straßen, als in der Befugniß der Colonisten zum Leinsäen oder im Besitze der Gerichtsbarkeit über die Dorfstraße von Seiten eines der berechtigten Grundherren gefunden.
Zuweilen kommt ferner die Baumpflanzung auf Dorfstraßen in Verbindung mit dem Leinsäen vor. Die zur Ausübung des Straßenrechts befugten Colonisten pflegten hier und da Weiden vor ihren Höfen auf der Dorfstraße anzupflanzen. Früher geschah dies mancher Orten nach alter Gewohnheit, herkömmlich und willkürlich von einzelnen Bauern; im Laufe des 16. Jahrh. wird aber auch hier häufiger eine besondere grundherrliche Verstattung für nothwendig erachtet. In den getheilten Dörfern führte dies bisweilen zu Händeln und Prozessen, indem der im Besitze der Straßengerichtsbarkeit sich befindende Grundherr die Weidenpflanzungen der eigenen oder fremden Colonisten nicht gestatten wollte. Diese Verhältnisse werden z. B. in Prozessen der Restorf unter sich wegen des Straßenrechts und der Gildeländer zu Wessin um 1570, des Klosters Dobbertin mit den Restorf auf Bolz wegen der Gerichtsbarkeit im Dorfe Lenzen um 1590, so wie der Gutsherrschaft von Lüsewitz mit der Kirche zu Petschow um 1700, besonders in den Zeugenverhören berührt. Mehrfache Angaben deuten darauf hin, daß in älterer Zeit allerdings manche Colonisten herkömmlich mit dem Leinsäen zugleich die Baumpflanzung, namentlich von Weiden, die sie ausschließlich nutzten, auf der Dorfstraße geübt hatten. Es bezogen sich z. B. in Schwetzin die Colonisten bei einem Streite über das Straßenrecht auf die vor den Höfen von ihnen gehegten Weiden hinsichtlich der Theilung und Begrenzung beim Leinsäen. - Später ward auch dieses Herkommen der Colonisten von den Grundherren allgemeiner beschränkt oder aufgehoben, indem man es als einen Eingriff in die Gerichts= und Polizeigewalt über die Dorfstraße ansah. Die Domanial=Aemter erklärten zuweilen das Weidenpflanzen für eine Amtssache. So sagte z. B. das Amt Boizenburg 1738 in einem Prozesse mit dem Gutsherrn von Tüschow, der Antheil an Granzin besaß, wegen abgehauener Weiden und eines niedergerissenen Zauns zu Granzin: "das Amt habe nach Angabe des Amtsbuchs die Straßengerechtigkeit zu Granzin; der von den Unterthanen des Beklagten gemachte Zaun sei wider das Straßenrecht zu weit auf die Straße gerückt, wogegen es zur Befugniß des Amtes gehöre, die Straße


|
Seite 404 |




|
mit Bäumen zu beflanzen, jedoch absque praejudicio viae et actus."
Uebrigens fand das Leinsäen auf den Dorfstraßen weder ganz gleichmäßig in derselben Straßengegend statt, noch ward es überhaupt in derselben bestimmten Weise geübt, indem hierauf manche locale, wie räumliche Erweiterung oder Beschränkung der Dörfer und die zeitweisen Verhältnisse zwischen den Grundherren und den Colonisten wesentlich einwirkten. Oft scheint das Leinsäen ausschließlich auf einem, in der Mitte de s Dorfes, belegenen freien Platze geübt zu sein, wie dies auch, als in Pommern vorherrschend, bezeugt wird 1 ). Die öfter vorkommenden Bezeichnungen: Straßenplätze, Straßenbrinke, Freiheit, wie bei Petschow, Poserin, Stove, Wessin und Woggersin, dürften in der Regel auf eine solche Lage hindeuten. Hier und da lief anscheinend der herkömmliche Fahrweg, wie z. B. in Kotendorf um 1598, zu beiden Seiten längs der Straßenbreite hin, so daß auf deren Mitte gesäet ward. Andrer Orten scheint sich der Anbau auf die Ufer der Dorfstraße beschränkt zu haben, wie etwa in Prosecken und Schwetzin, so daß die Colonisten den ihre Höfe begrenzenden Theil der Straße theilweise benutzten. Mitunter ward jedoch, wie z. B. in Miekow um 1586, einzelnen Bauern freigestellt, vor ihren Höfen oder sonst auf der Straße nach einem gewissen Verhältnisse Lein zu säen. - Ebenso ward auch schon im Laufe des 16. Jahrh. in manchen Dörfern, wo das Straßenrecht üblich war, nicht gerade alljährlich die Straße bebaut, sondern mehr nach den zeitweisen Umständen, "nach Gelegenheit der Jahre", wie dies von Kotendorf, Lenzen, Petschow, Wessin und andern Orten angedeutet wird.
11. Einfluß der Hufenzahl bei getheiltem Grundbesitze.
Sehr wichtig für die grundherrlichen, wie für die Colonats=Verhältnisse sind die vielfachen Theilungen des Grundbesitzes. Sie sind uralt und in zahlreichen Urkunden schon des 13. und 14. Jahrh. nachzuweisen. Als nahe liegend und unvermeidlich erscheinen sie für die Zeiten der Germanisirung des Landes, wo beim Mangel einer regelmäßigen Verwaltung und durchgreifenden Gesetzgebung schon die großen Dotationen, z. B. mancher Klöster, Zusammenhang und Einheit nicht immer verfolgten, wo die Erweiterung der geringen Volksmenge durch fremde Kolonisten, bei der Einwirkung viel=


|
Seite 405 |




|
facher, oft abweichender grundherrlicher Interessen, nicht selten willkührlich und planlos geschehen mußte und wo kleinere zeitweise Veräußerungen des Grundbesitzes durch Privatpersonen nach Neigung oder Bedürfniß, z. B. als Geschenk an Klöster oder durch Verkauf bei Geldnot ungehindert stattfanden. Die schon frühzeitig ausgebildete Eigenthümlichkeit des meklenburgischen Lehnrechts, namentlich die fast unbeschränkte Veräußerlichkeit und Verschuldbarkeit der Lehen 1 ), mußte die Theilungen des Grundbesitzes befördern. Nicht minder mußte dies durch die spätere Ausbreitung der ritterlichen Geschlechter geschehen, indem die nachgebornen Söhne von der Erbfolge nicht ausgeschlossen wurden, so daß zur Befriedigung der Nachgebornen im Laufe des 15. und 16. Jahrb. ungemein viele Teilungen des Grundbesitzes und Errichtungen neuer Rittersitze geschehen mußten. Ueberdieß ward die Sitte der antichretischen Verpfändung ganzer Güter oder ansehnlicher Theile ebenso frühzeitig und umfänglich in Meklenburg geübt, als die der Gewährung von Special=Hypotheken an Grund und Boden, welche gewöhnlich auf einzelne Gehöfte, Dienste und Pächte der Colonisten oder auf einen bestimmt bezeichneten Theil des Hauptgutes gerichtet wurden, was in den traurigen Zeiten des 17. Jahrh. mittelst des Systems der "adjudicatio in solutum" zu einer unglaublichen zeitweisen Entwerthung und zu mancher Zerstückelung des großen Grundbesitzes geführt hat. Daß die zum Gewährenlassen führende Beschränkung der landesherrlichen Hoheitsrechte auch hier eingewirkt hat, ist wohl nicht zu bezweifeln.
Die durch solche Teilungen herbeigeführte Zerrissenheit des Grundbesitzes war die Hauptquelle vieler Händel, obgleich vielleicht den Colonats=Verhältnissen nicht gerade überall und zu allen Zeiten nachtheilig. Die Teilungen ergriffen nicht bloß den Grund und Boden selbst, sondern auch die ihm anklebenden Rechte, wie das Kirchenpatronat, die Jurisdiction u. s. w. Das Theilungswesen ging so weit, daß die Colonisten einzelner Dörfer 3, auch wohl 4 verschiedenen Grundherren zustanden, daß Landesherren, Lehnleute und milde Stiftungen Antheile an einer und derselben Feldmark besaßen, ja, daß sogar einzelne Dörfer verschiedenen Landesherren zugehörten.
Demgemäß war auch das Straßenrecht häufig getheilt, wie schon oben u. a. die Veräußerung des halben Straßenrechts zu Berkow im J. 1473 angeführt ist. Bei solchen Teilungen normirte hinsichtlich des Leinsäens


|
Seite 406 |




|
auf den Dorfstraßen die Hufenzahl. Es war überhaupt Rechtens, wie noch ein herzogliches Erkenntniß vom 24. Jan. 1581 (bei Woggersin) besagt, "die Theilung der Guter, so von Geschlechtern pro indiuiso in diesen Landen gebraucht, nach Hufenzall zu machen." Diese war herkömmlich oder gesetzmäßig für manche ländliche Verhältnisse, wie die Schäferei und Jagdberechtigung, entscheidend. Nach der Polizeiordnung vom J. 1572, Titel: "Von Jagen", soll derjenige Jagd= und Schäfereirecht ansprechen dürfen, der 4 Hufen oder darüber auf einer Feldmark besitzt 1 ). Bei gemeinsamen Holzungen wurden die Mastgelder nach Hufenzahl getheilt 2 ). Dasselbe galt von Gerichtsgefällen, wo die Jurisdiction mehreren Grundherren zustand. - Im J. 1586 ward ein Streit zwischen Zabel Stal auf Pohnstorf und dem Amte Güstrow wegen 4 Bauhöfe zu Miekow und deren Antheil am Straßenrechte dahin verglichen, daß die Colonisten der 4 Höfe die Straße nach Anzahl der Hufen sollten besäen dürfen. - In einem Prozesse zwischen den Holstein und Linstow wegen des Straßenrechts zu Woggersin sagen 1586 mehrere Zeugen gleichmäßig aus: Die Parteien hätten früher bisweilen zu gleichen Teilen die Freiheit besäet; aber die Holstein besäßen mehr Hufen auf der Feldmark, als die Linstow, und nach altem Landgebrauch werde das Straßenrecht nach Anzahl der Hufen ausgetheilt. - Bei ungefähr gleicher Hufenzahl verglich man sich bisweilen über Theilung durch das Loos. So hatten sich früher einmal die genannten Holstein und Linstow wegen Woggersin dahin vertragen: daß keiner ohne des andern Vorwissen die Straße und Freiheit besäen solle, sondern man gemeinschaftlich zwei gleiche Stücke abmessen und durch das Loos vertheilen, nach der Erndte aber den Platz in Freiheit liegen lassen wolle.
12. Das Straßenrecht hört auf.
In der zweiten Hälfte des 17. und im Laufe des 18. Jahrh. ist die Gewohnheit, auf der Dorfstraße Lein zu säen, in Meklenburg nach und nach verschwunden. Zunächst mag dies allerdings in der durch Krieg und Pest, Leibeigenschaft und innern Unfrieden herbei geführten, lange fortgehenden Entvölkerung 3 ) (im J. 1750 war die Bevölkerung von


|
Seite 407 |




|
Meklenburg=Schwerin auf 150,000 Einwohner gesunken !) begründet sein. Auch mögen die vielen Truppen=Durchzüge dazu mitgewirkt haben. Der wesentlichste Grund dürfte aber, besonders für den ritterschaftlichen Grundbesitz, darin zu suchen sein, daß der Bauernstand überhaupt in Verfall gerieth, seitdem die Gutshörigkeit der Hintersassen vieler Orten in Knechtschaft und Besitzlosigkeit ausartete, so daß das Entlaufen der Leibeigenen immer häufiger ward. Patrimonialrechtlicher Druck und "Bauernlegen", durch die Reversalen vom J. 162l, Art. 16, wohl zu sehr erleichtert, fanden zwar hauptsächlich auf dem ritterschaftlichen Grundbesitze im 17. und 18. Jahrh. statt, doch wurden auch in den Domainen die Colonats=Verhältnisse durch die Gestaltung der Leibeigenschaft und manche Mißgriffe der Verwaltung wesentlich erschüttert. Es ist auffallend, aber unzweifelhaft, daß in Meklenburg, wo "altes Herkommen" eine so verbreitete, vielfach angesprochene und oftmals, namentlich in der Gesetzgebung und in den Landtags=Verhandlungen des 16. Jahrh., ausdrücklich anerkannte Rechtsquelle bildet, dieses alte Herkommen besonders in den Colonats=Verhältnissen im Laufe des 17. und 18. Jahrh. von Seiten der großen, freilich auch bedrängten Grundbesitzer ziemlich willkührlich gehandhabt worden ist. Daß eine schonungslose Ausdehnung der grundherrlichen Rechte fast alle herkömmlichen Befugnisse der Colonisten berühren mußte, liegt sehr nahe und ist bereits in Einzelnheiten angedeutet worden. - Uebrigens ist nicht zu verkennen, daß mancher Orten die sich ausbildende Straßenpolizei mit gutem Grunde den Anbau der Dorfstraßen beschränkte oder aufhob, wozu schon die Erweiterung der Posteinrichtungen in der Zeit von 1680 - 1750 bisweilen dringend auffordern mußte.
Daß der sonst grundgelehrte, aber auch oft unzuverlässige Westfalen 1 ) die Bedeutung des Straßenrechts nicht kannte, fällt um so mehr auf, als es zu seiner Zeit doch noch hier und da in Meklenburg und Pommern 2 ) geltend war. So beschwert sich, wie oben erwähnt, noch im J. 1702 der Pächter zu Vorder=Bollhagen über das Leinsäen der Colonisten


|
Seite 408 |




|
in Röddelin. In demselben Jahre beklagte sich der Pächter zu Hoppenrade bei herzoglicher Kammer, daß die Bauern zu Viecheln die Dorfstraße eigenmächtig bezäunt und mit Kohl bepflanzt hätten, so daß er nun daselbst kein Lein säen könne, wie sonst, üblich sei. Dagegen war freilich mancher Orten, z. B. nach den angeführten Prozeßacten über die Straße zu Petschow um 1705 das Säen auf den Dorfstraßen schon wesentlich außer Gebrauch. Die Acten wegen Granzin besagen 1738: das Amt Boizenburg habe seit Alters das Straßengericht zu Granzin und es sei deshalb die Straße "vormahlen verschiedentlich mit Leinsamen besäet gewesen." Später wurden bei der Directorial=Vermessung (1756 flgd.) hin und wieder, namentlich in den Aemtern Stavenhagen und Lübz, Dorfstraßen mit "nutzbaren Brinken" nach Abrechnung der Wege bonitirt. So lag damals in Poserin "der nutzbar geschätzte Acker auf der Straße an zweyn Flecken und das Uebrige war stark mit Weiden besetzet und dadurch getheilet." Allein ein alterthümliches, mehr oder minder abgabenfreies Nutzungsrecht der Colonisten fand hierbei wohl ohne Zweifel nicht mehr statt. Schon das Bonitiren der nutzbaren Brinke 1 ) deutet auf das Gegentheil; auch wird in einem Streite zwischen den Beamten der Vermessungs=Commission wegen Schätzung der Straße zu Poserin das Straßenrecht gar nicht angeführt. Endlich wird auch in gleichzeitigen Schriften über landwirtschaftliche Gegenstände, z. B. in den 1769 erschienenen: "Gedanken von Verbesserung des Flachsbaues, vornämlich im Meklenburgischen" 2 ) des Leinsäens auf den Dorfstraßen nicht mehr gedacht.


|
Seite 409 |




|
13. Das Straßengericht.
Bei den vielen Theilungen des Grundbesitzes und dem öfteren Verluste der betreffenden Urkunden und dem Mangel einer Codisication der ländlichen Rechtsgewohnheiten ward auch das Straßengericht die Quelle mancher Händel zwischen den Grundherren. Eine nahe Veranlassung des Streites lag zuweilen in der Theilung der Gerichtsgefälle, der Bruchgelder. Gewöhnlich wird aber diese Gerichtsbarkeit in den Acten mit dem Leinsäen auf den Dorfstraßen zugleich verhandelt, so daß im Gefolge von Streitigkeiten über das Straßenrecht die Frage der Gerichtsbarkeit öfter als das entscheidende Moment erörtert wird. Doch kommt der Gegenstand auch in selbständiger und in nicht processualischer Verhandlung vor, indem zu Zeiten des 16. und 17. Jahrh. auf den Besitz von Gerechtsamen, die zwar in der That von keinem großen Belange waren, aber doch dem Besitzer eine gewisse Würde gaben und zeitweise nutzbarer werden konnten, mehr Werth gelegt ward, als heutiges Tages. Außerdem hat, bei beschränkterer Einsicht in öffentliche Verhältnisse und leichterer Verfolgung des eigenen persönlichen Vortheils, die zu jener Zeit größere Liebe für das Local=Herkömmliche hier mitgewirkt.
Der oben bestimmte Begriff des Straßengerichts tritt öfter actenmäßig hervor, wie in dem angeführten Prozesse der Holstein gegen die Linstow wegen Woggersin um 1586, wo es heißt: - keineswegs hätten die Linstow das Straßengericht zu Woggersin allein besessen, "vnd wenn sich Felle vnd Bruche vff der Strassen zugetragen, allein das Gerichte geheget vnd die geburende Bruche daruon genommen."
Das Verhältniß zwischen der Gerichtsbarkeit und dem Leinsäen auf den Dorfstraßen wird, besonders in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., von streitenden Parteien zuweilen in ganz entgegengesetzter Weise bezeichnet. Gewöhnlich wird zwar behauptet, das Leinsäen sei Ausfluß der Gerichtsbarkeit, und noch später: es finde nur mitunter zur Bezeichnung und Wahrung der Gerichtsbarkeit von Seiten der ritterschaftlichen Grundherren und der Domanial=Aemter statt. dagegen wird aber auch zu beweisen gesucht, daß das Leinsäen selbstständig geschehen könne, daß das Straßenrecht etwas Unabhängiges und Hauptsächliches sei. - Als im J. 1573 das Amt Güstrow den Passow die Nutzung der Straße zu Zehna nicht weiter gestatten wollte, bezog es sich theils auf vorgekommene Mißbräuche, theils aber auch auf das dem Landesherrn zuständige Straßengericht zu Zehna. Indessen war nach dem


|
Seite 410 |




|
Rathe der herzoglichen Commissarien den Passow das Leinsäen, als altherkömmlich, unter üblicher Beschränkung, auch ferner zu gestatten. Bald darauf ließ das Amt Bukow, im Besitze der hohen Gerichtsbarkeit zu Danneborth, das von den Bibow auf der Straße daselbst gesäete Lein "des angemasseten hohen Gerichts halber" ausreißen, wogegen die Bibow den hiervon unabhängigen, vieljährigen Besitz des Straßenrechts zu Danneborth darzuthun suchten Als im J. 1584 Joachim Krammon, dessen Frau, geb. Hobe, als Erbjungfer Antheil an Kl. Lüsewitz und Tulendorf befaß, "die freye Straße zu Tulendorf, so zum höchsten Gerichte gehörig vnd dazu beschirmet wird, mit Leyn zu beseyen sich unterstanden" hatte, ließ Dietrich Bevernest, der das höchste Gericht daselbst besaß, angeblich, um sich in dessen Besitze zu erhalten, den Flachs auf der Straße zerstören. Es behaupteten ferner 1586 die Linstow gegen die Holstein wegen Woggersin: es sei Landgebrauch: "wer die Strasse vnd Freiheit mit Leien zu beseen befugt, das dem auch das Strassengerichte zugehore." In einem Streite zwischen dem Kloster Dobbertin und den Restorf auf Bolz wegen der Gerichtsbarkeit und des Leinsäens zu Lenzen erklärten sich die Parteien darüber einverstanden, daß "die Straßen=Freiheit mit zum hochsten Gerichte gehore". Das Amt Walsmühlen bezog sich 1598 wegen des angeblich ihm zuständigen Straßengerichts zu Kotendorf besonders darauf, daß es die Straße daselbst seit langer Zeit zur Erhaltung der landesherrlichen Gerichtsbarkeit zeitweise mit Lein besäet habe. Uebrigens gab es zu, daß den Pentz und den Lützow 10 Hufen zu Kotendorf gehörten. Im J. 1612 ward das Amt Boizenburg landesherrlich angewiesen, den vom dermaligen Inhaber von Zahrensdorf, Johann Meves, auf der Dorfstraße gesäeten Flachs zu zerstören, weil man dessen Vorgängern "das Geringste bis hieher am Straßengericht nicht gestendig gewesen." Im J. 1615 verkaufte Herzog Johann Albrecht II. an Joachim Oswald Wangelin das Straßengericht zu A. Schwerin "vnd also auch die Beseiung derselbigen." Endlich heißt es noch 1622 in dem Prozesse der Peccatel gegen die Maltzan wegen Blumenholz: es sei landgebräuchlich, "welchem das Strassengericht zukehme, der auch die Strassen wo vnd wie offte eß ihme gefellig, zu beseyen Macht habe."
Nach der vorherrschenden und damals allerdings naheliegenden Ansicht ward demnach das Leinsäen auf den Dorfstraßen als Zubehör oder Ausfluß der Gerichtsbarkeit betrachtet. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß auch die entgegenstehende


|
Seite 411 |




|
Ansicht, nach welcher das Straßenrecht als eine selbstständige, von der Gerichtsbarkeit unabhängige Befugniß erscheint, unter Umständen in der früheren Zeit Begründung und wirkliche Geltung gewinnen konnte, wie dies bereits oben unter 6, 9 und 10 durch Nachweisung von Thatsachen angedeutet ist. Es geschah dies hauptsächlich durch den Einfluß der Theilungen des Grundbesitzes und die Bedeutung des localen Herkommens. Ursprünglich benutzten einzelne Colonisten hier und da die Dorfstraßen mehr oder minder willkürlich nach localen und persönlichen Einflüssen in gutem Glauben. Hieraus entstand ein Herkommen, welches sich nach und nach verbreitete und eine gewisse Gültigkeit gewann. Wo der Grundbesitz getheilt war, ward die Straße mancher Orten und zuweilen lange Zeit hindurch von den Colonisten der verschiedenen Grundherren in gutem Glauben, ohne Widerspruch von Seiten des Gerichtsherrn, nach Anzahl der Hufen genutzt. Wohl nur aus diesen Gründen gestanden z. B. die im unzweifelhaften Besitze der Gerichtsbarkeit sich befindenden Aemter, wie das Amt Güstrow dieselbe zu Miekow und zu Zehna besaß, den andern auf derselben Feldmark berechtigten Grundherren, auch nachdem die Befugniß streitig geworden war, Antheil am Straßenrechte nach Hufenzahl oder wie sonst herkömmlich war, zu. Wie das locale Herkommen, wenn es unzweifelhaft erschien und gehörig dargestellt ward, noch in später Zeit zuweilen Anerkennung fand, ist ebenfalls bemerkt, wie z. B. hinsichtlich der Bauerschaft zu Röddelin noch im J. 1702. Einzelne Colonisten oder einzelne unter verschiedenen auf derselben Feldmark angesessenen Grundherren mögen auch frühzeitig durch einen besonderen Rechtstitel, wie Kauf, Verpfändung, Dienstvertrag u. s. w. bestimmten Antheil am Straßenrechte erworben haben. Wenn die zuerst bezeichnete Ansicht, dem eindringenden, allgemeinen Verfalle der Colonats=Verhältnisse entsprechend, seit dem Beginne des 17. Jahrh. entschiedener vorherrschend ward, so ist auch wohl hierin ein auf die bäuerlichen Interessen ungünstig mitwirkender Einfluß des römischen Rechtes nicht zu verkennen. In zweifelhaften Fällen hätte man zunächst auf locales Herkommen, auf die Theilungen des Bodens und auf die Entwickelung der Verhältnisse zwischen Grundherrn und Colonisten zurückgehen müssen. Dies geschah von Anwälden und Richtern seltener und jedenfalls ungründlicher, seitdem die eigenthümliche Bedeutung des deutschen Grundeigenthums oft mißverstanden, die Gutshörigkeit aber mehr und mehr nach römischen Mancipiats=Ansichten beurtheilt ward, und ein entsprechender Einfluß in der einheimischen Gesetzgebung der Reversalen vom J. 1621


|
Seite 412 |




|
bereits hervorgetreten war, da doch einer Seits das römische Recht weder ein Privat=Eigenchum mit Hoheitsrechten, noch ein deutsches Colonatswesen, noch endlich die umfassende Bedeutung des Herkommens, des Rechtsgebrauchs 1 ), als vorherrschender Quelle des Rechtes, gekannt hatte, und anderer Seits noch in neuerer Zeit trotz aller Bedrängniß ein Theil der Colonisten sich in persönlicher Freiheit, ein anderer im Besitze lehnrechtlicher und erbrechtlicher Nutznießungs= oder Eigenthumsrechte an Grund und Boden (Lehnschulzen, Erbmüller, Erbschmiede u. s. w.) erhielt.
Ganz der angedeuteten Wendung der Dinge entsprechend zeugen mancherlei Acten gegen das Ende des 16. Jahrhunderts von zunehmender Unkunde der Colonisten mit heimischen Rechtsverhältnissen, während bis um 1550 in Prozessen und Beschwerden ritterschaftlicher Untersassen und frommer Stiftungen, in Jurisdictions=Händeln u. s. w. Selbstbewußtsein und Rechtseifer der Colonisten noch einiger Maßen hervortreten. So gestehen z. B. in Zeugenverhören, die 1575 über die Gerichtsbarkeit in Schlowe stattfanden, mehrere der befragten Bauleute, das Wesen des höchsten und des "sidesten" Gerichts nicht zu kennen, andere erscheinen unklar über die Bedeutung des Rauchhuhns, so wie gewisser Beden und Dienste.
Das Straßengericht eines Dorfes war zuweilen im gemeinsamen Besitze mehrerer Grundherren, indem Beschwerden wegen einseitiger Erhebung von Brüchen bei den Straßengerichten mehrfach vorkommen. Gewöhnlich ward auch hier der Einfluß der Hufenzahl, besonders für die Theilung der Strafgefälle, geltend gemacht. Um das J. 1550 fielen die Brüche beim Straßengerichte zu Varchentin zur einen Hälfte dem Herzoge Joh. Albrecht I. und zur andern den Rostke auf Varchentin und Schloen zu. Später, 1570, machten aber auch die Krause Mitansprüche an dieses Straßengericht, indem sie das Eigenthum des Kirchenlehns und der meisten Hufen zu Varchentin behaupteten. Wegen verweigerter Theilung der Brüche beim Straßengerichte zu Marin klagten 1591 die Blücher wider die Marin. Es war nämlich um das J. 1580 ein Bauer auf der Straße zu Marin erschlagen, dessen Mörder 15 Gulden Strafgeld beim ältesten Schulzn erlegt hatte. Dieses Geld ward später von Levin Marin einseitig er=


|
Seite 413 |




|
hoben, während das Straßengericht angeblich den Blücher und Marin gemeinsam zustand, da beide ungefähr gleichen Antheil an der Feldmark des Ortes besaßen. Ebenso behaupteten 1586 die Holstein gegen die Linstow, daß das Straßengericht zu Woggersin ihnen gemeinsam sei. Noch um 1680 war das Straßengericht zu Zieslübbe halb landesherrlich, halb nach dem Lehngut Möderitz gehörig. - Indessen kommen auch Fälle vor, wo bei ziemlich gleicher Theilung der Feldmark, das Straßengericht einem Grundherrn ausschließlich zustand. So gehörte im J. 1610 das unferne Gadebusch belegene Dorf Jarmstorf zur einen Hälfte nach dem herzoglichen Amte Gadebusch, zur andern den Bülow auf Holtorf. Das Straßengericht stand jedoch ausschließlich dem Amte Gadebusch zu.
Das Verhältniß zwischen dem Straßengerichte und der Gerichtsbarkeit überhaupt war im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts nicht aller Orten gleichmäßig bestimmt. Gewöhnlich erscheint das Straßengericht als ein besonderer, wenn auch nicht grade immer selbstständiger Theil der Gerichtsbarkeit. Der Inbegriff der höchsten und niedrigsten Gerichtsbarkeit, als einem oder mehreren Grundherren zustehend, schloß nicht überall eo ipso das Straßengericht ein. Die auf der Straße vorkommenden Vergehen bildeten gleichsam einen eigenen Kreis der gerichtlichen Wahrnehmung. Ueber das Straßengericht wird bisweilen als über etwas Selbstständiges verfügt. Die uralten Theilungen der Feldmarken und die später sich häufenden Partial=Veräußerungen mußten auch auf die gesammte Gerichtsbarkeit einen wesentlichen Einfluß üben, indem dabei der altdeutsche Grundsatz festgehalten ward, daß jedem Grundherrn Schutz= und Schirmrecht und die Gerichtsgewalt über seine Hintersassen zustehe. Daher konnte es vorkommen und war wirklich öfter der Fall, daß in demselben Dorfe und auf derselben Feldmark 3 bis 4 Jurisdictionen bestanden: ein Grundherr besaß die höchste und niedrigste Gerichtsbarkeit überhaupt, oder nur diese, und ein dritter die höchste, ein zweiter das Straßengericht, ein dritter und vierter die Gerichtsbarkeit über seine Colonisten innerhalb deren Höfe, und vom Schulzen des Dorfes ward noch eine gewisse niederpolizeiliche Gewalt geübt. Alles dies war auch in vielen Dörfern und in deren Nähe schon äußerlich durch Galgen, Pranger und Halseisen erkennbar. Bisweilen war die hohe Gerichtsbarkeit zwischen mehreren Lehnleuten unter sich, oder zwischen einem der Landesherren und einem Vasallen getheilt, wenn sie gleich pro indiviso besessen ward; häufig hatten sich die Landesherren und demnächst andere große Grundherren bei Dotationen die hohe Gerichtsbar=


|
Seite 414 |




|
keit, als durch die Brüche möglicher Weise einträglich, vorbehalten. Auch die Kirchen und Pfarren waren bisweilen durch Dotationen mit bestimmen Colonats=Hufen im Besitze einer Gerichtsgewalt. - Demnach heißt es in Urkunden über Veräußerungen des Grundbesitzes so häufig: "hohestes edder Obgericht vber Haut vnd Har, sidestes vnd Strassengericht;" oder: "hogestes vnd sidestes Gericht vber Halß und Handt vf der Feldmarke, Strassen vnd binnen Zaunes." Im J. 1569 vertauschte Achim Halberstadt auf Kl. Brütz 5 Bauern zu Meteln an den Herzog Johann Albrecht I. unter Andern gegen die dem Herzoge in dem getheilten Dorfe Gr. Brütz zustehende "hogeste vnd sideste Gerichtsgewalt vber Halß vnd Handt vf der Veldmarke, Strassen und binnen Zauneß". Die Schoenberg auf Frauenmark wurden 1572 wegen des von ihnen angesprochenen Straßengerichts zu Grebbin durch landesherrliche Resolution dahin bedeutet: "sie hätten über ihre dortigen Leute nicht weiter zu richten, als was in deren beschlossenen vier Pfälen geschehe". 1 ) In den Beweisartikeln des Zabel Stall zu Pohnstorf wider das Amt Güstrow wegen Miekow v. J. 1578 heißt es: "Art. 18. Wahr, daß demnach das hohe vnd niedere Gericht zusampt dem Strassengericht vber vnd bei den streitigen Hofen dem Kläger zustehe". Als im J. 1598 wegen eines Todschlags zu Walsmühlen der Punkt streitig war, ob der Mord auf der Dorfstraße oder im Hofe eines Pentzschen Unterthanen geschehen sei erklärte das Amt Walsmühlen, daß es das hohe Gericht auf der Straße daselbst nur "vf beiden Seiten bis ahn die Zeune" anspreche. Otto Prignitz auf Bollewick behauptete 1628 die hohe, niedere und die Straßengerichtsbarkeit zu Nätebow und war andern Lehnleuten wegen dreier ihnen gehöriger Bauhöfe daselbst "keiner Gerichte weiter als auf den drey Hoeffen innerhalb Zauns gestendig". Diese Beispiele werden auch vermutlich den Begriff der bisweilen vorkommenden Zaungerichte bestimmen. Endlich war im J. 1645 der Herzog Adolph Friederich bereit, dem Gutsbesitzer von Altenhagen auf dessen Ansuchen das Straßengericht daselbst dergestalt zu concediren, daß er die von den Colonisten im Dorfe oder auf der Straße verübten Unthaten bestrafe, aber keine Jurisdiction über Reisende oder Einwohner des Dorfes, die nicht Bauern seien, zu üben habe.
Die Competenz der Straßengerichte war jedoch


|
Seite 415 |




|
anscheinend nicht immer genau auf die Dorfstraße beschränkt. Vielmehr standen wohl bisweilen "Straßen= vnd Feldgerichte" in einer gewissen natürlichen Verbindung. Es wird wenigstens über die Strafgefälle bei Straßengerichten zuweilen auch wegen solcher Fälle berichtet, die anscheinend auf freiem Felde geschehen waren. Auch werden Straßen= und Feldgerichte in Veräußerungs=Urkunden öfter in solcher Wortverbindung aufgeführt, daß diese auf einen sachlichen Zusammenhang fast unverkennbar hindeutet. So verpfändete Achim Riebe auf Broma im J. 1612 dem Rathe zu Friedland seine Erblehngüter zu Klokow und Kotelow unter Andern mit dem "Strassen= vnd Feldgerichte an Haut, Haar, Hals vndt Handt". Zu Blumenholz gab es 1620 ein Straßen= und Feldgericht, welches die Peccatel gemeinsam besaßen, die auch damals einen Verbrecher auf dem nahen Felde hatten hängen lassen. Im J. 1621 wird zu Kobrow ein landesherrliches "Strassen= und Feldgericht" erwähnt. - Dagegen kann eine Erstreckung der Straßengerichtsbarkeit, so weit sie Privatpersonen als Grundherren zustand, auf die Landstraßen für die Zeiten des 16. Jahrhunderts nicht füglich behauptet werden. Wie bereits oben unter 5 erwähnt ist, wollten die Landesherren, namentlich die Herzoge Heinrich und Ulrich z. M., selbst der Stadt Wismar die Gerichtsbarkeit und das Geleitsrecht auf den nahen Landstraßendämmen nicht zugestehen. Entsprechend ward gegen einzelne Lehnleute damals wiederholt und entschieden verfahren. So wird ein Fall erwähnt, der zu Mödentin zu Zeiten des Hans Preen vorkam; auch setzte in einem andern Falle, der im J. 1572 als Privatbeschwerde des von der Lühe zu Panzow auf dem Landtage mit verhandelt ward, der vermeintlich verletzte Grundherr der landesherrlichen Erklärung von der Regalität der Landstraßengerichtsbarkeit nichts weiter entgegen. 1 ) Doch zeigt sich diese Regalität allerdings in anderer Beziehung, z. B. hinsichtlich des Geleitsrechts und der Verpflichtung aus Gewalttaten, die auf der Landstraße gegen Reisende verübt wurden, damals, wie früher und später, in einzelnen Fällen etwas schwankend, worauf wohl die Landestheilungen und die ständischen Privilegien eingewirkt haben.
Die Straßengerichte wurden hauptsächlich in Fällen der Tödtung feierlich gehegt. Im Laufe des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts herrschten dabei noch wesentlich die älteren, landesüblichen Formen des altdeutschen


|
Seite 416 |




|
Gerichtsverfahrens vor. Die Hegung geschah da, wo die That begangen, oder wo der Körper des Entleibten gefunden war, immer aber unter freiem Himmel und "bei Sonnenschein", d. h. während hoher Tageszeit, und so, daß der "blinkende Schein", der Leib des Getödteten, gesehen ward. Wo Selbstmord, wo Tod durch Unfall oder blinde Naturgewalt vorlag, ward ein Noth= oder Fahrrecht gehalten; der todte Leib ward geprüft, der casus "kürzlich untersucht und schließlich Recht" gesprochen. In Fällen des Todtschlags fand das Blutgericht mit der Beschreiung statt. Der gewöhnlich entflohene Thäter ward friedlos gemacht, von dem Entleibten aber die Hand genommen, welches Letztere in Mecklenburg bis etwa um das Jahr 1580 noch durchweg geschah. Der Vorsitzende, Dingvogt, war seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert gewöhnlich ein Rechtsgelehrter oder doch ein öffentlicher Beamter, bisweilen noch aus dem Stande der Dorfschulzen, besonders beim Fahrrecht; die "Beisitzer im Rechte", Dingleute, so wie die "Vorsprachen und der Findes= oder Dingmann" waren häufig Colonisten. - Im einzelnen wich das Verfahren in den verschiedenen Landestheilen allerdings etwas ab 1 ), wie denn überhaupt in Deutschland selbst in den kleineren Territorien von einem durchweg und gleichmäßig geltenden Landrechte kaum die Rede sein kann, weil überall sehr viel von dem localen Herkommen und dem Einflüsse der privaten Patrimonialgewalt abhing. - Eben so sind auch die Straßengerichte in Meklenburg, so wie das ältere gerichtliche Verfahren überhaupt, nicht auf einmal und nicht gleichmäßig erloschen. Nur so viel ist gewiß, daß in der Zeit von 1650 bis 1750 2 ) auch das ältere gerichtliche Verfahren die wesentlichsten Umgestaltungen erlitten hat.


|
Seite 417 |




|



|



|
|
:
|
Ueber die Aussteuer der Töchter aus dem Lehn,
eine Urkundenmittheilung
von
G. C. F. Lisch.
Johans Albrecht.
Erbare, tugentsame, liebe andechtige. Wir haben
euer schreiben, betreffend einen furstandt, den
ihr den auch erbarn vnsern lehnleuten vnd lieben
getreuen Hartich vnd Reimern gebrudern den
Bulowen zu Radem bestellen soltet, nemlich das
ihr ihnen nach eurem todtlichen abgang dass gut,
so sie euch an stadt eures ehegeldts
freiwilliglich eingereumpt, auf euer lebelang zu
geniessen, wiederumb so gut, als sie euch das
vbergeben, liffern, vndt solchen furstandt
verburgen soltet, hören verlesen, vnd wissen vns
anfenglich vnserer deswegen an die hochgelerten
vnsere Rath, Professorn zu Rostock vnd lieben
getreuen Friederich Heinen, Lorentz Panclowen
vnd Heinrich Gladowen ausgegangener Commission
wol zu erinnern, wir seindt auch des recesses,
so durch sie zwischen euch beiderseits
auffgerichtet, nach nothdurfft berichtet, können
aber bei vns nicht erachten, warumb ihr
desselbigen vnd insonderheit des verburgten
furstandes beschwerung traget, dann ihr
gleichwol wisset, daß ihr kein erbjungfrau in
die gemelten guter seiet, euch auch dieselbigen
mit keinem rechten, noch aus landtüblicher
gewonheit, sondern allein aus gutwilligkeit
euerer vettern zukommen, so ist euch auch
gleichfals vnuerborgen, das nach dem gebrauch
vnserer lande vnd Furstentumb keiner Jungfrauen
mehr zur ehelichen aussteuer gepurt, dann so vil
ihres vatters guter jerlicher nutzung ertragen.
Nun werden wir bestendig berichtet, das solche
guter bei weitem so vil nicht, als obgenante
eure vettern euch in der gute vnd freuntschafft
gepoten, nemlich 300 fl. jerlich, ertragen
sollen, sondern selbs in der hauptsumme vber 500
fl. nicht vil werth sein sollen. Deswegen wissen
wir eurer bitt disesfals nicht stadt zu geben,
sondern ihr werdet euch selbs dermassen in die
sach zu schicken wissen, damit wir fernerm
anlauffen vnd ihr mit weitleufftiger
vnfruchtbarer suchung verschonet pleiben muget,
wollen wir euch gnediger mainung hinwider nicht
bergen. Datum Schwerin den 15. 8bris Ao.
 . 69.
. 69.
An
Jungkfrau Annen Bulowen.
Nach dem Concepte im großherzogl. meklenb. Geh. und Haupt=Archive zu Schwerin.


|
Seite 418 |




|
IX. Zur Erd= und Naturkunde.
Ein Paar Wisenthörner
oder Büffelhörner, gefunden auf der Feldmark Jörnstorf bei Neubukow, beim Ausgraben einer Wiese, 12 Fuß tief, unter Torf= oder Modererde, gewann der Verein durch Geschenk des Herrn Schlüter zu Jörnstorf.
Ein Elengeweih,
gefunden zu Grambow bei Goldberg im Torfmoor, schenkte dem Vereine der Herr von Passow auf Grambow.
Druckfehler
in den
Historischen Nachrichten von dem lübeckischen
Patriciat,
vom Dr. E. Deecke zu Lübeck.
| S. 55, | Z. | 10 v. u. | lies: | Verlehnten, | statt: | verlehrten. |
| S. 63, | Z. | 15 v. u. | - | van | - | von. |
| S. 66, | Z. | 11 v. o. | - | andert | - | endert. |
| - | Z. | 6 v. u. | - | denen | - | demen. |
| Z. | 4 v. u. | - | mer | - | wer. | |
| - | Z. | 3 v. u. | - | Selschop | - | Selchop. |
| S. 67, | Z. | 1 v. u. | wes | was. | ||
| S. 68, | Z. | 3 v. u. | - | van | - | von. |
| - | Z. | 4 v. o. | - | men | - | man. |
| - | Z. | 20 v. u. | - | Wasses | - | Wasser. |
| - | Z. | 5 v. u. | - | wolde | - | welde. |
| S. 69, | Z. | 19 v. u. | - | men | - | man. |
| S. 71, | Z. | 13 v. o. | Bunge | Bunze. | ||
| S. 75, | Z. | 5 v. o. | spele | schale. | ||
| - | Z. | 13 v. o. | - | dat spill schal | - | dat schal. |
| S. 78, | Z. | 12 v. o. | - | spele | - | schale. |