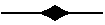|
[ Seite 341 ] |




|



|
|
|
- Ueber die rothen Sandsteine in den heidnischen Gräbern
- Hünengräber von Eversdorf
- Feuerstein-Manufactur bei Raben-Steinfeld
- Hünengrab und Steingeräthe von Dobbin bei Krakow
- Hünengrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3 (Vgl. Jahrb. IX., S. 368)
- Hünengrab von Plau Nr. 1, Nr. 2
- Hünengräber von Leisten (bei Plau)
- Schleifstein von Rambow Nr. 2 (Vgl. Jahrb. X, S. 269)
- Wetzstein von Quetzin
- Streithammer von Plau
- Die Graburnen der Kegelgräber
- Kegelgrab und Opferstätte von Peccatel bei Schwerin, Nr. 2
- Kegelgrab von Gr. Methling (bei Gnoien)
- Kegelgräber von Dobbin bei Krakow
- Kegelgräber von Weisin bei Lübz Nr.1., Nr.2., Nr.3.
- Kegelgrab von Weisin Nr. 4
- Kegelgrab von Retzow, D.A. Lübz, Nr. 5., 6., 7. (Vgl. Jahresber. IX, S. 381)
- Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3
- Kegelgrab von Sandkrug, D.A. Lübz, Nr. 1., Nr. 2.
- Kegelgräber von Kikindemark
- Kegelgrab von Spornitz
- Kegelgrab von Stolpe
- Kegelgrab von Wiechmanstorf
- Kegelgrab von Roggow
- Kegelgräber von Alt-Sammit bei Krakow
- Begräbnißplatz von Vietlübbe bei Plau, aus der Zeit der Kegelgräber
- Bericht über Kegelgräber von Plau
- Kegelgrab von Plau
- Begräbnißplatz von Liepen
- Ohrbommel aus Bernstein von Moltzow
- Die schwarzen Urnen der Wendenkirchhöfe
- Ueber die Verbreitung römischer Alterthümer in den Ostseeländern
- Kuchenform von Bützow
- Heberegister der Vogtei Grevismühlen aus den Jahren 1404 und 1519
- Der Dom zu Ratzeburg
- Die Domkirche zu Güstrow und die Kirche zu Satow
- Zur Münzkunde
- Verzeichniß des meklenburgischen Adels, von dem meklenburg-strelitzischen Minister Christoph Otto von Gamm, redigirt um das J. 1775
- Verzeichniß der in denen Herzogthümern Meklenburg ausgestorbenen Geschlechter, nebst Anzeige der Zeit, wann sie erloschen sind, und was sie für Wapens gehabt haben
- Die von Lewetzow und von Lowtzow
- De Schwartepapen
- Denkstein von Eversdorf
- Das meklenburgische Hofgericht im Mittelalter
- Hebungen des Amtes Rühn
- Fischerei des Gutes Steinhagen auf dem rühnschen See
- Huldigungsplatz zu Cölpin im Lande Stargard
- Rennthiere in Meklenburg
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 342 ] |




|


|
[ Seite 343 ] |




|



|



|
|
:
|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Im Allgemeinen.
Ueber die rothen Sandsteine
in
den heidnischen Gräbern.
E s ist in Meklenburg sehr häufig beobachtet und in unsern Jahrbüchern beschrieben, daß in den Gräbern der Steinperiode und auch noch oft in den Gräbern der Bronzezeit die Urnen mit dünnen, gespaltenen Platten von grobkörnigem, hellrothen Sandstein bedeckt und daß die steinernen Grabkisten mit denselben Steinen ausgezwickt und an den Seiten ausgelegt, selbst oft mit großen Sandsteinplatten gleicher Art ganz bedeckt, ja mitunter ganz von solchen Steinen erbauet sind. Diese stets wiederkehrende, nicht zu bezweifelnde Erscheinung, welche ohne Zweifel eine tiefere Bedeutung hat, war bisher nur in Meklenburg als ein charakteristisches Kennzeichen beobachtet worden (vgl. unten S. 349). Sie findet sich jedoch auch in andern Ländern.
In dem an Kegelgräbern äußerst reichen Thiergarten bei Kopenhagen war beim Steinbrechen von den Arbeitern ein ziemlich großes Kegelgrab geöffnet. Der Vorfall ward sogleich angezeigt und ich war am 2. Julius 1845 bei meiner Anwesenheit auf Seeland bei der Untersuchung gegenwärtig. Das Grab enthielt in der Mitte eine aus großen, starken Steinplatten wohl zusammengefügte Grabkammer zum Aufnehmen der ganzen, unverbrannte Leiche, gewissermaßen einen Sarg, von ungefähr 7 Fuß Länge und einigen Fuß Breite und Tiefe. Das Begräbniß war schon ausgeräumt; es fielen mir aber sogleich die gespaltenen, rothen Sandsteine, welche aus dem Grabe geworfen waren, in die Augen. Bei näherer Besichtigung fand sich, daß alle Fugen zwischen den großen Steinplatten mit solchen rothen Sandsteinen ausgezwickt waren und daß der westliche große Deckstein der Grabkammer ebenfalls aus rothem Sandstein,


|
Seite 344 |




|
der östliche jedoch aus röthlichem Granit bestand. Einige anwesende Forstmänner und Mineralogen versicherten, daß sich dieser rothe Sandstein in dem ganzen Thiergarten und der Forst von Jägersburg sonst nicht finde. - Bei genauerer Beobachtung wird diese Erscheinung auch wohl in andern Ländern hervortreten.
G. C. F. Lisch.
Ueber die Graburnen der Kegelgräber
vgl. man unten die Abhandlung über die Alterthümer aus der Zeit der Kegelgräber.



|



|
|
:
|
b. Zeit der Hühnengräber.
Hünengräber von Eversdorf.
Bekannt ist das ausgezeichnet große und schöne Hünengrab von Naschendorf (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXVI, Fig. II und III, und Erläuterung S. 164). In der Nähe desselben liegt zu Eversdorf bei Grevismühlen, in den jetzt zum Abräumen bestimmten eversdorfer Fichten an der barendorfer Scheide, ein ähnliches, jedoch lange nicht so schönes und so gut erhaltenes Hünengrab. Es ist ungefähr 130 Fuß lang, 16 Fuß breit, einige Fuß hoch und mit Steinpfeilern umstellt, welche jedoch größtentheils versunken sind.
In einiger Entfernung davon liegt an jeder Seite ein kurzes Hünengrab mit einer Steinkiste; beide sind jedoch schon gestört.
In den eversdorfer Eichen aber liegt ein Grab von seltener Form. Es ist ein ungeheurer Granitblock, ungefähr 9 Fuß lang, 5 Fuß breit und 4 Fuß hoch, welcher auf kleinen Steinen ruht, die jedoch fast ganz in die Erde versunken sind. Der Stein ist dadurch merkwürdig, daß er die ganz regelmäßige Form eines Sarges hat

Behauen ist der Stein nirgends, sondern er ist von Natur so gestaltet und zu dem Zweck gewählt worden.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 345 |




|



|



|
|
:
|
Feuerstein=Manufactur bei Raben=Steinfeld.
Auf der Feldmark von Raben=Steinfeld, auf hohem Ufer des schweriner Sees, in der sogenannten Seekoppel, fand sich auf einem kleinen Raume eine sehr große Masse der bekannten drei= und vierseitigen Späne aus Feuerstein, obgleich schon früher viele weggenommen waren. Bei der letzten Abräumung fanden sich noch mehrere Scheffel dieser Späne und andere steinerne Alterthümer, welche der Herr Oberjägermeister von Pressentin zu Raben=Steinfeld dem Herrn Premier=Lieutenant Baron von Stenglin zu Schwerin schenkte, welcher sie wieder dem Vereine zum Geschenke brachte.
Von mehreren Feuersteinspänen, welche derselbe besaß, war ihm nur einer übrig geblieben. Dagegen sind die andern dort gefundenen Alterthümer erhalten. Dies sind namentlich zwei Schleuder= oder Klopf= oder Knacksteine, beide aus feinkörnigem Granit oder hornsteinartigem Gesteine, der eine dunkelgrün, der andere röthlich: 1 1/2 " dicke, 2 1/2 " und 3 " im Durchmesser haltende, an beiden Seitenflächen conver gearbeitete Scheiben, welche in der Mitte jeder Seitenfläche eine Vertiefung, wie einen Fingereindruck, in der Mitte des schmalen Umfanges eine Rille haben, ganz wie der in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 20, abgebildete Stein. Die Rille um den größern Stein ist sehr fein, scharf und regelmäßig, um den kleinern Stein breit, unregelmäßig und vielfach ausgebrochen. Gleiche Steine mit Vertiefungen an beiden flachen Seiten, jedoch ohne die Rillen, "Knacksteine" genannt, hält man in Skandinavien für die Instrumente, mit denen man die Steinwerkzeuge des Alterthums bearbeitete; der Umstand, daß unsere Steine auf einer Manufacturstätte gefunden wurden, spricht allerdings sehr für diese Ansicht. Größere Steine dieser Art sind in Meklenburg zu Lehsen und Lütgenhof gefunden; vgl. Jahresber. IV, S. 24 und 25.
Ferner ward auf der Manufacturstätte zu Raben=Steinfeld die Hälfte einer im Schaftloche durchbrochenen Streitaxt aus Hornblende gefunden.
Ueber ähnliche Manufactur=Stätten, in der Regel an Seeufern, vgl. man Jahrb. IX, S. 362, und X, S. 262, und Jahresber. III, S. 41, 64 und 66, und VII, S. 46.


|
Seite 346 |




|
Auf der Feldmark Raben=Steinfeld wurden an verschiedenen Orten noch folgende Steinalterthümer gefunden und von dem Herrn Premier=Lieutenant Baron von Stenglin ebenfalls geschenkt:
eine Lanzenspitze aus hellgrauem Feuerstein, 9 " lang, am breiten Ende stumpf und von dort geradlinig zur Spitze auslaufend;
ein Keil aus Feuerstein, 3 1/2" lang;
ein Dolch aus dunkelgrauem Feuerstein, 5 " lang, sehr schmal, mit rhombischem Griffe.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab
und
Steingeräthe von Dobbin
bei Krakow.
In einem schon aufgebrochenen Hünengrabe nahe bei der Schmiede zu Dobbin, von welchem noch Spuren zu sehen sind, fanden sich noch folgende steinerne Alterthümer, welche der Herr von Jasmund dem Vereine schenkte:
ein Streithammer von Hornblende, von schöner, lang gestreckter Form, 7 " lang, polirt, mit nicht polirtem Schaftloche, welches eine rillenförmige Fläche hat;
ein Streithammer von Gneis, kurz und dick, 4 " lang, an der Oberfläche stark verwittert und mit hervorstehenden Adern festern Gesteins, mit polirten Schaftloch;
ein Keil von weißem Feuerstein, überall polirt, an einer Seite der Schärfe hohl geschliffen, von sehr zierlicher Form, 4 1/2" lang.
Außerdem fanden sich auf dem dobbiner Felde in Mergel= oder Sandgruben folgende steinerne Alterthümer, welche der Herr von Jasmund ebenfalls dem Vereine schenkte:
eine zerbrochene große Streitaxt aus stark mit schwärzlichem Glimmer und röthlichem Feldspath vermengtem Granit, mitten durch das polirte Schaftloch durchgebrochen, nur in der obern Hälfte vorhanden, hier 3 " breit und 2 " dick;
ein zerbrochener kleiner Streithammer aus hellgrüner Hornblende, kurz und schmal, mitten durch das sehr große, polirte Schaftloch, in den dünnen Wänden durchgebrochen, nur in der untern Hälfte vorhanden;


|
Seite 347 |




|
zwei kleine Keile aus Feuerstein, 4 " und 3 1/2 " lang, dünne, von sehr zierlichen Formen und überall polirt;
zwei große Keile aus Feuerstein, 6 " lang, an den beiden breiten Seiten geschliffen.
Daß die beiden einzeln gefundenen Streithämmer zerbrochen sind, kommt ohne Zweifel daher, daß der größere aus bruchigem Granit verfertigt ist, der kleinere aber ein zu großes Schaftloch und zu dünne Seitenwände hat.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hünengrab von Vietlübbe
bei Plau, Nr. 3.
Vgl. Jahrb. IX., S. 368.
Auf dem vietlübber Acker liegt da, wo die Wege vom Sandkruge nach Retzow und von Vietlübbe nach Schlemmin sich kreuzen, ein Hünengrab, umstellt von 8 Granitpfeilern und bedeckt mit einem einzigen Steine. Die Steine umschließen einen Raum von 12 Fuß Länge von Nordost nach Südwest und 6 Fuß Breite. Der südwestliche Stein war ausgewichen und der Deckstein zwischen die übrigen Tragsteine hineingesunken. Ehe dies Grab untersucht werden konnte, mußte der Deckstein durch Sprengen entfernt werden. Dann ward der nordöstliche Stein weggenommen und von hier aus die weitere Nachgrabung vorgenommen. Die über dem Urboden angehäufte Erde bestand aus Dammerde und war 2 1/2 'hoch. Der Urboden war mit kleinen Steinen, besonders calcinirten Feuersteinen belegt, zwischen denen Asche und Kohlen aus Tannen= und Buchenholz sich zeigten; weiterhin war ein sorgsam gelegter Steindamm, 6 ' lang und 2 'breit in der Längenrichtung des Grabes, ebenfalls mit Feuersteinen, Asche und Kohlen bedeckt. An zwei Stellen lag etwa 1' hoch über diesem Damme eine kleine Urnenscherbe; sonst fand sich nichts an Alterthümern. Aber rund umher war nahe an den Tragsteinen der Platz mit auf einander gelegten gespaltenen Sandsteinen gleichsam ummauert. Das Grab liegt in einer Niederung; einige hundert Schritte westlich ist eine Gruppe von 9 Kegelgräbern, welche bedeutend höher liegt, da der Boden sich nach Nordwest erhebt.
Vietlübbe, im April 1845.
J. Ritter.


|
Seite 348 |




|



|



|
|
:
|
Hünengrab von Plau Nr. 1.
Auf dem Felde Dresen, einem Theile der plauer Feldmark nach Ganzlin hin, lagen 2 Hünengräber rechts von der alten Landstraße nach Meienburg einige hundert Schritte entfernt. Das größere war 20 Fuß lang und 8 Fuß breit, mit je 3 Steinen der Länge nach und einem Schlußsteine in Nordost und Südwest umstellt und mit 2 Decksteinen, die alles dicht verschlossen, bedeckt. Nachdem alle Steine gesprengt waren, untersuchte ich die dazwischen drei Fuß hoch angehäufte Erde. Gleich am nordöstlichen Schlußsteine lag ein menschlicher Schädel und auch weiter das ganze Gerippe auf der Brandstelle, die sich durch das ganze Grab auf dem Urboden hinzog und an Kohlen, ausgeglüheten Feuersteinen und Asche kenntlich war. Der Schädel lag 1 Fuß höher: dem Anscheine nach war die Leiche in sitzender Stellung beigesetzt, an den Schlußstein sich lehnend. Die Stirnbildung bei diesem Schädel ist auffallend flach. Die Leiche war über 2 Fuß hoch mit den flach gespaltenen Sandsteinen bedeckt, mit denen auch die Seitensteine umher ausgezwickt waren. Ganz am entgegengesetzten südwestlichen Ende stand 1 1/2 Fuß über dem Urboden eine schon zerdrückte Urne ohne Verzierung; ihre Gestalt war nicht zu erkennen; darin schien nur Sand und Asche gewesen zu sein. Weiter fand sich an Alterthümern nichts.
Hünengrab von Plau Nr. 2.
Etwa 200 Schritte westlich von dem vorigen lag ein kleineres Hünengrab, dessen Schluß= und Decksteine schon früher weggenommen waren. Nachdem auch die Seitensteine zersprengt waren, durchsuchte ich die innere Erdmasse in einer Länge von 12 Fuß, einer Breite von 5 Fuß und einer Höhe von drei Fuß. Außerdem, daß auch hierin sich besonders am Rande viele flache Sandsteine, über dem Urboden eine Brandstelle mit ausgeglüheten Feuersteinen belegt und fast in der Mitte 2 Fuß hoch über dem Urboden in einer Lehmmasse die Scherben einer grobkörnigen Urne befanden, war in dem Grabe nichts von Alterthümern vorhanden.
Vietlübbe im Juni 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Hünengräber von Leisten (bei Plau).
Auf dem Felde des Gutes Leisten (vgl. Jahrb. IX, S. 355) lagen in der Richtung nach Plauerhagen unweit einer Niederung, auf


|
Seite 349 |




|
einer nach Südosten sich neigenden Fläche drei Hünengräber von gleicher Größe und Bauart. Auf einem kleinen fast runden Hügel, mit mäßigen Steinen im Umkreise umstellt, so daß sie fast das Ansehen von Kegelgräbern hatten, stand eine längliche Steinkiste von Nordwest nach Südost etwa 10 ' lang, während die Breite nur 4' betrug. Beim Ausbrechen der Steine zum Chausseebau fanden die Arbeiter den Boden der Steinkisten mit Steingrus, besonders weiß ausgeglüheten Feuersteinen belegt, außerdem aber in den Kisten:
1) einen kleinen Streithammer aus Gneis, 3 1/4 " lang,
2) einen geschliffenen, kleinen Keil aus grauem Feuerstein, 3 3/4" lang,
3) einen Schmalmeißel oder eine Lanzenspitze aus hellgrauem Feuerstein, roh zugehauen und nicht geschliffen, 4 1/2" lang,
4) ein spanförmiges Messer aus Feuerstein.
Vietlübbe.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Schleifstein von Rambow
Nr. 2.
Vgl. Jahrb. X, S. 269.
Zu Rambow bei Malchin ward in dem Fundamente
eines alten Gebäudes ein Bruchstück von einem
Schleifstein aus der Steinperiode gefunden und
von dem Herrn Landrath, Reichsfreiherrn von
Maltzan auf Rothenmoor, Rambow
 . dem Vereine geschenkt. Das fast
viereckige Bruchstück ist ungefähr 3 Quadratzoll
groß und 1 Zoll dick. Es ist von feinkörnigem,
quarzigen, festen, rothen Sandstein und an den
beiden breiten Flächen und einer schmalen Seite
glänzend glatt ausgeschliffen; der Stein ist
offensichtlich zu neuern Bauzwecken zerschlagen.
Der Stein ist ganz dem bei Dabel in einem
Hünengrabe neben Feuersteinkeilen gefundenen,
vollständigen Schleifsteine gleich, nämlich
roth, flach, dünne und an den beiden breiten
Flächen stark ausgeschliffen, und unterscheidet
sich von den freilich eben so bearbeiteten,
"keulenförmigen" Schleifsteinen, wie
solche in Skandinavien oft gefunden werden,
dadurch, daß diese prismatisch gestaltet, an
mehrern Stellen angeschliffen und aus weißem,
feinkörnigen Sandstein sind, wie ein solcher
ebenfalls zu Rambow gefunden ist (vgl. Jahrb. X,
S. 269 flgd.).
. dem Vereine geschenkt. Das fast
viereckige Bruchstück ist ungefähr 3 Quadratzoll
groß und 1 Zoll dick. Es ist von feinkörnigem,
quarzigen, festen, rothen Sandstein und an den
beiden breiten Flächen und einer schmalen Seite
glänzend glatt ausgeschliffen; der Stein ist
offensichtlich zu neuern Bauzwecken zerschlagen.
Der Stein ist ganz dem bei Dabel in einem
Hünengrabe neben Feuersteinkeilen gefundenen,
vollständigen Schleifsteine gleich, nämlich
roth, flach, dünne und an den beiden breiten
Flächen stark ausgeschliffen, und unterscheidet
sich von den freilich eben so bearbeiteten,
"keulenförmigen" Schleifsteinen, wie
solche in Skandinavien oft gefunden werden,
dadurch, daß diese prismatisch gestaltet, an
mehrern Stellen angeschliffen und aus weißem,
feinkörnigen Sandstein sind, wie ein solcher
ebenfalls zu Rambow gefunden ist (vgl. Jahrb. X,
S. 269 flgd.).
Solche rothe Sandsteinplatten, namentlich die grobkörnigen, welche zu Urnendeckeln dienten, findet man häufig zur Setzung


|
Seite 350 |




|
von Steinmauern und Fundamenten auf dem Lande angewandt und zeugen für eine unglaubliche Aufräumung der Hünengräber beim Beginn der neuern Ackercultur. Vgl. oben S. 343.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wetzstein von Quetzin.
Auf der Feldmark von Quetzin bei Plau ward beim Ausbrechen von Steinen zur Chaussee in der Erde ein eigenthümlich geformter Stein gefunden und durch den Herrn Pastor Ritter zu Vietlübbe für den Verein gewonnen. Ein eigentliches Hünengrab oder ein Hügel soll an dem Fundorte nicht gewesen sein, jedoch gehört der Stein ohne Zweifel der Steinperiode oder doch einer sehr fernen Zeit an. Der Stein besteht aus festem, dunkelgrauen Schiefer, hat eine sehr regelmäßige, elliptische oder kahnförmige, nach beiden Enden hin zugespitzte Gestalt, ist 9 1/2 "lang, 1 5/8 " breit in der Mitte und überall 3/4 " dick, ist in allen Flächen geglättet und wohl erhalten und an den Kanten ein wenig abgestumpft. Man hat solche Steine früher wohl Weberschiffsteine oder Schleudersteine genannt; in Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 19 ist ein solcher Stein abgebildet.
In Skandinavien werden solche Steine von verschiedenen Größen, aber immer ungefähr von derselben Gestalt, in Gräbern der Steinperiode und einzeln, häufig gefunden; in der königlichen Sammlung zu Kopenhagen und in der ebenfalls sehr reichen Sammlung des Herrn Professors Nilsson zu Lund finden sich diese Steine in sehr großer Zahl. Ich verdanke die Bestimmung dieser Steine der persönlichen Belehrung des Herrn Professors Nilsson, der mir dieselbe an jedem Exemplare seiner Sammlung so erläutert hat, wie ich die Beschaffenheit später an allen andern Exemplaren, auch dem unsrigen, beobachtet habe. Alle diese Steine haben nämlich an den breiten Seiten mehr oder minder tiefe, oft nur geringe, längs gerichtete Vertiefungen, welche in der Regel nach einer Seite hin schräge links hinab laufen, wenn man den Stein in der linken Hand hält. Sie waren zum Wetzen, Schärfen oder Nachschleifen kleiner Werkzeuge, vielleicht von Pfeilen oder Nadeln, bestimmt, so daß, wenn man den Stein in der linken Hand hielt, die schräge links laufenden Vertiefungen natürlich ohne Absicht entstanden. Die Form war nöthig, um ohne Bohrung von Löchern die Steine sicher in Bändern am Gürtel tragen zu können. Eine große Menge ähn=


|
Seite 351 |




|
licher Steine setzt diese Bemerkung außer allem Zweifel. Wahrscheinlich wurden diese bequemen Steine auch noch in jüngern Zeiten gebraucht.
G. C. F. Lisch.
Ueber diese "weberschiffartigen" "Klopf= und Schleifsteine" (vgl. auch oben "Feuersteingeräth=Manufactur von Raben=Steinfeld" S. 345) giebt Herr Masch zu Neu=Ruppin folgende Mittheilung aus Nilssons Forschungen.
Diese Steine, deren Bestimmung die Kopenhagener in den "Historisch=antiquarischen Mittheilungen, Kopenhagen, 1835, S. 81 " noch nicht erkennen, gehören nach Nilsson (Skandinaviske Urinvanare) zu dem Werkzeuge, mit welchem anderes gefertigt wird. Nilsson theilt sie in
und liefert viele Abbildungen davon, die seiner Erklärung, mit dem ihm beiwohnenden Scharfblick und Scharfsinn abgefaßt, zum klarsten, evidentesten Beweise dienen. "Sie sind stets von einer harten, öfters quarzartigen Steinart, bisweilen reinem Quarz, bisweilen Quarzsandstein, nie von Feuerstein oder Gneis."
Daß sie, wie die Kopenhagener sagen, sich auch von weicherer Steinart finden, wird dadurch widerlegt.
Der Klopfsteine giebt es 2 Arten:
1) bloße Klopfsteine, mit denen dem Feuersteine
die erste Form gegeben, der Stein geschlagen
(tillknackat) ward. Sie sind rund gedrückt,
flach=rund, flach=oval, vier =, sechseckig
 ., nicht scharfeckig, auch wohl
birnförmig u. s. w., alle haben kleine, in den
Flächen und Seiten sich gegenüberstehende, runde
Vertiefungen, bisweilen zu einem Loche
durchbohrt, zum bessern Fassen.
., nicht scharfeckig, auch wohl
birnförmig u. s. w., alle haben kleine, in den
Flächen und Seiten sich gegenüberstehende, runde
Vertiefungen, bisweilen zu einem Loche
durchbohrt, zum bessern Fassen.
2) Klopf= und Schleifsteine, mit welchen nur die Schärfe (Schneide) an= oder zurechtgeklopft (gehämmert) und auf deren Fläche dann geschliffen ward. Sie sind flach, viereckig oder oval; in der Mitte der Fläche findet sich eine geradlaufende Ritze (Furche), die vom Schleifen (Reguliren) der geklopften Schneide entstanden ist.
An den Enden beider Arten finden sich die Spuren der Schläge, sichtbar und deutlich.
Schleifsteine, mit welchen (vielleicht) nicht geklopft oder geschlagen ward, welche nur zum Anschärfen stumpfgewordener Schneiden dienten: die "weberschiffförmigen Steine" der Kopen=


|
Seite 352 |




|
hagener. In der Rille. (Falz) ward ein Riemen
befestigt, um sie am Gürtel zu tragen. Die Ritze
auf der Fläche ist schräge, wie sie entstehen
muß, wenn der Stein in einer, z. B. der linken
Hand gehalten und der zu schärfende Gegenstand:
Pfeil =, Lanzenspitze
 ., mit der andern Hand darüber
hingeführt wird.
., mit der andern Hand darüber
hingeführt wird.
Der ferner in den Histor.=ant. Mitth. erwähnte Stein, mit dem "nun fast verrosteten" eisernen Futter in der Rille, liegt im Museum zu Stockholm und ist nichts anderes, als ein solcher Schleifstein, den die späteren skandinavischen Bewohner, welche die Steingeräthe ihrer Vorbewohner für zauberkräftig hielten, so zu einem "Lebens=Siegesstein" (Amulet), den sie um den Hals trugen, umschafften.
Auch die "Probirsteine" (Hist.=ant. Mitth. S. 83, Fig. 56) rechnet Nilsson unbedingt zu den Schleifsteinen und beweiset es bündig, wie gewöhnlich. Sie gehören unbedingt zu den Urgeräthen und wurden nicht unwahrscheinlich von den Frauen zum Spitzen der Knochennadeln gebraucht und am Gürtel getragen, wie der Riemen beweiset.
Die Anführung, daß sie ursprünglich zum Probiren des Goldes oder Silbers gedient hätten, zerfällt in sich selbst.
Hinsichtlich der Schleifsteine Hist.=ant. Mitth.
S. 66 ist Nilsson einverstanden. Die
Original=Abhandlung in "Nordisk
Tidskrift"
 . 1 Bd., 2 H.: "Om nord.
Oldsager af Stehen", verdeutscht in den
"Mittheilungen", S. 63, hat er nach
Beendigung seines Werkes kennen gelernt.
. 1 Bd., 2 H.: "Om nord.
Oldsager af Stehen", verdeutscht in den
"Mittheilungen", S. 63, hat er nach
Beendigung seines Werkes kennen gelernt.
Neu=Ruppin.
A. G. Masch.



|



|
|
:
|
Streithammer von Plau.
Auf dem gaarzer Felde bei Plau ward unter einem Steinhaufen (wahrscheinlich dem Reste eines Hünengrabes) ein Streithammer aus Hornblende gefunden und von dem Herrn Chaussee=Baumeister Mühlenpfort erworben und dem Vereine geschenkt. Er ist klein und flach, hat die Gestalt eines schmalen, gleichschenkligen Dreiecks, ist 4" lang, am breiten Ende 2" breit und 1" hoch. Er zeichnet sich dadurch aus, daß er am breiten Ende in der Mitte durch die Höhe den 1/2" breiten Rest eines alten Schaftloches hat, woraus hervorgeht, daß er aus einer zerbrochenen größeren Streitaxt gebildet ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 353 |




|



|



|
|
:
|
c. Zeit der Kegelgräber.
Die Graburnen der Kegelgräber,
von
G. C. F. Lisch
Mit Abbildungen in Holzschnitt.
In Jahrb. X., S. 237 flgd. sind allgemeine Untersuchungen über die heidnischen Grabgefäße überhaupt angestellt und im Verfolg derselben S. 253 flgd. im Besondern die charakteristischen und eigenthümlichen Formen und Verzierungen der Graburnen der Hünengräber oder der Gräber aus der Steinperiode zur Anschauung gebracht. In den nachfolgenden Zeilen soll eine Charakteristik der Urnen der Kegelgräber in Meklenburg, der Gräber aus der zweiten heidnischen Culturepoche, versucht werden; unter Kegelgräbern verstehen wir nämlich die über dem Erdboden aufgeschütteten, kegelförmigen, oder halbkugelförmigen oder backofenförmigen, mit Rasen bedeckten Hügel (tumuli) der reinen Bronze=Periode, Hügel, welche vorherrschend und in der Regel Leichenbrand und nur Geräthe aus Bronze (Legirung aus Kupfer und Zinn) und mitunter Schmuck aus Gold, jedoch nie mehr Stein, auch noch kein Eisen enthalten, mit Ausnahme weniger, höchst seltener Fälle. Wir vermuthen, daß diese Gräber Völkern germanischen Stammes angehören, andere glauben sie den Kelten zuschreiben zu müssen; doch ist diese Frage kaum völlig reif zur Lösung, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß die Schilderungen der Germanen durch die Römer zu dem Inhalte der Kegelgräber trefflich stimmen: die Beantwortung der Frage kann hier auch ganz aus dem Spiele bleiben. Es soll hier auch nicht auf einzelne Ausnahmen, unverbürgte Funde und unklare Bildungen, wie häufig geschieht, gefußt werden; das System, welches sich hier von selbst ergiebt und nicht gemacht wird, gründet sich auf täglich und ohne Ausnahme sich wiederholende Erscheinungen und hunderte von Gräbern.
So viel ist außer Frage, daß die Kegelgräber einem sehr alten Volke angehören, welches einen hohen Grad der Tüchtigkeit und einen sehr feinen, edlen Geschmack besaß. Im südlichen Deutschland wird die Eigenthümlichkeit dieser Bildung oft durch Eindrängung der verwandten römischen Cultur verwischt und im


|
Seite 354 |




|
Norden in den jüngeren Zeiten durch eine frühere christliche Cultur und einen größeren Seeverkehr oft besonders modificirt; aber in einer gewissen, alten Zeit, der Zeit der reinen Bronze=Periode, ist diese Cultur in allen Ländern der westlichen Ostsee durchaus gleich. Ich habe innerhalb eines Jahres hinter einander die Sammlungen in Stettin, Berlin, Greifswald, Strelitz, Schwerin, Kiel, Kopenhagen und Lund gesehen und verglichen und die Erzeugnisse aller der Völker, denen die Geräthe in diesen Sammlungen angehören, durchaus in allen Stücken übereinstimmend gefunden; ich rede natürlich nicht von äußerst wenigen, einzelnen Ausnahmen während der Zeiten der verschiedenen Uebergänge, die so selten sind, daß sie kaum und mit geringer Sicherheit gefunden werden. Was also von Meklenburg gilt, das gilt zugleich auch von Pommern, Brandenburg, Lauenburg, Lübeck, Holstein, Dänemark und Schonen. - Der jüngsten heidnischen Periode, der wendischen, können diese Gräber natürlich nicht angehören.
Die Verfertigung der Urnen ist zwar in Jahrb. X. a. a. O. zur Untersuchung gezogen, jedoch mag eine kurze Schilderung der allgemeinen Eigenthümlichkeiten auch hier willkommen sein. Die Urnen der Kegelgräber sind, wie alle übrigen heidnischen Grabgefäße, aus Thon und zerstampftem Granit aus freier Hand geformt, dann mit einer feinen Thonschicht überzogen und in einem freien Feuer gedörrt oder halb gar gebrannt. Im Besondern findet man aber unter den Urnen der Kegelgräber sehr viele, welche ein viel mehr grobkörniges Gemenge haben, als die Urnen der Stein= und der Eisen=Periode; mitunter ist der Granit oder Feldspath nur so grob zerstoßen, daß die Gefäße von außen wie eine höckerige Steinmasse erscheinen. Im Allgemeinen hat man aber nur wenig Sorgfalt auf die Ausarbeitung der Grabgefäße gewandt und den Schmuck der Verzierungen fast ganz verschmäht, obgleich es auch viele sehr sauber gearbeitete Gefäße aus dieser Periode giebt. Dagegen sind die Grundformen immer edel und rein, wenn auch die rauhe Außenseite mitunter nicht gefallen mag. Die Grundform nähert sich immer mehr oder weniger dem Cylinder und man hat daher die Urnen der Kegelgräber auch wohl vasenförmige genannt, während die runden, kannenförmigen Urnen der Steinperiode sich mehr der Kugel, die flachen, schlüsselförmigen Urnen der Eisenperiode mehr der Scheibe nähern. Die Urnen der Kegelgräber vermeiden stets eine zu große Zuspitzung des Fußes und eine zu große Oeffnung der Mündung. Man kann die Grundform der Urnen der Kegelgräber eine antike nennen, wenn man unter antiken Formen die Formen der altitalischen und altgriechischen Cultur versteht, einer Cultur,


|
Seite 355 |




|
welche auch in den bronzenen Geräthen mit der nordischen übereinstimmt. Die großen Urnen der Kegelgräber gleichen in der Form ganz den schlichten römischen Graburnen aus Mittelitalien und unterscheiden sich von diesen oft nur dadurch, daß die römischen aus andern Thonarten gefertigt und gleichmäßig und fest gebrannt sind. Ich rede hier natürlich nicht von den bemalten sogenannten etrurischen Vasen griechischer Cultur, sondern nur von den in Gräbern Mittelitaliens gefundenen, röthlichen, schmucklosen Urnen zur Aufbewahrung der verbrannten Gebeine. Wenn man erst mehr auch für die Geschichte der Cultur, als für die höchste Ausbildung der Cultur sammelt und forscht, wird sich die Aehnlichkeit der alten Cultur des Südens und des Nordens zur Zeit der Bronzeperiode auffallend zeigen.
Endlich ist es eine Eigenthümlichkeit der Urnen der Bronzeperiode, daß die Grundform derselben fast in allen Gefäßen gleich ist. Freilich ist jede Urne anders, als die andere, und es findet sich die moderne Uniformität im Alterthum nicht; aber in keiner Periode des Alterthums ist das Festhalten an der edlen Grundform so allgemein, als in der Bronzeperiode, und in jeder andern Periode findet eine häufigere Abweichung von dem Grundgedanken und eine größere Mannigfaltigkeit statt.
Was nun die Form der einzelnen Urnen der Kegelgräber und vielleicht auch ihre Bestimmung betrifft, so lassen sich zur Zeit der Bronzecultur gleichzeitig drei Arten von Grabgefäßen unterscheiden.
mit den Ueberresten des verbrannten Leichnams gefüllt und, wenn mehrere Urnen in demselben Grabe stehen, gewöhnlich die größeren Knochenstücke enthaltend (ossuaria=Beinurnen). Am häufigsten findet sich jedoch nicht mehr, als eine solche große Urne in einem Grabe, und wenn sich mehr als eine Urne in einem Grabe findet, so ist die große Urne das Hauptgefäß, da es in der Regel auch die bronzenen Alterthümer zwischen den Knochen liegend enthält. Diese großen Urnen sind in der Regel sehr dickwandig und grobkörnig, am gewöhnlichsten von ganz hellbrauner Farbe und, mit höchst seltenen Ausnahmen, ohne Verzierungen. Ihre Form nähert sich der Cylinderform, die Ausbauchung ist nur sehr geringe und der Bauchrand liegt gewöhnlich in der Mitte. Ihre Höhe beträgt gewöhnlich 8" bis 10".
Diese großen Beinurnen scheiden sich in zwei verschiedene Arten:


|
Seite 356 |




|
1) Große, vasenförmige, ungehenkelte Urnen mit abgerundetem Bauchrande.
1/2 Größe.
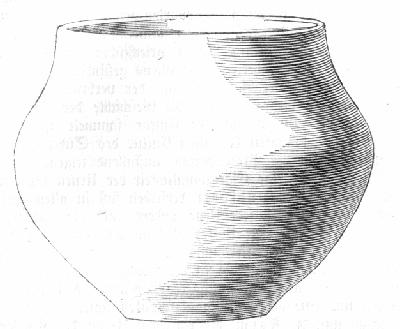
Diese Art von Urnen kommt in den Gräbern der reinen Bronzeperiode am häufigsten vor und acheint den Gräbern der ältern Zeit anzugehören. Die Form ist in der Regel edel und rein und verträgt ohne Störungen geringe Abweichungen (vgl. Frid. Franc. Tab. V.). Oft ist der Rand über dem Bauche höher, oft die Ausbauchung geringer und dann nähert sich die ganze Urne mehr dem Cylinder, ja es giebt aus der Bronzeperiode Urnen, welche die vollkommene Cylindergestalt haben. So stand zu Rakow bei Bukow in einem Kegelgrabe eine 13 " hohe, ganz cylindrisch geformte Urne, bei welcher ein Schwert und eine Lanzenspitze aus Bronze und eine 2 Fuß lange, bronzene Nadel, deren Knopf mit Goldblech überzogen war, gefunden wurden (vgl. Erster Bericht über das Antiquarium zu Schwerin, S. 9). Urnen dieser Art sind in Gräbern häufig zu finden, seltener in den Sammlungen, da sie, vielleicht ihrer Größe wegen, in den Gräbern gewöhnlich zerdrückt sind. Die oben abgebildete Urne ward in einem Kegelgrabe zu Perdöhl (Jahresber. V, S. 48 flgd.) gefunden; in andern Kegelgräbern daselbst fanden sich ähnliche Urnen. Diese Urnen scheinen die Grundform gebildet zu haben, da sich Gefäße aller Art und Größe von derselben Form finden.


|
Seite 357 |




|
2) Große, vasenförmige, ungehenkelte Urnen mit scharfem Bauchrande.
1/3 Größe.
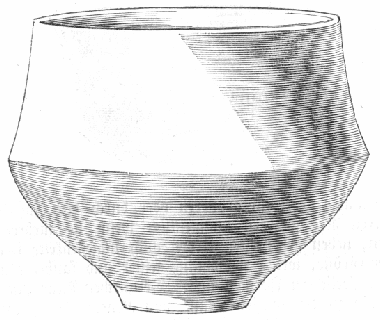
Diese Art von Urnen wird in den Kegelgräbern der jüngern Zeit häufig gefunden. Es läßt sich ihr jüngeres Alter daraus ermessen, daß die in ihnen gefundenen Bronzen gewöhnlich nicht sehr tiefen Rost haben und daß sie noch in Begräbnissen vorkommen, welche schon der Eisenperiode angehören (vgl. Frid. Franc. Tab.VI, Fig. 1, 3 und 4, u. Erläut. S, 23 flgd.). Sie sind sehr weit verbreitet und kommen noch in Böhmen vor (vgl. Kalina von Jäthenstein: Böhmens Alterthümer Taf. XXXIII, Fig. 2). Wegen des in der Mitte liegenden scharfen Bauchrandes ist ihre Grundform sehr fest bestimmt und daher erträgt sie keine andere Abweichung, als daß etwa der Bauchrand um ein geringes höher oder tiefer liegt. Die oben abgebildete Urne ward in dem Kegelgrabe von Meyersdorf Nr. 1. (vgl. Jahresber. V, S. 47) gefunden; auch fanden sich in den perdöhler Kegelgräbern (vgl. daselbst S. 48 flgd.) Urnen dieser Art. Diese Urnen sind den mittelitalischen Graburnen am ähnlichsten.
Diese beiden Arten von Urnen charakterisiren die Bronze=Periode hinlänglich; sie müssen lange Zeit in Anwendung gewesen sein, da noch in der Eisen=Periode mitunter ganze Lager von ähnlichen Urnen, wenn auch nicht in so reinen und strengen Formen, gefunden sind.


|
Seite 358 |




|
3) Mittelgroße, vasenförmige, ungehenkelte Urnen.
1/2 Größe.
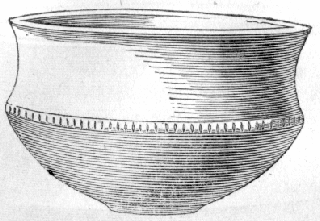
Mitunter stehen in größeren oder durch den Inhalt ausgezeichneteren Kegelgräbern, namentlich wenn sie mehrere Urnen enthalten, neben gehenkelten Urnen auch ungehenkelte Urnen von mittlerer Größe, welche gewöhnlich feiner und sauberer gearbeitet und von zierlichern Formen sind. Dergleichen Fälle sind aber in Verhältniß zu der großen Masse von Kegelgräbern, welche sich im Lande finden, nicht häufig. Die oben abgebildete Urne stand in dem großen, merkwürdigen Kegelgrabe von Ruchow (vgl. Jahresber. V, S. 32, Nr. 8) und ist vielleicht keine Graburne, sondern ein dem Todten mitgegebenes Gefäß zum häuslichen Gebrauche, da die Leiche nicht verbrannt, sondern in einer ausgehöhlten Eiche beigesetzt war. Die Verzierung, welche in senkrechter Auskerbung des etwas erhöheten Bauchrandes besteht, ist noch an einer andern Urne unbekannten Fundortes nachzuweisen.
Diese Urnen finden sich in der Regel in den Gräbern nicht allein, sondern nur neben einer großen, vasenförmigen, ungehenkelten Urne und enthalten gewöhnlich keine Knochen, sondern nur Sand und Asche und etwa kleine Knochensplitter, aber fast nie Alterthümer; man kann sie daher Aschenurnen (cineraria) nennen. Wenn sich eine solche Urne allein in einem Grabe findet, so ist sie nur scheinbar allein beigesetzt; in einem solchen Falle pflegen, statt der ungehenkelten Beinurnen, die verbrannten Knochen in einem Haufen oder in einer von Steinen gebildeten Höhlung oder Kiste gesammelt zu sein. Die gehenkelten Urnen sind fast immer von feinerer Masse, viel dünner als die ungehenkelten Urnen, oft ganz dünne, sauber ausgearbeitet, von


|
Seite 359 |




|
schwärzlicher Farbe und mitunter mit Verzierungen geschmückt. Die Grundform ist der der ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande (I, 1) gleich; nur ist die Form der gehenkelten Urnen in der Regel etwas geschmackvoller und zierlicher. Die gehenkelten Urnen scheinen daher ebenfalls einer älteren Periode anzugehören, um so mehr, da in der Steinperiode Urnen mit großen Henkeln vorkommen und sich in der Eisenperiode keine Urnen mit großen Henkeln mehr finden; in der Eisenperiode haben die Urnen nur durchbohrte Knötchen oder Höcker, durch welche man Schnüre ziehen konnte (Seiltöpfe). Die Henkel an den Urnen der Bronzeperiode sind aber so groß, daß man mit der vollen Hand hineinfassen kann. Die Höhe der Henkelurnen beträgt gewöhnlich 6 bis 7 ".
Die gewöhnlichste Gestalt der Henkelurnen der Kegelgräber ist die hier abgebildete, welche in einem Kegelgrabe zu Gallentin (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 1) gefunden ist; sie ist schwärzlich, etwas dick in den Wänden und sonst ganz gewöhnlich gearbeitet.
1/3 Größe.
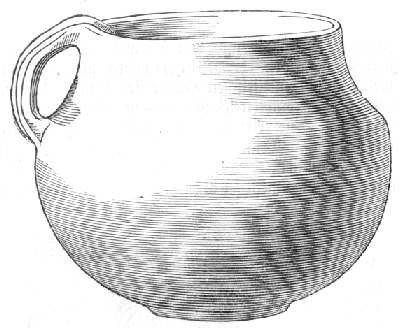
Mitunter haben diese gehenkelten Urnen unter dem Boden einen niedrigen, erhabenen Ring statt eines Fußes, während sonst an allen andern Urnen der Boden ganz glatt ist. Im Allgemeinen läßt sich bemerken, daß sich diese gehenkelten Urnen nicht so häufig finden, als die ungehenkelten.


|
Seite 360 |




|
Eine etwas zierlichere Form hat eine in einem Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber.V, S. 52, Nr. 18) gefundene Henkelurne
1/3 Größe.
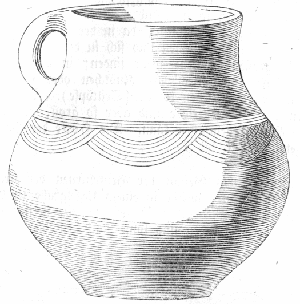
welche ziemlich dickwandig und von braungrauer Farbe ist. Sie zeigt zugleich eine Form der Verzierung aus der Bronzeperiode, welche aus concentrischen Halbkreisen besteht, die an einem mehrstreifigen, horizontalen Bande hangen, also eine Art "Guirlande" bilden. Diese Art der Verzierung bildet sich sehr frei, leicht und geschmackvoll und ist ohne Zweifel aus dem vorherrschenden Ornament der Bronzeperiode entsprungen, nämlich aus den bekannten horizontalen Spiralwindungen
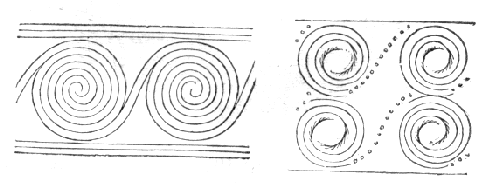
Urnenverzierungen sind übrigens in der Bronzeperiode sehr selten. In einem andern Kegelgrabe zu Perdöhl (vgl. Jahresber. V, S. 54, Nr. 25.) ward noch eine andere, gleich geformte und verzierte, jedoch kleinere Urne gefunden.


|
Seite 361 |




|
Ein anderes Ornament der Henkelurnen aus der Bronzeperiode besteht in vertieften, parallelen Kreisen, welche über dem Bauchrande bis zum Henkel liegen, wie die hier abgebildete,
1/3 Größe.

zu Gallentin gefundene Urne (vgl. Jahresber. II, S. 38, Nr. 2) zeigt.
Völlig und ausschließlich eigenthümlich sind der Bronzeperiode die ganz kleinen Gefäße oder Näpfe, welche sich sehr häufig in den Gräbern finden und hier gewöhnlich oben in den größern Urnen stehen; sie sind in der Regel ungefähr 3 " hoch und von sehr zierlichen und geschmackvollen, oft rein "antiken" Formen. Sie enthalten gewöhnlich nur etwas mit Asche vermischten Sand und sind vielleicht bestimmt gewesen, die Asche von den Stellen der edleren Theile des Leibes, z. B. des Herzens, der Augen u. s. w. aufzunehmen. Ihre Formen sind sehr mannigfaltig (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXV.), jedoch lassen sich einige Hauptformen herausfinden:
1) kleine Gefäße in Gestalt der großen, ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande: diese sind nicht sehr häufig und sind in der Farbe gewöhnlich auch hellbraun;


|
Seite 362 |




|
2) kleine Gefäße in Gestalt der großen ungehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit ziemlich engem und hohem, oft etwas eng auslaufenden Halse, auf dem Bauchrande mit zwei ganz kleinen, durchbohrten Knötchen, deren Oeffnung nicht größer, als eine dünne Schnur dick ist; diese charakteristischen Gefäße finden sich nicht selten in den Kegelgräbern; die hier abgebildete Urne
1/3 Größe.

ward in einem Kegelgrabe zu Perdöhl in einer großen Urne gefunden (vgl. Jahrb. V, S. 52, Nr. 15);
3) kleine Gefäße in Gestalt der großen gehenkelten Urnen mit abgerundetem Bauchrande, mit nicht ganz hohem, an der Oeffnung etwas nach außen umgebogenen Halse, mit einem großen Henkel am Halse; diese Gefäße, welche oft sehr sauber, edel und zierlich sind, werden häufig gefunden: das hier zunächst abgebildete Gefäß
1/3 Größe.

ist zu Moltzow gefunden, einer Feldmark, deren Kegelgräber an ähnlichen kleinen, zierlichen Gefäßen besonders reich sind. Das ferner hier abgebildete Gefäß


|
Seite 363 |




|
1/2 Größe.

ward in einem Kegelgrabe zu Retzow gefunden (vgl. unten); es zeichnet sich durch seine auf dem Bauchrande angebrachten Verzierungen aus, abwechselnd erhabene und vertiefte, schräge rechts laufende Schwingungen, welche tief in der ganzen Oberfläche des Gefäßes haften und bei der Verfertigung desselben geformt sein werden; dieselbe Verzierung findet sich noch an einigen kleinen, ähnlichen Gefäßen und einer großen, ungehenkelten, zu Spornitz gefundenen im Frid. Franc. Tab. V, Fig. 7, abgebildeten Urne in der großherzoglichen Sammlung und ist also für die Bronzeperiode wohl eine charakteristische Verzierung und bei der Seltenheit der Ornamente wohl zu beachten;
4) kleine gehenkelte Schalen, ungefähr in dem Charakter der Urnen, von den zierlichsten Formen, deren Grundtypus (dem dorischen Kapitäl ähnlich) die in Jahrb. X, S. 283, abgebildete, zu Moltzow gefundene Bronzeschale zu sein scheint; sie scheinen zum Ueberstülpen zu klein und überhaupt durch ihren Bau nicht geeignet zu sein und sind auch oft neben Urnen in Gräbern gefunden; sie sind oft ganz klein, oft etwas größer, bis zur Größe der eben erwähnten Bronzeschale: die hier abgebildete Schale
1/2 Größe.
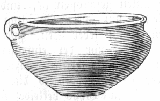
ward zu Moltzow gefunden, wo überhaupt viele Schalen gefunden sind.


|
Seite 364 |




|
Außer den oben aufgeführten, häufig vorkommenden, charakteristischen Formen kommen zuweilen, jedoch sehr selten, auch ganz ungewöhnliche Urnenformen vor. Zu diesen gehört die hier abgebildete bienenkorbförmige Urne, welche die Oeffnung an der Seite hat oder vielmehr eine Thüröffnung, welche mit einer Platte durch vorgeschobene Riegel verschlossen werden konnte. Die Urne ist zu Kikindemark bei Parchim in einem Kegelgrabe gefunden (vgl. Jahresber. III, S. 59).
1/3 Größe.
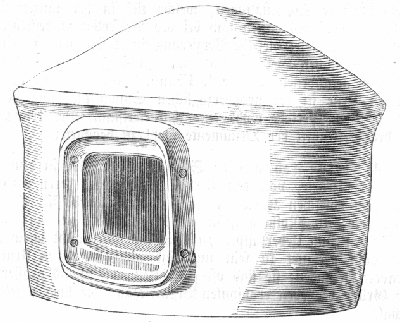
Sie hat senkrechte Wände, eine zugespitzte, gewölbte Decke, so daß sie oben und unten geschlossen ist, und eine viereckige Oeffnung an der Seite; um diese Oeffnung geht ein erhabener Rand, durch welchen an jeder Seite zwei Löcher gebohrt sind, durch welche die Riegel vor der einpassenden Thür geschoben wurden. Zu dem oben mitgetheilten Holzschnitte ist zu bemerken, daß die Wände der Urne deshalb so dick dargestellt sind, weil die Urne jetzt inwendig mit Gyps bekleidet und zusammengehalten ist, da sie zerbrochen war.
Urnen von gleicher Gestalt sind bis jetzt nur noch außerhalb Deutschland beobachtet und zwar zu Rönne auf Bornholm und zu Burgchemnitz in Thüringen (vgl. Jahresber. III, S. 49, Note).


|
Seite 365 |




|
Außerdem sind noch an seltnern Formen ganz cylinderförmige und eiförmige, mit einpassenden Deckeln versehene Urnen
1/3 Größe.
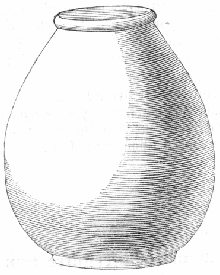
in mehreren Kegelgräbern zu Gallentin gefunden (vgl. Jahresber. II, S. 38 - 39).
In den Kegelgräbern finden sich oft große Schalen, welche, so viel bekannt ist, ebenfalls der Bronzeperiode charakteristisch sind. Sie sind groß, mehr oder minder flach, bald mit einem oder zwei Henkeln, bald ohne Henkel und ungefähr von der hier abgebildeten Form. Die hier dargestellte Schale
1/3 Größe.
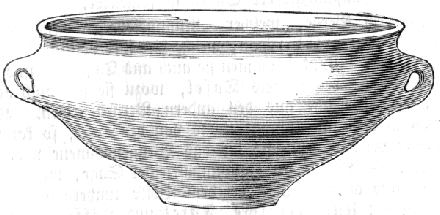
ward in einem Kegelgrabe zu Meyersdorf über die oben I, 2 abgebildete große Urne mit scharfem Bauchrande gestülpt gefun=


|
Seite 366 |




|
den (vgl. Jahresber. V, S. 47). Solche Erscheinungen sind in Kegelgräbern nicht sehr selten. In den 10 Kegelgräbern von Perdöhl waren z. B. 5 Urnen mit solchen Schalen bedeckt; vgl. Jahresber. V, S. 48 flgd. Nr. 5, 17, 18, 23 und 24.
Eine in der großherzoglichen Sammlung aufbewahrte Schale hat als Verzierung am Rande eben solche tiefe, schräge rechts gehende Schwingungen, wie sie das oben S. 363, III, 3 abgebildete kleine Gefäß von Retzow zur Verzierung trägt.
In Meklenburg sind große Schalen aus der Bronzeperiode nur als Deckschalen der Urnen beobachtet worden. Von einem anderen Gebrauche hat sich keine Spur gezeigt, am wenigsten hat irgend eine Erscheinung zur Annahme von Opferschalen Veranlassung geben können, von denen lange und häufig genug gefabelt ist.



|



|
|
:
|
Kegelgrab und Opferstätte von Peccatel
bei Schwerin, Nr. 2.
Mit einer lithographischen Abbildung.
In Jahrb. IX, S. 369 - 378, ist die Aufdeckung eines sehr merkwürdigen Kegelgrabes zu Peccatel bei Schwerin beschrieben, eines der merkwürdigsten Kegelgräber, welche je in Deutschland aufgedeckt sind. Ebendaselbst S. 370 - 371 ist eines andern, größern Kegelgrabes gedacht, welches ganz nahe bei jenem liegt; an diesem haften bei den Bewohnern der umherliegenden Dörfer viele Sagen, von denen dort einige mitgetheilt sind. Der Hauptinhalt der Sagen ist folgender.
In dem Berge, welcher "Rummelsberg" genannt wird, wohnen die Unterirdischen, welche hier ihre vollständige Wirthschaft haben. Mitunter kommen sie auch ans Tageslicht und halten auf der Spitze des Hügels Tafel, wozu sie sich auch Kessel und andere Geräthe aus den andern Bergen leihen. Kommt ein Mensch dazu und nimmt etwas von der Tafel, so kann diese nicht eher verschwinden, als bis das Weggenommene wieder hingelegt ist. - Dies ist der Hauptinhalt einer Sage, welche vielfach gestaltet und ausgeschmückt bei dem Volke umhergetragen wird. Die Begriffe: Unterirdische, Tafel und Kessel, bilden aber die Hauptegriffe der Erzählungen.


|
Seite 367 |




|
Die Berührung des Grabes war den Bewohnern des Dorfes Peccatel strenge untersagt. Nachdem aber der Dorfschulze gestorben war, hatte der Besitzer des Ackerstückes, auf welchem das Grab liegt, nicht nur den übrigen Bewohnern des Dorfes erlaubt, von dem Grabe Sand zu holen, sondern hatte auch selbst, bei wankenden Vermögensumständen, nach Schätzen in demselben geforscht, da das andere Grab so viel Ausbeute gegeben hatte. Er hatte bei diesen Untersuchungen mit einer Stange ein Steingewölbe in der Mitte des Grabes getroffen, war von oben herab hineingedrungen und zufällig gerade auf viele Bronzen gestoßen, welche er kaum hervorgeholt hatte, als die umherliegenden Steine in die Tiefe des Loches nachstürzten. In seinen Hoffnungen getäuscht, zeigte er bei dem großherzoglichen Domanial=Amte zu Schwerin den Fund als einen "zufällig am Rande des Hügels" gemachten an und lieferte die gefundenen Bronzen ein, um die Abtragung des Hügels auf Anderer Kosten zu erreichen und Theil an den in demselben enthaltenen Schätzen zu gewinnen, für welche, wie er in vollem Ernste versicherte, man das ganze Dorf kaufen könne. Unter solchen Umständen, da das Grab Aussicht auf wissenschaftlichen Gewinn eröffnete und vor unberufenen Händen nicht länger zu schützen war, mußte die Aufdeckung des Grabes vorgenommen werden. Ich begab mich daher sofort nach Peccatel, nahm die vorbereitenden Erdabgrabungen vor und deckte in Gegenwart und mit Hülfe des Herrn Dr. Beyer am 22. Novbr. 1845 alle Stellen auf, welche Gewinn verhießen. Geldeswerth und seltene Geräthe wurden auffallender Weise gar nicht gefunden, so sehr auch an manchen Stellen der Anschein dafür sprach; dagegen war der wissenschaftliche Gewinn sehr erheblich.
Der Hügel maß 120 Schritte im Umkreise und im Durchmesser 45 Schritte von Osten gegen Westen und 40 Schritte von Norden gegen Süden; er war in der Mitte ungefähr 10 Fuß hoch, von der Grundfläche der Aufthürmungen im Innern, und sehr rund und regelmäßig gewölbt, so daß er fast wie ein regelmäßiger Kugelabschnitt erschien; das ganze Erdreich, auf welchem der Hügel stand, schien von Natur etwas erhöhet zu sein. Er war, mit Ausnahme einzelner Steinsetzungen im Innern, ganz von Erde aufgeführt, deren Masse von den Arbeitern auf ungefähr 4000 vierspännige Fuder geschätzt ward. Der ganze Hügel bestand aus dem groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem die ganze, durchaus flache Feldmark in der Tiefe unterhalb der Tragerde besteht, war jedoch an vielen Stellen verschieden gemischt.


|
Seite 368 |




|
Da diese Masse zum völligen Abtragen zu groß war, so ward zuerst der Rand tief hinein abgetragen; dieser war nicht mit Steinen umsetzt, sondern ebenfalls nur von Sand gebildet; von Osten und Süden her ward der Hügel bis gegen die Mitte hin zum Theil abgetragen. Sodann ward ein großer Kreuzschnitt von Osten gegen Westen und von Süden gegen Norden bis auf den Urboden gemacht und von diesen Durchschnitten wurden Querdurchschnitte gegen die Ränder hin gemacht und endlich die meisten noch stehenden Theile in die Durchschnitte abgegraben. Es blieben nur einige Segmente, welche keinen Gewinn zu geben verhießen, nach den Rändern hin stehen.
Bei dem Durchschnitte von Osten gegen Westen ward auch der Hauptinhalt des Grabes bloß gelegt, indem genau in dieser Linie alles dasjenige stand, weshalb der Hügel vorzüglich aufgeführt zu sein schien.
Ungefähr in der Mitte des Grabes, etwas mehr gegen Osten hin, stand ein von großen Feldsteinen aufgeführtes Begräbniß, ungefähr ein Würfel von 5 Fuß. In der Tiefe lagen neben den zerbrannten starken Menschengebeinen die Trümmer von zwei Urnen, einer grobkörnigen, hellbraunen Urne und einem feinkörnigen, schwärzlichen Henkelgefäße. Neben diesen Urnentrümmern hatten die Alterthümer gelegen, welche von dem Bauer hervorgeholt und abgeliefert waren, nämlich:
ein Paar Handbergen aus Bronze, wie sie Frid. Franc. Tab. IV und Jahrb. IX, S. 329 abgebildet sind, vom Leichenbrande in sehr viele und verbogene Stücke zersprengt;
zwei gewundene, starke Kopf= oder Halsringe aus Bronze, wie Frid. Franc. Tab. X, Fig. 2, ebenfalls vom Leichenbrande in mehrere Stücke zersprengt;
fünf Handringe aus Bronze, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXII, Fig. 7, vom Leichenbrande nicht zerstört;
ein sogenanntes Hütchen oder ein Buckel aus Bronze, von der Bildung wie Frid. Franc. Tab. XXIII, Fig. 10, jedoch ungewöhnlich groß, 4 " im Durchmesser der Platte und ungefähr 3" hoch, durch den Leichenbrand zersprengt und verbogen:
all diese Gegenstände haben starken Rost;
eine Büchse von Bronze, rund und mit plattem Boden und Deckel, wie die in Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 3 und 4 abgebildeten, besonders aber wie die Fig. 4 abgebildete und ähnlich wie die in Jahrb. X, S. 281 abgebildete eingerichtet, nämlich


|




|


|




|
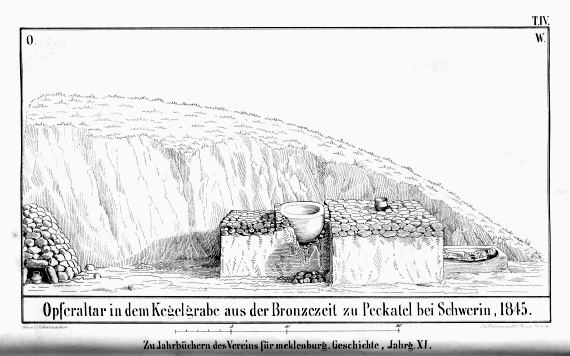


|
Seite 369 |




|
mit einem erhaben verzierten Boden, so daß die untere Seite die Hauptsache zu sein scheint, mit einem glatten, nicht verzierten Deckel, durch dessen Handhabe, so wie durch die beiden auf den Seitenrändern des Gefäßes stehenden Oehren ein Riegel gegangen ist, 4 " im Durchmesser und 1 1/2 " hoch, auf dem Boden sehr stark, auf dem Deckel fast gar nicht, auf den Seitenwänden sehr wenig gerostet; der Deckel ist defect, in der Seitenwand fehlt ein kleines Stück schon ursprünglich, eben so sind die Verzierungen eines Viertheils des Bodens durchbrochen gearbeitet: wahrscheinlich ist der Guß an diesen Stellen nicht gekommen und das ganze, sonst hübsche Gefäß bei der Einsetzung in den Hügel noch gar nicht ganz fertig gewesen; dem Leichenbrande ist die Büchse nicht ausgesetzt gewesen, eben so auch nicht
fünf fein durchbohrte Perlen oder Knöpfe von braunem Bernstein, abgeflacht und mit scharfen Rändern, von verschiedener Größe, 1 1/4 ", 1 ", 3/4 " und 1/2 " im Durchmesser und von verhältnißmäßiger Dicke, 3/4 " bis 1/4 " dick.
Genau in der Linie und in der Richtung von Osten gegen Westen stand ungefähr 10 Schritte westlich von der beschriebenen Begräbnißstelle bis gegen den westlichen Rand des Grabes ein Bau, dessen ganze Beschaffenheit und Regelmäßigkeit von der größten Merkwürdigkeit ist und offenbar einen gottesdienstlichen Zweck gehabt hat, um so mehr da von heidnischer Bestattungsweise unter diesem Bau keine Spur zu finden war. Als von oben hineingegraben ward, entstand die lebhafte Hoffnung, hier eine bedeutende Bestattung zu finden; aber die Hoffnung ward gänzlich getäuscht, jedoch durch eine sichere Ansicht ersetzt, welche sich nach völliger Bloßlegung als unzweifelhaft darstellte.
Die Mitte dieses Baues, welche durch eine beigeheftete lithographische Abbildung der frei gelegten Stelle in dem Durchschnitte des Grabes veranschaulicht ist, nahm ein Altar ein. Auf dem Urboden stand eine ganz regelmäßige, viereckige Erhöhung von 10 Fuß Länge, 10 Fuß Breite und 5 Fuß Höhe, in dem Niveau der Grundfläche des Begräbnisses; das ganze Erdreich schien aber vor dem Bau schon etwas erhöhet zu sein. Sie war ganz von dem gleichmäßigen, groben, lehmhaltigen Sande, aus welchem der umherliegende Acker besteht und welcher bei Aufthürmungen in den Seitenwänden fest steht, ohne irgend eine andere Beimischung, aufgeführt und mit einer doppelten oder dreifachen Lage ungefähr kopfgroßer Feldsteine bedeckt. Weder auf dem Urboden, noch in der Sandaufschüttung, noch auf der Steinbedeckung zeigte sich irgend eine Spur von Knochen oder Kohlen: das Ganze war völlig und durchaus rein. Oben auf stand zwischen einigen höher gestellten Steinen ein ziemliches geradewandiges,


|
Seite 370 |




|
ungefähr 6 " hohes, schon zerbrochenes, thönernes Gefäß, welches am Rande mit 1 1/2 " hohen, aus weit von einander stehenden Augen o gebildeten Zickzacklinien verziert war, in dieser Form.
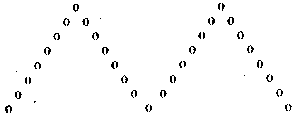
Daneben scheint noch ein anderes thönernes Gefäß in Form einer niedrigen Schale gestanden zu haben, da sich Bruchstücke von dem scharfen Bauchrande eines Gefäßes fanden, welche nicht zu dem ersten Gefäße gehört haben können.
Die Arbeiter waren sehr erstaunt, hier wirklich "die Tafel der Unterirdischen" zu finden; die Verwunderung ward aber noch erhöhet, als sich bald darauf auch der "Kessel" fand.
Oestlich unmittelbar an dem Altare stand ein durchaus regelmäßiger, cirkelrunder Kessel von gebrannter Erde, von 3 Fuß Durchmesser und 2 Fuß Tiefe, mit dem Rande ungefähr 1 Fuß über die Oberfläche des Altars hervorragend. Er stand ebenfalls auf einem Unterbau von demselben lehmhaltigen Sande und war auf dem Boden mit kleinen Feldsteinen ausgelegt und außen mit kleinen Feldsteinen in Sand ummauert, so daß der ganze Kesselbau in dem äußern Rande einen Durchmesser von 5 Fuß hatte. Die Wände des Kessels selbst waren von demselben lehmhaltigen Sande aufgeführt, aus welchem der ganze Hügel bestand. Wegen der Lehmhaltigkeit wird dieser Sand vom Feuer roth gebrannt und fest stehend, durch langes Brennen und Aufnahme von Ruß und Harz aber kohlschwarz und so fest, daß er losen Ziegeln ähnelt 1 ). Der Kessel war an Ort und Stelle von diesem Sande aufgeführt und ausgebrannt; die Wände bildeten eine ungefähr 2" dicke, schwarze Masse, welche so fest war, daß sie mit Spaten abgehauen werden mußte; nach außen hin war der umkleidende Sand roth gefärbt. Das Innere des Kessels enthielt nichts Besonderes, sondern war bei der Aufschüttung des Hügels mit reinem Sande gefüllt worden. Auch der Unterbau enthielt nichts als reinen Sand.
Unmittelbar östlich an dem Kessel stand ein kleiner viereckiger Tisch oder Altar, an jeder Seite 5 Fuß lang, von der Höhe des großen Altars, ebenfalls von reinem Sande aufgeführt


|
Seite 371 |




|
und mit einer doppelten Lage von kleinen Steinen gepflastert. Auch diese Erhöhung enthielt nichts außer Sand und Steinen.
Unmittelbar westlich an dem großen Altare, bis gegen den westlichen Rand des ganzen Hügels, stand auf dem Urboden in kleinen Feldsteinen eine regelmäßige Mulde oder Wanne, ebenfalls aus schwarz gebranntem Sande, gegen 6 ' lang, 3 ' breit und in der Mitte gut 1 ' tief, mit sehr fest gebrannter, 3 " dicker Wand, welche ausgebrochen werden mußte und sich in Stücken sehr gut transportiren und aufbewahren ließ. Diese Mulde, deren oberer Rand 3 Fuß niedriger stand, als die Oberfläche des großen Altars, war ebenfalls an Ort und Stelle gebauet und ausgebrannt, ohne Zweifel durch wiederholten, heftigen Brand, weil sonst die Mulde nicht eine so große Dicke und Festigkeit erlangt haben würde. In dieser Mulde lag eine unverbrannte Leiche, nach Osten und dem Altare hinschauend, mit den Füßen östlich am Altare, mit dem Schädel westlich gegen den Rand des Grabes. Die Leiche war sorgfältig in die Mulde gelegt und lag daher mit dem Becken tief und mit Kopf und Füßen viel höher; das Gerippe nahm daher nur einen horizontalen Raum von 5 Fuß ein: Die Leiche war in schwarze Erde gepackt, welche vielleicht aus den nahen Wiesen, ehemals Erlenbrüchen, genommen ward und daher noch hin und wieder verkohlte Rinde zeigte; diese schwarze Erde, welche sonst nirgends in dem ganzen Hügel lag, zeigte sich schon bei dem ersten Spatenstiche in den Rasen des Grabes. Vielleicht war es Branderde; jedoch ließ sich dieses nicht mit Bestimmtheit ermitteln. Das Gerippe ließ sich in seiner regelmäßigen Lage und ganzen Beschaffenheit sehr klar erkennen, obgleich es so morsch war, wie es in alten Gräbern selten gefunden wird; der Schädel ließ sich zu Moder zerreiben, die starken Schenkelknochen ließen sich zum größern Theile herausholen. Von Alterthümern war auch hier nichts zu finden; einige Scherben von einem thönernen Gefäße lagen seitwärts. Kohlen zeigten sich nirgends.
Dieser ganze Bau ist in seiner Art einzig und merkwürdig 1 ). Unser Verein hat von jeher die gottesdienstliche Deutung der gewöhnlichen Geräthe und gewöhnlichen Steingräber verschmäht, und die Zeiten werden überhaupt vorüber sein, wo man jedes Steingrab für einen Opferaltar und jeden steinernen Keil für ein Opfermesser ausgab. Aber hier, in Gegenwart


|
Seite 372 |




|
zweier Alterthumsforscher, welche nicht tumultuarisch in die Tiefe gruben, sondern mit Vorsicht und Ruhe erst den ganzen Bau umher völlig bloß legten und untersuchten, und in Gegenwart von 38 verständigen Arbeitern aus dem Bauerstande ist ein Irrthum unmöglich. Der Kessel und die Mulde standen stundenlang in den Wänden frei; sie wurden mit Haken und Spaten ausgeräumt; man stieg in sie hinein und sie konnten nur mit Mühe zertrümmert werden, als sie zur Untersuchung des Grundes entfernt werden mußten. Wir sind abgesagte Feinde einer jeden Hypothese, welche sich nicht auf Thatsachen begründen läßt; aber hier läßt sich zum ersten Male eine gottesdienstliche Deutung des Baues nicht abweisen. Der hier so genannte Altar wird wirklich ein Altar zum Schlachten des Opfers, die Leiche, welche zu den Füßen des Altars in der Mulde lag, vielleicht ein geopferter Sklave oder Kriegsgefangener gewesen sein 1 ), da man ihr nicht die Ehre der Verbrennung angethan hat. Der Kessel im Osten des Altars ist entweder als Wasserbehälter oder zu einem besondern Brandopfer, der verbrannten Hauptleiche gegenüber, benutzt worden. Der ganze Bau wird früher bloß gestanden haben und zum Todtencultus für die daneben verbrannten Leichen benutzt worden sein. Nach dem Aussterben eines Geschlechts oder dem Ende irgend einer Periode mögen denn alle Begräbnisse und der Altarbau zu Einem Hügel zugeschüttet worden sein.
Wir haben hier ohne Zweifel neben einem
Begräbnisse eine Opferstätte, und zwar aus einer
frühen Zeit der reinen Bronze=Periode,
vielleicht die einzige, die bisher entdeckt
worden ist. Denn die bisher für Opferstätten
ausgegebenen großen Wälle mit vielen
Topfscherben, Lehmstücken, Thierknochen,
Metallschlacken
 . sind durchaus nichts weiter, als
wendische oder ältere Wohnstätten, Burgen oder
Städte, namentlich die von Wagner bei Schlieben
und sonst von ihm und andern entdeckten und
vielfach beschriebenen Wälle in der Lausitz und
Sachsen (vgl. Klemm German. Alterthsk. S. 106
flgd.), die von Kalina von Jäthenstein
weitläuftig beschrie=
. sind durchaus nichts weiter, als
wendische oder ältere Wohnstätten, Burgen oder
Städte, namentlich die von Wagner bei Schlieben
und sonst von ihm und andern entdeckten und
vielfach beschriebenen Wälle in der Lausitz und
Sachsen (vgl. Klemm German. Alterthsk. S. 106
flgd.), die von Kalina von Jäthenstein
weitläuftig beschrie=


|
Seite 373 |




|
benen, in Böhmen aufgefundenen Fundstätten von
Scherben, Knochen
 ., die am Harze, ja selbst in
Meklenburg in der Ravensburg bei Neubrandenburg
aufgegrabenen Umwallungen (vgl. Jahresber. V, S.
110 flgd.) Alle Wälle sind den historisch
nachweisbaren und untersuchten, aus dem 12.
Jahrhundert stammenden, wendischen Burgwällen zu
Meklenburg, Werle, Ilow, Dobbin
., die am Harze, ja selbst in
Meklenburg in der Ravensburg bei Neubrandenburg
aufgegrabenen Umwallungen (vgl. Jahresber. V, S.
110 flgd.) Alle Wälle sind den historisch
nachweisbaren und untersuchten, aus dem 12.
Jahrhundert stammenden, wendischen Burgwällen zu
Meklenburg, Werle, Ilow, Dobbin
 . (vgl. Jahrb. VI und VII) völlig
gleich; ja einige dieser sogenannten
Opferstätten Mitteldeutschlands und Böhmens sind
nichts weiter als mittelalterliche Burgplätze,
wie der große Burgwall von Prillwitz in Meklenburg.
. (vgl. Jahrb. VI und VII) völlig
gleich; ja einige dieser sogenannten
Opferstätten Mitteldeutschlands und Böhmens sind
nichts weiter als mittelalterliche Burgplätze,
wie der große Burgwall von Prillwitz in Meklenburg.
Die Bedeutsamkeit des oben beschriebenen Fundes von Peccatel wird durch den Inhalt des unmittelbar bei diesem Grabe aufgedeckten andern Grabes außerordentlich erhöhet. Die in diesem gefundene, auf einem Wagen stehende Bronzevase (vgl. Jahrb. IX, S. 372 flgd.) ist ohne Zweifel ein gottesdienstliches Geräth, welches vielleicht einem Priester angehörte. Beide neben einander stehende Gräber scheinen derselben Zeit anzugehören.
Früher war die ganze Gegend dieser Gräber ganz mit Wald bedeckt; noch seit Menschengedenken ist in der Nähe der Gräber viel Holz abgeräumt. Zwischen den Steinen in der Tiefe dieses Grabes fanden sich oft Reste uralter Baumwurzeln.
Wie es gewöhnlich in großen Gräbern der Fall ist, fanden sich in dem Hügel zerstreut noch mehrere Begräbnisse.
Nicht weit vom Rande gegen Südwesten war eine Brandstätte. Auf derselben stand eine große Urne, welche ganz zertrümmert war, und unter einem großen, flachen Steine ein fast ganz erhaltenes kleines Thongefäß, 2 1/2 " hoch, ungefähr wie das oben S. 362 abgebildete, mit aschenhaltigem Sande. Andere Alterthümer wurden nicht gefunden.
Nahe dabei gegen Südost fanden sich wieder Kohlen und zwei größere Urnen, welche ebenfalls zertrümmert waren.
Nicht weit vom nordöstlichen Rande des Grabes fand sich neben Urnenscherben eine mit edlem Rost bedeckte, zerbrochene, kleine Pincette aus Bronze.
Mehr nach dem Hügel hinein, nordöstlich in der Nähe des mittlern Hauptbegräbnisses, fand sich ein sehr feiner gewundener Halsring und ein sauber gearbeiteter, feiner Handring, beide aus Bronze und zerbrochen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 374 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Gr. Methling (bei Gnoien).
Oestlich von dem Dorfe Gr. Methling und nur in geringer Entfernung davon liegt rechts am Wege nach Demmin ein Kegelgrab, genannt der Doctorberg, auf einem kleinen Bergrücken, der von Nordwest nach Südost sich erstreckt. Der Boden umher besteht aus Sand und aus diesem ist auch das Grab aufgeworfen. Der Kegel hatte 8 Fuß Axenhöhe und einen Durchmesser von etwa 4 Ruthen. Die Unterzeichneten unternahmen für den Verein die Aufdeckung des Grabes, wobei sie sich der zuvorkommenden Unterstützung des Herrn Pensionairs Tack zu Kl. Methling zu erfreuen hatten. Die Herren Amtmann Haase zu Dargun und Pastor Günther zu Gr. Methling waren ebenfalls wiederholt bei der Aufgrabung zugegen. Schon früher war am Rande nach Steinen gegraben und innerhalb des äußern Steinringes, gerade in Osten, eine Urne mit einer Pincette aus Bronze zu Tage gekommen; auch war wenige Tage vor unserer Ankunft ein glücklicher Weise nicht gelungener Versuch von Unberufenen gemacht, durch Eingraben von oben nordwärts den Inhalt des Grabes zu gewinnen, weil man in demselben wahrscheinlich einen Schatz erwartete. Zuerst ließen wir die Spitze des Kegels mit Karren abfahren und wollten einen Durchschnitt von Osten nach Westen machen, da sich aber bald Steinhaufen unter der Oberfläche zeigten, so ließen wir die Erde überall abtragen, um über die Steinlage, die zuerst unregelmäßig schien, einen sichern Ueberblick zu erhalten. Gleich oben 2 Fuß unter der OberfIäche zeigte sich etwa 10 Fuß östlich von der Mitte mit einer ziemlich bedeutenden Brandstelle ein kleiner Steinhaufen, unter welchem eine zerdrückte Urne stand mit einer Menge verbrannter Knochenreste, zwischen denen eine kleinere, gehenkelte Urne lag. Nach Abräumung aller Erde ergab sich, daß, weil an den Seiten schon früher die Steine ausgebrochen waren, fast der ganze Boden des Grabes mit Steinen belegt war, über denen sich drei Steinkegel von 4 bis 5 Fuß Höhe erhoben.
Der erste Kegel erhob sich gleich von Osten bis zu einer Höhe von 5 bis 6' und hatte seine Spitze etwa 10 ' von der Mitte des Hügels östlich. An der südlichen Seite dieses Steinkegels war bis fast 2 ' unterhalb des Urbodens die Erde stark mit Kohlen und Asche vermischt. Bei Abtragung der Steine fanden sich zwischen der untersten Schicht zwei Paar sehr weite, massive bronzene Armringe, von denen aber nur der eine Ring unversehrt war; er hat 4 1/2 und 5 1/4 " im Durch=


|
Seite 375 |




|
messer; die übrigen zeigten schon alte Brüche und Verbiegungen. Ein Paar, zu denen der unversehrte gehört, hat einen rhombischen Durchschnitt und gravirte Verzierungen aus schrägen und geraden Parallellinien; der dritte ist ebenfalls rhombisch, jedoch flacher und nicht verziert; der vierte ist platt und auch nicht verziert. Neben diesen lagen zwischen den Steinen zwei sehr dünne, fast drathförmig gearbeitete Ringe von 2 1/2 " Durchmesser, die aber durch die starke Oxydation an einzelnen Stellen mürbe geworden waren und bei der sorgfältigsten Behandlung in 2 und 3 Enden zerfielen. Unter dem Steinhaufen war eine Brandstelle von etwa 7 Fuß Länge und 4 Fuß Breite von Osten nach Westen, mit etwas Asche und Kohlen belegt; die Erde war einige Linien dick fest gebrannt. Diese Brandstelle war gegen 2' über dem Urboden und ganz horizontal geebnet, da der Urboden sich stark abrundete wegen des natürlichen Bergrückens, auf welchem das Grab gebauet war.
Der zweite Steinkegel lag in gleicher Höhe mit dem vorigen, genau westlich, von der Mitte des Grabes etwa 12' entfernt; er war aus größeren Steinen erbauet, die kaum von 2 Menschen gewälzt werden konnten. Die bei dem vorigen Kegel bemerkte Brandstelle setzte sich südlich auch von diesem Kegel fort, und es ward hier die Branderde schmierig, bis sich in der Tiefe auch die Gebeine eines Menschen, freilich nur in Bruchstücken, namentlich der Hinterkopf und mehrere Röhrenknochen, fanden. Zwischen dieser Modererde lagen Bruchstücke eines sehr dünnen bronzenen Ringes, welcher sehr stark oxydirt war und daher in viele Stücke zerbrach, jedoch nicht vom Feuer gelitten hatte. Unter dem Steinkegel fand sich nichts an Alterthümern. Am nordwestlichen Fuße dieses Kegels ward eine Steinkiste entdeckt, aus schön gespaltenen Sandsteinen erbauet, 3 Fuß lang, 1 1/2 Fuß breit und hoch. Sie war unversehrt, nur daß die längeren Seitensteine etwas ausgewichen waren; die Kiste enthielt aber nichts als Sand.
Ein dritter Steinkegel war südlich, etwa 20 Fuß von den beiden andern im Dreiecke gelegen, enthielt aber keine Alterthümer und überhaupt nichts Bemerkenswerthes, als daß er nur 3 bis 4' sich über den Urboden erhob.
Nahe an demselben, so wie noch an zwei Stellen auf der südlichen Seite des Hügels fanden sich wahrscheinlich später eingesetzte Urnen auf kleinen Brandstellen nahe unter der Oberfläche, so daß sie schon zertrümmert waren. Unter den darin


|
Seite 376 |




|
befindlichen Knochen war kein Metall aufzufinden; nur das war auffallend, daß sie mit lauter Kalksteinen umstellt waren.
Gnoien im September 1845.
von Kardorff auf Remlin.
von Bülow aus Neustrelitz.
J. Ritter
aus Vietlübbe.
Die innere Construction dieses Grabes ist auffallend der des Grabes von Peccatel ähnlich (vgl. oben S. 370 flgd.). Der Aufbau von Steinen mit einer nicht verbrannten Leiche, die verschiedenen Erhöhungen, welche keine Alterthümer bargen, und die ganze innere Anordnung ist in beiden Gräbern fast gleich, so daß auch in Methling wahrscheinlich ein Opferaltar, mit einer geopferten Leiche, im Grabe stand. Da aber diese Construction noch nicht bekannt war und man dergleichen bei der Aufgrabung nicht vermuthete, sondern , wie sonst wohl, verschiedene Begräbnisse in Einem Grabe erwartete, so wurden die Erhöhungen zugleich mit dem ganzen Hügel abgetragen. Die Beobachtung kann jetzt also nicht mehr ganz sicher genannt werden.
Da nun auch in dem Bau der Gräber sehr wichtige Eigenthümlichkeiten zu liegen scheinen, so ist bei der Aufgrabung größerer Gräber fortan noch mehr Sorgfalt zu beobachten. Es wird nöthig sein, daß man alle Steinbauten und mit Steinen bedeckte Erhöhungen, alle vom Feuer gefärbten Stellen, kurz alles Ungewöhnliche stehen, nur den bedeckenden Erdauftrag sorgfältig abräumen und so das eigentliche Innere des Grabes bis auf den Urboden völlig bloß legen läßt, dann erst aber an die ruhige Betrachtung und demnächstige sorgfältige Abtragung der einzelnen Bauten geht; hiebei ist nicht allein das zu beachten, was man an Alterthümern findet, sondern auch das, daß man nichts findet. - Solche Aufgrabungen werden allerdings bei einer großen Menge von Arbeitern und deren Unverstand und Ungestüm und auch bei eigener körperlicher Arbeit, da man nothwendiger Weise oft selbst mit Hand anlegen muß, viel Anstrengung und auch größere Geldopfer fordern; einem wahrhaften wissenschaftlichen Gewinne werden aber solche Opfer gerne gebracht. Nur ist die nüchternste Darstellung nöthig und nichts mehr zu vermeiden, als Selbsttäuschung und Uebertragung vorgefaßter Ansichten. So viel scheint aber gewiß zu sein, daß man noch lange nicht genug wissenschaftliche Aufgrabungen vorgenommen hat, sondern erst recht damit anfangen muß.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 377 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Dobbin
bei Krakow.
Vgl. oben Hünengräber, S. 346.
Auf dem dobbiner Felde befanden und befinden sich zum Theil noch viele Kegelgräber, theils vereinzelt, theils in größerer Anzahl vereinigt, so daß unweit des Einflusses der Nebel in den krakower See, auf dem linken Ufer des Flusses auf einer Anhöhe, einige hundert Gräber zusammen standen, welche leider im Laufe der Zeiten fast alle zerstört sind, so daß man zum Theil nur aus den Steinkreisen in der Erdoberfläche auf ein vorhanden gewesenes Grab schließen kann. Von andern Gräbern stand noch innerhalb des Steinkreises eine kleine Steinkiste, welche früher auch wohl mit Erde bedeckt gewesen sein mochte, wie es bei einigen ziemlich erhaltenen der Fall war.
Bei Dobbin, im krakower See, ward auch die schöne römische Vase, die Dobbin=Vase, gefunden, welche Jahresber. VIII, Taf. III. abgebildet und S. 50. beschrieben ist.
Beim Oeffnen der Gräber wurden häufig Urnenscherben in denselben gefunden; die ganzen Urnen zerfielen jedoch bei der leisesten Berührung und es gelang nur, drei derselben in einem leidlichen Zustande zu erhalten. In der Regel standen die Urnen in der Mitte der Steinkreise zwischen größeren, zusammengestellten Steinen oder in einer Steinkiste. Zuweilen fanden sich die Urnen aber auch mehr an den Seiten der Gräber; auch schienen mitunter mehrere Urnen um eine größere gestanden zu haben. In mehreren Urnen schienen Knochen gelegen zu haben.
Außerdem fanden sich in den Gräbern mehrere Alterthümer aus Bronze, welche, neben den vorstehenden Nachrichten, der Verein dem Herrn von Jasmund auf Dobbin verdankt.
In Gräbern auf der Höhe an der Nebel fanden sich folgende Alterthümer aus Bronze, welche alle edlen, jedoch nicht tiefen Rost haben und fast alle wohl erhalten sind:
drei sogenannte Scheermesser, wie Frid. Franc. Tab. XVIII, ohne Verzierungen;
drei Zangen, wie Frid. Franc. Tab. XIX, von denen eine zerbrochen ist, mit Verzierungen;
ein Pfriemen;
eine Säge, 3 1/2 " lang, an einem Ende mit einem Loche,
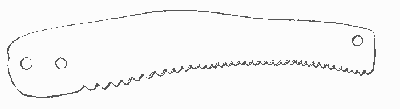


|
Seite 378 |




|
am andern mit zwei Löchern, zum Befestigen und Einspannen, ein sehr seltenes Stück des Alterthums; die Zähne werden nach dem einen Ende hin immer kleiner, dichter und stumpfer;

ein Doppelknopf mit langer, aufstehender Spitze, nach hieneben stehender Abbildung, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 3, 2 Zoll lang, am Ende der auf der Wölbung stehenden Spitze oder Stange mit einem ganz polirten, kleinen Knopfe versehen, so daß das Geräth nicht länger gewesen ist und daher eine räthselhafte Bestimmung hat; die convexe Oberfläche des Doppelknopfes nach der Stange hin ist vielfach verziert, eben so die Stange selbst mit feinen concentrischen Reifen geschmückt. Wahrscheinlich ist dieser Doppelknopf eine Art Buckel zum Zusammenhalten mehrerer Stücke und die Stange war wohl zum sicherern Halten und Regieren nothwendig. Die concave Seite der obern Wölbung ist in der concaven Wölbung mit einer grauen, festen, porösen Masse gefüllt und abgeglättet. Man vgl. unten Kegelgrab von Retzow Str. 6.

zwei Doppelknöpfe, Hemdsknöpfen gleich, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 22, nur etwas kleiner, der eine hoch convex, der andere flacher;
ein Knopf mit Oese, wie Frid. Franc. Tab. XXXII, Fig. 23, nur kleiner und platter;
ein Schließhaken oder Gürtelhaken aus Blech, mit 2 Löchern, 1" breit, 1 1/2 " lang;
ein Fingerring.
In den Gräbern an der Nebel fand sich auch noch:
eine größere Urne; in dieser stand:
eine kleinere Urne, welche mit Knochen gefüllt war;
ferner fand sich in einem andern Grabe:
eine ganz kleine Urne, welche mit Knochen gefüllt war und neben welcher mehrere Urnenscherben lagen, welche wahrscheinlich auch einer größern Urne gehört hatten, in welcher die kleinere gestanden hatte.
In einem Steinkreise am krakower See fand sich:


|
Seite 379 |




|
eine Stange oder Nadel, 1/4 " dick, mit sehr tiefem, hellgrünen, edlen Rost, in 3 Stücke zerbrochen, zusammen 9 " lang, ohne Knopf und Spitze.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Weisin bei Lübz.
Am 23. Juli 1845 theilte der Herr von Bülow zu Kuppentin mir die Nachricht mit, daß er bei Weisin mehrere Leute beim Ausbrechen von Steinen angetroffen habe, unter denen sie Bronzesachen gefunden hätten; er habe sich deshalb an den Herrn Hoffschläger auf Weisin gewandt, welcher sogleich die vorhandenen Alterthümer an sich genommen, die Arbeiter von dem Steinausbrechen wegbeordert habe und mich nun ersuche, dahin zu kommen, um im Interesse des Vereines nähere Nachforschungen anzustellen. Nachdem ich mich dahin begeben und durch weiteres Nachforschen, unterstützt durch den unermüdlichen Eifer des Herrn Hoffschläger, noch einige von den Leuten verheimlichte Stücke der Alterthümer herbeigeschafft hatte, händigte mir der Herr Hoffschläger die Bronzesachen gütigst für den Verein ein und verhieß für die folgenden Tage eine hinreichenden Anzahl Arbeiter zu weiteren Nachgrabungen zu stellen. Leider sind aber sämmtliche Sachen, mit Ausnahme der Armringe, von den Arbeitern zerbrochen, welche stets Gold gefunden zu haben glauben oder doch sehen müssen, wie solche Sachen inwendig aussehen! Bei der nun erfolgenden Aufgrabung waren der Herr von Bülow und der Herr Hoffschläger beständig mit der lebhaftesten Theilnahme gegenwärtig. Die früher schon abgetragenen Kegelgräber, in denen die Sachen gefunden waren, liegen auf einer Erhebung, die sich von Süden nach Norden wie ein kleiner Bergrücken erstreckt, besonders aber nach Osten sich abdacht, nahe an dem Wege von Weisin nach Gallin, auf dem sogenannten Tannenkampe.
Dieses Grab zeigte einen Durchmesser von 50 Fuß und eine Axenhöhe von nur 3 1/2 Fuß, aufgetragen aus Sand und Lehm, woraus auch der Boden umher besteht. Er hat den Namen Silberberg 1 ) und ist in der Mitte schon früher von Schatzgräbern durchwühlt. Der Steinkreis am Umfange war


|
Seite 380 |




|
noch vollkommen vorhanden, theilweise aber von der Erde verschüttet. Beim Ausgraben dieser Steine hatten die Arbeiter in dem südlichen Theile des Hügels ein Steinlager von gewöhnlichen Dammsteinen, etwa 6 Fuß lang von Osten nach Westen, 3 Fuß breit und 2 Fuß hoch gefunden und unter denselben folgende Sachen aus Bronze, mit edlem Roste bedeckt:
eine Handberge, deren Spiralen 3 3/4 " breit sind, von der stets vorkommenden Form und Verzierung, wie Jahrb. IX, S. 329;
zwei Handringe, 3 und 2 1/2 " weit; in dem einen derselben steckten 2 Fragmente von Knochen vom Arme, 4 Zoll lang;
ein kleinerer Ring aus viereckigem, starken Drath, offen, 2 und 1 3/4 " weit;
Fragmente von kleinen Ringen aus dünnem Drath;
ein gewundener Halsring von gewöhnlicher Form, mit über einander fassenden Häkchen an den Enden, 6" weit, und ein ähnlicher Halsring, jedoch viel feiner und enger gewunden.
Nachdem die Stelle wiederholt durchsucht war, schritten wir von hier aus weiter vor und deckten das ganze Grab auf innerhalb des Steinringes. Etwa 16 Fuß vom südöstlichen Rande nach der Mitte hin war ein kleiner Steinhügel, unter welchem sich aber nichts fand. Grade am östlichen Rande nahe am Steinringe lagen Scherben von Urnen mit etwas Asche zwischen dem Sande. Sowohl nach der Masse, der Oberfläche und der Farbe, als nach den Verzierungen gehören die Scherben zwei Urnen an. Beide aber zeichnen sich durch fortlaufende, auf dem Rande eingegrabene, eigenthümliche Charaktere aus, welche sich in Meklenburg noch nie auf Urnen gefunden haben. Die eine Urne, welche von feinerem Thon und hellbrauner Farbe ist, hat unter dem Rande fortlaufend dieselbe, hier abgebildete
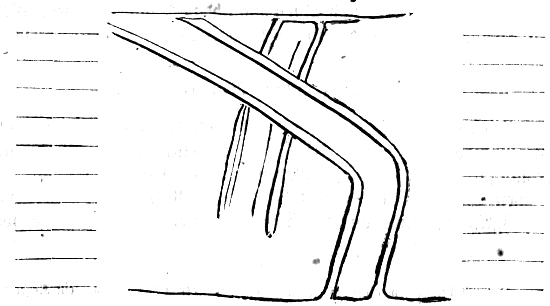


|
Seite 381 |




|
Verzierung, welche immer je zwei durch eine etwas schräge liegende Säule von kurzen, horizontalen, durch Stiche gebildeten Linien getrennt sind. Die andere Urne, welche mit mehr Kies gemischt und von dunklerer Farbe ist, hat unter dem Rande fortlaufend und ohne Trennung die hier abgebildete Verzierung:

Ob diese Charaktere nun bloße Verzierungen sind, oder ob sie tiefere Bedeutung haben, läßt sich jetzt schwerlich bestimmen; jedoch schien eine Abbildung derselben nothwendig. Die erstere Urne hat in der Mitte des Bodens unten eine runde Vertiefung von ungefähr 1" Durchmesser, welche beweiset, daß sie frei auf dem Daumen gedreht ist. Dem Anscheine nach stand ein drittes Gefäß an derselben Stelle, indem sich ein dünnes, stark gebogenes, mit einem kleinen Loche durchbohrtes Stück von einem Rande vorfand, welches zu keiner der andern Urnen gehören kann. In der Mitte des Hügels war ein Steinhaufen Von 12 Fuß Länge in der Richtung von Osten nach Westen und von 8 Fuß Breite. Die Steine waren gewöhnliche Dammsteine; doch die am Rande und in der westlichen Hälfte waren etwas größer. Die Höhe des Steinhaufens war etwa 2 bis 2 1/2 Fuß. Unter diesem Haufen war eine mit kleineren Dammsteinen belegte Fläche von 6 Fuß Länge und 3 Fuß Breite, bedeckt mit einer Lage von Asche und Kohlen ungefähr 1/4 Zoll dick. Die Mitte dieser Brandstelle war nicht genau der Mittelpunct des Grabes, sondern wich um 2 Fuß nach Norden ab. An Alterthümern fand sich nichts. Zwischen den größeren Steinen am westlichen Ende lag aber ein stark oxydirtes Hütchen. - Noch fand sich ohne Steine über dem Urboden nordöstlich von der Mitte gegen 16 Fuß entfernt eine Brandstelle, aber ohne weitere Alterthümer. Kohlen, besonders aus Erlen= und Eichenholz, lagen durch das ganze Grab zerstreut zwischen der Erde.


|
Seite 382 |




|
In nordwestlicher Richtung von dem vorigen Grabe etwas über 100 Schritte entfernt liegt ein anderes, aber schon früher fast ganz abgetragenes Kegelgrab. Außer dem Steinringe, der wie das vorige Grab einen Durchmesser von 50 Fuß zeigte, waren nur noch in der Mitte einige Steine gewesen, etwa 1/2 Fuß mit Erde bedeckt. Hier hatten die Arbeiter folgende Gegenstände aus Bronze gefunden:
zwei Handringe, 3 1/4 und 2 1/2 " weit, äußerlich stark geriefelt, wie Friderico-Franc. XXII, 9;
die Fragmente von 2 sehr starken, gewundenen Kopfringen;
das Fragment eines Diadems, wie Jahrb. IX, S. 333;
eine große Nadel mit einem platten Kopfe, der 2 1/2 " Durchmesser hat, und darunter mit vielen scheiben= oder ringförmigen Verzierungen, ganz wie die Friderico - Franc. XXIV, 1. abgebildete, nur daß sie 2mal drei Gruppen von drei Scheiben und eine in der Mitte von sechs Scheiben hat. Die Länge vom Kopfe bis zum Ende dieser Verzierung, mißt 6 3/4 " die vorhandenen Stücke der Nadel sind zusammen 12" lang; doch fehlt etwas in der Mitte, und mag die ganze Länge gegen 2 Fuß betragen haben.
Alle diese Sachen sind viel kräftiger und gröber gearbeitet, als die Alterthümer aus dem Grabe Nr. 1, und sind nicht allein mit tiefem grünen, sondern auch theilweise mit hochblauem Rost bedeckt.
Eine weitere Untersuchung des ganzen Grabes ergab durchaus keine weiteren Resultate.
Ganz, nahe nördlich von den vorigen war ein Kegelgrab gewesen, ähnlich wie das vorige, bis auf einige Steine früher schon abgeräumt; es hatte auch gleichen Durchmesser. In der Mitte waren von den Arbeitern gefunden:
eine Handberge, ganz wie die im Grabe Nr. 1, doch fehlt etwas vom Bügel,
zwei Handringe, wie die im ersten Grabe gefundenen, und
ein Diadem mit zwei Reihen eingravirter Spiralwindungen verziert, ganz wie die in Jahrb. IX, S. 333, und im Friderico - Franc. X, 5. und XXXII, 2, dargestellten Diademe gebildet.


|
Seite 383 |




|
Auch hier war eine weitere Nachgrabung fruchtlos. - Weiter nördlich scheinen noch 2 eben so große Kegelgräber gestanden zu haben, wie die ganze Beschaffenheit des Bodens, auch eine fast unmerkliche Erhebung desselben verrathen; es war aber keine Spur von Steinen zu finden und also auch keine Hoffnung vorhanden, hier noch Alterthümer zu entdecken.
Für eine weitere Nachsuchung und Aufdeckung von Gräbern auf seinem Gute hat der Herr Hoffschläger bereitwilligst seinen Beistand und seine gütige Mitwirkung zugesagt.
Vietlübbe im August 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Nachdem die Forschungen zu Weisin beendigt waren, trugen die Arbeiter wieder ein von Feldsteinen aufgebauetes Kegelgrab ab, dessen Inhalt jedoch der Herr Hoffschläger an den Verein einsandte. Leider ist der Inhalt theils durch das Alter, theils durch die Zerbrechlichkeit des Materials, theils durch die Ungeschicklichkeit der Arbeiter zum großen Theile zerstört, was um so mehr zu bedauern ist, als der Inhalt grade dieses Grabes sehr interessant war. Es fand sich nämlich
eine braune Urne von Thon, braun, dickwandig, ganz zerstört und mit zerbrannten Knochen gefüllt;
ferner fand sich zwischen dem eingesandten ganzen Inhalt des Grabes:
ein kleines Bronzegefäß, ungefähr 4 1/2 " weit und 2 1/2 " hoch, zur Hälfte vorhanden, aus getriebener Bronze nicht viel dicker als Schreibpapier, von fast halbkugelförmiger Gestalt, mit grade aufstehendem Rande, welcher 1/2 " breit eine Verzierung von erhaben getriebenen Schrägelinien \\\\\\ hat, wie die unten aufgeführten kleinen Thongefäße von Retzow, vgl. oben S. 363; ein anderes kleines Bronzegefäß von eben so dünnem Bronzebleche, ganz zertümmert, mit hohem Halse und einem kleinen Henkel, der mit einer eingravirten Zickzacklinie verziert ist, welcher durch einen fortgehenden Meißel gebildet ist; endlich lag zwischen den eingesandten Knochen eine Sichel von Eisen, wie Frid. Franc. Tab. XVII, Fig. 12, in zwei Stücke zerbrochen.
Wenn alles dieses zusammen gefunden ist, was sich vermuthen läßt, da die eiserne Sichel, mit Rost, Erde und Knochensplittern bedeckt, unerkannt zwischen den eingesandten Knochen lag, so ist das Grab allerdings sehr interessant, da es eines der sehr wenigen Kegelgräber ist, welche Spuren von Eisen


|
Seite 384 |




|
geliefert haben. Es ist freilich nicht sicher, in welchen Höhen sich die verschiedenen Alterthümer gefunden haben, aber es deutet alles auf die Bronzeperiode. Aus dem dünne getriebenen Bronzeblech läßt sich aber auf eine jüngere Zeit der Bronzeperiode schließen, da in ältern Zeiten nur Bronzeguß vorkommt; auch geht der Rost nicht tief, obgleich er schon edel ist.
Die Kegelgräber von Weisin repräsentiren daher die verschiedensten Perioden der Bronzezeit, von den stärksten Formen des Bronzegusses mit hochblauem Roste bis zu den dünnsten Formen der Bronzeblechtreibung mit leichtem hellgrünem Roste in Begleitung des Eisens.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Retzow,
D. A. Lübz, Nr. 5.
Vgl. Jahresber. IX, S. 381.
Um den Inhalt der von der Zerstörung bedrohten Gräber der Feldmark Retzow zu retten, schritt ich zu der Aufdeckung der noch bisher gut erhaltenen Kegelgräber, welche vom Dorf Retzow aus an der Landstraße nach Lübz die zweite Gruppe bilden. Sie bestanden ursprünglich aus 6 gleich großen Kegeln, von denen die Hälfte schon früher zerstört ist. Diese Kegelgräber sind eigentliche Steinkegel, deren Ringsteine noch deutlich zu Tage standen und Kreise von 30 Fuß Durchmesser bilden. Sie liegen auf einer nach Süden geneigten Anhöhe, deren Boden aus grobkörnigem rothen Sande besteht, womit auch die Steine der Gräber durchschüttet sind. Innerhalb des zuerst geöffneten südlichen Hügels fanden sich gegen die Mitte hin 2 Fuß über dem Urboden, zwischen den Steinen verpackt und von ihnen zerdrückt, neben einander 6 Urnen und in 2 derselben je eine kleinere, also zusammen 8 Urnen.
Zuerst standen östlich neben einander:
a. eine grobkörnige Urne, aus deren Bruchstücken sich die Form nicht erkennen ließ. Zwischen den darin befindlichen Knochen lag aus Bronze eine Messerklinge von 3" Länge, erst vorwärts und dann rückwärts gebogen, und eine Pincette, die aber sehr dünne und vom Oxyd zerfressen, daher etwas zerbrochen ist. Der Rost auf beiden Gegenständen ist edel, jedoch etwas matt.
b. eine braune Urne von feinerer Masse, in der Bauchweite mit schrägen, rechts nach unten auslaufenden, ziemlich breiten Eindrücken verziert. Der Inhalt bestand nur aus Knochen.


|
Seite 385 |




|
Sodann standen wieder 2 Urnen neben einander, nämlich
c. eine schwarze Urne, ähnlich wie Frid. Franc. V, 10, mit scharf gebogenem Bauche, und
d. eine ähnliche braune Urne. Der Inhalt beider Urnen bestand nur aus Knochen; in dieser letzten Urne lag
e. eine schon zerbrochene kleine Urne, wie die unter b. verziert, ohne Inhalt.
Endlich standen schon etwas westlich über die Mitte des Grabes hinaus
f. eine grobkörnige, ganz zerbröckelte Urne, in welcher unter den Knochen noch
g. eine kleine, ziemlich erhaltene Urne umgekehrt lag. Sie hat 2 3/4 "Höhe, ist in der Oeffnung 3 1/2" weit, im Bauche 3 1/4" und in der Basis 1 1/2". Die Verzierung ist wie bei den Urnen unter b. und e.; auch hat die Urne einen Henkel;
h. eine Urne, wie die unter c. beschriebene. Unter den Knochen lag ein kleiner, dünner, gewundener Halsring aus Bronze, und auf diesem Ringe hing ein kleiner Ring von 1 1/8" Weite. Beide sind matt oxydirt.
Weiter fand sich nichts in dem Hügel, dessen Höhe in der Mitte 5 Fuß betrug; auch war nirgends eine Spur von Brand.
Kegelgrab von Retzow, Nr. 6.
Der östlich von dem vorigen nur 20 Schritte entfernte Hügel enthielt in der Mitte, wo die Höhe nur 4 Fuß betrug, nur eine Urne, welche aber gänzlich zertrümmert war. Unter den Knochen fand sich ein Doppelknopf, ähnlich dem Frid. Franc. XXXII, 22, abgebildeten, nur daß die obere Scheibe noch eine 3/4" lange, mit einem kleinen Knopfe endende Spitze hat 1 ). Daneben lag ein Ring von 5/8" innerer und 7/8" äußerer Weite. Beide Sachen sind mit mattem Roste bedeckt. Außerdem fand sich nichts in dem Hügel.
Kegelgrab von Retzow, Nr. 7.
Nordwestlich von dem Grabe Nr. 2. war ein dem vorigen ganz gleicher Hügel, in dessen Mitte sich ebenfalls nur eine einzige Urne vorfand. Sie war bedeutend groß, aber ganz zerdrückt, mit scharf nach außen gebogener Bauchweite. Unter den vielen


|
Seite 386 |




|
und starken Knochen lagen ein kleiner Stift und das Bruchstück eines Ringes, beide aus matt oxydirter Bronze. Weiter war auch in diesem Kegelgrabe nichts.
Vietlübbe, im Mai 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Vietlübbe bei Plau, Nr. 3.
Ein Kegelgrab aus der Gruppe zwischen Vietlübbe und Damerow, zu welcher das im vorigen Jahrgange S. 380 beschriebene gehört, war von der nördlichen Seite bereits über ein Drittheil abgegraben. Um den Inhalt zu retten, ließ ich von Osten her den Hügel untersuchen. Er war in der Mitte 7 Fuß über dem Urboden erhöhet und hatte einen Durchmesser von 50 Fuß. Die sandige Erde war durchweg mit Dammsteinen angefüllt (Steinkegel); etwa in der Mitte standen auf dem Urboden 3 größere Steine aufgerichtet, mit ihren oberen Spitzen gegen einander gelegt. Zwischen diesen Steinen fanden sich die Scherben einer schwarzen, grobkörnigen Urne und drei Kopf= oder Halsringe aus Bronze 1 ), mit schönem, edlen Rost bedeckt, ähnlich gewunden wie Frid. Franc. XXXII, 3. Einer derselben ist etwas größer, als die beiden andern; allen dreien aber fehlt etwas an einem Ende. Sonst fand sich nichts weiter in dem Grabe. - Nur eines Steines ist noch zu erwähnen, der sich auf der südlichen Seite, gegen 10 Fuß vom Rande, nahe dem Urboden, in diesem Hügel fand. Es ist ein sonst ziemlich roher Granit, der auf einer etwas ebenen Seite von 16 " Länge und 12 " Breite 7 runde Vertiefungen von 2 - 2 1/2 " Durchmesser hat. Diese Vertiefungen sind nicht vollkommen rund und glatt, aber doch künstlich hervorgebracht und nicht durch Verwitterung, da sie durch Quarzadern hindurch gehen. Ganz dieselben Vertiefungen finden sich auf dem Decksteine eines Hünengrabes an dem Wege von hier nach Wangelin, an der Zahl wohl hundert. Der Volksglaube sieht sie für Eindrücke der Fingerspitzen an, damals entstanden, als die Riesen diesen Stein dahin gelegt haben.
Vietlübbe, im April 1845.
J. Ritter.


|
Seite 387 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Sandkrug, D. A. Lübz, Nr. 1.
Auf dem Felde des ehemaligen Dorfes Sukow, jetzt zum Forsthofe Sandkrug gehörig, liegt auf einer Anhöhe, die sich nach Südosten abdacht, eine Gruppe Kegelgräber, von denen nur wenige erhalten sind; doch kann man noch etwa 13 zählen, die zum Theile ganz oder halb zerstört sind. Um für den Verein zu retten, was noch vorhanden war, begab ich mich dahin und öffnete das noch am besten erhaltene Grab zuerst. Es hatte einen Ring von ziemlich großen Steinen gehabt, welche im Laufe des Winters zur Anfertigung eines Brunnens weggenommen waren. Der Durchmesser des Ringes betrug 4 Ruthen. Als ich innerhalb desselben von der Ostseite die Aufdeckung beschaffte, zeigte sich eine Ruthe vom Umkreise ein Steingewölbe, welches sich bis zu der Höhe von 5 Fuß in der Mitte hinauf zog. Die Axenhöhe des ganzen Kegels war 5 1/2 Fuß. Die Breite dieses inneren Steingewölbes war 18 Fuß von Süden nach Norden. Gegen die Mitte hin bildete das Steingewölbe eine muldenförmige Vertiefung von 8 Fuß Länge, 5 Fuß Breite und 2 1/2 Fuß Tiefe; die Mitte dieser Vertiefung lag 4 Fuß südlich vom Mittelpuncte des Hügels. Unterhalb dieser Vertiefung war die Erde auf dem Urboden mit Asche und Kohlen von Ellernholz stark bedeckt; an den Steinen war kein Brand bemerkbar. Mitten unter der Vertiefung, etwa 1 1/2 Fuß über dem Urboden war zwischen die Steine verpackt und von denselben zerdrückt eine Urne, welche nach den Scherben 8" in der Oeffnung hielt; der Inhalt war nur Asche. Weiter fand sich in dem Grabe nichts.
Kegelgrab von Sandkrug, Nr. 2.
Westlich von dem vorigen lag ein Kegelgrab etwa 50 Schritte entfernt; der Steinkreis war schon verschwunden und der innere Steinhaufe schon an der Süd= und Nordseite etwas angegriffen. Das Steingewölbe maß von Osten nach Westen 20 Fuß und hatte eine Axenhöhe von 5 Fuß. Gegen die Mitte hin stand 2 Fuß hoch über dem Urboden eine grobkörnige Urne, deren Gestalt unkennbar war, angefüllt mit Asche und Modererde. Auf dem Urboden waren nur geringe Spuren von Kohlen. Das Steingewölbe hatte keine Vertiefung, wie der vorige Hügel sie zeigte. Auch fand sich weiter nichts an Alterthümern.
Vietlübbe, im Mai 1845.
J. Ritter.


|
Seite 388 |




|



|



|
|
:
|
Kegelgräber von Kikindemark.
Die Chaussee=Arbeiten bei Parchim haben bisher wenig Alterthümliches zu Tage gefördert, obgleich ich ziemliche Erwartungen davon hegte, als ich erfuhr, daß man beschäftigt sei, die Kegelgräber in der Streithorst bei Kikindemark, wo ich vor einigen Jahren schon einmal Nachgrabungen angestellt habe (vgl. Jahresber. III, S. 57 und Jahrb. X, S. 280 - 283), aufzuräumen. Ich begab mich sofort mit dem Herrn Pastor Günther an Ort und Stelle; wir fanden aber schon eine Menge Grabhügel zerstört und viele Urnenscherben umherliegen; die Arbeiter versicherten aber, nichts weiter als solche zerbrochene Töpfe gefunden zu haben, weshalb sie es nicht für nöthig gehalten hätten, Anzeige davon zu machen. Wir ließen noch einmal die genauesten Instructionen zurück; aber alles, was ich erreicht habe, ist, daß sie mit den "Töpfen" etwas vorsichtiger umgegangen sind. Das ganze Begräbnißfeld, gewiß 20 Gräber, Hügel an Hügel, ist zerstört und der einzige Ertrag für die Alterthumskunde ist:
eine braune Urne, ohne Henkel, von der oben S. 356 abgebildeten Grundform, gegen 5 " hoch,
ein sogenanntes Schermesser von Bronze und eine grade Nadel mit kleinem Kopfe von Bronze, 5 1/2 " lang;
die beiden letztern Stücke sollen nach den Aussagen der Arbeiter nicht in einem eigentlichen Grabe, sondern daneben mitten in einem Fahrwege zwischen unregelmäßig liegenden Steinen gefunden sein, wobei ich jedoch bemerken muß, daß schon früher in diesem mächtigen Steinlager gewühlt ist und Fahrwege öfter mitten durch niedrige Kegelgräber gehen.
Parchim, 1845.
W. G. Beyer, Dr.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Spornitz.
Auf einer Durchreise durch Spornitz um Johannis 1845 reichte mir der dort wohnende Aufseher über die Chaussee =Arbeiten zwischen Spornitz und Parchim, Namens Speekmann, eine Graburne nebst einem Bronzering in den Postwagen.
Diese Alterthümer sind nach später eingezogener Erkundigung bei den in der Gegend sehr bekannten sieben Steinen, in der Nähe des Forsthofes Trotzenburg, auf der spornitzer Feldmark gefunden. Dort lag nämlich eine Gruppe von 6 großen Steinen und in einiger Entfernung davon ein 7ter, von welchen die Sage geht, daß es in Stein verwandelte Knaben seien. Sechs Pferde=


|
Seite 389 |




|
jungen, sagt man, hätten Kegel gespielt und sich statt der Kegel ihrer Würste, statt der Kugel des Brotes bedient; der siebente habe sich zwar entfernt, um keinen Theil an diesem Frevel zu nehmen, aber doch nicht unterlassen können, sich unterwegs umzuschauen, und in diesem Augenblicke seien alle sieben zu Stein geworden. (Die Sage ist offenbar unvollständig; wahrscheinlich begab sich der Frevel während der Kirche, und die Verwandlung erfolgte, nach der Analogie anderer Sagen, in dem Augenblicke, wo die Glocke stieß.)
Die unter einem dieser Steine gefundene, wohl erhaltene Urne ist zierlich und edel geformt, ungefähr von der oben S. 358 abgebildeten Form und Größe, nur nach oben hin spitz auslaufend, ganz röthlich gelb 1 ) gebrannt, ohne alle Verzierungen, in der Mündung 5 1/2 ", im Bauche 7 1/2 " weit und 4 1/2 " hoch, soll übrigens nichts als Erde enthalten haben. Der erst nach der Auffindung an einer stark oxydirten Stelle durchbrochene Ring von Bronze, welcher neben der Urne lag, ist ein sogenannter Oberarmring, nicht geschlossen, sondern mit beiden Enden etwas übereinander gebogen, und würde in voller Rundung etwa 4" weit sein. Er ist voll gegossen, viereckig, etwas oval gebogen, auf der einen Fläche voll und regelmäßig, auf der andern Fläche an den beiden äußeren Enden des Ovals mit einer halben Drehung wie gewunden ausgehöhlt und überall mit Parallellinien und Zickzacklinien, wie gewöhnlich, verziert, nur in den beiden Windungen ganz glatt, übrigens mit edlem Roste bedeckt. - Ein ganz ähnlicher Ring, vielleicht an derselben Stelle gefunden, ist zur Zeit jenes Fundes einem Juden in Parchim zum Verkauf angeboten, aber nicht wieder zu erfragen gewesen.
Schwerin, den 1. September 1845.
W. G. Beyer, Dr.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Stolpe.
Nach einem schriftlichen Berichte des Chaussee=Bau=Aufsehers Speekmann hat der Schachtmeister Eggers aus Consrade bei Schwerin im Monate Julius d. J. in den sogenannten "Dämmen" auf der Feldmark Stolpe bei Neustadt beim Steinbrechen eine mit Asche und Knochen gefüllte Urne und dicht daneben einen goldenen Ring gefunden, aber der allen Chaussee=Arbeitern gegebenen genauen Instruction ungeachtet doch nicht


|
Seite 390 |




|
abgeliefert. Auf diese Anzeige habe ich mich sofort an den Herrn Amtmann Weber zu Neustadt gewendet und um Untersuchung des Thatbestandes gebeten, leider aber zu spät, denn die Urne war bereits zerschlagen und der Ring zunächst an den Juden Jacob Ascher zu Neustadt angeblich für 3 Rthlr. 16 ßl., von diesem aber weiter an den Goldschmied Wegner daselbst für 4 Rthlr. verkauft und von letzterem sofort eingeschmolzen. Nach den von dem Herrn Amtmann Weber bei den genannten Personen eingezogenen Erkundigung bestand der Ring, dessen Größe nicht angegeben wird, aus 8 feinern Dräthen, welche je 2 um einander gewunden waren und also zusammen 4 an einander geschweißte Reifen bildeten.
Schwerin, den 1. Septbr. 1845.
W. G. Beyer, Dr.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wiechmanstorf.
Beim Bau der Chaussee von Cröpelin nach Neu=Bukow wurden im J. 1845 von den Steinbrechern einige aus Feldsteinen gewölbte Kegelgräber zu Wiechmanstorf bei Cröpelin ohne Wissen des Gutsherrn angegriffen. In einem derselben fand sich:
ein Paar gravirte Handringe aus Bronze, von denen der eine ganz zerbrochen ist,
ein sehr feiner glatter Handring,
ein gewundener Halsring aus Bronze,
eine große Haarnadel, mit einem glänzenden Steine, nach der Aussage der Arbeiter, welche jedoch nach ihrer Behauptung verloren gegangen ist.
Alle Sachen sind aus Bronze, ungewöhnlich fein und sauber gearbeitet und mit hellgrünem edlen Rost bedeckt. Die geretteten Stücke hat der Herr von Schack auf Wiechmanstorf dem Vereine geschenkt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Roggow.
Auf der Feldmark von Roggow bei Neu=Bukow steht ein großes Kegelgrab. Man könnte versucht sein, dasselbe, wie mehrere andere große, kegelförmige Hügel auf den Höhen in der Nähe der Ostsee (vgl. Jahrb. IX, S. 354), nicht für heidnische Gräber, sondern für Warten oder dgl. zu halten, welche Meinung auch wohl schon ausgesprochen ist. Jedoch scheint die Construction dieser Hügel durchaus für heidnische Gräber zu reden.


|
Seite 391 |




|
Der Herr von Oertzen auf Roggow ließ einen solchen großen Hügel, der, an einem Wege stehend, am Fuße schon etwas abgegraben war, an einer Seite ein wenig angraben und fand unter Kohlen sogleich eine Nadel aus Bronze, 4 " lang, oben etwas gebogen und am dicken Ende umgerollt, in Gestalt eines modernen Pfeifenräumers.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrgräber von Alt=Sammit bei Krakow.
Beim Ausbrechen von Steinen auf dem Felde von Alt=Sammit wurden gefunden und von dem Herrn Riedel auf Alt=Sammit dem Vereine zum Geschenke gemacht:
zwei kurze Schwerter oder Dolche aus Bronze, beide ein Mal zerbrochen und in den Bruchenden oxydirt, beide sehr schmal und dem Anschein nach sehr ausgeschliffen, beide mit kurzen, massiven, bronzenen Griffen, nämlich:
ein Schwert mit einem ovalen, glatten Griffe und einem großen ovalen, platten Knopfe, welcher mit 8 gravirten Spiralwindungen verziert ist, wie Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. Ic, in der Klinge 12 " lang;
ein Schwert mit einem viereckigen Griffe, welcher mit gravirten, parallelen Horizontal= und Perpendiculair=Linien verziert ist, und einem kleinen, viereckigen Knopfe, in der Klinge 14 " lang.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Begräbnißplatz von Vietlübbe
bei Plau,
aus der Zeit der Kegelgräber.
Auf der jetzigen vietlübber Feldmark, wahrscheinlich dem früheren Felde von Sukow, links vom Wege nach Plau, nahe der Rißbek und den Tannen, liegt eine Fläche von etwa 20 Ruthen Länge von Osten nach Westen und einer Breite von 8 Ruthen mit kleineren und größeren Steinhügeln bedeckt; der Platz heißt der "Mürerbusch" (Mörderbusch) und hatte früher eine bedeutende Größe, da die Fundamentsteine zu mehreren Gebäuden hier schon vor einigen Jahren ausgebrochen und einige Hügel am Rande halb zerstört sind. Sobald der ganze Raum aufgedeckt ist, werde ich das Nöthige über das Ganze am Schlusse nachträglich bemerken. Da die Steine überall zu Tage liegen und jetzt ausgebrochen werden, die Alterthümer aber hier scheinbar dicht gedrängt sich finden, so glaube ich, daß eine Aufdeckung


|
Seite 392 |




|
sehr im Interesse des Vereins ist, ehe fremde Hände den noch vorhandenen Theil dieses Begräbnißplatzes zerstören.
Einen halb zerstörten Hügel im Osten einstweilen übergehend, fing ich die Untersuchung
A. am nächstfolgenden Hügel an, der unversehrt war und bei einem Durchmesser von 50 Fuß eine Axenhöhe von 4 Fuß hatte, doch so daß oben in einer Fläche von etwa 30 Fuß dieser Hügel abgeplattet war. Schon einige Fuß vom östlichen Rande fand sich eine Brandstelle auf dem Urboden und bald darauf
1) eine Urne von 9 " Höhe, 11 1/2 " in der Oeffnung, 14 1/2 " im Bauche und 4 1/2 " in der Basis haltend. Sie ist unverziert und enthielt nur Knochen und Asche.
2) Etwa 5 Fuß weiter westlich stand mitten zwischen den Steinen, 2 Fuß hoch über dem Urboden eine Urne von 4 Fuß Höhe, 4 " Oeffnung, 4 1/2 " Bauchweite und 3 1/2 " Basis mit fast graden Wänden; sie war roh gearbeitet, bereits zerdrückt und außer einigen kleinen Knochen ohne weitern Inhalt.
3) Weiter südwestlich etwa 8 Fuß war eine Urne bis zum Rande in den Urboden versenkt, mit vielen Kohlen und gebrannter Erde umgeben, an Gestalt der ersten Urne gleich, aber 13 " in der Oeffnung haltend. Zwischen den Knochen lag:
a. ein Doppelknopf aus Bronze mit auslaufender Spitze, 2" lang, ganz wie die oben erwähnten Doppelknöpfe von Dobbin und Retzow (vgl. die Abbildung S. 378), und
b. ein Bruchstück von einem hohl getriebenen Handringe, ebenfalls aus Bronze, im Bruchende oxydirt.
Der Rost auf beiden Sachen ist nicht glänzend.
4) Etwa 10 Fuß westlich, südlich von der Mitte des Hügels, fand sich wieder eine Urne, an Bildung der 1 und 3 gleich, aber 9 " hoch, 14 " im Bauche und 6 " in der Basis weit.
Sie enthielt außer vielen und starken Knochen:
a. ein doppelt gebogenes, nämlich zuerst wie eine Sichel nach innen gekrümmtes und dann wieder rückwärts gekrümmtes Messer aus Bronze mit Griffzunge. Die am Rücken verzierte Klinge ist 8 ", die Griffzunge 2 1/2 " lang. Auf einer Seitenfläche ist der Rost so dünne, daß die Metallfarbe stark hervortritt; auf der andern Seite ist der Rost edel, jedoch nicht tief;
b. einen offenen, leise gewundenen Ring aus Bronze, 2 " weit, aus einem gut 1"' dicken, gedrehten Drathe, der an den offenen Enden platt ausläuft und 1 " weit überfaßt.


|
Seite 393 |




|
5) Südlich von der vorigen 5 ' entfernt war eine gleiche Urne, von 12 " Durchmesser in der Oeffnung, bis an den Rand in den rings umher verbrannten und mit Kohlen angefüllten Urboden versenkt. Außer Knochen und Asche enthielt sie nichts an Alterthümern 1 ).
B. Zwei kleinere, südlich von dem vorigen gelegene Hügel enthielten je eine
6 und 7) Urne, die aber zerdrückt waren und keinen weiteren Inhalt als Asche und Knochen hatten.
Vietlübbe, im Juni 1845.
J. Ritter.
C. Vier Hügel, welche nach einander in der Breite von Osten nach Westen fortschreitend durchgegraben wurden, gaben keine andere Ausbeute, als Urnenscherben und Brandstellen, obgleich die Hügel ganz unversehrt waren. Auch die Zwischenräume, da sie mit Steinen ausgelegt waren, ließ ich durchgraben.
D. In der Mitte eines alsdann folgenden Hügels stand auf dem Urboden eine Urne mit scharfem Bauchrande, von der oben S. 357 abgebildeten Grundform, den früher gefundenen ähnlich, aber kleiner; sie mißt nämlich 5 1/2 " in der Höhe, 6 1/2 "in der Oeffnung, 7 3/4 " in der Bauchweite und 3 1/2 " in der Basis. Der Inhalt bestand nur in Sand, Asche und kleinen Knochen. Dicht daneben lag auf dem Urboden ein Bruchstück von einem feinkörnigen Sandstein, welcher auf mehreren Flächen offenbar zum Schleifen gebraucht ist.
Vietlübbe, im August 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Bericht über Kegelgräber von Plau.
Da wo die alte Straße von Plau nach Meienburg die Chaussee jenseit der Appelburg am Ende der Tannen durchkreuzt, lagen 4 schon früher durchgrabene Kegelgräber von mäßiger Größe. Die Chaussee ist dort 3 bis 4' tiefer gelegt, als der Urboden der Gräber war. Bei den Arbeiten in der Gegend der Gräber


|
Seite 394 |




|
fanden sich hin und wieder Urnen, von denen mir etwa 6 in Scherben von verschiedener Gestalt und Dicke der Masse gezeigt wurden. Sie waren in dem dortigen kiesartigen Sande 2 bis 3 ' tief in der Erde gefunden und sämmtlich in Lehm verpackt gewesen; der Inhalt hatte nur aus Asche und Knochen bestanden. - Ein Hünengrab in der Nähe, noch in den Tannen liegend, sollte nächstens angegriffen werden.
Vietlübbe, Anfangs Juli 1845.
J. Ritter.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Plau.
In den Tannen rechts von dem Wege, der von der Appelburg bei Plau nach Twietfort führt, lag ein Kegelgrab von 30 Fuß im Durchmesser und 5 Fuß Axenhöhe. Die Erde war überall mit Steinen angefüllt und fast in der Mitte des Hügels nahe am Urboden fanden sich aus Bronze:
a. ein Stabbeschlag mit rhombischer Deckplatte, welche mit Ringverzierungen geschmückt ist, wie der Schwertknopf Frid. Franc. Tab. XIV, Fig. 2 c , nur etwas kleiner, jedoch ganz so, wie die antiken Schwertknöpfe gewöhnlich sind; es ward jedoch kein Schwert gefunden, wie überhaupt dergleichen Knöpfe öfter allein gefunden werden. Beim Finden waren noch Spuren von Holz darin sichtbar. Der Rost ist alt und edel.
b. ein runder, hutförmiger Buckel, 2 Zoll im Durchmesser und 3/4 " hoch. Der Bügel auf der untern Fläche war durch Oxydation so angegriffen, daß er beim Auffinden zerbröckelte. Der breite, flache Rand ist mit 12 sechsblättrigen, erhabenen Rosetten, der mittlere, hohle Theil ist mit Blättern verziert, und der höchste Teil stellt ein menschliches Gesicht dar. Alles ist erhaben gearbeitet 1 ).
Vietlübbe, im Juni 1845.
J. Ritter.


|
Seite 395 |




|



|



|
|
:
|
Begräbnißplatz von Liepen.
Der in Jahrb. X, S. 294, beschriebene Begräbnißplatz von Liepen gehört, wie auch Ritter S. 393. bemerkt, nicht der Eisenperiode, sondern der Bronzeperiode an. Eine von dem Herrn Reichsfreiherrn A. v. Maltzan auf Peutsch eingesandte, mit Parallellinien um den hohen Hals und mit Schrägelinien um den Bauch verzierte kleine Urne bestätigt diese Ansicht.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Ohrbommel aus Bernstein von Moltzow.
Im Laufe des Sommers 1845 ward zu Moltzow in derselben Modergrube, in welcher im Winter vorher ein bronzener Spiralcylinder gefunden war (Jahrb. X, S. 285 - 286), neben mehreren Urnenscherben ohne Verzierung noch eine Ohrbommel aus Bernstein gefunden und von dem Herrn Landrath Reichsfreiherrn von Maltzan auf Rothenmoor dem Vereine geschenkt. Dieselbe ist 1" lang, hat ganz den Charakter der Geräthe aus der Bronzeperiode, gehört wohl sicher in diese und ist nur geschnitten, nicht gefeilt. Der untere, dickere Theil hat ganz die Gestalt der Gefäße aus der ausgebildeten Bronzeperiode, wie z. B. das Bronzegefäß von Parchim (Jahrb. X, S. 281), darüber drei parallele, erhabene Reifen und darüber ein Oehr.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
d. Zeit der Wendengräber.
Die schwarzen Urnen
der Wendenkirchhöfe.
Es sind in unsern Jahrbüchern die häufig in den der letzten Zeit des Heidenthums angehörenden Wendenkirchhöfen oder Begräbnißplätzen der Eisenperiode gefundenen, ganz schwarzen Urnen mit den aus Punctlinien gebildeten, mäanderförmigen Verzierungen, welche mit einem laufenden, gezahnten Rade gebildet sind, öfter besprochen. Diese Urnen, welche, mit den ihnen eigenthümlichen Hefteln, in Frid. Franc. Tab. XXXIV. abgebildet sind,


|
Seite 396 |




|
sind in größerer Anzahl bisher nur in der westlichen Hälfte Meklenburgs und jenseit der Elbe in der ganzen Altmark beobachtet. Die Sammlungen in Berlin (außer denjenigen, welche aus der Altmark stammen), Neu=Strelitz und Stettin haben sie nicht; in Kopenhagen sah ich zwei ähnliche Urnen aus der Eisenperiode; aber sie waren nur ähnlich, nicht gleich. Nur in Kiel fand ich die Scherben einer einzigen Urne, welche mit unsern in Frage stehenden Urnen an Gestalt, Farbe und Verzierung völlig gleich war. Leider ist der Fundort dieser Urne nicht genau bekannt. Nach den von dem Herrn Professor Paulsen zu Kiel mir mitgetheilten Nachrichten aus den Verzeichnissen der kieler Sammlung ist die Urne der Gesellschaft für Erhaltung der vaterländischen Alterthümer zu Kiel von der patriotischen Gesellschaft geschenkt. "Da nun die patriotische Gesellschaft ihren Sitz zu Altona hat, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Urne aus Holstein, und also möglicher Weise aus Wagrien stammt."
G. C. F. Lisch.
e) Vorchristliche Alterthümer gleichgebildeter europäischer Völker.
Der Herr Inspector Beneke zu Pampow bei Teterow hat dem Vereine eine kleine Sammlung von Alterthümern aus andern deutschen Ländern zum Geschenke gemacht, welche von ihm selbst an den Fundorten erworben sind:
I. aus Holstein:
2 Keile aus Feuerstein,
1 spanförmiges Messer aus Feuerstein,
1 Framea mit Schaftloch und Oehr, aus Bronze, aus einem Grabe,
1 Scheermesser, aus Bronze, aus einem Grabe,
1 Pfriemen, aus Bronze, aus einem Grabe,
1 Nadel, aus Bronze, aus einem Grabe,
1 Messer aus Eisen, aus einem Grabe;
II. aus dem Oderbruche:
1 kleine, gehenkelte, glatte Urne, gefunden bei Gorgast, wahrscheinlich aus der Bronzeperiode.;
1 ganz kleine Urne, von der Gestalt und Größe einer mittelgroßen Zwiebel, mit parallelen Halbkreisen auf dem Bauchrande und mit eingestochenen Puncten verziert, welche mit einer weißen Masse (Kalk?) ausgestrichen sind (vgl. Jahrb. X, S. 266), wahrscheinlich aus der Steinperiode, gefunden bei Kienitz auf einem Begräbnißplatze.


|
Seite 397 |




|



|



|
|
:
|
f) Vorchristliche Alterthümer der Römer.
Ueber die Verbreitung römischer Alterthümer in den Ostseeländern.
Erst in neuern Zeiten ist durch wichtige Funde in den Ostseeländern die Aufmerksamkeit auf die Verbreitung römischer Alterthümer in diesen Ländern gelenkt worden. In Meklenburg sind in den neuesten Zeiten wiederholt bedeutende und interessante Funde gemacht worden, wie z. B. zu Gr. Kelle, Hagenow und Schwinkendorf (vgl. Jahresber. III, S. 42, V, Anhang und Lithogr. und VIII., S. 38 flgd. und S. 51 flgd.). Diese Alterthümer sind um so wichtiger und sicherer, als sie theils römische Fabrikstempel führen, theils von unzweifelhaft römischer Arbeit sind. In der Sammlung nordischer Alterthümer zu Kopenhagen werden viele in Dänemark gefundene römische Alterthümer aufbewahrt und unter diesen mehrere Bronzegefäße von ausgezeichneter Schönheit. Dieses Museum bewahrt aber noch viel mehr ächt römische Alterthümer, welche sicher in Dänemark ausgegraben sind, als bisher bekannt gewesen ist.
Zu den wichtigsten römischen Alterthümern in den Ostseeländern gehören die Kellen aus Bronze, theils weil grade sie oft die unverkennbaren Zeichen römischer Arbeit tragen, theils weil sie gewöhnlich Fabrikstempel führen (vgl. Jahresber. VIII, S. 41 u. 51), auch am häufigsten mit andern römischen Alterthümern zusammen gefunden werden und daher in der Regel ein sicheres Kennzeichen des römischen Ursprunges der Funde sind. Eine besondere Art dieser Kellen sind die ihnen an Form gleichen "Siebe" oder "Seihen" aus Bronze, Kellen, in welche die Sieblöcher in schönen, antiken Linien eingeschlagen sind. Solcher Kellen und Siebe bewahrt die Sammlung nordischer Alterthümer zu Kopenhagen eine ganze Menge, - Siebe gewiß ein Dutzend; alle sind aber hier den heimischen Alterthümern zugezählt. Dies ist nicht allein allgemein angenommen, sondern auch in Schriften ausgedrückt; in dem Leitfaden zur Nordischen Alterthumskunde, Kopenhagen, 1837, werden unter den heimischen "Sachen, welche man als die heidnische Gottesverehrung betreffend ansieht" S. 44. aufgeführt:


|
Seite 398 |




|
"4) Flache, große Schüsseln, oder Gefäße von Bronze, die gewöhnlich einen gedrehten Fuß haben sie werden für die sogenannten Opferbecken gehalten, worein das Opferblut gegossen wurde."
"5) Siebe von Metall, in ein thönernes Gefäß oder in ein anderes dazu gehörendes Bronzegefäß gesetzt."
Mein Freund Worsaae setzt in diese Bestimmung mit Recht Bedenken, indem er in seiner Schrift: "Dänemarks Vorzeit durch Alterthümer und Grabhügel beleuchtet," Kopenhagen, 1844, S. 55, sagt:
"Zu den rein römischen Alterthümern müssen die meisten größern Metallgefäße und namentlich einige runde, gedrehte Gefäße mit Handhabe, ferner die Seihen, einzelne Glassachen
. gerechnet werden."
Im Sommer 1845 entdeckte ich nun zu Kopenhagen auf den Griffen der Siebe, welche alle augenscheinlich von römischer Arbeit sind, unter dickem Rost die bekannten römischen Fabrikstempel. Es ist also keinem Zweifel unterworfen, daß alle Kellen und Siebe aus Bronze im Museum zu Kopenhagen römischen Ursprunges sind. Hiedurch aber werden die Fundorte der in Dänemark gefundenen rein römischen Alterthümer bedeutend vermehrt, so daß die Sammlung der in Dänemark gefundenen römischen Bronzegefäße ganz ansehnlich erscheint.
In den Sammlungen zu Kiel und Stettin habe ich keine ächt römischen Alterthümer bemerkt.
G. C. F. Lisch.
Römische Goldmünze von Neu=Brandenburg.
Auf dem Felde der Stadt Neu=Brandenburg ward eine römische Goldmünze des Kaisers Valentinian (425 - 455) ausgepflügt und von dem Herrn Dr. Jenning zu Stavenhagen erworben und dem Vereine geschenkt. Vgl. unten: IV. Zur Münzkunde.


|
Seite 399 |




|
g) Alterthümer außereuropäischer Völker.
Zur Erkennung und Erläuterung der Alterthümer unserer Steinperiode sind die Geräthe der außereuropäischen Völker von wesentlicher Bedeutung. Der Ausschuß des Vereins hat sich daher seit mehreren Jahren bemüht, solche Alterthümer, namentlich aus Amerika und Neu=Seeland, zu gewinnen. Bei der großen Schwierigkeit, zu solchen Sachen zu gelangen, sind jedoch diese Bemühungen bisher fruchtlos geblieben, obwohl sich in den neuesten Zeiten die Aussicht günstiger gestellt hat. Die Steinarten, aus denen diese Geräthschaften der sogenannten wilden Völker gefertigt sind, und die Formen derselben sind der Masse und Gestalt der Steingeräthe unserer Steinperiode auf eine überraschende Weise gleich; abgesehen von dieser merkwürdigen Uebereinstimmung, geben die Steingeräthe der außereuropäischen Völker durch ihre Anwendung häufig Aufschluß über die Benutzung unserer alten Steinwerkzeuge, da die außereuropäischen Geräthe noch häufig mit ihrer ursprünglichen Befestigung an den Schaften vorkommen, wie sie in Nilsson Skandinaviska Nordens Urinvånare häufig abgebildet sind. Es sind solche vollständige Geräthe von allen Entdeckern, Weltumseglern und wissenschaftlichen Reisenden von der Entdeckung Amerikas bis auf die neuesten Zeiten mitgebracht, - ein Beweis, daß die außereuropäischen Völker diese Geräthschaften zu allen Zeiten gebraucht haben und zum großen Theil bis auf das Eindringen europäischer Cultur auf demselben Standpuncte geblieben sind.
Durch Vermittelung des Unterzeichneten während seines Aufenthalts auf Seeland im Sommer 1845 hat nun der Herr Obrist=Lieutenant von Sommer, Commandant des Schlosses Rosenburg zu Kopenhagen, ein würdiger und einsichtsvoller Alterthumsforscher und Sammler, die aufopfernde Güte gehabt, unserm Vereine eine kleine Sammlung außereuropäischer Steingeräthschaften zu schenken, welche einstweilen dem nothwendigsten Bedürfnisse abhilft, und hat Aussicht auf mehr eröffnet, da ihm zuverlässige Quellen zu Gebote stehen.
Diese von dem Herrn Obrist=Lieutenant von Sommer dem Vereine geschenkten Steingeräthschaften außereuropäischer Völker sind folgende:


|
Seite 400 |




|
1 Keil aus Grünstein von der Insel St. Croix in West=Indien, 4 1/2" lang, mit zugespitztem "Bahnende", der Schärfe gegenüber;
1 Pfeilspitze aus Chalcedon von Godhavn in Nord=Grönland;
1 Pfeilspitze aus schwarzem Kiefelschiefer, wie Frid. Franc. Tab. XXX, Fig. 7, von Jacobshavn in Nord=Grönland;
1 Streitaxt aus festem, feinkörnigen Sandstein, zum Einklemmen in einen gespaltenen Schaft, ohne Durchbohrung, ungefähr von der Größe und Gestalt der Axt in Frid. Franc. Tab. XXIX, Fig. 3, von Easton am Delaware in Pensylvanien;
28 Lanzen=, Pfeil= und Harpun=Spitzen, meistentheils aus Feuerstein, aber auch aus andern Steinarten, von Easton am Delaware.
Die zuletzt erwähnten Geräthschaften, schreibt der Herr von Sommer, "sind in Nord=Amerika an den Ufern des Delaware=Stromes in der Nähe von Easton in Pensylvanien gefunden, wo man dergleichen Alterthümer in großer Menge antrifft. Die Indianerstämme, welche diese Gegend früher bevölkert haben, sind längst ins Innere von Amerika zurückgedrängt. Vielleicht gehörten diese Sachen nicht einmal den zuletzt von hier vertriebenen Eingebornen, sondern frühern Aboriginer=Familien an."
G. C. F. Lisch
Ferner hat der Herr Obrist=Lieutenant von Sommer dem Vereine in einer zweiten Sendung folgende steinerne Alterthümer zum Geschenke gemacht:
1 kleines Schneidewerkzeug aus- schwarzem Kieselschiefer, 1 1/2" lang, an der geschliffenen Schneide etwas zerbrochen, von Jacobshavn in Nord=Grönland:
1 Messerspitze, Fragment, 1 1/2" lang, dolchförmig geschliffen, von Ikaresak an der Umanaks=Bucht in Nord= Grönland, aus Angmak; mit dem Namen Angmak, bemerkt der Herr v. Sommer, bezeichnen die Grönländer mehrere Steinarten, gewöhnlich von gräulicher, bläulicher oder schwärzlicher Farbe, dem Anscheine nach alle der grönländischen Thonschieferformation angehörend, die bei einem gewissen Härtegrade sich leicht bearbeiten, schleifen und bohren lassen;


|
Seite 401 |




|
1 Lampe, halbkreisförmig, aus Topfstein, aus einem Heidengrabe unweit Godthaab in Süd=Grönland;
1Netzsenker aus Topfstein, ein mit einem regelmäßig durchbohrten Loche versehenes Bruchstück von einem alten, großen Gefäße, aus Godthaab in Süd=Grönland; dergleichen durchbohrte Scherben von Topfsteingeschirren, bemerkt der Herr v. Sommer, finden sich nicht selten in und neben den Ruinen von Wohnungen der alten nordischen Colonisten, mitunter 6 - 8, bis 10 Stück beisammen, die wahrscheinlich als Netzsenker benutzt sind (vgl. Jahrb. des Ver. f. meklenb. Gesch. X, S. 299); einige sind mit eingeschnittenen oder eingeritzten Runen oder runenähnlichen Figuren, andere mit einem Kreuze bezeichnet: Finn Magnusen spricht von ihnen in seinem Werke "Runamo og Růnere" S. 577 flgd. und erwähnt beiläufig eines solchen in der Sammlung des Herrn v. Sommer befindlichen Steines, von welchem dieser unserm Vereine eine Zeichnung übersandt hat;
1 Netzsenker aus mehr kalkschieferigem Topfstein, ebenfalls ein durchbohrtes Bruchstück von einem alten Gefäße aus Godthaab in Süd=Grönland.
G. C. F. Lisch.
2. Mittelalter.



|



|
|
:
|
In einer Grube in dem Hause des Herrn Kürschners Boldt zu Bützow, in der Schloßstraße, ward eine an beiden Seiten ausgeschnittene Holzform, gegen 10" lang und gegen 6" breit, gefunden. Auf der einen Seite ist, 9" hoch und 5 1/4" breit, die nach katholischer Weise ausgedrückte Dreieinigkeit dargestellt, wie Gott der Vater den Sohn am Kreuze im Schooße hält, wobei jedoch zu bemerken ist, daß die sonst gebräuchliche Taube, das Symbol des heil. Geistes, über dem Kreuze fehlt. Auf der andern Seite steht, 6 3/4" hoch und 4 3/4" breit, das Wappen der Stadt Magdeburg. Beide Darstellungen sind äußerst roh gearbeitet, wenn auch mit einigem Geschick und gewiß in einer herkömmlichen Weise. Aus dem Alter der Holzform, den


|
Seite 402 |




|
Gegenständen der Darstellung und dem Styl möchte sich aber schließen lassen, daß die Form noch aus der katholischen Zeit stammt, und aus der Größe und der ganzen Arbeit, daß sie nichts weiter ist, als eine Kuchenform. Und von dieser Seite hat die Form ihr Interesse, indem man sieht, welche Gegenstände man auf Eßwaaren versinnbildlichte und daß die Tradition nichts unerhörtes ist, daß die Heidenbekehrer Semmel in Kreuzesform backen ließen.
Auf Nachricht und durch Vermittelung des Herrn Friedr. Seidel hat der Verein die Form von dem Herrn Boldt zum Geschenk erhalten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 403 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Ortskunde.
Heberegister
der Vogtei Grevismühlen
aus
den Jahren 1404 und 1519
mitgetheilt von
G. C. F. Lisch.
Alte Register und Verzeichnisse aller Art sind von sehr großem und dauerndem Werthe für die Geschichtsforschung, weil sie ein sehr vielseitiges Interesse haben; viele Register sind für die deutsche Geschichte berühmt geworden und bilden eine unerschöpfliche Quelle der Forschung, wie für einen großen Theil Meklenburgs das Zehntenregister des Bisthums Ratzeburg. In Meklenburg sind bis jetzt äußerst wenige solcher Documente veröffentlicht. Daher wird es nützlich sein, von Zeit zu Zeit solche Urkunden mitzutheilen und der allgemeinen Benutzung und Bearbeitung hinzugeben. Freilich sind die deutschen Ostseeländer sehr arm an solchen Schriftwerken, weil es ihnen ganz an alten Klosterbibliotheken aus dem Mittelalter fehlt und zur Zeit der Reformation außer den Urkunden alle Schriften der geistlichen Stiftungen untergegangen sind. Aber es wird sich bei eifriger Forschung wohl manches finden, was bei der Seltenheit einen um so größern Werth hat.
Gegenwärtig wird ein jüngst entdecktes Beden= oder Contributions=Register der Vogtei Grevismühlen vom J. 1404 mitgetheilt, da das Register ziemlich alt ist und eine


|
Seite 404 |




|
in mancher Hinsicht interessante Gegend berührt. Das Register bildet ein Quartheft von 6 Blättern Papier und ist auf der ersten Seite (Pfarre Grevismühlen) und auf der letzten Seite (Pfarre Diedrichshagen) sehr abgescheuert. Es führt die Ueberschrift:
 CCCCIIII
CCCCIIII
precaria percepta XXIIII . . . . rum.
Es ist also ein Verzeichniß der erhobenen Bede (precaria) aus der Vogtei Grevismühlen.
Daß das Register die Vogtei Grevismühlen umfaßt, geht nicht nur aus dem Inhalte, sondern auch aus einem, Pachtregister derselben Vogtei vom J. 1519 hervor, welches fast alle dieselben Dörfer aufführt. Wenn auch die Mittheilung des Bedenregisters von 1404 der Hauptzweck dieser Zeilen ist, so ist doch auch das ebenfalls jüngst entdeckte Pachtregister von 1519 zugleich benutzt. Dieses Pachtregister ist ein Quartheft von 12 Blättern mit der Aufschrift:
Anno XIX°.
Das Pachtregister enthält bei jedem Dorfe den Namen des Dorfes, die Namen aller Bauern mit Angabe der Pachtsumme eines jeden Bauern und die Summe dessen, was das ganze Dorf trägt. Zur Vergleichung ist nicht das ganze Register abgedruckt, sondern es sind nur vollständig die Namen der Dörfer, die Anzahl der Bauern und die Pachtsummen der Dörfer mitgetheilt; (da die Zahl der Bauern in dem Register nicht wörtlich angegeben ist, sondern nur durch Zählung gewonnen ist, so ist sie mit deutschen Lettern und arabischen Ziffern angedeutet).
Uebrigens enthalten beide Register nicht alle Dörfer und Güter der Vogtei, da viele abgabenfrei waren; jedoch sind die angegebenen Namen und Verhältnisse schon interessant genug.
Zu noch größerer Anschaulichkeit sind auch die betreffenden Namen aus dem bekannten Zehntenregister des Bisthums Ratzeburg, herausgegeben von Arndt, 1833, zur Vergleichung gezogen.
Endlich sind die heutigen Namen nach dem meklenburgischen Staatskalender hinzugefügt.
Bei dem Abdruck ist folgendes Verfahren beobachtet. Vollständig und diplomatisch genau ist das Bedenregister von 1404 mitgetheilt, jedoch nicht ganz in der Reihenfolge des Originals. Die Dörfer der einzelnen Kirchspiele sind immer ganz


|
Seite 405 |




|
genau in der Reihenfolge des Originals abgedruckt. Da es aber von Interesse war, zu sehen, wie sich die Vogtei Grevismühlen aus dem Lande Bresen (mit Ausnahme des Kirchspiels Beidendorf), dem Lande Dassow und dem Walde Klütz gebildet hat, so ist die Kirchspielsfolge nach dem ratzeburger Zehntenregister gewählt; die Stellung der einzelnen Namen dieses Zehntenregisters hat sich aber nach dem Bedenregister von 1404 richten müssen. Da das Pachtregister von 1519 keine Pfarren angiebt, sondern die Namen bunt durch einander würfelt, so hat sich die Reihenfolge der Dörfer ebenfalls nach dem Bedenregister richten müssen, eben so auch die Reihenfolge der Namen aus dem Staatskalender. Es ist jedoch zu bemerken, daß aus dem ratzeburger Zehntenregister und dem Staatskalender nicht alle Namen aufgenommen, sondern die unbedeutendern, kleinern Ortschaften, welche in den Registern von 1404 und 1519 fehlen, oft weggelassen sind.
Man kann also in Beziehung auf den Abdruck sagen:
Das Bedenregister von 1404 ist vollständig und diplomatisch genau nach dem Originale abgedruckt, auch in der Reihenfolge der Dörfer in den einzelnen Kirchspielen, jedoch ist in den Kirchspielen die Reihenfolge des ratzeburger Zehntenregisters von 1230 gegeben; von dem Pachtregister von 1519 sind die Namen, die Bauernzahl und die Pachtsumme vollständig mitgetheilt, die Reihenfolge der Dörfer hat sich aber ganz nach dem Bedenregister von 1404 gerichtet; eben so hat sich die Stellung der Namen des ratzeburger Zehntenregisters und des Staatskalenders nach dem Bedenregister von 1404 richten müssen: so daß alle Mittheilungen zur Erläuterung des Registers von 1404 dienen.
Zur Aufklärung einzelner Seltenheiten und Dunkelheiten sind einige erläuternde Noten hinzugefügt; diese sind jedoch nur aus dem Vorrath der Studien genommen und machen nicht auf Vollständigkeit Anspruch; man wollte jedoch nicht vorenthalten, was man besaß. Zur vollständigen Erforschung aller Orts= und Sachverhältnisse würden sehr große Quellenstudien gehören. Einstweilen mögen diese Blätter zu Berichtigungen und Forschungen einladen.


|
Seite 406 |




|

1) Die Pfarren Dassow und
Mummendorf waren um 1230 sehr groß. In der
Folge wurden von der Pfarre Mummendorf die
beiden Pfarren Börzow und Roggenstorf
abgetrennt und von der Pfarre Dassow gingen
mehrere Dörfer an andere Pfarren über.
Mehrere Ortschaften in der Pfarre Dassow
sind auch bis jetzt unbekannt
geblieben.
2) Zur Zeit des ratzeburger
Zehntenregisters (um 1230) umfaßte die
Pfarre Mummendorf fast alle Dorfschaften,
welche etwas später in die drei Kirchspiele:
Mummendorf, Roggenstorf und Börzow vertheilt
wurden; viele Ortschaften bestanden damals
auch noch gar nicht oder lagen wüste.


|
Seite 407 |




|
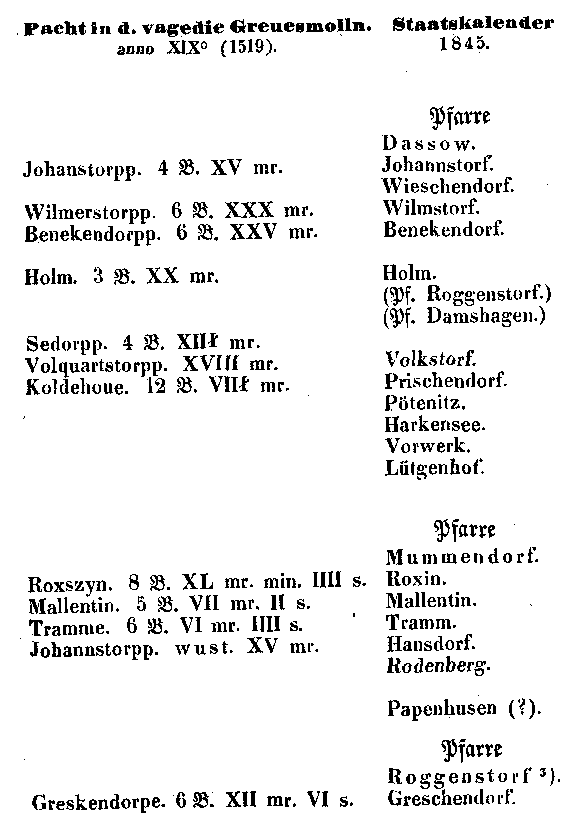
3) Roggenstorf ist das Dorf, welches im Zehntenregister Villa Reinwardi - Reinwardsdorf heißt. Späterhin im Mittelalter ward es Neuwerstorf oder Neuwenstorf, auch Roggenstorf geschrieben, woraus Roggenstorf gestorben ist, mit einer eigenen Pfarre, welche sich nur nach der Erkenntniß dieser Wandelung des Namens verfolgen läßt.


|
Seite 408 |




|
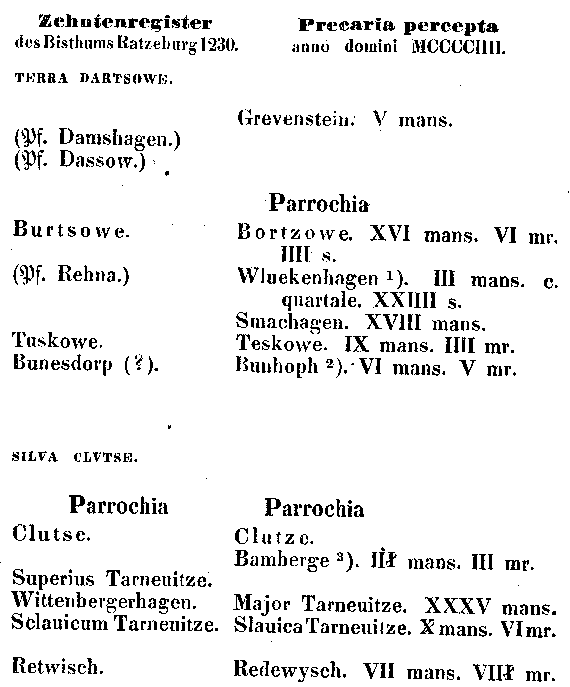
1) Wulwekenhagen lag bei dem
neuern Bernstorf, ward nach und nach kleiner
und endlich ganz wüst, bis es wieder unter
dem Namen Wilkenhagen aufgebauet ward.
2) Bunhoph ist das heutige Bonhagen: vgl.
Lisch Maltzan Urk. I, S. 159. Es hieß im J.
1309 Bunenhoph und noch im J. 1557 Bonhoff
und 1623 Bunenhove. Eben so hieß auch
Hafthagen, in der Pfarre Elmenhorst früher
Hafhoff.
3) Bamberg ist in der Feldmark
Klütz untergegangen. In einem Amtsregister
von 1557 heißt es: "Bamborch; Dussen
acker geheten Bamborch bwen Vernth Plessen
luede thom Klutze vnde geuen dar jarliks vor
VI mr. IIII s." - Im
Visitations=Protocolle von Klütz von 1541
heißt es: V mark aufm Bamberge beym Creutz
(Klütz) gelegen". - Im
Visitations=Protocolle von 1568 kommt
Bamberg nicht mehr vor.


|
Seite 409 |




|
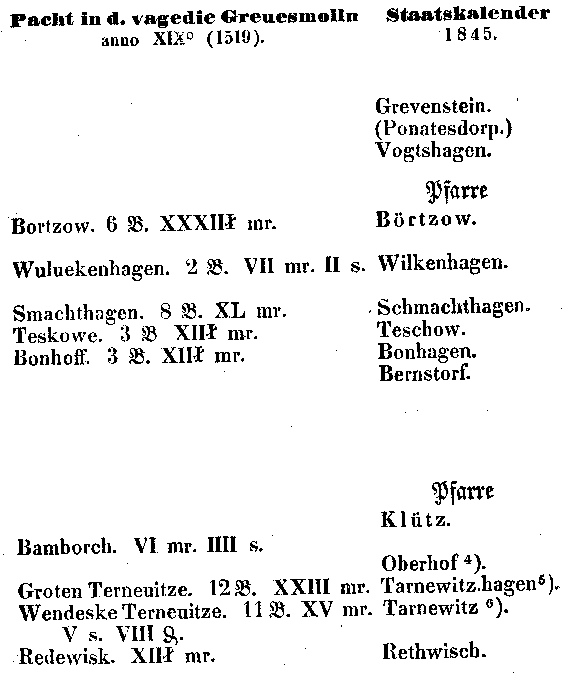
4) Von den 3 Tarnewitz erklärt
Arndt wohl mit Recht Superius Tarnewitze für
Oberhof. Im J. 1439 gab es im Gegensatze
auch ein Neddere Tarnewitze, worunter wohl
das eigentliche Tarnewitz oder Wendeschen
Tarnewitz verstanden ist.
5)
Tarnewitzerhagen kommt in der Zeit von 1358
- 1670 häufig vor. Arndt hält dieses Dorf
für Wittenbergerhagen, vielleicht mit Recht,
da dieses auch neben Tarnewitz vorkommt; im
J. 1366 z. B. verpfändet der Herzog Albrecht
den Brüdern Marquard und Hermannn Tarnewitz
die Bede aus den den Dörfern Tarnewitze und
Wittenborgherhagen, alze van "souen
vnde twyntich houen to dissen dorpen
belegen". - Im J. 1557 wird
Tarnewitzerhagen auch
Groten=Tarnewitzerhagen genannt, vielleicht
im Gegensatze zu Wittenborgerhagen., und
Wittenborgerhagen kommt nicht mehr vor.
Dagegen heißt im 16. Jahrh. Tarnewitzerhagen
oft bloß Hagen.
6) Tarnewitz ist wohl
ohne Zweifel das Dorf, welches auch
Wendisch=Tarnewitz genannt wird und welches
("villam slauicam Tarneuwiz") im
J. 1301 von dem Ritter Ludolph Negendank an
das Kloster Reinfelden verkauft ward. Im
Visitations=Protocolle vom J. 1568 werden
von den Dörfern Tarnewitz nur Wendeschen
Tarnewitz und Tarnewitzerhagen genannt.


|
Seite 410 |




|
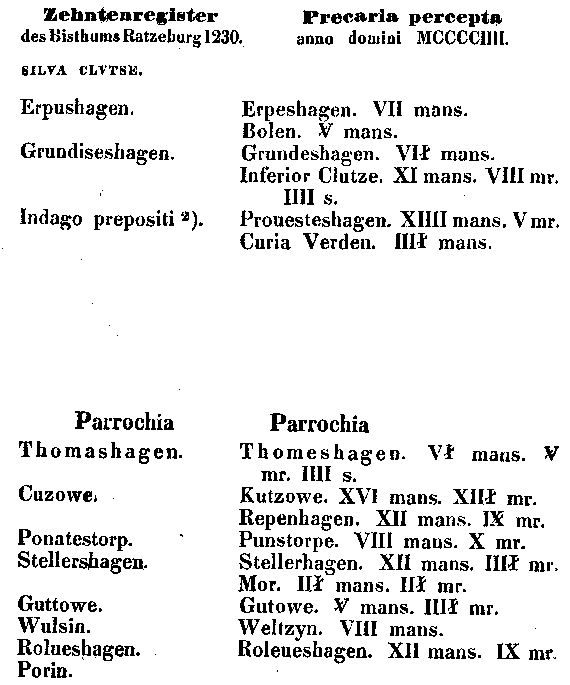
1) Arpshagen wird in den
Visitations=Protocollen von 1541 und 1568
wiederholt Marpeshagen genannt; dies ist
wahrscheinlich eine verkürzte
Zusammenziehung aus (tó=) Marpeshagen (=zum
Arpshagen), wie Drewskirchen aus tôr
Oedeakirchen, tôr Oeskirchen etc.
2)
Kl, Pravsthagen gehörte dem Dom=Capitel zu
Ratzeburg.
3) "Der Hof zum
Felde" kommt schon im J. 1568 vor.
4)Das durch ein stark besuchtes Seebad in
den neuesten Zeiten bekannt gewordene Dorf
Boltenhagen tritt erst mit dem Anfange des
14. Jahrhunderts in die Geschichte und zwar
gewöhnlich mit dem benachbarten Dorfe
Wichmanstorf, auch Wichmerstorf genannt.
Wahrscheinlich hat es seinen Namen von einem
Besitzer Bolte; denn im J. 1313 verkaufte
Gerhard von Hagen dem Ritter


|
Seite 411 |




|
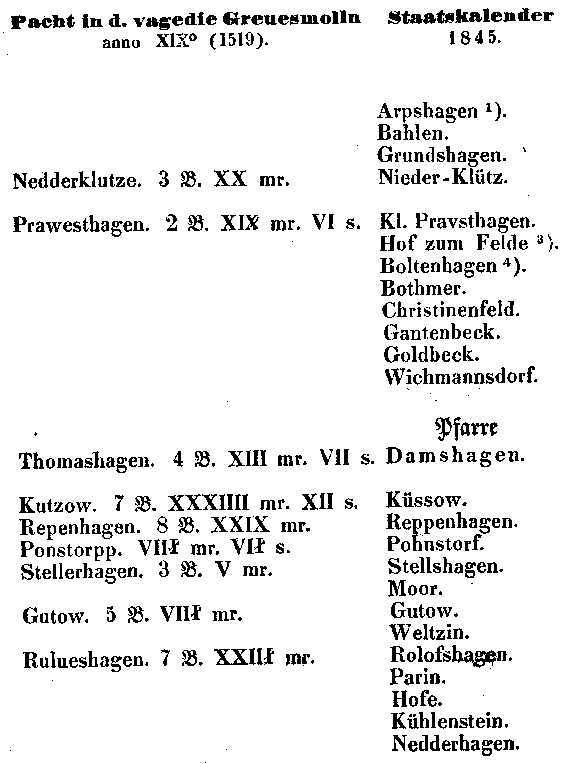
Johann Riken das Dorf Wichmanstorf und seine Güter, welche ein gewisser Bolte in Steinbeck besessen hatte (villam Wichmersdorpe et bona sua quae habuit quidam Bolto nomine in villa Stenbeke). Im J. 1326 hieß Boltenhagen: der Lange Hagen, als die Grenzen zwischen "Tarniuize" und "Wimerstorpe" beschrieben wurden, welche gingen von dem Moor bis zu den Grenzen des Dorfes Langhagen ("iuxta paludem vaque ad terminos ville, que Longa Indago nominatur"). Im J. 1333 gehörte Wichmanstorf der ritterlichen Familie Kulen, welche es damals mit Boltenhagen zugleich an das Kloster Reinfelden verkaufte in dessen Besitze beide Dörfer unter diesen Namen auch im J. 1336 vorkommen.


|
Seite 412 |




|
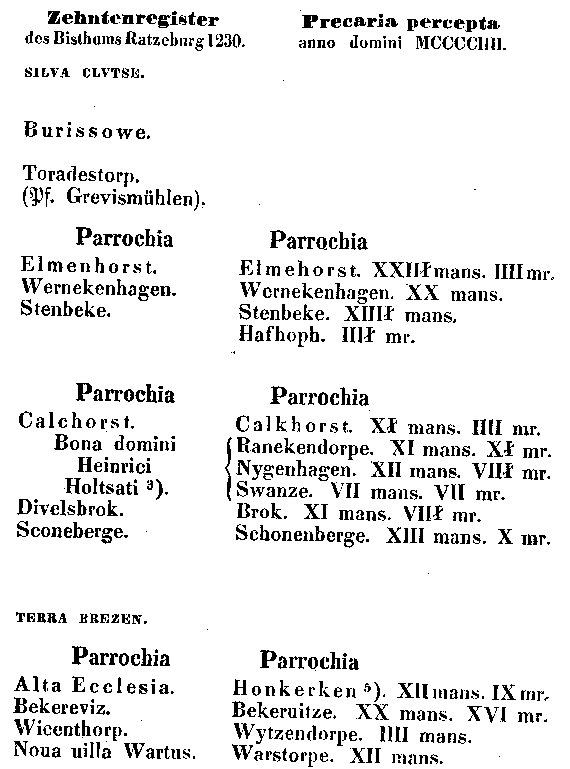
1) Um das Jahr 1230 war Bössow
noch keine eigene Pfarre.
2) Hafthagen
hieß noch im J. 1557 Haffhoff, wie Bonhagen,
Pf. Börzow, früher Bonhoff hieß.
3) Die
Holstein in diesen Gegenden waren mit den
dort begüterten v. Parkentin gleichen
(Stammes, im J. 1264 war Eckhard Holstein
Bruder des Thetlev und des Marquard von
Parkentin: vgl. Masch Gesch. des Bisth.
Ratzeburg, S. 161, Not. 2.
4)
Dönkendorf heißt im Ratzeb. Zehtenregister
Villa Thankmari und gehörte damals zu der
Pfarre Dassow.
5) Miristorp war der
Name des Dorfes, in dessen Nähe die Kirche
gegründet ward, von welcher das neben
derselben entstandene Dorf Hohenkirchen
hieß. Im J. 1158 hieß das Dorf Miristorp
(vgl. Franck A. u. N. M. X, S. 81 -


|
Seite 413 |




|
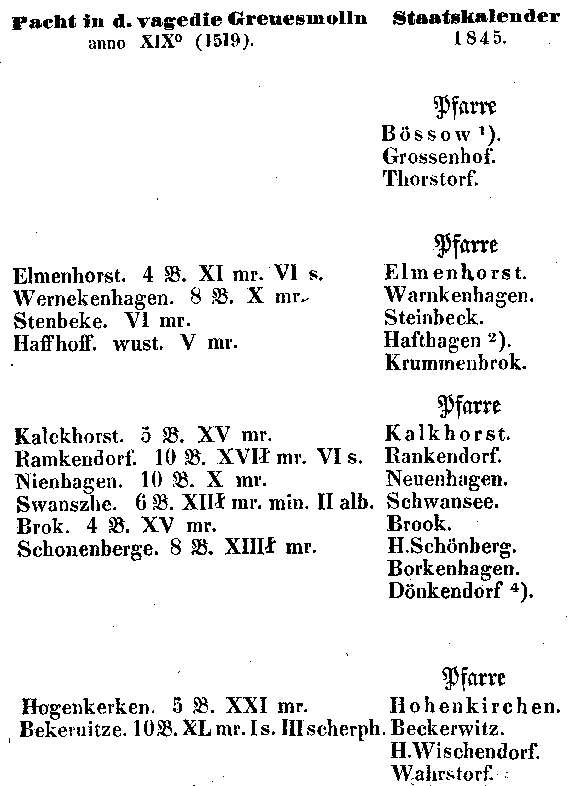
82). Im J. 1260 wird gesagt, daß Miristorp damals Hohenkirchen heiße (vgl Schröder P. M., (S. 679, und Masch Bisth. Ratzeb. (S. 121). Zwar steht dieser Zusatz auch in der Urk. vom J. 1158; es ist aber zu bemerken, daß diese Worte (Myristorp, que nunc Honkerken vocatnr) aus der Urkunde vom J. 1260 fälschlich den gedruckten Text der Urkunde vom J. 1158 eingeschoben sind (vgl. Arndt Zehntenreg. des Bisth. Ratzeb. S. 28, Not. 3). In dem Zehntenregister vom J. 1230 fehlt Miristorp, dagegen kommt schon Hohenkirchen vor. Interessant ist es daher, daß nach unserm Register von 1519 noch Mirstorp neben Hohenkirchen existirte, freilich nur mit einem Pacht zahlenden Bauern und 2 wüsten Erben. Nach den Amts=Registern wohnten noch im J. 1557 zwei Bauern zu Myrsthorp. Es war Mirstorp daher nicht in Hohenkirchen untergegangen, sondern dieses neben jenem erbauet. Mirstorp wird also erst im 16. Jahrh. ganz untergegangen sein. Vgl auf folgender Seite Not. 4.


|
Seite 414 |




|
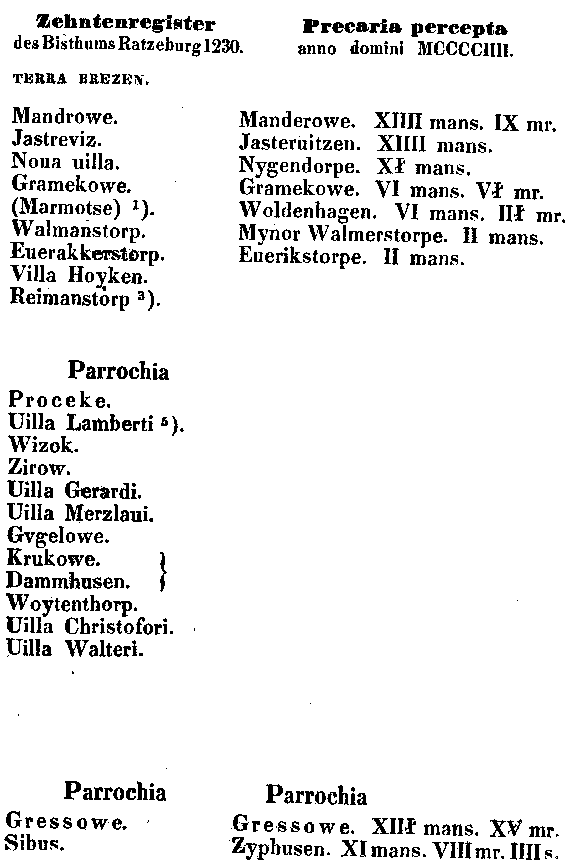
1) Marmotse ist ganz unbekannt;
vielleicht ist es in den neuen Dörfern
Woldenhagen und Niendorf untergegangen. Es
ist aber zu beachten, daß Woldenhagen schon
im J. 1219 existirte und an das Kloster
Sonnenkamp kam (vgl. Lisch Mekl. Urk. II, S.
3 flgd.).
2) Everakstorf ist sicher
Everstorf, welches jetzt zur Pfarre
Grevismühlen gehört.
3) Reimanstorf ist
unbekannt.
4) Siehe Not. 5 auf Seite 412.


|
Seite 415 |




|
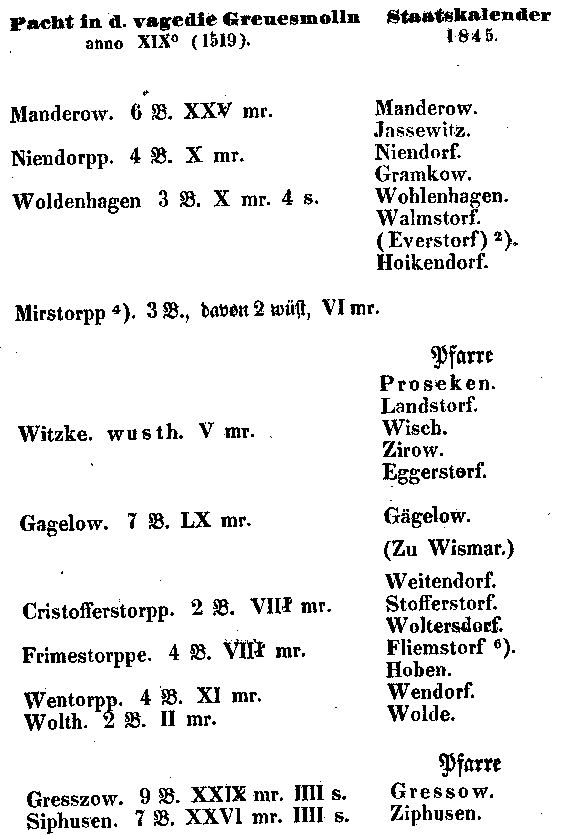
5) Im J. 1418 heißt daß Dorf noch
"Lantberstorpe" und im
Visitations=Protocolle von Proseken von 1568
"Der Hof zu Landtmerstorpe".
6) Der jetzige Hof Fliemstorf hieß früher
Frimanstorf. Im J. 1557
 . heißt er Frymerstorp und
noch im J. 1609 Frimenstorf. Von diesem Hofe
hat ohne Zweifel bis im 16. Jahrhundert
ausgestorbene Familie Vrigmannestorf,
Vrigmanstorf, Vrimanstorf oder Frimerstorf
ihren Namen; vgl. Lisch. Gesch. des Geschl.
Hahn I, A, S. 39 flgd.
. heißt er Frymerstorp und
noch im J. 1609 Frimenstorf. Von diesem Hofe
hat ohne Zweifel bis im 16. Jahrhundert
ausgestorbene Familie Vrigmannestorf,
Vrigmanstorf, Vrimanstorf oder Frimerstorf
ihren Namen; vgl. Lisch. Gesch. des Geschl.
Hahn I, A, S. 39 flgd.


|
Seite 416 |




|
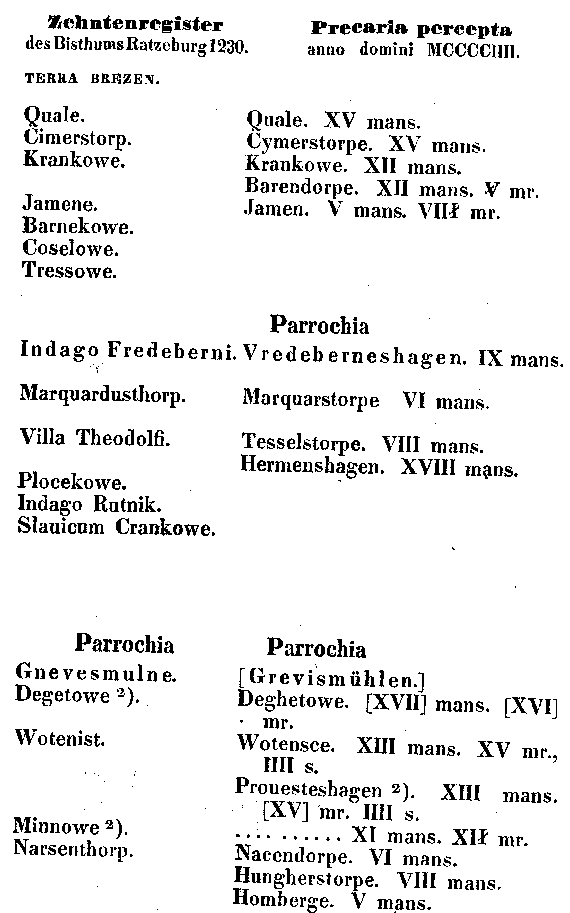
1) Um das J. 1230 hatte das Dorf Friedrichshagen nach keine eigene Pfarre. Friedrichshagen ist Indago Fredeberi oder Fredebernshagen; darauf hieß es auch Frebbershagen, in den neuern Zeiten Friedrichshagen.


|
Seite 417 |




|
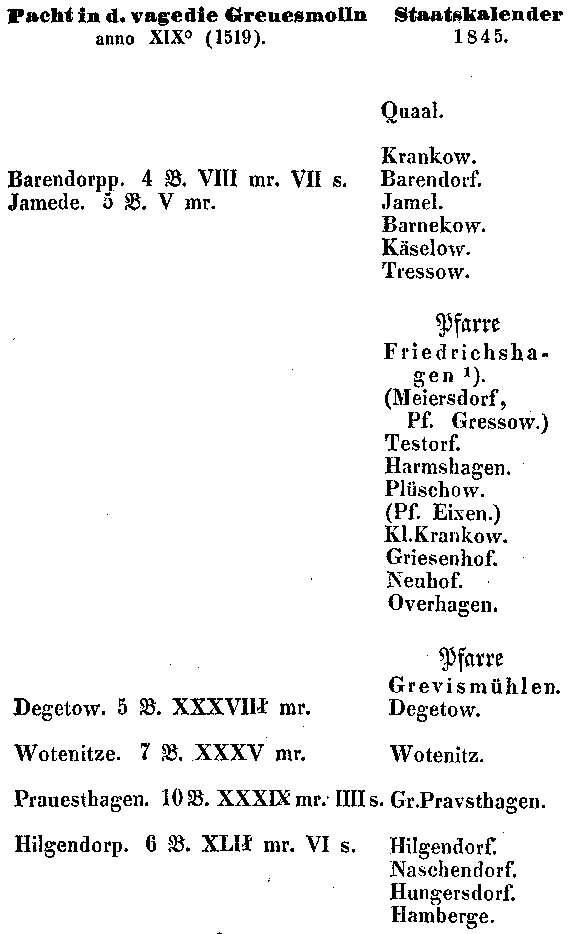
2) Degetow, Gr. Pravsthagen und Minnow gehörten dem Kloster Sonnenkamp oder Neukloster, eben so Woldenhagen, jetzt Wohlenhagen in der Pfarre Hohenkirchen. - Minnow ward seit dem Anfange des 16. Jahrh., sicher nach 1462, Hilgendorf genannt.


|
Seite 418 |




|
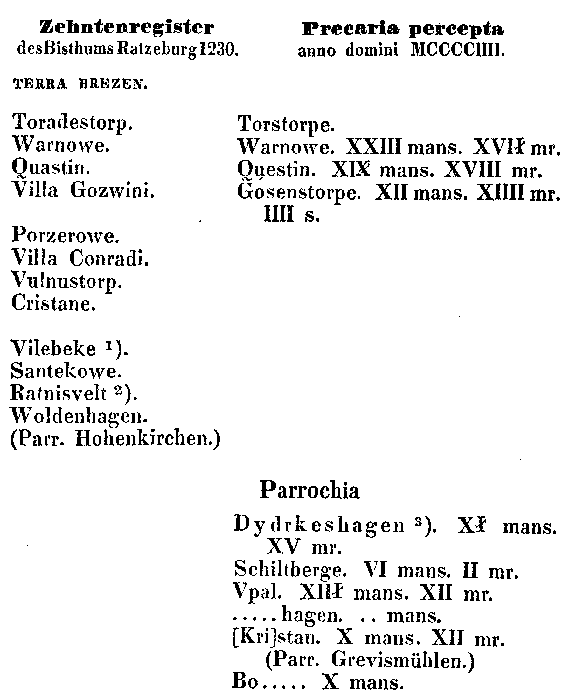
1) Hievon hat noch der Vilebeker
See bei Grevismühlen den Namen.
2) Dies
ist vielleicht das im Ratzeburger
Lehnregister vom J. 1335 (in Schröder P. M.
S. 1151) genannte Rodmansvelt bei
Grevismühlen: "in Guevesmolen in agro,
qui dicitur Rodemannesvelt".


|
Seite 419 |




|
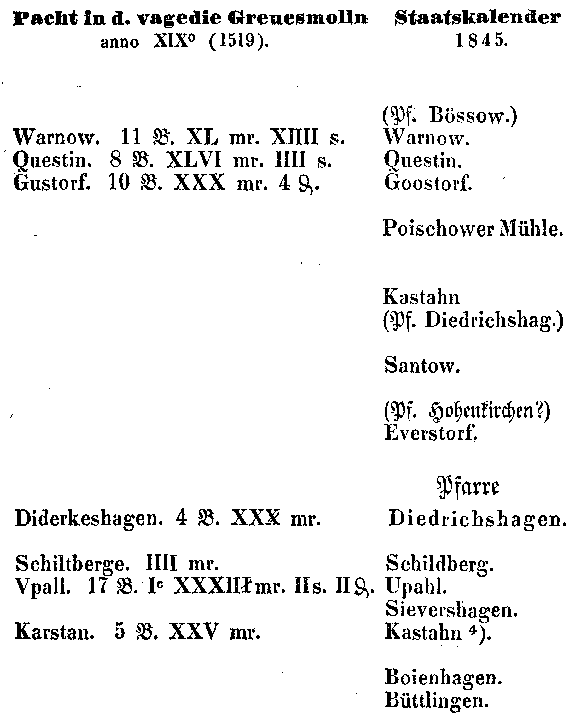
3) Im Ratzeburger Zehntenregister
wird die Pfarre Diedrichshagen noch nicht
aufgeführt.
4) Kastahn gehörte um 1230
zur Pfarre Grevismühlen.


|
Seite 420 |




|



|



|
|
:
|
III. Zur Baukunde
des Mittelalters.
Der Dom zu Ratzeburg
Der Dom zu Ratzeburg ist bekanntlich in der zweiten Hälfte des 12ten Jahrhunderts im byzantinischen oder Rundbogen=Style aus Ziegeln erbauet und in mehrfacher Hinsicht ein ausgezeichnetes und unter den Ziegelbauten seltenes Bauwerk. Von größeren Kirchen im nordöstlichen Deutschland ist ihm an Alter wohl nur der Dom zu Lübeck gleich, welcher jedoch nur noch das Mittelschiff vom ursprünglichen Bau erhalten hat. Der Dom zu Ratzeburg hat ein günstigeres Schicksal gehabt, indem mit Sicherheit nur die Fenster der Kreuzschiffe und durch Anbau von Kapellen die Außenwände der Seitenschiffe ihre ursprüngliche Gestalt verloren haben; vgl. Jahresber. VII, S. 61 flgd. Eine besondere Beachtung fordern jedoch die Gewölbe. Die Gewölbe des Chores, der Kreuzschiffe und des Mittelschiffes sind nämlich im Spitzbogenstyle aufgeführt. Nach einer Sage (vgl. Masch Gesch. des Bisth. Ratzeburg, S. 382) soll der Bischof Johannes von Parkentin (1479 - 1511) den Hauptganghaben erhöhen lassen. Dagegen behauptet der Architect Lauenburg (vgl. Masch a. a. O. S. 749), und nach ihm Andere, es leide keinen Zweifel, daß die jetzt vorhandenen Gewölbe gleichzeitig mit der Kirche aufgeführt seien. Daß dies unglaublich, ja unmöglich sei, lehrt der erste Anblick: alle Spitzbogengewölbe in der ratzeburger Kirche sind so unregelmäßig und leichtfertig angesetzt, daß sie unmöglich nach dem Grundplane des Baumeisters haben ausgeführt werden können, wenn man auch zur Zeit des Rundbogenstyls eine Wölbung im Spitzbogenstyle annehmen wollte, was auch wohl behauptet ist. Ein solcher Zwiespalt und eine solche Unsauberkeit, wie sie die Hauptgewölbe des ratzeburger Domes zeigen, sind aber in der Geschichte der Baukunst unerhört, und es ist wenigstens das außer Zweifel, daß zur Zeit des Rundbogenstyls die Rundbogengewölbe mit Rücksicht auf die Höhenverhältnisse und die Lage und Größe der Fenster sehr sauber und sorgfältig angesetzt sind, was im Schiffe des ratzeburger Domes durchaus nicht der Fall ist.


|
Seite 421 |




|
Eine treffende Vergleichung giebt der bekannte Dom zu Roeskilde. Dieses im 11. Jahrhundert im Rundbogenstyle von rothen Ziegeln aufgeführte Gebäude hat die größte Aehnlichkeit mit dem Dome zu Ratzeburg. Nicht allein die Außenwände sind denen des ratzeburger Domes sehr ähnlich, sondern auch das Innere beider Kirchen bietet viele Vergleichungen dar. Der Dom von Roeskilde ist nämlich ohne Ausnahme ganz im Spitzbogenstyle mit starken Rippen gewölbt und die Gewölbe sind eben so unsauber angesetzt, als die Gewölbe des ratzeburger Domes: bald liegt ein Fenster nicht in der Mitte des Gewölbes, bald schneidet eine Gewölbekappe sogar ein Fenster, bald steht ein Gewölbe hoch, bald niedrig über einem Fenster: kurz, man sieht auf den ersten Blick, daß auch hier, wie zu Ratzeburg, das Gebäude im 15. Jahrhundert ausgebauet ist. Von dem Dome zu Roeskilde ist aber die Zeit der Spitzbogenwölbung bekannt. Im J. 1443 legte nämlich eine heftige Feuersbrunst ganz Roeskilde in Asche und brannte auch den Dom aus. Der Ausbau währte 20 Jahre und erst 1464 konnte die Kirche neu geweihet werden. (Vgl. Behrmann, Grundrids til Roeskilde Domkirkes, S. 31 - 33).
Uebrigens stimmt der Dom zu Roeskilde im Aeußeren ganz mit andern Kirchen des Rundbogenstyls überein. Von den charakteristischen Merkmalen will ich zur Vergleichung nur das eine hervorheben, daß, was die Abbildungen nicht angeben, die Steine in den Giebeln der Kreuzschiffe in Zickzacklinien gestellt sind, eine Erscheinung, welche sich nicht allein an der Vorhalle des ratzeburger Domes findet, sondern auch an Kirchen aus der Uebergangsperiode; (vgl. Jahresber. III. S. 143; VI, S. 87; VII, S. 62.).
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Domkirche zu Güstrow
und
die Kirche zu Satow.
In Beziehung auf beide Kirchen, welche im Uebergangsstyle gebauet sind, ist in Jahrb. X, S. 309, hervorgehoben, daß sie eine eigenthümliche Pforte besitzen, deren Wulste zur Verzierung von rechtwinklig eingesetzten, zugespitzten Scheiben durchbrochen sind. Sind diese Pforten in beiden Kirchen auch schon im Spitzbogen gewölbt, so ist diese eigenthümliche Art der Verzierung doch noch ein Nachklang aus der Zeit des Rundbogenstyls. Grade eine solche, jedoch noch rundbogig gewölbte Pforte besitzt der uralte, ausgezeichnete Rundbogendom zu Lund.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 422 |




|



|



|
|
:
|
IV. Zur Münzkunde.
Auf dem Neubrandenburger Stadtfelde ward eine Goldmünze des K. Valentinian des jüngern (425 - 455) ausgepflügt und vom Hrn Dr. Jenning in Stavenhagen der Sammlung geschenkt. S. Jahresbericht X, S. 25. Ihre Größe ist nach dem Maderschen Münzmesser 13 und sie wiegt 5/16 Loth weniger 5 Aß (1 1/4 Ducaten).
Die Hauptseite derselben hat die Umschrift: DN PLA VALENTINIANVS P FAVG und zeigt das linksgekehrte Brustbild mit einem Diadem.
Die Rückseite hat die Umschrift VICTO RIA AVGGG. Der stehende Kaiser hält in der Rechten einen Stab, auf dem ein Kreuz und in der Linken eine Victoria, und setzt den rechten Fuß auf einen vorwärts gekehrten Elephantenkopf mit ausgestrecktem Rüssel. Neben ihm stehen die Buchstaben R M und unten CONOB (die natürlichste Erklärung dieser auf den Münzen der spätern Kaiser so oft vorkommenden Buchstaben ist, daß damit die Prägung in Constantinopel bezeichnet werde). An der Seite der Linie, auf welcher das Bild steht, befindet sich noch ein N.
Diese Münze gehört nicht zu den seltenen; sie ist auch schon im Museum Molano Bohmerianum I, p. 161. 1. mit der geringen Abweichung, daß R V statt R M steht, angegeben worden.
G. M. C. Masch.


|
Seite 423 |




|



|



|
|
:
|
V. Zur Geschlechter= und Wappenkunde.
Verzeichniß des meklenburgischen Adels,
von
dem meklenburg=strelitzischen Minister
Christoph Otto von Gamm,
redigirt
um das J. 1775.
Der bedeutendste Genealog Meklenburgs, so viel sich nach den vorhandenen genealogischen Werken beurtheilen läßt, ist der wail. meklenburg=strelitzische Geheime=Rath und Minister Christoph Otto von Gamm auf Carow (geb. 19. Jan. 1721 † 1797). Mit den größten Anstrengungen und Opfern verfaßte er die Stammbäume oder " Genealogien der adeligen Familien, welche das Indigenatrecht besitzen" und eine "Beschreibung der ausgestorbenen Geschlechter;" das letztere Werk ist im J. 1780 beendigt, das erstere ist ohne Jahreszahl, jedoch um dieselbe Zeit redigirt, da der Verfasser die Geburt seines Sohnes Friederich Ludwig Otto von Gamm im J. 1783 nachgetragen hat. Die Original=Handschriften beider Werke, früher in der großherzoglichen Handbibliothek zu Ludwigslust, werden gegenwärtig im großherzoglich=meklenburgischen Geheimen= und Haupt=Archive zu Schwerin aufbewahrt.
Aus dem Nachlasse des wailand Ministers von Gamm hat dessen Sohn, der Herr Kammerherr Friederich Ludwig Otto von Gamm auf Friedrichshof im Großherzogthume Meklenburg=Strelitz, dem Vereine die Handschrift des unten abgedruckten Verzeichnisses mitgetheilt und zur Verfügung gestellt.


|
Seite 424 |




|
Die Handschrift ist zwar nicht von des Ministers eigener Hand geschrieben; aber sie hat Nachträge, welche ohne Zweifel von seiner eigenen Hand geschrieben sind, namentlich der Artikel IV. 7. Knesebeck. Dieser Umstand, die Auffindung der Handschrift in des Ministers Nachlasse und die gleichzeitige Abfassung der beiden größeren Werke zeugen dafür, daß der Minister von Gamm der Verfasser der Uebersicht sei. Eine solche Arbeit konnte auch wohl nur während sehr umfassender genealogischer Forschungen entstehen.
Das hier mitgetheilte Verzeichniß ist ungefähr um das Jahr 1775 abgefaßt, also ungefähr zu der Zeit, als der Verf. seine Forschungen beendigt hatte und an die schließliche Redaction beider oben genanten größern Werke ging.
Das Verzeichniß ist vor dem J. 1778 abgefaßt, denn die Familie v. Gadow, welche in diesem Jahre anerkannt ward, ist in demselben gar nicht aufgeführt. Die im J. 1770 geschehene Reception der Familie IV. 8. v. Mecklenburg ist in den ursprünglichen Text aufgenommen, eben so in I. das Aussterben der Familien v. Pederstorf und v. Peccatel im J. 1773, u. s. w. Die Reception der Familie IV. 7. v. Knesebeck (vgl. VI. 39.) im J. 1774 ist in der Hauptredaction nachgetragen, dagegen das Aussterben der Familie I. v. Parkentin im J. 1775 schon bei der Abschrift eingefügt. Es ist daher das Verzeichniß wahrscheinlich im Anfange d. J. 1775 redigirt.
Der Verfasser scheint hiernach außer allem Zweifel zu stehen. Es gab damals in Meklenburg wohl nur zwei Männer, welche überhaupt zu solchen Arbeiten befähigt waren: der Minister v. Gamm und der Landes=Syndicus Pistorius zu Neu=Brandenburg. Pistorius war ebenfalls mit einem meklenburgischen Adelslexikon beschäftigt, welches er drucken lassen wollte. Pistorius wollte aber mehr historisch verfahren, v. Gamm arbeitete rein genealogisch. Bekanntlich hat Pistorius ungefär im J. 1767 eine Abtheilung seines Werkes, über die Familie v. Warburg, drucken lassen; aber " Undankbarkeit " und Mangel an Theilnahme sollen ihn an der Fortsetzung verhindert haben, so daß selbst diesem gedruckten Bruchstücke noch Titel und Schlußbogen fehlt. Pistorius starb im J. 1781, ohne sein Werk zu Ende gebracht zu haben. Nugent sagt in seinen Reisen durch Meklenburg, Berlin und Stettin, I, 1781, S. 244: "Pistorius arbeitet izt an einer Geschichte aller adlichen Familien in Meklenburg, wovon nächstens der erste Band herauskommen wird. Dies Werk erfordert unsägliche Mühe; es ist ein vollkommnes Adelslexicon, das aber mehr historische Bemerkungen enthält, als man sonst wohl gewöhnlich in solchen Werken antrift."


|
Seite 425 |




|
Der Uebersetzer fügt hinzu: "Pistorius ist dies Jahr gestorben, "ohne dies vortrefliche Werk zu Stande gebracht zu haben." - Pistorius starb also vor Vollendung seines Werkes ungefähr zu derselben Zeit (1781), als Gamm sein Werk vollendete (1780). Es wird also v. Gamm ohne Zweifel Verfasser des Verzeichnisses" sein. Freilich mochten sich beide Männer, zu denen noch Masch kam, ihre Arbeiten mittheilen und beide sich einander ergänzen, wie dies aus vorliegenden Briefen erhellt. Im Februar 1766 schrieb Masch an Pistorius: "Dem Hrn. Land=Synd. Pistorius kann man eine Anzeige von vielen adel. Familien. und einzelnen Personen verschaffen, die in Meklenburg von 1300 - 1600 gelebt haben, wenn demselben damit gedient ist. Pistorius bemerkt darunter: Den 25. ejusd. habe ich den Herrn Superintendenten um Communication dieser Nachrichten gebethen." Aus vielen an Pistorius gerichteten Briefen aus verschiedenen adeligen Familien in dem v. gammschen Nachlasse möchte man schließen, daß der pistoriussche Nachlaß in den Besitz des Ministers v. Gamm kam. Am strelitzer Hofe ward damals die aufkeimende vaterländische Alterthumskunde mit Vorliebe befördert.
Was den Werth des Verzeichnisses betrifft, so ist derselbe allerdings bedeutend. Freilich läßt sich nicht leugnen, daß in den Theilen, welche die alte Geschichte berühren, namentlich in dem "I. Verzeichniß der erloschenen Geschlechter," sehr viele Fehler vorkommen, welche sich jetzt wohl berichtigen lassen, aber bei dem damaligen mangelhaften Zustande der Archiv= und Urkundenforschung leicht zu erklären und zu entschuldigen sind. Auch ist nicht zu übersehen, daß v. Gamm die bekannten v. Behrschen Arbeiten und Sammlungen im Landesarchive, auch wohl die Hoinckhusen'schen Forschungen benutzte. Aber die übrige Masse des Materials, namentlich für die Ereignisse des vorigen Jahrhunderts, ist für unsere Geschichte und unser Recht so wichtig, daß die Mittheilung des Verzeichnisses nur dankenswerth erscheinen kann. Zuerst ist das Wagniß des Unternehmens dankenswerth, eine vollständige Namensübersicht zu geben: wer es kann, vertieft sich zu leicht in Einzelnheiten und entrückt sich dadurch seinem Ziele; wer der Sache nicht völlig gewachsen ist, vermag die Aufgabe gar nicht zu lösen. Es gehört eine ungeheure Masse von Kenntnissen und Erfahrungen und eine seltene Ausdauer und Selbstverleugnung dazu, eine so umfassende Arbeit zu Stande zu bringen: alles Dinge, die sich sehr selten finden. Dann aber ist die Arbeit höchst schätzenswerth wegen der großen Masse von Nachrichten, welche schon damals sehr schwer zu sammeln waren und jetzt vielleicht nicht mehr zusammen zu bringen sind, um so mehr,


|
Seite 426 |




|
da des Verfassers Leben in eine Zeit fällt, in welcher sich die Zustände wesentlich veränderten, deren Entwickelung also von großem Einflusse sein kann. Endlich hat die Arbeit durch ihre Uebersichtlichkeit und Eintheilung einen bedeutenden Werth erhalten.
Die ursprüngliche Handschrift ist sehr kurz und besteht fast nur aus Namen und Zahlen. Eine weitere Ausführung und Umarbeitung war beabsichtigt, reicht jedoch in dem Abschnitte I. nur bis zur Familie Kohlhans. In dem Abdrucke ist diese weitere Ausführung statt der ursprünglichen, kürzern Ausarbeitung genommen.
Die Handschrift ist getreu abgedruckt. Von Umänderungen konnte natürlich nicht die Rede sein. Es stand aber zur Frage, ob man nicht auffallende und bekannte Fehler in Noten berichtigen wollte. Aber hier stieß man gleich an den Fehler, durch dessen Vermeidung v. Gamm die Ausführung möglich gemacht hat: man kam vor Specialforschungen nicht weiter und konnte doch so bald nichts Vollständiges liefern. Es schien also am gerathensten, das Verzeichniß, da es fast urkundlichen Werth hat, getreu abdrucken zu lassen und die Verbesserung der Fehler Zeiten und Gelegenheiten anheim zu stellen, in denen sich etwas Vollständigeres bieten lassen kann, als es jetzt möglich ist.
Der Abdruck ist im Allgemeinen buchstäblich veranstaltet; nur einige unwesentliche Veränderungen in Abkürzungen und Bezeichnungen sind vorgenommen, z. B. ist Jahrh. statt: Sec., ungef. statt: pp. gesetzt, lediglich um den Satz nicht durch viele lateinische Lettern zu bunt zu machen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 427 |




|



|



|
|
:
|
I.
Verzeichniß
der in denen
Herzogthümern Meklenburg
ausgestorbenen Geschlechter,
nebst Anzeige der Zeit, wann sie
erloschen sind,
und was sie für
Wapens gehabt haben.
- Von der Aa. Das Wapen der hieselbst erloschenen Branche von dieser noch in andern Ländern florirenden Familie war, wie solches in Weigels A°. 1734 zu Nürnberg in Fol. herausgekommenen Wapen=Buch P. V. p. 146 unter den Westphälischen Geschlechtern befindlich ist.
- Aderstedt. Dieses aus dem Stifte Halberstadt hieher gekommene Geschlecht, erlosche alhier im 14. Jahrh. Es führete im silbernen Schilde eine blaue roht besaamte Blume, welche der Breite nach durchschnitten, und beyde Theile in etwas von einander gestellet. Auf den Helm, dessen Deken silbern und blau, erschiene eben eine solche Blume zwischen zwey einmahl der Breite nach von blau und silber wechselsweise getheilten Flügeln.
- Adram, welche sich auch Aderam, Adrum und Adrym schrieben. Von ihnen starb Paulus auf Zierstorff A°. 1638 als der lezte. Sie führeten im silbernen Felde oben zwey und unten ein rohte Hahnen=Köpfe rechts hinsehend, und einen deßgleichen aus den mit silbern und rohten Deken umgebenen Helm. Weigel hat sie in seinem Wapen=Buch P. I, p. 178 unter den Märkischen Geschlechtern gesezt, jedoch ist das Wapen in so weit übereinstimmend, nur daß er der Heraldik entgegen die Hahen=Köpfe links sehend angebracht, und ausserdem das Feld mit schwarzen Kreuzen besäämet hat.
- Ahlefeld. Diese uhralt=Holsteinsche Adeliche und zum Theil Gräfl. Familie ist noch im größten Flor in Dänemark und Holstein, und hat sich auch einer von denselben auf das neue vor etwa 25 Jahren wieder alhier begütert gemacht.


|
Seite 428 |




|
Von der im 17. Jahrh. hier erloschenen Branche wohnete Bartram 1628 auf Torriesdorff, sowie hiernächst Wolff, ein Sohn von Asmus, auf Großen=Rensow und Torriesdorf. Sie führen ein der Länge nach gespaltenes Schild, vorne im blauen einen silbernen herabhangenden Flügel, hinten im silbernem Felde 2 rohte Balken. Der Helm, dessen Deken zur rechten silbern und blau, und zur linken silbern und roht sind, ist mit ein rothes Küssen, das güldene Quäste hat, beleget, darauf ein silbener Jagd=Hund mit einem goldenen Halsband nebst dem Ringe umhabend, sizet.
- Alkün. Ein aus dem Fürstenthum Rügen hieher gekommenes Geschlecht, welches alhier gegen A°. 1400 erloschen ist. Deren angetroffenes Wapen bestand in einem Pocal.
- Alsenborg, welches Geschlecht alhier im 16. Jahrh. erloschen ist.
- Alvensleben. Von diesem annoch in der Alten=Mark und dem Herzogthum Magdeburg florirenden Geschlechte habe nur folgende zwey hier begütert angetroffen, nemlich Cord, dessen Witwe 1506 im Amt Buckow wohnete und hiernächst ohne Erben verstarb, und Hans auf Berge in derAlten=Mark, welcher alhie Subzien, Großen= und Kleinen=Lantow acquirirte, und 1522 ohne männliche Erben verstarb. Sie haben zum Wapen in einem goldenen Felde zween bluth=rothe Queerbalken, auf dessen untersten eine, auf den obersten aber zwo weisse gefüllte Rosen im Dryangel gesezet zu sehen sind. Aus den gekrönten offenen Helm steigt ein in die Länge gold und roht abgetheilte Triumph= oder Sieges=Baum, den einige als einen abgestorbenen und von Aesten entblößten Baum ansehen, worauf sich abermahls eine weisse Rose zeiget, welche von zweenen um besagten Stamm geschlungenen grün=blätterichten Dorn=Ranken gehalten wird. Die Helm=Deken aber sind mit den Seiten=Zierrahten goldfarbig, silber und roht.
- Appelgart, starben alhier im 17. Jahrh. aus.
- Aschen . Dieses Geschlecht kömmt alhie zum lezten 1366 vor. Deren Wapens sind in Weigels Wapen=Buch P. I p. 81 und P. V. pag. 121 befindlich.
- Aschersleben . Dieses uhralte Geschlecht stammt aus der Stadt Aschersleben her, und floriret annoch in der Mark Brandenburg. Die Branche aber welche hier von 1606 bis 1656 begütert gewesen ist, soll ungef. 1670 wieder erloschen seyn, wie solches auch Klüver P. II. pag. 600 behaupten will.


|
Seite 429 |




|
- Aversberg. Dieses gegen der Mitte des 16. Jahrh. erloschene Geschlecht, führete, sowohl im silbernen Felde, als auf den mit silbern und schwarzen Deken versehenen Helm, eine schwarze Bären=Tatze, welche eine rohte Oefnung hatte.
- Axekow. Mit dem Anfange des 16. Jahrh. erlosche dieses ganze Geschlecht. Es hatte zum Wapen im güldenen Schilde ein rohtes Herz, und zu dessen jeden Seite eine eisern=farbige stehende Schaaf=Scheere. Auf den Helm, dessen Deken gold und roht, stand eine goldene Strauß=Feder zwischen zweyen Schaaf=Scheeren.
- Babbe . Den letzten von diesem Geschlechte alhier, treffe 1396 an. Ob aber diejenigen dieses Nahmens, welche ich .annoch in diesem 18ten Jahrh. im Königreich Dänemark angetroffen, und vielleicht daselbst noch floriren mögen, von denen unsrigen abgezweiget sind, davon kann ich keine Gewißheit beybringen.
- Babzien . Der letzte dieses alten Geschlechtes, welcher auf Lansen seßhaft war, starb 1698. Sie führeten im blauen Felde, einen von silber und roht geschachteten Sparren. Auf den Helm, dessen Deken silbern, roht und blau, erschienen fünf güldene Lanzen, auf deren Spitzen kleine rohte Fahnen befindlich waren.
- Balgen , auch Balch. Dieses alte auf Wandrum und Roghan seßhaft gewesene Geschlecht erlosch ungef. 1600. Es führete im silbernen Felde eine schräge rechts in die Höhe gehende Figur wie eine gedoppelte Leiter gestaltet, und über den Helm eine dergleichen grade in die Höhe stehend. Die Helm=Deken waren silber und schwarz.
- Barnefleth , auch Barenfleth. Der letzte von ihnen angetroffene hieß Georg, und ward 1527 erster lutherischer Prediger bey der St. Marien=Kirche in Wismar. Sie führeten in einem der Breite nach gespaltenen Schilde, oben einen im Wasser schwimmenden Bären, und unten zwey Kreuzweise gelegete Fahnen.
- Barnefuer . Dieses alte Geschlecht beschloß ungef. 1500 den männlichen Stamm nach Roloff auf Freudenberg. Es führete im Wapen fünf brennende und an einander gebundene Fakeln, deren mittelste etwas länger als die andern war.
- Barnekow . Dieses ohngefehr 400 Jahr hindurch hier florirte Geschlecht starb ungef. 1600 mit einem Georg aus, welcher am Tage Anth. 1590 seine Lehngüter Gustevel und Poversdorff an Reimar v. Cramon um 25000 fl. veräussert hatte. Deren Wapen war ein schwarzer Widder=Kopf zwischen zweyen Flügeln von gleicher Farbe, im rohten


|
Seite 430 |




|
Felde. Da nun dieses Wapen mit demjenigen welches die noch in Pommern seyenden v. Barnekow führen, überein stimmend ist, nur daß diese noch über den Helm einen Pfauen=Wedel natürlicher Farbe haben; so liegt hieraus am Tage, daß sie eines Ursprungs gewesen sein müssen.
- Barnevelt . Das Wapen der von dieser Familie hieselbst erloschenen Linie ist in Weigels Wapen=Buch im Zusatz zum Fünften Theil pag. 36 unter denen Burgundischen Geschlechtern anzutreffen.
- Barnewitz . Dieses alte Chur=Mark=Brandenburgische Geschlecht machte sich im Anfange des 16ten Jahrh. in diesem Lande auf Retzow seßhaft und ging alhie den 25ten Apr. 1741 dem männlichen Stamm nach aus. Die noch lebende Frau Mutter des letzteren, welche am Hofe des Herzogs zu Meklenburg=Strelitz als Ober=Hofmeisterin stehet, ist die einzige, so deren gehabtes Wapen annoch führet. Es hat dieses im silbernen Felde, einen gehenden rohten Löwen mit ausgeschlagener Zungen. Auf den gekrönten Helm, dessen Deken von vorbesagtem Metall und Farbe, erscheinen drey Pfauen=Federn, deren mitlere silbern, die zur rechten roht, und die zur linken blau ist.
- Barold . Dieses hiesige uhralte Geschlecht starb den 28tenAug. 1746 mit dem Königl. Dänischen Major Christoph August auf Dobbin und Ziedlitz gänzlich aus. Sie führeten im himmelblauen Felde, drey der Breite nach Wellen=weise rinnende silberne Ströme. Auf den Helm, dessen Deken silbern und blau, erschienen drey Eichen Frucht= und Laub=tragende Pfähle, natürlicher Farbe.
- Barstorf . Dieses Geschlecht bestand in zweyen Branchen, wovon die eine annoch in der Mark=Brandenburg anzutreffen ist. Die andere aber ging hier den 20ten Sept. 1694 mit Johann Adolph auf Barstorf aus. Deren Wapen besteht in einem blauen Schilbe, worinnen zwey güldene auswerts gekehrte Kalk=Schlägel, zwischen welchen oben ein, und zu jeder Seite drey goldene Sterne der Länge nach herunter gehend, zu sehen. Ueber den Helm, dessen Deken gülden und blau, erscheinet der Länge nach, eine zur rechten blau und zur linken gülden gekleidete Jungfrau mit fliegenden, Haaren, einen grünen Rauten=Kranz auf dem Haupte tragend, und in jeder Hand einen auswerts gekehrten goldenen Kalk=Schlägel haltend.
- Barvoht , hodie Barfus, eine hier im 16ten Jahrh. erloschene Branche von einer in der Mark=Brandenburg noch


|
Seite 431 |




|
seyn sollenden Familie. Deren Wapen siehe Weigels Wapen=Buch P. I. p. 174.
- Behse , ein auf Rambow seßhaft gewesenes Geschlecht, erlosche im 17ten Jahrh.
- Bellin . Ein Geschlecht dieses Nahmens floriret annoch in der Mark=Brandenburg, und führet im Wapen, einen weissen Hahnen=Kopf nebst den Hals, im rohten Felde, auf den Helm aber einen Pfauen=Wedel natürlicher Farbe. Dieweil nun die unsrigen, von denen Claus zu Bellin A°. 1424 zum lezten vorkömmt, ein ganz anderes Wapen, nemlich einen Widder=Kopf geführt haben, so müssen sie auch nicht mit einander confundirt werden.
- Bengerstorf . Der letzte von ihnen angetroffene war Claus, welcher 1448 Kartelow besaß und Bürger in Güstrow war.
- Bentehove , welche ich nach dem 14tenJahrh. Nicht mehr angetroffen.
- Bentzin , von denen Jochim der letzt angetroffene, A°. 1509 Kirch=Herr unserer lieben Frauen in Parchim war.
- Berchen , auch Bergen, eine ausgestorbene Linie von einem Adelichen Geschlechte in Hamburg, deren Wapen in Weigels Wapen=Buch P. V. pag. 287 befindlich ist.
- Berckhaue . Die von diesem Geschlechte hier gewesene gingen im Anfange des 16ten Jahrh. mit Jacob auf Zehlendorf ab; allein in Pommern florirten sie annoch im Anfange dieses 18ten Jahrh. In deren an einer Urkunde de A°. 1316 angetroffenen wapen befanden sich im Felde drey Birkhäne, nemlich oben 2 und unten ein, und über den Helm 6 Pfauen=Federn. Aus der Gleichheit dieses Wapens mit dem V. Moltkeschen, wollen einige schliessen, als ob sie eines Ursprungs gewesen wären.
- Bergheide . Der lezte von ihnen welchen ich aufgezeichnet gefunden, war Johann, welcher 1398 Canonicus zu Schwerin war. Deren geführtes Wapen war ein aufgerichteter Löwe, welcher in der linken Vorder=Tatze ein Blat hielt.
- Bertekow , auch Bartekow. Der lezte dieses Geschlechtes, Nahmens Jürgen, starb 1469. Da ihm nun das Schloß Pleetz mit denen Gütern Salow, Bossow, Loga [h. Roga], Schwanenbeck, Ramelow, Wendorp mit der Beede in Bresevitz und zu Brom, mit denen Höfen und Hufen zu Dalen, Staven, Kuhblank, und etwas in Roggenhagen, benebst dem Erb=Land=Marschall=Amt des Landes Stargard zugestanden hatten; so ward Heinrich v. Hahn zu Kuchelmis mit alles genannte am Montage nach Mar=


|
Seite 432 |




|
tini lezteren Jahres von der hohen Landesherrschaft belehnet. Es hatten aber die von Bartekow drey von der rechten zur linken schräge herunter liegende Rosen im Wapen geführet.
- Beverneß . Dieses aus dem Hause Gülitz in der Mark Brandenburg abstammende Geschlecht etablirte sich am Ende des 15ten. Jahrh. in hiesigen Lande. Mit Joachim Friderich auf Lüsewitz, welcher der Tolle beigenahmt ward, und auch 1665 ohnfern der Stadt Malchin im Duel sein Leben verlor, erreichte dieses Geschlecht seine Endschaft. Deren geführtes Wapen bestand aus einem blauen Schilde, worinnen ein schräg rechts gelegter natürlicher Ast, aus welchen oben drey, und unten zwey grüne Eichen=Blätter hervor wuchsen. Auf den Helm, dessen Deken gold und blau, erschienen zwey schwarze ausgearbeitete Adlers=Flügel, zwischen welchen sich eine Pfahl=weise stehende güldene Kette presentirte.
- Beyenfleth . Diese alte Familie erlosche in der ersten Hälfte des 16ten Jahrhunderts.
- Biberstein . Eine Branche dieses Geschlechts erlosche hieselbst im 16ten Jahrh. Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch unter denen Schlesiern P. I. p. 56 befindlich.
- Biendorp . Die lezten von ihnen treffe A°. 1338 an.
- Blanckenburg . Der lezte von der hieselbst erloschenen Linie dieses Geschlechts war Jürgen, welcher Prilvitz in der Herrschaft Stargard, in der Uker=Mark aber Wulffshagen, das Städtgen Fürstenwerder, mit denen Dörfern Hildebrandshagen, Schlepkow und Hetzdorff besaß, und am Ende des 17ten Jahrh. verstarb. Allein eine andere Linie floriret annoch in Hinter=Pommern und Polen, woselbst sie unter andern die Herrschaft Friedland besizt. Sie führen einen silbernen Widder=Kopf mit schwarzen gekrümmten Hörnern, nebst dem Halse und einer rohten Oefnung, im blauen Felde, Auf den mit silbern und blauen Deken umgebenen Helm erscheinet ein güldenes Nest, worinnen ein silberner Pelican, welcher seine Brust durchhakket und mit dem daraus rinnenden Blute die darunter befindliche Jungen ernähret. In Weigels Wapen=Buch P. I. p. 172 steht dieses Wapen eben also unter denen Sächsischen Geschlechtern, nur daß die Figuren darin, der Heraldik entgegen, nach der linken Seite sehen.
- Bliskow . Der lezte von ihnen angetroffene war Hermann, welcher Ende des 14ten Jahrh. Decanus zu Schwerin war.


|
Seite 433 |




|
- Blome . Sie sind ursprüngliche Braunschweiger, und seit 1400 begütert in Holstein. Die hiesige Linie ging im 17ten Jahrh. aus. Sie führen einen blauen Schild, worinnen ein silberner springender Windhund mit offenem Rachen zu sehen, welcher mit einem güldenen Halsband und Ringe gezieret ist. Ueber den Helm, dessen Deken silber und blau, erscheinen drey Pfauen=Federn, auf denen wieder fünf dergleichen stehen.
- Bluatze . Dieses Geschlecht treffe nur allein im Jahr 1353 an.
- Bluncken . Der lezte von diesen angetroffene war Hinrich, welcher 1418 mit dem halben Dorf Stove beliehen ward.
- Bockholt , welche im 17ten Jahrh. abgegangen sind.
- Boddin . Dieses Geschlecht endigte 1501 Hans auf Boddin und Grossen=Rensow, und da seine Schwester Anna mit Hans v. Blücher vermählt war, so ward selbiger mit denen genannten Gütern investirt.
- Boleckow . Deren Abgang von mir nicht bestimmt werden kann.
- Bomgardten . Von diesen treffe Clausen zu Bansow A°. 1441 zum letzten an. Deren gehabtes Wapen hatte die Figur eines Stakets von 4 Pfälen, in deren Mitte etwas stand das einem Baum gliche.
- Bonsack . Von diesem Geschlechte finde ich die letzten A°. 1532 angezogen. In deren Wapen befand sich von unten zur linken schräge rechts in die Höhe gehend, eine krumme Ranke, an welcher 15 Blätter befindlich waren.
- Bozel . Der letzte von diesem Geschlechte angetroffene war Hans zu Goldebeck A°. 1412.
- Brahlstorp. Der lezte von ihnen Nahmens Hans hat 1523 die grosse Meklenb. Landes=Union mit untersiegelt. Sie führeten im Schilde eine Ganß mit einer Krone auf den Kopf und eine um den Hals. Auf den Helm waren drey Strauß=Federn befindlich.
- Brasghen , welche sich auch unterweilen Brasghen=Schönberg schrieben. Von ihnen treffe Henning auf Sülten im Amte Stavenhagen A°. 1353 zum lezten an.
- Brentz . Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. V. p. 115 unter denen Schwäbischen Geschlechtern befindlich.
- Bresen . Von ihnen treffe ich die Gebrüder Sigfrid und Hinrich auf Bresen und Zirzow A°. 1356 als die letzten an.
- Breyde . Die von diesem Geschlechte alhier gewesene finde 1485 auf Antheile in Krase und Kittendorf seßhaft. Sie führeten im Schilde einen ganzen, auf den Helm aber einen


|
Seite 434 |




|
halben Löwen mit ausgeschlagener Zunge. Es war auch eine Linie dieses Geschlechts in Holstein begütert, als welche ich daselbst im Jahr 1598 zum lezten vorgefunden. Selbige schrieben sich Breiden, und führeten mit denen unsrigen ein egales Wapen, nur daß die Löwen gekrönt waren.
- Brock . Der lezte von ihnen war Chim, welcher den 10ten Jun. 1589 sein Gut Brock (olim Divelsbrock) an Ulrich v. Pentz und Bernhard v. Plessen veräusserte. Sie bedienten sich einen der Länge nach gespaltenen Schild, vorne silbern worinnen ein halber schwarzer Adler, und hinten von roht und silber geweket.
- Brockhhusen . Selbige besassen das Gut Brockhusen im Amte Schwan, und treffe ich den letzten 1273 an. Ob nun aber die in Pommern annoch florirenden von ihnen abgezweiget sind, kann ich nicht bestimmen, indem ich nicht einmahl das Wapen derer unsrigen zu Gesichte bekommen habe.
- Brusehaver . Der lezte dieses alten Geschlechts war Ewald, welcher 1656 Pfandgesessener zu Arenshören, einer zum Gute Borckow gehörigen Pertinenz war. Sie führeten im silbernen Felde zwey über einander schräge rechts in die Höhe liegende länglichte und zakigte Stüke einigermassen Stämme gleich sehend. Ueber den Helm, dessen Deken silbern und schwarz, befinden sich zwischen zwey schwarzen auswerts gekehrten Adlers=Flügeln, zwey Adlers=Füsse ohne Klauen, deren Schenkel oben fast zusammen stossen.
- Brusekow . Der einzige welchen ich von diesen Nahmen angetroffen, war Matthias, welcher 1273 sein Gut Vorwerck bey Gnoien an Nicolaum Herren zu Werle verkaufte.
- Brusewitz . Der lezte dieses Geschlechts in hiesigen Lande soll einer Nahmens Hinrich gewesen seyn, dessen Tochter A°. 1465 mit Dionisio von der Osten zu Woldenburg in Hinter=Pommern im Ehestande lebete. Ob aber die Pommersche Branche dieses Geschlechts, von welcher annoch in der Mitte dieses 18ten Jahrh. einige lebten, nunmehro auch abgestorben oder nicht, dieses ist mir unbekannt. Deren geführtes Wapen ist, wie es in Weigels Wapen=Buch P. III. p. 165 unter denen Pommerischen Geschlechtern anzutreffen, nemlich: Im blauen Schilde zwey güldene Flügel, zwischen welchen eine Figur in Dreyek von selbigen Metall, die ich aber keinen Nahmen beyzulegen weiß. Auf den Helm, dessen Deken gold und blau, erscheinen fünf rohte Federn zwischen zweyen ausgebreiteten Adlers=Fügeln.
- Buck . Dieses 1423 zulezt angetroffene Geschlecht besaß um diese Zeit noch etwas in Stove und Kowaltz. Sie


|
Seite 435 |




|
führeten im Schilde drey schräge rechts herunter liegende Quadrate, über und unter denenselben war eben so schräge herunter gehend eine Figur, welche ich vor Balkens halte befindlich.
- Bukow . Dieses Geschlecht ist hier ohngefehr gegen 1400 abgegangen. Ob aber von diesen die in Pommern florirende abstammen, kann ich mit keiner Gewißheit sagen. Diese führen eine rohte Burg mit dreyen Thürmen im silbernen Felde. Auf den Helm ist eben eine solche Burg, deren jede Spitze mit einer Feder gezieret, wovon die erste roht, die mitlere blau, und die dritte gülden; vgl. Weigels Wapen=Buch P. III. p.158.
- Bundestorp . Deren Abgang von mir nicht bestimmt werden kann.
- Büno . Der lezte von diesen war einer Nahmens Rudolph, welcher im Amte Neuen=Kahlden begütert war und 1516 in Herzogl. Meklenb. Diensten als Kanzler stand. Es muß aber dieses Geschlecht mit denen noch florirenden v. Bünow nicht verwechselt werden, indem sie in keiner Verwandtschaft gestanden haben.
- Büren . Eine Branche von diesem noch in andern Ländern florirenden Geschlechte erlosche alhier im 14ten Jahrh. Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. I. p. 167 unter denen Sächsischen Geschlechtern befindlich.
- Busenitz . Deren Abgang ist mir unbekannt geblieben.
- Bussel . Dieses Geschlecht erlosche am Ende des 14ten Jahrhunderts.
- Butenscone , welche ich nur allein im 13ten Jahrh. angetroffen.
- Buter. Der lezte von ihnen angetroffene war 1506 im Amt Goldberg begütert.
- Bützow . Dieses am Ende des 17ten Jahrh. erloschene Geschlecht führete im blauen Schilde einen grauen Esels=Kopf mit einer rohten Oefnung. Ueber den Helm, dessen Deken blau und silber, war gleichfals die Figur des Feldes befindlich. Es müssen aber mit diese die in Vor=Pommern jezt vielleicht noch florirende nicht verwechselt werden, als welche im Schilde ein gestiefeltes und besporntes Bein, und über den Helm drey Pfauen=Fehdern führen.
- Bynth . Dieses im Amt Ribnitz begütert gewesene Geschlecht erlosche im 14ten Jahrh., und war dessen geführtes Wapen, ein Stamm mit sechs grünen Blättern.
- Cabold , welche auch Kobold und Caboldisdorp geschrieben antreffe. Der erste Wohnsiz von diesem im 15ten Jahrh.


|
Seite 436 |




|
erloschenen Geschlechte war das im Amte Güstrow belegene Kirch=Dorf Kabelsdorf.
- Cammin . Den lezten dieses Geschlechts treffe A°. 1274 auf Grambow seßhaft an.
- Campe . Den lezten von diesen hier im Lande treffe A°. 1345 an, und ist mir unbekannt, ob sie auch von denen noch im Lüneburg= und Braunschweigschen florirenden v. Campen abgestammet sind, oder ob sich diese von jenen herzweigen.
- Cisenow . Den letzten dieses Geschlechts habe A°. 1355 angetroffen.
- Cöln . Die lezte dieses ganzen Geschlechts war Leveke Dorotea, welche mit Hinrich v. Levetzow auf Misdorf, Grossen= und Kleinen=Markow, Herzogl. Mecklenb. Landrath vermählt war, und den 16ten Dec. 1637 verstarb. Sie führten im silbernen Felde zwey rückwerts gekrümmete Angeln. Auf den Helm, dessen Deken silber und schwarz, war eine solche Angel zwischen zweyen schwarzen Adlers=Flügeln.
- Conow . Dieses von denen alten Slaven abstammende Geschlecht ging hier im 15ten Jahrh. gänzlich ab; und kann ich mit keiner Gewißheit darthun, ob diejenigen dieses Nahmens, welche in der Mark Brandenburg anzutreffen, auch von ersteren abgestammt sind. Das Wapen der letzteren ist in Weigels Wapen=Buch P. V. p. 172 befindlich.
- Coppenstede . Diese treffe zum letzten A°. 1300 an.
- Cordesschlag auch Crudeshagen genannt. Dieses im 16ten Jahrh. erloschene Geschlecht war auf Vietlübbe im Amt Gadebusch seßhaft.
- Cowal , welche seit dem 13ten Jahrh. nicht mehr angetroffen habe.
- Cröpelin , ein in und um der Gegend Rostock seßhaft gewesenes Geschlecht ging 1528 aus. Deren geführtes Wapen war ein in der Queer getheiltes silbernes Feld, oben waren 2 halbe Männer, welche roht gekleidet und altförmische silberne Mützen oder Hühte auf ihren Köpfen hatten; unten aber waren schwarz und silber geschachtete Weken.
- Cröpelin , auch Kräpelin. Der erste Wohnsiz dieses Geschlechts, welches mit dem vorhin Beschriebenen nicht verwechselt werden muß, war das jezige Städtgen Gröpelin, vor alters Crupelin genannt. Mit einem Namens Henning, welcher den 1sten Nov. 1625 sein Gut Upahl an Jochim v. Cramon auf Borckow um und für 20100 Fl. Erb= und


|
Seite 437 |




|
eigenthümlich verkaufte, scheint dieses Geschlecht abgegangen zu seyn. Sie führten drey silberne altförmische Mützen oder Hühte im blauen Felde. Auf dem Helm, dessen Deken von genannten Metall und Farbe waren, erschien eine dergleichen Mütze oder Huht, aus welchen drey Pfauen=Federn natürlicher Farbe hervorgingen.
- Culpin , auch Cölpin . Dieses auf Galm im Amte Stargard seßhaft gewesene Geschlecht erlosch im 16ten Jahrh.
- Cusvelde . Deren Abgang ist mir unbekannt geblieben.
- Dähn . Der Abgang dieser Branche von einem Geschlechte, welches annoch in andern Ländern floriren soll, ist mir unbekannt.
- Daldorf . Der Abgang dieses Geschlechts, welches auf Bandekow wohnte, soll im 17ten Jahrh. gewesen sein.
- Daleveser . Der lezte, welchen ich von diesem Geschlechte angetroffen, hieß Tiedemann, und wohnte 1352 auf Reetz.
- Dambeck . Dieses mit Achim 1587 ausgegangene Geschlecht stammte aus dem Hause Dambeck im Amte Schwerin ab. Deren geführtes Wapen war ein von der rechten zur linken schräge hinunter liegender Balken.
- Damekow . Diese treffe ich im 14. Jahrh. auf dem Gute Wangelin zum lezten seßhaft an. Weigel bringt ein Wapen dieses Geschlechts in seinem Wapen=Buch P. III, p. 160 unter denen Pommerischen Familien an.
- Dammenhusen . Dieses Geschlecht finde zum lezten im 14. Jahrh. angezogen.
- Danneberg , von denen ich den lezten im 16. Jahrh. angetroffen habe.
- Dargaz, Darges auch Dargitz . Dieses Geschlecht ging Anno 1503 mit einem Nahmens Volrad ab, und ward Anthon v. Blücher mit seinen in Suckow gehabten Antheilen investiret. Deren Wapen war ein silberner Schild, welcher durch einen Pfahl oder Weinstock natürlicher Farbe der Länge nach in 2 gleiche Theile gesondert war. Zur rechten wuchs aus demselben eine blaue Traube, über und unter welcher neun güldene Pfenninge nemlich drey in jeder Reihe, und zur linken ebenmässig eine Traube zwischen 2 grünen Blättern. Auf den Helm, dessen Deken silber und blau, war der Pfahl etwas gekrümmet mit einer Traube zur rechten und einer Traube mit zweyen Blättern zur linken zu sehen.
- Dargeslow , von denen mir die Zeit des Abgangs unbekannt geblieben ist.


|
Seite 438 |




|
- Degingk eine Branche von einem alten Geschlechte aus Westphalen, welche sich hier im 17ten Jahrh. pfandbegütert machte und nach der Mitte des 18ten Jahrh. ausstarb. Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. V. p. 146 anzutreffen.
- Delge , welche ich zum lezten am Ende des 13ten Jahrh. angetroffen.
- Delmstew , von denen ich die Zeit des Abgangs nicht anzugeben weiß.
- Demen . Dieses Geschlecht, welches von dem Gute Demen bey Güstrow den Nahmen angenommen haben soll, treffe zum lezten Ao. 1297 an.
- Derekow . Dieses Geschlechtes ältester Stamm=Siz war das im Amte Ribnitz belegene Gut dieses Nahmens. Der letzte von ihnen Nahmens Hinrich zu Slavekendorp kömmt 1471 vor. Er war aber Ao. 1500 schon todt, dieweil zu der Zeit sein genanntes Gut bereits von einem v. Goldebagen besessen ward.
- Desewesow , deren Abgang von mir nicht angegeben werden kann.
- Dessentin, von denen ich gleichfals den Abgang nicht anzugeben weiß.
- Dick . Deren erstes Stamm=Haus war das Gut Dick oder Dickhof bey Goslar, und hieselbst scheinen sie gleichfals das Gut Dick, hodie Dickhof, erbauet zu haben. Sie hatten zum Wapen einen von der rechten zur linken schräge hinunter stehenden Degen, über denselben war eine Ranke mit 4, und unter derselben eine dergleichen mit 7 Blättern.
- Distelow . Das Stamm=Haus dieses am Ende des 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das Gut Distelow.
- Dollen von der . Eine Branche dieses Geschlechts soll annoch in der Ufer=Mark floriren. Diejenige aber, welche alhie begütert gewesen ist, ging gänzlich aus mit Agnesa, welche 1523 mit Henning v. Barstorff auf Barstorff im Ehestande lebte. Die bey der Stadt Neuen=Brandenburg belegene Dollen=See oder Tollen=See scheint ihren Nahmen von diesem Geschlechte erhalten zu haben. Deren geführtes Wapen war fast der Figur eines Stammes mit vier grünen Blättern ähnlich.
- Domersow , ein im 14ten Jahrh. ausgegangenes Geschlecht.
- Dörn . Dieses in der Grafschaft Schwerin begütert gewesene Geschlecht ging im 14ten Jahrh. gänzlich aus.
- Dörnen . Dieses am Ende des 17ten Jahrh. auf Rehberg im Stargardischen erloschene Geschlecht hatte zum Wapen,


|
Seite 439 |




|
zweene Karpen im silbernen Felde, und auf den Helm, dessen Deke silbern und blau, erschiene eine doppelte schwarze Pforte oder Thor.
- Dorneborg . Der Abgang dieses Geschlechts ist mir unbekannt geblieben.
- Dotenberg . Von diesem Geschlechte ist der Abgang von mir auch nicht anzugeben.
- Dracke . Die lezte dieses Geschlechts Nahmens. Engel vermählete sich mit Valentin v. Voß auf Luplow, und brachte demselben auf ihre Lebens=Zeit ihr väterliches Lehn=Gut Borgfeld zu. Als sie aber 1592 verstarb, so wurden die v. Krusen damit belehnet. NB. Es müßen die Frey=Herren v. Dracke in Schweden, mit denen vorhin genannten nicht verwechselt werden, indem sie in keiner Verwandtschaft gestanden haben.
- Dudingk . Dieses aus der Gegend Hildesheim hieher gekommene alte Geschlecht erbauete das im Amt Güstrow belegene Gut Dudingshausen und ging im 14ten Jahrh. gänzlich aus. Deren geführtes Wappen war ein rechts hin sehender alter Manns=Kopf.
- Dummerstorff . Der Abgang dieses alten Geschlechts habe ich nicht erfahren können.
- Eckhorst von der . Dieses auf Eckstorst im Stargardischen seßhaft gewesene Geschlecht, treffe am Ende des 14ten Jahrh. zum lezten an.
- Eicholtz . Deren Abgang mir unbekannt geblieben ist.
- Ekkerevorde . Dieses im 14ten Jahrh. zum lezten angetroffene. Geschlecht hatte im Wapen zwey niederhangende altförmische Flügel, oben mit den Wirbel=Knochen.
- Eleptz , welches Geschlecht ich nach dem 14. Jahrh. nicht mehr angetroffen.
- Elmenhorst . Dieses Geschlecht habe ich gleichfals nach dem 14ten Jahrh. nicht mehr angetroffen.
- Elsholte . Dieses aus dem Herzogthum Pommern in Meklenburg gekommene Geschlecht erreichte 1621 seine Endschaft mit einem Nahmens Hans auf Grünberg in der Uker=Mark. In deren Wapen befand sich im Schilde ein zerbrochener oder abgehauener Baum mit bloßen Wurzeln, und auf den Helm drey Strauß=Federn.
- Embecke , welches vermuthlich Einbecke heißen soll, und deren Wapen in Weigels Wapen=Buch P. III. p. 140 unter denen Brandenburgischen Geschlechtern anzutreffen ist. Zu welcher Zeit aber die hier etablirt gewesene Linie dieses


|
Seite 440 |




|
Geschlechts erloschen ist, hievon habe keine Nachricht erhalten können.
- Erpen . Dieses alte Geschlecht finde zum lezten mahl A°. 1299 angezogen.
- Everinge , welche ich nach 1265 nicht mehr gedacht Finde.
- Exen oder Eixen. Diese treffe zum lezten mahl A°. 1335 an.
- Falckenberg . Eine Branche dieses Geschlechts ging alhier am Ende des 15ten Jahrh. aus. Allein es floriren von derselben noch andere Linien in der Mark Brandenburg und anderen Ländern.
- Feldberg . Den lezten von diesem aus der Mark Brandenburg hergekommenen Geschlechte treffe 1506 auf Grammentin seßhaft an. Sie haben aber noch im Anfange des 17ten Jahrh. gelebet.
- Felden auch Velden . Dieses Geschlecht finde ich zum lezten A°. 1326 genannt.
- Fliemerstorp . Der lezte dieses Geschlechts Nahmens Arend lebte annoch 1504, als in welchem Jahr Henning v. Pentz auf Besendorf und Brahlsdorf mit des ersteren Gut Mandershagen expectivirt und eventuell investirt ward.
- Florin . Deren Abgang mir unbekannt geblieben ist.
- Forgow . Dieses Geschlecht ging alhie am Ende des 17ten Jahrh. aus.
- Franck , ein im 17ten Jahrh. vom Kayser nobilitirtes, und im 18ten Jahrh. wieder ausgestorbenes Geschlecht.
- Freiberg , olim Fryberg . Dieses alte Geschlecht erlosch alhie dem männlichen Stamm nach den 23ten Mart. 1721 mit Hans Ernst auf Karchow. Das ganze Geschlecht aber beschloß 1745 des lezteren Tochter Anna Dorotea, welche sich erstlich mit Jeremias Otto Friderich von Rohr aus dem Hause Meyenburg, und nach dessen 1728 erfolgtem Absterben, im Jahr 1730 mit Jürgen Ernst v. Oldenburg, so zu Mollersdorf den 28ten Dec. 1756 verstarb, vermählt gehabt hatte. Deren geführtes Wapen war: Eine rothe schräg links herunter gehende Binde im silbernen Felde. Auf den Helm, dessen Deke von vorigen Metall und Farbe, erschien eine blau gekleidete wachsende Jungfrau mit fliegenden güldenen Haaren, die Hände auf denen Hüften setzend; und hinter derselben gingen sieben grüne Distel=Blätter rund herum hervor.
- Frese , auch Vrese und Frise. Dieses Geschlecht treffe zum lezten gegen A°. 1500 an.


|
Seite 441 |




|
- Gägelow . Selbige treffe zum lezten mahl um das Jahr 1400 an.
- Galten . Von diesem hier erloschenen Geschlechte soll noch eine Branche in Jütland floriren.
- Gantzkow . Dieses Geschlecht muß nicht mit denen im Lande Stargard annoch blühenden v. Gentzkow confundirt werden. Der älteste Stamm=Siz von jenen, welche am Ende des 15ten Jahrh. erloschen sind, war das im Amte Güstrow belegene Dorf Gantzkow.
- Gardelage . Von diesem Geschlechte treffe nach A°. 1260 keinen mehr aufgezeichnet an.
- Gartz . Dieses auf Gartz im Amte Lübtz seßhaft gewesene Geschlecht finde zum lezten A°. 1344 angezogen.
- Gentzitz . Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.
- Gerritz . Deren Abgang mir auch unbekannt geblieben ist.
- Getzen . Von denen ich gleichfals den Abgang nicht anzugeben vermag.
- Ghelder . Den lezten von diesen angetroffenen war Könecke, so 1432 Liepen bei Kleinen=Vielen besaß.
- Gherden . Deren Stamm=Siz war das im Amte Plau belegene Gut Gherden oder Göhren. Der lezte von ihnen in diesem Lande war Hermann, welcher 1524 Poischendorf im Amte Bukow besaß. Ob nun diese mit denen annoch in der Mark Brandenburg florirenden v. Göhren einer Abkunft gewesen, ist mir unbekannt, indem mir niemahlen das Wapen deren ersteren zu Gesichte gekommen. Die Märkischen führen nach Zeugniß des Nürnbergschen Wapen=Buchs P. V. p. 140 im rohten Felde einen schräge rechts herunter gehenden blauen Balken, worin eine an einen Pfahl gebundene Weinrebe natürlicher Farbe zu sehen. Auf den gekrönten Helm erscheinen drey überhangende Pfauen=Federn, deren mittlere blau, die beiden andern roht sind.
- Ghoute . Der lezte von diesem Geschlechte Nahmens Clawes wohnte 1434 zu Nikrentz im Amte Ribnitz. Sie führeten einen Hirsch=Kopf im Wapen.
- Giker . Der lezte von ihnen angetroffene war Achim, welcher 1506 zu Badow im Amt Wittenburg wohnete.
- Glamantz . Den lezten Nahmens Achim finde A°. 1506 zu Gresse im Amte Boitzenburg wohnhaft.
- Glandorf . Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.
- Godenwege , welche alhie im 14ten Jahrh. zum lezten angetroffen.
- Goer . Deren Abgang ich nicht anzugeben weiß.


|
Seite 442 |




|
- Goldebage . Den lezten von diesem Geschlechte angetroffenen Nahmens Achim wohnete 1506 zu Schlavekendorf im Amte Güstrow. Das Wapen dieses Geschlechts war ein Bogen.
- Goldersen . Der Abgang dieses Geschlechts ist mir unbekannt geblieben.
- Goldstede . Den lezten dieses Geschlechts habe A° 1296 angetroffen.
- Golle . Den letzten habe 1506 zu Zarnsdorf im A. Boitzenburg seßhaft angetroffen. (Heißt: Golten: Letztes Wort Beil. 97.)
- Golm . Der älteste Ritter=Siz dieses am Ende des 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das Gut Golm im Stargardischen.
- Gottberg . Von denen ich nicht anzugeben weiß, wann sie abgegangen sind.
- Gramekow . Den lezten dieses Geschlechts treffe A° 1306 an.
- Grammelin . Deren Abgang ist mir unbekannt geblieben.
- Gronow . Den lezten von ihnen habe 1390 angetroffen. Sie führeten im silbernen Schilde ein geschachtetes Dreyek von oben bis nach der Mitte, und eben ein solches Dreyek von der Mitte bis unten hingehend.
- Gruben . Dieses Geschlecht erlosch mit einem Nahmens Hinrich, welcher 1358 Capellan bey dem Herzoge Albrecht zu Meklenburg war, da den dessen Gut Grubenhagen c. P. an denen v. Moltzahn gediehe. Deren geführtes Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. II. p. 124 folgendermassen anzutreffen: Nemlich einen güldenen Schild worinnen 2 rothe Pfähle zwischen denen sowohl, als auf beyden Seiten in der Mitte eine Rose von voriger Farbe zu sehen. Auf den mit roht und güldenen Deken umgebenen Helm befindet sich eine rohte Rose zwischen zweyen auswerts hangenden schwarzen Reiher=Federn.
- Grünow . Dieses aus der Uker=Mark nach der Herrschaft Stargard gekommene Geschlecht erbauete im lezteren Lande das Gut Grünow, welches nach ihren Abgang an denen v. Zernickow gediehe.
- Grüssow . Dieses Geschlecht finde zum lezten mahl im 14ten Jahrh. angezogen.
- Guelen auch Guhlen . Die alhier etablirt gewesene Branche dieses Geschlechts soll mit Johann Heinrich auf Levitzow und Vietlübbe um der Mitte dieses 18ten Jahrh. erloschen seyn. Allein es soll noch eine Linie von ihnen in der Grafschaft Ruppin und der Prignitz floriren. Deren


|
Seite 443 |




|
Wapen ist: ein rohtes Einhorn im silbernen Felde. Auf den gekrönten Helm, dessen Deken silber und roht, erscheinet ein wachsendes Einhorn, hinter welchen ein rohter, mit einem güldenen Schräg=Balken bemerkter Flügel hervorgehet.
- Gumer. Von diesem Geschlechte treffe Henneken auf Lambrechtshagen A° 1460 zum lezten an. In deren Wapen war eine Figur, welche oben zur rechten spizig anfing und etwas gekrümmt nach unten zur linken sich breit endigte.
- Gustekowe . Die lezten dieses Geschlechts treffe im 15ten Jahrh. an.
- Gustevel . Selbige waren Besitzer des eben also genannten und im Amte Sternberg belegenen Gutes. Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Paschen war 1552 der Stadt Lübeck bestalter Hauptmann zu Möln.
- Gutow . Die lezten von diesem Geschlechte angetroffenen waren die Gebrüder Gottschalk, Hermann und Hinrich, welche 1413 ihr Gut Gutow an Johann v. Quitzow um 1400 Mark verkauften, und befand sich in deren Siegel ein stehender abgelöseter Adlers=Schenkel.
- Gützow . Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Albrecht, wohnete 1628 zu Vogtshagen im Amte Grevismühlen.
- Hackenstede . Den lezten von ihnen habe im 14ten Jahrh. angetroffen.
- Hagenow . Dieses am Ende des 16. Jahrh. erloschene Geschlecht führete im blauen Felde einen grünen Hügel, aus welchem eine rothe Rose an einen grünen Stengel hervorwuchse, die zu beyden Seiten einen schwarzen Adler=Schenkel mit güldenen Bein und Klauen hatten. Auf den Helm, dessen Deken blau und gold, erschienen zwo Pfauen=Federn natürlicher Farbe, zwischen welchen einen von denen Adlers=Schenkeln der Feldung sich befindet. NB. Es scheinen die noch florirenden v. Kleinow oder Klenow mit ihnen eines Ursprunges gewesen zu seyn, indem deren Wapens gleichförmig sind.
- Hahnenzagel . Dieses war eine Branche deren v. Hahn, welche ihr Gut Zagel, hodie Sagel (zum Gut Rothenmoor gehörig) mit ihren Geschlechts=Nahmen vereinigt hatte. Sie erloschen am Ende des 14. Jahrh. und hatten im Wapen einen Hahn ohne Kopf und Hals.
- Hammerstein . Eine Branche von einer alten Familie aus Schlesien, welche hier nur kurze Zeit begütert gewesen ist,


|
Seite 444 |




|
und ungef. 1739 gänzlich ausstarb. Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. I. p. 61 anzutreffen.
- Hanenstede . Die lezten von diesem Geschlechte finde im 14ten Jahrh. angezogen.
- Hardenack . Dieses im Anfange des 15ten Jahrh. abgegangene Geschlecht führete einen Hahn im Wapen.
- Haren . Eine hieselbst erloschene Branche eines noch auswärtig blühenden Geschlechts. In Weigels Wapen=Buch P. I. p. 147 u. p. 190 sind zwei in etwas unterschiedene Wapen von diesem Geschlechte befindlich.
- Harte . Eine hieselbst ausgestorbene Linie dieses Geschlechts, deren Wapen in Weigels Wapen=Buch P. I. p. 68 befindlich ist. NB. Sie müssen aber nicht mit denen noch hieselbst florirenden von der Hardt verwechselt werden.
- Hasenkop . Eine Branche von denen noch florirenden v. Moltzahn, welche ihre Benennung nach denen im Wapen geführten Hasen=Köpfen genommen hatte, und am Ende des 15ten Jahrh. erlosche.
- Havelberg . Der lezte von diesem Geschlechte angetroffene Nahmens Hinrich besaß 1459 das Dorf Striggow.
- Heine . Der lezte von diesem Geschlechte finde 1395 angezogen.
- Helpte . Dieses aus der Mark=Brandenburg nach der Herrschaft Stargard gekommene Geschlecht erbaute daselbst das Gut Helpt. Der lezte von ihnen war Jürgen auf Pragsdorf, welcher 1535 vorkömmt. Sie führeten im rohten Felde eine silberne schräge rechts herunter gehende Binde, auf welcher drey mit den Köpfen niederwerts hängende doppelte schwarze Adler zu sehen, Auf den Helm, dessen Deken roht, silber und schwarz, waren 2 mit denen grünen Stengeln einmahl über einander gebeugete rohte Rosen.
- Helstedt , welche ich im 14ten Jahrh. zum lezten angetroffen habe.
- Hertzberg . Dieses Geschlecht stammet aus dem Herzogthum Braunschweig=Lüneburg ab. Die hieher gekommene Branche beschloß Nicolaus welcher 1507 Präpositus zu Fredland und Herzogl. Mecklenb. Raht war. Deren geführtes Wapen war ein der Länge nach durchschnittenes Schild, welches zur rechten einen wachsenden Hirsch hatte und zur linken geschachtet war. Die in Pommern und der Mark Brandenburg annoch florirende dieses Nahmens führen laut Zeugniß des Nürnbergschen Wapen=Buchs P. III. p. 157: Einen der Breite nach durchschnittenen


|
Seite 445 |




|
Schild, oben ein wachsender Hirsch natürlicher Farbe in Silber, der untere Theil aber von blau, gold und silber geschachtet. Auf den Helm befinden sich drey auf denen Spizen ruhende Pfeile, deren mittelster blau, die beyden andern gülden sind.
- Heuckendorp . Dieses Geschlecht welches vor alters Hoyken hieß, hat das im Amte Grevismühlen belegene Dorf Hoyken, welches hiernächst auch Heukendorp genannt ward, erbauet. Dieses Geschlecht scheinet im 15ten Jahrh. erloschen zu seyn; wenigstens ist es gewiß, daß die v. Plessen schon 1483 das Gut Heukendorf in Besitz gehabt haben. Deren geführtes Wapen war wie ein Dreyek gestaltet, in welchen eine Figur fast wie ein Hufeisen befindlich war.
- Heydebreck . Die hier etablirt gewesene Branche scheinet mit einem Namens Ewald auf Rehberg um der Mitte des 16ten Jahrh. erloschen zu seyn. Die in Pommern gewesene aber ist um das Jahr 1715 erstlich abgegangen. Sie führeten im rohten Schilde zweene in ein Andreas=Kreuz gelegte graue Heyden=Quäste mit grünen Stielen, und auf den Helm, dessen Deken silbern und roht, einen grünen Pfauen=Wedel zwischen zweyen schwarzen Büffels=Hörnern. vide Micräl. Pom. Chron. Lib. VI. p. m. 490. Es ist auch fast eben also in Weigels Wapen=Buch P. III. p. 155 anzutreffen.
- Hohnhävel . Der älteste Stamm=Sitz dieses am Ende des 15ten Jahrh. erloschenen Geschlechts war das in der Herrschaft Stargard belegene Gut Trollenhagen, welches bis im 15ten Jahrh. Hohnhävel geheissen hat.
- Höinckhusen . Dieses den 18ten Sept. 1716 vom Kayser im Adelstand erhobene Geschlecht erlosche dem männlichen Stamm nach den 7ten Sept. 1758. Sie führeten einen in 2 Theil nach der Länge abgetheilten Schild, in dessen hintern silberfarbenen Feldung ein mit denen Saxen einwerts gekehrter rohter Adlers=Flügel, in dem vordern mit 2 silberfarbenen Strassen in 3 gleiche Theile abgetheilter blau oder lasurfarbenen Feldung aber 3 sechsekigte güldene Sterne über einander erschienen. Auf dem Schilde stand ein offener blau angeloffener, roht gefutterter Turniers=Helm mit anhangenden Kleinod, rechter=blau und silber, linkerseits aber silber und roht herabhangenden Helm=Deken. Und auf den Helm ein silber, roht und blau durch einander gewundener Pausch oder Bund, darob zwischen zweyen mit denen Saxen einwerts gekehrten rohten Adlers=Flügeln, der in dem Schilde beschriebene Stern zu sehen war.


|
Seite 446 |




|
- Holdorp . Der lezte dieses Geschlechts scheinet David gewesen zu sein, welcher 1555 Raths=Herr in Malchin war. Dessen an dortigen Kirchen=Fenstern angetroffenes Wapen war: Ein der Länge nach getheilter Schild, in welchem zur rechten eine halbe silberne Lilie im rohten, und zur linken drey rohte Rosen an kleinen Stengeln im silbernen Felde befindlich waren.
- Holstein . Der erste von diesen Nahmens Philipp war ein natürlicher Sohn eines Herzoges zu Holstein, und erhielte 1652 mit seiner ersten Gemahlinn Margareta Dorotea von Pentz das Gut Redewin. Dessen Sohn Joachim Georg überließ solches 1709 käuflich an dem Herzoge Friderich Wilhelm zu Meklenburg. Da denn hiernächst dieses Geschlecht auch seine Endschaft wieder erreichte. In deren geführten Wapen war sowohl im Schilde als auf den Helm, ein Schwan, welcher eine Krone um den Hals hatte.
- Holsten . Von diesen erhandelte einer Namens Friderich A° 1650 Poischendorf, und Zacharias pfändete in solchen Jahre das Gut Klaber. Sie sollen in diesem 18. Jahrh. gänzlich ausgestorben seyn.
- Holtebötel . Dieses Geschlecht erlosche am Ende des 15. Jahrh. und hatten im Wapen gehabt einen gekrümmten Fuß eines Raubvogels.
- Holtz . Von diesem Geschlechte wohneten im Anfange des 17. Jahrh. Hans und Bartold zu Passentin. Allein zu welcher Zeit sie gänzlich abgegegangen sind, ist mir unbekannt geblieben. Sie führeten in ihrem Schilde drey Bäume.
- Horst . Deren Stammhaus war das im Amte Ribnitz eben also genannte Gut. Der lezte von ihnen angetroffene Nahmens Henning wohnete 1380 zu Weitendorf. In dessen Siegel waren 2 Storchs=Köpfe mit denen Hälsen, und zwischen diese ein sechsekigter Stern.
- Hoseck. Der lezte welchen ich von diesen angezogen gefunden war Stücke welcher 1363 von Ulrich v. Drieberg vier Höfe und Katen in Wendischen Roghan kaufte.
- Hoveschen . Die lezten welche ich von diesem Geschlechte genannt finde, sind die Gebrüdere Hinrich, Nicolaus, Mattheus und Bartoldus, so 1339 aus ihrem Gute Niendorp fünf Hufen an der St. Nicolai Kirche in Wismar veräußerten.
- Hoyen . Die lezte dieses Geschlechts war Anna aus dem Hause Fiensdorf, welche sich mit Diderich v. Plessen so


|
Seite 447 |




|
den 10ten Nov. 1576 verstarb, vermählt gehabt hatte. In dem silbernen Schilde dieses Geschlechts, befand sich sowohl, als auf den mit Silber und schwarzen Deken umgebenen Helm, das Haupt von einem schwarzen Maulthiere mit einer rohten Oefnung.
- Huda . Dieses Geschlecht scheinet mit Heinrico Leone Herzogen zu Sachsen und Bayern aus dem Lande Bremen hieher gekommen zu seyn. Den lezten von ihnen Nahmens Hinrich finde 1363 angezogen.
- Hünenmörder . Von diesem aus der Mark Brandenburg abstammenden Geschlechte, erhielte Joachim Otto auf Fiensdorf, Alversdorf und Harmsdorf von Sr. Kaiserl. Maj. d. d. Wien den 13ten Jul. 1704 die Renovation seines verloren gegangenen alten Adels, mit folgenden Wapen: Im blauen Felde eine nakende Manns=Person mit rauen schwarzen Bart und Haar, um die Hüft und Kopf mit einen Eppich=Kranz umgeben, die linke Hand in die Seite stützend, in der rechten aber einen ausgerupften Baum haltend. Auf dem Schilde ein offener adelicher gelb angeloffener roht gefutterten Helm mit einer Perlen=Krone, und beyderseits blau und weissen Helm=Deken gezieret. Auf den Helm die im Schilde beschriebene Manns=Person. Da nun dieser Joachim Otto den 31sten Oct. 1730 ohne Leibes=Erben verstarb; so erreichte dieses renovirte adeliche Geschlecht zugleich auch mit ihm seine Endschaft. Hierauf bekam sein nicht renovirt gewordener Bruder Claus Wilhelm seine Güter; und als dieser als der lezte seines Namens den 11ten Mart. 1731 verstarb, so nahm Hans Joachim v. Zülow, nachmaliger Herzogl. Meklenb. General=Major, Besitz von dem Lehn=Gute Fiensdorf, indem ihm schon A° 1717 die Expectance darauf ertheilt worden war. Die Allodial=Güter Alversdorf und Harmsdorf aber verkauften die Erben A° 1741 an Diderich Otto v. Winterfeld auf Varchow, welcher sie wiederum an den Herzogl. Meklenb. Geheimen=Kammer=Rath Theodor Friderich v. Schmid überließ.
- Husan . Der Errichter dieses Geschlechts war der Herzogl. Mecklenb. Kanzler Hinrich Husan, welcher den 14ten Oct. 1579 mit dem Gute Tessin im Amte Wittenburg belehnet ward. Das Wapen welches er bei der Nobilitation vom Kaiser erhielte, war sowohl im Schilde als auf den gekrönten Helm, ein sich selbst verbrennender Phönix. Die lezte dieses Geschlechts war Eva Margareta, welche den 2ten Aug. 1681 verstarb. Sie hatte sich den 2ten Oct.


|
Seite 448 |




|
1677 vermählt gehabt mit Johann Friderich v. Forst auf Tessin.
- Hushammer . Dieses hier und im Holsteinschen gewesene Geschlecht treffe am Ende des 14ten Jahrh. zum lezten an.
- Jabel . Von diesem Geschlechte treffe weiter nichts an, als daß 1333 Heino Holtze dem Raht der Stadt Pentzlin 6 Mk. jährliche Hebung in zwo Hufen des Dorfes Schmord angewiesen hat, welche gedachter Magistrat von denen Herren von Werle aus dem Antheil, so Erich v. Jabel daselbst besessen, erhalten hatte.
- Janekow . Dieses Geschlecht besaß im 14ten Jahrh. etwas in Dönkendorf, und nachhero treffe es nicht mehr an.
- Jesevitz . Dieses Geschlecht erlosche 1514, da dann Jaspar und Lippold v. Oertzen mit einem Theil von ihren gehabten Gütern als den Hof Bolland und 2 Katen in Neuen=Carin investirt wurden. Deren Wapen war ein zum laufen gerichtetes Windspiel.
- Jesow . Von ihnen war 1323 Marquard Bischof zu Ratzeburg; und finde nachhero keinen von ihnen mehr gedacht. Da nun deren Schild mit demjenigen ganz übereinstimmend gewesen, so sich die v. Perckentin bedient haben; so ist sehr wahrscheinlich, daß sie mit diesen eines Ursprunges gewesen sind.
- Ilow . Von diesen erhandelte Jacob A° 1319 das Dorf Rullenhagen um 230 Mk. von Gertrudis von Warborg Aebtissin des Klosters Wantzke. Ein mehreres finde von ihnen nicht.
- Jorck . Das Wapen von diesem im 17ten Jahrh. gänzlich abgegangenen Geschlechte wird im Nürnbergschen Wapen=Buch P. III. p. 156 als ein schräge rinnender blauer Strom im silbernen Felde, auf den Helm aber acht Fahnen oben blau und unten silber, vorgestellet. Allein ich habe selbiges in alten Kirchen=Fenstern und auf Kastens folgendermassen gemahlt gefunden: Im silbernen Felde ein rohter Querbalken, und auf den Helm eine wachsende roht gekleidete Jungfrau mit güldenen fliegenden Haaren, die Hände in die Seite sezend. Daß nun lezteres Wapen völlig richtig, und darin kein Strom, sondern eine Binde oder Balken vorkömmt, bestärken auch drey Siegels, welche ich an einer Urkunde de A° 1420 gefunden.
- Kaland . Dieses Geschlecht, welches mit denen noch florirenden von Kahlden nicht verwechselt werden muß, besaß allhier bereits in denen ersten christlichen Zeiten Alten=


|
Seite 449 |




|
Kaland (h. Alten=Kalden) und andere Güter. Hiernächst aber ist das Gut Rey fast biß zum Ausgange des 17ten Jahrh. in ihre Hände gewesen. In der Mitte dieses 18ten Jahrh. waren noch einige in auswärtiger Herren Diensten am Leben; allein sie sollen eingezogenen Nachrichten zu Folge, bald hierauf gänzlich abgegangen sein. Sie hatten zum Wappen, im blauen Felde eben eine solche rohte Figur als die von Bredow darin führen, und welche einem gekrümmten Horn mit sechs Zakken gleichet. Auf den Helm, dessen Deken blau und roht, erschiene eine kurze goldene Säule, welche drey grüne Pfauen=Federn trug, und an jeder Seiten von der rohten Figur der Feldung begleitet ward.
- Kalzow , auch Calsow , welche im 14ten Jahrh. abgingen, und nicht mit denen noch florirenden v. Kalsow verwechselt werden müssen.
- Karchow. Deren ältestes Stamm=Gut Karchow ist im Amte Stavenhagen belegen. Der lezte von ihnen Nahmens Arend starb 1471; und ward hierauf Lüdeke v. Hahn mit einem ihm zuständig gewesenen Ritter=Sitze im Gute Deven investiret.
- Kardel , von dem ich nicht anzugeben weiß, wann es hieselbst erloschen ist.
- Karesche . Eine Witwe dieses Geschlechts besaß 1506 Konow und Hansdorf im Amte Schwan; und nachhero finde keinen dieses Nahmens mehr gedacht.
- Kartelow . Sie besassen das eben also genannte Gut im Amte Neuen=Buckow. Die lezten treffe ich im 14ten Jahrh. an.
- Kastorf . Nach männlichen Abgang dieses Geschlechts erhielte Nicolaus v. Below deren gehabtes Lehngut Karchow; vid. Acta Provin. d. d. 1. 2. et 3. Oct. 1589 in denen Beyl. Num. 3. Grav. 3.
- Katt . Von diesem Geschlechte war Johann, Canonicus zu Rostock, A°. 1530 der lezte in diesem Lande. Da mir aber deren geführtes Wapen niemahlen zu Gesichte gekommen ist, so weiß ich auch nicht anzugeben, ob sie mit denen dieses Nahmens in denen Herzogthümern Magdeburg und Bremen annoch florirenden in Verwandschaft gestanden haben.
- Keding . Deren Wapen ist mir unbekannt, und so weiß ich auch nicht anzugeben, wann sie hieselbst erloschen sind.
- Keine . Die lezten, welche ich von diesem Geschlechte angetroffen, waren Churt und sein Bruder, im Amt Witten=


|
Seite 450 |




|
burg wohnhaft, so 1506 zum Kriege gegen der Stadt Lübeck 4 Pferde zu stellen angesagt wurden.
- Kerberg . Dieses alte Chur=Mark Brandenburgische Geschlecht wandte sich ohngefehr A°.1500 nach hiesigen Lande, und acquirirte das im Amte Wredenhagen belegene Gut Krümmel. Die allerlezte von ihnen war Catarina Ilsabe, welche am 17ten April 1742 unvermählt verstarb. In deren geführten Wapen waren: drey aus der rechten hervorgehende silberne Spitzen im rohten Felde. Auf den mit silbern und rohten Deken umgebenen Helm erschienen drey überhängende silberne Strauß=Federn.
- Kerckow . Dieses aus der Mark Brandenburg anhero gekommene Geschlecht acquirirte anfänglich das Schloß Veldberg im Stargardischen Kraise. Der lezte von ihnen war Jasper, welcher A°. 1470 das Dorf Triepkendorf und etwas in Karvitz an Hinrich v. Rieben auf Gahlenbeck und Klokow verpfändete.
- Kindt . Dieses Geschlecht besaß unter andern die Güter Dudingshausen und Kritzkow, und erlosch in der zweyten Hälfte des 15ten Jahrb. Sie führeten in ihrem Wapen ein Schwein.
- Klave , auch Clave. Den lezten dieses Geschlechts, Nahmens Marquard, finde 1390 angezogen.
- Kleppingk . Dieses Geschlecht treffe nach 1323 nicht mehr an.
- Klotow . Selbige treffe ich nach 1413 nicht mehr an.
- Knope . Es müssen diese nicht mit denenjenigen dieses Nahmens, welche in Holstein erloschen sind, und mit denen v. Wolff und v. Pogwisch eines Ursprungs und Wapens waren, verwechselt werden. Die unsrigen finde nach 1353 nicht mehr erwehnt. Deren geführtes Wapen war ein in 4 Dreyeke getheilter Schild, wovon das öberste und unterste silbern, und die zur rechten und linken blau waren.
- Koblanck , von denen ich nicht eigentlich bestimmen kann wann sie gänzlich abgegangen sind.
- Kohlhans , ungef. 1770.
- Korine oder Karyn , ungef. 1400.
- Kratzen , im 17. Jahrh.
- Kröcher , Meklenb. Branche, Ende des 15ten Jahrh.
- Kruckow , im 14ten Jahrh.
- Kruge oder Kroge , in der Mitte des 16ten Jahrh.
- Kühlen , auch Külen , Ende des 14ten Jahrh.
- Kühne .
- Kulebutz , Mekl. Linie, in der Mitte des 15ten Jahrh.


|
Seite 451 |




|
- Lankow , gegen 1400.
- Landeshere , im 14ten Jahrh.
- Landtwee .
- Langwedel , im 14ten Jahrh.
- Latenkoppen , um 1400.
- Lawe .
- Lebbin , Mekl. Branche, Ende des 17ten Jahrh.
- Leisten , müssen nicht mit denen noch florirenden v. Lehsten verwechselt werden.
- Leptzow , im 14ten Jahrh.
- Liepe , 15ten Jahrh.
- Linde , im 14ten Jahrh.
- Lindenbeck , im 17ten Jahrh.
- Lobeck , auch Lübeck , im 15ten Jahrh.
- Loh , im 16ten Jahrh.
- Lortche .
- Lowitz, auch Lovitz , im 15ten Jahrh.
- Lübberstorff , 1759.
- Lübow , im 13ten Jahrh.
- Luchow , gegen 1400.
- Lucka , nob. in der Mitte des 16ten und abgegangen im Anfange des 17ten Jahrh.
- Lüder , Ende des 15ten Jahrh.
- Ludorp , ungef. 1300.
- Mallin , im 15ten Jahrh.
- Malm , ungef. 1400.
- Manckmoß , ungef. 1400.
- Marsow , ungef. 1400.
- Mechelstorp , im 15ten Jahrh.
- Mentze im 16ten Jahrh.
- Meshoping , ungef. 1300.
- Metzeke , im 15ten Jahrh.
- Meyendorp .
- Meyorcke , im 14ten Jahrh.
- Militz , vom Kayser nobil. 1568 und 1725 abgestorben.
- Mirendorp , im 15ten Jahrh.
- Misner .
- Modentin , im 14ten Jahrh.
- Möderitz , im 16ten Jahrh.
- Mogelke , im 14ten Jahrh.
- Möllen , im 17ten Jahrh.
- Molne , im 16ten Jahrh.
- Morin , nach der Mitte des 17ten Jahrh.


|
Seite 452 |




|
- Mozer , auch Moser , ungef. 1400 und muß nicht mit andern noch florirende dieses Nahmens verwechselt werden.
- Müggesvelt , im Anfange des 16ten Jahrh.
- Müller , in der Mitte des 17ten Jahrh. mit dem Beynahmen von der Lühne in Schweden nobilitirt, und 1693 daselbst im Frey=Herrn=Stand erhoben Sie schrieben sich darauf Müller von der Lühne Baron von Mellentin, und kamen am Ende des 17ten Jahrh. hier im Lande, allein sie sollen ungef. 1770 erloschen seyn.
- Mund , im 17ten Jahrh.
- Mustickow , ungef. 1300.
- Naskow , im 14ten Jahrh.
- Negendanck , 1767.
- Netzke .
- Niendorp , auch Nigendorp , im 16ten Jahrh.
- Nienhanck .
- Nienkercken , auch Neuenkirchen , im 17ten Jahrh.
- Nortmann , Ende des 15ten Jahrh.
- Nossentin , im 15ten Jahrh.
- Oldenflet , im 17ten Jahrh.
- Oldenstadt , ungef. 1400.
- Orsen , im 16ten Jahrh.
- Osterburg .
- Osterwold , 1519.
- Pancker , in der Mitte dieses 18ten Jahrh.
- Pape , im 14ten Jahrh
- Parow , gegen 1400.
- Parum , 1517.
- Paschedach , sind ausgestorben im Anfange des 16ten Jahrh., allein eine von ihnen abstammende Branche, welche den Nahmen von Ditten angenommen hat, ist annoch im Flor.
- Pasenow , im 15ten Jahrh. und müssen die noch florirenden von Parsenow nicht mit ihren confundirt werden.
- Passentin , im Anfange des 16ten Jahrh.
- Pederstorff , kam in der Mitte des 17ten Jahrh. hier, und erhielte das Indigenat, allein es erlosche ungef. 1773.
- Perckentin soll mit der 1775 in Ribnitz verstorbenen Conventualin dieses Nahmens gänzlich erloschen sein.
- Petachle , im 14ten Jahrh.
- Petzeke , ungef. 1400.
- Piccatel , vor alters Peccatel , 1773.
- Pinnow , Ende des 17ten Jahrh.
- Pitit , im 14ten Jahrh.


|
Seite 453 |




|
- Plastein , 1550.
- Platen , in der Mitte des 16ten Jahrh.
- Platen , gegen 1600. NB. Diese beiden Geschlechter v. Platen, und die noch florirenden dieses Nahmens müssen nicht mit einander verwechselt werden, indem sie in keiner Verwandschaft noch Gleichheit des Wappens gestanden haben.
- Plawen , im 15ten Jahrh.
- Plöne , 1500.
- Poel , welches Geschlecht die Insel Poel und das Gut Großen=Schönfeld besaß, und in der Mitte des 16ten Jahrh. ausging. Es war eine Branche von der noch florirenden Familie von Pfuel, welche sich auch ehedem de Palude genannt hat.
- Polchow .
- Poppendorp , im 14ten Jahrh.
- Pragstorf .
- Pramul , ungef. 1600.
- Pretzendorp im 14ten Jahrh.
- Prignitz , Ende des 17ten Jahrh.
- Primerstorf .
- Pronesterhagen , im 14ten Jahrh.
- Prowe .
- Prutzkow , im 15ten Jahrh.
- Pula .
- Quastenberg , im 16ten Jahrh.
- Radeckow .
- Radem .
- Rahtlow , starb aus ungef. 1760.
- Rambow , im 14ten Jahrh.
- Ramelow .
- Ramelsberg , im Anfange des 16. Jahrh.
- Rand , im 14ten Jahrh.
- Reckentin , etablirte sich hier im Anfange des 17ten Jahrh. und erlosch 1745.
- Reder , ungef. 1300, und waren aus der Mark Brandenburg herstammend.
- Reetz , am Ende des 17ten Jahrh., und muß mit dem noch florirenden Geschlechte dieses Nahmens nicht verwechselt werden.
- Rehberg , Ende des 14ten Jahrh.
- Rehschinkel , im 14ten Jahrh.
- Reinershagen , im 16ten Jahrh.
- Rensow , im 14ten Jahrh.
- Resefeld , ungef. 1400.


|
Seite 454 |




|
- Retzow , ungef. 1700.
- Ritzerow , ungef. 1500.
- Roden , ungef. 1500.
- Rodenbeck , im 14ten Jahrh.
- Roggelin , ungef. 1400.
- Roggendorp , ungef. 1400.
- Roggentin , ungef. 1400.
- Roghe , im 16ten Jahrh.
- Romel , ungef. 1400.
- Römer .
- Rosenhagen , im 16ten Jahrh.
- Rositz .
- Rostke , auch Rostock , Ende des 17ten Jahrh.
- Ruhlfeind .
- Rukit , ungef. 1300.
- Rumpeshagen , im 17ten Jahrh.
- Rüsche , ungef. 1400.
- Rütze , im 15ten Jahrh.
- Salow , im 17ten Jahrh.
- Samekow , im 16ten Jahrh.
- Santow , ungef. 1400.
- Sasse , auch Zasse , Ende des 14ten Jahrh.
- Schade , im 14ten Jahrh.
- Schencken , im 16ten Jahrh.
- Schepelitze , im 15ten Jahrh.
- Scherf , Ende des 15ten Jahrh.
- Schinkel , im 16ten Jahrh., und hatte keine Gleichheit des Wapens mit denen annoch florirenden dieses Nahmens, mithin sie nicht mit einander confundirt werden müssen.
- Schmecker , im 17ten Jahrh.
- Schnakenborg , im 17ten Jahrh.
- Schöneich , eine Branche von einem annoch in andern Ländern florirenden Geschlechte, welche aus der Nieder=Lausitz um das Jahr 1500 hier kam und 1603 gänzlich abging.
- Schönenberg , nach der Mitte des 17ten Jahrh. Es muß nicht mit anderen dieses Nahmens noch florirenden Geschlechtern verwechselt werden, dieweil es mit keinen von diesen weder in Gleichheit des Wapens noch Verwandtschaft stand.
- Schönfeldt , Ende des 15ten Jahrh.
- Schönfeldt , im Anfange des 16ten Jahrh. Diese beyde Geschlechter standen weder mit sich noch mit andere dieses


|
Seite 455 |




|
Nahmens noch florirenden in Verwandtschaft und Gleichheit des Wapens.
- Schönow , in der Mitte des 17ten Jahrh., und muß gleichfals nicht mit andern dieses Nahmens verwechselt werden.
- Schötzen , auch Schössen , im Anfange des 17ten Jahrh.
- Schulenburg, im 16ten Jahrh., und war eine Branche von denen annoch florirenden dieses Nahmens.
- Schwalenberg , im 15ten Jahrh.
- Schwanewitz .
- Schwartepapen , ungef. 1400.
- Schwastorp , 1401.
- Schwerin , vor alters Zwerin , auch Etzwerin , eine Linie von dem noch florirenden Geschlechte derer v. Schwerin, ging ab im 14ten Jahrh.
- Schwetzin , im 16ten Jahrh.
- Schwinekendorp ungef. 1400.
- Schwingen , im 14ten Jahrh.
- Schwisow , auch Suisow , ungef. 1400.
- Scrathcher ungef. 1400.
- Sekow .
- See Sehe, , auch Szee , stammte aus Holstein ab, etablirten sich hier ungef. 1400 und erloschen in der Mitte des 17ten Jahrh.
- Seliche , im 15ten Jahrh.
- Seltz , im 14ten Jahrh.
- Siben , im 17ten Jahrh.
- Slemmin , ungef. 1400.
- Slüter .
- Slutow , im 14ten Jahrh.
- Sohneihlantke , im 16ten Jahrh.
- y, im 16ten Jahrh.
- Sorow , ungef. 1400.
- Speck , im 14ten Jahrh.
- Speckin , sind seit dem 17ten Jahrh. nicht mehr hier, allein es lebten von ihnen in der Mitte dieses 18ten Jahrh. in Dänischen Diensten. Da sich aber daselbst A°. 1763 keiner mehr befand, so vermuthe ich, daß das ganze Geschlecht ausgestorben ist.
- Spigelberg , im 14ten Jahrh.
- Sprengel , sind von 1506 bis in diesem Jahrh. hier begütert gewesen, und sollen jezt erloschen seyn.
- Stahl , im 17ten Jahrh.
- Stalbom , im 16ten Jahrh.


|
Seite 456 |




|
- Stargard .
- Steenbeck , im 15ten Jahrh.
- Stellet , im 14ten Jahrh.
- Sternberg , ungef. 1400.
- Stiten .
- Stockenberg , ungef. 1400.
- Stockfleth , im 16ten Jahrh.
- Stolle , im 15ten Jahrh.
- Stolpe .
- Storm , im 15ten Jahrh.
- Stove , im 15ten Jahrh.
- Stove , im 15ten Jahrh., und muß mit den vorhergegangenen nicht verwechselt werden, dieweil sie in keiner Verwandtschaft noch Gleichheit der Wapens standen.
- Stresow , im 15ten Jahrh.
- Stück , Ende des 15ten Jahrh.
- Stuten , im 16ten Jahrh.
- Stütenitz , im 14ten Jahrh.
- Svanensee 1361.
- Subzin .
- Suckow , ungef. 1500.
- Swertz , Ende des 14ten Jahrh.
- Tarnewitz , im 17ten Jahrh.
- Tarnow , anfänglich Tzarnekow, ungef. 1400.
- Tepling , 1685.
- Tessen , vor alters Tesmar , welche hieselbst ungef. 1500 erloschen ist, allein eine Branche von ihr soll noch in Hinter=Pommern floriren.
- Tessin, ging dem männlichen Stamm nach 1762 aus, und standen in keiner Verwandtschaft mit denen noch in Schweden dieses Nahmens seyenden.
- Tonstein .
- Tralow , im 17ten Jahrh.
- Travemünde .
- Trechow ungef. 1400.
- Tremon , ungef. 1400.
- Trentecop , im 14ten Jahrh.
- Treutman , im 17ten Jahrh.
- Tribow .
- Tripkendorp , im 15ten Jahrh.
- Trochen .
- Troste , im 16ten Jahrh.
- Tulendorp , im 16ten Jahrh.
- Turow , im 16ten Jahrh.


|
Seite 457 |




|
- Ulshagen .
- Utrecht , im 14ten Jahrh.
- Uxel .
- Vagel , ungef. 1400.
- Valckenhagen , ungef. 1400.
- Varenholt , im 16ten Jahrh.
- Venschow , ungef. 1400.
- Vicheln .
- Vienkerke , im 16. Jahrh.
- Volmgreuse , im 14ten Jahrh.
- Vredeber .
- Wacholt .
- Wagell .
- Wahrendorp .
- Waldenfels , 1560.
- Walie .
- Wall , im 13ten Jahrh.
- Walwitz 1523.
- Walmerstorp , im 14ten Jahrh.
- Walow , im 14ten Jahrh.
- Wamekow , im 14ten Jahrh.
- Wanenberg , im 14ten Jahrh.
- Wansheim , im 14ten Jahrh.
- Warlin , im 15ten Jahrh.
- Warmstrat .
- Warngaw , im 14ten Jahrh.
- Weddermoden , im 15ten Jahrh.
- Weida .
- Wendorp, im 13ten Jahrh.
- Werle , im 14ten Jahrh.
- Weyer , im 17ten Jahrh., und muß nicht mit denen noch in andern Ländern dieses Nahmens florirenden verwechselt werden.
- Weysin , 1715.
- Widenburg , im 15ten Jahrh.
- Wiendorp , im 13ten Jahrh.
- Wildberg .
- Wildenhagen .
- Wildhovet , im 16ten Jahrh.
- Willich , im 16ten Jahrh.
- Wincelberg .
- Wocethen , ungef. 1300.
- Wolckenstede , ungef. 1400.
- Wodenschwege im 15ten Jahrh.


|
Seite 458 |




|
- Wokrent , ungef. 1300.
- Wolden .
- Woltzow , im 16ten Jahrh.
- Wopersnow , von denen der erste im 16ten Jahrh. mit dem Gute Keetz belehnet ward, und sind dessen Nachkommen meines Wissens nach, am Ende des 17ten Jahrh. erloschen.
- Worpell .
- Worsten .
- Woserin , im 14ten Jahrh.
- Wotenitz , Wotzen, auch Wutzen und Wortze, Ende des 16ten Jahrh.
- Wotzelitz , im 15ten Jahrh.
- Wulf , 1500.
- Wulverkroge , Ende des 14ten Jahrh.
- Wüsten , Ende des 15ten Jahrh.
- Zahren , im 16ten Jahrh.
- Zart , im 14ten Jahrh.
- Zechern .
- Zechlin , 1496.
- Zehne , auch Cene, im 15ten Jahrh.
- Zelpin .
- Zernin , Zarnin, auch Czernin, ungef. 1500, und muß mit der noch florirenden Gräfl. Familie von Gzernin nicht verwechselt werden.
- Zernow im 14ten Jahrh.
- Zibzewitz .
- Zicker .
- Zickhusen , im 15ten Jahrh.
- Zisendorp , auch Cisendorp, im 15ten Jahrh.
- Zleten .
- Zühlen , welches in der Mitte dieses 18ten Jahrb. erloschen seyn soll.


|
Seite 459 |




|
II.
Verzeichniß
der noch florirenden
adelichen Familien,
welche in
denen Herzogthümern Meklenburg
für alt=Eingeborne angesehen
werden,
indem sie die Union von
1523 unterschrieben,
oder doch
wenigstens an der 1572
geschehenen Ueberweisung der
Klöster
Antheil genommen haben.
- von Ahrenstorff , von denen der erste ungef. 1540 alhier durch Vermählung mit Catarina v. Stalbom, der lezten ihres Geschlechts, zu Chemnitz, Briggow und Rosenow seßhaft ward.
- Barner .
- Barsse .
- Bassewitz .
- Beckendorff , verkauften A°. 1700 ihr Gut Buchholtz, und wandten sich nach Pommern.
- Behr , die Linien aus Grese und Nustrow.
- Below .
- Bernstorff .
- Bibow .
- Bischwang , von denen nur noch einer lebt.
- Blücher .
- Both .
- Buch .
- Buchwald , Johannsdorffer Linie.
- Bülow .
- Cramon .


|
Seite 460 |




|
- Dessin .
- Dewitz .
- Ditten , ist eine Branche von der im Anfange des 16ten Jahrh. abgestorbenen Familie derer v. Paschedach.
- Drieberg .
- Fineck , wovon nur noch einer lebt.
- Flotow .
- Gamm , wovon nur noch einer lebt.
- Gentzkow .
- Gloede , nur die Meklenburger und Pommern, nicht aber die in der Uker=Mark seyenden, als welche sich vor alters von Glüghen geschrieben haben.
- Grabow .
- Grambow .
- Hagen .
- Hahn .
- Halberstadt , wovon nur noch einer lebt.
- Hobe .
- Holstein .
- Von der Jahn , wovon nur noch einer lebt.
- Ilenfeld , wovon nur noch einer lebt.
- Kamptz .
- Kardorff .
- Ketelhodt .
- Kleinow , olim Klenow.
- Knuth .
- Kopplow .
- Kosboth .
- Koß .
- Kruse , eine Branche derer v. Holstein.
- Lehsten .
- Levetzow .
- Linstow .
- Lowtzow .
- Lück .
- Von der Lühe .
- Lützow , Claus Christoph, introduc. 1686, u. Joachim Wilhelm.
- Maltzahn , Gräfl. und Freyherrl. Branchen, und Moltzahn die Adel. Branchen.
- Mandeufel , hodie Manteufel, Ratteysche Linie ( † aus 1775).
- Möllendorff , der erste von ihnen hier angetroffene war Achim, welcher 1506 Rumpshagen besaß.
- Moltke .


|
Seite 461 |




|
- Oertzen .
- Oldenburg .
- Von der Osten .
- Passow .
- Pentz .
- Plessen .
- Plüskow .
- Preen .
- Pressentin .
- Pritzbuer .
- Quitzow .
- Raben .
- Restorff .
- Reventlow .
- Rieben .
- Rohr .
- Scarpenbarg , Scharpenbarg, hodie Scharffenberg, sind zwar seit 1768 nicht mehr hier, allein sie floriren noch in Norwegen.
- Schack .
- Schenck , die ersten, welche ich A°. 1530 von ihnen hier angetroffen, waren aus dem Hause Schweinsberg.
- Schwichold , oder Schwicheld, acquirirten 1510 die Güter Bresewitz, Beseritz und Dahlen, gingen im 17ten Jahrh. wieder hier weg, und floriren annoch in andern Ländern.
- Sperling , vor alters Sparling, auch Passer.
- Staffeldt floriren nur noch in Dänemark.
- Stoisloff , wovon nur noch einer lebt.
- Stralendorff .
- Thomstorff .
- Thun .
- Tornow .
-
Vieregge
.
Vogelsang (Nachtrag ohne Nr. D. Red.). - Voß .
- Wackerbarth . Die v. Wackerbarth sind zwar uhralt Meklenburger, allein sie gingen im 14ten Jahrh. aus solchen Lande. Die Linie aber, welche sich im 16ten Jahrh. wieder darin seßhaft machte, ist im 18ten Jahrh. gänzlich erloschen. Und obgleich also die hier florirende dieses Geschlechts nicht von denen abstammen, welche im 16ten Jahrh. wieder hieher gekommen sind, so werden sie dennoch unter die alt=Meklenburger gerechnet.


|
Seite 462 |




|
- Walsleben .
- Wangelin .
- Warburg .
- Weltzin .
- Wenckstern .
- Winterfeldt .
- Zepelin .
- Zernickow , welche noch in andern Ländern floriren sollen.
- Zülow .
III.
Die von der alten Meklenburgischen
Ritterschaft
als alt=anerkannte
und noch florirende
Geschlechter sind:
- Von Dechow , etablirten sich alhier am Ende des 17ten Jahrh., sind aber jezt nur noch in andern Ländern befindlich.
- Grävenitz , machten sich am Ende des 16ten Jahrh. alhier seßhaft.
- Jasmund , kamen hier am Ende des 16ten Jahrh.
- Von der Kettenburg , etablirten sich hier im Anfange des 17ten Jahrh.
- Krakevitz , sind ungef. seit 1640 hier.
- Von der Lancken , kamen im Anfange des 17ten Jahrh. hier.
- Lepel , von ihnen waren hier zwar im 15ten Jahrh. zwey Pfandes=weise begütert und in Herzogl. Diensten, allein sie starben im selbigen Jahrh. ohne Leibes=Erben zu hinterlassen. Hierauf machten sich im Anfange des 17ten Jahrh. die zwey Gebrüdere Adam und Victor Ludewig, auf Grambow und Fincken erblich seßhaft, deren Nachkommen denn auch unter denen alt=Meklenburgischen Geschlechtern mit aufgenommen worden sind. Da nun noch andere Linien, als die aus denen Häusern Seckeritz in Pommern und Neetzelkow auf der Insul Usedom floriren, und von welcher letzteren die Linie zu Wieck bey der Stadt


|
Seite 463 |




|
Gützkow in Pommern wieder abstammet, so können auch alle diese, dieweil sie von denen oben genannten 2 Brüdern nicht herkommen, auch nicht unter denen alt=Meklenburgern gezählet werden.
- Mareschal , deren Ankunft alhie ist mir zwar unbekannt geblieben; allein da einige Fräuleins von ihnen in hiesigen Klöstern aufgenommen worden sind, so haben sie auch hiedurch schon das Indigenat dieses Landes erlanget.
- Scheel , von diesem Nahmen ist nicht allein ein Geschlecht hier, sondern auch noch andere in Dänemark, Preussen, Rügen und Westphalen vorhanden; allein sie stehen in gar keiner Verwandtschaft noch Gleichheit der Wapen mit einander. Die hier florirende, jedoch nicht mehr begüterte, stammen aus dem Hause Güstelitz auf der Insul Rügen ab. Und obgleich der erste, welchen ich hieselbst angetroffen, der Kayserl. Obristwachtmeister Gabriel von Scheel ist, welcher 1652 Levkendorff pfändete, und 1659 das Gut Zülow erblich an sich brachte, so sind dessen Nachkommen dennoch mit unter die alten dieses Landes aufgenommen worden.
- Warnstedt , selbige etablirten sich 1598 alhier. Von ihnen ward Melchior 1625 im Schwedischen Adel introduc.
IV.
Die von der alten Meklenburgischen
Ritterschaft
und denen
alt=anerkannten
in denen
folgenden Jahren des 18ten
Jahrh.
recipirt gewordene
und noch florirende Geschlechter sind:
- Bothmer , Graf Hans Caspar Gottfrid zu Arpshagen vor sich und sein Descendenten 1733.
- Bredow Gebrüdere Caspar Matthias auf Eichhorst und Asmus Wilhelm auf Prilvitz, 1767. NB. von dieser Familie war aber schon einer Nahmens Achim A°. 1506 zu Suckvitz possessionirt.
- Dittmar , Freyh. Gottfrid Rudolph, Herzogl. Mecklenb. Geheimer Raht und nachmaliger Kayserl. Reichs=Hofraht, 1755.


|
Seite 464 |




|
NB. Er lebt unvermählt, und also noch zur Zeit als der erste und lezte dieses recipirt gewordenen Geschlechts.
- Dorne , Hermann Heinrich, auf Nienhagen, Herzogl. Geheimer=Raht, 1743.
- Förstner , Freyh. Carl, auf Gömptow, Herzogl. Meklenb. Schloß=Hauptmann, und nachmaliger Ober=Hofmeister, 1757.
- Kayserlingk , Ernst Christoph, auf Gevezin, Obrist=Lieutenant und nachmaliger Vice=Landmarschall des Stargardischen Krayses, 1755.
- Knesebeck , Wilhelm Fridrich, auf Greß, Oberhauptmann, recipiret 1774.
- Mecklenburg , die Linie aus dem Hause Zibühl 1742, und die Linie aus dem Hause Gültzow und Boldebuck, 1770.
- Meerheimb , Freyherren Gebrüdere Jasper Wilhelm und Helmuth Joachim, auf Gnemer und Wokrent, als von welchen lezteren denn auch die jezt noch lebende abstammen, 1727.
- Raven , die 4 Gebrüder, Ernst Werner auf Nossentin, Otto Christoph auf Boeck, Adolph Friderich auf Golchen, und Anthon Wilhelm, jeziger Assessor des Land= und Hof=Gerichts zu Güstrow, 1757. NB. Von diesem Geschlechte hat aber schon Matthias, nicht allein 1360 als ein Meklenb. Vasal den Vermählungs=Contract des Prinzen Johannes, einem Sohne des Herzoges Magnus zu Meklenburg, mit Judith, einer Tochter des Grafen Ottonis zu Hoya unterzeichnet; sondern auch ein Henning A°. 1523 die grosse Meklenburgische Landes=Union mit unterschrieben und untersiegelt. Wann nun alle jezt lebende dieses Geschlechts hätten beweißlich beybringen können, daß sie auch nur von dem lezteren abgestammet wären, so würden sie mithin auch schon sämtlich alt=Eingeborne gewesen seyn. Da ihnen aber der Beweiß gefehlt, so hat auch keine andere als die recipirt gewordene Nossentinsche Linie, aus welcher die vier genannten Gebrüdere abstammen, Antheil an dem Indigenat dieses Landes.
- Wendess , Herzogl. Mecklenb. Land=Raht Baltasar Henning auf Lichtenberg, mit seinen 3 Bruder=Söhnen: Friderich Christoph, Baltasar Ludewig Christoph, und Andreas Ernst von Wendessen, 1754;
- Wickede , Gottschalk Anthon, auf Dolzien und Nichleve, 1702.


|
Seite 465 |




|
V.
Von denen bereits sub Nr. II, III und
IV
vorgekommenen 115 Indigenat
habenden
Geschlechter sind
alhier begütert:
|
1. Arenstorff.
2. Barner. 3. Bassewitz. 4. Behr. 5. Below. 6. Bernstorff. 7. Blücher. 8. Both. 9. Bothmar. 10. Bredow. 11. Buch. 12. Buchwald. 13. Bülow. 14. Cramon. 15. Dessin. 16. Dewitz. 17. Ditten. 18. Flotow. 19. Gamm. 20. Gentzkow. 21. Gloede. 22. Graevenitz. 23. Hahn. 24. Halberstadt. 25. Hobe. 26. Holstein. 27. Jasmund. 28. Kamptz. |
29. Kardorff.
30. Ketelhodt. 31. Kettenburg,v. d. 32. Knuth. 33. Koppelow. 34. Kosboth. 35. Kosse. 36. Krakevitz 37. Lancken, v. d. 38. Lehsten. 39. Lepel. 40. Levetzow. 41. Linstow. 42. Lowtzow. 43. Lück. 44. Lühe, von der. 45. Lützow, 46. Maltzahn, die Freyh. u. Moltzahn d. Adel. Branchen. 47. Mareschal 48. Mecklenburg. 49. Meerheimb. 50. Möllendorff. 51. Moltke. 52. Oertzen. 53. Oldenburg. 54. Passow |
55. Pentz.
56. Plessen. 57. Plüskow. 58. Preen. 59. Pressentin. 60. Pritzbuer. 61. Quitzow. 62. Raben. 63. Raven. 64. Restorff. 65. Rieben. 66. Rohr. 67. Schack. 68. Stralendorff. 69. Tohmstorff. 70. Tornow. 71. Vieregge. 72. Voß. 73. Wackerbarth. 74. Warburg. 75. Walsleben. 76. Wangelin. 77. Warnstedt. 78. Weltzin. 79. Winterfeldt. 80. Zepelin. 81. Zülow. |


|
Seite 466 |




|
VI.
Geschlechter
welche das
Indigenat dieses Landes nicht
haben
und doch darinn begütert sind.
- Ahlefeld , ein alt Holsteinsches Geschlecht, wovon bereits eine Branche hier im 17ten Jahrh. erloschen ist. Die jetzt seyende Linie ward ungef. 1775 alhier begütert.
- Altrock , ein in diesem 18ten Jahrh. geadeltes Geschlecht.
- Bardeleben , ein alt Geschlecht aus der Mark Brandenburg.
- Berg.
- Berger .
- Billerbeck .
- Braun .
- Brockhusen .
- Clausenheim , ein am Ende des 17. Jahrh. nobilitirtes Geschlecht.
- Dassel .
- Döring .
- Ehrenstein , von denen der erste 1703 unter diesem Nahmen vom Kaiser nobilitirt ward, und vorhero Stüdemann geheißen hatte.
- Elderhorst .
- Engel . Die 2 Branchen dieses Geschlechts alhie, welche aus den Häusern Großen=Helle und Bresen sind, wurden in ihren Vor=Vätern A°. 1662 vom Könige in Schweden nobilitirt, und die leztere Branche noch ausserdem 1739 vom Kayser.
- Erlenkamp , vom Kayser baronisirt 1674.
- Eybe .
- Fabrice .
- Ferber , erhielten ihren verloren gegangenen alten Adel A°. 1704 vom Kayser renovirt.
- Fick .
- le Fort .
- Freiburg .
- Geisau .
- Gerskau , von denen der Stamm=Vater des Dambeker Hauses A°. 1735 vom Kayser nobilitirt ward.


|
Seite 467 |




|
- Goebe .
- Grelle , ein alt Pomerisches Geschlecht, wovon 1628 hier zwey zu Damekow und Madsow wohnten. Da sie aber hiernächst ihren Adel verloren haben, so hat der jetzt zu Madsow wohnende die Renovation vor einigen Jahren vom Kayser wieder erhalten.
- Güldener .
- Gundlach , welche ihren 1581 erworbenen Adel verloren, und die Renovation desselben A°. 1746 vom Kayser wieder erhalten haben.
- Gusmann .
- Hacke , ein altes Geschlecht aus der Mark Brandenburg, von welchem ich zum ersten A°. 1628 hier Caspar auf Netzeband angetroffen.
- Hardenberg , ein altes Braunschweig=Lüneburgisches Geschlecht.
- Hintzenstern .
- Höfisch .
- Hoevel .
- Holtzendorff .
- Hopfgarten , ein altes Geschlecht aus dem Schwarzburgischen, von welchen sich der erste allhier ungef. 1738 seßhaft gemacht hat.
- Kirchner .
- Kleist , ein altes Chur=Mark=Brandenb. Geschlecht.
- Klinggraff .
- Knesebeck von dem, ein alt Braunschweigsches Geschlecht. Von diesem acquirirte zwar einer 1358 einige Antheile in Gartz, allein ich finde sie nachher bis ungef. 1700, da sie Gresse im Amt Boizenburg kauften, nicht mehr hier; recipirt ward 1774 Wilhelm Friederich.
- König .
- Königsmarck , ein alt Chur=Mark=Brandenb. Geschlecht.
- Kriegersheim .
- Kröcher .
- Laffert .
- Lange .
- Langermann , ohngefehr am Ende des 17ten Jahrh. nobilitirt, und auch seitdem alhier etablirt.
- Lehmann .
- Liebeherr .
- Linde .
- Mandelslohe , ein altes Braunschweigsches Geschlecht, welches sich im 16ten Jahrh. in die Ober= und Nieder =


|
Seite 468 |




|
Sächsischen Branchen vertheilete, und von welcher lezteren sich der erste alhier 1679 seßhaft gemacht hat.
- Memerti .
- Meyen .
- Müller . Zu dieser Familie, welche in der Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kaiser nobilitirt ward, gehören die 2 Branchen zu Detershagen und Zisendorff in Meklenburg, und die zu Wohsen in Schwedisch=Pommern. NB. Es müssen aber diese nicht mit denen v. Müller aus dem Hause Großen=Rensow confundirt werden, indem sie in keiner Verwandtschaft noch Gleichheit der Wapens stehen.
- Normann , ein altes Pomerisch= und Rügianisches Geschlecht.
- von der Osten genannt Sacken , von denen sich der erste 1778 alhier begütert machte. Es stammt diese Familie zwar von denen v. d. Osten ab, allein da ihr noch zur Zeit der Beweiß fehlt, ob sie auch würklich zur Meklenburgischen Branche gehört, so hat sie auch noch nicht das Indigenat erhalten können.
- Plönnies .
- Pogwisch , ein alt Holsteinsches Geschlecht, welches sich alhier im 17ten Jahrh. etablirte.
- du Puits , ein alt Französisches Geschlecht, etablirte sich im 17ten Jahrh. alhier.
- von dem Rade.
- Rantzow , ein alt Holsteinsches Geschlecht.
- Raven , die Wrechensche Branche, als welche nur allein von dieser Familie das Indigenat nicht hat.
- Roepert , ein nach der Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kayser nobilitirtes Geschlecht.
- Sala, ein Venetianisches Geschlecht, welches seinen Adel verloren hatte, und die Renovation ungef. 1660 vom Kayser wieder erhielte, auch seitdem alhie begütert ist, und hiernächst in Grafen=Stand erhoben ward.
- Scheve .
- Schilden .
- Schlieben .
- Schoepffer , ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. nobilitirtes Geschlecht.
- Schrader .
- Schröder , ein nicht vor langer Zeit vom Kayser geadeltes Geschlecht aus dem Hause Großen=Nienhagen, welches aber mit der unbegüterten Familie v. Schröder zur Zeit


|
Seite 469 |




|
in Ankershagen seyend, weder Verwandtschaft noch Gleichheit des Wapens hat.
- Schuckmann , ein im Anfange dieses 18ten Jahrh. vom Kayser nobilitirtes Geschlecht.
- Schulenburg von der , ein auswärtiges altes Geschlecht.
- Schütz .
- Schultz von Ascheraden Freyherren.
- Schwerin , ein alt Pommerisches Geschlecht, von welchem im 14ten Jahrh. hier bereits eine Linie erloschen ist.
- Seitz .
- Stengelin Freiherren.
- Stern .
- Storch , ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kayser nobil. Geschlecht.
- Töbing .
- Treuenfels .
- Waitz. Baron von Eschen .
- Waldow .
- Walmoden .
- Wendhausen, Stisser Baron von . Der erste derer v. Wendhausen hieß ehedem Probst, und ward 1683 vom Kayser mit dem Nahmen Probst von Wendhausen nobilitirt. Da nun dieser keine Söhne hatte, so ward sein Schwiegersohn Stisser, A°. 1684 unter dem Namen Stisser von Wendhausen vom Kayser geadelt, auch hiernächst baronisirt.
- Wendland .
- Witzendorff .
VII.
Geschlechter
welche das
Indigenat dieses Landes haben
und
unbegütert darinn wohnen.
|
1 v. Barsse.
2. Bibow. 3. Bischwang 4. Dorne. 5. Drieberg. 6. Fineck. 7. Förstner Bar. |
8. Grabow.
9. Grambow. 10. Hagen. 11. v. d. Jahn. 12. Kaiserlingk 13. Kruse Bar. 14. v. d. Osten. |
15. Scheel.
16. Sperling. 17. Stoisloff. 18. Wenckstern. 19. Wendessen. 20. Wickede. |


|
Seite 470 |




|
VIII.
Geschlechter
welche das
Indigenat dieses Landes nicht
haben, und unbegütert darinn wohnen.
- Arenswald .
- Barnekow .
- Behmen .
- Berner , ein im Anfange dieses 18ten Jahrh. nobilitirtes Geschlecht, und welches demnach mit der alten Familie v. Barner nicht verwechselt werden muß.
- Bessel .
- Bodeck , ein altes teutsches, nächsthin in Preussen und andern Ländern ausgebreitetes Geschlecht, kam im 17ten Jahrh. hier.
- Boye .
- Brandenstein , ein alt Thüringisches Geschlecht.
- Brandt .
- Brehm .
- Brokes .
- Chambot , ein Französisches Geschlecht.
- Chassot , ein alt Geschlecht aus der Normandie in Frankreich.
- Dideron .
- Eilers .
- Falckenberg .
- Gevertsheim , ein um der Mitte dieses 18ten Jahrh. geadeltes Geschlecht.
- Gluer .
- Goertzke .
- Hanneckin .
- von der Hardt , am Ende des 17ten Jahrh. vom Kayser nobilitirt.
- Haefften .
- Hartwig .
- Hein .
- Horn , ein alt Pommerisches Geschlecht.
- Jagow .
- Kahlden , ein alt Rügianisches Geschlecht.
- Kahlenberg .
- Kalckreuther , ein altes Geschlecht, welches seinen Ursprung aus Portugal herleitet, sich im 17ten Jahrh. das Indigenat in Polen erwarb, und alhie vor wenigen Jahren noch begütert gewesen ist.


|
Seite 471 |




|
- Kalsow .
- Kessel .
- Kielmannsegge .
- Klein .
- Klenck .
- Klinge .
- Krauthoff , sind meines Wissens nach im Anfang des 17ten Jahrh. nobil. und wohnten 1628 schon zu Neddewin.
- Kreutzburg .
- Krivitz , auch Crivitz , wurden ungef. 1640 vom Kayser nobilitirt.
- Krohn .
- Kurtzrock .
- Löwen .
- Löwenklan .
- Löwenkron .
- Löwenstern .
- Mellentin , alt Pommern.
- Miltitz .
- von der Mülbe .
- Müller aus dem Hause Großen=Rensow, wurden gegen die Mitte dieses 18ten Jahrh. vom Kaiser nobilitirt und lebt nur noch einer von ihnen. Sie müssen mit andern dieses Nahmens nicht verwechselt werden.
- Nettelblatt .
- v. der Oehe , ein alt Rügianisches Geschlecht.
- Oerenstedt .
- Pannewitz .
- Platen , alt Rügianer.
- Rebeur .
- Reichel .
- Reyter .
- Riedesel .
- Rochow .
- Santen .
- Schmalensee , alt Pommer. Geschlecht.
- Schönberg .
- Schröder , ein in Ankershagen seyendes und nach der Mitte dieses 18ten Jahrh. von Kayser nob. Geschlecht, welches aber nicht mit denen v. Schröder aus dem Hause Großen=Nienhagen confundirt werden muß.
- Schurff , ein alt Geschlecht aus dem Hause Schurtz in Oestreich, welches in diesem 18ten Jahrh. über 60 Jahr hier begütert gewesen ist.


|
Seite 472 |




|
- Schwartz .
- Schwartzenberg .
- Sell .
- Seltzer .
- Sichter .
- Sittmann .
- Steinstorf .
- Suhm .
- Vietinghoff , ein alt Liefländisches Geschlecht, welches sich im 17ten Jahrh. hier begütert machte, und es auch bis 1743 gewesen ist.
- Vogelsang , ein alt Mekl.= Pommerisches Geschlecht, welches sich im 17ten Jahrh. hier seßhaft machte, und es seit einigen Jahren nicht mehr ist.
- Wick .
- Winnemer .
- Wolan , ein alt Französisches und hiernächst in Polen seßhaft gewordenes Geschlecht.
- Wurmb .
- Zieten , ein alt Chur=Mark=Brandenburgisches Geschlecht, welches in diesem 18ten Jahrh. beinahe 40 Jahr alhier begütert gewesen ist.
IX.
Geschlechter
welche das
Indigenat dieses Landes haben,
jedoch nur in andern Ländern
befindlich sind.
- Von Beckendorff .
- Dechow .
- Dittmar .
- Ilenfeld .
- Kleinow , olim Klenow.
- Manteufel , olim Mandeufel, Ratteysche Branche.
- Reventlow .
- Scharffenberg .
- Schenck .
- Schwicheld .
- Staffeld .
- Thun .
- Zernickow .


|
Seite 473 |




|
X.
Geschlechter
welche
das
Indigenat dieses Landes nicht
haben,
jedoch darin gewesen
sind,
und jezt noch in andern
Ländern floriren.
- Von Bissing .
- Birckholtz , Joh. introd. 1625 in Schweden.
- Böningk , sind seit 1749 nicht mehr hier.
- Burkersrode , ein alt Thüringsches Geschl. von dem in diesem 18ten Jahrh. hier einer einige Jahre begütert gewesen ist.
- Carben , v. Weig. Wap.=Buch P. I. p 130.
- Donner .
- Esmann .
- Finck .
- Gadow , waren vom 17ten bis im 18ten Jahrh. hier.
- Von der Groeben .
- Grünwald .
- Heiden , welches Geschlecht A°. 1187 sich aus dem Braunschweigschen nach Vor=Pommern wandte.
- Hekelow .
- Jaucke , wurden 1596 vom Kayser nobil., und waren hierauf hier über 50 Jahr begütert, da sie sich dann nach Pommern wandten.
- Junghen , Jungken, Jungkenmünzer, oder Jungkenn genannt Münzer von Mohrenstam, ein alt Rheinländisches Geschlecht.
- Kannen . Deren Wapen ist in Weigels Wapen=Buch P. III. p. 134 anzutreffen.
- Krog .
- Krohne .
- Krüger , ein gegen der Mitte dieses 18ten Jahrh. nobil. Geschlecht.
- Küssow , ein alt Pommer. Geschlecht.
- Lindemann , sind seit etwas über 20 Jahren nicht mehr hier.
- Von der Lippe , waren im 17ten Jahrh. hier.
- Lüderitz , waren im 17ten Jahrh. hier.
- Mannstein .
- Münchow , ein alt Pommer. Geschl. von dem einer in diesem 18ten Jahrh. hier begütert gewesen ist.


|
Seite 474 |




|
- Netzow , ein alt Pommer. Geschl., welches sich im 17ten Jahrh. auf Eichhorst seßhaft machte, solches aber 1746 wieder verkaufte und Meklenburg verließ.
- Nischwitz .
- Ostau , aus Preussen, von dem einer nach der Mitte des 18ten Jahrh. hier war.
- Podewils , alt Pommern.
- Putkammer , alt Pommern, sind seit wenigen Jahren nicht mehr hier.
- Putlitz , Gans Edle Herren zu, von diesem alten Chur=Mark=Brandenb. Geschlechte ist einer von 1737 bis 1755 hier in Mollensdorff seßhaft gewesen.
- Quasten , alt Pommern.
- Rammin , waren im 17ten Jahrh. hier.
- Rappe .
- Ribbeck , sind ungef. 1760 hier weggezogen.
- Roden , ein alt Geschlecht aus Hessen, ist seit einigen Jahren nicht mehr hier, und muß mit der ausgestorbenen Familie dieses Nahmens nicht verwechselt werden.
- Sanitz , Saentz , auch Sarnitz , waren hier im 17ten Jahrh.
- Von Scheiter , Bernhard Obrist war 1689 auf Tüschow und Granzien im Amt Wittenburg seßhaft, dessen Nachkommen floriren annoch im Hannöv. v. Franck L. XV. p. 217.
- Schlaff , ein neu geadelt= und jezt in Wismar seyendes Geschlecht.
- Schmieterlohe sind seit den 17ten Jahrh. nicht mehr hier.
- Schwandes , waren einige Jahre um der Mitte dieses 18ten Jahrh. hier.
- Seestedt , ein alt Holsteinsches Geschl. wovon einer hier im 17ten Jahrh. begütert war.
- Steding , alt Pommern, wovon einige hier im 17ten Jahrh. Pfand=begütert waren.
- Stöcken .
- Tadden , alt Pommern, waren hier im 17ten Jahrh. begütert.
- Tweestreng , ein alt Geschl. aus Hamburg, von welchem einer in diesem 18ten Jahrh. hier gewesen ist.
- Vegesack , von denen einer hier in diesem 18ten Jahrh. einige Jahre begütert gewesen ist.
- Vehler , ein alt Geschl. aus Westphalen.
- Wagner , ein alt Geschl. aus der Reichs=Stadt Augsburg, wandte sich von dort nach Böhmen, machte sich im 17ten Jahrh. hier seßhaft, und ist seit 1767 nicht mehr hier.


|
Seite 475 |




|
- Wedel , ein Graf aus Dänemark, war von 1720 an einige Jahre alhier seßhaft.
- Grund von der Worth .
- Wrangel , ein alt Geschlecht aus Liefland.
- Zesterfleth .
Wiederholung.
| Die Zahl der ausgestorbenen mehrentheils alt Meklenburgischen Geschlechter besteht in | 499 | Geschlechter. |
|
II. Die Zahl der florirenden
Geschlechter, welche das Indigenat in
diesem Lande haben, sind:
1. sub No. II, alt Eingeborne 93; 2. sub No. III, alt anerkannt 10; 3. sub No. IV. recipirte . . . . .12. |
115 | - |
|
III. Die Zahl der Geschlechter welche
anjezt in Meklenburg begütert,
sind:
1. sub No. V, Indigenathabende 81; 2. sub No. VIII, Nicht Indigenat=habende 86. |
167 | - |
|
IV. Die Zahl der Geschlechter welche in
diesem Lande unbegütert anzutreffen,
sind:
1. sub No. VII, Indigenat=habende 20; 2. sub No. VIII, Nicht Indigenat=habende 78. |
98 | - |
|
V. Die Zahl der Geschlechter, welche
hier gewesen, und jezt in andern Ländern
floriren, sind:
1. sub No. IX, Indigenat=habende 13; 2. sub No. X, Nicht Indigenat=habende 53. |
66 | - |
|
VI. Die Zahl der Geschlechter, welche
demnach noch hier floriren, sind:
1. Indigenat=habende 101; 2. Nicht Indigenat=habende 164. |
265 | - |


|
Seite 476 |




|



|



|
|
:
|
Die
von Lewetzow
und
von Lowtzow.
Die Familie von Lowtzow gilt für eine Familie aus dem alten, eingebornen Adel Meklenburgs und doch läßt sie sich bisher mit Sicherheit nicht früher hinaufführen, als bis zu der Zeit, wo sie selbst als eine alte Familie auftritt. Zuerst scheint sie unter dem Namen Lowtzow vorzukommen, als "Achim Lowtzo" im J. 1523 die Union unterschrieb, wenn anders der Name in dem Abdrucke richtig ist. Im großherzoglichen Archive zu Schwerin ist kein einziger Lowtzow vor dem 16. Jahrhundert aufgezeichnet, ein einziger Fall unter den alten Familien. Daher reichen die Stammbäume der Familie von Lowtzow auch nicht über das 16. Jahrhundert hinaus, wenige unsichere Namen abgerechnet. Dieser Achim Lowtzow ist der erste "Lowtzow", und doch vertrat er damals schon ein altes Geschlecht! Dies ist allerdings sehr auffallend und die Genealogen haben zu allerlei Hypothesen ihre Zuflucht genommen, unter andern auch, nach Latomus Vorgange, zu der, daß man glaube, die von Lowtzow seien aus der Familie von Lewetzow hervorgegangen, weil sie das Gut Lewetzow besessen haben. Dies ist aber wegen der völligen Verschiedenheit der Wappen nicht denkbar; die Gleichheit der Wappen ist nämlich das einzige sichere Kennzeichen der Stammesverwandtschaft mehrerer Familien. Die Sache läßt sich aufklären; jedoch bevor der Ursprung der von Lowtzow nachgewiesen werden kann, muß man über die von Lewetzow im Klaren sein. Es können hier jedoch nur allgemeine Umrisse und entscheidende Thatsachen über beide Familien gegeben werden. Es gab im Mittelalter zwei Familien von Lewetzow. Die bekannte, noch blühende Familie von Lewetzow, welche ein Gatter im Schilde führt, erscheint zuerst im Lande Meklenburg bei Wismar bis Gadebusch und Neukloster hin. Der Stammvater scheint Heinrich Leuzowe zu sein, welcher im J. 1219 auftritt (vgl. Lisch Mekl. Urk. III, S. 64), In der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. ist der Ritter und Rath Günther Lewetzow ein bekannter Mann; im Jahre 1277 verkaufte er mit seinem Bruder Heyne an die Stadt Wismar den Hof Dorsten, welcher in der Nähe der Stadt lag (vgl. Lisch Maltzan. Urk. I, Nr. XXII). Höchst wahrscheinlich hatte diese Familie ihren Namen von dem in der Nähe der Stadt Wismar bei Lübow liegenden Dorfe Lewetzow. In einem kleinen Hebe=


|
Seite 477 |




|
register des Bisthums Schwerin aus dem Ende des 13. Jahrh. heißt es bei den Zehnten mehrerer Dörfer in der Gegend von Wismar, wie Rosendal, wo der Ritter Helmold von Plessen, wie Krassow, wo die Brüder Hanenstert aufgeführt werden:
"In Lewetzow de vno manso dantur nobis XVIII mod. auene, et dominus Gunterus de sua curia dat ibidem IIII mod. silig., IIII ordei, IIII auene, licet in plus se extendant".
In der ersten Hälfte des 14. Jahrh. erscheint sie viel in der Gegend von Rostock. Erst um die Mitte des 14. Jahrh. kam sie nach und nach in den Besitz der nicht weit von Dargun liegenden Güter Schorrentin, Markow und Lunow u. a., auf welchen sich eben so viele Hauptlinien der Familie ausbildeten; so saßen z. B. noch 1360 die Bere auf Schorrentin. Am 1. Mai 1372 ward Heinrich von Lewetzow für sich und seine Familie mit dem Erbmarschallamte des Landes Werle=Güstrow und dem Dorfe Klentz als Dienstgut belehnt. Nach dem Aussterben des fürstlichen Hauses Werle im J. 1436 ward das Marschallamt des Landes Wenden zwischen den von Lewetzow und den Maltzan, welche ebenfalls um das J. 1370 mit dem Erbmarschallamte des Landes Werle=Goldberg belehnt worden waren, streitig, bis am Ende des 16. Jahrh. die Maltzan sich auf rechtlichem Wege im Besitze behaupteten (vgl. Lisch Maltzan. Urk. II, S. 240 flgd. und S. 251 - 256). Für die seit erster Belehnung das Erbmarschallamt bekleidenden Familien scheint der Helmschmuck ihres Wappens von Wichtigkeit zu sein, wobei man freilich nicht die neuern Entstellungen der Wappen betrachten, sondern auf die ältesten Siegel zurückgehen muß. Die Maltzan führen zwei Büsche über einander auf dem Helme, unten einen metallenen, wie es scheint, und darüber einen Pfauenwedel. Eben so führen die von Lewetzow einen doppelten Busch, unten ebenfalls einen metallenen, wie es scheint, auf welchem einzelne Federn liegen, und darüber einen Pfauenwedel. Die von Lützow führen ebenfalls einen breiten Pfauenwedel auf dem Helme. Es läßt sich daher im Allgemeinen annehmen, daß die alten Erbmarschallsfamilien einen Pfauenwedel auf dem Helme führen, gewöhnlich über einer zweiten kelchformigen, aber sehr ausgebreiteten, metallenen Helmzier mit den Farben des Wappens. Sie führen diesen Schmuck aber nicht, weil sie das Erbmarschallamt bekleiden, da die Maltzan schon lange vor der Gewinnung des Erbmarschallamtes diesen Helmschmuck haben (vgl. Lisch Urk. zur Gesch. des Geschl. Maltzan I, Lithogr. Taf. I), sondern sie bekleiden das Amt, weil sie, um so zu sagen, diesen Helmschmuck führten, oder


|
Seite 478 |




|
richtiger gesagt, weil sie nach Stellung, Besitz, Wappen u. s. w. aus alten bevorzügten Familien stammten, denen dieses wichtige Amt vor andern anvertraut ward. Auch die Landesfürsten führten einen Pfauenwedel auf dem Helme. Ein solcher Helmschmuck kommt auf alten, ächten Siegeln nicht häufig vor.
Eine zweite Familie von Lewetzow hing mit der so eben abgehandelten Familie gar nicht zusammen. Sie führte einen halben Hirsch im Schilde und war seit den ältesten Zeiten auf dem Dorfe Lewetzow bei Teterow angesessen, von welchem sie wohl ohne Zweifel den Namen führte. Dieses Gut grenzt unmittelbar an die Güter der andern Familie von Lewetzow; dieses auffallende Zusammentreffen der Namen und des Güterbesitzes kann aber nur ein rein zufälliges sein, da nach dem Wappen beide Familien gar nicht verwandt sind. Diese Familie von Lewetzow erwarb nach und nach mehrere Güter in der Nähe des Hauptgutes Lewetzow, zwischen Teterow und Lage, z. B. Todendorf, Tenze, Bützin, Lüningstorf, Carnitz u. s. w. Merkwürdig ist es wieder, daß die Familie von Lewetzow auf Schorrentin und Markow im 14. Jahrhundert Rechte an dem Gute Lewetzow hatte, welchen sie aber im J. 1390 entsagte; wahrscheinlich waren dies nur Pfandrechte an einzelnen Gerechtsamen, welche sie entweder von den Landesherren oder den Besitzern auf kurze Zeit erworben hatte. Uebrigens erscheinen beide Familien oft neben einander.
Die Existenz der Familie von Lewetzow auf Lewetzow mit dem halben Hirsch im Wappen ist ohne Zweifel und durch alle sie betreffenden, Original=Urkunden und Siegel, welche einzeln verglichen sind, begründet; es kann nicht der leiseste Zweifel gegen die Schreibung des Namens aufkommen. - Der Stammvater dieser Familie von Lewetzow auf Lewetzow scheint der Ritter Johannes von Lewetzow zu sein, welcher in der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. häufig bei den Fürsten von Werle und in der Nähe des Klosters Dargun vorkommt. Im J. 1304 hatte er eine Kirche zu Lewetzow erbaut, welche durch den Bischof Heinrich von Camin in demselben Jahre von der Mutterkirche zu Jördenstorf wegen zu großer Entfernung getrennt, zu einer Pfarrkirche erhoben und mit den Dörfern Lewetzow, Perow und Todendorf zum Kirchsprengel ausgestattet ward. Im J. 1305 setzte Johann von Lewetzow den zwei Priestern, welche er an der Kirche und einer in derselben von ihm gegründeten Vicarei angestellt hatte, mehrere Einkünfte aus. Am 25. Juli 1308 legirte er 60 Mark zu dem Altar in einer neuen Kapelle der Klosterkirche zu Dargun, vor welchem er und seine Frau Gertrud begraben sein wollten. Das an dieser Urkunde


|
Seite 479 |




|
hangende älteste Siegel ist Taf. I, Nr. 3, abgebildet. Im J. 1316 war er gestorben und seine Wittwe an den Ritter Conrad von Cröpelin wieder verheirathet. - Der Name Johann (oder Henneke oder Hans) ward von dem Ritter Johann vorherrschender Vorname in der Familie. - Am 31. Octbr. 1366 waren zwei Vicke von Lewetzow auf Lewetzow ("Vicke unde Vicke Lewytzowen, de to Lewitzowe wonen,") bei den Fürsten von Werle und führen Siegel mit dem halben Hirsche; die Namen sind mehrere Male sehr deutlich Lewetzow geschrieben; neben ihnen erscheint Günther Lewetzow auf Schorrentin (vgl. Lisch Maltzan. Urk. II, S. 198 und 201). Eine Urkuude vom J. 1406 im Archive der Stadt Güstrow besiegeln Günther von Lewetzow mit einem Gatter im Schilde und Henneke Lewetzow mit einem Siegel mit dem halben Hirsche und der Umschrift:
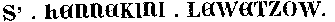
Am 25. Nov. 1437 ist der Knappe Dietrich von Lewetzow nach dem Aussterben des Fürstenhauses Werle unter den Vertretern der werleschen Ritterschaft bei dem Kaiser und besiegelt die Urkunde mit einem Siegel mit einem halben Hirsche und der Umschrift:
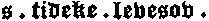
Wenn diese Vertretung unter "Diderik
Lewetsowen, Ulrich Moltzan marschalke, Mauricius
Vlotowen, Johans von Leesten - -
ingheseghelen" geschieht, so ist die
Würdenbezeichnung durch "marschalk"
nur auf Ulrich Maltzan allein zu beziehen, da
wohl die von Lewetzow auf Klentz
 ., aber nicht die von Lewetzow mit
dem halben Hirsche im Wappen Marschalle waren.
Im J. 1477 besiegeln Hans von Lewetzow auf
Lewetzow und seine Vettern Hans von Lewetzow auf
Carnitz und Vicke von Lewetzow zu Güstrow und
ferner Titke Lewetzow zu Lewetzow eine
Familienurkunde mit Siegeln mit einem halben
Hirsche, von denen noch zwei erkennbar sind.
Hans von Lewetzow auf Lewetzow stellte noch im
J. 1494 eine Urkunde aus.
., aber nicht die von Lewetzow mit
dem halben Hirsche im Wappen Marschalle waren.
Im J. 1477 besiegeln Hans von Lewetzow auf
Lewetzow und seine Vettern Hans von Lewetzow auf
Carnitz und Vicke von Lewetzow zu Güstrow und
ferner Titke Lewetzow zu Lewetzow eine
Familienurkunde mit Siegeln mit einem halben
Hirsche, von denen noch zwei erkennbar sind.
Hans von Lewetzow auf Lewetzow stellte noch im
J. 1494 eine Urkunde aus.
Diese Familie von Lewetzow auf Lewetzow mit einem halben Hirsch im Schilde läßt sich also bis zum Ende des 15. Jahrh. nachweisen. In der ersten Hälfte des 16. Jahrh. verschwinden aber diese von Lewetzow eben so plötzlich, als die von Lowtzow auftreten. Da nun die von Lowtzow einen halben Hirsch im Wappen führen und das Gut Lewetzow im 16. Jahrh. das Hauptlehn der Familie von Lowtzow war, so ist nichts gewisser, als daß die alte Familie von Lewetzow auf Lewetzow dieselbe Familie ist, welche sich seit dem 16. Jahrhundert durch eine veränderte Aussprache von Lowtzow nannte, wahrscheinlich durch den Uebergang von Lewetzow durch Leutzow in Lowtzow (ausgesprochen Lôtzo). Seit ungefähr 1550 wird der Name öfter Loutzouw


|
Seite 480 |




|
und Lautzau geschrieben, aber noch 1589 werden "Heinrich und Jochim gebrüder die Leutzouen auf Leuetzou" genannt, dagegen schon 1544 "Lowtzow". Die Familie von Lowtzow war noch das 18. Jahrhundert hindurch im Besitze des uralten Stammlehns Lewetzow.
Auf diese Weise werden sich beide Familien scheiden und es wird sich jetzt der Stammbaum der von Lowtzow vielleicht vollständig herstellen lassen, dagegen werden aus dem von Lewetzowschen Stammbaume vielleicht auch aus dem von Lowtzowschen der ältern Zeit, mehrere Personen nach beiden Seiten hinausscheiden müssen.
Mit den von Lewetzow sind die von Lowtzow nicht stammverwandt, vielleicht aber mit den von Oldenburg, mit denen sie gleiches Schildzeichen, wenn auch mit verschiedener Tinctur, führen.
Mit den von Lewetzow werden dagegen die Berne für gleichen Stammes sein, da sie ebenfalls ein Gatter im Schilde führen, wie das Taf. I, Nr. 4, abgebildete Siegel des Wolder Bernefür vom J. 1405, welchem alle andern bernefürschen Siegel gleich sind, zeigt; der niederdeutsche Name Bernefür heißt: Brennfeuer, von brennen oder bernen, wie in Bernstein. Die Hauptgüter der Bernefür waren Freudenberg, Heinrichsdorf und Tressentin bei Ribnitz. Die Bernefür haben nicht allein mit den von Lewetzow gleiches Schildzeichen, sondern sie kommen mit diesen auch im Verkehr in nähere Berührung. Im J. 1371 verkauften die von Sukow das Dorf Chlewe oder Klewe, jetzt Kleverhof bei Dargun an die von Lewetzow mit dem Gatter im Schilde (z. B. Werner Lewezowe knape de wonet tu deme Chlewe, 1371) und es blieben diese auch eine Zeit lang im Besitze des Gutes. Neben ihnen erscheinen aber auch die Bernefür auf Chlewe oder Kleverhof (z. B. Hans Bernevur, Hinrick Bernevurs sone, tome Chlewe, 1444). Am 14. Februar 1496 war mit Rolef Bernefür zu Chlewe das Geschlecht ausgestorben und die Güter fielen an die Lehnsherren heim.
In Wismar gab es auch eine Bürgerfamilie Lewetzow, z. B. "Johannes de Lewetzow, civis Wismariensis" am 11. Juni 1287 in Lisch Maltzan. Urk. I, S. 88 v. a. u. O. öfter.
Auch in Rostock gab es eine Bürgerfamilie Lewetzow, von denen im J. 1475 "Hinrik Levesowe radman der stad Rotzstok" mit seinen Söhnen Joachim und Heinrich eine Seelenmesse stiftet und die Urkunde mit einem Siegel



|
Seite 481 |




|
Im J. 1492 führt "Joachim Lewetzow, opidanus, opidi Rostock" ebenfalls

im Siegel. Diese Familie gehörte also wohl keiner Patricierfamilie an.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Schwartepapen.
Die Familie der Schwartepapen, welche im Mittelalter in der Stadt Plau wohnte und in der Nähe dieser Stadt viele Landgüter besaß, auch einen Sitz auf dem in der Nähe der Stadt liegenden Burgwalle der Feldmark Gaarz hatte, ist in den neuern Zeiten öfter zur Sprache gekommen und hat eine urkundliche Darstellung gefunden in: Lisch Berichtigung einer von dem Herrn Staatsminister v. Kamptz gemachten Aeußerung, 1844. Als Stammvater dieser Familie hat sich bisher Barthold Swartepape, 1313 - 1338, erkennen lassen, dessen Nachkommen in seinen Kindern und Enkeln bis gegen das Ende des 14. Jahrh. lebten. Barthold Swartepape wird ausdrücklich zwei Male Bürger zu Plau genannt; er ward durch die Erwerbung vieler Güter Lehnmann und endlich auch Vogt zu Plau.
Man hat diese Familie mit dem rittermäßigen Geschlechte Pape, welches in der Gegend von Malchow ansässig war, in Stammesverbindung zu bringen gesucht. Die Pape stammten von einem Ritter Dietrich Pape, welcher 1292 - 1303 vorkommt. Allerdings führten beide Familien denselben Helm, ein Pelikansnest, und von den Swartepapen ist auch ein Wappenschild bekannt.

Es ist aber durchaus ungewiß, ob die Swartepapen von den Papen herstammen; vielmehr ist es wahrscheinlich, daß beide Familien gleichzeitige Sprossen eines uns unbekannten Stammes


|
Seite 482 |




|
sind. Dies wird durch eine neuere Entdeckung noch wahrscheinlicher, indem die Familie der Swartepapen noch älter ist, als die Familie der Papen.
Durch eine in Lisch Gesch. und Urk. des Geschl. Hahn I, S. 109 mitgetheilte Urkunde vom 28. Sept. 1284 verpfänden die Fürsten von Werle
für 200 Mark lübischen Geldes mehrere Hebungen aus der Mühle zu Plau. Ich habe diese Worte durch
erläutert, muß aber nach anderweitigen, seitdem gemachten Studien diese Auffassung für irrig ansehen; ich habe mich schon bei der Herausgabe der Urkunde daran gestoßen, daß ein "Bürger" zugleich ein "Geistlicher (clericus)" sei, konnte aber die ganz nahe liegende Bedeutung der Worte nicht sehen und vergriff mich daher in Orthographie und Interpunction. In der Original=Urkunde steht nämlich ganz genau:

Dies darf man jetzt nur schreiben und interpungiren:
und übersetzen:
Der Ausdruck niger clericus ist nämlich in der lateinischen Urkunde nichts weiter, als eine lateinische Uebersetzung des Namens "Swarte Pape", grade wie der Name des Ritters "Pape" öfter durch "Clericus" übersetzt wird.
In einer andern, im königlich dänischen Archive zu Kopenhagen aufbewahrten lateinischen Original=Urkunde, datirt Plau 1295 am Tage Philippi und Jacobi, durch welche der Fürst Nicolaus von Werle dem Kloster Rühn das Patronat von Frauenmark und Severin verleiht, sind nach den Rittern folgende Bürger Zeugen: "burgenses de Plawe: Hynricus Niger Clericus, Johannes Marlowe". Also auch hier ist Schwartepape durch Niger Clericus übersetzt.
Heinrich Schwartepape war also schon im J. 1284 ein schlichter Bürger zu Plau und so wohlhabend, daß er den Fürsten Geld anleihen konnte. Ob er ein Vater oder Bruder des Barthold Swartepape, ob er mit dem Ritter Pape verwandt gewesen sei, läßt sich nicht mehr ermitteln; jedoch scheint er der erste des Namens Swartepape gewesen zu sein, ursprünglich Pape geheißen und sich durch das Beiwort von seinen Verwandten geschieden zu haben. Auch das ist nicht zu entscheiden, ob er der


|
Seite 483 |




|
Schlachterälteste Heinrich Pape sei, der in einer Urkunde vom J. 1306 in den Beilagen zu den Rostockschen Wöchentl. Nachr. S. 196 vorkommt.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Denkstein von Eversdorf.
Auf der Feldmark von Eversdorf bei Grevismühlen, in der östlichen Ecke, wo der Weg von Eversdorf nach Naschendorf den sogenannten Poststeig oder den Nebenweg von Wismar nach Grevismühlen schneidet, steht ein granitener Denkstein in der gewöhnlichen, oben abgerundeten Form. - Auf beiden Seiten sind Reliefbilder in gutem Styl mit Inschriften eingehauen. Auf der östlichen Seite steht ein Crucifix; zur rechten Hand desselben knieet ein unbewaffneter Mann in kurzem Wams mit unbedecktem Haupte, vor ihm steht zur linken Hand des Crucifixes gelehnt ein Wappenschild, mit einer Art von Thurm oder Gebäude mit Zinnen, über welchem eine Muschel,
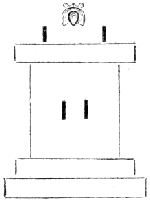
wie es scheint, steht. Vor dem Haupte des knieenden Mann liegt ein Spruchband mit der Inschrift:
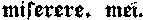
Unter der ganzen Darstellung steht die Inschrift:

d. i.
Anno domini MCCCXCI, ipso die decem millium (militum) Ludeke Morellenbuch, civis in


|
Seite 484 |




|
Wismer, hic interfectus est Orate deum pro eo.
(= Im Jahre des Herrn 1391, am Tage der zehntausend Ritter (22. Junii), ist Lüdeke Morellenbuch, Bürger in Wismar, hier getödtet worden. Bittet Gott für ihn.)
Auf der westlichen Seite steht wieder ein Crucifix, zur rechten Seite daneben Maria, zur linken Johannes, wie es scheint. Darunter ist wieder derselbe Bürger, vor seinem Wappen knieend, betend dargestellt, und zwar der Mann unter der Maria; vor ihm sind zwei Spruchbänder mit den Inschriften:
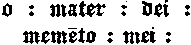
memento mei.)
Darunter steht wieder:
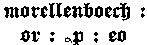
Orate pro eo.)
G. C. F. Lisch.


|
Seite 485 |




|
VI. Zur Schriftenkunde.
Urkunden.
Der Verein erhielt zum Geschenke an Urkunden:
I. Von dem Herrn Dr. Sorterup zu Kopenhagen:
1) 1604. April 19.
Instruction des Königs Christian IV. von Dänemark und des Herzogs Johann Adolph von Holstein für ihre Gesandten Jonathan Gutzlaf und Ludwig Pinzier zu deren Reise zum Herzog Carl von Meklenburg wegen des Heirathsgeldes der Herzogin Dorothea, Gemahlin des Herzogs Christoph.
2) 1605. Dec. 31.
Antwort des Herzogs Carl von Meklenburg auf die Vorträge dieser Gesandtschaft.
II. Von dem Herrn Advocaten Lembke zu Wismar die einen bekannten, von Müller in seinem Buche Ueber alte und neue Lehen, 1836, S. 112 flgd., und von Eschenbach in Beil. zu Rostock. Nachr. 1817, S. 33 und 90 flgd. behandelten Lehnfall berührenden Urkunden, welche der Herr Geber durch Zufall an sich gebracht und dem Untergange entrissen hat:
1) 1476, Febr. 2. (am dage lichtmissen.)
Curt Sperling zu Keetz und seine Söhne Curt, Lüder, Hans, Volrath, Otto und Jürgen verpfänden, unter Consens des Johann Sperling zu Schlagsdorf, dem Kloster zu Tempzin ihre beiden Höfe und das Dorf zu Keetz.
2) 1507. Dec. 10, (des vrigdages vor Lucien dage.)
Die Brüder Jürgen und Claus Bekendorf, wail. Jürgen Bekendorfs zu Buchholz Söhne, verkaufen den dritten Theil des Dorfes Buchholz, namentlich den Hof, den ihr Vater bewohnt gehabt hatte, mit dessen Zubehörungen an Otto Sperling zu Schlagsdorf.
3) 1508. Jan. 19. (mittwoch nach Prisce.)
Die Herzoge Heinrich und Erich von Meklenburg belehnen den Otto Sperling mit dem dritten Theile des Hofes und des


|
Seite 486 |




|
Dorfes Buchholz, welchen dieser von Jörg und Claus Bekendorf gekauft hat.
4) 1541. Jan. 22. (am sonnabent na Antonii.)
Die Brüder Curt und Hans Sperling auf Schlagsdorf und Rüting überlassen ihren Vettern Volrath und Jürgen Sperling zu Schlagsdorf ihre Hälfte des Gutes Keetz, welches sie von dem Kloster Tempzin eingelöset haben, auf 20 Jahre zu gebrauchen.
5) 1543. Jan. 17. (am dage Antonii.)
Die Brüder Curt und Hans Sperling und Curts Söhne Colaban und Achim zu Schlagsdorf und Rüting verkaufen ihren Vettern Volrath und Jürgen Sperling zu Schlagsdorf und Keetz die Hälfte des Gutes Keetz und alle ihre Rechte an demselben, welches diese von dem Kloster Tempzin eingelöset haben.
6) 1552. Febr. 20.
Der Herzog Johann Albrecht von Meklenburg belehnt die Brüder Volrath und Jürgen Sperling auf Schlagsdorf und Keetz mit dem Gute Turow, welches sie von den Brüdern und Vettern Lütke Johann, Vicke, Gert, Achim und Christoph Bassewitz zu Dalwitz, Lühburg, Thorstorff und Lukow gekauft haben.
7) 1563. Febr. 4.
Leveke von Bülow, wail. Jürgen Sperlings Wittwe, gibt dem fürstlich meklenburgischen Rathe Joachim Wopersnow auf Ratztow ihre Tochter Catharina Sperling zur Ehe und verschreibt ihr zur Mitgift namentlich das Gut Schlagsdorf, unter der Bedingung, daß wenn ihre andere Tochter Anna verheirathet werden sollte, Joachim Wopersnow mit deren Bräutigam um die Güter Schlagsdorf und Keetz kaveln oder sich vergleichen solle.
8) 1563. Mai 26, (mittwoch nach Exaudi.)
Der Küchenmeister Johann Grammertin cedirt, mit Bewilligung des Herzogs Ulrich, den ihm von dem Herzoge verliehenen Domhof zu Bützow an den fürstlich meklenburgischen Hofrath Joachim Wopersnow.
9) 1563. Junii 22.
Der ehemalige Präceptor des Klosters Tempzin, Conrad (?) Detlevi, bezeugt vor Notar und Zeugen die Richtigkeit eines im J. 1556 zwischen ihm und wail. Volrath Sperling auf Schlagsdorf abgeschlossenen Vertrages wegen eines Aalfanges.


|
Seite 487 |




|
10) 1569. Jan. 17. (am dage Antonii.)
Peter Wopersnow auf Nastaw verschreibt sich seinem Bruder Joachim Wopersnow, fürstlich meklenburgischem Hofrath auf eine Schuld von 300 Gulden pommerscher Währung.
11) 1570. Mai 27.
Der Kaiser Maximilian privilegirt des verstorbenen Georg Sperling eine Tochter, Catharina, des Joachim Wopersnow Ehefrau, und ihrer beider Leibeserben mit dem Rechte, die von ihrem Vater auf sie gekommenen Lehngüter Keetz, Turow und ein Dritttheil von Buchholz, welche sie theils eingelöset, theils wieder gekauft, nach Lehnrecht erblich zu besitzen.
12) 1570. Aug. 20.
Der Kaiser Maximilian nimmt den Joachim Wopersnow und seine Frau und seine beiden Kinder, auch seiner Frauen Schwester Anna Sperling mit ihren Gütern, namentlich mit dem Hofe Keetz, in seinen und des Reiches besondern Schutz und Schirm.
13) 1571. Mai 4.
Die Herzoge Johann Albrecht und Ulrich von Meklenburg belehnen in Folge des kaiserlichen Privilegii ihren Rath Joachim Wopersnow und seine und seiner Ehefrau Catharina Sperling Leibeserben mit den Gütern Keetz, Turow und einem Dritttheil von Buchholz.
14) 1574.
Der fürstlich meklenburgische Hofrath Georg Thesmer auf Buchholz uud Jürgen von Bülow auf Zibühl, als des wailand Joachim Wopersnow hinterlassenen Wittwe und Kinder Vormünder, lassen vor Notarien und Zeugen den Brüdern und Vettern Joachim, Christoph und Curdt Sperling den kaiserlichen Schirmbrief für Joachim Wopersnow und seine Familie, vom 20. Aug. 1570, mittheilen und dieselben in Grundlage dieses Briefes von der Beeinträchtigung an dem wopersnowschen Theile des Gutes Rubow abmahnen, jedoch Vergleichung darüber anbieten.
15) 1577. Jan. 24.
Die Wittwe des Domdechanten und Raths Joachim Wopersnow übergiebt der Vormundschaft ihrer Kinder ihre und


|
Seite 488 |




|
ihres Mannes hinterlassene Güter, namentlich Keetz, Turow, Buchholz und Pentzin.
16) 1577. Jan. 25.
Rubow.
Der fürstlich pommersche Canzler Georg Thesmar, als Vormund der Kinder des wail. Domdechanten und Rathes Joachim Wopersnow, nimmt für sich und seinen Mitvormund Georg von Bülow auf Zibühl von den Gütern Dämelow und Rubow, welche früher von dem Domcapitel zu Schwerin gekauft sind, in Besitz und weiset die Unterthanen dieser Güter an die Mutter der Minderjährigen, wie es bei den andern Gütern Keetz, Turow, Buchholz und Penzin geschehen ist.
17) 1581. Nov. 3.
Das Domcapitel zu Schwerin vergleicht sich schließlich mit der Curatel der Kinder des wailand Domdechanten und Raths Joachim Wopersnow, namentlich über mehrere Geldforderungen, über die Wahl seines Sohnes Joachim Wopersnow zum Domherrn, über eine Kasel seines Vaters und über die Auslieferung der Urkunden über die Güter Dämelow und Rubow.
18) 1582. Nov. 18.
Der schweriner Domherr Otto Wackerbart tritt der Vormundschaft der Kinder des wailand Joachim Wopersnow das Gut Keetz ab.
19) 1591. Jan. 17. (am dage Antonii.)
Joachim von Bülow auf Karcheez und Dr. Friederich Heine zu Redentin, als Vormünder des jungen Joachim Wopersnow auf Turow, Sohns des verstorbenen Joachim Wopersnow auf Keetz und Turow, verschreiben sich der Ilse Klevenow zu Güstrow, Wittwe des Hieronymus Donstein, auf eine Schuld von 4500 Gulden und setzen ihr dafür die Güter Turow und Rubow zum Pfande, unter Zustimmung des Jürgen Wopersnow auf Keetz, Bruders des minderjährigen Joachim Wopersnow.
20) 1622. Jan. 17. (am tage Antonii.)
Die Vettern Henneke und Matthias von Lützow auf Eickhof verkaufen an Joachim Wopersnow das höchste Gericht in den Gütern Turow und Keetz und mehrere Geldpächte aus dem Dorfe Turow.


|
Seite 489 |




|
21) 1624. Oct. 31.
Der Herzog Adolph Friederich von Meklenburg verleihet den Erben des Jürgen Wopersnow auf Keetz und dem schweriner Domherrn Joachim Wopersnow auf Turow erblich die Fischerei auf dem halben Höffer See an der Seite des Keetzer Feldes, mit Ausnahme der großen Wadenzüge über den ganzen See, für sich und ihre Leibeserben, so daß diese Gerechtigkeit nicht aus die Sperling übergehen soll, falls diese in dem Streite über das Gut Keetz gegen die Wopersnow siegen sollten.


|
Seite 490 |




|



|



|
|
:
|
VII. Zur Rechtskunde.
Das meklenburgische Hofgericht im Mittelalter.
Ueber die ältesten Formen des fürstlichen Hofgerichts sind bisher fast gar keine Nachrichten bekannt geworden, ja selbst die Existenz desselben im Mittelalter schwebt noch im Dunkel, wärend in manchen andern Ländern, z. B. im Brandenburgischen, die Sache ziemlich klar vorliegt.
Die älteste Urkunde, welche ein fürstliches Hofgericht und dessen Verfahren nachweiset, ist vom 7. Dec. 1309 (gedruckt in Lisch Urk. des Geschl. Maltzan I, Nr. LXIX). Es wird durch dieselbe bezeugt, daß damals das Hofgericht ganz einfach vor dem Fürsten selbst an dessen Hofe und in Gegenwart und durch Hülfe der Vasallen, als "dinglûde", also nach Analogie aller übrigen Gerichte, gehalten ward, welche sich nur durch den Stand der Gerichtspersonen und die streitigen Gegenstände von jenem unterschieden.
Eine Einsetzung eines förmlichen Hofgerichts scheint erst durch den Herzog Albrecht um die Mitte des 14. Jahrhunderts erfolgt zu sein, wie sich überhaupt unter diesem Fürsten die ganze Staatsverwaltung durch seinen eigenen Geist und durch den Drang des mehr bewegten äußern Lebens fester gestaltete. Wir finden unter ihm und seinem Bruder Johann von Stargard zuerst angestellte Hofrichter. In Meklenburg erscheint zuerst von 1365 - 1391, und zwar sechs Male: 1365, 1366, 1386, 1387, 1390, 1391, der Knappe, seit 1390 Ritter Heinrich Moltke auf Westenbrügge unter dem Titel eines "Hofrichters (hoverichter, judex curiae) des Herzogs von Meklenburg" und im J. 1353 der Ritter Albrecht Warburg ebenfalls unter dem Titel eines Hofrichters des Fürsten Johann von Meklenburg=Stargard.
Eine klare Anschauung der Gerichtsverfassung giebt die im rostocker Stadtarchive entdeckte, unten mitgetheilte 1 ) Original=Urkunde vom 14. Julii 1365. Nach derselben präsidirte in dem selbstständigen Hofgerichte (" in domini nostri et nostro judicio" - - ex nostro jussu et scitu")


|
Seite 491 |




|
der genannte Heinrich Moltke als Oberhofrichter des Herzogs von Meklenburg ("judex generalis curiae domini Alberti ducis Magnopolensis") und führte zur Besiegelung des Urtheils ein eigenes Gerichtssiegel ("sigillum ad huiusmodi judicium curiae nobis per praedictum dominum nostrum ducem specialiter ad hoc datum et commissum"). Dieses Siegel, welches an der bezeichneten Urkunde hängt und Taf. I, Nr. 1, abgebildet ist, führt das herzogliche Wappen und die Umschrift:
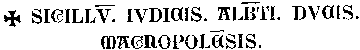
(d. i. Sigillum judicis Alberti ducis Magnopolensis: Siegel des Richters des Herzogs Albrecht von Meklenburg). Es geht aus demselben, wie aus der Urkunde, unzweifelhaft hervor, daß nicht, wie später, im Namen des Fürsten, sondern im Namen des Rechts durch den Gerichtspräsidenten Recht gesprochen ward.
Die zu der Zeit bestellten ordentlichen Assessoren oder Dingleute ("nostri in hujusmodi actu iudiciali assessores, proprie dinglude") waren zwei Vasallen: die Ritter Nicolaus von der Lühe und Gottschalk Pren, wahrscheinlich Landräthe, - die außerordentlichen Assessoren, welche die Urkunde mit besiegelten: die Vasallen, Knappen Otto von Dewitz und Hermann von der Lühe, und Johann von Baumgarten, Burgemeister, und Heinrich Vrese, Rathsherr von Rostock, da das Gericht damals in Rostock gehalten ward. Als Zeugen (Umstand) erscheinen noch 6 Vasallen und 4 rostocker Rathsherren.
So erscheint schon damals das höchste Gericht, bis auf die Zuziehung gelehrter Räthe, so vollständig und in mancher Hinsicht richtiger ausgebildet, als es sich bis auf die neuern Zeiten erhalten gehabt hat.
Eine ähnliche Urkunde vom 26. Sept. 1391 über ein zu Cröpelin gehaltenes Gericht ist schon früher in Franck A. u. N. M. VII, S. 53, und darauf in Lisch Urk. des Geschl. Maltzan II, S. 403, gedruckt. Diese Urkunde ist ebenfalls im Namen des Richters ausgestellt und mit dem Hofgerichtssiegel ("ingesegel, des ick bruke to mynes heren hoverichte to Mekelenborgh") besiegelt. Als Assessoren sind 4 Vasallen genannt; Rathmänner fehlen, da die Rathmänner von Cröpelin wohl nicht die Fähigkeit besaßen, im fürstlichen Rathe und Gerichte zu sitzen. Aus dieser Urkunde geht auch noch hervor, daß schon bestimmte allgemeine Gerichtstage ("dyngdaghe") angesetzt waren.


|
Seite 492 |




|
Die oben angeführte Urkunde vom 14. Juli 1365 ist auch des Gegenstandes wegen interessant, da sie über Besitz von Holzungen aburtheilt: es wird nämlich die Holzung zugesprochen nach der Formel "baumeshoch und baumestief", d. h. nach der Höhe, Länge, Breite und Tiefe der Bäume ("secundum altitudinem, longitudinem, latitudinem et profunditatem arboris, proprie bômeshôch vnde bômesdêp").
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Alte Ceremonien bei Erhebung von
Abgaben
und Ausübung von Gerechtigkeiten.
Der Schuhmacher Herr Friedr. Seidel zu Bützow, welcher sich sehr lebhaft für unsern Verein interessirt, hat nachstehende zwei Schilderungen von alten Gebräuchen eingesandt:
Hebungen des Amtes Rühn.
Beim Amte Rühn existirt noch folgendes alte Vermächtniß, welches früher von einer Prinzessin gestiftet sein soll. Am Tage vor Martini fährt der Landreiter mit noch einem Manne, von einem passiner Bauern gefahren, nach dem Gute Warstorf bei Schwaan; sie dürfen aber nicht vor Sonnenuntergang auf den Hof kommen. Wenn sie ankommen, muß eine Stube für sie eingerichtet sein, in welcher zwei aufgemachte Betten stehen; der Tisch muß schon gedeckt sein und Butter, Brot und Branntwein darauf stehen; der Landreiter erhält dazu eine Tonne schwaansches Bier und der Fuhrmann einen Scheffel Hafer für die Pferde. Zum Abendessen kommt Suppe, welche wieder abgetragen wird, wenn sie ihr Theil davon haben. Dann wird Rindfleisch, Kartoffeln und Pflaumen und zuletzt ein Gänsebraten aufgetragen; wenn sie hievon gegessen haben, so darf nichts wieder abgetragen werden, selbst wenn nur die Knochen übrig geblieben sind, sondern es muß alles so bis zum andern Morgen stehen bleiben, wo sie dann ihr Frühstück davon halten. Wenn sie abfahren wollen, muß der Gutsherr an den Landreiter 33 alte A. Gulden auszahlen; da solche Gulden nicht mehr vorhanden sind, so muß jeder Gulden mit 1 ßl. belegt werden. Auch muß er noch dem Landreiter so viel Rist Flachs, wie Tage im Jahr, überliefern, nämlich 365.
Von einem andern Gute in der Nähe, dessen Name mir entfallen ist, werden ihm 18 Gulden überliefert.
Der Landreiter bringt dies alles nach dem rühnschen Amte, welches unterdessen von verschiedenen Gütern in der dobbertinschen Gegend durch einen Boten eine bestimmte Summe Geldes hat


|
Seite 493 |




|
zusammenholen lassen, welches zum Theil von einzelnen Gütern nur in wenigen Schillingen besteht; auch muß das Bäcker Lützowsche Haus in Sternberg hierzu 24 ßl. zahlen.
Der Landreiter, von einem zepeliner Bauern gefahren, bringt nun alles nach dem Gymnasium in Schwerin.



|



|
|
:
|
Fischerei des Gutes Steinhagen auf dem rühnschen See.
Wie ich von alten glaubhaften Leuten zu Steinhagen erfahren, bestand vor alten Zeiten zwischen Steinhagen und Rühn die alte Gerechtigkeit, wenn im Winter der große rühnsche See zugefroren war, so gingen die Steinhäger, im Beisein des rühnschen Amtes, von ihrer Seite an den See und warfen eine Pflugschaar auf das Eis entlang; so weit nun das Eisen flog, konnten sie den Winter über fischen. Später ward dies abgeschafft, und Steinhagen erhielt dafür den kleinen See bei Schlukow, eine Meile von Steinhagen.
Bei dieser Gelegenheit kam folgender, am 9. Febr.
1763 an alle Beamten und Superintendenten
erlassener Befehl zum Berichte über die im Lande
bei Erhebung von Pächten
 . zu beobachtenden Ceremonien ins Gedächtniß:
. zu beobachtenden Ceremonien ins Gedächtniß:
Friederich von Gottes Gnaden Herzog zu Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr.
Weil seit einiger Zeit verschiedene Irrungen bey Unsrer Regierung vorgekommen sind, welche die Beobachtung gewisser Ceremonien bey Einhebung der Pächte betreffen; So sollet ihr hiemit befehliget seyn, fordersamst zu berichten:
1) Ob in Unserm euch anvertrautem Amte gewisse Pächte mit gewissen Ceremonien bey der Einhebung verknüpfet seyn, da entweder die Empfänger zu einer besondern Formalität und Gegenleistung bey der Erhebung oder auch die Pacht=Geber zu einer Neben=Prästation, oder, auch zu gewissen Feyerlichkeits=Beobachtungen, dem alten Herkommen nach, sich verpflichtet finden, und worinn
2) alle solche Feyerlichkeiten bestehen? Als welche ihr kurtz, doch verständlich, zu beschreiben habt.
An dem geschiehet Unser gnädigster Wille und Meinung.
Datum auf Unserer Vestung Schwerin, den 9ten Februar 1763.
Friederich, H. z. M.


|
Seite 494 |




|
Die in Befolgung des Befehls entstandenen Acten sind noch vollständig vorhanden. Merkwürdiger Weise enthalten sie aber fast alle nichts weiter, als den Bericht, daß - keine Ceremonien bei Erhebung von Pächten und Ausübung von Gerechtsamen beobachtet würden. Einige Male wird gesagt, daß die Einforderer von Pächten von denen, welche sie zu leisten hätten, bewirthet werden müßten.
Das einzige Bemerkenswerthe ist folgendes:
1) das Amt Neu=Bukow berichtet:
Ferner hat das zum Rostockschen Heyl. Geist gehörige Dorff Didrichshagen 22 Drt. 7 1/2 schffl. Korn allerley Gattung jährl. Termino Martini anhero zu liefern, und müssen auch diese Lieferanten , die inclus. der Fuhrleute auf 24 Persohnen ausmachen, dem Herkommen nach auf eine mahlzeit mit 4 Gerichten, als Hirse oder Reiß, Fischen, Hammelfleisch mit weißem Kohl, und Gänsebraten, und nebenher mit bier und Brandtwein, auch Toback und langen Pfeiffen tractiret werden und beim Abschiede machet der Schultz des Dorffs das compliment: daß Er sich für die Ehre bedancke, die Ihm zukomme. Wogegen man Ihm erwiedert, daß es nur eine Höfflichkeit sey.
2) Das Amt Wredenhagen berichtet:
a. Muß das in der Chur Mark Brandenburg belegene Dorff Röggelin, ohnweit Ruppien, Vier Tonnen Ruppiener Bier liefern.
Dieses Bier ist vor dem, am ersten Pfingst=Morgen, und NB. der Schuldigkeit nach vor Sonnen Aufgang aufs Ambt geliefert worden. Der damahlige Beambte aber Klentz, hat eine Verenderung des Tages vorgenommen, und solches darinn, daß die zwy Wagen, welche gedachtes Bier gebracht, sowol den Tag vor den Fest (da dis Dorff Röggelien 4 Meiln vom Ambte entlegen) alß auch den ersten Festtag fahren mußen, und hat solches auf den Freytag vor Pfingsten gesetzet, und so wird solches noch jetzo geliefert.
Bey geschehener Lieferung, ist und wird denen Lieferern zuforderst Brandtwein gereichet, sodann werden die Tonnen angestochen, und die Probe vom Bier abgezapfft, auch wol denen Ambts Leuten zu probiren gegeben, ob es gut sey. Wann nun solches vor gut erkant, so wird denen Bringern eine Suppe gemacht von diesen Bier, hiernechst bekommen solche wol einen Pfankuchen, und ein Gericht Fische, welches dieselben verzehren und reisen so dan wieder ab.
b. Aus dem Mecklenb. Dorffe Grabow, mußen gesambte Bauren, um Martini, und Fast Nacht, holtz aufs Ambt fahren, auch gewiße Kämpe Acker bestellen, solche Ackern säen, mähen


|
Seite 495 |




|
und einfahren, bey Jeder Art Arbeit, und wenn solche vollendet, bekommen sie Brodt, Fische und 1/2 Tonne Bier.
Auch mußen diese Grabower Bauren Jährlich den Tag vor Pfingsten, zwey Lauberhütten, auf Stellen die Ihnen angewiesen werden, bauen, und werden dabey mit Fische, Brod, und 1/2 Tonne Bier gespeiset und getränket.
c. Aus denen Dobbertienschen Kloster Dörffern, Sietow, Loeitz, Schwartz und Diemitz, werden gewiße Korn Pächte Ochsen, Schaaffe und Rauchhüner, Jährlich abgegeben, und werden die Bringer mit Erbsen gespeiset, auch wird denenselben wol ein von den gebrachten Schaafen geschlachtet, und aufgegeßen.
d. Aus denen Märckchen Dörffern, Sevekow, Dranse und Berlienken., mußen gewiße so genante Ablager Brodte, eine Kleine Anzahl Rüben, und gewißes so genantes Peitschen Geld gegeben, aber dieses muß von Amts Bedienten, aus Jeden Dorffe abgeholet werden.
3) das Amt Rehna berichtet:
Daß im hiesigen Ambte obwoll keine Pächte mit gewißen Ceremonien bei der Einhebung verknüpffet sein - - - - - Es wäre dann, daß hirunter dasjenige alte Herkommen und Verbindlichkeit hiesigen Ambtes gerechnet werden könte, nach welchem daßelbe jährlich die von 6 Schffl. Weitzen gebackene und aus Mehl und Waßer zubereitete Kuchen am Char=Freitage nach Lübeck absendet, und daselbst unter die Persohnen des Magistratus austheilen läßet wobei den Empfängern gleichwohl keine Gegen=Leistung oblieget, die Einlieferung der Kuchen auch durch einen mitgesandten Menschen ohne aller Formalitaet geschiehet.



|



|
|
:
|
Huldigungsplatz zu Cölpin
im Lande Stargard.
Bekanntlich huldigten die Stände des Landes Stargard auf dem ritterschaftlichen Gute Cölpin bei Stargard. Dicht vor dem Kirchhofe zu Cölpin, zwischen der Kirchhofspforte und der Straße ist ein großer viereckiger Platz mit alten Linden umpflanzt. Der Sage und auch dem Anschein nach soll diese Stelle der Huldigungsplatz gewesen sein. Auch sagt der Hofmeister Claus Josias von Behr: "Im Stargardischen ward zu Kölpin unter der Linde am Kirchhofe Musterung gehalten".
G. C. F. Lisch.


|
Seite 496 |




|



|



|
|
:
|
VIII. Zur Naturkunde.
Rennthiere in Meklenburg.
Es dient nicht allein zur Förderung der einzelnen Zweige der Naturwissenschaft, sondern auch zur Belebung der Geschichte, wenn man weiß, welche Thiere in den ältesten Zeiten der menschlichen Cultur in den Ländern gelebt haben; es kann hiebei entweder von noch in den Ländern lebenden, oder von dort ausgestorbenen Thiergattungen die Rede sein: letztere mögen hier allein zur Sprache kommen. Daß das Elen und der Auerochs früher in Meklenburg gelebt haben, ist durch häufige Auffindung von Gerippen und Gehörnen, über welche auch unsere Jahrbücher wiederholt Bericht erstatten, außer Zweifel; in der deutschen Sage, z. B. in den Nibelungen, kommen beide Thiere auch noch als vorzügliche Jagdthiere vor. Ob das Rennthier in den deutschen Ostseeländern gelebt habe, ist eine bisher noch nicht bestimmt zu beantwortende Frage, da es noch sehr an Material zur Lösung derselben fehlt; es soll jedoch hiedurch die Frage mehr, als bisher geschehen ist, angeregt werden. Der Herr Professor Nilsson in Lund ist der Meinung, daß das Rennthier in alten Zeiten auch in Deutschland gelebt habe; er unterrichtete mich über den Unterschied der Geweihe ähnlicher Thiere, im Interesse der Wissenschaft dringend weitere Nachforschungen wünschend. Nach Vergleichung aller seit 10 Jahren zur Vereinssammlung eingegangenen Geweihe ist eines wohl unzweifelhaft ein Rennthiergeweih, nämlich das im Jahresber. III., S. 114 - 115 aufgeführte, zu Gerdshagen bei Güstrow 24 Fuß tief in der Modde gefundene halbe Geweih. Das Geweih ist ganz glatt, die 2 1/4 Fuß lange Stange ohne Zacken, außer in einer Höhe von 1/2 Fuß mit einem kleinen Auswuchse von ungefähr 3 Zoll Länge, und endigt ohne Verzweigung in eine jetzt abgebrochene Schaufel. Die völlige Glätte der Oberfläche des Geweihes spricht bestimmt für ein Rennthiergeweih.
G. C. F. Lisch.