

|




|



|
|
|
- Hünengrab bei Prieschendorf
- Hünengrab bei Pampow
- Kegelgräber bei Gallentin
- Kegelgrab bei Pampow (bei Schwerin)
- Kegelgräber bei Borkow
- Kegelgräber bei Lelkendorf
- Grabalterthümer von Eickhof, Amts Sternberg
- Grabalterthümer von Ludwigslust
- Metallbeschlag eines Hifthornes
- Römisches Grab von Bibow bei Warin (Vgl. Jahresber. I, S. 93, 94)
- Wendenkirchhof zu Camin bei Wittenburg
- Zweiter Begräbnißplatz zu Camin bei Wittenburg
- Wendische Begräbnißurne von Malchin
- Taufbecken
- Münzensammlung
- Blocksberge in Meklenburg
- Der Taufstein aus der Döpe bei Hohen-Vicheln
- Die Glocke zu Camin
- Leichenstein in der Kirche zu Camin
- Leichenstein unter dem Portal der Schloßkirche zu Schwerin
- Reliquien-Urne zu Wismar
- Andeutungen über die altgermanischen und slavischen Grabalterthümer Meklenburgs und die norddeutschen Grabalterthümer aus der vorchristlichen Zeit überhaupt
Jahresbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Verhandlungen des Vereins
herausgegebenvon
A. Bartsch,
Prediger an der großherzoglichen
Irrenheilanstalt Sachsenberg bei Schwerin,
correspondirendem Mitgliede der Gesellschaft
für pommersche Geschichte und
Alterthümskunde, der
schleswig=holstein=lauenburgischen
Gesellschaft für vaterländische Geschichte
und des altmärkischen Vereins für
vaterländische Geschichte und
Industrie,
als
zweitem Secretair
des Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde.
Zweiter Jahrgang.
Mit zwei lithographirten Tafeln.
Auf Kosten des Vereins.

In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung zu Rostock und Schwerin.
Schwerin, 1837.


|




|


|
[ Seite I ] |




|
Inhaltsanzeige.
Erster Theil.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
| S. | |
| 1. Angehörige des Vereins | 1 |
| 2. Finanzielle Verhältnisse | 5 |
| 3. Verfassung und Verwaltung | 8 |
| 4. Versammlungen | 9 |
| 5. Domestica | 10 |
Zweiter Theil.
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
| 1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler. | |
| A. Sammlung von Schriftwerken | |
| I. Bibliothek | 12 |
| II. Sammlung meklenb. typographischer Alterthümer | 22 |
| III. Urkunden=Sammlung | 23 |
| IV. Sammlung anderer älterer Handschriften | 24 |
| B. Sammlung von Bildwerken. | |
| I. Grabalterthümer, Geräth, Waffen u. dgl. | |
| 1. Aus vorchristlicher Zeit. | |
| A. Aus der Zeit der Hühnengräber | 25 |
| B. Aus der Zeit der Kegelgräber | 35 |
| C. Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse | 53 |
| 2. Aus unbestimmter alter Zeit | 76 |
| 3. Aus dem Mittelalter | 78 |
| 4. Aus der neuern Geschichte | 85 |
| II. Geognostische Merkwürdigkeiten und andere seltene Naturalien | 85 |
| III. Pläne, Charten, Ansichten und Bildnisse | 86 |
| IV. Münzensammlung | 86 |


|
Seite II |




|
| S. | |
| C. Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art. | |
|
I.
Nachrichten von vorchristlichen
Grabdenkmälern
|
105 |
| II. Nachrichten von andern alten merkwürdigen Stätten | 110 |
| III. Nachrichten von alten Bildwerken | 114 |
| IV. Nachrichten von alten Schriftwerken | 123 |
| D. Vorbereitende Arbeiten, Actenstücke und Schriften für die Aufgrabungen des Vereins | 125 |
| I. Großherzoglich meklenburg=schwerinsche Verordnungen zum Schutz und zur Rettung vaterländischer Alterthümer | 128 |
| II. Großherzogl. meklenburg=schwerinsches Rescript wegen Gestattung von Aufgrabungen im Domanium für den Verein | 130 |
|
III.
Andeutungen über die altgermanischen und
slavischen Grrabalterthümer Meklenburgs
|
132 |
| IV. Instruction für Aufgrabungen, entworfen von der Aufgrabungs=Deputation des Vereins f. m. G. u. A. | 148 |
| 2. Bearbeitung des historischen Stoffes. | |
| A. Gelieferte Arbeiten | 157 |
| B. Angeregte und vorbereitete Arbeiten | 160 |
| C. Unterstützte und empfohlene Arbeiten außerhalb des Vereins | 165 |
| Anhang. Erklärung der am Ende des Berichts befindlichen lithographirten Tafel | 167 |
| Verzeichniß einiger im I. Jahrgange des Jahresberichts befindlichen Druckfehler. |



|




|


|




|



|
[ Seite 1 ] |




|
Erster Theil.
Aeußere Verhältnisse des Vereins.
I. Angehörige des Vereins.
I n den allermeisten Beziehungen hat ein ungemein günstiges Geschick über dem zweiten Lebensjahre des Vereins gewaltet, und alle folgenden Rubriken des gegenwärtigen Berichts werden nur Erfreuliches zu melden haben. Bloß diese erste bezeichnet, neben ansehnlichem Gewinne, auch mehr als einen schwerer Verlust. Um gleich den allerschmerzlichsten zu nennen, so verlor der Verein durch den Tod des allerdurchlauchtigsten Großherzogs Friederich Franz einen Protector, der, schon lange vor dem Auftreten des Vereins ein warmer Freund und ein treuer, sorgsamer Pfleger des vaterländischen Alterthums, auch dem später auf dieselbe Bahn getretenen die ehrendste Anerkennung, die huldvollste Theilnahme und die kräftigste Unterstützung angedeihen ließ, und so, wie in vielen andern großartigen Zeugnissen, in dem Vereine selbst ein hoffentlich langdauerndes Denkmal Seiner Liebe zu Meklenburgs Geschichte Sich stiftete, 1 ) Zum Glücke sind, wie diese Liebe, auch jene wohlwollenden Gesinnungen für den Verein auf den erhabenen Nachfolger des Betrauerten fortgeerbt, wie das nachstehende Cabinets=Rescript des jetztregierenden allerdurchlauchtigsten Großherzogs von Meklenburg=Schwerin bezeugt:


|
Seite 2 |




|
"Wir sagen dem Ausschuß des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde Unsern aufrichtigen Dank für das in dem Schreiben vom 3ten d. M. Uns bezeigte Beileid über den Uns betroffenen, tiefbetrübenden Verlust, so wie für den gleichzeitig Uns ausgesprochenen Glückwunsch. Das Uns angetragene Protectorat dieses schätzbaren Vereins nehmen Wir hiemit um so lieber an, da die Förderung vaterländischer Litteratur Uns stets angelegen, das Studium vaterländischer Geschichte uns stets erfreulich sein wird. Wir wünschen, daß der Verein mit dem schon bewährten regen Eifer sein schönes Ziel ferner verfolgen möge, und versprechen gern Unsere Mitwirkung hiezu.
Schwerin, den 6ten März 1837.
Und somit darf der Verein die zuversichtliche Hoffnung hegen, daß auch in Zukunft, nur unter den Auspicien eines andern Namens, dieselbe Huld von dem einen Throne Meklenburgs auf ihn ausströmen werde, welche von seinen ersten Anfängen an von dorther ihm zu Theil ward und die von dem zweiten Throne dieses Landes aus unter demselben Namen und in unverminderter Stärke ununterbrochen sich ihm bewähret hat.
Die Reihe der hohen Beförderer ward gleich nach der vorig jährigen General=Versammlung durch den regierenden Fürsten von Schaumburg=Lippe verstärkt, ein Gewinn, welchen nicht bloß der Umstand, daß Se. Durchlaucht in Meklenburg reich begütert sind, sondern mehr noch Höchstdessen lebhaftes, vielfach bewährtes Interesse für die Alterthumskunde als einen sehr bedeutenden und höchst erfreulichen betrachten läßt. Das Schreiben, welches die Genehmigung der vom Ausschusse dieserhalb vorgetragenen Bitte brachte, spricht zugleich die anerkennendsten, wohlwollendsten Gesinnungen für den Verein aus, Gesinnungen, deren Ausdruck später bei Gelegenheit des Dankes für die übersandten Druckschriften aufs huldvollste erneuert und deren Ernst durch ein den Dank begleitendes ansehnliches Geldgeschenk bethätigt ward. Auch von andern hohen Beförderern empfing der Verein in derselben Veranlassung freundlich dankende und anerkennende Worte.
Die Zahl der Ehrenmitglieder, welche von der vorigen Jahres=Versammlung durch die, freundlich genehmigte, Ernennung des königlichen Ober=Präsidenten der Provinz Pommern, Herrn von Bonin zu Stettin, auf 6 erhöht ward, sieht sich jetzt, in Folge von zwei schnell nach einander eingetretenen äußerst


|
Seite 3 |




|
betrübenden Todesfällen, auf 4 reducirt. Die Namen von Plessen (großherzoglich meklenburg=schwerinscher Geheimeraths= und Regierungs=Präsident, starb am 25. April 1837) und von Oertzen (großherzoglich meklenburg=strelitzischer Staatsminister, starb am 3. April 1837) sind mit den unauslöschlichen Zügen ausgezeichneter Verdienste in die Geschichtstafeln der beiden nahe verwandten und verbundenen Staaten eingegraben, denen ihre Träger mit so viel Treue und mit so viel Erfolg ihr Leben widmeten, und deren aufrichtige, allgemeine Trauer um sie ihre beste Lobrede ist: auch in unserm Vereine haben sie sich durch zahlreiche und große Wohlthaten ein bleibendes Gedächtniß gestiftet.
Was den Verkehr unsers Vereins außerhalb Meklenburgs betrifft, so hat auch in dieser Beziehung das verflossene Jahr großes Glück gehabt. Hier kann zunächst nur von der Erweiterung jenes Verkehrs die Rede sein: die Früchte desselben werden an andern Stellen des Berichts ihren Platz finden. Es wurden neue Verbindungen angeknüpft mit dem thüringisch=sächsischen Verein, mit dem voigtländischen alterthumsforschenden Verein und mit der königlichen schleswig=holstein=lauenburgischen Gesellschaft für Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, und damit zugleich ein Austausch der gegenseitigen Druckschriften eingeleitet. Auch die Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Zürich hat unserm Verein Correspondenz und Schriften=Austausch angetragen und mit Einsendung des ersten Heftes ihrer "Mittheilungen" den willkommenen Anfang gemacht; von unsrer Seite wird nicht gesäumt werden, einem so freundlichen Entgegenkommen freundlichst zu begegnen.- Zu correspondirenden Mitgliedern wurden ernannt:
1. Herr Professor Barthold zu Greifswald,
2.
- Etatsrath Falck zu Kiel,
3. -
Regierungs=Referendar A. von Minutoli zu
Berlin,
4. - Oberbibliothekar Schröder zu
Upsala, und
5. - Canzleirath Thomsen zu Kopenhagen.
Es schied aus dem Kreise der gelehrte schwedische Forscher, Reichsantiquar Liljegren zu Stockholm, den vor kurzem der Tod der Wissenschaft entriß. Danach beträgt die gegenwärtige Zahl der correspondirenden Mitglieder 48.
Als ordentliche Mitglieder sind im Laufe des zweiten Jahres folgende Personen (nach chronologische Ordnung) dem Verein beigetreten:
| 1. | Herr | Cand. juris und Archivgehülfe Glöckler zu Schwerin. |
| 2. | - | Hofrath und Prosessor Dr. Norrmann zu Rostock. |


|
Seite 4 |




|
| 3. | Herr | Doctor juris Sprengel zu Rostock. |
| 4. | - | Kammer=Ingenieur Zeller zu Güstrow. |
| 5. | - | Oberlehrer Weber zu Schwerin. |
| 6. | - | Canzlei=Fiskal, Hofrath Tolzien zu Schwerin. |
| 7. | - | Gutsbesitzer Cleve auf Karow. |
| 8. | - | Hofrath Dr. Crull zu Rostock |
| 9. | - | Bürgermeister, Hofrath Engel zu Röbel. |
| 10. | - | Bataillons=Auditeur Grimm zu Wismar. |
| 11. | - | Hauptmann a. D. von Restorff zu Bützow. |
| 12. | - | Auditor von Schöpffer zu Bützow. |
| 13. | - | Canzleirath von Bernstorff zu Bützow (jetzt Regierunasrath zu Neustrelitz) |
| 14. | - | Criminalrath von Bülow zu Bützow. |
| 15. | - | Criminalrath von Wick zu Bützow. |
| 16. | - | Hofrath, Advocat Ehlers zu Bützow. |
| 17. | - | Rector zur Nedden zu Bützow. |
| 18. | - | Criminalsecretär Reinnoldt zu Bützow. |
| 19. | - | Auditor Schlaaff zu Bützow. |
| 20. | - | Senator Drechsler zu Bützow. |
| 21. | - | Freiherr von Gloeden zu Bützow. |
| 22. | - | Stiftsprediger M. Carlstedt zu Bützow. |
| 23. | - | Cantor und Organist Fust zu Bützow. |
| 24. | - | Amtsarzt Dr. Rüst zu Grabow. |
| 25. | - | Apotheker Stockfisch zu Zarrentin. |
| 26. | - | Porträtmaler Fischer zu Schwerin. |
| 27. | - | Pensionär Rettich zu Rosenhagen. |
| 28. | - | Professor und Director Dr. Bachmann zu Rostock. |
| 29. | - | Doctor medicinae Löwenthal zu Grabow. |
| 30. | - | Probst M. Genzken zu Ratzeburg. |
| 31. | - | Stallmeister und Kammerherr von Boddien zu Ludwigslust. |
| 32. | - | Actuarius Paepcke zu Lütgenhoff. |
| 33. | - | Hofpostmeister Lingnau zu Neustrelitz. |
| 34. | - | Kammer= und Jagdjunker von Bülow zu Golchen. |
| 35. | - | Kammerherr von Vieregge auf Steinhausen zu Wismar. |
| 36. | - | Pastor Bauer zu Rehna. |
| 37. | - | von Behr auf Renzow. |
| 38. | - | Advocat Schwerdtfeger zu Schwerin. |
| 39. | - | Pensionär Schubart zu Gallentin. |
| 40. | - | Instructor Willebrand zu Schwerin. |
| 41. | - | Erblandmarschall Baron von Maltzan auf Burg Penzlin. |
Von diesen überlebte indessen der Hofrath und Professor Dr.


|
Seite 5 |




|
Norrmann zu Rostock den Empfang des Diploms nur um eine kurze Zeit, und es beträgt also der noch verbliebene Zuwachs dieses Jahres 40 Personen. Laut des ersten Jahresberichts belief sich die Zahl der damaligen ordentlichen Mitglieder auf 295. Von diesen hat der Verein späterhin 7 verloren, darunter 3 (den Geheimen Medicinalrath Dr. von Hieronymi zu Neustrelitz, den Hofrath Löscher zu Neustadt und den Landrath von Oertzen auf Brunn) durch den Tod. Es bleiben also aus dem ersten Jahre 288 und als neuer Erwerb des zweiten 40, zusammen 328 ordentliche Mitglieder.
Fassen wir die sämmtlichen Titel, unter welchen der Verein Angehörige besitzt, zusammen, so gestaltet sich die Zahlen=Uebersicht des ganzen gegenwärtigen Bestandes (mit Ausschluß der correspondirenden Vereine) folgendermaßen:
| I. | Protectoren | 2. |
| II. | Hohe Beförderer | 7. |
| III. | Ehrenmitglieder | 4. |
| IV. | Correspondirende Mitglieder | 48. |
| V. | Ordentliche Mitglieder | 328. |
| ----- | ||
| Summe aller Angehörigen des Vereins | 387. | |
2. Finanzielle Verhältnisse.
Wie blühend die finanziellen Verhältnisse des Vereins sind und wie im Einzelnen dieselben während des zweiten Jahres sich gestaltet haben, das zeigt die folgende, vom Berechner des Vereins, Herrn Canzleirath Faull, eingereichte Uebersicht der Einnahmen und Ausgaben.



|
Seite 6 |




|



|
Seite 7 |




|

Werden nun hievon auch die schon zum dereinstigen
Druck der meklenburgischen Regesten angewiesenen
Gelder, für jetzt 250
 ., und die zur Unterstützung der
meklenburgischen Urkunden=Sammlung des Herrn
Archivars Lisch bestimmten 100
., und die zur Unterstützung der
meklenburgischen Urkunden=Sammlung des Herrn
Archivars Lisch bestimmten 100
 . Gold als nicht mehr disponibel in
Abzug gebracht, so bleiben dennoch sehr ansehnliche
Mittel zu ferneren Unternehmungen und Verausgabungen
für das nächste Jahr zur Disposition des Vereins
. Gold als nicht mehr disponibel in
Abzug gebracht, so bleiben dennoch sehr ansehnliche
Mittel zu ferneren Unternehmungen und Verausgabungen
für das nächste Jahr zur Disposition des Vereins
1) Die Druckkosten für den zweiten Jahrgang der Jahrbücher und Jahresberichte sind hierin nicht mitbegriffen, sondern kommen, da einem Beschlusse des Ausschusses gemäß diesmal beide Schriften erst nach der General=Versammlung ausgegeben werden, für das Rechnungsjahr vom 1. Julius 1837/38 in Ansatz.


|
Seite 8 |




|
gestellt, ungerechnet die eigene Einnahme eben dieses Jahres. Und gewiß liegt es nicht im Zwecke des Vereins, ein Kapital=Vermögen anzuhäufen (die oben angeführten "belegten Kapitalien" bestehen einem großen Theile nach aus den für die Regesten und die Urkunden=Sammlung zurückgelegten Geldern, welche man, bis zu ihrer wirklichen Verwendung, nicht ganz ungenützt wollte liegen lassen), vielmehr legt er seine Einkünfte ohne Zweifel am besten an, wenn er sie unmittelbar im Dienste der Wissenschaft, für welche er arbeitet, verwendet. Indessen ist es doch auch rathsam, für etwanige unvorhergesehene Nothfälle und für nicht minder unvorherbestimmbare Gelegenheiten zu bedeutenden Erwerbungen und Unternehmungen einen Reservefonds zu behalten: denn die schlimmste aller Krankheiten, an welchen Gesellschaften wie die unsrige laboriren können, ist der Geldmangel. Beide Rücksichten werden denn auch im nächsten Jahre, wie bisher, bei der Verwendung der Geldmittel den Ausschuß leiten.
3. Verfassung und Verwaltung.
In der Verfassung unsers Vereins ist keinerlei Veränderung vorgenommen oder als nöthig ernannt worden, vielmehr haben die Statuten auch während des zweiten Jahres ihrer Wirksamkeit in jeder Hinsicht aufs beste sich bewährt.
Ebenso wenig hat das Verwaltungs=Personal einen Wechsel erfahren, sondern alle diejenigen, welche beim Beginne dieses Jahres den Ausschuß bildeten, haben bis zum Schlusse desselben ihre Functionen fortgeführt. Auch die jüngste, diesjährige General=Versammlung brachte, mit einer einzigen Ausnahme, keine Veränderung in dieser Hinsicht, indem sowohl die von einer Wahl unabhängigen beiden Herren Präsidenten und der in demselben Verhältniß stehende Herr Aufseher der Münzensammlung ihre Bereitwilligkeit zur Beibehaltung ihrer resp. Würden und Aemter freundlichst erklärten, als auch die übrigen Beamten durch Acclamation bestätigt, endlich drei der bisherigen Repräsentanten wieder gewählt wurden; nur der Herr Hofrath Holm erklärte zum Bedauern der Versammlung, anderweitiger Geschäfte wegen nicht länger dem Ausschusse angehören zu können, und an seine Stelle ward durch Stimmenmehrheit Herr Instructor Willebrand berufen. Für das nächste Jahr besteht also der Ausschuß aus folgenden Personen:
Se. Excellenz der Herr Regierungs=Präsident und
Minister von Lützow, Präsident des Vereins.
Herr Regierungsrath von Oertzen, Vice=Präsident.


|
Seite 9 |




|
Herr Archivar Lisch, erster Secretär.
Pastor
Bartsch, zweiter Secretär.
Herr Hofbuchdrucker
Bärensprung, Bibliothekar.
-
Geschichtsmaler Schumacher, Antiquar.
-
Canzleirath Faull, Rechnungsführer.
-
Schloßhauptmann und Kammerherr von Lützow,
Repräsentant.
- Oberlehrer Reiz,
Repräsentant.
- Director Dr. Wex,
Repräsentant.
- Instructor Willebrand, Repräsentant.
4. Versammlungen.
Auch in diesem Jahre hielt der Ausschuß regelmäßig seine Monats= und Quartal=Versammlungen, von welchen letzteren die 3 im Laufe desselben erschienenen Quartalberichte die Ergebnisse veröffentlichten. Die diesjährige General=Versammlung fand nach Vorschrift der Statuten am 11ten Julius zu Schwerin statt, und zwar im großherzoglichen Schlosse daselbst. Es hatten sich außer einer beträchtlichen Anzahl in Schwerin wohnender auch vom Lande und aus Rostock, Wismar, Schönberg und Lübeck Mitglieder eingefunden. Nachdem der Herr Präsident die Versammlung durch einige einleitende Worte eröffnet hatte, verlas der zweite Secretär den Jahresbericht, in welchen die übrigen Beamten an den geeigneten Stellen ihre Special=Berichte und Verzeichnisse, auch der Herr Rector Masch aus Schönberg seinen Bericht über den bisherigen Fortgang der Regesten (s. unten "angeregte und vorbereitete Arbeiten"), einlegten. Nachdem sodann die Erneuerung und theilweise Ergänzung des Ausschusses vorgenommen war und das oben angegebene Resultat geliefert hatte, ward der Versammlung der vom Herrn Dr. phil. Burmeister zu Wismar eingesandte Plan einer Sammlung und Erklärung der slavischen Ortsnamen in Meklenburg (s. unten "angeregte und vorbereitete Arbeiten") vorgetragen und den Mitgliedern zur Theilnahme und Unterstützung empfohlen. Hieran reihten sich mehrere Geschenke von Schrift= und Bildwerken, welche einige der Anwesenden im eigenen oder im Namen Abwesender überreichten, Mittheilungen über die "Blocksberge" in Meklenburg und andere interessante Gegenstände (was alles unter den betreffenden Rubriken des zweiten Theils seine nähere Erwähnung finden wird), u. dgl. m. Hierauf ward die Versammlung von dem Herrn Präsidenten mit einem Abschiedsworte entlassen und begab sich nun in denjenigen kleineren Theil des Vereins=Locales, in welchem die Bibliothek und die Alterthümer zur Zeit noch


|
Seite 10 |




|
aufgestellt sind und auch die Münzensammlung von dem Aufseher derselben für diesen Tag ausgestellt war. Das hier Vorhandene und Geschaute gab längere Zeit zu vielseitiger Unterhaltung und Besprechung Stoff. Am Abend vereinigten sich die meisten Mitglieder, welche an der General=Versammlung Theil genommen hatten, und noch einige andere, welche diese zu besuchen behindert gewesen waren, zu einem Mahle, welches von der Freude über das bisherige Gedeihen des Vereins gewürzt, durch eine frische Unterhaltung und mehrfache Toasts belebt wurde und gewiß nicht verfehlt hat, die Mitglieder, namentlich die auswärtigen den einheimischen, näher zu bringen und manches Streben im Interesse des Vereins durch persönliche Besprechung anzuregen oder zu fördern, ein Erfolg, welcher ja einer der Hauptzwecke der General=Versammlung und gewiß wo er erreicht wird, ein großer Gewinn ist.
5. Domestica.
Die baulichen Reparaturen und Veränderungen, welche auf Veranstaltung des großherzoglichen Hofmarschallamts in dem großen zum Vereins=Locale gehörigen Saale unternommen wurden, um denselben nicht bloß wohnlich und seinem künftigen Zwecke entsprechend einzurichten, sondern auch in würdiger, einfach edler Gestalt wiederherzustellen und von manchen Verunzierungen früherer Zeit zu befreien, sind ihrer Vollendung ganz nahe gerückt, und binnen kurzem wird sich der Verein, wie schon früher in den Besitz, so nun auch in den vollständigen Gebrauch seines ganzen schönen Locales gesetzt sehen. - In der Person des Hofküsters Buchheim, dessen Aufenthalt im Schlosse in unmittelbarer Nähe des Vereinslocales und dessen Charakter ihn aufs beste zu einem solchen Posten zu qualificiren schienen (eine Voraussetzung, welche durch die zeitherige Erfahrung vollkommen bestätigt ward), bestellte der Ausschuß dem Locale einen Custos, der, gegen eine billige Gratification, die Beaufsichtigung und Reinhaltung desselben, die Bewachung der Sammlungen, die Umherführung der Besuchenden, so wie ähnliche Geschäfte mehr zu besorgen und über das alles eine genaue Instruction erhalten hat. - Eine große neue Vergünstigung zu den vielen schon früher empfangenen ist dem Vereine vom großherzoglichen Hofmarschallamte durch die unterm 31. October v. J. bewilligte unentgeldliche Heizung des zu dem Locale gehörigen Arbeitzimmers an zwei Wochentagen, welche sich am besten zu Arbeitszeiten für die in demselben beschäftigten Beamten zu eignen schienen, zu Theil geworden. Ueberhaupt hatte der


|
Seite 11 |




|
Verein fortwährend, und so oft sich Gelegenheit dazu bot, von Seiten höchster und hoher Behörden der bereitwilligsten Unterstützung und Förderung sich zu erfreuen, und der Bericht wird in dem die Aufgrabungen betreffenden Abschnitte noch weitere Beläge hiefür zu nennen und zu rühmen haben.
Das große Siegel des Vereins ist nunmehr in Stahl gravirt worden und hat eine solche Einrichtung erhalten, daß es in eine Presse eingeschroben und in Oblaten abgedrückt werden kann. Der Ausschuß, um das Verdienst einer solchen Arbeit einem vaterländischen Künstler zuzuwenden, übertrug dieselbe dem Herrn Hofgraveur Jonas zu Güstrow, und glaubt nur gerecht gewesen zu sein, wenn er zu dem bedungenen sehr mäßigen Honorar noch den Ausdruck seines Dankes für das wohl gelungene Werk fügte.


|
[ Seite 12 ] |




|
Zweiter Theil.
Thätigkeit des Vereins für die Erreichung seiner Zwecke.
1. Sammlung und Aufsuchung historischer Denkmäler.
E ine sehr erfreuliche und erfolgreiche Thätigreit hat der Verein während des zur Rechenschaft stehenden Zeitraums auf diesem Theile seines Arbeitsfeldes entwickelt. Nicht bloß haben einzelne Mitglieder und Gönner unablässig sich beeifert, seine Sammlungen zu vermehren, seinen Vorrath von Nachrichten über Gegenstände des vaterländischen Alterthums mit interessanten Notizen zu bereichern und seine Unternehmungen für weitere Erforschung dieses noch so große Ausbeute verheißenden Gebietes auf mannichfache Weise zu fördern, sondern auch der Ausschuß ist sorgfältig bemüht gewesen, die ihm zu solchem Zwecke zu Gebote stehenden Mittel und dargebotenen Gelegenheiten zum möglichsten Vortheil des Vereins anzuwenden und zu benutzen, wiewohl dennoch die Verausgabungen dieser Art die von dem Etat dieses Jahres für die Sammlungen ausgesetzte Summe bei weitem nicht erreicht haben.
A. Sammlung von Schriftwerken.
I. Bibliothek
(Nach dem vom Bibliothekar des Vereins, Herrn Hofbuchdrucker Bärensprung, der General=Versammlung vorgelegten Verzeichnisse. Die Nummern schließen sich an die des vorigjährigen Verzeichnisses an. Vgl. Jahresber. I. S. 73-87.)
- Alberti, Abbatis Stadensis, Clironicon etc. Helmaestadii 1587. 4. (Geschenk des Herrn Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
- 219. Alberti, Variscia. Mittheilungen aus dem Archive des Voigtländischen alterthumsforschenden Vereins. 2te Lie=


|
Seite 13 |




|
ferung 1830. 3te Lieferung 1834. 8. [Dabei: Statuten und Bücherverzeichniß des Vereins.] (Geschenk des V. a. Vereins.)
- M. F. Arendt, Großherzoglich Strelitzisches Georgium. Nord=Slawischer Gottheiten und ihres Dienstes. Minden 1820. 4. (Geschenk des Hrn. Archivars Lisch.)
- K. F. L. Arndt, Das Zehntenregister des Bisthums Ratzeburg aus dem 13. Jahrhundert, nach der Urschrift abgedruckt. Mit Bemerkungen. Schönberg 1833. 4. (Geschenk des Hrn. Rectors Masch in Schönberg.)
-
M. T. Arnkiel's Außführliche Eröffnung was es
mit der Cimbrischen und Mitternächtl. Völker
 . ihrem Götzendienst
. ihrem Götzendienst
 . eine Bewandtniß gehabt, und was
von derselben Antiquitäten noch hin und wieder
zu finden sei
. eine Bewandtniß gehabt, und was
von derselben Antiquitäten noch hin und wieder
zu finden sei
 . [Auch: Der Uhralten
Mitternächtl. Völker Leben, Thaten und
Bekehrung.] In 4 Theilen beschrieben und mit
vielen Kupffer=Stücken beleuchtiget. Hamburg
1703. 4.
. [Auch: Der Uhralten
Mitternächtl. Völker Leben, Thaten und
Bekehrung.] In 4 Theilen beschrieben und mit
vielen Kupffer=Stücken beleuchtiget. Hamburg
1703. 4.
- H. W. Bärensprung's Versuch einer Geschichte des Theaters in Meklenburg=Schwerin. Von den ersten Spuren theatralischer Vorstellungen bis zum Jahr 1835. Schwerin 1837. 8. (Geschenk des Verf.)
- 225. Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. 3ten Jahrgangs 2tes Heft. 4ten Jahrgangs 1stes Heft. Stettin 1837. 8. (Geschenk der G. f. P. G. u. A.) [M. s. Nr. 11-14.]
- Beehr, Rerum Meclenburgicarum libri octo etc. Lipsiae 1741. fol. (Geschenk des Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
- Joh. Berckmann's Stralsundische Chronik. A. d. Handschriften herausgegeben von Dr. G. Ch. F. Mohnike und Dr. E. H. Zober. 1r Thl. Stralsund 1833. 8. (Geschenk des Hrn. Consistorialraths Dr. Mohnike in Stralsund.)
-
Bericht, gegründeter, eines Fürstl. Meklenb.
Theologi von jetzt vorwaltender
Landes=Kirchen=Verwirrung
 . Rostock und Neubrandenburg 1738. 4.
. Rostock und Neubrandenburg 1738. 4.
- 230. Bericht, erster und zweiter, der Königl. Schleswig=Holstein=Lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Kiel. Aug. 1836. Jan. 1837. Mit Lithographien. 2 Bde. 8. (Geschenk der Gesellschaft.)
- -237. Berichte der deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Alterthümer in Leipzig an die


|
Seite 14 |




|
Mitglieder. Lpz. 1825. 26. 27. 28. 29. 30. und 31. 7 Bde. 8.
-
A. Brandenburg, Geschichte des Magistrats der
Stadt Stralsund, besonders in früherer Zeit
 . Stralsund 1837. 4. (Geschenk des
Hrn. Syndicus Dr. Brandenburg in Stralsund.)
. Stralsund 1837. 4. (Geschenk des
Hrn. Syndicus Dr. Brandenburg in Stralsund.)
- Fr. W. A. Bratring, Die Grafschaft Ruppin in historischer, statistischer und geographischer Hinsicht. Berlin 1799. 8.
- J. Fr. Joach. von Bülow, Mit Kupfern und vielen Urkunden versehene historische, genealogische und critische Beschreibung des Edlen, Freyherr= und Gräflichen Geschlechts von Bülow. Neubrandenburg 1780. Fol. (Geschenk des Hrn. Adv. Diederichs in Güstrow.)
-
Calvör, Saxonia inferior antiqua gentilis et
christiana. Das ist: Das alte heydnische und
christl. NiederSachsen
 . Goslar 1714. Fol. (Geschenk des
Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
. Goslar 1714. Fol. (Geschenk des
Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
-
Joh. Alex. Döderlein,
a.
Antiquitates in
Nordgavia Romanae etc. Weissenburg 1731. 4.
b . Desselben Schediasma historicum Impp. P. Ael. Adriani et M. Aur. Probi Vallum et Murum etc. Nor. 1723.
c . Desselben Antiquitates Gentilismi Nordgaviensis etc. Regenspurg 1734.
d . Desselben Inscriptiones slavo-russicae Tabulae perantiquae Templi Kalbensteinbergensis in agris Nordgaviensibus etc. Tyrnaviae Hungar. 1724.
e . Desselben Slavonisch=Russisches Heiligthum mitten in Teutschland . Nürnberg 1724.
. Nürnberg 1724.
- Fr. von Dreger, Codex diplomaticus oder Uhrkunden, so die Pommersch=Rügianisch= und Caminsche, auch andere venachbarte Lande angehen. Tom. 1. bis Anno 1269 incl. Stettin 1748. Fol.
- 245. Jo. Geo. Eccardns, Corpus historicum medii aevi sive Scriptores res in orbe universo, praecipue in Germania, a temporibus maxime Caroli M. usque ad finem seculi post C. n. XV. gestas enarrantes aut illustrantes. Lips. 1723. Tom. I. & II. Fol.
- -251. Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen für gute Freunde. Jahrgang 1737-42. Rostock. 6 Bde. 8.
- (Dav. Faßmann,) Das glorwürdigste Leben und Thaten Friederich Augusti des Großen, Königs in Pohlen und


|
Seite 15 |




|
Churfürstens zu Sachsen
. Hamburg und Frkf. 1733. 8. (Geschenk des Hrn. Dr. Friedländer in Berlin.)
- H. Francke, Zur Geschichte Trajan's und seiner Zeitgenossen. Den Präsidenten und Vorstehern des Vereins für meklenb. Gesch. und Alterth. gewidmet. Güstrow 1837. 8. (Geschenk des Hrn. Dr. Francke in Wismar.)
-
G. Friedländer, Beiträge zur
Reformationsgeschichte
 . Berlin 1837. 8. (Geschenk des
Hrn. Dr. Friedländer in Berlin.)
. Berlin 1837. 8. (Geschenk des
Hrn. Dr. Friedländer in Berlin.)
- Ph. W. Gercken, Fragmente Marchica oder Sammlung ungedruckter Urkunden und Nachrichten zum Nutzen der Brandenburgischen Historie. Wolfenbüttel 1755. 8.
-
W. Grimm, Der Rosengarten. Herausgegeben von
 . Göttingen 1836. 8. (Geschenk des
Hrn. Prof. W. Grimm in Göttingen.)
. Göttingen 1836. 8. (Geschenk des
Hrn. Prof. W. Grimm in Göttingen.)
-
Fr. von Hagenow, Beschreibung der auf der
Großherzogl. Bibliothek zu Neustrelitz
befindlichen Runensteine
 . Mit 14 Holzschnitten. Loitz und
Greifswalde 1826. 4. (Geschenk des Hrn. Rectors
Masch in Schönberg.)
. Mit 14 Holzschnitten. Loitz und
Greifswalde 1826. 4. (Geschenk des Hrn. Rectors
Masch in Schönberg.)
- Helmoldi Chronica Slavorum seu Annales etc. Francofurti 1581. Fol. (Geschenk des Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
- Hempel, Inventarium diplomaticum historiae Saxoniae inferioris etc. 1r bis 3r Thl. Hannover u. Lpz. 1785. 1786. Fol. (Geschenk des Hrn. Dr. von Duve in Mölln.)
- L. F. Höfer, Auswahl der ältesten Urkunden deutscher Sprache im Königl. Geh. Staats= und Cabinets=Archiv zu Berlin. Hamburg 1835. 4. (Geschenk des Hrn. Geh. Archivraths Höfer in Berlin.)
-
a. Hoffgerichtsordnung der Durchl.
 . Herren Johans Albrechts und
Vlrichs, gebrüdern, Hertzogen zu Meckelnburgk
. Herren Johans Albrechts und
Vlrichs, gebrüdern, Hertzogen zu Meckelnburgk
 . Rostock 1570. 4.
. Rostock 1570. 4.
b. Kaiser Carols des Fünfften . Peinlich Halsgericht. Alten
Stettin 1569.
. Peinlich Halsgericht. Alten
Stettin 1569.
c. Hertzogs Barnims des Eltern vnnd Philips Gevettern, zu Pommern ., Ausschreiben und Verkündigung
des Keyserlichen Landfriedens. Alten Stettin 1569.
., Ausschreiben und Verkündigung
des Keyserlichen Landfriedens. Alten Stettin 1569.
- C. G. Homeyer, Verzeichniß deutscher Rechtsbücher des Mittelalters und ihrer Handschriften. Berlin 1836. 8. [2 Exemplare.] (Geschenk des Hrn. Professors Homeyer in Berlin.)
- M. Kalina von Jäthenstein, Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer. Mit 35 Steindrucktafeln.


|
Seite 16 |




|
Prag 1836. 8. (Geschenk des Hrn. Bibliothekars W. Hanka in Prag.)
- Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. 1r Jahrgang. Schwerin 1836. 8.
- 266. Jahresberichte der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin. 8r und 9r: 1836. 10r und 11r: 1837. 8. (Geschenk der Gesellschaft f. P. G. u. A.) [M. s. Nr. 97-102.]
- -269. Jahresberichte des thüringisch=sächsischen Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums. 1r, 2r u. 3r. Naumburg 1821. 1822. 1823. 8.
- Fr. E. Kettner, Antiquitates Quedlinburgenses etc. Lpz. 1712. 4.
- 272. P. von Kobbe, Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg. 1r u. 2r Thl. Altona 1836. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
- B. Kopitar, Glagolita Clozianus, i. e. Codicis glagolitici λειψανον. Vindobonae 1836. Fol.
- L. G. Kosegartens Uferpredigten u. hymnologische Aufsätze. Herausgegeben von Dr. G. Mohnike. Stralsund 1831. 8.
- L. G. Kosegarten s Akademische Reden. Herausgegeben von Dr. G. Mohnike. Stralsund 1832. 8.
- L. G. Kosegarten, Dissertationes academicae. Edid. Theoph. Mohnike. Sundii 1832. 8. (Nr. 274-276. Geschenke des Hrn. Consistorialraths Dr. Mohnike in Stralsund.)
- Krantz, Wandalia etc. Coloniae Agrippinae. Anno 1519. Fol.
- Kranzii Vandaliae et Saxoniae continuatio etc. Wittebergae 1586. Fol. (Nr. 277. 278. Geschenke des Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
-
-284. Fr. Kruse, Deutsche Alterthümer oder
Archiv für alte und mittlere Geschichte,
Geographie und Alterthümer, insonderheit der
germanischen Völkerstämme
 . 1sten Bandes 1stes bis 6tes
Heft. Halle 1824-1826. 8.
. 1sten Bandes 1stes bis 6tes
Heft. Halle 1824-1826. 8.
- L. von Ledebur, die Fünf Münsterschen Gaue und die Sieben Seelande Frieslands. Berlin 1836. 8.
- L. von Ledebur, Blicke auf die Literatur des letzten Jahrzehnts zur Kenntniß Germaniens zwischen Rhein und Weser. Berlin 1837. 8. (Nr. 285. 286. Geschenke des Hrn. Directors von Ledebur in Berlin.)


|
Seite 17 |




|
- -304. L. von Ledebur, Allgemeines Archiv für die Geschichtskunde des Preußischen Staats, 1r bis 18r Bd. Berlin, Posen und Bromberg 1830-1835. 8.
-
-307. L. von Ledebur, Neues allgemeines Archiv
 . 1r bis 3r Bd. Ebendas. 1836. 8.
. 1r bis 3r Bd. Ebendas. 1836. 8.
- -310. Leibnitii Scriptores rerum Brunsvicensium etc. 3 tom. Hanoverae 1707. 1709. 1711. Fol. (Geschenk des Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
-
a
. Joh. Geo. Leuckfeldi Antiquitates
Blanckenburgenses oder genealogische und
historische Beschreibung derer vormals gelebten
Grafen von Blanckenburg am Hartz=Walde
 . Frkf. u. Lpz. 1708. 4.
. Frkf. u. Lpz. 1708. 4.
b . Desselben Antiquitates Gandersheimenses. Wolfenbüttel 1709.
c . Desselben Antiquitates Ilfeldenses. Quedlinburg 1709.
d . Desselben Historia Spangenbergensis oder histor. Nachricht von dem Leben, Lehre und Schriften Cyriaci Spangenbergs . Quedlinburg und Aschersleben 1712.
. Quedlinburg und Aschersleben 1712.
- J. G. Liljegren, Run=Lära. Stockholm 1832. 8.
- J. G. Liljegren, Run=Urkunder. Stockholm 1833. 8.
- J. G. Liljegren, Monumenta Runica. [Svenskt Diplomatarium II. Bandets I. Del.) Stockholm 1834. 4. (Nr. 312-314 Geschenke des wail. Hrn. Canzleiraths Joh. G. Liljegren in Stockholm.)
-
a
. Lindenbrogii Scriptores Rerum
Germanicarum septentrionalium etc. Hamburgi
1706. Fol.
b . P. Lambecii Origines Hamburgenses etc. Hamburgi 1706.
c . Th. Anckelmanni Inscriptiones urbis Hamburgensis. Hamhurgi 1706. (Geschenk des Hrn. Landraths von Oertzen auf Kittendorf.) - G. E. F. Lisch, Recension von Höfer's Auswahl deutscher Urkunden in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik. 1836. Nr. 37. [worin auch über die ältesten meklenburgischen Urkunden in deutscher Sprache abgehandelt ist.] 4.
- G. C. F. Lisch, Ueber die Framea, aus Meklenburgischen Alterthümern. Im freim. Abendbl. 1832 Nr. 719. 4.
- G. C. F. Lisch, Beiträge zur Meklenb. Alterthumskunde. Im freim. Abendbl. 1832 Nr. 721. 725. 4. (Nr. 316-318 Geschenke des Hrn. Archivars Lisch.)
- (Lünig,) Des Teutschen Reichs=Archivs partis specialis Anderer, dritter und vierdter Theil. Fol.


|
Seite 18 |




|
- J. v. M., Curieuses Thaler =Cabinet. Das erste Fach, welches die Thaler der Röm. Kayser und Könige, wie auch der Ertz=Hertzogen von Oesterreich in sich hält. Lübeck 1697. 4. (Geschenk des Hrn. Rectors Masch in Schönberg.)
- H. G. Masii Antiquitatum Mecklenburgensium schediasma historico-philologicum. Lubecae 1700. 8. [2 Exemplare.] (1 Exemplar Geschenk des Hrn. Revisionsraths Schumacher.)
- F. A. Mayer, Abhandlung über einen im Fürstenthum Eichstädt entdeckten Grabhügel einer altteutschen Druidin. Mit 2 Steindrucktafeln. München 1836. 8.
-
Joh. Gottfr. von Meyer, vollständige
Beschreibung des
 . hochgräfl. Geschlechts der
Herren Reichsgraf= und Burggrafen von Kirchberg
in Thüringen. Ans Licht gestellt durch H. F.
Avemann. Frkf. a. M. 1747. 4.
. hochgräfl. Geschlechts der
Herren Reichsgraf= und Burggrafen von Kirchberg
in Thüringen. Ans Licht gestellt durch H. F.
Avemann. Frkf. a. M. 1747. 4.
- 325. v. Minutoli, Denkmäler mittelalterlicher Baukunst in den brandenburgischen Marken. Thl. 1. Lieferung 1 u. 2. Berlin 1836. Fol. (Gesehenk des Hrn. Referendars von Minutoli in Berlin.)
- Mittheilungen, Neue, aus dem Gebiete historisch=antiquarischer Forschungen. Herausgegeben von dem Thüringisch=Sächsischen Verein für Erforschung des Vaterland. Alterthums. 2ten Bandes 3tes und 4tes Heft. Halle 1836. 8. (Geschenk des Hrn. Dr. Karsten in Rostock.. [M. s. Nr. 150-153.]
- -329. Desselben Werkes zweiten Bandes 1stes bis 4tes Heft, in 3 Bänden. (Geschenk des Th.=S. Vereins.)
- Mittheilungen, historisch=antiquarische, herausgegeben von der Königl. Gesellschaft für Nord. Alterthumskunde. Kopenhagen 1835. 8. (Geschenk wail. Sr. Excellenz des Hrn. Ministers von Plessen.)
- Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Zürich. 1stes Heft. 1837. 4. Mit Abbildungen. (Geschenk der Gesellschaft.)
- J. C. W. Moehsen, Beiträge zur Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg von den ältesten Zeiten an bis zu Ende des 16. Jahrhunderts. Berlin u. Lpzg. 1783. 4.
- 334. G. Mohnike, Hymnologische Forschungen. 1r u. 2r Thl. Stralsund 1831. 1832. 8.
- G. Mohnike, Das sechste Hauptstück im Katechismus nebst einer Geschichte der katechetischen Literatur in Pommern. Stralsund 1830. 8.


|
Seite 19 |




|
- G. Mohnike, Die Krönung König Christians III. von Dänemark und seiner Gemahlin Dorothea durch Dr. Johann Buggenhagen. Stralsund 1832. 8.
- G. Mohnike, Geschichte der Buchdruckereien in Stralsund bis zum Jahre 1809. Stralsund 1833. 4.
-
-340. G. Mohnike, Bartholomäi Sastrowen
Herkommen, Geburt vnd Lauff seines gantzen
Lebens
 ., von ihm selbst beschrieben. Aus
d. Handschrift herausgegeben und erläutert. 1r
bis 3r Thl. Greifswald 1823. 1824. 8. (Nr.
333-340 Geschenke des Hrn. Consistorialraths Dr.
Mohnike in Stralsund.)
., von ihm selbst beschrieben. Aus
d. Handschrift herausgegeben und erläutert. 1r
bis 3r Thl. Greifswald 1823. 1824. 8. (Nr.
333-340 Geschenke des Hrn. Consistorialraths Dr.
Mohnike in Stralsund.)
- C. E. Mrongovius, Ausführliches Polnisch=Deutsches Wörterbuch, kritisch bearbeitet. Königsberg 1835. 4.
-
(H. Nettelbladt,) Historisch=diplomatische
Abhandlung von dem Ursprunge der Stadt Rostock
Gerechtsame und derselben ersteren Verfassung in
weltlichen Sachen bis ans Jahr 1358
 . Rostock 1757. Fol. (Geschenk des
Hrn. Senators Dr. Crumbiegel in Rostock.) [M.
vergl. Nr. 205.]
. Rostock 1757. Fol. (Geschenk des
Hrn. Senators Dr. Crumbiegel in Rostock.) [M.
vergl. Nr. 205.]
- J. C. Conr. Oelrichs Verzeichniß der von Dregerschen übrigen Sammlung Pommerscher Urkunden zur Fortsetzung dessen Codicis Pomeraniae vicinarumque terrarum diplomatici. Alten Stettin 1795. Fol.
- 345. G. Palkowitsch, Böhmisch=Deutsch=Lateinisches Wörterbuch. Prag 1820. 2 Bde. 8.
-
Pauli Jouij, von Com, Bischofs zu Nucera,
Warhafftige Beschreibung aller Chronikwirdiger
namhafftiger Historien vnd Geschichten, so sich
bey Menschegedächtnuß von dem 1494sten biß auf
das 1547ste Jar in der gantzen Welt
 . zugetragen und verlauffen
. zugetragen und verlauffen
 . Frkft. a. M. 1570. Fol.
. Frkft. a. M. 1570. Fol.
- M. Popoff, Description abrégé de la Mythologie Slavone. Traduit du Russe. St. Petersb. 1789. 8.
- -354. Fr. von Raumer, Historisches Taschenbuch 1r bis 7r Jahrgang. Lpzg. 1830-1836. Mit Kupfern. 8. (Geschenk des Hrn. Regierungsraths von Oertzen.)
- Chr. Detl. Rhode, Cimbrisch=Hollsteinische Antiquitaeten-Remarques etc. Hamburg 1720. 4.
- -359. F. A. Rudloff, Pragmat. Handbuch der Meklenb. Geschichte. 1r Theil. 2ten Theils 1ste bis 4te Abthlg. 3r Thl. 1r Band. Schwerin 1780-1794. 4 Bde. 8. [M. s. Nr. 177.]


|
Seite 20 |




|
- W. A. Rudloff, Versuch einer pragmatischen Einleitung in die Geschichte und heutige Verfassung der teutschen Chur= und fürstl. Häuser. 1r Thl. Von Braunschweig=Lüneburg, Sachsen und Brandenburg. Göttingen und Gotha 1768. 8.
- Pawel Josef Safari, Slowanské Starozitnosti (Slavonische Alterthümer). 1stes Heft. Prag 1836. 8. (Geschenk des Hrn. Bibliothekars W. Hanka in Prag.)
-
Sammlung, auserlesene, von allerhand alten und
raren Species=Thalern
 . Hamburg 1739. 4. (Geschenk des
Hrn. Rectors Masch in Schönberg.)
. Hamburg 1739. 4. (Geschenk des
Hrn. Rectors Masch in Schönberg.)
- Sammlung ungedruckter Urkunden und anderer zur Erläuterung der Niedersächsischen Geschichte und Alterthümer gehöriger Nachrichten. 1sten Bandes 1stes bis 6tes Stück. Göttingen 1749-1752. 8.
- Ch. L. Schäffer, Beyträge zur Vermehrung der Käntniß der Teutschen Alterthümer. Mit Kupfern. Quedlinburg und Lpzg. 1764. 8.
- M. Schmeizel, Einleitung zur Wappenlehre. Jena 1723. 8. (Geschenk des Hrn. Rectors Masch in Schönberg.)
- Schmidt, Historisches Taschenbuch über die Entstehung der Apotheken im Allgemeinen und in Dänemark und den Herzogthümern Schleswig=Holstein=Lauenburg. Flensburg 1835. 8. (Geschenk des Hrn Dr. Schmidt d. Aelt. in Sonderburg.)
- Ch. Sclöpken's historische Nachricht von dem Heydenthumb, ersten Christenthum und Reformation des Fürstenthums Lauenburg. Lübeck 1724. 8.
- -370. Joh. Jac. Sell, Geschichte des Herzogthums Pommern von den ältesten Zeiten bis zum Westphäl. Frieden 1648. Nach dessen Tode herausgegeben. Berlin 1819. 1820. 3 Thle. 8.
- Staatskalender, Großherzogl. Meklenburg=Schwerinscher. 1837. 8. (Geschenk von H. W. Bärensprung.) [M. s. Nr. 192. 193.]
- Wolf Stephan sohn, Serbisch=Deutsch=Lateinisches Wör= terbuch. Wien 1818. 8.
- Skulius Theod. Thorlacius, Borealium veterum Matrimonia, cum Romanorum institutis collata. Hafniae 1785. 8.
- -381. Verhandlungen der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen. Prag 1823-1825. 1832-1836. 8 Hefte. 8. (Geschenk des Hrn. Bibliothekars W. Hanka in Prag.)


|
Seite 21 |




|
- Witichindi Monachi Corbeiensis Annales. Francof. a. M. 1577. Fol. (Geschenk des Herrn Landraths von Oertzen auf Kittendorf.)
- Ch. Woldenbergius de origine Consistoriorum, imprimis Megapolitani potestate, jurisdictione et officio Consistorialium. Rostoch. 4.
Ein Ueberblick über das vorstehende Verzeichniß, unter Vergleichung des vorigjährigen, läßt eine ansehnliche Zahl sehr schätzbarer, zum Theil seltener historischer Werke als schon jetzt im Besitze des Vereins befindlich erkennen. Einer Hervorhebung des Wichtigsten bedarf es für den Kenner nicht. Nur auf ein neues, in diesem Jahre hinzugekommenes Element unserer Bibliothek möge hier hingewiesen werden, auf die Vertretung nämlich, welche eine wichtige Hülfswissenschaft der ältesten meklenburgischen Geschichte, das Studium der slavischen Sprachen, zunächst auf Veranlassung und zu Gunsten des mit diesem Studium eifrig beschäftigten Herrn Dr. Burmeister zu Wismar, in derselben gefunden hat, und welche, je nach dem Bedürfnisse, auch für die Zukunft eine willige Berücksichtigung und Verstärkung von dem Ausschusse sich versprechen darf. Ueberhaupt erkennt es der Ausschuß (und gewiß mit ihm der ganze Verein) für wünschenswerth und für ein Hauptziel seiner Bestrebungen, daß die Bibliothek allmälig dasjenige, was näher oder entfernter der meklenburgischen historischen Literatur angehört oder ihr dient, in möglichster Vollständigkeit in sich vereinige, und mit sichererm Gewinn, als in Büchern, dürften sich unsre Kapitalien schwerlich anlegen lassen. Deshalb wird es immer eine vorzügliche Sorge des Ausschusses sein, die Bereicherung der Bibliothek in ununterbrochenem, mit der Vermehrung der Geldmittel in Verhältniß stehendem Fortgange zu erhalten, und auf die fernere Freigebigkeit der einzelnen Mitglieder läßt sich gewiß auch mit Sicherheit rechnen. Daneben aber dürfte auch eine umfänglichere, vielseitigere Benutzung dieser Büchersammlung, welche ja nicht blos eigentlich gelehrten Apparat für den Forscher, sondern auch des allgemein interessanten und unterhaltend belehrenden Stoffes für jeden gebildeten Freund der vaterländischen Geschichte gar viel enthält, ebenso sehr im Wunsch und Zwecke des Vereins, wie im Interesse seiner einzelnen Mitglieder liegen. Die Bibliothek ist, wie bekannt (s. die Statuten), jedem Mitgliede zugänglich, und möchte gern, wie in der Natur der Sache liegt, von recht vielen angegangen werden.


|
Seite 22 |




|
II. Sammlung meklenburgischer typographischer Alterthümer.
Zu dem im vorigen Jahre vom Herrn Dr. Beyer zu Parchim geschenkten
- Breviarium diocesis Tzwerinensis 1529. Venundatur Rozstochij per fratres dom. viridis horti apud sanctum Michaelem. Exensum prodit hoc Breviarium Parisijs Anno 1530. 8.
sind neuerdings folgende alte meklenburgische Drucke hinzugekommen:
- Nic. Marescalci Thurii Annales Herulorum ac Vandalorum. Rostochii in aedibus Thuriis 1521. Fol.
- Nic. Marescalci Thurii Commentariolus Herulorum. Rostochii 1521. (Angebunden.)
- Nic. Marescalci Thurii Res a Judaeis gesta in Monte Stellarum. Rostochii 1522. Fol. (Es fehlen das Titelblatt und die 5 letzten Blätter.)
- Nic. Marescalci Thurii Deflorationes antiquitatum. Rostochii in aedibus Thuriis 1522. Fol.
- Vergiliocentonae elegantissimae veteris ac novi testamenti Probae Falconiae mulieris clarissimae. Impressum Rostochii in aedibus Thuriis 1526. Fol.
- Lactantii Firmiani opera. Rostochii 1476. Kleinfolio.
- Sti. Bernhardi, abbtis. Claraevallensis, sermones super Cantica Canticorum. Rostochii 1481. Großfol.
- Ein auf Pergament gedrucktes Schema zu einem Ablaßbriefe der Michaelisbrüder zu Rostock.
Die Nummern 2-6 wurden auf einer Doubletten=Auction der königl. Bibliothek zu Kopenhagen äußerst wohlfeil, und 7. 8 durch gütige Vermittelung des Herrn Prof. und Directors Dr. Bachmann zu Rostock (welcher noch weitere Mittheilungen über alte rostocker Drucke in Form einer Abhandlung für den Verein vorbereitet,) ebenfalls für einen sehr billigen Preis angekauft; Nro. 9 schenkte der Herr Dr. Deecke zu Lübeck. Der Ausschuß legt auch auf diesen Theil der Vereins=Sammlungen, und wohl mit Recht, einen großen Werth, und wird seinerseits die Erweiterung desselben sich stets angelegen sein lassen. Zu den übrigen Mitgliedern aber hegt er das Vertrauen, daß sie seine in dieser Beziehung mehrfach ausgesprochenen Bitten freundlich berücksichtigen und durch Schenkung oder Verkaufsantragung alter meklenburgischer Drucke, seien es auch


|
Seite 23 |




|
nur Bruchstücke und abgerissener Blätter, durch Angabe, wo sich Exemplare befinden, durch Beschreibung derselben, namentlich des Anfanges und des Endes, der Buchdruckerzeichen, Holzschnitte, Wasserzeichen u. dgl. den Ausschuß und den Verein sich zum Danke zu verpflichten nicht verschmähen werden.
III. Urkunden=Sammlung.
Diese empfing:
-
vom Herrn Archivar Dr. Lappenberg zu
Hamburg:
Abschrift von 16 Urkunden im Hamburger Stadtarchive aus dem 13., 14. und 15. Jahrhundert, das Bisthum Schwerin, die Herren von Meklenburg und die Stadt Wismar betreffend. -
vom Herrn Dr. Siemssen zu Wolde, aus dem
Nachlasse seines Vaters, des wail. M. Siemssen
zu Rostock:
eine Originalurkunde des Klosters Heiligenberg vom J. 1516. -
vom Hrn. Dr. Betcke zu Penzlin:
Abschrift einer gräflich=schwerinschen Bestätigungs=Urkunde der Stadt Neustadt vom J. 1344. -
vom Herrn Archivar Dr. Schmidt zu
Wolfenbüttel:
Abschrift von 2 Urkunden aus dem herzoglich braunschweigischen Landeshauptarchive, betreffend überelbische Besitzungen der Grafen von Schwerin, aus dem 14. Jahrhundert. -
vom Herrn Geheimen=Archivrath Höfer zu
Berlin:
Abschrift einer Urkunde der Gräfin Adelheid von Ratzeburg. -
vom Herrn Dr. Deecke zu Lübeck:
Abschrift von 3 Urkunden der Grafen von Schwerin und von Danneberg, über Privilegien der Stadt Lübeck in den gräflichen Landen, aus dem 13. Jahrhundert. -
vom Herrn Dr. von Duve zu Möllen:
Abschrift einer Urkunde des Herzogs Albrecht IV. von Sachsen und seiner Gemahlin Beate. -
vom Herrn Oberlehrer Dr. Hering zu
Stettin:
Abschrift von 3 Urkunden aus dem 13. Jahrhundert, betreffend den Fürsten Pribislav von Dobern und Belgart (früher von Richenberg=Parchim). -
vom Herrn Dr. Burmeister zu
Wismar:
Abschrift einer Urkunde, betreffend Vogtei und Zoll der Stadt Wismar.


|
Seite 24 |




|
-
vom Herrn Kammerherrn von Vieregge auf
Steinhausen zu Wismar:
7 Original=Urkunden aus dem 15-17. Jahrhundert, betreffend die Güter Steinhausen und Eichholz und deren Besitzer. -
vom Herrn Dr. Dittmer zu Lübeck:
Regesten von 47 ungedruckten Urkunden in lübeckischen Archiven über den früheren Besitz lübeckischer milder Stiftungen in Meklenburg.
Wird zu diesem neuen Erwerb das Besitzthum vom vorigen Jahre (Abschrift von 22 urkundlichen Documenten) hinzugerechnet, so enthält die Sammlung des Vereins zur Zeit:
Originalurkunden: 8.
Urkunden=Abschriften: 50.
Urkunden=Regesten: 47.
Bei dieser, gewiß noch weiter fortschreitenden Vermehrung des vom Verein gesammelten, bisher unbekannten urkundlichen Stoffes wird es nöthig, in späteren Jahrgängen der Jahrbücher, bis zur Bearbeitung desselben, einstweilen Auszüge oder Regesten mitzutheilen.
IV. Sammlung anderer älterer Handschriften.
Zu dieser kam:
-
M. Bernhardt Latomi meklenburgische Chronik
 . im Manuscript. Fol. (Geschenk
des Hrn. Freiherrn v. Gloeden zu Bützow.)
. im Manuscript. Fol. (Geschenk
des Hrn. Freiherrn v. Gloeden zu Bützow.)
-
Ein starker Foliant handschriftlicher, die
Grenzangelegenheiten zwischen Pommern und
Meklenburg, auch Brandenburg, von 1569 bis 1699
betreffender, oft gleichzeitig geschriebener
Verhandlungen, Recesse, Protocolle,
Streitschriften
 ., unter dem Titel:
"Pommersche Grenzsachen". (Geschenk
des Hrn. Advocaten Lemcke zu Wismar.).s
., unter dem Titel:
"Pommersche Grenzsachen". (Geschenk
des Hrn. Advocaten Lemcke zu Wismar.).s


|
Seite 25 |




|



|



|
|
|
B. Sammlung von Bildwerken.
I. Grabalterthümer, Geräth, Waffen u. dgl.
1. aus vorchristlicher Zeit:
A. Aus der Zeit der Hünengräber.
a. Gesammelter Inhalt einzelner Gräber:
Hünengrab bei Prieschendorf.
Der Herr Justizrath Päpcke auf Lütgenhof, Mitglied des Vereins, machte im März d. J. dem Ausschusse die gefällige Anzeige, daß auf seinem zweiten, nicht weit von Lütgenhof gelegenen Hauptgute Prieschendorf (bei Dassow, im nordwestlichsten Theile Meklenburg=Schwerins) eine alte Grabstelle sich befinde, und bot dieselbe dem Vereine zur Aufgrabung an. Nach getroffener näherer Vereinbarung mit dem Herrn Justizrath Päpcke ward vom Ausschusse der Herr Rector Masch zu Schönberg mit der Leitung dieser Aufgrabung beauftragt. Derselbe nahm den Auftrag bereitwillig an, und machte sich, mit der von der Deputation für Aufgrabungen entworfenen Instruction versehen, am 6ten Mai an das Werk. Ihm ward bei diesem Geschäfte die wohlwollendste Unterstützung von Seiten des Herrn Justizraths Päpcke zu Theil, welcher, wiewohl selber zu der Zeit von Hause abwesend, doch alle nöthigen Vorkehrungen und Anordnungen mit der größten Liberalität und Umsicht getroffen, und, ungerechnet die gastliche Aufnahme des Herrn Rectors Masch, auch Arbeiter, Werkzeuge und ein Gespann Pferde unentgeldlich zur Disposition desselben gestellt hatte, wofür der Ausschuß zum lebhaftesten, hiemit öffentlich ausgesprochenen Danke sich verpflichtet fühlt. Zugegen waren bei der Aufgrabung Herr Rettich von Rosenhagen und Herr Actuarius Päpcke von Lütgenhof, Mitglieder des Vereins. Folgendes ist der vom Herrn Rector Masch eingesandte, vom Herrn Archivar Lisch aus späteren Mittheilungen, sowie durch ausführliche Beschreibungen der gefundenen Alterthümer vervollständigte und mit Bemerkungen versehene Bericht über diese Aufgrabung.
Das Grab lag nordöstlich von dem Dorfe Prieschendorf auf der Höhe eines mäßigen Erdrückens und kündigte sich beim erstem Anblick als zu der Classe der Urgräber oder Hünengräber gehörend an. Die Gestalt des Grabes war die eines langen Rechtecks, etwas elliptisch; es hatte in seiner Hauptrichtung von Osten nach Westen 30 Fuß Länge, in seiner


|
Seite 26 |




|
Breite von Norden nach Süden 18 Fuß Ausdehnung. Rings umher war es mit 15 mächtigen unbearbeiteten Granitblöcken eingefaßt, welche in Zwischenräumen von 4 bis 7 Fuß aufgestellt waren und nur mit den Spitzen aus der Erde hervorragten. Der innerhalb dieses Steinringes umgekehrt muldenförmig aufgeworfene Grabhügel erhob sich etwa 5 Fuß hoch über den Urboden und bestand aus Lehm, wie der Acker umher. Von einem zweiten Steinkranze, 1 ) der das Grab früher in einer Weite von etwa 25 bis 30 Fuß, von dem Mittelpuncte des Grabes aus gerechnet, umgeben hatte, fanden sich nur noch einzelne Steine vor; vor einigen Jahren waren einige weggeräumt worden, welche aus zwei gegen einander aufgerichteten Steinen bestanden hatten und bis zur Spitze mit Erde bedeckt gewesen waren; die jetzt noch stehenden 5 Steine, unter und bei denen nichts gefunden ward, boten diese Erscheinung nicht. Ungefähr in der Mitte des Grabes 2 ) stand im Hügel eine große Steinkiste, welche jedoch keine Decksteine hatte.
Das Grab ward von Osten gegen Westen abgetragen.
Am äußersten Östlichsten Ende fand sich, in einer Tiefe von etwa 4 Fuß, innerhalb des Steinringes, eine Schicht von Kohlen, anscheinend von Tannenholz, und mit Kohlenstaub gemischte Erde. In dieser Kohlenschicht lagen Urnentrümmer von gewiß zwei, wenn nicht drei Urnen. Von einer Urne sind viele Reste vorhanden; sie war braun und rund gebaucht und die Masse sehr stark mit weißen Feldspathkörnchen und goldfarbigen Glimmerblättchen vermengt. Sie war am obern Theile mit eingegrabenen Verzierungen versehen: oben mit einem mehrfachen Kranze von kleinen Halbkreisen (wie geschuppt), von denen lange Perpendikulärstriche hinabgehen, deren jede aus mehrern unterbrochenen Strichen besteht; nach einem leeren Raume von der Dicke eines Fingers läuft eine Reihe von kleinen perpendikulären Strichen umher. Auch einen kleinen Henkel hatte diese Urne. Außerdem fanden sich noch theils Bruchstücke von einer dünnen, mit dunklen Glimmerfünkchen versehenen Urne, theils dicke, ziegelrothe, mit groben fleischfarbenen Feldspathkörnern durchknetete Urnenscherben. - Neben den Urnen=


|
Seite 27 |




|
trümmern lagen vier rothe Sandsteine; sie sind unregelmäßig im Umfange, drei ungefähr 6 bis 8 Zoll breit, der vierte kleiner; sie sind dünne, flach, platt und offenbar gespalten, um so mehr, da der Sandstein in einigen einzelnen Steinen noch geschichtet ist. Man könnte auf den Gedanken gerathen, daß diese Steine jene rothen Sandstein=Schleifsteine seien, welche in den altern Gräbern öfter gefunden sind; aber diese sind immer sehr feinkörnig und marmorartig, unsere Steine sind dagegen grobkörnig und zeigen keine Spur von einem Gebrauche: wahrscheinlich dienten sie zu Unterlagen und Deckeln der Urnen. - Dagegen fand sich neben ihnen ein kleiner, viereckiger Schleifstein von dichtem, feinem, dunkelschwarzem Thonschiefer, welcher den Goldstrich annimmt, 2 1/4" lang, 1 1/8" breit und 3/8" dick; die schmalen Seiten des regelmäßigen Randes in der Dicke sind offenbar zum Schleifen gebraucht.- Auf dieser Urnenstelle lagen auch zwei Messer oder Späne aus grauem, durchscheinendem Feuerstein, wie Frid.-Franc. Tab. XXVII. Fig. 5: das eine 4" lang und an allen Rändern abgestumpft, ausgebrochen und viel gebraucht, das andere an den Rändern scharf, jedoch zerbrochen und nur ungefähr zur Hälfte vorhanden, 2 1/2" lang. - Endlich fand sich noch an der Oberfläche verwitterter Bernsteinschmuck: eine kugelförmige Perle von ungefähr 1/2" im Durchmesser, an welcher an einem Ende ein kleiner, jetzt abgebrochener, aus dem Stück geschnittener Henkel gesessen hatte, und zwei herzförmig geschnittene, durchbohrte, jetzt zerbrochene Bernsteinstücke.
Von Osten gegen Westen weiterschreitend stand ungefähr in der Mitte des Grabes die Steinkiste.
Jenseit der Steinkiste in dem westlichen Theile des Grabes, ungefähr in der Mitte des Ganzen, fand sich eine zweite, größere Begräbnißstelle. Dieser Theil des Grabes war auch besonders eingehegt. Die Ringpfeiler waren von der Steinkiste an bis zum westlichen Ende des Grabes mit der flachern Seite nach innen aufgerichtet und die Lücken zwischen denselben waren, in einiger Entfernung nach innen, durch kleinere flache Steine verdeckt, so daß die eigentliche Begräbnißstätte im Innern noch besonders eingefaßt war. Diese Mauer umfaßte den ganzen westlichen Theil des Grabes. An der Nähe dieser Mauer erschien der Boden mehr mit Sand gemischt, als in dem übrigen Raume des Grabes; jedoch fand sich in diesem sandigen Raume nichts weiter. Innerhalb der innern Ringmauer, in der Mitte des westlichen Theils des Grabes, nahe westlich an der Steinkiste, war eine Brandstelle; diese war mit kleinen, ziemlich dicht gefügten Feuersteinen ge=


|
Seite 28 |




|
pflastert, welche durch den Brand weiß und halb verglaset sind. 1 ) Dieses Feuersteinpflaster war ganz mit Kohlen aus Tannenholz bedeckt.
Durch das Pflaster von Feuersteinen zeichneten sich die Stellen aus, wo die größere Masse der Urnenscherben gefunden wurde; diese, so wie der übrige Inhalt des Grabes, lagen westlich neben der Brandstätte, in der Mitte des westlichen Theils des Grabes. Eine ganze Urne kam nicht zum Vorschein; auch lagen nicht an denselben Stellen so viele Scherben, daß man fürchten könnte, eine Urne sei erst beim Aufgraben zertrümmert worden. Flache Steine lagen freilich in der Nähe der Scherben, jedoch nicht so, daß man sie mit Bestimmtheit als Deckel oder Unterlagen der Urnen angeben dürfte.
Die Scherben lagen ungefähr an drei Stellen nicht weit von einander. Wie sich aus der Farbe und den Verzierungen sogleich erkennen ließ, daß sie verschiedenen Urnen angehörten, so ergab auch eine sorgfältige Scheidung und Zusammenstellung der Fragmente, daß mit völliger Sicherheit sieben verschiedene thönerne Gefäße in dem Grabe vorhanden gewesen seien, wie sie im Folgenden so genau als möglich beschrieben sind.
Diese Aufgrabung bestätigt wieder die Seltenheit unversehrter Urnen in Hünengräbern; dennoch möchten sich die Formen der meisten Gefäße aus diesem Grabe durch Zeichnung herstellen lassen. - Außerdem sind diese Scherben von großer Wichtigkeit, indem man von ihnen mit Sicherheit weiß, daß sie aus einem Hünengrabe stammen, und man dieselben in der Folge zur Vergleichung von Urnen aus andern Arten von Gräbern wird gebrauchen können. Das vorzüglichste Resultat ist, daß die Verzierungen 2 ) vielleicht vorzüglich die Unterscheidung der Urnen aus den verschiedenen Arten der Gräber geben, wenn die äußere Form des Grabes gesichert ist, indem die Masse der gewöhnlichen Urnen aus verschiedenen Gräbern nicht viel von einander abweicht, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß die Masse der Urnen aus den Hünengräbern roher und dicker ist, als aus andern Gräbern, und sich jene, durchgehends schwarze Masse gewisser Urnen in den Kegel=


|
Seite 29 |




|
gräbern wohl nie in den Urnen der Hünengräber findet. - Ein anderes Resultat dieser Aufgrabung, in Vergleich mit Aufdeckungen anderer Gräber, ist das, daß die Glimmerblättchen in den Urnen kein unterscheidendes Merkmal der Urnen überhaupt sind, wenn nicht andere Umstände, z. B. jene feine schwarze Masse einiger Urnen in den Kegelgräbern und gewisse Verzierungen, hinzukommen, da sich glimmerhaltige Urnen jetzt in allen Arten von Gräbern gefunden haben.
Es folgt hier die Beschreibung der Urnen nach den Fragmenten.
1) Eine große Urne von einer grobkörnigen Masse und brauner Farbe. Der Boden hat 3 3/4" im Durchmesser; die Fragmente haben eine Dicke von ungefähr 3/8". Vom Boden her baucht sich das Gefäß aus. Es mag eine Bauchweite von ungefähr 8 bis 10" und eine Höhe von 10 bis 12" gehabt haben. Die Masse ist hin und wieder mit stahlfarbigen Glimmerblättchen vermischt.
Hiernach, nach der Farbe und der Masse, so wie nach den Schwingungen der Urne, gehört zu dem vorhandenen Untertheile mit vielen Stücken des Bauches eine Reihe verzierter Fragmente. Um den obern Theil des Bauches läuft eine ziemlich regelmäßig eingegrabene Verzierung: eine dreifache Reihe von perpendikulären Strichen von 1/4" Höhe; von der Mitte eines jeden Strichs geht nach der rechten Seite im spitzen Winkel nach unten hin ein kleiner, dünner Strich. Ohne Jagd auf Seltenheiten machen zu wollen, ergiebt sich von selbst, daß dies Zeichen einem runischen N gleicht. Die einzelnen Charaktere stehen ungefähr 3/8" auseinander. - Nach einem Fragmente hatte auch der etwas eingezogene Hals eingegrabene Verzierungen, wie herabgehende, zusammenhangende Spitzen. - Der Rand lief scharf aus und war etwas ausgebogen; nach einem Fragmente maß die Oeffnung der Urne 6".
2) Nach vielen Fragmenten stand daneben noch eine große Urne, ungefähr gleicher Größe, Masse und Farbe; die Masse ist jedoch stark mit goldfarbigen Glimmerblättchen gemengt. Der Rand läuft ganz perpendikulär aus. Um den Bauch lief eine Verzierung, welche zur Hälfte nach oben hin aus drei horizontalen, concentrischen Kreisen besteht, von deren unterm nach unten hin Querstriche von der Rechten zur Linken laufen; dann folgt nach unten hin ein leerer Ring, von ungefähr 1", worauf sich die Verzierung wiederholt, jedoch so, daß die Querstriche auf dem obern Kreise stehen und nach oben hin von der Linken nach der Rechten gehen.


|
Seite 30 |




|
3) Etwas davon entfernt stand ein weites, allenthalben ausgerundetes Gefäß von ziemlich feiner, glatter Ziegelmasse und röthlich gelber Farbe, ohne alle Verzierungen, allem Anscheine nach eine Schale, ungefähr wie die im Friderico-Francisceum Tab. XXXV, Fig. 14, von ungefähr 8" Oeffnung, mit senkrecht auslaufendem Rande.
4) Daneben stand ein Gefäß aus feinem Thon, rothgelb von Farbe, in kugelförmigen Schwingungen, mit einem 1/2" hohen, nach außen gebogenen Rande, ohne Verzierungen, sehr glatt im Aeußern.
5) Nicht weit davon stand ein Gefäß von grobkörniger, sehr dichter Masse und gelbbräunlicher Farbe. Alle Fragmente sind dicht mit eingegrabenen Verzierungen versehen. Diese Verzierungen bestehen aus dicht gedrängten, kurzen und dicken perpendikulären Linien in einzelnen Gruppen, auch um und über Halbkreise gruppirt. Der Boden hatte ungefähr 6" im Durchmesser, nicht viel mehr der Rand; das Gefäß scheint eine weit geöffnete Schale mit fast horizontalen Wänden gewesen zu sein. Die Verzierungen befinden sich auf der Außenwand schon unmittelbar am Boden und finden sich auch nicht nur auf dem obersten Rande des Gefäßes als Querlinien, sondern scheinen sogar unter den Boden hinzulaufen. Ein sehr kurzer, jedoch breiter und starker Henkel scheint zu diesem Gefäße zu gehören.
Außerdem standen in der Nähe dieser Urnen noch zwei kleinere Gefäße:
6) Ein kleines Grabgefäß, aus grobem Thon, hin und wieder mit Kiessand gemengt, in den Wänden matt ziegelroth, wie die Farbe alter Ziegel; nach dem Rande hin wird die Farbe gelblich. Der Boden hat 2 1/2" im Durchmesser. Das Gefäß baucht gar nicht aus, sondern geht, sich ein wenig nach oben erweiternd, in den Wänden grade in die Höhe, ungefähr in der Gestalt eines gewöhnlichen Blumentopfes oder Wasserglases (Becherform). Es mag ungefähr 3" Weite und 4 bis 5" Höhe gehabt haben.
Ein Fragment von einem Rande ohne Umbiegung, auf welchem außerhalb über einander drei Reihen hübscher Verzierungen von herabgehenden Spitzen sorgfältig eingegraben sind, wie sie auf dem Halse der Urne No. 1 stehen, scheint zu diesem Gefäße zu gehören. Auch der obere Rand ist mit Querlinien verziert.
7) Ein kleines Gefäß von einer sehr steinichten Masse, welche aussieht, als wäre sie aus zerstampftem Granit, in welchem fleischfarbiger Feldspath vorherrschend war, ist mit


|
Seite 31 |




|
einem dünnen und glatten braunen Ueberzuge von Thon von innen und außen bedeckt. Der Boden hat 2 3/4" im Durchmesser. Ueber demselben biegt sich das Gefäß sogleich aus, welches ungefähr 4 bis 5" Höhe und ungefähr 4" Bauchweite gehabt haben mag. Der Rand ist nicht ausgebogen, sondern läuft senkrecht und dünne aus.
An der Stelle, wo die Urnen standen, wurden auch viele andere Geräthschaften des Grabes gefunden; diese bestanden ohne Ausnahme aus Feuerstein: von Metall war keine Spur. Es ward gefunden:
1) ein an den beiden breiten Seiten geschliffener Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, wie Frid. Franc. Tab. XXVI, Fig. 2., gegen 5 1/2" lang, mit vielen ausgesprungenen Stellen;
2) ein gleicher, nur etwas dünnerer Keil;
3) die obere, 4" lange Hälfte eines an allen vier Seiten gleich breiten, überall geschliffenen Keils aus weißgrauem Feuerstein: der Bruch ist alt;
4) ein an allen vier Seiten geschliffener Schmalmeißel aus dunkelgrauem Feuerstein, wie Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 1, mit abgebrochener Spitze, 7" lang;
5) ein im Groben zugehauenes Stück von dunkelgrauem Feuerstein, 2" lang, und
6) ein eben so langes Stück von roh bearbeitetem, hellgrauem Feuerstein, beide etwa zu Pfeilspitzen oder dgl. bestimmt;
7-12) sechs schmalgeschnittene Messer oder sogenannte Späne aus grauem, durchscheinendem Feuerstein, wie am östlichen Ende des Grabes gefunden ward, sehr regelmäßig und an den Seiten sehr scharf, wie sie im Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 5. bis 11. abgebildet sind, nämlich: ein schmales Messer, an einem Ende dreiseitig, am andern Ende vierseitig im rhombischen Durchschnitt, gegen 4" lang, - zwei schmale dreiseitige Messer 3 1/2" und 2 1/2"lang, - ein breites, dreiseitiges Messer, 4" lang und 1 1/2" breit, - und zwei kleine dreiseitige Messerchen, 1 1/2" und 1 3/3" lang;
13) ein Fragment einer ganz dünnen Platte von hellgrauem Feuerstein, an einer Seite geschliffen, 2 1/4" lang und 1 1/4" breit;
14) ein unregelmäßiges, abgeschliffenes Stück Feuerstein mit scharfer Kante.
Endlich fand sich an der Urnenstelle noch eine gehenkelte Bernsteinperle, wie die vorher beschriebene, nur von birnförmiger Gestalt.


|
Seite 32 |




|
Die Steinkiste in der Mitte des Grabes war aus sieben Steinen zusammengesetzt, welche einen 7 1/2 Fuß langen und 3 1/2 Fuß breiten Raum umschlossen. Die Kiste hatte keine Decke, auch keine Bodenbedeckung, weder von Steinen, noch von Sand, sondern war mit Erde gefüllt. Ihre Richtung war von Süden nach Norden; an der Nordseite war sie geöffnet. In der Kiste ward gar nichts, auch nicht einmal eine Scherbe gefunden. Vor der Oeffnung der Kiste im Norden lagen in der Tiefe des Grabes, etwas tiefer, als die erste Brandstelle, wohl nicht hoch über dem Urboden, Knochen nebst zwei Zähnen, welche zu einem Thierschädel gehörten, jedoch in einzelnen Stücken getrennt; sie waren so weich, daß man sie kaum hervorziehen konnte, erharteten jedoch allmälig wieder. Nach der Untersuchung des Herrn Professors Steinhoff zu Schwerin, Directors der Thierarzneischule daselbst, gehören sämmtliche Knochen zu dem Schädel eines Pferdes, welches von mittlerer Größe und ungefähr 12 bis 14 Jahre alt gewesen ist. Die Knochen sind ohne alle Anzeichen von Brand; der abgeschlagene Pferdekopf muß also unverbrannt in das Grab gesetzt sein. Von andern Theilen eines Pferdes ist nach den Knochen nicht die geringste Spur vorhanden: alle Fragmente lassen sich leicht dem Schädel zuweisen.
Von Menschengebeinen war im Grabe keine Spur zu finden.
Nach dieser Beschreibung waren in diesem Grabe zwei Begräbnißstellen: zu beiden Seiten, im O. und W. der Steinkiste. Die Steinkiste, welcher leider der Deckstein fehlte, war wohl zu anderm Gebrauche bestimmt (vielleicht zum Altar?).
Als im Monat Junius die großen Ringsteine gesprengt und die Ueberreste des Grabes fortgeschafft wurden, fand sich im Osten des Grabes noch eine Begräbnißstelle, welche sehr weit in den Ring des Grabes hinausgerückt und bei der ersten Aufgrabung bei Beendigung der Arbeit übersehen war. Sie ward in Gegenwart des Herrn Actuarius Päpcke aufgedeckt und zeigte eine große Uebereinstimmung mit der Bestattungsweise im westlichen Theile des Grabes. Diese Begräbnißstelle, welche wohl ein Theil der oben berührten ersten Begräbnißstelle ist, war ebenfalls durch einen kreisförmigen Bogen von runden Feldsteinen eingehegt. Innerhalb der Einhegung war ein Pflaster von weiß gebrannten Feuersteinen, auf welchen ein Aschenhaufen mit erstaunlich vielen Kohlen lag, dem


|
Seite 33 |




|
Anschein nach von Tannenholz. Dabei lagen Trümmer von Urnen; nach der Masse und den Verzierungen waren es fünf gewesen. Die eine, von welcher der Boden vorhanden ist, ist äußerst roh gearbeitet und dick; sie ist im Innern schwärzlich gebrannt und mit vielem groben Feldspathgrus, wie von zerstampftem Granit, durchknetet. Zwei andere waren rothbraun mit Verzierungen, welche aus kurzen Strichen bestehen, die mit einem Stäbchen der Länge nach eingestochen sind; eine vierte ist hellröthlich, mit eingegrabenen Spitzen, wie Schuppen oder nebeneinander gestellte Halbkreise, verziert. Eine fünfte Urne war bräunlich ohne Verzierungen. Bei den Urnenscherben lagen zwei geschliffene Keile von Feuerstein: ein großer Keil von hellgrauem Feuerstein, am Bahnende abgeschlagen, 6" lang, 2" breit und 1" dick, und ein kleiner Keil von dunkelgrauem Feuerstein, 4 1/2" lang, 1 1/4" breit und 3/4" dick. Ferner fand sich daneben ein sehr schönes, rund gebogenes Messer von Feuerstein, wie ein Span, dreiseitig, wie ausgeschnitten, 4" lang und 3/4" breit. Endlich lag bei diesen Alterthümern der Schädel eines Thieres in kleine Stücke zerfallen; acht Backenzähne desselben sind noch wohl erhalten. Nach den wiederholten Untersuchungen des Herrn Professors Steinhoff zu Schwerin sind diese Zähne Backenzähne eines Pferdes; nach der Meinung des Herrn Thierarztes Reimer zu Schönberg dürften die Zähne einem Wiederkäuer angehören (?). 1 )



|



|
|
|
Hünengrab bei Pampow.
Die im Jahresber. I. S. 14 ohne Angabe des Fundorts aufgeführten, vom Herrn Candidaten Schütz zu Pampow bei Schwerin eingesandten verzierten Bruchstücke einer
 . dargestellt worden sind.
Namentlich und zunächst gilt dies von dem
Satze: daß das Vorkommen der Steinwerkzeuge
und der Mangel an Metall durchaus
charakteristische Kennzeichen der
Hünengräber oder Riesenbetten sind, eine
Erfahrung, welche auch für die
schleswig=holstein=lauenburgischen Lande
durch eine Menge von Nachrichten bestätigt
wird, die in dem ersten und zweiten Bericht
der Königl. schlesw.=holst.=lauenb.
Gesellschaft f. Samml. und Erhaltung vaterl.
Alterth. 1836 sich finden.
. dargestellt worden sind.
Namentlich und zunächst gilt dies von dem
Satze: daß das Vorkommen der Steinwerkzeuge
und der Mangel an Metall durchaus
charakteristische Kennzeichen der
Hünengräber oder Riesenbetten sind, eine
Erfahrung, welche auch für die
schleswig=holstein=lauenburgischen Lande
durch eine Menge von Nachrichten bestätigt
wird, die in dem ersten und zweiten Bericht
der Königl. schlesw.=holst.=lauenb.
Gesellschaft f. Samml. und Erhaltung vaterl.
Alterth. 1836 sich finden.


|
Seite 34 |




|
Urne sind auf dem pampower Hoffelde in einem mit großen Steinpfeilern umstellten und mit einem Decksteine belegten Hünengrabe gefunden.
1 kleine Streitaxt aus Hornblende, vor mehreren Jahren zu Leikendorf in einem Grabe gefunden (geschenkt vom Hrn. Kammer=Prasidenten von Levetzow auf Lelkendorf).
2 Keile aus Feuerstein, nur zugehauen und nirgends geschliffen, im Jahre 1830 zu Neu=Wangelin gefunden (vom Herrn von Bassewitz auf Neu=Wangelin).
1 großer Keil aus grauem Feuerstein, roh, aber sehr regelmäßig geschlagen und noch nicht geschliffen, gefunden beim Aufräumen eines Grabens auf dem Forstgehöfte auf dem Schelfwerder bei Schwerin (vom Herrn Oberförster Hennemann daselbst).
2 Keile aus Feuerstein, gefunden bei der Regulirung der Elde=Stör=Schiffahrt (vom Herrn Ober=Baurath Wünsch zu Schwerin).
1 kleiner Keil aus hellgrauem Feuerstein, überall geschliffen, gefunden zu Lelkendorf (vom Herrn Kammer=Präsidenten von Levetzow auf Lelkendorf).
1 geschliffener Keil von grauem Feuerstein, gefunden zu Gneve unweit der Müritz (vom Herrn Hofrath Engel zu Röbel).
1 großer geschliffener Keil aus grauem Feuerstein, vor einigen Jahren zu Ehmkendorf bei Sülz in einer Mergelgrube gefunden (vom Herrn Advocaten Schweden zu Schwerin).
1 Keil aus gelbem Feuerstein, geschliffen, 7" lang, 2 1/2" breit und 1 1/2" dick, gefunden in einer Mergelgrube zu Borkow, (Geschenk des Hrn. Oberlandförstmeisters Eggerss auf Borkow).
1 Messer mit Griff, aus Feuerstein geschlagen, gefunden im Jahre 1836 auf dem Pfarracker von Kirch=Mulsow bei dem "Heidenholze", an einem Hügel unter einem großen Steine (vom Herrn Pastor Löper zu Kirche Mulsow). Von demselben sind weitere Nachforschungen an der Fundstelle verheißen worden.


|
Seite 35 |




|



|



|
|
|
B. Aus der Zeit der Kegelgräber.
a. Gesammelter Inhalt einzelner Gräber:
Kegelgräber bei Gallentin.
Etwa zwei Meilen von Schwerin entfernt, unweit der nach Wismar führenden Chaussee, in der Nähe von Zickhusen, Neu=Lübsdorf und Gallentin und mit seinem östlichen Ende den schweriner See berührend, liegt ein sehr schön bestandener, größtentheils Laubholz enthaltender Wald, welcher gewöhnlich von dem einen der genannten benachbarten Orte das gallentiner Holz heißt. In diesem befinden sich (der Ausschuß verdankt die Anzeige hievon dem Herrn Ober=Baurath Wünsch zu Schwerin, Mitgliede des Vereins) eine ziemliche Anzahl kegelförmiger Erhebungen, welche leicht die Vermuthung erweckten, daß sie vorchristliche Gräber sein möchten. Um hierüber zur Gewißheit zu gelangen und event. durch eine Aufgrabung die von dem Steinbedarf der nahen Chaussee und der Anwohner schon vielfach berührten und noch ferner bedrohten Gräber für die genauere Kenntniß des vaterländischen Alterthums nutzbar zu machen und ihren etwanigen Inhalt dem Vereine zu retten, begab sich der Herausgeber am 3ten Julius d. J. in Begleitung des Herrn Ober=Bauraths Wünsch, welcher die Güte hatte, sein Fuhrwerk zu dieser Reise herzugeben, und eines andern Mitgliedes, des Herrn Advocaten Schwerdtfeger zu Schwerin, an Ort und Stelle. Diese beide Herren leisteten ihm bei diesem Unternehmen eine eben so eifrige wie geschickte Assistenz, und nicht minder zu rühmen ist die Liberalität des Herrn Pensionärs Schubart zu Gallentin, welcher den Aufgrabern in Wald und Haus die uneigennützigste Gastfreiheit angedeihen ließ, so wie die Gefälligkeit des Herrn Forst =Inspectors Mecklenburg zu Zickhusen, welche ebenfalls sehr vieles zur Förderung des Geschäftes beigetragen hat.
Mit den erforderlichen Arbeitern und Geräthschaften versehen und unter der Leitung eines der Localität vollkommen kundigen Mannes unternahm man zuerst eine allgemeine Besichtigung der fraglichen Hügel. Die meisten derselben waren, wiewohl mit Gehölz und Gebüsch bestanden, noch von so scharf ausgeprägter, kegelförmiger Gestalt, daß sich ihre Natur und Bestimmung nicht bezweifeln ließ. Die untersuchten Hügel liegen, der Mehrzahl nach, in zwei Gruppen, einer nördlichen am Rande des Waldes und einer südlichen in den sogenannten "gepflanzten Eichen", auf einem ringsum ebenen oder doch nur sehr schwach abgedachten Boden, auf welchen sie offenbar


|
Seite 36 |




|
künstlich aufgetragen sind. Aeußere Steinringe fanden sich bei keinem; doch sollen dergleichen, nach Aussage der Arbeiter, bei mehreren allerdings früher vorhanden gewesen, aber zum Bau der Chaussee hinweggenommen und verbraucht worden sein. 1 ) Dagegen fühlten sich bei mehreren durch die vorläufige Untersuchung mit einer Eisenstange Steine im Innern leicht heraus.
Man schritt nun zur Aufdeckung einzelner dieser Kegelhügel, und zwar zunächst zur gleichzeitigen zweier ganz nahe an einander, in der nördlichen Gruppe gelegenen, die sich zwar durch nichts weiter vorzugsweise empfahlen, als daß der eine gar nicht, der andere mit wenigen, weit auseinanderstehenden Bäumen bewachsen war, wodurch sie leichtere Arbeit verhießen. Doch ward diese von der andern Seite wieder erschwert durch den strengen, harten Lehm, aus welchem sie bestanden. Nichts destoweniger ward nach Anleitung der von dem Verein ausgegangenen Instruction die Abgrabung bewerkstelligt. In dem einen, kleineren traf man nahe unter der Oberfläche der Lehmdecke auf ein dichtes, gewölbartiges Lager von Feldsteinen verschiedener Größe. Nachdem diese vorsichtig hinweggeräumt und auch die darunter befindliche Erde sorgfältig ausgekehrt war, wobei sich aber nicht das Geringste von Interesse fand, erreichte man den Urboden. Hier zeigte sich, über die ganze Basis des Kegels in gleichmäßiger Stärke ausgebreitet, eine dünne Schicht von Kohlen; die Holzsubstanz ließ sich, da der Lehm innig damit vermischt war, nicht mehr unterscheiden. Von Knochen und dgl. zeigte sich nirgends eine Spur, selbst als man versuchsweise noch ziemlich tief unter die Kohlenschicht und den Urboden hineingegraben hatte. - Auch die Aufdeckung des zweiten, größern Hügels hatte keinen Erfolg: doch drang man freilich auch nicht nach allen Seiten bedeutend tief in denselben ein, da außer der hier fast steinharten Lehmmasse auch viele alte Baumwurzeln das Graben fast ganz unmöglich machten und selbst den Gebrauch der Hacke sehr erschwerten.


|
Seite 37 |




|
Desto günstigere Resultate lieferten 3 andere Grabhügel der südlichen Gruppe, welche durch die fortgesetzten Nachgrabungen dieses und des folgenden Tages geöffnet wurden.
Dieser Grabhügel war auf einen von Osten nach Westen gehenden Abhang aufgeschüttet, so daß sein westlicher Rand sich nur wenig über den Urboden erhob, während er von Osten her viel steiler und höher aus der Ebene emporstieg. Die größte Höhe des Gipfels, d. h. seine Erhebung über eine mit dem östlichsten (tiefsten) Rande der Basis horizontal liegende Linie, betrug 7'. Auch die Durchmesser der Basis differirten um einige Fuß: von Osten nach Westen hatte die Durchschnittlinie eine Länge von 40', von Süden nach Norden eine Länge von 35'. Der ganze Aufwurf bestand, wie der Boden umher, aus ziemlich sandigem Lehm. Ringsteine oder sonstige äußere Steinbedeckungen fanden sich nicht. Der untere Umkreis und auch des Gipfels Ränder waren mit jungen Buchen und Gebüsch bewachsen; die Mitte war frei, nur mit Rasen bedeckt.
Die Aufdeckung ward durch Abgrabung des Gipfels in der Richtung von Osten nach Westen bewerkstelligt. Als man etwa 2 1/2' der Höhe abgetragen hatte, stießen die Arbeiter an einer Stelle, welche etwa ein Drittheil der Länge der ganzen Durchschnittfläche von deren östlichem Rande entfernt war, auf einen ziemlich großen, platten Stein, der sich bald als Decke einer Steinkiste auswies. Diese hatte einen andern Stein von gleicher Größe zum Fundamente, auf welchem die 4 regelmäßig gesetzten Wände ruhten, die aus einigen größern aufrechtstehenden Steinen mit mehreren zur Ausfüllung der Lücken dazwischen gestellten kleineren bestanden und deren Ränder von dem darüber gelegten Decksteine genau gedeckt wurden. Die größten Steine (Deck= und Grundstein und 3 der Seitensteine) hatten 2' größte Länge und Breite, und waren theils natürlich abgeplattet, theils offenbar gespalten; die kleinern hatten die Form gewöhnlicher Feldsteine; alle bestanden aus Granit. Der Grundstein lag etwa 3' über der entsprechenden Stelle des Urbodens. Als die Decke abgehoben war, zeigten sich sogleich deutlich die Ränder mehrerer Urnen. Beim Hinwegnehmen einer der Seitenwände gewahrte man in der nachstürzenden Erde
1 dünnes, kleines Scheermesser aus Bronze, wie sie gewöhnlich in Kegelgräbern gefunden werden, und
Scherben einer großen Urne von rothbrauner, grobkörniger Masse und dickem Bruch,
zu welcher das erwähnte Messer wohl gehörte; ihren weitern


|
Seite 38 |




|
Inhalt hatte, so viel sich erkennen ließ, bloß Asche und Erde gebildet. Außer dieser zerfallenen fanden sich in der Kiste noch 5 andere Urnen, in zwei Reihen von Osten nach Westen. dicht neben einanderstehend; die Zwischenräume zwischen ihnen selbst, so wie zwischen ihnen und den Wänden der Kiste waren genau mit Erde ausgefüllt, so daß es schien, die Urnen seien absichtlich in Erde verpackt worden, da gegen ein zufälliges Eindringen der über und neben der Kiste liegenden Erde das genaue Aneinanderschließen der Wände und der Decke wohl geschützt haben mußte. Uebrigens war diese Erde innerhalb der Kiste ganz dieselbe, wie außerhalb. Der Boden der Urnen ruhte unmittelbar auf dem Grundsteine. Folgendes ist die nähere Beschreibung der Urnen dieser Kiste und ihres Inhalts 1 ):
1) eine röthlich gebrannte, mit Glimmerfünkchen durchsprengte Urne von einfacher Gestalt, ohne große Ausbauchung, 9" hoch, in der Mündung 7", im Bauche 11", in der Basis 3" im Durchmesser haltend, mit einem großen Henkel; die Wand ist dick. In ihr fand sich nichts als eine an manchen Stellen sehr klebrige Erdmasse.
2) ein kleines, dünnes, schönes Gefäß, im ganzen Bauche abgerundet, mit einem auf der Rundung senkrecht stehenden kurzen Halse, aus einer schwärzlichen, mit Glimmerfünkchen durchsprengten Masse, ungefähr 7" hoch, 8" im Bauche und etwas über 4" in der Mündung im Durchmesser haltend; der obere Theil des Bauches ist dicht gereifelt, am Halse steht ein großer Henkel. Zugedeckt war das Gefäß mit einer einfachen, überfassenden Schale. Die Scherben dieser Urne sind äußerst dünne, nur 1/8" dick und sehr gleichmäßig: ihre Verfertigung aus bloßer Hand wäre wunderbarer, als jede Geschicklichkeit auf der Töpferscheibe. Die Schale war von grober Masse und im Bruche gegen 1/2" dick. Der Inhalt bestand aus Erde und Asche, worunter einzelne Knochen, meistentheils sehr dünne Schädelknochen.
3-5) drei eigenthümlich, fast völlig eiförmig gestaltete Urnen, 8 bis 9" hoch, 6 bis 7" im größten Durchmesser,
 . in ihrem Zusammenhange
möglichst zu erhalten suchte, um sie
hinterher an gesicherterm Orte, nachdem die
Masse mehr erhartet und die Form durch
Zeichnung gerettet wäre, ihrer
Beschaffenheit und ihrem Inhalte nach
genauer untersuchen zu können. Doch scheint
es angemessen, hier alles, was die einzelnen
Kisten betrifft, gleich zusammenzufassen.
. in ihrem Zusammenhange
möglichst zu erhalten suchte, um sie
hinterher an gesicherterm Orte, nachdem die
Masse mehr erhartet und die Form durch
Zeichnung gerettet wäre, ihrer
Beschaffenheit und ihrem Inhalte nach
genauer untersuchen zu können. Doch scheint
es angemessen, hier alles, was die einzelnen
Kisten betrifft, gleich zusammenzufassen.


|
Seite 39 |




|
4 bis 5" in der Basis und ungefähr ebenso viel in der Mündung im Durchmesser haltend, von einer sehr dicken, grobkörnigen, rothbraunen Masse. Die eine war noch mit einem dünnen, einpassenden Deckel, wie eine Scheibe, 4" im Durchmesser und 1/2" dick, zugedeckt. Außerdem fanden sich noch 2/3 eines zweiten Deckels, der jedoch, ohne den einpassenden Rand, 1" dick und oben knopfförmig abgerundet, unten aber ausgehöhlt ist. Alle drei enthielten nichts als viele äußerst zarte Gebeine, offenbar von sehr jungen Kindern.
Dicht neben dieser ersten Kiste, etwas weiter südöstlich, fand sich eine zweite, ebenso gebaut und ebenso hoch über dem Urboden liegend, wie jene. In derselben standen
6. 7) zwei grobkörnige, dicke Urnen, von derselben eiförmigen Gestalt und ungefähr von gleicher Größe, wie die unter 3-5 angeführten. Die eine, um ein Weniges kleinere enthielt Erde und Asche, die zweite eine große Menge Knochenstücke.
Als man sich hierauf weiter nach Westen wandte, traf man genau in der Mitte des Grabes eine dritte Steinkiste. Sie lag um einen reichlichen halben Fuß tiefer, als die beiden andern: im Uebrigen war sie vollkommen ebenso construirt, wie jene. Darin standen
8) eine ziemlich abgerundete Urne aus schwärzlicher Masse, 7" hoch, 3 1/2" in der Basis, 8" im Bauche und 6" in der Mündung haltend, mit einem großen Henkel. Sie war mit Asche und fettiger, schmieriger, zäher Erde angefüllt.
9) eine Urne von seltener Form, mit dem aufliegenden Deckel wie ein vollkommener Cylinder, gleich einer hohen Büchse, gestaltet, überall von gleichem horizontalen Durchmesser, nämlich 5"; das Ganze ist 9" hoch, wovon auf den Deckel gegen 1 1/2" gehen. Die Masse ist schwärzlich, das Gefäß ohne Verzierung und Henkel; der Deckel ist von gleicher Masse und wie eine umgekehrte kleine Schaale mit senkrechten Wänden gestaltet. Diese Urne enthielt sehr zarte Gebeine, z. B. Gelenkwirbel von 1" Durchmesser, und sehr dünne Zahnwurzeln. Ziemlich nach oben lag ein bronzener Ring, 1" im Durchmesser, von dünnem runden Erzdrath, nicht geschlossen, sondern an beiden Enden übergreifend. Weiter nach unten lag die Hälfte eines ähnlichen, dünnen Ringes. Beide waren stark oxydirt.
Etwa 30 Schritte östlich von dem eben beschriebenen lag ein kleinerer, niedriger Hügel von 30' Durchmesser in der


|
Seite 40 |




|
Basis und 3' größter Höhe über dem Urboden. Er war mit Rasen und wenigem Gestrüpp bewachsen und zeigte dieselbe Erdmischung, wie der Boden umher und wie jener andere Hügel. Bei seiner am folgenden Tage vorgenommenen Eröffnung fand sich gleich nahe am östlichen Rande eine äußerst regelmäßig gesetzte, nur mit wenig Erde bedeckte Steinkiste. Die Decke bildeten zwei flache, über einandergelegte Steine, deren Fuge noch durch kleinere platte Stücke verstopft war. Jede der vier Seitenwände bestand aus einer fast gleichseitigen Granitplatte von etwa 4 □' Flächeninhalt und 2 bis 3" Dicke; diese, wie auch die Decksteine schienen gespalten; von Behauensein zeigte sich keine sichere Spur. Eine ähnliche Platte, wie die Wandsteine, bildete den Boden der Kiste. Auf ihm ruhte, rings umher bis zu den Wänden mit Erde umgeben,
10) eine große Urne von eigenthümlicher, schöner Form, weit und scharf ausgebaucht, sich allmälig nach oben verengend, 7" hoch, ungefähr 4" in der Basis, etwas über 12" im Bauche, 6" in der Mündung im Durchmesser haltend. Das Gefäß hatte zwei starke, eckige, kleine Henkel, ungefähr 2" hoch und breit. Die Masse ist fein, schwärzlich, mit Glimmerfünkchen vermengt; die Wände sind dünne. Zugedeckt war diese Urne mit einer umgestülpten, überfassenden, einfachen Schale, 3" hoch, 3 1/2" in der Basis, 7" in der Mündung im Durchmesser haltend, von einer mehr braunen, mit Glimmerfünkchen vermischten Masse. Unter den Henkeln hatte die Urne nicht tief eingegrabene Linearverzierungen: nach oben geöffnete Halbkreise und darunter abwechselnd schräge rechts und links laufende Parallellinien, beide Reihen von Verzierungen durch horizontale Kreise begrenzt. Angefüllt war sie fast ganz mit angebrannten Knochen, unter denen dicke Schädelfragmente sich bemerklich machten. Oben zwischen den Knochen fanden sich, im Andreaskreuze über der größern Knochenmasse liegend, zwei dünne Nadeln aus Erz mit leichtem edlen Rost, jede ungefähr 6" lang: die eine mit drei eingefeilten kleinen Knöpfen von der Dicke der Nadel, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXIV, Fig. 11; die andere oben knieförmig gebogen und am Ende mit einem großen concaven Knopf aus dünnem Erzblech. Tiefer in der Urne lagen drei Bruchstücke von zwei andern bronzenen, mehr oxydirten Nadeln; die Fragmente sind verbogen und schon im Bruche oxydirt. Ein diesen ganz ähnliches, ebenfalls stark oxydirtes Bruchstück einer Nadel hatte sich schon vor der Aufdeckung der Steinkiste in der Erde außerhalb derselben gefunden; wahrscheinlich wird dieses zu einer der letztgenannten Nadeln innerhalb der Urne gehört haben.


|
Seite 41 |




|
Außer dieser einen Steinkiste mit ihrem eben beschriebenen Inhalte fand sich in diesem Hügel, ungeachtet der genauesten Untersuchung, nichts.
In nördlicher Richtung von dem Grabe No. 1, ungefähr 200 Schritte von demselben entfernt, liegt ein anderer Kegelhügel, der größte der bei dieser Aufgrabung berührten. Die Durchmesser seiner Basis halten 50', die Höhe über dem Urboden beträgt etwa 8'. Nach der südlichen und östlichen Seite flacht er sich, vermuthlich in Folge von Abschwemmungen und früherer Bearbeitung, mehr wellenförmig und allmäliger ab, als nach den beiden andern Seiten. Größtentheils ist er mit Gehölz und zum Theil ziemlich mächtigen Buchen besetzt. Auch hier besteht Aufwurf und Boden aus etwas sandigem Lehm. Der ganze Hügel zeigte sich dicht unter der Erdoberfläche mit kleinen und mittelgroßen Feldsteinen gepflastert. Unter dieser Steindecke fand sich hart am östlichen Rande des Hügels, nur wenig über dem Urboden, eine Steinkiste, die aber nicht aus platten, gespaltenen, sondern aus gewöhnlichen Feldsteinen von runder, kantiger u. a. Form und von verschiedener Größe aufgebaut war; auch die Decke ward durch einige größere Steine dieser Art mit zwischengelegten kleineren gebildet; der Boden bestand aus einem größeren, etwas platten Steine. Die ganze Kiste hatte ein viel roheres, unregelmäßigeres Aussehen, als die in den beiden andern Gräbern entdeckten, und bestand mehr aus einer gewölbartigen Anhäufung von Steinen. In derselben hatten zwei Urnen gestanden, von welchen aber die eine beim Aufdecken der Kiste schon gänzlich auseinandergefallen war. Nach den Scherben zu urtheilen war sie ganz gleich der zweiten gewesen, die als eine dicke Urne fast ganz von derselben Gestalt und Größe, wie oben 3-5, und von grobkörniger, bräunlicher Masse sich auswies. Den Inhalt beider bildeten nebst Asche und Erde ziemlich starke Knochenstücke.
Ein hereinbrechendes Regenwetter hinderte für dies Mal weitere Nachforschungen. Gewiß aber sind in diesem Hügel noch mehr Steinkisten vorhanden, und er sowohl, wie die übrigen noch gar nicht zur Untersuchung gekommenen Kegelhügel dieses Gehölzes verdienen wohl eine fernere Nachgrabung.
In keinem dieser drei Gräber fand sich eine Spur von Brandstätten oder auch nur von Kohlen.
Wenn man übrigens Gräber von der Größe und dem Inhalte, wie die gallentiner, mit andern größern Gräbern, z. B. dem zu Ruchow aufgedeckten, vergleicht, in welche


|
Seite 42 |




|
letztere sich immer Waffen, wie eherne Schwerter, Speere, frameae, Handbergen u. dgl. fanden: so scheint daraus hervorzugehen, daß die Kegelgräber von bedeutender Höhe Kriegern und Helden des Volkes angehört haben.



|



|
|
|
Kegelgrab bei Pampow
(bei Schwerin).
(Inhalt geschenkt vom Herrn
Candidaten Schütz zu Pampow.)
Auf dem pampower Hoffelde liegt ein länglicher Hügel, ein Kegelgrab, auf den Urboden aufgeschüttet. Beim Ackern stieß man am Fuße dieses Hügels auf eine kleine, regelmäßig gesetzte Kiste aus platten Steinen, welche kaum einen Fuß hoch mit Erde bedeckt war. In dieser Kiste standen zwei Urnen neben einander, eine größere und eine kleinere; die größere war mit Knochen, die kleinere mit Erde und Asche gefüllt.
Die größere Urne, welche zertrümmert war, mochte, nach einem Bruchstücke, ungefähr 10" Höhe und 6 bis 8" Durchmesser gehabt haben. Die Wand war fast senkrecht; sie ist im Bruch schwärzlich gebrannt, im Aeußern gelbbraun und röthlich gefleckt, mit häufigen kleinen Glimmerfünkchen vermengt, ohne Verzierungen. Nach allen Zeichen ist sie nicht auf der Töpferscheibe geformt, sondern aus freier Hand geschnitten und mit einem feinen Thonüberzuge versehen.
Die kleinere Urne ist ein Gefäß mit einem 2" hohen wirklichen Henkel an dem hohen, engen Halse; der Bauch ist stark und scharf ausgebogen. Das Gefäß ist ganz von der Gestalt wie die in Frid. Franc. Tab. XXXV. Fig. 2 u. 4 abgebildeten gehenkelten Gefäße. Es hat gegen 6" Höhe, in der Mündung etwas über 3, im Bauche gegen 6 und in der Basis gegen 3" Durchmesser; die Farbe ist rothbraun, und über den scharfrandigen Bauch läuft ringsherum ein Band von eingegrabenen Verzierungen, welche aus mehreren parallel laufenden Zickzacklinien bestehen; der Henkel und ein Theil der Seitenwand sind ausgebrochen.
Alterthümer wurden nicht weiter gefunden.



|



|
|
|
Kegelgräber von Borkow.
Auf dem Felde von Borkow, zwischen Goldberg und Sternberg, in der alterthumsreichen Gegend Meklenburgs, finden sich mehrere, nicht unbedeutende Kegelgräber. Zwei derselben ließ der Besitzer des Gutes, der Herr Oberlandforstmeister Eggerss, vor einigen Jahren aufgraben und schenkte


|
Seite 43 |




|
dem Vereine darauf die in denselben gefundenen Alterthümer, von den nöthigen Aufgrabungsnachrichten begleitet. - Beide Gräber waren rein kegelförmig: in der Basis des Grabes auf dem Urboden lag ein Steinpflaster, mit Sand und Asche bedeckt; hier standen in der Mitte des Grabes die Urnen, welche mit einer Anhäufung von Feldsteinen bedeckt waren; auf diesem Steingewölbe lag eine Schicht von Erde und Rasen, welche das Grab im Aeußeren zur Kegelform abrundeten. - Es ward gefunden:
1) in dem einen Kegelgrabe: eine große, sehr grobkörnige Urne, im Bruche stark mit grobem Granitgrus, meist Feldspathgrus vermengt, weit und nicht stark ausgebaucht, mit scharfem Rande im Bauche, im obern Theile glatt und schwärzlich, im untern Theile rauh, ungefähr von der Gestalt wie Frid. Franc. Tab. V. Fig. 4, an 12" hoch, 8 1/2" im Rande, an 13" im Bauche, gegen 5" im Boden im Durchmesser. Die Urne war mit Knochenbruchstücken gefüllt.
Unter denselben fand sich: ein Stück oxydirten Erzbleche s, 2" lang, 1 1/4" breit, mit Bindloch an einem Ende, wahrscheinlich Stück eines Armringes, denen gleich, welche im J. 1837 zu Ludwigslust im Garten des Herrn Oberstlieutenants von Elderhorst gefunden sind (vgl. unten Alterthümer von Ludwigslust), - ferner: ein Stück oxydirtes, aber im Rost verhärtetes Eisenblech, 1 3/4" lang und 1" breit, wie ein Bruchstück von einem Messer, - ein höchst seltener Fund (Eisen!) in einem Kegelgrabe.
2) in dem andern Kegelgrabe fanden sich zwei zertrümmerte Urnen; die eine hatte einen kleinen, unten ausgehöhlten Fuß, Verzierungen von eingegrabenen, breiten Strichen im obern Theile und einen umgebogenen Rand, - die andere war einfach mit senkrechtem Rande. Unter den Knochentrümmern in der Urne fand sich eine kurze, am obern Ende zwei mal knieförmig gebogene Nadel von Erz mit Knopf, mit dickem edlem Rost überzogen. Ein Echinit ist wohl durch Zufall in die Nähe der Urne gekommen.



|



|
|
|
Kegelgräber bei Lelkendorf.
Von dem Herrn Kammer=Präsidenten von Levetzow zu Schwerin, Besitzer von Lelkendorf, wurde der Inhalt von 3 auf der Feldmark dieses Gutes aufgedeckten Gräbern, bestehend in
1 Scheermesser,
1 Haarpincette,
1 Armringe,


|
Seite 44 |




|
1 langen Nadel,
3 kleinen Ringen,
alles aus Erzcomposition und oxydirt, dem Vereine geschenkt.
Nach den Mittheilungen des Herrn Gebers lagen auf dem dortigen Felde mehrere Gruppen von runden Hügeln, die einzelnen Hügel in Reihen paarweise neben einander. Eine solche Gruppe war schon früher zerstört. Die zweite Gruppe ward vor einigen Jahren aufgedeckt. Alle Hügel waren rund, äußerlich nur von Erde aufgeschüttet. Gegen Osten hin stand der größte; er allein war am Fuße mit einem Steinkranze (zum Schutze des Grabes) umgeben. Gegen Osten im Hügel stand das Grab: eine viereckige Kiste von roh behauenen Steinplatten (ein höchst seltenes Vorkommen in Meklenburg!), ringsum zusammengesetzt und bedeckt. In dieser Kiste standen drei Urnen: eine größere mit Knochen und Asche gefüllt und darin auch das Scheermesser und die Zange. In zwei andern niedrigem Gräbern fanden sich Urnen, welche auf einem platten Steine standen und mit einem gleichen bedeckt waren: in diesen fanden sich die Ringe und die Nadel. Die Urnen fielen alle auseinander.



|



|
|
|
Grabalterthümer von Eickhof, Amts Sternberg,
eingesandt von dem Herrn Erblandmarschall von Lützow. Auf dessen Gute Eickhof wurden beim Ackern folgende Gegenstände an's Tageslicht gebracht:
eine Pfeilspitze, wie Frid. Franc. T. XXV, Fig. 8, nur etwas kürzer in der Klinge: 4" lang;
ein Scheermesser, wie Frid. Franc. T. XVIII. Fig. 11, 4" lang;
eine Pincette, wie Frid. Franc. T. XIX, Fig. 5, nur etwas kleiner und ohne Verzierungen, 2 3/4" lang;
eine Nadel, wie Frid. Franc. T. XXIV, Fig. 9, mit rundem Knopf und mit Reifen unter demselben, in der Mitte, ungefähr unter den Reifen, etwas gebogen.
Sämmtliche Sachen lagen unter kleinen Urnenscherben unter einem Haufen von Steinen. Sie sind sämmtlich von der Bronze der Kegelgräber und sind theilweise mit edlem Roste überzogen.



|



|
|
|
Grabalterthümer von Ludwigslust.
(Geschenk des Herrn
Oberstlieutenants von Elderhorst daselbst.)
Die nächste Umgebung von Ludwigslust ist sehr reich an Alterthümern; bei Haus=, Acker= und Gartenbauen sind nach


|
Seite 45 |




|
allen Richtungen hin öfter Urnen mit Alterthümern gefunden. Vorzüglich reich war aber die, jetzt mit Tannen besetzte sandige Anhöhe hinter dem englischen Garten vor dem jetzigen Schulzenhause des Dorfes Klenow, wo der hochselige Großherzog Friedrich Franz im J. 1810 Höchstselbst umfassende Aufgrabungen mit dem günstigsten Erfolge vornahm. Die hier gewonnene Ausbeute hat mit den Alterthümern aus den Kegelgräbern im Allgemeinen und in manchen Stücken besonders völlige Uebereinstimmung; sie ist, von Abbildungen begleitet, im Friderico-Francisceum S. 63 flgd. ausführlich beschrieben. Aber Einzelnes ist in jeder Hinsicht ganz eigenthümlich 1 ) und hat in Meklenburg noch nichts ihm Aehnliches gefunden, so daß man in der Bestimmung über die Alterthümer dieser Gegend einstweilen nur auf eine Uebergangsperiode in der Völkergeschichte rathen darf.
Es sind außer den erhaltenen Alterthümern in der Gegend von Ludwigslust häufig Urnen ausgegraben, welche jedoch, nach angestellten Erkundigungen, unter den Händen der Landleute untergegangen sind. Nächst dem angezeigten Sandberge beim klenowschen Schulzengehöfte ist vorzüglich der, nahe bei demselben liegende Garten des Herrn Oberstlieutenants von Elderhorst ergiebig gewesen, durch dessen sorgende Aufmerksamkeit und Liebe zur Sache die auf seinem Grundstücke gefundenen Alterthümer jedesmal gerettet und für die Wissenschaft gewonnen sind. Am merkwürdigsten ist aber der Fund, welcher im Frühling des J. 1837 bei Umsetzung eines Obstbaumes in diesem Garten gemacht und unserm Vereine von dem Besitzer geschenkt ward. Die Aufnehmung der Alterthümer ist von dem Herrn von Elderhorst selbst bewerkstelligt und sorglich erhalten, wie es der folgende Bericht nach den ausführlichen Mittheilungen des Herrn Schenkers besagt.
Einige Fuß tief im Sande, ohne Aufwurf eines Hügels, stand eine nicht große Urne, dunkel im Bruch und mit Kiessand vermengt, von dunkler Farbe im Innern, von gelbbrauner Farbe in der Außenseite, mit ziemlich horizontalen Wänden ohne große Ausbauchung, dem Anscheine nach den übrigen, im Frid. Franc. abgebildeten ludwigsluster Urnen ähnlich. Leider war die Urne schon zusammengedrückt; jedoch ist ein Rest des Untertheils aufbewahrt. In und bei der Urne war keine Spur


|
Seite 46 |




|
von Knochen und Asche. In der Urne auf dem Boden derselben lag gewissermaßen ein Nest von vielen hohl getriebenen, ganz erhaltenen und zerbrochenen Handringen von Bronzeblech; alle diese Ringe sind so künstlich in einander gelegt und gewissermaßen geflochten, daß diese Zusammenstellung noch jetzt, nach vielem Verschicken und Besehen, eine völlige Halbkugel bildet. Der Ringe, welche diese Halbkugel bilden, sind sechs in elf Enden; einige Ringe sind noch ganz, die übrigen in den Bruchstücken vollständig erhalten. Jeder Ring hat 3" im Durchmesser und ist im Blech gegen 1" breit, von der Dicke eines gewöhnlichen Eisenblechs. Die Ringe sind offen und glatt; Verzierungen sind nicht anders vorhanden, als daß jedes Ende durch zwei eingravirte Querlinien abgegrenzt ist. Kurz vor dem Ende hat jedes Ende des Ringes ein eingeschnittenes dreieckiges Loch von ungefähr 1/4" in den Seitenlinien, wahrscheinlich um durch Bänder die Ringenden zusammenbringen zu können. Die zerbrochenen Ringe sind noch in den Bruchstücken vollständig vorhanden; die Brüche sind alt und in den Bruchenden oxydirt; das Merkwürdigste ist, daß alle Bruchenden, welche noch alle zusammenpassen, kurz vor jedem Bruchrande zwei runde, regelmäßig eingebohrte Löcher haben, so daß immer je zwei solcher correspondirender Löcher von zwei zusammenpassenden Bruchenden gegenüberstehen, offenbar um die schon beim Gebrauch zerbrochenen Ringe durch Bänder wieder zusammenzuheften; von Metallnieten ist reine Spur. - Außerdem lag in dem "Neste" noch ein 2" langes und 1" breites Stück Erzblech mit Längenreifen verziert, dem Anschein nach ein Stück vom Rande eines bronzenen Gefäßes. - In der Höhlung der aus den Handringen gebildeten Halbkugel lagen zwei Schichten von kleinen Ringen, jede Schicht von 6 Ringen, in zwei Parthien neben einander gelegt, wie zwei Rollen. Die Ringe sind nicht alle gleich groß, sondern in jeder Schicht oder Rolle folgte einem größern Ringe ein etwas kleinerer, so daß eine Schicht sich bildet wie ein abgestumpfter Kegel; der größte Ring hat 1 3/8", der kleinste 1 1/8" im Durchmesser. Die kleinen Ringe sind alle geschlossen, massiv und rund im Drath, der gegen 1/8" dick ist. Bei einer Rolle von sechs Ringen lag noch ein siebenter, der jedoch dünner ist, als die übrigen. Alle diese Ringe scheinen zu Beschlägen benutzt worden zu sein. - Oben in der Höhlung zwischen den Zwei Rollen von Ringen lag ein kahnförmiger Beschlag aus Bronzeblech, 2" lang, in der Mitte 1 1/8" breit, an einer Seite eingebogen, inwendig, wie es scheint, mit Leder, gefuttert.


|
Seite 47 |




|
Dieser Beschlag scheint nach allen Anzeichen am Eingange einer Degen= oder Messerscheide gesessen zu haben, oder auch um das Ende eines breiten Griffes. - Ueber dem Ganzen lag ein bronzener Pfriemen, 4" lang, in einer Hälfte rund und spitz auslaufend, in der andern Hälfte viereckig und breit auslaufend.
Alle diese Sachen sind aus Metall, jedoch von einer andern Composition, als sonst in den Gräbern der Vorzeit vorkommt: das Metall ist nämlich heller, als sonst die antike Bronze. Der Pfriemen ist am dunkelsten (d. h. am meisten roth); die Armringe sind schon heller, noch heller ist der Beschlag; die kleinen geschlossenen Ringe sind fast ganz weiß, wie Silber. Edler Rost ist nicht bemerkbar; überhaupt ist die Oxydirung nur matt und wird stufenweise immer schwächer, je weißer das Metall ist: am meisten ist der Pfriemen verrostet, die kleinen Ringe dagegen sind fast ganz blank und haben nur stellenweise einen leichten Anflug von Rost.
Grabalterthümer von Neu=Polchow.
Vom Herrn Hofrath Dr. Crull zu Rostock ward geschenkt: ein großer gehenkelter Aschenkrug aus bräunlicher Masse mit Kiessand und Glimmersfünkchen, gefunden voll Knochen bei Neu=Polchow bei Lage; dabei eine zum Theil oxydirte Speerklinge von Erz und eine nicht durchbohrte Scheibe von Stein von ungefähr 1" Durchmesser.
Grabalterthümer von Ruchow.
Herr Geschichtsmaler Schumacher zu Schwerin lieferte eine Zeichnung des Inhalts des bei Ruchow 1819-1821 aufgedeckten großen Kegelgrabes, wie die Stücke im J. 1836 auf dem fürstlich bückeburgischen Gute Boldebuck aufbewahrt wurden. Die Zeichnung ist nach den Originalien. (Vgl Freimüth. Abendbl. 1821, No. 139.)
b. Einzeln aufgefundene Alterthümer.
Framea.
1 bronzene framea mit Schaftkerbe, ganz wie Frid. Franc. Tab. XIII. Fig. 5, ohne Rost, gefunden in der Bruchholzung des röbelschen Woolds, geschenkt vom Hrn. Hofrath Engel zu Röbel.
Commandostab oder Streitaxt.
Ein Commandostab oder eine Streitaxt mit Stiel aus Bronze, geschenkt vom Herrn Pensionär Burg=


|
Seite 48 |




|
wedel zu Hansdorff bei Doberan. Dieses Geräth ward auf dem Felde von Hansdorff, nicht weit von der hasdorffer Scheide, 6 Fuß tief in einer torfigen Moorgrube gefunden und ist daher, wie alle in Moor gefundenen bronzenen Alterthümer, nicht vom Rost angegriffen. Es ist dem zu Blengow gefundenen, in Frid. Franc. Tab. VII, Fig. 1, Tab. XV, Fig. 6 und Tab. XXXIII. Fig. 1 abgebildeten und in der Erläuterung dazu S. 115, 129 und 158 näher beleuchteten Exemplare ganz gleich. Es besteht aus zwei getrennten Theilen: dem Beile und dem Schafte oder Stiele, beides aus Bronze. Das Beil war in der Schaftlinie hohl und der Schaft ist nach der Beilseite hin zur Hälfte auch hohl, also weiter gehöhlt, als das ludwigsluster Exemplar; das vollgegossene Ende ist noch 9" lang. Beide Theile waren, als das Geräth gefunden ward, durch ein in beide Höhlungen gehendes Holz mit einander verbunden. Leider ist beim Finden die Beilseite des Schaftes und die breite Seite des Beils zerschlagen, das Ganze also nicht mehr vollständig. Der Schaft hatte am Ende ein Oehr, welches noch zum Theil vorhanden ist, als wenn es zum Tragen an einem Riemen gedient hätte. Von dem Beile fehlt fast die ganze Schaftseite; von den kegelförmigen Aufsätzen ist noch einer vorhanden. Da diese Seite zerschlagen ist, so ist ersichtlich, daß das Beil in seinen dickern Theilen hohl gegossen ist; das Erz ist in seinen Wänden ungefähr 1/8" dick. Zugleich ist ersichtlich, daß der Guß auch im Innern höchst regelmäßig und reinlich gehalten ist. Uebrigens sind die beiden Schneiden des speerartig auslaufenden Beiles durchweg, mit Ausnahme eines kleinen Endes nach der Schaftseite hin, in alten Scharten vielfach ausgebrochen und die Spitze ist im alten Bruch abgebrochen. so daß ein vielfacher, ernsthafter Gebrauch nicht zu bezweifeln steht. - Nach dem Ansehen und einer chemischen Probe besteht das Ganze aus jener bekannten Bronzemischung aus Kupfer und Zinn, wie sie immer in den Kegelgräbern vorkommt.



|



|
|
|
Metallbeschlag eines Hifthornes.
Durch einen glücklichen Zufall gelangte der Verein zu einem sehr seltenen und köstlichen Gegenstande des Alterthums, zu dem Beschlage eines großen Heer= oder Hifthorns, welches einem Blaseinstrumente, vielleicht von Horn, zur Befestigung gedient haben muß. Es ward in einer Grube des wismarschen Torfmoors ungefähr 6 Fuß tief gefunden und war ohne allen Rost (wie immer Bronze in Mooren).


|
Seite 49 |




|
Der Herr Amts=Actuar Treu zu Wismar traf dasselbe zufällig unter andern Metallen bei dem dortigen Glockengießer, der es zum Einschmelzen bestimmt hatte, und brachte es sogleich an sich, um es dem Vereine zum Geschenke zu überreichen. Von dem Horn selbst ist keine Spur gefunden.
Der Beschlag besteht aus drei Stücken, welche eine doppelte Reihe von Nietlöchern zur Befestigung an die Hauptmasse des Horns haben: aus dem Mundstücke, einem Mittelringe und der Schallmündung. Alle drei Stücke sind aus der bekannten antiken Bronze der Kegelgräber gegossen und auf der Außenseite mit allen möglichen eingeschlagenen und eingegrabenen Verzierungen bedeckt, welche die in Kegelgräbern gefundenen Geräthe aus Bronze schmücken, namentlich mit den Spiralwindungen und mit den Spitzen, welche die zahlreich gefundenen Handringe bedecken; auch die verschiedenen Verzierungen, welche das bronzene Gefäß in Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 1 bedecken, sind hier angebracht, so daß sich beide seltene Stücke des Alterthums in der Bestimmung ihres Alters zu unterstützen scheinen. Alle Stücke sind ohne Rost. - Das Mundstück ist 7" lang, in der Oeffnung 3/4" im Durchmesser, am Ende nach dem Horne hin 1 3/4" im Durchmesser und hier in sieben Spitzen ausgeschnitten. Es ist merkliche gekrümmt. Erhabene Reifen theilen das Erz in sieben glatte, verzierte Felder. - Der Mittelring ist 2 1/2" im Durchmesser und 3/4" breit. Auf der Außenseite stehen fünf, mit Querstrichen verzierte, erhabene Reifen, von denen der mittlere der größte ist; an diesem sitzt ein Oehr zur Befestigung eines Trageriemens. - Die Schallmündung ist ein becherförmiges Erz, 5 3/4" lang, an dem Ende nach dem Horne hin 4" und in der Mündung 5" im Durchmesser. Das Horn ward in den Beschlag hineingesteckt; etwas über 2" weit ist hiezu, soweit die Nietlöcher gehen, das Erz ausgefeilt und noch einmal so dünne, als in dem übrigen Theile. Ungefähr in der Mitte ist ein zweites Oehr zum Trageriemen angesetzt. Durch sechs hervorstehende Reifen ist die Außenseite in sieben Felder oder Bänder getheilt, welche die mannichfachsten Verzierungen tragen.
Diese Verzierungen, unter denen sich auch manche sonderbare Charaktere finden, machen dieses Horn vorzüglich merkwürdig und erfordern durchaus eine Abbildung, um nach derselben Untersuchungen anstellen zu können, welche ohne Abbildung nicht recht gelingen würden. Diese Abbildung muß aber bis auf eine andere Zeit ausgesetzt bleiben, da der Fund erst kurz vor der Generalversammlung eingereicht ist.


|
Seite 50 |




|



|



|
|
|
e. Römische Alterthümer.
Römisches Grab von Bibow
bei Warin.
Inhalt geschenkt vom Herrn
Ober=Münzmeister Nübell zu
Schwerin.
(Vgl. Jahresber. I, S.
93. 94.)
Ueber diesen merkwürdigen Fund geben wir folgenden Bericht des Herrn Archivars Lisch, zum Theil nach Mittheilungen des Herrn Kreisphysicus Dr. Bartsch zu Warin.
Vor einigen Jahren ward auf der Feldmark Bibow, dem Herrn Heerlein auf Hasenwinkel gehörig, nach Mergel gesucht. Man wählte die höchste Anhöhe der Feldmark, den sogenannten Mühlenberg, wo man unmittelbar an einem Haufen großer, unregelmäßig gelagerter und größtentheils durch Erde verdeckter Steine in die Tiefe grub und hier auch den schönsten Mergel fand. Diese Anhäufung von großen Steinen war ungefähr 8 bis 10' hoch über dem Erdboden und lag genau am östlichen Abhange des Berges, eines der höchsten in der ganzen Gegend, an dessen Fuße vor dem Grabe sich eine Seefläche ausdehnt. - Nachdem man beim Mergelgraben bis gegen 16 Fuß tief gekommen war und die Grube in dieser Richtung ausgebeutet hatte, ward in aufsteigender Richtung gegen die Spitze des Berges und das Grab hin fortgearbeitet und das Steinlager nach und nach von unten und den Seiten gelöst und entfernt, so daß man nach und nach von unten zur Mitte der Grundfläche des Grabes gelangte. Hier zeigte sich, während die Steine bei der Arbeit in die Grube rollten, unter vielen großen Steinen verpackt, ein großer, fester Lehmklumpen, aus dem etwas Schieferfarbiges hindurchschien. Der Gutsherr, welcher anwesend war, ließ den Klumpen, wie er da war, nach Hause bringen und fand in demselben zwei Gefäße von Thon mit Lehm gefüllt. Als bald darauf der Herr Obermünzmeister Nübell in Hasenwinkel eintraf, überließ Herr Heerlein demselben den Fund; der Hr. Nübell leerte darauf die Gefäße von dem füllenden Thon und fand in dem größern derselben ein Glas, Knochen und mehrere kupferne Münzen. Dieses Alles übergab der Hr. Obermünzmeister Nübell dem Verein.
Der Inhalt des Grabes besteht:
1) aus einer schlichten römischen Lampe aus sehr feiner, fester, hellgelber Siegelerde (terra sigillata), wie sie als einheimisches Product sonst in den Gräbern Norddeutschlands nicht vorkömmt;
2) aus einer kleinen schlichten Urne von derselben Thonmasse mit einem schieferfarbigen Ueberzuge, 4" hoch, 2 1/2" weit in der Mündung, 3 1/2" weit im Bauche und 1 1/2" im Durchmesser in der Basis;


|
Seite 51 |




|
in der Urne lagen:
3) Fragmente von angebrannten kleinen und dünnen Menschengebeinen;
4) Stückchen einer sehr dünnen Platte aus der Thonmasse der Lampe und der Urne, jedoch mit kleinen Kieskörnern gemengt, - und einige kleine Stücke Quarz;
5) ein sogenanntes Thränenfläschchen aus sehr reinem und durchsichtigem, bläulich=weißem Glase, 3" lang und ungefähr fingerdick;
6) acht römische Kupfermünzen; vier derselben sind auf der Oberfläche so sehr zerfressen, daß sie nicht mehr erkennbar sind. Von den übrigen geben drei zusammen das Bild Einer Münze desselben Gepräges. Die eine, mit hellgrünem edlem Rost überzogen, hat auf dem Avers zwischen zwei Victorien einen Altar und darunter die Inschrift: ROM. ET. AVG. auf dem Revers ist ein Brustbild erkennbar. Eine zweite Münze hat auf dem Revers das bekränzte Brustbild eines Imperators mit der Umschrift: CAESAR. PONT. MAX., der Avers ist unkenntlich. Eine dritte Münze von rother Farbe hat von dem Gepräge dieser beiden deutliche Spuren. Diese drei gleich großen Münzen geben zusammen das Bild einer und derselben Münze in drei Exemplaren, welche folgende Bestimmung hat:
Rev.:
CAESAR. PONT. MAX. (Caput laureatum.)
Av.:
ROM. ET. AVG. (Ara inter duas
Victoria basi insistentes.)
"Diese Kupfermünze des Kaisers Augustus ist in allen Größen vorhanden und überaus häufig. Die Umschrift des Averses heißt: Romaeet Augusto. - Eckhel, Doctrina Numorum Veterum VI, 135-137, hat diese Münzen eigens abgehandelt und bewiesen, daß sie nicht in Rom, dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit festgestellt, daß sie in Lugdunum Galliae (Lyon) geprägt sind, wo ein dem Augustus geweiheter, weit und breit besuchter Altar war, und zwar noch während des Lebens des Herrschers, während ihm in Rom, so lange er lebte, dergleichen Ehrenbezeugungen nicht gewidmet waren." 1 ) - Die achte Münze läßt theilweise noch etwas erkennen: auf dem Avers ist ein behelmtes (oder bekränztes ) Brustbild sichtbar, auf dem Revers eine stehende weibliche Figur mit einer großen Aehre in der rechten Hand, zu beiden Seiten die beiden Buchstaben S. C.


|
Seite 52 |




|
Ferner fanden sich neben der Urne, ungewiß jedoch, ob über oder unter derselben:
7) Bruchstücke einer niedrigen Schale aus feiner, braunrother terra sigillata. Von diesem Gefäße ist nur noch die Hälfte des Bodens vorhanden; der Rand umher ist ganz abgebrochen. Dieser Boden hat 4 3/4" im Durchmesser und ist achtseitig im Rande geformt. Durch Streifen in erhabener und vertiefter Arbeit ist die Oberfläche des Bodens nach dem Innern der Schale in verschiedene Felder getheilt. Nach der Hälfte zu urtheilen, war in der Mitte ein rundes glattes Feld, in welchem ein Thier, wie ein Scorpion oder Taschenkrebs liegt. Um dieses Medaillon stehen 4 (im Ganzen müssen 8 vorhanden gewesen sein) Felder in Form eines Trapezes; abwechselnd sind zwei und zwei Felder mit denselben Verzierungen versehen; zwei Felder sind mit Mäanderverzierungen bedeckt, auf denen in der Mitte zwei verschlungene Ringe liegen, zwei Felder sind mit viereckigen Rosetten bedeckt: auf dem Felde liegt in der Mitte das Thier (ein Scorpion?), welches auch auf dem Mittelschilde liegt; alle diese Verzierungen sind in erhabener Arbeit gepreßt.
Wahrscheinlich bildete diese Schale eine Untersatzschale für die übrigen Gefäße. Kundige Alterthumsforscher würden durch Erklärung verpflichten.
Nach allem Vorgebrachten ist nun, wenn auch keine Inschrift dafür spricht, der römische Ursprung des Inhalts dieses Grabes wohl außer allem Zweifel.
Um die Untersuchung für die Folgezeit festzuhalten, sind die Hauptgegenstände dieses Fundes durch eine lithographirte Zeichnung bei diesem Jahresbericht Tab. II und III aufbewahrt:
Fig. 1. die Schale.
Fig. 2. die Lampe.
Fig. 3. die Urne.
Fig. 4. das Thränenfläschchen.
Fig. 5 a et b. 2 Münzen.
Ausgepflügte römische Münzen.
Eine Kupfermünze des römischen Kaisers Alexander Severus, ungefähr v. J. 227 p. C., auf dem Felde von Cremmin bei Grabow ausgepflügt und dem Vereine vom Herrn Maler Langschmidt zu Schwerin geschenkt.
Av.
Das mit Lorbeer geschmückte Brustbild des
Kaisers.
Umschrift: IMP. CAES. M. AVR. SEV.
ALEXANDER. AVG.


|
Seite 53 |




|
Rev.
Ein schreitendes, nacktes Männerbild,
mit einem Helm auf dem Kopfe, einer hasta in der
rechten Hand und einem spolium auf der linken
Schulter; zu beiden Seiten: S.-C.
Umschrift: P.
M. TR. P. V. COS. II. P. P.
1
)



|



|
|
|
C. Aus der Zeit der Wendenbegräbnisse.
Gesammelter Inhalt einzelner Begräbnisse:
Wendenkirchhof zu Camin bei Wittenburg.
Hierüber berichtet der Herr Archivar Lisch Folgendes. Es war Ostern 1837, als der Herr Kammer= und Jagd=Junker Ad. von Bülow von Camin Kunde gab von einer Stelle auf dem Gute seines Herrn Vaters, an welcher, nach seiner Wahrnehmung, öfter viele Urnenscherben und allerlei Geräthe gefunden seien. Die Stelle sei an einem Bache ein Sandhügel, der von einigen Dorfbewohnern als Sandgrube benutzt werde; die Urnenscherben, die er gesehen habe, seien schwarz, mit Punktreihen verziert, und das Geräth sei vorherrschend aus Eisen. - Nach diesen Angaben und andern hinzugefügten genauem Beschreibungen mußte diese Begräbnißstätte zu der Classe der sogenannten Wendenkirchhöfe gehören, welche im Friderico-Francisceum, S. 81-100, und den Andeutungen, S. 18-24 (als Slavengräber) beschrieben und erläutert sind. - Eine Anfrage bei dem Herrn von Bülow auf Camin hatte den günstigsten Erfolg, indem derselbe höchst freundlich und bereitwillig jede Unterstützung verhieß und die nöthigen Vorkehrungen anordnete. Der Hauslehrer desselben, Herr Armbrust, stellte auf Wunsch des Herrn v. Bülow Erkundigungen an und berichtete, daß die Urnen nicht tief unter der Erdoberfläche ständen und, weil an der Stelle viel Sand gegraben werde, viele Urnen theils unvorsichtiger, theils muthwilliger Weise zerstört seien; auch hatten sich die Hirtenknaben oft ein Vergnügen daraus gemacht, "diese Töpfe auszupurren" und zu zertrümmern. Nach der Aussage des Dorfschulmeisters seien auch häufig allerlei Geräthschaften an der Begräbnißstelle gefunden, unter andern Gegenständen z. B. ein "Pokal von Erz", eine Streitaxt, die der Dorfschmied noch lange als Holzaxt benutzt habe, zwei Speere und ein kurzes Schwert von Eisen, welches Alles der Schmied aber zu Hufeisen verschmiedet habe. - Alle diese


|
Seite 54 |




|
Umstände sind leider Wiederholungen der Ereignisse, welche auch den Kirchhof auf der Mooster (Frid. Franc. S. 97 flgd.) trafen. - Nachdem nun Alles zu den Ohren der Gutsherrschaft gekommen war, ward die Stelle unter besondere Aufsicht derselben gestellt und jede Berührung des Kirchhofs untersagt. Auch ward der angegrabene Rand desselben untersucht, um zu retten, was nahe zu Tage stand; was sich bei dieser vorläufigen Untersuchung fand, hatte der Herr von Bülow auf Camin die Güte an den Verein einzusenden.
Der Fund zeigte eine überraschende Wiederholung dessen, was auf ähnlichen Wendenkirchhöfen zu Kothendorff und Gägelow (Frid. Franc. S. 89 u. 96) beobachtet war. Es fand sich nämlich:
1) eine schwarze Urne mit Menschengebeinen gefüllt; leider war sie zertrümmert, jedoch haben sich die Fragmente zu einer vollständigen Hälfte zusammensetzen lassen. Es ist eine jener Urnen, welche die Wendenkirchhöfe vor allen andern auszeichnen. Die Urne ist derjenigen völlig gleich, welche zu Gägelow gefunden wurde und Frid. Franc. XXXIV, Fig. 7 abgebildet ist, und der zu Kothendorff gefundenen, Fig. 6, äußerst ähnlich. Sie ist nicht hoch (6 Zoll), oben weit geöffnet (9 Z.), bauchig (von 11 Z. Bauchweite), nach unten spitz zulaufend (3 Z. in der Basis). Sie ist, wenn auch mit feinerm Kiessande durchknetet, doch von feinerer Masse und tief schwärz mit Asphalt überzogen, aus welchem an ausgesprungenen Stellen hin und wieder kleine Glimmerpünktchen hervorscheinen. Sie ist auch ganz wie die gägelower Urne verziert, nämlich mit Linien aus Reihen kleiner, scharfer, quadratischer Punkte, welche mit einem gezahnten Rade eingedrückt sind; es laufen immer zwei Linien neben einander, jedoch nicht von einem doppelten Rade. Die Verzierungen sind auf dem obern Theile in rechten Winkeln gebrochen, am Bauche zu Dreiecken gestaltet, welche mit der Spitze nach unten gerichtet sind, und im untern Theile zu senkrechten parallelen Linien gerichtet, überhaupt so wie bei der gägelower Urne, nur daß die Dreiecke mit Puncten gefüllt sind und die senkrechten Striche näher an einander stehen. Außerdem hatte die Urne einen zu beiden Seiten eingedrückten Knopf. - Die Urne war mit zersprungenen Menschengebeinen gefüllt; Reste des Schädels waren dick und zeigten groß und scharf gezahnte Näthe, welche gewöhnlich aus einander getrieben waren. - Unter den Knochen fand sich eine kleine, einfache Pincette aus Eisen, 2 1/4" lang und 1/2" bis 3/4" breit, am offenen Ende jedoch zusammengenietet, in Ueberein=


|
Seite 55 |




|
stimmung mit den räthselhaften bronzenen Geräthen in den Wendenkirchhöfen, welche Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 12 und 13 abgebildet sind, und eine am Anfange zu einem Oehr umgebogene Nadel ans Eisen, 3 3/4" lang. Auch lag zwischen den Knochen ein rundes Stück eines weißlichen, sehr porösen Feuersteins.
Ferner fanden sich
2) die Fragmente einer braunen Urne, ungefähr von der Gestalt, wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 4 und 5, mit den Verzierungen des gezahnten Rades versehen,
3) ein Fragment einer braunen Urne, mit denVerzierungen des gezahnten Rades versehen, nur daß die kleinen Quadrate hier viel größer sind und die Reihen, vierfach neben einander, mit Einem Rade eingedrückt zu sein scheinen,
4) die Fragmente einer braunen Urne, mit eingegrabenen Linien verziert, und
5) der größere Theil einer grobkörnigen, nicht verzierten Urne, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 2, welche ein kleines Oehr gehabt hat.
In Folge dieser vorläufigen Nachrichten und fortgesetzter weiterer Forschungen stand die Auffindung eines größern Urnenlagers zu vermuthen. Der Herr von Bülow auf Camin kam dem Verein höchst freundlich entgegen und gestattete nicht allein die Aufgrabung der fraglichen Stelle, sondern gewährte auch gastlich alle nöthigen Unterstützungen und Kosten der Aufgrabung, die Fuhren leistend, Arbeiter stellend u. s. w. Der erste Secretär des Vereins, Archivar Lisch, begab sich nach Camin; der Herr Kammer= und Jagd=Junker von Bülow, Sohn des Gutsherrn und Mitglied des Vereins, hatte sich auch eingefunden; und so begann mit einigen sorgsamen Gehülfen und den nöthigen Arbeitern am 17ten Junius d. J. die Aufgrabung, in theilnehmender häufiger Gegenwart vieler Zeugen aus der Nähe und Ferne.
Der Ort, wo die Aufgrabung vorgenommen ward, war das Ende eines Ackerstücks vor dem Hofe Camin, seitwärts von dem Dorfe und der Kirche, rechts in dem Kniee des Weges von Camin nach Kogel, dort wo der Weg nach Vitow abgeht. Die erste sichere Beobachtung war, daß die Urnen in den ursprünglichen, natürlichen Erdboden eingegraben waren; das Ackerstück war völlig eben und von der Aufwerfung eines Hügels war keine Spur vorhanden. Die Fläche ist ebener, kiesiger Roggenboden, läuft vom Hofe ohne Unterbrechung bis


|
Seite 56 |




|
in die Biegung des genannten Weges und fällt hier, parallel mit dem Wege nach Kogel, in einen mehr sandigen Abhang ab, an dessen Fuß der Abfluß einer nahen krystallhellen Quelle strömt, die sich an dem Kreuzwege in den Bach ergießt. An diesem Abhange, der sich ungefähr 6 bis 10' über den Quellabfluß erheben mag, waren seit Menschengedenken von Hirtenknaben und Ackerleuten oft Urnen und Urnenscherben gefunden, die aber immer verloren gegangen waren. An diesem Abhange ward landeinwärts die Aufgrabung vorgenommen.
Ehe die Beschreibung der einzelnen Funde vorgenommen wird, mag es passend sein, die allgemeinen Beobachtungen voraufzuschicken. Die Grabstätte erstreckte sich an 150 bis 200' längs des Quellabflusses parallel mit dem Wege nach Kogel. Es war ein Kirchhof [ein Wendenkirchhof 1 )], in den die Urnen mit ihrem Inhalt eingegraben waren. Die Zahl der Urnen, welche in einigen Tagen enthüllt wurden, betrug weit über zwei hundert; eine sehr bedeutende Anzahl mag früher ausgegraben und untergegangen sein; viele mögen noch in dem Boden stehen, obgleich sie im Verlaufe der Arbeit sich seltener zeigten. Die Urnen waren alle ohne Deckel und waren ohne irgend eine Umhüllung in die Erde eingesetzt; tiefer landeinwärts fanden sich unter der großen Anzahl ungefähr zwölf, welche mit einem Steine bedeckt waren. Die Urnen standen in der ganzen Ausdehnung des Begräbnißplatzes in langen Reihen, deren drei bei der Aufgrabung beobachtet wurden. Außerdem standen zwei Schichten von Urnen über einander: die untere Lage mochte 1 bis 2 Fuß tief stehen, die obere stand unmittelbar unter der Erdoberfläche. Die obere Urnenschicht war durch den Pflug gänzlich zerstört, die Urnen waren zusammengeklappt, umgekehrt u. s. w., und boten für den Augenblick oft die auffallendsten Erscheinungen. Diese Schicht stand unmittelbar auf der untern, so daß es zuweilen den Anschein haben konnte, als seien Urnen in einander gestellt, was jedoch nie der Fall war. Die untere Schicht stand klar in der Erde; die meisten Urnen waren jedoch durch die Decksteine oder durch den Druck der Erde zerborsten, so daß mit der größten Mühe und Sorgfalt nur ungefähr 12 ganze oder halbe Urnen aus dem feuchten Boden gerettet wurden;


|
Seite 57 |




|
die Masse der Scherben ist unglaublich groß. Der Druck der Erdschicht war so groß gewesen, daß z. B. kleine Feuersteine von 1 Zoll Durchmesser von innen durch die Urnenwände gedrängt waren und die Urnen zersprengt und durchlöchert hatten. In den einzelnen Reihen und Schichten standen die Urnen wieder gruppenweise oder nesterweise zusammen, oft zwei oder drei dicht neben einander und in der Nähe wieder mehrere kleinere Gruppen. Eine gefundene Urne war ein sicheres Zeichen, daß in der Nähe noch mehr standen. Jede Urne war sicher wenigstens ein Begräbniß; aber es ging daraus, daß die unbestreitbar zusammengehörende Mitgabe bei Einem Begräbniß in zwei Urnen vertheilt war, unleugbar hervor, daß in einzelnen Fällen mehrere Urnen zu Einem Begräbnisse verwandt wurden. Oft stand auch dicht neben der Urne mit dem Hauptinhalte eine andere, welche nur wenig Gebeine und fast lauter Sand mit Asche enthielt; einige Urnen schienen ganz leer neben gefüllten beigesetzt worden zu sein und enthielten nur Sand.
Die Urnen waren an Gestalt, Verzierung und Farbe
denen völlig gleich, welche in andern
Wendenkirchhöfen, wie z. B. bei Kothendorff,
Gägelow,
 . und vorzüglich in der Altmark
gefunden und wie sie im Friderico-Francisceum
Tab. XXXIV abgebildet sind; namentlich waren sie
den dort Fig. 6 bis 8 abgebildeten gleich: nicht
sehr hoch, oben weit geöffnet und nach unten
spitz zulaufend. Fast alle hatten kleine
Henkelchen und Knötchen; jedoch war nur ein
Henkel so groß, daß man einen Finger
hindurchstecken konnte. Fast alle trugen jene
Verzierungen, welche mit ausgezahnten Rädern
eingedrückt sind; nicht verzierte Urnen wurden
nur sehr wenige gefunden, mit eingegrabenen
Strichen verzierte Urnen waren höchst selten.
Bei weitem die meisten der Hunderte von Urnen,
gewiß die Hälfte, waren glänzend und tief
schwarz mit Asphalt überzogen, durch welchen
jedoch Glimmerblättchen hindurchschienen; die
übrigen waren dunkelbraun; nur eine einzige fand
sich von rothbrauner Farbe. Kleine Urnen waren
höchst selten; anders geformte Gefäße waren gar
nicht vorhanden. Ein glücklicher Zufall hat es
gewollt, daß fast alle, von den verzierten
schwarzen Urnen durch Gestalt, Verzierung und
Farbe abweichenden Gefäße, wenn auch nur zum
Theil, gerettet sind; dagegen sind von den
schwarzen Urnen nur wenige erhalten.
. und vorzüglich in der Altmark
gefunden und wie sie im Friderico-Francisceum
Tab. XXXIV abgebildet sind; namentlich waren sie
den dort Fig. 6 bis 8 abgebildeten gleich: nicht
sehr hoch, oben weit geöffnet und nach unten
spitz zulaufend. Fast alle hatten kleine
Henkelchen und Knötchen; jedoch war nur ein
Henkel so groß, daß man einen Finger
hindurchstecken konnte. Fast alle trugen jene
Verzierungen, welche mit ausgezahnten Rädern
eingedrückt sind; nicht verzierte Urnen wurden
nur sehr wenige gefunden, mit eingegrabenen
Strichen verzierte Urnen waren höchst selten.
Bei weitem die meisten der Hunderte von Urnen,
gewiß die Hälfte, waren glänzend und tief
schwarz mit Asphalt überzogen, durch welchen
jedoch Glimmerblättchen hindurchschienen; die
übrigen waren dunkelbraun; nur eine einzige fand
sich von rothbrauner Farbe. Kleine Urnen waren
höchst selten; anders geformte Gefäße waren gar
nicht vorhanden. Ein glücklicher Zufall hat es
gewollt, daß fast alle, von den verzierten
schwarzen Urnen durch Gestalt, Verzierung und
Farbe abweichenden Gefäße, wenn auch nur zum
Theil, gerettet sind; dagegen sind von den
schwarzen Urnen nur wenige erhalten.
Der Inhalt der Urnen bestätigte vollkommen die in den "Andeutungen" aufgestellten Ansichten. Gegenstände von Metall wurden in ungefähr 60 Urnen entdeckt. Vorherrschend


|
Seite 58 |




|
war Eisen; aus Eisen waren Schildnabel, Schwerter, Spieße, Beile, Schaafscheeren, Sicheln, Messer, Spangen, Hefteln u. dgl. - Bronze fand sich selten und nur in einzelnen Gegenständen, vorzüglich hin und wieder in einer Heftel, wie sie so häufig in den Wendenkirchhöfen vorkommen und Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 13 dargestellt sind; auch fand sich einige Male Eisen auf Bronze, namentlich in den Schildverzierungen und Schildnieten. - An edlem Metall fand sich nur ein silberner Haken an einem Armbande aus Bronze; Gold kam nicht vor. - Gegenstände aus Stein fehlten gänzlich; jedoch war es auffallend, daß besonders geformte längliche Feuersteine häufig und nur in den Urnen gefunden wurden, wenn sich auch nicht leugnen läßt, daß der Boden, in dem die Urnen standen, steinig war und die Steine durch Zufall in die Urnen gekommen sein können. Dicht neben einer Urne lagen lange Stücke von versteinertem Holz; dagegen fanden sich in Urnen nahe dabei Hefte von weichem, wohl erhaltenem Holze an eisernen Messern. - Glas ward gar nicht entdeckt.
Es folgt hier die Beschreibung der Alterthümer, wie sie in einzelnen Urnen gefunden sind; von den Urnen, in welchen Alterthümer gefunden wurden, ist keine erhalten. Die laufenden Zahlen bezeichnen die verschiedenen Urnen, welche an ihrem Standorte ausgeleert sind:
Die größte Ausbeute gewährten zwei schwarze, verzierte Urnen, ungefähr in der Mitte des Begräbnißplatzes, welche dicht neben einander standen. Sie waren die größten, welche entdeckt wurden: sie hatten ungefähr 13" Durchmesser im Rande, 15" Durchmesser im Bauche und 10" Höhe. Die Alterthümer, welche in beide Urnen vertheilt waren, gehörten offenbar zusammen, da von manchem zusammengehörenden ein Stück in jeder Urne lag. Die Gegenstände waren folgende (nach jeder Urne classificirt):
die eisernen Beschläge eines Schildes, ganz wie sie zu Kothendorff gefunden und im Frid. Franc. Tab. IX abgebildet sind, und zwar: ein Schildnabel von Eisen, drei kleinere eiserne Schildbuckel als Spitzen auf Bronzeheften, wie Frid. Franc. Fig. 1 b , ein ganz eiserner Buckel als Spitze auf eisernem Hefte, eine eiserne Schildfessel, ungefähr 10" lang, mit eisernen, geknöpften Nieten an beiden Enden;
eine Speerspitze von Eisen mit Schaftloch;


|
Seite 59 |




|
eine Speerspitze von Eisen mit Schaftzungen und abstehenden Lappen;
eine Schaafscheere von Eisen, ganz den heutigen ähnlich (die erste, welche in Meklenburg beobachtet ist; in der Altmark und in der Prignitz sind Schaafscheeren häufiger gefunden);
eine Sichel von Eisen (dies sind dünne halbmondförmige Messer, nach dem Ende hin spitz auslaufend, ungefähr 4" lang in der Sehne des Bogens und 1' bis 1 1/2" breit im Blech; diese Messer wurden zu Camin häufig gefunden und zeigen in einigen gut erhaltenen Exemplaren offenbar eine Sichel);
ein sichelförmiges Messer von Eisen mit einem Oehr an einem Ende;
ein kleiner runder Beschlag von Bronze von der Größe eines Pfennigs mit zwei bronzenen Nieten;
eine runde Schnalle von Eisen, an eine Schildspitze angerostet;
ein Messer von Eisen mit gradem Rücken und Spitze, mit Resten eines hölzernen Griffes;
eine Sichel von Eisen;
die Spiralwindung einer Heftel von Bronze;
ein Stift von Bronze mit gespaltenem und wieder zusammengenietem Ende, - räthselhafte Instrumente, wie sie sich in Wendenkirchhöfen häufig finden (vgl. Frid. Franc. Tab. XXXIII, Fig. 12 u. 13).
in einer schwarzen Urne:
vier Schildbuckel oder Spitzen ganz von Eisen;
eine Schildfessel von Eisen;
ein Schwert von Eisen; dieses Schwert ist in vier Enden zusammengebogen, ganz wie Frid. Franc. Tab. XV, Fig. 5, welches zu Kothendorff gefunden ist; es ist ungefähr 20" lang in der Klinge und ungefähr 1 1/2" breit, allmälig sich zuspitzend; es ist dünne im Eisen; ob es einschneidig oder zweischneidig war, ist nicht zu erkennen; das Heft ist 5" lang und vierseitig;
eine Sichel von Eisen;
ein kleines Messer von Eisen;
eine runde Schnalle von Eisen;
mehrere Ringe, Stifte und Beschläge von Eisen;
eine zierliche Heftel von Bronze, von der gewöhnlichen Art;
ein Beschlag von zwei kurzen, schmalen Bronzestreifen mit zwei bronzenen Nieten.


|
Seite 60 |




|
in einer schwarzen Urne:
eine breite Speerspitze von Eisen mit Schaftloch, 8" lang und gegen 2 1/2" breit in der größten Breite, als seltene Ausnahme wenig von Rost angegriffen.
in einer braunen Urne:
ein Beil oder eine Streitaxt von Eisen, 5" lang, 2 1/4" breit in der Schneide und 1" breit am Schaftloch, wie das bei Kothendorff gefundene Beil (Frid. Franc. Tab. VII. Fig. 4); das Schaftloch ist elliptisch und 1 1/2" lang; 1 ) ein Messer von Eisen;
eine viereckige Schnalle von Eisen, an einem kurzen Streifen Eisenblech sitzend.
in einer schwarzen Urne:
vier eiserne Schildspitzen oder Buckel auf
bronzenen Nietheften;
eine eiserne
Schildfessel mit bronzenem Endbeschlag.
in einer braunen Urne:
eine kleine Sichel von Eisen;
ein Messer von
Eisen;
eine dünne Stange von Eisen (ein
Wetzeisen?) in einem eisernen Ringe
hangend;
eine Heftel von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
ein Armring aus Bronze, ungefähr 4" im Durchmesser, aus dünnem, rundem Bronzedrath, welcher ungefähr 1/8" dick ist; die Enden sind zu Oehren umgebogen, durch welche ein doppelter Schließhaken von Silber geht, - das einzige Beispiel von edlem Metall in diesem Begräbnißplatze.
in einer schwarzen Urne:
eine Sichel von Eisen;
ein Messer von Eisen
mit wohl erhaltenem hölzernem Griffe;


|
Seite 61 |




|
eine Heftel von Eisen und
ein eiserner
Schnallenring, beide zusammengerostet;
ein
feinkörniger grauer Sandstein in Form eines
kleinen Schleifsteins;
ein regelmäßiger
bohnenförmiger kleiner Kiesel.
in einer schwarzen, schön verzierten Urne:
eine Sichel von Eisen;
eine runde Schnalle
von Eisen;
eine runde braune Kugel von Teig
oder Harz oder dgl.
in einer braunen Urne:
Bruchstücke eines Messers von Eisen;
eine
Schnalle von Eisen;
eine Heftel von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
ein Messer von Eisen;
eine Heftel von Bronze.
in einer schwarzen Urne:
eine Heftel von Bronze;
eine schwarze Urne, deren Boden auf der Außenseite verziert ist; die Verzierung bildet ein rechtwinkliges Kreuz, von dessen Balkenenden fächerförmig Linien wie Strahlen auslaufen; außer dieser Urne fand sich noch eine mit einem eben so verzierten Boden; - in der Urne
ein schmales, zierliches Messer von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine Sichel von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine Schaafscheere von Eisen, ganz wie die heute gebräuchlichen und wie die in der Urne Nr. 1 gefundene, nur kleiner, 8" lang.
in einer schwarzen Urne:
ein Stift von Bronze in Gestalt eines vollkommenen Cylinders, 2 1/4" lang und 3/16" dick, mit Ansatz von edlem Rost, ganz unbestimmten Gebrauchs.


|
Seite 62 |




|
in einer braunrothen, mit Strichen verzierten Urne:
ein Ring von Eisen, zur Hälfte vorhanden, wohl Rest einer Schnalle.
in einer schwarzen Urne:
das Fragment eines eisernen Geräths, unkenntlich.
in einer braunen Urne:
Fragment eines Schwertes von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine sehr schmale Heftel von Bronze.
in einer schwarzen Urne:
Fragmente einer Sichel und eines Stiels von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine Sichel von Eisen, zur Hälfte vorhanden;
ein hölzerner Messerstiel;
ein hohler,
kurzer Beschlag von Eisen;
ein Schildbuckel
von Eisen.
(Da sich gewöhnlich, wie auch in den Urnen Nr. 1, 2 und 5 vier Schildspitzen zusammenfinden, so ist es wahrscheinlich, daß diese Urne zu einer andern gehörte, welche den übrigen Theil des Schildes barg, so daß auch hier höchst wahrscheinlich die Bestattung in zwei Urnen bewerkstelligt war.)
in einer braunen Urne:
eine Sichel von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine viereckige Schnalle von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine Sichel von Eisen.
in einer großen braunen Urne:
eine viereckige Schnalle von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
ein Messer von Eisen mit Resten des hölzernen Griffes;


|
Seite 63 |




|
ein Fragment eines eisernen Stiels;
eine
breite Heftel von Bronze.
in einer schwarzbraunen Urne:
ein eisernes Messer mit hölzernem Griff;
die
Hälfte eines eisernen Ringes.
in einer schwarzen Urne:
eine Heftel von Eisen.
in einer braunen Urne:
eine Sichel von Eisen.
in einer kleinen schwarzbraunen Urne mit einem hohlen Fuße:
eine runde Schnalle von Bronze;
ein
rätselhafter Stift von Bronze, wie in der Urne 1 b.
in einer schwarzen Urne:
ein Messer von Eisen mit Resten eines hölzernen
Griffes;
eine dünne eiserne Stange,
viereckig, mit Resten eines hölzernen Griffes (Wetzeisen?).
in einer braunen Urne:
ein kleines eisernes Messer mit hölzernem
Griffe;
eine dünne eiserne Stange mit
Resten eines hölzernen Griffes (vgl. Nr.
32).;
eine kleine Sichel von Eisen, in der
Sehne 2 1/2" messend;
ein
Schnallenring von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
Fragmente einer eisernen Sichel;
eine kleine
Heftel von Bronze.
in einer schwarzen Urne:
ein Fragment eines eisernen Messers.
in einer braunen Urne:
ein Messer von Eisen.
in einer schwarzbraunen Urne:
eine runde Schnalle von Eisen.


|
Seite 64 |




|
in einer braunen Urne:
ein dünner eiserner Stift mit hölzernem Griffe
(Wetzeisen?);
ein eiserner Schnallenring.
in einer braunen Urne:
ein eisernes Messer mit hölzernem Griff;
eine eiserne Schnalle.
in einer schwarzen Urne:
ein eisernes Messer mit Spuren eines hölzernen
Griffes;
ein eiserner Stift mit Spuren
eines hölzernen Griffes;
eine runde
Schnalle von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
Reste eines eisernen Messers.
in einer schwarzen Urne:
Reste eines eisernen Messers.
in einer braunen, mit Strichen verzierten Urne:
eine Sichel von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
eine Schnalle von Eisen.
in einer braunen Urne:
Eisenstücke, anscheinend von einem Messer.
in einer schwarzen Urne:
ein Bruchstück einer eisernen Messerklinge.
in einer schwarz=braunen Urne:
eine Schnalle von Eisen.
in einer schwarzen Urne:
ein Messer von Eisen mit Resten eines hölzernen Griffes.


|
Seite 65 |




|
in einer schwarzen Urne:
ein Klumpen festen Eisenrostes, wie er sich in vielen andern Urnen in erdartigem Zustande fand.
in einer braunen Urne:
ein Klumpen festen Eisenrostes, wie in der Urne Nr. 49.
in einer schwarzen Urne:
ein Stück dünnes Kupferblech, verbogen, 3" lang und 2" breit, auch in den Rändern oxydirt, von unregelmäßiger Form, ohne Spuren seiner Bestimmung.
In einigen Urnen fanden sich neben Alterthümern von Metall oder allein auch auffallend geformte Feuersteine; zwar können sie bei Sammlung der Asche durch Zufall aus dem kiesigen Boden in die Urnen gekommen sein, aber alle haben ungefähr dieselbe Gestalt von Natur oder sind durch Menschenhände dahin gebracht, so daß eine besondere Bedeutung dieser Steine bei ihrem öftern Vorkommen wohl kaum zu bezweifeln steht.
in einer schwarzen Urne:
eine eiserne Stange (Wetzeisen?) mit Resten eines
hölzernen Griffes;
ein von Natur keilförmig
gestalteter Feuerstein, 2 1/2" lang.
in einer schwarzen Urne:
eine Heftel von Eisen;
ein dreiseitig
geschlagener Feuerstein, 3" lang und 1 1/2
" breit.
in einer braunen Urne:
ein regelmäßig geschlagener Feuerstein, wie die spanförmigen Messer aus den Hünengräbern, 1 3/4" lang und 3/4" breit.
in einer braunen, nicht verzierten Urne:
ein dreiseitiger Feuerstein, an zwei Seiten regelmäßig geschlagen, wie geschnitten, an der dritten Seite von Natur abgerundet, 2 1/2" lang und 1 1/4 " breit.


|
Seite 66 |




|
in einer schwarzen Urne:
ein keilförmiger Feuerstein, an einer Seite regelmäßig eben geschlagen, 3" lang und 1 1/4" breit.
in einer schwarzen Urne:
ein lanzenförmiger Feuerstein, 3" lang, roh.
in einer schwarzen Urne:
ein lanzenförmiger Feuerstein, 3 1/2" lang, roh.
in einer schwarzen Urne:
ein von Natur regelmäßig gerundeter Feuerstein, ungefähr 1 1/4" im Durchmesser.
unmittelbar neben einer schwarzbraunen Urne lagen Stücke von hellklingendem, weißgelbem, versteinertem Holze (dem Anschein nach Büchenholz).
Dies sind die, in dem caminer Wendenkirchhofe gefundenen Alterthümer. Von den Urnen, in welchen sich dieselben befanden, konnten keine gerettet werden. Dagegen wurden mehrere Urnen, wenigstens zur Hälfte im Längendurchschnitt, ans Tageslicht gebracht, welche keine Alterthümer enthielten. Alle diese Urnen sind nicht hoch, dagegen weit, gebaucht, oben weit geöffnet und nach unten spitz zulaufend. Es sind folgende:
eine große Urne, dunkelschwarz mit Asphalt überzogen, und mit einem Zahnrade verziert, 7 1/2" hoch, 12" im Durchmesser im Rande der Oeffnung, 14" im Bauche und 4 1/2" in der Basis im Durchmesser haltend, mit einem Knötchen statt eines Henkels; an einer Seite hat Eisenrost von Alterthümern, welche in einer unmittelbar daneben stehenden Urne lagen, eine Stelle mürbe gefressen und ein Loch eingestoßen; auch in der Urne sind Eisenrostflecke; die Urne ist ungefähr, wie die Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 6.
eine Urne derselben Art und Größe, nur daß aus dem Asphaltüberzuge goldfarbige Glimmerfünkchen durchschimmern; statt des Knötchens hat sie am Rande einen kleinen Henkel; über den vom Rande nach dem Boden laufenden perpendikulären, eingedrückten Punktlinien liegt zwischen jeder


|
Seite 67 |




|
ersten und dritten Linie über der mittlern ein Andreaskreuz aus gleichen Linienverzierungen; es ist ungefähr 1/5 ausgebrochen.
eine schöne geformte Urne, wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 1, ohne Verzierungen, schwarz mit Asphalt überzogen, durch welchen Glimmerfünkchen durchbrechen, 7 1/2" hoch, 9 1/2" im Rande, 13" im Bauche, 3" in der Basis im Durchmesser haltend; am Rande sitzt ein kleiner Henkel und und unter demselben stehen drei Knötchen, welche durch eingedrückte Punktreihen eines Zahnrades von einander getrennt sind; es fehlen vier kleine Stücke im Bauche.
eine kleinere, verzierte, schwarze Urne, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 7, mit Glimmerfünkchen, welche hie und da aus dem Asphaltüberzuge hervorbrechen, mit einem Knötchen, 6 1/2" hoch, 9 1/2" im Rande, 12" im Bauche, 4" in der Basis im Durchmesser, ungefähr zu 2/3 vorhanden.
eine kleinere, niedrige und weite Urne, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 8, glänzend schwarz von Asphalt, mit durchscheinenden Glimmerfünkchen, mit sehr feinen Punkten verziert, 5 1/2" hoch, 8 1/2" im Rande, 10 1/2" im Bauche, 3 1/2" in der Basis im Durchmesser, ungefähr zur Hälfte vorhanden.
eine kleine, hohe und enge Urne, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 9, jedoch sehr reich mit Punktlinien verziert, schwarz mit Asphalt überzogen, mit feinen, spärlichen, durchbrechenden Glimmerfünkchen, 7" hoch, 7" im Rande, 10" im Bauche, welcher hoch am Rande über dem schlanken Untertheil sitzt, und 3 1/4" in der Basis im Durchmesser, ungefähr zu 3/4 vorhanden.
eine ganz kleine, mit Punktreihen verzierte, dunkelbraune Urne ohne Henkel und Knötchen, 5" hoch, 6 1/2" im Rande, 8" im Bauche, ungefähr 3" in der Basis; im Boden und Bauche fehlt ungefähr 1/5.
eine große, weit geöffnete Urne, ungefähr wie Frid. Franc. Tab. XXXIV, Fig. 6, braun, ohne Ueberzug, reich mit Punkten verziert, mit einem kleinen Henkel am Rande, 7" hoch, 11 1/2" im Rande, 13 " im Bauche, 2 1/2" in der Basis im Durchmesser haltend; es fehlt ungefähr 1/5.


|
Seite 68 |




|
eine große, braune, mit Punktreihen verzierte Urne, ohne Henkel und Knöpfe, 8" hoch, 10 1/4" im Rande, 13" im Bauche, 4 1/2" im Boden, in zwei Hälften vollständig vorhanden.
eine gleiche Urne, 8 " hoch, 11" im Rande, 13 " im Bauche, 4 1/2" in der Basis, bis auf wenige Stücke vollständig.
eine niedrigere, weit geöffnete, mit Punkten reich verzierte, braune Urne, mit einem Knopfe, zur Hälfte vorhanden, ungefähr 6" hoch, 9 1/2" im Rande, 12" im Bauche.
eine ähnliche, anders verzierte Urne, zu 1/3 vorhanden, ungefähr 6 1/2" hoch, 9" im Rande, 12" im Bauche.
eine mit weit auseinander stehenden Punkten in Linien verzierte braune Urne, 5 1/2" hoch, 8" weit im Rande, 10" im Bauche, 3" in der Basis, zur Hälfte vorhanden; der fast ganz vorhandene Boden ist mit einem Kreuze verziert.
Von ungefähr 90 andern Urnen sind in Beziehung auf Masse, Farbe und Verzierung und mitunter auch auf Form hinreichend bezeichnende Stücke von Urnen aller Art gerettet; eine vielleicht eben so große Zahl, namentlich schwarzer, Urnen ward völlig zertrümmert gefunden. Vorherrschend sind Urnenstücke mit Punktreihen verziert; alle andern Urnen waren seltene Erscheinungen. Zu den seltenen Urnen gehören drei, von denen auf der ganzen Oberfläche des Bauches die eine mit einem Instrumente in dicht stehenden Rillen zerkratzt, die zweite mit einem Schneidewerkzeuge abgeschabt, die dritte, wie mit einem scharfen Tuche, rauh abgerieben ist. Wahrscheinlich sind diese Urnen nicht vollendet, indem die Urnen der Wendenkirchhöfe offenbar einer mehrfachen Behandlung bedurften: zuerst mußten sie, wegen des eingemengten häufigen Kiessandes, in der Hauptmasse gedreht werden; dann wurden sie von innen und außen auf der rauhen Oberfläche nach der ersten Bearbeitung mit einem dünnen Ueberzuge von reinem Thon, und endlich mit Verzierungen und Asphaltüberzug versehen; die rauhe Oberfläche aus der ersten Bearbeitung diente dann zum Festhalten der folgenden Ueberzüge. Der Gebrauch der Töpferscheibe scheint bei den Urnen in den Wendenkirchhöfen, bei ihrer hohen Vollendung, außer Zweifel zu sein. - Außerdem


|
Seite 69 |




|
sendet sich unter den Scherben noch ein runder, hoher Fuß und der oben beschriebene Boden einer Urne mit dem Kreuze mit fächerförmig gestalteten Balkenenden. Als Seltenheit verdient bemerkt zu werden, daß der flache Boden einer schwarzen Urne eine Dicke von 3/4" hat.



|



|
|
|
Zweiter Begräbnißplatz von Camin bei Wittenburg.
Nicht weit von dem großen Begräbnißplatze, jenseit des Quellenabflusses, ist eine zweite Begräbnißstelle, an welcher zuweilen Urnenscherben gefunden sind. Endlich ward vor kurzem auch eine ziemlich wohl erhaltene, weitgeöffnete, mit Streifen verzierte, braune Urne daselbst gefunden und in derselben eine eiserne Heftel, welche der Rost nicht angegriffen hat, weil der Boden hier mehr reiner Sand ist. Beide Stücke sind der Sammlung des Vereins einverleibt.



|



|
|
|
Wendische 1 ) Begräbnißurne von Malchin, No. 1.
In dem sogenannten "Hainholze" bei Malchin ward im Sommer 1836 bei Aufräumung des Weges von Malchin nach Basedow im Sande eine mit einem Steine zugedeckte Graburne gefunden, welche der Herr Geheime Hofrath Lüders zu Malchin ganz in dem Zustande, wie sie gefunden war, an den Verein einsandte. Dem Herrn Archivar Lisch verdankt der Bericht die folgende ausführliche Beschreibung und Erörterung dieses interessanten Gefäßes und seines Inhalts.
Die Urne ist 7" hoch, 10" weit im Bauch, 7 1/2" weit im Rande, 3 1/2" im Durchmesser in der Basis. Sie besteht aus Thon, der im Innern stark mit Kiessand vermengt ist; im Aeußern ist die Urne glatt, von brauner Farbe, mit Glimmerpünktchen. Der obere Theil der Urne ist mit Strichen verziert, welche aus freier Hand eingegraben sind. Die Hauptverzierung besteht aus den bekannten Zickzacklinien. Der Inhalt der Urne war bei der Ueberlieferung noch nicht angerührt; die Urne war völlig mit angebrannten, zersprungenen Knochen und Sand gefüllt; fast die Hälfte war Sand. Das Ganze war fest verpackt und mit Pflanzenwurzeln durchwachsen. - Eine Entleerung gab interessante Resultate; die Knochen waren sehr fein, die Schädelknochen sehr dünne, zwei Zähne sehr klein. Unter den Knochen fand sich


|
Seite 70 |




|
1) ein Würfel oder Spindelstein aus graubraunem feinem Sandstein oder gebranntem Thon, mit Verzierungen am äußern Rande: in der Mitte ein herumgehender Reif und zu beiden Seiten quer laufende Striche;
2) fünf Fragmente eines Kammes von feinem Knochen, in der Form wie Frid. Franc. XXXI, Fig. 5, nur kleiner, mit Nietlöchern, in deren einem ein eisernes Niet steckt, welches stark an ein Schädelfragment gerostet ist;
3) neun Fragmente von weiß calcinirten feinen Knochen= oder Elfenbeinplatten mit höchst regelmäßigen, feinen, eingepreßten Zickzackverzierungen; die Stücke geben einen weißen Strich, wie seine weiße Kreide; die Textur zeigt augenscheinlich ein Knochengebilde. Ein Nietloch, wie an den Fragmenten des Kammes, deutet daraus hin, daß diese Fragmente, welche sich nur durch die Feinheit und Verzierungen von denen sub 2 unterscheiden, ebenfalls einen Kamm gebildet haben;
4) Fragmente einer kleinen Heftel, nämlich: der um die Stange gewundene Spiraldrath aus Bronze und ein Stück einer Nadel aus Eisen, beides an ein Schädelfragment gerostet;
5) drei Stücke braunen Harzes, wie Stücke von Mumien, welche am Licht hell brannten und dann Wohlgeruch von sich gaben.
Nach den Gebeinen und den Geräthschaften möchte diese Urne wohl die Ueberreste eines jungen Frauenzimmers bergen: nach allem ist dies mehr als wahrscheinlich; dann erhielte das vielbesprochene Werkzeug des Spindelsteins hier allerdings seine Bedeutung.
Die Graburne von Malchin hat ein vielseitiges Interesse.
Zuerst ist es im hohen Grade merkwürdig, daß bei Cheine in der Altmark im J. 1825 ein völlig ähnlicher Fund gemacht ward. Hier bei Cheine war ein sogenannter Wendenkirchhof 1 entdeckt; dicht unter der Erde, ohne Hügelaufwurf, standen die Urnen zahlreich auf platten Steinen neben einander: alle sind weitbauchig und weit geöffnet, mit Linearverzierungen. Vorzüglich ist für uns eine Urne merkwürdig, weil sie fast denselben Inhalt hat, wie die malchiner; sie ist bei Kruse Tab. III, Fig. 5 abgebildet und der malchiner sehr ähnlich. In dieser Urne fand sich: 1) ein cylindrischer, in der Mitte durchbohrter Körper aus gebranntem


|
Seite 71 |




|
Thon, 3" dick und 11" im Durchmesser, von rothgelber Farbe: Danneil halt diesen Gegenstand für ein Amulet; 2) ein zweiter ähnlicher Körper; 3) drei aus Knochen geschnittene Körperchen (Fig. 13 und 14 bei Kruse), von denen zwei mit einem eisernen Stifte durchbohrt sind, der auf beiden Seiten fast 2" lang vorsteht, auf der einen Seite viereckig, auf der andern Seite undeutlich kopfförmig ist; diese Körperchen sind nach den lithographirten Abbildungen Fragmente eines Kammes, ganz den malchinern gleich; 4) drei Brusthefteln aus Bronze mit einer an einem Ende um eine Querstange gerollten Nadel, die sich am Ende des Bügels in eine Scheide legt (Fig. 8 bei Kruse), wie sich diese Hefteln so häufig in den Urnen der Wendenkirchhöfe finden; das Fragment einer Heftel in der malchiner Urne ist denen aus Cheine ganz gleich; 5) ein länglicher, unregelmäßiger Körper, von der Größe einer Saubohne, der aus einer Harzart zu bestehen scheint und von welchem Stücke auf glühende Kohlen gelegt schmolzen und einen Geruch gaben, ähnlich dem des Bernsteins. Außerdem fanden sich noch Stücke von andern Substanzen, von denen das eine einer verdickten Wurzel von Haidekraut (Erica vulgaris) glich und welches auf Kohlen ebenfalls verdampfte. Auch die Knochen der malchiner Urne waren mit Pflanzenwurzeln durchzogen; die verdickten Wurzeln erinnern an die auf dem Wendenkirchhofe bei Marnitz gefundenen, mit Morasteisen cylinderförmig überzogenen und in den Cylindern vergangenen Wurzeln 1 ); auch diese Wurzeln geben Geruch beim Glühen.
Nach dieser Vergleichung, welche in allen Stücken die auffallendste Gleichheit zwischen beiden, bisher sehr selten 2 ) beobachteten Begräbnissen zeigt, läßt es sich nicht bezweifeln, daß beide derselben Generation angehören. Nach den zierlichen Gebeinen in der malchiner Urne scheint diese einer weiblichen Leiche anzugehören; hiefür sprechen auch die Fragmente von Kämmen; hat dies seine Richtigkeit, so sind die viel besprochenen durchbohrten kleinen Scheiben (Spindelsteine, Amulete, Knäufe, Dopper, u. s. w. genannt) ein weibliches Geräth, also wahrscheinlich Spindelsteine; eben so sind dann die beschriebenen, häufig vorkommenden Brusthefteln ein weiblicher Schmuck. Die eisernen Niete (Eisen in so kleiner Arbeit!), in Vergleichung mit der Bestattungsweise, deuten auf ein


|
Seite 72 |




|
wendisches Begräbniß, und hat dies wieder seine Richtigkeit, so ist es außer Zweifel, daß die braunen Urnen mit Glimmerfünkchen wendischen Ursprungs sind, da die malchiner Urne von dieser Beschaffenheit ist.
Zur größern Veranschaulichung ist dieser interessante Fund in Tab. I. lithographirt diesem Jahresbericht beigegeben.
Fig. 1. ist die mit Knochen und Pflanzenwurzeln gefüllte Urne.
Fig. 2. sind charakterische Knochen aus der Urne: a und b sind zwei Zähne, an deren kleinerm ein ungehöriger Knochen auf der Krone festgerostet ist, - c ist ein Finger= oder Zehenknochen.
Fig. 3. a, b, c sind drei Stücke Räucherwerk.
Fig. 4. ist der eine Kamm aus festem Knochen, in viele Stücke zersprungen und wieder zusammengestellt. Bei a und b stehen eiserne Niete hervor, auf welchen etwas gesessen hat; das Niet bei a ist wie ein Knopf stark verrostet; bei d, e, f sind Nietlöcher; bei c ist ein Stück vom Schädel an der untern Seite des Kammes festgerostet.
Fig. 5. ist der zweite Kamm aus feinem, weißem, calcinirtem Bein mit eingegrabenen Verzierungen, wie wenn man einen Meißel auf seinem Ecken abwechselnd fortgehen läßt, mit Hinterlassung der Spuren seiner Schärfe. Bei a, b, c, d sind Nietlöcher. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese feinere Platte die erste Fig. 4. zur Zierde bedeckt hat; die Niete und Nietlöcher bei a und b in beiden Figuren scheinen auch übereinzustimmen.
Fig. 6. ist der Spindelstein aus grauem Thon.
Fig. 7. ist das Fragment der Heftel; a ist die Windung des kupfernen Draths; bei b ist eine eiserne Nadel, bei c ein Stück vom Schädel angerostet.
Die malchiner Begräbnißurne findet ferner noch Aufklärung durch Nachrichten von andern gleichen Funden in der Altmark, welche vom Hrn. Regierungsrath von Werder, zu Magdeburg, gemacht und in den Berichten der deutschen Gesellschaft zu Leipzig vom J. 1829, S. 4 flgd., beschrieben sind. - Bei dem Dorfe Sanne, 1 1/2 Meile von Tangermünde und 1 Meile von Stendal, zieht sich eine natürliche Anhöhe mehrere hundert Schritte weit im ebenen Felde hin. Hier wurden schon früher Urnenscherben in großer Anzahl gefunden und schon bei leichter Nachgrabung Urnen, welche auf ganz einfache Weise in den Sand neben einander eingegraben wurden, ohne alle Steinsetzungen, Höhlungen, u. dgl.; selbst einer Sicherung von oben erfreueten sich die


|
Seite 73 |




|
Urnen nicht. Man wählte nur die höchste Stelle des Hügelzuges zur Begräbnißstätte. Der Sand bedeckte einige Urnen noch fußhoch, andere nur zollhoch, ja eine stand mit dem Rande schon zu Tage. Bei der Entblößung der Urnen im feuchten Sande erschienen sie blendend schwarz. Von einigen achtzig Urnen wurden gegen 30 nur in Bruchstücken herausgenommen. Die Urnen haben einen kurzen Hals (Rand); unter dem Rande bauchen sie sich aus und verengen sich bis zum Fuße; ihre Farbe ist bald mehr, bald weniger schwarz oder braun, die Masse mit Kiessand, auch mit Glimmertheilen gemengt. Die Verzierungen der Urnen bestehen theils aus Vertiefungen, theils aus knopfartigen Erhöhungen. Die Vertiefungen bestehen aus Ringen, welche um die Urne herumlaufen, aus halben Bogen, graden Streifen, meist Dreiecken, und Punkten, alle mit freier Hand gemacht. Nur eine Urne ist mit Henkeln versehen, die andern haben kleine durchlöcherte Erhabenheiten. - Der Inhalt der Urnen bestand größtentheils aus gebrannten Menschenknochen, mit Beimischung des Sandes, der den Hügel bildet; von Asche fand sich wenig; die Stücke der Hirnschädel waren dazu gebraucht, die andern Knochenreste zu bedecken. In den meisten Urnen lagen dichte Gewebe von zarten Wurzelfasern. Zähne wurden wenige und nur selten ganz unverletzt gefunden. Von den Metallüberresten waren die meisten vom Feuer beschädigt. Man entdeckte einen spiralcylindrischen Fingerring von 3 1/2 Windungen, eine Heftel (wie sie gewöhnlich unter ähnlichen Umständen vorkommt); ferner zeigten sich Glasperlen von blauer Farbe. Ueberdies fanden sich Ueberreste von Kämmen (wie sie auf unserer Abbildung dargestellt sind), deren Zähne abgebrochen sind; in den Rändern derselben sind hervorstehende Metallnieten (von Eisen?). Auch lag in den Urnen Räucherwerk, in Form und Größe der türkischen Bohnen, das entzündet einen angenehmen Geruch verbreitet. Waffen fanden sich nirgends. - Nach dem Berichte vom J. 1831, S. 6 flgd., hatte die Begräbnißstelle abermals eine ziemliche Ausbeute gegeben. Neben einer großen Masse von Urnenscherben wurden auch einige wohlerhaltene Urnen zu Tage gefördert. Es kam wieder kein einziges Waffenstück vor, sondern nur Bruchstücke von blauen Glasperlen, Finger= und Ohr=Ringen, Nestelnadeln, Hefteln und Haarkämmen. Daß die (hervorstehenden) metallenen (eisernen?) Stifte in den Kammbruchstücken dazu gedient haben, Ueberplatten mit Verzierungen an den Kamm zu befestigen, wird durch die jetzt aufgefundenen Bruch=


|
Seite 74 |




|
stücke mit Zeichnung außer. Zweifel gesetzt. Diese Fragmente lagen bei neu aufgefundenen Kammbruchstücken und scheinen von vermürbtem Elfenbein zu sein. Fast in allen Urnen fand sich auch diesmal unter den Knochenresten ein Stück Räucherstoff in Form einer Bohne. Man darf wohl, ohne zu irren, annehmen, daß die sannesche Grabstätte eine Begräbnißstelle für das weibliche Geschlecht gewesen sei. - Auch in der Gegend von Schlieben (S. 7) fanden sich Alterthümer aus Bronze und Knochen, einige Fragmente von Haarkämmen, Glasperlen, Ringe, Nadeln, die denen gleichen, welche bei Sänne gefunden wurden, so wie schwarz geröstete Waizenkörner, welche auch an andern Begräbnißstellen bei Magdeburg gefunden wurden.
Von gleichem Inhalt waren, nach dem Berichte von 1831, S. 10, ähnliche Begräbnißstellen bei Langengrassau, unweit Luckau in der Niederlausitz, an einem hohen, oben flachen Sandberge, der Heidenkirchhof genannt, auf welchem sich flache Hügel befinden, aus welchem schon früher Metallsachen zu Tage gefördert wurden. Eine Begräbnißstelle enthielt eine Schaafscheere, ein spitzzulaufendes Messer, ein pfriemenartiges Werkzeug u. dgl., alles vom feinsten Stahl. In andern Grabstellen zeigte sich immer unter einer niedrigen Erddecke im natürlichen Boden eine kleine kesselartige Vertiefung, mit calcinirten Knochen, Asche und etwas fremder, rothbrauner Erde ausgefüllt. Hier traf man weder eine Urne, noch ein Geräth; nur wenige machten eine Ausnahme. In dem einen Grabe lag die (gewöhnliche) Heftel von Kupfer und ein achteckiger Spinnwirbel (Spindelstein). In einigen andern kamen langzahnige Kammbruchstücke von Knochen und kupferne und eiserne Ueberreste von Ketteln, Haken und andern, unkenntlichen Dingen vor. In einem andern Grabe war eine große Urne, welche die calcinirten Knochenreste von einem erwachsenen menschlichen Körper und einem Kinde enthielt; darunter lag ein sauber gearbeitetes stählernes Messer, eine eiserne Klammer, eine dergleichen Schnalle, eine lange Nadel von Knochen, ein Stück Kamm von Knochen mit krummen Zähnen und einer durchgeführten eisernen Niete, viel mit calcinirten Knochen zum Theil zusammengeschmolzenes dunkelgrünes Glas, dergleichen Bronzeklumpen und ein wohlerhaltener Spinnwirbel.
Der Herausgeber macht im Berichte von 1831, S. 10, die Bemerkung, daß die auf dem rechten Ufer der Elbe liegenden Gräber bloße beraste Sandhaufen, die des linken Elbufers mit


|
Seite 75 |




|
Steinen umkränzte Hügel seien, - eine Bemerkung, die sich durch den bloßen Augenschein in tausendfältigen Beispielen von großen steinumkränzten Gräbern in allen Ländern als unrichtig erweiset. Richtiger möchte die Behauptung sein, daß die Begräbnißstellen in der Erde sich vorzugsweise vom rechten Ufer der Elbe ostwärts finden und sich nicht weit in die Länder am linken Ufer der Elbe erstrecken. - Mehr Wahrscheinlichkeit hat jedoch die Bemerkung des Herausgebers, daß die einfachen Sandhügel den Wenden gehören.
Wendische Begräbnißurne von Malchin, No. 2.
Da es wahrscheinlich war, daß an dem Fundorte der ersten Urne noch mehr Alterthümer sich fänden, so richtete der Herausgeber an den Herrn Geheimen Hofrath Lüders die Bitte, weitere Nachforschungen dort anstellen zu lassen. Derselbe erfüllte mit gewohnter Bereitwilligreit dieses Gesuch, und der von ihm mit diesem Geschäft Beauftragte fand auch wirklich in der Nähe des ersten Fundortes noch eine zweite Urne nebst einigen Scherben, welche durch die Güte des Herrn Geheimen Hofraths Lüders dem Ausschuß ebenfalls eingesandt wurden. Die schon beim Auffinden mehrfach eingebrochene Urne zerfiel beim Auspacken gänzlich. Sie war von mittlerer Größe, rothbraun im Aeußern, ohne Verzierungen, dick im Bruch, roh in der Masse, mit scharfem Bauchrande, mit hohem, ausgebogenem Halse und einem kleinen Henkel. Angefüllt war sie ganz mit vielen, fest verpackten Menschengebeinen und mit Sand; der ganze Inhalt und selbst die Wand der Urne war dicht mit Pflanzenwurzeln durchzogen. Stücke von Schädel, Kinnladen und Zähnen waren sehr fein und zierlich, die Nähte des Schädels klar ausgebildet und leicht getrennt. Unter den Knochen fand sich:
1) ein durchlöcherter Spindelstein von grauem Sandstein, mit eingegrabenen runden Vertiefungen verziert;
2) drei Bruchstücke eines knöchernen Kammes, jedes mit einem eisernen Niet, welches an beiden Seiten der Knochenplatte hervorsteht;
3) ein Bruchstück einer feinern Knochenplatte, mit doppelten Punktreihen verziert, ähnlich den schwarzen Urnen aus den Wendenkirchhöfen;
4) einige Stücke braunen Räucherwerks.


|
Seite 76 |




|
Allterthümer von Röbel.
Als Geschenk des Hrn. Hofraths Engel zu Röbel empfing der Verein: 1 eisernen Schildnabel und 3 eiserne Schildbuckeln, ganz wie von dem kothendorfer Schilde in Frid. Franc. Tab. IX, Fig. 1, und wie die Schildreste aus den caminer Begräbnissen Nr. 1, 2 und 5, - gefunden im alt=röbelschen Kirchenholze in einer Urne, welche beim Ausgraben zerfallen ist.
Urnenscherben von Prillwitz,
geschenkt vom Herrn Archivar Lisch. Derselbe berichtet, daß der Boden des Dorfes Prillwitz bei Neustrelitz, namentlich des fürstlichen und des Pfarr=Gartens, fast keine Stelle zeige, wo man nicht mit geringer Mühe Urnenscherben fände, soviel die Gärten auch bearbeitet und gereinigt sind. Der Herr Berichterstatter fand an der ersten besten Stelle sogleich die eingesandten Scherben. Ohne Zweifel ist es sehr wünschenswerth, daß eine sorgsame und kundige Hand alle dort verstreuten Scherben sammele und namentlich die mit Verzierungen versehenen, so wie Stücke vom Boden, von den Ausbauchungen und von den Rändern, dem Verein übergäbe, da sich durch Vergleichung derselben wohl ein Resultat gewinnen ließe. Herr Pastor Horn zu Prillwitz ist freundlich hiezu aufgefordert worden.
Erzfigur von Kl. Schmölen.
Bleierner Abguß eines menschlichen, knieenden Bildes aus Erz, welches im Original in der großherzogl. Alterthumssammlung zu Ludwigslust befindlich ist (vgl. Frid. Franc Tab. XXXI, Fig. 1), und in einer Graburne bei Kl. Schmölen, Amts Dömitz, gefunden ward, geschenkt von der Frau Professorin Schröter zu Langensee.
2. aus unbestimmter alter Zeit.
Handmühle von Wahmkow
Vom Herrn Canzleirath von Bülow zu Bützow: eine Handmühle aus Granit, bestehend aus zwei, äußerlich abgerundeten und in der Mitte durchbohrten Platten von 1 1/2 Fuß im Durchmesser und zusammen 1 Fuß Höhe, gefunden von dem Herrn Geber im Jahre 1831 am See zu Wahmkow. In der steilen Anhöhe an diesem See befinden sich nämlich zwei Gruben, augenscheinlich von Menschenhänden angelegt und, nach des Herrn Einsenders Meinung, in der Urzeit zu Fischerwohnungen dienend. In einer derselben fand sich beim


|
Seite 77 |




|
Suchen nach Alterthümern diese Mühle, welche jedenfalls wohl der vorchristlichen Zeit, wahrscheinlich schon der Zeit der Hünengräber, angehört, 1 )
Helm von Dobbertin.
Im Jahre 1836 ward beim Torfgraben 8 Fuß tief unter der Oberfläche eines Moors, welches auf der Feldmark Sehlsdorf unweit der Grenze mit Herzberg liegt, ein großer, schöner, ganz glatter Helm aus Bronze, ohne Rost, gefunden und durch die Herren Vorsteher des Klosters Dobbertin dem Vereine übergeben. In dem Begleitungsschreiben (des Herrn Barons von le Fort) heißt es: "Der Form nach scheint er eine sogenannte Sturmhaube zu sein, und muß inwendig ein starkes Futter dazu gedient haben, sein Gewicht dem Inhaber erträglicher zu machen; auch würde er ohne ein solches schwerlich auf einen Kopf von gewöhnlicher Stärke gepaßt haben. Die (regelmäßig gebohrten und in gleichen Zwischenräumen von einander abstehenden) Löcher am untern Rande haben wahrscheinlich dazu gedient, das innere Futter oder das Visir zu befestigen, und der (durch die ganze Dicke hindurchgehende) Riß am obern Theile der Wölbung verräth den kräftigen Hieb eines Schlachtschwertes oder einer Streitaxt, welchem der Träger unterlegen ist".
Becken von Borkow.
Ein Becken aus antikem Erz, 2 3/4 "hoch, im Boden 13", im Rande 15 1/2" Durchmesser, mit fast senkrechter Wand und 3/4" breit übergebogenem Rande, ganz glatt, ohne Rost, gefunden in der Modde eines Solls (Teiches) zu Borkow, Geschenk des Hrn. Oberlandforstmeisters Eggerss auf Borkow. Ein Kennerauae wird einst vielleicht aus der Erzmischung das Alter des Beckens bestimmen können, welche viel Aehnlichkeit mit der des wismarschen Horns (s. o.) und des dobbertiner


|
Seite 78 |




|
Helms hat; vielleicht gehört es derselben Zeit an, aus welcher das wismarsche Horn unbezweifelt stammt, nämlich der (germanischen) Zeit der Kegelgräber.
Ein Beil aus Knochen,
ungefähr 5" lang, vorgefunden in der Rumpelkammer eines ritterschaftlichen Gutes, geschenkt vom Herrn Bürgermeister Pries zu Waren.
Ein Kieselschiefer, dem Anschein nach ein
Schleifstein,4" lang, 1" breit, gegen 1" dick, auf dem Felde von Borkow ausgepflügt, Geschenk des Herrn Oberlandforstmeisters Eggerss.



|



|
|
|
3. aus dem Mittelalter.
a. Gottesdienstliches Geräth.
Taufbecken:
1) Auf dem Gute Rey ward 10 Fuß tief in einem morastigen, aus dem Garten in einen Soll führenden Graben bei Aufräumung desselben ein Taufbecken von Mefsing mit getriebener Arbeit gefunden. Der Besitzer, Herr Landrath von Schack auf Rey, hatte die Güte, dasselbe dem Vereine zu schenken, und Herr Archivar Lisch hat sich darüber im Folgenden näher ausgesprochen.
Diese Taufbecken gehören nach der in ihnen befindlichen Inschrift noch zu den räthselhaften, obgleich sie häufig Gegenstand der Untersuchung gewesen sind. Zusammengedrängt sind diese Untersuchungen in Kruse's deutschen Alterthümern, 1825, B. I, H. 4, S. 56-85; hiezu kommen noch einzelne Nachweisungen in Bd. II, H. 1, S. 79, und im Zweiten Jahresber. des thüring.=sächs. Vereins, 1822, S. 34.
Diese Taufbecken sind weit verbreitet; sie sind bisher beobachtet in Deutschland, Frankreich, Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen und Island. Ihr übereinstimmendes Kennzeichen besteht darin, daß in der Mitte im runden Felde der Gegenstand einer biblischen Geschichte in getriebener Arbeit erhaben dargestellt ist; um dieses runde Feld läuft im Kreise eine erhaben gepreßte oder geschlagene Inschrift, deren geschnörkelte gothische Buchstaben, 7 an der Zahl, sich 5 Mal wiederholen.


|
Seite 79 |




|
Um diese dunkle Inschrift läuft zuweilen noch eine zweite, welche, klarer an Sinn, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Skandinavien aus einem deutschen Spruche besteht. Die innere Inschrift ist auf allen Becken gleich und scheint nach einem bestimmten katholischen Ritus gefertigt zu sein. Einige haben sie für gnostische Zeichen, andere für chaldäische Buchstaben gehalten; die besonnensten Erklärer finden darin eine abgekürzte, lateinische gottesdienstliche Formel.
Unser Becken, aus Messing geschlagen, mißt ungefähr 2 Fuß im Durchmesser und 3 Zoll in der Hohe; der Rand ist 3 1/2 Zoll breit. In der Mitte des Beckens ist in einem Kreise von 7 Zoll im Durchmesser von außen nach innen die Geschichte des Sündenfalls in erhabener Arbeit ausgetrieben: an einem Baume, um welchen sich die Schlange windet, stehen in einem Garten Adam und Eva, deren Gesichter entweder gar nicht ausgetrieben oder schon rund abgescheuert sind. Um dies Medaillon läuft in einem Kreise in einer Hohe von 1 Zoll eine von der innern Fläche des Beckens eingepreßte oder mit einem Stempel eingeschlagene Inschrift, welche, über dem Gipfel des Baumes mit der Schlange anfangend und von der Linken zur Rechten fortlaufend, sich fünf Mal in dem Kreise wiederholt. Diese auf allen bekannten Becken in derselben Form immer wiederkehrende Inschrift von sieben gothischen Buchstaben ist im zweiten Jahresber. des thüring.=sächs. Vereins Tab. VIII in der zweiten Stelle nach unserm Becken am getreuesten und klarsten dargestellt, auch in Kruse's deutschen Alterth. Bd. I, H. 4, Tab. 3, Fig. 1 a und Fig. 2 b und Tab. 4, Fig. 3 und Fig. 4 b finden sich getreue Abbildungen derselben. Die im dritten Jahresber. des thüring.=sächs. Vereins Tab. VIII abgebildete Inschrift fehlt jedoch darin, daß der erste Buchstabe nur zwei senkrechte Linien hat; auf unserm Becken sind drei Linien ganz deutlich, obgleich es sich nicht läugnen läßt, daß dieser Buchstabe an den verschiedenen Stellen nicht immer gleich ist, indem die erste Linie eine verschiedene Richtung oder Neigung hat. Außerdem beginnt jede Abtheilung eben so klar mit zwei kleinen Rosen über einander, wie in Kruse a. a. O. I, 4, Tab. 3, Fig. 1 a und Tab. 4, Fig. 3. Von allen Erklärungsversuchen scheint mir die von Thorlacius bei Kruse a. a. O. I, 4, S. 72 den Vorzug zu verdienen; derselbe liest nämlich:

Auf jüngern Taufbecken findet sich unzweifelhaft häufig die ähnliche Inschrift:
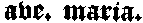


|
Seite 80 |




|
Becken, welche in dem mittlern Medaillon mit der Vorstellung des Sündenfalles und in der ersten Umschrift mit dem unsrigen übereinstimmen, finden sich in der Kirche zu Tönningen, in der Kirche zu Giebichenstein, in dem Stifte Steterburg, zu Kopenhagen und Wien (welches aus Italien stammen soll); man vgl. Kruse a. a. O. S. 59, 72, 80 und 81; nach Thorlacius a. a. O. bei Kruse findet sich in Skandinavien die Darstellung des Sündenfalles am häufigsten.
Von der Inschrift bis zum Rande des Bodens ist in unserm Becken, von außen nach innen getrieben, noch eine bildliche Darstellung in einem Ringe von 2 1/2 Zoll Breite: diese zeigt einen laufenden Hirsch, der von einem kleinem Thiere, einem Windspiel am ähnlichsten, begleitet wird; diese Darstellung wiederholt sich sechs Mal. Zwischen den Hirschen steht an 5 Stellen ein Stumpf eines Baumstammes mit einer Eichel und Eichenlaub, an der sechsten Stelle stehen zwei solcher Eichenstumpfe. Die getriebenen Reliefs des Sündenfalles und der Hirsche zeigen nicht allein gute Zeichnung, sondern auch eine große Geschicklichkeit und eine ausgezeichnete Berechnung der Wirkung des Treibens, nach den eingeschlagenen Vertiefungen auf der untern Seite zu urtheilen. - In den äußersten Rand des Bodens ist ein Kreis von kleinen Verzierungen mit einem scharfen Stempel eingeschlagen, welche, dicht an einander schließend, abwechselnd aus einer kleinen Rose und einem kleinen Blatte bestehen. Auf dem ausgebogenen Rande des Beckens ist ebenfalls mit Stempeln eine Verzierung eingeschlagen; diese besteht aus 70, nach dem Innern des Beckens geöffneten, aus zwei concentrischen Punktlinien gebildeten Rundbogen von ungefähr 1 Zoll Spannung, welche durch eine Rose in den Stützpunkten verbunden sind; unter jedem Bogen ist ein kleines Lamm mit einem Stempel eingeschlagen.
Die Darstellung des Sündenfalles hat bekannte Gründe; die Darstellung der Hirsche bezieht sich wohl auf Psalm 42, 1: "Wie ein Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet meine Seele, Gott, nach Dir". Daher ist auch in dem Mittelschilde des Beckens zu Glaucha statt des Sündenfalles ein Hirsch dargestellt; vgl. Kruse a. a. O. S. 83. Außerdem findet sich im Mittelschilde auch öfter die Geschichte von Josua und Caleb mit den Weintrauben (IV Mos. 13), wie in der Kirche zu Träden und an andern Orten (vgl. Kruse a. a. O. S. 59); außerdem ist auch die Verkündigung Mariä öfter dargestellt, wie in dem Becken der Moritzkirche zu Halle (vgl. Kruse a. a. O. S. 78). In dem Becken einer Dorfkirche bei Naumburg findet sich im Mittelschilde ein Kranz von


|
Seite 81 |




|
Granatäpfeln (vgl. Dritten Jahresber. des thüring.=sächs. Ver. S. 35), und in dem Becken der Kirche zu Punschrau bei Naumburg ist der große Christoph mit Christus in Kindesgestalt auf der Achsel dargestellt (vgl. Kruse a. a. O. III. 1, S. 79).
Die Erklärer scheinen diese Becken in das 12. und 13. Jahrhundert, in die Zeit der Heidenbekehrung und Kirchenerbauung zu setzen. Die Buchstaben der Inschrift scheinen jedoch einer jüngern Zeit anzugehören und mit den Buchstaben der Inschriften auf den Leichensteinen aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Aehnlichkeit zu haben; auch der Styl der zweiten deutschen Inschrift auf einigen Becken deutet auf diese Zeit.
Auf der äußern Seite des Randes sind zwei Wappen eingravirt. Links an der ersten Stelle steht das Wappen der von Köllen und darüber die Buchstaben
Rechts daneben steht das Wappen der von Bülow, darüber die Buchstaben:
und unter diesem letztern Wappen:
Diese Inschriften sind, wie hier gedruckt, in den lateinischen Capitalen des 16. Jahrhunderts gravirt. Das Becken war demnach Besitz oder Geschenk einer Anna von Bülow, verehelichten von Köllen, deren Gemahl ein E. v. Köllen war. Die von Köllen (de Colonia), eine meklenburgische Familie des Mittelalters, starben im 17. Jahrhundert aus und besaßen als altväterliches Lehn= und Haupt=Gut noch zuletzt Gr. Grabow und Cölln. Sie waren mehrfach mit dem Hause von Bülow verwandt; diese Vermählung ist aber bis jetzt unbekannt. Am wahrscheinlichsten ist dieser C. v. K. der Christoph von Köllen, welcher 1596 starb. Im J. 1624 lebten zu Gr. Grabow zwei Vettern Christoph und Caspar von Köllen, (Gerds und Adams von Köllen Söhne). Einer von diesen wird der in Frage stehende C. v. K. sein.
Nach Rey mag das Becken in Kriegszeiten gekommen sein. Rey war ein altes Gut der von Kalden, deren Name und Wappen aber von denen der von Kollen verschieden ist. Diese Bemerkung zur Abwehr von Vermuthungen auf die von Kalden, welche hier nicht möglich sind. 1 )


|
Seite 82 |




|
2) Bei Aufräumung des Karpfenteiches zu Krassow bei Wismar ward im Sommer 1835 gefunden und durch den Herrn Bataillons=Auditeur Grimm zu Wismar dem Vereine geschenkt ein dünne geschlagenes, rundes Becken von Kupfer, wahrscheinlich ein Tauf= oder Weihbecken. Im Innern sind zur Verzierung an der Wand vier schmale Kupferstreifen aufgekittet, auf deren jedem ein ausgepreßtes Bild des heil. Petrus mit den Schlüsseln in der Hand steht. In der Mitte auf dem Boden hat auf einer aufgetriebenen runden Erhöhung ein ähnliches, rundes Blech gesessen, auf welchem, nach dem Berichte der Finder, ein Frauenbild mit einem Kinde auf dem Arme zu selben gewesen ist.
Löffel.
Herr Kaufmann Dalitz zu Stadt Malchow schenkte durch den Herrn Schulrath Meyer zu Schwerin
1) einen in zwei Stücke zerbrochenen Löffel von Messin g mit Traubenverzierung am Stielende, ganz wie Frid. Franc. Tab. XXXI, Fig. 4, und wie der zu Alt=Kalden gefundene, Jahresber. I, S. 15 beschriebene;
2) einen ähnlichen Löffel von sehr gelbem Messing, am Stielende mit dem gegossenen Bilde eines Heiligen, der einen Stab in der Linken hält; darunter die mit Punkten eingeschlagene Inschrift: S. IACOBVS.
Beide Löffel sind gefunden bei Grabung eines Fundaments in der Stadt Malchow.
b. Weltliches Geräth.
Waffen:
1) ein Degen mit schmaler Klinge, ganz von Eisen, an der Stelle des Schlosses zu Grabow gefunden (vom Herrn Maler Langschmidt zu Schwerin).
 . - - Nähere Beschreibung und
Abbildung werden unten folgen". Auch in
Pommern finden sich mehrere Taufbecken
dieser Art, vgl. Vierter Jahresber. der
pommerschen Gesellsch. S. 72 flgd. (Hier
werden die letzten Buchstaben ebenfalls AVE
gelesen.)
. - - Nähere Beschreibung und
Abbildung werden unten folgen". Auch in
Pommern finden sich mehrere Taufbecken
dieser Art, vgl. Vierter Jahresber. der
pommerschen Gesellsch. S. 72 flgd. (Hier
werden die letzten Buchstaben ebenfalls AVE
gelesen.)
Sollten sich nicht auch in Meklenburg noch mehrere finden? Diese Frage empfiehlt sich der Aufmerksamkeit vorzüglich der Herren Prediger.


|
Seite 83 |




|
2) ein Schlachtschwert von Eisen mit breiter Klinge, welche halb abgebrochen ist, gefunden bei Vertiefung des Eldeflusses zwischen Plau und Lübz (vom Herrn Oberbaurath Wünsch zu Schwerin).
3) eine lange eiserne Lanzen spitze, gefunden unter tiefen Fundamenten eines Theils der alten Stadtmauer zu Röbel (vom Herrn Hofrath Engel daselbst).
4) eine Lanzen spitze aus Eisen, gefunden an der Fuhrt zwischen Kölpin= und Flesen=See bei Göhren (vom Herrn Oberbaurath Wünsch).
5) 6 Pfeilspitzen, 1 großer Bolzen, kleine Fragmente von einem Ringpanzer, 3 Ringe, alles aus Eisen, gefunden nebst mehreren andern Eisensachen von den Hauswirthen zu Vietlübbe bei Wegräumung alten Bauschutts und Mauerwerks auf den Wiesen an der Damerow=Karbower Scheide (vom Herrn Amts=Secretär Bahl zu Goldberg).
Anderes Geräth.
6) ein Steigbügel aus Eisen, mit der unter 4) erwähnten Lanzenspitze zusammen gefunden und von demselben Geber.
7) zwei verschiedene Sporen von Eisen (von einem ungenannten Geber).
8) ein eiserner Sporn mit langer Radstange, gefunden zu Vogtshagen bei Dassow (vom Herrn von Stern auf Gr. Welzin, Erbherrn auf Tüschow).
9) ein schaufelartiges räthselhaftes Werkzeug von Eisen, gefunden zu Prillwitz (vom Hrn. Pastor Horn daselbst).
10) Scherben von dicken Glasgefäßen, vom Herrn Archivar Lisch im J. 1836 auf der Burgstätte zu Prillwitz gesammelt. (Ein kleines Gefäß von derselben Art, wie diese Scherben, ist vor einiger Zeit beim Schlosse zu Güstrow in der Wiese gefunden und im Besitz der dortigen Domschule.)
11) ein großer vergoldeter Fingerring von Kupfer, mit eingesetztem Schilde von Glas, der aus zwei Stücken besteht: die untere pyramidalisch geschliffene Hälfte ist farblos und vergoldet, die obere Platte ist ebenfalls farblos; zwischen beiden ist eine rubinrothe, durchsichtige Lacklage, welche nicht allein die beiden Glasstücke verbindet, sondern auch dem Ganzen das Ansehn giebt, als sei das Schild ein á jour gefaßter Rubin. (Gefunden zu Maßlow, geschenkt vom Herrn Bataillons=Auditeur Grimm zu Wismar.)


|
Seite 84 |




|
Siegel:
Ein Siegel
 , gefunden unter altem, gekauftem
Metall (vom Herrn Plattirer Behrens zu Schwerin).
, gefunden unter altem, gekauftem
Metall (vom Herrn Plattirer Behrens zu Schwerin).
Lack=Abguß des großen Siegels des Fürsten Pribislav IV. (II.) von Richenberg=Parchim, nach einem OriginalSiegel (von Herrn Oberlehrer Dr. Hering zu Stettin).
Abdruck des Siegels des Friederich Hasenkop
 , eingesandt vom Herrn Rector Masch zu
Schönberg, der darüber Folgendes schreibt: "Der
Stempel, von dem der anliegende Abdruck genommen,
ist aus Metall und ward 1828 auf dem ratzeburger
Stadtfelde gefunden; er war damals im Besitze des
Senators Riemann in Ratzeburg, ob er ihn noch hat,
oder, wie er beabsichtigte, ihn nach Kiel gesandt,
weiß ich nicht."
, eingesandt vom Herrn Rector Masch zu
Schönberg, der darüber Folgendes schreibt: "Der
Stempel, von dem der anliegende Abdruck genommen,
ist aus Metall und ward 1828 auf dem ratzeburger
Stadtfelde gefunden; er war damals im Besitze des
Senators Riemann in Ratzeburg, ob er ihn noch hat,
oder, wie er beabsichtigte, ihn nach Kiel gesandt,
weiß ich nicht."
Die Familie Hasenkop ist als meklenburgische hinreichend bekannt und soll nach v. Meding Nachrichten v. adl. Wappen I. No. 336, der seine Nachrichten aus dem MS. des Herrn v. Gamm von abgegangenen meklenburgischen Familien genommen, mit Paschedag Hasenkop zwischen 1466 und 1498 ausgestorben sein. Allbekannt ist die Angabe, daß die Hasenkop mit den v. Maltzahn von einerlei Abrunft seien, obgleich entscheidende Beweise dafür oder dagegen mir nicht bekannt geworden sind.
"Haben die neuerdings angestellten archivalischen Untersuchungen über die Familie Molzahn (Maltzahn) diese Frage entschieden?"
Daß eine Aehnlichkeit des Wappens zur Entscheidung
nicht genüge, ist an sich schon klar und hier um so
mehr, da die ältesten mir bekannten Maltzahnschen
Siegel die Hasenköpfe gar nicht führen. Diese sind
aber das bei v. Westphalen Mon. ined. III. tab. V ad
p. 1465 No. 53 von 1292 mit der Umschrift:
 FREDERICI VAN MOLTZAN, welches einen
ausgerissenen Weinstock mit 2 Blättern und einer
Traube zeigt, und eins im ratzeburger Archiv von
1312 mit der Umschrift:
FREDERICI VAN MOLTZAN, welches einen
ausgerissenen Weinstock mit 2 Blättern und einer
Traube zeigt, und eins im ratzeburger Archiv von
1312 mit der Umschrift:
 , welches den Weinstock mit 3 Blättern
hat. In der Urkunde heißt er Mvltsan.
, welches den Weinstock mit 3 Blättern
hat. In der Urkunde heißt er Mvltsan.
Im ratzeburger Archiv sind nur 2 Siegel der Familie
von Hasenkop und zwar von 1319,
 mit 3 Hasenköpfen (auch bei v. Meding
l. c. erwähnt) und dann von 1397
mit 3 Hasenköpfen (auch bei v. Meding
l. c. erwähnt) und dann von 1397
 , das in einem gespaltenen Schilde
vorne 2 Hasenköpfe übereinander, hinten aber eine
kleine Traube (oder Blatt) und ein größeres Blatt
hat, also dem Maltzahnschen sehr ähnlich ist. Das mit=
, das in einem gespaltenen Schilde
vorne 2 Hasenköpfe übereinander, hinten aber eine
kleine Traube (oder Blatt) und ein größeres Blatt
hat, also dem Maltzahnschen sehr ähnlich ist. Das mit=


|
Seite 85 |




|
getheilte Siegel ist unstreitig viel älter, als jene beiden. Und liefert eine dritte Form.
Fridericus Hasencob findet, sich als Zeuge in der Urkunde von 1200 des Gr. Gunzel II. von Schwerin über Goddin und das Pfarrgut in Eixen in den Jahrbüchern des Vereins I. S. 200. (Wenn v. Meding l. c. ihn als 1221 lebend anführt, so kommt diese Jahrszahl zweifelsohne aus dem Abdruck der angegebenen Urkunde bei Westphalen mon. ined. IV. p. 906 (nicht 904, wie Jahrb. I. c. steht) her, der sie in jenes Jahr stellt.) Daß diesem das vorliegende Siegel gehörte, läßt sich freilich vielleicht nie nachweisen, jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, da es seiner Größe und Form nach doch wohl ins 13te Jahrhundert gestellt werden muß.
Zu dem im Jahresber. I. S. 16 aufgeführten Siegel des Jachgim Holloger bemerk Herr Rector Masch, daß Joachim Holloger im J. 1500 in einer Urkunde in Schröder's Pap. Meckl. p. 2602 vorkommt.
Vom Herrn Bürgermeister Pries zu Waren: ein großes eisernes Spornrad, gefunden auf einem angeblichen Lagerplatze wallensteinischer Truppen.
Vom Herrn Seminar=Director, Pastor Sellin zu Ludwigslust: ein Pfeifenkopf von Meerschaum, schön geschnitten, seines Alters wegen merkwürdig. Im obern Theile sind 11 Personen in halber Figur, über Schranken hervorragend, bei einem Zechgelage versammelt, en relief dargestellt. Den mittlern Raum nimmt Bacchus auf der Tonne ein; ein Gast zapft aus dieser. Unter der Tonne ist die Jahreszahl 1651 eingeschnitten. Costüm und Verzierungen stimmen zu dieser Zeit. Unten an der Seite ist unter Mauerbogen rechts der meklenburgische Stierkopf, links ein Wappenkreuz en relief eingeschnitten.
II. Geognostische Merkwürdigkeiten und andere seltene Naturalien.
Ein Echinit von Linsengröße, völlig erhalten, in Feuerstein, gefunden auf der Feldmark Crivitz am rechten Ufer der Warnow (vom Hrn. Bau=Conducteur von Motz zu Schwerin).


|
Seite 86 |




|
Ein Belemnit in Feuerstein, gut erhalten, mit vielen hervorstehenden polypenartigen Armen, ebendaselbst gefunden (von Demselben).
Ein Feuerstein mit einer wohl erhaltenen Muschelversteinerung, gefunden auf der Feldmark des Dorfes Salem, Amts Crivitz (vom Herrn Amtshauptmann Ratich zu Wittenburg).
Ein Geweih von einem Elenthier, im Störflusse bei der Schiffbarmachung desselben gefunden (vom Herrn Ober=Baurath Wünsch zu Schwerin).
III. Pläne, Charten Ansichten und Bildnisse.
Plan von Wismar und seiner Umgebung und der Blockade von 1715, nach dem Original des General=Majors von Schmettau (d. 13. Decbr. 1732), aus Makulatur bei einem Kaufmann hervorgesucht (vom Hrn. Cand. jur. Glöckler zu Schwerin).
Dr. von Hagenow's Charte von Rügen (Geschenk des Herrn Dr. von Hagenow zu Greifswald).
Vier Ansichten des ehemaligen bischöflichen Schlosses, jetzigen Amtshofes, zu Warin, welches nächstens abgebrochen werden soll, auf Kosten des Vereins gezeichnet vom Herrn Porträtmaler Krug aus Rostock.
Arnold's Originalzeichnung des Brustbildes der hochseligen Erbprinzessin Helena Paulowna für seinen Kupferstich, nach dem Pastellgemälde von Schröder (durch Herrn Dr. Friedländer zu Berlin von dessen Vater, welcher diese Zeichnung von Arnold's Erben erhielt).



|



|
|
|
IV. Münzensammlung.
Die Anzahl der Münzen und Medaillen des Vereins hat sich in dem abgelaufenen zweiten Jahre von 217 bis auf 492 Stücke vermehrt. Geschenke sind, der Zeit nach, eingegangen von den Herren Ober=Medicinalrath Dr. Flemming zu Sachsenberg, Kammerpräsidenten von Levetzow auf Lelkendorf, Regierungsrath von Oertzen zu Schwerin, Maler Langschmidt daselbst, Gutsbesitzer von Flotow auf Altenhof, Candidat Dethloff zu Schwerin, Gutsbesitzer Jahn auf Adamsdorf, Pensionär Drenkhahn zu Boddin, Bau=Conducteur Hermes zu Sachsenberg, Major von der Lühe auf Redderstorf, Apotheker Stockfisch zu Zarrentin, Bürgermeister Pries zu Waren, Rector Masch zu Schönberg,


|
Seite 87 |




|
Schulrath Meyer zu Schwerin, Ober=Münzmeister Nübell zu Schwerin, Superintendent Eyller zu Wismar, Dr. Beyer zu Parchim, Post=Commissär Krüger zu Hamburg, Regierungs=Präsidenten von Lützow zu Schwerin, Dr. Reder zu Rostock, Gutsbesitzer von Stern auf Gr. Welzin, Apotheker Schumacher zu Parchim, Gutsbesitzer Jahn auf Kl. Vielen, Hofrath Dr. Dornblüth zu Plau, Koch Schulz zu Gr. Markow, Kammerherrn von Vieregge sen. zu Wismar, Kammerrath von Grävenitz zu Neustrelitz, Dr. Burmeister zu Wismar und Adv. Schweden zu Schwerin.
Angekauft sind 27 Stücke.
Sämmtliche Medaillen und Münzen sind nunmehr geordnet und zerfallen in drei Hauptabtheilungen: Hohlmünzen, zweiseitige Münzen, Medaillen; jede dieser Hauptabtheilungen zerfällt in zwei Classen: in einheimische und in fremde, zu welchen letzteren auch die unbestimmten gelegt sind. Die einheimischen zweiseitigen Münzen sind für jetzt abgetheilt in Münzen
1) der Herren zu Werle, Fürsten zu Wenden,
2) der Bischöfe zu Ratzeburg,
3) der Herren und Herzoge zu Meklenburg,
a. vor der Landestheilung,
b. nach der Landestheilung
α. der Herzoge und Großherzoge von Meklenburg=Schwerin,
β. der Herzoge von Meklenburg=Güstrow
γ. der Herzoge und Großherzoge von Meklenburg=Strelitz,
4) der meklenburgischen Städte
a. Rostock,
b. Wismar,
c. Gnoien,
d. Güstrow,
e. Parchim (Privatscheidemünzen),
f. Neubrandenburg,
g. wegen Wismar die Münzen der Vierstädte (Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar).
Die auswärtigen Münzen sind abgesondert nach den verschiedenen Ländern oder Städten, denen sie zugehören.
Der General=Versammlung ist von dem Aufseher der Sammlung, Herrn Archivar Groth, ein vollständiges Verzeichniß sämmtlicher Münzen und Medaillen vorgelegt, woraus des beschränkten Raumes wegen hier nur nachfolgende angeführt werden.


|
Seite 88 |




|
Bracteaten.
1) Einheimische
a. Ein Stück, 9/12 Z. i. D., 14 Aß schwer.
Ein Büffelskopf mit einer Lilie zwischen den Hörnern, gekerbter Rand.
Vid. Evers Mekl. Münzverfassung II. p. 12 in fine.
b. Ein ditto, 8/12 Z. i. D., 10 Aß schwer.
c. Ein Hohlpfennig, 9/12 Z. i. D., 9 Aß schwer.
Der Büffelskopf, zwischen dessen Hörnern eine Krone mit drei Kugeln. Gekerbter Rand.
d. Ein anderer, 8/12 Z. i. D., 11 Aß schwer.
Ein Stierkopf mit geschlossenem Maule und sehr großen, beinahe zusammengehenden Hörnern, zwischen welchen eine Kugel schwebt; platter Rand.
2. Auswärtige
a. Lübeck, 10/12 Z. i. D., 9 Aß schwer. Ein Adler mit zwei Köpfen, gererbter Rand.
b. Hamburg, 8/12 Z. i. D., 12 Aß schwer. Drei Thürme auf einer Mauer, in deren Mitte ein Thor mit einem Nesselblatte.
c. Unbestimmt, ausgebrochen, 4 Aß schwer. Zwei neben einander gestellte Schilde, im rechten ein gekrönter Bärenkopf, im linken ein Vogel.
Solidi.
1) Werte, 7/12 Z. i. D., 6 Aß schwer.
| A. | In einem punktirten Zirkel der Stierkopf mit einer Lilienrkone, mit offenem Maule und heraushangender Zunge; Umschrift: . . . .WER . . Mönchsschrift. |
| R. |
In einem Zirkel ein Kreuz, worauf
eine wellenförmige Vertiefung, mit
fünf in's Kreuz gestellten Punkten.
Umschrift: MO. . . . PAR . . .
Mönchsschrift.
Vid. Evers II. pag. 20. |
2) Magnus und Balthasar.
a. 9/12 Z. i. D., 14 Aß schwer.
| A. | In einem Zirkel ein Schild, worauf ein gekrönter Büffelskopf mit breit geöffnetem Maule, aushangender Zunge und dem Halsfelle. Umschrift : MONET NOVA-GVSTROW Mönchsschrift. |
| R. |
In einem Zirkel ein Kreuz. Umschrift
von der rechten Seite: DVCVM
MAGNOPOLEnS
Mönchsschrift.
Vid. Evers II. pag. 46. |


|
Seite 89 |




|
b. 11/12 Z. i D., 22 Aß schwer.
| A. | Auf einem von einem Zirkel umgebenen Schilde der gekrönte Büffelskopf mit großen Zähnen und dem Halsfelle. Umschrift wie die vorige. |
| R. |
Auf einem durch einen punktirten
Zirkel gehenden Kreuze ein Schild
mit gleichem Büffelskopfe, nur ohne
Halsfell. Umschrift: DVCV MAG NOPO
LENS Mönchsschrift.
cf. Evers II. pag. 45. (verschieden) |
3) Wismar
Feines Silber, 10/12 Z. i. D., 26 Aß schwer.
| A. |
Ein Stern in einem
Zirkel auf einem von einem
punktirten Kreise eingeschlossenen
Lilienkreuze. Umschrift: Ein Stern,
MONETA
 WYSMAR Mönchsschrift.
WYSMAR Mönchsschrift.
|
| R. |
In einem punktirten Zirkel der mekl.
Büffelskopf mit einer Lilienkrone
zwischen beinahe geschlossenen
Hörnern, mit oben platten und unten
abgerundeten Ohren, mit aushangender
Zunge und netzförmigem, links bis an
das Ohr reichendem Halsfelle.
Umschrift: Ein Stern CIVITAS MAGNOP
Mönchsschrift.
Evers II. pag. 473. |
4) Hochmeister des Deutschen Ordens.
a. 11/12 Z. i. D., 28 Aß schwer.
| A. | Ein Schild, worauf ein Adler, liegt auf einem einen andern Schild quadrirenden, durchgehenden Kreuze. Umschrift: SALVA ° NOS ° DOMIN A 1518 Mönchsschrift. |
| R. | Ein von einem Zirkel umschlossener Adler. Umschrift: ein an den Enden ausgebrochenes Kreuz, A L BERTVS ° D: G 8 MGR ° G'NALIS Mönchsschrift. |
b. 11/12 Z. i. D., 28 Aß schwer.
| A. | Wie voriger. Umschrift: SALVA ° NOS ° DOMI NA1521. |
| R. | Ein Adler im Schilde auf einem schmalen, durch einen punktirten Zirkel gehenden Kreuze. Umschrift: ALBER T ° D ° G M ° GNE RALIS. |
5) Pommersche Städte
a. 7/12 Z. i. D., 13 Aß schwer (Gollnow).
| A. | Ein Greif mit zwei Wecken zwischen den Hinterfüßen. |


|
Seite 90 |




|
| R. | Zwei gegen einander gekehrte Halbmonde, umgeben von vier Sternen. |
b. 7/12 Z. i. D., 10 Aß schwer (Stargard an der Ihna).
| A. | Wie voriger. |
| R. | Ein Kreuz mit einem Stern in jedem Winkel. |
c. 8/12 Z. i. D., 3 Aß schwer (Garz an der Oder).
| A. | Ein Greif mit einem Dreiblatte zwischen den Vorder= und Hinterfüßen. |
| R. | Ein Schild mit einer lilienartigen Blume. Umschrift: M ° O ° N ° E ° T ° A ° Mönchsschrift. |
Sechslinge.
1) Herzogl. Mekl.
Albrecht. 8/12 Z. i. D., 14 Aß schwer.
| A. |
In einem punktirten
Zirkel der gekrönte meklenb.
Büffelskopf mit dem Halsfelle.
Umschrift von der rechten Seite:

|
| R. | Im punktirten Zirkel der stargardische Arm mit einer Binde. Umschrift: eine sechsblättrige Rose MONE . NO . DVC . MANOP Mönchsschrift. |
8/12 Z. i. D., 16 Aß schwer.
| A. | Der Büffelskopf, wie voriger, nur mit aushangender Zunge. Umschrift: Eine 6blättrige Rose ALBART DE . GRA . DUX Die hierin vorkommmenden 3 A sind Mönchsschrift. |
| R. | Wie voriger. Umschrift: Eine Rose mit 5 Blättern. MONE ° NO ° DVC ° MAN Mönchsschrift. |
8/12 Z. i. D., 15 Aß schwer.
| A. | Der Büffelskopf wie bei den vorigen, nur mit gefüllter Krone. Umschrift: ein Hundskopf ALBFR' DFI GRAD. |
| R. | Der Arm. Umschrift: HELF' GOT' GLV' BRO Das E im ersten Worte ist Mönchsschrift. |
9/12 Z. i. D., 15 Aß schwer.
| A. |
Der Büffelskopf mit
gefüllter Krone, ganz runden Ohren,
dem Nasenringe, auch mit einem
Theile des Halsfelles zu beiden
Seiten. Umschrift:
 . Die Buchstaben A und
M sind Mönchsschrift.
. Die Buchstaben A und
M sind Mönchsschrift.
|
| R. | Der stargardsche Arm im punktirten Zirkel. Umschrift: MONETA . NOV . WITEN . . . Die drei letzten Zeichen sind undeutlich, vielleicht B 37. |


|
Seite 91 |




|
2) Wismar.
8/12 Z. i. D., 12 Aß schwer.
| A. | Das senkrecht getheilte Stadtwappen in einem geschweiften Schilde, rechts der halbe Stierkopf, links von Silber und roth viermal queer getheilt. Umschrift: MON . NOV . WISMAR, eine Rose von fünf Blättern. |
| R. | Der Reichsapfel mit 96. Umschrift: LEOPOL . D . G. I . R . S . A. ohne Jahrszahl. |
Schillinge.
1) Herzog Christian z. M.
10/12 Z. i. D., 17 Aß schwer.
| A. |
Das gekrönte Wappen von
6 Feldern mit dem Herzschildlein; zu
den Seiten ist der Wappenmantel. Im
dritten Felde ist ein auf einem
(nach Petra Santa purpurnen) Plane
rechts schreitender Greif; das
vierte Feld enthält das gekrönte
Kreuz. Umschrift:
 CHRISTIAN
°
D . G . D . M
CHRISTIAN
°
D . G . D . M

|
| R. |
 — SCHILIN
— GMECHL — ENBVRG
— . 16 . 61 .
— SCHILIN
— GMECHL — ENBVRG
— . 16 . 61 .
Vid. Evers II, pag. 140, wo jedoch eine zwischen der Jahrszahl befindliche Figur, vielleicht ein Hut, nicht angegeben ist. |
2) Wismar.
10/12 Z. i. D., 22 Aß schwer.
| A. |
Ein Lilieukreuz in einem
Zirkel. Umschrift: MONETA
 WISMAR Mönchsschrift.
WISMAR Mönchsschrift.
|
| R. |
In einem Zirkel der meklenb.
Stierkopf mit einer Krone zwischen
langen Hörnern, oben platten und
unten runden Ohren, offenem Maule,
ohne heraushangende Zunge, mit einem
grade abgeschnittenen gegatterten
Halsfelle. Umschrift: eine Rose mit
6 Blättern, CIVITAS
 MAGNOP
Mönchsschrift.
MAGNOP
Mönchsschrift.
Vid. Evers II, pag. 473, wo aber die Zunge als heraushangend angegeben ist. |
3) Hamburg.
10/12 Z. i. D., 22 Aß schwer.
| A. | Das Stadtwappen in einem punktirten Zirkel. Umschrift: Zwei sich kreuzende Zainhaken, durch deren Durchschnittspunkt eine senkrechte Linie geht, HAMBUR STADGELDT. |
| R. | Zwei Ovale durchschneiden sich senkrecht; an den 4 Enden und in den 4 äußern Winkeln sind Ver= |


|
Seite 92 |




|
| zierungen; in dem innern Raume ist die Zahl 48. Ein punktirter Kreis umgibt das Ganze. Umschrift: CRUX CHRIS GLORI NO 1641. |
Ein Einzwölftelthalerstück der Stadt Bremen.
1 Z. i. D., 73 Aß schwer.
| A. | Der Reichsadler mit zwei Köpfen, darüber die Krone, in jedem Schnabel ein Ring; in der rechten Kralle das Scepter, in der linken Kralle das Schwerdt; im Herz schilde 1/12, darüber ein Kreuz; neben und unter den Krallen RDDR. Umschrift: FRANCISCCS . D . G . ROM . IMP. S . A |
| R. |
Zwei unten zusammengebundene
blühende Oelzweige, oben durch einen
Schildrand, worüber zwischen der
Umschrift eine Krone, vereinigt; in
der Mitte das Stadtwappen, ein
zierlicher, schräg liegender
Schlüssel. Zwischen den Oelzweigen
und der Umschrift
N . D . R . FUS . Umschrift: MON . NOV . REIP BREMENS . 1764 |
Ein halber Richsort des Herzogs Heinrich z. M.
1 4/12 Z. i. D., 80 Aß schwer.
| A. |
In zwei concentrischen
Zirkeln das rechts gekehrte Haupt
des Herzogs mit herunterhangenden
Haaren und starkem Barte; zu den
Seiten des Halses 15 25. Umschrift:
HENRIG . DE . GRA DVX MAGNOP
Anmerkung. 1. Vor und nach dem ersten, nach dem dritten und vierten Worte steht eine Rose von 5 Blättern. 2. Beide E sind Mönchsschrift. 3. Alle N, auch im R., haben den Verbindungsstrich verkehrt. |
| R. |
In einem punktirten Zirkel das
meklenb. Wappen mit vier Feldern und
dem Herzschildlein, welches
gegattert und weiß ist; der Greif im
zweiten Felde ist aufgerichtet; im
vierten Felde ist der wendische
Stierkopf schräge gestellt und
hinter der Krone desselben ragt in
der Mitte ein Horn hervor.
Umschrift: MONE NOVA GREVESMOLEM.
Vor und nach dem ersten Worte eine
Rose von 5 Blättern; hinter dem
zweiten Worte eine andere kleine
Blume.
cf Evers II, pag. 51 (verschieden). |


|
Seite 93 |




|
Dütchen.
1) Herzog Adolph Friedrich z. M.
1 3/12 Z. i. D., 71 Aß schwer.
| A. | Ein bis zum Fußrande des Schildes gehender Zirkel, darin das meklenb. Wappen auf einem spanischen Schilde, ohne Krone und Schildhalter. Umschrift: ° ADOLPH . FRIDR . V . G . G . HERTZ . Z . ein D, an welchem nach oben ein Zainhaken. |
| R. |
In einem punktirten Zirkel, zwischen
welchem und der Umschrift oben ein
Reichsapfel steht,
16. — REICHS — DALER — 1 . 6 . 3 . 2 . Umschrift: MECKL . F . Z . W. G . Z . S . D . L . R . V . S . H. Vid. Evers II, pag. 100. |
2) Rostock.
Feines Silber, 10/12 Z. i. D., 32 Aß schwer.
| A. | In einem geschweiften, von einem punktirten Zirkel eingeschlossenen Schilde der rechts schreitende Greif auf einem Balken in silbernem Felde; zwischen dem Schilde und dem Kreise ist rechts ein halber, links ein ganzer Stern. Umschrift: MONET . NOV . CIVI . ROSTOCHI . eine fünfblättrige Rose. |
| R. |
In einem punktirten Zirkel: XVI
— EINEN — REICHS
— DALER — S. T.
(Samuel Timpe.) Umschrift: Ein
Dreiblatt am Stengel, REICHES DALER
SILBEN. 1647.
Vid. Evers II, pag. 380 (etwas verschieden). |
3) Lübeck.
1 3/12 Z. i. D., 73 Aß schwer.
| A. | In einem punktirten und in einem feinen dichten Kreise, aus welchem jedoch das mit Strahlen und einer Blende umgebene Haupt hervorragt, der heil. Christoph bis an die Knie, mit bloßen Armen, einem faltenreichen Mantel um den Körper und einem Felle über Schultern und Brust, trägt auf dem linken Arme ein Lamm mit einem Halbzirkel über dem Hopfe. Zwischen der Umschrift: MONE NOV LVBECEN ist am Fußende in einer doppelten Einfassung ein von Silber und gegattert queer getheilter Schild zwischen 2 Zierrathen; außerhalb der Einfassung 6-3 |
| R. | Auf einem durch einen punktirten Zirkel gehenden Kreuze der zweiköpfige Adler. Umschrift: ein kleiner Vogel CRVX FVGA OMNE MALV |


|
Seite 94 |




|
4) Pommern.
1 2/12 Z. i. D., 54 Aß schwer.
| A. | Auf einem durchgehenden Kreuze, in einem Kreise ein Schild mit einem rechts aufgerichteten Greif. Ueber dem Schilde, innerhalb des Kreises zu jeder Seite des obern Kreuzbalkens ein Stern. Umschrift: BOGIS LAVS XIVD. G . DVX SP |
| R. | In einem punktirten Zirkel: 16. ST — REICHS — TALER — . 1628 . Umschrift: REICHS . SCHROT . VND . KORN . |
Gulden.
1) Herzog Gustav Adolph zu Meklenb.=Güstrow.
1 6/12 Z. i. D., 1 Loth schwer.
| A. | In einem geschweiften Schilde das mekl. Wappen, darüber eine Krone zwischen der Umschrift: V. G. G. GVST . ADOLF . HERZ . Z . MECKLENB. |
| R. |
EIN — GVLDEN — MECKLEN
— BVRGS — 1679. Der
Rand ist auf beiden Seiten
geriefelt, der Schnitt glatt.
Vid. Evers II. pag. 276 u. 277. |
2) Ein Vaterlandsgulden, 1 6/12 Z. i. D., 1 Loth schwer.
| A. | Auf einem oberhalb durch eine geschlossene Krone zusammengehaltenen Wappenmantel ein ovaler Schild mit dem schraffirten Wappen; der Herzschild ist ein ungetheiltes Oval; beide im Wappen vorkommenden Greife sind halb aufgerichtet. Umschrift: Eine Rose mit fünf Blättern, FRIED . FRANZ . V. G . G . HERZOG ZU MECKLENB . SCHWERIN |
| R. |
2/3, darunter im Abschnitte: DEM
VATERLANDE — 1813. Umschrift:
18 : STUCK EINE MARK FEIN
Anmerkung. Diese Gulden wurden blos im Jahre 1813 von den freiwilligen Geschenken der Meklenburger geschlagen. |
3) Rostock.
Ein Gulden oder halber Speciesthaler, 1 8/12 Z. i. D., 1 Loth 6 Aß schwer.
| A. | In einem punktirten Zirkel der rechts zum Kampfe gerüstete Greif mit gespaltenem Schwanze. Umschrift: MONETA . NOVA . CIVITA . ROSTOCHIENSIS 1637 S und T in einander geschlungen (Samnel Timpe). |


|
Seite 95 |




|
| Ein Adler mit zwei Köpfen und Zirkeln um dieselben; über ihnen, zwischen der Umschrift, die Reichskrone; im Reichsapfel auf der Brust 16 Umschrift: FERDINANDUS . III . D : G : ROM : IM : S : A : |
Speciesthaler.
1) Herzog Heinrich zu Meklenburg.
1 10/12 Z. i. D., 2 Loth weniger 18 Aß schwer.
| A. |
In einem geriefelten
Zirkel das Brustbild des Herzogs
Heinrich des Friedfertigen, im
Hermelin=Mantel, mit über einander
gelegten Händen; auf dem links
gekehrten, mit kurzen Haaren und
starkem Bart versehenen Haupte sitzt
ein Baret. Umschrift: HENRICVS + DEI
+ GRACIA + DVX + MEGAPOL' ein
Vogel.
Anmerkung. Beide hierin vorkommende D sind ein verkehrtes G. |
| R. |
Ein zierliches Lilienkreuz, in
dessen Winkeln oben rechts der
meklenburgische Büffelskopf, links
der aufgerichtete Greif; unten
rechts der Arm mit einer Binde, und
in der Hand einen Ring haltend,
links der schräge gestellte
wendische Stierkopf; auf der Mitte
des Kreuzes der gräflich
schwerinsche, gegattert und weiß
queer getheilte Schild mit einem
Knopfe in der Mitte. Umschrift:
MONETA + NOVA + GREVESMOLENSIS +
XXXX ein Vogel.
Vid. Madai Medaillen=Sammlung 1743, pag. 377 seq.; Evers II. pag. 49 hat HINRICVS. |
2) Herzog Albrecht zu Meklenburg.
1 11/12 Z. i. D., 2 Loth weniger 24 Aß schwer.
| A. | Das en face gestellte unbedeckte Brustbild des Herzogs Albrecht des Schönen, mit kurzen, glatt gekämmten Haaren, starkem Barte, mit über den Harnisch vom Halse herabhangender Kette, ohne Hände. Umschrift: ALBERTVS + DEI + GRACIA + DVX + MEGAPOLE ein, Blatt oder ein kleiner Baum. |
| R. |
Dem vorigen ähnlich, nur ist die
Form, sowohl des Lilienkreuzes, als
auch der einzelnen Schilde etwas
verschieden; auch ist der Herzschild
oben roth und unten gegattert.
Umschrift: Ein Blatt MONETA + NOVA +
GADEBVSSENSIS + 1543 +
Vid. Evers II. pag. 58. |


|
Seite 96 |




|
3) Meklenburg=Güstrow.
1 9/12 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. |
Das Brustbild des
Herzogs Carl, links gekehrt en
profil, mit kurzen glatten Haaren,
langem Knebelbarte, einer
Halskrause, im zierlichen Harnisch;
die rechte Hand ist auf den Gürtel
gestützt; der linke herabhangende
Oberarm ist nicht sichtbar, wohl
aber der aufgerichtete Unterarm mit
der Hand, auf deren Fingerspitzen
ein Reichsapfel ruht. Umschrift:
CAROLUS . DEI . GRA . DUX .
MEGAPOLENSI
1609
Anmerkung 1. Ein punktirter Zirkel reicht nur bis zu dem von den Augen an zwischen der Umschrift stehenden Kopfe, über welchem die Jahrszahl in kleinen Ziffern steht. Anmerkung 2. Der Reichsapfel ruht auf den Fingerspitzen, wird aber nicht, wie Evers II. pag. 241 sagt, von dem zum Theil sichtbaren Arm getragen. |
| R. | Das quadrirte Wappen mit dem Herzschildlein, welches oben gegattert und unten weiß ist; geschmückt mit drei Helmen; über dem aus dem mittlern derselben hervorragenden Pfauenwedel ruht ein grade liegender Stierkopf; über diesem sind drei große Pfauenaugen, über welchen, zwischen der Umschrift, ein Reichsapfel schwebt. Schildhalter sind rechts ein Stier, links ein Greif mit vier Adlerklauen. Umschrift: PRIN . UA . COM . SU . ROS TOC . E . STAR . |
4) Wallenstein, Herzog von Friedland und Sagan, später auch Herzog von Meklenburg.
1 10/12 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. | Das links gekehrte Profil des Herzogs Albrecht (Wallenstein) mit den Schultern, mit kurzen Haaren und einem Knebelbarte, mit breitem Halskragen; über der rechten Schulter scheint ein Mantel zu liegen; unter der Büste steht die Jahrszahl 1628. Umschrift: Eine fünfblättrige Blume ALBERTVS . D . G . DVX . ein Ordensstern FRIDLAN : ET. SAGAN |
| R. | Unter einer Fürstenkrone ein Schild mit einem gekrönten Adler mit rechtshin ausgeschlagener Zunge; |


|
Seite 97 |




|
| auf der Brust desselben ist ein quadrirter Schild mit vier gegen einander zum Kampfe gerüsteten Löwen. Umschrift: SACRI . ROMANI . IMPERII . PRINCEPS . |
1 11/12 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. | Wallensteins Brustbild en face, jedoch ein wenig links gekehrt, so daß nur das rechte Ohr, nicht aber das linke, sichtbar ist, mit kurzen, starke Winkel bildenden Haaren und Knebelbarte, in zierlichem Harnisch, über welchem eine, von einer Schulter zur andern reichende, über die Brust herabhangende Kette; ein Mantel ist auf der rechten Schulter zusammengebunden. Umschrift: eine Arabeske über dem Haupte, ALBERT . D . G . DVX . MEGA . ein Löwe in einem Zirkel FRD . (I und D sind zusammengezogen und stehen etwas niedriger) ET . SAG . PR . VAN |
| R. | Das mit dem zwischen der Umschrift befindlichen Fürstenhute bedeckte meklenburg=friedland=sagansche, aus 13 Feldern bestehende Wappen, welches von der Ordenskette des goldnen Vließes umgeben ist Umschrift: COM . SVE . DO : ROS . das von der Ordenskette herabhangende Vließ, ET . STARGAR 1632 |
5. Ein herzoglich sächsischer Achtbrüderthaler.
1 9/12 Z. i. D., 1 3/4 Loth schwer.
Auf jeder Seite sind, von einem Kranze umgeben, vier neben einander gestellte Brustbilder, mit entblößten Häuptern, herabhangengenden glatten Haaren, mit Ordensketten auf der Brust; die zur Rechten Gestellten zeigen die rechte Hand; die links Stehenden die linke Hand.
Auf einer Seite steht unten im Abschnitt:
MON : NOV : ARG : -
: FRAT : — DVC : SAX :
Umschrift: Vor jedem Namen ein Wappen der verschiedenen Landestheile: D : G : IO : ERNEST — FRIDERICVS — WILHELMVS — ALBERTVS .
Auf der andern Seite ist im Abschnitte zu lesen: LINEÆ ° VIMA : — : RIENSIS. 16 10 — WA Umschrift: gleichfalls vor jedem Namen ein einfaches


|
Seite 98 |




|
Wappen: IO : FRIDERIC, — ERNESTVS — FRID : WILHELM . — BERNHARD,
6) Stadt Lüneburg.
2 Z. i. D., 2 1/4 Loth schwer.
| A. | In einem Kranze das Stadtwappen: drei Thürme auf einer mit Zinnen versehenen Mauer, in deren Thor ein schräg liegender Schild mit einem links aufgerichteten Löwen. Umschrift: MONETA . NOVA . CIVITAT : LUNÆBURGENSIS . |
| R. | Der gekrönte zweiköpfige Adler; in dem auf der Brust befindlichen Reichsapfel die Zahl 32. Umschrift: LEOPOLDUS . I . D : G : RO : IM : SE : AU GUS : 1660, zwei über einander kreuzweise gelegte Schlüssel. |
7) Herzog Christian von Braunschweig, Bischof von Minden.
2 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. | Das links gekehrte geharnischte Brustbild en profil, in bloßem Haupte, mit einem breiten, ausgezackten Halskragen und einer Feldbinde. Umschrift von oben links: CHRISTIANUS D : G : EL . EP . MIND . DUX B . ETL . Zwischen den beiden D steht der verkehrt geschriebene Name des Münzmeisters, H S, mit einem Zainhaken in der Mitte. |
| R. | Das braunschweig=lüneburgische Wappen von 8 Feldern, mit dem Schilde des Bisthums Minden in der Mitte. Umschrift: eine fünf blättrige Rose, IUSTITIA ET CONCORDIA . A. 1624, eine Rose von 5 Blättern. |
8) Herzog August von Braunschweig=Lüneburg.
2 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. | Das vollständige braunschweig=lüneburgische Wappen mit 11 Feldern. Umschrift: AUGUSTUS HERTZOG ZU BRAUN : U : LU . |
| R. | Ein wilder Mann, der eine mit der Wurzel ausgerissene Tanne wie eine gefällte Lanze hält. Umschrift: ALLES MIT BEDACHT . ANNO 1659. H . S . zwei kreuzweise gelegte Zainhaken. |
Ducaten.
Jülich. 1 1/2 Z. i. D., einen Ducaten weniger 6 Aß schwer.
| A. | Johannes der Täufer in ganzer Figur, in der Linken einen über die Schulter gelegten Stab haltend, woran oben ein Kreuz; dieses, das Haupt mit dem Heiligenscheine, und die Füße, zwischen denen ein |


|
Seite 99 |




|
| Kreuz steht, befinden sich Zwischen der Umschrift: S. JOHANNES BABTISTA, eine undeutliche Figur. Mönchsschrift. | |
| R. | Vier zusammenstoßende Halbzirkel, in deren Winkeln, sowohl nach innen, wie auch nach Außen, kleine Blumen sind, umgeben fünf ein Kreuz bildende Schilde; im obersten und mittelsten derselben ist ein zweiköpfiger Adler; in dem zur Rechten eine undeutliche Figur; der zur Linken enthält ein unten gepfeiltes Krückenkreuz; der unterste Schild ist gegattert. Umschrift: + DVX REINALD' . IVL + COMS . ein Zainhaken. (Zwischen 1402 und 1423.) |
Ein meklenb.=strelitzisches Fünfthalerstück.
1 Z. i. D., einen Frd'or. schwer.
| A. |
Unter einer
geschlossenen Krone die in einander
geschlungenen Buchstaben A. F.
(Adolph Friedrich III.). Zu den
Seiten: V . G . G . H . Z . M.
Unten: 1748. |
| R. |
Unter einer geschlossenen Krone ein
barokscher, mit Laubwerk gezierter
Schild, worauf im goldenen Felde ein
Stierkopf mit einer Lilie zwischen
den Hörnern, mit dem Halsfelle und
dem Nasenringe. Darunter 5. THALER
— C . H . I (Jaster.)
Vid. Evers II. pag. 313 und die Tabelle. |
Ein (doppelter) Rosenobel.
1 6/12 Z. i. D., 2 Ducaten und 13 Aß schwer.
(Dieses Stück ist ausgepflügt auf dem kaltenhöfer Acker der Feldmark Prislich, im großherzogl. Amte Graboro, im Mai 1836.)
| A. | Das gekrönte Brustbild des Königs Eduard IV. von England in einem auf Wogen segelnden Schiffe; in der Rechten trägt der König ein Schwert, dicht daneben weht eine Fahne oder Flagge mit dem Buchstaben E (Mönchsschrift); in der Linken einen geviertheilten Schild, in dessen erstem und viertem Felde drei Lilien, 2/1, und im zweiten und dritten Felde drei über einander rechts laufende Leoparden. Die beiden Enden des Schiffes haben verzierte Einfassungen, aus welchen Taue nach dem Mastkorbe hinauf laufen. Der Bauch des Schiffes ist mit einer fünfblättrigen Rose mit 14 Saamenpunkten, und oberhalb, zu jeder Seite der Rose, mit einem |


|
Seite 100 |




|
| Leoparden und einer Lilie geschmückt. Neben dem obern Schildrande links, und unter der Rose in der punktirten Einfassung über der Umschrift, ist ein kleines Kreuz mit einem Stempel eingeschlagen (vielleicht das Zeichen der Münzsammlung, zu welcher dieser Rosenobel gehört hat). Umschrift: DNS ein Dreiblatt I ein Dreiblatt H ED VAR IV ein Dreiblatt DI ein Dreiblatt GRA ein Dreiblatt REX vier kleine Zeichen, je zwei und zwei über einander, ANGL drei Zeichen FRANC Mönchsschrift (vor 1484). | |
| R. |
Aus einer in der Mitte befindlichen
fünfblättrigen Rose gehen 16
Strahlen; auf dem je vierten
derselben sind Stufen, über welchen
eine Lilie zwischen Verzierungen,
abwechselnd mit diesen steht auf
andern Strahlen ein Leopard unter
einer Krone; über jedem dieser 8
Wappenbilder ist ein punktirter und
darüber ein geschlossener Bogen; in
den äußern Winkeln, welche diese
letztern bilden, ist eine Art
Dreiblatt, wie in der Umschrift. Das
Ganze wird von einem punktirten
Zirkel eingeschlossen. Umschrift:
eine fünfblättrige Rose IHE AVT
Dreiblatt TRANS undeutliche Zeichen
PER MEDIVM zwei Dreiblätter ILLORVM
Dreiblatt IBAT Dreiblatt.
Mönchsschrift.
Vid. Evang. Lucae Cap. IV. 30 cf. Köhler Münzbelustigungen VI. pag. 326 und VIII. pag. 143. |
Medaillen.
1) Adolph Friedrich, H. z. M.
2 1/3 Z. i. D., 3 7/8 Loth schwer.
| A. | In einem punktirten Zirkel das links en profil gekehrte Brustbild des Herzogs mit über der Stirn in die Höhe gestreiften Haaren, kurzem Kinnbarte, aufstehendem, mit Spitzen besetztem Halskragen, einer Feldbinde über dem zierlich gearbeiteten Harnisch oder Kleide; oberhalb, zu beiden Seiten, sind Vorhänge. Umschrift: ADOLPHVS . FRIDRICH . V : G : G : HERT : Z : MEC : F : Z : W : G : Z : S : D : L : R : V : S : H : ein Zainhaken. |
| R. | Fortuna, mit links gekehrtem Profil, auch dahin flatternden Haaren mit einem Shawl, der hinter dem Halse über beiden Schultern liegt, hinter dem |


|
Seite 101 |




|
|
Rücken mit beiden Enden
rechts fliegt, jedoch so, daß das
eine Ende, oberhalb der linken
Hüfte, die Mitte des Körpers
bedeckt, steht auf einer zwischen
der Umschrift sich befindenden
geflügelten Kugel, fassend mit der
Rechten ein rechts aufgeschwelltes
Segel, dessen unten spitz
zulaufendes Ende die Linke hält.
Hinter ihr jagen zwei behelmte
Reuter von ihr; ihr zur Linken,
etwas zurück, steht ein Baum.
Umschrift: FORTVNE . IN . FORTVNE .
FORT VNE . ANNO . 1613
Cf. Evers II. pag. 90. |
2) Auf den Tod der Fürstin Anna Maria, einer Tochter des Herzogs Adolph Friedrich z. M. und Gemahlin des Herzogs August zu Sachsen. 2 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. | Umschrift: Ein Vierblatt D. G. ANNA MARIA . DUX. SAX . IUL. CLIV . ET MONT . Im innern Zirkel, in eilf Zeilen: NAT — E DOMMEG — SVER . IUL . 1627 — NUPTA — IBID . 23 NOV . 1647 — DENATA — HAL . II . DEC . 1669-VIXIT — ANNOS XLII — MENS. 5 D—10 Diese letzte Zahl steht zwischen den Vor= und Zunamen des Münzmeisters Hl—F |
| R. |
Jacob, dessen Hut und Schäferstab
auf der Erde liegen, ringt mit dem
Engel; rechts die aufgehende Sonne,
obenüber und links Gewölke. Unter
den Füßen steht:
Ich lasse dich nicht.
Gen. 32. 27. Umschrift: Ein
Vierblatt DEVM QVI . HABET . OMNIA .
HABET .
Vid. Evers II. pag. 111 u. 112. |
3) Herzog Christian Ludewig z. M. 1 2/12 Z. i. D., 113 Aß schwer.
| A. |
Des Herzogs links
gekehrtes Profil, in flatternden
Haaren, mit dem Ordensbande über dem
Harnische. Umschr.: CHRIST. LVDOV .
D . G . DVX MECKLENB . R. Unter
einer Krone das ovale, Schraffirte,
von zwei Ordensketten umgebene
Wappen. Umschrift: PER ANGUSTA AD
AUGUSTA 17 52
Vid. Evers II. pag. 186 (verschieden). Anmerkung. Diese Medaille, eine ähnliche in Gold, und eine größere in Silber mit gleicher |
| R. |


|
Seite 102 |




|
| Präge, wurden am Geburtstage der Herzogin Louise Friederike, den 3. Febr. 1753, bei Hofe vertheilt. |
4) Die kleinere Begräbnißmedaille auf Herzog August von Braunschweig=Lüneburg, postulirten Bischof von Ratzeburg. 1 2/12 Z. i. D., 69 Aß schwer.
| A. | Das braunschweigsche Wappen mit einem Herzschilde, worauf eine Säule (oder ein Thurm), wohinter rechts ein Bischofsstab, und links ein Schwert schräge gesteckt sind; mitten über der Säule schwebt eine Bischofsmütze. |
| R. | In 10 Zeilen: . NAT. 18 — NOV . ĀŌ . 1568 — OBHT . I . OCT . ĀŌ —1636 . REXIT . DIŒ — CESIN . RA . ĀŌS 26 — PROVINCIAS . HAE — REDITARIAS ĀŌS — TRES . VIXIT ĀŌS — 67 . MENS . 10 — DI .12 |
5) 2 8/12 Z. i. D., 3 Loth schwer.
| A. | Herzog August von Braunschweig=Wolfenbüttel in einer Rüstung, einen Federhut auf dem Kopfe, eine nach hinten lang flatternde, Feldbinde um den Leib, den Commandostab in der Rechten, sitzet zu Pferde. Umschrift: AUGUSTUS V G G HERZOG ZU BRUNSWYK UND LUNABURG |
| R. |
Das braunschweig=lüneburgische
Wappen von 11 Feldern. Umschrift:
ALLES MIT BEDACHT ANNO 1655 H. S.
(Heinrich Schlüter.)
Ein Palmzweig umgiebt das Ganze. |
6) Gedächtnißmedaille auf Herzog Rudolph August, von Braunschweig=Lüneburg, 10/12 Z. i. D., 46 Aß schwer.
| A. | Das links gekehrte Brustbild des Herzogs en profil mit großer Lockenperrüque und im Harnische. Umschrift: RVD : AVG : D : G : DVX . BR . ET. L |
| R. |
NATUS — XVI MAY MDCXXII
— REG : AGGRESS : —
XVII . SEPT : MDCLXVI — OBIIT
. XXVI IAN — *MDCCIV*
— HC
 H zwei kreuzweis
gelegte Zainhaken
H zwei kreuzweis
gelegte Zainhaken
|
7) Medaille auf den Kurfürsten Johann Georg I. zu Sachsen, als Reichsvicar, 1 4/12 Z. i. D., 1/2 Loth schwer.
| A. | Der Kurfürst, die Krone auf dem Haupte, bekleidet mit dem Kurmantel, das Schwert in der Rechten eilend, sitzt auf einem mit lang überhangender |


|
Seite 103 |




|
| Decke und mit einem Federbusche auf dem Kopfe geschmückten Pferde, zwischen dessen Füßen die die Jahrszahl 16 19 und darunter das kursächsische Wappen, zu dessen Seiten Blumen stehen. Umschrift: PRO LEGE ET GREGE eine fünfblättrige Rose. | |
| R. | In zwölf Zeilen: D . G . — IOHANN . GEORG — DVX SAX . IVL . CLIV . E . — MONT . S . R . I . ARCHIMAR . — ELECC . ATO . POST EXCESS . — D . IMP . MATTHlÆ . AVG . SE — CUNDUM . VICAR.LANTGR . — THVR.MARCH.MISNLÆ — BVRGGR . MAGD . COM . D . MARCA. ET RAVENSP . — DNVS . IN RAVEN — STEIN . |
8) Sterbemedaille auf Magdalena Sibylla, eine Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen, welche, nachdem sie im Jahre 1647 Wittwe des Prinzen Christian von Dänemark geworden war, sich 1652 mit Friedrich Wilhelm II., Herzog zu Sachsen=Altenburg wieder vermählt hatte. 2 Z. i. D., 2 Loth schwer.
| A. |
Unter einer aus dem
obern Rande hervorbrechenden Sonne
eine von zwei aus Wolken zu beiden
Seiten hervorragenden Händen
getragene Krone; darunter ein Band
mit den Worten:
ICH HABE ÜBERWUNDEN, unter diesem ein auf der Vorderseite mit einer Blumenguirlande geschmückter Sarkophag, auf welchem die in einander geschlungenen Buchstaben M und S. |
| R. |
Eine Seite einer Pyramide, worauf in
10 Zeilen: V . — G . G . MAG
— DALENA — SIBYLLA
— GEB . AUS — CHURF
. STAM — U . VERMÆHLTE
— PRINC . ZU SACHSEN I . C .
UND BERG.
Im Abschnitte rechts steht in drei Zeilen: GEBOREN D . 23 XBRIS — 1617 ZU DRESDEN Im Abschnitte zur Linken gleichfalls in drei Zeilen: STARB SELIG D . 6 IAN — 1668 . ZU ALTEN — BURGK |
9) Begräbnißmedaille auf Prinz Johann Wilhelm, einen Sohn des Herzogs Bernhard zu Sachsen=Jena und der


|
Seite 104 |




|
Maria von Tremouille. 1 3/12 Z. i. D., beinahe 172 Loth schwer.
| A. |
Ein Sarkophag, bedeckt
mit einem Mantel, darüber der
Herzogshut, aus welchem zu beiden
Seiten ein Stab hervorragt. Auf der
vordem Fläche des Sarkophags steht:
RECTOR — ACADEMIÆ —
IENENSIS — MAGNIFI —
CENTISS :
Auf der rechten Seitenfläche: VIXIT — ANN — XV — MENS — VII — DIES — XII. Innere Ueberschrift: NON PERITVRA NECE. Aeußere Umschrift von unten rechts: IOH . WILH . DVX SAX . I . C . M . ANG . ET WESTPH . |
| R. |
NATVS — D . XXIIX MARTI .
— MDC . LXXV — DENATVS
— D . IV . NOVEMBRIS .
— MDC . LXXXX —
SEPVLTVAS — MENSE . IANUAR
. — M . C . XCI .
Die Inschrift des R wird von zwei Palmenzweigen, auf deren unterm Durchschnittspunkte ein symbolum mortis liegt, umgeben. |
10) Auf den Kaiser Tiberius. 2 Z. i. D., 2 5/8 Loth schwer.
| A. |
Das links gekehrte
Profil des Tiberius, mit einem
Lorbeerkranze im Haare. Umschrift:
TI CAESAR DIVI AVG F . AVGVSTVS IMP
III
Anmerkung. Die Zahl am Ende kann vielleicht IIII sein. |
| R. |
Ein Tempel mit geschmückter Façade;
auf jeder Seite eine Säule, worauf
eine beflügelte Figur, die zur
Rechten hält einen Ölzweig, die zur
Linken einen Lorbeerkranz in der
Hand. Zu den Seiten des Tempeis
steht: S C , unter dem Tempel:
ROMETAVG (d. a. 5 post Chr.)
Anmerkung. Diese Medaille ist von einem Kenner für ächt und sehr selten anerkannt worden. |
11) Spottmedaille.
a. Silber, 1 7/12 Z. i. D., 2 1/2 Loth schwer.
| A. | Ein rechtsgekehrter Kopf mit der Papstkrone; umgedreht: ein links sehendes Profil mit struppigen Haaren, Bockshörnern und Eselsohren. Umschrift: eine Rose mit sechs Blättern: DES BABST LEHR VND REICH IST DEM TEVFEL GLEICH. |


|
Seite 105 |




|
| R. | Rechts sehend ein Mannskopf en profil, mit dem Kardinalshut; umgedreht: ein links gekehrter Kopf mit der Narrenkappe. Umschrift: DER CARDINALSTAND IST NARNWERCK VND SCHANDT. |
b. Bleierne Spottmedaille auf den für untergeschoben ausgegebenen Sohn Königs Jacob II. von England, Jacob Franz Eduard. 1 4/12 Z. i. D., 3/4 Loth schwer.
| A. | Rechts der Hintertheil eines Kriegsschiffes mit französischer Flagge; weiter vorwärts eine auf einem Krebse reitende, mit einer Pfaffenmütze bedeckte Person, welche auf den Händen ein Windelkind, über dessen Haupte ein Stern schwebt, trägt; darunter im Abschnitte: IAC . FRANC . EDOUARD — SUPPOSE I'20IUIN — 1688. Umschrift von unten rechts: ALLONS MON PRINCE NOUS SOMMES EN BON CHEMIN. |
| R. | Ein Schild, enthaltend eine Windmühle in grünein Felde; über dem Schilde eine Pfaffenmütze, wohinter, als Ordenskette, ein doppelter Rosenkranz hervorkommt, den Schild umgiebt, unten, als Ordenszeichen ein Krebs, und er hat zur Devise: HONY . SOIT . QUI . BON . Y . PENSE . hat. Umschrift von unten rechts: LES ARMES ET L'ORDRE DU PRETENDU PRINCE DE GALES. |
C. Gesammelte Nachrichten von Alterthümern aller Art.
I. Nachrichten von vorchristlichen Grabdenkmälern.
Ueber die verschiedenen Arten von Gräbern und ihre Verbreitung schreibt Herr Dr. von Hagenow zu Greifswald: "In unsrer Provinz (Vorpommern) kommen jene kegelförmigen Hügel, die Gold, Spiraldräthe, Handbergen u. dgl. enthalten, fast gar nicht vor, und darum sind die Gegenstände von Metall auch bei uns so rar und werden nur zufällig in der Erde oder in Torfmooren gefunden. Eine Anzahl kegelförmiger Hügel, die ich für die fraglichen zu erkennen glaubte, täuschte mich stets beim Aufgraben. Ich wüßte auch nicht, daß hier jemals ein solches gefunden und eröffnet


|
Seite 106 |




|
sei; jenseit der Peene und in Hinterpommern sollen sie vorkommen. - Die Steinkisten sind wohl die ältesten Gräber; sie enthalten nur Steinsachen, schlechte Urnen, dann und wann Gerippe, aber nie Metall. - In welcher Reihenfolge die übrigen Arten folgen, ist unbestimmt; nur so viel scheint mir gewiß zu sein, daß die Urnen im Sande und in bloßer flacher Erde den Slaven als den letzten Heiden angehören. Hier um Greifswald, wie überall im Lande, sind dergleichen Urnenlager, und ich fand zum öftern Eisenbröckel, auch kleine Ringe und Fibeln von Bronze und dergleichen sehr oxydirtes Metall darin". - In der Altmark Brandenburg sind die sogenannten flachen Wendenkirchhöfe nicht selten und haben durch die Bemühungen des Herrn Professors Danneil zu Salzwedel die reiche Ausbeute geliefert, welche in der königl. Alterthumssammlung zu Berlin sich befindet. Ueber die Kegelgräber schreibt dieser verdienstvolle Mann: "Die kegelförmigen Grabhügel, wie sie sich bei Ihnen so viel zu finden scheinen, sind wahrscheinlich in der Altmark nicht vorhanden 1 ); dergleichen bilden nur Kugelsegmente bei uns, zur Kegelform erhebt sich meines Wissens kein einziger". - In Bezug auf die Wendenkirchhöfe theilt die königl. schleswig=holstein=lauenburgische Gesellschaft für Samml. und Erhalt, vaterl. Alterth. Folgendes mit: "Eine dritte Klasse von Gräbern sind die größern Begräbnißplätze aus alter Zeit, wo auf einem weiten Raume ohne Hügel Urne bei Urne sich finden kann. Solche Begräbnißplätze kommen in Wagrien, also auf früher slavischem Boden, vor."
Meklenburg ist an allen Arten vorchristlicher Gräber ungemein reich, wie vieles auch von diesen ehrwürdigen Resten der Vorzeit schon nutzlos zerstört oder unkenntlich geworden sein mag. Diesen Reichthum des Landes allmälig seinem ganzen Umfange nach kennen zu lernen, muß in mehr als einer Rücksicht dem Verein sehr wünschenswerth erscheinen 2 ). Deshalb hat der Ausschuß schon bisher sich angelegen sein lassen, eine ziemliche Menge von Notizen über diesen Gegenstand einzusammeln, und hofft und erbittet von der Willfertigkeit der Mitglieder, daß sie auch ferner mit derartigen Nachrichten ihn versehen werden.


|
Seite 107 |




|
1. Hünengräber.
a) Die pommersche Gesellschaft berichtet: "Aus einem Schreiben unsers Mitgliedes, des Herrn von Suckow zu Stralsund, erlauben wir uns Ihnen folgende Notiz mitzutheilen, die vielleicht einiges Interesse für Sie haben möchte: ""In meinem Vaterlande Meklenburg=Schwerin finden sich die großartigsten aller Heidendenkmäler, die ich gesehen habe: es sind dies ungeheure Steinkisten, kleine Pagoden; die ansehnlichsten sah ich auf dem Wege von Meyenburg in der Prignitz nach Plau"". Diese Notiz wird hoffentlich für die in der bezeichneten Gegend wohnenden Mitglieder nicht verloren sein, sondern nähere Mittheilungen veranlassen.
b) Herr Rector Masch zu Schönberg meldet: "In der Nähe des Flechtkruges, einer Pertinenz von Prieschendorf, liegen die holmer Tannen, zum Domanial=Amt Grevismühlen gehörend. An der westlichen Seite derselben, etwa 10 Minuten von dem genannten Kruge und einige 100 Schritte von dem Rande des Gehölzes entfernt, liegt ein oben runder, etwa 15-20 Fuß hoher, holzfreier Hügel, dessen obere Fläche 33 Fuß im Durchmesser hat. Auf demselben befindet sich ein (von dem Herrn Berichterstatter durch einen Situationsplan dargestelltes) Hünengrab. Ungewiß blieb es mir, ob dieses Grab bereits aufgedeckt sei oder nicht. Für das Erstere schien allerdings die Vertiefung zwischen den Steinen zu sprechen; jedoch war an keiner Stelle eine Spur von ausgeworfener Erde zu erkennen, der Hügel war außerhalb der Steinreihen durchaus eben und mit Moos bewachsen".
c) Von den großherzoglichen Beamten zu Crivitz ist in Folge der jüngst erlassenen allerhöchsten Verordnungen zum Schutze der vorchristlichen Denkmäler ein Bericht über die im Amte Crivitz vorhandenen heidnischen Gräber der Landes=Regierung zu Schwerin eingesandt 1 ) und von diesem hohen Collegium dem Ausschusse zur Kenntnißnahme mitgetheilt worden. Eins der in diesem Berichte genannten Grabdenkmäler auf der Hof=Feldmark Ruthenbeck hat von dem mitberichtenden Hrn. Amtshauptmann Mühlenbruch eine nähere Beschreibung und Zeichnung erhalten, wornach dasselbe unzweifelhaft ein Hünengrab ist. Der genannte Herr Beamte schreibt nämlich: "Das Monument ruhet auf 6 großen Steinen, die außerhalb über der Erde 3 1/2 Fuß hoch sind; der Deckstein ist 13 Fuß und 10 1/2 Fuß, unten ganz flach, oben gerundet und


|
Seite 108 |




|
3 1/2 Fuß dick; derselbe ist - angeblich durch einen Blitzstrahl - geborsten; unten ist die Erde etwas vertieft und hat hier eine Höhe von 5 F., der innere Raum ist 8 und 8 F. Nach vorne vor dem Eingange befinden sich noch 7 große Steine, die 1 bis 2 F. über die Erde hervorragen; in deren Mitte hat ein bedeutend großer Stein gelegen, der aber schon vor längerer Zeit gesprengt und anderweitig verbraucht worden ist". Außerdem werden, ohne nähere Bezeichnung ihres Characters, auf der Hof=Feldmark Ruthenbeck noch 3, auf der Hof=Feldmark Zapel 1, auf den Dorf=Feldmarken Domsühl 5, Goldenbow 7, Raduhn 1, Zapel 2 vorchristliche Monumente aufgezählt, und schließlich wird hiezu bemerkt: "Es sind wahrscheinlich mehr dergleichen Monumente hier und auf andern Feldmarken vorhanden gewesen, die aber früher zu Bauten und massiven Brücken verwandt worden, und da hier auf mehreren bedeutenden Feldmarken gar keine Steine sich befinden und bei dort statt gefundenen Bauten schon der Bedarf von den verzeichneten Feldmarken hat genommen werden müssen, hier aber auch die gewöhnlichen Feldsteine schon sehr vergriffen und sparsam werden, so wird die Noth zuletzt die Verwendung der Denkmäler erfordern".
d) Auf dem Felde von Zülow bei Schwerin, an dem Wege von Wittenburg nach Schwerin über Neumühle, dort wo sich der Weg von Walsmühlen über Rogahn von dem Hauptwege über Strahlendorf trennt, nicht weit von dieser Theilung vom Wege linksein, befindet sich ein mit großen Steinen umstelltes Hünengrab, 100 Fuß lang und 10 breit, mit einer langen Fortsetzung von einhegenden Steinen, auf einem wüsten Ackerstücke. (Mittheilung des Herrn Archivars Lisch.)
e) Nach einer Mittheilung des Herrn Amtsverwalters Hase zu Schwerin befinden sich auf der Feldmark Kuhs, Amts Güstrow, noch mehrere recht wohl erhaltene Hünengräber.
2. Kegelgräber.
a) Zu Kogel bei Wittenburg, am Wege von Dodow an Kogel vorbei nach Camin, rechts am Holze und in demselben, auf dem Försteracker, so wie
b) zu Goldenbow an der vellahnschen Scheide, links am Wege von Goldenbow nach Vellahn, sind mehrere Kegelgräber.
c) Auf dem Felde von Zülow bei Schwerin zu jeder Seite des Weges von der Landstraße nach dem Hofe ein großes, mit hohen Bäumen bepflanztes Kegelgrab.


|
Seite 109 |




|
d) Ein großes Kegelgrab bei Proseken, und
e) sieben bei Doberan.
f) Oestlich vom Dorfe Prillwitz stehen ungefähr vierzehn große Grabhügel von Kegelform, äußerlich von Erde aufgeschüttet. Die zunächst am Dorfe stehenden gehören zu den größten dieser Art.
g) Auf dem Felde von Gr. Upahl liegt nahe an der Scheide, dem Hofe Prützen gegenüber, auf einer Höhe ein Kirchhof mit vierzehn Kegelgräbern, von denen eins ziemlich bedeutend ist, alle aber nicht schwer aufzugraben sind. Umher liegen in der Ferne noch einzelne zerstreut.
Auf dem gegenüberliegenden Felde von Prützen sind nach der Aussage des Besitzers, Herrn Geheimen Finanzraths satow, noch zwei Kegelgräber, nahe der Stelle, wo er, ungefähr im J. 1820, ein Kegelgrab aufdecken ließ, dessen germanischer Inhalt im Besitze der Domschule zu Güstrow ist.
Auch auf dem angrenzenden tieplitzer Felde sind, in der Gegend des aufgegrabenen großen ruchower Grabes, noch einige Kegelgräber.
In dem Gehölze bei Upahl, auf dem Wege nach Dobbertin hin, zwischen Upahl und der Ziegelei, ist eine sehr große Menge von Gräbern, von denen die meisten leicht aufzudecken sind, und die beim Baumfällen und Ausroden dereinst doch zerstört werden.
(a-g Mittheilungen des Hrn. Archivars Lisch, meistens aus eigener Anschauung.)
h) In den Tannen bei Retgendorf, am östlichen Ufer des Schweriner Sees, und
i) in den Stadttannen bei Warin sind mehrere Kegelgräber. (Mittheilung des Herausgebers, aus eigener Anschauung.)
k) Bei dem Dorfe Kiekindemark bei Parchim, in der sogenannten Streithorst, zwischen der alten Landwehr und dem das jetzige Gebiet der Stadt Parchim von dem Domanialamt Neustadt trennenden Graben, findet sich eine Menge heidnischer (Kegel=?) Gräber. (Mittheilung des Herrn Stadtförsters Schultz zu Kiekindemark und des Herrn Dr. juris Beyer zu Parchim, welcher letztere sich zu weiteren Untersuchungen und Nachgrabungen an dieser Stelle bereit erklärt hat.)
l) An mehreren Stellen auf dem Felde bei Schwaan sind Hügel, welche Herr Gerichtsrath Ahrens daselbst ebenfalls für (Kegel=) Gräber hält.


|
Seite 110 |




|
3. Wendenkirchhöfe.
a) Der Kirchhof zu Presek, einer Pertinenz von
Hülfeburg bei Wittenburg, ist, nach einer
Schilderung des frühern Besitzers, Herrn von
Hammerstein, im Freimüth. Abendbl. 1821, No. 134,
ein Wendenkirchhof. Durch den Herrn Pastor Ritter zu
Wittenburg sind bei dem Herrn Pensionär Unruh zu
Hülfeburg dieserhalb Nachrichten, welche das frühere
Vorkommen von Urnen mit Ashe
 . an jener Stelle bestätigen,
eingezogen, und von letzterem für die Zeit, wo der
damals noch mit Rapp bestellte Platz abgeerntet sein
werde, weitere Untersuchungen verheißen worden.
. an jener Stelle bestätigen,
eingezogen, und von letzterem für die Zeit, wo der
damals noch mit Rapp bestellte Platz abgeerntet sein
werde, weitere Untersuchungen verheißen worden.
b) In der Pfarrhölzung zu Gägelow bei Sternberg, wo schon viele Urnen und Scherben gefunden wurden, von welchen Herr Präpositus Brehm daselbst zwei treffliche Urnen von der Art der in den Wendenkirchhöfen vorkommenden Serenissimo überreichte, sind nach des Herrn Präpositus Bericht noch mehr Schätze zu erwarten, "auf dem ersten gegen Süden nach dem Dorfe zu gelegenen, jetzt mit Tannen bewachsenen Berge in der bergigen Pfarrhölzung, auf der Höhe dieses Berges".
II. Nachrichten von andern alten merkwürdigen Stätten.
1. Künstliche Steinstellungen bei Blengow.
Zwischen Blengow und Meschendorf am Meeresstrand findet sich, nach dem Berichte des Herrn Pastors Mussäus zu Hansdorff, eine künstliche Steinstellung, deren Bestimmung sich bisher noch nicht hat ausmitteln lassen. Nähere Untersuchungen und Mittheilungen würden willkommen sein.
2. Merkwürdiger Platz bei Grabow.
Auf dem kaltenhof=prislicher Felde bei Grabow ist in einer flachen Gegend eine Vertiefung mit bedeutenden Hügeln umgeben. Diese Stelle wird seit undenklichen Zeiten vom Volke "Bund=Sahl" genannt. (Mittheilung des Herrn Gerichtsraths Stollberg zu Grabow.) Schon nach früheren Vorkommenheiten mancher Art ist diese Feldmark jedenfalls von hohem Interesse.
3. Merkwürdige Stellen bei Schwaan.
Herr Gerichtsrath Ahrens zu Schwaan schreibt über einige merkwürdige Punkte der dortigen Umgegend Folgendes:


|
Seite 111 |




|
"a) Burg Werle. Ueber die Lage dieser Burg ist bereits vielfältig geforscht. Aus hiesigen einzelnen. Später aufgezeichneten Nachrichten erhellt, daß man angenommen: die Burg habe bei Wiek gelegen, sei zerstört worden, und das Dorf habe davon den Namen Wiek - weil die Geschlagenen gewichen seien - erhalten. (s. Francke's Geschichte.) Soviel ist gewiß, daß bei Wiek Spuren eines alten Wallgrabens noch vor kurzem zu sehen gewesen sind. Man findet da eine bedeutende Menge von Scherben und Stücksteinen. Auch ist noch auf hiesigem Felde in der Nähe von Wiek eine mit einem Graben umgebene Fläche, welche als der Kirchhof bezeichnet wird. Nachgrabungen haben noch nicht stattgehabt 1 ).
b) Verehrungsort der Göttin Siwa. Diese Siwa soll im hiesigen Lindenbruche verehrt sein, wie unser Geschichtschreiber Francke I, pag. 223. 224, meldet. Es fehlen darüber jedoch alle weiteren Nachrichten; doch sind vor vielen Jahren Opfersteine gefunden, zu der Zeit aber zertrümmert. Auch sind ehemalige Linden=Alleen noch jetzt zu erkennen.
c) Burg bei Pölchow Bei dem Dorfe Pölchow bei Rostock, nicht weit von hier, sind im Holze noch bedeutende Reste von einer alten Burg, welche weiterer Nachforschungen würdig zu sein scheinen. Ein Kampf zwischen Obotriten und Rugiern hat angeblich die Burg zerstört".
4. Steinwall bei Adamsdorf.
In dem Berichte der deutschen Gesellschaft in Leipzig von 1829, S. 12, heißt es: "Uebrigens theilt uns der Herr Doctor Wagner (zu Schlieben) eine Bemerkung des Herrn Grafen von Blumenthal mit. Bei dem Gute des Herrn Grafen, Adamsdorf, unweit Neustrelitz im Meklenburgischen, befindet sich ein Ackerfeld, sonst ein Buchenwald, leicht einige tausend Morgen im Flächeninhalte, das mit einer Art von Mauer oder Steinwall umkränzt ist, worin mehrere hundert größere oder kleinere, regelmäßig gestellte und mit Fleiß zusammengetragene Steinhaufen sich


|
Seite 112 |




|
zeigen. Auf der einen Seite liegt die sogenannte Dobber=See, auf der andern soll, der Sage nach, eine Wendenstadt gestanden haben. Außerhalb der Steinumwallung liegt das Riesengrab. Nach Abtragung des einen Steinhügels fanden sich drei kleine Urnen und in einer derselben Ringe. Einen derselben 1 ) übergab uns Herr Doctor Wagner für unsere Sammlung. Es wäre sehr zu wünschen, von diesem merkwürdigen Platze eine genauere Beschreibung zu erhalten". Auf Veranlassung dieser Nachrichten wurde unsrerseits mit dem gegenwärtigen Besitzer von Adamsdorf, Herrn Gutsbesitzer Jahn, Mitgliede des Vereins, Correspondenz angeknüpft. Das Nachstehende enthält die von demselben gemachten Mittheilungen.
"- - Betreffend die Angabe des verstorbenen Herrn Grafen von Blumenthal, - - kann ich nicht umhin, derselben insofern zu widersprechen, als ein mit einem solchen Walle umkränztes Feld auf dem adamsdorfer Felde nicht existirt; ein solcher Steinwall ist aber wirklich vorhanden, nur läuft derselbe in fast gerader Linie, anfangs von Ost nach West, dann aber fast ganz nördlich. Die Länge beträgt fast 1/4 Meile und die Breite von 2 bis 4 Ruthen. Daß dieser Steinwall ganz durch Menschenhände bereitet sei, glaube ich nicht, (wiewohl ich zugebe, ja überzeugt davon bin, daß der größte Theil desselben auf diese Weise entstanden ist): er enthält zu große Steine, als daß man annehmen könnte, sie seien durch Menschenkräfte zusammengebracht (der eine Stein mißt gewiß 16 Fuß in der Länge). Die Linie des Walles ist höchst unregelmäßig. Auf der einen Seite liegt eine Bruchwiese (früher ein See und noch jetzt der trockne See - droege See oder dobe See - genannt), und in der Nähe dieser Wiese, östlich von derselben und ziemlich hoch gelegen, befinden sich deutliche Spuren eines Kirchhofes; derselbe enthält im Flächeninhalt 72 □Ruthen und ist mit einem aus einzelnen Steinen bestehenden Ringe umgeben. Nachgrabungen, die hier schon früher vorgenommen worden und die auch ich wiederholt habe 2 ), lieferten nichts als den Beweis, daß dieser


|
Seite 113 |




|
Ort als regelmäßiger Kirchhof benutzt worden ist; es finden sich nur noch wenige Knochen. Nicht sehr weit von diesem Kirchhofe soll nach der Aussage einiger Leute noch ein Kirchhof liegen, den man den "Heidenkirchhof" nennt: die Stelle habe ich noch nicht genau ausmitteln können; jedenfalls liegt sie auf derselben Seite des großen Steinwalles, auf welcher der vorhin genannte Kirchhof sich befindet. Auf der andern Seite des Walles liegen mehrere theils größere, theils kleinere Hügel, die viele Steine enthalten und mit Busch bewachsen sind; einer derselben, der jetzt der "Mürerberg" genannt wird und den der Graf von Blumenthal als das Riesengrab bezeichnet, ist von dem genannten Grafen geöffnet worden: von den Leuten, die diese Arbeit vollführten, wohnt noch einer in meinem Gute Liepen, und nach dessen Aussage fand man eine Urne mit kleinen Knochen und Asche nebst 3 Ringen von Messing; diese letztern sollen fein gravirt gewesen sein".
5. Lage von Suentana.
Ueber die Lage des Ortes Suentana, wo bekanntlich die empörten nordalbingischen Sachsen von den Obotriten unter Thrasiko i. J. 798 geschlagen wurden, macht Herr Dr. Beyer zu Parchim folgende Conjectur.
"Nach Luden, Gesch. des teutsch. V. Bd. IV, S.
395 und Not. 36 S. 557, hält Pertz diesen Ort für
"Suante im Amte Schwaan." Allein abgesehen
davon, daß es in diesem Amte meines Wissens überall
keinen Ort Suante giebt
1
), scheint mir
auch die Gegend gar nicht zu passen. Die
Veranlassung zu dem Kampfe gab bekanntlich der
Aufstand der Sachsen gegen den fränkischen
Statthalter Ebervin, nach dessen Vertreibung
dieselben sich zu einem Feldzuge gegen die
Obotriten, die alten Bundesgenossen der Franken,
rüsteten, von denen sie auch jetzt wieder
Unterstützung des zur Rache heraneilenden Kaisers
fürchten mußten. Auf diese Nachricht rückten die
Obotriten ihnen mit einem Heere entgegen, worauf es
sogleich zur Schlacht kam. ("Thrasico, cognito
Transalbinorum motu, cum omnibus copiis suis in
loco, qui Suentana vocatur, occurrit, commissoque
proelio ingenti eos caede prostravit." Adelmus
ad a. 798., cf. Klüver Beschreibung
 . Thl. 3, S. 26, Not. w.) Nach dieser
Erzählung glaube ich das Schlachtfeld nicht allzu
fern von der Grenze der streitenden
. Thl. 3, S. 26, Not. w.) Nach dieser
Erzählung glaube ich das Schlachtfeld nicht allzu
fern von der Grenze der streitenden


|
Seite 114 |




|
Völker suchen zu müssen, und hier bietet sich uns kein passenderer Ort dar, als die Ebene, auf welcher der alte Grenzfluß, die Suentina, entspringt, das alte Swentin=Feld, eine öde Gegend im Gebiete der Wagrier, in der Nähe des heutigen Bornhöft, die auch in spätem Jahren (1227) zum Schlachtfeld geeignet gefunden wurde und den Nachkommen jenes Thrasiko ebenfalls als Sieger sah. Vgl. über diese Gegend Adam. Brem. bist. eecl. lib. II. c. 9, und Bangertus in den Noten zu Helmold. chron. Slavorum I, c. 57, p. 137, dessen Worte v. Beehr rer. mekl. lib. I, c. 3, p. 37 seqq. und p. 40 anführt; S auch Crantzii Vandal. lib. III, c. 40, lib. VII, c. 24 und an a. O. Ich muß gestehen, mir scheint diese Vermuthung so nahe zu liegen, daß ich mich wundern würde, wenn ich der Erste sein sollte, der darauf verfällt. Gleichwohl habe ich sie noch nirgends ausgesprochen gefunden".



|



|
|
|
6. Blocksberge in Meklenburg.
In dem Quartalber. II, 2 ward die Bitte um möglichst Zahlreiche Nachrichten darüber ausgesprochen, ob sich auf den einzelnen Feldmarken noch Stellen finden, welche von dem Volke Blocksberge genannt werden, - eine für die Geschichte des Hexenwesens und der Hexenprocesse in Meklenburg sehr interessante Frage. Hierauf sind folgende "Blocksberge" in Meklenburg bis jetzt angemeldet worden (fernere Mittheilungen der Art werden erbeten):
a. bei Neddemin im strelitzischen, auch auf der schmettauschen Charte verzeichnet. (Mittheilung des Herrn Ober=Medicinalraths Dr. Brückner zu Ludwigslust.)
b. zu Waschow bei Wittenburg. (M. des Herrn Majors von Graevenitz auf Zühr.)
c. zu Sophienhof bei Waren. (M. des Herrn Kammerherrn von Vieregge sen. auf Steinhausen.)
d. zu Wietow, Amts Meklenburg. (M. des Herrn Bataillons=Auditeurs Grimm zu Wismar.)
e. f. zu Zarnewenz und Petersberg im Fürstenthum Ratzeburg. (M. des Herrn Rectors Masch zu Schönberg.)
g. auch auf dem Wege von Alten=Gaarz nach Zwendorff bei Neubukow soll einem Gerüchte nach ein Blocksberg sich finden. (M. des Herrn Pastors Mussäus zu Hansdorff.)
III. Nachrichten von alten Bildwerken.
I. Streithammer im 16. Jahrhundert.
Zur Geschichte der Streithammer theilt Herr Archivar Lisch die Notiz mit, daß in einem aus dem Anfange des 16.


|
Seite 115 |




|
Jahrhunderts stammenden, im großherzoglichen Archive zu schwerin befindlichen Verzeichnisse mehrerer Sachen, welche von Straßenräubern genommen sind, mit der Aufschrift:
auch
aufgeführt werden, und daß auch unter der Regierung des Herzogs Johann Albrecht I. in der Mitte des 16. Jahrhunderts noch "Fausthammer" vorkommen.



|



|
|
|
2. Der Taufstein aus der Döpe bei Hohen=Vicheln.
Im vorigen Jahrgange S. 33-35 ward eines aus der Döpe bei Hohen=Vicheln hervorgeholten, jetzt angeblich im Pfarrgarten dieses Dorfes befindlichen alten Taufsteins Erwähnung gethan, und gleichzeitig der mit diesem Steine in Verbindung gesetzten Sage von einer gewaltsamen Wendentaufe im Schweriner See oder in der Döpe gedacht. Ueber die verschiedenen Seiten dieses Gegenstandes sind nun neuerdings weitere Mittheilungen gemacht worden. Von diesen legen wir aber diejenigen, welche den ehemaligen Zusammenhang der Döpe mit dem Schweriner See und die Frage über die Richtigkeit der erwähnten Sage betreffen, einstweilen zurück, da ein geehrtes Mitglied eine Abhandlung über die Burg Dobbin vorbereitet, bei welcher Gelegenheit jene Punkte mit berührt und jene Materialien passender ihre Benutzung finden werden. Hier möge nur dasjenige angefüllt werden, was sich auf die Geschichte des in den 70ger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus der Döpe wirklich hervorgeholten Taufsteins, namentlich seine Schicksale seit der Zeit seiner Auffindung und seine Identität mit dem im Pfarrgarten zu Hohen=Vicheln noch jetzt befindlichen bezieht.
Hierüber giebt Herr Hülfsprediger Günther zu Neuenkirchen einige sehr schätzenswerthe Notizen, welche sein Vater, der wail. Pastor Günther zu Hohen=Vicheln, Nachfolger und einige Zeit Hülfsprediger jenes Pastors Friederici, zu dessen Zeit die Hervorholung des Steins erfolgte, aus dessen eigenem Munde gehört zu haben versicherte. "In der Döpe 1 ), so erzählte Friederici, nicht fern von einem sehr breiten Graben, der von der ventschower Scheide in die Döpe hineinläuft (dieser Graben ist, freilich nur noch sehr schmal, auch heute noch


|
Seite 116 |




|
sichtbar und bekannt unter der Benennung "drei Graben"), lag, in bedeutender Tiefe des Wassers, ein Stein, von welchem die Sage ging, daß dieser ein Taufstein sein solle, aus welchem ehemals Heiden getauft wurden. Ursprünglich solle derselbe in dem genannten Graben aufgestellt gewesen sein; in diesen solle eine Menge von Heiden hineingetrieben und eben hier auch ihre Taufe verrichtet worden sein. Allein nachdem die Heiden, voll Haß gegen die Christen, diese erschlagen, sei der Stein von ihnen ins Wasser geworfen. - - Hier lag er nun den hohenvichelnschen Fischern zum großen Hinderniß. Sehr oft, wenn man mit der sogenannten großen Wade fischte, kam diese in Berührung mit dem Steine, und selbst die der Oertlichkeit Kundigsten verwickelten nicht selten ihre Netze an demselben. So erging es auch dem Fischer Prignitz zu Hohen=Vicheln. Derselbe hatte eine neue Wade angekauft, und gleich beim ersten Zuge mit derselben gerieth diese an den Taufstein. Aegerlich darüber, befahl der Fischer seinen Leuten, die Wade anzuziehen, und es gelang ihnen, den Stein aus der Tiefe des Wassers dem Ufer näher zu bringen. Darauf ließ der Pastor Friederici ihn anholen und in die Kirche zu Hohen=Vicheln stellen. Späterhin erbat sich die rostocker Universität denselben. Demzufolge wurde der Stein nach Rostock transportirt und im dortigen Museum aufgestellt". Stimmt nun diese Erzählung, soweit sie die Emporholung des Steins aus der Döpe betrifft, im Wesentlichen mit dem Bericht des Herrn Präpositus Müller im vorigen Jahrgang überein, so weicht sie von des Letzteren Angaben desto entschiedener in der Nachricht ab, daß der aus der Döpe hervorgezogene Stein nach Rostock gebracht sei, während er nach jenen noch heute im Pfarrgarten zu Hohen=Vicheln sich befinden sollte. Bei dieser Angabe des Herrn Hülfspredigers Günther erinnerte sich der Herr Archivar Lisch, bei einem Besuche der Alterthumssammlung der Universität Rostock im Sommer 1836 in einem eingebundenen Hefte alter Kataloge und Nachrichten auch eine Nachricht über jenen Taufstein gefunden zu haben. Herr Professor Strempel zu Rostock hatte die Güte, die folgende genaue Abschrift dieser Nachricht aus den Museums=Akten mitzutheilen.
Ein See bei Hohen=Vicheln, welcher nur durch einen Ausfluß mit dem großen Schweriner=See zusammenhängt, führt von Alters her den Namen der Döpe, und die Tradition unter den dasigen Bauern besagt, daß in diesem See eine Menge Wenden getauft worden, so, daß sie in das Wasser


|
Seite 117 |




|
hätten hineingehen müssen, und sodann von Geistlichen, die in einem Kahn, wo sie einen Taufstein mit Weihwasser bei sich gehabt, unter ihnen herumgefahren, getauft worden wären. Eben diese Tradition aber sagte auch, diese Wenden wären nachher vom Christenthum wieder abgefallen, hätten ihre Geistlichen verjagt, den Taufstein aber gewaltsam zerschmissen, und das größte Stück davon in die Döpe versenkt. Da von Vater auf Sohn fort im Winter bei hellem Eise es auch immer geheißen hatte, man könne an einem gewissen Orte der Döpe, nach der ventschower Seite hin, den Döpelstein sehen, so betrieb es endlich vor etwa 12 Jahren zu einer solchen Winterzeit der jetzige Herr Pastor Friederici zu Hohen=Vicheln, daß ein Versuch gemacht wurde, diesen vermeintlich in die Augen scheinenden Stein herauszuholen, welches auch in Gegenwart verschiedener distinguirter Personen, von 6 bis 7 Arbeitsleuten mit Hacken bewerkstelligt wurde, ob derselbe gleich auf 6 Klafter tief lag. Die Beschaffenheit des Steins, der zwar nicht zierlich behauen, aber doch offenbar zu einem Wasserbehälter ausgehauen gewesen ist, dient der Tradition ganz wohl zur Bestätigung, und die bis dahin fortgelaufene Tradition läßt, bei dieser Beschaffenheit des Steins, nicht wohl zweifeln, daß derselbe bei der Taufe jener Wenden als ein Taufstein gebraucht worden sei. Und so ist derselbe als eine Antiquität mit hieher auf die Bibliothek geschafft worden, nachdem längst vorher Se. Wohlgeboren Herr Hofrath Tychsen sich bereit erklärt hatte, ihn aufzunehmen.
Bützow, den 2. Junii 1787.
Dr. J. P. A. Müller". 1
Dieses aktenmäßige Zeugniß stimmt mit der oben angeführten Erzählung des Pastors Günther nach mündlichen Aeußerungen des Pastors Friederici in der Hauptsache so gut überein, daß wohl als unzweifelhafte Tatsache angesehen werden kann,
1) es sei etwa um's Jahr 1775 aus der Döpe bei Hohen=Vicheln ein alter taufsteinartiger Stein hervorgezogen,
2) und dieser sei an das Museum der damaligen Universität zu Bützow 2 ) abgeliefert worden.


|
Seite 118 |




|
Auch Herr Präpositus Müller gesteht in einem späteren Schreiben, auf den Grund jener Zeugnisse, die größere Wahrscheinlichkeit der letzteren Annahme zu, und fügt als Bekräftigung eine weitere Angabe des Fischers Prignitz (eines Sohnes des bei der Auffindung des Steins betheiligten) bei, "wie er sich erinnere, daß vor langer Zeit ein Taufstein von Hohen=Vicheln nach Rostock oder nach Bützow gebracht worden; doch wisse er nicht, ob dieses der in der Döpe gefundene oder ein anderer gewesen sei".
Es fragt sich jetzt nur noch: was ist aus dem in der Döpe gefundenen, an die Universität zu Bützow abgelieferten Steine geworden? Die am nächsten liegende Annahme scheint die zu sein, daß er bei der Verlegung der Universität ebenfalls nach Rostock gebracht worden sei. Hier aber hat er, nach der Versicherung des Herrn Professors Strempel, bis jetzt noch nirgends aufgefunden werden können. Herr Archivar Lisch fand im dortigen Museum allerdings ein Stück eines alten Taufsteins aus rothem Granit mit einem darauf ausgehauenen Gesicht, welches etwas stark und fast thierisch ist: sollte das vielleicht ein Rest des bei unbekannter Veranlassung zertrümmerten sein? Einem vom Herrn Hülfsprediger Günther mitgetheilten, jedoch von ihm selbst bezweifelten Gerüchte zufolge wäre der alte hohenvichelnsche Stein in neuerer Zeit beim Anbau an dem "weißen Collegium" zu Rostock als Fundamentstein verwendet worden. - Möglich wäre es auch, daß derselbe, vielleicht des lästigen Transports wegen, gar nicht mit nach Rostock gekommen, sondern in Bützow zurückgeblieben wäre. Dann aber müßte in letzterem Orte seine Spur doch aufzufinden sein, und der Herausgeber hat dieserhalb ein geehrtes Mitglied in Bützow um Nachforschungen gebeten, ist indessen bis jetzt noch von dem Erfolge nicht in Kenntniß gesetzt worden. Und somit darf dieser Gegenstand noch zu weiteren Erkundigungen den rostocker und den bützower Mitgliedern empfohlen werden.
Was endlich den im Pfarrgarten zu Hohen=Vicheln befindlichen Stein betrifft, so enthält der Bericht des Herrn Hülfs=


|
Seite 119 |




|
predigers Günther darüber Folgendes: "Dieser Stein, wie zwei ähnliche Exemplare, welche außerdem noch zu Hohen=Vicheln vorhanden sein werden, diente in katholischer Zeit wahrscheinlich als Weihkessel. Zwei derselben sollen aus der ehemaligen Kirche zu Rubow stammen, von welchen der eine früher im Pfarrgarten und der andere auf dem Pfarrhofe stand. Der dritte Stein gehörte wohl von jeher der Kirche zu Hohen=Vicheln an, und wird dieser auch jetzt noch im Kirchengebäude seinen Stand haben, woselbst aber die zwei rubowschen Steine nie aufgestellt waren". Herr Präpositus Müller dagegen weiß, außer dem im Pfarrgarten befindlichen, nur noch "von einem am obern Rande sehr beschädigten Kelche eines ehemaligen Taufsteins oder Weihkessels, welcher schon seit undenklicher Zeit unten in der hiesigen Kirche gelegen haben soll, und vielleicht, als er noch ganz war, auf dem bei dem ersten Pfeiler der Kirche, Eingangs rechts, befindlichen, fast 1 Fuß hohen steinernen Postament gestanden hat". Der Herausgeber nahm vor Kurzem beide Steine selbst in Augenschein, und fand den im Pfarrgarten stehenden ganz der Beschreibung entsprechend, welche Herr Präpositus Müller von demselben geliefert hat; der andere, in zwei Stücke zerbrochene (denn das vom Herrn P. Müller erwähnte "Postament" gehört offenbar als Fuß zu dem zweiten Bruchstücke, dem Kelche), der in der Kirche liegt, ist ebenfalls von Granit und auch sonst, an Größe und Gestalt, jenem ersten ziemlich gleich, nur daß die roh ausgehauenen vier Gesichter des letzteren, überhaupt alle Verzierungen, ihm fehlen. Dieser mag wohl der alte hohenvichelnsche, und jener im Garten der (oder einer der?) aus der rubowschen Kirche sein. Beide können übrigens, ihrer Form nach, eben sowohl zu Taufsteinen, als zu Weihkesseln gedient haben: die Stellung des einen in der Kirche befindlichen, nämlich gleich am Eingange an einem Pfeiler (wenn anders diese seine jetzige Stellung seine ursprüngliche ist), scheint allerdings mehr die zweite Bestimmung anzudeuten.



|



|
|
:
|
3. Die Glocke von Camin.
"Die größere Glocke zu Camin bei Wittenburg ist viel besprochen. Nach der Sage in dortiger Gegend soll sie eine Inschrift tragen, welche Niemand habe enträthseln können, selbst, was jedoch kaum glaublich ist, der gelehrte Tychsen nicht. Nach brieflichen Mittheilungen (vgl. Jahresber. I, S. 35) des Herrn Pastors Bruger zu Warsow hätten "weder die berühmtesten Kenner, selbst Tychsen und Arendt, noch das großherzogliche Archiv zu Schwerin Aufschluß geben können;


|
Seite 120 |




|
eine weitläuftige Correspondenz, welche sein seel. Großvater, wailand Prediger zu Camin, mit einer Menge auswärtiger Gelehrten darüber geführt, sei leider nach dessen Tode nicht aufzufinden gewesen". - Die Inschrift, welche ich bei Gelegenheit der Aufgrabungen zu Camin persönlich untersuchte, ist aber in großen, schönen Zügen auf den ersten Blick völlig klar und lautet einfach:

d. i.
O . rex. gloriae . Jhesu . Christe . veni . cum . pace.
(O König der Ehren, Jesu Christ, komm mit Frieden.)
Es ist also die so häufig vorkommende
Glockeninschrift. Was dieselbe jedoch merkwürdig
macht, ist, daß sie in den bekannten römischen
großen Unzialen aus dem Anfange des vierzehnten
oder Ende des dreizehnten Jahrhunderts
ausgeprägt ist, während die meisten übrigen
Glockeninschriften derselben Art im Lande die
gothische Schrift des fünfzehnten Jahrhunderts
zeigen (vgl. Jahrbücher I, S. 65 und 68). - Die
angebliche Schwierigkeit der Erklärung dieser
Inschrift liegt wahrscheinlich darin, daß sie
nach schlechten und vielleicht immerfort
tradirten Abschriften vorgenommen ist. Nach der
vom Hrn. Pastor Bruger mitgetheilten Abschrift
zu urtheilen, ist freilich eine Erklärung nach
Abschriften wohl schwerlich möglich, da die
klaren Züge kaum wiederzuerkennen sind, selbst
wenn man die Glocke gesehen hat, und die
Abschrift mit dem letzten Buchstaben
 des Wortes P
des Wortes P


 anfängt, also mit
anfängt, also mit

 O, und nicht mit dem
O, und nicht mit dem
 . Nach einer Mittheilung des Herrn
von Bülow auf Camin, noch ehe ich die Inschrift
untersucht hatte, hatte auch wohl der bekannte
"nordische Alterthumsforscher" Arendt,
der die Glocke mit eignen Augen gesehen, richtig
gelesen, indem er es für eine Anrufung Christi
erklärt habe.
. Nach einer Mittheilung des Herrn
von Bülow auf Camin, noch ehe ich die Inschrift
untersucht hatte, hatte auch wohl der bekannte
"nordische Alterthumsforscher" Arendt,
der die Glocke mit eignen Augen gesehen, richtig
gelesen, indem er es für eine Anrufung Christi
erklärt habe.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
4. Leichenstein in der Kirche zu Camin.
"In der Kirche zu Camin bei Wittenburg ist links vom Altar ein Leichenstein aus Sandstein in die Wand gemauert, welcher, nach der Zeichnung des Herrn Bau=Conducteurs von Motz (vgl. Jahresber. I. S. 29), dem Leichensteine des Vicke von Stralendorf auf Möderitz und seiner Frau (vgl. Clemann's Parchimsche Chronik, S. 251), vom J. 1604, gleich ist. Es ist ein Leichenstein von dem Grabe des Hans Halberstadt, geb. 1551, und seiner Frau Katharina Pentzen, geb. 1561.


|
Seite 121 |




|
Auf dem Leichensteine sind die Figuren beider in Lebensgröße en haut relief ausgehauen, zu ihren Häupten die Wappen beider, auf dem Rande umher die Wappenschilder der Ahnen. Die Arbeit, der des möderitzer der Zeichnung nach völlig gleich, ist gut und ziemlich wohl erhalten, wird jedoch durch einen dicken Kalküberzug entstellt. Beide Arbeiten tragen ganz das Gepräge des Monuments des Herzogs Ulrich im Dom zu Güstrow.
Bei dieser Gelegenheit möge hier ein Gegenstand berührt werden, der in der Folge vielleicht zu manchen Hypothesen Veranlassung geben dürfte. In der Kirche zu Camin ist in der Wand rechts am Eingange ein kleines Pferd en relief in die Wand gemauert. Wie in und an dieser Kirche noch mehrere Marienbilder sich finden, so besaß sie auch ein Reiterbild des heil. Georg aus Holz gehauen, von welchem noch das Pferd unter der Thurmtreppe steht. Da nun dergleichen Bilder in den Kirchen gewöhnlich am Eingange angebracht sind und sich oft ein kleiner St. Georg neben einem größern findet, so ist nichts wahrscheinlicher, als daß das kleine in die Wand gemauerte Reliefbild eines Pferdes auf die Verehrung des St. Georg Bezug hat.
G. C. F. Lisch."



|



|
|
:
|
5. Leichenstein unter dem Portal der Schloßkirche zu Schwerin.
"Am 17. October ward unter dem Portal der Schloßkirche zu Schwerin eine neue Schwelle gelegt. Bei Aufnahme der alten Steine fand sich, daß das ganze Portal auf einem großen, behauenen Leichenstein ruhete, auf den die Pilaster gesetzt und die Schwelle gelegt war. So viel als möglich ward der Stein von seinen Bedeckungen befreiet; jedoch standen auf dem Kopf= und dem Fußende die Pilaster, welche nicht entfernt werden konnten. Der Stein war wie neu erhalten. Es waren zwei Figuren darauf eingegraben unter burgähnlichen Zinnen mit Thürmen, welche die Nischen bildeten. Rechts stand ein Ritter in Rüstung, links von ihm ein Frauenbild mit gefalteten Händen. An der linken Hand des Ritters, also zwischen beiden Figuren, war der Stein zum Einlassen einer Metallplatte zum Wappen schildförmig vertieft; darüber waren noch drei Vertiefungen, die eine wie ein Helm, die beiden andern, oberen neben einander waren rund. Die Inschrift war klar und erhalten. Sie begann offenbar oben und ging, von dem Beschauer, rechts herum. An der Seite der Frau war, so viel von den Pilastern nicht bedeckt war, zu lesen:


|
Seite 122 |




|

(d. i. [die Petri et] Pauli apostolorum obiit dominus Detlevus de Tzule mildes] -),
und an der Seite des Mannes stand:

(d. i. [anno] MCCCXCII sabbato ante Elisabeth obiit Beke uxor -).
Nach der Stellung der Inschrift zu schließen starb die Frau (1392) nach dem Manne. Die Ritter von Züle (verschieden von den v. Zülow), namentlich dieser Dethloff, waren in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bekannt und erscheinen oft im Gefolge der Fürsten.
Diese Bemerkungen werden hier deshalb ausführlich mitgetheilt, damit in der Zukunft, was so häufig in ähnlichen Fällen geschieht, nicht übertriebene Nachrichten von bedeckten Leichensteinen in der Schloßkirche sich verbreiten. Zugleich dient diese Bedeckung zum Beweise, daß man auch in einer aufgeklärten Zeit, wie die, in welche der Bau der Schloßkirche fällt (1561-1563), der Ueberreste des Alterthums nicht schonte.
G. C. F. Lisch."



|



|
|
|
6. Reliquien=Urne zu Wismar.
Die Schiffer=Compagnie zu Wismar ist im Besitze einer kleinen gläsernen, mit blauen Rändern verzierten Urne, ungefähr 6" hoch und 4" weit, mit einigen kleinen, an Pergamentstreifen genähten Beutelchen mit der Aufschrift: reliquiae de St. Mauritio und van sunte laurentius bente, außerdem einigen Knochen und, wie es scheint, Bernsteinstücken oder doch zum Räuchern gebrauchten Materialien. Die kleine pergamentne Schrift mit wohlerhaltenem Siegel, welche sich in dieser Urne befand, ist vom J. 1459 und vom Bischofe Johannes (von Ratzeburg), und unten auf der Urkunde steht episc. XXIII, welches mit Masch Geschichte des Bisthums Ratzeburg S. 352 stimmt. Die Urkunde enthält, daß die Kapelle zu Ehren des Apostels Paulus, Petrus u. s. w. rite geweiht sei. Urne und Urkunde ward, nach einem der Schiffercompagnie ausgestellten Atteste des wail. Consistorialraths Koch, damals Pastors zu St. Nicolai, im J. 1794 unter dem Altare gefunden. (Nach Mittheilungen der löbl. Schiffercompagnie und des Herrn Dr. phil. Burmeister zu Wismar.)


|
Seite 123 |




|
7. Parchimsche Münzen.
Zu der im Jahresber. I, S. 19 unter III, 1 aufgeführten parchimschen Kupfermünze bemerkt Herr Dr. juris Beyer zu Parchim: "Diese Münze hat hier bis vor einigen Jahren zu dem Werthe von 6 (nicht 3) Pfennigen cursirt. Es ist aber keine unter irgend einer öffentlichen Autorität geprägte, sondern lediglich von einer Privatperson, dem Kupferschmied Saul hieselbst, auf eigene Rechnung und Gefahr ausgegebene Münze, zu deren Annahme mithin auch keine Verpflichtung stattfand, die aber, wegen des derzeitigen Mangels an hinreichender öffentlicher Scheidemünze, in der Stadt und der Umgegend gern genommen wurde. Dieser Umstand hatte schon früher ähnliche Speculationen hervorgerufen; namentlich hatte der Kaufmann H. L. Karnatz und später der nachmalige Senator Hoffmann zinnerne Münzen ausgegeben, die hier gleichfalls als Sechslinge cursirten. Alle diese Privatmünzen sind später von ihren Ausgebern wieder eingelöst, weil sie nachgeprägt wurden. Aehnliches hat auch in andern Städten, namentlich in Röbel, stattgefunden".
IV. Nachrichten von alten Schriftwerken.
I. Sachsenspiegel.
In Homeyer's Verzeichniß deutscher Rechtsbücher des Mittelalters und ihrer Handschriften, Berlin 1836, wird, nach Dreyer's Verzeichniß in den Beiträgen zur Literatur, unter 375 ein handschriftliches niedersächsisches Remissorium über den Sachsenspiegel als im Stadtarchive zu Röbel befindlich aufgeführt und über Beschaffenheit und Inhalt der Handschrift nähere Nachricht gewünscht. Eine im Quartalber. II, 1 zu diesem Zwecke erlassene Aufforderung, begleitet von einer unmittelbar an den Herrn Bürgermeister, Hofrath Engel zu Röbel, gerichteten Anfrage, brachte von diesem folgende Erklärung: "Das niedersächsische Remissorium über den Sachsenspiegel, welches sich im hiesigen Stadtarchive befinden soll, ist mir darin nie zu Gesichte gekommen, wenn ich gleich selbst während meiner Amtsführung die hiesige Registratur geordnet habe. Fände sich dasselbe, so würde ich solches mit Vergnügen mittheilen".
Die über den ehemaligen Arpeschen Codex des Sachsenspiegels angestellten Nachforschungen und veröffentlichten Aufforderungen (s. Jahresber. I. S. 30. 31) sind, wie es scheint, bisher ohne Erfolg geblieben.


|
Seite 124 |




|
Ueber Fragmente des Sachsenspiegels dauerten die Verhandlungen mit dem Herrn Professor Homeyer, in Grundlage seines oben angeführten Werkes, von Seiten des Herrn Archivars Lisch nicht ohne Erfolg fort, und wird diese Angelegenheit der Berücksichtigung sämmtlicher Mitglieder dringend empfohlen.
2. Alte Wismarsche Stadtbücher.
Zu den bedeutendsten neueren Erscheinungen auf dem Felde der meklenburgischen Geschichte, und vielleicht der norddeutschen überhaupt, gehört die Wiederauffindung der alten wismarschen Stadtbücher durch den Herrn Dr. phil. Burmeister zu Wismar, welchem das Studium des dortigen Stadtarchivs von dem wissenschaftlichen Sinne des Magistrats bereitwillig gestattet worden ist. Der Verein darf sich im Laufe der Zeit manche interessante und wichtige Mittheilungen aus dieser reichen Quelle versprechen; Einiges ist ihm daraus schon zugeflossen.
3. Verschiedenes.
Mit dem Herrn Professor W. Grimm zu Göttingen ward über die Bearbeitung und Herausgabe mittelhochdeutscher Gedichte aus dem großherzoglichen Archive zu Schwerin correspondirt.
Die Herren Archivar Dr. Lappenberg zu Hamburg und Dr. Deecke zu Lübeck setzten mit dem Herrn Archivar Lisch die Forschungen über die Geschichte der Buchdruckerkunst in Meklenburg fort.
Cordesius, chron. Parch. c. VI. führt an, Herzog Heinrich habe sich von Luther einen Prediger für die 7000 Seelen starke lutherische Gemeinde in Parchim erbeten. Es wird Auskunft gewünscht, ob dieser Brief und die Antwort Luthers darauf noch vorhanden, und wo sie zu finden seien.
Ferner wird Nachricht erbeten, ob das von Nettelbladt, succ. notit. pag. 103, angeführte Manuscript Joachim Mantzel's: manipulus rerum Parchim., s. analecta ad M. Cordesii chron. Parchim., colligi coepta 1711, noch irgendwo vorhanden sei. Der Professor Mantzel zu Bützow, ein Vetter des Vf., bemerkt gelegentlich (Bütz. Ruhestunden Th. XIX, Nr. 6), daß das Mscpt. Sich dermalen (1765) in seinen Händen befinde.


|
Seite 125 |




|
D. Vorbereitende Arbeiten, Aktenstücke und Schriften für die Aufgrabungen des Vereins.
Wie schon im Obigen mehrfach angedeutet worden, sind in die Reihe der Schaffner für unsre Alterthümer=Sammlung planmäßige Aufgrabungen unter Autorität des Vereins mit diesem Jahre eingetreten. Es war dem Vereine nicht unbekannt, daß mancherlei Bedenklichkeiten gegen Unternehmungen dieser Art gehegt werden und Zweifel an ihrem Nutzen öfter ausgesprochen sind. solche ungünstige Meinungen finden allerdings eine Erklärung und Entschuldigung in der vielfach mangelhaften, ja verkehrten Weise, wie Aufgrabungen früher großentheils angestellt wurden, in dem frevelhaften Muthwillen, welcher so oft blos zur Befriedigung einer müßigen Neugier und ohne irgend einigen Nutzen für die Wissenschaft ehrwürdige Denkmäler der Vorzeit zerstörte, in der leeren, kleinlichen Curiositätenkrämerei, welcher die Gräber nicht selten dienen mußten, in dem Mangel an Plan und Combination, wodurch solche Unternehmungen entweder ohne festen Halt und bestimmtes Ziel blieben, oder als vereinzelte, losgerissene Erscheinungen ohne Zusammenhang mit gleichartigen dastanden und deshalb unbeachtet und unfruchtbar blieben, so wie in manchem Andern, was auch diese Art der Gräberei nicht ganz mit Unrecht in denselben übeln Geruch mit hineingezogen hat, in welchem die Schatzgräberei mit dem vollsten Rechte steht. Allein Mißbrauch hebt den Gebrauch nicht auf, und Fehler, die begangen werden, können unmöglich doch zur gänzlichen Vernachlässigung der Sache, an welcher sie begangen wurden, führen: nur zum Bessermachen sollen sie Veranlassung geben und auffordern. Jene nicht hinwegzuleugnenden früheren Mängel und Uebelstände einerseits, andrerseits die von den erfahrensten Kennern der Alterthumswissenschaft theils geahnte, theils klar erkannte Bedeutsamkeit des Lichtes, welches aus den Gräbern der Vorzeit, und nur aus ihnen, für manche Theile des Alterthums sich gewinnen lasse, mußten unserm Verein ein starker Antrieb werden, mit Benutzung aller der früher gesammelten Erfahrungen, mit ausreichenderen Mitteln auf dem nun schon besser erkannten Wege ein lohnenderes Ziel zu erstreben, als welches so manche der älteren Versuche erreicht hatten, und durch Erforschung vorchristlicher Grabdenkmäler seinerseits den möglich


|
Seite 126 |




|
größten Gewinn für die Geschichte des Vaterlandes und die Kenntniß der Vorzeit überhaupt zu Tage zu fördern. Der Verein hat diese Aufgabe, als seiner würdig, nicht verschmäht; aber er hat sich auch die Schwierigkeiten ihrer Lösung nicht verhehlt und durch möglichst umsichtige, sorgfältige Vorbereitung den Erfolg nach Kräften sicher zu stellen sich bemüht.
Die Deputation für Aufgrabungen, welche in Gemäßheit
eines von der vorigen General=Versammlung
genehmigten Planes gebildet ward (ihre bisherigen
Mitglieder sind der Herr Archivar Lisch, der Herr
Geschichtsmaler Schumacher und der Herausgeber),
konnte unter glücklichen Umständen an die
Ausrichtung des ihr gewordenen Auftrags gehen.
Einestheils fand sie in dem gräberreichen Boden
Meklenburgs ein ergiebiges, erst zum kleinen Theil
ausgebeutetes Feld; sodann sah sie, bei den
blühenden Verhältnissen des Vereins, hinlängliche
Geldmittel zu ihrer Verfügung gestellt; ferner
zählte sie unter den einheimischen und auswärtigen
Mitgliedern viele bedeutende Kräfte, auf deren
Mitwirkung sie rechnen durfte; endlich gewährte
ihren Arbeiten das Vorhandensein der ludwigsluster
Sammlung und die gleichzeitig fortgesetzte
Herausgabe des Friderico-Franciscei eine verstärkte
Anregung, eine willkommene Unterstützung und
Erleichterung. Denn weit entfernt, daß diese zwei
Aeußerungen eines und desselben Strebens
nebenbuhlerisch und neidisch sich gegenseitig
beeinträchtigt hätten, hat vielmehr eine der andern
wesentlich genügt und gedient. Wie die Sache der
ludwigsluster Sammlung und insbesondere des
Friderico-Franciscei durch den vom Verein geweckten
Sinn für die Alterthumskunde neuen Schwung erhielt,
wie der Verein jene Angelegenheit als seine eigene
ansah und als solche seinen Mitgliedern warm
empfahl: so empfing die Deputation ihrerseits in der
Geschichte der für jene Sammlung unternommenen
Aufgrabungen von dem Herrn Ober=Zoll=Inspector,
Hauptmann Zinck zu Dömitz äußerst nützliche
Vorarbeiten und Materialien, und nicht minder mußten
diejenigen Erfahrungen, welche eins ihrer
Mitglieder, Herr Archivar Lisch, in seiner andern
Eigenschaft als Aufseher der ludwigsluster
Alterthümer, so wie als Fortsetzer und Commentator
des Friderico-Franciscei, gesammelt hatte, ihr von
dem allergrößten Vortheil sein. Insbesondere bildete
die von demselben verfaßte und zu den
Vereinsschriften eingereichte Abhandlung:
"Andeutungen über die altgermanischen und
slavischen Grabalterthümer Meklenburgs
 .." einen unmittelbaren Vorläufer
und eine nothwendige Ergänzung ihrer eigenen
Arbeiten, und die auf dessen Veranlassung unterm
.." einen unmittelbaren Vorläufer
und eine nothwendige Ergänzung ihrer eigenen
Arbeiten, und die auf dessen Veranlassung unterm


|
Seite 127 |




|
10. December v. J. publicirten allerhöchsten Verordnungen zum Schutz und zur Rettung der vaterländischen Alterthümer leisteten niemandem wesentlichere Dienste, als eben dem Verein.
So entwarf denn die Deputation zwei zur Instruction für die Leiter von Aufgrabungen sich eignende Vorschriften, von welchen die eine "Andeutungen über Aufgrabung vorchristlicher Grabdenkmäler", die andere "Fragen" enthält, "deren Beantwortung bei Aufgrabung vorchristlicher Grabdenkmäler von dem Verein f. m. G. u. A. gewünscht wird." Nach vielfältiger Berathung der Mitglieder über dieselben wurden sie der pommerschen und der königlichen schleswig=holstein=lauenburgischen Gesellschaft, den Herren Ober=Medicinalrath Dr. Brückner zu Ludwigslust, Professor Danneil zu Salzwedel, Dr. von Hagenow zu Greifswald, Hauptmann von Ledebur zu Berlin und Ober=Zoll=Inspector, Hauptmann Zinck zu Dömitz zur Begutachtung mitgetheilt, von wo sie mit mancherlei sehr schätzbaren Bemerkungen versehen zurückkehrten und hierauf schließlich redigirt wurden. Alle Erfahrungen, die bisher auf diesem Gebiete gemacht wurden, sind in ihnen benutzt, und alle Zielpunkte, welche für eine auf möglichst großen wissenschaftlichen Erfolg berechnete Aufgrabung sich herausstellen, haben darin eine angemessene Berücksichtigung gefunden. Bei den bisherigen vom Verein ausgegangenen Aufgrabungen wurden sie in Abschrift benutzt: für den künftigen Gebrauch sollen sie in diesem Jahresbericht und auch in Separatdruck abgedruckt werden.
Es blieb jetzt nur noch die Gestattung einer Ausnahme von dem Verbot der Aufgrabung vorchristlicher Gräber im großherzoglichen Domanium, welches durch eine der erwähnten allerhöchsten Verordnungen erlassen war, zu Gunsten des Vereins zu erbitten übrig. Diesem Gesuche ward mit gewohnter Huld durch einen Regiminal=Erlaß d. d. Schwerin den 31. März 1837 vollständig entsprochen. Und nunmehr konnte, da auch mehrere Nachweisungen und Anerbietungen aufzudeckender Gräber dem Verein zugegangen waren, mit dem Eintritt der günstigen Jahreszeit zur wirklichen Veranstaltung von Aufgrabungen geschritten werden. Es sind ihrer bis jetzt drei vorgenommen worden: nämlich bei Prieschendorf (s. oben S. 25-33), bei Gallentin (S. 35-42) und bei Camin (S. 53-69). Glücklich genug haben diese drei ersten Aufgrabungen des Vereins gleich alle drei Hauptklassen der vorchristlichen Gräber in Meklenburg berührt. Noch glücklicher haben alle drei einen sehr guten Erfolg gehabt, und dies, so wie die freundliche


|
Seite 128 |




|
Unterstützung, deren die Deputirten des Vereins überall sich zu erfreuen hatten, und das lebhafte Interesse, welches diese Aufgrabungen in näheren und ferneren Kreisen erweckt haben, muß dem Verein Lust und Muth machen, auf der unter so günstigen Auspicien betretenen Bahn mit Eifer fortzuschreiten. Dabei ist es natürlich nicht seine Absicht, jedes lockende Grab zu öffnen und so die durch höhere Fürsorge vor sonstigem Angriff gesicherten Denkmäler mittelst eines erworbenen Monopols zu seinen Gunsten zu zerstören; vielmehr wird er dieselben mit allen seinen Kräften, und soweit die Verhältnisse es gestatten, zu schützen sich angelegen sein lassen. Allein wo entweder äußere Umstände eine anderweitige und dann für die Wissenschaft nutzlose Vernichtung drohen, oder wo innere Gründe im Interesse der Wissenschaft dringend die Oeffnung und Untersuchung eines alten Denkmals empfehlen, da wird er es nicht für eine Verletzung der Pietätspflicht gegen die vaterländische Vorzeit halten, sondern dieser Pflicht gemäß zu handeln glauben, wenn er den äußern Zusammenhang von Erde und Steinen lös't, um aus ihrer bewahrten Form und aus ihrem geretteten Inhalte der Geschichte eben jener Vorzeit eine Förderung zu verschaffen.
Wir geben nun die in diesem Abschnitte bis jetzt blos allgemein berührten Aktenstücke und Schriften in extenso.
I. Großherzogl. meklenburg=schwerinsche Verordnungen zum Schutz und zur Rettung vaterländischer Alterthümer. 1 )
(Publicirt im offic. Wochenblatt 1837, St. 2, Nro. 1638 u. 1639. Auch abgedruckt im Hamb. Corresp. 1837, Nro. 15.)
1.
Friedrich Franz,
von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg,
Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch
Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard
Herr
 .
.
 .
.
W ir befehlen, in Erweiterung Unsers Verbots vom 13. April 1804, wegen Aufgrabens heidnischer Gräber, euch hiedurch:


|
Seite 129 |




|
1) den Pächtern und Dorfschaften in den euch untergebenen Aemtern bei scharfer Ahndung aufzugeben, sich aller Beschädigung der Gräber und Denkmäler der Vorzeit nicht weniger aller Zerstörung derselben, zu Abhülfe wirthschaftlicher und baulicher Bedürfnisse, zu enthalten, so wie selbst strenge darauf zu wachen, daß ohne eingeholte Unsere besondere unmittelbare Erlaubniß diesem nicht entgegen gehandelt werde;
2) alle früher oder künftig zufällig gefundenen, in Privathänden befindlichen Alterthümer von den Domanial=Eingesessenen einzufordern und dieselben mit einem möglichst genauen Bericht über Fundort und Fundart an Unsere Alterthumssammlung in Ludwigslust einzusenden.
Uebrigens soll den Besitzern solcher Alterthümer zwar eine Entschädigung für die durch die Ablieferung versäumte Zeit nach Tagelohn, so wie durch Erstattung des Metallwerthes, wenn es begehrt werden sollte, zugestanden werden, jedoch habt ihr eure Amtsuntergebenen in vorkommenden Fällen über den höchst geringen Geldwerth der meisten Alterthümer angemessen zu belehren.
An dem geschieht Unser gnädigster Wille und Meinung. Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin, am 10. Dec. 1836.
Friederich Franz.
(L. S.)
L. H. von Plessen.
An
alle Beamte.
2.
Friedrich Franz,
 .
.
 .
.
F ügen, mit resp. Entbietung Unsers gnädigsten Grußes, allen Obrigkeiten Unserer Ritter= und Landschaft und überhaupt allen


|
Seite 130 |




|
Unsern Unterthanen und Landes=Eingesessenen hiemit zu wissen: wie Wir bei der hohen wissenschaftlichen Bedeutung und der Ehrwürdigkeit der Gräber der Vorzeit und der in ihnen gefundenen Alterthümer Unser Verbot wegen Aufgrabens heidnischer Gräber in Unsern Domainen vom 13. April 1804 durch vorstehende Verordnung zu erweitern geruhet haben, und Wir es mit dem gnädigsten Danke erkennen würden, wenn auch die auf den ritterschaftlichen und städtischen Grundstücken befindlichen alten Grabstätten nicht anders als etwa zu wissenschaftlichen Zwecken geöffnet würden, auch dafür Sorge getragen werden wollte, daß alle auf diesen Besitzungen zufällig gefundenen oder sonst im Besitze von Privaten befindlichen Alterthümer an eine der öffentlichen Alterthumssammlungen des Landes abgegeben werden, da alle Erfahrungen den endlichen Untergang von Gegenstanden des Alterthums im Privatbesitze gelehrt haben. Wir lassen dies durch Unser Wochenblatt zur öffentlichen Bekanntmachung gelangen.
Gegeben durch Unsere Regierung, Schwerin, am 10. December 1836.
Friederich Franz.
(L. S.)
L. H. von Plessen.
II. Großherzogl. meklenburg=schwerinsches Rescript wegen Gestattung von Aufgrabungen im Domanium für den Verein.
Paul Friedrich,
von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg
 .
.
U nsern gnädigsten Gruß zuvor! Veste und Hochgelahrte, liebe Getreue. Nachdem von eurem Vereine eine eigene Deputation zur Aufgrabung und Untersuchung vorchristlicher Grabdenkmäler ernannt und von dieser eine, von den kundigsten Männern des In= und Auslandes begutachtete Anweisung zu solchen Aufgrabungen ausgearbeitet worden ist, wollen Wir euch, auf eure Bitte vom 3. d. M., hiemit in Gnaden autorisiren, die genannten Aufgrabungen und Untersuchungen in Unsern Domainen zu veranstalten; jedoch versehen Wir Uns dabei zu euch, daß ihr dieselben nur erst nach reiflicher Erwägung der Umstände in jedem einzelnen Falle und nur im wahren Interesse der Wissenschaft unternehmen und sie nur zuverlässigen, sachkundigen Händen anvertrauen, so wie die Arbeit selbst genau nach


|
Seite 131 |




|
Maaßgabe der dazu entworfenen Instruction ausführen lassen werdet. Wir haben zu dem Zweck den urschriftlich anliegenden offenen Befehl an alle Unsere Beamten erlassen, und übermitteln euch denselben in Gnaden, womit Wir euch gewogen verbleiben.
Gegeben durch Unsere Regierung. Schwerin, am 31. März 1837.
Paul Friederich.
L. H. von Plessen.
An
den Ausschuß des Vereins
für
Mecklenb. Geschichte
 .
.
hieselbst.
Anlage.
von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürst zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg, auch Graf zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard Herr
 .
.
Thun hiemit allen Unsern Beamten kund: daß Wir dem hiesigen Vereine für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde die in der landesherrlichen Verordnung vom 10. December v. J. sub 1. gedachte besondere unmittelbare Erlaubniß zur Veranstaltung von Aufgrabungen und Untersuchungen vorchristlicher Grabdenkmäler in Unserm Domanium ertheilt haben, und befehlen demnach hiedurch allen Unsern Beamten, den Deputirten des genannten Vereins, wenn sie sich durch Vorzeigung dieses legitimiren werden, bei den oben bezeichneten Ausgrabungen allen erforderlichen Schutz angedeihen zu lassen. Urkundlich unter Unserm Handzeichen und Insiegel. Gegeben durch Unsere Regierung. Schwerin, am 31. März 1837.
Paul Friederich.
(L. S.)
L. H. von Plessen.


|
Seite 132 |




|



|



|
|
:
|
III. Andeutungen über die altgermanischen und slawischen Grabalterthümer Meklenburgs und die norddeutschen Grabalterthümer aus der vorchristlichen Zeit überhaupt,
von
G. C. F. Lisch,
Großherzogl. meklenb.
Archivar zu Schwerin, Aufseher der
Großherzogl. Alterthümersammlung zu
Ludwigslust
 .
1
)
.
1
)
Ist es wahr, daß das Vorhandensein und die Pflege der Geschichte, so wie eine geschichtliche Fortführung aller Verhältnisse, vorzüglich die geistige Ausbildung eines Volkes charakterisirt, so liegt auch der Wunsch sehr nahe, über die Uranfänge und die Entwickelung der heimatlichen Verhältnisse, über das Leben der Vorfahren möglichst im Klaren zu sein. Während die übrigen deutschen Völkerschaften ihre Geschichte bis in die ersten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung und noch weiter verfolgen können, besitzen die deutschen Ostseeländer nicht viel mehr, als eine Geschichte von sechshundert Jahren. Bekanntlich beginnt ihre urkundliche Geschichte erst mit dem Falle des Wendenthums in der Mitte des zwölften Jahrhunderts; und auch in den ersten Zeiten der sächsischen Einwanderung stießen die heimischen Geschichtsquellen gerade nicht reichlich, was wohl dem Umstande zuzuschreiben sein mag, daß in den deutschen Ostseeländern vorzugsweise Cistercienser=Klöster errichtet wurden, welche zwar, von Betriebsamkeit und verständiger Einsicht, unendlich viel für die Cultur des Landes und die Regelung aller Verhältnisse thaten, aber sehr wenig Bücher hinterließen. Zwar haben wir von Tacitus bis Helmold herab über die deutschen Ostseeländer manche Ueberlieferungen in den Geschichtsbüchern anderer Völkerschaften, aus denen wir eine Geschichte der vorchristlichen Zeit unsers Vaterlandes, so gut es gehen will, zusammenstellen können; aber alle diese Ueberlieferungen sind ohne Ausnahme fremde, oft fragmentarisch genug, nicht selten so dunkel, daß sie kaum verständlich sind; an heimischen Denkmälern über dem Erdboden können wir nichts aufweisen. sei


|
Seite 133 |




|
es an Bau=, Bild= oder Schriftwerken. Zwar wissen wir aus den gleichzeitigen Jahrbüchern anderer deutscher Völkerschaften und aus den spätern Andeutungen unserer Urkunden, daß in den letzten Jahrhunderten vor dem Falle des Heidenthums in Meklenburg slavische Völkerschaften wohnten; aber wie weit sie zurückreichen, ob sie seit uralter Zeit Eingeborne waren, ob sie später einwanderten und deutsche Völkerschaften unterjochten oder verdrängten: dies alles sind Fragen, welche bis heute noch nicht mit Bestimmtheit beantwortet werden können. Es ist freilich wahr, daß in den neuesten Zeiten gründliche Untersuchungen es zu beweisen übernommen haben, daß in den nordöstlichen Ländern Deutschlands im Anbeginn der europäischen Geschichte germanische Völkerschaften wohnten und diese ungefähr in der Mitte des sechsten oder siebenten Jahrhunderts von slavischen Völkern verdrängt wurden, welche sich bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts siegreich behaupteten; - aber diese frühere Existenz germanischer Völkerschaften in den deutschen Ostseeländern wird von nicht wenigen geistreichen und gelehrten Männern bezweifelt: der bis heute noch nicht ganz geschlichtete Streit ist bekannt; eben so bekannt ist es auch, daß sich der Vortheil immer mehr auf die Seite derjenigen geneigt hat, welche eine germanische Urbevölkerung in den spätern wendischen Ostseeländern annehmen. Viel mehr urkundliche Aufklärung ist schwerlich zu erwarten, da es kaum zu hoffen steht, daß noch neue historische Quellen entdeckt werden, welche für die ältesten Zeiten ergiebig sein könnten. Und gesetzt auch, wir gewönnen Sicherheit in der Erkenntniß der frühesten Begebenheiten, so fehlt uns dann noch immer eine Einsicht in das Leben und die Culturverhältnisse der Völker, welche dem neueren Zustande vorangegangen sind.
Die letzte und einzige Hoffnung, Licht in die Dunkelheit zu bringen, ruhet in den Gräbern, welche bekanntlich aus der Vorzeit als dauernde, Ehrfurcht gebietende Denkmäler noch herüberragen und in ihrem Schooße das bergen, was wir suchen: Erkenntniß des seins und des Lebens der Vorfahren. Nur wenn eine Erkenntniß der Grabalterthümer der mitteleuropäischen Tiefländer von Nordfrankreich bis in die Ebenen Polens vor uns liegt und eine Vergleichung von der einen Seite mit dem Skandinavischen und britannischen Norden und mit Rom, von der andern Seite mit den Ergebnissen aus den noch slavischen Ländern möglich macht, erst dann können wir ungetrübte Blicke in die Vorzeit thun. Und gelingt es uns, zum Ziele zu gelangen, so können wir darauf rechnen, daß aus der Vergleichung der gewonnenen Resultate mit den noch aus dem


|
Seite 134 |




|
europäischen und asiatischen Rußlande und aus Mittelasien zu gewinnenden Aufklärungen hervorgehen, welche zu den wichtigsten der Alterthumskunde gehören.
Meklenburg ist für die germanisch=slavische Alterthumskunde von nicht geringer Bedeutung, da es, mit unbedeutenden Ausnahmen, eines der westlichsten Slavenländer war und von der andern Seite nur durch ein schmales Meer von dem germanischen Skandinavien geschieden ist. Auch wurden von jeher die Ueberreste der Grabalterthümer in Meklenburg mehr geachtet, als vielleicht in manchen andern Ländern. Schon im Anfange des 16. Jahrh. sammelte der einsichtsvolle Herzog Heinrich der Friedfertige Graburnen und freute sich der Betrachtung der Vorzeit; auch der kunstliebende Herzog Christian Ludwig, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, achtete diese Alterthümer hoch und legte den Grund zu der jetzigen Sammlung des Großherzogs K. H. zu Ludwigslust. - Aber alle vereinzelten Funde, und hätte man deren noch so viele gemacht, werden die Alterthumswissenschaft nicht viel weiter bringen, vielmehr die Hypothesen und die Verwirrung noch mehren; alle ohne Nachricht überlieferten, vereinzelten Gegenstände des Alterthums verdienen, wenn sie nicht zufällig technischen oder künstlerischen Werth besitzen, mit Recht das Schicksal, dem sie früher oder später unterliegen: der "Rumpelkammer" anheimzufallen. Erst aus verbürgten, umsichtig und vorsichtig geleiteten Aufgrabungen, bei denen die äußere Gestalt und der innere Bau der Gräber eben so sorgfältig beobachtet wird, als die in ihnen verborgenen Ueberreste der Vorzeit, kann ein sicheres Resultat für die Geschichte gewonnen werden.
In Meklenburg blieb es der langen segensreichen Regierung des Großherzogs Friedrich Franz K. H. vorbehalten, umsichtige Aufgrabungen für die Wissenschaft zu gewinnen. Des erhabenen Fürsten Kenntniß und Werthschätzung alles dessen, was geschichtliche Bedeutsamkeit hat, ist bekannt. In die Fußtapfen seiner erlauchten Vorfahren tretend, beförderte Er auf jegliche Weise die Pflege des heimischen Alterthums, ja unternahm Höchstselbst die Leitung von Aufgrabungen, z. B. bei Ludwigslust, welche mit dem glänzendsten Erfolge gekrönt wurden. Besonders aber wurden, die Aufgrabungen in den Jahren 1804 bis 1806 durch die Thätigkeit des Hauptmanns, jetzigen Oberzoll=Inspectors Zinck zu Dömitz und die eifrige Theilnahme des verstorbenen Hofmarschalls von Oertzen in höchstem Auftrage betrieben, wobei der Fürst ununterbrochen Theilnehmer blieb. So entstand der Reichthum der großherzoglichen Sammlung germanischer und slavischer Alterthümer zu


|
Seite 135 |




|
Ludwigslust, begleitet von verbürgten Aufgrabungsberichten und vermehrt durch die Beiträge der allgemein verbreiteten Theilnahme: ein Reichthum, der zwar nicht übermäßig ist und nicht durch Seltenheiten blendet, aber durch eine gleichmäßige Vollständigkeit wohl die meisten Sammlungen in dieser Art übertrifft. Diese Schätze wurden von des Großherzogs K. H. mit der größten Liebe und Sorge gepflegt, bis die Zeit kam, wo ein allgemeines Interesse die wissenschaftliche Bearbeitung derselben wünschenswerth machte. Die günstigsten Aussichten hiezu boten sich dar, als der Professor Schröter zu Rostock, ein Mann von Sachkenntniß, Geist und Kraft, eben aus Skandinavien heimgekehrt, in den ersten Jahren des vorigen Jahrzehnds ein allgemeines Interesse für Grabalterthümer im Lande erweckte. Die Huld des Landesherrn ward ihm in dem Maße zu Theil, daß ihn eine Bestellung zum Aufseher der ludwigsluster Alterthumssammlung zur wissenschaftlichen Bearbeitung derselben, die ihm schon nahe lag, dringend aufforderte. Er sah die Wichtigreit der Sammlung ein und entwarf den Plan zur Herausgabe einer bildlichen Darstellung der vorzüglichsten Alterthümer und der repräsentirenden Stücke jeder Gattung, und demnächst zur Ausarbeitung einer umfassenden Erläuterung, welche die gesammte germanische und slavische Alterthumskunde begreifen sollte. Die Buchhandlung von Breitkopf und Härtel in Leipzig ging auf den Plan ein; das Ganze unter dem Titel: Friderico-Francisceum, sollte sechsunddreißig lithographirte Tafeln im größten Folio=Format, welche alle abzubildenden Gegenstände, wo möglich in natürlicher Größe, enthalten sollten, und einen Band Text nach Beendigung der Lithographie umfassen. - Se. K. H. der Großherzog übernahm die Kosten der Zeichnungen und der Zurüstung zum Texte. Schon im Jahre 1824 erschienen 3 Hefte mit 18 Tafeln. Kaum war Schröter von einer Reise nach Kopenhagen im Interesse des Werkes heimgekehrt, als ihm ein Nervenschlag den freien Gebrauch seiner Geisteskräfte raubte und ihn seiner begeisternden Wirksamkeit entzog. Er hinterließ zur Erkenntniß seines Plans und zur Fortsetzung seiner Arbeit- nichts, da er alle seine Ideen und Erfahrungen bei sich im Geiste trug und überhaupt nur auszuarbeiten pflegte, wenn er mit sich einig geworden war und das gesammte Material gesammelt hatte; er hinterließ nichts, als das fünfte und sechste Heft der Abbildungen bei der Buchhandlung; diese konnten jedoch nicht ausgegeben werden, da noch das letzte Heft fehlte. Seine werthvolle, vorzüglich für heimische Alterthümer in Deutschland und Skandinavien gesammelte Bibliothek verlor sich durch Versteigerung. -


|
Seite 136 |




|
Damit die kostbaren Lithographien nicht Makulatur würden, ward der gelehrte Professor Grautoff in Lübeck zur Vollendung und Erläuterung des Werkes im Jahre 1830 gewonnen; kaum hatte er aber die Sammlung in Ludwigslust revidirt, als ihn der Tod wegraffte, ohne daß auch er etwas anders hinterlassen hätte, als einige Handzeichnungen, um sich, fern von der Sammlung, ein klares Bild von den einzelnen Gegenständen verschaffen zu können. - Jedes Jahr drohte immer größern Verlust für die Sache; mit der Berufung an Schröters Stelle übernahm ich zugleich die Schwierige und wagliche Arbeit der Vollendung und Erläuterung des ganzen Werkes, welche bald beschafft werden mußte, da noch von Lebenden Nachrichten eingezogen werden konnten, ohne welche die Fortsetzung unmöglich war. Schröters umfassenden Plan mit Gründlichkeit zu verfolgen, lag außer den Grenzen der Möglichkeit; die Buchhandlung forderte bei den aufgewandten großen Kosten Beschränkung auf eine unentbehrliche Erläuterung der abgebildeten Alterthümer. Des Großherzogs K. H. brachte neue nothwendige Opfer. Schröters Vorbereitungen zum Werke fanden sich nach einiger Zeit; jedoch bestanden sie nur aus Excerpten aus Büchern über nicht meklenburgische Alterthümer, welche jetzt gar nicht benutzt werden konnten; an Hindeutungen über das Friderico-Francisceum fand sich nichts; flüchtige Bemerkungen, auf den Reisen nach Kopenhagen und Rügen gemacht, konnten allein theilweise zur Vergleichung dienen. Jedoch fand sich bei den Acten Schröters der bis dahin vermißte, alte Catalog über die Sammlung von dem Hofmarschall von Oertzen, als frühern Aufseher der Sammlung, in Ludwigslust bei der Sammlung der neuere Catalog Schröters und beim Hauptmann Zinck zu Dömitz dessen wichtige Tagebücher, die er bei den Aufgrabungen geführt hatte. Mit diesen Materialien und dem Hauptmaterial, der Sammlung selbst, welche zu weitern Nachforschungen im Lande Veranlassung gaben, ward dann die Arbeit unternommen; sie ist so weit vollendet, daß das letzte Heft der Abbildungen in der Lithographie und der Text im Drucke ist, so daß das Ganze spätestens bis zur Mitte d. J. im Buchhandel erscheinen kann.
Hierauf die Freunde und Beförderer des vaterländischen Alterthums aufmerksam zu machen und ihnen die Aufnahme des Werkes zum Besten der Sache ans Herz zu legen, ist der Zweck der bisherigen Darstellung. Zugleich aber möchte es an der Zeit sein, durch Darstellung der Resultate, welche aus der Bearbeitung der ludwigsluster Sammlung entsprungen sind, alle Vaterlandsfreunde auf die Wichtigkeit der Sache auf=


|
Seite 137 |




|
merksam zu machen und sie bei der täglich zunehmenden Zerstörung der Denkmäler des Alterthums zur Rettung dessen zu vermögen, was noch zu retten ist, oder doch wenigstens Nachrichten und Zeichnungen niederzulegen, wozu jetzt bei dem Verein für vaterländische Alterthumskunde in Schwerin oder bei der großherzoglichen Sammlung in Ludwigslust Gelegenheit geboten ist. Zwar wird das Friderico-Francisceum alle diese Resultate enthalten, aber, wie es bei einer kritischen Untersuchung ohne Vorarbeiten nur der Fall sein kann, werden sie bei der reinen Darstellung der gemachten Erfahrungen nur als bescheidene, gelegentliche Vermuthungen, nicht als gewonnene, an die Spitze gestellte Wahrheiten erscheinen können. Diese Resultate sollen hier nach nackten Erfahrungen gegeben werden, ohne irgend eine Beimischung geschichtlicher Ausführungen.
Das Resultat des Friderico-Franciscei ist, wenn nicht Alles trügt, eine klare Scheidung der germanischen und der slavischen Alterthümer in Meklenburg, hervorgegangen aus einer Vergleichung des Baues der verschiedenen Arten von Gräbern und der aus ihnen erweislich ans Tageslicht geförderten Alterthümer. Es gibt in den deutschen Ostseeländern verschiedene Classen von Gräbern nach ihrer äußeren Gestalt; man kann deren sieben bis acht unterscheiden; einige zeichnen sich aber vor allen andern so klar aus, wie sie sich bestimmt wieder von einander unterscheiden. Durch Aufstellung der drei vorzüglichsten Klassen wird sich aber die Richtigkeit der gewonnenen Resultate am besten rechtfertigen lassen.
I. Klasse: Germanengräber.
Es gibt in Meklenburg eine große Anzahl von Gräbern der Vorzeit, und vielleicht möchten ihrer die meisten sein, welche durch ihre bestimmte Form fast allgemein bekannt sind. Sie bilden runde, oft durch angesetzte Begräbnisse auch oval gewordene Hügel in Kegelform von 2 bis 25, auch 30 Fuß senkrechter Höhe vom Gipfel bis zum Mittelpunkt der Basis; daher ist ihnen der Name Kegelgräber gegeben. Nie haben sie große Steine auf dem Gipfel zur Bedeckung, eben so wenig große Steinpfeiler in den Seitenwänden zur Haltung; im Aeußern ist nichts anders sichtbar, als eine Rasen= oder Moosdecke. Oft, jedoch nicht als Regel, finden sich kleinere Feldsteine um den äußersten Ring des Grabes gelegt, zum Schutz und zur Bezeichnung; eben so häufig, und vielleicht häufiger, nicht selten bei Gräbern derselben Art neben einander, ist dies nicht der Fall. Als die größten Gräber dieser Art sind bisher die Gräber bei Proseken, Ruchow und Prillwitz bekannt


|
Seite 138 |




|
geworden. Im Innem sind die Ueberbleibsel und Geräthschaften des Todten unter Gewölben von rohen Feldsteinen oder in viereckigen Kisten von platten Feldsteinen beigesetzt. Die kleinern Hügel, in welchen nur ein Todter bestattet ist, bestehen häufig nur aus dem Einen Steingewölbe (Steinkegel), welches dann mit einer dünnen Erd= oder Moosdecke im Aeußern belegt ist; oft aber besteht das Grab eines Einzelnen auch nur aus Erde, mit Ausnahme der platten Unterlags= und Deckelsteine für die beigesetzte Urne. 1 ) Die größeren Hügel bergen gewöhnlich mehrere Begräbnisse oder Steingewölbe und Steinkisten neben einander und sind durch einen hohen Erdaufwurf zu einem runden Hügel vereinigt (Erdkegel). Das Auffallendste im Innern ist zuerst eine doppelte Bestattungsweise. Einige Todte sind in diesen Kegelgräbern als Leiche, ohne Verbrennung, in gewaltigen Särgen von Eichenholz begraben, wie es bei Beckentin, Neukirchen und Ruchow beobachtet ward; andere Leichen sind verbrannt und ihre Asche ist in Urnen beigesetzt; in einigen großen Hügeln finden sich beide Bestattungsarten neben einander in demselben Hügel, z. B. bei Ruchow, wo die Hauptleiche unverbrannt begraben, die übrigen Leichen verbrannt in Urnen beigesetzt waren. Sind die Leichen verbrannt, so findet sich auf dem Boden des Hügels oft die Brandstätte: ein Pflaster aus breiten Steinen, von ungefähr 5 Fuß Länge und einigen Fuß Breite; auf diesem Pflaster liegen dann Asche und Kohlen, unter den letztern sind Kohlen von Eichenholz und verkohlte Eicheln und Wacholderbeeren bemerkt. Die Urnen in den Gräbern dienten zur Aufnahme der aus dem Brande gesammelten Gebeine; häufig finden sich jedoch in einem Begräbnisse mehrere Urnen, von denen dann einige leer sind. 2 ) Die Urnen aus den Kegelgräbern lassen sich in zwei Klassen absondern. Einige sind von grober Masse, im Innern des Bruches stark mit Kiessand durchknetet, im Aeußern glatt von Thon, gelblich, gelbgrau, röthlich und bräunlich oder von gemischter Farbe, fest gebrannt;


|
Seite 139 |




|
ihrer Form nach sind sie entweder im Durchmesser überall nicht viel von derselben Weite abweichend und wenig spitz nach dem Boden zulaufend, oder mit einem engen Hälfe in Form eines Gießgefäßes; 1 ) die Form ist gediegen, edel, groß, jedoch nicht sehr regelmäßig in der Ausführung, so daß die Verfertigung derslben auf der Töpferscheibe als bestritten erscheint. Etwanige Verzierungen bestehen aus einfachen Strichen, welche mit einem unvollkommenen Instrumente aus freier Hand eingekratzt sind. Eine andere Art von Urnen in den Kegelgräbern besteht aus einer feinkörnigen, schwarzen Masse; auch im Aeußern sind sie glänzend und schwarz mit eingesprengten häufigen Pünktchen von Glimmer, 2 ) jedoch ohne allen schwarz färbenden Ueberzug; ihre Form ist kleiner, zierlicher, 3 ) geschmackvoller als die der größern gelblichen Urnen, auch sind die eingeschnittenen Verzierungen regelmäßiger und sorgfältiger gearbeitet. - Was in diesen Gräbern den Todten mitgegeben ward, zeichnet sich zunächst nach dem Material aus. Vorherrschend ist überall Bronze (Erz) von den schönsten Farben, nach chemischen Untersuchungen ungefähr aus 85 Procent Kupfer und 15 Procent Zinn bestehend, jedoch in abweichenden Mischungen, nach der Bestimmung des Geräths sorgfältig berechnet. Alle Gegenstände aus Erz scheinen gegossen zu sein: alle sind stark vom Rost angegriffen oder mit dem herrlichsten, glänzendsten edlen Rost bedeckt, wenn sie nicht im Moor gefunden sind, welches Sachen aus Bronze Jahrtausende lang völlig unversehrt und wie neu erhält. Zum Schmuck findet sich öfter reines Gold. Eisen ist bisher in reinem Kegelgrabe bemerkt, jedoch an einzeln gefundenen Gegenständen, wiewohl höchst selten, beobachtet; Silber ist nie gefunden. Bernstein ist nicht selten; Glasflüsse sind zweifelhaft. - Was nun die in den Kegelgräbern gefundenen Geräthschaften betrifft, so sind sie im höchsten Grade merkwürdig: alles in diesen Gräbern Gefundene ist fremd, eigenthümlich, oft räthselhaft, erinnert in einzelnen


|
Seite 140 |




|
Fällen nur an Rom und erfreut eben so sehr durch seine antike Eigenthümlichkeit, als durch seine edle, kräftige Form. In allen Gräbern wiederholen sich in den verschiedensten Abweichungen die immer vorkommenden Geräthschaften. Man hat Gußstätten für Speerspitzen mit Schmelztiegeln und Klumpen von Gußerz, z. B. bei Demmin, gefunden und daneben hunderte von gefertigten Geräthschaften: ein Beweis, daß sie heimischen Ursprungs sind; aber alle gefundenen Exemplare derselben Gattung waren verschieden. Einige sich häufig wiederholende Geräthe sind dieser Art von Gräbern völlig eigemhümlich. Als solche treten zuerst die wohl bekannten, von Tacitus geschilderten frameae auf, ohne Ausnahme aus Bronze. Dies sind schwere, voll gegossene Lanzenspitzen, welche in der Richtung des Schaftes statt zugespitzt zu einer beilförmigen Schneide abgestumpft waren: eine von den Römern so gefürchtete Waffe, welche die Germanen als Stoßwaffe und als Wurfwaffe gebrauchten; in mehrern Gräbern ist sie neben der bestatteten Leiche auf einem eichenen Schafte von 3 bis 4 Fuß Länge mit einem ledernen Riemen zum Zurückziehen nach vom Fortschleudern zur rechten Hand der Leiche gefunden worden. Diese Waffe (vergl. freim. Abendbl. 1832, No. 719), theils ganz voll gegossen zum Einlassen in einen gespaltenen Schaft, theils an einem Ende hohl gegossen zum Einstecken eines Schaftes, ist sonst bei keinem andern Volke beobachtet worden. Aber sie ist häufig in Norddeutschland, den Rheinlanden, den Niederlanden, Nordfrankreich, Britannien, Dänemark und Skandinavien gefunden und allgemein bekannt, wenn auch unter verschiedenen Namen, wie Celt, Paalstaf, Streitmeißel, Abhäutemesser, Hobeleisen, selbst als Thränenfläschchen. - Ferner charakterisiren sich die Kegelgräber durch die in zahllosen Formen immer wiederkehrenden Spiralwindungen, theils als platte Spiralwindungen in Tellerform, theils als springfederförimge Spiralcylinder, theils als eingegrabene und eingeschlagene Verzierungen. Diese Spiralplatten finden sich an den bisher den deutschen Ostseeländern eigenthümlichen Handbergen, d. h. Handringe mit auslaufenden großen und platt liegenden Windungen (wie Ammonshörner) zum Schutze der Hand und des Unterarms; sie finden sich in kleinerm Maßstabe an Fingerringen, als Ausläufer an den cylindrisch gewundenen Armschienen, in allen Größen an den Brusthefteln. Die Spiralcylinder finden sich häufig als Fingerringe und als Armringe oder Armschienen, vielleicht auch als Beinschienen. Als Verzierungen kommen sie in durchbrochener Arbeit in den Schwertgriffen vor; als eingeschlagene und eingegrabene Verzierungen


|
Seite 141 |




|
werden sie bemerkt an Diademen, Schildnabeln, Schwertknöpfen, Messerklingen, Haarzangen, Büchsen und Dosen, u. s. w. Diese Art von reiner Linearverzierung kommt ebenfalls nicht weiter vor. - Alle diese Merkmale sind allgemeine; aber eben so eigenthümlich ist alles Einzelne, was in den Kegelgräbern vorkommt. Eigenthümlich sind diesen Gräbern: jene kurzen, ungefähr 2 Fuß langen, zweischneidigen, gegossenen Schwerter aus Erz, mit erhabenem Mittelrücken und kurzem, kaum die Faust füllendem, ehernem Griffe; - jene kurzen, breiten Dolche mit dem kurzen Griff, den römischen so auffallend ähnlich; - jene Brusthefteln (fibulae) mit zwei Spiralplatten, ebenfalls nur den römischen ähnlich; - jene Diademe mit den eingeschlagenen Spiralverzierungen, jene großen und breiten Gerspitzen, jene langen Speerspitzen und Pfeile, und alle die immer neu verzierten Armringe, die spiralförmigen Fingerringe, die gewundenen Kopf= und Halsringe, die langen, großköpfigen Nadeln, die schönen Messer, die Scheermesser, die Haarzangen: alles aus Bronze; eigenthümlich sind ihnen die gewundenen goldenen Armringe und die cylindrisch gewundenen Fingerringe aus einfachem oder doppeltem Golddrath.
Diese Art von Gräbern ist gefunden von dem Weichselgebiete bis an die Pyrenäen und von den deutschen Hochländern bis tief in Skandinavien und Schottland hinein. Nimmt man dazu die auffallend hiemit übereinstimmenden Berichte des Tacitus, so läßt sich kaum bezweifeln, daß diese Art von Gräbern den Germanen angehört.
II. Klasse: Slavengräber.
Von den germanischen Kegelgräbern unterscheidet sich eine andere Art von Grabstätten in Meklenburg bedeutend, nämlich diejenigen Grabstätten, welche wohl Kirchhöfe und Wendenkirchhöfe genannt werden. Mit dem Namen von Kirchhöfen werden zwar gewöhnlich Gruppirungen vieler Gräber jeder Art, auch Gruppen von Kegelgräbern, belegt; aber eine Art von Kirchhöfen zeichnet sich vor allen andern durch ihren Inhalt sehr bestimmt aus. Die Wendenkirchhöfe sind nämlich langgestreckte, oft unscheinbare Gesammterhebungen auf Ebenen oder natürlichen Abhängen ohne bestimmte Form. 1 ) In diesen


|
Seite 142 |




|
unbestimmt geformten Erhebungen stehen die Urnen in unglaublicher Menge, am Rande umher zwischen kleinen Steinen verpackt, im Innern dicht gedrängt in der Erde, oft auch zwischen kleinen Steinen, nicht tief unter der Erdoberfläche. In den Urnen findet man Geräth aller Art. Kirchhöfe dieser Art und immer von derselben Art sind aufgedeckt oder berührt zu Kothendorf, auf der Mooster bei Marnitz, zu Gägelow, Preseck u. a. a. O.; oft sind sie unbeachtet beim Ziehen von Gräben und Landstraßen zerstört. Die Urnen enthalten immer Knochen und Asche; 1 ) von Bestattung der Leichen ist keine Spur, eben so wenig von Brandstätten, da der Beisetzungsplatz für die Urnen nicht zugleich die Brandstätte gewesen zu sein scheint. Die Urnen sind zwar denen in den Kegelgräbern in einiger Hinsicht ähnlich, aber die meisten unterscheiden sich charakteristisch von denselben, so daß es in der Zukunft vielleicht gelingen kann, die Gräber selbst nach Urnenscherben zu erkennen, wenn auch andere Kennzeichen fehlen. Die Urnen in den Wendenkirchhöfen sind von feinerer Masse 2 ) und regelmäßiger geformt, so daß der Gebrauch der Töpferscheibe bei ihnen wahrscheinlicher ist. Häufig sind sie mit einem platten einpassenden 3 ) Deckel bedeckt, welcher freilich gewöhnlich zerbrochen ist, während die Urnen in den Kegelgräbern gewöhnlich mit platten Steinen zugedeckt sind, was jedoch auch in den Kirchhöfen beobachtet ist. Oft haben die Gefäße nasenähnliche Knötchen und kleine Henkelchen, welche zum Anfassen fast zu klein sind. Der Hauptcharakter der slavischen Urnen liegt aber in ihrer Form und Verzierung. Während die Grabgefäße in den Kegelgräbern mehr gleichmäßig in ihrer Weite von oben nach unten und mehr edel und kräftig in ihren Umrissen, oder auch mit engem Halse und gehenkelt gebildet sind, ist die Form der slavischen Urnen, wenn auch mehr ausgearbeitet, doch gewissermaßen etwas übertrieben: sie sind oben weit geöff=


|
Seite 143 |




|
net und laufen nach dem Boden hin sehr spitz zu, so daß man sie oft kaum berühren kann, ohne sie umzustoßen. Die Verzierungen sind aber vorzüglich eigenthümlich: sie bestehen nämlich nicht selten aus parallelen, in spitzen oder in rechten Winkeln gebrochenen Linien, den Mäanderformen ähnlich, und sind offenbar mit einem viereckig gezahnten, wahrscheinlich radförmig gearbeiteten Instrumente eingedrückt. Auf einer zu Kothendorf gefundenen Urne ist ein rechtwinkliges, gleicharmiges Kreuz eingeprägt, dessen Balken links hin im rechten Winkel gebrochen sind, grade so, wie es sich auf den dänischen Goldbrakteaten aus den letzten Zeiten des Heidenthums findet. Oft sind die verzierten Urnen mit Asphalt von tiefschwarzer Farbe überzogen; die übrigen sind bräunlich gefleckt gebrannt, jedoch selten so hell, wie die germanischen Urnen; jene schwarz gebrannten, mit Glimmerfünkchen besprengten Urnen der Kegelgräber sind nicht bemerkt, wenn auch Glimmerfünkchen in braunen Urnen der Wendenkirchhöfe vorzukommen scheinen. Auffallend ist die sehr große Zahl der Urnen, welche in der Regel sehr gut erhalten sind, wenn Unverstand sie nicht zerstört hat. Alle diese Eigenthümlichkeiten, ja dieselben Formen finden sich in den verschiedensten Gegenden Meklenburgs wieder, stimmen auch auffallend mit den, in der Mark Brandenburg zahlreich gefundenen Urnen überein, während in den Kegelgräbern gewöhnlich jedes Stück des Alterthums zwar dieselbe allgemeine Grundform, aber doch immer seine besondere Gestaltung hat. - Die in den Wendenkirchhöfen gefundenen Geräthschaften lassen mit den in den Kegelgräbern gefundenen durchaus keine Vergleichung zu. Hier in den Wendenkirchhöfen ist alles mehr neu und bekannt, an die moderne Zeit grenzend, ja mit ihr übereinstimmend. Alles Fremdartige ist verschwunden: es fehlen die frameae, die Handbergen, die antiken Hefteln mit den Spiralplatten, die Spiralwindungen und Spiralverzierungen, die Spiralcylinder, die kurzen ehernen Schwerter u. s. w. Das Material, aus dem die meisten Sachen gefertigt sind, ist Eisen; aus Eisen sind die Schwerter, Lanzen, Pfeile, Schilde, selbst Streitäxte, Messer, Ringe u. s. w. Eigenthümlich sind den Wendenkirchhöfen lange, grade, wahrscheinlich einschneidige Schwerter, in mehrere Enden zusammen gebogen, um sie in die Urnen legen zu können: eine Erscheinung, welche dem Skandinavischen Norden völlig fremd ist, welche dagegen bei Ruppin neben einem mit christlichen Symbolen verzierten ehernen Gefäße beobachtet ward; eigenthümlich sind ihnen die großen, hutförmigen eisernen Schildbuckel; eben so modern sind die graden, spitzen


|
Seite 144 |




|
Messer, die Lanzenspitzen, - Geräthe, welche vorzüglich viel in der Altmark gefunden sind. Bronze (Erz) tritt in den Hintergrund; nur einzelne Gegenstände sind aus Erz gefertigt, z. B. kleine Ringe, Knöpfe, Schnallen, Nadeln, moderne Stopfnadeln, Verzierungen auf Eisen, namentlich Eichelverzierungen, welche man wohl für Glocken gehalten hat, und die immer in derselben Gestalt wiederkehrenden kleinen Brusthefteln mit gebogenem Bügel und mit einer kleinen, dünnen Nadel, während alle diese Gegenstände auch aus Eisen neben andern derselben Art aus Erz vorkommen. An diesen Geräthen aus Erz ist der edle Rost noch nicht bemerkt; gewöhnlich sind sie mit einem mehlartigen Anfluge von mattgrünem Oxyd bedeckt. Gold ist nie bemerkt; dagegen findet sich häufig Silber bei allen Gegenstanden, die auch aus Erz vorkommen; im skandinavischen Norden fällt Silber in die letzte Periode des Heidenthums und in den Anfang des Christenthums; arabische Schmucksachen und Münzen deuten darauf hin, daß das Silber wohl erst durch den Handelsverkehr des Khalifats in die Ostseeländer kam. Als Verzierungen kommen blaue und buntfarbig eingelegte Glasflüsse häufig vor, so auch Bernstein; sauber gearbeitete Gegenstände aus Knochen, wie z. B. Kämme, werden öfter gefunden; Darstellungen roher menschlicher Figuren und ringförmige Schnallen mit christlichen Inschriften mit lateinischen Schriftzügen des 12. und 13. Jahrhunderts werden in Urnen gefunden, welche eine Vergleichung mit denen aus den Wendenkirchhöfen aushalten.
Nach diesen unleugbaren Erfahrungen möchte es nicht gesagt sein, diese Art von Gräbern der slavischen Bevölkerung zuzuschreiben. Zwar spricht hiefür kein Tacitus; aber es giebt innere Gründe, welche diese Annahme unterstützen: in den Wendenkirchhöfen ist alles moderner und, mit Ausnahme des Eisens, weniger durch die Zeit angegriffen; diese Art von Gräbern erstreckt sich geographisch nur so weit, als die slaven gegen Westen und Norden vorgedrungen sind; die Vergleichung ergiebt, daß das Volk dieser Gräber mit dem Norden zur letzten Zeit des Heidenthums und mit dem Khalifat in Verbindung stand; ja Spuren einer christlichen Cultur kommen vor; endlich ist es der directe Gegensatz, oder doch eine völlige, nie zu vereinigende Abweichung von den, nach Rom deutenden Kegelgräbern, welche die sogenannten Wendenkirchhöfe der slavischen Bevölkerung zuschreibt.
Mit den Resultaten der Wendenkirchhöfe kann aber die Betrachtung der Wendengräber noch nicht geschlossen sein; es


|
Seite 145 |




|
läßt sich annehmen, daß einzelne Vornehmere des Volks besonders und kostbarer begraben wurden. Hierüber fehlen jedoch noch Erfahrungen.
III. Classe: Urgräber oder Hünengräber.
Diese Art von Gräbern bietet die großartigste Erscheinung im Reiche der Gräber dar. Diese Gräber bilden in der Regel ein Oblongum von unbehauenen großen Granitpfeilern und sind am Ostende mit gewaltigen Granitplatten bedeckt. Die größten Gräber dieser Art sind mit ungefähr 40 bis 50 Pfeilern umgeben, welche bis 4 Fuß im Durchmesser haben und noch 3 bis 6 Fuß hoch aus der Erde ragen, und sind gewöhnlich im Ostende mit 4 Steinen bedeckt, welche, bei einem Umfange bis 40 Fuß, in der Dicke ungefähr 4 Fuß messen; die Gräber haben oft eine Länge von 120 bis 160 Fuß. Das gewaltigste Grabdenkmal dieser Art, vielleicht in Deutschland, ist das bei Katelbogen; ein anderes majestätisches Grab liegt bei Naschendorf; übrigens sind sie in Meklenburg, namentlich im östlichen Theile desselben, nicht selten. Innerhalb der Steinpfeiler ist der Grabhügel aufgeschüttet wie eine langgestreckte, umgekehrt muldenförmige Erhöhung von 4 bis 8 Fuß Höhe. - Unter den großen Decksteinen findet sich gewöhnlich eine Steinkiste 1 ) aus großen, platten Steinen, in welcher die Alterthümer liegen, die übrigens auch in andern Theilen des Grabes Zerstreut sind. Der Inhalt dieser Gräber ist sehr einfach. Gewöhnlich finden sich nur Scherben von rohen, dick geformten Urnen; 2 ) in Meklenburg ist keine Urne bekannt, die unversehrt aus einem Hünengrabe gekommen wäre. Hin und wieder sind auch Gerippe von Menschen in den Hügeln gefunden. Das Material, welches in diesen Gräbern vorherrschend vorkommt, ist Feuerstein; jene vielbesprochenen, breiten, schön geschliffenen Keile aus Feuerstein (Streitkeile, an andern Orten auch wohl Donnerkeile und Thorskeile genannt) werden oft in großer Anzahl in ihnen gefunden; mit Sicherheit ist es nicht bekannt, daß sie je in einem andern Grabe gefunden wären. Außerdem finden sich noch Messer mancherlei Art aus Feuerstein in ihnen. Hiernach hat man diese Gräber einer uralten Zeit zugeschrieben, in welcher der


|
Seite 146 |




|
Gebrauch der Metalle noch nicht bekannt war. Aber es ist unleugbar, daß in Meklenburg in denselben auch Spuren von Eisen 1 ) vorkommen; gewöhnlich ist dieses Metall vergangen, aber man hat auch einzelne Geräthe noch ziemlich gut erhalten aus ihnen hervorgeholt, wie Ringe, Streithammer u. dgl. Die holländischen und nordischen Forscher leugnen zwar das Vorkommen von Eisen in den Hünengräbern; aber es lassen sich sichere Aufgrabungen in Meklenburg nicht wegleugnen. Außerdem finden sich noch Schleifsteine von feinkörnigem, rothem Sandstein und Bernsteinschmuck; weiter ist nichts beobachtet. Das Vorkommen des Eisens setzt die Bestimmung der Hünengräber einen Augenblick in Zweifel; aber ein Hinblick auf die geographische Verbreitung derselben giebt zur weitern Forschung Muth. Die Hünengräber finden sich nämlich in allen den Gegenden, in welchen die germanischen Kegelgräber vorkommen: in Norddeutschland, in den Niederlanden, in Nordfrankreich, in Britannien und in Skandinavien, also am häufigsten in den Ländern, wohin die Slaven nie gedrungen sind. Man ist also gezwungen, sie einer nicht slavischen Bevölkerung zuzuschreiben, und will man nicht annehmen, daß die Germanen im Laufe der Zeit gewaltige Rückschritte gemacht haben, so ist man veranlaßt, die Hünengräber einer alten germanischen oder vorgermanischen Zeit anzuweisen, gewiß einer Zeit, welche der voraufging, in der die Kegelgräber erbaut wurden, aus denen römischer Einfluß nur zu klar hervorleuchtet. Auffallend bleibt allerdings die Zurückdrängung des Eisens durch das römische Erz; aber der Mangel an Technik zur vollkommenem Bearbeitung des Eisens mag wohl Veranlassung zur allgemeinern Aufnahme der schönen, brauchbaren und edlen Kupfercomposition durch die Bekanntschaft mit den Römern geworden sein. Auch kommen allerdings Beispiele von dem fortgesetzten Gebrauche des Eisens in Kegelgräbern vor. - Der Name Hünengräber tritt übrigens auch in Deutschland, selbst in Süddeutschland, urkundlich schon im


|
Seite 147 |




|
Mittelalter auf und ist gleichbedeutend mit den ebenfalls in Urkunden vorkommenden Ausdrücken: Riesengräbern, Riesenbetten, Gigantengräbern, Gräbern der Vorzeit.
Außer diesen Hauptgattungen giebt es noch andere Arten von Gräbern, welche sich aber bei genauerer Forschung irgend einer Hauptgattung zuschreiben lassen. - Zuerst sind bekannt die Steinkisten oder Steinhäuser, von gelehrten Forschern auch Urgräber genannt. Dies sind freistehende, viereckige Steinsetzungen, in den Wänden von großen, auf die schmale Kante gesetzten Steinplatten erbauet, über welche ein großer Stein als Decke gelegt ist. Sie finden sich überall, wo sich die Hünengräber finden, und enthalten dieselben Gegenstände, nämlich Scherben von groben Urnen, und Keile und Messer aus Feuerstein. Sie sind also derselben Zeit zuzuschreiben, aus der die Hünengräber stammen, und möchten in den frühesten Zeiten der Hünengräber erbaut oder auch unvollendete Hünengräber sein, an denen der äußere Steinring und der aufgeworfene Erdhügel fehlt. Ihre Gestalt hat unzählige Male zu der Meinung Veranlassung gegeben, als seien diese Steinkisten Opferaltäre; oft werden sogar halb zerstörte Hünengräber für Opfersteine gehalten. - Andere Classen sind: sogenannte Kistenhügel, d. h. kleine Erdhügel mit Urnen, welche zwischen platten Steinen wie in einer Kiste verpackt sind, - ferner kleine Steinringe mit einem niedrigen Erdhügel und endlich bloße Erdhügel. Alle diese Gräber sind untergeordneter Art und enthalten gewöhnlich nur Urnen und andere, oft unscheinbare Kleinigkeiten. Je nach dem Inhalte wird man die einzelnen Hügel dieser Gattungen einer Hauptclasse zuweisen können, namentlich wenn man erst das Studium der Urnen durch sichere Beurtheilung der größeren Gräber eine festere Grundlage gewonnen hat. Bei dem Studium der deutschen Grabalterthümer thut man übrigens wohl, den Inhalt der süddeutschen Gräber einer genauen, sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, indem die Gräber dieser Gegenden oft bedeutende Eigenthümlichkeiten haben.
Dies sind die als fertig hingestellten Resultate der aus der großherzoglichen Sammlung zu Ludwigslust hervorgegangenen meklenburgischen alterthümlichen Forschungen, welche im Friderico-Francisceum durch Zeichnungen und authentische Aufgrabungsberichte begründet und erhellt, aber vielleicht nicht so fertig hingestellt sind, als es hier geschehen ist. Diese Zeilen haben nur den Zweck, dem größern Werke allgemeinern Eingang vorzubereiten und die allgemeinere Aufmerksamkeit bei etwa bevorstehenden Aufgrabungen zu schärfen, damit in den nächsten


|
Seite 148 |




|
Zeiten durch Zeichnung und Schrift noch gerettet werde, was nach einigen Jahrzehenden vielleicht vergeblich gesucht wird. Daß diese Schilderung für manche Forscher nicht umfassend genug geworden ist, liegt darin, daß hier nicht ein vollständiger Abriß der germanisch =slavischen Alterthumskunde, welche auch zu Hypothesen ihre Zuflucht hätte nehmen müssen, gegeben werden sollte, sondern nichts weiter als die Resultate, welche aus dem Friderico-Francisceum hervorgehen. Was hier vielleicht vermißt wird, bietet, nach meiner Einsicht, die ludwigsluster Sammlung nicht. Uebrigens werden diese Resultate ihre Würdigung erst nach dem Erscheinen und dem Studium des größern Werkes finden können. Diese Blätter sollen nichts weiter als Ankündiger, Vorläufer und demnächstige Begleiter des Friderico-Franciscei sein.
IV. Instruction für Aufgrabungen,
entworfen von der Ausgrabungs=Deputation des Vereins für mekl. Gesch. und Alterth.
1. Andeutungen über Aufgrabung vorchristlicher Gräber.
Zu den wichtigsten Denkmälern der Geschichte gehören die auf den Feldern zerstreuten Gräber aus der vorchristlichen Zeit, denn sie sind die einzigen Zeugen von allen den Jahrhunderten, über welche die Schrift schweigt oder doch dunkel ist. Aus ihnen vorzüglich ist zu lesen, welche Völker in den Ländern in uralter Zeit gewohnt, wie sie gelebt haben, und eine besonnene Vergleichung derselben in den verschiedenen Ländern kann zu den wichtigsten Aufschlüssen für die Geschichte führen, des Reizes nicht zu gedenken, den die Erkennung einer uralten, bisher nicht erkannten Culturstufe ausübt. Auch Meklenburg in allen seinen Gauen ist reich an Gräbern der Vorzeit; Jahrhunderte hindurch haben der Pflug oder Neugier und Gewinnsucht tausende von Gegenständen des Alterthums ans Licht gefördert, welche aber fast alle spurlos verschwunden sind, vorzüglich deshalb, weil sie im Privatbesitz blieben oder verheimlicht wurden; fast täglich hört man, bei einiger Nachforschung, von Funden, deren Spuren aber leider gewöhnlich eher wieder verschwinden, als die Mitwelt und die Nachwelt den geistigen Gewinn daraus geschöpft haben, der sich aus jedem Stücke des Alterthums schöpfen läßt. So reich auch Meklenburg noch an Grabdenkmälern ist, so sehr ist doch zu befürchten, daß bei der steigenden Ackercultur und den vielen neuen Straßen= und andern Bauten


|
Seite 149 |




|
der Reichthum sehr verringert werde, wenn nicht die Gegenwart eifrig das Vorhandene zu retten oder zu erkennen sucht.
Nicht die aufgefundenen Dinge allein sind es, welche viel Licht über eine dunkle Zeit verbreiten: oft sind aufgegrabene Urnen zu nichts nütze, wenn man nicht weiß, von wannen sie kommen; wahrhafter Gewinn läßt sich dann erst hoffen, wenn alle möglichen Umstände einer Aufgrabung mit Gewißheit bekannt sind. Eine verständig geleitete Aufgrabung führt oft zu wichtigern Aufschlüssen, wenn auch Rost und Nässe nichts von den dem Todten mitgegebenen Geräthschaften verschont haben, als ein glänzender Fund ohne Nachricht von den Umständen, wie er gemacht ward. Auch glaube man nicht, ein oft wieder erscheinendes stück des Alterthums sei ohne Werth, weil es schon bekannt sei, oder irgendein Stück sei zu unbedeutend für den Alterthumsforscher: im Gegentheil können die erfolgreichen Untersuchungen nach dem Stande der Wissenschaften erst jetzt beginnen, und jeder begründete Beitrag, sei er auch noch so klein, ist von Werth.
Der Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde hat daher die nachfolgende Reihe von Fragen entworfen, deren Beantwortung er bei etwanigen Aufgrabungen dringend wünscht, und schickt nur noch einige vorbereitende Andeutungen über die Art der Aufgrabung vorauf.
Die vorchristlichen Gräber in Meklenburg lassen sich nach ihrem Bau füglich in drei Klassen theilen:
1) Steinbauten, unter den Namen von Steinkisten, Steinkammern, Hünengräbern, Riesenbetten, Riesengräbern u. s. w. bekannt. Diese sind in den Wänden von großen, platten, auf die hohe Kante gesetzten Feldsteinblöcken in Form einer viereckigen Kammer errichtet, welche oben mit einer großen Steinplatte bedeckt ist; oft sind die Seitensteine versunken oder umgestürzt, und der gesenkte Deckstein gibt oft zu der Annahme von Opferaltären, Gerichtsplätzen, oder dgl. Veranlassung. Diese Gräber heißen in Meklenburg Steinkisten. Eine besondere Art dieser Gräber sind die sogenannten Hünengräber: dies sind lange, umgekehrt muldenförmige Erdhügel von 4 bis 8 Fuß Höhe und großer Länge, ringsum mit großen Steinpfeilern umstellt, in deren Ring an einem Ende eine Steinkiste in der Erde steht, überdeckt mit großen Steinplatten, häufig mit vier. - Diese beiden Arten von Steinbauten enthalten Gerippe oder Urnen, und Werkzeuge und Waffen von Stein, gewöhnlich von Feuerstein.
2) Kegelgräber, alle auf den Urboden aufgeschüttet; diese haben eine kegelförmige, oft auch ovale Gestalt, haben


|
Seite 150 |




|
keine Decksteine und keine Steinpfeiler in den Seitenwänden, jedoch zuweilen einen Kreis von kleinen Steinen am äußersten Fuß des Grabes zum Schutz und zur Bezeichnung desselben. Sie sind verschiedener Art. Die bedeutendsten sind große Hügel von Erde, welche im Innern Gewölbe von kleinen Feldsteinen enthalten, unter welchen sich die Alterthümer befinden. Ihnen gleich an Form sind kleinere Kegel, ganz von Feldsteinen aufgeführt und nur mit einer dünnen Moos= oder Erddecke bekleidet. Andere sind kleinere Erdhügel, an einem Ende mit einer kleinen Kiste von kleinern platten Feldsteinen, in welcher die Urnen stehen; andere sind Steinringe mit einem niedrigen Erdhügel innerhalb desselben; endlich bilden sie kleine Erdhügel ohne weitere äußere Kennzeichen. Diese aufgeschütteten Grabhügel (tumuli) enthalten in der Regel vorherrschend Geräthe aus Bronze und Urnen, mitunter auch Gerippe.
3) Kirchhöfe oder Wendenkirchhöfe, in denen Urnen in großer Zahl, oft zwischen Steinen verpackt, neben einander stehen. Diese Urnen, als die eigentlichen Begräbnisse, sind in den Erdboden eingegraben; wenigstens ist die Erhöhung der Wendenkirchhöfe sehr unbedeutend, kaum merklich, obgleich sie häufig an den höchsten Stellen einer Feldmark an Abhängen gefunden werden. Die Urnen dieser Begräbnißstellen enthalten, außer den Gebeinen, vorherrschend Geräthschaften aus Eisen.
Die Jahreszeit, in welcher Aufgrabungen am besten geschehen, möchte bei verschiedenen Gräbern verschieden sein. Besteht das Grab ganz aus Steinen oder schwarzer Erde, so ist die trockne Jahrszeit (im Sommer) wohl die beste; besteht das Grab aus Lehm, so ist die Zeit des Frühlings, wann der Frost aus der Erde ist, vorzuziehen, weil sich der Lehm dann am besten bearbeiten läßt; die aus Sand aufgeführten Gräber sind am besten im Spätsommer aufzudecken, weil dann die Urnen am meisten ausgetrocknet sind, namentlich in den Wendenkirchhöfen. Gestatten Umstände nicht die Aufdeckung der Gräber in den empfohlenen Jahrszeiten, so ist im Allgemeinen die Zeit des Frühlings vorzuziehen.
Auch die Aufdeckung der Gräber wird nach der verschiedenen Art derselben verschieden sein. Hier sind Erfahrungen über die Stelle voraufzuschicken, an welcher sich die Alterthümer finden.
In den Wendenkirchhöfen stehen die Urnen mit den Alterthümern dicht unter der Erdoberfläche. Die Steinbauten und Kegelgräber sind immer auf dem Urboden aufgerichtet; in den aufgeschütteten Kegelgräbern stehen die Alterthümer jedoch selten unmittelbar auf dem Urboden, sondern meistentheils in ver=


|
Seite 151 |




|
schiedenen Höhen über dem Urboden in dem Hügel; in den Steinkisten scheinen die Alterthümer auf dem Urboden gestanden zu haben, jedoch oft durch Versenkung oder Anschwemmung unter die jetzige Erdoberfläche gekommen zu sein; in den großen Hünengräbern sind die Alterthümer oft durch das ganze Grab zerstreut.
Die Frage, wo man die Aufgrabung eines Hügels beginne, läßt sich im Allgemeinen dahin beantworten, daß man bei den aufgeschütteten Hügeln am besten thut, im Osten anzufangen und nach unten angegebener Weise einen Durchschnitt gegen Westen zu machen. Kommt man an die Stelle, wo die Urnen stehen, so bezeichnet man dieselbe mit kleinen Stäben oder dgl., damit man sie beim Fortschritt der Arbeit nicht verliert. Dann läßt man einen Fuß von der Urne entfernt einen Graben rund um den Raum ziehen, und nun beginnt die Arbeit dessen, der die Aufgrabung leitet. Mit den Händen oder irgend einem Messer löset man behutsam von unten nach oben die Erde, welche in den Graben fällt und die nach und nach fortgeschafft werden kann. Ist die Urne etwas freier geworden, so kann man sie in ihrer Stellung einige Stunden stehen lassen, damit sie an der Luft erharte. Bald sieht man, wie sie beschaffen ist. Ist sie zerdrückt, so muß ihre Form sogleich durch Zeichnung aufbewahrt werden; dann sucht man möglichst große Stücke derselben zu retten und alle Scherben zu sammeln, damit diese nach ihrer Erhärtung möglicher Weise zusammengestellt oder doch wenigstens zur Untersuchung aufbewahrt werden. Der Inhalt der zerdrückten Urnen muß auf der Stelle genau untersucht werden. Hat die Urne Längenrisse, so muß sie auf der Stelle, wie sie mit ihrem Inhalt dasteht, mit Bändern umbunden werden, welche man mit kleinen Knebeln so fest anzieht, als nöthig ist, worauf man sie nach Befinden 1/2 bis 2 Stunden stehen läßt. Hat die Urne mehrere Risse, so ist es rathsam, dieselben nach 1/2 bis 2 Stunden nach der Umbindung an der Stelle zu leeren. Ist die Urne ganz und fest, so kann sie bald nach der Entblößung ausgehoben werden; ist jedoch der Wind scharf, so bedecke man sie. Die Urne eine Nacht hindurch an ihrer Stelle stehen zu lassen, ist unnöthig und gefährlich; der Leiter darf die Urne nicht verlassen. Steht die Urne in einer kleinen Steinkiste, so verrichtet der Leiter alle Arbeiten allein persönlich; er hebt zuerst den Deckstein ab, klappt die Seitensteine nach auswärts zurück und verfährt wie angegeben.
Bei kleinern Hügeln wird man am besten thun, sie von Osten her ganz abzutragen und, bis man auf die Urne stößt,


|
Seite 152 |




|
sorgfältig und dann nach der angegebenen Weise zu verfahren. Ist der Hügel ganz von Steinen aufgeführt, so ist es am gerathensten, ihn von oben herab abzutragen, bis man auf die mit Steinen bedeckten Alterthümer stößt, und dann nach der empfohlenen Art zu verfahren. - Die reichsten Hügel sind die großen Kegelgräber von Erde mit Steingewölben im Innern. Bei diesen ist es wohl am besten, zuerst in horizontalen Schaufelstichen den Gipfel, bei kleinern Gräbern ganz, bei großen Gräbern in einem von oben nach unten keilförmig gehenden Durchschnitt von Osten gegen Westen abzutragen, bis man auf die in Erde oder unter Steinen stehenden Alterthümer stößt. Dann beginnt man im Osten am Urboden und führt in horizontalen Schaufelstichen den Durchschnitt auf dem Urboden bis zu der Stelle fort, wo sich im perpendikulären Durchschnitt die Alterthümer zeigen, und verfährt hier nach der angegebenen Weise, den Durchschnitt bis zum Westende fortsetzend, mit der größten Behutsamkeit. Am besten ist es, die Hügel ganz abzutragen, oder sonst, wenn das Grab groß ist und noch Ausbeute vermuthen läßt, Seitendurchschnitte nach Norden und Süden zu machen.
Die Aufdeckung der großen Steinbauten oder Hünengräber hat mehr Schwierigkeiten. Oft ist es nicht nöthig, die Steine wegzuschaffen, sondern es genügt, wenn Sicherheit vorhanden ist, daß man die gewöhnlich aufgeschwemmte Erde in der Steinkammer 1 bis 2 Fuß tief unter der Erdoberfläche durchsucht. Will und muß man die Steine, namentlich die Decksteine, fortschaffen, so ist es am besten, die letztern nach außen hin abzuheben; geht dies nicht, so bleibt freilich oft nichts weiter übrig, als sie zu sprengen, was aber in der Regel den Alterthümern, wenn auch nur durch die Erschütterung, schadet. Wenn jedoch der Deckstein mit den Ecken über die Tragsteine wegragt und vorzüglich auf einem derselben zu ruhen scheint, so gelangt man, bei gehöriger Vorsicht, oft am besten zum Ziele, wenn man den Tragstein, auf welchem der Deckstein am meisten zu ruhen scheint, nach außen hin seitwärts untergräbt, bis er umstürzt und der Deckstein ihm nachfällt; doch müssen diese Einzelheiten bei der Aufdeckung der großen Steinbauten der Einsicht und Vorsicht des Anordnenden überlassen bleiben. - Ist die Grabstelle von Steinen frei, so kann man mit Bequemlichkeit die Erde 1 bis 2 Fuß tief untersuchen. Besonders genau muß man auf die Alterthümer dieser Gräber achten, weil oft und gewöhnlich sehr kleine, oft nur Zoll lange, mit Erde umkleidete Feuersteinsachen, wie Messer, Splitter, Späne, Pfeilspitzen, u. dgl. durch die ganze Ausdehnung des Grabes zerstreut


|
Seite 153 |




|
liegen, seltener bei den Urnen. Auf die Bernsteinsachen muß man genau achten, weil sie mit ihrer verwitterten Oberfläche oft schwer von der Erde zu unterscheiden sind. In den langen Hünengräbern sind die steinernen Geräthe oft durch den ganzen Raum des Hügels zerstreut.
Eine Hauptregel ist es übrigens, von da an, wo die Alterthümer sich zu zeigen anfangen, die Erde sorgfältig zu durchforschen, weil sich oft wichtige "Kleinigkeiten" neben den Urnen finden, und das Augenmerk hiebei genau auf diese kleinern Sachen, wie Korallen, Ringe, u. dgl. zu richten. Die Hände darf man dabei nicht schonen, selbst wenn man auch in jene schmierigen, übel riechenden Massen der Brandstätte kommt, die sich in den Steinkegeln finden.
Unerläßlich ist die beständige Gegenwart und die schärfste Aufmerksamkeit des Leiters, weil sonst nicht allein durch den Unverstand der Arbeiter der Zweck der Aufgrabung nicht selten vernichtet, sondern auch, bei der oft unglaublichen Behendigkeit derselben, von ihnen Manches unterschlagen wird, indem sie es nicht begreifen können, daß man bedeutende Kosten für einige verrostete Stücke Kupfererz und für Urnenscherben aufwenden sollte; die verständigsten Erklärungen werden nicht selten für unwahr gehalten und sind oft gefährlicher, als schweigen.
Die Führung eines Tagebuches an Ort und Stelle der Aufgrabung ist auf jeden Fall zu empfehlen, indem die Erfahrung lehrt, daß nach wenigen Stunden eine Beschreibung, an einem entfernten Orte verfaßt, schon von der Wahrheit abweicht.
Wenn man sich zur Aufgrabung begiebt, möchte es
nöthig sein, außer den Werkzeugen, welche die
Arbeiter gebrauchen, also, nach Maßgabe des Grabes,
Spaten, Schaufeln, Hacken, Hebebäumen
 ., folgende Sachen mit sich zu führen:
., folgende Sachen mit sich zu führen:
einen Compaß,
einen Maßstab,
einige hölzerne Pflöcke,
ein gutes Taschenmesser und etwa eine Handhacke,
eine Serviette zum Schutz der Urnen gegen Luft, Sonne und Wind,
ein Stück Wachslein zum Schutz der Urnen gegen plötzlichen Regen,
etwas Sackband und Bindfaden,
einige kleine hölzerne Knebel,
einen Korb mit Heu gefüllt, rohe Baumwolle und geschmeidige Maculatur zur Verpackung der Alterthümer.


|
Seite 154 |




|
Fragen, deren Beantwortung bei Aufgrabung vorchristlicher Grabdenkmäler vom Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde gewünscht wird.
1) Nachrichten über das Vorkommen und die Verbreitung sowohl verschwundener, als noch bestehender Alterthümer und Gräber in der Gegend des aufzudeckenden Grabes?
2) Etwaniger Name des Grabes, auch des Ackerstücks, auf welchem sich das Grab findet?
3) Volkssagen, welche an das Grab geknüpft sind?
4) Nachrichten von untergegangenen Ortschaften, und Namen der Gewässer und Gehölze in der Gegend des Grabes?
5) Lage des Grabes auf der Feldmark: ob in irgend einer Grenze, in der Mitte eines Ackerstücks oder bei Wohnungen?
6) Anzahl der neben einander liegenden Gräber, Verhältniß derselben zu einander und Beschaffenheit des Bodens, auf dem sie stehen?
7) Ob die Grabhügel einzeln oder in Mehrzahl beisammen, in Gruppen oder Reihen, auf Anhöhen oder bei Gewässern oder bei solchen Stellen liegen, die ehemals Gewässer gewesen sein mögen?
8) Material des Grabes im Aeußern: ob allein aus Steinen oder Erde, oder ob aus beiden zusammen?
9) Ob noch viel von der Erhebung des Grabes vorhanden, oder ob nur unmerkliche wellenförmige Erhöhungen, oder einige auf dem Erdboden liegende Steine?
10) Ob seit Menschengedenken das Aeußere des Grabes Veränderung erlitten habe durch Anschwemmung oder Anhäufung, durch Wegnahme von Steinen, durch Abspülen, Abgraben oder Abpflügen?
11) Aeußere Gestalt des Grabes: ob kegelförmig, gestreckt oder platt, ob rund, oval, viereckig=muldenförmig u. s. w.? (Wo möglich mit Umriß und Grundriß in Federzeichnung nach einem beliebig anzunehmenden Maßstabe.)
12) Bedeckung des Grabes mit Steinen und mit wie vielen, auf welche Weise, nach welcher Hmmelsgegend? Wie groß die Steine? (Wo möglich mit Federzeichnung.)
13) Umkränzung des Grabringes mit Steinen und mit wie vielen und in welcher Gestalt? (Wo möglich mit Federzeichnung.)
14) Höhe und Länge des Grabes über dem Erdboden, mit Berücksichtigung der Himmelsgegend? (Ist wo möglich in die Federzeichnung des Grundrisses einzutragen.)


|
Seite 155 |




|
15) Nähere Beschreibung des innern Baues des Grabes:
a) Ob ganz aus Erde?
b) Ob ganz aus Feldsteinen?
c) Ob aus Erde mit einzelnen Steingewölben im Innern zum Schutz des Inhalts des Grabes?
d) Ob mit einzelnen, regelmäßig gesetzten Kisten aus platten Steinen zum Schutz der Urnen?
e) Ob das Grab im Innern durch Queerreihen von Steinen in Abtheilungen geschieden?
f) Ob die Urnen ohne Hügelaufwurf unter die Erdbodenfläche eingegraben, und wie tief, und in welcher Umkleidung?
16) Von welcher Art die Erde des aufgeschütteten Hügels? Ob sie der Erdart des Grundbodens gleich, oder gemischt?
17) Ob die Steine im Innern und Aeußern des Grabes von einer Bearbeitung zeugen, ob sie gespalten oder behauen sind? Und im Falle der Bearbeitung: von welcher Steinart, und ob sie vielleicht ausländischen Ursprungs sind, z. B. von Marmor? Ob in die Steine Umrisse von Gestalten, Schriftzeichen oder andere Linien und Zeichen eingegraben sind ? (solche Steine sind vor allen andern Dingen zu retten und einzusenden, jedoch auch gleich zu zeichnen, damit jedenfalls die Züge nicht verloren geben.)
18) Richtung des Grabes und seines Hauptinhalts nach der Himmelsgegend?
19) Lage einzelner Alterthümer nach der Himmelsgegend und Richtung derselben, ob ganz horizontal, ob halb aufgerichtet, ob ganz senkrecht, wie z. B. oft die Steinkeile?
20) Ob die etwa gefundenen Skelette eine ausgestreckte, eine sitzende oder kauernde Stellung haben; ob bei den liegenden das Gesicht nach oben oder unten gekehrt ist; ob die Arme ausgestreckt am Leibe liegen oder nach oben gelegt sind; ob Beschädigungen oder Verwundungen am Skelette, namentlich am Schädel, zu erkennen sind; ob der Schädel eine auffallende Bildung hat; wie lang das Skelett, wie stark die Knochen sind; ob Anzeichen vorhanden sind, daß einzelne Körpertheile, z. B. Kopf und Arme, getrennt und besonders begraben, und ob dabei Anzeichen von Verbrennung des Rumpfes vorhanden sind?
21) Lage der Alterthümer im Grabe nach dem Umfange des Grabringes und der Höhe des Grabes?
22) Ob Spuren von Brandstätten, oder ob Bestattung des Leichnams ohne Leichenbrand?
23) Wenn sich Skelette finden, an oder bei welchen Gliedern derselben sich Alterthümer finden?


|
Seite 156 |




|
24) Ort der Brandstätte im Grabe und Beschaffenheit derselben ?
25) Ob mehrere Brandstätten oder Kohlenschichten neben oder über einander im Grabe?
26) Ob Kohlen vorhanden, und von welcher Holzart?
27) Genaue Beschreibung der Lage der Alterthümer zu einander, wobei Mittelpunkt, Ring und Richtung des Grabes zu Anhaltspunkten genommen werden können? (Wo möglich mit Federzeichnung des Grundrisses von der Lage der Alterthümer.)
28) Genaue Beschreibung und Messung der Alterthümer?
29) Genaue Beschreibung und Messung der Spuren von Alterthümern, z. B. von Eindrücken, Rost und Scherben, wenn die Alterthümer nicht gerettet werden können? (Wo möglich mit Federzeichnung der Alterthümer und der Spuren derselben.)
30) Beobachtung verschiedener Umstände, namentlich wenn die Alterthümer vergangen und zertrümmert sind, z. B.
a) ob Urnen vorhanden gewesen: wie viel, von welcher Art und Beschaffenheit?
b) Ob die Urnen aufrecht standen, ob sie umgestürzt lagen, ob sie auf der Mündung umgekehrt standen, ob sie zugedeckt waren?
c) Ob die Ueberbleibsel des verbrannten Leichnams in einer Höhle im Grabe ohne Urne gesammelt sind?
d) Ob die Urnen vielleicht in eine besondere Erdart eingesetzt waren?
e) Ob allein Sachen und Spuren von Kupfererz, - ob Gold dabei, - ob auch Silber, und bei welchen andern Metallen dasselbe?
f) Ob steinerne Werkzeuge, und ob diese allein oder mit Metallen zusammen? überhaupt welche Mineralien in Verbindung?
g) Ob Spuren von Holz oder Leder zu finden, z. B. an Speerschaften, Schwertgriffen und Scheiden, Riemen, Schildbedeckungen u. s. w.? wie lang die hölzernen Schafte, besonders an den Wurf= und Stoßwaffen, und die Griffe gewesen sind?
h) Ob Spuren von Glas, Bernstein, gebrannter Erde, Knochen, Elfenbein u. s. w.?
i) Ob Spuren von andern Knochen, als Menschenknochen, im Grabe, z. B. Knochen von Pferden, Hunden, Vögeln, von Hirschgeweihen und Eberzähnen? (Alle Knochenreste sind sorgfältig zu sammeln.)


|
Seite 157 |




|
k) Von welcher Gestalt die etwanigen Verzierungen an den Alterthümern und den Urnen, wenn sie auch zertrümmert sind? ob sie mit Instrumenten regelmäßig gemacht sind? (Wo möglich mit Federzeichnung.)
l) Wie die Urnen oder die Scherben davon beschaffen sind, aus welcher Masse, ob feinkörnig oder grobkörnig, von welcher Größe und Gestalt, von welcher Farbe, ob mit eingesprengten Glimmerpünktchen, ob mit Ueberzug von Erdharz oder Bleierz, ob mit Verzierungen? (Letztere in Federzeichnung.)
31) Ob außer Urnen noch Gefäße im Grabe?
32) Welche Gefäße mit Asche und Knochen gefüllt sind?
33) Ob männliche Werkzeuge, z. B. Waffen, vorherrschend sind, oder ob sich auch weibliche finden, z. B. Nähnadeln?
34) Ob die beigesetzten Sachen auf dem Urboden unter einem aufgeschütteten Hügel standen, oder ob sie unter der Oberfläche des Urbodens lagen?
2. Bearbeitung des historischen Stoffes.
A. Gelieferte Arbeiten.
I. Abhandlungen. 1 )
Vom Herrn Dr. Burmeister zu Wismar:
1) Wismarsche Chronik während der Regentschaft der Fürstin Anastasia, vom J. 1275 bis zum J. 1278, aus dem wismarschen Stadtbuche.
2) Erklärung meklenburgischer Volksnamen aus den slavischen Mundarten.
Vom Herrn Archivar Groth zu Schwerin:
3) Alphabetisches Namensverzeichniß derjenigen Personen, deren aus allen, größtentheils adeligen Familien vor dem Anfang des XIV. Jahrhunderts, laut der bisherigen Nachforschungen, in den Urkunden des großherzogl. Archivs zu Schwerin zuerst erwähnt wird.
Vom Herrn Oberlehrer Dr. Hering zu Stettin:
4) Urkundliche und heraldische Beiträge zur Geschichte des Fürsten Pribislav von Belgart, früher Pribislav II. (IV.) von Richenberg (=Parchim).


|
Seite 158 |




|
Aus der Feder des jetzigen Herrn Justizministers v. Kamptz Exc. zu Berlin, abschriftlich mitgetheilt vom Herrn Rector Masch zu Schönberg:
5) Chronologisches Verzeichniß der seit dem Jahre 1622 bei dem HoF= und Landgerichte zu Güstrow angestellten Präsidenten, Vicepräsidenten und Assessoren. Aus der Feder des Herrn Professors Levetzow zu Berlin, aus dessen Nachlaß von seiner Wittwe geschenkt: 1 )
6) Ueber die Runendenkmäler zu Neustrelitz, dritte und vierte Abtheilung, fast vollendet, mit vielen Entwürfen, Excerpten, Zeichnungen u. s. w.
Vom Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
7) Biographie des fürstlich meklenburgischen Secretärs Simon Leupold (1539-1579).
8) Ueber die rostocker Chroniken.
9) Ueber die Stiftung des Klosters Broda und das Land der Redarier.
Vom Herrn Rector Masch zu Schönberg.
10) Der Bauer im Fürstenthum Ratzeburg. Vom Herrn Archivar Dr. Schmidt zu Wolfenbüttel:
11) Beiträge zur Geschichte des Ritters Friedrich Spedt (Vgl. Jahrbücher I. S. 33 ff.)
Vom Herrn Geheimen Archiv=Director Dr.Voigt zu Königsberg und Herrn Archivar Lisch zu Schwerin:
12) Briefsammlung zum II. Jahrgange der Jahrbücher.
Vom Herrn Ober=Zollinspector, Hauptmann Zinck zu Dömitz:
13) Berichte über die von demselben auf großherzoglichen Befehl geleiteten Aufgrabungen vorchristlicher Grabdenkmäler, die letzten fünf Lieferungen.
Sehr lebhaft ist auch in diesem Jahre der wissenschaftliche briefliche Verkehr besonders mit den auswärtigen Mitgliedern gewesen, welche, abgesehen von ihren Geschenken zu den Sammlungen und von ihren größern Beiträgen zu den Schriften des Vereins, auch durch Rath und Fingerzeige, durch Erörterungen,


|
Seite 159 |




|
Nachforschungen und Mittheilungen aller Art vielfach genützt und so dem Vereine als wahrhaft correspondirende Mitglieder höchst freundlich sich bewährt haben. Namentlich ist die eifrige Mithülfe der Herren Danneil zu Salzwedel, Deecke zu Lübeck, von Duve zu Mölln, Friedländer zu Berlin, von Hagenow zu Greifswald, Hanka zu Prag, Hering zu Stettin, Höfer und Klaatsch zu Berlin, Lappenberg zu Hamburg, von Medem zu Stettin, Schmidt zu Wolfenbüttel, Thomsen zu Kopenhagen u. a. m. dankbar und rühmend anzuerkennen. Insbesondere ertheilte, um nur Einiges hervorzuheben, Herr Bibliothekar Hanka zu Prag Rathschläge über die Betreibung des slavischen Sprachstudiums innerhalb des Vereins. Herr Dr. Friedländer zu Berlin hatte die Güte, die in dem römischen Grabe von Bibow gefundenen römischen Münzen zu erklären. Herr Archivar von Medem zu Stettin gab für den Herrn Dr. von Duve zu Mölln Nachrichten über die Herzogin Jutta, Gemahlin des Herzogs Bugeslav VI. von Pommern=Wolgast, und über die Herzogin Elisabeth von Pommern, Gemahlin des Herzogs Erich I. von Sachsen=Lauenburg. Herr Archivar Dr. Schmidt zu Wolfenbüttel verfolgte im braunschweigischen Archive die Geschichte des Ritters Fr. Spedt. Herr Geheime Archivrath Höfer zu Berlin gab diplomatische Forschungen über zwei in Gercken Codex diplom. abgedruckte Urkunden der Herren Pribislav von Richenberg, und zwar: 1) von der Urkunde Pribislavs I. vom J. 1261 in Gercken Cod. dipl. Brand. I. p. 77, welche mit Einwilligung seines "soceri Richardi domini de Frisach" ausgestellt ist und von beiden besiegelt gewesen sein soll, sind die Siegel von dem, im königlichen Archive zu Berlin befindlichen Originale leider gänzlich abgefallen; 2) die Urkunde Pribislavs II. und der Herren H. und Richard de Vrysach vom J. 1287 in Gercken Cod. dipl. Brand. I, p. 244, befindet sich nicht im königl. Archive zu Berlin. - Mehreres aus diesen "kleineren Mittheilungen" geben die Miscellen des II. Jahrgangs der Jahrbücher.
Bald nach der vorigjährigen General=Versammlung ist der erste Jahrgang der Jahrbücher auch an die auswärtigen und der erste Jahresbericht an sämmtliche Mitglieder versandt worden. Gleichzeitig gelangten beide Schriften in den Buchhandel und fanden in öffentlichen Blättern (so im Freim. Abendbl. 1836, Nr. 935.) eine beifällige Beurtheilung. Mit diesem


|
Seite 160 |




|
zweiten Jahresbericht wird nun auch der zweite Jahrgang der Jahrbücher, noch umfänglicher und reicher ausgestattet als der erste, seinen Weg machen, auf welchem er hoffentlich ebenfalls Nutzen bringen und Beifall finden wird.
B. Angeregte und vorbereitete Arbeiten.
I. Die meklenburgischen Regesten.
(Vgl. Jahresber. I, S. 91 f. und 97 ff.)
Ueber den gegenwärtigen Stand dieses Unternehmens hat der Leiter desselben, Herr Rector Masch zu Schönberg, den folgenden Bericht eingesandt.
"Schon im Julius des vorigen Jahres erhielt ich vom Herrn Archivar Lisch die gedruckten Schemata zu den von mir übernommenen Regesten; ich legte sofort Hand ans Werk und übersandte zugleich den Herren, welche dem Ausschuß ihre Mitwirkung verheißen hatten, eine Anzahl Zettel. Ich habe mich der freundlichsten Antworten, welche das bereits gegebene Versprechen wiederholten, zu erfreuen gehabt. Herr Archivar Lisch und Herr Dr. von Duve haben die Arbeit bereits mit zahlreichen, schätzbaren Beiträgen unterstützt, was ich mit dem lebhaftesten Danke erkenne.
Bei der eingeleiteten Bearbeitungsweise, wo stets der in einem Werke enthaltene Vorrath von Urkunden ganz ausgebeutet ward, kann von der Vollendung eines Zeitabschnittes vorläufig nicht die Rede sein und ich muß mich darauf beschränken, die Zahl der ausgezogenen Urkunden anzugeben. So gaben denn:
Herr Archivar Lisch aus
| v. Ledebur, Archiv | 5 | |
| Albrecht II. und die nord. Landfrieden. | 5 | |
| Jahrbücher des Vereins I. | 14 | |
| Lenz, Markgräfl. Brandenb. Geschichte | 23 | |
| Küster, Collectio Opusc. | 19 | |
| ej. Nachtrag zu Opusc. II. | 1 | |
| v. Ledebur, Neues Archiv | 5 | |
| E. W. Gercken, Fragmenta Marchica . | 9 | |
| ej. Codex diplomat. | 93 | |
| G. W. v. Raumer, Codex diplom. | 33 | |
| ----- | 207 |
Herr Dr. v. Duve aus
| Boehmer, observat. jur. Feud. | 2 | |
| Suhm, Historie af Danmark IX - XI | 18 | |
| Dreier, monumenta anecdota | 1 | |
| Pistorii Amoenitates | 2 | |
| ---- | 23 |


|
Seite 161 |




|
Ich selbst aus
| Diariuni Vozstenense | 2 | |
| Harenberg, Hist. eccl. Gandersh. | 18 | |
| Sartorius=Lappenberg, Gesch. der Hanse | 157 | |
| Pistorius, Das Geschlecht v. Warburg | 18 | |
| Scheidt, Nachricht v. Adel | 6 | |
| v. Kamptz, Beiträge zum Staats= und Civil=Recht | 45 | |
| ej. Civilrecht | 21 | |
| Schröder, Papistisches Meklenburg | 869 | |
| ej. Wismarsche Erstlinge | 44 | |
| ej. Prediger=Historie | 6 | |
| ej. Evangelisches Meklenburg | 75 | |
| ---- | 1270 | |
| -- | ---- | |
| Summa | 1500 |
und mögen diese Urkunden etwa 1/6 des vorhandenen Vorraths ausmachen.
Auf die bisherige Weise das vorhandene Material herbeizuschaffen scheint sich bei der Bearbeitung durchaus zu empfehlen, weil dadurch viel doppelte Arbeit erspart wird. Beim Revidiren für den dereinstigen Abdruck werden sich einzelne Ungleichheiten, die freilich auf diese Weise unvermeidlich sind, leicht ausglätten lassen.
Damit aber das bereits Bearbeitete gewissermaßen vollständig sei, habe ich jede Urkunde im Hempel und im Meklenb. Urkundenverzeichmß nachgeschlagen und die Literatur, so weit sie darin verzeichnet ist, beigesetzt, und zugleich auf eine sehr einfache Art bemerkt, ob das Citat nachgesehen ward oder nicht, über die benutzten Werke aber ein Verzeichniß angefertigt. So wird es, wie ich hoffe, möglich werden, daß, wenn ich selbst dies Werk nicht vollenden könnte, ein Fortsetzer leicht sich in das Vorhandene hineinfinden kann, da der Plan, wie er dem Jahresbericht beigefügt ist, mit Berücksichtigung der Raumersparniß, genau befolgt ward.
Schönberg, den 30. Junius 1837.
G. M. C. Masch."
II. Die Sammlung meklenburgischer ungedruckter Urkunden.
(Vgl. Jahresber. I, S. 93.)
Der Herausgeber derselben, Herr Archivar Lisch, berichtet hierüber, daß bereits der zehnte Bogen des ersten Bandes im Druck vollendet sei und daß dieser erste Band im Laufe des nächsten Vereinsjahres erscheinen werde.


|
Seite 162 |




|
Schon im Quartalbericht 3. des ersten Jahres ward, auf den Vorschlag der Herren Archivar Lisch und Revisionsrath Schumacher zu Schwerin, den Mitgliedern die Wiederaufnahme der alten Sitte des Chronikenschreibens dringend empfohlen. Da der Gegenstand von großer Wichtigkeit und neuerdings auch in andern Staaten, zum Theil auf officiellem Wege, wieder in Anregung gebracht worden ist 1 ), und da andrerseits in dem vorigen Jahresberichte (S. 46) nur leicht darauf hingedeutet ward: so scheint es angemessen, den erwähnten Vorschlag, wie er in jenem Quartalberichte ausgeführt worden ist, hier zu wiederholen.
Auch neben Urkunden gestellt, behalten Chroniken immer einen eigenthümlichen Werth, da sie die Ereignisse mehr ,im Zusammenhang darstellen und vorzugsweise das Volksleben schildern; und auch die Buchdruckerkunst vermag ihren Werth nicht zu verdunkeln, weil den für die Oeffentlichkeit und die Gegenwart bestimmten Druckschriften gewöhnlich jener Reiz der Individualität mangelt, durch welchen Chroniken sich auszuzeichnen pflegen, letztere überdies, ihrer Natur und Bestimmung nach, manches speciellere, manche Local= und Personalnotizen aufnehmen, welche von jenen als unwesentlich und unerheblich oder aus andern Gründen verschmäht werden, wiewohl eben sie für die Nachwelt von großer Bedeutung sein oder werden können. Da überdies das Chronikenschreiben dem Schreiber selbst eine angenehme Beschäftigung gewährt, so hält der Ausschuß seinen Wunsch, daß Mitglieder des Vereins diesem Geschäfte sich unterziehen mögen, für hinlänglich gerechtfertigt und empfohlen. Die Hauptgesichtspunkte für die Abfassung von Chroniken möchten folgende sein: 1) daß der Schreiber nur eigene Erfahrungen berichte; 2) daß er sie nach seiner eigenen Auffassung darstelle; 3) daß er nichts weiter als Erfahrungen darstelle und die Begebenheiten nicht durch Reflexionen verdunkele. Die Chroniken, welche etwa angelegt werden möchten, sind für die Zukunft bestimmt. Die Schreiber mögen daher in denselben bemerken, für welche öffentliche Anstalt oder für


|
Seite 163 |




|
welche Person sie dieselben nach ihrem Ableben bestimmt haben und von welchem Zeitpunkte an ihre Benutzung erlaubt sein soll. Zur Beförderung des dereinstigen historischen Verkehrs wünscht der Verein aber, daß ihm Kunde über die Anlegung von Chroniken zugehe: er wird bis zu bestimmten Zeitpunkten, wenn es verlangt wird, diese Notiz verschwiegen halten und versiegelt in sein Archiv niederlegen. - Auch Darstellungen einzelner Begebenheiten durch Gleichzeitige wünscht der Verein unter gleichen Bedingungen in sein Archiv aufzunehmen.
Es ist Grund vorhanden anzunehmen, daß jener Vorschlag bereits Anklang und Beachtung gefunden hat und daß schon von mehreren Mitgliedern an einer Chronik ihres Wohnortes gearbeitet wird; nicht minder steht zu hoffen, daß auf diese erneuerte Aufforderung noch mehrere einem eben so angenehmen wie nützlichen Geschäfte einen Theil ihrer Mußestunden widmen werden.
Als Frucht seiner slavischen Sprachstudien beabsichtigt der Herr Dr. Burmeister zu Wismar, unter Mitwirkung des Vereins, ein Werk des bezeichneten Inhalts zu bearbeiten und herauszugeben, und hat über dieses Unternehmen folgenden Plan vorgelegt, bei dessen Kundmachung der Ausschuß dasselbe den Mitgliedern zur Unterstützung angelegentlich empfiehlt.
"Die Mehrzahl der Ortsnamen unsers Vaterlandes ist slavischen Ursprungs. Es wäre wohl an der Zeit, die Erklärung dieser Ortsnamen zu versuchen und dadurch den geschichtlich nur geahnten Zusammenhang mit andern slavischen Volksstämmen in ein helleres Licht zu stellen. Nun ist aber sicher nothwendiges Erforderniß, daß die Namen diplomatisch genau ermittelt werden. Denn nur zu oft sind slavische Namen im 13ten und 14ten Jahrhunderte, als die slavische Sprache als Volkssprache aufhörte, in deutsche Formen umgewandelt. Man könnte, um sicher zu gehen, ein alphabetisches Verzeichniß der jetzigen Ortsnamen beider Großherzogthümer zum Grunde legen und dann die früheren Formen möglichst genau aus Urkunden festgestellt eintragen. Dann erst dürfte die Erklärung und diese so vollständig als möglich aus sämmtlichen Mundarten aller slavischen Volksstämme versucht werden, bei welcher auch die früheren Erklärungsversuche von Freneel (Westphalen II, pag. 2413 f.) Mussaeus, Siemssen (letztere nur in Handschriften) erwähnt werden müßten.


|
Seite 164 |




|
Die Sammlung slavischer Ortsnamen Meklenburgs soll aus einem möglichst vollständigen Verzeichniß sämmtlicher ausgestorbenen und lebendigen Namen der Ortschaften beider Großherzogthümer bestehen, in allen ihren Formen von ihrem ersten Vorkommen in Urkunden und Chroniken alle Jahrhunderte hindurch bis auf die heutige Zeit. Jeder Name soll daneben aus den slavischen Mundarten sprachlich und fachlich erklärt werden.
Die Sammlung wird nach einer gewissen Form geschehen, zu welcher folgendes Schema festgesetzt ist.
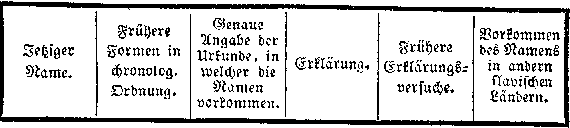
Der Dr. C. C. H. Burmeister zu Wismar übernimmt die Arbeit der Sammlung und Erläuterung der Namen nach dem angeführten Schema in alphabetischer Ordnung u. s. w.
Indem der Verein für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde dieses Werk in den Kreis seiner Bestrebungen zieht, fordert der Ausschuß des Vereins alle Mitglieder, welche diese Angelegenheit zu befördern suchen, auf, Beiträge unter der Adresse des Vereins nach Schwerin einzusenden. Die Beiträge werden dann dem Dr. Burmeister übermittelt werden. Die Mitarbeiter werden auch ersucht, sich unmittelbar mit dem Dr. Burmeister oder mit dem Ausschusse in Verbindung zu setzen
Da der Dr. Burmeister dieses Werk dem Vaterlande zu weihen gedenkt, so wird er dasselbe so anlegen, daß dem Kundigen die Fortsetzung leicht möglich ist; im Fall der Unterbrechung wird er die sämmtlichen Vorarbeiten und Correspondenzen dem Verein übergeben, bei Vollendung des Werkes dasselbe dem Vereine zur etwanigen Veröffentlichung vorlegen; bis dahin wird er dem Ausschusse die möglichen Mittheilungen zu wissenschaftlichen Zwecken für die Druckschriften des Vereins aus der Handschrift machen. Gegenwärtig hat der Verein


|
Seite 165 |




|
das Unternehmen durch Ankauf der größern Wörterbücher der slavischen Sprachen, welche dem Dr. Burmeister zur Verfügung gestellt sind, bereits gefördert und wird demselben auch ferner, den Umständen nach, die nöthige Unterstützung angedeihen lassen."
Die oben erwähnten, aus dem Nachlasse des Professors Levetzow zu Berlin in den Besitz des Vereins gelangten handschriftlichen Materialien zu der dritten und vierten Abtheilung seiner Untersuchungen über die Runendenkmäler zu Neustrelitz sind treffliche, aber noch der vollendenden Hand harrende Vorarbeiten. Bei der großen Wichtigkeit des Gegenstandes und um endlich ein sicheres Urtheil 1 ) über die Aechtheit und Bedeutung jener merkwürdigen Sammlung zu begründen, wozu, wenn nicht alles täuscht, eben dieser Levetzowsche Nachlaß den Weg bedeutend angebahnt hat, zugleich um das Andenken des zu frühe geschiedenen gelehrten Forschers zu ehren, hält der Ausschuß es für angemessen, zur Bearbeitung jenes Nachlasses hiemit aufzufordern, und wird er demjenigen, der sich diesem verdienstlichen Geschäfte untergehen will, denselben zu solchem Zwecke gern übergeben.
C. Unterstützte und empfohlene Arbeiten außerhalb des Vereins.
I. Codex diplom. Pomeran.
(Vgl. Jahresber. I., S. 47.)
Die neue Auflage und Fortsetzung des Dregerschen Codex diplomaticus Pomeraniae, welche Herr Professor Kosegarten zu Greifswald besorgt, ist in der Bearbeitung so weit vorgeschritten, daß die erste Abtheilung bald zu erwarten steht. Dieses Werk wird von unsrer Seite durch den Herrn Archivar Lisch fortwährend unterstützt und auch den übrigen Mitgliedern zur Förderung ferner empfohlen.


|
Seite 166 |




|
In der Tiedemannschen Offizin zu Rostock erscheint demnächst eine vom Herrn Rector Masch zu Schönberg bearbeitete, meklenburgische Wappensammlung. Der Name des Herrn Bearbeiters und die vorgelegten Steindruckproben haben dem Ausschusse hinlängliche Veranlassung geschienen, die Aufmerksamkeit der Mitglieder auf dieses Unternehmen empfehlend hinzulenken.
Ein solches Werk beabsichtigt der Herr Dr. Schmidt sen. zu Sonderburg, ein geborner Meklenburger, zu bearbeiten. Auf seinen Wunsch fordert der Ausschuß zur Mittheilung von angemessenen Beiträgen und Notizen für dasselbe auf.


|
Seite 167 |




|
Anhang.
Erklärung der am Ende des Berichts befindlichen lithographirten Tafel.
Diese Lithographie ward von dem Herrn Grafen von Bernstorff auf Wedendorf, Mitgliede des Vereins, dem Ausschusse zur Mitgabe für den Jahresbericht in einer beliebigen Anzahl von Abdrücken angeboten. Der Ausschuß nahm dieses freundliche erbieten gern und dankbar an, und empfing nun von dem Herrn Grafen die erforderliche Quantität von Exemplaren ohne alle Kosten, zugleich mit der folgenden Erläuterung.
Die Abbildung zeigt beide Seiten eines gegenwärtig unweit des Hofes Bernstorff aufgestellten Leichensteins. Der auf beiden Seiten desselben knieend dargestellte Werner Bernstorp (aus dem Hause Teschow, ehemals dem Hauptgute der Bernstorff in Meklenburg) soll 1351 von Detlev von Gadenstedt im Zweikampfe getödtet sein; er war Besitzer von Schmachthagen, welches zu Börzow bei Grevismühlen eingepfarrt ist.
Dieser Leichenstein, auf dessen Hauptseite die Figur, das Wappen und die Schrift in ziemlich hohem Relief erscheinen, während auf der Hinterseite fast nur Contoure eingegraben sind, ist 5-6 Fuß hoch, von grobkörnigem, durch Alter und Witterung theilweise verwittertem Sandstein, und keineswegs ein Kunstwerk, für die betreffende Familie aber von Werth, namentlich auch wegen des darauf befindlichen Wappens aus so alter Zeit. Er stand früher zu Börzow, bis im Jahre 1829 der hochselige Großherzog Friederich Franz die Versetzung desselben nach Bernstorff gestattete. Bis in das 17. Jahrhundert soll er in einer der Bernstorffschen Familie zu Teschow gehörig gewesenen Grabcapelle an der Kirche zu Börzow gestanden haben, nach deren Verfall aber ins Freie gestellt worden sein.



|




|


|




|
S. 7. Z. 12 v. u. statt: überlassen lies: überlassend.
S. 30 Z. 12 v. u. st. Dreyers's l. Dreyer's
S. 61. No. 32 st. Pentz l. Pertz.
S. 63. No. 62 ist hinzuzufügen: zu Warsow.
S. 64. No. 98 st. Hoffmann l. Volckmann.
S. 76. No. 66-81 und S. 81 No. 136. 137 sind Geschenke des Herrn Dr. Friedländer zu Berlin.
S. 80. Z. 5 u. st. Manasse l. Manesse.



|




|


|




|



|




|
