

|
[ Seite 225 ] |




|



|
|
|
- Wohnungen aus der Steinperiode zu Dreveskirchen (Fortsetzung von Jahrb. XIX, S. 290 flgd., und XX, S. 276)
- Hünengrab von Neu-Kalen
- Pfeilspitzen und Hirschgeweih von Allershagen
- Feuersteingeräthe von Lohmen
- Streitaxt von Schwaan
- Heidnischer Begräbnißplatz von Pisede
- Kegelgrab von Wiek (Nachtrag zu Jahrb. XX, S. 283)
- Die bronzene Spule von Viecheln
- Hifthorn von Bochin
- Wendenkirchhof und Heftel von Holm
- Wendenkirchhof von Gorschendorf
- Wendenurne von Malchin
- Spindelsteine
- Ueber die Hausurnen, besonders über die Hausurnen vom Albaner-Gebirge
- Römische Bronzestatuette der Ubertas, gefunden zu Manderow
- Alterthümer von der bischöflichen Burg zu Bützow
- Eiserne Alterthümer von Marlow aus der Reknitz
- Ueber ein zu Dreveskirchen gefundenes großes Thongefäß und den Ort Dreveskirchen (vgl. Jahrb. XVII., S. 368, XIX., S. 290, und oben S. 227 flgd.)
- Zinnernes Hausgeräth von Wend. Waren
- Die Kirche zu Gr. Wokern
- Die Kirche zu Lohmen
- Die Kirche zu Alt-Bukow
- Die Kirche zu Neu-Bukow
- Die Kirche zu Neu-Bukow
- Taufstein zu Neuburg
- Die zweischiffigen Kirchen zu Mestlin und Tarnow
- Die Kirche zu Retgendorf und die Kapelle zu Buchholz
- Die Kirche zu Zittow
- Die S. Gertrud-Kapelle zu Güstrow
- Kunstwerke der Kirche zu Rühn
- Alte Stickereien in der Kirche zu Güstrow
- Kirche zu Teterow (Nachtrag zu Jahrb. XII, S. 464)
- Beischläge der S. Olavs-Burse in Rostock
- Der Altar der Kirche zu Alt-Röbel
- Ueber das Kloster der Büßerinnen zu Röbel, später zu Malchow
- Das Giebelhaus zu Güstrow an der Mühlenstraße
- Ueber den Maler Erhard Gaulrap : ein Beitrag zu Kunstgeschichte Mecklenburg
- Ueber das Wappen der Grafen von Danneberg
- Siegel der Herzogin Hedwig von Meklenburg, Aebtissin des Klosters Ribnitz, 1423, + 1467, und der Herzogin Elisabeth, Hedwigs Nachfolgerin
- Ueber die Siegel der Stadt Grabow
- Alte maltzansche Siegel
- Fossile Pferdezähne von Schlutow
B.
Jahrbücher
für
Alterthumskunde.


|
[ Seite 226 ] |




|


|
[ Seite 227 ] |




|



|



|
|
:
|
I. Zur Altertumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Zeit der Hühnengräber.
Wohnungen aus der Steinperiode zu Dreveskirchen.
(Fortsetzung von Jahrb. XIX, S 290 flgd., und XX, S 276.)
Meine Vermuthung, daß sich auf dem Höhenzuge meines Feldes, welcher der Ostsee am nächsten liegt, noch mehrere heidnische Wohnstätten finden würden, hat sich bei der diesjährigen Drainage gerechtfertigt, und auch ich bin augenblicklich der Ueberzeugung, daß die Scherben, die ich das letzte Mal eingesandt habe (Jahrb. XIX, S. 289), von Hausgeräth herstammen und keine Aschenkrüge gewesen sind. Wir können annehmen, daß in diesem Jahre 50 solche Wohnstätten gefunden sind, und habe ich von sehr vielen einzelne kleine Bruchstücke von Scherben zur Bestätigung aufgenommen. Diese Wohnplätze lagen ebenfalls in der Tiefe von 4 Fuß und hielten sich nicht allein an diesem Höhenzuge gebunden, sondern folgten auch einer andern Richtung dem Hofe zu.
Der Theil der Höhe, den wir in diesem Jahre abdrainirt haben, heißt der Rauhberg. Fast an der höchsten Stelle, jedoch etwas seitwärts am Berge, stießen wir auf eine besondere Wohnung, welche die Aufmerksamkeit der Leute, die in diesem Graben arbeiteten, erregte und mir deshalb die Anzeige machten.
Ich ließ den Graben bei meiner Anwesenheit nun weiter vollenden; dieser ganze Platz hatte eine Länge von 12' und


|
Seite 228 |




|
war durch eine Steinschicht von ziemlich großen Steinen (wie 4 Mann einen heben konnten) in zwei ungleiche Hälften getheilt, von denen die nach Osten liegende Hälfte nur 4' hatte, mithin von der gewöhnlichen Größe, jedoch die auf der andern Seite der Scheide befindliche Hälfte doppelt so groß war.
Auch der Scherbenreichthum war bei weitem größer, und es stellten sich noch andere Vorzüge heraus, nämlich daß einige Scherben Spuren von Verzierungen und zwar stark erhaben an sich trugen.
So findet sich unter andern eine Scherbe, wo es fast nicht zweifelhaft sein kann, daß dieselbe eine Krone (?) vorstellen soll. Einzelne andere Bruchstücke haben andere Erhabenheiten.
Auch fand sich eine Scherbe mit einem Henkel, welcher durch 5 erhabene, platte Reifen von oben nach unten geziert ist. Es will mir auch scheinen, als wenn diese Scherben von verschiedenen Gefäßen gewesen sind, wenigstens fanden sich dieselben dicker und auch dünner.
Dreveskirchen, den 4. Septbr. 1855.
C. T. Koch.
Die Scherben stammen von verschiedenen Geräthen her und sind alle ohne Zweifel altheidnischen Ursprunges und stark mit grobem Granitgrus durchknetet. Die meisten sind sehr dick und sehr rauh auf der Oberfläche und nicht mit geschlemmtem, feinem Thon überzogen; diese Scherben sind sehr hart und scheinen dies dadurch geworden zu sein, daß sie, als Hausgeräthe, oft dem Feuer ausgesetzt gewesen sind. Einige Stücke sind sogar ziegelroth auf der Oberfläche gebrannt, im Innern des Bruches aber noch braun. Diese Gefäßscherben stammen wohl noch aus der Steinperiode. Dafür zeugen die "Verzierungen", aufgesetzte Knoten und Streifen mit Eindrücken, und ein sechsfach gereifter Henkel, ganz nach Art der Todtenurnen der Steinperiode, nur dicker und plumper. - Andere dünnere, mit feinem geschlemmten Thon überzogene, dunkelbraune Scherben haben das Aussehen der Thongefäße aus der ältern Zeit der Bronze=Periode. Außerdem fanden sich Knochen von Hausthieren, z. B. Rinderzähne, Eberhauer u. dgl. Auch Stücke von röthlich gebranntem Lehm kamen vor. Es leidet also keinen Zweifel, daß wir hier Höhlenwohnungen der ältern heidnischen Zeit gefunden haben.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 229 |




|



|



|
|
:
|
Hünengrab von Neu=Kalen.
In dem Grenzgraben zwischen den Holzungen der Stadt Neu=Kalen und des großherzoglichen Forsthofes Franzenshagen lag ein kleines Hünengrab, welches im J. 1852 bei Gelegenheit des Baues der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede abgetragen ward. Der Herr Burgemeister Mau zu Neu=Kalen, welcher den Arbeitern aufgegeben hatte, die beim Bau sich etwa findenden Alterthümer an ihn abzuliefern, und der sich fast täglich auf der Baulinie befand, war grade gegenwärtig, als dieses Grab, das zuerst als solches nicht erkannt ward, abgetragen ward. Die Decksteine waren nicht sehr groß, jedoch noch so groß, daß sie zum leichtern Transport einmal, jedoch nicht öfter, gesprengt werden mußten. Nach Abnahme der Decksteine fand sich, daß die Steinstellung ein heidnisches Grab war. In dem Grabe fanden sich die sehr verwitterten Gebeine einer menschlichen Leiche, welche nicht verbrannt war, und neben derselben ein nicht verziertes, glattes Gefäß aus hellbraunem Thon, ganz von der Gestalt, welche die Urnen der Steinperiode haben. Das Gefäß ist 7" hoch, nähert sich im Bauche der Kugelform und hat einen senkrechten, 2 1/2" hohen Hals, an dessen Anfange beim Bauche sich zwei ganz kleine Henkel oder durchbohrte Knötchen, von etwa 1" Höhe, zum Durchziehen einer Schnur, befinden. Das Gefäß hat die Gestalt, wie die in Jahrbüchern X, S. 255, oben, abgebildete, zu Moltzow gefundene Urne, nur daß der Hals der Neu=Kalenschen Urne niedriger und diese Urne ohne alle Verzierungen ist. Nach allen Umständen leidet es keinen Zweifel, daß dieses Grab der Steinperiode angehört. - Der Herr Burgemeister Mau hat diese Urne nebst Ueberresten von den Gebeinen an sich gebracht und dem Vereine geschenkt.
G. C. F. Lisch.
Hünengrab von Pisede



|



|
|
:
|
Pfeilspitzen und Hirschgeweih von Allershagen.
Zu Allershagen bei Doberan ward im Torfmoore, 8 Fuß tief, ein ungewöhnlich großes und starkes Hirschgeweih gefunden; neben demselben lagen andere Knochen und zwei kleine, gut gearbeitete Pfeilspitzen aus Feuerstein von der gewöhnlichen Größe, wie Frid. Franc. Tab. XXVII, Fig. 14 und 15. Das Geweih mit den Pfeilspitzen ist an die großherzogliche Geweihsammlung in Schwerin abgeliefert. Wenn es


|
Seite 230 |




|
auch nicht ganz sicher ist, daß das Geweih mit dem Stirnbein des Hirsches und die Pfeilspitzen aus derselben Zeit stammen, da die Pfeilspitzen nicht in dem Schädel stecken, so ist es doch wahrscheinlich, daß der Hirsch durch diese Pfeile getroffen und in dem Torfsumpfe verendet sei. Die Mächtigkeit des Torflagers läßt auf eine Zeit von wenigstens 1600 Jahren schließen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Feuersteingeräthe von Lohmen.
Zu Lohmen bei Dobbertin wurden in einem Torfmoore folgende Feuersteingeräthe gefunden und von dem Herrn Pastor Lierow zu Lohmen dem Vereine geschenkt:
vier Lanzenspitzen aus Feuerstein, eine mit Schaftzunge, zwei ohne Schaftzunge und eine zerbrochen;
zwei halbmondförmige Messer aus Feuerstein;
ein viereckiger Griff eines Dolches aus Feuerstein, von welchem die Klinge abgebrochen ist, von ausgezeichneter Arbeit;
sechs spanförmige Messer aus Feuerstein.
Der Herr Pastor Lierow berichtet, daß auf dem vor dem Dorfe Lohmen neu angelegten Begräbnißkirchhofe oft Feuersteinspäne und andere Bruchstücke von zerschlagenen Feuersteinen 1 ) gefunden, auch Urnen ausgegraben werden. Es war hier also wohl eine Fabrik von Feuersteingeräthen und eine heidnische Begräbnißstätte.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Streitaxt von Schwaan.
Eine Streitaxt aus Hornblende schenkte der Herr Burgemeister Daniel zu Schwaan. Diese Streitaxt ist zwar in der Form schon vollendet, aber noch nicht ganz fertig; die Schleifung ist erst an einer Seite angefangen und das Loch ist noch nicht ganz vollendet, indem es sich von unten nach oben von 6/8" bis 5/8" verengt, also noch lange nicht gleichmäßig und überhaupt nicht weit genug ist.
G. C. F. Lisch.
| Polnisch: |
lomen:
Steinbruch,
lomac: brechen (von harten Körpern), lom: Bruch. |
| Böhmisch: |
lom: Steinbruch, Abbruch
(fractura),
lomec: Steinbrecher, lomjm: brechen, lomenj: das Brechen (fractio). |


|
Seite 231 |




|
Streitaxt von Gr. Godems.
Zu Gr. Godems bei Parchim ward beim Graben eine Streitaxt, aus Grünstein, von schöner Form, gefunden und von dem Herrn Bau=Conducteur Voß zu Schwerin erworben und dem Vereine geschenkt.
Streitaxt von Ruthen.
Ein Bruchstück einer Streitaxt aus Grünstein=Porphyr, gefunden zu Ruthen bei Lübz in der Elde, schenkte der Herr Pastor Lierow zu Lohmen.
Keil von Schwaan.
Im J 1855 ward bei dem Bau des neuen Armen= und Krankenhauses zu Schwaan ein in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Keil gefunden und von dem Herrn Burgemeister Daniel zu Schwaan dem Vereine geschenkt. Dieser Keil ist aus Gneis, an beiden Enden ziemlich gleichmäßig zugeschärft, überall geebnet, 11" lang, 4 1/2" breit, 2 1/2" dick in der Mitte und 5 1/2 Pfund schwer.
Keil von Upahl.
Ein Keil aus Grünstein, in der Schneide offensichtlich oft nachgeschliffen, ward im September 1854 zu Upahl bei Güstrow beim Ausräumen einer Moddegrube gefunden und durch den Herrn Pastor Kossel für den Verein erworben.
Keile.
Vier Keile aus grauem Feuerstein, gefunden auf dem Felde zu Viecheln bei Gnoyen, schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen, nämlich:
zwei Keile, jeder ungefähr 6" lang, beide auf der einen breitern Seite stark abgesplittert und zerschlagen, und
zwei Keile, jeder gegen 4" lang, beide dick und auf den breiten Seiten zum größern Theile geschliffen.
Einen Keil aus gelblichem Feuerstein, ganz geschliffen, und einen Keil aus hellgrauem Feuerstein, roh zubehauen und angeschliffen,
beide gefunden zu Bülow bei Güstrow, schenkte der Herr Ingenieur Carl Beyer zu Güstrow.


|
Seite 232 |




|
Einen Keil aus Feuerstein, roh zubehauen und nur in der Schneide angeschliffen, und
einen Keil aus fettlosem, hellgrauen Feuerstein,
gefunden zu Jamel bei Grevismühlen, schenkte der Herr Bau=Conducteur Voß zu Schwerin.
Einen Keil aus grauem Feuerstein, gefunden zu Pustohl, A. Bukow, schenkte der Herr Dr. Crull zu Wismar.
Ein halbmondförmiges Feuersteinmesser,
gefunden auf dem Felde zu Remlin bei Gnoyen, bei dem großen, aufgedeckten Hünengrabe, in welchem eine hölzerne Keule gefunden ward (vgl. Jahrb. IX, S. 364), schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.
Pfeilspitzen aus Feuerstein von Bützow.
Auf dem Klüschenberge bei Bützow fand der Herr Friedrich Seidel zu Bützow zwei Pfeilspitzen aus Feuerstein, ungefähr 2" lang, aus Feuersteinspänen gebildet, und schenkte sie dem Vereine.
Vier Feuersteinspäne,
sichtlich zu Pfeilspitzen benutzt, gefunden auf dem Klüschenberge bei Bützow, schenkte der Herr Friedrich Seidel zu Bützow.
Ein Feuersteinblock,
1 3/4" lang, roh zubehauen, zur Bildung einer Pfeilspitze, ward von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow auf dem Klüschenberge bei Bützow gefunden und von demselben dem Vereine geschenkt.
Zwei Feuersteinspäne
fand der Herr Friedrich Seidel zu Bützow in der Darnow=Holzung bei Bützow und schenkte sie dem Vereine.
Schleifstein von Rogeez.
Einen Schleifstein von grauem, alten Sandstein, von ziemlich bedeutender Größe, an mehreren Seiten ausgeschliffen, in der Steinperiode zum Schleifen der steinernen Werkzeuge gebraucht, gefunden zu Rogeez bei Malchow, besitzt der Herr Major von Bülow auf Rogeez.


|
Seite 233 |




|
Schleifstein von Dierkow.
Auf einem wendischen Burgwalle oder Stadtplatze (Goderak?) in der Wiese von Dierkow bei Rostock, welche mit den bis zum Hofe Toitenwinkel reichenden Wiesen zusammenhängt, nicht weit von der Warnow, fand der Handlungslehrling Ulrich Lisch zu Rostock einen alten Schleifstein, welcher, nach den Schleifrinnen, zum Schleifen von schmalen Hohlmeißeln gedient haben mag. Der Stein, von dunkelgrauer, quarziger Steinart, ist schon in alter Zeit an beiden Enden verstümmelt; der Stein ist jetzt noch 7" lang, 3 1/2" breit und 1" dick und in den neuesten Zeiten beim Mergelgraben in drei, noch zusammenpassende Stücke zerschlagen.


|
Seite 234 |




|



|



|
|
:
|
b. Zeit der Kegelgräber.
Heidnischer Begräbnißplatz von Pisede.
Einige hundert Schritte südöstlich von dem der Stadt Malchin gehörenden, nicht weit von dieser Stadt liegenden Gehöfte Pisede, und etwas weiter von der vorüberführenden rostock=neubrandenburger Chaussee entfernt, lag im flachen Felde ein heidnischer Begräbnißplatz, aus welchem Feldsteine hervorragten. Einem Steinhauer war es gestattet worden, sich hier Steine auszubrechen. Erst nachdem dieser am Ende des Monats November 1855 die Steine ausgebrochen, den Platz durchwühlt, die hinter den Steinen stehenden Urnen beim Steingraben zerbrochen und deren Inhalt bis auf die metallischen Gegenstände verschüttet hatte, ward dieser Fund dem Herrn Apotheker Timm, dem Herrn Pastor Rathsack und dem Herrn Succentor Schliemann zu Malchin zufällig bekannt, welche sofort dem malchiner Magistrate davon Anzeige machten und denselben um Schutz und um die Mittel und die Erlaubniß zur weitern Aufdeckung und Verfolgung der Alterthümer baten, was auch bereitwillig gewährt ward. Die genannten Herren stellten sogleich die weitern Forschungen an, wurden aber durch das bald darauf im December eintretende Frostwetter an der vollständigen Nachgrabung gehindert. Glücklicher Weise war der Steinhauer ein verständiger Mann, der in seiner Weise bei der Ausgrabung ganz gut beobachtet hatte und alles auslieferte, was er gefunden hatte; hiernach scheint auch das Grab erschöpft zu sein. Der Herr Apotheker Timm, welcher den Fund an sich genommen hatte, suchte nun alle nähern Umstände der Ausgrabung festzustellen und hat nicht allein, mit Erlaubniß des Magistrats der Stadt Malchin, die gefundenen Alterthümer, sondern auch einen ausführlichen Bericht, der im Folgenden benutzt ist, an den Verein eingesandt.
war von ovaler Gestalt und hatte in seiner Länge von Nordwest nach Südost etwa 70' und in seiner Breite von Südwest nach Nordost etwa 50' Durchmesser. Der Platz hatte eine Erhebung von 1 1/2 Fuß über die ihn umgebende ebene Ackerfläche und ward mit dem übrigen Acker gepflügt und besäet. Nach der Aussage eines Arbeiters war der Platz vor einigen 20 Jahren


|
Seite 235 |




|
noch einige Fuß höher, so daß dort ruhende Arbeiter hinter demselben Schutz gegen Wind und Wetter finden konnten. Der Platz war in seiner westlichen Hälfte im Umkreise mit größern Granitsteinen eingefaßt, und es ist wahrscheinlich, daß auch die andere Hälfte von Steinen eingeringt gewesen ist; vor etwa 18 Jahren sind hier viele Steine zum Chausseebau ausgebrochen.
Innerhalb dieses mit Steinen umringten Begräbnißplatzes befanden sich mehrere Begräbnisse aus verschiedenen Perioden der heidnischen Vorzeit neben einander.
Am nordwestlichen Ende dieses Begräbnißplatzes ward ein Grab aus der Steinperiode entdeckt, welches ungefähr 1 1/2 Fuß tief unter der Oberfläche stand. Der innere Raum dieses Begräbnisses war im Rechteck von Granitblöcken gebauet und 4 1/2' lang, 2 1/2' breit und etwa 3' hoch. Die vier Seitenwände dieser Kiste waren von 5 größeren Steinen gebildet. Von außen, ebenfalls unter der Erdoberfläche, war diese Steinkiste von kleinern Steinen umgeben, deren Zwischenräume mit Lehm ausgefüllt waren, augenscheinlich um sie zu befestigen. Diese Steinkiste war nicht mit Steinen zugedeckt; jedoch sollen vor etwa 18 Jahren während des Baues der rostock=neubrandenburger Chaussee mehrere große Granitblöcke hier ausgegraben und zu Brückendecken verwandt worden sein. Die Längenrichtung der Steinkiste ging von Nordwest nach Südost.
In dieser Steinkiste lagen am südöstlichen Ende
und neben diesen nach Nordwest hin viele menschliche Gebeine, aus deren Lagerung man schließen muß, daß sie zu den Schädeln gehört haben. Leider sind die Schädel zerbrochen und die Gebeine zerschlagen und zum Theil verworfen; jedoch sind noch die Stirnbeine und einige Oberhauptbeine gerettet. Die Schädel sind nur dünne und klein und die Stirnen grade nicht schön gebildet; die eine Stirne ist ziemlich gut gestaltet, eine andere hat aber eine stark aufgeworfene Nase und eine starke Biegung nach hinten. So viel ist gewiß, daß die Schädel sich weder durch Größe, noch Schönheit, auch die übrigen Gebeine sich nicht durch Größe und Stärke auszeichnen. - Es ist möglich, daß die Leichen hockend oder sitzend in die Steinkiste beigesetzt worden sind; jedoch spricht die Länge der Kiste grade nicht dafür, da diese grade lang genug gewesen sein mag, um die Leichen hineinzulegen.
Neben den Schädeln lagen in der Steinkiste 3 Keile von Feuerstein, von denen zwei groß und dünne sind, der dritte ganz klein und in seiner Gestaltung sehr selten ist:


|
Seite 236 |




|
1 Keil von grauem Feuerstein, 6" lang, 1 3/4" breit im Mittel und 3/4" dick in der Mitte, auf den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und scharf nachgeschliffen;
1 Keil von grauem Feuerstein, 5 1/4" lang, 2" breit im Mittel und 3/4" dick in der Mitte, auf den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und scharf nachgeschliffen, jedoch an der Schneide an einigen kleinen Stellen zerschlagen;
1 kleiner Keil von grauem Feuerstein, 3" lang, 1" breit und 3/4" dick, etwas unregelmäßig, an den beiden breiten Seiten ganz geschliffen und an der Schneide sichtlich oft und zwar so nachgeschliffen, daß die Schneide gegen den Breiten=Durchmesser schräge liegt; wahrscheinlich ist dieser kleine Keil, der wegen seiner Kleinheit sehr selten ist, zum Einsetzen in eine hölzerne Keule oder dergleichen benutzt worden.
Weiter ward innerhalb dieses Grabes nichts gefunden.
Merkwürdig ist es, daß sich innerhalb des Steinringes, der den ganzen Begräbnißplatz umschloß, auch mehrere Begräbnisse aus der Bronzeperiode fanden, oder es war vielmehr, nach der Bauart, dieser Begräbnißplatz ein großes, wenn auch niedriges, Familien= Kegelgrab, in dessen Umkreis das Hünengrab hineingezogen war. Es ist einige Male beobachtet, daß Begräbnisse aus der Bronzeperiode oben auf Hünengräber gesetzt sind und das Ganze dann zu einem Kegelgrabe gemacht ist, wie z. B. in dem bekannten Grabe zu Waldhusen bei Lübek, in einigen Gräbern zu Moltzow am malchiner See; es ist aber in Meklenburg, so viel bekannt ist, noch nicht beobachtet, daß ein Hünengrab aus der Steinperiode neben Begräbnissen aus der Bronzeperiode in einem Kegelgrabe stand.
Innerhalb des die Begräbnißstelle umgebenden Steinringes standen
im Kreise umher, nicht weit von dem Steinringe, 1 1/2 Fuß unter der Erdoberfläche, also auf dem natürlichen Erdboden. Die Urnen waren alle zertrümmert, da sie vom Pflugeisen getroffen und dadurch zerstört waren. Nach den Scherben hatten sie die charakteristische bräunliche Farbe der Urnen der Kegelgräber und hatten ungefähr 3/4 Fuß im Durchmesser. Sie waren, wie gewöhnlich, von drei oder mehreren Steinen umstellt und mit einer Steinplatte zugedeckt, standen also in einer kleinen Steinkiste. Sie enthielten eine "kohlige Masse", also zerbrannte


|
Seite 237 |




|
Knochen, unter denen der Steinbrecher einige kleine Bronzestücke fand. Daß in diesem Grabe nach der Zeit der Steinperiode Leichenbrand geherrscht hat, geht daraus hervor, daß sich auch zwischen den kleinern Steinen, mit denen das Hünengrab von außen umpackt war, einige Kohlenstücke fanden; die Verpackung war also zur Zeit der Bronzeperiode geschehen. Wahrscheinlich ist in der Mitte des Begräbnißplatzes die Brandstelle gewesen, um welche, innerhalb des Steinringes, die Urnen beigesetzt sind.
In 4 von diesen Urnen fanden sich, nach Aussage des Arbeiters, kleine Bronzegegenstände, welche noch zu erkennen sind, da sie dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen und durch denselben zersprengt worden sind. Diese Gegenstände sind:
1 Paar Handbergen, aus Bronze, vom Feuer ganz in viele kleine Stücke zersprengt;
2 kleine Hefteln mit Spiralplatten, aus Bronze, durch den Leichenbrand verbogen, von denen jedoch nur noch die Spiralplatten vorhanden sind;
1 Diadem mit eingravirten Spiralwindungen, aus Bronze, von welchem jedoch nur noch ein kleines Stück, das offenbar, nach dem Roste zu urtheilen, durch den Leichenbrand abgesprengt wurde, erhalten ist;
Gegen Nordwest, am Ende, in der Mitte der Verengung des elliptischen Steinkreises, also nördlich neben dem Hünengrabe aus der Steinperiode, stand die größte Urne, welche etwa 1 Fuß im Durchmesser hatte. Nördlich neben dieser Urne lagen viele Bronzegegenstände, welche, nach der Aussage des Arbeiters, nicht in einer Urne, sondern so gefunden wurden, als wenn sie mit einem menschlichen Körper hingelegt waren. Alle diese Gegenstände sind ziemlich gut erhalten, in ihrer ursprünglichen Form und mit demselben, tiefen und alten Rost bedeckt, so daß es sicher ist, daß sie nicht dem Leichenbrande ausgesetzt gewesen sind. Dieses Grab, welches neben dem Hünengrabe lag, scheint das älteste und bedeutendste in dem Begräbnißplatze gewesen zu sein und keinen Leichenbrand erlitten zu haben. Die Bronzegegenstände dieses Begräbnisses sind:
1 Diadem, von ausgezeichneter Arbeit. Es ist nicht, wie gewöhnlich, mit gravirten Spiralwindungen verziert, sondern mit drei Paar queer und parallel laufenden, erhabenen Reifen mit eingravirten Horizontalstrichen verziert; die zwei dazwischen liegenden, vertieften, glatten Bänder sind an jeder Seite mit feinen, erhabenen Zickzacklinien auf vertieftem Grunde geschmückt. Der Rost ist tief und spielt ins Bläuliche. Diese Art von Diademen scheint älter zu sein, als die mit Gravirung verzierten.


|
Seite 238 |




|
1 Paar Armringe, massiv und einfach gravirt, eng, von 2 1/2" innerm Durchmesser.
2 Armringe, massiv und nicht gravirt, von derselben Weite; diese Ringe scheinen nicht zu diesem Begräbnisse zu gehören, da sie einen andern Rost haben.
1 gewundener Kopfring.
1 gewundener Halsring.
1 Nadel, deren Spitze abgebrochen ist, jetzt noch 2 1/2" lang.
1 Paar Handbergen, ziemlich wohl erhalten, reich gravirt.
Dieses Begräbniß scheint, nach den Schmuckgegenständen, einem Frauenzimmer anzugehören. Dann würden die Handbergen auch Frauenschmuck sein. Dies scheint auch aus mehrern andern Beobachtungen hervorzugehen. Leider ist noch kein Grab mit Handbergen wissenschaftlich aufgedeckt, aus welchem mit Sicherheit hervorginge, daß es einem Frauenzimmer angehörte.
Der Herr Apotheker Timm hat die Güte gehabt, die Bronzen zu analysiren, und hat gefunden, daß sie, wie gewöhnlich, nur aus Kupfer und Zinn bestehen und zwar ungefähr 90 Procent Kupfer enthalten.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kegelgrab von Wiek.
Nachtrag zu Jahrb. XX, S. 283.
Die in einer Urne mit Kinderknochen in dem Kegelgrabe von Wiek bei Schwaan gefundenen Raubvogelkrallen, welche in Jahrb. XX, S. 283 als Falkenkrallen angenommen sind, sind nach der gütigen Untersuchung und Bestimmung des Herrn Geheimen=Raths Professors Dr. von Lichtenstein zu Berlin wirklich Krallen eines Edelfalken.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die bronzene Spule von Viecheln,
welche in Jahrbuch XIX, S. 318, beschrieben und für die einzige bisher bekannt gewordene gehalten ist, hat ein Seitenstück gefunden. Auf dem sogenannten Wunderberge bei Lichterfelde in der Gegend von Neustadt=Eberswalde, einem runden Hügel von höchstens 30 Schritten Durchmesser, wurden, außer einigen Alterthümern aus Feuerstein, viele Alterthümer aus Bronze: 2 Frameen, 17 Pfeilspitzen, 2 Hefteln mit Spiralen,


|
Seite 239 |




|
3 Lanzenspitzen, mehrere Nadeln, Ringe, Dolche, ein Schwert u. s. w., welche zum großen Theile in den Besitz des Superintendenten Kirchner zu Gransee gekommen sind. Man vgl. die Schrift von Ernst Kirchner über Thors Donnerkeil, Neu=Strelitz, 1853, S. 25. In der Nähe des Wunderberges ward nun auch eine Spule von Bronze gefunden (vgl. E. Kirchner a. a. O. S. 97), welche zu der angeführten Schrift Kirchner's Fig. 26 abgebildet ist. - Beide Spulen sind von gleicher Größe und unterscheiden sich nur dadurch, daß an der Spule von Viecheln die Streben der Scheiben fest aus einem Stücke mitgegossen sind, an der Spule von Lichterfelde die Streben frei stehen.
G C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Hifthorn von Bochin.
In Frid. Franc. Tab. XII, Fig. 1, (vgl. Erläuterung S. 121) ist ein zu Bochin in der Mark Brandenburg gefundenes, im großherzoglichen Antiquarium aufbewahrtes, aus Bronze gegossenes Werk abgebildet, welches ohne Zweifel der Bronze=Periode der Kegelgräber angehört. Es ist dort stehend abgebildet und für ein Gefäß ausgegeben. Nach vielfältiger, genauer Prüfung hat sich diese Ansicht jedoch nicht behaupten lassen; es fehlt nämlich dem Gußwerke ein Boden, der auch nicht vorhanden gewesen sein kann, da jede Spur einer Anfügung fehlt. Dagegen erklärt sich das Werk leicht, wenn man es liegend darstellt und für die Schallmündung eines Hifthorns von einem Urstierhorne annimmt. Nach dieser Annahme hat das Gußwerk von Bochin die größte Uebereinstimmung mit dem bei Wismar gefundenen Hifthorn aus Bronze, welches im Jahresber. III, S. 67 flgd. beschrieben und abgebildet ist. Form, Größe, Verzierungen, der angegossene Henkel und vieles Andere stimmt in beiden Stücken genau überein. Besonders sind es die eingeschlagenen Dreieck= und die gravirten Bogenverzierungen, welche nicht allein auf beiden Stücken gleich sind, sondern auch mit andern verzierten Alterthümern aus der Bronze=Periode übereinstimmen, wie schon im Jahresber. III, S. 71 flgd. bemerkt ist. Es ist daher keinem Zweifel unterworfen, daß das Bronzewerk von Bochin zu einem Hifthorn gehört habe. - Daß ich im Frid. Franc. im J. 1837 von Spuren von Vergoldung an dem Bronzeguß von Bochin gesprochen habe, ist ein Irrthum von mir; die hellen Stellen sind nur Stellen, an denen der Rost abgescheuert ist und die Bronzefarbe durchscheint.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 240 |




|
Eine Lanzenspitze
aus Bronze, wahrscheinlich zu Hohen=Lukow gefunden, ohne Rost, schenkte der Herr Pastor Vortisch zu Satow.
Eine Lanzenspitze
aus Bronze, mit Schaftloch und Nagellöchern, ohne Rost, ist zu Gostorf bei Grevismühlen, im Torfmoore, 6 Fuß tief gefunden und von dem Herrn Oberforstmeister von Lehsten zu Rehna geschenkt.
Bronzering von Schwisow.
Zu Schwisow bei Bützow ward ein voll gegossener, schmaler Ring von Bronze, von der Größe eines Armringes, 2 1/2" weit, geöffnet, an beiden Enden spitz auslaufend, gefunden und von dem Herrn Friedr. Seidel zu Bützow erworben und dem Vereine geschenkt.


|
Seite 241 |




|



|



|
|
:
|
c. Zeit der Wendengräber.
Wendenkirchhof und Heftel von Holm.
Eine Heftel aus Bronze
mit Spiralfeder, von der bekannten Form der Hefteln aus der Eisenperiode, ward zu Holm bei Dassow auf dem "Vierenberge" in den Tannen in einer ganz zerbrochenen Urne, in welcher Knochensplitter lagen, 1 Fuß tief unter der Erde gefunden und von dem Herrn Oberforstmeister von Lehsten zu Rehna geschenkt. Es werden dort öfter zerbrochene Urnen gefunden; der Platz ist also ohne Zweifel ein wendischer Begräbnißplatz
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenkirchhof von Gorschendorf.
Bei dem Bau der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede wurden im J. 1852 von den Steinbrechern auf dem Felde von Gorschendorf vier große Urnen gefunden und mit in ihre Erdhütten genommen; leider zertrümmerten die Arbeiter bei einer unter ihnen entstandenen Schlägerei drei derselben. Die vierte erhielt der Herr Burgemeister Mau zu Neu=Kalen, welcher bald nach der Auffindung nach Gorschendorf geschickt hatte, und schenkte sie dem Vereine. Die Urne hat die Beschaffenheit der Urnen aus der ältern Zeit der Eisenperiode, ist ziemlich cylinderförmig, sehr groß, 13" hoch und ungefähr 10" weit in der größten Bauchweite, von hellbrauner Farbe und an der Außenfläche, mit Ausnahme des 2 1/2" hohen Halses, rauh und noch nicht mit geschlämmtem Thon überzogen und noch nicht geglättet. Die Urne gleicht, auch in der unfertigen Außenfläche, in jeder Hinsicht ganz mehreren in dem Wendenkirchhofe von Helm (vgl. Jahresber. V, S. 67 flgd.) gefundenen Urnen. Sie war mit zerbrannten Knochen, Asche und Sand gefüllt, es fanden sich aber bei der Ausleerung keine Alterthümer darin.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Wendenurne von Malchin.
Im Sommer 1854 wurden beim Ausgraben des schiffbaren Kanals bei Malchin 3 bis 4 Urnen gefunden, von denen nur


|
Seite 242 |




|
eine gerettet ward, die übrigen aber zerschlagen wurden. Der Herr Apotheker Timm zu Malchin erwarb die eine erhaltene Urne und schenkte sie dem Vereine. Die Urne ist aus heidnischer Zeit und scheint ein häusliches Geräth und keine Todtenurne gewesen zu sein. Es ist auch über den Inhalt dieser Gefäße nichts bekannt geworden. - Es ward beim Ausgraben auch ein Schädel und ein Kahn gefunden.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
|
Spindelsteine.
Einen Spindelstein, gefunden auf dem Felde zu Remlin bei Gnoyen, schenkte der Herr von Kardorff auf Remlin zu Gnoyen.
Einen Spindelstein, aus weißem Sandstein, bei den Erdarbeiten an der Chaussee von Neu=Kalen nach Pisede in der Stadtholzung von Neu=Kalen gefunden, ward von dem Herrn Burgemeister Mau zu Neu=Kalen erworben und von demselben dem Vereine geschenkt.
Einen Spindelstein aus Thonstein, und
einen Spindelstein aus gebranntem Thon, unbekannten Fundortes, schenkte der Herr Friedr. Seidel zu Bützow.
Einen Spindelstein aus grauem Sandstein, platt, gegen 2 Zoll im Durchmesser, mit concentrischen Kreisen um das Loch verziert, erwarb der Herr Pastor Kossel zu Tarnow für den Verein.
Einen Spindelstein aus gebranntem Thon, gefunden auf dem Kaninchenwerder bei Schwerin, schenkte der Herr Hofschlosser Duve zu Schwerin.
Drei Spindelsteine, welche in Dörfern des Amtes Schwerin von den Landbewohnern an Schlüssel gebunden waren, erwarb und schenkte dem Vereine der Herr Hofschlosser Duve zu Schwerin.


|
Seite 243 |




|



|



|
|
:
|
d. Vorchristliche Alterthümer gleich gebildeter europäischer Völker.
Ueber die Hausurnen,
besonders
über die Hausurnen vom Albaner=Gebirge,
vom
Archivrath Dr. Lisch .
In sehr fernen Zeiten ging ohne Zweifel dieselbe Cultur durch alle europäischen Länder, wie noch heute der Bildungsstand der sogenannten wilden Völker sehr ähnlich ist, selbst wenn sie in Zeit und Raum sehr weit von einander entfernt sind. Ja, es hat sich manche Eigenthümlichkeit aus dem grauesten Alterthume bis heute erhalten; so werden z. B. auf manchen Inseln an der Küste Dalmatiens die Thongefäße noch heute auf dieselbe Weise verfertigt, wie sie vor mehrern tausend Jahren allgemein in Europa und noch heute von den Flachschädeln an der Westküste Amerikas gemacht werden. Erst mit der größern Ausbildung der Bronzecultur, namentlich seit der Erfindung des Hohlgusses, und der Anwendung des Eisens erheben sich manche Völker zu einer eigenthümlichen Bildung und auf eine höhere Stufe, welche durch eine höhere Ausbildung in den Künsten, namentlich in der Baukunst, bezeichnet wird. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß in sehr ferner Zeit, die ich das epische Zeitalter nennen will, die Völker Griechenlands und Italiens ganz dieselbe Bildung hatten, welche wir bei allen andern nördlicher wohnenden Völkern Europas treffen. Leider ist uns von diesem Bildungsstande bis jetzt sehr wenig bekannt geworden; die Untersuchungen über die Alterthümer der Griechen und Italier bewegen sich fast ausschließlich um jene Zeit, aus welcher die Bau= und Schriftwerke jener Völker stammen. Einzelne Formen und Eigenthümlichkeiten von Geräthen jener ältesten Völker erhalten sich sehr lange, selbst bis in die römische Kaiserzeit hinein, während


|
Seite 244 |




|
in Norddeutschland die Cultur der Bronzeperiode bis zu ihrem Untergange ganz ungetrübt bleibt. Daher ist in Griechenland und Italien das ganz Alte oft sehr schwer von dem Jüngern zu unterscheiden; bei der großen Cultur, welche einst in diesen Ländern geherrscht hat, mag auch sehr wenig Altes übrig geblieben sein. Und doch werden und müssen sich bei genauerer Forschung in Griechenland und Italien Alterthümer finden, welche denen der mittlern und nördlichen Länder Europas gleich und älter sind, als der Anfang der Baukunst und des Schriftenthums. Es ist bekannt, daß an den Ufern des Hellespontus auf der Ebene von Troja dieselben kegelförmigen Grabhügel stehen, wie auf den Ebenen Norddeutschlands an den Gestaden der Ostsee. In der Privatsammlung des hochseligen Königs Christian VIII. von Dänemark in Kopenhagen sah ich einst mehrere alte italische Graburnen, welche Derselbe mit großer Anstrengung und tiefem Blicke in Italien gesammelt hatte und welche genau dieselbe Gestalt und Größe hatten, wie die (in den Jahrbüchern des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde, Jahrgang XI, 1846, S. 357, abgebildeten) Graburnen der Bronzeperiode im nördlichen Deutschland, nur mit dem Unterschiede, daß sie aus rothem Thon bestanden, während die norddeutschen immer eine braune Farbe haben. In unsern Museen findet man oft ein Bronzegeräth aus uralter Zeit Italiens neben jüngern Erzeugnissen der Kunst, und eben so oft daneben ein aus einem norddeutschen Bronzegrabe stammendes Stück "ungewissen Fundortes", welches vor längerer Zeit in eine Sammlung römischer Alterthümer gelegt ward, weil man damals die deutschen Alterthümer noch nicht kannte.
Es ist von großer Wichtigkeit, die wenigen Spuren zu verfolgen, welche zu einer tiefern Kenntniß des griechischen und italischen Alterthums im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. der ältesten Zeiten, leiten können. Und hiezu geben die "hüttenförmigen Aschengefäße" vom Albanergebirge die beste Veranlassung, wenn man sie mit den "Hausurnen" des Nordens vergleicht.
Um einen klaren Blick in diese interessante Angelegenheit thun zu können, ist es nöthig, die Geschichte der nordischen Hausurnen zu verfolgen.
Im J. 1826 hatte der Sächsische Verein zur Erforschung und Bewahrung vaterländischer Alterthümer zu Leipzig (vgl.


|
Seite 245 |




|
dessen zweiten Bericht, 1826, S. 30) die erste Urne dieser Art erhalten, welche zu Burg=Chemnitz in Thüringen gefunden und Fig. V zu dem erwähnten Berichte und hier wieder abgebildet ist.

Die Urne ist cylinderförmig, 12 1/2 Zoll hoch, ganz geschlossen und aus Einem Stücke, und ist oben mit einem kegelförmigen Dache bedeckt, in welchem sich eine viereckige Oeffnung von 3 1/2 Zoll im Quadrat befindet; diese Oeffnung war mit einem Deckel (einer Thür) zugedeckt, der in den die Oeffnung umgebenden Falz paßte und durch Riegel verschlossen werden konnte, welche durch zwei Oehren geschoben werden konnten, die an beiden Seiten der Oeffnung sitzen. Diese Urne ist nach den Abbildungen der nächstfolgenden, bei Rönne gefundenen Urne "völlig gleich und daher hat auch derselbe Holzschnitt zur Abbildung beider benutzt werden können.
- Leider ist nicht gesagt, in welcher Art von Gräbern diese Urne gefunden ist; jedoch mag die Bemerkung, daß durch ein Oehr ein "dünner metallener Drath gezogen" sei, zu der Vermuthung leiten, daß dieser Drath von Bronze war, weil sonst wohl gesagt worden wäre, daß der Drath aus Eisen bestehe, in diesem Falle aber wohl schon verrostet gewesen sein würde. In dem leipziger Bericht ist noch keine Vermuthung über die Gestalt dieser Urne ausgesprochen. Auch Klemm in seinem Handbuch der germanischen Alterthumskunde, 1836, S. 186, welcher diese Urne auf Taf. XIV, Fig. 13 wieder abbildet, hat noch keine andere Ansicht, als daß er sie unter den "Seltenheiten und Curiosis" aufführt und sie eine "sehr seltsame Erscheinung" nennt. - Ich wiederhole vorläufig ausdrücklich, daß diese Urne die Thür im Dache hat.
Im Sommer des J. 1833 leitete Se. Majestät der jetzt regierende König Frederik VII. von Dänemark während Seines Aufenthaltes auf der Insel Bornholm die Aufdeckung mehrerer Grabhügel und fand in der Haide Robbedale unweit Rönne in einem Hügel eine Urne, welche der bei Burg=Chemnitz gefundenen an Gestalt völlig gleich ist und auch noch die


|
Seite 246 |




|

Thür in dem Dache hat. Diese Urne, welche 11 Zoll in der Höhe und 8 1/2 Zoll im größten Durchmesser hat, ist abgebildet in den Historisch=antiquarischen Mittheilungen der königlichen Gesellschaft für nordische Alterthumskunde, Kopenhagen, 1835, S. 100, und darauf in dem Leitfaden für Nordische Alterthumskunde, herausgegeben von derselben Gesellschaft, Kopenhagen, 1837, S. 40, so wie in der englischen Uebersetzung desselben: Guide to northern archaeology etc., edited for the use of english readers by the earl of Ellesmere, London, 1848, p. 44. - Auch diese Gesellschaft spricht sich nicht weiter über diese Urne aus, als daß sie "in ihrer Art einzig" und zum Verschließen eingerichtet worden sei, "um die Gebeine vor jedem Berühren noch mehr sicher zu stellen". Auch Sorterup sagt in Kort udsigt over museet for nordiske oldsager, Kjöbenhavn, 1846, p. 34, nichts weiter, als daß die Urne die Oeffnung an der "Seite" habe. Worsaae setzt diese Urne in seinen Afbildninger fra det kongelige Museum for nordiske old-sager i Kjöbenhavn, 1854, p. 54, Fig. 222, mit Recht in die Bronzezeit.
Im Sommer des J. 1837 entdeckte der jetzige Herr Archiv=Secretair Dr. Beyer in einem Kegelgrabe aus der Bronzeperiode zu Kiekindemark bei Parchim eine gleich gestaltete Urne (vgl. Jahresbericht des meklenburg. Vereins III, S. 59), welche in den Jahrbüchern des meklenburg. Vereins XI, 1846, und XIV, 1849, S. 313, und hieneben wiederholt abgebildet


|
Seite 247 |




|

ist. Diese Urne, welche 10 1/2 Zoll hoch ist und 12 Zoll im Durchmesser hat, stammt ganz sicher aus der Bronze= Periode, da der Grabhügel die Gestalt der Gräber aus dieser Periode hatte und in demselben noch ein sicher der Bronze=Periode angehöriges, kleines, schönes Henkelgefäß und etwas Bronze gefunden ward. Auch ich hatte damals noch keine tiefere Einsicht in die Bedeutung dieser Urne und erklärte sie 1846 a. a. O. nur für eine "bienenkorbförmige Urne", den Deckel zu der Oeffnung aber für eine "Thür". Zu bemerken ist, daß diese Urne die Thür schon in der Seitenwand, jedoch noch ein rundes, kuppelförmiges Dach hat.
Darauf ward in einem heidnischen Grabe bei Aschersleben die in den meklenburg. Jahrbüchern XIV, 1849, S. 312, und hier wieder abgebildete Urne entdeckt, welche in das königliche Museum zu Berlin kam und durch den Herrn General=Director von Olfers in Gypsabgüssen an mehrere Museen verschenkt ward. Diese Urne, von viereckiger Gestalt, 16 Zoll hoch, mit der Nachbildung eines hohen Strohdaches und mit einer Thür an einer Seite, erkannte jeder sogleich für die Nachbildung eines Hauses. - Nach der Masse der Urne ist sie ohne
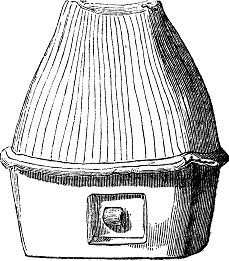


|
Seite 248 |




|
Zweifel heidnischen Ursprunges und nach der Farbe und Bereitungsweise stammt sie anscheinend aus der letzten Zeit der Bronzeperiode.
Durch Vergleichung mit dieser viereckigen Urne
von Aschersleben geleitet, erklärte ich in den
Jahrbüchern des Vereins für meklenburgische
Geschichte
 . XIV, 1849, S. 313, auch jene
runden Urnen mit kuppelförmigem Zeltdache und
mit einer Thür an der Seite, ohne Fenster oder
Andeutung derselben, für Nachbildungen der
jedesmaligen Wohnhäuser und erkannte in den
verschiedenen Formen die fortschreitende
Entwickelung der Wohnhäuser in alter Zeit.
. XIV, 1849, S. 313, auch jene
runden Urnen mit kuppelförmigem Zeltdache und
mit einer Thür an der Seite, ohne Fenster oder
Andeutung derselben, für Nachbildungen der
jedesmaligen Wohnhäuser und erkannte in den
verschiedenen Formen die fortschreitende
Entwickelung der Wohnhäuser in alter Zeit.
Im Herbste des J. 1853 machte der bekannte englische Alterthumsforscher Kemble, damals zu Hannover, längere Zeit umfängliche antiquarische Studien in den Museen zu Berlin und Schwerin und nahm die hier erworbenen Erfahrungen mit nach Hannover, als grade die gräflich von Münstersche Sammlung für das dortige Museum erworben ward.

In dieser Sammlung befand sich eine fünfte Urne
ähnlicher Art, welche zu Klus in der Nähe von
Halberstadt gefunden ist. Diese von Kemble in
der Zeitschrift des histor. Vereins für
Niedersachsen, Jahrgang 1851, zweites
Doppelheft, Hannover 1854, S. 391, beschriebene,
in Holzschnitt dargestellte und hier wieder
abgebildete Urne, 12 Zoll hoch, hat mehr eine
ovale Urnengestalt, ähnlich den bei Gallentin in
Meklenburg in mehrern Kegelgräbern der
Bronze=Periode (nach den Jahrbüchern des Vereins
für meklenb. Geschichte
 . XI, S. 365) gefundenen, hieneben
zur Vergleichung wieder abgebildeten Urnen, hat
einen einfassenden und überragenden, ebenfalls
kuppelförmig gewölbten, aber beweglichen Deckel
und eine viereckige Thür hoch in der Seitenwand,
wenn auch nicht mehr im Dache.
. XI, S. 365) gefundenen, hieneben
zur Vergleichung wieder abgebildeten Urnen, hat
einen einfassenden und überragenden, ebenfalls
kuppelförmig gewölbten, aber beweglichen Deckel
und eine viereckige Thür hoch in der Seitenwand,
wenn auch nicht mehr im Dache.



|
Seite 249 |




|
Neben der hannoverschen Urne ward die Hälfte eines gleichen, mit Einritzungen bezeichneten Deckels einer zweiten Urne gefunden, so daß im Ganzen jetzt sechs Hausurnen bekannt geworden sind, und zwar alle aus nördlichen Gegenden.
Kemble wiederholt bei der Bekanntmachung dieses Fundes in der hannoverschen Zeitschrift a. a. O. meine Forschungen aus den Jahrbüchern des Vereins für meklenburg. Geschichte XIV, S. 312 flgd., meint jedoch, "die Form, eben so wie die sehr gewöhnliche (?) Thonmasse führe zu der Meinung, diese Urne (von Klus) wenigstens gehöre einer durchaus spätern Zeit an, als der Bronzeperiode". Dieser Ansicht meines geehrten Freundes muß ich jedoch mit Bestimmtheit widersprechen, da die Urnen von Rönne und Kiekindemark sicher in kegelförmigen Hügeln der Bronzeperiode gefunden sind und grade die cylindrische Form dieser Art von Urnen bestimmt für die Bronzeperiode redet. Eben so wenig kann ich Kemble beipflichten, wenn er meint, daß, "da drei von den sechs bekannten Gefäßen dieser Art in der Nähe von Halberstadt gefunden seien, dies eher auf die Laune (?) eines einzelnen Töpfers, als auf eine weit (?) verbreitete Sitte zu deuten sei, und es sich allerdings denken lasse, daß die andern ähnlichen vielleicht ursprünglich aus derselben Quelle (?) gekommen seien". Freilich sind diese Urnen nicht sehr verbreitet, d. h. sie sind nicht häufig, aber schon aus diesen 6 Urnen ergiebt sich, daß die Form doch so weit verbreitet war, daß an eine Herstammung, wenn auch nur der Sitte, aus derselben Quelle wohl schwerlich zu denken ist; diese Urnen finden sich nämlich auf dem ziemlich großen Raume vom thüringer Walde bis zur Insel Bornholm und von der Ostsee bis zum Harzgebirge.
Die weiter unten folgenden italischen Forschungen werden meine Ansichten noch mehr bestätigen, wenn die gegenwärtigen nicht in sich selbst Haltung genug haben sollten.
Wirft man einen vergleichenden Blick auf die Gestalt aller dieser Urnen, so drängt es sich unwillkürlich auf, daß sie die Entwickelung des alten Wohnhauses darstellen. Die Völker, die in einem von der modernen Bildung entfernten Zustande leben, pflegen in der Regel runde Häuser mit einem kuppelförmigen Zeltdache zu haben; das Haus war eine Nachbildung des Zeltes. So haben noch jetzt viele Völker Afrika's runde Hütten mit kegelförmigem Dache (vgl. Weiß Kostümkunde, Stuttgart, 1855, I, S. 18, auch mit Abbildungen). Die älteste Form des Hauses geben ohne Zweifel die Urnen von Burg=Chemnitz und Rönne, welche die Thür im Dache haben, wie die Wohnungen ungebildeter Völker oft die Thür im Dache haben, zum Schutze gegen wilde Thiere; man stieg auf Leitern


|
Seite 250 |




|
hinein, welche man nach sich zog, und so war man durch die steilen, glatten Wände mehr gesichert. Jünger sind sicher diejenigen runden Häuser, wie die Urnen von Kiekindemark und Klus, welche die Thür in der Seitenwand haben. Das jüngste Haus wird wohl durch die Urne von Aschersleben dargestellt; dieses Haus war viereckig, mit hohem, steilem Strohdache, ein überraschendes Vorbild der jetzigen geringen Landhäuser.
Da alle runden Urnen dieser Art entweder bestimmt aus nordischen Gräbern der Bronzeperiode stammen, oder durch Vergleichung in diese verwiesen werden müssen, so läßt sich wohl mit Sicherheit annehmen, daß sie Abbildungen der Häuser der Germanen sind.
Nimmt man dies als wahrscheinlich an, so scheint es auch nicht unwahrscheinlich zu sein, daß selbst die Gräber der Bronzeperiode, welche stets kegelförmige Rasenhügel bilden, gleich den Decken der Hausurnen, eine Nachbildung des kegelförmigen Hausdaches sind. Auch giebt die zur Zeit der Bronzeperiode allgemein übliche Zudeckung der beigesetzten Urnen mit umgestülpten flachen Schalen diesen Urnen ein den Hausurnen ähnliches Ansehen, wenn auch gerade kein besonderes Gewicht auf diesen Gebrauch zu legen ist.
Ueberraschend ist die Aehnlichkeit der auf der Antoninssäule dargestellten germanischen Häuser mit den hier geschilderten Hausurnen; auf diese Aehnlichkeit haben auch Müllenhoff im Vierzehnten Bericht der schleswig=holstein=lauenburgischen Gesellschaft für die Sammlung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer, Kiel, 1849, S. 2, und Kemble in der Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen a. a. O. aufmerksam gemacht. Montfaucon L'Antiquité expliquée Suppl. I, pl. XXV, p. 63, sagt: "In eadem Antoniniana columna aedes "conspicimus ex lignis paleisque confectas rotundasque, quarum cacumen fornicis instar rotundum est et in conum desinit: sunt tamen illae non inconcinne structae. In casas porro nonnisi ab ostio lux ingrediebatur: quod ostium praealtum est et in nonnullis ad tectum usque aperitur. Eodem quoque modo veteres Galli aedes struebant suas". Die Schilderung dieser Tugurien stimmen ganz zu den Hausurnen; Columella schildert sie noch mit einem runden Dache ("testudineato tecto"). Mein Freund Müllenhoff irrt jedoch, wenn er die viereckige Hausurne von Aschersleben gradezu zur Vergleichung zieht und drückt sich etwas unbestimmt aus, wenn er sagt: Dies Stück (die viereckige Urne von Aschersleben), gewis eine Seltenheit, die ihres Gleichen sucht, stellt in der That das altgermanische, fast (?) quadratische oder


|
Seite 251 |




|
runde (?) Haus dar, das die Römer mit Recht ein tugurium nennen konnten, mit seinem hohen spitzen (?) Strohdach" u. s. w.; es ist hier offenbar die Schilderung der Alten und die Darstellung auf der Antoninssäule in die viereckige Urne hineingetragen, welche zwar das Bild eines Hauses giebt, aber nicht die Eigenthümlichkeiten der ältesten Urnen dieser Art hat. - Eben so wenig kann ich meinem Freunde Kemble darin beistimmen, wenn er sagt: "Eben aus der Form (?) dieser Tuguria (auf der Antoninssäule) geht auch hervor, daß diese Urnen nicht der Bronze=, sondern der Eisenzeit angehören". Wir dürfen nicht vergessen, daß sich in Norddeutschland und Skandinavien die Bronzeperiode viel (wohl tausend Jahre) länger rein und unvermischt erhält, als in Südeuropa, und erst spät (vielleicht erst gegen die Zeit der Völkerwanderung) plötzlich und ohne Uebergang (nach der Bronzeperiode hin) in die Eisenzeit übergeht, - und daß die Gestalt der Häuser sich noch länger halten konnte, als die unvermischte Anwendung der Bronze, wie sich denn, nach den Schilderungen der römischen Schriftsteller, in Italien die runden Häuser oder Tugurien auf dem Lande auch viel länger gehalten haben, als die reine Bronzeperiode, aus der die Hausurnen stammen. - Für das Alter der Hausurnen können nur die Form der Gräber und die Beigaben entscheidend sein.
Es gab gewiß einst eine Zeit, welche ich die Zeit der reinen Bronzeperiode nennen will, in welcher alle Völker Europa's und die asiatischen Völker der Küsten des Mittelmeeres dieselbe Cultur hatten. Zwar ist, wie oben bemerkt, in den südlichen Ländern von dieser Cultur bisher sehr wenig bekannt geworden; aber sie wird sich nach und nach aus einzelnen Zügen herausstellen lassen. Einen überraschenden Anhaltspunct bilden die oben geschilderten Hausurnen.
Im J. 1817 wurden im Albanergebirge, an dem Wege von Castel Gandolfo nach Marino, ungefähr 13 englische Meilen von Rom, viele Hausurnen in einer Felsspalte gefunden, welche von neu angewachsener Felsbildung überdeckt gewesen sein soll. Es läßt sich jetzt wohl schwerlich ermitteln, ob das Letztere gegründet ist, oder überhaupt nur wahrscheinlich sein kann, wenn man nicht etwa annehmen will, daß in jenen vulkanischen Gegenden die Felsschichten durch vulkanische Gewalten in jüngern Zeiten verschoben worden seien; es wird sich jetzt schwerlich ermitteln lassen, ob die Bedeckung des Felsspaltes, wenn sie wirklich vorhanden gewesen ist, vor oder nach der Beisetzung


|
Seite 252 |




|
der Urnen, durch Natur oder Kunst geschehen sei. Jedoch hängt von der Ermittelung dieses Umstandes für die Bestimmung der Urnen nicht viel ab. Es ist wahrscheinlich, daß das Volk, welches diese Urnen beisetzte, in dem felsigen Boden einen geschützten Felsspalt zur Beisetzung der Asche ihrer Todten benutzte.
Die zahlreichen Urnen dieses Fundes wurden weit zerstreut. Im J. 1846 kaufte der Herr Professor Dr. Gerhard zu Berlin in Rom im Kunsthandel ein Exemplar für das Museum zu Berlin, welches in der Terracottensammlung dieses Museums Nr. 5026 oder nach Gerhard's Leitfaden vom Jahr 1851 als Nr. 32 a aufgestellt ist. Ich fand sie hier im Herbste des J. 1855 und erkannte in derselben eine überraschende Aehnlichkeit mit den Hausurnen des Nordens. Die Urne vom Albanergebirge, welche 12 Zoll hoch ist, hat ebenfalls eine runde Basis, eine cylinderförmige Gestalt oder runde Wand, welche jedoch nach oben hin ein wenig zugespitzt ist, ein rundes, festes Dach und eine viereckige Thür in der Seitenwand. Diese Urne hat jedoch



|
Seite 253 |




|
einige Verzierungen, welche den nordischen Urnen
fehlen, diese Urnen aber noch mehr als die
Nachbildung eines Hauses erscheinen lassen. An
jeder Seite der Thür sind zwei etwas erhöhete
Rippen, welche wohl Pilaster oder Pfeiler zum
Tragen eines Vordaches bezeichnen sollen. Auf
dem kuppel= oder kegelförmigen Dache, welches
jedoch ein wenig länglich gedrückt ist, liegt in
der Mitte, in dem senkrechten Durchmesser der
Thür, ebenfalls eine Rippe zur Bezeichnung des
Firstbalkens. Zu diesem Firstbalken laufen an
jeder Seite 4 Rippen, zur Bezeichnung der
Sparren, hinauf, welche oben am Firstbalken
hervorstehende Köpfe haben. Die beiden Enden des
Firstbalkens laufen in eine kleine Figur von
erhöheten Rippen in der Form
 aus, vielleicht zur Bezeichnung
eines Giebelornaments über der Thür oder eines
Balkenwerkes zur Befestigung der Enden des
Firstbalkens. - Hier haben wir ein vollständiges
Bild eines altitalischen Hauses, mit den
Eigenthümlichkeiten der südlichen Häuser, mit 4
Pfeilern vor der Thür, den ersten Anfängen einer Säulenhalle.
aus, vielleicht zur Bezeichnung
eines Giebelornaments über der Thür oder eines
Balkenwerkes zur Befestigung der Enden des
Firstbalkens. - Hier haben wir ein vollständiges
Bild eines altitalischen Hauses, mit den
Eigenthümlichkeiten der südlichen Häuser, mit 4
Pfeilern vor der Thür, den ersten Anfängen einer Säulenhalle.
Die Masse und die Art der Verfertigung dieser Albanerurne stimmt ganz mit der der nordischen Urnen des Heidenthums, und überhaupt mit der charakteristischen Eigenthümlichkeit der Thongefäße aller sogenannten "wilden" Völker, d. h. wenn man so sagen soll, derjenigen Völker, welche noch keine Brennöfen kennen, überein; mit dem Brennofen, der zuerst immer mit der Cultur vorzurücken scheint, beginnt die höhere gewerbliche Bildung, erst nach dem Schmieden des Eisens. Die Albanerurne besteht im Innern der Wände aus grobkörniger, felsiger Masse, d. h. aus Thon mit zerstampfter Felsmasse durchknetet, und unterscheidet sich von den nordischen Urnen nur dadurch, daß die Masse, wie zahllose italische Gefäße, eine röthlich =braune Farbe hat, während die nordischen Gefäße aus braunem Thon bestehen, der mit (geröstetem? und) zerstampftem dunklen Granit durchknetet ist. Die ursprünglich rauhe Außenfläche der Albanerurne ist schließlich mit fein geschlämmtem, braunem Thon überzogen und geglättet. Die Verfertigungsweise dieser Urne ist also ganz dieselbe, wie bei den Thongefäßen aller andern alten, heidnischen Völker, welche noch nicht im Besitze der Wissenschaft und Kunst sind. Es ergiebt sich also aus der Form und der Verfertigungsweise der Albanerurne, daß in Italien einst dieselbe Cultur herrschte, wie im mittlern und nördlichen Europa.
Aber nicht nur Form und Verfertigungsweise der Albanerurne machen auf eine gewisse Stelle in der Geschichte der menschlichen Kunstentwickelung Anspruch; auch der Inhalt der Urne,


|
Seite 254 |




|
den ich in Berlin genau untersucht habe, redet für eine bestimmte Zeit, wenn man in diesem Falle einstweilen auch nur nach Perioden oder Jahrtausenden rechnen kann. Auf dem Boden lag noch etwas von dem Inhalte, das sich durch die ziemlich verschlossene Form der Urne darin erhalten hatte. Es liegen in der Urne: in kleine Stücke zerbrannte Menschengebeine und ein Blatt von einem thönernen Löffel; zwischen den Menschengebeinen fand ich ein kleines Ringelchen von Bronze und ein ungefähr einen Quadratzoll großes, dünnes, stark gerostetes Bruchstück von einem getriebenen oder gehämmerten Gefäße aus Bronze, welches mit zwei Reihen ganz kleiner, von innen heraus getriebener Buckel verziert ist, ganz auf dieselbe Weise, wie so viele dünne, nicht gegossene Gefäße aus Bronzeblech aus den Gräbern Norddeutschlands ans Licht gezogen werden. Solche norddeutsche Gefäße sind z. B. die bronzenen Schalen von Dahmen und Kl. Lukow, wie sie in den meklenburg. Jahrbüchern X, S. 283, und XIII, S. 376, von mir in Abbildungen dargestellt sind, ferner das Gefäß und die Nadel von Sparow, welche in Schröter und Lisch Friderico - Francisceum Tab. XII, Fig. 2, und Tab. XXIV, Fig. 20, abgebildet sind (vgl. auch die Abbildung der Nadel in den Jahrbüchern IX, S. 332).
Diese Entdeckung verweiset die Albanerurne bestimmt in die Zeit der ausgebildeten Bronzeperiode, und man kann wohl mit Bestimmtheit das Ergebniß der Forschung aussprechen, daß zu irgend einer Zeit die Bildung und der Geschmack bei den altitalischen und den norddeutschen und nordischen Völkern in vielfacher Hinsicht ganz dieselbe war, ja daß sie so weit ging, daß sich selbst seltene Formen bei beiden wiederholten, wobei jedoch scharf zu berücksichtigen ist, daß die Völker ihre Eigenthümlichkeiten neben der gemeinsamen Cultur ausdrückten, wie z. B. die Albanerurne ein Vordach oder eine Säulenhalle vor dem Hause andeutet, welche in den südlichen Ländern sehr verbreitet und ein Bestandtheil des Baustyls ward, in den norddeutschen Ländern aber nicht zur Anwendung kam.
Ueber diese Albanerurnen ist zur Zeit ihrer Entdeckung auch wiederholt geschrieben. Der Herr Professor Gerhard theilt mir mit, daß Alessandro Visconti (oder auch dessen Bruder Filippo) eine kleine Schrift über diesen Fund herausgegeben habe, in welcher er diese Urnen für antidiluvianisch (!?) erkläre, daß aber sein öfteres Bemühen um diese Schrift bis jetzt vergeblich gewesen sei; das Giornale Arcadico des Jahres 1817 und der folgenden Jahre würden aber wohl Nachweisung geben. Da aber einem mit Italien vertrauten Manne, wie dem Herrn Professor Gerhard, diese Schrift unzugänglich geblieben ist, so wird mir mein Bemühen viel weniger gelingen.


|
Seite 255 |




|
Dieser Auffassung und der angeblichen Art der Auffindung in einem von jüngerem Gestein überwachsenen Felsspalt mißtrauend, ist denn Gerhard (im Archäologischen Anzeiger, 1832, S. 172) eher der Meinung beigetreten, daß "jene seltsame "Hüttenform als eine für rhätische Soldaten der Kaiserzeit mit Erinnerung an ihre heimathlichen Formen gewählte Abweichung von der Form sonstiger Aschengefäße" zu betrachten sei. - Aber so sinnreich diese Erklärung auch sein mag, so scheint ihr doch der gesammte Fund zu widersprechen, da man alle Umstände in Erwägung ziehen muß, wie die Verfertigungsweise der Urne, die in derselben gefundenen Bronzen, u. s. w.; ja selbst die Form der Urne mit den vier Pfeilern an der Thür, welche keinen nördlichen Charakter haben, redet dagegen. Es ist nicht glaublich, daß rhätische Soldaten sich die Mühe sollten gegeben haben, auf eine ganz veraltete und sehr schwierige Weise ihre Urnen aus freier Hand zu machen und am offenen Feuer zu dörren, während sie sich jede beliebige Form bei zahlreichen Töpfern um ein Billiges bestellen konnten; es ist nicht glaublich, daß rhätische Soldaten feine Geschirre öder Schmuckgefäße von Bronzeblech sollten mit in fremde Länder genommen und ihren Todten mitgegeben haben, während sie zahlreiche Gegenstände anderer Art römischen Ursprunges gewiß im Besitze hatten.
Den rechten Punct in der Erklärung scheinen mir
die englischen Forscher getroffen zu haben.
Durch Canova erhielt A. W. Hamilton ein auch
noch mit Gebeinen gefülltes Exemplar der
Albanerurnen, und Hamilton gab sie an das
Britische Museum, wo sie Nr. 1 bildet, zum
Zeichen, daß man sie dort für sehr alt hält. In
dem Katalog des Britischen Museums wird gesagt:
die Urne sei eine Vase von grober, brauner
Waare, "in der Gestalt eines tugurium oder
einer ländlichen Wohnung der ältesten Bewohner
Italiens und ein Stück der ältesten italischen
Töpferkunst". Der Catalogue of the greek
and etruscan vases, Vol. I., London, 1851, sagt:
"Nr. 1. Oval vase. Hight 13 in., Length 15
in. Coarse brown ware. In the form of the
Tugurium or rustic cottage of the early
inhabitants of Italy. At one end is a moveable
door flanked by perpendicular ridges and
grooves, which perhaps represented fluted
pilasters. On each side of the roof are five
ribs meeting at the top of the ridge, and at
each end under a pointed projection is an object
like an
 inverted thus
inverted thus
 . The surface of the vase appears
to have been pointed, as traces of a rude
meander pattern remain in several places. The
inferior is filled
. The surface of the vase appears
to have been pointed, as traces of a rude
meander pattern remain in several places. The
inferior is filled


|
Seite 256 |




|
with burnt bones. This interesting specimen of the earliest italian fictile art was found in 1817 in the Monte Albano near the road from Castel Gandolfo to Marino, about 13 miles from Rome."
Daß die Hausform der Graburnen nicht bloß vereinzelte "Töpferlaune" sei, beweisen zur Genüge auch die etruskischen Grabkisten, welche oft Fortsetzung dieser Hausurnen und Erinnerung an dieselben sind. Die etruskischen Todtenkisten aus Stein oder gebranntem Thon haben häufig die Form eines Hauses mit Dach und Thüren, oft nur mit Andeutung von Thüren, ohne Durchbrechung der Wände. Beweisende Stücke sind z. B. Nr. 505 und 547 der etruskischen Denkmäler in der Sammlung der antiken Bildhauerwerke des Museums zu Berlin (nach dem Kataloge, Dreißigste Auflage, 1855). Besonders merkwürdig ist die etruskische Todtenkiste, Nr. 539, von dem "sogenannten Grabmale des Porsenna", dessen Deckel "ein Haus mit Eingangsthüren an den Seiten und einer vorragenden Bedachung darstellt" (einem sogenannten Schweizerhause ähnlich); das Dach ist weit vorspringend und die Thüren sind klein und viereckig. Diese etruskischen Grabkisten, als Fortbildung der altitalischen Hausurnen, scheinen mir den sichersten Beweis dafür zu geben, daß alle alten Völker Europa's die Todten gerne in der Nachbildung ihres Hauses beisetzten, wenn sie auch nur den Grabhügel in der Form des kegelförmigen Hauses nachahmen konnten.
Die Zeit der Hausurnen, wenn nicht Entdeckungen in Italien oder Griechenland etwas Bestimmtes ans Licht bringen sollten, scheint spätestens in die Zeit der römischen Könige zu fallen oder noch weiter zurückzureichen. Jedoch soll diese Vermuthung für nichts weiter gelten, als für eine Vermuthung.



|



|
|
:
|
Römische Bronzestatuette der Ubertas,
gefunden zu Manderow.
Vor drei Jahren stießen Arbeiter zu Manderow, in der Pfarre Proseken bei Wismar, beim Torfstechen in einer Tiefe von 4 Fuß auf etwas Hartes, das sich beim Herauswerfen als eine kleine Bronzefigur erwies. Das Torfmoor, welches an einem kleinen See liegt, war vorher mit Busch, namentlich mit Weiden bewachsen. Die Bronzefigur blieb so lange verborgen,


|
Seite 257 |




|
bis sie der Herr Cantor Krüger zu Proseken, in lebhafter Theilnahme an den Bestrebungen des Vereins, im J. 1855 für den Verein erwarb.
Die Figur ist 6 1/2 Zoll hoch, aus Bronze und hohl gegossen. Sie stellt eine weibliche Göttin dar, in langem Untergewande, mit etwas kürzerem Obergewande, dessen Ende nach hinten über die linke Schulter geschlagen ist; die rechte Schulter ist entblößt. Im linken Arme trägt sie ein großes, mit Schuppen verziertes Füllhorn, in welchem Aehren, Baumfrüchte und Weintrauben liegen. In der rechten Hand hält sie eine runde Schale. Auf dem Haupte trägt sie ein antikes Diadem. "Eigenthümlich ist das in einem starken Zopfe nach griechischer Weise zusammengefaßte, dann aber über den Scheitel mit einem Wulste zusammengefaßte Haar, welches sich hier wie eine Blume (Lotos?) bildet und so an die Isisdarstellungen späterer römischer Auffassung erinnert. In diesem (jetzt etwas schief gedrückten) Wulste zeigt sich ein Einschnitt, welcher wohl dazu bestimmt gewesen sein könnte, eine Scheibe (Sonnen= oder Mondscheibe?) getragen zu haben."
Die Figur ist aus spät römischer Zeit, jedoch noch von guter Arbeit. Sie stellt eine Ubertas (Segen) oder Felicitas publica dar, wie sie auch auf Münzen oft vorkommt. "Sie stammt aus der Zeit, in welcher fremde Gottheiten oder deren Attribute mit den heimischen zu neuen symbolischen Bezeichnungen verbunden wurden", wie der Kopfputz und die Attribute auf eine spätere Zeit hinweisen. Die Figur ist sonst schlank und zart gebildet, der Faltenwurf ist reich und geschmackvoll, die Züge sind edel und fein. Die Figur hat sowohl Kunstwerth, als besonders historischen Werth, da sie sicher in Meklenburg gefunden ist. Die meisten der zahlreichen in den Ostseeländern gefundenen römischen Alterthümer stammen aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, namentlich aus dem 2. und 3. Jahrhundert des römischen Kaiserreichs.
In der Auffassung der Herstammung, des Alters und der Zeit der Figur stimmen die berliner Archäologen in ihren Ansichten, welche mir durch den Herrn General=Director von Olfers mitgetheilt sind, mit mir überein.
Schwerin im Juni 1855.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 258 |




|



|



|
|
|
2. Alterthümer des christlichen
Mittelalters
und der neuern Zeit.
Alterthümer von der bischöflichen Burg zu Bützow.
Auf dem "Schlossplatze" zu Bützow, dem Platze der ehemaligen mittelalterlichen bischöflichen Burg, wurden beim Ausgraben der Erde zu den neuen Gebäuden im Sommer 1855 ferner noch gefunden und von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow geschenkt:
ein eiserner Schlüssel,
eine eiserne Pfeilspitze und
ein kleiner, glasurter Stein (wohl Kalkstein), durch einen großen Brand glasurt, und ferner noch
ein kleiner eiserner Schlüssel.
Bei dieser Gelegenheit berichtet der Herr Friedrich Seidel folgendes Ereigniß. Zum Umbau eines Fensters in dem Criminalgebäude (der bischöflichen Burg) entdeckte man 18 Fuß hoch über der Erde mitten in der aus sehr großen Mauersteinen fest gemauerten Wand ein kleines eisernes Gitter, dessen Stangen so sehr verrostet waren, daß sie nicht viel dicker waren als ein Rohrhalm. Unter der untersten Querstange war ein eichenes Brett von ungefähr 8 Zoll im Quadrat eingeschoben und unter diesem war ein ähnliches Stück Brett eingemauert. Zwischen beiden Brettern war ein leerer Raum, in welchem auf etwas Stroh 3 Hühnereier lagen, deren Inhalt ganz fest, wie krystallisirt oder verglaset, war. Die Maurer behaupteten, daß hier ursprünglich kein Fenster angelegt gewesen, sondern alles so beim Bau der Burg vermauert worden sei. Man vermuthet hinter diesem Umstande irgend eine Absicht, die sich aber wohl schwerlich errathen läßt.


|
Seite 259 |




|



|



|
|
:
|
Eiserne Alterthümer von Marlow
aus der Reknitz.
Bei der unumgänglich nothwendigen Vertiefung des Strombettes der Reknitz zur Anlage einer Brücke von Marlow nach Pommern fand sich, daß von der Stelle an, wo der Damm an der meklenburgischen Seite am Lande aufhört, nach dem entgegengesetzten pommerschen Ufer hin in der Reknitz ein Steinwall von ungefähr 30 Fuß Länge und 15 Fuß Breite lag. Wahrscheinlich ist in alter Zeit auf der meklenburgischen Seite hier wegen des sumpfigen Ufers eine Art Mole durch Einrammen eichener Pfähle, welche zum Theil noch stehen, und durch Versenken kopfgroßer Steine gebildet und von da an eine kleine Brücke von ungefähr 20 Fuß Länge über die Reknitz gemacht worden. Da aber alle Nachrichten über diese Brücke und den in Ueberresten in seiner ganzen Ausdehnung durch das Reknitzthal auf meklenburgischer und pommerscher Seite noch vorhandenen Damm schweigen, so muß sich die Erbauung dieses Brückendammes in eine sehr ferne Zeit verlieren.
Als die Arbeiter wenigstens drei Schichten dieser Mole und eine Masse von Steinen abgetragen hatten, fanden sich folgende Alterthümer:
1) ein eisernes Hufeisen, welches sehr klein ist und an welchem die Stollen nach unten stehen, wie noch jetzt bei der Winterschärfung der Vordereisen. Bei dem Bau der Chaussee bei Triebsees fand man auf einem versunkenen und überbaueten Knüppeldamme eine Menge solcher kleiner Hufeisen, an denen jedoch die Stollen hakenförmig nach oben gerichtet waren;
2) ein eiserner Sporn mit dünnen, runden Bügeln und einer kurzen Spitze statt des Rades 1 ); die beiden Oesen stehen in der Richtung verschieden, die eine, rund, perpendiculair, - die andere, viereckig, horizontal;
3) eine eiserne, lange und schmale Sichel, wie dergleichen in der Gegend von Marlow schon öfter gefunden sind;
4) ein eiserner Splint, vielleicht zum Zustecken einer Thür, wahrscheinlich von einem Schiffe.
Marlow, 1855.
Dr. Hüen.


|
Seite 260 |




|



|



|
|
:
|
Ueber
ein zu Dreveskirchen gefundenes großes Thongefäß.
und
den Ort Dreveskirchen.
Vgl. Jahrb. XVII., S. 368, XIX., (S. 290, und oben S. 227 flgd.
Bei Gelegenheit der Auffindung der heidnischen, unterirdischen Wohnstätten zu Dreveskirchen, zur Zeit der Drainirung des Feldes im J. 1855 ward auch ein anderer Fund gemacht, der, wenn er auch nicht altheidnisch ist, doch wohl dem früheren Mittelalter angehört.
Ungefähr 40 Ruthen von einer heidnischen Wohnstätte entfernt, fand sich mitten in einer quellenreichen Stelle ein großes Gefäß von gebranntem Thon, leider sehr zertrümmert. Dasselbe scheint eine Höhe von ungefähr 2 1/2 Fuß und einen Durchmesser von 2' gehabt zu haben; die Form in tonnenförmig. Es ist aus weißlichem Thon geformt, im Töpferofen gebrannt und am obern Rande von innen und außen weißlich glasurt. Der Rand an der Oeffnung ist stark gewulstet.
Unter dem Randwulste finden sich Spuren einer Verzierung.
Im Boden sind in der Mitte und im Umkreise Löcher durchgebohrt.
Das Gefäß stand auf einigen Bruchstücken von Ziegeln von 3" Höhe und 6" Breite, deren Oberflächen 4 3/4" unter dem umgebenden Terrain lagen.
Den Zweck des Gefäßes anlangend, so hat man es hier offenbar mit der Fassung eines Brunnens zu thun, wofür nicht allein die Durchlöcherung des Bodens, sondern auch die quellichte Beschaffenheit des Bodens deutlich sprechen. Eben so sicher gehört in Bezug auf das Alter das Gefäß frühestens dem Mittelalter an, wie der Charakter der Verzierung und die Glasur beweisen.
Die Verzierung besteht in an einander gereiheten kreisförmig gelegten Bändern, deren Enden von unten her in dem Kreise in eine Lilie von 1 1/2" Höhe auslaufen (oder: in an einander stoßenden kreisförmigen Bändern von 2" Durchmessern, in deren jedem eine mittelalterliche Lilie steht, mit einem Stempel eingedrückt), ein vielfach angewandtes romanisches Ornament, dessen Zeichnung hier in der Lilie jedoch schon germanische Weise hat, so daß man Uebergangsstyl annehmen könnte.


|
Seite 261 |




|
Aus der Existenz eines Brunnens würde man auf eine neu angelegte Wohnstelle schließen dürfen, und die urkundlichen Nachrichten scheinen merkwürdig mit dieser Annahme zu harmoniren.
Dreveskirchen hieß, ehe es eine Kirche erhielt, Gardeskendorf, und es wäre wohl möglich, daß man das Dorf bei Erbauung desselben an dem besten Punkte der Gegend, wo sie weithin sichtbar ist, um diese wieder aufgebauet habe, falls man nicht annehmen will, daß Gardeskendorf neben Dreveskirchen, wie Mirisdorf neben Hohenkirchen, existirt habe (vgl. Jahrbücher XI, S. 412, Nr. 5).
Es führt dies wieder auf die Etymologie des Namens. Dreveskirchen heißt bekanntlich im Mittelalter tôr Oedeskerken; z. B. in der 1431 transsumirten Urkunde des Fürsten Heinrich I. von 1270 (Jahrb. VII, S. 301). Eben so oft kommt aber im 14. und 15. Jahrhundert die Form Oeteskerken vor, und da scheint es nicht übermäßig hergeholt, wenn man sie mit dem Familien=Namen Oete in Verbindung bringt, den manche Personen dieser Gegend führten, z. B. 1328 Peter und Hinrik Oete von Klein=Strömkendorf, 1347 Timmo und sein Bruder Hinrik Oete und deren Vetter Hinrik, 1356 Jochen Oete, wismarscher Bürger, 1366 Hinrik Oete von Questin, Nicolaus Oete von Klein=Strömkendorf, und annimmt, daß die neue Kirche auf die Hufe eines Oete erbauet sei, oder, was minder wahrscheinlich ist, daß ein Oete sich um das Zustandekommen des Baues besonders verdient gemacht habe. Daß Oete ein Familien=Name ist und diese selten zu Ortsbezeichnungen gebraucht werden, ist freilich wahr; allein einmal mag zur Zeit der Entstehung Oete noch Personen=Name gewesen sein. Es scheint ein Diminutiv von Otto zu sein, welcher Name sich ebenfalls als Familien=Name hier findet; es finden sich außerdem auch noch andere Beispiele, z. B. Preensberg und Mecekendorf.
Bei der Aufgrabung dieses Gefäßes waren gegenwärtig die Herren Dr. Crull und Apotheker Beckmann aus Wismar, und sind die letzteren Annahmen über die Etymologie des Namens von dem Herrn Dr. Crull entstanden.
Dreveskirchen, 4. Septbr. 1855.
C. T. Koch.



|



|
|
:
|
Zinnernes Hausgeräth von Wend. Waren.
Im J. 1855 wurden bei den Grabungen zwischen dem Goldberger See und dem Serrahn=See an der Mildenitz mehrere zinnerne Geräthe gefunden, welche sich durch Geschmack in Form und Verzierungen auszeichnen und deshalb für die


|
Seite 262 |




|
großherzogliche Alterthümer=Sammlung erworben wurden. Es sind 4 große Schüsseln, 3 kleinere Schüsseln, 3 Teller, 1 Leuchter und 1 Maaß. Beachtenswerth sind nur die Schüsseln, namentlich die großen. Das Geräth war ohne Zweifel Bauernbesitz und im Anfange des 17. Jahrhunderts gefertigt. Von den Schüsseln tragen 4 folgende eingravirte Namen: Hans Berent, Jacob Lemcke, Jochim Lutke, Christianus Mosolf 1611; aus der letztern Jahreszahl läßt sich die Zeit des Ankaufes entnehmen. Sicher wurden die Geräthe im dreißigjährigen Kriege hier verborgen. Die Schüsseln sind mit drei Schilden, Stadtwappen und Zinngießermarken, bald 2 und 1, bald 1 und 2, gestempelt. Sechs Schüsseln haben einen Schild mit zwei gekreuzten Bischofsstäben, also wohl das Wappen der Stadt Bützow, eine einen Schild mit einem Stier vor einem Baume, also das Wappen der Stadt Güstrow. Daneben haben die bützower Schüsseln folgende Zinngießermarken: drei einen Schild mit einer Rose und den Buchstaben C. D., eine einen gleichen Schild mit I. E., eine einen Schild mit drei Sternen und I. E., eine einen Schild mit einem Henkelkrug (= Krôß, daher noch der Name Stênkrôsz); die güstrowsche Schüssel hat als Zinngießermarke einen Schild mit einem Steinbock. Die Schüsseln sind also wohl alle in Meklenburg gemacht.
Von den drei Tellern haben zwei einen Schild mit zwei gekreuzten Schlüsseln (Riga, oder Regensburg?, oder das Erzbisthum Bremen oder das Bisthum Minden?) und einen Schild mit einem Henkelkruge und H. M., einer einen Schild mit einem Stadtthor und einer Jungfrau darüber, also Magdeburg, und einen Schild mit M. Der Leuchter hat einen Schild mit einem Löwen und einen undeutlich gewordenen Schild. Das Maaß ist nicht gestempelt.
Die sämmtlich wohl in Meklenburg gefertigten, nicht schweren Schüsseln zeichnen sich alle durch Schönheit, Geschmack und Leichtigkeit sowohl in der Form, als in der Verzierung aus, und geben redende Beweise von der großen Handwerkstüchtigkeit, welche noch kurz vor dem dreißigjährigen Kriege herrschend war, wie dies z. B. auch an der Töpferei häufig bemerkt werden kann, eben so von der großen Ausdehnung der Gewerbe, da z. B. Bützow wenigstens vier tüchtige Zinngießermeister hatte, welche ihre Erzeugnisse bis nach Goldberg hin (wahrscheinlich durch die Jahrmärkte) verkauften. Man kann nicht genug aufmerksam auf die Handwerkserzeugnisse des 16. Jahrhunderts und der nächsten Jahre sein.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 263 |




|
Ein kleiner zinnerner Krug,
von der Gestalt und mit den Reifenverzierungen der Krüge aus dem 14. und 15. Jahrhundert, gegen 3 1/2" hoch, gefunden in der Gegend von Bützow, erworben und dem Vereine geschenkt von dem Herrn Friedrich Seidel zu Bützow.
Bronze=Grapen.
Der Herr Portraitmaler Schacht zu Rostock besitzt einen kleinen mittelalterlichen Grapen aus Bronze, 4 3/4" hoch und im Durchmesser. Auf dem Rande steht in Conturen eingegraben die Inschrift:
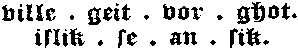
Rostock.
T. Rogge.
Silberschmuck von Niendorf.
Zu Gr. Niendorf bei Crivitz wurden beim Graben 20 Wittenpfennige der Städte Lübeck, Lüneburg und Hamburg aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts gefunden und mit denselben ein kleiner silberner Schmuck von der Größe der Pfennige, welcher so construirt ist, daß 6 Lilien von einem Knopfe in der Mitte nach einem vergoldeten Ringe gehen. Der Herr Pächter Krüger wandte diesen Fund dem Vereine zu.
Ein großes eisernes Messer
mit hölzernem Griffe, aus dem Mittelalter, ward in der Stadt Schwerin beim Legen der Gasröhren 4 Fuß tief gefunden und durch die Vermittelung des Herrn Kaufmanns Schnelle erworben.
Einen messingenen Siegelring,
aus dem 16. - 17. Jahrhundert, gefunden zu Brütz bei Goldberg, schenkte der Herr Jahn zu Güstrow. Auf dem Schilde steht ein halber Mann, der ein Schwert schwingt, zu jeder Seite ein Stern; über dem Schilde stehen die Buchstaben T. W.


|
Seite 264 |




|



|



|
|
:
|
II. Zur Baukunde
des christlichen Mittelalters.
Kirchliche Bauwerke.
Die Kirche zu Gr. Wokern.
Die Kirche zu Gr. Wokern bei Teterow ist eines der merkwürdigsten alten Gebäude in Meklenburg. Wir verdanken die Entdeckung dieser Kirche dem Herrn Ober=Appellationsgerichts=Copiisten Rogge zu Rostock, welcher im Sommer des J. 1855 von derselben saubere und getreue Zeichnungen aufgenommen hat; die Bedeutsamkeit dieser Erscheinung veranlaßte auch mich, dieselbe im Herbste des J. 1855 einer Prüfung an Ort und Stelle zu unterwerfen. Die nachfolgende Beschreibung ist daher doppelt und sicher verbürgt.
Die Kirche gehört zu den alten Feldsteinkirchen romanischen oder Rundbogen=Styls, von denen einige merkwürdige Beispiele in Meklenburg entdeckt sind. Sie ist von gleicher Bauart, wie die Kirche von Dambek oder Minzow bei Röbel (vgl. Jahrb. XV, S. 283 flgd.) und hat gewiß Aehnlichkeit mit der Kirche von Papenhagen bei Rambow, nicht weit von Malchin (vgl. Jahresber. VI, S. 103 flgd. und Lisch Maltzan. Urk. III, S. 262) gehabt, obgleich die letztere ganz Ruine geworden ist.
Die Kirche zu Gr. Wokern ist ganz von Granit=Feldsteinen erbauet, ohne daß irgendwo (mit Ausnahme der jüngern Wölbung des Schiffes) Ziegel angewendet wären. Das ganze Gebäude ist äußerst tüchtig aufgeführt, sehr wohl erhalten und zeigt


|
Seite 265 |




|
nirgends eine Spur des Verfalls. Die Ecken, die Thür= und Fensteröffnungen und die Gesimse sind von behauenen Granitfeldsteinen. Das Ganze, in alten, ehrwürdigen Verhältnissen, ist eine sehr befriedigende Erscheinung.
Die Kirche besteht aus einem vierseitigen Chor und einem oblongen Schiffe; der Thurm am Westgiebel ist ein neueres Bauwerk von Holz.
Der Chor ist ein Viereck, mit rechtwinklig angesetzter, grader Altarwand, und 26 1/2' lang, 21 1/2' breit, 25 1/2' (hamburger Maaß) hoch bis zum Scheitel des Gewölbes; die Mauern von Granitfeldsteinen sind 5' dick. Die Altarwand hat drei Fenster, die Südwand zwei Fenster und eine Pforte, alle im Rundbogen überwölbt. Die Nordwand hat auch zwei Fenster gehabt; als jedoch in etwas jüngern Zeiten, wahrscheinlich zugleich mit der Erbauung des Schiffes, an die Nordseite des Chors eine Sakristei angebauet ward, wurden die Fenster zugemauert und eine Sakristeithür durchgebrochen, welche jetzt wieder vermauert ist. Merkwürdig ist das kuppelartige Gewölbe des Chores, welches ganz aus unbehauenen Granitfeldsteinen in einer Dicke von 1 1/2' ausgeführt ist. Es hat keine Rippen und gleicht einem nicht ganz regelmäßigen und etwas unfertigen Kugelabschnitte. Rogge schreibt: "Das Gewölbe besteht aus 4 Kappen von Granitgerölle, 1 1/2 Fuß dick, welche gegen die Ecken der Umfassungswände Front machen, 2 Zoll hervorstehen und dadurch genöthigt sind, oben in kaum bemerkbaren Kehlen auf die Seiten dieses beinahe quadratischen Raumes zu stoßen, wodurch die Schildbogen auf denselben die Form einer Parabel erhalten". - Wenn auch die Construction aus 4 Kappen bestehen mag, so sind diese doch sehr wenig bemerkbar, und das ganze Gewölbe hat das Ansehen eines etwas unfertigen Kugelabschnittes. - Ein gleiches Gewölbe wird der Chor der Kirche zu Dambek gehabt haben, wie man noch an den hin und wieder stehenden Ansätzen sehen kann.
Wahrscheinlich ist dieser Chor die älteste Kirche, welche in den ältesten Zeiten allein stand, und war im Westen durch eine Wand (mit Thür) geschlossen. Als in etwas jüngern Zeiten das Schiff angebauet ward, ward diese Wand durchbrochen, wie es noch jetzt der im Uebergangsstyle gewölbte Spitzbogen des Triumphbogens zeigt.
Das Schiff ist jedenfalls etwas jünger, als der Chor, jedoch in den Ringwänden ganz in demselben Style ausgeführt; es ist 58' lang, 34 1/2' breit und 26 3/4' hoch; die Mauern sind 5' dick. Es hat an jeder Seite zwei Fensterpaare


|
Seite 266 |




|
(mit Ausnahme der westlichen Hälfte der Nordwand, welche wegen der Pforte nur ein Fenster hat) und in der Nordwand die Hauptpforte; eine Pforte in der Westwand ist jetzt zugemauert. Alle Thüren und Fenster sind im reinen Rundbogen überwölbt und eben so construirt, wie die Oeffnungen des Chores. Die nördliche Hauptpforte ist durchaus wohl erhalten; sie tieft sich rechtwinklig ein Mal ein und der überwölbende Halbkreisbogen ruht auf einem Gesimse, welches aus einem Plättchen und einer Höhlung gebildet ist. Die ganze Gliederung der Pforte besteht aus behauenen Granitfeldsteinen. - Eben so sind die glatt und schräge eingehenden Fenster construirt, welche im Rundbogen übewölbt sind. Dem Anscheine nach mag an den Fenstern in frühern Zeiten restaurirt sein. Die Pforten sind jedoch sicher von jeder Restauration unberührt geblieben.
Das Schiff der Kirche unterscheidet sich aber im Innern durch die Wölbung bedeutend von dem Chore. Das Schiff, welches durch einen starken Gurtbogen in zwei Theile getheilt wird, hat zwei Kreuzgewölbe, welche von Ziegeln aufgeführt sind; die Gewölbe haben Rippen, jedoch keine röhrenartige Schlußsteine, und sind etwas roh angesetzt. Diese Gewölbe sind gewiß alt, jedoch wahrscheinlich erst später, längere Zeit nach der Vollendung der Kirche, eingesetzt; ich kann sie nicht für ursprünglich und romanisch halten. Schon die Arbeit beweiset, daß sie später eingesetzt sind.
Das Alter der Kirche zu Gr. Wokern zu bestimmen, ist sehr schwer, da es in Meklenburg für diesen Fall an sichern Anhaltspuncten zur Vergleichung fehlt. Die bekannten übrigen Rundbogenkirchen sind alle von Ziegeln ausgeführt und liegen in den Bisthümern Ratzeburg und Schwerin, welche einen mächtigen Einfluß von Westen her, von Braunschweig, Hildesheim, Amelungsborn u. s. w., nicht zurückweisen können. Die Kirchen, welche hier zur Vergleichung kommen können, die Kirchen zu Dambek (oder Minzow) und Papenhagen liegen in andern Diöcesen und können einen Einfluß von Osten und Süden her nicht verleugnen. Die Kirche zu Wokern liegt im Bisthume Camin; die Kirche, welche ihr ganz gleich ist, ist die Kirche zu Dambek, welche im Bisthume Havelberg liegt. Die Kirchen zu Wokern und Dambek sind ganz gleich, an Styl, Bauart, Form, Größe, Material und Wölbungsweise. Die Kirche zu Dambek hat außer der romanischen Bauweise auch noch romanische Malerei in der Sakristei. Wenn nun auch der Chorschluß beider Kirchen gradlinig ist, so scheinen sie beide doch schon am Ende des 12. Jahrhunderts erbauet zu sein; wenn auch nicht die Kirchen ganz in dieser Zeit erbauet wurden, so ward doch vielleicht der Chor beider


|
Seite 267 |




|
Kirchen bei der Einführung des Christenthums errichtet und das Schiff später, jedoch nicht viel später, angebauet. Die beiden Chöre mögen gegen das Ende der romanischen Baustylsperiode gebauet sein. - Mehr Anhalt würde vielleicht die Kirche zu Papenhagen geben, wenn sie nicht in Ruinen läge. Diese Kirche ist eben so gebauet gewesen, wie die beiden andern Kirchen, hat jedoch in dem Fundamente eine halbkreisförmige Apsis als Chorschluß; daher scheint diese Kirche etwas älter zu sein, als die beiden andern. Zwar wird das Dorf Domherrenhagen oder Papenhagen dem im J. 1226 gestifteten Domherrenstifte zu Güstrow erst im J. 1240 als Hägerdorf verliehen (vgl. Lisch Maltzan. Urk. III, S. 262, und Lisch Hahn. Gesch. I, B, S. 54); aber die Kirche kann deshalb viel länger gestanden haben und vielleicht grade ihrer Ehrwürdigkeit wegen dem Dom=Capitel verliehen sein.
Jedenfalls ist die Bekanntwerdung dieser romanischen Feldsteinkirchen im östlichen Meklenburg von großer Wichtigkeit für die Kunstgeschichte Meklenburgs.
Merkwürdig ist es, daß diese drei romanischen Feldsteinkirchen des östlichen Meklenburgs in alten Zeiten Pfarr= und Mutterkirchen waren, aber alle sehr früh Tochterkirchen geworden sind, ja die Kirche zu Papenhagen ganz Ruine und die Kirche zu Dambek halb Ruine. Wokern war eine Pfarrkirche landesherrlichen Patronats. Im J. 1364 war Johannes Rumpeshagen Pfarrer zu Gr. Wokern ("dominus Johannes Rumpeshagen plebanus in Wokert"). Noch lange nach der Reformation war Wokern eine Pfarrkirche und ward erst im 17. Jahrhundert mit der Pfarrkirche zu Klaber vereinigt, welche ritterschaftlichen Patronats war. Im J. 1302 stiftete Deneko von Cröpelin mit seinen nächsten Verwandten eine Vikarei in der Kirche zu Wokern und dotirte sie mit der Primermühle.
An alten Kunstsachen besitzt die Kirche nichts, da sie vor einigen Jahren restaurirt und völlig ausgeräumt ist. In der Sakristei steht das zurückgesetzte alte Altarblatt aus Eichenholz geschnitzt, die Kreuzigung darstellend, eine Arbeit von nicht hohem Alter und keinem besondern Kunstwerth. Vor der nördlichen Hauptpforte liegen zwei halbmuldenförmige Mühlsteine von Granit aus der Heidenzeit, welche vielleicht im Mittelalter zu Weihbecken benutzt gewesen sind.
G. C. F. Lisch,


|
Seite 268 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Lohmen
bei Dobbertin gehört zu den älteren Landkirchen Meklenburgs. Chor, Schiff und Thurm sind aus Feldsteinen erbauet, mit behauenen Sockeln und Ecken.
Der Chor hat in der Ostseite 3 und in der Südseite 2 gekuppelte, schmale, schräge eingehende, aus Ziegeln construirte Fenster im Uebergangsstyle, welche unter einem Rundbogen stehen, ähnlich der Kirche zu Grevismühlen. Die Nordseite des Chores hat, wegen des Anbaues der Sakristei, nur Ein Fenster. Durch die Einfassung der Fenster durch eine Rundbogennische wird dieser Bau in eine sehr alte Zeit, etwa in das Jahr 1220, hinaufgerückt.
Das Schiff hat dreitheilige Spitzbogenfenster aus dem 14. Jahrhundert.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Alt=Bukow
ließ einen alten, merkwürdigen Bau vermuthen, da Bukow in der Geschichte der Bekehrung Meklenburgs eine hervorragende Stellung einnimmt, indem z. B. bei der Stiftung des Klosters Neukloster oder vielmehr der Wiederaufrichtung des Nonnenklosters Parkow zu Kussin, später Sonnenkamp genannt, im J. 1219 der Priester Walther von Bukow der erste in der Reihe der anwesenden Priester ist und vor den Priestern von Rostock, Lübow und Neuburg steht. Die Erwartung ward aber durchaus getäuscht, indem sich die Kirche als einen jungen, gewöhnlichen Bau mit vielen Unregelmäßigkeiten aus den schlechtern Zeiten des 15. Jahrhunderts zeigte. Der Thurm ist allerdings von großen Verhältnissen. An Alterthümern besitzt die Kirche nichts weiter, als ein ungewöhnlich hohes und schlankes, jedoch einfaches Kapitäl aus Kalkstein, von viereckiger Grundform mit abgefasten Ecken, etwas über 2 Fuß hoch, im Durchmesser wohl kaum ein Drittheil der Höhe haltend; dieses Kapitäl stammt von einem gewiß sehr merkwürdigen, alten Bau. Es steht gegenwärtig im Innern der Kirche am Seiteneingange auf dem Fuße eines ebenfalls alten Taufsteins aus Kalkstein. Diese beiden Trümmer sind wohl die einzigen und letzten Reste aus der alten Zeit Bukows.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 269 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Neu=Bukow.
Bei Gelegenheit der Beschreibung der Kirche zu Neuburg 1 ) im XVIII. Bande dieser Jahrbücher, S. 288, ist schon auf die Kirche zu Neu=Bukow 2 ) aufmerksam gemacht worden. Ein neuer Besuch derselben in Gesellschaft des Herrn Archivars Dr. Lisch, der sie in seiner Eigenschaft als Conservator inspicirte, macht jetzt eine Beschreibung möglich.
Die Kirche zu Neu=Bukow besteht aus einem Chor, einem Langhause mit Seitenschiffen und einem Thurmgebäude. Anbauten sind jetzt nicht vorhanden.
Der Chor ist von länglicher Gestalt und rechtwinklig geschlossen. Der Fuß besteht aus Granit. Das einfach gebildete Fußgesimse einschließend, laufen auf den Ecken Lissenen empor, an die sich oben als Fries eine doppelte Stromschicht schließt. Die drei Fenster der Altarwand, deren mittleres wenig höher ist, als die beiden seitlichen, sind schmal, mit schräger Laibung, mit einem Rundstabe eingefaßt, und mit abwechselnd glasurten Ziegeln gemauert. Der Giebel, dessen Einfassung schlecht restaurirt ist, ist ganz glatt, aber durchaus mit schräge, im Zickzack, statt horizontal gelegten, abwechselnd glasurten Steinen ausgezeichnet tüchtig aufgeführt 3 ). Nach Süden hat der Chor zwei Fensterpaare angegebener Bildung, nach Norden eins, da dort früher eine Sakristei oder, wie es noch in Neuburg heißt, "Gar[w]kamer" angebaut war. Auf der Südseite führt eine hübsch ornamentirte Pforte im Uebergangsstyle in den Chor.
Das Langhaus hat einen sehr hohen Unterbau von gehauenem Granit oder ist vielmehr mit solchem bekleidet. Auf jeder Ecke läuft von diesem eine Lissene empor, die sich auf den Langseiten in einem treppenartig ausgeschnittenen Bande vereinigen; der Grund unter diesem Bande ist geputzt und wird nach unten durch eine Stromschicht begränzt, welche auf den freien Theilen der Giebelseiten den Fries allein bildet. Oberhalb des Frieses sind die drei letzten Schichten über einander vorgekragt


|
Seite 270 |




|
und machen so das Dachgesims aus. Die südliche Thür befindet sich, wie die nördliche und die des Chores, in einem abgetreppten, mit abwechselnd glasurten Ziegeln versehenen Vorsprunge. Der Bogen ist der des Uebergansstyles, die Gliederung der Schmiege kräftig und wohlgeordnet, und mit Kapitälen versehen. Der nördlichen Thür fehlen diese; sie hat nur ein einfaches Kämpfergesims und ist bloß mit Viertelsäulen gegliedert. Auf beiden Seiten des Langhauses sind zwei Fenster angebracht, die aber nichts mehr vom Uebergangsstyle haben. Sie sind nicht schmal, sondern wohl vier bis fünf Fuß weit, nicht tief liegend, sondern springen nur einen Stein zurück, ihre Schmiege ist nicht schräge, sondern der vorspringende Stein abgerundet, und der Bogen, der sie schließt, ist ein kräftiger Spitzbogen, kurz man könnte glauben, daß sie im 14. Jahrhundert eingesetzt wären, wovon sich aber nicht die geringste Spur findet. Ob das Stabwerk ursprünglich so war, wie es jetzt ist, läßt sich nicht entscheiden, da es jüngst erneuert ist, jedoch, wenn ich nicht irre, dem früheren gleich. Im Allgemeinen machen sie der reichen und kräftigen Ornamentation des übrigen Baus gegenüber einen sehr nüchternen Eindruck. An den freien Theilen der beiden Giebelseiten finden sich je ein schmales Fenster von ziemlich gleicher Gliederung. Der östliche Giebel, der früher beträchtlich höher war, war mit Blenden belebt. Das Innere des Chores wird von Kreuzgewölben überspannt, die durch einen breiten Gurtbogen getrennt sein sollten, nach der Bildung der Wandpfeiler zu urtheilen; das jetzige Gewölbe scheint nicht dem ursprünglichen Bau anzugehören und mag, wie die des Langhauses, wo auch die Verbindung nicht ganz organisch ist, erst nach Vollendung des ganzen Baues von einem andern Meister ausgeführt sein. Die Fenster der Altarwand sind, wie außen, mit einem Stabe eingefaßt, nicht aber die seitlichen Fenster. Die Wände sind in größter Breite, jedoch nur um einen Stein vertieft.
In der nördlichen Wand sieht man die zur ehemaligen Sakristei führende Pforte, die im Rundbogen gewölbt ist und, ohne Schmiege, sehr einfach ornamentirt ist, indem an der Kante volle rothe Steine und glasurte sogenannte Flachecken wechseln. Das Triumphthor ist ganz schlicht gehalten; die rechtwinkligen Pfeiler sind etwas weiter als der Bogen, dessen schlichtem Kämpfer ihre letzten Schichten sich schräge nähern, worin man eine Reminiscenz an die romanischen Pilaster sehen könnte.
Das Langhaus besteht aus drei gleich hohen Schiffen, deren äußere die halbe Breite des mittleren haben, welches ziemlich doppelt so lang als breit ist. Die Schiffe werden von zwei großen Pfeilern getrennt. Diese haben die Grundform eines gleichschenkligen Kreuzes mit starken Dreiviertelsäulen in den


|
Seite 271 |




|
Winkeln; ihre Gesimse sind einfach aber kräftig gegliedert. Die Scheide= und Gurtbogen haben ein rechtwinkliges Profil. Auch hier sind die Wände flach vertieft, doch sind hier die Seiten der Nischen abgerundet, während ihr Bogen eine volle Kante hat. Die Fensterlaibung ist auch hier mit Ziegeln mit abgerundeten Ecken gebildet, nur daß sie tiefer ist als außen, indem sie zwei abgerundete Ecken mehr hat.
Während so Chor und Kirche dem späten Uebergangsstyle angehören, ist der Thurmbau, wie so vielfach, ein Werk des 15. Jahrhunderts, nüchtern und einfach gehalten, aber von guter Anordnung, und macht namentlich von Nordwesten her gesehen mit seinem hohen Helm einen sehr stattlichen Eindruck. Außer seinem Styl im Allgemeinen beglaubigen insbesondere noch einige Ornamentziegel, die in halber Höhe angebracht sind, sein Alter. Sie stellen die h. Jungfrau und den S. Nicolaus vor und finden sich ebenfalls an dem sogenannten Leichenhause von S. Nicolai zu Wismar, welches 1437 erbaut worden ist. Uebrigens ist die Bukowsche Kirche ebenfalls diesem Heiligen gewidmet.
Die ganze Einrichtung der Kirche ist aus jüngerer Zeit und schlecht, bis auf die Kanzel, die aus Eichenholz im frühen Rococostyle ziemlich gut geschnitzt ist; außerdem sind noch einige bronzene Wandleuchter da und Stangenleuchter aus dem siebenzehnten Jahrhundert, so wie ein älterer Kirchenstuhl mit dem v. d. Lüheschen und Hahnschen Wappen, bezeichnet A. V. D. L. und J. H., 1571. Aus früher Zeit findet sich nur ein vortreffliches kleines Weihrauchfäßchen (jetzt im Antiqarium zu Schwerin).
Von Malerei auf den Wänden ist nichts wahrzunehmen; ob sich welche auf den Gewölben und Bogen findet, muß dahin gestellt bleiben.
Alte Leichensteine sind noch vier vorhanden. Zwei, die schon sehr vertreten sind, liegen vor dem Altare. Man lies't noch:

Dieser ist glatt. - Der zweite zeigt unter einem Baldachin das Bild eines Priesters.
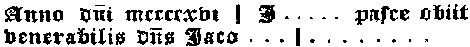
Zwei andere Steine liegen zwischen den Thüren des Langhauses, ebenfalls den Fußtritten sehr ausgesetzt, sind aber weniger mitgenommen.


|
Seite 272 |




|
Auf dem einen lies't man:
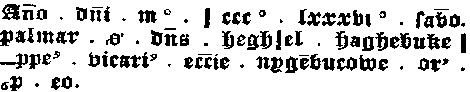
(Anno domini M . CCC . LXXXVI, sabbato palmarum, obiit dominus Heghel Haghebuke, perpetuus vicarius ecclesie Nygenbucowe. Orate pro eo.)
auf dem andern:

(Anno domini MD — — — obiit venerabilis vir dominus Theodidericus Runghe, hujus ecclesie vicarius et procurator horarum.)
Der Stein 1 ) liegt halb unter Stühlen und konnte daher jetzt nicht vollständig gelesen werden.
C. D. W.


|
Seite 273 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Neu=Bukow,
welche im Vorstehenden beschrieben ist, wird im zweiten Viertheil oder um die Mitte des 13. Jahrhunderts, jeden Falls nicht später, erbauet sein. Wahrscheinlich ward sie bei der Gründung der Stadt Neu=Bukow aufgeführt.
ist noch sehr dunkel und es ist äußerst wenig Material zur Geschichte der Stadt zusammengebracht. Sowohl bei der Stadt, als im großherzoglichen Archive fehlt es ganz an alten Stadturkunden, da sie verbrannt sind. Das Material muß also aus einzelnen Andeutungen zusammengebracht werden. Die älteste, die Stadt betreffende Urkunde ist vom Jahr 1304. Aber schon im J. 1270 ist eine doberaner Urkunde in Neu=Bukow verhandelt ("Acta sunt in Noua Buchowe, data Wismarie 1270 in die s. Processi et Martiniani"=2. Julii); vgl. Westphalen Mon. ined. III, p. 1512. Die Stadt wird jedenfalls aber noch älter sein. Das Lübeker Urkunden=Buch I, S. 204, Nr. 222, giebt eine Urkunde, durch welche eine Zusammenkunft in der neuen Stadt Bukow ("in novo opido Bukow") angesetzt wird; die Urkunde giebt leider das Jahr nicht an, aber die Herausgeber setzen sie in das Jahr 1255. Der ungewöhnliche Ausdruck: "in der neuen Stadt Bukow", statt in der "Stadt Neu=Bukow", scheint darauf hinzudeuten, daß die Stadt damals vor nicht langer Zeit gegründet war. Man wird mit der Gründung der Stadt und der Kirche wohl in das zweite Viertheil des 13. Jahrhunderts hinauf kommen.
Unmittelbar bei der Stadt Neu=Bukow liegt ein Burgwall, welcher ohne Zweifel der Stadt den Ursprung gegeben hat. Der Burgwall hat eine sehr bedeutende Ausdehnung und Höhe, ist aber an einer Seite sichtbar zum großen Theile abgegraben und sonst als Acker= und Gartenland viel durchgearbeitet, wie er auch gegenwärtig als Garten verpachtet ist. An einer Seite ist aber seine mit Bäumen und Buschwerk bewachsene Höhe sehr bedeutend. Er ist an einigen Seiten von Wiese und Wasser begrenzt; an einer Seite sind die Wiesen sicher durch Abtragung eines Theiles des Burgwalles ausgefüllt. Der Wall trug früher eine fürstliche Burg, und diese wird im 14. und 15. Jahrhundert in den Urkunden öfter genannt.


|
Seite 274 |




|
Die Burg Bukow war aber schon eine bekannte, wie es scheint, häufig besuchte Residenz der Fürsten von Meklenburg, in deren Nähe das erste Feld=Nonnenkloster zu Parchow (später unter dem verdeutschten Namen Sonnenkamp zu Kussin=Neukloster, wieder aufgerichtet) gestiftet ward. Am 2. August 1220 hob der Fürst Borwin I. zu Bukow ("Bukowe") das Strandrecht (vgl. Lübeker Urk. Buch I, Nr. 21) und den dassower Brückenzoll auf (vgl. das. Nr. 22), unter den Zeugen der letztern Urkunde steht der Priester Walther von Bukow ("sacerdos magister Walterus in Bukowe") obenan. Am 9. Julii 1231 war im Gefolge des Fürsten Johann von Meklenburg unter den Rittern auch der Vogt Günther von Bukow ("Gunterus aduocatus de Bucowe": Rudloff Urk. Lief. S. 25). Es geht hieraus hervor, daß Bukow damals, als nahe an der Grenze des Landes Rostock oder Kessin gelegen, eine Burg von Bedeutung war.
Ich glaube annehmen zu können, daß die alte Burg Bukow der bei der Stadt Neu=Bukow gelegene Burgwall ist, der noch in die Wendenzeit hineinreichen mag. - Alt=Bukow wird wohl immer nur das Bauer= und Pfarrdorf zum Burgwalle gewesen sein.
Der Strich des alten Landes Meklenburg von der Burg Meklenburg bis Doberan, der Meeresküste parallel, ist überhaupt der Beachtung sehr werth und sehr merkwürdig. Hier lagen fast in grader Linie von ungefähr 3 Meilen die wichtigen Burgen Meklenburg, Ilow, Neuburg, Bukow, daneben das älteste Nonnenkloster Parchow und darüber hinaus das älteste Mönchskloster Doberan.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Taufstein von Neuburg.
Die merkwürdige und interessante Kirche zu Neuburg (vgl. Jahrb. XVIII, S. 285 flgd., und VII, S. 73) hat gar kein altes Kirchengeräth mehr. In den Jahrb. XVIII, S. 286 ist erwähnt, daß zur Schwelle der Thurmpforte das Fragment eines Taufbeckens benutzt sei; es ist ein flach convex abgerundetes Becken aus bläulich weißem Kalkstein, mit Verzierungen eines Brillantstabes, welches umgekehrt ist und mit der abgerundeten Ecke die Schwelle bildet. - Bei dem Bau des Schulhauses in den neuesten Zeiten wurden aus den alten Fundamenten große Stücke der Seitenwände dieses Beckens ausgegraben, und da sie nicht recht paßten, von den Arbeitern in kleinere Stücke zerschlagen und diese theils wieder vermauert, theils zu einem Haufen von Pflastersteinen an der Dorfstraße geworfen. Hier fand ich im Herbste


|
Seite 275 |




|
1855 noch vier größere Stücke, etwa eine Spanne hoch, einige Spannen breit und etwa 1/2 Fuß dick, nach innen ausgehöhlt. Das Becken ist sehr alt und sehr kunstreich bearbeitet, vielleicht das kunstreichste im Lande. So viel sich noch erkennen läßt, war das Becken sehr groß und achteckig, geradwandig und ganz mit Verzierungen bedeckt. An den Ecken stehen runde Pilaster, auf jeder der 8 Ecken steht eine Nische, welche mit einem (aus zugespitzten Vierecken gebildeten) Brillantstabe eingefaßt ist. In jeder Nische steht eine Heiligenfigur in gleicher Fläche mit der Seite, nur durch eingegrabene Linien gezeichnet, auf vertieftem Grunde. Da der Stein auch immer queer durch zerschlagen ist, so hat sich keine ganze Figur mehr zusammenfinden lassen; jedoch läßt sich die angegebene Construction noch aus den Bruchstücken entnehmen. Der Taufstein war gewiß sehr alt und schön, vielleicht ein kostbares Kirchengeräth des Fürsten Johann des Theologen aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als seine Gemahlin Luitgard noch häufig auf der Neuburg residirte.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die zweischiffigen Kirchen zu Mestlin und Tarnow.
Wiederholt ist in unsern Jahrbüchern mehrerer merkwürdiger meklenburgischer Kirchen gedacht, welche nur Eine Reihe von Pfeilern, also zwei Schiffe haben. Bisher sind Kirchen dieser Art entdeckt zu Schlagsdorf, Ankershagen, Schwinkendorf, Gnoien und Reknitz (vgl. Jahrb. XII, S. 462, und XIII, S. 412); zu diesen kommen jetzt noch hinzu die Kirchen zu Mestlin und Tarnow. Betrachtet man diese Kirchen genau, so haben sie in den Verhältnissen alle ungefähr dieselbe Construction; alle sind hoch und schlank und von schönen Verhältnissen und scheinen ungefähr aus der besten Zeit des 14. Jahrh. zu stammen. Es scheint aber diese seltene Anlage nicht ursprünglich entworfen gewesen zu sein, sondern es ist wahrscheinlich, daß die Pfeiler erst bei einer spätern Wölbung eingebracht wurden. Ursprünglich mögen diese Kirchen eine Balkendecke gehabt haben. Als man aber im 14. Jahrhundert mehr in die Höhe strebte und mehr Gewölbe bauete, erhöhete man wohl oft die Ringmauern und wölbte den innern Raum. Nun waren diese für Ein Gewölbe zu weit und für drei Gewölbe zu schmal; man wählte also den Ausweg, zwei Gewölbe und Eine Reihe von Pfeilern zu bauen und dadurch zweischiffige Kirchen herzustellen.


|
Seite 276 |




|
Bei der Kirche zu Tarnow läßt sich dieser Gang des Baues ziemlich klar nachweisen. Für die katholischen Zeiten hatte diese Einrichtung grade nichts Unbequemes, um so weniger, da solche Kirchen durch diese Theilung gleich in die Männer= und Frauenseite getheilt ward.
Die Kirche zu Mestlin.
Die Kirche zu Mestlin 1 ) bei Dobbertin besteht aus Chor, Schiff und Thurm.
Der Chor hat eine quadratische Grundform, mit grader Altarwand, und ist von Feldsteinen (Granitquadern) erbauet; der Sockel und die Ecken sind regelmäßig behauen. Die schmalen Fensteröffnungen haben schräge eingehende, glatte Laibungen; ob sie rund oder im Uebergangsstyle leise gespitzt gewölbt sind, läßt sich nicht mehr genau erkennen, da in den Fensterwölbungen wohl schon oft restaurirt ist. Der Giebel hat Rundbogennischen. Der Chor stammt also sicher aus der Zeit, in welcher unsere meisten Kirchen gebauet sind, ungefähr aus dem J. 1230.
Das Schiff ist ein hohes, schönes Gebäude im Spitzbogenstyle, von sehr großen Ziegeln, und hat dreitheilige Spitzbogenfenster. In der Mitte des Schiffes stehen zwei schlanke Pfeiler, welche schöne Spitzbogengewölbe tragen. Dadurch wird die Kirche in zwei Schiffe getheilt. Die Pfeiler, welche Sockel haben, sind achteckig und so gestellt, daß 4 Ecken unter den Gewölbescheidungen stehen und mit Diensten bekleidet sind; es laufen also nach den 4 Weltgegenden 4 Dienste an den Pfeilern hinauf. Die in jüngern Zeiten in schwarz, grau und weiß bemalten Gewölberippen haben einen eigenthümlichen, sonst noch nicht beobachteten Schmuck, indem sie mit zahlreichen Scheiben oder Rippenschilden besetzt sind. Diese Scheiben, von 10 " Durchmesser und ungefähr l " Dicke, sind von gebranntem, hellgelben Thon und mit verschiedenen Reliefs, wie Sternen, Kreuzen, Rosetten u. s. w., verziert, welche immer mit verschiedenen Farben bemalt sind. Die Südpforte ist von 6 Wulsten eingefaßt und von abwechselnd schwarzen, grünen und rothen Ziegeln aufgeführt. Das Schiff wird ungefähr aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammen oder um diese Zeit auf die jetzige Weise eingerichtet sein.
Die Pforte im Thurme ist ebenfalls aus hellgrün glasurten und rothen Ziegeln aufgebauet.


|
Seite 277 |




|
Die Kirche zu Tarnow.
Die Kirche zu Tarnow bei Bützow ist ein hohes, schönes Gebäude. Die ganze, von kräftigen, großen Ziegeln erbauete Kirche, außer dem Thurme, bildet ein großes Rechteck, ohne äußerliche Abgrenzung eines Chores, mit grader Altarwand. In der Mitte der Kirche stehen 3 Pfeiler, welche die 8 Gewölbe der Kirche, also an jeder Seite 4 Gewölbe, tragen; die ganze Kirche wird hiedurch in zwei Schiffe getheilt. Die Pfeiler sind achteckig (ohne Dienste) und niedrig und die Gewölberippen setzen sich ohne Vermittelung auf die Pfeiler. Die schönen Gewölbe sind spitzbogig. Die Pforten sind kräftig und schön gegliedert; namentlich ist die westliche Pforte der Südwand sehr schön und reich an Gliederungen. Die dreitheiligen Fenster der Seitenwände sind im Spitzbogen construirt. Die Kirche, wie sie jetzt ist, stammt wohl aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. - Früher hatte die Kirche wahrscheinlich eine andere Einrichtung, als sie noch nicht gewölbt war, also noch keine Pfeiler in der Mitte hatte. Dies sieht man deutlich an der Ostwand. In den ältesten Zeiten hatte die Kirche Ein großes Fenster in der Mitte der Wand. Als man aber die Pfeiler und die Gewölbe in die Kirche bauete, mußte man einen Strebepfeiler in der Flucht der Pfeiler, also an die Mitte der Ostwand, setzen, um die Gewölbe zu stützen. Man mauerte also das Fenster in der Mitte der Altarwand zu, welches überdies zum Theil durch die Pfeiler verdeckt worden wäre, und setzte einen Strebepfeiler dahin. Eben so setzte man an jede Ecke der Altarwand einen Strebepfeiler; man sieht an dem Ziegelverbande, daß alle diese Strebepfeiler in jüngern Zeiten angebauet sind. Statt des einen Fensters brach man nun zwei Fenster in die Ostwand, so daß am Ende eines jeden Schiffes ein Fenster steht; diese Fenster sind zweitheilig und stehen nicht regelmäßig unter den Gewölben. Aus allen diesen Umständen erkennt man deutlich, daß die Wölbung zu zwei Schiffen jüngern Ursprunges ist, als die Anlage der Kirche.
Das Thurmgebäude ist ein ziemlich hoher Bau, ungefähr 100 Fuß hoch, und in verschiedenen Zeiten gebauet. Das untere Drittheil ist aus Feldsteinen erbauet und stammt wohl noch aus der Zeit des ersten Baues. Die oberen zwei Drittheile sind aus Ziegeln aufgeführt. In jeder Seite steht eine schmale, spitzbogige Nische, welche von oben bis unten reicht und in welcher drei Schallöffnungen über einander stehen.
Das Innere der Kirche ist jetzt ganz ausgeweißt. Aus mehrern Stellen, wo die Kalktünche abgefallen ist, sieht man deutlich, daß die Gewölbekappen auf goldgelbem Grunde


|
Seite 278 |




|
bemalt sind; dies läßt auf eine schöne Malerei schließen, welche, nach den Farbetönen, vielleicht der in der Bibliothek zu S. Katharinen in Lübek ähnlich gewesen ist. Da die Kalktünche sehr lose ist, so ist es wahrscheinlich, daß sie vor nicht sehr langer Zeit aufgebracht ist. Die vier mittleren Gewölbe haben noch Gewölbeschilde: die beiden östlichen: vom Altare aus gesehen rechts mit dem Wappen der v. Bülow (von dem Gute Prützen eingepfarrt), links mit dem Wappen der v. Blücher; die beiden westlichen: rechts mit einem Agnus Dei, links mit einem Adler. Die Schilde sind nur gemalt und ohne Reliefs und hiernach und nach den matten, verblichenen Farben wohl nicht alt.
Der Altar ist ein Flügelaltar aus der jüngsten katholischen Zeit und von schlechter Arbeit. Das Mittelstück enthält in der Mitte Christum am Kreuze mit Maria und Johannes Ev. und in abgesonderten Nischen in großen Figuren: zur Rechten Johannes d. T., zur Linken wahrscheinlich die H. Katharine, da die weibliche Heilige noch ein Bruchstück von einem Attribute in den Händen hält, welches einem Rade ähnlich sieht. Die Flügel sind queer getheilt. In jeder der 4 Abtheilungen stehen 4 Figuren. Zunächst dem Mittelstücke stehen 4 weibliche Heilige: zur Rechten, neben Johannes d. T., oben eine Heilige, welche auf jedem Arme ein Kind trägt, die H. Anna (?), unten die H. Gertrud mit einem Hospitalmodelle im Arme, zur Linken, neben der H. Katharine, oben eine gekrönte Jungfrau, der die Attribute fehlen, wahrscheinlich die H. Margarethe (?), unten die H. Barbara mit einem Thurme. Die Heiligen Katharine, Margarethe und Barbara gehören zu den Nothhelfern. Die übrigen Figuren, in jeder Reihe 3, sind die 12 Apostel, denen aber schon zum größern Theile die Attribute fehlen. Die Rückseiten der Flügel sind mit Malereien bedeckt, welche zwar wohl erhalten, aber schlecht gemalt sind.
Am Westende steht ein schöner Taufstein, der jetzt wieder in Gebrauch kommen wird. Der runde, einfache Fuß ist aus Granit. Die Schale ist aus Kalkstein und mit sehr guten, kleeblattförmigen, architektonischen Verzierungen bedeckt; sie stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 279 |




|



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Retgendorf
und
die Kapelle zu Buchholz.
Die in schöner Lage auf den Ufern des schweriner Sees liegende Kirche und Pfarre zu Retgendorf ward im J. 1241 gegründet. Der Bischof Theoderich von Schwerin (1239 - 1247) sagt in der Urkunde 1 ) vom 28. Decbr. 1241, durch welche er die Pfarre dotirt, daß er die Kirche, welche auf dem Grund und Boden der verwittweten Gräfin Audacia von Schwerin erbauet sei, geweihet habe ("quod nos vocati ad ecclesiam in Retkendorpe dedicandam"). Da der Priester aber noch nicht bedacht war, so vermochte der Bischof die Gräfin, daß sie zur Unterhaltung des Pfarrers 2 Hufen in Retgendorf hergab; diese bestätigte der Bischof, in Gegenwart des Grafen Gunzelin von Schwerin, durch die erwähnte Urkunde als Pfarrgut und bestimmte zugleich den Pfarrsprengel, indem er die Dörfer Flessenow, Schlagstorf, Tessin, Liessow und Buchholz, wo damals schon eine Kapelle gegründet war ("capellam in Bokholte fundatam") dazu legte. Die Kirche ist also ohne Zweifel im J. 1241 fertig geworden und geweihet, da die Urkunde erst am Ende d. J. gegeben ist und der Bischof, der kaum ein Jahr lang den Hirtenstab geführt hatte, wohl innerhalb eines Jahres die Dotirung der Pfarre betrieben haben wird.
Die jetzt stehende, eine Restauration erwartende Kirche zu Retgendorf ist aber nicht mehr jene alte, im J. 1241 geweihete, sondern eine etwa hundert Jahre später erbauete Kirche. Die ganz von Ziegeln aufgeführte Kirche ist, ohne Spur von einem ältern Bau, im ernsten Spitzbogenstyl des 14, Jahrhunderts, mit kräftigen Strebepfeilern und gothischen Thür= und Fensteröffnungen und Gewölben aufgeführt; vielleicht ist sie im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts erbauet. Sie bildet ein Oblongum mit einem dreiseitigen Chorschluß und ist drei Gewölbe lang. Der Thurm ist nur eine Etage hoch von Ziegeln hinaufgeführt.
Das Innere der Kirche ist jetzt überweißt, stand aber, nach sichern Spuren, früher im Rohbau, wie gewiß alle Kirchen des Spitzbogenstyls. An den Mauerpfeilern unter dem Triumphbogen sind an jeder Seite viereckige Flächen geputzt, sicher zur Aufnahme von Malereien, von denen der Herr Architekt Stern auch noch Spuren entdeckt hat.


|
Seite 280 |




|
Das Schnitzwerk dieser Kirche ist sehr beachtenswerth.
Der Altar besteht aus einem steinernen Tische, welcher mit einer Platte aus polirtem Stuck bedeckt ist, in welcher noch die 5 bischöflichen Weihkreuze in etwas zierlichen Formen stehen.
Der Altarschrein ist ein einfacher Flügelaltar. Die Einrahmung und das geschnitzte Laubwerk ist jung, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts; einige Seitenverzierungen sind ganz jung. Die in den Rahmen stehenden Holzschnitzwerke sind aber von großem Werthe. Sie stellen, in der Ansicht nach dem Altare hin, dar:
| Die Verkündigung | Die Kreuzigung | Die Anbetung |
| Mariä. | Christi. | der H. Drei Könige. |
Alle diese Holzschnitzwerke sind von großer Schönheit; die Figuren sind lang und von edler Bewegung, namentlich in der Verkündigung Mariä, und das Ganze macht einen befriedigenden Eindruck. Offenbar stammen diese Werke wenigstens aus der Zeit der Erbauung der jetzt stehenden Kirche, wenn sie nicht noch älter sind, was wahrscheinlich ist; für die jetzige Umrahmung sind sie nicht gemacht, da sie nicht genau hineinpassen, und schon nach dem Style nicht. Diese Werke gehören zu den bessern Schnitzwerken im Lande. Leider sind sie in neuern Zeiten mit schlechten Farben überpinselt. - Die Rückwände sind nicht bemalt.
Auf dem Balken unter dem Triumphbogen steht ein Crucifix, mit Maria und Johannes Ev. zu den Seiten, ebenfalls ein Werk aus guter, atler Zeit, in sehr passenden Verhältnissen und von guter Wirkung.
An der nördlichen Seitenwand steht eine Kreuztragung in ziemlich großen Verhältnissen, ebenfalls ein gutes Werk aus alter Zeit; der das Kreuz tragende Christus ist eine große, ernste Figur, die beiden Seitenfiguren sind nicht so gut.
Ein Epitaphium der Familie v. Sperling und einige Leichensteine sind aus der Zeit der neuern Geschichte.
Die Kirche hatte eine Pforte an jeder Langseite und eine Thurmpforte. Von den im guten Spitzbogenstyle erbaueten Pforten ist die südliche zugemauert, die nördliche, dem Pfarrhofe gegenüber, ist die Haupteingangspforte. Die Tür in dieser Pforte stammt sicher noch aus der Zeit der Erbauung der Kirche. Sie ist von Eichenholz und nach dem Innern der Kirche hin durch eine merkwürdige Belegung mit Riegeln in Form zweier Achtecke verbunden. Die Thür füllt die ganze spitzbogige Pforte, ohne Sturz; in den großen Flügel ist jedoch eine kleinere, viereckige Eingangsthür eingeschnitten. Der eiserne Beschlag dieser Thür ist so alt, wie die Thür, und äußerst tüchtig und


|
Seite 281 |




|
geschmackvoll gearbeitet; die Hespen laufen in Lilien von den schönsten Verhältnissen aus. Die ganze Arbeit ist schon eine große Seltenheit geworden. Sehr merkwürdig ist eine Bemalung der äußern Thürfläche. In dem Spitzbogen steht, in angemessenen, füllenden Verhältnissen, draußen auf der Thür ein großer gemalter meklenburgischer Stierkopf, freilich sehr vergangen, jedoch noch in den Umrissen zu verfolgen, namentlich in der in altem Style gehaltenen goldenen Krone. Diese merkwürdige Verzierung ist wohl sicher ein Zeichen, daß die Kirche zur Zeit der meklenburgischen Herrschaft, also nach dem J. 1359, nach dem Ankaufe der Grafschaft Schwerin durch die Herzoge von Meklenburg, erbauet worden sei; vielleicht ist die Kirche sehr bald nach dem J. 1359 vollendet, indem man durch Anbringung des einfachen Stierkopfes (ohne andere Wappenzeichen) die neue Herrschaft deutlich bezeichnen wollte. Zu andern Zeiten hätte man zu einer solchen weltlichen Bezeichnung nicht gegriffen. Die Anbringung des meklenburgischen Stierkopfes über der Hauptpforte scheint sehr bestimmt dafür zu sprechen, daß die Kirche im dritten Viertheil des 14. Jahrhunderts erbauet worden sei, wenn nicht schon der Baustyl dafür spräche.
Ueber dieser Pforte sind zwei gleicharmige Lilienkreuze, ein häufig vorkommendes Ornament, übereinander hohl eingemauert.
Von den Glocken ist die größte und die kleinste alt.
Die große Glocke hat folgende Inschrift in gothischer Minuskel:

Statt der Puncte stehen kleine Heiligenfigürchen zwischen den einzelnen Wörtern.
=Anno domini MCCCCLXXXII (1482) ante Galli. Da pacem rex gloriae Christi. Osanna vocor.
Die kleinste Glocke hat folgende Inschrift in gothischer Minuskel:
(Ein heiliger Bischof) anno (ein Heiligenbild) d
i (ein Heiligenbild) m (ein Antoniuskreuz 1 ) T) cccc (ein Antoniuskreuz) lv .
= Anno domini MCCCCLV (1455).


|
Seite 282 |




|
Die Kapelle zu Buchholz
ist, nach den Mittheilungen des Herrn Architekten Stern zu Schwerin, ein der Kirche zu Retgendorf ähnliches, jedoch etwas bedeutenderes Gebäude. Sie ist in demselben Styl erbauet, hat aber einen fünfseitigen Chorschluß und ist wohl etwas jünger als die Kirche zu Retgendorf. Sie ist nicht gewölbt und hat kein alterthümliches Mobiliar mehr. Diese Kapelle ist also auch nicht mehr diejenige, welche schon im J. 1241 stand.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die Kirche zu Zittow
wird ungefähr zu derselben Zeit gebauet sein, als die retgendorfer gebauet ward, vielleicht etwas früher. Urkundlich kommt die Kirche zu Zittow zuerst im J. 1286 vor, als der Graf Nicolaus von Schwerin dem Dom=Capitel zu Riga das Patronat der Kirche zu Zittow bestätigte, welches im J. 1520 auf die Antonius=Präceptorei Tempzin überging 1 ). Die Kirche ist aber älter, als 1286. Sie bildet ein Oblongum von 3 Gewölben Länge und einem Thurme.
Der Chor, ein Viereck von einem Gewölbe, mit grader Altarwand, ist im Uebergangsstyle, ungefähr 1230 - 1240, erbauet. Die Wände sind aus Granitblöcken aufgeführt, von sorgfältig gewählten Feldsteinen mit graden Flächen; die Ecken sind behauen. Die einfachen, aber würdig und gut construirten Fensterlaibungen sind aus großen Ziegeln. Trotz des guten Baues ist die Altarwand doch etwas ausgewichen und durch zwei colossale Strebepfeiler an den Ecken gestützt. Architektonische Ornamente fanden sich nicht. Die Gewölberippen haben ein halbkreisförmiges Profil und sind sehr stark.
Das Schiff von zwei Gewölben Länge ist jünger und dazu in jüngern Zeiten umgebauet, wie man im Innern deutlich sieht. Die Wände sind ebenfalls von Feldsteinen aufgeführt, welche aber kleiner und weniger sorgfältig gewählt und weniger gut vermauert sind, auch durch Brand gelitten haben mögen. Die Fenster sind in weitem Spitzbogen um das J. 1450 in schlechtem Styl von Ziegeln aufgeführt.
Der Thurm ist ein junges Werk im Rundbogenstyl aus dem 16 - 17. Jahrhundert.
An Merkwürdigkeiten besitzt die Kirche nichts weiter, als etwa die Kanzel und das kambser Chor, beide zu gleicher Zeit


|
Seite 283 |




|
erbauet, schwarz mit Gold decorirt, beide mit denselben Wappen und Namenszügen.
| 1. H. F. v. H. | 2. H. E. v. P. | 3. D. J. v. P. |
| J. v. H. | O. v. O. | G. E. v. L. |
d. i.
-
H. F. von Halberstadt (auf Cambs).
J. von Holstein. -
Helmuth E. von Plessen (aus dem Hause
Müsselmow auf Cambs) † 1694.
Oelgard von Oertzen. -
Dietrich Joachim von Plessen (auf Cambs) †
1733.
Gertrud Ele von Lepel.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Die S. Gertrud=Kapelle zu Güstrow.
Vor dem Hageböker=Thore der Stadt Güstrow steht eine kleine Kirche, der H. Gertrud geweihet, um welche der Begräbnißplatz, "Gertruden=Kirchhof", angelegt ist. Die Kapelle steht verlassen und ist leer und wüst, und ist längst aufgegeben und ausgeräumt; vor etwa 40 Jahren stand noch die Kanzel, von der jetzt aber keine Spur mehr übrig ist. Jetzt wird sie mitunter als Leichenhaus und als Aufbewahrungsort der Geräthschaften der Todtengräber benutzt. So unscheinbar und unangesehen diese Kapelle auch ist, so ist sie doch als Bauwerk sehr merkwürdig. Die Kapelle, welche keinen Thurm besitzt, in alten Zeiten aber ohne Zweifel einen Dachreiter gehabt haben wird, bildet ein Oblongum mit dreiseitigem Chorabschlusse. - Man. kann an der Kapelle drei Bauperioden genau unterscheiden.
Die westliche Wand bis zum Giebel ist der älteste Theil und wahrscheinlich sehr alt. Sie ist außen mit 5 langen, rundbogigen Doppelnischen verziert; wenn diese Rundbogen auch nicht sehr alt, sondern nur eine Reminiscenz aus alter Zeit sein mögen, so trägt doch die Wand Spuren einer fernen Zeit. Hiefür spricht auch die innere Verzierung. Im Innern stehen an der Wand dort, wo die Außenwand zwischen den Doppelnischen nicht vertieft ist, schwache Lissenen. Die Wand trägt aber auch im Innern Spuren alter Zeit. Sie ist nämlich mit festem Kalk glatt geputzt und dann nach alter Art mit Ziegeln bemalt. Das Roth dieser Malerei ist das bekannte, alte, gelbliche Roth; das Format der gemalten Ziegel ist aber ganz klein, ungefähr so groß wie das der jetzigen Ziegel, während die alten Malereien das Format der größten Ziegel, oft auch das der


|
Seite 284 |




|
Werksteine nachahmen; die Bandstreifen sind schwärzlich, während sie bei andern alten Malereien bläulich oder gelblich grau sind. Diese Malerei auf Putzgrund ist ein sehr beachtenswerther Ueberrest alter Zeit. Diese Malerei ist mit einer Kalktünche bedeckt, welche mit grünen Ranken bemalt ist, eine Verzierung, welche vielleicht dem Ende des 15. oder dem Anfange des 16. Jahrhunderts angehört. Auf diese jüngere Malerei sind einige weiße Kalktünchen aufgetragen.
Die beiden graden Seitenwände sind jüngern Ursprunges; man sieht deutlich, daß sie an die Westwand nur angelehnt sind. Diese Wände sind auch merkwürdig. Während die westliche Wand ein massiver Bau ist, haben die beiden Seitenwände im Innern eine Holzconstruction, welche außen mit Ziegeln verblendet ist 1 ). Im Innern bestehen diese Wände aus ausgemauertem Holzverband in der Construction eines Andreaskreuzes. Trotz dieser Construction, die aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen mag, sind die Wände doch noch ziemlich wohl erhalten. Die nördliche Pforte ist sehr gut gegliedert und verziert.
Der dreiseitige Chorschluß scheint der jüngste Theil zu sein. Er hat im Innern unter den Fenstern rundbogige Nischen, welche aber jedenfalls nicht alt sind, sondern vielleicht aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts stammen.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kunstwerke der Kirche zu Rühn.
Die Kirche zu Rühn besitzt noch mehrere alte Stickereien und Webereien zu Altar= und Kanzelbehängen u. s. w.
Unter andern besitzt sie noch eine alte gestickte Decke, welche zuletzt wohl als Kanzeldecke benutzt ist, aber wohl ein Stück von einem Antependium eines Altars ist. Diese Decke ist von verblichenem rothen Sammet mit goldenen Streifen. Darauf stehen in Seide gestickt Figuren von 1 Fuß Höhe, unter Baldachinen, von mittelmäßiger Arbeit und ohne eigentlichen Kunstwerth, wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammend. Das Hauptbild ist die Anbetung der Heil. Drei Könige, gut gezeichnet, 12 Zoll hoch und 17 Zoll breit. Zur Rechten stehen 4 Figuren, zur Linken 2 Figuren, welche jedoch nur schlecht gearbeitet und schwer zu erkennen sind. Wahrscheinlich sollen alle diese Figuren Apostel darstellen, da


|
Seite 285 |




|
Bartholomäus an einem Messer, Matthäus an einem Winkelmaaß, Jacobus d. ä. an einer Tasche zu erkennen ist.
Die Kirche zu Rühn bewahrt noch ein kleines Oelgemälde mit dem Bilde der Herzogin Ursula von Meklenburg, Aebtissin zu Ribnitz († 1586), mit der Jahreszahl 1586 und dem meklenburgischen Wappen. Die Herzogin ist vor einem Crucifixe knieend in grauer Klostertracht dargestellt, wahrscheinlich zum Gedächtniß ihres Todes. Im Hintergrunde ist eine alte Ansicht der Stadt Ribnitz.
Die Kirche zu Rühn hat noch ein großes Tauffaß (Fünte) von Holz aus dem 16. Jahrhundert.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Alte Stickereien in der Kirche zu Güstrow.
Die zur bessern Erhaltung der obern Altardecke in der Pfarrkirche untergebreitete leinene Unterdecke war mit mehrern Bruchstücken mit alten Stickereien geflickt, welche wahrscheinlich Kanten von alten Altardecken oder Antependien gewesen sind. Im Allgemeinen haben diese Stickereien antiquarischen Werth nicht allein wegen der Darstellungen und der Arbeit, sondern auch wegen der Zeichnung. Durch die Bemühungen des Herrn Kirchenvorstehers Gerber zu Güstrow sind diese Reste alter Kunst in das großherzogl. Antiquarium gekommen.
besteht aus zwei Streifen, 7 Zoll breit, jeder 3 1/2 Fuß lang, beide oben mit anscheinend etwas jüngern Stickereien von gleicher Breite geflickt. Der Grund der ältern Hauptstreifen ist von festem, blutrothen Taffet, dicht mit gestickten goldenen Lilien besetzt. Jeder alte Hauptstreifen hat zwei Felder, in deren jedem eine Heiligenfigur in Gold und farbiger Seide aufgenähet ist. Die Zeichnungen sind richtig, edel und geschmackvoll gehalten. Die Arbeit stammt wohl noch aus dem Ende des 14. Jahrhunderts.
Oben sind zwei eben so breite Streifen von 1/2 Fuß Länge Zum Ausflicken angesetzt. Diese sind offenbar nach unten hin abgeschnitten, da die Figuren nur bis zu den Knieen vorhanden sind. Das Seidenzeug des Grundes ist sehr lose gewebt; die Lilien sind nicht mehr ganz von Gold, sondern von Gold und rother Seide gestickt, eben so sogar die Heiligenscheine. Der Styl der Zeichnungen ist nicht so ernst, die Arbeit nicht so reich und gediegen, wie bei den übrigen Figuren.


|
Seite 286 |




|
Die Darstellungen sind folgende, von oben nach unten:
I. auf dem einen Streifen:
1) die H. Anna mit der Maria auf dem Arme, welche das Christkind auf dem Arme hat, (oben zum Ausflicken angesetzt);
2) der Apostel Andreas, mit einem Andreaskreuze vor sich; diese Figur fehlt jetzt ganz, ist aber aus den Umrissen auf dem Grunde klar zu erkennen;
3) der Apostel Paulus, mit einem aufgerichteten Schwerte in der rechten Hand;
II. auf dem zweiten Streifen:
1) Gott Vater, die rechte Hand zum Segnen erhoben, in der linken Hand die Weltkugel haltend;
2) der H. Gregor Papst, mit der dreifachen Krone, mit der rechten Hand einen päpstlichen Stab mit einem Doppelkreuze, in der linken Hand einen aufgerichteten großen Schlüssel haltend;
3) die H. Katharine, mit einer Krone auf dem Haupte, in der linken Hand ein nach unten gerichtetes Schwert haltend, mit dem Bruchstücke eines mit Stacheln besetzten Rades zu den Füßen.
besteht aus zwei Streifen, 8 1/2 Zoll breit, jeder 4 1/2 Fuß lang, welche oben durch ein gewebtes, gemustertes Stück Zeug von 1 Fuß Länge mit einander verbunden sind; unten an den Enden sind Franzen angesetzt. Der ganze Grund ist einfach, aber geschmackvoll gestickt oder genäht. Jeder Streifen enthält 3 Figuren, welche unter Baldachinen stehen. Diese Stickerei ist leichter und loser und nicht so reich, als in der andern Stickerei, auch ist die Zeichnung nicht so edel, wenn auch noch sehr gut Diese Stickerei enthält nur weibliche Heilige.
Die Darstellungen sind folgende, von oben nach unten:
I. auf dem einen Streifen:
1) die H. Katharine, in der rechten Hand ein nach unten gerichtetes Schwert haltend, neben dessen Spitze ein halbes Rad zu ihren Füßen liegt;
2) die H. Maria Magdalene (?), mit einer (orientalischen) Mütze und sehr langem, gelben Haar, etwas (eine Salbenbüchse?) in den Händen haltend, das nicht mehr zu erkennen ist;
3) die H. Johanna (?), (als Aebtissin?), mit einer Bischofsmütze auf dem Haupte, mit Weihel und Wimpel (d. i. Kopf= und Kinntuch), mit einem großen, auf der Erde stehenden Kreuze im linken und einem Gefäße (wie es scheint) im rechten Arme;


|
Seite 287 |




|
II. auf dem andern Streifen:
1) eine heilige Jungfrau, welche etwas in der Hand hält, das nicht mehr zu erkennen ist;
2) die mittlere Figur fehlt: der Leinewandgrund ist mit einer weiblichen Figur in Wasserfarben so schlecht bemalt, als hätte es ein Kind gemacht;
3) die H. Elisabeth, in fürstlichem Gewande, in goldenem Rock und rothem Mantel, mit einem weißen Wittwenschleier, mit einer Krone in der rechten Hand.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Kirche zu Teterow.
Nachtrag zu Jahrb. Xll, S. 464.
In Jahrb. XII, S. 464, ist die Inschrift auf dem Leichensteine des sonst bekannten teterowschen Pfarrers Gerhard Vogelsang, welcher im J. 1380 starb, mitgetheilt. Der Herr Ober=Appellationsgerichts=Copiist Rogge zu Rostock bringt nun die Nachricht, daß bei der Kirche zu Teterow noch ein alter schöner Kelch, ein Geschenk dieses Pfarrers Gerhard Vogelsang, aufbewahrt wird, der folgende Inschrift trägt:

An den sechs Knäufen am Griffe stehen die Buchstaben:
 S V S.
S V S.
Ein zweiter Kelch der Kirche zu Teterow hat einen Wappenschild mit drei Adler= oder Greifenköpfen und die Inschrift:

G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Beischläge der S.Olavs=Burse in Rostock.
Auf dem Hofe der Universitäts=Bibliothek zu Rostock stehen zwei große "Beischläge", d. i. Wangen oder Seitenstücke zu den Sitzen vor der Hausthür, welche früher vor dem am Hopfenmarkte, jetzt Blüchersplatze, in der Verlängerung der Kröpelinerstraße gelegenen Hause standen, welches für die alte S. Olavs=Burse oder Regentie der Universität gehalten und in neuern


|
Seite 288 |




|
Zeiten von den Professoren Tychsen und Normann bewohnt ward. Bei dem Verkaufe des Hauses behielt die Universität diese "Beischläge" als Denkmäler. Die beiden Steine sind große, dicke Kalksteinplatten und mit Relieffiguren auf vertieftem Grunde reich verziert.
1) Auf dem einen Beischlage steht in der Mitte in größerer Darstellung Maria mit dem Christkinde auf dem Arme und darüber in kleineren Darstellungen Johannes d. T. und der Apostel Andreas.
2) Auf dem andern Beischlage steht in der Mitte in größerer Darstellung der H. Georg und darüber in kleinerer Darstellung ein Wappen. Das Wappen ist ein Mal queer und zwei Male längs getheilt, enthält also 6 Schilde, je oben und unten drei. In heraldischer Ordnung stehen in der obern Hälfte 1) ein Vogel, 2) zwei ins Andreaskreuz gestellte Kreuzstäbe, 3) ein Stier; in der unteren Hälfte 4) ein Stier, 5) ein Vogel, 6) zwei gekreuzte Kreuzstäbe. Auf dem Schilde steht eine Bischofsmütze; hinter dem Schilde stehen, neben der Bischofsmütze, rechts ein Schwert, links ein Bischofsstab, ins Andreaskreuz gestellt.
Das Wappen stammt wohl aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, gehört wohl einem nordischen Bischofe an und ist wohl aus dem Familienwappen und dem bischöflichen Wappen desselben combinirt. Der zwei Male vorkommende Schild mit den zwei Kreuzstäben (Stäben, auf denen oben ein gleicharmiges Kreuz steht) ist wohl das bischöfliche Wappen. Die Schilde mit Vogel und Stier sind wohl das Familienwappen des Bischofes. Die Ermittelung des Wappens hat bisher in Skandinavien und im nordöstlichen Deutschland noch nicht gelingen wollen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 289 |




|



|



|
|
|
Der Altar der Kirche zu Alt=Röbel.
Der Altar der Marien=Kirche zu Alt=Röbel, welcher gegenwärtig durch einen neuen ersetzt und von seiner bisherigen Stelle versetzt ist, kann bei der großen Wichtigkeit der Kirche für die Baukunst vielleicht von Einfluß werden und verdient daher eine genauere Untersuchung und Beschreibung, so wie deren Veröffentlichung. Der Altar hatte überdies eine merkwürdige, wenn auch grade nicht lobenswerthe Einrichtung. Das frühere Mittelstück des Altars war nämlich ein vollständiger alter Altar, der mit den aufgeschlagenen Flügeln nicht breiter ist, als gewöhnlich das Mittelstück eines Flügelaltars einer kleinen Kirche zu sein pflegt. In der ersten Hälfte des 16. Jahrh. befestigte man nun diesen Altar mit aufgeschlagenen Flügeln zu einem Stücke und machte dieses zu einer Mitteltafel, setzte oben einen schmalen Aufsatz mit figürlichen Darstellungen auf und gab diesem Mittelstücke zwei neue Doppelflügel, in welche man viele andere alte, geschnitzte Figuren der Kirche, wenn sie nicht zu groß waren, ohne besondere Wahl setzte. Einige sind fast zu groß; einige sind sehr winzig, und deshalb hat man diese kleine Figuren auf Postamente gestellt. Der Styl des Schnitzwerkes dieser Flügel in Säulen und Baldachinen ist möglichst schlecht und verdient der Rede nicht. Diese neuern, verfallenen Flügel sind jetzt vernichtet, die Figuren ins Antiquarium versetzt.
Der alte Altar, jetzt in der Sakristei der Kirche aufgestellt, ist ein kleiner, alter Altar von ziemlich guter Arbeit.
Mitteltafel:
in der Mitte: die Jungfrau Maria, die Schutzpatronin der Kirche, auf dem Halbmond stehend, mit dem Christkinde auf dem Arme, gute Figur;
rechts in der Ansicht: die H. Anna (?) oder Maria Magdalena (?), stehende weibliche Figur, anbetend, gute Arbeit;
links: Johannes der Täufer, schlechtere Arbeit.
Die beiden früher mit der Mitteltafel zu Einem Stück verbunden gewesenen Flügel sind in der Vorderwand ein Mal längs und queer getheilt, so daß jeder Flügel 4 Heilige enthält, deren Namen zu ihren Füßen stehen. Flügel links in der Ansicht:
links:
oben: der H. Georg, stehend, den Drachen tödtend;


|
Seite 290 |




|
unten: der H. Justus (?), mit einer Kirche in den Händen (am Fuße steht: S. IOSTVS.);
rechts:
oben: die H. Barbara, mit einem Thurme neben sich;
unten: die H. Apollonia.
Flügel rechts in der Ansicht:
links:
oben: die H. Katharina mit einem Schwerte;
unten: die H. Gertrud mit einem Hospitale im Arme;
rechts:
oben: der H. Apostel Jacobus mit dem Pilgerstabe;
unten: der H. Nicolaus als Bischof.
Die Flügel des alten Altars waren früher mit der Mitteltafel zu Einer Tafel vereinigt; es war daher nur die Hinterwand derselben zu sehen. Diese enthält in jedem Flügel 2 kleine Gemälde auf Goldgrund, ernst und gut gemalt:
links in der Ansicht:
oben: eine H. Aebtissin mit Heiligenschein, in weißem Gewande, mit schwarzem Gürtel und schwarzem Mantel, wird von einem Bischofe geweihet; daneben rechts sitzen 5 Nonnen, in gleicher Tracht, in einem Chorstuhle, mit Büchern in den Händen; links knieen zwei männliche Figuren in langen weißen Untergewändern und reichen Obergewändern, die eine mit einem Buche, die andere mit einem Rosenkranze in den Händen;
unten: der H. Georg, den Drachen tödtend;
rechts:
oben: dieselbe H. Aebtissin, wie oben links, im weißen Untergewande und schwarzem, blau gefutterten Mantel, mit einem Bischofsstabe in der Hand, umher Nonnen, in gleicher Tracht, stehend, von denen zwei ein Bund Schlüssel halten;
unten: der H. Severian (?). An einem galgenartigen Gerüste hängt an Stricken der Heilige, dessen Füße mit einer großen Kugel oder einem Steine beschwert sind; links stehen Kriegsknechte mit Haken und Messern, im Begriffe, mit den Haken den Leib zu zerreißen, rechts ein König und zwei geharnischte Ritter.
enthielten in der Vorderansicht geschnitzte Figuren, welche von verschiedenen Nebenaltären ohne besondere Wahl angebracht waren. Die Flügel waren ein Mal queer getheilt und enthielten in jeder Reihe 3 Figuren:
Der Flügel links in der Ansicht:
unten:


|
Seite 291 |




|
in der Mitte: die H. Jungfrau Maria mit dem Christkinde;
links: die H. Anna, mit der Maria auf dem linken und dem Christkinde auf dem rechten Arme;
rechts: eine weibliche Heilige mit einer Mütze auf dem Haupte;
oben:
in der Mitte: die H. Jungfrau Maria mit dem Christkinde;
links: die H. Katharina, mit Schwert und Rad;
rechts: die H. Anna, mit einem Kinde auf jedem Arme.
Der Flügel rechts:
unten:
in der Mitte: die H. Jungfrau Maria, mit dem nackten Christkinde, welches in jeder Hand einen Apfel hält, auf dem Schooße;
links: eine gekrönte weibliche Heilige mit einem Apfel in jeder Hand;
rechts: der Apostel Johannes Ev. mit dem Kelche in der Hand;
oben:
in der Mitte: der H. Veit, als Bischof, in einem Grapen stehend;
links: ein Heiliger, mit einer Säule im Arme;
rechts: ein Heiliger mit einem Kreuze im Arme, beide ohne weitere besondere Zeichen.
Die Hinterseite der neuen Flügel, wenn sie über das Mittelstück zusammengeschlagen waren, waren mit schlechten Gemälden bedeckt. Jeder Flügel war einmal queer getheilt, enthielt also 2 Gemälde:
Flügel links in der Ansicht:
oben: wahrscheinlich Mariä Verkündigung, aber ganz verdorben und kaum mehr zu erkennen;
unten: die Geburt Christi: das Christkind in der Krippe.
Flügel rechts in der Ansicht:
oben: die Darstellung Christi im Tempel;
unten: die Anbetung der Heil. Drei Könige.
Die zweiten Flügel waren auf der Vorderseite bemalt, auf der Hinterseite nicht. Die Vorderseiten waren queer getheilt und enthielten in jeder der 4 Abtheilungen
im Ganzen also die zwölf Apostel.


|
Seite 292 |




|
enthielt mehrere kleine, schlecht geschnitzte biblische Scenen aus der ältesten biblischen Geschichte, z. B. den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradiese, den Tod Abels u. s. w.
Die Erklärung dieses Altares ist sehr schwierig, hat jedoch keinen so bedeutenden Werth, daß sich eine weit ausgedehnte Forschung der Mühe verlohnen sollte.
Der kleine, alte Altar ist aus dem Ende des 15. Jahrhunderts; die Flügel waren spät im 16. Jahrh., gewiß schon zur Zeit der Reformation angesetzt.
Die Hauptheilige der Kirche war die Jungfrau Maria, daher auch die Kirche die Marienkirche hieß. (Die neustädter Kirche war eine Nicolaikirche.) Daher hat auch wohl der kleine alte Altar immer der Marienkirche gehört, indem die Hauptfigur desselben ein Marienbild ist.
Man könnte jedoch auch annehmen, daß der Altar aus der Kirche des Dominikanerklosters auf der Neustadt bei der frühern Säcularisirung und Zerstörung des Klosters in die Marienkirche versetzt sei, wie die bekannten Chorstühle in die Nicolaikirche versetzt wurden. Die ungewöhnlichen Malereien auf den Rückwänden scheinen für einen Klosteraltar zu reden; jedoch scheinen keine bestimmte Beziehungen vorhanden zu sein.
Die Figuren in den Flügeln sind mannigfaltig genug, geben aber keine bestimmten Anhaltspunkte für die Geschichte der Kirche, von welcher nur bekannt ist, daß sie Nebenaltäre zu Ehren der H. Katharina, Philippi und Jacobi, des H. Georg und des H. Antonius hatte.
Die Klöster der Stadt Röbel sind in Jahrb. VIII, S. 114 flgd. behandelt. Auf der Neustadt war schon vor dem J. 1273 ein Nonnenkloster der Büßerinnen der H. Maria Magdalena und im J. 1285 ward auf der Altstadt ein Dominikaner=Mönchskloster gestiftet. Da aber zwei Klöster für die Stadt zu viel waren, so ward das Nonnenkloster im J. 1298 nach Malchow verlegt und den Dominikaner= oder Predigermönchen das Nonnenkloster auf der Neustadt eingeräumt.


|
Seite 293 |




|



|



|
|
|
Ueber das Kloster der Büßerinnen zu Röbel,
später zu Malchow,
lassen sich noch folgende interessante Aufklärungen geben.
Das Nonnenkloster zu Neu=Röbel war vom Orden der Büßerinnen der H. Maria Magdalena. Nach einer der Urkunden über die Verlegung des Klosters nach Malchow vom J. 1298 1 ) werden sie Nonnen "sanctimoniales de ordine poenitentium noue ciuitatis Robele, Hauelbergensis diocesis", genannt und nach einer Urkunde vom J. 1273 2 ) war das Kloster "ad honorem dei omnipotentis et beate Marie virginis ac sancte Marie Magdalene" ("sanctimoniales in Robele") geweihet. Der Orden war zur Zeit der Kreuzzüge, als Sittenlosigkeit überhand nahm, gestiftet und nahm gefallene Büßerinnen auf; es bildete sich jedoch schon sehr früh eine erste Abtheilung von wirklichen Klosterfrauen, die "Samenung zur Heil. Magdelene". Die Regel für die Büßerinnen der Heil. Maria Magdalene ("sororibus poenitentibus Mariae Magdalenae") war sehr strenge. Die Nonnen waren zur strengen Clausur, zum Schweigen und zur Arbeit verpflichtet, nährten sich mäßig von Gemüse, schliefen auf Stroh und wollenen Decken und kleideten sich in grobe, weiße Gewänder, daher sie auch wohl die weißen Frauen genannt wurden; die Strafen für selbst geringe Ueberschreitungen der Ordensregel waren sehr hart. Der Papst Gregor IX. gab dem Orden am 23. Oct. 1232 eine Regel, welche der Papst Nicolaus III. am 1. Jan. 1280 bestätigte. Gregor IX. gab demselben die Regel des H. Augustinus und die Ordnung der Nonnen des Heil. Sixtus von Rom ("institutiones ordinis monialium sancti Sixti de Urbe"). Die Klöster standen unter Priorinnen. Die vorzüglichsten Heiligen des Ordens waren, außer Maria, Maria Magdalena und Augustinus, noch Johannes d. T., Petrus und Paulus, Jacobus, Laurentius und Bartholomäus.
Das Kloster ward mit dieser Regel im J. 1298 nach Malchow verlegt, wo der erste Propst Albert hieß (1298: Albertus prepositus sanctimonialium in Malchow). Die Bezeichnung des Ordens ist in den malchowschen Urkunden sehr selten. Einmal werden sie aber im J. 1320 "ad honorem dei omnipotentis et beate Marie virginis ac sancte Marie Magdalene moniales in Malchow" genannt. Gewöhnlich


|
Seite 294 |




|
und häufig werden sie in den Urkunden nur als "religiosae dominae sanctimoniales in Malchow" bezeichnet. Daß die Nonnen zu Malchow die Ordensregel der Büßerinnen der Heil. Maria Magdalene befolgten, geht auch daraus hervor, daß das Kloster die Ordensregel des Papstes Gregor IX. vom J. 1232 und die Confirmation durch den Papst Nicolaus III. nach einer beglaubigten Abschrift vom J. 1305 besaß.
Im Laufe der Zeit muß aber das Kloster zu Malchow eine andere Regel angenommen haben. Im J. 1358 wird das Kloster "conventus monasterii S. Johannis baptiste et sancte "Magdalene in Malchow" und im J. 1376 werden die Nonnen "religiose domine sanctimoniales monasterii sancti Johannis baptiste ac sancte Marie Magdalene in Malchow" genannt. Diese Ausdrücke sind aber nicht klar. In einer Bulle vom 18. März 1474, durch welche die Wiederherbeischaffung der dem Kloster unrechtmäßiger Weise entfremdeten Güter angeordnet wird, nennt der Papst Sixtus IV. das Kloster bestimmt ein Cistercienser=Kloster ("monasterium antiqui opidi Malchow, per priorissam solitum gubernari, ordinis Cisterciensis, Zwerinensis diocesis"). Es ist eine bestimmte Thatsache, daß in allen Fällen, wo es irgend geschehen konnte, die meklenburgischen Feldklöster nach und nach der Regel des Cistercienser=Ordens zugewandt wurden, welcher in den Klöstern Doberan, Dargun und Neukloster so mächtige Stiftungen in Meklenburg besaß.
Wann das Kloster der Büßerinnen zu Neu=Röbel gestiftet sei, ist nicht mit Bestimmtheit zu ermitteln. Es wird jedoch nach dem J. 1232 (der Ordensregel) und vor dem J. 1273 (der ältesten bekannt gewordenen Urkunde des Klosters) gestiftet worden sein.


|
Seite 295 |




|



|



|
|
:
|
Weltliche Bauwerke
des Mittelalters.
Das Giebelhaus zu Güstrow
an der Mühlenstraße,
welches der bedeutendste Ueberrest alter weltlicher Baukunst in Güstrow und eines der ausgezeichnetsten Bauwerke aus einer gewissen Periode in Meklenburg ist, ist noch immer nicht fest bestimmt, so sehr das Gebäude auch eine Geschichte verdiente. Das Haus ist ein sehr großes Giebelhaus von bedeutenden Verhältnissen und ohne Zweifel in der allerletzten Periode des gothischen Styls, ja schon mit Anklängen an die "gothische Renaissance" aufgeführt. Es wird durch eine Auffahrt von einem rechts daneben stehenden massiven Queerhause getrennt, welches ursprünglich gewiß zu dem Giebelhause, als Scheure oder Speicher, gehörte, und hat hinter sich einen großen Garten, welcher in alten Zeiten auch einen großen Hof umschlossen haben mag.
Es ist immer meine Ansicht gewesen, daß dieses Haus schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, etwa gegen das Jahr 1530, erbauet worden sei. Der jetzige Besitzer hat nun an einem der alten Schornsteine einen gebrannten Ziegel entdeckt, in welchen die Jahreszahl 1539 mit arabischen Ziffern in den damals üblichen Zügen eingegraben ist. Das Haus ward also sicher im J. 1539, also nach den großen Stadtbränden, vollendet und ist sicher eines der letzten bedeutendern Beispiele alter Bauart in Meklenburg.
Es steht noch zur Frage, wem das Haus zur Zeit der Erbauung gehört habe. Ich glaube, es war der Hof des Klosters Doberan, welchen dieses im J. 1433 von dem Kloster Michaelstein zu seinen am Mühlenthore gelegenen Mühlen kaufte (vgl. Jahrb. XII, S. 13 und 331). Der Hof des Klosters lag nach der Kauf=Urkunde am Ziegenmarkte. Nun liegt jetzt das in Frage stehende Haus nicht am Ziegenmarkte, aber unmittelbar neben diesem in der Mühlenstraße,


|
Seite 296 |




|
wenn man vom Ziegenmarkte (oder Mühlenthore) nach dem Markte geht, links an der Straße, einige Häuser vom Anfange derselben; der Ziegenmarkt mag früher einen größern Raum eingenommen haben. - Eine andere Ansicht, der michaelsteiner oder doberaner Hof sei das letzte Haus der Stadt, wenn man vom Markte nach dem Mühlenthore geht, rechts am Mühlenteiche, gewesen, weil dieses hinten sehr altes Mauerwerk hat und auch am andern Ende des Ziegenmarktes liegt, kann wohl nicht richtig sein, da dieses Haus an einer Seite am Mühlenteiche liegt, in der Urkunde von 1433 aber ausdrücklich gesagt wird, daß der michaelsteiner Hof zwischen zwei Häusern, zwischen Hans von Schonen und Curt Rissert, liege. Demnach muß der Hof in einer Straße und nicht am Ende derselben gelegen haben.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 297 |




|



|



|
|
:
|
III. Zur Kunstgeschichte.
Ueber den Maler Erhard Gaulrap,
vom
Archivrath Dr. Lisch.
Wenn es auch bisher unser ununterbrochenes Bemühen gewesen ist, die alten Kunstwerke unsers Vaterlandes zu entdecken, zu bestimmen und bekannt zu machen, zu erhalten und im alten Geiste wiederherzustellen, so hat dies doch bisher zumeist die Denkmäler der Baukunst und die in und an diesen befindlichen untergeordneten und dieselben ausschmückenden Kunstwerke betroffen, da diese Werke einen höhern geschichtlichen Werth haben, als diejenigen, welche zur Ausschmückung des Einzelnlebens bestimmt sind und aus dem Einzelnleben hervorgehen. Bauten, wie die Dome zu Doberan, Schwerin, Güstrow und viele andere, wie die Schlösser zu Schwerin, Wismar und Güstrow, sind selbst große geschichtliche Denkmäler, welche oft viel deutlicher reden, als Urkunden; denn was ein Volk in Jahrhunderten gemacht hat, ist nicht selten bedeutender, als was ein Mensch in Tagen und Stunden gethan hat: nicht allein das ist Geschichte, was geschehen, sondern auch das, was gemacht ist, oder mit andern Worten, die Bildungsgeschichte mag wohl eben so hoch und höher stehen, als die Regierungs= und Kriegs= und Friedensgeschichte.
Dennoch ist es wohl förderlich, die Geschichte der Einzelnbestrebungen in das große Ganze einzureihen, und auch die Geschichte der zeichnenden Künste in der Vorzeit zu verfolgen, da sie an und für sich von Werth und man in unsern Tagen gewohnt ist, unter Kunstgeschichte oft nur Geschichte der Malerei zu verstehen, wie die "Kunstausstellungen" in überwiegendem Maaße Gemälde bringen und "Kunstblätter" oft vorherrschend Gemälde besprechen.
Wir haben aus dem 14. und 15. Jahrhundert sehr viele vortreffliche Werke der Malerei im Lande; alle aber sind kirch=


|
Seite 298 |




|
liche Werke, wie denn in frühern Zeiten die Malerei vorzüglich der Baukunst diente. Die Staffeleimalerei beginnt bei uns erst mit dem 16. Jahrhundert, nach dem Vorgange der großen Meister Albrecht Dürer und Lucas Cranach d. ä. Wenigstens haben wir wohl keine älteren, heimischen Staffeleibilder im Lande. Ueber die alten Altarwerke haben wir einige ausführliche urkundliche Nachrichten, welche um so wichtiger sind, als die Werke noch existiren. Diese mögen einer andern Untersuchung vorbehalten bleiben.
Jetzt mögen uns einige namhafte Maler am Hofe zu Schwerin im 16. Jahrhundert beschäftigen. Vorzüglich sind es zwei Maler, welche eine hervorragende Stelle einzunehmen scheinen, beide mit dem Vornamen Erhard, der eine in der ersten, der andere in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.
Der Herzog Heinrich der Friedfertige hatte einen Hofmaler Erhard Altdorffer, welcher in der Zeit 1512 - 1550 vorkommt. Der Herzog scheint sehr viel auf ihn gehalten zu haben, da er ihn oft auf Reisen zu großen Festlichkeiten mitnahm, was wohl hauptsächlich seinen Grund darin haben mag, daß die Kunstmaler zugleich Wappenmaler, also für Turnierfeste unentbehrlich waren. So nahm der Herzog ihn mit: zu dem großen Turnier am 23 - 28. Februar 1512 in Ruppin, da es in der Reiserechnung heißt:
"VII Pf. dem moler Erhart",
und zu der Vermählung der Prinzessin Katharine, seiner Schwester, mit dem Herzoge Heinrich von Sachsen=Freiberg am 5. Julii 1512 in Freiberg, da es in der Reiserechnung heißt:
"Zw Perleberck am dage Johannis Baptiste".
"XII ßl. Erhardt moler zerunge nach Wittenberck".
"Zw Habelberck am freitage nach Johannis vßlozunge".
"III ßl. dem Doctor vnde Erhardt moler".
Höchst wahrscheinlich ist es, daß Erhard Altdorffer diese Reise benutzte, um in Wittenberg den großen Maler Lucas Cranach d. ä. zu sehen, ja es ist möglich, daß er dessen Schüler war, wie aus der Vorsorglichkeit des Herzogs zu schließen sein dürfte, der ihn nach Wittenberg vorausschickte.
Im J. 1516 malte der "Maler Erhard" den Altar in der Heil. Bluts=Kapelle zu Sternberg (vgl. Jahrb. XII, S. 222 und 268); außerdem wird er öfter genannt; so z. B. malte "Erhart Alttorffer maler" Wappen im Schlosse zu Stavenhagen (vgl. Jahrb. V, S. 22).
Im J. 1537 schenkte der Herzog Heinrich seinem "Hofmaler, diener und lieben getreuen Erhart Alttorfer" ein Haus zu Schwerin an der Ritterstraße zum erblichen und freien Besitze, und befahl im J. 1547, daß sein "Hofmaler Meister


|
Seite 299 |




|
Erhart Alttorfer" von der Landbede wegen seines von ihm bewohnten Hauses verschont bleiben solle, da ihm das Haus als ein abgabenfreies geschenkt sei.
Um das Jahr 1550 überreichte Erhard Altdorffer dem jungen Herzoge Johann Albrecht "ein klein Werk mit seiner Faust gemacht" für eine "kleine und geringe Verehrung" und erbot sich, dem Herzoge unterthänige und angenehme Dienste zu erzeigen, falls es der Herzog Heinrich erlauben würde. Der undatirte Brief ist also nach 1547 und vor 1552 geschrieben. Der Brief ist unterzeichnet: "Erhart Altorffer itzt bawmeister". Es kommt in jener Zeit öfter vor, daß andere Künstler Baumeister werden; so ward der Bildhauer Philipp Brandin in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Baumeister des Herzogs Ulrich von Meklenburg=Güstrow und des Königs von Dänemark (vgl. Jahrb. V, S. 23 und 25).
Mit der Regierung des Herzogs Johann Albrecht I. verschwindet Erhard Altdorffer aus der Geschichte. Von seinen Werken scheint im Lande nichts übrig geblieben zu sein. Vielleicht ist von ihm ein auf Pergament im J. 1526 gemalter Stammbaum mit den Bildern und Wappen aller meklenburgischen Fürsten und Fürstinnen, ein Band in Folio, im Archive zu Schwerin, ein Werk seiner Hand. Die Kunstwerke in der Kirche zu Sternberg sind bei dem Brande der Kirche im J. 1741 untergegangen. In der herzoglichen Gemäldegallerie zu Gotha 1 ) ist freilich ein Brustbild des Herzogs Heinrich des Friedfertigen (jetzt auch in Copie im Antiquarium zu Schwerin), welches von einem Schüler Lucas Cranachs d. ä. stammt; dieses trägt aber das Monogramm I S. Von wem das Bild desselben Herzogs in der Gallerie auf dem schwedischen Schlosse Gripsholm bei Stockholm gemalt ist, läßt sich nicht beurtheilen, da die herausgegebenen Abbildungen nur als Costümbilder gelten können. Das von demselben Herzoge existirende Bild in Holzschnitt mag aber von Altdorffer gezeichnet sein.
Erhard Gaulrap.
Wichtiger für die Kunstgeschichte ist Erhard Gaulrap, ein Schüler des Lucas Cranach d. j., unter dem Herzoge Johann Albrecht I. in der Zeit 1560 - 1570.
Erhard Gaulrap war ein Sohn (wahrscheinlich der älteste) des Waffenschmiedes Benedict Gaulrap, des "Büchsenmeisters" des Herzogs Johann Albrecht I. von Meklenburg.


|
Seite 300 |




|
Der Herzog hatte im Anfange seiner Regierung, wahrscheinlich auf seinen Reisen während des oberländischen Krieges, den Vater kennen gelernt und bestellte ihn am 15. Sept. 1553 zu seinem "Büchsenmeister"; bei der Bestellung versprach ihm der Herzog auch: "Wan er vns auch etwas etzen, machen vnd vergulden wirdet, dasselbige wollen wir ihme zu ider zeytt mit billicher belonunge vorgnugen vnd bezalen". - Zwar wird Erhard Gaulrap in den gleichzeitigen Urkunden nirgends ein Sohn des Benedict Gaulrap genannt, aber aus den von dem schweriner Schulrector Bernhard Hederich in seiner Schwerinschen Chronik mitgetheilten Nachrichten werden die Verhältnisse der Familie Gaulrap ziemlich klar. Hederich sagt nämlich zum Jahre
"1553 Am tage Luciae (13. Decbr.) wird Lucas Gaulrap, des Vater ein kunstreicher Etzer bey Hertzog Johan Albrecht gewest, geboren, der seine kindliche Jahre, bey Leben seiner lieben Eltern, unter dem Dabercusio und seinem genero (B. Hederich) mit fleißigem studieren zubracht, hernach von seinem Bruder Erhard, einem fürtrefflichen Conterfeyer, Lucas Mahlers zu Wittenberg gewesener Discipel, nach Annaberg gefördert, da er folgends im Joachimthal seine studia etliche Jahr continuirt, hernach zu Leipzig sich auff das studium juris begeben, welches zu vollenziehen er Doctorem Ludolphum Schraderum ordinarium zu Frankfurt an der Oder fleissig in die sechs Jahr gehöret, von welchem er hernach des Reichs Vicecancellario D. Vieheuser, auch Doct. Lamperto Distelmeyer, Churfürstlichen Brandenburgischen Cancellario, commendirt, durch welcher beförderung er Kammergerichts=Advocat zu Cöln an der Spree worden und zum Syndico der Mittelmerckischen und Reppinischen Landschafft bestellet und sich mit D. Lucae Hoffmeisters, Churfürstlichen Brandenburgischen Rahts nachgelassenen Wittwe, Doctoris Johannis Weinleben, so auch Churfürstlicher Cantzler gewesen, Tochter, befreyet, in welcher Bestallung und Dienst er auch noch (1598) mit grossem ruhm, neben dem miltreichen Segen des Allmächtigen, verharret. Dieses fürnehmen Mannes hab ich in diesem chronico mit gedencken wollen, meine gebürliche danckbarkeit für seine milde und reiche handreichung zu bezeugen, die er zum offtermal an mir dermassen bewiesen, daß ich ihn mit Wahrheit wohl ein exemplum memoris et grati in praeceptorem discipuli nennen


|
Seite 301 |




|
und rühmen kann, auch meinen lieben Schwerinischen zu einer Erinnerung und Trost, daß sie unvermögens halben weder an Gottes Gnade, noch ihren Kindern, wie sie beym studiren zu erhalten seyn, verzagen, weil des offtgemelten Herrn Gaulraps der fromme Gott so väterlich sich angenommen und ihm seine mir und viel andern alhir bekante Liebe und Treu in matrem viduam et aegram, Gehorsam gegen seine praeceptores und geleistete treuen und fleissigen dienst in seiner Jugend so reichlich belohnet, dadurch er nicht allein so viel fürnehmer Leute Gunst, sondern auch Beforderung bekommen und nunmehr einen ansehnlichen Stand bey einem guten Namen und ehrlicher unterhaltung führet".
Nach diesem ausführlichen gleichzeitigen Berichte war der Syndicus Lucas Gaulrap zu Berlin ein Bruder des Malers Erhard Gaulrap und ein Sohn des kustreichen Etzers Benedict Gaulrap; also waren beide Brüder sicher Söhne des Benedict Gaulrap, der im J. 1553 Büchsenmeister des Herzogs Johann Albrecht ward. Die Nachrichten Hederichs stimmen genau mit einem Briefe des Lucas Gaulrap, d. d. Frankfurt a. d. O. 9. Nov. 1572 an den Herzog Johann Albrecht überein, in welchem er seine Lebensgeschichte umständlich erzählt.
Lucas Gaulrap ward zwei Monate nach des Vaters Anstellung 1553 in Schwerin geboren; also war Erhard Gaulrap sicher ein älterer Bruder, da er schon im J. 1557 in der Lehre war und späterhin seinen Bruder zum Studiren beförderte. Lucas Gaulrap sagt ausdrücklich, daß er nur diesen einen Bruder gehabt habe.
Benedict Gaulrap war wahrscheinlich aus dem Lande Meissen, da in der Folge seine Kinder, wenigstens auf längere Zeit, dahin zurückstreben. Sein Sohn Erhard war wahrscheinlich im Auslande geboren und mit den Aeltern nach Meklenburg gekommen; sein Sohn Lucas aber war ein geborner Meklenburger. Benedict Gaulrap lebte nicht lange nach seiner Anstellung in Schwerin; er starb sicher vor dem J. 1563 1 ), und hinterließ eine Wittwe, welche ihn in hülfsbedürftigen Umständen längere Zeit überlebte.
Nach des Vaters Tode nahm sich der Herzog Johann Albrecht der verlassenen Knaben väterlich an ("mei omni ope destituti quasi tutelam suscepit", sagt Lucas selbst im J. 1572). Da Lucas Anlage zum Studiren hatte, so gab der Herzog ihn


|
Seite 302 |




|
bei dem berühmten Schulrector Dabercusius in die Kost; schon am 2. Aug. 1563 quittirte Dabercusius über 4 Thaler Kostgeld für Lucas Gaulrap.
Wie der edle Herzog Johann Albrecht I. ein offenes Auge und Herz für jedes höhere Streben hatte, so wünschte er auch die Talente des jungen Erhard Gaulrap für die Kunst nutzbar zu machen. Der Herzog beförderte in dem Knaben zuerst die Kunst, die dessen Vater geübt hatte: er ließ ihn zu einem "Aetzer" ausbilden. Am 8. Dec. 1557 schreibt der Herzog in seiner Ausgabenrechnung:
"1557. 30 thaler dem Etzerjungenn, die er mir abuordienen soll, Schwerin am 8 Decembris, damit er etwaß lernen soll, dieweil er sich sein lebenlang zu mir vorpflichtet".
Der Herzog schickte ihn wohl nach Annaberg (vielleicht Gaulraps Geburtsort), um sich dort in der Kunst des Aetzens und Vergoldens der Rüstungen und Waffen auszubilden. Der Herzog hatte dort einen "Platener" Wulf von Speier, bei dem er seine Rüstungen machen ließ; so schreibt er in seinem Tagebuche: "1563. 50 taler dem Platener vf Sanct Annenberg Wulf von Speier vf einen harnisch zu schlagen, d. 25 Febr.".
Auf dieser Reise schickte der Herzog den Erhard Gaulrap bei dem Maler Lucas Cranach in Wittenberg vor, um bei ihm Portraits von Luther und Melanchthon zu bezahlen. In den Renterei=Rechnungen heißt es:
"1557. 24 thaler dem Etzerjungenn geben, so er Lucas Malern geben soll für Controfey deß Lutheri vnd P. Melancthonis, am 9 Decembris".
Diese Reise war für Erhard Gaulrap entscheidend. Vielleicht sollte der berühmte Lucas Cranach der jüngere 1 ), der würdige Sohn seines berühmten (1553 gestorbenen) Vaters, "ausgezeichnet im Portrait und Colorit", den jungen Gaulrap prüfen, vielleicht entdeckte dieser in ihm gute Anlagen und munterte ihn zur Malerei auf: genug Erhard Gaulrap ward Maler und Schüler des Lucas Cranach d. j.
Der Herzog wünschte wohl dringend einen Maler nach seinem Sinne zu haben, den er hatte ausbilden lassen. Er kaufte und bestellte, ehe Gaulrap ausgebildet war, oft Kunstwerke bei andern Malern:


|
Seite 303 |




|
"1560. Okt. 29. 100 thaler Johan Ophorn an rogken zur Wissmar verkauft für ein Stück Esau vnd Jacob".
"20 thaler eidem auff das stück des jüngsten gerichts eodem die zugestelt, sal kegen Faßnacht fertig sein".
"1563. Oct. 14. 25 thaler dem Maler Peter Böckel vf drey gemalte taffeln, so er aus dem niderlande gebracht".
Der Herzog gab nun den Erhard Gaulrap "in die Lehre 1 ) zu Lucas Cranach" in Kost und mit "Lehren und Studiren", um ihn die "Kunst der Malerei zu lehren", so daß Cranach ihn in allem Nothwendigen zu unterhalten hatte 2 ). Im Frühling des J. 1560 war Erhard Gaulrap sicher bei Lucas Cranach in Wittenberg; in des Herzogs Ausgabenrechnung heißt es:
"1560. 8 Mai. 12 thaler dem jungen Gert Maler nach Wittenberg geschickt seinem Meister".
Der Name Gert ist wohl ein Schreibfehler statt Erhard.
Neben der Malerei trieb Gaulrap aber auch noch die Kunst des Aetzens und ätzte für den Herzog noch einen Brustharnisch in Annaberg. In des Herzogs Ausgabenrechnung heißt es:
"1560. 27. Sept. 18 doppelte Ducaten dem Erhard Gilrapf maler und etzer, damit den kuriß zu vergulden, gen Dresden und Anneberge".
"31. Dec. 12 duppelte Ducaten noch geben dem jungen Maler, zu vergulden den kuriß zu S. Anneberge, auch mit zum hinderzuge".
Mit dem Ede des J. 1561 hatte Erhard Gaulrap seine Studien vollendet. Am 20. Februar 1562 zu Stargard nahm der Herzog Johann Albrecht den "jungen Maler" auf Lebenszeit in seinen Dienst, und Erhard Gaulrap verpflichtete sich, dem Herzoge, der ihm alle Beförderung geleistet, "daß er die Kunst der Malerei gelernt und erfahren habe", sich "weiter dazu zu halten" und dem Herzoge die Zeit seines Lebens zu dienen 3 .
Es war bei den zahllosen großartigen Unternehmungen des Herzogs Johann Albrecht allerdings eine Schattenseite, daß es


|
Seite 304 |




|
unter seiner Regierung oft an Geld mangelte. Die Schulden für Erhard Gaulrap wurden erst in den nächsten Jahren bezahlt.
In des Herzogs Tagebuche heißt es:
"1562. 7. Aug. 52 thaler Hertzog Vlrichs bawmeister entrichtet von Erhart Gaulraps des malers wegen bezalt, die er von ime gelehnet hat".
Des Herzogs Ulrich Baumeister war zu der Zeit Franziscus Parr (vgl. Jahrb. V, S. 23).
Lucas Cranach aber ward für seine Forderungen noch lange nicht befriedigt, und hoffte außerdem noch auf ein Ehrengeschenk. Er hatte für die Unterweisung und Unterhaltung im Ganzen 155 Thlr. 18 gr. zu fordern. Am 8. Nov. 1565 bat Cranach um Befriedigung; er erhielt auch 50 Thlr. auf Abschlag, aber noch im J. 1568 waren 105 Thlr. 18 gr. rückständig.
Erhard Gaulrap blieb mehrere Jahre in Schwerin; am 8. Nov. 1565 nennt L. Cranach ihn des Herzogs Diener. Mit der Zeit wird er aber des Herzogs Dienst verlassen haben und nach Meissen gezogen sein. Am 9. Nov. 1572 schreibt Lucas Gaulrap, daß sein Bruder ihn, freilich unbedachtsamer und voreiliger Weise, von der schweriner Schule zu sich nach Meissen gerufen habe, damit er besser die meißnische Sprache erlerne; darauf habe ihn sein Bruder auf die Schulen zu Annaberg und Joachimsthal und auf die Universität zu Leipzig, und endlich nach Frankfurt a. O. geschickt und ihn überall erhalten; da seinem Bruder aber die Ausgaben für ihn zu bedeutend wurden, so erbat er von dem Herzoge eine Unterstützung.
Hiemit verschwindet Erhard Gaulrap aus der Geschichte, wenigstens Meklenburgs.
Es ist nun die Frage, ob etwas von den Werken des Erhard Gaulrap übrig geblieben ist. Ich glaube es bejahen zu können. In dem Fest= und Tanzsaale des alten Schlosses zu Schwerin entdeckte ich vor vielen Jahren an der Hauptwand in einer in dem damals wüst stehenden Saale abgeschauerten Bettkammer hinter den Betten über der berühmten Inschrift des Herzogs Johann Albrecht I. (μητ άξενος μητε πολυξενος) ein wohl erhaltenes, großes Bild, den Herzog Johann Albrecht I. und dessen Gemahlin Anna Sophie auf einer Holztafel neben einander in halber Figur und Lebensgröße darstellend, in einem schönen, gleichzeitigen Rahmen, mit den meklenburgischen Farben blau, roth, gold und schwarz bemalt (vgl. Jahrb. V, 1840, S. 39). Das fürstliche Paar ist in den kräftigsten Lebensjahren dargestellt und allem Anscheine nach im J. 1562 gemalt, wahrscheinlich das Probestück und erste Ge=


|
Seite 305 |




|
mälde Gaulraps in Meklenburg. Ich glaube, daß man dies mit Sicherheit annehmen kann, da die Eigenthümlichkeiten der cranachschen Schule im Allgemeinen, besonders aber scharfe Charakteristik, klares Colorit und feste Farbe, bestimmt hervortreten.
Das Bild ist noch gut erhalten und noch in dem
alten Rahmen aus der Zeit des Herzogs Johann
Albrecht I. Dieser Rahmen ist an und für sich
und für die Kunstgeschichte des 16. Jahrhunderts
nicht unwichtig. Der Rahmen ist vielfarbig; die
äußersten Glieder, also gewissermaßen der Grund,
ist schwarz; der mittlere breitere Streifen ist
blau und von goldenen und einem rothen Streifen
begleitet; auf dem blauen Streifen liegt eine
hübsche goldene, flache Rankenverzierung aus der
Renaissance, welche in den Ecken und in der
Mitte der Seiten von erhabenen Thierköpfen,
Rosetten
 . gehalten ist: die Bemalung des
Ramens ist also in den meklenburgischen Farben
geschehen. Ganz dieselben, jedoch schmalere
Rahmen haben noch 4 Bilder (große Thierstücke)
von Martin de Vos; leider sind diese Rahmen
ihres Schmuckes beraubt und mit einer äußerst
schlechten schwarzen Oelfarbe überschmiert, aber
die Arabesken lassen sich in den Conturen noch
genau erkennen, eben so die Stellen, wo die
größern Verzierungen gesessen haben. Diese
Bilder
1
)
tragen den Namen des Künstlers; eines (mit einem
Leoparden) hat die ausführliche Inschrift:
. gehalten ist: die Bemalung des
Ramens ist also in den meklenburgischen Farben
geschehen. Ganz dieselben, jedoch schmalere
Rahmen haben noch 4 Bilder (große Thierstücke)
von Martin de Vos; leider sind diese Rahmen
ihres Schmuckes beraubt und mit einer äußerst
schlechten schwarzen Oelfarbe überschmiert, aber
die Arabesken lassen sich in den Conturen noch
genau erkennen, eben so die Stellen, wo die
größern Verzierungen gesessen haben. Diese
Bilder
1
)
tragen den Namen des Künstlers; eines (mit einem
Leoparden) hat die ausführliche Inschrift:
VOS . ANTVERPI-
ENCY . 1572.
Ohne Zweifel hat also der Herzog Johann Albrecht I diese Bilder noch selbst ankaufen und einrahmen lassen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Martin de Vos selbst in Meklenburg war und hier malte, wie er auch in fürstlichen Schlössern des Herzogthums Lüneburg gemalt haben soll. Im Schlosse zu Dargun sind einige Zimmer mit einer gewirkten Hautelisse= Tapete ausgeschlagen, welche an einer Seite, jetzt unter einer Leiste auf einer nach hinten umgeschlagenen Kante, den Namen MARTINVS DE VOS tragen 2 ). Martin de Vos hat also die Zeichnungen zu dieser Tapete, welche Gegenstände aus der alten Geschichte darstellen, geliefert.
Wahrscheinlich hat Erhard Gaulrap auch die beiden lebens=


|
Seite 306 |




|
großen Bilder des Herzogs Johann Albrecht I. und Gemahlin, in ganzer Figur, gemalt, welche die Jahreszahl 1574 tragen, früher in der Kirche zu Lübz (dem Wittwensitze der Herzogin) in Fetzen hingen, von hier durch mich nach Schwerin versetzt und für die großherzogliche Ahnengallerie im Schlosse zu Schwerin wiederhergestellt 1 ) sind. Diese Bilder sind sehr charakteristisch, leicht und mit Gewandtheit und Fleiß gemalt, leichter und sicherer als das oben erwähnte Bild auf Einer Holztafel, welches 10 Jahre älter ist. Im J. 1574 scheint Gaulrap aber in Meissen gewohnt zu haben, jedoch kann er immer nach Schwerin gerufen worden sein, da die Bilder unter einander in Gesichtszügen, Alter und Kleidung sehr ähnlich sind. - Die lebensgroßen Bilder des fürstlichen Paares in der Kirche zu Doberan sind erst im J. 1614 von D. B., d. i. Daniel Block, dem Hofmaler der Herzoge Adolph Friedrich I. und Johann Albrecht II., wahrscheinlich nach den lübzer Bildern, gemalt und im J. 1750 "renovirt", haben daher für die Kunstgeschichte gar keinen Werth.
Wichtiger ist in der doberaner Kirche das vortreffliche Bild des Herzogs Ulrich, welches im J. 1587 von dessen Hofmaler Cornelius Krommony, einem Niederländer, gemalt und noch nicht übermalt ist; von demselben Maler sind auch die Bilder der Aeltern des Herzogs in der doberaner Kirche, höchst wahrscheinlich auch die schönen Bilder des Herzogs Ulrich und seiner Gemahlin Elisabeth in der Kirche zu Rühn vom J. 1578. Vielleicht ist auch ein kleines Bild des Herzogs Ulrich und seiner Gemahlin Anna (?) zusammen auf einer Holztafel, früher im Archive, jetzt im Schlosse zu Schwerin, von diesem Maler.
Ob die gleichzeitigen kleinen Bilder des Herzogs Johann Albrecht, seiner Gemahlin und seines Bruders Carl im großherzoglichen Archive zu Schwerin von Erhard Gaulrap stammen, ist wohl schwer zu ermitteln.
Im Auslande mögen sich jedoch noch verschenkte Bilder von ihm finden.


|
Seite 307 |




|
Anlagen.
Nr. 1.
Ich Erhart gaulrap bekenne mit diser meiner eigenen hantschrift, das micher der durchleuchtige hochgeborner forst hertzogk hans albrecht zu Megklenborgk aus forstlicher angeborner mildigkeit mir armen gesellen alle forderung vnd hilfe gethan, das ich die kunst der mallerei gelernt vndt erfaren habe, vnd s. f. g. mich itz weitter dartzu halten, vnd dar kegen habe ich hochgemelten s. f. g. dar kegen zugesaget, hin fure s. f. g. die zeit meines lebens tzu dienen, doch das mich s. f. g. auch meiner gelegenheit nach mit vnterhaltung gnedigest vorsehen, und geschehen tzu stergert den 20 feberwarius 1562.
Nach dem Originale, im großherzogl. meklenburg. Geh. u. Haupt=Archive zu Schwerin, untersiegelt mit einem Siegel mit einem queer getheilten Schilde,in dessen unterer Hälfte ein Vogel, in dessen oberer Hälfte der Vordertheil eines springenden Rosses (wie es scheint) steht, über dem Schilde mit den Buchstaben E. G.
Auf der Rückseite steht von des Herzogs Johann Albrecht eigener Hand geschrieben:
"Des jungen Malers reuersal ad vitam".
Nr. 2.
Durchleuchtiger, hochgeborner furste, gnediger her. Ewer furstlich gnaden sein mein vnderthenige dinste zuuor. Gnediger furst und her. E. f. g. werden sih gnediglich zu entsinnen wissen des offtern schreiben vnd suplizeren van wegen E. f. g. diner Erhardt Gaulrap, welchen ih auff E. f. g. schreiben vnd begeren angenomen vnd E. f. g. befehl nah vnderhalten, das meine an ihn gewandt, mit kost, lheren vnd andern seine nottwendigen vnderhalten, do ih mih dann in vnderthenikeit zu E. f. g. niht allein der bezalung allein, sondern auh mit einer vorehrung in hoffnung gestanden, vnd noh, dan ih weis vnd habe E. f. g. horen rumen, das E. f. g. milde sein gegen denn, so E. f. g. dinen, verhoff niht, das ih der einige allein sey, der solhs must geratten, so ist noh mein vnderteniges bitten, E. f. g.


|
Seite 308 |




|
wollen mih nicht am shaden sein lassen, welhs E. f. g. vm ein hundert thaler ein geringes vnd nicht ein grosse, vnd bin vngezweifelt, E. f. gnaden werden mih dissmol genedigk bdencken, dan wel ih fur solhen muhen (?) E. f. g. vnderthenigk mit bitten ersucht vnd mir ein zettel von E. f. g. werden, darin formeldet, das E. f. g. mih mit eigener boshafft gnedigs beantwortten wolt, dorauff ih geholffen, bit noh vfs vnderthenigste, Ew. f. g. wollen mir mit disem botten gnedigklih beantwortten vnd den rest mit schicken, welhs in vnderthenikeit gegen E. f. g. fordinen wil, verhoff E. f. g. werden mir niht vrsachen geben, mih bei mein gnedigen hern den Churfursten des nah der lenge zu beklagen dorffen vnd furschrifft begeren. Damit sein E. f. gnaden got dem almechtigen in sein gnedigen schuz befholen, erhalte E. f. g. mit langer gesunheit. Datum Wittembergk den 8 nouember 1565.
Ewer furstlichen gnaden
vndertheniger diener
Lucas Cranach
Maler.
Dem durchleuchtigen vnd hochgebornnen fursten vnd hern hern Johans Albrecht hertzogk zu mechelnburg, fursten zu wenden, grafen zu swerin, Rostock vnd stargardt hern, meinem gnedigen fursten vnd hern.
Nr. 3.
Durchleuchtiger hochgeborner Furst, gnediger Her. Ewer furstlh. gnaden sein mein vnderthenige dinst zuuor. Gnediger furst vnd her. Ewer f. g. werden sich genedigk zu entsinnen wissen, das mihr noh etzlihs yeldt als nemlich 105 thl. 18 gr. von wegen Erhardt gawlrappen, so E. f. g. zu mir in di Lhere forschriben vnd befholen, demselbigen zu vnderhalten mitt Lheren vnd studern, zu seiner nottorfft, welhs sich den alles in di 155 thl. 18 gr. erstrecket, darauf ich 50 thl. entpfangen. Weil ich dan auff E. f. g. gnediges begern meinen fleis gethan vnd die forlage gethan, so sein doch E. f. g. bewogen worden, mir den resten nicht zu zalen. Doch kan ich mich des nicht berihten. das ich solhs gegen E. f. g. forschuldet, sondern der vnderthenigen hoffnung gestanden, E. f. g. wurden mich zur pbermassen mit einer forehrung bedacht haben; bit auch noch, das


|
Seite 309 |




|
E. f. g. mich genedicklichen, welhs ich E. f. g. heimstellen wil, wollen mich doch genedicklih bedencken vnd mih niht am schaden so sher lassen. E. f. g. wollen es doch, wie ich hoff, di 105 thlr. bezalen lassen, oder wo es ihe nicht sein kont, genedicklih die helffte geben lassen, vnd mein genediger furst vnd her sein, vnd do fileicht ihmendes mih bei E. f. g. angeben, dessen ih niht hoff, dan mir darin vnguttlih geschiht, wolten solhs mih in vngnaden niht entgelten lassen, vnd bit noh wie zuuorn, Ew. f. g. wollen mir was mit disem botten schicken, dan E. f. g. darann ein geringes vnd mir zu grossem nutz gereichett, welhs ich gegen E. f. g. in vnderthenikeit danckbar wil erfunden werden. E. f. g. wollen meins schreibens kein vngemaches thragen. Damit sein E. f. g. godt dem almechtigen in sein genedigen schutz mit langer gesunheit, fride vnd aller seliger wolfardt befholn. Datum Wittembergk den 19 februarii 1568.
Ewer furstl. Gnaden
vndertheniger
Diner
Lucas Cranach
Maler.
Dem durchleuchtigen hochgebornen fürsten vnd hern hern Johanns Albrecht Hertzogen zu Meckelnburgk
. meinem genedigen fursten vnd hern.


|
Seite 310 |




|



|



|
|
:
|
IV. Zur Wappenkunde.
Ueber
das Wappen der Grafen von Danneberg,
vom
Archivraht Dr. Lisch.
Die Geschichte der Grafen von Danneberg, welche Rudloff (in seiner Urkunden=Lieferung zur Kenntnis der Mecklenburgischen VorZeit, Schwerin, 1789,) zuerst übersichtlich dargestellt hat, ist für Meklenburg von großer Wichtigkeit, indem diese Grafen disseit der Elbe einen großen Theil des südwestlichen Meklenburgs, von Dömitz bis Marnitz und nördlich hinauf bis gegen Hagenow und Neustadt besaßen, also für einen Theil Meklenburgs als ehemalige Landesherren angesehen werden müssen. Die Städte Grabow und Dömitz und das Nonnenkloster Eldena verdanken den Grafen von Danneberg ihre Entstehung und Ausbildung.
Seit langer Zeit habe ich mich bemühet, die Siegel der Grafen von Danneberg zu erforschen, um auch von dieser Seite die geschichtliche Darstellung Rudloffs zu ergänzen. Ist auch das Wappen der Grafen von Danneberg nicht ganz unbekannt, so fehlt es doch noch ganz an einer genauen Forschung, durch welche sich allerdings bemerkenswerthe Ergebnisse herausstellen. Da nun bei der Ausschmückung des neuen Residenzschlosses zu Schwerin auch das Wappen der Grafen von Danneberg zur Frage kommt, so habe ich es für angemessen gehalten, meine Forschungen zu veröffentlichen und mein Verfahren zu rechtfertigen.
So wie die Grafschaft Danneberg durch die Elbe in
zwei Theile geschieden ward, so theilte sich
auch die Grafenfamilie mit der Zeit in zwei
Linien, deren jede ein besonderes Wappen führte.
Die Linie der Grafen von Danneberg zu Danneberg,
am linken Ufer der Elbe, führte einen
rechtsgekehrten, aufsteigenden, ungekrönten
Löwen, die Linie der Grafen von Danneberg zu
Dömitz
 ., am rechten Ufer;
., am rechten Ufer;


|
Seite 311 |




|
der Elbe, einen gleichen Löwen vor einer Tanne auf einem Berge (also außer dem Löwen noch ein redendes Zeichen) im Schilde. - Ich will bei meiner Darstellung der gräflich=dannebergischen Heraldik den rudloffchen Stammbaum zu Grunde legen, da er ausreichend ist, wenn auch durch die neuere Urkundenforschung gewiß viel bisher unbekanntes Material ans Licht gefördert ist.
Die Grafen von Danneberg haben folgende Abstammung und die dabei aufgeführten Schildzeichen mit den Jahren der Urkunde, an denen die Siegel hangen:
Grafen von Danneberg.

Die Siegel, unter deren Schildzeichen die Jahreszahl der Urkunden uneingeklammert steht, werden im Originale im großherzogl. Staats=Archive zu Schwerin aufbewahrt; die Siegel der eingeklammerten Jahreszahlen habe ich in andern Archiven und gedruckten Werken gefunden. Der Graf Volrad II. führt an einer Original=Urkunde des hannoverschen Klosters Mariensee an der Leine vom J. 1215 nur einen rechts gekehrten, aufgerichteten Löwen im leeren Schilde. Von dem Grafen Volrad III. zu Grabow, von der Dömitzer Linie, befindet sich im schweriner


|
Seite 312 |




|
Archive kein Original=Siegel; wohl aber ist sein Siegel, mit einem Löwen vor einer Tanne, in Harenberg Chron. Gandersheim., p. 1394, und in Rehtmeier Braunschw. Lüneb. Chron. I., p. 506, vom J. 1267, abgebildet und befindet sich auch, nach v. Hodenberg's Mittheilung, an einer Original=Urkunde im königl. Staats =Archive zu Hannover. An einer Urkunde im schweriner Archive vom J. 1273 führen zwar Adolfs I. Söhne Volrad III, Friedrich und Bernhard III ein gemeinschaftliches Siegel mit einem Löwen vor einer Tanne, welches freilich nur in einem Fragmente vorhanden ist, aber doch wohl Bernhard III angehört, da es von den übrigen gräflichen Siegeln verschieden ist; jedenfalls aber führen doch die drei Brüder zusammen das unterscheidende Schildzeichen.
Aus dieser Darstellung geht hervor, daß die Grafen von Danneberg disseit der Elbe sicher einen Löwen vor einer Tanne im Schilde führten (mit Ausnahme Heinrich's IV. zu Marnitz, von dem kein Siegel mehr vorhanden zu sein scheint) und daß die Grafen jenseit der Elbe dieses Schildzeichen nie, sondern nur einen Löwen (einmal auch zwei Löwen) im Schilde führten, - daß man also den Löwen vor einer Tanne für den disseitigen Landestheil unbedenklich als Wappen annehmen kann. - Die Tanne steht auf einem Berge, der freilich nicht hoch ist, sich aber doch deutlich genug von dem Boden etwas abhebt.
War nun auch die Gestalt des Wappens der Grafen von Danneberg ermittelt, so stand es doch noch zur Frage, wie dasselbe zu färben sei. Da die Grafen von Danneberg seit dem J. 1306 ausgestorben sind, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sich ein colorirtes Wappen derselben nicht mehr findet. Man muß also durch Schlüsse die Farben des Wappens zu ermitteln suchen. Dieser Schluß kann nur aus andern von den Grafen verliehenen Wappen hergenommen werden. Die Stadt Danneberg führt noch jetzt im Siegel einen Berg mit einer Tanne, welche von zwei Löwen gehalten wird, offenbar durch Verleihung der Grafen; in dem alten Siegel der Stadt Danneberg, von dem ein Abdruck vom J. 1437 vorliegt, fehlt aber der Berg ganz. Nach angestellten Erkundigungen sind die Farben des Siegels der Stadt Danneberg nicht mehr bekannt. In neuern Zeiten ist der Versammlungssaal des landschaftlichen Hauses zu Celle mit den Wappen der lüneburger adeligen Geschlechter, Stifter und Städte in Farben geschmückt und unter diesen das Wappen der Stadt Danneberg mit einer grünen Tanne zwischen zwei schwarzen Löwen im goldenen Felde, mit denselben Farben, mit welchen dort auch das Wappen der Stadt


|
Seite 313 |




|
Lüchow (drei schwarze Rauten im goldenen Felde, nach demselben Schilde, wie es die Grafen von Lüchow führten,) gemalt ist. Wenn ich auch kein Mißtrauen gegen diese Tingirung hegen darf, so kann ich diese doch auch nicht als unbedingt maaßgebend anerkennen, da es mir an begründeten Auctoritäten zu fehlen scheint. Ich habe daher unter den Vasallen der Grafen von Danneberg gesucht, ob sich hier nicht Anklänge des lehnsherrlichen Wappens finden könnten. Und hier treten uns zwei adelige Familien der Grafschaft Danneberg entgegen, welche auch in dem diesseitigen Theile der Grafschaft in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts öfter mit Siegeln auftreten: die von Danneberg und die von Hitzacker; von beiden Familien sind alte Siegel vorhanden und beide Familien existiren noch, so daß hier sichere Fingerzeige zu vermuthen sind, um so mehr, da sich die Farben der adeligen Wappen länger und reiner erhalten haben, als die der Städtesiegel. Die von Danneberg führen seit alter Zeit zwei Queerbalken im Schilde, jetzt zwei goldene Queerbalken auf einem blau und silbern geschachten Schilde, der von zwei goldenen Löwen gehalten wird (vielleicht einer Reminiscenz von den Grafen von Danneberg); die von Danneberg, welche ihres Namens wegen zur Berücksichtigung kommen mußten, müssen hier ausscheiden, weil sie von den Grafen von Danneberg (und deren Hauptburg) nur den Namen, aber nichts im Schilde führen. - Die von Hitzacker führen dagegen nicht den Namen, wohl aber seit alter Zeit das Schildzeichen ihrer Lehnsherren, nämlich einen Löwen im Wappen, jetzt einen silbernen Schild mit einem rothen Löwen, der mit zwei grünen linken Schrägebalken belegt ist. Dieses Wappen halte ich für das den von Hitzacker verliehene Wappen der Grafen von Danneberg, um so mehr, da mir die grünen Schrägebalken eine Hindeutung auf die Tanne zu sein scheinen. Daß der v. hitzackersche Löwe jetzt gekrönt ist und eine Hellebarde trägt, scheint mir nicht alt zu sein, da ich auf alten Siegeln keine Spur davon wahrgenommen habe; mehrere vorliegende gut ausgedrückte und erhaltene Siegel der v. Hitzacker aus der Zeit bald nach dem J. 1350 haben den gräflich=dannebergischen Löwen, ohne Krone, Hellebarde und Queerbalken.
Ich habe daher ohne Bedenken angenommen,
daß das Wappen der ehemaligen Grafen von Danneberg an dem rechten Ufer der Elbe ein rother Löwe vor einer grünen Tanne im silbernen Schilde sei.
Hiezu scheint vortrefflich zu stimmen, daß das Wappen der Stadt Dömitz, der Hauptresidenz dieser Grafenlinie, nach


|
Seite 314 |




|
der Tradition auch ein rothes Thor im silbernen Rundschilde ist.
Bestärken mag diese Annahme noch, daß in dem herzoglich=braunschweigischen Wappen die Tingirung des v. hitzackerschen, also des gräflich=dannebergischen Wappens, sonst nicht vorkommt.



|



|
|
:
|
Siegel der Herzogin Hedwig von Meklenburg.
Aebtissin des Klosters Ribnitz,
1423, † 1467,
und
der Herzogin Elisabeth, Hedwigs Nachfolgerin.
Die Herzogin Hedwig von Meklenburg, Tochter des Herzogs Johann II. von Meklenburg=Stargard, Aebtissin des Klosters Ribnitz 1423 † 1467, führt ein kleines, rundes Siegel mit einem Schilde mit einem Stierkopfe und im Rande, statt der Umschrift, mit den Buchstaben:
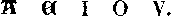
Die Herzogin führt dieses Siegel z. B. an zwei Original=Urkunden: vom Sonntage nach Katharine 1452 und vom Mittwoch vor Oculi 1467.
Dieses selbe Siegel führte auch ihre Nachfolgerin, die Herzogin Elisabeth von Meklenburg, Tochter des Herzogs Heinrich III. von Meklenburg=Schwerin, Aebtissin des Klosters Ribnitz 1467 † 1503. Die Herzogin Elisabeth führt dieses Siegel z. B. an einer Originalurkunde vom S. Marcus=Tage 1469 und auf einem Briefe vom Montage vor Himmelfahrt Christi 1482.
Es leidet also keinen Zweifel, daß beide Herzoginnen ein und dasselbe Siegel führten.
Bekanntlich führte der Kaiser Friedrich III. (1440 - 1493) diese Buchstaben als Wahlspruch: auf seinen großen, kleinen und Handsiegeln, in seinem Monogramm, an Gebäuden und Denkmälern, auf seinem Grabdenkmale. Bekanntlich sind unzählige Erklärungen versucht, bis man eine eigenhändige Erklärung des Kaisers entdeckte; die Buchstaben bedeuten:


|
Seite 315 |




|
 ustriae
ustriae
 st Imperare Orbi Vniverso
st Imperare Orbi Vniverso
oder
 lles
lles
 rdreich Ist Oesterreich Vnterthan.
rdreich Ist Oesterreich Vnterthan.
Vgl. Köhler's Münzbelustigungen, III, S. 169 flgd.
Uebrigens legte der Kaiser nicht immer denselben Sinn in diese Buchstaben; es steht z. B. auf einem Becher des Kaisers in der Ambraser Sammlung zu Wien der Spruch:
Aquila Ejus Iuste Omnia Vincet.
Vgl. v. Leber Wien's Kaiserl. Zeughaus I, S. 167.
Es möchte wohl schwer sein, zu enträthseln, welchen Sinn die Aebtissin Hedwig in diese Buchstaben gelegt hat. Das aber scheint sicher zu sein, daß die Wahl dieser Buchstaben durch den Kaiser Friederich III. veranlaßt worden sei.
G. C. F. Lisch.



|



|
|
:
|
Ueber
die Siegel der Stadt Grabow,
von
G. C. F. Lisch.
Viele Städte haben im Laufe der Zeit ihre ehrwürdigen Siegel, in denen oft ein großer Theil der Geschichte ihrer Stiftung liegt, so sehr entstellen lassen, daß der wesentliche Inhalt ganz verloren gegangen ist. Es giebt aber auch Städte, welche ihr altes Siegel ganz fallen lassen und ein neues Bild in das Siegel aufgenommen haben. So führte z. B. die von den Herzogen von Pommern bestätigte Stadt Stavenhagen, welche im 13. Jahrhundert zu Pommern gehörte, in einem großen Siegel einen Schild mit dem pommerschen, aufsteigenden Greifen; seit wenigstens drei Jahrhunderten hat aber die Stadt dieses Wappenbild fallen lassen und den Stierkopf in ihr Siegel aufgenommen, ohne Zweifel weil sie andere Landesherren erhalten hatte.
Auffallender ist aber die bis jetzt noch nicht erklärte und chronologisch ganz dunkle Veränderung des Siegels der Stadt Grabow. Die Stadt Grabow führte in alten Zeiten im Siegel den Heiligen Georg, in ganzer Figur auf dem Drachen stehend, mit einem aufgerichteten Schwerte in der rechten und einem auf die Erde gestützten, mit einem Kreuze geschmückten Schilde in der linken Hand. Das Siegel hatte eine zweifache Umschrift, in zwei Reihen: in der äußern:


|
Seite 316 |




|

in der innern:

Das große und das kleine Siegel waren von gleicher Bildung. Beide kommen während des 13 - 15. Jahrhunderts öfter vor. Noch während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts führt die Stadt Grabow ein kleines Siegel mit dem Heil. Georg, welches wohl im Anfange des 16. Jahrhunderts gestochen sein wird, da das Inschriftband im Renaissancestyl geschlungen um die Heiligenfigur gelegt ist. Dieses Siegel kommt in den Acten zuletzt am Donnerstag in den Pfingsten 1550 vor.
Jetzt führt die Stadt einen halben Mond und drei Sterne im Siegel. Ueber die Einführung dieses Siegels war bisher gar nichts bekannt und es hatte den Anschein, als wenn das Siegel erst in neuern Zeiten erfunden worden sei. Genauere Forschungen haben jedoch ein anderes Ergebniß geliefert. Dieses neue Stadtsiegel erscheint sehr bald, nachdem das alte Siegel mit dem Heil. Georg aufhört. Während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts führt die Stadt Grabow im Siegel einen Renaissance=Schild, auf welchem unten ein mit den Sicheln nach oben geöffneter halber Mond und darüber ein großer Stern in der Mitte des Schildes steht; über dem Schilde stehen die Buchstaben C. G. Dieses Siegel erscheint zuerst in den Acten am 12. Octbr. 1569 und fernerhin während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Darauf erscheint im 17. Jahrhundert, sicher im J. 1667, ein kleines Siegel ("Minor - Secret") mit einem halben Monde und drei Sternen zur Seite, und dieses Wappen ist bis heute das Wappen der Stadt Grabow geblieben.
Forscht man nach diesem so auffallenden Wechsel des Siegelzeichens der Stadt Grabow, so ist darüber keine urkundliche Nachricht vorhanden. Jedoch gestattet die Zeit der Abschaffung des alten und die Einführung des neuen Wappenzeichens den Schluß, daß der Wechsel zur Zeit (nach 1550 und vor 1569) und im Geiste der Reformation, namentlich der vollständigen Durchführung der Reformation durch den Herzog Johann Albrecht I., vielleicht im J. 1552, durch einfachen Rathsschluß, geschehen sei. Man entfernte aus dem Stadtsiegel das Bild eines katholischen Heiligen, nachdem in der Kirche die Verehrung der Heiligen vollständig abgeschafft war.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 317 |




|
Ueber
das Siegel der Stadt Brüel,
von
G. C. F. Lisch,
vgl. oben S. 64.



|



|
|
:
|
Alte maltzansche Siegel.
Im lübecker Archive hat der Herr Maler Milde zwei maltzansche Siegel entdeckt, welche bisher (in Lisch Urkunden des Geschlechts Maltzan) unbekannt geblieben sind:
1) an einer Urkunde vom J. 1320 ein schildförmiges Siegel mit dem ausgebildeten maltzanschen Wappen und der Umschrift:
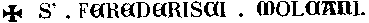
Diese Umschrift ist gewiß interessant, da sie
wohl noch ein Ringen zeigt, die slavische
Aussprache durch die herkömmlichen lateinischen
Buchstaben wiederzugeben; das
 statt Z in dem Namen Moltzan ist
sonst nicht weiter beobachtet. So wie in dem
Zunamen hier der Z=Laut durch C wiedergegeben
ist, so ist in dem sehr gedehnten Vornamen das C
durch SC ausgedrückt!
statt Z in dem Namen Moltzan ist
sonst nicht weiter beobachtet. So wie in dem
Zunamen hier der Z=Laut durch C wiedergegeben
ist, so ist in dem sehr gedehnten Vornamen das C
durch SC ausgedrückt!
2) ein schildförmiges Helmsiegel mit der Umschrift:

Der Helmbusch steht in der Umschrift an der Stelle des Kreuzes.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 318 |




|



|



|
|
:
|
V. Zur Naturkunde.
Fossile Pferdezähne von Schlutow.
Auf dem Felde von Schlutow bei Dargun wurden beim Graben von Muschelkalk in dem Lager, etwa 4 Fuß tief unter der Erdoberfläche, die Zähne eines großen Thiergebisses gefunden und mehrere derselben von dem Herrn Amtmann v. Pressentin an die schweriner Sammlungen eingesandt. Nach der gütigen Bestimmung des Herrn Geheimen=Raths Professors Dr. v. Lichtenstein zu Berlin sind dies Pferdezähne, welche sich im Alluvium, z. B. der Mark Brandenburg, sehr häufig finden.
G. C. F. Lisch.
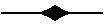


|




|


|




|
