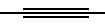|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
|
- Die Anfänge einer staatlichen Wirtschaftspolitik in Mecklenburg im 15./16. Jahrhundert
- Der Blievenstorfer Münzfund
- Zur Entstehung der Medaille von 1718 auf die mecklenburgischen Landesunruhen
- Wismars schwedische Regimenter im Nordischen Kriege
- Volksdialekt und Schriftsprache in Mecklenburg : Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache im 15./16. Jahrhundert (Fortsetzung und Schluß zu Jahrbuch 100 S. 199/248)
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1936-1937
- Hans Spangenberg
- Namensentstellung durch Verschiebung der Wortgrenze in einer Urkunde von 1328



|



|
|
:
|
I.
Die Anfänge einer staatlichen
Wirtschaftspolitik in Mecklenburg
im
15./16. Jahrhundert
von
Dr. Charlotte Millies
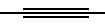


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|
Inhaltsverzeichnis.
| Einleitung: | ||
| Die Wirtschaftsstufentheorie. Die verfassungsgeschichtliche Entwicklung und der Einfluß des Staates auf das Wirtschaftsleben in Deutschland bis zum 15. Jahrhundert. Die politischen Verhältnisse in Mecklenburg im 15./16. Jahrhundert und die Herzöge als Träger wirtschaftlicher Maßnahmen | 5 | |
| Kapitel 1: | ||
| Die mecklenburgische Landwirtschaft im 16. Jahrh. und die Anfänge einer Agrarpolitik | 11 | |
| § 1. Die Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. | 12 | |
| I. Ackerbau, Gartenkultur, Forstwirtschaft und Fischerei | 12 | |
| II. Viehzucht | 14 | |
| § 2. Die Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. | 15 | |
| I. Ihre Neuorganisation durch die Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich | 15 | |
| II. Die Krise der Landwirtschaft, beginnend in der Mitte des 16. Jahrh. | 19 | |
| A. Die Lage von Ackerbau und Viehzucht | 19 | |
| B. Die Intensivierung der Landwirtschaft durch Veredelungswirtschaft | 19 | |
| Kapitel 2: | ||
| Die Anfänge einer Gewerbepolitik in Mecklenburg im. 16. Jahrh. | 22 | |
| Kapitel 3: | ||
| Die Anfänge einer Industriepolitik in Mecklenburg im 16. Jahrh. | 26 | |
| § 1. Eisen- und Kupferindustrie | 26 | |
| § 2. Salpetersiedereien | 30 | |
| § 3. Das Alaunwerk bei Eldena | 32 | |
| § 4. Papiermühlen | 34 | |
| § 5. Sonstige industrielle Betriebe | 35 | |
| Kapitel 4: | ||
| Das Bergwerkswesen in Mecklenburg im 16. Jahrh. | 36 | |
| Kapitel 5: | ||
| Das Salinenwesen in Mecklenburg im 16. Jahrh. | 40 | |
| Kapitel 6: | ||
| Das Verkehrswesen | 44 | |
| § 1. Die Fürsorge für die Landstraßen | 44 | |


|
Seite 4 |




|
| § 2. Die Wasserstraßen | 45 | |
| I. Der Bau des Elbe-Ostseekanals | 45 | |
| II. Weitere Wasserstraßen | 51 | |
| Der Zoll | 52 | |
| Kapitel 7: | ||
| Die Anfänge einer Handelspolitik in Mecklenburg | 53 | |
| § 1. Innenhandel | 54 | |
| I. Grundsätzliche Maßnahmen zur Regelung des Innenhandels und der Güterversorgung | 54 | |
| II. Konjunkturelle Maßnahmen | 58 | |
| § 2. Außenhandel | 60 | |
| I. Die Fürsorge der Herzöge für Handelssicherheit im Seehandel und Ordnung in Handelsangelegenheiten | 61 | |
| II. Handelsverordnungen aus außenpolitischen Gründen | 63 | |
| III. Außenhandel der Herzöge | 65 | |
| A. Handelsbestrebungen Herzog Magnus II. | 65 | |
| B. Handelsbeziehungen der Herzöge Albrecht VII. und Heinrich V. | 66 | |
| 1. Der Handel mit den Niederlanden | 66 | |
| 2. Schiffbau, Klipphafenschiffahrt und Streit mit den Hansestädten Rostock und Wismar | 68 | |
| 3. Floßschiffahrt nach Sachsen | 72 | |
| 4. Schiffsreisen nach Portugal, England und Frankreich | 73 | |
| 5. Handelsbeziehungen zu den norddeutschen Städten | 74 | |
| C. Handelsbeziehungen der Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich | 76 | |
| 1. Handel der Herzöge mit den Niederlanden | 76 | |
| 2. Der Bau zweier Seehandelsschiffe und die mit ihnen unternommenen Handelsexpeditionen unter Herzog Johann Albrecht I. | 77 | |
| a) Der Bau der Schiffe | 79 | |
| b) Die Handelsfahrten der beiden Schiffe "Greif" und "Ochsenkopf" | 80 | |
| 3. Die Klipphafenschiffahrt zur Zeit der Herzöge Johann Albrecht und Ulrich und deren Verhältnis zu den Städten Rostock und Wismar | 81 | |
| 4. Handelsverbindungen mit Mitteldeutschland | 82 | |
| a) Floßschiffahrt auf der Elbe | 82 | |
| b) Handelsverbindungen mit Leipzig und dem übrigen Mitteldeutschland | 83 | |
| 5. Handel mit den norddeutschen Städten | 84 | |


|
[ Seite 5 ] |




|
Einleitung
Man hat versucht, die deutsche Wirtschaftsgeschichte in einzelne Stufen ihrer Entwicklung einzuteilen und sie an bestimmten Idealtypen zu veranschaulichen. Die Theorien Schmollers und Büchers, über die die neuesten Versuche Sombarts und anderer nicht wesentlich hinausgekommen sind, gehen von der Voraussetzung aus, daß der stärkere Einfluß des Staates auf das Wirtschaftsleben erst mit dem Beginn der Neuzeit eingesetzt habe. Demgegenüber ist festzustellen, daß das Wirtschaftsleben sich bereits im Laufe des Mittelalters nicht ohne den Einfluß der staatlichen Gewalt vollzogen hat, wenn diese auch bis zum 13. Jahrhundert nur in bescheidenem Maße vorhanden war. Der geringe Einfluß des Staates auf das Wirtschaftsleben im früheren Mittelalter erklärt sich zum Teil aus der Dezentralisation zur Zeit des Lehnstaates, dem Königtum entglitt damals mehr und mehr die unmittelbare Verwaltung. Es fehlten die zur Vollstreckung des königlichen Willens nötigen Organe, die es Karl dem Großen noch ermöglicht hatten, verwaltungsrechtliche und wirtschaftliche Maßnahmen zu treffen. Erst mit dem Verfall des Lehnstaates, der in Zeiten überwiegender Naturalwirtschaft entstanden war, im 13. Jahrhundert, kam die Ordnung der Verwaltung und des Wirtschaftslebens wieder mehr in die Hände des Staates. Die im 13. Jahrhundert nachweisbaren Tendenzen zur Herausbildung einer Landesherrlichkeit und damit einer staatlichen Wirtschaftspolitik finden ihre Fortsetzung im 15./16. Jahrhundert mit der Entstehung des neuen obrigkeitlichen Polizeistaates 1 ).
Das Bestreben der jungen Landesobrigkeit, auch das Wirtschaftsleben ihrer Autorität zu unterstellen und einheitlich nach den Bedürfnissen des Ganzen zu regeln, wird zunächst aufgehalten durch den allgemeinen Verfall der Territorien und das Aufkommen der ständischen Gewalten. Als der Kampf der


|
Seite 6 |




|
Landesherrschaft gegen die Ordnung des Lehnstaates und seine Mächte kaum beendet war, erhoben sich die Stände, denen zur Erwerbung ihrer Macht und politischen Rechte die bereits seit dem 13. Jahrhundert herrschende starke Finanznot des Fürstentums zugute kam. Von den ständischen Gewalten hing die Bewilligung der Steuern im wesentlichen ab, das Fürstentum geriet dadurch in finanzielle Abhängigkeit von diesen 2 ). Die Linderung der Finanznot durch stärkere wirtschaftliche Betätigung und die Erreichung materieller Unabhängigkeit von den Ständen war deshalb die erste Aufgabe der Landesherren.
Neben der Stadtwirtschaft, deren Blüte in die Zeit der landesfürstlichen Ohnmacht (13. - 15. Jahrhundert) fällt, erhob sich im späteren Mittelalter allmählich die Territorialwirtschaft. Trotzdem also die mittelalterliche Stadtwirtschaft bestehen blieb, fand ein Umschwung im Sinne einer Territorialwirtschaft statt. Das Landesfürstentum wurde mit neu erworbenen Machtbefugnissen seit dem 15./16. Jahrhundert wieder ein entscheidender, die fortschrittliche Entwicklung verbürgender Träger des Wirtschaftslebens 3 ).
In den deutschen Territorien bildete sich schon um die Wende des 15./16. Jahrhunderts und im Laufe des 16. Jahrhunderts ein neuer Fürstentyp heraus 4 ), deren Vertreter Kurfürst Joachim I. von Brandenburg (1474 - 1523), Bogislaw X. von Pommern (1474 - 1523) 5 ), Herzog Albrecht von Preußen, der seit 1511 Hochmeister des Deutschen Ordens war 6 ), Markgraf Christoph von Baden (1475 - 1515) 7 ), Philipp der Großmütige von Hessen (1509 - 1567) 8 ), Herzog Christoph von


|
Seite 7 |




|
Württemberg (1550 - 1568) 9 ), Herzog Julius von Braunschweig-Lüneburg (1568 -1589) 10 ), Landgraf Wilhelm IV. von Hessen (1567 - 1592) 11 ) und Kurfürst August von Sachsen (1553 bis 1586) 12 ) waren. Die Landesherren begannen, die wirtschaftlichen Kräfte ihres Landes zu organisieren. Das geschah zunächst durch allgemeine Landes- und Polizeiordnungen und spezielle Landesordnungen. Darüber hinaus entwickelten die Fürsten durch ihre Eigenschaft als selbständige Wirtschaftspolitiker die neu gefestigten staatlichen Körper zu Repräsentanten wirtschaftlicher Macht nach außen hin und schufen hiermit die Vorstufe zu einer deutschen Volkswirtschaft 13 ).
Diese in Deutschland im 16. Jahrhundert sich vollziehende Entwicklung erfaßte auch Mecklenburg, wo sie ebenfalls begünstigt wurde durch die wirtschaftliche Begabung ihrer Herzöge. Ebenso wie für andere deutsche Territorien ist für Mecklenburg die Annahme unrichtig, daß die wirtschaftspolitische Betätigung der Herzöge bei "tastenden Versuchen" stehen geblieben sei 14 ). Schon Magnus II. (1477 - 1503) hatte eingesehen, daß jeder Staat gewisser wirtschaftlicher Machtmittel bedarf und seine Macht auf ökonomischem Gebiet deutlichster Ausdruck seiner inneren und äußeren Festigkeit ist. Die Verschuldung des mecklenburgischen Hauses gab in erster Linie den Anstoß zu einer vielseitigen Finanz-, Verwaltungs-, Wirt-


|
Seite 8 |




|
schafts- und Regierungspolitik 15 ). Unter Magnus II. waren bereits Ansätze zu einer neuzeitlichen Finanzordnung des Staates, nämlich zur Scheidung des Landesvermögens von dem landesherrlichen Vermögen, vorhanden, ebenso eine strengere Scheidung von Hofhaushalt und Landeshaushalt. Die Verwaltung wurde neu organisiert und ein Beamtentum geschaffen, das in dem Rentmeisteramt gipfelte. Magnus II. schuf etwas grundsätzlich Neues; durch wirtschaftliche Orientierung suchte er die inneren Kräfte des Landes zusammenzufassen und dem Staate dienstbar zu machen. Er hatte das Bestreben, die Isolierung der städtischen Wirtschaftsgebilde aufzuheben und an ihre Stelle die Einheit einer Territorialwirtschaft zu setzen. Darin fand Herzog Magnus II. Unterstützung bei den Landräten und sogar bei den Ständen 16 ), die eingesehen hatten, daß nur eine starke Hand Mecklenburg vor dem Verfall retten könne. Wenn es auch Herzog Magnus II. nicht gelang, die Seestädte Rostock und Wismar seiner Landeshoheit zu unterwerfen, so vermochte er doch, sie in gebührende Schranken zurückzudrängen. Alle seine Bemühungen waren von dem Bestreben erfüllt, den Staat von oben her politisch und wirtschaftlich zentralistisch zu organisieren.
Als Herzog Magnus II. im Jahre 1503 starb, hinterließ er seinem Bruder Balthasar (gest. 1507) und seinen Söhnen Heinrich V. (1479 - 1552) und Albrecht VII. (1486 - 1547) ein wirtschaftlich gesundes Land mit geordneten Finanzverhältnissen. Unter seinen Nachfolgern vollzog sich jedoch eine Rückentwicklung. Schon bald mußten sie zu Darlehen ihre Zuflucht nehmen und Ämter versetzen. Albrechts Neigung zur Prunkentfaltung und sein langjähriger Aufenthalt in der Fremde waren die Hauptursache für die erste Verschuldung von Magnus Söhnen. Sie wurde aber in der Hauptsache durch die im Jahre 1517 von den Ständen bewilligte Landbede beseitigt. Albrechts VII. mißglückter Versuch, im Jahre 1535/36 den dänischen Königsthron zu gewinnen, war der Grund für die neue, von nun an chronische Verschuldung des mecklenburgischen Fürstenhauses 17 ). Weiterhin charakteristisch für das ganze 16. Jahrhundert sind die sich immer wieder erneuernden Landesteilungsstreitig-


|
Seite 9 |




|
keiten, die unter den Herzögen Heinrich V. und Albrecht VII. ihren Anfang nahmen 18 ), und die Kämpfe mit den mecklenburgischen Hansestädten, die einer wirtschaftlichen Erstarkung des mecklenburgischen Landes nicht gerade günstig waren. Herzog Heinrich, gen. der Friedfertige, hatte zudem nicht die wirtschaftspolitische Begabung und den Weitblick seines Vaters geerbt, wenn er sich auch bemühte, dessen Wirtschaftsunternehmungen als guter und sparsamer Landesvater fortzuführen. Albrecht VII. war dagegen in der Wirtschaftspolitik auf große Ziele gerichtet, er schuf die Grundlage für die umfangreichen wirtschaftspolitischen Bestrebungen Herzog Johann Albrechts I. (1525 -76), dessen Persönlichkeit stark an Magnus ll. erinnert und der Mecklenburg vielleicht wieder zur gleichen Blüte geführt hätte wie dieser, wären die inneren und äußeren Schwierigkeiten nicht zu groß gewesen 19 ). Die Verschuldung hatte eine immer drohendere Form angenommen und war wichtiger Gegenstand der Beratung auf den Landtagen 20 ). Auch die Landesteilungsstreitigkeiten nahmen unter den Herzögen Johann Albrecht und Ulrich ihren Fortgang 21 ). In eine außerordentlich schwierige Lage kam Mecklenburg durch den unglücklichen Ausgang der Erbteilungsstreitigkeiten, die in Livland im Interesse Herzog Christophs (1537 - 1592) stattfanden 22 ). Herzog Christoph machte sich nach seiner Rückkehr nach Mecklenburg jedoch als Administrator des Stiftes Ratzeburg besonders um die Anfänge des Bergwerks- und Salinenwesens und der Metallindustrie verdient. Herzog Ulrich (1527 bis 1603), der im Landesteil Güstrow regierte, war schöngeistig


|
Seite 10 |




|
und religiös veranlagt und wirtschaftspolitisch bei weitem nicht in dem Maß interessiert wie sein Bruder Johann Albrecht I.
Waren die Bestrebungen und Maßnahmen auf wirtschaftspolitischem Gebiet bis dahin recht bedeutende gewesen, so ist mit dem Ende der siebziger Jahre ein starker Rückgang in dieser Beziehung festzustellen. Die katastrophale finanzielle Lage erlaubte, abgesehen von einigen Bestrebungen industrieller Art, keine wichtigen neuen wirtschaftlichen Unternehmungen mehr. Die hauptsächlichen Maßnahmen bis zum Ende des Jahrhunderts bestanden in Ausfuhrverboten, die Zeugnis ablegten von der schlechten wirtschaftlichen Lage Mecklenburgs. Schon vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges also, der die wirtschaftliche Blüte Mecklenburgs vollends vernichtete, sind bereits die von Herzog Magnus II. begonnenen und den Herzögen Albrecht VII. und besonders Johann Albrecht I. fortgesetzten wirtschaftlichen Unternehmungen durch innere und äußere Hemmnisse in ihrer Fortentwicklung gehindert worden.
Trotzdem die allgemeine politische Lage Mecklenburgs sich im Laufe des 16. Jahrhunderts verschlechterte, sind die wirtschaftspolitischen Maßnahmen von seiten der Landesherren im ganzen gesehen mannigfaltig. Ihre Betätigung auf den Einzelgebieten der Wirtschaft, in Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie, Bergwerks- und Salinenwesen und schließlich auf dem Gebiete des Verkehrswesens und der Handelspolitik sind ein deutlicher Beweis für die Entstehung einer territorialen Wirtschaft in Deutschland im 16. Jahrhundert.


|
[ Seite 11 ] |




|
Kapitel 1.
Die mecklenburgische Landwirtschaft
im
16. Jahrhundert
und die Anfänge einer Agrarpolitik
In einem Lande, das, wie Mecklenburg, von Natur aus einen agraren Charakter trägt, sind Maßnahmen auf dem Gebiete der Landwirtschaft die nächstliegende Aufgabe der Fürsten. Mannigfache Verordnungen zur Regelung und Organisation landwirtschaftlicher Angelegenheiten legen Zeugnis ab von ihrem Wollen und Streben; sagt doch einer der Herzöge zur Motivierung seiner Maßnahmen selbst einmal wörtlich: "dieweil Gott der Allmechtige das Hauß Meckelnburgk nicht sonderlich als andere Lender und Furstentumbe, sondern nur mit dem Veldtbau und Viezucht begabet" 23 ). Doch gerade auf dem Gebiete der Agrarpolitik sind die herzoglichen Maßnahmen mehr privater als staatlicher Natur. In der Übergangsperiode zwischen Mittelalter und Neuzeit, in der staatliche Wirtschaft und Privatwirtschaft noch nicht streng geschieden waren, tragen die Erlasse agrarpolitischer Art vorwiegend eigenwirtschaftlichen Charakter, wenn auch Ansätze allgemein wirtschaftspolitischer Gedankengänge vorhanden sind. Dies trifft vor allem für soziale Maßnahmen für die Landbevölkerung zu. Im Verhältnis zu anderen Territorien, wo starke Unterdrückung und Kneblung der Bauern herrschte, waren die Verhältnisse in Mecklenburg vor dem Dreißigjährigen Kriege verhältnismäßig günstig; die Leibeigenschaft herrschte hier im 16. Jahrhundert noch nicht wie in den Nachbarterritorien Holstein und Pommern 24 ). Der eigenwirtschaftliche Charakter der


|
Seite 12 |




|
Landwirtschaft schließt die Tatsache nicht aus, daß die Einkünfte aus Agrarproduktion im Außenhandel den Reichtum des Landes erhöhen und vor allem eine reichliche Lebensmittelversorgung Mecklenburgs gewährleisten sollten.
Das Prinzip der Zentralisation, das sich nun in Mecklenburg durchgesetzt hatte, tritt in der Landwirtschaft besonders klar zutage. Durch Magnus II. bereits, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, den Wohlstand des Landes wieder zu heben und die ererbte Schuldenlast abzuwälzen, hatte das Domanium seine alte Bedeutung zum Teil wiedergewonnen, die unter seinen Vorgängern verpfändeten Ämter und Gerechtsame wurden eingelöst 25 ). Außerdem findet sich die Bestimmung, daß wüste Hufen, an denen der Adel neben den Herzögen Nutzungsrechte hat, ganz in die Nutzung des Herzogs genommen und wieder bebaut werden sollen, falls die Adligen trotz Aufforderung sich weigern, sich an der Wiederbesetzung mitzubeteiligen 26 ).
Auf der Basis eines neu gefestigten Besitzes konnte sich nun eine Organisation und Auswertung der Landwirtschaft aufbauen, wie wir sie in den Jahrzehnten nach Magnus II. Tod entstehen sehen. Die Fäden der Verwaltung laufen in der Hand der Herzöge zusammen, diese sind es, die allein die maßgebende Instanz darstellen und bei jeder wichtigen Gelegenheit die Entscheidung haben.
§ 1. Die Landwirtschaft in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
I: Ackerbau, Gartenkultur, Forstwirtschaft und Fischerei.
Hatte man schon um die Jahrhundertwende unter Magnus II. landwirtschaftliche Produkte ausgeführt, so war dies unter Herzog Albrecht VII. in gesteigertem Maße der Fall 27 ). Es wurden Einnahmen für verkaufte Naturalien verbucht, die der herzoglichen Kasse zuflossen. Häufige Getreideverkäufe sprechen für einen bedeutenden Ackerbau. Bereits im Jahre 1519 wurde für 584 Mark Korn verkauft 28 ), im Jahre 1527


|
Seite 13 |




|
wurde der Verkauf von 25 Last Roggen an den Wismarer Bürger Steffen von dem Deiche verbucht, ebenso eine Einnahme für Roggen aus dem Amte Grabow und aus dem Amte Boizenburg. Auch Malz wurde ausgeführt. Im gleichen Jahre wurde für 305 Mark nach Mölln und für 200 Mark nach Wismar geliefert, aus den Ämtern Grabow und Walsmühlen wurden ebenfalls Einnahmen für Malz gemeldet 29 ). Bis zur Mitte des Jahrhunderts finden sich weitere zahlreiche Einnahmen für verkauftes Getreide, das auch außerhalb Mecklenburgs verhandelt wurde, so in Lüneburg, Hamburg und Stettin 30 ). Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, daß die mecklenburgischen Bäcker aus den herzoglichen Ämtern mit Brotgetreide beliefert wurden, auch ein Weizenverkauf an die Bäcker von Schwaan und ein Roggenverkauf an die Bäcker von Grevesmühlen fand in Jahren 1544 - 1545 31 ) statt. Weiter zu nennen ist eine Mehllieferung von etwa 200 Schiffspfund an Rostocker Kaufleute im Jahre 1550 32 ). Die Summe der Einnahmen für verkauften Roggen belief sich für den Güstrower Landesteil im Jahre 1556 auf etwa 1355 Gulden. Der Roggen stellte neben Hafer und Gerste das Hauptgetreide Mecklenburgs dar, während der Weizen stark in den Hintergrund trat. Das Anbauverhältnis von Weizen zu Roggen war damals niedriger als 1:10 33 ).
Die Verarbeitung des Getreides fand in zahlreichen herzoglichen Mühlen statt, zu denen die Mühlensteine wiederholt aus Pirna i. Sa. und Perleberg herbeigeschafft wurden 34 ). Der Bau herzoglicher Mühlen gab oft Anlaß zu Streitigkeiten mit dem Adel, der für sich das gleiche Recht, Mühlen zu errichten, in Anspruch nahm. Beschwerden über die für den Adel abträgliche Wirkung der herzoglichen Mühlen finden sich häu-


|
Seite 14 |




|
fig 35 ). Die Müllerordnung, von den Herzögen 1577 erlassen, gab Richtlinien zur Beseitigung von Mißständen 36 ).
Sogar der Weinbau nahm bereits unter Heinrich V. seit den ersten Jahren seiner Regierung einen gewissen Raum ein. "Am 12. Januar 1505 schickte er einen Weinmann nach dem Rheine, um Reben zu holen, und im Frühling d. J. ward in den Weingärten fleißig gearbeitet. 1505 waren "Weingärten" zu Schwerin und Lübz. Um Ostern 1506 ward der Schweriner Winzer wieder nach dem Rheine geschickt, um Weinreben und Knechte zu holen. 1508 waren die fürstlichen Weinberge zu Schwerin, Lübz, Plau, Grevesmühlen und Stargard schon in vollem Gange. Mehr fürstliche Weinberge von größerer Ausdehnung kommen nicht vor; von diesen aber verbreitete sich der Weinbau im 16. Jahrhundert über das ganze Land." 36a )
Ebenso sind im ersten Viertel des Jahrhunderts Anfänge einer Forstwirtschaft zu erkennen. 1519 ward Holz aus den Ämtern Güstrow, Ribnitz und Gnoien von Herzog Heinrich nach Rostock verkauft 37 ). Einen Bretterhandel nach Hamburg und Magdeburg hatte schon Herzog Magnus II. in den Jahren 1495 -99 betrieben 38 ).
Vermöge ihrer Fischereigerechtigkeit bildeten die Flußläufe und Seen eine Geldquelle für die Herzöge. Der Fischmeister zu Sternberg lieferte 1519 45 Mk. an die herzogliche Kasse ab 39 ). Späterhin finden sich weitere Einnahmen für Fische verzeichnet 40 ).
II. Viehzucht.
Die Viehzucht nahm zunächst, wie es scheint, einen weniger breiten Raum ein als der Ackerbau. Vereinzelt finden sich Angaben über den Verkauf von Ochsen und Schweinen 41 ). 1527 wurden 119 Ochsen nach Zerbst i. A. getrieben 42 ). Außer-


|
Seite 15 |




|
dem wurde schon unter Herzog Magnus II. 43 ) mit Speck gehandelt. Innerhalb der Viehzucht trat in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, wie auch später, die Schafzucht besonders hervor, was deutlich in dem ausgedehnten Wollhandel zum Ausdruck kommt. Schon 1518/19 wurde für 406 Mk. Wolle durch den Küchenmeister zu Wittenburg nach Lüneburg und zur gleichen Zeit für 80 Mk. aus dem Amte Lübz an den Rostocker Ratsherrn Veit Oldenborch verkauft 44 ). Aus dem Güstrower Bezirk wurde ebenfalls Wolle verhandelt 45 ). Herzog Heinrich schloß 1527 einen Vertrag mit zwei Schweriner Tuchmachern, worin er sich verpflichtete, während zweier Jahre alle Rheinische Wolle an sie zu verkaufen 46 ). 1528 wurden 117 Stein Wolle an den einen und 100 Stein an den anderen Tuchmacher geliefert. Die Menge der gesamten verkauften Wolle betrug etwa 300 Stein 47 ). 1532 wurde die Wolle der herzoglichen Schäfereien zu Boldela auf vier Jahre einem Schweriner Tuchmacher zugesagt 48 ). Eine weitere große Schäferei befand sich etwas später zu Krebsförden 49 ).
§ 2. Die Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
I. Ihre Neuorganisation durch die Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich.
Von der Mitte des Jahrhunderts ab findet sich eine Fülle von herzoglichen Verordnungen auf landwirtschaftlichem Gebiet, die auf eine Art Neuorganisation schließen lassen. Die Planmäßigkeit der Wirtschaftsführung ist es, die sich von jetzt ab immer wieder kundtut, erstens in den Verordnungen der Herzöge 50 ) und zweitens in der Art der Buchführung über Erträge, wie sie von den Rentmeistern, Küchenmeistern und Amtleuten gehandhabt wurde 51 ). Bei allen Maßnahmen sieht man immer


|
Seite 16 |




|
wieder die ordnende und unumschränkt herrschende Gewalt. Letzteres tritt besonders beim Verkauf der produzierten Güter hervor, der ohne Wissen und Willen der herzoglichen Grundherren nicht stattfinden durfte 52 ). Die Herzöge hatten über die rein wirtschaftlichen Vorteile hinaus das Ziel, die Güterversorgung im eigenen Lande sicherzustellen 53 ). Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Verordnungen der Fürsten über die Art der Verwaltung, über grundsätzliche Fragen der Bewirtschaftung und über Neuerungen und Verbesserungen durch Bauten.
Man war von der richtigen Erkenntnis geleitet, daß tüchtige Hilfskräfte Vorbedingung sind für die Produktivität der Landwirtschaft, daß Mißstände sich nicht einschleichen dürften, wenn gute Erträge erzielt werden sollten. Der Rentmeister wurde angewiesen, fest zu besoldende, wohlerfahrene Haushalter, Amtleute, Vögte und Schäfer zu bestellen, "damit der Ackerbau zu rechter Zeit begadet, die Früchte desselben wol eingesamblet undt die Nutzung von dem Viehe und Schafen uns zum besten aufgehoben werden muge" 54 ). Die Küchenmeister sollten nach eingeholter herzoglicher Zustimmung den Überschuß an Korn, Vieh, Wolle usw. an den Meistbietenden verkaufen und den Erlös sofort dem Rentmeister abliefern. Es wurden bestimmte Termine festgesetzt, an denen die Register in der Kammer zu Schwerin dem Rentmeister vorzulegen waren: Michaelis für Rindvieh, Schafe und Hanf, am Dreikönigstag für Gerste, Buchweizen und Schweine, Mitfasten für Weizen und Erbsen und Trinitatis für Roggen, Malz und Hafer, Fische und Holz. Jedes Register sollte eine Feststellung des Ertrages und Erlöses enthalten.
Das in die unteren Instanzen gesetzte Vertrauen wurde allerdings oft mißbraucht, z. B. das Halten eigenen Viehs auf den herzoglichen Höfen gab Anlaß zu Tadel 55 ). Besonders die Ausbeutung und Überbürdung der armen Untertanen mußte gerügt werden, wobei neben dem sozialen Gesichtspunkt beson-


|
Seite 17 |




|
ders der hieraus erwachsende Schaden für die Herzöge betont wird. Die Leute sollten arbeitswillig gemacht und erhalten werden. Den Müllerburschen sollte z. B. eine Zulage gewährt werden, damit sie gut mahlen 56 ).
Die Bewirtschaftung sollte möglichst rationell und sparsam, bei Vermeidung unnötiger Unkosten, durchgeführt werden, damit Fortschritte in der Produktionsmenge erzielt werden könnten. Genaue Anweisungen finden sich für alle Zweige der Landwirtschaft, "damit das Ackerwerck, Weinberge, Hoppenhave und ander Garten- auch Viehezucht, Scheffereien, Fischereien, Mollen, auch alle andere Nutzung in gutem Vortgang und Besserunge" 57 ). Die Dreifelderwirtschaft war die übliche Art der Bewirtschaftung. Von den 6000 Hufen des einen Landesteils wurden 4000 besät, während 2000 brach lagen 58 ).
Besonders hervorzuheben ist aus den Bestimmungen 59 ) für den Ackerbau die Festsetzung der Fruchtfolge, z. B. daß nach Flachs weiße Rüben angebaut werden sollten. Die Äcker sollten in ordentliche Schläge eingeteilt werden und nur das beste Saatkorn sollte Verwendung finden. Die Gerste sollte im zweiten oder dritten Jahr umgewechselt und die Saat von den einzelnen Hufen ausgetauscht werden, damit ein besseres Wachstum erzielt werde. Man sollte darauf achten, daß alle landwirtschaftlichen Arbeiten zur rechten Zeit geschähen, und daß das Getreide trocken eingefahren wurde. Äcker und Wiesen, die in Gründen lägen und überschwemmt wären, sollten abgegraben werden, damit das Wasser abfließe und Korn und Heu gedeihen könnten.
Neben dem Ackerbau sollte eine ausgedehnte Gartenkultur und Bienenzucht getrieben werden. Es finden sich Bestimmungen über Gemüse-, Obst- und Weinbau. Die Gärten sollten erweitert, Obstbäume angepflanzt und veredelt werden. Das zum Bebauen nicht geeignete Land sollte mit Bäumen bepflanzt und das Jungholz zum Schutze umfriedet werden. Überhaupt bestand damals bereits eine geregelte und planmäßige Forstwirtschaft. Von der Aufforstung der Hölzungen ist öfter die


|
Seite 18 |




|
Rede mit dem Bemerken, daß sie genügend Holz für die Untertanen liefern müßten und daß das überschüssige Holz verkauft werden sollte. Es sollte aber kein Holz unnütz gehauen und das gehauene Holz genau verzeichnet werden. Für jeden Stamm waren sechs junge Eichbäumchen in derselben Hölzung anzupflanzen.
Ebenso eingehende Bestimmungen finden sich für die Viehzucht und Geflügelhaltung. Es sollten genaue Verzeichnisse über die Kopfzahl angelegt werden. Die Art der Fütterung wurde genau bestimmt. Das Melkvieh war nach märkischer und meißenscher Art zu behandeln. Besonders sollte darauf geachtet werden, daß kein Getreide verfüttert wurde, es sollte in Kesseln für das Vieh gekocht und Kohl-, Hopfen- und Weinblätter sollten getrocknet als Futter dienen. Für das Jungvieh und die Muttertiere wurde besondere Wartung befohlen. In den Schäfereien sollte man durch sachgemäße Behandlung das Lämmersterben einzudämmen suchen 60 ). Zur Verbesserung der Zucht sollten junge Starken zugekauft werden. Von den Schäfereien sollten Böcke an die Untertanen zur Artverbesserung ihrer Schafe verkauft werden. Das Vieh sollte vor Krankheit geschützt, und aus diesem Grunde sollten alle Viehhöfe und Schäfereien untermauert werden.
Überhaupt standen die Baulichkeiten unter besonderer herzoglicher Fürsorge. Allgemein war bestimmt, daß sie in gutem Zustand zu erhalten wären. Vielfach finden sich Nachrichten über Neubauten und Instandsetzungen von Kornböden, Stallungen und Scheunen. 1548 wurde das Kornhaus zu Stavenhagen neu erbaut 61 ). Vom 28. Juli 1560 bis zum 2. Febr. 1561 wurde von einem Tischler mit drei Gesellen an einem Kornhaus zu Rehna gearbeitet und in den Jahren 1561 -64 zu Schwerin auf dem Klosterhof ein neues Kornhaus errichtet, wozu Bauholz aus Fürstenberg und Steine und Lehm zum Fundament zu Schiff herbeigeschafft wurden. In der gleichen und folgenden Zeit finden sich öfter Andeutungen über weitere Kornböden, Stallungen und Scheunen und deren Bau 62 ). Zu


|
Seite 19 |




|
Wittenburg wurde 1561 an der Schäferei gearbeitet, zu Neustadt ein Ochsen- und Viehhaus gebaut 63 ) und 1565 wurden in den einzelnen Ämtern neue Schweinehäuser errichtet 64 ).
II. Die Krise der Landwirtschaft, beginnend in der Mitte des 16. Jahrhunderts.
A. Die Lage von Ackerbau und Viehzucht.
In der Zeit um die Jahrhundertmitte trat eine Krise für die mecklenburgische Landwirtschaft ein. Trotz aller Anordnungen und Anweisungen der Herzöge, die sicher z. T. eine Folge der Krisenerscheinung waren und in diese Zeit hineinreichten, war die Rentabilität des Ackerbaus und der Viehzucht stark in Frage gestellt. Der veranschlagte Getreideertrag, um dessen Steigerung man sehr bemüht war, konnte in den Jahren 1569/70 in Wirklichkeit nicht erreicht werden. Herzog Johann Albrecht hatte 1571 darüber zu klagen, daß durch Unregelmäßigkeiten und Unachtsamkeiten von den meisten Ämtern nicht ein Heller Überschuß bleibe und daß kaum das zweite oder dritte Saatkorn Frucht trage. Bei der Viehzucht sei der Abgang größer als der Nachwuchs. Die Folge müsse nach drei bis vier Jahren, falls keine Änderung einträte, ein Aussterben des Viehs sein. Der Flachsbau decke bei weitem nicht die Bedürfnisse. Aus diesem Grunde wurde befohlen, mehr Sorgfalt auf die Wirtschaft zu verwenden, damit die Einfuhr von Leinen verringert werde 65 ). Der Mangel an Produkten des Ackerbaus wurde auch vielfach bedingt durch Mißernten. Diese Tatsache fand ihren Niederschlag in den mannigfachen Ausfuhrverboten in dieser Zeit 66 ).
B. Die Intensivierung der Landwirtschaft durch Veredelungswirtschaft.
Eine Folge und Begleiterscheinung dieser Zustände mag die nunmehr erhöhte Intensivierung der Landwirtschaft sein. Durch Vergrößerung des Bestandes und durch Zuchtversuche in der Viehhaltung und durch eine Verbesserung der Gartenkulturen


|
Seite 20 |




|
suchte man eine Erhöhung der Rentabilität der Landwirtschaft zu erreichen.
Im Jahre 1555 wurden Ochsen aus Dänemark eingeführt 67 ), im Jahre 1558 für 200 Taler Vieh und Schweine aus Pommern, ebenso im Jahre 1561 68 ). Daß es dem Herzog Johann Albrecht sehr um gute Zuchtschweine zu tun war, beweist ein Schreiben des Hauptmannes von Prignitz und Ruppin, wonach dieser seine Bitte um eine Anzahl guter Zuchtschweine nicht erfüllen konnte 69 ). 1566 wurden 100 Schweine aus dem Stift Verden und eine Anzahl Zuchtschweine gekauft 70 ). Im gleichen Jahre wurden 300 Ochsen zum Preise von 1400 Talern in Podolien Westrußland) gekauft 71 ). Fast gleichzeitig fand eine Ochseneinfuhr von 226 Stück aus Polen statt 72 ), die auf die Ämter verteilt wurden. Die 100 größten sollten im Amte Neustadt gemästet und dann zum Teil verkauft werden, die übrigen in Mengen von 6 - 15 Stück an die übrigen Ämter versandt werden. Gleichzeitig erging der Befehl, den Amtleuten das nötige Korn und Stroh zur Fütterung zuzusenden. Es sollte aber nur altes und verdorbenes Korn neben Häcksel und Malztrebern verfüttert werden 73 ). Die Ochsenhäute wurden an die Schweriner Schuster verkauft 74 ). Das gleiche geschah mit den Hammel-, Schaf- und Lämmerfellen. Herzog Albrecht machte einen Vertrag mit einem gewissen Kaspar Kruse, der bei vereinbarten Preisen das Erstkaufrecht haben sollte 75 ). 1567 wurde eine allgemeine Bestimmung über den Verkauf von Fellen erlassen 76 ).
Ebenfalls aus Holstein wurde Vieh eingeführt. Der Küchenmeister von Wredenhagen erhielt 1564 den Auftrag, dort für 200 Gulden junges Rindvieh einzukaufen und ins Amt Schwe-


|
Seite 21 |




|
rin zu bringen 77 ). Auch eine weitere Vergrößerung der Schafzucht scheint stattgefunden zu haben; sie nahm immer mehr an Bedeutung zu. Anfang der 70er Jahre wurde von Herzog Johann Albrecht eine Schäferei zu Wittenburg erbaut 78 ). Der Wollhandel ging damals weit über die mecklenburgischen Grenzen hinaus 79 ). In den Jahren 1550 -52 wurde Wolle nach Stettin versandt, 1550 etwa 580 Stein. Im Jahre 1559 kaufte der Magdeburger Bürgermeister für etwa 2650 Gulden alle vorrätige ein- und zweischerige Wolle in der Menge von 1880 Stein. Der Magister Simon Leupold verkaufte in herzoglichem Auftrag weiterhin Wolle in Bergedorf. Bis nach Sachsen und in die Niederlande, in die Lausitz und nach Schlesien ging sein Wollhandel. In Torgau, Schmiedeberg, Herzberg, Goldberg und Jessen wurde mecklenburgische Wolle von den Tuchmachern verarbeitet. Im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts erreichte die Einnahme aus der Wolle durchschnittlich 5000 Gulden im Jahr 80 ).
Die Amtsordnung von 1567 hatte bestimmt, daß die herzoglichen Gärten für einen ausgedehnten Gemüsebau erweitert und der Überschuß daraus verkauft werden sollte. Im Frühjahr 1567 brachte ein Weinrebner aus Köln Weinstöcke nach Mecklenburg und pflanzte sie in Schwerin an 81 ). Erbsen wurden in ziemlicher Menge angebaut 82 ). Gartensamen wurde 1597 sogar aus Augsburg bezogen 83 ).
In den Wäldern wurde im Sinne der Amtsordnung von 1567 aufgeforstet. Herzog Ulrich kaufte Tannensaat aus der Mark 84 ). Das Holzroden und die Verwüstung der Holzungen wurde streng verboten 85 ).


|
Seite 22 |




|
Kapitel 2.
Die Anfänge einer Gewerbepolitik
in
Mecklenburg im. 16. Jahrhundert
Die sich im 15./16. Jahrhundert allmählich durchsetzende Überordnung der territorialen Gewalt über die städtische fand ihren besonderen Niederschlag in wirtschaftspolitischen Bestimmungen für Handwerk und Gewerbe.
Das erste grundlegende Gesetz für Mecklenburg ist die Polizeiordnung von 1516 86 ), die in den Jahren 1542, 1562 und 1572 mehrere Neuauflagen und Revisionen erlebte. Die Veranlassung zu der von den Herzögen Heinrich und Albrecht mit dem Einverständnis der Landstände veröffentlichten Gesetzgebung boten die Klagen der Untertanen über Unordnungen und Mißbräuche in den Städten, die seit 1512 an die Herzöge gelangt waren. Der herzogliche Sekretär Johann Monnick wurde beauftragt, eine Rundreise durch alle Städte zu unternehmen und über die dortigen Verhältnisse zu berichten. Auf Grund seiner Erkundigungen und der Klagen, die ziemlich überall bei den Städten die gleichen waren, wurde nun die neue Polizeiordnung ausgearbeitet. Sie enthält allgemeine Abgrenzungen der städtischen und ländlichen Rechte und Einzelverordnungen über die einzelnen Zweige von Gewerbe und Handwerk.
Einen Anlaß zu stetigen Streitigkeiten zwischen Stadt und Land gab das Braugewerbe, das, zu den städtischen Rechten gehörig, auf dem Lande von Adel und Bauern nicht ausgeübt werden durfte, damit jede Konkurrenz für die Städte und eine Schmälerung ihrer wirtschaftlichen Macht wegfiel. Die Polizeiordnung brachte nun genaue Bestimmungen, die beiden Teilen, der Stadt- und der Landbevölkerung, entgegen kamen und so


|
Seite 23 |




|
alle Mißhelligkeiten durch genaue Abgrenzung der Gerechtsame zu beseitigen suchten. Es wurde verordnet, daß Adel und Geistlichkeit zwar brauen dürften, aber nur für den Eigenbedarf in ihrem Hause, keinesfalls sollten sie Bier gegen Entgelt ausschenken oder an die Krüger verkaufen. Alle anderen Landbewohner, wie die Bauern, Müller, Küster, durften nicht brauen, außer daß zur Erntezeit jeder Bauer für sich und sein Gesinde brauen konnte. Es wurde bei Strafe verboten, zu Kindtaufen, Hochzeiten und anderen Festen zu brauen. Zum wirtschaftlichen Schutz der Dorfkrüger, die ihr Bier aus der Stadt bezogen, ward verfügt, daß die Bürger sie nicht übervorteilen und mit Schulden belasten sollten. Der Krüger durfte nicht gezwungen werden, von seinem Gläubiger Bier zu beziehen, sondern sollte das Recht haben, zu kaufen, bei wem er wollte. Bei Abzahlung etwaiger Schulden sollte die Herrschaft behilflich sein 87 ).
Daß diese Verordnungen auch durchgeführt und Übergriffe der Städte gelegentlich verhindert wurden, zeigt ein Schreiben Herzog Heinrichs von 1517 an den Rat zu Rostock. Es handelte sich um einen Krüger zu Volkenshagen, den der Rat vertrieben hatte 88 ). Im Laufe des Jahrhunderts häuften sich aber doch trotz der Bestimmungen der Polizeiordnung die Klagen über das Bierbrauen auf dem Lande, so daß neue Verfügungen und Hinweise auf die Polizeiordnung nötig wurden. Auf Beschwerde der Stadt Wismar befahl Herzog Johann Albrecht 1549 allen Vögten, Küchenmeistern, Verwesern, Äbten, Propsten und allen Klöstern, dafür zu sorgen, daß entgegen den Bestimmungen der Polizeiordnung auf dem Lande kein Bier gebraut werde 89 ). Als die Städte sich auf dem Güstrower Landtage 1555 über Bierbrauen und Malzmachen auf den Dörfern beschwerten, wurde wiederum die Ungesetzlichkeit des Brauens auf dem Lande betont 90 ). Gleiche Klagen und Bestimmungen wiederholten sich auf den Landtagen von 1572 zu Güstrow und Sternberg, 1584 zu Sternberg und 1589 zu Güstrow. Die Amtsordnung von 1567 und eine Kon-


|
Seite 24 |




|
stitution der Herzöge von 1571 wiederholten das Verbot ebenfalls 91 ).
Wichtig vor allem aber waren die sehr eingehenden Bestimmungen über das Handwerk, die ein großes Interesse der Herzöge für das innere Leben der Städte und ihr wirtschaftliches Gedeihen bekunden. Von grundlegender Bedeutung war die Bestimmung der Polizeiordnung von 1516, daß das Handwerk ein Privileg der städtischen Einwohner bleiben und, außer den Schmieden, kein Handwerker auf dem Lande geduldet werden sollte 92 ). Diese Bestimmung wiederholte sich in späterer Zeit, außer in den neuen Polizeiordnungen, in den Entschlüssen der Herzöge Johann Albrecht und Ulrich auf dem Güstrower Landtag von 1555 93 ) und in der Amtsordnung von 1567 94 ). Eine Überfüllung im Handwerk, die das wirtschaftliche Auskommen der einzelnen in Frage stellen würde, sollte vermieden werden. Es wurde in der Polizeiordnung ein numerus clausus für Handwerker in den Städten aufgestellt, damit in jeder Stadt und in jedem Handwerk oder Amt nicht mehr Leute zugelassen wurden, als nötig waren und Existenzmöglichkeit hatten. Die Entscheidung hierüber wurde dem Ermessen des Rates einer jeden Stadt überlassen 95 ). Weiterhin wurde betont, daß tüchtige Handwerker gefördert 96 ) und Mißstände innerhalb des Handwerks beseitigt werden sollten 97 ).
Genaue Richtlinien wurden für die einzelnen Zweige des Handwerks aufgestellt. Die Polizeiordnung von 1516 wies den Rat der Städte an, im Interesse des gemeinen Wohls darauf zu achten, daß die Bäcker gutes Brot mit richtigem Gewicht backten, Fleischer, Schuhmacher und Schmiede ihre Ware zu angemessenen Preisen feilböten. Zur Kontrolle sollten sachverständige Ratsmitglieder mindestens alle Vierteljahr einmal Besichtigungen vornehmen und die Übertreter unter Strafe stellen 98 ).


|
Seite 25 |




|
Sogar in die Gepflogenheiten der Zünfte griffen die herzoglichen Bestimmungen ein. Die Polizeiordnung verbot übertriebene Schlemmereien bei Gildeschmäusen, die Anlaß zu wirtschaftlicher Schädigung der einzelnen und der Allgemeinheit wären. Außer der Pfingst- und Schützengilde waren alle Veranstaltungen untersagt. Es sollten in keinem Handwerk mehr als zwei Innungsversammlungen, Morgensprachen genannt, stattfinden; es durfte bei diesen Anlässen wohl Bier geschenkt, aber keine Speise aufgetragen werden 99 ).
Alle Handwerker sollten freien Eingang in ihr Amt haben, d. h. ohne Geld dafür zu entrichten und Meisterschmäuse dafür zu veranstalten 100 ). Weiterhin wurde bestimmt, daß die Lehrlinge dem Meister nicht mehr als das übliche Lehrgeld geben und beim Meisterstück dem Meister keine Geschenke machen sollten 101 ).
Um das Handwerk und dessen Wohlstand weiterhin zu schützen, wurden Mißbräuche, die wirtschaftliche Schädigung bedeuten, aufgehoben. Als sich das Schusterhandwerk zu Neubrandenburg 1572 beschwerte, daß ungelernte Schuster sich in den Städten und sogar auf dem Lande niederließen und Fellkäufer die Felle bei den Bauern aufkauften und so die Zufuhr in die Städte hinderten, was Teurung und Übervorteilung zur Folge habe, sorgten die Herzöge Johann Albrecht und Ulrich für Abhilfe. Sie stellten dabei die Bedingung, daß beim Schusterhandwerk selbst keine Übertretungen der Polizeiordnung mehr vorkämen und die festgesetzten Höchstpreise nicht überschritten würden. Übertretungen wurden bestraft und bei dreimaliger Wiederholung das Handwerk entzogen 102 ). Ebenso verfuhr man 1572 mit dem Tischlerhandwerk. Es wurde einerseits in seinen Interessen unterstützt und andererseits zur Innehaltung der Vorschriften ermahnt. Für angemessene Preise sollte es sorgen und den Entwurf einer Neuordnung den Herzögen zur Überprüfung vorlegen 103 ).


|
Seite 26 |




|
Kapitel 3.
Die Anfänge einer Industriepolitik
in
Mecklenburg im 16. Jahrhundert
Innerhalb der Wandlung, die sich in der wirtschaftlichen Struktur Mecklenburgs durch eine bewußte Wirtschaftspolitik der Herzöge im 16. Jahrhundert vollzog, nimmt der Beginn einer verzweigten Industrialisierung einen verhältnismäßig bedeutenden Raum ein. Diese Tatsache ist dadurch, daß Mecklenburg stets vorwiegend ein Agrarland war und heute noch ist, doppelt bemerkenswert. Das Bestreben der Herzöge, alle nur irgend möglichen wirtschaftlichen Kräfte aus dem Lande herauszuholen und es so nach außen hin unabhängig und sogar exportfähig zu machen, führte zur Entstehung mannigfacher industrieller Unternehmungen. Es entstanden eine Eisenindustrie, Salpetersiedereien, ein großes Alaunwerk, Kupfer- und Messingwerke, Pulver- und Papiermühlen und andere Rohstoffe verarbeitende Betriebe an verschiedenen Stellen des Landes. Bemerkenswert ist, daß sogar die für die Herstellung notwendigen Rohprodukte, die im Lande nicht oder nicht genügend vorhanden waren, eingeführt wurden, um in Mecklenburg verarbeitet zu werden, wie es in der Eisen- und Kupferindustrie geschah. Wenn auch der Erfolg der industriellen Betriebe in vielen Fällen sich als bedeutungslos erwies, so bleibt doch die Tatsache, daß auch auf diesem Gebiet ernste Bemühungen der Herzöge um die Verbesserung der mecklenburgischen Wirtschaft stattfanden.
§ 1. Eisen- und Kupferindustrie
Erste Spuren einer Eisenherstellung in Mecklenburg finden sich bereits im 13. Jahrhundert 104 ). Seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts wurden dann mehrere Eisenwerke in Mecklenburg errichtet, zu deren Entwicklung das Eingreifen der Herzöge wesentlich beigetragen hat. Wenn man die Geschichte


|
Seite 27 |




|
dieser Eisenwerke verfolgt, ergibt sich die bemerkenswerte Tatsache, daß auch hier, wie im Bergwerks- und Salinenwesen, der Erfolg kein dauernder war und daß die Werke der fürstlichen Kasse keinen Gewinn brachten.
Die Herzöge bemühten sich, das Eisen im eigenen Lande herzustellen, das früher aus Wernigerode, Schmalkalden, aus den Hansestädten und in der Hauptsache aus Schweden eingeführt worden war 105 ). Vor allem sind es die Herzöge Albrecht VII. und später Johann Albrecht I., die ihre Aufmerksamkeit den Eisenhütten zuwandten und sich bemühten, sie zur wirtschaftlichen Blüte zu führen. Einen ersten Anhaltspunkt für die auf Eisengewinnung gerichteten Bemühungen bietet ein Hinweis auf ein Eisenwerk in Grabow aus dem Jahre 1513 106 ). Aus einem Schuldbrief des Besitzers Johann Reymundt geht hervor, daß dieser das Eisenwerk von den Herzögen Heinrich und Albrecht zu Lehn hatte. Eine zweite undatierte Nachricht über einen Eisenhammer Herzog Heinrichs findet sich in dem Bruchstück eines Rentereiregisters, das, der Schrift nach zu urteilen, aus der Zeit um 1530 stammt 107 ). Ob es sich hierbei um das soeben erwähnte Eisenwerk zu Grabow handelt oder um den Eisenhammer in Neustadt, über den aus dem Jahre 1544 der erste Bericht vorliegt, oder um ein drittes, sonst nie genanntes Werk, ist nicht festzustellen. Ich möchte mich der Ansicht zuwenden, daß es sich um eine erste Aufzeichnung über den Eisenhammer zu Neustadt handelt, der 1544 wieder aufgerichtet wurde, wie es ausdrücklich in dem Kontrakt Herzog Heinrichs mit dem Blechschmied Mathes Schatz heißt 108 ). In dem Rentereiregister sind die Einnahmen und Ausgaben auf den Hammer verzeichnet, einer Einnahme von etwa 600 Gulden steht eine etwas größere Ausgabe gegenüber. Bemerkenswert ist, daß der zur Eisenherstellung nötige Eisenstein, genannt Osemunt, aus Lübeck bezogen wurde, das wohl die Einfuhr aus Schweden vermittelte.
Im Jahre 1544 fand nun ein Ausbau und eine Vergrößerung des Eisenhammers zu Neustadt statt, neben welchem außerdem noch ein Blechhammer angelegt wurde 109 ). Herzog


|
Seite 28 |




|
Albrecht beauftragte am 20. April 1544 den Blechschmied Matthias Schatz aus Nürnberg, die Aufsicht über den Eisenhammer zu übernehmen, und übergab ihm den Blechhammer in Erbpacht. Das Gebäude hatte dieser auf eigene Kosten zu erhalten und jährlich 40 Gulden Erbpacht zu zahlen. Wie sich die Anlage rentierte, ist nicht bekannt, jedenfalls existierte im Jahre 1572 der Blechhammer nicht mehr. Die Schmelzhütte bestand jedoch fort, wenn sie auch in der Zwischenzeit keine Erwähnung findet; 1570 wurde sie durch Herzog Johann Albrecht neu eingerichtet, der am 17. Juli den Eisenschmelzer Hans Maltzsch aus Steinbach auf sechs Jahre in seinen Dienst stellte. Es wurden Kugeln aller Art, Kanonen, Granaten, Mörser, Destillierkolben, Öfen, Mühlenzapfen, Gewichte, Pressen usw. hergestellt. Nachdem die Herstellungsmenge zuerst sehr gestiegen war, nahm sie wieder bedeutend ab und sank 1579 mit 290 Zentnern unter die für 1572 verzeichnete Menge von 350 Zentnern. Wie groß in dieser Zeit das Interesse des Herzogs am Gedeihen des Werkes war, zeigen die günstigen Bedingungen für den Schmelz- und Gießmeister, der seine Arbeiten nach einer bestimmten Taxe bezahlt bekam und daneben einen bestimmten Geld- und Naturallohn erhielt; außerdem wurden die Hilfskräfte ebenfalls von dem Herzog bezahlt. Da die Schmelz- und Gießhütte einen jährlichen Zuschuß brauchte, legte der Herzog im Jahre 1574 neben der Gießerei einen Frischhammer an, wo täglich zwei Zentner Stangeneisen zu Nägeln verarbeitet werden sollten. Zum Meister für dieses Werk wurde am 10. Mai 1574 Balthasar Keiner aus Schmalkalden bestellt. Einen Beweis für die ernstliche Bemühung des Herzogs, das Unternehmen zweckmäßig und rentabel anzulegen, bietet weiterhin die interessante Tatsache, daß er sich einen Bericht über das brandenburgische Eisenwerk zu Klosterfelde in der Neumark verschaffte. Der Herzog schloß oft persönlich die Rechnungen ab und zahlte den erforderlichen Zuschuß. Als er 1576 gestorben war, ließ Herzog Ulrich sich alljährlich genaue Berechnungen einliefern. Da diese in den Jahren 1576 bis 1579 zeigten, daß die Werke ohne Zuschuß nicht existieren konnten, der Holz- und Kohleverbrauch unverhältnismäßig groß war, wurden die Werke, da der Ertrag den Aufwendungen nicht entsprach, stillgelegt.
Außer diesen beiden Eisenwerken in Grabow und Neustadt wurden noch zwei Hämmer durch Herzog Christoph gebaut, die aber nicht genau zu lokalisieren sind, die die Ortsangabe in


|
Seite 29 |




|
beiden Fällen fehlt 110 ). Am 14. April 1563 beauftragte Herzog Christoph einen gewissen Wolf Spranger, einen neuen Eisenhammer auf seine eigenen Kosten zu bauen, wozu das nötige Holz ihm geliefert werden sollte. Er erhielt die Hammer zu Erblehn und hatte dafür jährlich 50 Mark lüb. an das Amt Schönberg zu bezahlen. Es ist demnach anzunehmen, daß der Hammer im Amt Schönberg lag. Der Bau des Werkes geschah also mit Unterstützung des Herzogs, aber ohne Risiko seinerseits, während bei dem Werk in Neustadt das Unternehmen ganz in den Händen der Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich lag.
Nachdem der im Gebiet Herzog Christophs gefundene Eisenstein von Sachverständigen untersucht worden war, ließ der Herzog 1575 zu dessen Verarbeitung eine Mühle an einem Wasser erbauen 111 ). Er bat die Sachverständigen, da er die Arbeit bald begonnen wissen wollte, einen der Eisengewinnung kundigen Mann zu ihm zu senden. Ob es sich bei dieser Eisenmühle um die Hammermühle zu Mannhagen bei der Steinburg oder um die zu Mechow (Bäk) bei Ratzeburg handelt, ist ungewiß. Jedenfalls zeigt auch dieses Unternehmen, wie groß Herzog Christophs Interesse für solche Anlagen war, und daß außer den bekannten Eisenwerken zu Grabow und Neustadt zu dieser Zeit noch weitere Betriebe entstanden.
Trotz der Armut Mecklenburgs an Edelmetallen bestand in Neustadt außer dem Eisenwerk in den achtziger und neunziger Jahren auch ein Kupferwerk. Aus dem Jahre 1592 ist das Bruchstück eines Inventars dieses Werkes erhalten 112 ), und am 3. Dezember 1593 besichtigte Herzog Ulrich persönlich die Kupfermühle 113 ). 1594 wurden größere Mengen Kupferkies und Kupfervitriol aus Goslar eingeführt 114 ). Es ist wohl anzunehmen, daß diese im Kupferwerk von Neustadt verarbeitet wurden. 1580/81 ist bereits eine Einnahme von 182 Gulden 8 Schillingen für verkauften Kupfer verbucht 115 ). Daneben wurde noch Kupfer eingeführt, 1585 aus Dresden und vorher 1569 und 1570 aus Ungarn 116 ). Neben dieser Kupfermühle


|
Seite 30 |




|
in Neustadt bestand noch eine solche bei Rostock, die 1572 kurz erwähnt wird 117 ). Zu Neustadt, das der Mittelpunkt der mecklenburgischen Industrie war, bestand zur gleichen Zeit wie das Kupferwerk ein Messingwerk, das auch in dem soeben erwähnten Inventar von 1592 erwähnt wird. Es zeigt sich also, daß Mecklenburg zu dieser Zeit eine nicht unbedeutende Metallindustrie hatte.
§ 2. Salpetersiedereien
Im Laufe des 16. Jahrhunderts entstanden in Mecklenburg eine Reihe von Salpetersiedereien. Der Einblick in ihre Entwicklung 118 ) gibt ein lebendiges Bild von der Art der Betriebsführung und dem Anteil der Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich an diesem industriellen Zweige. Während noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts der notwendige Salpeter nach Mecklenburg eingeführt worden war - Belege dafür sind Briefe über einen Salpeterkauf in Hamburg durch Hans Holm im Jahre 1523 und einen Salpeterkauf von zwei Erfurter Bürgern im Jahre 1526 -, begann in den siebziger Jahren eine großzügige Herstellung im eigenen Lande, deren Mittelpunkt zunächst Parchim war.
Wie aus einem Schreiben Ulrichs aus Schwerin vom 11. April 1573 an Herzog Johann Albrecht hervorgeht, waren schon Anfänge einer Salpetergewinnung in Mecklenburg von privater Seite gemacht worden. In diesem Schreiben wurde dem Herzog, der um Zusendung eines Salpetersieders gebeten hatte, mitgeteilt, daß ein solcher schwer aufzutreiben sei, da die Meister Verträge mit den Adligen hätten, denen sie für den Boden, aus dem die Salpetererde gewonnen würde, eine Gebühr bezahlten. Da sie so den überschüssigen Gewinn für sich behalten konnten, wollten sie sich nicht gern in fürstlichen Dienst begeben. Mit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts jedoch gelang es den Fürsten, das Salpetersieden so sehr unter ihren Einfluß zu bringen, daß es 1584 sogar zu einem Regal wurde; die Herzöge nahmen das alleinige Recht für sich in Anspruch, Salpeter sieden zu lassen, der Salpeterzehnte mußte von den Siedern an die fürstliche Kasse gezahlt werden, d. h. der zehnte


|
Seite 31 |




|
Zentner mußte kostenlos abgeliefert werden, während vorher die Sieder noch die Möglichkeit hatten, den überschüssigen Salpeter in Hamburg, Lüneburg oder anderswo zu verkaufen. Der Salpeter wurde zum Handelsobjekt und zu einer willkommenen Einnahmequelle für die fürstlichen Finanzen.
Die Salpetersiedereien zu Parchim werden zum ersten Male 1572 erwähnt. Der Salpetersieder erhielt 20 Gulden zur Löhnung seiner Knechte. Am 16. August erhielt dieser zum gleichen Zweck und zum Ascheeinkauf 30 Gulden, am 22. Mai 1573 15 Gulden 119 ). Laut des Dienstvertrages wurde dem Salpetersieder das notwendige Werkzeug zur Verfügung gestellt. Er erzielt bei halbjährlicher Kündigung jährlich 40 Gulden, für jeden Knecht 8 Gulden und Deputat. Herzog Ulrich schrieb an alle Amtsleute, Küchenmeister, Vögte usw., daß dieser Salpetersieder mit Namen Hans Koeler in seinem ganzen Lande Salpetererde graben dürfe unter der Bedingung, daß dadurch die Bürger und Bauern, in deren Ställen und Scheunen er graben werde, nicht geschädigt würden. Holz, Asche und alles andere notwendige Material sollte ihm zur Verfügung gestellt werden. Trotzdem litt jedoch die Salpeterherstellung zunächst unter dem Mangel der dazu notwendigen Produkte. Es bestanden also Schwierigkeiten, die Salpetersiederei in Gang zu bringen. Einen großen Teil der Schuld daran trug die Geldnot des Herzogs.
Am 4. Oktober 1573 befand sich bereits ein zweiter Salpetersieder mit Namen Berndt Ferber zu Parchim. Von da ab scheint der Salpetersieder das nötige Material gehabt zu haben. Aus dem Jahre 1575 ist ein Verzeichnis der Asche vorhanden, die aus den einzelnen Ämtern geliefert wurde. Zu diesem Register ist auch die Lieferung von Holz angedeutet. Von Fastnacht 1577 ab bis Ostern 1582 erhielt auch Hans Koeler wieder seine jährliche Besoldung von 40 Gulden. Er beschäftigte in dieser Zeit drei bis vier Knechte, darunter einen Meisterknecht 120 ). Damals scheint also das Salpetersieden in Blüte gestanden zu haben. Ein Beweis dafür ist, daß sogar Salpeter ausgeführt wurde. Am 18. April 1577 zahlte der König von Dänemark 785 Gulden 8 Schilling für 31 Zentner Salpeter 121 ).


|
Seite 32 |




|
In den achtziger und neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts fanden noch manche Bestallungen von Salpetersiedern statt, die außer in Parchim an verschiedenen Orten des Landes wirken sollten. Es wurde immer wieder betont, daß man ihnen das nötige Material zur Verfügung stellen sollte, sogar von den Kanzeln aus sollte den Bauern nahe gelegt werden, ihnen ihre Asche zu billigen Preisen zu überlassen. Die Küchenmeister erhielten Befehl, für den Zentner abgelieferten Salpeter 13 Taler zu zahlen und ihn an sicherem Ort aufzubewahren. Die Salpeterherstellung fand nun in großen Mengen statt, was aus den Ablieferungslisten hervorgeht. Wie schon gesagt, wurde der Salpeter zu einem einträglichen Handelsobjekt. Er wurde für 13 Taler pro Zentner von den Salpetersiedern aufgekauft und für 18 Taler wieder verkauft. Am 8. Februar 1586 kaufte ein gewisser Goedert von Borchau aus Hamburg 148 Zentner und 15 1/2 Pfd. Salpeter zum Preise von 2666 Talern 14 Schillingen. Nach Lübeck wurde in den Jahren 1591/92 ebenfalls Salpeter versandt 122 ). Mecklenburg entwickelte sich also hier von einem Einfuhr- zu einem Ausfuhrlande. Die Salpeterherstellung sicherte dem mecklenburgischen Lande die eigene Versorgung mit Salpeter und ermöglichte darüber hinaus den Versand nach außerhalb.
§ 3. Das Alaunwerk bei Eldena.
Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Salpetersiedereien entstanden, wurde bei Eldena am Wantzenberge Alaun entdeckt und im Anschluß daran eine Alaunsiederei angelegt 123 ). Ein besonderes Verdienst um dieses Alaunwerk hatten ebenfalls die Herzöge Ulrich und Christoph 124 ).
Am 24. Juli 1576 125 ) bestellte Herzog Ulrich Hans Stecher aus Huchholz in Sachsen zum Alaunsieder für das neue Werk.


|
Seite 33 |




|
Er sollte mit seinen sechs Gehilfen jährlich mindestens 1000 Zentner Alaun herstellen. Als Besoldung erhielt er jährlich 150 Taler und Naturallohn, den ihm das Klosteramt Eldena zuzustellen hatte. Das notwendige Werkzeug bekam er geliefert. Wichtig ist die Bestimmung, daß er darauf achten sollte, daß die Gehilfen voll beschäftigt würden, andernfalls sollte er Entlassungen vornehmen; es bestand also das Bestreben, das Lohnkonto nicht unnütz hoch steigen zu lassen. Der Alaunsieder stellte dann ein genaues Inventar auf, wie es für das Alaunwerk notwendig war. Aus diesem ist ersichtlich, daß die Anlage für die damalige Zeit sehr großzügig und technisch durchdacht war. Das nötige Holz wurde in der Lewitz genauen und die Elde hinabgeflößt. Zum Erzgraben forderte der Siedemeister weitere 12 Arbeiter an.
Sofort nach Einrichtung des Werkes wurde von Herzog Ulrich für Absatzmöglichkeiten des Alauns gesorgt. Er ersuchte bereits am 3. Juli 1578 die 14 größten Städte Mecklenburgs, bei den Gewandfärbern nachzufragen, ob sie Alaun gebrauchen könnten. Sie sollten diesen nicht mehr außerhalb des Landes einkaufen, sondern ihren Bedarf im Inlande decken. Es wurden sogar Alaunproben an die Färber gesandt.
Da der Alaunsieder Hans Stecher sich nicht als tüchtig genug erwies und die Aufwendungen unter seiner Leitung von Herzog Ulrich für viel zu hoch erachtet wurden und dem Ertrag nicht entsprachen, wurde er am 25. Juli 1578 durch Bastian Bentz aus Kaufungen in Sachsen und Steffen Lange aus Wickersrode in Hessen ersetzt, die die Anlage verbessern sollten, damit sie sparsamer wirtschaften und jede Woche mindestens 10 Zentner reinen Alaun abliefern könnten. Nach erfolgter Umstellung sollte einer von ihnen das Alaunwerk übernehmen. Michaelis 1578, also nach drei Monaten, wurde Sebastian Bentz dann zum ständigen Siedemeister bestellt. Die Zahl der dauernden Hilfskräfte wurde auf 18 erhöht. Nach dem Tode des Bastian Bentz 1584 trat Oswald Lange an seine Stelle; die jährliche Besoldung von 200 Talern wurde bei ihm auf 140 Taler herabgesetzt. Dem Hauptmann und Küchenmeister zu Eldena wurde befohlen, darauf zu achten, daß größte Sparsamkeit auf dem Alaunwerk obwalte. Die Herstellungsmenge entsprach jetzt der Forderung des Herzogs; sie betrug im nächsten Jahre 500 Zentner und es blieb ein Überschuß von 1039 Gulden. Ostern 1587 wurde wiederum der Siedemeister gewechselt, dessen Lohn weiter auf jährlich 100 Taler herab-


|
Seite 34 |




|
gesetzt wurde. Aus der Folgezeit fehlen Nachrichten über das Alaunwerk; aus dem Jahre 1601 ist aber bekannt, daß der Alaun nach Hamburg und Lübeck zum Verkauf gesandt wurde, er also zum Handelsobjekt nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb des Landes geworden war.
§ 4. Papiermühlen.
Mit der Entstehung der Buchdruckereien wurde eine große Menge an Papier nötig. Während früher das Papier aus Hamburg, Lübeck und Berlin bezogen worden war 126 ), begann man nun mit der Herstellung in Mecklenburg selbst. Auch hier war es wieder das persönliche Eingreifen der Herzöge, das den neuen Industriezweig förderte, der auch vom kulturellen Standpunkt aus sehr bedeutsam war.
Bereits 1519 schlossen die Herzöge Heinrich und Albrecht mit den Papiermachern Kaspar Vischer und Blasius Grün einen Vertrag über Aufrichtung einer Papiermühle zu Sternberg 127 ). Die Herzöge stellten die Lieferung des Inventars in Aussicht und verlangten eine jährliche Pacht von 40 Gulden. Ob der Bau zustande kam und wie lange die Mühle bestand, ist nicht feststellbar. Im gleichen Jahre 1519 wurde das Projekt einer Papiermühle zu Neustadt erörtert 128 ). Ob es sogleich ausgeführt wurde, ist aus den Akten nicht zu ermitteln, jedenfalls bestand die Papiermühle schon vor dem Jahre 1544 129 ). 1558 wurde ein Pächter mit Namen Michel Wolter vom Herzog Johann Albrecht angestellt, der aus seinen Waldungen das zum Ausbau der Mühle erforderliche Holz lieferte und dem Amtmann zu Neustadt befahl, für den guten baulichen Zustand der Papiermühle zu sorgen.
Ungefähr zur gleichen Zeit wurde in Grabow 130 ) eine Papiermühle erbaut. In welches Jahr der Beginn ihrer Tätigkeit fällt, ist ungewiß; erwähnt wurde sie zum ersten Male 1525. Im Jahre 1547 wurde sie dem Papiermüller Groen lebenslang in Pacht gegeben. Um 1589 war Martin Tiede dort als Papiermüller tätig. Dieser erhielt das Privileg


|
Seite 35 |




|
zum Lumpensammeln im ganzen Fürstentum. Die Papiermühle bestand in den folgenden Jahren fort und rentierte sich, nachdem sie neu hergerichtet worden war, zunächst sehr gut, was aus der Erhöhung des Jahreszinses hervorgeht.
Eine weitere Papiermühle wurde 1585 durch Herzog Ulrich auf Veranlassung der Rostocker Gelehrten zu Bützow angelegt 131 ). Der Herzog besichtigte persönlich den Ort, wo sie gebaut werden sollte. Ebenfalls in den achtziger Jahren wurde zu Gadebusch der Bau einer Papiermühle durch Herzog Christoph und seine Gemahlin geplant; das zur Verfügung stehende Geld reichte zunächst nicht aus, im Jahre 1611 aber bestand an dieser Stelle eine Papiermühle 132 ). Ob die von Herzog Johann Albrecht und Herzog Ulrich im Jahre 1577 geplante Papiermühle zu Parkentin zur Ausführung gelangte, ist ebenfalls fraglich 133 ).
Die mecklenburgische Papierfabrikation gelangte bald zu großem Ansehen. Ihr Ruhm drang so weit, daß Herzog Ernst Ludwig von Pommern schon 1579 Herzog Ulrich bat, ihm einen Papiermacher zu empfehlen, da er beabsichtige, in seinem Lande auch Papiermühlen anzulegen, trotzdem vermochte sich die mecklenburgische Papierindustrie auf die Dauer gegen die holländische, französische und englische Konkurrenz nicht durchzusetzen, da sie im Verhältnis zu den ausländischen Fabriken mit primitiven Betriebsmitteln arbeitete. Das Verdienst der mecklenburgischen Herzöge bleibt es aber, den Versuch einer umfangreichen Papierherstellung in Mecklenburg überhaupt gemacht und diese nach Kräften unterstützt zu haben.
§ 5. Sonstige industrielle Betriebe.
Außer den soeben geschilderten Industriezweigen bestanden im 16. Jahrhundert noch andere Betriebe industrieller Art, die ein weiterer Beweis für die große wirtschaftliche Betriebsamkeit in Mecklenburg zu jener Zeit sind.
Im Jahre 1512 ließen die Herzöge Heinrich und Albrecht eine Sägemühle im Amte Strelitz erbauen 134 ). 1519 bestand


|
Seite 36 |




|
eine Sagemühle zu Lübz 135 ), die mit fürstlichen Geldern errichtet wurde. Außerdem bestanden Pulvermühlen in Neustadt, Rehna und Rühn 136 ). Die Pulvermühle zu Neustadt war bereits 1520 vorhanden. Eine Ölmühle befand sich am Ende des Jahrhunderts im Amte Grabow und wurde von der Elde getrieben 137 ). Eine Walkmühle wurde 1571 auf Kosten der fürstlichen Kasse erbaut 138 ). Ob schon Ansätze zu einer Glasindustrie, die sich erst im 17. Jahrhundert in Mecklenburg reger entfaltete, vorhanden waren, ist ungewiß 139 ). Die bei Hofe nötigen Gläser wurden noch aus der Glashütte bei Stintenburg in Lauenburg bezogen 140 ).
Die industrielle Entwicklung nahm im beginnenden 17. Jahrhundert ihren Fortgang. Die Grundlage dazu geschaffen zu haben, ist das Verdienst der bewußten wirtschaftlichen Gesinnung des 16. Jahrhunderts und der in dieser Zeit regierenden Herzöge, die alle, zwar in verschieden hohem Maße, an dieser Entwicklung mitgeholfen haben.
Kapitel 4.
Das Bergwerkswesen in Mecklenburg
im
16. Jahrhundert.
Mannigfache Bestrebungen der mecklenburgischen Herzöge im 16. Jahrhundert finden sich auf dem Gebiete des Bergwerkswesens. Antrieb hierzu war sowohl das persönliche, wissenschaftliche Interesse, das besonders bei Herzog Christoph vorhanden war 141 ), als auch die Finanznot der Fürsten. Die uns


|
Seite 37 |




|
erhaltenen Schriftstücke über den Bergbau 142 ) zeigen mit Deutlichkeit, wie rührig die Bestrebungen der Herzöge zeitweise auch auf diesem Gebiete waren. Die Armut Mecklenburgs an Edelmetallen, die dem Zeitalter der Alchimisten eigentümliche Unkenntnis der Naturwissenschaft, die Unkontrollierbarkeit der durch "Sachverständige" verwalteten Unternehmungen und andere Umstände bewirkten jedoch, daß die herzoglichen Bemühungen letzten Endes ziemlich erfolglos blieben 143 ).
Ein erster Hinweis auf einen Versuch, Edelmetalle zu gewinnen, findet sich in einem Memorial des Herzogs Heinrich 144 ) von 1527. Es heißt hierin: "Es ist auch (in der Jabelheide) 145 ) ein Silber-Ertz gefunden, das men dar Achtyngen uf habe und den Probierer bestelle." In einem anderen undatierten herzoglichen Memorial aus der Zeit um 1541 über die Wiederaufrichtung der Saline zu Conow 146 ) wurde befohlen, nach der Ader, welche Eisen, Silber, Kalk und Salz enthalte, zu forschen.
Aus derselben Zeit findet sich eine Nachricht, aus der wir auf gleichgerichtete Bestrebungen Herzog Albrechts schließen können. Am 28. Juni 1544 übersandten der Kanzler Peter von Sprengel und der Amtmann Jorg von Carlewitz dem Herzog eine Probe von Silber und anderm Erz, die dieser einschätzen Iassen sollte. Gleichzeitig berichteten sie, daß zwei Personen auf der Steinburg 147 ) bei der neuen Fundgrube einen neuen Schacht eingesenkt hätten.
Bis 1573 fehlt nun leider jegliche Nachricht, aber von da an erhalten wir ein klareres Bild von den Bemühungen, besonders Herzog Christophs, den Bergbau des Landes zu fördern. Am 6. Dez. 1573 verlieh der Herzog dem Bergmeister Melchior Hüscher 148 ) aus Schneeberg das Privileg, im Stift Ratzeburg und den dazu gehörigen Ämtern Ablagerungen von Gold, Kupfer, Zinn, Blei, Alaun, Eisen, Stahl, Vitriol, Schwefel, Salz, Steinkohlen und allem anderen Metall ausfindig zu machen und diese auf seine Kosten abzubauen. Nach seinem


|
Seite 38 |




|
Gutdünken sollte er andere Bergleute hinzuziehen. Der Herzog versprach, ihm freies Holz zum Schacht und zum Hause aus seinen Hölzungen zur Verfügung zu stellen. Aus dem Ertrag behielt sich der Herzog vom dritten Jahre an den Zehnten vor. In den ersten zwei Jahren brauchten der Zehnt und andere Abgaben nicht gezahlt zu werden, "damit er das Bergkwergk desto besser muge anrichten, die Schachthäuser und allerlei Mulen und Eysenhemer auch Hutten erbawen". Außerdem befahl der Herzog allen Amtleuten und Befehlshabern, den Melchior Hüscher und dessen Gesellen überall ungehindert wirken zu lassen und sie in ihrer Tätigkeit zu fördern.
Melchior Hüscher blieb mehrere Jahre im Dienste des Herzogs. 1574 149 ) berichtete er aus Berlin, daß er sich auf die Reise begeben hätte, um seine Kuxe zu verkaufen und um einige Leute anzuwerben, damit er den Bau des Bergwerks bei Gadebusch 150 ) zum Nutzen des Herzogs fortsetzen könnte. Er bat um Geld, damit er den "reichen Segen Gottes" der in Mecklenburg noch verborgen liege, nutzbar machen könne. Weil er dieses große Werk auf eigene Kosten übernommen hätte, müßte er sich nach sachverständigen Bergleuten umsehen, die, was das Wesentliche sei, Betriebskapital zur Verfügung stellen könnten. Er empfahl, einen Sachverständigen anzunehmen, der 26 Jahre lang oberster Faktor in der "Alchimia" des verstorbenen Kurfürsten Markgraf Joachim 151 ) gewesen war. Dieser habe schon neue "Bergwerke" erschlossen, die noch in Betrieb seien. Er habe ihn zum Teilhaber des geplanten Unternehmens gemacht und mit ihm schon um mehr als 1000 Gulden verhandelt. Am 15. Oktober 1574 griff Herzog Christoph selbst fördernd in diese Angelegenheit ein. Er erbot sich brieflich, der Stadt Gadebusch zwei Buchen, die Hüscher zum Bau des Bergwerks benötigte, zu bezahlen. Aus diesem Brief geht eindeutig hervor, daß das Bergwerk sich bei Gadebusch befand. Der Herzog plante sogar eine persönliche Besichtigung des Bergwerks. Sein Interesse am schnellen Fortschreiten der Arbeiten geht auch daraus hervor, daß er Hüscher ermahnte, das Buchenholz ausschließlich zum Stollenbau, nicht etwa als Brennholz zu benutzen. Eine weitere kurze Nachricht über das Bergwerk zu Gadebusch fällt in das folgende Jahr 1575. Der Herzog schrieb am 18. März an Hüscher, der sich damals in


|
Seite 39 |




|
Perleberg befand, daß er mit dem kurfürstlich sächsischen Kammerjunker Wolf Reuchheupt über das Bergwerk zu Gadebusch verhandeln möchte. Da er nunmehr angefangen habe, das Bergwerk durch eigene Arbeitskräfte anlegen zu lassen, erachte er es für unnötig, Bergleute von außerhalb anzustellen. Aus dem Jahre 1579 ist eine letzte Nachricht über das Bergwerk in dem Schreiben eines Lübeckers an den fürstlich mecklenburgischen Sekretär Jens Wolff erhalten. Danach ging das Werk, das anscheinend eine Zeitlang stillgelegen hatte, in Privathand über.
Ein weiteres Bergwerk befand sich zu dieser Zeit auf dem Hilligenberge bei Tempzin 152 ). Auch hier ist das Interesse Herzog Christophs, sogar an der technischen Abwicklung der Arbeiten, offensichtlich. Befahl er doch am 25. April 1575 dem Küchenmeister zu Stowe, Johann Grube, er solle sich bei dem Bergmeister erkundigen, wie tief bereits gegraben sei und ob die Arbeit etwa durch Wasser gehindert werde. Am 3. Mai antwortete Johann Grube, man habe eine Tiefe von fünf guten Faden 153 ) erreicht, es sei aber bisher noch nichts Nutzbares gefunden worden.
Wie sehr man sich bemühte, wertvolle Mineralien zu finden, zeigt, daß man sogar in den Bächen danach suchte. Johann Grube berichtete, daß auch hier noch nichts gefunden sei, daß man aber Schlich 154 ) im Waldbache zu Kronskamp bei Laage angetroffen habe. Ein Bach jenseits dem Schmachtfelde nach Neschow zu verspräche nicht viel Ertrag 155 ). 1580 sehen wir einen erneuten Versuch, Edelmetall zu gewinnen. Herzog Christoph verpflichtete Hans Hillinger zur Bleistadt an einigen Orten, wo er Edelmetall vermutete, ein halbes Jahr lang danach zu suchen. Nach Ablauf dieser Zeit wurde Hans Hillinger entlassen 156 ), vermutlich, weil auch er nichts ausrichten konnte. Alle Versuche also, Edelmetall zu gewinnen, scheiterten. 1580 dachte Herzog Christoph noch einmal an Goldgewinnung. In einem Schreiben vom 21. August an den Rostocker Bürgermeister Berndt Pauluß 157 ) erinnerte er diesen an eine


|
Seite 40 |




|
Unterredung zu Warnemünde wegen eines Goldbergwerks. Er befahl, den Bau des Bergwerks zu fördern.
Der geringe Erfolg im eigenen Lande veranlaßte den Herzog vielleicht 1582, sich in einem anderen Territorium, und zwar in der Grafschaft Waldeck, an Bergwerken zu beteiligen. Er besaß Anteile des Bergwerks am Eisenberge, der St. Georg-, St. Sebastian- und St. Christoph-Fundgruben bei Corbach. Durch Vermittlung eines gewissen Wilhelm Friedrich aus Nordhausen kaufte er Kuxe der Waldeckischen Bergwerke. Sein Interesse am Gelingen dieser Unternehmungen war sehr stark, reiste er doch selbst nach Corbach, um dort mit Friedrich zu verhandeln.
Die mecklenburgischen Herzöge, besonders Christoph, bemühten sich also eifrig um Erschließung von Bergwerken, offenbar auch zu dem Zweck, den Reichtum ihres Landes zu vermehren. Es war nicht ihre Schuld, wenn die Bestrebungen nicht von Erfolg gekrönt waren.
Kapitel 5.
Das Salinenwesen in Mecklenburg
im 16. Jahrhundert
Auch im Salinenwesen, das schon seit Jahrhunderten in Mecklenburg betrieben wurde, ist die fördernde Hand der Herzöge gerade im 16. Jahrhundert sehr spürbar.
Schon 1527 befanden sich Salzsieder im Dienste der Herzöge Albrecht und Heinrich. Es sind zwei Zettel mit dem Datum des 2. Juli 1527 erhalten 158 ), auf denen die Besoldung der Salzsieder und die Kosten für Inventar, nämlich für einen Herd und ein Brauküben, verzeichnet sind. Der Meister sollte im ersten Monat 3 Gulden und im zweiten Monat 4 Gulden erhalten, die beschäftigten Knechte ebenfalls zuerst je 3 Gulden, dann 4 Gulden. Man wollte vor Erhöhung des Lohnes den Ertrag abwarten. Außerdem wurden Leute angestellt, die einen neuen Herd machen und helfen sollten, den Brunnen zu


|
Seite 41 |




|
säubern. Es handelte sich also um ein neu angerichtetes Salzwerk. Wo es gelegen hat, ist aus den kurzen Notizen, die wohl aus der Renterei stammen, nicht ersichtlich. Ich möchte annehmen, daß es sich hier bereits um eine erste Aufstellung für die Saline zu Conow handelt, die im selben Jahre in den Besitz der Herzöge überging. Die Priorin des Klosters Eldena, in dessen Besitz die Saline bis 1461 gewesen war, wandte sich am 30. Juni 1527 in einer Beschwerdeschrift an Herzog Heinrich 159 ), aus der hervorgeht, daß die Herzöge von dem Sülzer des Klosters die Saline zu dem niedrigen Preis von 100 Gulden gekauft hatten. Die Saline muß damals also gänzlich in Verfall gewesen sein. Herzog Heinrich war nun bemüht, sie wieder in Betrieb zu setzen. In seinem inhaltreichen Memorial, das in das Jahr 1527 zu setzen ist 160 ), spricht er von der Aufrichtung des neuen Brunnens aus dem alten, gibt Anweisungen für die notwendigen Geräte, wie Pfannen und Salztonnen, die Anfuhr des Holzes und die Herstellung der Kohle. Der Brunnen sollte Tag und Nacht in Betrieb sein 161 ). Der Herzog wollte den höchstmöglichen Ertrag erzielen.
Am 24. Aug. 1527 wurde der Bau des neuen Salzbrunnens in Gegenwart des Herzogs begonnen, und bereits am 26. Aug. begann man mit dem Sieden. Am 6. Sept. schon konnten acht Wannen Salz für die Hofhaltung nach Schwerin gesandt werden. Am 27. Okt. 1527 nahm der Herzog den Salzsieder Jürgen Rosenburg auf 1/4jährliche Kündigung in Dienst mit einem Lohn von wöchentlich 1 Gulden, freier Kost und Bier und jährlich einem Kleid 162 ).
Es ist anzunehmen, daß das Unternehmen sich zuerst als rentabel erwies, denn am 15. Juni 1528 wurde die Erbauung eines größeren Werkes an der gleichen Stelle von Herzog Heinrich in seines und seines Bruders Albrecht Namen dem Zimmermeister Hans Kuchler übertragen, dem zehn Knechte


|
Seite 42 |




|
zur Verfügung gestellt wurden. Nach Ablauf eines Jahres, am 14. Juni 1529, war der Bau vollendet 163 ).
Die Saline zu Conow blieb in den folgenden Jahren in den Händen der Herzöge. 1535 hat aller Wahrscheinlichkeit nach eine Renovierung oder Vergrößerung der Anlage stattgefunden 164 ). 1541 wurde die Saline durch einen Brand vernichtet 165 ). Der Wiederaufbau der Saline wurde sofort in Angriff genommen 166 ). Für September, Oktober und November sind Ausgaben für neues Inventar und außerdem der Lohn des Salzsieders Achim Zuele und seiner Gehilfen durch Wullenweber verzeichnet 167 ).
Inzwischen hatte von seiten des Herzogs von Lüneburg Opposition gegen die Salzherstellung in Mecklenburg eingesetzt. Lüneburg fürchtete anscheinend die Konkurrenz und den Verlust des Absatzgebietes Mecklenburg. Aber in Februar 1541 erließ Kaiser Karl V., wohl auf Ansuchen der mecklenburgischen Herzöge, einen Befehl an den Herzog von Lüneburg, den Herzog Albrecht von Mecklenburg in seinem Unternehmen nicht zu stören.
Da die Saline durch wildes Wasser nicht den nötigen Ertrag erzielte, übergaben die Landesherren sie am 20. Mai 1543 dem Salinenverwalter Jürgen Rose zur Wiederaufrichtung und Verwaltung, jedoch unter der Bedingung des Rückkaufes für 1000 Gulden. Diese Art der Verwaltung erwies sich auch nicht als glücklich, da viele Unregelmäßigkeiten vorkamen 168 ). Schließlich wurde die Saline am 1. Sept. 1546 wiederum durch Feuer vernichtet 169 ). Sofort plante man den Wiederaufbau, worüber dem Herzog Bericht erstattet wurde; man versprach, daß bereits Mitte November die Saline wieder fertiggestellt sein sollte 170 ).


|
Seite 43 |




|
Im Jahre 1572 bei der Entdeckung des Alaunberges bei Eldena 171 ) wurde man wieder auf die Saline bei Conow aufmerksam, und Herzog Ulrich schenkte die Benutzung derselben seinem Rentmeister Gabriel Brüggmann 172 ). Die Saline war noch bis 1584 weiter in Betrieb 173 ). Am 26. April 1579 erhielt der Salzsieder Hermann Wilcken, der den Sommer über auf der Sülze zu Conow gearbeitet hatte, 8 Gulden 174 ). Sogar auswärtige Sachverständige wurden hinzugezogen. So erhielt ein Lübecker am 29. Aug. des gleichen Jahres 2 Gulden 16 Schillinge 174 ). Am 26. März 1584 bekam ein Salzsieder aus Halle, der im Auftrage des Herzogs sein Gutachten über die Saline abgeben sollte, 1 Gulden 8 Schillinge und am 13. April 8 Gulden 175 ).
Weitere Nachrichten über die Saline zu Conow waren nicht aufzufinden. Es muß also vorläufig angenommen werden, daß das Unternehmen am Ende des Jahrhunderts nach mannigfachen Versuchen der Herzöge, die Saline trotz zweier Brände und anderer Schwierigkeiten zur Blüte zu bringen, als unrentabel einging.
Nachrichten über die aktive Beteiligung und das Eingreifen der Herzöge bei anderen Salzwerken sind nur spärlich vorhanden. Von der Saline zu Sülze ist bekannt, daß der fürstliche Anteil im Jahre 1607 verpachtet wurde 176 ). Zwei Schreiben des Bergmeisters Melchior Hüscher am 4. Aug. und 22. Sept. 1574 an Herzog Christoph enthalten Anspielungen auf den Salzbrunnen von Sülze und den Kauf des Dorfes zwecks Ausbeutung dieses Brunnens. Herzog Christoph verhielt sich zwar zunächst ablehnend. Als Wolf Reuchheupt, der Mitarbeiter Hüschers, sich am 18. März 1575 an den Herzog wegen des Salzquells, von dem er sich viel Ertrag versprach, wandte, bestellte der Herzog ihn zu einer Unterredung über "die Sülzen" 177 ). Über den Ausgang der Besprechung ist mir nichts bekannt geworden, fest steht aber, daß die Saline zu Sülze auch eine Zeitlang im Besitz des herzoglichen Hauses war.


|
Seite 44 |




|
Eine dritte Saline zu Sülten bei Brüel war Herzog Christoph geneigt, 1591 zu erwerben, doch der Handel kam nicht zustande, da der Herzog darüber starb (1592) 178 ).
Kapitel 6.
Verkehrs- und Zollwesen.
Ein wichtiger Faktor innerhalb der Wirtschaftspolitik und eng verbunden im besonderen mit der Handelspolitik ist die Regelung des Verkehrs- und Zollwesens. Die Verbesserung des Verkehrswesens ist eine wichtige Voraussetzung für alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen im damaligen Mecklenburg, besonders für die Anknüpfung von Handelsbeziehungen innerhalb und außerhalb des Landes. Einerseits sehen wir, daß infolge der damals im Verhältnis zu heute außerordentlich schweren Überwindungsmöglichkeit von Entfernungen die Übersicht der Herzöge über ihr Land und die Kontrolle über die Ausführung ihrer wirtschaftspolitischen Maßnahmen erschwert wurde. Andererseits ist bereits deutlich das Bestreben der Fürsten zu erkennen, diesen Zustand zu bessern durch die Sorge für Verkehrssicherheit und durch den Bau von Straßen sowie durch die Anlage von Wasserwegen Brücken zu schlagen für Handel und Gewerbe im Lande selbst und darüber hinaus.
Aus der maritimen Lage und dem sonstigen Wasserreichtum Mecklenburgs erwuchs besonders die Möglichkeit und damit die Aufgabe, auf dem Wasserwege Verkehrsmöglichkeiten zu schaffen. Erstaunlich ist es, mit welcher Ausdauer und Planmäßigkeit an dieser Aufgabe gearbeitet wurde. In engem Zusammenhang mit dem Verkehrswesen stand die Regelung der Zölle, die eine wichtige Einnahmequelle darstellten.
A. Verkehr.
§ 1. Die Fürsorge für die Landstraßen.
Bereits aus der Mitte des Jahrhunderts sind Verordnungen erhalten, die sich auf Erhaltung und Pflege der Landstraßen beziehen. Die Kaufleute waren niemals sicher vor Raub und Überfall, wie aus mehreren Schreiben der Stadt Wismar von


|
Seite 45 |




|
1527, 1528 und 1533 an Herzog Heinrich hervorgeht 179 ). 1549 versicherte Herzog Johann Albrecht der Stadt Wismar auf erneute Bitten, daß er auf das eifrigste bemüht sei, sichere Straßen zu schaffen, er habe allen Vögten befohlen, den Straßenräubern nachzuspüren. Damit besonders die Straße Wismar - Lübeck, eine wichtige Handelsstraße also, frei von ihnen sei, sollten im Amt Gadebusch berittene Polizeistreifen für Sicherheit sorgen 180 ). Ein gleiches Bestreben bewies Herzog Heinrich 1530, indem er für die Sicherheit von Rostocker Kaufleuten, die zur Leipziger Messe fuhren, Sorge trug 181 ). Die Herzöge Ulrich und Johann Albrecht erließen in ihren Amtsordnungen von 1567 und 1569 182 ) Verfügungen über die Pflege der Straßen, Brücken, Wege und Stege. Besonders wurde die Sicherheit auf den Zollstraßen betont, damit der Zoll, eine wichtige Einnahmequelle für die Staatskassen, nicht verloren gehe und die Nahrungszufuhr für die Städte nicht unterbunden werde. 1577 wurde von Herzog Ulrich mit Zustimmung der Landschaft beschlossen, alle engen Wege innerhalb eines halben Jahres abzuschaffen, damit niemand mehr an Leib und Gut Schaden leide 183 ).
§ 2. Die Wasserstraßen.
I. Der Bau des Elbe-Ostsee-Kanals.
Einen breiten Raum nehmen in der Wirtschaftspolitik der Fürsten vor allem die Maßnahmen über den Ausbau von Wasserstraßen ein, deren großartigste der Bau des Elbe-Ostsee-Kanals zwischen Dömitz und Wismar darstellt, der trotz heftigster Widerstände durchgeführt wurde 184 ). In der Hauptsache ist er das Werk der Herzöge Ulrich und Johann Albrecht. Die


|
Seite 46 |




|
natürlichen Flußläufe kamen dem Plan sehr entgegen. Die Nebenflüsse Elde und Stör boten die besten Voraussetzungen zu einer Wasserverbindung von der Elbe zur Ostsee.
Bereits 1480 hatten die mecklenburgischen Herzöge Magnus II. (1477 -1503) und Balthasar (1480 - 1507) Versuche unternommen, die Elde schiffbar zu machen und so einen Handelsweg zu schaffen, der den Durchgangshandel von der Elbe her mit Lüneburger Salz ermöglichte und die Stadt Wismar neben Lübeck wiederum zur Vermittlerin des Salzhandels machte. Außerdem boten die reichen Waldungen längs der Elde große Abholzungsmöglichkeit, die auf eine erhebliche Ausfuhr aus dem Lande hinwies. Die Herzöge bemühten sich aus diesem Grunde vielfach, die Benutzung der brandenburgischen Eldestrecke freizubekommen, ihre Verhandlungen mit den brandenburgischen Kurfürsten Albrecht Achilles (1470 - 1486) und Johann Cicero (1486 - 1499) blieben jedoch erfolglos.
Im Jahre 1512 nahmen die Herzöge Heinrich V. (1503 bis 1552) und Albrecht VII. (1503 - 1547) die Verwandlungen von neuem auf, aber auch Kurfürst Joachim I. versagte seine Zustimmung aus nachbarlicher Eifersucht. Auch die Hansestadt Hamburg verhielt sich auf Ansuchen des Herzogs um Geldzuschuß 1513 ablehnend. Aus diesen Gründen wurde das Unternehmen illusorisch, und erst 1531 berichtet eine "Wendische Chronik", daß von der Stadt Wismar und Herzog Albrecht von Mecklenburg ein neuer Graben von Wismar in den Schweriner See, von dort in die Elde und weiter in die Elbe begonnen worden sei. Um diese Zeit sind bereits Anfänge einer Schiffahrt auf der Stör noch anderweitig festzustellen 185 ). Herzog Albrecht machte einen Vertrag mit einem gewissen Hermann Mese des Inhalts, daß dieser mit 10 Hilfskräften Holz bei der Stör schlagen, bis an den Fluß heranbringen und auf die Schiffe laden solle.
Alle diplomatischen Versuche des Herzogs, Geldzuschüsse für den Ausbau des Kanals zu erlangen, scheiterten aber. Die Hansestädte bezweifelten den wirtschaftlichen Nutzen der Schifffahrt, die benachbarten Fürsten vertagten trotz des erheblichen Vorteils, den ihnen die erhöhten Zolleinnahmen bei der Leitung des gesamten Ostseehandels in die Elbe geboten hätten, nach wie vor ihre Zustimmung und Hilfe. Der Herzog Ernst von Lüneburg belegte sogar die auf der Elbe fahrenden Schiffe bei


|
Seite 47 |




|
den Zollstädten Bleckede, Hitzacker und Schnakenburg mit so hohen Zöllen, daß dadurch eine gedeihliche Entwicklung des Verkehrs auf der neuen Wasserstraße in Frage gestellt wurde. Auch Kaiser Karl V. ließ dem Herzog eine abschlägige Antwort zuteil werden. Doch trotz seiner gänzlichen Isolierung in dieser Angelegenheit fuhr Herzog Albrecht mit seiner Gemahlin, einer Tochter des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, im Mai 1533 mit zwei beladenen Schiffen die Elde hinunter. Dies veranlaßte den Kurfürsten von Brandenburg, die Auslieferung der Schiffe zu fordern. Unbeirrt jedoch ließ Herzog Albrecht an dem Wassergraben von Dömitz nach Wismar fortarbeiten. Er ließ nach den Aufzeichnungen des aus Siegen in Westfalen stammenden Mathematikers Tilemann Stella, der bei dem Kanalbau eine bedeutende Rolle spielte, drei Anhöhen nördlich des Schweriner Sees durchstechen, die Elde oberhalb Eldenas regulieren und Aufräumungsarbeiten im Fluß vornehmen. 1543 wurde bereits an einer Schleuse und einer Brücke zu Banzkow gebaut 186 ). Im Jahre 1545, zwei Jahre vor seinem Tode, versuchte er noch einmal mit Hamburg der Schiffahrt wegen in Verbindung zu treten; er sandte seinen Rat Peter von Spengel dorthin, um alle Mißverständnisse zu beheben, doch hatte dieser anscheinend keinen Erfolg 187 ).
Unter der Regierung seiner Söhne, der Herzöge Johann Albrecht I. und Ulrich, trat das Projekt des Elbe-Ostsee-Kanals in seine dritte Phase ein, die den Erfolg langjähriger Bemühungen und beinahe die Vollendung des Kanals brachte. Die Herzöge traten in neue Verhandlungen mit den Hansestädten ein. Am 2. Juli 1561 wurde der Lizentiat Hubertus Sieben an den Lüneburger Rat gesandt 188 ). Die Städte Magdeburg und Wismar waren ebenfalls an dem Bau stark interessiert, wie aus Akten von 1564 hervorgeht. Die Herzöge unterließen aber nähere Verhandlungen wegen übermäßiger Forderungen Wismars. Im folgenden Jahre 1565 wurde dem bereits genannten Tilemann Stella die Besichtigung des Terrains zwischen Viecheln und Wismar übertragen. An dieser Strecke wurde jedoch zur gleichen Zeit von seiten Wismars gebaut 189 ).


|
Seite 48 |




|
Auf herzoglichen Befehl begann man nun an einer Wasserstraße zwischen der Schweriner Fähre und Dömitz zu bauen. Herzog Johann Albrecht förderte zunächst die Arbeiten mehr als Herzog Ulrich, der vorher die Verteilung der Zölle auf der Wasserstraße geregelt wissen wollte. Dies geschah dann auch in dem freund-brüderlichen Vertrag zu Doberan am 13. Mai 1567. Jeder der beiden Herzöge verpflichtete sich, in seinen Ämtern auf seine Kosten die Schleusen bauen und die Ströme räumen zu lassen. Die Kosten sollten nach den Registern ausgeglichen und die Einkünfte auf beide Herzöge gleich verteilt werden. Nachdem Herzog Johann Albrecht schon im Herbst 1566 auf seinem Gebiet vier Schleusen auf der Stör und der Elde hatte bauen lassen, trat auch Herzog Ulrich 1567 wegen der Schleusen zu Grabow und Eldena in Unterhandlung. Eine Kommission besichtigte die Strecke von Schwerin bis Dömitz und hielt im ganzen sechs Haupt- und zwei Stauschleusen für erforderlich, von denen die Hauptschleusen zu Banzkow und Neustadt 190 ) und die Stauschleuse zu Plate bereits fertig waren. Auf der nördlichen Strecke wurden sieben Hauptschleusen in Ansatz gebracht. Als am 3. Febr. 1568 ein Abriß des "streitigen Stromes" bei Eldenburg an den Kurfürsten von Brandenburg gesandt worden war 191 ) und wieder eine abschlägige Antwort erfolgte, entschloß man sich auf Anraten Stellas zur Anlegung einer Wasserstraße zwischen Elde und Elbe auf mecklenburgischem Gebiet. Im Mai 1568 wurde bereits der Graben durch Stella und den Rentmeister Gabriel Brügmann 192 ) mit Hilfe des Wallmeisters Jost Spangenberg ausgemessen. Um die Kosten zu decken, mußten sich die Herzöge zu einer Steuer entschließen, da von den Hansestädten trotz wiederholter Ansuchen 193 ) keine Hilfe zu erwarten war. Aus den Ämtern wurde ein Schiffahrt- und Grabengeld erhoben, das 1571 im Gebiet Herzog Ulrichs allein die Höhe von rund 1030 Gulden erreichte 194 ). In den Jahren 1569 - 71 war der Bau in vollem Gange 195 ), und im Frühjahr 1571 sah die Schiffahrt ihrer Vollendung entgegen, wenn nicht ein Teil der Anlagen durch den Kurfürsten von Brandenburg zerstört worden wäre. Die Verzögerung der Arbeiten war jedoch nicht groß. Bereits Ende


|
Seite 49 |




|
Februar 1572 war die neue Elde im wesentlichen fertig. Die Schleuse zu Dömitz sah auch ihrer Vollendung entgegen; die Arbeiten hatte man einem niederländischen Schleusenmeister übergeben 196 ). Am 11. Aug. 1572 wurde die Fahrt von Eldena bis Dömitz eröffnet. Der Aufwand belief sich in Gestalt der Bezahlung des Wallmeisters Jost Spangenberg während der Jahre 1568 - 1572 auf etwa 35 000 Gulden. Umbauten und Ausbesserungen waren noch durchzuführen und die Aufsicht über den Kanal mußte nun geregelt werden. Zu diesem Zweck wurde 1574 Jost Spangenberg von beiden Herzögen gemeinsam zum Verwalter der neuen Fahrt eingesetzt. Er erhielt dafür jährlich 150 Gulden, die abwechselnd aus den beiden herzoglichen Kassen gezahlt wurden 197 ). Nachdem Herzog Ulrich selbst den Kanal hinuntergefahren und ihn besichtigt hatte 198 ), konnten die Herzöge den Städten Magdeburg und Hamburg im Jahre 1575 mitteilen, daß im Sommer der Schiffsverkehr aufgenommen werden könne. Was diesem noch hemmend entgegenstand, waren die hohen herzoglich lüneburgischen Elbzölle und das Stapelrecht der Stadt Lüneburg. Eine Gesandtschaft an den Herzog von Lüneburg im Okt. 1575 blieb, wie nach seinem bisherigen Verhalten zu erwarten war, erfolglos. Ein Ersuchen der Herzöge an die Städte Magdeburg und Hamburg um Bezahlung eines mäßigen Schleusengeldes zur Erstattung der Unkosten und Erhaltung des Grabens hatte nicht den gewünschten Erfolg. Der Betrieb wurde aber aufrecht erhalten. 1580 wurde eine Ausbesserung an der Schleuse zu Dömitz durchgeführt 199 ).
Inzwischen machte man bereits Pläne, die Strecke Viecheln - Wismar auszubauen, um den umständlichen Landweg auszuschalten. Am 20. Sept. 1575 fand in Wismar eine Besprechung zwischen Herzog Johann Albrecht und den Beamten mit dem wismarschen Rat statt, die aber kein endgültiges Resultat erzielte, da der Herzog auf seinem Stapelrecht in Wismar bestand, was von den Vertretern der Stadt nicht zugestanden wurde.
Nachdem Herzog Johann Albrecht, der eifrigste Förderer des neuen Wasserweges, am 12. Febr. 1576 gestorben war und


|
Seite 50 |




|
seinen Söhnen die Vollführung des Grabens testamentarisch aus Herz gelegt hatte, begann man bereits in der Woche nach Trinitatis 1576 mit den Vorarbeiten. Der Wallmeister Jost Spangenberg verpflichtete zwei Schleusenbauer für den neu zu erbauenden Teil der Fahrt bei Wismar, wohin sich auch Tilemann Stella begab 200 ). Das nötige Holz zum Schleusenbau wurde im Amte Grabow gehauen, eine diesbezügliche Anweisung war bereits im Februar durch Herzog Ulrich an den dortigen Küchenmeister Peter Heltorf ergangen 200 ). Der nötige Kalk wurde später zu Hamburg eingekauft 201 ). Eine Kommission besichtigte im Auftrage Herzog Ulrichs im Juni 1577 das Gelände und verhandelte mit dem wismarschen Rat 202 ) und einigte sich mit diesem über die Richtung des Kanals. Jost Spangenberg wurde von den Kommissaren Hans von der Lühe, Tilemann Stella und Gabriel Brügmann zum Leiter der nun zu beginnenden Arbeiten bestellt 203 ). Als Hauptmann 204 ) und Aufseher wurde Hans von der Lühe von Herzog Ulrich bestimmt. Gleichzeitig begann die Stadt Wismar mit Hilfe einer Hamburger Anleihe die Arbeiten auf ihrem Gebiet, und am 20. Juni 1578 besichtigte Herzog Ulrich persönlich den Graben.
Die Arbeiten wurden in den folgenden Jahren trotz unvorhergesehener Schwierigkeiten fortgeführt. Bei dem Dorf Mecklenburg wurde 1580/81 eine Schleuse gebaut 205 ) und der Rentmeister Joachim Schönermarck besichtigte im November 1580 die dortigen Arbeiten, ebenso im Juni 1581 die Stauschleuse beim Schweriner See, die sich also gleichzeitig im Bau befand 206 ). Der Schleusenmeister Jakob Barolt wurde mit dem Bau sämtlicher noch notwendiger Schleusen beauftragt, und Jost Spangenberg ließ die Gräberarbeiten im Tagelohn vollenden. Der gesamte Kostenaufwand für diese Strecke Viecheln - Wismar betrug etwa 20 000 Gulden. Für das Jahr 1581 waren es etwa 2000 Gulden 207 ).


|
Seite 51 |




|
Tilemann Stella fertigte einen Grundriß und eine Beschreibung der Fahrt im Auftrage des Herzogs an 208 ), die den daran interessierten Fürsten und Städten zugesandt wurde 209 ).
Eine Vollendung der gesamten Strecke von Dömitz bis Wismar hat nicht stattgefunden, was wohl hauptsächlich durch die Schuldenlast der Herzöge verursacht wurde. Auch Wismar war zum Weiterbau finanziell nicht in der Lage. Es wurden im 17. Jahrhundert und später noch Projekte für die Fertigstellung gemacht. Doch gelangten diese bis heute nicht zu ihrem Ziel, und die bereits geleisteten Arbeiten verfielen zum Teil wieder. Dem großartigen Projekt der mecklenburgischen Herzöge des 15. und 16. Jahrhunderts, das damals beinahe vollendet war, war also nicht der entsprechende Erfolg beschieden, was aber in diesem Zusammenhange nur ein Beweis ist für die Schwierigkeit der Durchführung und damit für die Tüchtigkeit und den Weitblick der Fürsten in verkehrspolitischer Beziehung.
II. Weitere Wasserstraßen.
Neben dem Elbe-Ostsee-Kanal spielte im 16. Jahrhundert die Schiffahrt auf der Schaale eine nicht unbedeutende Rolle. Bevor die Schaale zur Handelsstraße wurde, diente sie "in ausgiebiger Weise" zum Abflößen des Holzes aus den mecklenburgischen Waldungen zur Lüneburger Saline 210 ). In den Jahren 1550 - 1560 wurde die Schaale reguliert, Schleusen wurden angelegt und so eine Verbindung zwischen dem Schaalsee und der Elbe geschaffen. Die Initiative ging allerdings von der Stadt Lüneburg aus, die auch die Kosten trug 211 ). 1561 wurden mit Lüneburg wegen des neuen Wasserweges die grundlegenden Verhandlungen
gepflogen 212 ), die im Vertrag vom 10. Juli 1561 ihren Abschluß fanden 213 ). Im August 1564 wurde die Stadt ersucht, Vertreter zwecks Verhandlungen mit Herzog Johann Albrecht über die Schaalfahrt zu senden. Es handelte sich hierbei um die letzten Einzelheiten, insbesondere um die


|
Seite 52 |




|
Regelung der Zollfrage 214 ). "Um den 1. Sept. 1564 war die Schaalfahrt vollendet" 215 ). Die Lüneburger erschlossen sich dadurch einen neuen und billigen Weg für ihre Salzausfuhr nach Mecklenburg. Vor allem aber sicherten sie sich einen Teil ihres Brennholzbedarfes für ihren Salinenbetrieb und erlangten Einfluß auf die Regelung des Holzhandels und der Holzpreise. Andererseits blühte der Holzhandel der mecklenburgischen Herzöge und des anwohnenden Adels auf, und die Einnahmen der herzoglichen Zollhebestätten erfuhren eine Steigerung 216 ). Zu einer solchen Bedeutung wie der Elbe-Ostsee-Kanal, der unter viel günstigeren natürlichen Bedingungen stand, ist jedoch die Schaalfahrt nie gelangt 217 ).
Ein weiterer ziemlich umfangreicher Bau wurde am Überlauf der Elde bei Plau ebenfalls in der Mitte des Jahrhunderts in herzoglichem Auftrag durchgeführt. Am 15. Dez. 1548 erhielt der Küchenmeister zu Plau 541 Gulden, um alle Handwerker und Arbeiter, die dort als Gräber, Mauerleute usw. arbeiteten, zu löhnen 218 ). In den Jahren 1568/69 wurde zu Plau eine Schleuse gebaut, bei der sechs Arbeiter elf Wochen und zwei Tage beschäftigt wurden 219 ). Schließlich plante Herzog Johann Albrecht noch durch die Schiffbarmachung der Nebel einen bequemen Wasserweg von Güstrow nach Rostock herzustellen 220 ).
B. Zoll.
Die Förderung des Verkehrswesens war wesentlich bedingt durch die Förderung des Handels und die Hebung der Zolleinnahmen, die eine bedeutende Geldquelle für die fürstliche Kasse darstellten und genau registriert wurden 221 ).
Schon Magnus II. versuchte, eine territoriale Grenzzollpolitik durchzuführen, womit er allerdings den Seestädten Rostock und Wismar gegenüber wenig Erfolg hatte 222 ). Auch


|
Seite 53 |




|
Später setzten sich die Herzöge auf dem Gebiete des Zollwesens vielfach in Gegensatz zur Ritterschaft und zu den Städten. Es scheint sehr stark die Tendenz bestanden zu haben, den Zoll, der nicht nur an den Landesgrenzen, sondern auch in den einzelnen Ämtern erhoben wurde, hoch anzusetzen, um auf diese Weise die herrschende Finanznot zu lindern. Auf Beschwerde der Städte und des Adels wurde von seiten der Fürsten stets die Abschaffung der Zollerhöhungen zugesagt, doch die Klagen wiederholten sich auf den Landtagen vielfach während der ganzen zweiten Hälfte des Jahrhunderts 223 ). Mit besonders hohem Zoll wurde anscheinend der Hopfen belegt, es entstanden darüber sogar Meinungsverschiedenheiten der Herzöge untereinander. Als 1543 die Hopfenhändler aus Städten und Dörfern sich bei Herzog Heinrich über den von Herzog Albrecht verhängten hohen Zoll beschwerten, erklärte dieser, daß der Zoll gegen die kaiserliche Verordnung sei und gemildert werden solle 224 ). Der gleiche Fall wiederholte sich 1571 - 1589 in den Klagen über einen hohen Hopfenzoll, der von Herzog Christoph verhängt wurde. Herzog Johann Albrecht und Ulrich traten in diesem Fall als Vermittler auf und bestimmten die Abschaffung des Zolles 225 ).
Aus den vorhandenen Berichten geht also hervor, daß eine einheitliche Regelung für das Zollwesen im 16. Jahrhundert in Mecklenburg noch nicht bestand.
Kapitel 7.
Die Anfänge einer Handelspolitik
in
Mecklenburg im 16. Jahrhundert.
Der Handel, bisher zum größten Teil in den Händen der Städte, ward im 16. Jahrhundert mehr und mehr zum Gegenstand landesherrlicher Bestrebungen. Die Hanse hatte bereits


|
Seite 54 |




|
ihren Höhepunkt weit überschritten, die landesherrliche Gewalt war es nun, die sich zunächst der städtischen nebenordnete und schließlich überordnete. Diese in ganz Deutschland ziemlich gleichzeitig eintretende Entwicklung wurde in Mecklenburg begünstigt durch die Persönlichkeit seiner Herzöge. Magnus II. schuf bereits um die Jahrhundertwende die Basis für eine staatliche Handelspolitik 226 ), auf der seine Nachfolger aufbauen konnten.
Die Maßnahmen auf dem Gebiete des Handels erstreckten sich zunächst auf das eigene mecklenburgische Land, für dessen Versorgung mit Gütern Sorge getragen wurde. Sie gingen weit darüber hinaus, den Wohlstand des Landes durch Ausfuhr einheimischer Produkte zu mehren und diese wiederum einzutauschen gegen im Lande nicht vorhandene Güter. Innen- und Außenhandel sind es, die das wichtigste wirtschaftspolitische Betätigungsfeld der mecklenburgischen Herzöge des 16. Jahrhunderts darstellen und gleichzeitig die wirtschaftliche Bedeutung Mecklenburgs in dieser Zeit am deutlichsten kennzeichnen.
A. Innenhandel
1. Grundsätzliche Maßnahmen zur Regelung des
Innenhandels
und der Versorgung des Landes.
Eine allgemeine Regelung der inländischen Handelsverhältnisse fand zuerst in der von den Herzögen Heinrich X. und Albrecht XII. erlassenen Polizeiordnung von 1516 statt 227 ). Die Versorgung der Städte mit Lebensmitteln und die des Landes mit Kleidung und anderer Ware, der Austausch von landwirtschaftlicher und gewerblicher Produktion, der nur auf den städtischen Märkten stattfinden sollte, wurde durch die Bestimmung zu regeln versucht, daß die Bauern und andere Landbewohner Gerste, Roggen, Hafer, Weizen, Hopfen, Hanf, Vieh, Wolle, Honig, Butter und alle anderen überflüssigen Waren in die nächste Stadt, zu der ihr Dorf gehörte, zu Markt bringen und ihre Bedürfnisse wiederum dort decken sollten.
Es stand den Landbewohnern aber frei, falls die Preise auf dem nächsten Markt nicht angemessen waren, an einem beliebigen anderen


|
Seite 55 |




|
Ort zu kaufen und zu verkaufen. Die Preisbildung wurde durch die Verordnung zu beeinflussen gesucht, daß um "ziemliches Geld", also zu einem gerechten Preise, gehandelt werden sollte. Eine Übervorteilung der Landbewohner durch die städtischen Kaufleute sollte ausgeschaltet werden. Der Bierpreis sollte dem der Gerste, der je nach Ausfall der Ernte steigt und fällt, angeglichen werden. Der Rat der Städte hatte dafür zu sorgen, daß diese Bestimmungen eingehalten wurden 228 ). Es herrschte also noch die Idee des justum pretium, wie sie für das ganze mittelalterliche Wirtschaftsleben charakteristisch gewesen ist 229 ). Später, unter Herzog Ulrich, wurde dann die Festsetzung bestimmter Preistaxen angeordnet. Je nach dem Ernteausfall und der Marktlage sollten diese von Sachverständigen in den Städten festgesetzt, am Rathaus öffentlich angeschlagen und dem Herzog zur Durchsicht in die Hofkanzlei gesandt werden, Überteuerung sollte vermieden und die Preise der Waren sollten den Einkaufspreisen entsprechend festgesetzt werden. Besonders dafür eingesetzte Marktmeister hatten auf die Befolgung dieser Vorschriften zu achten 230 ). Nur gute und unverdorbene Ware sollte verkauft werden 231 ) und auf richtiges Maß und Gewicht sollte geachtet werden 232 ). 1586 ersuchte Herzog Ulrich die Stadt Rostock um Übersendung des rechtlich anerkannten Marktpfundes zwecks Überprüfung 233 ).
Auch das Münzwesen, das früher fast ganz den Bestimmungen der Hanse unterlag, kam seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mehr und mehr unter die selbständige Leitung der Landesfürsten. Schon die Herzöge Heinrich und Albrecht erließen 1542 ein Verbot gegen das wucherliche Einwechseln und Einschmelzen der Landesmünzen, und die Herzöge Johann Albrecht und Ulrich versuchten 1558, eine Verbesserung der


|
Seite 56 |




|
Münze nach Schrot und Korn und einen feststehenden Münzfuß einzuführen. Durchgreifende Maßregeln konnten jedoch erst durch die Reichsmünzordnung vom Jahre 1559 ergriffen werden 234 ). Als im Jahre 1590 die Bauern sich beschwerten, daß die Preise für ihre Waren in den Städten gedrückt und für ihre Bedürfnisse gesteigert und sie mit falschen Maßen und falschen Münzwerten betrogen würden, forderten die Herzöge sofortige Abstellung dieser Mißstände und drohten bei Übertretung die Einführung der Handelsfreiheit auf den Dörfern an 235 ).
Der Vorkauf und das Ausführen von Waren durch die Landbewohner war streng verboten, z. B. der Verkauf von Wolle nach außerhalb wurde dem Adel und den Bauern nicht erlaubt, damit ein Hochtreiben der Preise vermieden würde, die einheimischen Tuchmacher genügend einkaufen könnten und die Bürger ihr Gewand so billig wie möglich erhielten. Die Aufkäufer landwirtschaftlicher Produkte sollten auf dem Lande nicht zugelassen werden, da ihre Tätigkeit wirtschaftliche Schwächung der Städter nach sich ziehe und dem gemeinen Wohl schade. Die Waren sollten ausschließlich auf den einheimischen Märkten feilgeboten werden 236 ). Trotz der Wiederholung dieser Bestimmung aus dem Jahre 1516 in der Neuauflage der Polizeiordnung von 1542 237 ) wurde das Übel der Vorkäuferei und der verbotenen Getreideausfuhr nicht ausgerottet, gab vielmehr weiter Anlaß zu häufigen Klagen 238 ). Damit nicht soviel nach Lübeck ausgeführt werde, wo in der Regel höhere Preise gezahlt wurden, erging die Anweisung an Rostock und Wismar, die gleichen Preise wie die Lübecker zu zahlen 239 ).


|
Seite 57 |




|
Auf dem Landtage zu Güstrow von 1555 erging noch einmal ein entsprechendes Verbot 240 ). Die Polizeiordnungen von 1562 und 1572 wiederholten es, die letztere allerdings mit der Einschränkung, daß Aufkäufern, die andere nützliche und notwendige Waren, wie Salz u.dgl., ins Land brächten, ein maßvoller Einkauf gestattet werde 241 ). Diese Einschränkung wurde allerdings mißbraucht, und schon 1573 beklagte sich Wismar, daß trotz guter Ernte keine genügende Getreidezufuhr vorhanden sei, da die Salzwagen aus Sachsen im ganzen Lande das Getreide aufkauften 242 ). Es wurde weiterhin befohlen, die Polizeiordnung zweimal im Jahre, acht Tage nach Ostern und acht Tage nach Michaelis, öffentlich auf dem Rathause, von den Kanzeln herab und durch die Amtleute ablesen zu lassen 243 ). Letzteren war die Begünstigung des Vorkaufs besonders streng untersagt, und es wurde darauf geachtet, daß sie sich nicht bestechen ließen 244 ). In den Landtagsabschieden von 1572, 1584 und 1589 wurden die Polizeiordnungen in diesen Punkten bestätigt 245 ). Über den Vorkauf von Wolle war am 26. Okt. 1571 noch einmal eine Sonderkonstitution erlassen worden 246 ). Übertretungen kamen besonders in der Stadt Rostock vor. Herzog Ulrich schrieb deshalb in den Jahren 1574, 1575 und 1579 persönlich an den dortigen Rat, und beide Herzöge mußten 1590 die Mahnung noch einmal wiederholen 247 ). Ein gedrucktes Mandat vom 14. Okt. 1597 wiederholte von neuem das Verbot, betonte aber, daß der Kauf im Haus des Produzenten erlaubt sei 248 ). Trotz aller Verbote jedoch fanden die Klagen kein Ende.


|
Seite 58 |




|
Besonders die Adligen gaben immer wieder Anlaß zu Beschwerden. Bei ihnen war das Bestreben, auf eigene Faust Getreidehandel zu treiben, sehr groß, so daß Herzog Ulrich zu Gegenmaßnahmen greifen mußte 249 ). Wer Korn verschiffte, mußte für jede Schute 1 Tonne Salz und 1 Taler als Rekognition zahlen 250 ). Herzog Ulrich erkundigte sich am 11. Juli 1590 bei dem Amtmann und Küchenmeister von Neubukow nach dem Zwecke des Schutenbaues eines Untertanen und fragte an, ob dieser sein eigenes oder fremdes Korn auf dem Schiffe ausführen wolle. Weiterhin wurden Erkundigungen darüber eingezogen, ob Adlige und andere Untertanen Schiffe zu dem gleichen Zwecke hatten 251 ).
Es wurde sogar für die richtige Verteilung der Güter innerhalb des Landes Sorge getragen. So ersuchte Herzog Albrecht anläßlich einer Roggen- und Gersteteuerung die Stadt Rostock, von dem dortigen Vorrat den notleidenden Dörfern und Städten Korn zu angemessenem Preise zur Verfügung zu stellen, um eine Hungersnot zu verhindern 252 ). Aus dem Jahre 1574 ist die Verordnung erhalten, daß die Stadt Rostock auf den nahe gelegenen fürstlichen Ämtern Vieh, Hafer und Heu kaufen dürfe. Die Rostocker durften jedoch einen gewissen Umkreis ihrer Stadt nicht überschreiten, damit die anderen Städte genügende Bedarfsdeckungsmöglichkeiten behielten 253 ).
II. Konjunkturelle Maßnahmen
Neben dem stets wiederholten Verbot des Vorkaufs und der Verschiffung von Getreide durch die Landbewohner finden sich Bestimmungen, die die Getreideausfuhr zeitweise ganz verbieten. Diese Maßnahmen wurden bedingt durch den jeweiligen


|
Seite 59 |




|
Ausfall der Ernte, waren also konjunktureller Natur. Schon Herzog Magnus II. hatte Kornausfuhrverbote aus diesem Grunde erlassen 254 ). Herzog Heinrich verbot 1517 wegen einer Mißernte des Hopfens zur Verhütung eintretender Teuerung für eine Zeitlang die Ausfuhr 255 ). Die gleiche Verfügung von beiden Herzögen Heinrich und Albrecht findet sich für 1530. Schafe, Ochsen und Schweine, Roggen, Gerste, Hafer und Hopfen durften aus Mecklenburg zeitweilig nicht ausgeführt werden 256 ). Eine gleiche Maßnahme Herzog Albrechts wurde 1536 wahrscheinlich durch die Klage über Getreidemangel der Stadt Wismar veranlaßt 257 ). Der wiederholten Bitte Lübecks, die Kornausfuhr dorthin wieder freizugeben, wurde aus innerwirtschaftlichen Gründen nicht stattgegeben 258 ). 1559 wurde auf Anraten des Rentmeisters Siegmund von Esfeld ein neues Ausfuhrverbot für Hopfen erlassen 259 ). In den folgenden Jahrzehnten, einer Krisenzeit für die mecklenburgische Landwirtschaft 260 ), häuften sich die Ausfuhrverbote als Folge mehrerer Mißernten und wurden im Interesse der Versorgung des Landes erlassen. Herzog Johann Albrecht befahl am 22. Sept. 1571 allen Amtleuten, Vögten, Küchenmeistern und Zöllnern, dem Adel, den Landstädten und besonders den Städten Rostock und Wismar bei höchster Strafe, ihre Hopfen-, Korn- und Mehlausfuhr sofort einzustellen 261 ). Am 25. Okt. 1571 wurde der Befehl für Rostock wiederholt. Rostock leistete ihm nunmehr Folge, während Wismar sich dagegen sträubte 262 ). Das Jahr


|
Seite 60 |




|
1579 brachte eine besonders schlimme Mißernte, weshalb die Getreideausfuhr wiederum gänzlich verboten wurde. Es sollte vor allen Dingen unterbunden werden, daß Leute, die zu guten Zeiten das Getreide zu Spekulationszwecken aufgekauft hatten, es nun zu teuren Preisen verkauften und ausführten 263 ). Aus Anlaß derselben großen Mißernte verbot sogar Herzog Ulrich sämtliche Pfingst- und Maigilden im ganzen Lande. Von dem vorhandenen Vorrat durfte zu diesem Zwecke nichts verbraucht werden 264 ). Die Kornausfuhr nach Lüneburg aus dem herzoglichen Amte Grabow wurde auch nach der nächsten Ernte noch beschränkt und nur auf Bitten des Rates zu Lüneburg in kleiner Menge erlaubt 265 ). 1587 - 89 wurde die Kornausfuhr ebenfalls verboten 266 ), und gleichzeitig erging zur Verhütung einer Teuerung ein Verbot der Hopfenausfuhr, das aber, nach Deckung des Bedarfes in Mecklenburg, wieder aufgehoben wurde; ein bestimmtes Kontingent durfte ausgeführt werden 267 ). Weitere Kornausfuhrverbote finden sich in den neunziger Jahren, besonders für das Jahr 1597/98 268 ).
B. Außenhandel
Die Außenhandelsbeziehungen Mecklenburgs waren im 16. Jahrhundert sehr vielgestaltig. Neben denjenigen der Hansestädte Rostock und Wismar ist es der von den Herzögen selbst betriebene Handel, der neue Absatz- und Bezugsgebiete für Mecklenburg erschloß.


|
Seite 61 |




|
I. Die Sorge der Herzöge für Sicherheit im
Seehandel
und Ordnung in
Außenhandelsangelegenheiten der Untertanen.
Vermöge ihrer Eigenschaft als Landesherren war es zunächst die Aufgabe der Herzöge, für die ordnungsgemäße Abwicklung des Handels, im besonderen für die Handelssicherheit mecklenburgischer Kaufleute auf den Meeren, zu sorgen, um den Wohlstand zu schützen und vor allem den Handel der politischen Lage anzupassen. Diese Aufgabe wurde während des ganzen 16. Jahrhunderts in umfangreichem Maße von den Herzögen gelöst, die sich als übergeordnete Gewalt auch für die noch mächtigen Hansestädte erwiesen. - Es wurde von den Herzögen Sorge getragen, daß Schulden der Untertanen an auswärtige Kaufleute bezahlt wurden, und daß diese in Mecklenburg zu ihrem Recht kamen. Im Interesse der Handelsbeziehungen Mecklenburgs mit Sachsen befahl Herzog Johann Albrecht 1572 die Bezahlung der Schuld eines Rostocker Bürgers an zwei Leipziger Kaufleute 269 ). 1574 verwandte sich Herzog Johann Albrecht beim Rate von Rostock für einen sächsischen Kaufmann, der dort übel behandelt worden war 270 ).
Den größten Raum nahmen die Maßnahmen gegen das Freibeutertum und das Ausliegerunwesen auf der See ein, das im 16. Jahrhundert eine verhängnisvolle Rolle spielte. Nicht allein Seeräuber gefährdeten die Sicherheit, sondern gegenseitige Beraubung der Kaufleute verschiedener Staatszugehörigkeit, sogar im Auftrage ihrer Fürsten, waren an der Tagesordnung. Besonders Übergriffen von dänischer Seite mußte in der ersten Hälfte des Jahrhunderts entgegengearbeitet werden.
Schon 1504 wurden Rostocker Kaufleute, deren Ware im Sommer 1503 im Sunde geraubt war, aufgefordert, vor den Herzögen Balthasar und Heinrich in Sternberg zu erscheinen, um dort den Tätern gegenübergestellt zu werden 271 ). Als 1510 die Städte Rostock und Wismar sich wegen dänischer Auslieger beschwerten, erklärten sich die Herzoge bereit, zur Abstellung dieses Übels Gesandte an den König von Dänemark zu schicken 272 ). Die Herzöge Heinrich und Albrecht bekämpften


|
Seite 62 |




|
1511 ebenfalls das vom dänischen König veranlaßte Ausliegerwesen 273 ). Herzog Albrecht wandte sich 1514 persönlich an den König von Dänemark, um eine Regelung der Handelsbeziehungen zwischen Rostock und Dänemark in die Wege zu leiten 274 ). Als 1519 ein Rostocker Kaufmannsschiff auf der Reise nach Riga von Dänen beraubt wurde, schrieben die Herzöge wiederum an den dänischen König um Abhilfe 275 ). Ebenso 1527, als erneute Klagen von Wismarer Bürgern über wiederholten Schiffsraub, begangen durch einen dänischen Bischof und Auslieger des Königs, lautbar wurden 276 ).
Sogar für die Sicherheit fremder Kaufleute auf mecklenburgischem Gebiet wurde gesorgt; als die Stadt Danzig sich wegen eines Überfalls auf See an einen der mecklenburgischen Herzöge wandte, wurde ihr Unterstützung und Hilfe zugesagt 277 ). Gemeinsam mit den wendischen Städten sorgte Herzog Albrecht 1544 für Sicherheit auf der See, er beraumte eine Zusammenkunft zur Besprechung dieser Fragen in Lübeck an 278 ).
Im Jahre 1546 nahm Herzog Albrecht den Kampf gegen holländische Seeräuber auf. Als zwei Rostocker Kaufleute, die Gebrüder Meienfelt, sich 1546 bei ihm darüber beklagten, daß sie auf einer Handelsfahrt nach Bergen in Norwegen von holländischen Ausliegern beraubt seien, die die Schiffe nach Amsterdam mitgenommen und die Güter dort verkauft hätten, und als trotz seiner Bitte um Hilfe an den Kaiser und die Königin Maria von Ungarn und Böhmen, Statthalterin der Niederlande, er eine Rückgabe nicht erreichen konnte, befahl Herzog Albrecht, alle holländischen Kaufleute, die nach Mecklenburg kämen, anzuhalten und nicht eher wieder freizulassen, bis die


|
Seite 63 |




|
Angelegenheit rechtlich entschieden sei 279 ). Diese Maßnahme wurde allerdings vom Kaiser, der mehr auf Seiten der Holländer stand, nicht gebilligt 280 ). Herzog Heinrich sorgte 1550 dafür, daß einem seiner Bützower Untertanen, der eine Handelsfahrt zur See machen wollte, von Rostock sicheres Geleit gewährt wurde 281 ). Als 1568 ein mecklenburgisches Schiff auf offener See von Danziger Ausliegern beraubt war, schrieb Herzog Johann Albrecht an die in Danzig anwesenden Kommissare des Königs von Polen, ersuchte um Rückgabe der Güter und erreichte die Billigung seines Gesuches 282 ). Als 1571 eine kaiserliche Aufforderung an die Fürsten ergangen war, an der Beseitigung der Seeräuber in der Nord- und Ostsee mitzuhelfen 283 ), gab Herzog Ulrich diesen Befehl an die Stadt Rostock weiter und ersuchte um Beantwortung des kaiserlichen Fragebogens nach Art, Aufenthaltsort und Tätigkeit der Seeräuber 284 ).
II. Handelsverordnungen aus außenpolitischen Gründen
Besonders aufschlußreich ist das Eingreifen der Herzoge in Handelsangelegenheiten, soweit es aus politischen Motiven geschah oder der politischen Konstellation angepaßt war. Die Stadt Rostock wurde 1536 angewiesen, Lebensmittel an den Grafen Christoph zu Oldenburg und Delmenhorst zu liefern 285 ), der, wie Herzog Albrecht selbst, an der Unterstützung des ent-


|
Seite 64 |




|
thronten Königs Christian II. von Dänemark beteiligt war 286 ). Im Kriege zwischen Dänemark und Schweden empfahl Hg. Ulrich 1569 auf Anraten des dänischen Königs den Kaufleuten, bis zum bevorstehenden Friedensschluß die Handelsfahrten nach Schweden, wohin die Zufuhr gesperrt war, einzustellen, damit sie keinen wirtschaftlichen Schaden erlitten 287 ). Die Stadt Rostock ersuchte er, Hopfen an den König von Dänemark zu liefern 288 ). Auch die Einfuhrverbote der Jahre 1570 - 1580 nach Rußland geschahen aus politischen Gründen. Die seit 1556 dauernden Thronstreitigkeiten Herzog Christophs mit dem russischen Zaren Iwan II., dessen Reiterhorden Livland überschwemmten und die Sicherheit des Ostseehandels gefährdeten 289 ), zogen die Blockierung der Russen von Reichs wegen und das Verbot der Narwaschiffahrt nach sich. Die Herzoge Ulrich und Johann Albrecht verboten damals wiederholt bei schwerer Strafe den Städten Rostock und Wismar, Handel nach Rußland zu treiben 290 ). Die Grenzirrungen mit der Mark Brandenburg 291 ) führten Ausfuhrverbote dorthin herbei. Im Jahre 1563 fanden gegenseitige Grenzsperren zwischen Mecklenburg und Brandenburg statt, die allerdings nach Beratung zweier Räte des Herzogs mit dem Kurfürsten wieder aufgehoben wurden 292 ). Als der Kurfürst Johann Georg von Brandenburg XX die Einfuhr einzelner Waren verbot, erfolgte eine neue Ausfuhrsperre für alle Waren als Gegenmaßnahme der mecklenburgischen


|
Seite 65 |




|
Herzoge 293 ). Nach Beilegung des Streites wurde 1575 die Ausfuhr nach der Mark wieder freigegeben 294 ).
III. Der Außenhandel der Herzoge.
Der Handel, der zunächst ein Privileg der Hansestädte gewesen war, wurde im 15./16. Jahrhundert ein umfangreiches Betätigungsgebiet der mecklenburgischen Herzoge. Von den Städten deshalb zwar vielfach zur Behauptung ihres bisherigen Handelsmonopols angegriffen, waren die mecklenburgischen Herzoge vermöge ihrer landesherrlichen Gewalt doch imstande, diese Gegenströmungen zu überwinden, selbst in Verbindung mit den Haupthandelsplätzen ihrer Zeit zu treten und so das Land Mecklenburg als Territorium einzugliedern in den damaligen europäischen Markt.
A. Handelsbestrebungen Herzog Magnus II.
Bereits Herzog Magnus II. machte den Versuch, einen Außenhandel anzubahnen, der unabhängig war von Zwischenhändlern und den Seestädten Rostock und Wismar. Seine Absichten, auf dem Seewege Korn nach Holland zu verschicken, scheiterten zwar um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts an dem Widerstande der Seestädte und der benachbarten Fürsten, doch er erreichte sein Ziel durch Benutzung der Elbe. Alle zwei Jahre etwa sandte er auf diesem Wege Roggen nach Holland. 1492 ließ er in Hamburg Roggen verkaufen, und 1498 bestanden Handelsbeziehungen zu der Magdeburger Gegend. Nach Hamburg und Magdeburg betrieb er 1495 - 99 außerdem einen Bretterhandel. Er handelte sogar mit Produkten, die er selbst erst aufkaufen mußte. So trieb er Heringshandel bis nach Mitteldeutschland und einen Speckhandel nach Magdeburg. Für das eingenommene Geld wurden allerhand Waren eingekauft, in Leipzig Silber für die Münze, Zeug und andere Waren, in Magdeburg Salpeter und in Amsterdam Tuch und andere Bedarfsgegenstände 295 ).


|
Seite 66 |




|
B. Handelsbeziehungen der Herzoge
Albrecht VII. und Heinrich V.
I. Der Handel mit den Niederlanden.
Auch unter den Nachfolgern Magnus II., den Herzogen Albrecht VII. und Heinrich V., waren die Niederlande, besonders Antwerpen, das sich im 16. Jahrhundert zum Handelsplatz ersten Ranges entwickelt hatte 296 ), Zielpunkt der Handelsbestrebungen. Ein erhöhter Bedarf und allgemeines Steigen der Getreidepreise im Westen waren dem Getreidehandel dorthin günstig 297 ).
Da die Herzoge selbst nicht im Besitze von Schiffen waren, versuchten sie solche bei der Stadt Rostock zu borgen, wurden aber abschlägig beschieden, was aus der eifersüchtigen Haltung der alten Hansestadt dem neuen landesherrlichen Streben gegenüber leicht zu erklären ist. So war es den Herzogen Magnus und Balthasar 1503 ergangen, als sie einem Rostocker Schiffer eine Roggenladung für Amsterdam übergeben wollten 298 ); und die gleiche ablehnende Haltung bewahrte Rostock 1510 gegenüber den Herzogen Heinrich V. und Albrecht VII., als diese auf einem Rostocker Schiff Waren nach Dänemark senden und dort Lebensmittel einkaufen lassen wollten 299 ). 1514 gelang es den Herzogen, mit dem Schiffer Matthias Kegebein einen Vertrag abzuschließen, in dem dieser sich verpflichtete, ihnen 28 Last Roggen (1120 Zentner) nach Amsterdam zu verschiffen 300 ). Etwa zur gleichen Zeit wurde mit einem Schiffer aus Amsterdam verhandelt, an den 53 Last Roggen verkauft und 32 Last auf Fracht nach Amsterdam mitgegeben wurden, ebenso einige Bretter. Salz und Tuch aus Amsterdam wurden


|
Seite 67 |




|
dafür in Rechnung gestellt 301 ). 1522 hatte Herzog Heinrich aufs neue die Absicht, Roggen nach dem Westen zu schicken; er wandte sich durch seinen Kanzler Kaspar von Schöneich an Wismar um Zustimmung, daß die damit beladenen Schiffe im dortigen Hafen unter Segel gingen 302 ). Wismar scheint in diesem Falle eingewilligt zu haben, denn der Herzog wandte sich mit dem Ersuchen an Lübeck, vier oder fünf kleine Schiffe frei passieren zu lassen 303 ), worauf die Stadt zwar ihr Bedenken äußerte, aber die Fahrt frei gab 304 ).
Ein neuer Versuch wurde mit Hilfe des Wismarer Bürgers Blasius Malchow unternommen, dem von der Stadt Wismar der Vorwurf gemacht wurde, dem Herzog die Kaufmannschaft erleichtert zu haben. Der Kanzler Kaspar von Schöneich leugnete in einem Verteidigungsschreiben für Malchow an Wismar, daß Handelsbestrebungen der Herzoge überhaupt vorhanden seien; das ist sehr bezeichnend dafür, wie schwierig es für die Herzoge war, selbständig Handel zu treiben, da dieser verheimlicht werden mußte. Blasius Malchow brachte aus Holland Gewürz und Tuch für den Bedarf des Hofes mit 305 ).
Der Handel mit Holland wurde nun durch einen eigenen Abgesandten der Herzoge, den früheren Küchenmeister von Schwerin, Anthonius Schröder 306 ), weiter vermittelt, der seit 1518 als Kommissionär der Herzoge in Lübeck, Lüneburg, Hamburg, Jüterbog, Leipzig und Torgau tätig gewesen war 307 ).


|
Seite 68 |




|
1526 verkaufte er zu Amsterdam für etwa 600 Gulden Malz und Roggen im Auftrage der Herzoge und kaufte dort und in Antwerpen Gewand, Seide, Garn und Gewürz ein 308 ).
In den Jahren 1536 - 45 unterhielt Herzog Albrecht eine Handelsverbindung mit dem Antwerpener Bürger Willem Bornewasser, von dem er 1536 für 440 Gulden und 1537 für 136 Gulden Tuch kaufte. Für eine Schuld von 800 Gulden lieferte er ihm Mehl und Wolle nach Hamburg 309 ).
2. Der Bau herzoglicher Schiffe,
Klipphafenschiffahrt und Streit
mit den
Hansestädten Rostock und Wismar
Die Herzoge versuchten nun, zur Erweiterung ihres Handels in den Besitz eigener Schiffe zu gelangen. Im Jahre 1517 finden wir zum ersten Male Schiffe in ihrem Besitz. Auf der Lübecker Reede vor Travemünde wurden zwei herzogliche Schiffe schiffbrüchig 310 ). 1519 schickte Herzog Heinrich wiederum in einem Schiff 28 Last Roggen nach Danzig 311 ). Zur gleichen Zeit, in den Jahren 1516 - 19 etwa, war wiederum ein Schiff mit Korn westwärts gefahren, das aber durch die Friesen, Holländer und Burgunder beraubt wurde. Deshalb wandte sich einer der Herzoge an die Stadt Amsterdam, wo das Schiff hingebracht worden war und der Inhalt versteigert werden sollte, und bat, ihm das Schiff oder seinen Geldwert zuzustellen. Gleichzeitig wandte er sich in derselben Angelegenheit an den Herzog Karl von Burgund, den späteren Kaiser Karl V. (1519 - 58), und an die Stadt Enkhuizen, deren Bürger an dem Schiffsraub beteiligt waren 312 ).
Am 2. Mai 1526 wurde ein Schiff für 154 Gulden von einem Bürger zu Nästved auf Seeland gekauft 313 ). Im gleichen


|
Seite 69 |




|
Jahre wurde von dänischen Ausliegern ein mit Waren beladenes Schiff Herzog Albrechts beraubt, eine Folge von des Herzogs Parteinahme in den nordischen Wirren für den entthronten König Christian II. von Dänemark 314 ). Herzog Albrecht wandte sich schließlich an Kaiser Karl X., der an den neuen dänischen Herrscher Friedrich III. und Lübeck, das mit diesem verbündet war, den Befehl ergehen ließ, das geraubte Gut Herzog Albrecht wieder zuzustellen 315 ). Ebenso wurde 1526 ein herzogliches Schiff von Rostockern beraubt 316 ).
Im Jahre 1527 ging wieder ein Schiff, diesmal ein größeres, in den Besitz Herzog Albrechts über. Er kaufte es für 800 Gulden von den Schiffern Albrecht Cleie van Horn und Johann van der Bowe. Letzterer trat in des Herzogs Dienste 317 ). Dieses ist wahrscheinlich das gleiche Schiff, das Wismar im selben Jahre aus dem Klipphafen bei Golwitz auf Poel einholen ließ 318 ).
Ein offener Kampf mit den Seestädten Lübeck, Rostock und Wismar, die den Herzogen das Recht, Klipphäfen anzulegen, absprachen, hatte eingesetzt 319 ). Trotz dieser Streitigkeiten ließen die Herzoge 1528 ein weiteres Schiff bauen 320 ). Der herzogliche Kornhandel war inzwischen bis nach Schweden ausgedehnt worden. Der Schiffer Klaus Wernow zu Travemünde


|
Seite 70 |




|
nahm im Auftrage Herzog Heinrichs 70 Last Roggen, Mehl und Malz an Bord, die er nach Schweden bringen sollte 321 ).
1533 wurde mit dem Hamburger Kaufmann Heinrich Wapensticker, zu dessen Bruder Christoph Herzog Albrecht ebenfalls Handelsbeziehungen unterhielt 322 ), ein Vertrag abgeschlossen, in dem Herzog Albrecht ihm 100 Last Roggen, die Last für 20 Gulden, zu verkaufen versprach 323 ). Wismar gestattete das Auslaufen der mit dem Roggen beladenen drei Schiffe jedoch nicht 324 ). Wapensticker reiste nach Antwerpen, veranlaßte den Herzog von Cleve, die Durchfahrt in Hamburg zu erwirken, und stellte bei Gelingen des Handels, was bei dem Verhalten Wismars unwahrscheinlich war, noch weitere Ausfuhrmöglichkeiten nach dem Westen für Wolle in Aussicht 325 ).
Bei vielen Handelsunternehmungen sehen wir also die Herzoge von den Seestädten gehemmt. Der Streit um den Klipphafen bei Golwitz und ein dort errichtetes herzogliches festungsähnliches Gebäude erwachte 1532 aufs neue und dauerte, von den Seestädten gemeinsam gegen die Herzoge durchgeführt, bis 1534 326 ). Er wurde erst beigelegt, als Herzog Albrecht die Hilfe der Städte bei der Erwerbung der schwedischen Königskrone 327 ) brauchte, und die Städte, um ihre Hegemonie im Handel zu retten, eine gütliche Vereinbarung herbeizuführen suchten. Herzog Albrecht versprach, daß den Städten ihre alten


|
Seite 71 |




|
Privilegien unbeschnitten sein sollten, daß er mit Dänemark keinen Handel treiben und den Handel des Adels dorthin verhindern wollte. Herzog Heinrich schloß sich diesen Versprechungen an 328 ).
Der herzogliche Handel wurde aber aus diesem Grunde nicht eingestellt. 1534 erschienen zwei hamburgische Schiffe bei Golwitz und nahmen Korn von den Landesherren ein 329 ), wogegen Rostock und Wismar Protest einlegten 330 ). 1535 benutzte Herzog Albrecht die Zeit der Grafenfehde 331 ) zu Handelsgeschäften in Kopenhagen und verkaufte dort Korn 332 ).
1538 wurde ein herzogliches Schiff nach Amsterdam gesandt und so der Handel mit den Niederlanden wieder aufgenommen. Ein gewisser Gottschalk Remlingradt verkaufte wahrscheinlich dort Speck und Mehl, die er zu Wismar vom Herzog erhalten hatte 333 ). 1539 beabsichtigte Herzog Albrecht, zwei Schiffe im wismarschen Hafen zu befrachten, doch die von Wismar gestellten Bedingungen scheinen dies verhindert zu haben 334 ).
Auf den Versammlungen der wendischen Städte von 1538 und 1539 wurde Herzog Albrecht des Einvernehmens mit dem eben genannten Remlingradt, der Seeraub trieb, bezichtigt 335 ). Tatsächlich scheint sich Herzog Albrecht zu dieser Zeit am Freibeuterwesen beteiligt zu haben 336 ), wohl um die im dänischen Kriege erlittenen Verluste dadurch wettzumachen. Auf einem der gekaperten Schiffe befand sich Kupfer, das den Fuggern zu


|
Seite 72 |




|
Augsburg gehörte und das auf das Ersuchen ihres Prokurators zu Danzig wahrscheinlich wieder herausgegeben wurde 337 ).
Auf dem Regensburger Reichstag von 1546 wurde nun Herzog Albrecht von Kaiser Karl V. unter anderem das Privileg zugebilligt, zwei neue Häfen, einen bei Golwitz und den anderen bei Ribnitz, anzulegen 338 ). Wahrscheinlich handelte es sich jedoch nur um Privilegienentwürfe 339 ). Herzog Albrecht starb am 5. Jan. 1547, wohl ohne die feste Zustimmung des Kaisers erhalten zu haben.
3. Floßschiffahrt nach Sachsen.
In den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts betrieb Herzog Albrecht einen ausgedehnten Flößereibetrieb auf der Elbe und erschloß so Sachsen als neues Absatz- und Bezugsgebiet für Mecklenburg. Die Stadt Pirna an der Elbe war der Mittelpunkt dieser Handelsbeziehungen, was sich leicht aus dessen geographischer Lage erklärt, die es zum wichtigen Handelsplatz im damaligen Sachsen machte. 1525 wurde ein Handel mit Heringen, Stockfisch und Speck durch den Schandauer Bürgermeister Jörn Hensel im Auftrage Herzog Albrechts die Elbe hinauf betrieben. Ein Floß mit 28 Flößerknechten fuhr nach Sachsen, und in Hain, Mühlberg, Torgau, Mügeln, Stauchitz, Strehla, Riesa, Freiberg, Meißen und Lichtenburg wurden im ganzen 93 Tonnen Heringe zum Preise von etwa 450 Gulden verkauft. Mit der Einnahme für Stockfisch und Speck betrug der Gesamterlös etwa 482 Gulden. Auf einer zweiten Reise wurden Heringe zu Belzig in Brandenburg verkauft und Tuche in Sachsen eingekauft 340 ). Ebenfalls 1525 unternahm ein gewisser Nickel von Rotzschitz im herzoglichen Auftrage eine Floßfahrt mit 56 Flößerknechten nach Sachsen, kaufte zu Pirna und Hain für etwa 270 Gulden Tuch und Wein ein und besuchte den Ostermarkt zu Leipzig, wo er Silber einkaufte. 1526 finden wir Rotzschitz wieder in Leipzig auf dem Weihnachtsmarkt, wo er Wein einkaufte. Er flößte von dort nach Schandau, Torgau, Wittenberg und Belzig und kehrte durch die Mark nach Mecklenburg zurück. Nach nochmaliger Fahrt nach Leipzig zum Ostermarkt im Jahre 1527 flößte er von


|
Seite 73 |




|
dort nach Hamburg und trat von hier aus eine Reise nach Antwerpen und Amsterdam an, war zum Michaelismarkt und Weihnachtsmarkt wieder in Leipzig und unternahm von dort eine zweite Reise nach Amsterdam. Er brachte dorthin zu Schiff 1500 Dielen zum Verkauf, die der Herzog in Sachsen hatte aufkaufen lassen. Zur Zeit des Ostermarktes 1528 zu Leipzig kaufte er Mühlensteine, die nach Mecklenburg geflößt wurden, und machte danach eine Reise mit Jörg Hensel, dem Schandauer Bürgermeister, nach Hamburg und Amsterdam, wo er für 1000 Gulden Bretter verkaufte. Zu Antwerpen wurden Gewürz, Zucker und Gewand eingekauft. Zum Weihnachtsmarkt 1528 war er wieder in Leipzig 341 ). Ein gewisser Siegmund von Parczsche unternahm im Auftrage Herzog Albrechts in den Jahren 1525 - 27 Flößfahrten nach Sachsen und kaufte in Pirna Bretter auf, die ebenfalls westwärts geschickt wurden 342 ).
Ob die Flößfahrten einträglich für den Herzog waren, ist zweifelhaft, da die Ausgabe die Einnahme weit überschritt. Jedenfalls trat Herzog Albrecht als Handelsherr und Vermittler der beiden Handelszentren in Sachsen und in den Niederlanden auf.
4. Schiffsreisen nach Portugal, England und Frankreich.
Sogar nach Portugal richtete Herzog Albrecht seine Blicke. 1530 beabsichtigte er eine Handelsexpedition dorthin und wandte sich wegen eines Geleitbriefes an Kaiser Karl V., der den König Emanuel von Portugal ersuchte, zu gestatten, daß ein mecklenburgisches Schiff mit Spezereien beladen würde, wozu dieser seine Einwilligung gab 343 ). Herzog Albrecht hatte sogar die Absicht, Weizen in Hamburg aufzukaufen und zu Schiff nach Lissabon zu schicken. Da der Weizen in Hamburg aber sehr hoch im Preise stand, lohnte sich dieses Handelsgeschäft nicht 344 ). Wahrscheinlich ist der Plan des Herzogs also nicht zur Ausführung gelangt.


|
Seite 74 |




|
In den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts wurde von Herzog Heinrich gemeinsam mit Hamburger Handelsleuten ein Schiff gehalten und mehrere Jahre von dem Hamburger Schiffer Georg Dham geführt. Der Güstrower Rentmeister Siegmund von Esfeld reiste 1535 nach Hamburg, um Geld für den Schiffbau zu leihen, die Register zu prüfen und sich weiterhin nach der Möglichkeit eines Salzverkaufs in Hamburg zu erkundigen; er hatte keinen Erfolg 345 ). Nach Fertigstellung des Schiffes ward eine längere Reise nach England unternommen 346 ). Auf der Fahrt wurde in einer englischen Stadt Mehl verkauft. Dham händigte die Einnahme dem Handelsvertreter des Herzogs zu Hamburg, Johann Garlsdorf, aus, der seit 1524 des Herzogs Handelsinteressen vertrat 347 ). Im gleichen Jahre wurde eine zweite Reise unternommen, auf der in Brouage 348 ) an der französischen Küste Salz gekauft wurde. Mit einem Reingewinn von etwa 414 Mark kehrte der Schiffer zurück. Die dritte Reise ging ebenfalls über Frankreich, wo Salz gekauft wurde, das von Hamburg nach Dömitz und von dort auf "die Sulzen" gelangte. Gemeint ist wahrscheinlich die Saline von Conow, deren Wiederaufrichtung durch Herzog Heinrich 1527 geschah 349 ). Da sich nach der Reise Differenzen bei der Abrechnung ergaben, trat der Schiffer Dham aus dem herzoglichen Dienst aus und erhielt seinen Anteil am Schiffe ausbezahlt 350 ).
5. Handelsbeziehungen zu den norddeutschen Städten.
Rege Handelsbeziehungen waren mit mehreren norddeutschen Städten außerhalb Mecklenburgs und deren Bürgern vorhanden. Antonius Schröder, der bereits durch seine Reise


|
Seite 75 |




|
nach Holland bekannt geworden ist, war als Kommissionär der Herzöge in den norddeutschen Städten tätig. In Lübeck, der Metropole des norddeutschen Handels zu jener Zeit, wechselte er 1519 Geld im herzoglichen Auftrage auf der dortigen Wechselbank 351 ), die mehrere Male von den Herzögen in Anspruch genommen wurde 352 ). 1526 ließen sie durch diese Bank sogar Geld an eine Nürnberger Bank überweisen 353 ). Die Territorialität der Münze, die zu dieser Zeit noch bestand, machte dieses Vorgehen notwendig.
Zu Lüneburg wurde 1519 Wolle verkauft 354 ), zu Mölln 1527 Malz 355 ). Herzog Heinrich betrieb 1524 einen Handel mit Speck nach Magdeburg 356 ). Mannigfaltig waren die Handelsbeziehungen zu Hamburg in dieser Zeit. 1518 ersuchten die Herzoge drei hamburgische Kaufleute um Beitreibung einer Restforderung für Roggen, den diese 1504 erhalten hatten 357 ). 1528 wurde englisches Tuch zu Hamburg bei zwei Händlern gekauft 358 ) und 1529 ebenfalls Tuch, wofür Johann Garlsdorf Fracht und Zoll bezahlte 359 ). Aus dem Amt Grabow wurden in den dreißiger Jahren 50 Wispel Roggen nach Hamburg verkauft 360 ). Zu Magdeburg ließ Herzog Heinrich 1535 für über 300 Taler Kupfer und Zinn einkaufen 361 ). Nach


|
Seite 76 |




|
Ülzen wurde 1536 ein Roggenhandel betrieben 362 ). 1541 wurde an den Rat zu Lüneburg Roggen 363 ) und 1543 Malz nach Mölln verkauft 364 ). Roggenhandel nach Hamburg fand 1544 und 1546 statt, als der dortige Rat wegen einer herrschenden Teuerung darum bat 365 ).
C. Handelsbeziehungen der Herzoge Johann Albrecht I. und Ulrich.
1. Der Handel der Herzoge Johann Albrecht
und Ulrich
mit den Niederlanden.
Besonders Herzog Johann Albrecht I. knüpfte an die Bestrebungen seines Vaters an und pflegte, wie dieser, eifrige Handelsbeziehungen mit den Niederlanden. Die 1536 - 45 angebahnte Verbindung mit dem Antwerpener Bürger Willem Bornewasser wurde von ihm weitergeführt. Der Faktor Bornewassers zu Hamburg, Peter Sael, erhielt 1547 - 52 wiederholt größere Summen aus der herzoglichen Kasse 366 ). 1552 machte dieser im Auftrage des Herzogs eine Reise nach England 367 ) und erhielt 1558 seine letzte Bezahlung 368 ). Die Absicht Herzog Johann Albrechts, 1547 Roggen in die Niederlande zu verschiffen, wurde durch Hamburg vereitelt, das, da es selbst Bedarf hatte, die Durchfahrt nicht freigab 369 ). 1570 trieb er einen Asche- und Teerhandel nach Antwerpen 370 ).


|
Seite 77 |




|
Herzog Ulrich kaufte 1559 ebenfalls Tuch in Antwerpen 371 ), ebenso 1562, als er außerdem von einem dortigen Kaufmann eine Anfrage nach Wolle erhielt 372 ).
2. Der Bau zweier Seehandelsschiffe und die
mit ihnen unter-
nommenen
Handelsexpeditionen unter Herzog Johann
Albrecht I.
Im Jahre 1563 beginnt die interessanteste Phase im mecklenburgischen Außenhandel des 16. Jahrhunderts. Zwei große Seehandelsschiffe, die die Namen "Greif" und "Ochsenkopf" trugen, wurden zu Memel im Auftrage Herzog Johann Albrechts erbaut 373 ) und nach ihrer Fertigstellung zu großzügigen Handelsunternehmungen nach West und Süd, mit dem Zielpunkt des portugiesischen Hafens Lissabon, benutzt. Es ist bemerkenswert, daß gerade in der Zeit, da Mecklenburg sich in tiefen Schulden befand, die Schiffe mit z. T. geliehenen Mitteln und fremder Hilfe erbaut wurden. Der Berater Herzog Johann Albrechts, der Hofrat Johann Andreas Mylius 374 ), schreibt in seinen Annalen zum Jahre 1563 375 ): "Es hatte auch Hertzog Johann Albrecht zwey große schöne Schiffe an der Memel von Grund auf neu erbauen lassen. Obwol aber vom Hertzog zu Preußen großer Vortheil und Hülfe an Holz-, Hampf, Theer, und viel anderen Stücken zu solchen Schiffbau väterlich erfolget, so seynd doch unglaubliche Unkosten auf baar Geld zu allerhand Nothdurft und täglicher Unterhaltung nothwendiger Persohnen gegangen, dagegn alle Hülfe des Herzogen in Preußen fast nichts zu achten."


|
Seite 78 |




|
Der Plan Herzog Johann Albrechts, Handelsbeziehungen mit Portugal anzuknüpfen, war den Zeitverhältnissen glänzend angepaßt, waren doch Portugal und Spanien seit der Entdeckung Amerikas die Länder, in die sich der Schwerpunkt des Handels verlegte, der vorher östlich orientiert war, sich vorwiegend auf das Mittelmeer beschränkte und von dort nach Oberdeutschland ging. Außerdem fielen in diese Zeit die Kämpfe der nördlichen Niederlande mit Spanien, wodurch die starke Konkurrenz der Holländer für den deutschen Handel ausgeschaltet wurde. Der hansische Verkehr erstreckte sich jetzt bis nach Spanien und Portugal. Ebenso wie die Hansen richtete Herzog Johann Albrecht seine Blicke nach dem fernen Lissabon und nahm damit einen Plan seines Vaters, des Herzogs Albrecht, wieder auf, der schon eine Handelsexpedition nach der Pyrenäenhalbinsel plante. Hinzu kommt, daß durch häufige kaiserliche Mandate, so auch wieder am 26. Nov. 1560, der Export von Proviant nach Rußland aufs strengste verboten und damit das Handelsgebiet wesentlich beschränkt war.
Schon 1559 lenkte Herzog Johann Albrecht seine Aufmerksamkeit nach der Pyrenäenhalbinsel und trat durch einen Gesandten zu Genf in Verhandlung mit dem König von Spanien wegen einer Schiffahrt dorthin 376 ). Zu Anfang 1560 plante er eine Handelsfahrt nach Lissabon und ließ Erkundigungen über die dortigen Handelsverhältnisse und Absatzmöglichkeiten einziehen. Ein zu diesem Zwecke nach Portugal gesandter Schiffer berichtete am 11. März 1560 377 ), daß günstige Ausfuhrmöglichkeiten nach dort beständen, und daß der Weizenpreis sich täglich steigere, was sich aus dem Umstand erkläre, daß die Holländer auf Verbot der Königin von England nicht segeln dürften. Salz sei dort zu günstigen Bedingungen zu kaufen und werde noch billiger werden, da die Nachfrage nicht groß sei. Ein anderer genauer Bericht über die Handelsmöglichkeiten mit ostpreußischen Waren nach Lissabon gibt Aufschluß über die Ausfuhrprodukte. Außer einem Holz- und Bretterhandel und einem Getreidehandel war die Verschickung von Mehl, Speck, Wachs, Teer und Eisen in Aussicht genommen. Als Einfuhrartikel für Mecklenburg kam hauptsächlich das Salz in Frage, außerdem Spezereien aus allen Ländern.


|
Seite 79 |




|
Nach Feststellung dieser günstigen Handelsaussichten wurde nun der Bau der beiden Seehandelsschiffe in die Wege geleitet. Nachdem am 2. Jan. 1562 die endgültige Zustimmung Kaiser Ferdinands eingetroffen war, reiste Herzog Johann Albrecht selbst nach Preußen 378 ) und verweilte 12 Wochen lang in Königsberg. Die Oberaufsicht über den Schiffsbau übertrug er dem herzoglich preußischen Sekretär Balthasar Gantz. Nach der Beschaffung des Materials wurde der Bau mit z. T. geliehenen Geldern Anfang Juni in Angriff genommen. Zu Michaelis hatte er trotz allerlei Lohnstreitigkeiten und Unehrlichkeiten unter den Arbeitern bereits gute Fortschritte gemacht, und es bestand die Hoffnung, daß das erste Schiff über Winter fertiggestellt werden konnte. Die Beschaffung des Holzes für beide Schiffe erlitt jedoch eine Verzögerung, und im Winter 1562/63 trat wegen der Kälte eine gänzliche Arbeitspause ein. Als die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, schritten sie jedoch nur langsam fort, woran besonders der Mangel an Leuten Schuld trug. Zu allen Schwierigkeiten trat der Geldmangel Herzog Johann Albrechts hinzu. Balthasar Gantz, der bereits bedeutende Summen ausgelegt hatte, mußte wiederholt um Geld bitten. Um Mitte Sept. 1563 war der Bau des einen Schiffes dann glücklich so weit vorgeschritten, daß es von Stapel laufen konnte. Das Schiff, das durch einen Sturm einen Unglücksfall erlitt, blieb auf Anraten des Balthasar Gantz in Ostpreußen liegen, obgleich Herzog Johann Albrecht ursprünglich die Absicht gehabt hatte, es sofort nach seiner Fertigstellung nach Mecklenburg zu bringen. Der Bau des zweiten Schiffes war noch lange nicht vollendet. Herzog Johann Albrecht begab sich im Dez. 1563 noch einmal auf die Reise, um den Bau zu besichtigen. Er hoffte damals auf die baldige Vollendung der Schiffe, denn am 28. Dez. suchte er bei dem König von Dänemark um Paßbriefe für sie nach.
Während der nächsten zwei Jahre erfahren wir fast nichts über den Schiffbau, der kurz vor der Vollendung wahrscheinlich aus Geldmangel gänzlich niedergelegt wurde. Die Schuldenlast für den Schiffsbau scheint inzwischen so angewachsen zu sein, daß an einen Weiterbau vorläufig nicht zu denken war, und die Gläubiger zunächst einmal befriedigt werden mußten. Am 13. Jan. und 6. Sept. 1564 wurden im


|
Seite 80 |




|
ganzen 1700 Taler an einen gewissen Tonnies Krebs zu Lübeck auf die 2000 Taler zurückgezahlt, die Herzog Johann Albrecht mit "beschwerlichen" Monatszinsen bei ihm 1563 für den Schiffsbau aufgenommen hatte. An einen gewissen Friedrich Konitz wurden am 8. Sept. 1564 etwa 250 Taler zurückerstattet 379 ).
Erst 1566 wurde der Schiffsbau vollendet. Die Gesamtkosten für den Bau beliefen sich nach den Berechnungen der leitenden Persönlichkeiten auf rund 17529 Mk. Bei der Ausfahrt wurden die Schiffe durch einen heftigen Sturm fahrtunfähig gemacht und eine Handelsfahrt wurde für 1566 unmöglich. Im Frühjahr 1567 wurden durch die beiden Schiffer des Herzogs, Johann von Deilen und Matthias Meier, neue Mannschaften für die Schiffe angeworben. Matthias Meier heuerte für den "Greif", den er befehligen sollte, 35 Mann, Johann von Deilen, der Kapitän des "Ochsenkopf", im ganzen 31 Mann an 380 ). Am 30. April traten die Schiffe die Reise nach Mecklenburg an, waren am 23. Mai vor Wismar und gingen der Stadt gegenüber bei Brandenhausen auf Poel vor Anker. Herzog Johann Albrecht begab sich zur Besichtigung dorthin. Da der König von Dänemark die gewünschten Paßbriefe für die Schiffsreise nach Portugal nicht bewilligte, mußte diese vorläufig unterbleiben 381 ).
"Greif" und" Ochsenkopf".
Herzog Johann Albrecht machte aus diesem Grunde zunächst Riga zum Ziel seiner Handelsexpeditionen. Die Schiffe wurden mit Gütern, darunter Salz, Weizen, Malz und Wein, beladen und nach Rußland gesandt. Mit allerlei Waren befrachtet, kamen sie nach Mecklenburg zurück.
Zu Anfang des Jahres 1568 nahm Herzog Johann Albrecht seine Bemühungen, die Fahrt nach Lissabon frei zu bekommen, wieder auf. Er bat den König von Polen, für ihn am dänischen Hofe Fürsprache einzulegen; da die Paßbriefe trotzdem nicht einliefen, wandte er sich am 13. März 1569 an den Kaiser Maximilian, der zunächst Bericht von der Stadt Hamburg einholte, ob das Zugeständnis an Herzog Johann Albrecht etwa der Hanse zum Nachteil gereichen könne, schließlich aber doch


|
Seite 81 |




|
seine Einwilligung gab. Im Frühjahr 1570 kam die Reise nach Lissabon dann wirklich zustande.
Herzog Johann Albrecht schrieb am 20. März an den König Emanuel von Portugal, teilte ihm seine Absichten mit und bat gleichzeitig um seine Unterstützung und seinen Schutz vor Seeräubern. Am 27. April waren die Schiffe beladen und fahrtbereit und am Himmelfahrtstage fuhren sie nach Lissabon ab. Die Ladung bestand in der Hauptsache aus Holz, Weizen und Teer. Sie kamen glücklich in Lissabon an, löschten dort ihre Ladung und begaben sich, hauptsächlich mit Salz beladen, auf die Heimfahrt. Der "Ochsenkopf" sollte jedoch nicht nach Mecklenburg zurückkehren. Er ging auf der Heimreise im Golf von Biskaya bei einem großen Sturm unter 382 ). Die Besatzung konnte sich nur mit Mühe retten.
Auch der "Greif" hatte Unglück auf seiner Heimfahrt, er wurde leck und mußte die Küste von Seeland anlaufen. Die Ladung konnte jedoch beinahe ganz gerettet werden. Nach erfolgter Ausbesserung plante der Herzog eine neue Reise nach Lissabon. Der Kapitän wurde beauftragt, in Hamburg möglichst viele Güter einzunehmen. Für die Rückreise sollte wiederum Salz und andere Frachtgüter geladen werden. Am 12. Juli ging der "Greif" unter Segel, mit 22 Passagieren außer der Mannschaft an Bord. Am 1. Aug. traf er in Lissabon ein, wo er sieben Wochen lang liegen blieb. Am 20. Sept. trat er die Rückreise an, auf der auch ihn das Unglück ereilte. Am 8. Okt. strandete er in der Nähe von Calais.
Herzog Johann Albrecht sandte sofort nach Bekanntwerden der Katastrophe eine Instruktion an den Kapitän Michel Meier, dem er befahl, zu retten, was noch zu retten war, den Gubernator von Calais bat er gleichzeitig um Unterstützung bei den Bergungsarbeiten. Das Schiff und die Ladung waren jedoch vollkommen verloren. So wurde Herzog Johann Albrecht um seinen Gewinn gebracht und sein großer Plan, einen regelmäßigen Handelsverkehr mit Portugal ins Leben zu rufen, scheiterte.
3. Klipphafenschiffahrt und Verhältnis zu
den Städten Rostock
und Wismar zur Zeit
der Herzoge Johann Albrecht und Ulrich.
Die ersten 15 Regierungsjahre Herzog Johann Albrechts waren vorübergegangen, ohne daß die Klipphafenschiffahrt zum


|
Seite 82 |




|
Gegenstande des Streites zwischen ihm und den Seestädten Rostock und Wismar geworden wäre 383 ). Dann aber erneuerte sich der Kampf. 1562 verkaufte der Herzog an einen Königsberger Schiffer Korn, Wismar aber weigerte sich, die Ausfuhr zu gestatten. Der Schiffer mußte ohne Ladung wegsegeln 384 ).
Den Plan seines Vaters, auf Poel eine Art Festung zu bauen, wurde von ihm wieder aufgenommen. In den Jahren 1564 - 67 wurde an dem Gebäude bei Golwitz gebaut und außerdem dort eine Brücke ausgebessert 385 ). 1566 lag ein Schiff bei Golwitz, das von den Lübeckern ausgeplündert wurde 386 ). Auch die Einrichtung eines Hafens auf Fischland, den Herzog Albrecht bereits geplant hatte, wurde von Herzog Johann Albrecht wieder aufgenommen. Er beabsichtigte, den Hafen mit Hilfe venezianischer Sachverständiger auszubauen 387 ).
4. Handelsverbindungen mit Mitteldeutschland.
a) Floßschiffahrt auf der Elbe.
Die Handelsverbindungen mit dem mitteldeutschen Wirtschaftsraum, wie sie bereits durch den Flößereibetrieb auf der Elbe durch Herzog Albrecht angeknüpft waren, wurden zur Zeit Herzog Johann Albrechts I. weiter fortgesetzt und ausgebaut. Pirna war wiederum die Zentrale für diese Unternehmungen. Zwei festbesoldete Beauftragte des Herzogs, der "Einspännige" Joachim Funcke und der Kanzleischreiber Jürgen Fues, waren 1561 - 77 ständig als Leiter dieses Flößereibetriebes tätig. 1560 fuhren zwei Flöße und drei Schiffe mit einer Gesamtbesatzung von 76 Mann die Elbe hinauf und nach Pirna, wo Holz eingekauft wurde, unter anderem zum Kapellenbau im Schweriner Schloß. Die Expedition ging zollfrei durch die Gebiete des Erzbischofs von Magdeburg und des Markgrafen Joachim von Brandenburg. Auf einer zweiten Reise im Jahre 1561 waren Mühlensteine geladen. Fues unternahm von Sachsen aus eine Reise nach Prag 388 ). Um die Kosten für die


|
Seite 83 |




|
Schiffsreise wieder herauszubekommen, wies der Herzog Fues an, in Magdeburg für 500 Taler Getreide zu kaufen, es nach Meißen zu schiffen und dort zu verkaufen 389 ). 1563 wurden wiederum Mühlensteine durch Joachim Funcke zu Schiff nach Dömitz gebracht 390 ). Ebenso 1568 wurden Mühlensteine in Pirna eingekauft, außerdem Ketzberger Most, Wein, Äpfel und Weintrauben. Die beiden Schiffe des Herzogs wurden 1568 in Pirna ausgebessert 391 ). Gleiche Fahrten fanden in den Jahren 1572, 1573 und 1577 statt 392 ).
b) Handelsverkehr mit Leipzig
und dem
übrigen Mitteldeutschland.
Leipzig, damals schon von hoher Bedeutung als Messestadt 393 ), war für Mecklenburg Vermittlerin des oberdeutschen und orientalischen Handels. Schon zur Zeit der Herzoge Albrecht und Heinrich hatte man von den Leipziger Messen Waren, vornehmlich Spezereien und Gewürze, für den Bedarf des Hofes bezogen. Seit 1549 wurden die Leipziger Messen regelmäßig von herzoglichen Beauftragten besucht. Der Magister Simon Leupold, der zu dieser Zeit die Handelsinteressen in Mittel- und Norddeutschland vertrat, kaufte dort 1549 Gewürz und Seidengewand ein, ebenso 1551 394 ). In den folgenden zwei Jahrzehnten wurden von den Oster-, Michaelis- und Weihnachtsmärkten zu Leipzig fortlaufend Spezereien, Wein, Früchte, Südfrüchte, Baumwolle, Augsburger Tuch, ungarische Pflaumen und venedische Mandeln bezogen 395 ).
Wenn Mecklenburg sich in seinen Handelsbeziehungen zu Mitteldeutschland bisher vorwiegend rezeptiv verhalten hatte, so schaffte die Vergrößerung der Schafzucht in Mecklenburg zu dieser Zeit die Voraussetzung zu einem bedeutenden Wollhandel nach Sachsen. Der oben genannte Magister Simon


|
Seite 84 |




|
Leupold verkaufte in herzoglichem Auftrag Wolle in Torgau, Schmiedeberg, Herzberg und Jessen 396 ).
5. Handel mit den norddeutschen Städten.
Auch bei diesen ist eine Weiterverbreitung des mecklenburgischen Wollhandels festzustellen. Es wurde Wolle nach Stettin, Magdeburg, Wittstock, Havelberg, Bergedorf bei Hamburg und Lübeck versandt 397 ). Der Getreidehandel ließ seit den siebziger Jahren ganz nach, was aus den Verhältnissen in der mecklenburgischen Landwirtschaft und der allgemeinen Einschränkung der Getreideausfuhr zu erklären ist. Vereinzelt wurden Gerste und Roggen nach Lübeck, Lüneburg und Wismar verkauft 398 ). Zur Förderung der Elbschiffahrt und zur Beförderung herzoglicher Güter nach Hamburg wurden 1559 zu Dömitz zwar noch ein großes und zwei kleine Schiffe gebaut 399 ). Im Jan. 1572 wurden noch einmal vier Schiffe gebaut 400 ). In Havelberg wurden in den sechsiger Jahren zwei Speicher für Korn, das nach Hamburg verschifft werden sollte, gemietet 401 ).
Nach dem Tode Herzog Johann Albrechts I. im Jahre 1576 scheinen die Handelsbeziehungen, wenigstens in bezug auf die Ausfuhr, nicht fortgesetzt zu sein, was einmal die Folge der schlechten finanziellen Lage Mecklenburgs war und sich zum andern aus der Tatsache erklärt, daß der mehr religiös gerichtete Herzog Ulrich und seine Nachfolger keine so starken handelspolitischen Interessen verfolgten.
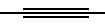


|
[ Seite 85 ] |




|



|



|
|
:
|
II.
Der Blievenstorfer Münzfund
von
Walter Josephi.
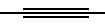


|
[ Seite 86 ] |




|


|
[ Seite 87 ] |




|
Anfang 1937 wurde zu Blievenstorf im Kreise Ludwigslust das als Büdnerei dienende alte Haus des Häuslers R. Schult abgerissen und darin dicht unter dem Fußbodenbelag eines Wohnraumes ein Topf aufgefunden, der beim Aufschlagen in Scherben ging. Er enthielt 251 meist recht gut erhaltene Silbermünzen, die beim Landesdenkmalpfleger für künstlerische und kunstgewerbliche Altertümer in Schwerin eingeliefert worden sind.
Bei diesem Münzfunde handelt es sich ausschließlich um Kleinmünzen (Talerstückelungen). Sie verteilen sich auf folgende Münzherren und Zeiten:
| Brandenburg-Preußen | 66 Stück. | ||
| Friedrich Wilhelm 1640 - 88: Unbestimmt (1), 1669 (1), 1683 (1), 1685 (1), 1687 (3), 1688 (3). | |||
| Friedrich III. (I.) 1688 - 1713: Unbestimmt (2), 1689 (3), 1690 (4), 1691 (5), 1692 (2), 1693 (15), 1699 (3), 1700 (1), 1701 (1), 1702 (2), 1703 (2), 1711 (1). | |||
| Friedrich Wilhelm I. 1713 -1740: Unbestimmt (2), 1716 (1), 1719 (2), 1720 (1), 1722 (1), 1724 (2), 1725 (1), 1735 (1), 1738 (2). | |||
| Brandenburg in Franken | 15 Stück. | ||
| Linie Bayreuth. Christian Ernst 1655 - 1712: 1696 (1), 1707 (1), 1708 (1), 1709 (2). | |||
| Georg Wilhelm 1712 - 1726: 1712 (1), 1723 (1), 1724 (1). | |||
| Linie Kulmbach. Georg Friedrich 1708 - 1735: 1728 (1), 1729 (1), 1730 (1). | |||
| Linie Ansbach. Johann Friedrich 1667 - 1686: Unbestimmt (2), 1678 (1), 1679 (1). | |||
| Braunschweig-Wolfenbüttel | 17 Stück. | ||
| Rudolf August und Anton Ulrich 1666 - 1704: Unbestimmt (1), 1693 (2), 1695 (1), 1696 (4), 1697 (2), 1701 (1), 1703 (1). | |||
| Anton Ulrich 1704 - 1714: 1705 (2), 1708 (2), 1710 (1), 1712 (1). | |||
| Haldenstein | 1 Stück. | ||
| Georg Philipp 1681 - 1693: 1690 (1) | |||


|
Seite 88 |




|
| Hoenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst | 1 Stück. | ||
| Ludwig Gustav 1688 - 1697: 1689 (1) | |||
| Jülich und Berg | 3 Stück. | ||
| Johann Wilhelm von Pfalz-Neuburg 1690 - 1716: 1710 (2), 1715 (1). Leiningen-Schaumburg 1 Stück. | |||
| Georg Wilhelm 1632 - 1695: 1691 (1) | |||
| Lippe-Detmold | 5 Stück. | ||
| Friedrich Adolf 1697 - 1718: 1713 (2), 1714 (1), 1715 (1). | |||
| Simon Heinrich Adolf 1718 - 1734: 1720 (1). | |||
| Pommern (schwedisch) | 5 Stück. | ||
| Karl XI. von Schweden 1660 - 1697: 1693 (3), 1694 (1), 1695 (1). | |||
| Sachsen (Kurfürstentum) | 58 Stück. | ||
| Johann Georg III. 1680 - 1691: 1691 (1). | |||
| Johann Georg IV. 1691 - 1694: 1692 (2), 1693 (6), 1694 (9). | |||
| Friedrich August I. 1694 - 1733: 1695 (4), 1696 (1), 1697 (2), 1698 (1), 1703 (4), 1704 (1), 1705 (2), 1707 (2), 1710 (2), 1711 (2), 1712 (1), 1713 (2), 1714 (1), 1716 (2), 1719 (1), 1721 (2), 1724 (3), 1725 (1), 1726 (2), 1727 (1), 1729 (1). | |||
| Friedrich August II. 1733 - 1763: 1736 (1), 1737 (1). | |||
| Sachsen-Hildburghausen | 4 Stück. | ||
| Ernst 1680 - 1715: 1715 (1). | |||
| Ernst Friedrich I. 1715 - 1724: 1717 (3). | |||
| Sachsen-Meiningen | 3 Stück. | ||
| Ernst Ludwig I. 1706 - 1724: 1714 (3). | |||
| Sayn-Wittgenstein-Hohenstein | 1 Stück. | ||
| Gustav 1657 - 1701 (1) | |||
| Schweden | 7 Stück. | ||
| Karl XI. 1660 - 1697: 1693 (1), 1694 (1). | |||
| Karl XII. 1697 - 1718: 1700 (1), 1706 (3), 1710 (1). | |||
| Waldeck | 2 Stück. | ||
| Karl 1728 - 1763: 1732 (2). | |||
| Bamberg | 2 Stück. | ||
| Peter Philipp von Dernbach 1672 - 1683: 1683 (1). | |||
| Marquard Seb. Schenk v. Stauffenberg 1683 - 1693: 1684 (1). | |||


|
Seite 89 |




|
| Hildesheim | 1 Stück. | ||
| Jost Edmund v. Brabeck 1688 - 1702: 1696 (1). | |||
| Köln | 1 Stück. | ||
| Joseph Clemens Herzog von Bayern 1688 - 1723: 1715 (1). | |||
| Münster | 43 Stück. | ||
| Friedrich Christian v. Plettenberg 1688 - 1706: 1695 (1). | |||
| Franz Arnold Frh. v. Metternich 1706 - 1718: 1709 (1), 1710 (4), 1711 (2), 1714 (14), 1715 (6), 1716 (3), 1717 (11), 1718 (1). | |||
| Osnabrück | 4 Stück. | ||
| Karl Herzog v. Lothringen 1698 - 1715: 1714 (1). | |||
| Ernst August Herzog v. Braunschweig-Lüneburg 1716 - 1728: 1721 (2), 1722 (1). | |||
| Padeborn | 7 Stück. | ||
| Franz Arnold Frh. v. Metternich 1704 - 1718: 1709 (1), 1713 (1), 1716 (1), 1718 (3). | |||
| Clemens August Herzog von Bayern 1719 - 1761: 1723 (1). | |||
| Verden | 1 Stück. | ||
| Karl XI. von Schweden 1660 -1697: 1691 (1). | |||
| Stadt Hildesheim 1622 (1), 1697 (1), | 2 Stück. | ||
| Stadt Mühlhausen 1703 (1) | 1 Stück. | ||
Wenn auch die leider bei Münzfunden so häufigen Veruntreuungen stets eine Fehlerquelle bergen, so kann doch hier auf Grund der eingelieferten Stücke festgestellt werten, daß die beiden preußischen Prägungen von 1738 die Leitmünzen für die Verbergungszeit darstellen. Da diese beiden Münzen auffällig frisch sind, werden Prägungsjahr und Verbergung nicht weit auseinander fallen.
An und für sich ist der Münzfund numismatisch bedeutungslos; er gewinnt aber dadurch ein hohes wirtschaftsgeschichtliches Interesse, daß er in jene lange seltsame Zeitspanne fällt, in der in Mecklenburg Münzprägungen fehlen. Die letzten datierten herzoglich-schwerinschen Prägungen stammten aus dem Jahre 1708, also noch aus der Regierungszeit des Herzogs Friedrich Wilhelm (1692 -1713). In den letzten fünf Jahren seiner Regierung sowie in der 34 Jahre währenden unruhvollen Regierung des Herzogs Karl Leopold (1713 - 1747) hat die Landesherrschaft keine Münze herausgebracht, und erst Herzog Christian II. Ludwig (1747 - 1756) richtet 1752 die


|
Seite 90 |




|
Schweriner Münzstätte mit einer dann allerdings recht starken Produktion ein 1 ).
Im Lande Strelitz liegen die Verhältnisse ähnlich. Auf dürftige Prägungen unter Herzog Adolf Friedrich II. vom Jahre 1703, denen aber wohl weniger eine wirtschaftliche als vielmehr eine staatsrechtliche Bedeutung zukommt, folgt ein Prägungsausfall bis zum Jahre 1745. Dieser Ausfall wird lediglich durch die Reformations-Jubiläumsmünzen von 1717 im Charakter von Denkmünzen unterbrochen.
Das gleiche ist bei Mecklenburgs Hansestädten festzustellen: auch sie hören im großen und ganzen am Ende des 17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts mit den Prägungen auf, um, abgesehen von wenigen Einzelausgaben, sich hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Kupfer-Prägungen zuzuwenden.
Vor um das Jahr 1738 vermutlich als Sparschatz verborgene Blievenstorfer Münzfund offenbart also die Mittel, mit denen sich der mecklenburgische Sparer gegen Schluß der einheimisch-münzenlosen Zeit auf diese wirtschaftliche Abnormität einzustellen wußte. Der Fund erweist, daß Mecklenburg nach mehr als drei Jahrzehnten ausfallender Münzproduktion entblößt von eigenen Münzen dastand, denn jener Bauer, der um 1738 seinen Sparschatz unter die Dielen seiner Stube barg, besaß keine einzige einheimische Münze: die übrigen deutschen Lande, selbst das Ausland, halfen für diese wichtigste wirtschaftliche Funktion, in der Mecklenburg versagte, aus.
Vor vom zuständigen Landrat angekaufte Blievenstorfer Münzfund wird dem Ludwigsluster Heimatmuseum zugeführt.
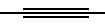


|
[ Seite 91 ] |




|



|



|
|
:
|
III.
Zur Entstehung der Medaille
von 1718
auf die
mecklenburgischen Landesunruhen
von
Walter Josephi
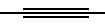


|
[ Seite 92 ] |




|


|
[ Seite 93 ] |




|

Die für die Münzgeschichte Mecklenburgs so unergiebige Regierungszeit des Herzogs Karl Leopold (1713 - 1747) hat der Nachwelt eine bemerkenswerte Medaille auf die Landesunruhen 1 ) geschenkt. Es ist dies die mehrfach als Gold-, Silber- und Bronzeprägung im Handel erschienene Bienenkorb-Medaille, von der das Staatliche Münzkabinett in Schwerin (Schloßmuseum) mehrere Stücke in Gold und Silber sowie einen Nachguß in Zinn besitzt:
| V. |
Über einer
Landschaft, aus der eine
Meineidigen-Schwurhand wächst,
fliegt ein Adler mit Blitzen in den
Krallen.
Umschrift: AD ARAS USQVE OBSEQVENS 
ACTOR. 4. V. 19 Im Abschnitt: NON PEIERASSE IUVABIT./ EXOD. 20. V. 7. &. 16./ 
|
|
| R. |
Ein
rauchender Bienenkorb, umgeben von
den ausgeräucherten Bienen, die
teils davonfliegen, teils auf der
Erde liegen.
Umschrift: FATIS CEDENTES MIGRATE COLONI  Ezech. 46. V.
18.
Ezech. 46. V.
18.
Im Abschnitt: DOMINICA MISERICORDIAS /DOMINI A  • 1718. / 1.
Petri 2. V. 23. /
• 1718. / 1.
Petri 2. V. 23. /

Randschrift:  LIEBER HAAB UND GUTH
VERLOHREN . ALS EIN FALSCHEN EYD GESCHWOHREN
LIEBER HAAB UND GUTH
VERLOHREN . ALS EIN FALSCHEN EYD GESCHWOHREN
|


|
Seite 94 |




|
Evers 2 ) erwähnt diese Medaille nur in goldenen und silbernen Exemplaren und fügt hinzu, sie sei "der Sage nach durch Veranlassung der Ritterschaft geprägt". Darüber hinaus hat die Augsburger Lokalforschung 3 ) festgestellt, daß ihr Schöpfer der Augsburger Medailleur und Stempelschneider Philipp Heinrich Müller 4 ) (geb. 2. 10. 1654 zu Augsburg, gest. 17. 1. 1719 zu Augsburg) gewesen ist.
Die schon dem Sinn der Umschriften nach wahrscheinliche "Sage" über die geistigen Schöpfer oder Veranlasser hat ihre Bestätigung durch einen neuerdings im Geheimen und Haupt-Archiv zu Schwerin aufgetauchten Zettel gefunden, der aufschlußgebende Vorschläge für die Randschrift dieser Medaille überliefert, und zwar abgefaßt vom Standpunkt der Verteidiger der ritterschaftlichen Rechte. Damit soll nun aber keineswegs behauptet werden, daß dieser Teil der Ritterschaft selbst damals in seiner Bedrängnis die Medaille habe prägen lassen; vielmehr ist bei ihrem häufigen Vorkommen anzunehmen, daß dem geschäftlich sehr begabten Augsburger Medailleur im Rahmen seiner zeitgeschichtlichen Emissionen die ja durch ganz Deutschland bekannten mecklenburgischen Wirren ein erwünschtes Thema waren. Soviel aber ergibt der Zettel mit Sicherheit, daß die Beschriftungsentwürfe in Mecklenburg erdacht sind und wohl erst in Augsburg in die für eine Medaille erforderliche knappe Form gebracht wurden.
Die der Medaille zugrunde liegenden historischen Tatsachen, von J. D. Köhler aus Zeitnähe unübersichtlich dargestellt, sind, kurz zusammengefaßt, die folgenden:
Das Jahr 1718 bedeutete für die mecklenburgischen Landeswirren den Höhepunkt: auf der einen Seite stand Herzog Karl Leopold, der bei seinen Bestrebungen, den fürstlichen Absolutismus durchzusetzen, nicht nur die günstigere Stelle des Angreifers einnahm, sondern auch über greifbare Machtmittel verfügte; auf der anderen Seite scharte sich die für ihre im Laufe der Zeit erworbenen oder auch durch die früheren


|
Seite 95 |




|
Landesherren verbrieften Gerechtsame kämpfende Ritterschaft, die nur über papierene Verteidigungswaffen verfügte und als Machtmittel einzig und allein auf das weit entfernte und dazu noch langsam arbeitende Reichsregiment in Wien angewiesen war, um den Engeren Ausschuß des landständischen Landtages. Dieser Engere Ausschuß als geschäftsführendes Organ des Landtages war ins Ausland geflüchtet und hatte sich in dem unter der Herrschaft des englischen Königs stehenden hannöverschen Ratzeburg konstituiert. Naturgemäß mußte sich gegen diesen Engeren Ausschuß in Ratzeburg als Mittelpunkt der geflüchteten und der inländischen opponierenden Ritterschaft der Hauptangriff des Herzogs richten, und da Versuche einer Lahmlegung beim König Georg 1. von Großbritannien fehlschlugen, so erklärte der Herzog sie als Rebellen und zog ihre Güter ein 5 ). Weiter legte er den einzelnen im Lande verbliebenen Rittern auf ihren Gütern durch herzogliche Kommissare einen Eid zur Unterschrift vor, um die Maßnahmen des Engeren Ausschusses zu Ratzeburg wirkungslos zu machen.
Dieser Eid, der das Thema der Medaille bildet, lautete 6 ):
Ich schwere zu Gott einen cörperlichen Eyd, daß ich an den boßhaften, zu einer öffentlichen Rebellion abziehlenden Schriften und Unternehmungen, welche die in Ratzeburg sich aufhaltende Mecklenburgische so genandte Land-Räthe und Deputirte zum Engeren Ausschuß, heim- und öffentlich heraus gegeben und verübet haben, kein Theil nehme, noch zu nehmen gedenke; sondern daß ich denen Reichs Grund-Gesetzen gemäß mich jedesmahl als ein treuer und gehorsamer Vasall und Unterthan gegen meinen angebohrnen Landes-Fürsten und Herrn unterthänigst bezeigen und aufführen wil; So wahr mir GOtt helffe, durch JEsum Cristum, Amen."
Die Güter der nicht Unterschreibenden wurden vom Herzoge in Verwaltung genommen, die Grundbesitzer mußten flüchten.
So standen die Dinge, als der Herzog zum 21. Juni 1718 nach Sternberg einen Landtag einberief und diesem erklärte,


|
Seite 96 |




|
der Engere Ausschuß zu Ratzeburg mißbrauche sein Siegel, weshalb dem Landtage ein neues, leicht verändertes Siegel übergeben werde. (Franck S. 132.) Der Landtag, meistens aus Rittern bestehend, welche den eidlichen Revers unterzeichnet hatten, verschanzte sich in dieser peinlichen Lage hinter Einsprüche, Vorbehalte u. dergl., voll bewußt, daß er mit der Kassierung des alten Siegels den Ratzeburger Standesgenossen den Rechtsboden abgrabe. Allein unter stärkstem landesherrlichen Druck kam endlich die vorbehaltlose Annahme zustande, und so siegelte am 28. Juni 1718 der Sternberger Landtag zum ersten Male mit dem neuen Siegel. (Franck S. 137.)
Der Kern der Sache ist also, daß die Ritterschaft des Sternberger Landtages dem schwer kämpfenden Engeren Ausschuß zu Ratzeburg und den sich um diesen scharenden landflüchtigen Rittern in den Rücken fiel und daher von Ratzeburg als meineidig und eidbrüchig angesehen wurde.
Erst zu Beginn des folgenden Jahres trat eine Klärung der Verhältnisse ein, indem als erste Auswirkung der nunmehr in Mecklenburg einrückenden Exekutionstruppen Herzog Karl Leopold unter dem 27. Februar 1719 ein Patent ergehen ließ, wonach die geflüchteten Ritter zurückkehren und ihre Güter wieder in Besitz nehmen möchten 7 ).
Das Einzelblatt des Geheimen und Haupt-Archivs zu Schwerin, das in neuerer Schrift mit der Zahl 1718 versehen ist, also wohl einem Aktenfaszikel des Jahres 1718 entnommen wurde, schildert die Darstellungen der Vorder- und der Rückseite der Medaille völlig richtig, gibt ebenso zutreffend die Umschrift und Abschnittschrift der Vorderseite an, während es bei der Rückseite zu den Worten
abweicht und damit offenbart, daß es sich nicht um die Beschreibung einer vorhandenen Medaille, sondern erst um Entwürfe handelt.
Wenn nun auf diesem Zettel die Angaben für die Randschrift fehlen, dafür aber eine Reihe von Vierzeilern folgen, in deren einem wir den Kern der Randschrift finden, so ist klar, daß hierin Ideen-Entwürfe für die Randschrift zu sehen sind.


|
Seite 97 |




|
| Vers 1. | |
|
Ein arbeitsames Volk muß
viele Drangsal leiden
Und seinen Honigfeim durch Qualm und Schwefel meiden. Doch lieber ist es ihm, daß Haus und Hof verloren, Wenn nur die Freiheit bleibt, kein falscher Eid geschworen. |
Ein Vergleich mit der Randschrift der Medaille zeigt, daß der zweite Teil dieses Verses die für die Ausführung gewählte Randschrift enthält.
| Vers 2. | |
| Auf die tot herunter fallenden und die in Freiheit mit Hinterlassung des Honigs wegfliegenden Bienen. | |
|
Die Nachwelt lobet mehr
in freier Luft gerückt,
Als um das Zeitliche in Qualm und Rauch erstickt. Die Freiheit lieb' ich mehr, entflieh in fremde Lande, Du aber strebst zu Haus in Schmauch und Knechtschafts Bande. |
| Vers 3. | |
| Auf die, so noch balanciren zu revociren. | |
|
Kehr um, kehr um, mein
Sohn, bereue deine Sünden,
Noch ist es Gnadenfrist, Vergebung ist zu finden. Wer diese Zeit verschläft, nicht seine Sünd erkennt, Der muß zur linken Hand und bleibt von uns getrennt. |
| Vers 4. | |
| Auf die, so das neue Landsiegel auf dem sogenannten Landtag angenommen. | |
|
Wohin, verwegne Schaar?
Wo sind der Väter Sitten?
Gibst du die Freiheit weg, die du doch nicht erstritten? Bedenke, was man wird von deiner Ehre sagen, Wenn, der von dir stammt her, wird diese Tat beklagen. |
| Vers 5. | |
| Auf die von guten Vorfahren böse Posterität. | |
|
Das alte Sprichwort
heißt: die Frucht fällt nah beim
Stamm.
Von tapfrer Löwen Art fällt nie ein furchtsam Lamm. Wie bist du denn so weit von deinem Stamm verschlagen, Hat dich vielleicht ein Rab von ihm dahingetragen? |


|
Seite 98 |




|
| Vers 6. | |
| An die in der Bosheit Verharrenden. | |
|
Wenn nun der Bräutigam
kommt, wie werdet ihr bestehen,
Er findet die Lampen leer und euch im Tunkeln gehen. Dann ist die Reu zu spät, wenn euch Verzweiflung quält. Ihr Narren habt diesmal des rechten Wegs verfehlt. |
| Vers 7. | |
| An die, welche ohne Wiederkehr die Andern Rebellen genennet. | |
|
Ihr bleibt in
Bauernpflicht und wir in Freiheit
stehen,
Bis Himmel, Erd und Meer, ja alles muß vergehen. Der Türken Fried ist da, der Spanier Flott' getrennet. Ihr Andern spiegelt euch, wenn Gott vom Kaiser spricht. So ist zu nichte bald der bösen Tat Gericht. |
Aus diesen Versen geht klar hervor, daß der Gedanke der Medaille aus den Kreisen der um den Ratzeburger Engeren Ausschuß sich scharenden Ritterschaft stammt und sich nur mittelbar gegen den Herzog, unmittelbar aber gegen die Mitglieder des Sternberger Landtages wendet. Man nennt die, welche den Revers unterzeichneten, Eidbrüchige. Ganz besonders wichtig ist der Vers 4, denn er ermöglicht die genaue zeitliche Ansetzung der Medaille: Sie muß, da sie das Datum 1718 trägt, in der Zeit nach dem 28. Juni entstanden sein. Für eine Fertigung nach 1718 gibt es keinen Grund, da ja bereits am 27. Februar 1719 das herzogliche Patent die Ursache aller dieser Aufregungen beseitigte, wie ja auch der Tod des Medailleurs bereits zu Anfang 1719 erfolgte.
Das Blatt mit diesen Vers-Entwürfen hat durchaus den Charakter einer Abschrift; man hat den Eindruck, es sei hintenrum dem Herzog eingereicht worden. Daß daraufhin der Herzog solidarisch mit dem Sternberger Landtage, zu einen Gegenhieb ansetzte, zeigt ein zweites Blatt, das den Entwurf einer Medaille im Sinne der herzoglichen Politik bringt, wobei bemerkenswert ist, daß dies Blatt mehrfach Korrekturen in anderer Tinte aufweist. Es hat die Überschrift: "Invencions auf Medaillen" und bringt Ideen-Entwürfe für zwei Medaillen, die anscheinend nicht ausgeführt wurden.
| V. | Eine Krone von königlichem alten Herkommen der Mecklenb. Wenden, so auf einem Postament stehet, auf welchem |


|
Seite 99 |




|
|
der
Büffelskopf stehet. Die Krone wird
gehalten von einer Hand, die sich
aus den Wolken strecket. Mit dieser
Überschrift:
Ich stärke dich durch die Hand meiner Gerechtigkeit. Bei dem Postament stehen etzliche ansehnliche Menschen, welche trachten, die Krone herunter zu stoßen. Mit dieser Beischrift: Es ist umsonst, daß ihr frühe aufstehet Und so nach dieser Krone gehet. |
||
| R. |
Auf der
andern Seite dieser Medaille kommt
Jupiter aus den Wolken, welcher mit
seinen Donnerkeilen die
übermächtigen Riesen zerschmettert.
Mit dieser Überschrift:
Dieser großen Heiden Pochen Muß nicht bleiben ungerochen. |
| Die erste Seite präsentiert eine fürstliche Person sitzend. | Auf der ändern Seite stehen 3 Personen mit bloßen Degens in der Hand haltend bei einander als verschworen stehend. |
| Ein Knecht soll Ich allein | Bei diesem Volke sein. |
| Ich bin es nur allein, der nicht als Fürst von seinem Land soll sein. |
Was wir
beschließen, da solls bleiben
bei
Obs gleich Gott und dem Recht schnurstracks zuwider sei. |
Zur Vollständigkeit sei hinzugefügt, daß es außer der Schwurhand-Medaille noch eine weitere Medaille auf die Landesunruhen unter Herzog Karl Leopold gibt; es ist dies das bei Evers (S. 178,1) als in Gold angeführte Stück, das er nach seiner eigenen Angabe nicht selbst gesehen hat, das aber während der Kriegsjahre für das damalige Großherzogliche Münzkabinett in Schwerin in Silberprägung erworben werden konnte:
| V. | In 8 Zeilen: Ihr / Graffen Herrn / und Edelleut / Suchet eure alte / Freiheit / Drüben auff / dern andern / Seit. | |
| R. |
Ein
blätterloser Baum.
Umschrift: Hyr hefft eine Ule setten. Dm: 24 mm; Gew: 3,1 Gr. |


|
Seite 100 |




|
Von dieser Medaille muß es noch eine Variante geben; denn im Geheimen und Haupt-Archiv zu Schwerin findet sich in dem die Medaillen des Herzogs Karl Leopold betreffenden Faszikel ein Akt mit einer anscheinend dem 18. Jahrhundert entstammenden Aufschrift:
Auf der einen Seite stund eine Taffel mit Personen besetzet, darüber stehet:
Ihr Ritter, Frie-Herrn und Edel-Leut
Seht ju Privilegie auff der andern Seit.
Auf der anderen Seite stehet ein abgestutzter Baum mit der Überschrift:
Mar hier heft ein Eul geseten
Der heft in juge Frieheit etc.
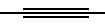


|
[ Seite 101 ] |




|



|



|
|
:
|
IV.
Wismars Schwedische Regimenter
im
Nordischen Kriege
von
Georg Tessin.
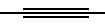


|
[ Seite 102 ] |




|


|
[ Seite 103 ] |




|
Die Stadt Wismar war im Westfälischen Frieden mit der Insel Poel und dem Amt Neukloster an Schweden abgetreten worden. Sie ist bis 1803 schwedisch geblieben und wurde dann erst von Mecklenburg zunächst als Pfandbesitz zurückgekauft. Ihre größte Bedeutung für Schweden hatte sie während des Nordischen Krieges. Schweden besaß zu Beginn dieses Krieges ja nicht nur Vorpommern mit Stettin und Stralsund, sondern auch das frühere Erzbistum und spätere Herzogtum Bremen mit der starken Festung Stade und das Fürstentum Verden. So lag die Bedeutung Wismars als schwedische Festung darin, zwischen Pommern und Bremen eine gesicherte Verbindung zu schaffen. Die Bedeutung der Stadt als Festung erlosch, als nach dem Nordischen Kriege Bremen und Verden an Hannover verloren gingen. Die Festung war nach der Einnahme durch die verbündeten Hannoveraner, Dänen und Preußen geschleift worden und wurde nicht wieder aufgebaut, aber noch heute erinnern die Namen früherer Befestungsanlagen an Wismars große Schwedenzeit im Nordischen Kriege, als die Stadt erst nach tapferer 10monatiger Verteidigung am 19. April 1716 kapitulierte. Sie hatte sich von allen deutschen Festungen Schwedens am längsten gehalten.
Über die Blockade Wismars 1711/12 und die Belagerung in den Jahren 1715/16 unterrichtet ausgezeichnet das vom dänischen Generalstab seit 1899 herausgegebene Werk "Bidrag til den Store Nordiske Krigs Historie", besonders Band 3: "Felttogene i Nordtyskland og Baahuslen i Östersöen og Kattegatt 1710 -1712", Kopenhagen 1906 und Band 7: "Erobringen af Sverigs Tyske Provinser, 1715 -1716", Kopenhagen 1922 1 ). Seitdem ist aber im Geh. und Hauptarchiv


|
Seite 104 |




|
zu Schwerin ein Bestand gefunden worden, der geeignet ist, diese Angaben nach mancher Richtung hin zu ergänzen. Unter den abgegebenen Akten des Domanialamtes Wismar befinden sich nämlich die Akten der früheren schwedischen Rentkammer in Wismar, die gerade aus der Zeit des Nordischen Krieges recht umfangreich sind. Sie enthalten fast Jahr für Jahr die Musterrollen der Regimenter der wismarschen Garnison neben vielen Nachrichten, die sich auf Verproviantierung und Ausrüstung der Festung beziehen. Den Regimentern Schwedens, die während des Krieges Wismar verteidigten, ist der nach folgende Aufsatz gewidmet. Denn es dürfte auch für die Mecklenburger nicht uninteressant sein, welche Regimenter damals in Wismar standen. Die deutschen Regimenter der Garnison Wismar waren zum nicht geringen Teil aus Mecklenburgern geworben.
Kriegsgeschichte Wismars
im Nordischen Kriege
Zur besseren Übersicht sei der Geschichte der schwedischen Regimenter eine kurze Übersicht der Ereignisse des Nordischen Krieges vorangestellt, an denen Wismar mittelbar oder unmittelbar beteiligt war. In Schweden war im Jahr 1697 Karl XII. im jugendlichen Alter von 15 Jahren zur Regierung gekommen. Diese Gelegenheit wollten die benachbarten Staaten ausnutzen, um Schweden aus der gewaltigen Machtstellung zu verdrängen, die es seit dem Dreißigjährigen Kriege in allen Randstaaten der Ostsee innehatte. Friedrich IV. von Dänemark strebte nach dem Gottorper Teil Schleswigs, den Karls Schwager und Freund, der junge Herzog Friedrich, besaß, und nach schonen, das früher dänisch gewesen war. Peter der Große von Rußland wollte sein Reich bis an die Ostsee ausdehnen und mußte dazu Ingermanland erobern, das schwedisch war. Der sächsische Kurfürst Friedrich August I. war gleichzeitig König von Polen und dachte daran, Livland mit seiner Hauptstadt Riga zu erobern. Diesen drei Mächten stand die schwedische Großmacht gegenüber mit einem seit Jahrzehnten geschulten Heer und unter einem König, der gleichzeitig entschlossener Feldherr war. Im Jahre 1699 kam es zum förmlichen Bündnis zwischen den drei Mächten. Dem Angriff der


|
Seite 105 |




|
Dänen auf Holstein-Gottorp begegnete Karl XII. im Mai 1700 durch einen Einmarsch seiner deutschen Regimenter in Südholstein, durch eine Landung auf Seeland und Bedrohung der Hauptstadt Kopenhagen. Am 18. August mußte der dänische König Frieden schließen. Die Russen wurden wenige Monate darauf, am 21. November 1700, in der Schlacht bei Narwa entscheidend geschlagen. Dann wandte sich Karl XII. mit seinen schwedischen Kerntruppen, Regimentern aus dem Baltenlande und einem aus den deutschen Provinzen herangezogenen Korps gegen Polen. Bei Klissow wurde das polnisch-sächsische Heer im Juli 1702 geschlagen. 1706 konnte Karl XII. in Sachsen selber einmarschieren und seinen Truppen dort Winterquartiere anweisen. Der in Alt-Ranstädt geschlossene Friede wurde jedoch nicht gehalten. Karl XII. wandte sich gegen Rußland und trat den berühmten Marsch in die Ukraine an, aber bei Pultawa wurde am 8. Juli 1709 die schwedische Armee von Peter dem Großen entscheidend geschlagen. Karl flüchtete in die Türkei und versuchte fünf Jahre, die Türken zu einem Krieg gegen Rußland zu bewegen. Die Zeit seiner Abwesenheit benutzten die Dänen 1709 zum Angriff auf schonen. Sie wurden aber schon am 10. März nächsten Jahres von den in aller Eile aufgestellten schwedischen Regimentern unter Steenbock in der Schlacht bei Helsingborg geschlagen und vom schwedischen Boden vertrieben. Ein weiterer Angriff auf Schweden im nächsten Jahre konnte nur von Seeland ausgehen. Dort aber herrschte die Pest, und eine Kriegführung war unmöglich. So entschlossen sich die Feinde Schwedens zum Angriff auf die deutschen Besitzungen. Stettin und Stralsund wurden belagert, Wismar zunächst nur blockiert. Ein Erfolg war dem großen verbündeten Heer nicht beschieden. Dagegen gelang es den Dänen am 7. September 1712 mit der Festung Stade das Herzogtum Bremen zu erobern, Peter der Große hatte inzwischen die schwedischen Festungen im Baltenlande, Riga, Reval, Kexholm und Wiborg, erobert und sich jetzt auch mit Teilen seiner Armee nach Deutschland gewandt. Noch einmal brachte Schweden es nach der Niederlage bei Poltawa fertig, unter rücksichtsloser Ausnutzung aller vorhandenen Kräfte eine neue Armee aufzustellen, die unter dem Sieger von Helsinborg, dem General Steenbock, im September 1712 auf Rügen landete. Am 20. Dezember 1712 schlug Stenbock auf mecklenburgischem Boden bei Gadebusch die isolierte dänische Armee, bevor die Sachsen und Russen herangekommen waren.


|
Seite 106 |




|
Auf dem Weitermarsch nach Holstein wurde er aber selbst bei Tönning eingeschlossen und mußte im Mai kapitulieren. Am 29. September 1713 wurde das belagerte Stettin von dem Kommandanten an Preußen und Gottorp als neutrale Mächte überlassen. Zum erneuten Kampf kam es wieder, als Karl XII, von der Türkei aus am 22. November 1714 heimlich in der Nacht in Stralsund ankam. Er dachte an keinen Frieden. Jetzt schlossen sich auch Preußen und Hannover dem gegen Schweden gerichteten Bündnis an, und die beiden noch gebliebenen Festungen Wismar und Stralsund wurden erneut belagert. Die Macht der Verbündeten war zu groß. Am 23. Dezember 1715 mußte Stralsund kapitulieren, am 19. April 1716 kapitulierte endlich auch Wismar. Die weiteren Kämpfe des Nordischen Krieges spielten sich in Schweden und Finnland, aber nicht mehr auf deutschem Boden ab.
Wismar wurde in den Nordischen Krieg zunächst 1700 hineingezogen. Die Stadt und die Randgebiete von Poel und Neukloster bildeten im Frühjahr dieses Jahres die Aufmarschbasis für das zum Einmarsch nach Holstein bestimmte schwedische Korps.
Während des Feldzuges von 1711/12 wurde die Festung zunächst nur von einem dänischen Einschließungskorps unter Generalleutnant Schönfeld seit dem 17. August 1711 zerniert, ohne daß dieses Korps wirklich in der Lage gewesen wäre, die Blockade der Festung durchzuführen. Noch weniger war dies möglich, als seit dem 1. Oktober Generalleutnant Rantzau das Kommando der Einschließungstruppen übernahm und diese fast nur noch aus Reiterei bestanden. Am 5. Dezember 1711 griff der Verteidiger der Festung, Generalmajor Schoultz sogar mit seinen sämtlichen vorhandenen Kräften das dänische Lager bei Lübow an. Dieser Angriff wurde zum Verhängnis. Die Dänen sammelten sich schneller als gedacht, und der Rückzug der Festungsbesatzung artete zur regellosen Flucht aus. Nur die Bassewitzschen Dragoner und 87 Infanteristen entkamen in die Stadt, den übrigen wurde der Rückweg abgeschnitten. 478 Gefallene und über 2000 Gefangene waren der Verlust der Besatzung, die mit den verbleibenden nur 450 diensttauglichen Mannschaften nicht einmal die wichtigsten Werke besetzen konnte. Da die Feinde aber nur über Reiterei verfügten, konnte die Festung trotzdem nicht genommen werden. Auch ein Bombardement von Wismar, das


|
Seite 107 |




|
vom 29. Dezember bis zum 2. Januar dauerte, blieb ohne Wirkung. Es konnte wegen Munitionsmangels am nächsten Tage nicht fortgesetzt werden, Auch fehlte es an Infanterie, die Breschen zu stürmen. Dazu erhielt die Festung in diesen Tagen Verstärkung durch das von See zugeführte schwedische Regiment Croneberg. Als am 19. Januar 1712 die dänische Armee, nach Aufgabe der Belagerung von Stralsund, südlich von Wismar nach Holstein zurückmarschierte, schloß sich das Rantzausche Korps ihr an.
Erneut wurde Wismar am 14. Juli 1712 von Rantzau eingeschlossen, aber mit noch geringerem Erfolg als im Vorjahre. Die schwedischen Dragoner konnten in die blockierte Festung ein- und ausreiten. Vor der anmarschierenden Armee Stenbocks ging Rantzau mit seinem kleinen Korps am 7. November nach Holstein zurück.
Die härteste Belagerung machte Wismar in den Jahren 1716/16 durch. Am 26. Juni 1715 wurde die Festung von einem dänischen Korps von 14 Eskadronen, 4 Bataillonen unter Generalleutnant Leegard eingeschlossen. Hierzu kamen 12 Eskadronen, 2 Bataillone Preußen unter Generalmajor von der Albe und im Oktober noch 6 Eskadronen, 2 Bataillone Hannoveraner unter Generalmajor Pentz. Diesmal war die Einschließung vollständig. Am 13. November muß Generalmajor Schoultz auch die bisher noch besetzte Insel Poel räumen lassen. Noch einmal gelang es den Schweden am 29. Dezember, ein Regiment Infanterie (Skaraborg), das ursprünglich für Stralsund bestimmt war, auf dem Seewege in die Festung zu werfen und größere Mengen Verpflegung zu landen. Dann aber wurde die Hungerblockade immer härter. Den Oberbefehl über das Einschließungskorps hatte nach dem Falle von Stralsund der dänische General Dewitz übernommen. Als am 10. April 1716 die Wismarsche Bucht durch eine von Ufer zu Ufer reichende Palisadenreihe mit dazwischen verankerten Flößen gesperrt und auch die Verbindung zu der kleinen Festung Walfisch unterbrochen war, war das Schicksal Wismars besiegelt. Am 19. April kapitulierte Schoultz nach tapferer Verteidigung. Für 89 Offiziere und 1000 Nationalschweden der Besatzung wurde freier Abzug nach Schweden bewilligt, der Rest der Besatzung wurde gefangen.


|
Seite 108 |




|
Infanterie.
A. Eingeteilte Regimenter.
Die schwedische Armee des Nordischen Krieges setzte sich aus zwei verschiedenen Gruppen zusammen. Es gab wie überall in der damaligen Zeit geworbene Regimenter. Den Kern des Heeres bildeten aber die eingeteilten Regimenter. Durch das Einteilungswerk unterschied sich Schwedens Armee stark von den Staaten des übrigen Europa. Es war auf diese Weise gelungen, eine nationale schwedische Armee zu schaffen, die von den Zufällen der Werbung und der häufigen Unzuverlässigkeit geworbener Regimenter frei war. Zwar gab es auch in anderen Staaten um die Wende des 16. zum 17. Jahrhundert vereinzelt Milizregimenter oder Landesausnahmsbataillone. Die Kriegstüchtigkeit dieser Truppen war jedoch sehr gering. Sie sollten dort, wo sie aufgestellt waren, im wesentlichen zur Verteidigung der engeren Heimat dienen und kamen für Verwendung im Felde nicht in Frage. Praktisch kam es aber bei all den deutschen Staaten, die diese Einrichtung hatten, meist darauf hinaus, daß die besten Mannschaften dieser Miliz, ohne viel zu fragen, unter die aktiven geworbenen Regimenter gesteckt wurden, wenn diese Bedarf an Rekruten hatten. Die Folge war, daß auch die Rekrutierung der Milizregimenter z. B. in Mecklenburg recht schwierig war und ihre Zuverlässigkeit sehr gering. Die einzelnen Domanialämter (der Bereich der Ritterschaft kam schon gar nicht in Frage) mußten bei dieser Gelegenheit, wenn ihnen die Stellung von Mannschaften für die Landmiliz befohlen war, Taugenichtse und Landstreicher los zu werden. So ist in den deutschen Staaten der Versuch, durch Aufstellung von Landmiliz das Heer zu verstärken, durchweg gescheitert, und man ging wieder zum System der geworbenen Regimenter über.
Im Gegensatz hierzu gehörten die eingeteilten Regimenter Schwedens zu den besten und zuverlässigsten Truppen der schwedischen Armee 2 ). In Schweden waren die Reste der altgermanischen allgemeinen Wehrpflicht, die auf


|
Seite 109 |




|
dem ganzen Bauernstand lag, lange erhalten geblieben. Die Könige hatten früher mit Zustimmung der Stände und dann nach Durchführung der Souveränität ohne sie das Recht gehabt, durch Ausschreibung nach Bevölkerungs- oder Hofzahl nationale Regimenter zu bilden. Diese Ausschreibung wurde im immer höheren Grade im Bauernstand unpopulär. Die Adelsgüter wurden frei und die Bürde für die Bauern der Krone immer drückender. So begannen die einzelnen Provinzen des Reiches diese Last, die die Aushebung mit sich brachte, abzulösen, indem sie sich verpflichteten, eine bestimmte Anzahl von Mannschaften ständig bereit zu halten. Auf diese Weise kam es zur Bildung der ersten stehenden Regimenter. Karl XI. setzte es nach manchen Widerständen durch, daß einmal die Bauern des Adels in gleicher Weise wie die Bauern der Krone von der Ausschreibung betroffen wurden, und dann wurde festgesetzt, daß der König diese Ausschreibung im Kriege ohne Zustimmung der Stände durchführen konnte. Unter diesen Umständen gingen immer mehr Landschaften dazu über, mit dem König bestimmte Verträge abzuschließen, die man "Knechthaltungskontrakte" nannte. Bis zum Tode Karl XI. 1697 hatten alle schwedischen und finnischen Landschaften, mit Ausnahme von Österbotten, derartige Verträge abgeschlossen.
Die ganze Einrichtung erhielt den Namen Rotering, denn das Land wurde in Roter eingeteilt, d. h. in Gebiete, die eine Anzahl von Bauerngütern zusammenfaßten. Diese Gebiete mußten in Gemeinschaft einen Knecht, d. h. einen Infanteristen werben, erhalten und bekleiden. Die einzelnen auf diese Weise geworbenen Landsknechte erhielten ein "torp", d. h. eine Kate mit Gartenland. Bewaffnung und Löhnung im Falle der Einberufung bezahlte die Krone. Die Kriegstüchtigkeit wurde dauernd geprüft und Befehlshaber für die einzelnen Kompanien schon im Frieden bestellt.
Jede Landschaft und bei größeren Landschaften jedes Lehn stellte auf diese Weise ein Regiment, das ihren Namen trug. Ebenso erhielten die Kompanien den Namen ihres Distrikts. Im ganzen wurden auf diese Weise 14 schwedische und 7 finnische eingeteilte Regimenter unterhalten. Die normale Regimentsstärke an Mannschaften betrug 1200 Mann, die in Friedenszeiten in 8 Kompanien eingeteilt waren. Nur die drei smaländischen Regimenter hatten 1100 Mann zu 8 Kompanien und das Regiment Nerike-Wermland 1674 Mann zu 10


|
Seite 110 |




|
Kompanien. Auch die finnischen Regimenter wichen etwas von der Regel ab. Mit Ausnahme der Regimenter Upland, Westerbotten und Calmar-Lehn kamen die 14 schwedischen eingeteilten Regimenter ganz oder teilweise während des Nordischen Krieges in Wismar zur Verwendung.
Im Kriege erwies sich die Zahl der Offiziere als zu gering. Im Juni 1700 wurden daher bei allen im Ausland verwandten Regimentern die Zahl der Kompanien auf 12 erhöht, ohne daß die Anzahl der Mannschaften vermehrt wurde. Eine Vermehrung erhielt vielmehr nur die Primaplana, d. h. die auf der ersten Seite der Musterrolle verzeichneten Offiziere, Unteroffiziere und Spielleute. Die Mannschaften des gleichen Gebietes standen in den einzelnen Korporalschaften zusammen. Fiel ein Mann im Felde durch Tod oder Desertion (die bei den schwedischen Regimentern sehr selten vorkam) aus, so blieb sein Platz in der Musterrolle und in der Korporalschaft solange offen (vakant), bis aus der Heimat von seinem Stellungsbezirk (Rote) ein Ersatzmann gestellt war.
Obwohl diese Verträge zwischen Krone und Landschaften über die Einführung des Rotering gerade die willkürliche Aushebung ausschließen sollten, kam es schon im ersten Kriegsjahre zur Aufstellung weiterer Regimenter. Der König befahl, daß je 3 Stellungsbezirke sich zusammentun und gemeinsam einen weiteren Mann stellen sollten. Die so ausgeschriebenen Truppen erhielten den Namen Tremänningar (Drei-Männer-Regimenter). 1702 wurden dann noch Fyrmänningar (Vier-Männer-Regimenter) und Femmänningar (Fünf-Männer-Regimenter) auf die gleiche Weise aufgeboten, indem in den Gebieten, in denen die eingeteilten Regimenter zu Hause geblieben waren, von je 4 und in den übrigen von je 5 Stellungsbezirken ein weiterer Mann gestellt werden mußte. Diese Regimenter fanden jedoch im wesentlichen in Schweden Verwendung, an der Verteidigung Wismars war keins beteiligt.
Nach der damals üblichen Weise waren die höheren Offiziere des Regiments (Oberst, Oberstleutnant, Major) gleichzeitig die Chefs der ersten 3 Kompanien und wurden bei diesen geführt. Zum Unterstab des Regiments gehörten dagegen der Regimentsquartiermeister, der Regimentsauditeur und der Regimentsschreiber, ferner 1 Regimentspriester, 2 Bataillonspriester, der Regimentsfeldscher mit 3 Gesellen,


|
Seite 111 |




|
der Regimentsweibel oder, wie er später hieß, Regimentsprofoß mit 3 gemeinen Profossen. Die Regimentsmusik bestand aus 4 Hautboisten (1 Dulsianbläser und 3 Schalmeibläsern). Der Regimentsquartiermeister hatte gleichzeitig häufig die Adjutantengeschäfte zu versehen, der Regimentsauditeur war Gerichtsherr des Regiments, der Feldscher besorgte mit seinen Feldschergesellen die kranken und Verwundeten, der Regimentsweibel und seine Gesellen hatten außer dem Vollzug von Strafen auch die Gefangenen zu bewachen und die Aufsicht über den Troß. Der vollständige Unterstab eines schwedischen Regiments bestand also aus 18 Köpfen. Bei Beginn des Krieges war er bei einigen Regimentern etwas schwächer, da noch nicht alle Stabspersonen ernannt waren.
Die Primaplana einer Kompanie bezeichnet die Offiziere und Unteroffiziere, die in den Musterrollen auf dem ersten Blatt (prima plana) geführt wurden. An Offizieren hatte die Kompanie den Kapitän oder Kompaniechef, den Leutnant und den Fähnrich. Die 6 Unteroffiziere waren Feldwebel, Sergeant, Musterschreiber, Führer, Fourier und Rüstmeister. Der Musterschreiber hatte die gesamten schriftlichen Geschäfte der Kompanie zu erledigen und vor allen Dingen die Musterrolle genau zu führen, monatlich zu vergleichen und den Musterkommissaren vorzulegen. Der Führer hatte die Aufsicht über die Kompaniebagage, der Fourier hatte für die Verpflegung zu sorgen und dem Rüstmeister lag die Sorge für die Waffen ob. Außerdem zählten zur Primaplana einer Kompanie die Spielleute (2 Trommler und 1 Pfeifer). Die Primaplana betrug also bei jeder Kompanie 12 Köpfe. Nur die 1700 aufgestellten 4 Verdoppelungskompanien hatten 11 Mann Primaplana, da der Pfeifer fehlte.
Zu den Mannschaften zählten auch die Korporale, deren jede Kompanie 6 hatte. Die Kompanie war entsprechend in 6 Korporalschaften eingeteilt. Bei Ausbruch des Nordischen Krieges bestanden die beiden ersten Korporalschaften noch aus Pikenieren, die mit langen Piken ausgerüstet waren, und die übrigen 4 Korporalschaften aus Musketieren. Die Ausrüstung mit Piken fiel bei den Garnisonregimentern weg, die nur Musketiere hatten. Die Aufstellung der Kompanie erfolgte in Rotten zu 6 Gliedern.
Der planmäßige Stand der eingeteilten schwedischen Regimenter betrug also 18 Köpfe Stab und 8 Kompanien zu 12 Mann Primaplana und 150 Mann, also 1314 Köpfe. Nur die


|
Seite 112 |




|
3 smaländischen Regimenter hatten 8 Kompanien zu 12 Mann Primaplana und 138 Mann, mit Regimentsstab also 1218 Köpfe. Bei Aufstellung der 4 Verdoppelungskompanien bei jedem Feldregiment im Sommer 1700 wurde nur die Primaplana vermehrt. Der Bestand blieb sonst unverändert. Das Regiment zählte jetzt 18 Köpfe Stab und 12 Kompanien zu 12 Mann Primaplana, also 100 Korporale und Mannschaften, also zusammen 1362 Köpfe. Die smaländischen Regimenter hatten nur 11 - 12 Mann Primaplana und 91 - 92 Mann und dadurch 1258 Köpfe. Die Regimenter in Schweden blieben auf dem Friedensstand von 8 Kompanien, und auch die nach der Schlacht bei Pultawa dort wieder aufgestellten Regimenter erhielten wieder die Stärke von 1311 oder 1258 Köpfen in 8 Kompanien. Auch wurde hier ein Drittel der Mannschaft wieder mit Piken ausgerüstet. Bei den nach Wismar 1711 und 1716 überführten Regimentern Skaraborg und Croneberg werden jedoch keine Pikeniere mehr genannt. Sie wären auch für den Dienst in der Festung nicht zu verwenden gewesen.
1.
Regt. Janköping-Lehn 3 )
Das Regiment war in Smaland eingeteilt und bereits im Sommer 1697 als Garnison nach Wismar überführt 4 ). Hier wurde das Regiment im August gemustert. Kommandant war Oberst Baron Berendt Wörner. Das Regiment hatte mit 1100 eingeteilten Mannschaften einen etwas geringeren Stand als die meisten schwedischen eingeteilten Regimenter und zählte (ohne Stab):
8 Kompanien zu 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren, 3 Spielleuten, 138 Mann (zusammen 150 Köpfe), insgesamt 1200 Köpfe.
Das Regiment blieb auch während des holsteinischen Feldzuges in seiner Garnison. Es war bis auf einige Mann stets nahezu vollzählig. An Stelle Wörners erscheint seit dem 1. Mai 1700 der Oberst Lorentz Clerck als Kommandeur in den Musterrollen. Am 3. Juni 1700 wurde das Regiment nach


|
Seite 113 |




|
der in Schweden üblichen Weise ohne Vermehrung der Mannschaften auf den Feldetat von 12 Kompanien gesetzt. Die neuen Kompanien hießen 1. bis 4. Verdoppelungskompanie. So zählte das Regiment jetzt (ohne Unterstab):
12 Kompanien zu 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren, 3 (2) Spielleuten, 92 (91) Mann (zusammen 104, bei den Verdoppelungskompanien 102 Köpfe), insgesamt 1240 Köpfe.
Am 1. Mai 1702 wurde das Regiment in Wismar zum letzten Male gemustert. Am 13. Mai erhielt es Befehl, zu dem sich in Pommern bildenden Korps Gyllenstierna zu stoßen. Auf dem Marsch stand es am 26. Mai bei Güstrow und am 30. bei Ivenack und Penzlin 5 ). Nur 45 Kranke blieben in Wismar und wurden hier bis Juli 1703 geführt.
Das Regiment focht in den nächsten Jahren in der Armee des Königs in Polen und wurde bei Pultawa gefangen. Schon Mitte November 1709 war es in Schweden aus den Bezirken wieder aufgestellt und konnte mit 5 Kompanien am 10. März 1710 an der Schlacht bei Helsingborg teilnehmen. 5 Kompanien wurden im Dezember 1711 und die übrigen 3 im Sommer 1712 unter Stenbock nach Pommern überführt. Das Regiment gehörte dann bis zur Kapitulation am 23. Dezember 1715 zur Besatzung von Stralsund 6 ).
2.
Regt. Croneberg-Lehn 7 ).
Auch dieses Regiment war in Smaland aufgestellt. Es wurde im Oktober 1699 nach Pommern überführt und kam mit 2 Kompanien nach Barth und mit 6 Kompanien nach Demmin. Am 5. Januar 1700 marschierte es entsprechend in zwei Kolonnen über Ribnitz und Neukalen nach Wismar 7 ). Hier wurde es vom Februar bis April gemustert. Kommandeur war Oberst Gustav Heidenfeld. Der Stand war mit 1200 Köpfen der gleiche wie beim Regiment Jankoping. Es hatte also auch den niedrigeren Stand der Småländer Regimenter. Am 24. Mai brach das Regiment im Verbande der nach Hol-


|
Seite 114 |




|
stein bestimmten Truppen von Wismar auf und nahm dann im Sommer an den Operationen des Korps Gyllenstierna in Holstein teil 8 ). Nach dem Frieden von Craventhal marschierte das Regiment zunächst nach Pommern in die alten Quartiere zurück. Aber schon am 24./25. November 1700 ging es, zur Verstärkung der Garnison in Wismar bestimmt, mit 4 Kompanien aus Damgarten bei Schwaan und 8 Kompanien aus Demmin bei Rühn über die Warnow 9 ). In Wismar ward das Regiment dann auch im Dezember 1700 und Januar 1701 gemustert. Es hatte ebenso wie Janköping im Sommer den Feldetat von 12 Kompanien (1240 Köpfe) angenommen. Infolge der Verluste im holsteinischen Feldzug hatte es im Dezember 110 Vakante. Das Regiment lag während dieser beiden Monate nicht in Wismar selbst, sondern in Poel und Neukloster. Nachdem das angestammte wismarsche Garnisonregiment von Holstein zurückgekommen war, ging das Regiment Croneberg im Januar 1701 wieder nach Pommern zurück 10 ).
Von hier brach es 1702 im Korps Gyllenstierna nach Polen auf, kämpfte dann in der Armee des Königs und wurde mit dieser bei Poltawa vernichtet. Die Neuaufstellung erfolgte in der Heimat bereits bis Mitte Oktober, so daß das Regiment am 10. März 1710 an der Schlacht bei Helsingborg teilnehmen konnte 11 ). Im Dezember 1711 wurde das Regiment auf der schwedischen Flotte eingeschifft, die zum Entsatz von Stralsund und Wismar bestimmt war. Da aber die wismarsche Garnison durch den mißglückten Ausfall vom 5. Dezember über zwei Drittel der Mannschaft verloren hatte, wurde das Regiment in den ersten Tagen des Januar 1712 dorthin überführt und zur Festungsbesatzung bestimmt 12 ).
Das Regiment zählte wieder wie zu Beginn des Krieges 8 Kompanien und 1200 Köpfe. Kommandant war der Oberst Nils Hestkov. Der wirkliche Stand des Regiments war jedoch geringer und betrug Anfang 1712 1057 Köpfe. Das Regiment wurde in Wismar nie komplett. Am 7. Dezember 1713 fehlten 216 Mann und am 15. Oktober 1714 228 Mann an der Sollstärke. Die dienstbare Stärke des Regiments verminderte sich noch durch zahlreiche Kranke, so daß bei der letzt-


|
Seite 115 |




|
genannten Musterung die Präsenzstärke ohne Stab 743 Mann betrug, zu denen noch 59 nach dem Walfisch kommandierte Unteroffiziere und Mannschaften traten. Das Kommando des Regiments hatte an Stelle des schon seit Monaten nach Schweden beurlaubten Obersten seit Januar 1715 der Oberst Swen Lagerberg 13 ). Unter dessen Führung nahm das Regiment an der tapferen Verteidigung von Wismar teil. Im Dezember 1715 hatten seine 8 Kompanien mit dem Stab einen Stand von 88 Köpfen, von denen 55 Mann krank und 2 Offiziere und 86 Mann auf den Walfisch kommandiert waren. Am 20. April 1716 zählte es 22 Offiziere, 777 Mann. Nach der am 19. April 1716 abgeschlossenen Kapitulation wurden 23 Offiziere, 541 Unteroffiziere und Mannschaften nach Schweden überführt 14 ).
Der Rest, etwa 200 Mann, wurde kriegsgefangen.
Die Uniform des Regiments war 1712 grau mit gelbem Futter. Den Grund hatte dieses Abweichen von der traditionellen blauen Farbe in den Schwierigkeiten bei der Wiederaufstellung von 1709 gehabt 15 ).
3.
Regt. Ostgiötha 16 ).
Das Regiment war in Ostgotland eingeteilt und bei den ersten Anzeichen eines Zwistes mit Dänemark zum Schutz Holstein-Gottorps und der deutschen Besitzungen Schwedens im Oktober 1699 nach Pommern überführt. Hier hatte es wohl in Stralsund gestanden und war am 5. Januar 1700 über Tribsees nach Wismar aufgebrochen 17 ). In Wismar wurde es von Februar bis April gemustert. Sein Kommandeur war Oberst Gustaf Ulfsparre Johansson. Der Etat des Regiments betrug ohne Stab:
8 Kompanien zu 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren, 3 Spielleuten, 150 Mann (zusammen 162 Köpfe) = insgesamt 1296 Köpfe.


|
Seite 116 |




|
Das Regiment hatte nur einen "Vakanten", sonst war es vollzählig. Einige Kranke befanden sich in Wismar und Stralsund. Am 24. Mai brach es mit der Armee nach Holstein auf und operierte dort bis zum Frieden von Craventhal gegen die Dänen. Auf dem Rückmarsch nach Holstein berührte es Wismar, ohne dort längere Zeit zu stehen, und ging nach Pommern zurück 18 ).
Aus Pommern brach das Regiment im Jahre 1702 mit der Heeresabteilung Gyllenstiernas nach Polen auf. Dort stieß es später zur Armee des Königs und wurde bei Pultawa vernichtet. In der Heimat wurde es neu aufgestellt und konnte schon am 10. März 1710 an der Schlacht bei Helsingborg unter Stenbock teilnehmen. Mit diesem ging es auch im Sommer 1712 nach Pommern hinüber, kämpfte bei Gadebusch und mußte in Holstein am 16. Mai 1713 bei Oldenswert kapitulieren 19 ).
In Wismar fanden sich an Kranken und Verwundeten aus der Schlacht bei Gadebusch im Januar 1713 23 Mann in den Lazaretten und 93, die dem Regiment Hestkov (2) zugeteilt waren. Im Juni waren es noch 99 Mann, von denen 89 die Kompanie Knorring des Feldstaatsregiments bildeten (s. u. 23) 20 ).
4.
Regt. Södermanland 21 ).
Das Regiment Södermanland war ebenfalls im Oktober 1699 bereits von Schweden nach Pommern überführt worden. Am 5. Januar 1700 brach es von Anklam über Demmin nach Wismar auf und wurde hier im Februar und März gemustert 22 ). Einige Kompanien (Oberst und Youngh) standen auf Poel, die Kompanie Bettendorf lag in Woltersdorf. Kommandeur war Oberst Arfwed Axel Mardefeld. Der Etat des Regiments war der gleiche wie der des Regiments Ostgiötha: 8 Kompanien zu 1296 Köpfen ohne Stab. Auch bei diesem Regiment fehlten bei der Musterung nur 2 Mann. Einige Kranke befanden sich in Anklam. Der Aufbruch von


|
Seite 117 |




|
Wismar erfolgte schon früher als der des Hauptkorps. Das Regiment marschierte im Anfang April über Zittow - Banzkow - Wehningen nach dem Herzogtum Bremen ab, um den bremischen Truppen den Übergang über die Elbe zu erleichtern 22 ). Nach dem Frieden von Craventhal ging das Regiment im September 1700 nach Pommern zurück. Während des Feldzuges war das Regiment in der in Schweden üblichen Weise auf Feldetat gesetzt und hatte 4 neue (Verdoppelungs-) Kompanien erhalten, ohne daß der Bestand an Mannschaften sich verändert hätte. So bestand das Regiment jetzt aus:
12 Kompanien zu 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren, 3 Spielleuten, 100 Mann (zusammen 112 Köpfe) = 1344 Köpfen.
Ende November 1700 marschierten 6 Kompanien des Regiments unter dem Oberstleutnant Gabriel Lilliebök vorübergehend von Demmin zur Verstärkung der Garnison nach Wismar und überschritten am 25. November bei Eickhof die Warnow 22 ). In Wismar wurden sie im Dezember gemustert. Infolge des vorangegangenen Feldzuges fehlten diesen 6 Kompanien 37 Mann an der Sollstärke. Noch im Dezember gingen sie nach Pommern zurück, da das geworbene Liewensche Regiment (13) aus Holstein in seine Garnison Wismar zurückkehrte.
Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin hatte seine gesamte Infanterie, in 2 Regimenter Schwerin und Buchwald formiert, im Frühjahr 1701 an die Generalstaaten der Niederlande vermietet, in deren Diensten sie bis 1713 am spanischen Erbfolgekrieg teilnahmen. Bis zur Bildung neuer Truppen durch Werbung mußte immerhin geraume Zeit vergehen. Um sein Land nicht schutzlos zu lassen, mietete er in der damals üblichen Weise mit Vertrag vom 30. April 1701 von dem Herzog Friedrich von Holstein-Gottorp, dem Schwager und Freund Karls XII., 600 Mann Schweden zum Schutze seines Landes und nahm diese in eigene Verpflegung. Gestellt wurde das Oberstenbataillon des Regiments Mardefeld, das bisher in Anklam gelegen hatte, in folgender Stärke:
| 6 Kompanien (Oberst, Major, Kapt. Kruse, Palmstruck, Wendel, Bettendorf) mit 18 Offizieren, 30 Unteroffizieren, | ||
| 6 Musterschreibern, 600 Mann, zusammen | 654 Köpfe, | |
| Unterstab | 13 Köpfe, | |
| -------------- | ||
| 667 Köpfe. | ||


|
Seite 118 |




|
Die Übernahme des Bataillons in mecklenburgische Dienste erfolgte am 1. September 1701 in Demmin: 2 Kompanien (Major und Wendel) kamen nach Güstrow, 2 1/2 (Oberst, Kruse und 1/2 Palmstruck) nach Schwerin und 1 1/2 (1/2 Palmstruck und Bettendorf) nach Wittenburg und Gadebusch in Garnison. Die letzteren wurden zu Beginn 1702 zu je 50 Mann auf Grabow, Parchim und Boizenburg verteilt 23 ). Im Mai 1702 wurde das Bataillon nach Pommern zurückbeordert und aus den mecklenburgischen Diensten entlassen, um zum Korps Gyllenstiernas zu stoßen, das sich in Pommern sammelte und an den Operationen in Polen teilnahm.
Bei Pultawa geriet auch dieses Regiment in russische Gefangenschaft. Es wurde bis Mitte Dezember 1709 in Schweden neu aufgestellt und konnte schon im nächsten Frühjahr an der Schlacht bei Helsingborg teilnehmen. Im Dezember 1711 wurde es zur Verstärkung der Besatzung von Stralsund nach Pommern überführt, focht im Korps Stenbocks bei Gadebusch und wurde ebenfalls in die Kapitulation von Oldenswert verwickelt 24 ).
An Verwundeten aus der Schlacht bei Gadebusch und an Kranken von Stenbocks Heer finden sich im Januar 1713 in den Lazaretten 21 und beim Regt. Buhrenschiöld (12) 54 Mann des Regiments. Im Juni bildeten 86 Mann die Leibkompanie des Feldstaatsregiments (23) 25 ).
5.
Regt. Skaraborg-Lehn 26 )
Das Regiment war in Westgotland eingeteilt und ebenfalls im Oktober 1699 nach Pommern überführt worden. Am 4. Januar 1700 marschierte es über Damgarten nach Wismar und wurde


|
Seite 119 |




|
in das Amt Neukloster und die wismarschen Dörfer verlegt 27 ). Hier wurde es von Februar bis April gemustert. 6 Kompanien lagen in Neukloster, die Kompanie des Oberstleutnants in Benz und die des Kapt. Leyoncreutz in Bantow. Oberst war Baron Nils Stromberg. Der Etat war der gleiche wie der des Regiments Ostgiötha. Das Regiment zählte daher in seinen 8 Kompanien ohne Stab 1296 Köpfe. Am Sollstand fehlten nur 2 Mann. Kranke lagen in Stralsund und Neukloster. Anfang April marschierte das Regiment zusammen mit dem Regiment Södermannland zur Verstärkung der Truppen in Bremen über Zittow - Banzkow - Wehningen an die Elbe ab 27 ). Nach dem Frieden von Craventhal ging das Regiment Skaraborg nach Pommern zurück.
Dort stieß es 1702 zu dem Korps Gyllenstiernas, das sich in Pommern bildete und dann an den Operationen Karls XII. in Polen teilnahm. Pultawa war auch sein Untergang. Bis Weihnachten 1709 wurde auch dies Regiment in der Heimat wieder errichtet. Es blieb jedoch bis 1715 in Schweden 28 ). Kommandeur des Regiments war nach der Wiedererrichtung Oberst Christof Georg Witting. Zur Unterstützung der stark bedrängten Festung Stralsund sollte das Regiment 1715 dorthin überführt werden und war bereits am 12. September in Karlskrona an Bord von 10 Kriegsschiffen eingeschifft worden, dann einige Tage später auf 19 Transportschiffe verteilt. Die Flotte kam aber durch Gegenwind nur bis Nystad. Erst im Dezember konnte dann Vizeadmiral Taube mit 4 Kriegsschiffen und 7 Transportschiffen auslaufen. Diese faßten aber außer Munition und anderen Kriegsbedürfnissen nur 700 Mann. Der Oberstleutnant Stael von Holstein mußte daher mit 551 Mann des Regiments zurückbleiben. Als Taube am 27. Dezember vor Rügen ankerte, hatte Stralsund bereits kapituliert. Es blieb also die beste Lösung, das Regiment nach Wismar zu überführen, dessen Besatzung sich noch hielt. Zwei Tage später kam Tube in der Wismarschen Bucht an. Um das Regiment an Land zu bringen, mußte erst eine Rinne durch das Eis geschlagen werden, das bis zum Walfisch reichte. Die Bürgerschaft war bei den knappen Lebensmitteln über diese verstärkte Einquartierung wenig erfreut, zumal die mitgebrachten Lebensmittel für die Truppen bestimmt waren 29 ).


|
Seite 120 |




|
Generalmajor Schoultz gibt in einem Brief von 31. Dezember die Stärke des Regiments mit 704 Köpfen an 30 ). Das stimmt überein mit der Musterliste des Regiments vom 24. Januar 1716. Diese nennt 15 Mann Stab, 16 Offiziere, 33 Unteroffiziere und Spielleute, 643 Korporale und Mannschaften, also 707 Köpfe. Davon waren allerdings 120 krank und 22 auf den Walfisch kommandiert. Da die H Hälfte der Kompanien in Schweden zurückgeblieben war und es namentlich an Offizieren fehlte, bildeten jeweils zwei halbe Kompanien eine kombinierte. Die erste Kompanie bildete die 1. bis 3., die zweite die 4. bis 6. Korporalschaft. Korporale und Mannschaften führten in der Musterrolle die Nummern 1 bis 150 ihrer alten Kompanien. Die Nummern der in Schweden gebliebenen Mannschaft blieben offen.
Um dem fühlbaren Offiziermangel abzuhelfen und kleinere, für den Krieg besser verwendbare Kompanien zu gewinnen, wurden aber schon von Februar ab 11 Offiziere, 18 Unteroffiziere des Regiments Welling (15) und 3 Offiziere sowie 1 Unteroffizier anderer Regimenter dem Regiment Skaraborg zugeteilt. Dadurch konnten die 4 kombinierten Kompanien wieder in 8 Kompanien mit einer Durchschnittsstärke von 90 Köpfen aufgelöst werden. Im März 1716 hatte das Regiment ohne die ihm zugeteilten Offiziere und Unteroffiziere eine Stärke von 697 Köpfen, von denen 104 krank waren. Am 20. April 1716 zählte es 14 Offiziere, 650 Mann. Am 19. April 1716 mußte Wismar kapitulieren. Die Besatzung wurde kriegsgefangen mit Ausnahme von 89 Offizieren und 1000 nationalschwedischen Mannschaften, die nach Schweden überführt werden sollten. Hierzu gehörten 15 Offiziere, 27 Unteroffiziere und Spielleute und 371 Mann des Regiments Skaraborg, also 403 Köpfe 31 ). Die in Gefangenschaft zurückbleibenden 231 Mann waren größtenteils krank, denn am 16. April hatte das Regiment allein an Mannschaften 203 Kranke gehabt 32 ).


|
Seite 121 |




|
6.
Regt. Elfsborg-Lehn.
Dies Regiment war nach dem Einteilungswerk in Westgotland beheimatet und war während des Nordischen Krieges zunächst in Schweden zurückgeblieben. Am 10. März 1710 hatte es an der Schlacht bei Helsingborg teilgenommen. Im Dezember 1711 wurde das Regiment zur Verstärkung der Garnison von Stralsund nach Pommern überführt und nahm später in der Armee Stenbocks an der Schlacht bei Gadebusch und dem Marsch nach Holstein teil 33 ).
An Verwundeten und Kranken lagen im Januar 1713 in den Lazaretten und Häusern 29 Mann des Regiments. Weitere 173 waren dem dortigen Regiment Buhrenschiöld (12) zugeteilt. Bei Aufstellung des Regiments Klingstedt finden sich noch 169 wieder Genesene in der Kompanie Rutwein und Franck dieses Regiments (s. Nr. 23). Sie gehörten 8 Kompanien (Leib-, Obstl., Major, Ahs, Reedwegen, Giessene, Södra Kind, Norra Kind) an 34 ).
7.
Regt. Westgiötha-Dahl
Dies Regiment stammte teils aus Westgotland, teils aus Dalekarlien. Es hatte in Schweden gestanden und wurde erst im Herbst 1712 mit der Armee Stenbocks nach Pommern überführt. Nach der Schlacht bei Gadebusch und der Kapitulation bei Oldenswert 35 ) sammelten sich bis zum Januar 1713 in Wismar 82 Mann in den Lazaretten und 13 beim Regiment Buhrenschiöld (12), die im Juni nach Abgang von Genesenen zur Armee und Toten noch 84 Mann zählten und die Kompanie Schoultz des Regiments Klingstedt (s. Nr. 23) bildeten. Sie gehörten zu 8 Kompanien (Leib-, Obstl., Major, Kühling, Kallanden, Toßbo, Wadbo, Sun och Nordahl). Im Gegensatz zu den anderen eingeteilten Regimentern wurde dieses Regiment häufig nach seinem Chef Generalmajor Patkul genannt, da es ausnahmsweise einen General als Chef hatte 36 ).


|
Seite 122 |




|
8.
Dahlregiment.
Das in Dalekarlien beheimatete Regiment hatte in der Armee des Königs am Feldzug in Seeland, in den Ostseeprovinzen und in Polen teilgenommen. Bei Pultawa war es 1709 verloren gegangen und dann in seiner Heimat neu aufgestellt worden. 1712 wurde es nach Pommern überführt und nahm unter Stenbock an der Schlacht bei Gadebusch und dem Marsch nach Holstein teil. Nach der Kapitulation Oldenswert am 16. Mai 1713 kam das Regiment in Gefangenschaft 37 ).
Bis Januar 1713 sammelten sich an Verwundeten und Kranken 165 in den Lazaretten und 163 beim Regiment Fürstenberg (13). Sie bildeten nach Aufstellung des Regiments Klingstedt (s. u. Nr. 23), noch 193 Mann stark, dessen Kompanien Freitag und Uggla. Diese Verwundeten stammten aus 8 Kompanien des Regiments (Leib-, Oberstl., Major, Rättwyck, Gagnes, Mora, Wästerdahl, Orsa), von denen die letzten 5 die Kapitäne Roth, Duglas, Cronsted, Siwersparr und Wasenberg zu Chefs gehabt hatten 38 ).
9.
Regt. Wermland.
Das Regiment, nach Seinem Einteilungsdistrikt auch Nerike und Wermland genannt, hatte gegenüber den übrigen eingeteilten Regimentern einen erhöhten Stand (1674 Mann). 2 Bataillone hatten unter dem König im Baltenland und Polen gefochten und waren bei Pultawa verloren gegangen. Ein Bataillon war in Schweden geblieben, hier wurde das Regiment 1709 wieder aufgestellt und unter Stenbock 1712 zum Teil nach Pommern überführt. In Stenbocks Armee focht es bei Gadebusch und nahm am Zug nach Holstein teil 39 ).
Von den 6 Kompanien des Regiments in Deutschland (Leib-, Major, Orebro, Carlstadt, Christinihamm, Naaß) fanden sich bis Januar 1713 an Kranken und Verwundeten in den Lazaretten von Wismar 44 und beim Bataillon Löwenhaupt (14) 72 Mann ein. Im Juni bildeten sie, noch 86 Mann, die Majorkompanie des Feldstaatsregiments (23) 40 ).


|
Seite 123 |




|
10.
Regt. Westmanland.
Das Regiment Westmanland hatte in der Armee des Königs in den Ostseeländern und in Polen gefochten und war bei Pultawa vernichtet worden. In der Heimat wieder aufgestellt, konnte es schon am 10. März 1710 an der Schlacht bei Helsingborg teilnehmen. Im Dezember 1711 wurde es zur Verstärkung der Stralsunder Garnison nach Pommern überführt, kämpfte unter Stenbock am 20. Dezember 1712 bei Gadebusch und wurde bei Oldenswert gefangen 41 ). In Wismar fanden sich vom Regiment bis zum Januar 1713 Verwundete und Kranke von 8 Kompanien (Leib-, Oberstl., Major, Berg, Stromsholm, Kungsöhr, Wäßby, Sahlberg) ein, 54 lagen in den Lazaretten, 105 waren beim Regiment Hestkov (2) eingeteilt. Im Juni waren es noch 150, die auf die Leib-, Oberstl. und Kapt.-Franck-Kompanie des Feldstaatsregiments (23, s. d.) verteilt wurden 42 ).
11.
Regt. Helsinge.
Das in Helsingland beheimatete Regiment hatte bis 1709 in den Ostseeprovinzen gefochten und war dann unter Löwenhaupt zur Armee des Königs nach Polen marschiert und nach der Schlacht bei Pultawa gefangen worden. In der Heimat wiedererrichtet, wurde es 1712 unter Stenbock nach Pommern überführt, focht bei Gadebusch und kam durch die Kapitulation von Oldenswert ebenfalls in Gefangenschaft 43 ). An Verwundeten aus der Schlacht bei Gadebusch und Kranken vom Heere Stenbocks lagen im Januar 1713 112 Mann in den Lazaretten, weitere 123 Mann waren beim Regiment Hestkov (2) eingestellt. Im Juni waren sie durch Abgänge zum Heer und an Verstorbenen auf 152 zusammengeschmolzen, die in die Kompanien Rosenmüller und Ackerfeld des Feldstaatsregiments (23, s. d.) eingeteilt wurden. Sie entstammten allen 8 Kompanien des Regiments (Leib-, Oberstl., Major, Alsta, Arbro, Ofwansio, Dielsbo, Järfsio) 44 ).


|
Seite 124 |




|
B. Geworbene Regimenter 45 ).
Eingeteilte Regimenter besaß Schweden nur in den alten schwedischen und finnischen Gebieten. In Schonen, den Ostseeprovinzen und in Schwedens deutschen Besitzungen standen geworbene Regimenter. Zu ihrer Unterhaltung mußten die betreffenden Provinzen Gelder aufbringen, mit denen sie ergänzt und verpflegt wurden. Ihre Nationalität war verschieden, es fanden sich in jedem Regiment ebenso wie damals überall in Europa Soldaten der verschiedensten Herkunft zusammen. Trotzdem überwog natürlich bei den Regimentern, die eine feste Garnison hatten, die Anzahl der Mannschaften derjenigen Landschaft, in der sie standen. Diese geworbenen Regimenter waren im Gegensatz zu den im Frieden in ihre heimatlichen Dörfer entlassenen Mannschaften der eingeteilten Regimenter ständig unter Waffen und bildeten die Besatzung der Festungen, mit denen Schweden seine Herrschaft in den Randstaaten der Ostsee sicherte. Während die eingeteilten Regimenter nur für schwedische Kriege verwandt wurden, sind geworbene Regimenter entsprechend dem Brauch der Zeit auch für fremde Kriege, z. B. an die Niederlande gegen Frankreich vermietet worden.
Eine besondere Stellung unter den geworbenen Regimentern nahm die Garde ein, die nur aus Schweden bestand und ihre Garnison in Stockholm hatte. In den erst kürzlich erworbenen zeitweise dänischen Gebieten standen zur Besetzung von Malmö, Landskrona und Göteborg sowie kleinerer Plätze drei geworbene Regimenter: das schwedische Leibregiment, das deutsche Leibregiment und das Garnisonregiment Malmö. Pommern hatte 1700 drei Regimenter in Stettin und Stralsund (darunter das Leibregiment der Königin-Witwe), Wismar zwei und das Herzogtum Bremen anderthalb Regimenter. Von diesen war ein Teil vorübergehend an Holstein-Gottorp zur Besatzung und zum Ausbau der Festung Tönning überlassen. In den Ostseeprovinzen standen zunächst 4 geworbene Regimenter in Narwa, Dorpat, Pernau und Riga.
Diese geworbenen Regimenter waren z. T. seit langem in ihren Standorten und hatten dadurch einen guten Stamm tüchtiger Soldaten. Die Ergänzung machte in Friedenszeiten keine


|
Seite 125 |




|
großen Schwierigkeiten, und die Anforderungen an Alter und körperliche Tüchtigkeit konnten im Gegensatz zu den schlechter zahlenden Kleinstaaten Norddeutschlands recht hoch sein. Auch die Dersertionen, die einen Krebsschaden aller geworbenen Regimenter bildeten, hielten sich daher in mäßigem Rahmen. Gefangene Mannschaften suchten sich sogar nach Möglichkeit zu ranzionieren und wieder zu ihren Regimentern zu kommen.
Während des Nordisten Krieges wurden die drei in Schweden geworbenen Regimenter nach Pommern und Wismar überführt. Auch wurden in den Ostseeprovinzen, in Polen und Sachsen neue Regimenter, z. T. unter Verwendung von sächsischen Kriegsgefangenen, errichtet. Die Zuverlässigkeit dieser Regimenter war jedoch sehr gering und die Desertionen sehr zahlreich. Ähnlich war es bei einem Regiment, das in Frankfurt am Main aus französischen Kriegsgefangenen des Spanischen Erbfolgekrieges durch Vereinbarung mit den Reichsständen errichtet wurde. Die Aufstellung solcher Regimenter erfolgte durch Kapitulationen, d. h. durch Vertrag mit dem zukünftigen Obersten des Regiments.
Die Dienstzeit der Mannschaften war entweder unbestimmt oder auf gewisse Jahre bemessen. Gerade die letzte Art der Annahme von Mannschaften war bei den alten geworbenen Regimentern Schwedens sehr häufig, und es konnte vorkommen, daß die Kapitulation, wie man sie nannte, während des Krieges ablief, ältere und unbrauchbare Mannschaften wurden bei den meist jährlich abgehaltenen Generalmusterungen durch die Musterkommissare "kassiert" und waren zu ersetzen. Die neugeworbenen Mannschaften mußten vor ihrer Einstellung dem Kommandanten der Festung präsentiert werden, erhielten ein bestimmtes Handgeld und traten dann in die Rotte der Abgegangenen ein.
In Wismar fanden während des Krieges verschiedene geworbene Regimenter, nicht nur die beiden dort beheimateten, Verwendung. Im Gegensatz zu den eingeteilten Regimentern, die die Namen der Landschaften führten, führten die geworbenen Regimenter die Namen ihrer Chefs. Diese waren nicht ohne weiteres mit dem Kommandeur identisch, sondern häufig Generäle. Dann führte ein Oberst oder Oberstleutnant das tatsächliche Kommando, während der Regimentschef allerdings für sein Regiment verantwortlich blieb.
Beim Wechsel der Chefs wechselten auch die Regimenter ihre


|
Seite 126 |




|
Namen. Als zweite Bezeichnung führten jedoch viele außerdem noch den Namen ihrer Garnison, z. B. Wismarsches Gouverneurregiment. Ebenso führten die Kompanien im Gegensatze zu denen der eingeteilten Regimenter, die nach Aushebungsbezirken bezeichnet waren, ausschließlich die Namen ihrer Kompaniechefs. Hier behielt auch der zum Stabsoffizier beförderte Offizier seine Kompanie, während er sie bei den eingeteilten Regimentern abgeben und eine der drei festen Stabskompanien übernehmen mußte.
Von diesen geworbenen Regimentern hatten die in Deutschland stehenden einen gleichmäßigen Etat. Der Unterstab war wesentlich stärker, es gehörten dazu der Regimentsquartiermeister, der Regimentspriester, der Regimentsauditeur, Sekretär, Adjutant, Regimentsschreiber, 2 Musterschreiber, 1 Gerichtsschreiber, der Regimentsfeldscher, 4 Barbiergesellen, der Regimentstambour, 1 Regimentspfeifer, 4 Schalmeienbläser, 1 Gerichtswebel, 1 Gewaltiger, 3 Profosse, der Stockmeister, Steckenknecht und Scharfrichter, im ganzen also 28 Personen. Die größere Zahl der Gerichtspersonen war wohl eine Folge der in diesen aus geworbenen Mannschaften bestehenden Regimentern häufigeren Vergehen. In Wirklichkeit waren jedoch bei den Regimentern nicht alle Stellen ständig besetzt. Gerichtswebel, Stockmeister, Steckenknecht, Scharfrichter und Regimentspfeifer fehlen z. B. bei den beiden wismarschen Regimentern ständig.
Die Primaplana der Kompanie bestand nur aus 10 Personen, nämlich den 3 Offizieren, dem Feldwebel, Sergeanten, Führer, Fourier, Kapitän d'armes (bei den schwedischen Regimentern Rüstmeister genannt) und 2 Tambours. Es fehlte also gegenüber den eingeteilten Regimentern der Musterschreiber und der Pfeifer.
Die Kompanien bestanden aus 6 Korporalen und 94 Mann, also 100 Köpfen. Das Regiment war in 12 Kompanien eingeteilt und hatte also ohne den Regimentsstab 1320 Köpfe, mit diesem 1348.
Das schwedische Leibregiment zu Fuß (12) (und auch das in Schweden stehende deutsche Leibregiment und das Regiment Malmö) hatten nur 12 Mann Regimentsstab und 8 Kompanien. Die Primaplana bestand hier, wie bei den schwedischen eingeteilten Regimentern, aus 12 Mann, die Kompanie aus 6 Korporalen, 132 Köpfen. Das Regiment hatte also in seinen


|
Seite 127 |




|
8 Kompanien je 150 Mann, also 1200 Mann und 12 Mann Stab 46 ).
Einen ganz abweichenden Stand hatte das in Frankfurt geworbene Regiment Bretholtz (21). Es sollte nach der Kapitulation außer Stab und Primaplana 8 Kompanien zu 125 Mann und nach einem späteren Befehl 8 Kompanien zu 150 Mann und dazu 110 Mann Stab und Primaplana und 100 Troßknechte, also 1410 Köpfe, erhalten 47 ).
Ebenfalls 8 Kompanien hatte das Elbinger Regiment Ekeblad (20).
Die Mannschaften und Korporale führten Musketen und Säbel, die Unteroffiziere das Kurzgewehr (Sponton) neben dem Säbel. Pikeniere gab es bei den geworbenen Regimentern nicht, da diese im wesentlichen zum Dienst in den Festungen bestimmt waren. Dagegen werden beim Regiment Vellingk 1715 und beim Regiment Königin-Witwe schon 1706 Grenadiere genannt. Bei den anderen Regimentern, insbesondere bei den beiden wismarschen, scheinen sie nicht bestanden zu haben. Es waren 8 bis 9 Mann für die Kompanie, für das ganze Regiment 100 und 8 Unteroffiziere. Ihre Ausrüstung bestand außer der des Musketiers in Handgranaten, die mit Lunten angezündet wurden. Am Bandelier trugen sie deshalb auch "Luntenverberger". Es waren die besten Leute der Kompanie. Sie stehen in der Musterrolle an den ersten Plätzen. Die Aufstellung war auch bei den deutschen Regimentern sechsgliedrig. Im ersten Glied der Rotte stand der Korporal oder sonst ein Gefreiter.
12.
Schwedisches Leibregiment zu Fuß 48 ).
Das Regiment war eins der drei in Schweden stehenden geworbenen Regimenter und ergänzte sich durch Werbung von Nationalschweden. Es bildete die Besatzung von Göteborg und kleinerer Festungen in Bahus-Lehn. Die Stärke des Regiments betrug planmäßig außer einem Stab von 12 Köpfen
8 Kompanien zu 3 Offizieren, 6 Unteroffizieren, 3 Spielleuten, 6 Korporalen, 132 Mann (150 Köpfe), insgesamt 1200 Köpfe.


|
Seite 128 |




|
Als im Sommer 1709 die Regimenter der pommerschen Garnisonen und Wismars zum Korps Krassows nach Polen beordert wurden, kamen die drei in Schweden liegenden geworbenen Regimenter nach Norddeutschland, das deutsche Leibregiment und das Garnisonregiment Malmö nach Pommern und das schwedische Leibregiment nach Wismar 49 ). Die Überführung erfolgte im Juni. Kommandeur des schwedischen Leibregiments war der Oberst Baron Nils Posse. In Wismar blieb das Regiment im ganzen weiteren Verlauf des Krieges. Es hatte zunächst stets seinen vollen Stand und zählte noch im Dezember 1711 während der ersten Belagerung einschließlich der Offiziere 1184 Köpfe. Durch königliche Order vom 23. Mai 1711 war Posse Landeshauptmann in Gotland geworden, und der Oberstleutnant im Leibregiment der Königin, Hindrick Buhrenschiöld, hatte als Oberst das Regiment erhalten, konnte es aber, da die Order erst im September ankam, infolge der Einschließung nicht mehr erreichen. Daher führte der Oberstleutnant Palmfelt das Regiment während der Belagerung. Bei dem Ausfall der Garnison am 5. Dezember 1711 und dem Angriff auf das dänische Lager bei Lübow zeigte das Regiment eine ausgezeichnete Haltung. Während die beiden wismarschen Regimenter Fürstenberg und Löwenhaupt sehr schnell die Flucht ergriffen, formierte das Leibregiment zwei Karrees und beantwortete die Aufforderung zur Übergabe mit Salven. Die Karrees wurden überritten und ein furchtbares Blutbad unter dem Regiment angerichtet, da die Schweden kein Quartier nehmen wollten. Der Oberstleutnant Palmfelt und 9 Offiziere fielen an der Spitze des Regiments 50 ). Etwa 100 Mann müssen gefallen sein, 629 wurden gefangen und von ihnen die 104 am schwersten Verwundeten wieder nach Wismar hineingeschickt, da die Dänen keine Möglichkeit hatten, sie zu verpflegen. Mit diesen Verwundeten hatte das Regiment jetzt nur noch einen Stand von 524 Köpfen in Wismar und schmolz bis Dezember 1712 sogar bis auf 479 Mann zusammen, da es keine Rekruten aus Schweden bekommen konnte und Deutsche zunächst nicht anwerben sollte.
Nach der Schlacht bei Gadebusch konnte es aus den Gefangenen 2 Korporale, 51 Mann wieder einstellen, die vorher im Regiment gestanden hatten und nach dem Gefecht bei Lübow in


|
Seite 129 |




|
dänische Regimenter gesteckt waren. Aus den Gefangenen "warb" das Regiment weitere 84 Mann an, durch freie Werbung erhielt es 183, und an der Trave konnten am 24. April 1713 noch 2 Offiziere 130 Mann des Regiments gegen dänische Gefangene eingetauscht werden 51 ). So erreichte das Regiment bis zum 10. Mai 1713 wieder einen Stand von 840 Unteroffizieren und Mannschaften.
Im März 1715 erhielt Oberst Prinz Casimir Wilhelm von Hessen-Homburg das Regiment und sollte es auf 12 Kompanien, 1400 Mann, bringen 52 ). In den wismarschen Stärkelisten ist jedoch von den 4 neuen Kompanien oder auch nur von dafür in Aussicht genommenen Offizieren nie die Rede. Das Regiment behielt seinen alten Sollstand von 8 Kompanien und hatte im Juli 1715 nur noch 731 Unteroffiziere und Mannschaften. Während der harten Belagerung Wismars im Winter 1715/16 schmolz der Stand des Regiments bis zum 20. April auf 24 Offiziere, 568 Unteroffiziere und Mannschaften zusammen. Nach der Kapitulation der Festung gehörten 16 Offiziere, 88 Unteroffiziere und Mannschaften zu den 1000 Nationalschweden, die in die Heimat entlassen wurden 53 ). Der Rest des Regiments wurde kriegsgefangen.
Die Uniform bestand nach den Montierungsrollen 1715 aus blauen Rocken mit gelben Aufschlägen und gelbem Futter, zinnernen Knöpfen, weißgelben Schnüren, blauen Hosen und gelben (oder weißen?) Strümpfen.
Das Regiment setzte sich in Friedenszeiten ausschließlich aus Schweden zusammen. Infolge der später erlaubten deutschen Werbung und der Einstellung dänischer Kriegsgefangener bestand die kriegstaugliche Mannschaft von 752 Köpfen bei der Generalmusterung im Januar 1715, für die Angaben gemacht sind, aus 480 Schweden, 74 Dänen, 22 Norwegern, 10 Balten, 8 Polen, 3 Russen, 4 Franzosen, 1 Ungarn und 1 Brabanter sowie aus 149 Deutschen (darunter 11 Mecklenburger, 15 Wismarer, unter diesen besonders die jugendlichen Tambours, 31 Holsteiner, 6 Pommern). Außer den Schweden und einigen Norddeutschen hatten die meisten anderen (im ganzen 230) vorher in dänischen Diensten gestanden.


|
Seite 130 |




|
13.
Wismars Gouverneurregiment 54 ).
Das 12 Kompanien starke Regiment des Generalmajors Baron Jürgen von Mellin hatte 1689 seinen Standort in Stettin gehabt. 1691 waren bereits vier und 1693 zwei seiner Kompanien den Sommer über vorübergehend zu Befestigungsarbeiten in Wismar 55 ). Als der nunmehrige Generalleutnant Mellin 1693 an Stelle Buchwalds Gouverneur von Wismar wurde, nahm er sein Regiment mit. Es traf im November in Wismar ein 56 ). Zum Unterschied von dem bisherigen Regiment Buchwalds, das der Oberst v. Kemphen erhielt, nannte man Mellins Regiment, das in der Folge stets dem Gouverneur der Festung zum Chef behielt, "Gouverneurregiment", wenn es nicht nach dem Namen des Chefs bezeichnet wurde. Es hatte wie alle deutschen Regimenter außer dem Stab einen Stand von
12 Kompanien zu 3 Offizieren, 5 Unteroffizieren, 2 Spielleuten, 6 Korporalen, 94 Mann (zusammen 110 Köpfe), insgesamt 1320 Köpfe.
Nachdem Mellin als Gouverneur von Wismar 1696 (Sept.) durch den Generalleutnant Baron Niels Gyllenstierna abgelöst und Generalgouverneur von Pommern geworden war, erhielt Gyllenstierna das Regiment. Ihm folgte nach seiner Beförderung zum Generalgouverneur des Herzogtums Bremen im Oktober 1698 als Gouverneur von Wismar und Chef des Regiments Generalleutnant Baron Bernhard von Liewen.
Ende Juli 1699 marschierte das Regiment auf Befehl des Königs nach Holstein, da sich die Verhältnisse zwischen dem Schwager Karls XII., dem Herzog Friedrich IV. von Holstein-Gottorp, und dem Dänenkönige zuspitzten 57 ). Bei Beginn der Feindseligkeiten stand etwa die Hälfte des Regiments in Friedrichstadt und wurde hier am 13. April 1700 angegriffen. Die Stadt wurde gestürmt, etwa 500 Mann des Regiments gerieten in dänische Gefangenschaft, 2 Fahnen wurden von den Dänen erbeutet. Nach diesem Verlust war der Rest des Regiments in der gottorpischen Hauptfeste Tönning nur noch 15 Offiziere und 592 Mann stark 58 ). Die Belagerung Tönnings mußte nach


|
Seite 131 |




|
fünfwöchiger Dauer am 2. Juni von den Dänen wieder aufgegeben werden, da ein schwedisch-lüneburgisch-holländisches Korps zur Unterstützung der Gottorper in Holstein einmarschiert war. Der Friede von Craventhal beendete die Feindseligkeiten am 18. August. Das Regiment Liewen erhielt Befehl zum Rückmarsch nach Wismar, wo es im Januar 1701 wieder eintraf 59 ).
Schon am 1. Juli 1700 hatten sich, während das Regiment noch in Tönning stand, in Wismar bereits wieder 25 Unteroffiziere und 103 Mann des Regiments angefunden, die sich teils mit eigenem Gelde losgekauft hatten, teils unter Lebensgefahr aus der dänischen Gefangenschaft entflohen waren. In Boizenburg stand seit 1696 ein Kommando von zuletzt 1 Offizier, 3 Unteroffizieren und 33 Mann aus allen Kompanien des Regiments, um als neutrale Truppen des niedersächsischen Kreises diese Mecklenburg-Güstrower Festung bis zum Abschluß des Hamburger Vergleichs vor einer vorzeitigen Besetzung durch Mecklenburg-Schwerin zu sichern. Nach Abschluß des Vergleichs Kehrten sie 1701 nach Wismar zurück.
Durch die Ranzionierten und die nach dem Craventhaler Frieden ausgetauschten Mannschaften konnte sich das Regiment in Wismar bis zum Juli 1701 wieder auf den vollen Stand ergänzen. Auf der kleinen Festung Walfisch war regelmäßig ein kleines Kommando von 26 Unteroffizieren und Mannschaften des Regiments. Da Liewen bei der Armee in Polen vor Thorn seinen Tod fand, wurde das Regiment seit dem Juli 1702 als vakantes Gouverneur-Regiment (oder als des gewesenen Gen. Liewen Regiment) bezeichnet, bis es im Mai 1704 in dem Generalleutnant Baron Hans Isaac Ridderhielm einen neuen Chef und Wismar einen neuen Gouverneur erhielt. Es blieb in den folgenden Jahren in Wismar stehen und war stets nahezu komplett. Für das in Polen stehende Sparresche Regiment (19) mußte es im Juni 1704 im ganzen 276 Mann und am 1. April 1707 an das gleiche, jetzt unter Horn stehende Regiment weitere 258 Mann aller Kompanien abgeben. Diese Kompanien wurden darauf je ein Jahr voll verpflegt. Von den Überschüssen, die sich daraus ergaben, hatten die Kompaniechefs innerhalb dieser Zeit ihre Kompanien durch Neuwerbung wieder aufzufüllen.
Am 8. Mai 1708 marschierte ein Bataillon von 5 Kompanien (550 Köpfen) des Regiments nach Hamburg, wo


|
Seite 132 |




|
Unruhen in der Bevölkerung ausgebrochen waren und schwedische, hannoversche und preußische Truppen als niedersächsische Kreistruppen zur Wiederherstellung der Ordnung eingesetzt wurden. Anfang Juli traf das durch Oberstleutnant Lewenhaupt geführte Bataillon wieder in Wismar ein 60 ).
Im nächsten Jahre (1709) wurde das ganze Regiment Ridderhielm mobil gemacht. Zelte und Kochkessel wurden in Hamburg und Lübeck in Auftrag gegeben, Regiments- und Medikamenten-Wagen beschafft, 168 Pferde zum Transport der Wagen angekauft und 43 Kutscher angeworben. Die fehlenden Stabspersonen wurden ernannt. Am 8. Mai konnte das Regiment nach Pommern ausmarschieren. Es hatte in den Kompanien einen Stand von 37 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 24 Spielleuten, 72 Korporalen und 1110 Mann, war also mit 1303 Mann in seinen 12 Kompanien nahezu komplett. Es stieß zum Krassowschen Korps, das in Polen operierte. Ein Bataillon des Regiments lag im Juli in der Festung Posen. Die Pest wütete stark unter den Truppen Krassows. Auch Desertionen brachten zahlreiche Abgänge. Schon im Juni fehlten 95, im Juli 149, im August 198 und im September 223 Mann an der Ausmarschstärke. Nach der Niederlage der Hauptarmee bei Pultawa räumte auch Krassow mit seinem Korps Polen und ging nach Pommern zurück. Von Stettin marschierte das Regiment Ende Oktober über Waren, Plau, Goldberg, Sternberg wieder nach Wismar, wo es am 6. November eintraf 61 ). Ohne Offiziere hatte es nur noch 930 Köpfe. Es fehlten also 354 Mann, im Januar 1711 sogar 413. Bereits im November schlug der Vizegouverneur von Wismar vor, das nochweit stärker mitgenommene Regiment Bretholtz (21) aufzulösen und unter das Ridderhielmsche Regiment zu stecken. Am 10. Januar 1710 wurde dieser Vorschlag ausgeführt und die Mannschaft des Bretholtzischen Regiments mit 1 Unteroffizier, 1 Tambour und 355 Mann dem Regiment Ridderhielm einverleibt, das dadurch mit 1233 Unteroffizieren und Mannschaften wieder annähernd den Sollstand erhielt. Die übriggebliebenen 104 Bagagepferde wurden am 14. Januar an das Dragonerregiment Marschalck abgegeben 62 ).
Generalleutnant Ridderhielm war am 13. August 1709 in Wismar gestorben. Die Ernennung eines neuen Regiments-


|
Seite 133 |




|
chefs war schwierig, da der König nach der Schlacht bei Pultawa in der Türkei weilte und Befehle von ihm nur mit großer Verzögerung und oft überholt in Schweden eintrafen. Seit dem Mai 1710 führen die Musterlisten des Regiments als neuen Kommandeur den Oberst Hinrich Jochim Wangelin auf. Während der Zeit seines Kommandos hatte das Regiment den Namen Gouverneur-Regiment verloren und hieß Ordinäres Wismarsches Infanterieregiment des Obersten Wangelin. Gouverneur war nämlich Generalleutnant Mauritz Vellingk, der sein in Stade und Holstein stehendes Regiment beibehielt. 1711 wurde der Generalmajor Reinhold Johan Fersen zum Gouverneur in Wismar ernannt, aber nur im April dieses Jahres als Chef des Regiments geführt. Da er in Schweden blieb und zum königlichen Rat ernannt wurde, bezeichnete man das Regiment jetzt als "Vakantes Wismarsches Gouverneurregiment". So auch, als nunmehr seit dem November 1711 Oberst Andres v. Fürstenberg als Kommandeur des Regiments geführt wurde. Er war schon am 23. Mai 1711 durch königliche Order aus Bender ernannt worden, konnte aber wegen der im August erfolgenden Einschließung Wismars durch die Dänen sein Kommando zunächst nicht antreten.
Im September 1711 fehlten dem Regiment an seinem Sollstand von 1320 Köpfen nur 4 Mann. Von den Mannschaften waren 67 auf dem Walfisch, 60 auf Poel, 28 in Pommern und 56 krank, 9 Mann auf Kommando oder im Arrest. Der dienstbare Stand in Wismar betrug zu Beginn der Belagerung daher 1096 Köpfe. Schwere Verluste erlitt das Regiment bei dem Ausfall aus Wismar und dem Gefecht bei Lübow am 5. Dezember. 820 Mann wurden gefangen 63 ). Die schwerer Verwundeten sandte der Feind nach Wismar zurück, da er sie selbst nicht pflegen konnte. Nach einer Liste vom 31. Dezember 1711 waren noch 741 Mann des Regiments in dänischer Gefangenschaft, 75 waren bei dem Ausfall gefallen. Die ganze Stärke des Regiments betrug nur noch 405 Unteroffiziere und Mannschaften. Die 12 Kompanien hatten eine Stärke von nur 25 bis 42 Mann. Auch nach der Aufhebung der Belagerung von Wismar blieb der Stand des Regiments unter Fürstenberg im ganzen Jahre 1712 gering. Im Dezember hatte es nur 459 Unteroffiziere und Mannschaften. Als nach der Schlacht bei Gadebusch die dänischen Gefangenen in Wismar eingebracht


|
Seite 134 |




|
wurden, benutzte man diese Gelegenheit in der damals üblichen Weise zur Komplettierung des Regiments. Zunächst fanden sich unter den Dänen 184 Mann, die früher beim Regiment gestanden hatten, bei Lübow gefangen waren und dänische Dienste angenommen hatten. Weitere 409 Mann wurden aus den dänischen Kriegsgefangenen im Januar 1713 "angeworben" 64 ). Weitere Werbungen kamen hinzu, so daß das Regiment Anfang März mit 1230 Unteroffizieren und Mannschaften seinen Sollstand von 1284 annähernd erreicht hatte. Um so unzuverlässiger war aber die innere Zusammensetzung geworden. Auch die Bekleidung sah bunt aus. Die Schweden trugen ihre blauen Rocke, die angeworbenen dänischen Rekruten aber teils rote, teils weiße Leibröcke und Surtouts. Eine einheitliche Bekleidung mußte daher beschleunigt durchgeführt werden.
Aus Timurtasch bei Adrianopel ernannte der König am 13. Mai 1713 den Generalleutnant Baron Gustaf Adam Taube zum Gouverneur von Wismar und zum Chef des seit Fersens Abgang vakanten Regiments, das unter Fürstenberg stets den Namen "Vakantes Gouverneurregiment" weiter geführt hatte. Taube blieb jedoch in Schweden, und Fürstenberg behielt weiter das Kommando des Regiments und blieb auch Chef der Leibkompanie. Am 24. April 1713 waren an der Trave noch 2 Offiziere 37 Mann des Regiments gegen die in Wismar befindlichen dänischen Gefangenen ausgewechselt worden 64 ).
Fürstenberg führte das Regiment während der zweiten Belagerung von Wismar. Anfang Juli 1715 zählte es 1021 Unteroffiziere und Mannschaften. Im Laufe der Belagerung schmolz es bis zum 20. April 1716 auf 22 Offiziere und 767 Mann zusammen. Das ganze Regiment wurde kriegsgefangen. Nur 2 Offiziere gehörten zu den 1000 eingeborenen Schweden, die in die Heimat entlassen wurden.
Die Uniform des Regiments bestand 1713 aus einem blauen "Surtoutrock" mit gelbem Futter, gelben Aufschlägen und Kragen, weißen Zinnknöpfen, blauem Kamisol, blauen Tuchhosen, gelben wollenen Strümpfen, Schuhen und Hut. Die Unteroffiziere hatten blaues Futter in den Rocken und keine farbigen Aufschläge. Am Hut hatten sie eine silberne Tresse. Die Röcke der Spielleute glichen denen der Mannschaften, waren aber mit Schleifen verziert. Die frühere Bekleidung hatte aus


|
Seite 135 |




|
Mänteln und Leibröcken bestanden. Die Mäntel waren zum Teil zu den Surtouts umgearbeitet worden. Sonst hatte wegen Schwierigkeiten der Geldbeschaffung die Uniformierung nur unvollständig durchgeführt werden können. Auf die Kamisols mußte verzichtet werden. An ihrer Stelle wurde die Brust herunter eine blaue lakene Klappe mit Zinnknöpfen an den Rock gesetzt. Außer den vorgeschriebenen blauen Hosen fanden sich auch solche von rotem und grauem Tuch, neben den gelben Wollstrümpfen auch Strümpfe aus grauem und braunem Laken. Einheitlich war also in Wirklichkeit nur noch der Surtoutrock.
Die Zusammensetzung des Regiments war entsprechend seinem Standort überwiegend norddeutsch. Die Mecklenburger stellten das stärkste landsmannschaftliche Kontingent. Von den 1282 Mann des Regiments waren im September 1703 234 Nordländer und Balten (111 Schweden, 24 Dänen, 9 Norweger, 57 Finnen, 33 Balten), 1016 Deutsche (912 Nord- und Ostdeutsche, 94 Mitteldeutsche und 10 Süddeutsche) und 32 Mann von verschiedener Nationalität (Polen, Böhmen, Ungarn, Russen, Franzosen, Holländer, Schotten, einer aus Konstantinopel). Von den Norddeutschen waren allein 312 Mecklenburger und 51 Wismarer, ferner 219 aus Schwedisch-Pommern und 28 aus dem Herzogtum Bremen.
14.
Wismars Garnisonregiment 65 ).
Ursprünglich war dieses Regiment das Regiment des wismarschen Gouverneurs gewesen. 1684 ist Generalleutnant Baron Otto Johann von Grothusen Chef des Regiments und Gouverneur von Wismar. Als er Kommandant der freien Stadt Hamburg wurde, folgte ihm 1690 Generalleutnant Friedrich von Buchwald als Gouverneur und Chef. 1690, 1691 und 1692 marschierte jedesmal ein Bataillon des Regiments in Stärke von 4 Kompanien im schwedischen Auxiliarkorps an den Rhein gegen die Franzosen 66 ). Buchwald starb am 3. Juni 1693. Sein Nachfolger Mellin behielt sein pommersches Regiment, das jetzt auf den Etat der wismarschen Rentkammer kam. Das bisherige Gouverneurregiment Buchwalds erhielt


|
Seite 136 |




|
im September der Oberst und Generalquartiermeister Jacob von Kemphen. Zum Unterschied von dem neuen Gouverneurregiment Mellins wurde es jetzt "Wismarsches Kommandanten- oder Garnison-Regiment" genannt, wenn es nicht mit dem Namen des Chefs bezeichnet wurde. Da die Stadt Wismar nur ein Regiment unterhalten konnte, kam es auf den Etat des Herzogtums Bremen, und 6 Kompanien des Regiments marschierten im November und Dezember 1693 dorthin ab. Seitdem stand nur ein Bataillon des Regiments in Wismar. Während der Streitigkeiten um die Erbfolge im Herzogtum Güstrow lagen regelmäßig von 1697 bis zum Hamburger Vergleich 23 Mann der 6 Kompanien des wismarschen Bataillons in Boizenburg, 1697 auch eine kombinierte Kompanie als Kreistruppe in der Hauptstadt Güstrow selbst. Auf Kemphen folgte als Oberst und Kommandant im Juli 1697 Magnus Stenbock, der spätere schwedische Armeeführer, auf diesen 1699 der Oberst Magnus Palmquist.
Von dem in Bremen stehenden Bataillon hatte Schweden 1695 ein Bataillon von 5 Kompanien (540 Köpfe) an den jungen Herzog Friedrich IV. von Holstein-Gottorp überlassen, der später Karls XII. Schwester Sophie heiratete. Das Bataillon galt in der Folge stets als holsteinisches, wenn es auch bis 1710 von der Stader Kammer bezahlt wurde. Es erhielt den Namen "Leibbataillon der Herzogin" 67 ). Eine kleine Abteilung des Regiments mußte sich nach Ausbruch der Streitigkeiten mit Dänemark am 23. April 1700 auf Schloß Gottorp ergeben. Der Hauptteil des Bataillons nahm an der Verteidigung Tönnings gegen die Dänen teil 68 ). Die Festung hielt sich, bis am 2. Juni die Belagerung aufgegeben wurde. Auch in den folgenden Friedensjahren blieb das Leibbataillon der Herzogin in Tönning. Erst 1711 wurde es in das bedrohte Stade gerufen, fuhr auf kleinen Schiffen von Tönning in die Elbe und entkam den Dänen glücklich am 5. Juli in die Oste hinein 69 ). Seit diesem Tage trat es wieder in schwedische Verpflegung und in den Verband des Regiments (jetzt Löpenhaupt) zurück.
Eine einzelne Kompanie des bremischen Bataillons hatte offenbar in diesen Jahren weiterhin im Herzogtum Bremen gestanden, wahrscheinlich auf dem Ottersberg.


|
Seite 137 |




|
Das wismarsche Bataillon Palmquist hatte im Herbst 1702 48 Mann zur Artillerie des Feldheeres nach Pommern gestellt, die bis zum April des nächsten Jahres durch Rekruten ersetzt wurden. Chef des Regiments wurde nach Palmquist (Sept. 1706) der bisherige Oberstleutnant Baron Carl Gustav Sperling. Unter ihm wurde am 8. Mai 1708 ein Bataillon von 5 Kompanien (550 Mann) unter Oberstleutnant von Nolcken als niedersächsische Kreistruppe in das unruhige Hamburg gesandt. Es kehrte Ende Juni schon wieder nach Wismar zurück 70 ). Sperling starb am 2. November 1708. Das Regiment blieb vakant, bis am 11. Oktober 1709 Oberst Graf Carl Julius Löwenhaupt zum Chef des Regiments ernannt wurde.
Nachdem das Bataillon aus holsteinischen Diensten nach Stade zurückgekehrt war, übernahm der zum Oberkommandanten der Festung ernannte Löwenhaupt durch Tausch eine dortige Kompanie, so daß das Stader Bataillon jetzt Leibbataillon wurde. Bei der Kapitulation Stades am 7. September 1712 wurde es kriegsgefangen (11 Offiziere, 241 Mann) 71 ).
Das wismarsche Bataillon hatte unter Major Rosenacker an der Verteidigung der Stadt während der ersten Belagerung teilgenommen und bei dem großen Ausfall der Garnison am 5. Dezember 1711 nicht weniger als 29 Tote und 450 Gefangene verloren, wovon 39 Verwundete von den Dänen wieder nach Wismar hineingesandt wurden. Das Bataillon behielt in Wismar nur 148 Mann und hatte auch im Dezember 1712 bloß 219 Unteroffiziere und Mannschaften. Erst nach der Schlacht bei Gadebusch konnte es aus den alten, unter die Dänen gesteckten Leuten des Bataillons (44), die jetzt wieder eingestellt wurden, und aus angeworbenen Dänen ergänzt werden. An der Trave wurden am 24. April 1713 weitere 8 Offiziere und 61 Mann des Regiments gegen dänische Gefangene eingetauscht. Im März hatte das Bataillon 606 Mann 72 ), im Juni war das wismarsche Bataillon bis auf 14 Mann komplett. 47 Mann des Leibbataillons aus Stade, die auch aus der Gefangenschaft freigekommen waren, und 45 Mann des Stader Bataillons Vellingk waren bis zum Mai dem Regiment zugeteilt und bil-


|
Seite 138 |




|
deten dann eine eigene "Stader Kompanie" unter Kapitän Rüttwin, dann die ersteren eine kleine selbständige Kompanie von 38 Mann unter Kapitän Vellingk auf Poel.
Am 25. August 1714 erhielt das Regiment an Stelle des verabschiedeten Löwenhaupt den Generalmajor Carl Adam Stackelberg zum Chef und wurde im Oktober 1714, da die wismarsche Garnison zu stark angeschwollen war, nach Stralsund verlegt. Dort ging das Regiment am 23. Dezember 1715 durch die Kapitulation der Festung verloren 73 ).
Die Uniform des Regiments sollte nach den Vorschlägen vom Frühjahr 1713 aus blauen Röcken, Westen und Hosen bestehen. Die Röcke waren zum Teil aus den alten Mänteln anzufertigen. Mutter, Kragen und Aufschläge waren rot.
Die Zusammensetzung des wismarschen Bataillons war im September 1703 überwiegend deutsch. Neben 504 Deutschen standen 99 Schweden, 4 Finnen, 14 Kur- und Livländer, 7 Dänen, 3 Polen und 2 Franzosen. Von den Deutschen stellte Mecklenburg mit 212 (einschl. 44 Wismarer) das größte Kontingent, dann folgten Herzogtum Bremen mit 72, Pommern mit 37 und Lübeck mit 30. Von den übrigen waren 125 Norddeutsche, 24 Mitteldeutsche und 4 Süddeutsche. Der Standort des Regiments war also für seine Zusammensetzung entscheidend.
15.
Stades Garnisonregiment 74 ).
Das Stader Garnisonregiment hatte bereits 1691 den späteren Generalgouverneur Baron Mauritz Vellingk zum Chef gehabt und in diesem und im nächsten Jahre je 4 Kompanien den Sommer über nach Wismar zu Fortifikationsarbeiten gestellt 75 ). Im Sommer 1699 wurden 6 Kompanien des Regiments an Holstein-Gottorp überlassen. Sie nahmen im Jahre 1700 an der erfolgreichen Verteidigung der Festung Tönning teil. Später standen 3 Kompanien in Husum, 2 in Tondern und 1 in Apenrade. 1711 sollte bei dem drohenden dänischen Angriff auf die deutschen Provinzen Schwedens dieses Bataillon nach dem Herzogtum Bremen überführt werden. Es
76) NKH, I, 177, 294.


|
Seite 139 |




|
kam jedoch nicht mehr durch und blieb in Tönning 77 ). Durch den Einmarsch der Armee Stenbocks in Eiderstedt im Februar 1713 wurde auch Tönning in den Krieg hineingezogen. In die Kapitulation der Armee bei Oldenswert am 16. Mai 1713 war die Festung Tönning nicht eingeschlossen. Sie blieb im Jahre 1713 von den Dänen blockiert und kapitulierte am 7. Februar 1714 gegen freien Abmarsch der ganz außerordentlich zusammengeschmolzenen Besatzung nach Eutin 78 ).
Das andere Bataillon des Regiments Vellingk hatte weiterhin die Besatzung von Stade gebildet und war bei Übergabe dieser Festung am 7. September 1712 in Kriegsgefangenschaft geraten 79 ). Von diesem Bataillon sammelten sich beim Regiment Löwenhaupt (14) aus den bei Gadebusch gefangenen Mannschaften, die unter dänische Regimenter gesteckt waren, aus Ranzionierten und an der Trave ausgetauschten bis zum Mai 1713 45 Mann in Wismar. Sie kamen dann zu einer Kompanie Rüttwin, die aus Stader Truppen auf Poel zusammengestellt war, und später zum Feldstaatsregiment Klingstedt, zuletzt zu dem daraus gebildeten Bataillon Wrangel. Beim Abmarsch der Feldstaatstruppen nach Stralsund im Oktober 1714 blieben sie in Wismar und bildeten mit dem aus Eutin eingetroffenen Bataillon den Stamm für die Neubildung des Regiments 80 ).
Das Bataillon aus Holstein war am 19. September 1714 aus Gottorper Diensten entlassen und in Wismar eingetroffen. Es hatte nur noch 10 Offiziere, 44 Unteroffiziere und Mannschaften in seinen 6 Kompanien! Dazu kamen jetzt 3 Offiziere 52 Mann vom Bataillon Wrangel. Das ganze "Regiment" hatte daher bei der Musterung am 15. Oktober 1714 nur 13 Offiziere 96 Mann von allen 12 Kompanien. 11 Offiziere waren kommandiert, zum größten Teil beim Feldstaatsregiment in Stralsund, oder beurlaubt. Kommandeur des Regiments, das Vellingk als Chef behielt, war der Oberst von Rosen und nach dessen Tode Oberst Wrangel, der aber nicht beim Regiment weilte, sondern Kommandeur des Feldstaatsregiments in Stralsund war. Bis zum Juli 1715 stieg der Stand des Regiments auf 20 Offiziere 164 Mann an. Im Februar 1716 wurden während der Belagerung von Wismar 11 Offi-


|
Seite 140 |




|
ziere und 11 Unteroffiziere zu dem mit wenigen Offizieren in Wismar angekommenen Regiment Skaraborg (5) kommandiert, das dadurch seine 4 kombinierten Kompanien wieder in 8 auseinanderziehen konnte. Am 20. April 1716 hatte das Regiment nur noch 18 Offiziere, 78 Mann. Es geriet durch die Kapitulation Wismars bis auf 12 Offiziere, die nach Schweden reisen durften, in Kriegsgefangenschaft.
Die Uniform bestand seit 1710 aus blauem Rock mit karmoisinen Aufschlägen, rotem Futter, zinnernen Knöpfen, blauem Kamisol, kalbledernen Hosen, blauem, rot gefüttertem Mantel mit rot-weißer Schnur, Hut und weißwollenen Strümpfen. 8 Offiziere und Unteroffiziere des Regiments und 100 Mann (für jede Kompanie 8 - 9) hatten mit weißem Kamelgarn bordierte Grenadiermützen erhalten.
Bei der Generalmusterung im Januar 1715 waren von den 131 Mann des gebliebenen Stammes aller 12 Kompanien 11 Schweden, 19 Balten, 3 Finnen und 81 Deutsche (darunter 30 aus Bremen), die restlichen 17 verteilen sich auf Dänemark, Norwegen, Polen, Flandern, Frankreich, England, Irland und Konstantinopel. 15 Mann hatten vorher in dänischen Diensten gestanden.
16.
Bremisches Infanterieregiment.
Das Regiment des Generalgouverneurs von Bremen, Generalleutnants Nils Gyllenstierna, hatte 1700 nur ein Bataillon von 6 Kompanien gehabt. Im Laufe des Krieges erhielt es ein zweites Bataillon. 1711 wurde es bis auf eine Kompanie, die in Ottersberg stand, nach Pommern verlegt und kam mit 3 Kompanien nach Stralsund, mit dem Rest nach Stettin. Das Kommando hatte jetzt Oberst Ludwig Franz Wullwart. Die in Bremen gebliebene Kompanie des Kapitäns Bergen wurde am 7. September 1712 bei der Kapitulation von Stande kriegsgefangen. Die in Stettin stehenden Kompanien kamen nach der Kapitulation dieser Festung am 29. September 1713 ebenfalls nach Stralsund und wurden hier bei der Kapitulation im Dezember 1715 kriegsgefangen 81 ).
In Wismar hatte das Regiment 1711 auf dem Durchmarsch vorübergehend gestanden. Ende April kam der Oberst Wull-


|
Seite 141 |




|
wart mit 550 Mann dort an und in den ersten Maitagen folgte ihm Major Kruse mit 3 Kompanien, 250 Mann, die vorher als Truppen des niedersächsischen Kreises in Hamburg gestanden hatten. Am 23. Juli marschierte das Regiment nach Pommern ab 82 ).
Von der in Stade gefangenen Kompanie wurden 3 Mann aus den eingebrachten Gefangenen nach der Schlacht bei Gadebusch übernommen und 14 Mann am 24. April 1713 an der Trave gegen dänische Gefangene ausgetauscht. Mit den Feldstaatstruppen gingen sie im Oktober 1714 nach Pommern weiter 83 ).
17.
Leibregiment Königin-Witwe 84 ).
Das Leibregiment der verwitweten Königin von Schweden hatte unter dem Oberst Carl Leonhardt Müller von der Lühne bis Oktober 1693 teils in Wismar und teils im Herzogtum Bremen gestanden. Im Oktober 1693 kam es im Austausch gegen das Regiment des neuen Gouverneurs von Wismar (Mellin) auf den pommerschen Etat und marschierte mit 8 Kompanien aus Wismar und 4 aus Verden nach Stettin ab. 1694 und 1695 arbeiteten noch einmal den Sommer über je 2 Kompanien des Regiments an den wismarschen Befestigungswerken. 1700 nahm es an dem holsteinischen Feldzug teil, berührte Wismar aber nicht 85 ). 1708 wird Oberst Johann Christof Stuart als Chef des Regiments genannt. Als Stettin am 29. September 1713 kapitulieren mußte, blieb das Regiment im Gottorper Sold und Eid bis Januar 1714 als neutrale Besatzung in der sequestrierten Festung. Dann wurde es durch Gottorper Truppen abgelöst und kam nach Stralsund. Hier wurde das Regiment, jetzt unter Kommando des Obersten Johann Reinhardt Trautvetter, durch die Kapitulation vom 23. Dezember 1715 kriegsgefangen 86 ).
Während des Nordischen Krieges hatte ein ursprünglich nach Holstein bestimmtes Bataillon des Regiments der verwitweten


|
Seite 142 |




|
Königin von Schweden, dessen Kommandant damals Generalleutnant Müller von der Lühne war, von Februar bis Mai 1706 vorübergehend im Amte Neukloster gelegen. Das Kommando dieses Bataillons hatte der spätere Kommandant des Regiments, Stuart, als Oberstleutnant geführt 87 ).
18.
Stralsunds Garnisonregiment 88 ).
Der Chef dieses 12 Kompanien starken Regiments war 1689 der Oberst Peter Macklier gewesen. Es hatte schon 1692 vier und 1693 und 1694 je zwei Kompanien den Sommer über nach Wismar als Besatzung gestellt 89 ). 1700 wird der Oberst Johann Klinkowström als Chef genannt und 1706 der Oberst Baron Martin Schoultz von Ascheraden. Im Februar 1706 wurden dann vorübergehend 6 Kompanien des Regiments (Leibkompanie, Major Grubbenhielm, Kapitän Taube, Hertel, Wulffrad und Bruyn) nach Poel in Quartiere gelegt. Sie blieben dort bis Ende Mai und gingen dann nach Pommern zurück 90 ). Schoultz wurde im Mai 1711 Vizegouverneur der Festung Wismar und leitete die Verteidigung während der Blockade von 1711/12. Er benutzte diese Stellung, um bei der nur lockeren Einschließung und der günstigen Lage Wismars zu den großen Werbeplätzen Hamburg und Lübeck hier Rekruten für sein Stralsunder Regiment werben zu lassen. Die ersten Mannschaften dieser "Freikompanie", wie sie auch genannt wurde, ließen sich im August 1711 anwerben. Bis zum April des nächsten Jahres stieg die Zahl dieser Rekruten auf 4 Unteroffiziere und 126 Mann. Am 14. April wurden nach Aufhebung der Blockade 50 Mann nach Stralsund geschickt, einige waren wieder desertiert, 60 blieben weiter in Wismar. Ein Bataillon des Regiments stieß im Herbst 1712 zur Feldarmee Stenbocks und nahm an der Schlacht bei Gadebusch und der Kapitulation von Oldenswert teil 91 ). Darauf sammelten sich in Wismar außer den Rekruten im Frühjahr 1713 auch 28 zurückgebliebene oder entlassene Kranke des Regiments an.


|
Seite 143 |




|
So konnten am 22. Mai 1713 abermals 51 Mann nach Stralsund gesandt werden. In Wismar blieben 3 Unteroffiziere und 39 Mann zurück, die sich durch Anwerbung bis zum Dezember 1714 wieder auf 65 Köpfe verstärkten. Diese Rekrutenabteilung wurde dann am 13. Dezember 1714 zum Regiment in Stralsund gesandt. Dort ging das Regiment am 23. Dezember 1715 durch Kapitulation verloren 92 ). Schoultz wurde für die tapfere Verteidigung von Wismar 1715/16 vom König zum Generalleutnant ernannt 93 ).
19.
Pommersches Infanterieregiment.
Das Regiment hatte seine Garnison ebenfalls in Stralsund. Chef war 1690 der pommersche Generalgouverneur und Feldmarschall Graf Nicolaus Bielke gewesen. 1693 hatten 2 Kompanien des Regiments den Sommer über mit an den Befestigungswerken von Wismar gearbeitet 94 ). Zu Beginn des Nordischen Krieges war der nunmehrige Generalgouverneur von Pommern, Feldmarschall Graf Jürgen Mellin, Chef des Regiments. Es wurde 1702 zu dem sich in Pommern formierenden Korps Gyllenstiernas bestimmt und marschierte mit diesem nach Polen. Als Regimentschef wird 1703 der Oberst Sparre und 1705 Oberst Horn genannt. 1709 kam das Regiment unter Krassow aus Polen zurück und wurde nach Stettin gelegt. Hier mußte es am 29. September 1713 kapitulieren. Die Festung wurde von neutralen preußischen und Gottorper Truppen in "Sequester" genommen und sollte auf Grund des Hauptrezesses von Schwedt erst nach abgeschlossenem Frieden an Schweden zurückfallen. Da Holstein-Gottorper Truppen zunächst nicht zur Verfügung standen, wurde das Hornsche Regiment zunächst in Gottorper Eid genommen und erst im Januar 1714 durch Holsteiner abgelöst. Es ging nach Stralsund und wurde bei der Kapitulation dieser Festung kriegsgefangen 95 ).
Zu Wismar hat das Regiment nur insoweit in Beziehung gestanden, als es während des polnischen Feldzuges zweimal


|
Seite 144 |




|
durch die in Pommern, Wismar und Bremen stehenden Regimenter aufgefüllt wurde. Auch das wismarsche Regiment des Gouverneurs Ridderhielm (13) gab im Juni 1704 276 und im April 1707 258 Mann an das pommersche Infanterieregiment ab.
20.
Elbings Garnisonregiment.
Das Regiment unter Kommando des Obersten Graf Clas Johansson Ekeblad war im Winter 1703/04 als Besatzung für die von den Schweden eroberte Festung Elbing errichtet worden. Auch von den Offizieren der wismarschen Garnison waren einige jüngere Offiziere zu diesem Regiment übergetreten und zur See nach Elbing abgegangen. Später kam das Regiment zum Korps Krassows, ging mit diesem 1709 nach Pommern zurück und wurde nach Stralsund in Garnison gelegt. 1712 trat es zur Feldarmee Stenbocks über, focht unter diesem bei Gadebusch und wurde auch in die Kapitulation von Oldenswert verwickelt 96 ).
Das Regiment hatte im Gegensatz zu den geworbenen deutschen Regimentern einen Stand von 8 Kompanien. Von allen 8 Kompanien (Leib-, Oberstleutnant, Major, Kapt. Usendorf, Sybrand, Völschen, Lochmann, Zuchmeister) fanden sich bis Januar 1713 Kranke und Verwundete aus der Schlacht bei Gadebusch in Wismar ein. 24 lagen in den Lazaretten, 54 waren dem Regiment Fürstenberg (13) zugeteilt. Sie kamen, noch 67 Mann, im Juni des Jahres zur Kompanie Sybrand des Feldstaatsregiments (23) 97 ).
21.
Fremdländisches Infanterieregiment 98 ).
Dieses Regiment, das in der schwedischen Armee neben dem Namen des Chefs auch "Fremlingar", d. h. Fremdländer genannt wurde, ist eins der seltsamsten Regimenter der schwedischen Armee. Am 19. Dezember 1706 schloß der König Karl XII. In Alt-Ranstädt eine Kapitulation mit dem Obersten Carl Bretholz ab, nach der dieser die Aufstellung eines


|
Seite 145 |




|
Regiments zu Fuß von 8 Kompanien zu je 125 Mann übernahm. Der Stab des Regiments sollte bestehen aus: Oberst, Oberstleutnant, Major, Regimentsquartiermeister, 2 Priestern, Auditeur, Adjutant, Regimentsfeldscher, 8 Gesellen, 1 Regimentsweibel, 6 Hautboisten, 8 Profossen, also 32 Personen; die Primaplanen aus 3 Offizieren, 5 Unteroffizieren, 1 Musterschreiber und 2 Trommlern, also aus 11 Köpfen. Dazu kamen für das Regiment 110 Troßknechte. An Werbegeld sollten 36 Taler für den Mann gezahlt werden, der vollständig bekleidet und ausgerüstet zur Musterung gestellt werden mußte. Geworben werden durften Deutsche und Franzosen, auch Schweizer, aber keine Sachsen, da die schwedische Armee damals selbst in Sachsen stand. Die Bestellung des Regiments hatte bis Ende Mai 1707 an einem noch zu bestimmenden Ort zu geschehen.
Die Zeit verschob sich, da die Werbung doch mehr Schwierigkeifen machte, als zunächst angenommen war. Bretholz warb in Frankfurt am Main unter den zahlreichen französischen Kriegsgefangenen, die sich nach den Siegen des Prinzen Eugen und Marlboroughs in den Rheinlanden befanden und dort zur Last fielen, da an einen Austausch zunächst nicht zu denken war. So überließ man sie gerne den Schweden. Da die französischen Regimenter weit mehr Offiziere hatten als die deutschen und schwedischen, erhielt Bretholz am 12. Februar die Erlaubnis zur "besseren Facilitierung der Werbung" für jede Kompanie doppelte Offiziere, Feldwebel, Sergeanten und Fouriere anzunehmen. Dann wurde am 15. August der Auftrag dahin erweitert, daß 200 Mann über die erste Kapitulation geworben werden sollten. Infolgedessen zählte das Regiment außer dem Stab und den 100 Troßknechten jetzt: 8 Kompanien zu je 6 Offizieren (Premierkapitän, Sekondkapitän, Premierleutnant, Sekondleutnant, Premierfähnrich, Sekondfähnrich), 9 Unteroffizieren (Premierfeldwebel, Sekondfeldwebel, Premiersergeant, Sekondsergeant, Premierführer, Sekondführer, Musterschreiber, Fourier, Captain d'armes), 2 Tambours (also 17 Köpfen der Primaplana), 6 Korporalen und 134 Mann (zus. 167 Köpfen) = insgesamt 1336 Köpfe.
Zum Sammelplatz des Regiments wurde Wismar bestimmt. Dort trafen die ersten 100 Mann am 7. April 1707 ein. Am 11. Oktober sollte das Regiment endlich gemustert werden. Bei dem Versuch dazu stellten sich aber soviel Mängel und soviel Unordnung in den eingeteilten Kompanien heraus, daß die Musterung um einen Monat verschoben werden mußte und erst


|
Seite 146 |




|
in den Tagen zwischen dem 1. und 8. November stattfand. Schon vor dieser Zeit war im Regiment wie es bei seiner Zusammensetzung aus größtenteils gepreßten Kriegsgefangenen nicht anders zu erwarten war, eine derartig starke Desertion eingerissen, daß die auf Grund des Befehls vom 14. August nachgeworbenen 200 unter die ersten 1000 Mann gesteckt werden mußten und das Regiment zunächst nur 8 Kompanien zu 142 Köpfen, also 1136 Mann, musterte. Am 3. Februar 1708 konnten dann die in Frankfurt nachgeworbenen 200 Mann, größtenteils ebenfalls Franzosen, zur Musterung gestellt werden und das Regiment in Zukunft den Sollstand von 1336 Köpfen ohne Stab führen. Während des ganzen Jahres blieb das Regiment in Wismar und annähernd komplett.
Im Mai 1709 zählte es 51 Offiziere, 1187 Unteroffiziere und Mannschaften. Am 8. Mai marschierte das Regiment zum Krassowschen Korps ins Feld nach Posen 99 ). Dieser Marsch wurde ihm zum Verhängnis. In der stets bewachten Festung Wismar war eine Desertion schwierig gewesen, im Felde bot sich Gelegenheit genug. Schon im Juni und Juli desertierte bei der Leibkompanie ein Viertel der Mannschaft. Bei den andern Kompanien wird es ebenso gewesen sein. Es nützte daher auch nichts, daß das Regiment am 1. September von einem (offenbar polnischen?) Regiment des Obersten Tarlow etwa 280 Mann überwiesen erhielt (je Kompanie 34 - 37). Der Heimweg wurde zur Katastrophe. Die Leibkompanie verlor im September mit 67 Mann fast die Hälfte des Bestandes. Die Kompanie Berch hatte während des Feldzuges 124 Desertierte, 7 "Strangulierte" (also hatte auch der Profoß gute Arbeit gehabt), 13 Gestorbene und 9 Kassierte, d. h. wegen Unbrauchbarkeit verabschiedete gehabt. Im Oktober stand das Regiment in Stettin und lieferte dort bereits einen Teil der erhaltenen Feldausrüstung ab. Anfang November traf es wieder in Wismar ein 99 ). Es hatte in den Kompanien nur noch 46 Offiziere und 507 Mann. 680 Mann und unter Einrechnung der vom Regiment Tarlow übernommenen sogar 960 Mann waren also im Feldzuge verloren, größtenteils durch Desertion.
Ein Weiterbestand dieses unzuverlässigen Regiments war zwecklos. Es aufzufüllen hätte große Mittel erfordert. Dazu kam, daß das Regiment im Gegensatz zu den schwedischen sehr


|
Seite 147 |




|
zahlreiche Offiziere hatte und seine Unterhaltung dadurch sehr teuer wurde. 1 Unteroffizier, 1 Tambour und 355 Mann des Regiments wurden am 10. Januar 1710 in das ebenfalls in Wismar stehende vakante Ridderhielmsche Regiment (13) untergesteckt, die Offiziere, 52 Unteroffiziere und 36 Korporale verabschiedet oder später in andere Regimenter übernommen 100 ).
Die Uniform des Regiments bestand aus einem blauen Rock mit "aurora" Unterfutter, Messingknöpfen, blauen Aufschlägen und Kragen, blauem Kamisol, blauen Tuchhosen, aurora Strümpfen, schwarzem Hut mit weißer Borte und großem weißen Knopf, blauem Mantel mit aurora Boy gefüttert, juchtenledernen Schuhen und schwarzem Halstuch. Die Korporale hatten zur Unterscheidung doppelte Knopflöcher, die mit aurora Kamelhaargarn ausgemacht waren. Die Tambours trugen dazu noch an den Seiten und auf dem Rücken rotwollene Steifen am Pierock (statt des Mantels), und ihr Rock war an allen Nähten mit drei Finger breiter wollener Schnur reich verbrämt. Um den Hut hatten sie ebenfalls eine rot-weiße Schnur. Röcke und Mäntel der Unteroffiziere waren blau gefüttert. Am Rock trugen sie vorn herunter eine silberne Platte. Taschen, Kragen, Aufschläge und Rücken waren mit starker silberner Tresse eingefaßt. Für den Ausmarsch sollten sie lederne Stiefeletten (Gamaschen) erhalten.
Die Ausrüstung der Unteroffiziere bestand aus einem Degen, der an einem büffelledernen Gehänge mit Messingschnalle getragen wurde, und dem Kurzgewehr (Sponton). Die Trommler führten keine Waffe und trugen die Trommel an einem Trommelriemen von Büffelleder, der mit rotem Juchten eingefaßt war. Die Mannschaften hatten einen Degen am büffelledernen Gehänge, eine Flintenmuskete mit Bajonett und einen Bandolierriemen aus Büffelleder mit rotjuchtener Patronentasche, Pulver- und Fetthorn und 3 Räumnadeln.
Die Fahnen waren von aurora und dunkelblauem Taft mit verschlungenem C und Krone, die der Leibkompanie weiß und dunkelblau. Jede Kompanie hatte eine Fahne. Zur Feldausrüstung des Regiments gehörten 1 Feldscherwagen, 2 Munitionswagen, 12 Proviantwagen, 18 Krankenwagen, alle vierspännig, und 36 Packpferde für die Zelte.
Die Zusammensetzung dieses Ausländerregiments war bunt. Von 1326 Mann des Regiments, deren Heimat bei


|
Seite 148 |




|
den Musterungen in den Jahren 1707 und 1708 genannt wird, waren 521 Franzosen, 100 Italiener, 39 Wallonen, Flamen und Holländer, 66 Engländer, Iren und Schotten, 23 Schweizer, 8 Spanier und Portugiesen, 19 Polen, Böhmen, Kroaten und Ungarn, nur 25 Skandinavier und Balten (darunter 10 Schweden!) und 524 Deutsche (darunter dem Werbeplatze entsprechend sehr viel Rheinländer, Pfälzer und Hessen (161), und 85 Süddeutsche). Schwedische Untertanen waren unter den Deutschen 22 Pommern, 3 Wismarer, 10 Bremer und 23 Zweibrücker. Trotzdem das Regiment sich in Wismar sammelte, waren (außer den Wismarern) nur 18 Mecklenburger darunter.
Ebenso bunt wie die Zusammensetzung des Regiments war die des Offizierkorps. Die Offiziere stammten aus allen Teilen Europas, sie hatten teils schon den verschiedensten Herren gedient, zum Teil schon als Gemeiner angefangen, zum Teil auch nur als Volontär an Kriegszügen bisher teilgenommen.
22.
Rheinisches Regiment.
In dem Herzogtum Zweibrücken, dem Stammlande Karls XII. stand während des Nordischen Krieges außer dem Regiment des Generalgouverneurs noch ein Infanterieregiment, das unter Oberst Carl Magnus Baron Leutrum am Spanischen Erbfolgekriege in englischem Sold teilgenommen hatte. Am 13. Januar 1712 hatte Leutrum mit dem Generalgouverneur von Bremen, Vellingk, eine Kapitulation abgeschlossen und stand nun in Zweibrücken. Von dort sollte das Regiment, das 12 Kompanien und damit offenbar den Stand der andern deutschen Regimenter hatte, 1714 nach Pommern marschieren. Aber alle Versuche, dem Regiment einen "transitum innoxium" nach Reichsbestimmungen zu gewähren, schlugen fehl. Dänemark, Hannover und Preußen sperrten ihre Grenzen Ohne Durchmarsch durch deren Gebiete konnte das Regiment nicht nach Pommern kommen. Und doch ließ sich die Überführung des Regiments nicht verhindern. Es wurde in Zweibrücken aufgelöst, und als Handwerker verkleidet durchwanderten Offiziere und Mannschaften in kleinen Trupps, mit hessischen Pässen versehen, die feindlichen Lande 101 ). Ende September 1714 fanden sich die ersten 64 Mann in Wismar ein. Von dort wurden sie in 17 Transporten von 13 - 50 Mann


|
Seite 149 |




|
nach Stralsund weitergeleitet, nachdem sie sich in Wismar einige Tage von den Strapazen des Marsches erholt hatten. Die Transporte begannen am 10. November, der letzte ging am 13. April 1715 nach Stralsund ab. Es war bei diesen Schwierigkeiten selbstverständlich, daß von einem geworbenen Regiment nur die zuverlässigsten Mannschaften durchkamen, die andern gingen unterwegs verloren. Sie mußten durch Neuwerbung ersetzt werden, die hauptsächlich in Hamburg erfolgte. Die Annahme der Neugeworbenen geschah dann in Wismar. Es passierten durch Wismar in diesem halben Jahr vom alten Stamm des Regiments (12 Kompanien: Oberst, Oberstleutnant, Major Schleicher, Kapt. Jung-Schleicher, Alt-Schleicher, Bobenhausen, Klopzinsky, Schwartzen, Wöllwart, Sent, Reinfort, Engelbrecht) außer den Offizieren 8 Stabspersonen, 28 Unteroffiziere, 6 Spielleute, 12 Korporale, 161 Mann, also 215 Köpfe und an neugeworbenen Rekruten 319, im ganzen also 534 Mann. Andere waren direkt nach Stralsund durchgekommen 102 ). In Stralsund wurde das Regiment durch die Kapitulation von 1715 kriegsgefangen 103 ).
C. Feldstaatstruppen.
23.
Regt. Klingstedt, später Batl. Wrangel und Numers 104 ).
Außer den eingeteilten und geworbenen Regimentern findet sich in Wismar ein Regiment, das aus beiden Teilen der schwedischen Armee zusammengesetzt war, das "Feldstaatsregiment" des Obersten Klingstedt. Nach der Schlacht bei Gadebusch waren etwa 2000 Kranke und Verwundete von der Armee Stenbock im Dezember 1712 nach Wismar eingebracht worden. Ein Teil konnte schon am 29. Dezember, weitere im Januar 1713 der Armee wieder folgen, ein Teil starb in Wismars Lazaretten. Im Januar 1713 lagen nach den Verpflegungslisten 465 Mann Infanterie in den Lazaretten und Bürgerhäusern. Die leichter Verwundeten und Kranken waren den einzelnen wismarschen Regimentern zugeteilt:


|
Seite 150 |




|
| dem Regt. Fürstenberg | 217 | (Dahl 163, Ekeblad 54) |
| dem Batl. Löwenhaupt | 72 | (Wermland) |
| dem Regt. Hestkov | 326 | (darunter: Ostgiötha 93, Westmanland 105, Helsinge 123) |
| dem Regt. Buhrenskiöld | 240 | (Elfsborg 173, Westgiötha-Dahl 13, Södermanland 54) |
| der Komp. Schultz | 28 | (Schoultz) |
| ------------ | ||
| 883 | ||
Die am besten Wiederhergestellten wurden nach Grevesmühlen geschickt, andere nach Poel. Der Rest bildete mit den in den Lazaretten Liegenden zwei Kommandos in Wismar, so daß am 1. April 1713 an Feldstaatstruppen, ohne die jetzt stets bei der wismarschen Rekrutenkompanie des Regiments Schoultz geführten Verwundeten dieses Regiments, erscheinen:
| Kommando bei Grevesmühlen, Kapt. Uggla, | 207 | Mann (von 7 Regt.) |
| Kommando auf Poel, Kapt. Ahlbeck, | 163 | Mann (von 8 Regt.) |
| Kommando in Wismar, Oberstl. Fuchs, | 428 | Mann (Dahl 195, Södermanland 45, Westmanland 81, Wermland 63, Ekeblad 44, dar. 166 krank) |
| Kommando in Wismar, Oberstl. Sterncranz, | 439 | Mann (Ostgiötha 93, Helsinge 140, Elfsborg 114, Westgiötha 93, dar. 145 krank) |
| ------------ | ||
| 1237 | ||
Anfang Juni standen bei Grevesmühlen 209, auf Poel 231 (inkl. einer aus den Ranzionierten der in Stade gefangenen Bataillone Vellingk und Löwenhaupt, der Kompanie Wöllwart und bremischer Landmiliz gebildeten "Stader Kompanie"), unter Kapitän Freytag (statt Fuchs) 396 und unter Kapitän Knorring (statt Sterncranz) 436 Mann, insgesamt also 1272 Mann.
Aus diesen Mannschaften der Feldarmee wurde am 17. Juni 1713 unter dem Obersten Hinrick Klingstedt ein Regiment von 12 Kompanien gebildet, das schon am gleichen Tage mit auf Wache zog. Die Offiziere hatte zum großen Teile der in Wismar liegende Rest des Regiments Vellingk gestellt. Offiziere und Unteroffiziere wurden möglichst so verteilt, daß jede Kompanie 3 Offiziere, 6 Unteroffiziere und 3 Spielleute erhielt.


|
Seite 151 |




|
Sonst blieben jetzt die Kontingente der einzelnen Regimenter möglichst geschlossen. Die Kompanien des Regiments hatten ohne Offiziere:
| Oberst Hinr. Klingstedt | 99 | (dar. Södermanland 81, Westmanland 14) |
| Oberstl. Lorenz v. Numers | 95 | (dar. Westmanland 88) |
| Major Hindr. Joh. Brackel | 92 | (dar. Westmanland 79) |
| Kapt. Herman Sybrand | 116 | (dar. Ekeblad 67, Vellingk 40, Wöllwart 4, brem. Landmiliz 3) |
| Kapt. William Ruthven | 97 | (dar. Elfsborg 95) |
| Kapt. Johann Friedr. Freitag | 92 | (dar. Dahl. 90) |
| Kapt. Hans Hinr. Knorring | 95 | (dar. Ostgiötha 89) |
| Kapt. Gustav Franc | 95 | (dar. Westmanland 46, Elfsborg 48) |
| Kapt. Rosenmüller, später Arnoldt Hoinken | 93 | (dar. Elfsborg 22, Helsinge 59) |
| Kapt. Zacharias Ackerfeldt | 93 | (dar. Helsinge 90) |
| Kapt. Hilleband Uggla | 94 | (dar. Dahl 91) |
| Kapt. Martin Hindr. Schoultz | 92 | (dar. Westgiötha 80, Ostgiötha 10) |
| ------------ | ||
| 1152 | ||
Im Oktober 1713 hatte das Regiment in der gleichen Formation ohne Offiziere 1139, in Januar 1714 1138 und im April 1084 Mann. Anfang Juni wurde das Regiment dann in 2 selbständige Bataillone aufgeteilt. Nach den Oktoberlisten von 1714 hatten die beiden Bataillone folgende Zusammensetzung:
| Bataillon Wrangel: | ||
| Oberstl. Hendr. Gustaf Wrangel (bish. Klingstedt) | 90 | Södermanland, Westmanland |
| Major Hind. Johann Brakel | 85 | Wermland |
| Kapt. Carl August Derenthal (bish. Ruthven) | 76 | Elfsborg |
| Kapt. William Ruthven (bish. Sybrand) | 125 | Vellingk, Ekeblad, Wöllwart |
| Kapt. Zacharias Ackerfeld | 76 | Helsinge |
| Kapt. Arnold H. Hoinken | 81 | Helsinge, Elfsborg |
| ------------ | ||
| 533 | Utffz. U, Mannschaften. | |


|
Seite 152 |




|
| Bataillon Numers: | ||
| Oberstl. Lorenz v. Numers | 89 | Westmanland |
| Major Herman Sybrand (bish. Schoultz) | 86 | Westgiötha, Ostgiötha |
| Kapt. Johann Friedr. Freitag | 89 | Dahl |
| Kapt. Christoffer Freytag (bish. Knorring) | 84 | Ostgiötha |
| Kapt. Gustav Franc | 89 | Westmanland, Elfsborg |
| Kapt. Joh. Matthias Jacobsen (bish. Uggla) | 83 | Dahl |
| ------------ | ||
| 520 | Utffz. U, Mannschaften. | |
Da die wismarsche Garnison für den Fall der Belagerung zu stark war, um mit der vorhandenen Verpflegung zu reichen, sandte Generalmajor Schoultz im Oktober 1714 außer dem Regiment Stackelberg und 300 Reitern auch die beiden Feldstaatsbataillone, allerdings ohne die Stader Mannschaft von Vellingk, nach Stralsund. Dort bildeten die beiden Bataillone seit Juni wieder ein Regiment Wrangel und wurden bei der Kapitulation der Festung kriegsgefangen 105 ).
Zusammenfassung.
In Wismar und dem schwedischen Landgebiet in Mecklenburg standen also während des Nordischen Krieges an schwedischer Infanterie:
| 1699: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Liewen (13) | 12 Kp. | Juli nach Holstein |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Regt. Janköping, Mörner (1) | 8 Kp. | |
| 1700: | ||
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Regt. Janköping, Mörner, sp. Clerck (1) | 8 sp. 12 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Heidenfeld (2) | 8 Kp. | Januar bis April auf dem Marsch von Pommern nach Holstein |
| Regt. Ostgiötha, Ulfsparre (3) | 8 Kp. | Januar bis April auf dem Marsch von Pommern nach Holstein |
| Regt. Södermanland, Mardefeld (4) | 8 Kp | Januar bis April auf dem Marsch von Pommern nach Holstein |
| Regt. Skaraborg, Stromberg (5) | 8 Kp. | Januar bis April auf dem Marsch von Pommern nach Holstein |


|
Seite 153 |




|
| Regt. Croneberg, Heidenfeld (2) | 12 Kp. | Nov. aus Pommern |
| Regt. Södermanland, Mardefeld (4) | 6 Kp. | Nov. aus Pommern, Dez. zurück |
| 1701: | ||
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Regt. Janköping, Clerck (1) | 12 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Heidenfeld (2) | 12 Kp. | Jan. nach Pommern |
| Wism. Gouv.-Regt. Liewen (13) | 12 Kp. | Jan. aus Holstein |
| 1702: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Liewen (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Regt. Janköping, Clerck (1) | 12 Kp. | Mai nach Pommern. |
| 1703: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Liewen (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| 1704: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Liewen, sp. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Rekruten v. Pomm. Inf.-Regt., Sparre (19) | - | Mai/Juni |
| 1705: | ||
| Wism.Gouv.-Regt. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| 1706: | ||
| Wism.Gouv.-Regt. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Leibregt. Königinwitwe, Müller (17) | 6 Kp. | Febr. Aus Pommern, Mai zurück |
| Strals. Garn.-Regt., Schoultz (18) | 6 Kp. | Febr. Aus Pommern, Mai zurück |
| 1707: | ||
| Wism.Gouv.-Regt. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | |
| Wism. Garn.-Regt. Palmquist (14) | 6 Kp. | |
| Fremdl. Inf.-Regt. Bretholz (21) | 8 Kp. | Nov. gemustert |
| Rekruten v. Pomm. Inf.-Regt., Horn (19) | - | März/April |
| 1708: | ||
| Wism.Gouv.-Regt. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | Mai/Juni 5 Kp. nach Hamburg |
| Wism. Garn.-Regt. Sperling (14) | 6 Kp. | Mai/Juni 5 Kp. nach Hamburg |


|
Seite 154 |




|
| 1709: | ||
| Wism.Gouv.-Regt. Ridderhielm (13) | 12 Kp. | Mai/Nov. in Polen |
| Wism. Garn.-Regt. vac. Sperling, sp. Löwenhaupt (14) | 6 Kp. | |
| Fremdl. Inf.-Regt. Bretholz (21) | 8 Kp. | Mai/Nov. in Polen |
| Schwed. Leibregt., Posse (12) | 8 Kp. | Juni aus Schweden |
| 1710: | ||
| Vak. Wism. Gouv.-Regt., sp. Wism. Inf.-Regt. Wangelin (13) | 12 Kp. | |
| Wism.Garn.-Regt. Löwenhaupt (14) | 6 Kp. | |
| Fremdl. Inf.-Regt. Bretholz (21) | 8 Kp. | Jan. aufgelöst |
| Schwed. Leibregt., Posse (12) | 8 Kp. | |
| 1711: | ||
| Wism. Inf.-Regt. Wangelin, sp. Wism. Gouv.-Regt. Fersen, sp. Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Wism.Garn.-Regt. Löwenhaupt (14) | 6 Kp. | |
| Schwed. Leibregt., Posse, sp. Buhrenschiöld (12) | 8 Kp. | |
| Brem. Inf.-Regt. Wullwart (16) | 12 Kp. | April aus Bremen, Juni nach Pommern |
| Freikomp. (Rekruten) Strals. Garn.-Regt. Schoultz (18) | 1 Kp. | seit Aug. geworben. |
| 1712: | ||
| Vak. Wism. Inf.-Regt. Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Wism.Garn.-Regt. Löwenhaupt (14) | 6 Kp. | |
| Schwed. Leibregt., Buhrenschiöld (12) | 8 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Hestkov (2) | 8 Kp. | Jan. aus Schweden |
| Freikomp. (Rekruten) Strals. Garn.-Regt. Schoultz (18) | 1 Kp. | |
| 1713: | ||
| Vak. Wism. Inf.-Regt., sp. Taube, Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Wism.Garn.-Regt. Löwenhaupt (14) | 6 Kp. | |
| Schwed. Leibregt., Buhrenschiöld (12) | 8 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Hestkov (2) | 8 Kp. | |
| Freikomp. (Rekruten) Strals. Garn.-Regt. Schoultz (18) | 1 Kp. |


|
Seite 155 |




|
| Stader Komp. aus 6 Kp. Vellingk (15), 6 Kp. Löwenhaupt (14) u. 1 Kp. Wullwart (16), sp. Nur Löwenhaupt | 1 Kp. | Mai errichtet |
| Feldstaatsregt., Klingstedt (23) | 12 Kp. | Juni errichtet |
| 1714: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Taube, Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Wism.Garn.-Regt. Löwenhaupt, sp. Stackelberg (14), mit Stader Kompanie | 7 Kp. | Okt. nach Pommern |
| Schwed. Leibregt., Buhrenschiöld (12) | 8 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Hestkov (2) | 8 Kp. | |
| Freikomp. (Rekruten) Strals. Garn.-Regt. Schoultz (18) | 1 Kp. | Dez. nach Pommern |
| Feldstaatsregt., Klingstedt, sp. | ||
| Feldstaatsbatl. Wrangel(23) | 6 Kp. | Okt. nach Pommern |
| Feldstaatsbatl. Numers (23) | 6 Kp. | desgl. |
| Stades Garn.-Regt. Vellingk (15), Reste von 6 Holst. und 6 Stader Kp., eff. ca. | 1 Kp. | Sept. aus Holstein |
| Rhein. Inf.-Regt. Leutrum (22), Durchmarsch und Werbung | - | seit September |
| 1715: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Taube, Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Schwed. Leibregt., Buhrenschiöld, sp. Prinz Hessen-Homburg (12) | 8 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Lagerberg (2) | 8 Kp. | |
| Stades Garn.-Regt. Vellingk (15), Reste von 12 Kp., | c. 1 Kp. | |
| Rhein. Inf.-Regt. Leutrum (22), Werbekommando | - | April nach Pommern |
| 1716: | ||
| Wism. Gouv.-Regt. Taube, Fürstenberg (13) | 12 Kp. | |
| Schwed. Leibregt., Prinz Hessen-Homburg (12) | 8 Kp. | |
| Regt. Croneberg, Lagerberg (2) | 8 Kp. |


|
Seite 156 |




|
| Regt. Skaraborg, Witting (5) | 8 Kp. | Jan. aus Schweden |
| Stades Garn.-Regt. Vellingk (15), Reste von 12 Kp., | c. 1 Kp. |
Die größte Stärke hatte die Garnison also im September 1714 mit 49 Kompanien, die geringste im Mai 1709 nach dem Ausmarsch der Regimenter nach Polen mit nur 6 Kompanien. Während der ersten Belagerung 1711/12 betrug die Stärke 27 bis 35, während der zweiten 1715/16 dann 29 bis 37 Kompanien Infanterie.
(Schluß folgt.)
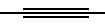


|
[ Seite 157 ] |




|



|



|
|
:
|
V.
Volksdialekt und Schriftsprache
in Mecklenburg
Aufnahme
der hochdeutschen
Schriftsprache
im 15./16. Jahrhundert
von
Paul Steinmann.
Fortsetzung und Schluß zu Jahrbuch 100 S. 199/248.
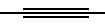


|
[ Seite 158 ] |




|


|
[ Seite 159 ] |




|
Inhaltsübersicht.
II.
Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg durch die herzogliche Kanzlei und durch die Herzöge.
2. Weitere Ausbreitung der hochdeutschen Schriftsprache in der herzoglichen Kanzlei zu Zeiten des Kanzlers Brand von Schöneich (1502-1507) und ihre gänzliche Einbürgerung durch seinen Neffen und Nachfolger Caspar von Schöneich (1507-1547).
| Seite | ||
| Untersuchung der bislang veröffentlichten Urkunden von Seite 1502 bis zur Teilung der mecklenburgischen Kanzlei (Anfang 1526) | 161-162 | |
| Untersuchung von wichtigen Sammlungen ungedruckter Urkunden: | ||
| Urkunden speziellen Charakters: Herzogliche Hausverträge und Hofordnungen, Rostocker und Wismarer Stadturkunden, Urkunden des Stifts Schwerin und des Klosters Doberan: Nichts Neues gegenüber den Verhältnissen zu Zeiten des Kanzlers Dr. Grunwald | 162-164 | |
|
Urkunden
allgemeinen Charakters:
Schuldurkunden:
Erst seit Caspar von Schöneichs Zeit erweitert sich der Kreis der Empfänger von hochdeutschen Urkunden und deren Anzahl |
164-166 | |
| Ergänzung und Erweiterung dieser Ergebnisse durch Heranziehung von Akten: | ||
| Rentereiregister: Seit 1508/09 hochdeutsch | 166 | |
| Schriftwechsel der Herzöge mit der Stadt Rostock: | ||
| Bereits seit 1502 dringt das Hochdeutsche ein, zu Brand von Schöneichs Zeit in bescheidenem Umfange, beträchtlich gesteigert seit Caspar von Schöneichs Kanzlerschaft | 166-168 | |
| Seit 1518 Sieg des Hochdeutschen in der Korrespondenz mit Rostock entschieden, von einem Widerstand Rostocks ist nichts mehr zu spüren | 168 | |
| Verordnungen und Ausschreiben: Hier herrscht, weil für die breiten Massen bestimmt, über 1525 hinaus das Niederdeutsche noch vor | 168-169 | |
| Ergebnis: Seit 1518 Sieg der hochdeutschen Schriftsprache in der herzoglichen Kanzlei entschieden. Verschwinden des Niederdeutschen aus den beiden herzoglichen Kanzleien kurz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts | 169-174 | |


|
Seite 160 |




|
| Seite | ||
| Teilung der mecklenburgischen Kanzlei in eine Schwerinsche und eine Güstrowsche | 174 | |
| Personal der mecklenburgischen Kanzlei von 1502 bis 1525: | ||
| Der Vizekanzler (Rentmeister) Trutmann | 175 | |
| Der Kanzler Brand von Schöneich (Seine Bedeutung für Aufnahme der hochdeutschen Sprache bislang sehr überschätzt) | 175-178 | |
| Der Kanzler Caspar von Schöneich (Ihm ist Hauptanteil an Ausbreitung und Einbürgerung des Hochdeutschen als Kanzleisprache zuzuschreiben) | 178-180 | |
| Der Rentschreiber (Rentmeister) Baltasar Rotermund, sein Übergang zur hochdeutschen Schriftsprache | 181 | |
| Die niederdeutsch schreibenden Kammermeister bzw. Rentmeister Jürgen Fineke und Johann Bullenberg | 181-182 | |
| Die Sekretäre und Schreiber (von diesen haben drei - insbesondere aber der Sekretär Michel Hildebrant - einige Bedeutung für Ausbreitung und Einbürgerung des hochdeutschen als Kanzleisprache | 182-186 | |
III.
Aufnahme, Ausbreitung und Einbürgerung der hochdeutschen Schriftsprache bei der Bevölkerung Mecklenburgs.
| 1. Beim Adel | 186-190 | |
| 2. Bei den herzoglichen Amts-Vögten (Amtmännern, Hauptleuten), Küchenmeistern, Kornschreibern und Küchenschreibern | 190-194 | |
| 3. Bei den Städten: | ||
| Die Residenzstädte Güstrow und Schwerin | 194-196 | |
| Die übrigen Landstädte | 196-198 | |
| Die Seestädte Rostock und Wismar | 198-204 | |
| 4. Bei der katholischen und evangelischen Geistlichkeit | 204-214 | |
| 5. Bei der Landesuniversität und bei den Schulen | 214-215 | |
| 6. In den Druckereien | 216-219 | |
| 7. In der Literatur | 219-223 |
IV.
Überblick und Ausblick.
| Überblick über die Forschungsergebnisse | 223-228 | |
| Tiefere Gründe für die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache | 228-235 | |
| Ausblick | 235-238 |


|
Seite 161 |




|
II.
Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg durch die herzogliche Kanzlei und durch die Herzöge.
2. Weitere Ausbreitung der hochdeutschen Schriftsprache in der herzoglichen Kanzlei zu Zeiten des Kanzlers Brand von Schöneich (1502-1507) und ihre gänzliche Einbürgerung durch seinen Neffen und Nachfolger Caspar von Schöneich (1507-1547).
Betrachtet man die bisher veröffentlichten, aus der herzoglichen Kanzlei stammenden Urkunden vom Jahre 1502 bis zum Anfang des Jahres 1526 1 ), wo wahrscheinlich die Teilung der Kanzlei erfolgte, so scheint es, als ob der Gebrauch der hochdeutschen Schriftsprache - wenigstens in den ersten 14 Jahren nach Grunwalds Tod (vor 21. März 1502) - keineswegs eine Steigerung erfuhr.
Die erste aus diesem Zeitabschnitt veröffentlichte hochdeutsche Urkunde stammt aus dem Jahre 1508, sie betrifft einen Rechtsspruch des Mecklenburgischen Land- und Hofgerichts 2 ). Die nächste Urkunde, eine Bestallung des herzoglichen Hofrates Dr. Nikolaus Marschalk, ist vom Jahre 1512 3 ). Vom folgenden Jahre ist der Dienstrevers des herzoglichen Kanzleischreibers (Sekretärs) Nikolaus Baumann 4 ). Aus den Jahren 1514 und


|
Seite 162 |




|
1515 liegen 4 bzw. 3 niederdeutsche Urkunden vor, denen keine hochdeutschen gegenüberstehen. - Bislang überwiegen die niederdeutschen Urkunden durchaus: von 1502 bis 1515 sind es 18 bei nur 3 hochdeutschen Urkunden. 1516 begegnen aber neben 2 niederdeutschen Urkunden 3 hochdeutsche. Die eine ist ein Kontrakt der Herzöge mit einem landesfremden Maler Erhard 5 ), die beiden andern sind Verträge zwischen den Herzögen und Bernd Maltzan 6 ). Hernach haben wir nur aus den Jahren 1517 und 1519 je eine niederdeutsche, vom Jahre 1522 eine niederdeutsche und eine hochdeutsche Urkunde. Diese ist ein Gutachten einiger Landräte über Herzog Albrechts Anspruch auf Teilung des Landes 7 ). Schließlich begegnen uns noch im Jahre 1524 2 hochdeutsche Urkunden: eine Lehnsurkunde Herzog Albrechts VII. für Matthias von Oertzen 8 ) und eine Hofordnung desselben Herzogs 9 ).
Die Sprache dieser Urkunden ist ein gutes Hochdeutsch, niederdeutsche Wörter finden sich nur ganz vereinzelt. Im ganzen sind bisher aus Brand von Schöneichs Zeit (1502-1507) 5 Original-Urkunden gedruckt, die sämtlich niederdeutsch sind, aus Caspar von Schöneichs Zeit bis zum Jahre 1525 einschließlich 27, davon sind 9 hochdeutsch.
Es ist klar, daß bei der geringen Zahl der veröffentlichten Urkunden diese Zusammenstellung für sich allein wenig Wert hat, da mit allerhand Zufälligkeiten zu rechnen ist. Eine allgemeine Angabe aber über das Verhältnis der Zahl der hochdeutschen zu der der niederdeutschen Original-Urkunden kann nicht gemacht werden, da die Regesten nur bis zum Jahre 1500 reichen.
Wir sind daher genötigt, für unsere Untersuchungen einige besonders wichtige Sammlungen von ungedruckten Urkunden heranzuziehen.
Zunächst 5 Abteilungen, die Urkunden ganz speziellen Charakters umfassen.
Die herzoglichen Hausverträge bzw. Hofordnun-


|
Seite 163 |




|
gen 10 ) dieses Zeitabschnitts: 1 aus dem Jahre 1503, 2 von 1504, je 1 aus den Jahren 1505, 1507, 1513, 1518, 1520 sind hochdeutsch. Es finden sich nur ganz vereinzelte niederdeutsche Wörter in diesen Urkunden. Die beiden von den Herzögen für Rostock ausgestellten Stadt-Urkunden von 1505 und 1518 11 ) sind niederdeutsch. Dasselbe ist der


|
Seite 164 |




|
Fall mit den für Wismar ausgestellten Stadt-Urkunden 12 ): 1 von 1502, 3 von 1504, 2 von 1505, je 1 von 1508, 1509, 1510, je 2 von 1513 und 1514 und 1 vom Jahre 1516. Niederdeutsch sind auch die 5 von den Herzögen für Bischof, Domkapitel bzw. Dompropst des Stifts Schwerin ausgestellten Urkunden der Jahre 1505, 1506 und 1513. Die 5 von den mecklenburgischen Herzögen in den Jahren 1509, 1516, 1517, 1520, 1525 für das Kloster Doberan ausgestellten Urkunden sind niederdeutsch. Hinzu kommt noch 1 niederdeutsche Urkunde von 1516, die zwar Abt und Konvent von Doberan als Aussteller nennt, die aber, wie aus dem beiliegenden, vom Kanzler Caspar von Schöneich (hochdeutsch!) verfaßten Konzept hervorgehe in der herzoglichen Kanzlei hergestellt ist.
Es zeigt sich in diesen Abteilungen im Vergleich mit den Verhältnissen zu Zeiten des Kanzlers Dr. Grunwald noch nichts Neues.
Bunter wird das Bild, wenn wir eine besonders umfangreiche Sammlung von Urkunden allgemeineren Charakters untersuchen, nämlich die von den Herzögen ausgestellten Schuldurkunden 13 ).
Es sind das von 1502 bis 1524 einschließlich 38 Urkunden, wenn wir nur die in Mecklenburg ausgestellten Schuldverschreibungen berücksichtigen.
Niederdeutsch sind alle 11 Urkunden der Jahre 1502 bis Anfang 1507. - Empfänger dieser Urkunden sind: Herzog Magnus von Sachsen, der Rostocker Prof. Lic. Baltasar Jenderick, Mitglieder des mecklenburgischen Adels: Hans Fryberg, Anna Zickhusen, Steffen und Andres von Bülow, der Hofjunker Jürgen Kaphingst, der Lübecker Kaufmann Thim Holm, der Nürnberger Kaufmann Paul Mülich.
Wie mit einem Schlage wird das Bild anders seit Sommer 1507, also seitdem Caspar von Schöneich das Kanzleramt verwaltete. Das zeigt anschaulich folgende Zusammenstellung:


|
Seite 165 |




|
| Jahr | hochdeutsche Urkunden | niederdeutsche Urkunden |
| 1507 | 2 | - |
| 1508 | 4 | - |
| 1509 | 1 | - |
| 1510 | - | 1 |
| 1511 | 3 | - |
| 1512 | 1 | 3 |
| 1513 | 3 | 1 |
| 1514 | 4 | 2 |
| 1516 | 1 | - |
| 1518 | 1 | - |
| 1524 | 1 | - |
Es stehen also in den Jahren 1507 bis 1524 bereits 21 hochdeutsche Urkunden den 7 niederdeutschen gegenüber!
Der Kreis der Empfänger dieser Urkunden ist zu einem guten Teil derselbe wie in den Jahren 1502-1507. Bemerkenswert ist nun aber folgendes: 2 für den Nürnberger Kaufmann Paul Mülich im Jahre 1504 ausgestellte Urkunden sowie eine Urkunde vom 18. Januar 1507 sind niederdeutsch, die 6 aus den Jahren 1507 (1. Juni), 1508, 1509, 1511, 1513 und 1514 aber hochdeutsch. Dasselbe ist der Fall bei 3 für den Kaufmann Anthonius von Metz bzw. für ihn und für Mattis Kornigel, der ein Angestellter oder Teilhaber Paul Mülichs war, im Jahre 1513 bzw. 1514 ausgestellten Schuldurkunden sowie in einer Urkunde, die der Augsburger Bürger und Kaufmann Ulrich Kissinger im Jahre 1514 erhielt. Für den Lübecker Kaufmann Thim Holm wurden nunmehr 1508, 1516 und 1518 die Schuldverschreibungen hochdeutsch abgefaßt, ebenso die für die Rostocker Kaufleute Claus Kron (1507) und Heinrich Gerdes (1511, 1512). Hochdeutsch sind eine Schuldverschreibung für Herzog Johann von Sachsen (1514) sowie eine Proklamation der mecklenburgischen Herzöge Heinrich V. und Erich an ihren Bruder Albrecht VII. vom Jahre 1508, in der sie erklären, daß sie ihm Geld nicht mehr schicken können. Eine Urkunde von 1508 für mittel- oder süddeutsche Adlige: Sigemundt Witzleben (Marschall), Hanns Lößer, Melchior von Kutzleben, Albrecht von Netzdorff, die in Herzog Albrechts Dienste getreten waren, und eine für dessen hochdeutschen Hofmarschall Christoff von Plawnitz (1524) sind hochdeutsch. Dagegen sind die Urkunden für die einheimischen bzw.


|
Seite 166 |




|
niederdeutschen Hof Junker Siffert Bok (1510) und Achim von Winterfeld (1512, 1514) sowie für den Drost zu Pinneberg, Claus Fridag (1512), niederdeutsch abgefaßt.
Dasselbe ist der Fall bei einer Schuldurkunde vom Jahr 1514, ausgestellt für einen Bürger zu Waren und für einen zu Röbel. - Während eine Schuldverschreibung vom Jahre 1511, ausgestellt für die Erben des Kaufmanns Reinert (Reinold) von Vemern, hochdeutsch ist, ist die andere vom nächsten Jahre niederdeutsch.
Noch klarer wird das Bild, wenn wir auch für diesen Zeitabschnitt unsere Untersuchungen auf die Akten ausdehnen.
Wir wiesen bereits darauf hin, daß die Rentereiregister 14 ), seitdem 1508 - 09 Balthasar Rotermund von seinem Onkel, dem Rentmeister Claus Trutmann, das Rentschreiber- bzw. Rentmeisteramt übernommen hatte - von vereinzelten niederdeutschen Worten abgesehen -, hochdeutsch geführt wurden.
In einzigartiger Weise unterrichten uns aber über den Umfang, in dem hochdeutsche Schriftstücke bereits an Einheimische aus der herzoglichen Kanzlei ergingen, die von den Herzögen an die Stadt Rostock gerichteten recht zahlreichen Schreiben 15 ). Sie ergänzen das aus der Untersuchung von Urkunden gewonnene Ergebnis ganz erheblich und sichern es.
Die hochdeutschen Schreiben setzen plötzlich mit dem Jahre 1502 ein. Das erste ist eine Anlage zu einem niederdeutschen Schreiben vom 18. März. Sie ist rein hochdeutsch, wie auch die folgenden Schreiben vom 17., 18. Mai und 8. Juni. Diesen 4 hochdeutschen Schreiben stehen noch 15 niederdeutsche gegenüber. Überhaupt sind die hochdeutschen Schreiben bis zum Beginn des Jahres 1507 noch durchaus in der Minderheit:


|
Seite 167 |




|
| hochdeutsch | niederdeutsch | |
| 1502 | 4 | 15 |
| 1503 | 1 | 9 |
| 1504 | 2 | 15 |
| 1505 | - | 31 |
| 1506 | 1 | 21 |
| ------- | ------- | |
| 8 | 91 |
Dies Verhältnis ändert sich aber sehr seit Sommer 1507:
| hochdeutsch | niederdeutsch | |
| 1507 | 6 | 13 |
| 1508 | 13 | 8 |
| 1509 | 11 | 11 |
| 1510 | 1 | 13 |
| 1511 | 4 | 20 |
| 1512 | 3 | 7 |
| 1513 | 4 | 16 |
| 1514 | 8 | 10 |
| 1515 | 7 | 8 |
| 1516 | 6 | 8 |
| 1517 | 9 | 8 |
| ------- | ------- | |
| 72 | 122 |
Der Prozentsatz an hochdeutschen Schreiben ist bedeutend gestiegen. In 2 Jahren (1508, 1517) überflügeln die hochdeutschen bereits die niederdeutschen, in 4 Jahren kämpfen beide um das Gleichgewicht. In den übrigen Jahren überwiegen die niederdeutschen Schriftstücke, z. T. noch erheblich.
Nach diesen Jahren des Schwankens haben wir seit 1518 eine fast ständig ansteigende Kurve der hochdeutschen Schreiben:
| hochdeutsch | niederdeutsch | |
| 1518 | 11 | 6 |
| 1519 | 13 | 6 |
| 1520 | 24 | 9 |
| 1521 | 21 | 4 |
| 1522 | 20 | - |
| 1523 | 9 | 1 |
| 1524 | 8 | 3 |
| 1525 | 12 | 2 |
| ------- | ------- | |
| 118 | 31 |


|
Seite 168 |




|
Diese Untersuchung hat folgendes Ergebnis:
Bereits während der Amtszeit des Kanzlers Brand von Schöneich ergehen einige hochdeutsche Schreiben an Rostock. Ein grundlegender Umschwung in dem Gebrauch der hochdeutschen Schriftsprache setzt aber erst seit dem Amtsantritt des Kanzlers Caspar von Schöneich ein, also seit Sommer 1507. - Denselben Befund ergab ja auch die Untersuchung der Schuldurkunden. - Nach 10 Jahren des Schwankens ist im Schriftverkehr mit Rostock seit 1518 der Sieg der hochdeutschen Sprache entschieden.
Während die Stadt Rostock noch 1495 und 1499 mit Erfolg gegen die hochdeutsche Schrift- und Verhandlungssprache des Kanzlers Dr. Grunwald aufgetreten war 16 ), ließ sie es sich bereits von 1502 ab gefallen, daß sie immer mehr hochdeutsche Schriften aus der herzoglichen Kanzlei erhielt 17 ). Aus dem Umstande, daß die von der herzoglichen Kanzlei für Rostock und für Wismar ausgestellten Stadturkunden bis 1515 bzw. 1516 niederdeutsch sind, kann man allerdings schließen, daß die Kanzlei wenigstens bei der Ausstellung von wichtigen und grundlegenden Urkunden den beiden Seestädten entgegenkam. Diese konnten ja auch hierbei eher Wünsche über die Sprache, in der die Urkunden abgefaßt sein sollten, äußern.
Während die herzogliche Kanzlei in den an den Rostocker Rat gerichteten Schreiben unbekümmert immer häufiger die hochdeutsche Sprache anwandte, war sie offensichtlich noch längere Zeit bestrebt, dem mecklenburgischen Volke gegenüber darauf Rücksicht zu nehmen, daß das Niederdeutsche bei ihm noch so gut wie unumschränkt herrschte.
Soweit ersichtlich, überwiegt bis 1525 und noch geraume Zeit darüber hinaus das Niederdeutsche in den gedruckten Verordnungen, Erlassen und Ausschreiben, die öffentlich dem Volke von den Kanzeln herab verlesen und hernach an die Kirchentüren oder an die Rathäuser angeschlagen wurden. Doch muß bemerkt werden, daß noch kein Verzeichnis der hochdeutschen mecklenburgischen Drucke, als Gegenstück zu Wiechmanns Verzeichnis der niederdeutschen Drucke, vorliegt.


|
Seite 169 |




|
Niederdeutsch ist das Mandat gegen die Femgerichte von 1512 - die erste gedruckte mecklenburgische Verordnung - 18 ), die Verordnung gegen die geistlichen Gerichte sowie die Hof- und Landgerichtsordnung von 1513 19 ), ein Mandat von 1515 an die Ritterschaft im Klützer Ort, ihre Schulden an die Lübecker Geistlichkeit zu bezahlen, die erste mecklenburgische Polizeiordnung von 1516, das älteste gedruckte mecklenburgische Landtagsausschreiben von 1517 20 ). Auch die folgenden gedruckten Landtagsausschreiben von 1521, 1523, 1524, die Aufgebotsschreiben von 1521 (3), 1523, das Steueredikt von [1525], die Streitschriften, welche die Herzöge Heinrich und Albrecht 1522 und 1523 (2) gegeneinander der Landesteilung wegen richteten, sind niederdeutsch. Dasselbe gilt von einer Ladung der Ritterschaft zu einem Rechtstag wegen der der Geistlichkeit entzogenen Renten von 1525 und von einer Verordnung über das Verlesen eines Gebets in Türkengefahr von 1523 21 ).
Als hochdeutsch gedruckte Erlasse sind bis zum Jahre 1525 bis jetzt bekannt geworden: der Abdruck eines kaiserlichen Mandats vom Jahre 1521 22 ), der Abdruck des Urteils des kaiserlichen Kammergerichts in dem Streit zwischen den beiden Herzögen wegen der Landesteilung von 1525 23 ) und Abdrucke von herzoglichen Hausverträgen in der Zeit von 1520 bis 1523 24 ). Doch ist es zweifelhaft, ob die hochdeutschen Drucke allgemein an die Mitglieder der mecklenburgischen Stände versandt wurden, da, wenigstens bei den letzten beiden Drucken, auch niederdeutsche vorhanden sind. Näher liegt es, anzunehmen, daß die hochdeutschen Drucke in der Hauptsache für fremde Fürsten, Fakultäten und Juristen bestimmt waren.
Was die in der mecklenburgischen Kanzlei selbst herrschenden sprachlichen Verhältnisse anbetrifft, so können wir dafür unbedenklich die Ergebnisse, die wir aus der Zusammenstellung der Schreiben der Herzöge an die Stadt Rostock gewonnen haben,


|
Seite 170 |




|
zugrunde legen 25 ): Seit dem Jahre 1518 - also vor der Trennung der mecklenburgischen Kanzlei - war der Sieg der hochdeutschen Schriftsprache über die niederdeutsche in der herzoglichen Kanzlei entschieden.
Nach der Teilung der Kanzlei in eine schwerinsche und güstrowsche bei Beginn des Jahres 1526 wurde das Niederdeutsche als Kanzleisprache immer seltener angewandt. Im Jahre 1526 sind von 15 aus den beiden herzoglichen Kanzleien an die Stadt Rostock ergangenen Schreiben nur 4 niederdeutsch.
1527 sind zwar von 34 noch 10 niederdeutsch, aber in den nächsten Jahren geht das Niederdeutsche ständig weiter zurück.
1528 sind von 25 5, 1529 von 40 3, 1530 von 15 1 niederdeutsch. Ähnlich ist es in den folgenden Jahren: nur vereinzelte Schriftstücke sind noch niederdeutsch. Es sind in der Hauptsache die für die Allgemeinheit bestimmten Land- und Rechtstagsausschreiben, Aufgebotsschreiben und Steueredikte. Hinzu kommen noch verschiedene Erlasse und Verordnungen, die vor allem im Schweriner Archiv erhalten und bisher im Rostocker Archiv noch nicht zum Vorschein gekommen sind 26 ). Doch begegnen uns hierbei schon hochdeutsche Drucke.
Das erste gedruckte hochdeutsche Landtagsausschreiben ist vom 23. Januar 1527 27 ). Aus demselben Jahre stammt, soweit


|
Seite 171 |




|
ersichtlich, die erste hochdeutsche Landfriedensordnung 28 ) und vom Jahre zuvor ein Münzedikt 29 ). Doch scheinen die niederdeutschen Verordnungen und Erlasse noch bis über das Jahr 1540 hinaus zu überwiegen. Am Ende einer langen Reihe von niederdeutsch gedruckten, aus den beiden herzoglichen Kanzleien stammenden Verordnungen, die, soweit wir sehen, nur gelegentlich von einigen hochdeutschen, unterbrochen sind, stehen 2 Verordnungen vom 15. August 1549: eine Verordnung gegen die sich herumtreibenden Landsknechte usw. und eine über Aufschub des Rechtstages, Verbot der Jahrmärkte, Läuten der Glocken usw. während der Pest 30 ). Ein ganz isoliert dastehender Nachläufer ist die niederdeutsche Kirchenordnung von 1557. Da der ersten mecklenburgischen niederdeutschen Kirchenordnung von 1540 eine hochdeutsche Kirchenordnung im Jahre 1552 folgte, von der 1554 eine neue Ausgabe erschien 31 ), so wurde die von den Herzögen angeordnete Übersetzung der Kirchenordnung von 1552/54 ins Niederdeutsche wahrscheinlich deswegen von ihnen für nötig befunden, weil sie auf Pastoren und Volk, bei denen die niederdeutsche Sprache noch sehr überwog, eine stärkere Einwirkung erzielen wollten 32 ).
Bei den gedruckten Landtagsausschreiben, die sich nahezu lückenlos im Rostocker Stadtarchiv erhalten haben, herrscht von 1526 bis 1540 einschließlich die niederdeutsche Sprache durchaus vor: 18 sind niederdeutsch, 4 hochdeutsch - hinzu kommt noch 1 nur im Schweriner Archiv erhaltenes hochdeutsches Stück. Ferner fand sich unter den aus demselben Zeitabschnitt stammenden gedruckten Aufgebotsschreiben und Steueredikten des Rostocker und Schweriner Archivs - 4 bzw. 1 an der Zahl - kein einziges hochdeutsches vor. Aus dem Jahre 1542 haben wir 11 hochdeutsche gedruckte Landtagsausschreiben und Steueredikte. 1543 sind 2 Landtagsausschreiben hochdeutsch, 1 niederdeutsch. Aus dem Jahre 1544 fanden sich 2 hochdeutsche Landtagsausschreiben und 1 hochdeutsches Türkensteueredikt vor. Aus dem Jahre 1545


|
Seite 172 |




|
2 hochdeutsche und 1 niederdeutsches; letzteres vom 14. September. Es ist das letzte gedruckte niederdeutsche Landtagsausschreiben in Mecklenburg. Die beiden letzten handschriftlich aus den beiden herzoglichen Kanzleien an Rostock ergangenen niederdeutschen Schriftstücke sind vom 4. Oktober 1542 33 ).
Die Schreiben, Quittungen und Bestallungsurkunden der Herzöge für ihre Amtsbeamten wurden, soweit bislang festgestellt, seit 1527, von einer Ausnahme abgesehen, hochdeutsch ausgefertigt 34 ).
Die Angehörigen des mecklenburgischen Fürstenhauses lassen in den 20er bis 40er Jahren ihre Privatschreiben untereinander, an fremde Fürstlichkeiten, an ihren Kanzler und an andere Hofbeamte nur in hochdeutscher Sprache ergehen 35 ). Von Herzog Heinrich V. und von Albrecht VII. sind verschiedene eigenhändige Schreiben und Aufzeichnungen
| niederdeutsch | hochdeutsch | |
| 1504 | - | 1 |
| 1507 | 1 | 1 |
| 1508 | 2 | 1 |
| 1511 | 2 | - |
| 1513 | 2 | - |
| 1515 | - | 1 |
| 1518 | 1 | 1 |
| 1520 | - | 1 |
| 1521 | 1 | 2 |
| 1522 | - | 1 |
| 1524 | 1 | - |
| 1525 | 1 | - |
Niederdeutsch ist die gleichzeitige Abschrift einer Urkunde von 1539, in der Herzog Albrecht VII. dem Jochim Osten seiner getreuen Dienste wegen ein Haus sowie Hebungen zu Sanitz verleiht. Hochdeutsch ist aber der Revers Ostens verfaßt. Ostens eigenhändige Versicherung und Unterschrift unter diesem Revers ist niederdeutsch. (A. Ribnitz, Beamte.)


|
Seite 173 |




|
vorhanden. Sie sind im Prinzip hochdeutsch, wenn auch gelegentlich einige niederdeutsche Wörter begegnen 36 ).
Sämtliche bisher gedruckten Originalurkunden sind von 1526 ab hochdeutsch. Meistens sind es Vergleiche der Herzöge mit Adligen oder für sie bestimmte Privilegien (9), im übrigen Urkunden für Pfarrer (2), Kontrakte mit einem Zimmer- bzw. Salinenmeister (2), mit 2 Baumeistern (2), und Urkunden für den Kanzler Johann von Lucka (3) 37 ).
Von den für Rostock ausgestellten - noch nicht veröffentlichten - Urkunden haben wir aus dem Jahre 1528 eine hochdeutsche, aus dem Jahre 1548 je eine hochdeutsche und niederdeutsche Urkunde. Die folgenden aus den Jahren 1560, 1565, 1566, 1573 sind sämtlich hochdeutsch 38 ). Von den entsprechenden Wismarer Urkunden ist eine Urkunde von 1548 hochdeutsch, eine aus demselben Jahre niederdeutsch, je eine von 1554, 1560 und 1565 hochdeutsch 39 ).
Diese beiden für Rostock und für Wismar ausgestellten Urkunden, Privilegienbestätigungen der Herzöge Johann Albrecht, Ulrich und Georg, vom 21. bzw. 24. April 1548 sowie eine Privilegienbestätigung derselben Herzöge für die Stadt Malchin vom 18. April 1548 40 ) sind die letzten niederdeutschen,


|
Seite 174 |




|
aus der herzoglichen Kanzlei stammenden Urkunden, die mir bislang begegnet sind.
Das Niederdeutsche war also, soweit bislang festgestellt werden konnte, kurz vor Mitte des 16. Jahrhunderts aus der herzoglichen Kanzlei oder vielmehr aus den beiden herzoglichen Kanzleien als Schriftsprache verschwunden.
Seit dem Jahre 1471, wo das Land Stargard nach dem Tode des letzten Herzogs Ulrich II. an das Herzogtum Mecklenburg fiel, gab es in Mecklenburg nur eine herzogliche Kanzlei 41 ). Herzog Albrechts VII. Bestreben nach Teilung des Landes brachte es aber dahin, daß in den Jahren 1520/25 zwei völlig getrennte Kanzleien entstanden.
Bereits im Neubrandenburger Hausvertrag vom 7. Mai 1520 machten sich die ersten Anzeichen der beginnenden Trennung bemerkbar, indem bestimmt wurde, daß jeder Herzog eigene Sekretäre und Kanzleischreiber haben sollte, wenn sonst auch festgesetzt wurde, daß eine ungesonderte Kanzlei mit einem Kanzler sein sollte. Zu dieser Zeit gab es auch noch einen gemeinschaftlichen Rentmeister. Seit Ende 1521 taucht aber bereits Johann Bullenberg als "kamerschriffer" Herzog Albrechts auf. Um diese Zeit wird Rotermund wieder Herzog Heinrichs Rentmeister geworden sein. Dagegen tritt noch der gemeinschaftliche Kanzler Caspar von Schöneich im Laufe des Jahres 1523 bei den Landesteilungsverhandlungen verschiedentlich hervor. In der Hauptsache scheinen die Zwistigkeiten zwischen Albrecht und Caspar von Schöneich 42 ) dazu beigetragen zu haben, daß bald jeder Herzog einen besondern Kanzler hatte. Wahrscheinlich erfolgte die endgültige Teilung der mecklenburgischen Kanzlei in eine Schwerinsche und Güstrowsche bei Beginn des Jahres 1526. Jedenfalls begegnet uns am 9. Januar 1526 Wolfgang Ketwig als Kanzler Herzog Albrechts. Er wurde wahrscheinlich am 6. Januar 1526 als Kanzler im Güstrowschen Landesteil angestellt, während Schöneich Herzog Heinrichs Kanzler im Schwerinschen Landesteil blieb 43 ).


|
Seite 175 |




|
Wir haben nun noch die Persönlichkeiten, die in den Jahren 1502/25 als Kanzler Leiter der mecklenburgischen Kanzlei waren oder in ihr als Rentmeister, Sekretäre oder Schreiber tätig waren, näher zu betrachten. Dabei ist der Versuch zu machen, ihre Herkunft, ihre Einstellung zur hochdeutschen Schriftsprache und ihren Anteil an deren endgültige Einbürgerung in der Kanzlei zu ergründen.
Nach Grunwalds Tod verwaltete der Rentmeister Claus Trutmann als Vizekanzler wahrscheinlich bis zum Anfang des Jahres 1502 provisorisch das Kanzleramt 44 ). Brand von Schöneich ist bislang zuerst am 10. Juni 1502 als mecklenburgischer Kanzler bezeugt. Im Wintersemester 1501/02 war er noch Rektor der Universität Leipzig. Er stammte aus Sorau in der Niederlausitz, war aus adligem Geschlecht und wurde im Sommersemester 1490 zu Leipzig immatrikuliert. Hernach wurde er dort Baccalaureus und Magister in der Philosophischen Fakultät und Baccalaureus beider Rechte. - Er starb kurz vor dem 4. März 1507 45 ).
Eigenhändige Schreiben Brand von Schöneichs konnten bislang nicht ermittelt wer-


|
Seite 176 |




|
den 46 ). In der Hauptsache müssen die Konzepte, Protokolle usw. während seiner Amtszeit durch Hofräte bzw. Kanzleisekretäre verfaßt sein.
In dem Jahre 1502 stößt man auf die Handschrift eines dem Namen nach nicht bekannten hochdeutsch schreibenden Sekretärs, der bereits 1501 festzustellen ist 47 ). Die Konzepte eines zweiten unbekannten Sekretärs begegnen in den Jahren 1503/04. 5 Entwürfe, für auswärtige Empfänger bestimmt 48 ), sind hochdeutsch, 5 Konzepte für Schreiben der Herzöge an Rostock und eine Eingangsregistratur sind niederdeutsch 49 ) Von 1502 bis 1509 ist eine Anzahl von Konzepten usw. einer dritten Hand festzustellen 50 ), von der auch die umfangreichen Land- und Hofgerichtsprotokolle von 1507 geschrieben sind. Diese dritte Hand ist wahrscheinlich identisch mit dem in den genannten Protokollen erwähnten Dr. Leo, der dort neben Dr. Nicolaus Marschalk auftaucht. Dieser Hofrat Dr. Leo 51 ) verfaßte die erwähnten Konzepte und Protokolle in der Regel in hochdeutscher Sprache, der selten einige wenige


|
Seite 177 |




|
niederdeutsche Wörter beigemischt sind. Aber Mitte 1507 entwirft er das Konzept für ein Schreiben der Herzöge an Rostock niederdeutsch, obwohl er kurz zuvor ein anderes für Rostock bestimmtes Konzept hochdeutsch abgefaßt hatte. Der Entwurf eines Geleitsbriefes vom Jahre 1509 ist niederdeutsch, das dazu gehörige, für Rostock bestimmte Anschreiben ist hochdeutsch! Caspar von Schöneich, der seit Ende 1503 als Hofrat Dienste tat, muß auch während der Amtszeit seines Onkels häufiger hochdeutsche Konzepte verfaßt haben 52 ). Vom Hofrat Dr. Nicolaus Marschalk Thurius, dem nachmaligen Rostocker Professor, der im Sommer 1505 in den herzoglichen Dienst trat, sind bislang einige hochdeutsche Konzepte aus den Jahren 1506 ff. ermittelt worden 53 ).
Wenn zu Brand von Schöneichs Zeiten die Hauptmasse der Konzepte, Protokolle usw. nicht von ihm als Kanzler selbst verfaßt wurden, so steht er damit im Gegensatz zu seinen Vorgängern und zu seinem Neffen und Nachfolger. Der Grund hierfür ist z. T. darin zu suchen, daß Brand von Schöneich häufig im Interesse des Fürstenhauses und des Landes ausgedehnte Reisen an die Höfe befreundeter Fürsten bzw. zum Reichskammergericht unternehmen mußte. Zu bemerken ist auch, daß er November/Dezember 1503 zu Gutenstein in Gefangenschaft saß und hernach kränklich war. Z. T. aber muß man


|
Seite 178 |




|
die Ursache auch in einer gewissen Gleichgültigkeit des Kanzlers, der sich wenig um die Kanzlei kümmerte. sowie in organisatorischen Mängeln und Mißständen im Kanzleibetrieb suchen. Das geht deutlich aus einer undatierten Denkschrift des Dr. Nikolaus Marschalk hervor, die wahrscheinlich im Jahre 1506 verfaßt wurde 54 ).
So viel ist sicher: Brand von Schöneich hat nicht die Bedeutung für die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache durch die Kanzlei gehabt, die ihm bisher allgemein zugeschrieben wurde 55 ). Wenn eine geringfügige Ausdehnung der hochdeutschen Sprache im inneren Kanzleibetrieb und im schriftlichen Verkehr mit Rostock festzustellen ist, so muß das fast ganz auf das Konto der Hofräte: Dr. Leo, Caspar von Schöneich, Dr. Nikolaus Marschalk und von zwei unbekannten Sekretären gesetzt werden, die entweder nur hochdeutsch schrieben oder es bevorzugten.
Caspar von Schöneich stammte gleichfalls aus Sorau. Er wurde zu Leipzig im Wintersemester 1490/91 immatrikuliert und im Sommersemester 1492 Baccalaureus in der Philosophischen Fakultät. Doch scheint auch er juristisch gebildet gewesen zu sein. Von Ende 1503 ab begegnet er, wie erwähnt, in Mecklenburg als Rat und Gesandter der Herzöge Balthasar


|
Seite 179 |




|
und Heinrich V. Im Laufe des Jahres 1507 trat er einige Zeit nach seines Onkels Tod das Kanzleramt an. Als gemeinschaftlicher Kanzler war er wahrscheinlich bis Ende 1525 tätig. Seit Anfang 1526 war er bis zu seinem Anfang Oktober 1547 erfolgten Tode Heinrichs Kanzler in dessen Landesteil.
Caspar von Schöneich war eine hervorragende und tüchtige, auch in wissenschaftlicher Hinsicht interessierte Persönlichkeit und ein trefflicher Berater Herzog Heinrichs.-Nach den drei in staatspolitischer Hinsicht wirklich bedeutenden Fürsten Mecklenburgs: Heinrich dem Löwen, Albrecht II. dem Großen und Magnus II., war er der erste bedeutende Staatsmann Mecklenburgs, über den wir Näheres wissen. - Herzog Magnus, Heinrichs Sohn, schrieb am 12. Oktober 1547 - unmittelbar nach Schöneichs Tod - mit Recht in einem Brief an seinen Vater, daß der Kanzler "ein ausbundt eines weysen, geschickten und theuren mans gewezen" 56 ). Nach Ausweis seiner Originalschreiben und seiner zahllosen Konzepte und Vermerke auf Urkunden und Akten schrieb er nur hochdeutsch 57 ). Selbst niederdeutsche Konzepte oder Reinschriften korrigierte er unbekümmert hochdeutsch! Doch eignete er sich ein genügendes Verständnis des Niederdeutschen an, wie seine zahlreichen Registraturvermerke auf niederdeutschen Urkunden, Registern und Akten zeigen. Da Sorau hart an der sächsischen Grenze lag und die Leipziger Universität unter dem Einfluß der sächsischen Kanzlei stand 58 ), könnte man an und für sich schon annehmen, daß die Sprache der Schöneichs im großen und ganzen mit der sächsischen Kanzlei(Schrift-)sprache identisch war. Es finden sich auch in Caspars eigenhändigen Konzepten Eigentümlichkeiten der sächsischen Kanzlei, und zwar sowohl der 1. streng mitteldeutschen Richtung (i in tonlosen Nebensilben usw.), als auch der 2. sich


|
Seite 180 |




|
mehr der kaiserlichen Kanzleisprache nähernden Richtung (anlautendes p statt b, und ähnlich k statt g) 59 ). Es scheint daher so, als ob schon unter den Schöneichs in der mecklenburgischen Kanzlei die obersächsische Kanzleisprache die Vorherrschaft errang. - Es findet sich keine Spur davon, daß Caspar von Schöneich sich wie Grunwald bemühte, das Niederdeutsche als Schriftsprache zu erlernen und anzuwenden. Es ist ihm daher ohne Zweifel der Hauptanteil an der weiteren Ausbreitung und endgültigen Einbürgerung des Hochdeutschen als Kanzleisprache in Mecklenburg zuzuschreiben.
Wir sahen, daß der Sieg der hochdeutschen Kanzleisprache seit dem Jahre 1518 entschieden war, und daß hernach nur noch vereinzelte niederdeutsche Schriftstücke auftreten. Es sind daher die Kanzler des Güstrowschen Landesteils: Wolfgang Ketwig (1526-1529) 60 ), Joachim von Jetze (1529-1543) 61 ), Peter von Spengel (1543 bis 1547) 62 ), für die Einbürgerung des Hochdeutschen ohne Bedeutung gewesen.


|
Seite 181 |




|
Als Claus Trutmann sich anscheinend Ende 1508 von dem aktiven Dienst als Rentmeister zurückzog, übernahm sein Neffe Balthasar Rotermund, der als Rentschreiber seit Frühjahr 1506 begegnet, die Funktionen des Rentmeisters, wenn er auch erst von 1512 ab mit diesem Titel auftritt. Er wurde 1499 zu Erfurt immatrikuliert und stammte aus dem nahe gelegenen Dorfe Waltersleben, also ebenso wie Trutmann aus mitteldeutschem Sprachgebiet. Bis etwa Mitte März des Jahres 1519 war er gemeinschaftlicher Rentmeister der Herzöge Heinrich V. und Albrecht VII. 63 ). Sein Nachfolger war der "Kammermeister" Jürgen Fineke, ein mecklenburgischer Adliger und Landrat. Dieser blieb wahrscheinlich bis gegen Ende 1521 im Amte. Hernach treten für die beiden Herzöge besondere Rentereibeamte auf. Rotermund wurde Heinrichs Rentmeister. Er verwaltete das Amt noch 1551. Am 21. August 1554 starb er als Herzog Heinrichs "gewesener" Rentmeister und Bürgermeister zu Schwerin.
Bemerkenswert ist es, daß Claus Trutmann, der seine Rentereiregister bis Ende 1507 (1508 ?) ganz überwiegend niederdeutsch geführt hatte, die Überschriften für das Rentereiregister seines Neffen und Nachfolgers vom Jahre 1508/09 sowie seine eigenen Schlußabrechnungen vom Jahre 1509 überwiegend hochdeutsch schrieb. Ebenso hatte Rotermund dem Küchenmeister zu Grabow noch 1507 eine niederdeutsche Quittung ausgestellt, während er 1508 ff. seine Rentereiregister, von einigen wenigen niederdeutschen Wörtern abgesehen, hochdeutsch führte! 64 ) - Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir als Ursache für diesen auffallenden Sprachwandel eine unmittelbare Beeinflussung durch den Kanzler Caspar von Schöneich annehmen. - Dagegen führte Jürgen Fineke seine Rentereiregister 1519 und 1521 niederdeutsch und versah das von 1519 am 23. Dezember


|
Seite 182 |




|
mit einer eigenhändigen niederdeutschen Anschrift an Herzog Heinrich 65 ).
Als Herzog Albrechts Rentereibeamter tritt seit Ende 1521 der "Kammerschreiber" Johann Bullenberg auf. Im Jahre 1535, wo er zum letztenmal bislang begegnet, führte er den Titel Rentmeister. - Er wurde im Jahre 1513 zu Rostock immatrikuliert und stammte aus Wismar 66 ). - Eine Quittung über den Empfang von Geldern, die er "van weggen myns g. h. hertig Albrecht" am 14. Dezember 1521 zu Wismar dem Küchenmeister von Neukalen ausstellte, ist rein niederdeutsch. Dasselbe ist der Fall bei 2 kurzen Niederschriften (Mottos) auf dem Amtsregister Güstrow 1524/25.
Zwischen 1504 und 1525 begegnet uns eine Anzahl von "Sekretären" und "Schreibern". Die genauere Bestimmung ihrer Funktion ist oft schwierig 67 ). Sekretäre werden auch z. T. die "Räte von Haus aus" 68 ) genannt, und


|
Seite 183 |




|
unter der Bezeichnung "Schreiber" verbirgt sich bisweilen ein Kanzleisekretär!
Leonhard Engeltaler ist von 1504 bis 1519 als Schreiber nachzuweisen. Vielleicht stammte er aus dem Braunschweig-Lüneburgischen. Eine von ihm geschriebene Quittung, die Herzog Heinrich dem Grabower Vogt Henning Oldenborch im Jahre 1504 (28. November) ausstellt, ist rein hochdeutsch. Dasselbe ist der Fall in einer 1507 (10. Februar) von Engeltaler eigenhändig geschriebenen, für denselben Vogt ausgestellten Quittung über den Empfang von Landbede 69 ).
Der Schreiber (Sekretär?) Johannes Smedeberge, der 1506, 1508, 1510 und 1511 begegnet, stammte aus Magdeburg und wurde 1502 zu Rostock immatrikuliert. Er war Priester des magdeburgischen Stifts und Notar. Ein von ihm geschriebener Entwurf zu einem Notariatsinstrument (Vertrag zwischen dem Rentmeister Claus Trutmann und einem Priester wegen eines Hauses zu Schwerin) vom Jahre 1508 ist rein niederdeutsch 70 ).
Joachim Litzmann: 1508-13: er begegnet bereits 1498 und 1501, wenn auch ohne Bezeichnung und Funktion eines "Sekretärs"; Priester Havelbergschen Stiftes und Notar.
Johann Monnick: 1508-18: er begegnet bereits 1502, wenn auch ohne Bezeichnung und Funktion. Er stammte aus Hamburg, 1496 wurde er zu Rostock immatrikuliert, 1497/98 Baccalaureus artium. Er war Priester des Havelbergischen Stiftes und Notar, besaß eine Reihe von geistl. Pfründen. In hervorragender Weise war er bei der Vorbereitung der Polizeiordnung von 1516 tätig. Das Niederdeutsche beherrschte er völlig. Noch 1518 schrieb er an Herzog Heinrich rein niederdeutsch. Vgl. Groth, Meckl. Jahrb. 57 S. 312/18.
Jürgen Offenberger: 1509-13. 1513 stellt er als "meckelnborgsche Sekretarius" den Herzögen eine hochdeutsche Quittung über den Empfang von 100 bzw. 90 Gulden aus, "deshalben, das ich wesenlich in irer f. g. lande wonen und bleyben soll".
Sebastian Schenk (von Schweinsberg): 1521-35. 1521 Herzog Albrechts Sekretär, 1524 ff. bei Herzog Heinrich, 1529 Sekretär von dessen Sohn Magnus, 1531-35 Herzog Heinrichs Sekretär und Rat. Er war Magister und stammte aus Schweinsberg - also aus hochd. Sprachgebiet. 1521 erhielt er einige geistl. Pfründen, 1534 war er Propst zu Güstrow. Meckl. Jahrb. 3 S. 88, 8 S. 38, 52 S. 233, 57 S. 316/17.


|
Seite 184 |




|
Jürgen Fineke 71 ), der von 1507 bis 1521 als Schreiber auftritt, könnte dem Namen nach ein Mecklenburger gewesen sein.
Nicolaus Baumann, der von 1507 bis 1526 als Schreiber bzw. als Sekretär begegnet, war sicher kein Mecklenburger. Er schrieb nachweisbar hochdeutsch, doch dürfen wir auch wohl mit Lisch annehmen, daß er das Niederdeutsche beherrscht hat 72 ).
1508 begegnet uns ein Schreiber Dietrich, bei dem es zweifelhaft ist, ob er mit einem Dietrich Runge, der 1506 auftritt identisch ist.
Michel Hildebrant ist von 1509 bis 1518 als Schreiber, seit 1519/20 bis 1534 als Sekretär Herzog Heinrichs bezeugt 73 ). Er stand in einem besonderen Vertrauensverhältnis zu Heinrich und zum Kanzler Caspar von Schöneich, dessen rechte Hand er offensichtlich war. Dieser korrigierte seine Entwürfe durch, während Hildebrant andererseits Schöneichs Konzepte ergänzte. Er hatte die Reinschrift und die Besiegelung von wichtigen Urkunden und Briefen vorzunehmen. Nach Schöneich und Rotermund war er die einflußreichste Persönlichkeit in der Kanzlei Heinrichs V. 74 ). In den 20er und 30er Jahren entwarf er häufiger selbständig Konzepte für wichtige Schreiben und Urkunden. - Die von ihm geschriebenen Urkunden und seine eigenhändigen Briefe und Berichte (1522, 1523, 1529) sind hochdeutsch 73 ).


|
Seite 185 |




|
Von 1511 bis 1517 begegnet uns ein Schreiber Florian (Florentz).
Henning (Heinrich) Stein ist uns sicher von 1515 bis 1517, wahrscheinlich aber von 1512 ab als Schreiber bezeugt. Seit 1519 begegnet er als Küchenmeister des Amtes Schwerin. Ein von ihm 1521 an Herzog Heinrich gerichtetes Schreiben ist rein niederdeutsch.
Der Schreiber Martin der Schwabe (1513-1518) war, wie sein Zuname zeigt, ein Oberdeutscher.
Barthold (Bartholomeus) Sandow, als Schreiber von 1516 bis 1520 nachweisbar, später (1530/1535) Heinrichs Sekretär, 1534 als Rat und Sekretär bezeichnet, stammte aus Güstrow und wurde 1507 zu Rostock immatrikuliert 75 ).
Vicke Hildebrant begegnet uns 1518, es steht nicht fest, ob er Schreiber oder Sekretär war. Er stammte aus Schwerin, wurde 1511 zu Rostock immatrikuliert und 1513 Baccalaureus artium 76 ).
Das Kanzleipersonal war also bunt zusammengewürfelt: Mecklenburger, Niederdeutsche aus anderen Staaten, Mitteldeutsche und mindestens ein Oberdeutscher.
Von diesen Kanzleibeamten werden Leonhard Engeltaler, Nicolaus Baumann und vor allem Michel Hildebrant für die weitere Ausbreitung und endgültige Einbürgerung der hochdeutschen Schriftsprache in der Kanzlei während der Zeit der Kanzlerschaft Caspar von Schöneichs von einiger Bedeutung gewesen sein, da sie das Hochdeutsche zum mindesten sehr bevorzugten.
Wir dürfen annehmen, daß die aus Niederdeutschland stammenden Sekretäre und Schreiber sich der hochdeutschen Sprache nach dem Vorbild Caspar von Schöneichs und ihrer nur hochdeutsch schreibenden Kollegen in steigendem Maße bedienten. Es mußte für sie auf die Dauer bequemer sein, die Konzepte Schöneichs nicht erst ins Niederdeutsche zu übersetzen, sondern sie gleich hochdeutsch abzuschreiben. Doch wurde offensichtlich bei den für weitere Kreise des Volkes bestimmten Verordnungen, Erlassen und Ausschreiben noch geraume Zeit darauf


|
Seite 186 |




|
Wert gelegt, daß sie in der Regel in niederdeutscher Sprache ergingen, bis schließlich die Bequemlichkeit der Schreiber und der sich immer weniger bemerkbar machende Widerstand der großen Menge gegen das Hochdeutsche auch diese Rücksichtnahme allmählich bis gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts fallen ließ.
III.
Aufnahme, Ausbreitung und Einbürgerung der hochdeutschen Schriftsprache bei der Bevölkerung Mecklenburgs.
1. Beim Adel.
Die hochdeutsche Schriftsprache fand in Mecklenburg, wenn wir von den Fürsten und dem Kanzleipersonal absehen, am frühesten beim Adel Aufnahme.
Soweit ersichtlich, bediente sich zuerst der mecklenburgische Adlige Otto Maltzan, der mit Herzog Magnus in Fehde geraten war und zeitweise auf dem Schlosse Hartenstein in der Oberpfalz weilte, in seinen 1497 und 1498 von dort aus an Herzog Magnus, an den mecklenburgischen Ritter Klaus Hahn und an den Kurfürsten von Brandenburg gerichteten Schreiben der hochdeutschen Sprache 77 ). 1508 schrieb Bernd Maltzan von Stavenhagen aus an den Kanzler Caspar von Schöneich hochdeutsch. Dagegen war noch ein Brief, den er 1505 an die mecklenburgischen Herzöge richtete, wie alle seine früheren Briefe und Urkunden aus den Jahren 1478 bis 1502 rein niederdeutsch. Ferner schickte 1508 Eckhard von Quitzow ein fast rein hochdeutsches Einladungsschreiben an Herzog Heinrich 78 ). 1514 sandten Wedege Gans zu Putlitz und Achim von Bülow von Neubrandenburg aus an die Herzöge Heinrich und Albrecht eine hochdeutsch abgefaßte Klageschrift gegen Bernd Maltzan 79 ) 1526 und 1529 schrieb Georg Maltzan an Herzog Heinrich hochdeutsch 80 ), 2 gedruckte Streitschriften des Klaus von Passow zu Goldberg gegen Henning Holstein zu Ankershagen aus den Jahren 1528 und


|
Seite 187 |




|
1530 sind hochdeutsch 81 ). 1532 sandte Henning Holstein von Ankershagen aus an die zu Güstrow versammelten Landstände eine hochdeutsche Schrift, in der er sich darüber beschwerte, daß Herzog Albrecht ihm seinen Kornhandel unterbunden hatte 82 ). Von Wickenwerder aus richtete er 1538 an den herzoglichen Leibarzt Koltsch einen hochdeutschen Brief, und 1539 stellte er zu Ankershagen eigenhändig einen hochdeutschen Revers dem Magister Simon Leupold aus. Dieser war von Anfang 1538 bis Mitte 1539 bei ihm als Erzieher seiner Kinder und als Schreiber tätig, stammte aus dem hochdeutschen Sprachgebiet (Prettin a. d. Elbe) und schrieb neben lateinisch nur hochdeutsch 83 ). Dagegen hatte Henning Holstein 1519 mit Achim Barenfleth einen Vertrag in niederdeutscher Sprache abgeschlossen und noch 1526. an Herzog Heinrich V. ein niederdeutsches Schreiben abgesandt 84 ). Niederdeutsch sind 4 Urkunden und 1 Brief Lippolds von Oertzen aus den Jahren 1508, 1519, 1520, 1530, 1535 85 ), ferner 3 an mecklenburgische Herzöge gerichtete Briefe des Matthias von Oertzen aus den Jahren 1531 (eigenhändiges Schreiben), 1535, 1537. Dagegen läßt seine Witwe um 1550 an Herzog Johann Albrecht hochdeutsch schreiben. Aus den Jahren 1571 und 1575 haben wir je ein weiteres hochdeutsches Schreiben von Angehörigen der Familie von Oertzen 86 ). Eine Urkunde des Henneke von Plessen aus dem Jahre 1509, ein Schreiben der Plessen an den fürstlichen Vogt zu Grevesmühlen von 1526 und ihr Absagebrief an den Bischof von Ratzeburg aus dem Jahre 1529 sind niederdeutsch 87 ). Philipp Prignitz schrieb 1535 an Herzog Heinrich niederdeutsch 88 ). Es richteten Klaus Lützow 1528, Baltasar und Achim Weltzin 1530 und Achim Hahn 1534 an die Stadt Wismar eigenhändige niederdeutsche Schreiben 89 ).
Von 13 aus den Jahren 1503 bis 1529 stammenden Urkunden, die als Aussteller mecklenburgische Adlige nennen, ist nur


|
Seite 188 |




|
eine hochdeutsch. Es ist eine zu Schwerin ausgestellte Urfehde-Urkunde des Volrath vom Busche aus dem Jahre 1527 90 ). Ich halte es aber für wahrscheinlich, daß die Urkunde aus der herzoglichen Kanzlei stammt. Die übrigen 12 Urkunden - je eine aus dem Jahre 1503, 1504, 2 von 1507, je eine von 1515 und 1516, 3 von 1520, eine von 1521, je eine von 1527 und 1529 - sind niederdeutsch 91 ). Aus den folgenden Jahren sind bisher nur vereinzelte Urkunden veröffentlicht: Eine Urkunde der Gebr. Hahn zu Basedow von 1539 ist niederdeutsch 92 ). Eine Urkunde Christophs von Bülow über eine Anleihe bei einem Karthäuser-Prior von 1550 ist gleichfalls niederdeutsch 93 ). Hochdeutsch ist ein Vergleich des Achim von Dewitz mit dem Kloster Wanzka aus dem Jahre 1551 94 ). Urkunden der Boths auf Kalkhorst vom Jahre 1563 (11. Februar und 7. Juni) sind niederdeutsch: Die letzten, bislang festgestellten niederdeutschen Urkunden, die mecklenburgische Adlige als Aussteller nennen 95 ).
Diese wenigen Urkunden und Briefe geben uns aber nur ein unvollständiges Bild von dem Vordringen der hochdeutschen Schriftsprache beim mecklenburgischen Adel. Sie zeigen uns, daß es um die Jahrhundertwende sich anbahnte, aber bei den einzelnen Persönlichkeiten recht verschieden gewesen ist. - Bemerkenswert ist es, daß Bernd Maltzan und Henning Holstein, die in der Sage unter dem Namen "de böse Bernd" und "Henning Bradenkirl" als berüchtigte Raubritter fortleben, nicht nur bei der Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache, sondern auch auf andern Gebieten sich als fortschrittlich gesinnte Menschen zeigten: Beide sind die ersten mecklenburgischen Adligen, von denen sich nachweisen läßt, daß sie einen eigenen Getreidehandel im Großen nach außerhalb mit Hilfe der Flußschiffahrt betrieben (1510 bzw. 1532) 96 ). Henning


|
Seite 189 |




|
Holstein gehört auch wahrscheinlich zu denjenigen mecklenburgischen Adligen, die sich zuerst der Reformation anschlossen 97 ).
Einen gewissen Anhalt über die Zeit, in der im allgemeinen das Hochdeutsche als Schriftsprache beim Adel durchgedrungen sein mag, geben uns die von der Gesamtheit der Stände oder von den sich lediglich aus Adligen zusammensetzenden landständischen Ausschüssen ausgestellten Urkunden und Aktenstücke.
Die Union der mecklenburgischen Landstände von 1523 ist in niederdeutscher Sprache abgefaßt 98 ). Die Erneuerung des kleinen Unionsausschusses von 1554 ist niederdeutsch 99 ). Die Urkunde, in der die Bevollmächtigung des Ausschusses durch die Gesamtheit der Stände im Jahre 1555 ausgesprochen wurde, ist hochdeutsch 100 ). - Bereits 1526 richteten die Stände an die Herzöge 2 hochdeutsche Schreiben 101 ). Dagegen haben wir aus den Jahren 1531 bis 1534 eine größere Zahl von niederdeutschen Schreiben, welche der kleine Unionsausschuß an die Herzöge und an die Stadt Rostock richtete 102 ). Alle späteren, im Jahre 1554 wieder einsetzenden Schreiben und Aktenstücke, die von den Landständen, Landräten und vom Ausschuß herführen, sowie die Urkunden von 1555,1558,1561,1564,1573 ff. sind hochdeutsch 103 ).
Wir dürfen somit wohl sagen, daß die hochdeutsche Schriftsprache beim mecklenburgischen Adel als


|
Seite 190 |




|
Korporation und daher wohl auch beim größten Teil der einzelnen Adligen zwischen 1534 und 1554 gegenüber der niederdeutschen den Sieg errang. Verstanden wurde das Hochdeutsche im allgemeinen schon früher, da die Adligen sich, wie wir sahen, verschiedentlich hochdeutsche Urkunden von der herzoglichen Kanzlei ausstellen ließen. Außerdem wurden von den Landräten geleistete Gutachten und Abschiede 1508 und 1522 hochdeutsch abgefaßt 104 ), und 1524 und 1539 hielt Herzog Heinrich auf Landtagen längere Vorträge in hochdeutscher Sprache. Hochdeutsch war auch die Rede, die Herzog Magnus vor den Ständen des Landes Wenden beim Empfang der Huldigung zu Krakow im Jahre 1548 hielt 105 ).
Bei der frühen Aufnahme der hochdeutschen Sprache durch verschiedene mecklenburgische Adlige ist es sicher, daß der Anstoß dazu nicht von der herzoglichen Kanzlei ausgegangen sein kann. Wir haben den äußern Anlaß darin zu suchen, daß im 15. und 16. Jahrhundert mecklenburgische Adlige als Lehnsleute in größerer Zahl häufig im Dienste ihrer Fürsten bei den vielen Kriegen des Reichs (Ungarn- und Türkenkriege, Romzüge usw.) oder bei den häufigen Fehden und Reisen der mecklenburgischen Herzöge nach Mittel- und Oberdeutschland kamen. Gar mancher weilte auch längere Zeit als Söldner oder als Student auf hochdeutschem Sprachgebiet. Der mehr oder minder stark entwickelte Drang in die Ferne, Alter, Begabung, wirtschaftliche Verhältnisse, Fehden und Zwistigkeiten mit den Landesherren und Standesgenossen dürften hier eine bedeutende Rolle gespielt haben. Späterhin mögen die aus der herzoglichen Kanzlei ergangenen Schreiben andere Adlige, die sich noch nicht die hochdeutsche Sprache angeeignet hatten, veranlaßt haben, auch die hochdeutsche Schriftsprache anzunehmen.
2. Bei den herzoglichen Amts-Vögten (Amtmännern, Hauptleuten), Küchenmeistern, Kornschreibern und Küchenschreibern.
Aus den Jahren 1508, 1519, 1521, 1525, 1528, 1529, 1530 usw. sind Schreiben und Berichte von Beamten der Vogteien bzw. Ämter in größerer Zahl erhalten. Sie sind zumeist an die Herzöge, an die Kanzler, Rentmeister und Sekretäre gerichtet. Außerdem sind noch zahlreiche Quittungen vorhanden,


|
Seite 191 |




|
in denen die Vögte, Küchenmeister oder Korn- und Küchenschreiber der Ämter den Beamten von andern Ämtern den Empfang von Geld, Vieh, Wolle, Bier, Lebensmitteln usw. bescheinigen 106 ).
Die große Masse dieser Schriftstücke ist - soweit sie von den betreffenden Beamten eigenhändig oder von ihren Schreibern verfaßt sind 107 ) - bis zum Jahre 1551 einschließlich niederdeutsch. In ganz vereinzelten Fällen macht sich seit Ende der 20er Jahre das Eindringen der hochdeutschen Sprache bemerkbar:
Jost Schubbers, Küchenmeisters zu Buckow, eigenhändig geschriebene Abrechnung mit Herzog Albrecht VII. über Bau und Ausrüstung eines Schiffes, dat. Wismar 22. März 1529, enthält einige hochdeutsche Wörter: Ich (neben ick), Kuchmayster, pezalt, peken (bekeme), zu (neben to). Das Konzept zu einer Quittung Schubbers über den Empfang von Lohn für die Schiffszimmerleute vom 1. Juni 1529 ist fast ganz hochdeutsch (niederdeutsch nur: aff, na) 108 ).
Achim Passow, Vogt zu Schwaan, richtet 1535 ein Schreiben an Rostock, das niederdeutsch mit einigen hochdeutschen Wörtern ist, ein zweiter Brief vom selben Jahr ist typisch messingsch 109 ).
In den 40er Jahren begegnen in einigen Schreiben verschiedener Amtsbeamten einige hochdeutsche Wörter, z. B. ich, freuntlich, freunde, nicht, gekofft, hab, kuchmeister, frei, hertzog. Einmal ist die Anschrift hochdeutsch.
An hochdeutschen Schriftstücken (gelegentlich haben sie einige niederdeutsche Wörter) sind vor 1552 bislang folgende ermittelt:
1543 (10. Okt., dat. Stargard): Adam Hoffmann, Küchenmeister zu Strelitz, bescheinigt eigenhändig dem Stargarder Küchenmeister Johann Koch den Empfang von 400 Gulden für Ankauf von Wein.


|
Seite 192 |




|
1544 (13. Okt., "auf slos alden Stargath"): Benedictus Forstenue 110 ) bescheinigt eigenhändig dem Stargarder Amtmann (Vogt) Johann Stedtfelder den Empfang von 230 Gulden für denselben Zweck 111 ).
1546 (29. Juni, dat. Fürstenberg): Hans Bultzing, Küchenmeister zu Fürstenberg, bescheinigt demselben Hauptmann zu Stargard den Empfang von Malz.
1547 (9. Juni, dat. Fürstenberg): Derselbe bescheinigt demselben den Empfang von Speck und Schmalz.
1546 (15. Dez.) und 1548 (11. Mai): Johann Andresen (Hans Andreas, auch Johann Dene genannt, ein Däne von Geburt), Vogt zu Wredenhagen, berichtet Herzog Heinrich über die Teilung des Malzes in der Mühle zu Röbel.
1547 (7. Februar, dat. Schwerin): Engelke Rostock, Küchenmeister zu Schwerin, bescheinigt dem Stargarder Vogt den Empfang von Lebensmitteln. - Jedoch ist hierbei zu bemerken, daß diese Quittung von einem Schreiber geschrieben ist und daß Rostock - aller Wahrscheinlichkeit nach - in demselben Jahre (15. Nov.) eigenhändig eine für das Amt Stargard bestimmte Bescheinigung in rein niederdeutscher Sprache ausstellt. Dasselbe ist auch der Fall bei einer Quittung Rostocks vom 27. Mai 1548, ausgestellt dem Güstrower Küchenmeister Bastian Harbrecht.
1551 (18. März, dat. Ribnitz): Lorenz Mathei, Küchenmeister zu Ribnitz, berichtet dem Herzog Johann Albrecht über Schäden an den fürstlichen Häusern zu Ribnitz und bittet um Dienstentlassung, da der neue Vogt seinen eigenen Schreiber mitgebracht hat. (Mit einigen niederdeutschen Wörtern: nha, dacklos, vatter, schriber, by, liden, innahm, entleddigen.)
Von 1552 ab ist die Mehrzahl der Schreiben und Quittungen hochdeutsch. Der Übergang zur hochdeutschen Schriftsprache vollzieht sich vielfach innerhalb weniger Jahre. So schreibt 1550 der Wesenberger Küchenmeister Heinrich Lembach an den herzoglichen Sekretär Magister Simon Leupold niederdeutsch mit einigen wenigen hoch-


|
Seite 193 |




|
deutschen Wörtern. Im Jahre 1555 bescheinigt er dem Hauptmann Asmus Schröder zu Wredenhagen den Empfang von Pacht hochdeutsch; niederdeutsch ist nur noch: negen (9).
Doch macht sich in den 50er Jahren gelegentlich ein merkwürdiges Schwanken bemerkbar:
Niclaus Tide, Küchenmeister zu Schwerin, stellt in den Jahren 1554-1559 (dat. Schwerin) eigenhändig 12 Quittungen den Küchenmeistern zu Stargard, Wredenhagen, Wittenburg, Dobbertin, Gadebusch und Rehna aus. 11 von diesen sind hochdeutsch. - Gelegentlich haben sie einige niederdeutsche Wörter: scheperie, botter, schaep (= Schafe), buhowe, frig, tunne. - Hingegen ist die zwölfte, mitten in der Reihe stehende Quittung vom 21. November 1556, die ebenso wie die unmittelbar vorangehenden und folgenden Quittungen vom 11. August 1556 und vom 23. Januar 1557 für denselben Küchenmeister von Wittenburg ausgestellt ist, niederdeutsch bis auf einige hochdeutsche Wörter: ich, dreitzehen, ochsenm, sechs, einhundert achtzehn, nach!
Einige - wohl ältere Beamte - halten ziemlich zäh an der niederdeutschen Sprache fest:
Der Küchenmeister zu Güstrow Hans Ebel stellt 1551, 1552, 1552, 1554, 1555 eigenhändig (dat. Güstrow) 9 Quittungen aus für die Küchenmeister zu Stargard: Johann Koch, Lorenz Deiher bzw. Peter Thunnecke, für den Landrentmeister Sigmund von Esfeldt und für den Güstrower Hauptmann Stellan Wakenitz, und zwar niederdeutsch mit einigen wenigen hochdeutschen Wörtern: ich (neben ick), hab, hertzogk, auch, kuchemester (neben kakemester), thaler (neben daler). Eine zehnte Quittung (1555), die ebenso wie die vorangehende desselben Jahres für Thunnecke ausgestellt, aber nicht von Ebel eigenhändig geschrieben wurde, ist hochdeutsch.
Stellan Wakenitz, Hauptmann zu Strelitz, ein geborener Pommer, schreibt am 11. Juli 1564 von Strelitz aus an Herzog Johann Albrecht eigenhändig niederdeutsch mit einigen wenigen hochdeutschen Wörtern: das, haben, kuchemester, mich, zeit, mir, file (= viel). Hingegen sind 3 von ihm ausgestellte, aber nicht eigenhändig geschriebene Quittungen und Schreiben aus den Jahren 1565 (27. April, dat. Schwerin) bzw. 1586 (5. Dezember) und 1587 (27. Februar) - er war seit 1576 Hauptmann zu Neustadt -. hochdeutsch verfaßt.
Der "alte Kuchemeister" zu Stargard Hans Kock, der den Herzögen 46 Jahre gedient hatte, schreibt im Jahre 1565


|
Seite 194 |




|
(19. Juni, dat. alten Stargardt) an Eitel Schenck, Hauptmann zu Ivenack und Bürgermeister zu Neubrandenburg, über seine Notlage niederdeutsch mit ganz wenigen hochdeutschen Wörtern: ausschoß, das, der, kuchemeister, tragen, ufgebracht.
Sonst sind in den 60er und 70er Jahren auch die eigenhändigen Schreiben der Amtsbeamten hochdeutsch, wenn auch selten stärkere oder geringere Beimengungen von niederdeutschen Wörtern begegnen: ick, tho, gedent, kordt, blive, gedan, hebben, ock, dat, unangespreken, wethen, avergen usw. (Jacob Netzeband, Küchenmeister zu Plau, 1567 an Herzog Ulrich), ick, van, by, thruwen (Revers des Balzar Köhne, Küchenmeisters zu Neustadt, 1575).
Das letzte bislang festgestellte Schreiben eines Amtsbeamten, das noch eine stärkere Beimischung von niederdeutschen Wörtern enthält, ja, zum guten Teil geradezu als "messingsch" bezeichnet werden kann, ist das eigenhändige Schreiben, das Diderich Stralendorff, Hauptmann zu Stargard (Broda und Feldberg), an Herzogin Elisabeth, "geboren uth konniglichem stammen zu Dennemarck" (Gattin Herzog Ulrichs V.), am 16. September 1589 (dat. uff e. f. g. huse alten Stargerth) richtete.
Die Register (Rechnungen) und Beschreibungen (Amtsbücher) der Ämter, die in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts durchweg niederdeutsch verfaßt sind, werden seit 1552/53 in steigendem Maße hochdeutsch geführt. Der Wandel vollzieht sich auch hier verhältnismäßig rasch, wenn sich auch hier gelegentlich ein Schwanken in der Sprache oder eine Beimengung von einigen niederdeutschen Wörtern bemerkbar macht: inname, ingehaven, uthgave, bliff[t], hertogen, höner, botter, wulle, tunnen, hoppen, solt, tho, de, olde usw.
Das letzte bislang ermittelte niederdeutsche Register, ein Bukower Register, ist vom Jahrgang 1565/66. Vereinzelte niederdeutsche Wörter begegnen aber noch weit darüber hinaus in den Registern und Amtsbüchern.
3. Bei den Städten.
Erheblich später als beim Adel erfolgte die Aufnahme und Einbürgerung des Hochdeutschen als Schriftsprache bei den Städten. Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts herrschte das Niederdeutsche noch unumschränkt.


|
Seite 195 |




|
Zuerst wurde die hochdeutsche Schriftsprache beim Rat der Stadt Güstrow eingeführt. Ein Schreiben an Rostock vom Jahre 1534 ist noch niederdeutsch, die folgenden von 1540, 1541, 1554 usw. sowie ein Schreiben an Herzog Albrecht von 1544 sind hochdeutsch 112 ). Dasselbe ist der Fall bei den Protokollbüchern des Rates der Jahre 1537 ff. 113 ). Die in hochdeutscher Sprache verfaßten Beschwerden der Landstädte über Handelsunternehmungen des Adels, die 1536 den Herzögen übergeben wurden 114 ), stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Schreibstube des Rates der Stadt Güstrow. Denn diese hatte zu jenen Zeiten die Führung der Landstädte. - Das Hochdeutsche wurde also wahrscheinlich zwischen 1534 und 1536 bzw. 1540 in der Güstrower Ratskanzlei heimisch.
Aus der Tatsache, daß die gemeinsamen Beschwerden der mecklenburgischen Landstädte hochdeutsch abgefaßt wurden, kann man den Schluß ziehen, daß bei den Ratsherren dieser Städte im Jahre 1536 bereits ein genügendes Verständnis des Hochdeutschen vorhanden war.
Das Schweriner Stadtverlaßbuch 115 ) ist bis zu den ersten beiden Eintragungen von 1548 niederdeutsch geführt.


|
Seite 196 |




|
Die nächste Eintragung vom selben Jahr 1548 und von derselben Hand, die übrigens schon 1546 begegnet, ist messingsch, die darauf folgende ist hochdeutsch mit einigen wenigen niederdeutschen Wörtern, dann folgen noch 2 niederdeutsche Eintragungen derselben Hand. Von einer neuen Hand folgen: je eine niederdeutsche Eintragung vom Jahre 1549 und 1550, je eine hochdeutsche und niederdeutsche Eintragung vom Jahre 1551 - die letzte niederdeutsche des Stadtbuches. Die folgenden derselben Hand von 1553, 1557, 1558, 1559, 1560 usw. sind hochdeutsch. Gelegentlich begegnen einige wenige niederdeutsche Wörter (wy, verdrage).
Die Gründe für das eigenartige Schwanken zwischen Hochdeutsch und Niederdeutsch werden klar, wenn wir uns die Eintragungen genauer ansehen. Die erste messingsche von 1548 betrifft den herzoglichen Kanzleisekretär Sigmund Zwinge, der mit seiner Frau vor dem Rat erscheint, um seinen letzten Willen kundzutun. In der zweiten, hochdeutschen Eintragung von 1548 wird bekundet, daß der Goldschmied Christoffer Schnider an Herzog Heinrich sein Haus verkauft. Zeugen sind Herzog Heinrichs Küchenmeister Paschen Gustefel, der herzogliche Kanzleisekretär Jacob Eger und der herzogliche Hausvogt Hans Smede. Die hochdeutsche Eintragung von 1551 betrifft die Schenkung eines Herzog Heinrich gehörigen Hauses in der Stadt an seinen Kanzler und Rat Dr. jur. Johann Scheiring. Die zwischenliegenden Eintragungen betreffen nur Angelegenheiten Schweriner Bürger. - Der Einfluß des schon lange hochdeutsch schreibenden und sprechenden Hofes und der Kanzlei ist hier also sozusagen mit den Händen zu greifen. Ebenso wie bei Schwerin wird er auch bei Güstrow maßgebend gewesen sein.
Es war ganz natürlich, daß die Kanzleien der beiden Residenzstädte Mecklenburgs bei ihren engen Beziehungen zu den herzoglichen Höfen und Kanzleien zuerst die neue hochdeutsche Schriftsprache annahmen.
Länger hielt sich das Niederdeutsche bei den andern Landstädten: Die Stadt Crivitz schrieb 1544 an Schwerin niederdeutsch 116 ). Bützow richtete 1550 an Rostock ein


|
Seite 197 |




|
niederdeutsches, 1583 an einen mecklenburgischen Herzog ein hochdeutsches Schreiben 117 ). Eine bei Herzog Heinrich 1547 von der Stadt Grevesmühlen eingereichte Klageschrift ist niederdeutsch 118 ). Ribnitz schrieb 1542 und 1543 an Rostock niederdeutsch. In 2 Schreiben von 1551 und je einem von 1552 und 1553 finden sich schon vereinzelte hochdeutsche Wörter. Das folgende Schreiben von 1557 ist messingsch, das letzte vom Jahre 1572 ist hochdeutsch 119 ). Schreiben der Stadt Röbel an die mecklenburgischen Herzöge aus den Jahren 1529, 1532, [1535], 1540, 1548, 1549 sind niederdeutsch, die nächsten von 1570, 1577, 1581, 1582 usw. hochdeutsch. Die eigenhändig geschriebene Quittung, die Adrian Tileman, Stadtschreiber und Acciseschreiber zu Röbel, dem Güstrower Bürgermeister Joachim Koch über seine jährliche Besoldung als Acciseeinnehmer am 21. September 1565 ausstellte, ist rein hochdeutsch 120 ). Dasselbe ist der Fall bei der Bevollmächtigungsurkunde vom 28. August 1561, durch die die Stadt Röbel den Licentiaten Erasmus Behem zu ihrem Prokurator in ihrem Streit mit Constantin Freiberg zu Karchow wegen der Fischerei auf dem See Glin bestellte 121 ). - Aus diesen Tatsachen kann man den Schluß ziehen, daß der Rat der Stadt Röbel die hochdeutsche Schriftsprache für den auswärtigen Schriftverkehr zwischen 1549 und 1561 einführte. Im internen Schreibbetrieb hielt sich das Niederdeutsche etwas länger: Das Röbeler Stadtbuch (Stadtverlaßbuch) von 1487 ff. 122 ) ist bis zum 4. Juni 1567 niederdeutsch geführt. Die nächste Eintragung vom 5. November 1567 - von einer neuen Hand herrührend - ist wie alle folgenden hochdeutsch mit einigen niederdeutschen Wörtern (witlichen, jungk und oldt, ufgedragen und furlaten). Doch muß bemerkt werden, daß diese niederdeutschen Reminiszenzen sehr bald verschwinden.


|
Seite 198 |




|
Die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in den Landstädten Mecklenburgs wird sich nach Ausweis dieser Stichproben seit den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts angebahnt haben, und zwar zunächst in dem auswärtigen Schriftwechsel mit den Landesherren, Ämtern und benachbarten Städten. In den 60er bis 70er Jahren wird sich hier das Hochdeutsche in der Hauptsache durchgesetzt haben. Länger als in den auswärtigen Schriftwechseln hielt sich das Niederdeutsche wohl allgemein im internen Schreibbetrieb, bei der Führung der Stadtbücher (Stadtverlaßbücher, Grundbücher), Register, Rechnungen usw. Genaueres darüber wird sich ergeben, wenn die Bestände der Archive und Registraturen aller Landstädte Mecklenburgs geordnet und verzeichnet sind. Doch ist soviel sicher, daß die Einführung der hochdeutschen Sprache nicht mit einem Schlage, sondern zu recht verschiedenen Zeiten erfolgte. Das Jahr 1567, das sich bei der Durchforschung des Röbeler Stadtbuchs ergab, wird gelegentlich nicht unbeträchtlich überschritten werden. So ist das Teterower Stadt-Gerichtsprotokoll- und Pfandbuch von 1590/1600 bis zum Schluß in der Hauptsache niederdeutsch geführt mit einigen wenigen hochdeutschen Wörtern: auf (neben up), zu (neben tho, daß (neben dat), zeit (neben tydt), kauf, zynse, gebrauchen, zwischen (neben tusken und twischen). Gelegentlich begegnen von der Hand desselben Schreibers 1591, 1599, 1600 eine Anzahl von messingschen bzw. hochdeutschen Eintragungen, dasselbe ist der Fall bei einigen längeren Eintragungen von andern Händen aus den Jahren 1591, 1593, 1594. Ferner ist das Rechnungsbuch der Stadt Teterow (von 1561 ff.) bis 1608 niederdeutsch geführt worden, seit 1609 ist es in hochdeutscher Sprache abgefaßt, wenn auch noch eine Eintragung von 1613 niederdeutsch ist. - Bis 1600 ist niederdeutsch das Teterower St. Jürgen-Register (von 1505 ff.), von 1601 bis 1618 schwanken die Eintragungen zwischen messingsch, niederdeutsch und hochdeutsch, seit 1619 hat sich das Hochdeutsche endgültig durchgesetzt 123 ).
Erheblich länger als bei den Residenzstädten Güstrow und Schwerin hielt sich das Niederdeutsche als Schriftsprache in den


|
Seite 199 |




|
Kanzleien der beiden großen Seestädte Rostock und Wismar.
Die von der Stadt Rostock für die Herzöge ausgestellten Urkunden, je eine aus den Jahren 1501, 1504, 1508, 1510, 1515, 1528, sind bis 1528 einschließlich niederdeutsch, die nächste vom 22. April 1561 ist hochdeutsch 124 ). Niederdeutsch ist eine für den Rostocker Syndikus Johann Oldendorp vom Rostocker Rat ausgestellte Bestallungsurkunde aus dem Jahre 1533, ferner ein Notariatsinstrument vom 29. Juni 1560, in dem der Rat Besitz vom Eigentum der Michaelisbrüder nimmt 125 ).
Die Instruktionen der Rostocker Ratssendeboten für die Landtage sind bis zum 6. März 1561 niederdeutsch. Die nächste vom 3. Juli 1564 ist, wie alle folgenden, hochdeutsch 126 ). Die von Rostocker Ratssendeboten an den Rat gesandten Berichte über Verhandlungen auf Landtagen usw. sind bis zum 16. Juni 1554 niederdeutsch. Der nächste vom 19. November 1554 beginnt niederdeutsch, ist aber hernach hochdeutsch abgefaßt mit gelegentlichen niederdeutschen Wörtern. Dieser Bericht ist von derselben Hand geschrieben, welche eine Instruktion vom 2. Oktober 1553 noch niederdeutsch geschrieben hatte. Der Bericht über die drei Landtage von 1555 ist niederdeutsch 127 ), doch ist die Antwort Rostocks auf die Proposition der Herzöge doppelt, in niederdeutscher und hochdeutscher Sprache, ausgefertigt. Ferner sind Rostocks und Wismars Antwort auf den fürstlichen Gegenbericht vom 24. Mai 1555 und ihre Antwort auf die Artikel vom 25. Mai 1555, die Visitation und das Konsistorium betreffend, hochdeutsch abgefaßt. Drei Berichte aus dem Jahre 1559 (23., 24. Oktober, 22. Dezember) sind niederdeutsch, die beiden nächsten vom 9. und 18. Dezember 1560


|
Seite 200 |




|
hochdeutsch, doch finden sich darin noch vereinzelte niederdeutsche Wörter.
Ein Schreiben Rostocks an die dortige Universität vom 5. März 1554 (gleichzeitige Abschrift) ist bereits hochdeutsch. Die an die Herzöge gerichteten Schreiben sind in der Regel bis 1560 einschließlich niederdeutsch, wenn auch gelegentlich einige wenige hochdeutsche Schriftstücke begegnen (1555, 1556, 1559, 1560), 1563 ff. begegnen nur noch hochdeutsche Schreiben. Die gleichzeitigen Abschriften von Schreiben an den ständischen Ausschuß vom 5. Dezember 1559, 20., 23. März 1561 sind hochdeutsch, doch weisen sie vereinzelte niederdeutsche Wörter auf. Die Schreiben Rostocks an Wismar sind bis zum 6. Juni 1561 niederdeutsch, seit dem 26. Mai 1564 hochdeutsch 128 ).
Diese Zeugnisse ergeben, daß in den 50er Jahren das Hochdeutsche in die Schreibstube des Rostocker Rates eindrang, auch die Ratsherren ergriff und vielleicht seit Ende des Jahres 1561, sicher aber seit 1563, im Schriftverkehr mit der herzoglichen Kanzlei, mit den Ständen und Landtagen und mit der Nachbarstadt Wismar den Sieg über das Niederdeutsche errungen hatte.
Längere Zeit hielt sich das Niederdeutsche aber noch im internen Betrieb, in den Stadtbüchern, Ratsprotokollen und Stadtrechnungen, teils weil man hier immer zäher an den alten niederdeutschen Formeln und überhaupt am Althergebrachten festhielt, teils weil es offensichtlich völlig dem Belieben des betr. Stadtsekretärs, Unterschreibers oder Ratsherrn überlassen war, welche Sprache er anwenden wollte 129 ).
Das Stadtbuch wurde erst seit 1598 hochdeutsch geführt 130 ). Die vom Stadtschreiber Markus Radeloff ge-


|
Seite 201 |




|
schriebenen Ratsprotokolle sind bis 1574 niederdeutsch, während die des Bernhard Luschow von 1571 und 1572, wie auch die des Petrovius von 1578 ff. hochdeutsch sind. Von den in der Regel von Ratsherren geführten Stadtrechnungen sind die Gewettrechnungen von 1581, 1582, 1583 noch niederdeutsch, doch finden sich bereits vereinzelte hochdeutsche Wörter in ihnen: "auß", "waß", usw. Von 1586 ab sind sie hochdeutsch. Die Kämmereirechnungen sind 1574, 1576, 1577 niederdeutsch, 1588, 1590 ff. hochdeutsch. Dagegen ist ein Bürgergeldregister von 1596 noch niederdeutsch.
Auch bei den für die Bürgerschaft bestimmten Verordnungen hielt sich das Niederdeutsche noch länger. Die Hochzeits- und Kindtaufordnung von 1538, das Mandat über die Sonntagshochzeiten von 1557, eine Verordnung vom selben Jahr gegen Diebstahl und Raub, die Verordnung über die Kopfsteuer und den 100. Pfennig von 1563, die Hochzeitsordnung von 1567, die Lohnordnung von 1572 und die Feuerordnung von 1573 sind niederdeutsch 131 ). Die erste bisher veröffentlichte hochdeutsche Ordnung der Stadt Rostock ist die für den gemeinen Kasten von 1567. Die dazu gehörigen Eide des Kastenschreibers und des Kastenherrn sind noch niederdeutsch, dagegen ist der Eid des neuen Kastenherrn von 1584 hochdeutsch. Der Eid des Vogtes von Warnemünde aus dem Jahre 1560 und der Warnemünder Bürgereid von 1580 sind niederdeutsch 132 ). Hochdeutsch sind die nächsten Hochzeitsordnungen von 1583 und 1591 133 ). Die Bürgersprachen sind bis 1600 einschließlich niederdeutsch, doch treten in ihnen seit den 60er Jahren einige hochdeutsche Wörter auf. In den Bürgersprachen von 1600 sind sie zahlreicher vertreten. Abgesehen von der Bürgersprache von 1606 (?) sind die nächsten Bürgersprachen von 1603 ab hochdeutsch, doch finden sich in ihnen noch gelegentlich vereinzelte niederdeutsche Wörter. Dagegen sind die von der Kanzel herab verkündigten Mandate und Verträge über die Jagd nur bis 1563 niederdeutsch, von 1572 ab hochdeutsch 134 ).


|
Seite 202 |




|
Ein größerer Teil der Rostocker Bürger muß sich schon bald an das Hochdeutsche gewöhnt haben, denn die durch Klaus Hamel dem Rat im Namen der Bürgerschaft vorgetragenen Artikel vom 31. Dezember 1560 sind in hochdeutscher Sprache abgefaßt 135 ). Doch sind Nachrichten darüber, wann das Hochdeutsche sich bei den einzelnen Rostocker Bürgern als Schriftsprache durchsetzte, bisher noch nicht festgestellt 136 ).
Von der Stadt Wismar ausgestellte Urkunden aus den Jahren 1560, 1564, 1566 sind hochdeutsch, doch finden sich noch bis 1569 niederdeutsche Urkunden vor 137 ).
Eine gedruckte Verordnung des Wismarer Rates über einen Glückstopf vom Jahre 1554 ist schon hochdeutsch 138 ). Ein Beglaubigungsschreiben für die zu einem Landtag abgeschickten Ratssendeboten vom Jahre 1555 ist gleichfalls hochdeutsch. Die Instruktionen für Landtage und Hansetage vom Juli 1560, 22. Februar 1561, 5., 12. März 25. Mai, 24. Juli 1562 sind niederdeutsch, vom 9. Januar 1561, 9. Oktober 1562, 9. Mai 1563 hochdeutsch. Hochdeutsch ist auch eine Instruktion für einen Prokurator in Speier vom 6. September 1560. Am 14. Januar 1561 schreibt die Stadt an den Landtagsausschuß hochdeutsch, am 20. März 1561 an die Herzöge dagegen niederdeutsch 139 ). Die in größerem Umfange erhaltenen Schreiben der Stadt an Rostock sind bis zum 11. Mai 1562 niederdeutsch. Doch finden sich seit den 40er Jahren in ihnen schon vereinzelte hochdeutsche Wörter:


|
Seite 203 |




|
waß, freundhe, zuvor usw. Vom Oktober 1562 ab sind sie aber rein hochdeutsch 140 ).
1554 schrieb der Wismarer Stadtsekretär Dionysius Sager an einen Rostocker Bürgermeister messingsch. 1557 und 1558 dagegen - er war seit 1555 nach Techens Mitteilung Ratsherr - schrieb er an die Stadt Rostock niederdeutsch. Der Wismarer Bürgermeister Peter Sasse schrieb 1555 an zwei Rostocker Bürgermeister messingsch. Er bemüht sich in diesem Schreiben sichtlich, hochdeutsch zu schreiben, aber es gelingt ihm nicht recht, und er verfällt immer wieder in sein angeborenes Niederdeutsch 141 ).
Diese Zeugnisse rechtfertigen den Schluß, daß seit den 50er Jahren des 16. Jahrhunderts vereinzelte hochdeutsche Wörter in die Schreibstube des Wismarer Rates eindrangen, daß hier und bei wismarschen Ratsherren in den 50er Jahren das Hochdeutsche mit dem Niederdeutschen um die Vorherrschaft rang und daß, wenigstens was den auswärtigen Schriftwechsel anbetrifft, seit Ende 1562 der Sieg zugunsten des Hochdeutschen entschieden war.
Auch in Wismar hielt sich das Niederdeutsche noch länger in den Stadtbüchern und Verordnungen 142 ). Die nicht mehr im Original erhaltenen Stadtbücher (Grundbücher) waren nach den erhaltenen Auszügen bis 1587 niederdeutsch, seit 1588 hochdeutsch geführt. Wahrscheinlich fällt dieser Wechsel der Sprache mit dem Amtsantritt des Stadtsekretärs Markus Tanke zusammen. Die kleinen Stadtbücher (Zeugebücher) sind rein niederdeutsch bis 23. Oktober 1576, dann treten vereinzelte hochdeutsche Eintragungen auf bis zum 13. Januar 1578, hernach sind sie dauernd hochdeutsch. Das Gerichtszeugebuch ist bis zum 31. Juli 1572 rein niederdeutsch, seit 29. August 1572 mit Eintritt des Schreibers Jochim Bomgarden messingsch mit überwiegendem hochdeutschem Charakter. Die Konzeptbücher beginnen im Januar 1569 und sind hochdeutsch.
Niederdeutsch sind die Verordnungen über Unzucht


|
Seite 204 |




|
und Ehebruch von 1566 143 ), die Begräbnisordnung von 1579, die Ordnung für die Träger von 1584 und der Eid der Kohlenträger in ihrer hochdeutschen Ordnung von 1586. Hochdeutsch ist die Gerichtsordnung von 1578 und die Bettelordnung von 1579. Die Bürgersprachen sind 1572-78, 1480-1608 niederdeutsch, 1610 hochdeutsch. Da aber die Kanzelabkündigungen seit 14. September 1580 hochdeutsch sind, kann man vielleicht sagen, daß auch in den Verordnungen im großen und ganzen etwa seit den 80er Jahren das Hochdeutsche den Sieg errungen hat.
Eine eigenhändige Quittung, die der Wismarer Bürger und Kaufmann Hinrich Alkopf dem herzoglichen Rentmeister Sigmund von Esfeld 1549 ausstellte, ist messingsch. Drei Rechnungen Alkopfs für Herzog Johann Albrecht von 1552 sind messingsch bis hochdeutsch. Doch blieb die Schriftsprache der Bürger Wismars im allgemeinen noch lange das Niederdeutsche. Eingaben und Schreiben von ihnen an den Rat sind noch 1599, 1609, ja bis 1648 niederdeutsch. 1657 richtete ein Wismarer Bürger an den Rat aber ein hochdeutsches Gesuch 144 ).
Der Anstoß zur Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache durch die Städte dürfte im allgemeinen von der herzoglichen Kanzlei ausgegangen sein, es werden daneben auch die Stadtschreiber eine Rolle dabei gespielt haben. Doch bedarf das noch eingehender Untersuchungen.
4. Bei der katholischen und evangelischen Geistlichkeit.
Zunächst fand die hochdeutsche Sprache Eingang in den Kanzleien der Bischöfe von Ratzeburg und Schwerin.
Das erste und einzige hochdeutsche Schriftstück, das aus der Regierungszeit des Ratzeburger Bischofs Heinrich (Bergmeyer, 1511-24) ermittelt werden konnte,. ist die gleichzeitige Abschrift eines Beglaubigungsschreibens vom 19. Oktober 1523, ausgestellt für den Reichstagsbevollmächtigten des Bischofs. - Der Umstand, daß das Dokument mit ins Reich genommen werden sollte, wird die Veranlassung zur Wahl der hochdeutschen Sprache gegeben haben. - Sonst sind die zahlreichen Urkunden aus Heinrichs Zeit, ebenso wie die aus den Regierungszeiten seiner Vorgänger, niederdeutsch ab-


|
Seite 205 |




|
gefaßt; auch ließ Heinrich Bergmeyer noch im Jahre 1523 an Herzog Heinrich V. von Mecklenburg niederdeutsch schreiben.
Für den aus einfachen Verhältnissen stammenden Sohn der Hansestadt Hamburg und nachmaligen Sekretär bzw. Kanzler der Herzöge von Sachsen Lauenburg war, wie seine eigenhändigen Schreiben zeigen, als Schriftsprache noch das Niederdeutsche das naturgegebene.
Hingegen wird Heinrichs Nachfolger Georg (von Blumenthal, 1524-50, er war zugleich Bischof zu Lebus), der aus einem alten Adelsgeschlecht der Prignitz stammte, bereits seit der Zeit, wo er bischöflicher Sekretär bzw. Dechant zu Lebus war, das Hochdeutsche als Schriftsprache angewandt haben. Jedenfalls aber richtete er 1524, 1525 und 1526 an die mecklenburgischen Herzöge und 1525 an den Rehnaer Vogt Georg Wolder hochdeutsche Schreiben. Hochdeutsch ist die von Georg selbständig ausgestellte Urkunde von 1540, in der er den Meistern des Schneiderhandwerks in seinem "Weychbilde" Schönberg ihre Gerechtigkeiten und Statuten (unter Transsumierung des niederdeutschen Privilegs des Bischofs Johann von 1500) bestätigt.
Andererseits sind Georgs Urkunden über die mit Zustimmung des Ratzeburger Domkapitels erfolgten Verkäufe von Renten (an den Lübecker Bürgermeister Claus Brömse, an den Vikar Johann Lange zu Gadebusch und an das Domkapitel zu Lübeck) aus den Jahren 1524, 1525, 1530 und 1545 - mit einer Ausnahme von 1525 - niederdeutsch. Hierbei macht sich offenbar der Einfluß des Domkapitels des Stifts Ratzeburg geltend, das noch lange an der niederdeutschen Schriftsprache festhielt. Die Urkunden des Domkapitels sind bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus (1525, 1526, 1531, 1550, 1552) niederdeutsch. Die dann folgenden Urkunden von 1589, 1592, 1596 sind hochdeutsch verfaßt 145 ).


|
Seite 206 |




|
Viel ungünstiger als beim Bistum Ratzeburg sind die Überlieferungsverhältnisse des Schrifttums des Bistums Schwerin.
Aus den Jahren 1500-1525 liegt nur je eine niederdeutsche Urkunde des Bischofs Johann bzw. des Domkapitels aus den Jahren 1506 bzw. 1514 vor.
Die Administratoren des Stifts Schwerin, die mecklenburgischen Herzöge Magnus bzw. Ulrich stellten 1526, 1527, 1541, 1546 bzw. 1550 Urkunden in hochdeutscher Sprache aus. Die ersten 4 Urkunden betreffen die Verleihung von Burglehen des Stifts an den herzoglichen Kanzler Caspar von Schöneich. In der Urkunde vom 2. April 1550 bescheinigt Herzog Ulrich, dem als "Postulatus" die interimistische Verwaltung des Stifts übertragen war, daß ihm das Domkapitel die Schlüssel zu den Schlössern und Städten Bützow und Warin übergeben habe. In einer 2. Urkunde von 1550 (Juni 5.) verpachtet Ulrich den Anteil des Stifts an der Fischerei auf den Seen bei Schwerin auf 10 Jahre dem Domdechanten Henning Pentz 146 ). - Der Inhalt dieser Urkunden spricht schon für die Wahrscheinlichkeit, daß sie von Angehörigen der herzoglich-mecklenburgischen Kanzlei geschrieben sind. Ein eingehender Schriftvergleich mit andern Urkunden der mecklenburgischen Herzöge (bes. Schuldbriefe) erhob diese Wahrscheinlichkeit zur Sicherheit. Dasselbe Ergebnis hatte auch eine Untersuchung von drei hochdeutschen Urkunden von 1535, 1540 und 1550, die als Aussteller das Schweriner Dom-


|
Seite 207 |




|
kapitel nennen. In den beiden ersten werden dem Kanzler Caspar von Schöneich gleichfalls Burglehen verschrieben. Durch die Urkunde von 1550 (April 2.) bescheinigt das Domkapitel, daß ihm die Schlösser, Städte und Voigteien Bützow und Warin mit allem Inventar und Zubehör von Herzog Heinrich so abgetreten seien, wie das Domkapitel sie s. Zt. dem Administrator Herzog Magnus übergeben hätte.
Das Schweriner Domkapitel selbst muß noch lange - bis in die evangelische Zeit hinein - das Niederdeutsche als Schriftsprache beibehalten haben. Niederdeutsch sind je ein Schreiben des Domkapitels von 1535 und der Dompriester und Kapellane von 1540 147 ), sowie die Urkunde vom 13. November 1567, in der das Domkapitel an Joachim von Halberstadt zu Klein Brütz den Domhof vor der Schelfe, an der Ecke bei der Schweriner Stadtmauer (Domhof, jetzt Arbeitsamt), verkauft. Die nächste Urkunde des Domkapitels vom 4. Januar 1568 - einem Schweriner Bürger wird ein am Kirchhofe gelegenes Haus überlassen - ist wie die folgenden von 1578 und 1587 hochdeutsch 148 ).
Niederdeutsch sind die Urkunden von Neukloster bis hin zum Jahre 1546 149 ).
Niederdeutsch sind ein Schreiben des Klosters Dobbertin vom Jahre 1544 150 ) sowie drei Quittungen, die im Jahre 1557 von der Priorin und der Unterpriorin dem Küchenmeister ausgestellt werden. Hochdeutsch sind Urkunden bzw. Rezesse der Kloster-Provisoren von 1581, 1583, 1586 151 ). Das von der jedesmaligen Priorin oder Unterpriorin desselben Klosters fast durchweg eigenhändig geführte Rechnungsbuch, das um 1491 beginnt und bis 1872 fortgesetzt wurde, ist bis weit in die evangelische Zeit hinein, bis 1626 einschließlich, niederdeutsch


|
Seite 208 |




|
geführt worden. Sehr selten kommen vorher hochdeutsche Wörter vor, z. B. 1600 "chuchmeister", "ins". Von 1633 bis 1636 macht sich ein Schwanken zwischen Hochdeutsch, Messingsch und Niederdeutsch bemerkbar. Die nächsten Eintragungen von 1649 ab sind hochdeutsch, wenn sich auch noch gelegentlich vereinzelte niederdeutsche Wörter vorfinden 152 ).
Die in den Jahren 1522, 1524, 1525, 1527, 1528, 1535, 1536, 1546 und 1549 von Abt, Prior und Konvent des Klosters Doberan an die mecklenburgischen Herzöge und an ihre Beamten gerichteten Schreiben sind niederdeutsch. Dasselbe ist der Fall bei Urkunden, die Abt und Konvent 1525 und 1528 dem Titke Bremer hinsichtlich des Hofes Jennewitz bzw. dem Lüneburger Bürger Claus Stoterogge ausstellen. Auch zwei für die mecklenburgischen Herzöge 1528 und 1530 ausgestellten Urkunden, die aus der Schreibstube des Klosters stammen, sind niederdeutsch. Die erste ist eine Bescheinigung über die Rückzahlung eines Darlehens durch Herzog Heinrich, in der zweiten wird den Herzögen Heinrich und Albrecht der Krakower See erblich gegen eine Rente von 50 Gulden verkauft. Andererseits stammt eine hochdeutsche Urkunde vom 6. November 1533, in der Abt Nicolaus I. dem Herzog Heinrich den Empfang von 8 Ölgemälden bestätigt, aus der herzoglichen Kanzlei. Dasselbe ist der Fall bei der hochdeutschen Urkunde vom 7. März 1552, in der Abt Nicolaus II. (Peperkorn), Prior und Konvent das Kloster mit allen seinen Gütern an Herzog Johann Albrecht abtreten. - Der Abt erhielt eine jährliche Leibrente von 100 Gulden. - Dieser letzte Abt des Klosters hat persönlich zäh an der niederdeutschen Sprache festgehalten, denn die Urkunde weist am Schlusse seine eigenhändig geschriebene Bestätigung in niederdeutscher Sprache auf. Dasselbe gilt von seiner Niederschrift über seine Abdankung (13. März 1552). Hingegen ist die wahrscheinlich aus der Klosterschreibstube stammende Urkunde vom 1. April 1549, in der Abt Nicolaus II. und der ganze Konvent des Klosters Herzog Heinrich bescheinigen, daß er "auß gnedighen willen" dem Kloster 50 Gulden gegeben hat, damit es die verfallenen Baulichkeiten des Klosters restaurieren lassen könne, hochdeutsch bis auf: mandag 153 ).


|
Seite 209 |




|
Früher als bei Doberan macht sich das Eindringen des Hochdeutschen in die Schreibstube des Klosters Broda bemerkbar.
Während Urkunden von 1530, 1531, 1536 sowie der Entwurf zu einem an die Stadt Neubrandenburg gerichteten Schreiben des Propstes Joachim von Gulen aus dem Jahre 1537 noch rein niederdeutsch sind, begegnen in einer niederdeutschen Schuldverschreibung desselben Propstes, ausgestellt für Prior und Kapitel zu Broda im selben Jahre 1537 einige wenige hochdeutsche Wörter: thue, tüchtigen. Eine 1541 von Propst Henning Becker, Prior und ganzen Kapitel dem mecklenburgischen Lehnsmann Diderick Lanckow zu Woggersin ausgestellte Urkunde weist bereits eine stärkere Beimengung hochdeutscher Wörter auf: zu (neben tho), wir (neben wy), bey (neben by), offenbar, das, uff, thun, auch. Rein niederdeutsch ist wiederum ein 1545 abgeschlossener Kontrakt zwischen Propst Joachim Ulrich und dem Klosterbrauer und -bäcker Achim Lange. Einige wenige hochdeutsche Wörter (ich, hauses neben huses) hat eine für Diderick Lanckows Erben ausgestellte Urkunde des genannten Propstes, des Priors und Konvents vom gleichen Jahre 1545. Ein im Jahre 1548 an die Herzöge gerichtetes Schreiben desselben Probstes, worin er um Milderung der Jäger-Ablagerlasten bittet, ist hochdeutsch.
Das erste hochdeutsche Schriftstück des Rostocker Dom-Kapitels (St. Jakobi), eine bei Herzog Ulrich eingereichte Beschwerdeschrift, ist vom Jahre 1556, vorangehen vier niederdeutsche Original-Aktenstücke aus dem Jahre 1531 154 ). Vom Karthäuserkloster Marienehe ist die erste hochdeutsche Urkunde vom Jahre 1553. Eine Urkunde von 1576, ausgestellt vom letzten Bruder des Klosters, ist niederdeutsch und hochdeutsch ausgefertigt, dagegen ist je ein Brief aus den Jahren 1532 und 1534 niederdeutsch 155 ). Noch länger hielt sich das Niederdeutsche bei den Rostocker Michaelisbrüdern: Ihre Urkunden aus den Jahren 1519, 1532, 1533, 1542, 1557 (2), 1559 sind niederdeutsch 156 ). Urkunden und Briefe von katholischen Pfarrern und Prälaten aus den Jahren 1511, 1522 (2), 1524 (2), 1526 (2), 1531, 1532, 1533 sind niederdeutsch 157 ).


|
Seite 210 |




|
Soweit es diese Zeugnisse erkennen lassen, scheint es so, als ob das Hochdeutsche in der rein katholischen Zeit - wenn wir von den Kanzleien der Bischöfe von Ratzeburg und Schwerin und des Klosters Broda absehen - bei den geistlichen Stiftungen und bei den einzelnen Geistlichen kaum eine Aufnahme gefunden hat. Bei den Kanzleien der Bischöfe von Ratzeburg und Schwerin ist aber zu bedenken, daß die genannten Bischöfe Territorialherren waren, die im allgemeinen mit den mecklenburgischen Herzögen auf gleicher Stufe standen. Hingegen verkörperten die Domkapitel die (geistlichen) Landstände der beiden Bistümer. - Das Hochdeutsche dürfte im allgemeinen erst nach der Mitte des Jahrhunderts bei der Geistlichkeit eingedrungen sein, als seit den 30er bis 50er Jahren die katholischen Stiftungen allmählich aufgehoben und verweltlicht wurden. Das Niederdeutsche scheint sich aber teilweise auch dann noch, wie das Dobbertiner Rechnungsbuch zeigt, recht lange gehalten zu haben.
Dagegen treffen wir das Hochdeutsche als Schrift- und Kanzelsprache bei evangelischen, aus dem hochdeutschen Sprachgebiet stammenden Predigern schon früh an.
Ein Prädikant Martin der Oberländer, der aus dem sächsischen Erzgebirge stammte, begegnet uns schon 1526 in Schwerin 158 ). 1531 richtete Faustin Labes, Prädikant zu Güstrow, an Herzog Albrecht ein hochdeutsches Schreiben 159 ). Hochdeutsch ist auch ein Schreiben des aus Ungarn stammenden schwerinschen Hofpredigers Egidius Faber an die Stadt Sternberg vom Jahre 1533 160 ). Der aus der Wetterau stammende Erasmus Alberus, welcher 1552/53 zu Neubrandenburg als Superintendent wirkte, verfaßte dort 1553 eine hochdeutsche Schrift wider die Lehre der Karlsstadter, die nach seinem Tode (1553) zu Neubrandenburg im Jahre 1556 gedruckt wurde 161 ). Eine Predigt des Rostocker Superintendenten Johannes Drakonites, der aus Karlsstadt im Würzburgischen stammte, vom Jahre 1558 war hochdeutsch 162 ). Johannes Biesenthal, Pastor zu Bellin, stellte 1558 dem Küchenmeister


|
Seite 211 |




|
zu Dobbertin eigenhändig eine hochdeutsche Quittung aus 163 ). Doch schrieben und predigten die aus Niederdeutschland stammenden evangelischen Prediger um diese Zeit noch hochdeutsch. Der aus Lübeck stammende Thomas Aderpul, Prädikant zu Malchin, schrieb 1531 an Herzog Albrecht niederdeutsch; sein Bekenntnis aus dem Jahre 1532 ist ebenso wie das seines Kollegen Georg Berenfelde, der Prädikant zu Friedland war, niederdeutsch 164 ). Ein Brief des Predigers Cyriacus von Bernburg zu Stuer an Herzog Heinrich von 1532, ferner ein Schreiben des Predigers Andreas Sachsse zu Konow an Egidius Faber von 1537 ist niederdeutsch 165 ). 1540 hielt der aus Boizenburg stammende Rostocker Predikant Heinrich Techen nach Beendigung der Predigt eine niederdeutsche Ansprache an die Gemeinde 166 ). Zwei Quittungen, die im Jahre 1552 der Pastor zu Schwerin, Ernst Rothmann, und der zu Parchim, Johannes Riebling, dem Rentmeister Sigismund von Esfeld eigenhändig ausstellten, sind niederdeutsch 167 ). Der Rostocker Prediger Johannes Jordanus richtete 1558 an den Rostocker Rat ein niederdeutsches Schreiben 168 ).
Im allgemeinen müssen bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus die hochdeutschen Predigten noch durchaus zu den Seltenheiten gehört haben: 1557 hielten es die Herzöge noch für nötig, die hochdeutschen Kirchenordnungen von 1552 und 1554 ins Niederdeutsche übersetzen zu lassen, wahrscheinlich um dadurch auf Pastoren und Gemeinden eine bessere Einwirkung zu erzielen 169 ).
Auch in der Bibel und in den Gesangbüchern hielt sich die einheimische Sprache noch lange.
Niederdeutsch sind die zu Rostock gedruckten Neuen Testamente von 1530, 1540, 1553 und die Bibel von 1580 170 ). Die Gesangbücher von 1525, 1531, 1543, 1577 sind niederdeutsch. Ob noch 1618 zu Rostock ein niederdeutsches Gesangbuch gedruckt wurde, ist noch nicht genügend geklärt 171 ). Wenn auch


|
Seite 212 |




|
der niederdeutsche Kirchengesang sich in den Dörfern wohl noch bis gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts gehalten haben mag, drang doch das Hochdeutsche seit der Wende des Jahrhunderts in den größeren Städten hier siegreich durch: Die 1601 zu Rostock gedruckten Psalmenharmonien des Rostocker Magisters Burmeister sind bereits hochdeutsch. Sie zeigen uns, wie "die Schule den hochdeutschen Gesang in die Kirche trug" 172 ).
Ferner findet sich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine blühende, von Mecklenburgern in niederdeutscher Sprache verfaßte geistliche Literatur 173 ). Da aber die hochdeutschen Drucke dieser Zeit noch nicht zusammengestellt sind, wissen wir nichts Näheres über das allmähliche Vordringen des Hochdeutschen auf diesem Gebiete und über das zahlenmäßige Verhältnis der niederdeutschen zu den hochdeutschen Schriften. Doch beauftragte Herzog Ulrich noch 1585 den Rektor der Güstrower Domschule, Omichius, in Leipzig in "sächsischer" (= sassischer, d. h. niederdeutscher) Sprache abgefaßte Hauspostillen zu kaufen, "da auf dem Lande viele Pastoren wären, welche die hochdeutsche Sprache nicht lesen und verstehen könnten" 174 ). Zwei gedruckte Predigten des Rostocker Pastors Gryse von 1587 und 1588 sind ebenso wie andere gedruckte Schriften desselben aus den Jahren 1593-1614 niederdeutsch. Aus dem Jahre 1596 haben wir schon eine hochdeutsche gedruckte Predigt eines andern Pastors der Stadt Rostock 175 ). Von mecklenburgischen Pastoren für Mecklenburger gehaltene gedruckte Leichenpredigten aus den Jahren 1551, 1593, 1594, 1595, 1602, 1609 sind niederdeutsch 176 ). Doch muß im allgemeinen im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts das Niederdeutsche immer mehr, und zwar recht schnell, als Schriftsprache der Pastoren und als Sprache der Predigten zurückgegangen sein. Ein sehr wahrscheinlich von dem Moisaller Pastor Leonhard Freundt herrührendes historisch-geistliches Lied


|
Seite 213 |




|
vom Jahre 1594 ist hochdeutsch 177 ). Zwei Berichte des Pastors zu Warnemünde, Joachim Mancelius, aus dem Jahre 1598 sind gleichfalls hochdeutsch 178 ). Als 1601 die Superintendenten bei Herzog Ulrich anfragten, ob die neue Kirchenordnung in meißnischer oder mecklenburgischer Sprache abgefaßt werden sollte, antwortete der Herzog, daß die Sprache hochdeutsch sein sollte, "weil nunmehr fast jedermann in diesem Lande" der hochdeutschen Sprache "kundig und erfahren ist" 179 ).
Es ging nun schnell zu Ende mit dem Niederdeutschen in der Kirche. Die gedruckte niederdeutsche geistliche Literatur, die Mecklenburger als Verfasser hat, geht nach 1600 sehr stark zurück. Gryses Gebete und Psalmen von 1614 sind das letzte Zeugnis dieser Literatur 180 ). Die 1609 gedruckte Leichenpredigt ist die letzte niederdeutsche. Sie wurde vom Wismarer Pastor Antonius Hertzberg 1608 beim Begräbnis eines Wismarer Bürgermeisters gehalten. Nikolaus Dunker, Pfarrer zu Woserin, der noch 1602 eine 1601 für einen mecklenburgischen Adligen gehaltene "Lyckpredigt" in niederdeutscher Sprache drucken ließ, verfaßte bereits 1616 für einen andern mecklenburgischen Adligen einen "Leichensermon" in hochdeutscher Sprache 181 ). Selbst im Schreibbetrieb der Landkirchen schwand das Niederdeutsche schnell dahin. Das Einnahmebuch der Kirchenvorsteher zu Toitenwinkel (Dorf bei Rostock) wurde von 1618/19 ab hochdeutsch geführt 182 ).
Die Reformation ist also ohne Bedeutung für die erste Einführung der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg gewesen. Diese war schon lange durch die herzogliche Kanzlei und durch mecklenburgische Adlige erfolgt. Dagegen dürfte die Reformation recht wesentlich zur weiteren Ausbreitung und endgültigen Einbürgerung der hochdeutschen Sprache beige-


|
Seite 214 |




|
tragen haben, indem insbesondere durch die hochdeutschen Predigten und Kirchengesänge die großen Massen an die hochdeutsche Sprache gewöhnt und damit vertraut gemacht wurden. Im übrigen verdrängte ja auch die Reformation die lateinische Sprache aus dem Gottesdienst.
Die niederdeutschen Pastoren werden wohl durch ihre hochdeutschen Amtsgenossen, durch die aus der herzoglichen Kanzlei ergangenen hochdeutschen Verordnungen, die sie von den Kanzeln herab zu verlesen hatten, durch Schule und Universität, vor allem aber wohl durch Luthers Schriften und durch hochdeutsche Andachts- und Predigtbücher angeregt sein, auch ihrerseits die hochdeutsche Sprache anzunehmen.
5. Bei der Landesuniversität und bei den Schulen.
Von dem aus Göttingen stammenden Professor Tileman Heverlingh, der von 1501 bis 1511 an der Rostocker Universität lehrte, wird berichtet, daß er klassische Autoren in niederdeutscher Sprache erklärte 183 ). Wann zuerst die hochdeutsche Sprache zu Rostock in Vorlesungen angewandt wurde, wissen wir nicht. Naturgemäß nahm die lateinische Sprache in der Humanistenzeit eine beherrschende Stellung im Universitätsbetrieb ein. Doch ist zu vermuten, daß Nikolaus Marschalk, der seit 1510 an der Rostocker Universität wirkte, die hochdeutsche Sprache gelegentlich in seinen Vorlesungen angewandt hat, wie er ja auch Briefe und Berichte hochdeutsch abfaßte 184 ). Allerdings muß auch das Niederdeutsche längere Zeit neben dem Hochdeutschen angewandt worden sein. Der aus Braunschweig stammende Professor Giltzheim schrieb 1522 an Herzog Heinrich hochdeutsch (mit einigen niederdeutschen Wörtern). Hochdeutsch war auch sein Bericht über die Schweißsucht von 1529, während er 1531 an den herzoglichen Kanzleisekretär Michel Hildebrand niederdeutsch schrieb 185 ). Ein Brief, den der Professor und Domherr Conrad Pegel für das Stift Schwerin im Jahre 1526 an Herzog Heinrich V. von Mecklenburg schrieb, ist niederdeutsch 186 ). Dasselbe ist der Fall bei Schreiben der Universität an Herzog Heinrich von 1522 und des Konzils an den Kanzler Caspar von Schöneich vom Jahre 1530 187 ). Eine Quittung des aus Breslau


|
Seite 215 |




|
stammenden Professors Aurifaber von 1552 ist hochdeutsch 188 ). Aus dem Umstande, daß die Stadt Rostock im Jahre 1554, also merkwürdig früh, ein hochdeutsches Schreiben an die Universität richtete 189 ), kann man vielleicht schließen, daß das Hochdeutsche schon in den 50er Jahren an der Universität üblich war. Hochdeutsch sind: Je eine eigenhändig geschriebene Gehaltsquittung der Rostocker Professoren David Chyträus und Tilemann Heshusius vom Jahre 1557 190 ) sowie zwei von der Universität für die Stadt Rostock ausgestellte Urkunden über das Kloster der Michaelisbrüder von 1568 und 1572 191 ).
Weit mehr als von der herzoglichen Kanzlei dürfte der Anstoß zur Einführung der hochdeutschen Sprache von landsfremden Professoren, die sich frühzeitig der hochdeutschen Sprache bedienten, ausgegangen sein.
Über die Aufnahme der hochdeutschen Sprache in den Schulen sind bislang nur wenige Nachrichten veröffentlicht worden. An der Kirchspielschule zu St. Marien in Rostock erklärte im ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts der aus Minden stammende "scholemeyster" Magister Hildebrandt Dorgelo lateinische Klassiker in niederdeutscher Sprache. Ferner hatten nach Gryse die Rostocker Michaelisbrüder "van oldinges her" in ihrem Kloster eine "gemeine düdische (d. h. niederdeutsche) schole" gehalten 192 ). An den beiden bedeutendsten Schulen des Landes, der Schweriner Fürstenschule und der Güstrower Domschule, scheint, wie man aus den von ihren Rektoren 1569 bzw. 1578 verfaßten hochdeutschen Schulkomödien schließen kann, das Hochdeutsche um diese Zeit schon üblich gewesen zu sein 193 ).
Trotz dieser dürftigen Nachrichten darf die Bedeutung der Schule für die weitere Ausbreitung und Einbürgerung der hochdeutschen Sprache nicht unterschätzt werden, sie hat hierbei zusammen mit der Universität zweifellos eine große Rolle gespielt. Fremde oder in der Fremde gebildete Lehrer dürften im allgemeinen das Hochdeutsche in die Schule hineingetragen haben.


|
Seite 216 |




|
6. In den Druckereien.
Die Einführung der auf hochdeutschem Sprachgebiet erfundenen Kunst des Buchdrucks in Mecklenburg ist wenigstens für die erste Einführung der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg von keinerlei Bedeutung gewesen.
Von 1476 ab wurde zu Rostock dauernd, zeitweise sogar gleichzeitig in mehreren Druckereien gedruckt: Nachweisbar von den Michaelisbrüdern von 1476 bis 1531 194 ), vom Rostocker Stadtsekretär Hermann Barckhusen von 1505 bis 1512(13?) 195 ), vom herzoglichen Rat und Universitätsprofessor Nikolaus Marschalk von 1514 bis 1522 196 ), vom Drucker Ludwig Dietz von


|
Seite 217 |




|
1509 bis 1558(59) 197 ). Trotzdem tauchen die ersten hochdeutschen Drucke aus Marschalks und Dietz's Werkstatt erst in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts auf. Die Michaelisbrüder und Barckhusen haben überhaupt nicht hochdeutsch gedruckt. Die hochdeutschen Drucke sind Abdrucke von herzoglichen Hausverträgen, gedruckt zwischen 1518(20) und 1523, von einem Mandat des Kaisers von 1521, von einem Urteil des kaiserlichen Kammergerichts von 1525, von herzoglichen Verordnungen aus den Jahren 1526, 1527, von Landtagsausschreiben aus den Jahren 1527, 1529 usw., denen später Steueredikte und Aufgebotsschreiben folgten 198 ). Es hing aber nur von der herzoglichen Kanzlei, nicht vom Belieben des Druckers ab, ob diese Mandate und Ausschreiben in hochdeutscher oder in niederdeutscher Sprache ergehen sollten 199 ). Dagegen dürften die Drucker wohl Einzelheiten in Sprache und Ausdruck gelegentlich nach eignem Gutdünken geändert haben 200 ). Die einzige hochdeutsche, bisher bekannt gewordene Privatarbeit eines Druckers, für die also ausschließlich seine Sprache in Betracht kommt, ist der Auszug aus mecklenburgischen Chroniken des Nikolaus Marschalk von 1522, den er dem Kanzler Caspar von Schöneich widmete 201 ). Von Hermann Barckhusen, der das Hochdeutsche und das Niederdeutsche völlig beherrschte, wissen wir sogar, daß es seine Be-


|
Seite 218 |




|
sonderheit war, hochdeutsche Privatdrucke oder -arbeiten ins Niederdeutsche zu übertragen 202 ). Auch die Rostocker Michaelisbrüder hatten um 1500 hochdeutsche Volksbücher ins Niederdeutsche übersetzt und gedruckt 203 ). Selbst aus der Werkstatt des Thüringers Nikolaus Marschalk gingen niederdeutsche Drucke hervor. Wenn auch deren Redaktion in der Hauptsache wohl Druckergehilfen besorgten, so wird Marschalk doch wohl fürs Niederdeutsche genügendes Verständnis gehabt haben. Es finden sich auch in seinen eigenhändigen Briefen einige niederdeutsche Wörter 204 ). Auch der aus Speier stammende Ludwig Dietz druckte, soweit wir sehen, mehr niederdeutsche als hochdeutsche öffentliche Schriften. Sein erster niederdeutscher Druck und zugleich seine erste niederdeutsche Privatarbeit ist das Lübische Recht von 1509 205 ). Auch fernerhin druckte er niederdeutsche Privatdrucke, z. B. den Reineke Vos 1517 und 1539 und "Dat nye schip van Narragonien" 1519. Dieses Werk wurde vielleicht von ihm selbst übersetzt und umgedichtet 206 ). Eine hochdeutsche Privatarbeit von ihm ist bislang nicht bekannt geworden. Er beherrschte das Hochdeutsche und das Niederdeutsche gleich gut, wie eigenhändige Schreiben von ihm zeigen 207 ).
Soweit wir sehen, haben die Druckereien bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus nur indirekt zur Ausbreitung der hochdeutschen Schriftsprache beigetragen, indem durch sie die aus der herzoglichen Kanzlei


|
Seite 219 |




|
hervorgegangenen hochdeutschen Ausschreiben und Verordnungen in großer Zahl durch das ganze Land verbreitet werden konnten. Die Drucker sind in dieser Zeit in der Hauptsache von der herzoglichen Kanzlei abhängig. Wie sich dieses später gestaltete, wissen wir nicht, da über die Drucker nach Dietz und über ihre Werke noch eingehende Untersuchungen angestellt werden müssen 208 ), vor allem fehlt uns aber noch immer ein Verzeichnis der hochdeutschen Drucke Mecklenburgs.
7. In der Literatur.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts macht sich der Mangel an originellen niederdeutschen Dichtungen sehr fühlbar. Die bedeutenderen, in niederdeutscher Sprache abgefaßten Werke sind fast durchweg Übertragungen aus dem Lateinischen oder Hochdeutschen 209 ).
Die erste hochdeutsche Dichtung dieser Zeit ist die spätestens 1510 vollendete Reimchronik des Nikolaus Marschalk. "Eigentlich ist sie weiter nichts als eine Genealogie der Fürsten" Mecklenburgs. Sie scheint nur Manuskript geblieben und nicht zum Druck befördert zu sein 210 ). Wahrscheinlich war sie auch von vornherein nicht für


|
Seite 220 |




|
die weitere Öffentlichkeit, sondern nur für das Fürstenhaus und für die gebildeten Hofkreise bestimmt und ist somit ein Zeichen dafür, daß die Hofsprache das Hochdeutsche war. Sie ist also ein Gegenstück zu Ernst von Kirchbergs Reimchronik, die Marschalk auch zum größten Teil als Quelle benutzte. Ich kann Müffelmann nicht beipflichten, der meint, daß Marschalk diese Chronik für das "Volk" geschrieben habe 211 ). Das "Volk" dürfte in dieser Zeit wenig Interesse für die durch Marschalk erfundenen Obotritenkönige gehabt haben. Das Hochdeutsche hatte um diese Zeit noch viel zu wenig Eingang gefunden, es spielten im Gegenteil die Übersetzungen aus dem Hochdeutschen eine Rolle, und selbst an Universität und Schulen hatte das Hochdeutsche noch keinen Fuß gefaßt.
Seit der Mitte des Jahrhunderts blühte besonders die lateinische Poesie der Humanisten, die deutsche Dichtung ist nur unbedeutend 212 ). In der Hauptsache wird sie zunächst durch einige historische Lieder und Schulkomödien vertreten.
Die beiden Rostocker historischen Lieder von 1549 und 1566, ein undatierter Lobspruch auf Rostock 213 ), ein Lied auf die Aufhebung der Klöster in Mecklenburg von 1552 sind niederdeutsch 214 ). Dagegen ist ein historisch-geistliches Lied über ein Wunder in der Kirche zu Moisall vom Jahre 1594 bereits hochdeutsch 215 ).


|
Seite 221 |




|
Die erste von den in Mecklenburg verfaßten hochdeutschen Schulkomödien ist der 1569 erschienene "Absalon" des aus dem hochdeutschen Sprachgebiet (Freiberg) stammenden Prorektors der Schweriner Fürstenschule Bernhard Hederich. Die nächste, der "Dionysius", vom Jahre 1578, gedichtet vom Rektor an der Güstrower Domschule Franziscus Omichius, ist dadurch bemerkenswert, daß der Verfasser bereits ein geborener Mecklenburger (Güstrower) ist. Das Niederdeutsche war schon bei Omichius auf komische Szenen beschränkt. Dasselbe war der Fall bei dem im Jahre 1605 verfaßten "Christus" des Rostocker Schulmeisters Joachim Burmeister, eines geborenen Lüneburgers, und bei der letzten in Mecklenburg gedichteten Schulkomödie, dem "Tobias" des zu Eichstedt bei Querfurt geborenen Magisters und Kantors Daniel Friderici vom Jahre 1637. Wenn dagegen in dem 1606 erschienenen "Isaak" des zu Rostock geborenen und dort wohnenden Kaufmanns Joachim Schlu das Niederdeutsche durchaus vorherrscht und das Hochdeutsche nur zur Charakterisierung der "junkerhaften und schulmäßigen" Sprechweise angewandt wird 216 ), so sieht das bereits nach bewußtem Kampf aus, den ein auf festem Heimatboden stehender und konservativ gerichteter Mann des praktischen Lebens gegen etwas führt, das er als schulmeisterliche Voreingenommenheit betrachtete.
Bedeutender als diese Schulkomödien sind die von Mecklenburgern verfaßten geistlichen Dichtungen. Sie blühten besonders im 17. Jahrhundert, vorher finden sich nur Ansätze.
Noch dem 15. Jahrhundert gehört das nach einer lateinischen Hymne gedichtete "älteste mecklenburgische Charfreitagslied" an 217 ). 1519 wurde zu Rostock das Mühlenlied und das Marienlied gedruckt. Ob sie auch in Mecklenburg zuerst gedichtet oder nur aus dem Hochdeutschen umgearbeitet wurden, ist ungewiß 218 ). Die nächsten niederdeutschen geistlichen Dichtungen stammen erst aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts (1555, 1565/66, 1591). Ihre Verfasser sind dem Stande nach Pastor, Professor, Rektor. Doch ist, wie Schröder betont, "die Zahl der sich der Landessprache bedienenden mecklenburgischen Dichter geistlicher Lieder auffallend gering" 219 ). Die


|
Seite 222 |




|
letzten niederdeutschen mecklenburgischen Dichtungen geistlichen Inhalts sind Gryses Christliche Gebete und Psalmen vom Jahre 1614 220 ).
Zahlreicher dagegen sind die geistlichen Dichtungen in hochdeutscher Sprache. Sie setzen mit der Jahrhundertwende (1594, 1599) ein. Ihre Verfasser gehören den verschiedensten Ständen Mecklenburgs an: Rostocker Universitätsprofessoren, Pfarrer, Lehrer, Adlige, selbst Angehörige des mecklenburgischen Fürstenhauses gehören zu den Dichtern 221 ). Es zeigt sich hier deutlich, daß seit den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts für die Gebildeten das Hochdeutsche die Literatursprache war. Daß auch bei den breiten Massen bald das Hochdeutsche maßgebend wurde, sieht man am besten daraus, daß der altbeliebte Reinkede Vos, der noch 1616 zu Rostock niederdeutsch gedruckt wurde, bereits 1650 zu Rostock eine allerdings recht üble hochdeutsche Bearbeitung erfuhr 222 ). Laurembergs berühmte vielleicht in den 30er Jahren entstandenen, 1652 gedruckten vier niederdeutschen Scherzgedichte waren wirklich der "Schwanengesang" der alten niederdeutschen Literatur- und Schriftsprache 223 ).
Den Niedergang des Niederdeutschen zeigen uns auch die Prosa-Chroniken.
Niederdeutsch ist noch die 1593 zu Rostock gedruckte Geschichte Joachim Schlüters von Gryse. Niederdeutsch ist auch die bis 1583(85) reichende sogenannte Bouchholtzsche Chronik, die vielleicht von dem Rostocker Buchbinder Christian Kohl, oder von einem andern, dem Buch- oder Druckereigewerbe angehörigen Rostocker geschrieben ist. Von 1602 ab wurde sie aber vom Rostocker Buchbinder Michael Scheiterer bereits in hochdeutscher Sprache fortgesetzt. Später wurde auch der erste Teil der Chronik hochdeutsch bearbeitet 224 ). Die lateinische, bis 1584 reichende Chronik des Petrus Lindeberg, eines geborenen


|
Seite 223 |




|
Rostockers, welche 1596 gedruckt wurde, erfuhr alsbald eine hochdeutsche Übersetzung.
Bereits früher schrieben in Mecklenburg weilende, aber aus hochdeutschem Sprachgebiet stammende Personen hochdeutsche Chroniken. Der aus Meißen stammende herzogliche Hofrat Andreas Mylius verfaßte zwei hochdeutsche Chroniken, die 1571 bzw. 1592 vollendeten Genealogia und Annales 225 ) Ferner schrieb der zu Freiberg geborene Schweriner Rektor Bernhard Hederich eine Chronik der Stadt Schwerin, die 1598 zu Rostock gedruckt wurde.
Schließlich soll noch erwähnt werden, daß auch eine Chronik der Stadt Plau über die Jahre 1619-32 226 ) und eine 1670 gedruckte Chronik der Stadt Parchim 227 ) in hochdeutscher Sprache abgefaßt sind.
IV.
Überblick und Ausblick.
Die hochdeutsche Schriftsprache wurde in Mecklenburg zuerst in die herzogliche Kanzlei eingeführt, und zwar durch den Kanzler Dr. Anthonius Grunwald, einen geborenen Nürnberger, vom Jahre 1493 ab, nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, durch die beiden aus Sorau in der Niederlausitz stammenden Kanzler Brand und Caspar von Schöneich seit dem Jahre 1502. Doch war während Grunwalds Amtszeit (1493-1501) die Anwendung des Hochdeutschen in Urkunden und Akten immerhin noch eine beschränkte. Niederdeutsch ist noch die Hauptmasse der Original-Urkunden und Briefe, nämlich die, welche für einheimische Adlige, Geistliche, Bürger, geistliche Korporationen und Städte sowie die, welche für benachbarte niederdeutsche Fürsten, Adlige und Städte be-


|
Seite 224 |




|
stimmt sind. Dagegen sind die Hausverträge und Hofordnungen der mecklenburgischen Herzöge seit Grunwalds Zeit hochdeutsch, Es scheint ferner so, als ob auch in diesem Zeitabschnitt für fremde hochdeutsche Fürstlichkeiten und Personen die Urkunden und Briefe im allgemeinen in hochdeutscher Sprache verfaßt werden. - Unabhängig von Grunwalds Einfluß nimmt zuerst Herzog Heinrich V., Magnus' II. ältester Sohn (geb. 1477), der in seiner Jugend jahrelang an süddeutschen Fürstenhöfen weilte, die hochdeutsche Sprache von 1494 ab an. - Herzog Magnus II. selbst läßt 1498 an seinen Kanzler Grunwald hochdeutsch schreiben. In dem innern Kanzleibetrieb spielt das Hochdeutsche neben dem Niederdeutschen wenigstens zunächst eine größere Rolle: Das Memorial von 1493 und die Kanzleiordnung von 1494 sind hochdeutsch, in der Hauptsache hochdeutsch sind Grunwalds Konzepte bis gegen Ende des Jahres 1495. In seinen an die Herzöge Magnus II. und Balthasar - zumeist eigenhändig - gerichteten Briefen schreibt Grunwald hochdeutsch (1498) und messingsch (1500). Der Rentmeister Claus Trutmann, der an und für sich das Niederdeutsche entschieden bevorzugte und auch seine Rentereiregister 1493/97 ganz überwiegend niederdeutsch führte, schreibt 1498 an den Kanzler eigenhändig hochdeutsch, an Herzog Magnus hochdeutsch, niederdeutsch und messingsch! Außer Grunwald und Trutmann beherrschen in der Kanzlei mindestens zwei bis drei Schreiber bzw. Sekretäre die hochdeutsche Schriftsprache. Das Hochdeutsche, welches durch Grunwald eingeführt wurde, scheint, wenigstens zuerst, die kaiserliche Kanzleisprache gewesen zu sein. Ein großer Teil der hochdeutschen Urkunden und Briefe ist aber nicht in einem reinen Hochdeutsch abgefaßt, sondern sie enthalten mehr oder minder starke Beimengungen von niederdeutschen Wörtern. Die niederdeutsche Opposition gegen die Einführung des Hochdeutschen war noch so stark, daß der Kanzler sich bald genötigt sah, das Niederdeutsche zu erlernen. Er wandte es vom Ende des Jahres 1495 ab immer mehr in seinen Konzepten an.
Grunwalds Nachfolger im Kanzleramt, Brand von Schöneich (1502-07), hat nicht die Bedeutung für die Aufnahme bzw. weitere Ausbreitung der hochdeutschen Schriftsprache gehabt, die ihm bislang allgemein zugeschrieben wurde. Neu ist, daß bereits einige hochdeutsche Schreiben aus der herzoglichen Kanzlei an Rostock ergehen - ferner begegnet eine Anzahl von hochdeutschen Konzepten und Hof- und Landgerichts-


|
Seite 225 |




|
Protokollen und -urteilen. Aber in der Hauptsache sind die Konzepte und Protokolle während Brand von Schöneichs Amtszeit durch Hofräte (Dr. Leo, Caspar von Schöneich, Dr. Nikolaus Marschalk) und zwei unbekannte Kanzleisekretäre verfaßt worden. Eine Erweiterung des Kreises von Empfängern hochdeutscher Urkunden ist nicht festzustellen.
Gleich beim Amtsantritt seines Neffen und Nachfolgers, des ersten weltlichen 228 ) mecklenburgischen Kanzlers Caspar von Schöneich (1507-1547), erfahren, die an einheimische Korporationen und Personen gerichteten hd. Schreiben eine starke Zunahme. Auch hochdeutsche Urkunden werden für Einheimische ausgestellt, und die bislang niederdeutsch geführten Rentereiregister werden wie mit einem Schlage hochdeutsch. Es scheint jetzt die obersächsische Kanzleisprache die Vorherrschaft errungen zu haben. Caspar von Schöneich verfaßte seine Konzepte nur hochdeutsch und hielt es nicht mehr für nötig, das Niederdeutsche als Schriftsprache zu erlernen und anzuwenden. - Die niederdeutsche Opposition gegen das Hochdeutsche läßt sichtlich nach. Nach einigen Jahren des Schwankens ist seit dem Jahre 1518 in der herzoglichen Kanzlei der Sieg des Hochdeutschen über das Niederdeutsche entschieden. In der Folgezeit ergehen nur noch vereinzelte niederdeutsche Schriftstücke aus der Kanzlei. Zumeist sind es die für die breite Öffentlichkeit bestimmten Ausschreiben und Verordnungen. - Man sah sich hier offensichtlich noch genötigt, darauf Rücksicht zu nehmen, daß als Sprache der großen Massen durchaus noch das Niederdeutsche herrschte. - Noch bis etwa 1540 scheinen die niederdeutschen Verordnungen und Ausschreiben stark zu überwiegen, dann nehmen sie sehr schnell ab. - Der sichtlich nachlassende Widerstand der Bevölkerung gegen die hochdeutsche Sprache und nicht zuletzt die Bequemlichkeit der Kanzleischreiber wird hierfür maßgebend gewesen sein. - Von einer ganz isoliert dastehenden niederdeutschen Verordnung vom Jahre 1557 abgesehen, bei der wahrscheinlich besondere Gründe für die niederdeutsche Abfassung maßgebend waren, ist die letzte niederdeutsche Verordnung vom Jahre 1549, das letzte niederdeutsche Landtagsausschreiben vom Jahre 1545, die letzte aus


|
Seite 226 |




|
der herzoglichen Kanzlei ergangene niederdeutsche Urkunde, die bislang festgestellt werden konnte, vom Jahre 1548 229 ).
Von mecklenburgischen Korporationen und Einzelpersonen nahm zuerst der Adel die hochdeutsche Schriftsprache an. Die ersten hochdeutschen Briefe eines mecklenburgischen Adligen stammen bereits aus den Jahren 1497 und 1498. Es folgen Briefe anderer Adliger aus den Jahren 1508 und 1514. Im übrigen war bei den einzelnen der Zeitpunkt der Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache recht verschieden. Doch scheint sie sich im allgemeinen zwischen 1534 und 1554 eingebürgert zu haben, wenigstens war dies bei der Korporation des Adels der Fall. Die letzte bislang festgestellte niederdeutsche Urkunde, die einen mecklenburgischen Adligen als Aussteller nennt, stammt aus dem Jahre 1563.
Bei den herzoglichen Amtsbeamten bahnte sich - von zwei Vorläufern aus den Jahren 1529 und 1535 abgesehen - die Aufnahme der hochdeutschen Sprache seit den 40er Jahren des 16. Jahrhunderts langsam an. Seit 1552/1553 hat das Hochdeutsche in Berichten, Amtsbeschreibungen und Registern das Übergewicht, wenn auch gewisse Schwankungen festzustellen sind. Einige, zumeist wohl ältere Beamte halten ziemlich zäh am Niederdeutschen fest. Das letzte bislang festgestellte niederdeutsche Amtsregister ist vom Jahre 1565/66 das letzte niederdeutsche Schreiben eines Amtsbeamten von 1585.
Von den Städten nahmen zuerst die Residenzstädte Güstrow und Schwerin das Hochdeutsche auf. Es wurde in Güstrow schon zwischen 1534 und 1536 bzw. 1540 heimisch, in Schwerin 1548/51. Bei den übrigen Landstädten wird sich die Aufnahme in den 50er Jahren angebahnt haben. In den 60er bis 70er Jahren hat es sich wohl überall in dem auswärtigen Schriftverkehr durchgesetzt. Länger, z. T. noch bis ins 17. Jahrhundert hinein, hielt sich das Niederdeutsche im internen Schreibbetrieb (Stadtbücher usw.). - Später als bei Güstrow und Schwerin erfolgte die Aufnahme des Hochdeutschen bei den Magistraten der beiden großen Seestädte Rostock und Wismar. Sie begann sich in den 50er Jahren langsam anzubahnen und errang, wenigstens was den aus-


|
Seite 227 |




|
wärtigen Schriftverkehr anbetraf, in Rostock vielleicht seit Ende 1561, sicher seit 1564, in Wismar seit Ende 1562 den Sieg. Länger hielt sich das Niederdeutsche im rein städtischen Schreibbetrieb, insbesondere in den Stadtbüchern (Grundbüchern) beider Seestädte. Sie wurden in Rostock erst von 1598, in Wismar von 1588 ab hochdeutsch geführt. In den Erlassen beider Städte setzte das Hochdeutsche sich im allgemeinen in den beiden letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts durch.
Bei der Geistlichkeit scheint es in der katholischen Zeit - abgesehen von den Kanzleien der Bischöfe von Ratzeburg und Schwerin und des Klosters Broda - kaum zur Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache gekommen zu sein.
Von den evangelischen Geistlichen bedienten sich die aus hochdeutschem Sprachgebiet stammenden naturgemäß schon früh - nachweisbar von 1526 an - der hochdeutschen Sprache. Doch hielten die niederdeutschen Pastoren, und dies war sicherlich die große Mehrzahl, noch lange, insbesondere auf dem Lande, an ihrer niederdeutschen Sprache fest. Der Umschwung trat erst im letzten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts ein, vollzog sich aber ganz plötzlich, so daß bald nach 1600 das Niederdeutsche in der Kirche sehr schnell abstarb.
An der Landesuniversität scheint das Hochdeutsche etwa seit den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts allmählich Eingang gefunden zu haben. In den 50er Jahren des Jahrhunderts hat es sch wohl durchgesetzt. An den beiden bedeutendsten Landesschulen zu Schwerin und Güstrow wird es sich in den 60er bis 70er Jahren eingebürgert haben.
Bei den einheimischen Gebildeten scheint, wie die Literatur zeigt, im allgemeinen seit der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert das Hochdeutsche die Schriftsprache geworden zu sein. Man dürfte daher wohl vermuten, daß es etwa um dieselbe Zeit auch im Buchdruck die Vorherrschaft errang, wenn auch bislang darüber genauere Nachrichten fehlen. Bei den breiten Massen in den Städten scheint das Niederdeutsche als Schriftsprache sich bis in den Dreißigjährigen Krieg hinein gehalten zu haben, machte aber wohl bereits um die Mitte des Jahrhunderts im großen und ganzen dem Hochdeutschen Platz.
Aufnahme und Einbürgerung der hochdeutschen Schriftsprache erfolgte also in


|
Seite 228 |




|
derselben Reihenfolge wie seinerzeit die der niederdeutschen 230 ): Herzogliche Kanzlei und herzogliche Familie, Adel, kleine Landstädte, große Seestädte, Geistlichkeit. Selbst bis in die Einzelheiten erstrecken sich die Parallelen (Stadtbücher!). Es tritt hier schon rein äußerlich, als wäre es ein Naturgesetz, zutage, welche Kreise für derartige sprachliche Neuerungen am meisten empfänglich waren, und wo das zäheste Festhalten am Althergebrachten sich geltend machte 231 ).
Die frühzeitige Anwendung der hochdeutschen Schriftsprache durch mecklenburgische Adlige läßt es als sicher erscheinen, daß hier zunächst nicht der Einfluß der herzoglichen Kanzlei sich geltend machte, wenn sie auch späterhin dafür weniger oder mehr (Magister Simon Leupold!) von Bedeutung war. - Die äußeren Einflüsse, die sich bei den Adligen recht früh geltend machten, sahen wir in ihrem häufigen Aufenthalt in Mittel- und Oberdeutschland.
Bei den herzoglichen Amtsbeamten dürfen wir mit großer Wahrscheinlichkeit die Annahme der hochdeutschen Schriftsprache dem Einfluß der herzoglichen Kanzlei zuschreiben. Bei den Städten mögen außerdem die Stadtschreiber dafür unmittelbar von Bedeutung gewesen sein. Vielleicht spielt auch die herzogliche Kanzlei eine gewisse Rolle bei der Aufnahme der hochdeutschen Sprache durch die Geistlichkeit, wenn hier auch der Einfluß der aus hochdeutschem Gebiet stammenden Pastoren, der Schule und Universität und besonders der Einfluß von Luthers Schriften und von hochdeutschen Erbauungsbüchern die bedeutendere Rolle gespielt haben mag. Doch bedarf es hier überall noch eingehender sprachlicher und stilistischer Untersuchungen. In Universität und Schulen dürfte das Hochdeutsche in der Hauptsache durch fremde oder in der Fremde gebildete Professoren und Lehrer eingeführt sein.
Es erhebt sich nun die Frage nach den tieferen Gründen der Aufnahme der hochdeutschen Schrift-


|
Seite 229 |




|
sprache in Mecklenburg überhaupt und insbesondere durch die herzogliche Kanzlei.
Von Lützow sah sie in dem "zufälligen Umstand, daß vom Anfang des 16. Jahrhunderts an fremde, aus dem Reiche gebürtige Männer . . . fürstliche Kanzler waren, die ihre hochdeutsche Muttersprache . . . in die Kanzlei einführten" 232 ) Diese Ansicht ist nicht zutreffend, denn schon der Kanzler Johann Tigeler (1486-93) war ein geborener Mitteldeutscher, und dennoch wurde durch ihn nicht das Hochdeutsche eingeführt. Er schrieb selbst fast ausschließlich niederdeutsch 233 ). Die mecklenburgischen Herzöge hatten es nämlich seit längerer Zeit vorgezogen, statt der einheimischen, fremde Männer als Kanzler zu berufen, offenbar um ganz gefügige Werkzeuge zu haben, die nur die Interessen der Herzöge, nicht die ihrer Standesgenossen vertreten sollten. Es wäre denkbar, daß auch noch der eine oder der andere Kanzler vor Tigeler ein geborener Mitteldeutscher war. Vielleicht war dies der Fall bei Johann Hesse, der von 1440-46 als Schreiber, Protonotar, Vizekanzler und von 1444 bzw. 1446-49 als Kanzler bezeugt ist und persönlich niederdeutsch schrieb 234 ).


|
Seite 230 |




|
Dies alles deutet übrigens schon darauf hin, daß es nicht die Absicht der mecklenburgischen Herzöge war, hochdeutsche Kanzler zu berufen, um dadurch die hochdeutsche Sprache einzuführen. Es liegt auch bei Grunwald kein Anzeichen dafür vor, daß seine Berufung erfolgte, weil er ein Hochdeutscher war und hochdeutsch sprach und schrieb. Durchaus wahrscheinlich ist es, daß Herzog Magnus bei den häufigen Verhandlungen zwischen Mecklenburg und Brandenburg oder auf seinen Reisen an den Brandenburger Hof Grunwald kennen gelernt und deswegen berufen hatte, wie ja auch Magnus' Sohn Albrecht VII. sich zweimal Kanzler aus Brandenburg holte 235 ). Die Berufung Brands von Schöneich erfolgte vielleicht, weil Magnus ihn auf der Hochzeit seiner Tochter Sophie mit dem Herzog (Kurfürsten) Johann von Sachsen, die am 1. März 1500 zu Torgau gefeiert wurde, oder sonst gelegentlich durch seinen Schwiegersohn kennen gelernt hatte 236 ). Caspar von Schöneich wurde


|
Seite 231 |




|
sicherlich durch seinen Oheim an den herzoglichen Hof gezogen, wie ja überhaupt die Vetternwirtschaft am mecklenburgischen Hofe in jener Zeit eine ziemliche Rolle spielte 237 ). Wie wenig die Herzöge daran dachten, nur hochdeutsche Kanzler in ihre Dienste zu ziehen, sieht man daraus, daß der aus Lübeck stammende Rostocker Professor Liborius Meyer 1490 das Kanzleramt in Vertretung verwaltete, und daß 1507 nach Brand von Schöneichs Tod Herzog Heinrich den Ratzeburger Domherrn Heinrich Bergmeyer, einen geborenen Niederdeutschen, der in seinen Briefen rein niederdeutsch schrieb, zum Kanzler berufen wollte 238 ). Übrigens wurde auch das wichtige Rentmeisteramt, nachdem es hintereinander von zwei aus Mitteldeutschland stammenden Persönlichkeiten: Claus Trutmann (1493-1512) und Baltasar Rotermund (1512-1519), verwaltet war, mit Jürgen Fineke (1519-23), einem mecklenburgischen Adligen, der seine Register niederdeutsch führte, besetzt. Ferner hatte Herzog Albrecht VII. als Rentschreiber bzw. -meister Johann Bullenberg (1523-35), einen geborenen Wismarer, der gleich-


|
Seite 232 |




|
falls niederdeutsch schrieb! - Allerdings sind beide schwerlich als retardierendes Moment zu betrachten, da sie im Gegensatz zu Trutmann und Rotermund nur als Kassenbeamte anzusehen sind und nicht in der Kanzlei tätig waren.
Dies alles drängt durchaus zur Vermutung, daß die tieferen Gründe für die Einführung der hochdeutschen Schriftsprache in die herzogliche Kanzlei nicht letzten Endes in den einzelnen Persönlichkeiten zu suchen sind. Die tieferen Gründe müssen vielmehr hinter ihnen liegen, so daß sie mehr die von einer geistigen Bewegung, einer großen Zeitströmung, Getriebenen als die Treibenden sind.
Diese große Bewegung haben wir nicht in der Reformation zu sehen. Denn sie faßte in Mecklenburg erst Fuß, als in der herzoglichen Kanzlei der Sieg der hochdeutschen Schriftsprache schon seit einigen Jahren entschieden war. Auch die neue Kunst des Buchdrucks kommt nicht in Betracht. Sie wurde zwar schon 1476 in Mecklenburg eingeführt, aber man begann erst in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts hochdeutsch zu drucken. - Eher könnte man annehmen, daß das Hochdeutsche infolge der Einführung zweier anderer Geisteserrungenschaften so nebenbei seinen Einzug in die herzogliche Kanzlei gehalten hatte. Nämlich infolge der Aufnahme des römischen Rechts in das Staatsrecht und der Einführung der modernen Zentralverwaltung. Beide neuen Errungenschaften nahmen im 14./15. Jahrhundert von Italien bzw. Burgund her ihren Siegeszug durch ganz Deutschland und ließen an die Stelle der Geistlichen, die bisher die herrschende Stellung an den Fürstenhöfen eingenommen hatten, die Gelehrten, insbesondere die Juristen und die modernen Beamten treten. Es wäre denkbar, daß die mecklenburgischen Herzöge sich genötigt sahen, aus Ober- und Mitteldeutschland stammende Juristen und Beamte zu berufen, die nun ihre Sprache mitbrachten und einführten. Fast könnte es so scheinen, als ob dies der Fall war, denn Grunwald war im römischen Recht gebildet, während seine beiden Vorgänger Theologen gewesen zu sein scheinen, und der erste mecklenburgische Rentmeister mit Beamtencharakter, Trutmann, stammte aus mitteldeutschem Sprachgebiet. Aber bei näherer Prüfung ist auch dieses nicht stichhaltig, denn bereits Nikolaus Reventlow, der von 1415 bis 1438 als Kanzler der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin be-


|
Seite 233 |




|
zeugt ist, war Jurist 239 ). Dasselbe gilt von Liborius Meyer. Ferner wurde die moderne Zentralverwaltung schon 1479, ohne daß es zunächst zur Berufung eines besonderen Beamten kam, eingeführt, und Trutmann schrieb in der Hauptsache niederdeutsch. -
Auch diese beiden wichtigen Errungenschaften kommen also als Gründe für die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache nicht in Betracht. Und doch muß ein ganz bestimmter Grund vorliegen, warum das Hochdeutsche erst um die Wende des 15. Jahrhunderts in der herzoglichen Kanzlei und beim Adel Eingang fand. Schon seit ungefähr 200 Jahren hatten die mecklenburgischen Fürsten hochdeutsche Poesie an ihrem Hofe gepflegt 240 ) und seit langem hochdeutsche Urkunden und Briefe


|
Seite 234 |




|
von fremden Fürsten erhalten 241 ), mecklenburgische Adlige hatten schon seit langen Jahren in Ober- und Mitteldeutschland gefochten, gereist und studiert. Trotzdem war es bislang weder bei den mecklenburgischen Fürsten noch beim Adel zur Einführung der hochdeutschen Schriftsprache gekommen. Der Grund lag ohne Zweifel darin, daß, als die mittelhochdeutsche Literatur noch in Blüte stand, das Lateinische unumschränkt als Schriftsprache herrschte. Als es von seiner beherrschenden Stellung verdrängt wurde, war die mittelhochdeutsche Hof- und Dichtersprache schon in Verfall geraten. Außerdem war sie als überfeinerte Kunstsprache wenig geeignet für eine Schriftsprache, als Sprache der Urkunden und Akten, da hier eine gewisse Nüchternheit und Klarheit, vor allem ein Vertrautsein mit der volkstümlichen Sprechweise erforderlich war. Kurz: Es gab im 14. Jahrhundert keine deutsche Gemeinsprache, sondern nur überall verschiedene Schriftdialekte ("Lantsprachen"). Somit war demgegenüber die Beibehaltung der einheitlichen niederdeutschen Schriftsprache für die mecklenburgischen Fürsten und Adlige das Selbstverständliche. Die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg war also überhaupt erst möglich, als in der kaiserlichen Kanzlei seit der Mitte des 14. Jahrhunderts, besonders durch Einfluß Karls IV., sich allmählich eine einheitliche Reichssprache herangebildet hatte. Sie begann noch im 14. Jahrhundert sich allmählich nach Brandenburg, Schlesien und Anhalt zu verbreiten. Bald nach der Mitte des 15. Jahrhunderts drang sie in die Kanzleien der Albertiner und in den 80er Jahren in die der Ernestiner ein, wo ihr allerdings in der durch sie angeregten obersächsischen Kanzleisprache ein recht ernsthafter Gegner erwuchs. Etwa um die Jahrhundertwende begann sie sich, wenn auch zunächst noch recht langsam, auf die schwäbischen, ober- und mittelrheinischen Gebiete auszudehnen. Diese Bewegung blieb aber nicht auf die fürstlichen Kanzleien beschränkt, sondern erstreckte sich auch auf die Universitäten


|
Seite 235 |




|
und Schulen, auf die Städte, auf die Druckereien und auf die Literatur, sie ergriff als neue große Zeit strömung überall die Gebildeten 242 ). - Diese Bewegung ist letzten Endes ein Ausfluß derselben vom Verfasser im I. Kapitel geschilderten, seit dem 12. Jahrhundert langsam auf kommenden antiklerikalen und nationalen Weltanschauung, der gegen Ende des 14. Jahrhunderts bereits die lateinische Schriftsprache erlegen war. - Nun waren seit den 80er Jahren des 15. Jahrhunderts die Beziehungen zwischen Reich und Einzelstaaten sehr viel lebhafter als früher geworden. Die kaiserliche Kanzlei führte, wie die Reichsakten des Schweriner Archivs zeigen, seit der Zeit einen lebhaften Schriftwechsel mit Mecklenburg. Vor allem aber reisten die mecklenburgischen Herzöge in dieser Zeit viel häufiger als früher zu den Reichstagen, um an den Beratungen über Türkenhilfe, gemeinen Pfennig, Reichsreform usw. teilzunehmen, oder um ihre Regalien vom Kaiser zu empfangen, oder aber, um, wie der junge Herzog Heinrich und sein Bruder Albrecht, Jahre lang (1494-1504 bzw. über 6 Jahre) an den Höfen hochdeutsch sprechender Fürsten oder des Kaisers Dienste zu tun. Mecklenburgische Adlige aber kamen sicherlich häufiger als früher ins Reich als Gefolgsleute ihrer Herzöge, oder um als Lehnsmannen in den Türken- und Ungarnkriegen, oder in kleineren Fehden als Söldner Dienste zu tun. Es war daher ganz natürlich, daß das mecklenburgische Kanzleipersonal, die Angehörigen des Fürstenhauses und mecklenburgische Adlige in die Bewegung, von der ihre Standesgenossen im Reich bereits ergriffen waren, hineingezogen wurden.
Die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg ist also als ein Glied in der großen nationalen Bewegung der Einführung einer für alle Deutschen verständlichen einheitlichen Reichssprache anzusehen. Diese Bewegung ist sicherlich ein Ausfluß des besonders stark im 15. Jahrhundert zutage tretenden Nationalbewußtseins und der Bestrebungen zur Schaffung einer starken deutschen einheitlichen Reichsgewalt. Es liegt daher letzten Endes die große nationale Idee der deutschen Einheit und das Streben nach ihrer Durchführung


|
Seite 236 |




|
der Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache in Mecklenburg zugrunde. - Die erste Voraussetzung für die deutsche Einheit auf staatlichem Gebiet war die Spracheneinheit! Diese Erkenntnis muß uns versöhnen mit dem Schicksal, dem die kräftige und doch so gemütvolle niederdeutsche Schriftsprache verfiel 243 ). Freilich erlag sie erst nach zähem Kampfe dem Hochdeutschen. Vor allem in den damals besonders konservativen Städten und ihren Bürgern machte sich ein starker Widerstand geltend gegen den "Sappen- und Minenkrieg" 244 ), den die herzogliche Kanzlei führte. Bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts hinaus galt bei der großen Masse der Gebildeten die niederdeutsche Sprache als "mekelnborger sprake", als "sassische effte nedderlendesche sprake", als "düsse sassische sprake" und als "unse dudesch", der hochdeutschen ("overlendischen", "hochdutzschen") Sprache gegenüber durchaus als etwas Ebenbürtiges 245 ). Daher übersetzte man auch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts vielfach hochdeutsche Werke ins Niederdeutsche. So wurde noch 1557 zu Rostock das "Trostbüchlin" "uth hogem důdeschen in unse sassessche sprake" übertragen, da "de overlendesche sprake eynem yderen nicht so lichtlick to vorstande ys, alse unse egen angebaren sprake" 246 ). Seit wann das umgekehrte Verhältnis eintrat, wissen wir nicht. Es dürfte die Herausgabe eines Verzeichnisses der hochdeutschen Drucke Mecklenburgs manche wichtige Aufklärung über den Wandel in der Bewertung der niederdeutschen Sprache geben. Jedenfalls erfuhr schon 1573 die 1543 zu Rostock in niederdeutscher Sprache gedruckte Schrift des Johann Freder vom "Loff unde unschuld der frouwen" eine Um-


|
Seite 237 |




|
arbeitung in die hochdeutsche Sprache 247 ). Ferner wurde 1597 die Schrift des Rostocker Syndikus Dr. Johann Oldendorp "van radtslagende", die "ehmals" (1530) in "niedersächsischer sprach" verfaßt war, "jetzt aber" durch den Rostocker Johann Forstenow "allen christlichen oberkeiten und sonst menniglichen zu nutz und besten von newen wiederumb auffgelegt und auß derselben niedersächsischen sprach in hochdeutsch versetzet" und dem Rostocker Rat gewidmet. Es scheint so, als ob hier das Niederdeutsche dem Hochdeutschen gegenüber als etwas Geringwertiges angesehen wird 248 ). Diese Geringschätzung des Niederdeutschen, welche die hochdeutsche Sprache als die feinere, als die Sprache der Gebildeten erscheinen ließ, dürfte etwa seit den 60er Jahren bei den Schulmeistern entstanden und durch sie unter das Volk getragen sein. - Tatsache ist, daß in den Schulkomödien der Rektoren der höheren Schulen das Niederdeutsche zur Charakterisierung des Tölpelhaften und Bäuerischen verwandt und Bauern und niederen Leuten in den Mund gelegt wurde, während die feineren Leute in den Schulkomödien hochdeutsch sprechen! - Berechtigt war diese Geringschätzung der niederdeutschen Sprache keineswegs, denn gerade in der Prosa, wo zuerst und in der Hauptsache die Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache erfolgte, war das Niederdeutsche dem Hochdeutschen durchaus gewachsen, wenn nicht überlegen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, erscheint uns zunächst die Verdrängung des Niederdeutschen durch die hochdeutsche Schriftsprache geradezu als etwas Widersinniges. Und doch muß man sagen, daß vom allgemeinen und großen deutschen Standpunkt aus betrachtet, die Verdrängung der alten niederdeutschen Schriftsprache durch die neuhochdeutsche ein Akt historischer Notwendigkeit war. Denn hätte sich nicht eine einheitliche deutsche Schriftsprache durchgesetzt, so wäre eine Verständigung und ein Zusammengehen von Süd und Nord wohl unmöglich gewesen. Wir hätten zu der unglückseligen, durch Reformation bzw. Gegenreformation begründeten konfessionellen Spaltung noch eine sprachliche Zersplitterung hinzubekommen. Deutschland wäre vermutlich für immer in zwei selbständige


|
Seite 238 |




|
Teile zerspalten geblieben. Um die Größe dieser Gefahr richtig zu erkennen, brauchen wir nur auf das stammverwandte Holland zu blicken, das zu einem guten Teil infolge des Festhaltens an einer niederdeutschen Dialekt-Schriftsprache dem Deutschtum entfremdet wurde.
Diese neue vorhin genannte geringschätzende Bewertung der heimischen Sprache wird es vor allem gewesen sein, die, nachdem die herzogliche Kanzlei die Art an den ragenden Stamm der alten niederdeutschen Schriftsprache gelegt hatte, ihr gänzlich "die Wurzeln abgrub", so daß sie gleich nach dem Anfang des 17. Jahrhunderts auch von der Kanzel und aus der Literatur verschwand. In Laurembergs vier, etwa im Dreißigjährigen Krieg entstandenen Scherzgedichten zeigte sich das alte Niederdeutsche noch einmal in seiner ganzen Größe, um dann für immer zusammenzubrechen. Sie waren wirklich der Schwanengesang der alten niederdeutschen Schriftsprache.
Als Volkssprache und Volksdialekt freilich lebte das "Plattdeutsche" noch Jahrhunderte lang fort und erreichte besonders in Fritz Reuter und John Brinckman noch eine große Blüte. Dann aber kam eine Zeit, wo das Plattdeutsche in den Städten immer mehr zurückging. Es schien hier als Sprache einer angeblich niederen, "unfeineren Kultur demselben Schicksal des Aussterbens verfallen zu sein, das es vor Jahrhunderten dem wendischen Volksdialekt bereitet hatte. - Jedenfalls schienen vor 1914 die Tage des Plattdeutschen in den größeren Städten gezählt zu sein. Glücklicherweise aber hat man nach dem schlimmen Ende des Weltkrieges wieder Anhalt und Trost in der Vergangenheit gesucht und sich auf dies Gut und Erbstück unserer Altväter besonnen. Die plattdeutschen Gilden und Vereine entfalteten eine rege Tätigkeit. Auf den Kanzeln wurde plattdeutsch gepredigt und auf der Bühne erschienen plattdeutsche Stücke - auch ernsten Inhalts - von bedeutendem Wert und großer Ausdruckskraft.
So hat der niederdeutsche Volksdialekt mit echt niederdeutscher Zähigkeit doch noch die schweren Stürme der Zeit überdauert und uns in die neue, bessere Zeit hinein das Geleit gegeben.


|
[ Seite 239 ] |




|



|



|
|
:
|
VI.
Die geschichtliche
und landeskundliche
Literatur
Mecklenburgs 1936-1937
von
Friedrich Stuhr.
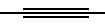


|
[ Seite 240 ] |




|


|
[ Seite 241 ] |




|
Bibliographie.
- Familiengeschichtl. Bibliographie, hrsg. von der Zentralstelle f. deutsche Pers.- u. Fam.-Gesch., Bd. V, Lief. 1-3 (Jahrgänge 1935, 1897-99 u. heraldische Bibliographie). Leipzig 1937.
- Stuhr (Friedrich), Die geschichtl. u. landeskundl. Literatur M.'s 1934-35 u. 1935-36. M. Jahrb. 100, 1936, S. 291-320.
Quellen. Urkundenlehre.
- Winter (Georg), Regesten der Markgrafen von Brandenburg aus Askanischem Hause. 9.-11. Lief. (1314- Ausgang der Ask.). Berlin-Dahlem (Verein für Gesch. der Mark Brandenburg), 1933, S. 641-884. [Mit Ergänzungen für das M. Ukb. aus chronikalischen Nachrichten.]
- Mecklenburgische Bauernlisten des 15. u. 16. Jahrb., hrsg. vom Ver. für m. Gesch. u. Alt.-Kunde, H. 1; Tessin (Georg), Das Amt Boizenburg. Schwerin (Bärensprung) 1937. 10 u. 215 S.
- Hasenritter (Fritz), Beitrage zum Urkunden- u. Kanzleiwesen Heinrichs des Löwen. (Greifswalder Abhandlungen zur Gesch. des Mittelalters, Heft 6.) Greifswald (L. Bamberg) 1936. 187 S.
Vorgeschichte.
- Germanen-Erbe. Monatsschr. für Deutsche Vorgeschichte, hrsg. von Hans Reinerth. 1. Jg., 1936, H. 3-8; 2. Jg., 1937, H. 1-12.
- Bastian, Die vorgeschichtliche Abteilung des Landesmuseums in Schwerin. Nied. Beob. 22. Okt. 1936.
- Beltz (R.), Vorgeschichtsforschung damals u. heute. Besinnliches aus den Erinnerungen eines alten Mannes. M. Ztg. 13. März 1936.
- Asmus (W. D.), Die rechtselbische Ausdehnung der Langobarden in den ersten zwei Jahrhunderten nach Zeitenwende. Die Kunde 4. 1936, S. 50 f.
- Bastian (Willy), Frühbesiedlung u. Umweltbedingungen. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 124-127.
- Becker (J.), Bilder aus der Vorgeschichte unserer Heimat. I. Die Steinzeit. Beitr. zur Heimatkunde Nr. 3, 16 S.
- Becker (J.), Ein Runenstein in M. M. Monatsh. 9. Jg., 1933, S. 466-468.
- Beltz (R.), Ein neuer Schalenstein. Zeitschr. M. 28. Jg., 1933, S. 23.
- Beltz (Robert), Beachtliche Steingeräte. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 100-102; 32. Jg., 1937, H. 1 S. 28-29.
- Hollmann (B.), Wichtigere vorgeschichtliche Funde u. Grabungen in M. 1934-35. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 11. Jg., 1935, S. 175-177.
- Hollmann (Bruno), Steinmale. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 127-128.


|
Seite 242 |




|
- Kröplin (Otto), Sonnensinnbilder. Monatsh. für M. 13. Jg., 1937, S. 308-313.
- Lorentz (F.), Der Name der Warnen in Ortsnamen M.'s. Ztschr. M. 31. Jg., 1936, H. 2 S. 59-60.
- Karbe (W.), Der Teufelsstein von Carpin. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 97-99.
- Bastian, Mesolithische Typentafeln des Fischlandes. In P. Kühl, Geschichte der Stadt u. des Klosters Ribnitz. Neubrandenburg 1933, S. 56-63.
- Beltz (R.), Der Burgwall von Alt Gaarz. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 11, 1935, S. 107.
- Beltz (R.), Der Burgwall von Alt Gaarz in M. (Reric?). Forschungen u. Fortschritte 11, 1935, S. 357 f.
- Bastian, Germanische Waffenschmiede von Körchow. Nied. Beob. 13. April 1937, 85. Folge; M. Ztg. 13. April 1937, Nr. 85.
- Aufsehen erregende Bronzefunde bei Lübtheen. Nied. Beob. 24. Aug. 1934.
- Karbe (W.), Grabungen aus der Gegend von Neustrelitz in M. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 11. Jg., 1935, H. 10 S. 197-199.
- Fl., Die Ausgrabungen in Perdöhl. Nied. Beob. 10. Okt. 1937, Sonntagspost, Folge 40.
- Range (Paul), Die Steinzeit im Fürstentum Ratzeburg. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 19. Jg., 1937, Nr. 2 S. 18-23.
- Krueger (Alb. G.), Rethra u. Arkona, die beiden slawischen Heiligtümer in Deutschland. Germanien, Monatshefte für Germanenkunde 1936, H. 9 S. 264-272.
- Agde (H.), Der germanische Ring von Roga u. die bronzezeitlichen Rasiermesser. Mannus 28, 1936, S. 153-160.
- Becker (J.), Aus den Schätzen des Rostocker Museums. Nied. Beob. 4. März 1934, Beibl.
- Becker (J.), Funde aus der Gegend von Rostock. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 9. Jg., 1933, S. 75 f.
- Becker (J.), Neue Funde aus. der Gegend von Rostock in M. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 10. Jg., 1934, H. 9 S. 200-202.
- Becker (J.), Vorgeschichtliches aus der Gegend von Rostock in M. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 11. Jg., 1935, H. 9 S. 177-180.
- Becker (J.), Neue Funde u. Untersuchungen in der Gegend von Rostock in M. 1936. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 12. Jg., 1936, H. 8-9, S. 194-198; Tafel 43, 1.
- Becker (J.), Der Waffenfund von Schwaan (M.). Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 12. Jg., 1936, H. 7 S. 170-172; Tafel 34-36.
- Sprockhoff (E.), Ein germanischer Grabfund der Völkerwanderungszeit aus Schwerin (M.). Germania 18. Bd., 1934, S.43-46.
- Hollmann (Bruno), Vorgeschichtliche Denkmale des Amtsgerichtsbezirks Sternberg. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 41-48.
- Asmus (R.), Die Dänen u. Wenden am Teterower See. Nied. Beob. 1935, Nr. 149-153.
- Beltz (Robert), Fünf Jahrtausende sprechen aus dem Warnowfund. Ein bedeutsames Stück Vorgeschichte in ihren Waffen. M. Ztg. 30. Dez. 1936, Nr. 304.


|
Seite 243 |




|
Geschichte.
- Jacobs (Hans Haimar), Heinrich der Löwe. Colemans kleine Biographien, H. 24. Lübeck (Coleman) 1933. 46 S.
- Reincke (Heinrich), Gestalt, Ahnenerbe u. Bildnis Heinrichs des Löwen. Zeitschr. d. Ver. für Lüb. Gesch. 28. Bd., H. 2, 1936, S. 203-224.
- Engström (Sten), Bo Jonsson, I, till 1375. Uppsala (A.-B. Lundequistska Bokhandeln) 1935. 331 S.
- Witte (Hans), Wie wurde Ostelbien u. besonders M. wieder deutsch? M. Monatsh. 12. Jg., 1936, 144. H., S. 692-698.
- Beltz (Hans), Wie entstanden M.'s Grenzen? M. Ztg. 13. Febr. 1937, Nr. 37.
Fürstenhaus.
- Bethe (Hellmuth), Die Bildnisse des pommerschen Herzogshauses. [darunter: der Sophie, Gem. Hz. Magnus II. v. M.; der Margarete, Gem. Hz. Balthasar v. M.; der Anna, Gem. Hz. Ulrich v. M.; der Klara Maria, Gem. Sig. Aug. v. M.] Baltische Studien N. F. 39. Bd., 1937, S. 71-99.
- Tessin (Georg), Herzog Karls schwedische Kriegsdienste im Dreißigjährigen Krieg. M. Jahrb. 100, 1936, S. 267-280.
- v. Ladiges (Therese Monika), Königin Luise. Colemans kleine Biographien, Nr. 52. Lübeck (Coleman) 1934. 45 S.
- v. Langermann, Bisher unbekannte u. unveröffentlichte Originalbriefe der Großherzogin Alexandrine, Gem. des Großherzogs Paul Friedrich, Mutter Friedrich Franz II. M. Jahrb. 100, 1936, S. 185-192.
- De voorouders in de rechte mannelijke lijn van H. K. H. Prinses Juliana [der Niederlande] en Z. D. H. Prins Bernhard [von Lippe-Biesterfeld]. - De wederzijdfche 32 kwartieren van het Prinselijk Bruidspaar. De Nederlandsche Leeuw 55. Jg., 1937, Nr. 1 Sp. 3-7, 15-18.
Familien- und Personengeschichte.
- Wentscher (Erich), Einführung in die praktische Genealogie. 2. Aufl. Görlitz (C. A. Starke) 1936. 169 S.
- Wecken (Friedrich), Familiengeschichtsforschung in Stichworten. Leipzig (Degener u. Co.) 1936. 111 S.
- Heintze-Cascorbi, Die deutschen Familiennamen geschichtlich, geographisch, sprachlich. 7. Aufl. Halle-Berlin (Buchhandlung des Waisenhauses) 1933. XII u. 536 S.
- Goebel (Otto), Niederdeutsche Familiennamen der Gegenwart. Wolfshagen-Scharbeutz (Franz Westphal) [1936]. 117 S.
- Albrecht (Edm.), Entwicklung von Familiennamen in M. Der Sippenforscher in M. 1936, Nr. 4-6; 1937, Nr. 1.
- Nörrenberg (Constantin), Entstellte Familiennamen. Fam.-Gesch. Blätter 35. Jg., 1937, H. 4 Sp. 111-124.
- Reincke (Heinrich), Über die Namensführung der Unehelichen. Ein Merkblatt. Zeitschr. für Niedersächs. Fam.-Kunde, 18. Jg., Nr. 9, Sept. 1936.
- Cordier (Leopold), Hugenottische Familiennamen in Deutschland. Eine Wegweisung für die wallonische, französische, waldensische


|
Seite 244 |




|
Familienforschung. Zu beziehen durch die Geschäftsstelle des Deutschen Hugenottenvereins; Berlin, Französischer Dom. Berlin (Montanus-Druckerei) [1930]. 56 S. - In den Geschichtsblättern des Deutschen Hugenottenvereins, Zehnt IX, H. 4/5; Koch, Die franz.-ref. Gemeinde Bützow.
- Sachse (Hans), M. Philhellenen [1821-22]. Rost. Anzeiger 16. Aug. 1936, Nr. 131.
- S. (O.), Genealogische Beziehungen M.'s zu den baltischen Ostseeprovinzen. Der Sippenforscher in M. 1936, Nr. 1-2.
- Staak (Gerhard), M.er als Siedler in Polen. Zeitschr. M. 31. Jg., H. 1 S. 13-27; H. 2 S. 46-53.
- v. Rohr, Bodentreuer Adel. [Auch in M.] Eine Statistik. Berlin (Stilke) 1936. 43 S.
- v. G., Der alte adlige Grundbesitz in M. u. das Erbhofgesetz. Deutsches Adelsbl. 52. Jg., 1934, Nr. 10 S. 158-160.
- v. Gadow (H. J.), Ritter u. Bauer in M. Deutsches. Adelsbl. 52. Jg., 1934, Nr. 27 S. 496-497; Nr. 29 S. 529-531.
- Felten (Werner), Die Personennamen der Stadt u. des Landes Boizenburg v. 13. bis 17. Jahrh. M. Jahrb. 100, 1936, S. 1-178.
- Benox (H.), Alte Güstrower Familien. Ein Rückblick auf unsere Vorfahren im 17. u. 18. Jahrh. Sonderdruck aus "M. Tagesztg." 3. Juni-16. Juli 1937. S. 1-19.
- Kenfenheuer (Johann Josef), Alphabetisches Namenregister bürgerlicher deutscher Wappenvorkommen. Hoffnungsthal-Köln (Emil Pilgram) 1937. 264 S.
- Frhr. v. Berchem (Egon), Wappenmißbrauch (Wappenschwindel, Wappendeutung u. Wappenfuscherei). Ein Vortrag. Fam.-Gesch. Blätter 35. Jg., 1937, H. 4 Sp. 141-144.
- Hentzen (Alfred) u. v. Holst (Niels), Die Großen Deutschen im Bild. Berlin (Propyläen-Verlag) 1936. 488 S.
- Gothaisches Geneal. Taschenbuch der adeligen Häuser, Teil B, 28. Jg., 1936. Darin: Abercron, Bassewitz, Boddien, Buchka, Cochenhausen, Dulitz, Einem, Haeseler, Hirschfeld, Ihlenfeld, Livonius, Michael, Paepcke, Rudloff, Sithmann, Suckow, v. Witzendorff.
- Awe (Julius), Das Altlehrergeschlecht Awe. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 10 S. 165-168.
- Bacmeister (Walther), Die Bacmeisterschen Urkunden in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Stuttgart 1936. 27 S.
- Seger (H.), Robert Beltz zum 80. Geburtstage. Nachr.-Bl. für Deutsche Vorzeit 9. Jg., 1933, S. 209-211.
- Beltz (Hans), Carl Beyer. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, H. 140 S. 409-412.
- Professor Heinrich Bohn, † 1936. [Eigene Aufzeichnungen.] Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 18. Jg., 1936, Nr. 3 S. 36-38; 19. Jg., 1937, Nr. 2 S. 24-26.
- Neckel (Heinrich), Das Poesiealbum der Louise Böttger (1791-1864). Der Sippenforscher in M., 1936, Sept., Nr. 3 S. 9-11.
- Brücknerscher Familienverband. 10. Bericht, 1. Jan. 1936. Greifswald (Hans Adler) [1936]. 62 S.


|
Seite 245 |




|
- Krauß (Erich), Ernst v. Bülow-Cummerow, ein konservativer Landwirt u. Politiker des 19. Jahrh. Historische Studien, H. 313. Berlin (Ebering) 1937. 170 S.
- Diers (Marie), Meine Kindheitserinnerungen an Schwarz. Heimatkal. des Kreises Waren 1936, S. 35-37.
- Schüppel (Karl), Heinrich [Prof. Dr. Heinrich Dittmann, [gest.] 1912]. Mitt. d. Altschülerschaft Realgymn. Schwerin Nr. 12, März 1937, S. 315-320.
- H., Der Maler Peter Paul Drewing. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, S. 441.
- Eggers (Eduard Rudolph), Ahnentafeln zur Familie Eggers. Hamburg (Hans Christians Druckerei) 1937. 111 Tafeln. - Stammfolge s. Deutsch. Geschlechterbuch, Bd. 89 unter "Eggers 4".
- Voll (Wolfgang), Daniel Friderici. Sein Leben u. seine geistlichen Werke [Kantor in Rostock 1618-1638]. Diss. Rostock. Kassel (A. Werner) 1936. 161 S. [Auch in der Schriftenreihe "Niederdeutsche Musik", Hannover (Nagel) 1936.]
- Friese (Heinrich), Prof. Dr. [Selbstbiographie]. Mitt. d. Altschülerschaft Realgymn. Schwerin Nr. 12, März 1937, S. 320-324.
- Frodien (Bruno), Stammtafeln der Familie Frodien in Listenform vom 1. Jan. 1935. 24 Bl.
- Sack (Gustave Bernhard Hederich, ein Schweriner Rektor. Nied. Beob. vom 3. Okt. 1936, Nr. 231, S. 4. [Beschreibung seines 1598 gedruckten astronomischen Buches.]
- v. Hennig (Ewald), Blätter zur Gesch. der Familie von Hennig. Stuttgart (Karl Kull) 1936. 147 S. Als Manuskript gedr. (Auf S. 67-70 betr. das Gut Tüschow.)
- Hillmann (H. J.), Die Geschlechter Hillmann unter dem Gesichtspunkt alt- und niedersächsischer Siedlung. Brunsbüttelkoog (D. Hinz) 1936. 170 S. 4 H.
- Reifferscheid (Heinrich), Walter Josephi 25 Jahre Museumsdirektor. Museumskunde N. F. VIII, 1936, H. 3 S. 94-96.
- Buddin, Hans Kähler, Kiel †. [Lehrer, geb. Dassow 18. Juli 1873.] Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 19. Jg., 1937, Nr. 1 S. 11.
- Ströbel (Rudolf), Friedrich Lisch, ein Vorkämpfer völkischer Vorgeschichtsforschung. Germanen-Erbe 1. Jg., 1936, H. 5 S. 130-136. [Vgl. Reifferscheids Arbeit über Lisch im Jahrb. 99, 1935.]
- Curschmann (Jakob), Friedrich Lisch u. das Römisch-Germanische Zentralmuseum [in Mainz]. Mainzer Zeitschr. 32. Jg., 1937, S.127-135.
- Hennings (Ulrich), Das Malchiner Bötticher Ambt u. die Familie Meysahn. Sonderdruck des Malchiner General-Anzeigers von Febr. 1937. 12 S.
- v. Loßberg (Fritz), Moltke. Colemans kleine Biographien, Bd. 68. Lübeck (Coleman) 1936. 54 S.
- Oldenburg (Gustav), Gesch. der alten m. Familie Oldenburg. Heidelberg (Winter) 1937. 240 S.
- Bobé (Louis), Stamtavle over Slaegten Plessen. Danmarks Adels Aarbog 1934, S. 95-201.


|
Seite 246 |




|
- Nachr.-Bl. d. Fam. v. Pressentin bzw. gen. v. Rautter. Nr. 25, Hartung (Jan.) 1937.
- v. Ravensche Fam.-Nachr., Nr. 47, 1937. [Darin: 16. Geschlechtsfolge: Bruno Küneke v. Raven.]
- Brömse (Heinrich), Kleine Beiträge zur Reuterforschung. Jahrb. des Ver. für niederdeutsche Sprachforschung Bd. 62, 1936, S. 145-154.
- Seelmann (Wilh.), Aus Fritz Reuters Festungszeit. Korr.-Bl. für niederdeutsche Sprachforschung 1936, H. 49 S. 3-5.
- Mitt. über die Gesch. der Familien Rosenow Nr. 43, Sept. 1936, S. 591-606. [40 Jahre Familienverband.]
- Schliemann (Sophie), Heinrich Schliemann Selbstbiographie, bis zu seinem Tode vervollständigt. 2. Aufl. mit Nachwort von Ernst Meyer. Leipzig (Brockhaus) 1936. 136 S.
- Schröder (Walter Johannes), Fritz Stavenhagen, Leben u. Werk. Neumünster i. H. (Karl Wachholtz) 1937. 141 S.
- Friedrich Techen †. [Archivrat in Wismar, gest. Wandsbek 30. März 1936.] Zeitschr. d. Ver. für Lüb. Gesch. 28. Bd., H. 2, 1936, S. 425.
- Kretzschmar (Joh.), Friedrich Techen †. Korr.-Bl. für niederdeutsche Sprachforschung 1936, H. 49 S. 2-3.
- Lübeß (Hugo), Friedrich Techen †. M. Jahrb. 100, 1936, S. 281-290.
- Entholt (Hermann), Zum Gedächtnis. Friedrich Techens. Hans. Gesch.-Bl. 61. Jg., 1936, S. 1-6.
- Janssen (Georg), Ahnentafel des Volkswirts Johann Heinrich von Thünen. Oldenburger Jahrb. 40. Bd., 1936, S. 151-158.
- Stremler (Alwina), Aus der Chronik der Fam. Tuve, geschrieben um 1840. [betr. auch die m. Fam. Eckermann]. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 1 S. 10- 18.
- Stammfolge Wiegels aus der Deutschen Roland-Wappenrolle Nr. 70. [Oberarzt Dr. W. in Schwerin.] Der deutsche Roland 24. Jg., 1936, H. 3/4 S. 16.
- Stein (Otto), Ahnenliste der Geschwister Wienck aus Samkow bei Carlow (Meckl.). Schönberg M. (Lehmann u. Bernhard), [1937], 24 S.
- Leutwein (Paul), Wißmann. Colemans kleine Biographien, H. 34. Lübeck (Coleman) 1933. 43 S.
- Witte (F. C.), Lebenserinnerungen. Rostock (Hinstorff) [1936]. 173 S. [Nicht im Buchhandel erhältlich.]
- Wossidlo. Wie ich zum Sammler wurde. M. Ztg. am Sonntag 7. Febr. 1937.
Kulturgeschichte, Volkskunde.
- Engel (Franz), Neue Wege der historischen Bauernforschung. Nied. Beob. 15. Okt. 1936, Nr. 241.
- Koch (Otto), Die zahlenmäßige Entwicklung der m. Bauernstellen in Domanium u. Ritterschaft von 1553-1930. Berichte über Landwirtschaft 21. Bd., 1936, 2. H. S. 185-202.
- Hedenkamp (Rudolf), Wanderung u. Auslese in Bauern- u. Gutsdörfern M.'s. Diss. Rostock. Sonderdruck aus "Archiv für Rassen- u. Gesellschaftsbiologie", Bd. 30, 1936, H. 6 S. 477-496.


|
Seite 247 |




|
- Scheele (Heinrich), Die Lauenburgische Bauernschaft in der ersten Hälfte des 16. Jahrh. nach den Geldheberegistern im Kieler Staatsarchiv. Ratzeburg (Lauenb. Heimatverlag) 1935. 51 S.
- Vogdt (Gerhard), Die Bauernbefreiung in M. Würzburg (Konrad Triltsch) 1937. 140 S.
- Stoffleth (Dietrich), Die m. Bauernfrage im Parlament von 1848-49 (gesehen in hist. Zusammenhang). Diss. Rostock. Karlsruhe-Grünwinkel (Sinner) 1935. 74 S.
- Der Bauer im Umbruch der Zeit. Verschiedene Aufsätze, hrsg. von Clauß (Wolfgang). Berlin (Reichsnährstand Verlags-Ges.) 1935. 236 S.
- Hochgraßl (H.), Neubildung deutschen Bauerntums. Mit Karte der bäuerlichen Siedlungen in M. Nied. Beob. 15. Okt. 1936, Nr. 241.
- Sager, Das Jahresergebnis 1936 der Neubildung deutschen Bauerntums in M. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S.142-143.
- Bahlow, Hans, Der Zug nach dem Osten im Spiegel der niederdeutschen Namenforschung, insbesondere in M. Ein Vortrag von 1933. Sonderdruck aus Teuthonista, Jg. 9, H. 4 S. 222-233.
- Wiegandt (Max), M. Auswanderung in die Vereinigten Staaten. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 2 S. 38-46.
- Teuchert, M. als nordische Provinz. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 108-113.
- Endler, Das m. Bauernmuseum "Wossidlo-Sammlung". Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 31-35.
- Schult (Friedrich), Ein m.'er Dorfschulze. Frankfurter Ztg. 17. Dez. 1936, Nr. 644-645.
- Engel (Franz), Das m. Bauernhaus im Mittelalter. Ausgrabungen in Hungerstorf bei Grevesmühlen. Nied. Beob 24. Okt. 1936, Nr. 249.
- Groß (Richard), Hausinschriften in M. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 36-39.
- Pries (J. F.), Spieker. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 3 S. 75-83; 32. Jg., 1937, H. 3 S. 101-105.
- Hebert (Werner), Der Fachwerkbau. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., März 1937, S. 144-145.
- Vick (Hans), Eine Nachricht vom Jahre 1789 über die Ratzeburger u. Rehnaer Volkstracht. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 19. Jg., 1937, Nr. 3 S. 39-43.
- Schlüter (Ernst), Friedrich der Große im m. Volksmund. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 3 S. 86-90.
- Brückner (Anna), Erntezeit im Lande Stargard vor 75 Jahren. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 3 S. 83-86.
- Wossidlo (R.), Knecht un Diern. Heimatkal, des Kreises Waren 1936, S. 31-35.
- Engel (Franz), Bäuerliches Handwerk im M.A. Die Ausgrabungen der Töpferwerkstätten von Dümmer u. Granzin. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 1 S. 18-24.
- Endler, Bäuerliches Arbeitsgerät u. seine Verbreitung in M. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 113-115.


|
Seite 248 |




|
- Evers, Handwerkssymbole u. einige Gebräuche des Handwerks (Heimatmuseum Waren). Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 3 S. 83-89.
- Fornaschon (Hermann), Zeit der Zunft. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 3 S. 89-94.
- Wossidlo (R.), M.'e Sprichwörter u. Bauernregeln über landwirtschaftliche Dinge. Heimatkal, des Kreises Waren 1937, S. 34-39.
- Wossidlo (R.), Vom Bollenstoßen. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 66-67.
- Wossidlo (R.), Der Storch im m. Volksglauben. Warener Tagebl. vom 16. u. 23. April 1937.
- Wossidlo (Richard), Brautkronen. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, 144. H. S. 689-691.
- Neumann (Walter), Flurnamen im Unterricht. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 22 S. 322-325.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Campow mit Hoheleuchte u. Neuhof (Hof). Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 18. Jg., 1936, Nr. 3 S. 38-50.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Neuhof (Domäne). Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 18. Jg., 1936, Nr. 4 S. 63-69.
Siedlung.
- Engel (Franz), Archäologische Methoden in der mittelalterlichen Siedlungsforschung. Neue Wege zur Erforschung der Ostkolonisation. M. Jahrb. 100, 1936, S. 249-260.
- Bendixen (Jens Andreas), Verlagerung u. Strukturwandel ländlicher Siedlungen. Ein Beitrag zur Siedlungsgeographie, ausgehend von Untersuchungen in der südwestlichen Prignitz. Kiel (Schmidt & Klaunig) 1937. 102 S. (Schriften des Geographischen Instituts der Universität Kiel Bd. VII, H. 2). [Betr. auch M.]
- Redlich (Clara), Nationale Frage u. Ostkolonisation im Mittelalter. (Rigaer Volkstheoretische Abb., Heft 2.) Berlin (Hans Robert Engelmann) 1934. 114 S.
- Kötzschke (Rudolf) u. Ebert (Wolfgang), Gesch. der ostdeutschen Kolonisation. Leipzig (Bibliogr. Institut) 1937. 251 S.
- Ipsen (Gunther), Die Bevölkerung des Ostseeraums. Altpreußische Forschungen 14. Jg., 1937, H. 2 S. 202-223.
- Großgrundbesitz im Umbruch der Zeit. Verschiedene Aufsätze, hrsg. von v. Rohr. 3. Aufl. Berlin (Georg Stilke) 1935. 160 S. [Darin S. 31-43: Biereye (Wilhelm), Kolonisation.]
Landeskunde.
- Hollmann (Wilh.), Wegekarte von Rostocks Umgebung u. der Seebäder - - -, sowie vom Fischlande u. dem Darß. 1:65 000. Rostock (Hermann Koch) [1936].
- Stein (Otto), Eine Grenzbestimmung zwischen dem Herzogtum Lauenburg u. dem Lande Ratzeburg im Jahre 1608. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 19. Jg., 1937, Nr. 3 S. 33-38.


|
Seite 249 |




|
- Stoll (Heinrich), Die unterhaltsame Reise des Herrn Dr. Nugent durch M. Reisebriefe aus dem Jahre 1766. Wismar (Hinstorff) [1936]. 194 S.
- v. Arnswaldt, Der Landschaftsschutz in M. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 1 S. 1-7.
- Bührs (Max), Wanderung durch unser nördlichstes Naturschutzgebiet [Dierhagen]. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, H. 140 S. 398-400.
- Endler, M.'s Acker im Laufe der Zeit. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 130-134.
- v. Bülow (K.), Die Acker- u. Waldböden M.'s. Hefte zur Verbreitung geologischen Wissens in M. Rostock (Geol. Landesanstalt), H. 9, Okt. 1936, 37 S.
- v. Bülow (Kurd), Wege des Wassers in den diluvialen Ablagerungen Norddeutschlands. Ein Beitrag zum Kapitel "Wasseradern". Archiv des Ver. der Freunde der Naturgesch. in M., N. F. 11. Bd., 1936, S. 89-102.
- v. Bülow (Kurd), Geologische Kleinigkeiten aus M.; Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 3 S. 68-75; 32. Jg., 1937, H. 2 S. 72-75 u. H. 3 S. 95-97.
- Sturm (Friedrich), Urkultur am Schaalsee. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, H. 140 S. 413-415.
- Nuß (Wilhelm), Seenprobleme in M. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 3 S. 91-95.
- Sturm (Friedrich), Schweriner See u. Pinnower See. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 1 S. 7-10.
- v. Bülow (Kurd), Sternberg, geologisch gesehen. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 37-41.
- Wagner (H.), Das Hannoversche Wendland. Monatsschr. Niedersachsen 42. Jg., 1937, Juni-Heft S. 251-257.
Wirtschaftsgeschichte.
- Blaschke (Heinz A.), Die politische u. wirtschaftliche Konstellation im Ostseeraum. Ein Beitrag zur Strukturanalyse des Ostseeraumes. Diss. Rostock. Kiel (KZ.-Druckerei) 1936. 63 S.
- Köhler, Die m. Landespferdezucht. Nied. Beob. 22. Okt. 1936.
- Marte (Walter), Der innere u. äußere Agrarversand M.'s. Berichte über Landwirtschaft N. F., 100. Sonderheft. Berlin (Paul Parey) 1934, S. 31-69.
- Hartwig (Julius), M.'e Handwerker auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt. M. Jahrb. 100, 1936, S. 179-184.
- Schulz (Fritz), M. u. Pommern als Wirtschaftsgebiet. Diss. Greifswald. Grimmen (Kreisztg.) 1933. 95 S.
Ortsgeschichte.
- Lemke (Otto), Die Ortschronik einer m. Kleinstadt in der Schule. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 22 S. 320-322.
- Tessin (Georg), Ratschläge zur Aufstellung einer Dorfchronik. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 22 S. 317-319.
- Steinmann, Das m. Dorf: Die Gesch. Darguner Klosterdörfer, 1. Alt Kalen, das Dorf, das im 13. Jahrh. eine Stadt war. Nied. Beob. 8. Sept. 1936, Nr. 209.


|
Seite 250 |




|
- Engel (Franz), Das m. Dorf: Kirch- u. Rum-Kogel im Kreise Güstrow. Vom Bauerndorf zum Gutshof. Nied. Beob. 23. Sept. 1936, Nr. 222.
- Graf von Bernstorf (Hermann), Bernstorf. Beitrag zu seiner Gesch. als Wohnstätte u. Landgut u. als Heimat der v. Bernstorffschen Familie seit dem Jahre 1237. Grevesmühlen (Korn u. Salchow) 1937. 36 S.
- Vick (Hans), Das Boizenburger Heimatmuseum. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 40-43.
- Bad Doberan mit seinem Ostseebad Heiligendamm. Eine Perle der Gotik u. des Klassizismus. 24 Lichtbilder mit Einleitung von Gerhard Ringeling. Rostock (Hinstorff) [1936].
- Kurz (O.), Grabow in Kriegszeiten u. als Garnison 1618- 1918. (Teil 3 der Gesch. Grabows.) Grabow (H. Bettenworth) 1937. 194 S.
- Port (Heinrich), Postgeschichte Grabows u. Umgebung. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 115-125.
- Belg (Friedrich), Chronik der Stadt Grevesmühlen. Schönberg M. (Leymann & Bernhard) 1936. 398 S.
- 125 Jahre Chr. Callies-Grevesmühlen, Dassow u. Klütz 1812-1937. Lübeck (Rahtgens) 1937. 30 S.
- Glasow (Hans), Das Güstrower Museum. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 1 S. 25-28.
- Schock, Von der ehem. fürstl. Stadtvogtei, der früheren Landdrostei u. dem Landratsamt zu Hagenow. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 4 S. 102-105.
- Unser Altar [in der Kirche zu Alt Karin]. Gem.-Bl. Alt-Karin Nr. 7, Juli 1936.
- Tessin, Interessante Feststellungen um Groß Klein. Wendisch Klein gleich Ahornort? Nied. Beob. 31. Okt. 1936, Nr. 255.
- Endler (C. A.), Kublank, ein altes Bauerndorf. Nied. Beob. 18. März 1937, Folge 65.
- Warncke (J.), Der ehemalige Altar der Kirche zu Lübsee. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 18. Jg., 1936, Nr. 3 S. 34-45.
- Bernhardt (Hugo), Über das Schicksal des Techelschen Turms auf dem alten Lübzer Schloß. M. Jahrb. 100, 1936, S. 261-266.
- Wienck (Paul), Zur 700-Jahrfeier der Stadt Malchow. Heimatkal. des Kreises Waren 1936, S. 38-42.
- Stein (Otto), Zur Gesch. des Schulzengehöftes zu Klein Molzahn bei Schlagsdorf in M. Zeitschr. f. Niedersächsische Fam.-Kunde 19. Jg., 1937, Nr. 7/8 S. 140-141.
- Wendt, Neubrandenburg. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, S. 431-433.
- Görschner (R.), Hauszeichen in der Ihlenfelder Vorstadt von Neubrandenburg. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 3 S. 81-83.
- Schmidt, Die Kätner von Neuhof. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 19. Jg., 1937, Nr. 1 S. 9-10.
- Dittmer (Paul), Entstehung von Oberhof mit Wohlenberg. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 22 S. 326-327.


|
Seite 251 |




|
- Schmidt (Heinz), Das vierte Korn [betr. Panzow], Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., März 1937, S. 164-172.
- Granzin (Martin), Das Parchimer Stadtarchiv neu geordnet. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 2 S. 61.
- Bachmann (Jürgen), Gastwirtssorgen vor 200 Jahren. Brauer Drühl aus Plau sucht sein Recht [1742]. M. Ztg. am Sonntag, 31. Jan. 1937.
- Hoefer, Von der ehemaligen Propstei auf dem Domhof Ratzeburg. Mitt. d. Heimatb, f. d. Fürst. Ratzeburg 18. Jg., 1936, Nr. 4 S. 58-59.
- Kühl (Paul), Geschichte der Stadt u. des Klosters Ribnitz in Einzeldarstellungen. Berlin-Tempelhof (Willy Schwarz) 1933. 753 S.
- Schmidt (Gertrud), Ein Beitrag zur Gesch. von Rövershagen. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 22 S. 319-320.
- Der Bau der Kirche in Schlieffenberg. Gem.-Bl. Reinshagen u. Schlieffenberg, Aug. 1936, Nr. 8 S. 7; Sept. 1936, Nr. 9 S. 7.
- Krüger (Friedrich), Schwerin einst u. jetzt. Niederdeutsche Welt 12. Jg., 1937, H. 1 S. 17-20.
- 200 Jahre Militärbauten in Schwerin. M. Ztg. 6. Febr. 1937, Nr. 31.
- Dettmann (Gerd), Der Schweriner Schloßgarten. M. Monatsh. 12. Jg., 1936, H. 140 S. 401-404.
- Steinmann (Paul), Burg Stargard. M. Monatsh. 12. Jg., 1936. H. 140 S. 421-425.
- Karff (C.), Unser Sternberg. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 34-37.
- Fischer (K.), Die Bauten Sternbergs. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937. H. 2 S. 59-62.
- Gosselck (Johannes), Von der Fischerei im Sternberger See. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 70-72.
- Orgel (D.), Die Fischzucht Sternbergs. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 67-70.
- Karff, Das "Bullenstöten" in Sternberg. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2. S. 65-66.
- Pries (J. F.), Ein Schafstall [bei Sternberg] als Kulturdenkmal. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 63-65.
- Timm (K.), Zur Gesch. des Dorfes Tolzin. Gem.-Bl. Reinshagen u. Schlieffenberg, Febr. 1937, Nr. 2 S. 13-14.
- Köhler, Aus der Geschichte der Stadt Waren. Warener Tageblatt 49. Jg., 1935, Nr. 153, 162, 174, 186, 210, 267 u. 274; 50. Jg., 1936, Nr. 98, 109, 120, 137, 149, 209, 221 u. 233.
- Bauerstaedt (Ernst), "Sonderrechte" der Seestadt Wismar. Diss. Rostock. Gütersloh i. Westf. (Thiele) 1935. IV u. 98 S.
- Schlettwein (Adolf), Fremdgesellen der Buchbinderzunft in Wismar 1760-1828. Archiv f. Sippenforschung 14. Jg., Mai 1937, H. 5 S. 139-143.
- Köhler, Die Burg Wredenhagen. Heimatkal. des Kreises Waren 1936, S. 51-52.


|
Seite 252 |




|
- Steinmann (Paul), Die Bauernsippe Laverentz (Frentz) zu Zepkow kämpft um ihre Hufe. Monatsh. M.-Lübeck 13. Jg., 1937, S. 135-138.
Kirche.
- Maybaum (Heinz), Kirchengründung u. Kirchenpatronat in der Kirchenprovinz Hamburg-Bremen während des Mittelalters. Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. 56. Bd., Kan. Abt. 25, 1936, S. 355-475.
- Willgeroth (Gustav), Die m. Pfarren. Ergänzungsband 1937. Schönberg M. (Lehmann u. Bernhard) 1937. 176 S. - Mit einem Nachruf von A. Schlettwein auf den am 15. März 1937 verst. Verfasser.
- Aufzählung der Patrone der Reinshäger Kirche. Gem.-Bl. R. u. Schlieffenberg, Juli 1936, Nr. 7 S. 7.
- Nizze (Adolf), Das Kloster zum Heiligen Kreuz zu Rostock. Pritzwalk (Adolf Tienken) [1937]. 54 S.
Schulen.
- Schulbauten im Gau M.-Lübeck 1933-1937. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 4 S. 41-62.
- Spencker (Friedrich) u. Burmeister (Wilhelm), Das Lyzeum mit Studienanstalt in Schwerin (Meckl.) 1911-1936. Schwerin (Sandmeyer) [1936]. 32 S.
- Timm (K.), Etwas über die Schulen im Kirchspiel Reinshagen u. Schlieffenberg. Gem.-Bl. R. u. Schl. April 1937, Nr. 4 S. 27-28.
- Zink (Ulrich), Die Schule in Sukow. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 10 S. 164-165.
- Wessel (F.), Lehrer an der Schule in Tessin [1587-1914]. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 10 S. 162-163.
Kunst.
- Lewels (M.), Die beiden ersten Bilder an Meister Bertrams Grabower Altar [jetzt in der Kunsthalle zu Hamburg]. Zeitschr. d. Ver. für Hamb. Gesch. 35. Bd., 1936, S. 107-113.
- Martens (Friedrich Adolf), Meister Bertram, Herkunft, Werk u. Wirken. Teildruck (Kap. III) einer Rostocker Diss.: Die Tafelmalerei des norddeutschen Küstengebietes von ihren Anfängen bis 1450 [betr:. u. a. den Grabower Altar]. Berlin (Deutscher Verein f. Kunstwissenschaft) 1936. 42 S.
- Castelli (Wilhelm), Güstrow, Pfarrkirche: Die Tafeln des Hochaltars. 12 Aufnahmen. Güstrow (Opitz u. Co.) [1936?].
- v. Bülow (Werner), Das 9-Kugel-Kreuz am Südportal des Ratzeburger Domes. Lauenburgische Heimat 11. Jg., 1935, H. 2 S. 25-30.
- Rudolph (Herbert), Formgeschichtliche Betrachtungen über die Werke Georg Titges im Ratzeburger Dom. Lauenburgische Heimat 12. Jg., 1936, H. 3/4 S. 71-81.


|
Seite 253 |




|
- Dettmann, Wer schuf das Epitaph der Ingeborg v. Parkentin [† 1615] im Dom [zu Schwerin]? M. Ztg. 24. Okt. 1936, Nr. 250.
- Josephi (Walter), Die Gr. S t i e t e n e r Fayence-Gruppe u. ihr Vorbild. M. Jahrb. 100, 1936, S. 193-198.
- Dörr (Erich Johann), Der M.er Otto Dörr u. sein neuer Ruhm. Velhagen u. Klasings Monatsh. 51. Jg., Febr. 1937, H. 6 S. 621-628.
- Helden in Stein. Unveröffentlichte Schöpfungen unsers Meisters W. Wandschneider. Nied. Beob. 20. Febr. 1937, Folge 43; Sonntagspost, Folge 7.
- Pries. Die öffentlichen Hochbauten in M. Nied. Beob. 12. Jg., 1936, Nr. 235, Okt. 8; Sonderbeilage "Wir bauen auf", S. 35.
- Ebel (Hans) †, Der Theatergraf. Karl Friedrich Graf von Hahn-Neuhaus. Unter besonderer Berücksichtigung seines Wirkens in Pommern. Ein Beitrag zur Gesch. des norddeutschen Theaters. Monatsbl. der Ges. für pomm. Gesch. u. Alt.-Kunde 51. Jg., 1937, Nr. 3 S. 35- 47.
Kriegsgeschichte.
- Generalstaben: Sveriges krig 1611-1632. Bilagsband I. Stockholm (Victor Petterson) 1937. 372 S.
- Köhler, Zur 130. Wiederkehr des Gefechtstages von Waren-Nossentin (1. Nov. 1806). Heimatkal. des Kreises Waren 1936, S. 42-44.
- A. (E.), Aus M.'s Franzosenzeit [Kirchenbucheintragungen]. Der Sippenforscher in M. 1936, Nr. 4, 5; 1937, Nr. 1-7.
- Helmuth von Moltke, Strategie u. Politik. Eine Auswahl aus Moltkes Schriften, hrsg. von Eberhard Kessel. Deutsche Schriften, Bd. 7. Potsdam (Protte) 1936. 157 S.
- Rassow (Peter), Der Plan des Feldmarschalls Grafen Moltke für den Zweifrontenkrieg (1871-1890). Breslauer Histor. Forschungen, Heft 1. Breslau (Priebatsch) 1936. 20 S.
- Beltz (Joh.), M.er stürmen den Hartmannsweilerkopf. Jäger [14] u. Grenadiere [89] in schwerem Ringen an der Vogesenfront vor 22 Jahren. M. Ztg. 22. Jan. 1937, Nr. 18.
- Bibeljé, Die letzten vom Douomont. Zur Erinnerung an die Räumung des Forts am 23-24. Okt. 1916. Das m. Res.-Inf.-Rgt. Nr. 90 in vorderster Front. M. Ztg. 23. Okt. 1936, Nr. 249.
- v. Lüttichau, Heldengedenktag 1937. Erlebnisberichte des III. Batl. Res.-Inf.-Regts. Nr. 90 in der Aisne-Champagne-Schlacht 1917. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 7 S. 109-113.
- Frhr. v. Hammerstein, Vor zwanzig Jahren. Schweriner Artillerie an der Somme. Mitt. d. Off.-Ver. Feld-Art.-Rgt. 60, 18. Jg., Nr. 91, Juli 1936, S. 10-14; vgl. auch M. Ztg. 24. Juni 1936.
- Zink (Ulrich), Soldatengräber 1914/18. Tagebuchblätter eines m. Grenadiers. M. Schulztg. 68. Jg., 1937, Nr. 7 S. 113-114.


|
Seite 254 |




|
Verfassung.
- Jesse (Edgar), Der Landtag zu Sternberg. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 54-58.
- Kähler, über Sitten u. Gebräuche des alten ständischen Landtages. M. Ztg. 3. Juni 1937, Nr. 126.
- Reinhardt (Ernst), Vom alten Landtag. Zeitschr. M. 32. Jg., 1937, H. 2 S. 48-54.
Sprachwissenschaft, Literaturgeschichte.
- Haeger (Fritz), Plattdeutsche Einheitsrechtschreibung und M. Mundart. Zeitschr. M. 31. Jg., 1936, H. 2 S. 53-58.
- Wossidlo (Richard) u. Teuchert (Hermann), M. Wörterbuch. 1. Lief.: A-afkabecheln. Neumünster (Wachholtz) 1937. XV u. 128 Sp.
- Steinmann (Paul), Volksdialekt u. Schriftsprache in M. Aufnahme der hochdeutschen Schriftsprache im 15./16. Jahrh. M. Jahrb. 100, 1936, S. 199-248. Forts. folgt.
- Fritz Reuter, Sämtliche Werke. Hrsg. von Friedrich Düsel u. Hermann Quistorf. Berlin (Th. Knaur) [1936]. 1. Bd.: 1235 S. 2. Bd.: 1260 S.
- Ruhnke (Otto R. C.), Die Nachdrucke zur Ausgabe letzter Hand der Schriften Fritz Reuters. Jahrb. des Ver. für niederdeutsche Sprachforschung Bd. 62, 1936, S. 154-163.
- Neese (Wilh.), Waren u. die Literatur. Heimatkal. des Kreises Waren 1936, S. 28-31.
- Langenmaier (Theodor), Deutsches Schrifttum unserer Zeit. Bamberg (C. C. Buchner) 1935. 118 S. [S. 95-99: Friedrich Griese].
Alphabetisches Verzeichnis.
v.
A
bercron (Fam.) 69.
Adel 61-63.
69.
Alexandrine (Großherzogin von Mecklb.)
48.
Anna (Herzogin von Mecklb.) 45.
Arkona 28.
Auswanderung 124.
Awe
(Fam.) 70.
B
acmeister (Fam.) 71.
v. Bassewitz
(Fam.) 69.
Bauern 4. 63. 114 ff.
Bauernbefreiung 118.
Bauernhaus 128.
Bauernlisten 4.
Bauernmuseum 126.
Beltz (Robert, Prof.) 72.
Bernhard (Prinz
von Lippe-Biesterfeld) 49.
Bernstorf
176.
Bertram (Maler) 228. 229.
Beyer
(Carl) 73.
Bibliographie 1 ff.
v.
Boddin (Fam.) 69.
Bohn (Heinrich, Prof.)
74.
Boizenburg 4. 64. 65. 177.
Böttger
(Louise) 75.
Brückner (Fam.) 76.
v.
Buchka (Fam.) 69.
v. Bülow (Ernst) 77.
Burgwall 21. 22.
C
allies (Chr., Firma) 182.
Carpin
19.
v. Cochenhausen (Fam.) 69.


|
Seite 255 |




|
Dänen 38.
Darß 153.
Dierhagen 157.
Diers (Marie) 78.
Dittmann (Heinrich,
Prof.) 79.
Doberan 178.
Dörr (Otto,
Maler) 235.
Drewing (Maler) 80.
Drühl
(Brauer) 198.
v. Dulitz (Fam.) 69.
E
ckermann (Fam.) 108.
Eggers. (Fam.)
81.
v. Einem (Fam.) 69.
F
amiliengeschichte 42. 50 ff.
Familiennamen 52-57. 64. 65.
Fischland 20.
153.
Frentz (Fam.) 218.
Friderici
(Daniel) 82.
Friese (Heinrich, Prof.)
83.
Frodien (Fam.) 84.
Fürstenhaus 45 ff.
Alt
G
aarz 21. 22.
Geschichte 40
ff.
Grabow 179. 180. 228. 229.
Grevesmühlen 181. 182.
Griese (Fam.)
258.
Güstrow 65. 183. 230.
v.
H
aeseler (Fam.) 69.
Hagenow
184.
v. Hahn (der Theatergraf) 238.
Hausinschriften 129.
Hauszeichen 193.
Hederich (Bernhard, Rektor) 85.
Heiligendamm 178.
Heimatmuseen
Boizenburg 177.
Güstrow 183.
Heinrich der Löwe 5. 40. 41.
v. Hennig
(Fam.) 86.
Hillmann (Fam.) 87.
v.
Hirschfeld (Fam.) 69.
Hungerstorf 128.
v.
J
hlenfeld (Fam.) 69.
Jonsson (Bo)
42.
Josephi (Walter, Prof.) 88.
Juliana (Prinzessin der Niederlande) 49.
K
ähler (Hans, Lehrer) 89.
Alt Kalen
174.
Alt Karin 185.
Karl (Herzog zu
Mecklb.) 46.
Kirche 219 ff.
Klara
Maria (Herzogin von Mecklb.) 45.
Groß Klein
186.
Kirch- u. Rum-Kogel 175.
Körchow
23.
Kriegsgeschichte 46. 239 ff.
Kublank 187.
Kulturgeschichte 114 ff.
Kunst 228 ff.
L
andeskunde 153 ff.
Landesmuseum
7.
Landtage 249-251.
Laverentz (Fam.)
218.
Lisch (Friedrich) 90. 91.
Literaturgeschichte 98. 255 ff.
v. Livonius
(Fam.) 69.
Langobarden 9.
Lübsee
188.
Lübtheen 24.
Lübz 189.
Luise
(Königin von Preußen) 47.
M
alchin 92.
Malchow 190.
Margarete (Herzogin v. Mecklb.) 45.
Meysahn
(Fam.) 92.
v. Michael (Fam.) 69.
Moltke (Helmuth, Graf) 93. 242. 243.
Klein
Molzahn 191.
N
eubrandenburg 192. 193.
Neuhof
(Schönberg) 194.
Neustrelitz 25.
Nossentin 240.
Nugent (Dr.) 155.
O
berhof (mit Wohlenberg) 195.
Oldenburg (Fam.) 94.
Ortsgeschichte 172
ff.
Ortsnamen 18.
v.
P
aepcke (Fam.) 69.
Panzow
196.
Parchim 197.
v. Parkentin
(Ingeborg) 233.
Perdöhl 26.
Pinnow
(See) 164.
Plau 198.
v. Plessen (Fam.)
95.
v. Pressentin (Fam.) 96.


|
Seite 256 |




|
Q uellen 3 ff.
R
atzeburg
Dom 231. 232.
Land (Fürstentum) 27. 154.
Propstei
199.
Volkstracht 132.
v. Raven
(Fam.) 97.
Regimenter
Gren. 89:
244. 248.
Jäger 14: 244.
Res.-Inf. 90: 245. 246.
Art. 60:
247.
Rehna 132.
Reinshagen 221.
225.
Rethra 28.
Reuter (Fritz) 98. 99.
255. 256.
Ribnitz 200.
Roga 29.
Rosenow (Fam.) 100.
Rostock
Kloster
z. Heil. Kreuz 222.
Museum (Altert.)
30.
Vorgesch. Funde 30-34.
Wegekarte 153.
Rövershagen 201.
v.
Rudloff (Fam.) 69.
S
chaalsee 162.
Schlieffenberg 202.
225.
Schliemann (Heinrich) 101.
Schulen 223 ff.
Schwaan 35.
Schwarz
(Ort) 78.
Schwerin
Dom 233.
Einst u. jetzt 203.
Landesmuseum
(Vorg. Abt.) 7.
Lyzeum mit Studienanst.
224.
Militärbauten 204.
Schloßgarten 205.
See 164.
Vorgesch. Funde 36.
Siedlung 60. 147
ff.
Sittmann (Fam.) 69.
Sophie
(Herzogin v. Mecklb.) 45.
Sprachwissenschaft 252-254.
Sprichwörter
140.
Stadtarchiv (Parchim) 197.
Burg
Stargard 206.
Stavenhagen (Fritz) 102.
Sternberg 37. 165. 207-212. 249-251.
Groß
Stieten 234.
v. Suckow (Fam.) 69.
Sukow 226.
T
echen (Friedrich) 103-106.
Tessin
227.
Teterow 38.
v. Thünen (Joh.
Heinr.) 107.
Tolzin 213.
Tüschow
86.
Tuve (Fam.) 108.
V
erfassung 249 ff.
Volkskunde 114
ff.
Volkstracht 132.
Vorgeschichte 6
ff. 90. 91.
W
andschneider (Wilh., Prof.) 236.
Wappen 66. 67.
Waren 214. 240. 257.
Warnen 18.
Warnow (Fluß) 39.
Wenden
38.
Wiegels (Fam.) 109.
Wienck (Fam.)
110.
Willgeroth (Fam.) 220.
Wirtschaftsgeschichte 167 ff.
Wismar 215.
216.
Wißmann (Forscher) 111.
Witte (F.
C.) 112.
v. Witzendorff (Fam.) 69.
Wohlenberg 195.
Wörterbuch 253.
Wossidlo (Prof.) 113.
Wossidlo-Sammlung
126.
Wredenhagen 217.
Z
entralmuseum, Röm.-Germ., 91.
Zepkow 218.
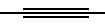


|
[ Seite 257 ] |




|



|



|
|
:
|
VIII.
Hans Spangenberg †
von
Heinz Maybaum.
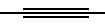


|
[ Seite 258 ] |




|


|
[ Seite 259 ] |




|
Am 2. Oktober 1936 verstarb im 69. Lebensjahre der allen Freunden der mecklenburgischen Geschichte bekannte ordentliche Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Landesuniversität Rostock, Dr. Hans Spangenberg. In ihm hat das deutsche Volk einen glühenden Patrioten, die gesamte deutsche Geschichtswissenschaft einen namhaften Gelehrten, unsere engere Heimat einen warmen Freund und erfolgreichen Förderer ihrer Geschichte, unsere Universität einen ausgezeichneten Lehrer verloren.
Spangenberg ist hervorgegangen aus der Schule P. Scheffer-Boichhorsts, die der deutschen Geschichtswissenschaft so manchen Gelehrten erzogen hat, und als Student noch in persönliche Berührung mit Treitschke getreten. Er hat nach Abschluß seiner Studien die Archivlaufbahn ergriffen, die ihn von Berlin über Münster und Breslau 1905 nach Königsberg führte, wo er sich 1906 habilitierte. Seine Vertrautheit mit der Geschichte des deutschen Ostens empfahl ihn besonders für den Lehrstuhl für mittlere und neuere Geschichte an unserer Universität Rostock, als dieser 1921 neu zu besetzen war.
Seine wissenschaftlichen Neigungen gehörten vornehmlich der Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte des Zeitraumes, den wir als späteres Mittelalter zu bezeichnen pflegen. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen seien hier nur seine beiden Hauptwerke genannt: Die Hof- und Zentralverwaltung der Mark Brandenburg im Mittelalter, 1908, und Vom Lehnsstaat zum Ständestaat, 1912.
Fast 1 1/2 Jahrzehnte lang hat Spangenberg dem Lande Mecklenburg, das ihm zur letzten Heimat geworden war, mit aller Hingabe, deren diese aufrechte Soldatennatur fähig war, gedient. Er, der, über das Alter der Wehrpflicht hinaus, freiwillig fast den ganzen Weltkrieg an der Westfront mitgemacht hat, zuerst als Kompanieführer, dann als Bataillonskommandeur, hat in den Jahren nach dem Zusammenbruch unter der


|
Seite 260 |




|
inneren und äußeren Not seines Volkes gelitten wie unter einer ganz persönlichen Not. Seine nüchtern-sachliche Wissenschaftlichkeit und sein in allen Lebenslagen bewährter phrasenloser Nationalismus machten ihn zu einer vorbildlichen Lehrer- und Erzieherpersönlichkeit. Aus seiner Schule ist eine Reihe von Arbeiten hervorgewachsen, die die Geschichte unserer engeren Heimat eine weite Strecke vorwärts gebracht haben. In den Arbeiten seiner Schüler steckt ein schwer zu ermessender Teil seiner eigenen Arbeitskraft.
In den Herzen aller derer, die ihn kannten, lebt Spangenberg fort als der reine uneigennützige Mensch, der nie persönlichen Vorteil oder eigenen Ruhm gesucht hat, der stets alles, was er war und hatte, eingesetzt hat für sein Volk und seine Pflicht.
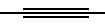


|
[ Seite 261 ] |




|



|



|
|
:
|
VIII.
Namensentstellung durch
Verschiebung der
Wortgrenze
in einer Urkunde von 1328
von
Wilfrid Kuhn.
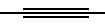


|
[ Seite 262 ] |




|


|
[ Seite 263 ] |




|
Rudloff 1 ) las in einer Urkunde von 1328 unter den Zeugen: Nicolaus de Muritz. Lisch 2 ) bemerkte hierzu, daß ein Ritter dieses Namens nicht vorkomme, und ließ feststellen, daß zu lesen sei: Nicolaus de Nůryz. Er folgerte daraus, daß Nikolaus von Oertzen (Stargardische Linie) gemeint und dessen Namensform Uritz ein dialektisches N vorgesetzt sei.
Die vorliegende sprachliche Erscheinung, Verschiebung der Wortgrenze, ist gemeindeutsch; enge Verbindung von Satzworten kann bei Satzauflösung unrichtige Worttrennung herbeiführen, es kann "Konsonantenantritt oder -verlust am Wortanlaut oder Wortauslaut entstehen" 3 ). Solche lautlichen Falschbildungen bringen besonders Änderungen in der Form ursprünglich vokalisch anlautender 4 ) Ortsnamen hervor. Behaghel 5 ) gibt z.B.: [im Elzdorf] Melzdorf. In einer Urkunde kommt vor: Joachim von Plesse "to můpal", entstanden aus t[omt dach]m Upal, von Lisch richtig bemerkt 6 ).
"Vorschub eines N" 7 ) liegt auch in der Urkunde von 1328 vor. Den anscheinend nicht sehr kundigen Schreiber verwirrte


|
Seite 264 |




|
die Präposition "von" 8 ) - der Name wurde ihm zweifellos deutsch diktiert -; er hörte: van Uriz, gebunden gesprochen: vanuriz, trennte falsch, übersetzte und schrieb "de Nůryz".
Es stimmt damit überein, daß andere vokalisch anlautende Personennamen ebenso behandelt sind. Lisch selbst weist darauf hin, daß der Name Axecow in älterer Zeit häufig Naxecow geschrieben wird" 9 ).
Die Erklärung des n-Vorschubs als Verschiebung der Wortgrenze erscheint richtiger als Lischs Ansicht, die auf der u. E. nicht einwandfrei erwiesenen Theorie von der wendischen Herkunft des Geschlechts und Namens aufgebaut ist 10 ), und wonach das "N" der Form "Nůryz" eine wendische Dialekterscheinung wäre 11 ). Aus der Annahme der Wortgrenzen-Verschiebung würde sich ergeben, daß der Name Oertzen nicht nur noch 1313 12 ), sondern auch noch 1328 in der alten Form von 1192: Uriz 13 ) vorkommt, lediglich in der Stammsilbe durch i-Einfluß verändert.
Weiterer Untersuchung muß die Prüfung der Herkunftsfrage der Familie von Oertzen vorbehalten bleiben; es sei vorläufig nur die Frage gestellt, ob nicht zwei Familien (Uriz und Oertzen) zu unterscheiden sind.