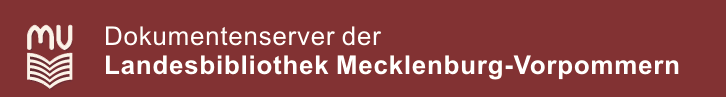|




|


|
|
|
-
Jahrbücher für Geschichte, Band 90, 1926
- Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht : Rechtsgutachten
- Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht : zweites Erachten
- Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht : Rechtsgutachten
- Die Travemünder Reede, Reedelage und Reedegrenze
- Rostocker Ehen in alter Zeit
- Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806)
- Gelegenheitsfindlinge aus meinen genealogischen Sammlungen
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/1926
- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1925 bis zum 30. Juni 1926 : Schwerin, 1. Juli 1926
Jahrbücher
des
Vereins für mecklenburgische Geschichte
und Altertumskunde,
gegründet von Friedrich Lisch,
fortgesetzt
von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.
Neunzigster Jahrgang.
herausgegeben vonStaatsarchivdirektor Dr. F. Stuhr,
als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schwerin, 1926.
Druck und Vertrieb der
Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.
Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.


|




|


|




|
Inhalt des Jahrbuchs.
| Seite | ||
| I. | Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht. Von Staatsminister i. R. D Dr. Langfeld | 1 |
| II. | Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht. Von demselben | 15 |
| III. | Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht. Von Univ.-Professor Dr. Julius v. Gierke - Göttingen | 25 |
| IV. | Die Travemünder Reede. Reedelage und Reedegrenze. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker | 113 |
| V. | Rostocker Ehen in alter Zeit. Von Pastor Friedrich Schmaltz - Bremen-Oslebshausen | 185 |
| VI. | Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806). Von Vikar Dr. Niklot Beste - Benthen | 211 |
| VII. | Gelegenheitsfindlingeaus meinen geneanalogischen Sammlungen. Von Forstmeister a. D. C. Frh. v. Rodde - Prüzen bei Tarnow | 321 |
| VIII. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/26. Von Staatsarchivdirektor Dr. Friedrich Stuhr | 329 |
| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 347 | |



|




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht : Rechtsgutachten
- Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht : zweites Erachten
- Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht : Rechtsgutachten
- Die Travemünder Reede, Reedelage und Reedegrenze
- Rostocker Ehen in alter Zeit
- Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763 bis 1806)
- Gelegenheitsfindlinge aus meinen genealogischen Sammlungen
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1925/1926



|


|
|
:
|
I.
Über die Grenzen der Staatshoheit
von
Mecklenburg-Schwerin
und Lübeck in der
Lübecker Bucht.
Rechtsgutachten
des
Staatsministers i. R. D. Dr. Langfeld=Schwerin.
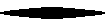


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|
Zwischen dem Freistaat Mecklenburg-Schwerin und der freien Stadt Lübeck ist eine Meinungsverschiedenheit entstanden über die Grenzen ihrer Staatshoheit an der Lübecker Bucht, insbesondere hat die Stadt Lübeck geltend gemacht, daß ihr die Staatshoheit auch an dem Wassergebiete der Ostsee zustehe, welches die mecklenburgische Küste von der Landesgrenze beim Priwall ab ostwärts bis zur Mündung des Baches Harkenbeck bespült, während Mecklenburg an dieser Wasserfläche, soweit sie als Küstengewässer anzusehen ist, die Staatshoheit für sich beansprucht.
Eine Entscheidung dieses Rechtsstreites soll durch die nachstehenden Ausführungen versucht werden.
Für die Entscheidung sind die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes über die Bestimmung der das offene Meer berührenden Grenzen eines Staatsgebietes maßgebend.
Nach Artikel 4 der Reichsverfassung gelten diese Regeln als bindende Bestandteile des Deutschen Reichsrechtes. Gegen ihre Anwendung auf den vorliegenden Fall kann nicht eingewandt werden, daß nach der Reichsverfassung (vgl. Art. 6 Ziff. 1, Art. 78 Abs. 1 ) die Beziehungen zum Auslande Sache des Reiches sind, und deshalb jene völkerrechtlichen Normen nur noch für die Grenzen des Reichsgebietes gegenüber dem Meere, nicht aber auch für die Bestimmung der Meeresgrenze zwischen deutschen Ländern zur Anwendung kommen können. Denn nach Artikel 2 der Reichsverfassung besteht das Reichsgebiet "aus den Gebieten der deutschen Länder". Die letzteren waren vor dem Eintritt in den Norddeutschen Bund, aus dem das Deutsche Reich hervorgegangen ist, völkerrechtlich selbständige Staaten. Ihr Gebiet, mit dem sie in den Norddeutschen Bund und später in das Reich übergegangen sind, bestimmte sich nach den Regeln des Völkerrechtes auch für ihre Beziehungen zueinander. Es muß deshalb auch heute noch für die Bestimmung der Seegrenze zwischen den Ländern Mecklenburg und Lübeck auf die völker-


|
Seite 4 |




|
rechtlichen Grundsätze zurückgegriffen werden, die bei ihrem Eintritt in den Norddeutschen Bund bestanden haben. Seitdem sind Änderungen dieses Gebietes nicht erfolgt, insbesondere nicht nach Maßgabe des Artikel 18 Abs. 1 Satz 2 der neuen Reichsverfassung vom 11. August 1919.
Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechtes über die Grenzen zwischen Staatsgebiet und offenem Meere sind folgende:
1. Eine rechtliche Herrschaft an dem offenen Meere ist nicht möglich. Schon nach dem auf dem römischen Rechte beruhenden gemeinen Rechte war das Meer eine res extra commercium, an der eine rechtliche Herrschaft ausgeschlossen war, eine res communis omnium, die dem Gebrauche aller hingegeben ist 1 ).
Der Freiheitsbegriff des Mittelalters, welcher als Grenzen seiner Betätigung nur die von der Natur oder der persönlichen Schwäche des Handelnden gegebenen Schranken anerkannte, hat freilich sich durch jenen Rechtssatz nicht gebunden gefühlt. Daraus erklärt es sich, daß nicht nur die großen, Seeschiffahrt treibenden Nationen, sondern auch kleine deutsche Territorialherren, deren Gebiet an die See stieß, sich besondere Rechte an dem Meere anmaßen konnten. Ein Beispiel ist das der Stadt Rostock vom Landesherrn eingeräumte Recht, die Fischerei auf der Ostsee, soweit sie sich auf diese hinauszubegeben getrauen sollten, auszuüben. Seitdem jedoch die von Hugo Grotius vertretene Rechtsansicht 2 ) von der bindenden Kraft völkerrechtlicher Normen überhaupt und von der völkerrechtlich gesicherten Freiheit des Meeres insbesondere Gemeingut der Kulturnationen geworden war, ist diese Ansicht auch an die Stelle alter, hiervon abweichenden mittel-


|
Seite 5 |




|
alterlichen Rechtsanschauungen getreten. Es hat sich deshalb auch für den an das mecklenburgische und lübische Gebiet grenzenden Teil der Ostsee der allgemeine völkerrechtliche Grundsatz der Freiheit des offenen Meeres gegenüber abweichenden partikulären Rechtsbildungen durchgesetzt.
2. Es entsteht jedoch die Frage: Was ist unter dem "offenen" Meere im Sinne dieser Rechtsnorm zu verstehen?
Die allgemein anerkannte Lehre des Völkerrechtes unterscheidet von dem offenen Meere die "Küstengewässer" und die "Eigengewässer" 3 ).
a) Küstengewässer ist der Saum des Meeres, welcher die Küste eines Landes bespült. Dieser Meeresteil unterliegt der Staatsgewalt des Uferstaates, aber nur in einzelnen Beziehungen. Der Uferstaat kann in Ausübung seiner Pflicht, Land und Bürger gegen die aus dem freien Zugang über das Meer her drohenden Gefahren zu schützen, auf dem Küstenmeer Abwehr- und Sicherungsmaßnahmen treffen. Dies gilt nicht nur von der Verteidigung gegen militärische Angriffe, sondern auch von dem Schutt gegen Einschleppung von Seuchen und Krankheiten sowie von der Verhütung von Zolldefrauden und Verfehlungen gegen die Finanzgesetze. Der Uferstaat hat andererseits die friedliche Handelsschiffahrt und Fischerei auf dem Küstenmeer zu dulden, kann jedoch die Fischerei und Küstenschiffahrt auf diesem Meeresteile seinen eigenen Staatsangehörigen vorbehalten. Auf dem Boden dieser Rechtsanschauung steht auch das Reichsgesetz vom 22. Mai 1881, betr. die Küstenschiffahrt (RGBl. S. 97), indem es im § 1 bestimmt:
"Das Recht, Güter in einem deutschen Seehafen zu laden und nach einem anderen deutschen Seehafen zu befördern, um sie daselbst auszuladen (Küstenfrachtfahrt), steht ausschließlich deutschen Schiffen zu."
im § 2 aber zuläßt, daß ausländischen Schiffen dieses Recht durch Vertrag oder Kaiserliche Verordnung eingeräumt werden kann.
Die Grenze des Küstenmeeres bilden nach der Landseite die Linie des tiefsten Standes der Ebbe, nach der Seeseite eine dem Ufer parallel laufende Linie in Entfernung von 5 Seemeilen


|
Seite 6 |




|
= 5,565 Kilometern. Diese Grenzbestimmung hat in der völkerrechtlichen Theorie und Praxis allgemein die früher üblich gewesene unbestimmte Normierung "auf Kanonenschußweite" verdrängt 4 ).
Die Normalgrenze des Küstenmeeres von 3 Seemeilen muß jedoch eine Einschränkung erleiden, wenn sie hinübergreift in das nach dem gleichen Maßstabe begrenzte Küstenmeer eines anderen Staates. Dieser Fall ist gegeben, wenn zwei Staaten durch einen Meeresteil getrennt werden, der eine geringere Breite hat als sechs Seemeilen, oder wenn die Uferlinie von zwei am Meere aneinander stoßenden Staaten nach innen gebogen ist, so daß die vom Ufer des einen Staates gezogene senkrechte Linie von drei Seemeilen sich mit der vom Ufer des anderen Staates gezogenen Senkrechten Linie von drei Seemeilen schneiden muß. In der völkerrechtlichen Literatur besteht jedoch Einverständnis darüber, daß in diesen Fällen die Küstengewässer der beiden Staaten beschränkt werden. Im ersten Falle, wenn die Staaten durch einen schmalen Meeresarm getrennt werden, wird die Grenze gegeben durch die Mittellinie zwischen beiden Staaten. Im zweiten Falle, wenn die Seegrenzen des Küstengewässers beider Staaten sich schneiden, wird die Grenze gegeben durch eine Linie, die von der Ufergrenze der Staaten ab so in das Meer geführt wird, daß jeder Punkt der Linie von dem Ufer beider Staaten gleich weit entfernt ist 5 ).
Da die Anerkennung des Hoheitsrechtes an dem Küstenmeere auf dem Zwecke, das Land an der Seeseite zu schüren, beruht, so ergibt sich, daß die Rechte am Küstenmeer aus der Staatshoheit über das Landgebiet herausgewachsen sind. Das Küstenmeer eines


|
Seite 7 |




|
Staates ist rechtlich nicht anders zu beurteilen als "eine Fortsetzung seines Uferlandes" 6 ).
Der berechtigte Staat kann deshalb das Küstenmeer getrennt von den durch dieses gedeckte Landgebiet ebenso wenig rechtswirksam veräußern wie Teile des offenen Meeres. Dagegen würde der berechtigte Staat in der Lage sein, im Wege der Vereinbarung mit dem Nachbarstaate, dessen seewärts belegene Grenze seines Küstenmeeres sich mit der seines eigenen Küstengewässers schneidet, die auf dem allgemeinen Völkerrechte beruhende Bestimmung der Grenze der aufeinander übergreifenden Küstengewässer anderweitig zu regeln, insbesondere dadurch, daß er zugunsten des Nachbarstaates auf den diesem an sich als Küstengewässer gebührenden Meeresteil verzichtet, der jenseits der Mittellinie liegt und deshalb dem verzichtenden Staate zugefallen ist.
b) Von dem offenen Meer ist weiter zu unterscheiden das "Eigenmeer", auch "Territorialmeer i. e. S." genannt. Dazu gehören:
α) Meeresbuchten und durch vorgelagerte Inseln oder Landzungen gebildete Haffe, deren Einfahrt so eng ist, daß sie vom Lande aus gesperrt werden kann;
β) kleinere Buchten, Reeden und Häfen, mögen sie von Natur oder künstlich geschaffen sein, wenn sie von dem Staatsgebiet desselben Staates umgeben sind und beherrscht werden können;
γ) Flußmündungen, d. i. der Teil des Meeres, in welchem Fluß und Meer sich vereinigen und dessen Grenze dem Meere zu "durch die äußerste Linie zwischen den letzten beiden Uferpunkten des Flusses" bestimmt wird, mögen die Punkte sich auf dem natürlichen Ufer oder auf einem künstlichen Bauwerk, z. B. einer Mole, befinden 7 ). Eigenmeere unterliegen in vollem Umfange der Herrschaft des sie umfassenden Staates.
3. Das Recht des Staates an dem Küstenmeere wie an dem Eigenmeere ist kein privatrechtliches, sondern ein öffentlich-rechtliches. Es ist kein Eigentum (dominium), sondern Staatsgewalt (imperium), wie das römische Recht sie schon an dem Meeres-


|
Seite 8 |




|
ufer anerkannte (vgl. 1. 14. D. de acquirendo rerum dominio 41, 1: "Litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, set ut ea quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt"). Es ist ein Ausfluß der Staatsgewalt wie die Herrschaft des Staates über die aus Festland oder Inseln bestehenden übrigen Teile seines Gebietes 8 ).
In völkerrechtlicher Beziehung äußert sich diese Herrschaft oder Gebietshoheit vorzugsweise im negativen Sinne, nämlich als Recht "zur Ausschließung jeder anderen nebengeordneten Staatsgewalt von einem bestimmten Teile der Erde" 9 ).
Dieses Recht ist unbeschränkt in Ansehung des Eigenmeeres, dagegen in Ansehung des Küstenmeeres mit der Legalservitut der Duldung fremder Schiffahrt und Fischerei belastet. Im Unterschiede zu der Staatshoheit an dem Festlande kann man deshalb auch sagen: "Der Staat hat eine beschränkte Gebietshoheit in den Küstengewässern" 10 ).
Die Lübecker Bucht ist, wie die Karte zeigt, die südwestliche von den Ländern Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Oldenburg (Fürstentum Lübeck) und Preußen (Holstein) umgebene Ausbuchtung der Ostsee, Für die von Lübeck an diesem Gewässer beanspruchten Rechte kommen für den vorliegenden Fall Preußen und Oldenburg nicht in Betracht. Es handelt sich nur um den Ausgleich der kollidierenden Ansprüche von Lübeck und Mecklenburg-Schwerin. Die Gebiete beider Staaten stoßen an der südlichen Küste der Lübecker Bucht bei dem zu Lübeck gehörigen "Priwall" zusammen, einer Landzunge, die von der Ostsee und dem Travefluß mit seiner östlichen Ausbuchtung gebildet wird.
Der zwischen beiden Ländern entstandene Streit dreht sich um ihre Rechte an dem Küstenmeer. Nach den vorstehend unter III 2 a ausgeführten völkerrechtlichen Grundsätzen würde von dem Grenzpunkte zwischen Mecklenburg und Lübeck am Priwall in die Ostsee hinein eine Linie zu ziehen sein, welche von der mecklenburgischen


|
Seite 9 |




|
wie von der lübischen Küste überall gleich weit entfernt ist. Der links von dieser Linie liegende Meeresteil gebührt Lübeck, der rechte von ihr liegende gehört Mecklenburg. Lübeck will diese Grenzfestsetzung nicht anerkennen.
Es beansprucht ein Gebiet von der Lübecker Bucht,
dessen Grenze im Westen und Süden durch die lübische und mecklenburgische Küste bis zur Mündung der Harkenbeck, im Osten durch eine von der Harkenbeck auf die Pohnstorfer Mühle und den Turm auf dem Gömnitzer Berg in Holstein gezogene Linie und im Norden durch eine von dieser Linie senkrecht auf den nordwestlich von Lübeck belegenen Brodtener Grenzpfahl gezogene Linie gebildet wird.
Dadurch entsteht ein Ausschnitt aus der Ostsee, der die Form eines unregelmäßigen Vierecks hat, in dessen Südwestecke die Travemündung liegt. Lübeck nimmt diesen Meeresteil als sein Küstenmeer in Anspruch und hat in Ausübung seiner Staatshoheit auf diesem Gebiete neuerdings namentlich die Fischerei auf ihm durch eine Fischereiordnung geregelt, durch welche die nichtlübischen Fischer, insbesondere die mecklenburgischen, von dem Fischfang auf diesem Gebiete tatsächlich fast ganz ausgeschlossen werden.
Es fragt sich: Ist der Anspruch Lübecks auf eine solche, von den völkerrechtlichen Grundsätzen abweichende Bestimmung des Küstenmeeres begründet?
Von lübischer Seite hat man den Anspruch auf verschiedene Weise zu rechtfertigen versucht.
a) Nach einer Ansicht 11 ) wird bestritten, daß die völkerrechtlichen Grundsätze auf diesen Meeresteil überhaupt zur Anwendung kommen können. Es sei nicht das Völkerrecht, sondern ein von diesem verschiedenes partikuläres Gewohnheitsrecht, das sich für die Lübecker Bucht gebildet habe, maßgebend. Dazu ist zu bemerken:
Soweit es sich um Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheit aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts handelt, müssen sie nach dem vorstehend unter III 1 Ausgeführten unbeachtet bleiben, weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf dem allgemeinen völkerrechtlichen Grundsatze über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden sind. Es kann deshalb nur eine tatsächliche Übung, die nach jenem


|
Seite 10 |




|
Zeitpunkte sich vollzogen hat, in Betracht kommen. Die Bildung eines Gewohnheitsrechtes für die Herrschaft über das Meer durch tatsächliche Ausübung von Hoheitsrechten war aber auch nach jenem Zeitpunkte nur insoweit möglich, als die Hoheitsrechte an Meeresteilen ausgeübt wurden, an denen eine rechtliche Herrschaft nach allgemeinen Rechtsbegriffen überhaupt ausgeübt werden konnte. Dies traf nicht zu für das rechtlich unfaßbare "offene Meer", sondern nur für die Meeresteile, welche als "Eigenmeere" oder "Küstenmeere" behandelt werden könnten. An dem "offenen" Meere kann ein Staat weder durch Okkupation noch durch sonstige Besitzakte Rechte erwerben 12 ). Selbst durch eine Vereinbarung mit anderen Staaten über das offene Meer kann ein Staat nur vertragsmäßige Rechte erwerben, nicht aber dingliche Rechte an dem Meere selbst 13 ).
Aus der Anwendung dieser allgemeinen, auch für die gewohnheitsrechtliche Rechtsbildung maßgebenden Rechtsgrundsätze auf den vorliegenden Fall ergibt sich, daß ein neuer Rechtszustand zugunsten Lübecks nur an dem Teile der Lübecker Bucht hätte entstehen können, welcher als "Eigen-" oder "Küstenmeer" der Hoheit eines Nachbarstaates unterlag, also an dem an sich zu Mecklenburg gehörenden Küstengewässer, wie es vorstehend unter III 2 a bestimmt worden ist. Dieses konnte aber im Wege gewohnheitsrechtlicher Rechtsbildung nicht dadurch Lübeck zufallen, daß Lübeck es als sein Herrschaftsgebiet tatsächlich behandelte. Außer der tatsächlichen Übung ist zum Entstehen eines Gewohnheitsrechtes noch erforderlich, daß die Übung opinione juris et necessitatis erfolgt ist, daß sie von der Rechtsüberzeugung getragen worden ist, in der Übung bereits geltendes Recht anzuwenden. Diese Überzeugung muß nicht nur auf lübischer, sondern auch auf mecklenburgischer Seite vorhanden gewesen sein, da sie ein die mecklenburgische Küste bespülendes und dem tatsächlichen Machtbereich Mecklenburgs unterstehendes Gewässer betrifft. Mag man nun auch unterstellen, daß diese Rechtsüberzeugung auf lübischer Seite bestanden hat, auf mecklenburgischer Seite ist sie jedenfalls nicht vorhanden gewesen.
Eine andere Frage ist, ob die einseitige tatsächliche Übung von lübischer Seite etwa als eine Übung bewertet werden kann, die unter dem Gesichtspunkte der Verjährung Lübeck die Staatshoheit über das streitige Gebiet verschaffen konnte. Hierauf wird unten unter V zurückzukommen sein.


|
Seite 11 |




|
b) Der Travefluß steht in seinem wichtigsten, schiffbaren Teile bis zum Ausfluß in das Meer unbestritten unter der Hoheit Lübecks und bildet einen Bestandteil des lübischen Staatsgebietes. Nach dem Völkerrechte steht dem Staate, welchem ein Fluß gehört, auch dessen Mündung, also der Meeresteil zu, in welchem sich Fluß und Meer vereinigen. Das unbestrittene Recht Lübecks an der Travemündung kann jedoch für die Begründung lübischer Ansprüche auf die Lübecker Bucht nicht verwertet werden. Denn als "Flußmündung" ist völkerrechtlich - wie vorstehend unter III 2 b γ bereits bemerkt worden ist - nur der Meeresteil anzusehen, der nach dem Meere zu durch die äußerste Linie zwischen den letzten beiden Uferpunkten des Flusses begrenzt wird. Das ist ein verhältnismäßig kleiner Meeresteil, der für den vorliegenden Streitfall überall nicht in Betracht kommt.
Auch aus der Fassung der für die Begründung der territorialen Ansprüche Lübecks mit Vorliebe verwerteten Verleihungsurkunde Kaiser Friedrichs I., der sog. Barbarossa-Urkunde von 1188, können Hoheitsrechte an der Lübecker Bucht als Ausflußgebiet des Traveflusses nicht abgeleitet werden. Denn will man auch den von der Urkunde gebrauchten Ausdruck: "usque im mare" nicht als gleichbedeutend mit "usque a d mare", d. h. "bis zu dem Meere", sondern vielmehr als "bis in das Meer hinein" verstehen, so kann eine unbefangene Auslegung darin doch nicht mehr finden als den Ausdruck des Gedankens, daß Lübeck "auch die Mündung" des Flusses habe zuerkannt werden sollen. Für die Annahme, daß auch außerhalb der Travemündung in der Lübecker Bucht, insbesondere soweit sie den in die Trave ein- und ausfahrenden Schiffen als Fahrwasser dient, Lübeck Hoheitsrechte haben verliehen werden sollen, hätte es eines bestimmteren Ausdruckes bedurft. Aber wenn es auch hieran nicht gefehlt hätte, wäre doch in der Verleihung eines so weitgehenden Rechtes an dem offenen Meere nur eine Bekundung der "weitgehenden mittelalterlichen Rechtsanschauung" über die Möglichkeit von besonderen Rechten an dem Meere zu finden, welche - wie bereits unter III 1 bemerkt worden - durch die spätere Entwicklung des Völkerrechtes ihren Rechtsbestand verloren hat.
c) Als ebensowenig stichhaltig erscheint der von Rörig a. a. O. unternommene Versuch, die Lübecker Bucht als "Reede" des Lübecker Hafens für Lübeck in Anspruch zu nehmen. Faßt man den Begriff "Reede" in weitestem Sinne auf, so kann darunter doch nur der vor einem Hafen liegende Meeresteil verstanden werden, auf welchem die Schiffe Anker werfen, wenn sie durch


|
Seite 12 |




|
ungünstige Wind- oder Flutverhältnisse oder durch andere Gründe bestimmt werden, nicht sofort in den Hafen einzulaufen. In der Regel bildet die Reede einen Teil des "Küstenmeeres" und unterliegt als solcher schon der Gebietshoheit des Hafenstaates. Nach der besonderen örtlichen Gestaltung kann eine "Reede" aber auch durch eine Einbuchtung der Küste oder eine der Küste vorgelagerte Insel oder Halbinsel gebildet werden. Steht in diesem Falle das die Reede einschließende und sie beherrschende Festland im Eigentum desselben Staates, so gehört die Reede auch diesem und steht unter seiner vollen Herrschaft. Eine solche örtliche Gestaltung haben die Schriftsteller im Auge, wenn sie als Beispiele für das "Eigenmeer" außer "Meerbusen, Baien, Buchten und Häfen" auch die "Reeden" aufführen 14 ).
Dagegen besteht kein völkerrechtlicher Rechtssatz, welcher einem als "Reede" zu bezeichnenden Meeresteile als solchem und ohne Rücksicht auf seine räumliche Beziehung zu dem Uferstaate den Charakter des "Eigenmeeres" zuerkennt.
Es bleibt somit nur die Erwägung übrig, ob sich Lübeck für seine Ansprüche an dem streitigen Meeresteile nicht auf ein durch Zeitablauf erworbenes Recht berufen kann.
In dieser Beziehung ist zu beachten, daß das Völkerrecht den Begriff der Verjährung im Sinne des Bürgerlichen Rechtes nicht kennt. "Auf dem Gebiete des Völkerrechtes" - bemerkt v. Lißt in Birkmeyers Encyklopädie § 11 Ziffer 2 - "muß der rechtsbegründende oder rechtsvernichtende Einfluß der Zeit in Abrede gestellt werden. Die Verjährung hat völkerrechtlich weder als acquisitive (insbesondere als Ersitzung) noch als extinktive die Kraft einer rechtserheblichen Tatsache", d. h. einer Tatsache, "an deren Vorliegen Untergang oder Veränderung von völkerrechtlichen Rechtsverhältnissen geknüpft ist."
Ebenso v. Martens a. a. O. § 90: "Im Unterschiede vom Privatrecht statuiert das Völkerrecht eine Wirkung der Verjährung nur in sehr beschränktem Umfange."
Aber andererseits fügt v. Martens hinzu: "Wirkliche Bedeutung hat im Bereiche des Internationalen nur der unvordenkliche Besitzstand (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit)."


|
Seite 13 |




|
Es wird deshalb zu prüfen sein,
ob Lübeck in der Lage ist, einen unvordenklichen Besitzstand an dem streitigen Meeresteile nachzuweisen.
Hierfür ist jedoch zu beachten, daß nur ein Besitzstand in Frage kommen kann, in welchem die Ausübung eines vom Völkerrechte anerkannten Rechtes am Meere in Erscheinung tritt. Lübeck hätte also Besitzakte nachzuweisen, welche sich als Ausübung der Staatshoheit am "Eigen-" oder "Küstenmeere" darstellen. Soweit der das lübische Gebiet bespülende Teil der Ostsee als Eigenmeer anzusehen ist, sind die lübischen Rechte unbestritten, im Streite befindlich ist nur die Frage nach dem Umfange des von Lübeck beanspruchten "Küstenmeeres", nämlich nach dem oben unter IV eingangs Bemerkten die Frage, ob Lübeck ein durch unvordenklichen Besitzstand erworbenes Hoheitsrecht auch an demjenigen Teile des mecklenburgischen Küstenmeeres bis zum Ausfluß der Harkenbeck geltend machen kann, der rechts von der vom Grenzpunkte am Priwall in die Ostsee zu ziehenden, von beiden Ufern gleich weit entfernten Linie liegt.
Der Übergang von Staatsgebiet von einem Staate auf einen anderen kann sich nach Völkerrecht nur mittelst derivativen Erwerbs, also durch Abtretung, vollziehen, mag diese freiwillig oder erzwungen (z. B. durch Krieg) sein. Okkupation von Staatsgebiet ist nur an herrenlosem Gebiete möglich 15 ). Wenn Lübeck sich für den Erwerb des bezeichneten Gebietes auf unvordenklichen Besitzstand beruft, so behauptet es, daß die unvordenkliche Ausübung seiner Hoheitsrechte auf diesem Gebiete in ihrer rechtlichen Wirkung der eines Rechtsgeschäftes, z. B. eines Vertrages, gleichkomme, durch das es dieses Gebiet von Mecklenburg hätte erwerben können.
Den Beweis eines solchen unvordenklichen Besitzstandes hat Lübeck zu führen. Bisher hat es ihn nicht: erbracht.
Es erscheint aber auch als sehr zweifelhaft, ob Lübeck die Führung eines solchen Beweises gelingen wird. Denn einmal müßte Lübeck beweisen,
daß es seit unvordenklicher Zeit die Staatshoheit an dem streitigen Gebiete ausschließlich, also ohne daß auch Mecklenburg in der fraglichen Zeit an ihm Hoheitsakte vorgenommen, ausgeübt hat, und es kann hierfür nur solche Besitzhandlungen geltend machen, die, wie die Aus-


|
Seite 14 |




|
Übung der Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt oder des obrigkeitlichen Strandschutzes publizistischen Charakters gewesen sind, im Gegensatze zu Okkupationshandlungen seiner Staatsangehörigen, die, wie der Fischfang im Küstenmeer oder die Schiffahrt, nur eine Ausübung des allgemeinen Gebrauches oder des freien Verkehrs darstellen, welchem das Küstenmeer jedes fremden Uferstaates unterliegt.
Auf der anderen Seite hat Mecklenburg seit Menschengedenken unbestritten Hoheitsrechte an dem streitigen Gewässer ausgeübt, z. B. durch die Landesherrliche Verordnung vom 10. Oktober 1874 "zum Schutze der Ufer und Dünen des Ostseestrandes" bei Rosenhagen, Brook und anderen Gütern (Rbl. 1874 Nr. 23). Denn die Feldmarken der genannten Güter Rosenhagen und Brook bilden seewärts gerade den Teil der mecklenburgischen Küste, welchen das streitige Gewässer bespült. Im § 1 der Verordnung wird ausdrücklich verboten, "aus der Ostsee bis 400 Meter in die See hinein ohne Erlaubnis der Ortsobrigkeiten Sand, Kies, Ton oder Lehm zu graben, Gras, Dünenkorn oder sonstigen Anwuchs abzuschneiden und Seetang oder Steine wegzunehmen". Die Verordnung bildet mithin eine unzweideutige Ausübung eines Staatsaktes nicht nur an dem Ufer, sondern auch an dem Meere.
Aus vorstehenden Ausführungen folgt:
Mecklenburg-Schwerin hat einen nach allgemeinem Völkerrecht wohlbegründeten Anspruch auf die Staatshoheit an dem streitigen Meeresteil. Sein Anspruch aus Zurückweisung der lübischen Ansprüche auf dieses Gebiet ist liguide. Für Mecklenburg ist actio nata. Mecklenburg kann diesen Anspruch ohne weiteres gegen Lübeck vor dem Staatsgerichtshof nach Maßgabe des Artikels 19 der Reichsverfassung erheben. In dem sich daraus entwickelnden Prozeßverfahren wird Lübeck den Erwerb des von ihm behaupteten Hoheitsrechtes zu beweisen haben.
Will Mecklenburg nicht selbst klagen, so kann es die Angelegenheit auch dadurch zum gerichtlichen Austrag bringen, daß es, ohne auf die Proteste Lübecks Rücksicht zu nehmen, seine Staatshoheit, etwa durch Maßnahmen der Polizeigewalt, an dem fraglichen Gebiete erneut betätigt und Lübeck es überläßt, dagegen bei dem Staatsgerichtshofe seine vermeintlichen Rechte im Klagewege geltend zu machen.
Schwerin, den 5. Februar 1925. (gez.) Langfeld.


|
[ Seite 15 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Über die Grenzen der Staatshoheit
in
der Travemünder Bucht.
Zweites Erachten
des
Staatsministers i. R. D. Dr. Langfeld - Schwerin.
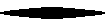


|
[ Seite 16 ] |




|


|
Seite 17 |




|
Das jüngste Erachten des Professors Rörig in Kiel: "Nochmals Mecklenburger Küstengewässer und Travemünder Bucht" veranlaßt mich in Ergänzung meines Gutachtens vom 5. Februar d. Js. - in folgendem als "Rechtsgutachten" zitiert - zu nachstehenden Bemerkungen:
Das Rechtsgutachten beschränkte sich darauf, die Frage:
ob an dem streitigen Meeresteile - dem die mecklenburgische Küste vom Grenzpunkte mit Lübeck am Priwall bis zur Harkenbeck bespülenden Gewässer - Lübeck oder Mecklenburg die Staatshoheit zukommt?
von allgemeinen rechtlichen Gesichtspunkten aus zu beantworten. Die Würdigung der tatsächlichen Vorgänge, in denen die Ausübung der Staatshoheit der beiden streitenden Teile in Erscheinung getreten ist, überließ das Rechtsgutachten dem von dem Geheimen und Hauptarchiv in Bearbeitung genommenen und inzwischen vollendeten Erachten, das in folgendem als "Archiverachten" zitiert werden soll.
"Rechtsgutachten" und "Archiverachten" widersprechen sich nicht, wie Rörig meint, sondern ergänzen sich.
Wie seinerzeit der Schiedsspruch des 4. Zivilsenats des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 indem Rechtsstreite zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin über die Grenze ihres Staatsgebiets an dem Dassower Binnensee, geht auch das "Rechtsgutachten" von der Ansicht aus, daß für die Entscheidung eines Streites zweier Staaten über die Grenze ihres Staatsgebietes in erster Linie die Normen des allgemeinen Völkerrechts grundleglich zu machen sind, und daß erst in zweiter Linie zu ermitteln ist, ob die völkerrechtliche Grenze etwa durch einen besonderen Rechtstitel, z. B. durch Verleihung seitens einer übergeordneten Staatsgewalt, wie in dem früheren Falle, durch Vertrag der beteiligten Staaten oder durch Ersitzung, geändert worden ist. Von diesem Standpunkte aus kommt das "Rechtsgutachten" zu dem Ergebnis: daß der streitige


|
Seite 18 |




|
Meeresteil als "Küstengewässer" im Sinne des Völkerrechts dem Uferstaate, also Mecklenburg, zuzusprechen ist, und daß die Grenze zwischen dem mecklenburgischen Hoheitsgebiete und dem lübischen Küstengewässer durch eine Linie gebildet wird, welche von der Ufergrenze am Priwall ab in gleicher Entfernung von den Ufern beider Staaten sich in das Meer erstreckt. Das "Rechtsgutachten" hat jedoch nicht übersehen, daß den beteiligten Staaten durch das Völkerrecht eine gewisse Freiheit zur anderweitigen Festsetzung dieser Grenze überlassen worden ist, insbesondere in der Form, daß durch Vereinbarung die Grenze des Küstengewässers zugunsten Lübecks nach der mecklenburgischen Seite hin verschoben werden konnte, vorausgesetzt, daß bei solcher Verschiebung das dadurch Lübeck zugefallene Gebiet noch immer vom festen lübischen Staatsgebiet aus sich beherrschen ließ, also kurz gesagt: bis zur völkerrechtlichen Dreimeilengrenze, gerechnet vom Lübecker Ufer ans. Nach den örtlichen Verhältnissen hätte - an diesem Maßstabe gemessen - durch die Verrückung der Grenze das ganze streitige Küstengewässer bis zur Harkenbeck Lübeck zugewiesen werden können. Eine vertragsmäßige Verrückung der Grenze kommt nicht in Frage. Was durch sie erreicht werden konnte, wäre jedoch auch durch langjährige Ausübung der lübischen Staatshoheit an dem fraglichen Meeresteile zu erreichen gewesen, mochte jener tatsächlichen Übung für ihre rechtsändernde Wirkung die Bedeutung eines zwischenstaatlichen Gewohnheitsrechts oder die eines unvordenklichen Besitzstandes zugekommen sein. Ob eine solche Rechtsänderung in der Tat eingetreten ist, darüber konnte sich das "Rechtsgutachten" nicht abschließend aussprechen, weil zur Zeit seiner Ausarbeitung das erst durch das "Archivgutachten" zusammenzustellende und tunlichst urkundlich zu erweisende tatsächliche, die Ausübung der Staatshoheit an dem Gewässer sowohl seitens Lübecks als seitens Mecklenburgs ergebende Material noch nicht vorlag.
Von der zu treffenden Würdigung dieses Materials wird die Entscheidung des vorliegenden Rechtsfalls abhängen.
Es wird auf Grund desselben der Staatsgerichtshof insbesondere die Fragen zu entscheiden haben:
Genügt das von Lübeck in bezug genommene Material, um den von Lübeck zu führenden Beweis des Erwerbs des Hoheitsrechts an dem streitigen Meeresteile indem Umfange, wie ihn Lübeck beansprucht, zu erbringen?


|
Seite 19 |




|
sowie eventuell:
Ist seitens Mecklenburgs der Gegenbeweis gegenüber dem klägerischen Beweise geführt, sei es direkt durch den Nachweis, daß die von Lübeck geltend gemachten Beweismittel nicht stichhaltig sind, sei es indirekt durch den Nachweis, daß nicht Lübeck, sondern Mecklenburg in der kritischen Zeit die Staatshoheit an dem strittigen Meeresteile ausgeübt hat?
Was Rörig auch in seinem jüngsten Erachten vorgebracht hat, reicht nicht aus, um eine andere Stellungnahme als die, welche sich aus dieser einfachen Rechtslage ergibt, zu rechtfertigen.
Rörig lehnt die Berücksichtigung des allgemeinen Völkerrechts für den vorliegenden Rechtsstreit schlechthin ab. Er will nur partikuläres Gewohnheitsrecht gelten lassen, das sich für das Verhältnis Mecklenburgs und Lübecks zu der Travemünder Bucht im Laufe einer über Jahrhunderte sich erstreckenden rechtsgeschichtlichen Entwicklung gebildet haben soll. Er macht aber außerdem für die Hoheitsrechte Lübecks an der streitigen Wasserfläche einen Erwerbsgrund geltend, der schon vor der Entstehung des heutigen Völkerrechts sich verwirklicht haben soll, - die Okkupation eines herrenlosen Gebietes.
Für diesen letzten Erwerbsgrund ist jedoch zu beachten, daß die Ostsee im Mittelalter wie heute noch ein herrenloses Gebiet gewesen ist aus dem Grunde, weil schon nach ihrer natürlichen Beschaffenheit ihre rechtliche Beherrschung unmöglich gewesen ist. Tatsächlich beherrschbar waren nur die Wasserflächen, auf welche von dem festen Lande aus eingewirkt werden konnte, nämlich das Küstengewässer. Daß auch dieses im Mittelalter eine durch Okkupation beherrschbare res nullius gewesen ist, das muß Lübeck doch erst beweisen. Bisher hat es diesen Beweis nicht erbracht. Das Gegenteil, daß das Küstengewässer der Okkupation nicht mehr offen stand, ergibt sich vielmehr aus den eingehenden Ausführungen des "Archiverachtens" über die von den Territorialherren und - auf Grund deren Verleihung - von einzelnen Städten an dem Strande ausgeübten, aus dem Hoheitsrechte fließenden Befugnisse. Zum "Strande" gehörten aber außer dem festen Ufer auch die von der Flut überströmten Flächen des Strandes.


|
Seite 20 |




|
Was nun weiter die Ablehnung der Anwendung des allgemeinen Völkerrechts auf den vorliegenden Fall betrifft, so wäre Rörig zuzustimmen, wenn man seiner eigenartigen Auffassung beipflichten müßte, daß die Anwendung des Völkerrechts nichts anderes sei als ein "Analogieschluß", und daß das allgemeine Völkerrecht nur eine Zusammenfassung der übereinstimmenden partikularrechtlichen Normen für das zwischenstaatliche Verhältnis der Völker bilde. Ein Analogieschluß wäre die Anwendung des Völkerrechts, wenn es keine unmittelbare Geltung beanspruchen könnte. Seine Anwendung wäre alsdann nicht anders zu beurteilen als der Fall, daß ein deutscher Richter einen ihm vorliegenden Rechtsstreit nach den für diesen maßgebenden Bestimmungen des englischen oder französischen Rechtes entscheidet. Und wäre das Völkerrecht nur eine Kompilation der übereinstimmenden zwischenstaatlichen Rechtsnormen der einzelnen Staaten, so müßte der Richter vor seiner Anwendung immer erst feststellen, daß es auch in dem Lande, dessen Recht der abzuurteilende Fall unterliegt, maßgebend ist. Schon diese Konsequenzen rechtfertigen das Bedenken an der Richtigkeit der Ansicht Rörigs über Wesen und Bedeutung des Völkerrechts. Rörigs Ansicht ist aber überhaupt rechtsirrtümlich. Sie wird dem wirklichen Charakter des Völkerrechts nicht gerecht. Wenn Rörig unter Berufung auf Triepel von dem Satze ausgeht: "Es gibt, wenn man so sagen darf nur partikuläres Völkerrecht, nur Sätze, die für zwei, drei, viele, niemals aber für alle Staaten gelten, und ein allgemeines Recht läßt sich aus diesen Einzelrechten nur im Wege der Vergleichung und Zusammenstellung der in mehreren oder vielen Staaten gleichmäßig, kraft besonderer Rechtsquelle geltenden Rechtssätze gewinnen", - so muß zugegeben werden, daß viele Normen des allgemeinen Völkerrechts auf Grund partikulärer Rechtsentwicklung, insbesondere zwischenstaatlicher Verträge, allgemeine Anerkennung erlangt haben. Daraus folgt aber noch nicht, daß alles Völkerrecht nur partikuläres Recht ist. Die Mehrheit der Völkerrechtslehrer lehnt jedenfalls diese Auffassung ab. Auch das allgemeine Völkerrecht ist eine Rechtsnorm, die aus einer alle Kulturstaaten bindenden Rechtsquelle fließt. Es ist nichts anderes als die Rechtsordnung für die Gemeinschaft, zu der im Laufe der Zeit alle Kulturstaaten sich zusammengeschlossen haben, teils auf Grund gemeinsamen Rechtsempfindens, teils auf Grund praktischer Erwägungen. Das allgemeine Völkerrecht regelt nur die Verhältnisse der einzelnen Staaten zueinander und zu der Gesamtheit. Es ist aber ein


|
Seite 21 |




|
gemeines Recht, nicht ein allgemeines, aus der Übereinstimmung der Rechtsordnung der Einzelstaaten sich ergebendes Recht. Es bindet die einzelnen Staaten, weil sie der Gemeinschaft, für die es sich entwickelt hat, angehören. Für die Anwendung eines völkerrechtlichen Rechtssatzes auf die zwischenstaatlichen Verhältnisse eines deutschen Staates genügt deshalb auch die Tatsache, daß der Satz dem allgemeinen Völkerrecht angehört, es bedarf nicht noch des Nachweises, daß der betreffende Satz in dem Staate als partikuläres Recht gilt. Das Völkerrecht bildet gewissermaßen das Grundgesetz der Völkergemeinschaft. Als solches enthält es wirkliche und zwingende Rechtsnormen, nicht nur theoretische Lehrsätze 1 ). Für das Deutsche Reich wenigstens ist in dieser Hinsicht jeder Zweifel beseitigt durch die Bestimmung des Art. 4 der Reichsverfassung: "Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts."
Aus diesem gemeinrechtlichen Charakter des Völkerrechts ergibt sich dann aber auch, daß es partikulären Vorschriften vorgehen muß, soweit es nicht selbst einer abweichenden partikulären Normierung Raum läßt. Wie weit dieser zwingende Charakter reicht, das mag für den einzelnen Rechtsfall nicht immer ganz leicht festzustellen sein. Im allgemeinen wird man doch sagen können, daß einer Rechtsnorm, welche nur den natürlichen Verhältnissen entspricht, oder an deren einheitlicher und sicherer Anwendung alle Kulturnationen gemeinsam interessiert sind, ein zwingender Charakter zuzuerkennen ist. Insofern läßt sich auch für das Verhältnis des partikulären Gewohnheitsrechts zu dem allgemeinen Völkerrecht der Gedanke verwerten, dem die bekannte Entscheidung Konstantins Ausdruck gegeben hat, welche in der Lehre des Pandektenrechts 2 ) so verschieden beurteilt worden ist: c. 2 C. quae sit longa consuetudo 8, 53:
Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est, sed non usque adeo sui valitura momento, ut rationem vincat aut legem.
Angewandt auf den vorliegenden Fall, dürfte hiernach eine zwingende Wirkung zuzugestehen sein:


|
Seite 22 |




|
aus rationellen Erwägungen dem Satze, daß an nicht begrenzten Meeresteilen eine Herrschaft unmöglich, an begrenzten nur soweit möglich ist, als sie vom Ufer aus ausgeübt werden kann;
aus dem allgemeinen Interesse an einer einheitlichen und sicheren Feststellung der Staatsgrenzen dem Satze über die Dreimeilengrenze.
Soweit völkerrechtlichen Rechtsnormen ein zwingender Charakter zukommt, mußte sich für den einzelnen Staat, der sich ihm unterwarf, aus diesem Charakter auch die Folge ergeben, daß das bisherige, mit dem betreffenden Rechtssatz in Widerspruch stehende einzelstaatliche Recht mit der Unterwerfung des Staates unter das Völkerrecht außer Kraft trat. Dies ist der Sinn der von Rörig bemängelten Bemerkung des "Rechtsgutachtens", daß "Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheitsrechte aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts - der Geburtsstunde des Völkerrechts - unbeachtet bleiben müssen, weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden sind".
Rörig glaubt die ausschließliche Berechtigung Lübecks an der Travemünder Bucht schon durch das überwiegende Interesse Lübecks an diesem Meeresteile rechtfertigen zu können. Er bemerkt: "Das ganze Travegebiet, soweit es schiffbar war, von Oldesloe bis einschließlich der Travemünder Reede, stellt einen Sonderfall dar, der zu verstehen ist aus der überragenden Stellung, die Lübeck in seiner wirtschaftlichen Nutzung und im Zusammenhange damit in seiner rechtlichen Beherrschung einnahm." Dem muß widersprochen werden. Gewiß ist Lübeck an der Travemünder Bucht weit mehr interessiert als einer der übrigen Uferstaaten. Aber das überwiegende Interesse eines von mehreren Teilnehmern an einer gemeinschaftlichen Sache ist kein Rechtsgrund, aus dem ihm die ganze Sache zugesprochen und über das entgegenstehende Recht der übrigen Teilhaber hinweggegangen werden kann. Es wäre dies ein flagranter Verstoß gegen den Grundsatz: "Justitia est constans et perpetua voluntas, jus suum cuique tribuendi" (l. 1 J. de justitia et jure I, 1). Das vorwiegende Interesse Lübecks an der Bucht kann nur als Motiv für eine vertragsmäßige oder gewohnheitsrechtliche Regelung der Hoheitsverhältnisse im lübischen Sinne dienen. Die Tatsachen, aus denen sich diese Regelung ergibt, müssen aber erwiesen werden. Dieser


|
Seite 23 |




|
Beweis kann weder ersetzt werden durch die Behauptung, daß das Fahrwasser in der Bucht, in welches die Trave ausläuft, als ein Teil des ganzen, in Lübecks Eigentum stehenden Travestroms anzusehen sei, noch durch die Behauptung, daß Lübeck die "Reede" von Travemünde gehöre und daß ihm deshalb die gesamte Wasserfläche zuzusprechen sei, welche nach den örtlichen Verhältnissen der Reede zugerechnet werden müssen, also insbesondere auch, wie Lübeck geltend macht, bis zu dem festen mecklenburgischen Ufer von Priwall bis zur Harkenbeck.
Flüsse sind rechtlich anders zu behandeln als Meeresteile. An dem fließenden Wasserstrom eines Flusses ist, da er durch die Ufer eingefaßt wird, eine rechtliche Herrschaft an sich möglich, auch wenn dem Staat, der sie in Anspruch nimmt, die Ufer des Flusses nicht gehören. Anders dagegen verhält es sich bei dem offenen Meere. Der Auslauf eines Flusses aus der Mündung in das Meer bildet aber, auch soweit in ihm die Strömung des Flusses noch festgestellt werden kann, einen Teil des Meeres - sei es Eigenmeer, sei es Küstengewässer - und untersteht deshalb den für solche Meeresteile maßgebenden Grundsätzen. Im vorliegenden Falle kommt indessen auf die Entscheidung dieser Kontroverse nichts an, weil das Fahrwasser der sog. Außentrave außerhalb des mecklenburgischen Küstengewässers liegt.
Anlangend dagegen die "Reede", so ist bereits in dem Rechtsgutachten ausgeführt worden, daß ein selbständiger Rechtsbegriff der "Reede" nicht anzuerkennen ist. Es ist unter "Reede" nichts anderes zu verstehen als die Bezeichnung eines Meeresteiles, der bestimmten Zwecken, nämlich der Bestimmung, als Ankerplatz der Schiffe benutzt zu werden, dient, der aber nach seinem Verhältnis zur Küste als Eigenmeer oder Küstengewässer anzusehen ist. Wenn also Lübeck auch das unmittelbar die mecklenburgische Küste bis zur Harkensee bespülende Gewässer als einen Teil der Reede in Anspruch nimmt, so muß es beweisen, daß es auch an diesem, nach allgemeinem Völkerrechte zum mecklenburgischen Küstengewässer gehörigen Meeresteile wirkliche Hoheitsrechte tatsächlich ausgeübt und damit gewohnheitsrechtlich oder durch unvordenkliche Verwährung die Staatshoheit erworben hat.
Es verbleibt somit bei der oben unter II am Ende festgestellten Rechtslage. Der Staatsgerichtshof hat die Aufgabe, auf


|
Seite 24 |




|
Grund des von den Parteien beigebrachten umfänglichen und nicht leicht zu behandelnden Tatsachen- und Beweismaterials die Frage zu entscheiden,
ob Lübeck der Beweis der durch Gewohnheitsrecht oder unvordenklichen Besitz erlangten Staatshoheit an der streitigen Wasserfläche in vollem oder in beschränktem Umfange gelungen ist.
Der Altmeister des deutschen Handelsrechts, welcher vorübergehend auch eine Zierde unserer Landesuniversität gewesen ist, Heinrich Thöl, macht im Vorworte zur ersten Auflage seines "Handelsrechts" über die Judikatur des früheren hanseatischen Oberappellationsgerichts in Lübeck die Bemerkung: aus den Entscheidungen dieses Gerichts habe ihn ein Geist angeweht, "kräftig und frisch wie reine Seeluft". Möchte es dem Staatsgerichtshof gelingen, durch seine Entscheidung in einer lübischen Sache dieses gesunde Rechtsempfinden neu zu beleben. Mehr noch wäre es jedoch zu begrüßen, wenn die Parteien noch vor der Entscheidung im Wege der Verständigung über eine klare, sichere und den Interessen beider Staaten entsprechende Regelung ihrer Seegrenzen den Streitfall erledigen sollten.
Schwerin, den 15. August 1925.
(gez.) Langfeld.
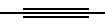


|
[ Seite 25 ] |




|



|


|
|
:
|
III.
Die Hoheits-
und Fischereirechte
in der Travemünder Bucht.
Rechtsgutachten
des
Universitätsprofessors Dr. Julius v. Gierke=Göttingen.
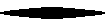


|
[ Seite 26 ] |




|


|
[ Seite 27 ] |




|
Inhalt.
| Einleitung | 29-30 | ||
| A. | Grundlagen für die Entscheidung im allgemeinen | 31-40 | |
| I. | Die von Lübeck in Anspruch genommenen Gewässer | 31 | |
| II. | Die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung | 31-40 | |
| B. | Allgemeine Prüfung der etwaigen besonderen Grundlagen bei dem vorliegenden Streitfall | 41-45 | |
| C. | Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem "streitigen Küstengewässer" | 46-111 | |
| I. | Die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor Ausbildung des modernen Völkrerrechts im Allgemeinen - Allgemeine Folgerungen für das streitige Küstengewässer | 46-66 | |
| II. | Die Abgrenzung des gesamten, von Lübeck in Anspruch genommenen Küstengewässers | 67-74 | |
| III. | Lübecker Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer? | 74-102 | |
| IV. | Mecklenburger Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer | 102-110 | |
| V. | Gewohnheitsrecht und Unvordenklichkeit | 110-111 | |
| D. | Entscheidung | 112 | |


|
[ Seite 28 ] |




|


|
[ Seite 29 ] |




|
Einleitung
I.
Der vorliegende Rechtsstreit zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin ist bei dem Staatsgerichtshof für das deutsche Reich anhängig. Lübeck hat beantragt, festzustellen, daß
- dem lübeckischen Staate auf dem bezeichneten Gewässerteil die Gebietshoheit zusteht, daß darüber hinaus
- dieser Gewässerteil lübeckisches Eigengewässer (in dem Sinne von öffentlichen Binnengewässern) ist,
- daß dem lübeckischen Staat auf diesem Gewässer das ausschließliche Fischereirecht zusteht,
- daß die Regierung des Landes Mecklenburg keinerlei Rechte an diesem Gewässer zu beanspruchen hat.
Es ist vorweg zu bemerken, daß für den Antrag unter 3 dem Staatsgerichtshof die volle Zuständigkeit fehlt, und daß der Antrag 4 in dieser Hinsicht nicht einwandfrei gefaßt ist. Nach Art. 19 der Reichsverfassung vom 11. August 1919 entscheidet der Staatsgerichtshof "über Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Art zwischen verschiedenen Ländern". Infolgedessen kann er nicht eine Entscheidung dahin treffen, daß dem lübeckischen Staat auf den Gewässern das "ausschließliche Fischereirecht" zusteht, denkbar ist nur eine Entscheidung über die Fischereihoheit. Entsprechend kann bei dem Antrage unter 4 nicht einfach von "Rechten", sondern nur von Hoheitsrechten die Rede sein.
In dem folgenden Gutachten werde ich mich daher nur mit den nicht privatrechtlichen Ansprüchen, d. h. mit den Hoheitsrechten in bezug auf die Travemünder Bucht beschäftigen.
II.
Die Gutachten anderer Sachverständiger, welche von mir bei meinem Gutachten benutzt worden sind, sind folgende - wobei ich gleich die Abkürzungen, die ich im folgenden benutzen werde, einfüge:
- Das erste Gutachten des Professors Dr. Rörig, Kiel: "Hoheits- und Fischereirechte in der Lübecker Bucht, insbesondere auf der Travemünder Reede und in der Niendorfer Wiek", Lübeck 1923 = Rörig I.


|
Seite 30 |




|
- Das zweite Gutachten des Professors Dr. Rörig, Kiel:"Mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede". Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und Altertumskunde Bd. XXII Heft 2. Lübeck 1924 (von mir nach den Seiten des Zeitschriftenbandes zitiert) = Rörig II.
- Das erste Gegengutachten des Geheimen und Hauptarchivs zu Schwerin vom 31. August 1923 nebst Nachtrag vom 12. Oktober 1923 = Archiv I.
- Das Rechtsgutachten des Staatsministers Dr. Langfeld vom 5. Februar 1925 = Langfeld I *).
Nachdem ich längere Zeit mit der Ausarbeitung meines Gutachtens beschäftigt war, sind mir noch folgende Gutachten zugegangen:
- Ein zweites Gutachten des Geheimen und Hauptarchivs: "Das vormalige Küstengewässer (Strand) und die Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht" = Archiv II *).
- Eine gutachtliche Gegenäußerung zu zwei Mecklenburger Gutachten von Prof. Dr. Rörig, Kiel = Rörig III.
- Ein zweites Gutachten des Staatsministers Dr. Langfeld vom 15. August 1925 = Langfeld II 1 )*).
*) Anm. des Hrsg.: Es sind gedruckt das Gutachten Langfeld I oben S. 1-14, das Gutachten Langfeld II oben S. 15-24, das Gutachten Archiv II im Jahrbuch 89, S. 1-228. Auf diese Drucke beziehen sich die betreffenden Seitenzahlen in den Noten.


|
Seite 31 |




|
A.
Grundlagen für die Entscheidung im allgemeinen.
I.
Die von Lübeck in Anspruch genommenen Gewässer.
Das von Lübeck in Anspruch genommene Gewässer ist ein Teil der Lübecker Bucht. Letztere ist eine Ausbuchtung der Ostsee als deren Uferstaaten Mecklenburg-Schwerin, Lübeck, Oldenburg und Preußen in Betracht kommen. Die Ufergrenze der Lübecker Bucht, an welcher die Länder Mecklenburg und Lübeck zusammenstoßen, befindet sich am Priwall, einer zu Lübeck gehörigen Landzunge, die von der Ostsee und dem Travefluß gebildet wird. Der Teil der Lübecker Bucht, den Lübeck in Anspruch nimmt, ist ein der Travemündung vorgelagerter Ausschnitt, dessen Grenzen folgende sein sollen: im Westen und Süden die lübeckische und mecklenburgische Küste bis zur Mündung der Harkenbeck, im Osten eine von der Harkenbeck auf die Pohnstorfer Mühle und den Turm auf dem Gömnitzer Berg in Holstein gezogene Linie, im Norden eine von dieser Linie senkrecht auf den Brodtener Pfahl (Grenze zwischen Lübeck und Oldenburg) gezogene Linie. Lübeck bezeichnet diesen Ausschnitt als "Travemünder Reede im weiteren Sinne".
Hiernach ist festzustellen, daß Lübeck für einen Teil des Meeres, der die deutsche Küste bespült, die Gebietshoheit in Anspruch nimmt, und daß dieser Meeresteil zu einem großen Teil unmittelbar der Mecklenburger Küste vorgelagert ist, nämlich an der Strecke Priwall-Harkenbeck.
II.
Die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung.
M. E. sind bislang die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung in den vorliegenden Gutachten noch nicht mit der erforderlichen Vollständigkeit herausgestellt worden. Durchaus ab-


|
Seite 32 |




|
zulehnen ist die Art, wie Rörig in seinen beiden ersten Gutachten an die Lösung der Frage herantritt, wenigstens greift er in der allgemeinen Formulierung der rechtlichen Grundlagen völlig fehl. Diese Formulierung geht aber dahin: "Über die Rechtsverhältnisse der Lübecker Bucht entscheidet nicht Völkerrecht, sondern örtliches, zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht" 2 ). "An der Tatsache, daß für die schwebenden Fragen wirklich zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht zu gelten hat, darüber kann es keinen Zweifel mehr geben" 3 ). Wie unrichtig und verwirrend es ist, solche Sätze als Ausgangspunkt der Betrachtung aufzustellen, dürften folgende Erwägungen ergeben. Zunächst ist das, was Rörig "zwischenstaatliches Gewohnheitsrecht" nennt, gleichfalls "Völkerrecht", es ist das sog. partikuläre Völkerrecht. Es ist ferner durchaus unzulässig, sich bei einem Rechtsgutachten in der Weise von vornherein festzulegen, daß hier ein örtliches Gewohnheitsrecht gelten muß 4 ). Wie ist es denn, wenn es nicht gelingt, ein solches Gewohnheitsrecht nachzuweisen? Es bedarf doch erst einer Untersuchung, ob sich wirklich ein örtliches Gewohnheitsrecht entwickelt hat, und dabei wären die Voraussetzungen des Gewohnheitsrechtes nachzuprüfen. Schließlich ist hier gar nicht berücksichtigt, daß doch auch andere Momente eine Abweichung vom allgemeinen Völkerrecht herbeiführen können, wie eine besondere vertragliche Grundlage oder eine einseitige Einräumung von Rechten (Privilegien) oder eine Rechtsgewinnung kraft Un-


|
Seite 33 |




|
verdenklichkeit 5 ) Dagegen wird in dem ersten Gutachten Langfelds richtig gekennzeichnet, daß an sich die allgemeinen völkerrechtlichen Normen gelten, und die etwaigen besonderen Grundlagen von Lübeck zu beweisen seien. Allein es wird in diesem Gutachten dem nicht richtig Rechnung getragen, daß wir bei der völkerrechtlichen Beurteilung der Küstengewässer zunächst von der Stellung des Deutschen Reiches auszugehen und erst dann auf die Rechtsbeziehungen der Länder überzugehen haben. Und es ist mißverständlich, wenn es daselbst heißt, daß etwaige Ausübungsakte der von Lübeck beanspruchten Hoheit aus der Zeit vor dem Ende des 17. Jahrhunderts unbeachtet bleiben müßten, "weil sie durch die zum Durchbruch gekommene, auf dem allgemeinen Grundsatze über die Freiheit der Meere beruhende neue Rechtsentwicklung erledigt worden seien" 6 ). Vielmehr muß auch alles vor dem Ende des 17. Jahrhunderts liegende bewertet werden, insoweit es sich in der späteren Zeit fortsetzen konnte und fortgesetzt hat, ohne zwingenden völkerrechtlichen Grundsätzen zu widersprechen. Daß seine Ausführungen auch nur in diesem Sinne zu verstehen sind, hat Langfeld in seinem zweiten Gutachten klargestellt 7 ).
Nach meiner Ansicht wird man in bezug auf die rechtlichen Grundlagen für die Entscheidung am besten zu trennen haben: die allgemeinen Grundlagen einerseits und die etwa möglichen besonderen Grundlagen andererseits.
Es handelt sich bei der Lübecker Bucht, insbesondere bei der angeblichen Travemünder Reede, um einen Teil des Meeres, welcher die Küsten des Deutschen Reiches und die Küsten mehrerer deutscher Länder bespült. Entsprechend dem bundesstaatlichen


|
Seite 34 |




|
Charakter des Deutschen Reiches ist daher in bezug auf die Hoheitsrechte über diese Fläche zwischen dem Deutschen Reich und den einzelnen Ländern - wir begnügen uns mit Lübeck und Mecklenburg - zu unterscheiden 8 ).
Die Hoheitsrechte des Deutschen Reiches über die es bespülenden Meeresteile bestimmen sich nach den Regeln des Völkerrechts, wobei zu beachten ist, daß das Reichsgebiet sich zwar aus den Gebieten der deutschen Länder zusammensetzt, aber dem Ausland gegenüber als ein einheitliches Gebiet bewertet werden muß (Art. 4 und Art. 2 der neuen RV.). Nach modernem Völkerrecht sind aber in bezug auf die einen staatbespülenden Meere zu unterscheiden die Eigengewässer (die nationalen Gewässer im engeren Sinn), die Küstengewässer (la mer territoriale) und das offene Meer. Der Unterschied beruht darauf, daß die Eigengewässer zum Staatsgebiet gehören, die Küstengewässer nicht zum Staatsgebiet gehören, aber einer beschränkten Gebietshoheit unterworfen sind, das offene Meer schließlich auch von einer solchen beschränkten Gebietshoheit frei ist. Die Grenzziehung zwischen diesen drei Gruppen ist streitig. Was die Küstengewässer 9 ) anlangt, so ist bekannt, daß in der neueren Gesetzgebung Deutschlands und anderer Staaten sowie in verschiedenen neueren Verträgen die Entfernung vielfach auf drei Seemeilen bestimmt wird, diese aber vom niedrigsten Wasserstande der Tiefebbe gerechnet. Dies ist insbesondere auch in dem von den Nordseestaaten geschlossenen Vertrage betreffend die polizeiliche Regelung der Fischerei in der Nordsee vom 6 Mai 1882 geschehen. Allein diese Berechnungsweise ist keineswegs allgemein anerkannt, und gerade im 20. Jahrhundert ist die Grenze vielfach sehr viel weiter, insbesondere durch einseitige Staaten präzis hinausgeschoben worden 10 ). Im Anschluß an die historische Entwicklung müßte die Grenze soweit herausgerückt werden, als


|
Seite 35 |




|
der Uferstaat seine tatsächliche Herrschaft auszuüben und seine Interessen zu sichern vermag 11 ). Was die Eigengewässer anlangt. So braucht hier nur auf ihre Abgrenzung von den Küstengewässern eingegangen zu werden, wie sie sich bei den Baien und Buchten darstellt. Baien und Buchten sind in ihrem inneren, von den Ufern aus noch vollständig beherrschten Teile Eigengewässer des Uferstaates, hieran schließen sich die Küstengewässer, an sie die offene See. Die Abgrenzung dieses inneren Teiles pflegt man so vorzunehmen, daß man sich von Küste zu Küste eine gerade Linie in solcher Breite der Bucht gezogen denkt, daß der Mittelpunkt der Linie durch die auf beiden Seiten errichteten Strandbatterien noch erreicht wird 12 ). In der Staatenpraxis (Deutschland, Frankreich) hat man z. T. die Breite auf 10 Seemeilen festgelegt, weitergehende Ansprüche Englands sind nicht anerkannt worden.
Wenden wir diese Ergebnisse auf das Verhältnis des Deutschen Reiches zu der Lübecker Bucht an, so müssen wir folgendes feststellen:
Die Lübecker Bucht ist, jedenfalls zu ihrem größten Teil, insbesondere aber auch in dem hier interessierenden Teil, nach allgemeinem Völkerrecht ein Eigenmeer des Deutschen Reiches. Unzweifelhaft nämlich kann der Anfang der ganzen Bucht von der Landseite an gerechnet auf weite Strecken hinaus in seiner Breite von den beiden Uferbuchtseiten aus vom Deutschen Reich durch Strandbatterien beherrscht werden, ist übrigens auch nicht breiter als 10 Seemeilen.
Es kann keinem Zweifel unterliegen und es ist ein seit langer Zeit anerkannter Grundsatz, daß über die Grenzverhältnisse der deutschen Gliedstaaten an Grenzgewässern die Grundsätze des Völkerrechts gelten. Treffend sagt das Reichsgericht in seinem Schiedsspruch zwischen Lübeck und Mecklenburg vom 21. Juni 1890:


|
Seite 36 |




|
"Die Anwendbarkeit dieser Grundsätze auch auf das Verhältnis der Gliedstaaten des Deutschen Bundes beziehungsweise Reiches untereinander unterliegt keinem begründeten Bedenken. Denn schon im alten Deutschen Reiche trennten sich seit Ausbildung der Landeshoheit die einzelnen Glieder von einander als verschiedene, wenn auch in mancher Hinsicht unselbständige Staatspersönlichkeiten mit besonderen Gebieten, und diese Eigenschaft haben sie niemals wieder eingebüßt, vielmehr ist ihre Selbständigkeit zeitweise - während des Bestehens des Deutschen Bundes - eine wesentlich erhöhte gewesen und zum Teil bis jetzt geblieben.. . . Es würde an jeder Regel für die Abgrenzung dieser Gebiete fehlen, wenn man nicht die vorstehenden Grundsätze auch auf sie für anwendbar erachten wollte. Dieser Anwendung stehen weder äußere noch innere Gründe entgegen."
Bei dem Schiedsspruch des Reichsgerichts vom 21. Juni 1890 handelte es sich um Binnengewässer. Es ist aber selbstverständlich, daß genau dasselbe auch für Meeresgrenzgewässer zu gelten hat. Und ebenso unzweifelhaft ist es, daß an alledem durch die neue Reichsverfassung vom 11. August 1919 nichts geändert ist. Zwar ist die Selbständigkeit der "Länder" gegenüber früher zugunsten des Reiches beschränkt worden, aber immer noch sind die Länder Gliedstaaten mit eigener Gebietshoheit (vgl. Art. 2 der RV.).
Somit entscheiden über die Abgrenzung der Hoheitsrechte der an der Lübecker Bucht gelegenen Länder über die Lübecker Bucht ebenfalls zunächst die allgemeinen Regeln des Völkerrechts, insbesondere ist die Abgrenzung zwischen Lübeck und Mecklenburg-Schwerin hiernach vorzunehmen. Hier erhebt sich aber die Frage, ob für die Abgrenzung die völkerrechtlichen Regeln für Eigengewässer, die von mehreren Staaten umgeben sind, zur Anwendung kommen, oder ob wir die Normen für die Abgrenzung von Küstengewässern zur Geltung zu abringen haben. Wir sahen nämlich, daß jedenfalls ein großer Teil der Lübecker Bucht als Eigengewässer des Deutschen Reiches in Betracht kommt, und es liegt nun der Gedanke nahe, daß es auch als Eigengewässer für die anliegenden Uferstaaten zu verteilen sei. Man könnte daran denken, daß insoweit die Rechtsverhältnisse am Bodensee, bei welchem von der herrschenden Lehre eine geteilte Herrschaft der Uferstaaten angenommen wird 13 ), entsprechend zur


|
Seite 37 |




|
Anwendung zu bringen seien. Allein diese Analogie muß deshalb abgelehnt .werden, weil es sich bei der Lübecker Bucht nicht um ein vom Meer abgeschlossenes Gewässer handelt, und jeder einem einzelnen Staat zugeteilte Teil für sich allein betrachtet sich nicht als ein von diesem Staat für sich beherrschbares "Bucht"-Gewässer darstellen würde. Man muß daher bei der örtlichen Abgrenzung der Hoheitsrechte unter den der Lübecker Bucht anliegenden deutschen Ländern nicht von einer Betonung ihres Charakters als Gliedstaaten ausgehen, sondern gerade umgekehrt sie als Staaten werten, und eine Abgrenzung unter ihnen nach den Regeln für solche Meeresgewässer vornehmen, welche für sie vom Standpunkt ihrer Selbständigkeit aus allein in Betracht kommen können - das aber sind die Regeln über Küstengewässer 14 ).
Nach anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen werden Küstengewässer unter mehreren, an ihnen nebeneinanderliegenden Staaten derart abgegrenzt, daß an der Ufergrenze der beiden Staaten eine Linie in die See in der Weise gezogen wird, daß jeder Punkt dieser Linie von dem Ufer der beiden Staaten gleich weit entfernt ist 15 ). Es kann also kein Uferstaat eine Hoheit über einen Meeresteil in Anspruch nehmen, welcher dem anderen Uferstaat in der angegebenen Grenze vorgelagert ist. Diese völkerrechtlichen Grundsätze ergeben sich aus der Natur der Sache. Denn das Küstengewässer dient als Schutzstreifen für den Uferstaat, und jede fremde Vorlagerung in dem Rahmen dieses Schutzstreifens greift auf das empfindlichste in die Sicherheit des Uferstaates ein. Hieran kann grundsätzlich auch nichts ändern, wenn die Uferstaaten als Gliedstaaten eines zusammengesetzten Staates in Betracht kommen, denn eine unbedingte Garantie ist nicht dafür gegeben, daß der Gesamtstaat nicht vorübergehend oder dauernd zusammenbricht.
Wenden wir die so gefundenen allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätze auf das Verhältnis von Lübeck und Mecklenburg-Schwerin hinsichtlich der Lübecker Bucht und auf das von Lübeck in Anspruch genommene Gewässer an, so ergibt sich folgendes:


|
Seite 38 |




|
Nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen ist der Anspruch Lübecks auf ein Hoheitsrecht insoweit völlig unbegründet, als er den der mecklenburgischen Küste vorgelagerten Meeresteil (Priwall-Harkenbeck) - jenseits einer an der Grenze der beiden Staaten am Ufer in die See hinein gezogenen, von den Ufern beider Staaten gleich weit entfernten Linie - umfaßt 16 ).
Die allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätze sind nicht unbedingt maßgebend, vielmehr können sie, insoweit sie nicht zwingender Natur sind, im einzelnen Falle beiseite geschoben sein. Nun sind die Abgrenzungen der Hoheitsrechte über Küstengewässer unter benachbarten Staaten der richtigen Ansicht nach nicht zwingender Natur; es handelt sich nicht um "unveräußerliche" Rechte eines Staates, die nicht in den Besitz eines anderen Staates kommen könnten. Denn nach herrschender Lehre kann die Gebietshoheit, wie die Staatsgewalt überhaupt, durch die zugunsten anderer Staaten übernommenen oder auferlegten dauernden Verpflichtungen beschränkt sein 17 ). Infolgedessen kann auch die "beschränkte Gebietshoheit", wie sie am Küstengewässer besteht 18 ),zugunsten eines benachbarten Uferstaates eingeengt sein. Diese Einengung aber wäre an sich auf verschiedener Grundlage möglich. Denkbar wäre:
α) Eine Einschränkung kraft partikulären Gewohnheitsrechts. Es müßte also nachgewiesen werden, daß eine erweiterte Hoheit von einem Staat andauernd ausgeübt worden ist, und zwar in der Weise, daß bei allen Beteiligten


|
Seite 39 |




|
die Überzeugung vorhanden war, daß hiermit geltendes Recht verwirklicht werde 19 ).
β) Eine Einschränkung kraft besonderen Rechtstitels. Als solcher könnte ein besonderer Vertrag zwischen den Uferstaaten in Betracht kommen, oder eine mehr einseitige Verleihung (Privileg) eines hierzu Legitimierten. Denkbar wäre auch ein Erwerb kraft Okkupation zu einer Zeit, wo die Gebietshoheit am Küstenmeer noch nicht anerkannt war 20 ).
γ) Eine Einschränkung kraft Unvordenklichkeit 21 ). Zur Unvordenklichkeit aber gehört eine seit unvordenklicher Zeit andauernde Ausübung der erweiterten Hoheit als Rechtsausübung. Hier ist der Nachweis eines Titels nicht erforderlich, noch weniger der Nachweis der Rechtsüberzeugung einer Gemeinschaft, für die sie als objektives Recht in Betracht kommen soll.
Zu beachten wäre dabei noch zweierlei: Einmal muß den Staat, welcher sich auf die erweiterte Hoheit beruft, die Beweislast treffen, und dabei werden an die Beweisführung besonders strenge Anforderungen zu stellen sein, weil es sich um einen anormalen Eingriff in die Hoheitsrechte eines anderen Staates handelt. Sodann ist zu bemerken, daß die Einschränkung


|
Seite 40 |




|
sich auf alle am Küstengewässer möglichen Hoheitsrechte oder nur auf einige von ihnen beziehen kann.
Auf unseren zur Entscheidung stehenden Fall angewendet, würde sich hieraus folgendes ergeben:
Lübeck müßte nachweisen, daß ihm kraft einer der oben angegebenen, besonderen Grundlagen das staatliche Hoheitsrecht (oder eines der staatlichen Hoheitsrechte) an Küstengewässern an der der mecklenburgischen Küste Priwall-Harkenbeck vorgelagerten Meeresstrecke anstelle von Mecklenburg zusteht.
Von dem Ausfall dieses Beweises wird dann der weitere Gang der Untersuchung abhängen. Wir wollen im folgenden das an sich Mecklenburg zukommende Küstengewässer Priwall-Harkenbeck mit "streitigem Küstengewässer" bezeichnen.


|
Seite 41 |




|
B.
Allgemeine Prüfung der etwaigen Grundlagen bei dem vorliegenden Streitfall.
1. Es ist zunächst unbestritten, daß ein besonderer Vertrag zwischen Lübeck und Mecklenburg über die Hoheit an dem streitigen Küstengewässer nicht abgeschlossen worden ist. Lübeck kann daher den Beweis einer besonderen vertraglichen Grundlage nicht erbringen.
2. Was die einseitige Verleihung seitens eines hierzu Legitimierten (Privileg) anlangt, so wird in den Gutachten von Rörig der Versuch gemacht, das sog. Barbarossaprivileg von 1188 in gewisser Weise zugunsten Lübecks heranzuziehen. Allein dieser Versuch muß als völlig fehlgeschlagen bezeichnet werden, und die von Rörig vertretene Ansicht ist ganz unhaltbar. Wir sehen ganz davon ab, daß nach neueren Forschungen sich das Privileg von 1188 als eine Fälschung darstellt 22 ).
Die Stelle der Urkunde, um die es sich handelt, lautet so:
"Insuber licebit ipsis civibus et eorum piscatoribus piscari per omnia a supradicta illa Odislo usque in mare preter septa comitis Adolfi, sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt."
In seinem ersten Gutachten hatte Rörig zu dieser Stelle erklärt 23 ): "Der Ausdruck ,bis ins Meer' läßt nach dem festzustellenden Sprachgebrauch kaum einen Zweifel, daß wirklich ein Stück Meeres mit einbegriffen sein soll." In der Anmerkung hierzu


|
Seite 42 |




|
fährt er dann wörtlich fort: "In dem bekannten Reichsgerichtsurteil von 1890 werden die Worte "usque in mare" mit "bis ins Meer" wiedergegeben, also auch eine Ausdehnung bis über die eigentliche Mündung hinaus angenommen." Dieser Sprachgebrauch werde auch noch durch einen Vergleich mit dem Freibrief Friedrichs II. von 1226 bestätigt, da hier für die Kennzeichnung" bis zur Mündung" der Ausdruck "usque ad mare" gebraucht werde. An einer späteren Stelle seines ersten Gutachtens sagt dann Rörig wörtlich 24 ): "In der Tat ließe sich aus dem Privileg Friedrichs I. die Übertragung des Fischereiregals ,usque in mare' folgern; nachweisen nicht." - Auf verschiedene Einwendungen des Mecklenburgischen Geheimen und. Hauptarchivs hin sucht Rörig in seinem zweiten Gutachten 25 ) die Stelle des Barbarossaprivilegs insbesondere mit dem Privileg für Rostock von 1256 in Parallele zu setzen, in dem es heißt: "a ponte aquatico . . . usque Warnemunde necnon extra portum in marinis fluctibus eo tanto dotamus beneficio piscature, quantum pre intemperie aeris audeant attemptare." Er meint, daß das angesehene Lübeck doch nicht hatte schlechter dastehen sollen als das jüngere und bescheidenere Rostock. Daher ergebe das Barbarossaprivileg eine Fischereigerechtigkeit Lübecks auf dem Meere (Reedegebiet); darüber hinaus sei aber als wirklicher Rechtszustand auch ein weitergehendes Hoheitsrecht auf Grund späterer Zeugnisse bereits damals anzunehmen. Im übrigen sei Lübeck gar nicht das Fischereiregal auf dem Meere "übertragen" worden, sondern es handele sich nur um die Anerkennung eines von Lübeck kraft eigenen Rechts erworbenen Fischereihoheitsrechts am Meere. Diese letzten Bemerkungen Rörigs erklären sich aus seiner absonderlichen Meinung, auf welche später zurückzukommen ist, daß nämlich ein Regal am Küstengewässer nicht bestanden habe, dieses vielmehr als völlig herrenlos der freien Okkupation offengestanden habe. Wir sehen daher hier 25 ) von einer Widerlegung ab und begnügen uns mit der Feststellung, daß Rörig in seinem ersten Gutachten erklärt hat, daß man aus dem Barbarossaprivileg eine Übertragung des Fischereiregals über Stücke des Meeres folgern könne, und daß Lübeck in einem Schreiben an Mecklenburg vom 12. Juni 1616 die Zugehörigkeit des "Travestromb mit dem Port und der Reide"


|
Seite 43 |




|
zu Lübeck auf "kayserliche und königliche Privilegien" stützt, wobei nach Rörig die "Reide" das ganze, jetzt von Lübeck in Anspruch genommene Küstengewässer umfassen soll 27 ). Es ist daher nötig, sich mit der Frage zu beschäftigen, ob das Barbarossaprivileg eine Verleihung von Hoheitsrechten über das Meer enthält.
Diese Frage ist voll und ganz zu verneinen. Die Deutung, die Rörig den Worten "usque in mare" gibt, ist unhaltbar. Die Worte können hier nur bedeuten "bis zum Meere". Und zwar aus folgenden Gründen: Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Ausdruck "usque in mare" in zahllosen Urkunden der damaligen Zeit, und zwar auch in Urkunden der kaiserlichen Kanzlei, in dem Sinn "bis zum Meere" gebraucht wird 28 ).Würden die Worte bedeuten, daß die Fischerei "bis in das Meer hinein" übertragen werden sollte, so wäre damit ein abgegrenzter Meeresteil nicht gegeben. Es ist aber alsdann ausgeschlossen, daß die Urkunde sich derart ausgedrückt hätte, wie es geschehen ist. Man würde nämlich niemals an eine Verleihung einer beliebig weit ausgedehnten Fischerei im Meere die Ausnahme der ganz oberhalb in der Trave gelegenen Lachswehr angeknüpft haben, da dies völlig einer anschaulichen Darlegung widersprechen würde 29 ). - Weiter ergibt der Bericht des gleichzeitigen Chronisten Arnold, daß Lübeck nur Hoheitsrechte "a mari usque
a) Urkunde von 1334: "totum plenum et liberum portum ab amne dicta Levoldesouwe usque Bulkehovede . . . cum omni libertate et dominio . . . dimisisse et donasse" (1390 bestätigt).
b) Urkunde von 1461: "gewe wii - de Killer vorde vrii to ewigen tiiden mid alleme genete wente in de apenbaren zee beide siiden mit dem vorstrande".
c) Urkunde von 1661: "Die Kieler Vöhrde mit allem Geniehs bis in die offenbare See mit den Vorständen an beeden Seiten bihs Bülck und Wisch-hovet eigenthümlich besitzen und geniehsen secundum Privil. v. 1334. 1390 und 1461".
Die Urkunden sind abgedruckt in den "Mitteilungen für Kieler Stadtgeschichte" Heft 23 S. 163 ff. - Man ersieht aus ihnen, daß hier auch der deutsche Ausdruck "bis in die See" bedeutet "bis zur See".


|
Seite 44 |




|
Thodeslo" erhalten hat 30 ). - Was aber die Gegenüberstellung des Barbarossaprivilegs und der Verleihungsurkunde für Rostock von 1256 anlangt 31 ), so verfährt Rörig hierbei und bei der anschließenden Betrachtung ganz ungenau. Zunächst läßt er beidem Barbarossaprivileg die Ausnahme von der Lachswehr des Grafen Adolfs ganz fort, obschon ihr durchaus entscheidende Bedeutung zukommt 32 ). Sodann wird bei der anschließenden Betrachtung bei dem Rostocker Privileg aus den Worten "in marinis fluctibus" plötzlich ein "usque (!) in marinis fluctibus" gemacht 33 ). In Wirklichkeit ergibt eine unbefangene Betrachtung gerade mit größter Deutlichkeit, daß Rostock eben ein Fischereirecht im Meere erhält, Lübeck aber nicht. - Aufs Schärfste zurückzuweisen ist schließlich noch die Behauptung Rörigs, daß das Reichsgerichtsurteil von 1890 eine Ausdehnung der Hoheitsrechte Lübecks bis über die eigentliche Mündung hinaus auf Grund des Barbarossaprivilegs angenommen habe. Das Reichsgericht übersetzt zwar die Worte "usque in mare" mit "bis ins Meer", es versteht darunter aber, wie seine Ausführungen unzweifelhaft zeigen, "bis zur Mündung ins Meer" 34 ). An manchen stellendes Urteils ist dies auch mit dürren Worten ausgesprochen; so schließt sich z. B. das Reichsgericht der Ansicht von Lübeck an, daß es sich "um die Einverleibung des Traveflusses, soweit dessen Wasser bei höchstem Wasserstande reicht, von der Mündung bis zur Brücke bei Oldesloe" handele, und es spricht von einer "Verleihung der Herrschaft über den Travestrom in der weitesten Ausdehnung seiner Wasserfläche bis zur Mündung" 35 )


|
Seite 45 |




|
Lübeck kann daher den Beweis, daß für es eine besondere Grundlage kraft eines Privilegs gegeben sei, nicht erbringen.
3. Die Frage, ob Lübeck als besondere Grundlage ein Gewohnheitsrecht nachweisen kann, setzt eine Untersuchung über die tatsächliche Ausübung von Hoheitsrechten im Laufe der Geschichte voraus. Gleiches ist aber auch bei der Frage der Unvordenklichkeit der Fall. Daher kann die Untersuchung in bezug auf beide Fragen zunächst auf weite Strecken zusammengehen. Dementsprechend wollen wir in einem besonderen Abschnitt: Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem streitigen Küstengewässer im Laufe der geschichtlichen Entwicklung betrachten. Dabei wird es aber unumgänglich nötig sein:
a) eine allgemeinere Betrachtung über die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor der Ausbildung des modernen Völkerrechts und allgemeine Folgerungen hieraus für das streitige Küstengewässer voranzustellen. Denn in den Gutachten Rörigs werden in dieser Hinsicht ganz sonderliche Ansichten vertreten.
b) Und ferner eine Prüfung vorzunehmen, auf welchen Fundamenten eigentlich die Abgrenzung des gesamten von Lübeck beanspruchten Küstengewässers (der von ihm sog. Travemünder Reede) beruht.
4. Wir haben oben als eine mögliche, besondere Grundlage für die Ansprüche Lübecks auch den Erwerb kraft Okkupation in einer Zeit, wo eine Gebietshoheit über Küstengewässer noch nicht anerkannt war, angeführt. Diese Frage kann ihre Erledigung erst finden, nachdem die Rechtsverhältnisse an den Küstengewässern in früherer Zeit klargestellt worden sind (oben 3 a).


|
Seite 46 |




|
C.
Die Ausübung von Hoheitsrechten an dem streitigen Küstengewässer.
I.
Die Rechtsverhältnisse an Küstengewässern vor Ausbildung des modernen Völkerrechts im allgemeinen. - Allgemeine Folgerungen für das streitige Küstengewässer.
Rörig geht in seinen Gutachten von der Vorstellung aus, daß im Mittelalter vor Ausbildung des völkerrechtlichen Begriffs des Küstengewässers die Wasserflächen an den deutschen Küsten des Meeres "offenes Meer" gewesen seien und noch keiner Verfügungsgewalt des Uferstaates unterlegen hätten 36 ). Aus diesem allgemeinen Satz werden dann von ihm wichtige Folgerungen für das im Streit befangene Küstengewässer gezogen.
Das Mecklenburger Staatsarchiv ist der Auffassung Rörigs mit aller Entschiedenheit entgegengetreten und verficht den Standpunkt, daß bereits im Mittelalter ein Hoheitsrecht des Uferstaates an seinen Gewässern an der Küste (Küstengewässern) bestanden und sich in verschiedenen Ausstrahlungen geäußert habe.
Nach meiner Ansicht kann kein Zweifel sein, daß Rörig in einem schweren rechtshistorischen Irrtum befangen ist.


|
Seite 47 |




|
Es soll im folgenden nicht auf alle Einzelheiten eingegangen werden, die in der vorliegenden Frage vorgebracht worden sind. Wir wollen uns darauf beschränken, einige markante Belege für die richtige Ansicht aneinander zu reihen und das Ergebnis festzulegen und gegen Einwendungen Rörigs zu verteidigen (unter I). Alsdann sollen allgemeine Folgerungen hieraus für das streitige Küstengewässer gezogen werden (unter II).
I. Wenden wir uns zunächst der Besprechung einiger wichtiger Belege zu, so wollen wir dabei so verfahren, daß wir die an die Lübecker Bucht angrenzenden Gebiete an den Schluß stellen, da sich die für sie maßgebenden Quellen am sichersten und besten nach Kenntnis der Quellen anderer Gebiete verstehen lassen.
Ein helles Licht auf die Rechtsverhältnisse am Küstengewässer wirft das Privileg Kaiser Friedrichs II. von 1226 (Preuß. Urkb. I 1. Nr. 56), durch welches er dem Hochmeister des Deutschen Ordens die Landeshoheit verlieh. In diesem lesen wir:
"Concedentes et confirmantes eidem magistro et domni sue - . . . totamterram, quam in partibus Prussiae - conquiret velut vetus et debitum jus imperii in montibus - fluminibus . . . et in mari."
Es kann daher gar keine Frage sein, daß hiermit der Orden auch die Landeshoheit über das dem Binnenlande Preußens vorgelagerten Meere, also über das Küstengewässer der Ostsee, erhielt. Das Küstengewässer untersteht der königlichen Verfügungsgewalt und die Hoheit über es wird als Regal übertragen 37 .
Im Anschluß hieran wurde alsdann vom Deutschen Orden und den Bischöfen von Samland und Ermland ein Fischereiregal in bezug auf die Küstengewässer der Ostsee, soweit sie ihre Länder bespülten, ausgebildet und gehandhabt 38 ).
Man vergleiche hierfür insbesondere:
Die Handfeste des Bischofs Siegfried von Pomesanien für die Stadt Schönwik (Fischhausen) von 1290 und deren Erneuerung


|
Seite 48 |




|
von 1305 39 ), in welcher es heißt, daß ihren Einwohnern übertragen sei "perpetuam libertatem piscandi in recenti mari" (d. h. dem Haff) und dann fortgefahren wird:
"Poterunt insuper . . . cives in perpetuum libere, cum voluerint in salso mari piscari."
In der Erklärung des Landmeisters Helwig von Goldbach über das Fischereirecht der Predigermönche in Elbing von 1302 40 ) lesen wir ferner:
"Quod idem prior et conventus . . . in recenti mari cum una sagena et in salso mari similiter cum una . . . libere piscandi, sicut dicta maria ad domum Elbingensem pertinent, habeant facultatem."
Im Jahre 1342 41 ) verlieh der Hochmeister Ludwig König den Fischern der Stadt Danzig die Berechtigung neben und mit den Leuten des Klosters Oliva 42 ), im Meere zu fischen, außerdem bestimmt er:
"In salso mari unam liberam navium habebunt peromne nostrum dominium pro captura allecum et piscium quorumcunque."
D. h. sie erhalten ein Schiff frei von Abgaben für den Fischfang im salzigen Meere in dem ganzen Herrschaftsgebiet des Ordens, d. h. in seinen Küstengewässern (man kann auch übersetzen "an unserm ganzen Herrschaftsgebiet entlang") 43 ).
Schon etwas früher sind uns Privilegien der Herzöge von Pommerellen überliefert, aus denen sich ergibt, daß diese ein Fischereiregal über ihre Küstengewässer ausübten.
Die älteste Urkunde ist das Privileg des Herzogs Suantepolk für das Kloster Sarnowitz von 1275 44 ), in welcher es heißt:
"Insuder addimus eis liberam potestatem in salso mari piscandi rumbos, esoces vel alios quoscunque pisces . . . stationes eciam que sunt vel haberi poterunt in terminis ipsorum . . . cum omni jure et proventus allecis de navibus


|
Seite 49 |




|
in eisdem stationibus allec capientibus . . . conferimus et donamus."
v. Brünneck 45 ) hat diese Stelle etwas freier so wiedergegeben:
"Der Herzog gewährte danach den Nonnen des Klosters . . . die Freiheit und die Gerechtsame, im salzigen Meere Schollen (Flundern), Hechte und sonstige Fische jeder Art zu fangen, auch innerhalb näher bezeichneter Grenzen den Heringsfang zu betreiben und in der See an geeigneten Stellen Einrichtungen und Anstalten zu haben und noch künftig anzulegen, welche das Fangen der Heringe ermöglichten und erleichterten."
Auch aus anderen Privilegien der Herzöge von Pommerellen erhellt das Fischereiregal am Küstengewässer 46 ).
Die älteste Urkunde, welche uns in der hier interessierenden Frage über die Küste des Festlandes Pommerns Auskunft gibt, ist die Gründungsurkunde der deutschen Stadt Kolberg von 1255. Wir schließen an sie sogleich die Besprechung zweier späterer Privilegien für Kolberg an.
Das Gründungsprivileg von 1255 47 ) ist von zwei Herrschern erteilt, dem Bischof von Kammin Hermann und dem Herzog von Pommern Wratislaw III. Zu dieser Zeit gehörte beiden das "Land" Kolberg, indem der östliche Teil dem Bischof, der westliche dem Herzog zustand. Die Stadt Kolberg aber wurde in der Weise gegründet, daß zwar ihr Grundstock im östlichen Gebiet lag, sie aber auch Berechtigungen im westlichen Teil und Gerechtsame, die beiden Herrschern gemeinsam waren, erhielt. In diesem Privileg heißt es nun:
"Piscationem quoque in fluvio Persanta et salsi maris, in quantum attingere possunt, liberam donavimus civitati sepe dicte."
Dies bedeutet: "Auch verleihen wir der genannten Stadt die freie Fischerei in dem Persantefluß und in dem Salzmeere, so weit sie zu reichen vermögen." Hiernach wird den Kolbergern die freie


|
Seite 50 |




|
Meeresfischerei verliehen, soweit sie sie betreiben können 48 ) also zu beiden Seiten des Ausflusses der Persante ohne bestimmtere Angabe.
Das Privileg ergibt also mit voller Sicherheit ein Fischereiregal der beiden Herrscher an ihren Küstengewässern.
Einen weiteren Einblick in dieses Regal erhalten wir alsdann durch die Privilegien für Kolberg von 1266 und 1286. Das Privileg von 1266 49 ) rührt von Barnim I., dem Erben Wratislaw III. in bezug auf den östlichen Teil des Landes Kolberg 50 ) her. In ihm wird nun unter anderem die freie Küstenfischerei der Stadt festgelegt auf die Meeresgewässer längs des Stadtgebietes, insoweit sie zur Landesherrschaft Barnims gehören:
"ut . . . ubicumque in salso mari, in quantum se eiusdem civitatis termini iuxta mare salsum in agris et campis extendunt . . . ut prescriptum est, allecia libere et absque cuiuslibet thelonei solucione capere valeant in locis predictis, quantum ad nostrem pertinent dominationem."
Wir sehen hier deutlich, wie die Küstengewässer zur Herrschaft des Uferstaates gehören, denn nur in bezug auf seine Küstengewässer erläßt der Herzog seine Verfügung. Gleichzeitig erkennen wir, daß man die Wasserflächen selbst als zur Landesherrschaft gehörig betrachtete. Die Urkunde von 1266 ist auch deshalb wichtig, weil sie uns die normale Abgabe vom Fischfang mitteilt:
"decem et octo denariorum de remo et unius masse allecium de navi," d. h. 18 Pfennige vom Ruder und eine "massa" Heringe vom Schiff," und diese Fischfangabgabe mit "theloneum" bezeichnet wird, das also von dem Zoll im engeren Sinne scharf zu unterscheiden ist 51 ).
In dem Privileg von 1286 52 ) gibt der Herzog vom Pommern Bogislav IV. der Stadt Kolberg die Freiheit des Fischfanges im Meere von der Stadt Kolberg an bis zur Swine an jedem Ort,


|
Seite 51 |




|
der zu seinem Herrschaftsbereich gehört. Der Fischfang wird auf Zugnetze und "Sommernetze" begrenzt und hiermit deutlich als Küstenfischerei gekennzeichnet:
"quod in salso sive in magno mari cum retibus strictis et hiis que somernette vocantur a dicta civitate Colberch usque ad Zwinam in omniloco ubinostrum est piscandi diversi et omnis generis pisces habebunt perpetuam libertatem."
Der Zusatz "in omni loco ubi nostrum est" 53 ) ist offenbar deshalb gewählt, weil dem Herzog von Pommern im Jahre 1286 der westliche Teil des Landes Kolberg nicht mehr gehörte, da dieser im Jahre 1276 von Barnim I. an den Bischof von Kammin übertragen worden war 54 ). Das gesamte Küstengewässer längs des Stadtgebietes Kolbergs gehörte zu dieser Zeit also dem Bischof von Kammin, und das Privileg schlug rechtlich nur durch in bezug auf das Küstengewässer von der westlichen Grenze des Kolberger Stadtgebietes bis zur Swine. - Wichtig an dem Privileg ist noch, daß der Herzog in ihm von Befehlen an alle seine Hauptleute, Vögte, Untervögte, Beamte und Einwohner spricht, daß diese die Gerechtsame der Kolberger nicht beeinträchtigen. Es besteht also eine landesherrliche Aufsicht über die Küstengewässer.
Von Barnim I. von Pommern, dessen Privileg für Kolberg von 1266 wir kennen gelernt haben, rührt auch das Privileg von 1274 ) 55 )für die Stadt Kammin her. In diesem wird ganz entsprechend dem Kolberger Privileg den Bürgern von Kammin für die Fischerei im Meere an der Küste des Landes Kammin Abgabenfreiheit gewährt ("in salso mari . . . quantum ad terram Camynensem pertinet . . ." "ab omni solucione, que nobis vel nostris debetur, ea libera iudicamus").
Sehr häufig sind auch Privilegien, welche Klöstern und Ortschaften abgabenfreie Schiffe beim Schollen- oder Heringsfang in den Küstengewässern des privilegierenden Landesherrn gewähren.
So gibt Barnim I. von Pommern im Jahre 1265 56 ) dem Kloster Dargun ein abgabenfreies Schiff zum Schollenfang "in


|
Seite 52 |




|
mari salso terre nostre dominio adiancenti" 57 ) wobei die gewöhnlichen Fischfangabgaben mit "pensio", "theoloneo", "exactio" bezeichnet werden. - So gibt der Bischof Hermann von Kammin dem Nonnenkloster bei der Altstadt Kolberg im Jahre 1278 ein abgabenfreies Schiff für den Heringsfang "in terminis nostris" 58 ) oder, wie es in einer anderen Urkunde heißt, "infra terminos Colberg et Coslin" 59 ).
Wir erwähnen ferner noch die weitgehenden Privilegien an das Jungfrauenkloster zu Cöslin von 1278 und 1279 60 ), in denen ein abgabenfreies Schiff für den Heringsfang und die Freiheit gewährt wird, "cum sagena (d. h. dem Schleppnetz) in salso mari pisces in nostris terminis capiendi".
Schließlich wird die Zugehörigkeit des Meeres zur Landesherrschaft auch durch das Privileg an die Stadt Treptow an der Rega von 1309 61 ) bewiesen. Hier erhält die Stadt den Fluß Rega mit allem Nutzen sowohl aufwärts wie abwärts, aber darüber hinaus noch bis auf eine Meile in die Ostsee:
"Dedimus ipsum flumen Reghe liberum cum omni usu ex eo flumine provenienti ac suis navibus ascendendo et descendendo usque ad spatium miliaris unius in ipsum mare salsum."
Was Rügen betrifft, so ergeben Quellen des 13 Jahrhunderts, daß dem Landesherrn das Küstengewässer daselbst gehörte 62 ). Dies wird durch das Rügische Landrecht bestätigt 63 ).
Es ist der "Außenstrand" um Rügen, der "große Strand". Er umfaßt Land und Wasser, "in" welchem die Fischerei betrieben wurde. Er untersteht den Amtleuten, "alle bröke und undat, so up angetagenen stranden upme lande und water von den vischern


|
Seite 53 |




|
edder sonsten geschuet, dat strafen und richten fürstlicher gnaden amptleude". Im einzelnen ist auf die eingehenden und überzeugenden Ausführungen des Mecklenburger Archivs zu verweisen. Hervorgehoben sei hier nur, wie sich der intensive Zusammenhang zwischen Strand im engeren Sinn (trockener Strand und dem von ihm aus beherrschbaren und nutzbaren Teil des Meeres (Küstengewässer) darin äußert, daß auch das letztere mit unter den weiteren Begriff des Strandes einbezogen wurde.
Bedeutungsvoll ist die Urkunde von 1326 64 ) in welcher uns die Belehnung des Grafen Gerhard mit dem Herzogtum Schleswig durch Waldemar überliefert ist. Die Belohnung erfolgt:
"cum omnibus regalibus ac aliis, cum dominio utili et directo, mari, aquis, portubus."
Wir haben hier eine Parallele zu dem Privileg für den Deutschen Orden von 1226 65 ). Es ist kein Zweifel: das Meer steht unter der Herrschaft des Landesherrn!
Dem entspricht es auch, daß von den Herrschern Schleswigs Privilegien in bezug auf Meeresgewässer an der Küste verliehen werden. So wird im Jahre 1480 der Stadt Schleswig von König Christian I. in bezug auf die Schlei privilegiert 66 ). Sie erhält alle Nutzungsrechte an dem Fluß von der Stadt an "an beyden Syden des Landes, wenthe an dat gemeyne Meer offte solte See enen Wecke Sees buthen Schlyes Muende".
Es wird hier nicht nur die Fischerei, sondern auch die sonstige Nutzung an einem Teil des offenen Meeres verliehen 67 ), ganz ähnlich, wie wir es bei Treptow an der Rega kennengelernt haben 68 ) 69 ).
Für Mecklenburg kommen vor allem die Privilegien für Rostock als unzweifelhafte Belege in Betracht. In dem Privileg


|
Seite 54 |




|
von 1252 70 ) wird die Fischerei auf der Warnow und Meeresfischerei verliehen:
"Et sic per alveum fluminis Warnowe usque Warnemunde nec non extra portum in marinis fluctibus eos tanto dotamus beneficio piscature, quantum perinteperie aeris et corporias audeant attemptare."
Für die Meeresfischerei werden also keine bestimmten Grenzen angegeben, wie wir dies auch bei der Gründung Kolbergs kennen gelernt haben 71 ). Aber die Parallele geht noch weiter, indem in dem Privileg für Rostock von 1323 diese Meeresfischerei auf die Küste des Rostocker Stadtgebietes begrenzt wird ("in marinis fluctibus inter Zarnestrom et Diderikeshagen") 72 ).
Als ferner im Jahre 1358 73 ) Rostock die volle Gerichtsbarkeit erhielt, wird sie ihm auch in bezug auf das Küstengewässer des Stadtgebietes zugesprochen:
"Tum intra eandem civitatem quam extra in terris et in mari circumquaque, prout in suis terminis . . . se extenduent."
Voll beweiskräftig ist ferner das Privileg für das Kloster Sonnenkamp von 1219 74 ), in welchem dieses Meeresfischerei an der Küste von Brunshaupten erhielt:
"in villa, que dicitur Bruneshovede, XXX mansos, et piscaturam dimidiam etiam juxta mare."
Es hat nichts Auffälliges, wenn hier von einer "halben Fischerei" die Rede ist; die Küstenfischerei kann zur Hälfte verliehen sein, indem die Hälfte einer Küstenstrecke oder die Hälfte von Fischzügen gemeint ist. Daß die piscatura . . . "iuxta" mare Küstenfischerei bedeutet, kann nicht zweifelhaft sein, wörtlich würde es mit Fischerei "an dem Meere entlang" zu übersetzen sein.
In bezug auf Holstein haben wir zwei Belege, die sich sogar auf die Lübecker Bucht selbst beziehen. Allerdings ist die Echtheit des einen Belegs streitig.


|
Seite 55 |




|
In einer Urkunde für die Stadt Neustadt von 1293 oder 1318 wird dieser vom Grafen von Holstein das Privileg erteilt 75 ):
"ut aqua maris sit etiam libera inter villam Rockentin et Hollm, et nihilominus aqua inter distinctiones supernas nominatas (d. h. den Grenzen des Stadtgebietes) sit eisdem appropriata."
Hier wird also ein Stück des offenen Meeres der Lübecker Bucht durch den Landesherrn der Stadt zugeeignet 76 ).
Die Echtheit dieses Privilegs wird von manchen bestritten 77 ), aber von angesehenen Forschern bejaht 78 ). Bis zum Beweise des Gegenteils wird man es als echt ansehen müssen. Der Inhalt des Privilegs hat später zu Recht bestanden.
Das zweite Privileg ist von den Grafen von Holstein für die Lübecker Fischer im Jahre 1252 ausgestellt 79 ). In ihm heißt es:
"Quod per totum districtum dominii nostri apud maria piscatione libere frui debent, et cum navibus suis ubi eis utile visum fuerit, ad litus accedere et redia sua in terra apud littora siccare . . . debent."
Hiernach wird den Lübecker Fischern gewährt:
a) abgabenfreie Meeresfischerei in den Küstengewässern des ganzen Landes,
b) das Recht, an der Küste zu landen und ihre Netze auf dem Lande zu trocknen.
Die Worte "per totum districtum dominii nostri apud maria piscatione libere frui debent" wird man am besten übersetzen: "Sie dürfen längs dem ganzen Gebiet unserer Herrschaft an dem Meere entlang den Fischfang abgabenfrei betreiben" 80 ). Daß Fischereibetrieb im Küstengewässer verliehen


|
Seite 56 |




|
wird, ergibt sich deutlich aus den folgenden Gewährungen von Berechtigungen am Lande 81 ). Es kann daher keine Frage sein, daß den holsteinschen Landesherrn ein Hoheitsrecht an ihren Küstengewässern zustand, und zwar speziell ein Fischereiregal.
Diesen Belegen, welche die ganze Ostsee an der Küste Deutschlands umfassen, fügen wir hinzu, daß auch die bekannte Geschichte des Strandrechts ergibt, daß den Territorialherrn ein weitgehendes Hoheitsrecht nicht allein über den trockenen, sondern auch über den überfluteten Strand zustand, so daß wir auch in dieser Hinsicht ein Hoheitsrecht an den Küstengewässern feststellen können.
Als Gesamtergebnis können wir daher folgendes festlegen:
Im Mittelalter, jedenfalls seit dem 13. Jahrhundert, stehen die Küstengewässer der Ostsee von der samländischen Küste an bis zur schleswigschen Küste (diese mit eingeschlossen) unter der Hoheit des Landesherrn des Territoriums, das sie bespülen. Man kann von einem landesherrlichen Regal an den Küstengewässern des Meeres sprechen, indem wir Regal in dem bekannten weiten Sinn des Mittelalters nehmen, wonach es sowohl die Hoheits- wie die nutzbaren Rechte umfaßt. Es ist interessant, daß wir eine Urkunde haben, welche uns zeigt, daß dieses Regal auf ein ursprünglich vom deutschen König sich beigelegtes Hoheitsrecht zurückgeht; es ist dies die Verleihungsurkunde Friedrichs II. an den Deutschen Orden von 1226. Dieses Regal an den Küstengewässern bewirkt, daß die Küstengewässer von der Landesherrschaft mit umspannt werden, daß sie mit der Landesherrschaft zusammen übertragen und verliehen werden. Im übrigen zeigt dieses Regal sehr verschiedene Ausstrahlungen. Wir sehen vor allem, wie aus ihm ein Fischereiregal hervorwächst. Die Küstenherrn haben die Fischereihoheit, sie regeln die Art der Fischerei (bestimmte Netze), die Zeit der Fischerei, sie beaufsichtigen die Fischerei, sie beziehen grundsätzlich Abgaben für den Fischfang (theloneum, pensio, exactio u. a.). Sie verleihen Fischereinutzungsrechte, vergeben Fischereiprivilegien mit Abgabenfreiheit (piscatio libera, navis libera). Aber den Küstenherren steht auch die sonstige Nutzung der Küstengewässer zu, sie übertragen daher Teile des offenen Meeres an Städte zur


|
Seite 57 |




|
allgemeinen Benutzung und zum freien Gebrauch (Treptow an der Rega, Schleswig, Neustadt). Die Küstenherren haben über die Küstengewässer eine Gerichtsbarkeit (Rügisches Landrecht), sie übertragen auch die Gerichtsbarkeit bei vergebenen Meeresstücken (Rostock 1358). Die Küstenherren haben an den Küstengewässern weitgehende Hoheits- und Nutzungsrechts kraft des Strandrechts.
Was die Abgrenzung des Küstengewässers von dem freien, offenen Meers anlangt, so läßt sich dafür eine allgemein gültige Formel für alle Küstenländer nicht aufstellen und ist auch wohl nicht aufgestellt worden. Man wird aber soviel sagen können, daß der Gedanke entscheidend war, daß das Küstengewässer jedenfalls soweit der Landesherrschaft zugehöre, als es vom Strande aus beherrschbar und nutzbar erschien.
So kann es für den rechtshistorisch geschulten Blick gar keinem Zweifel unterliegen, daß dieses Regal am Küstengewässer mit der Vorläufer des modernen Hoheitsrechts am Küstengewässer ist, wie es das Völkerrecht ausgebildet hat. Es wäre ja auch geradezu wunderbar, wenn die völkerrechtliche Hoheit am Küstengewässer plötzlich aus dem Nichts hervorgezaubert wäre, ohne daß sich eine Anknüpfung an die Vergangenheit fände. Freilich haben Umfang und Inhalt des Hoheitsrechts mannigfache Wandlungen erfahren.
Rörig hat in seinen späteren Gutachten verschiedene Einwendungen gegen die Darlegungen des Mecklenburger Staatsarchivs erhoben, die in wesentlichen Punkten auch meine vorstehenden Ausführungen treffen.
Von allgemeinerer Art ist die Bemerkung, daß nicht der völkerrechtliche Begriff des Küstengewässers in die ältere rechtshistorische Untersuchung hineingetragen würden dürfe 82 ). Allein dies ist weder vom Mecklenburger Staatsarchiv, noch von mir geschehen. Wir verwenden die Bezeichnung "Küstengewässer" bei der rechtshistorischen Betrachtung der früheren Zeit für die Meeresgewässer an der Küste. Es sind die Meeresgewässer, welche den einzelnen Territorien vorgelagert sind, wobei wir aber nur Teile des wirklichen offenen Meeres mit in Betracht ziehen 83 ). Es handelt sich also lediglich um einen kurzen treffenden Ausdruck, der sich ohne weiteres aus einer Betrachtung und Wertung der mittelalter-


|
Seite 58 |




|
lichen Quellen ergibt. Die Rechtsverhältnisse dieser Küstengewässer untersuchen wir nur auf Grund der mittelalterlichen Quellen. Und erst alsdann stellen wir fest, daß wir hier Vorläufer des modernen völkerrechtlichen Küstengewässers vor uns haben.
Von allgemeinerer Art ist auch die Bemerkung über die von Rörig anerkannten "Sonderbildungen". Hierüber sagt Rörig 84 ):
"An sich nur Rechte am Strande und freies Meer; Sonderrechte an Meeresteilen - soweit sie nicht als Haffs usw. ohnehin als Binnengewässer behandelt werden - nur im wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Schiffahrts- und Fischereibetriebe einzelner Städte am Unterlauf der Flüsse, rechtlich in Übertragung der Rechtsverhältnisse der größeren Binnengewässer unmittelbar hinter den Flußmündungen auf die für den Schiffahrtsbetrieb der Städte notwendige Wasserfläche vor ihnen."
Rörig will auf diese Weise die Rechtsverhältnisse von Rostock und Wismar erklären, er fügt neuerdings auch Kolberg und Schleswig hinzu. - Allein eine auch nur oberflächliche Betrachtung der von uns oben angeführten langen Kette von Belegen beweist, daß der von Rörig aufgestellte Satz ganz unrichtig ist. Es ist schlechterdings ausgeschlossen, hiermit die von uns vorgeführten Quellen erklären zu wollen. Diese Quellen ergeben nicht nur Rechte an "Meeresteilen" im Sinne Rörigs 85 ), sondern Rechte des Landesherrn an dem gesamten Meeresgewässer, das seiner Küste vorgelagert ist. Alle Zuweisungen von Rechten an diesen Meeresgewässern oder in bezug auf sie sind nur Ausschnitte aus dem allgemeinen landesherrlichen Recht am Küstengewässer. Und diese Zuweisungen von Berechtigungen erfolgen nicht bloß an Städte, sondern auch an Klöster, sie erfolgen nicht allein in Zusammenhang mit Flußmündungen, sie stehen vielfach in gar keinem Zusammenhang mit Binnengewässern. Und zahlreiche "Privilegierungen" an Städte oder sonstige Personen in bezug auf abgabenfreien Fischereibetrieb beweisen gerade, daß der Fischfang im Küstengewässer normalerweise der Regelung des Landesherrn unterlag.
Wenn neuerdings Rörig sagt 86 ), daß "kaum ein Anlaß vorliege", in diesem Prozeß auf die vom Staatsarchiv heran-


|
Seite 59 |




|
gezogenen Urkunden "aus den Gewässern Rügens, Usedoms, Wollins, Neuvorpommerns und Pommerns" einzugehen, so befindet er sich insofern allerdings in einem großen Irrtum, als gerade diese und andere Urkunden dieser Gebiete uns den richtigen Aufschluß über Mecklenburger Urkunden und insbesondere über die wichtige holsteinsche Urkunde von 1252 geben. Gerade aus diesem Grunde sind auch die Quellen weiterer Gebiete, namentlich von Ost- und Westpreußen, mit hereinzuziehen. - Die Bemerkung, daß "zudem" die Gewässer im westlichen Teil dieser Gebiete zum größten Teil "Haffe", "Bodden" sind, ist irreführend, denn bei dem Qellenmaterial des Staatsarchivs sind binnenländische Gewässer ganz ausgeschieden. Und wie steht es mit dem erdrückenden Quellenmaterial für die Küste von der Swine an östlich bis hinauf zur samländischen Küste?
Sehr merkwürdig ist die Berufung Rörigs 87 ) auf das preußische Fischereigesetz vom 11. Mai 1916 und dessen Erläuterungen. Rörig meint, daß die in dem Gesetz grundsätzlich anerkannte Freiheit des Fischfangs in den Küstengewässern mit einem früheren Fischereiregal an der ganzen südlichen Ostseeküste angesichts des "konservativen" Charakters des Fischereirechts nicht vereinbar sei. Es genügt, demgegenüber darauf hinzuweisen, daß die Meeresfischerei im Laufe der Zeit erhebliche Wandlungen durchgemacht hat, indem namentlich infolge der Aufnahme des römischen Rechts sich der Grundsatz des freien Fischfangs durchsetzte 88 ). Und es ist ferner zu beachten, daß das von uns behauptete Fischereiregal sich ja keineswegs in dem Regal im engeren Sinne erschöpfte, sondern auch staatliche Hoheitsrechte am Küstengewässer enthielt, diese aber bestehen auch heute an der ganzen Ostseeküste.
Außer diesen Einwendungen Rörigs, die mehr allgemeiner Natur sind, ist nun noch auf einige Einwendungen einzugehen, die sich auf einzelne unserer Belege beziehen. Was Rügen anbelangt 89 ), so verweise ich auch hier auf die Darlegungen des Mecklenburger Staatsarchivs 90 ). Es ergibt sich aus ihnen insbesondere, daß Rörig das Rügische Landrecht in seinen entscheidenden Stellen überhaupt gar nicht berücksichtigt hat.
Was die Mecklenburger Belege anbelangt, so ist an erster Stelle auf die wichtigen Urkunden für Rostock von 1252


|
Seite 60 |




|
und 1323 einzugehen. Rörig bemerkt über sie zunächst 91 ) daß, "sie nicht das mindeste besagen für ein allgemeines mecklenburgisches Hoheitsrecht am Küstengewässer oder gar für ein Fischereiregal an ihm", denn es handle sich (ebenso wie bei Wismar) um "Sonderbildungen" an "Meeresteilen", und die "marini fluctus" ständen in engem Zusammenhang mit der Warnow. Allein es ist ganz unverständlich, wie bei den Verleihungen der Fischerei "extra portum in marinis fluctibus quantum per intemperie aeris et corporis audeant attemptare" von "Meeresteilen" gesprochen und dies mit dem "portus" von Wismar verglichen werden kann. Es tritt ferner bei der Urkunde von 1323 ein Zusammenhang mit der Warnow überhaupt nicht hervor, da diese hier gar nicht erwähnt wird. - An einer ganz anderen Stelle aber läßt sich Rörig über die Urkunde von 1252 näher aus 92 ). Hier führt Rörig folgendes aus: Es habe sich zunächst auf der Warnow und dem "Meeresteile" vor ihrer Mündung de facto ein ausschließliches Fischereirecht der Rostocker Fischer ausgebildet. Dies sei durch die Urkunde von 1252 in der Weise "nachträglich legalisiert", "daß der Landesherr, dem nach der Rechtsanschauung im kolonialen Deutschland das Fischereiregal an der Warnow zustand, der Stadt den bestehenden Zustand durch formale Übertragung des Fischereiregals auf der Warnow legalisierte und auch der Auswirkung bis ins Meer selbst dabei gedachte" (!).
"Unbestimmt und eben nur als Anhang zur eigentlichen Regalverleihung auf der Warnow selbst sind . . . die auf Meeresgewässer bezüglichen Worte der Urkunde gehalten . . .".
"Der bestehende Rechtszustand war durch das Privileg des Landesherrn eben eigentlich (!) nur für die Warnow selbst zu denken. Was darüber hinaus ging, war gewohnheitsrechtliche Neubildung, die nur insoweit durch den Landesherrn legalisiert werden konnte (!), als man das in Betracht kommende Gewässer seewärts vom Warnemünder Hafen als Zubehör der Warnow behandelte" (!)
Man kann schwerlich ein Erstaunen unterdrücken, wenn man diese Ausführungen liest. Sie sind als rechtsgeschichtlich unhaltbar zurückzuweisen. Zunächst gipfeln sie in einer begrifflichen Haarspalterei, die dem mittelalterlichen deutschen Recht völlig fremd ist. Also der Landesherr hat "an sich", "eigentlich"


|
Seite 61 |




|
am Meeresgewässer gar keine Rechte, er "kann" daher das Meeresgewässer in seine "formale" Verleihung nur hereinziehen, indem und insoweit er es als "Zubehör" des Binnengewässers behandelt. Es ist doch merkwürdig, welche Begrenzung hier der landesherrlichen Gewalt kategorisch gesetzt wird, und welche überaus künstliche Konstruktion ausgedacht wird. Und wie außerordentlich klar und einfach liegen die Rechtsverhältnisse, wenn man unter Verwertung des sonstigen reichen Quellenmaterials, das wir für die Ostsee besitzen, von dem Hoheitsrecht des Landesherrn an seinen Meeresgewässern an der Küste ausgeht. Niemand bestreitet natürlich, daß landesherrliche Verleihungen von Rechten am Küstengewässer häufig in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Verleihungen von Rechten an Binnengewässern stehen, und sie sind auch oft in einer Urkunde zusammen vorgekommen. Allein sie finden sich sehr häufig auch völlig selbständig. Auch da aber, wo sie mit Verleihungen von Rechten an Binnengewässern zusammen erwähnt werden, werden sie rechtlich nicht als Verleihungen von Zubehörstücken angesehen. Auch die Urkunde von 1252 ergibt die völlig selbständige Aneinanderreihung der Verleihung auf der Warnow einerseits und auf dem Meere außerhalb des Hafens andererseits. Und wie wenig man an ein rechtliches Zubehör bei der Meeresfischerei dachte, zeigt die Urkunde von 1323 welche die Warnow überhaupt nicht erwähnt. Auch die Parallele mit Kolberg, die Rörig ausdrücklich anerkennt, beweist die Unrichtigkeit seiner Auffassung, denn es ist doch schlechterdings unmöglich, die ganzen Küstengewässer von Kolberg bis zur Swine als rechtliches Zubehör der Persante anzusehen 93 ).
Was das Privileg für Sonnenkamp von 1219 anlangt, so hat Rörig eingewendet 94 ), daß es sich hier nicht um Meeresfischerei handele, sondern um Fischerei in einem seeartigen Teiche bei dem Meere; dies beweise auch die Verleihung der "halben" Fischerei, von welcher beim Küstengewässer "wohl kaum" die Rede sein könne. Allein es ist sicher, daß die Verleihung der Fischerei in einem Teich in einem mittelalterlichen Privileg durch Benennung dieses Teiches ausgedrückt sein würde, von einem Teiche bei dem Meere ist aber in der Urkunde überhaupt nicht


|
Seite 62 |




|
die Rede 95 ). Und daß die Verleihung einer "halben" Fischerei bei Küstengewässern einen sehr guten Sinn ergibt, ist früher bereits erwähnt worden.
Schließlich hat Rörig auch zu der holsteinschen Urkunde von 1252 Stellung genommen, und zwar wiederholt.
In seinem ersten Gutachten erklärt Rörig 96 ), daß hier den Lübecker Fischern "vom ganzen Hoheitsgebiet der Grafen am Meere entlang gewährt" sei
"1. freier (d. h. abgabenfreier) Fischfang;
2. Landen der Fischerboote am Strande;
3. Trocknen der Netze an Strande;
4. Verwendung von Holz . . .".
Es wird dann weiter fortgefahren: "Was die Urkunde gewährt oder auch nur bestätigt, sind demnach Befugnisse auf dem Strande selbst; den Fischern soll es gestattet sein, auf holsteinschem Strande, also auf holsteinschem Grund und Boden, alle jene Handlungen vorzunehmen, die nötig sind, um die Wadenfischerei ordnungsmäßig durchführen zu können. Von dem Fischereibetrieb selbst, soweit er sich auf dem Wasser abspielt, enthält das Privileg nichts; konnte es auch nicht. Denn die Wasserflächen an der holsteinischen Küste waren zu einer Zeit, welcher der Begriff des Küstengewässers noch unbekannt war, offenes Meer und unterlagen noch keiner Verfügungsgewalt des Uferstaates; hier bedurfte es also für die lübischen Fischer keiner Privilegierung oder besonderen Anerkenntnis." Lübeck habe ein "besonderes Privatrecht" am Strande erhalten, das es durch seine Fischer nutzen ließ.
Das Mecklenburger Staatsarchiv hat dem gegenüber zunächst darauf hingewiesen 97 ), daß diese Urkunde keineswegs die bloße Gewährung von Strandnutzungen enthalte, sondern außerdem das Zugeständnis des freien Fischfangs im Küstenmeere, und daß die einzelnen Strandnutzungen von der eigentlichen Fischerei getrennt würden.


|
Seite 63 |




|
Rörig. hat darauf in seinem zweiten Gutachten ausgeführt 98 ): Die Worte in der "wichtigen" holsteinischen Urkunde "per totum districtum dominii nostri apud maria" bedeuteten: "im ganzen Gebiet unserer zwingenden Gewalt an dem Meere (entlang)". Das Herrschaftsgebiet läge also am Meere, schlösse es aber nicht ein. Die spezialisierten Bestimmungen der Urkunde sprächen eindeutig von Freiheiten am festen Ufer. Nur die ersten Worte "piscatione libere frui debent" "könnten zweifelhaft sein". Das Mecklenburger Staatsarchiv mache infolge seiner Annahme eines mecklenburgischen Fischereiregals am Küstengewässer aus dem "districtus dominii apud maria" den "Strand nebst dem Meere an der Küste". Es sei aber unzulässig, Analogieschlüsse aus Ergebnissen für die mecklenburgische Küste zu ziehen, außerdem täte die Auslegung des Staatsarchivs dem Wortlaut der Urkunde Gewalt an. Rörig schließt dann: "Ich bleibe im Einvernehmen mit Rehm bei dem früher Gesagten."
Das Mecklenburger Staatsarchiv ist darauf in seinem letzten Gutachten 99 ) nochmals ausführlich auf die Urkunde von 1252 eingegangen und hat m. E. die Stellungnahme Rörigs schlagend widerlegt. Ich möchte hier noch folgendes hinzufügen:
Die ganze Auslegung Rörigs erklärt sich lediglich aus seiner absonderlichen Ansicht, daß die Landesherren an sich keine Verfügungsgewalt am Meere gehabt hätten, und daß Ausnahmen nur bei "Meeresteilen" als "Zubehör" von Binnengewässern vorhanden gewesen seien. Eine unbefangene Auslegung der Urkunde von 1252 kann auch, ganz abgesehen von einer Verwertung der sonstigen Quellen, zu gar keinem anderen Ergebnis gelangen, als daß es sich hier um die Verleihung der abgabenfreien Meeresfischerei handelt. Die zahlreichen Quellenbelege aus dem gesamten Gebiete der Ostseeküste verstärken aber dies Ergebnis zu einer unumstößlichen Gewißheit. M. E. können "Zweifel" hier überhaupt nicht vorhanden sein. Über die wörtliche Übersetzung habe ich mich oben ausgesprochen. Die Auslegung Rörigs führt zu ganz unverständlichen Ergebnissen für den "abgabenfreien Fischfang" 100 ). In seinem neuesten


|
Seite 64 |




|
Gutachten sagt Rörig 101 "Ich bleibe dabei, daß es sich in ihr (der Urkunde von 1252) ausschließlich um Vergünstigungen handelt, die den lübischen Fischern im ganzen Landgebiet des Grafen, soweit es ans Meer stößt, erteilt werden. Der freie Genuß der Fischerei besagt nichts anderes als die Freiheit von dem theloneum, bedeutet: Abgabenfreiheit vom Fange. Die Erhebung des theloneums hat aber hier ebenso wenig etwas mit einem Fischereiregal zu tun wie auf Rügen oder in Schonen." Die Auslegung Rörigs wird hierdurch nicht verständlicher. Offenbar denkt er an einen "Zoll", der am Lande erhoben wurde. Aber wenn dies eine Abgabe vom Fischfang ist, so handelt es sich eben um ein Hoheitsrecht in bezug auf die Fangstätte, und das ist das Meeresgewässer und nicht das Land. Im übrigen ist von einem "theloneum" gar nicht die Rede, und selbst wenn dies der Fall wäre, würden wir es mit der Fischereiabgabe zu tun haben, wie wir sie in dieser Bezeichnung in völlig eindeutigen Quellen kennen gelernt haben. Auch der ganze Aufbau der Urkunde spricht gegen Rörig, denn eine Zollabgabe auf dem Lande käme doch erst nach der Landung in Betracht. - Ebenso unverständlich ist mir auch die Berufung Rörigs auf die holsteinsche Urkunde von 1247, in der er eine "gewichtige Stütze" für seine Ansicht gefunden zu haben glaubt. Denn es ist schlechterdings unmöglich, einen Unterschied machen zu wollen zwischen einem "concedere jus piscandi" und einem "piscatione frui debent", und wenn an einer Stelle der Urkunde von 1247 "liber" in Zusammenhang mit einem "theloneum" gebracht wird, so haben wir doch unzählige Urkunden, in denen dies der Fall ist. Die "libera piscatio" aber ist, wie unsere Quellenbelege einwandfrei dartun, ein Fischfang, für den eine Fischereiabgabe nicht bezahlt zu werden braucht, welche an sich auf Grund einer Fischereihoheit geschuldet wurde.
Auch Lübeck selbst hat das Privileg von 1252 in der späteren Zeit für einen Fischereibetrieb auf dem Küstengewässer verwertet 102 ). - Und so hat denn auch bereits Carl Rodenberg


|
Seite 65 |




|
in seinen Darlegungen über "Die älteste Urkunde für die Stadt Kiel von 1242" anläßlich des Kieler Hafenprozesses über unsere holsteinsche Urkunde von 1252 folgendes ausgeführt 103 ):
"Im Jahre 1252 gewähren die Grafen Johann und Gerhard den Fischern von Lübeck in den Meeren ihres ganzen Herrschaftsbereichs freien Fischfang."
Und in der Anmerkung 2 dazu heißt es:
"Hier wird verfügt für den ganzen Herrschaftsbereich der Grafen, und zwar 1. Für das Meer und 2. für das Ufer. Die Grafen rechneten also die maria zu dem districtus dominii nostri."
II. Allgemeine Folgerungen für das streitige Küstengewässer. Wir wissen, daß das gesamte von Lübeck in Anspruch genommene Küstengewässer in der Lübecker Bucht liegt und an der Strecke Priwall-Harkenbeck einen Meeresteil ergreift, welcher der Mecklenburger Küste vorgelagert ist.
Aus unseren Betrachtungen über die Rechtsverhältnisse an den Küstengewässern im Mittelalter können wir daher für diese Strecke - das streitige Küstengewässer - gewisse allgemeine Folgerungen ziehen:
1. Wir konnten für das Mittelalter, jedenfalls seit dem 13. Jahrhundert, ein Hoheitsrecht der Landesherren an ihren Küstengewässern an der Ostsee feststellen. Wir sahen, wie auch Mecklenburger Belege ein solches Hoheitsrecht bestätigen, und wie gerade auch in der Lübecker Bucht auf der der Mecklenburger Seite gegenüber liegenden holsteinschen Seite ein solches Hoheitsrecht anzutreffen war. Es ist hieraus der Schluß zu ziehen, daß auch an der Mecklenburger Seite der Lübecker Bucht und insbesondere an der Strecke Priwall-Harkenbeck ein Hoheitsrecht des Mecklenburger Landesherrn am Küstengewässer seit dem 15. Jahrhundert bestand.
2. Hieraus ergibt sich aber für unseren Streitfall:
a) Lübeck kann durch Okkupation ein Hoheitsrecht an der Mecklenburger Küste Priwall-Harkenbeck nicht erworben haben. Auf dieser besonderen Grundlage kann also Lübeck seinen Anspruch nicht aufbauen.


|
Seite 66 |




|
b) Somit bleiben nur noch die beiden besonderen Grundlagen: Gewohnheitsrecht und Unvordenklichkeit, zu prüfen.
c) Wir sahen, daß das Hoheitsrecht am Küstengewässer bereits im Mittelalter ein umfassendes Recht mit verschiedenen Ausstrahlungen ist. Soll also wirklich die Gebietshoheit an ihm durch Gewohnheitsrecht oder Unvordenklichkeit erworben werden, so setzt dies den Nachweis der fortgesetzten Ausübung verschieden gearteter wesentlicher Hoheitsrechte voraus. Insbesondere käme Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung in Betracht.
3. Von besonderer Bedeutung ist noch die holsteinsche Urkunde von 1252 104 ). Da sie sich auf das der Mecklenburger Seite der Lübecker Bucht gegenüber liegende Ufer bezieht und Lübecker Nutzungsrechte betrifft, so lassen sich aus ihr entsprechende Vermutungen auch für die Mecklenburger Seite, insbesondere die Strecke Priwall-Harkenbeck, und für Lübecker Rechte an ihr ziehen.
Infolgedessen ist es von Wichtigkeit, zweierlei hier für die Rechtsverhältnisse am holsteinschen Küstengewässer nach Maßgabe der Urkunde von 1252 festzustellen:
a) Die Lübecker erhalten durch sie kein Hoheitsrecht. Sie erhalten lediglich private Fischereinutzungsrechte im Küstengewässer und gewisse private Rechte am Ufer selbst. Das gesamte Hoheitsrecht, auch die Fischereihoheit, bleibt beim Landesherrn.
b) Die Lübecker erhalten kein ausschließliches Fischereinutzungsrecht. Sie erhalten ja gerade abgabenfreien Fischfang, der normale Fischfang wird also gegen Abgaben von anderen betrieben 105 ).


|
Seite 67 |




|
II.
("Travemünder Reede").
Ehe wir an eine Betrachtung der Ausübung einzelner wirklicher oder angeblicher Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer gehen, empfiehlt sich eine Prüfung über die Abgrenzung des gesamten, von Lübeck in Anspruch genommenen Küstengewässers.
Wir fragen:
- Wie gewinnt sie Rörig? Sind seine Ergebnisse stichhaltig? (I)
-
Seit wann hat man in Lübeck eine solche
Abgrenzung ausdrücklich vertreten? (II)
Alsdann ziehen wir die Folgerungen aus diesen Betrachtungen für das streitige Küstengewässer (Strecke Priwall-Harkenbeck) unter III.
I. Rörig geht bei seiner Abgrenzung 106 ) von der sog. Nautischen Reede, d. h. einem Ankerplatz für Schiffe, aus. Zu ihr werden die Meeresstreifen hinzugenommen, die zwischen ihr und dem Lande liegen, sowohl nach der Mecklenburger wie nach der holsteinschen Seite, unter Angabe ihrer Endpunkte am Lande (Harkenbeck einerseits - Brodtmer Pfahl andererseits). Seewärts wird das Gebiet dann abgegrenzt durch eine Richtungslinie Harkenbeck-Pohnsdorfer Mühle-Gömnitzer Berg und durch ein Lot, das von dem Brodtemer Pfahl auf diese Richtungslinie gefällt ist. Das so abgegrenzte Gebiet sei als Travemünder Reede im weiteren Sinne bezeichnet worden.
Nun wäre es doch zweifellos das wichtigste gewesen, möglichst genau die Lage der nautischen Reede nach Maßgabe der alten Quellen anzugeben. Allein dies geschieht nicht. Es wird lediglich auf die Kartenskizze II im Anhang verwiesen,. und da finden wir die nautische Reede eingezeichnet und in der Kartenerklärung heißt es für sie: "10 m Wassergrenze (ungefähre Abgrenzung der Reede im nautischen Sinn)". Hiermit ist aber die Lage der alten nautischen Reede in keiner Weise bewiesen;


|
Seite 68 |




|
auch in dem zweiten Gutachten Rörigs ist dies nicht geschehen 107 ). - Soviel aus dem bisher vorgebrachten Material zu erkennen ist, ist nun aber die von Rörig angenommene Lage Der alten nautischen Reede unzutreffend. Mit ihr stimmt, wie wir noch sehen werden, die Aussage des Zöllners Tydemann von 1547 in keiner Weise überein, und das Mecklenburger Staatsarchiv hat weitere Belege dafür beigebracht, daß die alte Reede dicht vor der Travemündung am westlichen Teile der Bucht gelegen war 108 ).
Wir kommen nun auf die Hinzunahme der "Wasserstreifen"- zwischen der nautischen Reede Rörigs und den Ufern - zu der nautischen Reede.
Für uns steht dabei im Vordergrund die Mecklenburger Seite, doch soll auch über die holsteinsche Küste etwas hinzugefügt werden.
Für die Mecklenburger Seite führt Rörig 109 ) als Beleg zunächst an die Aussage des Zöllners Tydemann von 1547:
"dath ein erbar radt to Lübeck je und allewege strom und strant van der reyde an beth in die Harkenbeke tho verbiddende gehett hebben, we ock noch in desse stunde."
Allein diese Worte ergeben nicht einen Wasserstreifen zwischen einer Reede und einem Ufer, so daß die Reede die eine Längsgrenzenseite, das Ufer die gegenüberliegende Längsseite bildet. Der Ausdruck "von der Rede an bis in die Harkenbeck" kann unmöglich in diesem Sinne verstanden werden. Dagegen finden die Worte ihre Erklärung durch die Untersuchungen des Mecklenburger Staatsarchivs 110 ), welches würdigt, daß die Aussage des Zöllners anläßlich einer Vernehmung über das Strandrecht am Priwall abgegeben wurde. Daher war die Küste des Priwalls in der Uferstrecke von der Reede bis zur Harkenbeck eingeschlossen. Mit Recht folgert das Staatsarchiv hieraus, daß die alte nautische Reede nordwestlich vom Priwall oder wenigstens diesem gegenüber gelegen haben muß. Wenn


|
Seite 69 |




|
dies aber der Fall ist, so erscheinen die Worte des Zöllners "von der Reede an bis in die Harkenbeck" verständlich, indem sie so auf einen Strom und Strand hinweisen, die in der Weise liegen, daß die Reede nur die westliche, die Mündung der Harkenbeck die östliche Grenzbestimmung angibt.
Als weiteren Beleg für einen solchen "Meereszwischenstreifen" zwischen Reede im nautischen Sinn und dem Ufer führt Rörig den Fischereivergleich von 1610 an.
Hier heißt es:
"Erstlich sollen die Travemünder Fischer mit Setzung ihrer Netze sich des Travestrohms binnen und außerhalb des Blockhauses wie dann auch der ganzen Reide gantzlich enthalten, bey . . ; zwischen dem Blockhause aber und dem Mevenstein an der Holstenseiten, auch der Harkenbeke und Blockhause auf der Meckelborgerseiten mogen sie ihre Netze setzen . . ." "Außerhalber aber gemelter Orten mögen die Travemünder in die Sehe und am Lande fischen und Netze setzen als sie best können."
Zweifellos handelt es sich bei der Fischereistrecke "Harkenbeke und Blockhause" um die Meeresstrecke am Mecklenburger Ufer bis zur Mündung der Harkenbeck. Aber daß diese Meeresstrecke eine Wasserfläche ist "zwischen der Reede (im nautischen Sinn nach Rörig) und der Küste", ergibt sich in keiner Weise aus dem Vergleich.
Noch weniger ergibt dafür etwas der Vergleich von 1826, denn in diesem ist von der nautischen Reede überhaupt nicht die Rede. Und wenn Rörig bemerkt, daß die Fischer im Jahre 1827 diesen Vergleich "Vergleich wegen Befischung des Ufers der Travemünder Reede" genannt hätten, so ist durch nichts bewiesen, daß mit der "Travemünder Reede" hier die nautische Reede Rörigs gemeint ist, auch wäre diese Bezeichnung selbst dann keineswegs" ganz zutreffend", denn die Strecke wäre nicht allein das Ufer der nautischen Reede, sondern auch das Ufer der Außentrave. Die Erklärung des Mecklenburger Staatsarchivs, daß die Fischer die Worte "Travemünder Reede" im Sinne von Travemünder "Bucht" gebrauchen 111 ), ist daher die zutreffende. Alsdann ist aber auch der Ausdruck in der Relation zum Urteil des Oberappellationsgerichts Lübeck von 1825 (das diesem Ver-)


|
Seite 70 |




|
gleich voranging) "Ende der Rehde, wo die Harkenbeck sich ergießt," einfach auf das Ende der "Bucht" zu beziehen 112 ).
Für die holsteinsche Küste 113 ) wird die Hinzunahme von Meeresstreifen zwischen nautischer Reede und Ufer von Rörig gefolgert zunächst für die Zeit, ehe Brodten lübeckisch wurde, aus den Verhandlungen Lübecks mit dem Domkapitel im Jahre 1775, bei denen Lübeck ein Jahrzehnte lang ausgeübtes Recht, am Brodtmer Ufer Steine zu holen, geltend machte. Rörig meint, ein "derartig weitgehendes wirtschaftliches Nutzungsrecht am Strande eines fremden Territoriums" sei "selbstverständlich undenkbar", "wenn Lübeck nicht zum mindesten auf der Wasserfläche vor dem Strande Gebietshoheit gehabt hätte". Daher sei auch diese Wasserfläche mit zu der nautischen Reede hinzugenommen worden. - Wir meinen, daß es "selbstverständlich undenkbar" ist, aus einem Recht, vom Wasser aus an einem fremden Ufer Steine zu holen, eine Gebietshoheit des Steineholenden an der vorgelagerten Wasserfläche zu folgern 114 ). Im übrigen ist zu betonen, daß bei der ganzen Angelegenheit von einzelnen Meeresstreifen zwischen nautischer Reede und Ufer nirgends gesprochen wird. - Für die spätere Zeit beruft sich Rörig auf einen Bericht des Travemünder Stadthauptmanns von 1804, in welchem dieser von dem "Ufer längs der Rehde am Brodtener Felde" redet, und auf den Niendorfer Fischereivergleich von 1817, in welchem als Anfangspunkt seines Gebietes die "travemünder Reede" genannt wird. Hier handele es sich um die Travemünder Reede im weiteren Sinn. Allein das Mecklenburger Staatsarchiv hat m. E. nachgewiesen, daß der Ausdruck "Reede" hier einfach im Sinne von Travemünder "Bucht" gebraucht ist 115 ). 116 ).


|
Seite 71 |




|
Ganz mißglückt ist schließlich Rörig die Abgrenzung des Küstengewässers nach der Seeseite hin 117 ). Durch die Darlegungen des Mecklenburger Staatsarchivs wird er völlig widerlegt 118 ). Die angebliche Richtungslinie Harkenbeck-Gömnitzer Berg hat es überhaupt nie gegeben und konnte es nicht geben, und die Eingabe des Travemünder Lotsenkommandeurs vom 8. Februar 1828 kann unmöglich sie gemeint haben, denn nach ihr befand man sich schon eine Seemeile vor Travemünde in offener See außerhalb der Reede. Mit dieser Richtungslinie bricht aber auch die völlig unnatürliche Lotlinie vom Brodtmer Pfahl, die einen sonderbaren spitzen Winkel für das angebliche Lübecker Küstengewässer herausschneiden würde, ganz zusammen.
Wir erwähnten bereits; daß Rörig Belege anführt, aus denen sich ergeben soll, daß mit "Reede" auch das gesamte, von ihm abgegrenzte Küstengewässer bezeichnet worden sei. Wir sahen aber, daß bei diesen Belegen aus dem 19. Jahrhundert "Reede" nur in dem belanglosen Sinne von Travemünder Bucht: gebraucht worden ist. Nun beruft sich aber Rörig für seine "Reede" im weiteren Sinn auch darauf, daß bei den Fischreusenstreitigkeiten - von 1616 und 1658 Lübeck geltend machte, daß auf der "statt reyde" die Reusen angelegt worden seien, die Anlage aber auf den Meeresstreifen vor der Mecklenburger Küste erfolgt sei 119 ). Dem gegenüber sei bereits hier darauf hingewiesen, daß dieses angebliche Lübecker Herrschaftsgebiet von Mecklenburger Seite sofort bestritten wurde 120 ). Und es ist durchaus irreführend, wenn Rörig einfach sagt 121 ), daß in dem sich anknüpfenden Schriftwechsel der Herzog von Mecklenburg für dieselbe Wasserfläche "die rede oder der strohme" gebraucht habe. Denn in Wirklichkeit handelt es sich bei dem Herzog um eine Ablehnung des von den Lübeckern vertretenen Standpunktes unter Verwendung, aber gleichzeitiger Ablehnung des von den Lübeckern beliebten Sprachgebrauchs: "Entlich können wir Euch auch des Angebens, das inhalts obberurten Eurn Schreibens die Reide oder der Strom der Ends Euch gehörig sein solte, gar nit einig sein, inmassen wir demselben hiemit feirlich wollen contradicieret und wiedersprochen haben."


|
Seite 72 |




|
II. Ehe Rörig sein erstes Gutachten erstattete, ist von Lübeck ein Hoheitsrecht über die Gewässer in der Travemünder Bucht mit den von Rörig angegebenen Grenzen niemals ausdrücklich geltend gemacht worden.
Im Gegenteil, man suchte seit dem Jahre 1870 die Hoheitsgrenze ganz anders zu bestimmen. Im Jahre 1870 nahm das Lübecker Stadt- und Landamt eine Hoheitsgrenze an von einer Seemeile ins Meer, von der Landgrenze Lübecks an gerechnet 122 ), im gleichen Jahre, und zwar am 10. Oktober 1870, schrieb der Senat der freien und Hansestadt Lübeck auf eine Anfrage an die Kgl. Regierung zu Schleswig,
"daß nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen auf Kanonenschußweite vom lübeckischen Ufer dem hiesigen Staate das Recht der Fischerei ausschließlich zusteht" 123 ).
Im Jahre 1895 berichtet das Lübecker Stadt- und Landamt 124 ), "daß Lübeck von jeher mit obrigkeitlichen Anordnungen auf den Teil der Travemünder Bucht innerhalb der Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld sich beschränkt habe", und daß jenseits dieser Linie die "freie See" liege.
Das Lübecker Fischereigesetz vom 11. Mai 1896 nahm dann diese Linie als Grenze an innerhalb der Travemünder Bucht.
Der fünfte Nachtrag zu diesem Gesetz vom 10. Januar 1925 setzte an Stelle dieser Beschreibung die "Travemünder Reede". Und eine Bekanntmachung vom gleichen Datum begrenzte diese "Reede" nach Maßgabe des Gutachtens von Rörig.
Es ist daher festzustellen, daß Lübeck sich erst durch die gesetzliche Regelung vom 10. Januar 1925 zu dem jetzt von ihm in Anspruch genommenen Küstengewässer bekannt hat.
III. Folgerungen für das streitige Küstengewässer (Strecke Priwall-Harkenbeck).
Wir können aus den vorstehenden Betrachtungen folgende Folgerungen für das Küstengewässer Priwall-Harkenbeck ziehen
1. Aus den Ausführungen unter I ergibt sich:
a) Das Küstengewässer Priwall-Harkenbeck ist nicht ein Meeresstreifen, der zwischen dem Ufer und einer nautischen


|
Seite 73 |




|
Reede in der von Rörig skizzierten Weise liegt: Es ist kein Meeresstreifen, der längshin auf der dem Ufer gegenüberliegenden Seite von der nautischen Reede begrenzt wurde. Mit dieser Feststellung ist eine grundlegende Vorstellung Rörigs für die angebliche Hinzunahme des Meeresstreifens zu dem Hoheitsrecht über die nautische Reede beseitigt. Für Rörig kommt der Meeresstreifen als notwendiger Schutzstreifen für die Hoheit über die nautische Reede in Betracht. Allein die wirkliche Lage der alten nautischen Reede zeigt, daß dies in keiner Weise der Fall war. Man vergleiche hierzu die Kartenskizze II Rörigs und die Kartenskizze des Mecklenburger Staatsarchivs (Archiv II zwischen S. 126 und 127). Man erkennt dann, wie völlig schief es z. B. ist, wenn Rörig im Hinblick auf das streitige Küstengewässer sagt 125 ): "Die Entstehung von Hoheits- und Nutzungsrechten an den Strandmeeren zwischen Reede und Ufer erfolgte nicht in der Richtung von der Küste nach der angeblich herrenlosen See zu, sondern in der Richtung von der mit Hoheitsrechten bereits erfüllten Reede im nautischen Sinn in der Richtung auf die Ufer hin, gleichgültig wessen Hoheit diese unterstanden." Und wie es in keiner Weise auf das streitige Küstengewässer paßt, wenn Rörig sagt: "Es ließe sich der Gedanke der Herrschaft des die Hoheit auf der Reede im nautischen Sinn besitzenden Staates über die Strandmeere der Reede aus dem Bedürfnis und Verlangen nach Schutz des die Reedehoheit besitzenden Staates und seiner Interessen ableiten" 126 ).
b) Es ist nicht nachgewiesen, daß das streitige Küstengewässer einen Teil eines "Hoheitsgebietes" bildet, der als "Reede" bezeichnet wurde.
c) Die Begrenzung des streitigen Küstengewässers nordöstlich seewärts durch die Richtungslinie Harkenbeck-Gömnitzer Berg ist unhaltbar. Es fehlt also an der notwendigen Grenzziehung, wie sie für eine erfolgreiche Inanspruchnahme erforderlich ist, auch an dieser Seite.
2. Aus den Ausführungen unter II ergibt sich:
Im Jahre 1870 hat Lübeck die Ansicht offiziell vertreten, daß allgemeine völkerrechtliche Grundsätze für die


|
Seite 74 |




|
Travemünder Bucht maßgebend sind. Hiermit steht die Inanspruchnahme des ganzen streitigen Küstengewässers völlig im Widerspruch.
Im Jahre 1896 hat Lübeck durch sein Fischereigesetz eine Fischereihoheit über einen Teil des streitigen Küstengewässers in Anspruch genommen (Seegrenze im Nordosten: Linie Harkenbeck - Haffkruger Feld).
Erst durch die Gesetzgebung von 1925 hat Lübeck das ganze streitige Küstengewässer in seine Fischereihoheit einzubeziehen gesucht.
III.
Wenn wir nunmehr zu einer Prüfung der Frage übergehen, auf welche Akte sich Lübeck als Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer beruft und berufen kann, so ist zunächst noch eine allgemeine Behauptung Rörigs zurückzuweisen, welche von ihm als Grundlage für seine Betrachtungen verwendet wird. Rörig behauptet nämlich, daß das ganze, von Lübeck in Anspruch genommene Küstengewässer eine rechtliche Einheit mit der Binnentrave mit Einschluß des Dassower Sees und der Pötenitzer Wiek gebildet habe und daher öffentliches Binnengewässer und Lübecker Staatsgebiet sei 127 ). Als "Thatsachen" für diese Behauptung führt Rörig zunächst das Barbarossaprivileg von 1188 an, allein wir sahen, daß dieses überhaupt nur die Binnentrave bis zur Mündung erwähnt 128 ). Es wird ferner eine Stelle aus einem Schreiben Lübecks von 1616 anläßlich der Fischereistreitigkeiten aufgeführt und auf diese sogar der größte Wert gelegt. Dabei wird aber unter anderem gar nicht hervorgehoben, daß gerade diese Stellungnahme Lübecks von Mecklenburg auf das entschiedenste bestritten wurde. Diese Stelle darf daher nicht als grundlegende "Thatsache" bewertet werden. Rörig beruft sich ferner auf Lübecker Fischereiverordnungen und Fischereigesetze (1585, 1881,1887, 1896). Allein sie könnten doch höchstens eine Fischereihoheit ergeben, im übrigen werden sie aber gar keiner eingehenden Untersuchung unterzogen. Schließlich wird auf die Eidesformel der lübischen Fischer 129 ) verwiesen, nach


|
Seite 75 |




|
welcher diese zur Aufsicht über des Rates "Ströme" verpflichtet gewesen seien, und diese auch auf dem streitigen Küstengewässer betätigt hätten. Allein auch hier würde höchstens eine Fischereihoheit herauskommen, und es fragt sich, ob sie wirklich auf dem streitigen Küstengewässer zu Recht bestanden hat. - Es kann also kein Zweifel sein, daß Rörig mit diesen "Thatsachen" die rechtliche Einheit von Binnentrave und dem Küstengewässer nicht bewiesen hat. Rörig setzt aber in seinen folgenden, einzelnen Betrachtungen immer voraus, daß dieser Beweis erbracht ist. So fehlt bei diesen eine unabhängige Würdigung 130 ), insbesondere ist es ganz unzulässig, aus Rechtsverhältnissen der Binnentrave und ihrer Ausbuchtungen schließen zu wollen, daß es bei dem Küstengewässer ebenso gewesen ist 131 ).
Was nun aber die Einzelfälle anlangt, die Rörig für die Ausübung einer Lübecker "Gebietshoheit" auf dem streitigen Küstengewässer geltend macht, so bemerkt Rörig hierüber allgemein folgendes 132 ):
"In einer großen Zahl aktenmäßig belegter Einzelfälle ist die Ausübung der Gebietshoheit Lübecks auf dem ganzen Reedegebiet (Reede im weiteren Sinn nach der Abgrenzung Rörigs) belegt. Zu nennen wären Sicherungsmaßnahmen für die Fahrt; Anlegung von Buchtfeuern; Maßnahmen der Seebefriedigung auf der Reede unter Heranziehung militärischer Machtmittel; eine allgemeine Verordnungsgewalt; Ausübung der Polizeigewalt über Jagd und Fischerei; vor allem aber das deutlichste Zeichen für volle Gebietshoheit: die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit und die Fischereihoheit. Auf letztere wird weiter unten noch einzugehen sein. Hier seien Akte der Hochgerichtsbarkeit kurz aktenmäßig nachgewiesen."
In der Tat geht Rörig darauf auf das Fahrrecht und später auf die Fischerei ein. Wir aber fragen, wo bleibt die große Zahl aktenmäßig belegter Einzelfälle für die sonstigen


|
Seite 76 |




|
von Rörig erwähnten Maßnahmen? Und betrafen sie auch das streitige Küstengewässer und nicht etwa nur insbesondere das Fahrwasser der Außentrave und die alte nautische Reede? Mit solchen allgemeinen Behauptungen ist doch gar nichts bewiesen 133 ) 134 ).
Wenden wir uns nun den Maßnahmen zu, die Rörig in spezialisierter Weise als Hoheitsakte Lübecks geltend macht. So kommen für eine Prüfung in Betracht:
1. Akte in bezug auf die Fischerei.
2. Das "Fahrrecht".
3. Maßnahmen in bezug auf gestrandete Schiffe.
Man kann also sagen, daß Maßnahmen zu prüfen sind, welche die Fischereihoheit, die Gerichtshoheit in Kriminalsachen und die Strandungshoheit betreffen. Hiernach soll im folgenden unterschieden werden.
Von Rörig wird geltend gemacht, daß Lübeck Gesetze und allgemeine Verordnungen kraft einer gebietsrechtlichen Fischereihoheit über das streitige Küstengewässer erlassen habe.
Sehen wir uns diese Fischereiverordnungen näher an.
a) Die älteste, in ihrem Wortlaut überlieferte Fischereiverordnung Lübecks, welche hier in Betracht kommt, stammt aus dem Jahre 1585.
In dem ersten Gutachten von Rörig 135 ) haben wir nur sehr wenig über sie erfahren. Er sagt eigentlich nur über sie:
"Die auf gebietsrechtlicher Grundlage aufgebaute Fischereiverordnung von 1585 erstreckt sich nach dem Wortlaut der Einleitung "up des erbaren radts und gemeiner stadt stromen und angehorigen potmessigkeiten" und regelt die Fischerei auf dem Binnengewässer so gut wie auf dem Reedegebiet."


|
Seite 77 |




|
In seinem zweiten Gutachten wird ein wenig näher auf diese Ordnung eingegangen 136 ). Rörig bemerkt, daß sie das gesamte "Strandmeer bis zur Harkenbeck ausdrücklich mit behandele". "Zunächst" werde den Schlutupern erlaubt, Laubbüschel für den Aalfang "auf der Mecklenburger Siden" am Ufer entlang zu legen, aber nur mit Wissen und Willen der Wetteherrn; es hätte "also über die Belegung des flachen Wassers am Mecklenburger Ufer der Travemünder Reede Lübeck verfügt". Es sei ferner bestimmt, daß von Jakobi bis Michaelis sich Schlutuper und Travemünder Fischer im genau angegebenen Verhältnis in die Befischung der Strecken Blockhaus-Mövenstein und Blockhaus-Harkenbeck zu teilen hätten. "Dazu treten Bestimmungen über die übrige Wadenfischerei der Schlutuper und Travemünder noch über die angegebenen Strecken hinaus bis in die opene wilde see."
Um zu einer richtigen Würdigung der Fischereiverordnung von 1585 zu gelangen, können aber diese spärlichen und z. T. ungenauen und nicht zutreffenden Betrachtungen nicht genügen.
Sehen wir uns zunächst den Eingang der Verordnung 137 ) an; hier heißt es:
"Nachdem einem erbarn rade van ohren underdanen den olderluden und gemeinen vischern sowol binnen dieser stadt alß tho Travemunde und Schluckup geseten allerhandt Klagen vorgekamen, dat de fischerey up des erbarn radts und gemeiner stadt stromen und angehorigen potmeßigkeiten eine tydt hero in unrichtigkeit geraden und einer dem andern baven alt hergebrachte gewonheit desfalls jmpaß gedahn . . ., hefft ein erbar radt . . . folgendes jedem deel thor gewissen nachrichtung, wo with, wanne, wolang und" woferne ein jeder der visherey gebrucken solle und möge, diese Verordnung . . . verfaten laten."
Es wird darauf zunächst die Fischerei der Lübecker, dann die der Schlutuper und schließlich die der Travemünder Fischer geregelt. Doch sind in mancher Hinsicht die Regeln für die einzelnen Fischergruppen nicht getrennt.
Was die Fischereigebiete anlangt, so wird unterschieden die Fischerei "binnen der Traven" und "buten der Traven".


|
Seite 78 |




|
Das Gebiet außerhalb der Trave wird auch mit "See"b bezeichnet. Vergleiche hierfür die Bestimmungen:
"Steit den Schluckupern fry, mit der enckelen waden van dem bolwercke an jnn der sehe an beiden siden des landes, so fernne alß se sich wagen wöllen, von Michaelis an beth tho Winnachten tho fischenn,"
und
"De Travemunder mögen -jn der see buten der traven . . . vischen."
In dem Gebiet außerhalb der Trave (also in der "See") wird unterschieden eine Fischerei mit den Strecken Blockhaus-Mövenstein und Blockhaus-Harkenbeck, ferner eine Fischerei in der "Wieck" und schließlich eine Fischerei in der offenen See, soweit wie ein jeder sein Leben wagen will.
Was die Regelung der Fischerei außerhalb der Trave anlangt, so ist die für uns wichtigste in den ersten und zweiten Artikeln der Reglung für die Travemünder Fischer enthalten. Hier ist bestimmt:
a) "De Travemunder vischer mögen jnn der see buten der Traven dag vor dag, wenn ehnen gelevet, so with sich des erbarn radts gerechtigkeit erstrecket und se ohre helse wagen willen, vischen . . ."
b) "Tom andern, offt ock wal de Travemunder und Schluckuper na oldern gebrucke befoget, dat ganze jahr dorch van Travemünde an beth in de wick und opene wilde see, so with ein jeder sin levent wagen will, tho vischen," so soll künftighin in der Zeit von Jakobi bis Michaelis folgender Unterschied gemacht werden:
Die Travemunder können alsdann alle Tage fischen auf den Strecken Blockhaus-Mövenstein und Blockhaus-Harkenbeck, ferner in der "Wiek" und der offenen See.
Die Schlutuper aber dürfen in dieser Zeit fischen,
mit 1/3 ihrer Waden und nur am Montag vormittags und in drei Nächten der Woche auf den Strecken Blockhaus-Mövenstein und Blockhaus-Harkenbeck,
mit 2/3 ihrer Waden alle Tage außerhalb dieser Strecke in der Wieck und der offenen See.
Um zum Verständnis der Ordnung von 1585 zu gelangen, ist naturgemäß von der Einleitung auszugeben. Hier heißt es, daß Klagen von den Untertanen, und zwar den Fischereikorporationen der Lübecker, der Travemünder


|
Seite 79 |




|
und der Schlutuper, an den Rat gekommen sind über die Fischerei auf des Rates und der Stadt Ströme und "angehorigen potmeßigkeiten", und daß deshalb die (Ordnung verfaßt worden ist, welche angibt, wie weit, wann, wie lang und inwiefern ein jeder die Fischerei gebrauchen soll. Nun kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auf den "Strömen" der Stadt die Fischereihoheit zustand, und daß der Ausdruck "angehorige potmeßigkeiten" übersetzt werden kann mit "zugehörigen Gebieten, die unter der Botmäßigkeit der Stadt stehen", also mit "zugehörigen Hoheitsgebieten". Nur größte Oberflächlichkeit könnte aber hieraus folgern, daß infolgedessen alle in der Ordnung selbst behandelten Fischereigebiete und infolgedessen ohne weiteres auch die Strecke Priwall-Harkenbeck unbedingt zu den Hoheitsgebieten der Stadt gerechnet wurden. Dies bleibt vielmehr zu prüfen.
α) Es ist daher zunächst zu fragen, ob die Ordnung von 1585 wirklich nur Gebiete umfaßt, welche der "Botmäßigkeit" der Stadt, also ihrer Hoheit, unterstanden?
Da aber erkennen wir, daß die Ordnung auch die Fischerei in der "Wiek" und darüber hinaus in der weiterliegenden See, ferner aber auch in der über die Harkenbeckmündung hinausliegende See zuweist und regelt.
Unter der "Wiek" ist die Niendorfer Wiek zu verstehen; sie wird teils selbständig genannt, teils ist sie in der "See" eingeschlossen. Allgemein wird die Fischerei außerhalb der Trave in der See zugewiesen mit den Worten "Soweit sich des erbarn radts gerechtigkeit erstreckt und se ohre helse wagen willen".
Wie aber stand es mit der Fischerei der Stadt in der Niendorfer Wiek und der darüber hinausliegenden See an der holsteinschen Küste? Wir erinnern uns an das wichtige Privileg von 1252, durch welches Lübeck die abgabenfreie Fischerei an der ganzen holsteinschen Küste erhielt 138 ). Wir haben festgestellt, daß die Lübecker hiermit lediglich ein privates Nutzungsrecht, aber kein Hoheitsrecht, auch keine Fischereihoheit, bekamen 139 ).
Hat sich hierin etwas in der späteren Zeit geändert? Da ist es nun von Wichtigkeit, daß gerade kurze Zeit vor der Ordnung von 1585 Lübeck selbst gegenüber dem Amtmann von Cismar sich auf dieses Privileg von 1252 berufen hatte. Nach den Mit-


|
Seite 80 |




|
teilungen von Rörig 140 ) glaubte im Jahre 1577 der Amtmann von Cismar, der Lübecker Fischerei an der Küste seines Amtsbezirkes ("auf seines amptes gepitte") entgegentreten zu sollen.
Es sei ihm "ganz ungeheuerlich" erschienen, daß die Travemünder Fischer "in eines Fürsten jurisdiction oder grundt und boden fischerei zu halten macht haben konnten". Als sich die Lübecker auf das Privileg von 1252 beriefen, erklärte sich 1583 schließlich der Amtmann bereit, "den Travemündern an der Küste seines Amtes keine Schwierigkeiten mehr zu machen". Der Amtmann erkannte also die Fischereiberechtigung der Lübecker nach Maßgabe des Privilegs von 1252 an, eine Gebietshoheit oder Fischereihoheit auf dem Küstengewässer seines Amtes hat er dagegen nicht eingeräumt, ebenso wenig auch ein ausschließliches Fischereinutzungsrecht der Lübecker. Auch an anderen Küstenstrecken Holsteins ist es um die gleiche Zeit zu Streitigkeiten gekommen; aus den Mitteilungen Rörigs 141 ) ergibt sich, daß man hier zu gewissen Abgrenzungen der Fischereiberechtigung der Lübecker und der Küstenbewohner kam, so war es insbesondere auch in der Niendorfer Wiek 142 ). Es hat sich also gegenüber dem Privileg von 1252 nichts Grundlegendes geändert 143 ).
Es ergibt sich somit, daß die "Wieck" und die sonstigen Küstengewässer der holsteinschen Küste von der Ordnung von 1585 mit umfaßt werden, aber der "Hoheit" der Stadt oder ihrer "Botmäßigkeit" nicht unterstanden 144 ). Was Lübeck hier hatte, sind private, nicht ausschließliche Fischereiberechtigungen, und sie werden in der Ordnung den drei Fischereikorporationen erneut zugewiesen unter Schlichtung von Streitigkeiten, wobei wir gewisse Beschränkungen der Schlutuper finden. In bezug auf diese Berechtigungen tritt Lübeck als gewöhnlicher Fischereiberechtigter in fremden Gewässern auf, der nur dadurch Besonderheiten aufweist, daß ihm eine Korporationshoheit zusteht 145 ). Dritten gegenüber wird ein Hoheitsrecht gar nicht gehandhabt. Man würde ja auch sonst zu dem "ungeheuerlichen" Ergebnis gelangen, daß


|
Seite 81 |




|
Lübeck sich ein Hoheitsrecht nicht allein über die Wiek, sondern über das ganze holsteinsche Küstengewässer beigelegt habe 146 ).
Wird das Gesagte berücksichtigt, so erscheint es durchaus verständlich, daß die Ordnung von 1585 in bezug auf die Fischerei "außerhalb der Trave in der See" davon spricht, daß sie reiche, "soweit sich des Rates Gerechtigkeit erstrecket und sie ihre Hälse wagen wollen". Der Ausdruck "Gerechtigkeit" ist hier in dem allgemeinen Sinn von "Berechtigung" zu nehmen. Gleichzeitig erkennt man, daß der Ausdruck "Botmäßigkeit" in der Einleitung der Ordnung zu weitgreifend gefaßt ist und infolgedessen mit dem Inhalt der Ordnung in Widerspruch steht 147 ).
Es entsteht allerdings die Frage, ob es nicht etwas Auffälliges ist, wenn Lübeck in einer einheitlichen "Ordnung" die Fischerei auf seinen Hoheitsgebieten und die Fischerei in fremden Gewässern, auf denen ihm nur Fischereiberechtigungen zustanden, behandelt. Wir können diese Frage wohl am besten dadurch erledigen, daß wir bemerken, daß Lübeck auch noch in neuester Zeit ausdrücklich eine solche Fischereiordnung erlassen hat. Die Fischereiordnung für den lübeckischen Freistaat vom 28. Februar 1881 bestimmt in § 1:
Die Fischereiordnung findet Anwendung auf die Küsten- und Binnenfischerei in allen unter lübeckischer Staatshoheit befindlichen und denjenigen fremdherrlichen Gewässern, auf denen und insoweit ein lübeckisches Mitbefischungsrecht ausgeübt wird, mit Ausnahme der geschlossenen Gewässer.
β) Wie stand es nun mit dem streitigen Küstengewässer (Strecke Priwall-Harkenbeck)?
Da ist nun jedenfalls das Nächstliegende, daß es von Lübeck mit als fremdherrliches Gewässer hereingezogen worden ist, in dem ihm Fischereiberechtigungen zustanden. Es handelt sich ja bei ihm genau so wie bei der Wiek und den


|
Seite 82 |




|
sonstigen holsteinschen Küstengewässern um ein Küstengewässer an einem fremden Territorium. Auch an ihm bestand an sich ein landesherrliches Hoheitsrecht 148 ). Offenbar sind die Fischereirechte Lübecks hier aber auf Grund stillschweigender Duldung des Landesherrn erworben worden 149 ). Daß sie alsdann kräftiger ausgestaltet gewesen sein sollten wie an der holsteinschen Küste, ist besonders unwahrscheinlich 150 ). Und ebenso wenig haben wir Anlaß, Lübeck unterzuschieben, daß es in der Ordnung von 1585 mehr in Anspruch nahm, als ihm wirklich zukam.
Zunächst ist allerdings bei ihr eine Auslegung Rörigs richtigzustellen. Es wird in der Ordnung von 1585 den Schlutupern erlaubt, "jedem söhs questen up der mekelborger siden by Scharlang to leggenn, jedoch mit der weddeherrn weten, willen und nalath". Rörig sagt über diese Erlaubnis zur Legung von Laubbüscheln zum Aalfang: "Also über die Belegung des flachen Wassers am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Reede verfügt 1585 nicht etwa Mecklenburg, sondern Lübeck" 151 ). Rörig versteht natürlich unter der "Travemünder Reede" hier die von ihm konstruierte Reede im weiteren Sinn. Allein eine Begrenzung des Ufers ist hier gar nicht angegeben, sie hätte aber durch Nennung der Harkenbeck erfolgen müssen, da die Ordnung auch die Fischerei außerhalb der Harkenbeck kennt. Da aber unmöglich das ganze Mecklenburger Seeufer ohne Grenze gemeint sein kann, läßt sich hieraus schon folgern, daß überhaupt die ganze Ortsbestimmung Rörigs nicht richtig ist. Offenbar bezieht sich die Stelle auf das Ufer an der Binnentrave an der Mecklenburger Seite 152 ). Und dies wird bestätigt durch eine andere Stelle der Ordnung von 1585, in der es heißt, daß die Travemünder "jnn der traven mit leggung der queste und angeln van den


|
Seite 83 |




|
tögen, de aldar van olders gehalden worden, bliven, und de Schluckupper dadurch an ehrer vischerey nicht behindern 153 ).
Sehen wir uns aber das an, was in der Ordnung von 1585 sich wirklich auf die Strecke Priwall-Harkenbeck bezieht, so ist in ihr nichts zu finden, was unserem nächstliegenden Ergebnis widerspricht, ja es lassen sich Momente anführen, welche es bestätigen. Zunächst ist festzustellen, daß die Ordnung nichts von einem ausschließlichen Fischereirecht Lübecks an der streitigen Strecke erwähnt, ein solches würde allerdings in starkem Grade auf ein Hoheitsrecht hinweisen. Sodann ist bei der Annahme eines Hoheitsrechts völlig unerklärlich, daß in der Ordnung nicht eine feste Abgrenzung gegenüber dem sonstigen Mecklenburger Küstengewässer gegeben wird. Nicht allein, daß die Harkenbeck gar nicht als hoheitsrechtlicher Endpunkt akzentuiert wird, indem auch von der Fischerei außerhalb der Harkenbeck die Rede ist, vor allem fehlt jede Abgrenzung des streitigen Küstengewässers durch die Angabe einer Linie von der Harkenbeckmündung in die See hinein.
Angesichts aller dieser Momente müßten es schon völlig eindeutige Beweise außerhalb der Ordnung von 1585 sein, welche Anlaß geben könnten, von unserer Deutung abzugehen. Mir scheinen solche nicht vorzuliegen. Zu beachten wäre dabei zunächst die Aussage des Zöllners Tydemann im Jahre 1547, die wir schon früher angeführt haben 154 ). Er sagte:
"Datt ein erbar radt to Lübeck je und allewege strom und strand von der reyde an beth in die Harkenbeke tho verbiddende gehett hebben, we ock nech in desse stunde."
Zur Würdigung dieser Aussage ist zu beachten, daß sie gelegentlich eines Streites zwischen Lübeck und Mecklenburg über das Strandrecht am Priwall gemacht wurde. Daraus ergibt sich zunächst, daß sie, für die Strecke Priwall-Harkenbeck überhaupt keine unmittelbare Bedeutung gehabt hat. Beachtet man aber ferner, daß es bei der Aussage gerade auf ein Strandrecht im engeren Sinne ankam, ein solches jedoch Lübeck an dieser weiteren Strecke überhaupt nicht besessen hat, so wird der Beweiswert dieser Aussage ganz abgeschwächt. Man kann daher nicht annehmen, daß sich Lübeck bei seiner Ordnung von Vorstellungen hat leiten lassen, die dieser Aussage zugrunde lagen.


|
Seite 84 |




|
Weiter wäre die Stellungnahme Lübecks bei den Fischreusenstreitigkeiten 1616 in Betracht zu ziehen, aus der Rückschlüsse für 1585 gemacht werden könnten. Es mag daher bereits hier bemerkt werden, daß die Ausführungen Lübecks in dieser Angelegenheit widerspruchsvoll und nicht stichhaltig sind und durch eine ganz besondere Neuerung im Fischfang hervorgerufen worden sind. Dagegen wird unsere Auslegung durch die Mecklenburger Stellungnahme und die Mecklenburger Zeugenaussagen bestätigt 155 ).
Nach alledem können wir sagen, daß überwiegende Gründe dafür sprechen, daß Lübeck in der Fischereiordnung von 1585 die Fischerei in dem streitigen Küstengewässer nicht kraft einer Fischereihoheit über dieses Küstengewässer geregelt hat.
b) Der Vergleich von 1610 stellt sich als eine Verordnung Lübecks dar, welche auf Grund von Streitigkeiten der lübischen Fischerkorporationen erlassen wurde und sich auf dieselben Gebiete bezieht wie die Verordnung von 1585 156 ). Er hat in bezug auf das streitige Küstengewässer denselben Charakter wie die Verordnung von 1585. Neue Momente, die Anlaß zu einer anderen Ansicht geben könnten, treten nicht zutage.
c) Der Vergleich von 1826 157 ) betrifft in der Hauptsache die Strecke Priwall-Harkenbeck, aber es ist auch die Fischerei außerhalb der Harkenbeck (und des Mövensteins) hereingezogen 158 ). Es handelt sich um einen Vergleich, der zwischen den Travemündern und den anderen Lübecker Fischerkorporationen zur Beendigung endloser Streitigkeiten abgeschlossen und von den Wetteherren bestätigt wurde. Auch hier ergeben sich keine neuen Momente, welche gegen unsere Deutung sprechen, daß Fischereiberechtigungen Lübecks in fremdherrlichen Küstengewässern in Frage stehen, die den Fischerkorporationen Lübecks zugeteilt sind. Rörig behauptet freilich, daß dieser Vergleich die ausschließliche Fischerei der lübischen Fischereikorporationen ergebe. Er


|
Seite 85 |




|
gebe "ein so minutiöses Bild der dort ausgeübten Wadenfischerei und der Strandfischerei mit Netzen, Angeln und Krabbenhamen, daß es ausgeschlossen ist, sich weitere Befugnisse derselben Art an diesem Küstenstriche auch nur zu denken" 159 ). Allein dies ist eine durch nichts bewiesene Behauptung. Sie wird auch unter anderem dadurch widerlegt, daß unstreitig Mecklenburger Fischer seit 1870 zu einer Zeit, wo dieser Vergleich noch galt, Jahrzehnte hindurch gefischt haben 160 ). Man versteht nicht, wie sie Platz gefunden hätten, wenn die Behauptung Rörigs richtig wäre. Oder sollten die Lübecker Fischerkorporationen unter Preisgabe ihrer angeblich bis ins einzelne geregelten Befugnisse ihnen Platz gemacht haben?
d) Die Fischereiordnung vom 28. Februar 1881.
Sie geht zurück auf ein zwischen mehreren Regierungen am 1. Dezember 1877/8. Mai 1880 getroffenes Übereinkommen wegen Herbeiführung übereinstimmender Maßregeln zum Schutze und zur Hebung der Fischerei.
Sie bezieht sich, wie wir schon früher sahen 161 ), "auf die Küsten- und Binnenfischerei in allen unter lübeckischer Staatshoheit befindlichen und denjenigen fremdherrlichen Gewässern, auf denen und insoweit ein lübeckisches Mitbefischungsrecht ausgeübt wird, mit Ausnahme der geschlossenen Gewässer" § 1.
In § 3 ist alsdann bestimmt:
"Im Sinne dieser Ordnung ist Küstenfischerei diejenige Fischerei, welche in dem der lübeckischen Staatshoheit unterworfenen Teile der (Ostsee und in der Trave mit ihren Ausbuchtungen (einschließlich des Dassower Sees und Poetenitzer Wyck) von der Mündung aufwärts bis zur Herrenfähre und dem Damm der Chaussee von Lübeck nach Travemünde, Binnenfischerei diejenige, welche in den übrigen Gewässern und in der Trave bis abwärts zu dem Punkte, wo die Küstenfischerei beginnt, betrieben wird."
Wir haben früher den § 1 dieser Ordnung dafür verwertet, daß eine einheitliche Reglung der Fischerei auf den Hoheitsgebieten und der Mitfischerei auf fremdherrlichen Gewässern in Lübeck nichts Auffälliges war 162 ). Jetzt entsteht für uns die


|
Seite 86 |




|
ganz andere Frage, welche Fischereigebiete nach Maßgabe der Ordnung von 1881 als fremdherrliche Gewässer in Betracht kamen. Nun ist eins klar: Geht man rein von dem Wortlaut des § 3 aus, welcher als Küstenfischerei bezeichnet die Fischerei, welche in dem der lübeckischen Staatshoheit unterworfenen Teile der (Ostsee und in gewissen Teilen der Trave betrieben wird, so würde sich ergeben, daß die Fischerei in der Ostsee nur geregelt werden soll, insoweit die Ostsee der lübeckischen Staatshoheit unterlag. Wie weit unterlag sie aber der Staatshoheit Lübecks? Wir wissen, daß man gerade in den Zeiten der Abfassung dieses Gesetzes in Lübeck durchaus völkerrechtlichen Ansichten in bezug auf das Küstengewässer der Ostsee huldigte 163 ). Es ist ferner klar, daß man bei dieser Fischereiordnung, die auf einer Verständigung mehrerer deutscher Staaten beruht, die allgemein anerkannten Grundsätze über die Staatshoheit in Meeresgewässern, im Auge haben mußte. Das Ergebnis wäre alsdann, daß von der Verordnung nicht umfaßt würden einmal die Fischereirechte Lübecks in der Niendorfer Wiek und in den holsteinschen Küstengewässern, und sodann und vor allem aber auch das streitige Küstengewässer (Priwall-Harkenbeck).
Die Auslegung, daß die Fischerei in der Ostsee nur geregelt werden soll, insoweit die Ostsee der lübeckischen Staatshoheit unterlag, hat aber ihre Bedenken, weil sie zu dem Ergebnis führen würde, daß für die fremdherrlichen Gewässer, von denen in der Ordnung die Rede ist, nur die Binnengewässer übrig blieben. Soviel wir sehen, kamen aber für Lübeck zu dieser Zeit keine fremdherrlichen Binnengewässer in Betracht.
Eine andere Auslegung ist dann möglich, wenn man die Definition der Küstenfischerei in § 3 durch § 1 ergänzt 164 ). Das würde bedeuten, daß der Küstenfischerei in den Teilen der Ostsee, welche der lübeckischen Staatshoheit unterliegen, gleichgestellt werden muß die Küstenfischerei in den Teilen der Ostsee, welche fremdherrliche Gewässer sind, in denen Lübeck aber ein Mitbefischungsrecht zusteht. Selbstverständlich könnten die Bestimmungen der Ordnung in den fremdherrlichen Gewässern aber nur insoweit gelten, als sie nicht mit Vorschriften des Inhabers des Hoheitsrechts im Widerspruch stehen. Legt man auch hier die da-


|
Seite 87 |




|
mals in Lübeck maßgebenden völkerrechtlichen Anschauungen zugrunde, so würden alsdann die vorhin genannten Strecken, insbesondere die Strecke Priwall-Harkenbeck, als fremdherrliche Gewässer, in denen Lübeck ein Mitbefischungsrecht zusteht, unter die Fischereiordnung Lübecks fallen.
Jedenfalls würde das Ergebnis stets sein, daß die Fischereiordnung von 1881 keine gesetzliche Reglung der Fischerei in dem streitigen Küstengewässer auf Grund einer Lübecker Fischereihoheit enthält.
Es ist auffallend, daß Rörig diese wichtige Fischereiordnung Lübecks von 1881 gar nicht bespricht. Offenbar ist er von dem Hoheitsrecht Lübecks auf der Reede im weiteren Sinn derart überzeugt, daß er es als selbstverständlich annimmt, daß die Staatshoheit Lübecks im Sinn der Ordnung von 1881 sich auf sie und damit auf das streitige Küstengewässer erstreckte. Allein wie ist dies damit vereinbar, daß man, wie auch Rörig anerkennt, zur Zeit der Abfassung des Gesetzes völkerrechtlichen Anschauungen in bezug auf die Travemünder Bucht huldigte? Und wie war es mit der Abgrenzung der "Reede", die doch Rörig erst entdeckt hat und die damals ganz unbekannt war?
e) Das Fischereigesetz vom 25. Juni 1896 hat gemäß § 1 das Fischereiregal in der Travemünder Bucht in Anspruch genommen, und zwar bis zur Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld (§ 2 IV). Es ist die erste allgemeine Verordnung, auf welche wir stoßen, die eine Reglung in bezug auf das streitige Küstengewässer enthält, welche einwandfrei ergibt, daß sie auf einer Inanspruchnahme einer Fischereihoheit durch Lübeck beruht. Aber sie umfaßt, wie wir bereits früher sahen 165 ), nur einen Teil des streitigen Küstengewässers. Erst das Lübecker Fischereigesetz von 1925 hat unter voller Aufnahme der Rörigschen Behauptungen das ganze streitige Küstengewässer in eine fischereihoheitliche Reglung einbezogen 166 ).
a) Von Rörig wird die Handhabung eines Fischereipolizeizwanges behauptet, durch welchen Lübeck namentlich Dritte von der Fischerei durch Zwangsmaßnahmen ferngehalten hätte.


|
Seite 88 |




|
α) Im Jahre 1600 sei "nach vorhergehendem Ratsbeschluß den Älterleuten von der Wette befohlen worden, wenn sie den Jochim Schröder (früher Schlutuper Wadenmeister), der im Auftrage des Junkers Vike Bülow auf Harkensee auf der "Reede" Wadenfischerei getrieben hatte, auf der "Reede" anträfen, ihm Kahn, Wade und alle Gerätschaften zu nehmen 167 ). Rörig versteht hier unter "Reede" seine Reede im weiteren Sinn.
Das Gutachten des Mecklenburger Staatsarchivs hat aber die Unrichtigkeit der Rörigschen Behauptungen schlagend nachgewiesen 168 ). Rörig vermengt in diesem Fall Eintragungen im Wettebuch und spätere Aussagen Mecklenburger Fischer, so daß ein ganz falscher Tatbestand entsteht, außerdem widerspricht er seinen früheren Ausführungen, nach denen der Ausdruck "Reede" bis 1616 nur im Sinn von nautischer Reede verstanden worden ist. In Wirklichkeit lag die Sache so, daß der Jochim Schröder außerhalb der nautischen Reede und innerhalb der Trave und Pötenitz gefischt hatte, und der Rat hatte angeordnet, daß ihm Wade und Kahn fortzunehmen sei, sofern man ihn auf des Rates Boden (d. h. am Lübecker Strande) oder auf der nautischen Reede antreffen würde. Hierzu war Lübeck natürlich berechtigt, denn auf der Trave hatte Schröder nichts zu suchen und am Lübecker Strand und der dabei gelegenen nautischen Reede konnte Lübeck polizeiliche Maßnahmen vornehmen. Bei der Aussage der Zeugen im Jahre 1616 handelt es sich dagegen nicht um diesen Fall, sondern um etwas ganz anderes. Die Zeugen bekunden, daß Junker Vike Bülow mit der großen Wade bis an das lübische Blockhaus oder bis nahe an Travemünde gefischt habe und dies ihm nicht verwehrt worden sei. Hier war also freie Fischerei und Lübeck wehrte sie nicht. Es ist aber unrichtig, wenn Rörig unter Vermengung mit dem Fall des Jochim Schröder sagt, daß Bülow es nur einem "Glücksfall" zuzuschreiben habe, wenn seine Wadenfischerei nicht sofort unterdrückt sei.
β) Der Fischreusenstreit von 1616.
Im März 1616 errichteten einige mecklenburgische Adlige eine große Fischreuse am Strande von Rosenhagen, das zu Harkensee gehörte. Die Fischreuse ragte außerordentlich weit in die Travemünder Bucht hinein. Dies ist der Ausgangspunkt des sog. Fischreusenstreites, dessen Verlauf sich aus dem


|
Seite 89 |




|
Gutachten des Mecklenburger Staatsarchivs ergibt 169 ). Im einzelnen ist auf die dortigen Ausführungen zu verweisen. Es sei hier kurz zusammenfassend folgendes hervorgehoben: Lübeck forderte am 29. März die Adligen zur Entfernung der Reuse auf, diese lehnen es ab und schlagen einen Lokaltermin vor. Als dieser ergebnislos verlief, ließ Lübeck die Reuse durch "einen Haufen Volks" gewaltsam entfernen. Die Adligen beschwerten sich am 6. April beim Herzog von Mecklenburg. Dieser ließ an Ort und Stelle eine eingehende Untersuchung anstellen, bei welcher 11 Zeugen unter Eid über verschiedene, mit der Angelegenheit zusammenhängende Fragen vernommen wurden. Auf den Bericht der Kommission hin richtete der Herzog an Lübeck ein Beschwerdeschreiben vom 22. Mai, in welchem Schadenersatz verlangt, die Neuerrichtung der Reuse mitgeteilt und mit Repressalien gedroht wurde. Gleichzeitig wies der Herzog die Adligen zur Neuerrichtung der Reuse an. Auf dieses Schreiben antwortete Lübeck unter dem 12. Juni 1616. - Es verging nunmehr einige Zeit mit Herstellung der Reuse. Sie wurde erst am 24. April 1617 ins Wasser gesetzt.
Am 27. April 1617 wurde die Reuse wiederum von Lübeck gewaltsam zerstört. Jetzt wurde von Mecklenburger Seite (Herzöge und einer der Adligen) beim Reichskammergericht gegen Lübeck geklagt. Es wurde ein Mandat gegen Lübeck vom 5. Juli 1618 erwirkt, durch welches Lübeck angewiesen wurde, die Reusen und Pfähle zu restituieren und in den vorigen Stand zu setzen. Hiergegen überreichte der Lübecker Syndikus, Lizentiat Martin Khun, am 2. Oktober 1618 eine Exzeptionsschrift beim Reichskammergericht. Über den weiteren Verlauf des Prozesses sind wir nicht unterrichtet.
Für die Beurteilung des Vorfalls sind natürlich von besonderer Wichtigkeit die beiden Schreiben Lübecks, das eine vom 29. März 1616 an die Adligen, das andere vom 12. Juni 1616 an den Herzog. Dabei ist zu beachten, daß dieses zweite Schreiben eine Antwort auf die Beschwerdeschrift des Herzogs vom 22. Mai 1616 ist. Der Standpunkt Lübecks tritt ferner entscheidend hervor in der Exzeptionsschrift des Syndikus Khun. Es kann keine Rede davon sein, daß dieses Schreiben als Quelle überhaupt auszuscheiden habe (!), wie Rörig will 170 ). Rörig behauptet, der Syndikus sei von Lübeck nicht orientiert worden, er sei das Opfer von Mißverständnissen geworden 171 ). Allein das ist unzutref-


|
Seite 90 |




|
fend 172 ). Ganz sonderbar ist schließlich die Berufung Rörigs auf die Protestationsklausel; es handelt sich um die allgemein gebräuchliche Klausel, die jeder Prozeßvertreter formalerweise anwendete, eine spezielle Bedeutung kommt ihr in unserm Fall nicht zu. - Wertvolle Ergänzungen für unsere Erkenntnis bieten aber auch die Schreiben der Adligen, der Kommissionsbericht und die Zeugenaussagen, die natürlich in unbefangener Weise gewürdigt werden müssen.
Da wir prüfen wollen, ob ein Hoheitsakt Lübecks vorliegt und vorliegen kann, der in einer Fischereihoheit über das streitige Küstengewässer wurzelt, gehen wir am besten von dem Schreiben der Lübecker an den Herzog vom 12. Juni 1616 aus.
Der Anfang des Schreibens enthält zunächst wichtige Zugeständnisse:
Es wird erklärt, daß ihnen niemals in den Sinn gekommen sei, die Adligen in dem "jure piscandi", "wan sie sich nur derselben wie herkommens und je allewege biß die zeit so woll bei ihnen selbst als ihren vorfahren gebreuchlich gebraucht" irgendwie zu "turbiren oder zu behindern" 173 ).
Und in unmittelbarem Zusammenhang wird hinzugefügt, daß sie noch weniger etwas hätten vornehmen wollen, wodurch der Herzog an seinem "des orths angrentzendem lande und desselben bottmeßichkeit" beeinträchtigt würde.
Als Begründung für die Zerstörung der Reuse wird alsdann angegeben, daß sie eine neue, ungewöhnliche, präjudizierliche und sehr schädliche Art der Fischerei darstelle: sie sei "uff unserem unstreitigen reide" derart weitgehend in das Wasser herein gemacht worden, daß hierdurch die Fischerei des Travestroms, des Dassower Sees und anderer Örter zerstört und außerdem auch die Schiffahrt im Aus- und Eingang verhindert worden sei. Es sei nicht richtig, daß solche Reusen und Pfähle an der holsteinschen Küste gebraucht würden; Lübeck würde sie sich aber auch da nicht gefallen lassen. Schließlich wird gesagt:
"Deweil dan . . . der Trauenstromb mit dem port und der reide, von Olderschlo an biß in die offenbahre see, unangesehen viele underscheidliche territoria daran stoßen, dieser guten statt wie mit Keyserlichen und Königlichen privilegien auch underschedlichen actibus possessoriis, so woll criminal- als civil-sachen, da es nott sein solte, woll zu behaupten, zugehorich." -


|
Seite 91 |




|
Es ist hiernach folgendes festzustellen:
Die Lübecker wenden sich gegen eine Fischfangeinrichtung, die außerordentlich weit mit ihren Pfählen und Anhängseln in die Bucht hineinragte und so bisher noch nicht angewendet worden war, weil sie ihrem Fischereibetrieb in der Trave und auch sonst schädlich war und angeblich sogar die freie Ein- und Ausfahrt bei der Trave verhinderte. Sie erkennen aber völlig an die sonstige Fischereiberechtigung der Mecklenburger und die "Botmäßigkeit" des Herzogs.
Was die Fischerei der Mecklenburger als solche anlangt, so wird das Zugeständnis Lübecks nicht allein in der Exzeptionsschrift mehrmals wiederholt, sondern es ist hier auch ausdrücklich vom Fischen mit Waden und Netzen die Rede. Es wird ferner die Mecklenburger Fischerei voll bestätigt durch die Zeugenaussagen in diesem Prozeß 174 ), die man noch durch die Zeugenaussagen in dem Streit wegen der Seefischerei bei Gaarz im Jahre 1618 175 ) verstärken kann.
Was bedeutet aber die "Botmäßigkeit" des Herzogs? Was darunter gemeint ist, wird aufgeklärt durch einen Zusatz im Konzept des Lübecker Schreibens, durch die Exzeptionsschrift und durch das Schreiben des Herzogs vom 22. Mai 1616, auf das Lübeck ja antwortete. Der Herzog sagt in seinem Schreiben 176 ): Es sei notorisch und den Lübeckern bekannt,
"das so wol das feste Land als der Strand und die Strandgerechtigkeit und was dem anhengig nit allein des Orts, do die Reusen gestanden", - sondern von Wismar bis Travemünde "dem Fürstl. Hause Mecklenburg iure superioritatis unzweifelhaft einzig und allein zuständig."
In dem Konzept des Lübecker Schreibens hatte daher auch an Stelle des Wortes "Botmäßigkeit" gestanden: "Strand und Strandgerechtigkeit" 177 ), und man hatte die letzten Worte lediglich gestrichen, um nicht damit das Strandrecht im engeren Sinn (Bergerecht) unnötigerweise anzuerkennen 178 ). In der Exzeptionsschrift wird dann wieder zweimal davon gesprochen, daß Lübeck sich niemals die "Strandgerechtigkeit" habe anmaßen


|
Seite 92 |




|
wollen, und um den früheren Bedenken Rechnung zu tragen, ist der Ausdruck "novum jus der Strandgerechtigkeit" gewählt.
Es ergibt sich hieraus, daß Lübeck die "Strandgerechtigkeit" des Herzogs allgemein und auch an der in Frage stehenden Uferstrecke anerkannt hat. Und zwar in ihrem vollen Umfang! "Strandgerechtigkeit" ist aber der technische Ausdruck für "Strandhoheit", diese bezieht sich jedoch nicht bloß auf den trockenen Strand, sondern auch auf das Küstengewässer, und umfaßt auch die Fischereihoheit 179 ). Deshalb werden auch in dem Schreiben und in der Exzeptionsschrift 180 ) die Strandgerechtigkeit und die Fischerei in eine enge Verbindung gebracht.
Wenn nun Lübeck weiter erklärt, daß die Reuse auf seiner "Reede" gestanden und diese "Reede" ihm auf Grund kaiserlicher Privilegien und zahlreicher Besitzhandlungen zugehörig sei, so ist dies, insoweit das mecklenburgische Küstengewässer in Frage steht, ein völliger Widerspruch zu dem früheren Anerkenntnis. Sieht man aber von diesem Widerspruch ab, so ist folgendes festzustellen: Lübeck führt hier den Ausdruck "Reede" neu ein 181 ), um etwas ganz anderes zu bezeichnen, als bisher darunter verstanden wurde; bisher kannte man nur die nautische Reede 182 ). Ferner: Lübeck macht sich einer Unwahrheit schuldig, wenn es sagt, daß ihm diese Reede durch kaiserliche Privilegien zugesprochen sei, denn das Barbarossaprivileg enthält nur Verleihung der Flußfischerei bis zur Mündung der Trave 183 ). Schließlich, Hoheitshandlungen Lübecks auf der "Reede" (im erweiterten Sinn Lübecks) gegenüber Dritten sind nicht bekannt. Auch das ergeben völlig einwandfrei die Zeugenaussagen 184 ). Eine Aufsicht der Fischereiältesten Lübecks gegenüber Dritten hat hier nicht bestanden 185 ). - Wie wenig geheuer Lübeck auch bei der neuen


|
Seite 93 |




|
Reede ist, zeigt sich darin, daß es als Grund für sein Vorgehen nicht die Störung der Fischerei auf dieser Reede, sondern die Störung der Fischerei in der Binnentrave und der Traveeinfahrt hervorhebt. Die Exzeptionsschrift aber wandelt, um dem neuen Reedebegriff "Facon" zu geben, die "Reede" fogar zum "portus" um 186 ).
Das Vorgehen Lübecks in dem Fischreusenstreit von 1616 ist daher nicht als die Ausübung einer ihm zustehenden Fischereihoheit zu werten, denn die von ihm für eine solche vorgebrachte Begründung ist nicht stichhaltig und steht mit seinen eigenen Zugeständnisse im Widerspruch. Das Vorgehen Lübecks ist eine unrechtmäßige Gewalttat, die als Anmaßung eines Rechtes erschien und als solche zurückgewiesen und gebrandmarkt wurde.
Zu ganz anderen Ergebnissen gelangt Rörig. Nach ihm bedeutet der Fischreusenstreit von 1616 "die erfolgreiche Abwehr Mecklenburger Versuche, den alten Bestand lübischer Hoheitsrechte nach Inhalt und räumlicher Ausdehnung zurückzudrängen 187 ). Der Irrtum Rörigs aber beruht auf sehr verschiedenen Gründen. Vor allem darauf, daß er von dem wirklichen Vorhandensein einer von lübischen Hoheitsrechten erfüllten Reede im weiteren Sinn ausgeht, und die Behauptungen Lübecks über sie, die hier zum ersten Male auftreten, für bare Münze nimmt. Ein weiterer schwerer Fehler von ihm ist der, daß er die Exzeptionsschrift als ergänzende Quelle ausschaltet 188 ), die sämtlichen Mecklenburger Zeugenaussagen verwirft 189 ) und immer wieder den von ihm ganz falsch verstandenen Vorgang über die Fischerei des Jochim Schröder heranzieht 190 ). Die wichtigen beiden Zugeständnisse Lübecks in seinem Schreiben vom 12. Juni 1616 und in der Exzeptionsschrift in bezug auf die Strandgerechtigkeit und die Mecklenburger Fischerei werden von Rörig in einer geradezu gewaltsamen und ausgetüftelten Weise zu beseitigen gesucht.


|
Seite 94 |




|
Lübeck habe nur "Botmäßigkeit am Lande selbst" zuerkennen wollen 191 ), und bei dem allgemeinen Zugeständnis der bisherigen und zukünftigen Fischerei der Mecklenburger sei Lübeck unehrlich und mit einer "reservatio mentalis" verfahren!! 192 ). Die Fischereihoheit Lübecks habe bis unmittelbar ans Ufer gereicht, und die Mecklenburger hätten nur Krabbenfang, vielleicht auch Aalfang betrieben 193 ). Mir scheint, daß diese Ausführungen Rörigs sich selbst richten.
Nicht recht verständlich ist es, wenn Rörig in seinem dritten Gutachten auf die Verhältnisse an der Schlei und auf das Urteil des Landgerichts Flensburg vom 20. Juni 1920 verweist 194 ). An der Schlei hatte die Stadt Schleswig kraft Privilegs ein ausschließliches Fischereirecht und hat dies gegen Eingriffe der Anlieger durch Zerstörung und Wegnehmen von Fischereigeräten, Pfählen usw. geschützt. Nun zitiert Rörig aus dem Urteil den Satz: "Deutlicher kann der Ausschluß Dritter nicht ausgesprochen werden." Allein dies wird doch von keinem Menschen bestritten. Selbstverständlich wollte Lübeck mit seiner Zerstörung der Reuse den Ausschluß der Reusenleger, mit diesem Fanggerät zu fischen, aussprechen. Aber während Schleswig in Ausübung eines feierlich verbrieften, wirklichen Rechts und mit rechter Gewalt handelte, beging Lübeck im Jahre 1616 unter Anmaßung eines Rechts eine unrechtmäßige Gewalttat. Das sind doch himmelweit verschiedene Dinge.
γ) Die Fischreusenzerstörung in Jahre 1658.
Als einen weiteren Fall berechtigter Handhabung fischereirechtlicher Polizeigewalt glaubt Rörig die Fischreusenzerstörung im Jahre 1658 anführen zu können 195 ). Es war wiederum bei Rosenhagen von einem Junker von Bülow eine große Fischreuse gesetzt worden. Die Lübecker Fischereiältesten machten am 14. Juli 1658 eine Eingabe hierüber an den Rat 196 ) mit der Mitteilung, daß infolge der Reuse die Fische "nicht mehr herein suchen können"
und eine Vergrößerung des Werkes zu befürchten sei. Sie verweisen auf den Vorgang von 1616 und bitten um eine erneute 'entsprechende Verfügung zur Zerstörung der Reuse. Es folgt


|
Seite 95 |




|
dann der Vorgang, wie er in dem Protokoll vom 26. Juli 1658 197 ) geschildert wird.
Rechtlich ist der ganze Vorgang genau so zu beurteilen wie der Vorgang im Jahre 1616. Rörig macht demgegenüber insbesondere geltend, daß im Jahre 1658 die Anzeige der Fischer ausdrücklich erfolgt sei, weil es des Rates "jurisdiction, hoch- und gerechtigkeit" betreffe, und die Fischer zu einer solchen Anzeige kraft des nunmehr präzise formulierten Fischereides verpflichtet gewesen seien. Allein die Eidesformel ist ganz allgemein gehalten, sie umfaßt die "Ströme" des Rates und verpflichtet zur Anzeige einer jeden Verletzung der "frei- hoch- und gerechtigkeit" des Rates. Die entscheidende Frage ist doch aber die, ob wirklich das Küstengewässer Priwall-Harkenbeck unter der Fischereihoheit der Stadt stand. Hier aber hatte Lübeck im Jahre 1618 die Strandgerechtigkeit und Fischereihoheit Mecklenburgs anerkannt. - Rörig beruft sich ferner darauf, daß man sich im Jahre 1658 das Vorgehen Lübecks habe gefallen lassen. Allein wir kennen die weiteren Ereignisse nicht, und es ist unstatthaft, irgend etwas Bestimmtes zu vermuten.
δ) Aus der ganzen Zeit von 1658 bis 1911 kann Rörig keine Fälle von fischerpolizeilichen Zwangsmaßnahmen Lübecks gegen Mecklenburger Fischer anführen.
Rörig sucht dies für die Zeit bis zum Jahre 1870 daraus zu erklären, daß nunmehr Mecklenburger Fischer auf der "Reede" überhaupt nicht mehr erschienen seien 198 ). Seit dem 19. Jahrhundert sei es sogar mit dem Krabben- und Aalfang der Mecklenburger an der Strecke Priwall-Harkenbeck zu Ende gewesen 199 ). Die letzte Bemerkung hängt mit der falschen Vorstellung Rörigs über das Aufhören der "Strandgerechtigkeit" zusammen, auf welche später noch zurückzukommen ist. Hier müssen wir die Behauptung Rörigs von dem Fehlen der Mecklenburger Meeresfischerei mit der größten Entschiedenheit zurückweisen.
Diese Behauptung ist angesichts der Fülle der Belege, die wir zur Zeit des Fischreusenstreites haben, geradezu ein Unding. Selbst wenn Lübeck seinen Willen in bezug auf die neuen großen Fischreusen durchgesetzt hätte, warum sollten die Mecklenburger den sonstigen herkömmlichen Fischfang hier aufgegeben haben? Hierzu lag ja auch vom Lübecker Standpunkt aus nicht die aller-


|
Seite 96 |




|
geringste Veranlassung vor! - Für die Zeit nach 1870 will Rörig die "Zulassung" Mecklenburger Fischer aus dem Eindringen völkerrechtlicher Anschauungen erklären 200 ). Rörig vergißt dabei nur, daß nach völkerrechtlichen Anschauungen eine lübische Fischereihoheit an dem streitigen Küstengewässer gar nicht bestand 201 ) 202 ).
b) Von Rörig wird als Beweis für die Handhabung des "Fischereiregals" auf dem streitigen Küstengewässer angeführt, daß Lübeck Abgaben für den Fischfang auf dem streitigen Küstengewässer von seinen Lübecker Fischern erhoben habe (bereits seit 1502) 203 ). Allein es ist nicht nachgewiesen, daß diese Abgaben (bis 1896) wirklich für die Seefischerei erhoben wurden, das Gutachten des Mecklenburger Staatsarchivs macht wahrscheinlich 204 ), daß es Abgaben für die Binnenfischerei gewesen sind. Aber auch wenn es Abgaben für die Seefischerei waren, so ist nicht einzusehen, warum hieraus auf ein Fischereiregal geschlossen werden muß. Auch mit unserer Annahme, daß es sich um einfache Fischereirechte Lübecks handelte, deren Nutzung es an seine Fischereikorporationen verteilte, ist es sehr gut vereinbar, daß sich Lübeck hierfür ein Entgelt ausbedungen hat.
c) Schließlich wird von Rörig 205 ) als Zeichen des Lübecker Fischereiregals geltend gemacht, daß lübeckische Gerichte die Streitigkeiten der lübischen Fischerkorporationen hinsichtlich ihrer Fischerei auf dem streitigen Küstengewässer entschieden hätten. Allein die Lübecker Gerichte sind hierfür auch kompetent gewesen, wenn es sich um Aufteilung von Fischereirechten Lübecks unter seine Fischerkorporationen gehandelt hat.
Von Rörig werden Fahrrechtshandlungen Lübecks auf dem streitigen Küstengewässer behauptet. Es handelt sich um die gerichtliche Leichenschau bei unnatürlichen Todesfällen, die im Mittelalter dem Inhaber der Gerichtshoheit zustand und in dieser Form seit dem Ende des 18.


|
Seite 97 |




|
Jahrhunderts in Fortfall gekommen ist. Wir unterscheiden die Zeit der Fahrrechtsfälle und die spätere Zeit.
1. Die Fahrrechtsfälle. Zunächst müssen die in dem ersten Gutachten Rörigs erwähnten Fälle aus dem Jahre 1559 und 1628 206 ) völlig ausscheiden. Denn es ist ganz klar, daß es sich bei ihnen um Unglücksfälle handelte, die sich auf der nautischen Reede ereignet haben. Rörig hat sie wohl deshalb auch in seinem zweiten Gutachten nicht erwähnt. Im übrigen ist noch folgendes zum Verständnis voranzuschicken. Wir erinnern uns, daß Rörig in bezug auf die Fischerei der Mecklenburger erklärt hatte, daß sie am Ufer Krabbenfang und wohl auch etwas Aalfang hätten betreiben können. In bezug auf das Fahrrecht wird dagegen Mecklenburg als Inhalt seiner "Strandgerechtigkeit" etwas mehr eingeräumt. Für Fahrrechtsfälle soll Mecklenburg zuständig gewesen sein, wenn eine Leiche "grundrührig" geworden sei, d. h. am Strande im flachen Wasser festgemacht worden sei, wenn man sie durch "Waten" hätte erreichen können. Dagegen sei Lübeck zuständig gewesen, wenn es sich um Leichen gehandelt hätte, die im Wasser frei getrieben hätten. Hierüber seien sich Mecklenburg und Lübeck im Jahre 1616 völlig einig gewesen. Damals hätte man nur darüber gestritten, ob die Leiche "grundrührig" oder "frei treibend" gewesen sei 207 ). - Allein diese Ausführungen Rörigs sind durchaus irrtümlich. Es kann keine Rede davon sein, daß Mecklenburg seine "Strandgerechtigkeit" und damit auch sein Fahrrecht nur auf "grundrührige" Leichen habe beschränken wollen, vielmehr wurde die Grundrührigkeit in diesem Falle nur angeführt, um damit schlagend die Behauptung Lübecks zu widerlegen, daß die Leiche von seinem Beauftragten "in der See treibend" eingeholt worden wäre 208 ). Dies wird insbesondere dadurch bewiesen, daß Mecklenburg seine "Strandgerechtigkeit" und sein Fahrrecht im Jahre 1616 bei dem Fischreusenstreit soweit erstreckt hat, bis "die Schiffe und die rechte Tiefe des Meeres gehet" 209 ). Es hat also eine Watengrenze nicht anerkannt, viel-


|
Seite 98 |




|
mehr reicht ihm seine Fahrrechtsberechtigung und sein Küstengewässer bis zum Anfang der hohen See. Darum hatte Mecklenburg andererseits gegen eine Einholung der Leichen auf der hohen See von seiten Lübecks nichts einzuwenden, da hier selbstverständlich die Einholung jedermann gestattet war 210 ). Auch sonst ist eine Watengrenze für die Ausübung des Fahrrechts nirgends bekannt. Es ergibt sich somit, daß aus dem Fall von 1616 für eine rechtmäßige Hoheitshandlung Lübecks auf dem von Mecklenburg in Anspruch genommenen Küstengewässer nichts zu entnehmen ist. Denn wenn in bezug auf den Tatbestand die Behauptung Lübecks zugrunde gelegt wird, fiel die Einholung der Leiche außerhalb desselben und war überhaupt keine Hoheitshandlung, wenn aber für den Tatbestand die Angaben Mecklenburgs zutreffen und die festgemachte Leiche von Lübeckern losgelöst worden war, war die Handlung Lübecks unrechtmäßig.
Wie liegt es bei den anderen Fahrrechtshandlungen, die Rörig für Lübeck geltend macht? Es handelt sich um die Vorgänge der Jahre 1792, 1799 und 1804. Rörig bemerkt über sie in seinem ersten Gutachten 211 ), "daß Lübeck den Rosenhagener Strand nach Leichen von Ertrunkenen absuchen ließ, 1792 blieb das Suchen ergebnislos". In seinem zweiten Gutachten 212 ) heißt es für alle drei Fälle: "Hingegen suchen 1792, 1799 und 1804 die Lübecker mit Booten den Strand nach Ertrunkenen ab und holen die Ertrunkenen nach Travemünde ein" (!). In der Anmerkung dazu werden einige weitere Angaben gemacht. - Die Feststellungen des Mecklenburger Staatsarchivs 213 ) über diese Fälle ergeben aber, daß für die Fälle von 1792 und 1799 gar nicht feststeht, wo die Leichen gefunden wurden, und daß 1804 überhaupt nichts gefunden worden ist. Für Fahrrechtshandlungen ist jedoch das Finden und der Fundort das Entscheidende 214 ).
2. Für die spätere Zeit sagt Rörig in seinem ersten Gutachten: "Im 18. Jahrhundert kam das Fahrrecht außer Gebrauch; an seine Stelle trat . . . das Physikatszeugnis. Nach wie vor wurden aber die auf der Reede treibenden Leichen von Lübeck aus eingeholt (1737, 1741); und der lübeckischen Jurisdiktion unterstanden alle jene Rechtsfragen, welche durch Ertrinken von


|
Seite 99 |




|
Schiffern auf der Reede hervorgerufen wurden; auch dann, wenn es Schiffer fremder Nationalitäten waren (1752, 1769, 1770, 1788 [englisches Schiff], 1793 [norwegisches Schiff], 1795 [englisches Schiff], 1800)".- Allein dies sind alles Behauptungen, die dadurch nicht bewiesen werden, daß eine Jahreszahl daneben gesetzt wird; hier sind doch eingehendere Ausführungen nötig. Sind denn die Leichen an der Mecklenburger Küste eingeholt worden? Was sind "alle Rechtsfragen, die durch das Ertrinken von Schiffern hervorgerufen werden"?
In seinem zweiten Gutachten bemerkt Rörig auch etwas über die Folgen des Fortfalls des Fahrrechts für Mecklenburg 215 ), welches ihm ja nach Rörigs Ansicht wenigstens bei "grundrührigen" Leichen zugestanden haben soll. Für Mecklenburg soll hiermit auch das mit dem Fahrrecht zusammenhängende Hoheitsrecht 216 ) verloren gegangen sein. Es bleibt aber ein Rätsel, warum die Mecklenburger nicht auch fernerhin Leichen, die sie im "Waten" erreichen konnten, "eingeholt" haben sollen.
In bezug auf Strandungsfälle wird von Rörig in entsprechender Weise wie bei den Fahrrechtsfällen zwischen der älteren Zeit und dem Beginn des 19. Jahrhunderts unterschieden.
1. Ältere Zeit. Für die ältere Zeit erkennt Rörig als zweiten 217 ) Inhalt der "Strandgerechtigkeit" ein Hoheitsrecht Mecklenburgs an dem streitigen Küstengewässer an, nämlich das Strandrecht und später ein Bergerecht in bezug auf gestrandete Fahrzeuge. Allein entsprechend wie bei dem Fahrrecht habe es eine sehr einengende Grenze gehabt, allerdings sei bei ihm die Grenze doch etwas "weiter" gewesen. Während bei dem Fahrrecht eine "Watengrenze" entscheidend gewesen sei, sei in bezug auf gestrandete Schiffe eine "Rittgrenze" in Betracht gekommen 218 ). Als Beleg für die Rittgrenze glaubt er einen Bericht des Vogtes von Travemünde aus dem Jahre 1660 über zwei in


|
Seite 100 |




|
der Bucht vor Rosenhagen gesunkene Schiffe verwenden zu können 219 ). Allein das Mecklenburger Staatsarchiv hat gezeigt 220 ), daß Rörig seine Quelle falsch verstanden hat; der Vogt erwähnt eine solche Grenze nicht, er berichtet vielmehr, daß der Herzog zwei berittene Gendarmen geschickt habe zur Erkundung des Strandungsfalles, diesen habe er, der Vogt, gesagt, das Schiff liege in einer Tiefe von drei Faden (5,4 m), daher seien Boote und Seeleute zur Bergung nötig, Reiter und Bauern würden nichts nützen können 221 ). Auch die sonstigen Akten des Falles von 1660 ergeben mit Sicherheit, daß eine solche Rittgrenze nicht in Betracht kam. Einerseits heißt es in dem mecklenburgischen Protokoll über die Untersuchung durch den Herzog selbst, daß man eine Bergung nicht hätte vornehmen können, weil keine Boote zur Stelle gewesen wären 222 ). Andererseits beruft sich Lübeck in einem Schreiben an den Herzog nur darauf, daß die Schiffe nicht an den Strand gekommen, sondern drei Klafter tief in See geblieben seien 223 ). Nun werden zwar für Teile der Mecklenburger Küste, insbesondere für die Wismarer Bucht, Ritt- und (oder) Wurfgrenze als Begrenzung des Strandrechts erwähnt 224 ), allein es handelt sich dabei nur um vereinzelte Zeugenaussagen. Wie das Mecklenburger Staatsarchiv nachgewiesen hat, sind solche Begrenzungen des landesherrlichen Strandrechts dem praktischen Leben völlig fremd 225 ). Es handelt sich offenbar um Verwechslungen mit Begrenzungen von grundherrlichen Rechten 226 ). Was die hier in Frage stehende Küstenstrecke anlangt, so wird von einem Zeugen im Jahre 1616 erwähnt, daß der Strand so weit dem Herzog gehöre, als man "mit einem wehligen Pferde hineinreiten und schwimmen und von demselben mit einem Pflugeisen weiter werfen könne", allein der Zeuge hatte vorher angegeben, daß des Herzogs Strand und Strandgerechtigkeit sich erstrecke, "so weit die Schiffe und die rechte Tiefe des Meeres gehet" 227 ).
Und diese letzte Formulierung wird auch von allen übrigen Zeugen angewendet, die von einer Ritt-, Pferdeschwimm- und


|
Seite 101 |




|
Wurfgrenze nichts wissen 228 ). Man wird daher die Schiffsgrenze als maßgebend betrachten müssen, die Schwimm- und Wurfgrenze existierte nur in der Phantasie des Zeugen und ist bei ihm offenbar durch Verwechslung mit anderen Begrenzungen veranlaßt worden. Ganz unzulässig ist es übrigens, wenn Rörig erklärt, daß die Kommissare der Rittgrenze des Zeugen eigenmächtig die Schwimmgrenze hinzugefügt hätten 229 ). - Aber Rörig selbst hält an seiner Rittgrenze gar nicht fest. So bemerkt er an einer anderen Stelle, daß entscheidend gewesen sei, ob die Fahrzeuge am Mecklenburger Strande "angeschlagen" worden seien. Auch dies ist allerdings unrichtig. Der Ausdruck "Anschlagen am Strande" wird von Fahrzeugen überhaupt nie gebraucht, er ist ja auch ganz unpassend. Rörig übernimmt das Wort "anschlagen" aus einer Zeugenaussage von 1616, hier aber bezieht es sich auf Holz, das von einem vor etwa 20 Jahren gesunkenen Prahm weggeschwemmt war.
Kann somit kein Zweifel sein, daß eine Rittgrenze nicht bestanden hat, daß vielmehr das Strandrecht des Herzogs bis zur Meerestiefe reichte und darüber hinaus offenes freies Meer war, so erledigen sich auch die von Rörig für eine Strandungshoheit Lübecks angeführten Fälle. In dem Faß von 1660 war zwar die Ladung des Schiffes von Lübeck geborgen worden, allein, wenn die Lübecker Angaben richtig waren, handelte es sich um ein Versinken im offenen Meer, und auch auf Mecklenburger Seite waren erhebliche Zweifel vorhanden, ob dies nicht zutraf 230 ). Was aber den Fall aus dem Jahre 1665 betrifft, so konnte die Strandgerechtigkeit Mecklenburgs nicht ausgeübt werden, weil der Seegang so hoch war; im übrigen aber haben die Schiffer sich selbst geholfen und das Schiff wieder flott gemacht 231 ).
2. Die spätere Zeit. Rörig sagt entsprechend wie bei den Fahrrechtsfällen: "Strandungsfälle kamen seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts in Fortfall; mit der mittelalterlichen


|
Seite 102 |




|
"Strandgerechtigkeit" hatte es ein Ende 232 ). Man kann dies nicht ohne das größte Erstaunen lesen. Es ist unrichtig, daß es mit der mittelalterlichen Strandgerechtigkeit ein "Ende" hatte. Vielmehr hat sich das Strandrecht bereits im Mittelalter immer mehr zu einem Hilfs- und Bergungsrecht abgeschwächt, in dieser geläuterten Form als Hoheitsrecht des Küstenherrn an seinem Küstengewässer erhalten und ist durch Strandungsordnungen eingehend als solches geregelt worden 233 ). Und da fragen wir: Wo sind denn neuere Fälle für die Ausübung einer lübischen Strandungshoheit in bezug auf die Strecke Priwall-Harkenbeck? Wo sind Hoheitsakte Lübecks, die beweisen, daß es an die Stelle von Mecklenburg in bezug auf das diesem angeblich abhanden gekommene Hoheitsrecht getreten ist?
IV.
Mecklenburger Hoheitsakte auf dem streitigen Küstengewässer
Wir erinnern uns, daß wir auf Grund der mittelalterlichen Quellen, welche für die Ostseeküste maßgebend sind, gefolgert haben, daß im Mittelalter, jedenfalls seit dem 13. Jahrhundert: ein umfassendes Hoheitsrecht Mecklenburgs an dem streitigen Küstengewässer, soweit es vom Strande aus beherrschbar und nutzbar erschien, bestanden hat 234 ). Bei der folgenden Betrachtung der Akte, welche Lübeck als Hoheitsakte in bezug auf das streitige Küstengewässer anführt, ließ es sich nicht vermeiden, auch Mecklenburger Hoheitsakte bereits mit hereinzuziehen. Im folgenden sollen diese Angaben für Mecklenburg namentlich noch in bezug auf die neuere Zeit ergänzt werden. Dabei haben wir gelegentlich der Würdigung der von Lübeck geltend gemachten Hoheitsakte gelernt, daß Mecklenburg in der früheren Zeit vor Ausbildung des modernen Völkerrechts das streitige Küstengewässer seiner Hoheit unterworfen ansah bis zur schiffbaren Meerestiefe 235 ); in der modernen Zeit sind dann völkerrechtliche Gesichtspunkte maßgebend erschienen. Dies muß beachtet werden,


|
Seite 103 |




|
wenn wir nunmehr auf einzelne Abspaltungen des allgemeinen Hoheitsrechtes eingehen.
1. Fischereihoheit. Die mittelalterlichen Fischereiabgaben, welche Mecklenburg auf Grund des Fischereiregals zustanden, sind anscheinend frühzeitig in bezug auf das streitige Küstengewässer fortgefallen. Auch Lübeck hatte für seine Fischereiberechtigung keine Abgaben zu zahlen. Aber diese Fischereiberechtigung Lübecks wurde nicht als Fischereihoheit angesehen. Sie erschien vielmehr nur als Mitbefischungsrecht, genau so wie Lübeck auch an anderen Stellen der Mecklenburger Küste die Fischerei ausübte. Dies und nichts anderes will auch die Formulierung der ersten Frage bei der Mecklenburger Zeugenvernehmung im Fischreusenstreit 1616 besagen 236 ):
"Ob nicht wahr, das die Hertzogen zu Meckelnburg und deroselben Beambten . . . den Strandt und die Strandgerechtigkeit, so weit die Schiffe und die rechte Tiefe des Meeres gehet, von Travemunde an biß hinunter, so weit Meckelburgisch Grund und Boden sich erstrecket, von undenklichen Jahren hero vor sich allein vertheidiget und vertretten und so weinig den Lubischen alß jemand anders das allergeringste außerhalb der gemeinen Fischereyen daran gestanden . . ."
Wenn Rörig in seinem dritten Gutachten bemerkt 237 ), daß hiernach gemäß Mecklenburger Auffassung ein "Gemeingebrauch an der Fischerei" und infolgedessen kein "Fischereiregal" bestanden habe, so befindet er sich in einem Irrtum. Die Worte "gemeine Fischereyen" weisen nicht: auf einen "Gemeingebrauch" in dem Sinn, daß jeder Beliebige hier fischen könnte, sondern auf eine gemeinsame Fischerei, die den Lübeckern zugestanden war. Im übrigen besteht auch bei einem Gemeingebrauch eine Fischereihoheit. Daß Mecklenburg sich hier die Fischereihoheit an seiner ganzen Küste (!) absprechen wollte, ist völlig ausgeschlossen. Im übrigen ist: auf unsere Darstellung des Fischreusenstreites zu verweisen, aus der sich auch ergibt, daß der Herzog zur Wahrung seiner Fischereihoheit die erforderlichen Verfügungen und Maßnahmen ergriff 238 ). Es sei hier nur nochmals be-


|
Seite 104 |




|
tont, daß die Fischereihoheit Mecklenburgs sich nicht bloß auf Krabbenfang und Aalfang bezog, sondern auch auf die gesamte Fischerei, insbesondere Waden- und Netzfischerei.
Allgemeine Fischereiverordnungen Mecklenburgs, welche sich auf das streitige Küstengewässer beziehen, sind, soweit bekannt, erst im 19. Jahrhundert erlassen worden. Es gehören hierher:
a) Die VO. vom 1. Oktober 1868. Sie ist erlassen "für den Fischereibetrieb am Außenstrande der Ostsee", in den Ostseebinnengewässern usw. Sie hat fischereipolizeilichen Charakter, sie verbietet insbesondere das Fischen mit schädlichen Fangzeugen, bestimmt Schonzeiten u. a. m. Sie richtet sich auf die Fischerei an dem ganzen Außenstrande der Ostsee und schließt daher das streitige Küstengewässer ein.
b) Die VO. vom 20. Juli 1875. Sie ist eine Revision der vorigen und enthält gleichfalls die entscheidenden Worte. Sie ist vom Mecklenburger Ministerium auf eine Anfrage hin unter dem 13. August 1875 an das Polizeiamt zu Lübeck geschickt worden. - Erwähnenswert ist, daß die VO. eine allgemeine Schongrenze für bestimmte Zeiten bis 1/8 Meile von der Küste ab (etwa 240 m) kennt (§ 3).
c) Die VO. vom 18. März 1891 enthält eine Reglung für den Fischereibetrieb "in allen unserer Hoheit unterstehenden Binnen- und Küstengewässern". "Der Fischereibetrieb in den Küstengewässern im Sinne dieser Verordnung umfaßt die Fischerei im Außenstrande der Ostsee . . . "(§ 1).
Die unter b erwähnte allgemeine Schongrenze ist letzt bis auf 1 km von der Küste ab normiert (§ 19 Ziff. 5) 239 ).
d) Die VO. vom 22. April 1904 regelt die Fischerei auf Plattfische "an der ganzen Ostseeküste unseres Landes bis auf


|
Seite 105 |




|
5 1/2 km von der Küste ab" 240 ). Ebenso die VO. vom 20. Dezember 1913 241 ).
2. Das Fahrrecht. Von Fahrrechtshandlungen, die Mecklenburg auf dem streitigen Küstengewässer ausgeübt hat, sind uns zweifellos drei überliefert; es handelt sich
um die Fälle von 1576, 1604 und 1757 242 ). Die "Grundrührigkeit" der Leiche war 1757 vorhanden, aber sie war nicht das Entscheidende 243 ). Entscheidend war, wie sich aus der Zeugenvernehmung im Jahre 1616 für die beiden anderen Fälle ergibt, daß die Leichen im Küstengewässer bis zum schiffbaren Meere hin gefunden worden waren 244 ). - Was. die moderne Zeit betrifft, so ist das Fahrrecht zwar verschwunden, aber die in ihm enthaltene Hoheit ist in die allgemeine Seepolizei über das Küstengewässer übergegangen.
3. Strandungs- und Bergehoheit.
a) Aus der früheren Zeit sind uns verschiedene Fälle überliefert, in denen Mecklenburg seine Strandungs- und Bergehoheit in bezug auf das streitige Küstengewässer ausgeübt hat. Es handelt sich namentlich um zwei Schuten, die im Jahre 1585 Schiffbruch erlitten hatten 245 ); entscheidend war, daß sie außerhalb des schiffbaren Meeres gestrandet waren. Eine "Rittgrenze" kam in keiner Weise in Betracht 246 ). Dies ergibt sich aus der Zeugenvernehmung im Jahre 1616 und den sonstigen Strandungsfällen 247 ). Gleiches ist auch für die Ausübung des Strandrechtes seitens Mecklenburgs im Jahre 1658 anzunehmen 248 ).
b) Im 19. Jahrhundert hat dann Mecklenburg seine Strandungs- und Bergehoheit an seiner gesamten Küste zunächst ausgeübt durch die sog. Regiminalverordnung vom 20. Dezember 1854 und die gleichzeitige


|
Seite 106 |




|
Instruktion für die an der Ostseeküste gelegenen Ämter, Strandung und Strandgut betreffend. Diese Verordnungen beziehen sich daher auch auf die Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck. Aus ihnen sei folgendes hervorgehoben:
In der Einleitung der VO. wird bemerkt, daß sich der Herzog grundsätzlich "des ohnehin seit langer Zeit nicht ausgeübten Regals des Strandrechts" für die Zukunft gänzlich begeben will. Dies bedeutet, daß der Herzog auf das alte Strandrecht im Sinn eines nutzbaren Regals, kraft dessen Schiffe und Schiffsgüter dem Küstenherrn verfallen waren, verzichtet. In den nachfolgenden Paragraphen werden dann Strandungs- und Bergewesen vom Standpunkt: der Strand- und Küstenhoheit aus geregelt. Es werden unterschieden die Strandung eines Schiffes, das von der Schiffsmannschaft noch besetzt ist, und sonstige Strandungsfälle.
Bei der Strandung eines noch besetzten Schiffes wird von der Strandung an der Küste ausgegangen und ihr die Strandung auf einer Sandbank in der Nähe der Küste und die Seenot gleichgestellt (§ 5). Den Beamten sind die gesamten Rettungs- und Bergungsmaßregeln anvertraut (§ 2). Die Hilfe darf dem Schiffer nicht aufgedrängt werden. Will er sich allein helfen, so
"beschränkt sich die Tätigkeit der Behörden darauf, Ordnung am Strande zu erhalten und das gestrandete Schiff gegen alle Eingriffe zu beschützen. Insbesondere haben Sie mit Strenge darauf zu halten, daß sich niemand wider Willen zur Hülfeleistung aufdringe, den Bergenden lästig oder hinderlich werde oder gar den hülflosen Zustand des Schiffes zur Erreichung widerrechtlicher Zwecke benutze" (§ 5).
Es folgen dann noch Bestimmungen für die Beamten über die Rettung der Menschen und die Löschung, wenn Beistand erforderlich ist (§ 6), schließlich das Verfahren nach beendeter Löschung, das hier nicht interessiert (§ 7).
Es kann also gar kein Zweifel sein, daß hier ein Hoheitsrecht über das Küstengewässer mit weitgehendem Polizeizwang ausgeübt wird.
Über die sonstigen Strandungsfälle bestimmt § 8:
"Zu den Geschäften der Beamten gehört auch die Disposition über das eigentliche Strandgut, d. h. alles, was außer den vor-


|
Seite 107 |




|
gedachten Strandungsfällen, wo sich von der Mannschaft noch jemand auf dem Schiffe befindet, an Schiffen. Schiffsutensilien und Gütern irgend einer Art an den Strand oder in die Flüsse treibt, auch was auf den in der Nähe der Küste befindlichen Sandbänken vom Schiffe und der Schiffsmannschaft verlassen, treibend oder versunken angetroffen oder geborgen wird". Es wird dem Berger eine Anzeige- und Auslieferungspflicht auferlegt. Schließlich folgen Strafbestimmungen für Entwendung und Beraubung der Schiffsbrüchigen (§ 9) 249 ).
Auch hier erkennen wir die Strandungs- und Bergehoheit, denn selbstverständlich haben die Beamten auch hier ihr Aufsichts- und Anweisungsrecht im Küstengewässer und nicht etwa nur auf dem trockenen Strand 250 ).
c) Die VO. vom 24. Dezember 1834 ist dann abgelöst worden durch die Reichsstrandungsordnung vom 17. Mai 1874. Es ist bei ihr folgendes zu beachten:
α) Sie unterscheidet in ähnlicher Weise wie die VO. von 1834: "Bergung und Hilfsleistung in Seenot", d.h. es ist ein Schiff auf den Strand geraten oder es befindet sich ein Schiff sonst unweit des Strandes in Seenot .(§ 4) - und sonstige Strandungsfälle (§ 20 ff.). Zu den letzteren gehört es,
"wenn besitzlos gewordene Gegenstände auf den Strand geworfen oder gegen denselben getrieben und vom Strande aus geborgen werden (Seeauswurf und strandtriftige Güter).
β) Die Verwaltung der Strandungsangelegenheiten wird von Strandämtern geführt. Unter diesen stehen Strandvögte, welche insbesondere die Maßregeln zu leiten haben, die zum Zwecke der Bergung oder Hilfsleistung zu ergreifen sind (§ 1). Die Organisation der Strandämter, die Abgrenzung ihrer Bezirke, die Anstellung der Strandbeamten usw. ist Sache der Einzelstaaten. Die Oberaufsicht hat das Reich (§ 2).
γ) Zur Ausführung der Strandungsverordnung erließ Mecklenburg unter dem 17. September 1874 eine Verordnung, in welcher die Bezirke der Strandämter bestimmt wurden. Der


|
Seite 108 |




|
Bezirk für das Strandamt Grevesmühlen wurde hier folgendermaßen angegeben:
"von der westlichen Grenze der Feldmark Beckerwitz bis zur Grenze des Gebietes der freien Hansestadt Lübeck".
Es war daher die Strecke Priwall-Harkenbeck mit in den Bezirk des Mecklenburger Strandamtes Grevesmühlen einbezogen, und es blieb auch das ihr vorgelagerte Küstengewässer der Strandungs- und Bergungshoheit Mecklenburg grundsätzlich unterstellt.
δ) Nun ist allerdings zu beachten, daß der Bundesrat des Deutschen Reiches eine Instruktion zur Strandungsordnung vom 17. Mai 1874 erlassen hat, in welcher die Kompetenzen der deutschen Strandvögte in gewisser Weise ineinander geschoben worden sind. Sie bestimmt nämlich in § 1:
"Wenn ein Schiff vor der deutschen Küste oder in deutschen Gewässern in Seenot gerät, sind die Strandvögte der benachbarten Bezirke gleichmäßig verpflichtet, die erforderlichen Vorkehrungen zur Rettung von Menschenleben, sowie zur Bergung und Hülfsleistung zu treffen. Die Leitung des Verfahrens steht für die ganze Dauer desselben demjenigen Strandvogt zu, welcher zuerst das Schiff betritt."
Es ergibt sich daher:
Im Interesse der Rettung von in Seenot geratenen Schiffen wird das ganze deutsche Küstengebiet als ein einheitliches Gebiet behandelt, so daß auch etwaige Landesgrenzen fallen. Der Strandvogt eines benachbarten deutschen Staates, der eher zur Stelle ist als der Strandvogt des Küstengewässers, in dem sich das Schiff befindet, hat den Vorrang und übt nunmehr die Strandungs- und Bergungshoheit kraft besonderer reichsrechtlicher Delegation aus.
Allein dies bezieht sich nur auf den Fall, daß ein Schiff in Seenot geraten ist. In allen übrigen Strandungsfällen ist jeder Strandvogt nur für seinen Küstenbezirk innerhalb des ihm übergeordneten Strandamts zuständig.
ε) Wie hat nun aber Lübeck den Bezirk seines Strandamtes abgegrenzt? Ich entnehme aus Perels "Handbuch des allgemeinen öffentlichen Seerechts" 1884 S. 405 251 ), daß der Amtsbezirk des lübischen Strandamtes Travemünde umfaßt:


|
Seite 109 |




|
"den Ostseestrand auf lübeckischem Gebiete von der mecklenburgischen bis zur oldenburgischen Grenze".
Warum ist denn da aber nicht die Küste Priwall-Harkenbeck mit aufgeführt? Und wie denkt sich Rörig eigentlich die Zuständigkeit des lübischen Strandvogtes, wenn Gegenstände gegen den Strand von Priwall-Harkenbeck "getrieben werden und vom Strande aus geborgen werden" sollen?
4. Verfügungshoheit.
Die Mecklenburger Verordnung vom 10. Oktober 1874 zum Schutze der Dünen des Ostseestrandes bei Rosenhagen . . . verbietet, "im Dünenbezirke oder an den hohen Ufern längs der Seeküste, wie auch aus der Ostsee bis 400 m in die See hinein, von dem seewärts gelegenen Fuße der Dünen bzw. der hohen Ufer gerechnet, ohne Erlaubnis der Obrigkeit Sand, Kies, Ton oder Lehm zu graben, Gras, Dünenkorn oder sonstigen Anwuchs abzuschneiden und Seetang oder Steine wegzuholen" 252 ).
In dieser Verordnung nimmt also Mecklenburg einen Streifen des Küstengewässers, und zwar gerade speziell des streitigen Küstengewässers (Priwall-Harkenbeck), kraft seiner Hoheit in intensivster Weise in Anspruch. Es erstreckt seine Befehlsgewalt auf die Grundlagen und gewisse Produkte des Küstengewässers und behält sich allein die Verfügung über sie vor. Eine stärkere Einwirkung auf das Küstengewässer ist nicht denkbar.
Und gerade diese Verordnung ist auf Ersuchen der Mecklenburger Regierung von Lübeck in Travemünde in ortsüblicher Weise zur öffentlichen Kenntnis gebrach t worden 253 ).
Hiermit hat Lübeck zweifellos das Hoheitsrecht Mecklenburgs an dem streitigen Küstengewässer anerkannt.
Wenn Rörig 254 ) hiergegen geltend macht, daß dies durch das lübische Gesetz von 1896 zurückgenommen sei, so ist dem auf das entschiedenste zu widersprechen. Rörig behauptet, daß Lübeck in diesem Gesetz "die Gebietshoheit" auf der Strecke Priwall-Harkenbeck in Anspruch genommen habe. Allein dies ist unrichtig,


|
Seite 110 |




|
das Gesetz nahm nur das Fischereiregal in Anspruch. Erst im Jahre 1912 scheint Lübeck die Gültigkeit der Mecklenburger Verordnung in Zweifel gezogen zu haben. - Sicher beruhte die Anerkennung der Verordnung durch Lübeck im Jahre 1874 und in der nächsten Folgezeit darauf, daß man völkerrechtlichen Anschauungen in bezug auf das Küstengewässer huldigte. Und wenn Rörig sich auf ein Gutachten Rehms beruft 255 ), daß dieses Anerkenntnis unverbindlich sei, weil es "auf Irrtum im geschichtlichen und logischen Urteil" beruhe. So entgegnen wir folgendes: Einmal ist es doch außerordentlich merkwürdig, daß man in Lübeck so schlecht mit seinen eigenen Hoheitsrechten Bescheid gewußt und eine so grenzenlos dürftige geschichtliche Kenntnis besessen haben sollte. Sodann aber läßt es sich nicht aus der Welt schaffen, daß Mecklenburg Jahrzehnte hindurch das von Lübeck anerkannte Hoheitsrecht tatsächlich ausgeübt hat.
V.
Wir erinnern uns, daß wir in eine Betrachtung der "Ausübung von Hoheitsrechten an dem streitigen Küstengewässer im Laufe der geschichtlichen Entwicklung" eingetreten waren, um hiernach feststellen zu können, ob sich Lübeck auf ein Hoheitsrecht an dem streitigen Küstengewässer im Widerspruch zu den allgemein anerkannten völkerrechtlichen Grundsätzen - auf ein Gewohnheitsrecht oder auf Unvordenklichkeit berufen kann 256 ).
Die Beantwortung dieser Fragen fällt nunmehr nicht mehr schwer. Wir müssen folgendes feststellen:
1. Zu einer erfolgreichen Inanspruchnahme des streitigen Küstengewässers kraft Gewohnheitsrechts oder Unvordenklichkeit würde der Nachweis gehören, daß das Küstengewässer in der angegebenen Begrenzung langandauernd der Hoheit Lübecks unterlag. Die Begrenzung ist erst durch das Fischereigesetz von 1925 von Lübeck vertreten worden 257 ). Aber auch andere, die völkerrechtlichen Grundsätze beiseite schiebende Begrenzungen zugunsten Lübecks konnten nicht nachgewiesen werden.


|
Seite 111 |




|
2. Was aber die lang andauernde Ausübung von Hoheitsrechten anlangt, so ist auch in dieser Hinsicht ein Nachweis Lübecks nicht erbracht. Im Gegenteil erkennen wir, daß Lübeck in früherer Zeit eine Fischereihoheit nicht anstand, und daß bei den Fischreusenstreitigkeiten im 17. Jahrhundert Akte Lübecks vorlagen, die als Gewalttaten und Anmaßungen einer Herrschaft erschienen und daher weder für ein Gewohnheitsrecht noch für die Unvordenklichkeit in Betracht kommen können. Was die spätere Zeit betrifft, so wird von Lübeck erst durch das Fischereigesetz von 1896 eine Fischereihoheit, und zwar nur in einem Teil des streitigen Küstengewässers, in Anspruch genommen. Aber dieses Gesetz beruht auf einem Irrtum und ist von Mecklenburg nicht anerkannt worden. Im Gegenteil, Mecklenburg hat nicht allein die Fischereihoheit seit dem Mittelalter besessen, sondern auch vertreten, und auch im 19. Jahrhundert zuerst für das streitige Küstengewässer fischereipolizeiliche Gesetze erlassen. - Ebenso wenig kann sich Lübeck auf Fahrrechtshandlungen und auf die Ausübung einer Strandungshoheit stützen. Im Gegenteil sehen wir, daß lediglich Mecklenburg in dieser Hinsicht in Betracht kommt. Die Ausübung sonstiger Hoheitsakte wird zwar von Lübeck behauptet, aber in allgemeinen Redensarten, ohne daß irgendwie ein Beweis angetreten wird. In bezug auf Mecklenburg aber fanden wir die wichtige, spezielle Verordnung über den Dünenschutz von 1874.
Allein nicht nur dies. Öfter konnten wir feststellen, daß Lübeck Hoheitsrechte Mecklenburgs unmittelbar anerkannt hat. Es seien hier in Erinnerung gebracht die Anerkenntnisse im Fischreusenstreit von 1616, das lübische Fischereigesetz vom 28. Februar 1881, die Lübecker Abgrenzung seines Strandamtsbezirkes auf Grund der Reichsstrandungsordnung von 1874, die Verkündigung des Mecklenburger Gesetzes über den Dünenschutz von 1874 in Travemünde.


|
Seite 112 |




|
D.
Entscheidung
I. Das Hoheitsrecht Lübecks über das Küstengewässer Priwall-Harkenbeck.
Es ergibt sich somit, daß Lübeck den Nachweis nicht erbracht, daß ihm auf einer besonderen rechtlichen Grundlage an dem Küstengewässer Priwall-Harkenbeck irgendein Hoheitsrecht in Abweichung von den allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen zusteht. Es konnte weder ein partikuläres Gewohnheitsrecht,noch ein besonderer Rechtstitel, noch Unvordenklichkeit nachgewiesen werden. Infolgedessen hat Mecklenburg das gesamte Hoheitsrecht an diesem Küstengewässer, insoweit es nach der allgemein anerkannten völkerrechtlichen Abgrenzung ihm zukommt 258 ).
II. Die Anträge Lübecks 259 ) werden mit dieser Feststellung völlig durchbrochen und sind daher in jeder Hinsicht abzuweisen.
Hiermit versichere ich, daß die vorstehenden Ausführungen meiner Rechtsüberzeugung entsprechen.
Halle a. S., 3. Oktober 1925.
ord. Professor des deutschen Rechts an der Universität Göttingen.


|
[ Seite 113 ] |




|



|


|
|
:
|
IV.
Die Travemünder Reede,
Reedelaage und Reedegrenze
von
Staatsarchivrat Dr. W.Strecker.
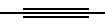


|
[ Seite 114 ] |




|


|
[ Seite 115 ] |




|
| Einleitung | 116 | |
| Reedelage und Reedegrenze | 119 | |
| A. |
Die alte nautische Reede
Beweise für die Reedelage im Archivgutachten von 1925, S. 119 bis 121. Ergänzungen, S 122 f. Eignung der inneren Bucht für Reedezwecke, S. 123 ff. Andere Ostseereeden, S. 126 - 128. Die Seekarten Waghenaers, S. 128 ff. Außentrave?, S. 133 f. "Trave van Femeren", S. 134 - 136. Geddas Karte, S. 137 bis 139. Die Fälle aus der Seekriegsgeschichte, S. 139 - 141. Seebuch von Månsson, S. 141 - 143. Kartenskizze von 1773, S. 143 - 148. Strandungen am Priwall, S. 148 - 150. - Geologische Veränderungen der Travemünder Bucht, S. 150 - 152. - Die Reede im Mittelalter, S. 153 f. |
119 |
| B. |
Die Reede im 19. Jahrhundert
Kartenskizze von 1803, S. 155. Französische Seekarte, S. 156 bis 159. Bericht des Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828, S. 160 - 163. Quellen aus dem Fischereistreit von 1823, S. 163 bis 169. Neueste Zeit, S. 169 - 172. |
155 |
| C. |
Die Peillieniengrenze
Peillinie nur moderne nautische Linie, S. 173 f. Der "Major", S. 174 f. Seine Weglassung auf der französischen Karte, S. 175 ff. Der Punkt A auf der Sahnschen Karte von 1823, S. 178 f. - Landgrenzpunkte und Lotgrenze, S. 179 - 181. Schluß, S. 181 f. |
173 |
| Nachwort | 182 | |
| 6 Beilagen (1-4, 5a, 5b). | ||


|
Seite 116 |




|
Einleitung.
Als der Streit um das Hoheitsrecht in der Travemünder Bucht zwischen Mecklenburg-Schwerin und Lübeck im März 1925 vor dem Staatsgerichtshofe für das Deutsche Reich anhängig wurde, waren wir noch mit der Anfertigung unseres vorigen Gutachtens beschäftigt, das erst mehrere Monate später (29. August 1925) abgeschlossen werden konnte 1 ). Das Ministerium entschloß sich daher, dem Staatsgerichtshofe zunächst die fertigen Abschnitte des Gutachtens, nämlich die Kapitel A und B des ersten Teiles nebst Anlagen, einzureichen. Zugleich legte es ein Rechtsgutachten des Staatsministers D Dr. Langfeld vom 5. Februar 1925 vor. Gegen dieses und den Torso unseres Gutachtens wendete sich Professor Dr. Rörig mit einer Gegenäußerung vom 6. Juli 1925. Exzellenz Langfeld erwiderte darauf mit einem zweiten Rechtsgutachten vom 15. August 1925. Wir indessen konnten die neue Rörigsche Schrift vorderhand auf sich beruhen lassen, weil vorauszusehen war, daß Rörig nach dem Abschlusse unserer Arbeit noch einmal das Wort ergreifen würde, und wir dann zusammenfassend erwidern wollten. Unterdessen aber erschien das vom Mecklenburg-Schwerinschen Ministerium eingeholte Rechtsgutachten des Universitäts-Professors Dr. J. v. Gierke in Göttingen vom 3. Oktober 1925. Es gelangt zu denselben Ergebnissen wie wir. v. Gierke berücksichtigt auch bereits die erwähnte Gegenäußerung Rörigs und bringt alles Wesentliche vor, was dagegen zu sagen ist. Wir haben dem kaum etwas hinzuzufügen.
Am 10. Oktober 1925 erließ der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich bis zur Entscheidung in der Hauptsache die bekannte einstweilige Verfügung.
Seitdem sind zwei größere Arbeiten über die Streitfrage herausgekommen. Der Professor des öffentlichen Rechts an der


|
Seite 117 |




|
Universität Rostock Dr. M. Wenzel ließ in der "Mecklenburgischen Zeitschrift für Rechtspflege, Rechtswissenschaft, Verwaltung" 2 ) eine Abhandlung: Die Hoheitsrechte in der Lübecker Bucht, Ein Beitrag zum Meeresvölkerrecht, erscheinen, die auch als Sonderdruck herausgegeben ist 3 ). Wenzel stimmt unseren rechtsgeschichtlichen Ergebnissen ebenfalls zu. Ferner hat Rörig ein neues Gutachten vorgelegt: Nochmals mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede, I. - III. Teil 4 ), im ersten Teile findet sich seine schon genannte Gegenäußerung vom Juli 1925 abgedruckt, im zweiten die einstweilige Verfügung des Staatsgerichtshofes mit den Gründen 5 ), im dritten erwidert Rörig auf das zweite Langfeldsche und das v. Gierkesche Gutachten sowie auf unser Archivgutachten von 1925, auch setzt er sich darin mit der Abhandlung Wenzels auseinander, soweit sie ihm bekannt geworden war.
Mit diesem dritten Teilte der Schrift werden wir uns in unseren folgenden Ausführungen beschäftigen. Wir schicken voraus, daß wir uns auf alles, was die Anwendung völkerrechtlicher Normen im vorliegenden Streitfalle betrifft, über die sich Rörig in der Vorbemerkung 6 ) verbreitet, durchaus nicht einzulassen beabsichtigen, weil wir uns als Historiker nicht für. hierzu befugt halten. Diese Fragen sind von berufener Seite, von Langfeld, v. Gierke und Wenzel, ausführlich besprochen worden. Weiter werden wir den ersten Abschnitt des neuen Gutachtens 7 ) zunächst übergehen. Rörig sucht darin wiederum die Ergebnisse zu erschüttern, die wir für die landesherrlichen Rechte am Küstengewässer seit dem Mittelalter gewonnen haben und die durch die Untersuchungen v. Gierkes noch wesentlich ergänzt sind. Ebenso sucht er unseren Nachweis zu bekämpfen, daß dem Barbarossaprivileg von 1188 für den vorliegenden Streitfall keine Bedeutung beizumessen sei 8 ). Wir sind der Meinung, daß diese Ausführungen Rörigs bei allen, die sich mit dem bisherigen Gang der Untersuchung und den vorgebrachten Quellen bekannt gemacht haben, auf jeder Seite Widerspruch erwecken müssen. Wir behalten uns


|
Seite 118 |




|
vor, auf einiges davon zurückzukommen, wollen aber fürs erste eingehen auf den Abschnitt B bei Rörig: die Travemünder Reede und ihre Grenzen (S. 76 - 142). Dabei handelt es sich ganz vorwiegend um zweierlei, um die Lage der alten nautischen Reede und um die Linie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle, d. h. es handelt sich um einfache Feststellungen, weniger um eine rechtsgeschichtliche Untersuchung, Während Rörig in dem betreffenden Abschnitte zunächst die neuere Zeit behandelt, wollen wir den umgekehrten Weg gehen.
Wir zitieren das neue Rörigsche Gutachten als Rörig III, die beiden früheren von 1922 (gedruckt 1923) und 1924 9 ) als Rörig I und Rörig II. Unser Archivgutachten von 1925 werden wir, wie es Brauch geworden ist, als Archiv II zitieren 10 ).


|
Seite 119 |




|
Reedelage und Reedegrenze.
In seiner neuen Schrift hat Rörig zum ersten Male Untersuchungen über die Örtlichkeit der Lübecker nautischen Reede angestellt und kommt zu dem Schlusse, daß darunter von jeher die Wasserfläche vor Rosenhagen zu verstehen sei. Wir dagegen haben in unserem vorigen Gutachten die alte Reede in die innere Bucht, dicht vor die Travemündung, nach dem Brodtener Ufer zu verlegt 11 ).
Warum kam es auf die Örtlichkeit der Reede an? Weil Rörig angenommen hat, daß hier schon seit dem Mittelalter eine Lübecker Gebietshoheit entstanden sei, ferner weil Lübeck beim Fischreusenstreit von 1616 vorgab, daß die bei der Harkenbeck ausgesetzte Reuse auf seiner Reede stehe, schließlich weil die Nachrichten über die Buchtfischerei des Harkenseer Gutsfischers Jochim Schröder von 1600, in denen Rörig einen Beweis für die Lübecker Fischereihoheit sieht, erst nach Feststellung der Lage der alten Reede richtig verstanden werden können 12 ).
Zurückweisen müssen wir Rörigs Behauptung 13 ), wir hätten bei unserer Feststellung über die Reedelage den Bericht des Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828 zur Hauptgrundlage unserer Beweisführung gemacht "unter völliger Ausschaltung aller anderen Quellenzeugnisse". Wir sind im Gegenteil die ersten gewesen, die überhaupt Zeugnisse für die Lage der alten Reede vorgebracht haben, und zwar vier Quellen aus dem 16., 17. und 18. Jahr-


|
Seite 120 |




|
ändert 14 ). Auf diese wichtigen Quellen geht aber Rörig so gut wie gar nicht ein. Er kommt (III, S. 104, 121) nur zurück auf die Aussage des Zöllners Tydemann von 1547 nicht aber auf das, worauf dabei aller Wert zu legen ist 15 ). Den Bericht des Lotsenkommandeurs haben wir bei unserer Untersuchung zunächst gar nicht benutzt. Sondern erst später bei der Behandlung der Reedegrenzen zur Bestätigung der von uns gefundenen Lage der alten Reede verwertet 16 ).
Die alte Reede allein haben wir untersucht. Die moderne ist gleichgültig. Denn, abgesehen von der jüngsten Vergangenheit, hat Lübeck nur zur Zeit der alten Reede, bei den Fischreusen-Streitigkeiten des 17. Jahrhunderts, nachweisbar einen Anspruch auf das mecklenburgische Küstengewässer der Travemünder Bucht erhoben. Im 19. Jahrhundert dagegen hat es sich auf den völkerrechtlichen Standpunkt gestellt, wie seine amtlichen Erklärungen und Handlungen in den siebziger Jahren beweisen 17 ). Und seine später angenommene und bis 1923 festgehaltene Hoheitsgrenze Harkenbeck-Haffkruger Feld führte mitten durch das Gewässer gegenüber der Harkenbeck, das man als Reede bezeichnete, "so daß Lübeck auf einem großen Teile dieser Reede gar keine Hoheit beansprucht hat, also der Ansicht war, daß eine Reede nicht notwendig unter der Gebietshoheit stehen müsse" 18 ).
Nach den erwähnten Quellen befand sich die alte Reede in der inneren Bucht, nach der Westküste zu (1547), beim Blockhause


|
Seite 121 |




|
(1616), beim Leuchtenfeld (1670), womit immer dieselbe Örtlichkeit gemeint ist. Das Blockhaus wird wiedergegeben auf einer Karten- Skizze des bekannten Kartographen Tilemann Stella von Siegen, der in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Im Dienste des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg tätig war (Beilage 1) 19 ) Nach der vierten Nachricht endlich lag ein Schiff, das im Mai 1792 auf der Reede gekentert war, laut der Auslage des mecklenburgischen Strandreiters "unter den auf der Rheede liegenden Schiffen wohl 400 Schritte vom Lande", Und zwar lag es gegenüber dem Priwall und so, daß man zwischen dem Schiff und dem Ufer eine Tonne sehen konnte, die gewiß nicht vor Rosenhagen, wo Rörig die alte Reede Sucht, verankert war. Nun mag der Strandreiter die Entfernung unterschätzt haben, in jedem Falle aber handelt es sich um die innere Bucht, immer noch um die Gegend vorm Blockhause, und hier lagen 1792 mehrere Schiffe auf der Reede 20 ).


|
Seite 122 |




|
Dazu kommt folgende Nachricht. In dem Strandungsfalle von 1516 21 ), in dem der Travemünder Vogt zwei Schuten, eine am Priwall, die andere bei Rosenhagen geborgen haben sollte, beschwerten sich alsbald die mecklenburgischen Herzöge über diesen Eingriff in ihre Hoheitsrechte. Lübeck erwiderte, daß das eine Schiff hart am Bollwerk und am Priwall Schiffbruch erlitten habe, das andere auf der Reede, wobei der Ort Rosenhagen durchaus nicht genannt wurde. Aus der Entgegnung der Herzöge, die Rörig bei seiner Besprechung dieses Falles (III, S. 119 f.) nicht berücksichtigt, geht hervor, daß man in Mecklenburg die Lübecker Auskunft dahin verstand, daß beide Schiffe am Priwall gescheitert sein sollten 22 ). Man suchte also die Reede, den angeblichen Strandungsort des zweiten Schiffes, gegenüber dem Priwall in der inneren Bucht und nicht vor Rosenhagen.
Zu allen diesen Quellen paßt es, daß während des Fischreusenstreites, bei dem Zeugenverhör in Harkensee 1616, verschiedene Strandungsfälle vorgebracht wurden, in denen Schiffe "uf der Reide zu Travemünde" oder "zu Travemunde uf der Reide" gesunken oder vom Anker gerissen seien 23 ). Das sind Ortsbestimmungen, die nicht auf eine Reede vor Rosenhagen schließen lassen, sondern offenbar für das Gewässer nahe vor Travemünde gelten sollten. Es erklärten denn auch die


|
Seite 123 |




|
mecklenburgischen Kommissare in ihrem Bericht, daß die Schiffe weitab von der Wasserfläche am Ausflusse der Harkenbeck, wo die Reuse gestanden habe, in der tiefen See "ihren gewönlichen Curs und Gang hielten", d. h. die Schiffe fuhren an der Harkenbeck vorüber, aber sie lagen in dieser Gegend nicht auf der Reede.
Schon jene vier in unserem vorigen Gutachten angeführten Quellen genügten zur Feststellung der alten Reede. Weitere Beweise brauchten wir nicht zu bringen 24 ). Nun aber ist die Frage, ob unsere gewiß sicher begründeten Ergebnisse trotzdem durch das neue von Rörig herangezogene Material, insbesondere das Kartenmaterial, erschüttert werden können. Wir antworten hierauf mit einem entschiedenen Nein. Denn Rörig verfährt bei seinen Untersuchungen gar nicht kritisch, ferner berechnet er die Lage der Reede nach den Wassertiefen, die in seinen Quellen angegeben werden, legt aber eine ganz irrige Fadenlänge von 2 m zugrunde und kommt infolgedessen zu irrigen Tiefen, also auch zu einer verkehrten Örtlichkeit, schließlich ist ihm eine Seekarte aus dem 17. Jahrhundert, worauf die alte Lübecker Reede deutlich verzeichnet ist, nicht bekannt geworden. Sie findet sich in dem Ostsee-Kartenwerk, das der schwedische Seemann Peter Gedda 1695 herausgegeben hat. Wir werden auf dieses Werk mehrfach zurückkommen.
Bevor wir uns aber dem Kartenmaterial zuwenden, wollen wir untersuchen, was es denn mit der so lebhaft verfochtenen Meinung Rörigs auf sich hat, daß die Wasserfläche, die wir für die alte Reede in Anspruch nehmen, für einen Ankerplatz nicht geeignet gewesen sei.
Ganz unverständlich ist uns seine Behauptung 25 ), wir hätten die Reede "ausgerechnet auf die Plate" versetzt. Denn die Plate liegt unmittelbar vor der Travemündung, wo sie auch auf der Sonderkarte der Traveeinfahrt, die sich am Fuße der großen französischen Seekarte der Lübecker Bucht von Beautemps-Beaupré findet, als Barre de la Trave angegeben ist. Und während das Wasser auf der Plate nach Rörigs eigenen Mitteilungen 1789 2 1/2 m 1831 8 - 13 3/4 Fuß (= 2,30 - 3,95 m) tief war 26 ), verzeichnet die Sonderkarte der Einfahrt nach Travemünde, die einen Teil der neuesten deutschen Admiralitätskarte der Lübecker Bucht


|
Seite 124 |




|
(Nr. 37) bildet, dort, wo wir auf der Kartenskizze unseres vorigen Gutachtens die alte Reede eingetragen haben - also innerhalb der vom Gömnitzer Turm (Major) am Brodtener Ufer vorbeigezogenen Linie - Wassertiefen bis zu 8,4 m 27 ). Auf der älteren Admiralitätskarte von 1873 (Nr. 37) steht in derselben Gegend auf der Majorlinie selbst, die sich leicht ziehen läßt, die Tiefenzahl 8,5 m. Das sind schon fast fünf Lübecker Faden (8,63 m).
Die Majorlinie, die erst im 19. Jahrhundert auftaucht, wird zwar im 17. Jahrhundert und früher keine Bedeutung gehabt haben, doch wollen wir sie bei unseren Untersuchungen als Bestimmungslinie verwenden. Der Ankergrund in der inneren Bucht ist gut. Die deutsche Admiralitätskarte von 1873 gibt innerhalb der Majorlinie, die sich leicht ziehen läßt, die Buchstaben Sk (Schlick). Auch Tanggrund wird vorhanden sein; wenn man auf der erwähnten französischen Seekarte, die 1811 aufgenommen ist, die Majorlinie konstruiert, so findet man zwischen der Linie und der Travemündung vermerkt: S Al (Sable, Algue), außerdem S (Sable) 28 ). Reiner Sandgrund ist aber für eine Reede völlig ausreichend.
Und hier auf der Wasserfläche, wo die alte Reede zu suchen ist, konnten vormals alle Schiffe liegen, auch die beiden großen Kriegsschiffe, deren Tiefgang Rörig (III, S. 114) aus der Arbeit von G. Kloth über Lübecks Seekriegswesen in der Zeit des nordischen Siebenjährigen Krieges (1563 - 1570) 29 ) entnommen hat. Wir begreifen nicht, warum Rörig aus den Angaben dieser Arbeit folgern will, daß die Reede durchaus vor Rosenhagen gelegen haben müsse. Denn das größte damalige Lübecker Kriegsschiff, der "Adler", soll einen Tiefgang von 9 lübischen Ellen gehabt haben; das sind 18 lübische Fuß = 3 Faden (5,17 m) 30 ). Der "Adler"


|
Seite 125 |




|
hätte also noch nicht 6 m gebraucht 31 ). Überdies ist hinter den Angaben, die sich über dieses Schiff erhalten haben, ein Fragezeichen zu machen 32 ). In der Überlieferung ist es zu einer Art von Märchenschiff geworden, und es war in jedem Falle so überragend groß, daß es als allgemeines Beispiel gar nicht dienen kann. Es gehörte zu dem Typ der damals in der Ostsee noch seltenem Schlachtschiffe 33 ), die eigens für den Krieg gebaut waren und deren Ausmaße für die Bestimmung der alten Lübecker Reede keineswegs entscheidend sind, ganz davon abgesehen, daß auch diese Fahrzeuge in der inneren Bucht reichlich ankern konnten.
Der "Adler" soll 800 Last gehalten haben 34 ) Von den drei übrigen Lübecker Linienschiffen in jenem Kriege war eines halb so groß (400 Last), der Rest noch kleiner 35 ). Früher waren die Schlachtflotten nur aus bewaffneten Kauffahrern zusammengestellt worden, und diese bildeten auch noch im nordischen Siebenjährigen Kriege die Mehrzahl der Schiffe in allen beteiligten Flotten 36 ).


|
Seite 126 |




|
Von den bewaffneten Handelsschiffen der damaligen Lübecker Flotte aber war nur eines 280 Last groß, die übrigen 200 Last und darunter. Das waren schon große Kauffahrteischiffe 37 ). Auch in dem einen schwedischen Schiffe von 1532, das Rörig anführt, sieht Kloth 38 ) "ein erstaunlich großes Schiff", "das die Fahrzeuge seiner Zeit weit übertraf und jedenfalls für den Kriegszweck gebaut war". Dabei hätte dieses Schiff, das 11 Fuß tief ging, die Plate bei hohem Wasserstande noch überfahren können.
Nach einer Erklärung des Wismarer Rates von 1621 bot eine Tiefe von acht Ellen (= 16 Fuß oder 4,60 m) Raum für große Schiffe zum Ankern und Segeln 39 ). Damit sollte aber nicht gesagt werden, daß die Schiffe eine solche Tiefe brauchten. Vor dem Dorfe Hoben, im Innenwinkel der Wismarer Bucht, wo gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Reede für große Schiffe festzustellen ist 40 ) und wo noch eine dänische Seekarte der westlichen Ostsee von 1818 41 ) einen Anker zeigt, sind auf der deutschen Admiralitätskarte von 1873 nur in der ausgebaggerten Fahrrinne 42 ) Wassertiefen von 5 - 5 1/2 m angegeben, zwischen Hoben und der Rinne finden sich Tiefen bis zu 4 m. Ältere Seekarten, die des Schweden Peter Gedda von 1695 und die etwa gleichzeitige des dänischen Seekartendirektors Jens Sörensen 43 ) verzeichnen an dieser Stelle 2 1/2 Faden (15 Fuß) 44 ).
In derselben Tiefe konnten große Schiffe natürlich auch in der Travemünder Bucht ankern. Ja, noch um die Mitte des


|
Seite 127 |




|
19. Jahrhunderts hätten binnen der Majorlinie die größten Dampfer liegen können, die es damals in der Welt gab, die aber für die Lübecker Fahrt gar nicht in Frage kamen 45 ). Ebenso hätte dieses Gewässer noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts für manche Kriegsschiffe genügt, z. B. für die gedeckten preußischen Korvetten (auch Fregatten genannt) aus der Zeit von 1860 - 1870, die 2600 t und 6 m Tiefgang hatten.
Viele andere Reeden waren nicht tiefer. Man darf durchaus nicht, wie Rörig (III, Anm., 89) es tut, zur Vergleichung auf die Reede von Hela hinweisen, die nach den Angaben in Waghenaers "Spiegel der Seefahrt" bei 25 Faden Tiefe lag 46 ). Denn die Helaer Reede ist ja außergewöhnlich tief, natürlich nicht, weil die Schiffe solcher Tiefe bedürfen, sondern weil der Grund hier steil abfällt. Das sagt Waghenaer ausdrücklich in seinem jüngeren Werk: Thresoor oft Cabinet van der Zeevaert (1592). Er gibt darin diese Reede auf 16 und 20 Faden an und rät, dicht am Lande zu ankern, da man sonst keinen Grund mehr habe 47 ).
Auch Waghenaer hat ungezählte Reeden bei viel geringeren Tiefen. Wir entnehmen aus dem Seekartenwerk von Wilhelm Janß Blaeu, De groote Zeespiegel (Amsterdam 1658) folgende Angaben über Ostseereeden, und zwar aus dem Text des Werkes, der öfter noch genauer ist als die Karten:
- Vor der Peenemündung am Ruden bei 3 und 2 1/2 Faden, so flach oder tief es gefalle. (Daar is de ghemeene Reede vor de Schepen.) Die Karte zeigt außerdem noch einen Anker bei 5 Faden.


|
Seite 128 |




|
- Libau, 4 1/2 oder 5 Faden weniger eine Elle (4 2/3 Faden).
- Pernau, 3 und 4 Faden (auf der Karte zwei Anker bei 3 Faden).
- Ystad, 3 Faden oder eine Elle weniger (daer is schoone sandtgrondt).
- Trelleborg, 4, 3 oder 2 1/2 Faden.
- Malmö, 3, 4 oder 5 Faden 48 ).
Solche Reeden finden sich auch auf der Nordsee. Natürlich gab es auch tiefere. Das richtete sich nach den geographischen Verhältnissen, dem Ankergrunde, der nicht felsig sein darf, und der Möglichkeit, vorm Winde Schutz zu haben.
Das Kartenwerk Peter Geddas von 1695 gibt auf einer Sonderkarte die Kopenhagener Häfen wieder. Da führt eine Fahrrinne in das Gewässer vor der Stadt zwischen den Inseln Seeland und Amager, und hier liegt der Kriegshafen (de haven voor de Vloot ofte Orloogsscheepen) bei 19 Fuß Tiefe, der Handelshafen (voor de Copvardiescheepen) bei 18 Fuß (3 Faden) 49 ). Solche Tiefe genügte völlig, wie auch die Wismarer Reede beweist, die überhaupt nur 2 1/2 Faden hatte. Die früheste Seekarte, die Rörig zum Beweise dessen, daß die Lübecker Reede vor Rosenhagen gelegen habe, heranzieht, findet sich in dem schon erwähnten "Spiegel der Seefahrt", dem Kartenwerk des holländischen Seemannes Lucas Janß Waghenaer von Enkhuizen aus der zweiten Hälfte des 16, Jahrhunderts. Es behandelt die Gewässer an einem großen Teile der europäischen Küsten. Die Karte, von der Rörig einen Ausschnitt wiedergibt 50 ), zeigt die Lübecker Bucht nebst dem Teile der Ostsee, der östlich von Fehmarn zwischen den dänischen Inseln und der


|
Seite 129 |




|
deutschen Küste bis jenseits Rügens liegt 51 ). Richtig hebt Rörig (III, S. 107 f.) hervor, daß in dem von ihm mitgeteilten Ausschnitte scheinbar nur die große Lübecker Bucht wiedergegeben wird, tatsächlich aber mit dem Gewässer vor der Trave die Travemünder Bucht gemeint ist.
Da findet sich vor dem Traveausflusse eine Sandbank, die Plate, die nach Rörig "so wesentlich ist, daß sie auf einer Karte so großen Maßstabes angegeben wurde". Das sei "der beste Beweis, was für eine Rolle diese Sandbank für die nordeuropäische Schiffahrt spielte". Auffallend ist es dann allerdings, daß die Fahrrinne, die über die Plate führt, von Waghenaer im Text 52 ) als ein "gutt Tief" von 6 Ellen (= 2 Faden, wie auf der Karte steht) und ausdrücklich als ein Tief "für grosse Schiffe" bezeichnet wird. Zwar bezweifelt Rörig diese Tiefenangabe, aber die Fadenzahlen Waghenaers gelten, wie er ausdrücklich sagt, für die mittlere Fluthöhe 53 ), und wenn es hier auf der Bank, auf die es gerade ankam, nicht stimmen sollte, so ist auf die übrigen Tiefenzahlen Waghenaers noch weniger Wert zu legen 54 ). Im übrigen finden sich Sandbänke überall auf den Waghenaerschen Karten, und sie sind, ebenso wie die Plate, wahrscheinlich auch nicht alle richtig gezeichnet.
Vor der Plate stehen quer über die Bucht zweimal die Zahlen 4 (4 Faden), dann folgen seewärts in einer Linie 6, 12, 12, Zahlen, die die Richtung des Fahrwassers angeben sollen, das dann östlich in die "Trave van Femeren" (wir kommen auf diesen Ausdruck


|
Seite 130 |




|
zurück) mündet, im Nordwesten aber an der holsteinischen Küste entlang führt. Zwischen den Zahlen 4 und 6 liegt ein Anker Also, folgert Rörig, liege die Reede zwischen 4 und 6 Faden. Darunter versteht er Tiefen von 8 - 12 m; mithin sei die Reede vor Rosenhagen zu suchen.
Nun kommt man aber bei 12 m Tiefe noch gar nicht auf die Höhe von Rosenhagen, womit immer die Gebäude gemeint sind, sondern kaum bis auf die Pötenitz-Rosenhäger Grenze 55 ). Überdies ist die von Rörig angenommene Fadenlänge von 2 m für die frühere Zeit ganz unzulässig. Sie ist überhaupt nicht genau und nur ein Ungefähr aus der Zeit des Überganges zum Metermaß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Faden betrug, wie noch jeder Seemann weiß, 6 Fuß 56 ); es ist der Klafter, die Strecke, die ein Mann mit ausgebreiteten Armen messen kann. Das Fußmaß war überall verschieden, wenn auch die Unterschiede meistens nicht bedeutend waren. Diese Unterschiede übertragen sich natürlich auf den Klafter. Nun werden aber Tiefenzahlen in der Travemünder Bucht auf Lübecker Angaben zurückzuführen sein, und es kann hier gar kein anderes Maß als der Lübecker Fuß und der Lübecker Klafter (Faden) zugrunde gelegt werden 57 ). Der Lübecker Fuß ist aber gleich dem Rostocker, er beträgt 127,5 Pariser Linien = 0,28762 m 58 ).


|
Seite 131 |




|
Mithin ist ein Lübecker Faden (6 Fuß) = 1,72572 m 59 ). Es sind also
Die Tiefenzahlen, zwischen denen der Anker auf der Waghenaerschen Karte liegt, betragen demnach 6,90 und 10,35 m. Vor allen Dingen aber erhebt sich die Frage, ob Waghenaer die Absicht hatte, ausdrücklich diese Tiefen als Reedegebiet zu bezeichnen, wovon er im Texte kein Wort sagt, oder ob er den Anker willkürlich in die Bucht gesetzt hat, zum Zeichen dessen, daß hier eine Reede war, die ja schließlich jeder finden konnte, der ankam, Daraufhin muß sein Werk, Text wie Karten, im ganzen geprüft werden, und wenn man das tut, so stellt sich heraus, daß die Anker häufig ganz ungenau liegen 60 ). Deswegen läßt sich für die Örtlichkeit der Reede nichts daraus schließen.


|
Seite 132 |




|
Wichtiger als die Karte bei Waghenaer ist der Text, den Rörig ja auch anführt und bespricht 61 ) Da heißt es, daß vor Lübeck eine große Inwiek und ein guter Hafen sei, wo man vor allen Winden, außer einem Nordost oder Nordnordost sicher liegen möge. Mit dieser großen Bucht und dem großen Hafen wäre nach Rörig "zweifellos die Reede bei Rosenhagen gemeint"; das ergebe sich aus der Warnung vor Nordost und Nordnordost. Als wenn diese Winde nicht in der inneren Bucht genau so gefährlich seien. Geschützt aber lag man nach Waghenaer gegen alle anderen Winde, also auch gegen Nordwest. Zwar wird in der Lübecker Bucht die schwerste See bei nordöstlichen Stürmen aufkommen, weil die Bucht gegen Nordost offen liegt. Soviel aber schirmt die von der mecklenburgischen Küste über acht Seemeilen entfernte holsteinische nicht, daß die Schiffe vor Rosenhagen gegen Sturm aus Nordwest sicher wären; das gilt zumal für die Schiffe der früheren Zeit, die eben der flachen Häfen wegen so rank gebaut waren und infolgedessen leicht kenterten. Wohl aber hatten sie Schutz gegen Nordwest in der inneren Bucht, weil hier das Brodtener Ufer den Sturm abfing. Auch mit dem Schutz gegen Nordwind muß es zu Waghenaers Zeiten in der inneren Bucht besser bestellt gewesen sein als heute. Die Ursache hierfür liegt in geologischen Veränderungen, auf die wir zurückkommen werden. In jedem Falle weisen die Angaben, die Waghenaer im Text macht, auf eine Reede dicht vor der Travemündung hin.
Nun aber hat ja Waghenaer 1592 noch einen zweiten Seeatlas herausgegeben, den - in kleinerem Format erschienen - Thresoor oft Cabinet van der Zeevaert, der manche Verbesserungen bringt und den auch Rörig anführt. Hier findet sich die Lübecker Bucht auf einer Karte, die das westliche Kattegat, die Belte und das Gewässer bis hinter Wismar wiedergibt. Einen Ausschnitt daraus geben wir in der Beilage 2 62 ). Diese Darstellung der Lübecker


|
Seite 133 |




|
Bucht ist jünger, für das holsteinische Ufer auch genauer als die im Spiegel der Seefahrt, die ihr gegenüber nicht mehr in Betracht kommt. Und auf der jüngeren Karte liegt der Anker vor Travemünde innerhalb der 5-Faden-Tiefen, die sich heute zuerst dicht hinter dem nordwestlichen Teile der Majorlinie finden. Eine Tiefe von 6 Faden wird gar nicht verzeichnet. Wir lassen es zunächst dahingestellt sein, ob man auf diese Lage des Ankers mehr Wert legen darf als auf die im Spiegel der Seefahrt. Der Text im Thresoor bietet nichts. Wichtig aber in den Waghenaerschen Werken ist für uns, außerdem Text im Spiegel, der Umstand, daß der Anker auf beiden Karten nach dem westlichen Ufer zu liegt, worunter, wie ja die Karten aufzufassen sind, das Brodtener Ufer zu verstehen ist. Dieses wird auf der jüngeren Karte übrigens schon ein wenig angedeutet. Es ist gar kein Zweifel, daß die Angaben Waghenaers sich auf eine Reede in der inneren Bucht, fern von Rosenhagen, beziehen.
Noch in anderer Hinsicht hat Rörig die Waghenaerschen Karten nicht richtig aufgefaßt. Auf dem von ihm bekannt gemachten Ausschnitte stehen nämlich vor der Travemündung die Worte: de Trave, Wer dies liest, wird es einfach für den Flußnamen halten. Warum soll er denn nicht vor der Mündung stehen? Ähnliches findet sich doch noch heute oft auf Karten. Der Name steht so weit draußen, weil er sonst die Plate und die Tiefenzahlen dahinter verdecken würde. Auf solche reine Äußerlichkeiten der Karte ist gar nichts zu geben. Rörig aber zieht den Schluß, daß die Travemünder Bucht von der Plate aus weiter seewärts den Namen "de Trave" geführt habe, eine Bezeichnung, die aufs schlagendste beweise, wie richtig .und den Zeitanschauungen entsprechend es sei, wenn er in seinen früheren Gutachten auf die Einheit von Trave und Reede hingewiesen habe. So sagt er denn, "der Sprache (!) Waghenaers folgend": "Die Außentrave seewärts der Plate ist die Travemünder Reede" 63 ). Ferner sieht er in der Karte einen Beweis für seine Auslegung des Barbarossaprivilegs von 1188; denn Waghenaer habe ja 1586 eine Trave "usque in mare" gekannt 64 ). Und zu unserer Feststellung, daß man niemals das Gewässer vor Rosenhagen oder die ganze Bucht "Trave" genannt habe, bemerkt er, daß ein Blick auf seine Kartenbeilage genüge, um sich vom Gegenteil zu überzeugen 65 ).


|
Seite 134 |




|
Wir wissen aber gar nicht, wie solche Behauptungen erhoben werden können. Gleich auf derselben Karte steht der Name des Fahrwassers, das bei Dornbusch (Hiddensö) vorüber nach Stralsund führt, "de Yelle" gleichfalls vor dem Einlaufe. Und man braucht nur die vorhergehende Karte aufzuschlagen, so findet man, daß es bei allen pommerschen Flüssen ebenso ist. Auch sonst ist es der Fall, z, B. bei der Düna. Wir geben die Karte der pommerschen Küste in der Beilage 4 verkleinert, im Original sind die Buchstaben der Flußnamen genau so groß wie bei der Trave. In Waghenaers Tresoor der Seefahrt aber stehen die pommerschen Flußnamen neben den Flußläufen, und der Name der Trave ist ganz verschwunden 66 ).
Wenn ferner im nordischen Siebenjährigen Kriege die Meldung kam, daß die schwedische Flotte "auf die Trave" gelaufen sein solle, so wird doch damit nicht bewiesen, daß die Reede "Trave" genannt wurde 67 ). Es ist hier ja nur die Richtung der Fahrt gemeint. Im selben Sinne kann man noch heute sagen: auf die Trave, auf die Elbe oder auf die Warnow laufen. Daß man nicht die ganze Travemünder Bucht Trave nannte, ergibt sich klar aus dem Lübecker Fischereivergleich von 1610 68 ). Und in der Fischereiordnung von 1585 wird das Gewässer außerhalb der Flußmündung niemals Trave, sondern "in der See" genannt. Im übrigen kommt es auf den Namen nicht an, denn es wäre gar nicht einzusehen, warum Mecklenburg an einer solchen "Trave" nicht hätte teilhaben sollen.
Schließlich weist Rörig 69 ) darauf hin, daß im Spiegel der Seefahrt "die gesamten Gewässer" zwischen den dänischen Inseln und der mecklenburgischen Küste als "De Trave van Femeren" bezeichnet würden. Das sei "ein sehr interessanter Beleg für die Tatsache, daß die ganzen südwestlichen Gewässer der Ostsee ihr Gepräge von der Bedeutung der auf Lübeck zielenden Schiff-


|
Seite 135 |




|
fahrt erhielten". Ebenso finde sich die " Trave van Femeren" auf der Karte im Tresoor der Seefahrt, wo außerdem "das gesamte Gewässer der Lübecker Bucht bis nach Fehmarn hinauf" die Bezeichnung "De Trave van Lübeck" führe 70 ). Das ist unrichtig. Es sind nicht die gesamten Gewässer, die so genannt wurden, sondern es handelt sich um ein Mißverständnis Rörigs, der offenbar glaubt, daß "Trave" hier mit dem Flußnamen im Zusammenhange stehe. So ist es aber nicht. Trave (verwandt wahrscheinlich mit le travers, transversum, traversum, die Durchquerung) heißt hier einfach: Fahrwasser. Das ergibt sich schon deutlich aus Waghenaers Beschreibung der Tiefen an der französischen Küste im Spiegel der Seefahrt 71 ); "Zwischen Heissant und Obreueracq 72 ) in der trauen oder farweg ist es tief 60 vadem". Und "Trave" im Sinne von Fahrwasser haben wir auch sonst bei den Beschreibungen französischer und englischer Gewässer 73 ) sowie in der Ostsee gefunden. In der Ostsee kennt Waghenaer eine "Trave van Langhelandt" 74 ); es ist der Langelands-Belt. Und er spricht von der Trave zwischen den kleinen Inseln Sprogö und Romsö, die im Großen Belt liegen 75 ) Auf einer Karte im Tresoor der Seefahrt, die in der Hauptsache die Küste von Rostock bis Danzig darstellt, finden sich zwischen Möen und Rügen in der Richtung auf die Lübecker Bucht die Worte: de Trave nae Lubeck. Diese Bezeichnung wird ebenso wie die "Trave von Fehmarn" ganz unverständlich, wenn man sie mit dem Travefluß in Verbindung bringt. Fehmarn liegt ja noch ganz am westlichen Ende der Ostsee, und wenn man von hier aus nach Osten zu, zwischen den dänischen Inseln und der deutschen Küste in die Tiefe des großen Meerbusens hineinfährt, so sieht man Fehmarn, so lange der Blick reicht, im Westen liegen. Deshalb hieß diese Fahrstraße: de Trave


|
Seite 136 |




|
van Femeren, Das ist sehr sinnvoll, hat jedoch mit dem Travefluß und der Lübecker Schiffahrt nichts zu tun. Die "Trave van Lubeck" aber ist das Fahrwasser der Lübecker Bucht 76 ).
Damit verlassen wir die Waghenaerschen Karten. Es gibt dann noch eine ganze Reihe älterer Atlanten, die auch Rörig in seinem Exkurs (III, S. 148) meistens erwähnt, aus denen sich aber nichts über die Travemünder Reede entnehmen läßt, weil sich weder ein Anker noch sonst etwas findet, woraus auf die Örtlichkeit der Reede zu schließen wäre 77 ). Zwar hat Rörig versucht, einen Teil dieser Karten zur Stützung seiner These von einer Reede bei Rosenhagen zu verwerten, aber dies erledigt sich bei Betrachtung der Karten von selber 78 ).


|
Seite 137 |




|
Wichtig ist dagegen die Rörig nicht bekannt gewordene Karte des Kapitäns und Kommandeurs der königlich schwedischen Steuerleute und Lotsen Peter Gedda. Dieser war dem schwedischen Vizeadmiral von Rosenfeldt, der sich schon lange mit der Verbesserung der bisherigen fehlerhaften Ostseekarten beschäftigt hatte, beigeordnet worden, um neue Karten aufzunehmen. Rosenfeldt und Gedda haben dann fünfzehn Jahre hindurch die ganze Ostsee befahren. Gleich darauf hat Gedda aus den von ihnen angefertigten großen Originalkarten ein Kartenwerk über die Ostsee und das Skagerrak zusammengestellt und 1695 in Amsterdam erscheinen lassen 79 ). Wir geben in der Beilage 3 einen Ausschnitt daraus,


|
Seite 138 |




|
auf dem die Lübecker Bucht mit der Travemünder Reede dargestellt ist 80 ). Die Küsten sind noch recht mangelhaft gezeichnet. Eigene Landmessungen haben Rosenfeldt und Gedda hier zweifellos nicht vorgenommen 81 ). Man sieht auf dem Ausschnitt vor der Travemündung eine Barre, die Plate, durch die ein Tief führt. Westlich davon, zwischen der Flußmündung und Neustadt, findet sich ein Küstenvorsprung und davor ein Riff. Es ist das Brodtener Höved mit dem Steinriff, denn einen anderen Küstenvorsprung und ein anderes Riff gibt es zwischen der Travemündung und Neustadt nicht. Wahrscheinlich soll aber nicht das ganze Steinriff, sondern nur der in der Nähe des Ufers gelegene Teil dargestellt sein. Ungefähr dort, wo das Riff im Süden endet, ist der Möwenstein zu suchen. Ferner zeigt die Karte drei Anker, einen auf der Traue selbst zur Bezeichnung der Flußreede, die es also gab. Die beiden anderen Anker liegen in der Bucht binnen den 5-Faden-Tiefen, einer dicht vor der Flußmündung, der zweite nach dem Brodtener Ufer zu, zwischen 5 und 3 Faden. Weil Gedda mit Ankern keineswegs verschwenderisch ist, so hat dieser zweite Anker sicher seine besondere Bedeutung. Die Reede zog sich also von der Travemündung nach Westen hin in der Richtung auf den Möwenstein.
Nun vergleiche man mit dieser Karte jene vier Quellen, aus denen wir die Lage der alten Reede erschlossen haben (oben S. 120 f.). Sie stimmen völlig damit überein. Und auch die Karte in Waghenaers Tresoor der Seefahrt (Beilage 2) steht mit der Geddaschen durchaus im Einklange. Genau da, wo wir auf der Kartenskizze unseres vorigen Gutachtens


|
Seite 139 |




|
die alte Reede eingetragen haben, lag sie nach Peter Gedda, dem Spezialisten der Ostseefahrt, 1695, fast achtzig Jahre nach dem Fischreusenstreit. Dieses Ergebnis ist überhaupt nicht mehr zu erschüttern. Und es versteht sich eigentlich von selbst. Denn es wäre ja der helle Widersinn gewesen, die Schiffe bei Rosenhagen ankern zu lassen, wo sie lange nicht so geschützt gelegen hätten und von wo das Leichtern, der größeren Entfernung wegen, viel mehr Zeit beansprucht haben würde. Es ist klar, daß man die Schiffe in die innere Bucht und nahe an die Barre heranbrachte. Wir hatten durchaus recht, in unserem vorigen Gutachten bei der Behandlung des Fischreusenstreites zu erklären, daß niemand etwas von einer Reede bei Rosenhagen gewußt habe.
Dem widerspricht auch durchaus nicht das, was Rörig (III, S. 112 ff.) aus der Seekriegsgeschichte anführt. Die Lübecker Kriegsschiffe, die im nordischen Siebenjährigen Kriege auf der Reede lagen oder wieder auf die Reede kamen, hielten sich natürlich in der inneren Bucht auf, soweit sie nicht über die Plate gesteuert wurden 82 ) Auch die schwedische Flotte, die 1565 ein lübisches Kriegsschiff auf der Reede überraschen wollte, muß - wenigstens zum Teil - in die innere Bucht eingedrungen sein, wo das Fahrzeug, auf das es abgesehen war, zweifellos lag. Die Schweden kamen damals in den Bereich der Geschütze des Blockhauses 83 ). Ebenso die dänische Flotte, die im Jahre 1612 lübische


|
Seite 140 |




|
Schiffe auf der Reede wegnehmen wollte. An Bord dieser bedrohten Fahrzeuge war "nicht ein einziger Schiffer" (nautischer Führer), und das "wenige Volk", das darauf war, erwiderte zwar das Feuer der Dänen, wußte aber im übrigen keinen Rat, als die Anker zu kappen und die Schiffe "an den Strand und Plate" treiben zu lassen 84 ). Der Wind wehte aus Südosten 85 ). Hätten aber die manövrierunfähigen Lübecker Schiffe bei Rosenhagen gelegen, so wäre gar nicht zu begreifen, wie sie bei der herrschenden Windrichtung auf den Travemünder Strand oder gar auf die Plate hätten treiben können. Sie müssen durchaus ganz in der inneren Bucht geankert haben. Als dann "das übrige Volk" an Bord kam und auch "vom Blockhause und Lande" mit großen Stücken geschossen wurde, brachen die Dänen das Gefecht ab "und legten sich wohl eine halbe Meile zurück auf die Rhede". Gemeint


|
Seite 141 |




|
ist eine halbe deutsche Meile. Und dieser Ankerplatz wäre nach Rörig immer noch die Lübecker Reede gewesen. Wenn man aber das Ende dieser Reede bei der Harkenbeck annimmt, wie Rörig es tut, so muß man auch den Schluß ziehen, daß die dänische Flotte bis dicht vor die Travemündung gekommen sei, denn von der Plate bis zur Harkenbeck waren es weniger als 4500 m, und etwa eine halbe Meile gingen ja die Dänen zurück. Hatten diese sich dagegen bei dem Feuergefecht in größerer Entfernung von den lübischen Schiffen gehalten, so muß der hernach aufgesuchte Ankerplatz weit jenseits der Harkenbeck gewesen sein. Im übrigen heißt "sich auf die Reede legen" einfach: vor Anker gehen; das kann man an einer Stelle tun, die für gewöhnlich nicht als Ankerplatz dient. Reede ist kein gebietsrechtlicher Begriff, sondern bedeutet ein räumlich unbestimmtes Gewässer vor einem Hafen oder vor einer Küste. Aber wo das Wort "Reede" vorkommt, da ist es für Rörig immer gleichbedeutend mit Hoheitsgebiet.
Rörig hat ferner das Seebuch über die Ostsee herangezogen, das Johann Månsson, vormals Altersteuermann und Kapitän der schwedischen Marine, 1677 herausgegeben hat 86 ). Månsson war ein Vorgänger Peter Geddas, der ihn im Vorworte zu seinem Kartenwerk lobend erwähnt, freilich nicht ohne zu bemerken, daß Månsson keine gehörige Kenntnis von der Meßkunst gehabt habe, so daß er nicht mit der erforderlichen Genauigkeit habe arbeiten können. Die Stelle in dem Seebuche, auf die es ankommt und die Rörig bei Schulze, Segelanweisung für die Lübecker Bucht 87 ), gefunden hat, lautet: "Wil man sättia på Lybeske Redden", so kann man das tun auf 5, 7 oder 8 Faden. Das "sättia" hat Schulze mit: Kurs zusetzen (auf die Lübecker Reede) wiedergegeben, nach Rörig aber hieße es: Anker setzen. Allein aller Wahrscheinlichkeit nach hat Schulze recht, zumal da kurz vorher das "sättia" in dem Seebuche noch einmal vorkommt und bestimmt: Kurs setzen heißt 88 ). Im


|
Seite 142 |




|
übrigen ist diese Stelle des Seebuches nicht von Belang. Wenn nämlich Månsson hätte sagen wollen: Anker werfen, so wäre seine Anweisung falsch. Das ergibt sich ja daraus, daß in der von Rörig 89 ) angeführten, 1735 erschienenen deutschen Übersetzung des


|
Seite 143 |




|
Seebuches, worin das "sättia" = Anker werfen aufgefaßt wird, eine offenbare Änderung der Tiefenangabe vorgenommen ist, indem 5 und 6 Faden genannt würden. Diese Ankertiefen von 5 bis 6 Faden werden für die Travemünder Reede auch in der holländischen Seekartenbeschreibung von 1749 90 ) sowie im Text des Seeatlasses angegeben, den der Holländer Voogt etwa 1771 hat erscheinen lassen.
Damit sind wir aber bereits im 18. Jahrhundert. Eine wichtige Quelle ist für diese Zeit die handgezeichnete Kartenskizze der Reede von 1773, die Rörig (III, S. 111 f.) bespricht und von der wir dem Lübecker Staatsarchiv ein Lichtbild verdanken 91 ). Ganz richtig hebt Rörig hervor, daß mit der grotesken Küstenzeichnung der Karte nichts anzufangen ist und daß die Lage der Reede nur durch die eingetragenen Wassertiefen bestimmt wird. Aber eben diese Wassertiefen hätten ihn davon abhalten müssen, die Reede auf die Höhe von Rosenhagen zu verlegen. Er beschreibt selber, daß die Karte Tiefen von 4, 5 und 6 Faden durch entsprechende Zahlenreihen vermerke, die sich quer übers Wasser hinziehen. Die Reihen liegen dicht hinter der Plate 92 ). Zwischen den beiden Linien von 4 und 5 Faden stehen die Worte: Reede vor Travemünde oder Lübeck. Wo aber finden sich solche quer über die Bucht liegende Tiefen von 4 bis 6 Faden? Vor Rosenhagen doch nicht! Zwar gibt es hier diese Tiefen auch, aber, wie überall vor der offenen Küste, längs dem Ufer, ungefähr parallel zu diesem. Fährt man dagegen von Rosenhagen aus quer über die Bucht, so kommt man auf immer tieferes Wasser, bis zu 17 m, und erst auf dem Steinriff wird es wieder flacher. Wohl aber sind jene querliegenden Tiefen viel weiter buchteinwärts vorhanden, in der Mitte des Wassers. Und hier ist die Reede gewesen.
Die Kartenskizze von 1773 lehrt aber auch, daß jene Angaben der Seebücher, wonach die Reede sich bei 5 bis 6 Faden befand, nicht genau sind. Denn die Bezeichnung "Reede vor Travemünde


|
Seite 144 |




|
oder Lübeck" steht, wie erwähnt, auf der Karte zwischen den Tiefenlinien von 4 und 5 Faden. Und wenn man jene Nachricht von 1792 (oben S. 121) in Betracht zieht, wonach ein gekentertes Schiff 93 ) unter mehreren anderen etwa 400 Schritte vom Lande auf der Reede lag, so müßte man fast das Doppelte dieser allerdings wohl unterschätzten Entfernung rechnen, ehe man überhaupt auf 4 Faden Tiefe kommt. Dann wäre das Schiff ungefähr mitten vor der Uferstrecke Travemünde-Möwenstein zu suchen 94 ). Das ist aber unwahrscheinlich, weil ursprünglich angenommen wurde, daß es am Priwall gestrandet sei. Es wird also nach der Kenterung näher am Priwall gelegen haben, etwa bei 3 Faden (5,17 m) 95 ). Sein Abstand von der Küste hatte dann noch nicht 600 Schritt betragen, und in dieser Gegend könnte auch recht wohl die Fahrwassertonne verankert gewesen sein, die man vor dem Schiffe sah. In jedem Falle muß die Entfernung vom Travemünder Ufer aus berechnet gewesen sein, weil sie vom Priwall aus wegen des dort flacheren Wassers immer zu groß werden würde 96 ). Und weil das Fahrzeug "unter den auf der Rheede liegenden Schiffen" lag, so müssen diese nicht weit von ihm geankert haben. Mag man nun das verunglückte Schiff bei 3 oder 4 Faden suchen, so besteht doch gar keine andere Möglichkeit, als daß alle diese Schiffe im westlichen Teile der inneren Bucht lagen.
Eine Ankertiefe von 6 Faden jenseits der Majorlinie ist jedenfalls auch im 18. Jahrhundert nicht mehr das Gewöhnliche gewesen. Dafür spricht letzten Endes auch die Nachricht, die Rörig (III, S. 116) über ein Schiff bringt, das 1746 beim Salutschießen auf der Reede in Brand geriet. Zunächst allerdings war dies die einzige Nachricht des Gutachtens, die uns stutzig machte. Denn wenn das Schiff wirklich, wie Rörig angibt, auf 8 Faden geankert hätte, so wäre es ja weit draußen, bei etwa 14 m Tiefe gewesen. Aber


|
Seite 145 |




|
es handelt sich um einen Irrtum, denn Rörig hat seine Quelle verlesen. Wie uns das Lübecker Staatsarchiv auf eine Anfrage erwidert hat, muß es statt 8 Faden heißen: "5 Faden Tiefe" Also lag auch dieses Schiff - ebenso, natürlich, das in der Nähe ankernde russische - in der inneren Bucht, weitab von Rosenhagen. Es lag auf der 5-Faden-Tiefe der Kartenskizze von 1773.
Die quer über einen Teil der Bucht führende 6-Faden-Linie dieser Skizze ist ungefähr die 10-m-Tiefenlinie, die ja dort, wo sie nach der Trave zu endet, quer über das Wasser läuft (Beilage 5 b).6 Faden aber (10,35 m) waren nach den mitgeteilten Nachrichten die äußerste Ankertiefe seewärts. Mithin steht fest, daß die Reede noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts da zu Ende war, wo sie auf Rörigs Kartenskizze 2, die seinem ersten Gutachten von 1923 beigegeben ist, überhaupt erst anfängt.
Überdies wissen wir aus dem, was im Vorstehenden angeführt ist, daß die Reede sich von der Mitte der inneren Bucht in nordwestlicher Richtung hinzog. So ist sie auch auf der von Rörig erwähnten Karte von 1803 eingetragen 97 ). Es erklärt sich diese Lage der Reede leicht daraus, daß die Schiffe hier am besten den Schutz des hohen Brodtener Ufers genossen. Eine Tiefe von 5 Faden findet sich denn auch zuerst im nordwestlichen Teile der Bucht, gleich hinter der Majorlinie 98 ). Die 4-Faden-Linie liegt weiter buchteinwärts nach der Trave zu. Und wenn ein Schiff auf 6 Faden ankerte, so wird es hinter den übrigen, ebenfalls im westlichen Buchtteile gelegen haben. Hierzu stimmt genau die Kartenskizze von 1773. Auf ihr liegen die Zahlenreihen, die die Tiefen von 4 bis 6 Faden bezeichnen, in der Richtung der Majorlinie, das läßt sich feststellen, weil sich eine Windrose auf der Skizze findet, und es lehrt auch schon der Augenschein. Von den einzelnen Tiefenlinien laufen noch einige Fadenzahlen auf die mecklenburgische Küste zu, die auf der Karte weiter keine Bedeutung haben, als daß sie bezeichnen sollen, wie die Wassertiefe von der Reede aus allmählich abnimmt. Sie sind aber für die


|
Seite 146 |




|
Bestimmung der Reedelage wertvoll. Von der 6-Faden-Linie, die ja ungefähr die 10-m-Tiefenlinie ist, gehen nämlich ab die Zahlen 5 und 4 1/2. Wenn man jetzt unsere Kartenbeilage 5 b, worauf die Tiefenzahlen der Admiralitätskarte zum Teil angegeben sind, zur Hand nimmt, so sieht man, daß die 10-m-Tiefenlinie in einen Schlauch ausläuft, Dieser muß unberücksichtigt bleiben, er ist auf der Admiralitätskarte von 1873 noch nicht angegeben und gehört wahrscheinlich zum seither ausgebaggerten Fahrwasser 99 ), Nun muß der Ankergrund von 6 Faden auf der Skizze von 1773 dort gewesen sein, wo die 10-m-Linie sich nordwestlich von der Schlauchöffnung hinzieht. Wenn man nämlich von diesem Teile der Linie aus die Richtung auf das mecklenburgische Ufer nimmt, und zwar parallel zur Majorlinie, in deren Richtung ja die Reede verlief, so finden sich Tiefen von 8,9 und 8,8 m 100 ). Auf der Admiralitätskarte folgt dann in genau derselben Richtung die Tiefenzahl 7,5, und dann kommt bald die 6-m-Wassergrenze. Diese Tiefen entsprechen aber den Fadenzahlen, die auf der Skizze von 1773 von der 6-Faden-Linie abgehen. Denn 5 und 4 1/2 Lübecker Faden sind = 8,63 und 7,76 m 101 ). Würde man nun aber den 6-Faden-Ankerplatz auch noch auf dem zurückspringenden südöstlichen Teile der 10-m-Tiefenlinie suchen, so stimmt es schlecht, denn hier nimmt das Wasser zunächst kaum ab, es findet sich auf der Admiralitätskarte die Tiefenzahl 9,9, dann - etwas südöstlich - die Zahl 9,6 (Beilage 5 b) und schon 200 m weiter nach der Küste zu folgt die 6-m-Wassergrenze. In dieser Gegend können Tiefen von 5 und 4 1/2 Faden höchstens auf ganz winzigen Strecken oder Punkten vorhanden sein, die zu bezeichnen für die Reede wenig Zweck gehabt hätte.
Dieselbe Untersuchung kann man über die Fadenzahlen anstellen, die auf der Kartenskizze von 1773 von den beiden übrigen Tiefenlinien ablaufen. Es stimmt auch hier 102 ). Zu beachten aber


|
Seite 147 |




|
ist besonders folgendes: Die 4-Faden-Tiefen reichen auf der Skizze nach dem mecklenburgischen Ufer zu weiter als die beiden anderen Tiefenreihen 103 ). Das würde durchaus nicht zutreffen, wenn man für den Ankergrund bei 6 Faden die ganze Breite der 10-m-Tiefenlinie in Anspruch nehmen würde. Denn dann hätte die Reihe der 4-Faden-Zahlen hier am kürzesten sein müssen. Es gehen nämlich die 4-Faden-Tiefen nach der Admiralitätskarte (Sonderkarte der Traveeinfahrt) südöstlich nur wenig über den Schlauch hinaus, der von der 10-m-Tiefenlinie abführt 104 ).
Die Reede lag also im nordwestlichen Buchtteil in der Richtung der Majorlinie: 6 Faden ungefähr auf dem nordwestlichen Teile der 10-m-Tiefenlinie, davor die 5-Faden-Tiefen, endlich, noch weiter nach der Trave zu, 4 Faden. Zwischen den einzelnen Linien sind natürlich noch mittlere Tiefen vorhanden, weil das Wasser nicht genau von 6 Faden auf 5 und 4 Faden abnimmt. Die Breite des auf der Kartenskizze bezeichneten Reedegewässers betrug etwa 600 m, die Länge (von dem Gebiet kurz hinter der 10-m-Tiefenlinie an nach der Trave zu) ungefähr 1 km das ergibt eine Fläche von etwa 3/5 qkm. Der mecklenburgische Buchtanteil aber, der ja erst gegenüber der Staatsgrenze am Priwall be-


|
Seite 148 |




|
ginnt 105 ), wurde von dieser Reede gar nicht berührt.
Es ist ein völliges Unding, die Reede auf Grund der Kartenskizze von 1773 vor Rosenhagen zu suchen. Ganz unrichtig ist auch Rörigs Behauptung, daß die Zahl der Strandungsfälle bei Rosenhagen "beachtenswert groß" sei 106 ). Wahrscheinlich ist sie nicht einmal größer als an anderen Küstengegenden. In unserem vorigen Gutachten haben wir alles mitgeteilt, was aus unseren Akten über Strandungsfälle bei Rosenhagen hervorgeht 107 ). Es ist wenig im Verhältnisse zu den Strandungen am Priwall 108 ). Gerade der Umstand, daß die Reede dem Priwall gegenüberlag, wird wesentlich dazu beigetragen haben, daß Lübeck seinen Anspruch auf die Halbinsel, die sonst von geringem Werte ist und nur als Weide diente, die Jahrhunderte hindurch so tatkräftig verfochten hat. übrigens betrifft die Zusammenstellung bei Rörig III, S. 120 (Anm. 110) zum großen Teile überhaupt keine Strandungen bei Rosenhagen 109 ). Und warum


|
Seite 149 |




|
sollen denn die beiden 1516 gescheiterten Schuten "Leichterboote


|
Seite 150 |




|
und Prähme" oder "Ballastboote" gewesen sein? 110 ) Schuten waren zunächst einfach kleine Schiffe 111 ). So ist die 1660 am Priwall gestrandete Lübecker Schute, deren Kapitän Hans Lampe hieß und die Waren nach Dänemark bringen sollte, keineswegs ein Ballastboot gewesen. Ebensowenig die anderen am Priwall aufgelaufenen Schuten aus Wismar, Dänemark und Schweden 112 ).
Soweit wir in den bisherigen Untersuchungen die Lage der Reede nach den Wassertiefen bestimmt haben, die in den Quellen angegeben werden, haben wir dabei die Messungen der neuesten Seekarte zugrunde gelegt, weil diese am genauesten ist. Einige ältere Seekarten aus dem 19. Jahrhundert, die schon Anspruch auf Genauigkeit machen können, widersprechen unseren Berechnungen durchaus nicht 113 ). Die Tiefen der Travemünder Bucht können sich aber im Laufe der Jahrhunderte nicht ganz gleich geblieben sein. Es hängt das zunächst zusammen mit den Veränderungen des hohen Brodtener Ufers, an dessen Zurückdrängung das Meer seit undenklichen Zeiten gearbeitet hat. Mit der fortschreitenden Zerstörung dieses Landvorsprunges ist nach den Angaben des Lübecker Geologen P. Friedrich 114 ) dreierlei verbunden: die Entstehung des Steinriffes, die "allmähliche Verflachung der Lübecker Bucht und "das Emporwachsen einer Sandbarre in der Mündung der Trave, nämlich der Priwallhalbinsel und des Untergrundes von Travemünde". Friedrich berechnet, daß das Brodtener


|
Seite 151 |




|
Ufer zur Zeit der Gründung Lübecks (1143) noch 800 bis 900 m weiter in die See hineinragte als 1911 115 ). Die gewaltigen, nach und nach abgespülten Sandmassen sind teils in die Niendorfer Wiek, teils in die Travemünder Bucht geschwemmt worden, wo sie sich hauptsächlich am Ufer der inneren Bucht vor der Travemündung abgelagert haben 116 ). Aber sie trugen auch zur Verflachung des Gewässers weiter seewärts bei, woran außerdem der Abbruchssand der mecklenburgischen Küste mitwirkte, der von der Strömung am Ufer entlang geführt wird 117 ). "Die Versandung der ganzen zwischen dem Brodtener Ufer und der mecklenburgischen Landseite einspringenden Travemünder Bucht", so schrieb der Lübecker Wasserbaudirektor Rehder 1898, schreitet "langsam aber stetig fort, sie ist zur Zeit dem Auge weniger erkennbar, weil sie vorwiegend auf den Uferhängen unter Wasser stattfindet . ." 118 ).
Freilich vollzieht sich die Verflachung des Buchtgewässers in weiterer Entfernung von den Küsten nur sehr allmählich 119 ).


|
Seite 152 |




|
Immerhin wird man für die Zeit vor mehreren Jahrhunderten mit etwas größeren Tiefen gerade in der inneren Bucht rechnen dürfen. Es ist klar, daß dies für das Ergebnis unserer Untersuchungen nur günstig sein kann. Damals, als die Seekarten Waghenaers entstanden, reichte das Brodtener Ufer noch etwa 400 m weiter in die See hinein 120 ), während andererseits die Sandanschwemmungen vor dem etwas zurückspringenden Travemünder Ufer südlich vom Möwenstein noch nicht so stark waren. Mithin bot die Reede in jener Zeit den Schiffen nicht nur gegen Nordwest und Nordnordwest, sondern, wenn sie nahe vor der westlichen Buchtküste ankerten, auch noch gegen reinen Nordwind Schutz. Das muß man ja auch aus den Angaben Waghenaers schließen 121 ). Die Schiffe hatten dann nach den heutigen Tiefenverhältnissen immer noch 4 bis annähernd 6 m Wasser, mehr als auf der Wismarer Reede, die noch nicht 4 1/2 m tief war 122 ). Je weiter dann das Brodtener Ufer zurückgewaschen wurde, desto mehr verminderte sich der Schutz gegen Nord.
Auch in der neueren Zeit haben natürlich nur die größeren Schiffe auf der Reede leichtern müssen. Es gibt zu denken, daß noch Waghenaer das Fahrwasser der Plate als ein "gutes Tief für große Schiffe" bezeichnet, also für Schiffe, die man damals noch zu den großen zählte; freilich nicht zu den größten, die besonders der westlichen Seefahrt gedient haben werden.


|
Seite 153 |




|
Wie aber war es im Mittelalter? Auf dem Lüneburger Hansetage vom 10. April 1412 wurde über ein Gesetz beraten, wonach kein Schiff gebaut werden sollte, das mehr als 100 Last Heringe fassen könne, und kein beladenes Schiff tiefer gehen sollte als sechs lübische Ellen (3,45 m) 123 ). Das wäre gerade die Tiefe, die Waghenaer 170 Jahre später für das über die Plate führende Fahrwasser angab 124 ), eine Tiefe, die also für Schiffe, wie sie 1412 äußersten Falles zugelassen werden sollten, nicht mehr ausgereicht haben würde. Nun aber bezeichnete man in Lübeck im Jahre 1407, also um die Zeit jenes Hansetages, schon Schiffe von über 24 Last als "große" 125 ). 1428, während des Krieges um Schleswig, sprachen die vor Kopenhagen liegenden hansischen Schiffshauptleute die Erwartung aus, daß die im Fahrwasser versenkten Fahrzeuge den Feind verhindern würden, mit "großen Schiffen", die über vier Ellen tief gingen, aus dem Hafen herauszukommen 126 ). 4 1/2 - 6 Ellen (9 - 12 Fuß) Wasser genügten aber schon für Schiffe von 70 - 80 Last 127 ). So groß sind die für die Ostseefahrt gebrauchten Fahrzeuge noch bis tief ins 19. Jahrhundert hinein in der Regel nicht gewesen 128 ).
Fest steht, daß während des Mittelalters im Lübecker Verkehr die kleinen Schiffe vorgeherrscht haben 129 ), die zweifellos


|
Seite 154 |




|
die Plate überwinden konnten. Erst seit der Mitte des 15, Jahrhunderts wäre hier nach Kloth eine Steigerung der Schiffsgrößen anzunehmen 130 ). 1455 hören wir zum ersten Male von einer Reede vor dem Lübecker Hafen, womit nur die Seereede gemeint sein kann 131 ). Elf Jahre später, 1466, klagte der Lübecker Rat darüber, daß der Hafen flacher geworden sei und die nach Lübeck bestimmten Schiffe nicht ohne zu leichtern einlaufen könnten, woraus sich merklicher Schaden ergeben habe und den Kaufleuten Kosten entständen 132 ). Durch Stromverbesserungen suchte man Abhilfe zu schaffen, sicher also handelte es sich hier um einen Übelstand, der sich noch nicht lange fühlbar gemacht hatte. Vor dem 15. Jahrhundert kann die Lübecker Seereede keine irgendwie wesentliche Rolle gespielt haben. Und sie nun gar schon für die Zeit des Barbarossaprivilegs von 1188 anzunehmen, ist ganz unmöglich.
Da die alte nautische Reede nicht im mecklenburgischen Buchtanteil lag, so hat sie für die obwaltende Streitfrage keinerlei Bedeutung, überhaupt beweist der Umstand, daß sich in der Bucht ein Ankerplatz befand, noch gar nichts für die Lübecker Ansprüche; denn das Ankern von Schiffen ist keine Lübecker Hoheitshandlung, Indem die Wismarer 1455 ein ihnen feindliches Schiff auf der Travemünder Reede wegnahmen, begingen sie eine Tat, die nur unter der Voraussetzung zu denken ist, daß mit einer Lübecker Gebietshoheit auf der Reede gar nicht gerechnet wurde 133 ). Auch die von Rörig angezogene Prahmordnung von 1580 134 ) lehrt nur die Existenz einer Seereede, aber weiter nichts. Denn Vorschriften über den Prahmbetrieb, der ja auch nicht nur auf der See vor sich ging, konnte der Lübecker Rat ohnehin erlassen. Die ankommenden Schiffer aber waren genötigt, sich den Vorschriften zu unterwerfen, weil sie sonst keine Prähme erhielten und nicht löschen konnten.
Nach Wenzel 135 ) liegt die Lösung der ganzen Streitfrage darin, daß Lübeck im 19. Jahrhundert seine Staatspraxis in Hinsicht auf die Travemünder Bucht den völkerrechtlichen Regeln


|
Seite 155 |




|
angepaßt hat. Die früheren Rechtsverhältnisse seien dieser Tatsache gegenüber belanglos, so daß eine historische Untersuchung darüber überhaupt nicht nötig gewesen sei. In jedem Falle ist es klar, daß die Örtlichkeit der Reede im 19. Jahrhundert nicht von Wichtigkeit ist 136 ). Da aber die Ausführungen, die Rörig darüber macht, wesentliche Irrtümer enthalten, so entgegnen wir folgendes:
Die erste Quelle für diese Zeit ist die von Rörig (III, S. 96) angeführte Kartenskizze von 1803, von der uns das Lübecker Staatsarchiv freundlicher Weise ein Lichtbild besorgt hat. Auf der Skizze wird die Reede durch zwei Anker bezeichnet, die dicht beieinander liegen und, wie auch Rörig erwähnt, etwa in der Richtung der Majorlinie eingetragen sind 137 ). Sie liegen ungefähr nördlich von dem Grenzpfahl, den die Skizze an der Staatsgrenze am Priwall vermerkt, der eine Anker in der Mitte des Wassers, der andere nordwestlich davon. Im übrigen liegen sie fast in einer Linie mit dem Möwenstein, der angegeben ist und buchteinwärts von der Brodtener Rifftonne mit der roten Fahne (später Rote Wete genannt), die ebenfalls angegeben ist und sich auch auf der französischen Seekarte (Kartenbeilage 2 a bei Rörig III) vor dem Brodtener Ufer als Pavillon rouge verzeichnet findet. Zieht man von dieser Tonne aus eine Linie in genau südlicher Richtung auf das mecklenburgische Ufer, so liegen die beiden Anker buchteinwärts von dieser Linie. Hinter den beiden Ankern steht in kleinen Buchstaben das Wort: Rhede. Die Buchstaben sind genau so groß oder klein, wie sie auf der Skizze für die Ortsnamen am Lande, für den Möwenstein, die Harkenbeck usw. verwendet sind. Und das Wort "Rhede" soll natürlich nur angeben, was die Anker bedeuten; daß es hinter diesen steht, worauf Rörig mit Unrecht Wert legt, ist völlig belanglos. Auch bei der Harkenbeck, dem Möwenstein und verschiedenen Ortschaften stehen die Namen rechts dahinter. Mithin lag die Reede 1803 noch ebenso wie auf der Kartenskizze von 1773, und zwar, wie beide Karten schließen lassen, im wesentlichen dicht bei der Majorlinie und noch vor dieser nach der Trave zu. Wäre die Reede 1803 vor Rosenhagen gewesen, das auf der Skizze ange-


|
Seite 156 |




|
geben ist, so würden die beiden Anker natürlich in der Höhe des Dorfes eingetragen sein.
Keine Quelle ist die französische Seekarte von Beautemps-Beaupré; denn aus ihr geht die Lage der Reede nicht hervor. Was Rörig (III, S. 87) aus der Karte schließen will, ist unrichtig, zum Teil ebenso an den Haaren herbeigezerrt wie die vermeintliche Außentrave bei Waghenaer. Wenn man den Ausschnitt aus der Karte betrachtet, den Rörig (III, Beilage 2 a) abgebildet hat, so sieht man in der Travemünder Bucht einen Punkt a. Mit ihm wäre nach Rörig "auf der Reede eine Stelle vermerkt", von wo sich "für den auf der Reede ankernden Schiffer" eine Ansicht von Travemünde biete, die am Kopfe der Seekarte wiedergegeben ist 138 ). Aber der Punkt a liegt ja nördlich von der Priwallgrenze, und die Reede soll doch nach Rörig bei Rosenhagen gewesen sein! Auch liegt der Punkt nicht "selbstverständlich" jenseits der Majorlinie 139 ), sondern beinahe darauf; die linke Klammer um den Punkt würde unten von der Linie noch geschnitten werden, und die neben dem Punkt stehende Tiefenzahl von 22 französischen Fuß (7,33 m) gehört noch zum Gebiet innerhalb der Majorlinie. Es ist aber wohl nur ein Zufall, daß der Punkt dicht hinter dieser Linie liegt, zumal da die Karte den "Major" nicht verzeichnet. Wahrscheinlich liegt der Punkt auf der damaligen Ansegelungslinie der Traveeinfahrt, und für Seeleute, die über die Plate fahren wollten, erfüllte in dem schwierigen Gewässer die Ansicht von Travemünde ja auch am besten ihren Zweck 140 ). Daß man die Lage der Reede nicht nach dem Punkte a bestimmen kann, lehrt ein ähnlicher Punkt auf der Seekarte. Diese zeigt nämlich auch die Neustädter Reede, wiederum ohne daß ein Anker eingetragen wäre, und hier ist ein Punkt b vermerkt, von wo man eine Ansicht von Neustadt hatte, die gleichfalls am Kopfe der Karte abgebildet ist (Prise en rade au point b). Dieser Punkt b liegt aber zwischen Tiefenzahlen von


|
Seite 157 |




|
vier, fünf und acht französischen Fuß, und es wird ja niemand annehmen, daß auf diesen Tiefen der Ankerplatz zu suchen sei 141 ).
Ferner stehen auf der Bucht und darüber hinaus die Worte: Rade de Travemünde. Wie Rörig aus der Art, wie diese Worte eingetragen sind, einen Schluß auf die Reedelage ziehen kann, ist unverständlich. Denn es ist ja klar, daß sie in der inneren Bucht wegen der sich dort häufenden Tiefenzahlen keinen Platz fanden. Ohnehin sind die Buchstaben zum Teil auseinandergerückt, um den Tiefenzahlen Raum zu schaffen 142 ). Dasselbe ist der Fall bei der Bezeichnung "Rade de Neustadt" auf der gleichen Karte. Auch hier finden sich die Worte weit draußen bei Tiefenzahlen von 54 -57 Fuß (18 - 19 m), wo der Ankerplatz nicht war. Die deutsche Admiralitätskarte von 1873 zeigt den Anker vor Neustadt neben der 6-m-Tiefenlinie. Auf der Travemünder Bucht hat diese Karte einen Anker binnen der Majorlinie, gleich hinter Tiefenzahlen von 7 und 7,5 m. Im übrigen gelten die Bezeichnungen Rade de Travemünde und Rade de Neustadt nicht bloß für den Ankerplatz, sondern ohne Zweifel für die gesamten Gewässer der beiden Buchten, Wir haben schon in unserem vorigen Gutachten gezeigt, daß der Ausdruck "Reede" für die Travemünder Bucht gebraucht wurde 143 ), und Rörig hat es jetzt bestätigt 144 ). Es ist ja nur zu verständlich, daß man ein solches Gewässer, in dem Schiffe verkehrten und ein Ankerplatz lag, in seinem ganzen Umfange "Reede" nannte, daß also diese Bezeichnung vom eigentlichen Ankerplatze auf die ganze Bucht übertragen wurde. Reede in diesem Sinne ist aber lediglich ein geographischer Begriff. Dagegen heißt die Niendorfer Wiek, die für die Schiffahrt nicht in Betracht kommt, auf der französischen Seekarte: Anse de Niendorf.


|
Seite 158 |




|
Schließlich finden sich auf der Karte die von Rörig nicht besprochenen Worte: Vase couverte de sable fin bonne tenue. Sie stehen hinter und zwischen den Tiefen von 30 Fuß. Daß sie sich gerade hier finden, hat seinen Grund nur darin, daß an dieser Stelle keine Tiefenzahlen vermerkt sind, also Raum für die Worte frei war. Denn den Schlick (vase) gibt es nicht nur hier, sondern auch weiter seewärts, ebenso weiter buchteinwärts binnen der Majorlinie 145 ), d. h. fast überall in der Bucht. Gerade aber vor einem Teile der Rosenhäger Küste, und zwar dem westlichen Teile, eignet sich der Grund weniger zum Ankern 146 ). Die genannten Worte der Karte gelten also gewiß nicht für den Meeresboden vor Rosenhagen, wo sie ja auch nicht stehen, sondern sie sollen offenbar die vorherrschende Beschaffenheit des ganzen Buchtgrundes und seine Brauchbarkeit fürs Ankern überhaupt angeben. Genauere Vermerke über den Grund sind ja daneben noch vielfach in Abkürzungen oder Anfangsbuchstaben auf der Karte eingetragen 147 ). Z. B. liest man weiter draußen verschiedentlich: Vase argileuse, tonhaltiger Schlick, der zum Ankern sehr geeignet ist, wie denn die Beschaffenheit des Meeresbodens überall vor der Küste kenntlich


|
Seite 159 |




|
gemacht wird, auch da, wo keine Reeden waren 148 ). Ganz ähnlich jenem allgemeinen Vermerk über den Buchtgrund stehen auf der Karte hinter der Bezeichnung "Stein-Riff" in Klammern die Worte: Fond dangereux pour le mouillage, also eine Warnung vor dem Ankern, obwohl kaum jemand auf den Gedanken kommen konnte, hier vor Anker zu gehen. Außerdem finden sich aber auch auf dem Steinriff genauere Angaben über den Grund dutzendfach.
Rörig vergleicht die französische Seekarte mit der Karte des Travemünder Hafens im Jahre 1848 149 ). Hier entspreche der Eintragung "Rade de Travemünde" genau die Bezeichnung "Guter Ankergrund". Ganz richtig ist das nicht; denn auf der jüngeren Karte beginnen die Worte weiter buchteinwärts, fast bei 4 Faden Tiefe, und ziehen sich von hier in großen Buchstaben ebenfalls bis jenseit der Harkenbeck hin. Daraus aber, daß der Boden einer ganzen Bucht als guter Ankergrund bezeichnet wurde 150 ) - was ja auch zutraf, denn schließlich konnte man hier überall ankern -, läßt sich der übliche Ankerplatz nicht ermitteln. Überdies stehen dieselben Worte auf der Karte noch einmal, aber kilometerweit nördlich, zu beiden Seiten des letzten Steinriffauslaufes, wo das Wasser 80 Lübecker Fuß (23 m) tief ist und selbstverständlich keine Reede war. Dieser zweite Vermerk lehrt gerade, daß "guter Ankergrund" nichts weiter bedeuten soll als: reiner Grund, während das Steinriff, das sich auf der Karte mit seiner äußersten Spitze zwischen die beiden Worte einschiebt, als "Stein- und Kiesgrund" bezeichnet wird 151 ).
Wo zur Entstehungszeit der französischen Seekarte die Reede lag, ergibt sich aus der erwähnten Skizze von 1803, die gar keinen Zweifel darüber aufkommen läßt. Es ist in diesem Zusammen-


|
Seite 160 |




|
hange einzugehen auf den Bericht des Lotsenkommandeurs Harmsen aus dem Jahre 1828 152 ), den wir nach Rörigs Meinung so ganz falsch verstanden haben sollen. Rörig 153 ) sucht zunächst gewissermaßen den Zeugenwert des Kommandeurs zu erschüttern, indem er auf dessen Schulden und auf die Zuchtlosigkeit zu sprechen kommt, die Harmsen unter den Lotsen einreißen ließ. Das alles aber hat mit der Kenntnis von der Reede, die man dem Kommandeur allerdings zutrauen muß, nichts zu tun. Und wenn der Bericht ohne Aufforderung erstattet wurde und "ganz isoliert bei den Akten liegt, so kann man doch ein derartiges Stück sehr wohl benutzen, wenn es eine klare Auskunft gibt. Dies tut der Bericht zunächst insofern, als die darin als Reedegrenze bezeichnete, vom "Major" ausgehende Linie nicht die Peillinie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle sein kann, die Rörig als Reedegrenze aufgestellt hat und für die gerade dieser Bericht als einziger Beweis angeführt worden war. Rörig hat seinen Irrtum ja auch zugegeben. Ferner ist klar, daß Harmsen gar keine andere Linie gemeint haben kann als die oft genannte, am Brodtener Ufer vorüberlaufende Majorlinie. Dies ist auch die einzige vom "Major" abgehende Linie, die in jener Zeit überhaupt erscheint.
Dem Kommandeur kam es darauf an, die Fischerei seiner Lotsen, denen die Berechtigung zum Fischfang abgestritten wurde, in Schutz zu nehmen. Nach Rörig (III, S. 78) wollte er sagen, daß das Gebiet am Brodtener Ufer, wo die Lotsen fischten, nicht zur nautischen Reede im Sinne des Vergleiches von 1610 gehöre, die den Travemündern verboten war. Dann aber besteht doch keine andere Möglichkeit, als daß Harmsen eine Grenzlinie für eben diese nautische Reede im Auge hatte. So ist es ja in der Tat gewesen. Rörig dagegen glaubt jetzt zwar auch, daß es sich um die Majorlinie handele, aber nur, soweit sie über das Steinriff führe, wenn nämlich die Lotsen auf dem Steinriff von dem Punkte am Brodtener Ufer aus, "wo zuerst der Gömnitzer Berg sichtbar wird", "ungefähr parallel zum Fahrwasser vor Travemünde Netze aussetzten, so blieben sie ja in der Tat außerhalb der Reede im nautischen Sinne" 154 ). Indessen ist gar nicht zu begreifen, was dann eigentlich die Majorlinie als Grenze für einen Zweck gehabt haben sollte. Ein Blick auf die Karte lehrt, daß sie für die Steinriff-Fischerei gar nicht paßt, für die ja nur eine Grenze am Platze


|
Seite 161 |




|
gewesen wäre, die "ungefähr parallel zum Fahrwasser" verlief. Es wäre ganz sinnlos gewesen, ausgerechnet auf dem Steinriff eine noch dazu dicht am Ufer vorüberlaufende Reedegrenze anzunehmen.
All dieses Herumdeuteln an Harmsens Bericht ist vergeblich und kann nichts an der Tatsache ändern, daß der Kommandeur die Majorlinie als eine Grenze zwischen der nautischen Reede und der "offenen See" betrachtete, und zwar selbstverständlich als eine Grenze innerhalb der Travemünder Bucht, wo ja die Reede lag. Ebenso selbstverständlich ist es, daß unter "offener See" nur das Gebiet östlich von dieser Grenze begriffen werden kann, für die Reede also nur die Wasserfläche westlich von der Majorlinie, nach der Trave zu, übrig bleibt. Fraglich könnte nur sein, ob Harmsen etwa eine Reedegrenze im Auge hatte, die aus älterer Zeit stammte und für den Schiffsverkehr damals bereits überholt war, als Fischereigrenze aber nach der Ansicht des Kommandeurs noch Gültigkeit hatte. Dies ist zu untersuchen.
Wir haben in unserem vorigen Gutachten noch angenommen, daß die Majorlinie als Reedegrenze lediglich für Fischereizwecke festgesetzt worden sei, während wir eine Reedegrenze für rein nautische Zwecke als unwahrscheinlich ablehnten 155 ). Jetzt aber ist von Rörig die wichtige Nachricht beigebracht worden, daß die Majorlinie eine nautische Linie gewesen ist. Nach der Angabe des Lotsenherrn sagte 1849 der damalige Lotsenkommandeur aus: der Gömnitzer Turm (der ja die Stelle des "Majors" vertrat) diene den Lotsen "noch besonders, da er, in gerade Linie mit dem Brodtener Ufer gebracht, die Ankerplätze auf der Reede angäbe" 156 ). Das kann nur heißen, daß die Schiffe von den Lotsen auf der Linie selbst oder doch in deren Nähe verankert wurden. So ist es gewiß schon zu Harmsens Zeit gewesen. Daher auch der Wunsch, nach dem Umsturz des als "Major" bezeichneten Baumes ein neues Seezeichen als Ersatz zu erhalten. Um 1820 verlief die Majorlinie noch über 100 m weiter östlich 157 ); man hatte auf ihr 5 Faden Wasser 158 ), mehr als für die größten Schiffe nötig war. In keiner Weise ist erwiesen oder auch nur wahrscheinlich, daß, wie Rörig meint, die Majorlinie als "äußerste Linie in der Richtung nach Travemünde zu diente, wo überhaupt


|
Seite 162 |




|
noch Schiffe verankert wurden" 159 ). Sondern es liegt nicht die geringste Veranlassung zu der Annahme vor, daß sich die Lage der Reede seit dem 18. Jahrhundert verändert habe. Freilich rechnet jene Kartenskizze von 1773 noch die 6-Faden-Tiefen mit zum Reedegebiet. Aber es ist schwerlich ein Zufall, daß die Bezeichnung "Reede vor Travemünde oder Lübeck" auf der Skizze zwischen den Tiefen von 4 und 5 Faden eingefügt ist, nicht zwischen den Tiefen von 5 und 6 Faden 160 ); denn in den beiden Fällen von 1746 und 1792, in denen wir den Ankerplatz von Schiffen auf der Reede genauer ermitteln können, lagen die Schiffe bei 5 Faden Tiefe (1746), also noch innerhalb der damaligen Majorlinie, oder noch weiter buchteinwärts (1792) 161 ).
Wo Schiffe, die etwa des Nachts und ohne Lotsenhilfe ankamen, vorläufig vor Anker gingen, ist ganz gleichgültig. Für die Lotsen aber galt die Majorlinie zweifellos nicht als äußerste Reedegrenze nach der Trave zu, sondern umgekehrt nach der See zu. Der Grund hierfür wird wiederum darin liegen, daß seewärts hinter der Majorlinie der Schutz gegen Nordwest aufhörte, den das hohe Brodtener Ufer bot. Deswegen war nach Harmsen die Reede an der Majorlinie zu Ende. Anders kann seine Eingabe von 1828 überhaupt nicht aufgefaßt werden. Das Gewässer jenseit der Majorlinie aber rechnete er bereits zur offenen See. Er hätte statt dessen auch wohl sagen können: Außenreede, eine Bezeichnung, die 1823 einmal erscheint und auf die wir sogleich zurückkommen werden; doch paßte es ihm augenscheinlich besser, den Ausdruck "See" zu gebrauchen, wo "jeder gleiches Recht" habe, also auch die Lotsen seiner Meinung nach fischen durften.
Dem widerspricht auch nicht die von Rörig angezogene kleine Abhandlung Harmsens im Schweriner Freimütigen Abendblatt vom 4. August 1826, worin er für die Errichtung eines Leuchtturmes an der mecklenburgischen Küste bei Buckhöft nordöstlich von Wismar eintrat 162 ). Denn wenn er bei dieser Gelegenheit erwähnte, daß bei Nacht kein einigermaßen großes Schiff in den Travemünder Hafen einlaufe, sondern entweder bis zum Tagesanbruche vor Anker gehe oder auf der Reede kreuze, so ist "Reede" hier etwas ganz Unbestimmtes und einfach das Gewässer


|
Seite 163 |




|
vor dem Hafen 163 ), worunter man getrost noch einen Teil der offenen See verstehen konnte. Mit Gebietshoheit hat das gar nichts zu tun. Einen Lotsen hatten diese Schiffe nicht an Bord; ausdrücklich sagt Harmsen in seiner Abhandlung, daß Lotsen bei Nachtzeit gewöhnlich nicht herauskämen, wenn nicht Notschüsse die größte Gefahr andeuteten. Fahrzeuge, die draußen, jenseit der Majorlinie, kreuzten oder ankerten, waren noch nicht auf der eigentlichen nautischen Reede.
Wie aber verhält sich Harmsens Bericht zu den Angaben, die Rörig aus den Akten über den Fischereistreit macht, der 1823 zwischen den Schlutuper und den Travemünder Fischern ausbrach 164 )? Die Ursache des Streites lag darin, daß die Schlutuper im Gewässer vor Rosenhagen ihre Waden über die dort ausgesetzten Stellnetze der Travemünder hinweggezogen hatten. Sie bestritten den Travemündern die Berechtigung, hier zu fischen, obwohl diesen in dem Fischereivergleich von 1610 nur untersagt war, Stellnetze auf der Trave und der nautischen Reede zu verwenden. In erster Instanz wurde dieser Streit von der Lübecker Wette entschieden. Da ist es denn von Wichtigkeit, daß die Auffassung der Wette über das, was man unter der eigentlichen Reede zu verstehen hatte, mit der Meinung des Lotsenkommandeurs offenbar in Einklang zu bringen ist. Die Wette wollte nämlich die etwa "beim Möwenstein anfangende und sich von dort noch weit in die See erstreckende Außenreede" nicht mehr als Reede im Sinne des Vergleiches von 1610 auffassen 165 ). Danach war die eigentliche nautische Reede ungefähr beim Möwenstein zu Ende. Fast also könnte man glauben, daß die Wette diese Reede auf ein noch kleineres Gebiet beschränkt habe als der Lotsenkommandeur; indessen ist der Möwenstein hier nur als ungenauer Bestimmungspunkt zu werten. Das Gewässer weiter seewärts, richtiger gesagt jenseit der Majorlinie, galt als Außenreede.
Über das, was Rörig neuerdings aus den Akten über diesen Fischereistreit vorbringt, ist schwer Klarheit zu gewinnen. Eine Schwierigkeit liegt schon darin, daß das Wort "Reede" sowohl im Sinne von "nautischer Reede" als im Sinne von "Travemünder Bucht" gebraucht wurde, und nicht jedesmal ohne weiteres deutlich ist, wie man es aufzufassen hat. Wenn der Tatort vor Rosenhagen als "zwischen der Reede und Rosenhagen" gelegen bezeichnet wurde


|
Seite 164 |




|
(einmal heißt es auch: zwischen Rosenhagen und dem Blockhause) 166 ), so ergibt sich allerdings, daß eine längs der Küste sich hinziehende Wasserfläche gemeint ist, die südlich an das Ufer und nördlich an die Reede grenzte 167 ), Mithin ist das ganze tiefe Gewässer der Bucht als Reede bezeichnet worden. Das beweist aber nicht, daß es überall als Ankerplatz diente, In keinem Falle kann angenommen werden - alle sonstigen Quellen über die Reede schließen es aus - , daß die ankernden Schiffe sich nach Belieben auf der ganzen Mitte der Bucht bis zur Harkenbeck hin verteilten. Sondern zu dieser Reede gehörte auch das Fahrwasser und die Außenreede, die jenseit der Majorlinie begann. Man kannte eben keine Reedegrenze im gebietsrechtlichen Sinne, sondern nur eine praktische Grenze, die Majorlinie. Unzulässig ist es ferner, aus der Art, wie man in diesem Streit den Fischereivergleich von 1610 auszulegen sich bemühte, Rückschlüsse auf die Verhältnisse zu machen, die zur Entstehungszeit des Vergleiches obwalteten. Denn die Akten lehren ja, daß man über den Sinn des Vergleiches sehr verschiedener Meinung war. Für die Zeit um 1610 wissen wir, abgesehen von der Lage der nautischen Reede, nur das eine, daß Lübeck bei Gelegenheit des Fischreusenstreites von 1616 die ganze Bucht Reede nannte, und zwar auch das flache Gewässer vor Rosenhagen, das für Reedezwecke unbrauchbar war.
Nun aber kann man sich eine Vorstellung davon machen, bis wieweit ans Ufer man in dem 1823 ausgebrochenen Prozesse das damals als Reede bezeichnete mittlere Buchtgewässer ungefähr rechnete 168 ). Die Schlutuper Fischer wollten nämlich den Vergleich von 1610 so auslegen, als ob die Travemünder dort, wo die Waden gezogen wurden, überhaupt nicht fischen dürften, sondern nur in der Mitte der Bucht. Diese Auslegung war unzutreffend und wurde auch hernach vom Oberappellationsgericht abgelehnt. Das Lübecker Obergericht aber, das in zweiter Instanz zu entscheiden hatte, machte sie sich zu eigen. Es sei die zwischen dem Ufer und der Reede gelegene Fischereistrecke Blockhaus - Harkenbeck in zwei Längsteile zu zerlegen, von denen der ans Ufer grenzende Teil seewärts bis dahin reichen sollte, wo die Wadenzüge anfingen, die


|
Seite 165 |




|
ja aufs Ufer zuführten, dieser Teil sollte den Schlutupern freistehen, der andere, an die Reede grenzende Längsteil den Travemündern. Darauf aber erklärten die Travemünder, daß die Waden "an der Gränze des Fischgrundes, bis zu 4 oder 5 Faden Tiefe", ausgeworfen würden. In dem dahinter liegenden Bezirke, der ihnen zugewiesen sei, fänden sich keine Fische mehr, die nur bis zu 5 Faden Tiefe anzutreffen seien. Auch sei dieser Bezirk entweder der Travestrom außerhalb des Blockhauses (also das Fahrwasser) oder die Reede, wo sie nach dem Vergleich von 1610 gerade nicht fischen dürften 169 ). Indessen war diese Erklärung unrichtig. Daß der Fischgrund weiter seewärts reichte, ergibt sich schon aus einer Bestimmung des Vergleiches von 1826, der den ganzen Streit abschloß 170 ). Mit Recht entgegneten denn auch die Schlutuper, daß die Waden nicht an der Grenze des Fischgrundes ausgeworfen würden, sondern daß sich noch hinter der von den Waden durchzogenen Strecke Fische aufhielten. Es muß auch angenommen werden, daß das Obergericht sich über die Auswirkung seiner Entscheidung und über das, was man unter der Reede zu verstehen hatte, klar war. Da aber die Wadenzüge bei einer Tiefe von 4 bis 5 Faden (6,90 - 8,63 m) begannen, so ergibt sich für die Schlutuper eine Fischereistrecke, die sich in einer Breite von etwa 800 m an der mecklenburgischen Küste entlang zog, also bis nahe an die 10-m-Wasserlinie reichte (vgl. Beilage 5 b) 171 ). Dahinter, seewärts, sollte aber erst das Revier der Travemünder kommen und dann die Reede. Mithin kann das, was man hier Reede oder Außenreede nannte, nicht mehr weit in den mecklen-


|
Seite 166 |




|
burgischen Buchtanteil übergegriffen haben. Es ist einfach die Verlängerung der eigentlichen nautischen Reede, wie wir sie oben festgestellt haben, nach der See zu. Eine Lübecker Gebietshoheit auf diesem Gewässer wird aber durch die bloße Bezeichnung Reede in keiner Weise dargetan.
Beiläufig sei noch aus den Akten über den Fischereistreit erwähnt, daß der Oberappellationsgerichtsrat Hach, der früher Lübecker Wetteherr gewesen war, zu Anfang seiner Relation den Tatort bezeichnete, indem er sagte, daß die Travemünder ihre Netze "ausserhalb der Trave zwischen der Rhede und dem Mecklenb. Ufer" ausgestellt hätten. Auch hieraus geht hervor, daß man die Travemünder Bucht nicht "Trave" nannte, wie Rörig es behauptet. "Außerhalb der Trave" bedeutet hier: in der See.
Zu besprechen bleiben noch zwei von Rörig benutzte Quellen, die in den Zusammenhang dieses Fischereistreites gehören, nämlich die Eingabe der Schlutuper Fischer vom November 1825 und die Bemerkungen des Navigationslehrers Sahn zu der Karte, die er 1823 über das strittige Fischereigebiet angefertigt hatte 172 ).
In der Eingabe von 1825 heißt es, daß man es für nötig halte, genau zu bestimmen, wo die sogenannte Wendseite (der größere Teil der strittigen Fischereistrecke) beginne. Schon ein Besichtigungsprotokoll vom 26. August 173 ) teile die ganze Strecke vom Blockhause bis zur Harkenbeck in zwei Teile, "wofür die Rhede den Abschnitt macht, von ihr an nämlich bis Harkenbeck, und wieder von ihr an bis zum Blockhause". Nun lasse sich aber nicht genau bestimmen, wo die Reede angehe. Die einzige vorhandene Bestimmung hierfür sei diese: Wenn man aus Travemünde ausfahre, so gewahre man bald zur linken Hand einen hohen Baum auf dem Süseler Felde, den "Major". Sobald dieser "auf die bezeichnete Art hinter das hohe Brodtener Ufer zu stehen kömmt, so ist man, nach der allgemeinen Annahme, auf der Rhede" Dieser Umstand bestimme denn auch den Anfangspunkt für die Wendseite, die von hier bis zur Harkenbeck reiche.
Wie ist dies zu verstehen? Nach Rörig so, daß die nautische Reede an der Majorlinie begonnen habe. Diese Deutung aber kann nicht zutreffen. Denn man hätte ja dann eine haarscharfe Grenze gehabt, also auch genau gewußt, von wo an die Reede zu rechnen sei. Und das wußte man gerade nicht: es wird ja ausdrücklich gesagt, daß sich der Anfang der Reede nicht genau bestimmen lasse.


|
Seite 167 |




|
Dies aber kann nur so gemeint sein, daß schon ein Teil der Wasserfläche westlich von der Majorlinie, nach der Trave zu, zur Reede gehörte. Ferner steht Rörigs Auffassung in vollem Widerspruche zu dem Harmsenschen Bericht von 1828, den er durch eine unhaltbare Interpretation ausgeschaltet hat. Unmöglich konnte der Lotsenkommandeur die Reede da enden lassen, wo sie nach der allgemeinen Ansicht erst anfing. Da nun aber in der Eingabe der Schlutuper Fischer sich das Wort "Reede" offenbar auf die Außenreede mit bezieht, für diese gesamte Wasserfläche (Reede und Außenreede) aber keine Grenzen vorhanden waren, so nahm man als Fischereischeide die einzige bekannte und leicht feststellbare Reedelinie an, eben die Majorlinie, auf und vor der die Schiffe von den Lotsen verankert wurden. Befand man sich, von Travemünde kommend, auf dieser Linie, so war man bereits "auf der Rhede" und hatte schon eine Strecke der Reede hinter sich. An unseren Ermittelungen über den Ankerplatz wird durch die Eingabe der Fischer nichts geändert.
Sodann die Sahnsche Karte von 1823. Diese Karte ist verloren gegangen, doch hat sich der Begleittext dazu erhalten, den Rörig (III, Anl. 3) veröffentlicht Auf der Karte waren zwei Punkte, A und B, vermerkt, und Rörig (III, S. 84) stellt Erwägungen darüber an, wo der Punkt B gelegen habe, den Sahn als "Mitte der Rhede" bezeichnete. Nun aber sind in dem Begleittexte alle Bestimmungswinkel für die beiden Punkte angegeben, so daß man diese leicht auffinden kann. Unsere Beilagen 5 a und 5 b zeigen die Lage der Punkte auf der französischen Seekarte und der jüngsten Admiralitätskarte 174 ). Es ergibt sich daraus, daß der Punkt B nicht da liegt, wo Rörig ihn vermutet hat, nicht vor Rosenhagen und auch nicht weiter seewärts, sondern gerade weiter nach der Trave zu. Das hat aber gar nichts zu bedeuten. Denn "Mitte der Reede" kann hier nicht das heißen, was Rörig darunter versteht, nämlich: Mitte der nautischen Reede. Und zwar schon deswegen nicht, weil - wie Rörig für den Fall, daß der Punkt nach Travemünde zu gelegen habe, richtig gesehen zu haben scheint - ein solcher in der Mitte der nautischen Reede gelegener Punkt als Grenzpunkt keinen Zweck gehabt hätte. Es kommt nirgends ein Fischereibezirk bei Rörig vor, der bis zum Punkte B gereicht hätte, ganz abgesehen davon, daß dieser Punkt nicht auf


|
Seite 168 |




|
der Fischereistrecke Blockhaus - Harkenbeck (Punkt A), sondern nördlich davon liegt. Zwar gelangt man, wenn man die Strecke Majorlinie - Punkt B um sich selbst verlängert, auf die Höhe von Rosenhagen. Aber nirgends wiederum wird gesagt, daß die Reede oder die Außenreede durch die Majorlinie und Rosenhagen begrenzt gewesen sei. Wie Rörig mitteilt, empfahl noch 1855 die vom Lübecker Lotsendepartement herausgegebene "Nachricht für Seefahrer" sogar den nachts eintreffenden Schiffen, auf 5 bis 6 Faden zu ankern 175 ), also weit vor dem Punkte B buchteinwärts. Die Mitte dieser Reede, die wir zum Teil schon als Außenreede ansehen, würde also viel näher bei Travemünde liegen als der Punkt B. Die Außenreede aber ging sicherlich ohne Grenze in die See über. Und es dürfte sich überhaupt ein Mittelpunkt weder für die Reede noch für die Außenreede noch für beide zusammen genau haben feststellen lassen.
"Mitte der Rhede" muß sowohl in dem Sahnschen Kartentext wie in dem Wetteprotokoll vom 26. August 1825 176 ), das sich auf die Karte bezieht, bedeuten: Mitte der Travemünder Bucht. Es wird in dem Wetteprotokoll, dessen Auszüge bei Rörig im übrigen teilweise unklar sind, gesagt, daß die strittige Wasserstrecke bis zur Harkenbeck gehe und von da in der Mitte der Reede nach Travemünde (d. h. nach dem Blockhause) zurückführe. Ferner bemerkt das Protokoll, daß in der Mitte der Reede sich keine Fische aufhielten. Beide Male kann mit "Reede" nur die Bucht gemeint sein. Es war verständlich, daß man nach Abfischung der Strecke bis zur Harkenbeck mitten durch die Bucht zurückkehrte, weil hier nicht gefischt wurde, man also niemand beim Fange in die Quere kommen konnte. Dagegen ist gar nicht einzusehen, warum man gerade durch die Mitte der nautischen Reede hätte zurückfahren sollen, die als Fischereigebiet noch in Betracht kam.
Die Richtung der Rückfahrt durch die Mitte der Bucht hat nun Sahn durch den Punkt B ausdrücken wollen, den man sich mit dem Blockhause verbunden denken muß. Festzustellen ist, daß Sahn die französische Seekarte zugrunde gelegt hat 177 ). Auf ihr liegt der Punkt B anders als auf der Admiralitätskarte, weil Rosenhagen,


|
Seite 169 |




|
durch das der Punkt mit bestimmt wird, auf der französischen Karte unrichtig eingetragen ist. Das hat Sahn aber nicht bemerkt 178 ). Um zu ermitteln, wie er den Punkt B gefunden hat, muß man also unsere Beilage 5 a zur Hand nehmen, die den Punkt auf der französischen Karte wiedergibt. Da lehrt schon fast der Augenschein, daß der Punkt auf der Mittellinie der Bucht liegt. sieht man nämlich die Harkenbeckmündung als Ende der Bucht an, wie es ja in Lübeck geschah, und legt von der Mündung aus eine Tangente ans Brodtener Höved, so wird durch diese das Buchtgebiet nach der See zu abgeschlossen. Wenn man dann zu der Tangente unendlich viele Parallelen quer über die Bucht von Ufer zu Ufer zieht und die Mittelpunkte der Parallelen miteinander verbindet, so ist diese Verbindungslinie, die keine gerade Linie sein würde, die Mittellinie der Travemünder Bucht. Nun aber ist der Punkt B auf der Beilage 5 a fast haargenau der Mittelpunkt einer Parallele zur Tangente Harkenbeckmündung - Brodtener Höved, Linien, die man ja auf der Beilage konstruieren kann. Die winzige, kaum wahrnehmbare Abweichung hat gar nichts zu bedeuten und erklärt sich auch leicht 179 ). Der Punkt B hat auf der Sahnschen Karte zweifellos auf der Mittellinie liegen sollen. Warum nun Sahn gerade diesen Punkt der Mittellinie angenommen hat, wird sich kaum feststellen lassen, es kommt auch nicht darauf an. Mit der nautischen Reede kann der Punkt nichts zu tun haben. Viel interessanter ist der Punkt A, den wir noch besprechen werden. -
Was erfahren wir nun aus der späteren Zeit über die nautische Reede?


|
Seite 170 |




|
Wie wir bereits erwähnt haben, wurde in der von Rörig angezogenen "Nachricht für Seefahrer" von 1855 den Schiffen, die nachts nicht eingebracht werden könnten, empfohlen, in 5 bis 6 Faden Wasser zu ankern. Selbst wenn die Kapitäne sich damals nach dem großen preußisch-dänischen oder dem englischen Faden richteten, so hatten sie bei 6 Faden 11,30 oder 10,97 m Tiefe. Damit kommt man immer noch nicht auf die Höhe von Rosenhagen, wo ja auch - laut dem Segelhandbuche von 1878 - der Ankergrund weniger gut ist 180 ). In § 4 der Lübeckischen Hafen- und Revier-Ordnungen von 1893 und 1904 181 ) heißt es, daß Schiffe bei heftigem Sturm, wenn ein gewisses Zeichen an der Signalstange der Windbake gegeben werde, nicht auf den Travemünder Hafen zusteuern dürften, sondern "auf der Rhede in 10 bis 12 Meter (5 bis 6 Faden) Wassertiefe ankern oder in See halten" müßten. Hier findet sich also zuerst der Faden auf 2 m berechnet, eine Abrundung, die aus der Zeit des Überganges zum Metermaße herrührt und dem großen preußisch-dänischen Faden (1,883 m) einigermaßen nahe kommt 182 ). Im übrigen aber handelt es sich hier ja nur um ein vorläufiges Ankern, und die Angabe der Ankertiefe von 5 bis 6 Faden bedeutet, ebenso wie in der "Nachricht" von 1855, nur einen Ratschlag, läßt aber keinen Schluß auf eine Gebietshoheit über die betreffende Wasserfläche zu. Sonst müßte man ja auch aus der Anweisung: "oder in See halten" denselben Schluß in Hinsicht auf das offene Meer ziehen dürfen. Reeden finden sich vor den Häfen vieler Städte, ohne daß diese je das Eigentum an dem Reedegewässer hätten beanspruchen können.
In dem Segelhandbuche für die Ostsee von 1878 wird gesagt, daß der gute Ankergrund (Schlick und Ton), der sich vor Travemünde bei 17 m Tiefe finde, in der Nähe der Ansegelungstonnen bei 10 und 12 m Tiefe wieder vorherrschend werde. Hier sei die Reede für Schiffe, die leichtern wollten 183 ). Allerdings lagen damals die Ansegelungstonnen von den 10 - 12-m-Tiefen noch weit ab; die Admiralitätskarte von 1873 verzeichnet die äußersten


|
Seite 171 |




|
Tonnen seewärts, die auch in dem Segelhandbuche erwähnt werden, gar nicht weit hinter der 6-m-Tiefenlinie. Auch findet sich Schlick und Ton noch in der inneren Bucht 184 ). Bedenkt man weiter, daß auf der Karte von 1873 ein Anker noch binnen der Majorlinie (unmittelbar davor) liegt, der offenbar die Reede für Kauffahrer bezeichnet, so kann man die Stelle in dem Handbuche nicht dahin verstehen, daß mit der Wiederkehr des guten Ankergrundes zugleich die eigentliche Handelsreede beginnen sollte, deren Örtlichkeit vielmehr nicht genauer angegeben wird. Diese Reede, wohin die Schiffe von den Lotsen gesteuert wurden und wo man leichterte, muß nach der Admiralitätskarte immer noch da gelegen haben, wo sie zur Zeit des Lotsenkommandeurs Harmsen gewesen war. Unseres Wissens wird noch heute von den Travemünder Fischern die Wasserfläche zwischen dem Flußauslaufe und den letzten Fahrwassertonnen als ein Gebiet "binnen de Reide" bezeichnet. Diese Tonnen sind etwa 200 m vor der 10-m-Wasserlinie verankert und haben sich früher noch weiter buchteinwärts befunden 185 ).
Die Reede für große Kriegsschiffe übrigens, die bei 17 m Tiefe gegenüber der Harkenbeck liegt, kann ganz unberücksichtigt bleiben 186 ). Auf der neuesten Admiralitätskarte findet sich der Anker, der diese Reede angibt, noch jenseit der Peillinie Gömnitzer Turm - Pohnsdorfer Mühle 187 ). Auch Rörig (III, S. 99) bemerkt, daß die Reede für große Schiffe außerhalb der Linie liege.
Mißverständlich ist es, wenn Rörig (III, S. 129) sagt, daß nach § 3 der Hafenordnung von 1904 auf der Reede "die Verpflichtung zur Benutzung eines im Staatsdienste angestellten Lotsen" bestehe. Denn diese Verpflichtung, die viele Ausnahmen gelten läßt, besteht "für die Einfahrt von See in den Trave-


|
Seite 172 |




|
münder Hafen und für die Ausfahrt seewärts aus ihm sowie für die Flußfahrt zwischen Travemünde und Lübeck". Das ist selbstverständlich ein Unterschied. Schließlich erwähnt Rörig (III, S. 130), daß das Lübecker Gesetz betreffend das Lotsenwesen von 1909 dem Lotsenkommandeur die Aufsicht über alle staatlichen Anlagen 188 ) auch auf der Reede (außerdem in Travemünde und auf einem Teile der Trave) übertrage. Wir müssen fragen, was für Anlagen hier denn gemeint sind. Es kann sich doch nur um die Betonnung handeln. Die Tonnen aber liegen nicht im mecklenburgischen Buchtgewässer, abgesehen von der neuerdings von Lübeck zur Bezeichnung seiner neuen Grenze ausgelegten Fischereitonne vor der Harkenbeck.
Ganz irrtümlich würde die Vorstellung sein, daß Mecklenburg, indem es auf seinen Buchtanteil nicht verzichten will, gewissermaßen an den Lebensnerv der Lübecker Schiffahrt rühre. Wer hat denn die Travemünder Lotsen mitsamt ihrer Dienstflagge gehindert zu einer Zeit, in der Lübeck selber die völkerrechtlichen Regeln als maßgebend für die Bestimmung des Hoheitsrechtes in der Bucht anerkannte? Keinesfalls kann denn auch das Lotsenwesen als Beweis für Gebietshoheit über einen Teil der See ins Feld geführt werden; es hat einen ganz anderen rechtlichen Ausgangspunkt. Sonst müßte z. B. auch die Stadt Rostock bis vor kurzem einen Teil des Meeres besessen haben, überdies spielt sich die Tätigkeit der Travemünder Lotsen im Fahrwasser ab, das von Mecklenburg gar nicht beansprucht wird. Auch möchten wir glauben, daß das Lübecker Lotsenwesen nebst dem Fahrwasser früher oder später vom Reiche übernommen werden wird, wie es bei anderen deutschen Hafenstädten heute schon der Fall ist.
Eine Reede im vormaligen Sinne gibt es auf der Travemünder Bucht nicht mehr. Das Leichtern gehört der Vergangenheit an, seit moderne Dampfbagger dafür gesorgt haben, daß große Schiffe bis Lübeck fahren können. Würde man die Trave, Plate und innere Bucht wieder versanden lassen, so wäre es mit der Lübecker Schiffahrt ohnehin vorbei. Wenn heute ein Schiff ausnahmsweise und aus besonderen Gründen bei 10 bis 12 m Tiefe vor Anker geht, so ist damit nicht gesagt, daß es sich im mecklenburgischen Gewässer aufhält, denn diese Tiefen finden sich ja auch im Lübecker Buchtanteil. Sucht es sich aber das mecklenburgische Gebiet aus, von dem hier nur eine kleine Ecke in Betracht käme, so hindert niemand es daran, und niemand stört es hier.


|
Seite 173 |




|
Der einzige angebliche Beweis, den Rörig für die angebliche Seegrenze der Reede, die Peillinie Gömnitzer Berg - Rohnsdorfer Mühle in seinem früheren Gutachten angeführt hatte, ist weggefallen. Rörig (III, 77) zieht ihn selber zurück. Damit ist eigentlich die ganze Frage erledigt. Was Rörig neuerdings vorbringt, zeigt nur, daß die Peillinie eine moderne nautische Linie ist. Dies aber wird von niemand bestritten. Sind denn nautische Linien gleichbedeutend mit Grenzen? Mit demselben Rechte kann man jede beliebige andere Linie auch für eine Gebietsscheide ausgeben.
Eine festgelegte "lineare Grenze", sagt Rörig, habe man nicht gehabt, es sei aber neuerdings der Übergang dazu "notwendig geworden" 189 ). Und da habe er denn "als Grundlage der seewärtigen Abgrenzung des Fischereibezirkes III" den Umfang der Reede so vorgeschlagen, "wie er durch die Jahrhunderte konstant gewesen" sei. Wir erwidern, daß sich diese Beständigkeit durch Jahrhunderte selbst dann keineswegs behaupten ließe, wenn der Bericht von 1828 als Quelle nicht ausgeschieden wäre.
Für die Lotsen und Seefahrer, meint Rörig, hätten Peillinie und Steinrifftonne genügt, um das Ende der Reede zu erkennen. Aber 1828 war die Reede für die Lotsen an der Majorlinie zu Ende. Auch ist ja die Steinrifftonne erst 1915 im Verlauf der Peillinie verankert worden, während sie vorher viel weiter buchteinwärts lag, ungefähr 1 km diesseit der Peillinie, zwischen dieser und dem Brodtener Höved 190 ). Und wenn die Peillinie auf 8,5 m Tiefe "frei vom Steinriff führt" 191 ), so hat das ja mit der Reede gar nichts zu tun, sondern gilt für die Fahrt über das Riff, wohl auch erst seit einer Zeit, in der man mit sehr tiefgehenden Schiffen rechnete. Ganz irreführend ist es übrigens, daß Rörig sagt, das Segelhandbuch von 1878 bringe "mit großem Fettdruck den Gömnitzer Berg als Überschrift eines besonderen Abschnitts", denn den Fettdruck findet man in dem ganzen Werke überall, oft ein paarmal auf der Seite, zur besseren Übersicht, wenn eine Reede, ein Riff, ein Leuchtturm usw. besprochen wird. Dabei ist die Peillinie auch heute nicht einmal eine Reedegrenze im rein nautischen Sinne. Für große Schiffe liegt ja der Ankergrund nach Rörig noch weiter seewärts, und es "gilt ein


|
Seite 174 |




|
Schiff nach dem Sprachgebrauch der Lotsen jetzt bereits als auf der Reede befindlich, wenn es von der Steinrifftonne aus gerechnet hinter dem 54. Breitengrad liegt" 192 ). Danach können sich Schiffe 3 km jenseit der Harkenbeck befinden und dennoch auf der Reede sein. Reedelinien sind eben keine Hoheitsgrenzen. Für Rörig aber ist überall da, wo ein Travemünder Lotse steuert, Lübecker Gebiet. Seine Bemerkungen auf S. 99 f. lassen beinahe darauf schließen, daß er am liebsten den 54. Breitengrad als Reedegrenze annehmen würde.
Wie wir in unserem vorigen Gutachten nachgewiesen haben, ist die Peillinie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle nicht "uralt", denn die Mühle war 1778 "neuerbaut" 193 ). Damit ist auch einer bloßen Vermutung, daß diese Linie eine Grenze gewesen sein könne, aller Boden entzogen. Aber Rörig weiß sich zu helfen. Er ersetzt die Mühle einfach durch deren "Erhöhung" 194 ). Willkürlicher kann man gar nicht verfahren. Die Peillinie treffe die mecklenburgische Küste "ungefähr" bei der Harkenbeck. So sei es "nach den Angaben der Quelle über die seewärtige Ausdehnung der Reede bereits im 16. Jahrhundert" gewesen 195 ). Wir bitten, uns diese wichtige, bisher völlig unbekannte Quelle zu nennen.
Der "Major" auf dem Gömnitzer Berge kann für sich allein, ohne die durch die Mühle bestimmte Richtung, schon gar keine Rolle mehr spielen. Denn man kann unmöglich behaupten, daß er auf die Harkenbeckmündung zugeführt habe; mit jedem anderen Punkt hätte er sich genau so gut verbinden lassen.
Nach Rörigs Erachten würde der Gömnitzer Berg "zweifellos" schon auf Waghenaers Karte im Spiegel der Seefahrt "als Profil aufgezeichnet" sein, "wenn es nicht ein unglücklicher Zufall wollte", daß die holsteinische Küste von Travemünde an nur angedeutet sei 196 ). Aber in Waghenaers "Thresoor der Seefahrt" ist ja diese Küste nicht bloß angedeutet, wie unsere Beilage 2 ergibt. Außer-


|
Seite 175 |




|
dem enthält dieses Werk sogar Küstenprofile der Lübecker Bucht (Beilage 2 am Kopf), und hier sieht man die mecklenburgische Küste von Wismar an, die holsteinische vom "Oosthoeck" 197 ) an, der Gömnitzer Berg aber und der Major sind nicht vermerkt.
Ohne den "Major" die alte Eiche oder Buche, die ja die eigentliche Landmarke war, hätte die Schiffahrt von dem Gömnitzer Berge schwerlich Nutzen haben können. Das zeigt sich auch darin, daß Lübeck nach dem Umsturz des Baumes ein anderes Zeichen errichtet wissen wollte. Wir haben aber weder den Berg noch den Major auf einer älteren Seekarte gefunden.
Auch die französische Seekarte gibt ihn ja nicht an. Nach Rörig (III, S.86) deswegen nicht, weil er 1815 schon umgefallen und der neue Turm noch nicht erbaut gewesen sei. Aber die Karte ist eigentlich gar nicht von 1815. Sie ist 1811 angefertigt worden, dann hat man sie mit nach Frankreich genommen und 1815 veröffentlicht 198 ). Nun rechnet Rörig mit der Möglichkeit, daß "auf dem Entwurf von 1811 der damals vielleicht noch stehende ,Major' eingetragen, 1815 aber, wo er sicher nicht mehr stand, beseitigt worden" sei 199 ). Warum jedoch soll es sich um einen bloßen Entwurf von 1811 handeln? Sicher ist überdies, daß der "Major" nicht nur 1811 noch Stand, sondern auch noch 1815; denn in diesem Jahre ist er erst umgefallen 200 ).
Ganz unmöglich ist Rörigs weitere Erwägung, daß man nun zwar wenigstens den Gömnitzer Berg auf der Karte habe anmerken können, daß aber dessen Weglassung "vielleicht einen rein äußer-


|
Seite 176 |




|
lichen Grund" habe, weil er "ganz an den Rand der Karte gerückt" worden wäre. Um sich vom Gegenteile zu überzeugen, genügt schon ein Blick auf die Admiralitätskarte, die in nicht viel größerem Maßstabe angefertigt ist. Außerdem kann man den Berg auf der französischen Karte mit Leichtigkeit bestimmen, und es ist auch an sich schon ganz unwahrscheinlich, daß man ein wichtiges Seezeichen aus äußerlichem Grunde hätte weglassen sollen.
Durchaus irrtümlich ist ferner Rörigs Meinung, daß der Berg "indirekt aufgenommen" sei, "insofern als der auf der Karte von 1815 stehenden Pohnsdorfer Mühle eine selbständige Bedeutung als Landmarke nicht zukommt, sondern nur in Verbindung mit dem Berge". Denn auf der Seekarte der Neustädter (Lübecker) Bucht, die der dänische Marineleutnant Schultz 1860 vermessen hat, findet sich eine auf die Mühle gerichtete Peillinie: Rohnsd. M. in einer Linie mit der Mitte von "Gule Klint" (gelbes Steilufer). Und diese Linie wird auch am Rande der Admiralitätskarte von 1873 durch ein Küstenprofil bezeichnet ("Die Pohnsdorfer Mühle über dem gelben Uferabhang"). Mit dem Gömnitzer Turme hat das gar nichts zu tun. Die Linie verläuft in vollkommen anderer Richtung und gilt anscheinend für die Fahrt nach Neustadt von Osten her. Also hatte die Pohnsdorfer Mühle als Seezeichen durchaus ihre "selbständige Bedeutung". Auf einer dänischen Seekarte, "Kaart over Belterne og Sundet", von 1799 201 ) wird sie noch nicht angegeben, während die gleichnamige Karte im dänischen Seeatlas (1818) sie bereits zeigt 202 ). Die Peillinie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle aber ist zweifellos erst aufgekommen, seit sich der Turm auf dem Berge erhob.
An sich bestände ja der Schimmer einer Möglichkeit, daß der "Major" 1815 umfiel, bevor die ersten Abzüge von der französischen Karte gemacht wurden. Daß aber das französische Marineamt sich vor der Veröffentlichung der Karte überhaupt noch einmal mit Lübeck in Verbindung gesetzt hat, halten wir schon im Hinblick auf die ganzen Zeitverhältnisse für völlig ausgeschlossen. Unsere Ansicht jedenfalls, daß der "Major" nie auf der Karte verzeichnet gewesen ist, wird dadurch bestärkt, daß er sich auch auf den früheren Seekarten nicht findet, überdies hätte zunächst schwerlich ein Grund bestanden, ihn wieder zu löschen. Denn es


|
Seite 177 |




|
muß noch über zehn Jahre später als 1815 etwas von dem Baume vorhanden gewesen sein, wonach man sich richten konnte. 1825 (November) erwähnten die Schlutuper Fischer ihn noch, und zwar in einer Weise, die gar keinen Zweifel darüber aufkommen läßt, das er als Merkzeichen gebraucht wurde 203 ). Ebenso wird in dem Fischereivergleich vom 7, Februar 1826 gesagt: "Die Strecke vom Blockhause an so weit hinaus, bis der Major (ein Baum auf dem Berg zu Gömnitz in Holstein) vor das Brodtener Ufer kommt" 204 ). Ein Baum, der "umstürzt", verschwindet ja noch nicht, vielleicht war nur die Krone oder ein Teil davon heruntergebrochen. Spätestens im März 1827 aber war von dem "Major" nichts mehr übrig 205 ). Wahrscheinlich hat der Hufner Mirau, zu dessen Besitztum der Gömnitzer Berg gehörte, 1826 die Reste des Baumes beseitigt. Dies wird das Jahr sein, in dem der Lübecker Senat für die Errichtung des Turmes eintrat 206 ), den dann der Herzog von Oldenburg 1828 bauen ließ.
Nach allem, was wir angeführt haben, können wir den "Major" nicht für ein altes Seezeichen von allgemeiner Bedeutung halten. Sein Zweck als Landmarke wird sich auf die Lübecker Reede beschränkt haben, weil ja die Majorlinie vor dem Brodtener Ufer eine Reedelinie war. In der von Rörig angeführten Eingabe der Lotsenherren an den Senat, worin die Erbauung eines Turmes als Ersatz für den "Major" verlangt wurde, dürften die Farben zu dick aufgetragen sein. Dies hat sich dann auch in dem Schreiben ausgewirkt, das der Konsul von Schlözer auf Ersuchen der "mit dem Lotsenwesen beauftragten" Senatoren an den Herzog von Oldenburg richtete. Doch heißt es hier, daß es sich um einen Gegenstand handele, "der für die Sicherheit der


|
Seite 178 |




|
Rhede von großer Wichtigkeit" sei, Lübeck erbot sich sogar, erforderlichen Falles die Kosten des Turmes zu bestreiten 207 ).
Aber auch für die Lübecker Reede ist der Major gewiß kein "uraltes" Merkmal gewesen. In Waghenaers Tagen, als das Brodtener Ufer noch etwa 400 m weiter nach Osten vorragte, konnte man den Baum von der nautischen Reede aus gar nichts sehen. Im übrigen hat die Frage, seit wann der "Major" als Landmarke diente, für den vorliegenden Streit längst alle Bedeutung verloren. Es kommt ja nicht darauf an, das Alter dieser Landmarke zu bestimmen, sondern Rörig soll feststellen, daß sie in Verbindung mit der Harkenbeckmündung eine Grenze gewesen sei. Hierfür hat er nicht das Geringste vorgebracht.
Wohl aber läßt sich nachweisen, daß es eine solche Grenze überhaupt nicht gegeben haben kann. Auf der Karte des Navigationslehrers Sahn von 1823 nämlich war die Fischereistrecke bis zur Harkenbeck vermerkt 208 ). Der Punkt A auf der Karte bezeichnete das Ende dieser Strecke nach der See zu. Wenn nun die Lübecker Buchtfischerei, wie Rörig annimmt, auf Gebietshoheit beruht hätte und die Grenze dieser Hoheit durch die Peillinie Gömnitzer Berg - Pohnsdorfer Mühle oder wenigstens durch


|
Seite 179 |




|
eine Linie Gömnitzer Berg - Harkenbeckmündung bestimmt worden wäre, so müßte der Punkt A selbstverständlich auf einer dieser Linien gelegen haben. Er lag aber, wie unsere Beilage 5 b ergibt, Hunderte von Metern hinter beiden 209 ). Sahn hat ihn einfach gegenüber der Harkenbeckmündung angenommen. Unsere Beilage beweist, daß der Punkt in gänzlich anderer Richtung zur Bachmündung liegt als die beiden genannten Linien. Und wenn man die Strecke Harkenbeckmündung - Punkt A seewärts verlängert, so berührt sie - auf der Admiralitätskarte sowohl wie auf der französischen - die holsteinische Küste in der Nähe des Pelzerhakens, ungefähr 4 1/2 km von der Stelle, wo die Peillinie Gömnitzer Turm - Pohnsdorfer Mühle die holsteinische Küste trifft 210 ). Diese Entfernung ist etwa so groß wie die Strecke von der Travemündung bis zur Harkenbeck.
Damit ist unumstößlich nachgewiesen, daß es weder die Peilliniengrenze noch die Grenze Harkenbeckmündung - Gömnitzer Berg gegeben hat.
Über die übrigen Grenzen, die Rörig für seine "Reede im weiteren Sinne" annimmt, hat er neues Material nicht vorgebracht 211 ). Daß der eine Landgrenzpunkt, die Harkenbeckmündung, nur eine rein praktische Nutzungsgrenze für die Lübecker Buchtfischerei gewesen ist, haben wir in unserem


|
Seite 180 |




|
vorigen Gutachten dargelegt 212 ). Es wird dies bestärkt durch die Angabe in dem Lübecker Wetteprotokoll von 1825, daß in der See "über die Harkenbeck hinaus es Wind und Wetter selten zuließen, ohne Lebensgefahr Netze zu setzen" 213 ).
Als zweiten Landgrenzpunkt sieht Rörig die Brodten-Niendorfer Scheide an. Wir haben nachgewiesen, daß dies unhaltbar ist 214 ). Eine Bestätigung unserer Ausführungen hierüber von 1925 liegt in folgendem: In seiner oben erwähnten Schrift über das Brodtener Ufer setzt P. Friedrich auseinander, daß die abbrechende Küste einen natürlichen Schutz dadurch verloren habe, daß die Lübecker von jeher die vorgelagerten Steine wegholten, die aus den früher abgespülten Massen stammten. Er erwähnt bei dieser Gelegenheit eine Stelle aus dem Bretlingsprotokoll Nr. 47 vom Jahre 1744, worin es heißt:
"Steine, nach die Bollwerke außer Travemünde zu fahren, weilen so wie es von vorigen Zeiten bis hero mit den Steinfuhren nach dem Bollwerke gehalten worden, der Rammeister mit ein oder zwei Kähnen oder Waadschiffen außerhalb der Reede vom Strande holen lassen . . ."
Nun ist es klar, daß mit der "Reyde" hier nicht die nautische Reede gemeint sein kann. Sie wäre als Grenzbestimmung ganz sinnlos gewesen, weil es sich von selbst verstand, daß Steine nur außerhalb dieser Reede geholt werden konnten, auf der es natürlich überhaupt keine Steine gab. Es handelt sich also in dem Protokolle um die "Reede im weiteren Sinne", die freilich etwas anderes ist, als Rörig glaubt. Denn weil die Steine "außerhalb der Reede" und dennoch vom Brodtener Strande geholt werden sollten, so kann ein Teil dieses Strandes nicht an der Reede gelegen haben. Dieser Teil ist natürlich die Nordseite bis zur Niendorfer Scheide. Die "Reede im weiteren Sinne" aber ist eben die Travemünder Bucht 215 ). Zu dem Wetteprotokoll Stimmen die von Rörig (I, S. 32) angeführten Travemünder Aussagen von 1775, wonach "seit Jahrzehnten am Brodtener Ufer und weiter bis kurz vor Niendorf im Auftrage des Lübecker Bauhofs Steine gesammelt und fortgeholt" waren.
Natürlich fällt mit dem Landgrenzpunkt an der Niendorfer Scheide und mit der Peillinie auch die Seegrenze im Nordwesten,


|
Seite 181 |




|
das Lot vom Grenzpfahl auf die Peillinie, weg. Dieses Lot ist überhaupt ganz willkürlich und, wie Rörig jetzt mitteilt (III, S. 140), auf Anraten des Lotsenkommandeurs gezogen worden, der in dem katholischen Kinderheim ein passendes Merkzeichen für den Landgrenzpunkt erblickte. Auf diese Weise läßt sich eine historische Grenze nicht gut begründen. Das Kinderheim ist übrigens auf der berichtigten Seekarte bereits verzeichnet. -
Zurückzuweisen ist noch eine Behauptung in dem jüngsten Schriftsatze des Lübecker Senates an den Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich vom 29. Juni 1926 Der Senat sucht nämlich den Umstand, daß die Grenze der Lübecker Reede nach Nordwesten so weit seewärts verlaufe, damit zu erklären, daß das Brodtener Ufer in früheren Jahrhunderten sehr viel weiter in das Meer vorgeragt habe. Es seien auch gelegentlich auf dem Steinriff weit draußen Dachziegel alter Form mit den Fischnetzen heraufgezogen worden. Wahrscheinlich wird angenommen, daß dort, wohin diese Dachziegel sich durch irgendeinen Zufall, z. B. infolge der Kenterung eines mit Ziegeln beladenen Schiffes, verirrt haben, vormals Häuser standen. so etwas kann doch gar nicht ernsthaft vorgebracht werden. Denn einmal hat das Brodtener Ufer Lübeck vor 1804 überhaupt nicht gehört, und sodann sind seit der Zeit, in der dieses Ufer bis dahin reichte, wo heute die Linie Gömnitzer Turm-Pohnsdorfer Mühle daran vorüberläuft, mindestens zweitausend Jahre verflossen.
Wir schließen unsere Ausführungen über Reedelage und Reedegrenze mit folgender Feststellung:
Die alte nautische Reede, wie sie zur Zeit des Fischreusenstreites bestand, hat nahe bei der Travemündung gelegen, dort, wo wir sie auf der Kartenskizze unseres vorigen Gutachtens eingezeichnet haben. Und noch im 19. Jahrhundert hat die eigentliche Reede, soweit die Lotsen sie rechneten, an der Majorlinie geendet. Wenn außerdem in neuerer Zeit Schiffe des Nachts oder während eines die Einfahrt in die Trave verhindernden Sturmes ohne Lotsenhilfe vorläufig auf 5 bis 6 Faden oder 10 bis 12 m Wasser Anker warfen oder werfen, so ist das völlig nebensächlich, berührt auch höchstens einen verschwindenden Teil des mecklenburgischen Buchtgewässers, der aber deswegen nicht lübeckisch geworden ist.
Reedegrenzen im Rörigschen Sinne hat man nie gekannt. Es werden denn auch in den Lübecker Hafen- und Revier-Ordnungen von 1893 und 1904, § 1, zwar die Grenzen der Häfen von Trave-


|
Seite 182 |




|
münde und Lübeck sowie der dazwischen gelegenen Flußstrecke, des Reviers, genannt, aber keine Reedegrenzen. Nach Rörig hätte es nun schon dreierlei Reeden gegeben: die nautische Reede, die "Reede im weiteren Sinne" und die Reede im Sinne von Travemünder Bucht 215a ). An dieses Dreierlei kann niemand glauben. Sondern es gab eine nautische Reede, und von ihr ging der Name als geographische Bezeichnung auf die Bucht über.
Nachwort.
Den weiteren Inhalt des neuen Rörigschen Gutachtens können wir vorläufig nicht mehr berücksichtigen. Auf eines aber ist noch einzugehen. Wir haben im März 1925 vom Lübecker Staatsarchiv Material über den Schiffsunfall bei Rosenhagen im Jahre 1660 erhalten, den Rörig (II, S. 266f.) behandelt hatte. Eine Bearbeitung dieses Materials vermißte Rörig in dem Torso unseres vorigen Gutachtens 216 ), der ihm im Frühling 1925 zugänglich wurde. Er behauptete daraufhin in seiner Entgegnung vom 6. Juli 1925, wir hätten diesen Fall "einfach unterdrückt". Jedoch gehört der Fall nicht in den allgemeinen Teil unseres Archivgutachtens, der Rörig vorlag, sondern sollte in dem damals noch unfertigen zweiten Teile, der von der Travemünder Bucht im besonderen handelt, dargestellt werden. Das hätte Rörig schon aus unserer Anmerkung 68 in Archiv II schließen können 217 ). Inzwischen hat er nun das ganze Gutachten erhalten, worin wir den Fall von 1660 auf dreieinhalb


|
Seite 183 |




|
Seiten (Archiv II, S. 108 - 111) besprochen und gezeigt haben, daß Rörig seine Quelle mißverstanden hat. Auch ist er durch v. Gierke (Anm. 230) auf die Hinfälligkeit seines Vorwurfes aufmerksam gemacht worden. Trotzdem hat er jetzt seine 1925 erhobene Behauptung ohne ein Wort der Berichtigung abdrucken lassen (III, S. 22).
Überhaupt ist Rörigs Diskussionsweise in dem neuen Gutachten sehr sonderbar, so auch die Art, wie er v. Gierkes Nachweis bekämpft, daß Rörig die Worte "bis ins Meer" in dem Reichsgerichtsurteil von 1890 ganz verkehrt ausgelegt hat. Man braucht nur v. Gierkes Ausführungen hierüber (S. 44) und die Entgegnung bei Rörig III, S, 65 f., Anm. 20, hintereinander zu lesen, um sich über den Wert einer solchen Diskussion, wie Rörig sie hier übt, klar zu werden, übrigens wirft Rörig uns auch diesmal Tendenz vor (III, S, 88), Es genügt dem gegenüber, darauf hinzuweisen, daß gerade seine eigene Quellenforschung über die Streitfrage sich in wichtigen Punkten als ungenau und irreführend herausgestellt hat.


|
[ Seite 184 ] |




|


|




|
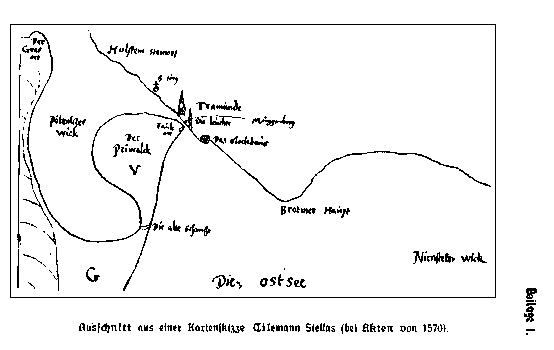


|




|


|




|
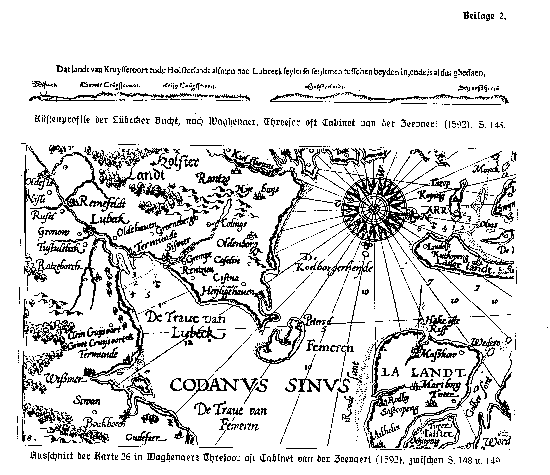


|




|


|




|
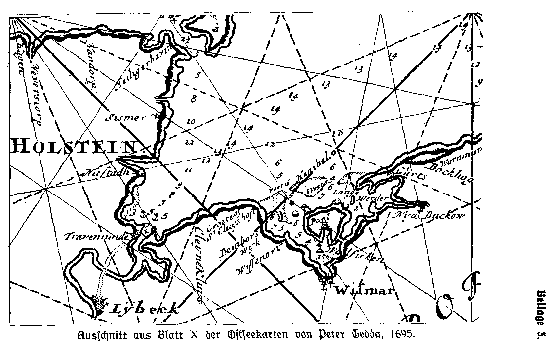


|




|


|




|
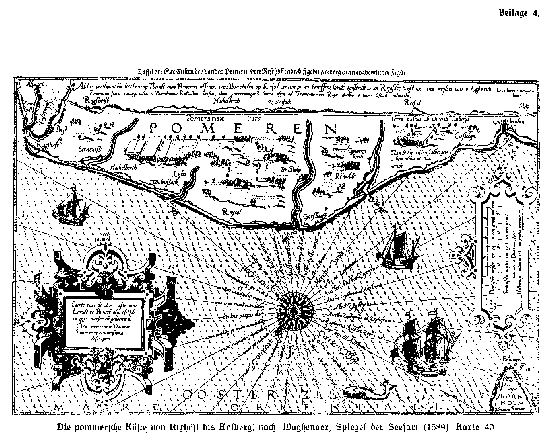


|




|


|




|
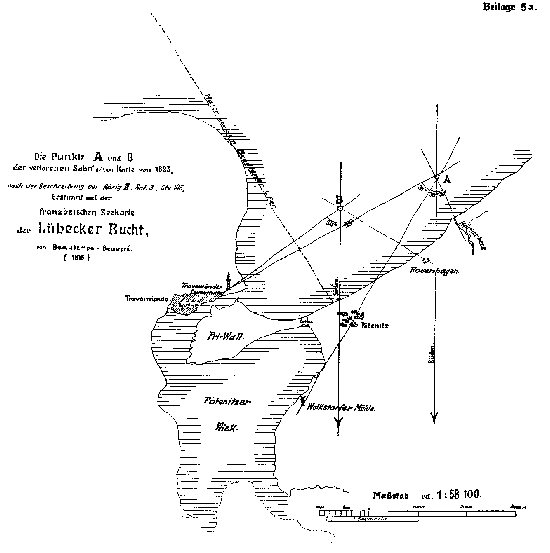


|




|


|
[ Seite 185 ] |




|


|
[ Seite 186 ] |




|



|


|
|
:
|
V.
Rostocker
Ehen in alter Zeit.
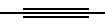


|
Seite 187 |




|
Bei meiner Beschäftigung mit Rostocker Familiengeschichte, die sich im wesentlichen auf die Zeit vom Anfang des 14 bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts bezog, habe ich in steigendem Maße meine Aufmerksamkeit auf alles gerichtet, was ein Licht auf das in der Überschrift bezeichnete Gebiet wirft. Was sich mir da ergeben hat und was ich nun im folgenden zusammenstelle, wird freilich den einigermaßen mit den gesellschaftlichen Zuständen der Vergangenheit Vertrauten schwerlich Neues bringen, nur neue Belege für Wohlkekanntes. Aber da diese Belege aus der Geschichte Rostocker Familien genommen sind, werden sie für die Mecklenburger doch vielleicht nicht ohne Interesse sein. Es ist doch immer ein Stück längst vergangenen Lebens unserer Stadt, das da seine Augen wieder aufschlägt.
Was sich mir zunächst aufdrängte, war der Eindruck außerordentlicher Heiratsfreudigkeit bei unseren Altvorderen. Freilich ist die Zahl der unverehelicht Bleibenden zumal im Mittelalter nicht gering. Wohl in keinem der alten vornehmen Rostocker Geschlechter fehlen die Söhne, die Priester - viel seltener Mönche - werden, oder die Töchter, die ins Kloster gehen. Auch in der evangelischen Zeit fehlt es nicht an unverehelicht bleibenden Jungfern, wenn sie auch sicher seltenere Erscheinungen sind als heutzutage. Und erst recht scheinen Hagestolze, wie etwa Caspar Elers († 1637), indessen Leichenprogramm sorgfältig die Beschwerden und Sorgen des ehelichen und ehelosen Gebens gegeneinander abgewogen werden (natürlich mit dem Ergebnis, daß das eheliche Leben daran reicher sei) oder der Jurist Caspar Nettelbladt († 1660) und der Rektor Magister Heinrich Friese († 1745), Ausnahmen geblieben zu sein. Bemerkenswert erscheint es übrigens, daß im Mittelalter in den großen reichen Ratsfamilien nicht selten männliche Mitglieder begegnen, die, in engster Besitz- und Erwerbs-Gemeinschaft mit ihren Brüdern und deren Kindern stehend, von diesen beerbt werden, also ohne Leibeserben sind Natürlich kann es Zufall sein, daß über ihr Verheiratetsein keine Nachricht in den Urkunden erhalten ist, aber das Wahrscheinlichere ist doch, daß sie wirklich ehelos blieben. Man hat den Eindruck, daß dies geschah, um einer Zersplitterung des Familienvermögens vorzubeugen, wie etwa jetzt noch in reichen katholischen Bauernfamilien jüngere Geschwister aus diesem Grunde geistlich


|
Seite 188 |




|
werden. So ist es der Fall bei Gerhard Wulf († nach 1398), Bruder des Ratmanns Johann Wulf, Heinrich Kruse († 1368/69), Bruder des Ratmanns Ludwig Kruse; Peter Frese († 1474), Bruder des Ratmanns Johann Frese und der Wobbeke Preen; vielleicht auch bei Arnold Hasselbek († nach 1427), Bruder des Hermann Hasselbek; Bertold Rode († 1380/1), Bruder des Ratmanns Gerhard Rode, und den beiden Kerkhoffs, Heinrich († 1464) und Hans († vor 1521).
Im allgemeinen aber ist es nicht nur selbstverständlich, daß der gesunde Erwachsene heiratet, sondern die Witwer und Witwen heiraten zumeist bald wieder, "nach der von der Natur und Sitte vorgeschriebenen Zeit". Von 441 Männern, die mir aus den Stammbäumen und Stammbaumbruchstücken Rostocker Familien bekannt wurden und bei denen sich die Feststellungen mit einiger Sicherheit machen ließen, waren 259 einmal, 155 zweimal, 24 dreimal, 2 viermal und einer, nämlich der Bürgermeister Jacob Diesteler, † 1702, fünfmal verheiratet. Von den 259 nur einmal Verheirateten starben 193 vor der Frau, kamen also für eine zweite Ehe gar nicht in Frage, 25 überlebten die Frau; bei 41 ließ sich nicht feststellen, wer zuerst starb. Nehmen wir nun auch an, daß 30 von diesen 41 die Frau überlebten, so ergäbe sich immer noch, daß von 237 Witwern nur 55 nicht wieder heirateten. Von 633 Frauen waren 380 nur einmal verheiratet, 226 zweimal, 27 dreimal. Unter den letzteren ist z. B. auch die erste Rostocker Pfarrfrau, die Frau des Reformators Jochim Slüter, Katharina, die Tochter des Kleinschmieds Hans Gele, die nach ihm noch die beiden Bruchfischer Jochim Buck und Hans Wilms geheiratet hat. Unter den 380 einmal Verheirateten sind 139 vor dem Ehemann verstorben, 167 überlebten ihn, bei 74 mußte die Frage, wer länger lebte, unentschieden bleiben. Rechnen wir, daß von letzteren etwa 50 den Mann überlebten, so ergäbe sich, daß von 470 Witwen nur 217, also weniger als die Hälfte, unverheiratet blieb 1 ). Und zwar waren nicht nur für junge, sondern ebenso auch für ältere und alte Witwen die Heiratsaussichten noch recht erheblich. In wie hohem Maße man damit rechnete, daß eine Witwe auch höheren Alters wieder heiratete, zeigt das Leichenprogramm der


|
Seite 189 |




|
Emmerentia Kirchhof, der letzten Namensträgerin dieses alten Geschlechtes († 1644). Sie wird darin höchlichst gepriesen, daß sie nach dem Tode ihres Mannes, des Provinzialgerichtsrates Jakob Hein, den sie um 10 Jahre überlebte, zu keiner weiteren Ehe Schritt: Dadurch habe sie sich einer Cornelia, Valeria und anderen Musterfrauen an die Seite gestellt, wie denn auch die alten Römer die Palme der Keuschheit denen erteilt hätten, die sich mit einem Manne begnügt hätten. Dabei war sie bei Heines Tode bereits 64 Jahre alt und 43 Jahre lang mit ihm verheiratet gewesen! Es waren natürlich in erster Linie wirtschaftliche Rücksichten, die zu diesen zahlreichen Wiederverheiratungen führten. Für viele Witwen wird es geradezu eine Notwendigkeit gewesen sein, nach einem zweiten Manne auszuschauen, der das Geschäft des Verstorbenen aufrechterhalten und fortführen und so ihre und ihrer Kinder Versorgung sicherstellen konnte. Auch die Witwen von Beamten und Pastoren waren vielfach für ihre Versorgung auf eine zweite Ehe angewiesen. Gewiß gab es Witwen genug, die das Gewerbe ihres Mannes mit Geschick und Tatkraft weiterführten. So z. B. jene Anna Beselin, die Witwe des Bürgermeisters Bernd Pauls, die, wie ihr Stiefsohn betont, "im Rechnen und Schreiben wohl erfahren, eine verständige matrona gewesen, so ihre Nahrung mit Kornkaufen, Mälzen und Brauen stark getrieben bis auf ihren tötlichen Abfall" (1613); so auch Elisabet Dankwertz, die Witwe des Kaufmanns Jochim Pentzin, die so wohlhabend und so tüchtig in der Besorgung der wirtschaftlichen und geschäftlichen Dinge war, daß ihr zweiter Mann Johann Christoffer Kilian seine Zeit ganz seinen mathematischen Studien und den städtischen Angelegenheiten - er wurde 1694 Senator - widmen konnte. Anna Beselin heiratete freilich noch einmal, den Bürgermeister Jakob Lembke, aber der Heiratsvertrag wahrt in hohem Maße ihre Selbständigkeit: Beide wollen je 1000 Gulden zur gemeinsamen Nahrung einbringen, beider Hopfengärten und auch des Bürgermeisters Amtseinkünfte gemeinsam benutzen,


|
Seite 190 |




|
auch zieht der Bürgermeister in der Braut Haus und benutzt es mit der Gewandschneide (Tuchladen) und Kessel, Grapen usw., aber alle anderen Güter bleiben getrennt. So führt auch Anna Sossenheimer († 1575), die Witwe des Wandschneiders und Ratmanns Johann Grote († 1557), das Geschäft ihres Mannes weiter. In einem Reichs-Kammergerichts-Prozeß wird eine Zitation, deren Annahme sie verweigert, "auf den Tisch, da sie Gewand abzuschneiden pflegt", niedergelegt. Daraus ersehen wir zugleich, daß diese vornehme und reiche Dame 2 ) ihre Kunden selbst bediente, was übrigens Dietz in seiner Frankfurter Handelsgeschichte auch für die Heimatstadt ihres Geschlechtes von den dortigen Patriziern nachweist.
So gab es Witwen genug, die, obwohl sie ihre Männer lange Jahre überlebten, zu keiner zweiten Ehe Schritten, "ihren Witwenstuhl nicht verrückten": Metke Make († 1594), die Witwe des Claus Frese, die 40 Jahre Witwe war, Geseke († 1508/21), die Witwe des Bürgermeisters Kord Köne; Geseke von Cölln († 1510/12), die des Konrad von Gnoien; Anneke Willems († nach 1540), die des Ratmanns Johann Frese; Anna Kahle († 1627/32), die des Schiffers Tietke Detloff, die 30 Jahre und darüber als Witwen lebten. Daraus, daß Frauen selbständig und tatkräftig in langem Witwenstande die Erziehung der Kinder, die Fortführung des Geschäfts und des Hauswesens in die Hand nahmen, erklärt sich auch, daß nicht nur in der Zeit, wo die Familiennamen erst vereinzelt auftreten, Männer gleichen Vornamens häufig durch Hinzufügung des mütterlichen Taufnamens voneinander unterschieden werden 3 ), sondern daß dann solche weibliche Vornamen
Es erscheint übrigens nicht überflüssig, zu bemerken, daß Wand- oder Gewandschneider Tuchhändler sind, die dem ersten Stande angehören und ratsfähig sind, nicht etwa, wie oft angenommen wird, Leute, die das Schneiderhandwerk betreiben. Diese heißen Schneider oder in früherer Zeit Schröder.


|
Seite 191 |




|
als Familiennamen sich weiter vererben. So geht z. B. die um 1300 blühende Familie Lise, gelegentlich auch mit dem vollen Namen Elisabeth benannt, auf einen Hermannus dominae Lyse Hermann Sohn der Frau Lise, zurück, der 1279 im Rat sitzt.
Aber nicht alle Witwen waren so geschäftstüchtig wie die oben genannten. Mancher mag es ähnlich gegangen sein wie Anna Iversen, der Witwe des 1549 verstorbenen Krämers Hans Kahle. Sie ließ als eine "schlechte, blöde, einige Weibsperson und verlassene Wittib" sich von einem gerissenen Geschäftsmann mit glatten Worten überreden, eine Schuld ihres landräumig gewordenen Schwiegersohnes zu übernehmen, wozu sie nicht im geringsten verpflichtet war. Im allgemeinen drängten die Verhältnisse doch zu einer zweiten Heirat, zumal wenn die Kinder noch klein waren, oder das verschuldete Geschäft schwer aufrecht zu erhalten war. In solchen Fällen wurde die Eheschließung von der Stadt dadurch begünstigt, daß dem Bewerber das Bürgerrecht zu geringerem Satz überlassen wurde. Eintragungen wie: 1606 Jacob Eggebrecht, zu Warnemünde bürtig, freiet Jacob Brauers Witwe mit 2 Kindern und viel Schulden: 16 Gulden (für einen Schiffer, denn das waren beide Ehemänner, ein sehr ermäßigter Satz!); 1610 Hinrich Klußmann, ein Kürschner aus Braunschweig, heiratet eine Witwe (nämlich die des Pelzers oder Kürschners Heinrich Schele) mit 6 kleinen Kindern und vielen Schulden usw., 1614 David Kriegel, ein Kopperschlegergesell, so Meister Heinrichs (nämlich des Kupferschmiedemeisters Heinrich Schmidt) Witwe mit zweierlei Kindern und über 2000 Gulden Schulden befreiet, usw., 1636 Märten Brosemann von Grimmelin in Meißen, ein Bortenmacher, welcher sel. Peter Schraders, auch Bortenmachers-Witwe in der Wasserstraße mit vielen Kindern freiet: die Bürgerschaft gelassen zu usw., sind nicht selten im Bürgerbuch.
Lagen solche Witwenheiraten im Interesse der Witwen, so oft nicht weniger im Interesse der Männer. Wenn 1621 Matthias Hinde, zu Nustrow bürtig, von seinen Junkern wohl abgeschieden (d. h. er hatte sich aus dem Hörigkeitsverhältnis zur adligen Gutsherrschaft losgekauft), der von seinen Eltern nichts als das nackte Leben erhalten und 14 Jahre lang bei Bernd Faulen treu gedient, die Langesche (d. h. die Witwe des Kaufmanns Jakob Lange) freiet, die wohl ein Eigentum (ein Haus) hat, aber mit viel Schulden behaftet ist, so trifft das Interesse beider Parteien zusammen. Für den vermögenslosen Handlungsdiener bietet die Heirat die gewünschte Gelegenheit, aus dem drückenden Dienstverhältnis heraus zu einem selbständigen Geschäft zu kommen. Oder eine


|
Seite 192 |




|
zusammengebrochene Existenz wird durch eine solche Heirat wieder neu begründet: 1613 wird dem aus Lübeck gebürtigen Kaufmann Heinrich Zuckerbecker, so seinen Handel in Schweden gehabt, dem aber, wie er heraußer gekommen, von den dänischen Schiffen all das seine genommen, die Bürgerschaft zu 40 Gulden gelassen, weil er die Friessche (Agneta Techentin, Witwe des Kaufmanns Hans Reimers und dann des Claus Frese oder Friese) mit 6 Kindern freiet. Die Rechnung stimmte freilich insofern nicht recht, als er aus den Schulden nicht herauskam, so daß er auf den Gedanken gekommen zu sein scheint, um sich seinen Verpflichtungen zu entziehen, nach Riga überzusiedeln, schließlich wird sein Haus, allerdings erst nach seinem Tode, im Konkurs verkauft. Doch nicht nur vermögenslose Männer suchten "ihr Heiratsglück" mit einer Witwe zu machen. Die Fälle, daß der junge Mann zunächst eine Witwe heiratet, sind auch bei den Söhnen vermögender, ja reicher Familien überaus häufig. Es ist bezeichnend, daß von den acht männlichen Gliedern der im 14. und 15. Jahrhundert blühenden reichen Ratsfamilie Grentze, über deren Eheverhältnisse wir überhaupt etwas wissen, vier zunächst eine Witwe heirateten. Es war eben immer verlockend, sich in ein bereits gebautes Nest zu setzen. Oft genug war ja auch das Vermögen noch ganz in der Hand des Vaters oder der verwitweten Mutter des Heiratslustigen. Daß auch bei Pastoren diejenigen Bewerber um eine Pfarre, die sich bereit erklärten, die Witwe oder eine Tochter des bisherigen Inhabers zu ehelichen, den Vorzug erhielten, ist bekannt. Die Mecklenburgische Kirchenordnung von 1602 bestimmt das ausdrücklich. Für die Handwerker, wenn sie nicht selbst Meistersöhne waren, schuf die Ehe mit einer Meisterswitwe die Möglichkeit, in den eng geschlossenen Kreis der Zunftmeister aufgenommen zu werden. Es wird für Rostock ausdrücklich bezeugt, daß, während die Meistersöhne freie Wahl hätten, die anderen Bewerber um eine Meisterstelle der Regel nach eine Meisterswitwe oder -Tochter heiraten mußten. Häufig findet sich im Gerberamtbuch von 1600 die Eintragung: N. N. hat auf des N. N. (eines Amtsbruders) Witwe oder Tochter das Amt geeschet. Natürlich kam es auch vor, daß dem Freier einer Witwe, wenn sich ihm die Heirat mit einer Jungfer bot, diese doch verlockender erschien, er abschwenkte und die Witwe schmählich sitzen ließ. So prozessiert 1655 Valentin Kirchbergs Witwe gegen Matthias Papenhagen, der sich mit Peter Ditmers, eines wohlhabenden Essigbrauers, Tochter Vornamens Anna anderweitig verlobt, puncto sponsaliorum. Umgekehrt lag ein Fall, von dem das Gerberamtbuch mit Entrüstung berichtet.


|
Seite 193 |




|
1633 eschet Zacharias Bergeshagen das Amt auf Heinrich Flintes Witwe. Diese hatte sich "zuvor fast mehrenteils verlobt mit einem Gesellen von Rudolstadt in Thüringen mit Namen Erhard Treiber, welcher schon auf ihr seinen Geburts- und Lehrbrief geholet. Danach ist sie aber wieder abfällig geworden und ihn nicht mehr haben wöllen, hat es auch beim Herrn Bürgermeister Nic. Scharffenberg soweit gebracht, daß sie ihn mit einem Stück Geld hat abgekauft. Und weil dasselbige zuvor niemalen in unserm Amt ist gehört worden, hat das Amt es nicht ungestraft lassen vorbeigehen können". Da die Flintesche sich aber der Strafe nicht unterwerfen will, kommt die Sache vor den Bürgermeister und schließlich wird entschieden: "weil sie wider das Amt gesündiget, und ein ehrbar Amt ihrethalben etliche Zusammenkünfte gehabt, solle sie dem Amt zur Strafe geben 8 Reichstaler wegen des vorbenannten Gesellen und wegen der Zusammenkünfte, Mühe und Ungemach zwei Tonnen Bier." Erhard Treiber hat sich dann mit einer Meistertochter getröstet, auf die er 1634 das Amt eschet.
Solche Ehen mit Witwen brachten dann häufig für den Freier einen Berufswechsel oder bestimmten endgültig die Berufswahl. Der spätere Bürgermeister Baltzer Gule, ein Wittstocker, studierte in Frankfurt a. O. und Rostock die Rechte. Als er aber um 1553 Agneta Kaffmeister, die Witwe des Brauers und Kaufmanns Jakob Gretemann, heiratete, hängte er die Rechtswissenschaft an den Nagel und widmete sich der "bürgerlichen Hantierung" seines Ehevorgängers. Er riet später seinem Schwiegersohn Heinrich Luders aus Hamburg, der ebenfalls in Rostock die Rechte studierte, zu gleichem Berufswechsel. Nicolaus Dunker aus Sternberg, später Ratsherr in Rostock († 1614), hatte die Schule in Schwerin besucht, fünf Jahre in Rostock Theologie und Philosophie studiert und war dann als Lehrer an die Schule zu Parchim gegangen. Als dann aber gute Freunde ihn nach Rostock zurückriefen und die Heirat mit Katharina Rüter, der Witwe des Brauers Jochim Dick, vermittelten, ging er von den Wissenschaften zur Brauerei über. Und wenn es im Bürgerbuch 1627 heißt: "Friedrich Quilitz, ein Student (er stammte aus Neubrandenburg), welcher seligen Baltzer Gulen (eines Gewandschneiders) Witwe freiet", oder 1633: "David Brandt, ein Student aus Güstrow, so Jochim Dunkers (eines Brauers) auf der Altstadt Witwe freiet", - so haben sicher auch diese beiden ihr Studium aufgegeben und sind zu den von ihren Vorgängern betriebenen Geschäften übergegangen. Die zahlreichen Ehen alternder Männer gingen, wie erklärlich, zum Teil auf das Bedürfnis derselben nach Pflege und Behaglich-


|
Seite 194 |




|
keit für ihr Alter zurück. Mit großer Offenheit wird das im Leichenprogramm des Advokaten Dr. Caspar Spalkhauer † 1631) ausgesprochen: "Was sollte der Greis tun? Seine Jahre gingen schon zur Neige, und er wurde täglich gebrechlicher; der Kränkliche hatte niemand, der für sein Essen und die übrigen Bedürfnisse sorgte, der den Wankenden gestützt, den Fallenden aufgerichtet hätte, deshalb meinte er, zu diesem letzten Stab seines Alters greifen zu müssen, und betrat tapferen Mutes zum dritten Mal den Ringplatz der Ehe". Und wenn 1396/7 der Bürgermeister Hinrich Katzow der Witwe seines Bruders Johann eine Leibrente von 50 Mark, die dieser ihr in seinem Testament "für ihre Dienste" ausgesetzt hat, zuschreiben läßt, so handelte es sich auch hier um eine solche Altersehe. Eine besondere Form dieser Altersversorgungsehen sind die Heiraten von Männern, die sich im Alter als Pfründner in das Heiligengeist-Hospital zurückzogen, mit Pfründnerinnen. So hat um 1610 PeterKröger, Ältermann des Hakenamtes, "ein alt grau Mann", der seine Frau verloren hat und ohne sie sein Geschäft nicht fortführen kann, eine ziemlich betagte Frau auf des Heiligen Geisthofes Freiheit geheiratet und sich dorthin zu wohnen begeben. Um 1595 hat der Brauer Claus Hermann d. Ä., 72 Jahre alt, der drei Pröven im Heiligen Geist hat und dort wohnt, dort noch einmal geheiratet, eine Anna Rogge, die ihm noch eine Pröve zubringt. Nebenbei: es ist bemerkenswert, daß auch Leute aus den gesellschaftlichen Kreisen des Claus Hermann ins Hospital gingen, denn die Pfründner galten doch in gewissem Sinne als Almosenempfänger. Ein Peter Kröger mußte deshalb seine Ehrenämter - er war nicht nur Ältermann, sondern auch Hundertmann - niederlegen. Von diesen beiden Ehen erfahren wir übrigens nur zufällig durch Prozesse, in denen sie erwähnt werden. Wie manche Altersehen mögen bestanden haben, ohne irgendeine Spur in den vorhandenen Urkunden zu hinterlassen.
Bei der Wahl des Ehegatten spielte die Rücksicht auf den Stand eine ausschlaggebende Rolle. Das ist bei der strengen Gliederung der städtischen Bevölkerung in Klassen oder Stände selbstverständlich. Im Leichenprogramm des Brauers Christoffer Hoyer, der 1618 Agneta, die Tochter des Claus Frese, heiratete, wird ausdrücklich bemerkt, daß, weil in Rostock die Brauer zum ersten Stande gehörten, er seine Gattin aus den ersten Familien wählen durfte. Man blieb in der Regel unter sich. Ja selbst innerhalb der einzelnen Handwerke heiratete man mit Vorliebe, wenn auch keineswegs ausschließlich, untereinander. Auch die in ihrer


|
Seite 195 |




|
Gattenwahl doch nicht beschränkten Meisterssöhne heirateten gern Töchter oder Witwen von Zunftgenossen. Der Gerber Jdel Schulte, der um 1577 ins Amt kam, hatte die Tochter eines Handwerksgenossen, ebenso sein Sohn Zacharias. Von den beiden andern wissen wir nichts Näheres. Von seinen Enkelkindern war die einzige, über die wir in dieser Beziehung etwas wissen, mit einem Gerber verheiratet. Von seinen Urenkelkindern war Zacharias mindestens in zweiter Ehe mit einer Gerbertochter, Anna mit einem Gerber verheiratet, und von des ersteren sieben verheirateten Kindern blieben wieder mindestens fünf innerhalb des Handwerks bei der Gattenwahl. So sind auch die Bruchfischer- und die Schifferfamilien, und unter diesen wieder besonders die um 1600 aus Warnemünde nachRostock übersiedelnden, vielfach untereinander verschwägert.
Aber so viel Gewicht auf das Innehaltender Standesgrenzen gelegt wurde, Heiraten hinüber und herüber kamen doch vor. Und diese Grenzen waren ja auch gar nicht in allen Fällen so starr, nicht nur, weil immer wieder Familien oder einzelne Zweige derselben in einen höheren Stand aufstiegen 4 ), sondern weil bei manchen Berufen die Grenze gar nicht eindeutig festgelegt war. So gehörten von den Gasthaltern die "fürnehmen" und von den Krämern diejenigen, die ein eigenes Haus und auch sonst ein "ziemliches" Vermögen besaßen, zum ersten Stand. Solche Bestimmungen sind doch nicht eindeutig und machen die Grenzen fließend.


|
Seite 196 |




|
Manche Kaufmannstochter verschmähte es nicht, lieber an der Seite eines wohlhabenden Meisters vom Handwerk auf dessen goldenem Boden ein gesichertes Dasein zu suchen, als vielleicht eines wenig vermögenden Kaufmanns unsicheres Geschick zu teilen, und mancher Kaufmann ließ sich eine reiche Handwerkertochter gefallen. Eine der vielen Töchter des Brauers und Kaufmanns Hans Dankwart (s. die vorige Anmerkung) war mit dem reichen Gerberältermann und Kirchenvorsteher Jakob Engelbrecht verheiratet, dessen Tochter heiratete dann wieder einen Kaufmann Christoffer oder Steffen Zander. Wendula Nettelbladt, die sicher der Ratsfamilie dieses Namens angehört und höchst wahrscheinlich eine Tochter des 1624 gestorbenen Brauers Heinrich Nettelbladt ist, von dem auch die freiherrliche Linie abstammt, heiratete nacheinander den Bäckermeister Claus Blüte und den Bortenmacher Marten Brosemann. Ihres Vaters Vermögensumstände scheinen freilich nicht glänzend gewesen zu sein, nach den zahlreichen Anleihen, die er aufnimmt, zu schließen. Und solche Ehen kommen bis in die allerersten Familien hinein vor. Nicht dahin gehört es freilich, wenn um 1562 Anna Krohn, unter deren Ahnen wir mindestens 7 Bürgermeister finden, den Hans Bermann heiratet, der ein Gasthaus am Markt hat (an der Stelle des jetzigen Mannschen Hauses). Denn die vornehmen Gasthalter gehörten ja zum ersten Stand, wie denn auch seine drei Schwiegersöhne im Rat gesessen haben und sein Vorgänger im Besitz des Gasthauses, Herr Gottschalk Hoppenstange, selber Ratmann war. Ebenso gehören die Goldschmiede, denen wir nicht selten als Schwiegersöhnen alter Ratsfamilien begegnen, dem ersten Stande an. Und auch die Barbiere scheinen, wenigstens zum Teil, eine höhere Einschätzung genossen zu haben, wohl weil ihr Beruf die Ausübung der Chirurgie einschloß und deshalb in den des Arztes überging 5 ). Aber etwas anderes und recht Auffallendes ist es, wenn wir 1364 der Tilse, einer Verwandten mütterlicherseits des Johann von Zehna, als Gattin des Schusters Hinrich Kolberg und 1372 als Gattin seines Zunftgenossen Johannes Barold begegnen. Denn dieser Johann von Zehna ist ein Neffe des herzoglichen Gerichtsvogts Wulf von Zehna, und Tilse wird bevormundet von Heinrich von Zehna, dem Vater des Bürgermeisters Vicke von Zehna. Es handelt sich also bei dieser Schustersfrau wirklich um ein Glied jener alten und vornehmen Familie. Auch ein Johann Rugewold, der Tuchscherer, also auch ein Hand-


|
Seite 197 |




|
werker, gehört zu den Erben jenes Johann von Zehna. 1389 werden als nächste Verwandte eines Schusters Nikolaus Pape Bernhard und Heyno Witte, Söhne der Ratsfamilie, bezeichnet, und 1486 begegnet uns ein Ältermann der Schmiede, Claus Goldberg, als Ehemann der Tochter Anneke des Ratmanns Dietrich Slorf. Und das alles sind fraglos nicht etwa Mißheiraten, die zu einem Bruch mit der Familie geführt hätten.
Andererseits verschmähte es auch der Adel nicht, sich mit den Bürgerfamilien zu verschwägern. Und nicht nur solche Adlige taten das, die sich selbst in der Stadt niedergelassen und das Bürgerrecht erworben hatten, wie etwa der Ratmann Vicko Alkun († vor 1368), der Bürger Ulrich von Reden († vor 1566), der Bürgermeister (seit 1574) Christoffer Bützow und der Ratmann (seit 1576) Christoffer Gentschow, vielleicht auch der Ratmann Conrad Unruhe († 1403/6). 1384 begegnet der Knappe Arnd von Gummern als Ehemann der Grete, Tochter des Ratmanns L. Gotland; 1395 der Ritter Matthias Axekow als Ehemann der Geseke, Tochter des Bürgermeisters Engelbert Katzow. Der Hinrich Moltcke, dessen Ehefrau Elisabet von den Bürgermeistern Arnold Kröpelin und Johann von Kyritz beerbt wird, und der Henneke Moltcke, der 1408 Ehemann der Gertrud Unruhe, Witwe des Ratmanns Lambert Kröpelin ist, dürften der Adelsfamilie angehört haben. Von den vier Töchtern des oben erwähnten Ratmannes Johann Grote und der Anna Sossenheimer waren drei an Adligeverheiratet: Margarete mit dem Junker Jürgen Schenk, der aus einer nicht vollbürtigen, aber in Mecklenburg und Hessen als adlig anerkannten Nebenlinie der Schenk zu Schweinsberg stammte, Anna mit dem vorhin genannten Christoffer Gentschow, und die jüngste, Agneta, mit dem Doberaner Amtmann und Offizialisten zu Rostock, Sebastian Barner, Erbherrn auf Schimm. Letzterer war in erster Ehe mit Anna Frese, Tochter des Ratmanns Jaspar Frese, verheiratet, und der Vetter derselben, der wiederholt genannte Claus Frese, Metken Sohn, in erster kinderloser Ehe von 1576-1589 mit der "edlen und tugendsamen" Lucia Pren, wohl einer Tochter des 1578 verstorbenen Jochim Pren auf Gubkow, der auch in Rostock Grundbesitz hatte. Wenigstens läßt ihr ein Achim Pren 1500 Gulden Brautschatz auszahlen, woraus zugleich erhellt, daß es sich keineswegs um ein verarmtes adliges Fräulein handelte. Auch die Ilsabe Weltzin, Schwester des Christoff Weltzin, die um 1582 den Rostocker Bürger Hermann Prenger und danach um 1586 den Brauer Jakob Koch heiratete, war nach ihrer eigenen Aussage "eine Adelsperson". Und obwohl ja Rostock kein eigentliches, wie anderswo in ge-


|
Seite 198 |




|
schlossenen Gesellschaften zusammengefaßtes Patriziat besaß, galten diese Ehen als ebenbürtig. Wenigstens wird der Sohn der Margaret Grote und des Jürgen Schenk, Johann Schenk, 1575 vom hessischen Landgrafen - er studierte damals in Marburg - als Edelknabe an den mecklenburgischen Hof empfohlen, und die Gentschowschen und Barnerschen Kinder gelten zweifellos als adlig. Enkel des Gentschowschen Ehepaares sind z. B. der Junker Hans Christian Rappe auf Beselin und die Klosterjungfrau Margarete Rappe in Dobbertin 6 ).
Den Ehegatten wählten die Rostocker natürlich zumeist unter den Rostockern. Unter den Nachbarn, aus derselben Straße, aus schon sonst verschwägerten Familien, aus der weiteren Blutsfreundschaft suchte man sich den Gatten gern oder wurde er einem ausgesucht. Aber Rostock stand in viel zu lebhaftem Verkehr mit der Außenwelt, das Leben des mittel- und niederdeutschen und des nordischen Gebietes flutete viel zu mächtig durch die alte Hansestadt, als daß dadurch nicht auch den Rostocker Familien immer wieder frisches Blut zugeführt worden wäre. Soweit her freilich wie der von 1550 bis 1557 in Rostock als Professor der Medizin wirkende, aus Antwerpen stammende Arzt Jakob Bording haben wohl kaum andere sich ihre Ehefrau geholt. Seine Gattin Francisca Nigrona war die Tochter eines genuesischen Patriziers, der nach Avignon übergesiedelt war und dort die Johanna de Rochelle geheiratet hatte. Sie wurde die Schwiegermutter des Professors


|
Seite 199 |




|
der Theologie Dr. Lucas Bacmeister, des Pastors an St. Petri Mag. Johann Hollenhagen und des Parchimer Superintendenten Anton Bocatius; ihr Sohn Dr. Jacob Bording war Professor in Rostock, später Bürgermeister von Lübeck. Durch sie kommt, soweit ich sehe, der Vorname Johanna zuerst in Rostock auf. Wenn man nun sonst auch nicht so weit her die Gattin holte, über Rostocks und Mecklenburgs Grenzen ging man doch häufig genug hinaus. Im Kaufmannsstande führten die mannigfachen Beziehungen zu auswärtigen Handelshäusern, der oft lange währende Aufenthalt der jungen Kaufgesellen in der Fremde wieder zu Verschwägerungen mit auswärtigen Familien; oder fremde Kaufgesellen führte ihr Beruf nach Rostock und sie blieben dort und freiten Rostocks Töchter. So sind es vor allem Wismarsche, Lübecker und Stralsunder, besonders auch westfälische Familien, mit denen man sich gern verschwägerte. Unter den Wismarschen Familien, die sich fortwährend mit Rostockschen verschwägerten und so zum Teil fast ebenso in Rostock wie in Wismar ansässig waren, sind besonders die Schmidt (Smedes), Tankes, Schwarzkopfs und Eggebrechts zu nennen. Auch den Rostocker Gewerken strömten immer wieder nicht nur aus mecklenburgischen Städten und Dörfern, sondern auch von weiter her, aus Thüringen, Franken, dem Meißnischen und Braunschweigschen z. B., Handwerksgenossen zu, die dann Rostockerinnen, in erster Linie natürlich Meisters-Witwen und -Töchter, heirateten. Dazu führte die Universität aus allen Gauen junge Männer herbei, von denen so mancher hier durch eine gute Heiratsgelegenheit sich fesseln ließ. Auch mancher jüngere oder ältere, dauernd oder vorübergehend dem Lehrkörper angehörende auswärtige Magister oder Professor heiratete gern in eins der guten alten Rostocker Geschlechter hinein. Trotz aller Neigung, bestehende Beziehungen zu pflegen und den Gatten oder die Gattin aus dem nach Art und Vermögensverhältnissen genau bekannten heimatlichen Kreisen zu wählen, gab es doch eine enge, nach außen sich ängstlich abschließende Heiratspolitik nicht.
Über das Alter der Eheschließenden beim ersten Eheschluß ist, da die Kirchenbücher nur zum kleinsten Teil in unsern Zeitraum hinaufreichen, nur da Genaueres festzustellen, wo Leichenprogramme vorliegen. Nicht einmal die Brautschatz-Zuschreibungen und -Quittungen geben sicheren Anhalt für das Jahr der Eheschließung, da sie sehr häufig erst jahrelang nach der Eheschließung erfolgten. Und noch seltener läßt sich das Geburtsjahr feststellen, wenn nicht zufällig der Betreffende als Zeuge in einem Prozeß begegnet und hier sein Alter - übrigens oft auch noch ungenau


|
Seite 200 |




|
genug - angibt. Sind wir hier somit fast ganz auf Leichenprogramme angewiesen, so gelten auch die nachstehenden Angaben wesentlich für eine bestimmte Gesellschaftsschicht, nämlich für Angehörige des ersten Standes- nur ganz vereinzelte Handwerker sind darunter - und nur für das 16. und 17. Jahrhundert. Es muß auch bemerkt werden, daß es nicht in allen Fällen feststeht, ob die bei den einzelnen Jahren angeführten Personen das betreffende Lebensjahr schon vollendet hatten, da sehr häufig wohl das Jahr, aber nicht der Tag der Geburt und der Eheschließung bekannt ist. Auch sind die Angaben über das Alter in jener Zeit nicht immer ganz zuverlässig. Von 105 Männern heirateten: 1 mit 20 Jahren; 6 mit 21; 6 mit 22; 10 mit 23; 5 mit 24; 6 mit 25; 8 mit 26; 8 mit 27; 7 mit 28; 4 mit 29; 9 mit 30; 9 mit 31; 4 mit 32; 2 mit 33; 4 mit 34; 6 mit 35; 5 mit 36; 1 mit 37; 1 mit 43; 1 mit 44; 1 mit 49 und 1 mit 53. Die Schwankungen im einzelnen sind natürlich zufällig, überhaupt ist die Zahl zu gering, um ein genaues Bild geben zu können. Soviel aber wird man vielleicht sagen können, daß bei den Männern, wie übrigens erklärlich, das eigentliche Heiratsalter mit dem 21, Lebensjahr, dem Jahr des Mündigwerdens, einsetzt, und daß von da ab die Häufigkeit des Eheschlusses für die einzelnen Lebensjahre bis etwa zum 31. ziemlich gleich bleibt und noch bis zum 36. nur geringe Abnahme zeigt. Noch spätere Ehen sind dann wohl mehr vereinzelte Fälle. Gegenüber heutigen Gepflogenheiten in den gleichen Gesellschaftskreisen ist also entschieden ein häufigeres Heiraten in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre festzustellen. Doch aber sind auch Ehen von Männern, die das 30. Lebensjahr überschritten haben, sehr häufig. Lange, bis tief in die Mannesjahre hinein, lebte oft der Kaufmann im Ausland - so die Rostocker besonders auch in Bergen -, um des Geschäftes willen und um den fremden Markt und allen Handelsbrauch gründlich kennen zu lernen, ehe er sich dauernd niederließ. Auch mancher Schiffer blieb bei seinem unruhigen Gewerbe lange unbeweibt, bis er schließlich, wenn er endlich einen Hausstand gründete, wohl auch zu einem seßhafteren Berufe überging, etwa wie der spätere Ratsherr Titke Maß, der 1626 mit fast 37 Jahren freite und dann Brauer wurde. Und die Studierten führten oft an den verschiedensten Universitäten und als Erzieher und Hofmeister ein jahrzehntelanges Wander- und Reiseleben, ehe sich ihnen eine Stellung bot, in der sie eine Familie ernähren konnten. Der Kaufmann Heinrich Pil heiratete 1621 mit 37 Jahren, sein Berufsgenosse Caspar Schwarzkopf 1616 gar erst mit 43. Peter Eggebrecht war 44 Jahr,


|
Seite 201 |




|
als er als Pastor von Biestow heiraten konnte. Arnold Burenius, der berühmte Gelehrte, Schulmann und Universitätslehrer, zählte schon 53, als er sich 1538 ein Weib nahm, und sein Kollege, der Mathematiker Conrad Pegel, war bei seinem Eheschluß auch schon 49 Jahre alt. Der jüngste Ehemann, der mir begegnet ist, ist der Brauer Markus Lembke, der 1620 mit 20 Jahren heiratete; und mit 21 und 22 Jahren heirateten unter andern Söhne der vornehmen Familien Guhl, Grote, Beselin, Hane, Lembke, junge Brauer, Kaufleute und Gewandschneider.
Was das Heiratsalter beim weiblichen Geschlecht betrifft, so heirateten von 114 Frauen: 1 mit 14 Jahren; 2 mit 15; 4 mit 16; 7 mit 17; 11 mit 18; 7 mit 19; 12 mit 20; 17 mit 21; 8 mit 22; 11 mit 23; 11 mit 24; 7 mit 25; 6 mit 26; 1 mit 27; 3 mit 28; 1 mit 29; 1 mit 30; 2 mit 32; 1 mit 39; 1 mit 40 Jahren. Das sich so für das weibliche Geschlecht ergebende Bild unterscheidet sich nicht nur darin von dem für das männliche, daß das gewöhnliche Heiratsalter um etwa 5 Jahre früher einsetzt und um mehr als 6 Jahre früher endet, sondern auch darin, daß es deutlich ein allmähliches Ansteigen und dann wieder Herabsinken der Häufigkeit des Eheschlusses für die einzelnen Lebensjahre zeigt, wobei der Höhepunkt um das 21. Jahr liegt. Heutzutage dürfte der Höhepunkt entschieden später liegen. Mit 14 Jahren "in der ersten Jugendblüte" heiratete Anna Kellermann 1524 den späteren Bürgermeister Bertold Kerkhof; und Katharina Papke war erst 15 Jahre alt, als sie dem Mediziner Heinrich Pauli vermählt wurde. Auch Ilsabe von Hervorden, die 1604, "sobald sie angefangen hatte, ehefähig zu sein", den Heinrich Steding heiratete, wird kaum mehr als 15 Jahre alt gewesen sein. Ebenso kann Margarete Dunker, die Braut des oben genannten 43jährigen Kaufmanns Caspar Schwarzkopf, bei ihrer Heirat höchstens eben das 16. Jahr vollendet haben. Alle vier sind Töchter von Ratsfamilien. Andererseits ist Margarete Hake 29 Jahre alt, als sie dem Dr. iur. Johann Domann, Anna Sandhagen 30, als sie dem Professor der Theologie Georg Bindriem, und Agneta Grote und Elisabet Lüschow 32, als sie 1581 dem Amtmann Sebastian Barner und 1668 dem Pastor Roloff an St. Petri die Hand reichen. Ja, Gertrud Laurenberg, die Tochter des Professors, hat erst mit 39 Jahren geheiratet, und Katharina Dunker, eine Tochter des Pastors an St. Petri, gar erst mit 40 Jahren den Pastor Kraft in Jesendorf. Jedenfalls, wenn Luther bekanntlich für den jungen Mann 20 und für das junge Mädchen 16 Jahre als das passende


|
Seite 202 |




|
Alter zur Verehelichung ansieht - allgemeine Regel war das so wenig, daß vielmehr die weitaus meisten beim Eheschluß erheblich älter waren.
Daß die Frauen älter waren als die Männer, kam natürlich häufig vor, da, wie wir gesehen, aus praktischen Gründen zunächst eine Witwe geheiratet wurde. Wenn der ungefähr 1523 geborene Brauer Claus Harmens in erster Ehe Anna Kegeben, die Witwe eines Claus Dunker, mit dem sie schon 1530 verheiratet war, freite, so war er jedenfalls beträchtlich jünger als sie. Agneta Kaffmeister war mindestens 1532 schon mit Jakob Gretemann verheiratet; ihr zweiter Mann, der spätere Bürgermeister Baltzer Guhl, ist eigener Angabe zufolge um 1530 geboren. Des bei seiner ersten Eheschließung 27jährigen späteren Ratsherrn Nikolaus Dunker erste Frau, Katharina Rüter, war 10 Jahre lang Witwe gewesen, und da sie aus erster Ehe mehrere Kinder hatte, auch mehrere Jahre verheiratet gewesen, also jedenfalls auch älter als er. Wendula Nettelbladt, die Witwe des Ratsherrn Jochim Wedege, die 37jährig 1613 den Michel Siebrand heiratet, war gewiß beträchtlich älter als dieser "junge Mann aus dem ersten Stande". Wendula Kleinschmidt, Witwe des Daniel Elvers, heiratet 1687 den Dr. iur. Johann Joachim Beselin, sie ist 32, er 26 Jahre alt. Und das sind sicher nur einzelne Beispiele eines häufigen Vorkommens. War die erste Frau so oft erheblich älter, so war die zweite dann zuweilen unverhältnismäßig viel jünger. Heinrich Sültemann, Ratsherr 1599, † 1611, heiratete um 1584 Anna Frese, die Witwe des Kaufmanns Peter Pentzin, mit dem sie schon 1546 verheiratet ist, die also bei ihrem zweiten Eheschluß beträchtlich über 50 Jahre alt war; nach deren wohl 1604 erfolgten Tode führte er dann die damals kaum 20jährige Bürgermeistertochter Agneta Tanke heim. Die zweite Frau des Senators Adam Borchart († 1646), Katharine Dunker, eine Enkelin des Pastors an St. Petri, war 19 Jahre alt, als ihr altersschwacher Mann sie zwei Jahre vor seinem Tode heiratete.
Vielleicht war es jene zweite Ehe der Anna Frese, die die spöttische Bemerkung des Lizentiaten Joachimus Reimers in einem Brief vom 4. Nov. 1584 aus Wittenberg an seinen Schwager Bernd Türkow in Rostock veranlaßte: daß er durch seinen alten Stubengesellen Ewald Brummer erfahren, "wie bei Euch die alten reichen Frauen in so großen Ehren gehalten werden, daß sie auch junge Gesellen freien, welches zwar einen nicht geringe wundern mag, aber was tut Geldgeiz nicht! Gott gebe aber, daß es wohl mit ihnen sämtlich und ihrem Ehe


|
Seite 203 |




|
Stande geraten möge, aber die Zeit wird es geben." Also die Unnatur solcher Bündnisse empfand man doch. Er selbst wurde freilich durch die Sorge bedrückt, sein eigener alter, schon zweimal verwitweter Vater werde noch einmal heiraten. Sein Stubengeselle hat aus Rostock die Nachricht erhalten, es sei dort "eine gemeine Sage", daß der alte Herr die älteste Pegels Tochter freien werde. Und noch 27. 4. 1586 schreibt Reimers aus Heidelberg an seinen Schwager: "Ich gedenke ja nicht, daß er des Pegels Tochter gefreiet habe oder werde, das wäre uns beiden sonsten übel gelegen! Ich weiß, daß Sie damit umgegangen sind, . . . Ist er ein alter Mann und will noch, da er auf seine Grube mit der Zeit gehet, nun ein jung Weib nehmen! Ich hoffe, Gott der Herr wird hindern und dem Pegels-Gesindichen, die uns nach dem Unsern gar listig stehen, es nicht lassen gut sein. Zwar unsern Vater meinen Sie nicht, besondern sein und unser Gütlein, wie das ein jeglicher, der nur einen Sinn hat, wohl verstehen wird können." Die Gefahr ging übrigens wirklich vorüber.
Mit grausamer Strenge wurde in gewissen Kreisen darauf gesehen, daß das junge Paar in vollen Ehren zusammenkam. Ein Fehltritt verschloß dem jungen Handwerker für immer die Aufnahme in die Zunft. Um 1585 hatte sich der Gerbergesell Peter Daber mit des Gerberältermanns Hans Murlemey Tochter vergessen. Trotzdem der Rat für ihn eintrat, konnte er nur so viel erreichen, daß er als Meister ohne Gesellen arbeiten durfte; in die Amtsgilde und andere Zunft-Zusammenkünfte durfte er nicht kommen. Um dieselbe Zeit wurde Jakob Bunsendorf, der mit seiner Frau vor der Ehe ein Kind gehabt, zwar in die Gilde der reitenden und gehenden Diener des Rats aufgenommen - hier war man also nicht ganz so streng -, aber seine Frau durfte bei den Zusammenkünften in ihrem Schütting nicht erscheinen. Und als dann ein Sohn des Paares, Paul Bunsendorf, die Aufnahme in das Gerberamt begehrte, wurde ihm das freilich auch aus andern Gründen, aber doch auch um des Fehltritts der Eltern willen verweigert. Die Zunftanwärter mußten nachweisen, daß sie nicht nur selbst ehelich und ehrlich, sondern auch von unberüchtigten und ehrlichen Eltern geboren seien. Es ist also nicht nur die unmaßgebliche Ansicht eines einzelnen Fanatikers, sondern die herrschende Anschauung dieser Kreise, die sehr fühlbare Wirkungen hatte, wenn in der Bunsendorfschen Sache 1607 der Hufschmiedeältermann Claus Behrens erklärt: wenn ein Mädchen Ehre und Rosenkränzlein (also damals noch nicht die bräutliche Myrthe!) verscherzet, so könne sie ihre Ehre nicht wiedergewinnen, und


|
Seite 204 |




|
wenn sie mit ihrem Manne hernach in der Ehe auch 10 oder 20 Kinder hätte; sie bleibe eine Hure. Paul Bunsendorf hat seine Sache bis vor das Reichskammergericht gebracht und, wie es scheint, doch mit Erfolg. Denn das Gerberamtbuch notiert zwischen 1611 und 1613, daß er das Amt geeschet habe. Auffallenderweise aber bringt es seinen Namen nicht in der Liste der Amtsbrüder auf dem ersten Blatt, in der sonst alle Neuaufgenommenen bis 1629 nachgetragen sind. Ob er doch nicht als vollberechtigter Amtsbruder anerkannt wurde? Wenn übrigens der 1613 als Amtsmeister aufgenommene Hans Daber ein Sohn des oben genannten Peter ist, so wäre auch das ein Beweis, daß jene rigorose Anschauung sich doch nicht durchsetzte. So wenig, wie 1535 die Straßburger Kannengießergesellen mit ihrer Ansicht durchdrangen, daß die uneheliche Geburt des Vaters des Aspiranten die Aufnahme unter die Gesellen unmöglich mache. Andere Kreise haben wohl sicher weniger streng gedacht in diesem Punkt. Von dem in Frankfurt a. M. nachweisbaren Brauch, daß außereheliche Kinder des Hausherrn mit fast gleicher Stellung neben den legitimen im Hause aufwuchsen, habe ich allerdings in Rostock keine Spur gefunden 7 ).
Daß die Ehen jener Zeit sehr viel kinderreicher waren als die modernen, ist bekannt. Freilich, überblicken wir die Stammbäume Rostocker Familien, soweit für ihre Feststellung weder Leichenprogramme noch Kirchenbücher in dieser Beziehung herangezogen werden konnten, so hat man diesen Eindruck zunächst nicht. In der älteren Familie Frese (etwa 1284-1600) z. B. kommen auf jedes verheiratete Mitglied 3 Kinder; bei den Grentzes (etwa 1316-1445): 2 6/7; bei den Kerkhofs (etwa 1382-1600): 4 2/13; bei den Kröpelins (etwa 1308-1500): 2 3/4; bei den Kruses (etwa 1325-1415): 2 2/9; bei den Makes (etwa 1375-1675): 3 1/5; bei den Türkows (etwa 1378-1610): 3 6/11; bei den Wulfs (etwa 1372-1510): 3 4/7; und, um diesen Ratsgeschlechtern noch eine Schiffer- und eine Handwerkerfamilie hinzuzufügen: bei den Eggebrechts (etwa 1566 bis etwa 1700): 3 3/4; bei den Engelbrechts,


|
Seite 205 |




|
soweit sie hier in Betracht kommen (etwa 1535-1670): 2 1/3. Aber der Eindruck ist falsch, nicht nur weil hier doch hie und da einmal auch sonst ein Sproß zufällig in den Urkunden nicht vorkommt - das wird nicht sehr häufig der Fall sein -, sondern weil hier zumeist alle im frühsten Kindesalter verstorbenen und auch manche ältere, aber vor den Eltern verstorbenen fehlen. Das Bild wird denn auch ganz anders, wenn man nur Ehen in Betracht zieht, deren gesamte Kinderzahl wir aus Leichenprogrammen oder Kirchenbüchern kennen. Da ergibt sich, daß 378 Männer - zum Teil aus mehreren Ehen - im Durchschnitt 7 Kinder hatten, wobei noch zu beachten ist, daß eine ganze Anzahl dieser Männer so früh starb, daß bei längerem Leben die Zahl der Kinder vermutlich beträchtlich höher geworden wäre. Bei 472 Frauen ergibt sich ein Durchschnitt von 5,75 Kindern, oder, wenn wir die Frauen, deren Ehen nur kurze Zeit währten, abrechnen, bei 419 Frauen ein Durchschnitt von 6,45 Kindern. Damit würde keine Statistik moderner Ehen den Vergleich auch nur entfernt aushalten. Daß der Durchschnitt bei den Männern etwas höher ist, hat seinen Grund darin, daß diese, verwitwet, doch noch regelmäßiger wieder heiraten als die Frauen. Daß Frauen 9, 10 und mehr Kinder hatten, war keine Seltenheit. Wenn freilich von Katharina Lange, Ehefrau des Brauers Heinrich Nettelbladt († 1624), als einzige Erinnerung in ihrer Familie die Nachricht fortlebte, daß sie Mutter von 14 Kindern gewesen sei, so galt dies doch als eine außergewöhnliche Leistung. Mir ist denn auch nur eine Rostockerin bekannt geworden, die es weiter gebracht hat: Ilsabe Voß, die Gattin des schon genannten Kaufmanns Johann Dankwardt († 1651), die ihm 18 Kinder gebar. Sie erreichte damit zwar nicht die Leistung der Eltern des oben erwähnten Bürgermeisters Christoph Bützow, die 22 Kinder miteinander hatten, aber doch die eines Bremers Johannes Wilmanns († 1720) und seiner Gattin. Es hätte also auch von ihrem Manne gerühmt werden können, was eine Gedächtnisrede in der Rostocker Universitätsbibliothek von jenem rühmt, daß, wenn auch von vielen Eheleuten etliche durch Gottes Segen noch mehr Ehepflanzen erhalten hätten, gleichwohl die Zahl mit einer Ehefrau erzielter 18 Kinder seltsam bleibe; wodurch er erweislich gemacht, daß nicht die Gelehrten allein, sondern auch ungelehrte und ehrliche Bürger zuweilen einen reichen Ehesegen dem Stifter des Ehestandes zu verdanken haben. Von diesen 18 sind bei dem Tode des Vaters übrigens schon sechs in jugendlichem Alter verstorben, wie denn überhaupt, soweit ich sehe, nur selten alle Kinder groß werden,


|
Seite 206 |




|
oft die meisten wieder jung versterben. So wurde die Fruchtbarkeit der Ehen durch die große Kindersterblichkeit, die natürlich auf der mangelhaften Entwicklung der ärztlichen Kunst und der Hygiene beruhte, in ihrer Wirkung wieder aufgehoben, wie das ja die oben mitgeteilten Angaben über die Kinderzahl in einzelnen Rostocker Familien beweisen. -
Was im Vorstehenden über die Ehen unserer Altvorderen zusammengestellt ist, wird den Eindruck erwecken, daß es dabei im allgemeinen sehr nüchtern und geschäftsmäßig zuging, und dieser Eindruck wird richtig sein. Das Herz wurde wohl nicht allzu oft befragt. Es ist bezeichnend, was der alte Stralsunder Bürgermeister Bartholomäus Sastrow, der 1538-41 in Rostock studiert hat, in seinen Lebenserinnerungen erzählt. Sein Bruder hatte sich in Eßlingen vorbehaltlich der elterlichen Zustimmung mit einer Bürgerstochter verlobt, die auch nach seiner, des Bartholomäus, Meinung sehr liebenswert ist und aus angemessenen Verhältnissen stammt. Aber die Eltern versagen die Einwilligung, und von Stund an hat er seinen Bruder nicht mehr froh gesehen. Hier lag offenbar eine tiefe Herzensneigung vor, aber sie führte nicht zum Ziel. Was dagegen Sastrow über seine eigene Verlobung und junge Ehe erzählt, klingt so frostig nüchtern und zeigt so gar keinen wärmeren Ton, daß es sich hier um eine Neigung kaum gehandelt haben kann. Im allgemeinen war es selten der Trieb des Herzens, der die Ehegatten zusammenführte, sondern sehr praktische Erwägungen, der Rat und Wille der Eltern oder guter Freunde. So hätte der Essigbrauer Peter Detmer d. Jüngere († 1638) gern noch sein Studium, namentlich auf medizinischem Gebiet, fortgesetzt, aber auf Wunsch der Eltern schreitet er zur Ehe, oder der erwähnte Nicolaus Dunker wird von guten Freunden nach Rostock zurückgerufen, um dort seine Brauerswitwe zu heiraten. Als der oben erwähnte Bernd Türkow die Freite zwischen seinem Schwager, dem jungen Kaufmann Hans Reimers, und seiner Schwestertochter Agneta Techentin betreibt, nimmt er erst die Vermittlung einer anderen Schwester, der Pfeilschen, in Anspruch, um dann die Sache bei der Mutter der Agneta selbst zu betreiben. Ihre Bedenken, daß die Tochter noch zu jung sei, werden mit der Vorstellung aus dem Felde geschlagen, daß Hans Reimers Vater eine Heirat seines Sohnes wolle, und daß er guten Vermögens sei, d. h. also, daß sonst eben eine andere die gute Partie machen werde. Der Eltern Wille, der Verwandten Rat und die Rücksicht auf die Vermögenslage geben den Ausschlag, Davon, ob bei dem jungen Ding eine Neigung


|
Seite 207 |




|
für den Bewerber bestand, hören wir nichts, und sie ist auch wohl nicht danach gefragt worden.
Und wie gestaltete sich nun das Zusammenleben in solchen Ehen? Darüber sagen uns die vorhandenen Nachrichten leider wenig. Sie beziehen sich meist auf Regelung der Vermögensverhältnisse. Wieviel stilles Glück oder Glücklosigkeit, wieviel Schuld und Versäumnis, oder wieviel Hingebung und treue Pflichterfüllung gegeneinander die Ehen, von denen wir da hören, umschließen, davon verraten diese trockenen Notizen nichts. Daß es auch in jenen Zeiten mit der ehelichen Treue und überhaupt mit dem Verhalten der Eheleute nicht immer stand, wie es sollte, weiß man, ja man erfährt zuweilen Erschreckendes darüber. An Betrübendem hat es da auch in Rostock nicht gefehlt. 1606 sollte der Brauer Heinrich Detloff, der sich mit seiner eigenen jungen Hausfrau, der Lübeckerin Katharina von Münster, nicht begnügt, sondern seinen Gang zu anderer guter Leute Kinder genommen und seine eigene Hausfrau in einem Warmbier zu vergiften versucht hatte, mit dem Schwert gerichtet werden; aber eben seine junge Hausfrau selbst und die Verwandtschaft bat für ihn und erreichte, daß er zu Stadtverweis begnadigt wurde. Er zog nach Ribnitz und seine Frau zog dorthin zu ihm. Das kann doch nur die Tat einer Liebe von großartiger Kraft des Verzeihens und des Vertrauens gewesen sein. 1606 müssen auch Henricus Knuppert - er war mit einer Schwester des aus Rostock stammenden Professors der Rechte Christian Ohm in Königsberg verheiratet - und Dorothea Nettelbladt, wohl eine Base seiner Frau, öffentlich Kirchenbuße tun, weil sie in Unzucht und Ehebruch miteinander gelebt. Und wenn der für den Rat vorgeschlagene Albertus Tunder 1582 mit der Begründung zurückgewiesen wird, daß er zwar sonst fromm und geschickt genug sei, aber kein Regiment über seine Frau habe, so besagt dieser Ausdruck doch wohl Ernsteres, als daß sie die Hosen anhatte. 1613 schwebt ein Reichskammergerichts-Prozeß zwischen Thomas Dobbin und seiner Ehefrau Margarete Dase. Beide sind Kinder von Ratsfamilien, sie klagt wegen Nichtgewährung des Unterhalts, er wegen böswilliger Verlassung. Die Ehe war von vornherein sehr unglücklich. Schon in der Brautzeit hatte sein launenhaftes und oft rücksichtslos verletzendes Verhalten es soweit gebracht, daß seine Verwandten nur mit Mühe einen Bruch verhinderten: Wenn sie erst unter eine Decke kämen, werde es besser werden. Aber es wurde nicht besser. Man hat fast den Eindruck krankhafter Reizbarkeit und Eifersucht bei dem jungen Ehemann, über die rohsten Mißhandlungen selbst im Wochenbett wird geklagt.


|
Seite 208 |




|
Einmal ist das Paar zu einer Geselligkeit geladen und der Gastgeber will die junge Frau, die guter Hoffnung ist, in seinem Schlitten abholen. Aber der Ehemann zwingt sie, in seinen Schlitten zu steigen, und jagt mit der Geängsteten in toller Fahrt wiederholt um den Hopfenmarkt und den Kaak auf dem Markt, bis er schließlich den Schlitten umwirft. Ein andermal höhnt er die aus dem Fenster Schauende, sie sähe wohl nach ihrem Galan aus; und als sie nach seiner Angabe ihm mit einer unglaublich rohen Gebärde antwortet, nach ihrer aber schweigend an die Wiege ihres Kindes tritt, schleudert er ihr das Buch, in dem er gerade liest - und es wird nicht versäumt, zu bemerken, daß es ein kalvinistisches, also ketzerisches war -, in den Nacken, übrigens erfahren wir aus diesem Prozeß zugleich von einem anderen Ehepaar der Gesellschaft, bei dem auch die Frau ihrem Manne, Christoffer Klevenow, wegen Mißhandlung entlaufen ist. Sehr unglücklich war auch die zweite Ehe der Tilsche Engelbrecht († 1594), Witwe des Kleinschmieds Brand Falkenberg, mit dessen Zunftgenossen Hermann Dreier. Er mißhandelte sie und schlug noch die alte Frau so jämmerlich, daß sie zu ihrer Tochter flüchtete und der Pastor in ihrer Leichenrede erklärte, ihr Mann habe sie zu Tode mißhandelt. Und daß solche Roheiten damals doch häufiger waren, als zu unserer Zeit, darf von vornherein angenommen werden. Derber und gewalttätiger war das damalige Geschlecht ohne Zweifel. Auch daß junge Frauen, wie wir das etwa von Ottilie Möller († 1577), der ersten Frau des Ratssekretärs Joachim Wendt, hören, sich häufiger für längere Zeit in das elterliche Haus flüchteten, mag damals öfter vorgekommen sein als heutzutage, auch ohne daß, wie es freilich dem Herrn Ratssekretär vorgeworfen wird, schlechte Behandlung von Seiten des Mannes vorlag. Denn bei der nüchternen Art der Eheschließung mußten die jungen Frauen sich doch zunächst immer wieder nach der Wärme des Mutterhauses zurückgezogen fühlen, ehe das Leben sie mit dem Ehegatten auch innerlich zusammenwachsen ließ.
Von einer vornehmen Rostockerin, die mit dem Manne, dem man sie verheiratete, innerlich nichts verband, die dann ihr heißes Blut und ihr leichter Sinn auf schlimme Abwege brachte, bis sie schließlich in einem Dirnen- und Abenteuerleben zugrunde ging, berichtete die Rostocker chronique skandaleuse des 17. Jahrhunderts. Margarete Meyer, die Tochter eines sehr reichen Lakenhändlers, Schwester eines Rittmeisters Meyer, ist von ihrem Vater gezwungen, den an Alter und Sitten ihr sehr ungleichen Dr. Marquard Gerdes zu heiraten. Der Vater meinte, damit eine Dank-


|
Seite 209 |




|
barkeitspflicht gegen dessen Vater erfüllen zu müssen. Die junge Frau redet bald schimpflich und verächtlich über ihren Mann, hält es mit verschiedenen Kurtisans und muß schließlich, da der Skandal zu groß wird, fliehen. In Lübeck lernt sie einen Hauptmann von Schock kennen, der sich in sie verliebt und sie auf ein Landgut bei Hamburg bringt. Dort hat er bisher mit seiner Frau zusammen gelebt, die er durch Entführung ihrer Mutter, einer reichen Hamburgerin, abgetrotzt hatte. Nun, wo er ihr in frivoler Rücksichtslosigkeit seine Mätresse ins Haus bringt, flieht sie zu ihrer Mutter zurück. Das Paar lebt dann in Mölln, wo ihm ein Sohn geboren wird, und in Ratzeburg. Ihren Unterhalt bestreiten sie von dem, was sie von ihrer Mutter, die in zweiter Ehe den Ratsherrn Dr. Buck geheiratet hatte, dadurch erpressen, daß sie deren Sohn an sich zu locken verstanden haben und ihn als Geißel mit sich herumführen. Als er aber entflieht, hört diese Quelle auf zu fließen, und nun verläßt der Hauptmann die Unglückliche, nachdem er sie mißhandelt und beraubt hat. Sie wandert in erbettelten Bauernkleidern nach Lübeck und wendet sich von dort an die Mutter. Von den Angehörigen in einem "Zuchthause" in Riga untergebracht, entweicht sie, um schließlich in Hamburg an der französischen Krankheit zugrunde zu gehen. Die Sterbende wendet sich an einen Rostocker, den Oberküster von St. Michaelis, Georgius Maß, und er vermittelt ihr ein ehrliches Begräbnis in dieser Kirche, so erzählt uns der Ratsherr Matthias Priestaff in seinem Tagebuch zum Jahre 1680.
Das sind einzelne Spure; eine Durchforschung namentlich der Gerichtsakten in dieser Richtung würde zweifellos noch manches Traurige ans Licht ziehen. Schon eine flüchtige Durchsicht der Verzeichnisse ergibt die Häufigkeit der wegen Mißhandlungen und böswilliger Verlassung geführten Prozesse. Wie sollte das auch anders sein, die Menschen waren damals nicht anders wie heute. Aber wie war das Verhältnis in den äußerlich korrekten Ehen? Darüber verraten uns die Akten wenig. Daß häufig die Gattin in den Urkunden von ihrem Ehegatten als seine freundliche, liebe Hausfrau bezeichnet wird, besagt nicht viel, das ist eine stehende Floskel. Die Leichenprogramme rühmen oft die Zärtlichkeit, die Wärme und den Frieden des ehelichen Verhältnisses und schildern mit starken Ausdrücken den Schmerz des Überlebenden, aber bei ihrer grundsätzlichen Neigung, in den höchsten Tönen zu loben, darf man auch da nicht alles für vollwichtige Münze nehmen, und etwaige Unstimmigkeiten würden natürlich mit Schweigen übergangen. An anderen Quellen fehlt es. Wenn von der erwähnten


|
Seite 210 |




|
Anna Beselin eine Äußerung, die sie über ihren zweiten Mann, den Bürgermeister Jakob Lembke, im Hause ihrer Schwester, der Hermannschen, getan hat, aufbehalten ist: "Lembke schweige nur stille, er ist aus meinen Gütern um mehr denn 10000 Gulden gebessert", so klingt das ja nicht gerade sehr freundlich, gibt aber doch als Gelegenheitsäußerung kein Recht, auf eine ungenügende Temperatur dieser Ehe zu schließen. Ganz hübsch ist es ja, daß man bei dieser Gelegenheit erfährt, daß der Brauch, daß Frauen ihre Männer, wenn sie von ihnen, und dann doch wohl auch, wenn sie zu ihnen sprachen, mit ihrem Familiennamen bezeichneten (ein Brauch, den ich in meiner Kindheit mit Verwunderung bei älteren Damen zuweilen bemerkte), schon damals bestand. Über das innere Verhältnis der Ehegatten zueinander erfahren wir also kaum etwas. Aber meiner Meinung nach wäre es grundfalsch, aus der uns reichlich nüchtern und geschäftsmäßig anmutenden Art, wie die meisten dieser Ehen zustande kamen, zu schließen, daß es diesen Verhältnissen im allgemeinen an Wärme und Hingabe gefehlt habe. Man darf diese Ehen keinesfalls mit jeder modernen Geldheirat, bei der die eigene Persönlichkeit bewußt und mit oft zynischer Unterdrückung besseren Empfindens verkauft wird, auf eine Stufe stellen. Man muß auch beachten, daß die ganze Zeit viel weniger individualistisch gestimmt war, und ihr das Recht und die Bedeutung der Persönlichkeit noch nicht, oder nicht bewußt aufgegangen war. Man braucht sich auch nur zu erinnern, daß es auch heute noch Volksschichten gibt, in denen ebenso ganz selbstverständlich praktische Erwängungen ausschlaggebend sind. Wer sie kennt, weiß - trotz allem Häßlichen, das auch da in Erscheinung tritt -, wieviel ganz selbstverständliches, schlichtes, treues Zueinanderstehen, ja wieviel gemütvolle Herzlichkeit sich oft auch in diesen Ehen aus dem gemeinsamen Erleben und Arbeiten, vor allem aus dem streben und sorgen für die gemeinsamen Kinder entwickelt. Es wird bei den Ehen unserer Altvorderen nicht anders gewesen sein.


|
[ Seite 211 ] |




|



|


|
|
:
|
VI.
Mecklenburgs Verhältnis
zu Kaiser und
Reich vom Ende des
Siebenjährigen
Krieges bis zum Aus=
gang des alten
Reiches (1763 bis 1806).
Von
Vikar Dr. Niklot Beste=Benthen.
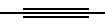


|
[ Seite 212 ] |




|
Inhalt.
| 1. Kapitel: | Mecklenburgs Beziehungen zu Kaiser und Reich bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges | 213 |
| 2. Kapitel: | Der Regierungsantritt Josephs II. und seine Wirkung auf Mecklenburg | 218 |
| 3. Kapitel: | Mecklenburgs Bemühungen um Erweiterung der Territorialrechte | 229 |
| 4. Kapitel: | Mecklenburg und der Fürstenbund | 262 |
| 5. Kapitel: | Mecklenburgs Verhältnis zum Reich unter der Regierung Kaiser Leopolds II. | 278 |
| 6. Kapitel: | Mecklenburg im Reichskriege gegen Frankreich (1792-1797) | 288 |
| 7. Kapitel: | Mecklenburgs Teilnahme am Schicksal des Reiches vom Frieden zu Campoformio bis zum Reichsdeputationshauptschluß | 295 |
| 8. Kapitel: | Mecklenburg und der Ausgang des Deutschen Reiches | 304 |
| Anhang | 312 | |


|
Seite 213 |




|
Die Beziehungen Mecklenburgs zu Kaiser und Reich bis zum Ende des Siebenjährigen Krieges.
"So eigentümlich großartig. So echt deutsch war die Idee der Reichskonföderation, daß sie entstellt und erstarrt, wie sie im sechzehnten, siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert erschien, dennoch nicht ohne mächtige Einwirkung auf das Leben blieb" 1 ). Immer noch wurden im 18. Jahrhundert deutsche Könige und römische Kaiser gewählt und gekrönt, ein Reichstag war in Regensburg versammelt, Reichsgerichte handhabten in Wien und Wetzlar das Recht, und ein Reichsheer sollte Deutschlands Kraft nach außen offenbaren. "Das Reich war seit Jahrhunderten Konföderation der deutschen Territorien, aber diese Konföderation wurzelte in einer tausendjährigen Geschichte, wurde getragen von dem Einheitsbewußtsein der Nation und gefördert von dem Ergänzungsbedürfnis der Territorien" 2 ). Die Reichsstände beriefen sich auf eine Reichsverfassung, welche die Unauflöslichkeit des Reiches voraussetzte, der deutsche König und der Reichshofrat deuteten auf das Dasein eines alle Deutschen umfassenden Staates hin. Aber es spielte sich jetzt eine Entwicklung ab, die einerseits bestimmt war von dem Willen des Reichsoberhauptes, seine Stellung zu der alten Höhe zu bringen und neu zu festigen, und andererseits durch die Haltung der Territorien, die das Reich nur als Mittel betrachteten, ihre eigenen Wünsche und Vorteile zu erreichen.
Mecklenburg bedurfte mehr als mancher andere deutsche Staat der Ergänzung durch das Reich. Das hatte seinen Grund vor allem in dem Kampf, den der Landesherr um seine Herrschaft zu führen hatte; bald suchten die Stände, bald der Herzog Recht beim Kaiser und Reichshofrat, jene wollten gegen "Bedrückung" geschützt sein, dieser wollte seine Regierung möglichst unabhängig führen und braute dazu die Hilfe von Kaiser und Reich. Außerdem war Mecklenburg durch die Nachbarschaft der Machtbereiche außer deutscher Staaten (Dänemark in Holstein, Schweden in Vor-


|
Seite 214 |




|
pommern) und die Abtretung eines Gebietsteils (Wismar mit Poel und Neukloster 1648 an Schweden) dazu gezwungen, seinen Halt fest an Kaiser und Reich zu suchen, von dessen Vermittlung immer wieder die vollständige Wiederherstellung des Besitzstandes gehofft wurde.
Seit der Thronentsetzung der Herzöge und der Regierung Wallensteins während des Dreißigjährigen Krieges hatte die kaiserliche Autorität besonders große Bedeutung für Mecklenburg gehabt. Immer wieder hatten Kaiser und Reichshofrat, veranlaßt durch die fortwährenden Streitigkeiten zwischen dem Herzog und den Landständen, ihren Einfluß geltend gemacht. Im Beginn des 18. Jahrhunderts war sogar eine Reichsexekution gegen den Herzog Karl Leopold nötig geworden, damals regierte eine kaiserliche Kommission von Rostock aus, bis schließlich Karl Leopold abgesetzt und sein Bruder Christian Ludwig als Administrator vom Kaiser eingesetzt wurde (1728) 3 ); auf diesen wieder übte der Reichshofrat bei allen Gelegenheiten einen bestimmenden Einfluß aus. Während dieser Zeit war häufig der Gegensatz zwischen dem Kaiser und dem König von Preußen in mecklenburgischen Angelegenheiten zutage getreten. Mecklenburg, das zu einer eigenen Politik in jenen Jahren kaum fähig war, blieb ganz von den Plänen seiner Nachbarn und den Verfügungen des Kaisers 4 ) abhängig und geriet durch die Verpfändung von vier Ämtern an Preußen und acht Ämtern an Hannover 5 ) in eine Zwangslage, deren Folgen das Verhalten des Herzogs auf Jahrzehnte hinaus bestimmen sollten. Der Kaiser achtete argwöhnisch auf alle Schritte, die Preußen etwa täte, um seinen Einfluß auf Mecklenburg zu verstärken. Er hatte vergebens zu verhindern versucht, daß die vier Ämter in preußischen Händen blieben, und als nun Herzog Christian Ludwig sich immer wieder bemühte, sie zurückzuerhalten, riet ihm der Kaiser sogar, Gelder zur Auslösung in Holland aufzunehmen 6 ). Es war für Mecklenburg in der Tat sehr wichtig, die Preußen, die sogar in Parchim eine Garnison eingerichtet hatten, wieder aus dem Lande fortzubekommen; denn sie entfalteten eine Werbetätigkeit, die ein Schrecken für das ganze Land war und den Herzog veranlaßte, beim Kaiser deswegen vorstellig zu werden. Herzog


|
Seite 215 |




|
Friedrich versuchte zwar noch 1756, die Werbestreitigkeiten. Mit Preußen durch einen Vertag beizulegen 7 ), darüber aber war man in Wien äußerst erzürnt, da diese Vorgänge benutzt werden sollten, um das Unrecht König Friedrichs vor aller Welt zu brandmarken. Diese Gelegenheit zeigte deutlich, wieviel Wert man in Schwerin auf die kaiserliche Gnade legte; denn auf unwillige Äußerungen des Reichsvizekanzlers Fürsten von Colloredo hin bemühte sich der Herzog sofort, durch eine eigene "Abschickung" die Gunst des kaiserlichen Hofes wiederzuerlangen.
Das war die Einstellung Mecklenburgs vor dem Beginn des Siebenjährigen Krieges, und es ist kein Wunder, wenn der Herzog nach dem Beginn der Feindseligkeiten auf die Seite Österreichs trat. Dazu veranlaßte ihn einerseits die gewalttätige Behandlung seines Landes und seiner Untertanen von Seiten der Preußen, andererseits die Furcht, sich den Unwillen des Kaisers zuzuziehen. Außerdem hoffte Mecklenburg viel von diesem verhängnisvollen Schritt. Im Falle eines Sieges der Feinde Friedrichs - und damit rechnete man mit Bestimmtheit - sollte der kaiserliche Hof die Rückgabe der verpfändeten Ämter bewirken, die mecklenburgischen Ansprüche auf Lauenburg 8 ) sollten beim Friedensschluß berücksichtigt und Wismar mit Poel und Neukloster von den Schweden zurückerlangt werden. Schließlich hoffte man darauf, daß der Kaiser den Herzog zum Kreisobersten des niedersächsischen Kreises und gegebenenfalls sogar zum Kurfürsten machen würde 9 ). Mecklenburg sollte diese Stellungnahme schwer büßen. Das Auftreten auf dem Reichstag in Regensburg im kaiserlichen Sinne, das Bündnis mit Frankreich und der Kaiserin veranlaßten König Friedrich, Mecklenburg als Feindesland zu behandeln und aus ihm herauszuziehen, was an Rekruten, Geld und Furage überhaupt nur zu erlangen war 10 ). Die Unterstützung, die die Höfe zu Paris und Wien versprochen hatten, blieb aus. Der Herzog ließ durch seine Gesandten Baron v. Ditmar in Wien und Baron Teuffel


|
Seite 216 |




|
von Pürkensee in Regensburg immer wieder seine Notlage vorstellen, es half alles nichts. In Wien meinte man sogar, der Herzog könne sich selbst helfen 11 ). Als dann der Friede zwischen Preußen und Schweden zu Hamburg geschlossen und Mecklenburg mit einbezogen wurde, mußte das Land noch die rückständigen Kontributionen zahlen; von Entschädigungen war gar nicht die Rede. Bei den Friedensverhandlungen in Hubertusburg wurde auf Mecklenburg keine Rücksicht genommen, die Treue zum Kaiserhaus hatte nicht die erhofften Vorteile gebracht. Mecklenburg hatte sich Preußen verfeindet und mußte an den Folgen des Krieges noch lange Zeit hindurch tragen.
Noch ein anderes Ereignis fällt in diese Zeit, das die Beziehungen zum Reich und die Abhängigkeit des Herzogs vom Kaiser deutlich zeigt. Die Streitigkeiten zwischen dem Landesherrn und den Ständen hatten zu langwierigen Verhandlungen vor dem Reichshofrat in Wien geführt und erst 1755 ihr einstweiliges Ende durch den "Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich" erreicht, den der Kaiser am 14. April 1756 bestätigte. Jetzt während des Siebenjährigen Krieges geriet der Herzog mit der Stadt Rostock in Streit 12 ). Dazu gab einmal die Weigerung der Stadt die Veranlassung, zu den Kriegskosten beizutragen, die dem Lande von den Preußen 1758 auferlegt wurden, woraus schließlich ein Prozeß beim Reichskammergericht entstand, der aber nicht zu Ende geführt wurde. Ferner erregte der Herzog den Zorn der Stadt durch die Berufung des Professors Döderlein aus Halle in die theologische Fakultät; denn während diese bisher der orthodoxen Richtung angehört hatte, kam Döderlein vom Pietismus her, dessen Anhänger auch Herzog Friedrich war 13 ). Die Fakultät verweigerte die Aufnahme des neuen Kollegen, bevor er das vorschriftsmäßige Kolloquium über seine Rechtgläubigkeit, von dem der Herzog ihn befreien wollte, bestanden habe. Der Rat als Kompatron der Universität unterstützte die Fakultät und bestritt dem Herzog das Recht zur Befreiung. "Es war der letzte Versuch einer Opposition mittelalterlicher Städtefreiheit gegen den vollendeten Sieg der Landeshoheit" 14 ), der sich jetzt abspielte. Rostock glaubte eine "reichsfreie"


|
Seite 217 |




|
Stadt zu sein und hatte sich auch bisher immer wider die Herzöge aufgelehnt und jeden bei Kaiser und Reich anhängig gemachten Prozeß geschickt von Instanz zu Instanz verschleppt. Jetzt suchte der Herzog einen Prozeß zu vermeiden und ließ sich durch den Gesandten Baron v. Ditmar in Wien vom Kaiser ein Patent für eine neue Universität erwirken (Oktober 1758). In Anbetracht seiner besonderen Treue gegen Kaiser und Reich wurde ihm gern willfahrt 15 ). Dem Herzog war aber sein eigentlicher Wunsch nicht erfüllt; denn er hatte ein kaiserliches Dekret, das die Rostocker Universität aufhob, erwartet, stattdessen aber enthielt das Patent die der Stadt Rostock so angenehmen Worte "sine praeiudicio vicinarum universitatum". Mehr konnte in Wien trotz aller Bemühungen nicht erreicht werden; 1760 wurde zur Gründung einer Universität in Bützow geschritten 16 ), und der Herzog hob von sich aus die Rostocker Akademie auf. Da verklagte die Stadt den Landesherrn beim Kaiser wegen Verletzung der Privilegien. Dieser wies aber die Klage ab, und sie ging an das Reichskammergericht in Wetzlar. Nach vielen Streitschriften und Beschwerden der Stadt wurden aber alle Streitigkeiten nicht durch das Gericht, sondern mit einem Vertrage im Jahre 1788 zwischen dem Nachfolger Herzog Friedrichs und der Stadt Rostock beigelegt 17 ).
So lagen die Dinge bei Schluß des Siebenjährigen Krieges. Dem Herzog mußte viel darauf ankommen, daß Kaiser und Reichshofrat ihm günstig gesinnt waren. Er brauchte die kaiserliche Autorität, um wirklicher Herr in seinem Lande zu sein. Es ist bezeichnend, daß König Friedrich während des Siebenjährigen Krieges und beim Abschluß des Hamburger Friedens nur den Engeren Ausschuß der Stände als gültiges und rechtmäßiges Regierungsorgan für das Land betrachtete und nur mit ihm die Friedensbedingungen vereinbarte 18 ). Das Bestreben des Herzogs


|
Seite 218 |




|
in den folgenden Jahren mußte sein, sich den Ständen gegenüber zu behaupten. Ferner mußten die verpfändeten Ämter wieder eingelöst und das Verhältnis zu Preußen einigermaßen erträglich gestaltet werden. Mecklenburg bedurfte der kaiserlichen Gunst und mußte doch stets auf Preußen Rücksicht nehmen, um den mächtigen Nachbarn nicht zu erzürnen.
Der Regierungsantritt Josephs II. und seine Wirkung auf Mecklenburg.
Wie war 1763 die Lage im Reich? "Friedrich hatte Schlesien dem Hause Österreich abgerungen; eine zweite Absicht aber, die er hegte, das Kaisertum von diesem Hause loszureißen und die oberste Gewalt im Reiche auf einer breiteren Grundlage neu zu gestalten, die hatte er nicht erreicht. Die ruhmwürdige Fürstin, welche Schlesien verlor, eroberte das Kaisertum mit ihren Waffen: sie überlieferte es ihrem Gemahl aus dem Haufe Lothringen und nach dessen Tode ihrem Sohn. In Wahrheit war sie der Kaiser, das Kaisertum war und blieb ein Bestandteil der Macht von Österreich. Bei ihrer Hofburg war der Sitz des Reichshofrates, von Wien aus wurde das Reichskammergericht geleitet und das Übergewicht der Stimmen am Reichstag zu Regensburg festgehalten . . . Im Reiche spielte der Eroberer von Schlesien nur die Rolle, die ihm als einem der ersten Reichsfürsten zukam" 19 ).
Ängstlich beobachtete Mecklenburg die politische Lage, es fürchtete sich vor neuen Verwicklungen, bei denen es nach Lage der Dinge nichts gewinnen konnte. Der Hofrat Edler v. Schmidt vertrat den Herzog in Wien; die Beziehungen zum Kaiserhaus, welches Mecklenburg in Anerkennung seiner Treue gnädig gesinnt blieb, wurden durch ihn in der herkömmlichen Weise gepflegt, und er mußte über alle Vorgänge am kaiserlichen Hof berichten. Vor allem nahmen die verschiedenen Prozesse der Ritterschaft beim Reichshofrat, meistens Berufungen gegen Entscheidungen der mecklenburgischen Land- und Hofgerichte in Güstrow und Schwerin, seine Tätigkeit in Anspruch. Die Zahl der Prozesse wuchs mehr und mehr; es waren vor allen Dingen Klagen der Adligen gegen ihre Pächter, die durch die schlechten Zeiten und die Teuerung in Not geraten waren und. vielfach Konkurs machen mußten, weil


|
Seite 219 |




|
sie ihre Pacht nicht zahlen konnten 20 ). So lagen die Appellationssachen von Klinggräff gegen Aschersleven 1762-63, von Barner wegen seines Gutes Zaschendorf gegen Deging bis 1767, von der Lühe zu Buschmühlen und Bolland wegen des verpfändeten Gutes Garvsmühlen 1770 vor. In diesen Jahren häuften sich die Konkurse auch unter den adligen Besitzern derart, daß der Herzog 1769 eine Beschwerde darüber beim Kaiser einreichte, aber natürlich keine Änderung oder Hilfe dadurch erreichte 21 ). Gegen die Bemühungen eines Dr. Wiese, der sich für Rostock einsetzte, mußte Schmidt eifrig tätig sein. Es lagen schließlich soviele mecklenburgische Sachen in Wien vor, daß nach dem Tode des Reichshofrats Frhr. v. Senkenberg (am 2. Juni 1768) erzählt wurde, er habe in seinen Phantasien immer nur von Mecklenburg gesprochen. Die huldvolle Gesinnung des Wiener Hofes kam durch allerlei Gnadenbeweise zum Ausdruck. So wurde der Bruder des mecklenburgischen Reichstagsgesandten Frhr. Teuffel v. Pürkensee, ein österreichischer Offizier, bevorzugt befördert aus Anerkennung "für die allerdevoteste Abhängigkeit und den Diensteifer seines Bruders für das Allerhöchst kaiserlich königliche Interesse" 22 ). Bei den Bemühungen Mecklenburgs 1763 um die Rückgabe der Ämter von Hannover und Preußen wurden die österreichischen Gesandten in London und Berlin zur nachdrücklichen Unterstützung angewiesen 23 ), allerdings hatten sie keine Erfolge zu verzeichnen; denn als der Graf v. Seilern bei König Georg III. davon sprach, wurde er kurz abgewiesen. Ebenso wenig erreichte der Gesandte in Berlin.
In Schwerin lebte man noch ganz in den Überlieferungen der letzten Jahrzehnte. Der Geheimratspräsident Graf v. Bassewitz, dessen Vater sogar den kaiserlichen Geheimratstitel geführt hatte, legte ebenso wie der Herzog Wert auf gutes Einvernehmen mit dem Kaiserhof. Der mecklenburgische Landrat v. Bassewitz sollte sogar 1766 eine Reichshofratsstelle erhalten; die Sache zerschlug sich aber wieder, als v. B. schon in Wien war 24 ). Die Hilfe des Reichsvizekanzlers nahm die Herzogin von Mecklenburg in Anspruch, als der Herzog von Württemberg die ihr zustehenden Zinsen und für ihre in Ludwigslust lebende Mutter das Witwengehalt


|
Seite 220 |




|
nicht zahlen wollte 25 ). Sie bat, es auf gütlichem Wege ohne Klage zu erledigen. Teilweise hatten Colloredos bereitwillige Bemühungen durch den württembergischen Gesandten Erfolg; denn die Herzogin-Mutter bekam ihre Gelder, während die Gemahlin Friedrichs selbst weiter vertröstet wurde.
Bemerkenswerter als alle diese Dinge von untergeordneter Bedeutung ist das Verhalten Mecklenburgs beim Tode Kaiser Franz I. und bei der Regierungsübernahme Josephs II. Der Hofrat v. Schmidt zeigte den am 18. August 1765 erfolgten Tod des Kaisers sofort dem Herzog an. Die Haltung Maria Theresias erfüllte den Herzog mit Bewunderung, vor allem ihre "ganz seltsame christliche Standhaftigkeit, mit der Sie das unerwartete härteste Schicksal" trug 26 ). Sofort nach dem Eintreffen der Nachricht schrieb der Herzog an die Kaiserin 27 ): "Meine unwandelbare Verehrung Ew. Kaiserl. Königl. Apostolischen Majestät und meine lebenswierige Veneration für das uns so früh entrissene preiswürdigste Reichsoberhaupt lassen mich dabei keinen Anstand nehmen, meine so grundmütige als tief ehrerbietigste Condolenz hierdurch schuldigst zu bezeugen, und wie ich nichts so sehr wünsche, als daß der Allerhöchste Ew. Kaiserl. Königl. Apostolische Majestät die schmerzhaftesten Empfindungen dieses betrübten Trauerfalls durch seinen gnädigen Trost und durch eine Folge vieler und ununterbrochener Glückseligkeiten lindere." Ein vorläufiges Notifikationsschreiben des eingetretenen Todes traf im Auftrage des neuen Kaisers Anfang September in Schwerin ein, und zwar war es durch den österreichischen Gesandten beim niedersächsischen Kreise, Herrn v. Raab in Hamburg, übersandt. Der Herzog antwortete ihm freundlich und drückte seine Freude über das neue würdige Reichsoberhaupt aus, sandte auch ein Glückwunschschreiben an Joseph ab, das der Edle v. Schmidt in Wien übermitteln mußte. Dann traf noch unmittelbar ein Notifikationsschreiben, vom 19. August datiert, vom neuen Kaiser ein, und Maria Theresia schrieb dabei dem Herzog: "Ich weiß, daß Euer Liebden an allem, was Mich und Mein Haus betreffen mag, jederzeit aufrichtig teilzunehmen belieben. Ich darf also nicht zweifeln, daß Dieselbe den höchst schmerzlichen Verlust, den Ich durch den am 18. d. M. erfolgten jählingen Tod Meines herzinnigst geliebtesten Gemahls


|
Seite 221 |




|
erlitten habe, mit besonderem Leidwesen teilnehmen werden" 28 ). Der Edle v. Schmidt betonte in einem Bericht Ende September, daß in Wien auch auf diese unmittelbaren Notifikationsschreiben noch Antwort erwartet würde, und zwar hätte der Reichskanzler sogar von einer besonderen Abschickung etwa eines Geheimen Rates gesprochen. Er bekam darauf Anweisung, zu beobachten und zu berichten, wie andere Fürstenhäuser es halten würden; der Herzog scheute wegen des schlechten Zustandes der Kassen eine besondere Absendung.
Indessen wurde Trauer für das Land angesagt, am 22. September 1765 (16. Sonntag n. Trin.) wurde in allen Kirchen des Landes ein Trauergottesdienst abgehalten, bei dem, wie bei solchen Anlässen üblich, ein besonderes Kirchengebet verlesen wurde, in dem des verstorbenen und des neuen Kaisers gedacht wurde. Während der nächsten vierzehn Tage (bis zum 6. Oktober) mußten jeden Mittag von 12 bis 1 Uhr die sämtlichen Kirchenglocken des Landes läuten. Jedes Orgelspiel, alle Musik und das Theater war während dieser Zeit verboten. Der Wechsel in der Besetzung des kaiserlichen Thrones wurde allen Landesbehörden mitgeteilt. Sechs Wochen hindurch mußte schwarz gesiegelt und die Publikationspatente an alle Kirchentüren angeschlagen werden. Die Gesandtschaften in Regensburg und Wien bekamen noch besonderen Auftrag zum Anlegen von Trauerkleidern, wofür dem Baron Teuffel für sich und das Gesandtschaftspersonal 280 fl. und dem Edlen v. Schmidt 200 fl. bewilligt wurden. Als Kleidung wurde vorgeschrieben: schwarze Kleider mit überzogenen Knöpfen, schwarze Degen und Schnallen, für die Sekretäre und Kanzleibeamten blaue Degen und Schnallen. Der Edle v. Schmidt wurde bei dieser Gelegenheit zum Geheimen Legationsrat ernannt; um Kosten zu sparen, hoffte man sich seiner zur Übergabe besonderer Kondolenz- und Glückwunschschreiben bedienen zu können, falls andere Höfe auch Gesandte schickten. Schmidt bekam ein besonderes Geheimrats-Kreditivschreiben, in dem die besondere Aufmerksamkeit für das kaiserliche Haus durch diese Ernennung betont wurde. Indessen berichtete der Gesandte 29 ), daß doch eine besondere Absendung nötig wäre; denn obwohl dem Reichsvizekanzler der schlechte Zustand der Kassen vorgestellt sei, habe er geäußert, der Kaiser würde es ganz besonders gern sehen. Da bekam der Baron Teuffel in Regensburg den Auftrag, sich für eine Reise nach Wien bereit-


|
Seite 222 |




|
zuhalten, und als im Herbst der braunschweigische Herzog und der Landgraf von Hessen-Kassel wirklich besondere Gesandte nach Wien gehen ließen, wurde ihm befohlen, mit den nötigen Kreditiv-, Beileids- und Glückwunschschreiben abzureisen. Er bekam 200 Dukaten Reisegeld. Diese Dinge waren aber erst Anfang Dezember geordnet, so daß Teuffel seinen Besuch in Wien mit Neujahrsvisiten vereinigen wollte. Es trat dann auch noch starke Kälte ein, und er konnte erst am 13. Januar 1766 von Regensburg abreisen und in Wien am 22. Januar eintreffen. Am 26. Januar erhielt er bei Hofe Audienz, in der er die mit schwarzem Rande versehenen Schreiben überreichte und seine Aufträge ausrichtete. An die Gemahlin Josephs II. war vom Herzog schon am 24. Oktober ein besonderes Schreiben gerichtet. Der Baron Teuffel meldete: "Ich kann nicht genugsam ausstreichen, wie allergnädigst ich besonders von des Kaisers Majestät und der verwittibten Kaiserin Majestät empfangen worden und in was vor verbindlichsten Terminis Höchstsie die Attention Euer Herzogl. Durchlaucht wegen der eigenen vorgenommenen Abschickung genommen." Im letzten Augenblick hatte noch Hessen-Darmstadt den mecklenburgischen Gesandten ersucht, zugleich mit seinem eigentlichen Auftrage Kondolenz- und Glückwünsche für den Darmstädter Herzog auszusprechen 30 ). So wurden dann die Kosten unter die beiden Höfe geteilt, aber im Vordergrund hatte doch die Aufmerksamkeit Mecklenburgs gestanden. Das ging auch aus dem Schreiben hervor, welches Joseph an Herzog Friedrich richtete 31 ): "Wir sind von Deiner Liebden Uns unabänderlich zutragenden wahren Achtung und Ergebenheit gänzlich gesichert und überzeugt, daß die über den höchst schmerzlichen Todfall Unseres gnädig und geliebten Herren Vaters Majestät eingeschickte Kondolenz, sowohl als auch zu Unserer hierauf angetretenen kaiserlichen Regierung an Uns schriftlich erstattete, und durch den eigens zu solchem Ende anhero abgeordneten Geheimen Rat und Comitialgesandten Teuffel von Pürkensee mündlich wiederholte wohlmeinende Glückwünsche aus einem reinen und deutsch patriotischen Herzen ihren Ursprung genommen haben." Weil der Fürst von Colloredo erkrankte, konnte der Baron Teuffel erst am 6. Februar bei diesem die Abschiedsvisite machen. Der Edle v. Schmidt und der Reichstagsgesandte berichteten mancherlei Erfreuliches über den neuen Kaiser. Die Aktivität und der Fleiß des Kaisers wurden gerühmt, und in


|
Seite 223 |




|
Schwerin versprach man sich besonders viel von der Verfügung an den Reichshofrat, die Prozesse genauer und schneller zu erledigen; binnen sechs Wochen sollte jetzt über jede Sache referiert werden. Infolge der Veränderungen in der Regierung, vor allem der Festigung in der Stellung des Fürsten Kaunitz als Obristhof- und Staatskanzler, glaubten die Schweriner Minister auf wichtige politische Vorgänge gefaßt sein zu müssen; Colloredos Ansehen fiel, die auswärtigen kaiserlichen Minister brauchten ihm nicht mehr wie bisher Duplikate von ihren Relationen einzusenden, sondern berichteten nur an Kaunitz 32 ).
Lange hatte die Frage der kaiserlichen Belohnung mit Mecklenburg, die nach der Reichsverfassung bei dem Wechsel in der Person des Kaisers oder des Landesherrn jedesmal vorgenommen werden sollte 33 ), geschlummert. Die letzte Belohnung war 1707 erfolgt. Herzog Friedrich hatte zu Beginn des Siebenjährigen Krieges eine Lehnsbefristung nachgesucht (21. Oktober 1757) und für drei Monate erhalten, dann war die Frist stillschweigend verlängert. Jetzt wurde aus Wien gemeldet, daß der junge Kaiser die Belohnungen wieder durchführen wollte. Deshalb richtete im Mai 1766 der Herzog ein Schreiben an den Kaiser und bat in Rücksicht auf die große Notlage seiner Kasse, die durch die Lasten des Krieges entstanden sei, um Aufschub wegen Erledigung der Lehnsangelegenheit. Der Kaiser erklärte, er wolle die Lage Mecklenburgs anerkennen, und gewährte durch den Reichshofrat zunächst auf drei Monate Indult, bemerkte aber, daß endlich die Sache geregelt werden müßte. Dieser gleiche Vorgang wiederholte sich jedesmal nach Ablauf der gewährten Frist. Als der Edle v. Schmidt im August 1766 berichtete, daß auch Baden und Dänemark für Holstein sich zur Belohnung willig zeigten, ließ der Herzog den Reichshofrat um genaue Mitteilung der Kosten ersuchen. "So aufrichtig haben wir doch nach unserer vollkommensten Devotion für Ihre kaiserliche Majestät und nach unserer besonderen Hochachtung für den kaiserl. Reichshofrat den besten Willen, auch in diesem Punkt unserer Schuldigkeit möglichst nachzukommen und so wenig möchten wir es uns dabei von anderen zuvortun lassen" 34 ). Die Reichshofkanzlei teilte die zu zahlenden Summen mit, die inzwischen durch die wiederholte Unterlassung der Belehnung aufgelaufen waren. Die Lehnssumme betrug 37500 fl., das Laudemium (Anfallsgeld) für Schwerin 50000 fl. und für Strelitz 30000 fl. (für


|
Seite 224 |




|
Strelitz wurde es dann auf 18000 fl. herabgemindert). Von der einen Hälfte der Lehnstaxe, die der Kurfürst von Mainz als Reichserzkanzler bekam, konnte noch eine Herabsetzung erhofft werden, aber die zu zahlende Summe blieb für die herzogliche Kasse doch zu groß, und das Lehen mußte wieder "gemuthet", d. h. weiterer Indult erbeten werden 35 ), bis die Lande sich wieder einigermaßen erholt hätten. Es erging in dieser Sache am 18. September 1766 eine kaiserliche Resolution: "Nachdem Kaiserliche Majestät nicht gemeint seien, die wirkliche Belehnung länger aufschieben zu lassen, werde dem Herzog zu Mecklenburg-Schwerin annoch ein Indult von drei Monaten dahin erteilet, daß er binnen solchen sowohl praestanda praestieren als auch das ganze Lehnsgeschäft gehörig berichtigen sollte." Indessen wurde im April 1767 wieder ein Indult für drei Monate erteilt. Ein gemeinsames Vorgehen der altweltfürstlichen Häuser veranlaßte ein längeres Ruhen der Sache. Es waren nämlich Vorstellungen beim Kaiser erhoben worden, um die Lehnsgebühren herabzusehen und die Zeremonien bei dem Belehnungsakt selbst zu ändern (das Knien der Gesandten sollte abgeschafft werden) 36 ). Auch Joseph II. selbst trug sich mit Plänen zur Änderung; so wollte er die spanische Mantelkleidung fortfallen lassen 37 ). Aber erst später wurde weiter darüber verhandelt. Wegen der Laudemiengelder, die zum Teil in die Kasse des Reichshofrats flossen 38 ), schrieb am 5. Februar 1774 der Reichshofrat Graf v. Graevenitz, ein Neffe des mecklenburgischen Geheimratspräsidenten, an den Herzog und bat, die rückständigen Gelder zu zahlen, da das Gehalt der Reichshofräte darauf eingerichtet sei. Ihm wurde geantwortet, daß "seine reichskundige Anhänglichkeit für das kaiserliche Haus Mecklenburg durch die Kriegsschäden verhindert habe, auch nur eine kleinere Summe aufzubringen". Der Graf möge die Verlegenheit bedenken, in der sich der Herzog seit dem Kriege mit seinen Landen befinde, "wo Edelmann, Bürger und


|
Seite 225 |




|
Bauer mit Dürftigkeit und Not zu kämpfen hat und einer nach dem anderen zugrunde gehet". Jedoch bekam der Graf mit diesem Schreiben ein Geschenk übersandt, nämlich "einen Riß, der das Walzenwerk der Münze in Schwerin und das neu angelegte Schleusenwerk in Ludwigslust beschreibt". Dabei blieb es vorläufig.
An kaiserlichen Verordnungen, die in Mecklenburg mit Genugtuung aufgenommen wurden, ist eine solche vom 7. Juli 1769 zu erwähnen 39 ), nach der keine fremden Werber in Deutschland geduldet werden sollten. ferner liegt ein kaiserliches Edikt vom 25. April 1772 vor 40 ), welches sich gegen den "blauen Montag" der Handwerker richtete. Außerdem wurde darin verfügt, daß in der Weberei weibliche Arbeitskräfte zugelassen sein sollten, ferner sollte ein Meister mehr wie einen Lehrling haben und auch über die früher erlaubte Anzahl Gesellen halten dürfen. Die Kinder von sog. "Wesenmeistern" und "Abdeckern" dürften nicht vom Handwerk ausgeschlossen werden, sie sollten von den Meistern als Lehrlinge nicht zurückgewiesen und ihre Töchter jederzeit ehrliche Personen und Handwerksleute heiraten können. Diese Verordnung wurde öffentlich verkündigt und sollte vom 1. Juli 1772 ab Gültigkeit haben 41 ). Sie diente dazu, Handwerksmißbräuche, die in großer Zahl auch in Mecklenburg eingerissen waren, zu beseitigen.
Auf dem Reichstage in Regensburg wurde Mecklenburg durch den Baron Teuffel von Pürkensee vertreten, der schon im Siebenjährigen Kriege alle Verhandlungen dort für den Herzog geführt hatte. Seit einiger Zeit war er kränklich, und im Winter 1767/68 trat er von seinem Posten zurück. Es kam nun darauf an, einen neuen Gesandten zu finden, "der neben anderen Vorzügen die größte Vertraulichkeit und Konnexion mit den hiesigen kaiserlichen Ministris und hauptsächlich in Wien hat". Herzog Friedrich legte aber nicht allzu viel Wert auf den Reichstag, und so wurde kein eigener Gesandter berufen, sondern ein Graf von Bünau, der Sachsen-Weimar vertrat, wurde mit Führung der mecklenburgischen Stimmen von 1767 bis 1778 beauftragt. 1779 führte die mecklenburgischen Vota eine Zeitlang Baron v. Wülknitz, der Gesandte von Hessen-Kassel, dann übernahm Baron Paul v. Gemmingen (Sachsen-Gotha) die Geschäfte für Mecklenburg. Die Berichte


|
Seite 226 |




|
wurden indessen in der Hauptsache von dem Regierungsrat Christian Ludwig Becker, dem Sekretär der mecklenburgischen Gesandtschaft, besorgt Mecklenburg hielt sich in dieser Zeit sehr zurück, lieber wurden Vota "quiesziert", und man versuchte allem auszuweichen, "was zur Kollision mit dem kaiserlichen Hof führen könnte". So auch 1769 in einer Angelegenheit der Kammergerichtsvisitation, wo Preußen gern die mecklenburgischen Stimmen für sich gehabt hätte 42 ). Die Stellen in der hohen Generalität des Reichsheeres, das allerdings nur in der Idee bestand und zu einer Verbindung von einzelnen Kontingenten geworden war, wurden mit Einverständnis des Reichstages besetzt 43 ). Als im Sommer 1767 eine Reichsfeldmarschallstelle durch den Tod des Pfalzgrafen Friedrich von Zweibrücken erledigt war, wandte sich im kaiserlichen Auftrage am 27. Oktober der Gesandte v. Raab in Hamburg an den Herzog und bat um Fürsprache für den Herzog Albrecht von Sachsen-Teschen, sowohl in Rücksicht "auf dessen hohe Geburt als auch auf seine nahe Verwandtschaft mit dem durchlauchtigsten Erzhause 44 ). Der Herzog antwortete, daß es ein Vergnügen für ihn sei, seine untertänigste Verehrung für des Kaisers Majestät und das kaiserliche Erzhaus bezeugen zu können, und gab dementsprechende Anweisungen. Auch der Wiener Bevollmächtigte v. Schmidt mußte dem Fürsten von Colloredo davon Mitteilung machen, damit der Kaiser davon Kenntnis bekäme. Der Herzog Albrecht, der selbst noch geschrieben hatte, erhielt ebenfalls eine freundliche Antwort. - An den Ereignissen in Wien und am Kaiserhof, von denen der Herzog von 1777 ab durch den Reichshofratsagenten Anton Ditterich von Erbmannszahl unterrichtet wurde, nahm man weiter den gebührenden Anteil. Als die Kaiserin Maria Theresia nach einer Krankheit im Juli 1767 wieder genas 45 ), wurden ihr besondere Glückwünsche ausgesprochen; ein paar Tage darauf kam die Todesnachricht von der zweiten Gemahlin Josephs II. 46 ), die ein Beileidschreiben an den Kaiser notwendig machte. Bis zu Neujahr 1767 waren regelmäßig Glückwünsche zum Jahreswechsel an den Kaiser und seine Gemahlin, die Kaiserin-Witwe, den Reichsvizekanzler, jeden Reichshofrat,


|
Seite 227 |




|
den Fürsten Kaunitz und den Hof- und Staatskanzler v. Starhemberg abgesandt. Maria Theresia ließ im Januar 1767 mit ihrem Dank mitteilen, sie könne die Wünsche zwar noch annehmen, aber nicht mehr beantworten, und Joseph verbat sich im April 1767 die besonderen Glückwünsche, er "wolle der patriotischen Gesinnung trotzdem versichert bleiben". So hörten 1768 die Gratulationen zum Jahreswechsel auf; an die Reichshofräte scheinen sie aber weiter ergangen zu sein, wenigstens liegt ein Glückwunschschreiben an den Reichshofratspräsidenten v. Hagen zu Neujahr 1779 vor. Außerdem ließ sich der Herzog während einer Krankheit Colloredos 1767 genaue Mitteilungen über dessen Befinden machen, und nach seiner Genesung mußte Schmidt ihm ein besonderes Glückwunschschreiben überreichen. Auch bei "Promotionen" (Ernennungen) hoher Persönlichkeiten versäumte Mecklenburg die Gratulationen nicht. So schrieb der Herzog dem Reichshofrat v. Thüngen 1767 und dem Reichshofrat Friedrich Karl v. Moser, dem er besonders freundlich gesinnt war, weil er in mecklenburgischen Angelegenheiten sehr tätig sein sollte; als der letztere 1769 ausschied, wurde sogar erwogen, ihn zum mecklenburgischen Comitialgesandten zu ernennen. Noch am 20. Mai 1768 hat Herzog Friedrich an ihn ein Schreiben gerichtet 47 ), in dem er im Gegensatz zu gelegentlichen Ungerechtigkeiten des Reichshofrats die Gerechtigkeitsliebe Mosers besonders lobt. Es heißt darin: "Was kann einem patriotisch denkenden Fürsten betrübter sein als seine in Gesetzen und Privilegien gegründete Freiheit gegen die verteidigen zu müssen, die als ihre auserkorenen Verteidiger gelten sollten? Und das alles unter einem glorwürdigen Reichsoberhaupt, von dessen persönlicher Gerechtigkeitsliebe jeder Mund voll Rühmens ist! Lassen Sie, ich ersuche Sie nochmals darum, durch Ihr Beispiel und Ihre standhafte Mitwirkung das ganze Reich überzeugt werden, daß es für Fürsten und Untertanen die größte Glückseligkeit sei, ein gemeinschaftliches Oberhaupt und Reichsgericht zu haben, und daß sie es sich zur wahren Pflicht machen, die Untertanen sowohl gegen alle Bedrückungen zu schüren als auch in Gehorsam ihrer Landesobrigkeit zu erhalten. Daß mithin die Reichsgerichte kein Zufluchtsort für diejenigen sein mögen, die alle ihre Pflichten gegen ihre Landesfürsten und selbst gegen ihre Mituntertanen abschütteln wollen." Beziehen sich diese Zeilen auch vor allem auf die mecklenburgischen Verhältnisse, so zeigen sie doch deutlich, wie der Herzog sich in jenen Jahren die Aufgabe des Reichshofrats dachte. - Bei dem Reichs-


|
Seite 228 |




|
kammergericht in Wetzlar lag ebenfalls eine große Anzahl mecklenburgischer Prozesse vor. Die Interessen des Herzogs nahm dort der Reichskammergerichtsprokurator v. Gülich wahr. Zur Unterhaltung des Kammergerichts zahlte Mecklenburg jährlich 560 fl. sein Präsentationsrecht 48 ) für das Reichskammergericht übte der Herzog 1776 aus, als dort eine Assessorstelle frei wurde. Ein früherer Bützower Professor Rudloff, der jetzt Hofrat in Hannover war (ein Bruder des herzoglichen Regierungsrats R.), sollte den Posten erhalten. Er trat später wieder davon zurück, und Hessen-Kassel übte das Präsentationsrecht aus.
Das niedersächsische Kreisdirektorium (Magdeburg und Braunschweig) trat in Tätigkeit, wenn ein fremder Gesandter akkreditiert worden war, wovon dem Herzog jedesmal Mitteilung gemacht wurde. 1775 wurde der kaiserliche Gesandte v. Raab in Hamburg durch den wirklichen kaiserlichen Hofrat Anton Baron v. Binder und Kriegelstein ersetzt. In dieser Angelegenheit erfolgte ein kaiserliches Schreiben an den Herzog, welches derselbe am 29. Juli 1775 beantwortete und seiner Verehrung für die "überall hervorleuchtende reichsväterliche allergnädigste Obsorge für die Wohlfahrt des werten deutschen Vaterlandes überhaupt sowohl als des niedersächsischen Kreises" versicherte.
Mit Preußen stand Mecklenburg in diesen Jahren in keinen sehr engen Beziehungen. Von Zeit zu Zeit hielt sich der Geheimrat Baron v. Lützow als außerordentlicher Gesandter in Berlin auf, um die Rückgabe der verpfändeten Ämter zu erwirken; wie es bei König Friedrich nicht anders zu erwarten war, erreichte er jedoch nichts. Nach der Zusammenkunft des Königs mit Kaiser Joseph 1769 in Neiße sollte der Kaiser um direkte Fürsprache in Berlin ersucht werden 49 ). Doch als der Gesandte v. Schmidt schrieb, daß die beiden Herrscher bei ihrer Zusammenkunft verabredet hätten, die lästige Form von Handschreiben in ihrem gesellschaftlichen Verkehr ganz fallen und alle Angelegenheiten durch ihren Gesandten in Audienzen erledigen zu lassen, und daher die Angelegenheit dem Reichsvizekanzler unterbreitet werden mußte, ließ man diese Absicht fallen, um nicht den Anschein einer Klage bei Kaiser und Reich zu erwecken. Man fürchtete sich in Schwerin vor Preußen in Erinnerung an die erlittenen Leiden, aber andererseits wußte man es auch zu schätzen, daß ein mächtiger Reichsfürst da war, der


|
Seite 229 |




|
gegebenenfalls bei Kaiser und Reich die Rechte der kleinen Territorien vertreten konnte. Das sollte sich im bayrischen Erbfolgekrieg und seinen Nachwirkungen zeigen, die den Anlaß gaben, daß Mecklenburg und Preußen einander wieder näher traten.
Mecklenburgs Bemühungen um Erweiterung der Territorialrechte.
Am 3. Januar 1778 starb der bayrische Kurfürst Maximilian Joseph. Ein Teil des Kurfürstentums wollte Joseph II- als erledigtes Reichslehn einziehen, Friedrich der Große trat diesen Plänen entgegen und begann den Feldzug in Böhmen, der mit dem Frieden von Teschen endete. Mecklenburg glaubte Ansprüche auf die Landgrafschaft Leuchtenberg zu haben. Als der dänische Etatsrat v. Moser in einer Veröffentlichung über die bayrische Frage meinte, auf Leuchtenberg habe niemand ein Recht, erhob sich in Schwerin große Entrüstung; denn schon vor dem Tode des Kurfürsten hatten die Minister dem Herzog vorgestellt, daß die Gelegenheit der bayrischen Thronfolge benutzt werden müsse 50 ), um Leuchtenberg zu erhalten. Das wollte man Preußen anbieten und dafür die vier verpfändeten Ämter zurücknehmen, während Strelitz mit Geld abgefunden werden sollte. Aber leider waren die Ansprüche nur schlecht begründet. Der umfangreiche Bericht aus dem Archiv, den die Minister anfertigen ließen, ergab zwar, daß im Jahre 1502 Kaiser Maximilian dem mecklenburgischen Herzog Heinrich dem Friedfertigen als Dank für seine Dienste und als besondere Auszeichnung die Anwartschaft auf diese Grafschaft verliehen hatte, seitdem war man zwar auf diese Angelegenheit wieder zurückgekommen, war aber in Wien stets abgewiesen worden 51 ). Moser hatte mit seiner Ansicht also nicht ganz unrecht, aber man beschloß in Schwerin, ihm eine für Gelehrte bestimmte goldene Medaille zuzusenden und ihn zu ersuchen, bei weiteren Veröffentlichungen auch die mecklenburgischen Ansprüche zu vertreten, die ihm als begründet dargestellt wurden. Er hat dies auch getan, denn in späteren Schriften trat er für Mecklenburg in dieser Angelegenheit ein. - Nun sondierte das Strelitzer Ministerium, das


|
Seite 230 |




|
in näheren Beziehungen zu Preußen stand, in Berlin, und es ergaben sich gute Aussichten für einen etwaigen Vortrag der Ansprüche bei König Friedrich. Doch eine eigene "Abschickung" von Schwerin aus erschien nicht angebracht, sondern Strelitz beauftragte den Geheimrat Seip, der sich gerade in Berlin aufhielt 52 ), unauffällig durch seinen Freund, den Geheimen Sekretär des Königs v. Steck, die Sache Friedrich bekannt werden zu lassen. Eine genaue Kenntnis der Akten über die Ansprüche könne von ihm nicht verlangt werden, da diese sich ja in Schwerin befänden, während das bei einem Abgesandten von dort der Fall sein müßte und dann die mangelhafte Begründung den Herzog in schlechtes Licht setzen würde 53 ). Steck mochte auch Hoffnung, der König würde vielleicht darauf eingehen, die Ansprüche zu vertreten. Die Strelitzer Minister schlugen vor, sich jetzt in aller Form an die preußischen geheimen Etatsräte, aber auch an den Kaiser in Wien zu wenden. Es wurde am 4. Februar 1778 ein gemeinsames Schreiben der beiden Ministerien an die preußischen Räte gesandt, in dem um Vortrag beim König gebeten und die Abtretung der Ansprüche auf Leuchtenberg gegen eine andere Entschädigung angeboten wurde. An den kaiserlichen Hof, der schon selbst Ansprüche auf das erledigte Reichslehen machte, wollte man sich noch nicht wenden. Es erschien nicht zweckmäßig, bevor die preußische Gesinnung bekannt wäre. Es wurde nur für den Fall in Aussicht genommen, daß Preußen etwa vor der Abtretung ein Belehnungsgesuch für Leuchtenberg seitens des Herzogs verlangte.
Die preußischen Minister antworteten, daß es geraten sei, sich nach Wien zu wenden, um dort die Anwartschaft geltend zu machen und der Einziehung als vakantes Reichslehen zu widersprechen, die in einem kaiserlichen Patent angekündigt war. Man sollte sich auf das darin geäußerte Versprechen berufen, daß eines jeden Prätendenten Recht berücksichtigt werden sollte. Die Gesandtschaft auf dem Reichstag sollte ebenfalls instruiert werden, im übrigen aber müßte man erst die nähere Klärung der Erbfolge abwarten. Auf ein Schreiben des Strelitzer Herzogs antwortete König Friedrich, daß er die Ansprüche Mecklenburgs kenne und sich durch seine Minister die weiteren genaueren Mitteilungen der mecklenburgischen Regierung vortragen lassen werde. In Schwerin wurde jetzt ein kurzes Promemoria, das die Ansprüche begründete, entworfen


|
Seite 231 |




|
und zur Verbreitung in Druck gegeben 54 ). Nach Wien wurde zunächst nicht geschrieben, man wollte eine Abweisung vermeiden. Doch am 3. März entschloß sich der Schweriner Herzog, den kaiserlichen Hof um Unterstützung zu bitten, da Preußen nichts weiter zu unternehmen schien. Er richtete ein Gesuch an den Kaiser mit einem Begleitschreiben an den Vizekanzler Fürsten von Colloredo. Ebenso wurde der Gesandte in Regensburg beauftragt, Unterstützung durch andere Fürsten zu gewinnen. Auch wandte sich der Herzog unmittelbar an König Friedrich und erhielt von ihm am 28. März ein "höfliches und freundliches Schreiben, wie noch keines nach Schwerin gelangt war", und in dem die preußische Verbindung in Aussicht gestellt wurde 55 ). Die Minister in Schwerin waren mit der Einleitung der Dinge sehr zufrieden. Sie wollten sich zwei Eisen im Feuer halten. Sie hofften zwar nicht auf eine besondere Zuwendung vom Kaiser, aber sie betrachteten es auch als zweifelhaft, daß sich der preußische Hof lange für die Interessen Mecklenburgs verwenden würde. Sie wollten so vorgehen, daß die Nachwelt "nichts Verfahrenes" feststellen könnte. Mecklenburg zog sich durch Hervorkehren seiner Ansprüche nicht den Verdacht eines Einverständnisses mit dem kaiserlichen Hof zu und entging dadurch der Gefahr einer üblen Behandlung durch eiserne Hand. "Im Falle eines Krieges hat man jedenfalls keine so ruinöse Invasiones wie im vorigen Kriege zu besorgen, wowider der Lage halber keine kaiserliche Gnade, so verehrlich diese auch sonst ist, das Land zu schüren vermag und wofür die Entschädigung hernach zu den frommen Wünschen gehört." Den Ministern war klar, daß das Anliegen Mecklenburgs dem kaiserlichen Hof nicht gerade angenehm sein würde. "Ein ungestümes oder spöttisches abschlägiges kaiserl. Conclusum dürfte dieses, woferne die Intercessiones der größeren Höfe nicht einigen Eindruck machen, vielleicht bald beweisen. Alles, was dem kaiserlichen Hofe anhänget, wird es immer äußerst tadeln, daß der Herzog nicht das ganze Interesse und alle hohe Befugnisse des herzoglichen Hauses immer bloß zur kaiserlichen Gnade und Willkür vorstellt, sich nicht von allen mächtigeren protestantischen


|
Seite 232 |




|
Reichsständen trennt und seine zelierte Anhänglichkeit an den kaiserlichen Hof durch öffentliche Auflehnung gegen den großen Nachbarn betätigt." Man wollte aber doch andererseits nicht als Feind des Kaisers gelten; denn als im April 1778 in der "Hamburgischen Neuen Zeitung" (58. Stück) eine Nachricht erschien, daß ein Korps mecklenburgischer Truppen zu den preußischen stoßen würde, wurde sofort durch den Baron Lützow der Syndikus Schubach in Hamburg beauftragt, die Widerrufung dieser unwahren Nachricht zu veranlassen und dafür zu sorgen, daß künftig nicht wieder solche Behauptungen erscheinen würden.
Die Antworten des Kaisers und des Fürsten Colloredo fielen nicht so ungünstig aus, wie man erwartet hatte, wenn sie auch nicht allzu viel Hoffnung ließen. Von einer "Abschickung" nach Wien sah man ab, aber ebenso sollte auch nach Berlin niemand gesandt werden, weil dadurch der kaiserliche Hof verstimmt werden könnte 56 ). Die Unterstützung bei Rußland, Dänemark und allen deutschen Höfen wurde nachgesucht. Mecklenburg erreichte in einer Hinsicht seine Wünsche, es blieb dieses Mal ganz von preußischen Werbungen verschont, und außerdem vertrat Preußen die Ansprüche auf Leuchtenberg bei den Vorverhandlungen in Braunau und dann auf der Friedenskonferenz in Teschen. Es ergab sich ein Schriftwechsel im Frühjahr 1779 mit den preußischen Ministern, und es schien zunächst so, als wenn die Wolfsteinischen Herrschaften in der Nähe von Ansbach als Entschädigung für Leuchtenberg gegeben würden, aber dann fragten die preußischen Räte an, ob Mecklenburg mit dem Privilegium de non appellando illimitatum (d. h. der gänzlichen Beschränkung des Berufungsrechtes der mecklenburgischen Untertanen an den Reichshofrat und an das Reichskammergericht) zufrieden sein würde. Die Minister in Schwerin waren zunächst ein wenig enttäuscht; ihnen war ein Landbesitz, den man dann an Preußen hätte abtreten können, lieber, und sie machten auch kein Hehl daraus. Das Privilegium würde, fürchteten sie, die Landstände unzufrieden machen und zu großen Weiterungen Anlaß geben. Es müßte eben auf alle Fälle ein Privilegium "illimitatum" sein. Diese Wohltat für das Land würde dann auch sehr gern genommen werden, weil die vielen Berufungen aufhörten und durch ein Oberappellationsgericht, das in Güstrow zu errichten wäre, und durch die herzogliche Justizkanzlei erledigt werden könnten. Jedoch baten die Minister, wenn irgend möglich, außerdem doch noch eine Entschädigung mit Land zu er-


|
Seite 233 |




|
wirken. Hertzberg und Finkenstein erwiderten, daß der König zusammen mit der Kaiserin und dem Hause Pfalz den Kaiser ersuchen würden, Mecklenburg das Privilegium de plane non appellando illimitatum zu verleihen. Aus den Verhandlungen entstand der 15. Artikel des Teschener Friedenstraktats vom 13. Mai 1779 57 ), nach dem der Kaiser erst um Erteilung und Ausfertigung des Privilegs von dem Herzog ersucht werden mußte. Man tröstete sich aber in Schwerin, ,,weil der König und die Kaiserin sich zur Unterstützung verpflichteten, ist doch Aussicht vorhanden, es zu bekommen, was beider "Appellationssucht" der Untertanen sehr angenehm sein würde, und die schon äußerst alarmierte Ritterschaft wird auch durch die ängstliche Abschickung "ganzer drei, sonderbarer Weise allesamt bucklichter Deputierten" nach Wien nichts dagegen ausrichten können".
Am 18. Mai 1779 traf die Mitteilung der preußischen Räte von dem Ergebnis der Friedensverhandlungen ein; eine unentgeltliche Erteilung des Privilegs, die der Herzog auch gewünscht hatte, war nicht zu erreichen gewesen. Jetzt wurden schriftliche Gratulationen zu dem Friedensschluß nach Berlin und Wien gesandt, von besonderen Absendungen 58 ) auch an den preußischen König wurde abgesehen. König Friedrich mache sich nichts aus solchen Gesandtschaften, und dann hätte auch der Wiener Hof sich beleidigt gefühlt, wenn nur nach Berlin jemand gekommen wäre, auch die hohen Kosten sollten gespart werden.
Jetzt aber sollten der Herzog und seine Minister nachdrücklich erfahren, wie wichtig die kaiserliche Gnade und Gunst war, und wie abhängig sie von dem Willen des Reichsoberhauptes waren. - Bereits am 9. Juni traf die Bitte des Engeren Ausschuß 59 ) beim Herzog ein, das Privilegium nicht anzunehmen, da es dem Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich von 1755 widerspräche. Aber da-


|
Seite 234 |




|
durch unbeirrt sandten beide Herzöge am 22. Juli ein umfangreiches Schreiben an den Kaiser, in dem die Erteilung des Privilegs nachgesucht wurde. An den Fürsten von Colloredo erging wieder ein Begleitschreiben. Man hatte voll Freude in Schwerin festgestellt, daß bereits Wallenstein als Herzog von Mecklenburg von Kaiser Ferdinand II. für sich und seine Nachfolger das Privilegium de non appellando illimitatum erhalten hatte; die Herzöge hatten sich dessen nur aus Haß gegen Wallenstein und seine Einrichtungen nicht bedienen wollen. Auf diese Erteilung beriefen sich jetzt die Herzöge und stellten dem Kaiser vor, daß nur eine Erneuerung oder Bestätigung des damals erteilten Privilegs in Frage käme. Ihnen seien "die Merkmale der erhabensten oberstrichterlichen Neigung zu allgemeiner Beförderung der besten Justizpflege und zur Bändigung der dawider unermüdet arbeitenden Schikane bekannt", deshalb hofften sie auf die Wohltat des Privilegs bei der großen Prozeßsucht der Untertanen, die vor allem durch die vielen Konkurse veranlaßt sei 60 ).
Inzwischen hatte sich die Ritterschaft und die Stadt Rostock eifrig bemüht, auf jeden Fall die Erteilung des Privilegs zu verhindern. Wie erwähnt, hatten sie bereits im April Gesandte nach Wien geschickt, die beim Kaiser vorstellig werden sollten. Zunächst konnte der Reichshofratsagent v. Ditterich berichten, daß ihre Bemühungen keine Erfolge hätten; denn die Mitglieder des Reichshofrats seien anscheinend der Auffassung, daß in dem Artikel 15 des Friedensvertrages schon eine kaiserliche Zusicherung enthalten sei, und vor allem sei der Baron Puffendorff als Referent der herzoglichen Sache günstig gesinnt. Aber bald kamen auch andere weniger erfreuliche Nachrichten aus Wien. Das zu errichtende Oberappellationsgericht werde so besetzt werden müssen, daß die Stände einen Teil der Mitglieder zu präsentieren hätten, und überhaupt seien jetzt die Darlegungen der Gegner beifälliger aufgenommen. - Ebenso arbeitete in Regensburg beim Reichstag, auf dem es sich um die Bestätigung des Teschener Friedens handelte 61 ), der Herr v. Viereck, ein Bruder des dänischen Gesandten in Wien, im Auftrage der mecklenburgischen Stände (er hatte in Mecklenburg Besitzungen gehabt, hatte sie aber durch Schulden im Konkurs verloren) gegen den Herzog. Auf dem Reichstag bildeten sich in der Frage des Friedens zwei Parteien, von denen die eine den Frieden ohne jeden Vorbehalt gutheißen, die andere eine be-


|
Seite 235 |




|
schränkende Klausel hinzufügen wollte. Der Herzog gab seinem Gesandten, dem Baron v. Gemmingen, zunächst nur Weisungen, wie er den Bemühungen der Stände eifrig entgegentreten sollte. Ihm wurden gedruckte Schriften übersandt, die von der Regierung veröffentlicht wurden, und die das Recht der Herzöge auf die Verleihung des Privilegs begründeten. Dagegen verbreitete Herr v. Viereck wieder andere Schriften, die in Schwerin mit Ärger als Beilagen der Gesandtschaftsberichte angenommen wurden. - Auf dem Reichstag wollte ein Teil der sog. "Klausulanten" die Rechte Dritter vorbehalten wissen; diese Gedanken waren natürlich den mecklenburgischen Ständen äußerst angenehm. Sie hofften dadurch auf Erleichterung ihrer Absicht, das Privileg unmöglich zu machen. Nach längeren Verhandlungen gelang es endlich dem Freiherrn v. Borié, dem österreichischen Direktorialgesandten 62 ). im Gegensatz zu den Bestrebungen des kurbrandenburgischen Gesandten v. Schwarzenau ein Reichsgutachten zustande zu bringen 63 ), "daß zu dem besagten Friedensschlusse und dessen zugehörigen, dem Reiche mit vorgelegten Akten und Konventionen des Reichs Beitritt und Einwilligung, jedoch unter der bedinglichen Voraussetzung und Zuversicht zu erteilen seien, daß sothaner Friedensschluß (wie es sich von selbst verstehe) 64 ) den Rechten des Reiches, dem Westfälischen für beide Religionsteile mit wechselweisen gleichen Rechten bestehenden Frieden und übrigen Reichsgrundgesetzen, oder jemand anderen an seinem erweislichen und behöriger Orten gebührendermaßen auszutragenden Rechte für jetzt und künftighin in keinem Fall zum Nachteil gereichen möge und solle." Mecklenburgs Gesandter v. Gemmingen hatte seine Stellung mit Preußen vereinbart, aber in seinem Votum alle Rechte betont (reservatis reservandis). Man war mit dem Ergebnis in Schwerin sehr zufrieden und hoffte, da der Kaiser dem Teschener Frieden in allen seinen Teilen beitrat, sei die Erteilung des nachgesuchten Privilegs sicher. Während des Winters war wenig in der Angelegenheit geschehen. Die Kaiserin Maria Theresia und Kaunitz hatten im November 1779 herzogliche Schreiben bekommen, in denen auch sie gebeten wurden, das Gesuch zu befürworten. Die preußische Ge-


|
Seite 236 |




|
sandtschaft (der Baron v. Riedesel und der Resident v. Jakobi-Klöst) 65 ) wurde vom König beauftragt, bei der Erledigung der im Friedensschluß angeregten Privilegsache mitzuwirken. Auch der Herzog bediente sich jetzt ganz der Hilfe Jakobis. Die ersten Berichte aus Wien lauteten nicht gerade hoffnungsfreudig. Die Umtriebe der Stände fanden williges Gehör. "Es ist leicht begreiflich, daß, da der kaiserliche Hof schwer an die Einschränkung seiner Gerichtsbarkeit durch Erteilung uneingeschränkter Appellationsprivilegien kommt, und die Reichsgerichte sich das Herzogtum Mecklenburg am wenigsten gern entziehen lassen, man die Vorstellungen eines Teils der Ritterschaft, welche durch Emissarien und Bankerotteure verleitet ist, mit Vergnügen aufnimmt, um einen Vorwand zu haben, die Erfüllung des 15. Artikels des Teschener Friedens abzuweisen" 66 ). Diese Ansicht der preußischen Minister kennzeichnet die Politik Wiens in dieser Angelegenheit während der nächsten Zeit. Allerdings erklärte die Kaiserin Maria Theresia dem Gesandten v. Riedesel, daß sie sich dem Friedensvertrag gemäß für die Erteilung des Privilegs beim Kaiser verwenden werde. Das Gleiche teilte Kaunitz im Auftrage der Kaiserin in der Antwort dem Herzog mit.
Der Kaiser selbst schien geneigt, zunächst ein Gutachten des Reichshofrats einzufordern; denn die Stände pochten auf ihre Rechte im Erbvergleich, in dem der Herzog versprochen hatte, "er werde den Berufungen an die Reichsgerichte den uneingeschränkten Lauf lassen", und spiegelten dem kaiserlichen Hof die Verleihung des Privilegs als bedenklich vor, weil das königlich preußische Haus beim Aussterben des herzoglichen in Mecklenburg sukzedieren werde 67 ). Der erste Bescheid, den der Geheime Reichsreferendar v. Leykam Jakobi erteilte, besagte, daß der Kaiser "überhaupt nicht ungeneigt sei, die unumschränkte Appellationsprivilegia,. insoweit solche niemand in seinem Recht verkürzen, zu erteilen, da solche wirklich öfters der Prozeßsucht der Untertanen Einhalt tun könnten". Nun wäre es aber auf der anderen Seite gewiß, daß bei despotischen Grundsätzen der Landes-


|
Seite 237 |




|
herren die Untertanen durch dergleichen Privilegia der Mißhandlung preisgegeben würden. Aus diesem Grunde wolle der Kaiser erst den Reichshofrat hören.
König Friedrich von Preußen war mit dieser Wendung nicht einverstanden; er meinte, daß man durch gerichtliche Erörterung der Sache seiner Verwendung ausweichen wolle, und er gab seinem Gesandten die strikte Anweisung, daß die Erteilung des Privilegs an Mecklenburgs Herzog Sache des Friedensschlusses sei; das Reichshofratsgutachten dürfe auf die Ausführung keinen Einfluß haben, wenn man auch seine Einforderung dem Kaiser nicht verwehren könnte. Das preußische Ministerium teilte jeden Schritt, der in der Sache getan wurde, bald nach Schwerin mit. Es war eine gute Gelegenheit für das Berliner Kabinett, in Wien immer wieder Vorstellungen zu erheben und dadurch Mecklenburg an sich zu binden.
Herzog Friedrich und seine Minister in Schwerin versprachen sich sehr viel von der preußischen Verwendung und beauftragten den Residenten v. Jakobi jetzt offiziell, die Sache zu betreiben. Allerdings scheute man sich, die Schreiben unmittelbar an ihn zu richten; sie wurden durch den Baron v. Lützow, der sich zeitweise in Berlin aufhielt, weitergegeben, "um den éclat zu vermeiden, den eine gelegentliche Estafette aus Mecklenburg an die kgl. preußische Gesandtschaft in Wien machen könnte" 68 ). Da Freiherr v. Leykam in einem Gespräch Jakobi gegenüber geäußert hatte, daß die Herzöge sich sonderbarerweise in ihrem Gesuch gar nicht auf den Teschener Friedensvertrag berufen hätten, wurde Jakobi beauftragt, darauf zu entgegnen, daß man dies aus Rücksicht für den Kaiser unterlassen habe, der das Privilegium eben nicht auf Grund des Friedens, sondern aus freier Entscheidung erteilen möge. Es wurde auch ein neues Schreiben an den Kaiser gesandt (am 20. März 1780), in dem wieder die Bitte um Erteilung des Privilegs ausgesprochen wurde, diesmal aber unter Berufung auf den Beitritt des Kaisers zum Teschener Friedensvertrage. Auch die größten Mächte Europas 69 ) wären Garanten dieses Vertrages und, wenn sich auch die Stadt Rostock und die Ritterschaft dagegen auflehne, so würde der Kaiser doch sicher darauf nicht achten, sondern baldigst das Privileg erteilen, das einst Wallenstein für Mecklenburg schon erhalten habe.


|
Seite 238 |




|
Aber trotz aller Anstrengungen, die Jakobi in Wien machte, verlautete lange Zeit nichts in dieser Angelegenheit. Freudig wurde in Schwerin eine Schrift des kgl. dänischen Etatsrats Joh. Jakob Moser aufgenommen: Der Teschenische Friedensschluß vom Jahre 1779. Er erklärte darin zu dem 15. Artikel, daß Mecklenburg als Äquivalent für Leuchtenberg das Privilegium de non appellando illimitatum erhalten werde. Dieselbe Freiheit besäßen die meisten weltlichen und geistlichen Kurfürsten auch für ihre neu erworbenen Länder, ferner Schweden für Vorpommern. Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt, Nach der kaiserlichen Wahlkapitulation Art. 18 § 6 sollte der Kaiser bei Erteilung solcher Vorrechte "die Notdurft väterlich beobachten", d. h. sparsam damit umgehen, um die Jurisdiktion des Reiches nicht zu beschränken. Er könne aus eigener Macht das Recht verleihen und sei darin nicht vom Reich abhängig 70 ). Die weitere Auslegung Mosers betonte, daß Preußen und Österreich das Gesuch des Herzogs unterstützen müßten, und daß nun die vielen Streitigkeiten mit den mecklenburgischen Landständen leichter erledigt werden könnten. Die im Jahre 1746 gedruckten Decisiones Imperiales in causis Mecklenburgicis machten einen kleingedruckten Folianten aus, welcher 886 meistens vom Reichshofrat ergangene gerichtliche Erkenntnisse von 1660 bis 1746 enthielt. Der kaiserliche Hof hätte Mecklenburg die Herrschaft Wiesensteig 71 ) oder dergleichen lieber gegönnt.
Dies merkte man auch aus dem ferneren Verhalten des kaiserlichen Hofes. Im April wurde Jakobi ein Vergleich zwischen Herzog und Ständen vorgeschlagen. Er berichtete an den Herzog,. der ebenso wie seine Gegner nicht darauf einging. Dann wurde bald die Abwesenheit des Kaisers, bald eine Krankheit oder Arbeitsüberlastung eines Reichshofrats als Grund für das Zögern angegeben. Der Sommer brachte keinen Fortschritt, erst als der Herzog am 27. Oktober Schreiben an den Fürsten von Colloredo und an den Freiherrn von Leykam richtete und diese bat, jetzt wirklich die unberechtigten Widersprüche der Stände abzuweisen, schien es, als ob der Reichshofrat die Sache in Angriff nehmen wollte. Aber auch die Ritterschaft war eifrig tätig. Jakobi be-


|
Seite 239 |




|
richtete am 14. November sogar, daß die Gegner hofften, bald werde ein für die Stände günstiges kaiserliches Konklusum erfolgen. Im übrigen beschwerte er sich über das schlechte Zusammenarbeiten mit dem mecklenburgischen Reichshofratsagenten v. Ditterich, der natürlicherweise enttäuscht war, daß er nicht alles. allein unternehmen durfte, was in der Angelegenheit zu geschehen. hatte. Ferner ließ der preußische Resident durch den Legations-Sekretär Regierungsrat Becker in Regensburg beim Herzog anfragen, ob er Geldmittel bekommen könnte, die er bei einem glücklichen Ausgang der Sache verwenden wollte 72 ). Er bekam sofort einen Kreditbrief über 1000 fl. zu diesem Zweck. Aber soviel der Herzog auch tun mochte, das Reichshofratsgutachten und die kaiserliche Entscheidung ließen noch immer auf sich warten. Die preußische Unterstützung reichte eben doch nicht aus, im Gegenteil, der Kaiser war nicht geneigt, König Friedrich einen Gefallen zu erweisen, besonders da es sich um eine Verringerung der Reichsgewalt handelte. Man gewinnt den Eindruck, daß Preußen eben auch nicht sonderlich viel daran gelegen war, daß Mecklenburg das Privileg schnell erhielt, wenn auch die preußischen Minister in ihren Schreiben wiederholt betonten, daß sie alle Hebel in Bewegung setzten, um die Wünsche des Herzogs zu erreichen.
In dieser Zeit vollzog sich die Wendung Rußlands zu Österreich. Bis dahin hatte es auf Preußens Seite gestanden und noch beim Teschener Frieden als Garant einen maßgebenden Einfluß gehabt. Jetzt aber war es Joseph II. gelungen, die russische Kaiserin Katharina II. für sich zu gewinnen 73 ). Für Mecklenburg sollten diese Verhältnisse insofern Bedeutung gewinnen, als nach dem Tode Maria Theresias (29. November 1780) Preußen in Petersburg und Paris aufs neue durch seine Gesandten auf die Erfüllung des 15. Artikels des Teschener Friedens hinweisen ließ. Diesen Schritten folgte der Herzog mit Schreiben an Katharina im Februar 1781 und an den Grafen Panin; man wußte, daß in Petersburg viel Gewicht auf die Durchführung des Teschener Friedens gelegt wurde, versprach sich von der russischen Verwendung sehr viel, und wenn auch der König von Frankreich, der als Garant des Friedens durch den mecklenburgischen Ministerresidenten Graf Diodati in Paris um Unterstützung gebeten worden war, sich der Sache annahm, konnte ein Erfolg nicht ausbleiben.


|
Seite 240 |




|
Wirklich kam jetzt die Angelegenheit beim Reichshofrat in Bewegung, aber im ungünstigen Sinne 74 ) 75 ). Im Auftrage des Kaisers teilte Fürst Colloredo dem Baron v. Riedesel mit, daß eine Entscheidung in Rücksicht auf Rußland, Frankreich und Preußen gefällt sei. Die Einwände der Ritterschaft wären als unbegründet abgewiesen, aber bei der Errichtung eines Oberappellationsgerichts müßten die Landstände mitwirken. Das Reichshofratskonklusum erfolgte am 11. April, am 14. April stimmte der Kaiser zu, und es wurde durch den Agenten v. Ditterich nach Schwerin gesandt, wo es am 25. April eintraf 76 ). Die Entscheidung erregte bei dem Herzog und seinen Räten große Enttäuschung, sie enthielt so viele Einschränkungen, namentlich in ihrem ersten Teil. Auf alle älteren Rechte der Ritterschaft und der Stadt Rostock, vor allem aber auf den Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich war Rücksicht genommen worden, so daß von einem Privilegium de plane non appellando illimitatum keine Rede sein konnte. Die Minister hatten vielmehr allen Grund, zu sagen, daß das hiernach ausgefertigte Privileg ein Privilegium limitatum sein werde, das man bereits besitze. Diese Ansicht brachte der Herzog bei seinem Dank an den König von Preußen vom 5. Mai zum Ausdruck, auch an den Fürsten Colloredo erging ein Schreiben 77 ), in dem die Enttäuschung unverhohlen ausgesprochen wurde; die vielen Einschränkungen und auch die Bestimmung, daß man sich wegen der Besetzung des Oberappellationsgerichtes mit den Ständen einigen sollte, seien gar nicht willkommen. Der Herzog wünsche aber, möglichst schnell ein Ende mit den Schikanen zu machen.
Aus diesem Grunde wurden auch die Stände am 3. Juli aufgefordert, Deputierte nach Schwerin abzusenden, um über die Einrichtung des Gerichtes mit der Regierung zu verhandeln. Die Antwort des Engeren Ausschuß war die Mitteilung, daß Abgesandte in Schwerin nicht erscheinen würden, sondern daß man Berufung gegen das kaiserliche Konklusum vom 11. April einlegen werde. Nun sah sich der Herzog genötigt, um weitere Unterstützung in Berlin, Petersburg und Paris nachzusuchen. Aus


|
Seite 241 |




|
Berlin traf auch bald die Versicherung ein, daß man der Sache zu ihrem Erfolg verhelfen werde. In Petersburg war der russische Etatsrat Aepinus, dessen Bruder Rostocker Professor und herzoglicher Geheimer Kanzleirat war 78 ), bei dem russischen Vizekanzler Ostermann für den Herzog tätig. Als Erfolg kam auch im Oktober ein Schreiben mit Versprechungen Ostermanns, man werde sich für den Herzog in Wien verwenden. In Paris versuchte der mecklenburgische Bevollmächtigte Graf Diodati bei Vergennes die erwünschte Instruktion für den Grafen v. Breteuil, den französischen Gesandten in Wien, zu erreichen, die ihm auch zugesichert wurde.
Am kaiserlichen Hof war wieder die preußische Gesandtschaft und der Reichshofratsagent v. Ditterich tätig. Vor allen Dingen sollte eine Ablehnung der Revision der Stände erreicht und dem Kaiser vorgestellt werden, daß die Verleihung des Privilegs eine bloße Gnadensache sei. Die Einsprüche der Stände sollten in Wien möglichst verächtlich gemacht werden: "Dieser ausgelassene Haufe entblödet sich nicht, sogar ein Remedium juris zu ergreifen" 79 ). Die Minister teilten Jakobi mit, daß sie dem Wunsche der Wiener Reichshofräte entsprechend einen Entwurf für das Oberappellationsgericht nach dem Muster von Celle ausgearbeitet hätten, aber dem Landtag würden sie diesen Plan nicht erst vorlegen, da sie "nicht die geringste Hoffnung eines guten Erfolgs und der Ermannung des blöden vernünftigeren Teils gegen die rasenden Schreier" entdecken könnten. "Unerhört und ohne Exempel bleibe es allemal, daß ein unpatriotischer Teil der eigenen herzöglichen Vasallen und Untertanen, unter der Anführung einiger böser Schuldner, welche die letzte Instanz in ihren Debitsachen am liebsten - wenn es möglich wäre - in Ostindien haben möchten, mit solchem Erfolg wider die wohltätige Vereinbarung der europäischen Höfe sollte angehen können." Aber nicht allein die Einsprüche der Stände waren schuld daran, daß der Herzog um das Privilegium illimitatum soviel Bemühungen anwenden mußte, der Hauptgrund lag in der Abneigung des Kaisers, den Einfluß der Reichsmacht weiter einzuschränken 80 ).


|
Seite 242 |




|
Trotz mehrfacher Bemühungen in Wien und Petersburg gelang es dem Herzog nicht, eine zusagende Antwort in Sachen des unbeschränkten Privilegs zu erhalten. Auch ein erbetenes Provisorium, das Jakobi unter Berufung auf das 1651 erweiterte Privileg nachsuchte, wurde von dem Geheimen Reichsreferendar v. Leykam abgelehnt. Mecklenburgs Herzöge hatten sich des 1629 Wallenstein verliehenen Privilegs aus Widerwillen gegen alles von ihm Herrührende nur kurze Zeit bedient und hatten dann 1651 eine geringe Beschränkung des Berufungsrechtes der Stände erreicht.
Auch die Anstrengungen des Herzogs in Petersburg wollten keinen Erfolg haben, obwohl Aepinus 81 ) unermüdlich tätig war.
Der Wiener Hof hüllte sich in Schweigen, obwohl einerseits Herr v. Viereck im Auftrag der Stände und andererseits die preußische Gesandtschaft für den Herzog unablässig tätig war. Jakobi bekam jetzt sogar eine jährliche Gage von 1500 fl., die ihm während des ganzen Aufenthalts in Wien bis zum Jahre 1792 vom Herzog gezahlt wurde. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß die Revision der Stände angenommen und die ganze Angelegenheit aufs neue verhandelt werden würde. Auch ein Schreiben des Herzogs an den Staats- und Vizekanzler v. Cobenzl, das Jakobi am 9. Januar 1782 überreichte, hatte keinen Erfolg. Endlich äußerte Leykam am 25. Januar seine "Privatgedanken" über die Sachlage und meinte, der Herzog täte am besten, einen Vergleich einzugehen, denn sonst könne die Angelegenheit noch mehrere Jahre hindurch dauern. Der Herzog wies nachdrücklich darauf hin, daß von einem Vergleich keine Rede sein könnte, da die Ritterschaft ja überhaupt von einer Einführung des Privilegs nichts wissen wolle, und dann sei jede Auseinandersetzung über die Art und Weise der Durchführung zwecklos. Am 2. Februar meldete Jakobi, "er habe aus sicherer Quelle, daß der Kaiser schon eine ganz günstige Resolution gefaßt habe, womit man sehr zufrieden gewesen wäre, aber da habe kurz vor der Bekanntgabe jemand


|
Seite 243 |




|
dem Kaiser mitgeteilt, es bestände die Möglichkeit zu einem Vergleich, und eine förmliche Entscheidung könne vermieden werden, welche, sie möchte ausfallen wie sie wolle, immer Gelegenheit geben würde, den Kaiser mit neuen Klagen und Vorstellungen zu behelligen; die Sache würde noch gar an den Reichstag gehen. Darauf hätte der Kaiser entschieden: nachdem Hoffnung zum Vergleich vorhanden sei, habe der Reichshofrat inzwischen mit allem ferneren Verfahren innezuhalten" 82 ). Ferner ließ Leykam Jakobi wissen, daß die Einmischung anderer Höfe sehr ungern gesehen würde 83 ).
In Schwerin wurde man jetzt unruhig und glaubte, sich nicht mehr ganz auf die preußische Hilfe verlassen zu dürfen. Das beweist. ein Schreiben des Herzogs an Ostermann vom 5. März. Nach den freundlichen Mitteilungen aus Petersburg und von der russischen Gesandtschaft in Wien habe er gehofft, bald nach der Erledigung der Sache dem Minister seinen Dank aussprechen zu können. Statt dessen habe der Kaiser erklärt, daß ein gerichtliches Verfahren nicht mehr stattfinde, aber das Privileg sei nicht erteilt und die gewährleistenden Höfe seien nicht benachrichtigt. Der Herzog sei völlig überzeugt, daß diese anscheinende Abneigung des Kaisers gegen die Erfüllung des kleinsten Punktes im Teschener Frieden einen anderen und wichtigeren Grund haben müsse "als das so ungegründete blinde Geschrei eines einzigen, das wahre Wohl des Vaterlandes nur aus Nebenabsichten verkennenden Teils der Untertanen und deren in der Person eines Bankerotteurs abgeordneten Deputati". Er denke vielmehr, daß der eigentliche Grund in dem Mißvernehmen zwischen Preußen und Österreich liege, weil sich der preußische König für die Sache eingesetzt habe 84 ). Jetzt möchte doch Rußland seinen ganzen Einfluß in Wien ausüben. - Wir sehen, wie die politische Einstellung der Großmächte von dem Herzog in diesem Augenblick benutzt werden sollte.


|
Seite 244 |




|
Trotzdem ging noch am 4. März ein Schreiben nach Berlin mit der Bitte um nachdrückliche Unterstützung. Die Sache läge ganz in den Händen Colloredos und Leykams, die man zu gewinnen versuchen müßte. Auch in Paris wurde durch Diodati wieder angefragt.
Am 16. März sprach Jakobi mit Leykam 85 ) und bekam zur Antwort, daß er selbst nicht wisse, weshalb der Kaiser keine Entscheidung bekanntgebe; wenn die Gesandtschaften von neuem darauf dringen wollten, würde ein Vortrag beim Kaiser geschehen. Nun wurden der preußische, russische und französische Gesandte ersucht, den Reichsvizekanzler an die Sache zu erinnern. Alle drei versprachen es, der Baron Riedesel tat es sogar noch am gleichen Abend. Leykam deutete immer wieder einen Vergleich an, Jakobi erwiderte aber, daß für den Herzog die unbedingte Einräumung des Privilegs von seiten der Stände Vorbedingung für alle Vergleichsverhandlungen über die Ordnung und Errichtung des Oberappellationsgerichtes sei. Das Privilegium sollte ein illimitatum sein, etwas anderes käme für den Herzog nicht in Frage 86 ). Am 24. März fragte plötzlich Leykam, ob Jakobi bald das Beglaubigungsschreiben des Herzogs von Mecklenburg erhalten werde, das der Hofrat Bouchholz in Aussicht gestellt hätte (das ist nicht zutreffend, wie B. selbst bemerkt). Leykam setzte hinzu, daß es wohl gut wäre, wenn man endlich wissen würde, mit wem man es zu tun hätte. Obwohl ja schon mehrere Akkreditierungsschreiben für Jakobi nach Wien gegangen waren, wurde in Schwerin noch am 16. April ein von beiden Herzögen unterzeichnetes Schreiben an Colloredo gesandt, das sich allerdings nur auf die Privilegsache bezog. Dabei wurde dem Residenten mitgeteilt, daß man ihn "nach glücklicher Erledigung der Angelegenheit je nach dem Stande des sodann zwischen den hohen Höfen zu Wien und Berlin vorwaltenden besseren oder schlechteren Vernehmens entweder öffentlich oder unter der Hand für den sonstigen Betrieb der herzoglichen Angelegenheiten" gebrauchen werde.
Jetzt wurde vom Herzog ein gemeinsames Vorgehen der Gesandten in Wien erwartet; denn er teilte Jakobi mit, daß ihm aus Petersburg und Paris ein "eifriges Betreiben der Angelegenheit" versprochen sei. Am 3. April meldete Jakobi, daß der französische Botschafter krank sei und Fürst Gallizin die Osterandachten habe, und sie deswegen noch nicht bei Colloredo gewesen seien, es


|
Seite 245 |




|
aber bei nächster Gelegenheit nachholen wollten. Am 10. April waren sie endlich beim Reichsvizekanzler und empfahlen ihm die Sache recht angelegentlich, wie sie versicherten 87 ). Colloredo sollte nur kurz geantwortet haben, er werde dem Kaiser ungesäumten Vortrag deshalb machen. Jakobi meinte, jetzt sei bald eine Entscheidung zu erwarten, aus Petersburg würde sicher sofort für Gallizin ein bestimmter Befehl eintreffen, wenn erst der Legationsrat v. Koch, der die Sache ja kenne, sich dort darum bemüht habe. Sonst sei jeder gemeinsame Schritt der Gesandtschaften erst nach langen beschwerlichen Unterhandlungen möglich. - Eine große Enttäuschung war in Schwerin, als am 20. April Jakobi berichtete, daß er mit Leykam gesprochen und von ihm erfahren habe, daß Fürst Gallizin überhaupt nicht bei Colloredo vorstellig geworden sei, "Sondern daß er nur, wie Leykam sich ausdrückte, von ungefähr etwas fallen gelassen haben mag, worauf der Reichsvizekanzler nicht attendieret haben möchte". Jakobi ließ sofort durch die russische Gesandtschaftskanzlei den Fürsten an sein Versprechen erinnern, welches er dem französischen Botschafter ausdrücklich wegen einer gemeinschaftlichen Vorstellung gegeben hatte. Gallizin selbst ließ sich wegen Unpäßlichkeit nicht sprechen. Jetzt wurde versucht, durch eine kleine Noteden Kaiser zu erinnern 88 ). Die Reichskanzlei weigerte sich indessen, dem Kaiser die Sache vorzutragen, wenn nicht alle beteiligten Gesandtschaften einen gemeinsamen Schritt täten. "Wenn das auch erreicht sei, würde sicher auszusetzen sein, daß Mecklenburg-Strelitz nicht auch vorstellig geworden wäre," meinte Jakobi. Am 26. April hatte endlich Gallizin mit Colloredo von der Sache gesprochen, und der Kanzler hatte ihm geantwortet (wie Gallizin Jakobi mitteilte), er habe bereits dem Kaiser die Angelegenheit vorgetragen und den Auftrag erhalten, bekanntzugeben, daß dem Reichshofrat das Fortschreiten in der Revision in via juris befohlen wäre. Das bedeutete eine Zulassung der Berufung. Aber sonderbarerweise erklärte der Referent v. Heß, der Reichshofrat wisse noch nichts davon, und auch Leykam sagte, ihm sei nichts davon bekannt, es müsse ein Irrtum vorgekommen sein. Gallizin habe wohl nicht recht verstanden oder Colloredo habe sich wegen seines Alters und harten Gehörs geirrt. Die Gesandten sollten nur kleine Erinnerungsnoten vorlegen. - Der Fürst Gallizin blieb indessen bei seiner Behauptung, er habe Colloredo sehr gut verstanden. Als Riedesel dann Leykam Anfang Mai zur Rede stellte, bekam auch er die Antwort, daß nach seiner


|
Seite 246 |




|
Ansicht ein Mißverständnis vorliege, Fürst Colloredo hätte sich undeutlich erklärt, "weil Fremde von Reichsgeschäften nur dunkle Begriffe hätten, und weil der Fürst sich zuweilen in französischer Sprache dunkel ausdrücke" 89 ). Leykam versicherte 90 ), der Kaiser habe noch keine Resolution gefaßt, die Sache liege noch ganz, wie sie gewesen sei, als Riedesel das letzte Mal bei Colloredo angefragt habe. Ob die Gesandtschaften neue Vorstellungen erheben sollten, stünde ganz in ihrem Belieben. Eine kaiserliche Antwort würde erfolgen, wann, sei ungewiß; es könnte ein Jahr dauern, und am Ende sei doch ein Vergleich nötig. Die Frage, ob das Privileg erteilt werden solle (quaestio an), sei entschieden, es komme nur noch auf die Ausführung an (quo modo). Darauf antwortete Riedesel, daß die Stände die quaestio an eben nicht als entschieden ansähen, sondern dagegen gerade Berufung einlegten 91 ). Leykam blieb bei seinem Rat zu einem Vergleich und meinte, der Kaiser würde selbst Vorschläge machen, nach denen sich die Parteien vergleichen könnten. Einige Punkte in den Einschränkungen müßten vielleicht noch näher bestimmt werden; jedenfalls werde er sich der Sache weiter annehmen. Riedesel gewann den Eindruck, als wenn es Leykam gar nicht auf eine kaiserliche Resolution ankomme, sondern daß er einen Vergleich herbeiführen wollte, der ganz unmöglich war. Den Grund für diese Bemühungen sah der preußische Gesandte darin, daß dem Kaiser mitgeteilt war, ein Vergleich stehe in Aussicht, und jetzt scheute man sich, erneut die Sache zu betreiben, und wollte auch wirklich einen Vergleich herbeiführen.
Auch nach Berlin hatten Jakobi und Riedesel von den Vergleichsvorschlägen berichtet. Darauf erfolgte ein Schreiben des Königs, der seine Gesandten anwies, auf solche Verhandlungen nicht einzugehen, vielmehr die fremden Botschafter, deren Höfe Unterstützung zugesagt hätten, recht eindringlich an die Erledigung der Sache zu mahnen. Von dieser Antwort gaben die preußischen Räte nach Schwerin Kenntnis.
Hier war inzwischen eine Nachricht des Grafen Diodati aus Paris eingetroffen 92 ), weiche große Entrüstung erregte. Der kaiserliche Gesandte Graf Mercy hatte nämlich dort erklärt, daß


|
Seite 247 |




|
die Privilegsache nur durch einen Vergleich beigelegt werden könnte; denn die mecklenburgischen Stände seien sehr wohl zu ihren Widersprüchen berechtigt. Darauf erging sofort eine Anweisung nach Paris, Graf Diodati sollte bekanntgeben, daß der Reichshofrat längst die Berechtigung des Privilegs anerkannt habe, und es sei nicht zu erwarten, daß der Kaiser sich von seiner "einmal ergangenen hohen kaiserlichen Decision wieder entfernen werde". Jakobi wurde am 13. Mai mitgeteilt, daß der Herzog sehr enttäuscht sei. Man habe "von der Wirkung der großmütigen Verwendung der drei Höfe mehr erwartet". Auch das Verhalten des Gesandten in Paris habe recht befremdet und man sehe, in wessen Händen die Sache liege (Leykams). Jakobi sollte auf die Taxen für das Privileg hinweisen. Vielleicht fielen diese in Wien etwas in die Wagschale. Der Kanzleirat Aepinus in Rostock wurde ersucht, durch seinen Bruder den etwaigen falschen Vorspiegelungen des kaiserlichen Gesandten in Petersburg vorzubeugen und sich dabei auf das Reichshofratskonklusum vom 11. April 1781 zu stützen. Alle Schritte in Petersburg und Wien nützten nichts, und immer deutlicher erkannte man in Schwerin die Absicht des kaiserlichen Hofes, es zu keinem Privilegium illimitatum kommen zu lassen.
Der Kaiser hatte inzwischen die Zarin und den König von Frankreich als Garanten des Teschener Friedens ersucht, ihre Bemühungen anzuwenden, daß die mecklenburgische Privilegsache auf gütlichem Wege geendigt werden könnte. Katharina ging darauf ein und erteilte ihrem Gesandten in Paris dahingehende Anweisungen. Nach Vereinbarung mit Frankreich wollte sie durch den russischen Gesandten v. Groß in Hamburg dem Herzog nähere Mitteilungen zugehen lassen. Ostermann versicherte dem Herzog, die Kaiserin bleibe auf alle Fälle dabei, daß dem herzoglichen Gesuch nach dem wörtlichen Sinn und Inhalt des Teschener Friedens Genüge geschehe 93 ). Die preußische Gesandtschaft in Petersburg war von diesen Dingen gar nicht in Kenntnis gesetzt. Diese Wendung hatte Cobenzl, der kaiserliche Gesandte, dort erregt. indem er erklärt hatte, der Kaiser könne das Verfahren gegen das Reichshofratskonklusum nicht wieder aufnehmen, weil der Herzog eine Revision ablehne, und ihm seien die Hände gebunden, da es nicht in seiner Gewalt stände, eine Wiederaufnahme anzubefehlen. Wie Herr v. Koch nach seiner Rückkehr dem Etatsrat Aepinus


|
Seite 248 |




|
erzählte, stand Leykam auf Seiten der Ritterschaft und beeinflußte den Kaiser so stark, daß die Sache daher diese Schwierigkeiten hatte 94 ).
Den Absichten der mecklenburgischen Stände war diese Wendung sehr willkommen, sie wollten die Sache möglichst hinziehen, bis das Interesse der Höfe ganz erlahmt sei. Der kaiserliche Hof dachte wirklich an einen Vergleich; eine ungenannt gebliebene Person überreichte Jakobi am 22. Mai den Entwurf dazu, der nach Schwerin gesandt wurde. Er ging darauf hinaus, daß die Ritterschaft sich zwar der Ausfertigung des Privilegs nicht widersetzen, daß aber andererseits die Herzöge die Einschränkungen voll anerkennen sollten.
Jakobi stellte nun auch Leykam zur Rede 95 ) wegen der bekannten Äußerung des Gesandten v. Mercy in Paris. Die Antwort war, es müßte ein Mißverständnis vorliegen; denn das kaiserliche Ministerium sei der Ansicht, daß die Stände ein jus contradicendi in bezug auf die Ausnahmen und Einschränkungen des kaiserlichen Conclusi besäßen, von der Erteilung selbst sei dabei nicht die Rede gewesen. Als Jakobi weiter fragte, ob diese Äußerung des Mercy, die derselbe aus einer von dem Reichsvizekanzler erhaltenen Instruktion gemacht hätte, auch einer Entscheidung des Kaisers entspräche, erklärte Leykam, Joseph habe noch keine Entschließung gefaßt. Die Absicht dieser in Paris getanen Äußerung sei nur die gewesen, die Meinung des Herzogs über die Fassung des ersten Teils des Conclusi näher kennen zu lernen. Jakobi hielt jede Erörterung darüber für unnütz, solange die Frage der Erteilung noch nicht geklärt sei. Als Leykam auf die Vergleichsvorschläge zurückkam, meinte der preußische Resident, er werde den Herzog zu einem Schreiben an den Kaiser veranlassen, in dem der ganze Hergang der Angelegenheit und die Schikanen der Ritterschaft genau vorgestellt würden. Der Kaiser wollte ja ein Privilegium illimitatum erteilen, deshalb würde der Herzog um ein Provisorium einkommen, in dem die Ausnahmen des ersten Teils im damaligen Konklusum einfach fortfallen sollten. Ein solches Schreiben werde Jakobi dem Kaiser in einer besonderen Audienz überreichen. Leykam tat zunächst so, als ob ihm dieser Plan ganz gleichgültig sei, dann versuchte er aber Jakobi zu überzeugen, daß das beabsichtigte Vorgehen auch nur eine Verfügung des Kaisers an den Reichshofrat erwirken werde,


|
Seite 249 |




|
die Sache weiter in via juris zu behandeln, am besten sei doch ein Vergleich. Am Abend nach dieser Unterredung waren Jakobi und Leykam zusammen auf einem Diner bei dem kurpfälzischen Gesandten. Der Österreicher nahm den Residenten beiseite und sagte, er habe inzwischen mit Colloredo von dem Mißverständnis in Paris gesprochen und bei diesem auch die Ansicht gefunden, daß nur die Ausnahmen des Conclusi die Ritterschaft zu Einsprüchen berechtige. Aber die Absicht, ein Provisorium zu erreichen, werde niemals Erfolg haben.
Trotzdem eine Nachricht in Schwerin eintraf, daß Frankreich beabsichtige, in Hamburg Vergleichsverhandlungen ins Werk zu setzen, ging eine nachdrückliche, auf ein Provisorium gerichtete Anweisung des Herzogs, der übrigens ebensowenig wie die Stände von einem Vergleich wissen wollte, an Jakobi nach Wien. "Wir erwarten, daß S. Kaiserl. Majestät der Reichskanzlei aufgeben würde, daß sie ohne ferneren Anstand und des, der kaiserlichen Unbeschränktheit in bloßem Gnadensachen ebenso sehr als allen Reichsfürsten überhaupt und uns in specie zum offenbaren Nachteil, hingegen durch die Wahlkapitulation so wenig als sonst durch irgend ein Reichsgesetz nicht begründet, von einigen unserer zudringlichen und unruhigen Untertanen, auch den berüchtigten Bürgermeistern und Ratmännern der einzigen Stadt Rostock ganz ungebührlich zur Hand genommenen Remedii Revisionis ohngeachtet, ein Privilegium de non appellando illimitatum in allen der Maße und Form, wie solche Privilegia illimitata anderen altfürstlichen Häusern im Reiche und selbst dem Hause Mecklenburg vormals erteilt worden, für uns und unser herzogliches Gesamthaus auf alle gegenwärtig besitzende Lande ausfertigen und dasselbe gegen Erlegung gewöhnlicher Gebühr ungesäumt aushändigen solle." Der Resident sollte versuchen, die Zurücknahme der von Wien aus gemachten Einleitung zu Vergleichsverhandlungen zu erreichen.
Über diese Pläne wurde jetzt weiter bekannt, daß Österreich an Verhandlungen unter der Teilnahme von Frankreich und Rußland ohne Preußen etwa in Hamburg dächte, anderen Meldungen zufolge sollten sie in Wien stattfinden 96 ). Leykam bestritt überhaupt, daß Hamburg jemals in Aussicht genommen sei, aber bei seiner Ansicht über die guten Aussichten eines Vergleichs blieb er immer noch, obwohl ihm Jakobi vorstellte, wie sehr durch das lange Zögern und durch die etwaige Annahme der Revision das kaiserliche Ansehen geschmälert werden könnte.


|
Seite 250 |




|
Jakobi riet dem Herzog jetzt, ein Schreiben an den Kaiser abzusenden, um ihn von der Ansicht, ein Vergleich sei im Werke, zurückzubringen; einer eigenen Abschickung, die in Schwerin erwogen war, widersprach er. "Weit entfernt, daß Augustissimus dergleichen Abschickung als Zeichen besonderen Ehrerbietung ansehen, so vermutet er im Gegenteil darunter, wie die Erfahrung lehret, die besonderen Absichten, den zu sollicitierenden Sachen durch Nebenwege andere Wendung zu verschaffen. Der Kaiser ist gewohnt 97 ), nach den Ideen, die er sich in einer Sache gleich im Anfange gemacht hat, auf einem und dem nämlichen Wege fortzufahren." "Abschickungen" kämen ihm sehr ungelegen. Vielleicht aber spielte der Wunsch Jakobis dabei eine Rolle, lieber allein die Angelegenheit zu erledigen.
Am 1. August 1782 wurde dann ein gemeinschaftliches Schreiben der beiden Herzöge abgesandt. Sie beriefen sich darauf, daß der Kaiser habe versichern lassen, er werde das Privileg erteilen, wenn es ohne Schädigung der Rechte Dritter geschehen könne. Das Konklusum vom 11. April enthalte zwar viele Einschränkungen, aber da ein Privilegium illimitatum nachgesucht und in Aussicht gestellt sei, hofften die Herzöge bei der demnächstigen Expedierung würden diese Ausnahmen fortfallen, da ja die Rechte Dritter nicht geschädigt würden. In der festen, auf die "weltbekannte kaiserliche Gerechtigkeitsliebe" gegründeten Überzeugung, daß das Privileg baldigst erteilt würde, hätten die Herzöge mit den Ständen über die Errichtung des Oberappellationsgerichts verhandeln wollen, dieses Entgegenkommen sei zurückgewiesen, weil die Renitenten Revision einlegen wollten. Sie hätten auch Erfolg gehabt, und jetzt verlaute sogar, nur auf dem Wege eines Vergleichs mit ihnen könnte das Privileg erlangt werden. Das alles könne beweisen, daß den mecklenburgischen Landesherren kein Vorrecht ohne die Einwilligung von Ritter und Landschaft bewilligt werden könnte. Da es aber reine Gnadensache sei, wolle der Kaiser geruhen, die von den Widerspenstigen zum bloßen Verschleppen der Sache ergriffene Revision nunmehr sofort zu verwerfen und die Expedition der Reichskanzlei zu befehlen.
Nach langen Bemühungen gelang es endlich Jakobi, am 22. September eine Audienz beim Kaiser zu erhalten 98 ). Leykam


|
Seite 251 |




|
war auf einige Monate verreist, ein Umstand, der der Sache entschieden zu Hilfe kam. Jakobi überreichte das herzogliche Schreiben und trug die Wünsche Mecklenburgs vor. Joseph hörte alles aufmerksam an und erklärte, daß er nichts gegen das Privileg habe, aber der Reichsschluß über den Frieden sei nur salvo jure cuiuscumque erfolgt 99 ). Das Recht Dritter dürfe nicht verletzt Werden. Jakobi sagte, das habe der Reichshofrat bereits entschieden, ein jus tertii sei nicht vorhanden. Der Kaiser erinnerte an die Ausnahmen, die hätten gemacht werden müssen, jeder müsse sein Recht bekommen. Der Gesandte äußerte, die Ausnahmen im ersten Teil des Conclusi ließen sich nicht aus den Verträgen zwischen Ständen und Landesherrn begründen. Joseph unterbrach ihn und sagte: "Wenn den Landesherren ganz freie Macht über ihre Untertanen gegeben würde, würden sie Despoten und mit solchen machen können, was sie wollten." Jakobi berief sich auf Franz I., der mehrere solche Privilegia erteilt hätte (u. a. für Hessen-Kassel, Hessen-Darmstadt und einige preußische Länder), und es hätten sich die üblen Folgen, welche der Kaiser erwähnt habe, nicht gezeigt, das Gegenteil, die Wohlfahrt der Länder, sei eingetreten; außerdem seien selbstverständliche Klagen über verweigerte oder verzögerte Justiz ausgenommen. Der Kaiser meinte, die genannten Länder hätten auch nicht derartige Verträge gehabt wie die Mecklenburger, welche erst kürzlich (1755) darüber paktiert hätten. Der Resident erwiderte, in dem Vergleich von 1755 wäre aber keine einzige Stelle, welche den Widersprüchen der Stände Recht gäbe. Joseph erklärte, er wolle niemand sein Recht nehmen, hätten die Stände Unrecht, würden sie zum zweitenmal abschlägig beschieden werden. Die Revision würde nicht verworfen werden, ohne die Gründe dafür zu prüfen. Das vom Herzog erhaltene Schreiben würde er dem Reichshofrat übergeben und von dem hören, ob die Sache revisible sei oder nicht.
Die Audienz würde noch längere Zeit fortgesetzt. Der Kaiser kam auf die Vergleichsvorschläge zurück, versprach aber schließlich, die Sache nochmals prüfen zu lassen. Aus den Äußerungen Josephs ging deutlich hervor, wie wenig er geneigt war, die Rechte der Landesherren zu erweitern und in der Sache Mecklenburgs nachzugeben.
Jakobi trat sofort mit dem russischen und französischen Gesandten in Verbindung und nahm sich vor, falls in vierzehn Tagen kein Bescheid erfolgt sei, in der Reichskanzlei nachzufragen. War


|
Seite 252 |




|
auch wahrscheinlich keine Abweisung der Stände mit ihrer Revision zu erwarten, so war doch der Herzog mit dem Ergebnis der Unterredung zufrieden. Jetzt müßten Stimmen im Reichshofrat gewonnen werden, meinte er 100 ).
Inzwischen war der Schriftwechsel mit Petersburg eifrig gepflogen. Aepinus hatte wiederholt Aufträge erhalten und konnte mancherlei berichten 101 ), so die Äußerung der Zarin, die sich Jakobi bereits in der Audienz beim Kaiser zunutze machen konnte. Diese Erklärung war veranlaßt durch die Vorstellung des preußischen Gesandten v. Goerz, welcher mitgeteilt hatte, "daß S. Königl. preuß. Majestät als Hauptkontrahent des Teschener Friedens sich beschwert finden, daß der Wiener Hof diesen Vorschlag zu einem Vergleich Ihnen nicht mitgeteilt hätte, und daß sie überhaupt nicht zugeben würden, daß in dieser Sache etwas ohne Ihre Teilnehmung abgemacht würde, daß dieser ganze Vorschlag offenbar nur darauf abziele, die Sache in die Länge zu ziehen und gänzlich zu eludieren; daß die Herren Herzöge von Mecklenburg Sr. Majestät zu erkennen gegeben, daß sie sich auf die vorgeschlagenen Vergleichsverhandlungen nie einlassen würden, und daß demzufolge Ihre Majestät verlangten, daß der Artikel des Teschener Friedens ohne Ausflüchte endlich purement und simplement erfüllt würde und dieserwegen Ihrer kaiserlichen Majestät Garantie ausdrücklich reklamierten."
Aepinus riet zu einem Schreiben an die Kaiserin, das auch am 10. September 1782 gemeinschaftlich von Schwerin und Neustrelitz abging. Es enthielt eine nochmalige eingehende Darstellung der ganzen Angelegenheit und betonte vor allem, daß ein Vergleich nicht in Frage käme, da das Privileg aus den Händen des Kaisers eine Gnadensache sein sollte 102 ). Man bat um tätige Unterstützung in Wien. Gleichzeitig bekamen Ostermann und Aepinus Briefe des Herzogs, in denen beide um Vermittlung ersucht wurden. Aepinus sollte mit den nötigen Empfehlungen die Schreiben an die Kaiserin und den Minister übergeben, außerdem teilte ihm der Herzog den Wunsch mit, Katharina möge ein eigenes Handschreiben an Joseph richten und nicht nur durch Fürst Galizin die Sache betreiben lassen. Jakobi wartete nun auf einen Schritt Rußlands.


|
Seite 253 |




|
Leykam war inzwischen von seiner Reise zurückgekehrt, aber der Kaiser war jetzt in Böhmen (Oktober 1782), da konnte zunächst auf keine Entscheidung gerechnet werden. Preußen hatte in Wien angefragt, was die Nachrichten über einen Vergleich zu bedeuten hätten, und zur endlichen Erledigung der Sache gemahnt. Die Antwort war gewesen, man habe nicht die Ursache zu den Vergleichsgerüchten gegeben. So ging das Jahr 1782 ohne eine Entscheidung zu Ende.
Der Herzog versuchte jetzt Kaunitz für die Erteilung des Privilegs zu interessieren (13. Januar 1783) und schickte Jakobi ein Empfehlungsschreiben für den Staatskanzler. Die ausländischen Gesandtschaften hüllten sich in schweigen. Jakobi erfuhr nur, daß Fürst Gallizin Katharina berichten solle, wie Joseph über die Sache denke, da sie die Angelegenheit zu beendigen wünsche. Weiter war Jakobi die Mitteilung des Gesandten Cobenzl bekannt geworden, in Petersburg wolle man nichts tun, womit man in Wien nicht einverstanden sei. Nicht ganz im Einklang damit stand die Nachricht von Aepinus, nach der die Kaiserin auf Vorstellungen des Grafen Goerz erklärt hatte. Sie wolle jetzt mit Frankreich und Preußen gemeinsam alles tun, um die Sache zu erledigen. Petersburg und Wien stimmten in der Sache ganz überein. Cobenzl hatte auf Befragen übrigens zugegeben, daß die Verleihung des Privilegs Gnadensache sei, aber er hatte gemeint, es könnten andere frühere Privilegien dazwischen stehen, und vor allem Rostocks Vorrechte 103 ) erwähnt.
Und doch gab anscheinend das Interesse Rußlands den entscheidenden Anstoß, die Privilegiensache wieder in Angriff zu nehmen; denn jetzt wurde beim Reichshofrat eine Kommission gebildet aus dem Präsidenten v. Hagen, dem Vizepräsidenten Graf Überacker und den Reichshofräten v. Bartenstein, v. Heß, Baron Puffendorff und Braun. Diese sollten ein Gutachten über die Lage der Angelegenheit abgeben 104 ). In der Zeit vom 5. bis 10. Februar fanden Konferenzen statt, in denen auch das Schreiben des Herzogs an die Zarin den Räten vorlag (es war durch Cobenzl aus Petersburg eingesandt). Das Resultat wurde auf ausdrücklichen kaiserlichen Befehl geheimgehalten, Jakobi aber erfuhr


|
Seite 254 |




|
unter der Hand davon und konnte dem Herzog mitteilen, die Kommission wäre der Ansicht, daß die Revision der Stände nicht abgewiesen werden könnte. Der Kaiser müßte die "Notdurft für die Erteilung solcher Privilegia väterlich beobachten". Eine Erneuerung des Vorrechts von 1629 komme nicht in Betracht. Aus diesen Gründen könne aber auch ein Provisorium nicht verfügt werden. Allerdings wurde auch ein Vergleich als recht schwierig bezeichnet. - Dieses Gutachten wurde nach Petersburg gesandt, um "der Kaiserin eine den darin enthaltenen Grundsätzen angemessene Idee von der jetzigen Lage der Privilegsache zu geben und um sie zu überzeugen, daß, wenn auf der einen Seite die Revision, weil man sich darin nicht einlassen will, nicht kann erledigt werden, sodann auf der anderen auch kein Vergleich erzielet werden, dem Kaiser die Hände gebunden sind und Allerhöchstdieselben ohne dem ganzen Reich zu begründeten Klagen Gelegenheit zu geben, keinen Machtspruch tun können." Solche Ansichten waren nach Jakobis Nachrichten vorhanden, und er riet dem Herzog, sich mit der Aufnahme der Revision einverstanden zu erklären, da der Kaiser auch trotz aller fremden Fürsprache auf seinem Standpunkt bleiben werde."
In Schwerin konnte man sich zunächst mit diesen Gedanken aber durchaus nicht befreunden. Es wurde erwogen, ob man dem Kaiser die Lehnsnehmung anbieten könne, wenn er dagegen das Privileg erteile. Das Berliner Ministerium, dem man diese Absicht mitgeteilt hatte zugleich mit der Bitte um die Vermittlung eines Handschreibens der Zarin an Kaiser Joseph, antwortete, es werde selbst in der Lehnssache keinen Schritt tun, ließe aber Mecklenburg darin ganz freie Hand. Ein Handschreiben der Zarin könnte nicht vermittelt werden. Doch sollten die preußischen Gesandtschaften weiter die Bemühungen des Herzogs unterstützen 105 ). Auf die Erfolge fremder Verwendung hofften der Herzog und seine Räte immer noch. "Wir sehen nicht ab, wer und was den Herzog zwingen kann, über die Friedenserfüllungssache sich in eine Revision einzulassen," schrieben sie am 31. März nach Neustrelitz.
Doch gehörte das Auftreten der fremden Höfe nach Jakobis Ansicht zu den frommen Wünschen 106 ). Gallizin tat nichts, die Kaiserin selbst hatte nach Wien geschrieben, "Sie fände die Gründe erheblich, welche bisher die Privilegsache verzögert hätten, sie wolle also die Beendigung derselben bloß von Sr. Majestät gerechten


|
Seite 255 |




|
Denkungsart erwarten und die Art und Weise Höchsteigenem Gutfinden überlassen". Den ganzen Frühling über geschah nichts, der Kaiser war auf Reisen, der Fürst Colloredo im Bad. Erst Ende Juni erinnerten die drei Gesandten (von Rußland, Preußen und Frankreich) den Vizekanzler wieder an die Sache, er sicherte einen Vortrag beim Kaiser zu 107 ). Jakobi begab sich zu Kaunitz und überreichte ihm das herzogliche Schreiben, das er solange zurückgehalten hatte, weil er meinte, der Staatskanzler würde nur bei gleichzeitiger Verwendung der fremden Höfe Unterstützung versprechen, wie er es nun auch wirklich tat.
Indessen hatte man sich in 'Schwerin doch für die Annahme der Revision. entschlossen. Das preußische Ministerium hatte geschrieben 108 ): "Die gegenwärtigen Konjunkturen und politischen Verbindungen 109 ) haben auch auf diese Sache einen sehr ungünstigen und nachteiligen Einfluß." Aepinus aus Petersburg berichtete von der Aussichtslosigkeit, auf Rußlands nachdrückliche Hilfe zu hoffen 110 ). - So teilte der Herzog Jakobi am 30. Juli mit, daß das "Mitangehen der Revision wohl nötig sei". Aber es sollten Vorkehrungen getroffen werden, daß eine ungünstige Entscheidung des Reichshofrates nicht bekannt werde. Jakobi hatte das früher schon versprochen.
Da geschah etwas Unerwartetes, der Kaiser schrieb am 16. August ein Handbillet an den Präsidenten v. Hagen, die Privilegiensache solle wieder in Gang gebracht werden, der Reichshofrat solle berichten, ob die Ritterschaft (!) wieder etwas vorgebracht hätte. Jakobi schrieb diese Wendung dem Einfluß des Fürsten Kaunitz zu, den er nochmals aufgesucht und der ihm Vortrag beim Kaiser versprochen hatte. Zwar sagte er, das Privileg könne nicht brevi manu erteilt werden, aber es sei eine Rechtssache, die erledigt werden müßte. Auch Rußlands Wünschen sollte dieser Schritt des Kaisers entsprechen. Näheres über die Gründe ergeben die Akten nicht. Schon am 18. August erfolgte eine kaiserliche Resolution, die Revision wurde zugelassen. - Die Ritterschaft versuchte jetzt wieder, durch ihre Bevollmächtigten die Sache zu verschleppen 111 ); sie erklärte, in Konkurssachen sich unter ein mecklenburgisches Oberappellationsgericht beugen zu wollen und auf dieser Grundlage zu einem Vergleich bereit zu sein. Jakobi


|
Seite 256 |




|
erwiderte, zwar sei eine Revision nicht angenehm, aber sie sei dem Herzog lieber als ein Vergleich, den die Sache nicht erlaube, da man nicht einer Vereinbarung mit der Ritterschaft, sondern nur der höchsten Huld und Gnade das Privileg zu verdanken haben wolle. Auch jetzt noch wieder hätte der Wiener Hof einen Vergleichsversuch gern gesehen, wie Jakobi erfuhr. Er wollte eben beide Parteien in steter Unzufriedenheit erhalten.
Am 21. August erging das erste reichshofrätliche Konklusum, die Ritterschaft sollte 6000, die Stadt Rostock 2000 Gulden Sporteln (Gerichtskosten) binnen zwei Monaten zahlen. Rostock erbat Herabsetzung der Summe, wurde aber abgewiesen. Der Ritterschaft wurden im Oktober zwei Monate Frist zur Bezahlung der Summe gewährt, die dann im Dezember beglichen wurden 112 ).
Von Schwerin aus erging eine Anweisung, die zum eifrigen Betrieb der Sache mahnte. Die ausgearbeitete Gerichtsordnung wurde mitgesandt, um sich des Beifalls dafür in Wien zu versichern, auch wurde versprochen, daß die Stände Mitbesetzungsrecht haben sollten. Jakobi hatte um Geldmittel "zur besseren Regelung" der Angelegenheit gebeten, der Herzog ließ ihm mitteilen 113 ), er sei seines Rechts sicher, den Dezernenten traue er "alle Rechtliebenheit" zu und die Kabale der Gegenseite fürchte er nicht viel, deshalb werde kein Geld gesandt. Jakobi hatte nämlich geschrieben, Herr v. Viereck ließe sich aus Mecklenburg schöne Pferde kommen, zeige diese Kaunitz, der großer Pferdeliebhaber sei, und bei der Pferdeleidenschaft in Wien würden sie auch anderweitig verwandt.
Jetzt wurden die Prozeßschriften für die Revision (Libelli revisionis) der Ritterschaft und der Stadt Rostock beim Reichshofrat eingereicht. Die erste umfaßte zwanzig kleingeschriebene Seiten und enthielt die Berufung auf die Rechte in den früheren Verträgen, betonte dabei, der Kaiser müsse sich seine Rechte doch auch vorbehalten. Rostocks Schrift war siebzehn Seiten lang. Jakobi meinte, beide enthielten nur "Sophisterei und reines Blendwerk, voll von seinen Wendungen, Verdrehungen und gefährlichen Einstreuungen". Das kaiserliche Konklusum vom 11. April 1781 wurde als ein voreiliges und den Gegenstand nicht erschöpfendes Erkenntnis bezeichnet. Dagegen wurde von der herzoglichen Seite keine Exzeptionsschrift, wie sonst üblich war, eingereicht, sondern der Herzog beschränkte sich auf eine Contradictio generalis und berief sich auf seine früheren Ausführungen in der


|
Seite 257 |




|
Sache 114 ). über die Verhandlungen ging das ganze Jahr 1784 hin; der Referent Baron v. Heß war längere Zeit verreist. Erst Ende des Jahres kam die Sache wieder in Bewegung. Die Ritterschaft geriet über den Ausgang in Sorge, sie ließ eine Schrift ausarbeiten: "Kurze Übersicht der Gründe der mecklenburgischen Landstände gegen das im höchstverehrlichen Concluso vom 11. April 1781 resolvirte Privilegium de non appellando". Darin stützte man sich vor allem auf die §§ 391, 392, 428, 431, 464 des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs, die die bisher gültigen Bestimmungen und Beschränkungen über Berufungen enthielten (z. B. die Höchstsummen eines Berufungswertes). Dieser Erbvergleich sei für alle Zeiten gültig. Auch wurde auf das bisher geltende Privilegium de non appellando hingewiesen, das in dem Erbvergleich und in der Bestätigungsurkunde des Kaisers mit aufgeführt war 115 ). Diese Schrift war in Wien in Umlauf und fand auch zustimmende Leser im Reichshofrat. Ein Gerücht wurde verbreitet, der inzwischen verstorbene Geheimratspräsident v. Bassewitz 116 ) hätte sich mit dem Privileg nur persönlichen Ruhm erwerben wollen, dem Herzog liege gar nicht so viel daran. Da hatte Jakobi wieder eifrig zu tun, um das Gegenteil zu behaupten. Auch der neue französische Gesandte in Wien Marquis de Noailles sollte für die Sache interessiert werden. An diesen schickte der jetzige Geheimratspräsident v. Dewitz mit einer Anweisung an Jakobi am 29. Dezember 1784 ein herzogliches Schreiben. Dewitz teilte dabei im Vertrauen dem Residenten mit, daß von seiten Hollands in Schwerin und Neustrelitz "Anträge zur Überlassung eines Korps von 4-5000 Mann gegen einen vorteilhaften Subsidientraktat geschehen, aber aus untertänigster Devotion gegen Seine kaiserliche Majestät sofort von beiden Seiten abgewiesen seien." Bei der "Kommunikation" des Schreibens nach Berlin (das Ministerium pflegte die meisten Schreiben in der Angelegenheit in Abschrift an die preußischen Räte zu senden) wurden diese letzten Sätze fortgelassen. Es handelte sich ja um die Streitigkeiten Josephs II. mit Holland 117 ) wegen der Scheldemündung; Frankreich und Preußen waren dabei seine Gegner, und so war die Vorsicht der Schweriner Räte sehr verständlich. Diese Schreiben kamen erst


|
Seite 258 |




|
nach längerer Zeit in Wien an (am 20. Februar 1785). Dewitz hatte schon besorgt nachgefragt und adressierte später alle Schreiben an Ditterich in der Sorge, es könnte doch in Berlin mehr, als ihm lieb war, zur Kenntnis gelangen.
Auf dem Landtag im Herbst 1784 hatten die Stände die Behandlung der Privilegsache in pleno abgelehnt und ein geheimes Komitee von drei Rittern gewählt, das die Sache mit dem Engeren Ausschuß beraten sollte 118 ). Nun waren ihre Hoffnungen geringer geworden, und es wurde beschlossen, eine Deputation nach Schwerin zu senden, die mit der Regierung verhandeln sollte. Anfang März wurde diese Absicht ausgeführt. Die Deputation war bereit, für Konkurssachen die Berufungsfreiheit aufzuheben und die Summen zu erhöhen, die bisher die Grenze für Appellationen gebildet hätten (§ 391 des Erbvergleichs) 119 ). Aber mitten in die Verhandlungen hinein kam die Nachricht von dem erfolgten Reichshofratskonklusum vom 12. Februar 1785, welches die Entscheidung vom 11. April 1781 voll bestätigte (plane confirmatoria prioris sententiae). Dem Herzog selbst kam das überraschend. Noch am 25. Januar hatten die mecklenburgischen Räte in Berlin angefragt, ob Preußen bei Schlichtung der Streitigkeiten zwischen dem Kaiser und Holland die Privilegsache zur Sprache bringen wolle, falls andere wichtige Dinge dabei erledigt würden. Vielleicht könnte die Expedierung des so lange hingehaltenen Privilegs erreicht werden. Hertzberg hatte geantwortet, der König wisse nichts von solchen Verhandlungen 120 ), gegebenenfalls aber wolle man an die Sache denken. - Jetzt teilte das Schweriner Ministerium voll Schadenfreude der noch tagenden Ständischen Deputation das Konklusum mit (am 12. März) und fügte hinzu, die Sache habe ein anderes Bild bekommen, die Oberappellationsgerichtsordnung werde noch durchgearbeitet und dann dem Landtag im Herbst vorgelegt werden. Die Deputierten erklärten aber, der ritterschaftliche Konvent in Rostock müsse erst befragt werden, und sie verließen Schwerin.
Bald meldete Jakobi aus Wien neue Bemühungen der Stände, die die Absicht hätten, noch das letzte Rechtsmittel zu ergreifen und den Antrag auf die Restitutio in integrum zu stellen. Zwar könne man unbesorgt sein: "Bei der jetzigen Zusammensetzung des Reichshofrates kann man sich von dessen Einsicht und Willfährigkeit zur Justizpflege allen rechtlichen Beistand wider


|
Seite 259 |




|
unziemliche und schikanöse Einstreuungen der Contradicenten versprechen." Herr v. Viereck, mit dessen Erfolgen die Stände äußerst unzufrieden waren, erhielt eine Abberufung, die ihn jedoch nicht hinderte, noch mehrere Monate hindurch gegen die Sache des Herzogs für seine bisherigen Auftraggeber tätig zu sein.
Der Geheimratspräsident v. Dewitz erhielt schon am 23. März eine private Nachricht aus Rostock, nach der die Stände das letzte Rechtsmittel in Wien ergreifen wollten, und am 28. März berichtete Jakobi, daß in Wien die Restitutio in integrum beantragt sei.
Indessen wurde dem Berliner Ministerium und dem Grafen von Vergennes in Paris der Dank des Herzogs für die Hilfe ausgesprochen. - Bezeichnend ist ein Schreiben der hundert Mannen 121 ) aus Rostock an den Herzog vom 12. April 1785, die sich im Namen eines großen Teils der Bürgerschaft gegen das Vorgehen E. E. Rates erklärten, der "das Vermögen dieser guten Stadt" unnötig für die neuen Weiterungen verwende. Diese Mitteilung wurde Jakobi zum Gebrauch in Wien übersandt. Auf Annahme des ständischen Antrages wurde nicht gerechnet. - Eine Veränderung in der Stellungnahme rief auch der Thronwechsel in Schwerin nicht hervor.
Am 24. April 1785 starb Herzog Friedrich 122 ), sein Neffe Friedrich Franz wurde sein Nachfolger. Sofort gingen die üblichen Notifikationen an den Kaiser und den Fürsten Colloredo ab, und schon am 25. April erhielten Jakobi und Riedesel, die beiden preußischen Bevollmächtigten, die Anweisung, daß der neue Herzog die Angelegenheit fortsetze. Am 4. Mai wurde Jakobi bei Colloredo in dieser Sache neu kreditiert.
Die Stände hatten inzwischen das letzte Rechtsmittel beim Reichshofrat ergriffen. Ihnen wurde eine Frist zur Einreichung der Restitutionslibelli gewährt, dann noch zweimal um je zwei Monate verlängert, so daß es Herbst wurde, bis die Sache verhandelt wurde. Am 2. Dezember fiel die Entscheidung; dem Restitutionsgesuch könne nicht stattgegeben werden. Das Konklusum vom 11. April 1781 bleibe maßgebend. Nun wünschte der Herzog


|
Seite 260 |




|
aber Milderung des ersten Teils der Conclusi 123 ) und beauftragte Jakobi, darüber zu berichten und mitzuteilen, wieviel das Privileg kosten würde und wie es mit der Expedierung stehe. Die Antwort lautete, die Ausnahmen könnten möglicherweise beseitigt werden, wie die Räte versichert hätten, Stände das dem Kaiser ganz frei. Aber es sei wieder nachdrückliche Unterstützung durch Rußland und Frankreich nötig; da diese schwerlich erreicht würde, sei es besser, gleich um Erteilung des Privilegs einzukommen. Es würde etwa 18000 bis 19000 Gulden kosten 124 ). Mit den Ständen müßte erst die Gerichtsordnung vereinbart werden. - Auf diesen Vorschlag ging der Herzog nicht mehr ein. Er zweifelte wohl an seinem Erfolg und ließ die ganze Angelegenheit, die seinen Vorgänger fast sechs Jahre hindurch beschäftigt hatte, bis zu einer passenderen Gelegenheit ruhen. Im Grunde hatten weder die Stände noch der Herzog, sondern Kaiser Joseph gesiegt, das Privilegium erteilte er nicht; Landesherr und Untertanen des mecklenburgischen Territoriums waren weiter darauf angewiesen, die Gunst des Wiener Hofes zu umwerben, um ihre nur einstweilen begrabenen Wünsche zur Erfüllung zu bringen. Der zuletzt so schnelle Betrieb der Angelegenheit seitens des Reichshofrates verrät die Absicht des Kaisers, bei seinen Tauschplänen mit Bayern und den Niederlanden wie andere deutsche Staaten so auch Mecklenburg auf seiner Seite zu haben und für sich zu gewinnen. (Vgl. Ranke a. a. O. I, Kap. 9.)
Die jahrelangen Bemühungen des Herzogs um das Privilegium de non appellando illimitatum waren nichts anderes gewesen als eine Phase in dem Kampf des Landesherrn mit den Ständen um die Herrschaft. Der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich von 1755 hatte schon auf Grund aller bis dahin geltenden Reichsschlüsse und Landesgesetze bestimmt, daß die Berufungen an die Reichsgerichte eingeschränkt würden; so sollte nicht mehr an die Reichsgerichte appelliert werden können, falls der Wert des Prozesses nicht 1000 Goldgulden erreichte (§ 391), ferner nicht in Ehe- und Kirchensachen. Im übrigen sollte den Berufungen "der starke ungehinderte Lauf gelassen werden". Es ist verständlich, daß die Stände auf keinen Fall diese Rechte, von denen sie eifrig Gebrauch machten, aufgeben wollten. Dem Herzog war natürlich


|
Seite 261 |




|
viel daran gelegen, das nachgesuchte Vorrecht zu erhalten, um dadurch einen Druck auf die Stände ausüben zu können und seinen Gerichten ein größeres Ansehen zu verschaffen (verweigerte oder verzögerte Justiz sollte nach wie vor Berufungen zulassen). - In der Goldenen Bulle (Kap. XI, §§ 3 u. 4) war das "letzte Entscheidungsrecht" den Kurfürsten verliehen. Seitdem bemühten sich immer wieder deutsche Fürsten darum (z. B. Württemberg erhielt es 1595). Auf dem Reichstag in Regensburg 1653 wurde die Willkür des Kaisers zu solcher Verleihung eingeschränkt (Wahlkapitulation Art. XVIII, § 6. "In Erteilung der Privilegien de non appellando, welche zur Ausschließung des heiligen Reichs-Jurisdiktion oder der Stände älteren Privilegien, oder sonst zum Präjudiz eines Tertii ausrinnen können, sollen und wollen wir die Notdurft väterlich beobachten"). Der Beitritt des Reiches zu dem Teschener Frieden war mit Vorbehalt der Rechte Dritter erfolgt. Auf diesen Sachverhalt konnten sich die Stände mit ihren Widersprüchen stützen. Außerdem bestimmte der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich, daß alle Zweifel und Mißverständnisse zwischen dem Herzog und den Ständen in Zukunft durch den Engeren Ausschuß oder auf dem Landtag "zur Zufriedenheit der getreuen Ritter- und Landschaft" beigelegt werden sollten. - Auf das Privileg hatte der Herzog jedoch mit keinem Worte verzichtet, und er betonte bei seinen Bemühungen immer wieder, daß es eine reine Gnadensache sei, und daß er das Privileg als Geschenk des Kaisers betrachten wolle. Den Behauptungen der Stände trat er besonders mit den Vorwürfen entgegen, daß sie nur die Berufungsfreiheit behalten wollten, um ihre Prozesse wie bisher verschleppen zu können. Sicherlich hatte der Herzog die besten Absichten, um seinem Lande durch das Privilegium die vielfach endlosen Prozesse zu ersparen; "Despotismus" lag ihm fern, wenn er auch die Herrschaft der Stände mindern wollte. Der Verfassung des deutschen Reiches sollte kein Abbruch getan werden. Es war der Versuch, die absolute Herrschaft des Landesherrn, die sich in Mecklenburg niemals durchgesetzt hat, zur Einführung zu bringen. -
Wenn der Herzog Friedrich Franz zunächst das Privilegium auch nicht weiter verfolgte, so sollten doch bald Gelegenheiten kommen, wo die Angelegenheit wieder aufgenommen werden konnte. Aber erst mußte Joseph II., der letzte Habsburger, der die deutsche Kaiserkrone zu altem Ansehen erheben wollte, die Augen für immer geschlossen haben.


|
Seite 262 |




|
Mecklenburg und der Fürstenbund.
Schon seit 1784 plante König Friedrich die "Aufrichtung eines Bündnisses unter den deutschen Fürsten nach Muster des Schmalkaldischen Bundes". Zu Beginn des Jahres 1785 gaben die Absichten Josephs II., der die österreichischen Niederlande gegen Bayern vertauschen wollte, den Anstoß, das Vorhaben weiter durchzuführen. Zunächst vereinigten sich am 23. Juli 1785 Preußen, Kursachsen und Hannover zu einer "reichsverfassungsmäßigen Verbindung der deutschen Reichsfürsten" 125 ).
Auch Mecklenburg sollte wie andere deutsche Staaten für den Bund gewonnen werden. Schon am 18. März 1785 schrieb der preußische Major v. Berge, der in Parchim in Garnison stand, an den Geheimratspräsidenten v. Dewitz, er habe vom König durch den General v. Möllendorf den Auftrag erhalten, Mecklenburg zum tätigen Beistand bei der Erhaltung des deutschen Reiches aufzufordern. Dewitz erwiderte sehr höflich, der Herzog schließe sich gerne patriotischen Reichsfürsten an, "damit er nicht in Gefahr käme, untergraben und über den Haufen geworfen zu werden". Die Aufrechterhaltung der deutschen Reichsverfassung und der ständischen Gerechtsame liege ihm sehr am Herzen. Er werde nähere Mitteilungen gern entgegennehmen 126 ). Major v. Berge schrieb am 28. März, der König sei erkrankt und die Entwicklung der Angelegenheit werde länger dauern. Weitere Nachrichten würden übersandt werden. Inzwischen hatte die Königin von England, eine geborene Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, mit der Gemahlin des Herzogs Friedrich Franz korrespondiert und dabei auch die Verhandlungen zum Fürstenbund besprochen. Die Herzogin stellte es darauf der Königin vor, daß es für Mecklenburg zunächst noch gar nicht möglich sei, dem Kaiser so gegenüberzutreten, die Freundschaft mit Hannover wolle man natürlich auch ferner pflegen.
Da traf ein Schreiben vom 6. Juni 1785 von dem Baron v. Binder, dem kaiserlichen Gesandten in Hamburg, an den Herzog ein 126). Der gewaltsame Austausch von bayrischen gegen österreichische Länder wurde im Auftrage des Kaisers als ein unbegründetes Gerücht hingestellt. Der Kaiser sei Gegenstand des allgemeinen Mißtrauens und Hasses. Auf allerhöchsten Befehl gelange hierdurch zur Eröffnung, "daß die Gerüchte offenbare Ver-


|
Seite 263 |




|
leumdungen und überhaupt für Absichten anzusehen seien, die der kaiserlich königliche Hof nie gehabt oder dermalen hat, noch jemalen haben wird, bei deren Erdichtung und Verbreitung kein anderer Endzweck sein kann, als das allerhöchste Reichsoberhaupt zum Gegenstand der allgemeinen Besorgnis aufzustellen. Dabei aber zugleich die selbsteigenen gefährdevollen Anschläge vorzubereiten und durchzusetzen.
Um jedoch die sämtlichen höchste und hohe Stände des Reiches nicht bloß durch Worte allein, sondern auf die werktätigste Art zu überzeugen, wieweit Seine Kaiserl. Majestät von den Ihnen so unverschämt angedichteten Absichten nicht nur entfernt, sondern wie fest sie entschlossen seien, die gesetzmäßige Reichsverfassung im ganzen und einzelnen genommen unverrückt aufrecht zu erhalten, wollen Allerhöchstdieselben gedachten und hohen Reichsständen, welche die allfällige Bewerkstelligung der bisher ausgestreuten oder was immer für sonstige gefährliche Absichten von irgendeiner Seite wirklich besorgen und durch eine engere Vereinigung sich gegen solche sicherzustellen für nötig ansehen dürften, eine förmliche und feierliche Verbindung unmittelbar mit dem Reichsoberhaupt selbst anbieten und sich gegen sie hierzu bereitwillig erklären. Einen mehr auffälligen, tätigen Beweis wissen Seine Kaiserl. Majestät von der wahren Gesinnung und Vorsorge für die Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen Reichsgrundverfassung nicht zu geben, sowie im Gegenteil jene höchst und hohe Reichsmitstände, die sich dessen ungeachtet gegen alle bessere Vermutung zu nebenseitigen Verbindlichkeiten einlassen dürften, bei der ganzen unparteiischen Welt außer alten Zweifel setzen werden, daß hierunter ganz andere Beweggründe und Absichten als die bloß äußerlich vorgegebenen obwalten. -
Es kann übrigens Ew. hochfürstl. Durchlaucht tiefsten Einsicht nicht entgehen, wie wenig dabei unter gehässiger Einleitung Vorhabende wider den kaiserlichen Hof gerichtete Verbindungen mit den Reichsgrundsätzen und sonderlich der Wahlkapitulation vereinbarlich seien, wie sehr hingegen derlei Vorhaben unübersehliche Verwirrung in der Reichsverfassung veranlassen, dem Gegenteil davon den abzielenden Vorteil zuwenden, den anderen Reichsmitständen aber den alsdann unausbleiblich erfolgenden unersetzlichen Schaden und Verlust zuziehen werden, mithin Kaiserl. Majestät selbe davon ernstlich abzumahnen, vermöge erwähnter Reichssatzungen zustehe."
Wir sehen aus diesem Schreiben, daß der Kaiser nicht nur den Gerüchten über den gewaltsamen Austausch von Bayern ent-


|
Seite 264 |




|
gegentreten wollte, sondern daß ihm auch daran lag, Mecklenburg in diesem Augenblick enger an sich heranzuziehen und von dem Eintritt in den Fürstenbund abzuhalten. Sogar ein Bündnis bot er dem Herzog an.
Die Antwort an den Baron v. Binder vom 25. Juni 1785 war sehr freundlich gehalten, ging aber auf den Sachverhalt nicht näher ein, nach einem Dank für das gesandte Schreiben fuhr der Herzog fort: "Der Inhalt desselben hat mir billig umso schätzbarer sein müssen, je mehr er von den erhabensten und verehrungswürdigsten auf die Erhaltung der Reichsverfassung und der darauf sich gründenden reichsständischen Wohlfahrt und Sicherheit gerichteten Gesinnungen Seiner Kaiserl. und Königl. Majestät Versicherung gibt."
Am 18. Juli 1785 traf schon wieder eine Mitteilung Binders in Schwerin ein 127 ). Die Nachrichten von der Unterstützung Rußlands in der Tauschangelegenheit 128 ) hatten zu der Ansicht Anlaß gegeben, der Kaiser lasse den Plan nur verleugnen und stehe in Wirklichkeit mit seiner ersten Kundgebung in Widerspruch. Jetzt wurde betont, daß es eben keine gewaltsame und die Reichsverfassung störende Handlung sei, sondern eine Verabredung mit dem Herzog von Zweibrücken. "Bei dieser handgreiflich überzeugenden Aufklärung der Sache kann demnach die bisher in Bewegung gebrachte Conföderation der Reichsstände gegen nichts anderes als gegen folgende drei Gegenstände gerichtet sein, nämlich entweder gegen die Seiner Kaiserl. Majestät angedichteten gewaltsamen Absichten oder gegen ähnliche von anderen Seiten etwa besorgende Gefahren oder endlich gegen solche Austausche oder sonstige Arrangements, worüber sich einzelne Stände des Reichs freundschaftlich, freiwillig und auf eine der gesamten Reichs-, Kreis- und ständischen Verfassung unschädliche Art für jetzige und künftige Zeiten nicht verstehen dürften." Binder bat, dem Kaiser das alte Vertrauen zu schenken, ersuchte dann aber auf ausdrücklichen kaiserlichen Befehl um "eine von der ganz freien Willkür abhängende, jedoch bestimmte und kategorische Antwort", ob erstens der Herzog eine nähere Verbindung gegen etwa zu besorgende gewaltsame Unternehmungen und reichsverfassungswidrige Gefahren für unnötig und überflüssig holte oder nicht, und zweitens, ob der Herzog im letzteren Falle der vom Kaiser angebotenen näheren Vereinigung beizutreten gewillt sei.


|
Seite 265 |




|
Dieses Ultimatum, wie man es wohl nennen darf, veranlaßte in Schwerin großes Kopfzerbrechen. Offizielle Verbindungen in dieser Angelegenheit mit Berlin und Hannover waren bisher noch nicht gepflogen; man wollte diese auf jeden Fall vermeiden. Die innerliche Feindschaft zwischen dem Wiener und Berliner Hofe schien den Schweriner Räten eine Gewitterwolke zu sein, die sich jeden Augenblick entladen könnte. Sie wollten möglichst ohne Konnexion und ohne Entfremdung den beiden Höfen gegenüber bleiben, "qui bene tacuit, bene vivit", meinte Dewitz. Nur Graf Bernstorff, der dänische Minister, ein geborener Mecklenburger, wurde ins Vertrauen gezogen. Aber noch bevor dessen Meinung gehört war, sandte der Herzog am 23. Juli 1785 ein Schreiben an den Baron v. Binder 129 ). "Der Wahrheit gemäß" versicherte er, daß ihm "zur Zeit von einer wirklich getroffenen Verbindung gewisser Reichsfürsten noch nichts weiter bekannt sei, als was einige deutsche und französische Zeitungen berichteten." Die Lage Mecklenburgs, die nahe Verwandtschaft mit den Nachbarn, die traurigen, noch nicht verwundenen Folgen des siebenjährigen Krieges erregten bei ihm billig den Wunsch, "außer Einmischung in diese oder jene große, Mich und Meine Lande aufs neue gleichen Gefahren aussetzende Welthändel zu bleiben". Diese Antwort ging auf die eigentliche Frage nicht ein und konnte doch den kaiserlichen Minister nicht erzürnen.
Noch im gleichen Monat (am 28. Juli 1785) 130 ) kam ein Schreiben des russischen Gesandten in Hamburg, Baron v. Groß, mit einer gemeinsamen Erklärung Österreichs und Rußlands, die die Versicherung enthielt, gewaltsam und verfassungswidrig und auch gegen den Frieden von Teschen solle nichts unternommen werden 131 ). Der Herzog erwiderte, der Teschener Friede sei in der Tat sehr wichtig und er selbst wünsche dessen Erfüllung auch in bezug auf das ihm versprochene Privilegium de non appellando illimitatum.
Von gleichem Datum wie das russische Schreiben war eine Anfrage v. Hertzbergs bei dem Geheimratspräsidenten v. Dewitz eingegangen. Er teilte die inzwischen vollzogene Gründung des Fürstenbundes mit und brachte als Veranlassung dafür vor, daß die Erklärung Österreichs nicht mit seinen Absichten und dem Teschener Frieden übereinstimmte. Mecklenburgs Herzöge als patriotische Reichsfürsten sollten mit dazu geladen werden; die


|
Seite 266 |




|
Verbindung sei rein defensiv und wolle niemand beleidigen. Aber vor der offiziellen Aufforderung wolle man erfahren, ob der Herzog etwa geneigt sei, dem Bunde beizutreten und dadurch das gegenwärtige Reichssystem mit allen seinen Kräften zu behaupten. Am 8. August antwortete Dewitz, der Herzog wünsche, daß seine freundschaftlichen Beziehungen und Gesinnungen gegen Preußen nicht bekannt werden möchten, weil dadurch gänzliches Mißtrauen gegen ihn am Wiener und Petersburger Hof entstehen würde. Außerdem hätte die Zarin erklärt, dem Teschener Frieden lege sie gleichen Wert bei wie dem Westfälischen Frieden. Solange der Kaiser sich die an Binder gegebene Antwort genügen lasse, fühlte sich der Herzog daran gebunden. Nur falls Joseph mit Schritten gegen seine bisherigen Erklärungen und gegen die Wahlkapitulation vorgehe, so daß die Freiheit der Stände in Zweifel gezogen und die Reichsverfassung umgestürzt werde, würde der Herzog den reichsverfassungsmäßigen Maßregeln des Königs gern beitreten. Hertzberg werde diese Vorsicht verstehen, wenn er bedenke, daß man erstens in Schwerin solange als möglich gegen die kaiserlichen Höfe "alles Menagement" gebrauchen müsse; zweitens wäre es für den König jetzt noch kein Vorteil, wenn er die freundlichen Gesinnungen des Herzogs öffentlich bekannt mache; und drittens habe der Wiener Hof ohnehin den Schweriner wegen seiner Annäherung an Preußen in Verdacht, nachdem der Herzog und seine Minister mit Einwilligung des Königs den Residenten v. Jakobi als ihren Chargé d'affaires in der Privilegiensache auserkoren und akkreditiert hätten. Dieses Schreiben wurde nicht durch die Post gesandt, sondern durch den gerade über Berlin reisenden Herrn v. Plessen überbracht. Auf die Aufforderung zum Beitritt, die von der hannoverschen Regierung an die Räte am 5. August erging, wurde am 15. August einfach die Antwort an Hertzberg kommuniziert und sich auf deren Inhalt berufen, man müsse "noch zur Zeit an sich halten". So vorsichtig verhielt sich die Schweriner Regierung, sie wollte es mit keinem verderben; und ein wenig hat sicher die Abneigung gegen Friedrich den Großen, dem man die Kriegsschäden und die Ablehnung der Ämterrückgabe nicht vergessen konnte, dazu beigetragen.
Mecklenburg-Strelitz, das immer Auskunft von Schwerin über dessen Stellungnahme erbat, verhielt sich ebenso. In Neustrelitz war das Berliner Ministerium noch dringender vorstellig geworden, auch Hannover und Kursachsen hatten angefragt, aber das Strelitzer Ministerium blieb zurückhaltend, es wollte den Beitritt hinausschieben.


|
Seite 267 |




|
Im August 1785 traf noch eine weitere Erklärung Preußens in Schwerin ein, die die Ursachen, welche zur Gründung des Bundes geführt hatten, ausführlich darlegte.
In Regensburg waren, wie bei solchen Anlässen gewöhnlich, eine Reihe von Druckschriften veröffentlicht, die der mecklenburgische Legationssekretär Regierungsrat Becker einsandte 132 ). Es war von einer "Staatsrevolution" von seiten Österreichs die Rede, während der Kaiser die Ursachen der Fürstenbundsgründung einer scharfen Kritik unterziehen ließ. Der Baron v. Gemmingen, der Mecklenburgs Stimmen zu führen hatte, trat gegen Preußen und seine Ansichten auf; er meinte, es sei ein Untergraben der Reichsautorität, das man sich in Berlin erlaube. Der Kaiser habe immer ein Toleranzsystem gelten lassen: "Der Patriotismus kann nicht beide Parteien vereinigen, weil in dem in soviele besondere Staaten verteilten deutschen Reich ein allgemeiner Patriotismus und ein allgemeines Interesse nicht statthaben können."
Der Herzog Karl August von Sachsen-Weimar teilte seinen Beitritt im Herbst 1785 nach Schwerin mit und sandte eine Abschrift seiner Beitrittserklärung. Dann verlautete längere Zeit hindurch nichts in dieser Angelegenheit.
Erst nach dem Tode Friedrichs des Großen trat Mecklenburg wieder in Beziehungen zu dem preußischen Hof 133 ). Die Auslösung der verpfändeten Ämter, die unter dem alten König nicht gelungen war, wurde von neuem durch den zu diesem Zweck nach Berlin abgesandten Baron v. Lützow 134 ) betrieben. Diesem schien zur Durchführung seiner Absichten eine Reise des Herzogs nach Berlin erwünscht, die der Herzog auch wirklich am 8. Dezember 1786 unternahm. In seiner Begleitung befand sich der Regierungsrat v. Bassewitz 135 ). König Friedrich Wilhelm II. nahm Friedrich Franz sehr liebenswürdig auf, die Ämterangelegenheit wurde in diesen Tagen von den Räten in Angriff genommen, schien zwar zunächst für Mecklenburg nicht viel Erfolg zu versprechen, aber der König machte die freundlichsten Versicherungen. Als auch Karl August von Sachsen-Weimar in Berlin eintraf, überreichte Friedrich


|
Seite 268 |




|
Wilhelm bei den Festlichkeiten dem Schweriner Herzog den Schwarzen Adlerorden 136 ). Im Laufe der Gespräche hatte Friedrich Franz auf den Vorschlag des Königs, er möge dem Fürstenbund beitreten, sich so unklar ausgedrückt, daß der König seinen unbedingten Beitritt annahm, obwohl der Herzog keine bestimmten Zusicherungen hatte geben wollen. Dewitz hatte ihm nämlich noch kurz vor der Abreise vorgetragen, daß nur ein geheimer Beitritt zum Fürstenbund dann in Frage komme, wenn die Ämterangelegenheit nach dem Wunsche Mecklenburgs erledigt sei.
Der König teilte nun gleich am nächsten Tage Hertzberg schriftlich mit, der Schweriner Herzog werde dem Bunde beitreten. Dieses Schreiben legte der preußische Minister dem Baron v. Lützow vor, und dieser erklärte, um den König nicht zu kompromittieren, der Herzog werde dem Fürstenverein gern beitreten, aber über die Art und Weise, wie es vor sich gehen sollte, das Erachten seiner Räte in Schwerin einfordern und auch die Meinung des hannoverschen Ministeriums erst hören, weil dieses damals nach Schwerin in dieser Angelegenheit geschrieben habe 137 ). Vor dieser Antwort hatte Lützow in seiner Verlegenheit erst mit dem Herzog und Bassewitz Rücksprache genommen. Jetzt begab sich der Regierungsrat v. Bassewitz schon einige Tage früher als der Herzog, der erst am 22. Dezember wieder abreiste, nach Schwerin zurück, um dort die Minister zu befragen. Diese waren über die Lage nicht gerade erfreut, denn jetzt mußte Mecklenburg auf alle Fälle dem Fürstenbund beitreten. Nach langen Beratungen erhielt der Baron v. Lützow am 27. Dezember 1786 diese Instruktion 138 ): "Nach Maßgabe des auf seiner Königl. Majestät Höchsteigenes Antragen von Uns zugesicherten Beitritts zu dem Fürstenverein hat Unser Gesandte zu versichern, daß Wir eben in Begriff gewesen, hierob mit dem Herzog von Mecklenburg-Strelitz zu korrespondieren, sobald Wir von demselben die erforderliche Erklärung, sie möge ausfallen, wie sie wolle, erhalten hätten, Wir nicht säumen würden, die Uns kommunizierte und von des Herzogs von Sachsen-Weimar Durchlaucht unterschriebene Akte gleichfalls zu originalisieren und öffentlich beizutreten." - Sodann wurden am 28. Dezember Schreiben nach Hannover und Neustrelitz gesandt, der Herzog habe eingesehen, daß indem Bündnis nichts enthalten sei, "was den hohen Befugnissen und Prärogativen des allerhöchsten Reichsober-


|
Seite 269 |




|
hauptes anstößig und entgegen wäre"; denn die beschworene Wahlkapitulation, der Westfälische und der Teschener Friede und sonstige Reichsgesetze sollten geschützt werden. Jetzt trage man kein Bedenken mehr, beizutreten. - Wir sehen, daß durchaus nicht Rache und Vergeltungsgedanken gegen den Kaiser den Grund zum Anschluß bildeten 139 ). Sondern daß der Herzog nur gute Miene zum bösen Spiel machte und seine veränderte Stellung, die durch ein Mißverständnis veranlaßt war, zu rechtfertigen suchte.
Am 2. Januar 1787 konnte Lützow mitteilen, der König sei hoch erfreut über den Beitritt des Herzogs, die nötigen Akten wurden dabei übersandt. Auch Hannover antwortete am 8. Januar 1787 und machte Vorschläge über den Akzessionstraktat. Der Herzog von Mecklenburg-Strelitz schrieb am 13. Januar, er habe noch Bedenken, dem Bunde beizutreten, weil sein jüngster Bruder, der 1786 verstorbene Prinz Georg 140 ), als General in kaiserlichen Diensten und bei Joseph II. hoch geachtet gewesen sei. Nun wolle er nicht undankbar erscheinen, besonders da er noch verschiedene Prozesse beim Reichshofrat liegen habe.
Nun wurden die Akzessionsakte hergestellt und am 16. Januar nach Berlin gesandt. Die offizielle Mitteilung von dem Beitritt nach Hannover erfolgte am 22. Januar. Zunächst schlich sich noch ein Irrtum ein, durch ein Versehendes Baron v. Lützow wurden die Artikel 6 und 7 nur auszugsweise aufgenommen. Erst am 4. Februar unterschrieb der Herzog das vollständige Original genau nach dem Muster des Weimarer Beitrittsprotokolls mit dem geheimen Artikel 141 ), am 5. Februar ging dieses nach Berlin und Hannover, und am 10. Februar bzw. 24. März trafen die Empfangsurkunden ein. Damit war der Eintritt in den Fürstenbund vollzogen.
Trotzdem waren noch lange Verhandlungen nötig, bis Ende März die Rückgabe der Ämter zustande kam. Jetzt lenkte Mecklenburg sein Augenmerk auf das 1648 an Schweden abgetretene Wismar mit Insel Poel 142 ) und dem Amt Neukloster. Schweden hatte nämlich wieder in der Angelegenheit des Warnemünder Zolls, den es 1715 an Mecklenburg verpfändet hatte und der dann auf-


|
Seite 270 |




|
gehoben war, Forderungen auf Wiederherstellung und Rückgabe des Zolls gestellt 143 ); der Herzog lehnte diese ab, weil es nicht nur Sache des herzoglichen Hauses, sondern "eine gemeinschaftliche Angelegenheit des ganzen deutschen Reiches sei, und vor weiterem mit dem Kaiser und den übrigen Reichsfürsten vereinbart werden müsse". Bald darauf hatte Dewitz eine Unterredung über diese Dinge und vor allem über die Rückerlangung Wismars mit dem in Schwerin anwesenden dänischen Minister Graf Bernstorff. Dieser riet ihm 144 ), "den Kaiser (der jetzt zuversichtlich von allen Regenten der einsichtsvollste Politicus wäre) von den Verhandlungen mit Schweden im Vertrauen zu unterrichten, das würde gewiß nichts schaden". Bei dieser Gelegenheit ermahnte er Dewitz aufrichtig, doch ja nicht zu unterlassen, die Korrespondenz mit dem kaiserlichen Hof einigermaßen zu unterhalten. Es wäre dem Kaiser sehr angenehm gewesen, daß der Herzog dem Fürstenbund anfangs nicht hätte beitreten wollen. Er fügte noch hinzu, es würde in Wien gut aufgenommen werden, wenn Dewitz dem Baron v. Binder in Hamburg von der Rückgabe der Ämter Nachricht gäbe und dabei mit einfließen ließe, daß der Herzog sich den Beitritt zum Fürstenbund nicht hätte entziehen können, wenn er diese so wichtige Angelegenheit beenden wollte. Wirklich schrieb Dewitz am 2. Juli 1787 an Binder und teilte ihm mit, daß die Ämter von Preußen zurückgegeben seien, und fuhr dann fort: "Je mehr dem herzoglichen Hause an Wiedererhaltung der demselben so lange entzogenen Ämter gelegen war, und so lästig und kummervoll es zugleich dem Landesherrn sein mußte, in seinen Landen fremde Troups und mancherlei damit begleitete Drangsale und Widerwärtigkeiten dulden zu müssen, desto weniger haben Durchlaucht, mein gnädigster Herr, zur Beförderung dieser dem herzoglichen Hause und dem Lande so wichtigen Angelegenheit und nach so vielen - bei Lebzeiten des verstorbenen Königs von Preußen selbst unter Vermittlung und Empfehlung verschiedener ansehnlicher Mächte, auch des Kaiserl. Königl. Hofes - vergeblich gemachten Versuchen und verunglückten Negotiationen sich entziehen mögen, dem Anlangen des jetzt regierenden, friedfertig freundschaftlich und nachbarlich gesinnten Königs von Preußen, dem sogenannten Fürstenbunde beizutreten, zu genügen, umso mehr da bei den nach dem Tode des Königs Friedrich von Preußen sich veränderten Umständen und Gesinnungen, und der weisen und rühmlichen Ge-


|
Seite 271 |




|
denkungsart des großen und erhabenen Regenten von Europa unter göttlicher Gesegnung alle gegründete Hoffnung zur Erhaltung und Fortdauer eines glückseligen guten Vernehmens unter Ihnen vorhanden ist".
Binder gratulierte höflich zu dem erreichten Ergebnis, so befremdlich und auffallend übrigens auch dasjenige Mittel gewesen sei, welches der Herzog sich habe gefallen lassen müssen, um wieder zu seinem Eigentum zu gelangen. - An den Kaiser selbst wandte sich der Herzog in den Angelegenheiten mit Schweden jedoch nicht.
Um Preußen auch ferner gefällig zu sein 145 ), nahm der Herzog an dem Mißgeschick des oranischen Hauses in Holland interessierten Anteil und ließ sich dazu herbei, auf die Anfrage des holländischen Gesandten in Berlin, Verhandlungen mit dem Prinzenstatthalter wegen Überlassung von Truppen zu führen, die nach anfänglicher Erfolglosigkeit am 5. Mai 1788 in Ludwigslust mit der Überlassung von tausend Mann endigten. Diese Truppen blieben bis 1795 in Holland. Daß Mecklenburg diesen Vertrag mit der Absicht, die Interessen des Kaisers, der ohnehin nicht stark an der Sache beteiligt war 146 ), zu schädigen, geschlossen haben sollte, ist nicht wahrscheinlich; es findet sich kein Anhaltspunkt dafür in den Akten.
Das Verhältnis zum Wiener Hof wurde durch eine andere Angelegenheit in diesen Jahren erheblich bestimmt. Seit dem 31. Juli 1767, dem Tag der Überreichung des Promemorias mit den verschiedenen Wünschen auf Änderung der Belehnungsweise, war von dieser Angelegenheit nicht mehr die Rede gewesen. Die Frage wurde wieder brennend, als Herzog Friedrich Franz 1. am 24. April 1785 den Thron bestiegen hatte. Er ließ am 18. Januar 1786 ein Rundschreiben an die Ministerien der altfürstlichen Häuser senden 147 ) (Braunschweig-Wolfenbüttel, Sachsen-Weimar, Gotha, Meiningen, Hildburghausen, Pfalz-Zweibrücken, Hessen-Kassel und Baden-Durlach). Es wurde um Meinungsäußerung in der Lehnsangelegenheit gebeten. Der Herzog würde sonst gern seiner Verbindlichkeit, sein angestammtes altfürstliches Reichslehen binnen Jahr und Tag beim Kaiser zu "muthen" und von neuem zu empfangen, nachkommen, wenn die Verhältnisse nicht so verwickelt wären 148 ). Zwar sei Mecklenburg vom Kaiser in dieser Sache nie


|
Seite 272 |




|
beunruhigt worden, aber es müßte jetzt geklärt werden, ob die kurfürstlichen Häuser bei den Zeremonien Vorzüge vor den anderen Fürsten erhalten sollten, und ob die hohen Taxen und Laudemiengelder gefordert werden dürften.
Auch der Baron v. Gemmingen in Regensburg erhielt den Auftrag 149 ), sich nach der Stellungnahme der anderen Fürsten in Lehnssachen zu erkundigen und darüber zu berichten.
Auf das Rundschreiben liefen verschiedene Antworten ein, die einen hatten das Lehen gemuthet und Indult erhalten, die anderen die Sache seit langer Zeit auf sich beruhen lassen. Der Herzog schrieb nun am 21. März 1786 an den Kaiser 150 ) und erklärte sich zum Lehnsempfang bereit, zu dem er nach seinem Regierungsantritt verpflichtet sei. Aber er bäte vorläufig um Indult, da er die erforderlichen Summen bei der großen Schuldenlast und den Ausgaben für die ausgelösten Ämter nicht aufbringen könne. Der Agent Ditterich überreichte dieses Schreiben der Reichskanzlei. Der Reichshofrat beschloß einen Bericht an den Kaiser, doch wurde die Angelegenheit noch nicht erledigt. Erst eine Nachricht vom 12. November 1787 über die Belohnung des Fürsten von Thurn und Taxis mit einer Grafschaft in Schwaben erregte wieder Interesse für die Lehnsangelegenheit, da das Knien des Gesandten und die spanische Kleidung 151 ) bei dieser Feierlichkeit fortgefallen waren. Im Reich erhob sich jetzt eine Debatte, ob der Kaiser befugt sei, sich bei Reichsbelehnungen die Kniebeuge zu verbitten. Das Eidesformular wurde auch geändert, es hieß jetzt nur statt einer längeren Formel: "So wahr mir Gott helfe." Statt der spanischen Kleidung sollten rote Mäntel oder eigene Kleider getragen werden. Wegen dieser Neuerungen Stand eine kaiserliche Verordnung in Aussicht. "Der Kaiser wünscht das Vertrauen und Einvernehmen zwischen Haupt und Gliedern im Reich wiederherzustellen," schrieb der Regierungsrat Becker am 7. Januar 1788 an den Herzog, und an diesem Tage erfolgte wirklich ein kaiserliches Dekret in Wien, welches die Zeremonien änderte und das Niederknien fortan untersagte.
Jetzt wurde vom Reichshofrat die Lehnsangelegenheit wieder aufgenommen. Mit Mecklenburg machte man den Anfang und teilte dem Agenten Ditterich die Summe, die zu zahlen sei, mit.


|
Seite 273 |




|
Sie belief sich im ganzen auf 154 363 fl., da die Taxen inzwischen durch die vier Thronwechsel der Kaiser 152 ) und ebenso vier der Herzöge seit 1713 so angewachsen waren. Dazu kamen Indultsgebühren und Laudemien, die gezahlt werden mußten, wenn eine noch nicht investierte Linie zur Regierung in den einzelnen Territorien gelangte. Das war 1713, 1747 und 1785 in Mecklenburg der Fall gewesen, wo jedesmal ein Herrscher ohne Söhne verstorben war.
Zunächst wurde am 8. Januar 1788 ein Indult von drei Monaten erbeten und gewährt. Jetzt kam es darauf an, ob man sich mit der Aufstellung der Kosten einverstanden erklären wollte; denn die ersten Beschwerdegründe von 1767 hatte der Kaiser jetzt durch ein Edikt aus der Welt geschafft und ließ nun die Lehnssache wieder aufnehmen in der festen Absicht, sie durchzuführen. "Diese Maßregel ist ein Probierstein, ob der deutsche Fürstenbund nicht andere Absichten zum Grunde habe als diejenigen, welche dem Publico angekündigt worden sind. Niemand werde es dem Kaiser verdenken, daß er darauf bedacht sei, den wahren Nexum zwischen dem Reichsoberhaupt und den Reichsmitgliedern aufrecht zu erhalten, und daß der Kaiser nicht etwa bloß erniedrigende Verbindungen herstellen wolle. Solches würde durch Abschaffung aller Zeremonien, woran sich sonst verschiedene Stände als nicht auf die jetzigen Zeiten passend gestoßen, genugsam an den Tag gelegt" 153 ).
Herzog Friedrich Franz verdachte die Absichten dem Kaiser gewiß nicht, im Gegenteil, ihm lag stets viel daran, die reichsverfassungsgemäße Verbindung mit dem Kaiser aufrecht zu erhalten, aber die Forderung des Reichshofrates war ihm zu hoch. Er wandte sich deswegen wieder an die anderen altfürstlichen Häuser und fragte sie nach ihrer Meinung bei der jetzt veränderten Lage. Die Antworten fielen aus, wie es nicht anders zu erwarten war: jeder fühlte sich beschwert, aber die meisten hatten doch Indult erbeten und erhalten.
Merkwürdigerweise war es gerade ein norddeutsches Territorium ohne deutschen Lehnsnehmer, über das in dieser Zeit die Belohnung ausgesprochen wurde. Am 8. Februar 1788 meldete Ditterich aus Wien 154 ), daß die Belohnung des dänischen Königs in der Person des Freiherrn v. Güldencrone für Holstein vollzogen


|
Seite 274 |




|
sei 155 ). Die Feierlichkeit war ohne die alten Zeremonien vor sich gegangen. Der Gesandte hielt seine Rede stehend, nicht, wie sonst üblich gewesen, kniend, und das Kniebeugen beim Vortreten wurde durch tiefe Verbeugungen ersetzt. Der mecklenburgische Agent Ditterich nahm wegen der Verwandtschaft der Häuser Dänemark und Mecklenburg daran teil und fuhr mit dem oldenburgischen Agenten zusammen in einem Wagen bei der Auffahrt.
Der Geheimrat Dewitz fragte jetzt gleich bei dem Minister Graf Bernstorff an, wie er es mit den Taxen und Anfallsgeldern gehalten habe. Die Antwort war, der Reichshofrat habe zwar sehr hohe Summen gefordert, aber man habe einen Vergleich abgeschlossen, mit dem der Kaiser sehr zufrieden gewesen sei, weil auch er die hohen Ansätze des Reichshofrats nicht billigte. Es sei eine Abschlagssumme gezahlt, und die Frage der Anfallsgelder offen gelassen. Auch Jakobi schrieb aus Wien an Dewitz 156 ), der Reichshofrat werde wegen der Summen mit sich handeln lassen. Doch Anfang März wurde Ditterich beauftragt, um Verlängerung der Indultfrist einzukommen, der Kaiser war abwesend (im Kriege gegen die Türken), eine Belohnung konnte jetzt doch nicht stattfinden. Die Korrespondenz mit den anderen Höfen wurde weiter unterhalten, manches Schreiben ging hin und her, ohne daß eigentlich ein wirkliches Ergebnis festzustellen gewesen wäre. Jetzt wandte sich der Herzog auch an Preußen und Hannover, was er bisher in dieser Angelegenheit noch nicht getan hatte, und fragte sie um Rat (Juni 1788). Beide lehnten es entschieden ab. Sich auf Verhandlungen wegen der Gebühren mit dem Reichshofrat einzulassen, obwohl sie zugestanden, daß der reichsständische Lehnsverband ein Teil der deutschen Reichsverfassung sei und mittels Lehnsempfang aufrecht erhalten werden müsse. In dem Schriftwechsel mit den deutschen Fürsten zeichnete sich vor allem Brandenburg-Onolzbach durch den Umfang der Schreiben aus, da es sich besonders beschwert glaubte.
Man erwartete jetzt in Schwerin ein energisches Vorgehen des Reichshofrates in dieser Sache, besonders als er verschiedenen fürstlichen Agenten Fristen zu Indultsgesuchen oder Lehnsnehmung anberaumt hatte. Deshalb ließ der Herzog im Juli 1788 ein eingehendes Promemoria von 25 Aktenseiten durch den Regierungsrat Rudloff ausarbeiten 157 ), in dem genau die Gründe dargelegt


|
Seite 275 |




|
wurden, durch die Mecklenburg sich benachteiligt fühlte. Wenn auch die Etikette geändert war, so handelte es sich jetzt um die Taxen. Dagegen, daß jetzt für acht Belehnungsfälle nachgezahlt werden sollte, obwohl nur eine einmalige Belohnung in Frage käme, wolle man nichts einwenden. Aber in den Jahren 1742-45 wäre der Fall der Belohnung überhaupt nicht denkbar gewesen, weil der Lehnsherr selbst durch Konklusum vom 11. Mai 1728 den damals regierenden Herzog Karl Leopold seiner Reichslehen, wenngleich nur provisorie, so doch plenarie enthoben, die Comitialstimmen in Untätigkeit gesetzt und die Regierung einem kommissarischen Administrator (Herzog Christian Ludwig) übergeben habe. In dem Augenblick wäre ein Antrag des abgesetzten Vasallen auf erneuerte Verleihung ebenso wie der des einstweiligen Administrators auf eigentümliche Übertragung vergeblich gewesen; denn dieser war nicht Kurator oder Vormund, sondern regierte im Namen des Kaisers. Es war damals eben ein nur provisorie, aber doch plenarie vakantes Lehen. Also zwei Thronfälle müßten in Abzug gebracht werden. Ferner wandte man sich gegen die doppelte Anrechnung der Gebühren wegen des Herzogtums Güstrow, beides, Schwerin und Güstrow, sei zusammen ein Reichslehen, auch für das säkularisierte Fürstentum Schwerin (das im Westfälischen Frieden als Entschädigung für Wismar gegeben war) dürften keine besonderen Taxen verlangt werden. Dann wurde die Frage aufgeworfen, ob für nicht nachgesuchte, aber doch stillschweigend gewährte Indultsfrist auch Gebühren zu zahlen wären. In der Berechnung der Reichskanzlei war noch ferner ein "annus utilis" nach dem Tode Herzog Friedrichs vergessen. Für die Zeit der kommissarischen Regierung und des siebenjährigen Krieges wurde überhaupt wegen Unmöglichkeit der Belohnung Kostenfreiheit verlangt. Schließlich unterzog man die Laudemial- und Anfallskosten einer Kritik und behauptete, daß die Nebenlinien schon längst coinvestiert seien, weil der Urgroßvater des Herzogs Friedrich Franz, Adolf Friedrich I., "für sich und seine Leibeslehnserben" im Jahre 1651 belehnt sei 158 ), also seine Nachfolger seien sämtlich mitbelehnte Agnaten. Kurz, die Berechnung des Reichshofrates von 151160 fl. wurde auf 21690 fl. in diesem


|
Seite 276 |




|
Promemoria zusammengestrichen. Man kann es dem Herzog nicht verdenken, wenn er deshalb soviel Mühe aufwandte.
Diese Denkschrift wurde an die anderen Höfe gesandt, die den Dank für das "recht gründliche Gutachten" aussprachen. Nach Wien gelangte sie nicht; denn am 17. September 1788 teilte Jakobi dem Präsidenten von Dewitz mit, daß der Kaiser wegen der Vorstellungen verschiedener Kurfürsten, die ebenfalls die hohen Kosten nicht zahlen wollten, dem Reichshofrat befohlen habe, die Lehnssache vorläufig einzustellen. Er selbst kam nicht mehr zur Erledigung der Angelegenheit, der Türkenkrieg nahm ihn in Anspruch, und die Nachrichten über seine Gesundheit wurden immer schlechter.
Mit dem baldigen Ableben des Kaisers wurde infolgedessen schon 1789 gerechnet. In der Publizistik dieses Jahres finden wir die Schrift eines mecklenburgischen Predigers in Parchim 159 ), in der als "Traum" die künftige Kaiserwahl vor Augen geführt wird. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das Haus Habsburg wiedergewählt werden solle, da es schon zu mächtig geworden sei und die schwächeren Reichsstände unterdrücken könnte. Das habe man vor allem aus den Plänen Josephs mit Bayern gesehen. Aber wen sollte man wählen? Es wird ein Vorschlag gemacht, man möge bald aus diesem, bald aus jenem Fürstenhause den deutschen Kaiser wählen, für ihn ein Reichsland schaffen und darin eine ständige Reichsarmee halten. Die Gebiete der geistlichen Stifter und die Bistümer sollten dazu verwandt werden. Joseph II. habe durch die Säkularisierungen in den Erbländern "ein nachahmungswürdiges Beispiel" gegeben, den Papst brauche man nicht zu fürchten; "denn mit dem Bann darf er nicht mehr hervorrücken". Dieses alles glaubte der Mecklenburger der künftigen Wahlversammlung "im Traum abgelauscht" zu haben. Soviel Interesse hatte er am Leben des Deutschen Reiches.
Der Reichstag hatte durch die Gründung des Fürstenbundes und dessen Pläne neue Belebung erfahren 160 ). Schon 1780 hatte Herzog Friedrich das Angebot eines preußischen Legationssekretärs Ganz angenommen, welcher "Comitialnebenstunden", d. h. genaue Berichte über die Vorgänge am Reichstag senden wollte. Der Herzog las sie selbst, aber sie trafen so unregelmäßig ein, daß man sie bald wieder abbestellte. Der Herzog Friedrich Franz äußerte einmal, er wolle wieder mehr Wert auf den Reichstag legen und


|
Seite 277 |




|
fände es "despektierlich", daß Mecklenburg keinen eigenen Gesandten in Regensburg hätte. Doch vorläufig behielt der Baron von Gemmingen weiter die Führung der Geschäfte und der Stimmen. 1789 wurde die Frage der Fortdauer des Reichstags im Fall eines Interregnum, das bei der schlechten Gesundheit Josephs II. bald zu erwarten war, besprochen. Die Kurfürsten hatten es beider letzten Wahlkapitulation durchgesetzt, daß auch unter dem Vikariat der Reichstag weiter tagen könnte; man hoffte dabei allerlei Vorteile für die einzelnen Territorien zu gewinnen. Herzog Friedrich Franz stimmte der Fortdauer zu, doch wies er den Gesandten an, dafür zu sorgen, daß die Kurfürsten ja nicht zu viel Rechte über ihre Reichsmitstände erhielten 161 ). Am 20. Februar 1790 starb Kaiser Joseph, am 28. Februar traf die vorläufige Nachricht durch Baron Binder in Schwerin ein. Der Herzog antwortete am 1. März: "Die Mir von Ew. Hochwohlgeboren beliebigst gegebene vorläufige Nachricht von dem nach Gottes unerforschlichem Ratschluß erfolgten frühen Ableben seiner Kaiserl. Majestät Josephs II. hat Mich zu sehr erschüttert, als daß ich in diesem ersten Augenblick Meine Regungen der innigsten Traurigkeit darüber auszudrücken vermöchte, Empfindungen, welche der Verlust eines so würdigen Reichsoberhauptes, dessen Andenken dem deutschen Vaterlande ewig unvergeßlich sein wird, natürlich hervorbringen müssen. Den hohen Angehörigen der verewigten Kaiserl. Majestät widme ich auch bei dieser höchst betrübten Gelegenheit Meine ganze Verehrung und besten Wünsche alles künftigen hohen Wohlergehens."
Schon vor dem Eintreffen der offiziellen Notifikation befahl der Herzog die Landestrauer und das Glockenläuten 162 ). Vom 14. März bis zum 28. März durfte kein Theater, keine Musik und kein Orgelspiel stattfinden. Im Kirchengebet mußte des verstorbenen Kaisers und des Reichsvikariats gedacht werden, da ein neuer deutscher König noch nicht gewählt war. Auch sollten alle übrigen Bestimmungen gelten, wie beim Tode Franz I. Bald traf auch die förmliche Notifikation aus Wien ein, zugleich mit der Todesnachricht von der Erzherzogin Elisabeth. Der Herzog sandte ein Beileidsschreiben an Leopold, den Nachfolger Josephs II. in den Erbländern, und betonte, "daß nicht bloß die geheiligten Verhältnisse der Pflichten", worin er als "Reichsfürst gegen die nun verewigte Römische Majestät zu stehen das Glück hatte, sondern


|
Seite 278 |




|
auch seine persönliche unumschränkte Ergebenheit gegen den Kaiser und das hohe Erzhaus" ihn zur Teilnahme auffordere. Weiter wurden Glückwünsche zur Thronbesteigung Leopolds in Österreich ausgesprochen.
Es ist keine Frage, daß Mecklenburg sich während der Regierungszeit Josephs II. mehr an Preußen angeschlossen hat wie bisher. Der Fürstenbund konnte nicht ohne Einfluß auf die Politik des Herzogs bleiben. Aber andererseits hat Joseph II. auch Mecklenburg gegenüber seine Reichspolitik durchsetzen wollen, und er erreichte es wenigstens, daß der Herzog darauf bedacht blieb, seine Verpflichtungen dem Reiche gegenüber zu erfüllen und mit dem Kaiserhofe ein gutes Einvernehmen aufrecht zu erhalten.
Mecklenburgs Verhältnis zum Reich unter der Regierung Kaiser Leopolds II.
Solange noch kein deutscher König gewählt war, trat nach der Reichsverfassung das Vikariat in Tätigkeit. Kursachsen übernahm für Norddeutschland, Pfalz für Süddeutschland die einstweilige Leitung. Kurfürst Friedrich August teilte im März 1790 den norddeutschen Fürsten die Übernahme des Vikariats mit, es wurden gedruckte Publikationspatente mitgesandt, die der Herzog dann weiter zur Verkündigung und zum Anschlag an alle Regierungsstellen, an die Landgerichte, an die Superintendenten, die Stadt Rostock und an Rektor und Konzil der Universität sandte 163 ). Zwar berichtete der "Envoyé extraordinaire" Baron v. Lützow aus Berlin, daß in Preußen die Reichsvikariatspatente nicht mehr "affigiert" würden, doch stellten die Räte des Herzogs fest, daß es für Mecklenburg notwendig sei, weil die Vikariatsgerichte nur über kurfürstliche Untertanen nicht gebieten dürften. Wegen der Fortdauer des Reichstags traf ein Handschreiben des Königs Friedrich Wilhelm von Preußen vom 1. März ein 164 ); er meinte, nach dem Tode Josephs könnten über die Befugnisse des Reichsvikariats und die Fortsetzung des Reichstages leicht Zweifel in Regensburg entstehen, und er bat, den mecklenburgischen Comitialgesandten erklären zu lassen, daß die Reichsverweser sofort ihr Amt antreten könnten und in ihrer Tätigkeit


|
Seite 279 |




|
von den Fürsten nicht gehindert werden sollten. Die Rechte dieser und eine baldige Beratung in der Reichsversammlung über die Vikariatsbefugnisse mögen vorbehalten bleiben. Es sollten Streitigkeiten und Untätigkeit in Regensburg vermieden werden, das allein sei der Grund zu diesem Schreiben. - Der Herzog antwortete zustimmend, und Gemmingen erhielt entsprechende Anweisung, die er in der Reichstagssitzung vom 19. April 1790 ausführte, und die sich in dem Votum Mecklenburgs 165 ) für die Notwendigkeit der Fortsetzung der Reichstagsgeschäfte aussprach.
Jetzt schien dem Herzog und seinen Ministern der Zeitpunkt gekommen, wo sie die Angelegenheit des Privilegium de non appellando illimitatum wieder aufrollen konnten. Die Absendung Lützows von Berlin nach Dresden wurde vorgeschlagen und am 17. März beschlossen 166 ). Er sollte dort dem Kurfürsten die Komplimente der beiden mecklenburgischen Herzöge machen und gleichzeitig das Vikariatsgericht für die Privilegsache interessieren. Am 15. April traf Lützow in Dresden ein und erledigte seine Aufträge. Er erhielt zunächst freundlichen Bescheid von den sächsischen Ministern, dann aber wurden diese zurückhaltender; sie hatten festgestellt, daß die vormaligen Vikariatsakten zur Hälfte mecklenburgische Streitsachen betroffen hatten. Sie meinten jetzt, man könne die Sache nicht übersehen, der Herzog möge eine besondere Abschickung oder ein längeres ausführliches Schreiben veranlassen. - Am 25. April kehrte Lützow nach Berlin zurück. Das Vikariat nahm Mecklenburg doch nicht weiter in Anspruch.
Statt dessen sandte das Ministerium am 14. Juni ein längeres Schreiben an die preußischen Räte und erinnerte an das versprochene Privileg, das man seinerzeit habe ruhen lassen, um einen besseren Zeitpunkt abzuwarten, "da von der allzu nachsichtsvollen Circumspection Josephs II. gegen die Stände nichts mehr zu erwarten war" 167 ). Der Hergang der ganzen Angelegenheit wurde eingehend vorgetragen; jetzt wolle man Preußen um Unterstützung und Erwähnung der Sache bei den Verhandlungen mit dem künftigen Kaiser und besonders bei der Wahlhandlung in Frankfurt und um dahingehende Instruktion der Gesandten bitten. In die kaiserliche Wahlkapitulation möge in den Artikel 18


|
Seite 280 |




|
Paragraph 6, der von diesen Privilegien sprach, hinter "die Notdurft zu deren Verleihung väterlich beobachten" ein erleichternder Zusatz aufgenommen werden: "hinfolglich da, wo bereits der Widerspruch eines tertii als unstatthaft und ein jus contradicendi als unerfindlich verworfen worden, unerwartet einer Vereinbarung mit denselben, das nachgesuchte Privilegium in gewöhnlicher Fassung erteilen und gegen Erlegung herkömmlicher Taxen unauffällig ausfertigen zu lassen". Preußen möge diesen Zusatz, der ganz auf die mecklenburgischen Verhältnisse zugeschnitten wäre und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt hätte, nachdrücklich befürworten und im Kurfürstenkollegium, das ja die Wahlkapitulation beraten mußte, durchsetzen. Mecklenburg wolle sich auch deswegen unmittelbar an alle Kurhöfe wenden und sogar einen eigenen Bevollmächtigten zum Wahlkonvent nach Frankfurt absenden, mache diese Pläne aber von der Zustimmung Preußens abhängig. Lützow bekam den Auftrag, sich mit den Geheimräten Hertzberg und Steck vertraulich zu besprechen 168 ).
Das preußische Ministerium antwortete unter dem 26. Juni und riet zur Vermittlung der Kurfürsten und Absendung eines Gesandten nach Frankfurt. Es hätte selbst schon die beiden Wahlbotschafter (Graf Goerz und Fürst Sacken) mit der Unterstützung der mecklenburgischen Wünsche beauftragt. - Am 1. Juli 1790 bat der Herzog den König Leopold als Inhaber der Kurwürde von Böhmen unter Berufung auf den Teschener Frieden und das Reichshofratskonklusum von 1781, das aber durchaus nicht den Erwartungen des Herzogs entsprochen habe, die endliche Ausführung des Privilegs zu ermöglichen, und zwar dadurch, daß in der Wahlkapitulation "die väterliche Beobachtung der Notdurft" so erweitert würde, daß jede Beschränkung für das Privileg fortfalle. Dieses Schreiben wurde dem Baron Binder in Hamburg zur Weitergabe übersandt. An alle Kurfürsten ergingen ähnliche Gesuche. Außerdem wurde dem Baron v. Lützow die Reise von Berlin nach Frankfurt befohlen, um auf dem Wahlkonvent die Wünsche Mecklenburgs durchzusetzen, die in einem ausführlichen Promemoria zur Überreichung in Frankfurt dargelegt waren 169 ).
Mit Kreditivschreiben an den Kurfürsten von Mainz und an den Bürgermeister und Rat der Reichsstadt Frankfurt versehen, reiste Lützow am 20. Juli ab. Es waren große Anschaffungen, nämlich zwei Wagen und üppige Kleider, dazu nötig gewesen;


|
Seite 281 |




|
denn in Frankfurt pflegte bei solchen Gelegenheiten große Pracht zu herrschen. Am 8. August traf Lützow in Frankfurt ein 170 ). Schon am 11. August war eine Auffahrt, bei der vor allem Kursachsen und Hannover riesiges Gepränge entfalteten.
Die Aussichten für die Sache Mecklenburgs waren zunächst ganz günstig. Lützow traf den Reichshofrat Baron v. Bartenstein, der Kurböhmen vertrat, und hoffte, ihn bei einem Diner zu gewinnen. Kurbrandenburg war bei der Unterstützung tätig und wirksam, nur Sachsen zeigte sich widerspenstig und war der Ansicht, es sei eine res judicata, über die bereits ein Konklusum vorliege. Von einem Einvernehmen zwischen Österreich und Preußen hoffte Lützow am meisten 171 ).
Da traten Zwischenfälle ein, die die Erfüllung der herzoglichen Wünsche sehr in Frage stellten. Böhmen, Köln, Trier und Pfalz machten Schwierigkeiten, und unter den Wahlbotschaftern erhoben sich Streitigkeiten 172 ). Preußen geriet dadurch, daß Kurmainz sich auf die Seite der katholischen Kurfürsten stellte, in Nachteil, und sein Einfluß wurde geringer. Lützow gab sich für seinen Auftrag alle Mühe, der Reichshofrat v. Bartenstein erinnerte zwar von der ganzen Sache, die er damals verhandelt hatte, nichts mehr, doch versprach er, sich damit zu beschäftigen. Den Grafen v. Loeben, den Gesandten Sachsens, konnte Lützow nicht überzeugen; jener blieb dabei, daß die Wünsche des Herzogs nicht erfüllt werden könnten, da die Rechte Dritter stets gewahrt bleiben müßten. Lützow begab sich sogar zum Kurfürsten von Mainz nach Aschaffenburg, wurde zwar sehr freundlich empfangen, aber man wollte von der Angelegenheit nicht viel wissen, sondern riet, einen passenderen Zeitpunkt abzuwarten. Der Baron v. Waldenfels (Kurköln) schlug Lützow gelegentlich eines Diners bei dem Grafen Goerz vor, daß die Frage ganz aus der Wahlkapitulation fortbleiben und nur in einem besonderen kurfürstlichen Kollegialschreiben dem Kaiser empfohlen werden sollte. Darauf ging aber der mecklenburgische Gesandte zunächst noch nicht ein.
Eine gute Unterstützung hatte Lützow in Frankfurt an dem württembergischen Comitialgesandten Baron v. Seckendorf 173 ), den


|
Seite 282 |




|
der Herzog selbst wegen der Verwandtschaft Württembergs und Mecklenburgs in einem besonderen Schreiben um Beistand gebeten hatte. Denn nicht allein die Privilegsache wollte Friedrich Franz berücksichtigt wissen, sondern Lützow sollte auch dafür sorgen 174 ), daß die Lehnsangelegenheit jetzt endgültig geregelt würde; auch dazu hatte er eine besondere Denkschrift aus Schwerin erhalten, die den Wahlbotschaftern vorgelegt werden sollte. Ein Rundschreiben hatte die altweltfürstlichen Häuser zur Teilnahme an diesen Schritten aufgefordert. Man wollte dafür sorgen, daß der kaiserliche Hof bestimmte Vorschriften für die Ausübung des Lehnsrechts mitbekomme. Die Kurfürsten sollten keine Vorteile vor den anderen Fürsten erhalten; man fürchtete, Kurmainz und Böhmen könnten solche für die Kasse des künftigen Reichshofrats und des kaiserlichen Hofes beantragen und durchsetzen. Auch Gemmingen in Regensburg hatte Anweisungen darüber erhalten. Aber diese Bemühungen blieben umsonst, in der Lehnsangelegenheit wurden keine Änderungen in die Wahlkapitulation aufgenommen.
In Darmstadt befand sich gerade der Prinz Karl von Mecklenburg-Strelitz 175 ). Dieser hoffte die Nachricht von der erfolgten Wahl an Leopold überbringen zu können, eine Aufgabe, die meistens anwesenden Prinzen zuzufallen pflegte; der Landgraf von Hessen hatte auch bei einer solchen Gelegenheit von Kaiser Franz I. das Privilegium de non appellando illimitatum erhalten.
Der Graf Goerz setzte sich anfangs für den Zusatz zu Art. 18, den Mecklenburg gewünscht hatte, ein und beabsichtigte, dem Wahlkonvent ein Monitum zu übergeben, aber die meisten Gesandten machten schon vorher Einwendungen, und dann kam inzwischen der Befehl aus Breslau 176 ), daß solche Monita zurückgehalten werden sollten, von welchen man voraussetzen könnte, daß sie nicht günstig aufgenommen werden oder der Parität ausgesetzt sein würden. Minister v. Beulwitz (Hannover) und andere Herren stellten Lützow in einer langen Konferenz vor, daß dem Herzog nicht damit gedient sein könne, wenn, wie es schon gewiß schiene, bei der jetzigen Lage der preußische Hof mit seinem


|
Seite 283 |




|
Ansuchen in der mecklenburgischen Sache nur abgewiesen würde. Lieber sollte eine neue Denkschrift um das kurfürstliche Kollegialschreiben an den künftigen Kaiser bitten. Da mußte Lützow nachgeben und setzte ein neues Promemoria auf, das er dem Mainzischen Direktorium übergab, und das am 11. September auf dem Wahlkonvent diktiert wurde. Jetzt unterstützten Pfalz, Köln, Sachsen, Brandenburg und Hannover dieses neue Gesuch. Mainz hatte sich etwas zurückgezogen, da Albini 177 ) "wahrscheinlich aus Eigennutz und der Sporteln halber" seinen Einfluß geltend gemacht hatte. Auch wurde jetzt ein neues Empfehlungsschreiben des Herzogs für Lützow den Wahlbotschaftern überreicht; denn das ursprüngliche war nicht richtig befunden, "weil einesteils die den kurfürstlichen Herrn Botschaftern zukommenden Prädikate sich nicht in derjenigen Ordnung placiert finden, in welchen dieselben ihrem Rang nach auf einander folgen, sodann aber weil anderen Teils die Ausdrücke "Ew. Liebden, Exzellenzen und Herren" dem den sämtlichen kurfürstlichen Herren Wahlbotschaftern gebührenden gleichen Rang keineswegs gemäß find und also eine Umänderung erfordern, wodurch diesen beiden Umständen gänzlich abgeholfen werde."
Am 14. September wurde ein kurfürstliches Kollegialschreiben in der Sache Mecklenburgs einstimmig angenommen 178 ). Auch Herr v. Fechenbach (Mainz) hatte sich jetzt dafür eingesetzt, und der Baron Bartenstein zeigte dem Grafen Goerz sogar ein Schreiben aus Wien, das eine erbetene Auskunft über die ganze Privilegsache enthielt. Danach sollte Joseph II. schon 1785 auf Veranlassung der russischen Kaiserin in einem Handbillett die Erteilung des Privilegs befohlen haben, aber die Stände hätten mit ihren


|
Seite 284 |




|
Vorstellungen die Ausführung verhindert, Geld sei dabei aber nicht gespart worden 179 ).
Inzwischen machte die Wahlangelegenheit Fortschritte, und der Herzog sandte Lützow schon am 14. September ein Gratulationsschreiben, das dem künftigen Kaiser Leopold überreicht werden sollte. Es trafen eine Reihe von Fürstlichkeiten in Frankfurt ein, Herzog Albert von Sachsen-Teschen und Gemahlin und die drei geistlichen Kurfürsten. Lützow wartete als "particulier" auf, da keine besonderen Audienzen genommen wurden. Nach der Wahl am 30. September wurde Prinz Karl von Mecklenburg-Strelitz wirklich beauftragt, das Wahldiplom nach Mergentheim zum Kaiser zu bringen, und er nahm sich vor, die Privilegienangelegenheit Leopold vorzutragen. Am 5. Oktober kehrte der Prinz hocherfreut zurück. Er hatte einen schönen Degen erhalten und dazu das Versprechen, der Kaiser werde sich des Privilegs annehmen, wenn es irgend tunlich wäre. Der Vizekanzler Fürst Colloredo, den Lützow noch aufgesucht hatte, versprach ebenfalls seine besten Bemühungen, aber er erwähnte doch den Widerspruch der Stände.
Über die Krönung des Kaisers berichtete Lützow am 11. September: "Vorgestern ist die kaiserliche Krönung auf die gewöhnliche feierliche Art, und welches sehr zu verwundern, ohne Unglück vor sich gegangen. Es ist wohl gewiß, daß diese erhabene Feierlichkeit einen großen Eindruck auf jeden Zuschauer machen muß, und daß in keinem Lande der Welt das Oberhaupt von einer solchen Anzahl von Kurfürsten, Fürsten und Reichsgrafen bedient und begleitet werden kann." Am 10. Oktober konnte Lützow dem neuen Kaiser das Glückwunschschreiben seines Herzogs überreichen und sein Anliegen vortragen; "der Kaiser hörte geduldig und huldreich zu und antwortete mit vieler Dankbarkeit und mit Versicherung der Begierde, welche er hätte, dem herzoglichen Hause nützlich zu sein" 180 ). Einweiteres Gesuch, das die Angelegenheit selbst betraf, wurde von dem Gesandten nicht übergeben, da das Kollegialschreiben erst später in die Hände des Kaisers kam. Lützow war unermüdlich, alle nur denkbaren Vermittlungen in Anspruch zu nehmen. Der Prinz Karl hatte leider keine Gelegenheit mehr, sich bei Leopold zu verwenden, aber der Reichsvizekanzler wurde eifrig bestürmt. Auch Fürst von Sacken und Graf Goerz versicherten, ihr möglichstes getan zu haben; Colloredo habe ihnen versprochen, daß der Kaiser das herzogliche Haus um so mehr


|
Seite 285 |




|
zufriedenzustellen wünsche, da er auch dadurch dem König von Preußen einen Beweis seiner Freundschaft geben könnte. Selbst Graf Cobenzl, der österreichische Staatsvizekanzler, machte sowohl dem Fürsten Sacken als auch Lützow große Hoffnungen und meinte, die Angelegenheit gehöre gar nicht erst vor den Reichshofrat, sondern sei eine rein politische Gnadensache. Am 16. Oktober begab sich der mecklenburgische Gesandte nach Berlin zurück.
In Schwerin war inzwischen ein Schreiben Leopolds vom 14. September eingetroffen, in dem er bedauerte, sich nicht für Erweiterung der kaiserlichen Rechte in der Wahlkapitulation einsetzen zu können, wie der Herzog gebeten habe, da er selbst Bewerber um den Kaiserthron sei. Wenn das kurfürstliche Kollegium etwas darin täte, würde er sich sehr freuen. - Am 28. Oktober teilte das preußische Ministerium mit, daß leider nicht mehr zu erreichen gewesen sei, als nur das kurfürstliche Schreiben. Der Herzog dankte dem König Friedrich Wilhelm und bat um weitere Unterstützung. Der Fürst Sacken sandte noch einen besonderen Bericht und meinte, seine Erfolge seien der Einstimmigkeit zwischen Österreich und Preußen, die jetzt herrsche, zu verdanken.
Doch erst am 12. Februar 1791 wurde die Privilegiensache in Angriff genommen und an den preußischen Residenten v. Jakobi in Wien eine Anfrage gerichtet, wie die Aussichten für eine neue Bitte um die Erteilung des Privilegs seien. Der am 13. Mai 1788 mit Rostock geschlossene Erbvertrag wurde mitgesandt. Jakobi antwortete 181 ), daß neue Vorstellungen beim Kaiser nötig seien, auf den es allein ankäme. Aber zunächst müsse eine Vereinbarung mit den Ständen über das Oberappellationsgericht getroffen werden und die Gerichtsordnung so verfaßt sein, daß der Reichshofrat erkenne, jedermann könne sich in allen Fällen wegen einer unparteiischen Gerechtigkeitspflege beruhigen. Wenn eine solche Ordnung den Ständen vorgelegt und sie darüber nach ihren Bedenken befragt seien, müßte der Herzog eine Vorstellung unter Berufung auf das Kollegialschreiben der Kurfürsten beim Kaiser einreichen. Auch die Unterstützung fremder Höfe sei am Platze; dann werde Leopold, der eingerissene Fehler und Mißbräuche gerne abschaffe, nicht mehr durch das Vorgehen der Ritterschaft von der Erteilung des Vorrechtes für Mecklenburg zurückgehalten werden.
Diesen Vorschlag hielten die Räte in Schwerin nicht für richtig 182 ); denn erst mußte man bestimmt die Befugnisse und Grenzen des Oberappellationsgerichts kennen, ehe eine Gerichts-


|
Seite 286 |




|
ordnung dafür mit Sicherheit entworfen werden konnte. Mit den Landständen konnte man weit besser verhandeln, wenn man das Privileg so hatte, wie es sein sollte. Dann konnte der Herzog sich immer noch nachgiebig und unparteiisch zeigen. Nun sollte Lützow beauftragt werden, die preußische Regierung zu sondieren und auch durch seinen Neffen von der Lühe, der sich gerade in Wien aufhielt, dort noch einige "gute Kanäle" zu suchen. Diese fanden sich jedoch nicht, wie es scheint; denn in dieser Angelegenheit wurde nicht mehr verhandelt. Erst 1803 tauchte der Gedanke daran wieder auf. Ein Jahr nach der Thronbesteigung des Kaisers mußte die Belehnung der Reichsfürsten erfolgen. Deshalb sandte schon am 15. April 1791 das Schweriner Ministerium ein Rundschreiben an die altweltfürstlichen Häuser mit der Frage, was jetzt in der Lehnsangelegenheit zu tun sei 183 ). Ebenso wurde wieder Baron v. Gemmingen in Regensburg beauftragt, mit anderen Gesandten Fühlung zu nehmen, nachdem die Kaiserwahl keine Veränderung gebracht habe. Die Antworten lauteten, man müsse doch wieder zur Lehnsmuthung schreiten, bis die Beschwerden aus der Welt geschafft seien. Aber als dann Mecklenburg wieder einwandte 184 ), die Kurfürsten hätten immer noch zu viele Vorteile, ihnen sei z. B. auch die Entschuldigung des persönlichen Fernbleibens beim Belehnungsakt erlassen, da kam es am 23. Mai 1791 zu einem "Konzert der altweltfürstlichen Häuser" in Regensburg. Es wurde eine "Registratur" 185 ) aufgesetzt, in der der gemeinsame Standpunkt in der Lehnsangelegenheit dargelegt wurde; es unterzeichneten Sachsen-Weimar, Baden, Meiningen, Coburg-Saalfeld, Hessen-Cassel, Braunschweig-Wolfenbüttel, Sachsen-Gotha, Württemberg, Ansbach-Bayreuth und Anhalt. Holstein-Glückstadt Schloß sich bezeichnenderweise aus. In dem Schriftstück wurden insbesondere die Einwendungen der Fürsten gegen die hohen Taxen und gegen das Zeremoniell festgestellt. Falls eines der Häuser sich beschwert fühle, solle es sich sofort mit den anderen in Verbindung setzen und auf die Vorstellungen von 1767 berufen, überhaupt sei eine Lehnsmuthung nicht ausgeschlossen, da sie verfassungsgemäß sei und vom Kaiser gefordert werden könne.
Als dann die drei geistlichen Kurfürsten und Anhalt und Württemberg während des Sommers zu Indultgesuchen schritten, schrieb auch Herzog Friedrich Franz am 9. September 1791 an den Kaiser, teilte ihm "als treugehorsamster Reichsfürst" seine


|
Seite 287 |




|
Bereitwilligkeit zur Lehnsnehmung mit. Doch seien die fortwährenden Behinderungen wegen der bereits 1767 geäußerten Anstände noch vorhanden, bis zu deren Erledigung er um Befristung und um die Erteilung eines gewöhnlichen Muthscheins bitte. Anfang November erfolgte vom Reichshofrat das Konklusum, die Lehnsrequisition sei ad acta genommen, und statt des Muthscheins wurde ein Protokollauszug erteilt 186 ). Mit diesem Vorgehen waren die anderen Höfe vollkommen einverstanden und folgten, soweit sie nicht schon Lehnsfrist erlangt hatten, dem Beispiel Mecklenburgs 187 ).
Nach der Wahl und Krönung Leopolds war in Mecklenburg der Regierungsantritt öffentlich durch Zeitungen bekanntgegeben und Danksagung in den Gottesdiensten angeordnet. Am 29. Dezember 1791 gratulierte der Herzog dem Kaiserhaus zu der Geburt einer Tochter des Erzherzogs Franz und seiner zweiten Gemahlin Maria Theresia. - Mit dem Einvernehmen Preußens und Österreichs war der Herzog sehr zufrieden; ihm war es am liebsten, wenn er mit beiden Höfen gleichmäßig freundlich verkehren konnte, ohne fürchten zu müssen, den einen oder anderen zu beleidigen. Durch einen Besuch des Prinzen Friedrich Josias von Coburg (ein Onkel des Herzogs) und des päpstlichen Nuntius Caprara 188 ) aus Wien am 4. Juni 1791 in Ludwigslust wurden glänzende Feste veranlaßt, zumal der Prinz im Türkenkriege siegreich gewesen war. Die beiden Persönlichkeiten trafen sich mit dem Könige von Schweden, um Besprechungen zum Schutze Ludwigs XVI. abzuhalten. Auch hierdurch wurde die Verbindung mit dem Wiener Hof etwas belebt. Die Neujahrsglückwünsche, die unter Joseph II. unterlassen waren, wurden jetzt wieder gesandt.
Wegen der Lütticher Unruhen schien es einen Augenblick möglich, daß der niedersächsische Kreis Truppen aus den Reichsmitständen heranziehen werde; für diesen Fall wollte der Herzog das Bataillon aus Holland verwenden, aber es kam nicht mehr dazu.
Nach kurzer Regierung starb Kaiser Leopold II. am 1. März 1792. Als die Nachricht eintraf, wurde Landestrauer angesagt (1. bis 15. April) und auch alle übrigen Anordnungen getroffen, die der Tod eines Kaisers nötig zu machen pflegte. Das Theater wurde sogleich geschlossen. An König Franz sandte der Herzog


|
Seite 288 |




|
sofort ein Schreiben, in dem von dem Schmerz die Rede war, von welchem er "über den Verlust des besten und ewig unvergeßlichen Kaisers mit allen Verehrern erhabener Fürstentugenden und mit allen rechtschaffenen Patrioten des Deutschen Reichs gemeinschaftlich ganz durchdrungen sei". Auch beim Tode der Kaiserin-Witwe am 15. Mai 1792 erging ein Beileidsschreiben.
Bis zur Wahl Franz' II. war wieder das Vikariat in Tätigkeit; am 20. Juli konnte dann der Herzog dem Baron Binder das Glückwunschschreiben zur Thronbesteigung des neuen Kaisers übermitteln 189 ). Bald darauf traf die offizielle Notifikation ein 190 ), die der Herzog dieses Mal durch ein weiteres Schreiben beantwortete. Von einer besonderen Absendung sah er ab, weil die Kosten zu groß waren, und auch keine geeignete Persönlichkeit in der Nähe von Wien war, die man hätte beauftragen können 191 ).
Wegen der Belohnung schrieb der Herzog am 3. Juni 1793 an Kaiser Franz und bat, wie schon zwei Jahre vorher, um Lehnsfrist und einen Protokollauszug statt des Muthscheins. Das Gesuch wurde am 22. August erfüllt. Der Herzog fügte seinem Schreiben hinzu: "Im übrigen erkläre ich mich in Untertänigkeit so schuldig als bereit, alles dasjenige, was mir dieser Lehnsempfängnis halber nach den Reichsgesetzen und dem Herkommen obliegt, gleich anderen getreuen Reichsfürsten und Vasallen auf das genaueste zu beobachten und zu praestieren. Nichts soll und wird unterdessen mich abhalten, die schuldigen Pflichten der unverbrüchlichsten Lehnstreue, gleich als wären sie bereits von mir beschworen, gegen Ew. Kaiserl. Majestät als meinen höchstverehrlichen Reichslehnsherrn bei jeder Gelegenheit und in der tiefsten Ehrerbietung zu erfüllen."
Bald sollte eine Gelegenheit kommen, wo nach diesen Versprechungen gehandelt werden mußte.
Mecklenburg im Reichskriege gegen Frankreich (1792-97).
Noch während der Regierung Leopolds war an die Kreisdirektoren ein kaiserlicher Gebots- und Verbotsbrief ergangen, der die Unruhen und aufrührerischen Bewegungen Frankreichs


|
Seite 289 |




|
betraf. Der Herzog erhielt dieses Avokator- und Inhibitor-Patent im Dezember 1792 und Schritt zu seiner Veröffentlichung 192 ); es sollten nicht nur die Intelligenzblätter dazu benutzt werden, sondern alle vorhandenen Möglichkeiten. Die Verkündigung des Kaisers enthielt acht Punkte. Es wurden Militärdienste in Frankreich verboten; vor Aufrührern und Volksverführern wurde gewarnt; eine Strafe gegen die, welche sich zum Aufruhr gebrauchen ließen, angedroht, ferner jede Verbindung mit Frankreich, die Ausfuhr von Pferden, Kriegsmaterial und Lebensmitteln dorthin untersagt; der Verlust von Geldern (Assignaten) und der Briefwechsel sollte möglichst vermieden und endlich der Verkehr und die Schriftenverbreitung im Reich überwacht werden. Der Herzog ließ noch einige Sätze hinzufügen und erinnerte darin an das Glück einer geordneten Verfassung: "Desto ernstlicher und landesväterlicher werden Unsere getreuen Untertanen hierdurch gewarnet; weder müßigen Spekulationen und hämischen Insinuationen eingebildeter Philosophen oder unberufener Volksaufwiegler, die auf eine Verkennung der gesetzmäßigen obrigkeitlichen Autorität, mithin auf den Umsturz regelmäßiger Verfassungen und auf zudringliche Einführung idealistischer Systeme der Politik abzielen, Gehör und Raum zu geben oder sich dadurch in der Schuldigen Anhänglichkeit an die gesetzliche Verfassung, mithin an der treuen Ausübung ihrer zum Teil beschworenen Untertanenpflichten irremachen lassen, weniger noch selber dergleichen verderbliche Grundsätze äußern und, sei es mündlich oder schriftlich, zu verbreiten, vielmehr, wo sie dergleichen erfahren und vermerken, davon der kompetierenden Obrigkeit gebührende Anzeige zu machen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie als Aufrührer und Komplottmacher mit reichs- und landesgesetzlicher Strenge bestraft werden sollen." An die Superintendenten erging der Befehl, eine besondere Predigt anzuordnen und den Pastoren "ihre vorgeschriebene pflichtmäßige Lehre von der weltlichen Obrigkeit" gehörig einzuschärfen 193 ).
Auch in Mecklenburg regte sich in jenen Jahren unter der städtischen Bevölkerung in Schwerin und Rostock Unzufriedenheit, die hier und da zu offenem, wenn auch harmlosem Aufruhr aus-


|
Seite 290 |




|
artete; durch Eingreifen von Militär und Obrigkeit wurde schnell ein Ende damit gemacht. Friedrich Franz war kein Freund dieser Ideen 194 ).
Schon 1791 hatte ihn die Besetzung des Elsaß durch die Franzosen mit Ärger erfüllt, und da Mecklenburg hierdurch die beiden Straßburger Kanonikate, die es u. a. 1648 für Wismar erhalten, aber eigentlich schon 1687 durch Ludwig XIV. wieder eingebüßt hatte, jetzt verlor, wandte er sich nach Berlin, um freundschaftliche Unterstützung des Königs für eine Entschädigung seitens des Reiches zu erbitten. Diese könnte etwa nach Beendigung des Krieges, den Österreich und Preußen im Frühjahr 1792 gegen Frankreich eröffnet hatten, erreicht werden.
In Regensburg wurde nun über einen Reichskrieg gegen Frankreich verhandelt und für die Stellung der Kontingente der Repartitionsfuß im Reichsschluß von 1681 maßgebend erklärt. Danach hatte bei Bewilligung eines Triplums Mecklenburg-Schwerin 425 1/6 Mann Infanterie und 510 3/7 Mann Kavallerie zu stellen. Der Herzog war für ein Vorgehen des Reiches gegen Frankreich, doch hoffte er, seine Truppen durch Geldentschädigung, wie es in früheren Zeiten üblich gewesen war, ablösen zu können. Aber eine kaiserliche Verordnung bestimmte, daß sämtliche Kontingente in natura gestellt werden müßten; gegebenenfalls könnte ein Fürst die Stellung für einen anderen Staat mitübernehmen. Mecklenburg besaß nur eine ganz geringe Anzahl Soldaten, die drei Infanteriebataillone waren nach dem noch erst 1791 für drei Jahre erneuerten Vertrag in holländischen Diensten. Dort könnten sie ebensogut gegen Frankreich kämpfen wie am Rhein, meinten die mecklenburgischen Minister 195 ). Jetzt wurde eine unmittelbare Beteiligung am Reichskriege nötig. Deshalb ergingen Anfragen wegen einer Stellvertretung an den Herzog von Braunschweig, Anfang Dezember; sie wurden ablehnend beantwortet 196 ). Da wurde der Baron v. Gemmingen in Regensburg beauftragt, im Falle einer Reichskriegserklärung bei dem österreichischen und brandenburgischen Gesandten auf eine Erlaubnis hinzuwirken, daß kleine und entfernt" vom Kriegsschauplatz liegende Staaten für die Truppenstellung entsprechende Beiträge an die Reichsoperationskasse zahlen könnten.
Als im Februar 1793 die Nachricht von der Hinrichtung des französischen Königs in Schwerin eintraf, legte der Herzog un-


|
Seite 291 |




|
aufgefordert Trauer an, weil der kaiserliche Hofes sicher auch tun werde 197 ). In diesen Tagen traf ein Schreiben des Reichsfeldmarschalls, des Prinzen Friedrich Josias von Koburg, an den Herzog ein, in dem der Oheim seinem Neffen vorschlug, daß Mecklenburg, abgesehen von seinem Kontingent, etwa zwei Regimenter auf Reichskosten stellen solle. Am 12. Februar antwortete der Herzog eigenhändig, er habe leider keine Truppen, kein Geld und keine Menschen: "Ginge es nach meinen Wünschen, so setzte ich mich gern, sobald es die Zeit erlauben würde, vor mein Regiment und marschierte, wohin sie befohlen; denn unter Ihrem Kommando, es sei in was für einem Verhältnis, wollte ich getreu mein Leben und Blut aufopfern; denn, bester Herr Onkel, sie können nicht glauben, was in mich für eine innerliche Wut gegen die Franzosen glühet, und besonders seit der Ermordung des unschuldigen Königs. Wollte Gott, ich wäre in diesem Augenblick Ihr Adjutant, so könnte ich doch persönlich beweisen, daß, was ich hier schreibe, nicht leeres Geschwätz ist, aber so muß ich mit Anwünschung alles möglichen Glücks und wahrhaftiger Teilnahme an den zu hoffenden glücklichen Fortschritten Ihrer vorzunehmenden kriegerischen Operationen als ein unbrauchbares Geschöpf hinter dem Ofen sitzen und sehen, wie Menschen, die nichts besser sind wie ich, dem allgemeinen Besten nützliche Dienste leisten." Ein Aufruf zu freiwilligen Beiträgen zur Verteidigung des Reiches, der von Regensburg übersandt war, wurde in Schwerin bekannt gemacht 198 ).
Inzwischen war im März ein Reichsgutachten für den Krieg gegen Frankreich zustande gekommen, und Mecklenburg mußte ernstlich an die Vertretung seiner Truppen herangehen. Da traf die Nachricht ein, daß doch beim Reichsfeldmarschall noch eine Möglichkeit vorhanden sei, für Geldzahlung Truppen zu erhalten 199 ). Deshalb wurden lange Verhandlungen mit dem Befehlshaber des Reichsheeres, mit dem kaiserlichen Gesandten beim niedersächsischen Kreis in Hamburg, ja mit dem Kaiser selbst notwendig. Der Schriftwechsel des Herzogs Friedrich Franz läßt stets die Treue zum Reich und die Bereitwilligkeit zur Erfüllung seiner Pflichten als Reichsfürst erkennen, aber die traurigen Verhältnisse in Mecklenburg waren mächtiger als er. Der Herzog scheute weder die Absendung eines besonderen Gesandten (Kammerherr v. Dorne), noch die Kosten der Stellvertretung, die der kaiserliche


|
Seite 292 |




|
Feldherr (Prinz v. Koburg), beschaffte, der ein Bildnis des Herzogs in Medaillenform enthielt. Mecklenburg hatte 195500 fl. für die Zeit vom 1. März 1793 bis 1. März 1794 zu zahlen. Die etwaigen Römermonate, die zum Unterhalt des Reichsheeres noch auf dem Reichstag bewilligt werden konnten, zählten dabei noch nicht mit. Der Landtag bewilligte von den Kosten, allerdings unter Bestreitung der Verbindlichkeit, 100000 fl., das übrige mußte aus der herzoglichen Kasse gezahlt werden.
Dabei kam es noch zu kleineren Reibereien mit Preußen; denn der König als Kreisdirektor fühlte sich übergangen, obwohl er kurz darauf seine Unlust an dem ganzen Kriege zeigte. Als der Reichstag, auch der mecklenburgische Gesandte, später forderte, daß auch die preußischen Truppen unter den Befehl des Reichsfeldmarschalls gestellt würden, zog Friedrich Wilhelm II. bekanntlich 1794 seine Truppen ganz von der Beteiligung am Kriege zurück.
Preußens Zurücktreten veranlaßte den Kaiser, doppeltes Gewicht auf die Verstärkung des Reichsheeres zu legen, und neue Forderungen traten an Mecklenburg heran; ein Mahnungsschreiben nach dem andern traf in Schwerin ein. Selbst der Gedanke an eine Reichsexekution, wie sie einst Herzog Karl Leopold erlebt hatte, wurde wieder lebendig. Viel Schuld hatte an dieser Verlegenheit die Gebundenheit des Herzogs in finanzieller Hinsicht an den Landtag. Sämtliches Militär mußte er allein erhalten, und zu Römermonaten (Beitrag für die Erhaltung des Reichsheeres im Betrage von 182000 fl., repartiert auf Kreise und Territorien) brauchte die Ritterschaft erst beizutragen, wenn über 200 in einem Jahr vom Kaiser oder von Reichs- und Kreiswegen gefordert wurden; die Städte zahlten erst, wenn über dreihundert Römermonate bewilligt waren. Nur über eine "Kontribution zu Garnisons-, Fortifikations-, Legationskosten, zu Reichsdeputations- und Kreistagen" sollte man sich nach dem Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich jedes Jahr auf dem Landtag vergleichen. Diese Lage macht es vielleicht verständlich, weshalb der Herzog sich so sträubte, Truppen aufzustellen; seine Kasse hätte es schwerlich leisten können. Die Reichstreue Mecklenburgs ist auch in diesen Verhandlungen immer wieder zu erkennen und war besser als die mancher anderer Staaten, die sich überhaupt nicht ernstlich bemühten.
Immer wieder suchte der Herzog bei den größeren oder militärisch leistungsfähigeren Staaten, wie Braunschweig und Hessen-Kassel, um Stellvertretung nach. Als das keinen Erfolg hatte, wurde die Berufung eines außerordentlichen Landtages in Erwägung gezogen, aber glücklicherweise gelang noch vorher die


|
Seite 293 |




|
Ablösung durch Truppen, die unter Prinz v. Rohan dem Reichsfeldmarschall (Herzog Albert v. Sachsen-Teschen) zur Verfügung stellen konnte.
Auf dem Reichstage in Regensburg war inzwischen das fünffache Kontingent bewilligt. Wie sehr die bedrängte Lage des Reiches dem Herzog Friedrich Franz am Herzen lag, beweist die Tatsache, daß er schon am 8. Oktober 1794 die Landräte durch ein Rundschreiben aufforderte, nach Schwerin zu kommen, um mit der Regierung zu beraten, was in der Kontingentsangelegenheit zu tun sei; denn die Stände müßten dazu herangezogen werden.
Nach § 168 des Erbvergleichs sollten in "vorfallenden Nöten" zunächst die Landräte gehört werden. Diese erschienen auch am 28. Oktober. Man trug ihnen die ganze Sachlage genau vor und, teilte ihnen auch mit, daß jetzt das fünffache Kontingent auf Reichstagsbeschluß zu stellen sei. Sie gaben indessen keine bestimmte Antwort, hießen die herzoglichen Maßnahmen gut und versprachen, dem Engeren Ausschuß in Rostock Bericht zu erstatten. Auf dem dann folgenden Landtag, wo der Herzog den Anschlag für das bewilligte fünffache Kontingent vorlegen ließ, mußte er erklären lassen, er vermisse den Patriotismus der Stände. Er bat, "die Schwierigkeiten zu unterlassen, um dem Reich einen öffentlichen Beweis von der politischen Gesinnung der hiesigen Stände zu geben". Aber dieser Wunsch des Landesherrn wurde nicht erfüllt. Der Landtag bewilligte zwar für das Triplum (dreifache Kontingent) monatlich 30 540 Taler, aber von weiteren Leistungen wollte er nichts wissen, weil darüber noch keine besondere Anforderung des Kreisdirektoriums vorliege und auch wohl nie eingehen werde. Ferner bestand er auf Einberufung eines besonderen Kreistages; denn die Belastung Mecklenburgs sei zu groß, auch habe der Herzog selbst viel zu wenig zur Verteidigung des Reiches beigetragen. Zur Stellung des Reichskontingents verpflichte die Stände eben kein Gesetz; was sie zahlten, sei freiwillige Beihilfe.
Kaum war der Landtag geschlossen, da traf ein Schreiben des Kreisdirektoriums vom 17. November 1794 ein und verlangte unter Beifügung des kaiserlichen Dekrets die ungesäumte Stellung des fünffachen Kontingents. Die Verlegenheit und Sorge in Schwerin war nicht gering. Die Besorgnis vor unangenehmen Überraschungen wurde auch wieder laut, da Geheimrat v. Bassewitz meinte: "Wir müßten meines Erachtens sehr auf unserer Hut sein und von den Reichsschlüssen, soviel nur immer möglich ist, um, kein Haarbreit abweichen." Es wurde betont, daß Mecklenburg


|
Seite 294 |




|
"immer noch die Gesinnungen hegte, welche das Herzogshaus unter den patriotisch denkenden Fürsten Deutschlands stets ausgezeichnet hätten."
Ehe noch die Angelegenheit zum Abschluß gelangt war, kam es im Frühjahr 1795 (5. April) zum Frieden von Basel zwischen Preußen und Frankreich. Alle Reichsstände, welche binnen drei Monaten die Vermittlung des Königs von Preußen nachsuchten, sollten für neutral erklärt werden, und im Mai wurde zur Sicherung Norddeutschlands eine Demarkationslinie von Ostfriesland bis an den Main vereinbart. Jetzt geriet Mecklenburg in eine schwierige Lage. Preußen hatte gewissermaßen den Frieden für das Land mit geschlossen, während sich das Reich noch im Krieg befand und der jetzige Reichsfeldmarschall erneut dringend zur Stellung des fünffachen Kontingents mahnte. An einen Partikularfrieden mit Frankreich dachte der Herzog gar nicht, auch gegen Preußen hegte er Mißtrauen; es könne am Ende seinen Schutz nur deshalb anbieten, um dafür das Recht zur Truppenwerbung im Lande verlangen zu können. "Eine voreilige verfassungswidrige Trennung von dem Reichsverbande und eine ohne alle Not ergriffene Absonderung von der kaiserlichen Partei dürften bei Kaiser und Reich eine üble Impression hervorbringen." So heißt es in einer Ministerialdenkschrift, der noch der Präsident v. Dewitz hinzufügte: Jeder Schritt, der zur Beteiligung am Frieden getan würde, ist dem kaiserlichen Hof auffallend und erregt Sensation und Widerwillen gegen den Herzog. Preußen wolle nur die Reichsfürsten von dem Reichsverband abziehen, um seine eigene Handlungsweise nicht so alleinstehend zu lassen. Hieraus sehen wir, daß die mecklenburgischen Minister durchaus nicht das Vorgehen Preußens, das zum Baseler Frieden geführt hatte, gutheißen konnten.
Mecklenburg zahlte, ohne es Preußen wissen zu lassen, noch für das ganze Jahr 1795 die Gelder für das dreifache Truppenkontingent. Allerdings stimmte Mecklenburg dem preußischen Antrag auf Einsetzung einer Reichsfriedensdeputation zu, ließ aber dabei erklären, daß eine möglichst geringe Anzahl von Bevollmächtigten am Platze sei, und der Kaiser solle im Namen des Reichs Friedensverhandlungen mit Frankreich beginnen. Natürlich wurde auf die mecklenburgischen Entschädigungsansprüche, die die Reichsdeputation bedenken solle, immer wieder hingewiesen.
Immerhin verlangte das Reich aufs neue zu Beginn des Jahres 1796 die erneute Stellung des fünffachen Kontingents. Wieder begannen neue schriftliche Verhandlungen, in denen der


|
Seite 295 |




|
Herzog seinen guten Willen, aber sein Unvermögen betonte, wenn der Kaiser ihn auf seine Pflichten zum Schutze des Vaterlandes hinweisen ließ.
Da wurde vom Niedersächsischen Kreisdirektorium ein Kreistag nach Hildesheim einberufen, auf dem Mecklenburg sich durch Geheimrat Graf v. Bassewitz vertreten ließ. Preußen verlangte jetzt noch die Stellung von Truppen zur Sicherung der Demarkationslinie. Das lehnte der mecklenburgische Gesandte seinem Auftrage gemäß entschieden ab; denn das würde der kaiserliche Hof als kränkend empfunden haben. Herr v. Dohm, der preußische Gesandte, ließ sich bei den Verhandlungen sogar zu der Äußerung hinreißen: "Nous n'avons pas le dos libre." v. Bassewitz schrieb: "Ich fürchte, es ist der letzte Kreistag, das Gebäude in Deutschland fällt, die Freiheit der Reichsstände sinkt." Schließlich wurde doch die Sicherung Norddeutschlands beschlossen. Mecklenburg konnte sich der Großmacht Preußen gegenüber nicht länger widersetzen und leistete in Zukunft keine Beiträge für das Reichsheer mehr. An die Stelle der Reichstreue trat jetzt der eherne Zwang der Lage, die für Schwerin eine der preußischen feindliche Politik ausschloß.
Mecklenburgs Teilnahme an dem Schicksal des Reiches vom Frieden zu Campoformio bis zum Reichsdeputationshauptschluß.
Nach dem Ausscheiden Preußens hatten Österreich und das Reich den Krieg gegen Frankreich fortgesetzt. Die Franzosen behielten schließlich trotz einiger Erfolge des Erzherzogs Karl die Oberhand, und der Kaiser mußte in den Frieden von Compoformio willigen. Am 20. April 1797, 10 Uhr abends, sandte der Legationssekretär Gumpelzhaimer diese Nachricht nach Schwerin ab; die Estafette traf am 25. April dort ein, und jetzt war die Freude groß. Man hoffte nun auch auf die Wiederherstellung des Reichsfriedens, über den denn auch bald wieder die Beratungen in Regensburg stattfanden. Der Herzog ließ das Votum "auf eine allgemeine Danksagung gegen Ihre Kaiserliche Majestät für die bezeugte reichsväterliche Sorgfalt, dem Reiche den längst erwünschten Frieden zu beschaffen, beschränken und den Antrag dahin richten, daß durch den Frieden der Status des Deutschen Reiches vor den mit Frankreich entstandenen Mißhelligkeiten in Grundlage älterer


|
Seite 296 |




|
Friedensschlüsse wiederhergestellt werde" 200 ). Am 4. Oktober, dem Tag des Namensfestes des Kaisers, ließ der Herzog den Frieden zwischen dem Kaiser und Frankreich publizieren. Dewitz meinte: "Quod felix faustumque sit!" Die offizielle Nachricht vom Friedensschluß sandte Baron Buol am 10. September 1797 201 ). Der Herzog dankte und äußerte, "der mir gütigst versicherten weiteren Mitteilung umständlicherer Nachrichten sehe ich um so sehnlicher entgegen, als ich mich gewiß überzeugt halte, daß durch die reichsoberhauptliche kaiserliche Fürsorge dem gesamten Deutschen Reiche ein auf dessen Integrität gebaueter heilsamer Friede baldig werde geschenkt werden".
Man darf nicht sagen, daß Äußerungen dieser Art bloße Schmeichelei gewesen wären. Dem Herzog und seinen Räten war das Dasein des Reiches ein notwendiger Bestandteil des deutschen Lebens. Dabei spielte die Tradition und die äußere Form gewiß ihre Rolle, aber man erwartete zunächst vom Kaiser, daß er die Rechte und Besitzungen der Fürsten schützen sollte, und der Gedanke an das deutsche Reich als solches fehlte nicht. Das trat deutlich hervor, als am 29. Dezember die Abschrift des Friedenstraktats zwischen dem Kaiser und Frankreich in Schwerin eintraf. Man war sehr verwundert über den Inhalt und vermißte die Erwähnung und die Zusicherung der Reichsintegrität, die der Kaiser doch dem Reichstage versprochen hatte. In dem Antwortschreiben an den Gesandten v. Buol wurde dies jedoch nicht erwähnt, "weil man das für Ironie halten könnte" 202 ). Es hieß nur: "Indem ich mit allen getreuen Verehrern des K. K. Erzhauses meine ehrerbietigsten Glückwünsche zu dem dadurch der österreichischen Monarchie erwünschten gesicherten Ruhestande und zu dem erhaltenen Zuwachs der kaiserlichen Erblande auf das teilnehmendste vereinige, bleibt mir nur noch der patriotische Wunsch übrig, daß die reichsoberhauptlichen Sorgen und Anstrengungen Seiner Kaiserlichen Majestät für die Erhaltung der glücklichen Verfassung unseres deutschen Vaterlandes durch einen ebenso glücklichen und glorreichen Reichsfrieden binnen kurzem mögen gekrönt, mithin dadurch die allerhöchste Zufriedenheit auf das vollständigste erreicht werden."
An den Rand eines unerfreulichen Berichts des Gesandten aus Regensburg vom 9. Januar 1798 schrieb der Geheimrats-


|
Seite 297 |




|
präsident v. Dewitz: "Von der Reichstagsverhandlung in Regensburg kann man jetzt sagen: Dum deliberat Roma, perit saguntum. Mainz ist verloren nebst anderen jenseits des Rheins gelegenen Ländern. Was kann man jetzt für Instruktion erteilen als diese: schicket euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit. Man muß der Gewalt und dem zwischen dem Kaiser und den Franzosen getroffenen Maßregeln nolens volens weichen und Folge leisten."
Inzwischen war zu dem Kongreß in Rastatt durch ein kaiserliches Dekret vom 1. November 1797 eingeladen 203 ). Zunächst wurde der Baron Buol von Schauenstein ersucht 204 ), Mecklenburg beim Kaiser bestens zu empfehlen und ihn um Vermittlung etwaiger Entschädigungen für die Straßburger Kanonikate und um Berücksichtigung der Ansprüche auf Lauenburg zu ersuchen. Der Herzog wäre sehr zufrieden, wenn er nur das Land zwischen der mecklenburgischen Grenze und der Elbe bei Dömitz bekommen könnte. Aber bald erschien es notwendig, einen eigenen Gesandten noch Rastatt zu senden, und deshalb besprach sich Friedrich Franz gelegentlich eines Besuches in Hamburg des Näheren über die etwaigen Aussichten auf Erfolge. Man wollte jetzt auch den Kaiser bitten, Mecklenburg besonders in den Reichsfrieden einzuschließen und ihm Nachsicht wegen der damals nicht geleisteten Kontingente zu gewähren 205 ). Würde Preußen etwas dagegen äußern, wollte man erklären, der Herzog habe willig zur Kreisdefension gezahlt, jetzt suche es auch im Reichsfrieden Schutz beim Kaiser. Buol wurde um Rat gefragt, wen man nach Rastatt senden solle. Gemmingen wollte man nicht nehmen, "er habe keinen festen Charakter". Der Graf Karl Christian zu Lippe, der die Expektanz auf den Posten eines mecklenburgischen Comitialgesandten bekommen hatte, schien auch nicht passend. Deshalb wurde schließlich der Geheimrat Graf von Bassewitz, der Mecklenburg schon in Hildesheim vertreten hatte, für die Reise in Aussicht genommen. Der Legationssekretär Gumpelzhaimer mußte sich ebenfalls nach Rastatt begeben, um Bassewitz zu unterstützen.
Auf dem Wege nach Rastatt reiste der Geheimrat über Hamburg und suchte dort mit einem Empfehlungsschreiben den Baron


|
Seite 298 |




|
Buol auf. Er erschrak aber sehr, als der Österreicher ihm rundweg erklärte, Mecklenburg habe alle Rückstände an die Reichs-Operationskasse zu zahlen, bis auf Unterstützung von Wien zu rechnen sei. Bassewitz blieb nichts anderes übrig, als die Kreisverpflichtungen vorzuschützen, zu denen Mecklenburg nach Lage des Landes gezwungen gewesen sei. Buol meinte, trotz dieser Verbindung hätten andere Reichsstände doch die notwendigen Zahlungen geleistet, und er erwarte das Gleiche von Mecklenburg; er fügte hinzu, der Geheimrat solle nur keine Schwierigkeiten suchen, der Herzog habe schon selbst mit ihm davon gesprochen 206 ). Am 25. Dezember 1797 mußte Graf Bassewitz den französischen Gesandten aufsuchen, um einen Paß von Hamburg bis Rastatt für die Reise durch das besetzte Gebiet zu erhalten. "Nun ward ich als ein Rekrut gemessen und als Pferd nach allen Abzeichen betrachtet und beschrieben, über 20 Artikel inquisitorisch befragt und darauf mit einem das Wesentlichste enthaltenden Dokument ausgerüstet. Es empörte sich ein gewisses Gefühl, in Deutschland französischen Schutz suchen zu müssen." So berichtete er dem Herzog.
Nach einer beschwerlichen Reise über Hannover und Frankfurt kam Bassewitz am 10. Januar 1798 in Rastatt an. Unterwegs hatte er viel Elend, vor allem das der flüchtenden Emigranten und die traurige Lage der von den Franzosen besetzten Gegenden gesehen 207 ). - Die Reichsdeputation war zunächst gegen die Gesandten der Reichsstände äußerst verschlossen; die Franzosen traten sehr herrisch auf und schüchterten die Versammlung so ein, daß ein Widerspruch kaum gewagt wurde.
Am 9. Januar wurde Bassewitz zum Grafen Metternich beschieden, der mit Lehrbach und Cobenzl zusammen den Kaiser vertrat; der Geheimrat übergab das Schreiben des Herzogs. Metternich dankte, brachte aber das Gespräch sogleich auf die Trennung des nördlichen Deutschland vom Reiche, welche die Verlegenheit des Kaisers veranlaßte. Um dem Vorwurf zu begegnen, der in diesen Äußerungen zu liegen schien, bat Bassewitz, auf Mecklenburgs geographische Lage Bedacht zu nehmen; im weiteren


|
Seite 299 |




|
Verlauf des Gesprächs war übrigens der kaiserliche Bevollmächtigte äußerst liebenswürdig 208 ).
Während der Unterhandlungen in Rastatt wurden viele Vorschläge zum Ersatz für die Geschädigten 209 ) gemacht. Bassewitz vertrat bei den einflußreichen Persönlichkeiten eifrig die Wünsche des Herzogs. Graf Cobenzl versprach Unterstützung, als ihm vorgehalten wurde, wie sehr Mecklenburg seine Anhänglichkeit an das kaiserliche Haus stets, besonders noch im siebenjährigen Kriege, betätigt hätte. Aber der Kongreß schien sich sehr in die Länge zu ziehen. Metternich meinte, "die Gesandten würden das Laub nicht nur ausbrechen, sondern auch wieder abfallen sehen". - Die Differenz zwischen Österreich und Preußen, die bei den Verhandlungen hervortrat, gab den kleineren Reichsfürsten Anlaß, Pläne zur Errichtung eines engeren Fürstenbundes zu erwägen. Bassewitz berichtete darüber am 23. Januar 1798: "Es bleibt in der Tat kein anderes Mittel übrig, da fremde Einmischung nicht zugelassen werden soll, Preußen und Österreich schon ihre Separatfrieden haben, folglich das übrige Deutschland verlassen und jeder einzelne Reichsstand nicht mächtig genug ist, sich dem stärkeren Feinde zu widersetzen. Die Hauptabsicht muß Erhaltung der deutschen Staatsverfassung und des Körpers, soviel die Umstände es zulassen, sein. Wird der Plan nicht verfolgt, so ist für Deutschland nicht nur keine Hoffnung zur Erhaltung, sondern es wird nach meiner Ahnung der Kongreß schnell gesprengt und namenloses Unglück vorbereitet. Gott gebe, daß ich irre, aber diese Betrachtungen sind nicht Folgen einer zu großen Furcht oder erhöhten Phantasie, sondern reifer Überlegung, nachdem ich mit dem Gang des Geschäfts und dem Urteil aller Personen von Einsicht bekannt bin." Zu einem Zusammenschluß deutscher Fürsten kam es jedoch nicht; die Uneinigkeit und der Zwiespalt der Meinungen dauerte weiter an. Der Braunschweiger Gesandte meinte, es sei eine nähere Verbindung norddeutscher Fürsten unter sich das Beste. Bassewitz trat dem entgegen und äußerte, daß dieser Weg bestimmt ins Verderben führen und die Uneinigkeit der Reichsstände nur noch mehr hervorkehren werde. Die Hoffnung auf Vereinigung von Wien und Berlin kehrt in seinen Berichten immer wieder. Die Abtretung


|
Seite 300 |




|
des linken Rheinufers war ihm besonders schmerzlich. Als die Friedensdeputation nicht mehr ein noch aus wußte, schrieb der Minister dem Herzog: "Mein Rat war, ein Mitglied der Deputation fordersamst nach Wien abzusenden, um dem Kaiser als Vater des Reiches die große Verlegenheit unmittelbar darzulegen, worin das Reich sich befinde, und die Bitte anzubringen, den Entschluß der Deputation zu richten, weil diese ohne Zusicherung seiner kräftigsten Unterstützung sich gemüßigt sehen würde, in die Abtretung des ganzen linken Rheinufers zu willigen. Dies schien jedoch keinen Beifall zu finden, weil dafür gehalten wurde, daß das Vertrauen durch die Abtretung von Mainz zu sehr geschwächt sei" 210 ). Die Anmaßung und das nichtachtende Auftreten der französischen Delegierten empfand Bassewitz tief und klagte mehrmals dem Herzog darüber, auch sprach er einmal besorgt von der Wehrlosmachung Deutschlands, wenn die Franzosen die Rheinfestungen, vor allem Ehrenbreitstein, behielten 211 ).
Als die Verhandlungen sich länger hinauszogen und es zu keinem Resultat kommen wollte, schien dem mecklenburgischen Gesandten ein längerer Aufenthalt unnötig, und nachdem die Erlaubnis von Schwerin eingeholt war, reiste er am 4. Mai wieder nach Hause zurück. Vorher hatte er der Reichsfriedensdeputation eine Denkschrift überreicht, die ihm aus Schwerin zugesandt worden war. Es heißt darin: "Daß Seine Herzogliche Durchlaucht von Mecklenburg-Schwerin durch den patriotischen Eifer und die rastlosen Bemühungen, mit welchen die fürtrefflichen Herren Reichsfriedensdeputation-Subdelegierte das wichtige Geschäft der Friedensunterhandlungen im constitutionellen Wege zu bearbeiten sich bestreben, dasjenige große Vertrauen ihnen bewähren, welches das ganze Reich von Anfang an auf sie gesetzt hat.
Seine Herzogliche Durchlaucht finden daher eine überzeugende Beruhigung darin, in dem gegenwärtigen Augenblick, wo die schröckliche Notwendigkeit sichere Aufopferungen des Reichs auf dem jenseitigen Rheinufer verlangt und auch Ihnen dadurch ein bekannter Verlust bevorstehe, die ferneren Unterhandlungen in den Händen dieser patriotischen Versammlung zu wissen und ferner diese allgemein vaterländische Angelegenheit ihrem Ermessen auf verfassungsmäßige Weise zu überlassen in der festen Zuversicht, sie werde es sich eine ebenso angenehme Pflicht sein lassen, diese Verhandlungen zum Wohle Deutschlands bald ihrem Ende näherzu-


|
Seite 301 |




|
bringen und, wenn einmal sich über die Grundsätze von Entschädigungen der Beteiligten vereinbart wird, sich das besondere Interesse des herzoglichen Hauses dem bestehenden Reichsverbande gemäß angelegen sein zu lassen." Es wurde in dem Schriftstück noch weiter der herzogliche Anspruch auf Entschädigung begründet. Ob das Vertrauen zu dem glücklichen Ende der Verhandlungen so groß war, wie geäußert wurde, mag nach den Erfahrungen, über die Bassewitz berichtet hatte, bezweifelt werden. Hier wurde die eifrig beobachtete Formalität zur reinen Ironie, obwohl doch auch darin noch ernste Anklänge an die Verantwortung der Reichsdeputation zu finden sind.
Dem Grafen Goerz, dem Vertreter Preußens, übergab Bassewitz eine besondere Denkschrift, in der die Ansprüche Mecklenburgs dem Grafen zur besonderen Berücksichtigung empfohlen wurden. Der Herzog und seine Räte in Schwerin verfolgten die Vorgänge in Rastatt mit großer Spannung und Anteilnahme. Dewitz schrieb oft kurze Bemerkungen unter die eingelaufenen Berichte; so am 9. Februar 1798: ,,Traurige Nachrichten und kummervolle Aussichten; uns bleibt für jetzt nur noch übrig, in spe et silentio, sowie in der Ferne der Entwicklung der Dinge entgegenzusehen."
Nach der Abreise des Grafen v. Bassewitz blieb der Legationsrat Gumpelzhaimer noch in Rastatt zurück und mußte regelmäßig Meldungen erstatten; erst als der Kongreß ohne Ergebnis 1799 aufgehoben wurde, kehrte er am 9. April auf Seinen Posten nach Regensburg zurück.
Der Reichsfriede kam nicht zustande. statt dessen begann Österreich aufs neue den Krieg gegen Frankreich. Der Kaiser verlangte auf dem Reichstag nachdrücklich Unterstützung der Reichsstände. Für Mecklenburg war die Frage, was sollte man tun? Unter Preußens Führung war Norddeutschland neutral, und nach den Abmachungen von Hildesheim hatte Mecklenburg zu den Kosten der Demarkationslinie beizutragen. Die Räte überlegten 212 ), daß die Fortsetzung von Lieferungen das Land womöglich zum Vorteil der Nachbaren erschöpfen würde und dem kaiserlichen Hof "bei dessen ohnehin bekannten Gesinnungen über diese Absonderung von der allgemeinen Reichsverteidigung um so viel mehr aufbringen, je mehr derselbe außerdem schon gegen die Unternehmungen des Berliner Hofes mißtrauisch und eifersüchtig zu sein berechtigt ist. So leicht sich auch die bisherige Assoziation zur Kreissicherung mit dem Geist der Reichsgesetze vereinbaren


|
Seite 302 |




|
und rechtfertigen läßt. So würden doch nach den vorliegenden, so offenen als beunruhigenden kaiserlichen Comitialerklärungen und Versicherungen eine ohne Not willkürlich verlängerte Bewaffnung der nördlichen Reichsstände für sich leicht als Mißtrauen gegen das allerhöchste Reichsoberhaupt und Abneigung gegen den gemeinsamen Reichsverband ausgelegt werden können, folglich jede fernere Teilnehmung daran höchst bedenklich sein." Mecklenburg wollte eben nicht in den Verdacht kommen, am Leben des Reiches keinen Anteil zu nehmen. Aber was sollte es jetzt auf dem Reichstag erklären lassen? Daß eine solche Erklärung nichts enthalten durfte, was dem Kaiser anstößig sein könnte, verstand sich für den Herzog von selbst. Das Reichsoberhaupt erwartete und verlangte tätige Unterstützung durch Römermonate und Quintuplum; die Verbindung mit Preußen ließ die Leistung der Reichspflichten nicht zu, weil es in dem Baseler Frieden den Franzosen versichert hatte, "daß diejenigen, welche in die Demarkationslinie begriffen wären, solche Pflichten nicht leisten dürften". Am liebsten hätte das Schweriner Ministerium geraten, beide Verbindlichkeiten zu erfüllen, aber dazu reichten die Kräfte des Landes nicht. So beschloß man, vor der Hand gar keine Äußerungen in Regensburg tun zu lassen 213 ), da sie "allemal nicht den Erwartungen des einen oder des anderen Teils entsprechen würden". Man tröstete sich damit, daß man in Wien die Zwangslage Mecklenburgs kenne; der kaiserliche Hof würde daher "ein Stillschweigen nicht für einen Mangel des guten Willens oder gar der Teilnehmung an Deutschlands Schicksal annehmen". Schließlich könnte man unter der Hand doch noch wieder die Reichsverpflichtungen übernehmen 214 ).
Der Herzog hielt sich im September 1799, wie gewöhnlich im Sommer, in Doberan auf und empfing dort den Besuch des österreichischen Bevollmächtigten Baron Buol, der von Hamburg aus dort weilte. Der Gesandte erklärte dem Herzog nachdrücklich, daß der Kaiser bei seinen Forderungen bleiben und auch die rückständigen Zahlungen für das Reichskontingent aus den früheren Jahren verlangen werde. Friedrich Franz faßte deshalb den Entschluß, im Stillen die Forderung des Kaisers zu begleichen, dabei aber Preußen in dem Glauben zu lassen, daß nichts gezahlt würde. Die Lieferungen für die Demarkationslinie sollten eingestellt werden mit der Begründung, der Kaiser von Rußland 215 ), der sich


|
Seite 303 |




|
dem Kriege gegen Frankreich angeschlossen hatte, verlange, daß man sich ganz still verhalte. Die Regierung aber stellte dem Herzog vor 216 ), daß die Kasse einfach die Kosten nicht aufbringen könnte; die kaiserlichen Forderungen müßten nach der Reichsverfassung erst durch das Kreisdirektorium mitgeteilt werden. Der Herzog konnte sich den Bedenken seiner Räte nicht verschließen; er beschränkte sich auf mündliche Äußerungen, um den österreichischen Gesandten von seiner reichspatriotischen Gesinnung zu überzeugen. Bis 1801 wurde noch weiter zu den Kosten der Demarkationslinie beigetragen; am 9. Februar d. J. kam es zum Frieden von Luneville. Kaiser und Reich mußten in die Abtretung des linken Rheinufers willigen, die geschädigten Fürsten aber sollten in Deutschland dafür Ersatz erhalten.
Als sich die Franzosen im Jahre 1800, wie schon einmal 1796, Regensburg näherten, ließ der Herzog die mecklenburgischen Gesandtschaftsbeamten (Becker und Gumpelzhaimer) ohne Antwort auf ihre Frage, ob sie fliehen oder wie sie sich sonst sichern sollten. An dem Hause der Gesandtschaftskanzlei ließen sie eine Tafel anbringen mit der Umschrift: "De la Serenissime Cour de Mecklembourg neutre." Das herzogliche Wappen war darauf, und darunter stand: "Sous la protection de S. M. Roi de Prusse." Als Gumpelzhaimer davon Meldung machte, erschien den Ministern in Schwerin das "sous la protection" anstößig, aber sie meinten, weil sie dazu keinen Auftrag gegeben hätten, gelte dies eben nur von der Person Gumpelzhaimers, und der Herzog selbst habe nichts damit zu tun.
Als im Juni 1801 dem Erzherzog Karl auf dem Reichstag für die ruhmvolle Verteidigung Deutschlands "der öffentliche Beweis der Hochachtung und Dankbarkeit" gegeben werden sollte, stimmte Friedrich Franz diesem Gedanken mit Freuden zu; selbst als Preußen nicht dafür war, blieb er dabei. - Daß der Herzog auch sonst an den Ereignissen im Reich teilnahm, beweist eine Spende von je 100 fl., die er der Reichstagsgesandtschaft für die in Not geratene Stadt Regensburg und für die zerstörte Festung Philippsburg anwies.
Das zustimmende Votum bei den Verhandlungen über den Frieden von Luneville hatte Graf Goerz 217 ) abzugeben, da ihm nach dem Tode des Baron v. Gemmingen seit 1800 die mecklen-


|
Seite 304 |




|
burgischen Geschäfte, allerdings unter großen Bedenken, übertragen waren. Der Herzog hielt es bald für nötig, wieder einen eigenen Gesandten in Regensburg zu haben, deshalb berief er 1802 den Kammerherrn Leopold v. Plessen 218 ) auf diesen Posten. Die Verhandlungen der Reichsdeputation, die inzwischen für die Festsetzung der Entschädigungen bestimmt war, hatten für Mecklenburg nicht geringen Wert; der Herzog hoffte, das Reich würde seine billigen Ansprüche nicht übergehen.
Mecklenburg und der Ausgang des Deutschen Reiches.
Nach dem Frieden zu Lunéville bemühten sich deutsche Fürsten um die Gunst der Franzosen, damit diese ihre Entschädigungswünsche erfüllten. Fremde Mächte hatten in Deutschland das Wort, auch Rußland mischte sich in die deutschen Angelegenheiten ein und übte auf die Reichstagsverhandlungen einen großen Einfluß aus.
Mecklenburg beteiligte sich nicht an dem Jagen nach Land- und Gelderwerb in Paris, sondern erwartete von der inzwischen eingesetzten Reichsdeputation die ihm gebührenden Entschädigungen für die Straßburger Kanonikate, am liebsten in Gestalt des Amtes Neuhaus im Herzogtum Lauenburg rechts der Elbe, oder es hoffte gar auf das ganze Lauenburg selbst 219 ). Aber nicht allein Entschädigungen sollte der Comitialgesandte v. Plessen in Regensburg erwirken, sondern der Herzog hoffte jetzt die Kurwürde zu erhalten 220 ). Er fand dabei Unterstützung bei Rußland, von dem die Gedanken zu dieser Erhöhung ausgingen, obgleich Mecklenburg sie sich schon früher häufig gewünscht hatte. Das Kurkollegium mußte durch die Abtretung des linken Rheinufers in seiner Zusammensetzung geändert werden, Köln und Trier mußten fortfallen, und dafür sollten drei neue Kurfürstentümer, nämlich Baden, Hessen-Cassel und Württemberg, geschaffen werden, später wurde auch Salzburg und Toskana dafür in Aussicht genommen. Rußland bewog den Herzog, Sich ebenfalls um die Kurwürde zu bemühen, aber mit der Erhebung zusammen wünschte Mecklenburg eine entsprechende Gebietserweiterung, vor allem


|
Seite 305 |




|
durch Lauenburg. Als diese Hoffnung wegen der abweisenden Haltung Hannovers bald schwand, richtete Friedrich Franz sein Augenmerk auf die beiden im Lande befindlichen Besitzungen des Deutschen Ordens (die Güter Frauenmark im Amt Gadebusch und Rosenhagen im Amt Schwerin) 221 ). Ebenso hoffte er, die Privatgüter und Dörfer des Heiligengeist-Hospitals in Lübeck (Wangern, Seedorf, Brandenhusen, Weitendorf auf Poel und Alt-Buckow und Warnkenhagen) zu erhalten.
Der Gesandte v. Plessen teilte in seinen ersten Berichten mit, wie unzufrieden Österreich über den Verlust seines Einflusses sei, und er betonte, daß für die Ernennung zum Kurfürsten "die kaiserliche Genehmigung weder in der Form noch dem Rechte nach" vernachlässigt werden dürfe. Die Reichsdeputation zeige große Gefälligkeit, da könne man schon etwas hoffen, besonders, da in Wien die Erhebung von Baden und Hessen-Cassel sehr ungern gesehen würde (von letzterem wegen seiner Verbindung mit dem preußischen Hof)- Der Kaiser gebe sich alle Mühe, seine Stellung Preußen gegenüber zu behaupten. Dann ging der Gesandte auf die sonstigen Verhältnisse im Reich ein und fügte hinzu: "Mit dem meisten Befremden werden Ew. Herzogl. Durchlaucht ersehen haben, wie man nicht nur den drei Hansestädten einzeln besondere Vorteile und selbst Acquisition zugesteht, sondern ihnen auch noch den großen Vorzug einräumen möchte, daß diese übrigbleibenden Städte ein eigenes Reichskollegium ausmachen sollten 222 ), weiches, wenn es gleich keinen decisiven Ausschlag auf Deliberationen geben kann, doch selbige rückgängig zu machen vermöchte" 223 ). Der kaiserliche Hof sei zweifellos auf Schonung und Unisicht für die Reichsstädte bedacht, während sie dafür in dem Kriege für die


|
Seite 306 |




|
Demarkationskosten und außerdem noch unter der Hand in Wien ihre Kontingentsbeiträge gezahlt hätten.
Um den Wiener Hof nicht zu erzürnen, wurden die Wünsche auf Abtretung der Deutschen Ordensgüter noch nicht geäußert 224 ). Im übrigen mußten Plessen und Gumpelzhaimer die mecklenburgischen Ansprüche auf alle mögliche Weise begründen und vertreten 225 ). nach langen Verhandlungen und verschiedenen Bemühungen konnte die Gesandtschaft endlich die Hoffnung auf Erfüllung der Entschädigungswünsche aussprechen. Mecklenburg sollte aus den säkularisierten Osnabrücker Stiften eine Rente von 10000 fl. außer den Lübecker Besitzungen erhalten. Jetzt dachten der Herzog und seine Räte wieder an das Privilegium de non appellando illimitatum, das erteilt werden könne, vielleicht als Vorbedingung oder als Folge der etwaigen Erhebung in den Kurfürstenstand.
Da erfolgte am 25. Februar der Reichsdeputationshauptschluß. Mecklenburg erhielt die sog. "lübischen Hospitaldörfer" und eine immerwährende Rente von 10000 fl., welche jetzt auf den Rheinzoll (Rheinschiffahrts-Oktroi) gelegt wurde 226 ).
Die Kosten der zukünftigen Kurwürde hatten dem Herzog viel Sorge gemacht und ihn immer wieder veranlaßt, auf größere Landzuweisungen sein Bestreben zu richten. Aber die Hilfe Rußlands und Preußens, die er dabei brauchte, war nicht allzu nachdrücklich. - Und jetzt wurde es immer deutlicher, daß der Wiener Hof der Erhebung Mecklenburgs nur dann zustimmen würde, wenn zur Parität der Konfessionen der Hoch- und Deutschmeister ebenfalls zum Kurfürsten gemacht würde; das konnten aber andererseits Preußen und Frankreich nicht zugeben, weil dann drei Brüder aus dem Erzhause ihre Plätze im Kurkollegium hätten. Wirklich wurde von dem russischen Gesandten Baron v. Bühler ein Antrag auf Erhebung des Herzogs von Mecklenburg mit Erteilung der damit verbundenen Vorteile gestellt 227 ). Aber ohne Zustimmung des kaiserlichen Hofes konnte natürlich nichts erreicht werden. Schon bei der Abstimmung über die Beschlüsse der Reichsdeputation am 10. März 1805 hatte Mecklenburg in einem längeren Votum


|
Seite 307 |




|
seine Befriedigung über die gesicherte Ruhe und verfassungsmäßige. Ordnung ausgedrückt und dem Kaiser den Dank für die bewiesenen Fürsorge für das allgemeine Beste des Reichs und dessen einzelne Glieder ausgesprochen. Es gereichte dem Herzog "zur besonderen Zufriedenheit, daß die Entschädigung des Erzhauses Österreich und des Herrn Großherzogs zu Toskana in Gemäßheit der Anträge Sr. Kaiserl. Majestät selbst bestimmt worden. Wenn die bedrängte Lage des gesamten Deutschen Reiches außerordentliche Maßregeln bisher erforderte und im einzelnen Aufopferungen notwendig machte, um desto mehr wäre nach wiederhergestellter Ruhe und, Ordnung auf die Befestigung des Reichsverbandes und auf Erhaltung der Reichsverfassung nach bestehenden Grundgesetzen, Formen und Herkommen vorzügliche Sorgfalt zu nehmen."
Ende Mai wurde Plessen beauftragt, mit einem herzoglichen Handschreiben und Empfehlungen an den Reichsvizekanzler Fürst Colloredo, den Staatsvizekanzler Graf Cobenzl und den russischen Gesandten eine Reise nach Wien anzutreten, um dort die Erhebung Mecklenburgs zum Kurfürstentum durchzusetzen 228 ). Er wurde vom Kaiser und den Ministern sehr freundlich aufgenommen und verhandelte viel mit der Reichs- und mit der Staatskanzlei, beobachtete dabei, daß diese beiden Behörden ständig auf gespanntem Fuße ständen, und deshalb große Vorsicht am Platze sei, um es mit keiner zu verderben. Mecklenburg begründete sein; Gesuch um die Kurwürde vor allem damit, daß es mit drei der neuernannten Kurfürsten in gleichem Range stehe 229 ) und daher billigerweise dieselben Vorteile erhalten müsse. Aber das sah der Reichsvizekanzler nicht für stichhaltig an und berief sich auf den Wunsch des Wiener Hofes, daß Erzherzog Karl als Hoch- und Deutschmeister ebenfalls Kurfürst werden müßte. Diese Meinung hatte man schon nach Petersburg mitgeteilt, und jetzt sollte Mecklenburg außerdem verpflichtet werden, im Falle der Erhebung, seine Stimme bei der nächsten Kaiserwahl nur dem Erbfolger in den österreichischen Staaten zu geben. Das wollte Plessen auch zugestehen, "es sei gewiß dem Hause Habsburg nicht zu verdenken, wenn es, so wenig reelle Vorteile mit der Kaiserkrone auch vorhanden seien, sie sich doch zu erhalten bestrebt sei, und es sei gewiß nicht unbillig, wenn der Kaiser ein Recht, welches er einem Reichsstande erteile, nicht gleich bei der ersten Anwendung gegen sich


|
Seite 308 |




|
selbst benutzt sehen wolle" 230 ). Rußland ließ sich aber auf solche Verpflichtungen nicht ein, da die Goldene Bulle Wahlfreiheit verlange. Plessen äußerte nun Cobenzl gegenüber, daß der kaiserliche Hof jetzt wohl von dieser Forderung Abstand nehmen, aber durch sein Wohlwollen, welches er durch die unbedingte Erteilung der Kurwürde dem Hause Mecklenburg erzeige, "Sich dieses zur Erreichung desgleichen Endzwecks weitdauernder, nur auf angenehmere Weise verbinden werde". Aber der Wiener Hof blieb bei seinem Wunsche, und der Gesandte v. Plessen riet schon zur freiwilligen Abgabe des Versprechens, begab sich aber inzwischen wieder nach Regensburg, da er beim Kaiser vorläufig nichts weiter erreichen konnte.
Auch in Schwerin war man geneigt, ganz den Forderungen des Kaisers zu entsprechen, und teilte diese Ansicht nach Petersburg mit 231 ). Weiteres ist in dieser Angelegenheit nicht festzustellen 232 ). Mecklenburg erhielt die Kurwürde und das Privilegium de non appellando illimitatum nicht. Auch seine Bemühungen um eine neue Virilstimme (für Rostock) auf dem Reichstag blieben umsonst. Es fehlten die erhofften Unterstützungen, und letzten Endes wird Frankreich den Ausschlag bei dem Mißlingen der Pläne für die Kurwürde gegeben haben, wenn auch der französische Botschafter zuerst in Regensburg den mecklenburgischen Wünschen geneigt geschienen hatte 233 ). Napoleon hatte nämlich seinen Gesandten Talleyrand am 31. August 1802 angewiesen 234 ), nicht mehr wie drei protestantische Kurfürsten zuzulassen und Mecklenburg dabei auszuschließen (Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, Bd. I, S. 178 ff., vermutet, weil es preußisch gesinnt sei). Das wird schließlich bei der Macht Frankreichs und seinem Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten der eigentliche Grund gewesen sein, weshalb der Herzog nicht die Stellung im Reich erhielt, die er für sich erhofft hatte. Österreich hätte möglicherweise doch zugestimmt, wenn Mecklenburg freiwillig seine Stimme für das Erzhaus versprochen hätte.
Die Reichsdeputation wurde noch von Mecklenburg-Strelitz in Anspruch genommen, da es ebenfalls Wünsche auf Entschädi-


|
Seite 309 |




|
gung wegen der Straßburger Kanonikate geltend machte; es bekam indessen nur eine neue Virilstimme im Reichsfürstenrat für Stargard.
Der Reichsdeputationshauptschluß hat ferner für Mecklenburg die Bedeutung gehabt, daß man jetzt an die Einziehung der Landesklöster gehen konnte 235 ). Es entspannen sich lange Verhandlungen mit den Ständen, die ihren Besitz in Anspruch nahmen Eine Einigung kam damals nicht zustande; erst 1809 bewilligtest diese dem Herzog eine Beihilfe von 80000 Taler aus den Überschüssen der Klöster, dagegen verzichtete Friedrich Franz auf etwaige Ansprüche, die er aus dem Reichsdeputationshauptschluß herleiten könnte 236 ).
Im Jahre 1805 gelang es Mecklenburg, Wismar, die Insel Poel und das Amt Neukloster von Schweden als Pfand zu erhalten 237 ). Auf den Wunsch des Herzogs hatte der König von Schweden die Benachrichtigung des Kaisers (gemäß Artikel 25 des Pfandtraktats) übernommen, und zwar erfolgte diese nur d'état à l'état, da es nur eine Verpfändung wäre; aber der Kaiser sollte immerhin ersucht werden, als Reichsoberhaupt für die Beobachtung des Artikel 16 zu sorgen ("daß der Hafen der Stadt Wismar nie zu einem Kriegshafen zu einem Gebrauch irgendeiner fremden Macht oder eines anderen Staates bestimmt werden könne"), da dessen Übertretung zugleich eine Verletzung des Reichsgebietes sein würde. Der Reichsvizekanzler Fürst Colloredo verlangte indessen von dem schwedischen Gesandten eine vollständige Abschrift des Vertrages, wenn der Kaiser etwas davon garantieren sollte. Der König von Schweden hielt dann aber eine kaiserliche Sanktion nicht für nötig, und diese erfolgte nicht mehr. -
Leider sind die Akten aus den nun folgenden Jahren sehr dürftig, so daß sich kein Bild daraus ergibt, wie Mecklenburg sich zu der 1804 erfolgten Errichtung des Kaisertums in Österreich gestellt hat, und welchen Eindruck der neue Krieg mit Frankreich und die Neutralität Preußens in Mecklenburg hervorriefen. - Jedenfalls schloß der Herzog sich in diesen Jahren enger an Ruß-


|
Seite 310 |




|
land und auch an Preußen an 238 ). Er bemühte sich vor allem, sein Land nicht in Verbindung mit etwaigen Feindseligkeiten gegen Napoleon zu bringen.
Die Beziehungen zum Kaiser wurden durch eine Reise des Erbprinzen Friedrich Ludwig wieder belebt. Dieser hatte nämlich seine Gemahlin, die russische Großfürstin Helene Pawlowna, 1805 verloren und begab sich 1805 für längere Zeit nach Süddeutschland und in die Schweiz 239 ). Auf der Rückreise stellte er sich in Wien dem Kaiser Franz vor und wurde von ihm sehr freundlich empfangen. Der Begleiter meldete dem Herzog, "daß vielleicht nie ein deutscher Reichsfürst mit mehrerer Auszeichnung in Wien aufgenommen wie Durchlaucht der Erbprinz". Auf Einladung und als Gast des Kaisers machte er einen Ausflug nach Preßburg mit, um dort der Eröffnung des ungarischen Landtages am 18. Oktober 1805 beizuwohnen. Er mußte dann sogar vor den anrückenden Franzosen aus Wien fliehen und hielt sich eine Zeitlang in Brünn auf; er wollte nämlich die Ankunft des Zaren in Österreich abwarten. Am 18. November fuhr er von Olmütz aus mit Kaiser Franz, dem Prinzen Ferdinand von Württemberg und dem Grafen Cobenzl dem russischen Kaiser entgegen. Er erlebte dann die Begegnung und das Zusammensein der beiden Kaiser und berichtete davon hoffnungsfreudig seinem Vater. Er gedachte dann die beiden Herrscher noch zu den Armeen zu begleiten, trat aber die Rückreise nach Mecklenburg doch schon Ende November an, so daß es ihr erspart blieb, an der gänzlichen Niederlage teilzunehmen, welche die Verbündeten am 2. Dezember 1805 in der Dreikaiserschlacht bei Austerlitz erlitten.
Erst nach langen Erwägungen entschloß sich Mecklenburg, 1805 der bewaffneten Neutralität Preußens beizutreten; aber es kam nicht mehr offiziell dazu. Die Schweriner Räte hatten vor allem das Verhältnis zu Rußland und dessen Spannung gegen Preußen zu der abwartenden Haltung veranlaßt. Im Herbst 1805 gestattete der Herzog den russischen und schwedischen Truppen den Durchmarsch nach Hannover und ebenso 1806 den Rückmarsch.
Napoleon hatte inzwischen Österreich besiegt, die süddeutschen Staaten schlossen sich dem Eroberer an; der Rheinbund wurde begründet.
In Schwerin befürchteten der Herzog und seine Minister sogar, Napoleon könne sich zum Kaiser von Deutschland ausrufen lassen.


|
Seite 311 |




|
Als im Juli 1806 der deutsche Reichsverband sich auflöste, war die Ratlosigkeit und Bestürzung recht groß, besonders als die Auflösungserklärung des Reichstages vom 1. August 1806 und die Niederlegung der deutschen Kaiserkrone durch Franz II. Bekannt wurde. Der Herzog schrieb: ,,Es bedarf keiner besonderen Souveränitätserklärung, es ist mir nichts daran gelegen." Als dann eine Aufforderung zum Beitritt in den Rheinbund kam, wurde sie abgelehnt 240 ); der Herzog wollte nur einem Bunde der nordischen Mächte gegen Frankreich beitreten; er würde, schrieb er z. B., einer Gründung eines Oberappelationsgerichts für den Rheinbund nie zustimmen. Der Geheimratspräsident Graf Bassewitz schrieb am 11. August: "Vielleicht ist der Augenblick gekommen, wo Preußen die Vernachlässigung seiner Pflicht teuer bezahlen muß, und wo vielleicht viele andere unverschuldet mitbüßen müssen . . . Wenn es gleich kein Verdienst für den Schwächeren ist, wenn er sich nicht zuerst von einem Verbande trennt, der ihm bisher Schutz gewährte und seine Existenz sicherte, so ist es doch viel wert, daß nicht wir dem Kaiser, sondern der Kaiser uns den Beruf aufsagt. - Dem unglücklichen Neide, der durch den Baseler Frieden noch mehr betätigt ward, hat Deutschland dies Unglück zuzuschreiben. Aber besorglich werden diejenigen, die es veranlaßt haben, die Folgen dereinst zu bereuen Ursache haben."
Diese Worte des mecklenburgischen Ministers zeigen den richtigen Blick für die politische Lage. Die Niederlagen Preußens bei Jena und Auerstädt kamen und mit ihnen der Zusammenbruch des einst so mächtigen Nachbarn. Bald mußte auch Mecklenburg die Hand Napoleons fühlen. Der Herzog von Mecklenburg-Schwerin wurde vertrieben, das Land in französische Verwaltung genommen.
Die nun folgende Leidenszeit hat auch gerade in Mecklenburg dazu beigetragen, die Besinnung auf das Deutsche Reich wieder lebendig zu machen. Als erster deutscher Reichsfürst trat Friedrich Franz 1813 wieder aus dem Rheinbund aus. Auf dem Wiener Kongreß 1815 war es der mecklenburgische Gesandte von Plessen, der eine Flugschrift schrieb mit dem Titel: "Grundzüge zu einem künftigen deutschen Gesamtwesen und einer Nationaleinheit", Plessen sollte dazu beitragen, "daß das gesamte Deutsche Reich ein einziges unzertrennliches Ganze bleibe" 241 ).


|
Seite 312 |




|
So tief wurzelte in mecklenburgischen Herzen der Gedanke an das einige Deutsche Reich; der Keim für künftige Gestaltung und Größe fand sich auch inmitten aller Zerrüttung, in aller Oberflächlichkeit und allem Eigennutz wie in anderen deutschen Territorien, so besonders auch in Mecklenburg.
Anhang.
I. Pro Memoria
"So vollkommen bereitwillig Sr. zu Mecklenburg-Schwerin und Güstrow regierenden Herzogl. Durchl., gleich anderen Reichsfürsten Alt-Welt-Fürstlicher Häuser, sind, Ihre von Kaiserl. Majestät und dem Reich tragende Reichs-Lehne und Regalien, mittelst feierlicher Kaiserlicher Belehnung gebührend zu empfangen; so sehr wünschen Höchstdieselbe, diese Angelegenheit überall in solche Umstände gesetzet zu sehen, daß dabey keine Bedenklichkeit oder Anstand weiter eintreten möge.
In dieser aufrichtigen. Gesinnung beziehen Höchstgedachte Sr. Herzogl. Durchl. bei dem Vorfall, da abseiten des hochpreislichen Kaiserl. Reichs-Hof-Raths und der Reichs-Canzelei an verschiedene altfürstliche Häuser in Ansehung sogenannter Laudemien und Anfalls-Gelder, wie auch der Lehn-Taxe und deren Vervielfältigung, bereits Anforderungen geschehen sind, die von denselben nicht für gegründet erkannt werden mögen, Sich auf Ihro Römisch-Kaiserl. Majestät allergnädigstes Versprechen in allerhöchst dero Wahl-Capitulation Art. XVII. § 15 und 19, nach welchem eines Theils von einer Belehnung, wenn gleich verschiedene Lehen empfangen werden, mehr nicht als N. einfacher Tax entrichtet, und dawider kein Herkommen eingewandt noch einige Erhöhung gemacht; anderen Theils aber die Churfürsten, Fürsten und Stände mit Laudemial- und Anfalls-Geldern von Lehen, damit sie allbereits coinvestiret gewesen, oder sonst mit ungewöhnlichen und neuerlichen Anforderungen nicht beschweret werden sollen.


|
Seite 313 |




|
Soviel hiernächst das Ceremonial bei den Belehnungen anlanget, halten Höchstgedachte Sr. Herzogl. Durchl. von Ihro Kaiserl. Majestät Weltgepriesener allerhöchsten Gerechtigkeits-Liebe sich völlig versichert, daß allerhöchstdieselben es Ihnen zu Gnaden halten werden, wenn Sie Sich und Ihr Fürstliches Haus bei den vorhin gehabten und in dem Westphälischen Friedens-Schluße ihnen gleich allen und jeden Churfürsten und Ständen des Reichs zu Vermeidung aller künftigen Irrungen aufs feierlichste bestättigten uralten Gerechtsamen und Vorzügen ungekränkt zu erhalten bedacht sind.
Ihro Römisch Kaiserliche Majestät allerhöchste Reichsväterliche Denkungs-Art und Rechts-Liebe lassen nicht zweifeln, daß nicht in diesen beiden Considerandis alles den Alt-Welt-fürstlichen Häusern nachtheilige und bedenkliche werde entfernet werden. Des regierenden Herrn Herzogs zu Mecklenburg Schwerin und Güstrow Durchl. haben daher durch Endes unterzeichneten Instructionsmäßig, wie andere Dero Alt-Welt-fürstl. Mit-Stände, Ihro völlige Bereitwilligkeit zu der schuldigen Lehns-Empfahung wiederholt bezeugen und in in solcher Absicht hiemit geziemend erklären und zu erkennen geben lassen wollen, daß man eines Theils sich zu den gewöhnlichen Tax- und Renumerations-Geldern, wie solche in einfacher Taxe und bei dem gegenwärtigen würklichen Belehnungsfall Wahl-Capitulationsmäßig zu entrichten sind, gebührend offeriere, dabei aber auch, gegen den klaren Buchstab der Wahl-Capitulation Art. XVII. § 18. und 19. mit mehrern Anforderungen nicht beschwert zu werden hoffe; und daß anderen Theils in Ansehung des Ceremoniels Sr. Herzogl. Durchl. wie andere Altweltliche Reichs-Fürsten, dem Vorgang einiger Geist- und Weltlichen Churfürstl. Höfe gemäß, die Lehns-Empfahung schuldigst zu vollziehen gar keinen Anstand nehmen werden.
Wien, d. 31sten Julii 1767."
II. Reichshofrats-Konklusum wegen der Beschwerden der mecklenburgischen Stände gegen die Verleihung des Privilegium de non appellando illimitatum an den Herzog von Mecklenburg, vom 11. April 1781.
"Ihre Kaiserl. Majestät haben gehorsamstes Reichshofratsgutachten allergnädigst approbieret und solchemnach, mit Verwerfung des von denen Landräten und Deputierten von der Ritterschaft der Herzogtümer Mecklenburg zum Engeren Ausschuß


|
Seite 314 |




|
eingelegten unstatthaften Widerspruchs und des von der Stadt Rostock insbesondere behaupteten, außer dem Fall, da die Herren Herzöge zu Mecklenburg jemand aus dem Mittel der dasigen Bürger und Einwohner bei dem Rat zu Rostock belangen, unerfindlichen juris contradicendi, den Herrn Herzogen zu Mecklenburg das von ihnen allergehorsamst nachgesuchte Privilegium de non appellando, nach vorgängiger Vereinbarung mit Ritter- und Landschaft wegen Besetzung des aufzurichtenden Oberappellationsgerichts und Landesgrundgesetzmäßige Verfassung einer Oberappellationsgerichtsordnung, jedoch
I. mit Ausnahme der Appellationen in causis fiscalibus und in Sachen, wo der Herren Herzoge besonderes Interesse mit eintritt, insoweit solche nach dem kaiserlichen Privilegio de non appellando vom 28. Oktober 1651 noch Statt finden, in specie derjenigen Berufungen, welche in jenen Fällen, wo die Herren Herzoge zu Mecklenburg eine oder mehr Personen aus dem Mittel der Bürger und Einwohner zu Rostock vor dem dasigen Rat gelangen, nach dem Erbvertrag vom 21. September 1575 von den Urteln des Rats Stracks an kaiserliche Majestät und das kaiserliche Reichskammergericht gehen, weniger nicht
II. mit Vorbehalt der Nullitätsklage und der querela de negata vel protacta justitia, ersterer nämlich in Sachen, wo das objectum litis die in dem Reichsabschiede vom Jahre 1654 § 112 bestimmte Summam appellabilem erreichet, oder über eine Obrigkeit, Gerechtigkeit, persönliche und Felddienstbarkeit und dergleichen, so nicht gewisse Achtung hat, gestritten wird, ratione derjenigen Nullitäten, welche in sanabilem defectum aus der Person des Richters oder der Partei oder aus den substantialibus des Prozesses mit sich führen, letzterer aber auf die Fälle, da jemand das aufzurichtende Oberappellationsgericht mit Recht ansuchet, und ihm dieses darauf in seit eines Monats nach beschehenem Ersuchen zu Recht nicht verholfen oder mit Gefährde verzogen hätte, und endlich
III. den - in den Fällen, da die Herren Herzoge entweder selbst oder durch die ihrige dem Erbvergleich vom Jahre 1755 oder den mit der Stadt Rostock getroffenen Erbverträgen und Konventionen vom 21. September 1573, letzten Februar 1584 und 26. April, auch 16. August 1748 contravenieren, oder die auf allgemeinen Landtagen vorkommende Beschwerden und aus dem Erbvergleich vom Jahre 1755 sich ergebende Zweifel und Mißverstände nicht nach Vorschrift der §§ 161, 162 und 521 besagten Erbvergleichs erledigen und abtun, oder auf andere Weise jemand extra-


|
Seite 315 |




|
judicaliter beschweren, oder zu Klagen Anlaß geben würden, - sowohl nach den gemeinen Rechten und Reichskonstitutionen offen flehenden, als in den §§ 165, 525 und 526 oft gedachten Erbvergleichs vom Jahre 1755 und in dem mit der Stadt Rostock im Jahre 1573 aufgerichteten Erbvertrag ausdrücklich stipulierten Wegen, auch im übrigen der nach dem mehrerwähnten Erbvertrag vom Jahre 1575 der Stadt Rostock in denen Fällen, da entweder die Herren Herzöge wider den dasigen Rat und die Gemeine eine Zivilklage anzustellen haben, oder da der Rat und die Gemeine zugleich wider die Landesfürsten etwas verbrochen, und diese sich deswegen besprechen werden, zustehenden ersten Instanz vor Kaiserl. Majestät und dem Kaiserl. Reichskammergericht unabbrüchlich
zu verleihen allergnädigst beschlossen.
Würden dann demzufolge die Herren Herzoge sowohl wegen Besetzung des aufzurichtenden Oberappellationsgerichts sich mit Ritter- und Landschaft vereinbaren, als mit deren Zuziehung eine Oberappellationsgerichtsordnung verfassen lassen, (wobei ersagter Ritter- und Landschaft dafür Sorge zu tragen unbenommen bleibet, daß die in dem Erbvergleich vom Jahre 1755 Art. XXI §§ 381, 393, 394, 396, 398, 399, 400 und 401 enthaltene Verordnungen auf das zu errichtende Oberappellationsgericht ihre ausdrückliche Anwendung erhalten), so ergehet, auf vorgängige bescheinigte Anzeige jener Vereinbarung und Produktion der abgefaßten Gerichtsordnung, wegen Expedition der Privilegii quaesiti fernere kaiserliche Verordnung."
III. Schreiben des Herzogs an den Kaiser wegen der vorzunehmenden Belehnung. 21. März 1786.
,,Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster und Unüberwindlichster Römischer Kayser, auch zu Hungarn und Böheim König,
Seitdem durch das am 24. April des abgewichenen Jahres 1785 erfolgte und Ew. Kayserl. Königl. Apostol. Majestaet zu seiner Zeit von mir allerdevotest angezeigte Ableben meines hochsel. Vater-Bruders, Herrn Friedrich regierenden Herrn Herzogs zu Mecklenburg Gnaden, die Regierung der Herzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Güstrow sammt den übrigen dazu gehörigen Fürstenthümern und Landen, auch meinem fürstlichen Hause zustehenden Reichsständige An- und Zusprüche, auf mich in natürlicher Ordnung vererbfället worden, erkenne ich es für eine meiner


|
Seite 316 |




|
größten Glückseligkeiten, Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät auch wegen dieser meiner angestammten altfürstlichen Reichs-Lehne als Obersten Reichs-Lehn-Herrn in allertiefstem Respect zu verehren.
Wie es nun solchem nach meine allererste Lehnsobliegenheit erfordert, über vorgenannte von meinen Vorfahren dem Reiche zu Lehn aufgetragenen Herzog-Fürstenthümer und Lande, wie auch die damit verknüpften Reichsfürstlichen Gerechtsame, Privilegien und Regalien von Ew. Kayserl. Königl. Apostol. Majestaet binnen rechtserforderlicher Frist die Reichs-Oberhauptliche Belehnung allerunterwürfigst nachzusuchen; So verfehl ich auch nicht, als ein treu-gehorsamer Reichs-Fürst und Vasall, vorgedachte altfürstliche Reichs-Lehne zu rechter Zeit hierdurch zu muthen und zu deren erneuerten Lehns-Empfahung allersubmissest mich zu erbieten. Ich würde auch sofort jetzt zur würklichen Empfahung solcher Investitur mich in aller Unterthänigkeit bereit erklären, wenn nicht die mein Fürstliches Haus noch fortwährend drückende und die von meinen fürstlichen Domänen noch nicht verwundene gar große Schäden, Geld-Erpressung, Verheer- und Verwüstungen und sonstige Drangsale des siebenjährigen Krieges nebst der mit schweren Kosten und großen Zinsen von Fremden und Auswärtigen aufgenommenen Geldern vollbrachten Einlösung der während vormaliger Landes-Unruhen an Chur-Braunschweig verpfändeten acht der beträchtlichsten Domanial-Ämter noch nicht abgebürdete Schuldenlast wie auch die Entbehrung der Einkünfte aus den seit eben dem erwähnten unglücklichen Zeitraum von Königl. Preußischer Seite noch detinirten vier anderen Ämtern, mich außer Stand setzten, die damit verknüpften Erfordernisse nach meinen Wünschen zu berichtigen.
Indem ich zugleich zu der preiswürdigsten Gnade und Gerechtigkeit Ew. Kayserl. Königl. Apostol. Majestaet allerunterthänigst vertraue, AllerhöchstDieselben werden auf das im Betreff des Reichs-Belehnungswesens unterm 31ten July 1767 nach dem Vorgange anderer altfürstlicher Häuser zu den Acten gebrachte diesseitige Pro Memoria ein allermildestes Augenmerk zu richten geruhen, sehe ich, obiger Hindernisse halber, mich genöthiget, allersubmissest zu bitten: Ew. Kayserl. Königl. Apostol. Majestaet wollten, bis zu deren endlichen Wegräumung, mit der Verbindlichkeit zur würklichen Empfahung der erneuerten Belohnung mit meinen Reichsfürstlichen Landen in allerhöchsten Gnaden mich zu befristen, inmittelst aber mir darüber einen gewöhnlichen Muthschein und Indult allerhuldreichst zu ertheilen.


|
Seite 317 |




|
Gleichwie ich aber dadurch mich nicht abhalten lassen werde, meiner angebohrenen Obliegenheit gemäß als einen getreuen Reichs-Fürsten und Vasallen gegen Ew. Kayserl. Königl. Apostol. Majestaet mich allerwege zu beweisen, also übergebe AllerHöchstdero Kaiserlichen Huld und Protection ich mich und mein fürstliches Haus in der allertiefsten Verehrung, womit ich unverbrüchlich bestehe
allerunterthänigst treugehorsamster
Reichsfürst Friedrich Franz, Herzog zu Mecklenburg."
Schwerin, den 21. März 1786.
IV. Registratura,
"Da bei erfolgter allerhöchst kaiserlichen Thronveränderung von neuem die Frage entstehet, wie man sich abseilen der altweltfürstlichen Häuser der Reichsthronbelehnung halber zu benehmen habe. So setzet man voraus: daß die Lehne binnen Jahr und Tag nach Antritt der jetzig glorreichen Regierung Sr. Kaiserl. Majestät zu muthen seien, ist aber zugleich dahin miteinander einverstanden: daß, da diejenige Anstände, welche die altweltfürstliche hohe Häuser zu dem bekannten Konzert im Jahre 1753 und zu denen im Jahre 1767 deshalb erneuerten Maßnehmungen veranlaßt haben, bishero so wenig
1) in Betreff der neugegründeten Anforderungen an mehrfache Tax-, Laudemien-, Anfalls- und Indultgeldern, als wenig
2) in Ansehung des Ceremonielpunkts
gehoben sind, sondern noch immer obwalten, bei jenem gemeinverbindlichen Konzert und Maßnehmungen unabweichlich standhaft zu beharren, sich nicht von einander trennen zu lassen, sondern in Fortsetzung vertraulichster Communication. causam communem zu machen und, wann ein oder anderen fürstlichen Haus ungleiche Zumutungen geschehen oder sonst in dasselbe gedrungen werden wollte, die Conzert- und unionsmäßige Assistenz der übrigen zu reklamieren, auch einander conjunctim unitis viribus zu leisten sei: Und daß insbesondere abseiten derjenigen Höfe, welche durch kaiserliche Reichs-Hofrats-Conclusa ex officio oder in anderer Maße zur Berichtigung der Lehnsempfängnis aufgefordert oder auch mit unstatthaften An-


|
Seite 318 |




|
forderungen beschweret werden wollten, den vorliegenden Umständen nach und in Gemäßheit der bereits im Jahre 1768 unter den altweltfürstlichen Gesandtschaften dahin getroffenen Abrede vor Ablauf des etwa anberaumten Termini, ohne eine neue Prolongation oder Indult zu begehren, mittelst Exhibierung einer förmlichen Vorstellung beim Reichs-Hofrath der ganze Inhalt davon den mehresten altweltfürstlichen Häusern im Jahre 1767 an den damaligen Herrn Reichs-Vicekanzler Fürsten von Colloredo überreichtem Promemoria vollständig dargelegt und mit ausdrücklicher Beziehung auf dessen geschehene Übergabe zu erkennen gegeben wäre: wie bereits damals der wirklichen Lehnsempfängnis halber, wenn nur die dabei sich ergebende in jenem Promemoria bemerkte Anstände zuförderst gehoben sein würden, die vollkommenste Bereitwilligkeit bezeiget worden: für jetzo aber, da nach der darauf zu erteilenden allergnädigsten kaiserlichen Resolution mit Hebung der Anstände entgegengesehen werde, die nämlichen Umstände annoch eintreten, mithin man unter wiederholter Bereitwilligkeitsversicherung zu schuldigster Vollziehung einer dem Vorgang eines geist- und weltlichen Churfürstlichen Hofes gemäße Lehnsempfahung sich vermüßigt sehe, gegen alles Präjudiz, weil man darunter keineswegs in mora, noch in culpa sei, sich und seine mit anderen altweltfürstlichen Häusern gemein habende Gerechtsame und Prärogative bestermaßen geziemend zu verwahren.
Wobei dann denen in Wien anwesenden der altweltfürstlichen, im Konzert begriffenen hohen Häuser Ministers, Räthen und Residenten, auch Agenten durch gemessene Anweisungsreskripte ernst-nachdrücklichst und geschärft aufzugeben wäre, über die ihnen in dieser gemeinsamlich interessierenden Angelegenheit zukommende Aufträge und Zufertigungen sofort mit einander vertraulichst zu communicieren, selbigen in allen dem Gebühr nachzukommen und anders nicht dann in Conformität derer ihnen ausdrücklich ertheilten Befehlen zu Werke zu gehen.
Vorstehende Registratur ist bei heutiger Zusammentretung von nachstehend unterzeichneten Reichstagsgesandtschaften der altweltfürstlichen Häuser concertieret und verfaßt, auch an allerseits hierbei interessierte höchste Höfe zur gnädigsten Approbation und Ratification unterthänigst einzusenden beschlossen worden.
Regensburg, den 25. Mai 1791. Salvo loco et ordine.


|
Seite 319 |




|
P. von Gemmingen von wegen Sachsen Gotha, Mecklenburg-Schwerin und Ratzeburg.
C. A. Freiherr von Seckendorff von wegen Württemberg und Mömpelgardt.
Theodor von Salzmann von wegen Brandenburg, Ansbach-Bayreuth und Anhalt."
V. Notifikationsschreiben des Kaisers nach erfolgter Wahl an den Herzog von Mecklenburg.
"Franz der Zweite von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien, zu Hungarn und Böheim, Erzherzog zu Österreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog zu Toskana pp.
Nachdem aus unzweifelbarer Fürsehung und Schickung Gottes die am 5. dieses Monats vorgegangene Wahl eines Römischen Königs und künftigen Kaisers mittels ordentlichen und einmüthigen Stimmen des Kurfürstlichen Kollegiums auf Uns ausgefallen, auch hierauf gestrigen Tages die Krönung zum Römischen Kaiser in Unserer und des Heiligen Römischen Reichs Stadt Frankfurt mit allen gebräuchlichen Feierlichkeiten glücklich vollzogen worden ist: So haben Wir nach Unserem Ew. Liebden zutragenden besonderen Neigung nicht unterlassen wollen, denselben dieses erfreuliche Ereignis hiemit gnädigst kundzumachen, nicht zweifelnd, daß Ew. Liebden daran freudigen Anteil nehmen und Uns diese Erhebung zur kaiserlichen Würde gerne gönnen werden.
Ew. Liebden können dagegen versichert sein, daß, gleichwie Wir Unsere kaiserliche Regierung mit göttlicher Hilfe und mit getreuem Beistand der Kurfürsten, Fürsten und Ständen des Reichs dergestalt zu führen gedenken, damit dadurch des Heiligen Römischen Reichs, Unseres werthen deutschen Vaterlandes, Nutzen und Aufnahme möglichst gefördert werden möge, also auch Wir insbesondere Ew. Liebden bei allen Gelegenheiten mit Kaiserlichem Schutz, Gnade und allem Guten wohl beygethan verbleiben werden. Gegeben mit Unserer und des Heiligen Reichsstadt Frankfurt den 15. Julius im Jahre 1792, Unserer Reiche, des Römischen auch des Hungarischen und Böhmischen im ersten.


|
Seite 320 |




|
VI. Herzoglisches Schreiben an den Kaiser nach erhaltener Notifikation der erfolgten Wahl.
Je dringender die Angelegenheit des gemeinschaftlichen deutschen Vaterlandes war, bei den jetzigen mancherlei Verwickelungen und critischen Verhältnissen baldigst mit einem Oberhaupt versehen zu werden, desto erfreulicher hat es für mich, sowie für jeden meiner patriotischen Reichs-Mitstände sein müssen, daß nach Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät mir darüber allergnädigst angeehrten Notifikation die deshalb angestellte Wahl, deren Einstimmigkeit sich nicht bezweifeln ließ, auf Allerhöchstdieselben ausgefallen und, nach den allgemeinen Wünschen, von Allerhöchstderselben angenommen worden. Glücklicher hätte diese Wahl nie getroffen werden können, da in Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät erhabenster Person alle die großen Eigenschaften, wodurch dero glorreiche Vorfahren sich und die Ihrem Zepter und Händen anvertraute Wohlfahrt des deutschen Reiches unsterbliches Verdienst erworben haben, so vollkommen vereiniget sind. Ich rechne es daher zu der glücklichsten meiner Stunden, wenn ich die Pflicht erfüllen darf, Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät mit Bezug auf mein hiebevor schon submissest erlassenes Glückwunschschreiben hiedurch insbesondere auch noch zu der jetzt angetretenen Kaiserwürde meine allerehrerbietigste Gratulation abzustatten und allen göttlichen Segen und Beistand zu dieser Oberhauptlichen Reichsverwaltung, sowie überhaupt, also besonders auch bei den gegenwärtigen Zeitläuften, in welchen Allerhöchstdieselben schon gleich den ersten Anfang dero Allerhöchsten Reichsbeschirmung mit sovieler Würde und Nachdruck bezeichnen, inbrünstig anzuwünschen. Darf ich gleich an der allgemeinen Kaiserlichen Obhut ohnehin einen Reichsmitständigen Antheil hoffen, so geruhen Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät doch, mich und mein herzogliches Haus hiedurch noch zur besonderen Allerhöchsten Gnade auf das submisseste empfehlen und dagegen die tiefste Devotion bezeugen zu dürfen, in welcher ich zeitlebens beharre Ew. Kaiserl. Königl. Apostol. Majestät unterthänigst gehorsamster Reichsfürst
Schwerin am 27. July 1792."
(Gegenzeichnung dreier Minister.)


|
[ Seite 321 ] |




|



|


|
|
:
|
VII.
Gelegenheitsfindlinge
aus meinen
genealogischen
Sammlungen
von
Forstmeister a. D. C. Frhr. v. Rodde in Prüzen bei Tarnow.
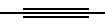


|
[ Seite 322 ] |




|


|
Seite 323 |




|
Zu dem Tagebuch des Erbgroßherzogs Friedrich Ludwig, das Geh. Regierungsrat Dr. Schröder im Jahrbuch 65, S. 123 ff., veröffentlicht hat, gibt er in den Fußnoten zahlreiche Nachweise über die im Tagebuch erwähnten Persönlichkeiten. Meine Sammlungen 1 ) ermöglichen es mir, zu diesen Fußnoten einige Ergänzungen und Richtigstellungen zu geben, deren Mitteilung, wie ich hoffe, den Vereinsmitgliedern willkommen sein wird.
S. 124 Anm. 3: Oberst Friedrich Wilhelm v. Lützow starb zu Renzow am 14. April 1802 und wurde am 17. desselben Monats auf dem alten Familiengute Salitz beigesetzt.
S. 175 Anm. 3: Generalmajor v. Fallois starb zu Oels am 20. Dezember 1834. Sein Vater, der aus Lothringen stammte, erhielt am 29. Mai 1775 den preußischen Adel.
S. 207 Anm. 2: Das Kirchenbuch Ludwigslust führt bei der Todeseintragung des Generalmajors Mecklenburg von Kleeburg als Geburtsort Güritz bei Eldena an.
S. 217 Anm. 2: Luise Friederike v. Barner, geboren zu Kalkhorst am 13. März 1771, starb als Konventualin zu Dobbertin am 28. Dezember 1836.
S. 224 Anm. 1: Landrat Adam Otto v. Vieregge, geboren 1749 zu Lantow, einem Gute seines Vaters, gest. in Wismar 6. Februar 1820. Er hatte 1783 9. März die verwitwete Hauptmannin Catharina Dorothea von Plessen, geb. von Plessen, auf dem Hofe zu Raden geheiratet, die Mutter des späteren Ministers Leopold Hartwig Engelke von Plessen, die er am 15. März 1805 durch den Tod verlor.


|
Seite 324 |




|
S. 225 Anm. 4: Gräfin America Bernstorff, geb. Freiin von Riedesel, starb zu Wesenberg 17. Mai 1856.
S. 225 Anm. 5: Bürgermeister Rudow, vorher Kommissionssekretär in Rostock, seit 1791 Bürgermeister in Rehna, gest. 1. September 1831 zu Grevesmühlen, 71 Jahre alt, war der Sohn eines Majors in Nassau.
S. 226 Anm. 1: Hier irrt Schröder: Der am 1. Oktober 1801 vom Kaiser Franz II. nobilitierte Geh. Rat Gottlieb Häseler war nach der Anzeige seiner Witwe, Schweriner Anzeigen 1813 S. 1500, bereits 27. Oktober, nach dem Kirchenbuch Kalkhorst 28. Oktober 1813 gestorben. Der 1844 in den eingeborenen Adel rezipierte Adolph Gottlieb Heinrich von Häseler auf Schwansee war ein Sohn des Geh. Rats. Danach ist auch Lehsten, Adel Mecklenburgs S. 91, zu berichtigen.
S. 226 Anm. 3: Louis Friedrich Heinrich du Trossel, geb. Neuruppin, gest. Schwerin 13. November 1871, 86 Jahre alt.
S. 227 Anm. 1: Oberjägermeister Gustav Adolf Hans von der Lühe, geb. auf dem väterlichen Gute Barnekow 1. Januar 1760, gest. Schwerin 3. August 1814.
S. 228 Anm. 3: Graf Jobst Karl von Schwicheldt, gest. Celle 31. Januar 1830.
S. 232 Anm. 1: Vizekanzleidirektor von Mecklenburg, get. Zibühl 9. September 1769.
S. 239 Anm. 2: Kammerpräsident Adolf Ludwig Carl von Scheve, geb. Neustrelitz 3. April 1758, gest. Neustrelitz 1. Mai 1831. Sein Bruder, Oberkonsistorialpräsident (nach dem Woldegk-Canzower Kirchenbuch Präsident des kurmärkischen Pupillencollegii) Adolf Friedrich von Scheve, get. Neustrelitz 29. Mai 1752, gest. Berlin 22. Februar 1837.
S. 240 Anm. 1: Das Domkirchenbuch Schwerin gibt bei der Todeseintragung des Kammerherrn Cuno Ludwig von der Kettenburg sein Alter auf dreißig und etliche Jahre an. Kirchenbuch Jördenstorf, wo Schwetzin eingepfarrt ist, gibt um die fragliche Zeit überhaupt keine Kettenburgschen Geburten; es ist auch damals so nachlässig geführt, daß es nicht möglich ist, die in der Abschrift (?) aufgeführten Eintragungen im Kirchenbuch aufzufinden. Das Kirchenbuch Belitz, wo die übrigen Kettenburgschen Güter eingepfarrt sind, hat zu dieser Zeit eine Lücke. Nach einer Hövelschen Ahnentafel fand die Vermählung seiner Eltern am 20. Juni 1773 statt.


|
Seite 325 |




|
S. 241 Anm. 1: Kammerherr und Hofmarschall Carl Detlof Friedrich Wilhelm von Rantzau, geb. Ludwigslust 24. Juni 1782 als Sohn des Oberstallmeisters Franz Friedrich von Rantzau, gest. Schwerin 28. März 1851, aber zu Ludwigslust beigesetzt.
S. 242 Anm. 2: Frau von Boecler, Sophie Christiane, geb. von Täubner, geb. zu Dresden, gest. zu Ludwigslust 27. Juli 1824 im Alter von 88 Jahren 7 Monaten.
S. 259 Anm. 1: Gustav Dietrich von Oertzen auf Kittendorf wurde erst 1802 (nicht 1792) zum Landrat gewählt (s. Bekanntmachung in den Schweriner Anzeigen 1802 Stück 104 S. 1393). Der Staatskalender von 1803 nennt ihn zuerst als Landrat, wonach Maltzan, Einige gute mecklenburgische Männer, und Koppe im Freimütigen Abendblatt zu berichtigen. Saß, Geschlecht von Oertzen VI S. 238 f., gibt das Jahr richtig.
S. 265 Anm. 1: Both hieß nicht Carl Julius, sondern Carl Moritz Christian, geb. 7. Februar 1792 zu Rambow, dem väterlichen Gute, gest. Ludwigslust 13. Oktober 1857.
S. 267 Anm. 1: Bernhard Joachim von Bülow, geb. auf dem väterlichen Gute Camin 8. Juni 1747, gest. Schwerin 30. August 1826. Er besaß außer Düssin auch die Güter Neu-Schlagsdorf, Retgendorf und Flessenow, welche nach seinem Tode von seinen Erben verkauft wurden, sowie Wendelstorf, Ventschow und Kressin, die er selber wieder veräußerte. Bülow wurde auch verschiedentlich zu diplomatischen Missionen gebraucht, so 1797 an den schwedischen Hof nach Stockholm, um wegen der beabsichtigten, aber durch russische Intrigen vereitelten Verlobung der Herzogin Luise Charlotte, ältesten Tochter Friedrich Franz I., mit dem Könige Gustav IV. Adolf von Schweden zu verhandeln. Vgl. Hirschfeld, Von einem deutschen Fürstenhofe I, 21 ff.
S. 271 Anm. 4: Leutnant von Arnim I. hieß mit Vornamen Carl Friedrich Wilhelm Christoph, Rufname Carl, geb. Lütgendorf 16. Februar 1794, nahm 1815 den Abschied, den er mit dem Charakter als Hauptmann erhielt, und heiratete Ludwigslust 5. Juni 1816 die Hofdame der Erbgroßherzogin, Caroline Amelie von Lützow (s. S. 220 Anm. 1), zweite Tochter des Oberhofmeisters August von Lützow. Arnim starb 7. Mai 1848 als Besitzer von Katelbogen, seine Witwe Ludwigslust 8. März 1888 im hohen Alter von 95 Jahren.
S. 272 Anm. 1: Oberst Louis August von Bilguer, geb. Rheinsberg, gest. Schwerin 2. März 1858, alt 80 Jahre 4 Monate.


|
Seite 326 |




|
S. 272 Anm. 2: Albert Friedrich Adolf von Arnim, geb. Lütgendorf 11. Juli 1795, machte als Junker beim Kontingentsregiment den Feldzug nach Rußland mit und fiel im Gefecht auf der Wilhelmsburg 12. Mai 1813.
S. 273 Anm. 1: Kammerherr Erich Friedrich Hans Carl von Graevenitz auf Waschow, get. daselbst 1. September 1750, gest. 20. November 1843 ebendaselbst.
S. 274 Anm. 1: Carl Wilhelm Ludwig von Koppelow, geb. auf dem väterlichen Gute Mentin 14. November 1788, gest. Schwerin 24. Oktober 1869.
S. 274 Anm. 1: Joachim Dietrich August Freiherr von Maltzahn, geb. Malchin 30. Juli 1788, gest. Klütz 18. März 1827. Im Freimüthigen Abendblatt 1827, Stück 461, findet sich eine Biographie von ihm.
S. 275 Anm. 5: Freiherr Friedrich Peter Carl Gottlieb von Forstner, geb. Ludwigslust 16. September 1790, gest. als charakterisierter Generalmajor Neuhaus bei Lübben 20. Mai 1857.
S. 288 Anm. 2: Carl Friedrich August von Yorry, geb. Magdeburg im Dezember 1791, gest. Sandberg vor Belzig 1834 als Obersteuerkontrolleur.
S. 300 Anm. 1: Philipp Christoph von Normann, geb. 22. Januar 1754, gest. 20. April 1825. Seine Gemahlin Susanna Elisabeth (Carolina?) Waitz von Eschen, gen. Hilchen, geb. 21. Januar 1762, gest. 28. August 1836. Deren erster Gemahl Reisemarschall von Walsleben auf Lüsewitz, get. daselbst 18. Juni 1744, gest. Stralsund 22. Januar 1790, hieß nicht Peter, sondern Detlof Philipp (s. Staatskalender). Hiernach wäre auch v. Buttlar, Stammtafeln der althessischen Ritterschaft, zu verbessern. Ganz falsch sind die Angaben im Deutschen Herold 9 (1878) S. 67 und 10 (1879) S. 78, wo dem Reisemarschall die Vornamen seines Bruders, des Oberstleutnant Wedige Gustav auf Woltow, beigelegt werden.
S. 300 Anm. 3: Freiherr Eberhard von Roeder, geb. Waldenbuch in Württemberg, gest. Schwerin 10. März 1855, 85 Jahre alt, als Hofmarschall a. D. und Vorstand der Bibelgesellschaft.
Im Jahrbuch 41, S. 3 ff., hat Archivrat Dr. Wigger das Leben der unglücklichen Königin Sophie Louise, geb. Herzogin zu Mecklenburg, der dritten Gemahlin des Königs Friedrich I. von Preußen, und ihre traurigen Schicksale an dem glänzenden Berliner Hofe geschildert. In diesem Aufsatz ist auch eine Darstellung ihrer Be-


|
Seite 327 |




|
ziehungen zu ihrer Freundin und Dienerin Eleonore von Graevenitz enthalten, die ihre Treue und Anhänglichkeit an ihre Gebieterin und ihr festes, offenes Bekenntnis ihres Glaubens an ihren himmlischen Herrn mit schmählicher Verleumdung, offener und versteckter Feindschaft und endlich mit gewaltsamer Vertreibung vom Hofe und aus dem preußischen Staate büßen mußte. Ziemlich lückenhaft sind die genealogischen Daten über Eleonore von Graevenitz, die Wigger gibt. Über ihre Geburt sagt er, es sei ihm nicht gelungen, Ort und Tag derselben aufzufinden, ingleichen (S. 50 Anm. 1), daß er über ihr ferneres Verbleiben, nachdem ihr Gemahl, Geh. Rat Nathanael von Sittmann, nach dem Sturze der allmächtigen Schwester, Wilhelmine von Graevenitz, vermählten Gräfin von Wrbna, aus Württemberg vertrieben war, sowie über ihren Tod nichts habe ermitteln können. Meine genealogischen Sammlungen geben darüber folgende Aufklärung:
Der Vater der Wilhelmine und der Eleonore war zuerst, ehe er als Marschall des Herzogs Gustav Adolf nach Güstrow kam, Amtshauptmann zu Wanzka. Das dortige Kirchenbuch, das 1680 beginnt, gibt an, daß der Hauptmann von Graevenitz am 23. Januar 1681 eine Tochter Eleonore Luvis und am 2. Oktober 1682 eine weitere Tochter Hanna Regetta (wohl Regina?) taufen ließ. Dies sind das Kammerfräulein der Königin von Preußen Eleonora und ihre jüngere Schwester Henriette, welche später mit der Mutter gleichfalls nach Stuttgart übersiedelte und dort den Kriegsratspräsidenten von Boldewin heiratete. Als Tauftag der Wilhelmine, die als Maitresse des Herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg in diesem Lande eine so bedeutende, aber unheilvolle Rolle von 1706 bis 1731 spielte, gibt Wigger (S. 28 Anm. 2) nach dem Kirchenbuch Schilde, ihrem Geburtsort, den 4. Februar 1684 an. Sie war also jedenfalls die jüngste der drei Schwestern.
Über das Verbleiben des Ehepaares von Sittmann und der Tod der Eleonore, geb. von Graevenitz, sagt eine Notiz in den genealogischen Sammlungen des weil. Johanniter-Ordensrats König in der Berliner Staatsbibliothek, daß der Baron von Sittmann sich 1742 zu Berlin aufgehalten habe und seine Frau daselbst verstorben sei, weshalb er dort mit dem Grafen von Graevenitz einen Prozeß geführt habe.
Im Jahresbericht des Jahrbuchs 23 (1858) wird ein Bild aus der Bildersammlung des Vereins erwähnt, das einen Herrn C. von der Lühe in Wien darstellt. Derselbe war am 9. März 1801 als


|
Seite 328 |




|
Kaiserlicher, Kämmerer und niederösterreichischer Regierungsrat gestorben. Im Jahresbericht des nächsten Jahrgangs werden dann noch einige Züge aus seinem Leben aufgeführt und angegeben, daß er Carl Emil hieß und aus einer holsteinschen Branche dieses alten mecklenburgischen Geschlechts im Jahre 1751 geboren war. Dies stimmt aber nicht ganz. Nach dem Kirch Grambower Kirchenbuch ist dort am 5. Juni 1752 getauft des Herrn von der Lühe, dänischen Kammerherrn, wohnhaft auf der Insel Falster, und der Madame von Lützau Junker Friederich Charl Emilius. Das Gadebuscher Kirchenbuch weist die Trauung der Eltern nach: Am 18. März 1749 wurden auf dem hochfürstlichen Amt daselbst getraut der Kammerherr aus Kopenhagen Herr Gideon von der Lühe und Fräulein Margarethe Hedwig Freiin von Lützauen. Dieser Gideon war dänischer Kammerherr, Ritter vom Danebrogorden, und starb als Amtmann zu Apenrade. Er war der älteste Sohn des Dietrich Otto von der Lühe auf Dambeck (R. A. Wredenhagen) und erhielt seinen Vornamen nach seinem mütterlichen Großvater, dem Obristleutnant Gideon du Puits auf Wehnendorf.
Im Jahrbuch 32 (1867), S. 155, ist eine in der Fayencefabrik zu Gr. Stieten angefertigte Butterdose aus dem 18. Jahrhundert in Gestalt einer sitzenden Ente beschrieben. Sowohl Deckel wie Gefäß haben die Inschrift:
Gros: Stitten
Chelij.
sowie eine Zahl. Das v. H. bedeutet von Hagen: damaliger Besitzer von Gr. Stieten war ein Herr von Hagen. Eine Erklärung des Chelij ist nicht versucht. Das Kirchenbuch von Beidendorf hat nun die folgende Eintragung: "1754 den 4. Jan. ist des Porcellain-Machers Rudolph von Chely kleine Tochter von 2 Jahr in ein gewölbt Begräbniß gebracht worden, wogegen ich [der Pastor] aber protestiret, weil dergleichen Begräbnisse auf dem Kirchhof nicht gebräuchlich sindt."


|
[ Seite 329 ] |




|



|


|
|
:
|
VIII.
Die geschichtliche und landes-
kundliche Literatur
Mecklenburgs 1925/1926
von
Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr.
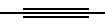


|
[ Seite 330 ] |




|


|
Seite 331 |




|
- Ravenstein (Hans), R.'s Volksausgabe von Spezialkarten d. Deutschen Reichs: Mecklenburg, 1:300 000. Frankfurt a. M. (Ravenstein) [1926]. - Neue Ämtereinteilung.
- Pfeiffer (H. A.), Übersichtskarte d. M. Seengebietes u. s. Verbindungen mit Ostsee, Elbe, Havel, Oder für Schiffahrt u. Wassersport. 1:250.000. Berlin W 35 (Gea-Verlag) [1925].
- Beltz (R.), Dreiperiodensystem [bei Einteilung d. Vorgeschichte]: Reallexikon d. Vorgesch. 2, S. 457-460.
- Beltz (R.), Zur Vorgesch. v. M.: Heimatbuch M. 1925, S. 76-97.
- Beltz (R.), D. Schweriner Altertümersammlung 1835-1925: Vorgeschichtl. Jahrb. 1, S. 117-120.
- Beltz (R.), Fibel (Bügelnadel): Reallexikon d. Vorgesch. 3, S. 283-301.
- Beltz (Robert), Denkmäler u. Funde d. Gegend v. Boizenburg: M. Nachr. 21., 24. Nov. 1925 (Nr. 272, 274); M. Ztg. 21., 23. Nov. 1925 (Nr. 272, 273).
- Beltz (R.), D. Hügelgräber bei Twietfort: M. Nachr. 25., 26. Juli 1925 (Nr. 171, 172).
- Schuchbardt (C.), Robert Koldewey †. [betr. Rethra auf d. Schloßberge bei Feldberg]: Praehist. Zeitschr. 16. Bd. (1925), S. 106.
- Karbe (W.), Arkona - Rethra - Vineta: Zeitschr. f. slav. Phil. 2, S. 365-372.
- Krueger (Alb. G.), Rethra u. Arkona: M. Monatshefte 2, S. 136-141.
- Karbe (W.), D. wendische Silberschatz von Blumenhagen: Praehist. Zeitschr. 16. Bd. (1925), S. 76-80.
- Dettmann (Gerd), Was wissen wir über d. Wohnhaus d. vorgeschichtl. Zeit?: M. Ztg. 17. April 1926 (Nr. 88); M. Nachr. 29. April 1926 (Nr. 98).
- Dettmann (Gerd), Vorgeschichtl. Grabsitten in unserer Heimat: M. Ztg. 25. Febr. 1926 (Nr. 47); M. Nachr. 6. März 1926 (Nr. 54).
- Dettmann (Gerd), Wie alt sind unsere Hünengräber?: M. Nachr. 21. Jan. 1926 (Nr. 17).
- Dettmann (Gerd), D. Tiere unserer Urzeit: M. Monatshefte 2, S. 125-126.
- Schmid (Heinrich Felix), D. slavische Altertumskunde u. d. Erforschung d. Germanisation d. deutschen Nordostens: Zeitschr. f. slav. Phil. 1, S.396-415, u. 2, S. 134-180. - Besprechung von D. N. Jegorow, D. Kolonisation M.'s im 13. Jahrh. Moskau 1915.


|
Seite 332 |




|
- Witte (Hans), M.'s Christianisierung u. Germanisierung: Heimatbuch M. 1925, S.97-104.
- v. Bülow (Jobst Heinrich), Was m. Ortsnamen erzählen: Rost. Anz. 13. Febr. 1926 (Nr. 37); M. Nachr. 19. März 1926 (Nr. 65). - Betr. die deutsche Besiedelung.
- Allerding (Friedrich), D. Flurnamen u. d. Besiedlung d. Landes Ratzeburg: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 8, S.2-7, 21-27.
- Meier (P. J.), D. Münz- u. Städtepolitik Heinrichs des Löwen: Niedersächs. Jahrb. 2, S. 125-144.
- Endler (E. A.), Hofgericht, Zentralverwaltung u. Rechtsprechung d. Räte in M. im 16. Jahrh.: M.-Strel. Gesch.-Bl. 1, S. 118-156.
- Vitense (Otto), Schill in M.: Rost. Anz. 6. Jan. 1926 (Nr. 4).
- Pagel (Karl), M. u. der Deutsche Zollverein: M.-Strel. Gesch.-Bl. 1. Jg., S. 102-117.
- Endler, Kinkels Flucht durch M.: M. Monatshefte 2, S. 155-160.
- Wahl (Adalbert), Deutsche Geschichte (1871-1914). Stuttgart (Kohlhammer) l. Bd. (1925), S. 279-284. - M. Verfassungskämpfe in den 70er Jahren.
- Scharenberg (Wolfgang), D. Sünden d. m. Ritterschaft. 1926 (Eigenverlag d. Verf.). 62 S. 8°.
- Endler (E. A.), Herzog Karl v. M.-Strelitz, d. Vater d. Königin Luise: Westermanns Monatshefte 70 (März 1926), S. 47-52.
- Endler, Herzog Carl, d. Gründer des Gymn. Carolinum [in Neustrelitz]: Landesztg. 12. Juni 1925 (Nr. 133).
- Meisner (Heinrich Otto), Vom Leben u. Sterben d. Königin Luise. Eigenhändige Aufzeichnungen des Kg. Friedr. Wilh. III. Berlin (Koehler) 1926. 93 S. Gr. 8°.
- Pauls (Eilhard Erich), D. Revolution d. Königin Luise: M. Monatshefte 1, S. 570-573.
- v. Oppeln-Bronikowski (Friedr.), Preußens Königin [Luise]: Deutsche Allg. Ztg. 10. März 1926 (Nr. 113/114).
- Molnar (Günther), Königin Luise: M. Ztg. 9. März 1926 (Nr. 56).
- Hoechstetter (Sophie), Königin Luise. Histor. Roman. Berlin (Bong) [1926]. 357 S. 8°.
- Sachse (Hans), D. Feuertaufe Friedrich Franz II. v. M.-Schwerin im Deutsch-dänischen Krieg: M. Rundschau 21. März 1925.
- Lexikon deutscher Familien, 2. Jahrg. (1925), S. 21: v. Hintzenstern; S. 38: Evers; S. 43: Schallehn; S. 50: Wunderlich.
- Ahnenreihen aus allen deutschen Gauen, bearb. von v. Ehrenkrook u. a. Nürnberg (Spindler) 1925. Heft 1 u. 2.
- Brenner (Siegfr. O.), Deutsche Einwanderer in Dänemark [aus Bürgerschaftsprotokollen d. Stadt Kopenhagen: 1699-1712]: D. Fam. Forscher I (1925), S. 156-160, 195-198, 248-253. Forts. folgt. - Auch eine Anzahl M.'er.
- v. Weltzien (Julius), Ein Beitrag zur Einwanderungsfrage [d. m. Adelsgeschlechter]: M. Jahrb. 89, S. 321-324.
- Gehrig (Oscar), D. Maler Thuro Balzer: M. Monatshefte 2, S. 223-226.
- Gehrig (Oscar), D. Maler Bartels: M. Monatshefte 2, S. 14-18.


|
Seite 333 |




|
- Rust (Wilhelm), Aus John Brinckmans Jugendzeit: M. Monatshefte 2, S. 102-106.
- Brücknerscher Fam.-Verband. 6. Bericht vom 23. Febr. 1924 - 1. Jan. 1926 [1926].
- Bunke (Franz), Wie ich zur Kunst kam, u. was sie mir ist; Erinnerungen: M. Monatshefte 1, S. 574-579.
- Schmidt (Wilhelm), Zum 100. Geb.-Tag v. Karl Eggers: M. Monatshefte 2, S. 310-312.
- Hustaedt (Konrad), Carl Adolf Johann Eggers (1787-1863), ein m.-strel. Maler: M.-Strel. Gesch.-Bl. 1, S. 94-101.
- Stieda (Wilhelm), Archivrat Carl Friedrich Evers in Schwerin im Verkehr mit Johann Bernoulli (III.): M. Jahrb. 89, S. 325-356.
- Schuh u. a., Eugen Geinitz †: Archiv f. Naturgesch. in M., N. F. 1, S. 1-26.
- Stahl, Geinitz' Bedeutung für M.: M. Monatshefte 1, S. 378-384.
- Iven'sche Fam.-Nachr. Nr. 3 (1926). Stettin (Pomm. Reichspost).
- Stern (Dorothea), Kaplunger, Bildhauerfamilie d. 18. Jahrh.: Thieme-Becker, Allg. Lex. d. bild. Künstler Bd. 19 (1926).
- Hamann (Ernst), Dr. Heinrich Klenz: Zeitschr. M. 21, S. 29-31.
- Werner (Theod. Gust.), D. Fam. d. niedersächs. Geschichtsschreibers Albert Krantz, ihre Ahnen u. Nachfahren: Zeitschr. f. niedersächs. Fam.-Gesch. 8, S. 69-79.
- Gehrig (Oscar), Ernst Lübbert [Maler u. Zeichner]: M. Monatshefte 1, S. 390.
- Lützowsches Fam.-Bl. Nr. 1-16 (1922-1926). Frankfurt a. O. (Marschner).
- Reifferscheid (H.). Carl Malchin: M. Monatshefte 2, S. 86-88.
- Schmidt (Berthold), Gesch. d. Geschlechts von Maltzan u. von Maltzahn. 2. Abt., 4. Bd. Schleiz (Webers Nachf.) 1926. 367 S. 8°.
- Sachse (Hans), Luise Mühlbach. ein Neubrandenburger Kind: M. Rundschau 18. Jan. 1925 (Nr. 15).
- Nachr.-Bl. d. Fam. v. Pressentin bzw. v. Pr. gen. v. Rautter. Nr. 13-14 (1926). Friedland (Döring).
-
Reinke (Johannes), Mein Tagewerk. Freiburg
i. Br. (Herder) 1925. 496 S.
Gr.-8°.
Bespr. v. Haack in M. Ztg. 8. Dez. 1925 (Nr. 286) u. M. Nachr. 9. Dez. 1925 (Nr. 287). - Vitense (Otto), Fritz Reuters Neubrandenburger Zeit: M. Rundsch. 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Vitense (Otto), Fritz Reuters Beziehungen zu Schwerin: M. Ztg. 15. Aug. 1925 (Nr. 189).
- Karnatz (Ludwig), D. Stavenhagener Stadtkind. Zu Fritz Reuters 115. Geburtstag am 7. Nov.: M. Nachr. 8. Nov. 1925 (Nr. 262).
- Sachse (Hans), Aus Tagebuchblättern eines alten Schweriner Arztes [des Geh. Med.-Rats Dr. Sachse, Leibarztes Fr. Fr. I.]: Rost. Anz. 29. u. 30. Dez. 1925 (Nr. 302, 303).
- v. Schack (Hans), Beitr. z. Gesch. d. Grafen u. Herren v. Schack, 4. Beitr., 4. Heft (1925).
- Gehrig (Oscar), D. Bildhauerin Margarete Scheel [in Rostock]: M. Monatshefte 1, S. 449-452.
- Ringeling (G.), Heinrich Seidel: M. Monatshefte 2, S. 36-39.
- Ernst (Gustav). Aus d. Jugend Tilemann Stellas [1525-52]: Siegen. Ztg. 22. Aug. 1925; Wanderjahre 1552-64: ebd. 24. Dez. 1925.


|
Seite 334 |




|
- Ernst (Gustav), Tilemanus Stella Sigenensis, d. erste Brockenbesteiger 1561: Zeitschr. d. Harzver. f. Gesch. u. Alt. 59, S. 79-84.
- Ringeling (G.), Johannes Trojan: M. Monatshefte 1, S. 635-639.
- Hansche (Reinhold), Bildhauer Prof. Wilhelm Wandschneider - Berlin: D. Kunstschule 8, S. 289-298.
- Düwahl (Ludwig), Wilhelm Wandschneider: M. Monatshefte 2, S. 302-304.
- Grotefend (Hermann), Chronologisches: Korr.-Bl. d. Ges.-Ver. 74, Sp. 114-121.
- Geinitz (Eugen), Erdgesch. v. M.: Heimatbuch M. 1925, S. 1-7.
- Mecklenburg. (Griebens Reiseführer, Bd. 104.) 7. Aufl. Berlin (Grieben Verlag) 1922. 96 S. Kl.-8°.
- Becker, D. m. Ostseeküste, ihre Entstehung u. Weiterentwicklung: M. Monatshefte 1, S.267-271.
- Becker (J.), D. m. Ostseeküste: Heimatbuch M. 1925, S. 8-15.
- Becker (J.), Sturmfluten an unserer Ostseeküste: M. Monatshefte 1, S. 642-646.
- Peters (Johannes), D. Gliederung d. deutschen Ostseeküste u. ihre geograph. Bedeutung. Rost. Diss. (Auszug). Neukloster (Schumacher) 1925.
- D. Ostseeküste von Memel bis Flensburg (Griebens Reiseführer, Bd. 55). 20. Aufl. Berlin (Grieben Verlag) 1926. 196 S. Kl.-8°.
- Deutsche Ostseeküste I: Lübeck, Mecklenburg, Schleswig-Holstein (Meyers Reisebücher). Leipzig (Bibliogr. Inst.) 1924. 230 S. Kl.-8°.
- Wolff (Hans), D. deutsche Ostseeküste von Flensburg bis Stettin (Terramare-Reisebücher Bd. 1). Berlin (Neue Verlagsanst.) 1924. 222 S. Kl.-8°.
- Zander (Walther), Insel Poel u. die Wismarsche Wasserkante: M. Monatshefte 1, S. 309-312.
- Schlüter (Ernst), Von Warnemünde bis Wustrow, eine Strandwanderung: M. Monatshefte 1, S. 344-351.
- Gosselck (Johannes), Wanderungen von Rostock nach Osten: M. Monatshefte 1, S. 409-413.
- Ahrens (Adolf), D. Rostocker Heide: Heimatbuch M. 1925, S. 42-45.
- Waldhäuser (Hinrich), D. Rostocker Heide: M. Monatshefte 1, S. 293-297.
- Ahrens (Rudolf), D. Fischland: Heimatbuch M. 1925, S. 15-19.
- Langpape (Wilhelm), Wanderungen im Warnowtal: M. Monatshefte 1, S. 394-397.
- Buddin (Fr.), Am Ratzeburger See: Heimatbuch M. 1925, S. 23-26.
- Gosselck (J.), Am Schweriner See: Heimatbuch M. 1925, S. 20-22.
- Westphal (Franz), Wie d. Lewitz entstand: M. Monatshefte 1, S. 468-471.
- Pries (Arthur), Rund um d. Müritz: M. Monatshefte 2, S. 21-24.
- Pries (Arthur), D. Hintersandpropstei: M. Monatshefte 2, S. 237-239.
- H. S., Vom Wanzkaer See: Landesztg., Beil. Nov. 1925.
- Fr. Sch., Tollensesee u. Tollenseangeln: M. Rundschau 19. Dez. 1925.
- Beltz, Vom Wisent: Zeitschr. M. 21, S. 53-54.


|
Seite 335 |




|
- Clodius (G.), Ornithologischer Bericht über M. für d. Jahre 1921 bis 1924: Archiv f. Naturgesch. in M., N. F. 1, S. 147-166.
- Wachs (Horst), Aus M.'s Tierwelt: Heimatbuch M. 1925, S. 51-75.
- Wachs (Horst), Langenwerder, ein Kleinod unserer Ostseeküste: M. Monatshefte 1, S. 318-322.
- Wachs (Horst), D. Insel Langenwerder-Poel als Vogelschutzgebiet u. Arbeitsstätte an der Ostsee: D. Naturforscher 1926/27, S. 83-88.
- Warnke (M.), Ciconia alba. D. weiße Storch in M.-Strelitz: M.-Strel. Heimatbl. 1, S. 32-36.
- Friederichs (K.), M.'s Insektenwelt: Heimatbuch M. 1925, S. 45-51.
- Ahrens (Ernst Ulrich), Unsere Forellenbäche: M. Monatshefte 2, S. 40-43.
- v. Arnswaldt, D. m. Wald: Heimatbuch M. 1925, S. 34-41.
- Bruhn (Walter), Vom Pflanzenkleid d. Heimat: Heimatbuch M. 1925, S. 26-34.
- Matthies (H.), D. Bedeutung d. Eisenbahnen u. d. Schiffahrt für d. Pflanzenverbreitung in M.; Rost. Diss.: Archiv f. Naturgesch. in M., N. F. 1, S. 27-97; auch Sonderdruck. Rostock. 74 S. 8°.
- Matthies (H.), Neue Pflanzen in M.: Archiv f. Naturgesch. in M., N. F. 1, S.136.
- Koppe (Fritz), Zur Flora von Feldberg i. M.: Allg. Botan. Zeitschr. 28/29, S. 85-89.
- Krause (Ernst H. L.), Bemerkungen über Rostocker Großpilze: Archiv f. Naturgesch. in M., N. F. 1, S. 98-135.
- Endler (C. A.), Flurnamen im Land Stargard: M.-Strel. Heimatbl. 1, S. 17-22.
- Flurnamen v. Boitin-Resdorf: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 42-43.
- Staak (Gerhard), De Fröhlichkikut [ein Straßenname in Plate]: M. Monatshefte 2, S. 96-97.
- Flurnamen von Wahlsdorf: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 56.
-
Peßler (Wilhelm), D. niedersächsische
Kulturkreis. Hannover (Niedersächs.
Verlagsges.) 1925. 70 S. 8°.
Bespr. von Otto Lauffer in Lit. Wochenschrift 1926, Sp. 424-426. -
Schmidt (Otto), M. Ein Heimatbuch. Wismar
(Hinstorff) 1925. 360 S. 8°.
Bespr. von Jonas in M. Monatshefte 1, S. 252-253. - Jacobs (Rud.), D. m. Landstädte: Heimatbuch M. 1925, S. 122-133.
- Grabow (Bernhard), M. Feste vor 500 Jahren: M. Monatshefte 2, S. 44-46. - Der Lohgerber in Rostock.
- v. Brunn, Von Apotheken in alter Zeit u. von sonderbaren Dingen, die es da zu kaufen gab: Heimatbuch M. 1925, S. 220-226.
-
Mielke (Robert). D. schöne Dorf in deutschen
Landen. Ein Bilderatlas. Leipzig (Quelle u.
Meyer) 1925.
Bespr. von Folkers in M. Monatshefte 1, S. 539-540. - Folkers (J. U), D. m. Dorf: Heimatbuch M. 1925, S. 107-118.
- Folkers (J. U.), D. Dörfer d. m. Küstengebietes: M. Monatshefte 1, S. 272-277.
- Ahrens (Adolf), D. Hägerort: Heimatbuch M. 1925, S. 104-107.


|
Seite 336 |




|
- Folkers (J. U.), Das echteste M.: M. Monatshefte 2, S. 70-75 - Die "Griese Gegend": Südwvest-M.
- Folkers (J. U.), D. Bauerndorf im Lande Ratzeburg: Quellen d Heimat 1925, Reihe F, Heft 2, S. 1-16.
- Folkers, Beitr. z. Bauernhausforschung in M.: Zeitschr M. 20, S. 97-130.
- Folkers (J. U.), Runde Häuser in m. Dörfern: M. Monatshefte 2, S. 257-260.
- Kaehlcke (P.), M.'s Bauern in Freiheit u. Leibeigenschaft: M. Monatshefte 1, S. 505-508.
- Pöhls (Werner), Die Bauern in M.: M. Monatshefte, 1, S. 563-566.
- Folkers (J. U.), Aus d. Gesch. d. Ratzeburgischen Bauernstandes: Quellen d. Heimat 1925, Reihe D, Heft 5, S. 9-16.
- Pöhls (Werner), Büdnereien u. Haüslereien: M.. Monatshefte 2, S. 19-20.
- Wossidlo (R.), D. m. Volkstrachten: Zeitschr. M. 20, S. 70-78.
- Gosselck (J.), M. Volkstrachten: Heimatbuch M. 1925, S. 252-256.
- Buddin (Fr.), D. alte ratzeburgische Volkstracht: Heimatbuch M. 1925, S. 245-251.
- Buddin (Fr.), Altratzeburgische Kopftracht: Heimatkal, f. d. Fürst. Ratz. 1926, S. 108-114.
- Ahrens (Adolf), Brautkronen: M. Monatshefte 2, S. 144-145.
- Wossidlo (R.), Alt-m. Sitten u. Brauche: Heimatbuch M. 1925 S. 197-219.
- Schroeder (M.), Erntefest: M. Monatshefte 1, S. 494-496.
- Romberg (G.), Beten up Nahwerschaft: M. Monatshefte 2, S. 32-35.
- Romberg (G.), Ut de oll Schaul: M. Monatshefte 2, S. 253-255.
- Gillhoff (Johannes), In den Zwölften: M. Monatshefte 2, S. 2-5.
- Wossidlo (R.), Karfreitagsglaube u. Ostergebräuche: M. Monatshefte 2, S. 191-195.
- Gillhoff (Johannes), D. Brot im Volksglauben: M. Monatshefte 1, S. 501-502.
- Staak (G.), Zaubersprüche: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 8, S. 30-35.
- Ahrens (Adolf), Hölzernes Schloß von Warnemünde: Zeitschr. M. 21, S. 46-47.
- Schmidt (O.), M. Sagen: Heimatbuch M. 1925, S. 227-238.
- Gillhoff (Johannes), Unser Volksrätsel u. s. Art: Heimatbuch M. 1925, 238-244.
(Landwirtschaft, Gewerbe, Verkehrswege.)
-
Maybaum (Heinz), D. Entstehung d.
Gutsherrschaft im nordwestl. M. (Amt
Gadebusch u. Amt Grevesmühlen); Rost. Diss.:
Beihefte 6 z. Vierteljahrschrift f. Sozial-
u. Wirtschaftsgesch. Stuttgart (Kohlhammer)
1926. 269 S. 8°.
Bespr. in Rost. Anz. 7. April 1926 (Nr. 79). - Rörig (Fritz), Nochmals Mecklenburgisches Küstengewässer u. Travemünder Reede: Zeitschr. f. lüb. Gesch. u. Alt. 24, S. 1-151.
- Strecker (Werner), D. vormalige Küstengewässer (Strand) u. d. Rechtsverhältnisse in d. Travemünder Bucht: M. Jahrb. 89, S. 1-228.


|
Seite 337 |




|
- v. Gierke (Julius). Rechtsgutachten über die Hoheitsrechte in der Travemünster Bucht. Schwerin (Sandmeyer) 1925. 33 S. Fol.
- Wenzel (Max), D. Hoheitsrechte in der Lübecker Bucht. Rostock (Hinstorff) 1926. 116 S. 8°.
- Priester, D. m. Landwirtschaft: Heimatbuch M. 1925. S. 281-290.
- Schultz, D. D. Landwirtschaft in M.-Strelitz: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
-
Westphal (H.) D. Agrarkrisis in M. in d.
zwanziger Jahren d. vor Jahrhs. (M. Landw.
Mitt. Heft 6), Rostock (Hinstorff) 1925. 179
S. 8°.
Bespr. v. Gustav Aubin in Lit. Wochenschr. 1925, Nr. 12, Sp. 374. - Weber (Hans Ludwig), Von M.s Handel, Industrie u. Schiffahrt: Heimatbuch M. 1925, S. 293-296.
- Schlüter (Ernst), Vom Reisen im. alten M.: Heimatbuch M. 1925, S. 256-261.
- Korff (Erich), M.'s See- u. Küstenfischerei. Rost. Diss. (Auszug) 1924. 2 S. 8°.
- Schmidt-Sibeth, Teichwirtschaft in M.: M. Monatshefte 1, S. 514 bis 518.
- Schmidt-Sibeth, Pelztierfarmen in M.: M. Monatshefte 1, S. 624 bis 629.
- Wachs (Horst), D. Seidenspinner u. s. Zucht: M. Monatshefte 1, S. 529 - 536.
- v. Döring, Neuere Erfahrungen über den Anbau fremdländischer Holzarten: 45. Hauptvers. d. Ver. M. Forstwirte 1924, S. 25-53.
- Mielck (Otfried), D. m. Bonitierung nach Scheffel Saat auf Grund d. LGGED. vom 18. April 1755, ihr Wesen, ihre Durchführung u. ihr heutiger Wert. Rostock (Hinstorff) 1926. 137 S. 8°.
- Karbe (W.). Adamsdorf: Landesztg. 1. März 1925 (Nr. 51).
- Voß (E.), Basedow: M. Monatshefte 1, S. 478-480.
- H. S., Über die Entwickelung d. Bahnhofes Blankensee: Landesztg. Beil. Nov. 1925.
- Hinselmann (Ina) Boizenburg: M. Nachr. 24. April 1926 (Nr. 94).
- Brüsehafer (Martin), Ostseebad Boltenhagen: M. Monatshefte 1, S. 342-43.
- Dargun, Festsch. z. Heimatfest aus Anlaß d. 50jähr. Bestehens d. Gem. D. am 1. 7. 1925. Schwerin (Bärensprung) [1925]- 48 S. 8°.
- Barnewitz (Hans), D. m. Amt Doberan. Rost. Diss. (Auszug). Rostock 1925. 3 S. 8°.
- Hesse (Heinrich), D. Gesch. von Doberan u. Heiligendamm. 2. Aufl. Doberan (Michaels) 1925. 59 S. 8°.
- Ringeling (G.), Bad Doberan, Heiligendamm u. Brunshaupten-Arendsee: M. Monatshefte 1, S. 333-340.
- Rubach (Gustav), Dömitz: M. Monatshefte 2, S. 205-209.
- Sachse (Hans), Eine eigenartige Duellaffäre in Fürstenberg im Jahre 1783: M. Rundschau 6. Juni 1925.
- Ulmer (Otto), D. Gesch. des Stahlbades Goldberg in M. Rost. Diss. (Auszug). Rostock 1923. 1 S. 8°.


|
Seite 338 |




|
- Golther (Wolfgang), D. niederdeutsche Gral: M. Monatshefte 1, S. 559-563.
- Eberhard (Raimund), Güstrow. Gedanken, Erinnerungen, Ausblicke: M. Monatshefte 1, S. 431-440.
- Warncke (J.), D. Reliefbild an d. sogen, alten Kapelle in Herrnburg: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 57-58.
- Fr. Sch., D. Krappmühle: M. Rundschau 6. Sept. 1925.
- Hunzinger, Aus d. Gesch. d. Kapelle in Meetzen: Roggendorfer Gem.-Bote 1 (1925), Nr. 5.
- Pöhlmann (Hans), Neubrandenburg: Zeitschr. M. 21, S. 33-38.
- H. K. F., D. Neubrandenburger Palais einst u. jetzt: Landesztg. 3. Jan. 1926 (Nr. 2).
- Wedemeyer (P.), Vom Neubrandenburger Wall. Vogelleben in d. Frühe: Zeitschr. M. 21, S. 43-46.
- Wendt, D. wirtschaftl. Entwicklung Neubrandenburgs in d. letzten 75 Jahren: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Alterdinger (Josef), D. Sammlungen d. Stadt Neubrandenburg: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Endler, Neustrelitz im 18. Jh.: Landesztg. 15. Jan. 1926 (Nr. 12).
- Sachse (Hans), Neustrelitz um d. Jahr 1860: M. Rundschau 3. Juni 1925 (Nr. 126).
- Witte (Hans), D. Neueinrichtung d. Hauptarchivs zu Neustrelitz: Archivalische Zeitschr. 3. F., 2. Bd., S. 111-118.
- Sachse (Hans), Berühmte Zöglinge d. Gymn. Karolinum zu Neustrelitz [Daniel Sanders, Césaire Villatte, Karl Schröder, Emil u. Karl Kraepelin, Reichskanzler Bernhard v. Bülow]: M. Rundsch. 7. Juni 1925 (Nr. 130).
- Sachse (Hans), Otto v. Bismarcks Aufenthalt in Neustrelitz [1837]: M. Rundschau 16. Febr. 1925.
- Karnatz (Ludwig), Penzlin: M. Rundschau 3. April 1925.
- Endler, D. Apotheken im Lande Ratzeburg [Ratzeburg, Schonberg]: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 8, S. 8-10.
- Warncke (J.), D. Saal in d. Propstei zu Ratzeburg: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 34-37.
- Siebahn (Ernst), Aufgang u. Niedergang d. Rehnaer Schusteramtes: M. Ztg. 23. Dez. 1925 (Nr. 298).
- Krambeer (Karl), Ribnitz: M. Monatshefte 2, S. 65-69.
- Das alte Röbel. Ein Gedenkbuch zur 700-Jahrfeier. Hrsg. v. d. Kirchgemeinderäten. Rostock (Hinstorff) 1926. 128 S. gr. 8°. - 24 Aufsätze zur Gesch. der Stadt und der Güter Ludorf u. Keile, Stammtafel Kratz, z. T. auch abgedruckt M. Monatshefte 2, S. 271-299.
- Lohff (Paul), Erinnerungen aus Roggendorf: Rogg.-Meetzener Gem.-Bote 1 (1925), Nr. 6-9.
- Techen (F.), D. m. Seestädte Rostock u. Wismar: Heimatbuch M. 1925, S. 133-144.
- C. B., Geologisches von Rostock u. Umgegend: Rost. Anz. 9. Jan. 1926 (Nr. 7).
- Rostocks ältere Topographien: Rost.Anz. 4. Okt. 1925 (Nr. 232).
- C. J., Erinnerungen eines alten Rostockers: Rost. Anz. 6. Febr. 1926 (Nr. 31).


|
Seite 339 |




|
- Joerges, D. Gesch. d. Rostocker Blücherdenkmals: M. Nachr. 15. Nov. 1925 (Nr. 268).
- Demmel (Karl), Dichter d. Stadt Rostock: M. Nachr. 3. Jan. 1926 (Nr. 2).
- Sachse (Hans), Kaiser Wilhelm I. Hoflager in Rostock vom 19. bis 23. Sept. 1875: Rost. Anz. 10. Sept. 1925.
- Bruhn (Walter), Mit "Consul Pust" auf Islandfahrt: M. Monatshefte 1, S. 301-305.
- Rostocker Sagen: Rost. Anz. 30., 31. Jan. 1926 (Nr. 25, 26).
- Voß (Otto), Ein m. Klosteridyll [Rühn]: M. Nachr. 9. Aug. 1925 (Nr. 184).
- Schmidt, Zur Gesch. d. Gasthofes "Stadt Hamburg" in Schönberg: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 8, S. 18-20.
- Hamann (Andreas), Rat u. Serenissimus. Ein Aktenkrieg um das Neue Gebäude [in Schwerin] 1780-86: M. Ztg. 30. April 1926 (Nr. 99).
- Dittmer (Christoph) Schweriner Stimmungsbilder. Schwerin (Sandmeyer) [1926]. 39 S. 8°.
- Schwänke (Helmut). Eine Wanderung um d. Faulen See: M. Nachr. 5. Nov. 1925 (Nr. 259).
-
† Horn (Alfred), Z. Gesch. d. Kirchspiels
Selmsdorf im Fürst. Ratzeburg. 2. Bd.
Schonberg i. M. (Lehmann & Bernhard)
[1926]. 303 u. 64 S. 8°.
Bespr. v. Buddin in Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 64. - Schliemann (U), Toitenwinkel: M. Monatshefte 2 (1926), S. 121-124.
- Schmidt. D. Quitzowburg bei Gr. Voigtshagen: Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 8, S. 37-38.
-
zu Barnewitz (Friedrich), Gesch. d.
Hafenorts Warnemünde. 2. Aufl. Rostock
1925.
Bespr. v. M. v. Falkenhayn in Zeitschr. f. Niedersachs. Fam.-Gesch. 7, Nr. 9, S. 216. - Nielson (Jürgen), Warnemünde: M. Monatshefte 1, S. 280 bis 283.
- Techen (Friedrich), D. Böttcher in d. Wendischen Städten, bes. in Wismar: Hans. Gesch.-Bl. 50, S. 67-127.
- Gehrig (Oscar), Bürgerbauten zu Wismar: M. Monatshefte 1, S. 313-317.
- Endler, Aus Woldegks Vergangenheit: Landesztg. 21 Okt 1925.
- Schüßler (Herm.), Alt-Woldegk - Das Rathaus: M.-Strel. Heimatbl. 1, S.22-27.
- Brückner, D. Woldegker Stadttore: M.-Strel. Heimatbl 1, S. 27-32.
-
Schmid (H. F.), D. Recht d. Gründung u.
Ausstattung von Kirchen im kolonialen Teile
d. Magdeburger Kirchenprovinz während d. MA.
Weimar (Böhlau) 1924. 213 S. 8°. - betr.
auch das Liutizenland mit d. Bist.
Brandenburg u. Havelberg.
Bespr. von Georg Arndt in Thür.-Sächs. Zeitschr. f. Gesch. u. Kunst 13, S. 83-85.


|
Seite 340 |




|
-
Hoogeweg (H.), D. Stifter u. Klöster d.
Provinz Pommern. 2. Bd. Stettin (Saunier)
1925. 1067 S. Gr. 8°. - Besitzungen in
M.
Bespr. v. M. Wehrmann in Pomm. Mon.-Bl. 1926, S. 11-12. - v. Bülow (J. H.), Ein Lübecker Mordprozeß von 1334 vor dem Schweriner Domdekan: M. Nachr. 13. Mai 1926 (Nr. 110).
- Willgeroth (Gustav), D. M.-Schwer. Pfarren seit d. Dreisigjähr. Kriege. Mit Anm. über d. früh. Pastoren seit d. Reform. 2 Bd. Wismar (Selbstverlag) 1925. S. 633-1128. 3. Bd. 1925 S. 1129 bis 1648. 8°.
- Schmaltz, D. evang. Kirche in M.: Heimatbuch M. 1925, S. 261-273.
- G. Kr., 75 Jahre unserer Landeskirche: M. Rundschau 3 Jan. 1925 (Nr.2).
- Meyer (Arnold Oskar), Windthorst u. die kath. Kirche in Holstein: Zeitschr. f. Schlesw.-Holst. Gesch. 55, S. 511-517. - betr. auch d. Religionsbeschwerde d. m. Kammerherrn v. der Kettenburg.
- Alte m. Lehrerbildungsstatten: Rost. Anz. 7. Mai 1926 (Nr. 105).
- Wendt, Überblick über d. Entwicklung d. Schulwesens in M.-Strelitz, bes. während d. letzten 77 Jahre: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
-
Stiehl (Otto), Backsteinbauten in
Norddeutschland u. Dänemark.
(Bauformen-Bibl. Bd. 17.) Stuttgart
(Hoffmann) 1923. 209 S. Gr. 4°.
Bespr. v. J. Warncke in Zeitschr. f. lüb. Gesch. u. Alt. 22, S. 447. -
Burmeister (Werner), Mecklenburg. Berlin
(Deutscher Kunstverlag) 1926. 64 S. 8°. Mit
135 Tafeln Abb. d. Staatl. Bildstelle zu
Berlin.
Bespr. v. Otto Grautoff im Berliner Tagebl. 10. Jan.1926 (Nr. 16). -
zu Krüger (Georg), Kunst- u.
Geschichtsdenkmäler d. Freistaats
M.-Strelitz I, 2. Neubrandenburg
1925.
Bespr. v. Meyer in Landesztg. 30. Sept. 1925 (Nr. 227); v. Rudolf Kautzsch in Lit. Wochenschrift 1926, Sp. 121-122; v. Ha[mann] in M. Ztg. 10. April 1926 (Nr. 82), v. Buddin in Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 7, S. 45-46. -
M. Bilderhefte. Heft 1-4. Rostock
(Hinstorff) 1923-25. 8°.
Bespr. v. G. Kohfeldt in Lit. Wochenschrift 1926, Sp. 589. - Pries (Joh. Friedr.), D. Baudenkmäler in M.-Schwerin: Heimat buch M. 1925, S. 166-192.
- Brückner, 75 Jahre Baukunst u. bild. Künste in M.-Strelitz: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Brückner, Baudenkmäler aus d. dörfl. u. städt. Siedelung d. MA. in M.-Strelitz: Heimatbuch M. 1925, S. 145-165.
- Schmaltz (Karl) u. Gehrig (Oscar), D. Dom zu Güstrow in Gesch. u. Kunst. Güstrow (Michaal) 1926. 45 S. Gr. 4°.
- Bruhns (Leo), D. Kirchen Rostocks: 1. Jahresbericht d. M. Landes-Univ.-Ges., S. 7-18.
- Burmeister (Werner), Wismar. Berlin (Deutscher Kunstverlag) 1926. 36 S. 8°. Mit 47 Tafeln Abb. der Staatl. Bildstelle zu Berlin.


|
Seite 341 |




|
-
Warnke (J.), Gerhard Cranemann zu Lübeck, d.
Meister d. Taufen zu Siek u. Schönberg:
Zeitschr. f. lüb. Gesch. u. Alt. 22, S.
172-178.
Bespr. v. Buddin in Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 6, S. 12-13. - Hoops (Herbert), d. Renaissanee-Epitaphien in Lübeck u. M. (1540 bis 1640). Rost. Diss. (Auszug) 1925. 4 S. 8°.
- Schulz (H.). M. Dorfkirchen: M. Monatshefte 1, S.457-464.
- Reifferscheid (Heinrich). D. Tempziner Altar, eine Wismarer Arbeit von 1411 (M. Bilderhefte, Heft 4). Rostock (Hinstorff) 1925. 25 S. 8°.
- Josephi (W.). D. Tempziner Altar: M. Monatshefte 2, S. 29-31.
- Dettmann (Gerd), Eine gotische Bildhauerwerkstatt M.'s: M. Monatshefte 1, S. 556-558.
- Fiesel (L.), Kreuzwunder: M. Monatshefte 2, S. 179-184.
- Karsten, Zwei geheimnisvolle Abendmahlsgeräte: M. Nachr. 13. April 1926 (Nr. 84) - der Kirche zu Vellahn.
- Düwahl (Ludwig), Vom Steinbeil zum Prunkpokal: M. Monatshefte 2, S. 98-101.
- Burmeister (Werner), Wandmalerei in M. bis 1400: M. Jahrb. 89, S. 229-320.
- Schulz (Heinrich), Alte Marienbilder in M.: M. Monatshefte 1, S. 604-608.
- Josephi (W.), Gustav Adolf Wulf [zu seiner Kreuzigung Christi im Landesmuseum]: M. Monatshefte 2, S. 168-170.
- Gehrig (Oscar), Plaketten von Wilhelm Jaeger [Bildhauer in Neubrandenburg]: M. Monatshefte 2, S. 196-197.
- Strauß (Konrad), Alte Terrakottenkunst in Norddeutschland: Denkmalpflege u. Heimatschutz 1925, S. 161-170. - in Wismar, Schwerin.
- Müller (Jenny). D. m. Stadttore: M. Monatshefte 2, S. 127-134.
- Brückner, Wiekhauser im Lande Stargard: Zeitschr. M. 21, S. 1-16.
-
Brandt (Jürgen), Alt-M. Schlösser u.
Herrensitze. Berlin (Wasmuth) [1925]. 192 S.
Gr. 4°.
Bespr. v. Dettmann in M. Nachr. 26. Juli u. 2. Aug. 1925 (Nr. 172, 178); v. Hamann in M. Ztg. 15. Aug. 1925 (Nr. 189); v. Oscar Gehrig in M. Monatshefte 1, S. 509-513; v. G. Kohfeldt in Lit. Wochenschrift Nr. 30, Sp. 955-956; v. A. W. Baalk in Zeitschr. M. 21, S.63-64. - Hustaedt (Konrad), M.-Strelitzer Schlösser: Heimatbuch M. 1925, S. 192-197.
- Reifferscheid (H.), M.'s kunst- u. ku1turgesch. Museen: Heimatbuch M. 1925, S.296-303.
- Witte (Hans), Aufbau u. Entwicklung d. Landesmuseums in Neustrelitz: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Wellhausen (Ulrich), Gibt es eine m. Kunst?: Landesztg. 19. Febr. 1926 (Nr. 42). - mit Besprechung von Bildern im Landesmuseum in Neustrelitz.
- Grüder (Erika), Beitr. z. Gesch. d. Theaterwesens in M.-Strelitz: M.-Strel. Gesch.-Bl. 1, S. 19-81.
- Winkel (Fr.), Adolf Glaßbrenner u. Frau Adele Peroni-Glaßbrenner in Neustre1itz: M.-Strel. Gesch.-Bl. 1, S. 82-94.
- Voß (E.), Von altdeutscher Musik [Luren]: M. Monatshefte 1, S. 580-581.


|
Seite 342 |




|
- Pollitz (Hermann), 75 Jahre Musikleben in M.-Strelitz: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Noelle (Marg.), D. m. Siegel von 1200-1400 u. ihre Beziehungen zur Großplastik: D. Fam.-Forscher 1 (1925), S. 229-240.
- Neuzeitliche Wappendarstellungen von H. Hinzmann-Hannover: Fam. v. Kahlden (mit dem Löwenkopf) u. v. Pressentin: Mitt. d. Herald. Verein Kleeblatt 1925, Nr. 3, Beil.
- Cloß (G. Adolf), D. Wappen Lützow: D. Deutsche Herold 57, S. 40-41.
- Endler, M. in Kriegszeiten: Heimatbuch M. 1925, S. 274-281.
- Vitense (Otto), D. Heimkehr d. Strelitzer Grenadiere u. Kanoniere 1871: M. Rundschau 3. Jan. 1925 (Nr. 2).
- Sachse (Hans), D. während d. deutsch-franz. Krieges 70/71 in Neustrelitz internierten franz. Kriegsgefangenen: M. Rundschau 7. April 1925.
- Aus d. Kriegstagebuch d. am 21. Mai 1915 gefallenen Lt. v. Olszewski, Adj.d. II./89: Nachr.-Bl. d. Bundes M. Gren. Nr. 9 (1925).
- Hoff (Ludwig), Mit d. 9. Komp. in der Schlacht an d. Somme: Nachr.-Bl. d. Bundes M. Gren. Nr. 8-9 (1925).
- Das R.-J.-R. 90 1914-1918. Hrsg. von Arthur Pries. (Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Truppenteile d. ehem. Preuß. Kont. Bd. 153.) Oldenburg i. O. (Stalling) 1925. 329 S. 8°.
- Beumelburg (Werner), Douaumont. (Schlachten d. Weltkrieges, Bd. 1.) 2. Aufl. Oldenburg-Berlin (Stalling) 1925. 189 S. 8°. - Ref.-Inf.-Regt. 90 vor Verdun.
- Frhr. Schenck zu Schweinsberg, D. Großh. M. Jäger-Batl. Nr. 14. Berlin (Deutsch. Jägerbund) 1926. 320 S. 4°.
- v. Graevenitz, D. 1. Abt. d. Großh. M. Feldart.-Rgts. 60 während d. Kämpfe bei Esternay [6. Sept. 1914]: Mitt. 35 des Off.-Ver. Rgts. 60, S. 2-8 D. Kämpfe westl. des Ourcq [8.-10. Sept.]: Mitt. 37, S. 8-12.
- Dommes, Mit der 6. Batterie Großh. M. Feldart.Rgts. 60 in d. Schlacht von Esternay am 6. Sept. 1914: Mitt. 36 d. Off.-Ver. Regts. 60, S. 3-6.
- Dose (W.), D. 187er im Filde. Stade (Heimberg) 1922. 174 S. 8°. - Mannschaftsersatz zumeist aus Schleswig-Holstein, den Hansestädten u. Mecklenburg.
- Krause (A.), Bei der 9./214: Div.-Ztg. d. ehem. 46. Res.-Div., 2. Jg. (1925), Nr. 8, S. 10; Nr. 9, S. 2-3; Nr. 10, S.4-6; Nr. 11, S. 3-4.
-
Frhr. v. Hammerstein (Christian),
Gedenkblätter für 54 im Felde gefallene
Heidelberger Vandalen. Oldenburg i. G.
(Stalling) 1922. 266 S. 8°.
Bespr. v. Stephan Kekule v. Stradonitz im Deutschen Herold 57, S. 14-15. - Reifferscheid (H.), Ein Jahr M. Mil.-Abteil. im Schloßmuseum: M. Ztg. 15. März 1926 (Nr. 61).
- Josephi (W.), D. alte Grenadier im Schloßmuseum: M. Ztg. 10. April 1926 (Nr. 82).
- Daniel (A.), Fahnen-Konservierung u. Restaurierung. Zu einer


|
Seite 343 |




|
Ausstellung im Schweriner Schloßmuseum: M. Nachr. 25. Dez. 1925 (Nr. 301).
- Rottke (Hans-Jürgen), D. Privilegien d. Stadt Rostock in d. Jahren 1788-1918. Rost. Diss. (Auszug). Güstrow (Lange) 1925. 4 S. 8°.
- Külper (Friedrich), D. Begriff d. Polizei im m.-schwer. Recht. Rost. Diss. (Auszug). Rostock 1924. 4 S. 8°.
- Endler, Städtische Selbstverwaltung u. Staatsaufsicht in der Vergangenheit in M.-Strelitz: Landesztg. 4. Juni 1926 (Nr. 128).
- Tabel (Carl), D. Jagdpachtvertrag in M.-Schwerin nach d. Jagdgesetz v. 9. 12. 20. Rost. Diss. Auszug 1923. 2 S. 8°.
- Berlin (Jürgen), Jagdpachtrecht im Gebiet d. ehemals doman. Landgemeinden u. d. Städte, die d. Jagdrecht auf Grund d. Gesetzes über d. Abtretung d. bisher d. Landesherrschaft zustehenden Jagdrechts vom 14. Nov. 1919 erworben haben. Rost. Diss. Rostock (Hinstorff) 1925. 88 S. 8°.
- Holstein (Rudolf), D. M.-Schw. Jagdrecht u. d. Umwandlung desselben durch d. Gesetz über d. Abtretung d. bisher d. Landesherrschaft zustehenden Jagdrechts v. 14. 11. 19 u. d. Jagdgesetz v. 9. 12. 20. Rost. Diss. (Auszug) 1925. 4 S. 8°.
- Stuhr (Friedrich), D. geschicht1. u. landeskundl. Lit. M.'s 1924 bis 1925: M. Jahrb. 89, S. 357-370.
- Witte (H.), D. Quellen zur slav. Namensforschung in M.: Zeitschr. f. slav. Phil. 2, S. 521-524.
- Lasch (Agathe), Vom Werden u. Wesen d. Mittelniederdeutschen: Niederdeutsches Jahrb. 51, S. 55-76.
- Teuchert (H.), D. m. Wörterbuch: Zeitschr. M. 21, S. 50-52.
- Mohr (Werner), Einiges aus d. plattd. Wortkunde: Zeitschr. M. 20. S. 78-93. - 58 seltene plattd. Wörter.
- Wossidlo (R.), Wind u. Wasser im Munde des m. Seemannes: M. Monatshefte 1, S. 352-354.
- Teuchert (H.), Grammophonaufnahmen m. Mundarten: Zeitschr. M. 21. S. 24-28.
- Rosenhagen (G.), D. Redentiner Osterspiel im Zusammenhang mit d. geistl. Schauspiel seiner Zeit: Niederdeutsch. Jahrb. 51, S. 91-103.
- Breyer (F.), D. Flucht d. Studenten Reinhardt u. Wagner aus d. Festungshaft in Magdeburg am 3. Okt. 1837 (Fritz Reuter, Ut mine Festungstid, Kap. 10): Gesch.-Bl. f. Stadt u. Land Magdeburg 60, S. 37-68.
- Winkel (Fr.), Ein wenig bekanntes Gedicht Fritz Reuters: De Wesenbarger Klock: Landesztg., Beil. 27. Mai 1925.
- Teuchert (H.), John Brinckmans Bedeutung für d. neuplattdeutsche Literatur: Niederdeutsches Jahrb. 51, S. 104-112.
- Kohfeldt (G), D. erste Aufnahme der John Brinckmanschen Dichtungen in M.: Niederdeutsches Jahrb. 51, S. 120-124.
- Teuchert (H.), Zur Entstehungsgesch. von John Brinckmans "Vagel Grip": Niedersachsen 29, S. 205-208.
- Gosselck (Johannes), John Brinckmans Güstrower Geschichten "Höger up" u. "Mottche Spinkus": M. Monatshefte 2, S. 210-214.
- Becker (Julius), Ein geschichtl. Irrtum in Brinckmans "Höger up": Niederdeutsches Jahrb. 51, S. 124-125.


|
Seite 344 |




|
Alphabetisches Verzeichnis.
A
damsdorf 164.
Agrarkrisis 155.
Ämtereinteilung, neue 1.
Apotheken
119.
Arendsee 172.
Arkona 10. 11.
Art.-Rgt. 60 (Feld-) 277. 278.
B
alzer, Thuro, Maler 40.
Bartels,
Rudolf, Maler 41.
Basedow 165.
Bernoulli, Johann 47.
v. Bismarck, Otto
190.
Blankensee 166.
Blumenhagen,
Silberschatz 12.
Boitin-Resdorf, Flurnamen
112.
Boizenburg 7. 167.
Altertümer
7.
Boltenhagen 168.
Bonitierung nach
Schfl. Saat, 163.
Brautkrone 136.
Brinckman, John 42. 301-305.
Brückner,
Familie 43.
Brunshaupten 172.
v.
Bülow, Reichskanzler 189.
Bunke, Franz,
Maler 44.
C
hronologie 73.
Cranemann, Gerhard 241.
D
argun 169.
Doberan, Amt u. Stadt,
170-172.
Dömitz 173.
Douaumont, Kämpfe
um, 275.
E
ggers, Karl 45.
Eggers, Karl Adolf
Joh., 46.
Epitaphien, Renaissance-,
242.
Esternay, Kämpfe bei, 277. 278.
Evers, Familie 36.
Evers, Karl Friedr.,
Archivrat 47.
F
amiliengeschichte 36 ff.
Fische
104.
Fischerei 158. 159.
Fischland
88.
Flurnamen 20. 111-114.
Friedrich
Franz II., Großherz. 35.
Friedrich Wilhelm
III., König von Preußen 30.
Fürstenberg
174.
Fürstenhaus 28 ff.
G
adebusch, Amt 148.
Geinitz, Eugen,
Prof. 48. 49.
Germanisierung 17 ff.
Geschichte 17 ff.
Glaßbrenner, Adolf,
Schriftsteller 263.
Goldberg 175.
Graal 176.
Grenadier-Rgt. 89: 270. 272.
273. 283. 284.
Grevesmühlen, Amt 148.
Griese Gegend 124.
Güstrow 177. 238.
Dom 238.
Gutsherrschaft, Entstehung d., 148.
H
ägerort 123.
Handel 156.
Heiligendamm 171. 172.
Herrnburg 178.
Hofgericht 22.
v. Hintzenstern, Familie 36.
J
aeger, Wilhelm, Bildhauer 253.
Jagdrecht 288-290.
Jäger-Batl. 14:
276.
Industrie 156.
Inf.-Rgt. 90
(Res.-) 274. 275.
Inf.-Rgt. 187: 279.
Inf.-Rgt. 214 (Res.-) 280.
Insekten
103.
Iven, Familie 50.
v.
K
ahlden, Wappen 267.
Kaplunger,
Bildhauerfam., 51.
Karl, Herzog 28.
29.
Karten 1 f.
Kelle, Gut 196.
v. d. Kettenburg, Kammerherr 228.
Kinkel
25.
Kirchenwesen 222 ff.
Klenz,
Heinrich, Dr., 52.
Koldewey, Robert 9.
Kraepelin, Emil u. Karl 189.
Krantz, A.,
Geschichtsschreiber 53.
Krappmühle 179.


|
Seite 345 |




|
Kratz, Familie 196.
Kriegsgefangene, franz.,
271.
Kriegs- u. Mil.-Geschichte 269
ff.
Kulturgeschichte 115 ff.
Kunst u.
Kunstgewerbe 231 ff.
Küstengewässer 149-152.
Landeskunde 74 ff.
Landwirtschaft 153
ff.
Langenwerder 100. 101.
Lewitz
92.
Literatur 291 ff.
Lübbert, Ernst,
Maler 54.
Lübeck, Streit mit - um die
Lübecker Bucht 149-152.
Lübecker Bucht
149-152.
Ludorf, Gut 196.
Luise,
Königin von Preußen, 28. 30-34.
v. Lützow,
Familie 55. Wappen 268.
M
alchin, Carl, Prof., Maler 56.
v.
Maltzan u. v. Maltzahn, Familie 57.
Marienbilder 251.
Meetzen 180.
Mühlbach, Luise 58.
Münzkunde 21.
Müritz 93.
Museen 259.
N
amensforschung, Slav., 292.
Neubrandenburg 181-185.
Palais 182.
Sammlungen 185.
Neustrelitz 186-190.
260-263.
Gymnasium 189.
Hauptarchiv 188.
Museum 260.
261.
Theater 262. 263.
v.
O
lszewski, Leutn. 272.
Ortsgeschichte 164 ff.
Osterspiel,
Redentiner 298.
Ostseeküste 76 ff.
149-152.
Ourcq, Kämpfe westl. des, 277.
P
elztierfarmen 160.
Penzlin
191.
Peroni-Glaßbrenner, Adele,
Schauspielerin 263.
Personengeschichte 36
ff.
Pfarren 225.
Pflanzen 106 ff.
Pilze 110.
Plate, Straßenname in, 113.
Poel, Insel 83.
Polizei, Begriff der,
286.
v. Pressentin, Familie 59; Wappen
267.
Preußen, Fürstenhaus 28. 30.-34.
R
atzeburg, Land u. Stadt 20. 90. 125.
130. 192. 193.
Rätsel 147.
Recht 285
ff.
Redentiner Osterspiel 298.
Rehna
194.
Reinhardt, Student 299.
Reinke,
Johannes, Prof. 60.
Rethra 9. 10. 11.
Reuter, Fritz 61-63. 299. 300.
Ribnitz
195.
Ritterschaft 27.
Röbel 196.
Roggendorf 197.
Rostock 86. 87. 118.
198.-206. 239. 285.
Denkmal, Blücher-,
202.
Geologisches 199.
Heide 86.
87.
Kirchen 239.
Lohgerber
118.
Privilegien 285.
Sagen
206.
Topographie 200.
Rühn 207.
S
achse, Geh. Med.-Rat, Dr. 64.
Sagen
146.
Sanders, Daniel 189.
Sandpropstei
94.
v. Schack, Familie 65.
Schallehn,
Familie 36.
Scheel, Marg., Bildhauerin
66.
Schiffahrt 156.
v. Schill, Major
23.
Schlösser 257. 258.
Schönberg 208.
241.
Taufe 241.
Schröder, Karl
189.
Schulwesen 140. 229. 230.
Schwerin 5. 91. 209-211. 254. 259. 282-284.
Museum 5. 259. 282-284.
Neues Gebäude
209.
Seen 91. 211.
Seidel, Heinrich 67.


|
Seite 346 |




|
Seidenspinnerzucht 161.
Selmsdorf 212.
Siegelkunde 266.
Siek. Taufe 241.
Sitten und Bräuche 137 ff.
Somme, Schlacht
an der, 273.
Stargard, Land, Flurnamen
111.
Stadttore 255.
Stella, Tilemann
68. 69.
T
empzin, Altar 244. 245.
Terrakotten
254.
Toitenwinkel 213.
Tollensesee
96.
Travemünde, Reede 149-152.
Trojan,
Johannes 70.
Twietfort, Hügelgräber 8.
V
andalen, Heidelb. Korps, 281.
Vellahn, Abendmahlsgeräte 248.
Verfassung,
Verwaltung 26. 285 ff.
Villatte, Césaire
189.
Vineta 10.
Vögel 98 ff.
Gr.
Voigtshagen, Burg, 214.
Vorgeschichte 3
ff.
Volkskunde 115 ff.
Volkstracht 132 ff.
W
agner, Student 299.
Wahlsdorf,
Flurnamen in, 114.
Wald 105. 162.
Wandmalereien 250.
Wandschneider, Wilh.,
Prof. 71.72.
Wanzkaer See 95.
Wappenkunde 266 ff.
Warnemünde 215.
216.
Warnowtal 89.
Wiekhäuser
256.
Wilhelm I., Kaiser 204.
Windthorst 228.
Wirtschaftsgeschichte 148
ff.
Wisent 97.
Wismar 198. 217. 218.
240. 254.
Bauten 218. 240.
Böttcher 217.
Woldegk 219-221.
Rathaus 220.
Tore 221.
Wulf,
Gustav Adolf, Maler 252.
Wunderlich,
Familie 36.
Z
eitrechnung 73.
Zollverein 24.


|
Seite 347 |




|



|


|
|
:
|
Jahresbericht
über das Vereinsjahr
vom 1. Juli 1925 bis 30. Juni 1926.
Der Mitgliederbestand hat sich leider etwas verringert. Wir haben aber damit rechnen müssen, daß die nach dem Kriege stark angewachsene Mitgliederzahl sich wegen der schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse nicht werde aufrechterhalten lassen. Eingetreten sind 18 Mitglieder, ausgetreten 52 meist jüngere Mitglieder, verstorben 11 (Anlage A). Der Verlust des Vereinsjahres beträgt also 45 ordentliche Mitglieder, der Bestand am Schlusse des Vereinsjahres: 4 Ehrenmitglieder, 7 korrespondierende und 647 ordentliche Mitglieder. Damit ist der Bestand vor dem Kriege (554 ordentliche Mitglieder am 50. Juni 1914) noch um fast 100 überschritten.
Von den Verstorbenen hat der Bürgermeister a. D. Geh. Hofrat Ewald Wohlfahrt in Neustrelitz dem Verein 40 Jahre hindurch in Treue angehört, der Kommissionsrat Carl Grotefend in Güstrow 36 Jahre und der Landforstmeister Achim von Arenstorff in Neustrelitz 25 Jahre.
Zu den Tauschvereinen sind hinzugekommen: der Heimatbund für das Fürstentum Ratzeburg in Schönberg (bisher gegenseitige Mitgliedschaft), die Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck zu Cassel, der 1925 gegründete Mecklenburg-Strelitzer Verein für Geschichte und Heimatkunde in Neustrelitz und die Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung in Königsberg i. Pr. Wir erhalten von diesen Vereinen gegen Lieferung unseres Jahrbuches die Mitteilungen des Heimatbundes für das Fürstentum Ratzeburg, die Nachrichten der Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck, die Jahresschrift: Mecklenburg-Strelitzer Geschichtsblätter und die jährlich mehrmals erscheinenden Mecklenburg-Strelitzer Heimat-
blätter, endlich die Altpreußischen Forschungen. Der Altertumsverein in Worms hat seine Monatsschrift "Vom Rhein", die wir seit 1902 eintauschten, in der Kriegszeit eingehen lassen; statt ihrer wird uns jetzt die Vierteljahrsschrift "Der Wormsgau" geliefert, die vom Altertumsverein gemeinsam mit den Direktionen der städtischen Sammlungen, der Stadtbibliothek und des Stadtarchivs zu Worms herausgegeben wird. Gekündigt ist der Tauschverkehr von der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde und vom Münchener Altertumsverein.
Die Vorträge des verflossenen Winters wurden am 4. November durch einen Lichtbildervortrag des Univ.-Prof. Dr. Bruhn aus Rostock über mecklenburgische Backsteingotik eröffnet. Am 1. Dezember sprach Staatsarchivrat Dr. Krabbo aus Berlin über das Land Stargard bis zu seinem Übergange von Brandenburg an Mecklenburg, am 18. Dezember Dr. phil. Beste aus Schwerin über Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenjährigen Krieges bis zum Untergange des alten Reiches 1 ). In sein eigentlichstes Arbeitsgebiet, die Chronologie, führte uns unser Ehrenmitglied, Geh. Archivrat Dr. Grotefend, indem er am 19. Januar, dem Tage nach seinem 81. Geburtstage, das Thema "Wie unser Volk im Mittelalter sich mit dem Kalender abfand" behandelte. Es folgte ein Vortrag des Univ.-Prof. Dr. Schüßler aus Rostock über "Bismarcks Sturz als Wendepunkt der europäischen Politik" (12. Februar). Den Beschluß machte Dr. rer. pol. Romberg aus Gr. Laasch mit dem Thema: Die wirtschaftliche Entwicklung der Lewitz (26. März).
Der auf der Hauptversammlung vom April 1925 in Aussicht genommene Ausflug nach Ratzeburg fand am 9. Juli unter starker Beteiligung statt. Nach der Besichtigung des stolzen Domes, dessen Bau im 12. Jahrhundert begonnen hat, bot eine Motorbootfahrt auf dem Ratzeburger See und dem Küchensee bis Farchau Gelegenheit, sich der schönen Umgegend Ratzeburgs zu erfreuen.
Die 91. Hauptversammlung wurde am 20. April 1926 zu Schwerin im Archivsaal unter der Leitung des Vizepräsidenten, der den durch eine Reise verhinderten Vereinspräsidenten vertrat, abgehalten. Erschienen waren etwa 80 Mitglieder. Pastor D. Schmaltz aus Schwerin hatte es übernommen, einen Licht-


|
Seite 349 |




|
bildervortrag über "Mittelalterliche mecklenburgische Madonnenbilder" zu halten und wußte das Verständnis für den Typus der einzelnen Darstellungen zu wecken, indem er diese im Zusammenhange mit der allgemeinen Entwicklung des Marienkultus ausdeutete. Der Geschäftsbericht wurde vom Unterzeichneten, der Kassenbericht (vgl. Anlage B) vom Rechnungsführer Rechnungsrat Sommer erstattet. Nachdem bereits auf der vorjährigen Hauptversammlung beschlossen war, den Jahresbeitrag wieder wie vor dem Kriege auf sechs Mark festzusetzen, beantragte jetzt der erste Vereinssekretär Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr, den während der Inflationszeit abgeänderten § 7 der Vereinssatzung in seiner alten Fassung wiederherzustellen 2 ). Die Versammlung nahm diesen Antrag an. Ebenso einen Vorschlag des ersten Vereinssekretärs, am 7. Juli einen Ausflug nach Bützow und Rühn zu unternehmen. Die satzungsgemäß zu Ende des Geschäftsjahres ausscheidenden Vereinsbeamten wurden wiedergewählt. Eingegangen war ein Schreiben des Lehrers J. Bohnsack Ludwigslust, worin die Versammlung aufgefordert wurde, dafür einzutreten, daß auf den Schulen des Landes die Anleitung der Schüler zu eigener heimat- und familiengeschichtlicher Betätigung gepflegt werde. Dieser Antrag wurde dem Vereinsausschusse zur Prüfung und Bearbeitung überwiesen. Der Ausschuß ist zu der Überzeugung gekommen, daß die Bestrebungen des Herrn Bohnsack sehr zu begrüßen sind. Das von ihm herausgegebene, für eigene Eintragungen der Schüler hergerichtete Stammbuch "Heimat und Familie, das Buch meines Lebens" ist, wenn es von den älteren Schülern unter Anleitung der Lehrer benutzt wird, zweifellos geeignet, zur Stärkung des Heimat- und Familiensinnes sowie zur Erhaltung der Volksart wesentlich beizutragen. Es ist daher dem Ministerium für Unterricht die Förderung der Angelegenheit warm empfohlen worden.
Schließlich sei darauf hingewiesen, daß in Schwerin monatlich einmal in Dabelsteins Restaurant ein genealogischer Abend


|
Seite 350 |




|
stattfindet. Mitglieder, die Einladungen hierzu zu erhalten wünschen, werden gebeten, sich an Herrn Jobst Heinrich v. Bülow, Schwerin, Graf-Schack-Straße 8, zu wenden.
Vereinsausschuß für das Jahr 1926/27.
Präsident: Staatsminister Dr. Langfeld, Exz.
Vizepräsident: Ministerialdirektor v. Prollius.
Erster Sekretär: Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr.
Zweiter Sekretär: Staatsarchivrat Dr. Strecker.
Rechnungsführer: Rechnungsrat Sommer.
Bücherwart: Landesbibliotheksdirektor Dr. Crain.
Bilderwart: Regierungsrat Rechtsanwalt Dr. Wunderlich.
Repräsentanten: Ministerialdirektor Dr. Krause,
Generaldirektor Gütschow,
Geh. Archivrat Dr. Grotefend
Generalleutnant v. Woyna, Exz.
Der zweite Vereinssekretär.
W. Strecker.
Anlage A.
Eingetreten sind:
1. Fabrikbesitzer Carl Aug. Lau, Woldegk. 2. Konsul Georg Bühring, Schwerin. 5. Dr. phil. Niklot Beste, Schwerin. 4. Frl. Clara v. Bülow, Lehrerin, Schwerin. 5. Jugendpastor Lic. Gottfried Holtz, Schwerin. 6. Lehrer Joh. Bohnsack, Ludwigslust. 7. Facharzt Dr. Wilh. Wiegels, Schwerin. 8. Franz Brunst, Reval. 9. Pastor Friedrich Schoof, Schwerin. 10. Die Stadtbibliothek in Stralsund. 11. Amtsgerichtsrat Gerhard Bauch, Wittenburg. 12. Hauptmann Paul Maertens, M. d. L., Neuhof auf Poel. 13. Bürgermeister Dr. iur. Ernst Wempe, Schwerin. 14. Referendar Herbert Siegfried, Schwerin. 15. Kammerherr Walter v. Leers, Ludwigslust. 16. Hofmusikalienhändler Carl Claussen, Schwerin. 17. Dr. med. Karl Cyrus, Arzt, Schwerin. 18. Pfarrer Joh. Thomes, Ratzeburg.
Ausgetreten sind:
1. Zahnarzt Dr. Wilhelm Lehmkuhl, Erfurt. 2. Ober-Steuerinspektor Richard Schröder, Schwerin. 5. Studienrat Dr. Leopold Köhler, Waren. 4. Gutsbesitzer Joh. Aug. Bolten, Kloddram. 5. Univ.-Prof. Dr. Bergfried Eßler, Göttingen. 6. Stadtrat Adolf


|
Seite 351 |




|
Grälert, Warin. 7. Domänenpächter Haus Hoffmann, Kämmerich. 8. Sanitätsrat Dr. Ulrich Lettow, Wustrow. 9. Vortrags- und Lehrverein Neubrandenburg. 10. Domänenpächter Wilhelm Hunzinger, Berlin-Friedenau. 11. Lehrer Friedrich Lübcke, Sülze. 12. Frau Pastor Ida Köhn, Schwerin. 15. Minist.-Sekr. Wilhelm Evers, Schwerin. 14. Mecklenb.-Schwerinsches Amt Röbel, aufgelöst infolge des Gesetzes über Neueinteilung des Freistaates in Ämter vom 11. Nov. 1925. 15. Oberst Richard Heß, Schwerin. 16. Rechtsanwalt Albert Sohm, Wismar. 17. Pastor emer. Theodor Koch, Bad Doberan. 18. Architekt Conrad Nax, Stargard i. P. 19. Kommerzienrat Vizekonsul Paul Podeus, Wismar. 20. Studienrat August Adam, Neustrelitz. 21. Buchhalter Karl Rabe, Schwerin. 22. Oberstleutnant Robert Bührmann, Berlin. 25. Frau Gutsbesitzer Anna Winter, Neu-Guthendorf. 24. Frau Geh. Reg.-Rat Helena Schröder, Schwerin. 25. Postamtmann Rechnungsrat Wilhelm Beese, Wismar. 26. Kaufmann Carl Ahlers, Schwerin. 27. Kaufmann Heinr. Lembcke, Schwerin. 28. Fabrikant Richard Völker, Schwerin. 29. Dr. phil. Gerd Dettmann, Bremen. 30. stud. phil. Walter Hävernick, Hamburg. 31. Reg.-Rat Huno von Holstein, Schwerin. 32. Gutsbesitzer Wilhelm Herrmann, Pustohl. 33. Frl. Elisabeth Großkopf, Schwerin. 34. Kaufmann Walter Henckel, Schwerin. 35. Kaufmann Karl Kammeyer, Schwerin. 36. Amtsgerichtsrat Karl Mehlhardt, Schwerin. 37. Kaufmann Alexander Murmann, Schwerin. 38. Reg.-Rat Dr. Wilhelm Neese, Schwerin. 39. Oberreg.-Rat Konrad Riedel, Schwerin. 40. Frl. Martha Rose-Grabow, Schwerin. 41. Landgerichtsrat Wilhelm Schmidt, Schwerin. 42. Amtsinspektor Hans Renjes, Malchin. 45. Major a. D. Hermann v. Santen, Berlin. 44. Domänenpächter Paul Jacob, Rosenow. 45. Rud. Schnütgen, früher Neuhof bei Parchim. 46. Staatsarchivrat Dr. Heinrich Kochendörffer, Kiel. 47. Pfarrer Heinrich Windus, Ratzeburg. 48. Bankbeamter Werner Scheibe, Schwerin. 49. Studiendirektor Dr. Rudolf Kleiminger, Wismar. 50. Zollinspektor Amandus Karl Mahn, Wismar. 51. Ministerialrat Dr. Hermann Bahlcke, Neustrelitz. 52. Buchhändler Victor Hußla, Schwerin.
Gestorben sind:
1. Kommissionsrat Carl Grotefend, Güstrow, am 10. (Okt. 1925. 2. Generalmajor z. D. Carl von Plüskow, Schwerin, am 16. Okt. 1925. 3. Kommerzienrat Heinrich Ohlerich, Rostock, am 17. Nov. 1925. 4. Bankdirektor Emil Wolde, Schwerin, am 20. Nov. 1925. 5. Major a. D. Charles von Koppelow, Schwerin, am 6. Jan. 1926.


|
Seite 352 |




|
6. Bürgermeister a. D. Geh. Hofrat Ewald Wohlfahrt, Neustrelitz, am 6. Febr. 1926. 7. Landforstmeister Achim von Arenstorff, Neustrelitz, am 27. Febr. 1926. 8. Kaufmann Ludwig Aron, Manchester. 9. Hoflieferant Carl Voß, Berlin, am 10. März 1926. 10. Schriftleiter Friedrich Bechly, Schwerin, am 22. April 1926. 11. Studienrat Dr. Paul Linnenkohl, Ribnitz, am 26. April 1926.
Anlage B.
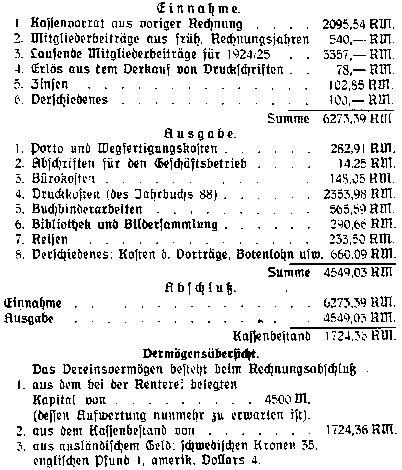
Der Rechnungsführer.
Sommer.