

|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
:
|
- Heinrich von Badewide (Bode) 1142(38)-1164
- Bernhard I 1161-1195
- Bernhard II 1190-1197
- Adelheid von Ratzeburg
- Adolf von Dassel, Graf von Ratzeburg
- Volrad I. ca 1153(45) - ca 1167
- Heinrich I. 1169 - 1209
- Volrad II. 1207-1226 und Heinrich 1203-1236
- Heinrich III. 1233-1237
- Bernhard I. 1227-1266 und Adolf I. 1245-1266
I.
Geschichte der Grafen von Ratzeburg
und Dannenberg
von
Dr. Wilhelm Meyer = Seedorf.
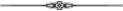


|
[ Seite 2 ] |




|
Diese Abhandlung hat im Sommer 1910 der philosophischen Fakultät der Universität Berlin zwecks Erlangung der Doktorwürde vorgelegen; die erste Hälfte des Kapitel I ist im Dezember 1910 als Inaugural=Dissertation erschienen.


|
[ Seite 3 ] |




|
Einleitung.
Einer der bedeutendsten Abschnitte der Geschichte Deutschlands im Mittelalter ist das 12. Jahrhundert. Überall spürt man frisches Leben und mutige Tatkraft, es ist ein Höhepunkt in der Poesie wie in der politischen Stellung Deutschlands. Es ist die Zeit Friedrich Bardarossas, die Zeit der größten Macht deutscher Kaiserherrlichkeit vor ihrem tiefsten Sturze. Überall regt sich ein Tatendrang und ein suchen neuer Ziele sondergleichen. Die alte Heimat wird zu enge; der Blick deutscher Fürsten und Ritter richtet sich in die Ferne, wo ihrem Tatendrang und ihrer Kampfeslust erwünschte Ziele zu winken scheinen. Nach dem gelobten Land wie nach der heidnischen Küste des baltischen Meeres richtet man den Blick, um den Drang nach mutiger und zugleich - im Sinne der Kirche - verdienstvoller Tat befriedigen zu können.
Doch zum Glück wird nicht all die frisch sich regende Kraft bei der Ausführung so weitschweifender Pläne, die zum guten Teil nur einer romantischen Abenteurerlust entspringen vergeudet. Zum Glück für Deutschland finden sich daneben kühler und klarer deutende Köpfe, die bei gesundem Ehrgeiz ihrem Tatendrang näherliegende und praktischere Ziele wissen. Das 12. Jahrhundert ist nicht allein die Zeit der Kreuzzüge und verlustreicher Italienfahrten, es ist auch das Jahrhundert harter und blutiger Kämpfe um Teile des deutschen Reiches, die, einst von Germanen bewohnt, seit vielen Jahrhunderten von fremden, slavischen Völkern besetzt waren, es ist die Zeit der bedeutendsten und folgenreichsten Kolonisation, die je in Deutschland stattgefunden hat. Zwei Männer ragen da vor allen hervor, die zwar nach Wesen und Stellung weit verschieben und untereinander Rivalen waren, deren Wirkung jedoch die gleiche gewesen ist, Albrecht der Bär und Heinrich der Löwe, die ja auch bereits der Volksmund in richtigem Gefühl seit alters zusammen nennt. Zwar ist die kolonisatorische Tätigkeit des Daltenstedter Grafen von stetigerem Erfolg gekrönt worden als die des herrschsüchtigen und gewalttätigen Sachsenherzogs, der


|
Seite 4 |




|
schließlich an einer Überspannung seines Machtstrebens scheiterte. Dennoch hat dieser auf Mit- wie Nachwelt stets die ungleich größere Wirkung ausgeübt, und bei der Vernichtung slavischen Wesens in diesen Gebieten muß ihm zweifellos der Vorrang eingeräumt werden. 1 )
Zwar war es nicht das erste Mal, daß man hier an der Elbe die Slaven aus den Sitzen, die sie zur Zeit der Völkerwanderung mühelos erworben hatten, wieder zu verdrängen suchte. Bekannt sind die Kämpfe Heinrichs I. sowie der folgenden Sachsenkönige. Doch kann von einer nachhaltigen Wirkung derselben nicht die Rede sein. In den hundert Jahren, die zwischen dem Tode Heinrichs II. und der Zeit des sächsischen Herzogtums Lothars von Supplingenburg liegen, waren hier im Slavenlande die Spuren germanischer Kultur und christlicher Mission ziemlich restlos getilgt. Begonnen war dann freilich eine tatkräftige Kolonialpolitik bereits durch Lothar, den Großvater Heinrichs des Löwen, der in seiner Hand mit dem Erbe Ottos von Nordheim und dem Herzogtum der Billunger eine ansehnliche Macht vereinigte und den Slaven gegenüber eine achtunggebietende Stellung einnahm.
Aber die eigentliche Wirkung und in gewisser Weise ein Abschluß dieser Politik wurde erst durch Heinrich herbeigeführt. Nach einigen blutigen "Kreuzzügen" wurde von ihm in diesen Gegenden soweit Ruhe und Ordnung geschaffen, daß man an eine endgültige Regelung der drei wendischen Bistümer Lübeck, Ratzeburg und Schwerin denken konnte. Und es ist gewiß kein Zufall, daß sämtliche Klöster dieser Gegenden, außer dem 1136 von Lothar zu Segeberg gegründeten, zur Zeit oder nach der Zeit Heinrichs des Löwen entstanden sind. 2 ) Und diese Stellung verdankte er allein seinem tatkräftigen und folgerichtigen Vorgehen, indem er sich für die von Lothar ererbte Herzogsgewalt durch Erwerb von Landbesitz, gräslicher und vogteilicher Rechte im Herzogtum Sachsen sowie durch umfangreiche Eroberungen im Slavenlande einen realen Untergrund schuf. 3 ) Und dadurch, daß er das bereits


|
Seite 5 |




|
unter Lothar zu beobachtende Verfahren, Grafschaften an Edelherren erblich zu erteilen und so Herzogstreue, willfährige Dynastengeschlechter zu schaffen, im ausgedehntesten Maße anwandte, erlangte er eine große Zahl anhänglicher und ergebener Vasallen.
Denn der Begriff des Komitats hatte sich seit den Zeiten der Karolinger völlig geändert. Nicht mehr war der Graf bloß richterlicher Beamter, sondern längst war dieser Titel Ausdruck einer hervorragenden Stellung geworden. Sei es, daß diese auf großem Grundbesitz, sei es, daß sie auf persönlichem Ansehen beruhte. Seit dem 10 Jahrhundert war daher die Entwicklung des Amtsbezirkes zur Territorialität und die völlige Neubildung von Grafschaften in vollem Gange, die dann im Herzogtum Sachsen unter Heinrich dem Löwen und seinen nächsten Nachfolgern zum Abschluß kam. Doch ist ein Unterschied zu machen zwischen den jetzt entstehenden Grafschaften. Während in dem westlichen und mittleren Teil des Herzogtums die neuen Grafengeschlechter zum guten Teil dadurch entstanden, daß der Herzog vorher reichsunmittelbare Grafschaften, die infolge Aussterbens ihrer Inhaber an ihn gefallen waren, an Leute vergab, die jetzt als Vize- oder Untergrafen von ihm abhängig waren, 4 ) muß das Wesen der östlichen Grafschaften an der Slavengrenze links wie rechts der Elbe von dem Gesichtspunkt der Kolonisation aus verstanden werden. Zwar, die Stellung der Grafen zum Herzog und damit zum Reich ist dieselbe wie in den westlichen Gebieten, sie sind Lehngrafen des Herzogs. Doch ihre Aufgabe, der Grund für ihre Schaffung ist ein anderer. Hier handelt es sich nicht um Gebiete, die von Deutschen bewohnt sind, oder in denen gar die Einrichtung des Grafenamts seit alters besteht. 5 ) Sondern hier werden Grafen eingesetzt, um die neueroberten Gebiete mit Deutschen zu besiedeln oder doch nach deutscher Art zu kolonisieren, indem sie den Wenden die überlegene deutsche Bestellungsart aufzwingen. Ihr Zweck ist, die mit dem Schwert eroberten Gebiete durch friedliche Kultur für den Herzog festzuhalten und allenfalls - das trifft jedoch


|
Seite 6 |




|
nur für die rechtselbischen Gebiete zu - durch Kleinkriege, zu denen jedoch meist die Wenden selbst den Anlaß geben, zu erweitern. 6 ) Man würde also das Wesen dieser Grafen vielleicht am besten treffen mit der Bezeichnung als Kolonisationsgrafen. Ein solcher Kolonisationsgraf war bereits der von Herzog Lothar im Jahre 1110 als Graf von Holstein eingesetzte Adolf von Schauenburg. Und als Kolonisationsgrafen in diesem Sinne haben wir die um die Mitte des 12. Jahrhunderts an der Slavengrenze auftauchenden Grafen von Osterburg, Lüchow, Schwerin, Ratzeburg und Dannenberg anzusehen. Die Geschichte der beiden letztgenannten Grafschaften von ihrer Entstehung bis zu ihrem Übergang in größere Staatsgebilde zu schildern, ist das Ziel der folgenden Darlegungen.


|
Seite 7 |




|
Kapitel I.
Geschichte der Grafen von Ratzeburg.
Der Name Ratzeburgs begegnet schon früh in der historischen Literatur. Zum erstenmal, soweit ich sehe, in dem Werk, dem wir überhaupt die erste genauere Kunde dieser Gegenden verdanken, in der Kirchengeschichte Adams von Bremen. Hier heißt es in dem berühmten 18. Kapitel des zweiten Buches bei der Aufzählung der wendischen Völker: "Item versus nos Polabingi, quorum civitas Razispurg". 1 ) Wir lernen also bereits hier, d. h. um das Jahr 1070, Ratzeburg als eine wendische Siedlung kennen. Nicht ganz eindeutig ist dabei die Bezeichnung als "civitas", worunter wir keinesfalls eine Stadt im späteren Sinne verstehen dürfen. Ratzeburg wird sich von den übrigen Siedlungen der Polabinger oder Polaber, wie sie später bei Helmold und Arnold genannt werden, vor allem durch die Burganlage eines wendischen Häuptlings unterschieben haben, weshalb es Adam denn auch an einer andern Stelle - Buch III, Kap. 19 - als "urbs" bezeichnet. Vor allem auf dieser Eigenschaft als Sitz des Anführers wird seine Bedeutung als Hauptort im Polabenlande, als civitas Schlechthin, beruht haben. Im 19. und 20. Kapitel des dritten Buches erzählt uns Adam dann, wie durch die eifrige Fürsorge des großen Erzbischofs Abalbert von Bremen und des Wendenfürsten Gottschalk um 1060 ebenso wie im wagrischen Oldenburg und in Mecklenburg auch in Ratzeburg das Christentum festen Fuß faßte, daß hier Klöster entstanden, ja sogar ein Bischofssitz in Ratzeburg eingerichtet und dem Griechen Aristo übertragen wurde. 2 ) In sehr willkommener Weise werden diese literarischen Nachrichten durch eine fast gleichzeitige urkundliche ergänzt und bestätigt. Im Jahre 1062 verleiht zu Köln Heinrich IV. auf Wunsch der Erzbischöfe Anno von Köln und Abalbert von Hamburg (-Bremen), die auf diese Weise einen festen Schutz des Christentums gegen die Obotriten zu erhalten hofften, 3 ) dem Herzog Otto


|
Seite 8 |




|
von Sachsen "quoddam castellum Razesburg dictum in eius-dem ducis Ottonis marchia et in pago Palobi situm" mit allen Rechten und Besitzungen, wie sie mit einer solchen Verleihung verbunden zu sein pflegten. Gleichzeitig bestimmt er:
"Habitatores vero terre eiusdem castelli decimam deo et episcopo, in cuius parochia supradictum castellum situm est, digne per omnia offerant." 4 )
Aus beidem ersehen wir, daß Ratzeburg um diese Zeit sowohl für die Macht des sächsischen Herzogs in der slavischen Mark wie für die Slavenmission ein wichtiger Stützpunkt war. Diese verheißungsvollen Anfänge christliccer Mission und damit auch einer höheren Kultur des Gesamtlebens im Wendenlande wurden jedoch infolge der Stürme, die nach der Ermordung Gottschalks im Jahre 1066 über dies Gebiet dahinbrausten, völlig vernichtet. Die zerrüttenden Bürgerkriege in Deutschland und die Schwäche des sächsischen Herzogtums ermöglichten es den Slaven, noch einmal wendische Religion und wendisches Recht bis zur Elbe hin wieder aufzurichten. Erst 80 Jahre später beginnt hier unter Heinrich dem Löwen von neuem germanische Kultur und Hand in Hand damit die Ausbreitung des Christentums. Und zwar geht man diesmal so zielbewußt und sachgemäß vor, daß seitdem alle diese Gebiete auf immer deutscher Sitte und deutschem Recht gewonnen sind. Und neben der Grafschaft Holstein, die seit 1110 das stets hervorragend tüchtige Haus der Schauenburger innehatte, und neben der Grafschaft Schwerin, die von Heinrich dem Löwen im Jahre 1160 eingerichtet und Gunzel von Hagen übertragen wurde, in dessen Familie sie dann bis über die Mitte des 14. Jahrhunderts blieb, ist es vor allem die Grafschaft Ratzeburg und das Haus Badewide, das hier rechts der Elbe nicht nur die Grenzwacht hielt, sondern auch tätig und mit Erfolg eine sachgemäße Kolonisation und Siedelung im Slavengebiet betrieben hat.



|



|
|
:
|
Heinrich von Badewide (Bode) 1142(38)-1164.
Zum erstenmal begegnen wir dem Namen Heinrichs von Badewide, des Begründers des Grafenhauses von Ratzeburg, in den Wirren und Kämpfen, die sich nach dem Tode Lothars von


|
Seite 9 |




|
Supplingenburg zwischen dem welfischen und dem askanischen Hause um das sächsische Herzogtum erhoben. Im Jahre 1138 hatte sich Albrecht der Bär, dem auf dem Tage zu Würzburg bekanntlich von Konrad III. an Stelle des geächteten Heinrichs des Stolzen das Herzogtum Sachsen verliehen war, Lüneburgs, Bardowieks und Bremens bemächtigt. 5 ). Da fielen auch die Nordelbinger, d. h. die Holsten und Stormarn, zu ihm ab und vertrieben ihren Grafen Adolf, den zweiten aus dem Schauenburger Hause, weil er ein treuer Anhänger Heinrichs des Stolzen und dessen Schwiegermutter, der Kaiserin Richenza, war, durch deren Gemahl sein Vater die Grafschaft erhalten hatte. An seiner Stelle setzte jetzt Albrecht der Bär Heinrich von Badewide ein. So berichtet uns Helmold in seiner Slavenchronik Buch 1, Kapitel 54. 6 ) Über Heinrichs Herkunft erfahren wir von Helmold nichts; doch nennt ihn Arnold von Lübeck, Helmolds Fortsetzer, in seinem Abriß der Geschichte des Ratzeburger Grafenhauses, Buch V, Kapitel 7, einen ".nobilis et illustris vir". Und auch in den wenigen Urkunden, in denen er genannt wird, wird er mehrfach als "nobilis" bezeichnet. 7 ).
Die Verbindung mit Albrecht dem Bären, in der wir ihn hier finden, hat ältere Forscher auf den, freilich naheliegenden, Gedanken gebracht, seine Heimat in der Nähe von Anhalt zu suchen. So haben sie ihn aus Thüringen stammen lassen und ihn mit dem Hause Orlamünde in enge Beziehung gesetzt. 8 ). Dem hat schon v. Kobbe in seiner "Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg" I, S. 116/17 widersprochen; doch folgt er dann selbst, auf eine eigne eingehende Untersuchung dieser Frage verzichtend, der Ansicht v. Wersedes "Niederländische Kolonien", der die Heimat Heinrichs von Babewide in Odersachsen sucht. 9 ). Demgegenüber hat Freiherr W. von Hammerstein, einer der besten Kenner dieser Verhältnisse und besonders in genealogischen Dingen


|
Seite 10 |




|
Sehr bewandert, in der "Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen" 1853 S. 233/39 und 1855 S. 355/63 10 ) nachgewiesen, daß Heinrich von Badewide aus dem Lüneburgischen, und zwar aus Bode bei Ebstorf stammt. Das wird erwiesen durch die Übereinstimmung der Namensform. Bode findet sich nämlich nach v. Hammerstein im Mittelalter stets erwähnt als Bodwede oder Botwede. Ebenso wechselt die Namensform bei dem "Badwide", mit dem Heinrich bei Helmold genannt wird, indem ihm ein "Bodwide" bei Arnold, und in Urkunden ein Bodewede, Botwede, Botwide oder gar Botwidel zur Seite steht 11 ). Daß Heinrich außer Bode noch andere Güter in der Nähe Ebstorfs besessen habe, wird erwiesen durch die im M. U.-B. I, 200 abgedruckte Urkunde, die von den Herausgebern auf etwa 1210 angesetzt wird 12 ). Hier verkauft nämlich der Propst und spätere Bischof Heinrich von Ratzeburg "wegen der entfernten Lage" die Güter seiner Kirche in Baven samt dem angrenzenden Walde dem Kloster Ebstorf mit allen Rechten, die daran Heinricus de Bodewede und seine Nachfolger besessen haben. Daß es sich hierbei um ein später zugrunde gegangenes Dorf nahe bei Ebstorf und nicht etwa um Baven bei Hermannsburg, wie er selbst ursprünglich angenommen hatte, handelt, weist v. Hammerstein Zeitschr. d. hist. Vereins f. Niedersachsen 1855 S. 355 ff. nach.
Dafür, daß Heinrich von Badewide ursprünglich in dieser Gegend Besitzungen hatte, spricht endlich noch Folgendes. Im 82. Brief des bekannten Abts Wibald von Stablo und Torvey, der von Jaffè zwischen 1146 und 1148 angesetzt wird, werden die Güter aufgezählt, die die abgesetzte Abtissin Judith von Kem-


|
Seite 11 |




|
nade verteilt hatte. 13 ) Dabei wird auch Heinrich von Badewide als Empfänger von 9 Hufen aus der "curia Cokerbike" genannt. Dies Cokerbike ist das heutige Kakerbek südlich von Stade. 14 ) Ein soIches Besitztum hatte für Heinrich doch nur Zweck, wenn er auch sonst in dieser Gegend begütert war. Leider erfahren wir nichts darüber, in welchem Verhältnis Heinrich von Badewide zu der Äbtissin Judith stand und welchem Umstand er eine solche Belehnung verdankte. 15 ) Außer diesen beiden Nachrichten erfahren wir über einen Besitz Heinrichs links der Elbe nichts. Doch ist das nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, daß zu dem allgemeinen Mangel an Urkunden so früher Zeit in diesem Falle hinzukommt, daß eine Urkunde der Grafen von Ratzeburg, außer wo sie als Zeugen fungieren, bisher überhaupt nicht bekannt geworden ist. 16 )
Über verwandtschaftliche Beziehungen Heinrichs von Badewide erfahren wir nur wenig. Einmal werden in einer Urkunde König Konrads III. vom Jahre 1145 gleichzeitig mit ihm zwei Brüder, Helmold und Volrad, als Zeugen genannt. 17 ) Daß wir in diesem Helmold den Vater Gunzels,des ersten Grafen von Schwerin, und in Volrad den ersten Grafen von Dannenberg vor uns hätten, ist eine ganz haltlose Annahme v. Duves, 18 ) die freilich zunächst durch ihre verblüffende Einfachheit besticht. Diese beiden Grafen-


|
Seite 12 |




|
häuser haben nie in engeren verwandtschaftlichen Beziehungen zum Ratzeburgischen gestanden, wie sich im Verlaufe dieser Untersuchung noch näher herausstellen wird. - Ferner berichtet uns Saxo Grammaticus, daß die Gemahlin Heinrichs eine Verwandte (cognata) des Königs Waldemar des Großen von Dänemark gewesen sei. 19 ) Leider erfahren wir über die Art der Verwandtschaft nichts Näheres. Doch ist diese Nachricht um so weniger zu bezweifeln, als wir sowohl den Grafen Heinrich wie seinen Sohn Bernhard, der ebenfalls eine Gemahlin aus dem dänischen Königshause hatte, auch sonst mehrfach mit diesem in enger Verbindung genannt finden (S. unten). 20 ) Daß das Geschlecht Heinrichs von Babewide nicht ganz unbedeutend gewesen sein kann, beweist wohl auch schon der Umstand, daß ihm Albrecht der Bär einen so wichtigen Posten wie die Grafschaft Holstein anwies.
Ob sich Heinrich daneben bereits persönlich hervorgetan hatte, wissen wir nicht. Jedenfalls bewies gleich sein erstes Auftreten, daß er seinem Amte gewachsen war. Sofort nach dem Tode Kaiser Lothars (3. Dezember 1137) hatten sich die Slaven, die allgemeine Unruhe und Unsicherheit in Sachsen benutzend, unter ihrem Fürsten Pribislav erhoben und vor allem die ihnen am meisten verhaßte Zwingburg Wagriens, das vor vier Jahren von Lothar erbaute Segeberg, zerstört und die deutsche Besatzung samt den Mönchen verjagt. Nun sammelte Graf Heinrich ein Heer aus Holsten und Stormarn und unternahm im Winter 1138/39 einen verheerenden Zug in das slavische Wagrien, das er auch völlig eroberte bis auf die festen Plätze Plön, Lütjenburg und Oldenburg, mit deren Belagerung er sich nicht aufhielt. Wohl aber brachte er Segeberg in seine Gewalt, das er jetzt, da der von Lothar dort eingesetzte Statthalter Hermann gestorben war, für sich in Anspruch nahm. 21 ) Durch dieses entschlossene und kraft-


|
Seite 13 |




|
volle Vorgehen erwarb sich Graf Heinrich bei Helmold die anerkennende Bezeichnung als eines "vir ocii impatiens et strenuus in armis". Im Sommer 1139 vervollständigten dann die Holsten jenen Eroberungszug auf eigene Faust, indem sie ohne den Grafen gegen Plön zogen, es eroberten, die Einwohner niedermachten und alles Land ringsum in eine Wüste verwandelten und so, wie Helmold sich ausdrückt, "einen sehr nützlichen Krieg führten". 22 )
Als nun aber Heinrich der Stolze in Sachsen erschien und vor seiner Übermacht Albrecht der Bär nach Süddeutschland zu König Konrad floh, war auch Heinrich von Badewide seiner Stütze beraubt, und er mußte vor dem mit dem Welfen zurückkehrenden Adolf II. die Grafschaft räumen. Zuvor jedoch steckte er die Burg Segeberg, von der beim Slaveneinfall nur das Suburbium zerstört war, und das äußerst feste Hamburg, eine Gründung der Mutter des Grafen Adolf zum Schutze gegen die Wenden, in Brand. Dann begab er sich vermutlich auf das linke Elbufer, vielleicht nach Bode. Als jedoch Heinrich der Stolze bald darauf starb (20. Oktober 1139), da erhielt Heinrich von Badewide von dessen Witwe Gertrud, die für ihren Sohn, den damals erst zehnjährigen Heinrich den Löwen, das Herzogtum verwaltete, einen Teil seines Besitzes zurück, indem er von ihr die von ihm eroberte "Provinz" Wagrien samt Segeberg 23 ) kaufte.
Das war jedoch nur möglich gewesen wegen einer persönlichen Abneigung Gertruds gegen Adolf II., dem sie dadurch Schwierigkeiten im eigenen Lande zu bereiten hoffte. Darin hatte sie sich auch nicht verrechnet; denn sofort begann zwischen den beiden Rivalen der Kampf um Wagrien. Als sie daher im Jahre 1142 sich mit Heinrich Jasomirgott vermählt und Sachsen verlassen hatte, erreichte Graf Adolf in Verhandlungen mit dem jungen Herzog Heinrich und dessen Ratgebern, daß ihm Segeberg und das ganze Wagrierland zurückgegeben wurde, einerseits, so drückt sich Helmold aus, "durch seine gerechtere Sache", andererseits.


|
Seite 14 |




|
"durch die größere Geldsumme", die er dafür bezahlte. Wir dürfen dahinter nicht etwa Bestechungsgelder für die Räte des Herzogs suchen, sondern diese Geldsumme war tatsächlich die Kaufsumme für das Land, wie ja einige Jahre zuvor auch Heinrich von Badewide dies Land von des Herzogs Mutter erkauft hatte. Und damals erhielt dieser zur Entschädigung für Wagrien Ratzeburg und das Polabenland als "festes Lehen" vom Herzog. 24 ) Geordnet wurden diese Dinge dann wahrscheinlich zu Bremen, wo wir die beiden Grafen am 3. September 1142 als Zeugen in der wichtigen Urkunde treffen, in welcher Erzbischof Adaldero von Hamburg-Bremen über die Teilung im Bremer Gebiet zwischen Herzogin Gertrud und ihrem Sohn, dem Herzog Heinrich, einer- und Markgraf Albrecht dem Bären andererseits urkundet. 25 ) Damit war nun Heinrich von Badewide in den Besitz des Landes gekommen, mit dessen Schicksal das seines Hauses bis zu dessen Aussterben, d. h. etwa 60 Jahre, eng verknüpft blieb.
Zwar wird sich Heinrich von Badewide sogleich nach Empfang dieses Gebietes als comes bezeichnet haben; denn schwerlich hat er, nachdem er einmal eine Grafschaft innegehabt hatte, sich mit einem geringeren Titel begnügt. 26 ) Doch nannte er sich nicht sofort nach der Hauptstadt jenes Gebietes Grafen von Ratzeburg. Das ist ein Titel, den Helmold erst zum Jahre 1156 auf ihn


|
Seite 15 |




|
anwendet, 27 ) d. h. erst nach der Gründung eines Bistums in Ratzeburg und nach der Regelung der Gebietsverhältnisse zwischen Grafschaft und Bistum. Noch zum Jahre 1154 bezeichnet er ihn als "comes Polaborum". 28 ) Wir gehen demnach kaum fehl, wenn wir annehmen, daß Heinrich um 1155 den Titel eines Grafen der Polaben mit dem eines Grafen von Ratzeburg vertauscht hat, wobei der Gedanke mitbestimmend gewesen sein mag, daß der alte Name nach den wiederholten Vernichtungskämpfen gegen die Slaven nicht mehr das Wesen seiner Grafschaft ausdrücke. Ähnlich erging es übrigens dem Titel des ersten Grafen von Schwerin. Obwohl Gunzel von Hagen bereits seit 1160 im Lande Schwerin den Befehl über die Slaven führte, erscheint er erst um 1167 als Graf von Schwerin, während er bis dahin, z. B. von Helmold, als "praefectus terrae Obotritorum" bezeichnet wird. 29 ) Für den ersten Ratzeburger Grafen kommt daneben bis zum Jahre 1149 in Urkunden der Titel "comes de Botwide" vor. Dieser Familienname verschwindet seitdem vollkommen; nur der Verfasser des Ratzeburger Zehntregisters hat sich um 1230 seiner noch einmal erinnert. 30 )
Nicht ganz einfach ist die Frage, was wir unter der "terra Polaborum" um diese Zeit zu verstehen haben, mit andern Worten, welches die Grenzen der Grafschaft Ratzeburg waren. Wie wir bereits sahen, gibt schon Adam von Bremen Ratzeburg als die Hauptstadt der Polabinger an, und nach der Urkunde Heinrichs IV. von 1062 lag Ratzeburg im "pagus" Palobi. 31 ) In dieser engen Verbindung mit Ratzeburg finden wir dann auch stets bei Helmold und Arnold die "terra Polaborum" genannt. 32 ) Beide geben jedoch keinen Anhalt zur genaueren Feststellung der Ausdehnung dieses Begriffes. 33 ) Der Name selbst besagt, auch wenn die .nicht ganz sichere Deutung als "Elbanwohner" als richtig angenommen wird, für die Grenzbestimmung des Polabenlandes garnichts, da damit ebensogut sämtliche Slaven des Elbtales wie


|
Seite 16 |




|
ein ganz .kleines Gebiet der Elbe bezeichnet sein könnte. So ist es gekommen, daß man die Polaben nicht immer an der richtigen Stelle gesucht hat. Meitzen, Siedelung und Agrarwesen II, 477, versetzt sie in die Gegend zwischen Dömitz und Boizenburg. Doch selbst wenn er das auf die Zeit Karls des Großen beschränken wollte, wie man allenfalls nach dem Zusammenhang annehmen könnte, wäre das irrig. Hier wohnten damals die Smeldinger 34 ), deren Namen ebenso wie der der Bethenzer, die zwischen Lauenburg und Boizenburg wohnten, später nie mehr genannt wird. Daß man später die Smeldinger zu den Polaben gerechnet habe, ist nicht wahrscheinlich. Sind sie in einem größeren slavischen Volksstamm aufgegangen, so möchte man eher an die Obotriten denken, da, wie wir gleich sehen werden, das Polabenland zu Helmolds Zeit östlich nur bis Boizenburg gerechnet wurde.
Zunächst läßt sich das eine mit Sicherheit sagen, daß die Polaben, wo immer sie in gleichzeitigen Quellen, die hier natürlich nur in Betracht kommen können, genannt werden, stets um Ratzeburg lokalisiert erscheinen. Für die linkselbischen Wenden in den Grafschaften Dannenberg und Lüchow findet sich dieser Name auch nicht ein einziges Mal. Um so weniger verständlich ist es, wenn heutige Forscher gerade diese als Polaben bezeichnen, ohne die Mecklenburger Wenden um Ratzeburg auch nur zu erwähnen. 35 ) Demgegenüber hat schon v. Raumer in seinen Historischen Karten und Stammtafeln zu den Regesta Historiae Brandenburgensis I, Karte Nr. 4, den Namen der Polabinger ganz richtig nur für das Ratzeburger Gebiet eingetragen. Und mit dieser Lokalisierung stimmen die Urkunden, die wir über die Grafschaft Heinrichs von Badewide besitzen, völlig überein. Zwar eine Urkunde, die die Grenzen derselben klipp und klar bestimmt hätte, hat es in


|
Seite 17 |




|
dieser Zeit, wo alles hier im Flusse war, wo erst nach und nach den Slaven das Land abgenommen und von Heinrich dem Löwen an deutsche Herren aufgeteilt wurde, für Ratzeburg so wenig gegeben wie für irgend eine andere dieser Grafschaften. Erst allmählich haben sich hier, vor allem in Verbindung mit der Neueinrichtung und Ausgestaltung des Bistums sowie mit der Schaffung der Grafschaft Schwerin (1166), feste Grenzen herausgebildet. Zu deren Feststellung sind wir darum angewiesen auf Urkunden, die für das Bistum Ratzeburg gegeben sind, mit dessen Entwicklung auch die Herausbildung fester Grenzen der Grafschaft gleichen Schritt gehalten haben wird. Nur im Volk wie bei den Geschichtsschreibern hat sich dann wahrscheinlich für dies Gebiet die Bezeichnung als "Polabenland" noch eine Zeitlang gehalten, während man es offiziell längst die Grafschaft Ratzeburg nannte.
So kommt es, daß wir erst von 1154 ab, d. h. seit der Errichtung des Ratzeburger Bistums, 36 ) die Möglichkeit haben, Genaueres über die Ausdehnung derselben zu erfahren, bis dann um 1171 die Einrichtung von Bistum und Grafschaft zum vorläufigen Abschluß kam. 37 ) Was zwischen diesen beiden Daten liegt, wird zusammengefaßt in der sogenannten Ratzeburger Dotationsurkunde - M. U.-B. I, 65 -, die angeblich im Jahre 1158, in Wirklichkeit jedoch viel später ausgestellt ist. Diese enthält sämtliche von 1154 bis 1171 für das Bistum Ratzeburg gegebenen Bestimmungen 38 ) mit einigen genaueren Angaben und ist daher auch für uns von großer Wichtigkeit. Hier erfahren wir nun, in welcher Weise die 300 Hufen, mit denen Heinrich der Löwe bekanntlich alle drei wendischen Bischofssitze ausstattete, im Bistum Ratzeburg verteilt waren. Vor allem gibt der Herzog dem Bischof das Land Boitin, das ist das Gebiet um das heutige Schönberg nordöstlich vom Ratzeburger See; dabei werden die Grenzen dieses


|
Seite 18 |




|
Ländchens im einzelnen festgesetzt. 39 ) Dies Gebiet wurde zu 250 Hufen gerechnet. Dazu legte der Herzog "de voluntate Heinrici et Dernardi comitum" noch 50 Hufen mit den Dörfern "Rodemoyzle, Ziethene, Verchowe, Kolatza". Das sind nach M. U.-B. IV, Ortsregister, Römnitz, Ziethen, Farchau und Horst bei Schmilau" 40 ), also ein Gebiet südlich des Ratzeburger Sees, das vom Lande Boitin durch einen Gebietsstreifen des Grafen getrennt wurde.
Auffallend ist, daß hier von einer Zustimmung der Ratzeburger Grafen nur bei 50 Hufen die Rede ist, während nach Helmold I, 77 Graf Heinrich dem Herzog die gesamten 300 Hufen "resignierte", wie denn überhaupt bei Helmold Heinrich von Badewide als der eigentliche Stifter des Ratzeburger Bischofslandes erscheint. Einen Irrtum Helmolds, wie v. Kobbe a. a. O. I, 289 Anm. 4 will, halte ich hierbei für ausgeschlossen, da er gerade an diese Tatsache, daß der Polabengraf 300 Hufen zur Ausstattung des Bistums schenkt, die Erzählung knüpft, wie auf Vorhaltungen des Propstes Ludolf von Euzolina (Högerstorf) Graf Adolf von Holstein dem Beispiel Heinrichs von Badewide folgt und ebenfalls 300 Hufen zur Ausstattung des Oldenburger (Lübecker) Bistums schenkt. Es scheint mir vielmehr dieser Unterschied zwischen der urkundlichen und der literarischen Darstellung höchst bezeichnend für die Auffassung der Parteien. Heinrich von Badewide und seine Freunde, zu denen, wie es scheint, Helmold selbst gehörte, 41 ) sind offenbar stets der Meinung gewesen, daß der eigentliche Stifter jener 300 Morgen der Graf von Ratzeburg gewesen sei. Dagegen lag Heinrich dem Löwen daran, den Vorgang so darzustellen, daß diese Ausstattung in der Hauptsache sein Werk sei. Dementsprechend


|
Seite 19 |




|
wird ein Anteil des Grafen in der Bestätigungsurkunde Hadrians IV. - M. U.-B. I, 62 -, die natürlich der Darstellung von seiten des Herzogs folgte, mit keiner Silbe erwähnt. Nach außen hin trat eben Heinrich der Löwe völlig als der Stifter aller drei wendischen Bischofssitze auf. Daran zu denken, daß er sich etwa bei der Einsetzung des Ratzeburger Grafen besondere Rechte im Lande Boitin vorbehalten hätte, wie er sie z. B. in Sadelbande und Gamme (Vierlanden) ausübte, wäre sicher falsch. Die Grafschaft Heinrichs von Badewide wird ursprünglich auch Boitin mit umfaßt haben; und somit ist Helmolds Darstellung ganz gerechtfertigt. 42 )
Die Schenkungen der Ratzeburger Grafen, oder besser wohl des Grafen Heinrich, die sonst noch in der "Dotationsurkunde" erwähnt werden, wie Panten [nördl. Mölln], Boissow [nordwestl. Wittenburg] und Walksfelde [westl. Mölln], sind insofern für die Abgrenzung der Grafschaft von Bedeutung, als wir aus ihnen ersehen, daß diese im Westen keineswegs, wie z. B. v. Kobbe a. a. O. I, 128 meint, mit der Stecknitz abschloß 43 ). sondern sich über sie hinauserstreckte, wahrscheinlich bis zur Grenze der Grafschaft Holstein, und zum andern, daß auch die Wittenburger Gegend zur Grafschaft Ratzeburg gehörte. Letzteres erfahren wir sonst nur aus dem sogenannten Ratzeburger Zentregister - M. U.-B. I, 370 -, das um 1230 angefertigt ist, um die vom Bistum verliehenen Zehnten festzustellen 44 ), ein Dokument, das in jeder Hinsicht von unschätzbarem Werte ist. Hier wird in der Einleitung gesagt, daß der Graf Heinrich von Badewide in den drei "Provinzen" Ratzeburg, Wittenburg und Gadebusch vom


|
Seite 20 |




|
Bischof den halben Zenten zu Lehen trage. Solcher Zehnte über ganze Gebiete wurde aber für gewöhnlich nur demjenigen übertragen, der dort zugleich auch die Grafenrechte ausübte. 45 ) Doch geht auch aus den weiteren Ereignissen hervor, daß auch die Länder Wittenburg und Gadebusch zur Grafschaft Ratzeburg gehörten.
Endlich gehörte dazu noch das Land Boizenburg. Das wissen wir aus einer Urkunde vom Jahre 1216, in der Graf Albrecht von Orlamünde, damals Graf von Holstein und Herr in Nordalbingien, den Hamburgern u. a. die Freiheit vom Elbzoll in Boizenburg bestätigt. 46 ) Hier wird gesagt, daß ihnen diese Freiheit vom Herzog Heinrich und vom Grafen Adolf verliehen sei. Dieser Graf Adolf ist bereits von den Herausgebern des Mecklenburger Urkunden-Buches richtig auf den Grafen Adolf von Dassel ausgedeutet worden, der nach dem Aussterben des Badewideschen Hauses durch Heirat die Ratzeburger Grafschaft erhielt. 47 )
Fassen wir das Gesagte noch einmal kurz zusammen, so ergibt sich als Besitz der Grafen von Ratzeburg alles Land zwischen der Grafschaft Schwerin, Dannenberg, dem Sadelbande oder Sadelbende und der Grafschaft Holstein bezw. dem Gebiet des Lübecker Bistums mit Ausnahme des Landes Boitin und einiger verstreuter Besitzungen des Bistums wie Römnitz, Ziethen, Farchau und Horst, die um die Südseite des Ratzeburger Sees herum lagen, und Panten und Walksfelde jenseits der Stecknitz in dem heute zu Mecklenburg-Strelitz gehörenden Gebiet von Mannhagen. Das ist also die "terra Polaborum" Helmolds und Arnolds. Da wir nun durch das Zehntregister in der Lage sind, bis auf ein Dorf genau die Grenzen der "terrae" Gabebusch und Wittenburg - bei Boizenburg, das bedeutend geringer bevölkert gewesen zu sein scheint, erfahren wir nichts über die Grenzen - anzugeben, so erhalten wir für unsere Grafschaft eine bei so früher Zeit außerordentlich sichere Begrenzung. Doch müssen wir uns vor Augen halten, daß diese, wie bereits oben dargelegt wurde, erst allmählich sich herausgebildet hat und so, wie wir sie soeben gefunden haben, erst etwa um 1170 feststeht. 48 )


|
Seite 21 |




|
Dies Gebiet war bis zu dem Eroberungszuge Heinrichs von Badewide im Winter 1138/39 in Händen des Slavenfürsten Pribislav gewesen. Als ihm dann Wagrien entrissen wurde, verlor er auch Poladien. 49 ) Dieses wurde jetzt, nachdem auf dem Tage zu Frankfurt (Mai 1142) Albrecht der Bär seine Ansprüche auf das sächsische Herzogtum hatte fahren lassen müssen, ein Lehen Heinrichs des Löwen. Und mit dessen Schicksal finden wir von jetzt ab das Heinrichs von Ratzeburg eng verknüpft, ohne daß wir mehr von irgendwelchen Beziehungen zu Albrecht dem Bären hören. Es ist das ein Grund mehr für die Richtigkeit der Annahme, daß diese auch vorher nie persönlicher, sondern lediglich politischer Natur gewesen waren. Er war abhängig nur vom sächsischen Herzogtum; doch diese Abhängigkeit wuchs mit dem Alter des jungen Herzogs. In seiner Begleitung finden wir von 1142 ab den Ratzeburger Grafen häufig. So in eben diesem Jahre zu Bremen, wo wohl nicht allein die Abgrenzung zwischen ihm und Adolf II. von Holstein, sondern auch ihre Aussöhnung stattfand. 50 ) In des Herzogs Gefolge treffen wir ihn auch im Jahre 1145 zu Magdeburg. Er ist hier samt seinen beiden Brüdern Helmold und Volrad Zeuge in einer Urkunde Konrads III., in der dieser einen Vertrag zwischen dem Magdeburger Domherrn Hartwig, dem späteren Erzbischof von Bremen, und dessen Mutter, der Markgräfin Richardis, einer- und dem Erzbischof von Magdeburg andererseits bestätigt, durch welchen letzterer sich verpflichtet, Hartwig zur Erlangung seiner Erbgüter in den Grafschaften Ditmarsen und Nortland behülflich zu sein. 51 ) Im folgenden Jahre finden wir Heinrich wieder in Bremen. Er ist hier Zeuge in einer Urkunde des Erzbischofs Adaldero von Bremen, der dem Kloster Neumünster den Zehnten der Marsch Bishorst überträgt und deren Grenzen bestimmt. 52 ) Auch dieses mehrfache Auftreten


|
Seite 22 |




|
in Bremen scheint dafür zu sprechen, daß der Ratzeburger Graf in der Nähe irgendwelche Besitzungen hatte. Über sonstige Beziehungen zum Erzbischof Adalbero erfahren wir nichts.
Leider hören wir auch nichts darüber, ob und in welcher Weise Graf Heinrich an dem großen Wendenkreuzzug beteiligt war, den im Jahre 1147 die deutschen Fürsten in Verbindung mit den Dänen, Tschechen und Polen unternahmen. Jedenfalls ging der Zug des nördlichen Heeres unter Heinrich dem Löwen über Ratzeburg. Denn nachdem man bei Artlenburg die Elbe überschritten hatte, ruhte man die erste Nacht in Pötrau, südwestlich von Ratzeburg. 53 ) Es wäre denkbar, daß man ihn zur Rückendeckung in Ratzeburg zurückgelassen hätte. Der Zug selber verlief bekanntlich unglücklich. Dennoch aber müssen wir wohl in ihm mit Ranke 54 ) einen der Faktoren Lehen, die zur Unterwerfung der Slaven und zur Kolonisation ihres Landes führten. Jedenfalls kann man vom Standpunkt der weltlichen Herren Haucks Urteil, der diesen Zug "das törichtste Unternehmen, das das 12. Jahrhundert kennt" nennt 55 ), nicht teilen. Daß er für die Missionsarbeit zunächst eher zerstörend als ausdauend wirkte, mag sein; doch war er vollkommen im Stile der ganzen Kolonisationspolitik dieser Zeit, der rück-sichtslosen Art eines Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären. Und sicherlich ist er nicht völlig nutzlos gewesen. 56 ) So konnten die beiden Grafen an der Slavengrenze, Adolf von Holstein und Heinrich von Badewide, seit dieser Zeit energischere Schritte als bisher zur Vertreibung der Slaven aus ihren Ländern tun.
Im Sommer 1149 finden wir beide wieder zusammen mit Heinrich dem Löwen auf dessen Rachezug gegen die Dietmarschen, die im Jahre 1144 den Grafen Rudolf von Stade erschlagen hatten. Sie halfen dem Herzog die trotzigen Bauern unterwerfen, deren Grafschaft dieser seitdem für sich in Anspruch nahm. Zum


|
Seite 23 |




|
Dank für den glücklichen Verlauf des Zuges bestätigte der Herzog dem Kloster Neumünster, dem Sitz des großen Wendenmissionars Vicelin, auf dem Rückweg in Egenbüttel bei Pinneberg Ländereien an Wilster und Stör, die ihm Graf Adolf und andere Holsten geschenkt hatten. Hier wird auch comes Heinricus de Bodwide als Teilnehmer des Zuges unter den Zeugen genannt. 57 )
Inzwischen hatte in diesen Gegenden dank der eifrigen Tätigkeit Vicelins das Christentum solche Fortschritte gemacht, daß man an die Neueinrichtung der drei wendischen Bistümer denken konnte. Um nun den Streitigkeiten, die zwischen Heinrich dem Löwen und Erzbischof Hartwig von Hamburg-Bremen über die Investitur dieser Bistümer ausgebrochen waren, ein Ende zu machen, ließ sich der Herzog im Jahre 1154 von Kaiser Friedrich Barbarossa das Recht der Investitur in den Bistümern Oldenburg (Lübeck), Mecklenburg (Schwerin) und Ratzeburg sowie allen Bistümern, die er etwa in bisher noch heidnischen Gebieten einrichten würde, verleihen. 58 ) Noch im selben Jahre wurde als erstes der drei Bistümer Ratzeburg eingerichtet und der Propst Evermod vom Marien-Stift in Magdeburg auf Empfehlung Wichmanns dorthin als Bischof berufen. 59 )
Zu ihm stellte sich Graf Heinrich von Anfang an gut, sei es auf Wunsch seines Herzogs, sei es, weil er selbst erkannte, daß der Bischofssitz als Mittelpunkt des Christentums in seinem Lande auch ein Stützpunkt seiner Kolonisationspolitik sei. Damals verzichtete er auf die bereits erwähnten 300 Hufen seiner Grafschaft, mit denen das Bistum ausgestattet wurde. 60 ) Auch überließ er dem Bischof die Zehnten in der ganzen Grafschaft. Doch erhielt er von diesem den halben Zehnten als Lehen zurück, mit Ausnahme jedoch des Zehnten von den 300 Hufen, die frei von allen Abgaben blieben, und an denen der Graf keinerlei Anrecht behielt, und ebenso der curiae episcopales. Im übrigen konnten Bischof und Graf das Recht der Wiederverleihung des Zehnten in vollem Maße üben; nur mußten in jedem Dorfe mit zwölf oder mehr Hufen zwei Hufen, in jedem Dorf mit weniger als zwölf Hufen


|
Seite 24 |




|
eine Hufe zu "Settinke"-Recht, d. h. zehntfrei als Schulzenhof, verliehen werden. 61 ) So war Graf Heinrich auch Lehnsmann des Bischofs geworden. Und von Anfang an bestand, wie bereits erwähnt, zwischen ihm und Evermod das beste Einvernehmen. Helmold hebt ausdrücklich hervor, daß Graf Heinrich die 300 Hufen mit landesüblichem Maße ausgemessen habe und nicht wie Adolf von Holstein mit einem viel zu kleinen. In diesen Jahren wird es auch gewesen sein, daß Heinrich dem Bischof die Insel in dem Ratzeburger See, auf der bereits seine Burg stand, zum Wohnsitz gab, damit er im Schutze derselben um so ungestörter das Missionswerk treiben konnte. Denn solange der Bischofssitz sich in St. Georg am See befand, war er stets den Angriffen der Slaven ausgesetzt gewesen. In der Tat machte denn auch in ihrem Lande das Christentum weiterhin die besten Fortschritte, so daß Helmold schon zwei Jahre später von einer guten Vermehrung der Kirchen im Polabenland berichten kann, wobei er dem Eifer des Bischofs wie des Grafen gleiches Lob erteilt. 62 ) Hinter allem stand jedoch als treibende Kraft der Herzog;
ihn fürchteten die Slaven. Dafür ist außerordentlich bezeichnend das Wort des Obotritenfürsten Niklot, das er auf dem Landtag, den der Herzog zum Jahre 1156 nach Artlenburg berufen hatte, sprach. Der Herzog hatte hier die Slaven ermahnt, das Christentum anzunehmen. Darauf antwortete Niklot: "Mag der Gott, der im Himmel ist, dein Gott sein, du sei unser Gott. Verehre du jenen, wir wollen dich verehren." 63 ) Wahrscheinlich war es 1156, als Heinrich von Badewide den Herzog auf dem Zuge nach Friesland - wie es scheint, gegen die Rüstringer - begleitete, von dem er sich dann die zwei friesischen Gefangenen mitbrachte, von deren wunderdarer Errettung aus ihren Ketten Amold berichtet. 64 ) Und am Schluß desselben Jahres war er mit im Heere Heinrichs des Löwen, als dieser versuchte, den


|
Seite 25 |




|
durch Barbarossa eingesetzten, jedoch bald vertriebenen Dänenkönig Sven wieder zurückzuführen. 65 ) Heinrich spielt hierbei eine etwas zweideutige Rolle. Saxo 66 ) berichtet uns nämlich, daß ihn Waldemar, Knud Lawards Sohn, der spätere Waldemar der Große, mehrfach durch Unterhändler habe bitten lassen, doch ja den Rückzug des Herzogs zu verhindern, da er, seines Sieges gewiß, ihn überfallen wolle. Hierzu habe den König seine nahe Verwandtschaft mit Heinrich bewogen. Doch diesem kamen offenbar Bedenken über eine so verräterische Handlungsweise gegenüber seinem Herzog. Als ihn dieser daher scherzend nach seinem "regulus", d. h.Waldemar, fragte, da wurde das sächsische Heer durch die Schilderungen Heinrichs von der Stärke des feindlichen Heeres an weiterem Vordringen verhindert, wenngleich Heinrich selber, getreu der Aufforderung seines Verwandten, zum tapferen Kampf riet. "So teilte er," sagt Saxo, "seine Treue zwischen den Bitten des Freundes und dem Befehl des Herzogs, um weder des einen Auftrag zu vernachlässigen noch durch Schweigen des anderen Sicherheit zu gefährden." Saxo hält offenbar diese. diplomatische Klugheit für ganz gerechtfertigt; wir vermögen sie leider mit der Treue eines Lehnsmannen nicht in Einklang zu bringen. Übrigens zeigt diese Erzählung, daß auch unter dem Gefolge des Herzogs nicht überall felsenfeste Treue zu finden war. - Saxo nennt hier Heinrich von Badewide zwar lediglich "Henricus, nobilis inter Saxones vir"; doch kann hier, schon nach den ganzen Beziehungen, nur an den Ratzeburger Grafen gedacht werden, den Saxo auch ein anderes Mal, wo nur der Ratzeburger Graf gemeint sein kann, einfach als Henricus bezeichnet. 67 ) So haben denn auch ältere Forscher darunter undedenklich Heinrich von Badewide verstanden. 68 )
Doch immer noch nicht konnten die Slaven zur Ruhe kommen, und gegen sie richtete sich fortwährend in erster Linie die Tätigkeit


|
Seite 26 |




|
Heinrichs des Löwen und seiner Grafen. Als nun der Herzog im Jahre 1159 mit Barbarossa den zweiten Italienzug antrat, verpflichtete er die Slaven samt ihrem Führer Niklot, in seiner Abwesenheit mit Sachsen und Dänen - auf letztere hatten es die Wenden ganz besonders abgesehen - Frieden zu halten. Zur größeren Sicherheit befahl er, daß alle wendischen Piratenschiffe seinem Abgesandten in Lübeck ausgeliefert würden. Die Wenden jedoch lieferten nur ein paar alte untaugliche Schiffe zum Schein ab; mit den übrigen unternahmen sie, sobald der Herzog diesen Gegenden den Rücken gekehrt hatte, einen Einfall in Dänemark. Als dann Heinrich, der sich bei Crema vom Heere des Kaisers trennte, Anfang 1160 nach Sachsen zurückkehrte, berief er sofort einen Landtag für sämtliche "Markmannen", 69 ) deutsche wie slavische, nach Darvörde bei Hittbergen a. d. Elbe. Bis Artlenburg kam auch König Waldemar von Dänemark, um sich über die von den Slaven ihm zugefügten Unbilden zu beschweren. Und da diese selbst, ihrer Schuld sich wohl bewußt, nicht beim Landtag erschienen, so wurden sie vom Herzog geächtet und für die Erntezeit ein Heereszug gegen sie angeordnet. 70 ) Wieder ging man wie 1147 von zwei Seiten gegen sie vor; vom Westen Heinrich der Löwe und seine Grafen, vom Norden Waldemar von Dänemark. Doch diesmal mit besserem Erfolg. Mit Feuer und Schwert wurde das Land verwüstet. Was von den Sachsen nicht zerstört wurde, vernichteten Niklot und seine Söhne, an der Gnade des Herzogs verzweifelnd, selber. 71 ) Und zur Befestigung seiner Herr-schaft teilte Heinrich der Löwe ihr Land jetzt an deutsche Herren auf, nachdem Niklot, der ewig unruhige Slavenfürst, bei diesem Zuge erschlagen war. Jetzt stand der Ratzeburger Graf nicht mehr allein an der Slavengrenze; sondern der Herzog setzte hier eine Reihe von Herren seines Gefolges aus der Braunschweiger Gegend als Burgvögte ein, 72 ) vor allem den Edlen Gunzel von Hagen mit seinem Gefolge in der Burg Schwerin. Und während die übrigen Herren im Jahre 1167 ihr Land wieder an Niklots Sohn Pribislav, der das Christentum annahm, verloren, 73 ) entwickelte


|
Seite 27 |




|
sich das Schweriner Gebiet dank der persönlichen Tüchtigkeit Gunzels zur mächtigsten Grafschaft im Wendenlande. Mit ihm zusammen finden wir fortan die Ratzeburger Grafschaft häufig genannt.
Im Anschluß an diesen Zug von 1160 wurden nun die Dinge im Slavenland endgültig geregelt. 74 ) Fußend auf dem ihm 1154 von Friedrich I. verliehenen Recht der Investitur ließ sich Heinrich der Löwe jetzt nach seinen Verdiensten auf dem zweiten Römerzug von den drei Bischöfen den Lehnseid leisten. 75 ) Jetzt stattete er auch das dritte der wendischen Bistümer, das Mecklenburger, nach dem Vorbild Ratzeburgs und Oldenburgs mit 300 Hufen aus. 76 )
Für einige Jahre herrschte jetzt Friede im Slavenland. 77 ) Bischöfe und Grafen wetteiferten in der Kolonisation des Landes, indem sie die Wenden veranlaßten, entweder deutscher Bebauungsweise sich anzupassen oder deutschen Ansiedlern Platz zu machen. Wie Adolf von Holstein Holländer, Friesen und Westfalen an Stelle der vertriebenen Slaven im Lande angesiedelt hatte, so zog auch Heinrich von Badewide jetzt zahlreiche Westfalen ins Land. Und auch die von Heinrich dem Löwen beim letzten Kriegszuge eroberten Burgen Ilow, Euscin, Malchow und vor allem Schwerin, Gunzels Sitz, mit ihrer Umgebung wurden von deutschen Ansiedlern besetzt. 78 ) Immer mehr wurden die Slaven zurückgedrängt. Wie hier die Grafen Heinrichs des Löwen, ging in der Altmark und in Brandenburg Albrecht der Bär rücksichtslos gegen sie vor und besiedelte das ihnen abgenommene Land mit Holländern, Seeländern und Flandern. 79 ) Von den Ansiedlern 80 ) im Polabenland und Obodritien berichtet uns Helmold, daß sie,


|
Seite 28 |




|
obwohl mitten unter Slaven wohnend - Helmold vergleicht sie deswegen mit den drei Männern im feurigen Ofen -, dennoch ihrer Verpflichtung gegen die Kirche durch regelmäßige Zentzahlung nachkamen im Gegensatz zu den Holsten in Wagrien, deren Land früher kolonisiert und also ertragreicher war. 81 )
Jener Kriegszug von 1160 bildet überhaupt einen bedeutsamen Einschnitt in der Geschichte der Wendenlande. Voll Stolz datierte Heinrich der Löwe nach ihm die Urkunde, durch die er im Jahre 1162 dem Propst und den zwölf Domherren in Ratzeburg 27 Mark aus dem Zoll zu Lübeck verlieh. 82 ) Diese Urkunde ist noch deshalb von besonderer Bedeutung für uns, weil wir aus ihr erfahren, daß Heinrich von Badewide auch Vogt der Kirche zu Ratzeburg war, ein Verhältnis, über das wir sonst nichts wissen. 83 ) Neben Graf Heinrich ist hier auch sein Sohn Bernhard Zeuge. Dieser, der zum erstenmal im Jahre 1161 in Braunschweig als Zeuge bei einer Verleihung Heinrichs des Löwen an Kloster Riddagshausen auftritt, 84 ) wird von jetzt ab bereits mehrfach in den Urkunden neben seinem Vater genannt. Auch er wird schon jetzt als "comes" bezeichnet, ein Beweis, daß dies Wort seine ursprüngliche Bedeutung bereits völlig verloren hatte und lediglich ein Titel war. Beide, Vater und Sohn, finden wir im selben Jahre noch einmal als Zeugen genannt, als Erzbischof Hartwig Elbe und Bille zu Grenzen des Ratzeburger Bistums bestimmt. 85 )
Im Juli des folgenden Jahres finden wir Heinrich zusammen mit Heinrich dem Löwen bei der Einweihung der Marienkirche in Lübeck, wohin der Herzog eine glänzende Versammlung geistlicher und weltlicher Herren berufen hatte. 86 ) Auch Erzbischof


|
Seite 29 |




|
Hartwig war hier anwesend, und nach zehnjähriger Feindschaft söhnte er sich jetzt mit dem Herzog aus. - Bei dieser Gelegenheit wird auch der Inhalt der im Lüb. U.-B. II, l Nr. 6 und 7 S. 8-11 abgedruckten beiden Urkunden festgestellt sein, so daß, wenn Graf Heinrich von Ratzeburg in diesen angeblich zu Verden im Jahre 1164 am 12. Juli ausgestellten Urkunden als Zeuge fungiert, daraus für den terminus ad quem leider nichts zu schließen ist. Wir können sie als letzte urkundliche Nachricht für den ersten Ratzeburger Grafen, so wichtig das gerade in unserem Falle wäre, daher nicht benutzen, wie das noch zuletzt Schmeidler in seiner Ausgabe des Helmold getan hat. 87 ) Denn da Herzog Heinrich am 7. Juli 1164 in Demmin war und von dort weiter ins Slavenland in der Richtung auf Stolp vordrang, 88 ) konnte er nicht am 12. Juli in Verden sein. Auch wird in der Urkunde Nr. 7 der am 6. Juli bei Verchen gefallene Graf Adolf von Holstein 89 ) als Zeuge genannt. Andererseits ist es doch höchst wahrscheinlich, daß Urkunden, die für die Domherren zu Lübeck gegeben wurden, eben bei der Stiftung des Doms festgestellt sind, zumal die Zeugenreihen der beiden Urkunden mit jener im M. U.-B. I, 78 große Ähnlichkeit haben. Auch weisen annus regni wie annus imperii auf 1163 hin. 90 ) Als letzte urkundliche Nachricht über Graf Heinrich von Ratzeburg haben wir vielmehr die im U.-B. d. Stadt Lübeck I S. 4/5 abgedruckte Urkunde Heinrichs des Löwen anzusehen. Danach ist er am 18. Oktober 1163 auf dem Landtag in Artlenburg zugegen, als der Herzog den Streit zwischen Deutschen und Goten auf Gotland schlichtet und den Goten die ihnen bereits von Kaiser Lothar gewährten "Friedens- und Rechtsbestimmungen" bestätigt. 91 )


|
Seite 30 |




|
Würde man Saxo Grammaticus folgen, so wäre auch Heinrich von Ratzeburg im Jahre 1164 zusammen mit Adolf II. von Holstein, Gunzel von Schwerin und Keinold von Dithmarschen von Heinrich dem Löwen bei seinem Zuge gegen Pribislav und die Pommernfürsten Kasimir und Boigislav nach Verchen vorausgeschickt, wo dann am 6. Juli bekanntlich Adolf und Keinold ihren Tod fanden. 92 ) Allein, hier liegt ganz offensichtlich eine Verwechslung mit Graf Christian von Oldenburg vor. Helmold, der den ganzen Verlauf dieses Zuges sowie den Überfall bei Verchen sehr ausführlich und viel genauer als Saxo schildert, erwähnt den Grafen von Ratzeburg mit keiner Silbe, 93 ) was um so auffälliger wäre, falls Heinrich mit bei Verchen war, weil Helmold, wie bereits erwähnt, dem Ratzeburger Grafenhause sehr nahe stand. Dafür nennt er Graf Christian von Oldenburg an den Stellen, wo Saxo Heinrich von Ratzeburg hat. 94 ) Es ist doch wohl natürlich, daß man dem Geschichtsschreiber, der den Dingen örtlich wie zeitlich am nächsten steht, den Vorzug gibt. 95 )
Offen bleibt dabei die Frage, ob Heinrich beim Gros des Heeres in Malchow zurückblieb oder überhaupt an diesem Zuge nicht teilnahm. Möglich, daß er gerade während dieses Zuges jene Gesandtschaft ausführte, von der Saxo SS XXIX, 121 spricht. Danach soll er nämlich von Heinrich dem Löwen zusammen mit dem Lübecker Bischof Konrad 96 ) an König Waldemar geschickt sein, um des Herzogs zweite Tochter mit Waldemars Sohn Knud zu verloben und ihm dadurch die Freundschaft des Dänenkönigs wieHerzugewinnen, die er nötig hatte, um die Slaven in Schach zu halten. Saxo erzählt dies zwar im Zusammenhang von Er-


|
Seite 31 |




|
eignissen des Jahres 1167. Allein, dies Jahr ist völlig ausgeschlossen. Denn erstens lag um diese Zeit der Herzog im Streit mit Bischof Konrad wegen der Investitur, 97 ) und zweitens lebte, wenn nicht alle Anzeichen trügen, Heinrich von Ratzeburg im Jahre 1167 nicht mehr, worauf wir gleich zurückkommen werden. Nun ist schon v. Kobbe a. a. O. S. 150 Anm. 2 der Versuch gemacht worden, diese Gesandtschaft ins Jahr 1164 zu setzen, indem er annimmt, daß Saxo sie mit der von ihm selber auf S. 115 zum Jahre 1164 erzählten Verlobung der ersten Tochter Heinrichs des Löwen, Richenza, und mit der von Helmold auf S. 217 und den Annalen von Stade zum Jahre 1171 erzählten Verlobung mit der zweiten Tochter Heinrichs, Gertrud, der Witwe des Grafen Friedrich von Rothenburg, verwechselt habe. Zu demselben Resultat gelangt dann, und zwar, wie es scheint, vollkommen unabhängig von v. Kobbe, von Breska in den Forschungg. z. deutsch. Gesch. XXII, S. 590/94. 98 ) Und wenn man auch zugeben muß, daß immer noch Zweifel bestehen bleiben, so steht man doch vor der Wahl, entweder Saxos Bericht ganz zu verwerfen oder diese Gesandtschaft des Grafen Heinrich ins Jahr 1164 zu setzen. Man könnte dann annehmen, daß Graf Heinrich nach seiner erfolgreichen Sendung 99 ) bei seinem Verwandten Waldemar geblieben sei und in seinem Heere jenen Wendenfeldzug mitgemacht habe und daß auf diese Weise, da Helmold nur von einem Zusammentreffen Waldemars mit Heinrich dem Löwen spricht, sein Schweigen über eine Teilnahme Heinrichs von Ratzeburg zu erklären ist.
Noch im selben Jahre scheint dieser dann gestorben zu sein. Denn von 1164 an nennt Helmold als Grafen von Ratzeburg stets Bernhard. Selbst bei der Verteidigung des Ratzeburger Landes gegen die Slaveneinfälle unter Pribislav wird Heinrich nicht mehr erwähnt. 100 ) Und so dürfen wir wohl seinen Tod auf 1164 setzen. 101 ) Von seinem Sohn und Nachfolger Bernhard I. wurde ihm in Ratzeburg an der Grenze des Domhofes


|
Seite 32 |




|
ein Denkstein gesetzt, der noch heute dort steht und in Stein das Verdienst des ersten Ratzeburger Grafen um die Begründung des Christentums in seinem Lande bezeugt. 102 )



|



|
|
:
|
Bernhard I 1161-1195.
Wir haben bereits oben - S. 28 - gesehen, daß schon bei Lebzeiten des Grafen Heinrich sein Sohn Bernhard neben ihm als "comes" auftritt, teils mit seinem Vater zusammen, teils allein. Das erste Mal begegnen wir ihm, da wir die Ratzeburger Dotationsurkunde, die ihn schon im Jahre 1158 als Zeugen aufführt, ausschalten müssen, 103 ) im Jahre 1161 in Braunschweig im Gefolge Heinrichs des Löwen. 104 ) Mit ihm finden wir Bernhard in fast noch engerer Verbindung als seinen Vater. Ihn und Gunzel von Schwerin bezeichnet Helmold als die "boni satellites optimi ducis". 105 ) Wo er konnte, vertrat er die Interessen seines Herzogs. Das zeigt gleich sein erstes Auftreten, über das wir etwas Genaueres wissen. Im Jahre 1162 belagerte nämlich König Waldemar I. von Dänemark mit Hülfe der Rugianer Wolgast, das, unter eigenen Führern stehend, 106 ) seine Küsten durch Seeräuberei beunruhigt hatte. Ihm kam Bernhard von Ratzeburg, der eine Verwandte des Königs zur Gattin hatte, mit zwei Schiffen zu Hülfe. Als er nun bei einer Versammlung die Rugianer fragte, warum sie sich nicht um die Gunst des Herzogs von Sachsen bemühten, antworteten sie verächtlich, sie hätten vor dem sächsischen Namen keinerlei Respekt. 107 ) Bernhard aber versetzte stolz, was der Herzog vermöge, würden sie binnen


|
Seite 33 |




|
kurzem erfahren. 108 ) Und tatsächlich huldigten bereits im folgenden Jahre, als der Herzog zur Stiftung des Doms in Lübeck weilte, ihm die Rugianer. 109 )
Was uns außer der Erzählung Saxos von der Anhänglichkeit Bernhards an seinen Herzog an diesem Bericht in erster Linie wichtig erscheint, ist, daß Saxo die Gemahlin Bernhards eine "neptis" des Dänenkönigs nennt. Daß wir hier "neptis" nicht wörtlich als Nichte aufzufassen haben, 110 ) bemerkt schon v. Robbe a. a. O. S. 156 Anm. 14, indem er auf den mittelalterlichen Gebrauch hinweist, "nepos" und "neptis" ganz allgemein zur Bezeichnung eines verwandtschaftlichen Verhältnisses anzuwenden. 111 ) Diese Gattin Bernhards I. hieß, wie uns Arnold in seiner Slavenchronik berichtet, Margareta und war die Tochter des Pommernfürsten Ratibor I. von Schlawe, des "Seekönigs". 112 ) Die Gemahlin Ratibors, Pribislava, war die Tochter des Herzogs Boleslav Crivosti von Polen, dessen zweite Tochter, Richenza, in zweiter Ehe mit dem russischen Fürsten Wladimir von Halicz (Galizien) vermählt war. Aus dieser Ehe ging Sophia, die Gemahlin Waldemars I., hervor. Mithin wäre Margareta von Ratzeburg eine Base der Gemahlin Waldemars. 113 )
Wenn hier Bernhard sich dem dänischen König mit zwei Schiffen anschließt, so läßt das auf eine nicht unbedeutende Macht der Ratzeburger Grafen selbst zur See schließen. Und letztere, so mögen wir annehmen, unterstand wohl schon bei Lebzeiten seines


|
Seite 34 |




|
Vaters dem Befehl Bernhards. Nachdem nun Heinrich gestorden war, übernahm Bernhard auch die Grenzwacht gegen die Slaven, indem er sich, wie uns Helmold erzählt, den Grafen Adolf II. von Holstein zum Vorbild nahm, den bedeutendsten Vorkämpfer des Deutschtums in diesen Gegenden, der leider zu früh gestorben war. 114 ) Zwar, von einer Teilnahme Bernhards an dem großen Zuge von 1164 erfahren wir nichts. Doch hatte er bald anderweit Gelegenheit, seine Tüchtigkeit zu beweisen. Auf jenem Zuge war Werrislav vom Herzog bei Malchow aufgeknüpft worden, und es war von den Söhnen Niklots nur noch Pribislav übrig. Dieser blieb auch nach dem Kriege, durch den er der väterlichen Erbschaft verlustig gegangen war, bei den beiden Pommernherzögen, in deren Verbindung er jenen Aufstand unternommen hatte. 115 ) Alle drei bauten dann Demmin, das der Herzog völlig hatte zerstören lassen, wieder auf. Und von hier aus unternahm er nun häufig Beutezüge ins Obodriten- und Polabenland und führte Menschen und Vieh gefangen fort. Da war es neben Gunzel von Schwerin vor allem Graf Bernhard, der in häufigen Kämpfen die Streitmacht Pribislavs aufrieb, so daß diesem schließlich die Pommernherzöge mit Kündigung der Gastfreundschaft drohten, wenn er nicht endlich Ruhe halte, sondern fortführe, "die Augen der Männer des Herzogs zu beleidigen". 116 )
Bernhard hielt dann auch treu zum Herzog, als jetzt unter Führung Wichmanns von Magdeburg und Albrechts des Bären der langverhaltene Unwille über des Herzogs herrisches Auftreten und seine wachsende Macht, "die Verschwörung aller gegen einen" zum Ausbruch kam, die im Süden mit der Belagerung von Haldensleben, einer der festesten Burgen des Herzogs, im Norden mit dem Einfall Christians von Oldenburg, der bisher eifrig auf seiten des Herzogs gegen die Slaven gekämpft hatte, in das Bremerland begann. Zwar haben wir dafür kein Zeugnis weiter als eine Urkunde, die vom Jahre 1167 datiert, deren Inhalt jedoch spätestens im Sommer 1166 festgesetzt ist. 117 ) Hier treffen wir unter den


|
Seite 35 |




|
Heinrich treu gebliebenen Herren 118 ) auch Bernhard von Ratzeburg. Ausdrücklich bezeugt ist uns eine Parteinahme für den ,Herzog nur von Gunzel von Schwerin und erst zum Jahre 1168 beim Streit um die Besetzung des Bremer Erzbischofssitzes. 119 ) Doch ist als sicher anzunehmen, daß bei all den Kämpfen dieser Jahre die Grafen im Nordosten des Gebietes Heinrichs seine zu- verlässigsten Anhänger waren. Alle, nicht nur der Ratzeburger, auch der Schweriner, Dannenberger und Lüchower Graf verdankte dem .Herzog ihre Stellung. Dazu hatte er, als der Kampf auszubrechen drohte, Pribislav wieder zu Gnaden angenommen und ihm alles Land außer der Grafschaft Schwerin zurückgegeben und in Holstein zum Vormund des jungen Adolfs III. den ihm er-gebenen Heinrich von Schwarzburg eingesetzt. 120 ) So war die Stellung Bernhards von vornherein gegeben.
Genannt finden wir ihn erst wieder im Jahre 1169, wo er am 7. November zu Artlenburg Zeuge ist, daß Herzog Heinrich die drei wendischen Bistümer mit je 300 Hufen ausstattet. 121 ) Wir haben oben - S. 23 f. - gesehen, daß dies in Ratzeburg schon im Jahre 1154 geschehen war und daß. wahrscheinlich auch im Jahre 1158 Heinrich der Löwe hierüber eine Urkunde, die jedoch verloren ist, ausgestellt hatte. Doch erst nach und nach waren die Dinge hier im Slavenland geordnet. Nun, war im Jahre 1166 der Oldenburger Bischofssitz nach Lübeck 122 ) und um 1166 der Mecklenburger nach Schwerin verlegt. 123 ) Und es wurden nun die Bestimmungen für alle drei Bistümer gleichmäßig gegeben. 124 ) Es werden unter anderem hierbei für die 300 Hufen


|
Seite 36 |




|
die wogiwotnitza, der Herzogszins der Slaven, erlassen und der Umfang der biscoponitza, des Bischofszinses, auf drei Kuriz und einen Schilling vom Haken festgesetzt. 125 ) Von den Gerichtsbußen für Kapitalverbrechen fallen zwei Drittel dem Bischof, ein Drittel dem Vogt zu, was hier für uns von besonderem Interesse ist, da die Ratzeburger Grafen ja Vögte des Stiftes waren. 126 ) Wenn so die drei Bistümer endgültig eingerichtet werden konnten, so war das wesentlich mit Bernhard von Ratzeburg zu danken. Von Helmold und Arnold wird einstimmig sein hervorragendes Verdienst um die Vollendung des "Gotteswerkes im Polabenlande" hervorgehoben. "Er führte glänzender aus, was sein Vater begonnen. 127 ) Und ganz in dessen Weise ging er vor, indem er die Slaven, die sich dem Christentum nicht unterwarfen, ohne Bedenken aus dem Lande trieb und dieses an deutsche Kolonisten aufteilte. 128 ) Auch trug seine Verbindung mit einer pommerschen Fürstentochter sehr zum Frieden des Landes bei, wie uns Arnold berichtet.
Ebenso wurde er durch seine Verwandtschaft mit dem dänischen Königshause veranlaßt, mit diesem in Frieden zu leben, wozu


|
Seite 37 |




|
noch kam, daß. er einen Teil Schleswigs vom Dänenkönig zu Lehen trug. So wird er denn häufig eine vermittelnde Rolle zwischen seinen beiden Lehnsherren gespielt haben. Das war besonders notwendig in den Kämpfen beider um den Besitz von Rügen, die auch nach dem Vertrage von 1166 129 ) fortdauerten. Als nun im Jahre 1168 Waldemar sich Rügens bemächtigte, ohne mit dem Herzog jenem Vertrage gemäß die Beute zu teilen, da hetzte Heinrich die wendischen Herren in Wagrien und dem Obodritenland wie die Fürsten von Pommern gegen ihn, die mehrere Jahre hindurch in häufigen Raubzügen seine Küsten in dauernder Angst und Unruhe halten mußten. Und sicherlich hatte es seine Billigung, wenn auch die deutschen Grafen und Herren sich an solchen Beutezügen beteiligten. Im Jahre 1171 130 ) beschlossen diese, die die Zeit zu solchem Unternehmen für besonders günstig halten mochten, einen Kriegszug gegen die Dänen, 131 ) als dessen Hauptführer Gunzel von Schwerin erscheint. Auf seinen Rat beschließt man, den Stoß gegen Schleswig zu richten. Doch weigert sich Bernhard von Ratzeburg entschieben, dorthin, wo er vom Dänenkönig belehnt war, einen Kriegszug zu unternehmen. An seiner und Heinrichs von Schwarzburg, des Statthalters von Holstein, Weigerung scheitert dann das ganze Unternehmen, und man beschließt, den Krieg bis zur Rückkehr des Herzogs aus Bayern zu verschieben. Doch ist dann sicher auch diese Angelegenheit bei der Zusammenkunft beider Fürsten an der Eider,


|
Seite 38 |




|
am 24. Juni 1171, beigelegt. 132 ) Diese friedliche Lösung war, wie gesagt, zum großen Teil Graf Bernhard von Ratzeburg zu danken.
Daß es sich bei diesem Lehnsverhältnis zum Dänenkönig nur um einen Teil von Schleswig handeln kann, 133 ) bemerkt bereits v. Kobbe a. a. O. I S. 157 Anm. 16 mit Recht. Er nimmt die Gegend an der nordfriesischen Grenze, in der Nähe des Lügumklosters, an und wird damit wohl das Richtige treffen. 134 ) Wir besitzen nämlich auch ein urkundliches Zeugnis für dies Lehnsverhältnis, das sogar noch bis in späte Zeit wirksam gewesen ist, wie das ja bei Besitzrechten im Mittelalter meist der Fall war. Ende des 13. Jahrhunderts erläßt nämlich "Johannes Tomessen miles, capitaneus castri Roetzburgh", zu sein und seiner Gattin Seelenheil dem Lügumkloster eine bestimmte Summe Geld, für die ihm das Kloster gewisse Dörfer in der Nähe des Klosters verpfändet hatte. 135 ) Suhm a. a. O. IX, 53 versteht unter diesem Roetzburgh richtig Ratzeburg. Falsch ist es dagegen, wenn er die Urkunde, der die Jahreszahl fehlt, ins Jahr 1204 setzt. Dem widerspricht schon der Wortlaut der Urkunde und vor allem der Ausdruck "capitaneus", der so früh in der Bedeutung von ."Befehlshaber" sich nicht findet. 136 ) Der Wahrheit nahe kommen die Verfasser des Index zu Langebek, Scriptores, die die Urkunde ins 14. Jahrhundert setzen wollen. 137 ) Dieser "Johannes Tomessen miles" ist nämlich niemand anders als der auch sonst bekannte Ratzeburger Vogt Johann von Erumessen, der Ende des 13. Jahrhunderts in Urkunden des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg mehrfach genannt wird. 138 )
In den nächsten Jahren sehen wir dann Bernhard dauernd in Verbindung mit Heinrich dem Löwen. Zum 9. September 1171 wird er als Zeuge genannt in der vermutlich zu Schwerin


|
Seite 39 |




|
ausgestellten Bewidmungsurkunde des Herzogs für das Bistum Schwerin. 139 ) Hierbei erhält u. a. der Ratzeburger Graf Einfluß auf die Festsetzung der Präbenden der Schweriner Domherren. 140 ) Und einige Tage später ist er Zeuge, daß der Herzog die curiae episcopales des Ratzeburger Bischofs von Heerfolge, Markding und Burgwerk befreit. 141 ) Am 9. Januar 1172 ist er, ebenfalls im Gefolge des Herzogs, Zeuge bei der Stiftung des Klosters Lüne durch Bischof Hugo von Verben, wahrscheinlich auf einem Landtag, den der Herzog zu Verben abhielt, bevor er seine Reise nach dem gelobten Lande antrat. 142 ) Von dort wird er den Herzog nach Braunschweig begleitet haben, um mit ihm und einer großen Zahl sächsischer Herren, unter diesen vor allem Bernhards Freund Gunzel, die Pilgerfahrt anzutreten. So treffen wir ihn dann in Jerusalem als Zeugen, daß der Herzog der dortigen Auferstehungskirche drei ewige Lampen stiftet. 143 ) Näheres über diese Reise Bernhards erfahren wir leider nicht. Im Dezember wird er mit dem Herzog wieder nach Deutschland zurückgekehrt sein. Wir finden ihn dann erst wieder genannt zum Jahre 1175 bei Gelegenheit der Dotierung der Kapelle St. Johannes auf dem Lande zu Lübeck durch den Herzog. 144 )
Wieder hören wir dann jahrelang nichts von Bernhard. Es macht sich hier das Fehlen aller von den Ratzeburger Grafen ausgestellten Urkunden recht fühlbar. 145 ) Als wir seinen Namen wiederfinden, ist ein Umschwung aller Verhältnisse eingetreten. Barbarossa, von Heinrich dem Löwen im Stich gelassen, hat die schwere Niederlage von Legnano erlitten. Und nun wird der


|
Seite 40 |




|
Herzog nicht mehr wie bisher von ihm gehalten, sondern der Kaiser läßt den Anklagen der zahlreichen Feinde des Löwen freien Lauf. Dieser jedoch kümmert sich um die Ladungen des Kaisers nicht. Weder zum Reichstag in Worms noch zu den seinetwegen anberaumten Gerichtstagen erscheint er, sondern fährt fort in seinen Kämpfen gegen seine Gegner. Und wieder sind es hauptsächlich die Grafen im östlichen Teil seines Gebietes, auf die er sich hierbei stützt. Im Juli des Jahres 1179 bringen sie, vor allem der junge Adolf III. von Holstein, der kürzlich die Grafschaft seiner Väter übernommen hatte, unser Graf Bernhard, Graf Bernhard von Wölpe, Gunzel von Schwerin und die Brüder Ludolf und Wilbrand von Hallermünde ein Heer auf, 146 ) um gegen die dem Herzog feindlich gesinnten westfälischen Grafen Simon von Teklenburg, Hermann von Ravensderg, Heinrich von Arnsberg und Widukind von Schwalenberg, die Teile der Länder des Herzogs besetzt hatten, zu ziehen. Mitten in das Gebiet dieser Herren dringen sie vor, und am 1. August kommt es zur Schlacht auf dem Halerfeld bei Osnabrück, wo eine große Anzahl Westfalen niedergemacht, noch mehr jedoch, darunter Graf Simon von Teklenburg, gefangen genommen werden. 147 )
Doch wegen der Gefangenen und des von ihnen zu erwartenden Lösegeldes geriet jetzt der Herzog in Streit mit einem Teil seiner Getreuen, vor allem mit Adolf von Holstein. Der Herzog, dessen trotzigen Sinn selbst die von allen Seiten hereinbrechenden Gefahren nicht zu irgendwelcher Nachgiebigkeit bewegen konnten, verlangte, weder gerecht noch klug handelnd, daß ihm sämtliche Gefangenen ausgeliefert würden. Dagegen machte Adolf mit Recht geltend, daß er, da er aus eigenen Mitteln ein Heer aufgebracht hätte, auch wohl das Lösegeld für seine Gefangenen beanspruchen dürfe, da es ihm sonst nicht möglich sei, ein zweites Mal den Herzog in dieser Weise zu unterstützen. Adolf behielt nun die Gefangenen; doch hatte er durch seinen Widerspruch den stolzen Herzog schwer gereizt. 148 ) Als dann nach dem siegreichen Zuge in das Thüringer


|
Seite 41 |




|
Gebiet im Mai des folgenden Jahres Gunzel von Schwerin, sei es aus Ergebenheit gegen den Herzog, sei es aus Rivalität gegen den Holsteiner, die Treue Adolfs beim Herzog verdächtigte und dabei vor allem auf jene Weigerung hinwies und nun der Herzog zum Beweis der Treue Adolfs seine Forderung wiederholte, verließ dieser voller Bitterkeit über so schnöde Behandlung mit seinem Anhang Braunschweig. Und nun besetzte der Herzog, dem solche Gelegenheit, das Gebiet eines untreuen Vasallen seinem Allod hinzufügen zu können, garnicht unerwünscht sein mochte, und der sich offenbar nach seinem Thüringer Siege wieder als Herrn der Lage fühlte, des Grafen Land. Er selbst eroberte Plön und setzte dort den ihm ergebenen Overboden Marcrad ein. Die stärkste Feste des Landes, Segeberg, ließ er durch Graf Bernhard von Ratzeburg belagern. Diese wurde, während Adolf das Land verlassen und sich auf die Schauenburg begeben hatte, von Mathilde, des Grafen tatkräftiger Mutter, verteidigt. Doch da der Schloßbrunnen versiegte, wurde endlich auch Segeberg zur Übergabe gezwungen und hier Lupold von Bayern als Schloßvogt eingesetzt. Das war im September 1180 geschehen. 149 )
Inzwischen jedoch war über den Löwen auf dem Tage zu Würzburg die Reichsacht verhängt. Zu Gelnhausen hatte man seine Herzogtümer bereits neu vergeben, 150 ) und von Tag zu Tag verringerte sich die Zahl seiner Anhänger, nachdem ihnen auf dem Hoftag zu Werla Entziehung von Lehen und Eigen angedroht war, wenn sie nicht spätestens bis Martini die Partei des Löwen verlassen hätten. 151 ) Kein Wunder, daß er, der nur durch eiserne Strenge seine Vasallen an sich gefesselt und wenig Liebe gesät hatte, jetzt überall Verrat witterte. So erhob er auch gegen Graf Bernhard, der bei ihm in Lüneburg weilte, Weihnachten 1180 die schwersten Beschuldigungen. Er wisse von seinen Getreuen zuverlässig, daß der Graf sich mit Feinden des Herzogs verschworen habe, ihn und seine Gemahlin nach Ratzeburg einzuladen und dort zu ermorden. Begründet war dieser Verdacht wohl nur auf Einflüsterungen von Feinden Bernhards und auf des Herzogs eigenem mißtrauischen Charakter. Nach allem, was wir von Bernhard wissen, ist ihm ein solcher Plan nicht wohl zuzutrauen. 152 ) Da


|
Seite 42 |




|
er sich nun gegen solche Verdächtigungen nicht genügend verantworten konnte, nahm ihn der Herzog samt seinem ältesten Sohn Volrad gefangen, zog mit einem Heere vor Ratzeburg und belagerte es. Und mit Hülfe der Lübecker, die ihm, offenbar aus Dankbarkeit für seine Wohltaten - denn ihre Macht und Blüte verdankten sie bekanntlich allein dem Herzog -, Schiffe, Waffen und Belagerungsmaschinen sandten, 153 ) wurde die Stadt bald bezwungen. Bernhard begab sich mit seiner Familie nach seiner Burg Gadebusch. Doch auch hier ließ ihm der argwöhnische Herzog keine Ruhe. "Weil er mit Feinden des Herzogs Freundschaft halte", 154 ) zog dieser zum zweitenmal mit Heeresmacht ins Land und zerstörte Gadebusch, wobei er nicht verschmähte, die vorgefundene reiche Beute mit sich zu nehmen. Er stürzte sich blind ins Verderben. In einem Augenblick, wo ihn die Feinde von allen Seiten bedrängten, wo der Kaiser sich rüstete, in eigener Person gegen ihn die Reichsacht zu vollstrecken, wo die erbetene Hülfe auswärtiger Fürsten versagt wurde, da trieb er langjährige erprobte Freunde, anstatt sie um so fester an sich zu ketten, durch Mißtrauen und Hartnäckigkeit zur Partei seiner Gegner. Wo es galt, alle Kraft gegen die alten Feinde zu sammeln, da verbrachte er die Zeit damit, sich neue zu schaffen, an den eignen Vasallen kleinliche Rache zu üben und in ihrem Lande Beute zu machen. Daß der Herzog auch in Ratzeburg einen Schloßvogt wie in Plön und Segeberg eingesetzt habe, hören wir nicht. Er ließ diese drei Burgen neu befestigen, um hier dem Angriff des Kaisers zu trotzen. 155 )
Im Juni rückte dieser nun mit einem starken Heere mitten durch die Lüneburger Heide auf die Elbe zu, vermutlich, um bei Artlenburg den Strom zu überschreiten und den Herzog, der sich in Lübeck befand, aus diesem seinem letzten Zufluchtsort zu vertreiden. In Bardowiek ließ er einen Teil seines Heeres unter dem neuen Herzog Bernhard und dessen Bruder, dem Markgrafen Otto I. von Brandenburg, zurück, um das dem Herzog treue Lüneburg, wo auch die Herzogin Mathilde sich befand, in Schach zu halten. Hier blieb wahrscheinlich auch Bernhard von Ratze-


|
Seite 43 |




|
burg, 156 ) der sich nach seiner Vertreibung aus Gadebusch zu Herzog Bernhard begeben hatte. Inzwischen wurde ihm durch seine Anhänger auf ganz unerwartete Weise seine Hauptstadt wiedergewonnen. Der Herzog nämlich begab sich, nachdem er Lübeck in Verteidigungszustand gesetzt hatte, nach Ratzeburg, um von hier aus die Elbe zu erreichen. 157 ) Als ihm nun am Morgen des 30. Juni die Besatzung der Burg das Geleit zur Elbe gab, ersahen die Freunde Bernhards die Gelegenheit, drangen in die Burg ein, warfen die wenigen zurückgebliebenen Leute des Herzogs hinaus und schlossen die Tore. Knirschend vor Zorn kehrte der Herzog auf die Nachricht hiervon um. Doch während er zu den Befehlshabern in Segeberg und Plön schickte, um die abtrünnige Festung wieHerzugewinnen, wurde ihm die Nachricht gebracht, der Kaiser rücke heran. Unverrichteter Sache setzte er nun seinen Weg nach Artlenburg fort, steckte, an allem verzweifelnd, diese wichtige Elbburg in Brand, damit sie dem Kaiser nicht in die Hände falle, und begab sich auf einem Kahne stromabwärts nach Stade. 158 )
Doch mit seinem Widerstand war es vorbei. Auch Lübeck ergab sich Friedrich, und der stolze Welfe war auf die Gnade seines kaiserlichen Vetters angewiesen. Auf einem Reichstag sollte seine Angelegenheit geregelt werden. Das geschah zu Erfurt im November 1181, wo man im wesentlichen die Würzburger Beschlüsse vom vorhergehenden Jahre wiederholte. Auch Graf Bernhard von Ratzeburg treffen wir hier im Gefolge des neuen Herzogs als Zeugen, daß Kaiser Friedrich Stadt und Burg Stade Erzbischof Siegfried von Bremen, einem Bruder des Herzogs Bernhard, verleiht. 159 ) Anknüpfend an diese Verleihung berichtet uns Arnold - II, 22 -, daß auch die aus ihren Ländern von Heinrich dem Löwen vertriebenen Grafen Bernhard und Adolf


|
Seite 44 |




|
"ihre Burgen und Provinzen vom Kaiser wiedererhalten hätten". Auch das ist wohl hier in Erfurt, wo wir auch Graf Adolf treffen, geschehen. Diese Nachricht ist jedoch nicht etwa so aufzufassen, daß diese beiden Grafschaften, wie z. B. die drei wendischen Bistümer 160 ) und die Stadt Lübeck, jetzt reichsunmittelbar wurden, 161 ) da wir später von der Huldigung des Grafen Bernhard an den Herzog hören, sondern es bedeutet lediglich eine Wiederherstellung der alten Verhältnisse in diesen Gegenden.
Bald darauf, wahrscheinlich im Frühling des nächsten Jahres, 162 ) kam dann Herzog Bernhard mit seinem Bruder, dem Markgrafen von Brandenburg, nach Artlenburg, um sich hier von den Grafen des östlichen Sachsens den Lehnseid schwören zu lassen. Der Aufforderung dazu kamen auch alle nach bis auf Adolf III. von Holstein. Mit ihm geriet Herzog Bernhard bald in offenen Streit, als er ihm das Ratkauer Land sowie die Stadt Oldeslo, die sich Adolf nach der Absetzung des Welfen angeeignet hatte, zu entreißen suchte. Und bald merkte man allgemein, daß nicht mehr eine so,wenn auch rücksichtslose, doch gewaltige Hand das Schicksal dieser Länder regiere wie bisher. "In jenen Tagen war kein König in Israel, es tat ein jeder, was ihm beliebte", so beginnt mit den Worten der Bibel Arnold von Lübeck sein drittes Buch. Und so war es in der Tat. Auf den stolzen Welfen, der hier ein eigenes Reich zu begründen im Begriffe stand, der die Slaven mit Kraft und Umsicht diesem Reiche unterwarf und dänische Übergriffe nachdrücklich zurückwies, dessen Machtwort allein hier Gültigkeit hatte, 163 ) folgte der zwar


|
Seite 45 |




|
persönlich tapfere, jedoch für eine solche Stellung, in der es galt, nach allen Richtungen hin trotzigen und eigenwilligen Elementen kraftvoll zu begegnen, viel zu schwache und wenig umsichtige Askanier, der wenig von der Art und vom Glück seines Vaters geerbt hatte, den dazu noch der Kaiser, der keine Sonder-macht in seinem Reiche wieder wünschte, nur lässig unterstützte, wenn er bei ihm Klage führte. 164 )
Freilich, es stand ihm auch nur ein kleiner Teil dessen, was Heinrich der Löwe an tatsächlicher Macht besessen, zu Gebote, da ja der größere Teil des Herzogtums an Philipp von Köln gekommen war. Aber umsomehr hätte er Ursache gehabt, zunächst vorsichtig zu versuchen, in seinem Lande Fuß zu fassen, indem er vor allem zu den Grafen sich gut stellte. Statt dessen ging er in allen Dingen schroff und völlig übereilt zu Werke. Kaum war er ins Land gekommen, so forderte er von seinen Untertanen neue, ganz unerhörte und unerträgliche Steuern. 165 ) Von den Bischöfen verlangte er die Investitur, die sie selbst Heinrich dem Löwen nur nach langem Widerstreben zugestanden hatten. 166 ) Endlich versuchte er, den Grafen Bernhard von Ratzeburg und Gunzel von Schwerin einen Teil ihrer Lehen zu entziehen. Da verbanden sich diese mit Adolf von Holstein. Alle drei zogen vor des Herzogs jüngst aus den Trümmern Artlenburgs erbaute Feste Lauenburg, 167 ) belagerten sie regelrecht unter Anwendung ihrer von Heinrich dem Löwen erlernten Kriegskunst und nahmen sie nach wenigen Tagen ein. Nicht genug damit, suchten sie sich der Macht des Herzogs der nicht imstande war, 168 ) dem offenbaren Aufruhr zu steuern, sondern sich klageführend an den


|
Seite 46 |




|
Kaiser wandte, vollends zu entziehen. Sie verjagten die Freunde des Herzogs aus dem Lande. Und zwar wandten sie sich zunächst gegen Nikolaus oder Niklot, den Sohn des 1164 vor Malchow erhängten Wertislav, der mit seinem Vetter Borvin oder Heinrich, dem Sohne Pribislavs und Schwiegersohn Heinrichs des Löwen, um die Herrschaft im Obodritenlande kämpfte und dabei, wie es scheint, von Herzog Bernhard unterstützt wurde. Mit Heeresmacht zogen sie gegen Ilow, drangen bei Nacht und Nebel auf einem geheimen Wege in die Burg, vertrieben die Mutter Niklots, nahmen die Besatzung gefangen und brannten die Feste nieder. Darauf kehrten sie, nachdem sie das Land in der üblichen Weise verwüstet hatten, mit reicher Beute heim. 169 ) Auf die BeschwErbe des Herzogs wurde dann im Dezember des Jahres 1182 auf dem Hoftag zu Merseburg der Streit zwischen ihm und den drei Grafen vom Kaiser dahin entschieben, daß Adolf von Holstein 700 und Bernhard und Gunzel je 300 Mark Pfennige zahlen und alle drei zusammen die zerstörte Lauenburg wieder aufbauen sollten. Das strittige Gebiet jedoch, das Ratkauer Land und die Stadt Oldeslo, behielt der Holsteiner. 170 )
Merkte man schon in diesen Kämpfen unbotmäßiger Vasallen gegen den Herzog das Fehlen der festen Hand des Löwen, dann wurde das noch offenbarer an der immer weiter um sich greifenden Eroberungslust der Dänen, die folgerichtig ihre Hoffnungen an den Sturz des Welfen geknüpft hatten und nun ihre Zeit für gekommen hielten. Kaum hatte Heinrich den Löwen sein Schicksal ereilt, als sie schon ihre Hand nach ganz Slavien ausstreckten. Schon fügten sich ihrem Befehle Bogislav von Pommern und Jarimar von Rügen, und erst durch Knuds, Waldemars I. Sohn, Eingreifen wurde der Streit im Obodritenlande zwischen Nilolaus und Borvin entschieben. 171 ) Ihrer Eroberungslust konnten sie um so ungehinderter folgen, als der Kaiser durch seine zweijährige Abwesenheit von Deutschland verhindert war, sie in die gebotenen


|
Seite 47 |




|
Schränken zurückzuweisen und der Herzog sowohl aus persönlicher Unfähigkeit wie aus dem Fehlen der nötigen Machtunterlage nicht imstande dazu war. Es kam hinzu, daß der seines Gebietes verlustig gegangene Welfe, dem das Reichswohl nie sehr am Herzen gelegen, diese Ambitionen seines dänischen Schwiegersohnes mit seinem Rat förderte. 172 ) So darf es uns nicht wundernehmen, daß der Dänenkönig, gereizt durch die beschämende Rücksendung seiner Schwester und seiner Mutter im Jahre 1187, nun offen die Feindseligkeiten gegen den Kaiser und das Reich begann und Anspruch erhob aus Wagrien, Holstein, Stormarn und das Polabenland, also auf ganz Nordalbingien. 173 ) Das bedeutete zwar einst-weilen nur ein Programm; denn noch verhinderte die Anwesenheit des Kaisers in Deutschland die Verwirklichung so ausschweifender Pläne. Doch mußten diese zu gelegener Zeit, wie sie dann die Bürgerkriege zwischen Otto IV. und Philipp von Schwaben boten, wieder aufleben. Einstweilen hatten die Einfälle der Slaven, die Knud gegen diese Gebiete aufhetzte, nur die Folge, daß sich die Grafen um so enger an den Kaiser anschlossen. Nicht an den Herzog; denn der versagte angesichts solcher Aufgaben vollständig. Nicht einmal in seinem eigenen Lande war er fähig, Ruhe und Sicherheit aufrecht zu erhalten, 174 ) geschweige denn, daß er dem konsequenten und energischen Vorgehen der Dänen einen Riegel vorzuschieben vermocht hätte.
Dennoch hielten die so von außen bedrängten Herren keineswegs im Innern Frieden. Sowohl Adolf von Holstein wie Bernhard von Ratzeburg lagen im Streit mit Lübeck wegen der Ausdehnung der Grenzen und anderer Besitzrechte. Daher berief der Kaiser die streitenden Parteien zu seinem Hoftag, den er im September 1188 zu Leisnig - zwischen Dresden und Leipzig - abhielt. Hier schlichtete er den Grenzstreit der Lübecker mit Graf


|
Seite 48 |




|
Bernhard - nur dieser interessiert uns hier - dahin, daß zwischen beiden im Osten die Stepenitz mit der Radegast, im Süden der Ratzeburger See bis Ratzeburg und im Westen die Stecknitz und der Möllner See die Grenze bilden sollten. 175 ) Allem Anschein nach war diese Entscheidung sehr zum Vorteil der Lübecker. Denn ohne daß wir davon hören, daß dieso irgendwelche Anrechte hier erworben hätten, erscheinen sie jetzt in Gebieten, die einst den Ratzeburger Grafen gehört hatten - s. S. 19 u. Anm. 43 -. 176 ) Übrigens bleibt hier eine Unklarheit, wie weit man die Stecknitz als Grenze der Grafschaft zu rechnen hat. 177 ) Als im Jahre 1202 Waldemar der Sieger sich dieser Gebiete bemächtigt hatte, ließen sich die vorsichtigen Lübecker von ihm diese Rechte bestätigen. 178 )
Bei diesen unsicheren Zuständen und der völligen Schwäche des Herzogs ist es nicht verwunderlich, daß man sich allgemein nach der kräftigen Hand des verbannten Welfen sehnte. Als nun im Mai des Jahres 1189 der Kaiser seinen letzten Kreuzzug antrat, da hielt der Löwe, der diese Stimmung bei den Herren Norddeutschlands genau kannte und den ein gegebenes Wort nicht sonderlich kümmerte, die Gelegenheit für günstig, noch einmal sein Glück zu versuchen, um zumindest das Herzogtum Sachsen wiederzugewinnen. Von Erzbischof Hartwig II. von Bremen, der durch dieses Bündnis sein verlorenes Ansehen wiederherzustellen hoffte, mit offenen Armen aufgenommen und mit der Grafschaft Stade belehnt, bemächtigte sich Heinrich der Löwe mit Hülfe der Holsten und Stormarn zunächst der Grafschaft des mit dem Kaiser gezogenen Adolf III., seines alten Gegners. Sofort fielen ihm auch seine früheren Freunde, vor allem Graf Bernhard von Ratzeburg, der, wie es scheint, alle von ihm erlittene Unbill völlig vergessen hatte, Graf Bernhard von Wölpe und Helmold von Schwerin, Gunzels Sohn, zu. Mit deren kräftiger Unterstützung belagerte er zunächst Bardowiek, gegen das er aus den Tagen seiner Achtung tiefen Groll hegte. Am 28. Oktober, dem Tage Simonis und Judä,


|
Seite 49 |




|
wurde diese seit alters berühmte Stadt völlig zerstört. 179 ) Dann zog er vor Lübeck, wohin sich der Verweser Holsteins, Graf Adolf von Dassel, mit der Mutter und Gattin Adolfs von Holstein geflüchtet hatte. Doch ergaben sich die Lübecker aus Furcht, das Schicksal Bardowieks teilen zu müssen, ohne Schwertstreich, wobei sie nur freien Abzug für Adolf von Dassel und die holsteinischen Gräfinnen zur Bedingung machten. Hierher legte der Herzog eine welfische Besatzung unter Bernhard von Ratzeburg, Helmold von Schwerin und dem Truchseß Jordan von Blankenburg, die den Winter über in Lübeck blieb. 180 ) Mitte Dezember ergab sich auch Lauenburg, der Hauptstützpunkt Herzog Bernhards, und erhielt eine welfische Besatzung. 181 )
So war Heinrich der Löwe bereits wieder im Besitz ganz Nordalbingiens bis auf Segeberg, der festesten Burg des Grafen Abolf. Als er nun diese durch Walter von Baldensele 182 ) belagern ließ, fielen plötzlich die Holsten und Stormarn, die ihren Verrat am Grafen Abolf bereuten, von ihm ab und verhinderten so die Einnahme der Burg. Damit wandte sich das Blatt wieder. Adolf von Dassel kehrte zurück und brachte, als im Mai des folgenden Jahres die lübische Besatzung auszog, um die Holsteiner für ihren Abfall zu strafen, dieser nahe bei Lübeck eine empfindliche Niederlage bei. Mit knapper Not entrann der Ratzeburger Graf der Gefangenschaft, während Helmold von Schwerin und der Truchseß Jordan in sicheres Gewahrsam nach Segeberg gebracht wurden. 183 ) Wenn nun auch der Welfe, durch diese Unglücksfälle zur Nachgiebigkeit gestimmt, Frieden mit dem jungen Heinrich VI. schloß, 184 ) war er doch keineswegs gesonnen, die Bedingungen desselben zu erfüllen, sondern benutzte die Abwesenheit des Königs, um nach wie vor das Land des Holsteiner Grafen zu beunruhigen. 185 )


|
Seite 50 |




|
Dieser war auf die Kunde von den Vorgängen in seinem Lande in Tyrus umgekehrt, hatte König Heinrich in Schwaben getroffen und von ihm das Versprechen seiner Unterstützung erhalten. Als er jedoch zu seiner Stammburg gelangte, mußte er die Unmöglichkeit erkennen, seine Grafschaft zu erreichen; denn an der Elbe hinderte ihm der Herzog selbst, von Slavien aus dessen Schwiegersohn Borvin den Zutritt. Er wandte sich daher an den Herzog Bernhard und dessen Neffen, den Markgrafen Otto II. von Brandenburg. Diese beiden geleiteten ihn mit Heeresmacht nach Artlenburg, wohin ihm die Anhänger aus seiner Grafschaft unter Führung Adolfs von Dassel entgegenkamen.



|



|
|
:
|
Bernhard II. 1190-1197.
Diese erbitterten Kämpfe des hartnäckigen Welfen mit Adolf von Holstein, des alten Herzogs mit dem neuen, die diese Gegenden überhaupt in zwei Heerlager teilten, führten auch eine tiefe Spaltung im Ratzeburgischen Grafenhause herbei. Fortan bietet sich uns das wenig erquickliche Schauspiel eines heftigen Kampfes zwischen Vater und Sohn. Aus der Ehe Bernhards I. mit Margarete von Pommern waren drei Söhne hervorgegangen, von denen die beiden älteren, Valrad und Heinrich, das Kriegshandwerk erlernten, um dereinst ihrem Vater in der Grafschaft zu folgen, während der jüngste, Bernhard, nach der Sitte der damaligen Zeit, in den geistlichen Stand trat. Er wurde Kanonikus am Moritz-Dom zu Magdeburg 186 ) und ist offenbar identisch mit dem in Magdeburger Urkunden von 1185 bis 1189 mehrfach als Zeugen genannten Kanonikus Bernhard. 187 ) Als nun Volrad in den mannigfachen Kriegszügen seines Vaters gegen die Slaven, an denen er sich ebenso wie sein Bruder Heinrich aufs eifrigste beteiligte, 188 ) in einer Schlacht bei dem Versuch, seinen Vater zu schützen, selbst den Tod gefunden hatte 189 ) und auch Heinrich gestorben


|
Seite 51 |




|
war, 190 ) da wandte sich sein Vater an Heinrich den Löwen mit der Bitte, sich für seinen jüngsten Sohn beim Papste zu verwenden, damit ihn dieser seines Mönchsgelübdes entbinde. Der Herzog, dem selbstdaran liegen mußte, daß die ihm ergebene Ratzeburger Dynastie fortgesetzt wurde, wandte sich an Clemens III., der denn auch dem jungen Grafen den Dispens erteilte. 191 ) Seit dieser Zeit nahm nun der jüngere Bernhard, da sein Vater schon alt war, tätigen Anteil an der Verwaltung der Grafschaft. 192 ) Als jetzt Adolf von Holstein sich den Eingang in seine Grafschaft zu erzwingen versuchte, da schloß sich ihm auch Graf Bernhard aus Furcht, seines Landes verlustig zu gehen, an. Er hatte trotz seiner geistlichen Erziehung das Wesen der Politik nur zu wohl verstanden. Ein Gefühl der Dankbarkeit gegen Herzog Heinrich, dem allein er den päpstlichen Dispens und damit seine Stellung verdankte, kannte er nicht. "Im Namen des Kaisers" trat er zu dem neuen Herzog über 193 ) und hatte damit die ganze Grafschaft in Händen, da Bernhard I. Heinrich dem Löwen die Treue hielt. So setzte sich auch die alte Feindschaft zwischen Adolf von Holstein und Bernhard I. von Ratzeburg fort. Denn diese beiden ehemaligen Waffengefährten lebten in bitterer Feindschaft, seitdem Bernhard dem Herzog Heinrich geholfen hatte, des Holsteiners Land zu unterwerfen. Und später, bei Adolfs III. Rückkehr, hatte Bernhard einen Teil der Vertriebenen gastlich aufgenommen. 194 )
Nachdem nun Herzog Bernhard und sein Neffe Adolf III. in seine Grafschaft zurückgeführt hatten, zogen sie wieder nach Hause, indem sie ihren Proviant den beiden Grafen, Adolf und dem jüngeren Bernhard, zur Belagerung Lübecks, das allein noch im Besitz des Welfen war, 195 ) zurückließen. Gegen diese beiden


|
Seite 52 |




|
schickte Heinrich nun - es war im Jahre 1191 196 ) - ein Entsatzheer unter Konrad von Rode, dem Statthalter Stades, und dem älteren Grafen Bernhard. Nachdem diese beiden bei Lauenburg heimlich über die Elbe gegangen waren, veranlaßten sie die Leute des jüngeren Bernhard, die bei Herrnburg, nahe Lübeck, standen, sich nach Ratzeburg zurückzuziehen und hoben so im Süden der Stadt die Belagerung auf. Am folgenden Morgen kam es jedoch zum Kampfe mit den Holsten 197 ) an der Schwartau, wo Konrad von Rode und Bernhard d. Ä. in die Flucht geschlagen und gezwungen wurden, sich nach Lübeck zurückzuziehen. Nun kehrte der jüngere Bernhard von Ratzeburg zurück und lagerte sich, noch verstärkt durch Leute des Grafen Adolf, der selbst krank zu Segeberg lag, wieder im Süden vor Lübeck. Sobald dies die Leute des Herzogs merkten, versuchten sie bei Nacht nach Norden durchzudringen, um auf einem anderen Wege wieder zur Elbe zu gelangen. Doch wurde ihre Absicht von dem jüngeren Bernhard durchschaut, der ihnen, durch die Wakenitz noch von ihnen getrennt, folgte und sie bei Boizenburg traf. Hier kam es zur Schlacht, und die welfische Partei erlitt abermals eine schwere Niederlage, so daß jetzt Adolf von Holstein, der auf diese freudige Botschaft hin gesund geworden war, daran denken konnte, sich Stades, der letzten Hauptstütze des Welfen, zu bemächtigen. Dies gelang ihm auch mit Hülfe Stadescher Gefangener, die ihm erzählten, daß man in der Stadt der Herrschaft des Löwen überdrüssig sei, in kurzer Zeit. 198 ) Bald folgte Lübeck. Beide Grafen zeichnete der Kaiser für ihr energisches Vorgehen mehrfach durch Geschenke aus. 199 )
Diese Erfolge der beiden Grafen bewirkten, daß jetzt endlich auch Herzog Bernhard seine Untätigkeit aufgab. Am 22. Februar 1192 200 ) rückte er mit einem starken Heere vor die Lauenburg, in der sich noch immer die vor drei Jahren hineingelegte Besatzung hielt, aufs eifrigste unterstützt von dem Holsteiner und dem jungen Ratzeburger Grafen, so daß man die Übergabe täglich erwartete. Doch erlitt hier der Herzog infolge seiner Sorglosigkeit eine schwere


|
Seite 53 |




|
Niederlage. Denn während Adolf von Holstein abwesend war und Graf Bernhard die Burg "Darsith" 201 ) belagerte, rückte ein welfisches Entsatzheer unter Graf Bernhard von Wölpe und Helmold von Schwerin deran und überwältigte das Heer des Herzogs, der sie zunächst gar nicht beachtet hatte und nun von dem plötzlichen Angriff völlig überrascht wurde. Mit knapper Not entging er selber der Gefangenschaft, während sein ganzes Heer gefangen genommen wurde und seine Gattin sich nach Ratzeburg flüchten mußte. 202 )
Natürlich wurde diese Zeit der allgemeinen Kämpfe und Unsicherheit auch benutzt, um Städte und Dörfer zu plündern und Beute zu machen. So waren auch - es scheint im Jahre 1193 gewesen zu sein - eines Tages Leute Helmolds von Schwerin, Bernhards von Wölpe und Bernhards I. von Ratzeburg auf eigene Faust in die Stadt Bardowiek eingedrungen, hatten die Domherren ausgeraubt, die Kirche zerstört und in jeder Hinsicht wie Räuber und Strauchdiebe gehaust. Die Klagen über diesen Plünderzug drangen selbst bis zum Papst, der nun, die drei Grafen aufforderte, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und den Schaden zu ersetzen. 203 )
Von irgendwelchem Einfluß des Herzogs Bernhard auf die Geschicke dieser Gegenden ist nicht das geringste zu spüren. Völlig selbständig handeln die Grafen hier. So schließt zugleich mit Markgraf Otto II. von Brandenburg und Adols III. von Holstein auch Bernhard von Ratzeburg im Jahre 1193 ein Bündnis mit Bischof Waldemar von Schleswig, der bereits das Herzogtum in Schleswig usurpiert und Dithmarschen vom Bremer Erzbischof
( ... )


|
Seite 54 |




|
erobert hatte und nun hoffte, mit ihrer Hülfe sich auf den dänischen Königsthron schwingen zu können. Das geschah teils wohl aus Tatendurst und Eroberungslust, teils auch aus Gegensatz zu König Knud, der mit Heinrich dem Löwen in Verbindung stand. 204 ) Ob dann auch Graf Bernhard sich an dem Zuge Adolfs, der ihn bis Schleswig führte, beteiligte, erfahren wir nicht. Dies Bündnis der Grafen mit Bischof Waldemar und dessen ehrgeizige Pläne scheiterten jedoch daran, daß ihn Knud bei einer Zusammenkunft hinterlistig gefangennahm. 205 ) Im folgenden Jahre zog nun Knud nach Holstein, um sich für den Einfall Adolfs zu rächen. Zwar wurde diesmal noch der Streit auf friedlichem Wege beigelegt, indem der Graf die Gnade des Königs mit einer Buße von 400 Mark erkaufte; doch zeigt bereits diese "erste Heerfahrt der Dänen ins Holstenland" die Tendenz, die dann sieben Jahre später zur Eroberung ganz Nordalbingiens führte. 206 )
Nachdem dann im März desselben Jahres zu Tilleda am Kyffhäuser die Aussöhnung zwischen Heinrich dem Löwen und dem Kaiser Heinrich stattgefunden und die Gegensätze hüben und drüben sich gemildert hatten, scheint sich auch im Ratzeburgischen Grafenhause eine Annäderung zwischen Vater und Sohn vollzogen zu haben. Der ältere Bernhard hatte die letzte Zeit in der Nähe des Welfen, teils wohl auf dessen Kriegszügen, teils in Braunschweig verbracht. 207 ) Als er nun sein Ende herannahen fühlte, ließ er sich nach Ratzeburg bringen und fand hier gastliche Aufnahme im Kloster, dessen Vogt er war und das er ja oft genug mit starkem Arm gegen die Slaven geschützt hatte. Und wenn auch der jüngere Bernhard, eingedenk der langen Feindschaft, ihn in seine Burg nicht aufgenommen hatte, so teilte er sich doch mit seiner Mutter in die Pflege des kranken Vaters. Und hier im Kloster zu Ratzeburg beschloß der ältere Graf Bernhard seine


|
Seite 55 |




|
Tage, wie es scheint, im Jahre 1195, also im selben Jahre wie sein großer Herzog, dem er in mannigfachen Kämpfen beigestanden hatte. 208 )
Nicht lange überlebte ihn sein Sohn. Noch zwei Zeugnisse von dessen Tätigkeit besitzen wir für die Zeit nach jenem fehlgeschlagenen Bündnis mit Bischof Waldemar von Schleswig. Im Jahre 1194 ist er Zeuge in einer Urkunde Isfrieds von Ratzeburg, der durch Schiedsrichter eine Trennung zwischen den Stiftsgütern des Bischofs und des Domkapitels vornehmen läßt. 209 ) Es scheint danach, daß er mit diesem, trotzdem Isfried ein eifriger Anhänger Heinrichs des Löwen war, in einem besseren Verhältnis gestanden hat als sein Vater, von dem der Bischof zur Zeit der Entzweiung Bernhards und des Herzogs wegen seiner Freundschaft mit dem letzteren mancherlei Bedrückungen zu ertragen gehabt hatte. 210 ) Zum letztenmal finden wir Bernhards II. Namen in einer Urkunde Kaiser Heinrichs VI., der auf seinem ersten großen Reichstag zu Gelnhausen am 24 Oktober 1195 bestimmt, daß die Grafschaft Stade zu 2/3 an den Erzbischof Hartwig II. von Bremen, zu 1/3 an den Grafen Adolf III. von Holstein fallen soll. 211 ) Ein bis zwei Jahre später ist auch er zu Ratzeburg einer Krankheit erlegen. 212 ) Jedenfalls lebte er im Jahre 1198 nicht mehr. In diesem Jahre unternahm nämlich König Knud einen Zug gegen


|
Seite 56 |




|
Otto II. von Brandenburg, der versucht hatte, sich die Pommern zu unterwerfen. Da traten ihm, bevor der Markgraf herankam, die Ranen, Obodriten und Polaben - mit diesem Ausdruck scheint Arnold jetzt nur die slavischen Bewohner der Grafschaft Ratzeburg zu bezeichnen - entgegen. Im folgenden Winter machte dann wieder der Markgraf zusammen mit Adolf von Holstein einen Einfall ins Slavenland. Und im Sommer 1199 rückte Knud bis zur Eider vor, um sich an dem Holsteiner zu rächen. Doch verlief auch dieser Zug noch, da Adolf von einer großen Anzahl mächtiger Herren unterstützt wurde, ergebnislos. 213 ) Da bei all diesen Kämpfen der Name Bernhards nicht mehr genannt wird, so wird man anzunehmen haben, daß er bereits gestorden war. 214 )



|



|
|
:
|
Adelheid von Ratzeburg.
Bernhard II. war vermählt gewesen mit Adelheid, der Tochter des Grafen Konrad von Wassel - zwischen Hannover und Peine -, Vicedominus von Hildesheim, und Adelheids, Gräfin von Hallermünde am Deister, wahrscheinlich einer Schwester der beiden Grafen Ludolf und Wilbrand von Hallermünde, die Arnold II, 13 als Freunde und Verbündete Heinrichs des Löwen nennt. 215 ) Da ihre Herkunft, soviel auch darüber bereits geschrieben ist, meist unrichtig angegeben wird, 216 ) andererseits aber gerade für diese frühe Zeit die genealogischen Zusammenhänge


|
Seite 57 |




|
von höchster Wichtigkeit sind, so muß hier, obwohl diese Arbeit im wesentlichen eine Darstellung der territorialen Verhältnisse zum Ziele hat, auf die Genealogie der Gräfin Adelheid etwas näher eingegangen werden. Toeche, Jahrbb. unter Heinrich VI. S. 211 Anm. 5 macht sie zu einer Tochter des Grafen von Querfurt und einer Schwester des Hildesheimer Bischofs Konrad I. von Ravensderg. Allein, hier liegt eine Verwechslung mit Adelheid, der zweiten Gemahlin des Grafen Adolf III. von Holstein vor, die nach Arnold V, 1 in der Tat eine Tochter Burchards von Querfurt war. 217 ) Dagegen machen sie Mooyer in dem eben zitierten Aufsatz und das M. U.-B. Bd. IV, Person.-Reg. S. 102, "Adelheid 8" zu einer Tochter des Grafen Günther von Käfernburg. 218 ) Auch das ist, falls die Vermutung des Freiherrn von Grote in dem eben zitierten Aufsatz S. 241, der annimmt, daß sich die Mutter Adelheids von Ratzeburg, Adelheid von Haller-münde, in zweiter Ehe mit dem Grafen Günther von Käfernburg vermählt habe, zutrifft, nur insoweit richtig, daß dieser also der Stiefvater der Gräfin von Ratzeburg war.
Diese Gräfin Adelheid finden wir zum erstenmal im Jahre 1189 genannt, wo sie zusammen mit ihrer Schwester Fritherun an das Kloster Marienberg bei Helmstedt in der Nähe gelegene Güter teils verkauft, teils verschenkt. 219 ) Nach dieser Urkunde ist Adelheid, die ältere von den beiden Töchtern des bereits verstorbenen Konrad von Wassel, damals noch unvermählt. Bald darauf wird sie dann die Gemahlin Bernhards II. von Ratzeburg geworden sein. Nachdem nun dieser im Jahre 1197 gestorben und ihm ihr Sohn, Bernhard III., nach wenigen Jahren im Tode nachgefolgt war, vermählte sie sich, damit dem letzteren die Dynastie Heinrichs von Badewide erloschen war, wieder, und zwar mit dem schon mehrfach genannten Grafen Adolf von Dassel. 220 )
Wir finden ihren Namen dann noch mehrfach bis zum Jahre 1244 in Urkunden genannt. Besonders interessiert uns hier die M. U.-B. I, 160 abgedruckte, aus der Zeit ihrer Witwenschaft. 221 )


|
Seite 58 |




|
wo sie als comitissa de Raceburg eine Seelenmesse für ihre als Nonne verstorbene Schwester Fritherun stiftet 222 ) und daher zugunsten des Ratzeburger Doms auf alle ihr von dem Dorfe Walksfelde zustehenden Rechte verzichtet. Es ist dies ein Beweis, daß in der Grafschaft Ratzeburg ebenso wie in Schwerin 223 ) die weibliche Erbfolge galt. An und für sich wäre es ja denkbar, daß sie diese Schenkung nur als Vormünderin ihres Sohnes macht. Aber abgesehen davon, daß die Urkunde nichts davon erkennen läßt, ist es sehr unwahrscheinlich, da die Schenkung für ein Glied ihrer Familie gemacht wird. AußErbem nennt sie sich auch noch später mehrfach Gräfin von Ratzeburg. So verkauft sie als Alheidis comitissa de Ratisburch im Jahre 1224 mit Zustimmung ihrer "Erben" Ludolf, Adolf und Berthold und ihrer Tochter Adelheid, der späteren Gemahlin des Grafen Ludwig I. von Ravensderg, zehn Hufen, acht Höfe und eine Wiese in Hamersleben - nordwestlich Oschersleben - an das dortige Kloster des Hl. Pankraz. 224 ) Diese hier genannten Erben sind ihre Kinder aus zweiter Ehe mit dem bereits verstorbenen 225 ) Grafen Adolf von Dassel. Der Ausdruck "deredes" für Söhne hat hier, wo ihre Tochter Adelheid ausdrücklich als filia bezeichnet wird, etwas Auffälliges, und so bezeichnet sie denn das Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt II S. 114 Anm. 1 als Neffen der Gräfin Adelheid und hält sie offenbar für Söhne Ludolfs, des Bruders Adolfs von Dassel. 226 ) Das ist unrichtig. Denn um 1230 verkauft Gräfin Adelheid von Ratzeburg mit Einwilligung ihrer "Söhne und Erben" dem Kloster Riddagshausen eine Hufe von ihrem Erbteil in Hedeper - südöstlich Wolfenbüttel -, und ihre Söhne Ludolf und Adolf geben dazu ihre Einwilligung. 227 ) Hier ist der Ausdruck "filii et deredes" offenbar eine Tautologie; gemeint sind die obengenannten beiden Söhne. Der nicht mehr genannte Berthold mag bereits verstorben sein. Auch kommt der Ausdruck heredes für Söhne in mittelalterlichen Urkunden häufiger vor. Es sind auch nicht etwa Stiefsöhne Adelheids, wie M. U.-B. I, 382 Anm. und


|
Seite 59 |




|
Mooyer a a. O. S. 97/98, irregeführt durch den Ausdruck "comites de Dasle", meinen, 228 ) aus einer ersten Ehe Adolfs von Dassel. Eine solche erste Ehe, die demnach in der Heimat des Grafen geschlossen sein müßte, ist, da wir ihn dauernd in unsern Gegenden finden, sowie überhaupt nach allem, was wir von ihm wissen, ganz unwahrscheinlich. Daß die Söhne den Titel ihres Vaters annehmen, ist nur natürlich, da dessen Ansprüche auf die Grafschaft Ratzeburg von Herzog Bernhard von Sachsen nie anerkannt waren. 229 )
Von der Abstammung Adelheids aus dem Hause der Grafen von Hallermünde finden sich später noch Spuren. Im Jahre 1237 verkauft Ludolf, Graf von Hallermünde, mit Einwilligung seines Bruders Wilbrand, Erzbischofs von Magdeburg, seiner Schwester Adelheid, Gräfin von Ratzeburg, und seines Sohnes Ludolf dem Kloster Marienthal drei Hufen seines Erbes in Hamersleben - siehe oben S. 58 - 230 ) Endlich besitzen wir noch eine Urkunde von ihr aus dem Jahre 1244, in der sie am 6 Mai zu Hoya ihrer Tochter, der Gräfin Adelheid von Ravensderg, ihre zeitlichen Güter überträgt. 231 ) Infolge der Vertreibung ihres zweiten Gatten und der unruhigen folgenden Zeiten - siehe folgenden Abschnitt - scheint sie seit 1201 nicht mehr nach Ratzeburg gekommen zu sein, wenngleich sie sich stehts als Gräfin dieses Landes bezeichnete.



|



|
|
:
|
Adolf von Dassel, Graf von Ratzeburg.
Mit dem als Kind verstorbenen Bernhard III. war, wie erwähnt, das Haus der Ratzeburger Grafen erloschen. So bemächtigte sich denn auf Grund seiner Heirat mit der Witwe Bernhards II. Adolf von Dassel der Grafschaft schon mehrfach sind


|
Seite 60 |




|
wir diesem Namen im Verlauf unserer Arbeit begegnet, und da er in diesen Gegenden eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat, wird es nötig sein, kurz auf seine Geschichte einzugehen. Ein Neffe des bekannten Kölner Erzbischofes und Kanzlers Friedrichs I. Rainald von Dassel, war er von Haus aus begütert im Wolfenbüttelschen und Magdeburgischen. 232 ) Doch erscheint er schon früh in unsern Gegenden in Verbindung mit seinem "Vetter" Adolf III. von Holstein. 233 ) Im Jahre 1179 nahm er teil an der Schlacht auf dem Halerfelde und weigerte sich ebenso wie Aldolf von Holstein, seine Gefangenen auszuliefern, und mit ihm verließ auch er die Partei des Herzogs. Als dann im Jahre 1189 der Holsteiner mit dem Kaiser ins gelobte Land zog, machte er Adolf v. Dassel zum Verweser seines Landes, und tapfer verteidigte dieser es gegen die Übergriffe des aus der Verbannung zurückgekehrten Welfen (s. oben S. 48/49). Auch als acht Jahre später der abenteuerfrohe Holsteiner abermals mit vielen anderen deutschen Fürsten dem Kaiser voraus ins heilige Land zog 234 ), wird er den bewährten Grafen von Dassel wieder zum Verwalter seines Landes gemacht haben. So wird ihn umgekehrt auch Adolf von Holstein bei der Besitznahme der Ratzeburger Grafschaft nach besten Kräften unterstützt haben. Freilich, viele Schwierigkeiten hat ihm diese wohl nicht bereitet. Denn wenn ihm auch nach Lehnrecht die Grafschaft nicht zustand 235 ), so wird ihm doch der Herzog Bernhard, viel zu schwerfällig und völlig gleichgültig gegen solche Übergriffe, wie er war, keinerlei Hindernisse in den Weg gelegt haben. Denn


|
Seite 61 |




|
sowohl vorder wie auch später noch treffen wir Adolf von Dassel in des Herzogs Gefolge, so z. B. ist er noch kurz vor seiner Heirat mit der Gräfin Adelheid bei Bernhard in Hildesheim und Goslar. 236 )
Adolf von Holstein, offenbar der tüchtigste, aber auch unruhigste Herr dieser Gegend, hatte sich seit seiner Trennung von Heinrich dem Löwen nie mit dem Welfen ausgesöhnt. Die unruhigen und verwirrten Zeiten des deutschen Bürgerkrieges um den Königsthron benutzend, zog er nun im Sommer des Jahres 1200 mit dem gleichgesinnten neuen Grafen von Ratzeburg vor die Lauenburg, die einzige den Welfen an der Elbe verbliebene Festung, in der jetzt eine Besatzung des Pfalzgrafen Heinrich, des ältesten Sohnes Heinrichs des Löwen, lag. Durch die Erbauung der Burg Haddenberg 237 ) und durch Belagerungsmaschinen und Schiffe, die der Holsteiner aus Hamburg herbeiholte, wurde die Besatzung zu Lande wie zu Wasser aufs schwerste bedrängt. Da faßte sie den Entschluß, um nicht den Grafen in die Hände zu fallen, sich dem Dänenkönige auszuliefern. Zwar wurde dieser Plan durch die beiden Grafen, die, sobald sie davon Kunde erhalten hatten, ihre Anstrengungen verdoppelten, vereitelt; doch wir sehen, welchen Einfluß bereits die Dänen infolge der Schwäche und Uneinigkeit der deutschen Fürsten bis tief in deutsches Gebiet hinein ausübten. Seit den wechselseitigen Einfällen des vorigen Jahres - s. S. 55/56 - waren sie von der Eider nicht mehr zurückgewichen, sondern lagen hier auf der Lauer, jeden Augenblick bereit, ihre Eroberungen bis zur Elbe auszudehnen. Bereits hatte der Holsteiner Graf dem König Knud die eben von ihm als Schutz gegen die Dänen wiederhergestellte Rendsburg ausliefern müssen, der sie nun aufs beste ausbaute. Mit dieser starken Grenzfestung hielt er den Schlüssel zum Lande Adolfs in Händen.
Ja, in Holstein selbst bestand eine dänische Partei der angesehensten und einflußreichsten Männer 238 ), die, durch Geldgeschenke und Lehenversprechungen Knuds und seines Bruders bestochen, nur darauf wartete, mit dem jetzt mächtig sich entwickelnden Königreiche vereinigt zu werden. Vor allem betrieben dieses Ziel die im Jahre 1181 bei des Grafen Rückkehr vertriebenen Verwandten und Freunde des Overboden Marcrad, die


|
Seite 62 |




|
sich damals zum Dänenkönig begeben hatten und nun willige Vermittlerdienste zwischen ihm und den Holsten leisteten. 239 ) Bei dieser Sachlage, wo wir Dänenfreundlichkeit bei den Holsten wie bei der Besatzung Lauenburgs erblicken, konnte es nur noch eine Frage der Zeit sein, daß diese Gebiete in dänischen Besitz übergingen.
Hatte schon der Umstand, daß ihm Lauenburg entgangen war, den Zorn Knuds gegen die beiden Grafen erregt, so geschah das noch mehr durch einen Einfall, den sie im folgenden Jahre nach Dithmarschen, das schon längst vom Dänenkönig beansprucht wurde 240 ), unternahmen. Wie es scheint, hatten sie diesen Zug gewagt im Vertrauen auf welfische oder staufische Hülfe, deren sie sich nach dem Bündnis zu Hamburg im Anfang dieses Jahres 241 ) sicher glauben mochten. Doch diese Hülfe blieb aus. Unaufhaltsam brach jetzt das Unheil über die beiden herein. Als erster mußte Adolf von Dassel seine Unbesonnenheit büßen. Auf Geheiß Knuds fielen die von ihm abhängigen Slavenfürsten Borvin und Niklot in die Ratzeburger Grafschaft ein. Als ihnen nun Adolf mit einem Heere entgegenzog, kam es am 25. Mai 1201 bei Waschow - 1/2 Stunde westlich Wittenburg - zur Schlacht. 242 ) Durch den Tod Niklots, der gleich zu Anfang der Schlacht fiel, wurden die Slaven zu maßloser Wut angestachelt und machten bis auf 700 Gefangene das ganze Heer nieder, sodaß kaum der Graf mit wenigen Begleitern entkam. Und seit dieser unglücklichen Schlacht, die durch seinen Mutwillen herbeigeführt war, hatte er allen Anhang im Lande verloren.


|
Seite 63 |




|
Einige Monate später ereilte auch Adolf von Holstein sein Geschick. Nichts half es ihm, daß er sich jetzt angesichts der von den Dänen drohenden Gefahr mit dem Pfalzgrafen Heinrich aussöhnte 243 ); denn der erwartete welfische Beistand blieb aus. Und am 14. September rückte der Herzog Waldemar von Schleswig, Knuds Bruder, mit einer bedeutenden Heeresmacht in Holstein ein und schlug den ihm entgegenrückenden Grafen Adolf, dem es bereits Schwierigkeiten gemacht haben mochte, in seinem abtrünnigen Lande überhaupt noch ein Heer zusammenzubringen, bei Stellau unweit Kellinghusen, sodaß sich der Graf fliehend nach Hamburg zurückziehen mußte. Itzehoe und Plön fielen in die Hände des Herzogs, während sich Segeberg, von jeder der festeste Platz des Landes, und Travemünde noch eine Weile gegen seine Belagerung zu halten vermochten.
Nachdem Waldemar so Bresche gelegt hatte, war es ihm ein Leichtes, sich mit Hülfe des kriegerischen Bischofs Peter von Roeskilde, mit dem zusammen er nach einem sechswöchigen Waffenstillstand Ende Oktober nach Holstein zurückkehrte, des ganzen Landes zu bemächtigen. Über Hamburg, wo ihn Klerus und Volk mit besonderen Ehrungen empfingen, und Bergedorf zog er dann weiter vor die Lauenburg. Hierher kamen ihm die Bewohner Ratzeburgs entgegen und boten ihm, um einem Einfall vorzubeugen, die Unterwerfung der Grafschaft an. Denn Adolf von Dassel hatte aus Furcht, von seinen eigenen Untertanen verraten zu werden, angesichts der Erfolge des Herzogs das Land verlassen und sich wahrscheinlich schon jetzt zu König Otto IV., bei dem wir ihn im Jahre 1204 finden 244 ), begeben. Waldemar baute nun die von den beiden Grafen nach der Besitznahme Lauenburgs zerstörte 245 ) Burg Haddenberg wieder auf und legte eine starke Besatzung hinein, um während seiner Abwesenheit diese wichtige Elbburg in Schach zu halten, und begab sich dann nach Ratzeburg, wo er die Unterwerfung dieser Stadt sowie Wittenburgs und Gadebusch's entgegennahm. Am 1. November war die Eroberung Holsteins und Ratzeburgs vollendet 246 ); nur noch


|
Seite 64 |




|
Segeberg, Travemünde und Lauenburg hielten sich, mit deren Eroberung Waldemar jedoch bereits die eigenen Landsleute der Belagerten beauftragen konnte.
Auch das wichtige Lübeck ergab sich ihm jetzt, aus Furcht, seine Schiffe zu verlieren. Diese waren nämlich wie alljährlich zum Fischfang auf Schonen ausgezogen und samt ihrer Bemannung dem Herzog in die Hände gefallen. Auch war es bereits von jeglicher Verbindung zu Lande wie zu Wasser abgeschnitten 247 ) und konnte auf auswärtige Hülfe nicht rechnen. Denn in Deutschland regte sich keine Hand zum Schutze des bedrohten Nordalbingien. König Philipp, vielleicht noch am ersten zu helfen bereit und imstande 248 ), war fern im Süden seines Reiches. Herzog Bernhard, der neben den beiden Grafen zunächst Betroffene, kümmerte sich nicht im geringsten um das Schicksal seines Herzogtums. In allem unähnlich seinem großen Vorgänger, ließ er schon seit langem die Dinge gehen, wie sie wollten, und sah gleichmütig zu, wie seinem Gebiet ein Stück nach dem andern entrissen wurde. Man wird unwillkürlich wieder an Arnolds scharfe, aber treffende Charakteristik erinnert. Der Welfe endlich, König Otto IV., dem wie seiner ganzen Zeit eine streng nationale Gesinnung völlig fernlag, hoffte offenbar an den Dänen Bundesgenossen für seine Kämpfe um den Königsthron zu finden. Daher zeigte er ihnen sein Einverständnis mit ihren Eroberungen, indem er sich durch eine zu Hamburg im Anfang des Jahres 1202 vereinbarte Doppelheirat aufs engste mit ihnen verbündete. 249 )


|
Seite 65 |




|
Auch Pommern und die Slavenländer waren nach und nach unter dänische Botmäßigkeit gekommen. Man hatte keine Zeit, sich um diese Gebiete zu kümmern, sondern verwandte sie lieder dazu, sich gegenseitig zu bekämpfen. So bröckelte von Deutschland, während es im Innern von Parteihaber zerrissen wurde, von außen ein Stück nach dem andern ab. Die Grafen und Herren dieser Gebiete waren auf sich allein angewiesen; weder Herzog noch König kümmerte ihr Schicksal. So konnte es geschehen, daß Adolf III. von Holstein, der nicht so vorsichtig wie sein Namensvetter, der Graf von Ratzeburg, sein Land verlassen hatte, sondern zäh das Seine zu verteidigen suchte, in die Hände der Dänen geriet und von ihnen im Triumphe durch das bisher von ihm beherrschte Land als Gefangener nach Dänemark geführt wurde. 250 ) Bald darauf ergaben sich auch Travemünde und Segeberg. Bereits nannte sich Waldemar, der seinem am 12. November 1202 verstorbenen Bruder Knud als König gefolgt war, "König der Dänen und Slaven und Herrn von Nordalbingien". 251 ) Nur die Lauenburg widerstand ihm noch. Endlich, im Herbst des Jahres 1203, wurde ihm auch diese gegen die Freilassung Adolfs von Holstein von ihrer tapfereren Besatzung ausgeliefert.
Und nun schritt er zu einer Neuverteilung dieser Gebiete. Während er selbst Dithmarschen samt den welfischen Alloden Gamme und Sadelbande behielt 252 ), belehnte er mit der Grafschaft Holstein und dem engeren Land Ratzeburg seinen 20jährigen Neffen und Großneffen des Herzogs Bernhard, den Grafen Albrecht von Orlamünde, den Sohn seiner Schwester Sophie und des Grafen Siegfried von Orlamünde. 253 ) In den Rest der Grafschaft Ratzeburg teilten sich Heinrich Borvin von Mecklenburg und Graf Gunzel von Schwerin, die damit den Lohn für ihre tätige Hülfe bei der Unterwerfung dieser Gebiete ernteten. 254 ) Und zwar erhielt Borvin das Land Gadebusch und Gunzel Wittenburg und Boizenburg. 255 ) Damit war die Grafschaft Ratzeburg endgültig zer-


|
Seite 66 |




|
trümmert, und zwar in der Weise, die dann für Jahrhunderte maßgebend blieb, wenngleich Graf Albrecht von Orlamünde für eine kurze Zeit das Wittenburger und Boizenburger Land, das er den Grafen von Schwerin genommen hatte, noch einmal mit dem Kernland der alten Ratzeburger Grafen in seiner Hand vereinte. 256 ) Von einer Tätigkeit des vertriebenen Grafen Adolf von Dassel ist in diesen Gegenden fortan nie mehr die Rede. Noch einige Male finden wir ihn als Zeugen genannt, wobei er im Gefolge des Herzogs Bernhard bald bei dem Welfen Otto IV., bald bei des Herzogs Neffen, dem Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg, erscheint. 257 ) Ein einziges Mal noch finden wir seiner Wirksamkeit als Grafen von Ratzeburg gedacht, als nämlich um das Jahr 1216 sein Nachfolger Albrecht den Hamburgern die Befreiung vom Zoll in Boizenburg, die ihnen Graf Adolf verliehen hatte, bestätigt. 258 ) Zwar verlangt in der Urkunde vom 24. September 1223 bei dem Vertrag über die Auslieferung des Königs Waldemar Graf Heinrich von Schwerin ausdrücklich, daß auch Adolf von Dassel sein Land wiedererhalten soll 259 ), doch hören wir nichts davon, daß er je dahin zurückgekehrt sei, was auch durchaus unwahrscheinlich ist. Denn schon im folgenden Jahre starb er. 260 )
Über zwanzig Jahre besaß hier dann Albrecht von Orlamünde ein wahrhaft fürstliches Reich. Nicht genug, daß, er zu seinem ihm 1203 verliehenen Gebiet nach und nach noch das Wittenburger und Boizenburger Land und als Vormund des


|
Seite 67 |




|
Enkels Waldemars die halbe Grafschaft Schwerin hinzuerwartet - nach der Metzer Abtretungsurkunde Kaiser Friedrichs II gehört ihm als Lehnsmann Waldemars alles Land zwischen Elbe und Elde 261 ), ja noch über die Elbe dehnte sich sein Gebiet aus. 262 ) Gern bezeichnete er sich in dieser Zeit neben seinen andern Titeln auch als Grafen von Ratzeburg 263 ), ein Zeichen, daß dieser Begriff einstweilen noch fortbestand. Als solcher entschied er im Jahre 1204 die zwiespältige Bischofswahl in Ratzeburg zugunsten Philipps und verwandte sich für ihn, den Dänenfeind, bei König Waldemar. 264 ) Als solcher bestätigt er den Hamburgern das bereits erwähnte Privileg über die Zollbefreiung zu Boizenburg 265 ) und macht Schenkungen an die Kirchen zu Dergedorf und Ratzeburg. 266 )
Doch als dann im Jahre 1223 infolge der Gefangennahme Waldemars des Siegers durch den Grafen Heinrich von Schwerin der Stern der Dänen sank, da war's auch mit der Herrschaft Albrechts vorbei. In der unglücklichen Schlacht bei Mölln im Januar 1225 geriet er gar in die Gefangenschaft des Schweriner Grafen und wurde zu seinem Oheim Waldemar nach Schwerin gebracht. 267 ) Und nachdem im zweiten Vertrag über seine Freilassung am 17. November 1225 König Waldemar auf alle seine Eroberungen zwischen Eider und Elbe hatte verzichten müssen, und nachdem dann seine trotzdem aufrechterhaltenen Ansprüche durch die Schlacht bei Bornhoeved endgültig zurückgewiesen waren, werden hier wieder die alten Rechtsverhältnisse eingetreten sein, wie sie im Jahre 1203 geschaffen waren. Das heißt, Land Gadebusch blieb bei der Herrschaft Mecklenburg, von der es, da Borvin treu zum Dänenkönig gehalten hatte, auch während der Dänenherrschaft wohl nicht getrennt war; die Länder Wittenburg und Boizenburg erhielt der Graf Heinrich von Schwerin


|
Seite 68 |




|
zurück 268 ); und endlich das engere Gebiet von Ratzeburg zog der im Jahre 1226 von den kleineren Herren als Herzog ins Land gerufene Sohn des Herzogs Bernhard, Albrecht 269 ), als herrenloses Lehngut ein und bildete daraus zusammen mit einigen linkselbischen Besitzungen und der vielumstrittenen, eben den Dänen entrissenen Lauenburg 270 ) das Herzogtum Sachsen-Lauenburg, das ja dann bis zum Jahre 1689 bestanden hat. 271 ) Damit verschwindet der Begriff der Grafschaft Ratzeburg aus der Geschichte.
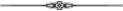


|
Seite 69 |




|
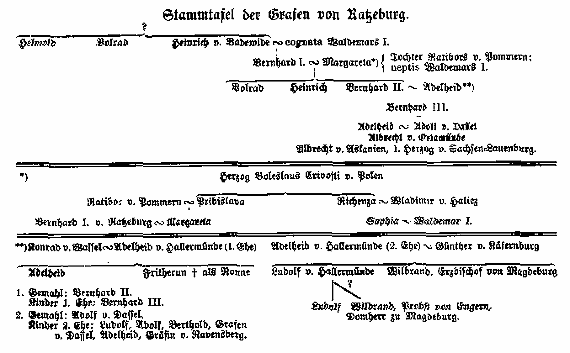


|
Seite 70 |




|
Kapitel II.
Geschichte der Grafen von Dannenberg.
Nicht allein auf dem rechten Elbufer wohnten Slaven. Dieser Fluß hatte ihnen bei ihrem Vordringen in die von den Langobarden zur Zeit der Völkerwanderung verlassenen Gebiete keineswegs Halt geboten. Sicher waren sie schon damals in einzelnen Splittern in das Gebiet vorgedrungen, das noch heute nach ihnen das Hannoversche Wendland heißt und das etwa dem Gebiet der Kreise Lüchow und Dannenberg entspricht. Verstärkt wurden sie dann, als in den Sachsenkriegen Karls des Großen viele Sachsen gerade aus diesen Gebieten weggeführt und von ihm in den verlassenen Sitzen Slaven oder, wie sie von den Deutschen genannt wurden, Wenden 1 ) angesiedelt wurden. Hier bildeten sie fortan einen eigenen Gau, dessen Name Drevani noch in dem heutigen Drawehn im Kreise Lüchow erhalten ist. So werden sie dann von späteren Schriftstellern selbst Trivani genannt 2 ); doch ist das offenbar lediglich eine Herleitung von jenem Gaunamen. 3 ) In den gleichzeitigen Quellen fehlt jeglicher Name für diese linkselbischen Slaven, wie denn Adam von Bremen und Helmold gänzlich von ihnen schweigen. Daß sie nicht wohl zu den Polaben zu zählen seien, wurde bereits gezeigt. 4 ) Eher möchte man an einen Zusammenhang mit den Obodriten denken, von denen sie vielleicht ein Splitter waren. Meitzen im zweiten Bande seiner "Siedelung und Agrarwesen" S. 370 hat für die Wenden, die sich zwischen Jeetzel und Milde, einem Zufluß der Biese bei Gardelegen, ausdehnten, die Bezeichnung Lipanische Wenden. Woher er diesen Namen, der sich sonst nirgends findet, hat, gibt er leider nicht an. 5 ) Als sicher darf man wohl annehmen, daß


|
Seite 71 |




|
diese Wenden im Gau Drevani, die durch eine südwärts der Einmündung des Cateminer Baches in die Elbe verlaufende Linie vom Bardengau getrennt waren 6 ), sowohl mit den Slaven der heutigen Altmark wie mit den rechts der Elbe zwischen Dömitz und Boizenburg wohnenden Smeldingern oder Smolinzern im engsten Zusammenhang standen.
Dieser Rückhalt, den sie besonders an den großen Slavenstämmen rechts der Elbe, vor allen den Obodriten, fanden, war auch wohl der Grund, daß die Billunger, die im Drawehn-Gau nominell die Grafschaft besaßen 7 ), hier wenig auszurichten vermochten. Fortwährende Grenzkämpfe mit den Bewohnern des Bardengaus waren die Folge. Auch waren die Verhältnisse im sächsischen Herzogtum einer planmäßigen Kolonisation in dieser Gegend nicht günstig, da die fortwährenden Aufstände der Sachsen gegen die fränkischen Kaiser und die Schwäche der späteren Billunger ein tatkräftiges Vorgehen gegen die Wenden verhinderten. Ob hierin schon unter dem tüchtigen Herzog und späteren Kaiser Lothar, der über die slavischen Gebiete rechts der Elbe mit aller Entschiedenheit eine Oberlehnsherrschaft in Anspruch nahm 8 ), irgendwie Wandel geschaffen wurde, vermögen wir bei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten aus dieser Zeit nicht zu erkennen. Sicherlich kann von einer nennenswerten Kolonisation unter ihm nicht die Rede sein. Auch hier wie rechts der Elbe im Obodritenland und SIavien blieb diese dem großen Enkel Lothars, Heinrich dem Löwen, vorbehalten. Unter ihm wetteiferten Klöster und weltliche Herren, das Wendenland der deutschen Kultur zu gewinnen. 9 )
Dieser energischen Kolonisationspolitik Heinrichs des Löwen verdanken auch die beiden im Hannoverschen Wendlande unter ihm auftauchenden Grafschaften, die von Lüchow und die von Dannenberg, ihre Bedeutung. Während dabei nun die Einrichtung der Grafschaft Lüchow immerhin noch an eine bereits bestehende Grafschaft, nämlich die zu Warpke, anknüpft, ist die Grafschaft


|
Seite 72 |




|
Dannenberg eine völlige Neuschöpfung dieses größten Kolonisators des Mitteltalters. Davon, daß die Grafschaft Dannenberg bereits von Karl dem Großen eingerichtet sei, wie ältere Forscher gemeint haben, kann gar keine Rede sein. Diese Ansicht, deren Urheber Pfeffinger in seiner ,,Historie des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses" 10 ) zu sein scheint, beruht auf einer völligen Verkennung der Verhältnisse, indem man vergaß, daß es sich hier um ein ursprünglich wendisches Gebiet handelt. So ist denn auch in den Urkunden - denn abgesehen von ganz wenigen Nachrichten aus literarischen Quellen müssen wir unsere Kenntnis dieser Dinge völlig aus ihnen schöpfen - von einer ursprünglich nur richterlichen Funktion bei den Grafen von Dannenberg wie bei denen von Lüchow ebensowenig zu erkennen wie bei den rechtselbischen Grafschaften Ratzeburg und Schwerin. Von Anfang an treten sie auf als Lehnsträger eines bestimmten Gebietes mit größerer oder geringerer Selbständigkeit, je nachdem das Herzogtum Sachsen, von dem sie abhängig sind, in starken und energischen Händen liegt wie zur Zeit Heinrichs des Löwen, oder in schwachen wie bei Herzog Bernhard und seinen Nachfolgern. Ebenso wie bei jenen besteht auch hier von vornherein das Prinzip der Erblichkeit: auch diese Grafschaften werden verwaltet von Dynastengeschlechtern. 11 )
Doch ein Unterschied besteht zwischen der Ratzeburger und der Dannenberger Grafschaft. Finden wir jene immer nur abhängig vom sächsischen Herzogtum, so lernen wir die Dannenberger Grafen von Anfang an auch als Lehnsträger der Markgrafen von Brandenburg kennen. Ja, als dann später die Trennung zwischen dem Gebiet des sächsischen Herzogs und welfischem Allod stattfand, da ging die Dannenberger Grafschaft von drei oder, wenn man die wenigen Lehen, die die Grafen vom Verdener Bistum hatten, mitrechnen will, sogar von vier Herren zu Lehen. Ein Umstand, der mit dazu beigetragen hat, daß das Wesen dieser Grafschaft von einigen älteren Forschern gänzlich verkannt wurde, indem diese bisweilen die Markgrafen von Brandenburg, bisweilen die Bischöfe von Verden als die eigentlichen Oberlehnsherren ansahen. Doch kann ein Zweifel darüber, daß die um 1153 auf-


|
Seite 73 |




|
tauchende Grafschaft Dannenberg ebenso wie die von Ratzeburg und Schwerin eine Gründung Heinrichs des Löwen und also ihrem Kern nach vom sächsischen Herzogtum abhängig ist, nach Prüfung der uns erhaltenen Nachrichten nicht mehr bestehen.



|



|
|
:
|
Volrad I. ca. 1153(45) - ca. 1167.
Der erste Dannenberger Graf ist Volrad I. aus dem Hause der Edlen von Salzwedel. Mit seinem vollen Titel finden wir ihn freilich erst mehrere Jahre nach seiner Einsetzung genannt. In der bereits bei Heinrich von Badewide erwähnten Urkunde Heinrichs des Löwen vom Jahre 1162 - M. U.-B. I, 74 - ist er als "comes Vollaradus de Dannenberg" Zeuge, daß, der Herzog dem Probst und den zwölf Domherren zu Ratzeburg 27 Mark aus dem Zoll zu Lübeck verleiht. 12 ) Hier treffen wir ihn auch zum ersten Male als Grafen im Gefolge des Löwen. Doch wenn nicht alles trügt, ist er bereits siebzehn Jahre früher nachzuweisen. In einer ebenfalls schon bei Heinrich von Badewide erwähnten Urkunde vom Jahre 1145, in der Konrad III. den Vertrag des Magdeburger Domherren und späteren Bremer Erzbischofs Hartwig sowie dessen Mutter, der Markgräfin Richardis, mit dem Magdeburger Erzbischof über Güter in Dithmarschen und Nortland bestätigt, sind u. a. als Zeugen genannt Friedrich von Salzwedel und dessen Bruder Volrad. Und zwar zwischen Graf Otto von Hillersleben und Heinrich von Badewide und dessen Brüdern. 13 ) Da Heinrich von Badewide aber damals bereits Graf von Ratzeburg war, so geht aus dieser Stellung, wenn man die bekannte Tatsache in Betracht zieht, daß im Mittelalter bei Aufführung der Zeugen streng auf die Rangordnung gesehen wurde, mit unzweifelhafter Sicherheit hervor, daß diese beiden Brüder de Salzwitelen, wenn sie auch nicht den gräflichen Namen führten, doch aus edlem Geschlechte waren.
Auch daß hier bereits, wo wir ihm zum ersten Male begegnen, Volrad in Verbindung mit dem Grafen Otto von Hillersleben - zwischen Neuhaldensleben und Wolmirstedt - auftritt,


|
Seite 74 |




|
ist sehr wichtig zur Feststellung seiner Identität mit dem ersten Dannenberger Grafen. Denn sieben Jahre später treffen wir ihn als Zeugen in einer Urkunde des Bischofs Ulrich von Halberstadt, in der dieser dem Kloster Hillersleben seine sämtlichen Besitzungen bestätigt. 14 ) Auch hier wird Volrad noch als "von Salzwedel" bezeichnet. Er sowohl wie der als Otto comes aufgeführte Graf Otto von Hillersleben erscheinen hier im Gefolge Albrechts des Bären. Endlich, in einer Urkunde, die der bekannte Erzbischof Wichmann von Magdeburg im Jahre 1157 für Kloster Ammensleben - das heutige Groß-Ammensleben auf dem rechten Ufer der Ohre, Hillersleben gegenüber - über eine Schenkung des Magdeburger Domherren Dietrich von Hillersleben, des Bruders des Grafen Otto, ausstellt, erscheint Volrad als "de Dannenbergh". 15 ) Hier erwähnt nämlich Wichmann, daß er jene Schenkung Dietrichs von Hillersleben bereits einmal, nämlich am Begräbnistage seines Bruders, des Grafen Otto von Hillersleben, einem 1. August, bestätigt habe in Anwesenheit des Markgrafen Albrecht und seiner Söhne Otto und Hermann und anderer namentlich aufgeführter Zeugen, von denen uns außer Volrad von Dannenberg auch Burchard von Falkenstein bereits aus der Urkunde vom 28. Juni 1152 bekannt ist. Das Jahr, in dem Otto von Hillersleben starb, nennt Wichmann zwar nicht; doch ist uns dieses von anderer Seite her bekannt. Nach den Pöhlder Annalen starben nämlich im Jahre 1154 kurz nacheinander "der Magdeburger Domherr Dietrich und sein Bruder Otto von Hillersleben". 16 ) Danach wäre also die Einrichtung der Grafschaft


|
Seite 75 |




|
Dannenberg auf die Zeit vom 28. Juni 1152 bis zum 1. August 1154 zu bestimmen. 17 )
Wollte man nun noch irgendwelche Zweifel hegen, daß unser Volrad mit Volrad von Salzwedel identisch sei, so dürfte ein Blick auf unsere Karte genügen, um aus den zahlreichen, durch spätere Urkunden erwiesenen Besitzungen der Grafen von Dannenberg gerade um Salzwedel herum zu erkennen, daß hier besondere Beziehungen bestanden haben, zumal wir Abbendorf ausdrücklich als Allod der Dannenberger Grafen genannt finden. 18 ) Wir gehen demnach schwerlich fehl, wenn wir annehmen, daß diese Besitzungen die Erbgüter Volrads waren. Denn von späteren Verleihungen in dieser Gegend an die Grafen von Dannenberg, etwa durch die Markgrafen von Brandenburg, hören wir nicht das mindeste. Andererseits erklärt sich auf diese Weise am einfachsten, daß wir bis gegen das Ende der Grafschaft Dannenberg die Grafen häufig in engster Verbindung mit den Markgrafen finden, zu denen sie doch an und für sich als Grafen von Dannenberg keinerlei Beziehungen hatten. Dementsprechend begegnet Volrad als ."von Salzwedel" nach 1152 nicht mehr, während sein Bruder Friedrich noch bis 1181 in Urkunden genannt wird. 19 )
Eins bleibt freilich dunkel, nämlich, warum Heinrich der Löwe zum Grafen von Dannenberg einen Vasallen Albrechts des Bären einsetzte. Darüber, daß die Grafschaft ebenso wie die von Lüchow von ihm, und zwar von ihm als Herzog von Sachsen, abhängig war, kann gar kein Zweifel bestehen, wenn wir erfahren, daß die beiden Grafen im Jahre 1182 ihre Grafschaften von dem neuen Herzog, Bernhard von Anhalt, zu Lehen nehmen. 20 ) Der naheliegende Gedanke, daß Volrad gar nicht von Heinrich dem Löwen, sondern von Albrecht dem Bären zum Dannenberger Grafen eingesetzt sei, würde also unrichtig sein. Wir müssen uns bei dem gänzlichen Mangel näherer Nachrichten über die


|
Seite 76 |




|
Einsetzung mit einem non liquet begnügen. Die Tatsache, daß Volrad in unmittelbarer Nähe Neuhaldenslebens, einer der wichtigsten Burgen Heinrichs des Löwen, in Ammensleben, Besitzungen hatte, legt den Gedanken nahe, daß schon vor seiner Einsetzung als Dannenberger Graf zwischen ihm und dem Herzog persönliche Beziehungen bestanden. Die Besitzung in Ammensleben wird als Allod der Dannenberger Grafen genannt, so daß wir vielleicht ihre eigentliche Heimat hier zu suchen haben und sie vielleicht vor nicht langer Zeit erst in die Altmark übergesiedelt waren.
Ebensowenig vermögen wir zu erkennen, ob Volrad in Dannenberg schon eine befestigte Ansiedlung, von der aus er sein Kolonisationswerk beginnen konnte, vorsand, oder ob diese erst von ihm angelegt wurde. Daß Dannenberg neueren Ursprungs als die rings herum wendisch benannten Ortschaften 21 ) ist, muß man wohl aus seinem deutschen Namen schließen. 22 ) Erwägt man daneben die bereits oben dargelegten Gründe, warum erst jetzt eine planmäßige Kolonisation hier möglich war, so wird der Schluß nicht allzu gewagt sein, daß die Stadt Dannenberg ihre Entstehung dem ersten Inhaber der Grafschaft verdankt. Auf alle Fälle war der Platz gut gewählt zur Anlage einer Burg, da er weit und breit die einzige Erhebung nahe der Jeetzel in dem ringsum sumpfigen Wiesenland ist und nur auf einer Seite mit dem höhergelegenen Lande zusammenhängt und so gegen etwaige Überfälle der Wenden leicht zu verteidigen war. Schien doch Dannenberg, als es im Jahre 1223 galt, die gefangenen Dänenkönige sicher zu verwahren, der beste Aufenthaltsort zu sein, weshalb es denn auch von einem gleichzeitigen Chronisten als ein "firmissimum et inaccessibile castrum" bezeichnet wird. 23 ) Die Gründung Volrads wird zunächst lediglich aus der eigentlichen Burg, die vermutlich nahe der Jeetzel an der Stelle des heutigen Amtsgerichtshofes lag und von der vielleicht noch ein Teil in dem sogenannten "Waldemarturm" als dem Burgverließ erhalten ist, und den dazugehörigen Wirtschaftsgebäuden bestanden


|
Seite 77 |




|
haben, die durch Wall und Graben mit der Burg zu einer kleinen Festung verbunden waren. 24 ) Erst etwa fünfzig Jahre später hören wir von Dannenberg als einer urbs.
Die Herrschaft, die so dem Grafen Volrad übertragen war, stellte keineswegs ein geschlossenes Gebiet dar; ein solches besaßen die Dannenberger Grafen erst in späterer Zeit, und zwar nur rechts der Elbe. Abgesehen von seinen zahlreichen Besitzungen um Salzwedel und in der Magdeburger Gegend, von denen gleich die Rede sein wird, zogen sich seine Lehngüter von der heutigen Altmark, etwa bei Ohrdorf beginnend, in einem weiten Bogen durch die Kreise Isenhagen, Uelzen, Lüneburg, Winsen bis zur Elbe, etwa in der Nähe der Luhe-Mündung, hin. Jedoch war, um das nochmals zu betonen, das durch diesen Bogen umgrenzte Land keineswegs ein geschlossenes Territorium der Dannenberger Grafen, sondern neben ihnen finden wir sowohl die Lüchower wie auch die Schweriner Grafen mit zahlreichen Besitzungen hier vertreten. 25 ) Zur Erklärung dieser eigentümlichen Sachlage muß man sich vor Augen halten, daß die Grafen, um ihren Herzog in seinen Slavenkriegen unterstützen und selbstwirksam koloni-sieren zu können, einer starken Kriegsmannschaft bedurften. Eine solche konnten sie aber vorderhand nur bilden aus deutschen Ministerialen, an die sie ihre Besitzungen weiterverliehen. So erklärt es sich auf die einfachste Weise einmal, daß sie, wenigstens bei den Dannenberger und den Schweriner Grafen ist das der Fall, in der nächsten Zeit fast nur in deutschen Dörfern belehnt erscheinen, und zum andern, daß ihre Besitzungen so weit verstreut liegen. So wird die Ansicht v. Hammersteins in seinem trefflichen Auffatz "Die Besitzungen der Schweriner Grafen am linken Elbufer", Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen 1857 S. 121, ganz das Richtige treffen, wenn er meint, daß die von Helmold I, 88 26 ) erwähnte "militia" Gunzels von Schwerin aus dessen Ministerialen am linken Elbufer bestand. Ähnlich wird es sich mit den linkselbischen Besitzungen der Dannenberger Grafen verhalten. Freilich finden wir diese urkundlich z. T. erst in später Zeit als Besitz der Grafen genannt; doch werden wir


|
Seite 78 |




|
kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß sie bereits Volrad I. von Heinrich dem Löwen verliehen sind.
In den nächsten Jahren finden wir ersteren dann mehrfach als Zeugen genannt. Da es sich dabei ausschließlich um Urkunden aus dem von Heinrich dem Löwen beanspruchten Gebiet handelt, scheint daraus hervorzugehen, daß er die Verbindung mit Albrecht dem Bären seit seiner Einsetzung als Dannenberger Graf aufgegeben hatte und sich jetzt nur als Lehnsmann des sächsischen Herzogs fühlte. Wir werden uns also zu denken haben, daß er diesen auf seinen mehrfachen Kriegszügen gegen die Slaven in Mecklenburg begleitete, so im Jahre 1158 und 1160 und auf dem noch bedeutenderen von 1164. 27 ) Wohl das wichtigste Zeugnis der nächsten Jahre ist eine Urkunde des Bischofs Hermann von Verden, der auf Grund von Klagen der Domherren von Bardowiek über Verkürzung ihrer Präbenden durch ihren Propst die Einkünfte von Propst und Domherren durch eine zu Verden am 28. Mai 1158 ausgestellte Urkunde genau regelt. 28 ) Dabei wird unter den Zeugen genannt "comes Wolradus, eiusdem ecciesiae advocatus", woraus hervorgeht, daß unser Graf Volrad die Vogtei in Bardowiek ausübte. Wenngleich er hier nicht als "de Dannenberg" bezeichnet wird, ist ein Zweifel an der Idendität mit dem Dannenberger Grafen nicht wohl möglich. Denn in dieser Gegend ist schlechterdings kein anderer Graf Volrad bekannt als in dem Dannenberger Dynastengeschlecht, wo dieser Name bis zum Aussterben der Familie mehrfach vorkommt. Einmal wird ein Volrad als Bruder Heinrichs von Badewide genannt 29 ); doch hat dieser sicher nie den Grafentitel geführt. Auch hat das Vogtamt der Dannenberger Grafen in Bardowiek nichts Auffälliges, wenn man bedenkt, daß sie ganz in der Nähe, nämlich in Dachtmissen und Erbstorf, Lehngüter besaßen. So behauptet denn auch v. Hammerstein, Bardengau S. 482, daß die Dannenberger Grafen Vögte des Stifts in Bardowiek gewesen seien. 30 ) Auch diese Besitzungen Volrads in unmittelbarer Nähe Lüneburgs deuten auf ein besonders nahes Verhältnis zu Heinrich dem Löwen. Wieder in einer ganz anderen Gegend finden wir


|
Seite 79 |




|
ihn begütert, wenn wir hören, daß. er dem Cisterzienser-Kloster Marienthal bei Helmstedt zwei Hufen in Ohrdorf - östlich Isenhagen - und den Zehnten vom Klostervorwerk in Groß-Brandsleben 31 ) - bei Oschersleben - geschenkt hat. Wir erfahren das aus einer im Jahre 1159 am 4. März im Lateran für Marienthal ausgestellten Urkunde des Papstes Hadrian IV. 32 ) und aus einer am 2. März 1160 zu Pavia ausgestellten Urkunde des Gegenpapstes Viktor IV. 33 ), die sich gegenseitig ergänzen und bestätigen. Auch hier wird zwar der Dannenberger Graf nur einfach als Volradus comes bezeichnet; doch wird durch spätere Nachrichten bestätigt, daß die Dannenberger Grafen in der Nähe, nämlich in Ammensleben, Besitzungen hatten. 34 ) Auch scheint der Umstand, daß sich in der Nähe Dannenbergs, wo es sonst keine Ortsnamen auf -leben gibt, ein Brandleben findet, diese Beziehungen zu bestätigen. 35 )
Wenn nun auch Volrad zum persönlichen Gefolge des Herzogs gehörte, werden wir doch nicht annehmen dürfen, daß er ihn auf seinen Zügen, die er mit dem Kaiser nach Italien unternahm, begleitete. Diese Aufgabe wird vermutlich mehr den westlichen und südlichen Grafen, denen von Wölpe, Scharzfeld, Rode usw., zugefallen sein, während die östlichen auf ihrem Posten im Slavenlande ausharren mußten. Doch sicherlich wird er wie bei den Slavenzügen, so auch bei allen Landtagen, die der Herzog in dieser Gegend mit seinen deutschen und slavischen "Markmannen" abhielt, zugegen gewesen sein, auf denen die slavischen Angelegenheiten besprochen und die Art des Vorgehens gegen sie festgesetzt wurde. Denn ein solches "colloquium provinciale" wie das im Jahre 1160 zu Barvörde abgehaltene, von dem uns Helmold


|
Seite 80 |




|
in seiner Slavenchronik I, 87 eine kurze Schilderung gibt 36 ), wird weit öfter stattgefunden haben als uns die Quellen berichten. In der nächsten Zeit finden wir Volrad meistens in denselben Urkunden wie Heinrich von Babewide als Zeugen genannt, so im Jahre 1162 außer in der bereits erwähnten Urkunde des Herzogs für die Domherren in Ratzeburg - M. U.-B. I, 74 - noch in der für das Ratzeburger Bistum sehr wichtigen Urkunde des Erzbischofs .Hartwig von Bremen, der "gemäß einer Vorschrift des Papstes Hadrian IV. und des Kaisers Friedrich I." auf Grund einer Grenzbestimmung des Herzogs Elbe und Bille als Diözefangrenzen für Ratzeburg festsetzt. 37 ) Im folgenden Jahre finden wir auch Volrad unter den zur Feier der Einweihung des Lübecker Doms im Juli zu Lübeck zahlreich versammelten Rittern und Herren des Herzogs. 38 ) Und am 18. Oktober war er beim Landtag zu Artlenburg zugegen, als der Herzog den Streit zwischen Goten und Deutschen auf der Insel Gotland schlichtete. 39 ) Im Jahre 1164 wird er in einer offenbar zu Lübeck ausgestellten Urkunde des Bischofs Konrad, der im Februar dieses Jahres Gerold im Bistum gefolgt war 40 ), als Zeuge genannt bei der Bestätigung der Besitzungen des dortigen Domkapitels. 41 )
Zwar haben wir für die nächsten Jahre keinerlei Zeugnis über ihn; doch werden wir als sicher anzunehmen haben, daß er bis zu seinem Tode immer ein treuer Vasall seines Herzogs geblieben ist, wie wir denn in dieser Zeit gerade die neugeschaffenen


|
Seite 81 |




|
Grafenhäuser des Ostens, die Grafen von Schwerin, Ratzeburg, Dannenberg und Lüchow, als die dem Herzog ergebensten Gefolgsleute finden, was ja auch ganz natürlich ist, da sie ihm ihre Stellung verdankten und durch seine Macht darin gehalten wurden. Umgekehrt hatte der Herzog gerade jetzt treue Vasallen nötig. Denn bereits erhoben sich unter Führung Albrechts des Bären und Erzbischof Wichmanns von Magdeburg die Fürsten Sachsens, die mit Recht von der gewaltig vorwärtsstrebenden Politik des Löwen für ihre eigene Selbständigkeit fürchteten. So finden wir denn auch Volrad in der bereits Kap. I S. 34/35 erwähnten Urkunde M. U.-B. I, 88, durch die im Jahre 1166 Heinrich der Löwe die Grenzen des Bistums Ratzeburg festsetzt als Zeugen genannt. 42 )
Dies ist die letzte zuverlässige Nachricht über Volrad. In welcher Weise er sich an den Kämpfen Heinrichs des Löwen gegen den Bund der sächsischen Fürsten und gegen den von ihm abgefallenen Grafen Christian von Oldenburg 43 ) beteiligt hat, wissen wir nicht. Möglich, daß er gerade in diesen Kämpfen seinen Tod fand. Jedenfalls muß er um diese Zeit gestorben sein. Zwar wird er noch in einer angeblich 1174 zu Artlenburg ausgestellten Urkunde Heinrichs des Löwen genannt 44 ); doch ist diese Urkunde ihrer ganzen Beschaffenheit nach so verdächtig, daß wir sie hier nicht berücksichtigen können. Das Aktum dieser Urkunde wird von den Herausgebern des M. U.-B. - ebenda Anm. - wie auch vom pommerschen U.-B. - I, 58 - auf den 19. September 1171 gesetzt. Allein, auch das nützt uns nichts; denn in der echten unter diesem Datum ausgestellten Urkunde - M. U.-B. I, 101 - erscheint überhaupt kein Dannenberger Graf. 45 ) Allerspätestens ist Volrad im Jahre 1169 gestorben. Denn in einer "1170 November 7. Artlenburg" datierten Urkunde, die jedoch ihrer Handlung nach ins Jahr 1169 gehört, erscheint bereits sein Sohn Heinrich als "comes" unter den Zeugen. 46 ) Doch noch viele Jahre später wird seiner treuen Dienste gegen


|
Seite 82 |




|
Heinrich den Löwen durch Bischof Isfried von Ratzeburg bei Gelegenheit der Verleihung der Länder Weningen und Jabel an den Grafen Heinrich gedacht. 47 )



|



|
|
:
|
Heinrich I. 1169-1209.
Zum ersten Male finden wir diesen genannt in der eben erwähnten Urkunde M. U.-B. I, 96. Es handelt sich hierbei um eine für die gesamten Verhältnisse in den drei wendischen Bistümern außerordentlich wichtige Urkunde Heinrichs des Löwen, die offenbar auf einem allgemeinen Landtage zu Artlenburg, das für solche Zwecke meistens als Versammlungsort diente, ausgestellt wurde. Denn Grafen und Herren sowohl aus dem Westen wie dem Osten sind hier reichlich vertreten. 48 ) so wird denn auch der Dannenberger Graf hier nicht gefehlt haben; sondern die Herausgeber des M. U.-B. sind völlig im Recht, wenn sie - Bd. IV, Pers.-Reg. S. 206 "Heinrich 229" - unter dem -zwischen Graf Gunzel von Schwerin und Bernhard von Ratzeburg genannten "Henricus comes" Heinrich I. von Dannenberg verstehen wollen. 49 ) Das nächste Zeugnis, das wir über ihn besitzen, stammt aus dem Jahre 1175 (1177?). Heinrich erscheint auch hier in der Umgebung des Herzogs und zwar zu Lübeck bei der Gründung und Ausstattung der dortigen Kapelle Johannis des Evangelisten. 50 )


|
Seite 83 |




|
Alls dann jedoch über den stolzen Herzog das Verhängnis hereinbrach und er Sachsen verließ, mußte das auch auf die Grafschaft Dannenberg seine Rückwirkung üben. Wie die übrigen Grafen des Ostens wird auch Graf Heinrich bis zum Jahre 1180 dem Herzog die Treue gehalten haben. Doch als jetzt über ihn die Reichsacht verhängt wurde und der Kaiser am 15. August zu Werla auf Beschluß der Fürsten seinen Anhängern mit Einziehung ihres Erbes und Lehens drohte, falls sie in den drei festgesetzten Terminen "seine Gunst nicht wiedererlangt hätten", da verließ auch Heinrich von Dannenberg ebenso wie die meisten der übrigen Anhänger die Partei des Welfen und trat zum Kaiser über. 51 ) Dieser Vorgang ist ganz unrichtig so aufgefaßt worden, als sei jetzt die Grafschaft Dannenberg Reichslehen geworden. 52 ) Davon kann natürlich garnicht die Rede sein. Ebenso wie die übrigen östlichen Grafschaften fiel sie bei der Neuverteilung des sächsischen Herzogtums dem Herzog Bernhard zu. Sie war und blieb rechtlich ein Teil des Herzogtums, wie das ganz klar aus der Lehnshuldigung im Jahre 1182 hervorgeht. 53 ) Nur infolge der Schwäche des neuen Herzogs einer- und der mit großer Zähigkeit festgehaltenen Ansprüche der Söhne Heinrichs des Löwen sowie der ihnen günstigen Zustände im Reich andererseits geriet sie später wieder in welfische Abhängigkeit, während z. B. die Lüchower Grafen immer mehr unter den Einfluß der Markgrafen kamen.
Von dieser Zeit an sehen wir daher Graf Heinrich, so oft er uns genannt wird, fast immer in der Begleitung des Herzogs Bernhard oder auch dessen Bruders und Neffen, der Markgrafen von Brandenburg. Der Anschluß an diese war für ihn um so natürlicher, als, wie wir gesehen haben, die Dannenberger Grafen auch in der Altmark bedeutende Lehen besaßen. So ist er Ende September 1181 mit dem Herzog zusammen, wie es scheint auf dessen Burg in Aschersleben oder auf einer anderen Burg seines


|
Seite 84 |




|
anhaltischen Landes. 54 ) Und als dieser im Frühling des nächsten Jahres nach Artlenburg kam, da schwur ihm auch Heinrich von Dannenberg ebenso wie die Grafen von Ratzeburg, Lüchow und Schwerin den Lehns- und Treueid. 55 ) Im Jahre 1184 treffen wir ihn zusammen mit seinem Oheim Friedrich, Vogt von Salz- wedel, den Grafen von Osterburg und Lüchow und anderen Herren als Zeugen der Dotierung des neugegründeten Nonnenklosters Arendsee bei dem Markgrafen Otto I. von Brandenburg, dem Bruder des Herzogs Bernhard. 56 ) Und im Jahre 1188 ist er Zeuge, als der Sohn und Nachfolger Ottos I., der Marfgraf Otto II., das Kloster des Hl. Nikolaus zu Stendal, eine Stiftung seines Bruders, des Grafen Heinrich von Gardelegen, bestätigt, aus dem sich später dann das Domstift entwickelte. 57 ) Und ebenso, als diese beiden Fürsten zwei Jahre später zu Altenburg eben diesem Stifte 20 Talente als Einkünfte aus ihrem dortigen Marktrecht verleihen. 58 ) Und noch einmal finden wir Heinrich von Dannenberg bei dem Grafen von Gardelegen, als dieser im Jahre 1192 Bestimmungen über den Nachlaß der Stendaler Domherren trifft. 59 )
Diese Verbindung gerade mit Heinrich von Gardelegen legt den Gedanken nahe, daß schon damals Heinrich von Dannenberg besondere Beziehungen mit diesem Enkel Albrechts des Bären und mit der Grafschaft Gardelegen verbanden. Nachdem nun, noch im Jahre 1192, Heinrich von Gardelegen kinderlos gestorben war 60 ), versah dort der Dannenberger Graf zeitweise dessen Grafenamt. Das erfahren wir aus der vielumstrittenen Urkunde


|
Seite 85 |




|
des Markgrafen Otto II. vom Jahre 1196, in der er bezeugt, daß er und sein Bruder, der spätere Markgraf Albrecht II., ihr ganzes Gebiet, sowohl Eigen wie Lehen, dem Erzbistum Magdeburg oder genauer der dortigen Moritzkirche - dem heutigen Dom - übertragen und von dieser als Lehen zurückempfangen haben; ein Vorgang, der auch durch die neuesten Erörterungen von Hartung und Sello noch keineswegs völlig aufgeklärt ist. 61 ) Nachdem am 24. November diese Übertragung zu Magdeburg im allgemeinen vorgenommen und am folgenden Tage auf Gebiet und unter Vorsitz eines Lehnsmannes des Erzbischofes von seiten des Erzstifts vollzogen war, begab man sich am 28. November in die Altmark nach Gardelegen. Und hier, auf Gebiet des Markgrafen, wurde unter Vorsitz Heinrichs von Dannenberg die Urkunde auch von seiten der beiden Askanier vollzogen. Es ist dies die einzige Urkunde nicht nur für die Dannenberger, sondern überhaupt für unsere Grafenfamilien, in der wir sie nicht als Verwalter eines Gebietes, sondern lediglich in Ausübung der alten Grafenfunktion als Vorsitzender bei einem Rechtsgeschäft finden. Denn - darauf muß entschieden hingewiesen werden - nur diesen Sinn haben die Worte der Urkunde "fideli nostro Heinrico comiti de Dannenberg, cuius idem comitatus erat, per sententiam auctoritatem dedimus vice nostra iudicio presidendi". 62 ) Die Art der Grafschaft, wie er sie hier ausübte, war völlig verschieden von seiner Stellung in der Grafschaft Dannenberg. So ist es denn erklärlich, sowohl, daß wir später keine Spur von Besitz der Dannenberger Grafen in dieser Gegend vorfinden 63 ), als, daß sonst nie wieder weder Heinrich noch seine Nachfolger als Grafen von Gardelegen bezeichnet werden; er war hier Graf nur in Vertretung der Askanier. Dabei ist das "fidelis


|
Seite 86 |




|
noster" auf die Dannenbergischen Besitzungen um Salzwedel zu beziehen. 64 )
Doch hatte sich Heinrich von Dannenberg, obwohl wir ihn diese ganze Zeit in der Umgebung der Markgrafen von Brandenburg oder des .Herzogs Bernhard finden 65 ), keineswegs völlig von der welfischen Partei entfernt. Es hat sogar den Anschein, als ob auch er sich Heinrich dem Löwen, als dieser im Jahre 1189, die Abwesenheit des Kaisers und des Grafen Adolf von Holstein benutzend, aus seiner zweiten Verbannung zurückkehrte und den Kampf gegen Herzog Bernhard begann, angeschlossen hat. Vielleicht, daß auch er mit dem schwächlichen Regiment des neuen Herzogs nicht einverstanden war, da er von ihm bei seinem Kolonisationswerk keine Unterstützung zu erwarten hatte. 66 ) Jedenfalls werden von Bischof Isfried von Ratzeburg, einem der treuesten Anhänger des Welfen, in der schon angeführten Urkunde M. U.-B. I, 150 unter den ihm von Graf Heinrich von Dannenberg geleisteten Diensten auch solche "coram domino Hemrico Saxonum duce" erwähnt. Welcher Art diese Dienste gewesen sind, vermögen wir nicht zu erkennen. Jedenfalls soviel steht nach dieser Urkunde fest, daß Heinrich I. von Dannenberg, offenbar einer der Tatkräftigsten aus dieser Familie, stets bestrebt war, seine Macht und sein Gebiet zu vergrößern. Schon mehrfach war er unter Hinweis auf seine und seines Vaters Ergebenheit gegen die Ratzeburger Kirche und ihren Bischof an Isfried mit der Bitte herangetreten, ihm in der Ratzeburger Diözese ein Lehen zu erteilen. In Hagenow willfahrte endlich um 1190 67 ) der Bischof diesen Bitten und verlieh dem Grafen die Zehnten der Länder Jabel und Weningen, d. h. wie die Urkunde selbst interpretiert, einmal das Land zwischen Sude und Walerow, [heute Rögnitz] und zweitens das Land zwischen Walerow, Elbe und Elde. Und zwar in der Form, daß in Weningen einstweilen noch die Abgaben der Slaven in der von Heinrich dem Löwen fest-


|
Seite 87 |




|
gesetzten Höhe 68 ) in die Kasse des Bischofs fließen und der Graf erst dann, wenn das Land von Deutschen besiedelt sei, in den Genuß des Zehnten treten sollte; und etwas abweichend für Jabel, das noch zum größten Teil wüste Heide war, in der Weise, daß der Graf sich verpflichtete, dies Gebiet binnen zehn Jahren zehntpflichtig zu machen und daß dann er und der Bischof sich in den Zehnten teilten. Ganz frei von der Verpflichtung der Zehntzahlung blieb natürlich die "curia episcopalis" des Landes Weningen, das schon in den Urkunden Heinrichs des Löwen für Ratzeburg genannte Malk.
Diese Urkunde ist in jeder Hinsicht von außerordentlichem Interesse. Nicht nur, daß damit der Grund zu den in späterer Zeit vielfach genannten bedeutenden rechtselbischen Besitzungen der Dannenberger Grafen gelegt war 69 ), - auch in die Art der Kolonisation erhalten wir hier einen recht willkommenen Einblick. Wahrscheinlich hat auch Heinrich von Dannenberg ebenso wie einige Jahrzehnte früher Adolf von Holstein, Heinrich und Bernhard von Ratzeburg und Albrecht der Bär, wie überhaupt alle Herren, die sich hier an der Kolonisation beteiligten, fremde Ansiedler ins Land gezogen, vielleicht z. T. von seinen magdeburgischen Besitzungen, dann aber auch ebenso wie die übrigen Herren Holländer. Jedenfalls werden "Holländer-Hufen" im nahen Darzing - dem heutigen Amte Neuhaus - erwähnt 70 ), und auch der mehrfach in dieser Gegend sich findende Name "Holländerei" 71 ) möchte darauf deuten, daß hier die Besiedlung,


|
Seite 88 |




|
hauptsächlich der Elbmarsch, deren Bebauung den Slaven besonders große Schwierigkeiten bereitete, durch Holländer stattgefunden hat.
Wie im einzelnen der Prozeß der Germanisierung sich hier vollzogen hat, vermögen wir nur unvollständig zu erkennen. Jedenfalls das eine steht wohl fest, daß man, nachdem in den Slavenkriegen Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären der Widerstand der Slaven gebrochen und deutsche Kolonistendörfer überall angelegt und so der Zusammenhang der Slaven zerstört war, jetzt viel friedlicher vorging. Wohl nur selten fand noch eine förmliche Vertreibung der Slaven statt, wie sie uns eine Lübecker Urkunde aus dem Jahre 1250 berichtet. 72 ) Und es ist bezeichnend, daß hier ausdrücklich bestimmt wird, daß diese Vertreibung "friedlich und freundschaftlich" geschehen solle, immerhin ein großer Fortschritt im Verhältnis zu den von den Billungerzeiten bis auf Heinrich den Löwen mit größter Erbitterung und Grausamkeit geführten Vernichtungskämpfen. Neben den Slaven siedelten sich Deutsche im selben Dorfe an und richteten hier die deutsche Hufenverfassung und deutsche Bebauungsweise ein. Man wird sich nachgerade den Gedanken der völligen Ausrottung der Slaven abgewöhnen müssen. 73 ) Und gerade hier in den eben erwähnten Ländern Jabel und Darzing hielten sie sich noch sehr lange in geschlossener Masse, während auf dem linken Elbufer offenbar schon sehr bald in der Grafschaft Dannenberg die Deutschen in der Mehrzahl waren, sei es, daß, dies Gebiet vorher überhaupt nur dünn bevölkert war 74 ), sei es, daß sich die Slaven vor den eindringenden Deutschen in die Lüchower Gegend zurückzogen, wo sich Reste wendischer Sitte und wendischen Rechts noch bis ins


|
Seite 89 |




|
17. Jahrhundert gehalten haben 75 ) und wo noch heute manche Spracheigentümlichkeiten an die Wendenzeit erinnern.
Wirksam finden wir dann diesen Vertrag des Grafen Heinrich mit Bischof Isfried in dem Ratzeburger Zehntregister vom Jahre 1230, wo die Dannenberger Grafen in der Tat als Besitzer des Zehnten im Lande Weningen genannt werden. 76 ) Doch ist es ihnen bis dahin noch nicht gelungen, das Land Jabel, wie es Heinrich versprochen hatte, zehntpflichtig zu machen. Noch immer bezieht hierher der Bischof seine biscoponitza. Offenbar sind die Dannenberger Grafen nie dazu gelangt, hier irgendwelche Rechte auszuüben, da der minderwertige Boden der Jabelheide und die bald darauf hereinbrechenden unruhigen Zeiten lange die deutsche Ansiedlung hinderten. Denn noch im Jahre 1258 entwerfen die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und Sachsen-Lauenburg, nachdem sie sich über ihre Ansprüche an diese Gebiete geeinigt haben, einen Plan zur gemeinsamen Kolonisation der Länder Darzing und Jabel. 77 )
Wird bereits in dieser Urkunde Isfrieds um 1190 Graf Heinrich als Freund Heinrichs des Löwen genannt, so finden wir ihn mit seiner eigentlichen Grafschaft bald wieder in völliger Abhängigkeit von den Welfen. Von einer Ausübung des herzoglichen Amtes durch Bernhard ist hier kaum etwas zu bemerken.


|
Seite 90 |




|
Niemals hören wir von einem hier abgehaltenen Landtag, keine Urkunde läßt eine Tätigkeit für diese Gebiete erkennen. Mit seinen eignen Grafen war er bald in Streit geraten. Und nun überließ er sie gegenüber den immer mächtiger vordringenden Dänen sich Selbst. Abgesehen von der ersten Zeit seiner Regierung scheint er sich selten in seinem Herzogtum aufgehalten zu haben. 78 ) So war es, nachdem Heinrich der Löwe im Jahre 1195 gestorben war, seinen Söhnen ein Leichtes, sich nach und nach im östlichen Sachsen wieder in den Besitz der 1180 verlorenen Gebiete zu setzen. Wie der vielumstrittenen Grafschaft Stade bemächtigten sie sich auch wieder der Grafschaften Dannenberg und Lüchow, während Graf Gunzel II. von Schwerin sich längst ihrer Partei angeschlossen hatte. 79 ) Um so sicherer fühlten sich die drei Söhne Heinrichs des Löwen bereits wieder in ihrem Besitz, seitdem sie im Januar des Jahres 1202 zu Hamburg mit König Knud von Dänemark und dessen Bruder, dem Herzog Waldemar, eine Doppelheirat zwischen den beiden Fürstenhäusern verabredet hatten. 80 ) So kann es nicht wundernehmen, daß bei dem Teilungsvertrag, den am 1. Mai 1202 die drei welfischen Brüder zu Paderborn schlossen, ebenso wie die rechtselbischen Besitzungen des Herzogs in Lauenburg und Mecklenburg auch die Grafschaften Dannenberg und Lüchow an Wilhelm von Lüneburg fallen, ohne daß von Ansprüchen Herzog Bernhards nur im geringsten die Rede ist; wird doch selbst Hitzacker, das Friedrich I. dem Herzog Bernhard ausdrücklich als Entschädigung für Lübeck verliehen hatte 81 ), hierbei als Besitz Wilhelms genannt.
Zwar ist bei diesem Vertrag von Dannenberg und Lüchow nur als "urdes" die Rede; doch bedarf es keines Beweises, daß diese hier lediglich als Mittelpunkte der Grafschaften aufzufassen sind, ebenso wie die übrigen in der Urkunde genannten Orte nur zur näheren Bezeichnung der vorher nach einigen Grenzpunkten angegebenen Gebiete dienen. 82 ) So finden wir denn auch seitdem häufig die Welfen des Hauses Lüneburg als Oberlehnsherren


|
Seite 91 |




|
dieser beiden Grafschaften genannt. 83 ) Wichtig an dieser Urkunde ist uns noch, daß hier Dannenberg zum ersten Male als Stadt begegnet. Zwar dürfen wir nicht ohne weiteres "urbs" mit "Stadt" übersetzen; doch erscheint unsere Annahme, daß diese Übersetzung hier am Platze ist, dadurch gerechtfertigt, daß um dieselbe Zeit in Lüneburg eine städtische Organisation nachweisbar ist 84 ), eine Tatsache, die nicht ohne Wirkung auf benachbarte Orte geblieben sein wird. Diese Nachricht ist uns um so wichtiger, als wir sonst für die nächste Zeit niemals etwas über die innere Einrichtung und Entwicklung unserer Grafschaften hören.
Inzwischen hatten die Eroberungen der Dänen glänzende Fortschritte gemacht. Die Grafschaften Holstein und Ratzeburg waren in ihrer Gewalt, ja Graf Adolf von Holstein selbst wurde von ihnen seit dem Dezember 1201 gefangen gehalten. 85 ) Im Herbst 1203 endlich war auch Lauenburg, die letzte Festung, die bisher noch den Dänen getrotzt hatte, zur Übergabe bereit, falls Adolf III. aus seiner Gefangenschaft befreit wurde. Dieser wurde nun aus Dänemark herbeigeholt und mit ihm in der Weise Frieden geschlossen, daß er auf Holstein zugunsten König Waldemars verzichtete und ihm für dessen sicheren Besitz zwölf Geiseln stellte. Unter diesen war außer zwei eigenen Söhnen des Holsteiner Grafen und einem Sohne des Grafen Ludolf von Dassel, eines Bruders Adolfs von Ratzeburg, auch ein Sohn Heinrichs I. von Dannenberg. 86 ) Doch wahrscheinlich nicht sein ältester Sohn Volrad, wie meistens angenommen wird 87 ), sondern sein zweiter,


|
Seite 92 |




|
der spätere Graf Heinrich II. Denn der Bestimmung gemäß sollten diese Geiseln erst nach zehn Jahren oder nur unter der Bedingung eher zurückgegeben werden, daß König Waldemar oder Graf Adolf vor Ablauf dieser Frist stürben. Doch obwohl letzteres nicht geschah, finden wir Volrad bereits im Jahre 1207 wieder zu Salzwedel, wo er zusammen mit seinem Vater Zeuge in einer Urkunde des Markgrafen Albrecht ist. 88 ) Nimmt man dagegen Heinrich II. für jenen dem König Waldemar gegebenen jungen Dannenberger Grafen, so ergibt sich eine sehr willkommene Ergänzung zu einer sonst ziemlich zusammenhanglos dastehenden Nachricht, die uns unten noch weiter beschäftigen wird, daß nämlich im Jahre 1236 in der Schlacht bei Seule auch ein Graf von Dannenberg im Kampfe gegen die Litauer gefallen sei. Daß dies Heinrich II. war, wird unten nachgewiesen werden. Wie kam nun ein Dannenberger Graf, dessen Interessenkreis an und für sich sicherlich das Schicksal des Ostseegebietes fernlag, nach Kurland? Da erscheint es nun sehr einleuchtend, daß er während seines zehnjährigen Aufenthaltes in Dänemark, das eben damals unter seinem großen König nicht nur in Deutschland, sondern viel mehr noch in den heutigen Ostseeprovinzen gewaltig sich ausdehnte, Eroberungszüge nach Livland und Estland unternahm und dort Kolonien gründete 89 ), zum ersten Male von jenen Ländern hörte und sich mit Kreuzzugsideen gegen die Litauer vertraut machte. Möglich sogar, daß er bereits damals von Dänemark aus an solchen Zügen teilnahm.
Mit einiger Sicherheit scheint noch ein anderes aus Arnolds Nachricht hervorzugehen. Wenn neben dem Sohn des ausdrücklich als Verwandten 90 ) Adolfs III. bezeichneten Ludolf von Dassel ein Sohn Heinrichs von Dannenberg als Geisel gegeben wird, so läßt das auf eine enge Verbindung auch dieser beiden Grafenhäuser schließen. Möglich, daß diese lediglich in einer persönlichen Freundschaft bestand, wahrscheinlicher jedoch, daß ihr auch ein Verwandtschaftsverhältnis zugrunde lag, welches dann, da uns andere derartige Beziehungen nicht bekannt sind, in der bereits von anderer Seite vermuteten Richtung zu suchen wäre 91 ), daß nämlich Heinrich II. eine Tochter Adolfs III. von Holstein zur Gemahlin hatte. Da diese beiden vielleicht eben damals oder kurz


|
Seite 93 |




|
zuvor in noch jugendlichem Alter, wie es die Sitte der Zeit war, verlobt waren, konnte Arnold Heinrich von Dannenberg noch nicht eigentlich als Verwandten des Holsteiners bezeichnen. Für ein solches verwandtschaftliches Verhältnis dürfte auch der Umstand sprechen, daß als Sohn Heinrichs II. ein Adolf auftritt, ein Name, der bisher in der Dannenberger Familie nicht gebräuchlich war.
Zweimal hören wir dann noch von dem Dasein Heinrichs I. von Dannenberg. Einmal in der bereits erwähnten Urkunde, die Markgraf Albrecht II. von Brandenburg am 4. Februar 1207 zu Salzwedel ausstellt 92 ), und dann, zum letzten Male, am 28. August 1209 zu Lüneburg, wo er und sein ältester Sohn, Volrad, an erster Stelle unter den Vasallen Wilhelms von Lüneburg als Zeugen genannt werden, daß er der neu zu gründenden Stadt Löwenstadt - ,dem heutigen Bleckede - das Recht einer freien Stadt verleiht und ihr "Weichbild" abgrenzt. 93 ) Wenige Wochen darauf scheint er gestorben zu sein; denn in einer am 22. Oktober desselben Jahres zu Bismark in der Altmark für Bischof Sibot von Havelberg ausgestellten Urkunde Albrechts II. von Brandenburg erscheint bereits sein Sohn Volrad allein als Zeuge 94 ), und später finden wir Heinrich nie mehr genannt.



|



|
|
:
|
Volrad II. 1207-1226 und Heinrich II. 1203-1236.
Ihm folgte, da sich Heinrich II. noch als Geisel Adolfs III. in Dänemark befand, zunächst sein Sohn Volrad II. allein. Später scheinen die beiden Brüder die Grafschaft gemeinsam verwaltet zu haben, ohne daß irgendwie eine Teilung vorgenommen wurde. Nur finden wir den jüngeren Grafen häufiger im Gefolge Ottos des Kindes von Braunschweig-Lüneburg, des Sohnes und Nachfolgers Wilhelms, während Volrad sich mehr in Dannenberg aufgehalten zu haben scheint. Zum ersten Male erfahren wir bei diesem etwas Sicheres über verwandtschaftliche Beziehungen der Dannenberger Grafenfamilie. Er war nämlich vermählt mit Jutta von Wölpe, der dritten Tochter des Grafen Bernhard II. von Wölpe, aus einem Geschlechte, das etwa gleichzeitig mit dem der Dannenberger Grafen als Vasallendynastie Heinrichs des Löwen auftritt 95 ) und in der Hoya-Bremer Gegend belehnt war. Schon im Jahre 1209 wird in der bereits angeführten Gründungsurkunde


|
Seite 94 |




|
Bleckedes gleich hinter Heinrich von Dannenberg und seinem Sohne Volrad Graf Bernhard von Wölpe als Zeuge genannt, während dann erst die sowohl den Dannenberger Grafen wie der neuen Gründung räumlich näherstehenden Grafen von Lüchow aufgeführt werden. Doch viel wichtiger ist eine Urkunde vom 27. Dezember 1215, in der Bernhard von Wölpe das Kloster Mariensee [bei Neustadt a. Rbg.] stiftet, wobei auch seine Schwiegersöhne Graf Heinrich von Hoya, Graf Siegfried von Osterburg und Graf Volrad ihre Zustimmung geben. 96 ) Nach allgemeiner Ansicht 97 ) kann unter diesem Grafen Volrad nur Volrad II. von Dannenberg verstanden werden, eine Annahme, der wir durchaus zustimmen dürfen, zumal wir Volrad mehrfach in der Gesellschaft der hier genannten Grafen finden, und dann auch, weil wir sehen, daß bei der folgenden Generation in der Dannenberger Familie der bisher nicht gebräuchliche Name Bernhard auftritt. Endlich, und das dürfte das Entscheidende sein, entspricht das für Graf Volrad der Urkunde angehängte Siegel mit dem aufsteigenden rechtsgekehrten Löwen im Schilde vollständig dem uns aus etwas späterer Zeit zuverlässig bekannten Wappen der Dannenberger Grafen. 98 ) Diese Ansicht über die Verbindung der beiden Grafenhäuser als richtig hingenommen, ergibt sich aus der Reihenfolge, in der die Töchter Bernhards von Wölpe genannt werden, daß die Gemahlin Volrads Jutta hieß.
Abgesehen von diesen gelegentlichen Nachrichten in den Zeugenreihen finden wir Volrad fast nur in Verbindung mit dänischen Angelegenheiten genannt. Freilich spielten diese seit der Eroberung Holsteins und Ratzeburgs im Jahre 1202 in immer wachsendem Maße für das ganze nordöstliche Deutschland die entscheidende Rolle. Immer mächtiger dehnte sich unter seinem tatkräftigen und ehrgeizigen König Waldemar, den die Nachwelt als den Sieger bezeichnet hat, dies kleine Inselvolk aus. Schon gehörte ihm Rügen und Pommern, Holstein und Dithmarschen; die mecklenburgischen Slavenfürsten waren ihm tributpflichtig, und in Livland und Estland drang es erobernd und kolonisierend vor. Es war


|
Seite 95 |




|
nur noch eine Frage der Zeit, daß die Ostsee ein dänisches Binnenmeer wurde. Von niemandem gehindert, durch die Wirren des Bürgerkrieges im Innern Deutschlands begünstigt, vom Welfen Otto IV. und Papst Innocenz unterstützt 99 ), hatte es Waldemar leicht. Sein Gebiet immer mehr zu erweitern, immer kühnere Pläne zu fassen. Doch ging er dabei klug und mit weiser Mäßigung zu Werke, indem er keineswegs versuchte, das eroberte Land zu danisieren, sondern die Verhältnisse, wo es anging, bestehen ließ und im übrigen sich mit der Lehnsherrschaft begnügte. So setzte er hier auch keineswegs einen Dänen zum Statthalter ein, sondern einen deutschen Grafen aus thüringischem Geschlecht, Albrecht von Orlamünde, mit dem ihn nahe verwandtschaftliche Beziehungen verbanden. Schritt für Schritt, doch folgerichtig und mit großer Stetigkeit, drang er vorwärts. Schon im Jahre 1208 hatte er aus Anlaß des Streits der beiden Schweriner Grafen Gunzel und Heinrich mit Johann Gans von Putlitz, den sie aus der Burg Grabow vertrieben hatten, einen Eroberungszug in die Grafschaft Schwerin unternommen und die Boizenburg zerstören lassen. 100 ) Dann hatten im Jahre 1214 die beiden Schweriner, die das Schicksal des Holsteiner und des Ratzeburger Grafen fürchten mochten, ihr Land von Waldemar zu Lehen genommen. Endlich hatte er im Jahre 1217 die einzige Tochter Gunzels I., die Schwester der beiden regierenden Grafen 101 ), mit seinem natürlichen Sohn, dem Grafen Nikolaus von Halland, vermählt. Als nun dieser ebenso wie seine Gattin und der Graf Gunzel bald darauf starb, hatte er die halbe Grafschaft Schwerin für seinen Enkel, den jüngeren Nikolaus von Halland, durch Albrecht von Orlamünde in Besitz nehmen lassen, während die andere Hälfte dem Grafen Heinrich, der sich damals gerade auf einem Zuge ins gelobte Land befand, verblieb. Am 28. Februar 1221 beurkundete Albrecht von Orlamünde in Ratkau, daß ihm von König Waldemar für die Zeit der Minderjährigkeit des Grafen Nikolaus von Halland die halbe Grafschaft Schwerin als Lehen übertragen sei und daß er sie, falls der junge Graf vorzeitig stürbe, an Waldemar zurückgeben wolle. Unter den Zeugen Albrechts finden wir auch die


|
Seite 96 |




|
beiden Grafen von Dannenberg, die sich für den Fall, daß der Orlamünder sein Versprechen nicht hält, zum Einlager in Ripen verpflichten. 102 )
Auch diese Tatsache, die doch offenbar ein freundschaftliches Verhältnis der Dannenberger Grafen zu dem dänischen Statthalter zur Voraussetzung hat, beweist, daß man die Herrschaft der Dänen im Lande keineswegs als drückend empfand. Man mochte mehr Sicherheit im Innern des Landes sowie größere Ruhe zur Kolonisationsarbeit in den slavischen Giebieten von ihr erwarten als von der Regierung des unbedeutenden und schwachen Askaniers. Längst waren auch die beiden Dannenberger Vasallen des Dänenkönigs geworden. Denn im Dezember 1214 hatte zu Metz der junge König Friedrich II. "seinem geliebten Waldemar, dem allerchristlichsten Könige der Dänen, um den Frieden seiner Herrschaft zu bewahren und die Feinde des Kaiserreiches zu bezwingen, mit Einwilligung der Fürsten des Römischen Reiches" alles Land jenseits der Elbe und Elde abgetreten. 103 ) Dazu gehörten auch die rechtselbischen Gebiete der Grafen von Dannenberg, die Länder Jabel und Weningen. Und man wird sich zu denken haben, daß die beiden Grafen diese nun als Lehen von Waldemar empfingen.
So war mit einem Federstrich, mochte sich auch der Kaiser mit seiner bedrängten Lage entschuldigen 104 ), leichten Herzens ein Gebiet des Deutschen Reiches aufgegeben, das mit so unendlichen Opfern und Mühen in jahrzehntelangen Kämpfen den Slaven abgerungen war. Weder den Kaiser, dessen Sinnen und Trachten auf Italien gerichtet war, noch den ohnmächtigen Träger des sächsischen Herzogtums kümmerte das Schicksal dieser Gebiete. Die kleinen Fürsten und Herren waren auf sich allein angewiesen. Und sie haben sich geholfen. so gut es eben ging, zunächst zwar mit einer Tat der Verzweiflung, die keineswegs dem Völkerrechte entsprach und auch bei den Zeitgenossen mehr Bewunderung als Billigung fand. 105 ) Doch haben sie dann später durch tapferen Kampf bewiesen, daß das Schicksal bei jener Tat keinen Unwürdigen begünstigt hatte. Schnell und unaufhaltsam, wie es ihn gehoben


|
Seite 97 |




|
hatte, riß es dagegen den stolzen Dänenkönig wieder in die Tiefe hinab. Jener Versuch, durch eine Familienverbindung mit dem Schweriner Grafenhause in dem ihm nominell gehörenden Gebiet festen Fuß zu fassen, sollte der letzte in dieser Richtung bleiben.
Ganz geruht hatte der Widerstand gegen die immer weiter vordringende Dänenherrschaft wohl nie. Sicher waren Männer wie Adolf von Holstein und sein Ratzeburger Namensvetter fleißig am Werke, den Haß gegen sie zu schüren. Ja, selbst dem nichts weniger als tatkräftigen Herzog Bernhard war gelegentlich das Bewußtsein seiner Pflicht gegenüber diesen Gebietsteilen gekommen. 106 ) Doch zu einem Vorgehen gegen den König vermochte er sich nicht aufzuraffen; seine Macht schien zu groß. Da änderte der verwegene Plan eines kleinen Grafen, sich der Person des Königs zu bemächtigen, plötzlich das Bild. Als im Jahre 1222 Graf Heinrich von Schwerin, mit dem Zunamen des Schwarzen, von seiner Kreuzfahrt nach dem gelobten Lande zurückkehrte, fand er seine halbe Grafschaft im Besitz der Dänen und sein Schloß zum Teil von ihnen besetzt; Güter seiner Schwiegermutter, einer Frau von Zlavien [Pommern?], waren von Waldemar eingezogen. 107 ) Heinrich sah sich von allen Seiten in einer unerträglichen Weise eingeengt. Da faßte er, da er allein einen offenen Kampf nicht wagen konnte, den Entschluß, durch eine rasche, kühne Tat sich der Person des Königs zu bemächtigen. Als sich dieser im Sommer 1223 nach seiner Gewohnheit zu Jagd und Fischfang mit seiner Familie und geringem Gefolge auf der kleinen und menschenleeren 108 ) Insel Lyö, im kleinen Belt westlich Fünen, aufhielt, nahm ihn und seinen ältesten Sohn in der Nacht vom 6. zum 7. Mai Graf Heinrich gefangen und brachte sie beide nach Deutschland. 109 ) Hier hielt er sie eine kurze Zeit in der ihm 1219 vom Markgrafen Albrecht verliehenen Burg Lenzen


|
Seite 98 |




|
in der Prignitz gefangen. Bald aber schaffte er sie, da Lenzen ihm offenbar dem Bereich Albrechts von Orlamünde noch zu nahe schien, über die Elbe, und zwar nach Dannenberg, in die Burg des ihm befreundeten Grafen Volrad 110 ), der in der nächsten Zeit in so naher Beziehung zu dem Schweriner Grafen genannt wird und in so hervorragender Weise an den folgenden Verhandlungen teilnimmt, daß man fast glauben möchte, daß er auch an dem Handstreich von Lyö, sei es als Teilnehmer, sei es als Förderer des Plans, beteiligt war.
Schon wenige Monate nach der Gefangennahme muß diese Überführung vorgenommen sein; denn am 4. November 1223 schreibt bereits Papst Honorius III. an Bischof Iso von Verden, daß es heiße, die beiden Dänenkönige befänden sich in seiner Diözese 111 ), worunter nur Dannenberg verstanden werden kann, da Lenzen zur Diözese Havelberg gehörte. Übrigens scheint aus dieser unbestimmten Ausdrucksweise hervorzugehen, daß man zunächst nicht wußte, wo der Schweriner Graf seine Beute in Sicherheit gebracht hatte. Dieser Umstand, der, bis man allgemein den Wert der gefangenen Dänenkönige erkannt hatte und der Graf auf Unterstützung der großen Fürsten rechnen konnte, von ziemlicher Bedeutung war, hatte neben der Tatsache, daß Dannenberg fast unzugänglich war 112 ) und auf Reichsgebiet lag, den Grafen von Schwerin wahrscheinlich zu seiner Wahl bestimmt. Sicher befanden sich die beiden Dänenkönige zur Zeit des Nordhäuser Vertrages vom 24. September 1223 schon zu Dannenberg. Das geht einerseits aus diesen Erwägungen, vor allem aber aus dem lebhaften Anteil, den Volrad von Dannenberg an den Verhandlungen nahm, hervor. Und hier haben sie etwa anderthalb Jahre in sicherer, doch ehrenvoller Haft verbracht. 113 )


|
Seite 99 |




|
Daß die Haft keineswegs so streng war, wie die Dannenberger Lokalsage will, ergibt sich einerseits aus einer Stelle des Nordhäuser Vertrages, wo ausdrücklich von der "honesta et commoda custodia" des Königs die Rede ist, andererseits aus dem Umstande, daß im Frühling des folgenden Jahres Bischof Albert von Livland und sein Bruder Hermann, erwählter Bischof von Estland, die gekommen waren, um für letzteren die Bestätigung Waldemars einzuholen, ungehindert Zutritt zu ihm erhielten. 114 ) Endlich dürfte schon eine einfache Überlegung lehren, daß man den mächtigen Dänenkönig, gegen den man keineswegs eine persönliche Feindschaft hegte 115 ), nicht wie jeden beliebigen Wegelagerer und Strauchdieb behandelte. Man hat ihm und seinem Sohne also sicher nicht das heute in Dannenberg dafür gezeigte enge Gelaß zum Gefängnis angewiesen, und der Name des "Waldemarturmes" ist eine Kombination späterer Zeit. Auch der, freilich dehnbare, Ausdruck der Stader Annalen "gravi custodia coartatur" scheint nach der obigen Urkundenstelle ein freier Zusatz des Verfassers zu sein. 116 )
Vom Reiche wie auch von Kaiser Friedrich II. war schnell die Bedeutung der Gefangenschaft des gefährlichen Dänenkönigs erkannt. Unbekümmert um die Abtretungsurkunde, die er ihm im Jahre 1214 über diese Gebiete ausgestellt hatte, unbekümmert um die dabei feierlich betonten Friedensrücksichten und Liebe zu König Waldemar, hielt er jetzt die Zeit für günstig, die damals notgedrungen aufgegebenen Gebietsteile wiederzuerlangen. Schon im August 1223 schrieb er von Neapel aus an Bischof Konrad von Hildesheim, er möge doch den Bischof Otto von Würzburg in seinem Bestreben unterstützen, die beiden Dänenkönige in die


|
Seite 100 |




|
Gewalt des Reiches zu bringen. 117 ) Danach scheint Otto von Würzburg, der damals neben dem "Gubernator" Engelbert von Köln als Stellvertreter des jungen Heinrich VII. auf die Reichsregierung den bedeutendsten Einfluß ausübte, schon früh im Namen des für den jungen König eingesetzten Rates Verhandlungen wegen der Übernahme der Dänenkönige in Reichsgewahrsam angeknüpft zu haben, wobei er von Engelbert von Köln, dem an all diesen Bemühungen zur Befreiung der nordöstlichen Gebiete Deutschlands von der Dänenherrschaft ein entscheidender Anteil zugewiesen werden muß, aufs tatkräftigste unterstützt wurde. Zum vorläufigen Abschluß führten diese Unterhandlungen dann in dem Vertrage, den am 24. September der Kaiser und dessen Sohn, oder vielmehr in deren Namen der aus geistlichen und weltlichen Herren gebildete königliche Rat mit dem Grafen Heinrich von Schwerin und dessen Freunden zu Nordhausen, wohin man einen Hoftag berufen hatte, schloß. 118 )
Hier nahm auch Volrad von Dannenberg einen hervorragenden Anteil an den Verhandlungen. Er erscheint immer gleich hinter Heinrich von Schwerin, und wir mögen uns denken, daß er ihm bei Aufstellung seiner Forderungen, die bis ins einzelste gehen, geholfen hat. Sicher gehört er mit zu denjenigen Freunden des Grafen, für welche sich dieser außer den 50 000 Mark zu eigener Verwendung noch 2000 Mark zur Verteilung ausbedingt. Er gehört dann neben Erzbischof Engelbert von Köln, den Grafen von Harzburg und Regenstein, Bernhard von Horstmar und dem Truchseß Gunzel der Kommission an, die die Höhe der Sicherheit dafür feststellen soll, daß Waldemar, bevor er aus der Reichshaft frei wird, dem Grafen Heinrich und seinen Freunden Urfehde schwört und auf alles Land diesseits der Eider verzichtet. Auch soll er neben dem Kölner Ersbischof und dem Schweriner Grafen mitbestimmen, ob und wann gegebenenfalls ein Austausch des jüngeren Waldemar gegen seinen Vater stattfinden soll. Denn während jener sogleich in das Gewahrsam des Reiches übergehen und nach Harzburg gebracht werden sollte, sollte der alte König einstweilen noch in der Haft des Schweriner Grafen verbleiben. Für den Fall, daß später ein Krieg gegen die Dänenkönige nötig sein würde, soll auch Volrad von Dannenberg neben einigen


|
Seite 101 |




|
anderen Herren versuchen, größere Fürsten, vor allen die welfischen und brandenburgischen, für einen allgemeinen Bund zu gewinnen. Nicht genannt wird der Dannenberger Graf unter denjenigen, denen vom Reiche ihre früheren Besitzungen und Rechte, die ihnen die Dänen genommen haben, zurückgegeben werden sollen, wie z. B. Adolf von Dassel und Adolf von Schauenburg, ein Beweis, daß die Dänen, wie bereits erwähnt, über das Dannenberger Gebiet, das in der Abtretungsurkunde von 1214 mit einbegriffen war, lediglich die Oberlehnsherrschaft beansprucht, im übrigen aber die Grafen hier ungestört gelassen hatten. Doch wird man anzunehmen haben, daß auch Volrad mit diesem Gebiet, den Ländern Jabel und Weningen, jetzt vorläufig vom Reiche belehnt wurde, wie denn in diesem Vertrag von irgendwelchen Rechten des sächsischen Herzogs nicht die Rede ist. Erst etwa 35 Jahre Später erblicken wir den Herzog Albrecht von Sachsen, auf den man jetzt, wahrscheinlich seines jugendlichen Alters wegen, keinerlei Rücksicht nahm, im Besitz gewisser Hoheitsrechte über Jabel. Endlich bestimmt Heinrich von Schwerin vor allen Volrad von Dannenberg zum Vollstrecker dieses Vertrages, falls er selber vor Erfüllung seiner Pflichten gegen das Reich stirbt. Und andererseits verpflichtet sich Volrad neben den übrigen Bürgen des Schweriner Grafen zum Einlager in Goslar, falls von ihrer Partei die Bedingungen nicht pünktlich erfüllt werden.
Man konnte auf seiten der Grafen, deren Interessen hier in so umsichtiger Weise von dem Schweriner Grafen vertreten wurden, mit dem Erreichten zufrieden sein. Hielten die Dänen diesen Vertrag, so war Deutschland von ihrem Joche frei bis zur Eider; wenn nicht. so war doch jetzt Hoffnung vorhanden, daß in einem Kampfe mit ihnen die kleinen Herren nicht mehr alleinstehen, sondern an den größeren Fürsten, ja am Reiche selbst eine Stütze haben würden. Doch auch letzteres glaubte seinen Vorteil bei dem Nordhäuser Vertrag gefunden zu haben. Niemand war über den Stand der Dinge erfreuter als Engelbert von Köln. In Hildesheim, wohin er sich von Nordhausen aus begeben hatte. Stellte er eine Urkunde aus, in der er "seinen geliebten Freunden, dem Grafen Heinrich von Schwerin und Volrad von Dannenberg, für die vielen Dienste, die sie ihm in Sachsen geleistet", ein Lehen von 15 Fuder Wein gab, die ihnen alljährlich zu Martini geliefert werden sollten. 119 )


|
Seite 102 |




|
Die Ironie des Schicksals wollte es, daß fast zur selben Zeit in Rom Papst Honorius III. ein Schreiben an Heinrich von Schwerin und seine Helfershelfer erließ dessen Inhalt von jener Urkunde Engelberts wesentlich verschieden war. Nicht umsonst hatten die letzten drei Könige der Dänen eine ausgesprochen papstfreundliche Politik getrieben. Noch im Jahre 1217 hatte Honorius ebenso wie ein Jahr früher sein Vorgänger Innocenz dem König Waldemar jene Metzer Abtretungsurkunde Kaiser Friedrichs II. bestätigt. 120 ) Dazu hatte sich Waldemar II. beim Papst durch das Versprechen eines Kreuzzuges ein geneigtes Ohr zu verschaffen gewußt, sei es, daß er dieses Gelübde schon vor seiner Gefangennahme getan, sei es, daß erst diese selbst ihn dazu bewogen hatte. 121 ) Jedenfalls wäre kein Versprechen mehr geeignet gewesen, diesen Papst, dessen Denken und Streben in dem Zustandekommen eines allgemeinen Kreuzzuges aufging 122 ), für sich zu gewinnen. Dazu mußte er schon um seines Ansehens willen, das er in der ganzen Christenheit als Schützer des Rechts genoß, bei einer so unerhörten Tat eingreifen. Als sich nun die dänischen Geistlichen und Fürsten mit einer Beschwerde über die Freveltat des Schweriner Grafen an ihn wandten 123 ), da hat er sich mit größtem Nachdruck sowohl bei dem Kaiser wie bei den übrigen Beteiligten für Waldemar eingesetzt, wie wir denn nicht weniger als zwölf Briefe von ihm besitzen, die er in dieser Angelegenheit bis zu der Eidentbindung Waldemars im Jahre 1226 geschrieben hat.
Zunächst wandte er sich an den Frevler selbst. Am 31. Oktober 1223 schrieb er aus Rom an Heinrich von Schwerin einen Brief 124 ), in dem er ihn vor allem darauf hinwies, daß seine Tat um so schwerer wiege, weil er dadurch seinem Lehnsherrn die Treue gebrochen und so, da die Menschen geneigter wären, Schlechtes als Gutes nachzuahmen, ein sehr böses Beispiel gegeben habe. Falls er nun nicht binnen Monatsfrist den Dänenkönig samt seinem Sohne "völlig und ohne irgendwelche Schwierigkeit" - das hieß also ohne Lösegeld - freigäbe, so habe er, der Papst, den Erzbischof von Köln beauftragt, ihn und alle seine


|
Seite 103 |




|
Helfershelfer mit dem Bann zu belegen und über die ganze Diözese, in der die beiden Könige gefangen gehalten würden, das Interdikt zu verhängen und ebenso über jeden Ort, wo der Graf sich aufhalten würde. Außerdem würde er des Grafen Lehnsleute von ihrem Treueid lösen und jeden bannen, der ihm ferner noch anhinge. Sollte er aber solche Strafen verachten und auch ferner noch die Könige gefangen halten, so würde er andere Strafen gegen ihn ausdenken und vor allem "die kaiserliche Rechte wider ihn zu erregen wissen", daß ihn dieser in die Acht erkläre. Ähnlich schrieb er am folgenden Tage an Engelbert von Köln 125 ), den er vor allem darauf hinwies, daß er, der Papst, schon um seines Ansehens wie auch seines Gewissens willen bei einer so schweren Rechts- und Treuverletzung - nur in diesem Lichte vermochte er nach dem einseitigen Berichte der Dänen die Tat zu sehen - eingreifen müsse. Ferner aber stände das Dänenreich in einem besonderen Zinsverhältnis 126 ) zum römischen Stuhl, und Waldemar wie seine Vorgänger hätten sich ihm stets als treue und ergebene Freunde erwiesen. Endlich, und dieser Grund würde allein schon sein Vorgehen erfordern, der Dänenkönig trüge, wenn auch nur heimlich, das Zeichen der Kreuzfahrer und habe fest versprochen, daß entweder er oder sein Sohn, oder doch allermindest fünfzig Ritter in seinem Auftrag dem heiligen Lande zu Hilfe kommen sollten. Der Papst, der über die Stellung Engelberts in dieser Sache offenbar nur sehr mangelhaft unterrichtet war und ihn für einen Freund der Dänenkönige gehalten zu haben scheint, lobt ihn dann für seine Bemühungen zur Befreiung der Dänenkönige und ermahnt ihn, darin fortzufahren und in diesem Sinne auf den Schweriner Grafen einzuwirken und ihn, falls er auf Mahnungen nicht höre, in den Bann zu tun. Ebenso schrieb er an die Bischöfe Berthold von Lübeck und Jso von Verden, indem er ihnen auftrug, den Grafen und seine Genossen zu bannen, falls er nicht binnen Monatsfrist seinen Gefangenen freiließe. Auch an den Kaiser wandte er sich 127 ), indem er ihm darlegte, daß er als oberster Schirmherr allen weltlichen Rechtes unmöglich eine solche Verletzung des Treueides dulden könne, sondern dem treulosen Grafen "die Zeichen seiner Entrüstung zeigen müsse". Er wolle ihm zwar nicht das Beispiel Davids, der, als ihm einer der Seinen meldete, er habe seinen Verfolger Gaul niedergemacht,


|
Seite 104 |




|
diesen Boten hinrichten ließ, weil er sich am Gesalbten des Herrn vergriffen habe, geradezu zur Nachahmung empfehlen, jedoch sei er als Kaiser dem König durch gleiches Interesse verbunden. Denn eine Auflösung aller rechtlichen Ordnung müsse eintreten, wenn man sich die Tat des Schweriner Grafen zum Muster nehme.
Führten nun auch diese Bemühungen des Papstes schließlich eine bedeutende Abänderung des Nordhäuser Vertrages herbei, so ist doch von einer augenblicklichen Wirkung nichts zu bemerken. Ob von den Bischöfen der Bannstrahl wirklich geschleudert ist, vermag man nicht zu erkennen und wird im einzelnen davon abgehangen haben, wie sehr sie in die weltliche Politik hineingezogen und an einer längeren Gefangenschaft der Dänenkönige interessiert waren. Eilig wird es weder der Lübecker Bischof, dessen Stadt sicherlich schon jetzt mehr Sympathien für die deutschen Fürsten als für Waldemar hegte, noch Jso von Verben damit gehabt haben, der als Bruder Bernhards von Wölpe den Dannenberger Grafen verwandt war. 128 ) Jedenfalls das eine steht fest, daß sich die Zunächstbeteiligten, der Schweriner und die Dannenberger Grafen, durch die Drohungen des Papstes nicht im geringsten schrecken ließen. Die Dänenkönige blieden nach wie vor in Dannenberg unter der Obhut Volrads. 129 )
Freilich, zur Befreiung des Landes jenseits der Elbe geschah von den Fürsten nichts, während andererseits auch die Dänen sich darauf beschränkten, Albrecht von Orlamünde zum Verweser des gesamten Reiches zu ernennen, von kriegerischen Maßnahmen zur Wiedererlangung ihrer Könige aber absahen. Denn einerseits befanden sich diese gleichsam als Geiseln in den Händen der Deutschen, andererseits fehlte den Dänen mit der Person Waldemars der Führer und die treidende Kraft aller ihrer Unternehmungen. Unterdessen scheinen dann zwischen Kaiser und Papst, die beide hierin eine Gelegenheit erblicken mochten, ihre getrübten Beziehungen zu einander zu verbessern, neue Verhandlungen gepflogen zu sein, in deren Verlauf der Papst von seiner ursprünglichen Forderung, die Dänenkönige ohne Lösegeld freizugeben, zurückkam, während Friedrich bereit war, einiges von dem, was die Reichsregierung in Nordhausen von Waldemar verlangt hatte, aufzugeben, und zwar im Grunde nicht wenig, wie wir noch sehen werden.


|
Seite 105 |




|
So zogen sich die Dinge hin bis zum Frühling des folgenden Jahres. Im März 1224 wurde der Deutsch-Ordensmeister Hermann von Salza von Friedrich aus Itatien abgesandt, einerseits, um Maßnahmen wegen des beabsichtigten Kreuzzuges zu treffen, andererseits, um diese dänische Angelegenheit zu regeln. 130 ) Am 20. Mai ist Hermann von Salza auf dem Hoftag in Frankfurt, und hier werden wahrscheinlich auf seinen Wunsch die übrigen von Reichswegen an den neuen Verhandlungen teilnehmenden Herren, wie Bernhard von .Horstmar, der Graf Hermann von Harzburg-Woldenberg u. a., bestimmt sein. 131 ) Unter Führung Hermanns, der jetzt auf Grund kaiserlichen Auftrages an Stelle Engelberts von Köln die Verhandlungen leitete, begab sich diese Reichskommission nach Dannenberg, um hier in Gegenwart Waldemars mit der Partei des Schweriner Grafen sowie mit der dänischen, die unter Führung Albrechts von Orlamünde und einiger dänischer Großen erschien, zu verhandeln. 132 )
In der darüber ausgestellten Urkunde ist der Einfluß der päpstlichen Bemühungen sofort zu erkennen. Nicht mehr stehen wie in dem Nordhäuser Vertrag Verpflichtungen des Reiches gegen den Schweriner Grafen oder des Dänenkönigs gegen das Reich an der Spitze, sondern der ganze erste Absatz enthält nur Be-stimmungen über die Ausführung des versprochenen Kreuzzuges. Dann folgen die Bedingungen, die das Reich für sich stellt: Der König selbst soll zwar auf Transalbingien verzichten und die ihm darüber ausgestellten Urkunden ausliefern; doch soll damit Albrecht von Orlamünde - also sein Neffe und derzeitiger Ver-weser des dänischen Reiches! - vom Reiche belehnt werden. Und ausdrücklich verspricht dieses, ihn in seinem Besitz zu schützen. Von einer Wiedereinsetzung oder auch nur Entschädigung des Holsteiner oder Ratzeburger Grafen ist diesmal keine Rede. Die Vasallen Waldemars sollen ihr Lehen jetzt von Albrecht von Orlamünde bezw. vom Reiche empfangen. Zu letzteren gehörten sicher


|
Seite 106 |




|
auch die Dannenberger Grafen. Waldemar selbst soll Herr von Rügen und allen slavischen Gebieten bleiben, die er früber innegehabt hat, nur soll er sie ebenso wie das dänische Reich vom Kaiser zu Lehen nehmen. Von dem, was man dem Grafen Heinrich von Schwerin zu Nordhausen versprochen hatte, wurde zwar das meiste beibehalten; doch war durch diesen Vertrag, der ihn einer so zuverlässigen Hülfe wie des Holsteiner und Ratzeburger Grafen beraubte und ihm Albrecht von Orlamünde, dessen Ansprüche im früheren Vertrage überhaupt nicht berücksichtigt waren, zum unmittelbaren Nachbarn gab, auch seine Lage eine viel bedenklichere geworden. Mit Waldemar persönlich verfuhr man sehr milde. Schon am 8. September, an dem zu Bardowiek der König und die Fürsten des Reiches ihre Einwilligung zu diesem Vertrage erteilen sollten, sollte er frei werden, selbst wenn die erste Rate der an den Schweriner Grafen zu zahlenden Lösesumme von 40 000 Mark noch nicht voll bezahlt sei.
Diesen Vertrag zu halten, verbürgt sich von seiten Heinrichs von Schwerin u. a. auch Graf Heinrich von Dannenberg mit zwei Söhnen, wahrscheinlich den späteren Grafen Bernhard I. und Adolf I. Warum nur er hier und nicht auch sein Bruder genannt wird, ist nicht ersichtlich. Möglich, daß Volrad, der seinerseits wieder bei dem nächsten Vertrag über die Freilassung der Dänenkönige vom 17. November 1225 - siehe unten - allein erscheint, gerade von Dannenberg abwesend war. Soviel scheint aus diesem Tatbestand horvorzugehen, daß beide Brüder in voller Eintracht und offenbar auch völlig unterschiedslos die Verwaltung der Grafschaft führten. Das scheint auch noch ein anderer Umstand, der gleich hier zu erörtern ist, zu beweisen. An der Urkunde hängt nämlich an fünfter Stelle das Siegel des Grafen Heinrich, von dem diesmal glücklicherweise auch die Umschrift erhalten ist. Dieses Siegelbild mit dem aufsteigenden rechts-gekehrten Löwen entspricht nun völlig dem auf S. 94 besprochenen des Grafen Volrad II. Nicht etwa ist, wie das in der folgenden Generation geschah, eine Trennung nach Form und Anordnung des Siegelbildes vorgenommen. 133 ) Später jedoch scheint eine Trübung dieses Verhältnisses eingetreten zu sein, da wir Heinrich noch vor der Schlacht bei Bornhöved im Gefolge des dänenfreundlichen Otto des Kindes erblicken, während Volrad bis zuletzt einer der eifrigsten Feinde der Dänen gewesen zu sein scheint. Möglich aber auch, daß Heinrich seinen Übertritt erst nach dem


|
Seite 107 |




|
Tode seines Bruders, der wahrscheinlich um 1226/27 erfolgte, vollzog. Der Rührigere in diesen Kämpfen gegen die Dänen ist, soweit das an der Hand der spärlichen Nachrichten entschieden werden kann, Volrad, während wir annehmen mögen, daß Heinrich seit seinem Aufenthalt in Dänemark als Geisel Adolfs von Holstein den Dänen eine gewisse Zuneigung bewahrt hatte. So erklärt es sich vielleicht auch, daß er bei all diesen Verhandlungen nur in dieser einen dem Dänenkönig verhältnismäßig günstigen Urkunde erscheint. 134 )
Noch fehlte jedoch diesem Vertrage, der einstweilen nur zwischen Waldemar und dem Grafen von Schwerin durch Vermittlung der von Hermann von Salza geführten Reichskommission abgeschlossen war, die Zustimmung des Königs und der Fürsten. Nach einer Bestimmung der Urkunde sollte zu ihrem Vollzuge ein Hoftag auf den 8. September nach Bardowiek einberufen werden, und inzwischen wollten die hier anwesenden "Reichsboten" 135 ) sich bemühen, die Fürsten des Reiches für den Vertrag zu gewinnen. Auf dem Hoftag, der dann vom 20. bis 25. Juli zu Nürnberg stattfand 136 ), wird Hermann von Salza über das am 4. Juli Erreichte Bericht erstattet und wahrscheinlich auch die Billigung der Reichsfürsten, denen die Wendung zugunsten des Dänenkönigs wohl nicht allzuviele Skrupel bereitete 137 ), gefunden haben.
Hier wird man auch den Termin des Bardowiker Hoftages auf den 29. September verschoben haben. 138 ) An diesem Tage fanden sich hier außer den nächstbeteiligten Grafen und Herren ein der zwölfjährige König Heinrich, Engelbert von Köln und die übrigen Fürsten des königlichen Rats sowie zahlreiche geistliche Herren. Auch der ältere Waldemar, der gemäß dem Dannenberger Vertrag jetzt gleich in Freiheit gesetzt werden sollte, war


|
Seite 108 |




|
von Dannenberg hierher gebracht 139 ), während der jüngere wohl noch in Dannenberg blieb. 140 ) Auf der andern Seite der Elbe lagerte Albrecht von Orlamünde, der ebenso wie die deutschen Herren mit einem großßen Heere erschienen war. Danach scheint es fast, als ob man von vornherein sich gegenseitig nicht recht traute, wobei immerhin die Deutschen als Grund ihrer kriegerischen Begleitung die Bewachung des Dänenkönigs geltend machen konnten, während die Rüstung Albrechts mit Recht Argwohn erwecken mußte. So ist es kein Wunder, daß die Verhandlungen nicht fortschritten, obwohl die Deutschen, offenbar den Dänen zuliebe zwecks Erleichterung des Verkehrs, zwischen dem 6. und 9. Oktober ihr Lager von Bardowiek nach Bleckede verlegten. 141 ) Möglich, daß schon hier durch Otto von Lüneburg, den einzigen Freund der Dänen unter den deutschen Fürsten, mit dem man in Lüneburg verhandelte 142 ), ein friedlicher Ausgang verhindert wurde. Kurz, die Verhandlungen zerschlugen sich hier in Bleckede vollständig, und Albrecht von Orlamünde zog samt dem ungeheuren Lösegelde, das er mitgebracht hatte, ab. Die Schuld scheint dabei durchaus auf seiten der dänischen Partei gelegen zu haben, wenigstens spricht die Sächsische Weltchronik, in deren Darstellung von Parteilichteit nichts zu bemerken ist, davon, daß die Dänen ihre Versprechungen nicht gehalten hätten. 143 )


|
Seite 109 |




|
Daß an diesen Verhandlungen auch der Graf von Schwerin und Volrad von Dannenberg eifrigen Anteil nahmen, ist bei der großen Bedeutung, die sie für ihre Gebiete unmittelbar hatten, selbstverständlich. Doch ist uns durch eine Urkunde, die König Heinrich am 9. Oktober für Kloster Pöhlde im Lager bei Bleckede aus-stellte 144 ), ihre Anwesenheit auch ausdrücklich bezeugt. Vermutlich war von ihnen der Dänenkönig hierher gebracht. Als nun nach dem Abzuge Albrechts von Orlamünde auch die deutschen Herren aufbrachen, scheint jener nicht mehr nach Dannenberg zurückgekehrt, sondern von Heinrich von Schwerin nach Schwerin mitgenommen zu sein, wo wir ihn zur Zeit der Schlacht bei Mölln, Mitte Januar 1225, finden.
So mußte man, nachdem alle Verhandlungen gescheitert waren, die Lösung der schwierigen Frage mit dem Schwerte suchen. Das erkannten auch die norddeutschen Fürsten, denen man fortan diese Angelegenheit wieder allein überließ, sofort. Noch im Dezember desselben Jahres rückte Erzbischof Gerhardt II. von Bremen, der bereits im Frühjahr dem erbittersten Feind des Dänenkönigs, dessen Vetter Waldemar, Bischof von Schleswig, für einen Einfall in Nordalbingien Streiter zur Verfügung gestellt hatte, und dem, wenn er auch in erster Linie für sein Erzbistum Erfolge suchte, doch bei dieser Befreiung deutschen Landes vom Dänenjoche ein Hauptanteil zugesprochen werden muß, über die Elbe und belagerte Itzehoe. Und diesmal waren ihm die Verhältnisse günstig. Allgemein scheint man der Herrschaft der Dänen müde gewesen zu sein. Der Adel Holsteins hatte Adolf IV., den Sohn des 1202 von Waldemar vertriebenen Grafen Adolf, selber ins Land zurückgerufen. Dieser kam nun zusammen mit dem Bremer Erzbischof, dessen Nichte er zur Gemahlin hatte, freudig begrüßt auch von dem Landvolk, das sich der Burgen des dänischen Statthalters bemächtigte. 145 ) Von Osten dagegen rückten Heinrich von Schwerin und sogar der Slavenfürst Heinrich von Werte, ein Sohn Borvins, der sich bisher dem Kampfe ferngehalten, in Holstein ein, nachdem sie - so müssen wir annehmen - ihr eigenes Gebiet von Dänen gesäubert hatten. Bei Mölln im südöstlichen Holstein kam es Mitte Januar 1225 146 ) zu einer erbitterten, blutigen Schlacht zwischen jenen vier verbündeten Herren und Atbrecht von Orla.-


|
Seite 110 |




|
münde, der nur von seinem Vetter 147 ), dem Welfen Otto von Lüneburg, unterstützt wurde. Hier wurden die Dänen völlig besiegt, und während Otto von Lüneburg über die Elbe entkam, geriet Albrecht von Orlamünde samt mehreren Edlen in die Gefangenschaft Heinrichs von Schwerin und wurde von diesem zu seinem Oheim, dem König Waldemar, nach Schwerin gebracht. 148 )
Als jetzt noch Lübeck und Hamburg auf die deutsche Seite traten, stand der ihrer sämtlichen Führer beraubten dänischen Partei ein mächtiger Bund durch gleiche Interessen verbundener Städte und Herren gegenüber. Schlag auf Schlag brach das Unglück über den stolzen Waldemar herein. "Es rächte damals," schreibt der sächsische Chronist, "unser Herrgott am Könige alles, was er am Grafen Adolf getan hatte." Dies stetige Unglück scheit den König ebenso wie die dänischen Großen zur Nachgiebigkeit gestimmt zu haben. So beginnen denn von ihrer Seite, wahrscheinlich schon im Sommer 1225 149 ), neue Verhandlungen, die jetzt, nachdem das Reich sich an den Kämpfen gar nicht beteiligt hatte, natürlich nur zwischen den Dänen und Heinrich von Schwerin und seinen Freunden geführt wurden und endlich am 17. November in einem Vertrage ihren Abschluß fanden, der, wie es scheint, zu Schwerin geschlossen wurde, 150 ) Hier treffen wir auch Volrad von Dannenberg wieder als den zunächst unter den Freunden Heinrichs von Schwerin Genannten, woraus in Verbindung mit einer anderen Nachricht, daß er auch an den Kämpfen gegen Waldemar im Jahre 1226 teilnahm, hervorgeht, daß auch er bis zuletzt an seinem Teil eifrig zur Befreiung des rechtselbischen Gebietes von der Dänenherrschaft beigetragen und nicht etwa die Partei zugunsten der Welfen gewechselt hat.
Was nun die Bestimmungen des Schweriner Vertrages im einzelnen betrifft, so gingen diese, da ja die hier verhandelnden Herren eine Rücksicht auf den Papst nicht zu nehmen brauchten wie seinerzeit der Deutschordensmeister, so ziemlich wieder auf die Nordhäuser Abmachungen zurück. Auch diesmal wurde von den norddeutschen Herren das Reichsinteresse weit besser wahr-


|
Seite 111 |




|
genommen als durch den Bevollmächtigten des Kaisers im Dannenberger Vertrag. Der Dänenkönig mußte schlechtweg alles Land zwischen Eider und Elbe, dazu ganz Slavien außer Rügen, wieder an das Reich herausgeben. Davon, daß er es als Reichslehen wiedererhalten sollte, ist hier ebensowenig die Rede wie von irgend-welchen Ansprüchen seines Neffen Albrecht von Orlamünde. Dagegen soll Adolf IV. von Holstein wieder in seine Grafschaft eingesetzt werden, für den man sich ausdrücklich auch die Übergabe Rendsburgs, einer der ältesten und meistumstrittenen Eroberungen der Dänen, ausbedingt. Ferner ließ sich Heinrich von Schwerin für sich und seine Freunde und Verwandten Urfehde von den Dänen schwören und auf zehn Jahre Geiseln stellen, darunter des Königs eigene Söhne. So verfuhr man mit Waldemar ganz nach dem Muster, das er selbst im Jahre 1203 gegeben hatte. Auf Grund dieses Vertrages wurde er dann endlich am 21. Dezember 1225 151 ) aus seiner langen Gefangenschaft befreit, während sein ältester Sohn und Albrecht von Orlamünde einstweilen noch in Schwerin verblieben.
Doch als dann den Abmachungen gemäß zu Ostern 1226 der jüngere Waldemar freigeworden war und der "Sieger" damit den Thronerben wiedererlangt hatte, da glaubte er die Zeit gekommen, altes, was er während seiner Gefangenschaft eingebüßt hatte, zurückzuerobern. Von einer ferneren Erfüllung des Vertrages war bei ihm nicht mehr die Rede, sondern er wandte sich an den Papst mit der Bitte, ihn seines Eides, den er dem Schweriner Grafen gegeben, zu entbinden, da er ihn nur gezwungen geleistet habe. Gleichzeitig erinnerte er auch wieder an seine Eigenschaft als Kreuzfahrer. 152 ) Doch scheint der Papst nur ungern diesen äußersten Schritt getan zu haben. Er wandte sich zunächst an Heinrich von Schwerin und an den Kaiser mit der Aufforderung, der Graf solle freiwillig auf den erzwungenen Vertrag verzichten, widrigenfalls er dem Kirchenbann verfalle. Doch haben offenbar diese Schreiden samt den Drohungen auf den Schweriner Grafen jetzt so wenig wie früher irgendwelchen Eindruck gemacht. So sprach denn Honorius III. am 26. Juni 1226 Waldemar von seinem Eide los mit der sophistischen Begründung, daß "der Eid nicht ein Band der Ungerechtigkeit, sondern eine Stärkung der Gerechtigkeit sein solle". 153 ) Nun war der Sieger wieder frei!


|
Seite 112 |




|
Und unbekümmert um das Schicksal seiner noch in den Händen des Schweriner Grafen befindlichen Söhne und seines Neffen begann er noch im selben Jahre seinen Eroberungszug in deutsches Gebiet von neuem. Während von Süden her ihm sein Neffe Otto von Lüneburg zu Hülfe zog, überschritt er selbstdie Eider, suchte sich von neuem Dithmarschens zu bemächtigen, was ihm auch im Anfang des folgenden Jahres gelang, und vor allem das wichtige Rendsburg wieder in seine Gewalt zu bringen. 154 )
Längst hatten die Fürsten erkannt, was ihnen drohte, und daß vom Reiche auch jetzt kein Beistand zu erhoffen sei. So schlossen sie sich denn selbst zu einem Bündnis zusammen. Auch riefen sie den Herzog Albrecht, den Sohn Bernhards I. von Sachsen, der bisher wohl kaum etwas von seinem Herzogtum gesehen hatte und auch jetzt beim Kaiser in Italien weilte, ins Land zurück, vermutlich mit der Erklärung, daß sie bereit seien, ihm die Lehmshuldigung zu leisten. Sie übergaben ihm, wie die Stader Annalen berichten, Ratzeburg und Lübeck. Damit erhalten wir den Ursprung des Herzogtums, das später als Sachsen-Lauenburg bezeichnet wurde. Denn während es nicht mehr festzustellen ist, welche Anrechte an Lübeck der Herzog Albrecht erhielt 155 ), liegt die Frage betreffs Ratzeburg sehr einfach: da irgendwelche Rechte des inzwischen verstorbenen Grafen Adols von Dassel oder seines Hauses bei dem Schweriner Vertrage mit Waldemar nicht mehr erwähnt werden, so erhielt jetzt Herzog Albrecht dessen Grafschaft, d. h., da inzwischen Gadebusch an Borvin von Mecklenburg, Wittenburg an Heinrich von Schwerin gekommen war, das eigentliche Ratzeburger Kernland mit der Hauptstadt Ratzeburg. 156 )
Vielleicht hatte, so dürfen wir vermuten, an dieser Berufung des Herzogs Albrecht Graf Volrad von Dannenberg einen nicht unwesentlichen Anteil. Denn sicher stand er dem Hause Albrechts von all den in Frage kommenden Herren besonders nahe; sehen wir ihn doch bereits im Jahre 1225 zweimal in enger Verbindung mit diesem, indem er in Urkunden sowohl der Markgräfin Mathilde, der Witwe des im Jahre 1220 verstorbenen Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg, wie des Grafen Heinrich von Anhalt, Herzog Albrechts Bruder, als Beirat und Zeuge bei


|
Seite 113 |




|
Güterveräußerungen fungiert. 157 ) Doch bevor noch der neue Herzog kam, zogen die verbündeten Herren dem Dänenkönig entgegen bis Rendsburg. In einer Urkunde Adolfs IV., die dieser hier am 29. September "in generali omnium Holtsatorum expeditione" für Kloster Preez ausstellt, finden wir neben dem Holsteiner Grafen, Heinrich von Schwerin, Ludolf von Hallermünde, dem Schwager der Gräfin Adelheid von Ratzeburg, auch Volrad von Dannenberg. 158 ) Doch noch einmal war dem "Sieger" das Kriegsglück hold. Noch am selben Tage wohl, oder doch gleich darauf kam es bei Rendsburg zur Schlacht, in der die Deutschen, obwohl sie dem Gegner zahlreiche Verluste beibrachten, infolge des ungünstigen Geländes schließlich unterlagen. 159 ) Und wieder stand jetzt mit dem Besitze Rendsburgs Waldemar ganz Holstein offen.
In diesen Kämpfen scheint Volrad II. von Dannenberg seinen Tod gefunden zu haben; denn jene Urkunde für Kloster Preez ist das letzte Zeugnis, das wir von ihm besitzen, während von jetzt ab sein Bruder Heinrich mehrfach, und zwar auf seiten Ottos von Lüneburg, genannt wird. Im Gefolge desselben erblicken wir ihn zu Braunschweig im Januar 1227. 160 )
Inzwischen trieben die Dinge einer Entscheidung zu. Bei Bornhoeved stand am 22. Juli 1227 das vereinigte Heer aller uns schon aus den früheren Kämpfen bekannten Herren, des Erzbischofs Gerhard II. von Bremen, der Grafen Adolf von Holstein und Heinrich von Schwerin, Heinrichs von Werle, sowie auch der beiden Städte Hamburg und Lübeck dem vereinigten Heer Waldemars und Ottos von Lüneburg gegenüber. Daß Heinrich von Dannenberg im Heere des letzteren gegen die alten Freunde und Verbündeten gekämpft habe, wo er doch von einem Sieg der dänischen Waffen sicher keine Vorteile zu erwarten hatte, ist nicht wohl anzunehmen, zumal wir ihn einige Jahre später wieder in enger Verbindung mit Adolf IV. von Holstein sehen. So wird denn jene große, für das Schicksal der ganzen nördlichen Gebiete Deutschlands auf Jahrhunderte entscheidende Schlacht ohne Mitwirken des Dannenberger Grafen geschlagen sein. Was diesen


|
Seite 114 |




|
zu seinem Verhalten veranlaßte, ist nicht zu erkennen, doch scheint aus den wenigen Nachrichten, die wir über ihn aus der nächsten Zeit besitzen, hervorzugehen, daß er auch später mehr zur Partei des Welfen als zu der der Verbündeten neigte Damit steht freilich in auffallendem Widerspruch das nächste Zeugnis, das wir von ihm haben. Als zu Anfang des Jahres 1229 Otto von Lüne- burg, der bei Bornhoeved in die Gefangenschaft des Schweriner Grafen geraten war, aus seiner Haft befreit wurde und dem Grafen Gunzel, dem Sohne des inzwischen verstorbenen Heinrich, Urfehde schwur, da verpflichtete er sich, falls er die ihm auferlegten Bedingungen nicht bis Epiphanias erfüllt hätte, samt seinen Bürgen zum Einlager in Dannenberg 161 ) Das setzt doch, dem Wesen des Einlagers entsprechend, voraus, daß der Dannenberger Graf zur Partei Gunzels von Schwerin gehört. Aber noch im selben Jahre erscheint Heinrich von Dannenberg Ende Dezember als Bürge Ottos in dessen Urkunde über den Friedensschluß mit Erzbischof Albrecht von Magdeburg und Bischof Friedrich von Halberstadt, wo er ausdrücklich als Vasall Ottos bezeichnet wird. 162 ) Und auch für den Anfang des nächsten Jahres ist uns ein Aufenthalt Heinrichs zu Braunschweig im Gefolge Ottos des Kindes bezeugt 163 ), so daß wir annehmen müssen, daß er sich hier damals wie vielleicht öfter längere Zeit hintereinander aufgehalten hat


|
Seite 115 |




|
Aus dieser Zeit erhalten wir auch einmal eine Nachricht über die Tätigkeit Heinrichs als Dannenberger Grafen, wenn wir hören, daß er das Dorf Bresegard im Lande Weningen an Bischof Gottschalk von Ratzeburg verkauft. 164 ) Es ist dies nicht nur die älteste Verkaufsurkunde, sondern überhaupt die älteste Urkunde über die Privattätigkeit der Dannenberger Grafen, von der wir Kenntnis haben.
In den folgenden Jahren finden wir Heinrich II. ganz entsprechend der eigentümlichen Lage seines Landes, das sich sowohl auf welfischem wie markgräflichem wie auch - und zwar hier bis auf geringe Ausnahmen nur mit dem rechtselbischen Teil - auf Gebiet des Herzogs von Sachsen ausdehnte, bald bei Otto von Braunschweig-Lüneburg, bald bei dem Markgrafen Johann I. und senem Bruder Otto, bald bei Herzog Albrecht. 165 ) Im Jahre 1234 ist er zu Halberstadt Zeuge Adolfs IV. von Holstein, der dort eine Urkunde über Schenkungen an Kloster Riddagshausen ausstellt. 166 ) Auch das werden wir als eine Stütze unserer Vermutung, daß verwandtschaftliche Beziehungen zwischen beiden Grafenhäusern bestanden, benutzen dürfen.
Das letzte urkundliche Zeugnis über Heinrich stammt aus dem Jahre 1236. Wieder finden wir ihn bei Otto von Lüneburg oder, wie er sich seit einem Jahre nannte, Herzog Otto von Braunschweig, und zwar als Zeugen in der Vertragsurkunde, durch die Otto und Erzbischof Gerhard II. von Bremen den uralten Streit der Welfen und des Bremer Erzstifts um die Grafschaft Stade beilegten. 167 ) Das mag etwa im Frühling gewesen sein. Bald darauf hat sich Graf Heinrich dann auf jene Heerfahrt nach Livland begeben, die ihm verhängnisvoll werden sollte.
Seit man Ende des 12. Jahrhunderts in den Ostseeprovinzen die Kolonisation und Christianisierung von deutscher wie dänischer


|
Seite 116 |




|
Seite begonnen hatte, waren hier nie mehr ruhige Verhältnisse eingetreten. Immer noch mußten durch förmliche Kreuzzüge die vorgeschobenen Posten der Kultur gestützt werden, da der Orden der Schwertbrüder, der hier in erster Linie den Kampf gegen das Heidentum führte, der weit überlegenen Zahl der Heiden allein nicht gewachsen war. So hatte Papst Gregor IX., dem das Schicksal dieser Gebiete sehr am Herzen lag, als er im März des Jahres 1236 den Legaten Wilhelm von Modena hierher sandte, ihm den Auftrag gegeben, auf alle Weise für den Schutz dieser Gebiete zu sorgen und vor allem die zu einer Fahrt ins heilige Land entschlossenen Ritter und Herren des nördlichen Deutschlands zu veranlassen, daß sie anstatt gegen die Türken nach Livland zögen, um hier ihre Glaubensbrüder zu schützen und das Christentum ausbreiten zu helfen. 168 ) Diese Aufforderung hatte den gewünschten Erfolg. Unter Führung des Grafen Heinrich von Dannenberg, dem die livländischen Verhältnisse seit seiner dänischen Gefangenschaft schon bekannt sein mochten, und des Edlen Dietrich von Haseldorf, offenbar eines Vasallen Adolfs von Holstein 169 ), trafen bereits im Sommer 1236 ansehnliche Scharen von Kreuzfahrern in Riga ein und veranlaßten Volkwin, den Ordensmeister der Schwertbrüder, zu einer Heerfahrt gegen die Littauer, zu denen das Christentum bisher noch kaum gedrungen war. Im Spät-sommer zog man los, sengte und verwüstete das Heidenland in der üblichen Weise, während sich die Littauer zurückzogen. Bereits befanden sich die Kreuzfahrer wieder auf dem Rückweg, da wurden sie bei Seule an der kurländischen Aa in der Nähe von Bauske in sumpfiger Gegend plötzlich von den Littauern umstellt und fast bis auf den letzten Mann vernichtet, am St. Moritztage, dem 22. September. Mit dem Ordensmeister und fünfzig seiner Ritter fielen auch Dietrich von Haseldorf und Heinrich II. von Dannenberg. 170 )


|
Seite 117 |




|
Diese Schlacht bei Seule hatte bekanntlich die Vereinigung des fast aufgeriebenen Ordens der Schwertbrüder mit dem der Deutschherren zur Folge, über die man bereits länger verhandelt hatte. Daß die Dannenberger Grafen mit einem dieser beiden Orden schon vorher in engerer Verbindung gestanden hätten, ist nicht bekannt, doch möchte man das fast schließen aus einer Urkunde von 1238. In diesem Jahre verliehen nämlich die Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg als Oberlehnsherren dem Kloster Dünaburg, das in naher Beziehung zu den Schwertbrüdern stand, 30 Hufen in Zachow und 50 Hufen in Siggelkow, die bis dahin die Grafen von Dannenberg und die Grafen von Schwerin von ihnen zu Lehen getragen hatten. 171 ) Das geschah, wie gewöhnlich in solchen Fällen, vermutlich auf Bitten der bisherigen Lehnsträger. Wir haben also hier ein weiteres Zeugnis für Beziehungen der Dannenberger Grafen zu Livland, sei es, daß diese schon länger bestanden, sei es, daß sie eben erst durch jenen unglücklichen Kreuzzug Heinrichs II geknüpft waren 172 )
Von den verwandtschaftlichen Beziehungen und Familienverhältnissen dieses Grafen erfahren wir mit Sicherheit so wenig wie bei seinen Vorfahren. Daß er vermutlich eine Tochter Adolfs III zur Gemahlin hatte, wurde schon gesagt. Was wir sonst noch über seine Familie zu berichten vermögen, beruht auf Schlüssen aus dem Atersverhältnis der in Frage kommenden Persönlichkeiten sowie aus der Art der Siegel, ein Kriterium, das von immer wachsender Bedeutung für die Ermittlung des Verwandtschaftsverhältnisses wird, da uns aus der Folgezeit eine


|
Seite 118 |




|
Ziemliche Anzahl der verschiedensten Siegelbilder erhalten ist. 173 ) Auf Grund dieser Schlüsse ergeben sich als Kinder Heinrichs II. drei Söhne, die Grafen Bernhard I. und Adolf I. und ein Kanonikus Heinrich, der jedoch ebenfalls den Grafentitel führt und als Heinrich IV. zu bezeichnen ist. 174 ) Da wir uns mit den ersteren beiden im Folgenden noch ausführlich zu beschäftigen haben, mag über ihn gleich hier alles gesagt werden, was wir von ihm wissen. Er wird zweimal, um 1245 [?] 175 ) und im Jahre 1255, zusammen mit seinen Brüdern Bernhard I. und Adolf I. urkundlich erwähnt und beide Male im Text als comes bezeichnet, während er das eine Mal, wo uns sein Siegel erhalten ist, als "Eccle. Canon." siegelt. 176 ) Wo er Domherr war, erfahren wir nicht. Saß, M. Jbb. 43, dessen Aufsatz für die genealogischen Dinge im wesentlichen das Richtige trifft, macht ihn in seiner Stammtafel S. 139 zum Domkellner in Verden, eine Vermutung, die wegen der späteren Beziehungen der Dannenberger Grafen zur Verdener Kirche - siehe unten - einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. - Daneben werden auch die Lüneburger U.-B., Abteilung V, Nr. 29, im Jahre 1253 genannten und als "filiae comitis Heinrici de Dannenberg" bezeichneten Gerburge und Sophie, die dem Kloster Isenhagen ihr Eigen in Mehmke [b. Salzwedel] übertragen, als Töchter Heinrichs anzusehen sein. 177 ) Ob, wie Krüger, Zeitschr. des histor. Vereins für Niedersachsen 1874/75 S. 297 ff. und 318, annimmt, Gerburge identisch ist mit der um dieselbe Zeit erscheinenden Gräfin Gerburge von Lüchow 178 ), muß, da uns diese Schenkung in Mehmke leider nur im Exzerpt überliefert ist, dahingestellt bleiben. 179 )


|
Seite 119 |




|
Bevor wir uns jedoch der neuen Generation zuwenden, die durch die Söhne Heinrichs II vertreten wird, müssen wir kurz von dem Erlöschen der durch Volrad II begründeten Linie des Hauses Dannenberg berichten, die bereits mit Volrads Sohn Heinrich ausstirbt.



|



|
|
:
|
Heinrich III. 1233-1237.
Zum ersten Male finden wir diesen erwähnt im Jahre 1233, wo Herzog Johann [Otto?] 180 ) von Braunschweig auf Bitten seiner Vasallen (fideles), des Grafen Heinrich von Hoya und des Grafen Heinrich von Dannenberg, dem Kloster Heiligenrode einen Hof zu Mackenstedt [b Hoya] schenkt. 181 ) Wenn hier Heinrich von Dannenberg neben seinem Oheim, dem Grafen von Hoya, genannt wird, so wird das, wie bereits Saß a. a. O. S. 120 auf Grund der Mackenstedter Verkaufsurkunde vom Jahre 1231
Hoyer U. -B. V, 14 - mit Recht vermutet, seinen Grund in Erbansprüchen haben, die von seiner Mutter Jutta herrührten. Wichtiger ist uns eine andere um 1237 ausgestellte Urkunde Heinrichs, in der er zusammen mit seinem Vetter Bernhard I dem Kloster St Johann in Uelzen "zum Ersatz für den Schaden, den ihm sein Vater Volrad II zugefügt hat", die Vogtei in Ripdorf [b. Uelzen] überläßt. 182 ) Welcher Art dieser Schaden war, wird uns nicht gesagt, und eine andere Nachricht über Zwistigkeiten zwischen Volrad von Dannenberg und dem Uelzener KIoster


|
Seite 120 |




|
besitzen wir nicht. 183 ) Doch gehen wir wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, daß sie bereits ziemlich lange zurücklagen und in die Zeit der allgemeinen Unruhen nach den Bürgerkriegen um den Königsthron fielen, die in Niedersachsen besonders groß waren und hier im Jahre 1223 einen besonderen Landfrieden nötig machten. 184 ) Wie gewöhnlich in solchen Zeiten, hatten damals besonders die Stifter und Klöster unter dieser Unsicherheit zu leiden. 185 ) Zu dieser Zeitbestimmung paßt sehr gut der Umstand, daß wir Volrad II., wie bereits gesagt, nach 1226 niemals mehr genannt finden. Auch diese Urkunde ist übrigens ein Beweis für die große Ausdehnung des Gebietes der Dannenberger Grafen, die in und bei Uelzen mehrfach mit Besitzungen genannt werden.
Noch zweimal finden wir Heinrich III. in demselben Jahre genannt, und zwar beide Male in Verbindung mit seinem Vetter Bernhard I., so daß man annehmen darf, daß auch jetzt noch keine Teilung zwischen den beiden Zweigen der Dannenberger Grafenfamilie vorgenommen war. Das eine Mal erfahren wir, daß die beiden Grafen dem Kloster Reinfeld - das ist das "Reme-velde" bei Pfeffinger - einen Hof (domus) im Dorfe Dachtmissen [bei Lüne] als Lehen übertragen. Diese Urkunde ist uns nur erhalten in der Bestätigung dieser Belohnung durch Herzog Albrecht I. von Sachsen. 186 ) Es muß dahingestellt bleiben, ob, wie v. Hammerstein, Bardengau S. 209, will, Dachtmissen Besitz der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und daher diese Bestätigung lediglich ein Akt der Höflicht der Dannenberger Grafen gegen den Herzog von Sachsen war. Bei den eigentümlichen Besitzverhältnissen dieser Zeit wäre es sehr wohl denkbar, daß Herzog Albrecht hier in nächster Nähe Lüneburgs tatsächlich Lehnsherr war, wie man aus dem Wortlaut der Urkunde schließen würde.


|
Seite 121 |




|
Im übrigen bemerken wir um diese Zeit nicht mehr viel von der Lehnsabhängigkeit der Dannenberger Grafen vom sachsischen Herzogtum. Erst im Jahre 1291 erfahren wir von einer anderen Belehnung, nämlich in Warlow. 187 ) Und als Zeugen finden wir die Dannenberger Grafen bei den sächsischen Herzögen jetzt nur noch ein einziges Mal genannt 188 ), während sie in der Begleitung der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg und der Markgrafen von Brandenburg verhältnismäßig häufig erscheinen. Ja, in dem Kampfe gegen das von den sächsischen Herzögen begünstigte Raubritterunwesen sehen wir sie sogar im offenen Gegensatz gegen die Herzöge Bündnisse abschließen (siehe unten).
Am 21. Juni 1237 treffen wir dann die beiden Dannenberger Grafen zu Lübeck, wo sie "ob favorem et affectum, quo circa cives ducimur Lubicenses", die Lübecker Bürger von allen Abgaben in ihrem ganzen Gebiet, insbesondere zu Dannenberg, Dömitz und Lenzen befreien, abgesehen von dem üblichen Zoll (iustum theloneum), der auch fernerhin von ihnen gezahlt werden muß. 189 ) Es wird sich dabei vermutlich hauptsächlich um Brücken- und Wegegeld gehandelt haben. Leider wird uns nicht gesagt, was die Dannenberger Grafen zu dieser entgegenkommenden Politik gegenüber Lübeck veranlaßte. Man wird jedoch kaum fehlgehen, wenn man den Grund in dem Wunsche sucht, ihren um diese Zeit aufblühenden Städten, eden jenen drei in der Urkunde genannten, gute Beziehungen zu dem damaligen Vorort des norddeutschen Handels und Verkehrs zu schaffen. Und andererseits unterhielt Lübeck seit der Zeit des gemeinsamen Kampfes gegen Waldemar II. gute Beziehungen zu den Fürsten und Herren Norddeutschlands. 190 )


|
Seite 122 |




|
Da wir im nächsten Abschnitt auf die Anfänge städtischen Lebens in Dannenberg näher einzugehen gedenken, muß hier kurz von den beiden anderen genannten Städten gesprochen werden. Dömitz, das später neben Dannenberg der wichtigste Ort der Grafschaft wurde und meistens der Sitz eines Mitgliedes der Grafenfamilie war - im Jahre 1291 wird Adolf II. von seinem Bruder Nikolaus geradezu als Graf von Dömitz bezeichnet 191 ) -, wird hier zum ersten Male genannt. Wenngleich die Namensform auf wendische Gründung schließen läßt, hat es offenbar seine Bedeutung erst durch die Dannenberger Grafen erlangt, und zwar vermutlich in erster Linie durch Anlegung einer Zollstätte. 192 ) Zwar wird es erst im Jahre 1259 ausdrücklich als "civitas" bezeichnet 193 ), doch ist, schon allein aus seiner Gleichstellung mit Dannenberg und Lenzen, als sicher anzunehmen, daß es schon jetzt das Stadtrecht erworben hatte. - Welche Rechte die Dannenberger Grafen in Lenzen besaßen, wird uns leider nirgends gesagt;
immerhin steht soviel fest, daß sie hier von den Markgrafen von Brandenburg gemeinsam mit den Schweriner Grafen belehnt waren. 194 ) Doch scheinen sie dies Lehen nur kurze Zeit jedenfalls nicht länger als etwa dreißig Jahre, besessen zu haben; denn im Jahre 1219 hatte Markgraf Albrecht II. allein den Grafen Heinrich den Schwarzen von Schwerin mit Schloß, Dorf und Zoll in Lenzen belehnt 195 ), und bereits 1252 hören wir, daß es an Brandenburg zurückgefallen sei. 196 ) Wahrscheinlich datierte jene Mitbelehnung aus der Zeit der engen Freundschaft zwischen den Schweriner und Dannenberger Grafen in ihrem Kampfe gegen Waldemar II. von Dänemark. 197 )
Innere Einrichtung der Grafschaft Dannenberg um 1250.
Bevor wir uns nun der nächsten, durch die Söhne Heinrichs II., Bernhard I. und Adolf I., vertretenen Generation zuwenden, müssen wir einen kurzen Blick auf die innere Einrichtung unserer


|
Seite 123 |




|
Grafschaft werfen. Freilich sind die Zeugnisse darüber, wenngleich sie sich im Verhältnis zur vorausgegangenen Zeit bedeutend mehren, immer noch recht spärlich. Dennoch muß es versucht werden, ein, wenn auch unvollkommenes, Bild der Struktur einer solchen Grafschaft zu gewinnen. Dieses wird jedoch, soll es überhaupt möglich sein, die aus ganz verschiedenen Jahren stammenden Nachrichten auf einen Zeitpunkt vereinigen müssen, der hier um das Jahr 1250 als die Zeit der größten Ausdehnung der Grafschaft Dannenberg gewählt ist. Wie bereits gezeigt 198 ), bestand die Herrschaft unserer Grafen links der Elbe aus lauter kleinen und kleinsten Besitzungen, die sich in einem großen Bogen von den Quellen der Jeetzel bis zur Mündung der Luhe erstreckten. Es war vollkommener Streubesitz; denn dicht neben einem dannenbergischen lag ein Dorf der Schweriner oder der Lüchower Grafen, ja sogar in allernächster Nähe von Dannenberg fanden sich Lehen der ersteren. 199 )
Der Besitz der Dannenberger Grafen verteilte sich, abgesehen von ihrem Allod in der Magdeburger und Salzwedeler Gegend, im wesentlichen auf vier Oderlehnsherren, nämlich die Herzöge von Sachsen, die Herzöge von Braunschweig-Lüneburg, die Markgrafen von Brandenburg und das Verdener Bistum. Von letzterem besaßen sie nur Zehnten. Das ist wichtig für uns; denn da in den Urkunden nur verhältnismäßig selten die Herkunft der Besitzrechte angegeben wird, werden wir überall da, wo wir links der Elbe Zehntbesitz der Dannenberger Grafen finden, die Verdener Kirche als Oberlehnsherrn anzunehmen haben. Merkwürdigerweise haben diese garnicht einmal zahlreichen Besitzungen dazu geführt, daß man in späterer Zeit die ganze Grafschaft, wenngleich im engeren Sinne, d. h. auf den linkselbischen Teil beschränkt, als Verdener Lehen ansah. Diese Ansicht ist erst zutreffend für das Ende des 14. Jahrhunderts, als es längst keine Grafen von Dannenberg mehr gab und als man unter der "comitia in Dannenberge" lediglich die Stadt selbst mit ihrer nächsten Umgebung verstand. 200 ) Genau genommen käme als fünfter Lehnsherr noch das Bistum Ratzeburg hinzu wegen des um 1190 von Bischof Isfried dem Grafen Heinrich I. verliehenen Zehnten im


|
Seite 124 |




|
Lande Weningen und Jabel. Doch besteht kein Zweifel, daß sich diese Zehntverleihung inzwischen zu einem Territorialbesitz ausgewachsen hatte und somit Lehen des Herzogs von Sachsen war, während, wie bekannt, das Land Jabel nie in den wirtlichen Besitz der Grafen übergegangen und daher unmittelbar an die Herzöge gefallen war.
Auch hinsichtlich der Rechte, die die Dannenberger Grafen an den einzelnen Besitzungen hatten, werden die mannigfachsten Unterschiede bemerkbar. Mehrfach sind sie, zumal bei brandenburgischen Lehen ist das der Fall, gemeinsam mit den Schweriner Grafen belehnt; an manchen Orten beschränkt sich ihr Lehen aus wenige Hufen; über Bardowiek und Ripdorf üben sie lediglich die Vogtei aus. - Wie schon erwähnt, wird uns in den wenigsten Fällen der Ursprung dieser Besitzrechte genannt; doch ist, abgesehen von den Fällen, wo das geschieht, immerhin ein weiterer Teil durch Schlüsse aus der Lage oder sonstigen Angaben, wie z. B., daß sie als Zehnten bezeichnet werden, festzulegen. Die Tabelle auf S. 125 möge das Verhältnis veranschaulichen. Die Besitzungen, deren Ursprung nicht angegeben ist in den Urkunden, deren Zugehörigkeit zur einen oder andern Gruppe jedoch als einigermaßen gesichert erscheint, sind mit einem Fragezeichen versehen. Dennoch hat hier nur etwa die Hälfte der Besitzungen eingetragen werden können. Die sämtlichen bekannten Rechte der Dannenberger Grafen sowie die urkundlichen Belege finden sich im Exkurs II. Ein großer Teil der nicht eingetragenen Orte findet sich im Lande Weningen, das den Grafen als Ganzes von den Herzögen von Sachsen übertragen war. Mehrfach werden hier Dörfer als Eigen der Grafen genannt; diese sind in der Tabelle in Klammern gesetzt, da sie natürlich von dem übrigen Allodialbesitz scharf geschieben werden müssen.
Die völlig verstreute Lage dieses Besitzes machte es den Grafen natürlich unmöglich, alles seber zu bewirtschaften; auch folgten sie nur dem Brauch der Zeit, wenn sie ihn als Afterlehen an ihre Mannen austeilten, die auf diese Weise für die Verpflichtung zur Heeresfolge entschädigt wurden. Im folgenden soll versucht werden, ein Bild dieses Lehensverhältnisses in der Grafschaft Dannenberg zu gewinnen:
1. Bei weitem die meisten Lehen hatte, wenigstens in späterer Zeit, die Familie von dem Knesebeck inne, die in den Brüdern Wasmod und Paridam zuerst im Jahre 1289 im Gefolge der


|
Seite 125 |




|
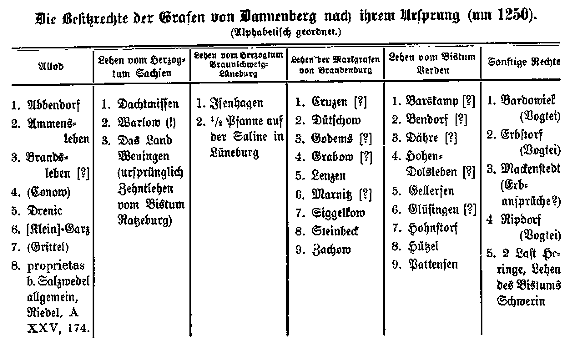


|
Seite 126 |




|
Dannenberger Grafen angetroffen wird. 201 ) Das zeigt uns eine außerordentlich wichtige Notiz in dem von v Hodenberg herausgegebenen Lüneburger Lehnregister der Zeit von 1330/52. 202 )
2. Die Brüder Lippold und Gerhard von Dähre waren in Dahre mit 6, in Bendorf mit 14 Wichhimpten Roggen belehnt, wie wir gelegentlich eines Tausches der beiden Brüder mit der Dährener Kirche erfahren. 203 ) Leider hören wir nicht, ob der Lehnbesitz der Dannenberger Grafen in diesen beiden Orten noch mehr als dies wiederverliehene Gut umfaßte. Allem Anschein nach trugen sie selbst es von der Verdener Kirche zu Lehen, da im Jahre 1250 Bischof Lüder von Verden jenen Tausch bestätigte Da wir nun im übrigen immer nur von Zehnten hören, die von der Verdener Kirche an die Dannenberger Grafen verliehen waren, so werden wir in jenen 20 Wichhimpten etwas Ähnliches zu sehen haben. - Einen Sohn Gerhards v. Dähre, Dithard, finden wir belehnt mit Hohnstorf [b Uelzen]. 204 )
3. Die in Dannenberger Urkunden sehr häufig als Zeugen genannte märkische Familie v. Bardeleben war mit Rohrberg [i. d. Altm.] belehnt. 205 )
4. Johann Gans v. Gartow, ein Mitglied der Familie Gans von Putlitz, und sein Sohn Gebhard (Gevehard) besaßen Gladdenstedt [ebenfalls i. d. Altm. ]. 206 )


|
Seite 127 |




|
5. Ebendort, in Mehmke, wird eine ganze Reihe von Lehnsträgern erwähnt, die jedoch sämtlich nur 1 bis 2 Hufen von den Dannenberger Grafen innehatten. Der wichtigste von ihnen ist Philipp v. Stöcken, dessen gleichnamigen Enkel 207 ) wir im Jahre 1311 auch in Tramm i. d. Altm. belehnt finden. Neben ihm werden genannt Berthold v. Weldensburg, Dietrich v. Jaborn, Konrad v. Botendorf, Dietrich Bocmast und Ida, Witwe v. Bornstedt. 208 )
6. Ludolf v. Estorf wird als Lehnsträger in Melbeck (b. Lüneburg) 209 ) und
7. Berthold v. Lengede in Cruzen im nordöstlichsten Teil der- Grafschaft genannt. 210 )
8. Huno v. Karwe wird im Jahre 1290 von Graf Nikolaus mit Grittel und der Holzungsfreiheit im Walde Liepe belehnt. 211 )
9. Das Allodialgut der Grafen in ihrer Heimat Ammensleben finden wir in Händen des Herrn Konrad, Schenk von Magdeburg, und Johann Kribbenclots. 212 ) Alle diese Lehnsmänner werden durchweg als "milites" bezeichnet; sie gehörten also dem Stande der Ministerialen an, der bekanntlich eben damals mächtig emporstrebte und bald seinen Anschluß an den der Ritterbürtigen vollzog.
Neben diesen ausdrücklich als von den Dannenberger Grafen mit Lehen ausgestattet erwähnten Herren treffen wir in ihrem Gefolge, meist als Zeugen, noch eine ganze Reihe anderer Ministerialengeschlechter. Das wichtigste derselben ist das der Herren von Dannenberg, das zum ersten Male im Jahre 1237 mit Ernst von Dannenberg in der bereits erwähnten Urkunde erscheint, die Heinrich III. und Bernhard I. der Stadt Lübeck ausstellen. 213 ) Auffallend ist, daß er sowohl wie die übrigen genannten Herren außer Ritter Arnold von Tramm hier als "mercatores" bezeichnet werden, während sie ganz offenbar dem Ritterstand an-gehören und wir z. B. den hier genannten Gerhard v. Bezmer im Jahre 1253 als Gerhard v. Boizmer in rittermäßiger Stellung.


|
Seite 128 |




|
finden. 214 ) Auch Ernst von Dannenberg wird noch ein zweites Mal um 1237 erwähnt und hier ausdrücklich als miles bezeichnet. 215 ) Später - er ist nachweisbar bis 1251 - finden wir ihn nur in Urkunden der Markgrafen genannt, und zwar ohne daß die Grafen von Dannenberg anwesend sind. Einmal wird er von jenen sogar als fidelis noster Ernestus de Dannenberg bezeichnet. 216 ) Auch Ernst's Sohn Heinrich, der bis 1295 erwähnt wird, scheint in der Hauptsache Vasall der Markgrafen gewesen zu sein. 217 ) Doch wird er auch zweimal als Vasall Bernhards II von Dannenberg genannt. 218 ) Von den Schweriner Grafen besaß er in unmittelbarer Nähe Dannenbergs Dorf und Mühle in Streetz. 219 ) Ein Sohn Heinrichs ist der bis 1311 als Knappe (famulus), später als miles mehrfach, jedoch nur ein einziges Mal in Verbindung mit dem Dannenberger Grafenhause, genannte Otto von Dannenberg. 220 ) Natürlich stand diese Ministerialenfamilie in keinerlei verwandtschaftlicher Beziehung zum Grafenhause, wie z. B. Riedel annimmt, bei dem sie im Namenverzeichnis Bd. I in bunter Reihe mit den Grafen erscheint. 221 ) Ob bereits der um 1190 als erster urkundlich nachweisbare Ministeriate der Dannenberger Grafen genannte Helingerus, miles de Dannenberge, dieser Familie angehört, muß unentschieden bleiben. Von sonstigen Ministerialengeschlechtern werden noch häufiger genannt die v. Hitzacker, die Paschedach, Dargeslav, Lasbek, Schlegel, Zicker, Clitzing, v. Breze - nach M. U.-B. IV, Ortsreg., aus Breetze b. Bleckede -, v. Estorf, v. Herzfeld, v. Pinnow, v. Dassow, v. Gartow, v. Holdenstedt, v. Bodenteich, v. Alvensleben, v. Wülmersen u. a. 222 ) Man sieht, mit den bereits oben unter den Belehnten genannten Herren


|
Seite 129 |




|
war es eine stattliche Schar von Gefolgsleuten, über die die Dannenberger Grafen geboten.
Mit dem festen Sitz der Grafen in Dannenberg und der Erweiterung der Burg zur Stadt, die verhältnismäßig schon früh vor sich gegangen war 223 ), und der wachsenden Verwaltungstechnik hatte sich hier ein förmlicher Hof nach dem Muster der Fürstenhöfe gebildet. So finden wir in den Urkunden häufig genannt den Hofkaplan und Hofnotar Hoger (Hogerus cappellanus et notarius curie) und als seinen Nachfolger Alberich. Dies Amt erschien so wichtig, daß die Söhne Adolfs I. einen eignen Kaplan, Heinrich, hatten. 224 ) Auch der Kämmerer, Tylo, findet sich. 225 ) Von sonstigen Beamten treffen wir in Dannenberg nacheinander die Vögte Martin, Hermann und Johann Mulo, die zu den milites gerechnet werden, und in der zweiten Stadt der Grafschaft, Dömitz, den Zöllner Johann. 226 )
Auch einige Spuren städtischen Lebens finden sich. So wird um 1230 der Propst Eilbert in Dannenberg genannt - M. U.-B. I Nr. 375 S. 376 -, den wir im Jahre 1240 zu Stade finden. Wie uns die Stader Annalen - MG SS XVI, 367 - berichten, gehörte er dem Minoritenorden an. Offenbar war sowohl er wie der im Jahre 1252 erwähnte Propst Cyriacus und der 1264 ohne Namen genannte dominus praepositus de Dannenberge 227 ) Vorsteher des Nonnenklosters zu Dannenberg 228 ) und zugleich Seelsorger der Stadt. In Dömitz werden uns um 1272 zu gleicher Zeit zwei Geistliche (sacerdotes) genannt, der plebanus [- Archidiakon] Alberich und ein Rudolf, dessen Amt nicht näher bezeichnet ist. In Dannenberg wird um 1279 ein Goldschmied Dietrich (Thidericus aurifaber) erwähnt 229 ), und


|
Seite 130 |




|
in Dömitz treffen wir ungefähr um dieselbe Zeit fünf Ratsherren (consules), darunter die beiden Schuster Arnold und Bernhard. 230 ) Beide Städte besaßen das Münzrecht, doch mit dem Unterschiede, daß dasselbe in Dannenberg von den Bürgern erworben war, während es in Dömitz den Grafen gehörte, was auf eine größere Selbständigkeit der ersteren Stadt überhaupt schließen läßt. 231 )



|



|
|
:
|
Bernhard I. 1227-1266 und Adolf I. 1245-1266.
Von den Söhnen Heinrichs II. folgten ihm, nachdem Heinrich IV. in den geistlichen Stand getreten war - siehe oben -, Bernhard und Adolf in der Grafschaft. Diese verwalteten sie, wie es scheint, völlig gemeinsam. Nur darin mag man einen Unterschied sehen, daß Bernhard mehrfach im Gefolge der Markgrafen von Brandenburg erscheint, während Adolf häufiger als Zeuge des Herzogs Albrecht von Braunschweig genannt wird. 232 ) Von den beiden Brüdern ist Bernhard offenbar bei weitem der ältere; denn während wir Adolf erst im Jahre 1245 nachweisen können 233 ), finden wir ihn bereits 1227 - also noch zu Lebzeiten seines Vaters - als Grafen von Dannenberg genannt. 234 ) Legt schon die enge Verbindung, in der Bernhard hier mit den Schweriner Grafen auftritt, den Gedanken einer verwandtschaftlichen Beziehung zu ihnen nahe, so wird eine solche und zwar in der Weise, daß die Gemahlin Bernhards eine Gräfin von Schwerin war, wahrscheinlich gemacht durch den Umstand, daß zwei seiner Söhne die Namen Nikolaus und Gunzel tragen, Namen, von denen der letztere seit langem im Schweriner Grafenhause gebräuchlich ist, während der erstere in beiden Familien ziemlich zu gleicher Zeit auftritt. Um so mehr sind wir zu einer solchen Annahme berechtigt, als es sehr wahrscheinlich ist, daß das seit langem zwischen beiden Grafenhäusern bestehende gute


|
Seite 131 |




|
Verhältnis auch zu einer verwandtschaftlichen Verbindung führte. 235 ) Den Namen der Gemahlin Bernhards erfahren wir nicht. - Wenig mehr ist uns bekannt über die Gemahlin Adolfs I. Wir wissen nur, daß sie Mathilde hieß und wahrscheinlich um 1259 starb, da in diesem Jahre Graf Adolf dem Nonnenkloster Eldena, dem bedeutendsten auf Dannenberger Gebiet, eine jährliche Hebung von 2 Chor Malz aus der Mühle zu Dömitz zu Seelmessen für seine verstorbene Gattin schenkte. 236 )
Während der nächsten Zeit treffen wir Bernhard zweimal als Zeugen, und zwar im Jahre 1230 bei dem Schutz- und Trutz-bündnis, das Fürst Johann von Mecklenburg und Herr Nikolaus von Rostock, Fürst von Werle, mit Graf Gunzel von Schwerin schließen 237 ), und im Jahre 1232 zu Gandersheim im Gefolge Ottos des Kindes von Braunschweig-Lüneburg, der der Abtissin Berta von Gandersheim Ersatz verspricht für den Verlust, den ihr Kloster während seiner Schweriner Gefangenschaft von seinen Leuten erlitten hat. 238 ) Daß er dann im Jahre 1237 mehrfach zusammen mit seinem Vetter Heinrich III. genannt wird, wurde bereits gesagt. Endlich im Jahre 1245 finden wir ihn zum ersten Male zusammen mit seinem Bruder Adolf genannt, und zwar im Kloster Oldenstadt bei Ülzen, wo beide Brüder "auf Bitten ihres Herrn", des Herzogs Otto von Braunschweig, auf ihr Lehnrecht an Isenhagen verzichten, da der Herzog hier ein Kloster erbauen will. 239 )
In den nächsten Jahren erscheinen die Dannenberger Grafen in ziemlich engem Zusammenhang mit den Markgrafen von Brandenburg. Denn während Bernhard im Jahre 1249 zu Arneburg als Zeuge Johannes I. und Ottos III. füngiert 240 ), werden "die Grafen von Dannenberg" zusammen mit anderen


|
Seite 132 |




|
Lehnsleuten der Markgrafen, den von Emmelndorf, Tralau und Crumesse, besonders genannt, als am 20. April 1252 Markgraf Johann I. zu Wolmirstedt Frieden mit Lübeck schließt. Dieses war nämlich am 25. März dieses Jahres durch Wilhelm von Holland an die Markgrafen verliehen 241 ) und lag seitdem in Fehde mit ihnen. Daran scheinen sich jene brandenburgischen Vasallen, voran die Dannenberger Grafen - ganz im Gegensatz zu ihrer Haltung im Jahre 1237 -, eifrig beteiligt zu haben. Denn es wird jetzt bestimmt, daß sie die Bürger Lübecks, solange sie in ihrem Gebiet sich befinden, in keiner Weise belästigen sollen. 242 ) Doch scheint diese Weisung wenig gefruchtet zu haben; denn bereits im nächsten Jahre wieder kündigen die Grafen Bernhard und Adolf von Dannenberg "auf Befehl ihrer Herren, der Markgrafen von Brandenburg," dem Rat und der Gemeinde zu Lübeck an, daß sie mit ihnen einen Waffenstillstand (treugas ad tempus) mit 14 tägiger Kündigungsfrist schließen wollen. Sie bitten, daß bis zur Aufhebung dieses Waffenstillstandes auch die Bürger ihrer Städte von den Lübeckern in ihrem Gebiet volles Geleit (plenum ducatum) erhalten, damit sie in Ruhe und Frieden ihrem Handel nachgehen können. 243 )
In denselben Zusammenhang gehört auch eine undatierte Urkunde, die vom Lübecker und ebenso vom Mecklenburgischen Urkundenbuch mit Recht ins Jahr 1253 gesetzt wird. Darin schreiben die Grafen Bernhard und Adolf von Dannenberg an die Lübecker auf ihre Beschwerde, daß ihnen in der Nähe der Stadt von Leuten der beiden Grafen Pferde gestohlen seien, daß die von ihnen bezeichneten Knechte (servi) nicht die ihrigen seien. Für den Fall jedoch, daß ihnen auch von ihren Leuten irgendwelcher Schaden zugefügt sei, möchten sie zwei Bürger unter dem Geleit der Grafen zu ihnen senden, mit denen sie dann die Sache näher untersuchen wollten. 244 )


|
Seite 133 |




|
Ein weiteres Zeugnis ihrer engen Verbindung mit den Markgrafen erhalten wir zwei Jahre später, als Otto III. dem Hl. Geisthospital zu Salzwedel alle Güter, die diesem von den Grafen von Dannenberg geschenkt sind, bestätigt. 245 ) Es scheint sich dabei teils um Allodialgut der Grafen, teils um brandenburgisches Lehen gehandelt zu haben, da die Worte des Markgrafen: "... si quid iuris habuimus in eisdem" andeuten, daß er keineswegs für die gesamte Schenkung die Oberlehnsherrschaft beanspruchte. Eine genaue Zuweisung der uns hier bekannten Besitzungen der Dannenberger zur einen oder andern Gruppe ist leider mangels näherer Angaben nur in zwei Fällen, für Abbendorf und Drenic, möglich. In der Nähe lag Gladdenstedt, das im Jahre 1255 die Lehnsmänner der Grafen Johann Gans von Gartow und sein Sohn Gebhard an Kloster Isenhagen für 74 Mark Schwarzsilber verkauft hatten und das sie nun dem Kloster frei von Vogtei und allen Spanndiensten (angariis et parangariis) übertrugen. 246 ) Drei Jahre früher hatte Graf Adolf das nahegelegene Dorf Drenic an die Bürger von Rohrberg verkauft, sich jedoch dabei ausdrücklich die Vogtei vorbehalten. 247 ) Das ist ein ganz bezeichnender Unterschied; man sieht, mit welcher Umsicht und Folgerichtigkeit die Kirche stets auf Erweiterung ihrer Rechte bedacht war; denn jenes Beispiel steht keineswegs vereinzelt da, sondern bildet durchaus die Regel.
Beachtenswert vom kulturgeschichtlichen Standpunkt ist in der zuletzt genannten Urkunde die Formel der Übertragung "tam in parenis quam lignis". Offenbar steht hier "ligna" im Gegensatz zu "parenae" [= paranae] 248 ), d. h. zum eingegrenzten Besitz. Danach muß man annehmen, daß noch um diese Zeit hier im Kolonialgebiet der Wald Gemeinbesitz, Allmende war. Eine Entscheidung darüber, ob diese Ansicht richtig ist oder der Ausdruck


|
Seite 134 |




|
hier nur rein formelhaft gebraucht wird, ist leider nicht mögtich, da er nur an dieser einen Stelle begegnet.
Im Jahre 1257 treffen wir Adolf dann wieder bei Herzog Albrecht von Braunschweig, und zwar auf einem Kriegszuge des selben gegen Simon von der Lippe, Bischof von Paberborn und SchJrmer (tutor) der Kirchen von Bremen und Corvey. Zwischen beiden findet nun zu Elstorf [b. Zeven] eine Versöhnung statt, während gleichzeitig der Bruder Simons von der Lippe, Erzbischof Gerhard von Bremen, seinen mit Herzog Albrecht und dessen Vater, Otto dem Kinde, geschlossenen Vertrag erneuert. 249 ) Ein Jahr später ist Adolf Zeuge in dem Vertrag, den auf Vermittlung Johanns I. von Brandenburg Herzog Albrecht von Braunschweig mit Herzog Albrecht I. von Sachsen zu Breitenfeld in Lauenburg schließt, dessen große Bedeutung für die endgültige Regelung der langwierigen Streitfragen zwischen den beiden Herrscherhäusern, insdesondere auch für den Darzing, bereits erwähnt wurde. 250 )
In diesen Jahren scheint sich nun das gute Verhältnis der Dannenberger zu den Schweriner Grafen getrübt zu haben. Noch um 1260 hatte Gunzel von Schwerin ebenso wie Johann von Mecklenburg und Nikolaus von Werle den beiden Dannenberger Grafen ihr altes Recht auf zollfreie Ein- und Ausfuhr in Parchim bestätigt. 251 ) Zwei Jahre später jedoch finden wir Gunzel von Schwerin und seine Söhne Heinrich und Helmold in Fehde mit Adolf von Dannenberg, bei der von beiden Seiten Räubereien begangen und auf dannenbergischer Seite sogar zwei Leute getötet wurden, bis sich schließlich Bischof Rudolf von Schwerin ins Mittel legte und am 20. April 1262 zu "Kempenberg" Frieden


|
Seite 135 |




|
stiftete. 252 ) Danach soll der Schweriner Graf, auf dessen Seite offenbar die Schuld lag, 36 Pfund für die beiden Ermordeten zahlen. Ferner überläßt er dem Dannenberger Grafen seinen Anteil an Zachow und Siggelkow, die beide bisher gemeinsam besessen hatten. 253 ) Dazu kommt als eine wichtige Bestimmung über den Durchgangszoll, das sogenannte Ungeld, daß die Leute des Dannenberger Grafen drei Jahre lang 150 Chor Getreide (annonae) "aus ihren eignen Städten und Ländern" durch das Schweriner Gebiet zollfrei befördern dürfen, mit Ausnahme des Schiffszolls. 254 ) Ebenso wird ihnen volle Zollfreiheit für den Transport von Holz bewilligt. Es scheint danach, daß in der Grafschaft Dannenberg - besonders kommt wohl der rechtselbische Teil in Frage - Getreide- und Holzausfuhr damals nicht unbedeutend war. Auch wurde die jagdrechtlich recht interessante Bestimmung getroffen, daß niemand ein im eignen Gebiet aufgejagtes Stück Wild über die Landesgrenze verfolgen dürfe, eine Bestimmung, die voraussetzt, daß beide Grafschaften bereits durch feste Grenzen getrennt waren. Und endlich wurde festgesetzt, daß niemand in seinen Burgen oder Ländern Leute dulden solle, die dem andern Schaden zufügen könnten. Gemäß einer bereits vorher getroffenen Verabredung ist der Schweriner Graf außerdem verpflichtet, auf seine Gefahr, doch auf Kosten des Grafen Adolf, diesem 40 gepanzerte Rosse (dextrarios falleratos) zu stellen.
Tatsächlich scheint dann durch diesen Vertrag das frühere gute Einvernehmen zwischen den beiden Nachbarn wiederhergestellt zu sein. Denn am 9. Juni 1266 schlossen sie einen Heiratsvertrag in der Form, daß die älteste Tochter Adolfs von Dannenberg mit dem ältesten Sohn Gunzels III., dem Grafen Helmold III., vermählt würde. 255 ) Als Mitgift sollte sie 800 Mark reinen Silbers von ihrem Vater erhalten und zum Leibgeding von den beiden Schweriner Grafen 400 Mark "gebräuchlicher Münze" als Ein-


|
Seite 136 |




|
kommen aus dem Lande Lenzen oder dem Lande Silesen [östlich vom Schweriner See] und einen Hof in Schwerin "apud fratres", d. h. offenbar in der Nähe des Mönchsklosters. Gleichzeitig wurde zwischen beiden Grafenhäusern ein Schutz- und Trutzbündnis geschlossen, das auch dann Geltung haben sollte, wenn die Heirat nicht zustande käme. Freilich hatte man sich vor diesem Fall ziemlich gesichert durch die Klausel, daß, falls einer der beiden Verlobten vorzeitig stürbe, dessen Brüder bezw. Schwestern an seine Stelle treten sollten. So werden wir - nähere Nachrichten darüber fehlen - anzunehmen haben, ,daß die hier verabredete Vermählung einer dannenbergischen Gräfin mit Helmold III. von Schwerin - 1274/95 - später in der Tat vollzogen wurde. Beide Grafenhäuser treffen wir im selben Jahre noch bei einer andern Gelegenheit in engster Verbindung. Als sich nach dem Tode Johanns I. von Mecklenburg dessen Söhne Johann und Hermann, von denen der eine zu Hildesheim, der andere zu Lübeck Domherr war, gegen ihren Bruder Heinrich mit den beiden Schweriner Grafen verbündeten, da gelobten sie, nur mit Einwilligung der Schweriner Grafen und Adolfs von Dannenberg Frieden mit ihrem Bruder schließen zu wollen. 256 )
Bald darauf scheinen dann beide Brüder gestorben zu sein. Ausdrücklich bezeugt wird uns das freilich nur für Adolf durch eine Urkunde vom 29. September 1267, in der seine Neffen Heinrich V. und Adolf II., Söhne Bernhards I., dem Kloster Scharnebeck [bei Lüneburg] die Zehnten in Pattensen und Gellersen verkaufen. 257 ) Da hierbei so wenig wie bei dem Bündnis, das Adolf II. im Jahre 1273 mit Gunzel von Schwerin und dessen Sohn Helmold schloß, Bernhard I. genannt wird, so müssen wir annehmen, daß auch sein Tod um diese Zeit erfolgte, wenngleich erst eine Urkunde vom Jahre 1276 ihn als verstorben erwähnt. 258 )
Die letzten 40 Jahre der Grafschaft.
Beide Brüder hinterließen zahlreiche Söhne und Töchter. Auch jetzt noch führten die Söhne, da jene Zeit den wichtigen Grundsatz, die Hauptmasse des Landes ungeteilt auf den ältesten


|
Seite 137 |




|
Sohn zu vererben, nicht kannte, die Verwaltung der Grafschaft gemeinsam. Doch scheint man, wenigstens unter den Vettern, eine gewisse Teilung vorgenommen zu haben. Denn als im Jahre 1267 jener Verkauf der Zehnten in Pattensen und Gellersen an Kloster Scharnebeck stattfindet - siehe oben -, da wollen Heinrich V. und Adolf II., falls die Söhne ihres Oheims Adolf mit dem Verkauf nicht einverstanden sind, für deren Anteil Ersatz von "ihren eigenen Gütern" schaffen. Auch wird gelegentlich Heinrich V. als Graf von Grabow und Adolf II. als Graf von Dömitz bezeichnet 259 ); doch beziehen sich diese Titel offenbar im wesentlichen nur auf ihre Residenz, denn nach wie vor hatten die Brüder sowohl wie die Vettern links wie rechts der Elbe gemeinsamen Besitz, der ihnen freilich bald verhängnisvoll werden sollte. - Als Söhne Bernhards I. werden uns im Jahre 1264 Heinrich V. 260 ), Adolf II., Bernhard II., Gunzel und Nikolaus genannt. 261 ) Von diesen wird Gunzel nur dies eine Mal erwähnt;
denn wenn Riedel a. a. O. A XVI S. 406 Nr. 20 ihn noch ein zweites Mal im Jahre 1279 finden will, so beruht das auf einem Lesefehler. 262 ) Eine Tochter Bernhards, deren Namen wir nicht erfahren, war mit einem gewissen Johann vermählt, der nach Saß a. a. O. S. 38 der Familie Gans von Putlitz angehörte. 263 ) - Söhne Adolfs I. waren Volrad III., Friedrich und Bernhard III. 264 ) Ferner geht aus dem Heiratsvertrag mit Schwerin, M. U.-B. II, 1089, hervor, daß er drei Töchter hatte. Von diesen war also die eine mit Helmold III. vermählt; eine andere scheint die im Jahre 1267 als Nonne im St. Lorenzkloster zu Magdeburg genannte Mechtildis, domicella de Dannenberg, gewesen zu sein, da Adolf I. zusammen mit seinem Bruder Bernhard im Jahre 1265 diesem Kloster 21/2 Hufen in Ammensleben


|
Seite 138 |




|
schenkt 265 ), die offenbar, wie gewöhnlich in solchen Fällen, als Pfründe dieser Tochter dienen sollten. 266 )
Von diesen Söhnen Bernhards und Adolfs tritt jedoch keiner besonders hervor, weshalb von jetzt ab eine nach den einzelnen Mitgliedern des Grafenhauses gesonderte Darstellung nicht angängig ist, ohne in eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von ein paar Urkunden auszuarten; ist es doch auch so nicht allzuviel, was wir über das fernere Schicksal der Grafschaft erfahren. Am häufigsten genannt finden wir in der Folgezeit die Söhne Bernhards, vor allem den ältesten, Heinrich V., während wir von den Söhnen Adolfs nur selten hören. Wie bereits angedeutet, führte der gemeinsame Besitz bald zu einem erbitterten Kampfe der Vettern um die Grafschaft. Auch sonst waren in dieser "kaiserlosen Zeit", zumal in diesen Gegenden, wo von den Fürsten niemand ein sonderliches Ansehen oder eine überlegene Macht besaß, wo daher die kleinen Herren nach Belieben hausten, Fehden an der Tagesordnung. So kam es, daß außer diesem Familienzwist noch ein besonderer Streit Heinrichs V. und seiner Brüder mit Gunzel III. von Schwerin entstand, an dem auch die Verwandtschaft beider Häuser nichts zu ändern vermochte. Wie es scheint, fanden nun die Söhne Bernhards I. Unterstützung bei dem Markgrafen Otto von Brandenburg, während die Söhne Adolfs außer an dem Schweriner Grafen an Nikolaus von Werle einen Bundesgenossen hatten. Schließlich legte sich Erzbischof Konrad II. von Magdeburg ins Mittel und nahm Dannenberg, Grabow und Dömitz als die wichtigsten Orte der Grafschaft in Verwahrung, bis die Vettern eine friedliche Lösung gefunden hätten. Die Schwerin-Dannenbergische Fehde dagegen sollte durch ein Gericht des Markgrafen Johann II. und seines Vetters Otto V. entschieden werden. 267 ) Offenbar hat sich dabei dann Heinrich V. völlig mit dem Schweriner Grafen ausgesöhnt; denn bereits im Anfang des folgenden Jahres finden wir ihn als Gunzels Zeugen zu Schwerin. 268 ) Und im Jahre 1273 stand er ebenso wie sein


|
Seite 139 |




|
Brüder Adolf II. in engster Verbindung mit den Schweriner Grafen in ihrem Kampfe gegen Johann von Braunschweig-Lüneburg 269 ) und die Stadt Lübeck, deren Schirmherr Johann war. Diesem Streit lag eine Gewalttat Gunzels zugrunde, der eines Tages im Walde bei Oldesloe lübische Kaufleute überfallen und ausgeplündert hatte. 270 ) Während er nun hierbei von den Herzögen von Sachsen, die beständig mit den Braunschweigern in Fehde lagen, und den Dannenberger Grafen unterstützt wurde, schlössen am 10 Dezember 1273 Herzog Johann und die Lübecker zu Lüneburg ein Bündnis zur Abwehr solcher Überfälle. 271 ) Diesem Bündnis gesellten sich Anfang 1274 auch Waldemar von Rostock und Graf Friedrich von Dannenberg, Sohn Adolfs I., zu. Letzterer schloß mit den Lübeckern ein Bündnis, das - eine höchst charakteristische Kennzeichnung der gänzlich unsicheren Lage - Geltung haben sollte, "solange er von den Erben seines Oheims im Besitz seines Landes unangefochten bleibe". 272 )
So war der kaum wiederhergestellte Friede im ,Hause Dannenberg zerrissen. Und sicher haben diese fortwährenden Fehden nach außen und im Innern nächst der zerstreuten Lage des Besitzes am meisten die Verarmung und schließlich den Verfall der Grafschaft herbeigeführt. Das läßt bereits eine am 10. März 1275 zu Schwerin ausgestellte Urkunde deutlich erkennen. Dort verpfändet Graf Heinrich V. die Burg Marnitz mit allen dazugehörigen Gütern für 56 Mark Silber an seinen "Verwandten" 273 ), den Grafen Helmold von Schwerin. Zwar macht er zur Bedingung, daß er, falls er Stadt und Burg Grabow und "seine Erbschaft" wiedererhält, Marnitz wieder einlösen kann; doch ist es mehr als zweifelhaft, ob es jemals wieder an Dannenberg gekommen ist. 274 ) Ebenso kennzeichnend für die finanzielle Lage Heinrichs ist es, wenn wir erfahren, daß er dem Wismarer Bürger Lambert von Klüz zur Bezahlung einer Schuld statt baren Geldes 5 Ballen


|
Seite 140 |




|
Tuch (V panni) gegeben hat. 275 ) Das ist die letzte zuverlässige Nachricht, die wir von Heinrich V. besitzen. Könnte man einer Notiz, die sich auf der Rückseite einer Urkunde des 13. Jahrhunderts findet, glauben, so würden wir ihn noch einmal im Jahre 1279, und zwar als Dompropst in Verden, finden. 276 ) Die Zuverlässigkeit dieser Nachricht muß, da die Urkunde selbst auch nicht den geringsten Anhalt dafür bietet und sonst mancherlei dagegen spricht, dahingestellt bleiben.
Von jetzt ab wird Heinrichs Bruder Bernhard II. häufig genannt. so nimmt er zusammen mit den verwandten Schweriner Grafen Helmold III. und Nikolaus I. lebhaften Anteil an dem für die norddeutschen Gebiete höchst wichtigen Landfrieden, den am 13. Juni 1283 Herzog Johann von Sachsen, Bogislav von Pommern, Wizlav von Rügen, die Herren von Werle, die Herren von Mecklenburg und die Herren von Rostock mit den "wendischen" Städten Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin und Anklam schließen, ein Bündnis, dessen Spitze sich zunächst zwar im wesentlichen nur gegen die Markgrafen von Brandenburg richtete, das jedoch als ein Anfang der Hansa betrachtet werden muß und das bereits im nächsten Jahre im Kampfe gegen Erich von Norwegen seine große Bedeutung zu erweisen Gelegenheit hatte. 277 ) Ebenso wie Johann von Sachsen, Helmold und Nikolaus von Schwerin und Johann von Mecklenburg verpflichtete sich hier auch Bernhard von Dannenberg, die Herren und Städte nach Vermögen (pro suo posse) zu unterstützen 278 ), mit anderen Fürsten und Herren kein Bündnis zu schließen und niemanden zum Nachteil der verbündeten Fürsten und Städte in seinem Lande auszunehmen. Er wird dann auch ausdrücklich erwähnt, als sich


|
Seite 141 |




|
einen Monat später Otto der Strenge von Lüneburg diesem Bündnis anschloß. 279 )
Dann begegnen wir dem Namen Bernhards erst wieder in den Jahren 1287 und 1288, wo er, das eine Mal zu Lüneburg, das andere Mal zu Ingolstadt, im Gefolge Ottos des Strengen auftritt 280 ), mit dem ihn ein besonders enges persönliches wie Lehnsverhältnis verbunden zu haben scheint. Denn in der letzten der eben angeführten Urkunden ist Bernhard unter den Bürgen des Herzogs bei dessen Ehevertrag mit dem Herzog Ludwig von Bayern 281 ) und verpflichtet sich, für ihn gegebenenfalls nach Hannover ins Einlager zu gehen. Und gleichzeitig erhält er den auszeichnenden Auftrag, neben dem Holsteiner und dem Wölper Grafen dafür zu sorgen, daß der Tochter des Bayernherzogs alle bei diesem Vertrage gemachten Versprechungen gehalten werden. Andererseits bezeugte ihm Otto seine Gunst dadurch, daß er ihm eine halbe Pfanne auf der Saline in Lüneburg verlieh, eine wichtige und gerade damals außerordentlich begehrte Einnahmequelle. 282 )
Eine solche Freundschaft mit einem mächtigen Fürsten war in jener Zeit fortwährender Fehden und Kämpfe doppelt wertvoll für die kleineren Herren, ja geradezu unentbehrlich. Und gerade hier in der Nähe des Gebiets der Dannenberger Grafen herrschten damals recht unsichere Zustände, unter denen die Grafschaft sehr zu leiden hatte. Nachdem nämlich im Jahre 1285 Herzog Johann I. von Sachsen-Lauenburg gestorben war, hatte sein Bruder Albrecht II. von Sachsen-Wittenberg zum Vormund seiner unmündigen Neffen Johann und Albrecht den Ritter Hermann Ribe eingesetzt. Dieser, ein kühner und tatkräftiger Mann 283 ), benutzte nun sein Amt in erster Linie dazu, nach Herzenslust im Lande zu rauben und zu plündern. Zumal die Kaufleute, insbesondere die Lübecker, hatten unter dieser Unsicherheit der Straßen und Flüsse zu leiden, da ihnen Hermann von seiner festen Burg in Hitzacker aus, durch die er Elbe und Jeetzel beherrschte, großen Schaden zufügte, wobei er samt seinen Spießgesellen vom sächsischen Herzog begünstigt


|
Seite 142 |




|
wurde. Daher hatten die Lübecker bereits im Jahre 1289 mit anderen Städten und den Fürften von Mecklenburg ein Bündnis gegen Albrecht zur Abwehr dieser Räubereien geschlossen, nachdem sie kurz zuvor Peter Ribe, einen Verwandten Hermanns, aufgeknüpft hatten. 284 ) Doch ärger als zuvor trieben jetzt die Räuber und Wegelagerer, an deren Spitze Hermann Ribe und Reimbern von Karlow standen, ihr Unwesen, von dem auch die umliegenden kleinen Territorialherren aufs ärgste belästigt wurden. Da wandten sich diese im Jahre 1291 an Otto von Lüneburg mit der Bitte um Hilfe, der denn auch am 19. Januar zu Dutzow bei Gadebusch zusammen mit den Grafen Adolf und Gerhard von Holstein und Nikolaus von Schwerin bestimmte, daß neun Raubburgen im Gebiet des Herzogs von Sachsen gebrochen würden. 285 ) Darunter werden auch Weningen und Warlow genannt, woraus wir ersehen, daß von dem ursprünglich geschlossenen Gebiet der Dannenberger Grafen rechts der Elbe ein Teil bereits jetzt in fremde Hände übergegangen war. 286 ) So hatten sie es nicht hindern können, daß nun mitten in ihrem Lande Raubburgen der Ribe lagen.
Das Eingreifen des Lüneburger Herzogs nützte zunächst jedoch nicht das mindeste; die Burgen wurden sofort wieder aufgebaut und das .Rauben und Plündern begann von neuem, bis endlich im Jahre 1296 Markgraf Otto von Brandenburg, der vom Kaiser zum obersten Friedensrichter für diese Gebiete bestellt war, zusammen mit Otto von Lüneburg und den jungen Herzögen von Sachsen-Lauenburg das feste Hitzacker, die Hauptburg Ribes, von Grund aus zerstörte. 287 )
In diesen beständigen Fehden und Kämpfen war die Macht und das Ansehen der Grafschaft Dannenberg immer weiter gesunken. Und das hatte sicherlich seinen hauptsächlichsten Grund in der Schwäche der Dynastenfamilie. Es war der Grafschaft nicht beschieben, in diesen unruhigen Zeiten von einer kraftvollen Hand gelenkt zu werden, wie wir diese z. B. in der Grafschaft Holstein während der ganzen Periode, die wir betrachtet haben, finden. Einer solchen wäre es vielleicht gelungen, gerade jetzt,


|
Seite 143 |




|
die allgemeinen Wirren klug benutzend, das Ansehen der Grafschaft zu heben, ihr Gebiet zu erweitern. Doch das genaue Gegenteil sehen wir hier eintreten. Dazu kam von der andern Seite das Streben der Oberlehnsherren nach Abrundung des eignen Landes. Und so bröckelte jetzt Stück für Stück ab. Am 1. August 1291 verkaufte zu Lauenburg Bernhard II. "Seinem Herrn", dem Herzog von Sachsen, die halbe Stadt Dömitz mit Zoll und Münze 288 ), und am folgenden Tage schließt zu Neustadt Bernhards Bruder Nikolaus einen Vertrag mit seinem "Vetter", dem Grafen Helmold III. von Schwerin, in dem er diesem für den Fall, daß er seine Erbgüter verkaufen muß, das Vorkaufsrecht für den Teil, den er zusammen mit seinem verstorbenen Bruder Adolf besessen hat, zusichert und ihm für einen etwaigen Kaufvertrag mit seinem Bruder Bernhard II. freie Hand läßt. 289 ) Wie wenig praktisch und staatsmännisch der Sinn Nikolaus' gerichtet war, geht schon daraus hervor, daß diese Vereinbarung ohne irgendwelche Gegenleistung vonseiten des Schweriner Grafen getroffen wurde.
In beiden Fällen ist von der Einwilligung oder sonstigen Teilnahme der drei Söhne Adolfs I. mit keinem Wort die Rede, und es macht ganz den Eindruck, als ob man schon damals mit dem Aussterben der Grafenfamilie rechnete. Dieser Eindruck wird noch verstärkt durch die Tatsache, daß die Grafen gerade in dieser Zeit zahlreiche, zum Teil recht bedeutende Schenkungen an die verschiedensten Klöster machten. So schenkt 1285 Graf Friedrich dem Kloster Eldena, dem die Dannenberger Grafen seit alters besonders zugetan waren, die Dörfer Glaisin, Grebs und Karenz. Im Jahre 1289 fügen Bernhard II. und Nikolaus 8 Hufen in Mallis mit dem Hoch- und Niedergericht sowie die Mühle bei dem Dorfe Strassen hinzu. 290) ) Und im selben Jahre schenkt Bernhard dem Kloster Diesdorf sein ganzes Erbe in Abbendorf


|
Seite 144 |




|
und 1292 dem Hl.-Geist-Kloster in Perver vor Salzwedel einige Einkünfte in Lagendorf und Andorf 291 ) und endlich 1293 dem St.-Johannis-Kloster in Ülzen einige Güter in der Nähe des Klosters. 292 ) Um diese Zeit scheint auch die Stadt Grabow von den Markgrafen eingezogen zu sein. 293 ) Man sieht: ein völliger Verfall der Grafschaft war eingetreten. So war es nur der letzte Schritt auf einer längst betretenen Bahn, wenn im Jahre 1303 Graf Nikolaus, der allein noch lebende Sohn Bernhards I., gegen eine Leibrente von jährlich 40 Mark Pfennigen auf Burg und Stadt Dannenberg sowie alles Land links von Elbe und Jeetzel zugunsten Ottos des Strengen von Lüneburg verzichtete und sich lediglich seine Lehngüter rechts dieser beiden Flüsse vorbehielt. 294 )


|
Seite 145 |




|
In der Urkunde hebt Nikolaus hervor, daß er diesen Vertrag einer "besonderen Liebe und Zuneigung" des Herzogs verdanke. Nicht ganz mit Unrecht. Wie die Dinge nun mal lagen, bedeutete diese Rente für den letzten Sproß des degenerierten Grafenhauses ein ganz annehmbares Geschäft, indem es ihm für den Rest seiner Tage eine feste Einnahme sicherte, wie er sie durch eigene Verwaltung des Landes schwerlich erzielt hätte.
Übrigens stand ein solcher Verkauf einer Grafschaft keineswegs vereinzelt da. So hatte im Jahre 1236 Graf Siegfried von Osterburg seinen ganzen Besitz im Gau Osterwalde zwischen Salzwedel, Brome und Gardelegen an Herzog Otto das Kind verkauft. 295 ) Und sogar ganz ähnlich wie in unserm Falle hatte im Jahre 1248 Graf Heinrich von Lauenrode sein Lehen und Eigen gegen eine Rente von 20 Mark, und zwar ebenfalls an Otto das Kind, verkauft. 296 ) Und endlich verkauften im Jahre 1358 die letzten Grafen von Schwerin, Nikolaus und Otto, ihre Grafschaft an Herzog Albrecht von Mecklenburg. Wie es scheint, war gerade das welfische Haus groß in dieser Politik der Abrundung; denn Otto der Strenge kaufte außer Dannenberg noch die Grafschaften Lüchow und Hallermund von Günther von Käfernburg bezw. Otto von Hallermund. 297 ) Daß die Herzöge dabei - eine naheliegende Annahme - irgendwie einen Druck auf diese Grafschaften ausgeübt hätten, wird nirgends ersichtlich; sondern es scheint stets wie bei den Dannenbergern der Verkauf in der Unfähigkeit der bisherigen Inhaber seinen Grund zu haben.
Daß dieser Vertrag vom Jahre 1303 alsbald und nicht erst nach dem Tode des Grafen Nikolaus, wie Havemann meint 298 ), wirksam wurde, zeigt uns eine Urkunde vom Jahre 1307, in der Otto der Strenge bei seinem Heiratsvertrag mit Fürst Heinrich von Mecklenburg und Stargard seiner zukünftigen Schwiegertochter Schloß und Stadt Dannenberg samt dem dazugehörigen Lande als Leibgedinge verspricht. 299 )
Ungefähr um diese Zeit muß dann noch ein anderes wichtiges Stück der Grafschaft verloren gegangen sein, nämlich die Burg


|
Seite 146 |




|
Dömitz mit dem dazugehörigen Gebiet, und zwar an die Herzöge von Sachsen, die ja bereits die Hälfte der Stadt besaßen. Denn während noch im Jahre 1303 Graf Nikolaus zusammen mit seinen Neffen Johann und Volrad, den Söhnen Adolfs II., dem Kloster Eldena einige Hufen in Karenz und 1305 das Dorf Grittel und Wald und Dorf Liepe übertrug, erscheinen diese Orte im Jahre 1308 im Besitz des Herzogs Rudolf von Sachsen-Wittenberg, der dann auch in Dömitz mehrere Urkunden ausstellte. 300 ) Und ebenso wie das Gebiet von Dömitz wird der ganze rechtselbische Teil der Grafschaft Dannenberg - abgesehen natürlich von den einzelnen Lehen der Markgrafen - an die Herzöge von Sachsen-Lauenburg und ihren Vetter Rudolf gefallen sein. Eine genauere Kunde davon besitzen wir leider nicht. Ebensowenig erfahren wir, ob die Grafen irgendwie dafür von den Herzögen entschädigt wurden oder ob diese einfach ihr Oberlehnsrecht geltend machten. Nur von einigen einstmals dannenbergischen Dörfern heißt es in einer Urkunde der Herzöge:
"... quae cum municione sive territorio Domenitz sunt ad manus nostras rite et racionabiliter devolute" 301 ), wobei freilich das "devolute" sowohl im einen wie im andern Sinne gedeutet werden kann. Vereinzelte Güter besaß übrigens Nikolaus von Dannenberg trotz des Vertrages von 1303 auch links der Jeetzel noch später, selbst in unmittelbarer Nähe Lüneburgs. 302 ) Am längsten scheint er seinen altmärkischen Besitz bewahrt zu haben, so daß er hier noch im Jahre 1308 Schenkungen an Kloster Isenhagen und 1311 an Kloster Arendsee machen konnte. 303 )
Diese Urkunde vom Jahre 1311 ist die letzte Nachricht, die wir besitzen nicht nur über Graf Nikolaus, sondern überhaupt von dem Dannenberger Grafenhaus. Denn auch von den einige Male in Urkunden genannten Söhnen Adolfs II. wird Johann im Jahre 1306 bereits als verstorben und Volrad IV. damals zum letzten Male erwähnt. 304 ) Von ihnen hat, wie es scheint, keiner mehr den Grafentitel geführt; Volrad nennt sich hier einfach nobilis vir Volradus.


|
Seite 147 |




|
Damit verschwindet die Familie der Grafen von Dannenberg aus der Geschichte 305 ) und zugleich auch der ursprüngliche Begriff der Grafschaft. Daß diese im engeren Sinne, d. h- Dannenberg mit seiner nächste Umgebung, an das Haus Braunschweig-Lüneburg fiel und zeitweilig als Verdener Lehen betrachtet wurde, ist bereits gesagt. Bei ersterem ist sie dann dauernd verblieben, die Stadt sogar zeitweise Residenz eines Mitgliedes der herzoglichen Familie gewesen, und es hat sich aus ihr das spätere hannoversche Amt und der heutige Kreis Dannenberg entwickelt.
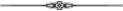


|
Seite 148 |




|
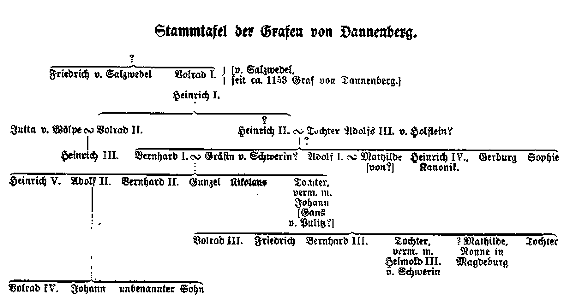


|
Seite 149 |




|
Das Wappen der Grafen von Dannenberg.
Das früheste Siegel, das uns von den Grafen von Dannenberg erhalten ist, ist das Volrads II. an der Urkunde Bernhards von Wölpe für Kloster Mariensee vom Jahre 1215. 1 ) Das Siegelbild zeigt einen rechtsgekehrten aufsteigenden Löwen. Von der Umschrift ist leider nichts mehr zu lesen. Dieser Löwe ist dann das allein Festbleibende in den mannigfachen Veränderungen, die das Siegel der Dannenberger Grafen in der Folgezeit ausweist. Ob dies ein willkürlich gewähltes Symbol war oder ob es die Beziehung der Grafschaft zu ihrem Schöpfer, Heinrich dem Löwen, ausdrucken sollte, muß mangels näherer Nachrichten dahingestellt bleiden. Genau dasselbe Siegel führte auch Volrads Bruder Heinrich II. 2 ), und auch noch Heinrichs II. Sohn Bernhard I. behielt diese Form bei, während Heinrich III., der Sohn Volrads II., ein Siegel mit einem linksgekerten Löwen führte, um anzuzeigen, daß er einer andern Linie des Hauses Dannenberg entsprossen sei. 3 ) Diese erlosch dann freilich bereits mit ihm.
Die nächste Veränderung nahm Adolf I., Bernhards Bruder, vor, und zwar in einschneidendster Weise. Er wählte statt der Schildform die runde Stempelform, ließ dabei zwar den Löwen rechtsgekehrt, fügte jedoch noch eine Tanne - offenbar des Anklangs von Dannenberg wegen - dazu. Diese beiden Formen wurden dann von dem Bruder Bernhards und Adolfs, dem Domherrn Heinrich IV., in der Weise kombiniert, daß er den Löwen mit der Tanne in das schildförmige Siegel setzte. 4 ) Von den


|
Seite 150 |




|
Söhnen Bernhards behielten die beiden ältesten, Heinrich V. und Adolf II., die ein gemeinsames Siegel führten, die Form ihres Vaters bei. 5 ) Dagegen fügte Bernhard II. zu dem einen Löwen noch einen zweiten hinzu, und zwar so, daß beide einander zugekehrt waren 6 ), während sein Bruder Nikolaus die Schildform mit dem rechtsgekehrten Löwen in die runde setzte. 7 )
Auch die Söhne Adolfs I. nahmen eine Änderung des von ihrem Vater überkommenen Siegels, des Löwen mit der Tanne, vor zur gegenseitigen Unterscheidung. Zwei derselben sind uns erhalten. Das eine, das des Grafen Friedrich, zeigt eine Tanne ohne Früchte 8 ), während man auf dem gemeinsamen Siegel Volrads III., Friedrichs und Bernhards III. sowie auf dem Einzelsiegel Volrads III. 9 ) Tannenzapfen - wenngleich, entsprechend dem damaligen Stande der Technik, roh gebildet - erkennt. 10 ) Das Siegel Johanns, des Sohnes Adolfs II., scheint sich von dem seines Oheims Nikolaus nur durch die Größe unterschieden zu haben. 11 ) - Übrigens ist das Wappen der Grafen von Dannenberg auch in das Stadtwappen übergegangen, das eine von zwei Löwen umschlossene Tanne zeigt.
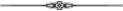


|
Seite 151 |




|
Verzeichnis der urkundlich genannten Orte in der Grafschaft Dannenberg.
Wie bereits im Text dargelegt, bestand der linkselbische Teil der Grafschaft Dannenberg fast nur aus Streubesitz. Ein einigermaßen zusammenhängendes Gebiet besaßen die Grafen hier wohl nur in der nächsten Umgebung der Stadt Dannenberg; doch wurde selbst dieses unterbrochen von Besitz der Schweriner Grafen; siehe die Karte!
Andererseits wurden Teile des rechtselbischen geschlossenen Gebietes, des Landes Weningen, zu ganz verschiedenen Zeiten von den Grafen verschenkt oder sonstwie veräußert. Und an der Grenze des Landes Weningen waren die Grafen ebenso wie links der Elbe mit Einzellehen von den Markgrafen von Brandenburg, z. T. gemeinsam mit den Schweriner Grafen, ausgestattet.
Das Verzeichnis der folgenden Orte soll nun dazu dienen, Art und Wesen der Rechte, die die Dannenberger Grafen hier besaßen, bezw. das Schicksal, das sie unter ihnen erfuhren, kurz zu überblicken. - Darüber hinaus ist es der urkundliche Beleg für die Karte und die auf S. 125 gegebene Tabelle.
Bei den Namen ist die moderne Schreibweise angewandt.
1. Abbendorf. Allod der Grafen von Dannenberg. Wird im Jahre 1289 von Bernhard II. dem Kloster Diesdorf geschenkt. Riedel A XXII, 98.
2. Ammensleben. Allod der Grafen von Dannenberg. 2 Hufen, die bis dahin Herr Johann Kribbenclot, und 2 Hufen samt einer Hofstelle, die Herr Konrad Schenk von Magdeburg zu Lehen gehabt hat, werden im Jahre 1265 dem St. Lorenzkloster in Magdeburg geschenkt. Regg. archiep. Magdeburg. II, Nr. 1626, 1641 und 1054.
3. Andorf. Die Einkünfte je einer Hufe zu Andorf und Lagendorf, die Heinrich Bruzer von ihm zu Lehen gehabt, schenkt


|
Seite 152 |




|
Bernhard II. im Jahre 1292 dem Hl. Geist-Kloster in Perver vor Salzwedel. Riedel A XXV, 276/77.
4. Bardowiek. Graf Volrad [von Dannenberg] wird im Jahre 1158 als Vogt der Kirche von Bardowiek genannt. Origg. Guelf. III, 477/78.
5. Barskamp. Der Zehnte von 4 Hufen in Barskamp, den bis dahin Herr Gericus 1 ) [von Barskamp] zu Lehen gehabt, wird im Jahre 1281 von Bernhard II. für 20 Mark Lübisch an Kloster Medingen verkauft. Harenberg, Historia ecciesiae Gandersheimens. S. 1696 f. - Es war vermutlich Verdener Lehen. - Auch die Grafen von Schwerin finden wir hier belehnt.
6. Bekentin. Siehe Dütschow.
7. Bendorf (Benthorp). Zugrunde gegangenes Dorf, wahrscheinlich in der Nähe von Dähre. Hier waren 14 Wichhimpten Lehen der Herren von Dähre. Riedel A XVI, 396. Vergl. Altmärk. Jahresber. XII, 45.
8. Boytighe [wo?]. Hatten zum Teil die Herren von dem Knesebeck zu Lehen. Lüneburger Lehnregister, ed. W: v. Hodenberg, S. 25. Wahrscheinlich identisch mit dem zugrunde gegangenen Dorfe Boyringen im südl. Amt Knesebeck. Siehe Saß S. 152 und Riedel A XVII, 330.
9. [Alten-] Brandsleben. Den Zehnten des Klostervorwerks schenkten die Grafen von Dannenberg - im Jahre 1159 wird Volrad I. als Schenker genannt; dann mehrfache Bestätigungen - dem Kloster Marienthal. Origg. Guelf. III, 535/37 und Pflugk-Harttung, Acta Pontific. inedita I, S. 284 f. u. a.
10. Bresegard. Um 1230 samt dem dazugehörigen Land an Bistum Ratzeburg verkauft. M. U.-B. I, 375 S. 376.
11. Conow. Adolf II. von Dannenberg schenkt im Jahre 1270 sein Eigen von 3 Hufen in Conow dem Nonnenkloster Eldena. M. U.-B. II, 1195.
12. Crucen. Jetzt untergegangenes Dorf zwischen Parchim und Siggelkow. Gemeinsamer Besitz der Dannenberger und Schweriner Grafen. Der bisher an Berthold von Lengede verliehen gewesene Teil wird im Jahre 1263 dem Kloster Dünamünde geschenkt. M. U.-B. II, 990. Vergl. M. U.-B. IV, 2687.
13. Dachtmissen. Lehen des .Herzogs von Sachsen. Ein Haus wird im Jahre 1237 von den Dannenberger Grafen dem Kloster Reinfeld übertragen. Pfeffinger II, 364/65.


|
Seite 153 |




|
14. Dähre (Döhre). 6 Wichhimpten waren Lehen der Herren von Dähre. Riedel A XVI, 396 (1223).
15. Dannenberg. Siehe Text, insbesondere S. 129 f.
16. Dömitz. Siehe Text, insbesondere S. 122 und 130.
17. [Hohen-] Dolsleben. Wahrscheinlich Verdener Lehen. Im Jahre 1279 überlassen die Grafen von Dannenberg auf Bitten Paridams von dem Knesebeck hier den Zehnten von 5 1/2 Hufen dem Kloster Diesdorf. Riedel A XVI, S. 406.
18. Drenie. Zugrunde gegangenes Dorf zwischen Beetzendors und Rohrberg, wo sich der Flurname Drenick noch heute findet. Wird im Jahre 1252 von Adolf I. den Bürgern von Rohrberg verkauft. Hahn, Collectio monumentorum veter. I, 259/60. Vergl. Altmärk. Jahresber. XII, 55.
19. Dütschow. Brandenburgisches Lehen, im Jahre 1273 zusammen mit Steinbeck für Bekentin an die Schweriner Grafen vertauscht. M. U.-B. II, 1298.
20. Erbstorf. Alle Ansprüche an die Vogtei zu Erbstorf überläßt im Jahre 1288 Bernhard II. dem Kloster Scharnebeck. M. Jbb. 43, 163/64 Nr. 6.
21. Eyendorf. Im Nekrolog des St. Michaelisklosters zu Lüneburg - Wedekind, Noten III, 27 - findet sich unter dem 10. April die aus dem 12. Jahrhundert stammende Eintragung: "O[biit] Volradus comes, qui dedit tres solidos in Jenthorpe de kamera." Sicherlich ist der hier genannte Schenker Volrad I. von Dannenberg, da ein anderer Graf Volrad in dieser Gegend nicht bekannt ist. Vergl. Saß S. 156 Nr. 61.
22. Falkenberg. An die Herren von dem Knesebeck verliehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25. - Wohl identisch mit den in der "Wische" b. Seehausen genannten Besitzungen, s. dort.
23. [Klein-] Garz (Gardiß). Das Eigen von 2 Hufen wird im Jahre 1290 an Ritter Heinrich v. Dannenberg verkauft. Riedel A XIV, 36.
24. [Süder-] Gettersen. Der dortige Zehnte ist ein Lehen von der Verdener Kirche und wird im Jahre 1267 von den Dannenberger Grafen zusammen mit Pattensen für 40 Mark geprägter Münze (pecuniae numeratae) an Kloster Scharnebeck verkauft. M. Jbb. 43, 159/60 und 162/63. - Nach J. v. Grote, Urkundl. Beiträge Nr. 4, handelt es sich dabei um Süder - Gellersen.
25. Geverdesbrughe [wo?]. Zugrunde gegangenes Dorf, wahrscheinlich in der Nähe von Dömitz. Aus der Mühle zu Gev. schenkt Adolf II. im Jahre 1277 der Kirche zu Dömitz


|
Seite 154 |




|
1 Wispel Korn. M. U.-B. II, 1441. - Vergl. Saß S. 147 Nr. 17.
26. Gladdenstedt. Bisher Lehen des Johann Gans von Gartow und seines Sohnes Gebhard, wird Gl. im Jahre 1255 von den Dannenberger Grafen für 74 Mark Schwarzsilber an Kloster Isenhagen verkauft. Lüneburger U.-B. Abteilung V, Nr. 31. - Später, um 1340, ist die Hälfte von Gl. in Händen der Herren von dem Knesebeck, Lüneburger Lehnreg. S. 25.
27. Glaisin. Zusammen mit Grebs und Karenz im Jahre 1285 von Graf Friedrich von Dannenberg dem Kloster Eldena geschenkt. M. U.-B. III, 1770.
28. Glüsingen. Der Zehnte zu Glüsingen - Verdener Lehen? - ist verliehen an die Familie Dise; M. U.-B. V, 2755. - Daß hier Glüsingen im Amt Medingen gemeint ist und nicht etwa Glüsingen bei Wittingen, s. Saß S. 155 Nr. 59.
29. Godems [Wodamiz]. Von Adolf I. dem Kloster Eldena überlassen; M. U.-B. III, 2118. - Daß "Wodamiz" nicht - Hoh.-Woos, wie M. U.-B. IV, Ortsreg. S. 96 meint,, vergl. ebenda S. 506 und Saß S. 141 f.
30. Grabow. Scheint Lehen der Markgrafen von Brandenburg gewesen zu sein. Im Jahre 1186 - M. U.-B. I, 141 - als Burg erwähnt; ebenso I, 149 und 162. Um 1208 ist diese in Besitz von Johann Gans v. Putlitz, M. U.-B. I, 182 Note. - Nach M. U.-B. II, 683 soll im Jahre 1252 ein Graf Volrad von Dannenberg die Stadt Grabow gegründet haben. Die Urkunde ist jedoch eine offensichtliche Fälschung; einen Grafen Volrab von Dannenberg gab es um diese Zeit nicht. Doch befindet sich die Stadt damals zweifellos in Händen der Dannenberger Grafen - M. U.-B. II, 845, 990, 1166, 1195 u. a. -, bis sie um 1288 im unmittelbaren Besitz der Markgrafen erscheint, M. U.-B. III, 1966. Vergl. Saß S. 143 f.
31. Grebs. Siehe Glaisin.
32. Grittel. Im Jahre 1290 samt der Holzungsfreiheit im Walde Liepe von Graf Nikolaus an Herrn Huno von Karwe verliehen; M. U.-B. III, 2049. - Im Jahre 1305 wird Grittel und Wald und Dorf Liepe von Nikolaus dem Kloster Eldena geschenkt; M. U.-B. V, 2985.
33. Hohnstorf. Der dortige Zehnte ist ein Lehen von der Verdener Kirche und wiederverliehen an Dithard von Dähre. Im Jahre 1264 wird er an das Nonnenkloster Medingen verkauft; Pfeffing. II, S. 366/67.


|
Seite 155 |




|
34. Hützel [Hirzzelo]. Der dortige Zehnte ist Lehen der Verdener Kirche und wird um 1268 an Kloster Scharnebeck verkauft; M. Jbb. 43, 161 Nr. 4. Vergl. dort S. 155 Nr. 60.
35. Hundeslaghe [wo?]. Vier Wenden [-höfe ?] waren verliehen an die v. d. Knesebeck; Lüneburger Lehnreg. S. 25. - Hundeslaghe - Honlege, wie Saß a. a. O. S. 152 Nr. 32 meint?
36. Isenhagen. 1245 verzichten Bernhard I. und Adolf I. auf ihre Anrechte an Isenhagen zugunsten ihres Lehnsherrn, des Herzogs Otto von Braunschweig-Lüneburg; Lüneburger U.-B., Abteilung V, Nr. 8.
37. Jübar. Im Jahre 1308 verkauft Gerhard Wolf von Beetzendorf 4 Hufen in Jübar an Kloster Isenhagen mit Zustimmung des Grafen Nikolaus von Dannenberg; Riebet A XXII, 108 f. - Einen andern Teil von Jübar hatten die v. d. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25. Vergl. Lüdelsen.
38. Karenz. Siehe Glaisin. Vergl. M. U.-B. V, 2890.
39. Lagendorf. Siehe Andorf.
40. Lenzen. Siehe Text S. 122.
41. Lichterfelde [littervelde]. Ein Hof mit 3/4 des Landes war verliehen an die Herren v. d. Knesebeck; Lüneburger Lehnreg. S. 25. - L. gehörte wahrscheinlich zu den Besitzungen in der "Wische" b. Seehausen, siehe dort und Falkenberg. Vergl. Riedel, Namenverzeichn. II, 269.
42. Liepe. Siehe Grittet.
43. Lüdelsen. Im Jahre 1308 verkauft Gerhard Wolf von Beetzendorf 91/2 Hufen in Lüdelsen mit Zustimmung Nikolaus' von Dannenberg an Kloster Isenhagen; Riedel A XXII, 108 f. Vergl. Jübar.
44. Mackenstedt [südwestl. Bremen]. Scheinen die Grafen von Dannenberg Erbansprüche aus der Heirat Volrads II. mit Jutta vonWölpe besessen zu haben; HoyerU.-B. V, Nr. 15 (1233).
45. Malliß. 1) 8 Hufen schenkt Bernhard II. im Jahre 1289 dem Kloster Eldena; M. U.-B. III, 2004. 2) 31/2 Hufen überläßt Adolf II. dem Kloster Eldena; M. U.-B. III, 2118.
46. Marnitz. Wohl Lehen der Markgrafen von Brandenburg. Im Jahre 1275 wird die Burg Marnitz von Heinrich V. an Helmold von Schwerin verpfändet; M. U.-B. II, 1356. Vergl. M. Jbb. 14, 75/47 und 43, 142.
47. Mehmke [Medebeke]. 1) Um 1245 wird hier eine ganze Reihe von Lehnsleuten genannt, deren Anteil dem Kloster Isenhagen verkauft wird; Lüneburger U.-B., Abtlg. V, Nr. 11.


|
Seite 156 |




|
2) Im Jahre 1253 verschenkten Gerburg und Sophie von Dannenberg ihren Anteil an M. an Kloster Isenhagen; ebenda Nr. 29.
48. Melbeck. 1/2 Ouadrans Roggen in Melbeck überträgt Graf Nikolaus im Jahre 1310 dem Hl. Geist- und St.Lamberti-Stift in Lüneburg, nachdem dieses ihn von Ludolf von Estorf gekauft hat; U.-B. d. Stadt Lüneburg I, 265.
49. Ohrdorf. 2 Hufen werden dem Kloster Marienthal geschenkt; vergl. Brandsleben.
50. Pattensen. Siehe Gellersen.
51. Plastau. Hatten die Herren v. d. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
52. Ripdorf. Die Vogtei von Ripdorf wurde im Jahre 1237 dem Kloster St. Johann in ÜIzen überlassen; M. Jbb. 43, 159.
53. Rohrberg, 1) 3 Hufen, Lehen Gerberts von Bardeleben, werden im Jahre 1248 dem Hl. Geist-Hospital zu Salzwedel verkauft; Riedel A XIV, 5. 2) Die Pfarrkirche zu R. wird im Jahre 1264 den Kranken des Johanniterordens zu Werben geschenkt; ebenda A VI, 17.
54. Rozeve [wo?]. Ein Haus zu Rozeve besaßen die v. d. Knesebeck zu Lehen von den Dannenberger Grafen; Lüneburger Lehnreg. S. 25. - Ob - Rossau westl. Osterburg, wie Saß S. 152 meint oder die Rosower Berge nördl. Osterburg?
55. Schneflingen. Hatten die v. d. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
56. Schüringen. 3/4 des Landes war verliehen an die Herren v. d. Knesebeck; Lüneburger Lehnreg. S. 25. - Daß das "sturinghe" dort - Schüringen, siehe Saß S. 151 f. Nr. 31; vergl. Jahresber. des Altmärkischen Vereins XIII, 120 und Riedel A III, 91.
57. Seehausen. In der "Wische" bei Seehausen waren die v. d. Knesebeck belehnt; Lüneburger Lehnreg. S. 25. Das waren vermutlich die Dörfer Falkenberg, Lichterfelde und Schüringen. Siehe Saß S. 151 Nr. 28 ff.
58. Siggelkow. Gemeinsames Lehen der Dannenberger und Schweriner Grafen von den Markgrafen. Im Jahre 1238 von ihnen zum Teil zusammen mit Zachow an Kloster Dünamünde geschenkt; M. U.-B. I, 488. Im Jahre 1262 kommt auch der Schweriner Anteil an Dannenberg; M. U.-B. II, 946.
59. Steinbeck. Siehe Dütschow.
60. Steinlage [stenlage]. Zugrunde gegangenes Dorf, wahrscheinlich in der Nähe von Dähre und Deutsch-Horst; Altmärk.


|
Seite 157 |




|
Jahresber. XII, 44. 3 Hufen waren Lehen der v. d. Knesebeck; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
61. Strassen. Die Mühle bei Strassen wird im Jahre 1289 von Graf Nikolaus dem Kloster Eldena geschenkt; M. U.-B. III, 2005.
62. Stuck. Von Adolf II. dem Kloster Eldena verkauft; M. U.-B. III, 2118.
63. Teschendorf [tessekendorp]. Hatten die v. d. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
64. [Hohen-] Tramm. 4 Hufen, die vorher Ritter Philipp oon Stöcken zu Lehen gehabt, überträgt im Jahre 1311 Graf Nikolaus dem Kloster Arendsee; Riede! XXII, 21 f.
65. Ülzen. Einige Besitzungen (agri et areae), die bei dem St. Johann-Kloster zu Ülzen liegen, überträgt Bernhard II. im Jahre 1293 diesem Kloster; M. Jbb. 43, 164 Nr. 7.
66. Warlow. 4 Hufen in Warlow, Lehen des Herzogs von Sachsen, verkauft Bernhard II. im Jahre 1291 an Ludolf, Vogt in Schwerin, und Ulrich Pinnow; M. U.-B. III, 2123 u. 2132.
67. Wibbese [wibeze]. Hatten zum Teil die v. b. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
68. Zachow. Siehe Siggelkow.
69. Zasenbeck [sasbeke]. 3/4 von Zasenbeck hatten die Heeren v. d. Knesebeck zu Lehen; Lüneburger Lehnreg. S. 25.
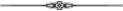


|
Seite 158 |




|
Bemerkungen zur Karte.
Für die Bearbeitung des rechtselbischen Teils der Karte, insbesondere für die Abgrenzung der Grafschaft Ratzeburg, wurde die Karte bei J. H. Neuendorff, Stiftsländer des ehemaligen Bistums Ratzeburg, Schwerin und Rostock 1832, herangezogen. - Die auf der linken Seite der Elbe eingetragenen Besitzungen der Schweriner, Dannenberger und Lüchower Grafen sollen dazu dienen, ein klares Bild der eigentümlichen Besitzverhältnisse hier zu gewinnen. Dabei ist zu beachten, daß eine Scheidung zwischen ganzem und teilweisem Besitz nicht vorgenommen ist, um die Übersicht nicht zu erschweren; wenn also ein Dorf z. B. unterpunktiert ist, braucht es darum nicht ganz den Ratzeburger Grafen gehört zu haben. Sind dagegen in einem Orte zwei verschiedene Grafen als Belehnte genannt, so ist dieser mit den entsprechenden Linien unterstrichen; später umgetauschte Besitzungen der Dannenberger Grafen sind durch eine senkrechte Linie rechts vom Namen bezeichnet. - Die Besitzungen der Dannenberger und Lüchower Grafen - eine Geschichte der letzteren zu schreiben, behält sich der Verfasser vor - sind auf Grund eigener Ermittlungen eingetragen, die der Schweriner dagegen nach den Darlegungen v. Hammersteins in seinem Aufsatz "Die Besitzungen der Schweriner Grafen am linken Elbufer", Zeitschr. des historischen Vereins für Niedersachsen 1857, 1-191. Da diese Schweriner Besitzungen links der Elbe außerordentlich zahlreich waren - v. Hammerstein zählt 247 Ortschaften auf -, konnte eine vollständige Eintragung derselben hier um so weniger in Frage kommen, als es dem Verfasser nur darauf ankam, ihre Lage im Verhältnis zu den Besitzungen der beiden andern Dynasten zu zeigen.
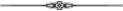


|
Seite 159 |




|
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Bücher.
Arn = Arnold v. Lübeck, Chronica Slavorum, MG Schulausg. nach der Ausgabe von Lappenberg, 1868.
Bernhardi = Wilh. Bernhardi, Konrad III.; in Jahrbb. d. deutsch. Geschichte, 2 Teile, Leipzig 1883.
v. Breska = Forschungg. zur deutsch. Geschichte, Bd. XXII. S. 577/605.
Detm. = Detmar, herausgeg. von K. Koppmann in Chroniken d. deutsch. Städte, Bd. XIX.
L. Giesebr. = Ludwig Giesebrecht, Wendische Geschichten, 3 Bde., Berlin 1843.
Giesebr. u. Giesebr. K. Z. = Wilhelm Giesebrecht, Geschichte d. deutschen Kaiserzeit.
v. Grote = Julius v. Grote, Die Grafen von Wassel in Zeitschr. ,d.histor. Vereins f. Niedersachs. 1853 S. 240/48.
Hahn = Simon Friedr. Hahn, Collectio monumentorum veterum Bd. I, Braunschw. 1724.
Harenbg. = Chr. Harenberg, Historia ecciesiae Gandersheimensis diplomatica, Hannov. 1734.
Hasse = Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten u. Urkunden, herausgeg. von P. Hasse, 3 Bde., 1886/96.
Hauck R.G. = A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. IV, Leipz. 1903.
Havem. = W. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig u. Lüneburg, Bd. I, 1853.
v. Heinem. = O. v. Heinemann, Geschichte von Braunschweig u. Hannover, 3 Bde., Gotha 1884.
Helm. = Helmold, Chronica Slavorum, MG Schulausg. von B. Schmeidler, Hannov. 1909.
v. Kobbe = Peter v. Kobbe, Geschichte u. Landesbeschreibung des Herzogtum Lauenburg, 3 Teile, 1836 f. (Hier meist- Teil I.)
Lor. = Hugo Loreck, Bernhard I, Herzog von Sachsen, in Zeitschr. d. Harzvereins, 1893.
MG = Monumenta Germaniae historica.
M. Jbb. = Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte.
Mooyer = E. F. Mooyer, Kritische BeitrÄge zur Geschichte u. Genealogie der Grafen V. Dassel in Zeitschr. des Vereins f. Geschichte u. Altertumskunde Westfalens, Bd. VIII, 87/115.
M. U.-B. = Mecklenburgisches Urkundenbuch.
Pfeffing. = J. F. Pfeffinger, Historie des Braunschweig-Lüneburgischen Hauses, 2 Bde., 1732.
Philipps. = Martin Philippson, Geschichte Heinrichs des Löwen, 2 Bde., Leipz. 1867.
Prutz = H. Prutz, Heinrich der Löwe, Leipz. 1865.


|
Seite 160 |




|
Riedel = Codex diplomaticus Brandenburgensis herausgeg. von A. F. Riedel in 3 Reihen, Berlin 1838/69.
Saß = E. Saß, Zur Genealogie der Grafen von Dannenberg, in M. Jbb. 43, S. 33/164.
Saxo = Saxo Grammaticus i. Auszug herausgeg. von Holder-Egger in MG SS XXIX, 37/161.
Sudendorf = Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig u. Lüneburg, herausgeg. von H- Sudendorf, 11 Teile, Hannov 1859/83.
Suhm = P. Fr. Suhm, Historie af Danmark, Kopenhagen 1775.
S.W. = Sächsische Weltchronik, herausgeg. von L. Weiland in MG, Deutsche Chronikk. Bd. II, Hannov. 1877.
Toeche = Th. Toeche, Kaiser Heinrich VI., in Jahrbb. d. deutschen Geschichte, Leipz. 1867.
Using. = R. Usinger, Deutsch-Dänische Geschichte 1189-1227, Berlin 1863.
Weiland -.- Ludw. Weiland, Das sächsische Herzogtum unter Lothar und Heinrich dem Löwen, Greifswald 1866.
Wigger = M. Jbb. 28, S. 3-247.
Winkelm. Ph. v. Schw. = Ed. Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, in Jahrbb. d. deutsch. Geschichte, 2 Bde., Leipz. 1873 u. 1878.
Winkelm. Friedr. II. = Ed. Winkelmann, Kaiser Friedrich II., in Jahrbb. d. deutsch. Geschichte, 2 Bde., Leipz. 1889 u. 1897.


|




|
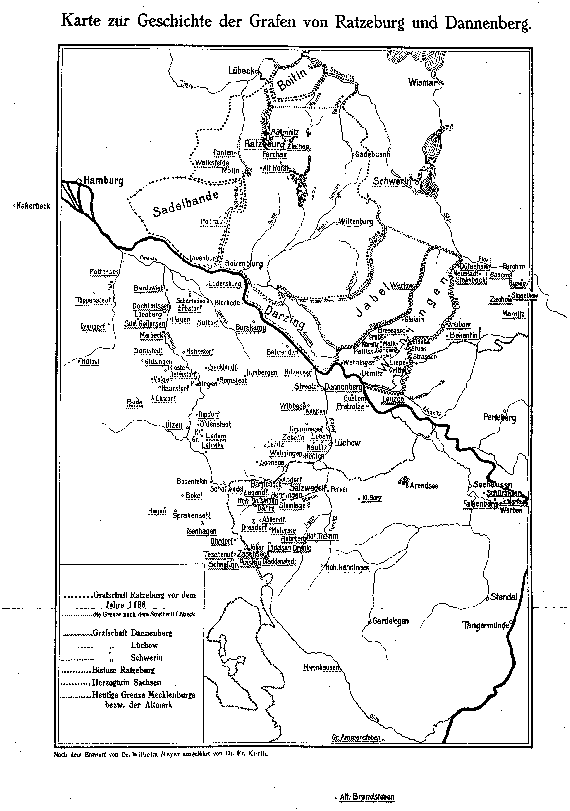


|




|
