

|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
|



|



|
|
:
|
I.
Beiträge zur Geschichte der Vitalienbrüder.
Von
Dr.
Hans Chr. Cordsen,
Seminar=Oberlehrer in Hamburg.
I.
Über die Zeit der Ausgabe und die Form der Mecklenburgischen Kaperbriefe.
1.
Koppmann, 1 ) Voigt, 2 ) Daenell, 3 ) Oelgarte, 4 ) Erslev, 5 ) Girgensohn 6 ) u. a. setzen alle die Ausgabe der Kaperbriefe der Vitalienbrüder ins Jahr 1391, während Lindner 7 ) allein unter Hinweis auf Hanserecesse IV. 15 (MUB. 12319) 1390 angibt, was bisher scheinbar ganz unbeachtet geblieben ist.
Daß die Eröffnung der Häfen nach der am 24. Februar 1389 erfolgten Gefangennahme des Königs Albrecht geschehen ist, ist klar; daß es erst nach dem 3. - 24. Mai 1391, der Zeit, in der Rostock, Wismar, das Bistum Schwerin, die Vogteien Gadebusch und Grevesmühlen einen engen Bund mit den Herzögen schlossen, 8 ) gewesen sein muß, wie Girgensohn anzunehmen scheint, ist nicht unbedingt erforderlich. Im Gegenteil; es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die letzten Worte des Vertrages, die Verpflichtung, niemand zu berauben, der im Geleit der Kontrahenten steht, auf die schon erfolgte Eröffnung des Kaperkrieges beziehen. 9 )


|
Seite 2 |




|
Einen terminus ante quem haben wir in der Antwort der preußischen Städte an Rostock und Wismar vom 30. Juni 1391. Dieses Datum steht unzweifelhaft fest. Es heißt dort: "Vortmer als ir uns schribet, das ir uwer haven geoffent hat alle den genen, dy uff ir eygen ebynture wellen keren und varen, das riche czu Denemarken czu beschedigen, das uns umbillich und gar umbequeme dungket umme des gemeynen kowfmans willen, der in disen sachen von beyden ziten frund ez und nicht czu schicken hat mit uwerem krige." 10 )
Das hier erwähnte Schreiben der Mecklenburger ist uns nicht erhalten. Man ist nicht gezwungen, anzunehmen, wie die Historiker, die 1391 angeben, zu glauben scheinen, daß es erst nach dem 4. April 1391 eingegangen sei, da es sonst auf der an diesem Tage stattgefundenen Versammlung zu Marienburg 11 ) hätte beantwortet werden müssen.
Seit November hatte die Schiffahrt geruht, und es ist sehr wohl möglich, ja nach den unten angeführten Gründen sogar wahrscheinlich, daß das im Herbst eingegangene Schreiben der Mecklenburger während der Wintermonate seine Beachtung gefunden hat. Erst das Frühjahr, in dem die Schiffahrt wieder begann, 12 ) hat die Aufmerksamkeit auf den Krieg überhaupt und auf jene Mitteilung der Städte Rostock und Wismar im besonderen gelenkt und die Antwort der preußischen Städte vom 30. Juni 1391 veranlaßt.
Nach Reimar Kock 13 ) haben Rostock und Wismar den Kapern ihre Häfen geöffnet, dewile de schepe (. . . mit hertoch Johann nha Stockholm) in der sehe weren. Da nun im Jahre 1391 der Zug Johanns erst im August erfolgte, 14 ) das Schreiben der preußischen Städte aber vor diese Zeit fällt, 15 ) so kann nur der im Herbst des Jahres 1390 unternommene Zug gemeint sein. 16 ) Auch Detmars Notiz, 17 ) daß schon im Frühjahr 1391 "wol hundert zeerovere edder mer" von den


|
Seite 3 |




|
Stralsundern gefangen worden seien, würde für das Jahr 1390 sprechen. 18 )
Wir werden daher wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen dürfen, daß zuerst die Herzöge für ihre Häfen 19 ) Kaperbriefe ausgestellt haben, jedenfalls gleichzeitig mit oder bald nach dem Vertrage vom 26. August 1390, 20 ) und daß auf deren Drängen Rostock und Wismar, die damals jedenfalls schon gerne mit ganzer Kraft für ihren Landesherrn eingetreten wären, 21 ) noch im Herbst ihrem Beispiel gefolgt sind. 22 ) Es ist demnach nicht das Jahr 1391, sondern mit Lindner 23 ) 1390 als Zeit der Eröffnung des Kaperkrieges anzusetzen. 24 )
2.
Seit den ältesten Zeiten war das ter buit oder ter kaap varen - wie die Holländer es nannten - eine der beliebtesten Beschäftigungen der Küstenbewohner der Nordsee. Besonders die Friesen, aber auch die Holländer und Seeländer legten sich darauf und verschafften sich auf diese Weise ansehnliche Reichtümer. Nach und nach aber wurde mit dem ter buit varen viel Mißbrauch getrieben, sodaß sich die Fürsten genötigt sahen, es zu beschränken, indem sie bestimmten, daß niemand ter buit varen dürfe, der nicht vom Grafen Briefe auf Schadloshaltung und damit die Erlaubnis erhalten hätte, die Schiffe dieser oder jener feindlichen Macht "aan te tasten, te nemen en op te bringen." Dafür wurde ihnen dann sicheres Geleit zugesagt.


|
Seite 4 |




|
Die Maßnahme der Mecklenburger war daher durchaus nichts Besonderes und Ungewöhnliches, wie Voigt u. a. meinen, und bis zum Friedensschluß 1395 waren die Züge der Vitalienbrüder nach damaliger Auffassung rechtlich vollkommen einwandsfrei. Die mecklenburgischen Kaperbriefe sind uns nicht erhalten. Der einzige aus der Antwort der preußischen Städte 25 ) erhaltene Satz läßt aber darauf schließen, daß sie ähnlich gelautet haben werden wie die uns erhaltenen holländischen 26 ) und dänischen 27 ) aus späterer Zeit. Die Form war stereotyp 28 ) und von einem besonderen Auftrag, Stockholm mit Lebensmitteln (vitalien) zu versorgen, wird nicht die Rede gewesen sein. Man hat von einem solchen angeblich in jenen Briefen erwähnten Zweck bisher allgemein den Namen Vitalienbrüder herleiten wollen.
Daß jedoch diese Ableitung des Namens falsch ist, soll im folgenden bewiesen werden.


|
Seite 5 |




|
II.
Die Bezeichnung Vitalienbrüder und Likedeler und die Beziehungen dieser Kaper zu den Piraten des Kanals und den Goldkompagnien des hundertjährigen Krieges.
1. Der Name Vitalienbrüder.
Über die Bedeutung des Namens Vitalienbrüder
erhalten wir aus den Urkunden sowie durch die
älteren Chronisten Detmar und Korner keinen
Aufschluß. Spätere Chronisten wie Reimar Rock
und Olaus Petri leiten den Namen davon her, daß
jene Scharen nicht um Gold, sondern auf eigene
Rechnung und Gefahr (eventure) in den Dienst der
mecklenburgischen Städte traten. So sagt Reimar
Kock († 1569) :
29
) "dusse gesellen de sick so
vorsammelden, dewile se nicht up besoldunge
dehneden, sondern up der egene eventuhre, n
 menden se sick
Victalienbroders" und Olaus Petri († 1552):
30
) Och the
kalledes fetaliebröder eller fetalianer theraf
att the lupo till siös och hemtade fetalie."
menden se sick
Victalienbroders" und Olaus Petri († 1552):
30
) Och the
kalledes fetaliebröder eller fetalianer theraf
att the lupo till siös och hemtade fetalie."
Bis auf Holberg 31 ) und Dalin 32 ) ist diese Erklärungsweise des Namens die einzige. Sie findet sich bei Krantz, 33 ) Lindenberg, 34 ) und Huitfeld. 35 ) Holberg und Dalin leiten den Namen ab von einem angeblichen "vornehmsten Zweck" der mecklenburgischen Kaper, Stockholm mit Lebensmitteln (victualien) zu versehen, ohne daß sie für diese neue Erklärungsweise oder gegen die oben angeführte ältere der Chronisten besondere Gründe anführen. Von der Zeit an findet man bei den Historikern entweder die ältere, die neuere oder auch beide Erklärungsweisen nebeneinander;


|
Seite 6 |




|
nach einer näheren Begründung sucht man bei allen vergebens. Die ältere Auffassung bringen Becker, 36 ) Suhm 37 ) und Jahn, 38 ) letzterer mit direkter Ablehnung der neueren. 39 ) Beide Auffassungen, ohne daß die Verfasser sich für die eine oder die andere entscheiden, finden sich bei Fr. W. Jaeger 40 ) und Y. Nielsen, 41 ) die neuere bei Sartorius, Sartorius=Lappenberg, Voigt, allen jüngeren Historikern und danach auch in sämtlichen Wörterbüchern und encyklopädischen Werken. 42 ) Auch Blok gibt in seiner soeben erschienenen Geschichte der Niederlande diese Erklärung, jedoch nicht ohne gelinden Zweifel an ihrer Richtigkeit zu äußern. 43 )
Was den stets erwähnten den Vitalienbrüdern zugeschriebenen Zweck, Stockholm mit Lebensmitteln (victualien) zu versorgen, anlangt, so ist in den Duellen von einem solchen nirgends die Rede. Nach dem einzigen aus den mecklenburgischen Briefen erhaltenen Satz ist ihre Aufgabe, "das riche czu Denemarken czu beschedigen", 44 ) wobei vor allem doch wohl an Kaperei zu denken ist. Daß die Vitalienbrüder jenen "angeblichen Zweck zur Schau getragen hätten", 45 ) ist eine unbegründete Vermutung und sehr wenig wahrscheinlich, da nach damaliger Auffassung die Ausübung des Kaperhandwerkes im Dienst einer kriegführenden Macht für mindestens ebenso "ehrenvoll" 46 ) galt. 47 ).
Als Grund für die neuere jetzt allgemein verbreitete Erklärung führt Koppmann in einer brieflichen Mitteilung an : "vitalien


|
Seite 7 |




|
bedeutet (cf. Schiller u. Lübben Mnd. Wörterbuch) ,eine Stadt mit Lebensmitteln versorgen, speisen,. Da es sich hier nur um die Stadt Stockholm handeln kann, so ist diese Ableitung gegeben."
Dagegen ist folgendes einzuwenden:
1. Der erste Teil des Kompositums Vitalienbrüder ist nicht das schwache Verbum vitalien, sondern der Plural des Nomens vitalie (pl. vitalien), denn erstens wäre diese Bildung gegen jeden Sprachgebrauch, da die mnd. Verbalkomposita nicht vom Infinitiv, sondern vom Stamm gebildet werden; 48 ) zweitens kommt, während das Nomen sehr gebräuchlich ist, das Verbum vitalien = verproviantieren im mnd sehr selten vor. Bei Schiller und Lübben 49 ) finden sich nur zwei Belege, beide außerdem noch aus viel späterer Zeit: Das Zitat aus "Lüb. Chron. 2, 553" stammt aus Rufus z. J. 1427, und das aus "Münst. Chron. 1, 259" ist erst um das Jahr 1450 anzusetzen. Auch im Lateinischen, Mittelfranzösischen und Englischen ist das Verbum im Verhältnis zum Nomen äußerst selten. 50 ) Gewöhnlich wird es mit "Lebensmittel zuführen" oder dergl. umschrieben; drittens spricht dagegen die lateinische Übersetzung "fratres victualium" in dem gleichzeitigen Brief des livländischen Ordensmeisters vom 12. Oktober 1392, 51 ) sowie die dänische Bezeichnung fitalgae brøthernae (1396). 52 ). Die bei Kalkar angeführten Belege für das dänische Verbum fetalje stammen aus späterer Zeit. (1521, 1525 und 1570). 53 )
2. und dieser Grund würde allein hinreichen, um die oben angeführte Erklärungsweise zu widerlegen, kommt die Bezeichnung vitalienses urkundlich schon vor der Belagerung Stockholms und vor der Ausgabe der mecklenburgischen Kaperbriefe in den Hamburger Kämmereirechnungen für die in der Nordsee vor der Wesermündung sich aufhaltenden Piraten vor. 54 ) 55 )


|
Seite 8 |




|
3. werden die Scharen, die in den Dienst der Mecklenburger traten, in den Urkunden vor 1395 sehr selten Vitalienbrüder genannt, was sicher nicht der Fall gewesen wäre, wenn sie selbst durch eine bei ihrer Ausrüstung ihnen gestellte Aufgabe, Stockholm zu versorgen, erst zu der Entstehung dieses Namens Veranlassung gegeben hätten. Bis zum Jahre 1395, also fast bis zur Beendigung des Krieges, heißen sie in den Hanserecessen mit wenigen Ausnahmen 56 ) entweder sine (Johanns) avølgheren, 57 ) sine hůlpers, 58 ) de van der Wiismair, 59 ) de lude, de in der zee sind tho unses heren . . . hulpe, 60 ) (de heren von Mecklenburg) und die iren 61 ) oder ähnlich. 62 )
Aufschluß über die Entstehung der Bezeichnung "Vitalienbrüder" erhalten wir durch einen Überblick über die Geschichte des aus dem Romanischen ins Niederdeutsche eingedrungenen Wortes vitalie. 63 )
1. Im klassischen Latein kommt victualia noch nicht vor; belegt sind nur vitalis (adj.) und vitalia = die edlen Teile
Von 1395 an ist "vitalienbruder" allgemein (IV. 256, MUB. 12774; 275, MUB. 12795; 278; 279, MUB. 12793; 280; 281; 330; 295, MUB. 12828; 296; 312, MUB. 128 0; 311; 334, MUB. 12872; 336; 337; 309; 335; 349; 355; 368; 370; 374; 420; 427; 428 usw., daneben weniger häufig zerovere (IV. 290; 292, MUB. 12815; 328; 336; 337; 359; 362; 373) oder zeeroubir adir vitalienbroder (IV. 426) die vitalienbruder, alse zeerouber (IV. 436).


|
Seite 9 |




|
des Körpers, auf denen das Leben beruht, 64 ) das letztere findet sich in übertragener Bedeutung bei Ambrosius und Prudentius. 65 ) victualis kommt zuerst vor bei Apuleius 66 ) und victualia = Lebensmittel, Proviant für das Heer, bei Cassiodor, 67 ) im späteren Latein beide Formen für Lebensmittel nebeneinander. 68 )
2. Im Französischen 69 ) sind die aus vitalia abgeleiteten Formen die frühesten und die am häufigsten vorkommenden, 70 ) während die Form mit c erst für spätere Zeit und auch nur spärlich belegt ist. 71 ) Wie später im Englischen und Niederdeutschen, so ist auch im Französischen das Verbum sehr selten. 72 ) Für unsere Theorie nun ist wichtig, daß sich schon im Französischen ein Nomen vitailleur resp. victuailleur findet. 73 ) In den ältesten Belegen bedeutet das Wort Marketender, Fouragierer und ist besonders in den Quellen aus der Zeit des 100 jährigen Krieges häufig. Bei Froissart tritt es uns ein Mal auch als Bezeichnung für den ganzen dem Heere folgenden Troß entgegen. 74 )
Größeres Gewicht aber noch lege ich darauf, daß schon im Jahre 1347 in einem gleichzeitigen Briefe vom Kapitän von Calais an den König von Frankreich die zur Verproviantierung von Calais verwendeten Seeräuberschiffe vitaillers genannt werden. 75 )
3. Um 1300 ist das Wort ins Englische eingedrungen. 76 ) Die Belege bei Stratmann=Bradley für das Nomen vitaille
Vgl. zum folgenden außer den Wörterbüchern besonders D. Behrens, Beitrag zur Geschichte der französischen Sprache in England, Französ. Studien Bd. 5. (1886) S. 104, 137 u. 167. Nach den auf S. 104 u. 137 gegebenen Belegen ist Stratmann=Bradley zu ergänzen.


|
Seite 10 |




|
pl. vitailes stammen aus den Jahren 1330 bezw. 1350, für das Partizip vittalit von 1375 und vetelid von 1435. Die folgenden Formen sind für das weiter unten Gesagte wegen der Zeit, aus der ihre Belege stammen, besonders wichtig. Es sind vittelleris sb. pl. (= foragers) aus Barbours Bruce (um 1375), 77 ) vittelouris und vitaillers 78 ) aus Piers the Plowman 79 ) (A=Text um 1362, B=Text um 1377).
4. Um dieselbe Zeit, 1330, kommt das Nomen auch im Niederländischen vor, 80 ) und in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. wird es auch ins Niederdeutsche eingedrungen sein. - Die Belege bei Schiller u. Lübben stammen alle aus viel späterer Zeit, erst aus dem 15. Jahrhundert. 81 ) Die latinisierte Form vitalienses in den HKR. z. J. 1390 dürfte mit zu den frühesten gehören; 82 ) in den Hanserecessen kommt es im 14. Jahrhundert mehrfach vor. 83 )
5. Für das Dänische stammt der früheste Beleg in der Form fitalgaebrøthernae aus d. J. 1396 84 )
In der Zeit der Lehnsaufgebote war es wie in den früheren Zeiten noch allgemein Regel, daß der einzelne selbst für seinen Unterhalt durch Mitführung von Lebensmitteln sorgen mußte. Nur Futter durfte vom Felde genommen werden. Reichte der mitgeführte Proviant nicht aus, so war der Ankauf auf aus=
Hiernach sowie nach dem folgenden ist Klaas Later a. a. O., wo das Wort vitalie nicht aufgeführt ist, zu ergänzen.
Vgl. auch Franz Burckhardt, Eine Studie zu den and. Lehnwörtern. Archiv f. Kulturgesch. III. 257. (1905).


|
Seite 11 |




|
geschriebenen Märkten oder von Kaufleuten im Lager selbst und die Requisition gegen Entschädigung gestattet. 85 ) Die beiden zuletzt genannten Formen für die Beschaffung des Unterhalts traten während der Kreuzzüge in den Vordergrund, und mit dem Aufkommen des Söldnerwesens artete das Requisitionssystem bei der Kargheit der Geldmittel der Fürsten in ein Raubsystem aus. 86 ) In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebten die Söldnerscharen ausschließlich vom Raube, 87 ) und es ist daher leicht erklärlich, daß die Bewohner der geplünderten Gegenden zwischen den Fouragierern oder auch dem ganzen Teil des Heeres, dem die Beschaffung des Proviants oblag, und gewöhnlichen Räubern in der Bezeichnung keinen Unterschied machte, die Namen für diese auf jene ausdehnte und umgekehrt. Auch die provisores regis machten hiervon keine Ausnahme. Klagen über Klagen ertönten beim Volk über die vitaillers, purveours oder wie es jene Verhaßten sonst nannte. 88 )
Daß der Name vitaillers dann auch auf die Räuber zur See, die die Söldnerscharen an Grausamkeit und schonungslosem Vorgehen wohl noch übertrafen, ausgedehnt worden ist, kann nicht wundernehmen, wenn man bedenkt, daß die zahlreichen Piraten des Kanals 89 ) den Franzosen sowohl wie den Engländern während des hundertjährigen Krieges bei der Beschaffung von Proviant die besten Dienste leisteten. Calais war Depotplatz, 90 ) und bei den späteren jahrelangen Kämpfen um diese Stadt haben gerade verwegene Seeräuber im Dienste der kriegführenden Mächte die kühnsten Entsatzversuche gemacht. 91 )


|
Seite 12 |




|
So ist es zu verstehen, daß einige Jahrzehnte später auch die Piraten der Nordsee von den Hamburgern als vitalienses bezeichnet werden; 92 ) es war eben der Name, in dem treffend das ganze Trachten jener Scharen zum Ausdruck kam. Mochten sie die Fouragierer vorüberziehender Heere sein oder mit Kaperbriefen versehen im Dienste kriegführender Mächte stehen oder auf eigene Faust rauben: die geplünderten Küstenbewohner und seefahrenden Kaufleute kannten und fürchteten sie alle nur als diejenigen, denen ihre vitalien und ihr ganzes Hab und Gut schonungslos preisgegeben war. 93 )
Für die mecklenburgischen Kaper kommt der Name Vitalienbrüder während der ersten vier Jahre ihrer Tätigkeit in den Urkunden nur zwei Mal vor; sie heißen sonst entweder die "Leute der Meklenburger", "ihre Nachfolger", "ihre Helfer" oder ähnlich, 94 ) und erst vom Jahre 1394 an, 95 ) als sie nach und nach immer mehr den Charakter gewöhnlicher Seeräuber annahmen und vor allem nach dem Friedensschluß von 1395, durch den ihnen der rechtliche Grund ihrer Existenz entzogen wurde, sind sie in allen Küstenländern der Nord= und Ostsee, von Calais 96 ) bis Reval, 97 ) von Stralsund 98 ) bis Bergen 99 ) unter dem Namen Vitalienbrüder bekannt. Auch aus dem letzten Teil des Wortes dürfen wir vielleicht noch eine Beziehung zu den Söldnerscharen des 100 jährigen Krieges herauslesen, denn auch diese hatten sich zu Beutegesellschaften (société de l,aqueste), 100 ) Rotten (italienisch: brigata), 101 ) Kompagnien zusammengeschlossen und sich die verschiedensten Namen beigelegt. 102 ) 103 )


|
Seite 13 |




|
2. Die Bezeichnung Likedeler.
Diese Bezeichnung kommt im Verhältnis zu der vorigen in den Quellen äußerst selten vor. Zum ersten Male tritt sie uns in einem Briefe Albrechts von Holland vom 16. Februar 1399 entgegen 104 ) und scheint überhaupt niederländischen Ursprungs zu sein. 105 )
Wenn auch vielleicht von jeher unter Raubscharen die Sitte bestanden haben mag, die Beute "gleich zu teilen", 106 ) so wird man doch unwillkürlich auch durch diese Bezeichnung an die Söldnerscharen Italiens und Frankreichs erinnert, von denen die Quellen stets mit Ausführlichkeit und nicht ohne Bewunderung für die strenge Ordnung, die beim Verteilen des erbeuteten Raubes beobachtet worden sei, berichten, und es ist fraglich, ob nicht auch der Name Likedeler ebenso wie die Bezeichnung Vitalier schon auf frühere Scharen von Seeräubern oder Söldnern angewendet worden ist.
Im Niederdeutschen scheint sich dieser Name nie recht eingebürgert zu haben. Nur der Verfasser der dritten Fortsetzung von Detmar (1401 - 1438) braucht ihn in der Erzählung von der Plünderung Bergens im Jahre 1428 einige Male, nennt die Piraten aber gleich darauf wieder vittalgenbrodere. 107 ) Vielleicht ist die Bezeichnung "Likedeler" weniger leicht verständlich gewesen, verdrehen doch spätere Chronisten sie in "liedekeclers" 108 ) oder gar in "Linkenmänner". 109 ) 110 )


|
Seite 14 |




|
3. Noch eine Beziehung zwischen den Soldkompagnien und den Vitalienbrüdern läßt sich feststellen. Nach HR. IV, 453 (z. J. 1398) sagen sie von sich, "se weren Godes vrende unde al der werlt vyande". 111 ) Ebenso hatte sich 30 Jahre früher (ca. 1362) der berüchtigte Söldnerführer Jean de Gouges genannt: l,ami de Dieu et l,ennemi de tout le monde. 112 ) Der verwegene Condottiere Werner v. Urslingen soll ein Brustschild getragen haben mit der Inschrift: Herr der großen Kompagnie, Feind Gottes, Feind der Traurigkeit und des Erbarmens. 113 )


|
Seite 15 |




|
III.
Der Angriff der Vitalienbrüder auf Bergen.
1.
Nordische sowohl wie deutsche Historiker haben bisher über die Plünderung Bergens durch die Vitalienbrüder sehr verschiedene Angaben gemacht, je nach der Quelle, der sie bei ihrer Darstellung gefolgt sind. Während ältere nur einen Überfall kennen, nehmen fast alle neueren irrtümlich deren zwei an und setzen sie in die Jahre 1392 oder 1393 und 1395. So Nicolansen 114 ) Munch, 115 ) Y. Nielsen, 116 ) L. Daae, 117 ) auch noch Erslev in seiner Dronning Margrethe, 118 ) Koppmann, 119 ) Daenell 120 ) u. a. 121 )
G.Storm hat zuerst darauf hingewiesen, 122 ) daß die Annahme eines zweimaligen Überfalls auf einer falschen Wertung Korners beruhe; und in der Tat muß die Plünderung vom Jahre 1395, wenn man das Abhängigkeitsverhältnis der Lübschen Chroniken, 123 ) vor allem die Unzuverlässigkeit Korners und die besser unterrichteten gleichzeitigen englischen und isländischen Quellen ins Auge faßt, als Fälschung aus der Geschichte verschwinden.


|
Seite 16 |




|
Die Quellen, die für die Untersuchung in Betracht kommen, sind folgende:
1.Detmar.
Er berichtet den Überfall zum Frühjahr 1392. Diese Angabe ist falsch; denn nach den zuverlässigen englischen und isländischen Quellen wurde der Befehlshaber von Bergen, Jon Darre, bei dem Überfall gefangen genommen. Im Frühjahr 1392 aber war Hakon Jonssøn Statthalter ("fehirdha oc hirdstiora"). 124 ) Jon Darre urkundet am 29. März 1392 in Oslo 125 ) und tritt erst im Herbst 1392 für den in diesem Jahr verstorbenen Jonssøn als Hauptmann in Bergen auf. 126 ) Aus HR. IV, 261, 7 geht hervor, daß Jon Darre vor dem Tage von Helsingborg (August 1394) sich zur Zahlung des Lösegeldes verpflichtet hat, seine Gefangennahme zu der diesem Termin näher liegenden Zeit (Frühjahr 1393, f. u.) also wahrscheinlicher ist.
2. Korner.
Sein Herausgeber J. Schwalm hat in der Einleitung nachgewiesen, daß Korner den Schluß der Detmarchronik, den Abschnitt von 1386 - 1395, oder eine parallele Quelle benutzt hat.
In der 1. Bearbeitung (α=Text 1416) berichtet er die Plünderung Bergens wie Detmar z. J. 1392 und wie dieser gleich im Anschluß an den Bericht über das Aufkommen der Vitalienbrüder. Den kurzen Detmartext schmückt er nur etwas weiter aus: Detmar: "In deme sulven jare wůnnen de vitalienbroder Bergen in Norwegen." Korner: "Vitaliani sive pyrate suprascripti Berghen oppidum in Norwegia ceperunt et spoliaverunt, inestimabilem thezaurum inde ducentes."
In der 2. Bearbeitung (A=Text 1420) hat er das Ereignis in das Jahr 1395 gesetzt, genau dieselben Worte wiederholt und nur noch hinzufügt: "Mercatoribus autem libenter pepercissent, si indifferentes permansissent non iuvantes isti vel illi parti. Sed quia civibus Bergensibus omnino auxilium ferre volebant, ideo et eos victos spoliabant.
In der 3. Bearbeitung (B=Text 1423) nimmt er die zweite Redaktion fast wörtlich, nur mit schwachen stilistischen Änderungen auf, fügt jedoch ausdrücklich hinzu, daß derZug nach BergenAlbrechts Befreiung (l395) voraufging. "Hoc anno ante liberacionem


|
Seite 17 |




|
Alberti regis Sweorum Vitaliani" etc. wie A. Der Schluß wird abgerundet mit den Worten "et bona illorum prenominatis civitatibus advehentes, ea ibidem vendebant et expendebant."
In der 4. Bearbeitung (D=Text von 1435) wiederholt er denselben wortreichen Bericht und von hier aus ist er in die plattdeutschen Chroniken, "die sog. Rufuschronik" und die Reimar Rocks, sowie in die lateinische Bearbeitung durch Albert Krantz übergegangen.
J. Schwalm hat nachgewiesen, daß die Berichte Korners im ganzen genommen aus den ältesten lübschen Chroniken (Detmar und dessen Quellen) stammen, während ihre Eigentümlichkeit in der freien, oft leichtsinnigen Bearbeitung desselben Stoffes besteht. In den verschiedenen Ausgaben seiner Chronik findet man manche Korrektur, Abweichungen und Zusätze, aber selten bringen sie neues Material. Man wird sich daher, wenn man seine Quellen feststellen will, an den α=Text halten müssen. In diesem wird der Überfall Bergens wie bei Detmar zu 1392 berichtet; in der zweiten Bearbeitung dagegen ist er darauf verfallen, den Überfall näher an die Befreiung Albrechts, ins Jahr 1395, zu rücken. Der Zusatz hier, daß die Vitalienbrüder auch die Deutschen plünderten, und der in der dritten Bearbeitung, daß sie die Beute in Rostock und Wismar verzehrten und verkauften, stammt offenbar nicht aus neuen Quellen; dergleichen konnte er aus seiner Phantasie nach dem, was er durch die Schilderung Detmars vom Charakter der Vitalienbrüder wußte, leicht hinzufügen.
Es ist demnach klar, daß Korners Bericht zum Jahre 1395 mit dem Detmars zum Jahre 1392 zusammenfällt und der Zug von 1395 als Fälschung aus der Geschichte verschwinden muß, und daß ferner die Angabe Detmars über die Zeit des Zuges (1392) durch die gleiche im α=Text Korners nicht gestützt wird (vergl. Storm a. a. O.).
Das richtige Datum und Jahr des Zuges erhalten wir durch einen Vergleich der gleichzeitigen englischen und isländischen Quellen.
3. Die englischen Quellen.
Es sind 3 Klagen der Engländer wegen des den englischen Kaufleuten bei der Plünderung zugefügten Schadens vorhanden.
In der Klage von 1412 heißt es: "circa annum regni regis Ricardi II. defuncti quartum decimum . . . venerunt certae personae dictae Societatis de Hansa infra portum


|
Seite 18 |




|
de Berne, in diversis vasis armatis . . . spoliaverunt depraedaverunt et malitiose verberaverunt dictos Mercatores Anglicos ac habitationes . . . combusserunt (ad valorem trium milium marcarum) necnon Obligationes et alias Securitates de Mille libri et amplius" . . . , sodaß die Kaufleute, um ihr Leben zu sichern, die Stadt verließen, bis der dänische König auf ihre Klagen seine Leute nach Bergen schickte, um ihnen Recht und Frieden zu verschaffen, was auch 1000 Mark kostete. 126a )
In der Klage von 1406: 127 ) Item . . . that about the feast of S. George the martyr, in the yeare of our Lord 1394 . . . malefactors and robbers of Wismar and others of the Hans with a great multitude of ships arrived at the town of Norbern in Norway and took the said town . . . took their goods . . . , burnt their houses and put their persons unto great ransoms . . . burnt 21 houses . . . to the value of 440 nobles. Item they took from Edmund Belyetere . . . and from other marchants of Lenne, to the value of 1815 pounds.
In der Klage von 1404 aber wird gesagt: 128 ) Item en le vigile de seynt George lan du regne le roy Richard II. seszime pluisourz malefeisours et robbours de Wyssemere et Rozstock del compaygnie del Hans forciblement avec graunde navey arrivoient al ville de Northberne en Norwey . . . gaygnerent . . . pristerent . . . arserent et lour corps a haute raunsoune metterent . . . damages et perdes des ditz pleyntifs de 5400 nobles.
Alle drei Klagen geben ein verschiedenes Jahr an für dieselbe Tatsache; im Datum stimmen 2 und 3 überein: um St. Georgsfest = 23. April und die andere genauer am Tage vor St. Georg, also 22. April. Da die Klage von 1404 im Original vorliegt, die von 1406 nur englisch, so wird man für die Angabe des Jahres die erstere vorziehen dürfen: im 16. Jahr Richards II. = 1393 gegen 1394. Die Angabe in I, "im 14. Jahr Richards II." = 1391, ist offenbar ein Fehler.
Daß der so gewonnene 22. April 1393 das richtige Datum ist, bestätigen auch die isländischen Quellen.


|
Seite 19 |




|
4. Die isländischen Annalen.
A. Gottskalks Annaler. 129 )
Sie schließen ursprünglich mit dem Jahre 1394, sind also gleichzeitig, und man sieht, daß der Verfasser den Fall so aufgezeichnet hat, wie er ihm von der Mannschaft des Bergenschen Schiffes "Lafransbollinn", das am 12. Juni 1393 im Tálknafjord landete und also etwa Mai 1393 von Bergen abgegangen war, berichtet wurde. Es heißt dort: 130 ) "Deutsche kamen nach Ostern nach Bergen mit 18 größeren Schiffen von Rostock und Wismar, König Albrechts Freunde. Sie gingen bei Nordnes an Land naesta dag fyrir Jons dag Hola byskups. (April 22.) Am Minoritenkloster entstand ein harter Kampf, Jon Darre wurde gefangen und tödlich verwundet. Sie liefen durch alle Kirchen der Stadt und nahmen alles, was Wert hatte, und verbrannten die Stadt Bergen. Der Bischof und die Bürger wurden gezwungen, ihnen zu huldigen."
B. Flatøannaler.
Sie sind für die Jahre 1388 - 1394 gleichzeitig. Das sieht man besonders zum Jahre 1393, wo es, nachdem die Ankunft von vier norwegischen Schiffen erwähnt wird, heißt : 131 ) "Man erzählte von Norwegen . . . . . daß im Frühjahr, in der Osterwoche, Deutsche nach Bergen kamen und ganz Norwegen für König Albrecht forderten. Er aber war in Dänemark bei der Königin im Gefängnis zusammen mit seinem Sohn Erich. Sie gingen am folgenden Donnerstag vor Anker, die Bewohner aber rückten ihnen entgegen und kämpften mit ihnen. Auf beiden Seiten fielen viele, die meisten auf Seite der Deutschen. Die Bürger unterlagen. Die Deutschen hatten 900 Schützen; der Anführer hieß Enis, ein Deutscher, Verwandter Albrechts; ein anderer hieß "Maekingborg", ebenfalls ein Verwandter Albrechts. Dieser fiel im Kampf und wurde beim Minoritenkloster begraben;


|
Seite 20 |




|
Enis ließ ihn ehrenvoll bestatten. 132 ) Die Leichen der anderen Gefallenen ließ er auf den Vaagen hinausschaffen und dort versenken. Jon Darre führte die Bürger - denn er war Hauptmann (fehirdir) - er kämpfte sehr tapfer, wurde jedoch von den Deutschen gefangen . . . . . . . Der, welcher "Maekingborg" tötete, hieß Erik (Eirikr). Die Deutschen richteten eine große Verheerung an, raubten und plünderten und verletzten beides, Kirchen - und Frauenrecht. Sie plünderten so sehr, daß sie alles, was sie nicht mitnahmen, in die See versenkten, Schiffe und Anker, deren sie habhaft werden konnten, fortführten, ausgenommen einen Anker, "Langbein" genannt, der König Olavs Eigentum gewesen war. Enis ließ das Land Albrecht huldigen, weil er der rechtmäßige König sei. Diese schwuren den Eid." (Namen fehlen.)
Beide Quellen stimmen in der Angabe des Jahres (1393) überein; nur in der Datierung besteht eine kleine Abweichung. Die Flatø=Annalen datieren: Donnerstag der Osterwoche 1393 = 17. April, während Gottschalks Annalen den 22. April angeben, was mit dem Tagesdatum der englischen Quellen übereinstimmt.
Dicht unter dem Fußboden fand man lose im Sand ein Skelett und ein Schwert. Vom Skelett war der Schädel, der in Lehm lag, ziemlich gut erhalten. Das Schwert, das sich in Bergens Museum befindet (Nr. 3357), hat nach Bendixen stark vom Rost gelitten, läßt aber die Konstruktion noch deutlich erkennen. Es ist ein sogenannter Zweihänder mit 0,08 m langem, ovalem Eisenknauf und rundem Griff, der, 0,40 m lang, nach der Klinge hin an Stärke zunimmt. Der Griff ist mit Holzschienen versehen gewesen, die wieder durch breite Ringe von vergoldetem dünnen Silberdraht (ringe af forgyldt, tynd sølvtraad) zusammengehalten wurden. Die Parierstange ist eine an den Enden ein wenig breiter gehämmerte (udhamret) Eisenstange. Die Klinge ist nahezu 1 m lang (genau 0,975 m) und 0,05 m breit.
Diese Zweihänder kamen im 14. Jahrhundert in Aufnahme, wurden im Fußkampf benutzt, zunächst vielleicht nur von den Befehlshabern geführt. Bei Villet-le-Duc, Mobilier francais II p. 385 findet sich die Abbildung eines Zweihänders aus jener Zeit, der fast genau die oben beschriebene Gestalt zeigt. Mit Rücksicht darauf, sowie auf die Wahrnehmung, daß der Schädel des Skeletts gewaltsam gespalten schien und das Grab den Eindruck gemacht hat, als ob es in Eile aufgeworfen sei, muß die Vermutung Bendixens, daß man es hier mit dem Schwert und dem Skelett des gefallenen "Mecklenburg" zu tun habe, als nicht unbegründet bezeichnet werden.


|
Seite 21 |




|
Über den Kampf selbst stimmen die Annalen überein oder ergänzen sich; die einen geben die Zahl der Schiffe auf 18 an, die andern die der Schützen auf 900, also pro Schiff 50. Diese Zahl ist wohl übertrieben; denn nach Vorschlag der Lübecker zur Ausrüstung der Seeräuber sollten auf jedem Schiff mit 100 Mann Besatzung "20 gute Schützen" sein. 133 )
Die isländischen Annalen waren im 16. Jahrhundert in Bergen unbekannt. Die Historiker Bergens schöpften daher aus Hermann Korner, und zwar in der lateinischen Bearbeitung des Albert Krantz. Korner hat, wie oben erwähnt, das Ereignis in das Jahr 1395 gerückt; Krantz gibt keine Jahreszahl an, bringt es aber, wie schon Korner, mit der Befreiung Albrechts in Zusammenhang. Der Darstellung des Krantz folgt Absalon Pederson in seinem Werk "Om Norrigis Rige" (1567). Er hat jedoch seine Quelle sehr flüchtig gelesen, denn im unmittelbaren Anschluß erzählt er: "eins von diesen Schiffen fing die Königin Margarete, auf dem waren 80 Mann, die sie alle enthaupten ließ". Diese Bemerkung steht aber bei Krantz weiter unten und bezieht sich auf die Schiffe des Herzogs Barnim von Wolgast, der 1398 in dänischen Gewässern raubte. 134 ) Krantz sagt nämlich: Una de grandioribus navibus quae 80 vexit armatos, in Daniam coacta, ab Reginà càpi iubetur, quos reperit de recenti praeda respersos omnes iussit feriri gladio." Aus Absalon Pederson hat Huitfeldt geschöpft und diesem folgten wieder Munch u. a. 134a )
Von Krantz ist auch die Reimchronik abhängig. Ihre Darstellung, die, wie Storm gezeigt hat, gänzlich unzuverlässig ist, verwerten Munch und Nielsen (mit willkürlichen Änderungen) und auch noch Girgensohn in seinem Werk über "Die skandinavische Politik der Hansa". 135 )


|
Seite 22 |




|
IV.
Die in den Quellen erwähnten Namen von Vitalienbrüdern.
Hierzu drängt sich vor allem die Frage auf: "Wer sind die in den isländischen Annalen als Anführer der Vitalienbrüder genannten "Enis" und "Maekingborg"?
Beide werden als "Verwandte Albrechts" bezeichnet. Maekingborg fällt. 136 ) Danach ist die Vermutung Oelgartes, 137 ) daß es Albrecht von Stargard gewesen sei, unrichtig, denn Albrecht starb erst 1397.
Von den Verwandten des Königs aus dem herzoglich mecklenburgischen Hause, die hier in Bergen am 22. April 1393 gefallen sein könnten, kommt nur Johann I. der Ältere von Stargard in Betracht, da wir über das Ende aller anderen sichere Nachrichten besitzen. 138 ) Von Johann I. von Stargard dagegen wissen wir nur, daß er um jene Zeit (1392 - 93) gestorben ist. Die letzte Urkunde von ihm stammt aus Bukow vom 10. Oktober 1392; 139 ) am 3. und 6. Februar 1393 regieren schon seine Söhne Johann und Ulrich 140 ) resp. Johann, Ulrich und Albrecht, woraus aber nicht unbedingt folgt, daß er im Februar 1393 schon gestorben sein muß. Er kann ebenso gut auf einem größeren Kriegszug außer Landes gewesen sein, was auf den im Frühjahr 1393 unternommenen Zug der Vitalienbrüder (als deren Führer er auch sonst häufig genannt wird) 141 ) nach Bergen passen würde. Daß er am 28. März 1393 noch gelebt hat oder wenigstens sein Tod noch nicht im Heimatlande bekannt war, können wir daraus entnehmen, daß sich damals sein Sohn Johann noch junior nennt, 142 ) was später nicht mehr geschieht, bis er 1395


|
Seite 23 |




|
im Gegensatz zu Magnus, Sohn, Johann IV., der Ältere genannt wird, 143 ) während Johann IV. schon 1394 144 ) als junior bezeichnet wird.
Marschalck berichtet über Johann des Älteren Tod: 145 ) "Obiit vero Joannes dux primus anno fere millesimo trecentesimo supra septuagesimum; Strelitii tumúlatus". Er weiß also nur, daß er nach 1370 gestorben ist, um so weniger kann der von ihm angegebene Begräbnisort Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. Schon Boll hat seine Richtigkeit bezweifelt, 146 ) da Strelitz damals noch nicht in unmittelbarem fürstlichen Besitz war. Für die Zeit des Todes kämen wir nach dem obigen auf die Zeit nach dem 28. März 1393; das stimmt vollkommen mit der Zeit des Todes des in den isländischen Annalen als Verwandten Albrechts bezeichneten "Maekingborg".
Daß Johann VI. von Waren, dessen Todesjahr auch nicht feststeht, 147 ) dieser Maekingborg der isländischen Quelle gewesen sein könnte, halte ich für nicht wahrscheinlich, da er uns nie als Anführer der mecklenburgischen Kaper entgegentritt und auch nicht auf den Namen Mecklenburg Anspruch machen konnte. Allerdings ist auch er um jene Zeit gestorben; die letzten Urkunden von ihm stammen aus dem Jahre 1389 (7. März und 29. März). 148 ) Am 16. Oktober 1395 aber ist er tot, denn es heißt in einer unter diesem Datum ausgestellten Urkunde des Klosters Malchow von ihm: "den juncher Johan van Wenden, deme god gnedich si". 149 )
Schwieriger dürfte es sein, festzustellen, wer "Enis" gewesen ist, da wir nicht bestimmt wissen, wie der Name Enis im Deutschen gelautet haben würde. Nach Nielsen 150 ) ist Enis Abkürzung und Kosename für Enar (isländ. Einarr ahd. Einharr). Stark 151 ) führt einen Namen Inizo = Henzo, Henizo = Heinrich auf. Unter den uns bekannten Verwandten des Königs finden sich aber keine, die für diesen Namen in Betracht kommen könnten.


|
Seite 24 |




|
Ob Enis Kosename für Johannes (Hans) sein kann, wage ich nicht zu entscheiden. 152 ) Wenn das angenommen werden dürfte, würde die Nachricht der Annalen sehr gut auf Johann IV. von Schwerin, den Sohn von Magnus, gehen können, da Johann seit 24.Mai 1391 153 ) nicht mehr in Urkunden genannt wird, bis er 1394 als Befehlshaber in Stockholm erscheint, 154 ) das er am 31. August 1395 übergibt, worauf die Vitalienbrüder, die nach dem Briefe des neuen Vogts von Stockholm vom 3. September 1395 noch in den Schären und in den Städten liegen, nach seinem Briefe vom 15. September auf Åbo und Wiborg zu absegelten. 155 )
An Herzog Ulrich von Stargard, der, nachdem er am 29.September 1392 einen Landeshauptmann für seine Abwesenheit (wor wi sulven nicht ensind) eingesetzt hatte (MUB. 12447), vom 22. Februar 1393 bis zum 28. Dezember des Jahres aus den mecklenburgischen Urkunden verschwindet (MUB. 12492, 12595), kann bei dem Enis wohl nicht gut gedacht werden.
An sonstigen Vitalienbrüdern werden seit dem Jahre 1390 folgende urkundlich genannt:
1. In dem Brief des livländischen Ordensmeisters vom 12. Oktober 1392 156 ) an den Ordensprokurator in Rom werden als "capitanei" der "fratres victualium" 157 ) genannt: "Henning Manduvel, Zilkauw, Berkelich, Kraseke, Kule, Preyn, Olavus Schutke, Ghunnar, Arnold Stuke, Nicolaus Gylge, Heyno Schutke."
2. Joh. Stoltevoet nennt in einem Schreiben an
Reval vom 6. Dezember 1393
158
) als
"vitalienbroders":
159
) "Clawys Mylres
160
) unde Arnd Stuke, Hennynk
Crabbe, Hinrik van der Lů, Deytliff Knut,
161
) Bernevur unde
sine z
 ne, Henneke
ne, Henneke


|
Seite 25 |




|
Scharbouwe, Prybe, Luder Ransouwe, Henneke van me Zee, Bertholt vanme Zee, Hinrik Tydemans, Hennynk Norman, Wyttekop, Clawis Zwarte, Crekauwe, Rode Kremer, Hans Meygendorp, Ketelhoid, Clawis Tymme, Beydenstorp, schipper Wedige, Degenert, Hennynk, Volmer Wrede, Schonenberg.
3.Die Urkunde über die Stiftung der Messe zu Stockholm vom 24. Juni 1394 162 ) überliefert uns die Namen: "Her Rambold Sanewitze, Her Bosse van deme Kalende, Riddere; Arnd Stüke, Clawus Mylges, 163 ) Marquard Preen, Hartwich Sedorpe, Lyppold Rumpeshaghen, Hinrik Lüchowe, Bertram Stokeled unde schypher Joseph, Knapen."
4.Als Anführer der Schar, die den Bischof Tord von Strengnäs gefangen nahm, werden genannt 164 ) Arnoldus Stuke und Nikolaus Milies.
Lisch hat zuerst darauf hingewiesen, 165 ) daß es für die Beurteilung der ganzen Erscheinung der Vitalienbrüder von größter Wichtigkeit sei, nachzuweisen, wer ihre Führer gewesen seien. Im folgenden habe ich, soweit es mit Hilfe der gegenwärtig zugänglichen Urkunden möglich ist, versucht diesen Nachweis zu führen; wir werden meist mecklenburgische Adlige unter ihnen antreffen.
Bernevur, (Barnefuer, Barnevur, Barnfüer, 166 ) ein um 1500 ausgestorbenes mecklenburgisches Adelsgeschlecht, erscheint zuerst im 14. Jahrhundert. Vielleicht ist der 1361 als Knappe bei Herzog Albrecht von Mecklenburg zusammen mit Stralendorp und Moltke genannte Ulrich B. 167 ) mit dem HR. VIII. 960 (MUB. 12584) erwähnten Bernevur identisch.
Beydenstorp (Boidendorf, Boidenstorf, Boienstorf), 168 ) ein rittermäßiges, nie sehr ausgebreitetes und nicht oft genanntes Geschlecht.


|
Seite 26 |




|
Crekauwe ( = Krakow, Cracowe). Nach Mülverstedt 169 ) sind die Crakow ein altadeliges, im 13. und 14. Jahrhundert in der Altmark anfälliges, auch um diese Zeit im Lande Terichow begütertes Geschlecht, wo sein Stammsitz vielleicht das mit der Stadt Genthin vereinigte Dorf Krackow war. In der Altmark lagen seine Güter namentlich in der Gegend von Salzwedel.
Im Jahre 1358 treffen wir zwei aus dem Geschlecht Krakow als Kriegsmannen Herzog Albrechts von Mecklenburg. 170 )
Crabbe (Krabbe), 171 ) der Name mehrerer weit verbreiteter dänischer Adelsgeschlechter. (Das dänische Adelslexikon führt deren neun auf.) Vielleicht gehört der HR. VIII. 960 (MUB. 12584) als Vitalienbruder genannte Henning Crabbe einer der in der (Dansk) Historisk Tidstrift 1879 S. 617 ff. erwähnten ältesten Familien an. 1350 lebte ein Krabbe, dessen Siegel eine Krabbe 172 ) zeigt; nach HTD a. a. O. jedenfalls der letzte seines Geschlechts. 1367 wird ein Michael Niclesson dictus Crabbe genannt, dessen Vater 1336 sich nur Nikolaus Michelson, dessen Sohn aber später sich Niels Krabbe nannte. 173 )
Ketelhoidt ( = Ketelhodt) 174 ) ein schon in der ersten Hälfte des 13. Jhdts. in Mecklenburg eingewandertes Geschlecht, das Mecklenburg wieder verlassen hat, um sich in Thüringen niederzulassen, wo es noch jetzt, namentlich im Fürstentum Schwarzburg, seßhaft ist. 175 )
Es ist nicht ausgeschlossen, daß einer der beiden im Necrologium Gotlandiae fratrum Minorum in Wisby 176 ) genannten Ketelhoet und Kaetilö mit dem HR. VIII, 960 (MUB. 12584) genannten Vitalienbruder identisch ist, da das Necrologium über


|
Seite 27 |




|
die Grabstätte von nicht weniger als vier anderen Vitalienbrüdern Aufschluß gibt. 177 )
van der Lü, Hinrik. Das Geschlecht "von der Lü od. Lühe" hat seinen Namen von dem Flüßchen "Lühe" im alten Lande. 178 )
Um 1382 heißt es: "Dominus Conradus de Lu, Curd de Busch(ge)mole, 179 ) Conrad de Lu iunior proscripti sunt eo, quod Marquardum Hagemester nostrum concivem suis bonis in portu dominorum 180 ) spoliaverunt, quapropter profugi facti sunt et omni jure Lubicense provicti". 181 ) Der oben erwähnte Heinrich, der vielleicht mit einem der 1395 als im Dienste Johanns II. stehend erwähnten 182 ) identisch ist, scheint in seinem Geschlecht also würdige Vorgänger gehabt zu haben.
Nikolaus Milies. Er scheint einer der Hauptanführer der Vitalienbrüder gewesen zu sein, da er in sämtlichen oben angeführten Urkunden genannt wird. 183 ) Mit Arnd Stuke zusammen, der dieselbe Rolle spielt, führt er 1392 die Schar, die den Bischof Tord von Strengnäs gefangen nahm. 184 ) Nach der darüber sprechenden Urkunde stammte er aus dem Ratzeburger Stift. 185 )
Bunge III. 710: Nicolaus Gylge. ebenfalls Schreibfehler. Suhm XIV. 585, MUB. 12669: Clawus Mylges.
SRPergmbref 2867: Nicholaus Milies.
Das Hauptwerk über die Familien Mylius und ähnlicher Namensform: J. C. Mylius, Geschichte der Familie Mylius. Genealogischbiographische Familienchronik der Mylius aller Zeiten und Länder. Buttstädt 1895 (nicht im Handel), ist in mehreren wesentlichen Punkten zu berichtigen. Nach ihm ist Milies erst im 17. Jahrh. aus Mylius entstanden, dieses selbst um die Mitte des 16. Jahrh. aus Müller latinisiert. Vor 1550 soll nach ihm der Name Mylius nur äußerst selten vorkommen und vor 1500 hat er ihn überhaupt nicht nachweisen können.
Vgl. dagegen den obigen Namen, die Hildesheimer Stadtrechnungen, herausg. v. Doebner und Riedel, cod. dipl. Brand. wo schon seit dem 14. Jahrh. Bürger und Geistliche mit dem Namen Milges, Milies erscheinen. Auch als Vorname kommt Milies und Miliges im 14. Jahrh. vor (Sudendorf Urkb. III. 36; VII. 62).


|
Seite 28 |




|
Hennynk Norman, aus der adeligen rügischen Familie Norman, in der der Name Henning althergebracht ist. 186 )
Arnd Stuke, stets mit Nik. Milies zusammen in allen oben angeführten Urkunden genannt. 187 ) Er stammte aus dem nach Stück bei Schwerin genannten nie zahlreichen mecklenburgischen Adelsgeschlecht. 188 ) 1349 wurde ihre Feste Kützin bei Wittenburg von den Lübeckern zerstört. 189 ) Um 1380 schon finden wir ihn als Führer von Seeräuberscharen an der livländischen Küste, 190 ) von 1392 an bei allen wichtigen Ereignissen. Mit Nik. Milies scheint er einer der Hauptanführer der Vitalienbrüder gewesen zu sein. 191 )
Luder Rantzowe, aus dem berühmten holsteinischen Adelsgeschlechte der Rantzau.
Henneke und Bertholt vanme Zee 192 ) (vom See, v. d. See, de Stagno), dem in Lauenburg und Mecklenburg begüterten Geschlecht angehörig.
Henning Manduvel 193 ) gehört zu der noch blühenden Familie, die im Mittelalter ihre Wohnsitze auch im Stargardschen hatte. 194 )
Marquard Preen 195 ) war der Sohn des Henneke Preen zu Davermoor (südl. von Gr.=Brütz) in der Grafschaft Schwerin. Als Graf Otto von Schwerin 1357 starb, und Albrecht v. Meklenburg gegen den Grafen Nikolaus v. Tecklenburg und dessen Sohn Otto seine Ansprüche auf die Nachfolge in der Grafschaft geltend machte, traten Henneke und seine Söhne Johann, Heinrich und Gottschalk, geheißen "Preen von d. Davermoore", mit allen Verwandten in die Dienste Albrechts. 196 ) Marquard (der noch nicht genannt wird) ist damals vielleicht noch ein Knabe oder


|
Seite 29 |




|
außer Landes gewesen. Er begegnet uns zuerst 1367, wo Henneke und Marquard Urfehde schwören müssen. 197 ) Darauf erscheint Marquard als Hauptmann der Vitalienbrüder, 1392 in den livländischen Gewässern, 198 ) 1393 und 1394 vor und in Stockholm. 199 ) Mit der Befreiung Albrechts verschwindet nicht allein Marquard, sondern auch die ganze Linie seines Geschlechts. 200 )
Heyno u. Olav Schutke (Schutte) 201 ) wohl nicht aus dem mecklenburgischen Adelsgeschlecht der Schosse, Schotze oder Schutze 202 ) sondern aus einer Familie Schutte mit dreizintiger Gabel im Wappen (MUB. 12120). 1359 haben zwei Schutte, Heino und Otto ebenso 1358 Detlef und Nikolaus mit einem Seedorp u. a. einen Raubzug ins Ratzeburgische unternommen. 203 ) Vielleicht ist der in Wisby bestattete Johannes Schutte 204 ) ein Verwandter des hier erwähnten Heyno. Ein Henneke Scutte wird 1379 als Straßenräuber genannt, ein gleichnamiger ist ist ebenso wie andere des Namens (Borchard, Clawes, Peter) bei Räubereien in der Wismarschen Gegend 1391 und 1392 beteiligt, 205 ) doch ist es zweifelhaft, ob es sich bei diesen um Glieder eines adligen Geschlechtes handelt.
Nambold Sanewitze 206 ) (Tzanewitz 207 ) hat die Urkunde in Stockholm mitunterzeichnet und ist auf Gotland gestorben. 208 )
Bosse van deme Kalende 209 ) (v. Kaland oder Kalen) gehört dem um die Mitte des 18. Jahrhunderts erloschenen aus Alt=Kalen stammenden, besonders zu Rey begüterten Geschlecht an. 210 ) Bosse, ein Kosename für Burchard, stammt aus der


|
Seite 30 |




|
Finkenthaler Linie; sein Vater ist Hermann auf Finkenthal. 211 ) Am 4. November 1387 verkaufte Bosse 2 Hufen an das Kloster Dargun; 212 ) am 19. September 1392 erteilte der Herzog Johann der jüngere von Meklenburg dem "Busse v. d. Kalande", seinem treuen Diener, die Freiheit, das halbe Gut Stove, das seine Ehefrau geerbt, nach seinem Belieben zu verpfänden und zu verkaufen, 213 ) und am 2. Oktober 1392 bezeugt Herzog Johann, daß Sigrit, "Bosse von dem Kalends Weib", vor ihm ihr väterliches Erbe aufgelassen habe. 214 ) Aus allen diesen Veräußerungen geht hervor, daß Bosse v. Kaland zu besonderen Unternehmungen Geld gebrauchte, aufnahm und sogar seine Frau ihr Erbteil verpfänden mußte; er scheint bei diesen Verpfändungen schon außer Landes gewesen zu sein. Seine Ehefrau wird ihm später gefolgt sein, denn beide liegen in Wisby auf Gotland begraben. 215 ) Der bei Lindström 216 ) erwähnte Grabstein darf wohl mit Sicherheit als derjenige Bosses bezeichnet werden. 217 )
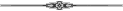


|
Seite 31 |




|



|



|
|
:
|
II.
Die Begründung und Entwickelung
der
kirchlichen Organisation Mecklenburgs im Mittelalter.
Von
Pastor K. Schmaltz, Sternberg.
(Schluß.)
~~~~~~~~~~~~
3. Die an Kammin verlorenen Länder.
a) Circipanien.
Circipanien, das politisch schon seit den sechziger Jahren des 12. Jahrhunderts an Pommern verloren gegangen war, geriet, wie schon im vorhergehenden Bande gesagt, seit dem Ende desselben auch kirchlich unter die Gewalt des pommerschen Landesbischofs. Dieses Land umfaßte das nördlich durch Trebel, Recknitz und Nebel, ostwärts durch Peene und Ost=Peene, süd= und westwärts durch eine von Zettemin zum Goldberger See und von dort auf den Parumer See gezogene Linie begrenzte Gebiet. Es zerfiel in eine Reihe von Ländern, von denen sich das Land Kalen mit dem Ländchen Hart auf Grund der Urkunde 3721 einigermaßen näher abgrenzen läßt. Seine Ost= und Südostgrenze bilden mit der heutigen Landesgrenze zusammenfallend Trebel und Peene durch den Kummerower See bis zum Malchiner See. Von dort läuft die Grenze nordwärts mit den Westgrenzen der Kirchspiele Panstorf, Mistorf, Levitzow, Belitz, Polchow, und schließlich ostwärts mit den Nordgrenzen der Kirchspiele Walkendorf, Boddin, Alt=Kalen und Brudersdorf zusammenfallend. Ein Unterteil bildet das zwischen Teterower und Malchiner Peene gelegene Ländchen hart. Nördlich des Landes Kalen liegt das Land Gnoien, südlich das Land Malchin. Die Grenzen des ersteren sind durch Trebel und Recknitz gegeben. Letzteres wird ostwärts


|
Seite 32 |




|
durch die Ostpeene begrenzt. Seine Südgrenze fällt mit derjenigen der Kirchspiele Schwinkendorf (1967) und Rambow (3282) 1 ) zusammen. Westlich und nördlich des Malchiner Sees gehörten die Kirchspiele Grubenhagen, Schorssow und Bülow noch dazu =nach von Herrn Dr. Witte gütigst zur Verfügung gestellten Auszügen aus Bederegistern im Archiv zu Schwerin (Amt Malchin, Kaiserbede 1496, Landbede 1518 und 1567). Ob das kleine Kirchspiel Hohen=Demzin noch zu Malchin zu rechnen ist, muß dagegen zweifelhaft bleiben. Das zu ihm gehörige Grube erscheint zwar M. U.=B. 1347 als im Lande Malchin belegen und ebenso wird das zweite dorthin eingepfarrte Dorf Karstorf zu Malchin gehören, da es einst nach Bülow eingepfarrt war (Visit. 1541), aber Hohen=Demzin selbst wird von jenen Bederegistern als im Amte Teterow belegen gegeben (Amt Teterow: Landbede 155 ? und 1567). Für den Westen Circipaniens erscheinen zur Wendenzeit die Namen Bisdede und Tribede. Aber über den Bereich, für welchen diese Namen gelten, ist man nicht im klaren. Seit der Arbeit von Lisch über die Länder Bisdede und Tribede (M. Jbb. 12, 24 - 35) hat man sich gewöhnt, unter Bisdede den westlich der Länder Kalen und Malchin gelegenen Teil Circipaniens zu verstehen, unter Tribede aber das Land Gnoien. Ersteres ist gesichert durch die Urkunden 162 und 411. Die Burg Bisdede lag am Gutower See südlich von Güstrow. Für letzteres spricht nur die Verbindung "im Lande Tribeden und Gnoigen" in einem Clandrianschen Regest (826). Anders entscheidet sich Wigger, der (Meckl. Annalen I, 126 f.) Bisdede (= Güstrow), Krakow, Teterow und vielleicht Laage als Unterteile von Tribede ansieht. Ich schließe mich letzterem an. Die Urkunde 141 (ebenso 149) mit ihrem "omnes villas terre que dicitur Noue . . . . a Butessowe in utraque parte aque, que Nebula dicitur, usque ad terram, que Tribeden vocatur" und der allerdings gefälschte Einschub in Nr. 162 "ipsa terra Tribeden cum castro Bizdet" führen entweder auf eine Gleichsetzung beider Länder oder darauf, daß Bisbede ein Teil des Landes Tribede ist, das neben ihm eben vielleicht aus den Burgwarden Krakow (Burgwall auf einer Insel und auf dem Ehmkenwerder, Schlie IV, 416) und Teterow (Burgwall im See, Schlie V, 1 f. 224) bestand. Von Bützow nebelaufwärts gelangt man niemals nach Gnoien, sondern zunächst nach Bisdede=Güstrow. Weiter aber führt auch folgendes auf die


|
Seite 33 |




|
Gleichsetzung von Tribede mit den drei späteren Ämtern Güstrow, Krakow und Teterow. Das Güstrower Domstift erhielt nach Urkunde 438 die Archidiakonatsrechte über "Bisdede", nach Urkunde 439 über "Bisdede sive Tribedene". Nun finden sich aber, abgesehen von jenem Clandrianschen Regest, nach welchem das Güstrower Domkapitel dem Schweriner Bischof "alle Zehnten im Lande Trybeden und Gnoigen" enthebt, keinerlei Spuren von irgendwelcher Tätigkeit des Dompropstes im Lande Gnoien. Dafür aber gibt das Visitationsprotokoll von 1534 für die Pfarren von Krakow, Dobbin, Lüdershagen, Lübsee, Wattmannshagen, Gr.=Wokern und Teterow an, daß hier der Propst von Güstrow instituiere, d. h. eben die Archidiakonatsrechte ausübe. Das sind aber gerade die landesherrlichen Pfarren jener drei Ämter, nicht aber des Landes Gnoien. Zu ihnen kommt noch nach M. U.=B. 11183 und 11255 die Pfarre von Reinshagen, welche ebenfalls in diesem Gebiet liegt. Zwar schließt Schlie (V, 25) aus diesen beiden Urkunden, daß die Jurisdiktion des Güstrower Propstes sich auch über die Hartpfarre Mistorf, und also in das östliche Circipanien hinein erstreckt habe, jedoch mit Unrecht. Es handelt sich in ihnen um den Umtausch einiger Äcker einer Vikarei in der Reinshäger Kirche, welchen der Propst genehmigt. Der Umstand, daß die für sie eingetauschten Äcker zufällig in der Mistorfer Feldmark liegen, beweist garnichts für die Jurisdiktion des Güstrower Propstes über die Mistorfer Kirche, denn diese Äcker sind nicht Kirchengut, sondern gehören dem Ritter Hartwich Wotzenitz. Nur das erhellt, daß der Propst für die Reinshäger Kirche zuständig war. Die einzige Spur, welche auf eine über jene drei Ämter hinausreichende Amtstätigkeit desselben führen könnte, ist eine Akte über eine Pfarrbesetzung in Schorssow im Jahre 1510, bei welcher er beteiligt war, auf die Lisch (M. Jbb. 12, 29 Anmerk. 1) hinweist. Schorssow aber liegt im Lande Malchin, und so mag möglicherweise auch dieses noch als Unterteil von Tribede anzusehen sein.
Politisch war, wie gesagt, Circipanien schon im 12. Jahrhundert an Pommern - Demmin gekommen und blieb bei demselben bis zum Jahre 1236. Dann kam es im Verlauf der durch den Kremmener Vertrag beendeten Verwickelungen an die mecklenburgischen Fürsten, die es mit bewaffneter Hand besetzt hatten. Der westliche Teil des Landes aber, vermutlich Tribeden in dem von uns angenommenen Umfange, war schon vorher - man weiß nicht wann und wie - in mecklenburgische Hände gekommen; 1226 verfügte Heinrich von Rostock als Landesherr über Güstrow


|
Seite 34 |




|
und Umgegend (323), 1229 seine Söhne über die Einöde von Rosin, und nach einer Urkunde von 1233 besitzen sie den Zehnt über "die ganze Einöde, welche Bisdede genannt wird" (411). Das Jahr 1226 ist aber überhaupt das erste, aus dem uns Nachrichten über Ereignisse in diesem Teil von Circipanien erhalten sind; weder von pommerscher noch von mecklenburgischer Seite verlautet vorher etwas. Man darf es als ziemlich sicher annehmen, daß er damals erst ganz vor kurzem in mecklenburgische Hände gekommen war. Denn von hier aus war weder Kolonisation noch kirchliche Organisation vor 1226 bisher in Angriff genommen, während sie in den angrenzenden mecklenburgischen Strichen schon weit vorgeschritten war. Mit der Errichtung des Kollegiatstiftes Güstrow und der Verleihung der Einöde Rosin an Kloster Michaelstein (323 369) setzt beides erst ein. Noch 1233 wird das Land Bisdede eine Einöde genannt (411) - offenbar war dieser pommersche Grenzstrich gegen Mecklenburg, schon an sich größtenteils Waldgebiet, wie viele Grenzstriche arg entvölkert. Wenn Schlie (IV, 187) meint, daß die Kirche in Güstrow 1226 schon bestand und nur in eine Kollegiatkirche umgewandelt ward, ja in dem westlichen Chorjoch der Domkirche einen Rest jener vor 1226 errichteten Kirche sehen will (S. 202), so sagt einerseits die Stiftungsurkunde (323) deutlich genug, daß Heinrich von Rostock die Kirche für das Stift erst errichtet hat, und ist andererseits jenes westliche Chorjoch mit dem daranstoßenden gleichzeitig und auf eine Kirche angelegt, deren Dimensionen die einer Landkirche weit übersteigen, zudem ganz in Backstein aufgeführt, erscheint es vor 1226 als Undenkbarkeit; auch dem Stile nach dürfte es schwerlich vor 1226 angesetzt werden können.
Der Grund für dieses verhältnismäßig späte Einsetzen der Kolonisation und kirchlichen Einrichtung von Mecklenburg aus kann nur darin gesucht werden, daß dieser Landstrich um 1226 eben erst in mecklenburgischen Besitz gekommen war, Pommern aber diese entlegenen Grenzgebiete vernachlässigt hatte.
Weiter ostwärts auf Demmin zu, in den Ländern Kalen und Malchin, war beides von pommerscher Seite aus schon weiter vorgeschritten. Wie wir oben wahrscheinlich zu machen gesucht, waren im östlichen Circipanien schon zu Bernos Zeiten die drei Pfarrkirchen von Röcknitz, Lübchin und Malchin errichtet worden, erstere von dem 1172 gegründeten Kloster Dargun aus, letztere landesherrliche Gründungen. Wir hatten weiter gesehen, daß wahrscheinlich nach Bogislavs Tode unter der veränderten politischen Stellung der pommerschen Fürsten die Bischöfe von Kammin


|
Seite 35 |




|
mit deren Unterstützung ihren Sprengel auch über Circipanien ausgedehnt hatten, und daß Brunwards Versuch, die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen, trotz günstiger päpstlicher Entscheidung an der Ungunst der politischen Lage gescheitert war (ca. 1198). Obgleich der Prozeß bei der Kurie fortging und für die Schweriner Ansprüche günstig lief (446), blieb Kammin im Besitz Circipaniens.
Die kriegerischen Verwickelungen der achtziger und neunziger Jahre werden auch hier die kirchliche Entwickelung zurückgehalten haben. Ja, die Zustände wurden so schwierig, daß, wohl um 1190, die Darguner Mönche ihr Kloster aufgaben und nach Eldena in das Gebiet des dänenfreundlichen Jaromar übersiedelten. Jahrelang lag nun das Kloster wüst "eine Behausung wilder Tiere und Schlupfwinkel von Räubern", wie Bischof Sigwin sich ausdrückt. Erst 1209 ward es durch diesen wiederhergestellt und mit Mönchen aus Doberan besetzt. Dieses Datum scheint nun den Beginn der Wiederaufnahme der kirchlichen Organisationsarbeit von Kammin aus zu bezeichnen. Ob jene drei Pfarrkirchen die Kriegszeiten durchdauert haben? Von Lübchin und Malchin, als unter dem unmittelbaren Schutz der Kastellane dieser Burgwarde stehend, darf es angenommen werden, betreffs Röcknitz dagegen mag man zweifeln, ob der Pfarrer aushielt, wo die Mönche wichen. Jedenfalls ist auch er im Jahre 1219 wieder da (247). In diese Zeit um 1209 gehört auch die Gründung der Kirche von Polchow im Westen des Landes Kalen, wohl durch die Landesherren, denen der Ort gehörte. Kasimar schenkte ihn 1216 (223) mit der Einöde "Geresowe vel Chowale" an Dargun, und wie nun im selben Jahre (226) Bischof Sigwin dem Kloster die Kirche "que est in villa eorum Polchowe cum omni iure nostró, prout ordo solet ecclesias possidere" überträgt, so kann es sich dabei unmöglich schon um eine Gründung Darguns handeln, welche überdies dem Kloster nicht erst hätte übertragen werden müssen. Bestand die Kirche aber schon, und war sie mit dem Ort in Klosterbesitz übergegangen, so mußte das in jenen Worten angedeutete Bannrecht über sie allerdings noch vom Bischof geschenkt werden, andernfalls hätte sie den Propst von Demmin weiter unterstanden, der in diesen Gegenden zuständig war (225, 247, 491). Zwischen Röcknitz und Demmin tritt 1215 (219) die Kirche zu Levin zum erstenmal entgegen, auch sie unter Bischof Sigwin (779) gegründet und von dem in der ganzen Gegend reichbegüterten Kastellan Rochill von Demmin dotiert (799). Das Patronat scheint jedoch in Händen der Landesherren gewesen zu sein (527). Als vierte Kirche im Lande Kalen ward um dieselbe Zeit die


|
Seite 36 |




|
von Schorrentin errichtet, auch sie von Rochill, der 1215 bis 1226 urkundlich vorkommt, dotiert (Schlie I, 594), und ebenfalls landesherrlichen Patronats (Visit. 1534). Ihr Kirchspiel griff über die Teterower Peene hinüber und umfaßte noch das jetzige Kirchspiel Neukalen, reichte also vermutlich bis an das von Malchin. Endlich errichtete Dargun zwischen 1209 und 1232 eine fünfte Kirche in Altkalen (401). In den kleineren Ländern Gnoien und Malchin ließ man sich dagegen wohl noch mit den einzigen Kirchen von Lübchin und Malchin begnügen. Nur in dem untergegangenen, südwestlich Malchin an der Westpeene gelegenen Wargentin, welches Kasimar 1215 (219) dem Kloster Arendsee schenkte, scheint dieses schon um 1220 (272) die Errichtung einer Kirche beabsichtigt - und wohl auch ausgeführt zu haben. Weiter westwärts im Lande Tribeden fehlt es an jeder Nachricht. Indessen kann es bei den energischen Fortschritten, welche die kirchliche Organisation im östlichen Circipanien machte, nicht ganz ohne Kirche geblieben sein. Vielleicht mag die von Teterow bis in diese Zeit hinaufreichen.
Fragt man nun, ob diese Fortschritte auch hier mit der deutschen Kolonisationsbewegung zusammenhängen, so zeigen die Schenkungen von 1216 und 1225 (225, 311) mit ihren ausführlichen Grenzbestimmungen, aus denen hervorgeht, daß die Feldmarken noch nicht vermessen waren, und die verschiedentlich begegnenden Einöden und verlassenen Wendendörfer (223, 225, 335), daß die Besetzung des Landes mit Deutschen jedenfalls noch nicht weit vorgeschritten war. Die erste Spur derselben fände sich 1215 in der Nähe von Malchin, wenn M. U.=B. 219 B mit seinen "fossata, que sunt nominata Uosgrouen" echt wäre. Aber gegenüber Nr. 219 A charakterisiert sich dieser Passus als Zusatz. Er stammt aus Nr. 371, der Bestätigung von Nr. 219 durch die Rostocker Fürsten, mit welcher 219 B, das nur als Abschrift vorhanden ist, auf einem Blatte steht. Aber auch diese Bestätigung ist nur in Abschrift vorhanden und ihre Datierung ist falsch: weder 1219 noch nach der Indiktion 1233 waren die mecklenburgischen Fürsten Herren im Lande Malchin. Die "Voßgrowen" bei Malchin im Jahre 1215 sind also höchst fraglicher Natur. Sieht man von ihnen ab, so ist das erste deutliche Anzeichen deutscher Einwanderung der zehn Jahre später (311) begegnende deutsche Ortsname "Lilekesdorp" (Lelkendorf bei Neukalen). Demnach muß die Kolonisation auch im östlichen Circipanien schon unter pommerscher Herrschaft und nicht nur in der Umgebung von Dargun in Gang gekommen sein.


|
Seite 37 |




|
Denn bei der großen Zehntverleihung des Jahres 1235 an das Güstrower Domkapitel (439) begegnen unter den 7 in den Ländern Malchin und Kalen gelegenen Ortschaften drei, "slavicum Methnic", "teutonicum Butzin" und "parvum Daleniz", welche offenbar deutsche Einwanderung bezeugen. Ja die unterschiedslose Anführung von Hufenzahlen in diesen 7 Orten macht es höchst wahrscheinlich, daß sie alle, auch Wendisch=Methling, schon in deutschen Hufen lagen, die Kolonisation also bereits soweit vorgeschritten war, daß auch den Wenden reservierte Dörfer schon deutsche Agrarverfassung erhalten hatten. Beachtet man nun, daß die deutsche Einwanderung bereits 1210 die Ostgrenze des nördlich des in Frage stehenden Gebietes liegenden Landes Rostock erreicht hatte und um eben diese Zeit mit der Neubesetzung von Dargun mit deutschen Mönchen die Weiterführung der kirchlichen Organisation einsetzt, so darf als sicher angenommen werden, daß letztere auch hier mit der deutschen Einwanderung Hand in Hand ging. Ihren völligen Ausbau erreichte sie wie jene ihren Höhepunkt freilich erst nach dem Übergang des Landes aus pommerscher in mecklenburgische Herrschaft.
Während so die kirchliche Organisation Circipaniens unter dem Schutze der pommerschen Herzöge von Kammin aus vorschritt, war Brunward, wie er selbst klagt "propter potentiam laicorum, dominorum videlicet Dyminensium" (446) nicht imstande, das ihm entrissene Gebiet zu betreten. Sobald jedoch das westliche Circipanien, Tribede, unter mecklenburgische Herrschaft gekommen war, traf er Anstalt, sich desselben kirchlich zu bemächtigen und es von Schwerin aus zu organisieren. Auf seinen Antrieb stiftete und dotierte Heinrich von Rostock im Angesichte seines nahenden Endes 1226 eine Kollegiatkirche in Güstrow (323), und wenn hierbei unter den Ämtern der Stiftsherrn auch das des Scholastikus aufgeführt wird, also die Errichtung einer Schule für Kleriker sofort in Aussicht genommen wird, so ist die Absicht klar: das neue Stift soll Ausgangs= und Mittelpunkt der Versorgung Circipaniens werden. Bei der Aufstellung der Urkunde erscheinen schon einige Glieder des neuen Kapitels als Zeugen, ein Zeichen, mit welcher Energie Brunward die Sache betrieb. Wenige Tage darauf starb Heinrich von Rostock, aber sein Vater, der alte Burwy, bestätigte die Stiftung (331). Im April 1229 ward die bischöfliche Bestätigung in Güstrow selbst vollzogen (368).
Inzwischen aber war auch Burwy gestorben (Januar 1229) und sein Enkel Nicolaus, welcher nach kurzer Vormundschaft die Regierung im östlichen Mecklenburg ergriff, nahm eine andere


|
Seite 38 |




|
Haltung ein. Um den Preis des Zehnten super totam solitudinem Bisdede trat er den Ansprüchen Conrads von Kammin bei. Ja es gelang letzterem sogar, das Güstrower Kapitel selbst zu gewinnen - wahrscheinlich ebenfalls durch Zehntversprechungen - vielleicht die, über welche die Schenkungsurkunde 1235 (439) ausgestellt ward. Schon 1230 (378) ließen sie sich als "Capitulum Caminensis diocesis" von Gregor IX. ihren Besitz bestätigen. Brunward war somit auch aus Tribeden wieder ausgeschlossen, seine eigene Stiftung sogar ihm abtrünnig geworden. Eine neue Aussicht tat sich ihm wenige Jahre später auf, als der inzwischen mündig gewordene Borwin im Lande Rostock die Regierung übernommen hatte und zugleich die pommersch=brandenburgisch=dänischen Verwickelungen den mecklenburgischen Fürsten Aussicht auf Gebietserweiterung gegen Pommern eröffneten. Nun gewann Brunward den jungen Borwin durch umfangreiche Zehntversprechungen in den zu erobernden Ländern, ihm zur Erlangung seiner bischöflichen Ansprüche auf dieselben behülflich zu sein. Auch Erzbischof Gerhard von Bremen betrieb die Sache. Am 5. Februar 1236 kam es zum Abschluß des Bündnisses. Aber die Gesinnung des jungen Borwin schlug um, wohl infolge des am 20. Juni zu Kremmen zwischen Pommern und Brandenburg zustande gekommenen Friedens. Borwin stand davon ab, Brunwards Interessen neben den seinen zu vertreten, das Bündnis löste sich auf. Brunward mußte sich nach einem andern Helfer umsehen. Er glaubte ihn in dem ältesten der 4 Brüder, Johann von Mecklenburg, gefunden zu haben; durch noch größere Versprechungen wußte er im August desselben Jahres diesen zu dem gleichen Bündnis zu bewegen, auch diesmal jedoch ohne Erfolg. Nicolaus von Werle und Borwin von Rostock trugen den Gewinn davon und teilten ihn; Borwin erhielt Gnoien, Nicolaus den Löwenanteil, Tribeden, Kalen, Malchin. Die Verbündeten Johann und Brunward gingen leer aus; Circipanien blieb kamminisch.
Brunward starb am 14. Januar 1238. Sein Nachfolger Friedrich, der jüngste nun auch schon betagte Sohn des alten Gunzelin von Schwerin, erreichte zwar einen päpstlichen Befehl, ihn in den Besitz der strittigen Gebiete zu setzen (492), aber er kam nicht zur Ausführung. Friedrich starb schon nach einem Jahre und sein Nachfolger, der bisherige Dompropst Dietrich, verzichtete 1247 in einem Vergleich mit Wilhelm von Kammin auf die Ansprüche der Schweriner Kirche. Zwar nahm sein zweiter Nachfolger, Rudolf, den Kampf noch einmal auf, indem er die Sache von neuem bei der Kurie anhängig machte; diese beauftragte


|
Seite 39 |




|
die Bischöfe von Ratzeburg und Halberstadt und den Abt von Lehnin mit der Schlichtung des Streites. Drei Jahre hindurch (1257 - 60) wurde hin und her verhandelt. Zur Entscheidung scheint es nicht gekommen zu sein. Schließlich beruhigte man sich bei dem Vergleich von 1247 (cf. 857): Circipanien blieb für Schwerin verloren.
Die nach allen diesen Kämpfen endlich festgelegte Sprengelgrenze zwischen Kammin und Schwerin hat Grotefend (M. Jbb. 68, 219 - 66) auf Grund des urkundlichen Materials genau beschrieben. Hier mag es genügen, danach die schwerinschen Grenz=Kirchspiele der Reihe nach zu nennen: schwerinisch sind an der Mündung der Rick in die Ostsee beginnend das Greifswald gegenübergelegene Wiek, dann Neuenkirchen, Horst, Grimmen, Kirch - Baggendorf, Glewitz, Medrow, Dorow (jetzt Nehringen), Tribsees, Sülze, Kölzow, Tessin, Kammin, Groß - Ridsenow, Laage, Recknitz, Alt=Güstrow, Lüssow, Parum, Karcheez, Lohmen, Dobbertin, Goldberg, Kuppentin (mit Poserin), Karow, Kieth, Wangelin, Lütgendorf, Sommerstorf, Vielift, Lansen, Rittermannshagen (ohne Faulenrost, das zu Schwinkendorf gehörte, und Demzin, das eine eigene Pfarre bildete), Groß=Bievitz, Barchentin, Groß=Barchow und Luplow.
Schon unter pommerscher Herrschaft hatte in Circipanien die Besiedelung mit deutschen Bauern begonnen und war der Ausbau des Pfarrsystems kräftig vorwärts gekommen. Die Pfarren von Lübchin im Lande Gnoien, von Levin, Röcknitz, Kalen, Polchow, Schorrentin im Lande Kalen, die von Malchin und Warkentin im Lande Malchin waren errichtet, so daß man sich versucht fühlt, zu vermuten, auch über dieselben hinaus sei das Pfarrsystem schon unter pommerscher Herrschaft in ersten großen landesherrlichen Kirchspielen über das ganze Land hin ausgedehnt worden. Dennoch scheint dem nicht so. Die große, 14 Ortschaften umfassende landesherrliche Pfarre Jördensdorf - (Levitzow gehörte noch dazu) - wird nämlich 1318 (4026) in der Bestätigung Johanns von Werle als "unse lehen, dat unse oldern gegeuen hebben und wy iegenwerdich bestedigen", also ausdrücklich als eine erst unter mecklenburgischer Herrschaft erfolgte Gründung bezeichnet, und auch die ebenso große Nachbarpfarre Belitz scheint in pommerscher Zeit noch nicht bestanden zu haben, wenigstens besaß die Kirche von Polchow den Zehnten des Dorfes Belitz selbst und war mit dem zu Belitz gehörigen Dorfe Prebberede dotiert (402, 354). Ihr Kirchspiel scheint also ursprünglich auch diese Ortschaften umfaßt zu haben. Der eigentliche Ausbau des Pfarrsystems wird


|
Seite 40 |




|
daher erst unter mecklenburgischer Herrschaft nach 1235 erfolgt sein. Er muß aber unmittelbar nach dem Übergang in diese und dem damit eintretenden Höhepunkt der Kolonisationstätigkeit in diesen Gegenden stattgefunden haben. Denn wenn Nicolaus von Werle 1240 (1292) in den späteren südlich des Malchiner Sees gelegenen Dörfern Papenhagen und Marxhagen 40 Hägerhufen dem Domstift Güstrow teils verkauft, teils schenkt, und 4 Hufen zur Ausstattung der Kirche des Ortes hinzugibt, so erhellt, daß man damals schon zur Waldkolonisation und zur Errichtung von Kirchen in aus wilder Wurzel gerodeten Ortschaften überging, die Errichtung von Kirchen für die älteren Dörfer also schon geschehen war. Ebenso setzt die Abzweigung einer Tochtergemeinde und Kirche zu Basedow von dem Anfangskirchspiel Malchin im Jahre 1247 (589), wobei die in die neue Kirche einzupfarrenden Dörfer der Reihe nach aufgeführt werden, voraus, daß schon weitere Nachbarkirchspiele bestanden, also zum mindesten das landesherrliche (Schlie V, 140 f.) Kirchspiel von Schwinkendorf. Zur selben Zeit wie Schwinkendorf wird auf der anderen Seite des Sees die ebenfalls landesherrliche (Schlie V, 66 ff) Pfarre von Bülow errichtet sein, mit Basedow und Papenhagen gleichzeitig, kurz darauf dann die des 1243 (547) urkundlich auftretenden Grubenhagen. Letztere begegnet zuerst 1288 (1989), die von Schwinkendorf 1271 (1229), die von Bülow allerdings erst 1372 (10271), aber alle diese Kirchen sind durch ihre stattlichen, dem besten Übergangsstil angehörigen Granitbauten als im wesentlichen gleichzeitig und spätestens um die Mitte des Jahrhunderts gegründet erwiesen. Das trifft auch für die durch Umbauten in der gleichen Zeit stark veränderte Kirche von Schwinkendorf zu (Schlie V, 140 ff.). Auf dem Hart wurde zur selben Zeit die Pfarre von Hohen=Mistorf errichtet; ihr Pfarrer begegnet schon 1249 (622) 1 ), auch sie landesherrlichen Patronates (Visit. 1534). Die übrigen Kirchen des Landes erscheinen alle als später gegründet. Auch hier also bewährt sich die Erkenntnis, daß die Kirchen der Hauptepoche der Kolonisationszeit in der Regel landesherrlich sind, und darf das vielleicht auch für die beiden, von denen es nicht nachweisbar ist, Grubenhagen und Basedow, angenommen werden.
Im Lande Kalen ward das Pfarrsystem durch die beiden großen landesherrlichen Kirchspiele von Jördensdorf und


|
Seite 41 |




|
Belitz vervollständigt. Beide begegnen urkundlich zwar erst kurz nach 1300 (4026, 3721), aber ersteres ist durch seine treffliche Übergangskirche gesichert (Schlie V, 36 ff.), und dann kann letzteres, obgleich seine Kirche erst gotisch ist, nicht fehlen; die Lücke würde zu groß sein; auch weisen die Reste seiner romanischen Fünte (Schlie I, 479) auf eine frühere Zeit. Zudem liegt das große Kirchspiel in einer schon zur Wendenzeit stark besiedelten Gegend und beruht nicht auf Waldkolonisation. Weiter nordwärts im Lande Gnoien mögen zu der alten Kirche von Lübchin die beiden von Gnoien und Basse hinzugekommen sein. Ersteres ist zwar erst nach 1238 Stadt und Mittelpunkt des Landes geworden - bis dahin war es Lübchin (479), aber sein Kirchspiel wird, da es auch eine Reihe Dörfer - einschließlich Wasdow - umfaßt, älter sein als die Erhebung zur Stadt, und Basse begegnet zwar erst 1364 (9308) als Kirche, aber sein aus Granitsteinen aufgeführter Chor scheint ursprünglich dem Übergangsstile angehört zu haben (Schlie I, 494 f.). Wie Gnoien es ist, so war wohl auch Basse ursprünglich eine landesherrliche Kirche, wenigstens scheinen die Moltke von Strietfeld, welche später (1541) im Besitz des Patronates sind, 1364 nur das der von ihnen gestifteten Vikarei zu haben. Dieses aber wird wie auch anderwärts die Handhabe geworden sein, das Patronat der Pfarre selbst in ihre Hände zu bringen ( vergl. Blankenhagen).
Damit war nun auch in den drei Ländern Malchin, Kalen und Gnoien dem ersten Bedürfnis nach Kirchen genügt. Fragen wir nun endlich auch hier nach der Größe dieser landesherrlichen Kolonisationskirchspiele, so begegnet uns bei denen, die nicht durch dazwischen geschobene kleinere ritterliche Pfarren verkleinert sind, refp. bei denen die ursprüngliche Zugehörigkeit letzterer zu ihnen urkundlich nachweisbar ist, die altbekannte von ca. 9-12 Ortschaften, so bei Jördensdorf, Belitz, Levin, Schorrentin, Grubenhagen. Aber auch bei den übrigen kommt man auf dieselbe Größe, wenn man die Ortschaften der zwischeneingeschobenen jüngeren Kirchspiele auf sie verteilt. Mit Ausnahme von Polchow, das in Hakenhufen liegt, zeigen alle diese Kirchdörfer auf der Witteschen Karte teils reindeutschen Charakter, teils - in der Minderzahl - schwächere wendische Spuren, so selbst das ausdrücklich als theutonicalis (3987) von dem slavicalis unterschiedene Schorrentin. Es sind offenbar alles deutsche Besetzungsdörfer. Kolonisation und erste Kirchspieleinteilung sind also auch in diesen unter bischöflich kamminscher und - wenigstens bis 1235 - herzoglich pommerscher Herrschaft stehenden Landschaften


|
Seite 42 |




|
unter denselben Verhältnissen und nach denselben Grundsätzen erfolgt wie in den bisher behandelten mecklenburgischen Ländern Ratzeburger und Schweriner Sprengels.
Die Folgezeit brachte in den drei Ländern Malchin, Gnoien und Kalen nur noch zwei landesherrliche Kirchspiele hinzu, die von Walkendorf und Neu - Kalen. Ersteres erweist sich durch seine geringe Größe sowie dadurch, daß es seiner Lage nach aus dem von Polchow herausgeschnitten erscheint, deutlich als jüngeren Datums; 1273 (1282) ist es jedoch auch bereits vorhanden und geht sein Patronat in den Besitz von Dargun über. Letzteres ist das rein städtische des 1281 gegründeten Neu=Kalen. Obgleich es selbstverständlich mit der Stadt zugleich errichtet ward, findet sich die erste urkundliche Erwähnung der Kirche doch erst 1318 (4007), ein Beispiel, wie sehr bei den urkundlichen Nachrichten der Zufall mitspielt.
Zahlreicher ist der Nachwuchs an ritterlichen und klösterlichen Pfarren, und zwar vor allem im Lande Malchin und Hart. Hier ist das Pfarrnetz durch die vielen Nachgründungen schließlich so engmaschig geworden, wie wir es bisher noch nicht getroffen haben. Die ca. 1240 (1292) unter dem Patronate des Domkapitels Güstrow errichtete Pfarre von Papenhagen (jetzt Rambow) und die 1247 (589) von Malchin abgezweigte von Basedow sind schon genannt. Sie mögen den Unfang gemacht haben. Dann folgt am Südende des Malchiner Sees Dahmen, dessen Kirche - an urkundlichen Nachrichten fehlt es leider - auf der Grenze des Übergangsstiles zum gotischen stehend, um das Jahr 1300 gebaut sein muß (Schlie V, 139). Im Jahre 1247 bestand sie noch nicht, da das dorthin eingepfarrte Sagel damals zu Basedow gelegt ward (589). Dasselbe gilt von Demzin a. d. Peene, da 1247 die beiden Liepen ebenfalls noch nach Basedow gehörten. Es hat seine Kirche zwischen 1310 und 1344 durch Dargun erhalten. In ersterem Jahre erwarb das Kloster "plenam proprietatem totius ville Demecyn" von den Werleschen Fürsten (3383). Aus der Hand des Klosters ging es dann in die der von Flotow über und 1344 belehnt Johann v. Werle diese mit Demecin "totaliter exceptis mansis plebani" (6401). Inzwischen ist also die Kirche erstanden. Sie ist nach dem dreißigjährigen Kriege eingegangen und das Kirchspiel mit Rittermannshagen vereinigt (Schlie V, 146). Ebenfalls eine Darguner Gründung ist die Kirche von Gielow; 1228 hatte Jenike von Verchen den Ort dem Kloster geschenkt und dieses ihn dann kirchlich mit seinem anstoßenden pommerschen Besitz um Duckow verbunden, wo das Kloster nach


|
Seite 43 |




|
1232 eine Kirche errichtet hatte (401, 1578), ebenso das zwischen 1253 (721) und 1281 (1578) vom Kloster gelegte Dörfchen Mucelitz, welches 1247 zum Malchiner Kirchspiel gehört hatte (589), und das Dorf Benitz. Noch 1307 ist Gielow ohne Kirche. Bald darauf aber muß es seine frühgotische Kirche erhalten haben (Schlie V, 14), doch blieb sie bis 1766 Filiale von Duckow.
Auf der anderen Seite des Malchiner Sees an der Grenze des Landes Tribeden entstand noch das kleine ritterschaftliche Kirchspiel Hohen=Demzin. - Seine Kirche entstammt der gotischen Zeit (Schlie V, 79 ff.). Nachrichten fehlen jedoch gänzlich. =Bristow ist erst eine Gründung der Reformationszeit.
Drei weitere kleine ritterschaftliche Pfarren erstanden im Lande Hart zu Panstorf, Gorschendorf und Retzow - letzteres nach der Witteschen Karte ein wendisches Kossatendorf. Leider sind die Verhältnisse sehr unklar. Die ersteren beiden erscheinen urkundlich zuerst 1366 (9449, 9500) als bestehend. Die Kirche von Panstorf gehört der gotischen Zeit an (Schlie V, 117 f.). Über die von Retzow fehlt es ganz an mittelalterlichen Nachrichten. Jetzt ist sie Filiale von Gorschendorf, doch war sie einst selbständig, da sie nicht nur mit 4 Hufen dotiert war und auch eine Küsterei besaß, sondern wenigstens in den 60 er Jahren des 16. Jahrhunderts auch eigene Pastoren hatte, die allerdings, da es keine Wedem mehr gab, bei den Bauern einliegen mußten. Das Patronat hatten 1585 die von Levetzow, obgleich sie den Ort nicht besaßen, sondern die von Hahn, denen auch das Nachbardorf Remplin gehörte. In Gorschendorf haftete 1635 das Patronat am Gut, 1585 wird es als landesherrlich bezeichnet, fehlt aber 1534 unter den landesherrlichen Patronaten (Visit.) Im späteren Mittelalter waren beide mit der Pfarre von Malchin verbunden, aber auch Gorschendorf hatte zwischen 1567 und 1587 wieder seinen eigenen Pfarrer (vergl. Schlie V, 112 f., Schliemann: "Zur Geschichte der Gorschendorfer Pfarre" im Archiv für Landeskunde XI, 270 - 284; 609 - 624). Auch der Umfang dieser drei kleinen Kirchspiele ist undeutlich. Wendischhagen zwar kann nur zu Panstorf gehört haben, aber von Remplin muß es ungewiß bleiben, ob es auch hierhin oder zu Retzow, und von Gülitz, ob es zu diesem oder Gorschendorf gehörte. Wenn endlich Schliemann und ihm folgend Schlie die Kirche von Retzow als die ehemalige Mutterkirche der von Gorschendorf bezeichnen, so ist das lediglich Vermutung ohne jeden positiven Anhalt.
Weit deutlicher liegen die Verhältnisse dieser nachgegründeten kleineren Kirchspiele im Lande Kalen. Hier erstand zunächst zwischen


|
Seite 44 |




|
den beiden alten Pfarren von Polchow und Alt=Kalen die ritterliche von Boddin; 1288 (7221) ward ihre Kirche geweiht, ein charakteristischer Bau des späteren Übergangsstiles (Schlie I, 511). Dann folgte das kleine, nur drei Dörfer umfassende Kirchspiel Levitzow , von Jördensdorf im Jahre 1304 (2930, 2936, 3027) abgezweigt, auch dieses noch mit einer kleinen Kirche des Übergangsstiles. Ihr Gründer ist Johann von Levetzow, der zugleich in ihr noch eine Vikarei errichtet. Das Patronat der Kirche erhielt Dargun, hatte aber dagegen den Jördensdorfer Pfarrer für den Verlust der 3 Dörfer mit jährlich 5 M. zu entschädigen. Auf Levitzow folgt Schlakendorf. Hier errichtete Dietrich Moltke 1305 (3007) für seine beiden Dörfer Schlakendorf und Karnitz eine Kirche und Pfarre und dotierte sie mit 2 Hufen und Kornhebungen. Auch für den Küster ward gesorgt, er erhielt 1 Morgen Land, jährlich 8 Schilling und von jeder Hufe einen Scheffel Solange der gegenwärtige Pfarrer der Mutterkirche Schorrentin lebt, soll er auch die Verwaltung der von Schlakendorf haben. Nach seinem Tode aber soll diese einen eigenen Pfarrer erhalten, der der Mutterkirche aber mit 3 M. jährlich aus Trebelin entschädigt werden. Wenige Jahre später, 1309, errichtete Dargun in Brudersdorf eine neue Pfarre (3298). Eine Filialkapelle von Röcknitz hatte hier schon bestanden; jetzt ward sie als selbstständige Pfarre ausgestattet und die beiden bisher nach Levin eingepfarrten Dörfer Darbein und Bralin zu ihr gelegt. Zu Röcknitz ward, um es für den Verlust von Brudersdorf zu entschädigen, Cantim (Lehnenhof) gelegt und dem Pfarrer von Levin der Verlust dieser 3 Dörfer mit jährlich 8 M. vergütet, die ihm der Pleban von Brudersdorf zu zahlen hatte, jedoch nur ad dies vitae. Endlich erscheint 1541 (Visit.) im nördlichen Teil des jetzigen Boddiner Kirchspiels als selbständige Kirche die von Dölitz. An mittelalterlichen Nachrichten über sie fehlt es jedoch. Weitere Dörfer scheinen nicht zu ihr gehört zu haben.
Im Lande Gnoien errichteten die dort begüterten von Haken=städt und Musteke um 1250 eine Pfarre in Methling (1167) - ihr Kirchspiel umfaßt nur 3 Dörfer, die bis dahin wohl zur Kirche von Gnoien gehört hatten - , und wurden in dem der Kirche von Basse reichlich entlegenen Strich an der Recknitzniederung die beiden ritterlichen Pfarren von Vilz und Thelkow errichtet. Die Kirche der ersteren ward 1288 geweiht (Schlie I, 406 und dazu M. Jbb. 72, 252). Die letztere wird zwar erst 1370 (10105) urkundlich erwähnt, aber ihr Übergangsbau läßt sie als mit der von Vilz gleichzeitig erscheinen (Schlie I, 411 f.).


|
Seite 45 |




|
Auf das deutlichste tritt es auch hier wieder hervor, daß die Gründung selbständiger Pfarren mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts vorbei ist, denn Wasdow, das erst 1375 seine Kapelle erhielt (Schlie I, 507; M. U.=B. 10676), war bis zur Reformation Filialkapelle von Gnoien und hat erst dann durch Curd Hobe einen eigenen Prediger bekommen, den dieser, da die Kapelle nicht danach dotiert war, aus eigenen Mitteln erhalten mußte.
Sehr viel undeutlicher liegen die Dinge in dem noch übrig bleibenden Teile Circipaniens, dem Lande Tribede, über das der Güstrower Dompropst die Archidiakonatsrechte ausübte. Schon insofern steht es einzig da, als hier alle Kirchspiele, große und kleine, bis auf die 4, Badendiek, welches das Domkapitel von Güstrow auf seinen Gütern errichtete, und Kussow , das ebenfalls unter dem Patronat des Domkapitels stand, Kirch=Rosin, das dem Kloster Michaelstein gehörte, und die ritterliche Kirche von Bellin, landesherrlichen Patronats sind: Teterow (1552 vgl. mit 2295), Gr.=Wokern (Visit.=Prot. von 1534 und M. U.=B. 2792; hier hat sich Schlie V, 45 verlesen), Klaber (2864), Serrahn (Schlie IV, 335), Dobbin (Visit. 1534), Krakow (Visit. 1534), Sammit (Visit. 1534), Kirch - Kogel (Schlie V, 357, Anm. 2), Zehna (2113), Lüdershagen (Visit. 1534), Lübsee (Visit. 1534), Reinshagen (Schlie IV, 299), Wattmannshagen (Visit. 1534), Warnkenhagen (Visit. 1534), Thürkow (Visit. 1534). 1 ) Urkundlich sind für das 13. Jahrhundert nur 4 von ihnen bezeugt, Teterow für 1294 (2295), Zehna für 1291 (2113), Lüdershagen für 1288 (1964) und Wattmannshagen für 1279 (1490 f.), 4 für den Beginn des 14. Jahrhunderts: Wokern für 1302 (2792), Klaber für 1303 (2864), Krakow für 1305 (3072) und Reinshagen für 1319 (4125), die übrigen garnicht im Mittelalter; ein sehr geringes Ergebnis. Aber was hier fehlt, das bringt zum Teil wenigstens der Baubefund wieder ein. Die 9 landesherrlichen Kirchen Teterow, Wokern, Klaber, Serrahn, Krakow, Kirch=Kogel, Zehna, Lüdershagen, Wattmannshagen, dazu die von Bellin und Kirch=Rosin, haben Bauten des Übergangsstiles, gehören also dem 13. Jahrhundert an, die frühgotischen von Reinshagen, Warnkenhagen, Dobbin und Badendiek dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts. Nur die von Thürkow


|
Seite 46 |




|
und Alt=Sammit scheinen mir trotz Schlie, der sie als frühgotisch resp. wohl noch dem 13. Jahrhundert angehörig bezeichnet, nicht sicher so früh angesetzt werden zu können, ebenso die von Lübsee; sie sind vielleicht erst spätmittelalterlich (cf. Schlie IV und V unter den Orten).
Näheres über die Entwickelung des Pfarrsystems läßt sich nur mit der größten Reserve vermuten. Außer Güstrow, wo 1226 eine Kirche erbaut wurde, scheinen trotz ihrer späten Erwähnung Krakow und Teterow die ältesten Kirchorte zu sein, wie sie denn in der Nähe der wendischen Hauptburgen des Landes liegen. Für die Kirche von Krakow geht ihr höheres Alter daraus hervor, daß Chor und Schiff zwei verschiedenen Stufen des Übergangsstiles angehören, so zwar, daß der große Chor der jüngere Teil ist und offenbar an die Stelle eines kleineren älteren getreten, nachdem das Dorf zum oppidum geworden war (cf. Schlie IV, 318 f.). Für Teterow läßt es sich aus der Gestalt seines Kirchspiels vermuten, welches das von Groß=Wokern von zwei Seiten umschließt und daher wohl als das ältere anzusehen ist. Nun erscheint aber die Kirche von Wokern mit ihrem noch ohne jede Anwendung von Ziegeln erbauten Chor und ihrem rundbogigen Portal als die älteste in weitem Umkreise und wird kaum später als 1250 angesetzt werden dürfen, wahrscheinlich aber schon um einiges früher (Schlie V, 46 f.). Ihre Begründer aber waren die mecklenburgischen Fürsten (2792) 1 ). Bedenkt man nun, daß während der eigentlichen Kolonisationszeit steinerne Kirchen gemeiniglich erst nach Verlauf von 2-3 Jahrzehnten an die Stelle der hölzernen Erstlingsbauten traten, so ist die Errichtung der Wokernschen Pfarre in der allerersten Zeit nach der mecklenburgischen Besitzergreifung, d. h. nach 1226, erfolgt und mag daher die von Teterow in der Tat schon der pommerschen Zeit angehören, dann aber vielleicht auch die von Krakow. Steht aber für die Wokernsche Kirche die Gründungszeit, bald nach 1226, fest, so werden wir das Jahrzehnt von 1226 - 36 als die Zeit anzusehen haben, in welcher mit der Einwanderung ein erstes Pfarrsystem entstand.
Betrachten wir nun, um wenigstens vermutungsweise noch ein wenig weiter zu kommen, Lagerung und Größenverhältnisse der Kirchspiele, so zeigt sich, daß dieselbe ebenfalls durchaus nicht mehr so klar ist wie in den Ländern, von denen wir herkommen. Die


|
Seite 47 |




|
Kirchspiele, auch die landesherrlichen, sind größtenteils kleiner als wir es gewohnt sind. Doch zeigen sich auch hier noch solche von derselben oder doch annähernd derselben Größe, wie die wohlbekannten landesherrlichen Kolonisationskirchspiele. Aber sie liegen nicht so planmäßig über das Land verteilt, daß man aus ihnen ein anfängliches Parochialsystem von solchen rekonstruieren könnte. Es sind dies, außer Teterow, Serrahn und die 4 Hagenpfarren Lüdershagen, Reinshagen, Wattmannshagen und Warnkenhagen; auch Kirch=Kogel mit seinen 7 Ortschaften mag noch dazu gerechnet werden. Alle übrigen sind kleiner und zählen zum Teil nur 1-2 Ortschaften; selbst Wokern, dessen Pfarre, wie oben gezeigt, wohl bald nach 1226 errichtet ist, umfaßt wenigstens am Ende der Entwickelung nur noch 2 Dörfer. Danach hat es den Anschein, als ob hier, wo die Kolonisation und mit ihr die erste Kirchspieleinteilung etwas später einsetzte, bereits von Anfang an neben den größeren auch kleinere Kirchspiele errichtet worden sind, das hergebrachte Prinzip der Einteilung in größere Kirchspiele nicht mehr vollständig durchgeführt ward, indem ein neues, auf reichlichere Versorgung ausgehendes Prinzip dazwischen kam oder doch einsetzte, ehe die kirchlichen Verhältnisse sich mit der Kolonisation konsolidiert hatten. Jedenfalls aber werden wir jene größeren Pfarren Serrahn und Kirch=Kogel neben Teterow, Krakow und Güstrow als die ältesten ansehen dürfen, als ein wenig jünger dann die großen Hagenpfarren.
Ganz singulär wäre es dabei, wenn Kirch=Kogel, wie noch Schlie (IV, 388) annimmt, Wendisch=Kogel, die Kirche also nicht in dem deutschen Dorfe, sondern in dem wendischen errichtet wäre, allein ein von Grotefend (M. Jbb. 68, 253) angezogenes Heberegister von 1445 zeigt, daß Kirch=Kogel und Wendisch=Kogel zu unterscheiden sind, und letzteres wohl in Rum=Kogel zu suchen ist. Es ist also auch hier das deutsche Dorf, welches die Kirche erhielt. Etwas später als die genannten Kirchen werden dann, wie gesagt, die vier Hagenpfarren errichtet sein, Lüdershagen mit seiner trefflichen alten Übergangskirche (Schlie IV, 328), Wattmannshagen, wo noch der Chor dem Übergang angehört, Schiff und Turm aber schon dem gotischen Stil, endlich Reinshagen und Warnkenhagen mit ihren frühgotischen Kirchen, die drei letzteren umfangreiche Kirchspiele von 8 - 12 Ortschaften. Aber auch hier liegen die Dinge nicht ganz klar. Die Kirche von Wattmannshagen wird zuerst 1279 in der Urkunde 1490 erwähnt. Drei Gebrüder von Ketelhot schenken "dotantes ecclesiam parrochialem in Wademeshagen" derselben 3 Hufen und


|
Seite 48 |




|
8 Katen des Dorfes. Es kann sich hier kaum um etwas anderes handeln als um die Dotierung der Pfarre bei ihrer Errichtung, denn erstens sind 3 Hufen und 8 Katen eine vollständige Pfarrausstattung, und zweitens geschieht die Schenkung ohne jede dem Pfarrer auferlegte besondere Gegenleistung, wie Seelenmessen u. dergl.; ja am selben Tage (1491) schenkt der eine der drei Gebrüder noch eine Hufe in Raden für Seelenmessen dazu. Die Pfarre wird also erst 1279 gegründet sein, und zwar in schon länger kolonisierter Gegend. Denn jene Seelenmessen sollen für eine Reihe namentlich genannter, schon verstorbener Verwandter der Brüder Ketelhot gelesen werden. Wenn nun unter diesen als erster ein Fredebern begegnet und der Nachbarort von Wattmannshagen den Namen Friedrichshagen trägt (1541 Visit. noch "Vredershagen"), so haben wir in diesem Fredebern von Ketelhot unzweifelhaft den Gründer von Friedrichshagen, und ist die Waldkolonisation dieser Gegend schon eine Generation vor der 1279 lebenden erfolgt. Dann aber muß für die kirchliche Versorgung derselben, die überdies unter ihren ca. 30 Ortschaften 16 wendischen Namens zählt, also auch vorher nicht unbevölkert war, ebenfalls um eine Generation früher etwas geschehen sein, denn daß sie bis dahin von Güstrow, Serrahn und Wokern aus stattgefunden habe, schließen die allzugroßen Entfernungen aus. Man wird also annehmen müssen, daß von den drei Kirchen Reinshagen, Warnkenhagen und Wattmannshagen, die baulich älteste, Wattmannshagen, in Wirklichkeit die jüngste ist, ihr Chor zugleich mit der Pfarrgründung um 1279 errichtet und ihr ein Kirchspiel aus Teilen der älteren Pfarren Wokern, Reinshagen und Warnkenhagen gegeben ward, daß letztere beiden aber erst später ihre anfänglichen Holzbauten durch die staatlichen frühgotischen Kirchen ersetzten, die sie jetzt aufweisen. Wir würden also die Errichtung der drei älteren Hagenpfarren Lüdershagen, Reinshagen und Warnkenhagen etwa in das vierte oder fünfte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts zu setzen haben.
Der weiteren Entwickelung, zum Teil vielleicht aber auch schon derselben Zeit, würden dann die kleineren landesherrlichen Kirchspiele zuzuweisen sein, mit Sicherheit Klaber, das ja 1303 (2864) seine Pfarre hat und dessen Kirchengebäude sich deutlich als der letzten Zeit des Überganges angehörig und nur für ein kleines Kirchspiel berechnet charakterisiert (Schlie V, 49). Man kann geradezu sagen, einfach rechteckig mit zwei Kreuzgewölben geschlossen wie es ist, ist es typisch für diese kleineren nachgegründeten Kirchspiele (cf. Witzin). Für Thürkow und


|
Seite 49 |




|
Lübsee muß dieser Ansatz allerdings Vermutung bleiben und ebenso für Sammit, von welchem es übrigens nicht ganz sicher ist, ob es eigene Pfarre war oder nur Filiale von Krakow. Im Visitationsprotokoll von 1534 hat es zwar den Anschein, als ob es eigentlich selbständig ist, aber der Pfarrer von Krakow verwaltet es. Von den nicht landesherrlichen Pfarren wird Bellin durch seine hübsche alte Übergangskirche wohl schon in die Mitte des 13. Jahrhunderts hinaufgerückt. Die Kirche von Badendiek war 1238 (485) noch nicht da, denn ihr Ort war noch nicht vorhanden; 1273 (1292) ist er da, eine Gründung des Güstrower Domkapitels, das denn auch die Kirche errichtete. Ihr Kirchspiel umfaßt nur dem Dom gehörige Ortschaften, ist also vom alten Dom=Kirchspiel abgenommen, vermutlich doch mit der Gründung des Ortes zugleich, also vor 1273. An Badendiek mag sich Kussow, jetzt zum Kirchspiel Reinshagen gehörig, anschließen, wo nach dem Visitationsprotokoll von 1541 eine eigene Pfarre bestand, deren Patronat das Güstrower Domkapitel hatte. Mittelalterliche Nachrichten über den Ort fehlen. Da aber das angrenzende Dehmen zur Ausstattung des Güstrower Domkapitels gehörte (323), wird Kussow vermutlich ebenfalls Besitz desselben gewesen sein, das hier für diese beiden Dörfer die Kirche errichtete. Endlich Kirch=Rosin. Der Ort lag 1229 (369), als die Fürsten ihn dem Kloster Michaelstein schenkten, wüst. Das Kloster besetzte ihn neu und baute dort die Kirche, die es durch einen Mönch seines Konventes verwalten ließ (M. Jbb. 12, 329, 332). Da sie dem Übergangsstil angehört, so ist auch sie noch eine Gründung des 13. Jahrhunderts.
Während Circipanien um 1236 in mecklenburgischen Besitz überging, verblieben die beiden kleinen Länder Tüzen und Gädebehn, d. h. das Gebiet der späteren Vogtei Stavenhagen einschließlich der pommerschen Enklave Zettemin=Duckow, noch unter pommerscher Herrschaft. Erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts erhoben die mecklenburgischen Fürsten - man weiß nicht auf Grund wovon - Pfandansprüche auf dieselben, und 1317 werden die beiden Länder an sie abgetreten. Kolonisation und kirchliche Versorgung haben hier also noch unter pommerscher Herrschaft stattgefunden. Der ersteren ward das Land etwa um die Mitte des dritten Jahrzehntes des 13. Jahrhunderts geöffnet, wenn man die Verleihung der Einöden Gülzow und Scharpzow


|
Seite 50 |




|


|
Seite 51 |




|
mit 691) außer Ivenack selbst noch 8 Dörfer, d. h. die beiden jetzigen Kirchspiele von Ivenack und Ritzerow, 1 ) und als neuntes wird ursprünglich - bis es Stadt wurde auch Stavenhagen dazu gehört haben, denn dort saßen die von Stove, die das Patronat über die Kirche von Basepohl hatten und auch dieses selbst wie auch Ivenack besaßen (691). Wir haben hier also ein richtiges Kolonisations=Kirchspiel, nur ist es nicht landesherrlichen, sondern ritterlichen Patronats, wie denn die Kolonisation des Landes so gut wie ganz nicht als Werk des Landesherrn, sondern des einwandernden deutschen Adels erscheint, der von Stove, Voß, Wachholz, Heydbrack usw. Es ist das erste urkundlich bezeugte des Landes; 1252 (691) ist es bereits vorhanden. Reinbern von Stove verlieh seine Kirche und das Patronat dem von ihm gegründeten Nonnenkloster Ivenack; später zerfiel es in mehrere kleinere Kirchspiele. Da im Jahre 1256 (762) Stavenhagen nicht mehr zum Kirchspiel gehört, so wird es eben zur Stadt erhoben worden sein und gleichzeitig sein ursprünglich rein städtisches Kirchspiel erhalten haben. Das jetzige Kirchspiel Stavenhagen ist nämlich aus den 5 früheren Kirchspielen Stavenhagen, Gülzow mit Scharpzow, Ritzerow, Jürgenstorf mit Pribbenow und Krumsee gebildet, und zwar erst nach der Reformation. Um 1260 (861) ist auch dieses, weil rein städtisch, offenbar schon nachgegründete Kirchspiel da. Älter und mit Basepohl gleichzeitig mögen etwa die Kirchen von Kittendorf und Kastorf sein. Für erstere fehlt es zwar an urkundlichen Nachrichten, aber die treffliche alte Übergangskirche selbst (Schlie V, 203 ff.) zeugt für ihre Erbauung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Das Patronat haben 1541 (Visit.) die Voß, welche seit 1255 als Burgmannen in Stavenhagen sitzen, und denen ursprünglich das ganze Kirchspiel Kittendorf gehört haben wird. Sülten sowie Jürgenstorf und Voßhagen, welche später eine eigene Pfarre bildeten, sind nachweislich in ihrem Besitz gewesen (1013, 1100, 1101 ; Schlie V, 164). Kittendorf selbst allerdings ist 1338 und 1349 (5890, 6934) nicht mehr in ihren Händen, aber das Patronatsrecht über die Kirche erscheint als ein Überbleibsel einstigen Besitzes auch hier, und so mögen sie die Gründer der Kittendorfer Kirche gewesen sein, wie die von Stove der Basepohler. In Kastorf besaß Ivenack um 1280 (1533)


|
Seite 52 |




|
8 Hufen und das Patronatsrecht über die Kirche mit ihren beiden Filialkapellen zu Rosenow und Galenbeck (1666). Schwerlich ist das Kloster als Begründer derselben anzusehen, weit eher die von Heydbrack. Von jenen 8 Hufen erscheinen nämlich 4 als Dos der Pfarre (1666), während die 4 übrigen der Ritter Johann von Heydbrack und seine Frau auf Lebenszeit als Lehen in Nießnutz vom Kloster hat. Sicherlich handelt es sich hier wie in hundert anderen Fällen um eine Schenkung an das Kloster, deren Nießnutz sich die Geber auf Lebenszeit vorbehalten hatten. Dann aber wird auch das Patronat der Kirche mit den anderen 4 Hufen als Schenkung der Heydbrack anzusehen sein. Das Bestehen zweier Filialkapellen neben der Hauptkirche in dem doch nur kleineren Kirchspiel schon um 1283 weist aber darauf hin, daß die letztere schon längere Zeit bestand, und daß die Errichtung von Kirchen damals schon sehr weit vorgeschritten sein mußte.
So mögen denn neben Tüzen wenigstens Basepohl, Kittendorf und Kastorf um 1250 ihre Kirchen gehabt haben, und um 1255 Stavenhagen als fünfte dazugekommen sein. Die Basepohler Pfarre ward nach Gründung des Klosters Ivenack dorthin verlegt, die Kirche von Basepohl aber von derselben getrennt; 1275 belehnte Bischof Hermann von Kammin den Ritter H. v. Metzkow mit dem Patronat derselben (1357), und noch bis 1638 hatte sie ihren eigenen Pfarrer. Dann erst ward sie wieder mit Ivenack vereinigt (Schlie V, 177).
Inzwischen aber war auch Dargun auf seinem Besitz an der Westgrenze kirchengründend vorgegangen. Im Jahre 1226 (330) hatte es von Wartislav das Dorf Pinnow mit der Einöde Gützow, 1229 (373) das benachbarte Duckow mit der Einöde Scharpzow erworben; unmittelbar daran stieß jenseits der Peene das 1228 von Jenike von Verchen dem Kloster geschenkte Gielow und Beniz (355). Das Kloster hatte den neuen Besitz sofort energisch angefaßt. Schon 1235 (443) ist Gülzow wieder aufgebaut und mit Kolonisten besetzt, 1248 (604) ist auch Scharpzow neu besetzt und 1253 (721) begegnet der in Gielow errichtete Klosterhof (curia) zum erstenmal. Für diesen gesamten Besitz ward dann in Duckow eine Kirche errichtet; 1232 (401) ist sie noch nicht vorhanden, wohl aber 1281 (1578). Als eigene Gründung Darguns steht sie auch unter dem Banne des Klosters (1629). Bald darauf, 1293 (2246) erhielt sie eine Filialkapelle in Gü1zow, die dann 1307 (3166) zu einer eigenen Pfarre erhoben ward, sodaß nun zwei Kirchspiele: Duckow mit Beniz und Gielow, und Gülzow mit Scharpzow und Pinnow bestanden, von denen letzteres in Scharpzow


|
Seite 53 |




|
schon eine Filialkapelle besaß, die 1303 (2892) vom Kloster errichtet war, und ersteres bald darauf in Gielow ebenfalls eine erhalten sollte.
Unterdes waren jedoch die Erwerbungen Darguns weitergegangen; 1249 (622, 632) hatte es von Reinbern und Raven (v. Wachholz ?) das an Pinnow grenzende Rathenow (Rottmannshagen) erworben; 1262 (945) ward es im Auftrag des Klosters durch den Ritter Joh. v. Wachholz mit deutschen Kolonisten besetzt, der dafür jede dritte Hufe als Lehn erhielt. Zwei Jahre vorher hatte Dargun schon das westlich angrenzende Pribbenow (861, 862) und gleich darauf das südlich an Rathenow grenzende Zettemin mit dem Rüzenwerder (Rüzenfelde) erworben (908, 1162, 1392, 1393). Von einer Kirche ist nicht die Rede, auch 1282 (1629) noch nicht, aber 1327 (4802) erscheint der Pleban Thymmo von Zettemin und 1332 (5298) wird die Parochie erwähnt. Da nun die ganze Parochie aus den Händen der von Wachholz erworben ward (632, 945, 3199, 5298), so ist es nicht ausgeschlossen, daß diese auch die Gründer der Kirche sind, zumal es an Beweisen dafür fehlt, daß sie später dem Banne des Klosters unterstand. Jedenfalls aber ist das stattliche, dem jüngsten Übergangsstil angehörige Gebäude der Kirche ein Werk Darguns und offenbar von demselben Baumeister erbaut, der die Duckower Kirche errichtet hat (Baudenkmäler d. Prov. Pommern II 1, 18 f. u. 81 ff.).
Wohl von Kittendorf abgezweigt und ebenfalls Voßischen Patronates (Visit. 1541) entstand weiter das Kirchspiel Jürgenstorf. An Nachrichten fehlt es gänzlich, aber der noch stehende Unterbau des alten Turmes der Kirche ist "gotisch aus dem 14. Jahrhundert" (Schlie V, 166). Noch weniger wissen wir über die von Ivenack abgezweigten beiden kleinen Pfarren klösterlichen Patronates Ritzerow und Grieschow; 1276 gehörten beide noch zum Ivenacker Kirchspiel (762). Grieschow war im Besitz des Klosters, Ritzerow nicht, sondern gehörte den Landesherrn; 1 ) beide Pfarren waren 1542 vereint, der Pfarrer wohnte in Ritzerow; 1603 dagegen ist letzteres mit Stavenhagen vereint, ersteres wieder zu Ivenack zurückgekehrt (Schlie V, 158). Auch das jetzt zu Ivenack gehörige Krummsee hatte im Mittelalter eine Kirche, die im 16. Jahrhundert Filiale von Jürgenstorf war (Schlie V, 158), vielleicht aber einst selbständig gewesen ist. Ebensowenig wissen wir über die ebenfalls dem Kloster gehörige Kirche zu Fahrenholz , das 1272 (1241) in den Besitz Darguns übergegangen war. Seit 1750 ist die Pfarre


|
Seite 54 |




|
von dort nach Borgfeld verlegt. Auf dem Gebiet der alten Pfarre Tüzen war von den von Schönfeld wohl schon vor 1266 die Kirche in Zwiedorf gegründet worden. Von 1266 ab (7183) erwarb Kloster Reinfeld schrittweise das Dorf von den Schönfelds, endlich 1293 (7333) auch das Patronat der Kirche, die also nicht eine bloße Filialkapelle, sondern selbständig war. Die kleine Kirche gehört dem späteren Übergangsstile wohl erst zu Anfang des 14. Jahrhunderts an (Schlie V, 192). Nicht viel später hat das benachbarte Röckwitz seine frühgotische Kirche erhalten (Schlie V, 189 f.). An urkundlichen Nachrichten fehlt es; 1579 war sie wie die von Zwiedorf mit dem benachbarten pommerschen Tützpatz vereinigt (Schlie V, 188). Endlich scheint auch die landesherrliche Burg und Flecken Wolde eine selbständige Kirche gehabt zu haben, da sie erst seit 1575 (Schlie V, 188) mit Röckwitz verbunden ist und noch heute als mater vagans gilt. Mittelalterliche Nachrichten fehlen leider ganz. So sind es nicht weniger als 17 Kirchspiele, welche das kleine Land Tüzen schließlich aufwies, die meist nur je 2-3 Ortschaften umfaßten, niemals aber die Zahl 4 überstiegen.
Ganz ähnlich liegen die Dinge in dem östlichen Nachbarländchen Gädebehn. Hier ist die Pfarre von Möllen die einzige landesherrliche (1534 Visit.). Mitten im Lande gelegen, dazu in einem wendischen Hakenhufendorf (Wittesche Karte) errichtet, hat sie die Vermutung für sich, die älteste und nicht erst im Gefolge der Kolonisationsbewegung errichtet zu sein. Aber an Urkunden fehlt es. Die gotische Kirche wird von Schlie (V,276) um1300 angesetzt, sicherlich wenigsten um etwas zu früh. Sie ist also schwerlich die erste an ihrer Stelle. Gädebehn selbst hatte 1326 ( 4783 ) eine eigene Pfarre, aber, wie es scheint schon damals Voßischen Patronates (4783 und dazu Schlie V, 272). Sie ist im dreißigjährigen Kriege untergegangen (a. a. O. S. 275 Anmerk. 2) und mit Möllen vereinigt. Auch Klein=Helle, jetzt Filiale von Möllen, scheint einst selbständig gewesen zu sein (a. a. O. S. 272), da es zwar 1534 mit Möllen, am Ende des 16. Jahrhunderts jedoch mit Gädebehn vereint war, also kein festes Filialverhältnis hatte. Deutlicher sieht man bei Kleeth , dessen Kirche mit ihrer Filialkapelle in Tarnow 1273 (1300) von den von Dargatz gegründet oder wohl nur zu einer eigenen Pfarre erhoben ward. Das Patronat ging bald darauf von den Dargatz an das Kloster Reinfeld über (2065, 2139, 2640, 3538). Auch sie ist im dreißigjährigen Kriege untergegangen und mit Möllen vereint. Weiter erscheint Briggow 1551 (Schlie V, 253) als Filiale von Groß=Helle, aber durch das schwerinsche Kirchspiel


|
Seite 55 |




|
Luplow und das kamminsche Kleeth von letzterem völlig getrennt, kann dies schwerlich das ursprüngliche Verhältnis sein und muß auch Briggow als einstmals selbständig angesehen werden. Groß=Helle selbst ist 1363 (9190) Pfarrdorf und hat 1541 (Visit.) eine Filiale in Schwandt (Schlie V, 253). Doch wird auch diese als mater vagans bezeichnet und nach der Urkunde über die Stiftung der Pfarre von Kleeth von 1273, die hier wie in Tarnow mit einer Hufe dotiert ward, möchte man eher glauben, daß Schwandt ursprünglich dorthin gehört habe.
Mit Groß=Helle stoßen wir an die kammin=havelbergische Sprengelgrenze. Über seine Zugehörigkeit zum Kamminer Sprengel gibt es zwar keine Urkunde, doch darf sie als sicher angenommen werden, da das südlich von ihm gelegene Wrodow sicher kamminisch war (1666). Ob dieses nur Filiale von Groß=Helle oder einst selbständige Kirche war? Vermutlich doch letzteres, da es nach der Reformation mit Penzlin vereint ward.
Suchen wir nun hier, ehe wir weitergehen, die Sprengelgrenze festzustellen, so sind also Gr.=Helle und Wrodow kamminisch, ebenso Gevetzin (3609, 3643) und demnach auch seine Filiale (Schlie V, 282) Passentin. Die Grenze wird der aus dem Wrodower See fließende Bach gebildet haben. Dem entspricht denn auch, daß die angrenzende Pfarre Chemnitz ebenfalls nach Kammin gehört (3004), ebenso Breesen mit seiner Filiale Pinnow (1666) und Woggersin (1489: Calübbe gehört zum Kirchspiel Woggersin). 1 ) Dagegen springt Havelberg mit Zierzow (70610) über den Bach in das Kamminische vor. Ebenso ist das Kirchspiel Penzlin wie das ganze Land havelbergisch (1327), und dementsprechend sind es auch die Kirchspiele von Gr.=Flotow, Gr.=Lukow, Mallin, Wulkenzin und Weitin, obgleich es sich urkundlich für Gr.=Flotow nicht nachweisen läßt.
Kehren wir zu den Kirchspielen des Landes Gädebehn zurück, so ist das nächste, Gevezin, jetzt Filiale von Wulkenzin, 1311 (3498, 3609, 3643) als selbständige Pfarre kamminschen Sprengels vorhanden, und 1305 (3004) ward die Kirche von Chemnitz geweiht und ausgestattet, vermutlich eine Stiftung der dort als Lehnsmänner Brodas angesessenen Kruse, von denen das Patronat später an das Kloster kam (Schlie V, 265). Die kleine, noch dem Übergangsstil angehörige Kirche (a. a. O. 266) ist ein weiterer Beweis dafür, daß man um 1300 in diesen östlichen Gegenden


|
Seite 56 |




|
noch allgemein im Übergangsstil baute. Über die Nachbarpfarre Breesen läßt sich nichts sagen, als daß das Patronat zwar 1534 landesherrlich ist, aber vermutlich erst nach 1491 durch Rückfall des Dorfes bei dem Aussterben der von Parsenow (Schlie V, 260) an die Herzoge gekommen ist. Die letzte Pfarre endlich, Woggersin, ist 1346 (6708) vorhanden und hat sogar neben dem Pfarrer noch einen Vikar.
Damit sind wir am Ende; wie man sieht, auf dem engen Raume dieses kleinen Ländchens ein Gewirr von 10 - 11 selbständigen Pfarren, bis auf Möllen alle ritterlich, meist nur mit dürftigen Fachwerkkirchen versehen, ohne ausreichende Doten. Die Entwickelung bleibt undurchsichtig. Nur das läßt sich auch hier konstatieren, daß, soweit die Nachrichten reichen, die letzte Pfarre im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts gegründet ist.
Überblicken wir nun den gesamten kamminschen Teil Mecklenburgs, dessen kirchliche Entwickelung wir verfolgt haben, so zeigt sich in ihm, von Westen nach Osten - dem Gange der Kolonisation folgend - vorschreitend, ein immer deutlicher werdender Unterschied. In denjenigen Ländern, deren Kolonisation am frühsten begonnen hat, Gnoien und Kalen, um 1210, finden wir noch durchweg die alten großen landesherrlichen Kolonisations=Kirchspiele, und neben ihnen, zur Ergänzung der klaffendsten Lücken, nur wenige kleinere ritterliche Pfarren. Anders schon im Lande Malchin und Hart. Auch hier zeigen sich noch deutlich jene landesherrlichen Kolonisations=Kirchspiele, aber neben ihnen eine ungleich reichere Entwickelung jener kleineren nachgegründeten ritterlichen Pfarren. Auf 5 jener größeren (inkl. Malchin) kommen 10 der letzteren. Ganz ähnlich liegt es, wie wir sahen, im Lande Tribede, das um 1226 der Einwanderung geöffnet ward. Um dieselbe Zeit, 1226, beginnt diese auch im Lande Tüzen, das ebenfalls noch Spuren der älteren großen Kirchspiele zeigt, aber diese sind hier nicht mehr landesherrlich, sondern schon ritterlich, und sie sind in der Folgezeit gänzlich überwuchert und aufgelöst durch eine Überzahl von kleinen und kleinsten Kirchspielen. Und in dem östlichsten dieser Länder, in Gädebehn, das die Einwanderung naturgemäß am letzten erreichte, finden wir nur noch ein Gewirr kleiner ritterlicher Pfarren. Auf das deutlichste treten hier die oben vermuteten beiden Prinzipien der Kirchspielerrichtung hervor, das ältere der landesherrlichen großen und das jüngere, mit dem Eintreten des deutschen Adels in die Kolonisationsarbeit schnell aufkommende der kleinen ritterlichen Kirchspiele, nach dem womöglich jeder adlige Kolonisator für


|
Seite 57 |




|
seinen Besitz eine eigene Pfarre errichtete. Je später die Kolonisation einsetzt, desto mehr überwuchert das letztere. Wie stark der Einfluß dieses neuen Prinzipes in den Ländern der jüngeren Kolonisation war, zeigt deutlich das Verhalten der Abtei Dargun. Während sie es in ihrem alten Gebiete, im Lande Kalen, ruhig bei den großen Kirchspielen beließ - nur Brudersdorf kam hier zu den drei alten Pfarren Röcknitz, Levin und Alt=Kalen hinzu - sah sie sich veranlaßt, auf ihren späteren Erwerbungen im Lande Tüzen nicht weniger als 3 selbständige Kirchspiele von je nur 3 Ortschaften zu errichten.
Wir werden sehen, wie diese hier beobachteten Erscheinungen sich im südlichen Mecklenburg Schweriner und Havelberger Sprengels wiederholen.
4. Das südliche Mecklenburg Schweriner Sprengels.
a) Goldberg und Sternberg=Parchim.
Während der südlich der Elde gelegene Teil Mecklenburgs dem Bistum Schwerin im Laufe des 13. Jahrhunderts verloren ging und an Havelberg kam, verblieben ihm in der südlichen Hälfte des Landes die Länder Sternberg=Parchim (nördlich der Elde), Goldberg, Plau (nördlich der Elde), Malchow und Waren. Wir wenden uns nun der kirchlichen Entwickelung dieser Landstriche zu. Da die frühsten und vollständigsten Nachrichten das kleine, werlesche Land Goldberg betreffen, so mag dieses hier an der Spitze stehen, obgleich dem westöstlichen Zuge der Kolonisation nach das Land Sternberg den Vorrang hätte. Aber die Nachrichten über dieses sind weit lückenhafter und undeutlicher.
Das Land Goldberg umfaßt die jetzigen Kirchspiele Karcheez, Gr.=Upahl, Ruchow, Lohmen, Woserin, Dobbertin, Techentin, Goldberg und Woosten. Bei seiner Gründung im Jahre 1219 verlieh hier Burwy dem Nonnenkloster Sonnenkamp "in villa que dicitur Techentin 20 mansos et stagnum cum adiacente silva"(254). Bald darauf, zwischen 1219 und 1225, gründete er dann auf dem am Ufer des von der Mildenitz durchflossenen großen Sees gelegenen Burgwall Dobbertin ein Mönchskloster Benediktiner Ordens. Dotiert war es mit den 3 Dörfern Dobbertin, Dobbin und Jellen, jedes zu 40 Hufen gerechnet. Die Gegend war offenbar noch nicht mit Deutschen besetzt. Die runden Hufenzahlen beider Schenkungen, die Hinzufügung von Wald zeigen, daß es sich nicht schon um deutsche Dörfer mit abgegrenzter Feldmark handelt, sondern um wendische, deren ge=


|
Seite 58 |




|
ringe hufenlose Feldmarken durch Rodung auf je 40 resp. 20 Hufen ausgedehnt werden sollen. Geschehen ist das jedoch nur bei Dobbertin selbst und auf dem neuklosterschen Besitz (1120), dagegen sind die 40 Hufen bei Jellen bis heute Waldland geblieben - es ist die jetzige Schwinzer Heide =, und auch von den 40 Hufen bei Dobbin blieb das meiste Forst. Dem entspricht, daß nach der Witteschen Karte diese ganze Gegend ungewöhnlich starke wendische Bevölkerungsreste noch im 15. Jahrhundert zeigt. Dobbin liegt in Hakenhufen, Dobbertin selbst, Jellen, Kleesten, Schlowe, Borkow, Lenzen, Garden, Woosten sind wendische Kossatendörfer, Ruchow und Wendisch=Waren zahlen nur Pauschalbede. Mit wenigen Ausnahmen haben alle Ortschaften einen mehr oder minder großen Bruchteil wendischer Bevölkerung. Danach darf man jene beiden Schenkungen von 1219 und aus dem Anfang der 20 er Jahre als den Beginn einer freilich nur mangelhaft durchgeführten Kolonisation ansehen; 1237 (469) begegnen uns denn auch auf dem Dobbiner Gebiet bereits die beiden Hagendörfer Wulframshagen (jetzt Alten - und Nienhagen) und Gerdshagen. Zwischen 1225 und 1226 erwarb das Kloster zu seiner Ausstattung durch weitere Schenkung das Dorf Lohmen sowie Kornhebungen in Goltz, dem späteren Goldberg, hinzu (343). Dann begegnet auch der Propst der Dobbertiner Brüder (344) und 1231 (386) verleiht ihnen Johann von Mecklenburg das Patronat über die Kirche in Goltz. Drei Jahre weiter wird von Brunward dem Kloster, das inzwischen aus einem Mönchs - in ein Nonnenkloster umgewandelt ist, das Archidiakonatsrecht über die Kirchen der Umgegend, nämlich Goltz, Lohmen, Ruchow, Gehtz ( = Karcheez) und Woserin verliehen (425). Auch hier gehen also Kirchengründung und Kolonisation Hand in Hand. Bemerkenswert ist, daß eine derselben, die von Ruchow, in einem Dorfe errichtet ist, das nur eine Pauschalbede zahlte, also damals noch wendisch war (Wittesche Karte). Diese 5 Kirchen sind offenbar außer Dobbertin selbst und vielleicht Techentin alle zu jener Zeit im Lande Goldberg vorhandenen, und wenn wir später hier noch die ritterlichen Pfarren kleinsten Umfanges Groß=Upahl, Zidderich und Woosten zwischen jene von 1234 eingeschoben und ebenfalls zum Dobbertiner Archidiakonat gehörig finden (425, n), so sind diese als spätere Gründungen in Anspruch zu nehmen. Auch dem Baubefunde nach sind die Kirchen in Woserin, Ruchow und Lohmen - in Goldberg wurde später eine größere Stadtkirche gebaut - die ältesten; sie gehören zu den ausgesprochensten Typen des späteren Übergangsstiles (Schlie IV, 379, 164, 383). Da die Kirche von


|
Seite 59 |




|
Goltz, wie erwähnt, urkundlich schon 1231 (386) begegnet, so wird das Jahrzehnt von 1220 - 1230 als die Gründungszeit dieser 5 und mit Dobbertin selbst 6 Kirchen anzusehen sein. Drei von ihnen, Woserin, Goltz und Ruchow, sind, wie von Kolonisationskirchen dieser Zeit zu erwarten, landesherrlichen Patronates (5029, 386, Schlie IV, 163: Brief Heinrichs des Älteren, auf Grund dessen die Brüsehaver später das Patronat haben. Schlie bringt hier öfter Patronat und Bann [Archidiakonatsrecht] durcheinander), die vierte, Lohmen, ist in dem von Dobbertin 1225 erworbenen Dorfe errichtet und später wenigstens auch Dobbertiner Patronates ( 983 ), also wohl als eine Gründung der Mönche zwischen 1225 und ca. 1231 anzusehen. Wie in dem unmittelbar westlich angrenzenden Lande Tribede erreichen auch hier diese Kolonisationskirchspiele nicht mehr die alte Größe, sie umfassen, die jüngeren 3 Kirchspiele eingerechnet, nur noch je 4 bis 8 Ortschaften , ja Woserin hat deren nur 3. Und neben ihnen findet sich bereits ein ritterliches Kirchspiel kleinsten Umfanges, Parcheez: es hat nur 2 Dörfer. Wir sehen, wie hier die um etwas mehr als ein Jahrzehnt später als im nördlichen Mecklenburg einsetzende Kolonisation im laufe von nur 10 - 15 Jahren trotz unvollkommender Besetzung des Landes es zu einer weit reichlicheren Versorgung mit Kirchen gebracht hat als dort. Ein Resultat, das einerseits unsere Vermutungen für die kirchliche Entwicklung in dem angrenzenden Lande Tribede bestätigt und andererseits für die Erkenntnis derselben in den weiteren Landschaften des südlichen Mecklenburg nicht ohne Wichtigkeit ist.
An diese 6 Pfarren des Landes Goldberg schließt sich endlich als siebente die von Techentin an. Auf dem Grund und Boden Sonnenkamps, von diesem errichtet, gehörte sie nicht mehr zum Dobbertiner Archidiakonat, sondern unterstand dem Bannrecht des Propstes von Sonnenkamp. Urkundlich begegnet sie zwar erst 1299 (2551) und ihre gotische Kirche ist noch jünger, doch mag sie mit jenen sechsen gleichzeitig sein. Ihr Kirchspiel umfaßte 6 Ortschaften, ist ihnen also an Durchschnittsgröße gleich.
Die weitere Entwicklung brachte wie gesagt, noch die 3 kleinen ritterlichen Pfarren von Groß=Upahl, Woosten und Zidderich hinzu. Die erste begegnet urkundlich zwar erst 1357 (8321), aber ihre Übergangs=Kirche sichert sie für das 13. Jahrhundert (Schlie IV, 278). Wahrscheinlich ist sie von Ruchow abgenommen. Die beiden anderen sind aus Teilen des Goldberger Kirchspiels gebildet. Die von Woosten ist schon 1269 (1153) vorhanden, die von Zidderich tritt zuerst 1307 (3188)


|
Seite 60 |




|
auf. Sie ist später wieder eingegangen. Der Ort gehört jetzt nach Techentin. Ihr Kirchspiel beschränkte sich daher wohl auf den Ort selbst; auch das von Upahl ist nicht größer und das von Woosten umfaßte 2-3 Ortschaften.
Im Lande Sternberg=Parchim ist die erste Spur deutscher Kolonisation in dem 1222 (282) bei der Gründung des Spitals in Tempzin genannten deutschnamigen und in Hufen liegenden Orte Goldbek zu sehen; er lag in unmittelbarer Nähe des späteren Sternberg. Die zweite Nachricht ist die 1225/26 erfolgte Bewidmung von Parchim mit Stadtrecht (319), in der Heinrich Borwin (II) sagte: "terram Parchem, terram inquam desertam et inviam, terram cultui daemonum dedicatam, colonis commisimus christianis, ipsos . . . invitantes. In ipsa quoque provincia civitatem construximus". Dies sind aber überhaupt die ersten urkundlichen Nachrichten aus dem ganzen Umkreis des Landes. Wir werden daher nicht fehl gehen, wenn wir den Beginn der deutschen Einwanderung nicht allzuviel früher setzen. Sie kann erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrzehntes des 13. Jahrhunderts hier begonnen haben, etwa 10 Jahre später als im Norden. Dazu stimmt, daß sie um 1219 im Lande Goldberg ihren Anfang genommen zu haben scheint.
Mit der Einwanderung erst ward das Land christlich. Bis dahin hatte erst in Parchim selbst eine Kirche bestanden. Vergebens haben wir nach Spuren weiterer Kirchen gesucht. Nun aber ward es anders. Im Jahre 1229 (370) errichtete Johann von Mecklenburg auf Brunwards Wunsch in 4 Dörfern der Parochie Parchim Kapellen, die Grundbesitzer dotierten sie für den Unterhalt der dort anzustellenden Plebane und der Pfarrer von Parchim erhielt das Patronatsrecht über sie. Für den Ausfall an Einkünften ward er dadurch entschädigt, daß die Burgkapelle in Parchim, welche ihm neben der Stadtkirche zustand, mit 6 Hufen in Boeck dotiert ward. Die übergroße Parochie warb also in 5 kleinere zerschlagen. Es sind Parchim, Lanken, Möderitz, Klockow und Damm, eine Maßregel, die eine einigermaßen durchgeführte Parochialeinteilung des Landes als schon bestehend voraussetzt. Ja, erst wenn in der Umgegend schon eine reichlichere Versorgung mit Kirchen stattgefunden hatte, wird man sich entschlossen haben, die kostspieligere Teilung der übergroßen Anfangskirchspiele vorzunehmen, deren Versorgung nun gegen die der Umgegend zurückgeblieben war. Wir dürfen also als sicher annehmen, daß die Parochialeinteilung des Landes Parchim um 1229 bereits im großen und ganzen geschehen war


|
Seite 61 |




|
Beachtenswert ist übrigens, wie auch hier noch der Landesherr - auf Anregung des Bischofs als der eigentlich Handelnde erscheint. Die Grundbesitzer dotieren zwar, aber auf seine Anordnung, und nicht sie erhalten. das Patronat, sondern wieder nach seiner Anordnung der Pleban der Mutterkirche.
Wollen wir nun aber den Versuch machen, die Kirchspielseinteilung des Landes Parchim, wie sie um diese Zeit war, zu ermitteln, so sind wir bei der Lückenhaftigkeit der urkundlichen wie der baulichen Daten in weiterem Maße als bisher uns auf Analogieschlüsse nach den dort erzielten Ergebnissen einzulassen genötigt. Da jedoch das Parochialsystem des Landes durch Auflösung und Zusammenlegung von Kirchspielen seit der Reformation teilweise starke Veränderungen erlitten hat, haben wir zunächst den Versuch zu machen, es so wiederherzustellen, wie, es auf der höchsten Stufe seiner Ausbildung vor der Reformation war.
Wir beginnen im Norden des Landes. Hier bildete das jetzt zu Sternberg gehörige Kobrow mit Stieten und Schönfeld einst eine eigene Parochie (5411, Visit. von 1534). Auch die in der Sternberger Feldmark aufgegangenen Orte Goldbek und Luckow sowie das ebenfalls auf der Sternberger Feldmark untergegangene Wendendorf - noch heute heißt ein Teil des "Wendfeldes" "Auf der Dorfstätte" - werden zu Kobrow gehört haben. Westlich von diesem lag das ebenfalls untergegangene Kirchspiel Powerstorf (= Schönlage ); es umfaßte 1541 die Ortschaften Weitendorf, Kaarz, Weselin, Tülchendorf, Venzkow; 1603 gehört
auch Necheln zum Kirchspiel, doch wird das nicht ursprünglich sein, da es jenseit der Warnow im Lande Mecklenburg lag.
In Venzkow bestand 1589 eine Filialkapelle; ja, da diese noch eine eigene Wedem besaß, muß sie einstmals selbständig gewesen sein (cf. Schildt in M. Jbb. 56 Quber. I, S. 8 - 12, 57 Quber. I, 13 - 15). Weiter westlich zerfiel das jetzige Holzendorfer Kirchspiel in zwei, das von Holzendorf mit Gustävel und Wendorf und die kleine Parochie Müsselmow (Schlie III, 422). Auch das Nachbarkirchspiel Kladow - Vorbeck zerfiel einst in zwei selbständige; Vorbeck hatte sein eigenes Patronat (Schlie III, 340) und trägt noch heute den Titel einer mater combinata. Wenden wir uns wieder ostwärts, so war die jetzige Filiale von Gägelow, Dabel, einst Filiale der mit ihrem Dorfe untergegangenen Kirche von Nepersmühlen (3102); diese lag am Ausflusse des Pritzer Sees in den Borkower. Das Kirchspiel hat wohl nur diese beiden Orte umfaßt. Ebenso war das jetzt mit Prestin vereinte Wamckow einst selbständig.


|
Seite 62 |




|
Sein Kirchspiel umfaßte als Filiale auch Hohen=Pritz (770), das dann im Laufe des Mittelalters ebenfalls selbständig geworden ist und noch im 16. Jahrhundert seinen eignen Pastor hatte (Schlie IV, 176 f.). Weiter muß das jetzt als Filiale zu Crivitz gehörige Barnin einst selbständig gewesen sein, da ersteres in der Grafschaft Schwerin, letzteres aber im Lande Parchim lag. An Nachrichten fehlt es freilich. Auch das jetzt mit Klinken vereinigte Raduhn war einst selbständig; es besaß nach 1645 seine eigene Wedem (Schlie IV, 466) und ist zeitweilig noch mit Garwitz verbunden gewesen. Richtig wird es daher auch heute noch als mater combinata bezeichnet. Letzteres, Garwitz, umfaßte ehemals nur Damerow. Bergrade, Domsühl und Zieslübbe sind erst bei der 1820/22 erfolgten Auflösung des 1229 errichteten Kirchspiels Möderitz zu Garwitz gelegt worden. Zu Möderitz gehörte außer diesen drei Dörfern noch Neuhof (Schlie IV, 466). Aber auch Domsühl scheint einst selbständig gewesen zu sein; es gilt noch heute als Tochterkirche, während die andern beiden, Bergrade und Zieslübbe, nur Kapellen sind, und besaß sein eigenes Patronat, das bis 1645 in Händen des Klosters Dobbertin war (Schlie III, 345). Weiter war Dargelütz, jetzt Filiale von Grebbin, einst selbständig (Schlie IV, 485). Endlich erscheint Greven, die jetzige Tochterkirche von Lanken, im 15. Jahrhundert im Verzeichnis der Kirchen des Schweriner Sprengels als selbständig und ebenso 1542 (Schlie IV, 553). 1 ) Dagegen ist Passow, welches jetzt als Tochterkirche gilt, nur Filialkapelle von Benthen gewesen (Schlie IV, 543). Aber Weisin, die zweite Benthener "Tochterkirche," gehörte einst zum Kirchspiel Kuppentin und liegt nicht mehr im Lande Parchim (436) und wird daher als ehemals selbständig anzusehen sein, bis sie zu Benthen gelegt ward.
Es sind also nicht weniger als 40 selbständige Pfarrkirchen, die es einst auf dem in Frage stehenden Gebiete gab. Keines ihrer Kirchspiele erreicht mehr eine über 6 Ortschaften hinausgehende Größe; nicht weniger als 10 aber umfassen nur noch das Kirchdorf selbst, und doch muß es einst auch hier Kolonisations=Kirchspiele der alten oder annähernd der alten Größe gegeben haben, denn sofort das ostwärts an das Land Parchim angrenzende von Kuppentin hatte 13 Ortschaften (436) und das südwärts an die Stadt Parchim stoßende und noch zum Lande Parchim


|
Seite 63 |




|
gehörige von Slate umfaßt noch heute 7, dessen Nachbar Marnitz 10 Ortschaften. Das Resultat der Entwickelung aber ist ein ganz gleiches wie in den Ländern Malchin und Goldberg; diese selbst wird daher ebenfalls die gleiche gewesen sein, d. h. ehe die Einteilung in landesherrliche Kolonisations=Kirchspiele ganz zustande gekommen war und die Verhältnisse sich einigermaßen konsolidiert hatten, begann die Errichtung kleinerer Kirchspiele durch adlige Kolonisatoren und Grundbesitzer, und das mag schon um das Jahr 1230 oder kurz vorher begonnen haben - man erinnere sich an das 1234 bereits bestehende kleine ritterliche Kirchspiel Karcheez im Lande Goldberg. Auf der Suche nach den um dieses Jahr bestehenden Parochien dürfen wir also nicht mehr wie in den nördlichen Gegenden die ritterlichen von vornherein ausscheiden. Immerhin wird es gelten müssen, daß diejenigen, welche nur eine einzige Ortschaft umfassen, als jüngeren Datums anzusehen sind, und ein Kirchspiel, je größer es ist, mit desto mehr Sicherheit zu denen der ersten Parochialeinteilung gerechnet werden kann. Wir werden demnach die kleinsten auf einen Ort beschränkten Pfarren von Witzin, Venzkow, Müsselmow, Barnin, Raduhn, Domsühl, Dargelütz, Greven und Gischow, als hier noch nicht in Betracht kommend zurückstellen dürfen, und in der Tat läßt es sich von einer, Gischow, nachweisen, daß sie jünger ist; sie ist erst 1304 (2942 cf. 8814) von Burow abgezweigt worden. Über das Dasein der übrigen schweigen die Urkunden. Zu ihnen kommen aber weiter die beiden rein städtischen Parochien Sternberg und Parchim=Neustadt; letztere war 1249 (633) in der Errichtung und um dieselbe Zeit ward Sternberg und mit ihm auch seine Kirche gegründet (Schlie IV, 134) - und nachweislich jüngeren Datums sind die vier 2 - 3 Ortschaften umfassenden Kirchspiele Vorbeck, Bülow, Hohen=Pritz und Granzin. Kritzow, das nach Vorbeck eingepfarrt ist, gehörte 1317 (3932) noch nach Kladow. Da es nun von letzterem durch Vorbeck getrennt wird, muß auch dieses noch nach Kladow eingepfarrt gewesen sein. In Bülow ward 1311 (2942) erst der Friedhof geweiht Hohen=Pritz war 1256 (770) noch Filialkapelle von Wamckow, und Granzin muß zwischen 1235 und 1277 seine Kirche erhalten haben; 1235 nämlich, als der Ort noch in der Besiedelung begriffen war, erwarb unter anderen auch Kloster Rühn hier einige Hufen (440), die es 1277 wieder verkaufte. Da nun die dortige kleine Kirche, über die es sonst an mittelalterlichen Nachrichten fehlt, Rühnschen Patronat war (Schlie IV, 549), so erhellt, daß sie zwischen jenen Jahren errichtet worden ist.


|
Seite 64 |




|
Nachdem nun diese 15 kleinsten Kirchspiele als jüngeren Datums ausgeschieden sind, bleiben immer noch 25 übrig, eine für das Jahr 1230 zweifellos noch zu hohe Zahl. Stellen wir daher zunächst aus ihnen diejenigen heraus, die sich durch die größere Anzahl ihrer Kirchspieldörfer deutlich als zur ersten Einteilung gehörig kennzeichnen. Es sind dies, wieder im Norden beginnend, Groß=Raden, das nach Abzug des jüngeren Buchenhof nur 4 alte Orte umfaßt, zu denen aber als fünfter auch der ehemalige in der Sternberger Feldmark aufgegangene fürstliche Hof Dämelow (3293) gehört haben muß, da die auf seinem Boden liegende Sternberger Burg noch heute dorthin eingepfarrt ist, und dem der Lage nach auch Witzin, das später eine eigene Kirche hatte, zugewiesen sein wird; Kobrow, dessen Kirchspiel, wie oben gesagt, 5 Ortschaften umfaßte; Powerstorf, welches, das jüngere Venzkow eingerechnet, die Zahl 6 erreichte; Kladow, das mit dem von ihm ausgegangenen Vorbeck auf 6-7 ältere Ortschaften kommt, Wamckow, das 1256 (770) ein Kirchspiel von ebenfalls 6 Dörfern war; Mestlin und Frauenmark, die je 5-6, Möderitz, das 4-5 ältere Ortschaften zählt und Lanken, das, die jüngere Pfarre Greven eingerechnet, auf 6 Orte kommt.
Diese 9 Pfarren liegen nun in zwei ziemlich geschlossenen Komplexen zusammen, von denen die des südlichen, die von Frauenmark, Möderitz, Parchim und Lanken urkundlich für etwa 1230 gesichert sind. Parchim war wie gesagt 1229 schon vorhanden, Möderitz und Lanken sind in diesem Jahre errichtet und die Kirche von Frauenmark ist von dem um 1230 lebenden Hermann von Dragun gegründet (siehe oben M. Jbb. 72, 187 f.) und sein alter Feldsteinchor ist sicher nicht viel jünger als dieses Jahr. An diese 4 Kirchspiele schließen sich aber noch drei weitere, ein wenig kleinere, nur 4 Ortschaften umfassende an, nämlich Brütz, das von jenem Nikolaus von Brüsewitz gegründet worden ist, der 1230-35 verschiedentlich vorkommt (2350, 381, 454), Benthen und Grebbin, die aus baugeschichtlichen Gründen zu den ältesten des Landes gehören. Die Kirche von Benthen ward zwar erst 1267 (2693) geweiht, aber diese Weihe bezieht sich wahrscheinlich nur auf die, wie es scheint, jüngere Apsis und den in ihr aufgestellten Altar (siehe oben M. Jbb. 72, 187). Aber selbst wenn die ganze Kirche erst 1267 fertig geworden wäre, so dürfte doch nach allen Analogien die Gründung der Pfarre um gut ein Menschenalter weiter zurückliegen. Die Kirche von Grebbin erscheint urkundlich zuerst 1284 (1766), aber ihr Chor (Schlie IV,


|
Seite 65 |




|
486 durchaus ungenügend beschrieben) aus Feldsteinen ohne jede Verwendung von Ziegeln errichtet, mit seinem rippenlosen Backofengewölbe und gedrückt spitzbogigen Triumphbogen, das sogar noch ein Kämpfersims zeigt, ist sicher älter als dies Jahr und läßt ebenfalls auf eine Gründung der Pfarre vor 1229 schließen. Letztere beiden Kirchen füllen aufs beste die Lücke zwischen Brüz einerseits und Lancken, Möderitz und Frauenmark andererseits.
Diese 7 zusammenliegenden Kirchspiele, welche schon damals, eben um ihrer aneinanderschließenden Lage willen, nicht größer als 4 - 7 Ortschaften gewesen sein können, zeigen nun auf das deutlichste, daß um 1230 auch im Lande Parchim wie im Lande Goldberg die Errichtung von Pfarren schon ziemlich weit vorgeschritten war, und berechtigen zu der Annahme, daß auch der nördliche Komplex von größeren Pfarren - die Kirchspiele Kladow, Powerstorf, Kobrow, Gr.=Raden, Wamckow und Mestlin - um diese Zeit schon ganz oder doch größtenteils vorhanden war, zumal wenn man sich daran erinnert, daß auch in dieser Gegend bereits um 1222 deutsche Ansiedler saßen, obgleich die positiven Daten hier mangelhafter sind. Die Kirchen von Groß=Raden und Wamckow erscheinen zuerst 1256 (770, 771), letztere sogar schon mit einer Filialkapelle, die von Kobrow freilich erst 1333 (5411), die Kladower 1317 (3932), die Mestliner 1450 (Schlie IV, 372) und die von Powerstorf gar erst 1505 (M. Jbb. 57 Quber. I, 13 f.). Aber wie wenig eine so späte Bezeugung im Einzelfalle zu sagen hat, zeigt der Chor der Mestliner Kirche, welcher aus Feldsteinen ohne Verwendung von Ziegeln zu den Leibungen der Fenster aufgemauert, nicht wohl später als um die Mitte des 13. Jahrhunderts angesetzt werden kann. Er und neben ihm die Kirchen von Frauenmark, Benthen und Grebbin sind fraglos die ältesten Landkirchen des Landes. Die Kirchen von Kobrow und Powerstorf sind leider untergegangen.
Zwischen diesen beiden schon um 1230 ziemlich reichlich mit Kirchen versehenen Komplexen liegen nun aber ausgedehntere Strecken, die der Lage nach nicht mehr von diesen aus versorgt worden sein können und, da sie kein unbewohntes Waldland, sondern schon zur Wendenzeit besiedelt waren, ebenfalls um 1230 nicht ganz ohne Kirchen gewesen sein werden. Suchen wir nun nach diesen, so bieten sich uns zunächst wieder die größeren Kirchspiele des Restes, die zwar nicht mehr die Größe von 5 - 7 Ortschaften erreichen, jedoch wie Brüz, Benthen und Grebbin immerhin noch die von 4 Orten haben. Es sind dies Gaegelow (im Visitationsprotokoll von 1541 fehlt unter seinen 4 Dörfern aller=


|
Seite 66 |




|
dings Rothen, aber das kann zufällig sein), Holzendorf mit Müsselmow, Klinken, das jetzt zwar nur zwei Ortschaften hat, mit den untergegangenen Werder und Nemersdorf (Schlie III, 375, 383) aber auf 4 kommt, Kladrum und endlich Zapel, das mit dem untergegangenen Fenzkendorp (Wittesche Karte) ebenfalls 4 erreicht. Von diesen 5 weiteren Kirchen sind 2, nämlich Kladrum und Zapel, landesherrlichen Patronats (9258, Visit. 1534).
Die Kirchen von Kladrum und Zapel sind allerdings erst spät erwähnt, 1406 die eine (Schlie III, 357), die andere 1534 (Visit.). Aber das jetzige Gebäude der ersteren ist wenigstens um 1300 errichtet, und die letztere ist um der großen Lücke zwischen Frauenmark und der Grenze nach Crivitz zu unbedingt unentbehrlich. Von den drei ritterlichen Pfarren ist die von Gaegelow durch ihre hübsche Übergangskirche für das 13. Jahrhundert, und zwar wohl schon seine Mitte, gesichert; urkundlich begegnet sie 1270 (1178). Über die von Klinken und Holzendorf gibt es zwar keine direkten Nachrichten, aber ersteres wird schon 1230 (382) erwähnt, und zwar als Zusammenkunftsort für eine aus zahlreichen Personen bestehende Grenzregulierungskommission, und letzteres ist 1235 (440) bereits mit holsteinschen Ansiedlern besetzt.
Rechnet man nun diese 5 weiteren Kirchspiele ebenfalls zu den um 1230 bestehenden, so ist eine ziemlich gleichmäßige Verteilung von Kirchen über das Land erreicht. Nur unter den nahe zusammenliegenden kleinen Kirchspielen von Demen, Bülow, Prestin, Wessin, Barnin möchte man noch eine alte Kirche vermuten, und in der Tat erscheint die von Demen bereits 1265 (1046).
Wir dürfen also außer Parchim selbst etwa 18 Kirchspiele im Lande Parchim nördlich der Elde als um 1230 bereits errichtet ansehen, eine Zahl, die verhältnismäßig der urkundlich für das Land Goldberg für 1234 feststehenden entspricht, also im ganzen das richtige treffen wird. Landesherrlichen Patronats sind von ihnen, abgesehen von Lancken und Möderitz: Gr.=Raden, Kobrow, Kladrum, Zapel (Visit. 1534), Wamckow (770), Frauenmark (1009), Grebbin (9258). Das Patronat der übrigen ist wenigstens später in ritterlichen Händen. Mag nun von den übrigen kleineren Kirchspielen immerhin das eine oder andere ebenfalls schon um diese Zeit errichtet sein, so werden sie doch im ganzen der Folgezeit zuzuweisen sein.


|
Seite 67 |




|
Von diesen erscheinen zuerst die beiden städtischen Kirchspiele der Neustadt Parchim und Sternbergs; ersteres war 1249 (633) in der Errichtung, letzteres begegnet 1256 (770), wird aber mit der Stadt selbst um etwa ein Jahrzehnt älter sein. Darauf folgt in der Sternberger Gegend das nur eine Ortschaft umfassende Kirchspiel Witzin; 1270 (1178) ist es da; seine kleine einfach rechteckige und zweijochige, dem späten Übergangsstil angehörige Kirche ist so recht typisch für diese nachgegründeten kleinen Kirchspiele (Schlie IV, 161). Gleichzeitig sind in der Parchimer Gegend Garwitz, das 1278 (7200 als Pfarre auftritt, und Granzin, das (vgl. oben S. 63) zwischen 1235 und 1277 seine Kirche erhielt. Nepersmühlen mit seiner Filiale Dabel erscheint 1306 (3102). Im Jahre 1304 (2942 vgl. 8814) begegnet zuerst das ostwärts von Parchim im Eldenwinkel gelegene Kirchspiel von Burow, wird aber auch schon das noch kleinere von Gischow errichtet und von ihm getrennt. Ebenfalls dem Anfang des 14. Jahrhunderts gehört die Errichtung der Pfarre von Bülow an; 1311 (3479) ward ihr Kirchhof geweiht 1 ) und bald darauf muß auch das von Vorbeck errichtet und von Kladow abgenommen sein; 1317 (3932 vgl. oben S. 63) besteht es noch nicht, aber die kleine frühgotische Kirche (Schlie III, 342) weist doch noch in das erste Drittel des 14. Jahrhunderts. Endlich begegnet 1331 (5291) die Kirche von Prestin und hat Hohen=Pritz bereits 1256 (770) eine Filialkapelle von Wamckow, die später - leider läßt sich nicht sagen, wann - selbständig geworden ist (Schlie IV, 177).
Über die Gründungszeit der übrigen Kirchen, Domsühl, Dargelütz, Herzberg, Greven, Müsselmow, Venzkow, Barnin, Wessin, Raduhn läßt sich nichts bestimmteres beibringen. Dargelütz ist 1379 (11219) Pfarrort; Herzberg hat eine gotische Kirche, aber ihre nähere Ansetzung ist unsicher. Dasselbe gilt von Domsühl, dessen Kirche im westlichen Teil noch gotisch ist. Greven erscheint im 15. Jahrhundert im Verzeichnis der Schwerinschen Kirchlehen als selbständige Kirche


|
Seite 68 |




|
und ebenso 1542 (Schlie IV, 553). Für Müsselmow gibt es überhaupt keine mittelalterlichen Daten außer seiner gotischen Kirche. Bei Venzkow, Barnin, Raduhn und Lutheran fehlt auch das. Wessin ist 1391 Kirchort und hat eine gotische Kirche (Schlie III, 360 f.). Aber auch diese Pfarren werden so gut wie alle spätestens dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts angehören. In diese Zeit fällt wenigstens auch hier die Gründung der letzten Kirchen, über deren Errichtung es urkundliche Nachrichten gibt.
Landesherrlichen Patronats sind von diesen 22 kleineren Pfarren außer den beiden städtischen nur noch die von Nepersmühlen (3102), Wessin (Schlie III, 360, Urkunde von 1391) und Burow (Visit. 1534).
Werfen wir nun auch hier am Schlusse noch einen Blick auf die Nationalität der Kirchdörfer, so sind unter den 18, die der ersten Kirchenerrichtung, angehören werden, drei, die wendischen Charakter tragen, nämlich Powerstorf und Frauenmark, beides Kossatendörfer, und Kladow, ein Hakenhufendorf. Da jedoch in ihnen später keine wendischen Namen mehr begegnen, sind sie im Laufe der Zeit von ca. 1250 - 1375 schon den Wenden verloren gegangen. Mehr oder weniger wendische Namen finden sich dagegen noch in Gr.=Raden, Kobrow, Mestlin, Kladrum, Klinken, Lancken, Brüz und Grebbin.
Von den übrigen sind noch Bülow, Wessin und Garwitz Hakenhufendörfer, Dargelütz ein Kossatendorf; letzteres sowie Bülow zeigen jedoch im 15. Jahrhundert keine wendischen Namen mehr, sind also nachträglich noch germanisiert - vermutlich fand die Errichtung der Kirchen hiermit im Zusammenhange statt =, während Wessin, Garwitz und weiter Domsühl, Greven, Granzin und Burow solche in mehr oder minder großer Zahl aufweisen (Wittesche Karte).
Über die Zehnten der letzten drei zum Schwerinschen Sprengel gehörigen Länder Plau, Malchow und Waren scheint nach einer allerdings unsicheren Identifizierung eines Elandrianschen Regestes mit Angaben Hederichs (240) im Jahre 1218 ein Vertrag zwischen Bischof und Kapitel abgeschlossen zu sein. Er ist das einzige Zeichen, daß damals die Kolonisation auch diese Gegenden bereits erreicht hatte oder wenigstens an ihrer Grenze stand, bereit, in sie einzudringen.


|
Seite 69 |




|
Im Lande Plau, dem früheren Burgward Cuthin, bestand wahrscheinlich schon von Berno her die Kirche von Quetzin. Die deutsche Einwanderung muß auch hier noch wesentlich gleichzeitig mit der im Lande Parchim stattgefunden haben, da die Gründung der deutschen Stadt Plau, welche von nun ab dem Lande den Namen gab, ebenfalls noch auf die beiden Borwine zurückgeht, also spätestens 1226 fällt (428) Mit der Stadt entstand in ihr natürlich auch eine Pfarrkirche, deren Kirchspiel die angrenzenden Dörfer, wie Grapentin und Gedin, welche später in der Stadtfeldmark untergegangen sind, zugewiesen wurden (2199). Als zweite Landpfarre begegnet uns 1235 (436) Kuppentin; Brunward bestätigt ihre Pfarrhufen und Kirchspiel. Letzteres umfaßt mit seinen 13 Dörfern - auch hier treffen wir also noch wieder die bekannte Größe der landesherrlichen Kolonisationskirchspiele - noch die von Poserin und Weisin und greift sogar mit Wessentin, Broock und Bobzin auf das linke Eldeufer in die späteren, damals also noch nicht errichteten Kirchspiele Lübz, Broock und Barkow über. Wahrscheinlich aber ist auch das von Kuppentin 1235 nicht erst gegründet, sondern schon in den zwanziger Jahren. Derselben Zeit wird dann auch vermutlich die 1254 auftauchende Kirche von Karow angehören. Da Pribislav in diesem Jahre auf die Bitten der Eingepfarrten das Einkommen der dürftigen Pfarre durch Schenkung von 5 Hufen aufbessert (732), so wird auch sie schon eine Weile bestanden haben. Das Kirchspiel war klein, der Boden arm, daher die Einkünfte nur gering. Man mochte bei der Gründung der Pfarre auf weitere Rodungen in den ausgebreiteten Karow umgebenden Kiefernwaldungen gerechnet haben, als diese und damit größere Einnahmen ausblieben, zeigte es sich, daß die Pfarre aufgebessert werden mußte.
Es werden also um 1235 im Lande Plau nördlich der Elde die 4 Pfarren Quetzin, Plau, Kuppentin und vielleicht auch schon Karow bestanden haben. Sie sind alle landesherrlichen Patronates (Visitationsprot. v. 1534; für Karow noch M. U.=B. 732 von 1254). In Frage käme noch die auf der Grenze der Länder Plau und Malchow gelegene Pfarre Alt=Schwerin, deren westliche Hälfte mit Alt=Schwerin selbst noch zum Lande Plau gehörte (Schlie V, 393). Indes begegnet sie urkundlich erst 1375 (10843) und ist ihre Kirche, soweit die dürftige Baubeschreibung ein Urteil gestattet, erst nach 1300 gebaut (Schlie V, 418), auch scheint sie niemals landesherrlichen Patronats gewesen zu sein, sondern eine Gründung der Gamme vom Werder, die dort zuerst 1346 (6646) als ansässig erscheinen. Sie wird also


|
Seite 70 |




|
späteren Ursprungs sein, und ihre westliche Hälfte ursprünglich zu Karow gehört haben. Auch entspricht das Übergreifen ihres Kirchspiels in zwei Länder nicht den Prinzipien der Parochialeinteilung der Kolonisationszeit
Ostwärts vom Plauer und Alt=Schweriner See erstreckt sich das Land Malchow, in seiner nördlichen Hälfte noch heute zum großen Teil von meilenweiten Waldungen bedeckt. Im
16.Jahrhundert umfaßte es die Parochien Malchow, Alt=Schwerin zum Teil, Nossentin, Kieth, Wangelin, Lütgendorf, Jabel nördlich der Seereihe, südlich derselben Satow, Grüssow, Poppentin und Lexow (Schlie V, 393). Aber auch Stuer wird noch dazu zu rechnen sein.
Hier bestand, wie oben gezeigt, wohl schon von Berno her die Kirche zu Alt - Malchow, welche Nossentin und Lexow und wohl auch den Malchower Anteil des Alt=Schweriner Kirchspiels noch mit umfaßte und nordwärts von den riesigen Waldungen begrenzt ward. Nord= und ostwärts derselben liegen die Pfarren Kieth, Wangelin, Lütgendorf und Jabel. Von ihnen begegnet Wangelin schon 1244 (552), Kieth und Jabel 1256 (763), Lütgendorf erst 1304 (2935). Die Kirchen gehören alle erst dem 14. Jahrhundert an, nur die von Lütgendorf wird schon der Zeit um oder kurz vor 1300 zuzuweisen sein (Schlie V, 431). Sie gehört dem Typus der kleinen einfach rechteckigen Bauten aus der allerletzten Zeit des Übergangsstiles an, wie er für die kleineren nachgegründeten ritterschaftlichen Kirchen üblich war. Es bleiben also für unsere Epoche Kieth, Wangelin und Jabel. Von ihnen scheint Wangelin immer ritterlichen Patronats gewesen zu sein (6152), ebenso Lütgendorf; Kieth und Jabel jedoch waren ursprünglich landesherrliche Pfarren. Das Patronat von Jabel finden wir später in den Händen des Klosters Malchow, welches das Dorf um 1410 halb von den Hahn=Solzow, halb von den Werleschen Fürsten erworben hatte (Schlie V, 422). Auch die Hahns aber hatten ihre Hälfte des Dorfes noch nicht lange gehabt; es scheint ursprünglich ganz im Besitze der Landesherren gewesen zu sein und damit auch das Patronat. Dem entspricht auch die erste kirchliche Notiz über Jabel: 1256 (763) verlieh Nikolaus von Werle den Pfarrern der Probstei Alt=Röbel sowie den Pfarrern, von Malchow, Kieth und Jabel das Recht, über ihr Vermögen testamentarisch zu verfügen. Malchow, Kieth und Jabel werden die Pfarren seines Patronats im Lande Malchow gewesen sein, wie denn Malchow nachweislich (2503) fürstlichen Patronats war und es für Jabel eben wahrscheinlich gemacht ist. Wangelin, das


|
Seite 71 |




|
auch schon existierte, ging leer aus, weil es nicht zur Verfügung der Fürsten stand.
Bei Malchow selbst ward 1235 auf einer Insel die deutsche Stadt Malchow gegründet (433). Mit ihr entstand natürlich auch die Kirche von Neu=Malchow, welche jedoch nicht zu einer selbständigen Pfarrkirche erhoben ward, sondern dem Pleban von Alt=Malchow untergeben blieb (2503. 2505. 2506. 2507). Die Stadtgründung wird für die südlich der Seereihe gelegenen Strecken den Punkt bezeichnen, wo hier die Kolonisation zu einem gewissen Abschluß gekommen war. Von den hier bestehenden Pfarren ist Grüssow erst 1255 (747) gegründet, fällt also noch fort, und wird auch die ritterschaftliche Pfarre Poppentin, welche 1284 (1758) zuerst begegnet, vermutlich noch auszuscheiden haben; sie ist ihrer Lage nach aus Alt=Malchow herausgeschnitten. Satow aber, obwohl urkundlich erst 1284 (1758) als Pfarre bezeugt, muß um 1255 schon eine Kirche gehabt haben, denn da die in diesem Jahre neugegründete Pfarre Grüssow mit einer Hufe zu Kogel dotiert, dieses aber nicht zum Kirchspiel Grüssow gelegt wird, so muß es seine kirchliche Versorgung schon anderswo, d.h. wie heute in Satow, gehabt haben. Dieses hatte also um 1255 schon eine Kirche, und zwar landesherrlichen Patronats, da Johann III. von Werle bei der großen Belehnung der von Flotow in dieser Gegend ihnen auch Satow, das bisher in seinem Besitz gewesen, mit Ausnahme der Pfarrhufen verleiht (6401). Später haben die von Flotow dann auch das Patronat an sich gebracht. Stuer aber wird damals noch keine Kirche gehabt haben, da weder bei der Erstbelehnung von 1340 (6069) noch beider Gesamtbelehnung von 1344 (6401) wie bei Satow und Demzin von Pfarrhufen die Rede ist. Ein Pfarrer von Stuer erscheint erst 1363 (9171), und die Pfarre ist 1541 Flotowschen Patronates; sie ist also von den Flotows, bald nachdem sie um 1340 hier ansässig geworden waren, gegründet und von Satow abgetrennt worden.
Endlich mag auch die ebenfalls landesherrliche Kirche von Sietow, obgleich sie urkundlich erst 1328 (4985) auftritt, schon der ersten Kirchspieleinteilung der Kolonisationszeit angehören.
Ihr Kirchspiel füllt die südöstliche Ecke des Landes Malchow aus, wie das von Satow die südwestliche, und ihr alter Kirchenbau (Schlie V, 437 ff.) ist schwerlich später als in die Mitte des 13. Jahrhunderts zu setzen, denn nachdem um diese in dem nahen Röbel der Ziegelbau zu blühen begonnen hatte, würde man sich kaum auch in Sietow noch ganz ohne Ziegel beholfen haben. Zudem


|
Seite 72 |




|
charakterisiert er sich gegenüber der 1255 geweihten Kirche des nachgegründeten Nachbarkirchspiels Grüssow (Schlie V, 434 f.) in seiner Anlage mit Chor und breiterem Gemeindehaus, während jene schon den vereinfachten einfach rechteckigen Grundriß, wie er für die kleineren nachgegründeten Kirchspiele üblich ward zeigt, als die Kirche eines größeren und älteren Kirchspiels.
Der ersten Kirchspieleinteilung mögen demnach im Lande Malchow die Landesherrlichen Pfarren von Malchow mit Neu=Malchow, Kieth, Jabel, Satow und Sietow angehört haben, dazu kam vielleicht auch schon die ritterliche Pfarre Wangelin. Abgesehen von Malchow selbst, das mit dem nachweislich erst später von ihm abgezweigten Nossentin 13 - 14 alte Ortschaften umfaßte, erreicht keines von ihnen mehr den Umfang der älteren Kolonisationskirchspiele, sondern nur noch die für die Länder Goldberg und Parchim charakteristische Durchschnittsgröße von 6 Dörfern. So kommt Satow mit dem jüngeren Stuer und einem Teil des ebenfalls jüngeren Grüssow auf 7 Orte; Sietow hat selbst nur 4, aber dürfte anfänglich auch Klink und einen Teil des Poppentiner Kirchspiels umfaßt haben. Kieth hat nach Abschluß der Kirchenerrichtung noch 6 ältere Ortschaften und Jabel 4.
Folgen wir nun der weiteren Entwickelung, so ist im Lande Plau nördlich der Elde vielleicht nur noch eine einzige Pfarre errichtet worden, nämlich die von Plauerhagen, das 1235 noch zum Kuppentiner Kirchspiel gehörte (436). Seine Kirche gilt jetzt als mater combinata, doch erscheint sie bei ihrem ersten Auftreten in den Visitationsprotokollen von 1534 und 1541 bereits wie heute als Filiale von Kuppentin, und gehörte das jetzt bei ihr eingepfarrte Zarchlin einst zum Quetziner Kirchspiel (Schlie IV, 611). Die heute selbständige Kirche von Poserin aber, die dem Stile nach noch dem 13. Jahrhundert angehören mag (Schlie IV, 394), ist 1534 ebenfalls noch Filialkapelle von Kuppentin, wohin der Ort schon 1235 (436) eingepfarrt war. Sie ist erst infolge der Reformation selbständig geworden.
Südlich der Elde aber entstanden noch einige weitere Kirchspiele. Zunächst ward hier noch eine landesherrliche Pfarre errichtet, die von Lübz. Das später hierhin eingepfarrte Bobzin gehört zwar 1235 (436) noch nach Kuppentin, und urkundlich begegnet die Pfarre erst 1316 (3818), aber, landesherrlichen Patronates und immer noch die Größe von 5 Ortschaften erreichend, kann sie nicht allzulange nach 1235 errichtet sein. An sie schließt sich, ebenfalls von Kuppentin abgezweigt, die kleine


|
Seite 73 |




|
ritterliche Pfarre von Broock. Auch sie ist auf Grund ihrer von Schlie (III, 542) allerdings recht mangelhaft beschriebenen Kirche noch dem 13. Jahrhundert zuzuweisen, und dasselbe gilt endlich für die teils (mit Wessentin) von dem Kuppentiner, teils wohl von dem alten Quetziner Kirchspiel abgezweigten Pfarre Barkow. Sie ward wohl zwischen 1271 und 1320 von dem märkischen Kloster Stepenitz errichtet, welches hier Besitzungen erworben hatte.
Zahlreicher sind die Nachgründungen von Kirchen im Lande Malchow. Hier machte zunächst der Riesenumfang des alten Burgwardkirchspieles Malchow Nachgründungen notwendig. Hier ward zwischen Malchow und Satow die neue, ebenfalls noch landesherrliche Pfarre von Grüssow eingeschoben (7580. 6390). Im Jahre 1255 weihte Bischof Rudolf von Schwerin ihre Kirche und bestimmte den Umfang ihres Kirchspiels auf die 4 Dörfer Grüssow, Walow, Zislow und Globen (747). Man könnte freilich vermuten, daß es sich bei der Weihe der Steinkirche nicht um die erste gehandelt habe und die Pfarre schon länger bestand, allein die Bestimmung des Umfanges ihres Kirchspiels spricht dagegen, und ebenso weist der Umstand, daß sie in Grüssow selbst nur mit einer Hufe, mit einer zweiten aber in dem außerhalb des Kirchspiels gelegenen Kogel dotiert ward, daraus hin, daß sie nicht unter den noch unfertigen Verhältnissen der ersten Kolonisationszeit, wo am Orte selbst unschwer 2 Hufen hätten reserviert werden können, sondern unter schon festgewordenen Verhältnissen gegründet ward. Aus der östlichen Hälfte des Malchower Kirchspiels ward das ritterliche von Poppentin herausgeschnitten - auch Sietow gab wohl an dasselbe ab =; 1284 begegnet es zuerst urkundlich (1758). Nordwestlich von Malchow entstand, wohl eine Gründung der Gamme vom Werder, die Pfarre Alt=Schwerin mit ihrem teilweise ins Land Plau übergreifenden Kirchspiel. Urkundlich begegnet sie zwar erst 1375 (10843), aber das "frühgotische" Portal der einfachen Backsteinkirche (Schlie V, 418) sichert sie wenigstens für die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aber, da ihr Kirchspiel wie die von Grüssow und Poppentin immerhin noch die Größe von 4 älteren Ortschaften erreicht, wird sie schon älter sein und vielleicht schon wie diese dem zweiten Drittel des 13. Jahrhunderts angehören. Dasselbe mag auch für das ritterliche Kirchspiel Lütgendorf gelten, welches mit seinen ebenfalls 4 alten Dörfern die Nordostecke des Landes ausfüllt, obgleich es, wie gesagt, erst spät bezeugt ist. Um 1300 war es jedenfalls, wie seine kleine


|
Seite 74 |




|
Kirche ausweist, vorhanden. Endlich ward im nordöstlichen Teil des Malchower Kirchspiels um 1317 (3895) die Pfarre Nossentin errichtet. Die Art ihrer Errichtung ist bezeichnend für diese späte Zeit. Die Eingesessenen, Adel und Bauern, faßten den Plan, erbaten die Einwilligung des Klosters, dem das Patronat der Mutterkirche Malchow zustand, und setzten sich mit ihm dahin auseinander, daß das Kloster zwar nach wie vor das Meßkorn aus dem neuen Kirchspiel erheben sollte, die Oblationen dagegen mit 2 Mk. jährlich abgelöst und der Malchower Küster mit jährlich 8 Schillingen entschädigt wurde. Die neue Pfarre aber ward nicht, wie herkömmlich, mit Landhufen dotiert - offenbar waren solche in Nossentin bei den festgewordenen Erbpachtverhältnissen nicht zu haben =, sondern mit 14 Mk. jährlicher Einkünfte, die teils in dem untergegangenen Redenisce, teils in Nossentin selbst angewiesen wurden. Ihre Besetzung sollte dem Kloster zustehen, die Stifter jedoch das Vorschlagsrecht haben. Der Bischof von Schwerin hat nichts mehr als dieses Übereinkommen zu bestätigen. Die Initiative für die Errichtung von Kirchen ging längst nicht mehr von der Kirchenleitung aus.
Über die Gründungszeit der drei kleinsten, je nur ein Dorf umfassenden Pfarren Hagenow, Klink und Stuer fehlt es an direkten Nachrichten. Für Stuer kann man, wie oben ausgeführt, die Zeit zwischen 1344 und 1363 als die ihrer Errichtung erschließen. Die von Hagenow begegnet zuerst 1449, wo ihr Patronat dem Kloster Malchow gehört (Schlie V, 399), welches auch das Dorf - leider wissen wir nicht seit wann - besaß. Sie ist später wieder eingegangen und der Ort gehört, wie wohl zu Anfang, wieder zum Kirchspiel Jabel. Die Kirche von Klink schließlich begegnet erst im Visitationsprotokoll von 1541, und schon da als mit Sietow verbunden.
Sehr viel undeutlicher liegen nun zuletzt die Dinge im Lande Waren, das ursprünglich vielleicht zum Teil noch zum Lande Malchow gehört hat - wenigstens wird 1260 (857) das untergegangene und einst bei Rittermannshagen gelegene Martinsdorf noch zu Malchow gerechnet =, zum andern Teil aus dem Lande Schlön (857) gebildet ward. Es umfaßt die jetzigen Kirchspiele Waren, Sommerstorf, Vielist, Rittermannshagen, Lansen, Gr.=Gievitz, Varchentin, Gr.=Varchow, Luplow, Schlön, Gr.=Dratow und Federow, dazu die teils ganz eingegangenen, teils zu Filialen gewordenen von Panschenhagen, Falkenhagen mit Schönau, und Deven.


|
Seite 75 |




|
Wäre der Brodaschen Urkunde von 1230 (377) zu glauben, so hätten damals schon Federow, Falkenhagen, Schönau, Kargow und Waren als Pfarrkirchen bestanden. Allein die Urkunde ist eine der vielen Brodaschen Fälschungen und wird durch die glücklicherweise erhaltenen echten (1284 und 5226) widerlegt. Schönau und Kargow waren noch 1331 (5226) Filialkapellen von Falkenhagen und Federow, sind also sicher um 1230 noch nicht vorhanden gewesen. Auch das kleine Kirchspiel von Gr.=Dratow, das aus dem von Schlön herausgeschnitten scheint, darf wohl als jüngeren Datums angesehen werden. Das Patronat der Kirche besaß 1541 Kloster Broda, obgleich es sonst im Dorfe niemals einen Besitz gehabt, dieses vielmehr den von Kamptz gehörte. Nun hatte aber Broda 1331 (5226) gegen das Patronat von Waren die von Federow, Falkenhagen und Schlön eingetauscht. Bei den beiden ersten führt die Urkunde ihre Filialkapellen auf, bei Schlön nennt sie keine; es besaß also noch keine. Die Kirche von Dratow wird also vermutlich erst nach 1331 von den von Kamptz erbaut und von Schlön abgezweigt sein, wobei ihr Patronat, weil das der Mutterkirche dem Kloster gehörte, ebenfalls demselben reserviert ward - es war der Preis für die Zustimmung zur Abzweigung der neuen Pfarre.
Im übrigen sind die Nachrichten über die durchweg nur kleinen Kirchspiele dürftig. - 5 von ihnen umfaßten nur 1 - 2 ältere Ortschaften und über 4 kommt nur ein einziges hinaus. - Spuren jener älteren und größeren Kolonisationskirchspiele finden sich nur spärlich und undeutlich. Schlön selbst, der einstmalige Hauptort des Landes, hat ein Kirchspiel von 7 älteren Ortschaften, das mit den 3 Dörfern des Dratowers auf 10 anwächst, und ist offenbar als eine der ältesten Pfarren des Landes anzusehen. Urkundlich begegnet sie zuerst 1265 (1029), zugleich mit ihr aber auch ihre südliche Nachbarpfarre Federow, deren Kirchspiel zwar nur 3 ältere Orte umfaßt, aber an Fläche - Wald und Heide - einen noch größeren Umfang hat. - Die Kolonisation ist hier nicht zur Vollendung gekommen. Auch Varchentin, die nordöstliche Nachbarin von Schlön, mag ursprünglich als größeres Kirchspiel geplant gewesen sein. Vielleicht weist seine schmale und langgestreckte Form die mit Kraase (5433) von der Schwerin=Caminschen Grenze bis zur Havelbergischen hinüberreicht, darauf hin, daß es einst den ganzen Winkel zwischen diesen Grenzen einzunehmen bestimmt war. Urkundlich begegnet es zwar erst 1304 (2945), aber seine Übergangskirche stammt noch aus dem 13. Jahrhundert (Schlie V, 214 f.), und die Gründung der Pfarre wird


|
Seite 76 |




|
noch älter sein als diese. Das ist alles. Immerhin, scheidet man aus den 7 landesherrlichen Pfarren des Landes 1 ) die von Falkenhagen und Sommerstorf als jünger aus - erstere wird, weil Hagenpfarre, noch nicht der ersten Anlage angehören, und letztere liegt der alten Pfarre Vielist zu nahe =, so erhält man die 5 planmäßig über das Land verteilten und bis auf Federow mit alten steinernen Übergangskirchen des 13. Jahrhunderts ausgestatteten landesherrlichen Pfarren von Vielist, Waren, Schlön, Varchentin und Federow und mit ihnen vielleicht den ursprünglichen Plan der landesherrlichen Kirchspieleinteilung und die ältesten Kirchen. Das erste urkundliche Vorkommen der letzten drei ist schon erwähnt. Die Kirche von Waren begegnet zuerst 1243 (547); für Vielist fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten. Aber wie hier in dem Südostwinkel des Schweriner Sprengels die Kolonisation am spätesten eingedrungen sein muß, so wird gleich von Anfang an diese im Entstehen begriffene Einteilung infolge der Errichtung. ritterlicher kleinerer Pfarren durchbrochen worden und nicht mehr zur Vollendung gekommen sein. Vielleicht mag die von Groß - Gievitz mit ihrer hübschen Übergangskirche, an der zwei Stufen des Übergangsstiles zu unterscheiden sind ( Schlie V, 365 ff. ), hierher gehören. In Urkunden fehlt es leider. Ein deutliches Bild der Entwicklung läßt sich nicht mehr geben. Ich zähle die übrigen Pfarren nach der Reihe ihrer erstmaligen Bezeugung durch Urkunden oder Bauten auf.
Schon 1258 (823; da der Pfarrer von Falkenhagen hier vor dem von Kieth steht, so ist an das mecklenburgische und nicht an das vorpommersche Falkenhagen zu denken, das übrigens auch keine eigene Pfarre hatte) ist die landesherrliche Hagenpfarre Falkenhagen da. Der Ort ist später eingegangen; er lag südlich von Alt=Schönau, das mit seiner Kapelle ein Nest des ehemaligen Kirchspiels ist. Zwei Jahre darauf begegnet die Pfarre des später in Rittermannshagen aufgegangenen Mertinsdorf (857). Die Pfarren von Groß=Varchow und Luplow begegnen zuerst 1326 (4749), die von Deven allerdings erst 1373 (10501), aber ihre kleine frühgotische Kirche rückt auch sie spätestens in das erste Drittel des 14. Jahrhunderts hinauf. Bald nach 1300 muß dann die Kirche von Mertinsdorf nach Ritter=


|
Seite 77 |




|
mannshagen verlegt worden sein, wenn nicht einfach der letztere Name auch auf das erstere übergegangen ist. Begegnet auch der Pleban von Rittermannshagen erst 1373 (10404), so gehört doch die frühgotische Kirche bereits in die erste Hälfte des Jahrhunderts. Wohl zwischen 1331 und 1366 (9340; cf. oben) entstand die Pfarre von Groß=Dratow, wenn nicht doch, wie Schlie (V, 363) vermutet, der alte Teil des Schiffs seiner Kirche schon dem 13. Jahrhundert angehört.
Über die Kirchen von Lansen, Sommerstorf und Panschenhagen fehlt es, abgesehen von dem dem 15. Jahrhundert angehörigen Verzeichnis der Pfarrlehen des Schweriner Sprengels (Archiv, Schwerin), ganz an mittelalterlichen Nachrichten. Auch aus dem Baubestand ihrer gotischen Kirchen läßt sich nichts näheres ermitteln. Die von Panschenhagen ist übrigens wieder eingegangen (M. Jbb. 68, 256). Ist mit ihr etwa die sonst nicht identifizierbare landesherrliche Pfarre von Albrechtshagen identisch, welche im Visitationsprotokoll von 1534 neben Sommerstorf steht? Ob die Kapelle zu Kraase, die dem Stile nach um 1300 erbaut ist (Schlie V, 325), einst selbständig gewesen ist - ihre Patrone waren die Rostke (ebdas. 212, 324) =, muß dahingestellt bleiben; sehr wahrscheinlich ist es nicht, da das Dorf 1333 (5433) noch zur Varchentiner Parochie gehörte und ebenso 1541 (Visit.).
Was endlich die Nationalität der Kirchorte in den 3 Ländern Plau, Malchow und Waren betrifft, so zeigt die Wittesche Karte, daß sie fast alle mehr oder minder starke Bruchteile wendischer Bevölkerung haben - am stärksten die Malchower Kirchorte Wangelin, Kieth und Satow =, daß jedoch, abgesehen von Alt=Malchow, welches als Kossatendorf erscheint, kein einziger mehr wendische Verfassung - Hakenhufen oder Pauschalbede - hat, daß sie also wohl sämtlich als im Kern deutsche Kolonisationsdörfer angesehen werden müssen.
Wir sind am Ende der Pfarren des Schweriner Sprengels. Auch hier im Südostwinkel desselben, in welchem die dem Gange der Kolonisationsbewegung folgende kirchliche Entwicklung zuletzt in Bewegung gekommen sein muß, ist uns das Vielerlei kleiner und kleinster Pfarren neben spärlichen Resten größerer Kirchspiele begegnet, wie es für die nach ca. 1220 kolonisierten Gegenden charakteristisch ist. Auch hier ist die Errichtung selbständiger Pfarren, soweit es sich nachweisen läßt, mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts so gut wie ganz vorüber.


|
Seite 78 |




|
5. Die an Havelberg verlorenen Gebiete.
a. Bis zum Verlust an Havelberg.
Wir kommen nun zu den jahrzehntelang zwischen Schwerin und Havelberg strittigen Grenzgebieten, den südlich des Eldeufers gelegenen Ländern Brenz, Ture (Lübz), Röbel, Turne (östlich der Müritz) und Tollense (Penzlin). Leider sind die Urkunden über diesen Streit sehr dürftig; es sind nur ein paar ziemlich inhaltlose Clandrianschen Auszüge vorhanden. Immerhin läßt sich doch mehr erkennen, als nach ihnen scheinen sollte. In Ottos des Großen Stiftungsbrief für Havelberg von 946 (14) waren alle diese Länder diesem zugewiesen, Peene - und Eldelauf als Nordgrenze des Bistums festgesetzt worden und Konrads II. Bestätigung von 1150 (52) hatte diese Bestimmungen wiederholt. Nun war aber 1160 in der von Heinrich dem Löwen eroberten Wendenmark das Bistum Schwerin errichtet und die Grenzen desselben soweit gesteckt worden, wie der Machtbereich des Herzogs ging, das hieß aber bis über Elde und Peene hinaus. Dementsprechend hatte im Jahre 1170 die kaiserliche Bestätigung des Schweriner Bistums, ohne auf jene älteren Rechte Havelbergs Rücksicht zu nehmen, die Castra Parchim, Cuthin und Malchow cum omnibus villis ex utraque parte alvei, que dicitur Elde, ad ipsa castra pertinentibus, also die Länder Brenz, Marnitz (?), Ture, Malchow mit Röbel, und vom pommerschen Gebiet das Land Tollense, wozu wohl auch das Land Penzlin zu rechnen ist, dem Schweriner Bistum zugesprochen (91). Ebenso hatte die päpstliche Bestätigung Alexanders III. vom Jahre 1178 die Grenzen des Bistums als mit der provincia ducis Henrici zusammenfallend, und in dem hier in Frage kommenden Teil von Schwerin bis Vipperow (an der südlichen Müritz), von dort durch das Land Müritz und Tollense an die Peene führend, bezeichnet (124). Auf der andern Seite ließ sich Hubert von Havelsberg ein Jahr darauf die alten Ottonischen Grenzbestimmungen durch den Kaiser von neuem bestätigen (130), während die päpstliche Bestätigung Schwerins durch Urban III. von 1186 (141) die Grenzbestimmung Alexanders III. wiederholt, aber genauer festlegend bestimmt, daß die Grenze von der Peene, das Land Tollense und Müritz mit Vipperow einschließend, bis zu dem (südlich der Müritz gelegenen) Besuntwalde laufe, der die Grenze zwischen Havelberg und Müritz bilde und von dort, das Land Warnow auf beiden Seiten der Elde einschließend, bis zum Castrum Grabow gehe. Diese genaueren Bestimmungen werden dann in den weiteren päpstlichen Bestäti=


|
Seite 79 |




|
gungen von 1189 (149) und 1197 (162) festgehalten, und endlich bestimmt die kaiserliche Ottos IV. von 1211 (202): Termini autem episcopatus et ducatus Saxonie versus Ruiam et Pomeraniam atque marchiam Brandenburgensem tendentes sub eodem limite claudi debent et comprehendi, was auf dasselbe hinauskommt. Zunächst hatten nun freilich diese gegenseitigen Rechtsansprüche nur auf dem Papier gestanden, es handelte sich um Missionsgebiet, das bisher weder von der einen noch anderen Seite in Angriff genommen worden war. Praktisch wurden sie erst, als die kirchliche Versorgung dieser Grenzgebiete ins Werk gesetzt werden mußte, d. h. mit dem Eintritt der Kolonisationsbewegung in dieselben. Nun kam es zu einem zwischen den beiden Bistümern bei der Kurie geführten Prozeß, der sich Jahrzehnte hinzog und erst 1252 durch einen Vergleich sein Ende fand, in welchem allerdings der Havelberger den Löwenanteil der Beute davontrug, obgleich die Arbeit in den strittigen Gebieten, soweit es sich erkennen läßt, von dem Schweriner geleistet worden war; 1227 (341) hören wir zum ersten Male von dem schwebenden Prozeß; es ergeht ein Interlokuturteil; leider wissen wir nicht, welchen Inhaltes. Politisch standen diese strittigen Gebiete unter mecklenburgischer Herrschaft. Von hier kam denn auch der Strom der Einwanderer, der sie besetzte. Die Besiedelung der Länder Brenz und Ture wird im wesentlichen gleichzeitig mit der von Parchim und Plau, deren südlichsten Teile sie bilden, stattgefunden haben, d. h. im 3. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts. Ein Zeichen davon finden wir in der 1219 erfolgten Schenkung des Dorfes Cesemow (= Michaelsberg, bei Karbow in der Ture gelegen) an das Michaeliskloster in Lüneburg. Dagegen scheint die von Magdeburg und Stendal aus vorschreitende Besiedelung der Mark Brandenburg damals noch nicht bis in die nördlichen Grenzstriche der Priegnitz vorgeschritten zu sein. Das ganze 13. Jahrhundert hindurch stand diese nur mittelbar unter der Hoheit der Markgrafen, teils - die alten Burgwarde von Wittstock und Putlitz - gehörten sie dem Havelberger Bistum, teils stand sie unter der Herrschaft mächtiger Familien, wie der Herren von Plote u. a. (Riedel: Die Mark Brandenburg im Jahre 1250. I, 303 f.). Blumenthal (2 Meilen südöstlich von Pritzwalk) soll zwar schon vor 1200 mit Patronat an den Johanniterorden gekommen sein (a. a. O. 302), und würde ein frühes Vordringen deutscher Kolonisten wenigstens bis in diese Gegend beweisen, aber Wittstock erhielt erst 1248 (a. a. O. S. 292), Pritzwalk 1256 (S. 297), das südlicher gelegener Kyritz 1237 (S. 303) Stadtrecht. Die


|
Seite 80 |




|
Entwickelung der Kolonisation war also hier, wie es scheint, gegen Parchim, Plau, Malchow um ein bis zwei Jahrzehnte zurück. Dem entspricht es denn auch, daß für die zunächst in Frage stehende Periode bis ca. 1235 noch fast alle kirchlichen Nachrichten für diese Gebiete fehlen. Immerhin zeigt die Gründung des Nonnenklosters Marienfließ all der Stepenitz unmittelbar an der mecklenburgischen Grenze im Jahre 1231 (Hauck, K.=G. Deutschl. IV, 979), daß die Kolonisation nun auch hier angelangt war und mit ihr auch die kirchliche Versorgung jetzt die Grenze erreicht hatte. Von einem Versuch, dieselbe in den zwischen Havelberg und Schwerin strittigen Gebieten in Angriff zu nehmen, hören wir nichts. Schon die politische Zugehörigkeit derselben zu dem Lande des mit Brunward eng verbundenen Borwin hätte ihn überdies unmöglich gemacht. Aber was Havelberg so oder so nicht vermochte, das war von Schwerin aus bereits begonnen.
Wir haben oben wahrscheinlich zu machen gesucht, daß die Errichtung der ersten Kirche in Parchim schon auf Berno zurückgeht, mindestens aber in die Zeit vor der deutschen Einwanderung fällt. Der Bereich aber, in dem der an ihr stehende Priester wirkte, und daher später auch ihr Kirchspiel, griff auch auf das linke Ufer der Elde über, und als Brunward im Jahre 1229 (370) das übergroße Kirchspiel teilte, errichtete er in dem linkseldischen Teil desselben die beiden neuen Pfarren Klockow und Damm. Wie ebenfalls oben bemerkt, setzt aber diese Teilung voraus, daß das Kirchspiel Parchim damals schon nach allen Seiten abgegrenzt war, also Nachbarkirchspiele schon vorhanden waren, und das gilt natürlich auch für den linkseldischen Teil desselben; er besaß also schon eine von Schwerin ausgegangene Organisation. Dasselbe gilt aber weiter für den linkseldischen Teil des Landes Ture, denn wenn Brunward 1235 (436) dem rechts der Elde gelegenen Kirchspiel Kuppentin auch drei linkseldische Dörfer, Bobzin' Broock und Wessentin, bestätigt, so liegt in dieser Abgrenzung, daß auch links der Elde noch mindestens ein Kirchspiel schon bestand, und Brunwards Tätigkeit als zuständiger Bischof sich auch hierhin erstreckte, wie das denn schon für 1219 aus der Schenkung von Cesemow an das Michaeliskloster (260) hervorgeht: Brunward mußte dieselbe mit seinem Banne konfirmieren. Er ist es denn auch, der 1230 (376) mit den Fürsten Johann und Pribislav einen Zehntvertrag über das Land "Warnow an beiden Seiten der Eldene und im Lande Brenitz abschließt, nach welchem die Fürsten den Zehnt der ritterlichen Lehngüter und vom übrigen Zehnt die Hälfte, Brunward den


|
Seite 81 |




|
Rest erhalten soll. Freilich, wenn sich hier die Bestimmung findet, daß die Fürsten dem Bischof seinen halben Teil des Zehnten "verschaffen" sollen, so könnte man vermuten, daß diese Bestimmung gegen den Havelberger Bischof gerichtet gewesen sei als den tatsächlichen Besitzer. Allein, wenn die Fürsten auf Seite Brunwards standen und, wie die Urkunden von 1219 und 1229 zeigen, immer gestanden hatten, dazu die kirchliche Versorgung von ihm ausging, war der Havelberger gar nicht in der Lage, seine Ansprüche praktisch geltend zu machen. So wird diese Bestimmung nichts anderes zu bedeuten haben als der im Poeler Zehntvertrag sich findende Satz: et ipse (der Fürst) de altera medietate iustam decimam expedite nos habere efficiet, der sich gegen die "obstinatschen" Bauern richtet. Ebensowenig aber ist mit Rudloff ( Meckl. Gesch. I, 3 S. 160) aus der Schenkung der beiden bei Plau gelegenen Dörfer Gardin und Gaarz durch Borwin im Jahre 1223 (298 und 299) an das Havelberger Domkapitel zu schließen, daß man damals der Havelberger Kirche "die Diözesanrechte jenseits des Flusses nicht streitig gemacht habe". Die Urkunden von 1219, 1229 und 1235 zeigen deutlich genug, daß für die Fürsten vor und nach 1223 Brunward der zuständige Bischof war, und überdies lag Gardin wahrscheinlich auf dem rechten Ufer der Elde, also in unstreitig schwerinschem Gebiet.
Wenden wir uns nun weiter ostwärts zu den Ländern Röbel, Vipperow und Müritz, wo die Schwerinsche Grenze im Besuntwalde verlaufen sollte, so sind auch hier die ersten urkundlichen Nachrichten zugleich Zeugnisse, daß Brunward es war, der hier faktisch Diözesanrechte ausübte, und die kirchliche Versorgung in Angriff nahm. Im Beginn des vierten Jahrzehntes des 13. Jahrhunderts drang die mecklenburgische Kolonisation auch in die Gegend des Besuntwaldes vor. Nicolaus von Werle schenkte 1233 (414, 415) dem Kloster Amelungsborn dort den See Dranse mit dem zugehörigen Bache und 60 Hufen , und das Kloster muß die Schenkung bald in Besitz genommen haben ; neun Jahre darauf finden wir hier den Klosterhof Drans (537) . Wenn nun Nicolaus 1233 seiner Schenkung hinzufügt: Sane partem decime de prefatis bonis nos contingentem eidem ecclesie contulimus, und zwei Monate darauf Brunward auf die Verwendung. des Amelungsborner Geschäftsträgers, des in Satow stationierten Mönches Stephan (cf. 365, 429, 454, 556 f.), dem Kloster den Zehnt von der Schenkung des Fürsten verleiht (418), so liegt hierin erstens, daß zwischen Brunward und Nicolaus von Werle ein Zehntvertrag über jene Landstriche abgeschlossen worden war, nach


|
Seite 82 |




|
dem ein Teil der Zehnten dem Fürsten zustand. Dann, da diese Zehntverträge durchgängig im Laufe der Kolonisation erfolgten, mit dieser aber die kirchliche Einrichtung Hand in Hand ging, so ist es Brunward, der hier die ersten Pfarren errichtete und als der zuständige Bischof handelte. Wann dieser Vertrag geschlossen worden war, wissen wir nicht. Jedenfalls aber sah Amelungsborn noch 1233 Brunward als den rechtmäßigen Bischof an und ließ sich von ihm den Zehnt schenken; er wird daher auch faktisch noch im Besitze der Diözesangewalt gewesen sein. Brunward sah auch hier in seinen Ordensgenossen "socios laboris", Pioniere des Christentums (418). Ebenso ist er es, der noch 1237 (462) zu der Schenkung des Fürsten Nicolaus an Doberan über 50 ostwärts an den Amelungsborner Besitz anstoßende Hufen am Zechlin den Zehnt hinzufügt. Zechlin aber gehörte nach ebenderselben Urkunde schon zum Lande Turne, in welchem das schwerinsche Kloster Dobbertin schon vor 1237 Lärz und Schwarz mit 70 Hufen besaß, welche nordwärts an den Doberaner Besitz anstießen und an welche sich endlich ebenfalls im Lande Turne die große Schenkung der Söhne Borwins von 1227 an den Johanniterorden in und um Mirow anschloß (342, 344). Um 1227 war diese Gegend noch nicht mit Deutschen besetzt. Die Besiedelung ist erst das Werk des Ordens, der zwischen 1227 und 1242 hier einen Hof (Curia, noch keine Komturei) anlegte.
Bald darauf, wohl nachdem Circipanien und mit ihm auch die Abtei Dargun wieder mecklenburgisch geworden war, erhielt auch diese in dieser Gegend, nordwärts von Mirow um Kratzeburg, Besitz (777, 789). Auch hier erscheint Brunward als der zuständige Bischof ; von ihm besaß Dargun den Zehnten von Kratzeburg (= Werder; 777). Diese "Dörfer auf der Heide" aber, später zur Komturei Mirow gehörig, werden nicht mehr zum Lande Turne zu rechnen sein, sondern zum Lande Wustrow (Penzlin), welches sie mit Langhagen, Liepen, Speck und Boek von drei Seiten umfaßt (Vogtei Penzlin; Kaiserbede 1496; Landbede 1518 und 1567 im Archiv Schwerin), während das zur Vogtei Wredenhagen=Röbel gehörige Turne nur bis Klopzow und Roggentin reicht (Amt Wredenhagen: Landbede 1531/34, 1539 und 1567) und das Amt Wesenberg mit Babke und Leussow an diese Dörfer grenzt (Amt Wesenberg: Landbede 1505). Somit ist es auch im Lande Penzlin der Schweriner Bischof, auf den die erste kirchliche Organisation zurückzuführen ist, mag dieses nun bereits vor 1226 in mecklenburgische Hände gekommen sein oder erst 1236


|
Seite 83 |




|
infolge des Kremmener Vertrages. Die Sache ist zweifelhaft; für ersteres spricht, daß die Urkunde 987 Heinrich Borwin II. als Gründer der Stadt Penzlin ausgibt, aber nach Techen (M. Jbb. 70, 182) ist die Berufung auf Borwin in dieser Urkunde möglicherweise unbesehen aus der Güstrower Urkunde von 1228 (359) herübergenommen und daher die Gründung der Stadt durch Borwin keineswegs sicher.
Endlich wird auch der 1239 (499) vorkommende Präpositus Nicolaus von Röbel nicht, wie das Namenregister des Urkundenbuches annimmt, der erste havelbergische Präpositus sein, sondern der Schweriner, da sich unter den gleichzeitigen Schweriner Domherren einer gleichen Namens findet - ein Nicolaus ist 1246 Domherr und 1248 - 61 Scholastikus in Schwerin - , nicht aber unter den Havelbergern, soweit das M. U.=B. darüber Auskunft gibt. Die Schweriner Organisation war hier eben die erste, nicht die Havelberger.
Es erübrigt nun noch einen Versuch zur Bestimmung der Kirchen zu machen, welche in diesen Grenzgebieten in unserer Epoche noch von Schwerin aus errichtet sind.
Im Lande Brenz wurden, wie gesagt, 1229 die beiden Kirchspiele Damm und Klockow von Parchim abgezweigt, ersteres ein kleines Kirchspiel von 3 oder, wenn Garwitz ursprünglich auch dahin gehört hätte, 4 Ortschaften hart an den beiden Eldeufern, letzteres, aus, einer Reihe später in der Feldmark der Neustadt Parchim und in den Waldungen des Sonnenberges untergegangenen Dörfern gebildet, welche die Stadt Parchim 1366 aus der Erbschaft der Mallin (6288) erwarb (9449, 9457), ein wenig größer, die 5 Dörfer Klockow, Voddow, Lübow, Brokow und Slepkow umfassend, falls nicht das eine oder andere von ihnen schon zur Nachbarpfarre Slate gehörte. Dotiert wurden beide von den - adligen - Herren des Ortes (patroni), d. h. Klockow wohl von den von Mallin, die schon damals im Lande Parchim ansässig waren (370). Wir sehen also auch hier südlich der Elde um 1229 bereits - deutschen - Adel ansässig und bei der Errichtung von Kirchen beteiligt. Es müssen nun aber, wie oben ausgeführt, damals schon mehr Kirchspiele im Lande Brenz bestanden haben. Die Nachrichten sind äußerst dürftig, auch die Kirchenbauten, fast alle ärmliche Fachwerkgebäude oder neueren Datums, lassen uns so gut wie ganz im Stich. Die Kirchspiele sind zahlreich und meist klein, die von Zierzow, Pankow, Balow, Dambeck, Klüß, Werle auf das Dorf selbst beschränkt, andere wie Brenz, Spornitz, Neese und das eingegangene von


|
Seite 84 |




|
Steinbeck, zählen nur zwei Ortschaften, auch hier also wieder das Bild der späteren Kolonisation. Doch fehlt es nicht ganz an Spuren älterer größerer Kolonisationspfarren. Als solche charakterisiert sich die Nachbarpfarre von Klockow, Slate, mit ihren 6 Ortschaften und weiter deren Nachbarin Marnitz die sogar 10 umfaßt. Begegnet nun urkundlich auch erst 1384 (Schlie V, 498) der Pfarrer von Slate (der Mann fehlt im Register des Urkundenbuches), so läßt sich die Existenz der Pfarre doch indirekt schon für 1229 erweisen. Wäre sie 1229 noch nicht dagewesen, so müßten ihre Dörfer damals nach Klockow eingepfarrt und Slate später von diesem als Tochterkirche abgezweigt worden sein; die Nachbarin auf der andern Seite, Marnitz, kommt, weil ein eigenes "Land" für sich bildend, hierfür nicht in Betracht. Filiale von Klokow aber war Slate nicht, denn dann hätte der Pfarrer von Parchim wie über die Tochter von Damm, Matzlow (Schlie IV, 492), so auch über die von Klockow das Patronat haben müssen; es war jedoch landesherrlich (Visit. 1534). War also Slate schon vor 1229 die südlich an die alte Parchimer Parochie grenzende Pfarre, so werden wir die westliche Nachbarpfarre in dem alten Hauptort des Landes, in Brenz mit seinem Burgwalle, suchen dürfen, obgleich das Kirchspiel nur aus zwei Dörfern besteht und seine Kirche erst 1368 (9732 f.) urkundlich vorkommt. Im Süden scheint das Marnitzer Kirchspiel, noch jetzt von auffallender Größe, einst das ganze Ländchen umfaßt zu haben; die von Suckow und Brunow erscheinen aus ihm herausgeschnitten, wodurch es seine eigentümliche wunderliche Gestalt erhielt. Es erscheint somit fast als Burgwardkirchspiel und gehört daher sicher in die Zeit der ersten kirchlichen Einrichtung bei noch spärlicher Einwanderung. An Nachrichten fehlt es freilich ganz, und auch die Kirche - ein dürftiger Fachwerkbau - sagt nichts aus.
Im übrigen dürfen wir uns die Errichtung von Pfarren unter Brunward hier in den äußersten Grenzgegenden noch nicht allzuweit vorgeschritten denken. Die deutsche Einwanderung hat nur in ihrem nördlichen Teil festen Fuß gefaßt, Slate und Damm erscheinen auf der Witteschen Karte als rein deutsche Orte und Brenz, Spornitz, Siggelkow zeigen nur spärliche wendische Reste. Aber südlich von ihnen drängen sich die Hakenhufendörfer und diejenigen, die Pauschalbede zahlten, und zeigt die Bevölkerung durchweg starke wendische Bruchteile, so selbst in Marnitz. Zu Brunwards Zeit werden sie noch so gut wie ganz wendisch geblieben sein. Dann aber wird, wie der Blick auf das westliche


|
Seite 85 |




|
wendische Nachbargebiet - die Jabelheide - lehrt und sich weiter im östlichen, dem südlichen Ture, ebenfalls zeigen wird, die kirchliche Organisation hier noch einstweilen im Rückstand geblieben sein und die meisten Pfarren erst der späteren havelbergischen Zeit angehören. Nur mit der größten Reserve wage ich, die größeren unter ihnen, die landesherrlichen (Visit. 1534) Pfarren von Muchow und Brunow und die ritterlichen von Herzfeld und Möllenbeck, als vielleicht noch dem Ende der Brunwardschen Zeit angehörig, zu vermuten. An Daten fehlt es freilich ganz.
Deutlicher sehen wir in der südeldischen Hälfte des Landes Ture. Auch hier hat die deutsche Einwanderung die südlichen Grenzdörfer nicht erreicht; sie blieben auch später noch wendisch. Was die Versorgung mit Kirchen betrifft, so bestanden um 1235 die Kirchen von Lübz, Barkow und Broock sicher noch nicht, da die später hier eingepfarrten Dörfer Bobzin, Broock und Wessentin noch zum Kirchspiel Kuppentin gehörten (436). Weiter aber fehlten ebenfalls noch die Kirchen von Kreien, Karbow, Stüwendorf (bei Vietlübbe untergegangen) und Ganzlin, alles Patronate des Klosters Stepenitz, das erst nach 1274 hier Erwerbungen zu machen begann (1322), und ausschließlich Klostergrund umfassend. Michaelisberg (Cesemow), die Schenkung Borwins an das Michaeliskloster in Lüneburg, in dem seines Vaters Gebeine ruhten, besaß zwar 1265 (1049) eine Pfarrkirche, aber es ist fraglich, ob diese über das Jahr 1256 hinaufreicht. Das Kloster hatte in diesem Jahre das Dorf zur Hälfte an die von Bodenstedt, zur andern an die von Wittenlog verliehen (766). Als nun erstere Lehnsmänner erbenlos gestorben waren, wollte das Kloster das Lehen derselben zurücknehmen, stieß jedoch auf Schwierigkeiten, die endlich 1265 (1049) dahin geschlichtet wurden, daß das Kloster die eine Hälfte des Dorfes zurückerhielt und zugleich das Patronat ihm abgetreten (cedat nostre donationi) wurde. Daraus scheint hervorzugehen, daß die Kirche erst eine Stiftung der v. Bodenstedt, vielleicht in Gemeinschaft mit den Wittenlog, war, da das Patronat sonst schwerlich in ihren Händen gewesen sein würde.
Nach alledem bleiben für unsere Periode nur die beiden herzoglichen (Visit. 1534) Pfarren von Vietlübbe und Görgelin übrig. Letzteres, bei Retzow untergegangen (cf. Schlie IV, 615), umfaßte die Kirchspiele Gnewsdorf und Retzow (1534 und 1541 Visit.). Als Kirche begegnet es 1534 zum ersten und letzten Male. Besser sind wir über Vietlübbe unterrichtet, das zwar seit 1274 und 1288 mit dem dorthin eingepfarrten Damerow


|
Seite 86 |




|
wie die Nachbardörfer ebenfalls in den Besitz von Kloster Stepenitz übergegangen war (1322), dessen Patronat jedoch 1534 in den Händen der Landesherren ist. Die Kirche ist also keine Gründung des Klosters, sondern wird 1274 schon bestanden haben und im Besitz der Fürsten geblieben sein. Da jedoch Vietlübbe und Görgelin einander zu nahe liegen, so ist anzunehmen, daß 1235 erst eines von beiden eine Kirche hatte.
Ostwärts vorschreitend kommen wir weiter zum Lande Müritz, der späteren Vogtei Röbel, welche auch das östliche Ufer des Müritzsees und das Gebiet der Komturei Mirow umfaßte. Die Nachrichten über die Kirchen sind hier wieder dürftig. Über die ritterlichen Patronatskirchen von Karchow, Finken, Dammwolde, Massow und Grabow gibt es überhaupt keine mittelalterlichen, ihre Kirchenbauten sind neueren Datums und lassen nichts erschließen. Kleine Kirchspiele von nur 1 - 2 Ortschaften, wie sie sind, dürften sie nicht zu den ältesten gehören. Die über die drei weiteren ritterlichen Kirchen Ludorf, Nätebow und Leizen vorhandenen Daten aber lassen diese als jünger wie unsere Periode erscheinen. Die Kirche von Ludorf ist 1346 nicht nur geweiht, sondern auch gegründet (6649; man beachte das "primo"). Der mit seiner romanischen Apsis älter erscheinende Bau ist ein unglücklicher Versuch in einer Zeit, wo man es nicht mehr verstand, romanisch zu bauen. Die Kirche von Nätebow begegnet zuerst 1331 (5218). Die hier beurkundete Stiftung von 3 Vikareien in der Rätebower Kirche fällt zwischen 1284 und 1309 (erstes und letztes Datum des Stifters), nicht wie Schlie (V, 520) irrtümlich annimmt, erst um 1331, wahrscheinlich aber auch die Gründung der Kirche selbst, da das Patronat ursprünglich (Visit. 1534) von Bunesch war, das Kirchspiel nur die drei im Besitz der Familie befindlichen Dörfer Nätebow, Bollewiek (5218) und Spitzkuhn (2825, 6058) umfaßt, die von Bune aber erst mit Conrad (1284 - 1309), der Werlescher Rat war, 1 ) in diese Gegend gekommen zu sein scheinen, und dieser erst 1302 in Spitzkuhn Besitz erwarb. Dem entspricht denn auch die in die letzte Zeit des Übergangsstiles gehörige Kirche (Schlie V, 521). Endlich Leizen erscheint zwar 1298 (2486) als selbständige Pfarrkirche und hat ebenfalls einen Bau des Übergangsstiles, kann aber, da es garkein Kirchspiel hat, unmöglich als eine der Anfangskirchen angesehen werden, wie es denn auch der Lage nach als aus dem von Dambeck herausgeschnitten erscheint. Es bleiben sonach die landesherrlichen Kirchen Alt= und Neu=Röbel, Wredenhagen mit Zepkow, Vipperow,


|
Seite 87 |




|
Dambeck (alle nach Visit. 1534), Kiewe (3475), Kambs (4222) und Melz (das Patronat ist zwar 1534 nicht mehr herzoglich, sondern Hahn'sch, aber die von Hahn sind erst nach 1410 in Besitz des Ortes gekommen, vorher war er im Besitz der Landesherren - er gehörte zum Leibgedinge der Elisabeth v. Werle (1054) =, also muß auch das Patronat ursprünglich diesem gehört haben). Endlich rechnen wir zu ihnen auch Wendisch=Priborn, obgleich es 1541 den von FIotow und von Rohr zustand.
Von diesen wird zunächst die Kirche von Alt=Röbel mit ihrem größeren Landkirchspiel als die älteste anzusehen sein. Ihre Errichtung muß in die allererste Zeit der Kolonisation fallen, wenn nicht etwa in ihr eine noch ältere Burgwardkirche zu sehen ist, da die Gründung der Stadt Neu=Röbel noch auf Heinrich Borwin II. zurückgeführt wird (911), also spätestens 1226 erfolgt ist. Letztere aber wird bei ihrer Gründung auch ihre Kirche erhalten haben, die freilich wohl zunächst - solange auch Neu=Röbel noch dem Schweriner Bischof unterstand - mit der von Alt=Röbel verbunden blieb, ebenso wie die von Neu= Malchow mit der von Alt=Malchow. Von den südlich gelegenen Landkirchspielen gehört Dambeck fraglos der ersten Einrichtung an, obgleich sein Pfarrer urkundlich erst 1298 (2486) auftritt. Seine noch ohne jede Anwendung von Ziegeln aus sorgfältig geschichteten Granitquadern erbaute Kirche gehört einer früheren Stufe des Übergangsstiles an und ist schwerlich nach der Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut. In ihrer Anlage - Chor und breiteres Gemeindehaus - erweist sie sich überdies als für ein größeres Kirchspiel bestimmt. Ebenso dürfen wir für Vipperow, den alten Hauptort der Gegend mit seinem Burgwalle (Schlie V, 597), annehmen, daß seine Kirche mit zu den ältesten gehört, obgleich der jetzige Bau, ebenfalls dem Übergangsstil angehörig, um etwas jünger erscheint als die Dambecker Kirche. In den Ziegel=Leibungen der Fenster und Türen zeigen sich schon die Wirkungen der Ziegelbauten von Röbel (Schlie V, 572). Südlich von beiden liegen die 4 kleinen landesherrlichen Kirchspiele Kambs, 1270 (1190), Melz, 1298 (2486), Kiewe, 1311 (3475) zuerst genannt, und (Wredenhagen=) Zepkow, dessen Kirche ein noch dem Übergangsstil angehöriges Fundament zu haben scheint (Schlie V, 561). Ob von ihnen schon eins unserer Zeit angehört, muß fraglich bleiben. Wahrscheinlich sind sie alle jünger. Endlich bleibt noch Wendisch=, ursprünglich Groß= oder Deutsch=Priborn (Schlie IV, 623), welches einst noch über die jetzige mecklenburgische Grenze hinausgriff und Burg und Stadt (3943 vom Jahre 1317)


|
Seite 88 |




|
Meyenburg, dazu mit Darze einen Teil des jetzigen Stuerschen Kirchspiels und das bei Priborn untergegangene Loitz, umfaßte (Visit. 1541/42; Schlie IV, 623, 625), also ein verhältnismäßig großes Kirchspiel war. Freilich gibt es über seine Kirche keine mittelalterlichen Nachrichten, ist das Kirchengebäude aus Fachwerk und das Patronat wenigstens 1534 nicht mehr landesherrlich. Dennoch dürfen wir es um des großen Kirchspiels willen und weil es sonst im westlichen Teil des Landes noch an jeder Kirche gefehlt haben würde, vielleicht auch noch neben Alt=Röbel, Dambeck und Vipperow den Kirchspielen der schwerinschen Epoche zurechnen. Diese 4 sind denn auch die einzigen, die eine Größe von 4 Ortschaften und darüber erreichen, also noch als Reste früherer größerer Kolonisationskirchspiele angesehen werden können. Bei dem von Vipperow ist dabei zu beachten, daß das erst 1346 errichtete zur Pfarre erhobene Ludorf vor diesem Jahre auch noch zu Vipperow gehört haben muß, da keine andere Havelberger Pfarre an dasselbe angrenzt. Dambeck aber umfaßte einst Minzow und Bütow (Visit. 1534; Schlie V, 526 f) und wohl auch die beiden der Lage nach aus ihm herausgeschnittenen Leisten und Karchow.
Südlich an diese Kirchspiele grenzte das ungeheure Gebiet des Besuntwaldes, welches Nicolaus von Werle zum größten Teil den kolonisationseifrigen Cisterziensern zur Urbarmachung angewiesen hatte. Altenkamp hatte seinen Anteil 1232 (410) um Mönchshof, Amelungsborn 1233 (414) um Dranse, Doberan wohl zur selben Zeit um Zechlin (462), desgleichen Dobbertin, an letzteres grenzend, um Lärz und Schwarz vor 1237 (469), der Johanniterorden um Mirow 1227 (342) und Dargun um Kratzeburg wahrscheinlich bald nach 1236 erhalten. Im Gebiet von Amelungsborn findet sich schon 1242 in Dranse eine curtis, d. h. ein von Laienbrüdern bewirtschafteter Klosterhof (537), und auf diesem der Cisterzienserregel gemäß fraglos auch eine Kapelle und ein Priester. Ob auch Doberan und Altenkamp zur selben Zeit ihren Besitz schon unter die Rodehacke genommen und Ackerhöfe angelegt hatten, ist unsicher; es fehlt an Nachrichten darüber, und ebenso für den Dobbertiner Besitz. Doch ist hier sicher, daß dieses seine Kirchen in Lärz und Schwarz erst später gebaut hat; 1263 (983) fehlen sie noch unter den Patronatskirchen des Klosters. Auch ob die Johanniter in Mirow schon in unserer Periode eine Kirche erbaut haben, bleibt unsicher; 1227 sollte ihnen das geschenkte Land noch erst angewiesen werden (344); erst allmählich rundeten sie ihren Besitz ab (1199); 1242 (541) haben sie einen Hof in Mirow, aber noch ist das ganze Dorf


|
Seite 89 |




|
nicht in ihrem Besitz; 1270 (1199) sind Komturei und Pfarre vorhanden, aber noch ist die Besiedelung nicht vollendet.
Dagegen darf vermutet werden, daß im Gebiete der jetzigen Kirchspiele Schillersdorf und Kratzeburg, das, wie oben gesagt, wohl schon in das Land Penzlin hineinreicht, die eine oder andere Kirche noch unter Brunward errichtet worden ist, wenngleich keine direkten Nachrichten vorliegen. Bischof Heinrich von Havelberg schenkte 1256 (777) dem Kloster Dargun den Zehnt der Dörfer "auf der Heide" (8640) Werder (=Kratzeburg), Arnoldesdhorp, Granzin, Techentin, Blankenfort "sicut antea possederant (die Mönche) a domino Zuerinensi". Es gab also schon vor 1252 (Vertrag Havelberg=Schwerin) hier deutsche Dörfer, deren Zehnten Dargun vom Schweriner Bischof besaß. Ja, diese Dörfer hatten, wenigstens zum Teil, schon deutsche Vorbesitzer gehabt, von denen sie das Kloster gekauft hatte (z. B. 789: Ludewin). Das führt auf eine Kolonisation spätestens in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre, wahrscheinlich aber schon früher. Vergaben nämlich die Fürsten um 1227 Mirow und zu Anfang der dreißiger Jahre die südlich an dieses grenzenden Heidegegenden zur Kolonisation, so wird die hier von Norden (Mecklenburg) vordringende Einwanderung eben damals diese nördlich von Mirow gelegenen Gebiete erreicht haben. Die deutschen Ansiedelungen aber können nicht ohne kirchliche Versorgung geblieben sein. Leider fehlt es fast ganz an mittelalterlichen Nachrichten darüber. Nur das wissen wir, daß Schillersdorf 1304 (2938) cum iure patronatus in ecclesia ibidem aus den Händen der Landesherren in die der Komturei Mirow überging, wir also Schillersdorf wohl als eine landesherrliche Kolonisationspfarre anzusehen haben. Daneben scheint Dargun auf seinem Gebiete die drei Pfarren Kratzeburg, Blankenförde und Granzin errichtet zu haben. Kratzeburg begegnet als selbständige Pfarre, soweit bekannt, zuerst 1579 (G. Krüger: Die Pastoren im Lande Stargard seit Reformation. M. Jbb. 69, 93), Blankenförde 1568 (Visit. - a. a. O. S. 13). Aber auch Granzin scheint ursprünglich selbständig gewesen zu sein, da es nach der Reformation bald zu Blankenförde, bald zu Kratzeburg gelegt wird (a. a. O. S. 13, 93). Endlich ist aber auch Babke als ehemals selbständige Pfarre anzusehen. Zum Klostergebiet gehörte es nicht mehr, also auch schwerlich zu einer der drei Klosterpfarren. Trotzdem finden wir es 1602 (a. a. O. S. 13) mit Blankenförde verbunden, später ward es mit Schillersdorf vereinigt. Über die Gründungszeit dieser Pfarren sind wir freilich im Dunkeln, zum mindesten eine von ihnen aber muß als um


|
Seite 90 |




|
1230 - 40 errichtet angesehen werden, am wahrscheinlichsten die landesherrliche von Schillersdorf.
Endlich aber gehört vielleicht auch das Kirchspiel von Alt=Gaarz an der Müritz zu diesen ältesten und noch der Schweriner Zeit entstammenden Pfarren, obgleich seine Kirche erst 1298 (2514) erwähnt wird. Sie geht damals, wie es scheint, aus dem Patronate des Landesherrn in das der Komturei Mirow über. Ihr Kirchspiel umfaßte 1541 (Visit.) Vietzen, Retzow und Kotzow. Retzow ging mit seiner Kapelle später zu Rechlin über, wohin es noch jetzt gehört, während Kotzow bei Gaarz verblieb. Da aber Kotzow durch Retzow vom Gaarzer Kirchspiel vollständig abgeschnitten wird, so kann die Zugehörigkeit von Retzow zu Gaarz nicht als eine um 1541 nur vorübergehend bestehende Verbindung angesehen werden, sondern muß Retzow von Anfang an zu ihm gehört haben. Da nun aber weiter die Nachbarkirchen von Lärz und Schwarz nachweislich erst zwischen 1263 und 1282 (siehe unten) gegründet sind und auch die kleine Kirche von Krümmel, über die es an mittelalterlichen Nachrichten leider fehlt, da ihr Kirchspiel nur das Dorf selbst umfaßt, gegenüber dem größeren Kirchspiel von Gaarz als jünger erscheint, alle diese Orte aber 1237 (469) vorhanden sind und nicht bis rund 1270 ohne kirchliche Versorgung geblieben sein können, zumal die deutsche Einwanderung zwischen 1237 und 1257 (790, 1347) auch hier Fuß gefaßt hatte, so muß Alt=Gaarz als der alte Kirchort dieses ganzen Gebiets angesehen werden und mag auch diese Pfarre noch in Brunwards letzte Jahre hinaufreichen und, vielleicht um die Zeit, als hier die großen Landschenkungen an die Klöster stattfanden, um 1230 bis 1235, gegründet sein.
Wenden wir uns endlich zum Lande Penztin, so muß die Kirche von Penzlin selbst, wenn anders es richtig ist, daß es schon vor 1226 durch die mecklenburgischen Fürsten zur Stadt erhoben wurde, was übrigens zu dem eben über den Beginn der Einwanderung in dem südlichen Nachbargebiet Gesagten stimmt, spätestens in diesem Jahre gegründet sein. Da ihr Kirchspiel auch eine Reihe von Dörfern umfaßt etwa 6 bis 7 ältere Ortschaften =, ist es kein nachgegründetes Stadt=Kirchspiel, sondern gehört zu denen der ersten Einrichtung. Daß wir ihr Patronat später in Händen des Stiftes Broda finden, hat so wenig Bedeutung wie der Umstand, daß dieses auch das von Waren besaß; es war Schenkung des Landesherrn. Dagegen ist die Kirche von Freidorf vielleicht wirklich eine Stiftung Brodas und gehört allem Anschein nach schon in unsere Periode. Sie


|
Seite 91 |




|
erhielt schon 1266 (1080) in Ankershagen eine Filiale, neben welcher sie selbst später eingegangen ist. Ihr Kirchspiel umfaßte also das jetzige von Ankershagen, vielleicht auch noch das von Rumpshagen. Freidorf aber mit 50 Hufen und 10 Hufen in Rumpshagen finden wir 1273 (1284) im Besitze von Broda, und zwar an Stelle der ihm ursprünglich in der Stiftungsurkunde versprochenen "Vilim et desertas villas quea Vilim inter fines Chotibanz Lipiz et Hauelam iacent" (135). Zur Wendenzeit hatte, wie wir gesehen, dieser Besitz nur auf dem Papier gestanden. Praktisch mußte die Frage nach demselben aber sofort werden, als die deutsche Einwanderung hierher kam und mit ihr
zugleich auch die Errichtung des Stiftes endlich realisiert wurde.
Damals muß auch das Abkommen zwischen dem Stifte Broda (Havelberg) und den Fürsten getroffen sein, nach welchem dieses an Stelle von Vielen und den Oedländereien das zu 50 Hufen gerechnete Freidorf und 10 Hufen in Rumpshagen, dazu die Patronate von Waren und Penzlin erhielt. Ersteres und somit auch seine Kirche ist also möglicherweise eine Gründung des Stiftes. Da jedoch zwar Freidorf selbst in seinem Besitz war, sein umfangreiches Kirchspiel - es umfaßte 7 - 8 ältere Ortschaften - aber in der Hauptsache aus Dörfern bestand, die dem Stifte nicht gehörten, so ist die Pfarre keine erst nachträglich auf Stiftsgrund für diesen errichtete, sondern eine der erst errichteten. Dann aber liegt die Annahme nahe, daß auch sie nicht erst von Broda errichtet ist, sondern eine landesherrliche Kolonisationspfarre war, deren Patronat wie das von Waren und Penzlin bei jenem Abkommen in den Besitz des Klosters überging.
Auch hier begegnen uns also Reste der bekannten größeren Kolonisationskirchspiele der ersten Periode. Die übrigen Kirchspiele sind kleinster Art, umfassen nur je 1 bis höchstens 2 Dörfer. Nur das landesherrliche von Groß=Luckow (2945) und das unter dem Patronat der von Peckatel (1317) stehende von Peckatel erreichen noch die Größe von 4 Ortschaften. Von letzterem gehen übrigens die beiden jetzigen Filialen Langhagen und Liepen ab; sie sind, da sie nach der Reformationszeit als vagierende Kirche bald bei Kratzeburg bald bei Blankenförde Anschluß suchten, bis sie endlich mit Peckatel vereinigt wurden (Krüger: M. Jbb. 69 S. 13, 93), als ursprünglich selbständige Kirchen anzusehen. Dagegen mag ein Teil des jetzigen Prillwitzer Kirchspiels, die Dörfer Hohen=Zieritz und Zippelow, vielleicht einst zu Peckatel gehört haben, da sie 1274 nicht zum Lande Stargard, sondern zum Lande Penzlin gehörten (1317) und es unwahrscheinlich ist, daß


|
Seite 92 |




|
die Kirchspielsgrenzen über die politischen hinausgriffen. Zudem waren sie ebenfalls im Besitz der von Peckatel und würde so das Peckateler Kirchspiel eine erwünschte Abrundung erhalten. Beide, das Kirchspiel von Groß=Luckow und das von Peckatel, obgleich ersteres urkundlich erst 1304 (2945) begegnet, letzteres wohl 1274 (1317), mögen vielleicht auch noch der schwerinschen Periode, vielleicht dem Ende der dreißiger oder dem Anfang der vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts, angehören.
Östlich und nordöstlich der Müritz dürfen wir also die Kirchen von Schillersdorf, Freidorf und Penzlin, vielleicht auch schon die von Alt=Gaarz, Kratzeburg, Peckatel und Groß=Luckow, als im Laufe der zwanziger bis vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts noch von Schwerin aus errichtet ansehen.
Bis an die Grenzen, die Brunward für sein Bistum behauptete, ging in der Tat auch seine Wirksamkeit, und war er es, dem man die erste kirchliche Versorgung verdankte. Dennoch sollten diese Grenzgebiete dem Bistum Schwerin wieder entrissen werden. Brunward hat es freilich nicht mehr erlebt. Solange er lebte, war es ihm gelungen, die Havelberger Ansprüche zurückzuweisen, ja in den letzten Jahren seiner Regierung scheint dieses den Kampf aufgegeben zu haben. Nach seinem Tode brach er von neuem aus. Inzwischen war nämlich die politische Lage eine wesentlich andere und für Havelberg günstigere geworden. Von den Enkeln Borwins war der älteste, Johann von Mecklenburg, wie wir gesehen, in dem gegen Kammin geführten Streit um die Sprengelgrenze Brunwards Verbündeter gewesen. Solange er die Vormundschaft über seinen jüngsten Bruder Pribislav führte, war er auch Havelberg gegenüber Brunwards natürlicher Rückhalt. Als nun aber Pribislav in demselben Jahre, in welchem Brunward starb, 1238, mündig ward und die Herrschaft über das Land Parchim selbst übernahm, suchte er im Gegensatz zu seinem Bruder Anlehnung an Brandenburg, wie er denn auch eine brandenburgische Edle als Gattin heimführte. Dementsprechend wird er auch für die havelbergischen Ansprüche zugänglicher gewesen sein als sein Bruder. Jedenfalls entstand zwischen ihm und Brunwards Nachfolgern bald genug eine immer schärfer werdende Spannung, die schließlich in offenem Kampf ausging. Ebenso aber scheint auch die Politik des zweiten der mecklenburgischen Brüder, des Nicolaus von Werle, welcher im Südosten des Landes regierte, von einem gewissen Gegensatz gegen die Ansprüche des Landesbischofs beseelt gewesen zu sein. Wir haben schon gesehen, wie sein Übertritt


|
Seite 93 |




|
auf die Seite des Bischofs von Kammin den faktischen Verlust von Circipanien für Schwerin besiegelte.
Bei dieser veränderten Lage lebten nun aber sofort auch die havelbergischen Ansprüche auf die südeldischen Teile Mecklenburgs wieder auf. In den vierziger Jahren hören wir von neuem von päpstlichen Kommissaren, welche die Streitenden zitieren (520). Zugleich griff Bischof Wilhelm von Havelberg praktisch in die Verwaltung der beanspruchten Gebiete ein - offenbar im Einverständnis mit ihren weltlichen Herren und unter ihrem Schutze. Im Jahre 1242 (537) ist er es, der die einst von Brunward verliehenen Zehnten von Dranse dem Kloster Amelungsborn verleiht als ad nos pertinentes. Schon damals also muß dieses trotz seiner engen Verbindung mit dem Schweriner Bistum ihn als den für diese Gegenden zuständigen Bischof anerkannt haben; offenbar war er in ihrem Besitze und mindestens seit 1249 (634 vgl. mit 748) hatte er einen eigenen mit den Rechten eines Archidiakons versehenen Propst zur Ausübung seiner Ansprüche in Neu=Röbel. Auch hier lief also die Sache für Schwerin ungünstig. Zwar Bischof Dietrich, der schließlich Kammin gegenüber nachgegeben hatte, gab hier den Kampf noch nicht auf, aber sein Nachfolger Rudolf entschloß sich 1252 zu einem Vergleiche, in dem er fast das ganze strittige Gebiet verloren gab (710), und Innocenz IV. bestätigte denselben (549). Leider sind wir auch über diesen Ausgang nur sehr mangelhaft unterrichtet, und gelingt es nur lückenhaft, die Sprengelgrenze, wie sie durch ihn endlich festgelegt ward, klar zu stellen. Im Lande Parchim und Ture scheint den Ansprüchen Havelbergs gemäß der Eldelauf im allgemeinen die Grenze gebildet zu haben. Von den durch ihn begrenzten Kirchspielen gehören Muchow (Visit. 1534), Brenz (8818), Spornitz (7934, 11320) Siggelkow (1217, 1280), sicher zu Havelberg. Auch Herzfeld war havelbergisch (7525: Karrenzin); von Slate läßt es sich leider nicht nachweisen. An zwei Stellen aber überschritt das Bistum Schwerin den Flußlauf, und zwar in der Ture von Plau bis Lübz und bei Parchim. Dort reicht das schwerinsche Kirchspiel Plan südwärts über die Elde hinüber und schließt sich an dieses das ebenfalls schwerinsche Kirchspiel Barkow. - 1255, also 3 Jahre nach dem Grenzvertrage, verleiht Bischof Rudolf von Schwerin an Pribislav von Parchim neben dem Zehnt von Plau auch den von "Lelecowe", d. h. dem nach Barkow eingepfarrten Lalchow, und am 29. Juni 1519 investiert der Archidiakon von Waren einen Kleriker mit einer Kommende in der Marienkapelle: "prope et extra villam


|
Seite 94 |




|
Berckow nostri districtus." (Schwerin, Archiv.) Weiter aber ist das größere Kirchspiel Lübz fast zur Hälfte auf dem rechten Ufer der Elde gelegen, und seine dortige Filiale Lutheran scheint nie mehr als eine Filiale gewesen zu sein, da ihre geringe Ackerkompetenz - 9 Morgen für eine selbständige Pfarre bei weitem nicht reicht, was sie gewesen sein müßte, wenn die Elde hier die Grenze gebildet hätte. Demnach ist anzunehmen, daß auch Lübz noch schwerinisch war, und damit stimmt nicht nur, daß 1235 (436) das jetzt hierhin gehörige linkseldische Bobzin zu dem Schweriner Kirchspiel Kuppentin gehörte, sondern auch jenes von Schlie häufig zitierte "Verzeichnis der Pfarrlehen und Kirchen in dem schwerinschen Stiftssprengel gehörig" (Archiv Schwerin), welches Lübz als schwerinisch aufführt. Nun ist dieses Verzeichnis - es stammt von 1571 und trägt die Unterschrift: "das kegenwertige Verzeichnus mit des Stifts Schwerin übergebener Matrikul im Originali übereinstimbt bezeuge ich Franz von Stiten mit eigener Hand . . ." - zwar recht fragwürdiger Natur; es ist nicht nur sehr unvollständig, sondern es wirft auch die Pf arren der verschiedenen Archidiakonate, obgleich es dieselben nach diesen geordnet bringen will, häufig durcheinander; aber abgesehen von den beiden fraglichen linkseldischen Pfarren Lübz und Klockow führt es nur Pfarren auf, deren Zugehörigkeit zu Schwerin fraglos ist. Es scheint also in diesem Punkte zuverlässig zu sein. Muß also danach Lübz als zum Bistum Schwerin angehörig angesehen werden, so wird das auch für das kleine zwischen Lübz und Barkow eingekeilte Kirchspiel Broock zu gelten haben, welches 1235 ebenfalls noch zu Kuppentin gehörte. Havelbergisch dagegen ist das südlich an Plau und Barkow grenzende Kirchspiel Gorgelin=Gnevsdorf; eine vom 10. Mai 1509 aus Ostia datierte Bannbulle gibt Gorgelin und ein bischöfliches Schreiben von 1511 Gnevsdorf als solches (Archiv Schwerin, Kirchenakten). Damit ist der Lage nach auch Ganzlin als havelbergisch gegeben, und wahrscheinlich auch Karbow und Kreien, obgleich es sich urkundlich nicht nachweisen läßt. Ich ziehe also die Grenze zwischen Plau , Barkow, Brock und Lübz einer= und Görgelin, Karbow und Kreien andererseits.
Ebenso überschritt die Schweriner Sprengelgrenze bei Parchim den Eldelauf; das auf dem linken Ufer desselben gelegene Kirchspiel der Neustadt Parchim war entgegen der Behauptung Rudloffs (Meckl. Gesch. in Einzeldarstell. Heft 3, 62 und 122), wie zahlreiche Urkunden beweisen (7200, 3176, 4513 usw.), schwerinisch, und nach jenem eben genannten "Verzeichnis der Pfarrlehen usw." ist auch das angrenzende Kirchspiel Klockow noch zum Bistum


|
Seite 95 |




|
Schwerin zu rechnen. Eigentümlich liegen die Dinge in Damm, das wie Klockow zu den Patronatskirchen des Pfarrers von St. Georg in Parchim gehörte. Sein Kirchspiel erstreckte sich auch auf die rechte Seite der Elde und umfaßte hier das Dorf Malchow, in welchem 1325 (4620) Bischof Johann von Schwerin eine Kapelle weihte und als filia mit der mater von Damm verband. Danach möchte man annehmen, daß auch diese zweite Tochterpfarre von Parchim schwerinisch geblieben sei. Doch steht dem entgegen, daß ihre zweite Filialkapelle zu Matzlow 1399 (Schlie IV, 492) ausdrücklich als havelbergisch bezeichnet wird, und daß 1413 ein presbiter Havelb. diocesis als Pfarrer in Damm erscheint (Schwerin, Archiv). Die Schwierigkeit wird sich nicht anders heben lassen, als indem man annimmt, daß das Kirchspiel Damm havelbergisch war und der Bischof von Schwerin die Malchower Kapelle nur in Vertretung des Havelbergers weihte.
Auch zwischen dem Plauer See und der Müritz ist die Grenze nicht mit absoluter Sicherheit feststellbar. Schwerinisch waren hier Stuer (2016, Jbb. 26, 58) und Grüssow (747, 5233, 7660), dann aber auch das zwischen beiden eingekeilte Satow, und endlich Alt=Röbel (2505), wo ein Schwerinscher Archidiakon seinen Sitz hatte. Ihnen gegenüber lagen die havelbergischen Kirchspiele Leizen, Dambeck, Rätebow (2486, 5218), Ludorf (6649), Finken (Jbb. 28, 279) und Neu=Röbel (2505), wo der havelbergische Propst faß. Wohin das Kirchspiel Wendisch=Priborn gehört, vermag ich nicht nachzuweisen, doch darf der Lage nach angenommen werden, daß es havelbergisch war und daß die Grenze zwischen ihm und denen von Satow und Stuer sich zum Südende des Planer Sees hinzog. Von Röbel ab überschritt die Grenze nordostwärts die Müritz, um dann in derselben Richtung weiter zu laufen, links die schwerinschen Kirchspiele Federow (2016), Gr.=Dratow (1752), Schloen [Gr.=Plasten] (1 752), Varchentin [Kraase] (1852, 5433), Gr.=Varchow (4749) und, wie es scheint, Luplow (vgl. Grotesend, M. Jbb. 68, 258) lassend, rechts das havelbergische Ankershagen (1080), mit dem nach dem Visitationsprotokoll von 1574 und einem Bericht von 1589 (Schlie V, 347) Boeck und Speck im Mittelalter vereint waren und von dort aus durch Vikare verwaltet wurden. An Ankershagen schließen sich nordostwärts Möllenhagen und Groß=Flotow, für die es zwar keine direkte Nachricht über ihre havelbergische Zugehörigkeit gibt, die aber sowohl im Verzeichnis der Schweriner Pfarrlehne wie in den oben genannten Zehnthebungsregistern des Archidiakonates Waren fehlen und daher unbedenklich Havelberg zugeschrieben werden


|
Seite 96 |




|
können. Damit ist dann die oben beschriebene havelberg=kamminsche Grenze erreicht.
Wenden wir uns nun der weiteren Entwickelung, dieser für Schwerin verlorenen Gebiete zu.
In dem südlich der Elde gelegenen Teil des Landes Parchim (Marnitz und Gorlosen eingeschlossen) war die deutsche Besiedelung, je weiter man südwärts geht, desto mehr zurückgeblieben. Sie ist auch später nur wenig vorgerückt. Die Hauptmasse der Bevölkerung blieb wendisch. Die politische Zugehörigkeit dieser Landstriche blieb, bis sie Im Laufe des 14. Jahrhunderts definitiv an Mecklenburg kamen, wechselnd. Als Brunwardskirchen hatten wir hier die von Klockow, Damm, Slate, Brenz und Marnitz bezeichnet, es jedoch auch für die von Muchow, Herzfeld, Möllenbeck und Brunow als nicht ganz ausgeschlossen hingestellt, daß sie schon etwa dem 4. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts angehören. Jedenfalls sind sie nicht allzulange danach errichtet, obgleich die ersten urkundlichen Nachrichten erst sehr viel jünger sind. Die landesherrliche Kirche von Muchow begegnet erst 1534 (Visit.), und auch über die ritterliche von Möllenbeck fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten. Die von Herzfeld erscheint 1343 (7375) und die von Brunow ist wenigstens dadurch für das 13. Jahrhundert gesichert, daß ihre Filialkapelle zu Drefahl noch dem Übergangsstile angehört (Schlie III, 218). Es sind auch hier noch einige kleine landesherrliche Pfarren nachgegründet worden, und zwar wohl auf dem Gebiete der alten Brenzer Pfarre die beiden von Spornitz mit Dütschow und von Steinbeck mit Stolpe. Letztere begegnet zuerst 1293 (2203), erstere 1354 (7934). Weiter südlich ward die kleine Pfarre von Zierzow errichtet; sie erscheint ebenfalls 1354 (7934) zum ersten Mal, ohne daß wir ihre Gründungszeit näher bestimmen können. Neben diesen landesherrlichen aber erstand eine ganze Reihe von ritterlichen und klösterlichen Pfarren. Als erste von ihnen taucht schon 1256 (770) die von Siggelkow auf. Sie wird eine Gründung des Klosters Dünamünde sein, das in den Jahren 1235 und 1238 (426, 488) das Dorf und das benachbarte Zachow erworben und daselbst einen Klosterhof errichtet hatte. Zum Siggelkower Kirchspiel wird ursprünglich auch Gr.=Pankow gehört haben, das später wann läßt sich nicht feststellen, da es gänzlich an mittelalterlichen Nachrichten fehlt eine eigene Pfarre erhielt, deren Patronat sich 1541 (Schlie IV, 563) wie das von Siggelkow in den Händen der von Koppelow auf Mentin befand. Zwischen die landesherrlichen Pfarren Brenz, Steinbeck und Muchow einerseits


|
Seite 97 |




|
und Slate, Marnitz und Brunow andererseits schoben sich die ritterlichen von Herzfeld , Möllenbeck und Balow ein. Erstere beiden sind schon erwähnt, letztere ist für 1370 (Schlie III, 213) zuerst bezeugt. Da sie nur ein einziges Dorf umfaßt, wird sie zu den jüngsten gehören. Dasselbe mag auch für die beiden kleinen an Balow grenzenden ritterlichen Pfarren Neese und Werle gelten, über die es an mittelalterlichen Nachrichten ganz fehlt. Im Lande Marnitz ward neben Brunow die ritterliche Pfarre Suckow von der alten Landespfarre abgezweigt. Sie umfaßt noch 4 Ortschaften und wird daher nicht zu den jüngsten gehören. Urkundlich begegnet sie zuerst 1328 (4949), wo die von Hunger, welche ihre Gründer zu sein scheinen, das Patronat an Marienfließ abtraten, nachdem dieses kürzere oder längere Zeit vorher schon in den Besitz des Dorfes gelangt war (vgl. 5123). Weiter mag auch noch Dambeck zum Lande Marnitz gerechnet werden, ein kleines, nur den Ort selbst umfassendes Kirchspiel, das durch seine Übergangskirche wenigstens für die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert gesichert ist. Ob die kleine Kirche des benachbarten Klüß je selbständig war, ist fraglich; 1656, wo sie zuerst auftaucht, ist sie Filiale von Neuhausen in der Priegnitz (Schlie III, 219). Die Südwestecke des Landes endlich bildet das Amt Gorlosen. Die einzige landesherrliche Pfarre hier ist Gorlosen selbst. Doch ist es fraglich, ob sie das von Anfang an gewesen ist, da sie 1534 unter den landesherrlichen Kirchen fehlt. Aus dem 16. Jahrhundert stammt wohl auch ihre Kirche. Fundamente ihrer Vorgängerin wurden 1876 aufgedeckt. Die Burg begegnet 1354, aber über die Kirche fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten (Schlie III, 201 ff.). Neben dem von Gorlosen selbst bestand als zweites Kirchspiel das von Bekentin - es bildet jetzt den linkseldischen Teil der Grabower Parochie - ;die vom Kroge, welche damals auf der Burg Gorlosen saßen, hatten hier 1339 (5917, 5938) das halbe Patronat.
Bemerkenswert ist, daß die kleinen ritterlichen Pfarren Pankow, Balow und Dambeck, ebenso aber auch die größere von Herzfeld und die landesherrliche von Brunow in wendischen Orten errichtet sind. Alle 5 zeigen auf der Witteschen Karte nicht nur starke Bruchteile wendischer Bevölkerung, sondern auch wendische Verfassung (Hakenhufen resp. Pauschalbede).
Deutlicher als im havelbergischen Teil des Landes Parchim ist die weitere Entwicklung in dem des Landes Ture (Amt Lübz - Plau).


|
Seite 98 |




|
Um 1235 wird hier nur eine Kirche, wohl die von Vietlübbe, bestanden haben (vergl. oben S. 85 f.). An diese wird sich bald darauf als zweite landesherrliche Pfarre die ziemlich umfangreiche von Görgelin angeschlossen haben. Um dieselbe Zeit, wohl zwischen 1256 und 1265, errichteten die von Bodenstedt und Wittenlog als Lehnsleute des St. Michaelisklosters in Lüneburg die Kirche von Michaelsberg (vergl. S. 85). Mit diesen drei Pfarren wäre nun dem kirchlichen Bedürfnis genügt gewesen. Allein es sollten noch 5 weitere hinzukommen. Vom Jahre 1271 ab begann das benachbarte Cisterziensernonnenkloster Marienfließ zu Stepenitz in dieser Gegend umfangreiche Erwerbungen zu machen (1223); 1274 waren bereits die Dörfer Karbow, Wilsen, Kreien, Darz und Damerow ganz, Stüwendorf, Vietlübbe, Barkow und Dresenow teilweise in seinem Besitz (1322). Dieser Besitz ward in den folgenden Jahrzehnten noch vervollständigt (1955, 2629), und noch 1346 erwarb das Kloster das ganze Dorf Ganzlin von den von Below hinzu (6653).
Auf diesem seinem Besitz treten uns nun 1320 (4221) die 4 Pfarrer von Kreien, Karbow, Stüwendorf (bei Vietlübbe untergegangen) und dem schon schwerinschen Barkow entgegen. Da alle diese kleinen nur 2 - 3 Dörfer umfassenden Kirchspiele von der Reformation an landesherrlichen Patronates sind, 1534 aber noch nicht unter den landesherrlichen Pfarren erscheinen, so sind sie alle als Gründungen des Klosters zwischen 1271 und 1320 anzusehen. Ihre kleinen, nicht mehr in ihrer Ursprünglichkeit erhaltenen Kirchen erlauben leider keine genauere Datierung. Weiter aber begegnet uns auf dem ebenfalls dem Kloster gehörigen Darz eine Pfarre mit eigner Wedem, die noch bis 1581 ihren eigenen Pfarrer hatte. Dann ward sie mit Karbow kombiniert (Archiv Schwerin, Kirchenakten, Karbow). Endlich finden wir auf der jüngsten Erwerbung des Klosters, Ganzlin, bei der Visitation von 1541 ebenfalls eine Pfarrkirche Stepenitzer Patronates. Schlie (IV, 618) nimmt zwar an, daß schon die Vorbesitzer, die von Below, Gründer der Kirche gewesen sind, allein da die Kaufsurkunde (6653) des Patronates keine Erwähnung tut, wird sie erst als eine Gründung des Klosters nach 1346 anzusehen sein und Ganzlin bis dahin zu Görgelin gehört haben. Was die Nationalität der Kirchdörfer betrifft, so scheinen hier Kirchen fast ausschließlich in deutschen Orten errichtet zu sein; auch Marienfließ hat die 5 genannten Kirchen in solchen errichtet. Von seinen wendischen Dörfern an der Grenze der Priegnitz hat nur Darz eine Kirche erhalten.


|
Seite 99 |




|
Mit Ganzlin haben wir die Südspitze des Plauer Sees erreicht. Von da an beginnt der havelbergische Teil des Landes Röbel, südlich von dem ungeheuren Gebiete des Besuntwaldes begrenzt, das ebenfalls noch zum Lande Röbel gehörte. Bis an den Rand dieses Waldgebietes, scheint es, war um 1235 die Kolonisation vorgeschritten gewesen, und neben der Neustadt Röbel die landesherrlichen Pfarren von Vipperow, Dambeck und vielleicht Groß (Wendisch)=Priborn errichtet. Nachgegründet wurden hier am Rande des Waldgebietes die beiden kleineren landesherrlichen Pfarren Kambs und Zepkow. Erstere ist 1270 (1199) vorhanden, letztere kann allerdings nur erschlossen werden. Die noch vorhandene Feldsteingrundlage der Kirche stammt nach Schlie aus dem 13. Jahrhundert (V, 561). Dazu muß der Ort eine gewisse Bedeutung gehabt haben, da 1285 (1781) das Landding des Amtes Wredenhagen hierhin verlegt wurde. Wredenhagen selbst aber wird erst kurz vorher entstanden sein, und zwar zuerst die Burg, dann im Anschluß an sie auch das Hagendorf (indago novi castri; 2228); 1284 (1754) begegnet die Burg als novum castrum zum ersten Mal; 1354 (8015) hat Wredenhagen seinen eigenen Pfarrer und 1534 ( u. 1541) ist Wredenhagen Pfarrort, Zepkow aber Filiale. Da die Kirche des letzteren aber älter scheint, so mag das Verhältnis ursprünglich das umgekehrte gewesen sein.
Zu diesen beiden landesherrlichen kam eine Reihe ritterlicher Pfarren; zunächst zwischen Röbel und Dambeck die von Nätebow, wohl zwischen 1284 und 1300 (vergl. oben S. 86) von den seit 1284 hier angesessenen von Bune für ihre drei Dörfer Nätebow, Bollewiek und Spitzkuhn errichtet; dann vom Dambecker Kirchspiel abgezweigt die Pfarre von Leizen , welche 1298 (2486) zuerst begegnet, weiter die von Finken, Dammwolde, Massow und Grabow, über die es leider an mittelalterlichen Nachrichten ganz fehlt. Doch muß zum mindesten die von Finken um 1298 schon bestanden haben, da die Errichtung der nur ein einziges Dorf umfassenden Leizener Pfarre ohne einigermaßen genügende Versorgung der westlich anstoßenden Dörfer nicht wohl denkbar ist. Auch die Kirche von Karchow - wohl eine Stiftung der hier angesessenen von Pritzbuer - ,welche schon 1541 mit Dambeck verbunden war, muß einst selbständig gewesen sein, da sie eine eigene Wedem hatte und seit 1587 (Schlie V, 528) der Pastor dort wohnte; 1534 fehlt sie noch unter den Filialen von Dambeck, war also wohl noch selbständig. An mittelalterlichen Daten fehlt es auch über sie. Endlich, wohl als letzte hier, ward 1346 (6649) die Ludorfer Pfarre von der von Vipperow abgezweigt und ihre


|
Seite 100 |




|
wunderliche kleine Kirche erbaut. Sie ist eine Stiftung der von Marin. Alle diese Kirchspiele umfassen nur je 1 - 2 Dörfer.
Da dieser ganze Landstrich nur eine spärliche wendische Bevölkerung gehabt zu haben scheint, sind auch die Reste derselben geringer als in den Grenzstrichen, aus denen wir herkommen. Die Kirchen scheinen ausschließlich in deutschen Orten erbaut, wenngleich einige derselben, wie Zepkow, Kambs, Melz, Karchow, noch stärkere Reste wendischer Einwohner zeigen. Wendische Verfassung - Pauschalbede resp. Kossatenland - haben nur die bei den Kirchdörfer Finken und Grabow, aber gerade sie zeigen keine wendischen Familiennamen mehr, sind also nachträglich doch noch mit Deutschen besetzt worden, womit denn auch die Errichtung ihrer Kirchen in Zusammenhang stehen wird.
Inzwischen aber war die Kolonisation längst in das im Süden vorgelagerte Heidegebiet des Besuntwaldes, das Ländchen Lieze, wie es später genannt wurde, eingedrungen. Die Gründung der beiden kleinen landesherrlichen Pfarren von Melz und Kiewe wird hierbei erfolgt sein; die von Melz begegnet zuerst 1298 (2486), die von Kiewe 1311 (3475), wo Dorf und Patronat in den Besitz von Altenkamp übergehen. Auch Buchholz , das als Ort 1273 (1283) vorhanden ist und dessen Kirche im 16. Jahrhundert mit der von Melz vereint war, scheint ursprünglich eine selbständige Pfarre gehabt zu haben, da die Weigerung des Besitzers, Hans v. Rohr, seine Bauern bei dem Wiederaufbau der 1590 abgebrannten Wedem in Melz helfen zu lassen, und die daraus folgende zeitweilige Trennung von Melz und Buchholz (Schlie V, 563) sich so am ersten erklärt, daß Buchholz mater war und sich daher nicht zum Bau in Melz verpflichtet fühlte, daher aber auch ohne Schwierigkeit sich von diesem trennen konnte. Die frühgotische Kirche (a. a. O. S. 568) erweist, daß auch diese Pfarre spätestens im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts errichtet ward.
In der unmittelbaren Nachbarschaft hatte Altenkamp, das, wie wir eben gesehen, um 1311 auch in Kiewe Fuß faßte, seit 1232 amis See Kotze um Mönchhof einen bedeutenden Besitz und setzte hier eine umfangreiche Besiedelung ins Werk. Die Dörfer Winterfelde, Wüsterade, Schönfeld, Groß=Berlin und Glave (3475 vom Jahre 1311) sind das Resultat derselben. Auch für die kirchlichen Bedürfnisse hatte das Kloster gesorgt und in mehreren dieser Dörfer Kirchen gebaut (a. a. O.) Altenkamp trat seinen Besitz später (im Jahre 1436) an die Stadt Wittstock ab. Dann sind jene 5 Dörfer eins nach dem andern wieder eingegangen; Winterfeld und Groß=


|
Seite 101 |




|
Berlin schon vor 1556 (vergl. Schlie V, 549 Anmerkung). Nur der Mönchshof ist übrig geblieben, sonst ist die Heide wieder zur Siegerin über die menschlichen Ansiedelungen geworden.
Als östlicher Nachbar von Altenkamp rodete sein Tochterkloster Amelungsborn, dem hier 1233 (414) ein noch größeres Gebiet - über zwei Quadratmeilen - Heidelandes angewiesen waren. Wie schon erwähnt, hatte es bereits vor 1242 (537) den Klosterhof Dranse angelegt und damit auch eine Kapelle errichtet, einen Priester an ihr stationiert. Hier erstanden die Dörfer Sewekow, Schweinrich, Zempow; 1274 (1314) ward Berlinchen hinzu erworben, und auch hier wurden unter Klosterpatronat Kirchen errichtet in Berlinchen, Schweinrich und Sewekow. Wieder ostwärts an das Amelungsborner Gebiet angrenzend, hatte die Enkelin von Altenkamp und Tochter von Amelungsborn, Doberan, 50 Hufen Waldland, die später zu 86 anwuchsen (462, 596), erhalten, das Dorf Zechlin gegründet und ebenfalls eine Pfarrkirche gebaut, die 1306 (3091) zuerst begegnet.
Südwärts dieses Klosterbesitzes erstreckte sich die mecklenburgische Lieze am Ostufer der Dosse entlang bis Netzeband und Rögelin. Ihre Ostgrenze strich von letzterem nordnordostwärts durch die Heide auf Zechlin zu. Um 1232 hatte auch hier die Kolonisation schon begonnen und waren neben den märkischen Herren von Ploto - ein Zeichen, daß wir hier bereits im Bereiche der von Süden her vordringenden märkischen Einwanderung sind die Klöster Arendsee und Dünamünde an der Arbeit. Die kirchlichen Nachrichten sind dürftig; 1358 (8456) hören wir von den Kirchen zu Netzeband und Dargitz; die Rossower Kirche hat einen Schnitzaltar des 14. Jahrhunderts (Schlie V, 591). Das ist alles. Doch sind diese Kirchen nicht die einzigen geblieben und waren es schon damals schwerlich..
Nördlich der oben genannten Klostergebiete erstreckte sich die Lieze ostwärts der Müritz bis Mirow und Wesenberg (Boll: Geschichte des Landes Stargard I, 84). Hier bestand, wie oben (S. 89 f.) wahrscheinlich gemacht, schon das Kirchspiel von Schillersdorf, vielleicht auch das von Alt=Gaarz. Südlich von ersterem und östlich des letzteren war seit 1227 dem Johanniterorden ein umfangreicher Besitz zugewiesen, aber mit seiner Kolonisation scheint es langsamer vorangegangen zu sein, handelte es sich doch auch hier wesentlich um Heideland. Schwerlich ist die Kirche von Mirow vor 1242 errichtet (vergl. S. 88); 1270 (1199) aber ist sie da. Inzwischen aber war ostwärts von Mirow schon Stadt und Kirchspiel Wesenberg entstanden, vermutlich im Zusammenhange


|
Seite 102 |




|
mit der seit 1236 von Süden her in das Land Stargard ein=strömenden märkischen Kolonisationswelle; 1257 (789) wird ihr Name zum ersten Mal genannt. Nicolaus von Werle ist ihr Gründer (1450). Da ihr Kirchspiel auch einige Dörfer umfaßt, so wird die Gründung des Ortes und die Errichtung des Kirchspiels in die erste Zeit der Kolonisation fallen, d. h. wohl bald nach 1240. Zum Lande Wesenberg gehören auch noch die Pfarren Drosedow und Wustrow (Landbede des Amtes Wesenberg von 1505 und Amtsrechnungen von Mirow, 1559 und 1590). Erstere, jetzt zur 2. Pfarre in Wesenberg gelegt, war noch 1534 eine selbständige Pfarre landesherrlichen Patronates (Visit.). An mittelalterlichen Daten fehlt es ganz; ebenso über Wustrow. Auch dieses war nach der Reformation zeitweise mit Wesenberg verbunden, bis es 1772 zu Strasen gelegt ward (Krüger im M. Jbb. 69, 231 f.). Die wechselnde Verbindung gibt es an die Hand, daß es einst selbständig war, und die außerordentlich große Dotation mit 3 märkischen und 5 wendischen Hufen (Visit. 1541) macht es zur Sicherheit.
Kehren wir zurück in die Umgegend von Mirow. Zu den älteren und größeren Kirchspielen von Schillersdorf, Gaarz und Mirow kamen auch hier noch eine Reihe kleinerer. Zwar die jetzigen Filialen von Schillersdorf, Qualzow und Roggentin, scheinen niemals mehr als Filialkapellen gewesen zu sein, aber Granzin war einst selbständig. Es gehörte neben Kratzeburg und Blankenförde zu den drei Pfarren, die auf dem Darguner Gebiete nördlich von Mirow errichtet wurden. Soweit das Urkundenbuch reicht, fehlt es über sie gänzlich an Nachrichten. Ebenso sind die jetzigen beiden Filialen Mirows, Leussow und Zirtow, schwerlich von Anfang an das gewesen, da sie nicht zum ursprünglichen Gebiet der Komturei gehören, sondern erst 1273 bis 1301 (1285, 2415, 2726) von ihr hinzu erworben wurden. Beide Orte fehlen 1270 (1199) in der Grenzbeschreibung der Komturei, deren Gebiet damals östlich bei einem bezeichneten Baum mit dem von Wesenberg. zusammenstieß. Das gerade mittenwegs zwischen Mirow und letzterem gelegene Zirtow muß also damals noch wüste gelegen haben. Dazu stimmt dann auch, daß bei dem Erwerb von Leussow und Zirtow dem Orden zugleich das Be=siedelungsrecht verliehen wird. Beide werden also verödete Wendendörfer gewesen sein, deren Neubesetzung erst um 1273 in Angriff genommen wurde. Wenn nun bei diesen Erwerbungen dem Orden unter andern Rechten auch das ecclesiasticum beneficium verliehen wurde (1285, 2726), so wird es sich um eine Voraus=


|
Seite 103 |




|
verleihung für beabsichtigte Kirchenerrichtungen handeln, und darf angenommen werden, daß diese nicht allzu lange nachher ausgeführt worden sind. Ihre Stellung zu Mirow wird dann die=selbe gewesen sein, wie die der jetzigen dritten Filiale desselben, Starsow, das ebenfalls erst nachträglich, in den Jahren 1287 bis 1321 (1917, 2885, 4301), zur Komturei erworben ward. Hier bestand 1341 (6116) eine Kirche, inbetreff deren der Orden dem Bischof von Havelberg zusichert, daß sie ihm untertan sein solle "prout antiquitus fuerat" "ac si in ipsa esset clericus secularis". Sie hatte also schon vor ihrer Erwerbung durch den Orden bestanden, dieser sie aber nicht weiter mit einem clericus secularis besetzt, sondern einem seiner Ordenskleriker zur Verwaltung übertragen, mußte jedoch dafür dem Bischof zusichern, daß ihre rechtliche Stellung dadurch. nicht verändert werden solle. Wie Starsow werden auch Leussow und Zirtow von Mirow aus durch Ordenskleriker verwaltet worden sein, bis alle drei schließlich in der Mirower Pfarre ganz aufgingen.
Westlich von Mirow, zwischen dem Gebiete der Komturei und der Müritz, lag die Pfarre von Gaarz. Südlich von diesem hatte, wie schon oben erwähnt, das Kloster Dobbertin vor 1237 (469) das Dorf Lositz (= Lärz) mit 40 Hufen und 30 Hufen zwischen Crumemir (= Krümmel) und Zwertitz (= Schwarz) erhalten; 1257 (790) finden wir dort die 4 Dörfer Lärz, Verlinge, Schwarz und Zeten im Besitz des Klosters. Verlinge ward jedoch bald mit Schwarz vereint (1347). Dazu erwarb dann das Kloster noch um 1280 die Nachbardörfer Sagwitz (1513) und Diemitz (1610). Um diese Zeit muß es auch die beiden Kirchen in Lärz und Schwarz errichtet haben. Noch der Schutzbrief Urbans IV. von 1263 (983) führt nur die beiden alten Klosterpatronate Goldberg und Lohmen auf, aber als Dobbertin 1282 (1610) von Albrecht von Brandenburg das Eigentumsrecht für Schwarz und Zeten erhält, wird auch das ius patronatus dazu gerechnet, und 1288 (1963) gibt Bischof Heinrich von Havelberg dem Kloster den "Bann", d. h. das Archidiakonatsrecht über Lärz und Schwarz. Beide Kirchen sind also vorhanden. Ihre Pfarrer erscheinen dann 1337 (5802) zum ersten Mal. Neben ihnen erstand in dem benachbarten Krümmel eine kleine ritterliche Pfarre, über die es leider an Nachrichten fehlt. Schlie (V, 564) meint zwar, sie sei von jeher Filiale von Gaarz gewesen, allein 1541 (Visit.) gehörte sie noch nicht zu diesem, und wird also einst selbständig gewesen sein. Nur auf das eine Dorf Krümmel geschränkt, wird sie aber ebenfalls zu den jüngeren Pfarren gehören.


|
Seite 104 |




|
Nördlich von Gaarz saßen die von Retzow auf Retzow und den benachbarten Dörfern; sie errichteten hier die Pfarre von Rechlin. Leider fehlt es über sie ganz an mittelalterlichen Nachrichten, aber noch 1541 (Visit.) ist das Patronat in Retzowschen Händen und begegnet uns in Leppin eine Filialkirche, die, wie es nach der für eine solche beispiellos großen Dotierung mit 6 Hufen scheint, einst auch eine selbständige Pfarrkirche der von Retzow gewesen sein mag.
Nordwärts an Rechlin schließen sich die beiden kleinen ritterlichen Kirchspiele Boeck und Speck, über die es ebenfalls an Nachrichten mangelt. Boeck selbst und das ihm benachbarte untergegangene Seedorf begegnen jedoch schon 1273 (1295, 1342). Die einzigen noch in das Mittelalter zurückreichenden kirchlichen Daten über beide finden sich im Visitationsprotokoll von 1574, wonach die von Holstein auf Ankershagen beschließen, Boeck und Speck zusammenzulegen, in Speck eine Wedem zu bauen und sie mit Acker usw. auszustatten. Daneben steht ein Kommissionsbericht von 1589, nach welchem Boeck und Speck vor der Reformation von Ankershagen aus durch Kapläne bedient worden sind. Diese Nachrichten sind dunkel; nach der letzteren scheint es, als ob beide nur Filialkapellen von Ankershagen gewesen seien, und dazu stimmt, daß die Kirche in Speck 1574 weder Wedem noch Acker hat. Aber die Entfernung beider Orte von Ankershagen - 10 resp. 16 Kilometer in der Luftlinie - läßt es als undenkbar erscheinen, daß das das ursprüngliche gewesen sei - vor allem in diesen Gegenden der kleinen Kirchspiele. Sie müssen einst selbständig gewesen sein. Dunkel aber bleibt dann wieder, wie Broda, das im Mittelalter die Kirche von Ankershagen besaß, auch in den Besitz der Patronate von Boeck und Speck gekommen ist, wo es, soviel wir wissen, keinen Besitz hatte. Auch fehlen beide in der päpstlichen Bestätigung der Brodaer Patronate von 1500 (M. Jbb. III, 229), obgleich diese nicht nur die Hauptkirchen, sondern auch die Filialen wenigstens zum Teil mit aufführt.
Mit Ankershagen betreten wir endlich das Land Penzlin, wo unter dem schwerinschen Krummstab sicher die Kirchen von Penzlin selbst und Freidorf, vielleicht auch noch die von Groß=Luckow und Peckatel, errichtet worden waren. Auch hier ist noch eine große Anzahl kleinster Pfarren erstanden. Zunächst erhielt um 1266 (1080) Freidorf eine Filialkirche in Ankershagen. Sie ist eine Stiftung der dort eingesessenen von Anker und ward bald selbständig; 1328 (4914) hat sie ihren eigenen Pfarrer. Die Kirche von Freidorf blieb neben ihr bestehen (9340); sie


|
Seite 105 |




|
existierte noch um 1500, ist dann aber eingegangen. Wohl von Freidorf abgezweigt sind die beiden kleinen Pfarren Rumpshagen und Möllenhagen. Erstere begegnet zuerst in der gefälschten Urkunde Nr. 377. Die Fälschung ist nach 1331 angefertigt (vergl. die Note zu 5241), und zwar wohl erst geraume Zeit nachher, aber vor 1402, wo sie von den Fürsten von Werle transsumiert wurde. Aber damit ist über die Gründungszeit der Pfarre nichts entschieden. Sie kann beträchtlich früher liegen. Auch über die der Möllenhäger Pfarre wissen wir nichts, als daß vielleicht der 1365 begegnende Pleban von "Oldenhagen" (9340) der von Möllenhagen ist.
Eine Reihe weiterer Pfarren entstanden auf dem weitausgedehnten Besitz der von Peckatel, nämlich zu Groß=Vielen, Zahren, Liepen, Langhagen und Hohen=Zieritz. Zum Teil wenigstens müssen sie schon 1274 bestanden haben, da es damals bei der großen Belehnung der von Peckatel im Lande Penzlin (1317) heißt: "cum collatione beneficiorum seu ecclesiarum" (Plural). Der Pleban von Vielen erscheint wahrscheinlich schon 1266 (1080), sicher aber 1310 (3404). Aber auch Zahren, das einst selbständig war - es besaß noch 1664 eine eigene Wedem (Schlie V, 308) - hat spätestens in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts seine Kirche erhalten; dahin weist wenigstens deren frühgotischer Stil (Schlie V, 312 ff.). Über die Pfarren von Langhagen und Liepen fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten; ersteres ist eine schon 1274 (1317) vorhandene Rodung der von Peckatel, aber auch Liepen scheint einst ganz oder doch zum größten Teil in ihrem Besitz gewesen zu sein, wie sie denn auch das Patronat besaßen. Beide waren einst selbständig, da sie nach der Reformation bald mit Blankenförde, bald mit Kratzeburg verbunden waren, bis sie endlich zu Peckatel gelegt wurden (Krüger: M. Jbb. 69, 5. 13, 93). Über Hohen=Zieritz mit Zippelow fehlt es ebenfalls an weiteren Nachrichten; 1274 gehörten sie noch zum Lande Penzlin (1317). Vielleicht bestand damals auch diese Pfarre schon. Später ward sie mit der Stargarder Pfarre Prillwitz vereinigt.
Im Nordwesten des Landes ward wohl von Groß=Luckow abgezweigt das kleine Kirchspiel Groß=Flotow. An Nachrichten fehlt es, doch wird die Abzweigung schon stattgefunden haben, ehe das Patronat von Groß=Luckow 1304 (2945) an Broda überging, da sich dieses sonst fraglos wie in Ankershagen und Rumpshagen auch das Patronat der Tochterkirche vorbehalten haben würde. Ebenso ist auch Mollenstorf, ein Besitz der


|
Seite 106 |




|
von Bardenfleth, wohl von Groß=Luckow abgezweigt worden; 1335 (5610) erscheint sein Pfarrer, und in dieselbe Zeit weist die kleine Kirche (Schlie V, 316).
Endlich sind auch in der Nordostecke des Landes noch zwei kleinere Kirchspiele entstanden, Kruckow und Alt=Rehse. Beide gehören nämlich noch zum Lande Penzlin, während ihre unmittelbare Nachbarschaft, die Umgegend von Broda, schon zum Lande Gädebehn gehört und somit pommersch blieb, als das Land Penzlin mecklenburgisch wurde (vergl. Boll: Geschichte des Landes Stargard I, 53 f.). Dem entspricht, daß zwar keins der anstoßenden Brodaschen Dörfer Rehse, Wulkenzin, Weitin 1273 (1284) in dem Werleschen Bestätigungsbrief für das Stift erscheint, wohl aber Wustrow, das einzige Kirchspielsdorf der Pfarre Rehse (457). Es sind nämlich zwei Rehse, jetzt Alt= und Neu=Rehse, zu unterscheiden, von denen das eine, Neu=Rehse, Broda gehörte, pommersch war und im Kirchspiel Wulkenzin lag, das andere zum Lande Penzlin und denen von Peckatel gehörte (5275). Letzteres ist der Kirchort. Wann er seine Kirche erhalten hat, ist fraglich; 1331 war sie wohl kaum schon vorhanden, da sonst ihr Pfarrer schwerlich bei dem Rehser Grenzvergleich neben denen von Penzlin und Gevezin gefehlt haben würde (5275). Dazu stimmt auch, daß sie in der nach 1331 gefälschten Urkunde Nr. 377 unter den Brodaschen Patronatskirchen noch fehlt, obgleich der Ort genannt wird, während sie im Jahre 1500 unter ihnen erscheint (M. Jbb. III, 229). Die zweite oben erwähnte Pfarre, die von Kruckow, dagegen ist schon früher nachzuweisen; 1346 (6657) ist sie da, aber nicht Brodasche Patronatskirche; sie fehlt 1500 unter diesen.
Was endlich die Nationalität der Kirchdörfer auf der Lieze und im Lande Penzlin betrifft, so zeigen sich zwar in den meisten derselben wendische Bevölkerungsreste. Als eigentliches Wendendorf aber kann nur Liepen bezeichnet werden, das bei einer starken Zahl wendischer Familiennamen auch wendische Verfassung - Hakenhufen - zeigt.
An das Land Penzlin mag sich endlich noch das Gebiet des Stiftes Broda schließen mit seinen drei Pfarren Wulkenzin, Weitin und Zierzow. Es gehörte politisch zum Lande Gädebehn und kam erst um 1300 mit diesem unter mecklenburgische Herrschaft, scheint jedoch von Anfang an zum Havelberger Sprengel gehört zu haben.
Wulkenzin und Weitin gehörten zwar zur ersten Schenkung Kasimars und Bogislavs (95, vergl. 135), aber obgleich unmittelbar vor dem Tore von Broda gelegen, scheinen nicht einmal


|
Seite 107 |




|
diese beiden Orte von den Stiftsherren selbst kolonisiert zu sein. Sobald sich das Dunkel, das über ihnen liegt, lichtet, finden wir sie in den Händen verschiedener Adelsfamilien als Klosterlehen, und zwar Wulkenzin um 1315 in denen der von Passentin, Wodarge, Voß, Sasse und Kosegarten (3737, 3888, 4321), Weitin in denen der von Holstein und Voß (4209). Erst von 1320 ab begann das Stift beide Orte stückweise wieder zurückzuerwerben. Die Pfarre von Weitin wird zuerst 1319 (4081), die von Wulkenzin 1339 (5960) erwähnt. Aber wer hat sie errichtet? Das Stift, oder jene Lehnsleute, welche die Orte mit deutschen Bauern besetzten? Für Weitin scheint es ziemlich klar: die letzteren. Denn 1320 (4209) erwarb Broda unter 27 Hufen auch 2 Pfarrhufen in Weitin von den von Holstein, während der Rest des Ortes mit 15 Hufen noch in den Händen der von Voß blieb. Das ist die halbe Dos, die von den Vorbesitzern der Holstein gegeben sein muß, die andere Hälfte wird in jenem Voß'schen Rest des Dorfes stecken. Das Patronat muß hiernach den Lehnsleuten zugestanden haben und somit nun erst zur Hälfte ans Stift gekommen sein. Noch 1339 (5960) scheint Weitin nicht zu den Kirchen zu gehören, die unter dem Brodaer Patronat standen. Wulkenzin war damals Brodaschen Patronates, aber ob schon lange und gar von Anfang an? 1335 (5583) hatten auch hier die Rückerwerbungen begonnen.
Eigentümlich liegen die Dinge in Zierzow. Dieses gehörte nicht zu der ursprünglichen Ausstattung des Stiftes (135). Auch in den Fälschungen aus dem 3. oder 4. Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts (95, 563) fehlt es noch. Erst in der dem 14. Jahrhundert angehörigen Fälschung, M. U.=B. 377, begegnet es als 1230 von Nicolaus von Werle (!) dem Stifte bestätigt (ebenso 3563). Wirklich besessen hat es den Ort nicht. Bis 1342 war er in den Händen der von Holstein und Kruse, welche damals den größten Teil ihres dortigen Besitzes an den Treptower Bürger Siegfried von Bresen verkauften. Das Stift belehnte letzteren mit diesen Gütern in Zierzow in derselben Weise, wie die von Holstein und Kruse dieselben "a primeva plantacione et radicacione hactenus" . . . . „in verum pheudum possiderunt" (6196). Wie man sieht, hatte es wenigstens das Lehnrecht über Zierzow vermittels jener Fälschungen sich anzueignen gewußt. Ein Teil von Zierzow blieb übrigens noch in den Händen der von Holstein (6384, 6657). Wenn nun 1344 (6384) zum ersten Mal die Pfarre von Zierzow begegnet, so ist es, obgleich die dieselbe betreffenden Handlungen (6384, 7061) mit Willen resp.


|
Seite 108 |




|
vor Propst und Konvent von Broda geschehen - diese waren ja Lehnsherren von Zierzow =, höchst unwahrscheinlich, daß das Stift das Patronat besaß oder jemals besessen hat; 1339 (5960) scheint es dasselbe jedenfalls noch nicht gehabt zu haben. Auch diese Kirche ist als eine Stiftung des eingesessenen Adels anzusehen. Das gesamte so hoch bewertete Verdienst Brodas um die kirchliche Organisation seiner Umgegend schrumpft also noch mehr zusammen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die Kirche von Freidorf die einzige Pfarrkirche, die es errichtet hat, und selbst bei dieser ist es fraglich. Höchstens könnte bei Errichtung der Pfarren von Wulkenzin und Weitin vielleicht von einer Einwirkung des Stiftes auf seine Lehnsleute die Rede sein. Übrigens war das Stift, wie wir aus dem Umstand sehen, daß es selbst die unmittelbar vor seiner Tür gelegenen Dörfer Wulkenzin und Weitin nicht in eigene Bewirtschaftung nehmen oder selbst mit Bauern besetzen konnte, sondern als Lehen an adlige Lokatare austun mußte, viel zu arm, um eine weiter reichende Wirksamkeit ausüben zu können; es kämpfte fortwährend selbst um seine Existenz und hielt sich nur mit Mühe über Wasser.
6. Das Land Stargard mit Strelitz, Ahrensberg und Lychen.
Durch den Vertrag von Kremmen war im Jahre 1236 das Land Stargard mit dem Lande Beseritz aus pommerscher Herrschaft in die der Markgrafen von Brandenburg übergegangen. Nach Süden zu bildete das wohl schon länger brandenburgische Lychen die Verbindung mit der Mark. Zwischen diesem und der altmecklenburgischen Lieze (Turne) mit Wesenberg lag das Ländchen Ahrensberg, auf welches der Bischof von Havelberg Ansprüche machte. Auch Strelitz scheint noch dazu gehört zu haben (Boll: Geschichte des Landes Stargard I, 51 f., 56 ff.). Kirchlich gehörten Stargard, Ahrensberg und Strelitz nach Havelberg, das Land Lychen dagegen zum Bistum Brandenburg (a. a. O. S. 58).
Versuchen wir diese Länder näher gegeneinander abzugrenzen, so nimmt das Land Stargard die ganze Nordhälfte des jetzigen Mecklenburg=Strelitz ein. Im Süden wird es größtenteils durch das Land Strelitz=Ahrensberg begrenzt. Zur Bestimmung seines Umfanges sind wir auf Nachrichten des 16. Jahrhunderts angewiesen, und auch diese ergeben nur ungefähre Resultate. Leider sind die Bederegister hier so gut wie garnicht zu brauchen, da nach ihnen eine Reihe von Dörfern bald im Amte Strelitz, bald


|
Seite 109 |




|
im Amte Stargard zu liegen scheinen. So bleibt nur ein Verzeichnis der "Kaspelkirchen des Amts Strelitz 1572" (mitgeteilt durch Geh. Archiv rat Grotefend aus dem Schweriner Archiv), welches außer der Stadt Strelitz selbst die Kirchen von Wuserin (= Userin) und Quassowe, Lütken und Großen=Trebbow, Turow und Zinnow, Furstensehe, Grunowe, Nemerowe, Wukule und Gnewitz, Arnßbergk, Blomenhagen und Glambeck, Weisin, Prillwitz, Grammertin, Dolgen, Bercfelde, Großen=Schonefeld, Ratteleg (= Rödlin) aufführt. Danach bestimmt sich der Umfang des Landes ungefähr, doch dürfte einerseits Gnewitz auszuscheiden haben; es gehörte (s. unten) zum Bistum Brandenburg und also wohl zum Lande Lychen, und andererseits Nemerow, das schon zu Stargard gehört haben muß; daß sie 1572 unter den Kirchen des Amtes Strelitz erscheinen, wird sich aus infolge der Reformation eingetretenen Veränderungen erklären; beides waren Pfarren der säkularisierten Komturei Nemerow. - Dagegen möchte ich, obgleich sie nicht mit aufgeführt sind, die im 16. Jahrhundert schon eingegangene und mit Prillwitz vereinigte Pfarre Usadel und ebenso die 1505 als im Amte Strelitz gelegen genannte Pfarre Rollenhagen als noch dorthin gehörig ansehen; mit Rödlin reicht Strelitz bis an den Wanzkaer See, der hier die Grenze gebildet zu haben scheint, Rollenhagen liegt aber noch südlich desselben, und wenn man auch Usadel noch zu Strelitz rechnet, so würde der aus dem Wanzkaer See fließende Bach die Grenze bis zum Tollense=See gebildet haben. Endlich aber mögen auch Strasen und Priepert zu Ahrensberg=Strelitz gehört haben; 1572 gehörte letzteres zwar ins Amt Fürstenberg, doch war es (s. unten) nicht brandenburgisch, sondern havelbergisch, und wird demnach ursprünglich nicht mehr wie Fürstenberg zum Lande Lychen gehört haben.
Letzteres aber reichte mit Fürstenberg und dessen südlichen Nachbarkirchspielen einerseits, mit den Heidekirchspielen Dabelow, Gnewitz, Triepkendorf und Feldberg andererseits in das mecklenburgische hinein und grenzte mit diesen teils an Strelitz, teils an Stargard (siehe darüber weiter unten).
Ob die Christianisierung dieser Gebiete vor deren Übergang in brandenburgische Hände überhaupt in irgend einem erheblichen Maße schon in Angriff genommen war, darüber fehlt es völlig an Nachrichten. Es finden sich auch nirgends anderweitige Spuren, wie etwa noch erkennbare Burgwardskirchspiele, die in wendische Zeit zurückführten. Immerhin wird unter der Herrschaft der in=


|
Seite 110 |




|
zwischen christianisierten Pommern wenigstens im Hauptorte des Landes, in Stargard selbst, eine Kirche anzunehmen sein. Sie wird schon dadurch gefordert, daß der dort sitzende pommersche Kastellan mit seiner Umgebung Christ gewesen sein muß. Auch die Errichtung des 1171 um den Ausfluß der Tollense aus dem gleichnamigen See dotierten Tochterstiftes von Havelberg erscheint bis 1236 immer noch nicht als realisiert. Zwischen 1182 und 1244 fehlt es über dasselbe völlig an Nachrichten. Erst in letzterem Jahre tritt es uns als inzwischen in dem an der Tollense gelegenen Orte Broda errichtet entgegen (563). Aller Wahrscheinlichkeit nach waren die Kanoniker erst kurz vorher im Gefolge der märkischen Einwanderung gekommen.
Sobald nämlich das Land in den Besitz der Markgrafen gekommen war, öffneten sie es der deutschen Einwanderung, das sicherste Mittel, um es sich zu sichern. Und hier nun trifft die zweite große Strömung der Kolonisationsbewegung auf die erste, in deren Zuge wir uns bisher bewegt hatten. Während die Küstenländer der Ostsee bis an die Odermündung von dem über Artlenburg kommenden und ostwärts vordrängenden Strom lüneburgischer, westfälischer, niederländischer Ansiedler besetzt worden waren, hatte eine zweite Strömung ihren Ursprung in den westlich der Elbe gelegenen Gegenden der Altmark und des Magdeburgischen. Von hier aus war die Mark Brandenburg besetzt worden. Die Ausläufer dieses Stromes besetzten um eben diese Zeit (um 1235 bis 1247) die Ukermark (v. Sommerfeld: Geschichte der Germanisierung Pommerns in Schmoller: Staats= und sozialwissenschaftliche Forschungen XIII, 5, S. 148 f., 159 ff.). Noch heute grenzt sich diese ostfälische Einwanderung nach Mundart und Bauart zwischen Anklam und der Ukermark deutlich ab gegen jene westfälische der Küstenländer (Bau= und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern, Teil II, Rgbz. Stettin, Band 1 S. 1 f.). Ihr gehört auch die des Landes Stargard an; zahlreiche altmärkische Ortsnamen und Adelsgeschlechter im Lande Stargard (Boll a. a. O. I, 60 ff.; Riedel: Die Mark Brandenburg I, 443) reden davon deutlich genug. An Nachrichten über diese Einwanderung fehlt es dagegen so gut wie ganz, wie denn überhaupt bis in die siebziger Jahre des 13. Jahrhunderts fast gar keine Urkunden aus dem Lande Stargard erhalten sind. Urkundlich fest steht nur die Gründung der deutschen Stadtburgen Friedland (im Jahre 1244), Neu=Brandenburg (im Jahre 1248), Lychen (im Jahre 1248). Für Woldegk ist die Stiftungsurkunde nicht mehr vorhanden, doch wird seine Gründung in dasselbe Jahrzehnt fallen, wie die der vorgenannten.


|
Seite 111 |




|
Auch hier kam die wirkliche Christianisierung des Landes erst mit dem deutschen Bürger und Bauern, der seinen deutschen Priester mitbrachte und in dem Dorfe, das er besetzte, seine Kirche baute. Leider fehlt es auch hierüber völlig an urkundlichen Nachrichten. Erst um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert werden sie etwas reichlicher und gewähren einen, wenn auch nur dürftigen, Einblick in die Pfarrorganisation, wie sie sich bis dahin entwickelt hatte.
Am deutlichsten sehen wir in den Landstrichen unmittelbar südlich und östlich des Tollense=Sees. Neben der 1288 (1939) zuerst genannten Pfarre des 1259 (833) zur Stadt erhobenen Stargard begegnen hier 1293 (2208) die von Blankensee und Zachow, vertreten durch ihre Priester, 1302 (2806) die von Ballwitz, über deren Patronat zwischen dem Kloster Wanzka und den Dargatzen verhandelt wird, 1306 die von Warbende (3125), 1310 die von Prillwitz und Usadel (3404) und 1312 die von Rollenhagen und Rödlin (3512), alle fünf durch ihre Plebane bezeugt. Abgesehen von Stargard, welches landesherrlichen Patronates ist (Visit. 1534), erscheinen alle diese auf engem Raum zusammengedrängten Pfarren als ritterlichen beziehungsweise klösterlichen Patronates. Die Kirchen von Prillwitz und Usadel gehören den von Peckatel auf Prillwitz (vergl. 3404); Ballwitz war ohne Frage ursprünglich. Dargatz'schen Patronates (2806); Blankensee und Zachow werden ebenfalls ursprünglich ritterlichen Patronates gewesen sein, da es höchst unwahrscheinlich ist, daß das eben (im Jahre 1290) gegründete Nonnenkloster Wanzka schon 3 Jahre nach seiner Gründung zwei neue Pfarren errichtet hat, und dasselbe wird für Rollenhagen gelten. In letzteren beiden waren wohl die Soneke (3422), in ersterem die von Blankensee (5171) Patrone gewesen. Warbende ward 1305 (3013) dem 1299 neugegründeten Cisterzienserkloster Himmelpforte bei Lychen geschenkt, jedoch so, daß Wilhelm Soneken es, wie bisher vom Landesherrn, so von nun ab vom Kloster zu Lehen hatte. Seine schon im folgenden Jahre bezeugte Pfarre ist sicher nicht erst als Klostergründung, sondern als Stiftung der Vorbesitzer - der Soneken anzusehen. Auffallend ist die Kleinheit aller dieser Pfarren. Nur die von Stargard, deren jetzige Filialen Bargensdorf, Quastenberg und Sabel niemals etwas anderes als Filialkapellen gewesen zu sein scheinen, ist ein wenig größer. Usadel, Zachow, Ballwitz, Rollenhagen, Blankensee und Warbende umfassen nur je 1 - 2 Dörfer. Aber auch Rödlin war nicht größer, da Carpin und Gr.=Schönfeld die jetzt dazu gehören, einmal selb=


|
Seite 112 |




|
ständige Pfarren waren (siehe weiter unten) und ebenso wenig Prillwitz. Denn, wie oben (S. 91) vermutet, gehörten Hohen=Zieritz und Zippelow ursprünglich nicht zu ihm, und die jetzt dorthin eingepfarrten Orte Blumenholz, Blumenhagen und Weisdin bildeten ehemals ebenfalls selbständige Pfarren (siehe weiter unten). Wir finden also hier auf engem Raume aneinandergedrängt um das Jahr 1300 acht kleine ritterliche Pfarren von nur je ein bis zwei Ortschaften. Hier sind sie einmal zufällig um dieselbe Zeit bezeugt, im übrigen fehlt es leider sehr daran. Bezeugt um den Anfang des 14. Jahrhunderts sind weiter noch im eigentlichen Stargard die drei ursprünglich landesherrlichen Stadt=Pfarren von Neubrandenburg (1271: M. U.=B. 1232), Friedland (1295: M. U.= B. 2354) und Woldegk (1271: M. U.=B. 1232), die ebenfalls landesherrliche von Lübbersdorf (1290: M. U.=B. 2058) und die ritterlichen von Krumbeck (1313: M. U.=B. 3587), Hinrichshagen (1311: M. U.=B. 3494), Ballin (1306: M. U.=B. 3127), Leppin (1293: M. U.=B. 2208), Schönbeck (1293: M. U.=B. 2208), Liepen (1306: M. U.=B. 3125), Warlin (1314:M. U.=B. 3686), Trollenhagen (= Hohenhaven), Brunn, Satow und Schwanbeck (alle 1308: M. U.=B. 3243). Ein wenig später bezeugt sind die ebenfalls ritterlichen bezw. klösterlichen Pfarren von Helpt (1327: M. U.=B. 4874), Schönhausen (1318: M. U.=B. 3953), Neddemin (1327: M. U. =B. 4817) und Ganzkow (1337 M. U.=B. 5902), die landesherrliche von Glieneke (1376: M. U.=B. 6834 n), die ritterliche von Godenswege (1379: M. U.=B. 11213), und endlich, jedoch nicht sicher, Plate (4874). Von diesen liegen wieder auf einem Haufen zusammen Hinrichshagen, Plate, Ballin und Leppin, alle 4 wieder von nur je einem und zwei Dörfern. An der Nordwestgrenze entlang liegen von ihnen unmittelbar aneinander grenzend Wulkenzin, Weitin, Zierzow, Trollenhagen, Neddemin, Ganzkow, Brunn, wiederum alle nur ein bis zwei Dörfer umfassend; Trollenhagen allein hat deren drei. Endlich liegen von ihnen unmittelbar zusammen die drei Glincke, Liepen und Warlin, wiederum von der selben Größe.
Nach diesen zufällig erhaltenen Bezeugungen dürfen wir schließen, daß das Land Stargard um 1300 bereits in eine Anzahl kleiner, nur eine bis höchstens drei Ortschaften umfassender Pfarren zerfiel, wenn es auch an weiteren mittelalterlichen Nachrichten bisher fehlt, und daß um diese Zeit auch hier das Parochialsystem völlig ausgebaut war.
Dieses Ergebnis aber wird noch wesentlich verstärkt durch eine von mir persönlich unternommene, allerdings noch unvoll=


|
Seite 113 |




|
ständige Erforschung der Stargarder Kirchenbauten. Danach sind von den 16 einst selbständigen Pfarren des Landes Beseritz (Friedländer Werder), abgesehen von den schon urkundlich für den Beginn des 14. Jahrhunderts gesicherten von Trollenhagen, Neddemin, Ganzkow, Brunn, Schwanbeck und Salow, welche alle, mit Ausnahme der frühgotischen Kirche von Trollenhagen, Übergangsbauten aufweisen, noch die 7 von Ihlenfeld, Neuenkirchen, Staven, Roggenhagen, Roga, Dahlen und Beseritz mit Übergangskirchen versehen. Die von Neverin ist wahrscheinlich frühgotisch - der zur Barockzeit vorgenommene Durchbau läßt die ursprüngliche Art nicht mehr sicher erkennen =, die von Rossow ist ein Fachwerkbau (nach Mitteilung), die von Bresewitz ist verfallen und soll ganz oder teilweise ebenfalls Fachwerk gewesen sein. Rechnet man nun, daß in diesen östlichen Gegenden noch die beiden ersten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts wesentlich im Übergangsstil gebaut worden ist (vergl. die Chemnitzer Kirchweihe im Jahre 1305) - weiter herab wird man schwerlich gehen dürfen =, so wäre von den 16 kleinen Pfarren des Werders nur für 3 ihre Existenz im ersten Drittel des 14. Jahrhunderts nicht erweisbar.
Dasselbe ergibt sich für den ostwärts an den Werder an=schließenden Komplex von Pfarren. Hier sind Glieneke, Liepen, Schönbeck, Lübbersdorf urkundlich gesichert, letztere beiden überdies durch ihre Übergangsbauten. Dazu aber kommen wieder die Übergangskirchen von Brohm, Jatzke, Ganzkow, Eichhorst, die frühgotische von Holm und die vielleicht auch ursprünglich frühgotische von Sadelkow.
An den urkundlich gesicherten Komplex Leppin, Ballin, Hinrinchshagen, Plate schließen sich unmittelbar an die Übergangskirchen von Techendorf, Dewitz, Käbelich, Kölpin, Warlin und die frühgotische von Pragsdorf. Sponholz hat eine Fachwerkkirche, aber Küssow wieder einen Übergangsbau, und mit ihm ist dann wieder der Anschluß an die erst genannten beiden Komplexe erreicht.
Ebenso schließen sich an den urkundlich für das erste Drittel des 14. Jahrhunderts gesicherten Komplex von Pfarren um Wanzka die weiteren von Kammin, Quaden=Schönfeld und Möllenbeck durch ihre Übergangsbauten, Rowa durch seine frühgotische Kirche, und endlich wird auch die untergegangene Kirche von Godenswege, welche 1665 als aus "großen Steinen" erbaut bezeichnet wird (Krüger S. 66) zu den Übergangsbauten zu zählen sein.
Es erübrigt nun noch zweierlei, einmal die Sprengelgrenzen und sodann Zahl, Namen und Umfang der Pfarren festzustellen, wie sie zur Zeit der höchsten Ausbildung des Stargarder Pfarr=


|
Seite 114 |




|
systems bestanden haben, so weit sich das aus den mir zugänglichen späteren Nachrichten ermöglicht.
Zunächst ersteres: Da weder havelbergische noch kamminsche Matrikeln oder Register erhalten sind, so ist die Grenze dieser beiden Bistümer nur mit annähernder Sicherheit zu bestimmen; im allgemeinen wird sie mit den politischen Grenzen des Landes Stargard gegen Pommern und die Ukermark zusammenfallen, die zugleich größtenteils natürliche Grenzen sind. Urkundlich als havelbergisch erweisbar sind folgende Grenzkirchspiele: Nedde=min, 1325 (4634, 8; 11695) zur Präpositur Friedland gehörig; Trollenhagen, Brunn (8151, 2), Schwanbeck (6317) - 1308 (3243) treten ihre Priester als Zeugen einer Urkunde des Kalandes vom Friedländer Werder auf, offenbar als Mitglieder dieser Korporation; Beseritz, der alte Hauptort des Friedländer Werders oder des Landes Beseritz (457); Friedland, 1327 (4874) havelbergische präpositur; Schönhausen (11439, 4), Tafelgut des Bischofs von Havelberg (1119); Daberkow - 1267 (1119) erhält der Bischof von Havelberg den Ort für den Zehnt im Lande Pritzwalk. Zu Kammin gehörte die Pfarre von Hildebrandshagen, südlich von Woldegk (11439, 3, 5). 1 )
Besser sind wir über die mit der Grenze des Landes Lychen gegen Stargard und Strelitz zusammenfallende havelberg=branden=burgische Sprengelgrenze orientiert, da für das Bistum Branden=burg eine Matrikel von 1459 und ein Prokurationsbuch erhalten sind (aus dem Archive in Berlin im Auszug mitgeteilt durch Herrn Dr. Curschmann), aus welchen die Grenze mit Sicherheit erhellt. Danach waren Feldberg mit Läven, Carwitz, Triepkendorf mit Hasselförde, Gnewitz, Dabelow, Alt=Thymen, Fürstenberg, Buchholz, Dannenwalde, Tornow die Grenzkirchspiele auf brandenburgischer Seite. Auf havelbergischer Seite würden es demnach sein: Schlicht, Dolgen, Grünow, Grammertin, Wokuhl, Fürstensee und Priepert. Dazu stimmt, daß 1572 als "Kaspelkirchen des Amts Strelitz", welches zum Bistum Havelberg gehörte, aufgeführt werden u. a. Dolgen, Grünow, Grammertin, Wokuhl und Fürstensee, allerdings auch Gnewitz, welches sowohl in der Matrikel als im prokurationsbuch als brandenburgisch erscheint, aber das erklärt sich leicht daraus, daß Gnewitz nach der mit der Reformation erfolgten Auflösung der Bistümer mit dem nahegelegenen Wokuhl verbunden


|
Seite 115 |




|
worden war. Grünow ist überdies urkundlich als havelbergisch bezeugt (9476). Schlicht gehörte wie Lichtenberg (1560 Visit.) wohl schon zum Lande Stargard. Unsicher aber bleibt die Zu=gehörigkeit von Lütten= oder Hinrichshagen, da es in jenen brandenburgischen Registern fehlt. Nach dem Visitationsprotokoll von 1534 war es jedoch wie Feldberg mit der brandenburgischen Pfarre Carwitz verbunden und wird somit wohl zu Brandenburg gehört haben. Die drei östlich des Feldberger Sees gelegenen Kirchen von Fürstenhagen, Wittenhagen und Konow aber sind schon zum Bistum Kammin zu rechnen; sie fehlen in den brandenburgischen Registern und können der Lage nach nicht wohl mehr zu Havelberg gehört haben. Überdies behauptete 1578 (Visit.) der Pfarrer des ukermärkischen - also sicher kamminschen - Weggun, daß Fürstenhagen immer Filiale seiner Kirche gewesen sei.
Wir wenden uns nun zur Bestimmung von Zahl, Namen und Umfang der in diesen Gebieten gelegenen Pfarren und beginnen mit dem Lande Stargard und innerhalb desselben mit den Pfarren des Friedländer Werders. Daß Trollenhagen, Neddemin, Ganzkow, Brunn und Schwanbeck selbständige Pfarren waren, war schon urkundlich bezeugt (S. 112). An letzteres grenzen Dahlen und Beseritz, jetzt vereint, ehemals beide selbständig; Dahlen erscheint 1541 (Visit.) als Pfarrort und Beseritz war von 1570 bis 1757 Sitz der Pfarre (Krüger in M. Jbb. 69, 26), muß also eine eigene Wedem besessen haben und dementsprechend früher einmal selbständig und Sitz eines eigenen Priesters gewesen sein, wie es denn auch mit Acker ausgestattet war (Visit. 1541). Ebenso scheinen die drei jetzt vereinten Kirchen von Staven, Roggenhagen und Rossow ursprünglich alle ihre eigenen Pfarren gehabt zu haben. Staven erscheint zuerst 1585 als Pfarrort (Krüger a. a. O. S. 186) und die Kirchen von Rossow und Roggenhagen besitzen noch heute jede ihre eigenen Pfarrhufen, waren also schwerlich einst nur Filialkapellen - denn bei solchen findet sich nirgends eine Dotierung mit Hufen. Das angrenzende Neverin mit seiner Filialkapelle in Glocksin war nach dem Visitationsprotokoll von 1541 früher mit Ihlenfeld verbunden. Schwerlich jedoch von Anfang an, denn da die von Ihlenfeld es damals von letzterem getrennt hatten und Neverin 1596 (Krüger a. a. O. S. 151) seinen eigenen Pastor hat, wird es ursprünglich eine voll ausgestattete Pfarre gewesen sein. Neue Pfarren zu dotieren war die Neigung des Stargarder Adels im 16. Jahrhundert nicht gerade. An Jhlenfeld grenzt Neuenkirchen, das 1560 als Pfarrort erscheint (Krüger a. a. O. S. 138), an dieses Roga mit der


|
Seite 116 |




|
Filiale Bassow, das (Krüger a. a. O. S. 158) 1366 einen Kaplan und Kirche besaß. Da in Bassow keine Pfarrhufen gewesen zu sein scheinen (Visit. 1541), wird es nur als Filiale anzusehen sein. Der Pfarrer des angrenzenden Salow erscheint schon 1308 (M. U.=B. 3243).
Es folgen die Pfarren der Friedländer Gegend: Neben Friedland selbst, die Pfarre von Lübberstorf, welche schon 1290 (2058) bezeugt ist, die jetzt verbundenen Schwichtenberg, Sandhagen und Bresewitz, von denen ersteres 1560 mit eigenem Pfarrer erscheint, letzteres bis 1537 ebenfalls einen eigenen Pfarrer hatte (Krüger a. a. O. S. 176) - 1541 (Visit.) war es mit Salow verbunden =, und das mittlere noch heute durch seine Pfarrhufe sich als ursprünglich selbständig erweist. An Schwichtenberg grenzt die heutige Pfarre Kotelow - Klockow - Wittenborn. Von diesen dreien war Kotelow 1382 (11428) und 1541 (Visit.) Pfarrort. Da der Sitz der Pfarre dann aber von 1558 bis 1607 in Klockow war (Krüger a. a. O. S. 90), so muß auch dieses eine Wedem besessen und einst selbständig gewesen sein. Dasselbe aber ist für Wittenborn wahrscheinlich, da es bald mit Brohm (1541 - 1669, bald mit Gehren (1669 - ?) und jetzt mit Kotelow verbunden und also offenbar keine Filiale mit festem Verhältnis zur mater war (Krüger S. 19. 61). Der Sitz der Nachbarpfarre Gehren=Galenbeck war bis 1659 Galenbeck, dann wurde er infolge eines Pfarrbrandes nach Gehren verlegt, wo die Pfarre 2 Bauergehöfte besaß (Krüger S. 61); letzteres besaß also ebenfalls eine vollausgestattete Pfarre. An dieses grenzt das Kirchspiel Voigtsdorf=Schönhausen - seit 1267 (1119) Besitz des Bischofs von Havelberg. Schönhausen hatte 1318 (3953) und 1382 (11439, 4) seinen eigenen Pfarrer; Voigtsdorf, 1382 Pfarre (11439, 5), erscheint 1603 (Krüger S. 173) als Filiale von Schönhausen, dessen Kirche im 30jährigen Kriege ganz eingegangen ist. Jetzt wird es von Badresch aus versorgt, das 1541 (Visit.) als eigene Pfarre erscheint, und mit der jetzt auch Rattey verbunden ist, das ebenfalls 1541. (Visit.) noch selbständig war. Westwärts an letzteres grenzen die jetzt verbundenen Kirchen von Schönbeck, Lindow und Brohm, alle drei ebenfalls einst selbständig. Schönbeck hat schon 1293 (2208) seinen eigenen Priester, Lindow erscheint 1534 (Visit.) als selbständige pfarre und Brohm 1541 (Visit.). Dasselbe gilt von den beiden jetzt verbundenen Nachbarkirchen Jatzke und Genzkow. Ersteres hat 1560 einen Pastor; als aber die Pfarre im 30jährigen Kriege abbrannte, zog der Pastor nach letzterem, das also ebenfalls


|
Seite 117 |




|
eine Wedem gehabt haben muß. (Krüger S. 82). Die angrenzende Kirche von Sadelkow ist zwar 1541 mit Eichhorst verbunden (Krüger S. 35) besitzt aber zum Zeugnis ihrer ursprünglichen Selbständigkeit wie damals so noch heute ihre eigenen Pfarrhufen. Eichhorst begegnet zuerst 1541 (Visit.) als eigene Pfarre, das jetzt mit ihm verbundene Liepen ist schon 1306 (3125) durch seinen Pleban als selbständig bezeugt, ebenso das benachbarte Glienke für 1376 (6834 n). Rühlow erscheint 1534 (Visit.) als selbständige Pfarre. Warlin hat schon 1314 (3686) seinen Pfarrer. Über seine Filiale Pragsdorf fehlt es an Nachrichten; vielleicht war es nie mehr als Filiale. Dagegen ist das jetzt mit ihm vereinigte Sponholz 1541 (Visit.) eine eigene Pfarre, die allerdings zur Zeit mit der neubrandenburgischen von Küssow verbunden ist; der Pfarrer wohnte damals in Küssow. Die Pfarre von Neubrandenburg. selbst begegnet zuerst 1271 (1232). Ostwärts an Sponholz grenzt die jetzige Pfarre Dewitz - Cölpin; 1541 (Visit.) waren beide noch getrennt und selbständig. Auch die Nachbarpfarre Kublank - Neetzka - Golm zerfiel ursprünglich in drei; 1534 (Visit.) erscheinen Kublank und Golm als selb=ständige Pfarren; Neetzka hatte noch 1568 seinen eigenen Pfarrer, Patron war das pommersche Kloster Stolpe (Krüger S. 96). Von der ostwärts angrenzenden Pfarre Helpt - Kreckow - Holzendorf scheint Kreckow niemals mehr als Filiale von Helpt gewesen zu sein (Krüger S. 76); letzteres begegnet 1541 (Visit.) zuerst: als Pfarre, Holzendorf aber war einst selbständig, noch 1579 hatte es seinen eigenen Pastor (Krüger S. 81). Das benachbarte Gr.=Daberkow erscheint 1541 (Visit.) als Pfarre. Ob seine jetzige Filiale Mildenitz einst selbständig war, muß dahingestellt bleiben.
Nun folgt die Stadtpfarre von Woldegk; sie erscheint zuerst 1271 (1232). Ihre jetzigen Filialen Canzow und Pasenow waren einst selbständig. Letzteres ist erst 1584 (Krüger S. 236) mit Woldegk verbunden, ersteres, jetzt ritterlichen Patronates und 1382 Pfarre (11439, 3, 5), wird auch nachträglich mit Woldegk verbunden sein, da dessen Kirchspiel im übrigen nur die Stadt=Feldmark um=schließt, also als rein städtisches gegründet sein wird. Die Nachbarpfarre Käbelich erscheint zuerst 1534 (Visit.). Auch ihre Filiale Petersdorf wird ursprünglich selbständig gewesen sein, da sie 1637 und 1671 ein eigenes Pfarrgehöft besaß (Krüger S. 86). An sie schließen sich die 4 schon früh bezeugten Pfarren Leppin, Plath, Ballin und Hinrichshagen (M. U.=B. 2208, 4874, 3127, 3494). Letzteres hatte 1541 (Visit.) eine Filialkapelle in Rehberg. Das östlich an Hinrichshagen grenzende Göhren erscheint zuerst 1541


|
Seite 118 |




|
(Visit.) als Pfarre. Über Wrechen und Fürstenhagen fehlt es an Nachrichten. An sie schließt sich das große zusammengeworfene Kirchspiel Bredenfelde - Cantnitz - Lüttenhagen - Krumbeck - Lichtenberg, ursprünglich 5 Kirchspiele: Bredenfelde selbst erscheint als Pfarre 1534 (Visit.), Cantnitz 1541 (Visit.), Krumbeck schon 1313 (3587), Lichtenberg erscheint 1555 mit eigenem Pfarrer (Krüger S. 233). Endlich Lüttenhagen oder Klein - Hinrichshagen (Krüger S. 22) kann schon der Lage nach nicht ursprünglich zu Bredenfelde gehört haben. Nach dem Visitationsprotokoll von 1534 gehörte es wie Feldberg zur Pfarre Carwitz und damit zum Bistum Brandenburg und Lande Lychen. Zum Bistum Havelberg und Lande Stargard dagegen gehörte Schlicht. Zum Kirchspiel Carwitz - Feldberg hat es ursprünglich nicht gehört, da es in den, Visitationsprotokollen von 1534 und 1541, welche die hierhin gehörigen Kapellen aufzählen, fehlt. Nach Krüger (a. a. O. 16) war es bis zum dreißigjährigen Kriege Filiale von Bredenfelde. Da es aber von diesem durch das Kirchspiel Krumbeck vollständig getrennt ist, kann auch das nicht das ursprüngliche sein, und muß es als einstmals selbständig gelten.
Westwärts an Bredenfelde stößt das Kirchspiel Teschendorf - Loitz. Beide Kirchen erscheinen schon 1534 (Visit.) vereint. Da aber jede mit 4 Hufen dotiert ist (ebendort), sind sicher beide als volldotierte Pfarren anzusehen. Dann folgt Warbende - Watzken=dorf - Gramelow - Quadenschönfeld. Warbende hat schon 1306 (3125) seinen Pfarrer, ebenso 1541 (Visit.). Schon damals scheint Quadenschönfeld mit ihm verbunden. Da jedoch die nächsten beiden Pastoren (in den Jahren 1558 und 1579) in letzterem wohnen, dann aber wieder Warbende Pfarrsitz wird (Krüger S. 214 f.), so müssen beide eine Wedem gehabt haben und ursprünglich selbständig gewesen sein.
Aber auch Watzkendorf war es einst; noch 1560 hatte es seinen eigenen Kirchherrn (Krüger S. 221). Da mit ihm zugleich Henning Behr auf Möllenbeck zur Rechnungsablage vor die Visitatoren zitiert wird, scheint dieses, das jetzt zu Rödlin gehört, damals mit Watzkendorf verbunden gewesen zu sein, wahrscheinlich auch als mater. Über Gramelow fehlt es ganz an Nachrichten; vielleicht war es nie mehr als eine Filiale von Quadenschönfeld, zu dem es 1541 (Visit.) gehört.
Die Nachbarpfarre Rödlin - Kammin - Möllenbeck ist ebenfalls bunt zusammengewürfelt. Wie eben erwähnt, gehörte Möllen=beck einst nicht zu ihr, wie es denn auch durch Watzkendorf voll=ständig von ihr getrennt ist. Dasselbe gilt von Kammin mit den


|
Seite 119 |




|
Dörfern Riepke und Godenswege, von denen das letztere noch 1541 (Visit.) eine eigene Pfarre bildete. Der Rest gehört nicht mehr in das Land Stargard, sondern zu Strelitz (siehe dort).
Wenden wir uns nun nordwärts nach Stargard, so erscheint dieses schon 1288 (1939) als Pfarre. Seine drei Filialen, Sabel, Bargensdorf und Quastenberg, waren wohl nie mehr als Kapellen. Von Sabel wenigstens darf es als sicher angenommen werden, da der Ort mit aller Gerechtigkeit ganz zur Wedem in Stargard gehörte (1541, Visit.). Die Nachbarpfarre Rowa hatte 1541 (Visit.) einen eigenen Pastor, und die beiden Nemerow waren dorthin eingepfarrt. Da die Pfarre aber bald darauf nach Groß=Nemerow verlegt wurde (Krüger S. 121), scheint auch dieses eine Wedem gehabt und einst selbständig - die Pfarre der Komturei Kl.=Nemerow - gewesen zu sein. Dazu stimmt, daß beide, Rowa und Groß=Nemerow, später wieder auseinander gingen, ersteres zu Ballwitz kam (Krüger S. 160), letzteres sich nach Prillwitz hielt (Krüger S. 113). Nun folgen die schon oben behandelten Pfarren Ballwitz, Zachow, Blankensee.
Es sind sonach im eigentlichen Lande Stargard im ganzen 81 selbständige Pfarren gewesen, mit Ausnahme der einzigen von Stargard Selbst alle nur 1 - 3 Ortschaften umfassend, genau dem entsprechend, was die wenigen um 1300 bezeugten Pfarren als Voraussetzung für das ganze Land ergeben hatten. Irgend welche Spuren größerer landesherrlicher Kolonisationskirchspiele, wie sie für die übrigen Teile Mecklenburgs, gleichviel ob Ratzeburger oder Schweriner oder Kamminer Diözesanverbandes, charakteristisch waren, finden sich nicht. Das einzige ein wenig größere - 4 Ortschaften umfassende - Kirchspiel ist das von Stargard selbst, das danach in der Tat älter sein wird als die übrigen und noch in die pommersche Zeit zurückreicht. Die wenigen Kirchen landesherrlichen Patronates - außer den 5 Stadtkirchen sind es nur Lübbersdorf (2058), Glienke, Rühlow und Kublank (Visit. 1534) - sind völlig regellos über das Land zerstreut. Alle anderen Kirchen sind ritterlichen, einige wenige städtischen oder klösterlichen Patronates. 1 ) Was uns schon bisher teils deutlicher, teils undeutlicher entgegengetreten war, daß in den Landstrichen, in denen die Kolonisation erst etwa um 1220 oder später einsetzt, im Gegensatz zu den Gegenden der älteren Kolonisation die kleineren ritterlichen Pfarren immer mehr überwiegen, um schließlich -


|
Seite 120 |




|
wie im Lande Gädebehn - die großen landesherrlichen Koloni=sationskirchspiele ganz zu verdrängen, das zeigt sich hier im Lande Stargard, dementsprechend, daß es erst 1236 der Ein=wanderung geöffnet ward, in vollendetem Maße. Kolonisation und Kirchenbau wurden im wesentlichen nicht von den Landes=herren selbst in die Hand genommen, sondern dem als ihre Lehnsleute einströmenden deutschen Ministerialadel überlassen, der das Land von Anfang an mit einer Anzahl kleiner selb=ständiger Kirchspiele bedeckte. Dazu stimmt Bolls Bemerkung, daß im Lande Stargard fast alle Kirchen "wie nach einem Muster aus Granit erbaut" sind (Geschichte des Landes Stargard I, 177). 1 ) Bei der allgemeinen Wanderlust, die sich im 13. Jahrhundert auch des Klerus bemächtigt hatte - ich erinnere daran, daß der Cisterzienserorden sich genötigt sah, Maßregeln gegen den in seinen deutschen Klöstern überhand nehmenden Drang zur Missionswanderschaft in die Wendenländer zu ergreifen =, mochte es dem kolonisierenden Adel nicht schwer fallen, auch die nötige Zahl von Priestern aus der Heimat mitzubringen oder sonst zu finden.
Man hat diesen auffallenden Unterschied zwischen dem Lande Stargard und dem westlichen Mecklenburg auf ein von dem der nördlichen Bistümer abweichendes Organisationsprinzip der Havelberger Bischöfe zurückführen wollen, die bestrebt gewesen seien, möglichst jedem Ort seinen eigenen Pfarrer zu verschaffen, während erstere sich mit der Errichtung größerer Kirchspiele begnügt hätten. Wie sich uns nunmehr ergeben hat, kann von einer solchen Verschiedenheit der Organisationsprinzipien in den einzelnen Bistümern keine Rede sein. Dieselbe Erscheinung zieht sich durch alle hindurch. Sie beruht nicht auf kirchlichem Plane, sondern auf der sozialen Verschiebung, die im Laufe des 13. Jahrhunderts eintrat, indem seit ca. 1218 der deutsche Ministerialadel immer stärker in die Wendenlande einströmte, als Lehnsmannschaft der Landesherren ansässig ward, und nun seine Tätigkeit inbezug auf Kolonisation und Kirchenbau neben die der Landesherren trat, um sie schließlich fast ganz abzulösen.
Auch im Lande Stargard ist übrigens die Dotation der Pfarren, soweit urkundliches Material vorliegt, meist die bekannte mit 4 gewöhnlichen oder 2 Hägerhufen, so z. B. 4 Hufen in Rühlow, Glienke, Teschendorf, Loitz (Visit. 1534), Krumbeck


|
Seite 121 |




|
(3587), Rowa, Kölpin, Sponholz, Helpt, Badresch, Lindow, Triepkendorf (Visit. 1541), 2 Hägerhusen in Hinrichshagen (3494). Zwei Hufen haben Salow, Roga, Dewitz, Küssow (Visit. 1541), einzelne, wie Cosa, nur eine Hufe (Visit. 1541). Auch hier haben die Pfarrkinder die Wedem zu bauen, wie eine Stargarder Synode von 1288 (1939) ausdrücklich festsetzt. Dasselbe gilt natürlich auch hier von dem Kirchengebäude selbst.
Die Reste der wendischen Bevölkerung - wie sie die Wittesche Karte verzeichnet - sind im Lande Stargard durchweg geringer als in den meisten Teilen des übrigen Mecklenburg; unter den Kirchdörfern zeigen nur Ganzkow, Neverin, Blankensee und Watzkendorf noch in späterer Zeit solche in stärkerem Maße; wendische Verfassung hat kein einziges mehr.
Wenden wir uns nun südwärts zum Lande Ahrensberg - Strelitz, dessen wahrscheinlichen Umfang wir oben (S. 108 f.) fest=zustellen versucht haben. Die Bischöfe von Havelberg machten Rechte auf dasselbe geltend, die auch 1305 (2980) von den Markgrafen anerkannt wurden, wie es scheint, jedoch nur vorübergehend; denn schon 1329 (5081) finden wir das Land in ihren Händen. Vorher war es als Stiftslehen in denen der Herren von Lindow. Jedenfalls gehörte es zur Havelberger Diözese.
Auch hier sind wir über die Einführung der kirchlichen Organisation schlecht unterrichtet. Wahrscheinlich fand sie erst zugleich mit der im Lande Stargard statt. Zu Fürstensee finden wir 1287 (1931) einen Priester. Die Pfarrer von Prillwitz, Usadel, Rollenhagen und Rödlin begegnen, wie schon gesagt, 1310 und 1312 (3404, 3512). Die Pfarre von Strelitz wird zuerst 1329 (5081 f.) genannt, also bereits ehe der Ort zur Stadt erhoben ward. Später finden wir hier sogar ein Kollegiatstift (7086). Ahrensberg wird 1329 (5081) "stedeken" genannt, hatte also sicher auch seine Kirche. Die von Grünow erscheint 1345 (6504); damals erwarb das Kloster Wanzka, nachdem es schon 1342 (6249) den Ort erworben hatte, das Patronat von den Kruse's. 1366 ist noch Streit darüber mit dem Kollegiatstifte zu Strelitz (9476). Das ist alles, was an mittelalterlichen Nachrichten vorhanden ist.
Wie Stargard ist auch Strelitz mit Pfarren kleinsten Umfanges bedeckt. Die jetzige Parochie Pri1lwitz zerfiel einst in fünf kleine Kirchspiele, von denen eins, Hohen=Zieritz mit Zippelow, schon zum Lande. Penzlin gehörte (vergl. oben S. 105). Eine zweite Pfarre begegnet 1310 in Usadel (3404); sie scheint


|
Seite 122 |




|
um 1572 bereits eingegangen gewesen zu sein. Weiter aber führt jenes Verzeichnis der Strelitzer Kaspelkirchen von 1572 die Kirche zu Blumenhagen mit der Filiale zu Glambeck und die von Weisdin auf. Zu letzterer wird die jetzige Filialkapelle von Blumenholz gehört haben. Erst der Rest bleibt für das einstige Kirchspiel Prillwitz. Weiter aber muß auch im Gebiet der jetzigen Pfarre Neu=Strelitz eine Kirche bestanden haben. Jenes Verzeichnis von 1572 hat hier freilich keine Pfarre, aber Zierke besaß eine Kirche, die lange von Blumenhagen aus versorgt worden ist. Da aber 1707 die Pfarre von letzterem nach Zierke verlegt ward, so muß sie mit Wedem und Acker ausgestattet, also ursprünglich selbständig gewesen sein (Krüger S. 14). Südwärts an Zierke stößt das Kirchspiel Gr.=Quassow - Userin. Es zerfiel 1572 in die zwei Kirchspiele, das von Userin mit der Filiale Gr.=Quassow und das von "Lütken= und Großen=Trebbow". Ersteres umfaßt den alten, bereits vor 1346 (6628) veräußerten Besitz des Klosters Stolp und ist wohl eine Gründung desselben; die Pfarre begegnet zuerst 1534 (Visit.). Nun folgt Ahrensberg; es begegnet erst in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts als Pfarre (Schlie V, 588), seine südliche Nachbarin, Strasen, 1534 (Visit.), jedoch ohne ihre beiden Filialen Wustrow und Priepert. Erstere war längere Zeit mit der zweiten Pfarre in Wesenberg verbunden und ward erst 1772 zu Strasen gelegt (Krüger S. 223), und letztere war im 16. Jahrhundert Filiale von Ahrensberg (Schlie V, 588), wahrscheinlich aber ehemals selbständig. Wenden wir uns nun wieder nordwärts, so hatte Fürstensee, wie bereits gesagt, schon 1287 seinen Priester; es erscheint auch 1572 als eigene Pfarre Auf dieses folgt Alt=Strelitz selbst, schon 1329 als Pfarre bezeugt. Mit ihr ist jetzt Thurow verbunden, es war aber noch 1572 eine selbständige Pfarre mit einer Filialkapelle zu Zinow. Nun folgen Rollenhagen und Rödlin, welche schon 1312 ihre eigenen Pfarrer hatten. Letztere Pfarre aber, welche jetzt eine ganze Reihe von Dörfern umfaßt, zerfiel einst noch in nicht weniger als 6 Pfarren, von welchen 3, Kammin, Godenswege und Möllenbeck, als zum Lande Stargard gehörig, schon oben behandelt sind. Auf dem Rest erscheinen 1572 die beiden Pfarren Rödlin und Groß=Schönfeld. Aber auch Carpin hatte 1560 seine eigene Kirche; sie war damals mit dem stargardschen Watzkendorf verbunden (Krüger S. 221); da sie aber von dem=selben durch das Groß=Schönfelder Kirchspiel vollkommen getrennt ist, so muß auch sie als ursprünglich selbständig angesehen werden.


|
Seite 123 |




|
Östlich und südlich an die ebengenannten grenzt das große Heidekirchspiel Grünow; auch dieses zerfiel noch 1572 in drei, nämlich Grünow, Dolgen und Bergfeld; von diesen war Dolgen 1541 mit Triepkendorf verbunden gewesen, später mit Gr.=Schönfeld, bis es endlich zu Grünow kam (Krüger S. 172) und Bergfeld ebenfalls 1580 mit Schönfeld vereint (ebenda). Endlich gehörten 1572 zum Lande Strelitz noch die beiden kleinen Heidepfarren Grammertin, wohin das jetzt zu Grünow gehörige Goldenbaum eingepfarrt war (Krüger S. 70 f.) - sie ist im 30jährigen Kriege untergegangen =, und Wokuhl, letzteres seit 1285 (1797) im Besitz der Johanniter Komturei Mirow, später Nemerow.
Wir zählen also im Lande Strelitz - Ahrensberg im ganzen 23 Pfarren. Ihr Umfang beschränkt sich, abgesehen von Prillwitz und Userin, welche ein wenig größer sind, meist nur auf eine einzige Ortschaft, höchstens aber auf drei.
Schon länger endlich als die bisher behandelten Gebiete scheint das Land Lychen in den Händen der Markgrafen gewesen zu sein. Indes wird seine Germanisation kaum vor der des Landes Stargard begonnen haben. Erst zugleich mit Neu=Brandenburg und Friedland ward auch hier eine deutsche Stadt begründet - 1248 =, und noch 1299 bei der Stiftung des Klosters Himmelpfort erscheint das Land größtenteils als Wald und Heide (2582). Auch die kirchliche Organisation wird erst mit der Einwanderung in Gang gekommen sein. Lychen selbst besaß natürlich von seiner Erhebung zur Stadt an, 1248, eine Kirche, vermutlich aber als Hauptort doch auch schon früher. Sein Kirchspiel scheint ursprünglich auch Dabelow noch umfaßt zu haben (5819). Fürstenberg erscheint zuerst 1287 (1931) mit einem eigenen Priester. Ob sein jetziges Filial Buchholz einst selbständig war, muß dahingestellt bleiben. Dagegen scheint das jetzige Kirchspiel Tornow - Blumenow - Barsdorf - Dannenwalde aus 4 selbständigen zusammengeworfen zu sein. Bei der Visitation von 1568 ward beschlossen, Blumenow mit Dannenwalde und Tornow mit Barsdorf zusammenzulegen; 1575 ist denn auch ein Pastor in Dannenwalde vorhanden. Aber auch Blumenow hat 1586 seinen eigenen Pfarrhof (Krüger a. a. O. S. 30), war also einst selbständig. Über Barsdorf fehlt es mir an weiteren Nachrichten.
Nordwestlich der Stadt Lychen erwarb die Johanniter Komturei Nemerow am Ende des 13. Jahrhunderts die Heidedörfer Wokuhl, Dabelow, Kl.=Karstavel, Gnewitz und Gardow (1797, 1873, 2791,


|
Seite 124 |




|
5819). Es entstand hier eine neue Komturei in Gardow, für deren Besitz eine Pfarre in Dabelow errichtet ward. Sie begegnet uns freilich erst 1638 (Krüger a. a. O. S. 23). Ihr Patronat gehört aber noch 1664 der "Komturei Lütken=Nemerow" (a. a. O. S. 24).
Ebenso wie über Grammertin fehlt es an mittelalterlichen Nachrichten für die Pfarren Triepkendorf - Mechow und Carwitz - Lüttenhagen - Feldberg Wittenhagen - Conow. Triepkendorf erscheint 1534 (Visit.) als landesherrliche Pfarre, und 1541 (Visit.) ist Mechow, das seit 1271 (1232) Broda, seit 1290 (2058) Wanzka gehörte, mit ihm verbunden, doch erscheint auch letzteres nach dem Prokurationsbuch des Bistums Brandenburg als selbständige Pfarre. Was das zweite große Kirchspiel betrifft, so war 1534 (Visit.) die Pfarre in Carwitz. Zu ihr gehörten die Kapellen in Feldberg, Läven und Hinrichshagen (= Lüttenhagen). Conow und Wittenhagen gehörten also damals noch nicht dorthin. Über ersteres fehlt es mir an Nachrichten. Letzteres hatte eine eigene Wedem und war mit 4 Hufen dotiert (Krüger a. a. O. 233 f.), also von Haus aus selbständig. Beide werden schon zum Bistum Kammin gehört haben. Läven gehört jetzt zu Triepkendorf und Lüttenhagen ist mit Bredenfelde verbunden. Erst 1857 ward die Pfarre von Carwitz nach Feldberg verlegt. Doch scheint der Pastor schon 1541 (Visit.) dort gewohnt zu haben. Läven war mit 2 Hufen dotiert, Hinrichshagen mit einer (Visit. 1541). Wahrscheinlich waren also auch diese Kirchen einst alle selbständig. Das Netz der Pfarren erscheint sonach auch - hier im Bistum Brandenburg - ebenso engmaschig wie im Lande Stargard Havelberger Verbandes. Offenbar ist es dieselbe Kolonisationswelle, die hier wie dort die kirchliche Organisation gebracht hat.
7. Ergebnisse.
Es erübrigt nun die Ergebnisse dieses letzten Kapitels kurz zusammenzufassen. Wie wir gesehen, mußte bei der Lücken=haftigkeit der Daten die Gründungszeit mancher Pfarren unsicher bleiben. Immerhin dürfte soviel deutlich geworden sein, daß man bei der unter dem Einfluß der deutschen Einwanderung vor sich gehenden Ausgestaltung des Pfarrnetzes auch im Bistum Schwerin sowie den Kamminschen und Havelberger Teilen Mecklenburgs zwei Perioden zu unterscheiden hat, eine ältere der größeren und fast ausschließlich landesherrlichen Kirchspiele, welche vom Beginn der


|
Seite 125 |




|
Einwanderung bis rund 1235 reicht, und eine jüngere der kleineren und kleinsten Kirchspiele, fast ausschließlich privater, d. h. ritterlicher oder klösterlicher Stiftung, welche von da ab bis in das erste Drittel des 14. Jahrhunderts, also rund bis zum Jahre 1335, reicht. Mit diesem aber hört die Errichtung neuer Pfarren so gut wie ganz auf. In den ganzen hier in Frage kommenden Gebieten steht nur die Errichtung von 4 Pfarren nach dem Jahre 1335 ziemlich fest. Von einer ganzen Reihe mußte es allerdings fraglich bleiben, ob sie vor oder nach diesem Jahre gegründet sind, zieht man aber in Betracht, daß es nicht nur im Westen - für die Bistümer Lübeck und Ratzeburg =, wo ein lückenloses urkundliches Material vorliegt, sondern ebenso im Osten - im Lande Stargard - für diejenigen Komplexe, für welche das urkundliche oder baugeschichtliche Material ausreichend ist, gilt, daß der Ausbau des Pfarrsystems mit dem Jahre 1335 abgeschlossen ist und nur noch ganz vereinzelte Nachläufer fehlen, nimmt man dazu, daß sich uns in denjenigen Teilen des mittleren Mecklenburg, für welche das Material ergiebiger ist, wie die Länder Goldberg, Plau, Lübz in seiner südlichen und den größeren Teil der nördlichen Hälfte, dasselbe Resultat ergeben hat, so dürfen wir es unbedenklich auch als für die übrigen geltend annehmen. Es können nur ganz vereinzelte Kirchen unter denen, deren Gründung vor 1335 nicht erweislich ist, als erst nach diesem Jahre errichtet angesehen werden.
Vergegenwärtigen wir uns nun diese Entwickelung etwas genauer, so war es die erneute Kolonisationsbewegung, der sich nach dem Jahre 1204 unter der dänischen Herrschaft auch die Länder der mecklenburgischen Wendenfürsten öffneten, welche den Ausbau des bisher noch sehr unvollkommenen Pfarrsystems im Bistum Schwerin herbeiführte. Hatte bis dahin die Errichtung von Kirchen sich im wesentlichen - abgesehen von der Grafschaft Schwerin - an die wendische Burgwardverfassung angeschlossen, so wurden nun im Anschluß an die deutsche Einwanderung, soweit dieselbe reichte, und mit ihr fortschreitend in einträchtigem Zusammenwirken von Bischof und Landesherren überall planmäßig Kirchen gebaut und Kirchspiele von 9 - 13 Ortschaften abgegrenzt. Wie der Strom der deutschen Einwanderer von Westen nach Osten fortschreitend zuerst den Norden Mecklenburgs besetzte und um 1210 bereits die Ostgrenze bei Marlow erreicht hatte, so ist es auch der Norden, dessen Pfarrsystem zuerst ausgebaut wurde. Um 1224 war es westlich der Warnow bereits fertig und begann man schon mit der Errichtung kleinerer nachgegründeter Kirch=


|
Seite 126 |




|
spiele, um die bei der ersten Einteilung gelassenen und inzwischen durch die fortschreitende Kolonisation erfüllten Lücken zu schließen - Satow, Lambrechtshagen, Dreweskirchen. Besonders reichlich war von Anfang an die Versorgung mit Kirchen im bischöflichen Stiftslande unter Brunwards alleiniger Leitung. Aber auch ostwärts der Warnow muß es um 1230 ebenso weit gewesen sein. So kamen im Lande Mecklenburg - Brüel - Bukow zu den vielleicht 6 älteren Kirchen 6 - 7 weitere, in den westwarnowschen Teilen der Länder Rostock und Schwaan zu den 5 - 6 älteren 11 - 12 neue Kolonisationskirchspiele, im Lande Bützow zu der älteren Kirche des Hauptortes 8 weitere, östlich der Warnow erstanden im Lande Werle 7 Kirchspiele, im Lande Rostock zunächst wohl die drei größeren, das Maß der Kolonisationskirchspiele überschreitenden von Bentwisch, Sanitz und Ribnitz. Man vergleiche hier die ebenfalls größeren, am Ostrande der ersten Kolonisationsbewegung liegenden Kirchspiele des Landes Wittenburg: Wittenburg, Hagenow und Vellahn. Sehr bald aber - d. h. wohl auch noch vor ca. 1235 - kamen noch 5 weitere, unter ihnen sogar schon Hagenpfarren hinzu, und zur selben Zeit war die Bewegung auf das vorpommersche Gebiet übergetreten und mit der Einwanderung zu den 3 - 5 alten Kirchen eine Reihe, etwa 7 - 10, neuer entstanden. Um 1232 war diese ganze Nordhälfte des Bistums sogar schon in Archidiakonate eingeteilt und damit der kirchliche Aufbau vollendet.
Auch der Grafschaft Schwerin und ihrer kirchlichen Entwickelung kam die erneute Kolonisationsbewegung zu gute. Der östlich vom Schweriner See gelegene Teil des Landes erhielt jetzt mit der deutschen Einwanderung auch seine Kirchen, und auch in die bisher wendisch gebliebene Heidegegend südlich des Sees drang die kirchliche Organisation vor. Im ganzen mögen hier bis zu Brunwards Tode 7 - 9 neue Pfarren entstanden sein.
Zur selben Zeit aber setzte nun auch im östlichen Teile Mecklenburgs, im damals pommerschen Circipanien, die kirchliche Arbeit von Kammin her ein, wahrscheinlich auch hier größtenteils im Zusammenhange mit der beginnenden Einwanderung. Unter Bischof Sigwins und seines Nachfolgers Konrad Leitung wurden auch hier Kirchen gebaut und Kirchspiele eingerichtet in derselben Weise wie im übrigen Mecklenburg. Zu den drei alten Burgward=Kirchen der Länder Gnoien, Kalen und Malchin kamen so bis zum Jahre 1235 5 - 6 weitere Pfarrkirchen. Brunwards Bemühungen, die verlorenen Gebiete zurückzugewinnen, waren vergebens. Ein Anlauf dazu, den er 1226 machte, als der westliche


|
Seite 127 |




|
Teil Circipaniens unter mecklenburgische Herrschaft gekommen war, indem er die Errichtung eines Kollegiatstiftes in Güstrow betrieb und erreichte, war vergebens. Schon 1230 finden wir auch hier den Kamminer Bischof in Besitz. Ob es überhaupt noch zu weiteren Kirchenerrichtungen hier unter schwerinscher Leitung gekommen ist, bleibt zweifelhaft. Der eigentliche Ausbau des Pfarrsystems geschah unter kamminischer Leitung. Es mögen bis ca. 1235 zu der Güstrower Kirche hier noch 4 - 5 Kirchen gekommen sein.
Ein wenig später als im nördlichen Mecklenburg scheint die Kolonisation im südlichen eingesetzt zu haben - wohl erst im Laufe des zweiten Jahrzehntes des 13. Jahrhunderts, und bald macht sich hier auch die Tätigkeit des deutschen Adels bemerkbar. Dem entspricht es, daß hier die Kirchspiele von vornherein kleiner angelegt werden und neben den landesherrlichen Kirchen auch ritterliche schon zu erscheinen beginnen. Bis zum Jahre 1235 entstanden im Lande Goldberg 7, im rechtseldischen Teile des Landes Parchim ca. 18, im Lande Plau 3, in Malchow ca. 6, in Waren 5 - 8 Pfarren. Da hier bis dahin überhaupt nur die 3 Kirchen von Parchim, Quetzin und Malchow bestanden zu haben scheinen, so nahm der Kirchenbau jetzt erst eigentlich seinen Anfang, überflügelte aber sofort den im nördlichen Mecklenburg.
Und mit der Einwanderung drang die kirchliche Organisation von Schwerin aus auch über die Elde in die mit Havelberg strittigen Gebiete vor. Wir haben gesehen, wie bis in die unwirtlichen Gegenden des Besuntwaldes Brunwards Tätigkeit es war, die ordnend und bestimmend eingriff, und daß hier in diesen Grenzgebieten, in denen die Kolonisation eben Fuß zu fassen begann, noch 10 - 20 Kirchen unter seiner Leitung errichtet sind. Ebenso ist er es, dem die östlich der Müritz gelegenen Teile der Lieze und das Land Penzlin ihre erste kirchliche Einteilung verdanken; 4 - 6 Kirchen sind auch in diesen Grenzstrichen noch unter der Leitung des Schweriner Krummstabes gebaut und besetzt worden.
Es ist eine ungemeine und ausgebreitete Tätigkeit, die in den letzten 30 Jahren der Amtsführung Brunwards von Schwerin aus ins Werk gesetzt und geleitet wurde, ein enormer Umschwung der gesamten Dinge, der in ihnen eintrat. Als Brunward sein Amt antrat, mochten im gesamten Schweriner Bistum vielleicht 28 Kirchen bestehen; als er im Januar 1238 die Augen zutat, hinterließ er eine Diözese, die bis an die entlegensten Grenzen mit Kirchen und Priestern versorgt, wohlgeordnet und eingeteilt


|
Seite 128 |




|
war und deren bis dahin fast ganz heidnische Bevölkerung jetzt überall stark mit christlichen Deutschen durchsetzt war. Es sind unter Brunwards Amtsführung allein nicht weniger als 100 bis 125 Kirchspiele errichtet worden. Freilich sind ihre Kirchen mit wenigen Ausnahmen in deutschen Besetzungsdörfern erbaut worden, doch blieb auch in diesen selbst fast immer ein großer Teil der wendischen Einwohnerschaft in untergeordneter Stellung sitzen, und wo es an deutscher Einwanderung noch mangelte, da errichtete man auch in Wendendörfern Kirchen. Das bisher als ganzes immer noch heidnische Land war christlich. Die letzten Reste heidnischer Bevölkerung, die sich vielleicht hier und dort noch hielten, mußten bald genug aufgesogen werden. Das konnte nur noch eine Frage weniger Jahrzehnte sein.
Aber wie die Kolonisation noch nicht zum Stillstande gekommen war, sondern teils als dichtere Besetzung des urbaren Landes, teils als Waldkolonisation noch fortging, so entstanden auch noch fortwährend zahlreiche neue Kirchspiele. Es beginnt die Periode der ritterlichen Kirchengründungen, neben denen nur noch einzelne landesherrliche und eine Reihe von klösterlichen erscheinen. So füllen sich allmählich die Lücken, welche die erste kirchliche Einteilung noch, gelassen, und verkleinern sich die reichlich großen Kirchspiele der ersten Epoche. In der Grafschaft Schwerin entstanden so noch 10 kleinere Pfarren, die namentlich den südlichen Heidestrecken und ihren wendischen Bewohnern zu gute kamen, soweit nicht diese jetzt noch weiter zurückgedrängt wurden. Im Lande Mecklenburg - Brüel - Bukow kamen noch 12 kleinere Kirchspiele hinzu, die sich in schmalem Zuge an der östlichen Grenze hinziehen; im Lande Rostock - Schwaan westlich der Warnow 8, zum Teil Waldpfarren, ostwärts des Flusses 12, auch hier zum Teil Waldpfarren. Noch mehr - über 20 - sind es, die im schwerinschen Vorpommern erstanden. Auch das Stiftsland Bützow hat trotz seiner reichlichen Versorgung noch 4 weitere Pfarren erhalten - unter ihnen nur eine ritterliche.
Während aber die nördliche Hälfte des Landes, deren Kolonisation früher begonnen und auch früher zum Abschluß gekommen war, trotz dieser Nachgründungen im allgemeinen ihren durch die älteren und größeren Kirchspiele gekennzeichneten Charakter bewahrt hat, ist derselbe in der südlichen mehr und mehr durch die zahlreichen kleinen Nachgründungen verwischt worden, und sind es diese letzteren, welche dem Lande den kirchlichen Charakter geben. Hier sind im Lande Goldberg noch 3, im Lande Sternberg - Parchim schwerin=


|
Seite 129 |




|
schen Teils 22, in den Ländern Plau, Malchow, Waren 10 bis 12 Pfarren errichtet worden.
Im ganzen hat also das Bistum Schwerin noch einen Zuwachs von 81 - 83 Pfarren auf mecklenburgischem Boden erhalten, wozu noch die vorpommerschen jüngeren Pfarren kommen würden, deren Zahl ich nicht genauer anzugeben vermag, die aber immerhin 20 übersteigen wird.
In Circipanien hatte sich der Bischof von Kammin behauptet; er blieb im Besitz, auch als Circipanien um 1235 ganz unter mecklenburgische Herrschaft kam. Wie gesagt, hatte auch hier der Ausbau des Pfarrsystems bereits unter pommerscher Herrschaft begonnen und waren zu den alten Burgwardpfarren aus der Bernonischen Zeit eine Reihe weiterer gekommen; durchgeführt ward jedoch dieser Ausbau - auch hier nach dem Prinzip der, großen landesherrlichen Kolonisationskirchspiele - erst unmittelbar nach dem Übergang in die mecklenburgische Herrschaft. Die Zahl der Kirchspiele muß bis etwa zum Jahre 1240 auf etwa 25 - 26 angewachsen sein. Um dieses Jahr begann man auch hier bereits mit der Errichtung von Hagenpfarren (Papenhagen) und der Teilung der alten Riesenkirchspiele (Basedow). Auch hier ist dann die Entwickelung zur Gründung zahlreicher kleiner ritterlicher Kirchspiele weiter geschritten, spärlich in den nördlicheren Gegenden - Land Gnoien und Kalen =, reichlich in den südlichen. Sie brachte noch 25 - 26 neue Kirchspiele hinzu. Noch stärker überwiegen diese letzteren in den beiden Ländchen Tüzen und Gädebehn, welche bis zum Beginn des 14. Jahrhunderts unter pommerscher Herrschaft blieben. Vor dem Beginn der Kolonisation, die hier erst in den zwanziger Jahren begonnen haben wird, mag in jedem der beiden nur eine Burgwardkirche - zu Tüzen und Mölln - bestanden haben. Im Lande Tüzen finden sich noch Spuren älterer größerer Kolonisationskirchspiele, im Lande Gädebehn aber fehlen sie ganz; in beiden führte die Entwicklung zu einem überaus engmaschigen Netz kleiner und kleinster Pfarren, - ich zähle im ganzen deren 27.
Dieselbe Entwickelung finden wir in den südlichen und östlichen an Havelberg verlorenen Grenzgebieten, in denen die erste kirchliche Einrichtung noch auf Brunward zurückzuführen ist. Auch hier sind die älteren größeren landesherrlichen Kirchspiele von der unmittelbar nach ihrer Errichtung einsetzenden ritterlichen Kolonisation und Kirchengründung überwuchert worden. Es mögen in den Ländern Parchim, Brenz, Marnitz, Gorlosen 12 - 16, im havelbergischen Teil der Ämter Lübz und Plau 7, im Lande


|
Seite 130 |




|
Röbel 12, in der Lieze - wo die klösterliche Kirchengründung in den Vordergrund tritt - mit Einschluß der Heidegegend um Kratzeburg ca. 25, und endlich im Lande Penzlin noch 11 selbständige Pfarren nach dem Übergang dieser Länder unter die Jurisdiktion des Havelberger Bischofs errichtet worden sein.
Die jüngsten Kolonisationsgebiete, Stargard, Ahrensberg und Lychen endlich, in die der Strom der Einwanderung erst nach 1236 einzuströmen begann, weisen gar keine Spuren jener größeren Kirchspiele der ersten Kolonisationszeit auf. Sie sind wie das Land Gädebehn mit einem außerordentlich engmaschigen Netz kleiner Pfarren überzogen, die fast ausschließlich ritterlicher Gründung sind, und auch hier im äußersten Osten ist der Ausbau des Pfarrsystems mit dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts abgeschlossen, die Entwickelung, um deren Verfolgung es sich. in dieser Arbeit handelt, zu Ende gekommen.
~~~~~~~~~~~~~
VI.
Die Filialkapellen.
Schon früh hat man auch mit der Errichtung von Filialkapellen begonnen. Schon das Ratzeburger Zehntregister scheint solche zu kennen (Valluhn, Lassahn, Wedendorf, Gramkow), und zur selben Zeit begegnen die ersten Filialen im Schweriner Bistum (Wttenförden, Banzkow, Uelitz, Buchholz, Dreweskirchen). Diese älteren Filialen erscheinen meist wie die Mutterkirchen mit Acker dotiert, so jene 4 Ratzeburgischen (375: S. 366, 370, 372), die schwerinsche von Wittenförden (237). Sie sind teilweise später selbständig geworden. Neben der Ausstattung mit Acker findet sich schon bei Wittenförden die durch Kornlieferungen. Hier hatte jeder der Bauern jährlich 1 Wispel Roggen zu liefern. Auch Dreweskirchen ward mit der Lieferung von jährlich 11 Drömpt Meßroggen ausgestattet. Über die in diesen Filialkapellen zu haltenden Gottesdienste sind wir nur für Wittenförden unterrichtet. Dort aber sollte allwöchentlich Messe gelesen werden.
Die Initiative zur Errichtung scheint von den bäuerlichen Einwohnern selbst ausgegangen zu sein, so offenbar bei Drewes=


|
Seite 131 |




|
kirchen (363) und doch wohl auch bei Wittenförden, wo es im übrigen der Landesherr ist, der die Kirche ausstattet (237).
Genauer unterrichtet sind wir über die Art, wie die Errichtung von Filialkapellen zu Anfang des 14. Jahrhunderts vor sich ging, und über die damals hierbei üblichen Festsetzungen. Niemals - soweit das Material reicht - geht die Anregung zur Errichtung einer Kapelle von der kirchlichen Oberbehörde aus. Immer sind es die Ortseingesessenen oder Grundherren, denen auf ihre Bitte die Errichtung gestattet wird. Sie haben natürlich auch die Baupflicht. Zum großen Teil ist es der ortseingesessene. Adel, der die Kapellen stiftet und dotiert, so 1299 (2551) die von Below in Below, 1326 (4749) die von Kruse, Goltbek, v. Berge und Nemerow in Lehsten, 1329 die von Trechow, York, Babbe und Wardenberg in Langen=Trechow (5046 n) und die von Wulfskroge, Horst und Barolt in Passin (5046). Doch sind sie nicht immer die einzigen Beteiligten. Während nämlich die von Below in Below einfach die Einkünfte der Kapelle festsetzen und der Abt von Doberan bei Errichtung der Kapelle seines Klosterdorfes Gallin (7945) im Jahre 1354 kurzweg die villani mit der für die Messen zu leistenden Entschädigung "belastet" (onerare), stehen bei Stiftung der Kapellen in Trechow und Passin die bäuerlichen Einwohner dieser Orte neben dem Adel ("una cum villanis") als mithandelnde. Offenbar hatten sie, weil es sich bei den jährlich für die Messen von den Colonen zu leistenden Abgaben um neue Auflagen handelte, die ihnen auferlegt wurden, als freie Erbpächter ein Wort mitzureden, und konnte ohne ihre Willigkeit und Zustimmung nichts geschehen. Bei jener Ausstattung der Kapelle von Below, bei der die villani nicht erwähnt werden, mag es sich um Einkünfte aus schon bestehenden Leistungen - Pacht, Census, Zehnt - handeln. In der Handlungsweise des Doberaner Abtes dagegen kündigt sich schon die beginnende Herabdrückung der freien Erbpächter in die Hörigkeit an. In den landesherrlichen Amtsdörfern dagegen sind es ausschließlich. die villani, die Bauern und Kossaten, selbst, welche die Errichtung, ihrer Kapellen ins Werk setzen und sich zur Leistung von Abgaben verpflichten; so bei der Gründung der Mistorfer Kapelle (6252). Der Landesherr gibt nur durch Besiegelung des Stiftungsbriefes seine Zustimmung. Ebenso verhält es sich bei der Kapellenstiftung in dem Güstrower Kapitelsdorf Göldenitz - in welchem übrigens auch der Landesherr noch Besitztitel hatte - . Auch hier geben Domkapitel und Landesherr nur ihre Zustimmung. Man sieht, wie selbständig handelnd, opferwillig und voll Initiative hier


|
Seite 132 |




|
auch in kirchlicher Hinsicht der freie Bauer noch auftritt, und wie die Errichtung von Kapellen selbst auf dem Grundbesitze des Adels durchaus nicht allein dessen Werk ist, sondern ebenso sehr das seiner Bauern.
Nun zu den bei der Errichtung von Kapellen üblichen Festsetzungen! Als typisches Beispiel mögen hier die für die Bützower Filialen zu Passin und Langen=Trechow im Jahre 1229 (5042, 5046) getroffenen Bestimmungen folgen. Viermal im Jahre, an den drei großen Festen und am Kirchweihtage, soll in der neu erbauten Kapelle Messe gelesen werden. Dazu haben die Ortseingesessenen einen angemessenen, mit zwei Pferden bespannten Wagen zu stellen, welcher den Meßpriester und seinen Ministranten holt und zurückbringt. Dafür erhält der Pfarrer der Mutterkirche (hier Dekan und Kapitel von Bützow) jährlich 4 Mark, welche von allen aufzubringen sind, welche die Hufen des Dorfes bebauen - also von den Bauern und den adligen Höfen. Taufen und Beerdigungen werden der Mutterkirche reserviert, ebenso die Oblationen, das, was gegeben wird, wenn die Juraten mit dem Bedelbrette gehen, und der Inhalt des Stockes. Legate, die der Kapelle gemacht werden, sollen nur zu einem Drittel derselben zur Anschaffung von Büchern, Kelchen und Paramenten gehören, die andern beiden Drittel der Mutterkirche und ihrem Pfarrer (hier Dekan und Kapitel) zufallen. Von einer Dotierung mit Acker ist nicht die Rede.
Diesen Bestimmungen entsprechen im wesentlichen die der übrigen Kapellen, deren Stiftungsbriefe uns erhalten sind, so die von Mistorf und Göldenitz aus den Jahren 1342 und 1360 (6252 und 8740). Bemerkenswert ist nur, daß sich bei Mistorf 4 Dörfer zusammentun, um die Kapelle zu bauen, daß in beiden Kapellen 6 Messen jährlich. gelesen werden sollen. Zu den Messen der großen Feste und der Kirchweih kommen hier noch zwei, an Assumptionis Mariae und am Tage des Patrons der Kapelle, hinzu. Dafür erhält der Pfarrer von jeder Hufe einen, bezw. in Göldenitz 1 1/2 Scheffel Roggen und von jedem Käter 16 Pfennige, der ministrierende Scholar für jede Messe einen Schilling.. Die Mistorfer Kapelle erhält auch das Beerdigungsrecht. In Malchow (4620) soll der Pfarrer jährlich 14 Scheffel Roggen und 5 Mark, der Küster 7 Scheffel Hafer erhalten, dafür "debet semel missam administrare" - einmal im Jahr, oder in der Woche? =. Ähnliche Bestimmungen hat auch der Stiftungsbrief der Kapelle in Lehsten vom Jahre 1326 (4749), nur daß hier noch zwei Katen geschenkt werden. Abweichend sind die Bestimmungen über


|
Seite 133 |




|
die Meßtage für die von Doberan 1354 (7945) in Gallin errichtete Kapelle; hier sollen 4 Messen, und zwar in der zweiten Woche nach Ostern, in der Frohnleichnams=, Michaelis= und Epiphanias=Woche, gehalten werd en. Fremde sollen auf dem Kirchhof beerdigt werden können, während die Einheimischen an den Friedhof der Mutterkirche Kuppentin gebunden bleiben. Am reichlichsten ist die Entschädigung, welche dem Pfarrer von Techentin 1299 bei Stiftung seiner Filiale in Below ausgesetzt sind (2521); er soll 30 Scheffel Roggen und 7 Mark jährlich erhalten. Dafür aber muß er auch an allen Sonn= und Festtagen, ja, auch in der Woche zweinmal in Below Messe lesen. Mit Acker sind alle diese Kapellen nicht dotiert. In Scharpzow soll 1303 die Kapelle mit einem Scheffel von jeder Hilfe und 8 Mark jährlich aus=gestattet werden (2892).
Ich gebe nun eine Aufzählung der in den verschiedenen Bistümern auf mecklenburgischem Boden errichteten Kapellen mit Hinzufügung ihrer ersten Erwähnung, woran sich bei jedem Bis=tum eine Zusammenstellung der wenigen Daten über die Gründungs=zeit derselben schließen wird und ein Versuch, aus diesen wenigen Daten einige Schlüffe zu ziehen. Als Quellen für diese Zusammenstellung dienten neben den heute noch vorhandenen und im Staatskalender aufgeführten Kapellen das Mecklenburgische Urkundenbuch und die Visitationsprotokolle von 1534 und 1541/42. Im übrigen war ich auf das Schliesche Denkmäler=werk angewiesen, das allerdings nicht ganz erschöpfend ist. So hat er, um ein Beispiel zu nennen, die 1534 erwähnten Filialen: von Thürkow und Hohen=Mistorf übersehen. Da aber auch die Visitationsprotokolle es bisweilen unterlassen, die Kapellen nam=haft zu machen, so mögen auch in meiner Zusammenstellung möglicherweise einzelne Kapellen fehlen.
Ich beginne mit dem Bistum Natzeburg und gehe es nach den einzelnen Ländern durch.Im Lande Wittenburg begegnen in der Parochie Hagenow die Kapellen von Bakendorf, 1603, und Toddin 1520 (Schlie III, 8, 14, Anm. 3); in der Parochie Wittenburg die von Lehsen und Waschow, 1554 (Schlie III, 51); in der Parochie Döbbersen die von Boddin undDusternbeck, 1534 (Visit.); in der Parochie Vellahn die von Marsow, 1534 (Visit.), und von Banzin, 1653 (Schlie III, 93); in der Parochie Kammin die Kapellen von Goldenbow und Dodow, 1653 (Schlie III, 94); in der von Zarrentin die zu Valluhn, 1230 (375: S. 366); in der von Neuenkirchen die von Lassahn, 1230 (375: S. 366); in der von Pritzier die


|
Seite 134 |




|
Kapelle zu Warlitz, 1653 (Schlie III, 148). Die Parochien Lützow, Gammelin, Parum und Körchow sind ohne Filialkapellen geblieben. Die Kapelle zu Lassahn erscheint um 1335 als selbständig, ward später aber wieder zur Filiale von Neuenkirchen (1534, Visit.).
Verhältnismäßig zahlreicher ist die Errichtung von Filialkapellen im Lande Boizenburg. Hier hatte das Boizenburger Kirchspiel 1534 (Visit.) Kapellen in Rensdorf, Gülze und Bandekow. Zu Blücher gehören 1534 (Visit.) die Kapellen von Dersenow, Besitz, Niendorf und Krusendorf. Granzin hat solche in Gallin und Bennin (1534, Visit.). Letztere wird übrigens schon um 1500 zuerst erwähnt (Schlie III, 134, 137). Endlich hat Zweedorf eine Kapelle in Nostorf, 1483 (Schlie III, 131), und Gresse in Lüttenmark, 1541 (Visit.). Hier ist also kein Kirchspiel ohne Filialkapelle geblieben.
Nicht so reichlich finden wir sie im Lande Jabel=Wehningen. Dömitz, Grabow, Eldena, Jabel sind ohne Filialen geblieben. Dagegen hat Gr.=Laasch 1534 (Visit.) Kapellen zu Kleinow (dem jetzigen Ludwigslust) und Karstädt, Konow eine zu Niendorf, 1592 (Schlie III, 169) und Picher eine zu Kummer (16. Jahrhundert, Schlie III, 29). Eine zweite muß es einstmals in Strohkirchen gehabt haben, doch fehlt es darüber an Nachrichten. Die Dürftigkeit der Heidegegend und die Ärmlichkeit ihrer noch bis ins 16. Jahrhundert vorwiegend wendischen Bevölkerung hat - in diesen Landstrichen offenbar hemmend gewirkt.
Andere Gründe aber muß es haben, wenn die Errichtung von Filialkapellen trotz der Wohlhabenheit der Landschaften immer spärlicher wird, je weiter man von der Elbe nordwärts wandert. Schon das Land Wittenburg war gegen Boizenburg zurückgeblieben; mehr noch das Land Gadebusch. Außer der bald als Kirche von Grambow selbständig gewordenen Rehnaer Filiale Wedendorf, 1230 (375 S. 370), und: der ebenfalls zur Rehnaer Parochie gehörigen von Strohkirchen, deren einziges Denkmal der Ortsname ist, scheint hier allein die Parochie Gadebusch selbst eine Filiale, und zwar in Meetzen, gehabt zu haben, 1689 (Schlie II, 488, Anmerkung 3). Dagegen hat die zur Grafschaft Schwerin gehörige Parochie Eichsen neben der zweiten Kirche in Mühleneichsen, welche zur Pfarrkirche ward, als die ältere von Groß=Eichsen Stiftskirche der Johanniter=Priorei wurde - beide sind 1283 (1674) da =, noch Kapellen zu Moltenow und Rüting, 1541 (Visit.).


|
Seite 135 |




|
Im Lande Boitin scheint keine einzige Filialkapelle errichtet zu sein, denn die von Schwanbeck ist keine solche, sondern eine Siechenhauskapelle. Ebenso fehlen sie ganz in den Ländern Dassow und Klütz. Im Lande Bresen scheint allein Grevesmühlen eine solche in Warnow gehabt zu haben - sie wird 1518 erwähnt (Schlie II, 345) - und Hohenkirchen eine in Gramkow, die 1230 (375: S. 372) begegnet, von der es aber sonst keine Nachricht gibt. Die Kapelle von Weitendorf aber in der Parochie Proseken gehört wiederum als Leprosenhauskapelle nicht hierher.
Näher zu datieren ist von diesen 36 Kapellen, abgesehen von den 4 schon im Zehntregister von 1230 erwähnten zu Valluhn, Lassahn, Wedendorf und Gramkow, nur die Gründungszeit von fünfen. Von diesen gehört eine, die zu Marsow, schon dem 13. Jahrhundert an. 1 ) Die übrigen vier scheinen der allerletzten Zeit vor der Reformation anzugehören. Die Kapelle von Nostorf ist 1483 geweiht (Schlie III, 131), die von Bennin 1503 (Schlie III, 137), die von Toddin sogar erst 1520 (Schlie III, 8) und die von Gallin wird, da sie der Heiligen Anna geweiht ist (Schlie III, 136), deren Cult damals im Aufblühen war, ebenfalls der letzten Zeit des Mittelalters angehören. Jedoch muß es bei diesen Kapellen fraglich bleiben, ob sich die genannten Daten auf die erstmalige Stiftung, oder etwa wie bei Greven, das um 1500 einen Umbau erhielt, nur um einen solchen handelt. Immerhin ist soviel deutlich, daß in dieser letzten Zeit vor der Reformation der Kirchenbau noch einen neuen Trieb hervorbrachte. Und während man im Süden des Bistums Filialkapellen baute, errichtete man im Norden stattliche Kirchtürme. So gehören die von Proseken, Beidendorf, Dietrichshagen, Hohenkirchen, Dassow dem 15. Jahrhundert an; vielleicht auch die von Klütz und Damshagen, der von Gressow wohl erst dem Anfang des 16. Jahrhunderts (Schlie II unter den betreffenden Orten).
Auch im Bistum Schwerin zeigt sich die Erscheinung, daß der Norden kapellenarm, der Süden kapellenreich ist. Im Lande Mecklenburg mit Brüel und Buckow finden sich nur in den beiden Kirchspielen Hornstorf und Neuburg Filialkapellen. Ersteres hatte


|
Seite 136 |




|
eine solche in Alt=Wismar 1481 (Schlie II, 235), letzteres in Dreweskirchen 1229 (363); es muß aber noch eine zweite gehabt haben, da 1306 von Filialkapellen die Rede ist (3096). Daneben hatte natürlich der Doberaner Klosterhof Redentin seine Kapelle, aber als nur für die mönchische Gemeinschaft bestimmt, zählt sie hier nicht mit. In den Ländern Rostock und Werle (Schwaan), soweit sie westlich der Warnow liegen, fehlt es ebenfalls fast ganz an Filialkapellen. Nur Neuenkirchen besaß zwei, zu Hohen=Luckow, 1310 (3359), und Jürgenshagen, 1593 (Schlie IV, 99), und vielleicht Schwaan eine zu Gr.=Grenz. Im Lande Rostock östlich der Warnow hat nur Ribnitz zwei Kapellen, die eine zu Dierhagen 1560 (Schlie I, 363), die andere an der Grenze der Rostocker und Ribnitzer Heide am Mönkenberge, der Heil. Dreifaltigkeit geweiht, 1514 (Schlie I, 363). Noch eine Kapelle begegnet uns 1471, die "Capelle Hilg=hemur" auf dem Kapellenberg bei Vietow, das jetzt zu Sanitz gehört. Aber damals (Zehntregister des Rostocker Archidiakonats von 1473) erscheint sie als halb selbständig und gab es an ihr zwei Vikare; 1541 (Visit.) gehört sie nach Tessin. Die Kapelle St. Jürgen vor dem Rövershagen im Kirchspiel Volkenshagen, 1534 (Visit.) ist keine eigentliche Filialkapelle, sondern die eines Siechenhauses (Schlie I, 610).
Zahlreicher werden schon die Kapellen im rechts der Warnow gelegenen Teil des Landes Werle=(Schwaan). Schwaan selbst hat hier drei Filialen, zu Mistorf 1342 (6252), zu Göldenitz 1360 (8740) und zu Wiendorf 1534 (Visit.). Im Kirchspiel Kavelstorf begegnet die Kapelle von Reez im 18. Jahrhundert (Schlie IV, 35), im Kirchspiel Kammin die von Weitendorf 1545 (Schlie I, 456) und Kossow (Schlie I, 454); im Kirchspiel Recknitz die von Mierendorf und Rampeschendorf 1646 (Schlie IV, 293). Kritzkow hat eine zu Weitendorf (Schlie I, 461), Lüssow zu Oettelin, Sarmstorf, Gr.=Schwiessow und Käselow 1646 (Schlie IV, 287) und endlich Alt=Güstrow 1541 zu Suckow (Schlie IV, 189 Anmerkung 7). Auf 11 Kirchspiele fallen also 14 Kapellen, wobei immer noch erst auf je 4 - 5 Ortschaften eine Kirche oder Kapelle kommt.
Noch zahlreicher sind verhältnismäßig die Filialkapellen im Stiftslande Bützow, das auch in dieser Beziehung in deutlichem Gegensatze zum Ratzeburger Stiftslande Boitin steht. Obgleich hier die Kirchspiele von Anfang an geringeren Umfanges waren als sonst, haben doch von den 13 Kirchspielen des Landes nur vier sich ohne Kapellen beholfen. Im Bützower Kirchspiel finden


|
Seite 137 |




|
wir allein 3 Filialkapellen, die von Passin und Langen=Trechow 1329 (5042, 5046) und die von Zepelin (Schlie IV, 75). Noch zahlreicher sind sie in der großen Neuenkirchener Parochie. Hier gab es 1593 außer den schon genannten in der Vogtei Schwaan gelegenen Kapellen zu Hohen=Luckow und Jürgenshagen auf Stiftsgebiet die von Penzin, und 1620 begegnet als vierte die von Selow (Schlie IV, 99). Zernin hat 1542 (Visit.) eine zu Peetsch, Tarnow um 1600 zu Mühlen=Geez (Schlie IV, 125 - die von Prützen ist erst kurz vor 1620, nach Verfall der von Mühlen=Geez, errichtet; ebenda 281), Bernitt 1593 zu Moltenow (Schlie IV, 108); in Schlemmin bestand die alte mater als filia von Moisall weiter bis ins 17. Jahrhundert (Schlie IV, 115). Endlich hatte Qualitz eine Kapelle auf dem Grabower Kapellenberge und Warin eine solche auf dem Kapellenberge im Käterholz (Schlie IV, 119).
Ebenso eifrig ist man in der Grafschaft Schwerin im Kapellenbau gewesen. Hier kommen auf 23 zum Teil schon recht kleine Kirchspiele 21 Filialkapellen. Meteln hat 1534 (Visit.) eine solche in Zickhusen, Cramon 1541. (Visit.) in Drieberg und Herren=Steinfeld, Groß=Brütz 1649 in Klein=Brütz (Schlie II, 507) und Grambow, Perlin 1541 (Visit.) in Groß=Welzin, Schwerin selbst 1217 (237) in Wittenförden, Pampow 1534 (Visit.) in Groß=Rogahn, Warsow 1534 (Visit.) in Kotendorf, Plate 1534 (Visit.) in Consrade und Banzkow, wozu 1596 (Schlie II, 666) noch die auch schon ältere Kapelle von Peckatel kommt. Goldenstedt hatte 1534 (Visit.) eine Kapelle in Rastow, Neustadt 1583 (Schlie III, 296) in Lüblow (die Kapelle von Wöbbelin entstammt erst dem 19. Jahrhundert. Schlie III, 296). Östlich vom Schweriner See hatte Retgendorf 1241 (533) eine Filiale in Buchholz, Zittow 1653 (Schlie II, 657) zu Zaschendorf, Cambs, Langen=Brütz und Brahlstorf, Pinnow zu Görslow und Suckow (im 16. Jahrhundert; Schlie III, 335).
Wenden wir uns nun zum Lande Sternberg=Parchim, soweit es Schwerinschen Sprengels ist, woran sich gleich das Werlesche Gebiet des Dobbertiner Archidiakonats schließen mag, so hatte hier, wie wir gesehen, die Entwickelung des Pfarrsystems schon zu einem ungleich engmaschigeren Netz geführt wie in den nördlicheren Teilen Mecklenburgs. Von den 50 selbständigen Pfarren dieses Gebietes umfaßten 32 nicht mehr als 1 - 3 Ortschaften, die übrigen, mit Ausnahme von zweien, 4 - 6. Nur Kladow und Lohmen waren größer. Trotzdem ist es auch hier noch zur Errichtung von 32 Filialkapellen gekommen, und zwar ist es auch


|
Seite 138 |




|
innerhalb dieses engeren Gebietes zu beobachten, daß diese, je weiter man nach Süden kommt, desto zahlreicher sind, so daß in der Umgegend von Parchim schließlich fast jeder Ort seine Kapelle oder Kirche hat.
Wenig Kapellen hat noch die Umgegend von Sternberg. Hier besaß nur die alte Pfarre von Nepersmühlen eine solche in Dabel 1306 (3102), Powerstorf zu Venzkow (Schlie III, 345), Wamkow zu Hohen=Pritz 1256 (770) und Gr.=Niendorf 1541 (Visit.), Prestin zu Runow 1688 (Schlie III, 349). Desto zahlreicher werden sie südlich einer etwa von Zapel auf Goldberg gezogenen Linie. Zapel hat Filialen zu Rutenbeck 1560 und Tramm (Schlie III, 371 und 373); Frauenmark 1264 zu Severin (1009), dazu 1593 zu Schlieven und Gämtow ( - Friedrichsruhe; Schlie IV, 484), Garwitz 1542 (Visit.) zu Damerow, Möderitz zu Zieslübbe und Bergrade (Schlie IV, 466), Parchim zu Paarsch 1464 (Schlie IV, 465 Anmerkung 4), Lanken zu Darze, Stralendorf und Rom 1563 (Schlie IV, 553), Burow zu Kl.=Niendorf 16. Jahrhundert (Schlie IV, 562), Grebbin zu Kossebade und Woeten 1534 (Visit.), Kladrum zu Badegow und Grabow 1534 (Visit.), Mestlin zu Rüst 1557 (Schlie IV, 373), Herzberg zu Lenschow 17. Jahrhundert (Schlie IV, 412), Benthen zu Passow und Weisin 1557 (Schlie IV, 543), Brüz zu Seelsdorf 17. Jahrhundert (Schlie IV, 402), Techentin zu Below 1299 (2551). Im Dobbertiner Archidiakonat besaß Goldberg eine Kapelle in Medow 1334 (5475), Woosten zu Wendisch=Waren 1542 (Visit.), Woserin zu Borkow 16. Jahrhundert (Schlie IV, 175) und Lohmen in Gerdshagen 1649 (M. Jbb. 68, 251).
Ganz ähnlich endlich liegen die Dinge im letzten Teil des Schweriner Sprengels, in den Ländern Plau, Malchow und Waren: auch hier das schon bei weitem engmaschigere Netz von Kirchspielen unter 36 Kirchspielen sind 19, die bis zu 3 Ortschaften und nur 3, die über 6 zählen - die vielen kleinen ritterlichen Pfarren; und doch daneben noch eine kräftige Entwicklung des Kapellenbaus auf jene 36 Kirchspiele kommen 24 Filialkapellen , und zwar besonders in den Ländern Plau und Waren. Das Waldland Malchow ist darin etwas zurückgeblieben. Kuppentin hat 1534 (Visit.) Kapellen zu Poserin und Plauerhagen (letztere wird jetzt als mater bezeichnet, gehörte aber schon 1235 (436) zu Kuppentin), dazu 1347 (6712) in Zahren und 1354 (7945) zu Gallin; Quetzin zu Zarchlin und Leisten (Schlie IV, 611); Lübz zu Lutheran 1609. (Visit.


|
Seite 139 |




|
Glocke von 1491) und Benzin 1609 (Visit.); Malchow zu Lexow 1 298 (2503), Grüssow zu Walow 1 542 (Visit.) und Zislow 1649 (Schlie V, 445. "Zislow haben die Vlotow aus dem Kirchspiel genommen"; Visit. 1542 bei Grüssow; es gehört jetzt zu Satow); Jabel zu Hagenow 1449 (Schlie V, 399); Lütgendorf zu Gaarz 17. Jahrhundert (Schlie V, 431); Faltenhagen zu Schönau 1331 (5226) - Federow zu Kargow 1331 (5226); Schlön zu Torgelow, Groß= und Klein=Plasten 17. Jahrhundert (Schlie V, 359) - Groß=Dratow zu Schwaßtorf 17. Jahrhundert (Schlie V, 359); Groß=Gievitz zu Klein=Gievitz und Hungersdorf 17. Jahrhundert (Schlie V, 367); Varchentin zu Kraase (Schlie V, 324); Groß=Varchow zu Lehsten 1326 (4749) und Bredenfelde (Schlie V, 219). 1 )
Sonach zählen wir alles in allem im mecklenburgischen Gebiet des Bistums Schwerin 109 Filialkapellen. Versuchen wir nun über die Entstehungszeit derselben ein wenig Klarheit zu verbreiten, so sehen wir uns hier einer noch weit ungünstigeren Lage gegenüber als bei den Pfarrkirchen. Von nur ganz wenigen Kapellen gibt es mittelalterliche direkte Nachrichten, durch welche die Gründungszeit näher festgelegt wird. Für die Zeit von 1385 bis zur Reformation sind wir dafür allerdings auf die Angaben des Schlieschen Werkes angewiesen. Doch da dieser die Orts=und Kirchenakten aller heute noch bestehenden Filialdörfer aus=gezogen hat, wird das urkundliche Material so ziemlich ganz vorliegen, und ist wenig mehr zu erwarten. Auch der Baubefund bringt uns nur in ganz wenigen Fällen weiter. Die weitaus meist en Kapellen sind. Fachwerkbauten nachmittelalterlichen Charakters - meist natürlich an SteIle älterer Fachwerkgebäude =, oder wenn Steinbauten, doch auch erst nachmittelalterlich, und selbst die spätmittelalterlichen lassen keinen sicheren Schluß auf die Zeit der Gründung zu, da auch sie schon Ersatzbauten sein können. Immerhin lassen sich doch aus den vorhandenen Daten Wahr=scheinlichkeitssslüsse ziehen.
In der Grafschaft Schwerin sind von den 21 mittelalterlichen Filialkapellen nur 4 näher zu datieren. Sie stammen alle schon aus der großen Kolonisationsepoche der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Es sind Wittenförden, gegründet 1217 (237), Uelitz, das vermutlich um dieselbe Zeit errichtet ward


|
Seite 140 |




|
(vergl. oben), Banzkow, das Lisch nach seiner alten Kirche ebenfalls mit Wittenförden gleichzeitig ansetzt (vergl. oben), und Buchholz, das 1241 (533) schon eine Kapelle hatte. Von ihnen ward Uelitz schon 1270 selbständig (1188), Wittenförden wohl erst durch die Reformation.
Im Lande Mecklenburg sind alle drei Filialkapellen genauer datierbar; auch sie gehören noch der Zeit vor 1330 an. Die von Dreweskirchen ward schon 1229 (363) errichtet und 1318 (4033) selbständig. Da aber schon vorher ein eigener Kaplan an ihr angestellt war, kann sie kaum mehr zu den Filialkapellen im engeren Sinne gerechnet werden. Auch die zweite Filialkapelle von Neuburg ist 1306 (3096) da. Endlich sank die alte Kirche von Alt=Wismar bei der Verlegung der Pfarre um 1320 nach Hornstorf zur Filialkapelle herab, oder ging damals ganz ein; erst 1481 ward sie von neuem errichtet (Schlie II, 235).
Die Länder Rostock und Werle (Schwaan), soweit sie links der Warnow liegen, hatten ebenfalls nur drei Filialkapellen. Es handelt sich hier nur um die Filiale der Schwaaner Kirche zu Grenz und die der von Neuenkirchen zu Hohen=Luckow und Jürgenshagen. Die zweite ist 1310 (3359) geweiht. Die erste ist durch ihre Kirche einigermaßen näher zu datieren: das Bauwerk entstammt dem 14. Jahrhundert (Schlie IV, 103).
Im Lande Rostock rechts der Warnow ist von den drei Filialkapellen nur eine zu datieren, die 1514 errichtete Dreifaltigkeitskapelle in der Ribnitzer Heide.
Von den 14 Kapellen des rechts der Warnow gelegenen Teiles des Landes Werle sind leider nur 4 einigermaßen näher festzulegen. Es sind dies zunächst die 3 Filialen von Schwaan, deren erste, die von Mistorf, 1342 (6252) errichtet ward; 1360 (8740) ward die zweite, die von Göldenitz, gestiftet und die dritte, die von Wiendorf, gehört mit ihrem gotischen Bauwerk ebenfalls dem 14. Jahrhundert, und zwar wohl der ersten Hälfte desselben, an (Schlie IV, 15). Zu diesen dreien kommt nur noch die Kapelle von Weitendorf im Kirchspiel Kritzkow, deren Chor, einer älteren Bauperiode als das ursprünglich ebenfalls gotische Schiff angehörig, auch dem 14. Jahrhundert zuzuweisen ist (Schlie I, 461). Gotisch sind noch die Kapellen von Weitendorf im Kirchspiel Kammin und von Suckow, aber zu näheren Datierungen fehlt der Anhalt.
Von den 11 Kapellen des Stiftslandes Bützow sind nur 3 datierbar. Die älteste ist die 1264 (1017) durch Verlegung der Pfarre nach Moisall zur Filiale herabgesunkene Mutterkirche zu Schlemmin. Sie bestand als solche noch bis in das 17. Jahr=


|
Seite 141 |




|
hundert (Schlie IV, 115). Die beiden anderen, Passin und Langen=Trechow, sind im Jahre 1329 (5042, 5046) gestiftet, also ebenfalls noch im ersten Dritteil des 14. Jahrhunderts. Alle übrigen sind auch baulich nicht näher zu bestimmen, da sie teils eingegangen, teils dürftige Fachwerkbauten sind.
Wenden wir uns nun zum kapellenreichen Süden des Bistums, so sind von den 32 Kapellen des Landes Sternberg=Parchim 12 - 18 näher zu datieren. Von diesen gehören 4 sicher noch dem 13. Jahrhundert an. Es sind dies Hohen=Pritz, dessen Kapelle schon 1256 (770) vorhanden war, Severin, welche 1264 (1009) zuerst erwähnt wird, Below, dessen Kapelle 1299 (2551) gestiftet ward, und Dabel, das 1306 (3102) bereits Filiale war. Dem 14. Jahrhundert, und zwar wohl zumeist seiner ersten Hälfte, gehören 6 - 7 Kapellen an, nämlich die von Medow, deren Kirchhof 1334 (5475) geweiht ward; ihren Bauwerken nach die von Schlie als frühgotisch bezeichneten von Tramm, Zieslübbe und Ruthenbeck (Schlie III, 371, 373; IV, 471 f.), die gotischen von Groß=Niendorf und Kossebade (Schlie III, 355; IV, 437), und wahrscheinlich wegen ihrer Glocke von 1389 (Schlie IV, 377) auch die von Rüst. Auch letztere bezeichnet Schlie als früh=gotisch - indes ist es mir fraglich, ob mit Recht. Ihr Giebel ist jedenfalls ausgesprochen spätestgotisch, aber der könnte auch spätere Zutat sein. Eine einzige Kapelle ist nachweislich erst im 15. Jahrhundert gegründet; es ist die von Paarsch, die 1464 errichtet ward (Schlie IV, 465 Anmerkung 4).
Endlich von den 24 Filialkapellen der Länder Plau, Malchow und Waren lassen sich nur 7 näher datieren. Von diesen gehören 6 der Zeit vor 1335 an, und nur eine ist kurz darauf gegründet. Die von Lexow begegnet schon 1298 (2503), die von Lehsten ist 1326 (4749) gestiftet, die von Schönau und Kargow begegnen zuerst 1331 (5226), aber letztere ist noch. ein Bau des Übergangsstiles (Schlie V, 350) und dürfte daher noch dem 13. Jahrhundert angehören. Erstere, ein Bauwerk der Frühgotik (Schlie V, 373 f.), ist um oder bald nach 1300 anzusetzen. Endlich sind auch die Kapellen von Kraase und Poserin wohl mit Schlie (IV, 394 V, 325) als Bauten des 13. Jahrhunderts anzusetzen. Bald nach, 1335, im Jahre 1354, ward die Kapelle in Gallin erbaut (7945), und die von Zahren scheint 1347 (6712) errichtet zu sein. Spät=gotische Kapellenbauten finden sich in diesen 3 Ländern über=haupt nicht.
Fasse ich zusammen, so sind von den datierbaren Kapellen weitaus die meisten vor dem Jahre 1335 gegründet, nur ganz


|
Seite 142 |




|
einzelne später, und zwar bald nach diesem Jahre der aber erst in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Errichtung von Filialkapellen beginnt schon in der großen Kolonisationsperiode und setzt sich während der Nachkolonisation fort. Spärlich im Norden, strebt sie, je weiter man nach Süden und Osten fortschreitet, desto mehr dem Ziele nach, welches im Lande Stargard erreicht ist, nämlich daß auf jedes zweite oder dritte Dorf eine Kirche oder wenigstens Kapelle kam. Wie es nach den vorhandenen Daten scheint, findet auch diese Entwickelung bald nach dem Abschluß der Errichtung von neuen Pfarrkirchen, etwa um 1350, im wesentlichen ihr Ende. Erst unmittelbar vor der Reformation sind wieder noch einige wenige Kapellen errichtet worden - wie im Ratzeburgischen.
Mehr noch wie in der Südhälfte des Bistums Schwerin überwog in den altmecklenburgischen Teilen des Bistums Havelberg die Zahl der kleinen nur 1 - 3 Ortschaften umfassenden Kirchspiele. Unter den 85 Kirchspielen der Länder Brenz, Marnitz, Lübz, Röbel, Lieze, Wesenberg und Penzlin sind nur 17, welche größer sind, und unter diesen nur zwei, welche die Größe der alten Kolonisationskirchspiele erreichen. Dennoch ist man auch hier noch eifrig, im Bau von Kapellen gewesen, - ich zähle deren 47 - und hat nicht geruht, bis auch hier fast jedes zweite Dorf seine Kirche oder Kapelle hatte; ja es gibt manche Kirchspiele, in denen jedes Dorf damit versehen ist.
Ich gebe zunächst wieder eine Aufzählung derselben.
Im Havelbergischen Teil des Landes Parchim und Marnitz hat Damm Kapellen zu Malchow, 1325 (4620), und Matzlow, 1399 (Schlie IV, 492); Spornitz zu Dütschow, 1567 (Schlie III, 305); Brenz zu Blievenstorf, 16. Jahrhundert (Schlie III, 300); Steinbeck zu Stolpe, 16. Jahrhunder (Schlie III, 302); Bekentin zu Kremmin, 1534 (Visit.); Herzfeld zu Karenzin und Stresendorf, 1574 (Schlie III, 308); Slate zu Groß= und Klein Godems, 1603 (Schlie IV, 498); Marnitz zu Ziegendorf, Wulfsahl und Meierstorf; Suckow zu Porep, 1534 (Visit.); Brunow zu Drefahl, 1534 (Visit.).
Im südlichen Teil der Ture, dem Amte Lübz, hat Kreien eine Kapelle zu Wilsen, 1609 (Schlie IV, 568); Görgelin zu Gnevsdorf, 1534 (Visit.), und Retzow, 1542 (Visit.).
Im havelbergischen Teil des Landes Röbel hat Dambeck eine Kapelle zu Bütow, 1534 (Visit.); Wredenhagen zu Zepkow, 1542 (Visit.); Kambs zu Karbow, 16. Jahrhundert


|
Seite 143 |




|
(Schlie V, 542); Vipperow zu Zielow und Priborn, 1534 (Visit.).
In der Lieze und um Wesenberg hat Schwarz eine Filiale zu Diemitz, 1557 (Schlie V, 581); Alt=Gaarz zu Viezen; Rechlin und Leppin zu Roggentin und Klopzow, 1542 (Visit.) und zu Retzow, 1662 (Schlie V, 579) - letzteres gehörte 1541 (Visit.) noch zu Alt=Gaarz =; Schillersdorf zu Qualzow und Roggentin; Userin zu Groß=Quassow, 1534 (iVsit.).
Im Lande Penzlin hat Freidorf Filialen zu Ankershagen, 1265, zu Pieverstorf, Dambeck und Klockow (Schlie V, 294 Anmerkung 3); Peckatel zu Klein=Vielen, 1568 (Schlie V, 319) und vielieicht zu Hohen=Zieritz; Groß=Luckow zu Marin, 1304 (2945), Ave und Kl.=Luckow, 1551 (Schlie V, 284); Penzlin zu Smort, 1273 (1284), Lapitz, Puchow und Lübkow, 1582 (Schlie V, 242); Kruckow zu Mallin, 1608 (SchlieV, 260).
Von diesen 45 Kapellen läßt sich nur für 8 die Zeit ihrer Errichtung näher bestimmen. Alle 8 gehören der Zeit vor 1330 an, die meisten dem 13. Jahrhundert. Die von Ankershagen ward 1266 (1080) errichtet. Ihre Ausstattung mit zwei Hägerhufen und die große damals erbaute Kirche machen den Eindruck, als ob ,es von vornherein auf Gründung einer selbständigen Kirche abgesehen gewesen wäre. Sie muß denn auch bald selbständig geworden sein; 1328 (4914) hatte sie ihren eigenen Pleban. Wenige Jahre darauf, 1273, begegnet die Filiale von Penzlin, Smort (1284), und 1304 (2945) die von Luckow, Marin, alle drei im Lande Penzlin. Im Lande Röbel muß Zepkow, die Filiale von Wredenhagen, der Reste ihrer alten Kirche wegen (Schlie V) noch dem 13. Jahrhundert angehören. Im Lande Parchim=Marnitz gehören die Kapellen von Dütschow und Drefahl ihres Stiles wegen (Schlie III, 305, 218) noch dem 13. oder doch dem Anfang des 14. Jahrhunderts an; die von Malchow ward 1325 (4620) geweiht, und endlich darf von den Kapellen zu Stolpe und Porep mit größter Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß sie um 1300 oder bald danach errichtet sind. Beide Dörfer waren, Stolpe seit 1274 (1322), Porep seit 1295 (2347, 2494, 3175), im Besitz des Klosters Marienfließ. Wir kennen den Eifer dieses Klosters im Kirchenerrichten von der Ture her, wie es dort von 1274 ab Erwerbungen machte und dort bis 1320 nicht weniger als 4 Pfarren errichtet hat. Es wird seinen Besitz im Lande Parchim nicht lässiger versorgt haben. Spätmittelalterliche Bauwerke finden sich unter den Kapellen dieser


|
Seite 144 |




|
Länder garnicht. Zum Teil gotisch ist nur noch die von Bütow (Schlie V, 537), aber zu näherer Zeitbestimmung fehlen die Anhaltspunkte. Auch hier liegt danach der Schluß nahe, daß, wie die Errichtung von Pfarren, so auch die von Kapellen um die Mitte des 14. Jahrhunderts im wesentlichen ihren Abschluß gefunden hat.
Die Länder Stargard, Ahrensberg und Lychen können hier füglich übergangen werden, da die ganz vereinzelten Filialkapellen, die sich in ihnen finden, schon im vorigen Kapittel mit aufgezählt sind. Die Kleinheit der Kirchspiele machte sie so gut wie ganz überflüssig.
Es bleibt nunmehr noch der zum Kamminschen Sprengel gehörige Teil Mecklenburgs, Circipanien und die Länder Tüzen und Gädebehn, übrig.
Dieses Gebiet zerfiel seiner kirchlichen Entwickelung nach, wie wir gesehen, in drei Teile. Die Nordhälfte von Circipanien war charakterisiert durch ihre großen Kirchspiele, welche für die ältere landesherrliche Kolonisation bezeichnend sind; die südliche Hälfte bietet ein Gemisch jener älteren großen und kleineren Kirchspiele. Die Länder Tüzen und in noch höherem Maße Gädebehn dagegen zeigen die ausgeprägte Art der späteren Kolonisation, die zahlreichen kleinen Kirchspiele wie sie für Stargard charakteristisch waren. Dem entspricht nun auch die Entwickelung des Kapellenbaues. In der nördlichen Hälfte Circipaniens wenig Kapellen. Nur Warnkenhagen hat eine zu Diekhof, 16. Jahrhundert (Schlie V, 44); Thürkow zu Appelhagen, 1534 (Visit.); Gnoien zu Wasdow, 1375 (Schlie I, 507 Anm. 3); Alt=Kalen zu Finkental, 1560 (Schlie I, 584); Belitz zu Klein=Bützin, 1534 (Visit.), und Schorrentin zu Gr.=Markow, 1585 (Schlie I, 597). Nur das unmittelbar an der pommerschen Grenze gelegene und schon zu der an Kirchen und Kapellen überaus reichen Umgegend von Demmin gehörige Levin zählt mehr Kapellen, nämlich, abgesehen von der älteren zu Brudersdorf, 5, und zwar zu Zarnekow, Upost, Warrenzin, Wolkow und Beestland, 1560 (Schlie I, 564, Anm. 2).
Verhältnismäßig zahlreicher sind die Kapellen in der südlichen Hälfte Circipaniens. Hier hat Serrahn eine Filiale zu Langhagen 1541 (Visit. Warum diese keine vorresormatorische Stiftung sein soll, wie Schlie V, 52 vermutet, ist nicht einzusehen. Er begründet seine Vermutung übrigens nicht); Grubenhagen zu Gr.=Lückow und Klocksin, 1648 (Schlie V, 55); Damen zu Schorssow, 1403 (Schlie V, 65), Schwinken=


|
Seite 145 |




|
dorf zu Heinrichshagen, Langwitz, Lupendorf, Tressow, 1648 und 1662 (Schlie V, 141) und vielleicht auch schon zu Faulenrost (siehe oben S. 139 Anm. 1); Hohen=Mistorf zu Bukow, Teschow und Niendorf, 1534 (Visit.); Retzow vielleicht zu Remplin, 1647 (Schlie V, 115). Zu Circipanien gehört endlich noch Gielow, das 1560 (Schlie V, 149 Anm. 6) eine nach Duckow hin eingepfarrte Kapelle hatte. Bristow aber, das seine Kirche erst um 1600 erhalten hat (Schlie V, 71.), scheidet aus.
Im Lande Tüzen, wo sich noch die Spuren einstiger größerer Anfangskirchspiele neben den vielen kleineren erhalten haben, ist es durch noch weit eifrigeren Kapellenbau dahin gebracht, daß hier mindestens jedes zweite Dorf seine Kirche oder Kapelle hatte. Im alten Ivenacker Kirchspiel sind allein errichtet worden, zu Zolkendorf, Weitendorf, Klockow und Wackerow, 1541 (Schlie V, 177); Tüzen hatte 3, zu Kriesow und Borgfeld, 1534 (Visit.), und zu Markow, um 1600 (Schlie V, 185); Kastorf ebenfalls 3, zu Rosenow und Galenbeck, 1283 (1666), und zu Knorrendorf, 1541 (Visit.). Aber auch die kleineren Kirchspiele sind nicht ohne Filialen. Gülzow hat eine in Scharpzow, 1303 (2892, 3166); Jürgenstorf zu Pribbenow und Krummsee, 1552 (Schlie V, 158); Kittendorf zu Sülten, 1541 (Visit.), und Röckwitz zu Gützkow, 1579 (Schlie V, 188).
Im Lande Gädebehn dagegen war wie in Stargard für den Kapellenbau wenig Raum mehr. Hier sind nur noch 3 Kapellen entstanden, die von Kleeth in Tarnow, 1273 (1300); die von Breesen in Pinnow, 1429 (Schlie V, 264 Anm. 3); und die von Gevezin in Passentin, 1575 (Schlie V, 282).
Die Gründungszeit läßt sich auch hier nur bei wenigen - im ganzen 11 von diesen 44 Kapellen näher bestimmen.
Von diesen 11 - gehören 6 sicher noch dem 13. Jahrhundert an, eine ist unmittelbar nach 1300 gegründet: die zu Tarnow war 1273 (1300) vorhanden, die zu Rosenow und Galenbeck 1283 (1666), die zu Gülzow ward 1293 (2246) errichtet, 1307 (3166) zur Pfarrkirche erhoben und erhielt die 1303 (2892) begründete zu Scharpzow als Filiale. Die von Brudersdorf ward 1309 (3298) ebenfalls nach längerem Bestehen zur Pfarrkirche gemacht, und die zu Schorssow ist nach Schlie (V, 65) ein Bau des 13. Jahrhunderts
Dem 14. Jahrhundert gehören die beiden Kapellenbauten zu Gielow und Gessin an (Schlie V, 150, 137); doch mag. die Stiftung der Kapellen auch hier schon weiter zurückliegen. Nach einer allerdings erst späten Nachricht ist die Kapelle zu Wasdow


|
Seite 146 |




|
im Jahre 1375 errichtet (10676). Endlich die von Pinnow ist wenigstens vor dem Jahre 1429 erbaut. Diese Jahreszahl trug ihre alte Glocke, diesmal auch für die Kirche ein sicheres Datum, da ihre Inschrift die Glocke ausdrücklich als der Kirche in Pinnow gehörig angab (Schlie V, 264 Anm. 3). Spätmittelalterliche Bauten fehlen auch hier unter den Kapellen ganz. Auch hier ergibt sich also, so dürftig auch die Daten sind, der (Schluß, daß die Mehrzahl der Kapellen schon dem 13. Jahrhundert angehört und der Kapellenbau im Laufe des 14. Jahrhunderts allmählich anfgehört hat.
~~~~~~~~~~
VII. Die Archidiakonate.
Nachdem wir der Entwickelung des Pfarrsystems bis in seine letzten Verzweigungen gefolgt sind, bleibt nun noch eine Untersuchung der größeren Gruppen, in welche die Pfarren zu Zwecken der kirchlichen Jurisdiktion und Verwaltung innerhalb des Bistums zusammengefaßt wurden. Zwar die älteren Einteilungsweisen in Dekanate und Archipresbyterate, wie sie um 1200 in Alt=Deutschland teilweise noch bestanden, finden wir hier auf Kolonialboden, wie es scheint, nicht mehr, wohl aber die inzwischen aufgekommene und zu großer Selbständigkeit entwickelte Institution des Archidiakonats, auf welche allmählich fast alle geistlichen Funktionen des Bischofs übergegangen waren; Jurisdiktion, sowie Seelsorge und Institution der Priester war aus den Händen des immer mehr zum weltlichen ,Fürsten werdenden Bischofs in die seiner Archidiakone hinübergeglitten; geblieben war ihm wenig mehr als die höhere Jurisdiktion, daß er für die Entscheidungen des Archidiakons die obere Instanz blieb und daß die Errichtung und Weihe neuer Kirchen ihm vorbehalten war. So finden wir denn auch in Mecklenburg die "institutio, visitatio, correctio" (1009; vergl. 122, 439, 2156 usw.) in den Händen von Archidiakonen. Anfangs freilich hielten die Bischöfe selbst bisweilen noch nicht nur Generalsynode, sondern auch Sendgericht, wie Bischof Heinrich von Ratzeburg 1217 in Bergedorf (228), doch wird das ,auch hier wie in Alt=Deutschland bald aufgehört haben. Wenigstens finden sich weiter keine Spuren einer sendgerichtlichen Tätigkeit der Bischöfe mehr. Sie fiel den Archidiakonen zu. Selbst die Ernennung dieser aber kam den Bischöfen bald voll=


|
Seite 147 |




|
ständig aus den Händen, indem die verschiedenen Archidiakonate ein für allemal mit bestimmten kirchlichen Ämtern verbunden wurden, deren Übertragung nicht in der Hand des Bischofs lag, nämlich mit den Präposituren und Dekanaten der Dom= und Kollegiatkirchen oder den Präposituren von Klöstern, welche durchweg selbst das Recht der Wahl ihrer Pröpste und Dekane besaßen (z. B. Rehna: 471; Dobbertin: 425) 1 ) So ward die Stellung der Archidiakone dem Bischof gegenüber immer selbständiger, und zwar bis zu dem Grade, daß um 1350 im Bistum Schwerin ein Kompetenzstreit zwischen dem Bischofe und den Archidiakonen von Schwerin, Bützow=Rostock, Tribsees, Parchim und Waren ausbrechen konnte, in dem nicht nur der Bischof die Archidiakone, sondern die letzteren ihren eigenen Bischof exkommunizierten und die Archidiakone ihre Stellung behaupteten. Das Ergebnis war, daß der Bischof in das Verfahren der Archidiakone nicht eingreifen durfte, außer auf gesetzmäßige Appellation, und wenn die Archidiakone säumig in ihrer Pflicht sein sollten, sowie daß in den schwereren Fällen, bei denen es fraglich war, ob sie vor die Archidiakone oder den Bischof gehörten, der Erzbischof von Bremen über die Zuständigkeit entscheiden sollte (7611). Dieses Resultat entsprach im wesentlichen den Festsetzungen der Bremer Provinzialsynode von 1292 (2156). Erst gegen Ende des Mittelalters gelang es den Bischöfen, das Archidiakonat wieder in eine bescheidenere Stellung zurückzudrängen, und zwar durch die Entwickelung eines neuen, unmittelbar vom Bischof abhängigen Amtes, des der bischöflichen Offiziale, die aus ursprünglich nur für einzelne Fälle beauftragten allmählich zu ständigen Amtsträgern wurden, und auf die der größte Teil der kirchlichen Jurisdiktion überging. So finden wir um die Mitte des 15. Jahrhunderts eine Reihe kirchlicher Prozesse innerhalb des Rostocker Archidiakonates nicht mehr wie einst in den Händen des Archidiakons, sondern des Offizials, der sie meist allein und höchstens unter Mitwirkung des Archidiakons entscheidet. (Collectaneum des Petr. Boye, im Archiv zu Schwerin.)
Nach diesen voraufgeschickten allgemeinen Bemerkungen gilt es nun, die Entwickelung der Archidiakonate im einzelnen zu verfolgen.


|
Seite 148 |




|
Im Bistum Ratzeburg hören wir zuerst 1237 (471) von Archidiakonaten. Neben dem bereits bestehenden des Ratzeburger Dompropstes, welchem u. a. das Land Gadebusch unterstand, wurde damals ein zweiter für den Propst des neugegründeten Nonnenklosters Rehna errichtet, welcher außer Rehna und seiner Tochterkirche Wedendorf die Kirchen des Landes Bresen umfassen sollte. Schon einige Jahre vorher, zwischen 1230 und 1235, war von Bischof Gottschalk ein dritter Archidiakonat über alle Kirchen zwischen Sude und Elbe, d. h. die Dannenbergischen Länder Jabel, Wehningen und das Land Derzing, errichtet und dem Propste des eben gestifteten Nonnenklosters Eldena überwiesen worden. Ein weiterer Archidiakonat hatte bis 1247 (593) die Kirchen der Sadelbaude, wohl mit Einschluß der Gamme und Bergedorfes, umfaßt. Bis zu diesem Jahre war er von dem Domherrn Arnold von Bergedorf verwaltet worden. Nun ward er mit dem des Dompropstes für immer vereinigt. Dieser aber scheint, wie das ja auch in der Natur der Sache liegt, der älteste Archidiakonat gewesen zu sein. Er umfaßte neben dem Stiftslande Boitin die Länder Ratzeburg, Wittenburg, Gadebusch und wohl auch Boizenburg, d. h. die schon seit ca. 1204 politisch getrennten Teile der Grasschaft Ratzeburg, wird also älter sein als 1204, und wenn man bedenkt, daß schon 1191 in dem noch etwas jüngeren Bistum Schwerin der Archidiakonat des dortigen Dompropstes begegnet, wird man geneigt. sein, den Ratzeburger noch um ein beträchtliches in das 12. Jahrhundert zurück zu datieren. Im Jahre 1237 bei Errichtung des Rehnaer Archidiakonates gab er an dieses zwei Gadebuscher Kirchen ab und wurde dafür durch die des Landes Dassow entschädigt. Ausgenommen von der Jurisdiktion des Dompropstes war jedoch - wenigstens in späterer Zeit - das Domkapitel sowie die übrige Geistlichkeit des Domes und der beiden Ratzeburger Kirchen, St. Peter und St. Georgsberg; sie unterstanden dem Dekan des Domkapitels (Masch: Geschichte des Bistums Ratzeburg S. 414).
Der Rehnaer Archidiakon hatte seit ca. 1337 einen ständigen Offizial in Wismar, neben dem noch ein Sendpropst erscheint (Crull: M. Jbb. 33, 65 Anm.). Später scheint er die Wismarschen Kirchen verloren zu haben, denn 1409 wurde in dem Vertrage zwischen Herzog Johann von Mecklenburg, dem Bischof und Domkapitel über die drei Wismarschen Hauptkirchen, ausgemacht, daß das Patronat derselben - ursprünglich bischöflich - dem Herzoge gehören solle, die Introduktion, welche zu den Befugnissen des Archidiakons gehörte, aber dem Propst und Kapitel des Ratzeburger


|
Seite 149 |




|
Doms (Masch a. a. O. S. 302), und 1504 wurde die kirchliche Jurisdiktion über Wismar einem dort stationierten bischöflichen Offizial übertragen (ebenda S. 379 f.). Indes mag es sich hier vielleicht nur um die schon erwähnte, im 15. Jahrhundert eintretende Beschränkung der Befugnisse des Archidiakons handeln und nicht um eine völlige Trennung Wismars von Rehna. Endlich wurden in demselben Jahre 1504 für zwei der Ratzeburger Kanonikate noch zwei neue Archidiakonate geschaffen, der eine über Stapel, d. h. den Derzing, der andere über Lauenburg, wie es scheint, beide also nur ein einziges Kirchspiel umfassend (ebenda S. 387 ff.).
Weit mannigfaltiger als im Bistum Ratzeburg ist die Entwickelung des Archidiakonates im Bistum Schwerin. Als erster der Schweriner Archidiakonate begegnet und der des Abtes von Doberan. Schon 1177 (122) in der ersten Privilegienbestätigung des Klosters finden wir "ad Abbatis providentiam" im Gebiete der Abtei " ecclesiarum disposicio, sacerdotum constitucio, ius sinodale quod bannum vocatur" (vergl. 380, 406) und in der hundert Jahre später erteilten Bestätigung Bischof Hermanns "bannum, ius sinodale, cura und ordinacio" (1297). Auf Grund dieses Privilegiums, das den Cisterzienserklöstern ordnungsmäßig gebührte, erstand innerhalb des Abteigebietes der Archidiakonat von Kröpelin. Bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts schein ihn der Abt nicht selbst verwaltet, sondern einem Schweriner Domherrn übertragen zu haben (Urk. 2512 vom Jahre 1298 und Urk. 4923 vom Jahre 1328, vergl. dazu 4415). Abt Conrad aber nahm im Jahre 1353 die Abhaltung des Sendgerichts selbst in die Hände. Vergebens remonstrierte der Bischof und drohte mit Exkommunikation. Der Abt setzte seine Ansprüche siegreich durch (7852, 7918). Im Rostocker Archidiakonatszehntregister von 1473 (Archiv zu Schwerin) finden wir die Kirchen der Abtei bei dem Rostocker Archidiakonat, jedoch ausdrücklich als "extra archidiaconatum" bezeichnet, also wohl nur für die Einziehung der an die Curie zu zahlenden Zehnten bequemlichkeitshalber mit Rostock vereinigt.
Als zweiter Archidiakonat begegnet sodann 1191 in der päpstlichen Privilegienbestätigung (151) der des Schweriner Dompropstes, indem hier "ad preposituram bannum totius Zwerinensis provincie per omnes ecclesias et in ipsa civitate Zwerinensi excepta principali synodo eiusdem civitatis" gelegt wird. Er erstreckte sich hiernach über die Grafschaft Schwerin (vergl. zu "provincia Swerinensis" M. U.=B. 141,


|
Seite 150 |




|
280), umfaßte aber auch das Land Mecklenburg in engerem Sinne. Er wird bis zur großen Kolonisation neben Doberan der einzige geblieben sein. Der nächste muß der von Rostock gewesen sein, obgleich er urkundlich erst 1252 (686) begegnet. Die Errichtung des Rühner Archidiakonats und die Zuweisung der jüngeren Pfarre Lambrechtshagen zu diesem im Jahre 1233 (420) setzt seine Existenz voraus, und ebenso das Bestehen eines Archidiakonates in Tribsees schon um 1232 (406). Er ward, wie es scheint, vom Rostocker Marienpfarrer verwaltet (686), bis er 1270 (1178) mit der Präpositur der Bützower Kollegiatkirche vereinigt ward; er umfaßte im wesentlichen die Kirchen des Landes Rostock und erhielt daher auch jene Kirche zu Lambrechtshagen von Rühn zurück. Später war er eine Zeitlang wieder von der Bützower Präpositur getrennt, ward aber 1310 (3421) von neuem auf immer mit ihr vereinigt.
Als dritter Archidiakonat tritt dann der schon erwähnte von Tribsees für das Rügensche Vorpommern auf. Als sein erster Präpositus begegnet uns 1232 (406) Jaroslaw, der Sohn Wizlavs I. von Rügen. Später ward er von Schweriner Kanonikern verwaltet (z. B. 1299 M. U.=B. 2568).
Auf ihn folgt der 1233 (420) errichtete Archidiakonat des neugegründeten Rühner Nonnenklosters. Er umfaßte die Pfarren des Stiftslandes Bützow und der nördlich angrenzenden Teile der Werleschen Vogtei Schwaan. Bei der Errichtung des Kollegiatstiftes in Bützow mußte er jedoch die Bützower Pfarre herausgeben. Ebenso verlor er später an Rostock die Pfarren Satow und Lambrechtshagen, jedoch wohl erst nach 1381; denn damals reichte er noch "iuxta muros opidi Rostock" (7143 Nr. 39) Da das Kloster die Wahl seines Propstes hatte, so kam die Präpositur in die verschiedensten Hände; bald ist es ein Pfarrer, der sie hat, wie um 1290 der von Plau (2124), bald ein Schweriner Domvikar, so um 1330 (5469), selbst ein Ratzeburger Kanonikus kommt als Propst von Rühn vor (859, 915 usw. um 1260).
An den Rühner mögen sich die beiden anderen, etwa um dieselbe Zeit errichteten klösterlichen Archidiakonate anschließen, der von Dobbertin über die Werleschen Pfarren des Landes Goldberg, der wohl zugleich mit der zwischen 1231 und 1234 ward (425) - auch hier lag die Wahl des Propstes in den Händen des Konventes - und der von Neukloster, für den es zwar an einer Verleihungsurkunde fehlt, der aber später (3595 vom Jahre 1313; vergl. auch 3968, 7143, 38) deutlich als be=


|
Seite 151 |




|
stehend hervortritt; er beschränkte sich übrigens auf die Pfarren des Klostergebietes.
Um dieselbe Zeit wie die von Rühn und Dobbertin werden im Gefolge der Kolonisation und Pfarrerrichtung in den Ländern Parchim, Plau, Waren und Röbel auch diese vier Archidiakonate errichtet sein, wenngleich sie urkundlich erst später hervortreten; zuerst, wenn wir oben recht geurteilt haben, der von (Alt=) Röbel, schon 1239 (499) oder wenigstens 1256 (763). Da die größere Hälfte des Landes Röbel an Havelberg verloren ging, so blieben ihm nicht mehr als 7 Pfarrkirchen. Dann folgte der von Parchim, dessen Archidiakon zwar erst 1285 (1787) begegnet, der aber um 1264 (1009) sicher bestand. Um 1275 taucht weiter der von Plau auf. Er war damals in den Händen des Domdekans von Schwerin (1369 n). Auch dieser Archidiakonat war, nachdem alle südlich der Elde gelegenen mecklenburgischen Gebiete havelbergisch geworden waren, sehr zusammengeschrumpft; er kann nicht mehr wie 3 - 4 Pfarrkirchen umfaßt haben. Er verschwindet daher schon seit 1293 (2199), wo er zum letztenmal erwähnt wird, aus der Geschichte. Seine Kirchspiele scheinen dem Warener Archidiakonat zugefallen zu sein, bei dem wir wenigstens Plau selbst in den Zehntlisten des 16. Jahrhunderts finden (vergl. weiter unten). Dieser letztere endlich begegnet mit seinem Archidiakon zuerst 1287 (1914) und 1288 (1964). Die Archidiakonate von Parchim und Waren sind ständig in den Händen von Schweriner Domherren; sie waren wohl mit bestimmten Stellen des Domkapitels verbunden. Bei Alt=Röbel scheint das nicht der Fall gewesen zu sein. Hier war in der Regel der Pfarrer der Altstadt Röbel zugleich Archidiakon.
Als letzter und jüngster der schwerinschen Archidiakonate ward endlich im Jahre 1270 aus einigen werleschen Pfarren des Amtes Schwaan und einigen mecklenburgischen des Landes Sternberg ein Archidiakonat für den Dekan der Bützower Kollegiatkirche errichtet (1178).
Im Sprengel des Bistums Kammin, soweit dieser in das mecklenburgische hineinreicht, begegnet zuerst 1215 (219 A) der Präpositus von Demmin - zweifelsohne, da Demmin keine Kollegiatkirche besaß, der Archidiakon, und zwar vermutlich für das zu Demmin gehörige Cirzipanien. Es ist dieselbe Zeit, in der das Bistum Kammin mit Kirchengründungen in Cirzipanien begonnen hatte. Sicher reichte die Jurisdiktion des Propstes auch später in mecklenburgischer Zeit noch in das Land Kalen hinein; Levin gehörte zu seiner Prävositur, bis es 1309 dem


|
Seite 152 |




|
Alt=Kalener Archidiakonat zugewiesen wurde (491, 3286). Jener Alt=Kalener Archidiakonat aber war der der Abtei Dargun für die Kirchen ihres Grundbesitzes und umfaßte noch 1282 (1629) nicht mehr als die Kirchen von Alt=Kalen, Röcknitz, Duckow und Polchow, zu denen später Brudersdorf, Gülzow und Levin kamen. Zwar war dem Kloster in seinen Stiftungsurkunden das Archidiakonatsrecht nicht ausdrücklich zugestanden worden, aber als Bischof Sigwin 1216 (226) die Wiederherstellung desselben beurkundete, schenkte er ihm ecclesiam que est in villa eorum (der Mönche) Polchowe cum omni iure nostro, prout ordo solet ecclesias possidere. Da der Bischof das Patronat nicht zu verschenken hatte, so kann es sich hier nur um die Archidiakonatsrechte handeln, die dem Orden herkömmlich in seinen Kirchen zustanden. Im Jahre 1232 werden diese denn auch in der Privilegienbestätigung Bischof Konrads ausdrücklich genannt. Die Ausübung derselben übertrug das Kloster dem Pfarrer von Alt=Kalen (491 vom Jahre 1239). Später scheint sie zeitweise in den =Händen des Leviner Pfarrers gelegen zu haben, worauf dieser Ansprüche an die Archidiakonatsrechte gründete, mit denen er jedoch nicht durchdrang (M. Jbb. 68, 229; M. U.=B. 12829).
Ein dritter Archidiakonat ward dann schon vor dem Jahre 1235 von Bischof Konrad für das Land "Bisdede sive Tribedene" errichtet. Als erster verwaltete ihn der Güstrower Domdekan Dietrich, dann aber verlieh der Bischof dem Güstrower Kapitel das Recht, einen aus seiner Mitte für dies Amt zu wählen (438, 439). Die Folge war, daß er auch hier bald ständig mit der Präpositur verbunden ward. Über die Ausdehnung der Länder Bisdede und Tribede und damit der Archidiakonatsrechte des Güstrower Propstes ist oben bereits gesprochen worden. Sie umfaßten wahrscheinlich nur die drei Ämter Güstrow, Krakow und Teterow, vielleicht jedoch auch noch das Land Malchin, in welchem der Propst im Jahre 1510 eine Pfarrbesetzung vornahm (in Schorssow; M. Jbb. 12, 29, Anm. 1) und dessen Hauptkirche Malchin seit 1301 (2751) dem Domstift Güstrow inkorporiert war. Das Land Hart aber, damals ein Unterteil von Kalen, wird wie dieses zur Demminer Präpositur gehört haben. Urkundliche Nachweise fehlen allerdings bis auf einen freilich nicht ganz sicheren. Die Urkunde 9500 vom Jahre 1366 hat nämlich ein Siegelband aus einem zerschnittenen Briefe, auf welchem zu lesen steht: "de Gard officialis prepositi Dymyn discreto viro rectori ecclesie in Ghorissendorp". Das scheint ein amtliches Schreiben und macht die Zuständigkeit des Demminer


|
Seite 153 |




|
Propstes für Gorschendorf wahrscheinlich. Über Gnoien fehlen, abgesehen von jenem Clandrianschen Regest von 1258 (826), nach welchem Bischof Rudolf von Schwerin darüber klagt, daß das Kapitel Güstrow ihm unter andern Zehnten auch die im Lande Tribeden und Gnoien enthebe, alle Zeichen der Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Archidiakonat. Zu Tribeden kann es nicht mehr gehört haben, und der Lage nach möchte man es mit Kalen dem Demminer Propste zuweisen. Letzteres wird endlich auch für die beiden kleinen Ländchen Tüzen und Gädebehn zu gelten haben.
Am dürftigsten sind auch in betreff der Archidiakonatsverhältnisse die Nachrichten für die havelbergischen Teile Mecklenburgs. Der erste havelbergische Archidiakon, dem wir auf mecklenburgischem Boden begegnen, ist der von Neu=Röbel. Das Mecklenburgische Urkundenbuch sieht zwar ,schon in dem 1239 (499) auftretenden Präpositus Nikolaus einen havelbergischen Propst, doch wohl mit Unrecht. Jedenfalls sicher havelbergisch ist der 1249 zuerst auftretende präpositus Stephanus (634 u. öft.). Wie sein Nachfolger Johann Storm (1758, 1863) wird auch er Pfarrer der Nikolaikirche in der Neustadt Röbel gewesen sein. Später wenigstens war die Präpositur fest mit der Pfarre verbunden, und gehörten zu ihr 33 Kirchen (Visit. 1534). Sie umfaßte den südlichen Teil des Landes Röbel - das Amt Wredenhagen, Melz, Dambeck und Lehsten gehörten zu ihr (2486) =; ging aber noch über die Grenzen desselben hinaus.
Gegen Ende des 13. Jahrhunderts, 1295, erscheint dann der zweite havelbergische Archidiakon, der Propst von Friedland (2354). Auch diese Propstei erscheint von Anfang. an mit der Pfarre verbunden gewesen zu sein (4340; Visit. 1534). Ihrem größeren Umfange entsprechend - sie umfaßte ungefähr 80 Kirchen (Visit. 1534) - waren ihre Inhaber jedoch meist höheren Ranges und Standes. Gleich der zweite, Christian von der Dollen, war Domherr und Vizedom von Kammin (5308), der dritte, Anton von Plessen, Domherr von Lübeck (5428, 5530, 6629). Der Umfang der Präpositur wird sich auf das Land Stargard in engerem Sinne beschränkt haben, für das wir oben 81 Pfarrkirchen zählten, was mit den ungefähr 80 von 1534 stimmt.
Ein dritter Archidiakonat scheint endlich für den Propst von Broda bestanden zu haben. Im Jahre 1317 wurde nämlich dem Siegfried Mezcke, der sich an dem Pfarrer von Penzlin vergangen hatte, als Buße auferlegt, Bittgänge um die Kirchhöfe von Penzlin und "VII ecclesias in prepositura Brodensi con=


|
Seite 154 |




|
stitutas" zu machen. Weitere Nachrichten fehlen leider ganz. Man wird aber hiernach annehmen dürfen, daß der Propst von Broda die Archidiakonatsrechte über die Kirchen des Landes Penzlin ausübte. Jedenfalls unterstand ihm die Pfarre der Stadt Penzlin, denn der dortige Pfarrer hatte 1367 (9694) pro quodam excessu an den Propst von Broda eine Strafe zu zahlen, die dieser ihm auferlegt hatte.
Versuchen wir nun, soweit möglich, die Grenzen der genannten Archidiakonate im einzelnen festzustellen.
Beginnen wir mit dem Bistum Ratzeburg. Hier bestanden, wie gesagt, abgesehen von den beiden erst 1504 errichteten Archidiakonaten Lauenburg und Stapel, welche wir füglich außer acht lassen können, nur die drei der Pröpste von Ratzeburg, Rehna und Eldena. Da wir nun über den Umfang der Sprengel der letzteren beiden durch die Urkunden 471, 5613 und 2118 genau orientiert sind, so ergibt sich der Rest als der des Ratzeburger Propstes.
Dem Rehnaer Propst wurde 1237 (471) der Bann der Kirchen von Rehna, Wedendorf, Wismar, Proseken, Hohenkirchen, Beidendorf, Gressow, Grevesmühlen, Klütz, Damshagen, Elmenhorst, Kalkhorst, Rüting (= Dietrichshagen) und der etwa noch im Lande Breesen entstehenden Kirchen zugewiesen. Es sind sämtliche damals bestehenden des Landes Breesen (inkl. Klütz). In der Folgezeit wurden hier noch die Kirchen von Friedrichshagen und Bössow errichtet, dazu, wohl noch im Bereich der Rehnaer Parochie selbst, Lübsee. Alle diese Kirchen finden wir denn auch 1335 (5613) in ununterbrochener Reihe zusammen aufgeführt. Mit Rehna beginnend und mit Elmenhorst schließend, worauf dann mit einem großen geographischen Sprung zu Eldena und den Kirchen seines Archidiakonats übergegangen wird, bilden sie offenbar eine beabsichtigte und vollzählige Aufzählung der Kirchen des Rehnaer Archidiakonates. Seine Grenze begann also im Nordwesten an der See und lief zunächst zwischen den Kirchspielen Kalkhorst, Damshagen, Grevesmühlen einer= und Dassow, Roggenstorf, Börzow andererseits südwärts, bog dann, die Kirchspiele Lübsee, Rehna und Grambow umkreisend, nach Nordwesten, dann nach Süden und endlich ostwärts ab, um zwischen denen von Dietrichshagen, Friedrichshagen und Beidendorf einer=, Eixen und Dambeck andererseits in dieser Richtung fortlaufend die Ratzeburg=Schweriner Sprengelgrenze zu erreichen.
Als zum Eldenaer Archidiakonat gehörig werden 1291 (2118) alle Kirchen zwischen Sude und Elde bezeichnet. Aufgeführt


|
Seite 155 |




|
werden namentlich die von Eldena, Grabow, Dömitz, Konow, Jabel, Leussow, Picher, Stapel, Laasch. Auch 1335 (5613) sind es noch nicht mehr. Seine Grenzen sind also im Süden die Elbe, im Osten die Elde bis hinauf in die Gegend von Neustadt. Hier biegt sie - immer mit der Bistumsgrenze zusammenfallend - zwischen den Kirchspielen Gr.=Laasch und Neustadt nach Westen um, läuft dann den Jasnitzer Bach entlang in die Sude und diese hinunter wieder zur Elbe zurück. Nur am Unterlauf der Sude verläßt sie diese auf kurze Zeit, um die zu den Kirchspielen Boizenburg und Zahrensdorf=Blücher gehörige Teldau auszuschließen.
Alles, was nicht zu diesen beiden Archidiakonaten gehört, haben wir als zu dem des Dompropstes gehörig anzusehen, und dem entspricht die Anordnung der Kirchen in der Pfarrtaxe (5613), welche, mit den Ratzeburger Kirchen beginnend, an diese die sicher zum Ratzeburger Propstarchidiakonat gehörigen Kirchen der Sadelbaude anschließt, zwischen welche sie die der Gamme und von Bergedorf einschiebt, darauf die der Länder Boizenburg, Wittenburg, Gadebusch, Boitin folgen läßt und endlich mit den 1237 dem Ratzeburger Propst überwiesenen Dassower Kirchen, zu denen inzwischen Börzow und Roggenstorf gekommen sind, schließt. Nun folgen die Rehnaer Kirchen und am Schlusse die Eldenaer.
Schwieriger schon ist die Ermittelung der Archidiakonatsgrenzen für das Bistum Schwerin. Wir gehen hier am besten von den kleineren Kloster=Archidiakonaten aus, deren Umfang sich genau feststellen läßt, und beginnen mit dem von Doberan. Im Jahre 1273 (1297) bestätigt Bischof Hermann von Schwerin dem Kloster den Bann über die Kirchen Kröpelin, Steffenshagen, Parkentin und Rabenhorst. Es sind die Kirchen des alten Abteigebietes. Nur die von Stäbelow fehlt - sie bestand noch nicht. Auf einem Blatte von ca. 1320 (4153), das die Pfarrtaxen der Neuklosterschen und Doberaner Pfarren enthält, ist dann auch diese da, aber die von Rabenhorst bezw. die an ihre Stelle getretene von Rethwisch fehlt, offenbar weil sie durch einen Mönch verwaltet wurde und daher abgabenfrei war. Alle 5 Kirchen finden wir endlich beisammen im Jahre 1353 (7852) und im Zehntregister der Kirchen des Rostocker Archidiakonates von 1473 (Collektaneum des Petr. Boye im Schweriner Archiv). Bei Rethwisch findet sich hier die das Fehlen in der Pfarrtaxe von ca. 1320 erklärende Bemerkung: "monachus est; nihil dat". Es sind also diese 5 Kirchspiele, welche den Doberaner Archi=


|
Seite 156 |




|
diakonat ausmachen. Die übrigen Kirchen Doberaner Patronates, wie Neuburg, gehören nicht mehr dazu.
Auch der Neuklostersche Archidiakonat umfaßte nur die Kirchen des Dotationsgebietes. In jenem Zehntregister des Rostocker Archidiakonats von 1473 wird auch die von 1219 her Neukloster gehörige Kirche von Kessin aufgeführt, aber ausdrücklich als "extra Archidiaconatum". Sie unterstand also, obgleich mitten unter den Pfarren desselben gelegen, nicht dem Rostocker Archidiakon, sondern - eben dem Propst von Neukloster. Und wenn 1313 (3595) der Visitator des Erzstiftes Bremen über Visitationsgebühren der Pfarren von Nakenstorf, Bäbelin, Brunshaupten, Kessin und Techentin in Gegenwart "domini prepositi novi claustri, cui sunt subiecti" quittiert und um 1320 (4153) diese selben Kirchen zusammen auf ihr Pfarreinkommen taxiert werden, so haben wir hier den Umfang des Neuklosterschen Archidiakonates. Es sind tatsächlich alle auf dein Dotationsgebiet bestehenden Pfarren; sie und nur sie stehen unter dem Bann des Propstes, daher fehlt denn auch in beiden Urkunden die Kirche von Groß=Tessin, deren Patronat das Kloster 1275 (1373) erworben hatte; ihr Pfarrer war eben nicht dem Neuklosterschen Propst "subiectus", sondern dem Rühner Propst, zu dessen Archidiakonat Gr.=Tessin 1233 (420) gelegt worden war, und die Taxe der Gr.=Tessiner Pfarre gehörte, nicht unter die der Neuklosterschen, sondern die der Rühner Archidiakonatspfarren, denn der Archidiakon ist es, welchem die Eintreibung. der Zehnten für die päpstliche Kammer obliegt. 1 ).
Der Umfang des Dobbertiner Archidiakonates ergibt sich für das Jahr 1234 aus M. U.=B. 425. Damals waren es die Kirchspiele von Goldberg, Lohmen, Ruchow, Karcheez und Woserin. Später kamen noch die nachgegründeten Kirchen von


|
Seite 157 |




|
Gr.=Upahl, Zidderich und Woosten hinzu. Auch sie gehören im 15. Jahrhundert zum Dobbertiner Archidiakonat (425 n).
Der vierte klösterliche Archidiakonat ist der des Klosters Rühn. Er ward 1233 (420) errichtet und ihm die Kirchen von Bützow, Warin, Retschow, Satow, Karin, Neuenkirchen, Tessin, Qualitz, Baumgarten, Boitin, Tarnow, Parum, Bernitt und Lambrechtshagen zugewiesen, d. h. offenbar alle Kirchen des Stiftslandes Bützow und dazu die Werleschen Pfarren im westlichen Teile der Vogtei Schwaan. Hinzugekommen durch Nachgründung sind hier im Stiftslande die Kirchen von Moisall, Zernin, Warnow und Laase. Dafür mußte Rühn 1248 bei der Errichtung des Kollegiatstiftes in Bützow die Kirchen der Stadt Bützow herausgeben. Vergeblich remonstrierte der Propst dagegen; 1265 (1034) mußte er nachgeben. Dagegen behauptete er seine Archidiakonatsrechte gegen das Bützower Kapitel in Neuenkirchen (1288, 7676). Außer Bützow aber verlor er im Laufe des Mittelalters noch die Pfarren von Satow und Lambrechtshagen; 1473 finden wir sie bei dem Rostocker Archidiakonat; und endlich sind auch die nach 1233 in jenen westlichen Teilen des Amtes Schwaan errichteten Pfarren Passee, Berendshagen und Heiligenhagen nicht ihm, sondern dem Rostocker Archidiakonat zugefallen, bei dem wir sie ebenfalls 1473 finden. Daraus ergeben sich die Grenzen des Rühner Archidiakonates, wie er sich tatsächlich gestaltet hat.
An diese kleineren klösterlichen schließt sich. der ebenfalls nicht umfangreiche des Dekans der Bützower Kollegialkirche. Außer Bützow selbst umfaßt er die Pfarren Schwaan, Sprenz, Lüssow, Alt=Güstrow, Kritzkow, Kamps, Raden, Sternberg, Gägelow und Witzin (1178). Er bestand sonach aus zwei getrennten Teilen, einem kleineren im Süden des Stiftslandes Bützow, der die 4 Pfarren Sternberg, Gägelow, Witzin und Raden umfaßte - wobei übrigens zu beachten ist, daß Kobrow damals noch eine selbständige Pfarre war und nicht zu Sternberg gehörte - und einem größeren, der sich an die Ostgrenze des Rühner Archidiakonates anschloß, außer Bützow selbst auf dem linken Warnowufer Schwaan und Kamps umfaßte, auf dem rechten mit Hohen=Sprenz und Kritzkow die Recknitz erreichte, an welcher die Grenze dann hinauflief bis an die Nebel, deren Lauf die Südgrenze zugleich des Bistums Schwerin gegen Kammin bildete bis wieder zurück zum Kirchspiel Bützow.
Weit größer war der Archidiakonat Rostock, der Bischof Hermann in derselben Urkunde von 1270 (1178) mit der Präpositur der Bützower Kollegiatkirche vereinigte. Er sollte


|
Seite 158 |




|
außer den Kirchen der Stadt Rostock selbst 25 Kirchen der Umgegend umfassen. Seinen genauen Umfang lernen wir aus jenem schon oft zitierten Zehntregister von 1473 (im Archiv in Schwerin, Collektaneum des Petr. Boye) kennen. Er umfaßt außer den 4 Rostocker Stadtpfarren die Kirchspiele Ribnitz, Wustrow, Kuhlrade, Marlow, Kölzow, Sülze, die beiden Wulfshagen, Blankenhagen, Rövershagen, Volkenshagen, Bentwisch, Teutenwinkel, Tulendorf, Sanitz, Dänschenburg, Tessin, Kavelstorf, Petschow, Kammin, Lage, Gr.=Ridsenow, Recknitz, d. h. östlich der Warnow alle Kirchen zwischen Ostsee, Recknitzunterlauf und der Schwerin Kamminer Grenze, welche nicht schon zum Archidiakonat des Bützower Dekans gehören, mit Ausnahme des unter dem Neuklosterschen Propstes stehenden Kessin. Auf dem linken Warnowufer folgen dann die weiteren Kirchspiele Biestow, Buchholz, Heiligenhagen, Satow, Passee, Berendshagen, Hanstorf, Lambrechtshagen, Lichtenhagen und Warnemünde, d. h. wiederum alle Kirchen des Landes Rostock und der Vogtei Schwaan, die nicht nach dem oben ausgeführten schon einem der kleineren Archidiakonate von Doberan, Rühn und Bützow angehörten. Mit dem östlichsten derselben, Passee, ist die Grenze zwischen Werle (Vogtei Schwaan) und Mecklenburg (Vogtei Buckow) erreicht.
Es bleiben nun noch die Archidiakonate Schwerin (Dompropst), Parchim, Waren, Röbel=Altstadt und Tribsees, für deren Umfang die Nachrichten dürftiger sind.
Von ihnen ist indes der Umfang des Archidiakonates Tribsees ohne weiteres durch die mit der Nordostgrenze Mecklenburgs gegen Pommern hin zusammenfallende Ostgrenze des Rostocker Archidiakonates gegeben. Er war und blieb, so weit wir wissen, der einzige Archidiakonat im schwerinschen Vorpommern. Neuenkamp scheint dieses sonst gewöhnlich den Cisterzienserklöstern für ihre Kirchen zugestandene Recht nicht besessen zu haben. Wenigstens fehlt es mir an urkundlichen Belegen.
Schwieriger schon ist es, den Umfang des Archidiakonates Waren zu bestimmen, obgleich sich seine Nord= und Ostgrenze von selbst ergibt, da sie sich mit der Schwerin. Kamminer bezw. Schwerin Havelberger Grenze decken muß, die auch zugleich. die Grenzen des Landes Waren sind. Die mittelalterlichen Nachrichten sind äußerst dürftig, sie bestehen nur aus drei Urkunden, M. U.=B. 5233, 2507 und 5921, von denen erstere noch als völlig unzuverlässig ausscheidet. Sie handelt von den Zehnten aus verschiedenen Dörfern und trägt die Randbemerkung "de decima in archidiaconatu Warnensi". Allein unter diesen


|
Seite 159 |




|
Dörfern finden sich auch. Schalentin bei Parchim und das noch westlicher gelegene Severin, Orte, die fraglos nicht mehr zum Warenschen Archidiakonat gehört haben können. Die zweite Urkunde zeigt, daß Malchow mit seiner Filiale Lexow noch dazu gehörte. Die dritte bringt einen Pfarrer von Karow als Vizepropst von Waren, der in Jabel Synode hält, woraus mit Sicherheit zwar hervorgeht, daß Jabel unter dem Warenschen Propst stand. Für Karow jedoch steht dies damit noch nicht fest. Schlie (V, 448) will auf Grund einer Urkunde von 1480 auch Stuer noch zum Warenschen Archidiakonat rechnen, doch wohl mit Unrecht, die von ihm zitierte Urkunde handelt nicht von einer Funktion des Warener Archidiakons in Stuer, sondern nur von der Besetzung einer Vitarie der Flotow auf Stuer in Waren durch denselben.
So sind wir auf die Listen der im 16. Jahrhundert eingegangenen bischöflichen Zehnten im "Archidiakonat Waren" angewiesen. Sie sind vorhanden aus den Jahren 1532 - 34, 1594 und 1602 (Schweriner Archiv). Die Zehnten sind sehr verschieden eingegangen, und namentlich die Listen der ersteren Jahre weisen nur eine geringe Zahl von Orten auf. Stellt man aus ihnen die Kirchspiele zusammen, in welchen die Kirchdörfer selbst oder doch Kirchspielsdörfer als zehntzahlend genannt sind, so erhält man als Umfang des Archidiakonates die Kirchspiele Gr.=Varchow, Varchentin, Gr. =Giewitz, Schloen, Gr. =Dratow, Lansen, Vielist, Sommerstorf, Waren, Federow, Kieth, Lütgendorf, Malchow, Jabel, Alt=Schwerin, Nossentin, Poppentin, Klink, Grüssow und Plau.
Es sind dies so ziemlich alle Kirchspiele der Länder Waren und Malchow. Es fehlen nur die von Luplow, Deven, Rittermannshagen und Hohen=Wangelin, welche der Lage nach zum Archidiakonat gehört haben müssen, deren Fehlen sich. aber leicht dadurch erklärt, daß in ihnen längst alle Zehnten in andere Hände übergegangen waren. Es bestätigt sich hierdurch das über die Nord= und Ostgrenze des Archidiakonates Gesagte. Aber die Südgrenze gegen den kleinen Archidiakonat Alt=Röbel! Nach dem Visitationsprotokoll von 1534 hatte der Propst von Alt=Röbel die Jurisdiktion über 6 Pfarrkirchen "buten Röbel". Nimmt man hier die Bezeichnung Pfarrkirchen im eigentlichen Sinne, als Kirchen, mit denen eine eigene Pfarre verbunden ist, so bleiben nach Abzug von Malchow mit Lexow zwischen den Eldeseen und der havelbergischen Grenze gerade die 6 Kirchspiele Stuer, Satow, Grüssow, Sietow, Poppentin und Klink. Von diesen aber erscheinen Poppentin, Grüssow und Klink in unseren Zehntlisten als zum


|
Seite 160 |




|
Warener Archidiakonat gehörig, und zwar nicht erst 1594 und 1602, wo ein Irrtum leicht möglich wäre, da die Archidiakonate damals bereits seit Jahrzehnten zu bestehen aufgehört hatten, sondern schon 1532 - 34, wo der des Alt=Röbeler Propstes noch bestand. Dann aber blieben auch mit Einrechnung der Filialkapellen nicht mehr 6 Kirchen für den letzteren. Man wird also annehmen müssen, daß, da die Einziehung der bischöflichen Zehnten nicht in den Händen der Archidiakone lag, der kleine Röbeler Sprengel hierfür mit dem Warener zusammengeworfen war, und die Grenze vermutungsweise so zu ziehen ist, daß südlich der Seenreihe nur Malchow mit Lexow noch zu Waren gehört.
Ebenso unsicher ist aber auch die Westgrenze. Jene Zehntlisten nennen, und zwar ebenfalls schon 1532 - 34, auch Plau als zum Warener Bezirk gehörig. Plau hatte einst seinen eigenen Archidiakon gehabt, jedoch, wie es scheint, nur auf kurze Zeit, gehörten doch nicht mehr als 7 - 8 Pfarren zum Lande Plau schwerinschen Teils. Es wird in der Tat seit etwa 1300 zu Waren gehört haben. Die Kirchspiele des Plauer Landes sind Plau, Kuppentin mit Poserin, Karow, Quetzin und ein Teil des Alt=Schweriner Kirchspiels; dazu südlich der Elde Barkow, Brook und Lübz. Rechnen wir diese zum Warener Archidiakonat, wie es für Barkow durch die oben erwähnte Urkunde von 1519 feststeht, so fällt die damit gegebene Grenze im Norden teils mit der Schwerin=Kamminer, teils mit der Grenze des Dobbertiner Archidiakonates zusammen, im Süden wird sie von der Bistumsgrenze gebildet. Westlich aber von Kuppentin und Lübz beginnt mit Passow und Lanken das Land Sternberg - Parchim (4570, 4959), und war aller Wahrscheinlichkeit nach schon der Parchimer Archidiakon zuständig. Wir ziehen also die Westgrenze vermutungsweise am Westrande der Kuppentiner und Lübzer Parochie.
Am dürftigsten sind die Nachrichten über den Umfang der beiden letzten schwerinschen Archidiakonate, Schwerin und Parchim; indes ergeben sich ihre Grenzen aus denselben im Zusammenhalt mit den bisher festgestellten Grenzen der übrigen Archidiakonatsbezirke mit ziemlicher Sicherheit.
Der Präpositur des Schweriner Kapitels war schon 1194 (151) in der päpstlichen Bestätigung des Domkapitels der Bann über alle Kirchen der ganzen "provincia Swerinensis" beigelegt worden, d. h. doch wohl (vergl. M. U.=B. 141, 280) der Grafschaft Schwerin. Aber das Bannrecht des Propstes erstreckte sich noch weiter; wir finden ihn zuständig in Sülten (1910) und


|
Seite 161 |




|
Penzin (8318) im Lande Brüel, in Mecklenburg (Schlie II, 282; Visit. 1534) und Alt=Wismar (Crull in M. Jbb. 41, 122; Verhandlungen von 1475 über den Wiederaufbau der Kapelle) im Lande Mecklenburg. Wir dürfen daher annehmen, daß letzteres mit dem kleinen zu ihm gehörigen Lande Brüel ebenfalls zur Schweriner Propstei gehörte. Dann ist es aber auch für das zweite zu Mecklenburg gehörige Land, das Land Ilow und Buckow, wahrscheinlich, obgleich wir hier keine direkten Nachrichten besitzen. Schlie (II, 241) möchte letzteres zwar dem Bützower Präpositus auf Grund der beiden Urkunden 3088 und 4033 zuweisen. Allein aus der Mitbesiegelung einer Neuburger Pfarr - Urkunde, an der eine Reihe von sicher in keiner Beziehung zur Neuburger Pfarre stehenden Personen teilnehmen, ist auf ein amtliches Verhältnis des Bützower Propstes zu dieser nicht zu schließen. Und auch die bloße Zeugenschaft desselben bei der Trennung der Pfarre Dreweskirchen von Neuburg gibt keinen sicheren Schluß, obgleich es auffallend ist, daß bei der aus Schwerin datierten Urkunde nur der Bützower Präpositus und ein Bützower Kanonikus Zeugen sind. Hier möchte man wirklich ein amtliches Verhältnis vermuten. Doch steht dieser Annahme entgegen, daß wir einmal nirgends etwas von einem besonderen Archidiakonat Buckow hören, und andererseits, daß zur Bützower Propstei schon das ausgedehnte Rostocker Archid iakonat gehörte. Die Buckower Kirchen gehörten nachweislich nicht zu letzterem, und daß zwei Archidiakonate mit der Bützower Präpositur vereint gewesen wären, ist nicht nur unerweisbar, sondern auch höchst unwahrscheinlich. So wird es doch als das wahrscheinlichste zu gelten haben, daß auch Land Buckow als Pertinenz von Mecklenburg dem Schweriner Propste unterstand. Ist das aber der Fall, so würde die allein fragliche Ostgrenze des Schweriner Archidiakonates - im Norden würde sie die See, im Westen und Süden die Ratzeburger Diözefangrenze bilden - von der See bis an die Warnow bei Eickhof mit den westlichen Grenzen der Archidiakonate Doberan, Rühn, Rostock, Neukloster zusammen fallen, welche sich, abgesehen von dem Neuklosterschen Gebiet, zugleich mit den politischen Grenzen der Länder Rostock, Schwaan, Bützow, Warin decken. Weiterhin würde die Archidiakonatsgrenze mit der des Landes Brüel die Warnow aufwärts laufen, welche hier von Eickhof bis in die Gegend von Sternberg zugleich die Grenze des Bützower Dekanats=Archidiakonates bildet, würde dann mit der Grenze der Grafschaft Schwerin an der Warnow weiter aufwärts zu ziehen sein bis in den Barniner See und von dort mit der Grafschafts=


|
Seite 162 |




|
grenze südwärts laufend Crivitz, Krudopp und Göhren auf der Schweriner Seite einschließend, etwa bei der Mittelschleuse die Elde und damit die Bistumsgrenze erreichen. Was ost= und südwärts dieser eben beschriebenen Grenze liegt, ist das Land Sternberg=Parchim und dem Parchimer Archidiakonat zuzuweisen, dessen weitere Grenzen im Norden durch die der Archidiakonate Bützow (Dekanat), Neukloster, Dobbertin und die oben vermutungsweise festgestellte Westgrenze des Warener, im Süden endlich durch die Elde, als Bistumsgrenze gebildet würden. Urkundliche Nachrichten über die Zuständigkeit des Parchimer Archidiakons in irgendwelchen Teilen dieses Gebietes fehlen allerdings. Die politische Zugehörigkeit zum Lande Parchim und die festgestellten Grenzen der Nachbararchidiakonate müssen hier genügen.
Wenden wir uns nun zur Bestimmung der Grenzen der drei mecklenburgischen Archidiakonate des Bistums Kammin und beginnen wieder mit dem klösterlichen, dem von Dargun (= Alt=Kalen). Im Jahre 1232 (401) gehörten zu ihm die Kirchen Röcknitz, Kalen und Polchow; 1282 (1629) ist die von Duckow hinzugekommen; 1309 (3286) wurde auch Levin dazugelegt. Auf dem durch diese Kirchspiele umgrenzten Gebiete wurden endlich um 1300 noch die beiden Pfarrkirchen von Brudersdorf und Gülzow errichtet. Da auch sie auf Klostergebiet entstanden, finden wir sie 1395 ebenfalls beim Darguner Archidiakonat (M. U.=B. 12829; M. Jbb. 68, 229), nicht so dagegen die landesherrliche Pfarre Walkendorf, welche schon vor 1273 (1282) von Polchow abgezweigt worden war. Obgleich ihr Patronat inzwischen in die Hände Darguns übergegangen ist, gehört sie 1282 (1629) nicht zu den Darguner Bannkirchen, und dasselbe wird für die wohl ebenfalls nicht. von Dargun gegründete Kirche von Zettemin gelten, welche vermutlich 1282 auch schon vorhanden war. Darnach sind die Grenzen des Darguner Bezirkes zu ziehen. Er zerfällt in drei getrennte Teile, deren größter die Kirchspiele Röcknitz, Alt=Kalen, Brudersdorf und Levin umfaßt, der zweite Duckow mit Gielow und Gülzow; der dritte besteht allein aus dem Kirchspiel Polchow.
Was nun die beiden Archidiakonate Demmin und Güstrow betrifft und ihre gegenseitige Abgrenzung, so ist oben ausgeführt worden, daß sich. die Jurisdiktion des Güstrower Präpositus aller Wahrscheinlichkeit nach nur auf die Ämter Güstrow, Krakow, Teterow und vermutlich auch Malchin erstreckte, Kalen und doch wohl auch Gnoien aber zur Demminer Präpositur gehörten. Wir werden daher die Archidiakonatsgrenze hier auf


|
Seite 163 |




|
der politischen der Länder Kalen - Hart einer= und Teterow=Malchin andererseits und weiter Malchin einer= und Tüzen andererseits zu suchen haben, wie sie oben bereits beschrieben ist.
Lassen sich so die Kamminer Archidiakonate nur noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit begrenzen, so sind wir für die Havelberger in einer noch wesentlich ungünstigeren Lage. Mit ziemlicher Sicherheit lassen sich hier nur die Grenzen der Friedländer Propstei festlegen. Das Land Stargard umfaßte nach unserer Zählung in der Tat gerade 81 Pfarren, d. h. soviel wie zur Friedländer Propstei gehören sollten; beider Grenzen fallen also zusammen und die Richtigkeit der oben gezogenen Grenze des Landes wird durch dies Zusammentreffen bestätigt. West=, Nord= und Ostgrenze sind gegeben und die Südgrenze lief an der Südseite der Pfarren Wrechen, Schlicht, Cantnitz, Möllenbeck, Watzkendorf, Warbende, Blankensee mit Wanzka, Zachow und Nemerow
Der Jurisdiktion des Brodaer Propstes scheint das Land Penzlin, mit Einschluß der 3 Pfarren Wulkenzin, Weitin und Zierzow, unterstanden zu haben. West= und Nordgrenze sind durch die Bistumsgrenze gegeben. Die Ostgrenze bildet der Tollense=See mit der Lips. Von da ab lief sie weiter südwestwärts zwischen den Penzliner Kirchspielen Hohen=Zieritz, Peckatel und Langhagen und den Strelitzer Prillwitz, Weisdin und Zierke. Ganz so sicher ist die Südgrenze nicht zu ziehen, doch wird sie nach den oben gegebenen Daten zwischen den Kirchspielen Blankenförde, Granzin, Bök einer= und Leussow Schillersdorf, Leppin und Rechlin andererseits zu ziehen sein.
Zur Neu=Röbeler Propstei gehörten 33 Kirchen (Visit. 1534 ). Wo sind diese zu suchen ? Sicher zunächst im Amte Röbel, dem späteren Amte Wredenhagen. Hier finden sich. zwischen Plauer See und Müritz noch 17 mecklenburgische Pfarrkirchen; von ihnen gehörten Lezen, Dambeck und Melz nachweislich (2486) zur Präpositur. Aber das Amt Röbel erstreckte sich auch östlich der Müritz; auch Mirow, Fleth, Zechlin wie Dranse und das heißt wohl die ganze bis Wesenberg reichende mecklenburgische Lieze scheinen dazu gehört zu haben. 1 ) Rechnet man nun weiter demnach die 12 östlich der Müritz gelegenen Kirchen Krümmel, Garz, Rechlin, Leppin, Babke, Schillersdorf,


|
Seite 164 |




|
Leussow=Zirtow, Starsow, Wesenberg, Drosedow und Wustrow=Mirow wird als Komtureikirche exempt gewesen sein, und in seinen beiden Kirchen zu Lärz und Schwarz hatte Dobbertin die Jurisdiktion (1963) - zur Röbeler Präpositur und weiter die Kirchen der jetzt preußischen Lieze, wobei wieder von den Kirchen der Klosterländereien abzusehen ist =, so kommt man ungefähr auf die Zahl 33.
Wer aber hatte die Jurisdiktion im Lande Ahrensberg=Strelitz? Der Propst von Wittstock oder etwa der Propst des späteren Strelitzer Kollegiatstiftes? Und zu welcher Präpositur gehörten die 8 Kirchen der südlichen havelbergischen (Lübzer) Ture und die 21 der havelbergischen Hälfte des Landes Parchim? Letztere sind wohl zu Perleberg zu rechnen, wo ein Propst seinen Sitz hatte (11203). Mit den uns erhaltenen Urkunden lassen sich diese Fragen leider nicht lösen.


|
Seite 165 |




|
Register
der Kirchorte, Klöster, Archidiakonate und Diözesangrenzen.
Der Buchstabe a bezeichnet das Jahrbuch 72, der Buchstabe b das Jahrbuch 73.
| A btshagen a, 270. | Basse b, 41. |
| Ahrensberg b, 109. 121 f. | Bassendorf a, 270. |
| Ahrensboek a, 99. | Bassow b, 116. |
| 104. 143. | Basthorst a, 215. |
| Ahrenshagen a, 193. b, 91. 95. | Baumgarten a, 244 f. b, 157. |
| Altenkamp b, 88. 100. | Beestland b, 144. |
| Altenkrempe a, 95. 99. 108 f. | Behlendorf a, 1 22. 215. 220. |
| Altkalen s. Kalen. | Beidendorf a, 143 f. 208. 210. 212. |
| Amelungsborn a, 167. 246. b, 88. | b, 135. 154. |
| 101. | Bekentin b, 97. 142. |
| Ankershagen a, 193. b, 91. 95. | Belitz b, 39. 41. 144. |
| 104. 143. | Bellin b, 45. 49 |
| Appelhagen b, 144. | Below b, 131. 133. 138. 141. |
| Ave b, 143. | Bennin a, 222. b, 134 f. |
| Benthen a, 187. b, 62. 64. 138. | |
| B äbelin a, 173. 175. 263. b, 156. | Bentwisch a, 250 ff. 255 f. 267. |
| Babke b, 89. 164. | b, 126. 158. |
| Badegow b, 138. | Benzin b, 139. |
| Badendiek a, 183. b, 45. 49. | Berendshagen a, 245. 264. b, 157 f. |
| Badresch b, 116. 121. | Bergedorf a, 121. 123. 147. 216. |
| Baggendorf a, 259. 269 f. b, 39. | b, 148. 155. |
| Bakendorf b, 133. | Bergfeld b, 109. 123. |
| Ballin b, 112 f. 1 17. | Bergrade a, 185. b, 62. 138. |
| Ballwitz b, 111. 119. | Berkentin a, 122. 128. 201. 204. |
| Balow b, 83. 97. | 213. |
| Bandekow b, 134. | |
| Banzin b, 133. | Berlinchen b, 101. |
| Banzkow a, 165. 229. b, 130. 137. | Bernitt a, 244. 265. b, 137. 157. |
| 140. | Beseritz b, 113 f. 115. |
| Bargensdorf b, 111. 119. | Besitz b, 134. |
| Barkow b, 69. 73. 85. 93 f. 98. 160. | Bibow a, 172. 238. 260 f. |
| Barnin b, 62 f. 66 ff. | Biendorf a, 174 f. 241. 260 f. |
| Barsdorf b, 123. | Biestow a, 179. 194. 243. 245 ff. |
| Barth a, 190 f. 194. 258. 270. | b, 158. |
| Basedow a, 182. b, 40, 42. 129. | Blankenförde b, 89. 91. 102. 105. |
| Basepohl b, 50 ff. | 163. |


|
Seite 166 |




|
| Blankenhagen a, 250 ff. 255 ff. | Büchen a, 127 f. 201. 204. 213. |
| b, 158. | Buchholz (Schwerin) a, 232. b, 130. |
| Blankensee b, 111. 119. 121. 163. | 137. 140. |
| Blievenstorf b, 142. | - (Schwaan) a, 245 f. b, 158. |
| Blücher a, 222. b, 134. 155. | - (Lychen) b, 114. 123. |
| Blumenhagen b, 109. 112. 122. | - (Lieze) b, 100. |
| Blumenholz b, 112. 122. | Alt=Buckow a, 169. 173. 175 f. 194. |
| Blumenow b, 123. | 238. 241. |
| Boddin (Wittbg.) b, 133. | Neu=Buckow a, 175. 260 f. |
| - (Kalen) b, 44. | Buckow (Hardt) b, 145. |
| Boek b, 82. 95. 104. 163. | Bülow (Malchin) a, 182. b, 40. |
| Boitin a, 244. b, 157. | - (Parchim) b, 63. 66 ff. |
| Boizenburg a, 137 ff. 147. 213. 219. | Burow b, 63. 67f. 138. |
| b, 134. 155. | Bütow b, 142. 144. |
| Bootstede a, 270. | Kl.=Bützin b, 144. |
| Borgfeld b, 50. 145. | Bützow a, 169f. 194. 234. 244. |
| Borkow b, 138. | 265 f. b, 150. 157. Archidiakonat: |
| Bornhöved a, 93. 98 f. 100 f. 107. | b, 151. 157. |
| 109. | |
| Börzow a, 142. 206. 218 ff. 221. | |
| b, 154 f. | C ambs (Röbel) b, 87. 99 f. 142. |
| Bosau a, 93. 99. 105 f. 107. 109. | - (Schwerin) b, 137. |
| Bössow a, 208. 218. 221. 261. | - cf. Kambs. |
| b, 154. | Camin a, 130ff 145 ff. 148. b, 133. |
| Cammin (Schwaan) a, 247 ff. 256. | |
| Brahlstorf b, 137. | b, 39. 136.158. |
| Brandenburg, Sprengel b, 114 f. | Cantnitz b, 118. 163. |
| Brandshagen a, 258 f. 270. | Canzow b, 117. |
| Bredenfelde (Lauenbg.) a, 122. 126. | Carpin b, 111. 122. |
| 128 ff. 144. 147. 213. | Carwitz b, 114f. 118. 124. |
| - (Waren) b, 239. | Cesemow b, 79 f. 85. |
| - (Stargard) b, 118. 124. | Chemnitz b 55. |
| Breesen b, 55 f. 145. | Conow (Wehningen) a, 41. 202 f. |
| Brenz b, 83f. 93. 96. 142. | 205. 213. 219. b, 134. 135. |
| Bresewitz b, 113. 116. | - (Stargard) b, 124. |
| Briggow b, 154. | Consrade b, 137. |
| Bristow b, 145. | Cramon a, 164. 166. 194. 227. |
| Broda a, 191 ff. b, 75. 90. 104 ff. | b, 137. |
| 108. 110. Archidiakonat: b 153. | Crivitz a, 230 f. |
| 163. | |
| Brohm b, 113. 116. | Curau a, 100. 107. |
| Broock b, 69. 72. 80. 85. 94. 160. | |
| Brudersdorf a, 180. b, 44. 57. | D abel b, 61. 67. 138. 141. |
| 144f. 162. | Dabelow b, 109. 1 14. 123f. |
| Brüel a, 172 f. 194. 238. 240. 262. | Daberkow b, 114. 117. |
| Brunn b, 112 f. 114 f. | Dahlen b, 113. 115. |
| Brunow b, 84f. 96 f. 142. | Dahmen a, 182. b, 42. 144. |
| Brunshaupten a, 175. 241. b, 156. | Dambeck (Breesen) a, 207. 217. 221. |
| Brunstorf a, 215. | 228. b, 154. |
| Gr.=Brütz a, 165 f. 194. 227. b, 137. | - (Brenz) b, 83. 97. |
| Kl.=Brütz b, 137. | - (Röbel) b, 86 ff. 95. 99. 142. 163. |
| Langen=Brütz b, 137. | - (Penzlin) b, 143. |
| Kirch=Brüz b, 64 f. 68. 138. | Damerow b, 62. 138, |


|
Seite 167 |




|
| Damgarten a, 259. 269 f. | Drechow a, 191. 269f. |
| Damm a, 185. b, 60. 80. 83 f. | Drefahl b, 96. 142 f. |
| 95 f. 142. | Dreilützow a, 130. 216. 221. b, 134. |
| Dammwolde b, 86. 99. | Dreveskirchen a, 175. 241. 261 f. |
| Damshagen a, 123. 209 ff. b, 135. | b, 126. 130. 136. 140. |
| 154. | Drieberg b, 137. |
| Dannenwalde b, 114. 123. | Drosedow b, 102. 164. |
| Däuschenburg a, 131. 251 f. 253. | Duckow b, 43. 52. 145. 152. 162. |
| 256. 266. b, 158. | Düsterbeck, Dusternbeck b, 133. |
| Dargelütz b, 62 f. 67 f. | Dütschow b, 96. 142 f. |
| Dargitz b, 101. | |
| Dargun a, 169. 180. 257. b, 34 f. | E ichhorst b, 113. 117. |
| 36. 42. 44. 50. 52 82. 88 f. | Eickelberg a, 260 f. |
| Archidiakonat: b, 152. 162. | Eixen (Schwerin) a, 133f. 145. 148. |
| Darz b, 98. | 199. 227. b , 134. 154. |
| Darze b, 138. | - (Pommern) a, 258 f. 270. |
| Dassow a, 142 f. 146. 148. 205 f. | Eldena (Wehningen) a, 141. 199. |
| 210f. 213. b, 135. 154. | 202 f. 204. 213. 219. b, 134. |
| Demen b, 66. | Archidiakonat: b, 148 154 f. |
| Demern a, 215. 220. | - (Pommern) a, 257 b, 35. |
| Demmin a, 149 ff. 1 90. 194. Archi= | Elmenhorst (Klütz) a, 209 ff. 213. |
| diakonat : b, 151f. 162 | 221. b, 154. |
| Demzin b, 39. 42. | - (Pommern) a, 270. |
| Hohen=Demzin b, 43. | Eutin a, 95. 99 f. 107 ff. |
| Dersenow b, 134. | |
| Deven b, 74. 76. 159. | F ahrenholz b, 53. |
| Dewitz b, 113. 117. 121. | Faldera a, 91. 98. |
| Deyelsdorf a, 270. | Falkenhagen b, 74 ff. 139. |
| Diedrichshagen a, 142. 199 f. 207 ff. | Faulenrost b, 39. 139. 145. |
| 211.214. 218. b, 135. 154. | Federow b, 74 ff. 95. 139. 159. |
| Diekhof b, 144. | Feldberg b 109. 114 f. 118. 124. |
| Diemitz b, 143. | Finken b, 86. 95. 99 f. |
| Dierhagen b, 136. | Finkenthal b, 144. |
| Dobbertin b, 39. 57 f. 82. 88. 103. | Flemendorf a, 270. |
| 47. Archidiakonat : b, 150. 156 f. | Gr. Flotow b, 55. 95. 105. |
| 164. | Frauenmark a, 187f. b, 64 ff. 68. |
| Dobbin b, 33. 45. | 138. |
| Doberan a, 169. 176 f. 243. 263. | Freidorf a, 193. b, 90. 92. 104. 143. |
| 265 f. b, 82. 88. 101 . 131. Archi= | Friedland b, 1 10. 112. 1 14. 116. |
| diakonat : b, 149. 157. | Archidiakonat : b, 153 163. |
| Döbbersen a, 130 f. 145 ff. 212 f. | Friedrichshagen a, 142. 208. 218. |
| b, 133. | 220 f. b, 154. |
| Dodow b, 133. | Friedrichsruhe b, 138. |
| Dolgen b, 109. 114. 123. | Fürstenberg b, 109. 114. 123. |
| Dölitz b, 44. | Fürstenhagen b, 115. 117. |
| Dömitz a, 141. 202. 205. 219. b, | Fürstensee b, 109. 114. 121 f. |
| 134. 155. | |
| Domsühl a, 185. b, 62 f. 67 f. | G aarz (Buckow) a, 175 f. 194. 234. |
| Dorow a, 270. b, 39. | 238. 240. |
| Dranse b, 88. 101. 163. | Alt=Gaarz (Ture) b, 90. 92. 101. |
| Gr.=Dratow b, 74 f. 77. 95. 139. | 103. 143. 164. |
| 159. | Gaarz (Malchow) b, 139. |


|
Seite 168 |




|
| Gädebehn b, 54. | Gorschendorf b, 43. 152 f. |
| Gadebusch a, 113. 131. 133. 147. | Görslow b, 137. |
| 213. b, 134. | Gorlosen b, 97. |
| Gägelow b, 65 f. 157. | Grabow (Stadt) a, 202 f. 205. 219. |
| Galenbeck (Tüzen) b, 52. 145. | b, 97. 134. 155. |
| - (Stargard) b, 116. | - (Bützow) b, 137. |
| Gallentin a, 233. | - (Parchim) b, 138. |
| Gallin (Boizenbg.) a, 222. b, 134 f. | - (Röbel) b, 86. 99 f. |
| - (Plau) b 131. 133. 138. 141. | Grambow (Gadebusch) a, 134. 199 f. |
| Alten=Gamme a, 216. | 202. 205. 213 f. 216. b, 134. 154. |
| Neuen=Gamme a, 216. | - (Schwerin) b, 137. |
| Gammelin a, 130. 216. 220f. b, 134. | Gramelow b, 118. |
| Gämtow b, 138. | Gramkow a, 199. b, 130. 135. |
| Ganzkow (Gantzow) b, 113 115 121. | Grammertin b, 109. 114. 123. |
| Ganzlin b, 85. 94. 98. | Granzin (Boizenbg.) a, 138 f. 146 f. |
| Gardeskendorp a, 241. | 219. 222. b, 134. |
| Gardow b 123. | - (Parchim) b, 63. 67 f. |
| Garwitz a, 185. b, 62. 67 f. 83. 138. | - (Ture) b, 89. 102. |
| Geesthacht a, 119. 137. 146.202. 204. | Grebbin b, 64ff. 68. 138. |
| Gehren b, 112. | Gr.=Grenz a, 183. 264. b 136. 140. |
| Genzkow b, 112f. 116. | Gresse a, 138. 202. 204. 219 f. 221. |
| St. Georgsberg a, 113. 121ff. 126. | b 134. |
| 128. 147. 198. 201. 222. b, 148. | Gressow a, 143. 200. 208. 210f. |
| Gerdshagen b, 138. | b, 135. 154. |
| Gessin b, 145. | Greven (Boizenbg.) a, 222. b, 135. |
| Gevetzin b, 55. 145. | - (Parchim) b, 62ff. 67 f. |
| Gielow a, 182. b, 42 f. 53 145 162 | Grevesmühlen a, 143f. 146. 148. |
| Gr.=Gievitz b, 39. 74. 76. 139. 159. | 205. 207 f. 210. 213. b, 135. 154. |
| Kl.=Gievitz b, 139. | Grieschow b, 53. |
| Gischow b, 63. 67. | Grimmen a, 258 f. 269 f. b, 39. |
| Glambeck b, 109. 122. | Gristow a, 269 f. |
| Gleschendorf a, 100. 107. 110. | Grönau a, 122. 128. 198 f. 201. |
| Glewitz a, 191. 269 f. b, 39. | 204. 213. |
| Gliencke b, 112f. 117. 119 f. | Grubenhagen b, 40f. 144. |
| Gnewitz b 109. 114. | Grünow b, 109. 114 f. 121. 123. |
| Gnewsdorf b, 85. 94. 142. | Grüssow a, 186. b, 70 f. 73. 95. |
| Gniffau a, 100. 110. | 139. 159. |
| Gnoien b, 41. 44 f. 144. | Gudow a, 122 f. 126. 128 ff. 144. |
| Godehardsdorf s. Kessin. | 147. |
| Gr.=Godems b, 142. | Gülze b, 134. |
| Kl.=Godems b, 142. | Gülzow (Tüzen) b, 51. 52. 145. 162. |
| Godenswege b, 112f. 118. 122. | - (Sadelbande) a, 215. |
| Goderak s. Kessin. | Alt=Güstrow a, 248 f. 266. b, 39. |
| Göhren b, 117. | 136. 157. |
| Goldberg b 39. 57 ff. 138. 156. | Güstrow a, 183 f. b, 33 f. 37 f. 46. |
| Goldebee a, 172. 260f. 127. | Archidiakonat: b, 152. 162. |
| Goldenbow b, 133. | Gützkow (Pommern) a, 189 f. |
| Göldenitz b 131 f. 136. 140. | - (Tüzen) b, 145. |
| Goldenstädt a, 233. b, 137. | |
| Golm b, 117. | H agenow (Stadt) a, 130 f. 145 ff. |
| Goltz s. Goldberg. | 213. 256. b, 126. 133. |
| Görgelin b, 85 f. 94. 98. 142. | - (Malchow) b, 74. 109. 139. |


|
Seite 169 |




|
| Hanshagen a, 270. | Kamin s. Kamin. |
| Hanstorf a, 245 (="torf",nicht: | Kammin, Sprengel: b, 39. 55. 114. |
| ="hagen") 264. b, 158. | Archidiakonat: b, 151 f. |
| Hasselförde b, 114. | Kammin (Stargard) b, 113. 118. |
| Havelberg, Sprengel: b, 55. 78 ff. | 122. |
| 93ff. 114f. Archidiakonat: b, 153f. | Kammin s. Kammin. |
| 163 f. | Karbow (Lübz) b, 85. 94. 98. |
| Heiligenhagen a, 245. 265. b, 157 f. | - (Röbel) b, 142. |
| Heinrichshagen b, 144. | Karcheez b, 39. 57 ff. 156. |
| Gr.=Helle b, 55. | Karchow b, 86. 88. 99 f. |
| Kl.=Helle b, 54. | Karrenzin b, 142. |
| Helpt b, 112. 117. 121. | Kargow a, 191. b, 75. 139. 141. |
| Herrnburg a, 135ff. 203 f. 213. | Karlow a, 122. 127 ff. 144. 146f. |
| Herzberg a, 172. b, 67. 138. | 213. 215. |
| Herzfeld b, 85. 93. 96 f. 142. | Alt=Karin a, 244 f. 247. |
| Hildebrandshagen b, 114. | Karow a, 186. b, 39. 69. 159 f. |
| Hilgemur b, 136. | Karstädt b 134. |
| Himmelpfort b, 111. 123. | Käselow b, 136. |
| Hinrichshagen b, 112 f. 117. 121. | Kastorf b, 51 f. 145. |
| Kl.=Hinrichshagen b, 115. 118. 124. | Käterholz b, 137. |
| Högersdorf a, 91. 93. | Kavelstorf a, 247 ff. 256. b, 136. |
| Hohenkirchen a, 143. 199. 206. 208. | 158. |
| 210 f. b, 135. 154. | Kenz a, 270. |
| Holm b, 113. | Kessin a, 154. 158. 169. 178. 194. |
| Holzendorf (Schwerin) a,172. b, | 250 ff. 256. b, 156. |
| 61. 66 | Kieth b, 39. 70. 72. 77. 159. |
| - (Stargard) b, 117. | Kiewe b, 87. 100. |
| Hornstorf a, 172. 238. 262.b, 135 f. | Kirchdorf (Poel) a, 242. |
| 140 | - (Pommern) a, 259. 270. |
| Horst a, 269 f. b, 39. | Kirchiesar a, 234. |
| Hungersdorf b, 139. | Kittendorf b, 51 f. 145. |
| Klaber b, 45. 48. | |
| J abel (Jabel) a, 140f. 146. 148. | Kladow b, 61. 64f. 68. 137. |
| 202 f. 205. 222. b, 134. 155. | Kladrum b, 66. 68. 138. |
| - (Malchow) b, 70. 72. 139. 159. | Kleeth b, 54. 145. |
| Jatzke b, 113. 116. | Kleinow b, 134. |
| Kirch=Jesar a, 234. | Klink b, 72. 74. 159. |
| Jesendorf a, 172. 238. 260. | Klinken b, 66. 68. |
| Ihlenfeld b, 113. 115. | Klockow (Parchim) a, 131. 185. b, |
| Jördensdorf b, 39ff. 44. | 60. 81. 83 f. 94. 96. |
| Jürgenshagen b, 136 f. 140 | - (Penzlin) b, 143. |
| Jürgenstorf b, 51. 53. 145. | - (Stargard) b, 116. |
| Ivenack b, 50 ff.145. | - (Tüzen) b, 145. |
| Klocksin b, 144. | |
| K äbelich b, 113. 117. | Klopzow b, 143. |
| Alt=Kalen a, 180. b, 36. 39. 57. | Klüß b, 83. 97. |
| 144. Archidiakonat: b, 152. 162. | Klütz a, 123. 209 f. 212 f. b, 135. |
| Neu=Kalen b, 36. 42. | 154. |
| Kalkhorst a, 209 ff. 212. 221. b, 154. | Knorrendorf b, 145. |
| Kambs s. Cambs. | Kobrow b, 61. 64 ff. 68. 157. |
| - (Schwaan) a,183. 245. 265. | Kirch=Kogel b, 45. 47. |
| b, 157. | Kölpin b, 113. 117. 121. |


|
Seite 170 |




|
| Kölzow a, 183. 250 ff. 253 f. 256 f. | Lapitz b, 143. |
| b, 39. 158. | Lärz b, 88. 90. 103. 164. |
| Konow (Wehningen) s. Conow. | Lassahn a, 130. 199. 201. 204. 212 f. |
| - (Strelitz) b, 115. | 215. 220. b, 130. 133 f. |
| Körchow a, 130 ff. 144. 146 ff. | Lauenburg a, 213. 215. Archi= |
| b, 134. | diakonat: b, 149. 154. |
| Kosa (= Brohm) b, 121. | Läven b, 114. 124. |
| Kossebade b, 138. 141. | Lebrade a, 100. 107. 109 f. |
| Kossow b, 136. | |
| Kotelow b, 116. | Leezen (Holstein) a, 100. 107. |
| Kotendorf b, 137. | Lehsen b, 133. |
| Kraak a, 234. | Lehsten b, 131 f. 139. 141. |
| Kraase b, 75. 77. 95. 139. 141. | Leisten b, 138. |
| Krakow b, 33. 45 f. 49. | Leizen b, 86. 88. 95. 99. 153. 163. |
| Kratzeburg b, 82. 89. 91 f. | Lenschow b, 138. |
| Kreckow b, 117. | Leplow a, 191. 269 f. |
| Kreien b, 85. 94. 98. 142. | Leppin (Ture) b, 104. 143. 163 f. |
| Kremmin b, 142. | - (Stargard) b, 112 f. 117. |
| Kriesow b, 50. 145. | Leussow (Jabel) a, 202 f. 205. 213. 219. b, 155. |
| Kritzkow a, 248 f. 266. b, 136. 157. | - (Mirow) b, 102 f. 163 f. |
| Kröpelin a, 169. 176 f. 194. 263. | Levetzow a, 261. b 39. 44. |
| Archidiakonat: b, 149. 155. | Levin a, 170. 180. b, 35. 39. 41. |
| Kruckow b, 106. 143. | 44. 57. 144. 152. 162. |
| Krumesse a, 122. 128. 201. 204. 213. | Lexow a, 186. b, 70. 139. 141. 159 f. |
| Krummbeck b, 112. 118. 120. | |
| Krümmel b, 90. 103. 164. | Lichtenberg b, 115. 118. |
| Krummsee b, 51, 53. 145. | Lichtenhagen a, 243. 245 ff. b, 158. |
| Krusendorf b, 134. | Liepen (Penzlin) b, 91. 105 f. |
| Kublank b, 117. 119. | Liepen (Stargard) b, 112 f. 117. |
| Kuddewörde a, 119. 137. 146. 202. | Linau a, 122. 215. 220. |
| 204. | Lindow b, 116. 121. |
| Kuhlrade a, 131. 251. 256. 268. | Lohmen b, 39. 57 ff. 137 f. 156. |
| b, 158. | Loitz (Pommern) a, 190 f. 194. |
| Kummer b, 134 | - (Stargard) b, 118. 120. |
| Kuppentin b, 39. 62. 69. 72. 80. | Lübbersdorf b, 112 f. 116. 119. |
| 84. 94. 133. 138. 160. | Lübchin a, 180 f. 194. b, 34 ff. 39. |
| Kurslake a, 216. | Lübeck a, 88 ff. 93. 96. 99. 108 f. |
| Kussow b, 45. 49. | Lubimari villa a, 143. |
| Küssow b, 113. 117. 121. | Lübkow b, 143. |
| Lüblow b, 137. | |
| L aage a, 183. 247 ff. b, 39. 158. | Lübow a, 169. 171. ff. 194. 238. |
| Gr.=Laasch a, 202 f. 204 f. 219. | Lübsee (Gadebusch) a, 199. 201 f. |
| b, 134. 155. | 213. 216 f. 220 f. b, 154. |
| Laase a, 244. 266. b, 157. | - (Güstrow) b, 33. 45 f. 49. |
| Lambrechtshagen a, 243. 244 ff. | Lübtheen a, 203. |
| b, 126. 150. 157 f. | Lübz b, 69. 72. 85. 94. 138. 160. |
| Langhagen (Teterow) b, 144. | Gr.=Luckow (Malchin) b, 144. |
| - (Penzlin) b; 82. 91. 105. 163. | - (Penzlin) a, 191. b; 55. 91 f. |
| Langwitz b, 144. | 104 f. 143. |
| Lanken a, 131. 185. b, 60. 62. | Kl.=Luckow (Penzlin) b, 143. |
| 64 f. 66. 68. 138. 160. | Hohen=Luckow (Schwaan) a, 245. |
| Lansen b, 39. 74. 77. 159. | b, 136 f. 140. |


|
Seite 171 |




|
| Lüdershagen (Güstrow) b, 33. 45. | Mirow (Schwerin) a, 229. |
| 47 f. | - (Ture) b, 82. 88 ff. 101 f.123. |
| - (Pommern) a, 269 f. | 163. |
| Ludorf b, 86. 95. 99. | Mistorf b, 131 f. 136. 140. |
| Lupendorf b, 144. | Hohen=Mistörf b, 33. 40. 133. 145. |
| Luplow b, 39. 74. 76. 95. 159. | Möderitz a, 131. 185. b, 60. 62. |
| Lüssow a, 248f. 266. b, 39 136 157. | 64 ff. 138. |
| Lütau a, 119 f. 123. 137. 146 f. | Moisall a, 244. 265. b, 137. 157. |
| Lütgendorf b, 39. 70. 73. 139. 159. | Möllen b, 54. 129. |
| Lutheran b, 62. 68. 94. 138. | Möllenbeck (Brenz) b, 85. 96 f. 163. |
| Lütjenburg a, 99. 105. 109. | - (Stargard) b, 113. 118. 122. |
| Lüttenhagen b, 115. 118. 124. | Möllenhagen b, 95. 105. |
| Lüttenmark b, 134. | Mollenstorf b, 105. |
| Lützow s. Dreilützow. | Mölln a, 127 f. 201. 204. 213. |
| Lychen b, 110. 123. | Moltenow b, 134. 137. |
| Mönchshof b, 100. | |
| M alchin a, 181f. 194. b, 34 ff. | Mönkenberg b, 136. |
| 39. 42. | Gr.=Moordorf a, 269 f. |
| Alt=Malchow a, 184. 186. 194. b, 70. | Muchow b, 85. 93. 96. |
| 72 f. 77. 127. 139. 159 f. | Mühlengeez b, 137. |
| Malchow (Stadt) a, 186. b, 71f. | Kirch=Mulsow a, 175. 260 f. |
| - (Parchim) b, 95. 132. 142 f. | Mummendorf a, 142 f. 206. 210 f. |
| Maliante a, 143. | 213. |
| Malk a, 140. f. 146. 148. 202. | Müsselmow a, 172. b, 61. 63. 66 ff. |
| Mallin b, 55. 143. | Mustin a, 122 f. 126. 128. 130. 133. |
| Marienehe a, 245. | 145. 147. 213. |
| Marin b, 143. | |
| Gr.=Markow (Kalen) b, 144. | |
| Markow (Tüzen) b, 50. 145. | N akendorf a, 262 f. b, 156. |
| Marlow a, 131. 182 f. 194. 235. | Nätebow b, 86. 95. 99. |
| 250 ff. 253. 256. b, 158. | Naundorf a, 97. |
| Marnitz b, 84. 96. 142. | Neddemin b, 112 f. 114 f. |
| Marsow a, 213 b, 133. 135. | Neese b, 83. 97. |
| Martinsdorf b, 74. 76. | Neetzka b, 117. |
| Massow b, 86. 99. | Nehringen a, 270. b, 39. |
| Matzlow b, 95. 142. | Nemerow b, 109. 119. 123. 163. |
| Mechow b, 124. | Nepersmühlen b, 61. 67 f.138. |
| Mecklenburg a, 114. 150 f. 160. | Netzeband b, 101. |
| 171 ff. 238. b, 161. | Neubrandenburg a, 191 b, 110. |
| Medow b, 138. 141. | 112. 117. |
| Medrow a, 259. 270. b, 39. | Neuburg a, 173. 175 f. 194. 234. |
| Meezen b, 134. | 238. 240 b, 135 f. 140. 156. 161. |
| Meierstorf b, 142. | Neuenkamp a, 258. |
| Melz b, 87. 100. 163. | Neuenkirchen (Wittenburg) a, 130 ff. |
| Mestlin b, 64 f. 68. 138. | 144. 147. 199. 201. 213. 215. |
| Meteln a, 164. 228. b, 137. | b, 133 f. |
| Methling b, 44. | - (Pommern) a, 259. 269 f. b, 39. |
| Michaelisberg b, 79. 85. 98. | - (Stargard) b, 113. 115. |
| Mierendorf b, 136. | Neuhausen b, 97. |
| Mildenitz b, 117. | Neukirchen (Schwaan) a, 244 ff. |
| Minzow b, 88. | b, 136. 140. |
| Mirisdorf a, 208. | - (Holstein) a, 100 f. 107. 109. |


|
Seite 172 |




|
| Neukloster a, 172. 239f. 262f. b, 59. | Perlin a, 164 f. 228. b, 137. |
| Archidiakonat: b, 150 f. 156. | Petersdorf b, 117. |
| Neumünster a, 90. 98 ff. | Petschow a, 247 ff. 256. b, 158. |
| Neustadt a, 230. b, 137. 155. | Picher a, 202 f. 205. 213. 219. |
| Neverin b, 113. 115. 121. | b, 134. 158. |
| Niendorf (Boizbg.) b, 134. | Pieverstorf b, 143. |
| - (Hardt) b, 145. | Pinnow (Schwerin) a, 230 f. b, 137. |
| Gr.=Niendorf (Parchim) b, 138. 141. | - (Gädebehn) b, 55. 145 f. |
| Kl.=Niendorf (Parchim), 138. | Gr.=Plasten b, 95. 139. |
| Niepars a, 269 f. | Kl.=Plasten b, 139. |
| Nossentin a, 186. b, 70. 72. 74. | Plate (Schwerin) a, 165. 229. |
| 159. | |
| Nostorf b, 134 f. | b, 137. |
| Nüchel a, 110. | Plath, Plate (Stargard) b, 112 f. |
| Nusse a, 121 ff. 126. 128. 144. 147. | 117. |
| 215. | Plau a, 185. b, 69. 93. 159 f. |
| Archidiakonat: b, 151. 160. | |
| Plauerhagen b, 72. 138. | |
| O ldenburg a, 93 ff. 99. 103 f. 109. | Ploen a, 96. 99. 108 f. |
| Oldesloe a, 99. 108. 109. | Pokrent a, 133. 201. 204 f. 221. |
| Oettelin b, 136. | Polchow a, 181. 266. b, 35. 39. |
| 41 f. 152. 162. | |
| P aarsch b, 138. 141. | Poppentin a, 186. b, 70 ff. 73. 159. |
| Pampow a, 163. 165 f. 194. 227. | Porep b, 142 f. |
| b, 137. | Poserin b, 39. 69. 72. 138. 141. 160. |
| Gr.=Pankow b, 83. 96 f. | Powerstorf b, 61. 64 f. 68. 138. |
| Panschenhagen b, 74. 77. | Pragsdorf b, 113. 117. |
| Panstorf b, 43. | Preetz a, 99. 107. 109. |
| Pantlitz a, 269 f. | Prerow a, 270. |
| Papenhagen b, 40. 42. 129. | Prestin b, 66 f. 138. |
| Parchim a, 131. 184 f. 194. b, 60. | Pribbenow b, 51. 145. |
| 63. 67. 83. 93 f. 127. 138. Archi= | Priborn b, 143. |
| diakonat: b, 151. 162. | Wend.=Priborn b, 87 f. 95. 99. |
| Parkentin a, 176 f. 194. 243. 263 f. | Priebert b, 109. 114. 122. |
| b, 155. | |
| Parum (Wittenburg) a, 130 ff. 144. | Prillwitz b, 91. 105. 109. 111. |
| 146. 148. 216. b, 134. | 119. 121. 123. 163. |
| - (Bützow) a, 244 f. b, 39. 157. | Hohen=Pritz b, 62 f. 67. 138. 141. |
| Pasenow b, 117. | Pritzier a, 130ff. 145ff. 148. b, 133. |
| Passee a, 245. 247. 264. b, 157 f. | Prohn a, 190 f. 194. 258 f. 270. |
| Passentin b, 55. 145. | Pronstorf a 100. 107. 109. |
| Passin a, 266. b, 131 f. 137. 141. | Proseken a, 143 f. 146. 148. 205f. |
| Passow b, 62. 138. 160. | 208. 210 f. 213. b, 135. 154. |
| Pechau a, 97. | Puchow b, 143. |
| Peckatel (Penzlin) b, 91f. 104. 143. | Pütte a, 190. 269 f. |
| 163. | |
| - (Schwerin) b, 137. | Q uadenschönfeld b, 113. 118. |
| Peetsch b, 137. | Qualitz a, 244. 265. b, 137. 157. |
| Penzin (Brüel) a, 55. 191. 193. | Qualzow b, 102. 143. |
| 240. 261 f. b, 161. | Gr.=Quassow b, 109. 122. 143. |
| - (Bützow) b, 137. | Quastenberg b, 111. 119. |
| Penzlin b, 90. 92. 104. 143. 154. | Quetzin a, 184 ff. 194. b, 68 f. 72. |
| Perleberg, Archidiakonat: b, 164. | 127. 138. 160. |


|
Seite 173 |




|
| R abenhorst a, 178. 242. 263 f. | Rödlin b, 109. 111. 118. 121 f. |
| b, 155. | Roga b, 113. 115. 121. |
| Gr.=Raden b, 64 ff. 68. 157. | Gr.=Rogahn b, 137. |
| Raduhn b, 62f. 67 f. | Roggendorf a, 131. 133. 201. 204f. |
| Rambow b, 42. | 213. 221. |
| Rampeschendorf b, 136. | Roggenhagen b, 113. 115. |
| Rastow a, 233. b, 137. | Roggenstorf a, 206. 219ff. b, 154f. |
| Ratekau a, 99. 100. 105. 109. | Roggentin (Rechlin) b, 102. 142. |
| Rattey b, 116. | - (Schillersdorf) b, 143. |
| Ratzeburg a, 111 f. 115 f. 215. b 148. | Rollenhagen b, 109. 111. 121 f. |
| Archidiakonat: b, 148 ff. 155. | Roloffshagen a, 269 f. |
| Sprengelgrenze: a, 125. | Rom b, 138. |
| Rechlin b, 104. 142. 163 f. | Rosenow b, 52. 145. |
| Recknitz a, 248 f. b, 39. 136. 158. | Kirch=Rosin b, 34. 45. 49. |
| Redefin a, 203. 222. | Rossow (Lieze) b, 101. |
| Redentin a, 174. 241. b, 136. | - (Stargard) b, 113. 115. |
| Reez b, 136. | Rostock a, 169. 178 f. 194. 243. 250. |
| Rehberg b, 117. | 255 f. 263. Archid.: b, 150. 157f. |
| Rehna a, 133 f. 144 f. 147. 199. | Rövershagen a, 250 f. 267 f. b, 136. |
| 210. 213. b, 131. 147. Archid. | 158. |
| 210. 213. b, 134. 147. Archid.: | Rowa b, 113. 119. 121. |
| b, 148. 154. | Rubow a, 232. |
| Alt=Rehse b, 106. | Ruchow b, 57 ff. 156. |
| Reinberg a, 259. 270. | Ruest b, 138. 141. |
| Reinfeld a, 229. 233. | Rühlow b, 117. 119 f. |
| Reinkenhagen a, 269 f. | Rühn a, 244f. Archid.: b, 150. 157. |
| Reinshagen b, 33. 45. 47 f. 49. | Rumpshagen b, 91. 105. |
| Remplin b, 43. 145. | Runow b, 138. |
| Rensdorf b, 134. | Russow a, 175. 241. 260. |
| Rensefeld a, 110. | Ruthenbeck b, 138. 141. |
| Retgendorf a, 230 ff. b, 137. | Rüting s. Diedrichshagen. |
| Rethwisch a, 176. 178. 242. 264. | Rüting b, 134. |
| b, 155. | |
| Retschow a, 244 ff. b, 157. | S aal a, 269 f. |
| Retzow (Hardt) b, 43. 145. | Sabel b, 111. 119. |
| - (Plau) b, 85. 142. | Sadelbande, Archid.: b, 148. |
| - (Ture) b, 90. 143. | Sadelkow b, 113. 117. |
| Ribnitz a, 131. 183. 250 ff. 253. | Gr.=Salitz a, 131. 133 202. 204 f. |
| 255 f. b, 126. 136. 140. 158. | 221. |
| Richtenberg a, 258 f. 270. | Salow b, 112 f. 116. 121. |
| Gr.=Ridsenow a, 247 f. 266. b, 39. | Alt=Sammit b, 45 f. 49. |
| 158. | Sandesneben a, 122. 215. 220. |
| Rittermannshagen b, 39. 42. 74. | Sandhagen b, 116. |
| 76 f. 139. 159. | Sanitz a, 131. 250 ff. 253. 256. |
| Ritzerow b, 51. 53. | 267. b, 126. 136. 158. |
| Alt=Röbel b, 83. 86ff. 95. Archid.: | Sarau a, 99. 107. 109. |
| b, 151. 159 f. | Sarmstorf b, 136. |
| Neu=Röbel b, 86 f. 93. 95. Archid.: | Satow (Schwaan) a, 237. 245 f. |
| b, 153. 163 f. | 265. b, 126. 150. 157 f. |
| Röcknitz a, 180. 194. b, 34 f. 39. | - (Malchow) b, 70 ff. 77. 95. 139. |
| 44. 57. 152. 162. | 159. |
| Röckwitz b, 54. 145. | Schadegard a, 190. |


|
Seite 174 |




|
| Scharpzow b, 51. 52. 133. 145. | Serrahn b, 45. 47. 144. |
| Schillersdorf b, 89 f. 92. 101. 143. | Severin b, 138. 141. |
| 163 f. | Sewekow b, 101. |
| Schlagsdorf a, 122. 126. 128 f. 130. | Siebenbäumen a, 122. 215. 220. |
| 144. 147. 213. 222. | Siebeneichen a, 119 f. 137. 147. |
| Schlakendorf b, 44. | Sietow b, 71 f. 159. |
| Schlamersdorf a, 99.107 f. 109. | Siggelkow b, 84. 93. 96. |
| Schlemmin (Bützow) a, 265. b, 137. | Slate b, 63. 83 f. 93. 96. 142. |
| 140. | Smort b, 143. |
| - (Pommern) a, 270. | Sommerstorf b, 39. 74. 76 f. 159. |
| Schlicht b, 114 f. 118. 163. | Speck b, 82. 95. 104. |
| Schlieffenberg b, 45. | Sponholz b, 113. 117. 121. |
| Schlieven b, 138. | Spornitz b, 83 f. 93. 96. 142. |
| Schlön b, 74ff. 95. 139. 159. | Hohen=Sprenz a, 248f. 266 b 157. |
| Schmilau a, 122. 127. 201. 204. 213. | Stäbelow a, 264. b, 155. |
| Schönau b, 74 ff. 139. 141. | Stapel a, 202 f. 220. b, 155. |
| Schönbeck b, 112. 116. | Archid.: b, 149. 154. |
| Schönberg a, 135 f. 147. | Stargard b, 110f. 119. |
| Quaden=Schönfeld b, 113. 118. | Starkow a, 269 f. |
| Gr.=Schönfeld b, 109. 111. 122 f. | Starsow b, 103. 164. |
| Schönhausen b, 112. 114. 116. | Staven b, 113. 115. |
| Schorrentin a, 169. 180. b, 36. | Stavenhagen b, 50 ff. |
| 39. 41. 44. 144. | Steffenshagen a, 176. 178. 242 f. |
| Schorssow b, 33. 144 f. | 263. b, 155. |
| Schwaan a, 183. 194. 245. 265. | Steinbeck b 84 96 142. |
| b, 136. 140. 157. | Herren=Steinfeld b, 137. |
| Schwanbeck (Boitin) b, 135. | Steinhagen a, 270. |
| (Stargard) b, 112 f. 11 4 f. | Stepenitz b, 73. 80. 85 f. 97. 98. |
| Schwandt b, 55. | Sterley a, 122. 126. 128ff. 131. |
| Schwarz b, 88. 90. 103. 143. 164. | 144. 147. |
| Schwarzenbeck a, 215. | Sternberg b, 63. 67. 157. |
| Schwaßtorf b, 139. | Stolp (Kloster) b, 122. |
| Schweinrich b, 101. | Stolpe b, 96. 142 f. |
| Schwenzin a, 191. | Stoltenhagen a, 259. 269 f. |
| Schwerin a, 149ff. 155f. 157f. 159f. | Stralendorf (Schwerin) a, 165. 230. |
| 164. 166. 194. 227 f. Sprengel= | 233. |
| grenze: a, 159. 188. 223f. b, 39. | - (Parchim) b, 138. |
| 78ff. 93ff. Archid.: b, 149f. 166f. | Stralsund a, 257. 270. |
| Alt=Schwerin a, 186. b, 69 f. 73. | Strasen b, 109. 122. |
| 159f. | Strelitz b, 121f. Archid.?: b, 164. |
| Schwichtenberg b, 116. | Neu=Strelitz b, 122. |
| Gr.=Schwießow b, 136. | Stresendorf b, 142. |
| Schwinkendorf b, 39 f. 139. 144. | Strohkirchen (Jabel) b, 134. |
| Seedorf a, 122. 126. 128f. 131. | - (Gadebusch) b, 134. |
| 144. 147 f. 213. | Stück a, 164. 166. 194. 227. |
| Seelsdorf b, 138. | Stuer b, 70 ff. 74. 95. 159. |
| Segeberg a, 89 ff. 99f. 101ff. | Stüwendorf b, 95. 98. |
| 106. 109. | Suckow (Güstrow) a, 249. b, 135. |
| Selent a, 100. 107. 109f. | 140. |
| Selow b, 137. | - (Schwerin) b, 137. |
| Selmsdorf a, 135f. 203. 204. | - (Marnitz) b, 84. 97. 142. |
| Semlow a, 258. 270. | Sülstorf a, 163 f. 229 f. |


|
Seite 175 |




|
| Sülte a, 233. | V alluhn a, 198 f. 201. 204. b, 130. |
| Sülten (Brüel) a 238. 240. 261f. | 133. 135. |
| b, 160. | Varchentin b, 39. 74 ff. 95. 139. 159. |
| - (Tüzen) b, 145. | Gr.=Varchow b, 39. 74. 76. 95. 139. |
| Sülze a, 183. 251 f. 253 f. 256 f. | 159. |
| b, 39. 58. | Velgast a, 270. |
| Süsel a, 91 f. 95. 99 f. 105. 107. | Vellahn a, 130 ff. 144 f. 147. 256. |
| 109. | b, 126. 133. |
| Venzkow b, 61. 63 f. 67 f. 138. | |
| Tarnow (Bützow) a, 244 f. b, 137. | Viecheln a, 164. 169. 171f. 19l. 238. |
| 157. | Gr.=Vielen b, 105. |
| - (Gädebehn) b, 54. 145. | Kl.=Vielen b, 143. |
| Techentin b, 57. 59. 1 33. 138. 156. | Vielist b, 39. 74. 76. 159. |
| Tempzin a, 240. | Vietlübbe (Gadebusch) a, 133 f. |
| Teschendorf b, 113. 118. 120. | 144. 148. |
| Teschow b, 145. | Vietlübbe (Lübz) b, 85 f. 98. |
| Gr.=Tessin a, 244 f. 247. b, 156 f. | Vietow b, 136. |
| Tessin (Stadt) a, 250 ff. 253 ff. | Vietzen b, 90. 143. |
| 256 f. b, 39. 136. 158. | Vilz a, 252. b, 44. |
| Teterow b, 33. 36. 45 ff. | Vipperow b, 86 ff. 99. 143. |
| Teutenwinkel a, 251. 256. 267. | Voigdehagen a, 270. |
| b, 158. | Voigtsdorf b, 116. |
| Teutendorf s. Teutenwinkel. | Volkenshagen a, 250 ff. 255 f. b, |
| Thelkow b, 44. | 136. 158. |
| Thulendorf a, 251. 267. b, 158. | Vorbeck b, 61. 63. 67. |
| Thürkow b, 45. 48. 133. 144. | Vorland a, 259. 269 f. |
| Alt=Thymen b, 114. | |
| Toddin b, 133. 135. | W ackerow b, 145. |
| Torgelow b, 139. | Walkendorf a, 181. b, 42. 162. |
| Tornow b, 114. 123. | Walow b, 139. |
| Tramm b, 138. 141. | Wamkow a, 172. b, 61. 64 ff. 138. |
| Gr.=Trebbow (Schwerin) a, 165. | Hohen=Wangelin b, 39. 70. 72. 77. |
| 228. 233. | 159. |
| - (Strelitz) b, 109. 122. | Wanzka b, 110 f. 121. 124. 163. |
| Langen=Trechow a, 266. b, 131 f. | Warbende b, 110 f. 118. 163. |
| 137. 141. | Warder a, 99. 107. 109. |
| Treptow a, 190. 224. b, 50. | Waren a, 191. 193. b, 74 ff. 159. |
| Tressow b, 144. | Archid.: b 151. 158 ff. |
| Tribohm a, 190. 258 f. 269 f. | Wend.=Waren b, 138. |
| Tribsees a, 190 f. 194. 258 f. 269 f. | Wargentin b, 36. 39. |
| b, 39. Archid.: b, 150. 158. | Warin a, 171. 244 f. b, 137. 157. |
| Triepkendorf b, 109. 114. 121. 123f. | Warnkenhagen b, 45. 47 f. 144. |
| Trollenhagen b, 112 f. 114 f. | Warlin b, 112 f. 117. |
| Turow b, 109. 122. | Warlitz b, 134. |
| Tützpatz b, 54. | Warnemünde a, 247. 263. b, 158. |
| Tüzen b, 50. 52. 129. 145. | Warnow (Bützow) a, 244. 265. |
| b, 157. | |
| U elitz a, 229. 233. b, 130. 139 f. | - (Bresen) b, 135. |
| Gr.=Upahl b, 57 ff. 157. | Warrenzin b, 144. |
| Upost b, 144. | Warsow a, 164. 230. 234. b, 137. |
| Usadel b, 109. 111. 121. | Waschow b, 133. |
| Userin, Wuserin b, 109 122 f. 143. | Wasdow b, 41. 45. 144 f. |


|
Seite 176 |




|
| Wattmannshagen b, 33. 45. 47 f. | Wulfsahl b, 142. |
| Watzkendorf b, 118.121 f. 163. | Rostocker=Wulfshagen a, 251.256. |
| Wedendorf a, 199 f. 202. 204. 210. | 268. b, 158. |
| 214. 216. b, 130. 134 f. 154. | Kloster=Wulfshagen a, 131.183. |
| Weggun b, 115. | 250? 251. 268. b, 158. |
| Weisdin b, 112. 122. 163. | Wulkenzin a, 191. b, 55.106 ff. |
| Weisin (Plau) b, 62.69. 138. | 112. 163. |
| - (Strelitz) b, 109. | Wuserin s. Userin. |
| Weitendorf (Bresen) b, 135. | Gr.=Wusterwitz a, 96. |
| - (Cammin) a, 247.b, 136. 140. | Wustrow (Fischland) a, 250 f.268. |
| - (Kritzkow) a, 248.b, 136. 140. | b, 158. |
| -(Tüzen) b, 145. | - (Wesenberg) b, 102. 122. 164. |
| Weitin a, 191. b, 55. 106 ff. 112. | Wyk s. Wieck. |
| 163. | |
| Gr.=Welzin b, 137. | Z achow b, 111. 119. 163. |
| Werben a, 230. | Zahren b, 105. 138. 141. |
| Werle b, 83. 97. | Zahrensdorf a, 138 f. 146ff. 219. |
| Wesenberg b, 101 f. 164. | 222. b, 155. |
| Wessin b, 66 ff. | Zapel b, 66. 138. |
| Westenbrügge a, 175. 241. | Zarchlin b, 138. |
| Wieck, Wyk a, 269 f. b, 39. | Zarnekow b, 144. |
| Wiendorf b, 136. 140. | Zarrentin a, 130 ff. 145. 147. 198 f. |
| Wilsen b, 142. | 201. 213. b, 133. |
| Wippendorf a, 89. | Zaschendorf a, 230. 233. b, 137. |
| Wismar a, 207 f. 210. 213f. 217 f. | Zechlin b, 101. 163. |
| b, 148 f. 154. | Zehna b, 45. |
| Alt=Wismar a, 172 f. 238. 262. | Zepelin b, 137. |
| b, 136. 140. 161. | Zepkow b, 86 f. 99 f. 142 f. |
| Wittenborn b, 116. | Zernin a, 244. 265. b, 137. 157. |
| Wittenburg a, 113. 130 f. 145 ff. | Zettemin b, 53. 162. |
| 212. 213. 21(3. 256. b 126. 133. | Zickhusen b, 137. |
| Wittenförden a, 165. 228. b, 130f. | Zidderich b, 58 f. 157. |
| 137. 139 f. | Ziegendorf b, 142. |
| Wittenhagen b,115. 124. | Zielow b, 142. |
| Wittstock, Archid.?: b, 164. | Hohen=Zieritz b, 91. 105. 112. 121. |
| Witzin b, 63. 67.157. | 143. 163. |
| Wöbbelin b, 137. | Zierke b, 122. 163. |
| Woeten b, 138. | Zierzow (Gädebehn) b, 55. 106 f. |
| Woggersin b, 55 f. | 112. 163. |
| Gr.=Wokern b, 33. 45. 47. | - (Brenz) b, 83. 96. |
| Wokuhl b, 109.114. 123. | Zieslübbe a, 185. b, 62. 138. 141. |
| Wolde b, 54. | Ziethen a, 222. |
| Woldegk b, 110.112. 117. | Zingst a, 270. |
| Wolfsdorf a, 270. | Zinow, Zinnow b, 109. 122. |
| Wolgast a, 189. | Zirtow b, 102 f. 164. |
| Wolkow b, 144. | Zislow b, 139. |
| Woosten b, 57ff.138. 157. | Zittow a, 230f. b, 137. |
| Worth a, 215. | Zolkendorf b, 145. |
| Woserin b, 57ff.138. 156. | Zurow a, 172. 238. 260f. |
| Wrechen b 117.163. | Zweedorf a, 138 f. 202. 204. 219 ff. |
| Wredenhagen b,86. 99. 142 f. | b 134. |
| Wrodow b 55. | Zwiedorf b, 54. |
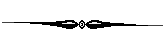


|
[ Seite 177 ] |




|



|



|
|
:
|
========== Die zweite ===========
mecklenburgische Hauptlandesteilung
1621.
Von Dr. Gustav Duncker, Marburg.
Einleitung.
V on den ersten Abschnitten der neueren Geschichte Mecklenburgs hat die Zeit des dreißigjährigen Krieges bei weitem die reichste Bearbeitung gefunden. Die Usurpation des Landes durch Wallenstein und die Vertreibung der Fürsten Adolf Friedrich I. und Hans Albrecht II. 1 ) haben immer wieder Anlaß zu neuer Bearbeitung dieser Zeit von andern Gesichtspunkten aus gegeben. Dagegen wurde die kurz davor liegende Periode strenge gemieden. Von der Reformation in Mecklenburg und der Zeit ihres großen Begründers, des Herzogs Johann Albrecht I., ging man unter Beschränkung auf eine möglichst gedrängte Darstellung sofort zu der bewegten Zeit des dreißigjährigen Krieges über.
Und doch wurden in dem nur wenig beachteten Zeitraum die wichtigsten Bedingungen für die folgende Periode geschaffen.
Ganz anders hätte sich die Geschichte Mecklenburgs gestaltet, 2 ) wenn das Testament Johann Albrechts I. in die Wirklichkeit um=
"Sollte nun solch vinculum unionis in diesem fürstentumb durch die totaldivision, wie hoch zu befahren, erst gelöset und hernach gänzlich ( ... )


|
Seite 178 |




|
gesetzt undese damit aucie Primogenitur zur Geltung gebracht worden wäre. Viel entschiedener wäre die Haltung der einheitlichen Regierung in den Wirren der nächsten Zeit gewesen, und die Folgen würden dem entsprochen haben nach der guten oder üblen Seite hin.
Die gemeinsame Herrschaft aber blieb, und da war es wieder von der allergrößten Bedeutung für die Zukunft des Landes, sowohl daß die fürstlichen Brüder in ihrem Streben nach Unabhängigkeit überhaupt zur Teilung des Landes schritten, als auch wie sie dieselbe vollzogen. Wäre es zu einer Totaldivision gekommen, so hätte Mecklenburg wohl für alle Zeiten aufgehört, ein einheitliches Land zu sein, und zur politischen Trennung wäre wahrscheinlich noch die konfessionelle getreten. Auch für das Verhältnis der Regierung zu den Ständen war diese Zeit von besonderer Wichtigkeit. Denn das Bestreben der Fürsten, von ihrer drückenden Schuldenlast befreit zu werden und die Teilung des Landes durchzuführen, schaffte den Ständen die Gelegenheit, eine Menge von Privilegien zu erringen, die der Regierung später oft recht beschwerlich geworden sind.
Es wurde also in dieser Zeit ein gut Teil der Zukunft Mecklenburgs entschieden.
Der Abschnitt, der die Jahre 1608 bis 1621 umfaßt, verdient es daher wohl, der Gegenstand einer besonderen Betrachtung zu sein.


|
Seite 179 |




|
Benutzte Akten und häufiger angeführte Literatur.
I.
Akten des Großherzoglichen Geheimen und Haupt=Archivs zu Schwerin:
Acta Divisionis Terrarum Mecklenburgensium: Vol. LXVIII, fasc. 1 bis Vol. LXIII, fasc. 21, zitiert: Act. div. mit Faszikel= und Teilnummer.
Pacta Domus: fasc. 10b, 11 und 12 - Nr. 64-90.
Domestica Principum Mecklenb. Varia: Herzog Adolf Friedrichs I. Tagebücher, Abt. A, zitiert: Tagebuch Adolf Friedrichs.
Correspondenz zwischen den Herzögen Adolf Friedrich I. und Hans Albrecht II. zu Mecklenburg wegen verschiedener Angelegenheiten.
Herzog Adolf Friedrichs I. eigenhändiger "Discours de present I'estat de Mechelbourg: des desordres en c'este estat et des remediemens".
II.
Boll, Ernst: Geschichte Mecklenburgs mit besonderer Berücksichtigung der Kulturgeschichte. Neubrandenburg 1855/56.
Breyer, Robert: Wallensteins Erhebung zum Herzog von Mecklenburg. Diss. Göttingen 1881.
Dehr, W.: Die Mecklenburgische Geschichte. Schwerin 1851.
Franck, David: Alt= und Neues Mecklenburg. Güstrow und Leipzig 1755: lib. XII.
Gerdes, Georg Gustav: Nützliche Sammlung. Wismar 1736.
Greverus, Dr. jur. Ernst: Zur Geschichte des mecklenburgischen Jagdrechtes. Dissertation. Rostock 1906.
Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde in Schwerin, zitiert: "Meckl. Jahrbuch" und Jahrgangsnummer.
Klüver, Hans Heinrich: Beschreibung des Herzogtums Mecklenburg, dritten Teils zweites Stück. Hamburg 1739.


|
Seite 180 |




|
Krabbe, Dr. btto: Aus dem kirchlichen und wissenschaftlichen Leben Rostocks. Berlin 1863.
Lützow, K. Ch. F. von: Versuch einer pragmatischen Geschichte von Mecklenburg: Dritter Teil. Berlin 1835.
Plagemann: Handbuch der mecklenburgischen Geschichte. 1809.
Raabe, Wilhelm: Mecklenburgische Vaterlandskunde, ed. Gustav Quade. Dritter Band. Wismar 1896.
Rosen, Gottlieb von: Hans Behr der Ältere und seine Söhne Daniel, Hugold und Samuel. Stralsund 1896.
Rudloff, Dr. Friedrich. August von: Neuere Geschichte von Mecklenburg, III. Teil, 2. Bd. Rostock u. Schwerin 1822.
Sachsse, H.: Mecklenburgische Urkunden und Daten, Rostock 1900.
Schirrmacher, Dr. Fr. W.: Johann Albrecht I., Herzog von Mecklenburg. Wismar 1885.
Schreiber, Heinrich: Herzog Adolf Friedrich I. und Johann Albrecht II. von Mecklenburg. Schwerin 1900.
Schulenburg, Otto: Die Vertreibung der mecklenburgischen Herzöge Adolf Friedrich und Johann Albrecht durch Wallenstein und ihre Restitution. Dissertation, Rostock 1892.
Schulze, Dr. Hermann Johann Friedrich: Das Recht der Erstgeburt in deutschen Fürstenhäusern und seine Bedeutung für die deutsche Staatsentwickelung. Leipzig 1851.
Spalding, Dr. J. H.: Mecklenburgische öffentliche Landesverhandlungen, aus öffentlichen Landtags= und Landes=Conventsprotokollen gezogen. 1. Band. Rostock 1792.
Wagner, Dr. Richard: Der Güstrowsche Erbfolgestreit. Meckl. Jahrbuch, Band 67 und 68.
Wöhler, Hellmuth: Münzwesen in Mecklenburg=Schwerin. Schwerin 1847.
Nach Fertigstellung dieser Arbeit ist als Heft X der Süsserott'sch en Sammlung "Mecklenburgische Geschichte in Einzeldarstellungen" erschienen: Schnell, Mecklenburg zur Zeit des dreißigjährigen Krieges 1603-1658. Das 1. Kapitel, auf das ich hier hinweisen möchte, gibt eine übersichtliche Darstellung der Landesteilungsverhandlungen und sei zur Orientierung bestens empfohlen; allerdings mußte der Verfasser nach der Anlage und dem Zweck des Süsserott'schen Werkes auf eine erschöpfende Ausnutzung der handschriftlichen Quellen, wie ich sie zu erreichen versucht habe, verzichten.


|
Seite 181 |




|
1.
Als im Jahre 1227 Fürst Heinrich Borwin I. von Mecklenburg starb, herrschte in seinem Lande hinsichtlich der Erbfolge das Prinzip der Gleichberechtigung der männlichen Deszendenten. Die dem Fürstentum im allgemeinen ursprünglich zugrunde liegende Amtsidee, die Berücksichtigung des Gesamtwohls war gänzlich verschwunden. Das Land galt als ein Patrimonium des Fürsten, das beliebig auseinandergeriffen werden konnte, die Untertanen als nutzbare Pertinenz des Landes. 3 ) Demgemäß teilten die vier Enkel Borwins, die ihrem Großvater in der Herrschaft folgten, nach erlangter Großjährigkeit 1229 und 1233 das Land in die Teile Mecklenburg, Parchim=Richenberg, Rostock und Güstrow=Werle. 4 ) Diese Zersplitterung dauerte bei wechselnder Teilung fort bis zum Jahre 1471, wo alle Landesteile wieder in die Hand Heinrichs des Dicken zusammenfielen. Aber schon im Jahre 1480 teilten dessen Söhne das Land abermals in die beiden Herrschaften Schwerin und Güstrow.
Die Folgen dieser andauernden Zerstückelung machten sich bald bemerkbar. Das Ansehen der Fürsten sank, die mehrfache Hofhaltung und die Streitigkeiten untereinander verschlangen große Summen 5 ) und brachten sie schließlich in eine drückende Abhängigkeit von ihren Rittern und Städten. Da erwachte endlich die Reaktion. 6 ) Der staatskluge Johann Albrecht I., der im Jahre 1547 die Regierung des güstrowschen Teils antrat, erkannte mit klarem Blick, daß die Herrschaft nur erstarken könne, wenn die Teilungen für immer aufhörten und die Regierung dauernd zur Staatseinheit zurückkehrte. Daher versuchte er, als sein Oheim Heinrich V. der Friedfertige im Jahre 1552 starb und das ganze Land wieder zusammenfiel, die Herrschaft ungeteilt in seiner


|
Seite 182 |




|
Hand zu behalten. Allein sein Bruder Ulrich erhob dagegen bei Kaiser Karl V. Protest und erlangte, daß Johann Albrecht gezwungen wurde, am 11. März 1555 in den Vertrag zu Wismar zu willigen. Darin erhielt Ulrich das Land Wenden mit der Hauptstadt Güstrow, während Johann Albrecht sich. mit der Herrschaft Schwerin begnügen mußte. Aber, was Johann Albrecht im Leben nicht erreichen konnte, das. suchte er durch letztwillige Bestimmungen zu erzwingen. In seinem Testamente, das er wenige Jahre vor seinem Tode errichtete, 7 ) bestimmte er u. a., es sollte sein ältester Sohn Herzog Johann VII. allein in der Landesregierung succedieren, der jüngste Sohn, Herzog Sigismund August, sich aber mit einer jährlichen Pension von 6000 Gulden und den Nutzungen der Ämter und Stadt Strelitz, Mirow und Jvenack ohne Einrede oder Ausflucht zufrieden geben. 8 ) "Sollte 9 ) sich auch. nach gottes schickung der fall dermaßen zutragen, daß unser freundlicher lieber bruder herzog Ulrich und seiner lieb gemahl oder auch unsere beide andere freundliche liebe brüder, herzog Christopher und herzog Karl, vor oder nach. unserm tod versturben und also alle die lande und herrschaften zu Meckelnburg auf unsere linien und stamm allein fielen: so wollen wir doch nicht, daß dieselbigen zwischen unsern beiden lieben söhnen geteilet, sondern unser ältester sohn, herzog Johannes, um obgehörter und anderer mehr bewegenden urfachen willen, fürnehmlich aber, damit dies fürstliche haus Meckelnburg wiederum desto mehr in zunehmen und aufsteigen gebracht werde, darin allein fuccedieren, herrschen, regieren und erben, aber mehr genanntem, unserm jüngsten sohn noch einmal soviel an ämtern und einkünften, auch jahrgeld aus der kammer . . . mit obberührter maaß und vorbehalt abtreten und einräumen soll, als ihme, herzog Sigismunden Augusten allbereit hierin vermacht und ausgesetzet ist. . . . Sollte aber unser ältester sohn . . . ohn männliche, eheliche geborne leibserben, versterben, so sollen alsdann alle unsere land und leute samt allen lehen und eigen . . . auf unsern jüngsten sohn, herzog Sigismunden Augusten, nach erbgangsrecht kommen und verstammet werden. Gleicher gestalt es dann auch herwieder mit unsers


|
Seite 183 |




|
ältisten sohns suecession in des jüngsten erbschaft, da der jüngste am ersten versturbe, soll gehalten werden.
Drei Jahre darauf starb Johann Albrecht I. am 12. Februar 1576 im kaum vollendeten 51. Lebensjahre. Nach dem Testament kam nun Sigismund August für die Erbfolge nur im Falle eines kinderlosen Ablebens seines ältesten Bruders in Betracht. Aber Ulrich, der Bruder Johann Albrechts I., der die Vormundschaft für die Prinzen übernahm, war 10 ) "an die gleiche brüderliche Successionsberechtigung des gemeinen Rechts gewöhnt". Er trug daher Bedenken, "die väterliche Bevorzugung der Erstgeburt zu vollziehen", und legte die Regentschaft erst nieder, als "auch der jüngere seiner Volljährigkeit ganz nahe war, um den Brüdern die Ausgleichung ihrer Ansprüche selbst zu überlassen."
Die Verständigung zwischen ihnen kam bald zustande. Am 20. Mai 1586 einigten sie sich in einem Vertrage zu Schwerin. 11 ) Das väterliche Testament wurde durchweg anerkannt, und Johann VII. übernahm die Landesregierung. Damit war das Testament in seinem ersten Teile glücklich durchgesetzt. Seine zweite Forderung aber, daß der güstrowsche Teil, falls die dort regierenden Herzoge ohne Erben sterben würden, an den Schweriner fallen und mit diesem vereint werden sollte, wurde beanstandet. Johann Albrecht I. hatte in seinem Testament nämlich nur seine Söhne erwähnt, in der festen Hoffnung, daß diese ihre Oheime überleben würden. Daß aber auch seine ferneren Nachkommen in den Sinn des Testaments mit einbegriffen waren, wird offenkundig durch die angehängte kaiserliche Bestätigung. Der Kaiser sagt darin, das Testament solle in allen seinen Punkten, Klauseln und Artikeln, "sonderlich 12 ) aber soviel die verordnete succession und erbsetzung . . . anlangt . . ., stet, fest und unverbrüchlich gehalten und vollzogen und weder von gedachts unsers lieben oheim und fürsten söhnen und erbnehmen, auch deren nachkommen noch sonst jemand andern . . . dawider etwas fürgenommen, gehandelt oder verstanden werden."
Aber im Testament selbst standen diese Worte nicht, und so war "für den betreffenden Passus die Auffassung möglich, daß dadurch nur die Ausführung des Testaments selbst sichergestellt, aber nicht dessen Geltung ausgedehnt werden sollte". 13 )


|
Seite 184 |




|
Und so kam es wirklich. Die Hoffnung, die Johann Albrecht I. gehegt haben mochte, erfüllte sich. nicht. Er selbst überlebte keinen seiner Brüder, 14 ) und auch sein Sohn Johann VII. starb frühzeitig an Wunden, die er sich in einem Anfall von Geistesstörung mit eigener Hand 15 ) beigebracht hatte, am 22. März 1592, lange vor seinen Oheimen Ulrich und Karl. "Drückende Schulden und daraus entspringende Quälereien verbitterten dem überdies charakterschwachen Herzoge das Leben so sehr, daß er schon 1590 Lust hatte, der Regierung zu entsagen.
Der unglückliche Fürst hinterließ drei unmündige Kinder, Adolf Friedrich I. und Hans Albrecht II., im Alter von vier und zwei Jahren, und eine Tochter Anna Sophie. Für die jungen Prinzen übernahmen ihr Großoheim, Herzog Ulrich, und ihr Oheim, Herzog Sigismund August, der jedoch am 5. September 1600 starb, die Regierung. 1603 schied auch. Herzog Ulrich 16 ) aus dem Leben, ohne Erben zu hinterlassen, und an seine Stelle trat der jüngste Bruder Johann Albrechts I., der schon im 63. Lebensjahre stehende Herzog Karl. 17 ) Auch. er hinterließ bei seinem Tode keine legitimen Erben, "da er 18 ) dem Stande einer ebenbürtigen Ehe eine zärtliche Verbindung mit Anna Deelen - vermutlich 19 ) seiner Haushälterin zu Mirow - vorziehend, nur natürliche Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter, erzeugt hatte, die dem von Herzog Heinrich dem Friedfertigen mit seinem natürlichen Sohne Balthasar gegebenen Beispiel zufolge den Namen "von Mecklenburg" 20 ) führten." 21 )
Die jungen Herzöge, Adolf Friedrich I. und Hans Albrecht II., die 1607 von größeren Reisen heimkehrten, wurden in den Jahren 1606 und 1608 auf Karls Betreiben vom Kaiser für mündig


|
Seite 185 |




|
erklärt und von ihrem Großoheiln ill die Regierungsgeschäfte eingeführt. 22 )
Nun, als Adolf Friedrich. großjährig geworden war, war für ihn die Zeit gekommen, das Testament seines Großvaters zu vollstrecken, denn die Vorbedingungen dazu waren alle erfüllt. Warum benutzte er die Gelegenheit nicht, verschaffte sich zunächst den schwerinschen Teil für sich allein, indem er Hans Albrecht mit einer Apanage abfand, und erhob schon jetzt für den Augenblick, da Karl starb, Ansprüche auf das ganze Land? Kannten die Herzöge das Testament etwa nicht, oder war es ihnen gar verheimlicht worden, und ließen Intrigen Adolf Friedrich. die klaren Tatsachen zugunsten seines Bruders nicht erkennen, oder fehlte es ihm an Mitteln und Macht, im Sinne des Testamentes Johann Albrechts I. zu handeln? Die Antwort auf diese Fragen ist natürlich nur in bezug auf Adolf Friedrich. wichtig. Mußte doch er allein das Testament vollstrecken: er sollte den alten Brauch, das Land beliebig zu teilen, umstoßen und dafür sorgen, daß das Land in einer Hand blieb. Dies war im Interesse des Landes und, weil er der Erstgeborene war, auch in seinem eigenen, aber nicht in dem Hans Albrechts. Dieser wäre, wenn er das Testament auch wirklich: eher. gekannt hat, doch nur auf dem einen Standpunkt geblieben, den er immer vertreten hat. Er hätte vermutlich trotzdem stets einen Teil des Landes beansprucht und von dem Testament wohl ain liebsten nichts verlauten lassen. Wann Herzog Adolf Friedrich. die erste Kenntnis von dem Testament seines Großvaters erhalten hat, ist durch Zufall aus einer Aufzeichnung 23 ) Samuel Behrs, 24 ) des geheimen Rates Adolf


|
Seite 186 |




|
Friedrichs, fast bis auf den Tag festzustellen gelungen. Die Aufzeichnung beginnt folgendermaßen:
"D. O. M. A.
(sein Wahlspruch.: Deo optimo, maximo, aeterno.)


|
Seite 187 |




|
Nach der brüderlichen vereinung zu Güstrow, daß das landt in 2 gleich theile solte getheilet werden, hatt mein herr erstlich seines großherrvater testament vom canceler uberkummen."
Aus dieser Aufzeichnung, die vom 24. Mai 1608 datiert ist, geht klar hervor, daß Adolf Friedrich in diesem Jahre "erstlich", d. i. zuerst, Kenntnis von dem Testament erhalten hat, und zwar muß es in der Zeit zwischen Abfassung des brüderlichen Vertrags 25 ) und dieser Aufzeichnung, also zwischen dem 28. April und dem 24. Mai 1608 gewesen sein. 26 )


|
Seite 188 |




|
Die Frage, warum ihm nicht eher Mitteilung von dem Testament gemacht wurde, beantwortet die weitere Aufzeichnung Samuel Behrs, - weil man sich "ex praecipitantia", also aus Übereilung und Unbedachtsamkeit nicht darum gekümmert hat. Dabei liegt aber der Gedanke nicht allzu ferne, daß der Vormund Herzog Karl bei seinen Großneffen dieselbe Methode wie früher Herzog Ulrich bei Vater und Onkel angewandt hat, daß er absichtlich mit der Testamentsenthüllung so lange wartete, bis auch der jüngere Bruder, Hans Albrecht II., großjährig geworden, selbst sein Interesse wahren konnte. Die weitere Frage, warum Adolf Friedrich, nachdem er wenige Tage nach dem ersten brüderlichen Vertrage das Testament Johann Albrechts I. kennen gelernt hatte, nicht jenen Vertrag umstieß und den letzten Willen seines Großvaters noch jetzt zur Geltung brachte, beantwortet Samuel Behr dahin, daß dem jungen Fürsten nicht das Original, sondern nur eine Abschrift des Testaments ohne die kaiserliche Konfirmation vorgelegen habe. Seine Aufzeichnungen lauten nämlich nach der oben angeführten Stelle folgendermaßen:
"quod huic contractui videtur contrarium ideoque sequentia notavi:
I. ob testamentum avi principis mei a caesarea maiestate confirmatum firmum sit, ita ut obliget nepotes in eo persev[er]are, etiamsi in privilegio horum nulla sit facta mentio expressa:
NB. Si in testamento avi nepotum non est facta mentio non tenebuntur stare eo testamento neque dum privilegium caesarium ulterius poterit extendi.
II. Ob nachmals kraft dieses testaments der getroffner brüderlicher contract müge und könne annulliert und umgestoßen werden, fürnemlich weil man ex praecipitantia der tractation zum inhalt des testaments nicht kommen künnen.
III. Confirmatio caesaria muß ad manus gebracht werden, ex eaque videre, si principi prosit aut non ut nepoti.
IV. Num consultum ut instrumentum formetur, daß man mit diesen tractaten aus ursachen übereilet were?"


|
Seite 189 |




|
Aus dieser Aufzeichnung Samuel Behrs geht hervor, daß Adolf Friedrich auf Grund des ihm vorliegenden Testaments der Meinung gewesen ist, dasselbe habe nur auf seinen Vater und seinen Onkel Bezug gehabt, nicht aber auch auf ihn und die ferneren Nachfolger. Wann Adolf Friedrich die kaiserliche Bestätigung zu Händen bekommen hat, steht nicht fest. Viel später wird es aber nicht gewesen sein, denn er spricht von ihr in einer Aufzeichnung vom 14. Juli 1611 27 ) unter Bezugnahme auf das Testament, daß man annehmen muß, er habe sie damals gekannt. Die Aufzeichnung lautet: Die Totaldivision "bekräftigt auch dieses Unsers großherrvaters testament, welches auch kaiser Maximilian confirmieret, denn hat mein herr vater macht gehabt, das ganze land einem zu geben, so hat er auch. ja macht gehabt zu teilen."
Die Verhältnisse hätten sich aber trotz alledem vielleicht anders gestaltet, wenn der jugendliche, damals noch nicht zwanzigjährige Fürst, der einer so schwierigen Aufgabe allein unmöglich schon gewachsen sein konnte, mit mehr und besseren Ratgebern umgeben gewesen wäre. Unter diesem Mangel hat er sehr zu leiden gehabt. Samuel Behr schreibt in einer Anmerkung zu dem oben angeführten IV. Punkte seiner Aufzeichnung:
"NB. Fuit dissuasum, adminicula principi in omnibus defuere neque cuiquam fidere aut haec communicare potuerunt,"
und Herzog Adolf Friedrich klagt später noch verschiedentlich, daß er "damalen eben mit beistand und räten so übel beraten gewesen". 28 ) Um so mehr war in dieser Zeit sein Ohr den Ratschlägen seines Großoheims und seiner Mutter geöffnet. Er selber bedauert in einem Schreiben vom 16. Oktober 1616, daß er sich seines ihm unzweifelhaft zustehenden Rechts "ungeachtet deren in wailand Hans Albrechten . . . testamentlicher disposition ausgeführten stattlichen motiven und ursachen, warum nur eine einzige regierung anzustellen, auf inständiges anhalten des wailand herzog Karl und seiner mutter, wie er mit beistand und räten nicht der notdurft nach versehen, begeben . . ." 29 )
Wie nun eigentlich die Herzogin - Mutter Sophie und Herzog Karl über das Testament gedacht haben, ob sie die Bestimmungen desselben, da die nächsten direkten Nachkommen Johann Albrechts I.


|
Seite 190 |




|
gestorben waren, als erfüllt und das Testament schon für erledigt gehalten haben, und ob sie mehr das Interesse ihres Großneffen und Sohnes Hans Albrechts II., oder aber auch des Landes selbst im Auge gehabt haben, läßt sich nicht mit Sicherheit klarstellen. Daß aber Hans Albrechts Interessen auf jeden Fall gewahrt wurden - ob absichtlich oder unabsichtlich, ist zweifelhaft -, das liegt auf der Hand. Vielleicht wollte Karl deswegen nichts von dem Testamente wissen, weil er nicht vergessen hatte, "wie ihn und insonderheit seinen Bruder Christopher die vormalige Ausschließung geschmerzet". 30 ) Soviel ist jedenfalls sicher, daß er Hans Albrecht lieber hatte als Adolf Friedrich und ihm, "seinem Lieblinge", 31 ) z. B. auch nach seiner Vermählung mit Karls Nichte jährlich einen Zuschuß von tausend Gulden 32 ) gab.
Hatte außerdem Herzog Ulrich die Erbfolgebestimmung Johann Albrechts I. bei Feststellung der Verhältnisse zwischen seinen Neffen Johann VII. und Sigismund August schon beanstandet, wieviel mehr mußte nun nicht Karl sie bei den Enkeln für nicht maßgeblich ansehen.
Sicherlich haben aber Herzog Karl und die Herzogin=Mutter, abgesehen vielleicht von den kleinen Intrigen, die sie anzuwenden nicht verschmähten, um ihre persönlichen Neigungen auszuführen, nur das geraten, was sie für das Wohl des Landes und seiner Fürsten für gut und notwendig hielten. Und in ihrer genauen Kenntnis von der trüben Lage im Lande wird auch der Hauptgrund zu suchen sein, warum sie sich. der Totaldivision widersetzt haben. Denn wirklich konnte für die Herzöge der eigene Regierungsantritt in einem so tief verschuldeten Lande, 33 ) wie der schwerinsche Anteil war, wenig Reiz haben, da ihre sämtlichen Rentereieinkünfte bis auf die geringe Summe von 6000 Gulden, also ebenso hoch wie die einstigen Apanagegelder Sigismund Augusts, mit dem jährlichen Kapitals= und Zinsenabtrag der ererbten Schuldenlast aufgingen. 34 ) Überdies 35 ) waren viele ihrer Schlösser und reichsten Ämter verpfändet, so daß bei dem gänzlichen


|
Seite 191 |




|
Mangel an passenden und genügenden Abfindungsgegenständen sowohl an Geld wie auch an Gütern die Entschädigung für Hans Albrecht mit den größten Schwierigkeiten verknüpft gewesen wäre. Dieser Mangel an genügenden Mitteln, der Johann Albrecht I. schon das Leben vergällt hatte, 36 ) der seinen Sohn Johann VII. schwermütig machte und in einen frühen Tod trieb, war vor allem die Ursache, welche auch Adolf Friedrich verbot, das Testament Johann Albrechts zu vollstrecken, denn die Unmöglichkeit einer entsprechenden Abfindung seines jüngeren Bruders war zu offensichtlich. So erklärt es sich, daß Adolf Friedrich bereitwillig seinem Bruder die Hälfte des Landes überließ und "auch ein mehreres zu erhaltung und fortpflanzung brüderlicher liebe und einigkeit, auch zu gedeih und aufnehmen seines uralten, fürstlichen hauses zu thun gemeinet gewesen". Die Einigung des Landes in einer Hand war somit nicht zustande gekommen. Aber die drückende Schuldenlast, die der Haupthinderungsgrund gewesen war, war damit auch nicht beseitigt. Vielmehr bildet der Streit um die Beschaffung der zu ihrer Tilgung erforderlichen Mittel den roten Faden, der die folgende Geschichte bis zum Jahre 1621 durchzieht.
Die Fürsten waren, um die Schuldenlast abzuwälzen, auf die Stände angewiesen, und diese benutzten nun die Notlage der Herzöge, um, soviel wie möglich, privilegien für sich zu erzwingen. 37 ) Die jungen Herzöge blieben, als auch der jüngere


|
Seite 192 |




|
auf Betreiben Karls schon am 28. Januar 1608 vom Kaiser für mündig erklärt und ihnen von Herzog Karl, der die Vormundschaft niederlegte, der schwerinsche Teil überlassen war, zunächst zusammen. Am 14. April entbot 38 ) der Oheim sie zu sich nach Doberan und zeigte ihnen dort, in welchem Zustand das Land war, das sie nun selbst regieren sollten. Er legte ihnen ans Herz, möglichst sparsam zu wirtschaften, damit die Schulden nicht vermehrt würden, empfahl ihnen, Rechnung von ihren Rentmeistern zu fordern 39 ) und die vom Vater und Großvater übernommene Schuldenlast genau aufzeichnen zu lassen. Hiernach sollten sie einen Landtag berufen. 40 ) Auch er hatte sich nämlich schon bei den Ständen bemüht, eine Erleichterung der Schulden für die Herzöge zu schaffen, aber die Stände hatten "solche Willfahrung verschoben, bis die Herren, die es gebrauchten, selbst regieren würden". Er riet aber zu großer Vorsicht, wenn sie die Bitte gewährt sehen wollten, denn die Stände wären schon durch. die andauernden Türkensteuern ziemlich geschwächt.. Von einer Huldigung, die die Herzöge wünschten, riet er ab, weil sie nur große Kosten verursachte, auch überall nicht nötig wäre, da die Stände den Fürsten schon in ihrer Minderjährigkeit gehuldigt hätten. 41 ) Hiervon jedoch ließen die Herzöge sich nicht abbringen. Seinem Dringen auf Sparsamkeit aber suchten sie nach besten Kräften nachzukommen und beschlossen, da ihre Einkünfte so niedrig waren, daß 42 ) sie auch. mit bestem Willen keine getrennte Hofhaltung einrichten konnten, vor der Hand wenigstens


|
Seite 193 |




|
in Gemeinschaft zu bleiben. Die Leitung der Regierung übernahm Adolf Friedrich als der Ältere.
Hans Albrecht, 43 ) somit durch Regierungsgeschäfte vorläufig noch nicht gebunden, benutzte diese Zeit, sich nach einer Gemahlin umzusehen. Er ließ sich wohl durch Herzog Karl und seine Mutter dazu bewegen, um die Hand seiner Tante, 44 ) der Herzogin Margarethe Elisabeth, der verwaisten, einzigen Tochter des Herzogs Christoph zu Mecklenburg und dessen zweiter Gemahlin Elisabeth, Tochter König Gustavs I. Wasa von Schweden, anzuhalten. Zwar war sie etwa 6 Jahre älter als er, aber die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen und vor allem finanzielle Gründe werden den Ausschlag für diesen Entschluß gegeben haben. Denn die reiche Mitgift der Prinzessin verschaffte Hans Albrecht nicht nur ein stattliches Vermögen, sondern befreite auch außerdem das Land von einer großen Last. Margarethe Elisabeth, die nach dem Tode ihres Vaters mit ihrer Mutter nach Schweden gegangen war, hatte nämlich eine große Forderung an Mecklenburg, und das Land wäre sehr in Verlegenheit gekommen, wenn sie sich mit einem auswärtigen Fürsten vermählt und der Bruder ihrer Mutter, ihr Vormund, der König Karl IX., ihr zu ihrer Forderung verholfen hätte.
Natürlich konnten die Herzöge nun nicht mehr wie bisher in einer engverbundenen Häuslichkeit leben. Daher rieten ihnen Herzog Karl und die Fürstin=Mutter, ihre bisherige Gemeinschaft 45 ) aufzugeben und alle Ämter des ganzen Landes in Anbetracht des hohen Alters Herzog Karls schon jetzt in zwei gleiche Teile zu zerlegen. Die Teilung selbst sollte erst nach Karls Tode durch das Los vollzogen werden. 46 )
Diesem Vorschlag zeigten sich die Fürsten geneigt und legten ihren Entschluß in dem brüderlichen Vertrag vom 28. April 1608 fest. Darin reservierte sich Adolf Friedrich jedoch das Recht der Erstgeburt und alle damit verknüpften im Lande üblichen Vorrechte, so wenig Vorteile sie ihm auch brachten. Das Testament Johann Albrechts I. wurde ihm, wie oben dargelegt, noch. immer vorenthalten. Karl gedachte wohl, durch Abmachungen Adolf Friedrich zuvor zu binden, vielleicht ihn auch erst einen kritischen Einblick in die unglücklichen Finanzverhältnisse des Landes tun


|
Seite 194 |




|
zu lassen. Er sah eben nicht den Nutzen, sondern nur den Schaden, der unter den augenblicklichen Verhältnissen aus der Testamentsvollstreckung entspringen konnte. Somit wurde er der Anlaß, daß sich Mecklenburg, anstatt die hohe Idee Johann Albrechts I., die Staatseinheit, zu verwirklichen, weit von ihr entfernte. Sein und der Herzogin=Mutter Rat bewirkte die Ämterteilung, der dann später die Teilung der Ritterschaft und Städte folgte.-
2.
Bevor sich die Herzöge der Ausführung dieses Werkes widmen konnten, wurden sie zunächst von einer anderen, wichtigeren Sache in Anspruch genommen.
Es galt für sie jetzt vor allem, Mittel zu beschaffen, um sich von der ererbten großen Schuldenlast zu befreien.
Daher beriefen sie auf Herzog Karls Rat zum 31. Mai 1608 einen außerordentlichen "Convokationstag" 47 ) nach Schwerin. Aber alle ihre rührenden Klagen 48 ) über ihre unverschuldete, traurige Lage fruchteten nichts. Die verstockten Gemüter der Landesvertreter ließen sich nicht einmal zu einer bestimmten Antwort bewegen, sondern die Stände ersuchten die Herzöge nur, den Schuldenstand genau verzeichnet zur Prüfung vorzulegen und die treulosen Verwalter zur Rechenschaft zu ziehen, in der Hauptsache aber verwiesen sie auf einen allgemeinen Landtag.
Damit Hans Albrecht die Möglichkeit erhielte, einen eigenen Haushalt zu führen, schlossen die Herzöge am 9. Juli einen Interimsvertrag zu Güstrow, wonach Hans Albrecht bis zum Ableben ihres Großoheims Karl, - dann sollte der Vergleich vom 28. April 1608 in Kraft treten - zu seinem Unterhalte die vorhin von Herzog Christoph innegehabten Ämter Gadebusch und Tempzin nebst einem Jahrgeld von 1600 Gulden, halb zu Antoni, halb zu Johannis zahlbar, erhalten sollte. 49 ) Alles andre, aus


|
Seite 195 |




|
genommen die Wittumsämter, sollte Adolf Friedrich behalten, dafür aber auch alle Lasten und Abgaben der Landesverwaltung begleichen, die väterlichen Schulden verzinsen und die Prinzessin=Schwester unterhalten. Am gleichen Tage wurde ein Verzeichnis aller Schulden aufgestellt, die die Höhe von 766 681 Gulden erreicht hatten. 50 )
Nach diesen mit seinem Bruder getroffenen Abmachungen reiste Hans Albrecht nach Stockholm und vermählte sich dort am 9. Oktober 1608. Von väterlicher Seite waren seiner Gemahlin 20 000 Taler 51 ) zugesichert, die ein Landtag vom November 1609 auch bewilligte. Außerdem hatte sie Anspruch auf die großen Rückstände des Brautschatzes ihrer Mutter. 52 ) Am 17. Januar 1609 wurden davon 20 000 Taler zu Hamburg deponiert und am 19. April desselben Jahres mit dem Vorbehalt der Rückzahlung an die Krone Schweden im Falle eines unbeerbten Ablebens der Herzogin an Adolf Friedrich gegen Verpfändung des Amtes Crivitz gegeben. Das übrige noch rückständige Geld konnte Hans Albeecht trotz wiederholter Bitten und Forderungen jetzt nicht erhalten. 53 )
Unterdessen war Adolf Friedrich aufs eifrigste darauf bedacht, aus eigener Kraft seine finanzielle Lage besser zu gestalten. Wegen des hohen Kurses der Reichstaler 54 ) beschloß er, die Hebungen von den Ämtern statt in Gulden in dieser Münze einfordern zu lassen. Herzog Karl, den er von seinem Vorhaben am 3. Februar 1610 in Kenntnis setzte, riet ihm aber von seinem Plane ab, weil die Zeiten ungeeignet wären und er dann keine Pächter finden würde. 55 ) Ferner trug Adolf Friedrich seinem Kanzler Hajo von Nessen auf, 56 ) ihm Vorschläge zu machen, wie der Aufwand der Hofhaltung
Der Gemahlin Chriftophs, geb. Prinzeß Elisabeth von Schweden, waren ihrer Zeit 100 000 Taler als Brautschatz versprochen. Davon waren nach und nach aber nur 72426 Taler bezahlt, mithin noch 27 574 Taler rückständig geblieben. Diese restierende Summe wurde mit den allmählich angesammelten Zinsen von Karl IX. am 2. Aug. 1605 zu 57 283 Talern anerkannt und mit 2871 1/2 Talern jährlich zu verzinsen versprochen. Außerdem brachten 12 000 Taler, die die Herzogin am 22. Juli 1590 ihrem Bruder zu 6 % Verzinsung geliehen hatte, ihr auch noch jährlich 720 Taler ein.


|
Seite 196 |




|
einzuschränken und jährlich wenigstens doch etwas zum Schuldenabtrag zu erübrigen sei. Aus dem Verzeichnis aber, das dieser nach Überlegung mit dem Rentmeister Adolf Friedrichs im Jahre 1609 vorlegte, ergab sich das niederschmetternde Resultat, daß zur Bestreitung der ganzen Hofhaltung, der Besoldung aller Beamten usw. jährlich 25144 Gulden nötig waren, während sich die Einkünfte aus allen Ämtern, aus Zöllen und Orbören nach Abtrag der Zinsen nur auf 14144 Gulden beliefen, so daß also jährlich ca. 11000 Gulden Schulden gemacht werden mußten. 57 ) Der Kanzler riet Adolf Friedrich daher, zusammen mit seinem Bruder und Großonkel von den Ständen eine Beihilfe zu fordern. Hiernach vereinbarten die Fürsten mit Herzog Karl, nachdem sie die Erbhuldigung überall im Lande persönlich entgegengenommen, die Berufung eines Landtages, der dann von letzterem 58 ) zum 1. November 1609 nach Wismar ausgeschrieben wurde. Er sollte sich mit der Beihilfe der Stände zum Abtrag der fürstlichen Schulden, mit Bewilligung der Fräuleinsteuer für Hans Albrechts Gemahlin als einer geborenen Herzogin zu Mecklenburg und mit einer eventuellen Kontribution für die erschöpfte Kasse der Kreisstände befassen. Bei dem ersten Punkt verzichtete Herzog Karl für seinen Teil zugunsten seiner Großneffen. Am 5. November gaben darauf die Stände ihre Resolution ab, allerdings nicht eher, als bis der Rentmeister der Fürsten, Andreas Meier, 59 ) dessen ungetreue Verwaltung die Stände vor allem als die Ursache der großen Verschuldung des fürstlichen Hauses ansahen, in Haft genommen war. 60 ) Aber auch jetzt war die Antwort nicht befriedigend. Zwar


|
Seite 197 |




|
bewilligten sie, obgleich sie es als gegen das Herkommen erachteten, für eines abgefundenen Prinzen (des verstorbenen Herzogs Christoph) Tochter auf Kosten des ganzen Landes eine Fräuleinsteuer aufzubringen, aus persönlichen Rücksichten, und weil das Geld im Lande blieb, diese in Höhe von 20000 Gulden, aber die beiden andern Forderungen wurden für noch unnötig gehalten. Sie empfahlen den Fürsten wiederum eine strengere Rechnungsaufnahme ihres Rentmeisters und machten alle weiteren Geldbewilligungen vor allem von einer genügenden Abhilfe ihrer Beschwerden abhängig.
In diesen, welche sie gemeine Gravamina 61 ) nannten, war zunächst der Wunsch geäußert, die Fürsten möchten in Gemeinschaft mit ihnen eine erneute Revision der Kirchenordnung vornehmen lassen. Dies Ansinnen lehnten jedoch die Fürsten ab, weil sie sich als die Rechtsnachfolger der Bischöfe ansahen und sich demnach nicht für verpflichtet hielten, in kirchlichen Dingen den Rat der Stände einzuholen. Sodann baten sie um Verbesserung der Gerichtsordnung und um mehr Ernst und Eifer bei Prozessen und andern Rechtshandlungen, und hieran reihten sich endlich noch Bitten um Aufhebung der neuen und erhöhten Zölle, um Abtretung des Landkastens 62 ) und um Einschränkung der Jagdbefugnis.
Darauf übergab die Ritterschaft für sich ihre noch unerledigten Beschwerden 63 ) und bat zunächst, daß ihnen das, was ihnen 1606 bewilligt wäre, in einen Revers gebracht, unterschrieben und besiegelt würde, "damit man doch in einigen Dingen Gewißheit habe." Vor allen Dingen baten sie um Revision der constitutiones feudales (des Lehnsrechtes), um Verhinderung von Durchzügen fremden Kriegsvolkes durch das Land und schließlich um Einführung von Aufwandsgesetzen (leges sumptuariae) und harten Strafen gegen die eingerissene Unsittlichkeit und Falschmünzerei.


|
Seite 198 |




|
Auch die Städte wandten sich mit einer Bittschrift an die Herzöge, worin sie wie die Ritterschaft darum baten, daß ihre 1607 erledigten Gravamina ihnen in einem Revers bestätigt werden möchten.
Herzog Karl benachrichtigte hierauf die Stände am 14. Mai, daß er ihnen am kommenden Deputationstage zu Wismar, am 11. Juni 1610, antworten lassen werde, und beauftragte seinen Kanzler Daniel Töllner, den Ständen die fürstlichen Resolutionen unter der Bedingung zu geben, daß sie nun die fürstlichen Schulden übernähmen. Zugleich wurde ihm in seiner Instruktion aufgetragen, mit den Ständen darüber zu verhandeln, wie sie sich zu einem Bündnis mit den Führern der gegen die katholische Liga gebildeten protestantischen Union, von denen die Herzöge zum Beitritt aufgefordert waren, stellen würden.
Am 14. Juni 1610 gaben die Stände eine Erklärung ab, in der sie für die Resolutionen der Fürsten und die Abstellung einiger Beschwerden dankten, zugleich aber baten, die noch übrig gebliebenen Punkte ihrer Gravamina zu erledigen. Würden alle berücksichtigt, dann wollten auch sie auf dem nächsten Landtage ihre Erklärung über die Forderungen der Fürsten abgeben. Jetzt sei es überall unmöglich, da die Sachen von solcher Wichtigkeit wären, daß außerhalb eines gemeinen Landtages und einer Beschlußfassung sämtlicher Stände deswegen nichts Bestimmtes abgemacht werden könnte. 64 )
Dieser Resolution fügten sie die Bitte um Zusammenfassung aller ihnen gegebenen fürstlichen Resolutionen in einem Assekurationsreverse hinzu.
Da der Deputationstag somit in der Hauptsache ohne Erfolg verlaufen war, berief Herzog Karl zum 25. Juni 1610 einen Landtag nach Sternberg, 65 ) der tags darauf eröffnet wurde. Adolf Friedrichs Kanzler, Hajo von Nessen, übergab die fürstliche Proposition, die sich von der früheren außer einer Forderung von 5000 Reichstalern 66 ) alsZulage zu der Fräuleinsteuer nicht unterschied. Er erklärte, die Herzöge wären bereit, der Landschaft soviel Vor=


|
Seite 199 |




|
rechte wie noch nie einzuräumen; daher möchten die Stände nun durch Verweigerung der gesuchten Hülfe nicht mehr zu erzwingen suchen, als die Fürsten ihnen überhaupt bewilligen könnten. Sodann gab er im Namen aller drei Fürsten eine Erklärung ab, in der den Beschwerden der Stände in der weitgehendsten Weise Rechnung getragen wurde.
Drei Tage berieten die Stände miteinander. Dann antworteten sie unter Betonung ihres eigenen Unvermögens hinsichtlich der Kontribution, daß sie 200000 Gulden aufbringen wollten, wenn die Herzöge sich verpflichteten, die verpfändeten Ämter einzulösen, die unerledigten Forderungen der Stände zu erfüllen und in einem Assekurationsrevers zu bestätigen und außerdem den Rentmeister zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen. 67 )
Die Fräuleinsteuer anlangend, erklärten sie sich bereit, außer den schon bewilligten 20000 Gulden den Fürsten die geforderten 5000 Taler zu geben, doch sollte diese Zugabe nicht als eine Erhöhung der Fräuleinsteuer, sondern als ein "liberrimum donum" angesehen werden. Hinsichtlich des dritten Punktes, der Union, widerrieten die Stände aus allen Kräften, besonders aus finanziellen Rücksichten; "die Conföderation wäre nur auf Zulage und Contribution (! ) gemeinet". Schon am folgenden Tage aber, dem 30. Juni, erklärten die Herzöge, daß die Regierung, wenn nicht mehr als 200 000 Gulden bewilligt würden, nicht bestehen könnte. Sie baten nochmals darum, daß wenigstens "5 Tonnen Goldes", also 500000 Gulden aufgebracht würden. Wenn sie diese bekämen, wollten sie bezüglich der Verfügung darüber und der übrigen daran geknüpften Bedingungen den Wünschen der Stände nachkommen. Die als Zulage zur Fräuleinsteuer bewilligten 5000 Reichstaler nahmen sie an. Hinsichtlich der Union versprachen sie, sich ohne Not und Vorwissen der Stände dem Bündnis nicht anzuschließen.
Jetzt fanden sich die Stände dazu bereit, der schon bewilligten Summe noch 100000 Gulden hinzuzulegen und also im ganzen nun 300000 Gulden aufzubringen.
Aber damit waren die Forderungen der Fürsten nicht erfüllt, und so ging auch dieser Landtag, ohne ein Einverständnis in den Hauptsachen erreicht zu haben, erfolglos auseinander. Es war zugleich der letzte, welchem Herzog Karl beiwohnte, denn schon am 22. Juli 1610 starb er, 70 Jahre alt, zu Güstrow. Damit fiel den jungen Herzögen auch die Herrschaft über den


|
Seite 200 |




|
güstrowschen Teil zu. Aber auch dies Gebiet war verschuldet, so daß es zurzeit nur neue Bürden brachte und die Sorgenlast vermehrte. Doch die Fürsten gaben die Hoffnung auf Besserung der Lage noch nicht auf und versuchten noch einmal, ihre Forderungen durchzusetzen. Zum 24. September 1610 wurde ein neuer Landtag nach Sternberg ausgeschrieben. Die Fürsten erklärten, 300000 Gulden wären zu gering, als daß ihnen dadurch von Grund aus geholfen werden könnte. Die Landesvertreter aber ließen sich nicht zu größeren Opfern bewegen. Das Einkommen aus den durch Karls Tod sehr vermehrten Kammergütern, eine eifrige Aufsicht über die Rentereibeamten und eine sparsame Wirtschaft würden auch ohne weitere Kontribution die Not beseitigen, war ihr Bescheid.
Als die Herzöge also keine Aussicht auf Erfüllung ihrer Forderungen sahen, machten sie den Ständen noch einen Vorschlag. Sie erklärten sich bereit, ihnen gewisse Ämter mit den darauf liegenden Schulden auf gewisse Zeit zu überlassen. Ritter= und Landschaft sollten dieselben während dieser Zeit bewirtschaften und sie ihnen dann, wenn die Zeit verflossen wäre, schuldenfrei zurückgeben.
Um dies reiflich zu erwägen, erbaten die Stände eine Bedenkzeit. Sie wurde gewährt. Zugleich ließen die Herzöge ihnen, um sie sich und ihren Forderungen geneigter zu machen, einen Entwurf des Assekurationsreverses hinsichtlich der oben erwähnten Punkte vorlegen.
Vier Wochen nach diesem Landtag zu Sternberg wurde dann am 30. Oktober 1610 zu Güstrow ein neuer abgehalten. Die Stände bedankten sich hier zunächst für den erhaltenen Assekurationsrevers, berieten aber hauptsächlich nur, in welchen Punkten sie noch Ergänzungen in dem erhaltenen Revers erreichen könnten. Mit einer Bitte um die andere suchten sie ihre Rechte den bedrängten Fürsten gegenüber zu verstärken. Der Adel forderte als ein freier Stand, der aller , Kontributionen" überhoben wäre, daß ein dreißig Jahre im Besitz gewesenes Lehngut keiner Revokation unterworfen sein sollte. Die Städte begehrten, daß ihnen der "Abschuß" von den fortziehenden Einwohnern und das Recht, Zünfte zu errichten, bewilligt und eine "reine" Erklärung gegeben würde, daß die Ausfuhr des Getreides zur See, wie auch das Mälzen (Malzbereiten) und Brauen zum Verkauf ihnen allein gehörte, u. a. m. Vielleicht wären zu der angebotenen Summe von 300000 Gulden noch 50000 hinzugelegt worden, wozu sich einige von der Ritterschaft anfangs bereit


|
Seite 201 |




|
erklärten, 68 ) dann aber hätten die Fürsten noch auf bedeutend mehr Forderungen der Stände eingehen müssen, wobei sie auf jeden Fall den kürzeren gezogen hätten. So hartnäckig sich die Stände in dem Streben nach Sicherstellung und Erweiterung ihrer Vorrechte zeigten, so zäh widerstanden sie allen Bitten und Forderungen der Fürsten um Gewährung der für die Schuldentilgung unbedingt erforderlichen Summe von 500000 Gulden und ließen es bei dem schon zu Sternberg gemachten Angebot von 300000 Gulden bewenden. Auf Übernahme ganzer Ämter und der darauf ruhenden Schuldenlast gingen sie nicht ein.
Um wenigstens der äußersten Not abzuhelfen, nahmen die Fürsten endlich das Anerbieten der Stände an und bestimmten zugleich, auf welche Ämter die einzelnen Summen bezahlt werden sollten. Auch wegen des modus contribuendi, besonders einer stärkeren Heranziehung der niederen Bevölkerungsklassen zur Besteuerung, ließen die Fürsten ihnen freie Hand. Alle diese Maßregeln aber waren noch zu früh getroffen, denn als man die Auszahlung des Geldes erwartete, ließen die Stände erkennen, 69 ) daß sie überhaupt nicht eher etwas zu geben gedächten, bis ihre Beschwerden völlig erledigt wären. Der ihnen vorgelegte Revers wäre nicht bestimmt genug abgefaßt und ihren Gravamina nicht so, wie sie erwartet hätten, abgeholfen worden. Schließlich reisten sie einfach, wie es bei ihnen üblich war, vor dem Schluß des Landtages ab, und die wenigen Zurückgebliebenen konnten und wollten dann natürlich nichts Bindendes beschließen. Dieser Gang der Verhandlungen und die andauernde Halsstarrigkeit der Stände mußte den Fürsten auf die Zeit natürlich im höchsten Grade unerträglich werden.
Da griffen sie zu dem letzten Mittel, die Stände gefügiger zu machen, zu der Teilung des ganzen Landes, der sogenannten Totaldivision. War es die Furcht, daß Herzog Hans Albrecht den Kalvinismus in seinem Landesteil eiuführen würde, oder die Angst, dann, wo sie geteilt und damit die in ihrer zusammenhaltenden Menge beruhende Macht stark verringert wäre, den Forderungen der Fürsten weniger leicht widerstehen zu können - jedenfalls wurden sie aufs äußerste erregt, als sie diesen Plan der Fürsten erfuhren.
Um hierzu Stellung zu nehmen, hielten sie am 16. Januar 1612 zu Güstrow, wohin sie als Zeugen zu der am 2. Februar


|
Seite 202 |




|
stattfindenden Taufe von Hans Albrechts erstem Sohn Johann Christoph geladenwaren, eine Versammlung ab. Das Resultat dieser Beratung übergaben sie in einer Schrift dem Kanzler zu Güstrow. Sie behaupteten darin, eine gänzliche Teilung Mecklenburgs und seiner Bewohner wäre wider das Herkommen und der Wohlfahrt des Landes schädlich. Nur unter der Bedingung, von einer ihnen so gefährlich erscheinenden Neuerung verschont zu bleiben, und bei Ausstellung eines klaren Reverses machten sie Hoffnung, auf dem nächsten Landtage anstatt der nun schon zweimal bewilligten 300 000 Gulden für jeden Herzog 100000 Taler innerhalb dreier Jahre aufzubringen. Da ein Gulden zu 24 Schilling, 70 ) ein Taler damals aber zu 37 Schilling gerechnet wurde, so betrug letzteres Angebot 7 400 000 Schilling gegenüber 7 200 000 Schilling des ersteren, mithin 200 000 Schilling = 8333 Gulden = 5405 Taler mehr. Diese relativ ganz geringe Zulage erfüllte aber keineswegs die Forderung der Fürsten. Vielmehr wurde Adolf Friedrich durch die neue Widersetzlichkeit aufs äußerste empört. Er erklärte die Zusammenkunft, die ohne das Vorwissen der Landesherren abgehalten wäre, für gesetzwidrig und die Schrift für beleidigend; dem Adel ließ er gleichzeitig durch die Landmarschälle verbieten, sich in Dinge zu mischen, "die ihn nicht angingen". Sie sollten vielmehr den gebührenden Respekt wahren, "weil er widrigenfalls es an den nötigen Gegenmaßregeln nicht fehlen lassen werde". 71 )
Eine solche Sprache ihres Landesherrn hatten die Stände



|
Seite 203 |




|
bisher noch nicht gehört. 72 ) Durch diese scharfe Zurückweisung wurde das Band gelöst, das sie mit den Fürsten vereinigte, und bewirkt, daß nun acht Jahre hindurch kein Landtag ab gehalten wurde.
Nach dem Sinne Hans Albrechts war dies schroffe Vorgehen keineswegs. 73 ) Er hätte viel lieber gesehen, die angebotene Summe wäre angenommen und den Forderungen der Stände nachgegeben worden. Da der Assekurationsrevers doch schon herausgegeben wäre, meinte er, den Ständen auch noch in einigen weiteren Punkten nachgeben zu können, um endlich die zur Schuldentilgung unbedingt erforderlichen Summen in die Hand zu bekommen. Adolf Friedrich aber hörte auf solche Vorstellungen nicht. Sein Ehrgefühl war zu tief verletzt, als daß er seines Bruders Wünschen hierin hätte folgen und sich den Ständen noch weiter hätte fügen können. Dazu wären auch zu viele Landtage mit großen Kosten zwecklos abgehalten und ihre Reden von den Ständen zu sehr "cujoniert". 74 ) Nach endlicher Bewilligung der Hilfe würden sie doch nur darauf bedacht sein, immer mehr Rechte der Krone an sich zu reißen. Lieber aber, als sich weiter zu demütigen, wollte er zusehen, mit seinen Schulden allein fertig zu werden. Auch Hans Albrecht müßte bei reiflicher Überlegung so handeln. Hinzuzufügen vergaß er hierbei wohlweislich nicht, daß die Verhältnisse sich allerdings anders gestalten würden, wenn sie die Totaldivision in die Wege leiteten. Dann wäre Hans Albrecht frei und könnte die Hälfte der bewilligten Summe ohne Rücksicht auf ihn gegen die Ausstellung des Assekurationsreverses von seinem Landesteil entgegennehmen.
Aber an diese Totaldivision war fürs erste noch nicht zu denken, hatte man doch jetzt noch nicht einmal die viel unbedeutendere Ämterteilung, die schon 1608 beschlossen und 1611 endlich begonnen war, gänzlich durchgeführt, viel weniger noch alle dabei entstandenen Schwierigkeiten beseitigt. - Um die fernere Entwicklung des Kampfes der Fürsten mit den Ständen weiter verfolgen und richtig erkennen zu können und lästige Wiederholungen zu vermeiden, ist es notwendig, unser Augenmerk zunächst dieser inzwischen vorgenommenen Ämterteilung zuzuwenden.


|
Seite 204 |




|
3.
Wir erinnern uns, wie die Herzöge unter dem Einfluß Herzog Karls und ihrer Mutter in dem brüderlichen Vertrag vom 28. April 1608 beschlossen, alle Ämter des Landes in zwei gleiche Teile zu zerlegen. Obwohl dieser denkwürdige Beschluß schon 1608 gefaßt war, so ging doch bis zum Beginn der vorbereitenden Taxierungen noch über ein Jahr unbenutzt hin, denn Herzog Karl hielt es für nötig, daß zuvor die Erbhuldigungen beendet würden. Schließlich aber brachte Adolf Friedrich die Angelegenheit in Fluß. 75 ) Auf seine Bitte ließ Karl von seinem Rat, dem späteren Kanzler Hans Albrechts, Dr. Ernst Cothmann, die "Instruktion für die zu der Exaequation der Ämter deputierten Räte" anfertigen. Am 22. Februar 1610 wurde dieselbe nach längeren Verhandlungen glücklich fertiggestellt. Darin wurde den Räten, die mit der Taxierung der Ämter betraut wurden, 76 ) aufgetragen, die jährlichen Intraden und Einkünfte der Güter genau aufzuzeichnen, auch die Gebäude abzuschätzen und dabei auf deren Zustand zu achten und in Erwägung zu ziehen, ob größere Reparaturen notwendig wären, oder ob sie durch Errichtung von neuen Gebäuden und anderen Verbesserungen zu höherer Leistungsfähigkeit gebracht werden könnten. 77 ) Sie sollten auch beachten, wieviel Pacht die Bauern bezahlten, 78 ) ob sie dieselbe gut aufbringen könnten, und ferner, wieviel Jägereien und Wälder und damit verbundene Mastungen bei den Gütern wären.



|
Seite 205 |




|
So sollten sie den ganzen Besitz auf den Ämtern und die Höhe der Einnahmen daraus veranschlagen und sodann von einem jeden Amt die Summe angeben, die es wert wäre. Hiernach verlangte die Instruktion, daß die verschiedenen Ämter "gegen einander gesetzt" und in zwei möglichst gleiche Teile gebracht würden. Soweit es möglich wäre, sollten hierbei Auswechselungen vorgenommen werden, indem Dörfer, die von ihren Ämtern weit entfernt lagen oder gar verschiedenen Ämtern Abgaben zahlen mußten, mit anderen, besser gelegenen vertauscht würden. Um ein einigermaßen sicheres Urteil über das Einkommen der Ämter zu gewinnen, wurden die Einkommenregister der Jahre 1581 bis 1583 mit denen von 1607 bis 1609 verglichen und aus diesen ein Durchschnitt zusammengestellt. Diese "Extrakte" aus den einzelnen Amtsregistern verfertigten die Amtleute, doch stellte sich später wiederholt heraus, daß sie manches überschlagen und im allgemeinen viel niedrigere Summen angegeben hatten, als die Deputierten bei "Beziehung" der einzelnen Ämter 79 ) und vorgenommener genauer Schätzung feststellen konnten. 80 ) Es war auf keinen Fall eine leichte Aufgabe für die Deputierten, alles genau zu beachten und in Anschlag zu bringen, und nur in geraumer Zeit ließ sich das schwierige Werk vollbringen. 81 ) Auch konnten sich die Deputierten selbst nicht andauernd mit der Sache beschäftigen. Denn da sie von dem Ertrage ihrer Güter lebten, - auf große Dotationen von den Fürsten konnten sie nicht rechnen - 82 ) waren sie natürlich darauf bedacht, während der Zeit der Saat, der Ernte und des Umschlags (d. i. des Termins) zu Hause und für sich tätig zu sein.
Hierdurch wurde das Werk wiederholt unangenehm unterbrochen, aber ganz abgesehen davon, traten auch sonst noch genug


|
Seite 206 |




|
Schwierigkeiten ein, die dazu beitrugen, die Teilung zu verzögern. Oft waren z. B. die Register nicht zu finden, oder sie erwiesen sich als sehr unrichtig und unbrauchbar. Viel hemmender aber waren für die Sache noch die verschiedenen Maße, die im Lande gebraucht wurden. Zur Regelung dieser Schwierigkeit mußten die Amtleute einen "Amtsscheffel mit aufgebranntem Amtsvermerk" einschicken. 83 ) Viel Sorgfalt erforderte es natürlich, daß hierbei keine Versehen unterschlüpften, 84 ) und wenn auch bald zwei Notare, Mathias Eberdes und Stephan Schilling, bestellt wurden, jeden Extrakt aus den Registern zu beglaubigen, so hatte dies wiederum weitere Verzögerung zur Folge 85 ). Die Verantwortlichkeit und die Größe des Werkes und besonders mancherlei Fehler in den Schätzungen erforderten sorgfältige, zeitraubende Arbeit.
Ein Verlust für die Fürsten war es, als Herzog Karl, der mit regem Interesse 86 ) ihr Vorhaben gefördert und manche Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen glücklich beigelegt hatte, nach kurzer Krankheit starb. Jetzt hielten die Stände des Landes die Zeit für gekommen, ihren Einfluß geltend zu machen. Am 19. Juli 1610 wandten sich die Landräte mit einem Bedenken an die Herzöge, 87 ) in dem sie rieten, es bei der Teilung, wie sie unter Johann Albrecht I. und Ulrich gewesen, verbleiben zu lassen, denn die neue Teilung würde nur viel Geld und Zeit erfordern. Zur Vermeidung schweren Streites baten sie, wenigstens auf keinen Fall die Regierung eher zu ergreifen, als bis die Teilung gänzlich vollzogen wäre. Diese Ratschläge der Landräte hatten zur Folge, daß die Herzöge die Verhältnisse abermals eingehend erwogen und sich in einem neuen Vertrage einigten.


|
Seite 207 |




|
Dieser Interimsvertrag vom 24. Juli 1610, 88 ) so genannt, weil seine Bestimmungen nur auf die Zeit bis zum völligen Ausgleiche der beiden Landesteile Schwerin und Güstrow gerichtet waren, forderte möglichste Beseitigung aller Ungleichheiten, 89 ) gerechte Verteilung der bis jetzt von Adolf Friedrich allein getragenen Schulden und Übernahme auch der Obligationen Karls zu gleichen und teilen. Die 1000 Gulden betragende jährliche Rente des verstorbenen Herzogs an Hans Albrecht sollte diesem zu Antoni zum letztenmal zur Hälfte ausgezahlt werden. Zugleich einigte man sich, die Beamten des güstrowschen Teils fürs erste in ihren Ämtern zu belassen und bis zur Vollendung der Erbteilung alle Ämter gemeinsam zu verwalten. Bis dahin behielt Adolf Friedrich für seinen Unterhalt Strelitz und Stavenhagen und Hans Albrecht Gadebusch, Tempzin und Neukloster, jedoch mit dem Vorbehalt eines näheren Ausgleichs ihres verschiedenen Ertrages. Alle übrigen schwerinschen Ämter wurden gegen Vergütung der Verbesserungskosten zur allgemeinen Teilung zurückgegeben.
Am 8. August erneuerten die Herzöge die Instruktion für die Deputierten. Die Berechnung der Ämter sollte allein auf die Kollationierung der Amtsregister der Jahre 1606 bis 1609 beschränkt werden. Auch sollte eine Verhinderung 90 ) des einen oder andern Deputierten das Werk in keiner Weise aufhalten. Dieser Instruktion gemäß wurden wiederum einige Ämter abgeschätzt, doch schon am 3. September 1610 fand abermals eine Änderung statt. Es sollten nunmehr auch die Leibgedinge und "Holzungen" 91 ) der Schätzung unterworfen und die Einkünfte der Flußschiffahrt, die bisher gemeinsam gewesen, den Einnahmen der betreffenden Ämter zugerechnet werden. Ferner wurden die Deputierten angewiesen, die beisammen gelegenen Ämter, Dörfer und kleinen Städte, wenn möglich, nicht voneinander zu trennen. 92 )
Anfang April 1611 war die Abschätzung der Ämter, der erste Teil des Werkes, glücklich vollendet. Am 13. statteten die Deputierten den Herzögen in einer Relation Bericht über ihre Tätigkeit ab. In dem Register, das sie nach langer mühseliger


|
Seite 208 |




|
Arbeit aus den Extrakten aufstellen konnten, waren vor allem die Beträge von den "stehenden und schwankenden Geldhebungen" und der zu Geld berechneten Abgaben von Korn verzeichnet. Aber auch die Erträge der "Mühlenpächte" 93 ) und Heuernten und Aufzucht von Schweinen und Schafen, 94 ) sowie der Butter= und Käsebereitung waren abgeschätzt, nachdem in ihrer Berechnung Gleichheit geschaffen war. Ebenso fanden Wiesen, Gärten (Küchen=, auch Hasen= und Fuchsgärten), Fischereien und Holzungen gebührende Berücksichtigung. Auch die Deputatdienste, die den Ämtern geleistet werden mußten, wurden der einfacheren Rechnung halber und um möglichst Zeit zu gewinnen, in Geld umgerechnet und "also 95 ) die mannspersonen, jedoch cum quodam moderamine, auf fünfzig und die weibespersonen auf jedem amt und hofe auf dreißig gulden gesetzet". Als die Aufrechnung der Ämter und ihrer Intraden von den Deputierten bewerkstelligt war, ging man daran, die Teilung auszuführen. Am 26. April erhielten die Verordneten von den Herzögen den Befehl, ihre Meinung darüber kund zu tun, wie die Teilung am besten vor sich gehen 96 ) könnte. Anfangs getrauten sie sich nicht, diese wichtige Sache allein anzufassen, glaubten auch wohl, die Herzöge würden es zuvor mit ihren Räten reiflich überlegen und sie selbst dann nur bei der einen oder andern Schwierigkeit hinzuziehen. Letzteres geschah jedoch nicht, vielmehr forderten die Fürsten sie abermals auf, sich über den Teilungsmodus zu äußern. Daher machten sie sich dann schließlich ans Werk. Anfangs versuchten sie, abgesehen von einigen Auswechselungen, es bei der alten Teilung, in den güstrowschen und schwerinschen Teil zu belassen. Bei reiflicher Überlegung erschienen ihnen aber die Verhältnisse gegen früher so verändert, 97 ) daß sie es für gut hielten, einige Ämter des schwerinschen Teiles gegen entsprechende des güstrowschen zu vertauschen und umgekehrt und so Gleichheit zu schaffen. Zur


|
Seite 209 |




|
Beratung dieser wichtigen Sachen schlug Adolf Friedrich seinem Bruder am 8. Mai 1611 98 ) vor, daß einer von ihnen in Doberan, der andere in Schwerin Wohnung nehmen sollte, damit sie in der Nähe der "Deputierten wären, die in Doberan verhandelten, und so die Verhandlungen nicht länger durch zeitraubend es Hin= und Herschicken der ,Akten verzögert würden. 99 ) Wegen der Wichtigkeit der Sachen hielt er es für gut, zu besserer Beratung noch einige Fürsten hinzuzuziehen, wie es früher geschehen war. Er selbst beabsichtigte, den Pfalzgrafen Philipp Ludwig bei Rhein und den Herzog Johann Adolf zu Schleswig=Holstein zu Vertretern seiner Interessen zu wählen. 100 ) Auf sein Ansinnen an Hans Albrecht, sich ebenfalls zwei Fürsten zu Beratern zu erbitten, ging dieser aber nicht ein. Er äußerte in seiner Antwort vom 9. Mai, man möchte nur, ohne noch lange zu beraten, bald zur Teilung schreiten, weil ja doch alles durchs Los entschieden würde, eine vollständig gleiche Teilung aber ein Unding wäre. Wenn Adolf Friedrich jedoch die Sache nochmals von den Deputierten, möchte beraten wissen, so wollte er sich schließlich auch dazu bereit finden lassen. Zur Teilung aber nun noch fremde Fürsten hinzuzuziehen, hielte er nicht für geraten. Mit Recht schrieb er, es wäre auch bei den bestehenden gefährlichen Zeiten nicht unbedenklich, den "Zustand" des Herzogtums vor Fremden aufzudecken und eine Angelegenheit, die sie unter sich abmachen könnten, an die breite Öffentlichkeit zu ziehen. Schließlich bat er nochmals dringend, die Sache möglichst zu beschleunigen.
In einer neuen Beratung vom 3. Juni 1611 einigte man sich endlich dahin, daß die Deputierten nicht mehr in Doberan, sondern in dem in der Mitte zwischen Doberan und Schwaan gelegenen Meierhofe 101 ) Fahrenholz beraten sollten. Wohl um die Kosten eines besonderen Unterhaltes für sie zu sparen, und vor allem auch, um über den Gang der Verhandlung und alle Abmachungen sofort genaue Kenntnis zu haben, auch schnell Rat


|
Seite 210 |




|
geben und so direkten Einfluß ausüben zu können, nahmen die Herzöge je zwei derselben zu sichins Quartier. Nur zu den Verhandlungen ritten die Deputierten nach Fahrenholz. Auf ihren Wunsch war ihnen von jeder Seite noch ein Beirat gegeben worden. Auf den 10. Juni wurde der Beginn der Verhandlungen in Fahrenholz festgesetzt. Bis dahin sollte jeder Fürst über das, was er noch zu ändern nötig hielt, seine "Bebenken" aufsetzen und dem anderen zuschicken. 102 ) Dabei zeigten die Fürsten, wie überhaupt bei den ganzen Verhandlungen, eine gar ängstliche Vorsicht. Jeder war peinlichst darauf bedacht, stets das Äußerste für sich zu fordern, und suchte' um nichts zu vergessen, möglichst, ehe er seine Bedenken aus der Hand gab, zuvor die des Gegners kennen zu lernen, und auf diese Weise, wenn irgend angängig' noch Vorteil für sich herauszuschlagen. 103 )
Am 11. Juni begannen die Deputierten zu Fahrenholz ihre täglichen Verhandlungen. Ein besonders heißer und langer Kampf entspann sich über den Punkt, wie die Ämter zusammengelegt werden sollten. Hauptsächlich bildeten Dömitz und Boizenburg als die einzigen Festungen und Handelshäfen des Landes an der Elbe den Zankapfel. Auch die Verteilung der Grenzämter machte große Schwierigkeiten, denn keiner wünschte mehr als der andere durch die andauernden Grenzstreitigkeiten belästigt zu werden. Außerdem sollte die Trennung so geschehen, daß nachher kein Amt aus dem andern Hebungen hätte. Ebenso war auf günstige Zuteilung der "Ablager", 104 ) auf zusammenhängende Forsten und Wildbahnen 105 ) zu achten; kurz, jeder Fürst suchte sich, so gut es ging, einen möglichst abgerundeten, in sich geschlossenen Landesteil zu verschaffen. Auch die Voneinandersetzung der Leibgedinge, welche die beiden verwitweten Herzoginnen, Anna, die zweite Gemahlin Herzog Ulrichs' und die Herzoginmutter, innehatten, war mit großen Schwierigkeiten verknüpft, denn die Herzoginnen waren keineswegs gewillt, genauen Bericht über Einkommen und Stand ihrer Ämter abzulegen. Erst nach vielen


|
Seite 211 |




|
vergeblichen Beteuerungen, daß es nicht Neugierde, sondern zum Teilungswerk unbedingt notwendig wäre, 106 ) erlangten die Herzöge, daß schließlich ihre Großtante, die Herzogin Anna, die Grabow, Grevesmühlen, Walsmühlen und Gorlosen innehatte, in die Abschätzung willigte. 107 ) Ihre Mutter aber schlug ihnen ihr Begehren rundweg ab und sandte nur die Register von drei Jahren, "woraus das notwendigste zu ersehen" sein würde. Die Verhandlungen, die auf Hans Albrechts Wunsch nur noch mündlich geführt wurden, erfuhren eine erneute Verzögerung, als man zu der Teilung der Ämter Gadebusch. und Tempzin kam, die, wie erwähnt, anfangs Hans Albrecht zum Wohnsitz und seiner Gemahlin als event. Witwensitz bestimmt waren. Adolf Friedrich forderte, daß, falls die Ämter ihm durch das Los zufielen, nicht nur Hans Albrecht und seine Gemahlin darauf verzichteten, sondern daß ihm auch "wegen der 108 ) von herzog Christophers . . . erster gemahlin herrührenden ehegelder, dafür gemeldte ämter zum unterpfand gleichsam verschrieben, genugsam assecuriert werden möge".
Es waren nämlich Herzog Christophs erster Gemahlin Dorothea, der Tochter König Friedrichs I. von Dänemark, 20000 Taler als Mitgift gegeben und dafür für den Fall ihres kinderlosen Ablebens die Ämter Gadebusch und Tempzin verpfändet worden. Die Herzogin war nun am 11. November 1575 ohne Leibeserben verstorben, und Dänemark hatte darauf auf die beiden verpfändeten Ämter Anspruch erhoben. Als nun Hans Albrecht II. Christophs Tochter Margarethe Elisabeth heiratete, bekam er als Heiratsgeld vom Lande, wie oben erwähnt, 20000 Taler, die in Rostock zinsbar belegt wurden. Weil hierdurch den Herzögen wieder flüssige Gelder zu Gebote standen, so bewirkte Dänemark einen kaiserlichen Arrest, sich für seine eingetragenen Gelder auf Gadebusch und Tempzin an den Brautschatz halten zu können. Dadurch wurden diese Ämter von Dänemark frei, gingen dafür aber in den unmittelbaren Besitz von Hans Albrecht oder vielmehr seiner Gemahlin über. 109 ) Damit die Ämter jedochwieder Gemeingut der Herzöge würden und auch für die Ämterteilung in Betracht kommen könnten, zahlte Adolf Friedrich an Hans Albrecht, als dieser zur Erbhuldigung Geld nötig hatte, 20000 Taler. Eine darüber ausgestellte Quittung unterzeichnete Hans Albrechts


|
Seite 212 |




|
Gemahlin zwar, einen direkten Verzicht auf Gadebusch und Tempzin, den Adolf Friedrich verlangte, leistete sie aber nicht. Hierdurch fühlte sich Adolf Friedrich beunruhigt. Um nun, falls die betreffenden Ämter an ihn kommen würden, keine Scherereien zu haben, glaubte er auf seinen Forderungen bestehen zu müssen. Deshalb kames zu längeren Verhandlungen, und erst am 30. Juni sandte Hans Albrecht an Adolf Friedrich den ratifizierten Revers wegen der auf Gadebusch und Tempzin haftenden Hypotheken.
Solche und ähnliche Streitigkeiten und Reibereien waren an der Tagesordnung.
Man kann sich denken, wie sehr die Herzöge bestrebt waren, recht bald zu eigener Regierung zu kommen. Aber Adolf Friedrich fürchtete, daß Hans Albrecht, wenn die Ämter geteilt und verlost wären, einer weiteren Teilung des ganzen Landes große Schwierigkeiten in den Weg legen würde. Daher machte er den Vorschlag, das ganze Land zuvor in zwei völlig gesonderte Teile zu zerlegen und erst dann endgültig zu teilen. Hans Albrecht wollte hiervon, jedoch nichts wissen. Auch ihre Väter hätten wiederholt die Landteilung vorgenommen, aber niemals durchgeführt. Dies wäre der beste Beweis dafür, daß sie unmöglich wäre. Außerdem würde zu ihrer Vollführung auf jeden Fall viel Zeit erforderlich sein. Und gerade dieser Umstand schreckte ihn am meisten ab, denn er wollte auf keinen Fall noch länger "im Gedränge sitzen". Daher entschied er sich dafür, nur die Ämter teilen zu lassen. Adolf Friedrich aber war sich damals wohl selbst noch nicht ganz klar darüber, ob zur Zeit eine gänzliche Teilung überhaupt angebracht wäre. Vom 12. Juni 1611 haben wir eine eigenhändige Aufzeichnung von ihm, in der er in Erwägung zieht, "ob nicht ein Interimsvergleich auf zehn oder zwanzig Jahre zu machen" wäre. Die verschiedensten Gedanken gingen ihm damals durch den Kopf. Er überlegte sogar, ob es nicht überhaupt besser wäre, seinem Bruder die Regierung allein zu überlassen. Eine seiner von ihm selbst niedergeschriebenen Reflexionen lautet wörtlich folgendermaßen: 110 )
"Propos et pensees qui son venu en mon opinion et repose cela au quatre poinct:
I. Sy je laise le gouvernement de ce paix isi au mon frere seulement.
II. Ou que je luy laise jusques apres troys an.


|
Seite 213 |




|
III. Ou que mon gouvernement depent seulement de moy mesme.
IV. Ou un gouvernement ensemble.
Bei dem ersten punct ist viel zu bedenken. Erstlich, ob ich kann unverheiratet bleiben, denn da nicht verheiratet, könnte dieser ohne einiges bedenken sehen, daß dabei wohl ein ruhsamer stand, da aber auf die ander meinung nach geschehenem dieses, wäre ich übel daran und konnte es bei der posteritet nicht verantworten. Zudem mucht der bruder erben bekommen, wo nicht mit dieser, jedoch mit einer anderen gemahl, so würde meine posteritet sich wenig zu erfreuen haben und würde ihnen noch ärger ergehen als mir anitzo, welches wohl zu bedenken. Den andern punct würde mir fast verklenerlich sein, daß ihn ein solches anmuten wäre, zudeme würde er auch große unordnung einführen, daß ich darnach zeit meines lebens genugsam zu corrigieren hätte. Die leute würden auch die desordre also gewohnt, daß nimmer daraus zu bringen. Betreffend den drittenpunct würde dieser in zwei unterschiedliche fragen geteilt 1. ob solches selbst, oder durch die räte selbst möchte wohl etwas gehen. Da komme aber nicht gerne an, wird mir auch nach meinem kopf nicht sein; 2. durch leute, - müßte ich einen statthalter haben. Wor der zu nehmen, mag gott wissen, der wird helfen, denn das manquement ist an leuten, die etwas verstehen und ein courage haben, die meinen adversaires dürfen den kopf bieten in meinem abwesen. Den vierten punct halte gar für nicht ratsam, sondern fast für hoch schädlich, denn wir uns doch darüber nicht vergleichen. Sehe also fast kein mittel oder hilfe. Gott, der mag helfen, der wird auch helfen um seines sohnes willen."
Um zu einem bestimmten Entschluß zu kommen, begehrte er wiederholt, die Meinung seiner Räte zu hören. Am 14. Juni erhielt er eine ausführliche Resolution von ihnen, der er dann im großen und ganzen folgte. Sie machten ihn darin auf die Schwierigkeit des Werkes aufmerksam. 111 ) Wenn er auch mit seinem Bruder einig wäre, so würde er die Untertanen doch nicht ohne ordentlichen Prozeß zum Einverständnis mit der Teilung bringen können, weil Akten vorhanden wären, wonach sie die Teilung verhindern könnten. Es würden sich auch die großen Städte nicht zwingen lassen. Wenn einer die Teilung


|
Seite 214 |




|
hätte vollführen können, so wäre es sein Großvater Johann Albrecht I. gewesen, "der es als ein hochbegabter und weitbefreundeter fürst nicht würde, was geschehen können, stocken haben lassen". Sie rieten ihm daher vorerst von der Totaldivision ab, damit er sich nicht der Landschaft und seinem Bruder entfremdete. Erst sollte er die Ämter allein teilen. Wohl aber könnte er von Hans Albrecht einen Revers fordern, daß er ihm bei künftiger Totaldivision nicht hinderlich sein wollte. Später würde sich dann vielleicht immer noch Gelegenheit bieten, mit der Totaldivision zu Werke zu gehen.
Nach Kenntnisnahme dieser Resolution stand Adolf Friedrichs Entschluß fest. Besonders der Ietzte Punkt leuchtete ihm ein. Seine, eigenhändige Aufzeichnung lautet folgendermaßen: "Ich vermeine . . . mit meinem bruder nicht zu teilen als ganz erblich welches ich verstehe nicht allein auf unser ämter, sondern auch des ganzen landes, als auch des adels und der städte." Seine Gründe waren: die gänzliche Teilung wäre nicht nur der Billigkeit gemäß, sondern auch im Reiche gebräuchlich und wegen des "Gemenges", wegen Verhütung von Streit und Zank und endlich auch der Untertanen halber notwendig. Aber trotz dieser schwerwiegenden Gründe wollte er sich Hans Albrechts Wünschen anpassen und für jetzt nur die Teilung der Ämter vornehmen, "doch mit diesem beding , daß solche voneinandersetzung der ämter soll der künftigen erbteilung der ritterschaft und städte accommodiert werden, item, daß mein bruder dagegen zum künftigen sich reservieren undverpflichten soll". Für Hans Albrecht fügte er hinzu, er möchte sich doch überlegen, daß ihm die Totaldivision gar nicht nachteilig sein könnte, da er (Adolf Friedrich) selbst durch etwaige Ungelegenheiten doch ebensosehr wie Hans Albrecht getroffen würde. Er würde doch nicht seinen "eigenen schaden und verderb suchen!" Sollte aber Hans Albrecht hierin nicht willigen, so drohte er, auch die Teilung der Ämter nicht vollführen zu wollen.
Am 22. Juni 1611 ließ Adolf Friedrich zu Doberan einen diesbezüglichen Revers 112 ) aufstellen, worin sich beide Fürsten, um die Teilung der Ämter nicht noch länger aufzuschieben, die vollständige Teilung des Landes vorbehielten. Wenn sie jetzt wegen Kürze der Zeit und andrer Gründe zunächst nur die Ämter teilten, so sollte das die Teilung der Ritterschaft und Städte nicht hindern, sondern, wenn später einer von ihnen auch


|
Seite 215 |




|
diese zu vollziehen wünschte, so sollte der andere sich nicht widersetzen, sondern ihm vielmehr dazu behilflich sein.
Hans Albrecht konnte sich nicht ohne weiteres entschließen, diesen Revers zu unterzeichnen, erklärte sich aber schließlich in einem Revers bereit, sich unter der Bedingung zur Totaldivision zu verpflichten, "wann es E. L. sowohl als uns, wie auch land und leuten zum besten gereichen mag und zu erheben sein wird".
Adolf Friedrich ging auf diesen Kompromiß nicht ein. Wie dringend Hans Albrecht ihn am 5. Juli auch ersuchte, da sie im Hauptwerk einig wären, doch nicht wegen einiger weniger Punkte das Teilungswerk noch länger aufzuhalten, so ließ er nicht von der Forderung ab, daß zuvor der Revers ohne jegliche Klausel unterzeichnet würde. Schließlich fügte sich Hans Albrecht, da er "befunden", wie er später, am 13. Oktober 1611, an Adolf Friedrich schreibt, 113 ) "daß E. L. von ihrer meinung nicht abstehen, sondern ehe das ganze, domal fürgewesenes, hochnötiges und uns beiderseits sowohl, als land und leuten ersprießliches und nützliches teilungswerk zergehen lassen wollte". Am 6. Juli setzte auch er seinen Namen unter den Revers.
Damit hatte Adolf Friedrich nach langem Kampfe gesiegt. In einer eigenhändigen, die ganzen Teilungsschwierigkeiten zusammenfassenden "Deduktion" erinnerte er 1613 an diese streitumwogte Zeit, wie er 114 ) anfangs die Ämterteilung allein gar nicht gewollt hätte, aber "ich mußt mich, wie man an mir gewohnet, bei öfteren, weit aussehenden dingen concernierende brüderliche liebe, land und leute was bequemen, ließ mich soweit in die enge [treiben], jedermänniglich den scheffel vollzumessen, daß, wann mein bruder sich reversierte, land und leute mit mir zu teilen, so mucht die ämterteilung ihren fortgang gewinnen. Aber das gäbe auch difficulteten, würd dahin geschlossen . . . Ich kam mit wenig comitat gegen seine große pompa nach Fahrenholz. Und ob man wohl auch da mir den revers nicht geben wollte, sondern es war eitel losen, - losen. Ich sollte mit mein bruder losen. Jedoch mußte er mir doch folgen, dar ich ihn haben wollte. Wie ich den revers bekam, wissen die, so dabei gewest. Also kam dieser schöne revers heraus, worauf dann die losung folgte und mir durch Gottes verhengnus mein von natur und recht mein gebührends väterliches erbteil fiel.


|
Seite 216 |




|
Das andere hette mir ganz auch oder ja zum wenigsten der halbe teil gebühret".
Mit der Herausgabe des Reverses war das Teilungswerk nun endlich so weit diehen, daß man zur Losung schreiten konnte. Am9. Juli 1611 wurde zunächst in Anwesenheit beider Fürsten der Vertrag verlesen. Darauf "ist 115 ) . . . im namen Gottes daselbst auffem hofe im bauwhause in der großen stuben das los gelegt worden durch einen kleinen bauerjungen, Ties Kartlow geheißen, von Kleinen=Grentz 116 ) bürtig, und ist herzog Adolf Friedrichs f. g. das schwerinsche und M. g. f. und herrn das güstrowsche teil gefallen". 117 )
4.
In dem Teilungsvertrag von Fahrenholz 118 ) wurden die Ämter mit ihren Pertienzien und Gerechtigkeiten in zwei Teile zerlegt 119 ): Die schwerinsche Hälfte umfaßte die Ämter: Schwerin,


|
Seite 217 |




|
Crivitz, Tempzin, Neubukow, Doberan mit Marienehe, Mecklenburg, Gadebusch, Goldberg, Wredenhagen, Zarrentin mit dem Schaalezoll, Neustadt, Strelitz mit dem dazu gehörenden Gute Goldebow (gegen die Verpflichtung zur einstweiligen Zinsenzahlung an die Herzogin Clara Maria, die Witwe Herzog Sigismund Augusts, der es verpfändet war, und nach ihrem Tode gegen Erstattung des halben Kaufgeldes an den güstrowschen Teil), Fürstenberg, Wanzka und Ivenack (letztere beiden jedoch nur bis zum Rückfall des güstrowschen Witwenamtes Grevesmühlen), Eldena mit den Eisenhütten und dem Alaunwerk und Dömitz, die Höfe Poel und Wiechmannsdorf, die Wittumsämter der Herzogin=Mutter Sophie: Lübz, Rehna und Wittenburg, in Wismar den halben mecklenburgischen und doberanschen Hof, sowie die dortige "Tönnies= 120 )
Hofs=Herberge" (gegen Erstattung), und den ganzen Klosterhof und die Jagd inParchim. Zu der andern, der güstrowschen Hälfte kamen mit der Bedingung einer Vergütung von 30250 Gulden (zahlbar in drei Raten) an Schwerin für den ungleich besseren Zustand der Gebäude die Ämter Güstrow mit dem Klosterhof, Sternberg mit dem Kloster, Schwaan, Ribnitz, Gnoien mit dem Sülzer Salzwerk, Dargun, Neukalen, Stavenhagen, Stargard, Broda, Feldberg, Wesenberg, Plau, Marnitz, Neukloster und Boizenburg mit dem Schaalezoll, der Herzogin Anna Wittumsamt Grabow mit Gorlosen und Walsmühlen, Grevesmühlen (jedoch nur bis zum Rückfall der schwerinschen Ämter Ivenack und Wanzka) und der halbe mecklenburgische Fürstenhof in Wismar.
Gemeinschaftlich blieben, abgesehen von der ganzen Ritterschaft und den Städten, dem Hof= und Landgericht, der Landesuniversität, dem Konsistorium, dem Kreuzkloster und dem Doberaner Hof zu Rostock, über deren Verwaltung mehrere ändernde, hier aber nicht weiter wichtige Bestimmungen getroffen wurden, und ferner außer der abwechselnden Bestellung der Superintendenten ebendort und in Neubrandenburg, wie auch der ebenfalls abwechselnden Kirchenpatronate in den Städten, außer Parchim und Güstrow, 121 )


|
Seite 218 |




|
wo die Superintendenten und Prediger von Schwerin resp. Güstrow aus eingesetzt werden sollten, vor allem die Archive zu Schwerin und Güstrow, die abwechselnde Bestellung der Stadtvögte außer in Schwerin und Güstrow, wo dies Recht dem betreffenden Herrn allein zustand, die Flüsse mit der geplanten Schiffahrt von dem Schweriner See in die Ostsee, die Aufnahme und das Geleit fremder Fürsten, vorfallende Grenzstreitigkeiten mit den Nachbarstaaten, die schwebenden Prozesse mit dem Stift Schwerin wegen der Hofgerichtsassessur und anderer Hoheitsrechte, der Kapitalabtrag an die Königin Sophie von Dänemark, das Gesuch um Erhöhung der Elbzölle beim Kaiser, die Kammergerichtsunterhaltung zu Speier, sowie der Unterhalt und die künftige Aussteuer der Prinzessin Anna Sophie und endlich die Schulden des verstorbenen Herzogs Karl.
Besondere Bestimmungen wurden getroffen wegen der auf den Ämtern befindlichen Bibliotheken und Rüstkammern, die demjenigen Teile allein verbleiben sollten, dem ihr Aufbewahrungsort zufallen würde. Die Geschütze auf den fürstlichen Häusern mit alleiniger Ausnahme der zu Gadebusch stehenden, die Herzog Christoph größtenteils aus Schweden von seinem Schwiegervater erhalten hatte und die deshalb als ein Fideikommiß Hans Albrechts anzusehen waren, sollten gleichmäßig verteilt werden. Die gleiche Bestimmung wurde über die Güstrower Vorräte an Leinenzeug und Hausgerät, Pulver und Salpeter getroffen (soweit sie nicht zum Amt gehörten), auch der Ertrag der Orbören und die Benutzung der Ablager in den Städten, außer denen von Schwerin und Güstrow, sollten, letztere jedoch alle Jahre abwechselnd, beiden Fürsten in gleicher Weise zugute kommen. Die Papiermühle zu Gadebusch versprach Hans Albrecht an Adolf Friedrich gegen eine Vergütung abzutreten, falls diesem die schwerinschen Lande zufallen würden. Ebenso sollte es Hans Albrecht freistehen, seines Bruders Haus zu Güstrow "gegen erstattung des kaufgeldes und scheinbaren besserung" zu erwerben. Demjenigen endlich, der Schwerin erhalten würde, wurde anheimgestellt, wegen der jährlichen Weinlieferung von Lübeck nach Schwerin für sich allein ein Abkommen zu treffen, und ebenso wurde dem künftigen Besitzer von Ribnitz die Lizenz gegeben, das dort befindliche Kloster gegen Erstattung an die Landschaft erwerben zu dürfen.
Als allgemeingültige, besonders für die Folgezeit sehr schwer wiegende Bestimmungen wurden hinzugefügt, daß "ein jeder mit dem anteil, welches ihm der Allmächtige durchs loos geben und zueignen wird, ohn einiges gegenwärtiges oder künftiges


|
Seite 219 |




|
widersprechen, . . . friedlich und begnügig sein und dagegen weder in noch außerhalb rechtens das geringste nicht tentieren, noch fürnehmen. . . . Da aber sich künftig befinden sollte, daß darin das eine oder ander übergangen und aus dem gemenge nicht gebracht und unter andern in den kirchenlehen etwas übersehen wäre, so soll daher kein streit erreget, sondern das ius patronatus bei den ämtern, darin die kirchen gelegen, hinfuro verbleiben und keiner in des andern ämtern etwas behalten, außerhalb, was in specie dem einen oder andern amt in diesem vertrage zugeeignet. . . . Sollten auch nach geschlossenem diesem vertrage neue irrungen über alle hoffnung und zuversicht einfallen, oder von wegen ungleichen verstandes dieses vertrages streit erreget werden, so sollen dazu Unsere räte und zwar von einem jeden teile zweene ernennet, ihrer eide und pflichten zu diesen sachen erlassen und ihnen die entscheidung solcher irrungen und mißverständnissen auf maße und weise, wie wir uns beiderseits dessen vereinigen wollen, committieret und anbefohlen werden oder, da durch denselbigen weg den sachen nicht abzuhelfen, Unsere beiderseits nahe verwandten und von einem jedem einer zu verhör und hinlegung solcher irrungen von Uns erbeten werden".
Zugleich mit der Aufstellung des Erbvertrages wurde auch die Berechnung der vererbten Schuldenlast vorgenommen. Eine völlig gleiche Teilung aber gelang wegen der verschieden hohen Posten nicht sogleich. 122 ) Zur Ausgleichung 123 ) mußte Hans Albrecht Adolf Friedrich 250 Taler und Adolf Friedrich seinem Bruder am kommenden Termin 22 Gulden 12 ßl. 7 ½ (? PF erstatten. Die bedeutendste Gläubigerin der Fürsten war die verwitwete


|
Seite 220 |




|
Königin von Dänemark mit 250000 Gulden. Dazu kamen noch 50000 Gulden, die ihr im Jahre 1607 als Abfindungssumme bewilligt waren. Ferner hatten die Herzogin Anna 24000 Gulden, Graf Günter zu Oldenburg 40000 Reichstaler, die Herzogin Clara Maria 8500 Taler und die Städte Lüneburg und Lübeck namhafte Summen zu fordern. Die übrigen Gelder, teilweise hohe Summen, wurden reichen Edelleuten aus dem Lande, den
Rats= und Kirchenkassen 124 ) verschiedener Städte, auch der Universität, sowie vor allem Kaufleuten und Handwerkern geschuldet.
"Zur Erhaltung brüderlicher Einigkeit und Verhütung künftiger Mißhelligkeiten" wurden auch die Vorjagden 125 ) geteilt. Zum schwerinschen Teil kamen 126 ) aus dem Amt Neustadt drei Hirsch= und Schweinejagden und die Rehjagden in der Holzung der Stadt Parchim, ferner aus dem Amt Schwerin 9 127 ) Vorjagden, aus Wittenburg 14, Gadebusch 6, Rehna 2, Fürstenberg 4 und Strelitz 1; zum güstrowschen Teile fielen aus dem Amt Stargard an Vorjagden 16, Feldberg 4, Grabow 3 und Ribnitz 1.
Obwohl die Ämterteilung nun nach langer, harter Arbeit von den Deputierten vollbracht und auch alles, was dazu gehörte und sich darauf erstreckte, wie es schien, glücklich geteilt war, so waren damit die Bestimmungen der Verträge doch noch nicht verwirklicht. Vielmehr herrschte anfangs ein ziemliches Durcheinander, und nicht unzeitgemäß war daher Adolf Friedrichs Vorschlag, jetzt, wo man doch ändern müsse, auch sogleich gründliche Säuberung zu halten. Er riet also zur Vornahme einer "durchgehenden totalteilung, wodurch nicht allein das gemenge in


|
Seite 221 |




|
unsern ämtern . . ., sondern auch sonst in unserm ganzen fürstentum, land und leuten aufgehoben, einem jeden ein gewisser ort landes allein assigniert und, was etwa ein teil dem andern an städten, mannschaft, einkünften und andern kommoditäten übertreffe, auf billige rechtmäßige erstattung gesetzt" würde. Er erbot sich, bis zu "deren beständiger effectuation noch etlich jahr 128 ) in communione aller land und leute" mit Hans Albrecht zu verbleiben. Da aber dieser hiervon nichts wissen wollte, so forderte Adolf Friedrich, daß doch wenigstens für die Zeit bis zur gänzlichen Vollstreckung des Vertrages die Regierung gemeinsam sein sollte. Aber auch auf eine solche, allerdings weitgehende Abmachung ließ sich Hans Albrecht nicht ein, erklärte sich schließlich aber bereit, bis zum Herbste 1611 auf eine selbständige Regierung zu verzichten.
5.
Nach dem Abschluß des Erbvertrages machte man sich zunächst daran, die Bestimmungen desselben auszuführen. Wie es von vornherein gar nicht anders möglich war, ergaben sich dabei die allerdenkbarsten Schwierigkeiten, und zwar umsomehr, als die die Absicht, solche zu konstruieren, wenn zuerst auch unbewußt, tatsächlich von Anfang an vorhanden war. Hans Albrecht gönnte nämlich Adolf Friedrich seinen Anteil nicht. Letzterer gibt uns darüber selbst folgende interessante Schilderung: 129 ) "Wie gerne mir mein teil gegönnt war, mögen die postreuter sagen, die zwischen Schwaan und Fahrenholz geritten zu denen, so zu Schwaan damals auf zeitung warten. Ich ließ mich aber, Gott lob, nichts anfechten, sondern dankte Gott für das und war lustig und content". Daneben findet sich eine von Adolf Friedrich


|
Seite 222 |




|
gleichfalls eigenhändig geschriebene, das Verhältnis zu seinem Bruder aufs trefflichste charakterisierende Note: "Hierbei ist zu merken Gottes des allmächtigen wunderbare schickung, daß wie mein bruder und ich 3 mal zu Güstrow darum spielten, wo ein jeglicher während der teilung sein quartier nehmen sollte, da ist mir 3 mal Doberan und ihme Schwaan zugefallen. Da schlug untreue seinen eigenen herren! Weil durch dies spiel meim bruder zufiel, daß zu Schwaan sein quartier nehmen sollte, verzehrte er alles, was da zum besten wor, der hoffnung, es sollte sich das glück wenden, daß er mein teil bekäme und ich das ander. So sollte ich zu Schwaan ein kalte Küchen finden. Aber Gott hats anders geschickt, dafür ich ihm herzlich danke".
Vorgenommen wurden zuerst die Regelung der Grenzstreitigkeiten zwischen den einzelnen Ämtern, die Revision der Rent= und Küchenmeisterrechnungen und die Teilung des Nachlasses Herzog Karls (seiner "alchimistischen Scharteken" und seiner "Destillierstuben"). Sowohl hierzu als auch zur Voneinandersetzung des Jägerzeuges, der "Wild= und Jagdtücher", sowie überhaupt der gleichmäßigen Teilung des ganzen Vorrats auf den Ämtern wurden Deputierte ernannt. Dann eilte man zum Ausgleich von Schwerin und Güstrow, wo die Herzöge ihre Hofhaltungen haben sollten. Obgleich diese beiden Städte im Vertrag von Fahrenholz gemein gelassen waren, so waren doch ihre hauptsächlichsten Erträge und Rechte dem Fürsten zugeteilt, dem die betreffende Stadt zufallen würde. Sie wurden daher genau inventarisiert und gegen einander ausgeglichen. Damit kein Versehen vorkäme, forderte z. B. Adolf Friedrich, daß die Geschütze zu Schwerin von einem "rotgießer oder einem andern der metalle kundigen mann" abgeschätzt würden, was natürlich lange Zeit erforderte.
Solange etwaige Zweifel durch Abschätzung und Besichtigung klargelegt werden konnten, ging die Regelung der Sachen, wenn auch nur langsam, so doch stetig vorwärts. Die ersten Schwierigkeiten ergaben sich bei der Abschätzung von Adolf Friedrichs auf der Schloßfreiheit zu Güstrow gelegenem Hause, 130 ) das Hans Albrecht dem Erbvertrage gemäß gegen "Erstattung des Kaufgeldes und scheinbaren Besserung" übernehmen sollte. Größere Verzögerungen aber entstanden, als man sich über die Ausübung der Gerichtsbarkeit nicht einigen konnte. Hans Albrecht glaubte,


|
Seite 223 |




|
mit den geteilten Ämtern auch die ganze Gerichtsbarkeit darin erhalten zu haben. 131 ) Er meinte nämlich, zur Zeit ihrer Vorfahren wäre darin leider "keine feste ordnung" gewesen, sondern sobald einer "eine böse sache" gehabt hätte, wäre er zu der andern Obrigkeit gelaufen. Dadurch wäre "die gerechtigkeit aufgehalten" und große "weitläufigkeit" unter den damals regierenden Fürsten entstanden. All dies könnte aber, wenn ein jeder Herzog in seinem Gebiet die Gerichtsbarkeit allein ausübte, vermieden werden; Adolf Friedrich möchte daher seinem Wunsche nachkommen. Dieser aber wollte sich hierauf nicht einlassen, obgleich er im Grunde selbst nichts mehr als möglichste Freiheit und Trennung wünschte. Dies auffallende Verhalten Adolf Friedrichs erklärt sich aus seinem Bestreben, eine Menge von strittigen Punkten zu sammeln, um durch sie desto wirksamer auf den Vollzug der Totaldivision dringen zu können. Er erklärte also, 132 ) die Jurisdiktion über die in den Ämtern eingesessene Ritterschaft wäre wie diese selbst keine Gerechtsame der Ämter, da sonst ja auch z. B. die Königin=Witwe von Dänemark, der die Ämter Bukow und Neukalen mit allen Gerechtigkeiten verschrieben waren, die Gerichtsbarkeit in denselben ausüben könnte. Sie gehörte vielmehr wie die Belehnung der Ritterschaft zu den Regalstücken des Fürstentums, die noch nicht geteilt wären. Daher müßte sie bis zur Tolaldivision gemeinsam bleiben. Bald stellten sich noch ernstere und erheblichere Störungen ein.
Ungefähr ein Jahr nach dem Abschluß des Vertrages trat Adolf Friedrich mit drei Forderungen an Hans Albrecht heran. Sie betrafen die Rückzahlung des von Hans Albrecht schon erhobenen kröpelinschen Pachtkornes, 133 ) die Ausübung der Fischereigerechtigkeit auf dem Techentiner=Hägersee 134 ) und vor allem die gemeinsame Verwaltung, der Städte Schwerin und Güstrow. Auf diese drei Punkte meinte Hans Albrecht nicht eingehen zu können, und so wurden sie der Anlaß zu langen Streitigkeiten, die 135 ) sich bis zum Jahre 1617 hinzogen und erst dann ihre Erledigung fanden. Auch die Regelung der Rent= und Küchenmeisterrechnungen während des Interimsjahres 1610 - 11 fand erst im Jahre 1615 ihren Abschluß. Von Adolf Friedrich wurden Heinrich v. Sperling und


|
Seite 224 |




|
von Hans Albrecht Mathias von Linstow
136
)
und, als dieser krank wurde, Mathias von Bülow
und später Rüdiger von Mönnichow beauftragt,
"was die herzöge
137
) in dem
interimsjahr aus den ämtern genossen und dahero
einer dem andern zu erstatten schuldig,
gegeneinander gebührlich abzurechnen und also in
richtigkeit zu bringen". Die Arbeit dieser
Deputierten erstreckte sich darauf, zu
ermitteln, 1. was die Fürsten von ,den Ämtern
bei verschiedenen "ausrichtungen"
empfangen hatten, 2. "was an geld, korn und
victualien und anderm anno 1611 auf Trinitatis
bei den ämtern in vorrat geblieben", und 3.
was schließlich, damals die Fürsten den Beamten
auf den Ämtern schuldig geblieben waren, und
inwieweit die Ausgaben die Einnahmen übertroffen
hatten. Am 12. März 1614 konnten sie die
abschließende Rechnung aufstellen.
138
)
Darnach hatte Adolf Friedrich während des
Interimsjahres an Geld, Korn usw. für 1870
Gulden 11 ßl. empfangen und der Vorrat auf den
schwerinschen Ämtern sich auf 2673 Gulden 9 ßl.
8
 belaufen. Der ganze Ertrag des
schwerinschen Teils war also 4543 Gulden 20 ßl.
8
belaufen. Der ganze Ertrag des
schwerinschen Teils war also 4543 Gulden 20 ßl.
8
 gewesen. Bei Hans Albrecht
ergaben sich die Summen 2283 Gulden 5 ßl. und
8508 Gulden 10 ßl., zusammen mithin 10791 Gulden
15 ßl. Der güstrowsche Teil übertraf demnach den
schwerinschen um 6247 Gulden 19 ßl., sodaß Hans
Albrecht an Adolf Friedrich 3123 Gulden 21 ßl. 6
gewesen. Bei Hans Albrecht
ergaben sich die Summen 2283 Gulden 5 ßl. und
8508 Gulden 10 ßl., zusammen mithin 10791 Gulden
15 ßl. Der güstrowsche Teil übertraf demnach den
schwerinschen um 6247 Gulden 19 ßl., sodaß Hans
Albrecht an Adolf Friedrich 3123 Gulden 21 ßl. 6
 zu erstatten hatte. Adolf
Friedrich forderte zu dieser Summe die
"interessen" von 1610 an. Hans
Albrecht weigerte sich zwar anfangs, weil es
139
) "seines wissens bei einigem
stand (außer den kaufleuten) nicht bräuchlich,
noch rechtens wäre, in solchen fällen die zinsen
anzuschlagen oder abzufordern", erklärte
sich aber im Juli 1614
140
) doch zur
Zahlung bereit.
zu erstatten hatte. Adolf
Friedrich forderte zu dieser Summe die
"interessen" von 1610 an. Hans
Albrecht weigerte sich zwar anfangs, weil es
139
) "seines wissens bei einigem
stand (außer den kaufleuten) nicht bräuchlich,
noch rechtens wäre, in solchen fällen die zinsen
anzuschlagen oder abzufordern", erklärte
sich aber im Juli 1614
140
) doch zur
Zahlung bereit.
An diese Abrechnung knüpften sich noch andere Ausgleiche 141 ) für "ausrichtungen" von Fürstlichkeiten, Verbesserungen der Gebäude usw., wobei wiederholt Meinungsverschiedenheiten hervortraten. So wollte z. B. Adolf Friedrich an einer Ausrichtung Hans Albrechts für den Kurfürsten von Brandenburg, dessen Gemahlin und den Herzog von Braunschweig nicht teilhaben. Diese hätten nicht allein, ohne ihn 142 ) "drumb im geringsten


|
Seite 225 |




|
ersuchet und belanget" zu haben, was ihm sehr "befrembd" vorgekommen, in seinem Amt Wredenhagen "Abfuhren" gefordert und noch dazu während der Ernte und dadurch das Amt "sehr beschwert", sondern wären auch garnicht von ihm, sondern nur von Hans Albrecht eingeladen gewesen und hätten auch diesen allein besucht. Dieser Ausgleich zog sich lange hin, besonders weil keiner recht wußte, wie hoch er die einzelnen Sachen veranschlagen sollte, und daher möglichst zuvor die Taxe des andern zu erfahren 143 ) suchte. Im Laufe des Jahres 1615 aber wurde auch diese Angelegenheit in der Hauptsache geregelt. 144 )
Unterdessen machte Adolf Friedrich neue Versuche, die Totaldivision in die Wege zu leiten. Hans Albrecht aber zeigte, wie gesagt, trotz seines Reverses nicht die geringste Lust, ihm darin zu willfahren, sondern suchte die Sache hinzuziehen. Schließlich in die Enge getrieben, bestätigte er, daß er das, was er vereinbart hätte, "dergestalt wie es formaliter beliebet", 145 ) auch halten würde. Hierin erblickte Adolf Friedrich natürlich wiederum einen Versuch, die gänzliche Teilung zu umgehen. Erst nach erregtem Schriftwechsel erhielt er das Versprechen, daß der Revers "nicht aus seinem rechten teutschen verstande" gezogen werden sollte. Zeigte Hans Albrecht so am Anfang schon, daß er der Totaldivision auf jede Weise Hindernisse in den Weg stellen wollte, so verfolgte er diese Verschleppungspolitik 146 ) umsomehr, je mehr die Teilung sich der Verwirklichung näherte. Ihn leitete darin vor allem sein Kanzler Dr. Ernst Cothmann, auf dessen Intentionen er ohne weiteres einging. Man kann es diesem sicherlich hochbefähigten Manne ,nicht verdenken, wenn er der Totaldivision entgegenarbeitete, denn in seinem Gutachten, 147 ) das er Hans Albrecht am 1. März 1612 übersandte, in dem er


|
Seite 226 |




|
genau abwog, was für und wider die Totaldivision sprach, waren nur neun Gründe dafür, achtzehn aber dagegen. Sehr einleuchtend war besonders der zweite Grund, den er gegen die Teilung anführte, daß sie oft versucht, aber nie vollführt worden wäre. Daher durfte er seinen Einfluß gegen die Totaldivision mit Recht geltend machen, aber nicht edel war es, daß er dem jugendlichen Fürsten in seinem Bedenken vom 1. März 1612 hinsichtlich der Totaldivision den Rat gab, 148 ) er sollte zunächst "darauf zugehen, damit der anfang von Adolf Friedrichs f. g. gemacht werden möge und also E. f. g. anfänglich erwartet hätte, was derselbe zu behauptung der totaldivision für= und beibringen lassen wird, . . . [dann] hätte E. f. g. dawider nun zu fernerm und besserm nachdenken obermeldter sachen difficultäten und beschwerungen . . . anzuzeigen! . ." Diesen Ratschlägen folgte Hans Albrecht und befahl auch seinen Räten, in diesem Sinne zu handeln, als sie mit den Abgeordneten Adolf Friedrichs zu der ersten größeren Beratung über die Teilung der Ritterschaft und Städte zusammenkamen. Am 27. und 28. März fand diese zu Sternberg statt. Als Hajo von Nessen sich erbot, Adolf Friedrichs "Bedenken", wie es verabredet war" gegen die Hans Albrechts auszutauschen und sich daraufhin weiter mit ihnen zu (vergleichen, erklärte Cothmann, 149 ) daß sie solche nicht übergeben könnten. Vielmehr wären sie dem Reverse gemäß der Meinung, "daß herzog Adolf Friedrichs f. g. dies werk fürnehmlich treiben würden, und daß herzog Hans Albrechts f. g. nur rat und that hierzu geben sollten". Da die Verhandlungen somit ergebnislos verliefen, versuchte Adolf Friedrich mit Bitten zu erreichen, was er durch rechtmäßige


|
Seite 227 |




|
Forderung nicht erlangen konnte. Am 20. April 1612 verstand er sich zu folgendem flehentlichen Bittschreiben an seinen Bruder: 150 )
"Freundlicher lieber bruder! Ich vermerke aus Deinem schreiben an mich, 151 ) auch aus dem sternbergischen gehaltenen protokollo, 152 ) daß dem assecurationsrevers 153 ) will eine andere glossa zugesetzt werden, als der teutsche verstand ist. Und mochte wohl der bruder solch protokoll, dies schreiben und den assecurationsrevers gegeneinanderhalten, ich bin der opinion, sollte dieser assecurationsrevers auch auf alle der welt universitäten verschickt werden, es würde ihn keiner so verstehen, wie ich ihn zu verstehende haben soll, man mir beibringen will. Ich muß es dahin deuten, daß leute [Cothmann!] begehren dergestalt die sachen ins weite feld zu treiben . . ., wie Unserm eltervater, auch großvater geschehen, bis Unser einer stirbet. Gott weiß, ich begehre nicht, als brüderlich mit Dir zu traktieren, sehe auch keinen furteil an, wüßte auch nicht, worin er stecken sollte, und wollte nur wünschen, Du mir anderwärts könntest abfinden, ich wollte des wesens lange absein. Einmal kann und will ich in dem gemenge nicht länger sein, auch so nicht mehr arbeiten, einem andern vor. Was hab ich davon, daß ich der älteste bin, nicht mehr, als daß alles auf mich soll geschoben werden. Ich soll es machen, ein ander will mich corrigieren. . . Ich wüste nicht, was brüderlicher sein kann, als wann ich meinem bruder mein bedenken gebe, er mir seines hinwieder, darum ich nochmals brüderlich bitte, er sich dieses nicht wegern und diese sache mit mir mit fleiß treibe, dann sie so schwer nicht ist, wie man vermeinet. Ich halts dafür, daß land und leute niemals sein mit der wage von einander gewogen, wird man auch kein fürstentum so geteilet finden, daß nicht dem einen oder andern teil was mangelt. Wann mein bruder der opinion wie ich, mir deucht in einem tage sollte es wohl unter Uns de modo können richtig werben. Also wird sich mein bruder ungezweifelt accommodieren". Solchen Bitten konnte und durfte Hans Albrecht nicht widerstehen, wollte er nicht den Verdacht auf sich lenken, daß er die Sache absichtlich aufhalte. Er erklärte sich also bereit, seine Räte mit seinem "Bedenken" zum 2. November wiederum nach Sternberg zu schicken.


|
Seite 228 |




|
Adolf Friedrich, hierüber hoch erfreut, lud ihn darauf am 22. Oktober 1612 154 ) mit seiner Gemahlin auf Martini=Abend ein mit der Bitte, ihm die Martinsgans verzehren zu helfen. Und nicht umsonst war diese Nachgiebigkeit und Höflichkeit. Am 2. November 155 ) wurden die versprochenen "Bedenken" übergeben. Somit war der erste Schritt in dieser Sache getan.
Aber nur zu bald gelang es Cothmann, Hans Albrecht wieder in sein Fahrwasser zu lenken. Am 7. Januar 1613 zeigte er ihm, welchen Fehler er begangen hätte. Bisher wäre es seine (Hans Albrechts) Meinung gewesen, Rostock und Wismar, das Hofgericht, die Akademie, das Konsistorium und die Klöster auf keinen Fall zu teilen. Nun aber müßte er zu seiner Verwunderung bemerken, wie Hans Albrecht plötzlich "von dieser meinung ohne einige ex adversis angezeigte motiven abstehe und einen neuen, weiteren modus dividendi durch eine spezialinstruction an die hand gebe. Ich bin der meinung," schrieb er, "daß E. f. g. es bei Ihrem vorigen fürschlage zu lassen haben." Ja, er unterfing sich sogar, seinen früheren unwürdigen Ratschlägen entsprechend, den Vorschlag zu machen, mit der Teilung nochmals von vorne anzufangen und vor allem zu beraten, ob die Totaldivision denn überhaupt vorzunehmen sei. Seine Meinung wäre, "daß solch pactum und vereinigung pro personali pactione geachtet und bloß 156 ) allein auf Euer ff. gg. beide person gedeutet [werde], und daß dasselbige auf die subditos, qui inviti dismenbrari non possunt!, nicht gezogen, noch extendiert werden könne". Hans Albrecht hatte für diese Einflüsterungen ein nur allzu geneigtes Ohr, als daß er sie unbeachtet lassen konnte. So kam es, daß sich das Verhältnis der Fürsten bald wieder trübte.
Am 2. März 1613 fand eine neue Verhandlung zu Sternberg statt, nachdem Adolf Friedrich sich vorher 157 ) von seinen Räten Bolrath von der Lühe zur Schulenburg, Hans Christoph von Jasmund zu Cammin, Elias Judelius und Heinrich von Husan auf Tessin ihre Meinung über die Totaldivision hatte mitteilen lassen. Die Deputierten überreichten einander die von ihren Fürsten


|
Seite 229 |




|
erhaltenen Instruktionen. Nach Verlesung derselben 158 ) aber erkannten Adolf Friedrichs Räte, daß Hans Albrecht ihnen nicht im" geringsten damit an die Seite ging, sondern daß in seinem "Bedenken" kaum andres als Fragen enthalten waren. Als sie sich hierüber beschwerten, machten Hans Albrechts Abgeordnete nach Cothmanns Rat die Einwendung, es wäre überhaupt noch. ganz unzeitgemäß, jetzt schon über den Modus der Teilung zu beraten, man sollte sich erst vergewissern, ob sie überall möglich wäre. Diesen Vorwurf wies Adolf Friedrich energisch zurück, indem er antwortete, daß man über die Art der Teilung überhaupt nie zu früh und zu viel beraten könnte. Was die Totaldivision selbst anbeträfe, so wäre sie möglich, wenn man nur den festen Willen zu teilen hätte. Im übrigen verwies er auf den Revers. Zugleich forderte er am 4. März von Hans Albrecht eine runde Erklärung, ob er die Totaldivision ernstlich treiben wollte oder nicht. Dieser erwiderte, daß er es für dringend notwendig hielte, bei der Teilung auch "auf das ende zu schauen," ob sie überhaupt möglich wäre oder nicht. Er versprach aber schließlich, 159 ) "zu der totaldivision rat und that zu geben . . ., wann zufoderst . . . communication gehalten wird, wie . . . denen dieserseits angedeuteten difficultäten . . ., auf den fall, da dieselben [von den Ständen] opponiert werden sollten, zu begegnen und gebührlichermaßen abzuschaffen sein mögen".
Die Hauptschwierigkeiten, die seiner Meinung nach dem Teilungswerk entgegenstanden, ergaben sich aus der Gemeinsamkeit des Hofgerichts, des Konsistoriums, der Universität und der obersten Appellationsinstanz, woran die Fürsten nach dem Assekurationsrevers nicht rütteln durften. - Über diesen Revers setzte sich Adolf Friedrich jedoch leicht hinweg, man brauche sich "darum weiter nicht zu bemühen!" Er wollte ein eigenes Hofgericht haben und seine Ritterschaft und Städte so "traktieren", daß sie mit der Administrierung der Justiz zufrieden wären. Ebenso beanspruchte er sein eigenes Konsistorium. Die Universität sollte dem allein gehören, dem die Stadt Rostock zufiele - die Abfindung des andern Teils ließ er unerwähnt -, und "der episcopus" und die Akademie sollten künftig ihre Appellationen statt an das Land= und Hofgericht 160 ) an den Fürsten richten, dem sie unterständen.


|
Seite 230 |




|
Trotz dieser und andrer, immer neu auftauchender Streitpunkte gediehen die Verhandlungen dank dem zähen Festhalten Adolf Friedrichs an seinem Plane doch allmählich weiter. Endlich war man soweit, daß man an die Aufstellung der erforderlichen, Instruktion schreiten konnte. Vor allem war darin die wichtige Entscheidung zu treffen, wie der Adel geteilt werden sollte. Es handelte sich um die Teilung nach Roßdiensten, Hufen oder Aussaat. Von der Berechnung nach Roßdiensten wurde den Fürsten von ihren Räten allgemein abgeraten, weil sie zu ungenau wäre, 161 ) aber auch mit den Hufen war es nicht anders, gab es deren doch dreierlei: die Heger=, Land= und Hakenhufen, 162 ) von denen die ersteren 60, die andern 30, die letzten 15 Morgen groß waren. In der Instruktion einigte man sich schließlich dahin, daß der Adel 163 ) nach Hufenzahl und Aussaat geteilt und dabei die Güte der Äcker und die Ungleicheit der Hufen, soviel wie irgend möglich, in Acht genommen werden sollten. Am 24. März 1613 kam schließlich die "einhellige" Instruktion für die Teilung der Ritterschaft, der gemeinen Klöster und der geistlichen und Allodialgüter zustande. 164 ) Es wurde den Deputierten aufgetragen, 165 ) die alten und neuen "Reichs= und Landhülfenregister" nachzusehen und zu vergleichen und darnach einen Überschlag zu machen, wieviel ein jeder Lehngutsinhaber und seine Vorfahren an Reichs= und .Landsteuern nach Anzahl seiner eigenen und seiner Bauern Hufen gegeben hatte, und wieviele Bauernhufen bei jedem Gut gelegen waren. Nach dieser Aufstellung sollten sich die Deputierten in die Ämter selbst begeben und von den Beamten ein richtiges Verzeichnis fordern über den ganzen Adel und seinen und seiner Bauern Besitz. Dies Ergebnis sollte dann mit dem Auszug aus den Registern verglichen und eventuelle Unterschiede und die Gründe derselben hierin vermerkt werden.


|
Seite 231 |




|
Ferner wurde bestimmt, daß die Deputierten auch die Allodialgutsbesitzer, die Pfandinhaber und diejenigen, "Erbjungfern gefreit" hätten, einzeln auf das Rathaus der im betreffenden Amte gelegenen Stadt laden und sie, wenn es noch nicht geschehen war, vereidigen und bei Androhung des Verlustes ihrer Güter bezw. ihres Pfandschillings zur wahren Aussage darüber ermahnen sollten, wieviel Hufen sie selbst und ihre Bauern hätten, wie groß die Aussaat und wie die Beschaffenheit des Bodens wäre. Diese Angaben wären dann ebenfalls mit dem aufgestellten Extrakt der Beamten zu vergleichen. Wenn aber die Besitzer außer Landes wären, wie z. B. die vieler geistlicher Allodialgüter, und somit schwerlich zu zwingen, persönlichen Bericht zu erstatten, so sollten die Deputierten bei den Bauern, die zu den betreffenden Gütern, gehörten, Erkundigungen einziehen. Wegen der Klöster wäre in gleicher Weise von den Provisoren und Pröpsten derselben Auskunft zu fordern.
Hätten sie alle diese vorbereitenden Arbeiten beendet und die neuen, "durch Abtreibung von Bauern" entstandenen Rittersitze und Lehngüter, die dem Adel neuerdings erst verkauft oder geschenkt worden wären, genügend berücksichtigt, so sollte aus allen Protokollen ein Überschlag über die Hufen und die Aussaat aller Güter eines jeden Amtes gemacht, diese darauf gegeneinander gehalten und dann ein sich dabei erweisendes Defizit des einen oder anderen Amtes ausgeglichen werden. Den beieinander liegenden Familienbesitz sollten die Deputierten nicht auseinanderreißen, auch solche, die die gesamte Hand hätten, mit ihren Gütern möglichst unter einem Herrn belassen und ebenso den Adel mit der Kirche, über die ihm das Patronat zustände.
Gleichzeitig mit Fertigstellung dieser Instruktion erging im Namen der Herzöge an alle Amtleute der Befehl, die erforderlichen genauen Erkundigungen über Hufenzahl und Beschaffenheit der Güter einzuziehen. Ebenso wurde jedem Ritter aufgetragen, die Hufenzahl seines Gutes anzugeben, und, falls sie ihm unbekannt wäre, sein Land neu aufmessen zu lassen. Auch sollte er sich in den nächsten sechs Wochen "zu Hause halten" und den Deputierten, die ihn in dieser Zeit vor sich fordern würden, der Wahrheit gemäß Auskunft geben.
Die Ritter aber mußten lange warten, bis die Deputierten, kamen, denn bevor diese noch ans Werk gehen konnten, loderte der langverhaltene Streit wegen jener obenerwähnten drei Unklarheiten des Fahrenholzer Vertrags auf. Die Verhandlungen hatten sich so zugespitzt, daß Adolf Friedrich sich nicht eher auf


|
Seite 232 |




|
weitere Verhandlungen einlassen wollte, bis jene Punkte geregelt wären.
Ja, er drohte sogar den Vertrag von Fahrenholz wieder umzustoßen und, sich auf das Testament seines Großvaters Johann Albrechts I. berufend, diesem Geltung und sich allein die Regierung zu verschaffen. 166 ) Mit Recht 167 ) bestand er am 16. März 1613 168 ) vor allem darauf, daß Schwerin und Güstrow nicht als geteilt angesehen würden.
Von den zur Ämterteilung zugezogenen Räten Lühe, Moltke, Regendank und Meier forderte er Bericht, ob damals Güstrow, Schwerin, Laage und Krakow mit in die Teilung gebracht wären. Diese erklärten einhellig, daß sie die beiden Ämter Schwerin, und Güstrow , wohl verglichen und dabei genau bestimmt hätten, was davon dem künftig darin residierenden Herzog allein zufallen sollte, von einer Teilung aber wüßten sie nichts. Nur, um die Einkünfte der beiden Ämter auszugleichen, wären die Orbören aus Laage und Krakow zu Güstrow gelegt worden, nicht aber als eine der Stadt gehörige Pertinenz, wie nach Hans Albrechts Behauptung.
Auch aus dem Vertrag selbst, den Protokollen und den täglichen Berichten der Deputierten über die Verhandlungen suchte Adolf Friedrich seinem Bruder darzutun, daß von der Teilung dieser Städte keine Rede sein könnte. Die Deputierten wären, wie aus ihrer Instruktion ersichtlich, zu solchem Handeln auch nicht bevollmächtigt gewesen.
Erst nach einem Vierteljahre ließ Hans Albrecht hierauf Adolf Friedrich seine Antwort zugehen. 169 ) Seines Bruders


|
Seite 233 |




|
Meinung gerade entgegen hielt er jene Städte für geteilt und Laage und Krakow für Pertinenzien von Güstrow. Deswegen dürfte "keine laesion 170 ) angezogen werden, weil das ganze werk auf das loos gesetzt, und daher E. L. auch dieser güstrowsche anteil, wann es Gottes wille gewesen, hatte zukommen können, auf welchen fall E. L. sich dabei auch ohne allen zweifel würden geschützt und, daß wir dagegen mit dem schwerinschen teil content sein sollten, erkläret haben". Aber auch, wenn er diese Tatsache ganz beiseite ließe, müßte ihm Güstrow mit seinen Pertinenzien allein zustehen, da er doch nach Abschluß des Vertrags von 1611 ohne einen Widerspruch Adolf Friedrichs Güstrow an sich genommen ,und somit alle "actus possessorios" ein Jahr hindurch ausgeübt hätte. Schon dadurch allein wären die Städte in seinen vollkommenen Besitz übergegangen. Sollte aber Adolf Friedrich trotzdem auf seiner Behauptung bestehen, so wäre die Sache ja "leichtsam" durch den Erbvertrag und seine darin angeordneten "weg und mittel beizulegen. - Während die Verhandlungen über diesen Punkt hin= und hergingen, war auch die zweite Streitsache, betreffend das Kröpeliner Heuerkorn, akut geworden. Es handelte sich hier um eine Abgabe von 57 Drömt Hafer, die Kröpelin alljährlich zu Lichtmessen an das Kloster zu Doberan als Pachtzins für vor langen Jahren überlassene Ländereien zu zahlen hatte. Diese Abgabe war bei der Abschätzung 1610/11 von den Deputierten nicht als eine Hebung "ratione servitutis alicuius", sondern als eine Hebung "ratione domini agrorum" angesehen und deshalb nicht in das Register der "Hebungen des Amtes Doberan aus dem Amte Schwaan", zu dem Kröpelin gehörte, eingetragen worden.
Als nun die Ämter geteilt wurden, nahm Hans Albrecht das Kröpeliner Heuerkorn für sich in Anspruch. Er berief sich auf das Register der Hebungen, nach dessen Angaben Kröpelin nicht verpflichtet, war, solches an Doberan zu geben. Es käme der Paragraph des Erbvertrages in Betracht, "daß nämlich die hebungen, weIche einer aus des andern ämtern gehabt, hinfüro bei einem jeden amte bleiben sollten. 171 ) Da aber sich befinden sollte, daß das eine oder andere . . . aus dem gemenge nicht gebracht . ., so sollte daher kein streit erreget" werden. Adolf Friedrich machte hiergegen aber Einwendung und zeigte,. daß es sich gar nicht um eine Hebung aus dem Amte Schwaan, sondern um einen Pachtzins handle, dessen Ausgleich von den Deputierten


|
Seite 234 |




|
vergessen sei. Schon aus dem Namen Heuer= oder Hurkorn 172 ) ginge hervor, daß die Kröpeliner verpflichtet wären, Ackerzins zu zahlen. Denn der Acker wäre nicht ihr Eigentum, kein Mensch gäbe Zins oder Hure von einem Acker, der ihm selbst gehörte, sondern es wäre ein Stück Land, das ihnen aus dem Amt Doberan zur Pacht überlassen wäre. Daher wäre der Paragraph des Erbvertrages einschlägig, "daß das, was dem einen oder andern amt in specie zugeschlagen ist, dabei gelassen werden soll". 173 ) Hans Albrecht aber bestritt, daß diese Abgabe der Kröpeliner ein "Ackerzins" wäre, und bat, ihm doch zu zeigen, von welchem Acker denn solch Heuerkorn gegeben würde. Wie sehr Adolf Friedrich sich auch bemühte, dies nachzuweisen, so kam er in seinen Nachforschungen schließlich doch nicht weiter, als festzustellen, daß das Heuerkorn 174 ) "von etlichem acker, so nicht weit von der stadt, nahe bei den vogelstangen nach Brüssow [ = Brusow] zu belegen", nach Doberan gegeben würde.
Mit dieser ungenauen Erklärung war Hans Albrecht nicht zufrieden, er blieb daher bei seiner Behauptung, das Heuerkorn wäre eine Hebung, die nach nunmehr vollzogener Teilung gemäß dem von ihm angezogenen Paragraphen des Erbvertrags in Wegfall gekommen sei. Um endlich den Streitigkeiten ein Ende zu machen, einigten sich die Herzöge am 28. Januar 1614 - Adolf Friedrich hatte sich schon am 2. August dazu bereit erklärt -, die Entscheidung über die fraglichen Punkte des Fahrenholzer Vertrages "auf einem gewissen veranlassungsprozeß", d. h. in erster Instanz durch "vier Unparteiische vom Adel 175 ) aus ihren Lehnsleuten" 176 ) herbeiführen zu lassen. Bevor dieser Prozeß begonnen hatte, forderte Adolf Friedrich unzweifelhaft in der Absicht, um seine


|
Seite 235 |




|
Anrechte auf die Mitherrschaft in Güstrow noch zu verstärken, von dem Rat der Stadt eine "Losierung" oder ein Gewölbe zu sicherer Aufbewahrung von Geldern auf dem Rathause. 177 ) Aber Hans Albrecht durchschaute die Absicht und verbot, "weil wir Uns eben 178 ) befahren müssen, daß daher ein actus possessorius in dem bevorstehenden veranlassungsprozeß gegen Uns angezogen werden möchte", dem Rat, dem Befehl seines Bruders nachzukommen. Infolgedessen wurde Adolf Friedrichs Forderung abgelehnt. Dieser war darüber aufs äußerste empört. 179 ) In seinem Schreiben an den Rat 180 ) warf er ihm nicht nur Ungefälligkeit, sondern auch gröbste Verletzung des Gehorsams vor, den sie ihm "mit ausgestreckten armen und fingern" durch "einen leiblichen Eid" beschworen hätten, und stellte ihnen anheim, sich mit ihm "in öffentliche contradiction" zu setzen. Auch seinem Bruder schrieb er in diesem Sinne und wollte damit dessen Verbot "feierlich und ausdrücklich" widersprochen haben.
So traten die Fürsten unter Aufhetzung ihrer Untertanen im eigenen Lande öffentlich gegeneinander auf. Traurigere Früchte konnte wahrlich die gemeinsame Regierung nicht zeitigen, auch in keiner Weise dem Testament Johann Albrechts I. mehr Hohn gesprochen werden! Unwillkürlich wird man dabei an das Schreiben dieses Fürsten erinnert, das er am 5. Januar 1566 an seinen Bruder Ulrich richtete. 181 ) Auch damals waren die Untertanen mutwillig und frech, von Pommern, Sachsen und Brandenburg wurden die mecklenburgischen Grenzen geschmälert. Am Kammergericht waren aus keinem Lande mehr Sachen anhängig als aus Mecklenburg, und gerade diese wurden am meisten verschleppt. Alles die Folgen der unseligen gemeinsamen Regierung! Ebenso traurig, in Anbetracht der gefährlichen Zeiten vielleicht noch schlimmer, waren die Verhältnisse jetzt. Mochte nun Hans Albrecht II. zu der Einsicht gekommen sein, daß er ein weiteres Festhalten an seiner Politik eventuell mit seinem und des Landes Ruin bezahlen müßte, mochte ihm das Verhältnis zu Adolf Friedrich auf die Dauer unmöglich erscheinen, oder glaubte er, seine später näher zu betrachtenden Religionsbestrebungen mehr fördern zu können, wenn er Cothmanns Bahnen verließ, jedenfalls


|
Seite 236 |




|
konnte man von dieser Zeit an eine gewisse Schwankung in seiner Politik wahrnehmen.
Als die Räte der Fürsten am 16. April 1614 wiederum zu einer Beratung über die Beilegung der Streitigkeiten zusammenkamen, ließ Hans Albrecht vorbringen, 182 ) da ihm zu Ohren gekommen, Adolf Friedrich ,hätte sich der Teilung begeben, so bäte er, damit man doch endlich zum Ziel gelangte, ihm entweder das Gegenteil zu beweisen oder seinen Revers zurückzugeben. 183 )
Aber trotz dieses Einlenkens von seiten Hans Albrechts war man von einer tatkräftige Förderung versprechenden Einigung noch weit entfernt. Alle Verhandlungen der Räte fruchteten nichts, da keiner der Fürsten an ein Nachgeben dachte. Im Gegenteil befahl Adolf Friedrich am 28. Juni 1614 184 ) dem Stadtvogt von Güstrow, der sich mit dem Rat daselbst, wegen der Jurisdiktion in Verhandlungen einlassen wollte, "auch nicht in Adolf Friedrichs Namen das Gericht abhielt", bei Androhung harter Strafen, sich "solcher gütlichen Handlungen" zu enthalten. Auch Hans Albrecht trieb es jetzt ärger denn zuvor. 185 )
Noch stärker gerieten die Fürsten aneinander, als Adolf Friedrich dem Rate zu Güstrow unter Erinnerung an den ihm in der Huldigung geleisteten Eid befahl, einen Rüstwagen mit vier Pferden für eine Reise ins Ausland (nach Pommern) "auszustaffieren". Die Güstrower, denen die Erfüllung dieser Pflicht und für sich schon nicht angenehm war, die Forderung auch eine Verletzung ihrer Privilegien zu sein schien, erinnerten sich an Hans Albrechts Gebot, ohne sein Wissen keinen Befehl seines Bruders auszuführen, und trugen ihm die Angelegenheit vor. Was sie erwartet hatten, geschah. Der Herzog verbot ihnen nicht nur, Adolf Friedrichs Befehl nachzukommen, sondern versprach ihnen auch, falls dieser "via facti" gegen sie vorginge, ihnen Schutz zu gewähren. Als Adolf Friedrich sich wiederum getäuscht sah, sandte er einen schweren Drohbrief nach Güstrow: "Wollen 186 ) demnach dergleichen nichtiger excusationes und entschuldigungen


|
Seite 237 |




|
garnicht, sondern vielmehr gebührender parition Unser rechtmäßigen befehlichen von Euch unnachlässig gewärtig sein, in dero verbleibung aber Euch für treu= und eidsvergessene achten und halten und solches durch öffentlichen anschlag hiezugehöriger mandaten zu männiglichs wissenschaft publicieren, und über das die von Uns Euch erteilte confirmation für privilegien, deren, ihr euch durch vergessentliche hintansetzung mehrberührter Pflicht verlustig gemacht, hinwieder cassieren und aufheben".
Jetzt wurden die Güstrower ängstlich. Sie beteuerten, 187 ) daß sie wohl gehorsam sein wollten, aber gegen Hans Albrechts Gebot nicht handeln könnten. Er hätte die Macht in Händen, da er mit ihnen in einer Ringmauer wohnte. Gegen die Drohung Adolf Friedrichs aber legten sie feierlichen Protest ein und schlugen ihm vor, ihnen gemäß der Reichskonstitution drei Fürsten zu präsentieren, von denen sie einen auswählen wollten, damit er die Sachen entschiede. Bis dahin baten sie ihn, sich von der via facti fernzuhalten. Am 26. Juni 1615 188 ) forderte Adolf Friedrich von der ganzen Bürgerschaft Güstrows "nochmals und endlich bei voriger commination" eine präzise Antwort, "ob sie seinen befehlen gehorchen wollten". In vierzehn Tagen erwartete er ihre Erklärung. "Wann dieselbige der gebühr erfolget . ., soll ihren untertänigen suchen stattgegeben und, was des heiligen römischen reiches constitutiones . . . besagen, unverlängt verfüget . . . werden". Die Güstrower versprachen, 189 ) daß sie seinen Befehlen gehorchen wollten, soweit es ihnen möglich wäre.
Da Adolf Friedrich sich jeglichen Schriftwechsel verbeten hatte, sandte Hans Albrecht am 7. Juli 1615 die beiden Landräte Abraham von Winterfeld und Gebhard von Moltke 190 ) zu ihm. Sie sollten "vernünftig und reiflich" über Güstrow und Schwerin verhandeln, damit er sich endlich, wenn es nicht erwiesen würde, daß bei Güstrow noch etwas ungeteilt wäre, in Ruhe seines Besitzes erfreuen, andernfalls ein Prozeß schleunigst Klarheit schaffen könnte. Da Adolf Friedrich nun seinerseits wieder Bedenken trug, Hans Albrecht in einem Schreiben zu antworten, so sandte er an Nessen seine "endliche erklärung in forma instructionis", damit er sie den in Rostock versammelten Räten Hans Albrechts mündlich vortragen sollte. Er blieb dabei,


|
Seite 238 |




|
Güstrow, Schwerin, Krakow und Laage wären ungeteilt, außer in den Punkten, die durch den Erbvertrag spezifiziert wären. So scheiterte auch dieser Einigungsversuch. Hoffte Adolf Friedrich nun doch noch einen "actus possessorius" für sich gewinnen zu können, oder war es Zufall, jedenfalls rief Mathias von Linstow zu Bellin 191 ) in einer Geldforderung an den Güstrower Bürger Sebastian Leupold die Hilfe Adolf Friedrichs an und erwirkte in der Schweriner Kanzlei "promotoriales um rechtshilfe an den rat zu Güstrow". Dies erfuhr Hans Albrecht und ließ, weil er wohl annahm, daß es ihm zum Hohne geschehen wäre, vielleicht auch fürchtete, daß Adolf Friedrich hieraus möglicherweise einen "actus possessorius" ableiten könnte, von Linstow "die faust nehmen" und verurteilte ihn zu 1500 Taler Strafe, an deren Stelle er dessen Haus in Güstrow einzog. Dieser Vorfall setzte natürlich von neuem böses Blut unter den fürstlichen Brüdern. Erhöht wurde Adolf Friedrichs Zorn noch, als sein letzter Versuch, den Bürgermeister von Güstrow, Dr. Martinus Gerdes, an seinen Hof zu Schwerin zu laden und damit in seine Gewalt zu bringen, mißlang. Dieser war nämlich klug genug, Hans Albrecht den Befehl vorzulegen, der natürlich sofort die Reise untersagte. Gerdes entschuldigte sich, 192 ) nicht kommen zu können, wenn er sich nicht in die größten Ungelegenheiten stürzen wollte, und erschien nicht. So hatte also Adolf Friedrich alles mögliche versucht, ohne etwas zu erreichen. Selbst der Veranlassungsprozeß wollte, zumal allerhand Störungen 193 ) vorkamen, nicht rechten Fortgang nehmen. In der Angelegenheit standen sich die Meinungen der Parteien schroff gegenüber. "Der produzierte erbvertrag" 194 ) wurde "von einem teile so, vom andern teile anders in unterscheidlichen paragraphis interpretiert". Die Deputierten erklärten schließlich, es wäre für sie, die "die angezogenen iura nicht studieret, eine wahre unmöglichkeit gewesen, diese sache zu decidieren", und baten die Fürsten, die Angelegenheit einer "Juristenfakultät" zu übertragen. Aber Adolf Friedrich wollte davon nichts wissen, damit nicht ihre


|
Seite 239 |




|
"brüderlichen erbverträge an andern auswärtigen örtern kund" würden. Er forderte, daß die Deputierten ihrem Eide gemäß entscheiden sollten, "was recht ist". 195 )
Am 2. Dezember 1614 gab er jedoch nach: die Akten wurden der "Juristenfakultät" zu Frankfurt a. O. übersandt. In dem Gutachten, das diese erteilte, wurde die Sachlage genau erörtert. 196 ) Für Hans Albrecht spräche zwar der Erbvertrag, doch dürfte man die Worte, nach denen alle Kommunion aufgehoben sein sollte, nicht zu stark betonen, sondern sollte vielmehr bedenken, daß man "in actione bonae fidei, als nämlich familiae herciscundae" wäre, "in welchen man nicht sogar genau auf den worten liegen, sondern dasjenige in acht nehmen muß, was der billigkeit auf sich selbst gemäß ist, wie denn auch dieser handel zwischen brüdern und zwar fürstlichen personen vergangen, in deren contracten und handlungen bona fides vor andern exuberieren . . . , und ist in allen dergleichen fällen dieses die beste und gewisseste rechtschnur". Ihr Rat war, die Sache in Güte beizulegen: dem güstrowschen Teil das Heuerkorn zu lassen, weil es dazu gehörte, dem schwerinschen Teil aber auf andere Weise genügende Erstattung zu geben. In Anlehnung an dies Gutachten entschieden die Deputierten, nachdem sie sich zuvor der Zustimmung Hans Albrechts versichert hatten, am 12. Juni 1615 dahin, daß das Kröpeliner Heuerkorn bei den Fürsten zu gleichen Teilen gegeben werden sollte. Ihr Urteilspruch lautete wörtlich: 197 ) "Dieweill [aus] . . . uns übergebenen extracten und unser einkommenen relation wir nicht befinden können, daß dies . . . korn von den domaligen beampten zu Dobberan gedacht, noch in ihren extraeten dessen erwehnett, . . . und also ein unoffenbahrtes stück geblieben, daß derowegen diß streitige Kröpelinsche korn unter beiderseits fürstlichen gnaden zu theilen . . . . Dannenhero auch der erfolgte fürstliche vortragk auf das, was uns nicht offenbahret, nicht kann noch mag verstanden werden, allermaßen wie das wortt des fürstlichen erbvortrags "übergangen" anders nicht verstanden . . ., denn von dem, was von uns Deputierten übergangen, und nicht, was von den beambten in ihren extracten nicht offenbaret worden". - Sie taten damit das Klügste, was sie unter den obwaltenden Umständen tun konnten. Adolf Friedrich aber glaubte, dies Urteil


|
Seite 240 |




|
nicht annehmen zu können und verwarf es. 198 ) Damit waren alle Einigungsversuche gescheitert.
Diese unheimliche Spannung zwischen den Fürsten, der scheinbar unvermeidliche Bruch 199 ) und die Furcht vor dem Kommenden lagerte wie eine drückende Last auf dem ganzen Lande. War doch bei einer weiteren Steigerung der Differenzen die Befürchtung eines tätlichen Angriffs unter den Fürsten nicht unberechtigt. Wenigstens hat Hans Albrecht ernstlich mit einem solchen gerechnet, bezw. sich dagegen zu sichern gesucht. Dies erhellt unschwer aus dem Vorwurf, den ihm Adolf Friedrich wegen seiner Rüstungen machte. Es "ist unleugbar, daß eben fervente illa controversia [d. i. der Streit mit Güstrow], und da der Streit am heftigsten gewesen, die bürger zu Güstrow auch wider ihren willen [?] mit musqueten versehen, zum drillen und waffen abgericht, frömbde soldaten angenommen und auf die bürger, zu deren nicht geringer beschwerung geleget und verteilet worden, welches, daß es nicht zu behuf des kreises, weil die zeit keine einige werbung wegen


|
Seite 241 |




|
des kreises für genommen, sondern einer viel andern intention beschehen, den soldaten vom hauptmann Adam von Köten erteilte paßzettel und der soldaten nach beschehener abdankung gethaner bericht genugsam ausweisen. 200 )
6.
Nun gerieten auch die Stände in Furcht und beschlossen, 201 ) um allen Möglichkeiten vorzubeugen, zwischen den Herzögen zu vermitteln. Sie stellten sieben Deputierte auf' die die Streitigkeiten nach besten Kräften schlichten sollten. Wegen des außerordentlichen Geschickes, mit der sie ihre Aufgabe anfaßten, und wegen des großen Erfolges verdienen ihre Namen besonders genannt zu werden. Es waren: 202 ) die Landräte Henneke von Reventlow zu Ziesendorf und Gebhard von Moltke zu Toitenwinkel, ferner David von Reventlow zum Gnemern, von Rostock der Syndikus Dr. Johann Domann und der Ratsverwandte Jochim Schütte 203 ) und von Wismar der Bürgermeister Dr. Daniel Eggebrecht und der Syndikus Dr. Mattheus Gerdes. 204 ) Diese Unterhändler wandten sich zunächst an Adolf Friedrich. Sie wüßten wohl, so brachten sie vor, "daß man zum ratschlage nicht kommen sollte, man sei dann dazu berufen und erfordert worden", aber trotzdem hätten sie es gewagt, überzeugt von der Uneigennützigkeit ihres Tuns. Sie wären, getrieben von der Sorge um das Wohl des Vaterlandes, gekommen, um die zwischen den Fürsten entstandenen bedrohlichen Differenzen zu beseitigen. Man möchte diese ihre guten Absichten anerkennen und sie nach Kräften unterstützen.


|
Seite 242 |




|
Adolf Friedrich wollte trotzdem anfangs nichts von ihnen wissen. Zu groß war noch sein Zorn über die bewiesene Rücksichtslosigkeit und Starrköpfigkeit der Stände, als daß er ihr Anerbieten sogleich freundlich angenommen hätte. Schließlich aber mochte es ihm doch wohl nicht geraten scheinen, ihre Hilfe abzulehnen. Daher unterdrückte er seinen Zorn, änderte das am 7. April 1616 schon abgefaßte, 205 ) die Unterhändler abweisende (!) Schreiben und hieß sie höflichst willkommen. 206 ) Diese machten sich nun unverzüglich an ihr schweres Werk, und der Erfolg begleitete ihre Tätigkeit. Auf ihre Vermittelungsversuche gab Hans Albrecht in gewisser Weise nach und erklärte sich dazu bereit, seinem Bruder dasjenige von Güstrow abzutreten, d. h. Erstattung für das zu geben, was ihm von Güstrow als offenbar ungeteilt nachgewiesen werden möchte. Im übrigen aber beharrte er noch am 12. Dezember 1616 207 ) auf seiner Meinung, daß die Städte Schwerin und Güstrow geteilt wären. Auf eine so heikle Sache aber, die "indivisa" der Städte anzugeben, wollte Adolf Friedrich nicht eingehen, viel weniger noch etwas von einer Abtretung und Erstattung der ihm in Güstrow zustehenden Rechte wissen. Bis zur Totaldivision sollte es bei den im Erbvertrag festgesetzten Bestimmungen verbleiben.
Auch inbetreff des Heuerkorns war er, wie gezeigt, gänzlich anderer Ansicht als Hans Albrecht und forderte es für sich allein. Wegen des Gutachtens der Universität Frankfurt a. O., auf das sich Hans Albrecht berief, erklärte er, 208 ) daß ihn "weder gelahrte noch ungelahrte und in sonderheit die angedeutete etlicher fürnehmer rechtsgelahrter zensur, wann auch derselben ein ganzer kohlwagen voll wäre", nicht abhalten sollte, die Sache von neuem prüfen zu lassen, "weil man solche zensuren vor geld und nach eines jeden bericht leichtlich erlangen kann". Daher sollten die Unterhändler das Verfahren noch einmal aufnehmen. Ihrem Spruche wollte er sich fügen. Am 19. Dezember 1616 209 ) lenkte endlich Hans Albrecht ein. Die "specifikation der indivisorum" von Schwerin und Güstrow sollte nicht der Stein des Anstoßes sein. Hierin wollte er nachgeben und auch die Division und Erstattung


|
Seite 243 |




|
bis zur Totaldivision dahingestellt sein lassen ; 210 ) "jedoch mit dieser maß: soferne es sich über zuversicht mit berührter tolaldivision über ein jahr verweilen würde, daß alsdann nach verlauf eines jahres der anfang der division an gemeldten städten Güstrow und Schwerin gänzlich verrichtet . . . werden möge". Auch hinsichtlich der Zugehörigkeit der Städte Laage und Krakow zu Güstrow wollte er sich bescheiden, obwohl er sich dabei sehr gut auf Verjährung berufen könnte, wenn ihm die Reduktionsakten - d. h. die alten Teilungsakten, auf die sich Adolf Friedrich berief und nach denen auch bei den früheren Teilungen, besonders zur Zeit Herzog Johann Albrechts I. und Ulrichs, diese Städte niemals als Pertinenzien von Güstrow angesehen worden wären - im Original vorgelegt würden und er daraus erkennen könnte, daß sie damals ungeteilt geblieben wären.
Sehr entgegenkommend zeigte er sich auch hinsichtlich des Kröpeliner Heuerkorns, wo er mit vollem Recht bei dem Urteil der "Kompromissare" und ihren Abmachungen (daß es eben bei diesem Urteil endgiltig verbleiben sollte) hätte verharren können. Er versprach, sich dem Spruch der Unterhändler zu fügen und Adolf Friedrich gegebenenfalls an anderen Orten für das Korn hinreichende Erstattung zu gewähren. Ebenso sollte schließlich die Fischerei auf dem Häger See dem Pastor und Schulzen zu Techentin gestattet werden, wenn ihm die Originalurkunden über diese Gerechtigkeit vorgelegt würden. Ganz richtig meinte Hans Albrechts vertrauter Rat Otto Preen, 211 ) diese letzte Sache wäre überhaupt von "so schlechter importanz", daß Hans Albrecht ohne Bedenken nachgeben sollte, er könnte aber "gewisse ordnung und maaße zu fischen" geben und vor allem sich ausbedingen, daß man es später an anderen Orten ebenso hielte. Über diese glückliche Wendung der Verhältnisse waren die Deputierten hoch erfreut. Sie faßten die Resultate der Verhandlungen in eine "vertragsnotul" zusammen, die sie in zwiefacher Form 212 )


|
Seite 244 |




|
ausstellten und Adolf Friedrich zur Begutachtung bezw. zur Unterzeichnung zusandten. Aber dieser war mit keiner von beiden ganz zufrieden, sondern ließ daran von Hajo von Nessen verschiedene Änderungen vornehmen. 213 ) Und wirklich waren die Verhältnisse nicht so klar, wie es anfangs scheinen mochte. Hans Albrecht hatte ja zwar für Güstrow und Schwerin die Ungeteiltheit an sich schließlich zugegeben, aber damit war noch nicht sicher, daß er auch das, was noch ungeteilt geblieben war, gemein lassen würde, und daß sich die Fürsten über das, was gemeinsam oder geteilt wäre, auch einig wären. Und dies zeigte sich bald. Hans Albrecht folgerte nämlich aus der Einsetzung des Superintendenten und des Stadtvogtes zu Güstrow, die er mit Recht nach dem Erbvertrag beanspruchen konnte, zugleich auch, daß das ius episcopale und die Jurisdiktion 214 ) einem jeden Fürsten in seiner Stadt allein gehörte. Weiter glaubte er auch den Dom zu Güstrow als sein Eigentum ansehen zu können, 215 ) denn wenn auch die Stadt Güstrow gemein wäre, so gehörte doch der Dom, der nicht etwa eine Pertinenz der Stadt wäre, ihm allein. Schon 1556 wäre derselbe im Ruppinschen Machtspruch Herzog Ulrich zugeeignet worden, und dieser hätte 1556 darin für sich allein eine Synode abgehalten, ihn ferner auch aus eigener Tasche restauriert und allein mit Predigern besetzt. Mit dem Dom selbst betrachtete Hans Albrecht auch die Güter und Einkommen desselben als sein Eigentum, denn die zu Güstrow residierenden Fürsten hätten stets die Konfirmation und den Konsens über die Domgüter allein gegeben, immer auch allein die Vorsteher des Doms bestellt und Delikte auf der zum Dom gehörigen "Freiheit" nur von ihren Räten aburteilen lassen.
Adolf Friedrich aber wollte weder die Jurisdiktion noch das ius episcopale und den Dom Hans Albrecht zugestehen. Besonders wegen der letzteren, der "geistlichen" Sachen, entstand ein erbitterter Kampf. 216 )
Unschwer erkennt man den Grund, wenn man den sich immer mehr äußernden Religionsbestrebungen 217 ) Hans Albrechts ge


|
Seite 245 |




|
bührende Rechnung trägt. Die Verhandlungen 218 ) hierüber zogen sich bis zum April 1617 erfolglos hin. Um das Werk möglichst zu beschleunigen, lehnten die Unterhändler jetzt jede schriftliche Verhandlung ab. 219 ) Auch Adolf Friedrich unterstützte dies Bestreben und begab sich, um ihnen weite Wege und Zeitverschwendung zu ersparen, nach dem näher bei Güstrow gelegenen Doberan. Die Unterhändler, die ihrer Anschauung nach durchweg auf Seiten Adolf Friedrichs standen, suchten Hans Albrecht zu bewegen, Adolf Friedrichs Forderungen stattzugeben. Dies Drängen wurde jenem jedoch sehr bald unangenehm. Daher schrieb er an Adolf Friedrich, 220 ) "und wär meins erachtens unnötig, die unterhändler in diesen sachen weiter zu gebrauchen. Es könnten auch so viel desto bequemlicher unsere abgeordenten diener, von unsern mehr und hoher angelegenen sachen betreffend, unterredung pflegen".
Auf diesen unsinnigen Vorschlag ging aber Adolf Friedrich glücklicherweise nicht ein, "in erwägung, daß ja niemals unsere räte in allen tractaten etwas fruchtbarliches ausgerichtet, oder, da ja noch etwas beschlossen, der eine teil es auf weiß, der andere auf schwarz gedeutet".
Unentwegt setzten die Unterhändler unterdessen ihre Arbeit fort. Von Adolf Friedrich aufs kräftigste unterstützt, gelang es ihrem Drängen und Werben schließlich, Hans Albrecht wenigstens in einigen Punkten zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Am 14. Mai 1617 221 ) konnten sie Adolf Friedrich berichten, daß seine Wünsche "auf ihre wiederholte unterthänige bitte hin endlich" zum größten Teil erfüllt wären, nur das ius patronatus zu Güstrow und damit die Gerechtigkeit über den Dom daselbst wolle Hans Albrecht auf keinen Fall abtreten. 222 ) Und in diesem Punkte stellten sich auch die Unterhändler auf die Seite Hans Albrechts. Sie machten Adolf Friedrich auf die Bestimmung des Fahrenholzer Vertrages aufmerksam, daß, wenn etwas, und besonders in Kirchenlehen, übersehen wäre - und wegen des Domes war eben keine besondere Bestimmung getroffen worden -, daß deswegen doch kein Streit entstehen, sondern das ius patronatus bei den Ämtern, darin die Kirche gelegen, verbleiben sollte. Adolf Friedrich aber wollte auch hier wiederum die Sache nicht vom juristischen Standpunkt angesehen wissen, man sollte vielmehr an die Zukunft denken.


|
Seite 246 |




|
Wenn Hans Albrecht der Dom und die Bestimmung darüber allein gegeben würde' so wäre ihm damit auch die Macht gegeben, seiner Glaubensrichtung darin Geltung zu verschaffen. Es wäre aber nicht angängig, daß die größte Kirche der Stadt einer, abgesehen von Hans Albrechts Hose, doch nur kleinen Zahl allein zum Gottesdienste reserviert würde. Diese Befürchtungen waren allerdings berechtigt, und man kann es Adolf Friedrich nicht verdenken, daß er, bevor er sich zu weiteren Zugeständnissen herbeiließ, von Hans Albrecht einen Revers forderte, inbetreff der Religion keine Änderung vornehmen zu wollen.
So wachte er ängstlich über die Erhaltung der reinen Lehre und machte hierin wieder gut, was er, durch die Verhältnisse gezwungen, an dem Testamente seines Großvaters gefehlt. Nicht leicht war sein Kampf mit Hans Albrecht, der die lutherische Lehre aus Überzeugung befeindete. Dieser hatte die kalvinische Lehre in Leipzig und in der Schweiz kennen gelernt. Bald mächtig durch ihre Einfachheit gefesselt, nahm er sie je länger, je mehr in sich auf, und obgleich Mecklenburg ein lutherisches Land war, so entwickelte sich doch auch dort seine religiöse Anschauung immer mehr in der angedeuteten Richtung. Besonders wird dies seinem Verkehr mit dem pommerschen Edelmann Tesmar oder Thersen von Passow 223 ) zuzuschreiben sein, den er in Genf als Kriegsoberst kennen gelernt hatte, und dem er später, als er nach Mecklenburg gekommen war, sein ganzes Vertrauen schenkte. (Er fiel am 25. August 1614 in einem Duell mit Georg Christoph von Rosen bei der Vogelstange vor Tessin.). Ein offener Widerwille gegen die lutherische Lehre zeigte sich bei Hans Albrecht zuerst bei der Taufe seiner ersten Kinder, 224 ) bei der er die Abrenuntiation und den Exorcismus bei Seite gelassen haben wollte. Da er aber nur das letztere bei dem güstrowschen Geistlichen erreichen konnte 225 ) und auch sonst auf Widerstand stieß, nahm er, um seine Wünsche leichter durchsetzen zu können, (am 22. Oktober 1615) den reformierten Theologen Georg Ursinus aus Schlesien


|
Seite 247 |




|
zum Hofprediger an. 226 ) Dieser mußte bei mehreren Gelegenheiten auch im Dom zu Güstrow predigen und 1617 sogar bei dem Tode der Gemahlin Hans Albrechts, der Herzogin Margarethe Elisabeth, die Leichenpredigt halten. 227 )
Diese Übergriffe erregten die größte Besorgnis der Stände. Sie betrachteten sie als Eingriff in ihre privilegierten Rechte: es würden dadurch die landesherrlichen Reversalen vom 4. Juli 1572, nach denen das Land bei der augsburgischen Konfession gelassen werden sollte, gefährdet. Auch Adolf Friedrich stellte sich, wie oben gesagt, auf ihre Seite, denn auch für ihn war das Verhalten Hans Albrechts, abgesehen von allem andern, ein Eingriff in das ihnen beiden gemeinsam zustehende Landesepiskopat. Er forderte, um in Zukunft gesichert zu sein, einen Revers. Nach langem Sträuben kam Hans Albrecht dem Drängen Adolf Friedrichs am 23. Mai 1617 228 ) zu Schwaan nach und gelobte, "daß in den städten und auf dem lande unsers fürstentums keine andere als die bis dahero in den kirchen und schulen unserer lande bekannte und angenommene augsburgische confession und lutherische religion gepredigt und gelehret werden sollte". Er erklärte sich auch bereit, sich der Landschaft gegenüber reversieren zu wollen, sie bei ihrem Bekenntnis zu lassen und "auch inmittelst und bis dahin auf dem lande und in den städten kein anderes fürnehmen oder verhängen zu wollen". Da nun der güstrowsche Dom weder zur Stadt Güstrow gehörte, noch auf dem Lande lag, so war unschwer Hans Albrechts Absicht zu erkennen, 229 ) daß er diese Kirche unter dem allgemeinen Ausdruck nicht mitverstanden wissen wollte. Gegen die Möglichkeit einer solchen Deutung verwahrte sich Adolf Friedrich am 26. Mai zu Doberan durch eine feierliche Protestation, 230 ) daß unter den Worten "auf dem lande und in den städten" auch die Stadt


|
Seite 248 |




|
und der Dom zu Güstrow miteinbegriffen wären. "Daferne aber obbemeldter revers jetzt oder künftig in einen andern verstand, als obstehet, gezogen und in der stadt Güstrow, dem dom daselbst oder sonsten auf dem lande über gute zuversicht änderung in doctrinalibus oder ceremonialibus tentieret werden sollte, daß er sich alsdann des zwischen ihm und seinem freundlichen, lieben bruder itzo gemachten vertrages und aller widrigen deutung berührten reverses ungehindert des juris episcopalis gebrauchen und kraft desselben die neuerungen zu behindern nicht unterlassen will".
Als Hans Albrecht hierauf erklärte, daß er das, was er versprochen hätte, halten wollte, 231 ) unterzeichneten die Herzöge am 29. Mai 1617 einen aus 8 Punkten bestehenden Vertrag 232 ) folgenden Inhalts:
Güstrow und Schwerin sollten gemäß Hans Albrechts Vorschlag vom 19. Dezember 1616, abgesehen von den 1611 schon geteilten Stücken, die genau festgestellt wurden, beiden Fürsten gemeinsam sein, bis man sich wegen der Totaldivision verglichen hätte. Wäre diese jedoch innerhalb Jahresfrist nicht bewerkstelligt, so sollte der Anfang mit der vollständigen Teilung beider Städte gemacht werden. Bis dahin aber hätte Adolf Friedrich in Parchim und Hans Albrecht in Güstrow die Ernennung und Einsetzung der Geistlichen, ebenso auch ein jeder in seiner Residenz die Bestellung der Stadtvögte allein. Der Dom zu Güstrow und seine Freiheit, mit dem ius episcopale, der Jurisdiktion und Verwaltung der Ökonomie sollten Hans Albrecht, wie andrerseits die gleichen Rechte in Parchim Adolf Friedrich allein zustehen. Dagegen sollte, um jeder Ungleichheit vorzubeugen, das ius episcopale und die Jurisdiktion über die Pfarrkirche zu Güstrow beiden Fürsten gemein sein. Abgesehen von den obigen Bestimmungen über den Dom zu Güstrow und die Kirche zu Parchim, sollte überhaupt die ganze geistliche und weltliche Jurisdiktion beiden gleichmäßig zustehen, ein jeder auch dem Superintendenten zu Güstrow und Parchim in der Amtsführung außerhalb seines Wohnsitzes 233 ) und den Stadtvögten zu Güstrow und Schwerin und denen in den andern gemeinen Städten gebieten dürfen. Auch die Streitigkeiten wegen Laage und Krakow wurden jetzt geregelt. Diese


|
Seite 249 |




|
Städte sollten außer den im Vertrage von 1611 Hans Albrecht gegebenen Rechten (der Orbör und den Brüchen in beiden Städten, des Chorgelds, Zolls und der Mühle zu Laage und der Fischerei zu Krakow) beiden Fürsten "pro indivisis" zustehen, bis man sich anders darüber einigen würde.
Betreffs des Kröpeliner Heuerkorns wurde es bei der Entscheidung der Deputierten, daß die Hälfte desselben Adolf Friedrich alljährlich entrichtet werden sollte, belassen, jedoch mit dem Zusatz, daß Hans Albrecht am kommenden Michaelis alles Korn erstatten sollte, was er Adolf Friedrich bisher vorenthalten hatte.
Die Fischereigerechtigkeit auf dem Techentiner=Häger See mußte Hans Albrecht nach Feststellung aus dem Visitationsbuch und Bericht der früheren Beamten zu Neukloster dem Pastor und Schulzen zu Techentin und dem Schulzen zu Hagen zugestehen.
Damit waren nun endlich die Streitigkeiten beigelegt, die, aus dem Vertrag von 1611 entsprungen, 6 Jahre hindurch die Gemüter erregt hatten. Aber in einem Punkte sollte auch der jetzt geschlossene Pakt das Schicksal seines Vorgängers teilen. Abgesehen von einigen die "ausantwortung" von Akten, die "session und direktion bei gemeinen zusammenkünften" und die Holzflößung auf der Elbe, der Müritz und dem Plauer See betreffenden, hier aber weniger oder gar nicht in Betracht kommenden Bestimmungen wurde nämlich hinzugefügt, daß ein jeder Herzog in vier Monaten alles aufzeichnen und dem andern übergeben sollte, was er seit 1611 für das Gesamtwohl "dergestalt ausgegeben und verleget" hätte, daß er dafür Erstattung beanspruchen könnte. Es sollte der eine dem andern dann die etwa vorhandenen Mehrausgaben bar ersetzen.
Dieser Paragraph gab wieder zu langwierigen
Reibereien Anlaß. Als Hans Albrecht nämlich
Adolf Friedrich Ende September 1617
234
)
seine Liquidation in Höhe von 12 016 Gulden 12
ßl. 1/2
 überreicht hatte, antwortete
dieser, daß es ihm nach Revision der einzelnen
Punkte scheinen wollte, als verstände Hans
Albrecht den Paragraphen des letzt geschlossenen
Vertrages dahin, daß nun auch "die alten
rechnungen", die, wie oben erwähnt, 1615 in
der Regelung der Rent= und
Küchenmeisterrechnungen beglichen wären, wieder
"recoquiert"
235
)
werden sollten. Dies wollte er auf keinen Fall
haben und forderte daher ein neues Verzeichnis.
Hans Albrecht kam diesem Verlangen
überreicht hatte, antwortete
dieser, daß es ihm nach Revision der einzelnen
Punkte scheinen wollte, als verstände Hans
Albrecht den Paragraphen des letzt geschlossenen
Vertrages dahin, daß nun auch "die alten
rechnungen", die, wie oben erwähnt, 1615 in
der Regelung der Rent= und
Küchenmeisterrechnungen beglichen wären, wieder
"recoquiert"
235
)
werden sollten. Dies wollte er auf keinen Fall
haben und forderte daher ein neues Verzeichnis.
Hans Albrecht kam diesem Verlangen


|
Seite 250 |




|
am 28. Mai 1618 236 ) nach. Am 7. Januar 1619 waren die Herzöge bis auf zwei Punkte einig. 237 ) Da sie über dieselben kein volles Einverständnis erlangen konnten, beschlossen sie, 238 ) ihre Räte zusammenzuschicken. Aber obwohl Adolf Friedrich dreimal mit Vorschlägen zur Regelung hervortrat und sich Hans Albrechts Wünschen nach Möglichkeit anzupassen suchte, so fand dieser stets neue Einwände. Deshalb gab Adolf Friedrich seine Bemühungen auf und ließ die Sache ruhen. Sie wurde später im Erbvertrage 1621 miterledigt.
Wenngleich der Vertrag von 1617 somit nicht vollständig zum Ziel führte, so wirkte er doch klärend und reinigend auf die Verhältnisse. Jetzt löste sich die beängstigende Spannung zwischen Adolf Friedrich und der Stadt Güstrow. Selbstverständlich mußte er den Güstrowern wie Hans Albrecht Linstow Verzeihung gewähren. Um aber doch eine gewisse Genugtuung zu haben und die Güstrower in etwas seine Macht spüren zu lassen, teilte Adolf Friedrich dem Magistrat mit, 239 ) welche Rechte Hans Albrecht allein an der Stadt hätte, daß alles andere aber mit aller landesfürstlichen Gerechtigkeit, "auch geistlich und weltlich jurisdiktion in der stadt daselbst" beiden Fürsten gemeinsam wäre. Die Güstrower hingegen konnten es sich nicht versagen, ihm in derselben Weise zu begegnen, wie Hans Albrecht es seinerzeit so oft getan hatte, und baten, 240 ) "weil leichtsam etwas vorfallen könnte", was sie nicht verständen, "um genaue spezifikation der punkte, die gemein bleiben sollten". Ärgerlich ließ ihnen Adolf Friedrich antworten, 241 ) daß es der "aus vorwitz oder ander leute getriebe (Cothmann?) gesuchten spezifikation" nicht bedürfe, sie würden aus den divisa wohl die indivisa erkennen können.
7.
Mit Fertigstellung des Vertrages war der erste große Schritt zur Totaldivision getan. Es schien, als sollte sie sich nun in ruhigem Laufe, einem Flusse gleich, der die Stromschnellen nach langem Toben überwunden hat, ihrem Ziele nähern. Doch nur zu bald tauchten neue Hindernisse auf. Drei Klippen waren


|
Seite 251 |




|
es vor allem, an denen die Totaldivision zugrunde gehen sollte: Der kalvinistische Religionseifer Hans Albrechts und das energische Bestreben der Stände, dauernd davor gesichert zu sein, ferner die Schwierigkeit der Teilung von Rostock und endlich die immer drückender werdende unglückliche finanzielle Lage der Herzöge.
Unmöglich war es bei Hans Albrechts tiefwurzelnder Neigung für den Kalvinismus, den wegen der Religion ausgestellten Revers in Adolf Friedrichs Sinne zu halten. Vielmehr muß man annehmen, daß er sich trotz seiner Versprechungen von vornherein bewußt mit dem Gedanken getragen hat, wie es die in dem Revers wegen des Doms enthaltenen Unklarheiten und sodann seine kurze Abfertigung an Adolf Friedrich deutlich erkennen lassen, jenen, wo er nur konnte, zu umgehen.
Mit offener Gewalt war allerdings nicht viel zu erreichen. Daher beschränkte er sich zunächst darauf, im stillen der lutherischen Kirche entgegenzuwirken. Als im November 1617 das Reformationsjubiläum als allgemeines Landesfest gefeiert werden sollte, 242 ) wußte er die deswegen angestellten Verhandlungen - eine einseitige Anordnung der Feier von seiten Adolf Friedrichs ließ ja das gemeinsame Summepiskopat nicht zu 243 ) - geschickt solange hinzuziehen, daß die geeignete Zeit vorüber war, ehe die Beratungen und die daraus entstandenen Streitigkeiten zum Schluß geführt worden waren. 244 ) Und auch dann noch verweigerte er seine Zustimmung. 245 ) "Nun nach verflossener zeit dessenthalben etwas ferner fürzunehmen", wäre seiner Meinung nach unmöglich, weil es "ungleich verstanden" werden könnte. 246 )
Dieser Vereitelung des Reformationsfestes, die den Anlaß zu neuer Mißstimmung gab, 247 ) folgte bald darauf Hans Albrechts


|
Seite 252 |




|
Verbot an die lutherischen Pastoren, der Kalvinisten in ihren Predigten nicht "auf eine verhaßte art" 248 ) zu gedenken und sich aller groben Anzüglichkeiten "des schmähens und verdammens" 249 ) zu enthalten.
Daß dies Vorgehen Hans Albrechts nicht als momentane Eingebung oberflächlichen Parteihasses anzusehen ist, zeigt die Energie, mit der er seit langer Zeit die Religionssache betrieb. Sie war ihm wirklich. Herzenssache. Vor allem aus Religionsinteresse fiel die Wahl für seine zweite Ehe 250 ) auf die auch zur reformierten Lehre gehörige älteste Tochter des reformierten Landgrafen Moritz von Hessen, Elisabeth. Am 25. März 1618 feierte er seine Hochzeit zu Cassel. Diesem Schritt folgte 251 ) alsbald der andere, daß er sich selbst zum Kalvinismus bekannte und am 28. Juni den reformierten Gottesdienst feierlich in die Schloßkirche 252 ) zu Güstrow einführte. Als dann am 14. November 1618 sein Sohn Karl Heinrich starb, ließ er von seinem reformierten Prediger, und zwar im Dom zu Güstrow, die Leichenpredigt halten. 253 ) Natürlich bewirkte die enge Verbindung mit dem hessischen Hofe und der mißliche Ausgang des böhmischen


|
Seite 253 |




|
Krieges, der viele Reformierte 254 ) auch an den güstrowschen Hof flüchten ließ, daß Hans Albrecht immer entschiedener für seine Religionsfreunde Partei nahm und ohne Rücksicht auf den Vertrag von 1617 den ganzen Dom für sich beanspruchte. Argwöhnisch betrachteten die Stände 255 ) sein Vorgehen. 1618, auf dem Landtag zu Sternberg, erinnerten sie ihn an sein Versprechen, sie bei der augsburgischen Konfession zu belassen und ihnen auch "auf erstem landtag, wenn deswegen gebührliche ansuchung geschehen würde, dessen zu versichern", und baten nun, ihnen "die versprochenen reversales mitzuteilen". Diese Mahnung blieb aber ohne Wirkung. 256 ) Hans Albrecht dachte jetzt nicht mehr an sein Versprechen, sondern entfernte kurzerhand den Altar aus dem Güstrower Dom 257 ) und stellte daselbst einen kalvinistischen Geistlichen auf die Kanzel. 258 ) Jetzt betraute Adolf Friedrich die Unterhändler mit dieser Angelegenheit. Am 9. Januar 1619 259 ) mußten sie Hans Albrecht sein Unrecht vorhalten und ihn nochmals um die Reversalen ersuchen. Dieser ließ sich hierdurch nicht einschüchtern. Er behauptete, "nichts unrects oder gar zu viel", sondern vielmehr noch weniger getan zu haben, als er befugt wäre. 260 ) Wiederum sandte Adolf Friedrich, weil es doch "in die harre so nicht kann gut geheißen werden", 261 ) am 10. Februar 1619 die Unterhändler zu ihm. Der Dom und das ius episcopale darüber wären Hans Albrecht allerdings zugesprochen, doch nur ad interim. Eine Änderung in Religionssachen aber wäre, hiervon ganz abgesehen, ausdrücklich sowohl durch den Revers als auch durch die Protestation Adolf Friedrichs verboten. 262 ) "Die einstellung der ihnen so unfreundlich abgeschlagenen jubeljahres celebrierungen" hätte er "gerne verschmerzt", aber "die unterdrückung der wahren und in diesen landen allein hergebrachten religion mit verletzung seines gewissens zu verhängen", schiene ihm unverantwortlich. Würde Hans Albrecht auch "hinfüro mit solchem procedieren verfahren", so wollte er


|
Seite 254 |




|
seines Teils an "manutenierung dieses itzigen regiments und standes das äußerste wagen und sich hinfüro so verächtlich nicht halten lassen".
Eng berührte sich hier der konfessionelle Streit mit den Bestrebungen für die Totaldivision. Hans Albrecht widersetzte sich Adolf Friedrichs Bemühungen, das ius episcopale, das 1617 doch nur ad interim geteilt war, mit in die Teilung zu bringen, aufs äußerste, vor allem wohl, weil er fürchtete, seinem Plan später noch mehr Hindernisse gegenüber zu sehen. 263 ) Er erklärte sich am 31. Mai 1620 zwar dazu bereit, die Einkünfte des Güstrower Doms mit denen der Parchimer Kirche vollkommen auszugleichen, wollte dann aber das ius episcopale dauernd allein für sich behalten, 264 ) auch "sich des doms nach seinem eigenen gefallen gebrauchen und sonsten außerhalb des domes und der schloßkirche in religionssachen keine veränderung vornehmen und sich dessenthalben gegen Adolf Friedrich und die ganze ehrbare ritter= und landschaft genugsam reversieren, wenn Adolf Friedrich sich zu gleichmäßigem revers verstehen werde". Als Adolf Friedrich hiermit nicht einverstanden war, drohte er die ganze Sache "zu der landschaft communication" 265 ) zu bringen und vor richtiger Erledigung der Angelegenheit und vor allem nicht im Falle einer gänzlichen Erfolglosigkeit des dazu berufenen Landtages weder in Sachen der Totaldivision noch der Partikularabtretung der Ämter tätig zu sein. Diesen Vorsatz wagte er jedoch auf Adolf Friedrichs dringliche Mahnung 266 ) nicht auszuführen. Aber dieser war in eine außerordentlich unangenehme Lage versetzt. Er wollte die Totaldivision, die Teilung des ganzen Landes mit allen Gerechtigkeiten, auf jeden Fall durchsetzen. Dies Ziel, das er Jahre lang erstrebt, lag jetzt ganz nahe vor ihm, und wohl ohne große Schwierigkeit hätte er es in Kürze erreichen können, wenn er nur in betreff des Güstrower Doms Hans Albrecht nachgegeben hätte. Aber seine religiöse Überzeugung war ihm nicht feil. Streng rechtlich stellte er sich auf den Standpunkt des Vertrags von 1617 und wollte das ganze ius episcopale mit in die Total


|
Seite 255 |




|
division gebracht wissen. Er hoffte, wenn dann später Hans Albrecht Güstrow und das ius episcopale darüber zufallen würde, ihn durch Reverse usw. so fest verpflichten zu können, daß hinsichtlich der Religion keine Übergriffe möglich sein würden. Aber die Stände sahen die Lage der Dinge in schwärzerem Lichte. Sie meinten, daß Hans Albrecht nach Vollführung der Totaldivision Tür und Tor für die Betätigung seiner Glaubensrichtung geöffnet wären und er sich die günstige Lage sicherlich zu nutze machen würde. 267 ) Versprechungen und Eide aber, durch die er vielleicht gebunden werden könnte, möchte er erst recht verletzen und unbeachtet lassen, wenn er in seinem Lande allein und unabhängig regierte und nicht mehr gezwungen wäre, sich von seinem Bruder dreinreden zu lassen. Nur dann glaubten sie mit Zuversicht in die Zukunft schauen zu können, wenn das Episkopat des Landes ungeteilt blieb, nur dann wären Religionsänderungen durch Hans Albrecht unmöglich.
So standen sich jetzt die drei Faktoren mit ihren Forderungen gegenüber: Hans Albrecht forderte den Dom zu Güstrow und freie Ausübung seiner Religion, er versprach dafür die Totaldivision. Adolf Friedrich wünschte nichts mehr als diese und stellte seinem Bruder, wie im folgenden noch näher zu zeigen ist, für seine Unterstützung baldigste Erfüllung seines - neben der Religionsfrage - Hauptwunsches, einer Kontribution, in Aussicht. Die Stände schließlich wollten vor allem ihre Gravamina gehoben und ihre Wünsche in betreff der Religion und Totaldivision berücksichtigt wissen. Sie versprachen dafür, sich den Fürsten hinsichtlich der Schuldenübernahme willfährig zu erzeigen.
Es fragte sich nun, welche der Parteien die Kraft besitzen würde, ihre Rechte und Ansprüche geltend zu machen. Hans Albrecht hatte die Totaldivision, auch während er scheinbar sein ganzes Interesse darauf richtete, der lutherischen Lehre in jeder Weise Abbruch zu tun, unterdessen nicht im geringsten aus dem Auge gelassen. Da er nur in ihr eine genügende Garantie zu haben vermeinte, für den Kalvinismus ungestört tätig sein zu können, so war er nach Abschluß des Vertrages von 1617 der


|
Seite 256 |




|
erste, der zu ernstlichem Beginn mit der Totaldivision drängte. Am 20. Oktober 1617 268 ) sandte er ein dringliches Schreiben an Adolf Friedrich: "daß mit der totaldivision etwas schleuniger verfahren und all und jede communio weggehoben und also auch die communicationsschreiben hinterwärts gesetzt würden". Gleichzeitig bat er darum, daß ihre Räte zur Beratung zusammenkämen.
Adolf Friedrich war mit diesem Vorschlag natürlich einverstanden, stellte jedoch zweierlei Bedingungen. Nicht nur sollte "alles gemenge 269 ) in den ämtern" - zu dem Ende wäre es notwendig, noch einige Ämter wieder gegeneinander auszutauschen 270 ) - "und ganzen lande aufgehoben und einem jedweden ein gewisser ort landes allein 271 ) assigniert werden", sondern Hans Albrecht sollte auch den Weg angeben, wie die Totaldivision am besten zu bewerkstelligen wäre. Er erinnerte dabei an seinen Vorschlag von 1611, eine Totaldivision und nicht die Ämterteilung allein vorzunehmen. Hans Albrecht hätte damals nicht auf diesen Rat gehört, sondern vielmehr seine Ausführung verhindert. Dafür möchte er nun den Modus angeben, wie das damals durch seine Schuld Versäumte am leichtesten nachzuholen wäre. Gemeinsame Verhandlungen ihrer Räte aber hielt er, wie die Erfahrung hinreichend gezeigt hätte, für gänzlich unzweckmäßig. 272 ) Im Gegensatz zu Adolf Friedrich meinte aber


|
Seite 257 |




|
sein Kanzler Hajo von Nessen, daß eine gänzliche Teilung unmöglich wäre, auf jeden Fall müßte Rostock gemeinsam bleiben. Denn wenn die Stadt, wie Adolf Friedrich wünschte, an Güstrow fiele, so würden zu der Erstattung 273 ) der Städte Rostock und Güstrow die Städte Wismar, Parchim, Malchin, Neubrandenburg und Friedland gar nicht genügen. Dazu käme der Übelstand, daß die drei letztgenannten Städte fast gänzlich von Hans Albrechts Ämtern umgeben wären, wodurch nichts anderes entstände als eine "perpetua litium materia". Auf diese wohlbegründeten Vorstellungen hin setzte Adolf Friedrich seine Ansprüche herab. Am 5. Januar 1618 274 ) schrieb er Hans Albrecht, daß seinetwegen Rostock gemein 275 ) bleiben könnte. "Sollte aber E. L. Dieselbe allein begehren und mir erstattung dafür bequemen, wollten wir Ihr dieselbe auch wohl gönnen." Hans Albrecht wäre, mit dem ersten Vorschlag nun wohl einverstanden gewesen, wenn Adolf Friedrich auch Wismar hätte gemein lassen wollen, diese Stadt aber seinem Bruder allein zu lassen, schien ihm unmöglich. Denn was sollte er dafür nehmen? - etwa Rostock? - Das hielt er nicht für geraten schon wegen des schwierigen Ausgleichs an sich, als auch besonders wegen des Verlustes an andern Städten, die er nicht entbehren zu können glaubte. Adolf Friedrich aber wollte Wismar auf jeden Fall mit in die Teilung 276 ) gebracht, und zwar zu seinem Gebiet gelegt haben. Gegen Güstrow könnte Schwerin selbst unter Zuhülfenahme von Parchim auf keinen Fall gesetzt werden, nur Wismar allein wäre das geeignete Äquivalent.
Nicht ohne Wert sind die bei dieser Erwägung von Dr. Christoph von Hagen (einem Rat Adolf Friedrichs) gegebenen, allerdings tendenziös gefärbten Schilderungen über den Zustand der einzelnen Städte: 277 )
| Wismar | Die noch übrigen gemeinen | Güstrow | |
| Parchim | Städte als: | Malchin | |
| Schwerin | Sternberg | Laage | Brandenburg |
| Kröpelin | Krakow | Teterow | Friedland |
| Waren | könnten zum Ausgleich | Woldeck | |
| dieser gebraucht werden. | Röbel." | ||


|
Seite 258 |




|
Von Schwerin sei bekannt, so schreibt er am 21. September 1619, daß dasselbe "von gemeinen und privatintraden eine arme, baufällige und fast ganz nahrlose stadt sei, dabei keine stadtmühlengüter, holzungen, wiesenwachs, hüte und weide oder andere große nützbarkeiten vorhanden, also auch, daß das rathaus nicht ein paar pferde auf dem stall zu halten vermag. 2. Daß sie weder kirche oder schule hat, sondern dieselbe ganz unter fremder jurisdiktion belegen, daran man den herzogen zu Mecklenburg nunmehr an geistlicher und weltlicher jurisdiktion, hoheiten und regalien das geringste nicht geständig sein will und, da etwan künftig eine mutatio religionis, welches doch Gott der allmächtige gnädig abwenden wollte, einfallen sollte, die armen bürger und einwohner in seelen seligkeit gefahr gestürzt werden könnten, also daß in diesem punkt bei keiner im ganzen lande geteilten oder ungeteilten stadt, kleine oder groß, ja fast bei keinem dorfe eine solche incommodität, alse eben bei dieser stadt Schwerin vorhanden und, wann man gleich eine absonderliche kirche und schule anrichten wollte, daß doch dazu weder ort oder einige geistliche hebungen vorhanden, auch überaus große unkosten dazu gehören und vielleicht der episcopus wegen des juris parochialis solches auch streiten würde. 3. Daß es nur eine halbe stadt, 278 ) weil der anderteil, die Schelfe genannt, dem herrn administratori cum omni jure zuständig. 4. Daß dabei diese große beschwerungen, wie zum öftern grobe und kleine mißhandlungen ungestraft bleiben, wann entweder die thäter dahin auf die Schelfe sich salvieren oder auch, wie noch jüngst mit Christoph Raben sich zugetragen, dieselben ex carcere sich losmachen und dahin leichtlich, weil es so nahe bei einander, ihr refugium haben können und also der justizien den rücken geben. 5. Daß der herr administrator seinen sitz und wohnung innerhalb der stadtmauer, auch die capitulares ihre häuser und höfe haben, darüber man nichts zu kommendieren, und also peregrinos, non subditos gleichsam vor augen sehen und leiden muß. 6. Daß vor J.f.g. räte und diener in der stadt fast keine wohnungen vorhanden, auch keine mit großen unkosten und discommoditäten können gebauet oder gemietet, daß sie nicht entweder der stadt oder des bischofs jurisdiction sollten unterwürfig sein."


|
Seite 259 |




|
Aber auch Parchim sei "eine ausgebrannte, arme, unvermögene stadt und, obgleich ziemliche holzungen und etzliche dörfer dazu belegen, so ist doch die holzunge dahero, daß die stadt in wenig jahren zweimal ausgebrannt, 279 ) sehr verhowen und fast öde gemachet, bei den dörfern auch mehr sandhofen und soviel geistliche hebungen und andere onera vorhanden, daß die stadt derselben wenig zu genießen hat und dahero auch das rathaus mit schuldenlast behaftet. So ist auch die nahrung bei den bürgern fast ebenso gering wie zu Schwerin und mit Güstrow sonderlich. auch der gebew und häuser halber nicht zu vergleichen. Es sein zwar daselbst zwei kirchen und eine schule, welche cum omni jure J. J. f. f. g. g. beiderseits zustehen, aber alle drei sehr klein und baufällig und die intraden dermaßen gering, daß, wann nicht die armenhäuser jährlich in etwas die hülfliche hand lieheten, dieselben nebenst die kirchen= und schuldienern nicht erhalten werden könnten. Wie arm und unvermügen auch die eine oekonomie daselbst sei, ist daraus leichtsam abzunehmen, daß eine zeit hero die kirchen und schuldiener ihre besoldungen, welche ohne das sehr gering ist, zu gebührender zeit nicht erlangen mögen, und darüber viel klagens und querulierens gewesen. So ist auch daselbst gegen den thumb und thumbfreiheit und die dazu gehörigen stattlichen gebew, häuser, dörfer und ansehnliche, reiche intraden keine erstattung befindlich und, wanngleich in vorgesetztem allen einige gleichheit mit Güstrow zu er spüren sein sollte, so würde doch dieselbe hierdurch fast gänzlich. absorbiert, daß herzog Hans Albrechts f.g. derselben hofstatt zu Güstrow, Unser gnädiger fürst und herr aber zu Parchim keine, ja nicht einmal ein haus daselbst hat."
Hinsichtlich der Stadt Güstrow aber müsse man zugeben, "daß dieselbe von gemeinen und privat intraden eine reiche, wohlgebaute und mit guter nahrung wohlgesegnete, ziemlich große stadt sei, 280 ) derselben nicht allein alle daselbst vorhandenen, ansehnlichen, großen wassermühlen, sondern auch eine stattliche holzunge, der Priehmer genannt, und andere land= und stadtgüter, auch viel wiesenwachs, hüte und weide zustehen und dahero ohne die mühlenpferde vier pferde auf dem stall halten. Dabei auch diese kom=


|
Seite 260 |




|
modität, daß die Nebel in die Warnow gehet und von da auf Rostock, darauf sie zu schiffe können ihre waren ab= und zuführen. 2. Daß daselbst zwen wohlgebaute kirchen, eine auf der thumbfreiheit, die andere in der stadt, auch eine kleine außerhalb der stadt, wie auch eine wohlgebaute, große schule und zwei an zinsen, pächten, dörfern, und landgütern, äckern und gütern reiche ökonomien, deren eine in der stadt, die ander beim thumb vorhanden, darüber die herzöge zu Mecklenburg allein das kommando und die geistliche und weltliche jurisdiktion haben, und die thumbkirche so nahe bei dem fürstlichen hause belegen, daß man durch einen gang darein kommen kann, dieselbe auch mit stattlichen begräbnussen und fürstlichen epitaphiis und genealogiis versehen und gezieret. 3. Daß die ganze stadt totaliter den herzogen zu Mecklenburg allein zuständig, dieselben auch allein darüber zu gebieten und mit keinen fremden hohen oder niedrigen standes personen einige communion haben und dahero das vierte und fünfte incommodum wie bei Schwerin dabei ganz nicht vorhanden. 4. Daß alle herzog Hans Albrechten fürstliche räte und diener ihre guten, bequemen und wohlgelegenen häuser und wohnungen, so von des rats und aller fremden jurisdiktion gänzlich exempt sein, auf der thumb= und burgfreiheit können h ben, und noch viel andere stattliche häuser daselbst übrig, darüber keimand anders dann die herzöge zu Mecklenburg zu kommendieren haben."
Wismar 281 ) dagegen sei die allein geeignete "exaequation" gegen Güstrow. Es hätte zwar einige Vorteile davor voraus,


|
Seite 261 |




|
andererseits wäre aber doch auch wohl zu erwägen, "daß die häuser mehresteils verfallen, öde und wüste stehen und fast die halbe stadt unbewohnt sei, der see= und kaufhandel hinweg und die bürgere fast allein von dem ackerbau, mültzen und brawen gleich andern landstädten ihre nahrung haben und sehr unvermügen sein. Dahero auch die intraden gering und das rathaus arm und in schweren schulden vertiefet, bei der stadt auch gar keine holzunge vorhanden und die mehresteils dörfer den kirchen und armenhäusern daselbst zustehen, und, wanngleich einige hoffnunge sein möchte, wie man doch nicht siehet, wodurch daß der seehandel und kaufmannschaft wieder herzubringen, so würde doch dadurch J. f. g. nichts accresciren . . ."
Nicht unrecht hatte Adolf Friedrich, wenn er Wismar zu seinem Teile haben wollte. Ganz abgesehen nämlich von dem einen Teil des Mecklenburgischen Hofes und einigen andern Häusern in der Stadt, die er seit 1611 schon im Besitz hatte, war Wismar rings von seinen Ämtern umgeben, und es mußte ihm ein Pfahl im Fleische sein, wenn er es nicht bekam. Hans Albrecht aber, ganz entschieden gegensätzlicher Meinung, 282 ) sagte, eine solche Gruppierung der Städte wäre beiden früheren Teilungen niemals gemacht, weiter wäre es auch überhaupt unmöglich, einer Seestadt eine Landstadt gegenüberzustellen.
Noch viel weniger wollte er von einer Abtretung Boizenburgs wissen, 283 ) weil ihm dann der Zutritt zum Elbstrom abgeschnitten würde. Auch Cothmann 284 ) wie Bugislaf von Behr warnten hiervor aufs dringlichste, und sie hatten damit Erfolg. Denn trotz der mannigfaltigsten Bitten Adolf Friedrichs ließ Hans Albrecht sich in diesem Punkte nicht umstimmen. Auch als am 4. Februar


|
Seite 262 |




|
1618 auf Hans Albrechts Vorschlag die zeitraubenden Wechselschreiben eingestellt wurden, befahl er seinen zur Verhandlung deputierten Räten in der mitgegebenen Instruktion, 285 ) sich wegen Boizenburgs nicht in Beratungen einzulassen. Den Tausch der Leibgedingsämter Neukloster und Grabow 286 ) sollten sie nur gegen günstige Erstattung annehmen. Damit, daß Rostock und die Universität gemeinsam blieben, erklärte er sich einverstanden. Ebenso sollte es auch mit Wismar gehalten werden. Auch die gänzliche Teilung der weltlichen und geistlichen Jurisdiktion, des Konsistoriums und des Hofgerichts schien ihm zu dieser Zeit schwer ausführbar, denn er glaubte, daß Rostöck, das seine eigene weltliche und geistliche Jurisdiktion hätte und von seinen Gerichten an das Landgericht bezw. an das fürstliche Konsistorium und weiter an das gemeinsame Hofgericht appellieren könnte, sich dieser Gerechtigkeit wohl nur schwer begeben würde. Beseitigen könnte man diesen Hinderungsgrund nur dann, wenn "zur erörterung der Rostocker processe" vielleicht jährlich zwei "consistorii= und hofgerichtstage" abwechselnd zu Schwerin und Güstrow abgehalten würden.
Am 13. Februar 1618 287 ) kamen die beiderseitigen Räte 288 ) in Schwerin zur Beratung zusammen. Am 23. Februar 289 ) hatten
1. Es kämen S. f. g. an einem ort aus dem gemenge und kriegten do einen feinen traktum,
2. bekämen ihre wildbahnen allein und hätten sich
3. des betrübten zanks itzo mit der witwen, hernach herzog Hans Albrecht zu entheben.
4. Und könnte die totaldivision hernach gleichwohl inandergehen und hiermit nicht begeben sein, sondern meines erachtens ein großer knoten daraus gehoben werden,
5. itzo muchte diese permutation bei herzog Hans Albrecht besser als hernach zu heben sein.
6. Eldefahrt wäre auch desto leichter zu verbessern.
7. An Tempzin und Goldberg gehet Illmo weinig ab, an Grabow allerhand herrlig= und gerechtigkeit zu.
8. An gebäude zur Neustadt dorfte desto weiniger gewandt werden" usw. usw.


|
Seite 263 |




|
sie sich bis auf Wismar und Boizenburg geeinigt. Darauf machten sie eine Pause, damit unterdessen die alten Teilungsregister und =rezesse 290 ) aufgesucht und daraus alle für sie wichtigen Sachen excerpiert würden. Adolf Friedrich riet nun, wenn das Werk "ein gutes Ende nehmen" solle, "noch räte und doctoren" hinzuzuziehen, und fand damit bei Hans Albrecht ein geneigtes Ohr. 291 ) Am 15. April 1618 nahmen die Verhandlungen zu Parchim ihren Fortgang, jedoch auch jetzt erfolglos. Hans Albrecht wollte 292 ) Wismar zwar mit in die Teilung geben, aber nur wenn er ",bei der erstattung nicht verkürzt" würde. Er erklärte sich ferner auch bereit, Gorlosen, Grabow und Marnitz umzutauschen und nach glücklicher Vollführung der Totaldivision - aber dann erst - auch noch die Ämter Neukloster und Walsmühlen hinzuzulegen, alles jedoch nur, wenn er dafür von Adolf Friedrich hinreichende Entschädigung erhielte. Vollkommen gingen indes die Meinungen auseinander wegen der Schiffahrt von Schwerin nach Wismar, die Adolf Friedrich als untaxierbar ohne Erstattung für sich allein haben wollte, ferner vor allem wegen Boizenburgs und der Wildbahnen u. a. m. Da Hans Albrecht hierin absolut nicht nachgeben wollte und Adolf Friedrich also keine Möglichkeit sah, zu einem für ihn einigermaßen annehmbaren Resultat zu kommen, gaben Adolf Friedrichs Deputierte am 18. April 1618 alle weiteren Bemühungen mit der Resolution


|
Seite 264 |




|
auf: das Teilungswerk "sollte verbleiben, bis Hans Albrecht weiter darum anhielte" . 293 )
Allzulange sollte indes die Unterbrechung diesmal nicht währen. Doch nicht die Totaldivision an sich, auch nicht konsessionelle Bestrebungen waren jetzt die Ursache, daß Hans Albrecht die Teilungsverhandlungen wieder aufnahm, sondern der dringende Wunsch, möglichst bald von der Schuldenlast 294 ) freizukommen, die sich im Laufe der Jahre bedeutend vermehrt hatte, so daß er, unter ihrem Druck seufzend, sich entschloß, 295 ) Adolf Friedrich um die Zustimmung zu der Erhebung einer Landeskontribution zu bitten. Dazu mußte jedoch ein Landtag ausgeschrieben werden und vor allem er selbst auch der Hülse seines Bruders gewiß sein. So kam es denn, daß er Sorge trug, sich Adolf Friedrich wieder zu nähern. Am 10. Oktober 1618 ließ er durch seinen Rat Otto Preen bei Samuel Behr, "als den S. f. g. dem Werk und dessen befürderer wohl assectioniert wissen", anfragen, "ob er vermeine, daß Adolf Friedrich" - selbst an diesen zu schreiben, getraute er sich wegen des voraufgegangenen Zwistes 296 ) nicht - "zu der totaldivision dergestalt noch geneigt sei, daß das amt Boizenburg, zu dessen permutation Hans Albrechts f. g. aus vielen hochwichtigen ursachen sich nicht verstehen können, ihm verbleibe". In diesem Fall "wäre er bereit, das werk zu continuieren und sich zu allen billigen mitteln nochmals zu accommodieren".
Aber Adolf Friedrich zürnte seinem Bruder, und der Religionsstreit brachte sie, wie oben gezeigt, noch weiter auseinander. Erst am 9. Mai 1619 297 ) fand als erster Schritt zur Versöhnung eine Beratung zwischen Otto Preen und Samuel Behr in Parchim statt. Die Fortsetzung derselben war am 8. September zu Stern


|
Seite 265 |




|
berg. 298 ) Die Ausschreibung eines Landtags wies Samuel Behr hier in Adolf Friedrichs Namen schroff ab. Es wäre undenkbar, daß die Fürsten den Ständen, die durch ihr Verhalten den Bruch herbeigeführt hätten, zuerst die Hand zur Versöhnung reichten. Die Landschaft hätte zwar schon einmal darum angehalten, 299 ) jedoch in einer Weise, daß ihr noch geantwortet, es andrerseits. aber auch bei dieser Antwort allein belassen wäre, bis man "eine andere resolution von ihnen empfinge". Als Hans Albrecht bei Adolf Friedrich somit nichts erreichen konnte, bat er darum, wenigstens doch eine Kontribution, wenn auch ohne Landtag, einfordern zu dürfen. Hierzu versprach Adolf Friedrich, falls es angängig wäre, seine Zustimmung, aber nur unter der Bedingung, daß die Ämter "umgesetzt" würden. 300 ) Als Adolf Friedrich ferner gleichzeitig seine Forderung hinsichtlich des Amts Boizenburg fallen ließ, zeigte sich auch Hans Albrecht in bezug auf die Auswechselung der Leibgedingsämter nachgiebiger. Bestimmtes wurde jedoch nicht abgemacht, sondern vorerst nur beschlossen, dieselben abzuschätzen und das Ergebnis mit dem Register 301 ) von 1607/09 zu vergleichen. Die Abschätzung sollte tunlichst noch von den früheren Deputierten vorgenommen werden. Reventlow, Linstow und Quitzow 302 ) wurden also damit beauftragt, doch nicht zu ihrer Freude, 303 ) denn es heißt, daß sie 304 ) nur "übel aufzubringen" gewesen wären. Zugesellt wurden ihnen Andreas von Pritzbuer 305 ) zum Eickhof und Arend von Möllendorf. 306 ) Diese Teilung der Ämter erschien Adolf Friedrich mit Recht als die Grundlage für die fernere gedeihliche Entwicklung des ganzen Teilungswerkes, denn vorher war eine Voneinandersetzung der Ritterschaft und Städte unmöglich. Hans Albrecht aber meinte, daß die Teilung der Ämter mit der der Ritterschaft


|
Seite 266 |




|
sehr gut "pari passu" 307 ) gehen könnte. In seinem Interesse lag es eben, so schnell wie möglich fertig zu werden, um sein Ziel zu erreichen. Wiederholt ließ er daher durch seine Räte darauf dringen, man möchte doch "superficialiter teilen und alles so genau 308 ) nicht nehmen . . ., da es 309 ) auf die goldwacht doch nicht könne von niemand gewogen werden".
Jetzt, nach sechsjähriger Unterbrechung, konnte man wieder ernstlich an die Teilung des Adels denken. Es wurde entgegen der 1613 gegebenen Instruktion, da eine so eingehende Abschätzung, wie sie damals beabsichtigt war, als zu zeitraubend erschien, nunmehr auf Hans Albrechts Vorschlag 310 ) beschlossen, den Adel allein nach Roßdiensten zu teilen. Es fragte sich nur, wie diese, deren Zahl in den einzelnen Ämtern sehr verschieden war, auszugleichen wären. Adolf Friedrichs Meinung war, 311 ) dies müßte nicht aus einem Amt, sondern nach Gelegenheit "aus vielen örtern" geschehen. Auch Hans Albrecht versprach am 29. Oktober 1619, 312 ) hierüber seine Erklärung abzugeben, verlangte jedoch - denn der heftige Streit wegen des hatte in ihm die Befürchtung erregt, daß Adolf Friedrich vielleicht einer Teilung des jus episcopale gar nicht mehr zustimmen werde vorher zu wissen, ob Adolf Friedrich denn überhaupt noch beabsichtige, "ganz und gar totaliter zu teilen, darunter Hans Albrecht . . . außerhalb Rostocks und der universität, darüber man sich absonderlich zu vergleichen, alles mitverstehe." Andernfalls wäre es, da der Zweck dann ja doch nicht erreicht würde, "fast ebenso gut, daß man es in antiquis terminis ließe". Auf Volrath von der Lühes Rat 313 ) antwortete Adolf Friedrich hierauf mit der Klausulierung, daß er die Totaldivision, soviel nur immer möglich, zu "effectuieren" gedächte. 314 ) So gingen


|
Seite 267 |




|
die Verhandlungen hin und her, ohne von rechtem Erfolg begleitet zu sein. Im Dezember 1619 315 ) erklärte Samuel Behr deshalb, nun "keine schriften mehr wechseln" zu wollen. Von jetzt an sollte mündlich verhandelt werden, damit es "schleuniger" ginge. Hans Albrecht aber meinte, und nicht mit Unrecht, man müßte doch, bevor man zusammenkäme, in den Hauptpunkten einig sein. 316 ) Er wollte durch Preen zuvor noch einige Vorschläge machen lassen, über die Samuel Behr erst mit Adolf Friedrich Rücksprache nehmen möchte. Da Behr erkrankte, 317 ) traf an seiner Stelle sein Bruder Hugold im Dezember mit Preen zusammen. 318 ) Hans Albrecht ließ jetzt durch diesen darum bitten, "Adolf Friedrich möchte sich soweit bemühen und die teilung der städte, ritterschaft und ämter, wie er es für gut hielte, zu papier bringen". 319 ) Adolf Friedrich, weit entfernt, 320 ) hierauf einzugehen, forderte darauf am 4. Fe=
1. a) hätten sie die arbeit schon einmal verrichtet und dafür von Hans Albrecht obgleich er sich zu einem ausführlichen bedenken verpflichtet hätte, nur eine "lahme obstatschrift" erhalten.
b) Man hegte ferner gegen Hans Albrecht den argwohn, daß er dem landgrafen Moritz von Hessen stets alles communizierte, was Behr mit Preen traktierte, und daß man deswegen immer solange auf antwort warten müßte. Vermutlich würde Hans Albrecht auch einen neu angegebenen modus Adolf Friedrichs dem landgrafen unterbreiten und dieser von neuem verbesserungen für nötig befinden, denn oculi plus vident oculus.
c) könnte man dann vielleicht zum drittenmale arbeiten und auch dann noch nicht zum ziele kommen.
II. Hans Albrecht aber müßte jetzt vielmehr den modus dividendi aufsetzen, denn:
a) "itzo suchen herzog Hans Albrechts f. g. die teilung," daher möchte er nun auch billig das bedenken deswegen abfassen.
3) Da Preen, wie er geäußert, den modus wüßte, wie der adel zu teilen, möchte er ihn aussetzen usw.
III. Es gäbe nun außerdem noch einen weg, um zu entscheiden, wer den modus dividendi machen sollte:
a) das los, dann aber könnnte Hans Albrecht doch Adolf Friedrichs modus zur begutachtung, nach Kassel senden.
( ... )


|
Seite 268 |




|
bruar 1620 seinerseits ebenfalls, daß Hans Albrecht den Plan, wie alles am besten zu teilen wäre, aufstellen ließe. 321 ) Aber auch dieser hütete sich wohl. Die Teilungsschwierigkeiten erhöhten sich noch, als Adolf Friedrich seinen Plan änderte und jetzt auch Rostock wieder mit in die Teilung gebracht haben wollte, vielleicht, weil er Wismar auf jeden Fall für sich beanspruchte und so die Schwierigkeiten deswegen leichter aus dem Wege zu räumen hoffte, - vielleicht auch, 322 ) weil er nicht recht wußte, wie es mit der Universität usw. zu halten wäre, wenn Rostock gemein bliebe.
In dieser kritischen Zeit schien es fast, als sollte, weil keiner nachgeben, keiner die Initiative ergreifen wollte, die ganze Teilung in Frage gestellt werden. Man überlegte 323 ) schon, wie es werden
c) das beste wäre daher wohl, daß "die fürsten räte niedersetzten, welche die teilung communicato consilio et deliberatione machten, und daß, wann sie bald fertig, die fürsten beiderseits zusammen kämen, vor der zeit aber niemand von ihnen davon etwas referierten, damit es nicht weggesandt würde, und daß die fürsten dann nicht eher voneinander zögen, eher man wegen des modi richtig oder - es zerginge!"


|
Seite 269 |




|
sollte, wenn offener Streit entstände. Da führte Preen 324 ) wiederum eine mündliche Verhandlung mit Samuel Behr herbei. Er machte den Vorschlag, die beiden Fürsten sollten, wie 1611 in der Nähe von Fahrenholz, sich jetzt um Neustadt herum aufhalten, so daß die Räte, die dort verhandeln sollten, gegebenerfalls schnell mit ihnen Rücksprache nehmen könnten. Dieser Plan kam jedoch nicht zur Ausführung, denn häufige Reisen 325 ) Adolf Friedrichs und andere Hindernisse schoben eine Zusammenkunft immer weiter hinaus.
Schließlich einigte man sich am 5. Mai 1620 endlich dahin: 326 ) Nicht angebracht wäre es, daß ein Herzog alle Arbeit allein machte und der andere nur daran seine Kritik übte. Daher wollten sie sich in die Aufgabe teilen. Adolf Friedrich sollte die Ritterschaft voneinandersetzen und die dazu nötige Instruktion 327 ) abfassen. Die Städte sollte Hans Albrecht teilen und dafür seinerseits die diesbezügliche Verfügung treffen. Die spätere Ausführung dieser Pläne sollte von möglichst wenig Deputierten, 328 ) nämlich nur von je einem Landrat, einem fürstlichen Rat und einem Notar, vorgenommen werden. Nur "in dubiis" sollten mehrere Räte zur "decision" hinzugezogen werden. Die Teilung der Ämter aber sollten die beiderseitigen Räte verrichten. Mit dem Werk wollten sie so bald als möglich beginnen. Die Fürsten sollten nur noch am 29. Mai 1620 zu einer letztbeschließenden Beratung zusammenkommen. 329 ) Als der Tag erschien, stellte sich Hans Albrecht zwar ein, 330 ) Adolf Friedrich aber kam nicht. Er meinte, "daß 331 ) durch die landräte und noch zur zeit und, ehe man sich eines gewissen modo procedendi verglichen und die instructiones hinc inde übergeben, wenig auszurichten". Er


|
Seite 270 |




|
beauftragte Samuel Behr, mit Preen zu beraten und diesem weiter auch die unterdessen fertiggestellte Instruktion wegen der Teilung des Adels zu übergeben. Hans Albrecht erklärte sich jetzt durch Preen dazu bereit, 332 ) "Rostock, obgleich ihm dasselbige große beschwerungen geben wird, zu seinem teil zu nehmen, damit die totaldivision ihren fortgang desto besser nehmen möge". Dann müßte ihm aber auch die Universität allein zufallen. "Kassiert oder transferiert" dürfe sie nicht werden, "weil sie in fundatione auf Rostock gewidmet" sei. Dies wäre nicht nur in einem Vertrag von 1563 bestimmt, sondern es würden auch sowohl der Bischof wie der Rat, der als compatronus auch Rechte an der Akademie hätte, nur schwerlich in die Kassation und Translation derselben willigen, weil der Vertrag ausdrücklich besage, daß sie in Rostock bleiben sollte, solange der Rat und die Gemeinde daselbst sie in ihren Privilegien nicht beeinträchtigten.
Über die Bereitwilligkeit Hans Albrechts, Rostock zu nehmen, war Adolf Friedrich sehr erfreut, hinsichtlich der Universität aber meinte er, daß sie sich sehr wohl an einen andern Ort verlegen ließe. 333 ) Seinem Drängen gelang es, daß sich Hans Albrecht endlich nach längeren Debatten über die Teilung der Universität 334 ) damit einverstanden erklärte, "daß die sämtlichen reditus der akademie zusammengerechnet und der halbe teil 335 ) davon S. f. g.


|
Seite 271 |




|
(d. i. Hans Albrecht) verbleiben möge", die andere Hälfte aber Adolf Friedrich erstattet werden sollte. Zu gleicher Zeit ungefähr ließ Adolf Friedrich nun die Instruktion über die Teilung der Ritterschaft übergeben. 336 ) Danach sollte zunächst "an alle vom adel, denen die güter eigen sind, item mutatis mutandis an die pfandinhaber, pensionarios und witwen, so lehngüter zur leibzucht innehaben, item an die besitzer der allodialgüter" der Befehl ergehen, "taxt und anschlag 337 ) eines jeglichen lehengutes aufn erbkauf" zu machen und bis zu einer bestimmten Zeit ebenfalls mitzuteilen, wie hoch sie den Fürsten mit Roßdiensten verpflichtet wären. Hierauf sollten sich die Deputierten an die Arbeit machen, die eingesandten Berichte prüfen, einen Generalanschlag machen und schließlich die Hälfte der Güter zu Schwerin, die andere Hälfte zu Güstrow legen. 338 )
Am 6. Juni 1620 339 ) konnte auch Hans Albrecht seinerseits Adolf Friedrich die Instruktion wegen Teilung der Städte Rostock, Wismar, Parchim, Neubrandenburg, Güstrow, Schwerin, Malchin, Friedland, Waren, Röbel, Sternberg, Woldegk, Teterow, Krakow und Laage 340 ) übermitteln lassen.


|
Seite 272 |




|
Rostock und Wismar waren natürlich die Hauptsache. Daher verlangte die Teilungsbestimmung auch, daß die Deputierten zunächst in Rostock zusammenkämen und dort über 1. Folge, 2. Kontribution, 3. Stellung von Rüstwagen und Trabanten, 4. Accisen, 5. Orbör, 6. Opfergeld an die fürstlichen Köche "und dergleichen offizierern" und 7. über alle andern Gerechtigkeiten der Fürsten sich genauen Bericht holten und, wo es ging, wie beim "Doberanschen Hof", selbst die Besichtigung vornähmen.
Ebenso sollte es darauf mit Wismar und dem fürstlichen Haus daselbst gemacht werden. Auch wegen des ius episcopale und der geistlichen Jurisdiktion daselbst sollte, weil die Stadt in diesen Punkten ähnlich wie Rostock gewisse Privilegien 341 ) für sich in Anspruch nahm, genaue Erkundigung eingezogen werden. Hiernach wies die Instruktion die Deputierten zu den andern Städten, daß sie sich auch dort über 1. das ius episcopale und die geistlichen Güter, 2. das ius patronatus, 3. die Ökonomieen und deren Einkünfte, 4. die Bestellung der Prediger, Schuldiener, Organisten und Küster und 5. überhaupt über alle Gerechtigkeiten erkundigten und ferner auch, da die Städte keine bestimmte Folge hatten, sondern je nach dem Aufgebot Leute zu stellen verpflichtet waren, über die Einwohner= und Häuserzahl sich genau unterrichteten. Im Anschlag von Parchim sollte außerdem auch "die wichtige schiffahrt und negotiation" daselbst genügende Berücksichtigung 342 ) finden. Natürlich wurde den Deputierten, um eine möglichste Beschleunigung der Sache zu erzielen, die Hülfe der Stadtvögte und der andern fürstlichen Beamten zur Verfügung gestellt.
Adolf Friedrich war mit dieser Instruktion im wesentlichen einverstanden. 343 ) Aber die Schiffahrt in Parchim wollte er nicht


|
Seite 273 |




|
abschätzen lassen, "aus denen ursachen, daß davon die landesfürsten keinen vorteil hätten, besondern dem ganzen lande solches zum besten käme".
War man somit ausnahmsweise schnell in den wesentlichen Punkten einig geworden, so ergaben sich diesmal die Schwierigkeiten aus der Sache selbst.
Bald zeigte es sich deutlich, 344 ) daß die Totaldivision vornehmlich davon abhing, ob es möglich wäre, die Regalien 345 ) in Rostock und Wismar abzuschätzen und dafür genügenden Ausgleich zu finden, denn wegen der Teilung der übrigen Städte konnte man sich leichter vergleichen. Hans Albrecht hielt es daher für gut, daß bei diesen beiden Städten der Anfang gemacht würde und ihre Räte sobald als möglich zusammenkämen, um über die Beseitigung der Ungleichheiten in diesen Regalien zu beraten. 346 ) Die Schwierigkeiten 347 ) wuchsen jedoch bei näherer Betrachtung unendlich, und immer mehr trat die Unmöglichkeit zutage, Rostock mit in die Teilung zu bringen. Wie sehr Adolf Friedrich es auch wünschte, so rieten ihm doch fast alle seine eigenen Vertrauten mehr oder weniger davon ab. Ja, als er Christoph von Hagen auftrug, die regalia in Rostock abzuschätzen, bat dieser darum, ihn "mit solcher unmöglichen 348 ) arbeit in gnaden zu verschonen", da sie "inaestimabilia" wären. Wenn Rostock Hans Albrecht gegeben würde, genügten alle andern Städte nicht, zumal Güstrow ausgenommen wäre, diesen Vorteil auszugleichen, denn 349 ) außer den großen "jura und regalia" hätte Rostock die "academien, die stattlichen gebew an kirchen, klöstern, rathause, collegiis und auditoriis, hospitalien und häusern, das consistorium und die communität, die freiheit auf dem Doberanschen hofe, die wälle,


|
Seite 274 |




|
zwenger, graben, geschütz und munition, die große mannschaft in häusern, buden und kellern, der mehresteils bürger reiche nahrung, auch großes vermögen an barschaft, silber und gold, derselben und der stadt und hospitalien, auch des klosters zum Heiligen Kreuz viele dörfer, wohlgebaute höfe, stattliche mühlen, holzungen, auch der kirchen drei unterschiedliche große ziegelhöfe und andere intraden, die reiche ökonomei, die Oberwarnow bis an Schwaan, Warnemünde, die rekompens wegen der postulaten und accisen" usw. Ob die Teilung Rostocks aber überhaupt möglich wäre und statthaben könnte, schien ihm mehr als zweifelhaft. Denn sie haben "privilegia und aufgerichtete verträge, auf das ganze haus Mecklenburg gerichtet", und es "ist zu besorgen, daß sie dawider . . . allerhand tentieren und zum wenigsten prozeß und mandata inhibitoria ausbringen und Herzog Hans Albrecht f. g. dann von E. f. g. [Adolf Friedrich] die eviction und defension fordern möchte". Ganz unangebracht wäre es, Rostock mit Wismar zu vergleichen. Der Rostocker Handel sei 350 ) "im aufwachs, der wismarische aber in augenscheinlich täglichem verderb und abfall inaequaliter handgreiflicher zu verspüren. Dannhero Wismar wegen einkünften und anderm mehr einer land= denn seestadt zu vergleichen, denn dieser stadt wenig landgüter, ohne was geistliche, zuständig, als den hospitalien in Heiligen Geist in der stadt und zu St. Jakob vor der stadt,sonsten die übrigen zwei klöster in der stadt, als das graube in gringem zustand, das andere aber, das schwarze kloster genannt, also arm und ausgesogen, daß alle jahr die ausgab die einnahme überreichet, auch an gebäuden so baufällig, das es nicht möglich, lange in dem stand zu verbleiben, wie dies alles aus dem protokoll der ad 1618 fürstlichen abgeordneten commission genugsam zu ersehen". Zu der "manglung der landgüter" tritt "auch noch die schuldenlast und armut . . . wegen der accisen"; zahlte Rostock 500 Gulden, so hatte Wismar deren jährlich nur 200 zu entrichten. Aber Adolf Friedrich gab einen einmal gefaßten Plan so schnell nicht wieder auf, zumal er sich in der Vorteilhaftigkeit seiner Ansicht durch ein Gutachten Cothmanns bestärkt glaubte, in dem dieser der Teilung von Rostock zuriet. So sehr er Cothmann auch wegen seiner Gesinnung haßte, so hatte er andrerseits doch dessen berechnende Schlauheit niemals verkannt. Er meinte, daß dieser, "welchem dieser lande gelegenheit zum guten teil bekannt sein werden, 351 ) sich des werk es sicherlich nicht unternommen, weniger


|
Seite 275 |




|
unsers bruders Lbd. dazu geraten haben würde, 352 ) wenn es so gar unmöglich sein sollte". Erst, als die aufgezeichneten Regalien von Rostock und Wismar sich als vollkommen ungleich und unausgleichbar erwiesen, als auch Samuel Behr trotz seines Eifers, Adolf Friedrichs Pläne zu fördern, auf die Dauer sich der Unmöglichkeit einer Teilung Rostocks 353 ) nicht verschließen konnte und am 13. August 1620 seine Ansicht dahin aussprach, daß es notwendig wäre, Rostock gemein zu lassen, - da wußte auch er nicht mehr, wie er die Totaldivision retten sollte. Nur ein Weg war noch möglich: beide Städte, Rostock und Wismar, könnten einem 354 ) gegeben werden, und dem Schicksal müßte es es überlassen bleiben, jedem sein Teil zuzuweisen. Und in diesem Sinne machte er am 4. November 1620 Hans Albrecht den Vorschlag, 355 ) Rostock, Wismar, Parchim und Schwerin "uff eine seit und die andern landstädte uff die andere seit zu setzen . . . und dann zu losen, immaßen es dann J. f. g. nochmals uffs los ihresteils setzen wollen . . ., wäre solches auch eine unvorteilhafte teilung". Hans Albrecht aber wollte nicht 356 ) noch einmal "per sortem" teilen. Auch müßte Rostock gemein bleiben, weil es "vor sich, sowohl auch der hospitäl St. Jürgen und Heiligen Geistes, wie auch der bürger güter mit den ämtern Güstrow, Schwaan und Ribbenitz nicht allein grenzen, ja, auch einer aus des andern hebung habe, ja, daß noch mehr, daß J. f. g. (d. i. Adolf Friedrich) mit der stadt Rostock in der Ribbenitzer heide streitigkeiten und daselbst die jagden habe", so wäre "dahero
I. Rostock und Wismar sollten zu Schwerin gelegt und die Städte dann folgendermaßen geteilt werden:
"Rostock dagegen Güstrow, Brandenburg, Teterow, Laage, Krakow.
Wismar dagegen Friedland, Malchin, Woldeck.
Schwerin dagegen Sterneberg.
Parchim dagegen Waren und Röbel.
II. Sollte aber dieser weg wegen der stadt Rostock und der akademieen nicht gehen können, so lasse man dieselbigen stücke bis zu weiter vergleichung gemein und ausgesetzt sein."


|
Seite 276 |




|
leichtlich abzunehmen, wann die stadt Rostock geteilt und J. f. g. herzog Adolf Friedrichen zugefallen, was daraus für inconventien erfolgen wurden, daß nemblich J. f. g. nicht allein mit der stadt Rostock würden perpetuas lites haben, sondern könnten auch zwischen JJ. ff. gg. streit und mißverstände erreget werden". Als somit auch dieser letzte Vorschlag verworfen wurde, da war auch Adolf Friedrichs Rat zu Ende, - die eigentliche Totaldivision, die Teilung, wie er sie erstrebt, war mit dem Fallen dieses letzten Planes gescheitert.
Aber damit war eine eingeschränkte Teilung des Landes nicht ausgeschlossen. In richtiger Erkenntnis der Sachlage beschloß Adolf Friedrich daher zufrieden zu sein mit dem, was erreichbar war. Am 7. November 357 ) ließ er durch Samuel Behr erklären, daß er einverstanden wäre, Rostock gemein zu lassen. Dadurch wurde die Teilung der Städte bedeutend vereinfacht, immerhin aber konnten auch jetzt noch bei eingehender Behandlung durch Mängel 358 ) an Nachrichten usw. leicht ernstliche Hindernisse entstehen. Daher riet Hans Albrecht jetzt nochmals dringend, "superficialiter zu teilen", die Städte einfach voneinanderzusetzen 359 ) und sie einem jeglichen Teile zuzueignen, "hernachher erst zu aestimieren und die befindliche übermaß dann eins oder andernteils der gebühr zu erstatten". 360 ) Die Teilung der Städte wollte er folgendermaßen machen: Wismar, Parchim, Schwerin, Sternberg, Waren, Laage und Krakow sollten zu dem einen Teil, Güstrow, Teterow, Malchin, Brandenburg, Friedland, Woldegk, Röbel und Kröpelin dagegen zum andern Teil gelegt werden. Adolf Friedrich war mit dem Vorschlag im allgemeinen schon zufrieden, mit der Teilung an sich aber gar nicht. 361 )


|
Seite 277 |




|
Er wollte Laage und Krakow gerne abgeben, dafür aber Kröpelin und Malchin auf seiner Seite haben. 362 ) Als aber Hans Albrecht hierauf am 26. November 1620 erklärte, daß er Kröpelin zwar für Laage und Krakow hingeben, Malchin aber auf jeden Fall für sich haben wollte, 363 ) gab Adolf Friedrich am 28. November nach 364 ) und verzichtete auf Malchin. Die Teilung der Städte wurde also folgendermaßen festgesetzt. Adolf Friedrich erhielt: Wismar, Parchim, Schwerin, Waren, Kröpelin; Hans Albrecht dagegen: Güstrow, Teterow, Malchin, Brandenburg, Friedland, Woldegk Laage und Krakow. Von Adolf Friedrichs Seite blieb Sternberg und von Hans Albrechts Röbel "ausgesetzt und im gemenge, damit die einer= oder andrerseits befindliche übermaß dadurch erstattet werden könnte".
Unterdessen war auch die Teilung der Leibgedingsämter zum Abschluß gekommen. Mit der Taxierung 365 ) derselben waren seitens Adolf Friedrichs Ulrich von Negendank, seitens Hans Albrechts Joachim von Lehsten betraut worden. Ihre Instruktion, die ihnen am 20. Juli übergeben wurde, enthielt im wesentlichen die gleichen Punkte wie die bei der Teilung der Ritterschaft. Nachdem die verwitweten Herzoginnen gebeten waren, die Deputierten durch ihre Amtleute möglichst unterstützen zu lassen, sollte am 2. August 366 ) mit der Taxierung der Ämter begonnen werden. Allein Adolf Friedrich konnte keinen seinem Deputierten beizuordnenden "qualificierten" Notar 367 ) bekommen, - "ein mangel", meinte er, "der doch in diesem lande nicht zu verhoffen!" Da ferner Hans Albrecht noch einige Änderungen 368 ) in der Instruktion vorzunehmen wünschte, so verzögerte 369 ) sich die Angelegenheit bis zum 11. September. Am 15. 370 ) wurden die Deputierten endlich vereidigt, und nun ging die Arbeit schnell von statten.
Schon am 13. November 1620 371 ) war die Abschätzung vollzogen und die Teilung vorgenommen worden.


|
Seite 278 |




|
Jetzt, nachdem alles wohl auseinandergesetzt und die Teilung auf dem Papier vollzogen war, fragte es sich, ob sie denn auch so glatt in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnte, ob die Stände ohne weiteres darein willigen oder die Fürsten andernfalls die Macht besitzen würden, auch gegen deren Willen die Totaldivision, abgesehen von Rostock, vollständig durchzuführen.
Die Stände 372 ) hatten sich, wie erinnerlich, 1611/12 aufs entschiedenste gegen die Totaldivision ausgesprochen, durch ihren Widerstand jedoch nichts andres erreicht, als daß sie 1612 aufgelöst und nach Hause geschickt wurden. Zur Untätigkeit gezwungen, blieb ihnen damals nichts andres übrig, als das Tun der Fürsten aufmerksam zu beobachten und über ihre Privilegien zu wachen.
Erst der Streit der Fürsten untereinander bot ihnen Gelegenheit, sich diesen zu nähern. Die von ihnen aufgestellten Unterhändler wurden von den Herzögen willkommen geheißen. Allmählich schien sich so das Verhältnis mit den Fürsten zu bessern, zumal die Unterhändler in Hans Albrechts Bestreben nach einer Landeskontribution - diese stand ihm, wie sich später zeigen wird, höher als die ganze Totaldivision die kraftvollste Unterstützung fanden. Denn um die Kontribution zu erlangen, war ein Landtag nötig. Nichts aber wünschten die Stände sehnlicher. Denn nur auf diesem Wege konnte ihr Verhältnis zu den Herzögen gebessert werden, nur so war es möglich, diese durch Bewilligung der Kontribution zum Verzicht auf die Landesteilung und zur Abhülfe der ständischen Beschwerden zu bewegen. Adolf Friedrich hätte sich vielleicht trotz aller früheren Streitigkeiten mit den Ständen hinsichtlich des Ausschreibens eines Landtags zu Hans Albrecht entgegenkommend verhalten, wenn nicht gerade zu jener Zeit Ritter= und Landschaft den Fürsten eine zu Güstrow verfaßte Resolution übergeben hätten, in der sie, wie Adolf Friedrich fand, ihnen "fein verdeckt vorgeschrieben, wie die regierung zu führen sei" 373 )
Als die Stände ferner noch um einen Revers baten, in dem die Herzöge eine Permutation der Landschaft für immer ablobten, konnte sich Adolf Friedrich zu der Ausschreibung eines Landtages nicht verstehen. Hans Albrecht aber fand bald einen neuen Grund, mit dem er die Forderung eines Landtages begründen konnte. Wie oben angedeutet, hatte im Fahrenholzer Vertrag ein Herzog


|
Seite 279 |




|
dem andern, dem das Amt Ribnitz zufallen würde, seine Hilfe zum Erwerb des dortigen, den Ständen gehörigen Klosters zugesichert. Schon 1613 hatte Hans Albrecht daher, um mit den Ständen zu verhandeln, den Ausschuß der Landschaft berufen. "Bei der beratschlagung waren jedoch soviele widrige punkte zu tage getreten, daß für das mal nichts fürgenommen werden konnte". 374 ) Jetzt kam er hiermit nun von neuem und bat Adolf Friedrich um Unterstützung und - er wollte das Kloster nach vorgenommener Taxierung für das Amt Broda eintauschen - zur Erledigung des Handels abermals um eine Zusammenkunft der Ritter= und Landschaft. Unter dieser Begründung konnte Adolf Friedrich eine solche nicht versagen. Mit Zustimmung seines Bruders berief also Hans Albrecht zum 15. November 1618 375 ) einen Ausschuß der Stände zu einem sogenannten Convokationstag nach Sternberg auf den Judenberg und versprach, selbst dahin zu kommen, um mit ihnen zu verhandeln. Als aber am 14. November sein damals nur allein noch lebender Sohn Karl Heinrich starb, blieb er, darüber sehr niedergeschlagen, zu Hause, ließ seine orderung durch Cothmann vortragen 376 ) und um möglichst schleunige Erledigung der Angelegenheit ersuchen. Gleichzeitig baten die fürstlichen Räte Adolf Friedrich hatte die seinen auch gesandt - den Ausschuß, die von dem niedersächsischen Kreistag beschlossene Steuer von einem 377 ) Römermonat 378 ) zu bewilligen. Der Ausschuß erklärte am 18. November, 379 ) daß er keine festen Beschlüsse fassen könnte, ehe nicht die Landräte, die nur noch zu zweien 380 ) vorhanden wären, nachgewählt würden. Erst dann wäre es möglich, über den Tausch des Klosters Ribnitz mit dem Amt Broda zu beraten. Hinsichtlich der Kreissteuer aber, von der in dem fürstlichen Ausschreiben nichts erwähnt und zu der daher die Abgeordneten der Städte nicht bevollmächtigt wären, könnte kein bestimmter Beschluß gefaßt werden ; zu ihrer Bewilligung wäre ein Landtag erforderlich. Schließlich baten sie wieder, ihren Beschwerden abzuhelfen, und versprachen dafür, die 1611 gestellten Forderungen der Fürsten "nach bestem vermögen" zu


|
Seite 280 |




|
erfüllen. Hans Albrecht erklärte am 26. Januar 1619, daß er für die Ergänzung der Landräte Sorge tragen und mit seinem Bruder wegen des Landtages verhandeln wollte. Adolf Friedrich dagegen war weit entfernt, einen solchen zu bewilligen, und ließ dem Landmarschall 381 ) Henneke von Lützow, den die Stände, ihn in Sternberg zu begrüßen, abgeschickt hatten, eine "nicht gnädige antwort" 382 ) zu teil werden. Dem Ausschuß ließ er mitteilen, die Landräte wären zwar nicht viel nütze, doch wolle er neue ernennen, wenn die Stände solche vorschlügen. Einen Landtag würde er nicht ausschreiben, da die Erfahrung ihre Zwecklosigkeit hinreichend bewiesen hätte. Den Ständen wären Freiheiten wie nie zuvor eingeräumt worden, ohne sie dadurch auch nur zu einiger Nachgiebigkeit bewegen zu können. Landtage wären auch zur Bewilligung von Kreissteuern nicht nötig. Und, um den Ständen dies ad oculos zu demonstrieren, gab er seinem Bruder nach und ließ am 19. Juli 1619 einfach durch ein Edikt, ohne die Stände weiter zu fragen, die Kreissteuern verkündigen.
Die Stände machten zwar sowohl hiergegen als auch gegen die Totaldivision am 8. September die ernstlichsten Vorstellungen und erklärten solch Vorgehen der Fürsten wider alles Herkommen und das Huldigungsversprechen und baten nochmals darum, einen Landtag auszuschreiben und sie in ihren Rechten ferner nicht zu kränken. Adolf Friedrich aber wies sie am 26. Januar 1620 383 ) mit scharfen Worten ab und verbat sich eine so kühne Sprache. Er erklärte sich jedoch bereit, "ihre unbesonnenheit noch einmal zu übersehen" und einen Landtag ausschreiben zu lassen, nicht etwa, als ob er ihn für notwendig hielte, um ihre Einwilligung zu den Kreissteuern zu erlangen, sondern um endlich ihre Gründe gegen die Totaldivision zu hören und vor allem ihre Privilegien und Reverse zu sehen, damit so wenigstens für die Zukunft jede Gelegenheit zu Weiterungen und Erfindungen abgeschnitten würde. Sie möchten also zusammenkommen und ihre Wünsche durch einen Ausschuß vorbringen lassen. 384 )
Diesen Wink der Fürsten machten sich die Stände schnell zu nutze. Als neue Landräte ernannt waren und diese sich mit den drei Landmarschällen und den Abgeordneten der beiden Seestädte am 1. Mai 1620 zu Güstrow versammelt und darauf auch


|
Seite 281 |




|
den ganzen Adel nach Sternberg gut Beratung gerufen hatten, setzten die also vereinigten Stände am 27. Juni einen dauernden, aus 35 Personen bestehenden Ausschuß mit der Bestimmung fest, daß diese aus allen drei Kreisen (dem mecklenburgischen, wendischen und stargardschen) gewählten "Personen nit allein für diesmal, sondern, do auch künftig diesem unserm gemeinen vaterlande hochangelegenen sachen zur hand stoßen werden, drüber fleißige consultation halten und . . zum besten befurdern, welche auch zu der behuf für und für bleiben , . ." usw. 385 )
"Und was also obberührte deputierte ihrer besten diskretion nach beratschlagen, handelen und schließen werden, solches wollen wir ebenso kräftig achten, als wann es alles von uns selbst gegenwärtig beliebet und beschlossen wäre".
Die Namen des Ausschusses wurden den Fürsten anfangs geheim gehalten und ihnen erst auf ihr ausdrückliches Verlangen am 3. November von dem Landmarschall Henneke von Lützow bekannt gegeben. 386 )
Die von den Herzögen gepflogenen Totaldivisionsverhandlungen machten unterdessen immer größere Fortschritte. Da wandte sich der jetzt konstituierte Ausschuß mit folgender Bitte an die Fürsten: Weil bei der Landesteilung vor allem ihr "seelheil und wohlfahrt" in Betracht käme, möchte es ihnen nicht verdacht werden, daß auch sie sich die "sache überlegten"; sie wollten sich auch jeder Censur enthalten. Trotzdem brachten sie im folgenden u. a. alle Gründe, die Hans Albrecht seinerzeit Adolf Friedrich entgegengehalten hatte. Sie beriefen sich darauf daß sie im Lauf der Zeit "mit einer gewissen forma und norma 387 ) einer unzerteilten regierung privilegieret und begnadet worden". Es wäre ihnen in dem von den Herzögen "anno 72, 388 ) den 2. Juli, . . . erteilten . . . assekurationsrevers 1. ein gemeines land= und hofgericht verordnet, 2. darauf auch status ecclesiastici et politici regiminis mit publicierung consistorial=, policei= und hofgerichtesordnunge durch heilsame constitutiones löblich konstituieret, 3. ferner auch die mit E. f. g. städten aufgerichtete pacta, privilegia auf gemeldte regierunge gerichtet, eines teils


|
Seite 282 |




|
stände auch mit sonderbaren privilegiis de non dividendo befreiet, immaßen dann E. f. g. alle solche frei= und gerechtigkeit bei der angenommenen erbhuldigunge confirmieret". Da durch die Totaldivision alle ihre Rechte fast mit Füßen getreten würden, möchten die Fürsten davon abstehen und sie wenigstens "bei unzerteilter justitiae administratio aller habenden und wohlerlangten frei= und gerechtigkeiten . . . belassen". Billig wäre es auch, wenn nicht den ganzen Ausschuß, so doch wenigstens die Landräte beider Beratung über die Landesteilung hinzuzuziehen.
Die Herzöge sahen in dieser Bitte der Stände einen Ein= und Übergriff in ihre Rechte und waren so erzürnt darüber, daß sie eifrig nach dem Urheber und Verfasser solcher unbotmäßigen Gedanken fahnden ließen, um ihn fassen und strafen zu können. Ihr Verdacht fiel dabei vor allem auf den Professor der Rechtswissenschaft Dr. Lindemann zu Rostock, den sich die Stände zum Landfyndikus erbaten. Dieser wurde einem peinlichen Verhör unterworfen, 389 ) leugnete aber jegliche Beihilfe.
Aber wie sehr die Fürsten auch den Widerstand der Stände zu beugen suchten, so mußten sie diesem Verhalten doch sowohl wegen der Behinderung, die sie dadurch erfahren konnten, als auch wegen der Kontribution, die sie erlangen wollten, gebührend Rechnung tragen. Es wurde ihnen klar, 390 ) "daß man, ehe zum hauptwerk der totaldivision geschritten würde, dahin bedacht sein müsse, wie den behinderungen . . . mit bestande zu begegnen und die division in eil anitzo fortzusetzen, ehe von der landschaft mehr behinderungen eingestreut würden" Deswegen sandten sie ihre Räte am 2. November 1620 (Samuel v. Behr und Michel Bruns von Adolf Friedrichs, Barthold von Bülow und Otto v. Preen von Hans Albrechts Seite) zur Beratung zusammen. Sie verkannten die der Landesteilung aus dem Assekurationsrevers und dem gemeinsamen Hofgericht drohenden Gefahren nicht, meinten aber, "daß sich die landschaft hierin nicht ferner sperren werde. Sollte es aber über zuversicht geschehen, könnte man's ihnen in


|
Seite 283 |




|
beiden canzleien mit sperrung der justiz so müde machen, daß sie sich endlich wohl würden accommodieren müssen." J. f. g. hielten es auch dafür, daß bei der römischen kaiserlichen Mtt. bei itzigem zustande mandate de dividendo an die landschaft leichtlich ausgebracht werden können, immaßen dann von J. f. g. löblichen vorfahren in simili casu auch beschehen", ferner "halten es J. f. g. dafür, wann ein jeglicher herr in seinem lande ein hofgericht bestellte, darinnen der landschaft unparteiliche, schleunige justiz administriert würde, daß sie sich dann im geringsten nicht zu beschweren." Von einer Zuziehung der Landräte zum Teilungswerk wollten die Herzöge nichts wissen.
Als die Stände somit nichts erreicht hatten, legten sie 391 ) am 14. November 1620 unter Berufung auf ihre Privilegien feierlichst gegen die Landesteilung Protest ein. Eine solche Wendung der Dinge konnte den Landesherren natürlich nicht recht sein. Daher ließen sie den Ausschuß am 16. November von neuem auffordern, ganz sachlich die einzelnen Gründe der Stände gegen die Totaldivision vorzubringen. 392 ) Diesem Wunsche entsprechend, forderten die Stände vor allem Sicherheit wegen der Religion und die Ungeteiltheit des ius episcopale, des Konsistoriums und des Hofgerichts. Die Fürsten erklärten sich hierauf bereit, ihnen die Erhaltung der lutherischen Kirche versichern und auch ihre Beschwerden erledigen zu wollen. Auf die andern Forderungen gingen sie nicht ein. 393 ) Der Ausschuß jedoch, nicht befugt, mit den Herzögen ohne vorherige Besprechung mit den Ständen irgend ein Abkommen zu treffen, bat zunächst um Entlassung, damit er der Ritter= und Landschaft Ergebnis und Stand der Verhandlung mitteilen könnte, sodann aber zur Erledigung weiterer Verhandlungen um Berufung eines Landtages. Jetzt endlich gaben die Herzöge diesen Bitten nach und schrieben zum 13. Dezember 1620 394 ) nach acht Jahren wieder den ersten Landtag aus. Hier erklärten sie von neuem, 395 ) daß sie das Land= und Hofgericht und das Konsistorium nicht gemeinsam lassen könnten, da sie entschlossen wären, alles außer Rostock und der Kontribution zu teilen. Gerne aber würden sie den Wünschen der Stände soweit wie möglich Rechnung tragen, das Münzwesen "fleißig beaufsichtigen", ihnen nach vollendeter Totaldivision auch das erbetene


|
Seite 284 |




|
Landrecht 396 ) geben und ihre Beschwerden nach besten Kräften beseitigen.
Die Stände antworteten hierauf, 397 ) daß sie niemals in die Teilung des weltlichen und geistlichen Gerichtes willigen, 398 ) sich auch alle rechtlichen Mitteln dagegen vorbehalten würden, versprachen aber, falls die Herzöge die Totaldivisionsbestrebungen fallen ließen, die "Beschwerungen" der Ritter= und Landschaft abschafften und ferner Hans Albrecht sich auch des Doms zu Güstrow und des Klosters zu Ribnitz begeben würde, sich ihrerseits zu einer "ansehnlichen kontribution" bereitfinden zu lassen. Hierauf wurden die Verhandlungen wegen des herannahenden Weihnachtsfestes bis zum 9. Januar verschoben.
Mit einer neuen Hemmung, und zwar von einer Seite, von der man es nie gedacht hätte, leiteten sich die Verhandlungen des neuen Jahres 1621 ein. 399 )
Die Rostocker hatten in den Ferien eine gewichtige Resolution verfertigt, die sie nun vorbringen ließen. 400 ) Wenn das ganze Land geteilt würde, wollten auch sie ihre Stadt einem Teile zugeeignet haben. Sie hätten Privilegien, daß sie im Fall einer Totaldivision mit in die Teilung kommen, "nur einem landesfürsten subjekt sein und des insgemein beiden regierenden landesfürsten geleisteten homagialeides von einer seite entbunden" werden müßten.
Auch von der Ritterschaft kam unter Berufung auf den Assekurationsrevers, den Rostocker Erbvertrag und den Wismarschen Appellationsrezeß eine neue Resolution ein. Nochmals bat sie um Abstandnahme von der Totaldivision, indem sie jetzt dabei besonders auf die Zeitlage und den traurigen Zustand des Landes verwies, der die Teilung gar nicht zulassen würde. Die Herzöge möchten sich doch vergegenwärtigen, "wieviele inconvenienzen entstehen würden, wenn zwei landrechte und zweierlei prozeß in


|
Seite 285 |




|
einem lande und fürstentum sein sollten". Weiter bat 401 ) sie, die "vollziehung des vor diesem (1611) abgefaßten assecurationsreverses nunmehro dergestalt zu erledigen und zu befördern, daß sie dermaleinst das erwünschte ziel so vielfältig gehaltener landtage erreichen möchte".
Hierauf gaben die Fürsten am 15. Januar eine lange Erklärung ab. Sie versprachen den gravamina der Städte "beschaffung thun zu wollen, daß die eine geraume zeit her eingerissenen mißbräuche des brauens, mälzens und verkäuferei 402 ) gänzlich abgeschafft und der längst publizierten polizeiordnnng in allen nachgelebt werden sollte". Gleicherweise gaben sie auch den Forderungen der Ritterschaft nach. Die Teilungsbestrebungen aber verteidigten sie energisch. Die Totaldivision wäre berechtigt, nicht allein wegen des "juris consuetudinarii", sondern auch nach den von Karl V. und andern Kaisern gegebenen Lehnbriefen. Der Assekurationsrevers, der Erbvertrag und der Appellationsrezeß "könnte der division in nichts hinderlich sein", 403 ) da in denselben "nicht eines gemeinen, sondern nur schlechterdings des hofgerichts gedacht würde". "Befremdend" aber wäre es, "zu vernehmen, daß die städte Rostock und Wismar resp. jetzt geteilt und dann ungeteilt sein wollten und ihre praetendierten privilegia in utramque partem deuten könnten, welches sie . . . dafür halten müßten, daß man dies werk singulari studio zu hemmen gemeinet sei". "Was" vollends "von der forma regiminis und flor dieser lande angezogen worden, so befünden Sermi, . . . daß dies land seiner gelegenheit nach ganz nicht floriere, sondern je länger, je mehr ruinieret würde, indem der adel an vermögen nicht allein sehr abnehme, sondern auch vor diesem unerhörte viele cessiones bonorum et concursus geschehen wären, und die städte außer wenigen nicht geringen abgang ihrer nahrung empfünden, zu welcher continuation die communio als mater discordiae, die divisio aber zu besserm aufnehmen und gedeihen ursache und anlaß genug geben könnte und würde". 404 ) Sie sollten sich daher den ihnen "von Gott vorgesetzten landesfürsten in ihren unzweilichen rechten des juris dividendi und dessen posses ferner nicht opponieren" und dadurch die Krisis, die sonst unzweifelhaft eintreten müßte, vermeiden. Die hierin offen ausgesprochene Anteilnahme der Fürsten an dem Wohl des Landes


|
Seite 286 |




|
war in diesem Augenblick das rechte Wort am rechten Ort. Ein einseitiges Nachgeben der Stände war natürlich nicht zu erwarten, vielmehr mußten beide Parteien einander entgegenkommen, um die gewünschte Einigung herbeizuführen. Am 17. und 19. Januar erboten sich Ritter= und Landschaft, jedoch unter Wiederholung ihrer Bitte um Abstandnahme von der Totaldivision und nach abgelegtem Versprechen der Herzöge, "sie in einer region bei einer religion, einem rechte und gesammten gericht, in einem corpore einig und ungetrennt zu lassen", auch den Dom zu Güstrow nicht zu reformieren, ferner die Gerichte zu verbessern, sie nicht gegeneinander aufzubieten, ihre Privilegien zu bestätigen und die noch unerledigten Beschwerden abzuschaffen, diesen "beiderseits mit 600 000 fl. mecklenburgischer währung, und also jeglichem mit 300 000 fl. . . . beizutreten". 405 )
Jetzt, wo die Stände nicht nur ihren Forderungen, sondern auch ihren Gegenleistungen so bestimmte Form gegeben hatten, war es Sache der Fürsten, sich zu entscheiden. Und diese taten 406 ) das, wozu sie durch die Verhältnisse gezwungen wurden.


|
Seite 287 |




|
Unter dem Druck ihrer Schulden und bewogen durch den lebhaften Wunsch nach Ruhe, gaben sie den Forderungen der Stände nach.
Hans Albrecht war der erste, der den Forderungen der Stände Gewährung versprach. 407 ) Wie sehr er auch anfangs hinsichtlich der Religionsfrage alle ihre "remonstrationen" zurückgewiesen hatte, so erkannte er doch, zumal sich auch Adolf Friedrich in diesem Punkte so gänzlich auf ihre Seite stellte und ihre Forderungen unterstützte, je länger, je mehr die Hoffnungslosigkeit seiner Wünsche. Die Landesteilung verlor allerdings damit für ihn an Bedeutung. So war es verständlich, daß er sich durch die Aussicht, von seiner bedeutenden Schuldenlast befreit zu werden, den Ständen geneigt zeigte. Adolf Friedrich wurde dies unendlich viel schwerer. Er hing ungleich fester an der Totaldivision als Hans Albrecht an seinen religiösen Bestrebungen. Sein ganzer Charakter zeigte überhaupt ebensoviel mehr Festigkeit wie sein Geist Schärfe. 408 ) Dennoch gab auch er am 18. Januar 1621 409 ) nach, nicht zum wenigsten durch


|
Seite 288 |




|
Hans Albrechts Bitten dazu bewogen. Land= und Hofgericht und das Konsistorium sollten gemein bleiben und die sonstigen Wünsche der Landschaft erfüllt werden. Doch nun reute Hans Albrecht sein Zugeständnis, und er verlangte den Dom für sich. Große Mühe kostete es Adolf Friedrich, ihn von seiner Forderung abzubringen. Erst als ihm zugestanden wurde, "seine begräbnis= und leichenpredigt durch seinen calvinschen pfaffen darin verrichten zu lassen", erklärte er sich bereit, sich "des doms gänzlich zu begeben". Am 24. 410 ) jedoch wurde er von neuem schwankend und drohte alles "zu zerschlagen", wenn er den Dom nicht erhielte. Am 25. 411 ) bemühte sich Adolf Friedrich vergebens, den Räten Hans Albrechts "zu gemüte zu führen, wenn sie die kalvinsche religion so fortsetzen wollten, daß dadurch die teilung und kontribution verhindert" würde, und zornig drohte er, Hans Albrecht zu weiteren Anleihen nicht mehr seine Zustimmung zu geben. Dieser aber rächte sich hierfür mit der "commination", "nun eine ganz neue kalvinsche kirche zu Güstrow zu bauen, dafür aber die totaldivision ganz zu zerschlagen, sich der kontribution auch gänzlich zu begeben". Am 27. 412 ) erkannte er endlich das Nutzlose seines Widerstandes und erklärte, "es sei so nicht gemeint, wie es vielleicht aufgenommen; er begehre nur seine kapelle auf seinen häusern und allhier seine schloßkirche größer zu bauen und einen praeceptor für etliche wenige knaben". 413 )
Am gleichen Tage 414 ) erhielten auch die Stände offiziell die Nachricht, daß das Hofgericht und das Konsistorium gemein bleiben und später neugeordnet werden sollten, und daß Hans Albrecht sich der Reformation des Domes begeben hätte.
Trotz der glücklichen Einigung konnten die Verhandlungen auf diesem Landtag nicht weiter geführt werden, weil die meisten


|
Seite 289 |




|
Ritter dem direkten Verbot der Herzöge entgegen des "Umschlags" halber heimgereist waren.
Am 5. Februar trat ein neuer Landtag zu Güstrow zusammen. Von den Ständen, die sich über das Entgegenkommen der Herzöge hocherfreut zeigten, wurden zunächst nochmals einige Beschwerden vorgebracht. Gleichzeitig baten sie, damit die Verhandlungen doch endlich "zur gedeihlichen endschaft" kommen möchten, um einen Revers, der alles zusammenfaßte, was ihnen bis jetzt von den Fürsten bewilligt war. Die Herzöge versprachen am 9. Februar, 415 ) ihrem Wunsche unter der Bedingung nachzukommen, daß auch sie nun endlich "der kontribution halber zu ihrem kontentement" sich erklärten. Am 13. 416 ) ging den Ständen der erste Entwurf des erbetenen Assekurationsreverses zu, und nach zweimaligen Änderungen am 14. 417 ) und 17. wurde er, aus 49 Punkten bestehend, am 23. Februar 1621 von den Ständen angenommen und von den Fürsten unterzeichnet. 1626 wurde er vom Kaiser bestätigt. 418 ) Gleichzeitig 419 ) mit den Fürsten erfüllten auch die Stände ihr Wort und erklärten sich bereit, "zur abhelfung der fürstlichen schulden" 1 000 000 Gulden zu erlegen, und zwar sofort 600 000 Gulden und sodann "über sechs jahr zweimalhunderttausend gülden gleichfalls mit den zinsen und folgends über zwei jahr, von abgewichenem antoni an zu rechnen über acht jahr, die übrigen 200 000 fl. sammt den zinsen". Damit die Stände diese Summe "desto füglicher und träglicher" zusammenbringen könnten, gaben 420 ) ihnen die Fürsten ferner die Erlaubnis "der freien disposition und dispensation", was diese in vollstem Maße ausnutzten. Gleichzeitig versicherten sie auch, "daß diese der landschaft jetzt abermals geleistete freiwillige hülf ihnen und allen ihren nachkommen . . . an ihren privilegien . . . ganz unnachteilig sein" sollte und die Stände, "auch solche . . . hülfe zu leisten, hinfüro nicht . . . verpflichtet . . . und weiter . . . [der] nachkommenden herzogen zue Mecklenburg schulde . . . zu bezahlen nicht schuldig sein" sollten.
8.
So stand denn endlich, nachdem alle Hindernisse überwunden und die drei Parteien zufriedengestellt waren, nichts mehr im


|
Seite 290 |




|
Wege, zur Ausführung der nun schon so lange betriebenen Landesteilung zu schreiten. Am 3. März 1621 wurde der Erbteilungsvertrag vollzogen und darin die Fahrenholzer Teilung der Ämter dahin geändert, daß zur besseren Abrundung der beiden Landesteile die bisherigen güstrowschen Ämter: Grabow, Gorlosen, Marnitz, Neukloster, Sternberg mit dem Klosterhof und Walsmühlen gegen die bisherigen schwerinschen Ämter Strelitz, Goldberg, Wredenhagen und Fürstenberg ausgewechselt wurden. 421 ) Ein beider unter Hans Albrechts Ämtern eingesessenen Ritterschaft gefundener Überschuß 422 ) an Roßdiensten wurde dadurch ausgeglichen, daß genügend viele Dienste von den Grenzämtern des güstrowschen Teils zu den angrenzenden schwerinschen geschlagen wurden. Die Städte schließlich wurden so geteilt, daß an den schwerinschen Teil: Wismar mit allen fürstlichen Häusern, Schwerin, Parchim, Waren und Kröpelin, ferner die adeligen Städtchen Brüel, Malchow und Dassow und zur gleichmäßigen Teilung der Elb= und Schaalezölle auch noch Dömitz und Zarrentin fielen; zum güstrowschen Teil aber kamen: Güstrow, Laage, Krakow, Malchin, Röbel, Teterow, Neubrandenburg, Friedland und Woldegk, ferner die adeligen Städte Penzlin, Sülze und Marlow und schließlich der Elbe wegen (trotz seiner Abgelegenheit von Güstrow) Boizenburg.
Geteilt wurden sodann die Schiffahrt, die Strafen, Dispensationsgelder, das Begnadigungsrecht usw., das ein jeder Herzog
Die je vier letzten der obengenannten Ämter aber waren bis zum Ableben der Herzogin Anna von Pommern einerseits und der Herzogin=Mutter andererseits nicht in den Händen der Herzöge.


|
Seite 291 |




|
in seinem Gebiet allein haben sollte. Einem jeden für sich sollte es ferner auch freistehen, seine Ritter= und Landschaft getrennt zu berufen,
Gemeinsam aber blieben:
- Rostock mit Warnemünde, dem Doberanschen Hof und allen seinen Gütern und die Universität,
- ferner die vier Klöster Dobbertin, Malchow, Ribnitz und zum Heiligen Kreuz in Rostock und sodann die Komturei Nemerow,
- das Hof= und Landgericht,
- das Konsistorium,
- der Landtag und
- die Grenzstreitigkeiten, die Kosten zum Reichskammergericht u. a. m.
Ein ebenfalls am 3. März geschlossener Nebenvertrag fügte als allgemeine Bestimmung hinzu, daß kein Herzog künftig mehr als 600 000 Gulden Hypotheken, abgesehen von Kriegszeiten, auf seine Ämter eintragen lassen durfte.
Weiter sollten weder Domänen noch ritterschaftliche Güter an fremde Fürsten verkauft werden, die fürstliche Wittumsverschreibung künftig nur 12 000 Gulden betragen und der unvermähiten Herzogin Anna Sophie von ihren Brüdern nach dem Tode der Mutter jährlich 6 000 Gulden, ausgezahlt werden. Schließlich wurde noch festgesetzt, daß etwaige Unklarheiten dieses Erbvertrages von zwei beiderseits beauftragten, ihrer Eide vorher entlasteten Räten beseitigt werden sollten; eine weitere Teilung des Landes wurde verboten und vollends der jeweilige ältere regierende Landesherr zum Senior des gesamten Fürstenhauses bestimmt.
Schluß.
Nach zehnjährigem Kampf und Streit war endlich die Teilung des Landes vollzogen. Die von den Herzögen erstrebte Totaldivision war gescheitert. Die Ursache lag zum Teil in der Schwierigkeit der Sache selbst, zum Teil an dem Mangel an Einmütigkeit unter den Fürsten, die niemals unerläßlicher war als in diesem erbitterten Kampfe. Ein besonders wichtiger Grund war auch die drückende Schuldenlast, durch die die Fürsten in die Hände der Stände gegeben wurden, und endlich der Widerspruch dieser selbst. Denn die Stände würden sich nie gutwillig der vollständigen Teilung gefügt, sondern, wenn es zum äußersten gekommen wäre, auf Grund ihrer verbrieften Rechte beim Reichskammergericht und auch beim Kaiser Beschwerde erhoben haben,


|
Seite 292 |




|
Für das Land war die Teilung, so wie sie zu Stande kam, ein großer Segen. Das Unheil der bisherigen gemeinsamen Regierung war beseitigt und der konfessionellen Trennung vorgebeugt.
Im Jahre 1695, als Herzog Gustav Adolf von Mecklenburg=Güstrow ohne männliche Erben starb, war noch einmal die Möglichkeit gegeben, das ganze Land unter einer Hand zu vereinigen. 423 ) Der damalige Herzog Friedrich Wilhelm von Mecklenburg=Schwerin machte auch sofort seine Rechte geltend und fand beim Kaiser Unterstützung. Allein die niedersächsischen Kreisstände traten für seinen Bruder Adolf Friedrich II., der als Schwiegersohn Gustav Adolfs Ansprüche auf Güstrow erhob, ein, und so wurde in dem Hamburger Vergleich 1701 die dritte Hauptteilung des Landes in Mecklenburg=Schwerin und Mecklenburg=Strelitz vorgenommen. Noch zweimal ist später der Versuch einer völligen Trennung gemacht worden - 1748 424 ) und, hundert Jahre später, 1848 425 ) - aber ohne jeglichen Erfolg.
Wenn heute, wo dem Lande eine neue Verfassung gegeben werden soll, die Totaldivision wiederum in Frage kommt, so hat sie nicht mehr die Bedeutung wie 1621. Denn im Laufe der drei Jahrhunderte sind manche früher gemeinsame Einrichtungen verschwunden bezw. getrennt: das Hofgericht ist beseitigt und neben dem Konsistorium in Rostock ist ein eigenes in Strelitz eingerichtet, auch die Finanzverwaltung ist völlig gesondert u. a. m. Heute umschließt eben, und das fehlte damals oder war mitten im Untergehen begriffen, das starke Band des geeinten Deutschen Reiches alle Glieder. Wir haben wieder eine Zentralgewalt, die einen bedeutungsvollen Einfluß, wie man ihn von einer größeren oder geringeren Absonderung eines Bundesstaates von einem andern auf den Stand des Ganzen vielleicht befürchten könnte, von vornherein gänzlich unmöglich macht.
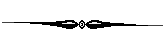

 14 ß. Daß es sich nicht etwa
um einen Druckfehler
(
14 ß. Daß es sich nicht etwa
um einen Druckfehler
(