

|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
:
|
I.
Beiträge zur Geschichte der Vitalienbrüder.
Von
Dr.
Hans Chr. Cordsen,
Seminar=Oberlehrer in Hamburg.
I.
Über die Zeit der Ausgabe und die Form der Mecklenburgischen Kaperbriefe.
1.
Koppmann, 1 ) Voigt, 2 ) Daenell, 3 ) Oelgarte, 4 ) Erslev, 5 ) Girgensohn 6 ) u. a. setzen alle die Ausgabe der Kaperbriefe der Vitalienbrüder ins Jahr 1391, während Lindner 7 ) allein unter Hinweis auf Hanserecesse IV. 15 (MUB. 12319) 1390 angibt, was bisher scheinbar ganz unbeachtet geblieben ist.
Daß die Eröffnung der Häfen nach der am 24. Februar 1389 erfolgten Gefangennahme des Königs Albrecht geschehen ist, ist klar; daß es erst nach dem 3. - 24. Mai 1391, der Zeit, in der Rostock, Wismar, das Bistum Schwerin, die Vogteien Gadebusch und Grevesmühlen einen engen Bund mit den Herzögen schlossen, 8 ) gewesen sein muß, wie Girgensohn anzunehmen scheint, ist nicht unbedingt erforderlich. Im Gegenteil; es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die letzten Worte des Vertrages, die Verpflichtung, niemand zu berauben, der im Geleit der Kontrahenten steht, auf die schon erfolgte Eröffnung des Kaperkrieges beziehen. 9 )


|
Seite 2 |




|
Einen terminus ante quem haben wir in der Antwort der preußischen Städte an Rostock und Wismar vom 30. Juni 1391. Dieses Datum steht unzweifelhaft fest. Es heißt dort: "Vortmer als ir uns schribet, das ir uwer haven geoffent hat alle den genen, dy uff ir eygen ebynture wellen keren und varen, das riche czu Denemarken czu beschedigen, das uns umbillich und gar umbequeme dungket umme des gemeynen kowfmans willen, der in disen sachen von beyden ziten frund ez und nicht czu schicken hat mit uwerem krige." 10 )
Das hier erwähnte Schreiben der Mecklenburger ist uns nicht erhalten. Man ist nicht gezwungen, anzunehmen, wie die Historiker, die 1391 angeben, zu glauben scheinen, daß es erst nach dem 4. April 1391 eingegangen sei, da es sonst auf der an diesem Tage stattgefundenen Versammlung zu Marienburg 11 ) hätte beantwortet werden müssen.
Seit November hatte die Schiffahrt geruht, und es ist sehr wohl möglich, ja nach den unten angeführten Gründen sogar wahrscheinlich, daß das im Herbst eingegangene Schreiben der Mecklenburger während der Wintermonate seine Beachtung gefunden hat. Erst das Frühjahr, in dem die Schiffahrt wieder begann, 12 ) hat die Aufmerksamkeit auf den Krieg überhaupt und auf jene Mitteilung der Städte Rostock und Wismar im besonderen gelenkt und die Antwort der preußischen Städte vom 30. Juni 1391 veranlaßt.
Nach Reimar Kock 13 ) haben Rostock und Wismar den Kapern ihre Häfen geöffnet, dewile de schepe (. . . mit hertoch Johann nha Stockholm) in der sehe weren. Da nun im Jahre 1391 der Zug Johanns erst im August erfolgte, 14 ) das Schreiben der preußischen Städte aber vor diese Zeit fällt, 15 ) so kann nur der im Herbst des Jahres 1390 unternommene Zug gemeint sein. 16 ) Auch Detmars Notiz, 17 ) daß schon im Frühjahr 1391 "wol hundert zeerovere edder mer" von den


|
Seite 3 |




|
Stralsundern gefangen worden seien, würde für das Jahr 1390 sprechen. 18 )
Wir werden daher wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen dürfen, daß zuerst die Herzöge für ihre Häfen 19 ) Kaperbriefe ausgestellt haben, jedenfalls gleichzeitig mit oder bald nach dem Vertrage vom 26. August 1390, 20 ) und daß auf deren Drängen Rostock und Wismar, die damals jedenfalls schon gerne mit ganzer Kraft für ihren Landesherrn eingetreten wären, 21 ) noch im Herbst ihrem Beispiel gefolgt sind. 22 ) Es ist demnach nicht das Jahr 1391, sondern mit Lindner 23 ) 1390 als Zeit der Eröffnung des Kaperkrieges anzusetzen. 24 )
2.
Seit den ältesten Zeiten war das ter buit oder ter kaap varen - wie die Holländer es nannten - eine der beliebtesten Beschäftigungen der Küstenbewohner der Nordsee. Besonders die Friesen, aber auch die Holländer und Seeländer legten sich darauf und verschafften sich auf diese Weise ansehnliche Reichtümer. Nach und nach aber wurde mit dem ter buit varen viel Mißbrauch getrieben, sodaß sich die Fürsten genötigt sahen, es zu beschränken, indem sie bestimmten, daß niemand ter buit varen dürfe, der nicht vom Grafen Briefe auf Schadloshaltung und damit die Erlaubnis erhalten hätte, die Schiffe dieser oder jener feindlichen Macht "aan te tasten, te nemen en op te bringen." Dafür wurde ihnen dann sicheres Geleit zugesagt.


|
Seite 4 |




|
Die Maßnahme der Mecklenburger war daher durchaus nichts Besonderes und Ungewöhnliches, wie Voigt u. a. meinen, und bis zum Friedensschluß 1395 waren die Züge der Vitalienbrüder nach damaliger Auffassung rechtlich vollkommen einwandsfrei. Die mecklenburgischen Kaperbriefe sind uns nicht erhalten. Der einzige aus der Antwort der preußischen Städte 25 ) erhaltene Satz läßt aber darauf schließen, daß sie ähnlich gelautet haben werden wie die uns erhaltenen holländischen 26 ) und dänischen 27 ) aus späterer Zeit. Die Form war stereotyp 28 ) und von einem besonderen Auftrag, Stockholm mit Lebensmitteln (vitalien) zu versorgen, wird nicht die Rede gewesen sein. Man hat von einem solchen angeblich in jenen Briefen erwähnten Zweck bisher allgemein den Namen Vitalienbrüder herleiten wollen.
Daß jedoch diese Ableitung des Namens falsch ist, soll im folgenden bewiesen werden.


|
Seite 5 |




|
II.
Die Bezeichnung Vitalienbrüder und Likedeler und die Beziehungen dieser Kaper zu den Piraten des Kanals und den Goldkompagnien des hundertjährigen Krieges.
1. Der Name Vitalienbrüder.
Über die Bedeutung des Namens Vitalienbrüder
erhalten wir aus den Urkunden sowie durch die
älteren Chronisten Detmar und Korner keinen
Aufschluß. Spätere Chronisten wie Reimar Rock
und Olaus Petri leiten den Namen davon her, daß
jene Scharen nicht um Gold, sondern auf eigene
Rechnung und Gefahr (eventure) in den Dienst der
mecklenburgischen Städte traten. So sagt Reimar
Kock († 1569) :
29
) "dusse gesellen de sick so
vorsammelden, dewile se nicht up besoldunge
dehneden, sondern up der egene eventuhre, n
 menden se sick
Victalienbroders" und Olaus Petri († 1552):
30
) Och the
kalledes fetaliebröder eller fetalianer theraf
att the lupo till siös och hemtade fetalie."
menden se sick
Victalienbroders" und Olaus Petri († 1552):
30
) Och the
kalledes fetaliebröder eller fetalianer theraf
att the lupo till siös och hemtade fetalie."
Bis auf Holberg 31 ) und Dalin 32 ) ist diese Erklärungsweise des Namens die einzige. Sie findet sich bei Krantz, 33 ) Lindenberg, 34 ) und Huitfeld. 35 ) Holberg und Dalin leiten den Namen ab von einem angeblichen "vornehmsten Zweck" der mecklenburgischen Kaper, Stockholm mit Lebensmitteln (victualien) zu versehen, ohne daß sie für diese neue Erklärungsweise oder gegen die oben angeführte ältere der Chronisten besondere Gründe anführen. Von der Zeit an findet man bei den Historikern entweder die ältere, die neuere oder auch beide Erklärungsweisen nebeneinander;


|
Seite 6 |




|
nach einer näheren Begründung sucht man bei allen vergebens. Die ältere Auffassung bringen Becker, 36 ) Suhm 37 ) und Jahn, 38 ) letzterer mit direkter Ablehnung der neueren. 39 ) Beide Auffassungen, ohne daß die Verfasser sich für die eine oder die andere entscheiden, finden sich bei Fr. W. Jaeger 40 ) und Y. Nielsen, 41 ) die neuere bei Sartorius, Sartorius=Lappenberg, Voigt, allen jüngeren Historikern und danach auch in sämtlichen Wörterbüchern und encyklopädischen Werken. 42 ) Auch Blok gibt in seiner soeben erschienenen Geschichte der Niederlande diese Erklärung, jedoch nicht ohne gelinden Zweifel an ihrer Richtigkeit zu äußern. 43 )
Was den stets erwähnten den Vitalienbrüdern zugeschriebenen Zweck, Stockholm mit Lebensmitteln (victualien) zu versorgen, anlangt, so ist in den Duellen von einem solchen nirgends die Rede. Nach dem einzigen aus den mecklenburgischen Briefen erhaltenen Satz ist ihre Aufgabe, "das riche czu Denemarken czu beschedigen", 44 ) wobei vor allem doch wohl an Kaperei zu denken ist. Daß die Vitalienbrüder jenen "angeblichen Zweck zur Schau getragen hätten", 45 ) ist eine unbegründete Vermutung und sehr wenig wahrscheinlich, da nach damaliger Auffassung die Ausübung des Kaperhandwerkes im Dienst einer kriegführenden Macht für mindestens ebenso "ehrenvoll" 46 ) galt. 47 ).
Als Grund für die neuere jetzt allgemein verbreitete Erklärung führt Koppmann in einer brieflichen Mitteilung an : "vitalien


|
Seite 7 |




|
bedeutet (cf. Schiller u. Lübben Mnd. Wörterbuch) ,eine Stadt mit Lebensmitteln versorgen, speisen,. Da es sich hier nur um die Stadt Stockholm handeln kann, so ist diese Ableitung gegeben."
Dagegen ist folgendes einzuwenden:
1. Der erste Teil des Kompositums Vitalienbrüder ist nicht das schwache Verbum vitalien, sondern der Plural des Nomens vitalie (pl. vitalien), denn erstens wäre diese Bildung gegen jeden Sprachgebrauch, da die mnd. Verbalkomposita nicht vom Infinitiv, sondern vom Stamm gebildet werden; 48 ) zweitens kommt, während das Nomen sehr gebräuchlich ist, das Verbum vitalien = verproviantieren im mnd sehr selten vor. Bei Schiller und Lübben 49 ) finden sich nur zwei Belege, beide außerdem noch aus viel späterer Zeit: Das Zitat aus "Lüb. Chron. 2, 553" stammt aus Rufus z. J. 1427, und das aus "Münst. Chron. 1, 259" ist erst um das Jahr 1450 anzusetzen. Auch im Lateinischen, Mittelfranzösischen und Englischen ist das Verbum im Verhältnis zum Nomen äußerst selten. 50 ) Gewöhnlich wird es mit "Lebensmittel zuführen" oder dergl. umschrieben; drittens spricht dagegen die lateinische Übersetzung "fratres victualium" in dem gleichzeitigen Brief des livländischen Ordensmeisters vom 12. Oktober 1392, 51 ) sowie die dänische Bezeichnung fitalgae brøthernae (1396). 52 ). Die bei Kalkar angeführten Belege für das dänische Verbum fetalje stammen aus späterer Zeit. (1521, 1525 und 1570). 53 )
2. und dieser Grund würde allein hinreichen, um die oben angeführte Erklärungsweise zu widerlegen, kommt die Bezeichnung vitalienses urkundlich schon vor der Belagerung Stockholms und vor der Ausgabe der mecklenburgischen Kaperbriefe in den Hamburger Kämmereirechnungen für die in der Nordsee vor der Wesermündung sich aufhaltenden Piraten vor. 54 ) 55 )


|
Seite 8 |




|
3. werden die Scharen, die in den Dienst der Mecklenburger traten, in den Urkunden vor 1395 sehr selten Vitalienbrüder genannt, was sicher nicht der Fall gewesen wäre, wenn sie selbst durch eine bei ihrer Ausrüstung ihnen gestellte Aufgabe, Stockholm zu versorgen, erst zu der Entstehung dieses Namens Veranlassung gegeben hätten. Bis zum Jahre 1395, also fast bis zur Beendigung des Krieges, heißen sie in den Hanserecessen mit wenigen Ausnahmen 56 ) entweder sine (Johanns) avølgheren, 57 ) sine hůlpers, 58 ) de van der Wiismair, 59 ) de lude, de in der zee sind tho unses heren . . . hulpe, 60 ) (de heren von Mecklenburg) und die iren 61 ) oder ähnlich. 62 )
Aufschluß über die Entstehung der Bezeichnung "Vitalienbrüder" erhalten wir durch einen Überblick über die Geschichte des aus dem Romanischen ins Niederdeutsche eingedrungenen Wortes vitalie. 63 )
1. Im klassischen Latein kommt victualia noch nicht vor; belegt sind nur vitalis (adj.) und vitalia = die edlen Teile
Von 1395 an ist "vitalienbruder" allgemein (IV. 256, MUB. 12774; 275, MUB. 12795; 278; 279, MUB. 12793; 280; 281; 330; 295, MUB. 12828; 296; 312, MUB. 128 0; 311; 334, MUB. 12872; 336; 337; 309; 335; 349; 355; 368; 370; 374; 420; 427; 428 usw., daneben weniger häufig zerovere (IV. 290; 292, MUB. 12815; 328; 336; 337; 359; 362; 373) oder zeeroubir adir vitalienbroder (IV. 426) die vitalienbruder, alse zeerouber (IV. 436).


|
Seite 9 |




|
des Körpers, auf denen das Leben beruht, 64 ) das letztere findet sich in übertragener Bedeutung bei Ambrosius und Prudentius. 65 ) victualis kommt zuerst vor bei Apuleius 66 ) und victualia = Lebensmittel, Proviant für das Heer, bei Cassiodor, 67 ) im späteren Latein beide Formen für Lebensmittel nebeneinander. 68 )
2. Im Französischen 69 ) sind die aus vitalia abgeleiteten Formen die frühesten und die am häufigsten vorkommenden, 70 ) während die Form mit c erst für spätere Zeit und auch nur spärlich belegt ist. 71 ) Wie später im Englischen und Niederdeutschen, so ist auch im Französischen das Verbum sehr selten. 72 ) Für unsere Theorie nun ist wichtig, daß sich schon im Französischen ein Nomen vitailleur resp. victuailleur findet. 73 ) In den ältesten Belegen bedeutet das Wort Marketender, Fouragierer und ist besonders in den Quellen aus der Zeit des 100 jährigen Krieges häufig. Bei Froissart tritt es uns ein Mal auch als Bezeichnung für den ganzen dem Heere folgenden Troß entgegen. 74 )
Größeres Gewicht aber noch lege ich darauf, daß schon im Jahre 1347 in einem gleichzeitigen Briefe vom Kapitän von Calais an den König von Frankreich die zur Verproviantierung von Calais verwendeten Seeräuberschiffe vitaillers genannt werden. 75 )
3. Um 1300 ist das Wort ins Englische eingedrungen. 76 ) Die Belege bei Stratmann=Bradley für das Nomen vitaille
Vgl. zum folgenden außer den Wörterbüchern besonders D. Behrens, Beitrag zur Geschichte der französischen Sprache in England, Französ. Studien Bd. 5. (1886) S. 104, 137 u. 167. Nach den auf S. 104 u. 137 gegebenen Belegen ist Stratmann=Bradley zu ergänzen.


|
Seite 10 |




|
pl. vitailes stammen aus den Jahren 1330 bezw. 1350, für das Partizip vittalit von 1375 und vetelid von 1435. Die folgenden Formen sind für das weiter unten Gesagte wegen der Zeit, aus der ihre Belege stammen, besonders wichtig. Es sind vittelleris sb. pl. (= foragers) aus Barbours Bruce (um 1375), 77 ) vittelouris und vitaillers 78 ) aus Piers the Plowman 79 ) (A=Text um 1362, B=Text um 1377).
4. Um dieselbe Zeit, 1330, kommt das Nomen auch im Niederländischen vor, 80 ) und in der ersten Hälfte des 14. Jahrh. wird es auch ins Niederdeutsche eingedrungen sein. - Die Belege bei Schiller u. Lübben stammen alle aus viel späterer Zeit, erst aus dem 15. Jahrhundert. 81 ) Die latinisierte Form vitalienses in den HKR. z. J. 1390 dürfte mit zu den frühesten gehören; 82 ) in den Hanserecessen kommt es im 14. Jahrhundert mehrfach vor. 83 )
5. Für das Dänische stammt der früheste Beleg in der Form fitalgaebrøthernae aus d. J. 1396 84 )
In der Zeit der Lehnsaufgebote war es wie in den früheren Zeiten noch allgemein Regel, daß der einzelne selbst für seinen Unterhalt durch Mitführung von Lebensmitteln sorgen mußte. Nur Futter durfte vom Felde genommen werden. Reichte der mitgeführte Proviant nicht aus, so war der Ankauf auf aus=
Hiernach sowie nach dem folgenden ist Klaas Later a. a. O., wo das Wort vitalie nicht aufgeführt ist, zu ergänzen.
Vgl. auch Franz Burckhardt, Eine Studie zu den and. Lehnwörtern. Archiv f. Kulturgesch. III. 257. (1905).


|
Seite 11 |




|
geschriebenen Märkten oder von Kaufleuten im Lager selbst und die Requisition gegen Entschädigung gestattet. 85 ) Die beiden zuletzt genannten Formen für die Beschaffung des Unterhalts traten während der Kreuzzüge in den Vordergrund, und mit dem Aufkommen des Söldnerwesens artete das Requisitionssystem bei der Kargheit der Geldmittel der Fürsten in ein Raubsystem aus. 86 ) In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebten die Söldnerscharen ausschließlich vom Raube, 87 ) und es ist daher leicht erklärlich, daß die Bewohner der geplünderten Gegenden zwischen den Fouragierern oder auch dem ganzen Teil des Heeres, dem die Beschaffung des Proviants oblag, und gewöhnlichen Räubern in der Bezeichnung keinen Unterschied machte, die Namen für diese auf jene ausdehnte und umgekehrt. Auch die provisores regis machten hiervon keine Ausnahme. Klagen über Klagen ertönten beim Volk über die vitaillers, purveours oder wie es jene Verhaßten sonst nannte. 88 )
Daß der Name vitaillers dann auch auf die Räuber zur See, die die Söldnerscharen an Grausamkeit und schonungslosem Vorgehen wohl noch übertrafen, ausgedehnt worden ist, kann nicht wundernehmen, wenn man bedenkt, daß die zahlreichen Piraten des Kanals 89 ) den Franzosen sowohl wie den Engländern während des hundertjährigen Krieges bei der Beschaffung von Proviant die besten Dienste leisteten. Calais war Depotplatz, 90 ) und bei den späteren jahrelangen Kämpfen um diese Stadt haben gerade verwegene Seeräuber im Dienste der kriegführenden Mächte die kühnsten Entsatzversuche gemacht. 91 )


|
Seite 12 |




|
So ist es zu verstehen, daß einige Jahrzehnte später auch die Piraten der Nordsee von den Hamburgern als vitalienses bezeichnet werden; 92 ) es war eben der Name, in dem treffend das ganze Trachten jener Scharen zum Ausdruck kam. Mochten sie die Fouragierer vorüberziehender Heere sein oder mit Kaperbriefen versehen im Dienste kriegführender Mächte stehen oder auf eigene Faust rauben: die geplünderten Küstenbewohner und seefahrenden Kaufleute kannten und fürchteten sie alle nur als diejenigen, denen ihre vitalien und ihr ganzes Hab und Gut schonungslos preisgegeben war. 93 )
Für die mecklenburgischen Kaper kommt der Name Vitalienbrüder während der ersten vier Jahre ihrer Tätigkeit in den Urkunden nur zwei Mal vor; sie heißen sonst entweder die "Leute der Meklenburger", "ihre Nachfolger", "ihre Helfer" oder ähnlich, 94 ) und erst vom Jahre 1394 an, 95 ) als sie nach und nach immer mehr den Charakter gewöhnlicher Seeräuber annahmen und vor allem nach dem Friedensschluß von 1395, durch den ihnen der rechtliche Grund ihrer Existenz entzogen wurde, sind sie in allen Küstenländern der Nord= und Ostsee, von Calais 96 ) bis Reval, 97 ) von Stralsund 98 ) bis Bergen 99 ) unter dem Namen Vitalienbrüder bekannt. Auch aus dem letzten Teil des Wortes dürfen wir vielleicht noch eine Beziehung zu den Söldnerscharen des 100 jährigen Krieges herauslesen, denn auch diese hatten sich zu Beutegesellschaften (société de l,aqueste), 100 ) Rotten (italienisch: brigata), 101 ) Kompagnien zusammengeschlossen und sich die verschiedensten Namen beigelegt. 102 ) 103 )


|
Seite 13 |




|
2. Die Bezeichnung Likedeler.
Diese Bezeichnung kommt im Verhältnis zu der vorigen in den Quellen äußerst selten vor. Zum ersten Male tritt sie uns in einem Briefe Albrechts von Holland vom 16. Februar 1399 entgegen 104 ) und scheint überhaupt niederländischen Ursprungs zu sein. 105 )
Wenn auch vielleicht von jeher unter Raubscharen die Sitte bestanden haben mag, die Beute "gleich zu teilen", 106 ) so wird man doch unwillkürlich auch durch diese Bezeichnung an die Söldnerscharen Italiens und Frankreichs erinnert, von denen die Quellen stets mit Ausführlichkeit und nicht ohne Bewunderung für die strenge Ordnung, die beim Verteilen des erbeuteten Raubes beobachtet worden sei, berichten, und es ist fraglich, ob nicht auch der Name Likedeler ebenso wie die Bezeichnung Vitalier schon auf frühere Scharen von Seeräubern oder Söldnern angewendet worden ist.
Im Niederdeutschen scheint sich dieser Name nie recht eingebürgert zu haben. Nur der Verfasser der dritten Fortsetzung von Detmar (1401 - 1438) braucht ihn in der Erzählung von der Plünderung Bergens im Jahre 1428 einige Male, nennt die Piraten aber gleich darauf wieder vittalgenbrodere. 107 ) Vielleicht ist die Bezeichnung "Likedeler" weniger leicht verständlich gewesen, verdrehen doch spätere Chronisten sie in "liedekeclers" 108 ) oder gar in "Linkenmänner". 109 ) 110 )


|
Seite 14 |




|
3. Noch eine Beziehung zwischen den Soldkompagnien und den Vitalienbrüdern läßt sich feststellen. Nach HR. IV, 453 (z. J. 1398) sagen sie von sich, "se weren Godes vrende unde al der werlt vyande". 111 ) Ebenso hatte sich 30 Jahre früher (ca. 1362) der berüchtigte Söldnerführer Jean de Gouges genannt: l,ami de Dieu et l,ennemi de tout le monde. 112 ) Der verwegene Condottiere Werner v. Urslingen soll ein Brustschild getragen haben mit der Inschrift: Herr der großen Kompagnie, Feind Gottes, Feind der Traurigkeit und des Erbarmens. 113 )


|
Seite 15 |




|
III.
Der Angriff der Vitalienbrüder auf Bergen.
1.
Nordische sowohl wie deutsche Historiker haben bisher über die Plünderung Bergens durch die Vitalienbrüder sehr verschiedene Angaben gemacht, je nach der Quelle, der sie bei ihrer Darstellung gefolgt sind. Während ältere nur einen Überfall kennen, nehmen fast alle neueren irrtümlich deren zwei an und setzen sie in die Jahre 1392 oder 1393 und 1395. So Nicolansen 114 ) Munch, 115 ) Y. Nielsen, 116 ) L. Daae, 117 ) auch noch Erslev in seiner Dronning Margrethe, 118 ) Koppmann, 119 ) Daenell 120 ) u. a. 121 )
G.Storm hat zuerst darauf hingewiesen, 122 ) daß die Annahme eines zweimaligen Überfalls auf einer falschen Wertung Korners beruhe; und in der Tat muß die Plünderung vom Jahre 1395, wenn man das Abhängigkeitsverhältnis der Lübschen Chroniken, 123 ) vor allem die Unzuverlässigkeit Korners und die besser unterrichteten gleichzeitigen englischen und isländischen Quellen ins Auge faßt, als Fälschung aus der Geschichte verschwinden.


|
Seite 16 |




|
Die Quellen, die für die Untersuchung in Betracht kommen, sind folgende:
1.Detmar.
Er berichtet den Überfall zum Frühjahr 1392. Diese Angabe ist falsch; denn nach den zuverlässigen englischen und isländischen Quellen wurde der Befehlshaber von Bergen, Jon Darre, bei dem Überfall gefangen genommen. Im Frühjahr 1392 aber war Hakon Jonssøn Statthalter ("fehirdha oc hirdstiora"). 124 ) Jon Darre urkundet am 29. März 1392 in Oslo 125 ) und tritt erst im Herbst 1392 für den in diesem Jahr verstorbenen Jonssøn als Hauptmann in Bergen auf. 126 ) Aus HR. IV, 261, 7 geht hervor, daß Jon Darre vor dem Tage von Helsingborg (August 1394) sich zur Zahlung des Lösegeldes verpflichtet hat, seine Gefangennahme zu der diesem Termin näher liegenden Zeit (Frühjahr 1393, f. u.) also wahrscheinlicher ist.
2. Korner.
Sein Herausgeber J. Schwalm hat in der Einleitung nachgewiesen, daß Korner den Schluß der Detmarchronik, den Abschnitt von 1386 - 1395, oder eine parallele Quelle benutzt hat.
In der 1. Bearbeitung (α=Text 1416) berichtet er die Plünderung Bergens wie Detmar z. J. 1392 und wie dieser gleich im Anschluß an den Bericht über das Aufkommen der Vitalienbrüder. Den kurzen Detmartext schmückt er nur etwas weiter aus: Detmar: "In deme sulven jare wůnnen de vitalienbroder Bergen in Norwegen." Korner: "Vitaliani sive pyrate suprascripti Berghen oppidum in Norwegia ceperunt et spoliaverunt, inestimabilem thezaurum inde ducentes."
In der 2. Bearbeitung (A=Text 1420) hat er das Ereignis in das Jahr 1395 gesetzt, genau dieselben Worte wiederholt und nur noch hinzufügt: "Mercatoribus autem libenter pepercissent, si indifferentes permansissent non iuvantes isti vel illi parti. Sed quia civibus Bergensibus omnino auxilium ferre volebant, ideo et eos victos spoliabant.
In der 3. Bearbeitung (B=Text 1423) nimmt er die zweite Redaktion fast wörtlich, nur mit schwachen stilistischen Änderungen auf, fügt jedoch ausdrücklich hinzu, daß derZug nach BergenAlbrechts Befreiung (l395) voraufging. "Hoc anno ante liberacionem


|
Seite 17 |




|
Alberti regis Sweorum Vitaliani" etc. wie A. Der Schluß wird abgerundet mit den Worten "et bona illorum prenominatis civitatibus advehentes, ea ibidem vendebant et expendebant."
In der 4. Bearbeitung (D=Text von 1435) wiederholt er denselben wortreichen Bericht und von hier aus ist er in die plattdeutschen Chroniken, "die sog. Rufuschronik" und die Reimar Rocks, sowie in die lateinische Bearbeitung durch Albert Krantz übergegangen.
J. Schwalm hat nachgewiesen, daß die Berichte Korners im ganzen genommen aus den ältesten lübschen Chroniken (Detmar und dessen Quellen) stammen, während ihre Eigentümlichkeit in der freien, oft leichtsinnigen Bearbeitung desselben Stoffes besteht. In den verschiedenen Ausgaben seiner Chronik findet man manche Korrektur, Abweichungen und Zusätze, aber selten bringen sie neues Material. Man wird sich daher, wenn man seine Quellen feststellen will, an den α=Text halten müssen. In diesem wird der Überfall Bergens wie bei Detmar zu 1392 berichtet; in der zweiten Bearbeitung dagegen ist er darauf verfallen, den Überfall näher an die Befreiung Albrechts, ins Jahr 1395, zu rücken. Der Zusatz hier, daß die Vitalienbrüder auch die Deutschen plünderten, und der in der dritten Bearbeitung, daß sie die Beute in Rostock und Wismar verzehrten und verkauften, stammt offenbar nicht aus neuen Quellen; dergleichen konnte er aus seiner Phantasie nach dem, was er durch die Schilderung Detmars vom Charakter der Vitalienbrüder wußte, leicht hinzufügen.
Es ist demnach klar, daß Korners Bericht zum Jahre 1395 mit dem Detmars zum Jahre 1392 zusammenfällt und der Zug von 1395 als Fälschung aus der Geschichte verschwinden muß, und daß ferner die Angabe Detmars über die Zeit des Zuges (1392) durch die gleiche im α=Text Korners nicht gestützt wird (vergl. Storm a. a. O.).
Das richtige Datum und Jahr des Zuges erhalten wir durch einen Vergleich der gleichzeitigen englischen und isländischen Quellen.
3. Die englischen Quellen.
Es sind 3 Klagen der Engländer wegen des den englischen Kaufleuten bei der Plünderung zugefügten Schadens vorhanden.
In der Klage von 1412 heißt es: "circa annum regni regis Ricardi II. defuncti quartum decimum . . . venerunt certae personae dictae Societatis de Hansa infra portum


|
Seite 18 |




|
de Berne, in diversis vasis armatis . . . spoliaverunt depraedaverunt et malitiose verberaverunt dictos Mercatores Anglicos ac habitationes . . . combusserunt (ad valorem trium milium marcarum) necnon Obligationes et alias Securitates de Mille libri et amplius" . . . , sodaß die Kaufleute, um ihr Leben zu sichern, die Stadt verließen, bis der dänische König auf ihre Klagen seine Leute nach Bergen schickte, um ihnen Recht und Frieden zu verschaffen, was auch 1000 Mark kostete. 126a )
In der Klage von 1406: 127 ) Item . . . that about the feast of S. George the martyr, in the yeare of our Lord 1394 . . . malefactors and robbers of Wismar and others of the Hans with a great multitude of ships arrived at the town of Norbern in Norway and took the said town . . . took their goods . . . , burnt their houses and put their persons unto great ransoms . . . burnt 21 houses . . . to the value of 440 nobles. Item they took from Edmund Belyetere . . . and from other marchants of Lenne, to the value of 1815 pounds.
In der Klage von 1404 aber wird gesagt: 128 ) Item en le vigile de seynt George lan du regne le roy Richard II. seszime pluisourz malefeisours et robbours de Wyssemere et Rozstock del compaygnie del Hans forciblement avec graunde navey arrivoient al ville de Northberne en Norwey . . . gaygnerent . . . pristerent . . . arserent et lour corps a haute raunsoune metterent . . . damages et perdes des ditz pleyntifs de 5400 nobles.
Alle drei Klagen geben ein verschiedenes Jahr an für dieselbe Tatsache; im Datum stimmen 2 und 3 überein: um St. Georgsfest = 23. April und die andere genauer am Tage vor St. Georg, also 22. April. Da die Klage von 1404 im Original vorliegt, die von 1406 nur englisch, so wird man für die Angabe des Jahres die erstere vorziehen dürfen: im 16. Jahr Richards II. = 1393 gegen 1394. Die Angabe in I, "im 14. Jahr Richards II." = 1391, ist offenbar ein Fehler.
Daß der so gewonnene 22. April 1393 das richtige Datum ist, bestätigen auch die isländischen Quellen.


|
Seite 19 |




|
4. Die isländischen Annalen.
A. Gottskalks Annaler. 129 )
Sie schließen ursprünglich mit dem Jahre 1394, sind also gleichzeitig, und man sieht, daß der Verfasser den Fall so aufgezeichnet hat, wie er ihm von der Mannschaft des Bergenschen Schiffes "Lafransbollinn", das am 12. Juni 1393 im Tálknafjord landete und also etwa Mai 1393 von Bergen abgegangen war, berichtet wurde. Es heißt dort: 130 ) "Deutsche kamen nach Ostern nach Bergen mit 18 größeren Schiffen von Rostock und Wismar, König Albrechts Freunde. Sie gingen bei Nordnes an Land naesta dag fyrir Jons dag Hola byskups. (April 22.) Am Minoritenkloster entstand ein harter Kampf, Jon Darre wurde gefangen und tödlich verwundet. Sie liefen durch alle Kirchen der Stadt und nahmen alles, was Wert hatte, und verbrannten die Stadt Bergen. Der Bischof und die Bürger wurden gezwungen, ihnen zu huldigen."
B. Flatøannaler.
Sie sind für die Jahre 1388 - 1394 gleichzeitig. Das sieht man besonders zum Jahre 1393, wo es, nachdem die Ankunft von vier norwegischen Schiffen erwähnt wird, heißt : 131 ) "Man erzählte von Norwegen . . . . . daß im Frühjahr, in der Osterwoche, Deutsche nach Bergen kamen und ganz Norwegen für König Albrecht forderten. Er aber war in Dänemark bei der Königin im Gefängnis zusammen mit seinem Sohn Erich. Sie gingen am folgenden Donnerstag vor Anker, die Bewohner aber rückten ihnen entgegen und kämpften mit ihnen. Auf beiden Seiten fielen viele, die meisten auf Seite der Deutschen. Die Bürger unterlagen. Die Deutschen hatten 900 Schützen; der Anführer hieß Enis, ein Deutscher, Verwandter Albrechts; ein anderer hieß "Maekingborg", ebenfalls ein Verwandter Albrechts. Dieser fiel im Kampf und wurde beim Minoritenkloster begraben;


|
Seite 20 |




|
Enis ließ ihn ehrenvoll bestatten. 132 ) Die Leichen der anderen Gefallenen ließ er auf den Vaagen hinausschaffen und dort versenken. Jon Darre führte die Bürger - denn er war Hauptmann (fehirdir) - er kämpfte sehr tapfer, wurde jedoch von den Deutschen gefangen . . . . . . . Der, welcher "Maekingborg" tötete, hieß Erik (Eirikr). Die Deutschen richteten eine große Verheerung an, raubten und plünderten und verletzten beides, Kirchen - und Frauenrecht. Sie plünderten so sehr, daß sie alles, was sie nicht mitnahmen, in die See versenkten, Schiffe und Anker, deren sie habhaft werden konnten, fortführten, ausgenommen einen Anker, "Langbein" genannt, der König Olavs Eigentum gewesen war. Enis ließ das Land Albrecht huldigen, weil er der rechtmäßige König sei. Diese schwuren den Eid." (Namen fehlen.)
Beide Quellen stimmen in der Angabe des Jahres (1393) überein; nur in der Datierung besteht eine kleine Abweichung. Die Flatø=Annalen datieren: Donnerstag der Osterwoche 1393 = 17. April, während Gottschalks Annalen den 22. April angeben, was mit dem Tagesdatum der englischen Quellen übereinstimmt.
Dicht unter dem Fußboden fand man lose im Sand ein Skelett und ein Schwert. Vom Skelett war der Schädel, der in Lehm lag, ziemlich gut erhalten. Das Schwert, das sich in Bergens Museum befindet (Nr. 3357), hat nach Bendixen stark vom Rost gelitten, läßt aber die Konstruktion noch deutlich erkennen. Es ist ein sogenannter Zweihänder mit 0,08 m langem, ovalem Eisenknauf und rundem Griff, der, 0,40 m lang, nach der Klinge hin an Stärke zunimmt. Der Griff ist mit Holzschienen versehen gewesen, die wieder durch breite Ringe von vergoldetem dünnen Silberdraht (ringe af forgyldt, tynd sølvtraad) zusammengehalten wurden. Die Parierstange ist eine an den Enden ein wenig breiter gehämmerte (udhamret) Eisenstange. Die Klinge ist nahezu 1 m lang (genau 0,975 m) und 0,05 m breit.
Diese Zweihänder kamen im 14. Jahrhundert in Aufnahme, wurden im Fußkampf benutzt, zunächst vielleicht nur von den Befehlshabern geführt. Bei Villet-le-Duc, Mobilier francais II p. 385 findet sich die Abbildung eines Zweihänders aus jener Zeit, der fast genau die oben beschriebene Gestalt zeigt. Mit Rücksicht darauf, sowie auf die Wahrnehmung, daß der Schädel des Skeletts gewaltsam gespalten schien und das Grab den Eindruck gemacht hat, als ob es in Eile aufgeworfen sei, muß die Vermutung Bendixens, daß man es hier mit dem Schwert und dem Skelett des gefallenen "Mecklenburg" zu tun habe, als nicht unbegründet bezeichnet werden.


|
Seite 21 |




|
Über den Kampf selbst stimmen die Annalen überein oder ergänzen sich; die einen geben die Zahl der Schiffe auf 18 an, die andern die der Schützen auf 900, also pro Schiff 50. Diese Zahl ist wohl übertrieben; denn nach Vorschlag der Lübecker zur Ausrüstung der Seeräuber sollten auf jedem Schiff mit 100 Mann Besatzung "20 gute Schützen" sein. 133 )
Die isländischen Annalen waren im 16. Jahrhundert in Bergen unbekannt. Die Historiker Bergens schöpften daher aus Hermann Korner, und zwar in der lateinischen Bearbeitung des Albert Krantz. Korner hat, wie oben erwähnt, das Ereignis in das Jahr 1395 gerückt; Krantz gibt keine Jahreszahl an, bringt es aber, wie schon Korner, mit der Befreiung Albrechts in Zusammenhang. Der Darstellung des Krantz folgt Absalon Pederson in seinem Werk "Om Norrigis Rige" (1567). Er hat jedoch seine Quelle sehr flüchtig gelesen, denn im unmittelbaren Anschluß erzählt er: "eins von diesen Schiffen fing die Königin Margarete, auf dem waren 80 Mann, die sie alle enthaupten ließ". Diese Bemerkung steht aber bei Krantz weiter unten und bezieht sich auf die Schiffe des Herzogs Barnim von Wolgast, der 1398 in dänischen Gewässern raubte. 134 ) Krantz sagt nämlich: Una de grandioribus navibus quae 80 vexit armatos, in Daniam coacta, ab Reginà càpi iubetur, quos reperit de recenti praeda respersos omnes iussit feriri gladio." Aus Absalon Pederson hat Huitfeldt geschöpft und diesem folgten wieder Munch u. a. 134a )
Von Krantz ist auch die Reimchronik abhängig. Ihre Darstellung, die, wie Storm gezeigt hat, gänzlich unzuverlässig ist, verwerten Munch und Nielsen (mit willkürlichen Änderungen) und auch noch Girgensohn in seinem Werk über "Die skandinavische Politik der Hansa". 135 )


|
Seite 22 |




|
IV.
Die in den Quellen erwähnten Namen von Vitalienbrüdern.
Hierzu drängt sich vor allem die Frage auf: "Wer sind die in den isländischen Annalen als Anführer der Vitalienbrüder genannten "Enis" und "Maekingborg"?
Beide werden als "Verwandte Albrechts" bezeichnet. Maekingborg fällt. 136 ) Danach ist die Vermutung Oelgartes, 137 ) daß es Albrecht von Stargard gewesen sei, unrichtig, denn Albrecht starb erst 1397.
Von den Verwandten des Königs aus dem herzoglich mecklenburgischen Hause, die hier in Bergen am 22. April 1393 gefallen sein könnten, kommt nur Johann I. der Ältere von Stargard in Betracht, da wir über das Ende aller anderen sichere Nachrichten besitzen. 138 ) Von Johann I. von Stargard dagegen wissen wir nur, daß er um jene Zeit (1392 - 93) gestorben ist. Die letzte Urkunde von ihm stammt aus Bukow vom 10. Oktober 1392; 139 ) am 3. und 6. Februar 1393 regieren schon seine Söhne Johann und Ulrich 140 ) resp. Johann, Ulrich und Albrecht, woraus aber nicht unbedingt folgt, daß er im Februar 1393 schon gestorben sein muß. Er kann ebenso gut auf einem größeren Kriegszug außer Landes gewesen sein, was auf den im Frühjahr 1393 unternommenen Zug der Vitalienbrüder (als deren Führer er auch sonst häufig genannt wird) 141 ) nach Bergen passen würde. Daß er am 28. März 1393 noch gelebt hat oder wenigstens sein Tod noch nicht im Heimatlande bekannt war, können wir daraus entnehmen, daß sich damals sein Sohn Johann noch junior nennt, 142 ) was später nicht mehr geschieht, bis er 1395


|
Seite 23 |




|
im Gegensatz zu Magnus, Sohn, Johann IV., der Ältere genannt wird, 143 ) während Johann IV. schon 1394 144 ) als junior bezeichnet wird.
Marschalck berichtet über Johann des Älteren Tod: 145 ) "Obiit vero Joannes dux primus anno fere millesimo trecentesimo supra septuagesimum; Strelitii tumúlatus". Er weiß also nur, daß er nach 1370 gestorben ist, um so weniger kann der von ihm angegebene Begräbnisort Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen. Schon Boll hat seine Richtigkeit bezweifelt, 146 ) da Strelitz damals noch nicht in unmittelbarem fürstlichen Besitz war. Für die Zeit des Todes kämen wir nach dem obigen auf die Zeit nach dem 28. März 1393; das stimmt vollkommen mit der Zeit des Todes des in den isländischen Annalen als Verwandten Albrechts bezeichneten "Maekingborg".
Daß Johann VI. von Waren, dessen Todesjahr auch nicht feststeht, 147 ) dieser Maekingborg der isländischen Quelle gewesen sein könnte, halte ich für nicht wahrscheinlich, da er uns nie als Anführer der mecklenburgischen Kaper entgegentritt und auch nicht auf den Namen Mecklenburg Anspruch machen konnte. Allerdings ist auch er um jene Zeit gestorben; die letzten Urkunden von ihm stammen aus dem Jahre 1389 (7. März und 29. März). 148 ) Am 16. Oktober 1395 aber ist er tot, denn es heißt in einer unter diesem Datum ausgestellten Urkunde des Klosters Malchow von ihm: "den juncher Johan van Wenden, deme god gnedich si". 149 )
Schwieriger dürfte es sein, festzustellen, wer "Enis" gewesen ist, da wir nicht bestimmt wissen, wie der Name Enis im Deutschen gelautet haben würde. Nach Nielsen 150 ) ist Enis Abkürzung und Kosename für Enar (isländ. Einarr ahd. Einharr). Stark 151 ) führt einen Namen Inizo = Henzo, Henizo = Heinrich auf. Unter den uns bekannten Verwandten des Königs finden sich aber keine, die für diesen Namen in Betracht kommen könnten.


|
Seite 24 |




|
Ob Enis Kosename für Johannes (Hans) sein kann, wage ich nicht zu entscheiden. 152 ) Wenn das angenommen werden dürfte, würde die Nachricht der Annalen sehr gut auf Johann IV. von Schwerin, den Sohn von Magnus, gehen können, da Johann seit 24.Mai 1391 153 ) nicht mehr in Urkunden genannt wird, bis er 1394 als Befehlshaber in Stockholm erscheint, 154 ) das er am 31. August 1395 übergibt, worauf die Vitalienbrüder, die nach dem Briefe des neuen Vogts von Stockholm vom 3. September 1395 noch in den Schären und in den Städten liegen, nach seinem Briefe vom 15. September auf Åbo und Wiborg zu absegelten. 155 )
An Herzog Ulrich von Stargard, der, nachdem er am 29.September 1392 einen Landeshauptmann für seine Abwesenheit (wor wi sulven nicht ensind) eingesetzt hatte (MUB. 12447), vom 22. Februar 1393 bis zum 28. Dezember des Jahres aus den mecklenburgischen Urkunden verschwindet (MUB. 12492, 12595), kann bei dem Enis wohl nicht gut gedacht werden.
An sonstigen Vitalienbrüdern werden seit dem Jahre 1390 folgende urkundlich genannt:
1. In dem Brief des livländischen Ordensmeisters vom 12. Oktober 1392 156 ) an den Ordensprokurator in Rom werden als "capitanei" der "fratres victualium" 157 ) genannt: "Henning Manduvel, Zilkauw, Berkelich, Kraseke, Kule, Preyn, Olavus Schutke, Ghunnar, Arnold Stuke, Nicolaus Gylge, Heyno Schutke."
2. Joh. Stoltevoet nennt in einem Schreiben an
Reval vom 6. Dezember 1393
158
) als
"vitalienbroders":
159
) "Clawys Mylres
160
) unde Arnd Stuke, Hennynk
Crabbe, Hinrik van der Lů, Deytliff Knut,
161
) Bernevur unde
sine z
 ne, Henneke
ne, Henneke


|
Seite 25 |




|
Scharbouwe, Prybe, Luder Ransouwe, Henneke van me Zee, Bertholt vanme Zee, Hinrik Tydemans, Hennynk Norman, Wyttekop, Clawis Zwarte, Crekauwe, Rode Kremer, Hans Meygendorp, Ketelhoid, Clawis Tymme, Beydenstorp, schipper Wedige, Degenert, Hennynk, Volmer Wrede, Schonenberg.
3.Die Urkunde über die Stiftung der Messe zu Stockholm vom 24. Juni 1394 162 ) überliefert uns die Namen: "Her Rambold Sanewitze, Her Bosse van deme Kalende, Riddere; Arnd Stüke, Clawus Mylges, 163 ) Marquard Preen, Hartwich Sedorpe, Lyppold Rumpeshaghen, Hinrik Lüchowe, Bertram Stokeled unde schypher Joseph, Knapen."
4.Als Anführer der Schar, die den Bischof Tord von Strengnäs gefangen nahm, werden genannt 164 ) Arnoldus Stuke und Nikolaus Milies.
Lisch hat zuerst darauf hingewiesen, 165 ) daß es für die Beurteilung der ganzen Erscheinung der Vitalienbrüder von größter Wichtigkeit sei, nachzuweisen, wer ihre Führer gewesen seien. Im folgenden habe ich, soweit es mit Hilfe der gegenwärtig zugänglichen Urkunden möglich ist, versucht diesen Nachweis zu führen; wir werden meist mecklenburgische Adlige unter ihnen antreffen.
Bernevur, (Barnefuer, Barnevur, Barnfüer, 166 ) ein um 1500 ausgestorbenes mecklenburgisches Adelsgeschlecht, erscheint zuerst im 14. Jahrhundert. Vielleicht ist der 1361 als Knappe bei Herzog Albrecht von Mecklenburg zusammen mit Stralendorp und Moltke genannte Ulrich B. 167 ) mit dem HR. VIII. 960 (MUB. 12584) erwähnten Bernevur identisch.
Beydenstorp (Boidendorf, Boidenstorf, Boienstorf), 168 ) ein rittermäßiges, nie sehr ausgebreitetes und nicht oft genanntes Geschlecht.


|
Seite 26 |




|
Crekauwe ( = Krakow, Cracowe). Nach Mülverstedt 169 ) sind die Crakow ein altadeliges, im 13. und 14. Jahrhundert in der Altmark anfälliges, auch um diese Zeit im Lande Terichow begütertes Geschlecht, wo sein Stammsitz vielleicht das mit der Stadt Genthin vereinigte Dorf Krackow war. In der Altmark lagen seine Güter namentlich in der Gegend von Salzwedel.
Im Jahre 1358 treffen wir zwei aus dem Geschlecht Krakow als Kriegsmannen Herzog Albrechts von Mecklenburg. 170 )
Crabbe (Krabbe), 171 ) der Name mehrerer weit verbreiteter dänischer Adelsgeschlechter. (Das dänische Adelslexikon führt deren neun auf.) Vielleicht gehört der HR. VIII. 960 (MUB. 12584) als Vitalienbruder genannte Henning Crabbe einer der in der (Dansk) Historisk Tidstrift 1879 S. 617 ff. erwähnten ältesten Familien an. 1350 lebte ein Krabbe, dessen Siegel eine Krabbe 172 ) zeigt; nach HTD a. a. O. jedenfalls der letzte seines Geschlechts. 1367 wird ein Michael Niclesson dictus Crabbe genannt, dessen Vater 1336 sich nur Nikolaus Michelson, dessen Sohn aber später sich Niels Krabbe nannte. 173 )
Ketelhoidt ( = Ketelhodt) 174 ) ein schon in der ersten Hälfte des 13. Jhdts. in Mecklenburg eingewandertes Geschlecht, das Mecklenburg wieder verlassen hat, um sich in Thüringen niederzulassen, wo es noch jetzt, namentlich im Fürstentum Schwarzburg, seßhaft ist. 175 )
Es ist nicht ausgeschlossen, daß einer der beiden im Necrologium Gotlandiae fratrum Minorum in Wisby 176 ) genannten Ketelhoet und Kaetilö mit dem HR. VIII, 960 (MUB. 12584) genannten Vitalienbruder identisch ist, da das Necrologium über


|
Seite 27 |




|
die Grabstätte von nicht weniger als vier anderen Vitalienbrüdern Aufschluß gibt. 177 )
van der Lü, Hinrik. Das Geschlecht "von der Lü od. Lühe" hat seinen Namen von dem Flüßchen "Lühe" im alten Lande. 178 )
Um 1382 heißt es: "Dominus Conradus de Lu, Curd de Busch(ge)mole, 179 ) Conrad de Lu iunior proscripti sunt eo, quod Marquardum Hagemester nostrum concivem suis bonis in portu dominorum 180 ) spoliaverunt, quapropter profugi facti sunt et omni jure Lubicense provicti". 181 ) Der oben erwähnte Heinrich, der vielleicht mit einem der 1395 als im Dienste Johanns II. stehend erwähnten 182 ) identisch ist, scheint in seinem Geschlecht also würdige Vorgänger gehabt zu haben.
Nikolaus Milies. Er scheint einer der Hauptanführer der Vitalienbrüder gewesen zu sein, da er in sämtlichen oben angeführten Urkunden genannt wird. 183 ) Mit Arnd Stuke zusammen, der dieselbe Rolle spielt, führt er 1392 die Schar, die den Bischof Tord von Strengnäs gefangen nahm. 184 ) Nach der darüber sprechenden Urkunde stammte er aus dem Ratzeburger Stift. 185 )
Bunge III. 710: Nicolaus Gylge. ebenfalls Schreibfehler. Suhm XIV. 585, MUB. 12669: Clawus Mylges.
SRPergmbref 2867: Nicholaus Milies.
Das Hauptwerk über die Familien Mylius und ähnlicher Namensform: J. C. Mylius, Geschichte der Familie Mylius. Genealogischbiographische Familienchronik der Mylius aller Zeiten und Länder. Buttstädt 1895 (nicht im Handel), ist in mehreren wesentlichen Punkten zu berichtigen. Nach ihm ist Milies erst im 17. Jahrh. aus Mylius entstanden, dieses selbst um die Mitte des 16. Jahrh. aus Müller latinisiert. Vor 1550 soll nach ihm der Name Mylius nur äußerst selten vorkommen und vor 1500 hat er ihn überhaupt nicht nachweisen können.
Vgl. dagegen den obigen Namen, die Hildesheimer Stadtrechnungen, herausg. v. Doebner und Riedel, cod. dipl. Brand. wo schon seit dem 14. Jahrh. Bürger und Geistliche mit dem Namen Milges, Milies erscheinen. Auch als Vorname kommt Milies und Miliges im 14. Jahrh. vor (Sudendorf Urkb. III. 36; VII. 62).


|
Seite 28 |




|
Hennynk Norman, aus der adeligen rügischen Familie Norman, in der der Name Henning althergebracht ist. 186 )
Arnd Stuke, stets mit Nik. Milies zusammen in allen oben angeführten Urkunden genannt. 187 ) Er stammte aus dem nach Stück bei Schwerin genannten nie zahlreichen mecklenburgischen Adelsgeschlecht. 188 ) 1349 wurde ihre Feste Kützin bei Wittenburg von den Lübeckern zerstört. 189 ) Um 1380 schon finden wir ihn als Führer von Seeräuberscharen an der livländischen Küste, 190 ) von 1392 an bei allen wichtigen Ereignissen. Mit Nik. Milies scheint er einer der Hauptanführer der Vitalienbrüder gewesen zu sein. 191 )
Luder Rantzowe, aus dem berühmten holsteinischen Adelsgeschlechte der Rantzau.
Henneke und Bertholt vanme Zee 192 ) (vom See, v. d. See, de Stagno), dem in Lauenburg und Mecklenburg begüterten Geschlecht angehörig.
Henning Manduvel 193 ) gehört zu der noch blühenden Familie, die im Mittelalter ihre Wohnsitze auch im Stargardschen hatte. 194 )
Marquard Preen 195 ) war der Sohn des Henneke Preen zu Davermoor (südl. von Gr.=Brütz) in der Grafschaft Schwerin. Als Graf Otto von Schwerin 1357 starb, und Albrecht v. Meklenburg gegen den Grafen Nikolaus v. Tecklenburg und dessen Sohn Otto seine Ansprüche auf die Nachfolge in der Grafschaft geltend machte, traten Henneke und seine Söhne Johann, Heinrich und Gottschalk, geheißen "Preen von d. Davermoore", mit allen Verwandten in die Dienste Albrechts. 196 ) Marquard (der noch nicht genannt wird) ist damals vielleicht noch ein Knabe oder


|
Seite 29 |




|
außer Landes gewesen. Er begegnet uns zuerst 1367, wo Henneke und Marquard Urfehde schwören müssen. 197 ) Darauf erscheint Marquard als Hauptmann der Vitalienbrüder, 1392 in den livländischen Gewässern, 198 ) 1393 und 1394 vor und in Stockholm. 199 ) Mit der Befreiung Albrechts verschwindet nicht allein Marquard, sondern auch die ganze Linie seines Geschlechts. 200 )
Heyno u. Olav Schutke (Schutte) 201 ) wohl nicht aus dem mecklenburgischen Adelsgeschlecht der Schosse, Schotze oder Schutze 202 ) sondern aus einer Familie Schutte mit dreizintiger Gabel im Wappen (MUB. 12120). 1359 haben zwei Schutte, Heino und Otto ebenso 1358 Detlef und Nikolaus mit einem Seedorp u. a. einen Raubzug ins Ratzeburgische unternommen. 203 ) Vielleicht ist der in Wisby bestattete Johannes Schutte 204 ) ein Verwandter des hier erwähnten Heyno. Ein Henneke Scutte wird 1379 als Straßenräuber genannt, ein gleichnamiger ist ist ebenso wie andere des Namens (Borchard, Clawes, Peter) bei Räubereien in der Wismarschen Gegend 1391 und 1392 beteiligt, 205 ) doch ist es zweifelhaft, ob es sich bei diesen um Glieder eines adligen Geschlechtes handelt.
Nambold Sanewitze 206 ) (Tzanewitz 207 ) hat die Urkunde in Stockholm mitunterzeichnet und ist auf Gotland gestorben. 208 )
Bosse van deme Kalende 209 ) (v. Kaland oder Kalen) gehört dem um die Mitte des 18. Jahrhunderts erloschenen aus Alt=Kalen stammenden, besonders zu Rey begüterten Geschlecht an. 210 ) Bosse, ein Kosename für Burchard, stammt aus der


|
Seite 30 |




|
Finkenthaler Linie; sein Vater ist Hermann auf Finkenthal. 211 ) Am 4. November 1387 verkaufte Bosse 2 Hufen an das Kloster Dargun; 212 ) am 19. September 1392 erteilte der Herzog Johann der jüngere von Meklenburg dem "Busse v. d. Kalande", seinem treuen Diener, die Freiheit, das halbe Gut Stove, das seine Ehefrau geerbt, nach seinem Belieben zu verpfänden und zu verkaufen, 213 ) und am 2. Oktober 1392 bezeugt Herzog Johann, daß Sigrit, "Bosse von dem Kalends Weib", vor ihm ihr väterliches Erbe aufgelassen habe. 214 ) Aus allen diesen Veräußerungen geht hervor, daß Bosse v. Kaland zu besonderen Unternehmungen Geld gebrauchte, aufnahm und sogar seine Frau ihr Erbteil verpfänden mußte; er scheint bei diesen Verpfändungen schon außer Landes gewesen zu sein. Seine Ehefrau wird ihm später gefolgt sein, denn beide liegen in Wisby auf Gotland begraben. 215 ) Der bei Lindström 216 ) erwähnte Grabstein darf wohl mit Sicherheit als derjenige Bosses bezeichnet werden. 217 )
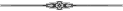

 14 ß. Daß es sich nicht etwa
um einen Druckfehler
(
14 ß. Daß es sich nicht etwa
um einen Druckfehler
(