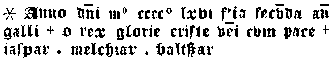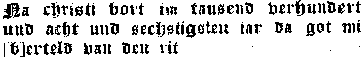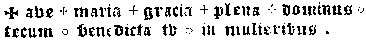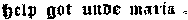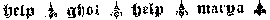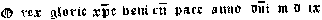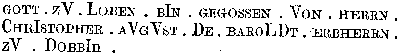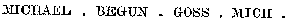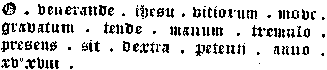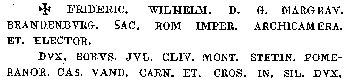|




|


|
|
|
-
Jahrbücher für Geschichte, Band 40, 1875
- Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge
- Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg
- Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, aus der Zeit von 1627 bis 1630
- Ueber die Familie Grelle und von Grelle
- Topographie der Pfarre Klütz
- Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXIV, S. 24 flgd.)
- Oberst Otto Hoppe von Schwerin
-
Jahrbücher für Alterthumskunde, Band 40, 1875
- Hünengrab von Kronskamp
- Hirschhorn-Streitaxt von Lüsewitz
- Feuerstein-Zapfen von Neukloster (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 117)
- Kegelgrab von Gädebehn Nr. 2
- Bronze-Messer von Crivitz
- Bronze-Messer von Schwerin
- Bronzefund von Hinzenhagen
- Bronzeschwert von Sukow
- Bronzeschwert von Warbelow
- Bronzeschwerter von Dörgelin
- Bronzeschwert von Groß-Methling
- Bronzeschwert von Rosenow
- Bronzeschwert von Neuhof
- Begräbnißplatz von Naudin
- Begräbnißplatz von Leussow
- Gläserner Spindelstein von Dämelow
- Glasperlen von Toitenwinkel
- Steinalterthümer von Lydien
- Bronzene Leuchter-Figur von Schwerin
- Bronzene Leuchter-Figur von Rostock
- Die Kirche zu Lohmen
- Der Dom zu Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXXVI, S. 148 und 172 flgd.)
- Kirche und Reliquien-Urne von Stöbelow
- Kirche und Reliquien-Urne von Leussow (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 193 flgd.)
- Die Kirche zu Picher (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 195)
- Die Kirche zu Warnemünde : [Nachtrag]
- Die Kirche zu Frauenmark (Nachtrag zu Jahrb. XXV, S. 282)
- Die Kirche zu Severin
- Die Kirche (Kapelle) zu Schlieven
- Die Kirchen zu Karchow, Zielow, Damwolde, Melz, Wendisch-Priborn, Lärz, Krümmel
- Die Kirche zu Kittendorf
- Die Kirche zu Mollenstorf
- Die Kirche zu Kirchdorf auf Pöl (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 308)
- Die Glocken der Kirche zu Dobbertin
- Glocken der Kirche zu Bützow
- Glocke von Walkendorf
- Glocke von Gr. Tessin
- Glocken der Kirche zu Steffenshagen
- Glocke von Lehsten
- Glocke von Qualitz
- Glocken der Kirche zu Vellahn
- Glocke von Klinken
- Glocke zu Consrade
- Glocke von Gr. Vielen
- Glocke von Gr. Godems
- Glocke von Peccatel bei Schwerin
- Glocke von Krakow
- Glocke von Dobbin
- Die Kirchen zu Spornitz, Dütschow, Blievensdorf, Herzfeld und Karenzin (Präpositur Neustadt)
- Die Kirche zu Paarsch
- Die Kirche zu Lutheran
- Die Kapelle zu Bergrade
- Die Kapelle zu Benzin
- Die Kirche zu Friedrichshagen
- Die Kirche zu Pinnow in der West-Priegnitz
- Die Kirche zu Gr. Varchow
- Die Kirche zu Kieth
- Die Kirche zu Grambow
- Die Kirche zu Karow
- Die Kanzel der Kirche zu Zarrentin
- Das Siegel des Klosters Ivenack
- Ueber das Siegel des Nicolaus von Oertzen (in Jahrb. XXXIX, S. 223)
- Ein Siegel des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg
- Das Siegel der Universität Rostock
- Römergräber in Meklenburg : Römische Alterthümer von Häven
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im October 1874
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Januar 1875
- Quartalbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im April 1875
- Quartal- und Schlussbericht des Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde : Schwerin, im Juli 1875
Jahrbücher
des
Vereins für meklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde,
aus
den Arbeiten des Vereins
herausgegebenvon
Dr. G. C. Friedrich Lisch,
großherzoglich meklenburgischem
Geheimen Archiv=Rath,
Conservator der
geschichtlichen Kunstdenkmäler des
Landes,
Direktor der großherzoglichen
Alterthümer= und Münzen=Sammlungen zu
Schwerin,
Commandeur des königl.
dänischen Dannebrog= und des königl.
preußischen Kronen=Ordens, Ritter des Rothen
Adler=, des Nordstern und des Oldenburg.
Verdienst=Ordens 3 Cl., Inhaber der
großherzogl. meklenb. goldenen
Verdienst=Medaille und der königl.
hannoverschen goldenen Ehren=Medaille für
Wissenschaft und Kunst am Bande, der
Kaiserlich österreichischen und der großen
kaiserlich russischen goldenen
Verdienst=Medaille für
Wissenschaft,
wirklichem Mitgliede der
königlichen Gesellschaft für nordische
Alterthumskunde zu Kopenhagen und der
königlichen Akademie der Wissenschaften zu
Stockholm, correspondirendem Mitgliede der
königlichen Akademie der Wissenschaften zu
Göttingen, der kaiserl. archäologischen
Gesellschaft zu St. Petersburg,
der
antiquar. Gesellschaft zu Abbeville und der
Oberlausitz. Gesellschaft der Wissensch. zu
Görlitz,
wirklichem Mitgliede der
archäologischen Gesellschaft zu
Moskau,
Ehrenmitgliede der
anthropologischen Gesellschaft zu
Berlin,
der geschichts= und
alterthumsforschenden Gesellschaften zu
Dresden, Mainz, Hohenleuben, Meiningen,
Würzburg, Königsberg, Lüneburg, Emden,
Luxemburg, Christiania, Zürich, Stettin und
Greifswald,
correspondirendem
Mitgliede
der geschichts= und
alterthumsforschenden Gesellschaften zu
Lübeck, Hamburg, Kiel, Hannover, Leipzig,
Halle, Jena, Berlin, Salzwedel, Breslau,
Cassel, Regensburg, Kopenhagen, Graz, Reval,
Riga, Leyden, Antwerpen, Stockholm und des
hansischen
Geschichtsvereins,
als
erstem
Secretair des Vereins für meklenburgische
Geschichte und Alterthumskunde.
Vierzigster Jahrgang.
Mit 3 Holzschnitten.
Mit angehängten Quartalberichten.
Auf Kosten des Vereins.
In Commission in der Stillerschen Hofbuchhandlung.
Schwerin, 1875.


|




|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gedruckt in der Hofbuchdruckerei von Dr. F. W. Bärensprung.


|




|
Inhaltsanzeige.
A. Jahrbücher für Geschichte.
| Seite | |||
| I. | Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge, von dem Archivar Dr. Wigger zu Schwerin | 3 | |
| II. | Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg, mitgetheilt von dem Geheimen Archiv=Rath Dr. Lisch zu Schwerin | 87 | |
| III. | Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, 1627 bis 1630 mitgetheilt von dem Professor Dr. Lorenz zu Wien | 89 | |
| IV. | Ueber die Familie Grelle und von Grelle, von dem Geh. Archiv=Rath Dr. Lisch | 131 | |
| V. | Zur Topographie der Pfarre Klütz, von demselben | 136 | |
| VI. | Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin, von Dr. Crull zu Wismar | 138 | |
| VII. | Oberst Otto Hoppe von Schwerin | 142 | |
B. Jahrbücher für Alterthumskunde.
| I. | Zur Alterthumskunde im engern Sinne. | |||
| 1) | Vorchristliche Zeit. | |||
| a. | Steinzeit | 145 | ||
| b. | Bronzezeit | 147 | ||
| Kegelgrab von Gädebehn, von Dr. Lisch | 147 | |||
| Mit 2 Holzschnitten. | ||||
| Bronzefund von Hinzenhagen, von demselben | 149 | |||
| c. | Eisenzeit | 154 | ||
| Römische Alterthümer von Häven. Siehe Nr. IV. Nachtrag | 220 | |||
| d. | Alterthümer außereuropäischer Völker | 157 | ||
| Steinalterthümer von Lydien, von demselben | 157 | |||
| 2) | Christliches Mittelalter | |||
| Bronzene Leuchterfiguren, von demselben | ||||
| II. | Zur Baukunde. | |||
| Christliches Mittelalter. | ||||
| Kirchliche Bauwerke | 161 | |||
| Kirche zu Lohmen, von Dr. Lisch | 161 | |||


|




|
| Seite | ||||
| Dom zu Schwerin, Wandmalereien im Kapitelhause, von Dr. Lisch | 169 | |||
| Kirche zu Warnemünde, Nachtrag von demselben | 179 | |||
| Glocken | 195 | |||
| III. | Zur Siegel= und Wappenkunde | |||
| Siegel des Klosters Ivenack, von demselben | 214 | |||
| Mit 1 Holzschnitt. | ||||
| IV. | Nachtrag | |||
| Römergräber in Meklenburg, Römische Alterthümer von Häven, von Dr. Lisch | ||||


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge
- Wallensteins Verordnung über Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg
- Briefe Wallensteins, meistentheils über Meklenburg, aus der Zeit von 1627 bis 1630
- Ueber die Familie Grelle und von Grelle
- Topographie der Pfarre Klütz
- Bischof Nicolaus I. Böddeker von Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXIV, S. 24 flgd.)
- Oberst Otto Hoppe von Schwerin
A.
Jahrbücher
fürGeschichte.


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|



|


|
|
:
|
I.
Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten
nach dem Orient
im Zeitalter der Kreuzzüge.
Von
Archivar Dr. F. Wigger,
I.
Die Wallfahrt des Obotritenfürsten
Pribislav
und des Grafen Gunzel
I. von Schwerin
mit Herzog
Heinrich dem Löwen.
Der Herzog Heinrich der Löwe von Baiern und Sachsen stand im Jahre 1171 auf dem Gipfel seiner Macht und seines schon von den Zeitgenossen angestaunten Glückes. Nächst dem Kaiser Friedrich I. war er bei weitem der mächtigste Fürst des Reiches; er hatte Baiern gewonnen, das Herzogthum Sachsen bis an die Peene erweitert, seine Gegner zum Schweigen gebracht, mit dem König Waldemar von Dänemark nicht nur Frieden geschlossen, sondern auch eine Familienverbindung verabredet. Sein schwierigstes Werk war die Bezwingung der Wenden und die Einleitung ihrer Bekehrung gewesen; es hatte so recht seinem Charakter zugesagt, in dem sich ein nicht geringer Grad von Herrschsucht und Eigensucht mit kirchlichem Sinn in merkwürdiger Mischung vertrug.
Man konnte die Macht des Wendenthums für gebrochen halten, seitdem Zwantewits Bild auf Arkona gefallen war.


|
Seite 4 |




|
Heinrichs ehemals hartnäckigster Feind, der Wendenfürst Pribislav, war nicht nur besiegt, sondern auch aufrichtig versöhnt; er war des Herzogs Freund und Bewunderer geworden 1 ), und dabei nicht nur ein äußerlicher Bekenner des Christenthums, sondern auch innerlich von dessen Kraft und Wahrheit überzeugt. Wenn dieser Wendenfürst sich seines Volkes kräftig annahm und dessen Ueberreste unter dem Schutze fester Burgen neu sammelte und ansiedelte 2 ), so gründete er doch auch, um demselben die Segnungen der Kirche und christlicher Cultur leichter zu vermitteln, im Frühling 1171 das Kloster zu Althof bei Doberan 3 ); und am 9. Sept. 1171 erschien Pibisav sogar, wie schwer es im gewesen sein mag, auf einer der vornehmsten Burgen seiner Väter einen fremden Grafen walten zu sehen, zu Schwerin, als der Bischof Berno den Dom weihete und Herzog Heinrich, begleitet von manchen seiner Getreuen, gleichsam zum Abschluss seines Wirkens im Wendenlande, die feierliche Stiftung und Ausstattung des jüngsten seiner drei wendischen Bisthümer, zu der vornehmlich Pribislav das Kirchengut beisteuerte, vollzog 4 ).
Eben damals traf der Herzog schon Vorbereitungen zu einer Wallfahrt ins Heilige Land. Es waren nicht politische Beweggründe, die ihn in den fernen Orient trieben, wo sich für seine stets praktische Politik kein Feld fand; auch konnte er dort bei dem blühenden Zustande des Königreiches Jerusalem keine Gelegenheit zu Beweisen seiner Tapferkeit und Aufopferungsfähigkeit für kirchliche Zwecke erwarten. Treffend bemerkt vielmehr sein jüngerer Zeitgenosse Abt Arnold von Lübek 5 ), dem wir unsere Kunde von jener Wallfahrt zumeist verdanken: "Nachdem .. der Friede im Wendenlande befestigt .., der Herzog nun solcher Ruhe theilhaftig geworden und so großen und gefahrvollen Stürmen glücklich entronnen war, glaubte er, fromme es, das Heilige Grab als den Hafen des Heils aufzusuchen, den Herrn dort anzubeten, wo einst seine Füße gestanden." Damit handelte Heinrich ganz im Sinne seiner Zeit, die jede Wallfahrt, und namentlich


|
Seite 5 |




|
die nach dem Heiligen Lande, als eine Buße oder als ein gottgefälliges Dankopfer ansah. Nebenbei reizte ihn aber wohl auch das Verlangen, den sagen= und wunderreichen Orient überhaupt, und namentlich jene Orte zu sehen, welche durch die Kämpfe und die Siege der Kreuzfahrer berühmt geworden waren, und das Reich zu schauen, welches die Streiter Christi in Palästina mit zahllosen Opfern und unvergleichlicher Hingabe von Gut und Leben geschaffen hatten.
Sein Herzogthum befahl Heinrich für die Dauer seiner Wallfahrt dem Erzbischof Wichmann von Magdeburg, seiner Gemahlin Mechthild zur Seite ließ er zwei tüchtige Ministerialen; eine große Anzahl von seinen geistlichen und weltlichen Herren in Sachsen aber nahm er zu seinen Gefährten. Unter den geistlichen ragten der Bischof Konrad von Lübek und die Aebte Berthold von Lüneburg und Heinrich von Braunschweig (dessen Mittheilungen Arnold von Lübek wiedergiebt 1 ), unter den weltlichen Herren der Obotritenfürst Pribislav, der Graf Gunzel I. von Schwerin, Graf Siegfried von Blankenburg 2 ) u. a. hervor.
Wohl leisteten Pribislav, den der Kaiser Friedrich 1170 unter die Fürften des Reichs aufgenommen hatte 3 , und der Graf Gunzel als des Herzogs Lehnmannen mit solchem Gefolge dem Herzog Heinrich einen schuldigen Ehrendienst. Und wenn auch nicht deutlich genug bezeugt würde, daß Pribislav sein Lehnmann gewesn sei 4 ) (wiewohl die Fürsten von Meklenburg hernach ihre Lande nicht von den Herzogen von Sachsen zu Lehn nahmen): so lag es doch in den gegenseitigen Beziehungen, daß Pribislav, wenn der


|
Seite 6 |




|
Herzog gegen ihn den Wunsch äußerte oder ihm das Anerbieten machte, ihn unter seine Reisebegleiter aufzunehmen, nicht wohl ablehnen konnte. Aber es spricht auch nichts gegen die Annahme, daß des Herzogs geistlicher Beweggrund in dem Herzen des neubekehrten Wendenfürsten einen kräftigen Widerhall fand, und daß sich dieser danach sehnte, dem Erlöser am heiligen Grabe und auf Golgatha seinen Dank darzubringen.
Wie der Herzog seine Gemahlin (die ihrer Entbindung entgegen sah) daheim ließ, so blieb auch Pribislavs Gemahlin, die Fürstin Woizlava, zu Meklenburg, und ebenso die Gräsin Oda zu Schwerin von der langen und anstrengenden Fahrt zurück. Jener standen während der Abwesenheit ihres Gemahls vermuthlich ihr Sohn Burwin, der wohl mindestens 20 Jahre zählte und wahrscheinlich schon mit Mechthild, der Tochter Herzog Heinrichs, vermählt 1 ) war, und ihr Neffe, des unglücklichen Fürsten Wartislav hinterbliebener Sohn Niclot (der spätere Fürst von Rostock), schützend und helfend zur Seite; und eine ähnliche Stütze fand Gunzels Gemahlin, die Gräfin Oda, an ihrem ältesten Sohne Helmold. Wenigstens wird dieser so wenig wie die beiden jungen meklenburgischen Herren unter dem Gefolge des Herzogs erwähnt. Ueberdies hatten die beiden Regentinnen in dem Bischof Berno von Schwerin einen einsichtsvollen Rathgeber.
Die Octave des Festes der Heil. drei Könige (13. Jan.) 1172 2 ) ward noch zu Braunschweig verlebt; dann brach der Herzog mit dem Fürsten Pribislav und dem ganzen zahl=


|
Seite 7 |




|
reichen Gefolge von dort auf, zunächst nach Baiern. Zu Regensburg, wo das Marienfest am 2. Februar begangen ward, schlossen sich dem Pilgerzuge noch mehrere bairische Edle an, namentlich die Pfalzgrafen Friedrich und Otto von Wittelsbach 1 ).
Man wollte den damals seit den beiden Kreuzzügen gewöhnlichen Weg nach dem Qrient über Constantinopel einschlagen; Boten des Herzogs an den König Stephan von Ungarn, vielleicht auch an den Kaiser Manuel, eilten dem Zuge voran, um ein freies Geleite durch die Lande zu erbitten.
Zu Kloster=Neuburg begrüßte Herzog Heinrich von Oestreich mit einer großen Schaar von Priestern und Laien seinen Stiefsohn, den Herzog von Sachsen und Baiern, und führte ihn und sein ganzes Gefolge nach Wien.
Dort wurden Schiffe genommen, mit Speise und Wein und allem sonstigen Reisebedarf ausgerüstet, wobei der Herzog von Oestreich eine große Freigebigkeit bewies, und mit einem großen Theil des Reisegepäcks beladen. Denn hier begann Herzog Heinrich mit seinem Gefolge die Donaufahrt. Die Knechte dagegen führten die Rosse zu Lande längs des Stromes weiter, trafen aber am Abend immer wieder mit den dann landenden Schiffen zusammen. Der Abt Heinrich von Braunschweig, der die Pilgerfahrt in der strengsten Form, im härenen Gewande, in unablässigem Fasten und Beten zurücklegte, pflegte während des ganzen Zuges an jedem Abend eine Vigilie und an jedem Morgen vor dem Aufbruche eine Frühmesse zu Ehren des Heilands und der Heil. Jungfrau zu halten 2 ).
Auch der Bischof Konrad von Worms und der Herzog Heinrich von Oestreich gaben von Wien aus der Pilgerschaar das Geleite, der Herzog jedoch nur, um sie seinem Schwager, dem Könige Stephan von Ungarn, zuzuführen. Der Wormser Bischof dagegen ging mit einem vertraulichen Auftrage Kaiser Friedrichs I. nach Constantinopel, um dort für seines Kaisers Sohn um eine Tochter Kaiser Manuels zu werben; daneben aber sollte er auch, so meinte man wenigstens, diesem Pilgerzuge bei dem oströmischen Kaiser eine günstige Aufnahme er=


|
Seite 8 |




|
wirken, die bekanntlich Barbarossa selbst, freilich nicht ohne eigene Schuld, und König Konrad III. bei demselben Kaiser auf ihrem Kreuzzuge nicht gefunden hatten.
In Mesenburg (jetzt Mosony oder Wieselburg) erwartete die Wallfahrer schon Florenz, König Stephans Abgesandter, um sie durch Ungarn zu geleiten. So ging die Fahrt die Donau hinunter ruhig von Statten, bis am 3. oder 4. März die starke Festung Gran erreicht ward.
Dort überraschte die Pilger aber eine schlimme Kunde; in derselben Nacht nämlich (4. März) starb der König Stephan, wie man meinte an Gift, das ihm sein Bruder Bela, der mit ihm in schweren Zerwürfnissen lebte, hatte reichen lassen. Mit des Königs Tode war aber das sichere Geleite durch Ungarn erloschen. Glücklicher Weise war jedoch der Erzbischof und Primas von Ungarn eben in der Stadt, um die Vorbereitungen zu des Königs Beisetzung zu treffen. An ihn wurden nach gepflogener Berathung der Bischof Konrad von Lübek und die beiden vorhin erwähnten Aebte wegen eines weiteren Geleites abgesandt; und der Erzbischof ging gern auf solchen Wunsch ein, berief die anwesenden Magnaten zu einer Berathung und erwirkte leicht den Beschluß, daß Florenz den Pilgerzug durch ganz Ungarn sicher hindurch führen sollte.
So ward denn die Donaufahrt eine Weile glücklich fortgesetzt, wenigstens, so weit der Strom in südlicher Richtung durch die ungarische Ebene ruhig dahin fließt. Hernach aber ereignete sich ein Unfall, der leicht dem ganzen Unternehmen hätte ein jähes Ende bereiten können. Wo sich dieser zutrug, wird von unserm Gewährsmann nicht berichtet; vielleicht geschah das Unglück dort, wo unterhalb der Einmündung der Drau die sirmische Bergkette (jetzt Werdnik genannt) den Donaustrom zu einer fast östlichen Richtung bis zum Einflusse der Theiß zwingt und die Höhen, wenngleich an sich nicht bedeutend, zum Theil schroff in den Strom hinabfallen; oder es ereignete sich erst auf der Strecke nahe unterhalb Belgrad, wo "zur Rechten abschüssige Felsenhügel mit verfallenen Castellen" erscheinen, wenn dort auch jetzt "kein so gefährlicher, mit Klippen besäeter Engpaß 1 )" hervortritt, wie


|
Seite 9 |




|
Arnold ihn schildert. "Ungeheure Klippen", schreibt er, "springen dort Bergen gleich vor, deren eine von einer Burg gekrönt wird; sie hemmten den Lauf des Wassers und erschwerten die Vorüberfahrt aufs Aeußerste; denn die verengten Gewässer bäumen sich und schäumen zuerst hoch empor und stürzen hernach mit großem Getose in die Tiefe. Dennoch kamen nach Gottes Willen alle Schiffe daselbst unverletzt vorüber; nur allein der Herzog litt dort Schiffbruch. Indessen, die auf der Burg waren, warfen sich schnell in einen Nachen und zogen den Herzog ans Land; Gunzel aber und der Truchseß Jordan und die Uebrigen retteten sich durch Schwimmen. Das Schiff ward wieder hergestellt, und so erreichten sie Brandiz, wo bei dem Wassermangel die Schiffe auf dem Trocknen standen", weil, wie ein ortskundiger Mann bemerkt, "der rechte Arm der getheilten Donau hier bei niedrigem Wasserstand schmal und seicht wird."
"Brandiz", das slovenische Branitschewo, das alte römische Viminiacum, heut zuTage unter dem Schutt der weitläufigen Ruinen bei Kostolatz begraben (östlich von Belgrad am südlichen Donauufer), war im Mittelalter oft ein Zankapfel der Griechen und der Ungarn 1 ); damals gehörte es dem Kaiser von Byzanz. Bei dieser Stadt pflegten


|
Seite 10 |




|
die Reisenden die Donau zu verlassen und den Landweg nach Constantinopel einzuschlagen. Eben diese Absicht hatte auch der Herzog Heinrich. Ein Beamter (legatus) 1 ) Kaiser Manuels empfing die Pilgerschaar und den Bischof von Worms, um sie sicher weiter zu führen.
Ohne Gefahr und Beschwerden ließ sich aber dieser
Landweg allerdings auch nicht zurücklegen. Denn
zunächst war der verrufene
"Bulgerewald" zu passiren, der sich
zwischen Branitschewo und Nisch östlich von der
Morava ausdehnte, ein Waldrevier, welches sich
von den Höhen der Mittelgebirge (Golidsch,
Omolje, Golubinje
 .) zu dem sumpfigen Thale der
Morava hinabzieht und hie und da von sehr
unzuverlässigen Bulgaren und Serben bewohnt
ward. Der lange Wagenzug, welcher mit einem
Ueberfluß von Lebensmitteln und Bequemlichkeiten
aller Art beladen war, mußte auf dem engen, oft
nur ein Geleise breiten und dabei, zumal jetzt
im Frühling, tiefen Waldwege alle Augenblicke
anhalten, so oft nämlich ein Wagen oder ein
Karren zerbrach oder die im Schlamm stecken
bleibenden Pferde den Dienst versagten.
.) zu dem sumpfigen Thale der
Morava hinabzieht und hie und da von sehr
unzuverlässigen Bulgaren und Serben bewohnt
ward. Der lange Wagenzug, welcher mit einem
Ueberfluß von Lebensmitteln und Bequemlichkeiten
aller Art beladen war, mußte auf dem engen, oft
nur ein Geleise breiten und dabei, zumal jetzt
im Frühling, tiefen Waldwege alle Augenblicke
anhalten, so oft nämlich ein Wagen oder ein
Karren zerbrach oder die im Schlamm stecken
bleibenden Pferde den Dienst versagten.
Doch diesem Uebelstande war noch abzuhelfen. Der Herzog gebot nämlich bald, die Wagen preiszugeben, das Gepäck aber und vom Proviant so viel als möglich auf die Pferde zu laden, alles Andere dagegen zurückzulassen.
Schlimmer als der Verlust, den der Pilgerzug hiedurch erlitt, war es vielleicht noch, daß die Bulgaren und Serben, welche sich der zurückgebliebenen zahlreichen großen Weinfässer und Kisten mit Mehl, Fleisch, Fischen und sonstigen Leckerbissen bemächtigen konnten, durch einen so mühelosen Gewinn zu bösen Absichten verlockt wurden.
Der Obotritenfürst Pribislav mag sich Anfangs gefreut haben, als er hier im Serbenlande eine Sprache vernahm, die seiner wendischen Muttersprache verwandt und


|
Seite 11 |




|
ihm wenigstens zum Theil wohl verständlich war. Aber er sollte bald erfahren, wie übel seine entfernten Stammesgenossen gegen den Pilgerzug gesinnt waren. Abt Arnold 1 ) kann nicht Worte genug finden, um die Wildheit und die Gier dieser "Belialssöhne" zu beschreiben. Man darf dabei jedoch auch nicht außer Acht lassen, daß die Serden nicht ohne Grund stetes Mißtrauen gegen ihren kaiserlichen Herrn zu Constantinopel hegten, daß sie in früheren Zeiten mit den Kreuzfahrern schon schlimme Erfahrungen gemacht hatten, und daß der Pilgerzug Herzog Heinrichs ein kleines Heer ausmachte, indem er nach Arnolds Angabe 2 ) nicht weniger als 1200 streitbare Männer zählte.
Als nun der byzantinische Geleitsmann, im Moravathal dem Zuge vorauseilend, in der mitten in dieser Waldgegend (12 Meilen von Branitschewo) belegenen kleinen Festung "Ravanelle" (wohl richtiger "Ravanetz" oder "Ravana" 3 ), jetzt Tjuprija, d. h. Brückenstadt, genannt) anlangte, welche den Uebergang über die Ravanitza, einen kleinen Zufluß der Morava, beherrschte, und dort eine ehrenvolle und gastliche Aufnahme für die Pilger begehrte, wie sie sich in des Kaisers Landen zieme: da verweigerten die Serben mißtrauisch jeglichen Einlaß derselben und wiesen sogar den kaiserlichen Sendboten selbst schnöde ab.
Auf eine so unwillkommene Botschaft zog Herzog Heinrich bis nahe an die Festung hinan, schlug dort sein Lager auf und machte nun wiederholt Versuche, die Serben durch freundliche Unterhandlungen umzustimmen; er verlangte von ihnen nur noch einen Geleitsmann und versicherte, mit diesem in Frieden weiterziehen zu wollen. Aber das Mißtrauen der Serben gegen abendländische Pilger und Kreuzfahrer war zu groß, sie ließen sich auf keine Verhandlungen ein.
Da richtete Herzog Heinrich an die seinen eine kräftige Anrede, die wir, wie sie Arnold aufgezeichnet hat, hier wiedergeben. "Als Pilger", sprach er, "hätten wir freilich ruhig und friedfertig unseres Weges ziehen und uns einer Feste des Kaisers, zu dem wir uns hinbegeben, nicht in Kriegsrüstung nahen sollen. Aber da jene Belialssöhne ja nicht


|
Seite 12 |




|
friedlich verfahren, sondern, wie es scheint, Streit mit uns beginnen wollen: so erhebt die Banner! Vorwärts! Der Gott unserer Väter, für dessen Namen wir wallfahren und auf dessen Geheiß wir unsere Brüder, unsere Frauen und Kinder, Haus und Feld verlassen haben, sei mit uns! Hier gilt es unsere Kraft zu zeigen. Kämpfen wir tapfer! Sein Wille geschehe! Denn wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn."
Mit erhobenen Bannern zogen die Pilger nun an der Festung vorüber und schlugen dann unweit derselben ihr Lager wieder auf, in einem langgestreckten Thal, an einem klaren Bache, auf der einen (östlichen) Seite 1 ) durch Anhöhen, auf der andern durch niedriges, dichtes Gebüsch gedeckt. Sie zündeten große Wachtfeuer an, stellten Posten aus, ließen dem Leibe die nöthige Pflege angedeihen und legten sich dann zur Ruhe.
Um Mitternacht aber wurden die Schläfer sehr unsanft geweckt. Die Serben hatten nun die Größe des Zuges überschlagen können; er mochte ihnen nicht allzu unbezwinglich erscheinen. Die Bevölkerung des ganzen Waldgebirges hatte sich zusammengeschaart und rückte in vier Abtheilungen von verschiedenen Seiten heran. Um die Deutschen zu schrecken und wo möglich zu einer vorschnellen Flucht zu bewegen, wobei eine reiche Beute zu erwarten stand, stimmten die feindlichen Haufen abwechselnd ein furchtbares Schlachtgeheul an.
Sofort erhoben sich die Pilger und rüsteten sich zum Streit. Zum herzoglichen Banner versammelte der Marschall schnell die Ritter, während die Knappen, unter deren Schutze seitwärts die Schlachtrosse und die Packpferde standen, angewiesen wurden, von einem etwanigen Angriffe der Feinde den Rittern sofort Meldung zu thun.
Der Herzog nahm, mit seiner Rüstung angethan, Platz vor einem mächtigen Wachtfeuer, neben ihm saßen der Bischof von Lübek und die beiden Aebte, sein Vertrauter, Graf Gunzel von Schwerin, stand mit andern Tapfern vor ihm; sie besprachen, was zu thun sei, und feuerten gegenseitig ihren Muth an. - Da flog plötzlich ein Pfeil nahe bei ihnen nieder. Und als sie nun alle schnell auffuhren und zu den Waffen griffen, ward auch schon gemeldet, daß das Lager des Wormser


|
Seite 13 |




|
Bischofs angegriffen, ein Ritter dort durch einen Pfeilschuß getödtet und zwei Knechte durch vergiftete Pfeile auf den Tod verwundet seien.
Augenblicklich sandte der Herzog diesem Bischof 20 gepanzerte Ritter zur Hülfe; und diesen gelang es bald die Serben zurückzutreiben, zumal da der feindliche Führer durch einen Schuß aus einem Wurfgeschoß getödtet ward.
Nun wagten die Feinde keinen neuen nächtlichen Ueberfall mehr. Als am nächsten Morgen, nachdem ein dichter Nebel sich endlich zerstreut hatte, die Deutschen ihren Marsch fortsetzten, bemerkten sie freilich den ganzen Tag über noch Serben, welche den Zug in einiger Entfernung auf den Höhen begleiteten, um etwanige Nachzügler abzuschneiden; indessen gaben sie diesen dazu keine Gelegenheit.
Unversehrt gelangten die Pilger, an der bulgarischen Morava bis zum Einflusse der Nissava und dann längs dieser hinaufziehend, nach der Stadt Nisch 1 ), die als seinen Geburtsort Kaiser Constantin einst verschönert, Attila hernach zerstört, Kaiser Justinian aber wieder hergestellt und befestigt hatte. Hier durften sich die Deutschen nach langen Anstrengungen ausruhen; sie fanden hier eine sehr ehrenvolle Aufnahme und wurden auf Kosten Kaiser Manuels bewirthet.
Ohne alle Fährlichkeiten legten sie hierauf den Weg nach Constantinopel auf der bekannten Straße über Sophia, Philippopel und Adrianopel 2 ) zurück. Am Charfreitage (14. April), also volle drei Monate nach der Abreise von Braunschweig, zogen die Pilger in die durch die Erzählungen der Normannen und der Kreuzfahrer auch im nördlichen Europa wegen ihrer Pracht und ihres Reichthums längst als Wunderstadt berühmte Hauptstadt des oströmischen Kaisers Emanuel ein.
Wie anziehend einem Ankömmling aber auch alle Herrlichkeiten Constantinopels erscheinen mochten, der hohe Festtag verbot den Deutschen alle Zerstreuungen. In aller Stille feierten die Pilger die Passion des Herrn, und ebenso begingen sie den heiligen Sonnabend vor Ostern.
Am ersten Ostertage hörten sie schon in aller Frühe die Messe. Aber nach dem Frühmahl stiegen sie endlich zur Kaiserburg hinan. Dorthin hatte Herzog Heinrich seine für


|
Seite 14 |




|
den Kaiser mitgebrachten zahlreichen und kostbaren Geschenke bereits vorausgesandt, die köstlichsten Pferde mit Decken und Sätteln, Panzer, Schwerter, Gewänder von Scharlach und die feinsten Leinenstoffe.
Kaiser Manuel I. stand bei den Deutschen nicht eben im besten Andenken wegen des Haders, den er 25 Jahre früher mit seinem Schwager, dem deutschen Könige Konrad III., bei Geleaenheit des zweiten Kreuzzuges, vornehmlich um die unbesonnene Weise Barbarossas, gehabt hatte. Aber man kannte ohne Zweifel doch auch seine große Vorliebe für das abendländische Ritterthum, wie er denn selbst alle ritterlichen Künste gern und mit Auszeichnung geübt hatte und damals - im Alter von 52 Jahren - vielleicht mitunter noch übte. Wie sollte er also nicht den längst berühmten Herzog von Baiern und Sachsen freundlich bei sich aufnehmen, zumal, wenn er nicht mit einem Kreuzheere, sondern mit einer Schaar friedlicher Pilger erschien, und obenein gerade dessen mächtiger Gönner, Kaiser Friedrich, der den Herzog so warm empfahl, sich mit dem oströmischen Kaiserhause aufs Engste zu verbinden gedachte!
Unter solchen Umständen ließ sich erwarten, daß der prachtliebende Manuel den vollen Glanz des berühmten byzantinischen Ceremoniels entwickeln würde.
Und so geschah es auch. Nur drückt sich unser Berichterstatter, Abt Arnold von Lübek, leider so unbestimmt aus, daß die von ihm bezeichneten Oertlichkeiten sich kaum wiedererkennen lassen.
Aus der östlichen Spitze der Landzunge, welche das Häusermeer Constantinopels bedeckt, erhebt sich die alte Akropolis, auf welcher der Kaiser residirte. Dort lag im Norden der goldene Saal, und an diesen schlossen sich südwärts mehrere Prachtbauten. Dann folgte der freie Platz, auf dem sich die Sophienkirche erhebt, und weiter gelangte man durch "das Thor der Todten" zum Hippodrom. Eine lange Treppe führte vom Hippodrom hinunter zu den Uferbefestigungen.
Eben diese hohe Treppe stiegen vermuthlich die Deutschen zu ihrer feierlichen Audienz beim Kaiser hinan, und gelangten also zunächst in den Hippodrom, wenn anders diese Rennbahn der bei Arnold genannte weite, ebene, ummauerte Jagdhof (curia venationis) ist 1 ). Dorthin hatte Manuel zum feierlichen Empfang der Gäste und zugleich zur Begehung des Osterfestes die sämmtlichen weltlichen Großen seines Hofes und


|
Seite 15 |




|
die höchste Geistlichkeit berufen. Er selbst erschien im kaiserlichen Ornate. Zahllose Zelte von seinen Leinen= oder Baumwollenstoffen und Purpur, mit vergoldeten Spitzen und sonstigem, je nach dem Range und Stande der Inhaber mannigfach abgestuftem Schmuck waren daselbst aufgeschlagen.
Herzog Heinrich ward vom Kaiser zunächst aufs Feierlichste begrüßt; dann begann alsbald die große Procession. Der Weg war belegt mit Purpur, über welchen sich noch ein mit Gold durchwirkter Stoff hinzog, und mit goldenen Lampen und Kränzen geschmückt. Die erste Abtheilung des Zuges bildete die Geistlichkeit; auf diese folgte der Kaiser selbst mit dem Herzoge Heinrich, und die fremden Ritter, darunter also auch der Fürst Pribislav und der Graf Gunzel, schlossen sich ihnen an. So zogen sie hin zu dem "goldenen Zelte", welches von Gemmen und Edelsteinen blitzte. Damit wird der "goldene Saal" gemeint sein; denn es heißt, daß die Procession von hier zur (Sophien=) Kirche zurückkehrte.
In der Kirche nahm der Kaiser Platz aus seinem "hohen" Throne; und wenn einst dem König Ludwig VII. von Frankreich 1147 auf seinem Kreuzzuge bei der bekannten langen Unterredung im kaiserlichen Pallast ein dem kaiserlichen Throne gegenüber stehender, wie die Byzantiner mit Genugthuung behaupten, viel niedrigerer Sessel geboten war, so ward hier für Herzog Heinrich ein, auch vermuthlich niedrigerer, Thron neben dem kaiserlichen aufgestellt. So hörten die deutschen Pilger das Hochamt am ersten Ostertage an; ihre Gedanken, welche durch die ihnen bisher unbekannte Pracht zerstreut und verwirrt waren, wurden nun wieder auf die rechte Pilgerstimmung zurückgeführt.
Der Kaiser Manuel hatte ein lebhaftes Interesse für theologische Fragen. Er war, wie sehr ihm dies die Griechen verdachten, der Union der morgenländischen und der abendländischen Kirche nicht abgeneigt; confessionellen Erörterungen pflegte er mit Spannung zu folgen und fällte gern selbst das Endurtheil. Es wird ihm also ganz willkommen gewesen sein, wenn es nicht gar auf seinen Wunsch geschah, daß 1 ) nach der Tafel, als sich eine freiere Unterhaltung entsponnen hatte, die Bischöfe von Worms und von Lübek ein der Würde des hohen Festtages angemessenes geistliches Gespräch mit den Gelehrtesten unter den Griechen anregten, über einen Hauptunterschied der römischen von der griechischen Kirchenlehre, ob nämlich, wie die Griechen lehren, der Heilige Geist


|
Seite 16 |




|
nur von Gott dem Vater, oder aber, wie die abendländischen Kirchen bekennen, von Gott dem Vater und von dem Sohne ausgehe. Man stritt hin und her, bis der ebenso beredte und gelehrte als demüthige Abt Heinrich von Braunschweig, indem er nicht nur die einschlagenden Stellen der Heiligen Schrift, sondern auch die Aussprüche der Kirchenväter ihnen entgegen hielt, die griechischen Schriftgelehrten zum Schweigen brachte und damit vor dem Kaiser und dem ganzen Hofe großen Beifall errang. -
Beim Aufbruche schenkte die Kaiserin Maria (die Tochter des Fürsten Raimund von Antiochia) dem Herzoge Heinrich so viel Sammet, daß er sein ganzes ritterliches Gefolge darein kleiden konnte, und jedem Ritter buntes Pelzwerk und einen Zobel.
Die Pilger ließen in Constantinopel ihre Pferde und den ganzen Troß zurück; ein einziges Schiff, das der Kaiser Manuel seinen Gästen zur Verfügung stellte und mit allem Bedarf reich ausstattete 1 ), faßte die Theilnehmer an der Ueberfahrt nach dem Heil. Lande.
Dem Fürsten Pribislav war eine Meerfahrt wohl nichts Unbekanntes; in den zahlreichen Fehden der Wenden mit den Dänen hatte er die Ostsee gewiß oft genug durchkreuzt, der Anblick des Meeres mochte mancherlei Erinnerungen in ihm wach rufen. Die meisten Pilger aber, die sich auf dem Schiffe befanden, waren mit den Gefahren und Schwierigkeiten einer Seefahrt nicht vertraut. Sie geriethen daher in große Todesfurcht, als in der Nacht - wohl noch im Marmorameere - der Wind in einen Sturm ausartete. Aber am andern Morgen gab sich auch die Schiffsmannschaft großer Besorgniß hin, als man das Fahrzeug auf zwei Klippen zutreiben sah; und die Pilger zweifelten schon kaum noch, daß sich das Unglück auf der Donau wiederholen werde. Aber, wie nach Arnolds Angabe eine hehre Jungfrau dem einen der Pilger in der vorigen Nacht im Traumgesicht verkündigt hatte, das Schiff blieb unversehrt. Denn im gefahrvollsten Augenblick entdeckte die Mannschaft zwischen den Felsen noch ein Thor und konnte, da eben der Sturm einhielt, das Fahrzeug unbeschädigt hindurch steuern.
Weitere Unfälle auf der See werden uns nicht verzeichnet. In Akkon 2 ) (Ptolomais) betraten die Wallfahrer den heiligen Boden Palästinas. Die Schönheit und die Sehenswürdigkeiten


|
Seite 17 |




|
dieser Stadt und der glänzende Empfang, den sie dort fand, konnte die Pilgerschaar nicht zu einem längeren Verbleiben bewegen, ihre Sehnsucht trieb sie zur Eile nach dem endlichen Ziele ihrer Pilgerfahrt an. Den Weg nach Jerusalem legten die Wallfahrer auf Pferden, Maulthieren und Eseln zurück; sie wählten auch nicht den geringen Umweg über Nazareth, sondern die kürzeste Straße, um möglichst schnell die heilige Stadt zu erreichen. Arnold nennt uns auf dieser Strecke keinen einzigen Ort, den sie berührten.
In Jerusalem war die Ankunft des Pilgerzuges bereits gemeldet, und ein festlicher Empfang bereitet. Die Templer und die Johanniter zogen mit großem Gefolge dem Herzog entgegen und geleiteten ihn und seine Gefährten in die heilige Stadt. Dort empfing ihn wiederum die Geistlichkeit, Hymnen und Loblieder auf den Herrn anstimmend.
Der erste Weg wird auch diese Pilger zur Auferstehungskirche hingeführt haben 1 ), die das Hauptziel der Wallfahrt bildete. Seitdem unlängst die Passionskapelle und die Kreuzauffindungskapelle nebst der Krypte der heil. Helena durch einen großen Bau mit der Grabeskirche verbunden waren, fand der Christ in diesem Gebäude die bedeutendsten Heiligthümer vereinigt, Alles, was ihn an des Heilands Leiden und Sterben und an seinen Sieg über den Tod erinnerte.
Wie erwünscht es uns nun sein würde, einen Blick in die Herzen der Pilger zu thun, die jetzt an den heiligen Stätten knieten, und namentlich in Pribislavs Herz, - unser Gewährsmann berichtet uns nur von den prachtvollen Geschenken, welche Herzog Heinrich hier darbrachte, wie er am heiligen Grabe eine große Summe Geldes 2 ) opferte, wie er die Kapelle (basilica), in welcher das heilige Kreuz verwahrt ward, mit musivischer Arbeit schmückte und die Thüren derselben mit gediegenem Silber bekleidete, wie er drei ewige Lampen 3 ), eine vor dem heiligen Kreuze, eine vor der Passion des Herrn auf der Schädelstätte und eine vor dem heiligen


|
Seite 18 |




|
Grabe, stiftete - Graf Gunzel von Schwerin diente ihm bei dieser Schenkung als Zeuge -, und wie er endlich den Templern und Johannitern außer andern Geschenken sehr viele Waffen und 1000 Mark Silbers 1 ) zum Ankaufe von Landgütern gab, damit sie daselbst junge Streiter unterhalten möchten, wenn wieder der Krieg begönne.
Diese Zeit war allerdings nicht mehr fern. Der König Amalrich III. von Jerusalem hatte sich durch seine Kriegszüge nach Aegypten wohl hohen Ruhm erworben, durch solche Einmischung in die dortigen Verhältnisse aber auch gewissermaßen den späteren Fall des christlichen Königreiches eingeleitet; und schon zu seiner Zeit begannen die Fehden wiederum. Jetzt aber herrschte Friede, der König war in Jerusalem; und er zeichnete die abendländischen Gäste gar sehr aus, drei Tage lang gab er ihnen Gastmähler in seinem eigenen Palast.
Ueber solchen Festlichkeiten ward aber der Hauptzweck der Wallfahrt nicht aus dem Auge gelassen. Alle heiligen Stätten wurden besucht, das Thal Josaphat, der Oelberg, Bethlehem und Nazareth; und hernach ward unter einer Bedeckung der Templer auch eine Fahrt nach dem Jordan und nach der Wüste, wo Jesus 40 Tage lang versucht war, unternommen. Der religiöse Charakter einer Wallfahrt ward überall gewahrt: Abt Heinrich von Braunschweig war, wiewohl vom Fasten und Wachen ganz erschöpft, stets im Zuge und hielt an jeder heiligen Stätte, die man besuchte, einen angemessenen Gottesdienst.
Zurückgekehrt nach Jerusalem 2 ), ward Herzog Heinrich dort vom patriarchen Amalrich noch zwei Tage 3 ) festgehalten; dann aber traten die Pilger ihre Heimfahrt an.


|
Seite 19 |




|
Sie zogen zunächst wieder nach Akkon, wählten aber nicht wieder den Seeweg nach Constantinopel. Man hatte dies sonst um so eher vermuthen dürfen, da vornehmlich die Geistlichen von den Anstrengungen der Reise und von dem Fasten bereits ermattet waren, und eine Landreise durch Syrien und Kleinasien gerade im Juli den an die Sommerhitze des Morgenlandes nicht gewöhnten Deutschen so leicht verderblich werden konnte. Warum dennoch der Herzog sich für den Landweg entschied, meldet Arnold uns nicht; es ist aber kaum zweifelhaft, daß Heinrich sich von dem Wunsche leiten ließ, auf dem Rückwege jene Gegenden kennen zu lernen, durch welche einst Gottfried von Bouillon und seine Mitanführer mit dem ersten Kreuzheer nach dem Heiligen Lande gezogen waren. Wenigstens schlug er, wie wir sehen werden, genau ihre Straße ein.
Er vergönnte seiner Begleitung zu Akkon eine Rast, eilte selbst aber, begleitet von dem Abte Heinrich, unter der Bedeckung einer starken Schutzmannschaft der Templer, die auf dieser nahe an dem Gebiete der Ismailiten (Assassinen) vorüberführenden Straße gewiß nicht überflüssig war, voraus nach Antiochia. Er hatte dem erkrankten Bischof von Lübek, dem Abte Berthold von Lüneburg und andern Herren wohl die Heimfahrt über das Meer freigestellt; aber Bischof Konrad bedauerte es bald, sich von seinem Herzog getrennt zu sehen, er wollte ihn auch um einiger Geschäfte willen sprechen. Er eilte demselben also mit den übrigen Reisegefährten auf einer Barke nach. Doch erreichte er ihn nicht mehr. Kaum gelangte er noch lebend nach Tyrus; er starb, als sie dort eben landeten, am 17. Juli 1 ). Graf Gunzel von Schwerin und die andern Gefährten des Herzogs, welche daselbst zugegen waren, begruben ihn feierlich in jener Stadt. Abt Berthold fühlte sich zu krank, um die Landreise fortzusetzen; er kehrte also nach Akkon zurück, und dort starb er acht Tage nach Konrads Tode, am 24. Juli 2 ).


|
Seite 20 |




|
In Antiochia scheint das ganze übrige Gefolge sich mit dem Herzog wieder vereinigt zu haben. Fürst Boemund III. gewährte dort seinen deutschen Gästen, die ihm gewiß von seinem Schwager, dem Kaiser Manuel, aufs Beste empfohlen waren, eine glänzende Aufnahme. Den größten Dienst aber leistete er ihnen wahrscheinlich damit, daß er sie vor dem Herrscher von Armenien warnte.
Dieser armenische Prinz Milo (oder wohl richtiger Melih oder Malich genannt) hatte einst dem Templerorden angehört; hernach beherrschte er, während sein Bruder Toros als König das ganze Land Armenien regierte, ein Gebiet am cilicischen Taurus. Hier gewann er bald einen üblen Ruf. Im Jahre 1171 nämlich, als Stephan, der Sohn des Grafen Theobald von der Champagne, seinen Rückweg aus Palästina von Antiochia über Cilicien durch Kleinasien nahm, legte Milo ihm bei Mamistra einen Hinterhalt und ließ ihn vollständig ausplündern; der Graf erlangte nur mit Mühe von den Räubern einen elenden Gaul, um seinen Weg fortsetzen zu können. Als dann bald hernach Toros starb und die Großen des Landes seinen Schwestersohn Thomas auf den Thron erhoben, schloß Milo ein Hülfsbündniß mit dem Sultan Nureddin, und mit dessen Truppen machte er sich zum Herrn von Armenien; er trat nun aber sofort feindselig gegen die Christen auf, trieb die Templer aus Cilicien, verkaufte christliche Gefangene an die Ungläubigen u. s. w. Der Fürst von Antiochia und andere christliche Herren ergriffen sogleich gegen ihn die Waffen. Der König Amalrich versuchte darauf noch erst eine gütliche Vermittelung; als aber solche erfolglos war, fiel er mit den andern christlichen Fürsten in Cilicien ein, mußte sich jedoch mit Verwüstungen des offenen Landes begnügen, da ihn die Nachricht von einer Unternehmung Nureddins gegen die Burg Petra oder Krak in Arabien abrief 1 ). -
Nicht hinlänglich mit diesen Ereignissen und mit dem Charakter des Armeniers bekannt, stürzte Herzog Heinrich der Löwe sich und seine Gefährten in die größte Gefahr, indem er Milo um freies Geleite durch sein Land bat. Der Armenier schickte dem Herzog eine Gesandtschaft von 20 vornehmen Männern entgegen, die ihm versichern sollten, daß der König bereit sei, ihn ehrenvoll und in durchaus ungestörtem Frieden durch sein Land zu geleiten.
Da empfing Heinrich aber in Antiochia noch rechtzeitig die Warnung, sich dem Armenier nicht anzuvertrauen. In


|
Seite 21 |




|
der That möchte sonst auch der Obotritenfürst Pribislav hier ein ähnliches Loos gehabt haben, wie ein Jahrhundert später, wie wir sehen werden, seinen Enkel Heinrich den Pilger in Aegypten traf.
Heinrich gab also die Absicht, seinen Weg durch das Land des Armeniers zu nehmen, auf. Er zog vielmehr mit seiner Begleitung von Antiochia hinab zu dem unweit der Mündung des Orontes belegenen "Simeonshafen" (jetzt Soldu oder Suwadia genannt); dort bestiegen sie die Schiffe, welche der Fürst Boemund ihnen besorgt hatte, und fuhren auf denselben an dem größten Theile der Küste von Cilicien vorüber bis nach der Stadt Tarsus (zu jener Zeit "Torsult", von den Saracenen "Tortun" genannt), die damals entweder noch dem Kaiser von Griechenland gehörte oder schon von diesem an den Fürsten von Antiochia abgetreten war 1 ).
Noch war indessen die Gefahr nicht ganz beseitigt, wenn anders der Weg durch Kleinasien fortgesetzt werden sollte. Denn das Land zwischen Tarsus und dem cilicischen Taurus (dem Bulgar=Dagh) war seit dem erwähnten Streifzuge des christlichen Heeres wieder in der Gewalt des durch Zurückweisung seines früher erbetenen Geleites sehr erzürnten Milo; erst hinter dem Gebirge lag das Gebiet des Sultans Kilidsch Arslan II. Dieser Letztere aber stand zu Milo in keinem besseren Verhältnisse als die christlichen Fürsten in Syrien. Er sandte also dem Herzoge Heinrich auf dessen Anmeldung nach Tarsus eine Bedeckung von 500 schwerbewaffneten Reitern (milites) entgegen, welche den Pilgerzug durch Milos Gebiet geleiten sollten.
Waren somit unsern Wallfahrern also auch die syrischen Pässe, durch welche einst das erste große Kreuzheer nach Antiochia gezogen war, nicht zu Gesichte gekommen, so konnten sie nun doch auf demselben Wege, auf dem einst Tankred den ersten Zug von Heraklea durch die hohen Pässe des


|
Seite 22 |




|
Taurus nach Tarsus hinabgeführt hatte, zum Hochlande von Kleinasien hinaufsteigen. Sie entgingen glücklich der Rache des Armeniers; aber doch mochte mancher unter ihnen bald über die Wahl des Weges durch Kleinasien murren. Denn, hätten nicht ihre saracenischen Reiter, wohlbekannt mit der "Rumenischen Wüste", schon im Gebirge die Packpferde mit Wasserschläuchen beladen, so wären auf dem dreitägigen Marsche durch die wasserlose Einöde bei glühender Sommerhitze Menschen und Pferde verschmachtet. In "Rakelei" (dem alten Heraklea, jetzt Erekli) erquickten aber die Türken mit großer Freundlichkeit die Pilger, welche sie als ihres Sultans Gäste ansahen.
Den Landesherrn selbst, den Sultan Kilidsch Arslan II., sahen die Deutschen erst auf ihrem weiteren Zuge zu Axarat (jetzt Aktscha=Schehr), wo derselbe zu einem feierlichen Empfange Vorbereitungen getroffen hatte. Da er an den Füßen ganz gelähmt und darum beständig in einem Wagen zu fahren genöthigt war, würde es ihm schwer geworden sein, den Gästen selbst entgegen zu kommen.
Zu Axarat also begrüßte er den Herzog Heinrich mit Kuß und Umarmung - als einen Blutsfreund. Heinrich wußte von dieser Verwandtschaft nichts; der Sultan erzählte ihm aber, daß eine seiner Ahnfrauen, die Gemahlin eines russischen Königs, eine deutsche Edle gewesen sei 1 ). Dann bezeugte er seine große Freude über die glückliche Ankunft seiner Gäste; er dankte Gott, daß sie Milos Händen entkommen seien, da dieser treulose Verräther ihnen sonst nicht nur ihr Gut, sondern auch ihr Leben genommen haben würde. Er selbst erwies den Deutschen eine großartige Gastfreundschaft in orientalischem Stil. Nachdem er dem Herzog Mantel und Untergewand von schönster Seide verehrt hatte (aus denen dieser hernach Priestergewänder anfertigen ließ), wurden 1800 Rosse vorgeführt, von denen sich jeder der "Ritter" des Herzogs eins nach Gefallen auswählen durfte. Der Herzog selbst empfing noch 30 starke Rosse mit silberbeschlagenen Zäumen und mit Sätteln von Elfenbein und Tuch, 6 Filzzelte nebst den 6 Kamelen, die sie tragen sollten, und deren Führern, endlich auch noch 2 Leoparden, die vermuthlich zur Jagd abgerichtet waren, da sie auf Pferden saßen und von Sklaven geleitet wurden.
So schwach der Körper, so regsam war der Geist des Sultans; er ging gern auf ernste Unterhaltungen ein. Der


|
Seite 23 |




|
Herzog berührte bei einem solchen Bespräche auch den Islam und unterließ nicht, seinen Gastfreund zur Annahme des Christenthums zu ermuntern; er erörterte weitläufiger die Lehre der Heiligen Schrift, und namentlich auch, daß Gott Mensch geworden. Da antwortete Kilidsch Arslan, dem dies alles, da seine Mutter eine heimliche Christin war, gewiß keineswegs neu erschien: "Es sei nicht schwer zu glauben, daß Gott, der den ersten Menschen aus einem Erdenkloß gebildet, auch selbst, wenn es sein Wille gewesen sei, von der unbefleckten Jungfrau das Fleisch angenommen habe." In der That scheint jene Unterredung großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben. Man schrieb es wenigstens der Vermittelung Herzog Heinrichs zu, daß der Sultan allen Christensklaven in seinem Lande die Freiheit schenkte 1 ). Dieser ward wegen seiner Milde gegen die Christen gerühmt; und als ihm später auf ihrem Todbette die Mutter ihren Glauben bekannte und ihn ermahnte, an Christum zu glauben und die Christen zu lieben, soll er es gelobt, aber hinzugefügt haben, er wage es der Saracenen wegen nicht, seinen Glauben offen zu bekennen 2 ). -
Nachdem sich die Pilger in Aktscha=Schehr bei dem gastfreien Sultan verabschiedet hatten, setzten sie ihre Reise über Ismil und "Cunin" (Iconium, Konieh), des Sultans Hauptstadt, in nordwestlicher Richtung auf Isnik (Nicäa) fort, also auf der Straße des ersten großen Kreuzzuges. Auf diesem Wege gelangten sie demnach über das alte Antiochia (bei Jalobatsch) oder Philomelium (jetzt Akschehr) in die Gegend von Doryläum (jetzt Eskischehr), wo einst durch die heiße Schlacht am 1. Juli 1097 die Kreuzfahrer die Macht des Sultans Kilidsch Arslan I. gebrochen hatten, und wo hernach König Konrad III. auf seinem Kreuzzuge im October 1147 nach dem mühevollen Zuge durch Gebirge und Wüsten bei den Angriffen der leichten türkischen Reiter und der schändlichen Verrätherei der Griechen den größten Theil seines Heeres verloren hatte und mit den Trümmern desselben auf einem Seitenwege durch die Gebirge von Lykaonien nach Nicäa zurückzukehren


|
Seite 24 |




|
genöthigt war. Nachdem die Pilger einen "Wald" von drei beschwerlichen Tagereisen - den Dumandji=Dagh? -, der das Sultanat von Konieh vom Gebiete des griechischen Kaisers schied, überwunden hatten, sahen sie - schon auf griechischem Gebiete - die "Alemannenburg", von welcher aus einst Gottfried von Bouillon das ganze Saracenenreich erobert haben sollte, und dann erreichten sie die damals noch schön befestigte und ansehnliche Stadt "Anikke" (Nicäa, Isnik), an welche sich so viele Erinnerungen aus den ersten Kreuzzügen knüpften, der Untergang der Schaaren Peters von Amiens und Walters in der Nähe derselben, und die gewaltige Belagerung der Stadt, um deren Früchte schließlich der griechische Kaiser die Pilgerfürsten zu bringen gewußt hatte.
Der kürzeste Weg hätte nun die deutschen Wallfahrer von Nieäa über Nikomedien, Chalcedon und Skutari nach Constantinopel zurückgeführt: das war der Weg der alten Kreuzfahrer. Aber sie wandten sich westlich, dem "St. Georgenarm" (dem Hellespont) zu. Sie setzten über denselben bei der Stadt "Willekume" (Gallipoli) und richteten dann ihren Zug wieder auf Constantinopel, um dort ihren Troß an sich zu nehmen und auf der ihnen schon wohlbekannten Straße durch Ungarn der lange entbehrten Heimath wieder zuzueilen.
Den Kaiser fanden sie in seiner Hauptstadt nicht; er verweilte damals in "Manopolis", dessen Lage nicht sicher ist 1 ). Sie suchten ihn daselbst auf, um von ihm Abschied zu nehmen, und erfuhren von ihm gleiche Gastfreundschaft wie früher. Trotz ihrer Sehnsucht nach der Heimath mußten sie noch einige Tage bei ihm verweilen. Vermuthlich wollte er auch nicht die gute Gelegenheit versäumen, von dem staatsklugen Herzoge über die Zustände in Palästina und Kleinasien, die ihn so lebhaft interessirten, Nachrichten einzuziehen und Urtheile zu vernehmen. Aber seine Zuneigung zu Heinrich scheint doch nicht allein durch politische Rücksichten bestimmt worden zu sein. Bei dem Abschiede überhäufte der Kaiser ihn wieder mit köstlichen Geschenken. Der Herzog lehnte diese indessen in höflichster Form ab und erbat sich dafür - Reliquien, an denen der Kaiser sehr reich war und mit


|
Seite 25 |




|
denen er gern vor seinen Gästen zu prunken pflegte. Manuel ging auch auf diesen Wunsch willig ein; er schenkte seinem Gaste nicht nur eine große Zahl von Reliquien, sondern auch köstliche Edelsteine zum Schmuck derselben 1 ).
Die Heimkehr über Nisch, durch den Bulgerewald, durch Ungarn, wo der König Bela freies Geleite und gute Verpflegung gewährte, und durch Oestreich verlief ohne jeglichen Unfall.
Nach der Ankunft in Baiern begrüßte Herzog Heinrich zunächst den Kaiser Friedrich zu Augsburg, wo derselbe 1172 das Weihnachtsfest beging; dann aber eilte er nach Braunschweig, welches er gerade nach Jahresfrist wieder betrat. Seinem Hause war während der Wallfahrt große Freude widerfahren; es war ihm eine Tochter (die Richenza) geschenkt.


|
Seite 26 |




|
Auch der Graf Gunzel von Schwerin sah, so viel wir wissen, seine zahlreiche Familie ohne Verlust wieder.
Zu solchem Empfange bildete aber die Heimkehr des Fürsten Pribislav einen traurigen Contrast. Der Obotritenfürst fand seine Gemahlin, die Fürstin Woizlava, nicht mehr; sie hatte während seiner Wallfahrt nach den heiligen Stätten ihre irdische Wallfahrt vollendet und in der Klosterkirche zu Althof (bei Doberan) ihre Ruhestätte gefunden 1 ).


|
Seite 27 |




|
II.
Die Kreuzfahrt
des Grafen
Heinrich I. von Schwerin.
Erst fünfzehn Jahre waren seit der gemeinsamen Wallfahrt des Fürsten Pribislav und des Grafen Gunzel I. mit Herzog Heinrich verflossen, als die heilige Stadt Jerusalem, wo jene ein christliches Königreich in allem Glanze gesehen hatten, an den großen Sultan Saladin verloren ging. Das Abendland rüstete sich alsbald zur Wiedereroberung der heiligen Stätten, und kein geringerer Mann als der alte Kaiser Friedrich I. stellte sich an die Spitze der zahllosen christlichen Kämpfer.
Pribislav erlebte diese Ereignisse nicht mehr († 1178), und eben so wenig Graf Gunzel I. († um 1185). und man möchte vermuthen, daß das Beispiel ihrer Väter und deren Erzählungen in ihnen wohl eine Vorliebe für das Heilige Land und Begeisterung für dessen Wiedereroberung erweckt hätten. Die Lage Niedersachsens und Meklenburgs war aber allerdings der Art, daß die meklenburgischen Landesherren dem Gedanken an eine Betheiligung bei dem Kreuzzuge nicht wohl Raum geben konnten. Herzog Heinrich, längst seiner Herzogthümer verlustig und voll tiefen Grolls, räumte lieber, als daß er sich dem Kreuzzuge angeschlossen hätte, auf des Kaisers Begehr einstweilen seine Erblande; da aber sein Nachfolger im Herzogthum Sachsen die meklenburgischen Herren und andere innerhalb seines Gebietes nicht hatte zu gewinnen verstanden und des nötigen Ansehens entbehrte, ließ sich kaum vermuthen, daß Herzog Heinrich die Gelegenheit versäumen würde, in des Kaisers Abwesenheit zurückzukehren und seine Macht auszubreiten. Ueberdies war erst vor wenig Jahren ein heidnischer Ausstand in den meklenburgischen Landen unterdrückt; dann waren die meklenburgischen Fürsten Burwin I. und Nicolaus mit einander


|
Seite 28 |




|
in Fehde gerathen und endlich darüber gar Mannen des Königs von Dänemark geworden!
Mehr Anklang fand in Niedersachsen allerdings der Kreuzzug, den Kaiser Heinrich VI. ins Werk setzte. Unter den Herren, welche 1197 fortzogen, finden wir u. a. den Erzbischof von Bremen, den Bischof von Verden, den Grafen Adolf von Holstein, der schon früher für das Heilige Land gekämpft hatte, genannt, und auch etwa 400 Lübeker nahmen das Kreuz 1 ). Aber daß Meklenburger sich angeschlossen hätten, finden wir nicht überliefert.
Einen neuen Impuls empfingen die Deutschen, als der große Papst Innocenz III., und nach dessen Tode sein Nachfolger Honorius III., und der junge König Friedrich II. mit großem Eifer zu einem Kreuzzuge aufriefen. Die ersten Erfolge waren freilich wenig aufmunternd; der König Andreas von Ungarn, süddeutsche Herren u. s. w. richteten 1217 in Palästina wenig aus. Im Mai 1218 aber setzten die Kreuzfahrer von Akkon nach Aegypten über, um hier die Macht der Saracenen an der Wurzel zu vernichten. Unter der Führung des Königs Johann von Jerusalem, des Herzogs Leopold von Oestreich und vieler anderer weltlicher Herren, sowie des Patriarchen von Jerusalem und zahlreicher Bischöfe, hernach (seit dem Herbste 1218 2 ) vornehmlich unter der Oberleitung des päpstlichen Legaten, Cardinal=Bischofs Pelagius von Albano, belagerten sie die sehr feste Stadt Damiette; und wiewohl der Herrscher von Aegypten, Al=Kâmil, derselben mit großer muhammedanischer Macht zu Hülfe kam, bezwangen sie diesen festen Platz nach unsäglichen Mühen und Kämpfen endlich am 5. Novbr. 3 ) 1219. Die Feste Tanis fiel ihnen ohne Kampf zu.
Wir wissen, daß an der Belagerung von Damiette neben zahlreichen Friesen auch manche Niederdeutsche aus der Bremischen Kirchenprovinz mitgewirkt haben 4 ), aber


|
Seite 29 |




|
nicht, ob Pilger von der Ostseeküste unter diesen gewesen sind. Jedenfalls war bis dahin keiner der Regenten aus Meklenburg 1 ) nach Aegypten gezogen.
so wichtig nun ein solcher Erfolg der Kreuzfahrer war, sie benutzten nicht den Schrecken, welcher sich der Aegypter bemächtigt hatte, um sofort tiefer ins Land einzudringen. Vielmehr erwarteten sie in Damiette erst weitere Verstärkungen, und namentlich den König Friedrich II, der immer zögerte, selbst sein Gelübde zu lösen, wohl aber viele Herren zum Ablegen des Gelübdes und zu baldigem Aufbruche antrieb.
Da trat denn im Jahre 1220 2 ) auch Graf Heinrich I. von Schwerin, ein Sohn Gunzels I., seine Kreuzfahrt nach Aegypten an. Ob ihn jedoch des Königs Friedrich II. erwähnte allgemeine Aufmunterung dazu bewogen hat, darf man bezweifeln. Denn die Grafen von Schwerin waren den Welfen, denen sie ihre Grafschaft verdankten, zugethan; Heinrich hatte den Kaiser Otto IV. auf seinem Zuge nach Italien begleitet 3 ), und von ihm ein Privilegium 4 ) erlangt, das nicht nur dem Domcapitel zu Schwerin neue Rechte einräumte, sondern auch der Stadt Schwerin zu Gute kam. Friedrich II. dagegen hatte dem Könige Waldemar II. von Dänemark, der die Grafen Gunzel I. und Heinrich I. von Schwerin gezwungen, ihn als ihren Lehnherrn anzuerkennen 5 ), alle Lande nördlich von der Elbe und Elde förmlich abgetreten 6 ), und die Päpste Innocenz III. und Honorius hatten dem Dänenkönige diesen Besitz bestätigt 7 ). Wie früher Waldemars Hand schwer auf den Grafen gelastet hatte 8 ), so zeigte er hernach, indem er seinen natürlichen Sohn Nicolaus von Halland mit Ida, der Erbtochter des Grafen Gunzelin II. (und Nichte des Grafen Heinrich), vermählte, deutlich genug, daß er wenigstens die eine Hälfte der Graf=


|
Seite 30 |




|
schaft Heinrich I. und seinen Nachkommen zu entziehen suchte 1 ). Immerhin war also die Lage des Grafen Heinrich daheim eine unerquickliche; aber nicht solche Verstimmung kann den klugen und erfahrungsreichen Mann bewogen haben, bei schon herannahendem Alter - er mochte etwa 60 Jahre Zählen 2 ) - auf längere Zeit sein Land zu verlassen, wo, wenn sein älterer Bruder Gunzel II. sterben sollte, sofort jene Besitzergreifung von dänischer Seite zu befürchten stand, da Nicolaus von Halland mit Hinterlassung eines kleinen Sohnes bereits verstorben war. Vielmehr wird es der ritterlicher Sinn und die damit damals noch verbundene Liebe zur Kirche gewesen sein, die trotz aller politischen Bedenken den kühnen, unternehmenden Grafen anspornte, mit einem großen Theile der geistlichen und weltlichen Herren der Christenheit und mit andern zahllosen Gläubigen für das Kreuz Christi in den Kampf zu ziehen. In Gemeinschaft mit seinem Bruder Gunzel II. hatte er nicht nur deutsche Klöster gefördert, sondern vornehmlich den Hospitalbrüdern zu St. Johann in Jerusalem hatten sie ihre Vorliebe zugewandt, der Orden verdankte ihnen erhebliche Schenkungen 3 ). Hatte Heinrich damit sein hohes Interesse für das heilige Land und für die Kreuzfahrer genugsam bewiesen, so lag es ihm nicht fern, jetzt, wo das Haupt der Kirche den Aufruf zum Streit für das Heilige Land so laut ergehen ließ, und die erwartete Führung des Kreuzheeres durch das weltliche Haupt der Christenheit entscheidende Erfolge verhieße auch sein Leben einzusetzen und die den Pilgern verheißene Krone zu erstreben.
Diese hätte ihm aber leicht schon zu Theil werden können, bevor er noch Aegypten erreichte; denn schon unterwegs ward er mit den Saracenen handgemein. Während nämlich die Christen zu Damiette in Unthätigkeit verharrten, unterließ der ägyptische Sultan Kamil nichts, um ihnen Abbruch zu thun. Oberhalb der Stadt Damiette, dort, wo von dem Nilarm, der an dieser Stadt vorüberfließt, sich ein Nebenarm, der Canal von Aschmun, ostwärts abzweigt, erbauete er ein festes Lager (Mansurah), um die muhammedanischen Streitkräfte daselbst zu sammeln; gleichzeitig aber


|
Seite 31 |




|
richtete er auch seine Aufmerksamkeit auf die See, um die Verbindung Damiettes mit Europa, die Zufuhr und die Zuzüge der Pilger zu hemmen. Wohl hatte der Doge von Venedig im Sommer 1220 14 schnellsegelnde Kriegsschiffe 1 ) den Christen in Aegypten zu Hülfe gesandt; sie erreichten den Hafen von Damiette im August, also eben zu der Zeit, wo die zweite Hauptüberfahrt der Kreuzfahrer zu geschehen pflegte (während die erste und bedeutendste Ueberfahrt im Frühling [passagium vernale] stattfand). Aber während diese dort ruhig im Hafen lagen, erschienen auf dem Mittelmeere nicht weniger als 33 von Kâmil ausgerüstete Galeeren, welche den Christen unsäglichen Schaden zufügten, indem sie Handelsschiffe, die Proviant nach Damiette schaffen sollten, sammt der Mannschaft nahmen, die Fahrzeuge plünderten und verbrannten, die Pilger aber gefangen abführten. Solche Kaper griffen denn auch ein großes, von Lastschiffen begleitetes Schiff an, welches den Grafen Heinrich von Schwerin mit andern Edlen aus Deutschland an Bord hatte. Es entspann sich ein heftiger Kampf; die Kreuzfahrer aber vertheidigten sich mannhaft, tödteten und verwundeten viele von jenen Aegyptern und entkamen so glücklich der Gefahr. Sie verloren von ihren Begleitschiffen nur ein dem Deutschen Hause gehöriges Lastschiff, das mit Gerste beladen war, durch griechisches Feuer. Die venetianischen und andere Galeeren liefen zu spät von Damiette aus, als daß sie jenen hätten Hülfe bringen können 2 ).
Als Graf Heinrich nun also im Spätsommer 1220 in Aegypten eintraf, fand er das Kreuzheer noch zu Damiette,


|
Seite 32 |




|
welches nun schon seit etwa 10 Monaten in den Händen der Christen war; und noch immer eröffnete sich keine Aussicht, daß man zu einer größeren Unternehmung aufbrechen würde. Viele Streiter waren bereits unmuthig geworden und nach und nach heimgekehrt. Selbst der König Johann von Jerusalem, dem der päpstliche Legat doch Damiette zugestanden hatte, war, mißvergnügt über des Legaten Herrschsucht, abgesegelt; auch viele andere weltliche Herren waren von Pelagius verletzt; und die lange Unthätigkeit entsittlichte, zumal in jenem Klima, einen nicht geringen Theil der Mannschaft. Vergebens hatte der Cardinal die Führer wiederholt zum Aufbruche nach Kairo ermuntert; seine Gegner waren zu stark, er hatte nichts durchgesetzt. Während Kâmil in seinem festen Lager zu Mansurah die muhammedanischen Streitkräfte nach und nach vereinigte, verharrten die Christen auch den ganzen nächsten Winter in ihrer Ruhe. Wiederum hoffte man Friedrich II., nach seinem neuen im November 1220 bei seiner Kaiserkrönung geleisteten Gelöbnisse, im nächsten März zu Damiette zugehen; und darauf setzte man nun alle Hoffnung. Aber er selbst erschien nicht. Als sein Vorbote und Stellvertreter, der Herzog Ludwig von Baiern, im Mai in Aegypten eintraf, regte sich wohl neues Leben in dem Kreuzheere; da aber immer der Kaiser sein Versprechen nicht erfüllte, gelang es dem Legaten endlich durch seine Beredsamkeit, in dem Rathe der Fürsten die großen Bedenken, welche gegen einen Zug nach Kairo erhoben wurden, niederzuschlagen und sie zum Marsche nach dieser Hauptstadt von Aegypten auch ohne den Kaiser zu bestimmen. Ende Juni begann man den Aufbruch aus dem Lager zu Damiette; auch der König Johann von Jerusalem kehrte nun wieder zum Heere zurück. In der That war es jetzt aber zu früh oder zu spät, oder wenigstens die äußerste Zeit, wenn man noch vor der Ueberschwemmung des seit Johannis steigenden Nils das Ziel erreichen wollte. Denn wie schnell man die wenigen Tagemärsche nach Kairo gleich nach der Eroberung von Damiette hätte zurücklegen mögen, jetzt war es nicht mehr abzusehen, wie lange der Sultan die Christen mit seinem Heere in seinem festen Lager aufhalten konnte. Man beeilte sich aber trotzdem keinesweges; erst am 17. Juli verließen die Kreuzfahrer das Lager von Fareskur, das 3 Stunden von Damiette entfernt war.
Wohl mochten sie, unbekannt mit der Stärke, der Umsicht und dem Muthe des Sultans und mit den schwierigen Terrainverhältnissen, sich den frohesten Hoffnungen hingeben. Denn die Zahl ihres Fußvolks betrug, wenn auch nicht


|
Seite 33 |




|
200,000 Mann, wie ein ägyptischer Schriftsteller 1 ) meint, so doch eine "unzählige" Menge, darunter wohl 4000 Bogenschützen; dazu kamen 1200 Ritter 2 ) mit ihren Knappen und andere Reiter, im Ganzen wohl 4-5000 zu Roß. Eine Flotte von 600 Schiffen, unter denen etwa 300 Koggen und 18 Galeeren, die andern Transportschiffe waren, deckte den rechten Flügel des am östlichen Nilufer hinaufziehenden Heeres, während Infanterie den linken schützte, Cavallerie sich zwischen ihnen ausbreitete, und Pfeilschützen und Lanzenschleuderer den Vortrab bildeten. Wie sollte König Johann von Jerusalem also Gehör finden mit seinem Vorschlag, die Stadt Scharmesah, die der Sultan zerstört hatte, wieder zu befestigen und dort in dem fruchtbaren Lande die Ankunft Kaiser Friedrichs II. abzuwarten! Schon nach einer Woche standen die Kreuzfahrer, da sie unterwegs verhältnißmäßig wenig belästigt waren, den Aegyptern gegenüber aus der Landspitze zwischen dem Nil und dem Kanal von Aschmun, nur durch diesen Kanal vom Feinde getrennt.
Wie wenig aber der Sultan geneigt war, den Christen sein Land ohne den härtesten Kampf zu überlassen, hatten sie schon unterwegs aus den von ihm befohlenen Verwüstungen abnehmen können. Jetzt sahen sie vor sich ein stark befestigtes Lager und zu dessen Seite auf dem Nil eine Flotte von 100 Galeeren 3 ); alle Mannschaft Aegyptens war aufgeboten, an die Muhammedaner in Syrien der Ruf um schleunige Verstärkung ergangen. Den Christen blieb nichts weiter übrig, als ihr Lager zu befestigen und zur Vertheidigung einzurichten. Vier Gefechte fielen zu Gunsten der Muselmänner aus 4 ).
Und doch zeigte Kâmil die besonnenste Mäßigung. Bei den jetzt eingeleiteten Friedensverhandlungen begehrten die Christen für die Herausgabe von Damiette "die Uebergabe von Jerusalem, Askalon, Tiberias, Gabala, Laodicea und der übrigen Städte des Meeresufers, die Saladin Jusuf erobert hatte "sowie "300,000 Dinare als Ersatz für den Schaden, welchen ihnen Al=Muazzam, der Fürst von Da=


|
Seite 34 |




|
maskus [Kâmils Bruder], durch Zerstörung der Mauern von Jerusalem [nach dem Falle von Damiette] zugefügt habe"; und alle jene Lande und Plätze gestand ihnen der Sultan für sich und seine Brüder zu, mit Ausnahme der festen Plätze Karak und Saubak (Mont royal) 1 ). Vergebens befürwortete König Johann von Jerusalem - und mit ihm die morgenländischen Herren - die Annahme dieser Bedingungen, womit das Ziel des Kreuzzuges, die Herstellung seines Königreiches, erreicht wäre. Der Cardinal Pelagius, der geprahlt hatte, er hoffe in wenig Tagen in Kairo zu sein, berief sich aus entgegenstehende Verbote des Papstes und des Kaisers, mit den Ungläubigen keinen Frieden zu schließen 2 ) - und er drang durch; die Verhandlungen wurden abgebrochen.
Aber man verharrete in der Unthätigkeit. Während nun im August mehr als 10000 Pilger unmuthig aus dem Lager nach Damiette zurückkehrten, um nach Hause zu fahren, entwickelte der Sultan die größte Tätigkeit. Seine Brüder, der furchtbare Christenfeind Al=Muazzam und Aschraf, sowie andere syrische Fürsten waren herbeigeeilt, so daß seine Reiterei wohl auf 40000 Rosse stieg 3 ); und im Rücken der Christen erschienen seine Kriegsschiffe, die er von Rosette her durch einen vom steigenden Nilwasser schiffbar gewordenen Canal im Delta (Mahalle) gehen ließ, um seinen Gegnern die Zufuhr abzuschneiden. Bald spürten auch die Kreuzfahrer die Schwierigkeiten der Verpflegung, und am 18. August wurde eine Anzahl ihrer Schiffe von den ägyptischen theils genommen, theils versenkt. Aegyptische Reiter gingen über den Canal von Aschmun und sperrten auch den schmalen Landweg nach Damiette, den der steigende Nil noch gelassen hatte.
Die Kreuzfahrer, welche "wie die Vögel ins Garn und die Fische ins Netz" gegangen waren, entschlossen sich jetzt zu dem unvermeidlich gewordenen Rückzug; am Abend des 26. August ward in aller Stille das Lager abgebrochen und verlassen. Aber da die Menge, zum Theil berauscht von dem preisgegebenen Wein, einen Theil der Zelte anzündete oder in Brand gerathen ließ, merkten die Feinde die Flucht und traten die Verfolgung an. In der Dunkelheit der Nacht irrten die Christen in Verwirrung umher, zum Theil


|
Seite 35 |




|
in dem Schlamm des ausgetretenen Nils; viele ertranken. Wohl warfen König Johann und die Ordensritter am nächsten Tage die andringenden Reiter tapfer zurück. Aber die Aegypter durchstachen in der nächsten Nacht Nildämme, viele Schläfer ertranken. Die Unmöglichkeit zu entkommen, heftige Angriffe der Aegypter, und auch der treulose Uebergang mancher Christen zum Feinde, veranlaßten die Führer des Kreuzzuges, mit dem Sultan Unterhandlungen anzuknüpfen: "sie baten um Schonung gegen Abtretung von Damiette an die Muslimen". Vergeblich zogen sich indessen zwei Tage die Verhandlungen hin, eine Partei unter den Muhammedanern wollte von Schonung nichts hören. Da jedoch die Christen der bedingungslosen Kriegsgefangenschaft einen ehrenvollen Untergang vorzuziehen erklärten, auch schon ihre Vorbereitungen zu einem verzweifelten Kampfe machten, mit ihrer Vernichtung aber das wohlbesetzte Damiette nicht gewonnen wäre, und da die Aegypter "die Franken auf den Inseln und anderswo fürchteten, welche denen bei Damiette zu Hülfe kommen konnten" 1 ): so kam am 30. August ein Vertrag zu Stande, worin die Christen sich verpflichteten, dem Sultan Damiette und die Burg Tanis herauszugeben, sie dagegen mit allen beweglichen Gütern freien Abzug aus Aegypten haben, alle beiderseitigen Gefangenen frei sein und die Muhammedaner das bei Tiberias erbeutete heilige Kreuz herausgeben sollten. Geisel bürgten von beiden Seiten für die Ausführung dieser Bedingungen.
Sofort ward nun den eingeschlossenen Christen von Seiten des Sultans Zufuhr und ein freundlicher Verkehr gewährt. Er gab seine christlichen Gefangenen noch vor der Ausführung des Vertrages los, ließ eine Brücke über den Nil schlagen, damit die Kreuzfahrer auf trockneren Wegen heimkehren könnten, verbot, sie irgendwie zu beschimpfen u. s. w.
Aber die nach Damiette abgesandten Ordensmeister stießen dort mit dem Begehr, die Stadt zu übergeben, auf heftigen Widerspruch. Die Führer der eben angelangten Flotte Kaiser Friedrichs und die deutschen und italienischen Kreuzfahrer daselbst sträubten sich ebenso heftig gegen die Annahme jenes Friedens, als die Franzosen und Orientalen sie befürworteten. Da man indessen keine Möglichkeit sah, die Stadt lange zu verteidigen, ward Damiette am 7. September (122l) von den Christen geräumt, die Muhammedaner zogen am nächsten Tage ein, und die Kreuzfahrer verließen schnell Aegypten 2 ).


|
Seite 36 |




|
Ueber die persönlichen Erlebnisse des Grafen Heinrich von Schwerin während seines Aufenthaltes in Aegypten finden wir nichts ausdrücklich erwähnt. Aber das darf uns nicht Wunder nehmen; denn selbst in der ausführlichen Erzählung dieses unglücklichen Kreuzzuges, welche wir dem Kölner Scholasticus (und späteren Paderbornschen Bischof) Oliver verdanken, werden uns auch nur die obersten Führer des Zuges genannt, zu denen ja Heinrich nicht gehörte. Wir finden den Grafen jedoch erst am 31. März 1222 wieder in seiner Heimath; und daß er, ohne sich an dem Kampfe zu betheiligen und ohne das übliche volle Jahr dem Kreuze gedient zu haben, aus Aegypten heimgekehrt wäre, widerspricht seinem ganzen Charakter. Endlich erblicken wir eine Hindeutung auf seine Theilnahme an dem unglücklichen Zuge nach Mansurah in den Worten eines Zeitgenossen.
Am 31. März, - am Grünen Donnerstage - des Jahres 1222 beurkundet nämlich zu Schwerin der dortige Bischof Brunward in Anwesenheit nicht nur seiner Domherren und einer Reihe von Schwerinschen Vasallen, sondern auch des Propstes Hermann von Hamburg und des Domherrn Friedrich von Hildesheim, welche beide Brüder des Grafen Heinrich I. von Schwerin waren, sowie des Abtes von Doberan und der Pröpste von Lübek und Neukloster - also in einer großen, feierlichen Versammlung -: "Graf Heinrich von Schwerin habe, als er, um dem Heiligen Lande zu Hülfe zu kommen, gegen die Heiden jenseit des Meeres eine Kreuzfahrt unternommen, mit großen Mühen und Kosten und mit gar vielen gefälligen Dienstleistungen es erlangt (magnis laboribus et expensis et quam pluribus obsequiis obtinuit), daß der Cardinal der heiligen Römischen Kirche, Bischof Pelagius von Albano, da dieser daselbst das Amt eines apostolischen Legaten verwaltete, ihm Blut des Herrn schenkte, das in einem Jaspis verschlossen war", mit der gestrengen Weisung, diesen unvergleichlichen Schatz einer Conventualkirche zu übergeben 1 ), und der Graf habe


|
Seite 37 |




|
dies H. Blut an diesem Tage, dem Grünen Donnerstage, in dem Schweriner Dom, wo die Gebeine der Seinigen - sowohl seines Vaters als seiner Bruder 1 ) - ruheten, dargebracht, Clerus und Laien hatten dasselbe mit Procession und Gesang empfangen.
Aus der Schenkung dieser kostbaren Reliquie und aus der ausdrücklichen Erwähnung gar vieler gefälliger Dienst=


|
Seite 38 |




|
leistungen dürfen wir sicher den Schluß ziehen, daß der Graf sich nicht den Wünschen des Cardinals entgegengestellt und sich nicht von dem Zuge ferngehalten, sondern sich ihm durch Folgsamkeit werth gemacht hat, wie denn auch der Kühnheit des Grafen die thatkräftige und unternehmende, aber leider auch unbesonnene Weise des Cardinals mehr zugesagt haben wird als die bedächtige, aber den rechten Zeitpunct verpassende Art seiner Gegner unter den Kreuzfahrern.
Uebrigens fand der Graf Heinrich sein Land bei seiner Heimkehr in einer recht traurigen Lage wieder. Sein Bruder Gunzel II. war schon zu Ende des Jahres 1220 gestorben, dessen Landestheil vom Grafen Albrecht von Orlamünde, dem Gewalthaber des Königs Waldemar H. von Dänemark in dessen deutschen Gebieten, für dieses Königs und Gunzels oben erwähnten Enkel, den jungen Grafen Nicolaus von Halland, in Besitz genommen. Es liegt nicht mehr in unserer Aufgabe, zu erzählen, durch welch verzweifeltes Mittel Graf Heinrich sich hernach des Königs bemächtigte, und wie die dänische Herrschaft in Norddeutschland gebrochen ward.


|
Seite 39 |




|
III.
Die Pilgerfahrt
des Fürsten
Heinrich I. von Meklenburg.
"Infelix peregrinato et omni
pro Christo morte grauior."
Alb. Krantz.
Man würde irre gehen, wenn man daraus, daß, so viel wir wissen, allein Graf Heinrich I. von Schwerin an dem von den Päpsten Innocenz III. und Honorius III. ausgeschriebenen Kreuzzuge Theil nahm, den Schluß ziehen wollte, daß der Eifer für die Bekämpfung der Feinde des Kreuzes Christi, ein Gedanke, welcher Jahrhunderte lang die abendländische Welt begeisterte, nicht auch in Meklenburg Streiter für die Kirche erweckt hätte. Nur gab der Papst Innocenz III. diesen ein anderes Ziel, indem er durch seine Bulle vom 5. Qctober 1199 die Christen in Westfalen, Sachsen, Nordalbingien und im Wendenlande aufforderte, die jüngst von dem Segeberger Canonicus Meinhard durch seine Predigt und die Stiftung des Bisthums Uexküll gegründete (von dessen Nachfolger schon durch den Tod besiegelte) Kirche in Livland gegen die dortigen Heiden zu schützen, und denen, die das Gelübde einer Wallfahrt nach den heiligen Stätten gethan hatten, gestattete, dafür nach Livland zur Vertheidigung der dortigen Kirche zu ziehen, auch diese Streiter in seinen apostolischen Schutz nahm 1 ). Es ist sicher eine beachtenswerthe Erscheinung, daß in Meklenburg schon, als hier die christliche Kirche kaum eine feste Gestalt und den nöthigen Ausbau gewonnen hatte, auch sofort der Eifer für die Ausbreitung des Christenthums und den Schutz der in Livland und Preußen entstehenden Bisthümer erwachte. Vornehmlich der Bischof Philipp von Ratzeburg († 1215)


|
Seite 40 |




|
erwarb sich in dieser Beziehung um Livland die größten Verdienste, Jahre lang war er dem Rigischen Bischof Albrecht ein treuer Helfer und Stellvertreter 1 ). Aber auch Bischof Brunward von Schwerin nahm selbst 1219 2 ) an einem Kreuzzuge nach Preußen Theil. Wie Graf Albert (von Orlamünde) von Holstein und Ratzeburg 3 ) 1217, so machte auch Fürst Burwin I. von Meklenburg, wiewohl schon ein Sechziger, 1218-1219 eine Kreuzfahrt nach Livland 4 ). Schon früh unterstützte man die Ritterschaften des Schwertordens und des preußischen Ordens von Dobrin durch Schenkungen meklenburgischer Güter, Söhne des meklenburgischen Adels traten unter die Ordensbrüder; und andere Ritter, welche wir bald zahlreich in Meklenburg antreffen, werden sich eben im Streite gegen die Heiden an der Ostsee ihre Sporen verdient haben. Denn jene Kämpfe wurden auch von der folgenden Generation aufgenommen. Ein Graf von Danneberg ist in Livland gefallen; Graf Gunzel III. von Schwerin hat nicht nur Güter an das Kloster Dünamunde verliehen, sondern erschien selbst in Riga und ward 1267 sogar zum Schirmherrn und Verweser des Erzbisthums ernannt 5 ); und sein Schwager, der Fürst Johann I. von Meklenburg, beschenkte nicht nur die Ordensritter und gab den Rigischen zu Wismar und sonst in seinen Landen gleiche Freiheiten mit den Lübekern 6 ), sondern, wenn man einer späteren Sage bei Kirchberg 7 ) Glauben schenken darf, hat er auch selbst eine Kreuzfahrt nach Livland unternommen.
Keiner unserer Fürsten ging aber lebhafter auf diese Richtung ein, als Johanns I. Sohn und Nachfolger, Fürst Heinrich I. von Meklenburg. Schon mit seinem Vater - und vielleicht mit seinem jung verstorbenen Bruder "Poppo dem Kreuzfahrer" - war er, wie Kirchberg meldet, nach Livland gezogen; und als er hernach zur Regierung gekommen war, unternahm er (vielleicht gleichzeitig mit seinem Oheim, dem Grafen Gunzel III. von Schwerin), begleitet von seiner Gemahlin Anastasia, jene Kreuzfahrt nach


|
Seite 41 |




|
Livland, während welcher ihm zu Riga sein ältester Sohn, Heinrich II., geboren ward, und von welcher er ein kleines Mädchen von heidnischen Eltern, das er im Kampfesgewühl sicherem Verderben entrissen hatte, heimbrachte, um es als seine Adoptivtochter dem Kloster Rehna zu übergeben 1 ).
Gipfelte der ritterliche Sinn jener Zeit in der Liebe zum Herrn und in dem Schutze und der Pflege seiner Kirche, so sehen wir diesen Fürsten Heinrich I. von solcher Gesinnung ganz durchdrungen. Er bewies sie durch reiche Schenkungen an die Kirchen und durch Förderung kirchlicher Wohlthätigkeitsanstalten 2 ), wobei er sich des Rathes und der Unterstützung


|
Seite 42 |




|
der beiden Bischöfe zu Schwerin und Ratzeburg, des Grafen Hermann von Schladen und Ulrich von Blüchers, erfreuete 1 ).
Nach allem diesem versteht man es wohl, wenn der Fürst Heinrich I., nicht zufrieden, gegen die Heiden an der Ostsee für die Ausbreitung der Kirche Christi gestritten zu haben, sich entschloß, sobald sich nur irgend eine Aussicht zur Befreiung des Heiligen Grabes aus den Händen der Ungläubigen eröffnete, zu Christi Ehre eine Kreuzfahrt nach dem Heiligen Lande zu unternehmen. Aus den Händen des Bischofs Ulrich von Ratzeburg empfing er das Kreuz 2 ).
Oder lag dem Fürsten der Gedanke für das Heilige Grab zu streiten fern? Wollte er nur als friedlicher Pilger dahin ziehen, um dort wie seine Vorfahren Herzog Heinrich der Löwe und Pribislav zu beten und durch die Anschauung der heiligen Orte, wo Jesus gelebt und gelitten, sich dessen Gedächtniß um so mehr zu vergegenwärtigen und seinen Glauben zu stärken, ein gottgefälliges, verdienstliches Werk zu thun?
Die letztere Ansicht ist schon von Kirchberg angedeutet 3 ) und neuerdings wieder geltend gemacht 4 ), man hat den Fürsten daher vor andern durch den Beinamen des "Pilgers" ausgezeichnet; früher dagegen, schon seit dem 15. Jahrhundert, faßte
 .
.


|
Seite 43 |




|
man Heinrichs Fahrt vornehmlich als einen Auszug "zur Unterstützung des Heiligen Landes", als eine Kreuzfahrt, auf.
Versuchen wir nun, uns aus den Quellen ein richtiges Bild von Heinrichs Unternehmen zu entwerfen, so müssen wir vorweg gestehen, daß dieselben leider sehr lückenhaft und sehr mangelhaft sind, und wir, um sicher zu gehen, nicht umhin können, auch die Lage des Heiligen Landes und die Zeitverhältnisse, unter denen der Fürst seinen Entschluß faßte, uns zu vergegenwärtigen.
Wir besitzen freilich in der "Chronik des (Lübischen) Canzlers Albrecht von Bardewik vom Jahre 1298 bis 1301" 1 ) einen zeitgenössischen Bericht über die Rückkehr Heinrichs des Pilgers, geschrieben von einem Lübeker und beruhend auf den Mittheilungen, welche der wenig Jahre früher heimgekehrte Fürst und vielleicht sein Diener Martin Bleyer, wahrscheinlich bei dem Besuche in Lübek selbst, gegeben hatten. Aber so wichtig uns diese Nachrichten sind, so sehr haben wir zu bedauern, daß sie sich vornehmlich nur auf die Heimkehr beschränken, über die früheren Ereignisse aber nur wenige, wenngleich sehr werthvolle, Andeutungen enthalten.
An diesen Bericht reihen sich zunächst die Lübeker Jahrbücher, welche mit 1324 schließen, und die Chronik, welche der Franciscaner=Lesemeister Detmar zu Lübek in den Jahren 1385-1395 schrieb. Denn die Berichte, welche beide 2 ), in verschiedener Ausführlichkeit, von der Heimfahrt im J. 1298 enthalten, sind ersichtlich aus einer Quelle geflossen. Sie gehen ohne Zweifel zurück auf die leider ver=


|
Seite 44 |




|
loren gegangene Lübische Stadtchronik; und namentlich Detmars genaue Angaben über die Begegnung des Fürsten zu Rom mit einem Lübischen Agenten und über den Empfang des Fürsten zu Lübek beweisen, daß die Quelle Detmars alsbald nach diesen Ereignissen, etwa zu Anfang des 14. Jahrhunderts, geschrieben ward.
Aber Detmar beschränkte sich bekanntlich nicht auf Lübische Quellen 1 ). Unter den andern, die er benutzt hat, war auch eine (wenn nicht mehrere) wendische Chronik. Aus dieser entnahm er vermuthlich die Nachricht, welche er zum Schlusse seiner Angaben über das Jahr 1271 bringt:
In deme sulven iare Cristi do untfing dat cruce de erlike her Hinric van Mekelenborch to thende over mer. He loch over unde wart ghevanghen; he wart gheantwordet deme soldan, de hell eme in der vengnisse XXVI iar.
Auf solche "Chronica Obotritorum" beruft sich geradezu Hermann Korner, der bis etwa 1438 geschrieben hat, und zwar zweimal, einmal, wo er des Fürsten Auszug 2 ), und hernach, wo er desselben Heimkehr berührt 3 ). Und wirklich hat er nicht Alles, was er giebt, aus Detmar's Chronik entnommen, namentlich nicht die Nachricht, daß der Fürst das Kreuz vom Bischof von Ratzeburg empfangen habe. Im


|
Seite 45 |




|
Uebrigen aber ist bekannt genug, wie wenig zuverlässig Corner in der Angabe seiner Quelle für jeden einzelnen Fall ist. Das Meiste, was er hier nach der wendischen Chronik giebt, ist ersichtlich aus Detmar's Chronik oder aus dessen Lübischer Quelle entnommen. Dazu kommen Flüchtigkeiten, wenn solche nicht zum Theil auf Rechnung des Abschreibers zu setzen sind; z. B. setzt er die Ausfahrt auf das Jahr 1273, die Heimkehr ins Jahr 1301, dort berechnet er die Dauer der Gefangenschaft auf 26, hier auf 28 Jahre, den Diener des Fürsten nennt er unrichtig Hermann statt Martin, die Verpflegung des Fürsten von Rom bis Lübek soll der Lübische Rathsschreiber getragen haben u. s. w.
Was man übrigens von Korner's "wendischer Chronik" und von seiner Benutzung derselben halten mag, gewiß ist, daß man früh, anscheinend zu Wismar, und zwar in dem Franciscaner=Kloster, welches zum Fürstenhause in nahen Beziehungen stand, Aufzeichnungen über die Pilgerfahrt Heinrichs gemacht hat. Namentlich schreiben wir denselben die drei Hauptdata zu, die, in abgeleiteten Quellen erhalten, durchaus unverdächtig sind. Doch davon hernach mehr.
Eine eigenthümliche Stelle nimmt endlich Ernst von Kirchberg ein, der einzige Schriftsteller des Mittelalters, der es versucht hat, eine einigermaßen zusammenhangende Erzählung von des Fürsten Fahrt nach dem Orient zu geben. Er hat anscheinend keine chronistische Aufzeichnungen benutzt; eben darum entbehrt aber sein Bericht auch der Nüchternheit, welche noch den seines Zeitgenossen Detmar auszeichnet. Gelegentlich beruft sich Kirchberg geradezu auf die umlaufende Sage 1 ); seine meisten Nachrichten aber kann man unbedenklich zurückführen auf jenen Berthold von Weimar, der, bis dahin Chorschüler zu Magdeburg, sich ebendaselbst 1298 dem auf der Heimkehr begriffenen Fürsten anschloß und hernach, wie Kirchberg 2 ) meldet, noch 40 Jahre im Kloster Doberan gelebt hat, also gegen das Jahr 1340 verstorben sein muß. Daß er an Kirchberg noch persönlich Mittheilungen gemacht hätte, deutet Letzterer nirgends an; dieser Schriftsteller, der erst 1378 seine Reimchronik zu schreiben anfing, war auch schwerlich schon 40 Jahre früher zu Doberan. Er hat also seine Nachrichten im besten Falle erst aus zweiter Hand, jedenfalls durch mündliche Ueberlieferung, erfahren. Ueberdies darf man auch zweifeln, ob Berthold von Weimar, der


|
Seite 46 |




|
nicht Augenzeuge der Erlebnisse im Orient gewesen war, die Erzählungen, welche er aus dem Munde des Fürsten selbst oder von dem fürstlichen Diener Martin Bleyer vernahm, bei dem Mangel an eigener Anschauung (und vielleicht auch an den erforderlichen geographischen Vorkenntnissen) allemal richtig verstanden, und ob er sie bis ins Alter treu behalten hat. Einer Prüfung des Kirchberg'schen Berichtes aber werden wir uns um so weniger entschlagen dürfen, da derselbe nicht nur die Kreuzfahrt Heinrichs, sondern zugleich die Genealogie des meklenburgischen Fürstenhauses betrifft. Uebrigens, wiewohl Kirchberg verhältnißmäßig ausführlich erzählt, bleibt doch auch dabei noch mancher Punct dunkel. Liest man die erwähnten Berichte aus dem Mittelalter allein, so begreift man kaum des Fürsten Thun und Schicksale, ja seine ganze Fahrt erscheint fast abenteuerlich. Und bezeichnend genug hebt in der Chronik Albrechts der Abschnitt über jene an mit den Worten: "By desen tyden scude och vele wonders in der werlde."
Versuchen wir also unsere einheimischen Aufzeichnungen durch einen Blick auf die Lage des Heiligen Landes zu der Zeit, da der meklenburgische Fürst den Orient aufsuchte, zu ergänzen und zu erläutern.
Im Allgemeinen war man in unsern Gegenden unterrichtet von den Bedrängnissen, in welchen die Christen Palästinas schwebten, seitdem Jerusalem, auf kurze Zeit durch Kaiser Friedrich II. noch einmal der Christenheit wiedergewonnen, durch die grausamen Chowaresmier für den Sultan Ejub von Aegypten wieder besetzt war, der erste Kreuzzug König Ludwigs IX. von Frankreich nach Aegypten einen unglücklichen Verlauf genommen hatte, und die Christen mehr und mehr auf die Seeküste und einzelne feste Plätze im Innern beschränkt waren. Denn, wie wir aus Testamenten 1 ) ersehen, wanderten einzelne Pilger auch aus unsern Gegenden immer noch nach dem Heiligen Lande, und dieser oder jener wird doch auch zurückgekehrt sein. Ueberdies sandten ja die Päpste ihre Boten in alle Lande aus, um unter Darlegung des obwaltenden Nothstandes zu Gaben für das Heilige Land und zu Kreuzfahrten dahin auffordern zu lassen. Endlich standen die Johanniter=Comthureien in


|
Seite 47 |




|
beständigem Verkehr mit den Leitern des Ordens und dadurch mit dem Haupthause desselben zu Akkon.
Nach einigen Jahren äußerer Ruhe, welche die morgenländischen Christen durch innere Streitigkeiten ausfüllten, begann für sie mit dem Jahre 1260 eine gar schwere Zeit. Die Ritterschaft des Königreichs Jerusalem erlitt eine furchtbare Niederlage von den von Norden her eindringenden Turkmannen 1 ), welche sehr schwer empfunden ward. Aber noch verhängnißvoller sollte es für sie werden, daß die Mongolen, aufgemuntert vom Könige von Armenien, über Bagdad, wo sie das Chalifat zerstörten, 1260 nach Syrien vordrangen, Haleb, Damaskus und viele andere Plätze einnahmen. Die Christen begrüßten dieses Ereigniß freilich Anfangs als ein höchst erfreuliches; denn gegen sie bezeigten sich diese grausamen Feinde der Muhammedaner, Dank der christlichen Gemahlin des Khans Hulaku, milde und freundlich. Schon verhöhnten jene leichtfertig hie und da die Saracenen. Aber bald entfremdeten sie sich auch die Mongolen und begünstigten den Zug des ägyptischen Sultans Kotuz, als dieser nach Syrien kam, um die Mongolenmacht zu vernichten. Dies gelang Kotuz noch in demselben Jahre durch zwei Siege; aber indem er nun das Sultanat Damaskus mit Aegypten vereinigte, umschloß eine muhammedanische Herrschaft fast ganz die christlichen Gebiete in Palästina; und was das bedeutete, sollten die Christen nur zu bald erfahren. Eben weil Kotuz diesen freundlich gesinnt war, aber auch, weil er den Ehrgeiz seines Mamlukenführers Bibars nicht befriedigte, ward er (wie bereits ein anderer Sultan vor ihm) von Bibars schon auf dem Rückmarsch nach Aegypten ermordet. Der Mörder ward jetzt Sultan; die Muhammedaner priesen ihn, den bewährten Krieger, als den "Vater der Eroberungen", sie rühmten seine Gerechtigkeit und seine unermüdliche Thätigkeit, sie sahen in ihm wegen seiner strengen Beobachtung ihrer Lehren und Gebräuche eine Säule des Islams; die Christen aber sollten bald seine Rohheit, seine Grausamkeit und seinen Fanatismus kennen lernen.
Bibars haßte und verachtete die syrischen Christen; er hat von ihnen gesagt, es hinge nicht von ihm ab, den Untergang der Franken zu hindern, weil sie selbst an ihrem Verderben arbeiteten, und der Kleinste unter ihnen zu zer=


|
Seite 48 |




|
stören pflege, was der Größte zu Stande gebracht habe 1 ). In der That fehlte es ihnen an aller Eintracht und an Verständniß ihrer Lage. Genueser und Venetianer führten auch dort ihre Fehden 2 ), Johanniter und Templer lebten nicht selten in Spannung, König Hugo von Cypern, der den auch noch bestrittenen Titel eines Königs von Jerusalem annahm, und der Titularpatriarch von Jerusalem fanden gar wenig Gehorsam. Ward ein Orden oder ein christlicher Fürst von dem Sultan angegriffen, so sahen die andern Christen wohl müssig zu, und Jeder schloß oder brach die Verträge auf eigene Hand. Es fehlte dem Feinde daher nie an einem Vorwande, sich auch seinerseits über die Verträge hinwegzusetzen, wenn es ihm so vortheithaft erschien; und einzelne Christen reizten ihn obenein noch dadurch, daß sie Einverständnisse mit den Mongolen unterhielten.
Sie erlitten unter solchen Verhältnissen die schwersten Verluste. Wegen Verbindungen des Fürsten Boemund mit den Mongolen ließ Bibars 1262 das Gebiet von Antiochia verwüsten. Er verbrannte wegen Verletzung des Waffenstillstandes durch die Ritterschaft zu Ptolomais 1263 die Marienkirche zu Nazareth und die Verklärungskirche auf dem Tabor, er verheerte das Land bis Tripolis und Akkon, ja er bedrohete Akkon selbst 3 ). Dann kam es zu einem Waffenstillstand; aber wieder verletzten Christen diesen, und wieder suchten andere Hülfe bei den Mongolen. Da kehrte der Sultan mit Heeresmacht nach Syrien zurück, zerstörte 1265 Cäsarea und ließ Arsuf von den eigenen Einwohnern der Stadt vernichten. 1266 gewann er die Templerfeste Safed (unweit Bethsaida) und ließ die tapfere Besatzung ermorden. 1268 nahm er auch Joppe ein und zerstörte unter unerhörten Grausamkeiten die Stadt Antiochia, so daß auch Boemund, damals in Tripolis, einen Waffenstillstand


|
Seite 49 |




|
eingehen mußte 1 ). Akkon und Tyrus 2 ) standen nunmehr als die letzten namhaften Seeplätze der christlichen Bevölkerung in Syrien da, und namentlich auf Akkon setzte sie alle ihre Hoffnung.
Auch dieses einzunehmen und die Christen vollends aus Palästina zu vertreiben, war der sehnlichste Wunsch des Sultans Bibars. In Jerusalem flehete er um Muhammeds Segen für seine Waffen; und er erregte nicht nur den Fanatismus seiner Emirs durch die reichlichste Befriedigung ihrer Beutegier, sondern auch den Fanatismus aller Moslim. Willig zahlten sie die "Gottessteuer", die der Sultan ihnen auferlegte, als er 1267 einen neuen Einbruch der Mongolen befürchtete, und schon 1265 hatte sich in Damaskus eine Gesellschaft zum Loskauf muhammedanischer Gefangenen von den Christen gebildet 3 ).
Papst Urban IV., der früher selbst Patriarch von Jerusalem gewesen war, und sein Nachfolger Clemens IV. ließen es nun freilich an Sorge für das Heilige Land nicht fehlen; sie trieben nicht nur Steuern zu dessen Hülfe ein, sondern sie suchten demselben auch Streiter zu erwecken. Aber Europa war gegen solche Mahnungen gleichgültiger geworden; zumal die Deutschen, die von je her im Eifer für die Kreuzzüge es den Romanen nicht gleich gethan hatten, schenkten ihnen wenig Gehör. Des Papstes Clemens Parteinahme für Karl von Anjou, den er nach Neapel gegen die Hohenstaufen gerufen hatte, mußte ihm die Herzen der Deutschen entfremden. Ueberdies war das Reich seit dem Tode König Konrads IV. in Auflösung begriffen; jeder Fürst handelte nach seinem persönlichen Interesse. Der Markgraf Otto von Brandenburg, der im Kampfe gegen die Preußen seinen religiösen Eifer bewiesen hatte, erregte im Papste Clemens die schönsten Hoffnungen; da aber dieser jenem eine zur Kreuzfahrt nach Palästina erbetene Unterstützung abschlug, kam es in Deutschland auch nicht einmal zu einer Rüstung. Wenn also kleinere deutsche Fürsten und Herren wegen eines Gelübdes oder aus dem Drange ihres Herzens den geängstigten syrischen Christen ihren Arm leihen wollten, so blieb es ihnen überlassen, auf eigene Hand, allein oder etwa mit einigen willigen Mannen und Genossen, über das Meer zu ziehen, wie es von Zeit zu Zeit französische Herren und deutsche Pilger thaten, oder


|
Seite 50 |




|
aber, wie englische Prinzen, Italiener und Niederländer zu thun gedachten, sich dem großen Kreuzheere anzuschließen, mit dessen Bildung die Könige von Frankreich, Navarra, Aragonien und Neapel schon, als Clemens 1268 starb, eifrig beschäftigt waren. Und wenn auch der päpstliche Stuhl in den nächsten Jahren unbesetzt blieb, so war doch Ludwig der Heilige nicht der Mann, den einmal Gott gelobten Kreuzzug darum aufzugeben; seine Begeisterung und seine und seiner Verbündeten Macht verhießen in der That den Christen einen endlichen großen Erfolg und flößten den Muhammedanern die größten Besorgnisse ein.
Ob nun aber wirklich der Fürst Heinrich von Meklenburg die Absicht gehegt hat, sich dem großen Kreuzzuge der verbündeten Könige von Frankreich, Navarra und Neapel anzuschließen, vermögen wir mit urkundlicher Sicherheit nicht zu bestimmen. Schon Korner hat, wie oben S. 44 erwähnt ist, des Fürsten Pilgerfahrt mit jenem großen Kreuzzuge in Verbindung gebracht; und wenn Heinrich einigermaßen von der Lage des Orients, von dem Kriegszustande, der noch zwischen den Ueberbleibseln des Königreichs Jerusalem und dessen Vasallen und dem Sultan von Aegypten obwaltete, unterrichtet war: so durfte er in der That gar nicht hoffen, Jerusalem als friedlicher Pilger zu erreichen. Wir wissen auch, daß er wenigstens seine Rittergürtel nicht daheim gelassen hat; im härenen Pilgergewande ist er also wohl nicht ausgezogen.
Es spricht auch nicht gegen Korners Auffassung, daß Heinrich erst im Sommer 1271 aufbrach, während die Könige schon im Jahre 1270 ausgezogen waren. Denn nach früheren Erfahrungen waren die Kreuzzüge in einem Jahre nicht zu vollenden; am wenigsten aber durfte man solches von diesem neuen erwarten. Denn, abgesehen von der Macht und der Thatkraft des Aegypters, ließ sich der König Ludwig von Frankreich durch seinen Bruder Karl von Neapel bereden, vorerst 1270 nach Tunis zu ziehen; erst wenn dieses bezwungen sei, wollte man den Orient erobern. Wie bekannt genug ist, starb aber Ludwig IX. vor Tunis am 25. August; zu Ende Octobers schlossen dann die Könige von Navarra und Neapel mit dem Herrscher von Tunis ihren Frieden, im November zog das Kreuzheer aus Afrika ab, zum größten Theil nach Sicilien. Während nun aber die Christenheit von hier den Aufbruch nach dem Morgenlande erwartete, faßten zu Trapani am 25. November die Könige Karl von Neapel und Philipp von Frankreich mit ihren Baronen den


|
Seite 51 |




|
Beschluß, den Kreuzzug nach Palästina auf volle 3 Jahre zu verschieben. Das große Heer zerstreuete sich hierauf. Nur 500 Friesen fuhren schon von Tunis aus im Herbste 1270 nach Akkon, und im nächsten Frühling ging von Sicilien aus der englische Kronprinz Eduard mit seinem tapferen Häuflein eben dorthin. Wie dieser, konnte immerhin auch der Fürst von Meklenburg, - sei es, daß er jenen beschlossenen Aufschub während der Winterzeit, wo Schnee und Kälte den Verkehr zwischen Italien und Deutschland über die Alpen hemmte, gar nicht mehr rechtzeitig und genau und vollständig erfuhr, um danach seinen Entschluß zu ändern, oder daß er in demselben eine Vereitelung des ganzen Unternehmens erkannte, aber die Ausführung seines einmal geleisteten Gelübdes darum nicht verschieben wollte, - mit einem kleinen Gefolge eine Fahrt nach dem Heiligen Lande auf sich nehmen, um an seinem Theile den bedrängten Christen daselbst die gelobte Hülfe zu bringen.
Denn wenn auch der Sultan Bibars sich, so lange ihn das große Kreuzheer bedrohete, ruhig verhalten hatte: so stand doch jetzt, nachdem jene Gefahr mindestens auf einige Jahre hinaus beseitigt war, zu vermuten, daß er wieder irgend einen Vorwand benutzen würde, um sein Vorhaben gegen Akkon auszuführen. Und war auch dieses gefallen und die christliche Ansiedelung in Syrien erst einmal ganz vernichtet, so durfte er eine abermalige Gründung eines christlichen Reiches in Palästina bei der ersichtlichen Abnahme der Begeisterung für die Kreuzzüge kaum noch fürchten. Es galt also, Akkon mit allen Kräften und in kürzester Frist beizuspringen, wollte man nicht das Heilige Land ganz in die Hände des Sultans gerathen lassen.
Recht kurz berichtet, wie wir oben gesehen haben, Detmar zum Jahre 1271, daß Herr Heinrich von Meklenburg das Kreuz empfing, um über das Meer zu ziehen. Viel ausführlichere Kunde giebt uns der gelehrte und fleißige M. Dietrich Schröder 1 ) zum Jahre 1271 aus einer seitdem verloren gegangenen handschriftlichen Chronik von Wismar. Nach dieser ist Heinrich am " 13. Julii" 1271 "mit vielen seiner Ritter und Edelleute, das Heilige Land und die darinnen bedrengte Christen wider die Saracenen verfechten zu helffen, ausgezogen,


|
Seite 52 |




|
nachdem er am gemeldetem Tage von Martino, des Wismarischen Franciscaner=Closters damahligem Guardiano, auf de[m] Franciscaner=Kirchhof mit dem H. Creutz bezeichnet und eingeseegnet, und daraus zu einem Feld=Obersten verordnet und bestätiget worden."
Fast mit denselben Worten hatte früher schon Steinmetz (Latomus) dieselbe Nachricht aus einer "Histor. Johannit." gebracht 1 ), nur daß er 1 ), durch Albert Krantz verleitet, irrig hinzufügt, Fürst Heinrich sei ausgezogen "auff Babst Gregorii 10., der damals die gantze Weld beherrschet, ausschreiben" - während Gregors Wahl doch erst am 1. Sept. 1271 geschah, als Heinrich Akkon schon ganz oder fast ganz erreicht hatte, und der Fürst dort den neu erwählten Papst vor dessen Abfahrt nach Italien noch antraf - und daß er als den Tag des Auszuges nicht den 13. Juli, sondern den 13. Juni angiebt. Der Schluß der Erzählung Schröders verräth nun freilich sogleich die sagenhafte Erweiterung einer späteren Zeit; aber wir dürfen darum doch kaum bezweifeln, daß der Kern derselben echt ist und der Hauptinhalt auf eine sehr alte, den Ereignissen beinahe gleichzeitige Aufzeichnung zurückgeht. Dafür bürgt die Nennung eines bestimmten Namens und eines bestimmten Datums. Leider wird uns von dem Jahre 1255 an, wo Bruder Dietrich Guardian der Franciscaner zu Wismar war 2 ), Auch den angegebenen Daten, mag man nun den 13. Juli oder den 13. Juni für einen Schreib= oder Druckfehler halten, steht keine urkundliche Nachricht entgegen; vielmehr sind die letzten uns erhaltenen Urkunden des Fürsten Heinrich vor seiner Wallfahrt im Jahre 1271, am 9. und am 12. Juni, und zwar zu Wismar, ausgestellt 3 ). Wir


|
Seite 53 |




|
stehen aber nicht an, den 13. Juni (nicht den 13. Juli) für das richtig überlieferte Datum zu erklären. Denn einmal konnte der Fürst, welchen Weg nach dem mittelländischen Meere er auch wählte, kaum noch hoffen, wenn er erst am 13. Juli aus Wismar zog, noch rechtzeitig einen Hafen am Mittelmeer zu erreichen, um mit dem großen Sommerzuge, der spätestens im August nach Akkon abging, dorthin überzufahren; zum andern gewinnt die Urkunde vom 12. Juni, in welcher Heinrich dem Kloster Sonnenkamp (Neukloster) das Eigenthum von 4 Hufen zum Besten des Siechenhauses schenkte, erst ihre rechte Deutung, wenn wir annehmen, daß der Fürst diese Schenkung Angesichts seiner großen und gefahrvollen Fahrt machte.
Zweifelhafter ist aber jene Stelle des Berichts, wonach der Fürst von vielen seiner Ritter und Knappen begleitet gewesen sein soll. Allerdings ist die landläufige Vorstellung, als ob Heinrich allein mit einem Diener (denstknecht, knappe), dem Martin Bleyer, der früher 1 ) als Grundbesitzer zu Wismar im Stadtbuche erscheint, und ohne alles ritterbürtige Gefolge auf die Pilgerfahrt gegangen sei, nicht nur gegen die Sitte jener Zeit, sondern Detmar berichtet auch ausdrücklich, daß dem Fürsten "de sine dar (zu Kairo) alle dot blewen ane en knecht, Mertine"; und ebenso hat auch nach den Lübischen Jahrbüchern Heinrich dort bis auf Martin seine ganze Gefolgschaft oder Dienerschaft verloren (perdita tota sua familia). Immerhin begünstigt aber dieser Ausdruck familia die Ansicht, daß die Zahl der Getreuen, welche dem Fürsten sich anschlossen, eine unerhebliche gewesen ist 2 ). Leider können wir von diesen
 geschicket
haben."
geschicket
haben."


|
Seite 54 |




|
keinen einzigen außer Bleyer namhaft machen; nicht einmal die Sage hat uns einen Namen aufbewahrt.
Ueber die Vorbereitungen, welche der Fürst Heinrich traf, um die Angelegenheiten seines Hauses und seines Landes für die Dauer seiner Pilgerfahrt zu regeln, sind wir hinlänglich unterrichtet 1 ). Die Regierung übertrug er seiner weisen und erprobten Gemahlin; tüchtige Räthe und Vögte, wie Heino von Stralendorf, Detwig von Oertzen, Ulrich von Blücher u. s. w., standen ihr zur Seite. Für alle schlimmen Fälle aber bestimmte er, nicht seine Brüder, denen er nach früheren Erfahrungen 2 ) wenig Vertrauen schenken mochte, auch nicht den bereits hochbetagten Oheim Nicolaus von Werle, sondern dessen beide Söhne, die Fürsten Heinrich und Johann, zu Vormündern seiner Gemahlin und seiner 3 Kinder 3 ), der Prinzessin Luitgard, die etwa 14 Jahre zählen mochte 4 ), und der beiden Söhne Heinrich, der kaum 4 Jahre alt war, und Johann, der höchstens erst im zweiten Lebensjahre stand 5 ).
Sowie nun aber der fürstliche Pilger von seinem Hause und von seinen Unterthanen Abschied nimmt, ist er auch unsern Blicken auf lange Zeit entschwunden. Seine Zeitgenossen wenigstens geben uns über den Weg, welchen er nach Palästina einschlug, auch nicht den leisesten Wink.
Anders freilich Kirchberg. Nach diesem 6 ) zog Heinrich aus
mit synen mannen rechte,
rittir vnd knechte,
- vnd quam gar schon
in dy stad zu Ackaron,
dy man Akers nennet
vnd hude noch wol irkennet,
mit geleyde vnd mit synnen
von Marsilien der konigynnen,
dy syns vatir swestir waz.


|
Seite 55 |




|
Die Beurtheilung dieser Angabe ist nicht eben leicht. Freilich die (auch an einer andern Stelle 1 ) von Kirchberg erzählte) Verwandtschaft des Fürsten Heinrich I. von Meklenburg mit der angeblichen Königin von Marsilien (Marseille) und deren Schwester, einer Königin von Cypern, gehört in das Gebiet genealogischer Fabeln; und es gab damals, als Heinrich nach Palästina zog, schon längst keine Herrscherfamilie mehr zu Marseille. Wie man sich aber auch die Entwickelung einer solchen Sage denken mag, wahrscheinlich ist sie daraus entsprungen oder dadurch begünstigt, daß der Fürst auf seiner Fahrt nach Akkon Marseille und Cypern berührt hat.


|
Seite 56 |




|
Schlug der Fürst den Landweg durch Deutschland ein, so lag ihm allerdings die Richtung auf Venedig am nächsten. Aber wir wissen ja nicht, ob ihn überall noch in der Heimath die Kunde von dem Aufschub des Kreuzzuges erreichte. Wußte er von demselben noch nichts, so war es ganz natürlich, daß er die wichtigste französische Hafenstadt am Mittelmeere aussuchte, um sich dort französischen Kreuzfahrern anzuschließen. Und selbst wenn er rechtzeitig von dem Aufgeben des Kreuzzuges unterrichtet war, konnte auch er immerhin, so gut die Friesen den Seeweg um Spanien herum einzuschlagen pflegten und sich ihrer Flotte 1218 Schiffe aus der Bremischen Kirchenprovinz anschlossen 1 ), etwa in Hamburg oder wohl leichter noch in Bremen ein hanseatisches Schiff besteigen und auf demselben entweder zunächst einen Hafen des südlichen Frankreichs am Atlantischen Ocean erreichen und Marseille dann auf dem Landwege aufsuchen, oder auch dasselbe Schiff direct bis Marseille 2 ) benutzen, um von dort auf einem Orientfahrer nach Akkon zu gelangen. Die Kaufleute und Schiffer von Marseille wetteiferten damals mit den Venetianern, Genuesen und Pisanern in Rechten und Freiheiten im Heiligen


|
Seite 57 |




|
Lande und in der Schifffahrt und im Handel nach Akkon, Cypern und Aegypten 1 ).
Cypern aber liefen die Schiffe auf dem Wege nach Akkon ohne Zweifel sehr häufig an. Gegen den Herbst des Jahres 1271 hatten sie dazu indessen um so mehr Grund, weil der Sultan Bibars, nachdem er schon im Juni dorthin eine Flotte von 11 oder 14 Galeeren ausgesandt hatte, und diese an den Klippen vor dem Hafen Limiso gescheitert, 3000 Saracenen 2 ) dabei theils vom Meere verschlungen, theils gefangen genommen waren, sofort daran ging, eine neue, viel stärkere Flotte gegen Cypern auszurüsten. Immerhin rieth die Vorsicht, in einem cyprischen Hafen Erkundigungen über etwa kreuzende ägyptische Galeeren einzuziehen.
Vor dem Herbst 1271 wird Heinrich von Meklenburg, welchen Weg er auch bis an das Mittelmeer eingeschlagen haben mag, Akkon nicht erreicht haben.
Die prachtvoll gebauete Stadt, deren Ausdehnung am Meere die Deutschen an die Lage von Köln erinnerte, ihre gewaltigen Mauern und Burgen machten auf jeden Ankömmling einen tiefen Eindruck; und die bunte und mannigfaltige Bevölkerung, welche in den Straßen wogte, die Zahl der fremden Fürsten und Herren, der Ordensritter und der Milizen, welche alle begierig schienen, sich mit den Moslim zu messen, konnten wohl einen Fremdling zuerst über die Lage der Christen in Syrien täuschen. Bald aber mußte Jedem klar werden, daß diese keineswegs erfreulich war.
Denn so lange der Sultan die Ankunft der abendländischen Könige in Syrien und einen gleichzeitigen Einfall der Mongolen 3 ) zu fürchten hatte, war er nur darauf bedacht gewesen, alle Vorbereitungen zu seiner Vertheidigung zu treffen. Die Mauern Jerusalems hatten die Saracenen freilich längst zerstört; der Sultan brach aber auch ein in der Nähe belegenes Kloster, damit sich auch dort die Christen nicht festsetzen möchten. Aber sowie jene Gefahr für ihn


|
Seite 58 |




|
verschwunden war, ging er sofort wieder zum Angriff über 1 ). Die Johanniter in ihrer "Kurdenburg" hatten ihm früher sehr zur Unzeit gedroht; im Frühling 1271 bezwang er dies Schloß. Dann gewährte er den Johannitern und den Templern einen Waffenstillstand, um Boemund von Tripolis für eine angebliche Verbindung mit den Mongolen zu züchtigen. Als er 2 Burgen eingenommen hatte, der Graf aber den Kampf auf Leben und Tod fortzusetzen drohete, ging Bibars auf einen verhältnißmäßig milden Waffenstillstand ein, um so mehr, da er von der Ankunft zahlreicher abendländischer Pilger hörte.
Wir meinen nicht die Friesen, von denen oben die Rede war; diese haben vielmehr das Heilige Land verlassen, ohne zum Kampfe mit den Ungläubigen zu kommen 2 ). Aber am 9. Mai 1271 traf der englische Kronprinz Eduard (I.) 3 ) mit seiner tapfern Schaar in Akkon ein; er führte 1000 auserlesene Männer, darunter 300 Ritter, nach dem Heiligen Lande. Indessen, wie willkommen den Rittern zu Akkon solche Hülfsmannschaft unter der Führung eines Prinzen von wildem Muthe und von unerschütterlicher Standhaftigkeit sein mußte, zumal in einem Augenblick, wo man den Sultan täglich vor den Thoren erwarten durfte: zu einem Vorgehen gegen den Feind fühlten sich die Christen darum doch nicht stark genug. Ja, sie konnten es nicht einmal verhindern, daß Bibars im Juni von Damaskus heranrückte und eine Burg des Deutschordens, Koraïn (Montfort), angriff und am 11. einnahm, hieraus selbst bis nach Akkon streifte und dann Koraïn zerstörte 4 ). Als darauf aber der Sultan, wegen des oben erwähnten gescheiterten Angriffs auf Cypern


|
Seite 59 |




|
nach Aegypten ging, um eine neue Flotte auszurüsten, brach Eduard mit seinen englischen und französischen Pilgern und mit andern Streitern, angeblich mit 7000 Mann, am 12. Juli aus Akkon nach St. Georg (Lydda) auf und zerstörte diese Feste; indessen verlor er auf dem Rückwege viele Leute, die in der glühenden Hitze ihren Durst durch übermäßigen Genuß von Honig und Früchten zu stillen suchten 1 ). Zu größeren Unternehmungen mußte man die Ankunft neuer Pilger mit dem alljährlich spätestens im August aus Europa abgehenden zweiten großen Zuge abwarten. Auch wurden bereits Verbindungen mit den Mongolen angeknüpft, um sie zu einem Einfall in Syrien zu bewegen.
Leider war die Zahl der im September anlangenden Pilger, unter denen wir uns also auch den Fürsten von Meklenburg denken, nicht so groß, als man gehofft hatte; es wird ausdrücklich erwähnt, es sei der englische Prinz Edmund "mit geringer Gesellschaft" in Akkon eingetroffen 2 ). Dennoch hatten, wenn wir der Angabe in einem Briefe des Sultans 3 ) Glauben schenken dürfen, die Christen "schon eiserne Leitern angefertigt und schickten sich an, sich auf Safad und eine andere Feste zu stürzen"; aber sein Erscheinen in der Nähe - er kam unerwartet am 19. Sept. in Damaskus an -, meint er, habe den Franken den Muth genommen.


|
Seite 60 |




|
Bibars entwickelte eine große Thätigkeit; er eilte nach Hamah, nach Hems, inspicirte das Kurdenschloß und die Feste Akkar im Gebiete von Tripolis, die er im Frühling gewonnen hatte, Truppen waren zu einem Zuge gegen Akkon schon bestimmt; er erwartete ohne Zweifel einen gleichzeitigen Einmarsch der Christen und der Mongolen. Wirklich fielen die Letzteren auch etwa den 20. October 1 ) in Syrien ein, in den Landschaften von Antiochia, Aleppo, Hamah u. s. w. richteten sie furchtbare Verwüstungen an; aus Damaskus flüchteten sich schon viele Einwohner. Erst als Bibars zu Ansang Novembers Hülfe aus Aegypten erlangte, trieben er und seine Feldherren die Mongolen zurück, welche beutebeladen abzogen.
Unbegreiflich ist es, daß erst jetzt die Christen in Akkon sich rührten. Sie hatten sich lange gerüstet. König Hugo von Cypern und Jerusalem war, sobald die Gefahr wegen einer Landung der Feinde aus Cypern ausgehört hatte, Akkon zu Hülfe geeilt, und Eduard von England wußte hernach auch die cyprische Ritterschaft, die sich lange geweigert hatte ihre Insel zu verlassen, dahin zu bestimmen, daß sie sich zahlreich in Akkon einfand 2 ). Die Templer, die Johanniter und die Deutschordensritter, sämmtliche anwesende Pilger - also vermuthlich auch der Fürst von Meklenburg und seine Begleiter - und die ganze Miliz zu Akkon schlossen sich dem Könige Hugo und den englischen Prinzen an; am 23. Novbr. verließen sie endlich die Stadt.
Indessen nahmen sie auch jetzt nicht die Richtung auf Damaskus oder dem Sultan entgegen, suchten sich auch nicht der muhammedanischen Festungen in der Nähe von Akkon zu bemächtigen, um gleichsam Außenwerke zu gewinnen, sondern sie zogen aus einem uns unbekannten Grunde gegen Süden, über Cäsarea hinaus, um die muhammedanische Feste Kakun 2 )., welche auf dem Wege nach Joppe lag und früher


|
Seite 61 |




|
einmal im Besitz der Templer gewesen war, zu erobern und zu brechen.
Aber leider nahm dieser Zug durch die Schuld der Oberanführer einen recht unrühmlichen Ausgang. Die Kreuzfahrer stießen nämlich bei Kakun auf ein großes Zeltlager von Turkmannen, die hier ruhig, die Ankunft des Heeres nicht ahnend, ihre Heerden weideten; sie überfielen diese Hirten, erschlugen ihrer etwa 1000 und erbeuteten von den Heerden 5000 Thiere. Diese große Beute machte die Christen aber lässig in ihrer Absicht auf die Festung. Nach einem Berichte von ihrer Seite hatten sie dieselbe nur schwach angegriffen und wären dann mit ihrer reichen Beute umgekehrt und mit geringem Verluste nach Akkon zurückgelangt 1 ). Nach Makrizi (p. 101) aber griffen sie die Saracenen in der Burg an, ein Emir ward getödtet, ein zweiter verwundet, und der Commandant Bedjka=Alai sah sich genöthigt, den Platz zu räumen. Sobald der Sultan davon Kenntniß erhielt, eilte er von Aleppo nach Damaskus, um dort Vorbereitungen zu einer Expedition nach Kakun zu treffen; er überschätzte diesen Angriff. Denn sowie der Emir Akusch=Schemsi sich den Christen mit Heeresmacht näherte, "ergriffen" (nach Makrizis Erzählung) "die Franken, welche Kakun besetzt hatten (occupaient), sofort die Flucht. Sie wurden von der Armee verfolgt, welche ihrer eine große Menge tödtete, eine Anzahl Turkmannen aus ihren Händen befreiete und eine große Zahl von Feinden niedermachte


|
Seite 62 |




|
(égorgea). Die Franken verloren, wie man sicher ermittelte (vérifia), bei dieser Gelegenheit 500 Pferde und Maulthiere."
Mögen diese Angaben Makrizis auch übertrieben sein, dieses ganze Unternehmen brachte den Christen großen Schaden. Daß der Sultan jetzt an der Spitze der Truppen aus Aegypten und Syrien zornig vor Akkon erschien 1 ), war noch der geringste Nachtheil; denn die Umgegend war längst eine Einöde, und Regengüsse nöthigten Bibars noch im December zum Abzuge nach Kairo. Schlimmer war es, daß des Sultans Mißachtung gegen die Christen hiedurch noch erheblich wuchs; er hielt sie fortan für feige. Als Gesandte König Karls von Sicilien und Neapel bei ihm in Kairo erschienen, um ihn zu einem Frieden mit König Hugo zu bewegen, bemerkte Bibars schnöde: "Da so viel Leute sich zu schwach gefühlt hätten ein einziges Haus (Kakun) zu nehmen, so sei es nicht wahrscheinlich, daß sie ein Land erobern möchten wie das Königreich Jerusalem 2 )."
Das Uebelste war jedoch, wenigstens für den Fürsten Heinrich von Meklenburg und für andere Pilger, welche das Heilige Grab zu besuchen gedachten, daß die muhammedanische Bevölkerung Syriens, die ohnehin durch den Einfall der Mongolen schon erbittert genug war, durch den ungeahnten Angriff auf friedliche Hirten aufs Aeußerste erzürnt ward. Man durfte fürchten, daß sie gegen friedlich dahin ziehende Pilger Vergeltung üben würden. Eine Wallfahrt von Akkon nach Jerusalem und den andern heiligen Stätten ward unter diesen Umständen ein höchst gefährliches Unternehmen.


|
Seite 63 |




|
Andererseits aber mußte es dem Fürsten Heinrich bald klar genug geworden sein, daß zu einem ruhmvollen Kampfe gegen die Ungläubigen zur Zeit gar keine Aussicht vorhanden, geschweige denn an einen Siegeseinzug in Jerusalem zu denken war. Wollte er sich also seines Gelübdes in Jerusalem entledigen, und nicht heimkehren, ohne das Heilige Grab besucht zu haben, so mochte es ihm am zweckmäßigsten erscheinen, dorthin noch im Winter zu wallfahren, bevor man den Sultan, dessen Geneigtheit zum Frieden noch recht zweifelhaft erschien, wieder mit Heeresmacht vor Akkon erwarten durfte.
so trat er denn, von den seinen begleitet, im Januar 1272 von Akkon aus die Fahrt nach der Heiligen Stadt an. Vielleicht, um nicht als Kämpfer, sondern als friedlicher Wallbruder zu erscheinen, ließ Heinrich seine Rittergürtel nebst einigen andern Werthsachen zu Akkon im Hause des Deutschen Ordens zurück.
Aber das schlimmste Loos sollte ihm zu Theil werden: er ward am Tage Pauli Bekehrung (am 25. Januar) von Muhammedanern gefangen genommen und dem Sultan zugeführt.
Ueber die Umstände, unter denen sich dies unglückliche Ereigniß vollzog, sind wir nicht näher unterrichtet; ja nicht einmal über den Ort, wo die Gefangennehmung geschah, sind unsere Quellen in Uebereinstimmung. Detmar und die Lübeker Jahrbücher nennen leider den Ort gar nicht; Kirchberg dagegen meldet, daß der Fürst mit seinem Diener Martin Bleyer die Grabeskirche zu Jerusalem besucht habe und dort nach der üblichen Darbringung eines Geschenkes beide von den Heiden gefangen genommen und an den Sultan überliefert seien. Er setzt hinzu:
dy andirn quamen von im alle
zu lande heym von sulchir walle;
wy sy von dannen quamen doch,
des kunde ich ny irfarin noch.
Und nur etwas bestimmter berichten die Franciscaner zu Wismar 1 ), der Fürst und seine Edelleute seien "alle gefangen worden van den Saracenen im tempel des hilligen graues am dage conversionis Pauly".


|
Seite 64 |




|
"De adel auerst des hern Hinrici", heißt es hier weiter, "wurden, wedderumb gefort in dat ehre vaderlandt, da se versamleten eynen schatt" (Schatz) "tho ehres hern verlosinge" (Auslösung). "Wen de here Hinricus wort myt eynem knechte, Martinus Bleyer genomet, in Babylonien gefort".
Aber wenngleich diese Uebereinstimmung zweier von einander unabhängiger Quellen auf den ersten Blick etwas Bestechendes hat, so erkennen wir in ihrer Angabe rücksichtlich des Ortes doch den Einfluß der Volkssage, welche es liebt die Erzählung dramatischer zu gestalten. Denn in der Chronik Albrechts, deren Bericht wir auf des Fürsten eigene Mittheilungen zurückführen zu müssen glauben, heißt es, Heinrich sei auf dem Wege zum Heiligen Grabe gefangen genommen ("over mere an pelegrimaze uppe deme weghe tho deme heylyghen grave").
In völliger Uebereinstimmung melden dann aber alle unsere Quellen weiter, daß der Fürst nach "Babylonien" (oder Kairo) abgeführt und dort in Gefangenschaft gehalten sei. Am genauesten ist auch hier wieder die Chronik Albrechts, wo es heißt, Heinrich sei gefangen gewesen "by Babelonie up eneme torne, de heet Kere."
Denn der alten römischen Militairstation Babylon entsprach etwa die muhammedanische Stadt Fostat am rechten Nilufer. Die Christen pflegten Letztere im 13. Jahrhundert noch Babylon zu nennen; für sie war dies der wichtigste Theil der ganzen "dreifach getheilten und dreieckigen Stadt", wie sie uns der oben mehrfach erwähnte Oliver in seiner Erzählung vom Kreuzzuge nach Damiette in den Jahren 1218-21 beschreibt. "Die Stadt Babylon selbst, am Nil erbauet, dehnt sich" (nach Oliver 1 ) "der Länge und der Breite nach aus, hat gerade Straßen und dichtgedrängte Wohnungen wegen der zahlreichen Bevölkerung. Die Christen haben dort mehrere Kirchen; sie sind sehr zahlreich (numerosa multitudo) und sind dem Landesfürsten dienstbar und tributpflichtig (sub tributo servientium). In dieser Stadt sind die Niederlagen der Kaufleute, welche aus Alemanien" (Armenien?), "Aethiopien, Libyen, Persien und andern Gegenden kommen. Beinahe eine Meile davon, in der Richtung auf Damiette, breitet sich Kairo mit weitläufigen Gebäuden und Straßen aus; es hat prachtvolle Wohnsitze, welche dem Adel des Landes und vor=


|
Seite 65 |




|
nehmeren Bürgern zum Aufenthalt dienen. Diese Stadt erreicht den Nil nicht, wie Babylon, sondern ein mit Schilfwurzeln besäeter Raum" (spatium junceis radicibus consitum) liegt dazwischen. Ferner erblickt man auf einer höheren Warte die aus großen Thürmen bestehende Feste des Sultans (castrum regale). Von der Burg aber zieht sich zu beiden Seiten eine Mauer herab, welche Kairo und Babylonien umschließt. Zwischen diesen drei Stadttheilen aber liegt ein großer sandiger platz, auf welchem ein zahlreiches Heer lagern kann."
Diese Beschreibung wird auch noch für die Zeit gelten, da, ein halbes Jahrhundert später, der meklenburgische Fürst als Gefangener nach Kairo gebracht ward. Er ward also in die bei den arabischen Schriftstellern schlechthin als "die Bergfeste" bezeichnete Citadelle geführt, welche der Sultan Saladin auf einem Abhange des Mokattam aufgeführt hatte, wo auch seine Nachfolger (wie in neuester Zeit die Vicekönige) residirten, und wo jetzt zahllose Reisende von der Terrasse neben der Moschee den entzückten Blick über die zu ihren Füßen ausgebreitete Stadt, die "Perle des Orients", und bis zu den "im Süden sich scharf am Horizont abhebenden Pyramiden" hinschweifen lassen. -
Der traurige Ausgang der Wallfahrt ließ es nun freilich um so mehr bedauern, daß Heinrich der Pilger Akkon so früh verlassen hatte; denn 3 Monate später hätte er seine Fahrt höchst wahrscheinlich ohne alle Gefahr vollenden können. Der Sultan brach wohl auf die Nachricht, daß sich die Mongolen wieder regten, schon am 4. März wieder aus Kairo nach Syrien auf; aber noch unterwegs erschienen bei ihm Gesandte aus Akkon und baten um einen Waffenstillstand 1 ). Wie entschieden auch der Prinz (jetzt König) Eduard


|
Seite 66 |




|
von England widersprach, knüpften die Einwohner und die Ritterorden zu Akkon, in der Ueberzeugung keinen genügenden Widerstand leisten zu können und in der Absicht den Untergang Akkons zu verhüten, solche Unterhandlungen an. Bibars sandte drei Beamte zu Friedensverhandlungen nach Akkon voraus; er selbst war bis in die Ebene von Cäsarea und in die Nähe von Akkon mit seinem Heere vorgerückt, als am Charfreitage (22. April) der Friede abgeschlossen ward, auf 10 Jahre 10 Monate 10 Tage und 10 Stunden. Der König Eduard blieb ausgeschlossen; der Vertrag beschränkte sich auf christlicher Seite auf den König Hugo von Jerusalem und Cypern und auf die Ebene von Akkon und den Weg nach Nazareth (mehr gestand der Sultan also dem "König von Jerusalem" von diesem ehemaligen Reiche nicht zu, und von Tripolis war nicht die Rede); hier blieben die Christen von Tribut frei. Uebrigens gestattete Bibars den Christen den ungestörten Besuch seiner Lande und insonderheit auch der heiligen Stätten; wir hören auch in den nächsten Jahren nichts von Gefangennehmung der Pilger. Im Gegentheil berichtet ein christlicher Schriftsteller: "Viele Christen, syrische und fremde, besuchten nun Bethlehem und Nazareth und andere Orte der Heiligen; aber zum Grabe des Herrn wallfahrten nur wenige, weil es bei Strafe des Bannes verboten war, damit nicht durch die Opfer, welche die Christen dort darzubringen pflegten, und durch verschiedene Zölle die Feinde des Kreuzes Christi bereichert würden und die Christen Einbuße erlitten 1 )".
Leider war bei dem Waffenstillstande von einer unentgeltlichen Freilassung gefangener Christen nicht die Rede; und


|
Seite 67 |




|
wahrscheinlich kannte man in Akkon noch nicht das unglückliche Loos des meklenburgischen Fürsten, und konnte man sich also schon aus diesem Grunde seiner bei den Friedensverhandlungen nicht annehmen.
Denn die spätere Nachricht, daß Heinrichs Begleiter - bis auf den einen Diener Bleyer - sofort frei gegeben seien, um für ihren Herrn ein Lösegeld zu beschaffen, verdient keinen Glauben. Ohne Zweifel ist richtiger, was die Lübeker Jahrbücher 1 ) andeuten und Detmar ausdrücklich berichtet, daß nämlich Heinrichs Begleiter mit ihm nach Kairo abgeführt wurden und dort nach und nach - mit Ausnahme jenes einen Dieners - verstorben sind. Daraus erklärt es sich auch, daß drei Jahre verfließen konnten, bevor man in Meklenburg sicher erfuhr 2 ), daß der Landesherr noch lebe, sich aber in der Haft der Muhammedaner befinde.
Zu Anfang des Jahres 1275 hatte seine Gemahlin endlich gewisse Kunde von dem Unglück ihres Gemahls. Am 20. Januar 1275 vereignete die Fürstin nämlich den Nonnen zu Neukloster das Dorf Arendsee; und sie bemerkt darüber in ihrem Schenkungsbriefe 3 ): "Dies haben wir deshalb gethan, damit Gott, der Herr von unaussprechlicher Barmherzigkeit, der wohl regiert und nichts übereilt, um der


|
Seite 68 |




|
kräftigen Fürbitte willen dieser Dienerinnen Christi und wegen anderer guter Werke, welche bei ihnen so zahlreich im Schwange sind, unsern geliebten Gemahl Herrn Heinrich von Meklenburg aus den Fesseln der Heiden, in denen er gefangen liegt, unversehrt errette und ihn uns und unsern Kindern und seinen andern Anverwandten, die in tiefer Trauer seiner Heimkehr harren, zu rechtem Troste zurücksende."
Warum aber wurden, so fragt man, von Meklenburg aus jetzt, wo man die Gewißheit hatte, daß der Landesherr nicht todt, sondern Gefangener war, keine Versuche gemacht ihn loszukaufen? Der Friedenszustand zwischen den syrischen Christen und dem Sultan von Aegypten währte bis 1280; es dürfte also doch unschwer der Ort, wo er gefangen lag, aufzufinden, und der Preis für die Freilassung durch die Vermittelung der Lübeker und der Orden nach Aegypten zu befördern gewesen sein.
Die Schuld trägt, so viel man sieht, zum großen Theil des Fürsten Heinrich Bruder, Fürst Johann (II.), der es übel empfand, daß sein Bruder ihn, den nächsten "Schwertmagen" und gebornen Vormund, bei seiner Bestimmung über die Vormundschaft, wie auf S. 54 erwähnt ist, übergangen hatte. Darf man Kirchbergs Erzählung Glauben schenken, so versuchte der Fürst Johann sogar, als seine Schwägerin Anastasia eines Tages mit ihren beiden kleinen Prinzen eine Fahrt nach Ratzeburg zu einem Besuche bei dem herzoglich sächsischen Hofe unternahm, bei Rehna sich gewaltsam seiner beiden Neffen zu bemächtigen, woran er jedoch durch die List der Frauen verhindert ward 1 ).
Die vom Fürsten Heinrich vor seinem Auszuge zu Vormündern eingesetzten beiden werleschen Vettern beriefen nun ihrerseits im Jahre 1275 2 ) die Gesammtheit der Mannen und Rathmänner aus dem Lande des Fürsten Heinrich zu dem ersten uns bekannten Landtage nach Wismar und traten


|
Seite 69 |




|
vor diesen ihr vormundschaftliches Amt an; die Wismarschen Burgmannen erklärten sich für sie. Sofort legten aber Fürst Johann und sein Bruder, der Propst Nicolaus, hiergegen Verwahrung ein, unter Berufung auf Fürsten und Herren. Johann wollte sich eher die Fortführung der Regierung in der bisherigen Weise (durch die Fürstin Anastasia) gefallen, als sein näheres Recht auf die Vormundschaft beeinträchtigen lassen. Da die Wismarschen Burgmannen ihn und seinen Bruder Nicolaus in die fürstliche Burg nicht einließen, beklagten sich die beiden Fürsten nicht nur bei ihrem Schwager, dem Grafen Gerhard von Holstein, und bei ihrem Neffen, dem Grafen Helmold von Schwerin, sondern Johann fiel auch mit einer bewaffneten Schaar ins Land ein und verbrannte die Höfe jener Burgmannen. Kaum gelang es dann dem greisen Fürsten Nicolaus von Werle, auf einem neuen Landtage zu Wismar (1275), einen allerseits (auch von den verwandten Fürsten) gebilligten Vergleich zu Stande zu bringen, wonach der Fürst Johann wirklich zum Vormunde der Fürstin Anastasia und ihrer Söhne und des Landes gewählt ward und mit seinem Bruder Nicolaus und der Fürstin unter dem Beistande von sechs erwählten Mannen (Regentschafts= oder Landräthen) die Regierung führen sollte 1 ).
Aber auch jetzt gelangte das Land nicht zu dauerndem Frieden. Der Fürst Johann leistete seinen werleschen Vettern, den vom Fürsten Heinrich hinterlassenen Weisungen folgend, Beistand in einer Fehde mit Brandenburg. Dafür fiel aber der Markgraf Otto im Bunde mit den Grafen von Schwerin und Holstein verheerend in die Herrschaft Meklenburg ein; und diese mußte, als es nach einem halben Jahre zum Frieden kam, noch Kriegskosten im Betrage von 500 Mark Silbers zahlen, die besser zur Befreiung des Landesherrn hätten verwandt werden können. Ja die Unzufriedenheit mit der Vormundschaft, die allerdings die zugeordneten Landräthe nicht immer heranzog 2 ), steigerte sich so, daß der Vogt zu


|
Seite 70 |




|
Gadebusch, Ulrich von Blücher, einer jener Regentschaftsräthe, ungeachtet die Fürsten Johann und Nicolaus ihre Verwaltung und Fortführung der Vormundschaft einem Spruche von Fürsten und Herren unterwerfen wollten, im Bunde mit dem Grafen (Helmold) von Schwerin und einem Theil der Ritterschaft die Herren von Werle wieder an die Spitze der Regierung zu bringen suchte. Diese besetzten (1277) Sternberg und Gadebusch, vertrieben den Fürsten Nicolaus aus Grevesmühlen, führten von der Burg Meklenburg aus offene Fehde mit der Regierung zu Wismar und zogen im nächsten Jahre auch noch den Markgrafen Otto von Brandenburg auf ihre Seite. Erst, nachdem es im Herbst 1278 dem Fürsten Johann gelungen war, von den Feinden 80 Mann, Ritter und Knappen, gefangen zu nehmen, vermittelten benachbarte Fürsten einen Frieden, wonach die Fürsten Johann und Nicolaus die Vormünder ihrer Neffen bleiben sollten, bis diese zu ihren Jahren gekommen sein würden 1 ).
Während das Land in jenen Fehden verwüstet ward, gelangte nun nach Wismar das Gerücht, der Landesherr sei in der Gefangenschaft gestorben; und wenn auch keine Bestätigung erfolgte, so mußte jenes doch auf den Eifer für das Werk seiner Befreiung lähmend einwirken. Auch scheint trotz des neuen Vertrages die Einigkeit im Regiment nicht groß gewesen zu sein; wir finden nämlich Urkunden aus den Jahren 1279 und 1280 2 ), in denen der Fürst Johann nicht einmal der Zustimmung seiner Schwägerin gedenkt, auch nicht der ihres ältesten Prinzen, der doch damals bereits zwölfjährig, also vermuthlich schon "zu seinen Jahren" gekommen war 3 ). Wie Anastasia und ihre Söhne sich schließlich dieses


|
Seite 71 |




|
Vormundes entledigt haben, verbirgt sich uns insofern, als aus den Jahren 1281 und 1282 und aus der ersten Hälfte des Jahres 1283 keine einzige Urkunde vorliegt, welche uns einen Einblick in die Regierung verstattete. Nach Kirchberg versuchte Fürst Johann (wohl 1282), freilich vergeblich, Grevesmühlen durch Ueberrumpelung in seine Hand zu bringen; und erst als die mit ihm verbündeten Thüringer, Meißener, Brandenburger, Lüneburger, Lauenburger und Holsteiner bei Grambow am 7. Mai 1283 von dem jungen Fürsten Heinrich unter dem Beistande der Städter aus Wismar und Rostock in die Flucht getrieben waren, sah sich Johann gezwungen, sich zur Ruhe zu begeben 1 ). Er saß fortan zu Gadebusch; schon in dem großen Landfrieden, welchen der Herzog von Sachsen=Lauenburg und die Fürsten, Vasallen und Städte der wendischen Ostseeländer am 13. Juni 1283 zu Rostock abschlossen 2 ), wird der Fürst Johann für sich, und seine beiden Neffen werden gleichfalls für sich ge=


|
Seite 72 |




|
nannt, und fortan 1 ) sehen wir die Fürstin Anastasia mit ihren beiden Söhnen als "domini Magnopolenses" gemeinsam regieren, wobei selbstverständlich Heinrich mehr und mehr an die Spitze trat. Seit dem Tode seines Bruders (1289) führte der Fürst Heinrich II. ganz allein das Regiment, und zwar, da keine gewisse Nachricht von dem Tode des Vaters eingetroffen war, unter dessen Siegel fort.
Uebrigens glaubte Heinrich allerdings im Jahre 1286 schon nicht mehr, daß der Vater noch am Leben sei; er bezeichnet ihn in einer Urkunde vom 26. Juli d. J. geradezu als einen Verstorbenen 2 ). Man hatte also lange keine Kunde mehr von ihm erhalten.
Eben so wenig wird auch dem Gefangenen eine Kunde aus der Heimath zugegangen sein. Denn wenngleich Kairo der Mittelpunkt der muhammedanischen Welt war, so ward doch der Verkehr mit dem Abendlande durch die ägyptischen Seestädte vermittelt; in die Citadelle von Kairo aber gelangte vollends kaum eine Nachricht aus dem Norden Europas.
Die Begleitung des Fürsten starb, wie erwähnt, nach und nach dahin, bis auf den einen treuen Diener Bleyer. Diesem ward, wie es scheint 3 ), eine freiere Bewegung ver=


|
Seite 73 |




|
gönnt. Er lernte in Kairo die dort blühende Kunst der Seidenweberei, und mit dem Ertrage seiner Thätigkeit unterstützte er seinen fürstlichen Herrn. Uebrigens war wohl auch Heinrichs Haft keine so strenge, daß er auf den Kerker beschränkt war; denn er ward allmählich unter den Muhammedanern eine sehr bekannte Persönlichkeit; "man sagte überall im Lande, daß er heilig wäre", berichtet uns die Chronik Albrechts. Entlassen ward er freilich ohne Lösegeld doch nicht.
Seiner Befreiung durch Loskauf wären aber, wie schon bemerkt ist, die politischen Verhältnisse im Orient lange Zeit hindurch günstig gewesen. Denn vorübergehende Reibungen abgerechnet, hielten die christlichen Gewalthaber, da ihnen nur schwache Unterstützungen und wenig streitbare Pilger aus dem Abendlande zugingen, und der Sultan, weil ihm die Mongolen zu schaffen machten (und vielleicht auch, weil er den angestrengten Bemühungen des Papstes Gregor X. um einen neuen Kreuzzug keinen Vorschub leisten wollte), den Frieden; über Akkon hätte man wohl des meklenburgischen Fürsten Freilassung erwirken können.
Als Bibars 1277 starb, folgte ihm zunächst sein Sohn Malek as Said Berkeh, ein unbesonnener Jüngling; aber nach zwei Jahren ward er von seinen Emirs in der Citadelle von Kairo belagert und abgesetzt, und wenige Monate später verdrängte den jüngeren Sohn des Bibars, einen Knaben, dessen Atabek, der kühne Emir Saifeddin Kalavun. Noch einmal schien den syrischen Christen die Gelegenheit sich zu erheben günstig. Sie verbanden sich mit den Mongolen. Diese fielen in Syrien ein, und in Damaskus hatte sich ein Gegner Kalavuns zum Sultan aufgeworfen. Aber Kalavun besiegte die Mongolen in einer bedeutenden Schlacht 1281. Da mußten die Christen froh sein, daß er mit ihnen die Verträge erneuerte.
Und doch konnten sie nicht Frieden halten! Die Johanniter reizten den Sultan und verloren dadurch 1285 die starke Feste Markab. Zornig nöthigte er den Fürsten Boemund, der weniger schuldig war, ihm die Seefeste Marakia zerstören zu helfen, und er fand 1287 einen Vorwand diesem sogar die stark befestigte Seestadt Laodicea zu nehmen. Immer deutlicher trat seine Absicht hervor, alle christlichen Plätze in Syrien, wie die Muhammedaner es wünschten, nach und nach in seine Gewalt zu bringen.
Unter solchen Umständen mußte allerdings dem Fürsten von Meklenburg auch die letzte Hoffnung auf Heimkehr


|
Seite 74 |




|
schwinden. Und doch war um diese Zeit seine Befreiung wahrscheinlicher als je vorher während der 15 Jahre seiner Gefangenschaft.
Nämlich 1287 erhielt seine Gemahlin, wir wissen nicht, auf welchem Wege, sichere Kunde davon, daß Heinrich am Leben und in Kairo sei. Sie und ihre beiden Söhne unterließen nun nichts um ihn zu befreien, und die Nachbarstadt Lübek und der Deutsche Orden Waren zu Diensten gern bereit. Am 10. Decbr. 1287 erschien die Fürstin Anastasia mit ihren beiden Söhnen Heinrich und Johann selbst zu Lübek; sie verpflichteten sich dort urkundlich, den Brüdern vom Deutschen Hause zu Akkon für allen Schaden zu stehen, den diese an 2000 Mark Silbers bis nach der Befreiung ihres Herrn und Vaters und bis zum Eingange dieser Summe in Mecheln erleiden könnten. Und drei Tage später bescheinigte die Stadt Lübek jene Summe empfangen zu haben, unter der Verpflichtung, solche auf Ostern 1288 an den Deutschordensmeister auszuzahlen 1 ).
Also bis Ostern 1288 hoffte man das Befreiungswerk vollführt zu sehen. Aber dies Jahr verstrich vergebens; auch 1289 erschien der Fürst nicht. Und im Spätherbste, während Anastasia noch den Tod ihres am 27. Mai 1289 auf einer Fahrt von Wismar nach Pöl ertrunkenen jüngeren Sohnes betrauerte, lief ein Brief aus Akkon zu Lübek ein, worin unter dem 14. August der Präceptor des Deutschordens, Wirich von Homberg, und das ganze Capitel des Hospitals zu Akkon den Rath der Stadt Lübek anwiesen, der Fürstin Anastasia und ihren Söhnen jene 2000 Mark Silbers zurückzahlen, "weil einstweilen leider keine Hoffnung vorhanden sei, daß der edle Herr Heinrich von Meklenburg aus den Fesseln der Saracenen freigekauft werde, bis es Gott in seiner Barmherzigkeit gefalle, andere Mittel und Wege zu seiner Befreiung zu eröffnen 2 ).
Bald hernach, als Mitte Decembers 1289 der junge Fürst Heinrich II. zu Erfurt den König Rudolf von Habsburg begrüßte, traf er hier, wohl auf Verabredung, den Hochmeister des Deutschordens, Burchard von Schwanden, und empfing von diesem (außer einer neuen Anweisung für die Stadt Lübek, jene 2000 Mark Silbers zurückzuzahlen) als theure Reliquien die Kostbarkeiten, welche der Vater bei dem Antritte der verhängnißvollen Pilgerfahrt zu Akkon im Ordens=


|
Seite 75 |




|
hause zurückgelassen hatte: eine goldene Spange,
2 Gürtel, 2 silberne Kannen und einen in 4
Theile zerlegten (silbernen) Becher
1
). Damals gab der
junge Fürst noch der Hoffnung Ausdruck, daß,
wenn Gott Gnade gäbe, sein Vater noch einmal
wieder aus den Fesseln der Saracenen befreiet
werden möchte. späterhin aber begegnen wir
ähnlichen Spuren von Hoffnung nicht mehr. In der
That nahmen auch die Angelegenheiten der
syrischen Christen bald einen Verlauf, der dem
Fürsten jede Aussicht auf die Rückkehr seines
Vaters raubte.
Wirich von Homberg hatte den
oben erwähnten Brief zu Akkon unter dem
schmerzlichen Eindruck geschrieben, den Kalavuns
letzter Zug nach Syrien hinterlassen mußte.
Längst war nämlich dessen Auge auf die schöne
und feste Stadt Tripolis gerichtet gewesen, im
Frühling 1289 aber lockte ihn ein ungetreuer
Diener der Fürstin Lucia selbst herbei. Wiewohl
die Christen dieses Mal in richtiger Würdigung
der Gefahr einig waren und alle treuen Beistand
leisteten, fiel doch nach tapferster
Vertheidigung Tripolis am 27. April 1289; es
ward von dem Sultan geplündert und dem Erdboden
gleich gemacht
2
). - In diesem Ereigniß
ahnten nun Viele nur ein Vorspiel dessen, was
Akkon zu erwarten hatte. Schon wanderten fortan
manche Christen von hier nach Europa aus; aber
nur sehr wenig neue Verteidiger fanden sich in
der bedroheten Stadt ein. Dazu kam, daß die
Machthaber dort bald wieder uneins wurden und
auch nicht die durch die Verhältnisse gebotene
Klugheit bewiesen. Als der Sultan für vielleicht
von Saracenen provocirte Friedens=
Da (zu Akkon) liez her alle syne ubirmaz
dy her hatte von gelde,
czwey tusint guldene ich melde,
by eyme creditor zumal,
dem in dy konigynne beual.
Daz gelt liez holen sidder
syn son, her Hinrich, widder
vnd virczerte ys uf der vart
zu Erforte, da her rittir wart,
by czid des Romischen koniges da,
den man Rudolf nante ja.
- Die Quittungen, welche Heinrich II. am 20. Jan. und Anastasia am 1. Febr. 1290 der Stadt Lübek über die Rückzahlung jener 2000 Mark Silbers ausstellten, s. M. U.=B. Nr. 2057 und 2059.[Absatzende]


|
Seite 76 |




|
Verletzungen Einzelner Genugthuung forderte, schlug man ihm dieselbe ab. Da brach er im October 1290 zur Zerstörung der unglücklichen Stadt aus Kairo aus. Ihn selbst ereilte nun freilich der Tod, noch bevor er die Grenze Aegyptens überschritt; aber sein bereits zu seinem Nachfolger bestimmter Sohn Aschraf, ein Mann von wilder Gemüthsart, brannte vor Begier, des Vaters Plan auszuführen, er wies alle Friedensunterhandlungen zurück. Wohl vertheidigten die Christen in der letzten, höchsten Gefahr Akkon aufs Mannhafteste; aber den gewaltigen Anstrengungen der Muhammedaner konnten sie auf die Dauer nicht widerstehen: nach etwa 6 Wochen ward am 18. Mai 1291 die Stadt des Sultans Beute, und nach 3 Tagen mußten auch die letzten Helden, die sich in eine Burg geworfen hatten, capituliren. Sie wurden, wie die meisten Männer, welche gefangen waren, niedergehauen (70000, nach Andern sogar 105000 Christen fanden in Akkon ihren Tod), die Weiber, die nicht entkommen waren, wurden zu Sklavinnen gemacht, die herrliche Stadt in einen Aschenhaufen verwandelt. Die Christen verließen gleichzeitig Tyrus, bald auch Sidon; ein Emir zerstörte Beirut; aus der Burg Atslits, dem Pilgerschloß und Tortosa entflohen die Christen. Ihre Ansiedelungen in Syrien hatten damit ein Ende.
Nun hörte man, seitdem der Verkehr des Abendlandes mit Syrien abgebrochen war, in Meklenburg nichts mehr von dem gefangenen Landesherrn. Zweimal erfuhr man schreckliche Täuschungen 1 ). Es erschienen nämlich nach einander zwei Betrüger, die sich für den Fürsten Heinrich den Pilger ausgaben. Des Fürsten alte Räthe Detwig von Oertzen und Heinrich von Stralendorf prüften und entlarvten sie jedoch; der eine ward in der Stepenitz bei der Börzower Mühle ersäuft, der andere zu Sternberg verbrannt. Auf die Heimkehr des echten Pilgers rechnete man, seitdem bereits mehr als 20 Jahre verflossen waren, nicht mehr; Heinrich II. führte noch immer des Vaters Siegel und bewies sich dadurch immer noch als dessen Stellvertreter in der Regierung, aber er bezeichnet ihn in einer Urkunde vom 20. Januar 1298 als verstorben 2 ).


|
Seite 77 |




|
Und doch hatte Gott den unglücklichen Pilger nicht nur erhalten; sondern am 20. Januar 1298 war Heinrich auch bereits in Freiheit gesetzt und aus der Heimkehr ins Vaterland begriffen.
Jedoch nicht Aschraf, dem Zerstörer von Akkon, der die Zahl der Gefangenen noch erheblich mehrte, hatte der meklenburgische Fürst seine Freilassung zu verdanken. Wie Heinrich schon bis dahin in der "Bergfeste" bei Kairo manchen Wechsel im Regimente des Saracenenreiches gesehen hatte, so erfuhr er solche dort auch noch mehrere; er hat in Aegypten noch schreckliche Ereignisse erlebt. Verachtung muhammedanischer Satzungen, unnatürliche Wollust und grausame Behandlung einiger Emirs, welche sich Aschraf zu Schulden kommen ließ, machten es seinem ehrgeizigen höchsten Beamten, dem Emir Baïdara, leicht, eine Verschwörung gegen des Sultans Leben mit mehreren Emirs anzuzetteln; sie ermordeten ihn auf der Jagd im Decbr. 1293. Baïdara und die meisten Mörder traf alsbald die Strafe, sie wurden niedergemacht; Aschrafs Bruder Nâser=Mohamed, noch ein Knabe, ward von den Emirs auf den Thron gesetzt, der Emir Ketboga führte die Regierung. Letzterer aber ließ seine Nebenbuhler ermorden, setzte sich im December 1294 selbst auf den Thron in der "Bergfeste" und sperrte den abgesetzten jungen Sultan daselbst in ein Gefängniß. Die Regierungszeit Ketbogas (Melik=Adel nannte er sich) war aber eine höchst traurige; Aegypten und Syrien wurden zwei Jahre lang von einer furchtbaren Theurung und Hungersnoth heimgesucht; in Kairo überstieg das Elend und die Sterblichkeit alle Vorstellung. (Damals mögen die Ersparnisse Martin Bleyers seinem fürstlichen Herrn sehr zu Statten gekommen sein.) Uebrigens entzweite sich auch Ketboga mit den Emirs; diese bildeten, während er mit seiner Armee auf dem Wege von Damaskus nach Kairo begriffen war, eine Verschwörung gegen ihn. Nur mit Mühe entkam der Sultan aus seinem Zelte nach Damaskus; sein erster Reichsbeamter, Ladjin, ward, nachdem er den Emirs hatte schwören müssen nicht zu ihrem Nachtheil seine Mamluken zu begünstigen, vom Heer als Sultan (Melik=Mansur) anerkannt (Novbr. 1296). An der Seite des Kalifen zog der neue Herrscher in Kairo ein, und an demselben Tage fielen zur Freude der Bevölkerung die Preise der Nahrungsmittel um die Hälfte; die rückständigen Steuern des ganzen Reiches hatte er schon erlassen. Auch Damaskus erkannte Melik=Mansur an; Ketboga mußte sich ergeben. Da er Treue gelobte, verschonte


|
Seite 78 |




|
ihn Lagdin und Schenkte ihm ein Bergschloß; auch manche gefangene Emirs und Mamluken wurden in Freiheit gesetzt 1 ).
Ladjin war von Kalavun zum Emir erhoben; unter Aschraf war er Anfangs Statthalter zu Damaskus gewesen, aber während der Belagerung von Akkon in Folge von Angeberei unschuldiger Weise vom Sultan verhaftet, hernach freigelassen, späterhin aber, weil sein Schwiegervater in Ungnade fiel, abermals verhaftet und, nachdem dieser getödtet war, strangulirt. Da aber die Bogensehne, mit der die Erdrosselung vollzogen ward, gerissen war, hatte ihn Aschraf auf Fürbitte anderer Emirs begnadigt, weil er hoffte, Ladjin würde an den Folgen der Erdrosselung sterben 2 ). Hernach hatte Ladjin an der Ermordung Aschrafs persönlich Antheil genommen, und dieser Mord peinigte fortan sein Gewissen; er erwartete, daß Mord durch Mord gesühnt werde 3 ). Und wiewohl er eine durch Milde und Gerechtigkeit ausgezeichnete Regierung führte, auch den abgesetzten Sultan Nâser=Muhammed aus der Gefangenschaft auf das Schloß Krak sandte und demselben schwur, ihm, wenn er zu seinen Jahren gekommen sein würde, die Regierung zu übergeben und sich bis dahin nur als dessen Reichsverweser zu betrachten 4 ): ist jene Befürchtung doch eingetroffen. Der Hochmuth seines übrigens thätigen und uneigennützigen ersten Reichsbeamten Mankutimur, dem der Sultan nur allzu viel Gewalt einräumte, erzeugte eine Verschwörung, welcher beide im Jahre 1299 zum Opfer fielen 5 ).
Dieser Sultan Mansur=Ladjin ist es also, unter dessen Regierung der Fürst Heinrich von Meklenburg seine Freiheit wieder gewann; und alle ältesten Berichte stimmen darin überein, daß er sie dem Sultan selbst verdankte 6 ).


|
Seite 79 |




|
Ueber die Veranlassung aber giebt nur Kirchberg einen Bericht, und zwar (Cap. 134) ausdrücklich unter Berufung auf die umlaufende Sage.
Nach dieser meklenburgischen Sage war Ladjin ein Renegat und offenbarte sich als solcher dem Fürsten Heinrich, als er am Abend vor Weihnachten (1297) zu demselben in den Kerker trat und ihn fragte, ob er ihn zu Ehren seines Schöpfers an dessen Geburtstag in Freiheit setzen solle. Heinrich lehnte Anfangs solches Geschenk ab, weil er daheim die Seinen doch wohl nicht mehr am Leben und sein Land in fremden Händen finden würde. Der Sultan aber flößte seinem Gefangenen Muth ein, indem er ihm mittheilte, er habe gehört, daß seine Gemahlin noch lebe und sein Sohn regiere. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit gab sich darauf Ladjin zu erkennen als ein vormaliger Diener des Fürsten Johann von Meklenburg; noch jung sei er zu Riga dessen Geschützmeister 1 ) gewesen und habe dort auch seinen jetzigen Gefangenen selbst gesehen. Später - so erzählte er weiter - sei er "zu dem keisyr von Tartarye" gezogen, habe sich in dessen Dienst "lange czid" aufgehalten und allmählich emporgeschwungen, und sei nun zuletzt Sultan von Aegypten geworden. Jetzt bat ihn der Gefangene, ihn mit seinem Diener nach Akkon zu entlassen, wo er Kaufleute zu finden hoffe, die sie in ihre Heimath mitnehmen möchten. Am Weihnachtstage ward Heinrich mit reichen Gaben in Gesellschaft Martin Bleyers nach Akkon entsandt.
So die Sage. Der Schluß ist aber ersichtlich unhistorisch; denn Akkon lag ja in Trümmern. Wohl hielten dort 60 bis 80 Söldner Wache, welche gegen deutsche Pilger, die dahin kamen und an ihrem Gange erkannt wurden, sich freundlich betrugen, ihnen sicheres Geleite gaben und mit denselben trotz des Verbotes im Koran Wein tranken 2 ); aber Heinrich konnte dort doch keinen Schuldner mehr finden, bei dem er vor 27 Jahren Geld niedergelegt hatte, und der, wie Kirchberg weiter meldet, sich dessen nicht mehr entsann, aber den Fürsten nun doch gastlich ausnahm und ihm ein Schiff ausrüstete. Wir können auch sofort in das Gebiet der Erfindung verweisen, was die Sage weiter meldet, daß nämlich Heinrich auf dem Meere abermals von Saracenen gefangen genommen und dem Sultan wieder zugeführt, von diesem


|
Seite 80 |




|
aber zum zweiten Male reichlich beschenkt entlassen sei und dann unterwegs seine Tanten, die Königinnen von Cypern und Marsilien, besucht habe.
Indessen, so unglaublich die ganze Sage klingt, dürfen wir uns, da sagen meistens einen historischen Kern bergen, einer Prüfung ihres Inhaltes und der Frage nach ihrer Entstehung nicht entziehen.
Glücklicher Weise hat uns Kirchbergs jüngerer Zeitgenosse, der von uns oft angezogene ägyptische Geschichtschreiber Makrizi (geb. 1364 zu Kairo) 1 ) aus dem Schatze seiner sehr umfänglichen biographischen Forschungen auch genügende Personalien über den Sultan Ladjin mitgetheilt, welche uns in den Stand setzen, jene ganze Sage zu widerlegen.
Ladjin zählte bei seiner Ermordung im J. 1299 erst etwa 50 Jahre 2 ), er ist also um 1249 geboren; und er war schon Mamluk in Aegypten in einem Alter von etwa 10 Jahren. Denn als 1259 der Sultan Melik=Mansur (Sohn des Melik=Moezz=Aïbek) abgesetzt und mit seinem Bruder und seiner Mutter von dem neuen Sultan Kotuz in das griechische Kaiserthum verbannt war, ward unter andern seiner zurückgebliebenen Mamluken der "kleine Ladjin" an den Emir Kalavun verkauft. Der neue Herr gewann "den Kleinen" (assaghir) oder den "Rothkopf" (schukaïr, er hatte röthliches Haar und blaue Augen) lieb, machte ihn Anfangs zu seinem Pagen und ließ ihn in seinem Dienste aufsteigen; und als Kalavun hernach (1277) Sultan geworden war, erhob er Ladjin, wie bereits erzählt ist, zum Emir und zum Gouverneur (naïb) von Damaskus 3 ). Die weiteren Schicksale Ladjins sind schon oben kurz erwähnt. Daß er ein heimlicher Christ gewesen sei oder den Islam vernachlässigt habe, wirft ihm nicht einmal sein entschiedener Gegner Abulfeda vor. In seiner Jugend war er dem Weine ergeben gewesen; später verabscheute er Wein und Spiel, lebte äußerst mäßig, fastete und betete, wie es der Koran vorschreibt, und fand in reichen Spenden von Almosen seine Freude; Gerechtigkeit und Billigkeit erwarben ihm allgemeine Liebe 4 ). Als er nach der oben erwähnten Strangulirung in einer verfallenen Moschee (von


|
Seite 81 |




|
Tulun) eine Zuflucht gefunden hatte, gelobte er, sie, wenn er am Leben bliebe, dereinst wieder aufzubauen, und er hat als Sultan das Gelübde erfüllt. Er gründete daneben eine große Akademie, welche fast ausschließlich der Auslegung des Korans und der Traditionen des Propheten, sowie des muhammedanischen Rechts für alle vier orthodoxen Secten dienen sollte, und eine Freischule, wo Waisen den Koran lesen lernten 1 ). Von einer geheimen Hinneigung Ladjins zum Christenthum wissen aber die arabischen Schriftsteller leider nichts.
Entsprang denn jene Sage, welche uns Kirchberg aufgezeichnet hat, aus einer dunklen Kunde von der Milde des Sultans Ladjin? Vielleicht dürften wir aus seinem Charakter, aus seiner Milde und seiner Zuneigung zu tugendhaften Menschen, welche ihm besonders nachgerühmt wird 2 ), ohne Weiteres uns den Gnadenact gegen einen gefangenen Fürsten, den man in Aegypten für einen Heiligen ansah, und von dem auch längst kein Lösegeld mehr zu erwarten war, hinlänglich erklären. Eine Veranlassung dazu war leicht gefunden; wahrscheinlich aber war es folgende.
Der Sultan Mansur=Ladjin verletzte sich im Herbste 1297 schwer die Hand, und mußte daher zwei Monate lang in seinem Palaste verweilen. Als er dann am 21. Tage des Monats Safar (= 7. Decbr.) zum ersten Male aus der Burg auf den Meïdan hinabritt, fand er Kairo und Misr (Fostat) prächtig geschmückt, Häuser und Läden wurden an Schauluftige theuer vermiethet: so groß war die Freude über die Genesung des überaus beliebten Herrschers. "Bei seiner Rückkehr vom Meïdan," erzählt Makrizi, "bekleidete dieser Fürst die Emirs mit Ehrengewändern, theilte Almosen an die Armen aus und setzte mehrere Gefangene in Freiheit 3 )."
Dieser Erzählung des ägyptischen Geschichtschreibers glauben wir eine große Wichtigkeit für unser Thema beilegen zu müssen. Denn wenngleich Makrizi leider die Gefangenen, welche der Sultan mit der Freiheit beschenkte, nicht namhaft macht, so wagen wir doch die Vermuthung, daß sich unter ihnen der, wie wir wissen, in Kairo und weiter wohl bekannte und für heilig gehaltene Fürst von Meklenburg


|
Seite 82 |




|
befand. Immerhin stimmt die Zeit sehr gut. Die Vorbereitungen zur Reise konnten einige Wochen in Anspruch nehmen, die Abreise von Kairo Weihnachten erfolgen; damit möchte auch die Einmischung dieses Festes in die Sage ihre Erklärung finden.
Allem Ansehen nach hatte der Sultan zu solchem Gnadenacte aber auch noch einen besonderen Beweggrund, den uns eine gelegentliche Aeußerung in der Chronik Albrechts von Bardewik enthüllt.
In dieser wird nämlich zunächst nur die Freilassung mit kurzen Worten berichtet: "Der Sultan gab ihn ledig und los der Gefangenschaft von wegen seiner Trefflichkeit (ghode); denn man sagte im ganzen Lande, daß er (Fürst Heinrich) heilig wäre. Und der Sultan gab ihm auch seinen Knappen wieder, der mit ihm über See gefangen genommen ward, der heißt Martin Bleyer. Der Sultan über See ließ dem Herrn von Meklenburg Guts genug geben." - Hernach aber erfahren wir, daß der Sultan dem Fürsten eine - leider nicht näher bestimmte - Botschaft an den Papst auftrug; und eben hierin ist vielleicht das vornehmste Motiv Ladjins bei der Freilassung seines Gefangenen zu suchen.
Möglicher Weise entsprang aber auch aus der dunklen Kunde von der Botschaft des Sultans an den Papst und an die Ueberlieferung, daß die Reliquie vom Heil. Kreuz, welche der Fürst mit heimgebracht haben soll, ein Geschenk des Sultans gewesen sei, die ganze Sage von Ladjins heimlichem Christenthum, die dann bis auf Kirchbergs Zeit eine sehr ausgebildete Gestalt gewonnen hatte, hernach aber noch dahin erweitert ist, daß der Sultan "eines Müllers Sohn aus Gadebusch" gewesen sei, was selbst David Franck "so gar unglaublich nicht" fand, obwohl er sich im Gegensatz zu Latomus mehr zu Krantzens Meinung von heimliche Flucht hinneigte 1 ). -
Begleiten wir jetzt den Fürsten Heinrich auf seiner Heimfahrt nach etwa 26 und einem halben Jahre, von denen er fast volle 26 Jahre in der Gefangenschaft verlebt hatte!
"De soldan van over mere," so berichtet uns die Chronik des Kanzlers Albrecht, "de leyt gheven deme heren "van Mekelenborch rede ghut. Darmede quam he by "dessyt des meres an de prinsinnen van der Moreyen.


|
Seite 83 |




|
De leyt eme gheuen somere" (Saumthiere) "unde andere perde, dartho twe bunter cleidere und rede ghut an groten Tornoysen tho pantquerttinghe" (zum Reisebedarf); aldus untfench de prinsinne den edelen man an groter werdicheyt unde myt innygher leve. Darna karde he van dennen und nam orlof van der prinsinnen, unde he quam tho Rome."
Also nicht gerades Weges fuhr der Fürst aus einem ägyptischen Hafen nach Italien, sondern zunächst nach Morea, wo die an der Südküste belegenen venetianischen Seestädte Modon und Korone den Handel nach Aegypten vermittelten. Die Herrschaft über einen großen Theil von Morea aber führte damals, wie wir schon oben S. 55 f. erwähnten, die Erbtochter des Fürsten Wilhelm von Villehardouin, Fürstin Isabelle von Achaja, damals eben Wittwe des Florenz d'Avesnes von Hennegau, die mit ihrer einzigen Tochter, Mathilde von Hennegau, zu Andravida Hof hielt; diese also war die "Prinsinne van der Moreyen", die dem Pilger eine so freundliche Aufnahme und Unterstützung gewährte. Andravida lag Zakynthos gegenüber an der Westküste von Morea, die Ueberfahrt nach einem neapolitanischen Hafen am Ionischen Meere war von dort aus leicht auszuführen. Ob man nun aber aus Kirchbergs verwirrtem Berichte (S. 79 f.) dann weiter entnehmen darf, daß Heinrich der Pilger auf dem Wege nach Rom die damals längst verwittwete Königin Margarete von Neapel noch aufsuchte, das lassen wir dahin gestellt sein.
In Rom gelangte er, wie wir von Detmar und Albrecht hernehmen, mit seinem Diener am Freitage vor Pfingsten (am 23. Mai 1298) an. Dort traf er den Lübeker Stadtschreiber Alexander Hüne, der sich eben in Geschäften seiner Vaterstadt daselbst aufhielt; und von diesem konnte er nun endlich gewisse und ausführliche Kunde über die Schicksale seines fürstlichen Hauses und den Zustand seines Landes erfahren. Wie gespannt mag er auf dessen Mittheilungen gelauscht haben!
Da gab es dann freilich manch betrübendes Ereigniß zu erzählen. Des Fürsten einzige Tochter Liutgard war wenige Jahre nach seiner Abfahrt aus der Heimath mit dem Herzog Przemislav von Gnesen vermählt, aber neun Jahre hernach von ihrem Gemahl einer Buhlerin halber ums Leben gebracht; Heinrichs jüngerer Sohn, Johann III., war 1289 aus einer Fahrt von Wismar nach Pöl ertrunken; Heinrichs Brüder, die beiden Geistlichen Nicolaus und


|
Seite 84 |




|
Hermann, sowie seine Schwester, die Gräfin Elisabeth von Holstein, waren gestorben; auch seine Oheime Nicolaus von Werle und Burwin von Rostock, sowie des Letzteren Söhne waren gleich manchen andern Verwandten längst heimgegangen; sein Vetter Heinrich von Werle, dem er einst die Vormundschaft mit zugedacht hatte, war sogar von seinen Söhnen ermordet! Mancher Krieg hatte das Land durchtobt. Aber des Fürsten Gemahlin Anastasia war noch am Leben; ihr Sohn Heinrich II. führte das Regiment mit kräftiger Hand und lebte seit 6 Jahren in einer glücklichen (wenngleich mit keinem Sohne gesegneten) Ehe mit Beatrix von Brandenburg.
Durch Hünes Beihülfe gelang es auch dem Pilger, schon am ersten Pfingsttage (25. Mai) eine Audienz beim Papste Bonifacius VIII. zu erlangen. Der Papst empfing ihn sehr herzlich, hörte seine Botschaft vom Sultan Ladjin mit Aufmerksamkeit an, verkündete dem frommen Dulder die Vergebung seiner Sünden und entließ ihn mit seinem apostolischen Segen.
Von Rom aus schlug der Fürst von Meklenburg den Landweg über die Alpen nach Deutschland ein; ohne Zweifel ging er über den Brenner durch Baiern, Franken und Thüringen. Denn er besuchte hier (nach Kirchberg) seine mütterlichen Verwandten, die Grafen von Henneberg. Sein weiterer Weg führte ihn nach Magdeburg, wo der Rath ihn gastlich aufnahm. Wollte er von hier aus auf der kürzesten Straße in seine Heimath, nach Wismar, zurück kehren, so hatte er sich nach Dömitz oder Grabow zu wenden, welche Städte damals beide zur Grafschaft Danneberg gehörten 1 ).


|
Seite 85 |




|
Dort aber, zu Dömitz oder zu Grabow, konnte ihm die Nachricht nicht entgehen, daß die den beiden Städten nahe gelegene Burg Glaisin durch seinen Sohn Heinrich II. und seinen Bruder Johann von Gadebusch, die Herzoge von Sachsen=Lauenburg, brandenburgische und lübische Mannschaften belagert ward; es galt, an den Vertheidigern der Burg, Hermann und Eckhard Rieben und deren Genossen, die Strafe für schweren Landfriedensbruch zu vollstrecken.
In das Lager vor Glaisin sandte also der heimkehrende Fürst die Botschaft von seiner bevorstehenden Ankunft voraus.
Aber durfte man solcher Meldung Glauben schenken, da man schon zweimal so schrecklich getäuscht war? Natürlich erregte die Botschaft am meisten den Sohn des Pilgers, Heinrich II. Dieser hatte, als vor 27 Jahren der Vater von ihm zog, erst drei Jahre gezählt; ihm schwebte, wenn überall noch eine einigermaßen klare Erinnerung von dem Vater, nur das Bild eines Mannes in voller Kraft (von kaum 40 Jahren!) vor; er konnte also nicht selbst die Aufgabe übernehmen, die Echtheit des neuen Ankömmlings zu prüfen. Darum eilte er sofort nach Wismar, setzte die Mutter von dem Vorfall in Kenntniß und brachte die alten Räthe, welche früher die beiden Betrüger entlarvt hatten, Detwig von Oertzen und Heino von Stralendorf, mit sich ins Lager vor Glaisin 1 ). Auch die erkannten an seiner Gestalt ihren alten Herrn nicht wieder, so "verzehrt" war sein Körper; aber aus den Antworten, welcher der Pilger aus ihre Fragen gab, überzeugten sie sich, daß es der alte Fürst Heinrich war. Jetzt erst konnte man sich der vollen Freude hingeben. Die Fürstin Anastasia, hievon benachrichtigt, kam ihrem Gemahl, der den kürzesten Weg nach Wismar durch die Grafschaft Schwerin einschlug, bis an die Grenze der Herrschaft Meklenburg, bis Hohen Vicheln, entgegen. So unkenntlich Andern seine Erscheinung gewesen war, das Auge der Gemahlin erkannte an gewissen Wahrzeichen den Eheherrn sogleich wieder 2 ).
Staunen und Jubel ging durch das Land; Wismar bereitete dem alten Landesherrn einen feierlichen Empfang. Am Tage Pantaleons 3 ), am 28. Juli, traf er dort ein; das


|
Seite 86 |




|
Holz des heiligen Kreuzes, welches er mitgebracht hatte, in den Händen tragend, soll er in großer Procession von den Bürgern und der Geistlichkeit in die Marienkirche zu einem Te Deum geleitet sein und die eine Hälfte der Reliquie an das Franciscaner=Kloster zu Wismar, die andere an das Kloster Doberan geschenkt haben.
Nachdem der Fürst von Allen begrüßt, Alles, was ihm in den 27 Jahren seiner Abwesenheit aus Meklenburg widerfahren war, und Alles, was sich unterdessen daheim ereignet hatte, ausgetauscht, auch die Anstrengungen der Reise einigermaßen überwunden waren: da machte er - am 24. August vermuthlich (dem Datum Detmars) - der Nachbarstadt Lübek, welche sich einst so eifrig, wenngleich erfolglos, um seine Befreiung bemühet hatte, einen Besuch. Sobald sie seine Annäherung vernahmen, ritten ihm Rathsherren und Bürger "mit Schalle" entgegen; sie empfingen ihn mit dem Gesange: "Justum deduxit Dominus" und mit andern Ehren und sandten ihm zum Willkommen reiche Geschenke.
"Während der Herr von Meklenburg zu Lübek verweilte", so schließt die Chronik Albrechts ihren Bericht, "da starb sein treuer Dienstknecht, der mit ihm über Meer gefangen war, Martin Bleyer; und er ist zu Wismar begraben. Also nimmt die Märe ein Ende."


|
[ Seite 87 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Wallensteins Verordnung
über
Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes
in Meklenburg
mitgetheilt
von
Dr. G. C. F. Lisch.
Da in unserer Zeit über die Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes, auch gleicher Münze, in Deutschland so viel geredet, geschrieben und verordnet ist, so wird es gewiß Theilnahme finden, lesen zu können, wie ein so entschlossener Mann wie Wallenstein in gleicher Angelegenheit im Jahre 1629 in seinem neuen Lande Meklenburg verfuhr, indem er folgende Patent=Verordnung erließ.
Von Gottes Gnaden Albrecht,
Hertzog zu
Friedland vnd Sagan,
 .
.
" E Rsame liebe Getrewen, Nachdem Wir aus erheblichen vnd wichtigen Vns darzu bewegenden Vrsachen, vnd bevorab zu befürderung des gemeinen besten, entschlossen, in vnsern sämbtlichen Mecklenburgischen Fürstenthumben vnnd Landen, auch denselben incorporirtem Stifft eine eintzige durchgehende


|
Seite 88 |




|
an Scheffeln, Maaß, Ellen vnd Gewicht hinfüro zu gedulden vnd gebrauchen zu lassen, vnd dargegen alle andere hinweg zu thun vnd abzuschaffen, Vnd nun für rhatsam vnd gut befunden, daß der Rostocker Scheffel, Maaß, Elle vnd Gewicht beybehalten, vnnd alle andere hiernach reguliret vnd gleichförmig gemacht werden sollen.
Demnach überschicken wir euch hierbey einen rechten Rostocker Scheffel, nebenst Maaß, Elle vnd Gewicht, mit gnädigem begehren vnd ernstem befehlich, daß ihr alle in vnser Stadt
bey den Bürgern vnd Einwohnern vorhandene Scheffel, Maaß, Ellen vnd Gewicht auff das Rhathaus fürdern vnd bringen, vnd alles nach dem jetzo überschicketen Rostocker vorgleichen vnd wrogen, welche aber etwan nicht gleich gemacht werden könten, entzwey schlagen vnd zerbrechen, vnd hinfüro durchauß keine andere dann Rostocker Maaß gedulden, vnd von jemands, er sey auch wer er wolle, nit gebrauchen lassen, euch auch im Einkauff vnd wieder verkauffung der Waaren, proportionabiliter darnach richten sollet.
Vnd damit diß vmb so viel beständiger in schwang gebracht werden müge, setzen Wir pro certo termino hier zu nechstkommenden Tag Johannis Baptistæ, alßdann diß alles seinen anfang gewinnen, vnd folgends steiff, fest vnd vnvorbrüchlich gehalten werden solle, Vnd jhr vollnbringet daran Vnsern gnädigen auch ernsten zuvorlessigen Willen vnd meynung. Datum Güstrow den 6. Maji, Anno 1629."
proprium.
DEn Ersamen Vnsern lieben Getrewen,
Bürgermeistern vnnd Rhatmannen
in
Vnser Stadt
Nach dem gedruckten Patent auf einem halben Bogen Papier im großherzoglichen Geheimen und Haupt=Archive zu Schwerin.


|
[ Seite 89 ] |




|



|


|
|
:
|
Briefe Wallensteins,
meistentheils über Meklenburg,
aus der Zeit von 1627 bis 1630,
mitgetheilt
vom
Professor Dr. Ottokar Lorenz
zu Wien.


|
[ Seite 90 ] |




|


|
[ Seite 91 ] |




|
III.
Briefe Wallensteins,
meistentheils über Meklenburg,
aus der Zeit von 1627 bis 1630,
mitgetheilt
vom
Professor Dr. Ottokar Lorenz
zu Wien.
Vorbericht.
Wohl selten ist für die Meklenburgische Geschichte ein so wichtiger und anziehender Fund gemacht, als die Entdeckung der hier mitgetheilten Briefe Wallensteins, welche zum größten Theil Meklenburg betreffen oder berühren. Die Briefe, aus der Zeit von 1627 bis 1630, sind fast alle an den bekannten Obersten Sant Julian gerichtet, welcher im Jahre 1628 auch Wallensteins Bevollmächtigter in Meklenburg war, bis dieser in demselben Jahre selbst in seinem neuen Lande erschien.
Die Briefe wurden von dem Herrn Ministerialrath Samwer in Nieder=Oesterreich zu Wallsee gefunden, einer ehemaligen Sant Julianischen Herrschaft, welche jetzt Sr. Hoheit dem regierenden Herzoge Ernst von Sachsen=Coburg gehört. Der Markt Wallsee liegt im Lande unter der Ens, am rechten Ufer der Donau, nicht weit von Amstetten und dem Ufer der Ens.
Der Herzog Ernst, Höchstwelcher bei seiner bekannten und bewährten Theilnahme an der Beförderung der Wissenschaft und Kunst die Wichtigkeit des Fundes erkannte, ließ die Originale dem Geschichtsforscher Professor Dr. Ottokar Lorenz in Wien zur wissenschaftlichen Benutzung übergeben. Herr Professor Lorenz schrieb im Sommer 1874 sämmtliche


|
Seite 92 |




|
Briefe ab und stellte die Abschriften aus eigner Bewegung vertrauensvoll dem Vereine für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde zur Aufnahme in dessen Jahrbücher zur Verfügung. Die Meklenburgische Geschichte verdankt also dem Herren Professor Lorenz die Abschrift der Briefe, Sr. Hoheit dem Herzoge Ernst aber die Ermöglichung der werthvollen Mittheilung, welche zum verehrungsvollen Danke auffordert.
Die Originale sind darauf von Sr. Hoheit dem Herzoge Ernst der herzoglichen Autographen=Sammlung in Gotha zur Aufbewahrung übergeben.
Der Inhalt der Briefe ist sehr merkwürdig und geschichtlich überaus bedeutend. Wir finden in ihnen nicht allein den geschichtlichen Faden während der Herrschaft Wallensteins in Meklenburg, sondern auch die Ansichten und Willensmeinungen des Mannes klar ausgesprochen. Was aber noch wichtiger ist, das ist das Ergebniß, daß alle die großen staatlichen Veränderungen und Anordnungen während der Regierung des strengen Herrschers aus dessen eigenen Ansichten und Vorsätzen hervorgingen. Die Forschungen über Wallensteins Regierungsformen, Leben, Handlungsweise und Charakter, welche aus weitschichtigen Meklenburgischen Archiv=Acten in den Jahrbüchern XXXV, S. 45 flgd., XXXVI, S. 3 flgd. und XXXVII, S. 3 flgd. vorgetragen sind, finden in den Briefen durchweg überraschende Bestätigung.
Was die Form der Briefe betrifft, so sind bei weitem die meisten von Wallensteins eigener Hand geschrieben 1 ). Die Briefe sind auf einen ganzen Bogen Papier geschrieben; sie sind in Briefform zusammengefaltet, auf der Rückseite des zweiten Blattes, wo dasselbe noch vorhanden ist, mit der Adresse versehen und mit dem kleinen Wallensteinschen Secret=Siegel, wo es noch erhalten ist, versiegelt gewesen; das große Meklenburgische Staatssiegel Wallensteins 2 ) kommt nicht vor.
Es folgen hier die Briefe nach der Zeitfolge in wortgetreuem Abdruck. Mögen sie theilnehmenden Forschern reichen Stoff zu tieferen Betrachtungen geben, welche jetzt nicht angestellt werden konnten.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 93 |




|
* Nr. 1.
Die von Breslau werden Zweifls ohn das gelt aufs
Regiment erlegt haben, nun hab ich dem herrn
geschrieben, das er das, was auf mein person vor
Junium und Julium kompt, mir auch vor die
 fändle ebenmessig auf die 2 monat
dem Morando abführen, dieweil ich nun die 80
m
R. schuldig bin, so wolle der herr
das was auf mich kompt, zurück bey sich halten,
undt da es anders müglich das ubrig noch so
viel, das man die 80
m
R. bezahlen
soll, von des Regiments gelt nehmen und wenn ich
dem herrn avisiren werde solche schuldt der 80
m
R. bezahlen, ich versprich ihm was
er von des Regiments gelt leihen wirdt, das ich
dem Regiment solches in puncto will erstatten,
undt dahin erlegen, denn ich bekomme von den
Magdeburgern izt gelt; bitt der herr sehe das er
so viel gelts bey sich helt, auf das die 30
m
R. bezahlt werden, ich wills gewis
alsbalden mit dank restituiren undt dem herrn
obligirt verbleiben
fändle ebenmessig auf die 2 monat
dem Morando abführen, dieweil ich nun die 80
m
R. schuldig bin, so wolle der herr
das was auf mich kompt, zurück bey sich halten,
undt da es anders müglich das ubrig noch so
viel, das man die 80
m
R. bezahlen
soll, von des Regiments gelt nehmen und wenn ich
dem herrn avisiren werde solche schuldt der 80
m
R. bezahlen, ich versprich ihm was
er von des Regiments gelt leihen wirdt, das ich
dem Regiment solches in puncto will erstatten,
undt dahin erlegen, denn ich bekomme von den
Magdeburgern izt gelt; bitt der herr sehe das er
so viel gelts bey sich helt, auf das die 30
m
R. bezahlt werden, ich wills gewis
alsbalden mit dank restituiren undt dem herrn
obligirt verbleiben
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Domits den 28. Augst 1627.
Herrn Obristleitnampt
Sant Julian zuzustellen.
* Nr. 2.
Aus des herrn schreiben vernimb ich, das er das gelt von der Contribution auf Prag will nehmen undt wenn ich befehlen werde consigniren; ich sag ihm dank. Er behalt es nur bis zu meiner ankunfft, alsdann will ich mich mitt ihm in allem vergleichen, undt dahin gewis undt unfelbar wiederumb erstatten. Wegen Sagan hab ich mein opinion albereit geendert und begehr nichts mehr in Jhr. Matt. ländern, denn ich sehe, große stück seindt schwer zu bekommen undt unsicher zu halten; proponir nochmals Mechelburg, denn sie haben auch gutte wort geben, aber sich nicht laut ihren Worten verhalten; will mir der Kayser das Landt


|
Seite 94 |




|
ganz undt gar verkaufen, desto lieber wirdts mir sein; wo aber nicht ganz undt gar, so vermeine ich des eltern theil undt ein stück von des jüngeren, denn er ist auch umb ein stück besser als der elter gewest; in summa ich will machen, das der jünger ihm vor ein gnadt solches wirdt halten, den eltern werden wir mitt etlichen ämptern contentiren, das er wirdt zu leben haben, in summa ich will bey meiner ankunft zu allem mittel bringen. Zu deme es ist ein fürsttl. (?) von 6000 Reichsthalern einkommens im landt, das will ich den Kayser bitten, er wolle wie auch der Bapst sein Bewilligung geben, das ich köndte den Jesuitern geben undt darmit 2 Collegia, eins zu Rostock, das ander zu Wismar sundiren, undt dadurch die Chatholische Religion einführen. Der herr muß aber sehen das diese tractation wegen Mechelburg nicht weiter geht, als zwischen dem fürsten von Egenberg, herren Zerda undt dem herrn allein, das der Fürst derweil preparatoria macht auf das bey meiner ankunft die räthe selbst dies proponiren; als dann will ich mich im anfang ein wenig spreizen undt auf die letzt acceptiren. mit Sagan halte der herr der Zeitt zurück, denn eins ist besser als das ander, ich aber verbleibe des herrn gutwilliger
A. h. z. Fr.
Rossa den 29. Oktob. 1627.
P. S. Der herr communicire dies alles mit herrn Zerda.
Herrn Obristleitenampt
Sant Julian zuzustellen. Prag.
* Nr. 3.
Was ich dem Ob. von Ziemann schreiben thue, wirdt der herr aus beylag vernehmen können; bitt undt verlasse mich auf den herren, das diesem wirklich nachgelebt wirdt undt das landt in continenti aller molestien enthebt, das volck so im landt bleiben wirdt, muß von anderwerths ihre underhaltung haben. den Port zu Rostock muß man mitt


|
Seite 95 |




|
forti alsbalden schließen undt stark befesten, darauf starcke mercidia (presidia) in beyde stett einführen undt in continenti anfangen die Citadellen zu bauen undt was die stett undt stendt contribuiren werden, solches zur Erbauung der Citadellen undt sonsten was im landt wird vonnöthen sein zu fortificiren anwenden. bitt den herrn ganz fleißig, er secundire fleißig diesen mein willen, auf das das landt conservirt, die Citadellen erbaut, wo etwas von nöthen ist zu fortificiren, ohne verliehrung einiger Zeitt fortificiret undt alles unnötigs volck aus dem landt ausgeschafft, daselbige aber, so im landt wirdt bleiben müssen, von anderwerths underhalten, der herr wirdt mich gewis darmitt aufs höchste obligiren, im übrigen remitir ich mich auf des von Walmerode mündlichs anbringen undt verbleibe hirmit
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Prag den 9. Febr. 1628.
P. S. Zu Boizenburg ist von des herrn Generall Tilli Volck gewest, solches muß in continenti zurück undt hergegen mein presidium hinein gethan werden. Was das politisch guberno im landt, Wie auch die Cameralia, bitt ich der herr wolle aufs böste und nützlichste anordnen, wie ichs mitt ihm verlassen hab. Die Fürsten muß man fortschicken, denn zween Hanen auf einem müst taugen nicht zusammen.
* Nr. 4.
Ich vernimb vom Ob. von Zieman, das die von Stralsund sich anfangen zu rebelliren, ich befehle ihm sie mitt gewalt anzugreifen undt zum gehorsam zu bringen, denn principiis obsta; der herr muß auf die von Rostock undt Wismar auch wachtsames Aug geben, denn seindt auch böse buben under ihnen, ich vermeine der herr solle in ein jede von bemeldten steten 3000 man zu fus undt 2 comp. reiter legen undt die bürger disarmieren; doch sehen, das von den soldaten daselbst keine Neckereien, oder geltspretensionen geschehen, auch scharfe disciplin gehalten. Zu dem muß der herr den porto bey Warnemündt mitt forti alsbalden


|
Seite 96 |




|
schlissen undt wol vorsehen. Und dieweil dem Obristen Aldringer undt dem von Walmerode der Obriste von Zieman nicht wirdt bey der huldigung assistiren können, als wirdt der herr alles über sich nehmen müssen, so wol die politica als militaria undt in allem dahien bedacht sein, wie wir uns am besten des landts versichern, insonderheit auff erbauung der Citadellen in beyden steten; solches muß aber ohne Verzug ins Werck gericht werden, darumb bitt ich der herr thue dazu, zum ersten presidire stark die Stett und alsbald schlisse er die porti undt alsdann gleich daraus lasse er die Citadellen machen, aber es müssen realwerck sein, denn die stett seindt mächtig, ich aber verbleibe des herrn gutt= williger
A. h. z. Fr.
Gitschin den 27. Febr. 1628.
P. S. So baldt die huldigung führüber oder wol zuvor in wehrender oder führangegangener huldigung nach dem der herr der notdurfft wirdt vor sehen, so sehe er das beyde fürsten aus dem landt sich begeben per amor o per forza, denn da muß man alle curtoisie auf die Seit setzen, quia salus suadet. der herr diferire darmitt durchaus nicht.
Herrn hern Obristenn
Sant Julian zuzustellen
cito.
cito.
citissime
wo er anzutreffen ist.
* Nr. 5.
Aus des herrn Schreiben von Warnemündt den 15 Marci datirt hab ich vernommen, was der poeuel in der statt Rostock vor die handt zu nehmen sich unterstehen will, wie der König nicht unterlest, sie durch seine gesandten zum ungehorsam zu solicitiren, auch was der adel sich vor im-


|
Seite 97 |




|
pertinenzen anzufangen verlauten lest, diesem allem vorzukommen ist dies mitl: der herr halte bey dem Ob. von Zieman an umb mehr Volck, im fall das diese zwey Regiment des Torquato undt Farensbach nicht genung sein. der herr sehe, das in continenti die bürger zu Rostock disarmirt werden undt ein Citadellen angefangen; dies soll auch zu Wismar geschehen, dahero ich denn den herrn aufs fleißigste bitten thue, er wolle keine Zeit verliehren, sondern ohne einzige mora dies ins Werck richten; ihre Abgesandten seindt noch dahie, aber ich weis sie in allem an den Ob. von Zieman, under dessen aber sehen sie, das das, was ich wegen der beyden stett befehlen thue, ins werck ohne einige dilacion gesetzt wirdt. Die herzog sehe der herr ohne einige replica alsbalden aus dem lande schaffen per forza, denn ich will sie durchaus nicht drinnen leiden, bitt der herr komme diesem wircklich undt baldt nach, er wirdt mich obligiren, ich aber verbleibe
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Gitschin den 2. April 1628.
P. S. Der herr wolle alle die Expedicionen von Schwerin, Sternberg undt Büzen auf Küstrau bringen wegen Büzau oder des stiefts Schwerin darf keine andere Expedecion; der herr schlage sie zu des landts von Mechelburg expedicion, denn ich hob mein grosse bedencken darin, et erit unum ovile et dux et non episcopus pastor.
Anm. Büzau ist die Stiftsstadt Bützow.
* Nr. 6.
Ich zweifle nicht, das der herr wirdt meine underschiedliche schreiben bekommen haben, in welchen ich dem herrn befohlen, er solle auf alle weis sich der beyden stett wol bemächtigen und in continenti Citadellen daselbst erbauen lassen, denn die noth erforderts undt ich mein propositum auf keinerley weis nicht mutiren werde, dahero denn die efectuirung dessen muß unverzüglichen vor die handt genomen werden; versehe mich also gegen dem herrn, das es gewis geschehen wirdt. Wegen der herzog von Mechelburg


|
Seite 98 |




|
bitt ich der herr inquirire fleißig, quia salus suadet. Die herzog aber versehe ich mich, das sie auf meine vielfeltige Zuschreiben vom herrn allbereit, auf was vor weis es ist, seindt aus dem landt geschafft worden. Das guberno ziehe der herr alles auf Küstrau, bitt auch der herr sehe auf alle weis, das das landt widerumb angebaut wirdt undt das die untherthanen zum Vieh undt rossen kommen, undt also remitir ich dem herrn das landt ganz undt gar, wie ers anstellen wirdt, also contentire ich mich undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Prag 3. Aprill 1628.
P. S. Den Plessen, so abgesandter dahie gewest ist, sehe der herr zu bekommen, gefenglich einziehen undt auf der festung zu Domits wol verwahren lassen; der herr sehe vor meiner Ankunft alle Nothdurft an Unterhaltung machen zu lassen, vor mich undt alle die so mitt mir komen auch vor mich etwas von gelt.
Adresse wie oben.
Anm. Küstrau ist die Stadt Güstrow in der Mitte von Meklenburg, wo Wallenstein in dem großen und schönen, noch stehenden Schlosse der jungem herzoglichen Linie seine Residenz nahm.
* Nr. 7.
Nichts anders weis ich dem herrn izt zu schreiben, allein das was ich zuuor so oft befohlen hab wiederholen, als nemblich, das der herr in puncto beyder herzog aus dem landt schaft, zu Rostock undt Wismar Citadellen ohne verliehrung einiger minuten anfengt zu bauen, daselbsten auch die bürgerschaft disarmirt, in politicis undt economicis bestelt wie ers am besten ansieht, ich will zu ende dies dahir aufbrechen, zu ende Maiji zu Küstrau sein. bitt der herr lasse alle preparacion wegen der Unterhaltung daselbst vor mich undt die so mitt mir kommen, machen, wie auch etwas von gelt denn von hinnen bringe ich keins mitt. Den Plessen, so dahir ihr abgesandter gewest ist, lasse der herr


|
Seite 99 |




|
gefenglich einziehen undt zu Domits wol verwahren, ich aber verbleibe des herrn gutwilliger
A. h. z. Fr.
Prag 10. April 1628.
Adresse wie oben.
* Nr. 8.
Der herr thuet auch meldung in seinem schreiben das die ständt aus Mechelburg mich auf der kraniz empfangen wollen; nun ist es zwar wahr, das mir mitt ceremonien wenig gedient ist, nichts destoweniger auf das sies nicht vor ein ofesa anziehen theten, so will ichs geschehen lassen, doch in alleweg sehe der herr, das zuvor die herzog undt ihr gemahlin aus dem landt weck sein undt nach empfangung dies sehe der herr in 3 oder 4 tagen, das sie alle fort ziehen wie auch die alte herzogin.
* Nr. 9.
Ich hab dem herrn albereitt oft geschrieben das ich die Citadellen zu Rostock undt Wismar will haben, dahero denn ich endlich befehlen thue, er lasse den Ob. von Zieman wissen, das er solle so viel volks ins landt führen als es zu dem Werck von nöten ist; undt alsdann habe man in continenti die Citadellen zu erbauen, denn das ist mein letzte resolucion undt darvon will ich nicht weichen undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Prag den 17. Aprill 1628.
Adresse wie oben.


|
Seite 100 |




|
* Nr.10.
Aus des herrn Schreiben hab ich vernommen wie es
mitt der huldigung abgangen ist, undt das die
fürsten auf ihrer gemahlin leibgedüng auf 15 tag
zu wohnen begehrt; nun bin ichs nicht zuwider,
wanns nicht lenger ist als auf 15 tag, aber
nacher will ich nicht, das sie weder ihre
gemahlin lenger im landt sich aufhalten sollen,
doch die leibgedünck können ihre gemahlin durch
dero beamten guberniren lassen, aber sie selbst
will ich nicht das sie im landt wohnen auf
keinerley weis. Der herr von Walmerode schreibt
mir, das er sich wegen alles einkommens im landt
erkundigt, nun kan ers nicht anders sich
erkundigen, als aus den alten Registern, dahero
denn große confusiones erspringen müssen,
dieweil in langer Zeit die güter nicht das
tragen werden, was sie zuvor getragen haben,
derowegen sage ihm der herr er solle bis zu
meiner Ankunft diferiren, sonsten wolle ich dem
herrn jemandhen, der in cameralibus das manego
hette, gern hier abordnen, aber ich hab ja
keinen. bitt der herr nehme subjecta von dorten
undt sehe, wie das landt wiederumb angebaut
wirdt. die Citadellen zu Rostock und Wismar, daß
sie erbaut und bald angefangen werden, bitt der
herr verliehre keine Zeit darmitt. Anstatt des
Hebrons Regiment führe der herr ein anderes Volk
in Wismar undt diese, das sie in Pomern
marchiren, ich aber verbleibe
 .
.
Prag den 20. Aprill 1628.
P. S. Das stieft Schwerin, ziehe der herr ein und incorporire alles zum herzogthumb, id est die justicisachen vor des herzogthumbs tribunal, die cameralia zu des herzogthumbs cameralibus. Alle die bischöflichen ministros undt expeditiones fertige der herr ab ut sit unum ovile et unus pastor Bitt der herr sehe, das die gestüter nicht weck kommen, auch aus den Wildbahn gebe der herr wol achtung, so wol das die . . . . . fürher nicht weck komen.


|
Seite 101 |




|
* Nr. 11.
Ich bitt der herr sehe, das dem hanns de Wite die 5000 R der von Zieman bezahlen lest. ich vernimb auch, das der von Zieman 45 m Reichsthaler von Lübeck auf hamburg dem hans de Wite hatt richtik machen wollen; solches gelt aber durch den Rector Wenzel undt Gabriel de Roa arrestirt zu lübeck ist worden, ich schreibe zwar dem Rector Wenzel, ein greulichen filz dessen wegen undt befehle ihm solches zu relaxieren, der herr erkundige sich dessen undt berichte mich, warumb sie solches gethan haben, der herr bemühe sich auch auf alle Weis etlich Schief zu armieren, auf das wir uns zu Mehr auch algemach groß machen, sonsten werden aus Dünkirchen in kurzem 10 Orloch Schief zu Wismar einlaufen, welche der herr daselbst annehmen lasse, das Brabantisch Regiment hatt ordinanz von mir nach der Lausitz zu marchiren; bitt der herr Informire die Sachen dahien, auf das alle contribucionen aus dem landt zu Mechelburg vor mich bleiben, denn ich hab sonsten kein ander Gelt, undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Prag 28. Aprill 1628.
* Nr. 12.
Ich hab dem herrn albereit bericht, wie ich will in landt zu Mechelburg gehalten haben dahero denn ich bitt der herr sehe diesem allem fleißig nach u. s. w.
Aufträge wegen Erbauung der Citadellen, Schließung der Häfen, u. s. w. wie in den frühern Briefen.
Horzits 20. Maii 1628.
* Nr. 13.
Aus beylag wirdt der Herr sehen können, was mir der herr von Walmerode schreibt, darumb rede der herr mitt


|
Seite 102 |




|
dem Obriestn von Zieman, auf das dieselbige fürsten in puncto aus dem landt geschaft werden undt der herr brauche darmitt keine curtesi gegen ihnen, der herr sehe auch dieweil sie sich auf den Schweden verlassen, das das landt mitt volck so wol versehen wirdt, das ich keiner sache mich nicht zu besorgen hab. und verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Gitschin 21. Maii 1628.
P. S. Die Citadellen lasse der Herr bauen in continenti, disarmire die bürger, undt sehe starke presidia in die Seestett einzuführen.
* Nr. 14.
Aus beylag wirdt der herr sehen, was der Graf von Schwarzenburg an Ihr. Matt. begehrt; nun vermeine ich das alle seine Rathschleg gar zu rident seindt, nichts desto weniger was Aufwerfung der forti bey Travemündt anbelangt, lasse ich mir solches nicht gar übel gefallen; bitt der herr communicir es mitt dem Ob. von Zieman wie auch Ob. Aldringer undt sehe das Werck zu befördern, das die forti daselbst aufgeworfen undt starck presidirt werden ich aber verbleibe
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Gitschin den 21. Maii 1628.
Ohne Adresse.
* Nr. 15.
Aus des herrn schreiben hab ich vernommen, das der graf von Mansfeldt etlich sachen zu der schief armazon begehrt, nun vermeine ich das man auf alle weis ihm alles das, was er begehen thuet, soll geben, undt die schief rüstung


|
Seite 103 |




|
befördern; was er aber empfangen wirdt, das er dem herren ordentliche Quittungen gibt, denn nacher muß mir solches alles erstattet werden. Der herr correspondire mitt dem Ob. Aldringer fleissig wegen des Volks so aus undt in das Landt zu Holstein zieht, auf das sie zu Boizenburg übersetzen; dazu denn der Herr ein große Anzahl von Schiefen daselbst halten laß. Was die beyden Herzogen anbelangt, da ist es kein ander müglichkeitt, sie müssen aus dem landt auf alle weis. Was aber die alte Herzogin betriff solches remitire ich alles in des herrn discretion, viel lieber wolle ich schon das sie auch weck ziehen thete, vermeint aber der herr das nicht sein kan. so seys, doch auf alle weis die andere zwo, das sie fort und alsbalden ziehen, denn ich vermeine innerhalb eines monats friest im landt anzulangen. Das die stendt 100 m Reichsthaler bewilligen wollen, sehe ichs gern, bitt aber der herr unverhalten unterdessen das volck mitt Profant bis zu meiner ankunft, denn ich werde selbst viel gelts bedürfen, will aber aus Pomern undt der Mark Brandenburg gelt contribucion vor das Volck in Mechelburg anordnen. Die 90 m Reichsthaler, so die Rostocker noch erlegen sollen, wolle ich das dieselbige auch zu meiner ankunft ins landt vorhandten wehren; denn ich dem hans de Wite über 400 m R. schuldig bin worden wegen etlicher herschaften, so er vor mich bezahlt halt undt izt wirdt baldt der termin kommen ihm satisfaccion zu geben. Bitt der herr befehle im ganzen landt fleißig inquisicion zu halten, was das landt an gelt und Profant vor die Kaiserliche Soldatesca gegeben hatt undt wenn sies gegeben haben, denn ich solches muß haben, im übrigen verbleibe ich allzeit
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Gitschin den 24. Maiji 1628.
P. S. der herr lasse viel Prouisionen von unterhaltung vor mich machen denn es kompt gar viel Cavalirie mitt mir.
Am Rande: Selkisch und Kroatisch (?) Regimenter werden teglich durch das landt von Mechelburg marchiren müssen.
Ohne Adresse.


|
Seite 104 |




|
* Nr. 16.
Ich vermeine innerhalb 3 wochen zu Frankfurt an der Oder ankommen; bitt der herr halte sich in bereitschaft, auf das wenn ich ihm schreiben werde er alsbalden per posta zu mir kommen kan, denn ich wolte in den politicis undt militaribus alles mitt dem herren apunctiren undt nacher wolte ich gern das der Kanzler oder vice Kanzler aus Mechelburg mitt zwen andern Räthen bey mir stets assistiren thete, deren parer ich bey allen Resolucionen anhören köndte; ich bin sonsten in willens, in den Räthen So wol auch andern Diensten im landt undt bey mir desselbigen Adels mich mehr zu gebrauchen, als die vorige Herzog gethan haben. Bitt auch den herrn ganz fleißig, er sehe vor meiner Ankunft die sach in ein richtigkeit zu bringen, auf das Ihr. Matt. können ein legitimirten Proceß bey den Herzogen machen, warumb sie sie des landts privirt haben. Der herr wirdt mich obligiren, denn als denn wirdt die publication der investitur folgen. Bitt auch der herr sehe, das die Soldatesca bis zu meiner ankunft sich mitt der Profant pacimitirt (?) ich wills ihnen gewis einbringen, denn ich bedarf des gelts wegen satisfaccion meiner Creditoren gar nöthig, undt verbleibe hirmitt des herrn gutwilliger
A. h. z. Fr.
den 24. Maji 1628.
* Nr. 17.
Die von Rostock undt Wismar seindt bey mir angelangt undt ihr beschwerungen angebracht, mir auch des herrn schreiben presentirt; ich sehe das nicht anders sein kan, als in beyden steten alsbalden Citadellen anfangen zu bauen, denn die stett thun kein gutt, wenn sie nicht ein Zaum im Maul haben, bitt der herr thue dazu ohne Verliehrung einiger Zeitt, denn ich werde gewis mein meinung nicht endern. Des Hebrons Volck muß heraus, welchen ich das abgezwungene gelt wie auch die Impertinenzen, welche es mitt ihnen vorgenommen nicht werden pasirt werden, der


|
Seite 105 |




|
herr rede mitt dem Ob. von Zieman das des Hebrons Volck in continenti heraus aus Wismar zieht undt anstatt desselbigen von des herren Regiment so viel Volck, als von nöten ist hinein gethan wirdt. ich aber verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Gitschin den 28. Maii 1628.
* Nr. 18.
Was anbelangt das guberno im landt zu Mechelburg zu bestellen, so vermeine ich, das auf diese weis soll angestellt werden. Das hofgericht nehme der herr in continenti von Sternberg undt transfirire solches nach Küstrau. in bemeldtem hofgericht vernehme ich, das sitzen landtrichter undt Landt unterrichter undt 6 Doctores, zu denen adjungire der herr noch andere 6 von Adl. Bey der Kanzelung zu Küstrau wolle ich gern neben den Kanzler undt den Doctoren auch etliche von Adl halten. In den Cameralibus nehme der herr leut so darzu taugen und formire von ihnen ein consilium, doch werden 4 oder 5 Personen in allem genung sein, über das wolte ich gern wegen der Mechelburgischen expeditionen bey mir den Kanzler oder vice Kanzler haben neben par doctoren undt par von adl auf das, wenn etwas aus dem landt kompt, ich mitt ihnen die sachen conferiren undt resolucionen nehmen könndte, wie auch iemandthen wegen der Cameral sachen. über das werden etlich von Adl nicht vor räth. sondern also bey mir in diensten sein wollen, so .will ich mich lieber von ihnen, als von andern bedienen lassen. Diesem, bitt ich, der herr dencke fleissig nach undt disponir auf solche weis. Der herr ziehe alsbalden das Stieft Schwerin ein, undt ziehe die justici sachen zu meiner justici, die Cameralia zu meinen Cameralibus undt lasse kein schein des vorigen guberno daselbst aus hochbedencklichen ursach undt solches das auch in continenti geschicht.


|
Seite 106 |




|
* Nr. 19.
Ich schicke dem herrn ein lehnsbrief von Kayser Rudolf wegen Mechelburg in originali, auf das wenn man den meinigen wirdt ausfertigen sollen, kein error geschieht. Der Kayser hatt mich sonsten in dem meinigen belehnt auf mein ganzes geschlecht, (auf welche ich festigen (?) werde), der herr schreibe dem Maxen, das er ihm ein Abschrifft des lehnbriefs, den man mir vorm jahr hatt geben, schickt. - Der herr schicke dem Maxen dies beyliegendes schreiben zu, undt sehe, das er den lehnsbrief baldt bekompt. Dem herrn von Stralendorf und herrn von Nostiz kann der Herr ein Honorarium versprechen, wie viel es dem herrn gefallen wirdt. Den Acord wegen Mechelburg mitt der hofCamer hab ich auf diese weis geschlossen, das ich die intraden der Camergüter soll 4 per cento bezahlen, ich schicke izt nach Wien die intraden undt schulden soviel sich bis dato Creditoren angemeldt haben, undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Küstrau 15. Jan. 1629.
P. S. Der herr schreibe dem Maxen auch wegen Abschrifts des acords wegen Mechelburg mitt der hofCamer.
Auf der Rückseite: Informazione d'ell accordo con la Camera.
Anm Max ist des Herzogs Vetter Max von Waldstein.
* Nr. 20.
Der herr hatt sehr recht daran gethan, das er dem herrn von Questenberg an meiner statt ist zu gevatern gestanden, der herr kaufe ein galanten vor 5 oder 6 hundert Reichsthaler undt verehre sie der kindlbetterin an meiner statt. Der hans de Wite klakt erschreklich, das man ihm in Schlesien nicht die termin helt; bitt den herrn gar fleissig, er nehme sich darumb mitt eifer an undt sehe das ihm das gelt unverzüglich erlegt wirdt; undt das lichtensteinisch Regiment, das nicht von den mitln, so zu der arme seindt asignirt worden, unterhalten wirdt, denn auf solches


|
Seite 107 |




|
gelt hatt alles der hans de Wite anticipirt. Undt dieweil das jahr schon herumb ist, muß der herr sehen, das in continenti uns ander mitl eingeräumt werden. Dieselbige aber werden sich müssen zum wenigsten auf ein Milion Reichsthaler erstrecken. bitt der herr sehe, das er solches vor des fürsten verreisen richtet, in betrachtung das auch der graf von Colalto sich noch dorten fünden thuet. ich aber verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Küstrau den 25. Maiji 1629.
P. S. So baldt mein investitur wirdt erfolgt sein, so sehe der herr noch vor des fürsten verreisen die privilegia heraus wegen dieses landts zu bekommen, denn so lang ich dieselbige nicht hab, so kan ich weder in politicis noch spiritualibus kein Nuz schafen.
Adresse wie oben.
Sign. Ordine di presentare
600 Rth. al Sign. di Questenberg.
* Nr. 21.
Dieweil nun mein sach expedirt ist undt dem herrn wol bewust ist, was ich versprochen hab undt auf welche termin zu zahlen, als bitt ich den herrn ganz fleißig er rede mitt meinem Vetern, dem Maxen, auf das er steht auf alle weis die termin zu halten, denn ich will nicht undanckbar sein undt mein credit verliehren undt verbleibe hiermitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Kustrau den 12. Juni 1629.
P. S. Die Dankbrief werde ich dem herrn mitt diesem Curir schicken, dem herrn Zerda danke aber der herr am allermeisten dieweil der fürst dorthen nicht ist, ehe ha fato servicio.
Adresse: Herrn Herrn Obristen
Sant Julian zuzustellen. Wien.


|
Seite 108 |




|
* Nr. 22.
Aus des herrn schreiben vernehme ich, das die Mechelburgische sach schon zu endt gebracht ist, darführ ich denn dem herrn ganz fleissig dank sagen thue, das er solche muehe angewandt, will mich befleissen, solches mitt danck gegen ihm wiederumb zu erkennen. Was anbelangt des Adls privilegia, weis der herr selbst wol, das ich des adls freundt bin und wolle sie auf keinerley weis gern destruiren aber wenn ich nur das privilegium erhalten werde, das sie nicht apeliren, so will ich gewis sie lassen wie edlleitt undt nicht wie pauren leben; dahero denn ich bitt, der herr sehe solches vor seinem verreisen auszubringen. Wenn der herr die sachen zu Wien wirdt expedirt haben, so kan er sein Weg nach Spaha nehmen, denn Ihr Matt. dienst erfordert, das der herr sein gesundheitt föllig recuperirt undt nacher deroselben noch lange Zeit dienen kan. In Schlesien zur execution kan ich niemandthen schicken, denn man mirs bey hof übel auslegen thete, aber dieweil mir der herr von Dona schreibt, das in Ober Schlesien man die Contribucion nicht einfodern kan, so schicke man das lichtensteinisch Regiment dahien, das sie an Teschnischen, Tropischen undt Jegerndorfischen undt auch in den herschaften Ples, Beiten undt etlichen ändern lägern undt die ändern zwinge man zur contribucion. bitt der herr sehe, wie ers richten wirdt undt hir mitt verbleibe ich des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Küstrau den 17. Juni 1629.
P. S. Der herr hett sollen wegen des adls Privilegien mitt dem Fürsten reden undt wenns der fürst aprobirt hette, erst vorbringen, denn ich hab wol gewust, das der von Stralendorf solcher hindern würde; izt sehe er, das dies alles copirt wirdt undt das man vom hof aus auch keine Privilegien ihnen confirmirt, bis die Commission, wegen derer so sich teilhaftig an der Rebellion gemacht haben, vorüber sein wirdt. bitt den herrn er stelle die Sachen fleissig auf dem; izt ist der fürst nicht an der handt. Der herr sehe das dem von Walmerode und Oberkamp befohlen wirdt mir baldt das landt einzureimen. Der Aldringer kan nicht abkommen.
Adresse wie sonst. Wien.


|
Seite 109 |




|
* Nr. 23.
Ich bekomm gleich izt ein schreiben von dem Comissari Liebheldt, das der Wizleben mitt seinem Regiment nach der Weterau (?) marchirt ist; solches soll nicht halb complet sein. Der Graf von Colalto hat deswegen die ordinanz geben, auf das er das ander volck alles nach Italien nehmen köndte. Kompt der Franzos, Elsaß ist verlohren, denn ich kan keinen Menschen dahien schicken undt bedarf selbst eines starcken succurs. Bitt das man ihm am hof beföhlt, er solle auf Elsaß achtung geben und ein gutten theil des volcks so er in Italien genommen zuruck schicken. Die Schweizer wollen auch die in Bünden angreifen. Der graf Colalto, wirdt er sich in Italia imponiren. so ist er verlohren undt des Kaysers reputation auf ewig dahin, denn sehe man wol auf; denn wir stehen auf den fall, wo nicht die sachen baldt accomodirt werden. In summa man muß mehr das publicum undt Ihr. Matt. dienst als etwan künftigs privatum commodum in acht nehmen, bitt der herr nehme sich dessen mitt eifer an, auf das sie mitt dem frieden nicht diferiren undt dem Colalto befehlen sich nicht zu imponiren, aber weis nicht wessen er sich resolviren wirdt. Der Spinola wirdt auch lieber den Krieg dorten sehen, dieweil in Niederlandt so übel zugeht, das er nicht solle dürfen hineinziehen, bitt der herr führe diese Sach wol, denn es dependirt Ihr. Matt. ganze wolfarth daraus. Ich aber verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 28. September 1629.
Adresse: Hern
.
Sant Julian zuzustellen. Wien.
Am Rande: Welschen Krieg betreffend.


|
Seite 110 |




|
* Nr. 24.
Aus beylag wirdt der herr sehen, was mir vor ein Danck gegeben wirdt wegen meines treuherzigen Discurs den Italianischen krieg anlangend. Darauf ich nicht hab unterlassen wollen dem herrn auf diese puncta mein meinung zu eröfnen. Was anbelangt, das ich im Reich verhast bin, das geschieht aus der Ursach, das ich dem Kayser gar zu wol gedient hab wieder ihr vieller willen; das ich mitt grosser macht friedt machen thue, das ist racjon denn si vis pacem, para bellum. - das ich weich, wenn ich was angreif, wie es mitt Stralsundt undt Magdeburg geschehen ist, da denn gar also wehr, so wehr es nicht bös, denn non est inconstantis sed prudentis mutare consilium in melius; solches auch die fornembste Generäle gethan haben, als Prinz Moritz vor Geldern (?) undt Brill Spinola vor Bergen op Soon, graf Tilly vor Nieburg. Von Stralsundt bin ich nicht gewichen, neben allen dem schönen provision so die Kayserliche Arme hett, sondern hab ein solchen reputirlichen acord mitt ihnen gemacht, als vielleicht je ein General mitt einer statt gethan hatt. Mitt Magdeburg hab ich nicht angefangen gehabt zu tractiren wie der von Questenberg das schreiben datirt hatt, dahero sie von diesen Sachen bey hof discurirt undt nicht Churfürstliche ministri geschrieben haben, denn sie solches aus meinem schreiben genomen, in welchen ich ihnen geschrieben hab, das ich zu precaviren, auf das die hanfestet nicht in die äußerste Desperacion gerathen, sich mitt Schweden undt holländern völlige conjungiren, dann andern malcontenten im Reich auiso geben, sich zu ihnen zu schlagen undt zu rebelliren ich mitt ihnen werde friedt machen müssen, was denn vor 5 Tagen geschehen ist, undt ich nicht allein die sache componirt, sondern auch die stett dermassen derivirt, das sie gewiß itzunder mehr als je zuvor in Ihr Matt. devocion seindt. Dieweil ich nun in dieser opinion bin beym Wolstandt, wenn unser herr was verhencken thete, wessen hette ich mich zu getrösten. Damit man aber nicht vermeinen solle, das ich die Resolucion im Zorn nehmen thue, als will ich damitt bis auf künftigs ordinari diferiren.


|
Seite 111 |




|
dies hab ich allein dem herrn communiciren wollen, wie man mich tractiren thuet, undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 12. Octob. 1629.
Der herr darf sich zu Wien keiner sach mehr so starck annehmen, wie mein meinung zuvor gewest ist, über 3 tag werde ich ihm mein resolucion zuschreiben.
* Nr. 25.
Der herr halt aus meinem jüngsten schreiben vernommen, das ich wegen des von Questenberg schreiben mitt meiner resolucion bis zu diesem ordinari innhalten werde. Nun weis der herr in was vor labirint izunder alle unser sachen gerathen, denn wem wir ansehen, der ist unser feindt, vom Hof aus hab ich in nichts kein assistenz, sondern viel mehr impedimenta beim Wolstandt, Wie man meine acciones explicirt. Was geschehe nicht, wenn etwas unglückseligs, wies in krieg zu geschehen pflegt, solte erfolgen, undt was mehr ist, wenn der fürst mitt todt abgehen solle; alle Chur undt fürsten ja meniglich muß ich mir wegen des Kaysers zu feinden machen undt was der consideracionen mehr seindt. Als hab ich vermeint, doch con bell modo mein carico als Capiten General de terra ferma zu resigniren, undt den Generalat auf der See zu behalten auch das Volck so in Pomern und des Churfürsten von Brandenburg landen, Anhalt undt Stiefter losirt wegen der See undt Seecordon zu defendiren, unter mir zu behalten; doch nicht alle zeitt dürfen persönlich darbey sein. Undt dieweil ich den herrn hoch estimiren thue undt ein groß vertrauen zu ihm hab, bitt er schreibe mir deswegen sein meinung zu undt ich verbleibe hirmit des hern guttwilliger
A. h. z. M.
Halberstadt 14. Oktober 1629.


|
Seite 112 |




|
P. S. Ich bitt da noch der fürst ein Verdrus wegen des schreibens hatt, der herr sehe ihm solches zu benehmen, denn mich betrübts bis in todt, denn dieweil ich dem fürsten so viel obligirt bin, bezeugs mitt Gott, das ich lieber will sterben, als das er soll disgustirt werden wegen meiner.
* Nr. 26.
Ein solches schreiben hab ich dem herrn von Questenberg gethan, wie der herr melden thuet. Der herr weis, das das Volk so in Polen ist dieser Örther nicht losieren kan, dahero denn oder in Schlesien oder oben im Reich. destwegen mir denn der herr expresse order zu schreiben, auf das die Churfürsten nicht sagen, das ich solches wieder Ihr Matt. willen thue undt der herr sehe, das er mir die order mitt der ersten ordinari schickt, denn non datur medium, wollen sie krieg führen, menagiren, dem Reich gusto und nicht disgusto durch die einquartierungen geben, so suchen sie ihnen unsern Herr Gott zum General undt nicht mich im wiedrigen dieweil ich die sach nicht anders werde anstellen können eher denn Ihr Matt. ein so merklicher Undienst unter meinem Generalat geschehen solte, so muß ich sehen wie ich mich dessen distrigiren werde. Der herr weis selbst alle die Ursachen. Darumb seh es der her zu richten; ists doch nur bis auf den Maijum angesehen, dies muß man darbey gedenken. Der Kayser muß das Volk wiederumb cumplieren oder wir werden von den feinden überrascht undt sprevisti gefunden werden, bitt der herr schicke mir mitt der ersten ordinari die gathegorische antwort oder in Schlesien oder oben ins Reich undt das man die schuldt nicht nacher mir giebt, das ichs wieder Ihr Matt willen thue, undt verbleibe hirmit
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 20. Oktob. a. d. 1629.
Herrn Hern Obristen
Sant Julian zuzustellen. Wien.


|
Seite 113 |




|
* Nr. 27.
Der Herr wirdt Zweifls ohne zuvor informirt sein worden, wie der duca Savelli, wie ich dem Ob. Hatzfeldt in Vorpomern das Comando gegeben, seines welschen Wuchs nicht vergessen, sondern, unter dem pretext eines flus, der ihm in die Achsel gefallen, sich von seinem Regiment absentirt undt bis dato nicht erscheint. Nun ist dem Kayser wenig mitt seinen Romanischen competenzen gedient, dahero denn ich resolvirt bin das Regiment einem andern zu geben. bitt aber der herr rede mitt ihm, das ers selbst lieber renuncirt denn solches wirdt ihm rühmlicher sein; thuet ers nicht so will ichs in continenti einem andern geben; undt da dem also wehre wegen des flusses in die Achsel sollst er albereit 8 oder 9 monat absent, welches ihm ein schlechte reputation giebt. bitt der herr sehe wie er mitt zuthun des herren Zerda ihn dahin disponirt, das ers vor sich selbst thuet. Thuet ers nicht, der schadt ist sein, ich wills . . . . als dem andern vergeben, bitt aber der herr thue das seinige darbey auf das lieber, da er anders ihm selbst nicht im weg will sein, mitt guttem geschicht undt er solches durch ein schreiben alsbalden von mier sucht undt ich verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 25. Octob. 1629.
Adresse wie oben.
* Nr.28.
Ich vernehme das der graf Johan gegen den Gülichischen Landen sein Zug genommen hat undt daselbst invernieren würdt, nun würdt Neuburg grosse exclamaciones machen, der herr muß dem fürsten sagen er solle preoccupiren denn es kan nicht anders sein. Hier schicke ich dem herren auch ein post script von dem graffen von papenhaim welcher


|
Seite 114 |




|
beym herren Tilli gewest ist undt mich dies avisirt, der herr communicirs dem herrn Zerda undt ich verbleibe hirmitt
des h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt den 25. Octob. 1629.
* Nr. 29.
Gleich izt kompt die ordinari, ich verhofe der herr von Questenburg wirdt albereitt auf dem weg sein, will mitt ihm wegen aller sachen schliessen, ich vernehme das der Savelli hofkriegsrath ist worden undt das er zuvor sein Regiment hatt wollen resigniren, aber graf Colalto hatt gesagt er solle gemach thun bis ich solches an ihn werde anbringen lassen, bitt der herr treib es izt fort undt sehe das ers mitt diesem ersten ordinari resignirt, auf das ichs strecke denn es ist sehr abkommen, niemandt nimbt sich nicht darumb an; was anbelangt die Schlesische Quartir, der herr Questenberg schreibt mir, das sie auf des landtags schlus warten; das taugt nichts, den rechten landtag will ich erst Ihr Matt. machen. Das Volck ist in desperacion, darumb bitt ich man diferir darmitt nicht, man nimbt das von Dona. das ist auch nichts werth, denn er begehrt nur sein Regiment undt kein anders hinein, bitt der herr mache dem baldt ein endt, das man dem grafen von Colalto plenipotenz schickt zu tractiren; weis nicht ob er den frieden gern sieht in Italien; wegen der Provisionen in Elsaß will ich die Anordnung thun. Der Graf von Dampir darf keine Riter nicht bringen bis in sein Winterquartir ich aber verbleibe hirmitt
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt 26. Octob. 1629.
Adresse wie oben.


|
Seite 115 |




|
* Nr. 30.
Mitt dem vorigen ordinari hab ich dem herrn geschrieben wegen des duca Savelli das er sein Regiment resigniren soll, dieweil nun der herr izt in Schlesien ziehen thuet, als bitt ich, der herr sehe, das er solches vor des herren verreisen thuet. er muß nicht exemplisiciren mitt etlichen so ihre Regimenter haben undt nicht assistiren; er ist nicht aus denen, welchen mans wegen ihrer langwähriger Dienst bewilligt, er gedencke auch nicht, das etwan ein intercession ihm helfen köndte. bitt also der herr sehe, das es gewis undt in continenti geschieht. Benebens hab ich den herrn noch erinnern wollen, er solle drauf bedacht sein, doch keinen menschen solches communicieren, wenn das volck wirdt losirt sein, wie wir etwan 60000 Strich korn auf der Oder vor die armee aus den quartiren werden bekommen in gleichen etwan 3000 Cent: lunden, wie auch etwan 100 wägen mit Zwillich, bedeck vor die Arteleri undt etwan 600 Pferdtdecken mitt ihren geschirren, denn so baldt das volck würdt losirt sein, so will ich Ihr Matt. bitten sie wollen in Schlesien anbefehlen, auf das solches dem herrn geliefert wirdt. wenn der herr von Questenberg wirdt zu mir kommen, so will ich ihm die commission geben, aber izt will ich noch nicht aussprengen undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt 28. Octob. a d. 1629.
Adresse wie oben. Wien.
* Nr. 31.
Der herr halt mir dieser tagen geschrieben, das Ihr Matt. dem grafen von Colalto die plenipotenz den frieden zu tractiren geschickt haben; nun hab ich dies darbey zu erinnern vor nöthig erachtet, welches ich bitt der herr dem


|
Seite 116 |




|
Fürsten vorbringe, das der Graf den Frieden daselbst gar nicht gerne sehen thuet, denn hette er dem fürsten das vorgebracht, was ich ihm von Dobran wegen des welschen Kriegs wie der accord mitt dem Consales geschehen war, zugeschrieben undt nacher von Küstrau auch das ich mich mitt den Spaniern conformirt, das mans erst auf den zukünftigen friling solte anfangen, so wehre die sach nie so weit gerathen, denn wie er zu Wien ist gewest, so hatt er Ihre Matt. undt dem Fürsten was ihm gefallen hatt vorgebracht. Nacher hatt man mir auch solche ordinanzen auf sein vorbringen zukommen lassen, das ich durch etliche bin afrontirt worden in deme man dem Merode befohlen hatt, wenn ihm von anderwerths ein befelch köme, auf mich meinendt, er solle aus Binden ziehen, so solle er demselbigen nicht nachkommen, es ist aber nie mein ernst gewest Binden zu verlassen, allein die Spanier zu schrecken, das sie besser mitt der underhaltung sollen zuhalten. Izt ist von nöthen das der fürst dextramente darmitt umbgeht, denn der tractiren soll die arma undt verstandt hat kan leicht so viel clausulen fünden, das zu keinem schlus nicht kompt, dies bin ich im gewissen schuldig zu avertiren, denn es ist pro bono publico, das in Welschlandt friedt würdt, sonsten versichere der herr den fürsten, das mein will allezeit dahien wirdt gericht sein wo der seinige, undt wegen seiner nicht allein alle molestien der welt willig will ausstehen, sondern auch das leben lassen undt verbleibe hirmitt.
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt 29. October 1629.
* Nr. 32.
Hiebey schicke ich dem herrn das schreiben an den Camer Presidenten, gefelts dem herren das also gutt ist, so verpetschier es der herr undt übergebe ihms undt sehe das er die sach vor seinem verreisen richtet und unterschriebener hatt, er sage das er nicht darf verreisen bis er dies in henden wirdt haben, denn er wehre destwegen geschickt worden, undt dieweil sie werden wollen, das der herr forth soll, so werden sie dies auch alsbalden expediren. ich bitt der herr


|
Seite 117 |




|
bring es durch, denn wenn der President abzieht undt ein anderer kompt, so werden viel mehr diliculteten, denn der ander wirdt nicht von allem wüssen wie die tractaten zwischen uns gangen sindt. Der herr schencke liberatissimamente an alle orth wo es von nöthen thuet, denn dies consolidirt mir alles was ich bekommen hab, darumb spare er kein gelt, sehe nur das baldt geschieht undt ich verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 2. November 1629.
* Nr. 33.
Aus beylag wirdt der herr sehen, wie der Calvinische herzog von Lüneburg bey hof practicirt, das man der herzogin zu Braunschweig das anricht undt mir, dieweil ich sie aus Kaysers befehlich inmitirt, den afronto thun will. Bitt derowegen den herrn, hatt er mir je ein Dienst gethan, so welle er sich dieses mitt eifer annehmen, undt nicht aufhören, bis der auspracticirte befehlich revocirt wirdt undt mir solche revocation zugeschickt, wie auch befohlen, ich solle die herzogin darbey manuteniren. Der herr sei versichert, das ich solches mitt so danckbarem gemüth werde annehmen, als wenn er mir noch ein landt von Mechelburg zu weg gebracht hette, undt verlasse mich genzlich auf den herrn das er solches wirdt zu gewünschtem endt bringen, daführ ich ihm denn gewis zum allerhöchsten werde verobligirt bleiben undt verbleibe hirmitt des herr gutwilliger
A. h. z. M.
Halberstadt den 18. Novemb. 1629.
* Nr. 34.
Ich vernehme, das der her Zerda auf seine güter verreist ist, nun hab ich ihm diese tag geschrieben, dieweil Ihr


|
Seite 118 |




|
Matt. so ungern an die Schlesische quartir kommen, so will ich das volck ins Reich losieren, aber wenn die Churfürsten werden schreien, so excusire mans bey hof. Ich habe ihm auch geschrieben, er solle Ihr Matt. bitten auf das sie in Schlesien befehlen, das sie heuer 100 m Strich korn auf der Oder nach Wolgast schicken sollen, denn dahie werden wir gewis den Winter über nicht brot wegen des Müßwachs, haben, bitt derowegen der herr nehme sich darumb mitt eifer an, ich will auch nicht das der von Dona soll die Disposicion darüber haben, denn ich weis wie er mir zuvor gethan hatt, dessen ich mich zu ihm nie versehen hette, aber der herr muß sich darumb annehmen, denn es ist seines thuns, wie auch der Ob. Aldringer sich zuvor dessen allezeit angenehmen. Das getreidt wirdt müssen diesen Winter zu der Oder geführt werden, undt auf den friling auf Wolgast gelassen, es müssen auch die fürsten undt stendt das schief undt fuhrlohn bezahlen. bitt der herr feiere nicht darmitt, sondern greife baldt zum werck, denn die Zeitt lauft uns hien, ehe dann wir uns versehen. Die Schlesier werdens auch gar gern thun, damitt sie von der einquartirung befreit werden und ich verbleibe hirmitt
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt den 19. Novemb. 1629.
P. S. Des graf Dampirs reiter ziehen ins Reich er wirdt mügen zu mir kommen undt erst über ein par monat recruten machen.
* Nr. 35.
Der Doctor Oberkamp würdt ihm wegen etlicher meiner sachen, wie sie sollen gericht werden schreiben, bitt er seh es aus solche weis zu richten undt je eher je lieber mir es sein wirdt. der herr solicitire starck, das allen Chur undt fürsten mein investitur communicirt wirdt, wie nicht weniger das das bando Imperiale wieder die Herzog von Mechelburg ergeht. Das der Savelli sein Regiment resignirt, bitt der herr mahne ihn, denn ich werde gewis nicht auf


|
Seite 119 |




|
ihn warten sondern will ein andern Ob. dem Regiment führstellen undt verbleibe hirmitt
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt den 25. Novemb. 1629.
Adresse wie oben. Wien.
* Nr. 36.
Ich bitt der herr überantworthe dies beyliegendts schreiben dem fürsten undt schicke mir wiederumb die antworth undt wenn meine sachen werden expedirt sein undt wegen der 100 m Strich korn aus Schlesien vor die armada die Anordnung gethan, als wirdt der herr sich wiederum hieher verfügen können. Der herr sehe das der duca Savelli baldt macht wegen der resignacion seines Regiments, der herr wirdt mich darmitt obligiren. Dem Maxen sage der herr warumb er mir so selten schreibt, ich aber verbleibe
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt. den 26. Novemb. 1629.
Adresse wie oben. Wien.
* Nr. 37.
Ich zweifl nicht, das der herr wirdt mein undt des Doctors Oberkamps schreiben empfangen haben, in welchem ich dem herrn zu wüssen gethan, das der Doctor Oberkamp ihm wirdt zuschreiben, auf was vor weis mein privilegium de non apellando soll ausgefertigt werden, bitt derowegen den herrn ganz fleissig er woll es auf solche weis ausfertigen lassen. Dem Maxen sage der herr, er wirdt mir


|
Seite 120 |




|
wol können auf meine schreiben antworten undt ich verbleibe hirmitt
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt. den 30. Novemb. 1629.
P. S. Der herr sehe das alle meine sachen baldt ausgefertigt undt untergeschrieben werden.
Wegen des getreitds aus Schlesien sollicitire der herr fleissig.
* Nr. 38.
Aus beylagen wirdt der herr sehen, was mir der graf von Nasau schreibt, nun überschicke ich ihm das schreiben allein deßwegen, das er sehen soll, das man im Niederlandt nicht aufhören will die 7000 man von Kayser zu begehren; ich aber keineswegs sie nicht entrathen kan, denn auf den friling wirdt man wol sehen, was vor feindt alles gegen dem Kayser sich erzeigen werden undt wir nicht volck genug haben ihnen allen zu resistiren; dahero denn ich den herrn bitten thue, er wolle beim fürsten preocupiren, auf das er der Spanischen botschaft zur antwort giebt das Ihr Matt. des volcks nicht werden auf keinerley weis entrathen können, sondern solle die Infantin ermahnen, sie sollen daselbst ihre arme strecken, auf das auf den friling sie sich vom volck nicht entblöst befinden ich aber verbleibe hirmitt
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt. den 2. December 1629.
Nr. 39.
Copia des kayserlichen Decrets Mechelburgischen Kauffschilling betreffend. Von der Röm. kay. auch zu Hungarn undt Boheimb konigl. Majtt. unserm allergnädigsten herrn, der Krieges Rath Cammerern undt bestellten Obristen herrn heinrichen Freyherrn


|
Seite 121 |




|
von Sant Julian hirmitt in gnaden zur vermelden, daß allerhöchst ernante Ihr Kay. Maytt. gnädigst vernomben, waß er herr Obrister in nahmen Ihr. fürstl Gnaden herrn Albrechten, herzogen zue Mechelnburg, Friedland und Sagan u. s. w. wegen des S. f. Gnaden überlassenen herzogthumbes Mechelnburg undt der darzugehörigen Fürstenthumb, Graffschaft, herschafften undt länder mitt überreichung des über selbiges herzogthumb undt länder, durch höchstgedachter Ihr Kay. Maytt. respective Kriegs undt Hoff=Cammeräthen bestellten Obristen undt obristen Veltwachtmeistern zu Roß undt Fueß, herrn Johann von Aldringern Freyherrn undt herrn Reinharten von Walmerode, der jhärlichen ertragung halber gemacht, undt ausgesetzten, Sich auf sechs und achtzig Tausent ein undt siebenzig ein halben Reichsthaller undt neunzehn schilling drey ein halben pfennig erstreckenden anschlags gehorsambist angebracht, undt zugleich wegen allergnädigster ratification dieses anschlags in unterthänigkeit gebetten hatt undt Ihr Kay: Maytt. darauf sich gnädigst erkläret, soviel das haubtwerkh anlangt es bey der einmal vorgegangenen investitur, undt darüber Sr. fürstl. Gnaden allbereitt wiederfahrener würklicher belähnung als römischer Kayser gnädigst undt allerdings bewenden zu lassen Betreffent aber den Kauffschilling, dessen man sich nach vergangener ordentlicher Aestimation undt schatzung mehrberührten Fürstenthumb undt länder einkommen vermüge der beiderseits aufgerichten nothurfften zu vergleichen, ob wollen Ihr Kay. Maytt. befinden, daß in bemeltem anschlag weder der Contribution oder des fueß gelds (wie man es nennt) noch der Zöll, Mauth, ungelt, der Pergwerkh Aperturen undt ander extraordinari anlangen, welche gemeiniglich ein mehreres als die ordinari gefell ertragen, gar nicht getacht undt also der Anschlag für Ihr Kay: Maytt. (der ansehnligen Regalien, so seine Fürstl. Gnaden darbey überkomben, gänzlich zu geschweigen) gar zu genau einzogen worden: So wollen Sie jedoch in gnädigster ansehung undt erwegung Sr. fürstl. Gnaden bißhero in allen occasionen zu dero unsterblichem ruhm erwiesenen und noch immerdar zu Ihr. Kay. Maytt. allergnädigstem belieben, mitt daransetzung leibs undt lebens continuirenden weldkündigen gehorsambisen ansehligen undt hochersprießlichen Dienst, deroselben alles, so etwan der weitere Vergleich mit sich bringen undt begreiffen möchte, ohne fernere tractation der aufrichtung einer Neuen oder weiteren Kaufs aus Kay. Milden gnaden freywillig nachgesehen undt mehrbenambtes herzogthumb


|
Seite 122 |




|
Mechelburg sambt denen darzu gehörigen undt einmahl eingereumten Fürstenthumb, Graff: herrschaften undt landen ohne anspruch der ertragung allein mit nachfolgenden Contributionibus gnädigst überlassen haben.
Nehmlich das Erstlich aller undt ieder sich darunter befündenden geistlichen gütter eine ordentliche separation gemachet.
Fürs ander von Sr. f. Gnaden die auf den herzogthumb Mechelburg undt zugehörigen Fürstenthumb undt landen hafftende rechtmessige undt liguitirte schulden gegen Refaicirung der zu Prag verwilligden gnade per sieben mahlhundert dausent Gulden reinisch, den der aufgewendeten Krieges Kosten ohne Ihrer Kays. Maytt. entgelt, entrichtet undt abgestattet werden.
Fürs dritte, daß Sr f. Gnd. daßjenige, so die Contribuciones von ihrem Fürstenthumb, herrschafften undt Gütter in Königreich Böhmen undt herzogthumb Schlesien über die ihr von dero daselbst in Böhmen angelegten Summen geldes gebührende, Sechs per Cento interesse jezt oder ins Künfftige mehrers antreffen werden, allemahl gutwillig zu tragen undt an gehoriges orth abführen. *
Undt zum Vierdten und letzten dem beyderseits verglichenen revers, so von Ihr. Kay. Maytt. undt Sr f. Gnd. gefertiget worden undt sie bey handen haben, zum Cassiren zurückgeben undt einstellen laßen. Deßen auf allerhöchstgetachter Ihr Kay. Maytt. Allergnädigsten undt Special befehlich man ihm herren Obristen auf anfangs erwehntes Sein gehorsambistes anbringen undt bitten, hierdurch zu Seiner nachrichtung es Sr. fürstl. Gnaden also gebührendermaßen anzudeutten hirmitt erinnern sollen.
Undt verbleiben Ihr. Kay. Maytt.
Per Imperatorem. 8. Decembris
1629.
* Hierzu findet sich von Wallensteins Hand die Randbemerkung:
"Dieser Punkt muß ausgelassen werden, denn was mehr als die Interesse austragen von den contribucionen einkompt, darvon wirdt mir das capital der 900 m R. bezahlt undt ich dieserwegen ein diploma von Ihr. Matt., so mir a. 1625 ist gegeben worden, hab."


|
Seite 123 |




|
* Nr. 40.
Aus des herrn schreiben vernehme ich, was er mir wegen des fürsten von Egenberg indisposicion schreiben thuet, welches mich in der sehlen betrübt, denn ich gewis mein besten freundt dardurch verliehren müste; verhofe aber zu Gott, das er ihn noch weiter zu der Christenheit wolfarth erhalten wirdt. Was anbelangt das getreidt, hette ichs zwar lieber auf der Oder aus Schlesien, aber wirdts nicht sein können, so sehe der herr, das ein theil auf der Elb undt ein theil auf der Oder hinunder geschickt wirdt, denn wir haben ja das volck nicht zu unterhalten. Die Mechelburgischen Pauern werdens müssen nacher zu landt in vorPommern führen, aber der herr sehe, das man gewis auf die Zahl der 100 m Strich kompt. Ich wolle gern den Nuncio glück wünschen, das er Cardinal ist worden, aber hab zum ersten kein welschen dahie, der mir das Schreiben vor ihn macht, nacher möchte er mir Ezelenza perlatesta geben, welches mir nicht lieb wehr, der Cardinal Barbarino undt ander geben mir alle alteza. Bitt der herr sehe, das ich baldt mein erlaubnis kan nach Gitschin zu ziehen bekommen, denn von heitt über 4 Wochen will ich auf sein, mich aber dorten nicht lenger als 6 Wochen aufhalten undt gleich wiederumb nach dem Reich begeben, dahien denn der herr mitt allen meinen sachen, so expedirt worden, auch komme undt dieselbigen mitt bringe. Der Savelli macht mir mitt der renunciacion gar zu lang, underdessen geht das Regiment in mallhora, ich werd es müssen vergeben undt verbleibe hirmitt
des herrn guttwilliger
A. h. z. Fr.
Halberstadt den 10. Decemb. 1629.
P. S. Was der Pater Manio wegen des princen aus Polen angebracht hatt, sehe ich nicht das Ihr Matt. ein Dienst daraus erfolgen solle, aber darvon mündlich zu Gitschin. Die Kosaken bedarf ich nicht, das teutsche Polnisch volck werde ich ohne das bekommen.
Adresse wie oben. Wien.


|
Seite 124 |




|
* Nr. 41.
Aus des herrn schreiben vernehme ich, das der fürst gern sehen thete, das ich das Regiment dem Savelli lassen solte, nun ob zwar der Savelli besser taugt mitt Cardinalen zu Rom cumplimenta zu machen, als im krieg sich zu gebrauchen, dazu das Regiment so schwach undt schlecht ist gewest, das sie nicht 1000 man kranck undt gesundt in der lista eingeben, so wolle ich doch ungeacht dies alles auf des fürsten befehlich gethan haben, dieweil ich S. l. groß obligo tragen thue, berichte aber dem herrn, das ich das Regiment albereitt vor 10 tagen zu reformiren anbefohlen undt solches albereitt ohne allen Zweifl wirdt erfolgt sein, dahero denn, wenn ich schon wolte, so kann ichs nicht mehr remediren. Da aber S. l. bifohlen, undt in welschlandt von denen Regimentern eins vacanter wehre, so könndte man ihn, nicht wegen seiner, aber auf des fürsten befehlich acomodiren. Sonsten halt der Max ein befehlich mitt dem herrn ein sach zu communiciren darauf ich mich denn referiren thue. Der herr kann wegen des Savelli dem fürsten durch herrn Zerda, wenn der herr nicht selbst mitt S. l. reden kan, die sach vorbringen lassen, denn gewis wegen der grossen obligi, so ich dem fürsten hab, will ich das eußerste thun undt meiner natur gewalt thun auf das dero befehlich vollgezogen wirdt undt verbleibe
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt. den 4. Jan. 1630.
Adresse wie oben. Wien.
* Nr. 42.
Aus des herrn schreiben vernehme ich, das er alle sachen gericht halt nur des Topii nicht, sag dem herrn fleissig Danck deßwegen. was des Topii sach anbelangt, wenn der herr von Questenberg wirdt auf Wien kommen, undt man daselbst mein meinung wol vernehmen, so wirdt man gar kein bedenken darin haben; dahero lasse der herr dieselbige


|
Seite 125 |




|
nur unexpedirt. Was die 100 m Str. korn anbelangt, da bitte ich der herr sehe das solches oder das gelt dafür verschaft wirdt, auf das mans gewis zu anfang Aprillis kan haben. Der herr rede mit dem Brunco (?) ja auch der Spanischen botschaft gar, das ichs sehr gern sehen thete, wenn der Brunco etwan umb die Lichtmes sich bey mir zu Gitschin befünden thete, denn ich wolle unterschidliche sachen des Königs dienst betrefendt mitt ihm conferiren, wenn der herr seine sachen wirdt gericht haben, so komme er auch auf Gitschin undt bringe sie mitt, insonderheit aber wegen des getreidts ein richtickeitt. undt ich verbleibe
d. h. g.
A. h. z. M.
Halberstadt. den 7. Jan. 1630.
* Nr. 43.
Wegen des Topij sach.
Solches er Ihr Matt. schreibt, dieweil die Abschrift dessen bey gelegt ist, dem Ob. Sant Julian zu communiciren undt ihn bitten, er solle sehen die sach dahien zu richten auf das mir Ihr Matt. commission geben über die sach mich zu erkundigen undt dem beleidigten zu billickeitt verhelfen. Dieser ist sonsten Chatholisch kan viel dem haus von Oesterreich dienen in sonderheitt in den Niederlandten undt das ich den Sant Julian laß bitten, er solle dies werck als wenns mein eigen weher ihm anbefohlen sein lassen wirdt mich gewis obligiren.
Die welchen man bitten soll Ihr Matt. wollen zum herrn annehmen.
Er ist verheirat mitt des Barnefeldts tochter gielt viel bey dem Prinzen von Oranien ist ein wol intencionirter man zum Frieden, wirdt gutte dienst leisten können auf alle weis sehen, das man ihms zu wege bringt. sehe deßwegen bey dem fürsten preocupiren undt das ja heraus bringen.


|
Seite 126 |




|
Nr. 44.
Albrecht von Gottes Gnaden.

Wolgeborner besonders lieber Her Obrister; Waß unß Ihr Kays. Maytt. wegen des herrn Churfürsten zur Brandenburg Liebden zuschreiben undt benebenst deroselben entschuldigung, warumber Sie auf den außgeschriebenen Churfürstl. Collegialtag nicht erscheinen khönnen, übersenden thuen, Solches hat der Herr auß beyliegenden Abschriften mit mehreren zu ersehen. Wie wier nun gerne sehen daß des herrn Churfürsten zur Brandenburg Lden. in diesen Satisfaccion bekhommen möchten, gleichwoll daß Volkh auß erheblichen Ursachen nicht abgeführet werden khann,
Alß wird der herr doch in Bedacht sein, solchs Anstellung zu machen, daß Ihr Ldn. in allen, waß mensch undt müglich gratisicirt wirde, damit dieselb nicht Ursach haben, sich zu beschweren, daß dero Lande undt Leith vorsetzlicher Weiß ruinirt werden. Welche er dann rechts zu thuen wißen wirdt.
Geben Carlsbadt den 28. Aprilis 1630.
A. h. z. M.
Adresse. Dem Wolgebornen unserm besonders lieben Herrn Heinrichen Freyherrn von St Julian Röm Kay. May. KriegsRath Cammerern bestellten Christen undt GeneralCommissario.
Beilage.
1) Mittheilung ad Mandatum Imperatoris von der Entschuldigung Kurbrandenburgs wegen Nichterscheinung auf dem Regensburger Convento.
Als Beilage hiezu:
Churbrandenburg entschuldigt sich auf den Churf. Convent nit erscheinen zu khönnen umb willen er seine Länder bey seiner Zurückkunft auß Preußen ganz desolirt befunden, daß er auch seinen Unterhalt für sich undt die seinigen


|
Seite 127 |




|
schwerlich werde zu gewartten haben, stehe auch in Zweiffel ob ihr May: darbey suchende höchst rümblichen scopus werde khönnen erhalten werden, wenn diejenigen mit denen der fried zu tractieren nit an der stell und sich etwan hernach an den churfürstl Schluß nit verbunden zu sein erachten würden.
Bittet deßwegen für entschuldigt zu halten, "sondern gnedigst zu verhelfen"
1) daß das Volkh auß seinen landen abgeführt oder zum wenigsten die seiner Residenz negst gelegene Ämbter, so dem St Julianischen Regiment in 16 Monaten nahend 300000 Rth. contribuiret ohne den starkhen Rest, so noch darüber von selbigen Regiment praetendirt werden,
2) daß die Stad Frankfurt an der Oder der monatlichen 9000 thaler contribution erledigt,
3) In den Quartirn mit dem unterhalt solche billichkeit zu verordnen, damit gleichwoll zwischen den gehorsamben Stenden undt feinden ein Unterschied gehalten werde.
4) Weiln das Pappenheimbische Regiment auß der alten Mark abgeführt wirdt, kein ander volkh mehr daselbst einzulegen. Wenn Ihr May. ihne hierin erhören und ihm sonsten müglich sein würdt bey derselben sich gehorsambst einzustellen, wolle er sich darauf weiters erklären daß dieselbe seine treugehorsambiste Affection zu dero großte contento vermerkhen werden.
Nr. 45.
Torquato Conti schreibt à Son Altesse den Kurfürsten von Brandenburg, daß der König von Schweden noch diesen Sommer seine Unternehmung auf deutschland mache, daß er die Absicht habe das Ufer der Oder zu gewinnen und zu beherrschen und daß deshalb die Festungen in Stand zu setzen und mit guten Garnisonen zu besetzen waren.
Nr. 46.
11. Mai 1630. Oberst Wengersky ist mit dem Oberst Torquato Conti in Streit sowol über Truppendislocirungen in Meckelnburg wie auch über Proviantlieferung


|
Seite 128 |




|
Torquato Conti antwortet von Colberg 11. May
1630. Herr Obrist Sant Julian, Hatzfeldt undt
Wir habens die Austheilung des Volcks so wol wie
die besatzung des Landts Mechelburg, als dessen
was zu Veldt ziehen muß umb Mechelburg und
Pommern zu succuriren wie nicht weniger die
Austheilung der Proviandt . . . . mit einander
gemacht - aber kein effect dabei . . . . gehet
darüber übel bezeugen wir vor Gott, den Kayser
und dem General

Nr. 47.
4. Juni 1630.
Meldung über das Vorrücken der Schweden in Preußen von dem Landvogt zu Scheke (?).
Kaiserliches Mandat an die schlesischen Truppen nach Pomern zu ziehn vom 27. Mai 1630.
Schreiben des Königs Sigismund von Polen an den VeltMarschall Torquato Conti (in Abschrift).
Hochwolgeborner besonders lieber Herr. Derselbe hat sich gutermaßen zu erinnern, waß wier vor diessem uf sein begehren wegen haltung guter Correspondentz mit den unserigen bey dießen gefehrlichen leuften an ihne schriftlich abgehn lassen.
Undt weilen wir da von den unserigen glaubwürdig bericht worden waßgestalt der Gustavus mit deme die Zeithero im Fürstenthumb Preußen habenden Schwedischen Volkh nunmehr von dannen aufzubrechen, daßelbe über die Weichsel zu setzen undt gegen den pommerischen Grentzen, wieder daß kheyserliche Volkh einzuführen vorhabens sein solle.
Alß haben wir hierauf nit underlaßen durch die unserige weilen es wieder die neulicher Zeit aufgerichte Compactata lauft bey dero Cantzlarn Axelio Ochsenstern umb gewießerer nachricht willen dießfalls erinnerung thun zu lassen. Worauf da von ihme dieße Antwort erfolget, daß er von den Jenigen, so umb der Kayserlichen Consilien gute Wießenschaft haben sollen, gewieße Nachricht eingezogen, daß die Khay. Soldatesca dahier intentionirt sey in obgemelt Fürstenthumb Preussen einzufallen undt sich etlicher Pässe undt örtter daselbst zu be=


|
Seite 129 |




|
mechtigen. Dannenhero dießeß unsers Khönigreichs Proceres, gleichsamb wider das Khays. Volkh aufzuwickheln vermeinet undt derentwegen hierauf gute zuhalten anermahnen thuet, zu welchem ende er den auch zur Verhütung solchen einfalß ein volkh dahin zu commendiren verursacht worden wehre.
Derowegen wir den ohnumbgenglichen notturft zu
sein erachtet den herrn solches zu seiner
nachrichtung in vertrauen drch Zaigern dießes
eigenen Kosaggs eilfertig zu avisiren, damit er
sich hiernach zurrichten undt in einem undt
andern, sowol wegen eröfnung der Consilien, alß
auch der antworten gefahr halben deß feindes den
sachen preveniret werdten möge. Inmaßen er
seiner habenden dexteritet nach den sachen, wie
recht zu begegnen, wißen wirdt. Wolten
 .
.
Geben in unserer Statt Warschau den 31. Mai 630
Sigismundus Rex.
Ahn herrn Velt Marschall
Torquato Conti.
Nr. 48.
Vom 4. Juni 1630 wird aus Preußen gemeldet, daß Gustav Adolf aus Schweden bereits abgereist sei und daß er gegenwärtig 36 Regimenter habe.
(Bericht Wolffs von Kreuzern Landtvoigt zu Scheke (?)
4 Briefe des Banquier Hanns de Witte an St. Julian.
Quittungen über eingezahlte Summen a Conto Wallensteins.
* Nr. 49.
Ich berichte ihn, das der hans de Wite an mir nicht erbar handelt, denn er mir das gelt nicht, wie sich gebührt erlegen thuet, dahero denn der herr sehe ihm von dem


|
Seite 130 |




|
asignirten gelt keines mehr zu erlegen, sondern sehe, das er mir etwan einen andern kaufman ernennt, dem man das gelt würdt abführen können, denn ich mitt dem ehrvergessenen schelmen nichts mehr will zu thun haben, das gelt aber bitte ich, er sehe so viel es immer müglich ist das er zusammen bringt, auf das ich wegen meiner von Ihr Matt. expensen kan contentirt werden undt verbleibe.
 .
.
Meiningen den 2. Sep. 1630.
Adresse wie oben, ohne Ort.
Nr. 50.
Mando a S. S. la letera de credenza per la cita de Wratislavia V. S. gli potera prometer, che sarano liberi passato il mese de Julio; a le compagnia de Nasau no sono obligate dar niente, perche il lor quartiro e. a. Franckenstein. Jo mandare le due comp. che stano a Namschel nel imperio al colonello de Arcim (?) V. S. potera meter dentro quelle Comp. nove armandole che so cerano adesso e con sul fine vostro
afecionatissimo de sua S.
A. duca de Fridland.
Cosla 10 de Julio 1627.
Anm. Ein Blatt, wahrscheinlich von Wallensteins Hand, ohne Adresse, jedenfalls an einen der italiänischen Officiere gerichtet, vielleicht an Torquato Conti.


|
[ Seite 131 ] |




|



|


|
|
:
|
IV.
Ueber
die Familie Grelle und von Grelle.
Von
Dr. G. C. F. Lisch.
In den Untersuchungen über den meklenburgischen Adel ist oft von der Familie Grelle die Rede gewesen, welche eine gewisse Berühmtheit dadurch erlangt hat, daß es erwiesen ist, daß sie in der neuen Geschichte die erste bürgerliche Familie war, welche ohne Beschränkung mit adeligen Lehngütern belehnt ward; vgl. Extra Sendschreiben, 1843, S. 167.
Woher die Familie stammt, ist ungewiß; aber im 16. Jahrhundert war sie in Wismar ansässig und in Ansehen. Jürgen Grelle war 1530 † 1553 Burgemeister zu Wismar, eben so Hieronymus Grelle 1588 † 1591; vgl. (Crull) Verzeichniß der Bürgermeister zu Wismar.
Hermann Grelle kaufte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Gut Damekow, und dies ist die erste, bisher bekannt gewordene Erwerbung eines adeligen Lehngutes durch einen Bürger in der neuen Geschichte. Damekow war ein altes Lehn der adeligen Familie vom Sehe oder See. Diese wohnte im 16. Jahrh. in mehrern Gliedern auch in der Stadt Wismar, so z. B. 1546 Hans vom Sehe und 1534-1550 Joachim vom Sehe Rathmann zu Wismar. Hermann Grelle kaufte Damekow in zwei Theilen. Im J. 1570 kaufte "Hermann Grelle, Bürger in Wismar", von dem "Lehnmann Hans vom Sehe zu Damekow", damals zu Tatow wohnhaft", dessen väterliches Erb- und Lehngut im Dorfe Damekow, nämlich dessen "beide Höfe


|
Seite 132 |




|
und Erb= und Lehngut", und ward am 15. März 1570 von dem Herzoge Johann Albrecht damit "zu einem rechten Mannlehn" ohne Beschränkung und in derselben Form, wie jeder andere Lehnmann, "belehnt". Am 15. Mai 1584 kaufte der Lehnmann Hermann Grelle "zu Damekow" von Burchard vom Sehe zu Eikhof, damals zu Wismar wohnhaft, den übrigen Theil von Damekow, nämlich "einen Bauhof und 6 Hufen Landes", welche Burchard vom Sehe von seinem Vetter Joachim vom Sehe, Rathmann zu Wismar, ererbt hatte, und am 29. Nov. 1584 gab der Herzog Ulrich zu diesem Verkaufe seinen "Consens". Seitdem wurden die Grelle immer als Lehnträger betrachtet. Hermann Grelle starb 27. Febr. 1615 und seine Söhne 1 ) Hermann, Joachim und Jacob mutheten am 4. Jan. 1616 das Lehn.
Am 29. März 1611 kaufte "Hermann Grelle zu Wismar wohnhaft und zu Damekow erbgesessen" von der v. Bülow' schon Vormundschaft das Lehngut Madsow, welches seit dem 15. Jahrh. im Besitze der Familie von Bülow gewesen war, und am 4. Jan. 1612 ward er von dem Herzoge Adolf Friederich damit als zu "rechtem Mannlehn" belehnt.
Es ist zwar mitunter behauptet, daß die Wismarsche Familie Grelle adeligen Ursprunges sei; dies läßt sich aber durchaus nicht nachweisen und wahrscheinlich machen, und die Familie selbst hat es nie behauptet. Es gab im Mittelalter in Westpreußen und Hinterpommern eine alte adelige Familie von Grell, welche im J. 1809 ausgestorben ist. Bagmihl im Pommerschen Wappenbuche, III, S. 176, welcher diese Familie behandelt, sagt, daß "diese Familie auch in Meklenburg begütert gewesen sei und dort 1628 die Güter Damekow und Madsow besessen habe, welches letztere nach 1775 "im Besitze eines Herrn von Grell" gewesen sei, und v. Penz sagt in seinem Verzeichniß des Meklenburgischen Adels (Jahrbuch XI, S. 467): "Grelle, ein alt Pomerisches Geschlecht, wovon 1628 hier zwey zu Damekow und Madsow wohnten. Da sie aber hiernächst ihren Adel verloren haben, so hat der jetzt zu Madsow wohnende die Renovation vor einigen Jahren vom Kayser wieder erhalten."


|
Seite 133 |




|
Diese Darstellungen beruhen aber auf rein willkührlichen Annahmen. Es läßt sich weder die Abstammung der Wismarschen Grelle von den pommerschen von Grell nachweisen, noch sind die Wappen beider Familien gleich, indem die Pommerschen Grell im rothen Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte silberne Lanzen und oben und unten einen goldenen Stern und auf dem Helme eine roth gekleidete gekrönte Jungfrau mit einem silbernen Ringe in jeder Hand führten. Auch haben die Wismarschen Grelle nie den Adel behauptet; sicher ist es, daß sie nie als Adelige angesehen und anerkannt sind.
Es ist jetzt das Adelsdiplom der Wismarschen Grelle aufgefunden, dessen Mittheilung Hauptzweck dieser Zeilen ist. Dieses beweiset unwiderleglich, daß sie erst im J. 1777 geadelt sind. Am 15. März 1777 wurden Otto Dieterich und Carl Ludwig Grell auf Madsow von dem Kaiser Joseph "in den Adelsstand erhoben." Sie hatten nur vorgebracht: ihre Vorältern hatten seit Jahrhunderten in dem Herzogthume Mecklenburg Güter besessen und solche seien unter die Adeligen mitgerechnet worden. Von einer Renovation eines alten oder verloren gegangenen Adels ist nicht die Rede. Auch ward ihnen nicht das Wappen der Pommerschen von Grell bestätigt, sondern ihr bisher gehabtes Wappen als adeliges verliehen.
Hier folgt das Diplom im vollständigen Auszuge.
Wir Joseph der Andere, von Gottes Gnaden
Erwehlter Römischer Kayser - - - -
----------------------------
----------------------------
"Wann Uns von denen beyden Gebrüderen, Unseren und des Reichs lieben Getreuen Otto Dieterich und Carl Ludwig Grell allerunterthänigst vorgetragen worden, welcher gestalten ihre Voreltern, vermög deren Uns beygebrachten glaubwürdigen Zeugnißen, seit Jahrhunderten in dem herzogthum Mecklenburg Güther besessen und solche unter die Adeliche mitgerechnet worden seyen, der größte Theil ihrer Lehen=Güther aber wäre durch Brand und Unglücksfälle, besonders durch die dreysigjährige Kriegsdrangsale aus ihrem Eigen=


|
Seite 134 |




|
thum gekommen, daß nun nach der Zeit das einige Lehen Guth Madsow annoch bey ihrer Famille geblieben, und von ihme Otto Dieterich Grell eigenthümlich besessen und bewohnet werde; Wie dann einer aus ihrem Geschlecht, derer Grell, die ansehnliche Bürgermeister=Stelle in der Stadt Wismar bekleidet, welcher im Jahr Fünfzehen hundert drey und Fünfzig gestorben und in Wismar begraben seye, auch ihre Voreltern und sie selbsten Uns und dem heiligen Römischen Reich ihre allerunterthänigsten Dienste ohnausgesezt geleistet, und sich jederzeit adelicher guter Sitten und Wandels beflissen hätten; Und Uns dahero sie beyde Gebrüdere allerunterthänigst gebetten, daß Wir sie, in Betrachtung ersterzehlter vorzüglich gegen Uns und das heilige Reich sich erworbenen Verdiensten, in des heiligen Römischen Reichs Adelstand aus Allerhöchster Kayserlichen Milde zu erheben geruheten, welche unschätzbare Gnade sie gegen Uns und das heilige Reich lebenslang mit allerunterthänigstem Dank zu verehren erbietig seyen, solches auch wohl thun können, mögen und sollen.
So haben Wir dem nach aus erstangeführten Unser Kayserliches Gemüth bewegenden Ursachen mit wohlbedachtem Muth, gutem Rath, und rechtem Wissen, ihnen, Otto Dieterich und Carl Ludwig, Gebrüderen Grell, die Kayserliche Gnade gethan, und sie samt ihren ehelichen Leibes=Erben, und derenselben Erbens=Erben, beyderley Geschlechts, absteigenden Stammens, für und für, in des heiligen Römischen Reichs Adelstand gnädigst erhoben, eingesezt, und gewürdiget, auch der Schaar, Gesell= und Gemeinschafft anderer adelichen Personen dergestalt zugesellet, zugefüget und verglichen, als ob sie von ihren Vier Ahnen, Vätter= und Mütterlicher Seits, in solchem Stand herkommen und gebohren wären."
--------------------------
--------------------------
"Ferner, und zu mehrerer Gedächtnus dieser Unserer Kayserlichen Gnade haben Wir ihnen, Otto Dieterich und Carl Ludwig Gebrüderen Grell, ihren ehelichen Leibes=Erben, und derenselben Erbens=Erben, beyderley Geschlechts, ihr bishero gehabtes nachfolgendes adeliches Wappen verliehen, und in alle Zeit zu führen gnädigst gegönnet und erlaubet; Als einen gantzen rothen mit zwey silbernen Querbalcken belegten Schild, in dessen oberen Abtheilung rechts ein goldener Stern und zwey goldene Lilien, in der mitteren drey, und in der unteren Abtheilung abermahls zwey goldene Lilien neben einander zu ersehen; Auf dem Schild ruhet ein


|
Seite 135 |




|
offener, adelicher, blau angeloffener, roth gefütterter, rechtsgekehrter, goldgecrönter, zur Rechten mit roth und silbernen, und zur Lincken mit roth und goldenen herabhangenden Decken, auch umhabenden Kleinoden, gezierter Turniershelm; Worüber zwischen zweyen mit roth und silber abwechselnden Adlers=Flügel mit einwärts gekehrten Sachsen, ein goldener Stern erscheinet; Wie solch=adeliches Wappen in Mitte dieses Unsers Kaiserlichen Gnaden=Briefs mit Farben eigentlichen entworffen und gemahlet ist.
--------------------------
--------------------------
Wir haben über dieses noch zu mehrerer Bezeigung Unserer Kayserlichen Gnade ihnen, Otto Dieterich und Carl Ludwig Gebrüderen Grell, und ihrer ehelichen Nachkommenschafft, beyderley Geschlechts, gnädiglich gegönnet und erlaubet, daß sie nun hinführo in ewige Zeiten gegen Uns, Unsere Nachkommen, Römische Kaysere, deren Canzleyen, und sonsten männiglich, in allen ihren Reden, Schrifften, Handlungen und Geschäfften sich von Grell, wie nicht weniger von allen ihren mit rechtmäßigem Titul besitzenden oder künfftig noch überkommenden Gütheren, nennen und schreiben, von männiglich auch also genennet und geschrieben werden sollen und mögen."
--------------------------
--------------------------
"Mit Urkund dieses Briefs, besiegelt mit Unserem Kayserlichen anhangenden Insiegel, der geben ist zu Wien, den Fünffzehenden Tag Monats Martii, nach Christi Unsers lieben Herrn und Seeligmachers gnadenreichen Geburt, im Siebenzehen hundert Sieben und Siebenzigsten, Unsers Reichs im Dreyzehenden Jahre.
V. R. Fürst Colloredo.
"Ad Mandatum Sac. Caes.
Majestatis proprium.
"Franz Georg von Leykamp.
Collat. und registr.
M. H. Molitor
mppr."


|
[ Seite 136 ] |




|



|


|
|
:
|
V.
Zur
Topographie der Pfarre Klütz
Von
Dr. G. C. F. Lisch.
In den Jahrbüchern XII, S. 392 flgd. ist die Topographie der Pfarre Klütz gründlich untersucht. Das Land um Klütz war in den ältesten Zeiten Wald und hieß der Wald Klütz ("silva Clutze"), später der Klützer Ort, d. i. Ecke oder Winkel, weil das Land wie eine Ecke in das Meer weit vorspringt. In dem Walde entstanden durch Ausrodung zahlreiche niedersächsische Dorfanlagen, von denen viele den Namen - Hagen führen. Daher ist der "Klützer Ort" eben ein solches Hagenland, wie das Hagenland Drenow zwischen Rostock und Doberan, wenn jetzt auch ohne bemerkbare Reste von alten Volkseigenthümlichkeiten 1 ).
Der Hauptort des Klützer Ortes war das alte Dorf, jetzt Flecken Klütz, in welchem sich schon früh eine Kirche mit einer großen Pfarre bildete. Die bedeutendsten Orte dieser Pfarre waren seit alter Zeit die Ortschaften Klütz und Tarnewitz, welche schon früh an ritterliche Familien zu Lehn gegeben wurden, Klütz an die von Plessen, Tarnewitz an die von Tarnewitz, welche ohne Zweifel von diesem Gute den Namen führten; die von Plessen sind noch jetzt in dieser Gegend ansässig, die von Tarnewitz sind im 17. Jahrhundert ausgestorben.


|
Seite 137 |




|
Eine Eigenthümlichkeit ist es, daß bei den beiden Hauptorten Klütz eine große Menge kleinerer Ortschaften entstand. Bei Tarnewitz lagen z. B. Hof Tarnewitz, Hof Ober=Tarnewitz (jetzt Oberhof), Tarnewitz, Groß=Tarnewitz, Nieder=Tarnewitz, Tarnewitzerhagen, Güldenhorn, Lindenhase, Wittenborgerhagen. In den neuesten Zeiten ist bei Tarnewitz noch eine bisher unbekannte Ortschaft entdeckt. In dem Wismarschen Zeugebuche (f. 45) entdeckte Herr Dr. Crull folgende Stelle:
"1520. Eyn bosegelt breff vppe hundert m. houetstols imme Vinckenhagen, so Hinrick Tarneuissen imme Klutzer orde tokamet, vorsegelt."
Hier wird offenbar ein Tarnewitzisches Gut Vinkenhagen im Klützer Ort aufgeführt. Lange ist nach der Lage dieses Gutes vergeblich geforscht. Endlich fand sich in den alten Lehnacten folgende Nachricht vom 26. April 1582, welche auf die rechte Spur zu leiten scheint.
"Die beiden Höfe alß Vinckenborg und Güldenhorn, beide im Tarnewißerhagen bei der Mühlen belegen, sind jewerle Hofehäue gewesen und von den Tarneuißen gebauet im Nieder=Clutz"
Es scheint nicht zweifelhaft zu sein, daß Vinkenborg der Hof zu Vinkenhagen war. Vinkenburg lag also bei Güldenhorn; Güldenhorn, in früherer Zeit auch ein Rittersitz, ist aber in den jetzigen Oberhof, einiger Acker auch zu Christinenfeld und Tarnewitzerhagen übergegangen.
Vinckenborg und Güldenhorn werden "Hofehäue" genannt, ein Ausdruck, welcher selten vorkommt. Ich erkläre ihn durch Hofhöfe, d. i. Wirthschaftshöfe oder kleinere Ritterhöfe, welche zum Hauptrittersitz gehören. Der Plural von: hof lautet im Plattdeutschen noch jetzt: "häve".


|
[ Seite 138 ] |




|



|


|
|
:
|
VI.
Bischof Nicolaus I. Böddeker
von Schwerin,
von
C. D. W.
Nachtrag zu Jahrb. XXIV, S.
24 flgd.
In der früher gegebenen Skizze von dem Leben des Bischofs Nicolaus I. von Schwerin ist gesagt, daß derselbe 1425 zuerst als Pleban an S. Marien zu Wismar vorkomme und sein Nachfolger in diesem Amte zunächst 1446 genannt werde. Nach späteren Entdeckungen war M. Böddeker aber schon 1423, Julii 8., Pfarrherr zu S. Marien und bekleidete dies Amt noch 1440, Januar 3.
Zu den Beweisen seines Wohlwollens gegen Verwandte und seines Eifers in guten Werken, welche ihm a. a. O. vindicirt sind, kommt eine Urkunde, welche neuerdings in das Wismarsche Raths=Archiv zurückgelangt ist. Der Bischof hatte nach derselben eine Muhme - Moddere -, welche sich im Kloster zum H. Kreuz in Rostock aufhielt, aber dort nicht förmlich eintreten konnte, da es dem Kloster an Mitteln zum Unterhalte für dieselbe fehlte. Deshalb schenkte der Bischof dem Kloster 500 Mark Sundisch und legte dann dem Convente die Bitte vor, nach dieser Besserung des Vermögens seiner Verwandten nunmehr die Aufnahme zu gewähren, welchem Ansinnen der Convent denn auch sofort laut der 1457, März 30. ausgestellten Urkunde, Anlage, entsprach. Der Bevollmächtigte des Bischofs bei diesem Vorgange war Timotheus, Prior der Karthause zu Marienehe.


|
Seite 139 |




|
Anlage.
Das Kloster zum H. Kreuz in Rostock bezeugt den Empfang einer Schenkung von 500 M. Sund. Seitens des Bischofs Nicolaus I. von Schwerin und dafür die Aufnahme dessen Muhme Gese Köllen in das Kloster
Wii Laurencius Kuleman, commissarius, Dorothea Hagemester, priorissa, vnde gantze sammelinge des closters tome hilgen Crutze to Rostke vor vns vnde vnse nakomelingen bekennen vnde betugen witliken apembare vor alsweme an desseme vnsen apembreue, dat de werdige ghestlike vader here Tymotheus, prior tor Carthu e sz to Marienee, van weghen des erwerdigen in god vaders vnde vnses gnedigen heren heren Nicolawes, bisschoppes to Zwerin, an vnser allen ieghenwardicheit ghelesen hefft ene cedulen, dar he vns ene copien van gaff, van worden to worden aldus ludende.
Erwerdigen, jnnigen iuncfrouwen vnde leuen sustere in Cristo Jhesu vnseme heren. De erwerdige in god vader, vnse gnedige here van Zwerin begheret wol, dat syne moddere, de gii hiir myt juw hebben, mochte hiir entfangen werden an juwen orden vnde myt juw hir deme almechtigen gode denen, beyde dach vnde nacht, vnde leuen na der regulen sancti Benedicti in willigem armode, kuscheit vnde horsame vnde anderen doghetsamen ovingen to der ere des almechtigen godes dorch erer sele salicheit hir to vorweruende myt der hulpe godes. Doch so is deme suluen vnseme gnedigen heren wol witlik, dat gii noch gheringhe hebben van tiidliken guderen vnde iarliken tynsen, also dat gii nicht wol mere personen konen voden van den guderen des closters, wan gii nu tor tiid hebben, vnde dar vmme ok nene personen mere moghen entfangen, wan der nu ieghenwardich sint in desseme clostere, dorch der vorhedinge willen des paweses Bonifacii octaui, capitulo periculoso de regularibus, libro sexto, jd en were denne, dat juwes closteres gudere also vele me e r worden verme e ret, dat gii mere personen konden voden sunder brok nodtroftiger


|
Seite 140 |




|
dinge. Hiir vrnme so denket de sulue vnse gnedige here van syneme vrigeme wilkore de gudere desses closters to vormerende to der ere des almechtigen godes dorch siiner sele salicheit also vele, also eme dunket, dat me ene persone kone mede voden vnde entholden sunder brok notroftiger ding, de dar leue na der regulen sancte (!) Benedicti vnde den gesetten des ordens Cisterciensis, vnde dar to so antwerde ik van vnses gnedigen heren wegen juw viffhundert Sundesche mark, dar gii senden iarlike renthe mede kopen, de to ewigen tiiden schoten blyuen by dessem clostere, jsset, dat de personen des closters, de nu sint, vnde ere nakomelinge blyuen an der bewaringe der regulen sancti Benedicti. Weret ouers, dat god vorbede, dat gii edder juwe nakomelinge wedder afftreden van. der bewarenge der regulen sancti Benedicti vnde den anderen ghesetten der tilgen Romeschen kerken edder des ordinis Cisterciensis, so scholen alsodane renthe, gekofft myt dessen vifhundert marken, gantzliken wesen an der schikkinge des suluen vnses gnedigen heren vnde komen, dar syne gnade se wert hennegheuende mundliken effte an syneme testamente edder myt loffwerdigen breuen. Vppe alsodane vorword vnde myt alsodanen beschede so antwerde ik juw desse vitfhundert Sundesche mark.
Vurder mer bekennen wii Laurencius, commissarius, Dorothea, priorissa, vnde gantze sammelinge bauenscreuen, dat wii van deme vorgescreuen ghestliken vadere priore tor Carthu e sz in sulker vorscreuen wiise myt sodanen vorworden vnde vorbeschede desse bauenscreuen viffhundert mark rede euer entfangen hebben in gudeme golde vnde grauen Stralen vnde Rosthker schillingeren (!), dar wii den vorbenomeden vnsen gnedigen heren van Zwerin van qwiteren ieghenwardigen an desseme breue. Vnde als wii denne sodane vifhundert mark entfangen hadden, so hofft de sulue erbenomede werdige ghestlike vadere here Tymotheus, prior tor Carthu e sz, an vnser allen bauenscreuen ieghenwardicheit gelesen noch ene cedulen aldus ludende:
Erwerdigen leuen juncfrouwen. Also nu aldus vormeret sind de gudere desses closters also vele,


|
Seite 141 |




|
dat me dar mogheliken euer personen mach van vorwesen an notroftigen dingen, also biddet de erwerdige in god vader vnse gnedige here van Zwerin vnde ik van syner wegen, dat gii dorch god willen entfangen syne modderen anjuwen orden, vppe dat se myt juw moghe denen deme almechtigen gode de tiid eres leuendes an willigeme armode, kuscheit vnde horsame vnde anderen doghetsamen ovingen na der regulen sancti Benedicti vnde willen er mede deylen van den guderen desses closters de ding, de er nod sint to eres lyues berghinge ghelik den anderen personen juwes closters dorch de beloninge des almechtigen godes.
Also bekennen wii vurder, dat wii de innigen juncfrouwen Gheszken Kollen, vnses leuen gnedigen heren van Zwerin. moddere, slichtes vmme godes willen jn vnsen orden sancti Benedicti vor ene sustere an vnse clostere myt gantzer werdicheit leffliken vnde dangknamyghen entfangen hebben an ovinge vnses orden vnde vele guder doghet to denste deme almechtigen gode vnde vnses closters gudere mede to brukende lik vnsen anderen leuen susteren. In orkunde vnde tuchnisse alle desser bauenscreuen ding so hebben wii des conuentes vnses closters ingesegele myt willen, witschop vnde gudeme medewetende henget vnde hengen beten vor vnde an dessen breff, de gheuen vnde screuen is na der bord Cristi vnses leuen heren dusent verhundert amme souen vnde veftigesten iare des mydwekens na deme sondage Letare Jherusalem in der vasten.
Nach dem Originale im Raths=Archive zu Wismar auf Pergament in Querfolio. An einem Pergamentbande ist das Siegel mit grüner Wachsplatte angehängt, welches aber ein Bild nicht mehr klar erkennen läßt. Auf der Rückseite steht von einer Hand des funfzehnten Jahrhunderts:
"Littera provisoris et priorisse ac tocius conuentus monasterii sancti (!) crucis in Rostock super quingentis marcis Sundensibus donatis per reuerendum in Cristo patrem et dominum dominum Nicolaum episcopnm Zwerinensem."


|
[ Seite 142 ] |




|



|


|
|
:
|
VII.
Oberst Otto Hoppe von Schwerin.
Ein gemaltes Stammbuchblatt, im Besitze des Herrn Pastors Ragotzky zu Triglitz, correspondirenden Mitgliedes des Vereins, mit einem Wappen mit Schild und Helm, jedes mit 3 grünen Hopfenranken an Hopfenstangen auf silbernem Grunde, hat folgende Inschriften:
(Wappen.)
Zu stetß wehrender gedechtniß vndt Bruderlicher affection schreibe Ich Endeßbenanter dem wollEdlen Besten vndt Manhafften H. Hallensteiner von Mantauß, anhero geschehen zu Troppau den 9. Juny Anno 1627.
Otto Hoppen von Schwerin
itziger Zeit b. Obristen
Baudissin Regimente.
Anm. Ein Wolf Heinrich v. Baudissin commandirte im 30jährigen Kriege ein kaiserliches Regiment; später war derselbe kursächsischer Generalfeldmarschall. - Der Oberst Otto Hoppe von Schwerin ist eine sonst unbekannte Person, und war sehr wahrscheinlich ein durch den Krieg begünstigtes Schweriner Stadtkind. In unbedeutenden Stadt=Acten wird im 17. Jahrhundert der Bürgername Hoppe einige Male beiläufig genannt.
G. C. F. Lisch.


|
[ Seite 143 ] |




|



|


|
|
|
- Hünengrab von Kronskamp
- Hirschhorn-Streitaxt von Lüsewitz
- Feuerstein-Zapfen von Neukloster (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 117)
- Kegelgrab von Gädebehn Nr. 2
- Bronze-Messer von Crivitz
- Bronze-Messer von Schwerin
- Bronzefund von Hinzenhagen
- Bronzeschwert von Sukow
- Bronzeschwert von Warbelow
- Bronzeschwerter von Dörgelin
- Bronzeschwert von Groß-Methling
- Bronzeschwert von Rosenow
- Bronzeschwert von Neuhof
- Begräbnißplatz von Naudin
- Begräbnißplatz von Leussow
- Gläserner Spindelstein von Dämelow
- Glasperlen von Toitenwinkel
- Steinalterthümer von Lydien
- Bronzene Leuchter-Figur von Schwerin
- Bronzene Leuchter-Figur von Rostock
- Die Kirche zu Lohmen
- Der Dom zu Schwerin (Nachtrag zu Jahrb. XXXVI, S. 148 und 172 flgd.)
- Kirche und Reliquien-Urne von Stöbelow
- Kirche und Reliquien-Urne von Leussow (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 193 flgd.)
- Die Kirche zu Picher (Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 195)
- Die Kirche zu Warnemünde : [Nachtrag]
- Die Kirche zu Frauenmark (Nachtrag zu Jahrb. XXV, S. 282)
- Die Kirche zu Severin
- Die Kirche (Kapelle) zu Schlieven
- Die Kirchen zu Karchow, Zielow, Damwolde, Melz, Wendisch-Priborn, Lärz, Krümmel
- Die Kirche zu Kittendorf
- Die Kirche zu Mollenstorf
- Die Kirche zu Kirchdorf auf Pöl (Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 308)
- Die Glocken der Kirche zu Dobbertin
- Glocken der Kirche zu Bützow
- Glocke von Walkendorf
- Glocke von Gr. Tessin
- Glocken der Kirche zu Steffenshagen
- Glocke von Lehsten
- Glocke von Qualitz
- Glocken der Kirche zu Vellahn
- Glocke von Klinken
- Glocke zu Consrade
- Glocke von Gr. Vielen
- Glocke von Gr. Godems
- Glocke von Peccatel bei Schwerin
- Glocke von Krakow
- Glocke von Dobbin
- Die Kirchen zu Spornitz, Dütschow, Blievensdorf, Herzfeld und Karenzin (Präpositur Neustadt)
- Die Kirche zu Paarsch
- Die Kirche zu Lutheran
- Die Kapelle zu Bergrade
- Die Kapelle zu Benzin
- Die Kirche zu Friedrichshagen
- Die Kirche zu Pinnow in der West-Priegnitz
- Die Kirche zu Gr. Varchow
- Die Kirche zu Kieth
- Die Kirche zu Grambow
- Die Kirche zu Karow
- Die Kanzel der Kirche zu Zarrentin
- Das Siegel des Klosters Ivenack
- Ueber das Siegel des Nicolaus von Oertzen (in Jahrb. XXXIX, S. 223)
- Ein Siegel des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg
- Das Siegel der Universität Rostock
- Römergräber in Meklenburg : Römische Alterthümer von Häven
B.
Jahrbücher
fürAlterthumskunde.


|
[ Seite 144 ] |




|


|
Seite 145 |




|



|


|
|
:
|
I. Zur Alterthumskunde
im engern Sinne.
1. Vorchristliche Zeit.
a. Steinzeit
Hünengrab von Kronskamp.
Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 115.
Das Steingrab (Dolmen) zu Kronskamp bei Lage ist in Jahrb. a. a. O. nach einem mündlichen Berichte des Herrn Pächters Witt beschrieben. Herr Witt hat später folgende genauere schriftliche Mittheilungen über das Grab gemacht. Das Grab stand in der großen Wiese des Reknitzthales, 80 Fuß vom Acker entfernt, am Fuße eines ziemlich hohen Berges, den man dort den Tempelberg nennt. Das Grab war ungefähr 8 Fuß lang und 6 Fuß breit und von mächtigen, glatten Granitblöcken aufgebauet; der Deckstein, welcher leider gesprengt ward, war "von ungeheurer Größe". Die Ecken des Grabes waren mit kleinern Steinen verzwickt. Der Feuersteinkeil, ein "Streitkeil" welcher in dem Grabe Pfunden ward und jetzt vom Herrn Witt eingesandt ist, ist 15 Centimeter (6 1/4 Zoll) lang und sehr schön polirt und scharf geschliffen, ein Zeichen, daß auch in großen, alten Steingräbern polirte Feuerstein=Geräthe vorkommen.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 146 |




|



|


|
|
:
|
Hirschhorn= Streitaxt von Lüsewitz.
Der Herr Landsyndicus a. D. Groth zu Rostock schenkte, durch Vermittelung des Herrn Amtmanns Burchard, eine Streitaxt aus Hirschhorn, welche im Herbst 1874 im Torfmoor zu Lüsewitz bei Rostock gefunden ist. Die Axt, aus dem Rosen= oder Wurzelende eines starken Hirschhorns, ist 12 Centimeter lang. Das Schaftloch ist unten viereckig und oben oval, vielleicht um zur bessern Befestigung des Schaftes hölzerne Keile von unten einzutreiben.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Feuerstein=Zapfen von Neukloster.
Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 117.
Ueber die zu Neukloster auf dem Felde gefundenen Feuerstein=Zapfen oder Spitzen, erachtet der Herr Geheime Regierungsrath und Conservator von Quast auf Radensleben bei Neu=Ruppin, unser verehrtes correspondirendes Mitglied, zur Erklärung im Januar 1875 Folgendes. "Bis in sehr neue Zeit hinein war es hier üblich, daß der hier noch jetzt wie in Meklenburg herrschende Haken (nur im Lande Ruppin und Löwenberg 1 ) an dem Unterholze, das auf der Erde streift" (in Meklenburg Hakenhöft und Resterbrett) an der Unterseite mit Löchern eingebohrt ward, in welche möglichst passende Feuersteinzapfen eingelassen wurden, die das Holz gegen das Verreiben durch die Erde schützten; erst neuerlich hat man statt dessen Eisenschienen untergelegt. Sollten die zu Neukloster gefundenen Feuersteinzapfen nicht zu diesem Zweck gedient haben, da der Meklenburgische Haken mit dem hiesigen völlig identisch ist"? - (In südöstlichen Ländern Europas sollen ähnliche Splitter und Zapfen aus Feuerstein auch zu Vorrichtungen zum Korndreschen verwandt werden).


|
Seite 147 |




|



|


|
|
:
|
b. Bronzezeit
Kegelgrab von Gädebehn Nr. 2.
In dem Forstrevier von Gädebehn bei Crivitz stand nicht weit von dem 1873/74 aufgedeckten, in den Jahrb. XXXIX, S. 125 beschriebenen Kegelgrabe ein ähnlicher, größerer Hügel, auch ein Kegelgrab. Der runde Hügel war sehr breit und 4-5 Fuß hoch, am Rande umher auch mit größeren "Feldsteinen" eingefaßt und fast ganz mit "Feld=
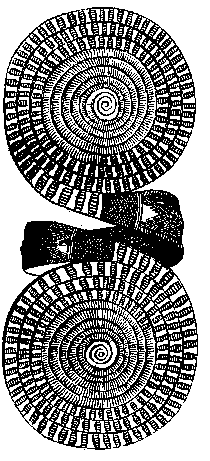
steinen" (erratischen Geschieben) angefüllt. Der Hügel ward von vielen Arbeitern unter sorgsamer und theilnehmender Leitung und Aufsicht des Herrn Försters Kolbow zu Gädebehn im Winter 1874/75 abgetragen und erwies sich ebenfalls als ein Kegelgrab der Bronzezeit. Auf dem Boden lagen:
neben größern, also nicht verbrannten Menschenknochen, welche aber sehr morsch waren und zerbrachen,
zunächst folgende voll gegossene, schön verzierte Alterthümer aus Bronze, welche mit edlem Rost bedeckt sind, im Gesammtgewicht von 4 Pfund:
zwei gleiche sogenannte "Handbergen", Armringe mit zwei auslaufenden Spiralplatten, wie sie in Meklenburg häufig gefunden und hieneben und Frid. Franc., Taf. IV


|
Seite 148 |




|
abgebildet sind, freilich etwas zerbrochen, aber doch in den Bruchstücken vollständig vorhanden;
zwei gleiche breite, flache Armringe, mit Schrägestrichen ganz so verziert, wie die Ringe an den Handbergen, also diesen gleich, wie Frid. Franc., Taf. XXII, Fig. 8,
zwei gleiche schmälere und dickere Armringe, von ovalem Durchschnitte, mit Querstrichen verziert, wie sie in Meklenburg in Kegelgräbern der älteren Bronzezeit häufig gefunden sind, wie Frid. Franc., Taf. XXII, Fig. 5.
Auf den Spiralplatten der Handbergen standen zwei kleine, hellbraune, thönerne Urnen:
eine ganz kleine Urne mit einem kleinen Henkel, 3
1/2 Zoll hoch, welche jedoch zerbrochen war,
aber in einer senkrechten Hälfte noch erhalten
ist,
und eine großere Urne, welche
jedoch ganz zerfallen war.
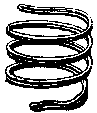
Bei diesen Alterthümern lag ein spiralförmig gewundener goldener Fingerring von doppeltem Golddrath von 5 bis 6 Windungen, von der Gestalt der hieneben stehenden Abbildung, 10 Gramm schwer. Die beiden Enden sind geschlossen. An einem Ende sind einige Gruppen von kleinen, dünnen Querstrichen eingefeilt oder eingeritzt. Goldene Fingerringe dieser Art sind in Meklenburg nicht sehr selten vorgekommen. Der vorliegende Ring ist sehr enge und paßt nur auf einem dünnen Finger, kaum auf einem dünnen kleinen Finger einer kleinen Manneshand.
Der Herr Förster Kolbow hat alle diese Alterthümer zur großherzoglichen Sammlung eingereicht.
Nach Metall, Form, Arbeit, Verzierung und Rost der Alterthümer gehört dieses Grab ohne Zweifel der älteren Bronzezeit an, wie solche Gräber in Meklenburg sehr häufig beobachtet sind, namentlich noch in den letzt verflossenen Jahren in der Gegend zwischen Parchim und Sternberg. Alterthümer wie die hier beschriebenen sind in den Schweriner Sammlungen, mit Nachweisungen, zahlreich vorhanden.
Nach der Mehrzahl der Alterthümer war dieses Grab ein Frauen grab. Sollte diese Vermuthung richtig sein, so würden die bisher noch nicht sicher bestimmten bronzenen sogenannten Handbergen auch zum Frauenschmuck gehören.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 149 |




|



|


|
|
:
|
Bronze Messer von Crivitz.
Im Sommer 1874 ward im Torfmoor der Stadt Crivitz 6 bis 7 Fuß tief ein Messer von Bronze, ohne Rost,gefunden und von dem Herrn Burgemeister Kothé zu Crivitz dem Vereine geschenkt. Das Messer, ohne Zweifel zu Handarbeiten bestimmt, ist ein sogenanntes Rasirmesser, von der bekannten Gestalt, wie solche Messer im Frid. Franc. Taf. XVIII, und in Worsaae Nord. Olds. Taf. 36 abgebildet sind. Das Ende des dünnen, drathartigen Griffes scheint in einen kleinen Thierkopf, Hunde= oder Pferdekopf, mit langem Maul und Ohr auszulaufen; diese Bildungen können aber auch die Gußzapfen sein. Beim Putzen haben die Finder den Griff leider abgebrochen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronze=Messer von Schwerin.
Der Herr Gürtler Günther zu Schwerin schenkte ein seltenes Bronze=Messer, welches er mit altemMessing zum Einschmelzen gekauft hatte. Leider ist die Spitze abgebrochen und verloren gegangen. Die Klinge ist ungefähr 4 Zoll oder 9 Centimeter lang gewesen und sichelförmig geschweift, hat also sicher als Messer gedient. Dieses Messer ist dadurch selten, daß der dünne stangenförmige Griff am Ende gespalten und spiralförmig einwärts gerollt ist, wie die Enden mancher Schwertgriffe, welche ebenfalls selten sind; vgl. Worsaae Nordisk. Oldsager, Taf. 31, Nr. 134 bis 136. Das Messer gleicht im Griffe den in Worsaae a. a. O. Taf. 33 Nr. 154 und 155 abgebildeten "vermeintlich symbolischen Nachbildungen von Schwertern", welche auch wohl Messer sein werden. Unser vorliegendes Exemplar ist nach der Gestalt der einschneidigen und geschweiften Klinge sicher ein Messer.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzefund von Hinzenhagen.
Im Anfange des Frühlings 1875 ward auf der Feldmark des dem Herrn Grafen Hahn auf Kuchelmiß ge=


|
Seite 150 |




|
hörenden Gutes Hinzenhagen bei Krakow ein seltener Bronzefund gemacht und für den Verein gewonnen. Es ward im Gehölze aus einem vormaligen Wasserloche Modererde als Dünger ausgegraben. Nachdem ungefähr 400 Fuder Moder ausgegraben waren, sah der die Ausgrabung leitende Guts=Inspector Schwager in einer Tiefe von ungefähr 4 Fuß neben Thierknochen und "viel Holz" auf einer Stelle beisammen viele Alterthümer liegen, welche derselbe sammelte und rettete. Unter dieser Moderschicht lag eine Schicht von "Moos", ungefähr 1 1/2 Fuß dick, und darunter weiße (wahrscheinlich mergelige) Erde, welche auch noch brauchbar war. Herr Schwager überbrachte die Alterthümer dem Gutsherrn Herrn Grafen Hahn, welcher sie jedoch dem Herrn Schwager schenkte. Im Anfange des Monats März sah der reitende Gensdarm Brinckmann II. zu Krakow auf einem Rundritt diese Alterthümer in Hinzenhagen und berichtete über den Fund eingehend an das Gensdarmerie=Commando zu Schwerin, welches mir den Bericht zur Kenntnißnahme mittheilte. In Folge dieser Vorgänge wandte ich mich an den Herrn Inspector Schwager, welcher auf meine Vorstellung und Bitte den ihm jetzt gehörenden Fund dem Vereine zum Geschenke machte.
Die Alterthümer bestehen zum größten Theil aus Bronze und gehören ohne Zweifel der jüngeren Bronzezeit an.
Die gefundenen Alterthümer sind folgende.
I. Bronzene Alterthümer, alle ohne Rost.
2 Diademe, mit schrägegestreiften Querreifen verziert, eines zerbrochen.
42 kleine Hütchen, ("tutuli"), 2 1/2 Centim. hoch, davon 36 gleich groß und verziert, 6 etwas kleiner.
30 dünne geschlossene Ringe von 3 Cent. Durchmesser und 3 Millimeter Dicke; von diesen Ringen sind 3 mal 3 Stück in einen vierten und 2 mal 2 Stück in einen dritten lose gehängt, ohne daß eine Spur von Oeffnung oder Löthung zu finden wäre, müssen daher so ineinanderhangend gegossen sein; 12 Stück sind einzeln.
2 kleine, dünne gewölbte Knöpfe von 2 1/4 Cent. Durchmesser, unten mit einer Oese.
2 dünne und schmale, halboffene Armringe, auf der Oberfläche mit Strichen und Puncten verziert, in 6 Stücke zerbrochen.
18 dünne, zusammengerollte und platt gedrückte Bronze=Bleche von 2 1/2 bis 3 1/2 Cent. Länge und 4 bis 5 Cent.


|
Seite 151 |




|
Breite, vielleicht Bekleidung oder Beschlag von Riemen oder dgl.
II. Außerdem wurden noch einige andere Alterthümer gefunden, welche wohl einer frühern Zeit angehören:
1 Streitaxt von Hirschhorn mit einem runden Schaftloche; die Beilschneide ist abgebrochen.
1 kleiner Schmalmeißel aus Feuerstein, roh zugehauen und nur an der Schneide geschliffen, 7 1/2 Centim. lang und 2 1/2 Cent. breit.
3 Scherben von großen thönernen Töpfen, welche nach heidnischer Weise bereitet und nicht verziert sind, vielleicht der Bronzezeit angehörig.
III. Endlich wurden auch mehrere kleine zerbrochene Thierknochen, z. B. vom Schaf, gefunden, darunter auch 2 kleine Pferdezähne.
Besondere Aufmerksamkeit erregen die 96 Bronzen. Der Fund gleicht an Styl, Arbeit und Zahl den beiden merkwürdigen Funden von Holzendorf (Jahrb. XXXIV, S. 220) und von Ruthen (Jahrb. XXXIX, S. 127), welche unter gleichen Umständen gemacht wurden. Diese beiden letzteren Funde sind nach unverkennbaren Zeichen ohne Zweifel Gießstätten der jüngeren Bronzezeit. In dem vorliegenden Funde von Hinzenhagen ist aber keine Spur von Gießerarbeit zu entdecken. Jedoch gehört der Fund sicher derselben Zeit an. Wahrscheinlich bildet der Fund den Vorrath eines Händlers, der vielleicht auch ein Gießer war und an der Fundstelle in einem Pfahlbau wohnte, wie aus dem "vielen Holz" in dem Moder, auch aus den Topfscherben und den Thierknochen zu schließen sein dürfte.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzeschwert von Sukow.
Im Jahre 1865 ward zu Sukow, A. Crivitz, beim Torfstechen im Moor ein Bronzeschwer t mit Griffzunge gefunden und an die großherzogliche Alterthümersammlung abgeliefert.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 152 |




|



|


|
|
:
|
Bronzeschwert von Warbelow.
Der Herr Gutsbesitzer Otto auf Warbelow bei Gnoien hat Sr. Königlichen Hoheit dem Großherzoge für die Großherzoglichen Sammlungen ein zu Warbelow gefundenes Bronzeschwert zum Geschenk überreicht, welches vollständig wie neu erhalten und frei von Rost, also in einem Moor gefunden ist. Das Schwert ist wie gewöhnlich die Bronzeschwerter gestaltet, zweischneidig mit erhabenem Mittelrücken; jedoch hat die Klinge keine Längslinien zur Verzierung am Mittelrücken oder sonstige Verzierungen und Spuren von Griffbefestigung, sondern ist ganz glatt. Die Klinge ist ungefähr 26 Zoll lang; die Griffzunge, welche nur die Gestalt einer dünnen viereckigen Stange von ungefähr 3/4 Zoll Breite hat, ist ungefähr 6 Zoll lang.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzeschwerter von Dörgelin.
Zu Dörgelin bei Dargun wurden in der Waldung unter einem großen Steine zwei Bronzeschwerter gefunden und von dem Finder an das großherzogliche Amt Dargun und von diesem an das großherzogliche Antiquarium eingeliefert. Die Klingen sind von lebhaft grünem edlen Rost bedeckt und tief durchdrungen, so daß sie nur noch einen schmalen Erzkern haben; daher sind die Schneiden ganz abgebrochen. Die längste Klinge, welche in der Mitte beim Herausgraben aus der Erde zerbrochen ist, ist ungefähr 22 Zoll lang und hat einen mit Linien gut verzierten Mittelrücken. Die zweite Klinge ist 17 Zoll lang und hat zwar einen erhobenen Mittelrücken, ist jedoch ganz glatt.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzeschwert von Groß=Methling.
Auf einer Erbpachthufe zu Gr.=Methling bei Dargun ward beim Aufräumen eines Grabens ein kurzes Schwert von Bronze mit Griffzunge gefunden, und von dem Erbpächter dem wailand Herrn Staatsminister a. D. v. Lützow


|
Seite 153 |




|
Exc. auf Boddin übergeben, welcher es an die Sammlungen zu Schwerin einschickte. Die zweischneidige Klinge, welche wohl erhalten ist, hat die gewöhnliche Form und eine Länge von nur 15 Zoll. Ein "kurzer Griff", welcher daran gewesen sein soll, ist leider verloren gegangen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzeschwert von Rosenow.
Zu Rosenow, R. A. Stavenhagen, bei Bahnhof Mölln, Ward in einer Wiese beim Ziehen eines Grabens ein Bronzeschwert mit Griffzunge gefunden, welches von dem Herrn v. Blücher auf Rosenow dem Vereine geschenkt ward. Die vollständig erhaltene, scharfe Klinge, welche 24 Zoll lang ist, ist zweischneidig und hat einen erhabenen Mittelrücken, jedoch keine Ausbauchung in den Schneiden und keine Verzierungen. Die kurze Griffzunge, welche am Ende zerbrochen ist, bildet eine viereckige Stange ohne Nietlöcher.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzeschwert von Neuhof.
Zu Neuhof bei Zehna (bei Güstrow) ward im Jahre 1872 an einem Abhange, der früher mit Eichen bestanden war, in einer Tiefe von 4 bis 5 Fuß (also in einer ehemaligen Höhlenwohnung ?) in horizontaler Lage ein wohl erhaltenes Schwert von Bronze gefunden und von dem Gutsbesitzer Herrn Gösch geschenkt. Die zweischneidige Klinge ist gearbeitet wie sonst die Klingen der Bronzezeit und hat auf beiden Seiten einen durch Linien abgegrenzten Mittelrücken. Die Klinge ist 49 Centim. (20 1/4 Zoll) lang. Sie unterscheidet sich aber dadurch von allen bisher bekannten bronzenen Schwertklingen, daß sie, ohne Verbreiterung in der Mitte, spitz ausläuft und ungewöhnlich schmal ist; sie ist im größern Theil der Mitte nur 2 1/4 Centim. (ungefähr 1 Zoll) breit und ähnelt einer modernen, kurzen Degenklinge. Sie hat oben eine viereckige Griffzunge. Der Griff, welcher unzweifelhaft aus Holz und Leder gewesen ist, fehlt.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 154 |




|



|


|
|
:
|
c. Eisenzeit.
Begräbnißplatz von Naudin.
Beim Bau der Eisenbahn von Kleinen nach Lübek ward im Herbst 1868 zu Naudin bei Kleinen in einer Sandgrube ein sogenannter "Wendenkirchhof" aufgegraben, in welchem außerordentlich viele mit zerbrannten Menschengebeinen gefüllte Urnen standen, welche jedoch alle zerbrochen waren und beim Graben zertrümmert wurden. Nur ein Bruchstück von einer braunen dickwandigen Urne ohne Verzierungen mit einigen Knochen konnte der Gutsbesitzer Herr Strömer, welcher zu spät Nachricht von dem Funde erhalten hatte, einsenden. Nach der Urne zu schließen, gehörte der Begräbnißplatz der jüngeren Eisenzeit an. Sonstige Alterthümer sind nicht bemerkt worden. Herr Strömer berichtet über die Fundstelle Folgendes. Der Begräbnißplatz war ein Kiessandhügel (eine Horst) in einem trocken gelegten, kleinen, flachen See. Die Bestattungsweise war sehr ärmlich. Die zerbrannten Gebeine lagen zum Theil in Urnen, bald mit, bald ohne Schutzsteine, zum Theil aber auch nur in kleinen Gruben, welche mit Feldsteinen ausgesetzt waren. - Auch der Herr Kammer=Secretair Meyer zu Schwerin, der in seiner Jugendzeit zu Naudin gelebt hat, berichtet, daß schon früher an der bezeichneten Stelle oft Urnenscherben gefunden seien.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Begräbnißplatz von Leussow.
Zu Leussow ward in neuern Zeiten nicht tief unter der Erdoberfläche ein Begräbnißplatz entdeckt, aus welchem viele Urnenscherben ans Licht gefördert wurden. Es gelang auch,


|
Seite 155 |




|
eine ziemlich vollständige große Urne, hellbraun von Farbe und gegen 11 Zoll hoch, zu retten, welche durch die Fürsorge des Herrn Försters Dohse in das großherzogliche Antiquarium gekommen ist.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Gläserner Spindelstein von Dämelow.
Herr von Storch auf Dämelow, bei Brüel, nördlich von Häven, fand auf seinem Gute nahe an der Ventschower Grenze auf dem Felde einen höchst seltenen Spindelstein oder Würtel und schenkte in richtiger Würdigung des Fundes denselben dem Verein.
Der Spindelstein ist von dunkelgrünem Glase, am Rande mit gelben Zickzacklinien oder Spitzen verziert. Die Arbeit ist ohne Zweifel römisch. Dieser Spindelstein gleicht also an Masse, Verzierung und Arbeit ganz dem zu Nieder=Rövershagen bei Rostock gefundenen und in Jahrb. XXXIX, S. 137 beschriebenen Exemplar; nur ist das Exemplar von Dämelow 1 ) kleiner und an Gestalt mehr ringförmig (2 Cent. im Durchmesser), während das Exemplar von Rövershagen dünner und scheibenförmig ist.
Beide Funde sind auch dadurch merkwürdig, daß die Fundorte 9 Meilen aus einander liegen; Dämelow liegt allerdings nur ungefähr eine Stunde von Häven, dem Fundorte vieler römischen Alterthümer.
Zu Dämelow sind schon früher blaue römische Glasperlen gefunden; vgl. Jahrb. XXXVIII, S. 152.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Glasperlen von Toitenwinkel.
Auf dem großen Burgwall zu Toitenwinkel bei Rostock an der Warnow (vgl. Jahrb. XXI, S. 53) wurden


|
Seite 156 |




|
3 farbige Glasperlen gefunden und von dem Herrn
Dr. Wiechmann zu Rostock erworben und geschenkt,
nämlich:
eine größere Perle von
dunkelblauem Glase,
eine kleine Perle
von grünlichem Glase,
eine
Stangenperle bestehend aus 3
zusammengeschmolzenen,kleinen Perlen von
grünlichem, opalisirenden Glase, mit einem durch
alle drei grade durchgehenden kleinen
Loche.
Wahrscheinlich sind diese
Perlen römischen Ursprungs.
Nachträglich sei hier bemerkt, daß früher
auf dem Burgwalle nichts gefunden ist, auch nach
dem Berichte des theilnehmenden ehemaligen
Pächters Sachse bei der "Abrajolung"
des Burgwalls nichts.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 157 |




|



|


|
|
:
|
d. Alterthümer anderer europäischer Völker
Steinalterthümer von Lydien.
Der Herr Dr. Hermann Stannius (aus Rostock), Kaiserlich=Deutscher Consulats=Verweser zu Smyrna, schenkte im September 1874 den Schweriner Sammlungen eine Sammlung von Steinalterthümern, welche in Lydien bei Sardes 1 ), der ehemaligen Hauptstadt des Königs Krösus, im Gygäischen See gefunden sind 2 ) und "durch Zufall" in seinen Besitz gekommen waren.
Die Sammlung besteht aus 37 kleinen steinernen Keilen (oder Beilen, oder Meißeln), welche zwischen 12 und 4 Cent. (4 1/2 und 1 1/2 Zoll) lang und zu einem großen Theile breit gestaltet sind. Alle sind sorgfältig gearbeitet und auf der ganzen Oberfläche polirt, die meisten mit regelmäßig nachgeschliffener Beilschneide. Fast alle sind unversehrt, nur wenige zeigen geringe Spuren vom Gebrauch. Die Bearbeitungsweise ist wie bei allen Völkern, welche eine Steinzeit gehabt haben, wie z. B. im Norden Mitteleuropas, in der Schweiz u. s. w.
Das Gestein aller Keile ist "schwarzer Kieselschiefer", der seit alten Zeiten sog. Lydische Stein, welcher noch jetzt unter dem Namen "Probierstein" von den Goldarbeitern zum probiren des Goldes gebraucht wird. Die Farbe ist vor=


|
Seite 158 |




|
herrschend schwarz, nur wenige Stücke sind dunkelbraun. - Wahrscheinlich sind zu den Geräthen passende Geschiebe oder Gebirgstrümmer benutzt, sie sind also durch die Natur vorgearbeitet, wie hin und wieder Schichtungs= oder Spaltungsfurchen anzeigen, welche durch das Poliren nicht ergriffen sind.
Diese Alterthümer geben wohl den unzweifelhaften Beweis, daß die Steinzeit vor langen Zeiträumen auch in Klein=Asien geherrscht hat, bevor sich das bekannte reiche und üppige Leben in Lydien entfaltete.
Die Auffindung dieser steinernen Alterthümer in einem See dürfte auch die Vermuthung berechtigen, daß diese Alterthümer Reste eines uralten Pfahlbaues sind.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 159 |




|



|


|
|
:
|
2. Christliches Mittelalter.
Bronzene Leuchter=Figur von Schwerin.
Der Verein ist vor Kurzem in den Besitz einer von jenen oft besprochenen Figuren von Messing gekommen, welche in Deutschland weit verbreitet sind. Es stellt eine 14 Centim. hohe männliche Figur mit ausgebreiteten Armen, in bloßen Haaren, mit kurzem Bart und mit einem kurzen Wams bekleidet dar. Der verstorbene Minister Freiherr v. Hammerstein hat in Jahrb. XXXVII, S. 173 flgd., mit 2 Tafeln Abbildungen, diese Figuren für "echte wendische Götzen" erklärt, wogegen sie in Jahrb. XXXIII, S. 238 flgd. als nicht seltene mittelalterliche Leuchter bestimmt sind. Unsere Figur gleicht am meisten den in Jahrb. XXXVII, Taf. II, Fig. 4, und Taf. I, Fig. 3 a und b abgebildeten Figuren. Unsere Figur ward vor ungefähr 40 Jahren in Schwerin beim Bau der Frankeschen Apotheke am altstädtischen Markte, Nr. 8, an der Ecke des Marktes und der Königsstraße, 16 Fuß tief unter der Oberfläche von dem verstorbenen Maurerparlier Pamperin zu Schwerin gefunden und 1875 aus dessen Nachlaß von dem Sohne desselben, Maurer Johann Pamperin, erworben. Die Figur ist ziemlich gut erhalten; nur der rechte Arm ist beim Finden von den Arbeitern zur Prüfung des Metalls abgeschlagen. Auf der linken Hand sitzt noch ein Niet, wahrscheinlich zur Befestigung einer nicht mehr vorhandenen Schale. Die Bestimmung der Figur kann wohl nicht zweifelhaft sein, namentlich wenn man die in Jahrb. XXXVII, Taf. II, Fig. 4 abgebildete, auf einem Dreifuß stehende Figur damit vergleicht. Auch unsere Figur hat unter dem linken Fuße einen hohen Absatz oder Zapfen zum Einlassen in ein Untergestell; der rechte Fuß ist beschädigt.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Bronzene Leuchter=Figur von Rostock.
Vor mehr als zehn Jahren hörte ich wiederholt, oft als Geheimnis, daß auf dem Hofe der Haack'schen Gießerei in


|
Seite 160 |




|
Rostock sehr tief eine sonderbare Figur von Metall aufgefunden sei, welche hin und wieder auch wohl für ein Götzenbild ausgegeben ward. Auf genauere Erkundigung ergab sich auch die Richtigkeit des Fundes und durch die Vermittelung des Herrn J. Tiedemann zu Rostock ward mir die Gelegenheit verschafft, den Fund selbst genau zu sehen, dessen Anblick zwar meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, aber die Hoffnung auf ein Götzenbild wieder zerstörte. Die Figur ist in Rostock auf dem sogenannten Beguinenberge auf dem Glockengießerhofe, der zu der Eisen= und Glockengießerei des Herrn Kaufmanns Kühl (Firma C. Haack u. Sohn) gehört, vor mehreren Jahren beim Graben eines Brunnens 30 Fuß tief gefunden. Die Figur, welche aus mittelalterlicher Bronze gegossen ist, stammt ohne Zweifel aus dem norddeutschen Mittelalter und stellt nach meiner Ansicht einen Leuchter oder einen Lichthalter dar. Auf einem gegen 2" hohen und 3 1/2" breiten Untersatze in Form eines mittelalterlichen Dreipasses auf drei Beinen, steht eine etwa 7" hohe Figur in Gestalt eines Ritters, welcher beide Arme gekrümmt vor sich hält; die Hände sind in Gestalt eines Oehres geschlossen und durchbohrt, so daß von oben herab eine Stange durchgesteckt werden kann. Die rechte Hand reicht über den Untersatz hinaus, die linke Hand aber steht über dem Untersatze, welcher grade unter der Hand auch durchbohrt ist, so daß der Ritter mit der linken Hand eine jetzt fehlende Stange gehalten hat, welche wahrscheinlich einen Leuchter getragen hat. Die Figur des Ritters ist nach alter Weise dargestellt. Sie ist mit einem eng anschließenden Wappenrock gekleidet, welcher bis über die Hüften geht; tief um die Hüften trägt er einen Rittergürtel; der Kopf ist mit einer eng anschließenden Helmkappe bedeckt, welche über Schultern, Brust und Rücken herabfällt; von der Spitze der Kappe fällt ein Riemen auf den Rücken hinab; die Füße sind mit langen, seitwärts gebogenen Schnabelschuhen bekleidet. Nach dieser Bekleidung kann es nicht zweifelhaft sein, daß diese Figur einen Ritter vorstellen soll und aus dem Mittelalter stammt.
Herr J. Tiedemann hat die große Freundlichkeit gehabt, in seiner lithographischen Anstalt von der ganzen Figur zwei Zeichnungen, von der Vorderseite und von der Hinterseite, nehmen zu lassen und dieselben dem Vereine zu schenken.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 161 |




|



|


|
|
:
|
II. Zur Baukunde.
Christliches Mittelalter
Kirchliche Bauwerke.
Die Kirche zu Lohmen.
Die Kirche zu Lohmen bei Dobbertin, zwischen Dobbertin und Güstrow, welche schon im Jahrb. XXI, S. 268 kurz geschildert ist, ist seit dem Jahre 1872 im Innern restauriert und hat dabei durch die Entdeckung eines reichen Schmuckes die Aufmerksamkeit im hohen Grade auf sich gezogen. Am Ende August 1872, nachdem die junge Kalktünche schon abgenommen war, habe auch ich die Freude gehabt, die Kirche genauer untersuchen zu können.
Die ganze Kirche, bestehend aus Chor, Schiff und Turm, bildet ein verhältnismäßig großes Rechteck von guten Verhältnissen und ist ganz aus Feldsteinen mit behauenen Sockeln aufgeführt; nur die Pforten und Fenster sind von Formziegeln eingesetzt.
Der Chor, mit rechtwinklig angesetzter, grader Ostwand, ein Gewölbe groß, ist im Uebergangsstyle ausgeführt, wohl noch in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Kirche des Dorfes, welches schon seit 1227 dem Kloster Dobbertin gehörte, jedoch wohl erst der Chor, stand schon im J. 1238,


|
Seite 162 |




|
da in diesem Jahre der Schweriner Bischof Brunward dem Kloster Dobbertin das Archidiakonat über die Kirchen ("ecclesias") zu Goldberg, Lohmen, Ruchow, Karcheez und Woserin verlieh (vgl. Meklenb. Urk.=Buch I, Nr. 425); im J. 1263 nahm Papst Urban IV. das Kloster Dobbertin und dessen Güterbesitz und Rechte, darunter auch das Patronat ("jus patronatus") von Lohmen in seinen Schutz und Schirm (das. II, Nr. 983). Das Chorgewölbe hat Gewölberippen von quadratischem Durchschnitt, wie die ähnliche alte Kirche von Gägelow (vgl. Jahrb. XXIV, S. 336). In der Ostwand des Chores stehen neben einander 3 Fenster, in der Südwand 2, in der Nordwand 1 Fenster (das zweite fehlt wegen des Anbaues der Sakristei), alle schmal, schräge eingehend im Uebergangsstyl und außen durch einen Rundbogen gekuppelt. Der Chor ist im Innern durch einen breiten Gurtbogen (den "Triumphbogen") vom Schiffe getrennt.
Das Schiff, etwas jünger, im altgoethischen Style, ungefähr aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts, ist zwei Gewölbe lang und hat unter jedem Gewölbe an jeder Seite ein größeres dreitheiliges Fenster im gothischen Styl.
Die ganze Kirche ist im Innern mit festem, grauem Kalk geputzt, wie gewöhnlich die Meklenburgischen Feldsteinkirchen im Uebergangsstyl, und war in jüngeren Zeiten wiederholt "ausgeweißt", d. h. mit Kalk übertüncht.
Die Kirche hat also an den Wänden neben den Fenstern, die Thurmwand mitgerechnet, 15 größere Wandflächen.
Als zur festeren Restauration im Innern die dicke, jüngere Kalktünche abgenommen ward, entdeckte man zur großen Ueberraschung, daß ursprünglich die ganze Kirche mit farbigen Malereien geschmückt war, von denen noch viele Ueberreste vorhanden waren. Aber nicht allein die Gewölbe, Bogen und Rippen waren durch Malereien verziert, sondern auch alle größern Wandflächen mit figürlichen Gruppen in fast Lebensgröße bemalt. Der Raum unter den Fenstern ist nicht bemalt. Freilich stand es schon lange fest, daß die meisten der zahlreichen Kirchen im Uebergangsstyl im Lande mit Wandgemälden geschmückt waren. Aber die Bemalung der Kirche zu Lohmen ist wohl die reichste im ganzen Lande. Aehnlich bemalt war die ähnliche Kirche zu Lüssow (vgl. Jahrb. XXXV, S. 201 flgd.), jedoch bestanden die Bilder zumeist nur aus einzelnen großen Figuren.
Die Dobbertiner Klosterverwaltung beschloß, in richtiger Würdigung des seltenen Schatzes, die Malereien zu conser=


|
Seite 163 |




|
viren und restauriren zu lassen, und übertrug die Restauration der Malereien dem Historienmaler Carl Andrea aus Dresden, welcher dieselbe auch im Jahre 1873 ausgeführt hat.
Andreä hat nach Vollendung der Arbeit die Malereien und Restaurationen im "Christlichen Kunstblatt für Kirche, Schule und Haus", 1874, Nr. 2, S. 18 flgd. beschrieben. Ich werde Gelegenheit haben, diese Beschreibung im Folgenden zu berücksichtigen. - Auch Herr Pastor Lierow zu Lohmen beabsichtigte im J. 1874 eine Geschichte der Restauration und eine Beschreibung seiner Kirche zum Besten einer Thurmuhr auszuarbeiten und herauszugeben. Aber leider ist am 3. Novbr. 1874 Abends das Pfarrgehöft mit dem Pfarrhause zu Lohmen völlig abgebrannt.
Im Folgenden liefere ich eine Beschreibung der Malereien. Ich werde dabei meine eigenen Anschauungen zum Grunde legen und die erwähnten Beschreibungen des Herrn Andreä dabei berücksichtigen, wobei ich bemerken muß, daß Herr Andreä manches, wo das Alte nicht mehr ganz klar war, verändert und auch Neues nach seinen Anschauungen gegeben hat, wie ich bei den einzelnen Bildern bemerken werde.
Die Malereien sind folgende.
Zunächst die Malereien des Chors.
Die quadratischen Rippen des Chorgewölbes waren geputzt und im Grunde roth und darauf mit weißen Ornamenten bemalt, welche alle verschieden sind, wie die gleichen Gewölberippen der Kirche zu Gägelow (vgl. Jahrb. XXIV, S. 339). Diese Bemalung ist also sicher sehr alt.
Die Gewölbekappen des Chores waren mit figürlichen Darstellungen bemalt und außerdem mit sehr schönen romanisirenden Arabesken, welche vielleicht aus der Zeit des Baues stammen.
In der östlichen Gewölbekappe über dem Altar war Christus als Weltenrichter in reicher Gruppirung erkennbar. Auch Andreä beschreibt dieses Bild des jüngsten Gerichts eben so. Andreä beschreibt dieses Gemälde nach dessen Restauration folgendermaßen. "Christus als Weltenrichter in lichtrothem Mantel auf doppeltem Regenbogen thronend, die Erde zum Schemel seiner Füße, rechts die Jungfrau Maria, links Johannes der Täufer, hinter Maria die Himmelsthür, der heilige Petrus und eine Schaar seliger unbekleidet eingehend, dieses Bild der Himmelsthür uralt; hinter dem Täufer der Höllenrachen, ein Gewimmel


|
Seite 164 |




|
Unseliger von Teufeln in den flammensprühenden, mit langen Zähnen bewaffneten Schlund gezerrt; dieses Bild nicht primitiv. Reizend sind zwei Engel, welche aus dem rothen Linienbouquet des Schlußsteins ihre Posaunen herab erschallen lassen."
Die Gewölbe des Schiffes und die Wölbung des Triumphbogens sind nur mit Arabesken bemalt, welche jedoch von geringerm Werth und viel jünger sind, als die des Chorgewölbes.
Auf den Wänden war die Passionsgeschichte Christi in einer geschichtlichen Reihenfolge in lebendigen, fast lebensgroßen Gruppen dargestellt. Ein gedankenreicher Zusammenhang im geschichtlichen Fortschritte war nicht zu verkennen. Andreä meint, daß "Passionsspiele den Maler zu den sehr dramatischen Bildern lebhaft angeregt haben."
Nach meinen Anschauungen begannen die Passionsbilder auf der Nordwand des Chores am Triumphbogen, der Chorpforte gegenüber, gingen dann immer rechts fortschreitend über die Ostwand hinter dem Altare, setzten sich über die ganze Südwand fort und endigten an der Thurmwand im Westen; die nördliche Wand des Schiffes vom Thurm bis zum Triumphbogen zeigte einzelne Figuren.
Ich habe auf der Südwand erkennen können: Christus vor Pilatus, die Kreuztragung, die Kreuzerhöhung, die Kreuzigung (das Crucifix). Auf der Thurmwand ist die Kreuzabnahme dargestellt. Andreä nimmt eine andere Reihenfolge an, wobei auch wohl die von ihm geschaffenen neuen Bilder von Einfluß gewesen sein mögen. Er nimmt an, daß der Cyclus der biblischen Darstellungen auf der Ostwand hinter dem Altar beginnt und von hier zuerst nach links, dann nach rechts bis zur Thurmwand fortgeht. Er zählt dann folgende Bilder nach Nummern auf.
1) "War nicht mehr erkennbar, ich mußte neu schaffend vorgehen und malte: Christus wäscht dem Petrus die Füße."
2) "Das Abendmahl, theilweise
vorhanden."
"Diese beiden ersten
Bilder im Chorraum deuten auf den eben dort
aufgestellten Altar und Taufstein."
3) "Christus im Gebetskampf am Oelberg, die drei schlafenden Jünger, der tröstende Engel, Alles leidlich erkennbar."


|
Seite 165 |




|
4) "Der Kuß des Verräthers, der eifernde Petrus fast durchweg neu geschaffen."
5) "Christus vor Caiphas."
6) "Christus vor Herodes."
7) "Christus vor Pilatus (ecce homo)."
8) "Pilatus wäscht sich die Hände. Christus
wird weggeschleift."
"Alle diese
Bilder fast erloschen."
9) "Der Dorngekrönte im Purpurmantel mit dem Rohrscepter."
10) "An der Südwand des Schiffes die Kreuztragung; dieses Bild war am besten erhalten von allen."
11) "Die Kreuzannagelung, nur theilweise vorhanden."
12) "Das Crucifix. Maria und Johannes, rechts unter dem Kreuze Kriegsknechte, welche um den heiligen Rock würfeln."
"Hiemit schließen die biblischen Darstellungen. Die große Darstellung auf der Thurmwand, die Kreuzabnahme blieb unrestaurirt."
Auf der Nordwand des Schiffes, vom Thurm bis zum Triumphbogen waren einzelne Figuren dargestellt. Ich erkannte den H. Christoph (Nothhelfer), die H. Katharina (Nothhelferin) und die H. Maria Magdalene. Katharina und Magdalene sind auch auf dem alten geschnitzten Altar dargestellt und gehören ohne Zweifel zu den Local=Heiligen der Kirche. Der H. Christoph war in colossaler Größe bekanntlich in den meisten Kirchen am Eingange angebracht. .- Andreä fand hier "Spuren des Sündenfalls, des S. Christophorus und einer H. Magdalene, ganz unbekleidet von Engeln gehoben", und sagt: "nur den großen Christoph restaurirte ich; er mißt eine ganze Menge von Ellen."
Auf der großen Westwand des Triumphbogens war der H. Georg (Nothhelfer) zu Pferde dargestellt, wie er den Drachen tödtet, in colossaler Auffassung. Andreä sagt: "Den Zenith des Triumphbogens nahm ein heil. Georg ein: das lebensgroße Pferd und der riesige Drache grade mitten im Kirchenraum störten gewaltig; ich malte ihn tiefer seitwärts mehr nach unten, wo mir nur 2 Figuren gänzlich verlöscht waren, und an seiner Stelle componirte ich das Lamm mit der Siegesfahne, umgeben von den vier Evangelisten=Sym=


|
Seite 166 |




|
bolen. Rechts und links abwärts folgen sich, hineingestellt in die rothe Ranke, Maria mit dem Christkind in einer Strahlenglorie, S. Barbara und der H. Georg, auf der andern Seite S. Catharina und zwei Bischöfe, welche der Pastor von Lohmen S. Augustin und Ansgar genannt hat." "Im Ganzen "restaurirte" Andreä 111 Figuren." Aus dem Voraufgehenden ergiebt sich jedoch, daß viele Figuren neu geschaffen" sind.
Ueber die Zeit und Art der Malerei äußert sich Andreä also. "Die Lohmener Bemalung datirt etwa aus dem Jahre 1450. Renaissance=Elemente kommen gar keine vor, sondern durchweg ältere Anklänge, sogar einige mit Pietät conservirte Stücke einer ältern Bemalung. Die ältere Bemalung scheint die sorgfältigere Technik des al fresco auf dem nassen Mörtel gewesen zu sein." - Ich möchte aber die Malereien für etwas älter halten.
Die Räume des westlichsten Gewölbes hatten mehrere Eigenthümlichkeiten, welche wohl einer besondern Aufmerksamkeit werth sind.
In der westlichsten Gewölbekappe stand ein ziemlich großes rothes Kreuz, in der Gestalt wie es auf dem Schilde des H. Georg gemalt zu sein pflegt, in den Ecken etwas ausgebogen. Das Kreuz Christi ist es nicht; es ist ein Ordenskreuz, steht jedoch auf einem kleinen Fuße. An ein Tempelherrenkreuz wird nicht zu denken sein, da dieses achtspitzig war und ein Zusammenhang mit dem Templerorden hier ganz ferne liegt. Möglich ist es, daß es auf irgend eine Weise mit dem Kloster Dobbertin zusammenhängt, welchem das Dorf Lohmen und das Kirchen=Patronat bis heute immer gehört hat. Bezug auf den Bau wird das Kreuz jedenfalls haben, da es das westlichste Bild in der Kirche ist. - Ueber dem Kreuze ist eine menschliche Büste mit einer Kappe oder einem Helm gemalt. - Vielleicht soll das Ganze hier wieder den H. Georg vorstellen.
Auf der westlichen Nordwand des Schiffes neben dem Thurme, also zum Theil unter dem rothen Kreuze, stehen mehrere Zeichen, welche ebenfalls Aufmerksamkeit verdienen. Zunächst dem Fenster steht ein Wappenschild in schwarzen Linien: auf einem Schilde zwei gekreuzte Lilienstäbe, ungefähr wie das Wappen in der Neu=Röbelschen Kirche, abgebildet in Jahrb. XXXIII, S. 155; nur haben die Stäbe in der Lohmenschen Kirche an allen Enden Lilien. Daneben scheint eine Inschrift gestanden zu haben; es ist jedoch davon nichts


|
Seite 167 |




|
mehr zu erkennen. Unter diesem Wappenschilde steht ein Meklenburgischer Stierkopf mit sehr zottigem Halsfell. Daneben steht eines der bischöflichen Weihkreuze.
Dies ist der ungewöhnliche und großartige Schmuck der Kirche, welchen die Klosterverwaltung möglichst im alten Geiste wieder herzustellen bemüht gewesen ist, ein Unternehmen, welches ebenso schwierig, als verdienstlich war. In einem so großen Umfange ist bis jetzt noch keine Restauration im Lande ausgeführt.
Der alte Altar ist ein kleiner Flügelaltar aus dem 15. Jahrhundert. Die Mitteltafel enthält geschnitzte Figuren; die Flügel sind bemalt, jedoch in jungem Zeiten schlecht übermalt. Die Mitteltafel enthält folgende Figuren in der Ansicht:
| Johannes d. T. | Maria | Bischof |
| mit dem | ( S. Erasmus?) | |
| S. Katharina. | Christkinde. | Maria Magdalena. |
Johannes d. T. mit dem Lamm, S. Katharina mit Rad und Schwert, Maria Magdalena mit der Salbenbüchse; dem bischöflichen Bilde fehlen Hände und Attribute. - Andreä berichtet: "Anstatt des verstümmelten und verzopften alten Altarschreines, welchen wir als Antiquität an einer Seitenwand aufstellten, ward ein ganz neuer Altar hergestellt, ohne hohe Rückwand, mit würdigem Leuchter= und Crucifix=Schmuck."
Vor dem Altartische lag eine alte, sehr abgetretene Fußdecke mit leisen Spuren alter Kunstarbeit. Nachdem dieselbe umgekehrt war, zeigte es sich, daß die nach unten gekehrte Seite noch ziemlich gut erhalten und die Decke der Rest eines guten, alten Hautelisse=Teppichs etwa aus der ersten Hälfte des 16. Jahrh. war; es ist das untere abgeschnittene Ende eines großen Teppichs, welcher lebensgroße Figuren enthalten hatte. In der Ansicht rechts sind die Beine von zwei Männern mit sehr breiten Schuhspitzen, links der untere Theil des faltigen und schleppenden Kleides einer Frau zu sehen; dazwischen stehen zwei Kinder, deren Gestalten noch ganz erhalten sind. Unter den Kindern stehen 2 Wappen in Farben, Schilde und Helme: nach der Frau hin das Wappen der von Blücher, nach den Männern hin das Wappen der von Penz.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 168 |




|
Beilage.
1518.
Irluchtige, hochgebarne furste, g. h. J. ff. g. hadde gescreuen vmme enen knecht geheten Peter, den sulften hebbe wy gekregen vnnd heft vngepyniget bekant, dat he vnnd Jacop Berckhane vnnd andersz nemant de kercke to Lome gebraken vnd bestalen hebben, vnd desz hebbe wy guth bewysz in syner wasschen, dar van dem suluer krutz vnd angnusz dei vnd olt gelt vnd suluer knope, schalen inne ysz. Item heft forder bekant, dat Berckhane de kercke to Vpaell allene gebraken. Item heft noch in der wasschen IIII sulue lepel, vnd IIII lepel heft Berckhane vnd vertich gulden, dat hebben se gestelen de kercheren to Szedorpe in dem lanto Sasszen. Van den vertich gulden heft de knecht XII gulden gekregen vnd de IIII lepel.
Auf der Rückseite steht die Registratur:
vnfolter petter bokantnis
1518.
Nach dem Original auf einem halben Bogen Papier im Staats=Archive zu Schwerin.


|
Seite 169 |




|



|


|
|
:
|
Der Dom zu Schwerin.
Nachtrag zu Jahrb. XXXVI, S. 148 und 172 flgd.
Von
Dr. G. C. F. Lisch.
Wandmalereien im Kapitelhause.
Einleitung.
Nach Vollendung der Restauration des Domes zu Schwerin, 1866-1869 (vgl. Jahrb. XXXVI, S. 148) ward im Frühling 1875 noch eine Entdeckung gemacht, welche für die Geschichte der alten Kunst und des Schweriner Domes von großer Bedeutung ist. An der Südseite des Chores, dem Altmarkt gegenüber, ist von der südlichen Chorpforte bis an das südliche Kreuzschiff eine schmale, zweistöckige Kapelle angebauet, welche bis heute das "Kapitelhaus" genannt wird. Diese Kapelle ist nach Archivnachrichten unter dem Bischofe Friedrich II. v. Bülow (1365-1375) bei dem Bau des polygonen Chorschlusses, also während der Vollendung des Domes in seiner jetzigen Gestalt, angebauet und von dem Bischofe vorzüglich zum Dom=Archive bestimmt (vgl. Jahrb. a. a. O. S. 149), daher noch jetzt der Name "Kapitelhaus".
Die Kapelle ist ein schmales Gebäude im gothischen Baustyl von zwei Gewölben Länge und in beiden Stockwerken gewölbt. Das obere Stockwerk ist bis heute zum Aufbewahrungsort der Domschriften (Archiv) bestimmt gewesen. Das untere Stockwerk war aber eine gottesdienstliche Kapelle, für deren Bestimmung der noch stehende kleine Altar mit einer dicken Granitplatte zeugt.
Die Kapelle hat in der langen südlichen Außenwand zwei Fenster und in der schmalen östlichen Wand ein kleineres


|
Seite 170 |




|
Fenster, unter welchem der Altar steht. Die westliche Wand stößt an das südliche Kreuzschiff. Die Eingangspforte im Norden von der Kirche her ist unter dem östlichen Gewölbe durch die sehr dicke Kirchenmauer durchgebrochen und im Spitzbogen gewölbt.
Diese untere Kapelle war mit Kalk leicht geputzt und übertüncht, jedoch an vielen Stellen, auch an den Gewölben etwas schadhaft geworden. Als die Kapelle im Jahre 1875 zu einer zweiten "Sakristei" bestimmt und deren Restauration beschlossen war, ward mit der Abnahme des schadhaften Putzes und der Tünche im April 1875 begonnen. Dabei entdeckte man nach vereinzelten Spuren, daß die ganze Kapelle nicht nur mit Ranken, sondern auch mit Figuren bemalt war. Es ward daher, wo der Putz noch fest war, nur die Tünche behutsam abgenommen und dadurch ein großer Theil der Malereien frei gelegt 1 ).
Die Wandmalereien.
Es zeigte sich nun, daß die ganze Kapelle bemalt war. Die Wände waren mit lebensgroßen Figuren und mit Rankenwerk bemalt, auch die Gewölbe waren angemessen und stylgemäß bemalt. Leider war schon sehr viel abgefallen und verblichen, auch bei der Abnahme des Kalkputzes zerstört, da man von den Malereien unter der Tünche keine Ahnung hatte.
Was aber noch erhalten war, ist ungewöhnlich schön und giebt Zeugniß von einer hohen Kunstausbildung. Die Gemälde, welche ohne Zweifel der Zeit der Vollendung der großartigen Kirche, also der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts angehören, sind sehr schön, und die schönsten alten Gemälde in Meklenburg und vielleicht in Norddeutschland. Jedenfalls sind sie schöner und edler, als die etwas Jüngern, wenn auch reichen Gemälde in der Kirche zu Lohmen (vgl. oben S. 161 flgd.)
Die figürlichen Darstellungen.
Das Hauptgemälde steht in dem gothischen Bogenfelde über der Eingangsthür und stellt dar:
1) Die Anbetung der Jungfrau Maria, der Schutzpatronin und Localheiligen des Domes, durch die Dona=


|
Seite 171 |




|
loren, d. i. die Gründer und Wohlthäter der Kapelle. Die gekrönte heilige Jungfrau in blauem Untergewande und rothem Obergewande sitzt auf einem Throne von mittelalterlichen Formen und hält im linken Arme das auf ihrem Schoße stehende, mit einem rothen Rock bekleidete Christuskind und in der rechten Hand einen Lilienstengel. Zur linken Hand der Maria knieet anbetend ein Bischof mit Bischofsmütze und Bischofsstab, zur rechten Hand eine weibliche Figur in langem, rothem Mantel. - Die Prüfung und Bestimmung dieses Bildes wird mit der Zeitbestimmung unten folgen.
2) In dem breiten Mauerbogen über der Thür sind in grünem Rankenwerk auf großen kreisrunden Scheiben, die lebensgroßen Brustbilder von 6 Propheten mit Spruchbändern in den Händen, auf denen aber keine Schriftzüge mehr zu erkennen waren.
Die Wände sind alle mit Heiligenfiguren in Lebensgroße und mit Rankenwerk bemalt gewesen. Von dem Rankenwerk waren nur noch einzelne geringe Spuren zu bemerken, so daß sich mit Sicherheit nichts herstellen ließ.
Die vorzüglichsten Gemälde standen an der südlichen Hauptwand, an jeder Seite der beiden Fenster eines, der Eingangsthür gegenüber. Es sind noch folgende Gemälde vorhanden.
3) An der westlichen Seite des östlichen Fensters steht die Heilige Katharina, eine sehr schöne, meisterhafte Figur, ein mit Messern besetztes kleines Richtrad in der erhobenen rechten Hand tragend und ein gesenktes großes Schwert von altmittelalterlichen Formen mit der linken Hand haltend.
4) Daneben an der östlichen Seite des westlichen Fensters steht der Evangelist Johannes, im grünen Obergewande, in der linken Hand den Kelch haltend, mit der rechten Hand denselben segnend oder auf denselben zeigend. Aus dem Kelche ragt eine Hostie hervor.
An jeder der beiden andern Seiten der Fenster hat nach geringen Spuren auch noch eine Figur gestanden. Es war aber durchaus nichts mit Gewißheit zu erkennen.
Die beiden schmalen Wände im Osten und Westen der Kapelle waren auch mit Figuren geschmückt gewesen, welche jedoch auch gänzlich verfallen waren.
Die nördliche Längswand war ebenso bemalt gewesen, wie die südliche Wand. Jedoch ist die Wand durch Türen, nämlich durch die Eingangsthür und durch die Seitenthür zur Capitelstube und eine andere Thür durchbrochen, so daß die Wandflächen nur unbedeutend sind. Dennoch ist unter


|
Seite 172 |




|
dem westlichen Gewölbe, der Figur des Evangelisten Johannes gegenüber, noch eine Figur erhalten, nämlich
5) die Figur des Apostels Paulus mit der rechten Hand ein Schwert in die Höhe haltend.
Alle diese Gemälde sind im Frühling 1875 mit der größten Schonung des noch Vorhandenen und Erkennbaren restaurirt 1 ) oder vielmehr ausgebessert, so daß ohne Uebermalungen nur die durch die Putzabnehmung schadhaft gewordenen Stellen durch einzelne Linien und kleine Flächen ergänzt sind. Namentlich sind alle Conturen, also die Composition, bei der Restauration strenge geschont und nur einzelne Gewandflächen theilweise übermalt. Die Malereien geben also noch jetzt ein treues Bild der ursprünglichen Darstellung.
Die Gewölbe
waren nach einigen leisen Spuren auch bemalt gewesen. Da die Gewölbe im Bau und im Kalkputz ausgebessert werden mußten, so ist allerdings eine neue Gewölbeverzierung auf dem weißen Kalk nach Maßgabe der noch vorhandenen Farbenreste ausgeführt. Zu Hülfe genommen sind dabei die reichen Gewölbemalereien der leider zum Abbruch bestimmten Schwarzen=Mönchs= oder Dominikaner=Kloster= Kirche zu Wismar, welche aus gleicher Zeit stammt und in gleichen Farben bemalt ist. Die Rippen sind, wie dort, grün und dunkelgrau oder schwarz bemalt und von rothem Blattwerk begleitet; um die Schlußsteine sind in den Gewölbekappen größere rothe Lilien=Ornamente gemalt. - Der Sockel der Wände ist allerdings nach Art eines Teppichs neu bemalt, um die Figuren nicht zu sehr in der Luft schweben zu lassen.
Bedeutung und Zeitbestimmung.
Die Malereien haben einen großen geschichtlichen und künstlerischen Werth, vorzüglich durch die noch mögliche Bestimmung des 1. Hauptgemäldes mit der Anbetung der Jungfrau Maria durch die Donatoren, welche sich noch bestimmen lassen.
Den anbetenden Bischof kann man mit Sicherheit als den Bischof Friedrich II. von Bülow (1365 † 1375)


|
Seite 173 |




|
erkennen, unter welchem die Domkirche in ihrer jetzigen Gestalt (1374) vollendet und die Kapelle gebauet ward, und welcher unter der in der Kirche vorhandenen, jetzt an der Nordwand aufgerichteten großen und prachtvollen Messingplatte 1 ) in Messingschnitt 2 ) vor dem Hochaltare, ungefähr vor der Eingangsthür der Kapelle, begraben ward, wie noch vor vielen Jahren zu sehen war.
Die anbetende Figur in dem rothen Mantel soll klar eine weibliche Figur darstellen, sowohl nach dem Gesichtsausdruck, als nach den Locken an den Schläfen, dem Kopfschleier und dem Diadem um die Stirne. Die Figur ist ohne Zweifel die Königin Richardis von Schweden. Richardis war die erste Gemahlin, 1359 † 1377, des Herzogs Albrecht III. von Meklenburg, welcher 1363 bis 1389 auch König von Schweden war. Als Königin von Schweden ist sie erkennbar an dem rothen Königsmantel, in welchem auch ihr Gemahl auf mehreren alten Bildern dargestellt ist. Richardis war der letzte Sproß des Hauses der Grafen von Schwerin und ihre Vorfahren lagen alle im Dome zu Schwerin, in der Heiligen=Bluts=Kapelle, begraben. Die Königin hat sich daher noch kurz vor ihrem Tode der Kirche dankbar bezeigen und sich ein Familien=Denkmal stiften wollen. Aus gleicher Veranlassung war auch in der Heiligen=Bluts=Kapelle das lebensgroße Bild ihres Gemahls, des Königs, neben den Bildern der Grafen von Schwerin, gemalt. (Vgl. Jahrb. XIII, S. 161 flgd.) Das Bild der Königin ist wohl das älteste Portraitbild in Meklenburg und vielleicht in Nord= Deutschland. Die Königin ist freilich nicht in Meklenburg, sondern in Schweden begraben.
Das ganze Gemälde soll also die "Donatoren", d.h. die Erbauer und Wohlthäter, der Kapelle darstellen. Man konnte das Gemälde auch ein Denkmal auf die Vollendung des Domes nennen.
Hiernach und nach der Baugeschichte des Domes läßt sich auch die Zeit der Gemälde feststellen. Das Hauptgemälde, so wie auch die andern Bilder, werden um das Jahr 1375, zur Zeit der Vollendung der Kirche und der Kapelle, also grade vor 500 Jahren, gemalt sein, als beide Personen noch lebten. Und hiezu stimmt auch der ganze,


|
Seite 174 |




|
edle Styl der Gemälde, welche zu den bedeutendsten alten Denkmälern im Lande gehören.
Die kirchliche Bestimmung der Kapelle läßt sich wohl schwer mit Sicherheit nachweisen. In dem Verzeichniß der 42 Altäre des Domes vom J. 1553 (vgl. Jahrb. XXXVI, S. 167 flgd.) wird auch ein Altar in der "geschlossenen Kapelle des Blutes Christi" ("in sacello clauso Sanguinis Christi") als der 39. aufgeführt. Dies mag die Kapelle im "Capitelhause" sein, da im Dome keine andere geschlossene Kapelle ist. Die berühmte "Heiligen=Bluts=Kapelle" hinter dem Hochaltare kann nicht gemeint sein, da diese in dem Altarverzeichniß an erster Stelle als "des "heiligen Bluts = Kapelle" ("capella cruoris Christi") aufgeführt wird. Vielleicht war in der Kapelle im Kapitelhause das ältere Heilige Blut, welches der Graf Gunzelin I. von Schwerin schon im 12. Jahrhundert aus dem Gelobten Lande heimgebracht haben soll (vgl. Jahrb. XX, S. 234) oder überhaupt das "Sacrament" aufbewahrt. Zur Bestimmung eines andern Altars für die Kapelle giebt das Altarverzeichniß keine Veranlassung.
Die Restauration der Kapelle ist, bis auf das Fenster in der schmalen Ostwand, Ende Mai 1875 vollendet.



|


|
|
:
|
Kirche und Reliquien=Urne von Stöbelow.
Nicht weit von Doberan steht in dem Dorfe Stöbelow eine kleine alte Kirche, welche seit langen Zeiten ein Filial der Pfarrkirche zu Parkentin ist. Zur katholischen Zeit war zu Stöbelow eine eigene Pfarre. Jm J. 1718 war nach Archivnachrichten noch eine "Wedeme" (Pfarrhof) daselbst. Seit dem Ende des 16. Jahrh., wahrscheinlich seit der Reformation, erscheint aber Stöbelow als Filial von Parkentin So weit die Archiv=Acten zurückreichen, ist in denselben, von 1597 bis 1703, nur von der Baufälligkeit der "kleinen" Kirche, namentlich an Dächern, Fenstern, Thüren und Stühlen, die Rede.
Herr Baumeister Müschen giebt nach eingehender Untersuchung folgende Nachrichten über das Kirchengebäude. Die Kirche mit dem Thurm ist von Ziegeln im größten Format im gothischen Baustyl; die Fenster, Thüren und Nischen sind in sehr guten Verhältnissen im Spitzbogen geschlossen. Die Kirche ist nur klein und besteht aus zwei fast quadratischen Gewölbejochen, welche mit gut erhaltenen, schlanken spitzbogigen Kreuzgewölben bedeckt sind. Die spitzbogigen Fenster


|
Seite 175 |




|
haben gemauerte Pfosten und sind in der Nord= und Südwand zweitheilig, in der Ostwand dreitheilig. Der gut erhaltene Bau zeigt in Kirche und Thurm in verkleinertem Maaßstabe manche Anklänge an die nahe Mutterkirche zu Parkentin. Der Thurm hat 4 Giebel mit Blendnischen, über denen sich der Thurmhelm als kräftige achtseitige Pyramide erhebt. Altes Mobiliar besitzt die Kirche nicht mehr.
Im J. 1874 ist eine überraschende Entdeckung gemacht, welche einige Blicke in die Vergangenheit dieser Kirche thun läßt.Im Herbste 1874 untersuchte Herr Amtmann Burchard zu Rostock, vom Domanialamte Toitenwinkel, bei der Jahresbesichtigung die Kirche. Er entdeckte dabei in der Kirche hinter dem Altare unter dem großen Fenster etwa in Manneshöhe ein Rüstloch, das mit Spinnweben dicht verklebt war und in das wohl seit langer Zeit keine menschliche Hand hineingelangt hatte. Er griff hinein und holte aus einem Wust von Staub und Kalk, Spinnen und Motten eine hölzerne runde Büchse heraus, welche ohne Zweifel der Reliquienbehälter des ehemaligen alten Altars war, wie dergleichen hölzerne Reliquiarien schon öfter in alten Altären in Meklenburg gefunden sind. Die Büchse, 5 1/2 Centim. (2 1/4 Zoll) hoch und 8 Centim. (3 1/4 Zoll) im Durchmesser, ist aus rohem Holz gedrechselt und hin und wieder unregelmäßig mit senkrechten blutrothen Streifen bemalt. In der Büchse lag ein kleiner menschlicher Knochen, ein Stück von dem 3. oder 4. Halswirbel, in dünnes dunkelblaues Seidenzeug gewickelt, ein Stückchen dunkelgelbes Zeug und ein Stückchen Weihrauch. Dies Alles war in einen Lappen von schwerem dunkelrothem Seidenzeug mit eingewirkten goldenen Verzierungen (Thieren, wie es scheint), von hohem Alter, vielleicht aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, gewickelt.
Oben darauf lag in der Büchse ein kleines rundes Siegel mit eingelegter rother Wachsplatte in einer ungefärbten, außen braunroth bemalten Wachsschale. Das runde Siegel, gegen 3 Centim. im Durchmesser, zeigt den den Kelch segnenden Bischof im Brustbilde, unter demselben einen rechts gelehnten Schild mit einem rechts gekehrten halben Widder über einem links gekehrten Bischofsstabe; die Umschrift lautet (mit Ergänzungen):
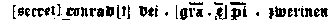
Dies ist also ohne Zweifel das Secretsiegel des Bischofs Conrad Loste von Schwerin (1482-1503). Vgl. Jahrb. VIII, S. 26-27.


|
Seite 176 |




|
Oben auf der Büchse lag ein kleiner Papierzettel, welcher von Gewürm stark zerfressen und abgenagt war; es ist noch zu lesen:
auf der einen Seite:
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - unden so wurden die - - - -
- - wieder - herrein - - - - -
- - setz aber - - - - - - - -
auf der andern Seite:
Kirchen vor - - - - - - - -
Pinngel, Da - - - - - - - -
Die Handschrift scheint der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts anzugehören. Ohne Zweifel ist dies eine Nachricht der damaligen Kirchenvorsteher. Der Name Pingel ist nach des Herrn Amtmanns Burchard Bericht in Stöbelow noch jetzt sehr häufig. Im J. 1703 waren nach den "Beichtkinder=Specificationen" unter den Bauern: "Hans Pingel" und "der alte Hans Pingel".
Aus diesen Funden ergiebt sich Folgendes.
Die Reliquien, vielleicht auch die Büchse, sind nach den offenbar sehr alten Umhüllungen alt, aus dem frühen Mittelalter.
Am Ende des 15. Jahrhunderts (zwischen 1490 und 1500) besorgte, nach dem Bischofssiegel, der thätige Bischof Conrad Loste von Schwerin, welcher mehrere Altäre im Lande besorgt hat, z. B. die großen Altäre zu Schwerin und Bützow, einen neuen Altarschrein 1 ), ohne Zweifel noch im mittelalterlichen Geschmack, und weihete den neuen Altar.
Wahrscheinlich am Ende des 18. Jahrhunderts ward dieser Altar des Bischofs Conrad, vielleicht wegen Baufälligkeit, abgebrochen und dabei die Reliquienbüchse gefunden, welche von den Kirchenvorstehern zum Andenken in das Rüstloch "hereingesetzt", hier aber vergessen ward, bis sie in unsern Tagen wieder ans Licht gekommen ist. Aus den Gewölben und im Thurme liegen noch zerbrochene Schnitzwerke und Reste von verstümmelten Figuren, ohne Zweifel von diesem alten Altar.
Der jetzige Altar im modernen Styl, mit einer Kanzel über dem Altartische statt einer Bildtafel, ist vor ungefähr 40 Jahren errichtet.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 177 |




|



|


|
|
:
|
Kirche und Reliquien=Urne von Leussow.
Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 193 flgd.Die alte, kleine Kirche zu Leussow wird, nach der Einweihung der neu erbaueten Kirche im Herbst 1874, im J. 1875 abgebrochen 1 ). Die Hoffnung, beim Abbruch irgend ein geschichtliches Zeugniß im Mauerwerk zu finden, wird aber nicht in Erfüllung gehen, da das Vermuthete schon längst gefunden ist. Als im Jahre 1839 der moderne Altar aufgerichtet und der "schon alte, vermalte und vergüldete Altar von altem Schnitzwerk" entfernt ward, fand man, nach dem Berichte eines Sohnes des frühern Pastors Studemund, als Augenzeugen, in dem gemauerten Altartische unter einer Steinplatte in einem hölzernen Gefäße ein mit einer Wachsplatte zugedecktes gläsernes Reliquiengefäß, welches sogleich an mich für die großherzogliche Alterthümer=Sammlung eingesandt und hier verzeichnet und bis jetzt aufgestellt, von mir aber bis jetzt in Hinsicht auf den Fundort vergessen gewesen ist.
Das Gefäß ist von ungefärbtem Glas mit aufgesetzten Glasknöpfen, cylindrisch von Gestalt, 4 /2 Zoll hoch und 2 Zoll im Durchmesser. In dem Glasgefäße lagen kleine Reliquien=Knochenreste und das von einer vermoderten Urkunde übrig gebliebene erste Secret=Siegel des Ratzeburger Bischofs Johann von Parkentin, 1479-1511 (vgl. Masch Gesch. des Bisth. Ratzeburg S. 385) mit der Umschrift:

Um das Jahr 1500 ist also ein neuer Altar errichtet, welcher im J. 1706 schon wieder alt war, und das Kirchengebäude sonst an Pforten und Fenstern umgebauet und nach damaligem Style modernisirt. Hiedurch läßt sich die etwas undeutliche Inschrift

auf einem braunrothen Steine erklären, welcher in der Außenwand oben neben der Südpforte eingemauert war und jetzt wohl mit Sicherheit

gelesen werden kann. Man kann also als gewiß annehmen, daß die Kirche im Jahre 1500 umgebauet und


|
Seite 178 |




|
ein neuer Altar 1 ) errichtet ward, welcher im Jahre 1839 verschwunden ist.
Schwerin im Januar 1875.
G. C. F. Lisch.
Nachtrag. Nach Vollendung dieser Zeilen ist die Kirche abgebrochen und im Anfange des Frühlings 1875 der erwähnte braunrothe Inschriftstein in die Schweriner Sammlungen geliefert. Bei schärferer Beleuchtung liest man auf demselben mit Sicherheit:

Der Umbau des Aeußern der Kirche ist also im J. 1520 vollendet. Der Altar kann aber schon einige Jahre vorher fertig und aufgestellt worden sein.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Picher.
Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 195.Auch die alte Kirche zu Picher ist im Frühling 1875 abgebrochen, um einer neuen auf derselben Stelle Platz zu machen. Gefunden ward beim Abbruch nichts, obgleich der Herr Präpositus Köhler die Arbeit sorgsam überwachte. Es bestätigte sich aber dabei die von mir geäußerte Ansicht, daß der östliche Theil ein Anbau aus jüngerer Zeit sei. Dies veranlaßte den Herrn Präpositus Köhler zu weitern Nachforschungen. Derselbe fand denn auch im Pfarr=Archiv die Nachricht,
"daß 1635 unter Herzog Adolf Friedrich die Kirche verlängert sei."
Dies bezeugen auch die Acten des Staats=Archivs.
Am 22. Sept. 1633 bittet der Pastor M. Joachim Rönckendorf den Herzog "um Steine zum Bau und um einen neuen Altar". Am 19. Nov. 1634 berichtet derselbe dem Herzoge, daß "die Kirche zu Picher zu klein im Gebäu gewesen sei und deshalb habe erweitert und größer gebauet werden müssen."
Hiezu stimmen auch die der Zeit nach bestimmten und von mir a. a. O. S. 196 ausgezählten und beschriebenen,


|
Seite 179 |




|
auf Glas gemalten Wappen 1 ), welche alle zwischen 1620 und 1640 fallen. Auch der Herzog wird sein Wappen in einem Fenster gehabt haben, indem der Pastor M. Joachim Rönckendorf am 19. Nov. 1634 den Herzog zu den Fenstern für sich "um eine Lufft (Lucht) mit Waffen und Fenster zum Geschenk" bittet. Von diesem Fenster war aber keine Spur mehr vorhanden.
Hieraus ergiebt sich, daß der östliche Theil der Kirche nicht, wie ich a. a. O. S. 196 angenommen habe, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. angebauet ist, daß man aber noch 1635 den junggothischen Baustyl herzustellen sich bemühte, was wohl selten vorkommt.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Warnemünde.
Von
Dr. G. C. F. Lisch.
Nachtrag zu Jahrb. XXXIX, S. 177.
In den Jahrbüchern a. a. O. ist die alte, jetzt abgebrochene Kirche zu Warnemünde beschrieben, deren Geschichte in den drei letzten Jahrhunderten eng mit der Geschichte des Fleckens zusammenhängt.
Von besonderer Wichtigkeit waren dabei die Kirchenstühle aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, deren gut geschnitzte Wangen zum Andenken in die neue Kirche versetzt sind.
Ueber den Schnitzker dieser Stühle ist aus einer bei der Kirche noch aufbewahrten Schrift auf einem Bogen Papier in Folio eine kurze Nachricht des Pastors Joachim Mancelins (1588 † 1628), a. a. O. S. 181, mitgeteilt, aus welcher hervorgeht, daß das Gestühl der Kirche im Jahre 1598 vollendet war. Da diese Schrift in Folge neuerer Entdeckungen wichtig ward, so habe ich mir dieselbe von


|
Seite 180 |




|
dem Herrn Pastor Gundlach zur Abschrift erbeten, um sie hier in der
vollständig mitzutheilen. Aus dieser Schrift geht nun hervor, daß dieselbe von dem Pastor Joachim Mancelius verfaßt und von demselben im J. 1598 zum Andenken in die damals fertig gewordene Taufe gelegt ist, wo sie in jüngern Zeiten gelegentlich gefunden sein wird. Mancelius hat also nach ungefähr 300 Jahren seinen Zweck erreicht.
Diese Schrift hat in den neuesten Zeiten ein merkwürdiges Seitenstück erhalten. Im J. 1874 ward bei dem Abbruch der Kirchenstühle in der äußern Brüstung des Diedrichshäger Stuhles am westlichen Ende der Kirche eine gleiche Schrift, wie Nr. 1, auf einem Bogen Papier in Folio von derselben Umschrift gefunden und mir von dem Herrn Amtmann Burchard zu Rostock mitgetheilt. Die Schrift war in ein Stück Papier gewickelt, welches fast gänzlich vergangen war. Die Schrift selbst ist von Gewürm ungewöhnlich stark zerfressen und abgeschabt und hat daher sehr viele Lücken.
Durch Hülfe der ersten in der Taufe gefundenen Schrift und scharfes Studium ist es aber gelungen, den Inhalt so herzustellen, wie er hier in der
mitgetheilt wird, freilich mit vielen Ergänzungen in [ ], welche aber wohl richtig sein werden.
Aus dieser Schrift geht nun hervor, daß sie von dem Pastor Joachim Mancelius im J. 1598 zum Andenken an die Vollendung der Stühle an den Ort, wo sie gefunden ist, gelegt ward. An derselben Stelle hatte früher, also ohne Zweifel seit der katholischen Zeit, eine Orgel gestanden, welche in den letzten Jahrhunderten der abgebrochenen Kirche fehlte, aber die Stelle hatte schon 1598 eine geraume Zeit "wüste gestanden".
Es folgen hier die beiden Schriftstücke, welche zugleich auch ausführliche Nachrichten über das Verwaltungs=Personal in der Stadt Rostock und dem Flecken Warnemünde im J. 1598 geben.


|
Seite 181 |




|
Anlage Nr. 1.
1598, März 29.
Im Jar nach der gnadenreichen geburt vnsers Herrn Jesu Christi 1598 ist im namen der heiligen Dreyfaltigkeit diese gegenvertige Tauffe dieser Kirchen zu Wernamunde zum zierath gemacht, vorfertiget vnd an diesen ort gesetzet worden, als Rudolphus Secundus, der in diesem jare noch mit dem Torkischen Keyser im Königreich Vngern heftig gekrieget, Römischer Keyser gewesen ist.
In diesem Fürstenthumb Meckelnburg hat der hoch[gebor]ner Furst vnd Herr Hertzog Vlrich, der fast 70 jare [an] alter erreicht vnd welchem der liebe Gott noch lange [die]sem lande zum besten fristen vnd erhalten wolle, das regiment loblich vorwaltet.
Daneben sind auch die Durchlauchtigsten Fursten vnd Herrn Hertzog Carolus, Hertzog Sigismundus Augustus, Hertzog Adolphus Fridericus vnd Hertzog Johannes Albertus Herrn im Lande Meckelnburg gewesen.
Die Burgermeister vnd Rathsvorwanten der Statt
Rostock sind zu diesem male gewesen: Herr Jacob
Lemchen, Herr M. Henricus Runge, Herr D.
Fridericus Heine vnd Herr Johan Kellerman,
Burgermeister,
Herr Andreas Maes vnd Herr
Nicolaus Herman Kemm[erherrn]
Herr Michael
Breide, Herr Herman Nettelnblad
vnd Herr
M. Johannes Korff, wetteherrn,
Herr
Michael Geismer vnd Herr M. Petrus
Voth,
weinherrn,
Herr Bartelt Schmidt, Herr
Zacharias Beneken
vnd Herr Hermannus
Schilling, Richteherrn,
Herr Vith von
Heruern, Herr Leuin Rike, Herr
Steffen
Dobbin, Herr Hinrich Guseber vnd Joachim Wedige.
Zu dieser Zeit hat ein Reichsthaler gegolten 33 schilling lubisch vnd ist eine schware theuerung gewesen, das ein scheffel Roggen 36 schilling lubisch vnd ein scheffel gersten 20 lubische schillinge gegolten hat.


|
Seite 182 |




|
Vber dieser vnd den andern benachbarten Kirchen des Rostkerschen Kreises, die außerhalb der Statt Rostock gelegen sind, ist zu diesem mal von vnserm itztregierenden Herrn Hertzog Vlrich zum Superintendenten deputiret vnd vorordnet, der wolgelehrter Johannes Frederus der Heiligen schrifft Doctor vnd Professor in der Vniuersitet Rostock.
Dieser Kirchenpastor vnd Prediger ist zu diesem mal gewesen Herr Joachimus Mancelius Rigensis, der nicht allein die reine Euangelische lehre, wie sie Ao. 1530 auff dem Reichstage zu Augsburg dem Keyser Carolo 5 vnd den damals Reichsstenden ist vbergeantwortet worden, in dieser Kirchen nach den gaben, die ihm Gott gegeben, rein vnd lauter gelehret vnd die hochwirdigen Sacramenten nach der Einsetzung des Herrn Christi administriret vnd verreichet hat, sondern auch mit fleisse befoddert, das diese Kirche mochte ordentlich gezieret vnd reinlich gehalten werden, wie denn auch zu seinen Zeiten der Predigstul sampt allen Mans= vnd Frawenstuelen, desgleichen alle fenstern in der Kirchen, daneben auch die Wedem oder das Pfarhaus nebenst der Schulen ist gebawet vnd verfertiget worden.
Der Vogt in diesem Flecken Wernamunde der von einem Erbarn Rath der Statt Rostock alhie eingesetzet ist, hat geheissen Heinrich Boddeker, der ein feiner, alter, betageter Man fast von seinen 70 Jaren gewesen und in die 34 Jaren diesem Flecken vorgestanden hat.
Die Vorsteher dieser Kirchen, die diese Tauffe haben bawen vnd sonst in der Kirchen alles mit fleisse haben vorfertigen vnd vorthsetzen helffen, sind gewesen: Jacob Rikentroch, Simon Hagemeister, Hinrick Kale vnd Hans Langehinricks.
Der Schulmeister hat geheissen Jodocus Jungling.
Vnd der Schnitzcher, der diese Tauffe vnd auch den Predigstuel sampt allen Mans= vnd Frawenstulen für die gebuer gemachet, hat in diesem Flecken gewohnet vnd hat geheissen Hans Wegener.
Dies ist zur gedechtnis geschrieben vnd hirin geleget Ao. 1598 den 29. Martii.


|
Seite 183 |




|
Anlage Nr. 2.
Des Pastors Joachim Mancelius
Nachricht über die Erbauung der Stühle in
der alten Kirche zu Warnemünde.
1598,
Junii 14.
Nachdem noch bey Menschengedencken . . . . . . . Orgelwerck, welchs von vnsern lieben Vorfaren mi[t] g[roßen] vnkosten die[ser] Kirchen [z]u[m zie]rath erbawet, an diesem orte gestanden . . . . . . noch zu . . . . . . . noch heutiges tages alhie sehen . . . . . . . . je . . . . . . . . ff Herrn Jacobi . . . . . ern . . . . . . . . da . . . . . . . . . . [bew]illigung dieses kirchspiels . . . . . . . . er . . . . [v]erwustet worden, diese stete . . . . . . e raume Zeit wuste gestanden, als haben die itzigen vorsteher dieser kirchen nemlich Jacob Rikentroch, Simon Hagemeister vnd Hans Langehinricks im namen der heiligen Dreyfaltigkeit aus reiffem vnd zuuor wolbedachtem Rath, auch mit vorwissen der Erbarn . . . . . Herren de[putirten der Statt Rost]ock als Herrn Herman Nettelnblat vnd Herrn M. J[ohannis] Korff vnd mit consens vnd volbort Ihres Pastorn Herrn Joachimi Mancelii dieso Stuele der Kirchen zum zierath vnd den [le]uten, die zu jeder Zeit mit vorwilligung der vorsteher darauff stehen werden, zum besten . . . . bawen vnd vorzeitigen lassen i[m jar]e nach der geburt vnsers Herrn Jesu Christi 1598, als Rudolphus S[ecundus in diesem jare mit dem Torkischen] Keyser [im Königreich Vngern heftig gekrieget Romischer Keyser] gewesen ist.
[In diesem Furstenthumb Meckelnburg hat der] hochgeborner F[urst] vnd [Herr H]ertzog [Vlrich, der fast 70 jar] im alter er[reicht] vnd welchen der liebe [Gott noch lange diesem] lande zum best[en fri]sten [w]olle, das regiment vor sich vorwaltet.
Die Burgemeister vnd Rathsuorwandten der Statt
Rostock seind zu diesem mal gewesen: Herr Jacob
Lem[cke], Herr M. Henricus Runge, Herr D.
Fridericus Heine vnd Herr Johan Kellerman,
Burgermeister, Herr Andreas Maes vnd Herr
Nicolaus Herman, Kemmerherrn, Herr Michael
Geismer vnd Herr M. [Petr]us [Vo]th,
[Wei]nherrn, Herr Michael Breide, Herr Herm[an
Nettelnb]la[t] vnd Herr M. [Johan]nes Korff
[we]tteherrn, Herr Bertelt Schmid, Herr
Zacharias Ben[ecke] vnd [Herr] [Her]mannus
S[chi]lling, Richtherrn,
Die vnbeämpten
Rathsherrn seind [gewesen Herr Vi]th von
Heruern, Herr Leuin Rike, Herr S[teffen Dobbin,
Herr Hinri]ck Gusebier vnd Herr Joach[im Wedige].


|
Seite 184 |




|
[Vber diesen vnd den] andern benachbarten K[irchen] des [Rostker]schen [Kreises, die] außerhalb der Statt Rostock gelegen sind, ist zu diesem [mal] [von v]nserm itztregierenden Landsfursten [Hertzo]g Vlrich zum [Super]intendenten deputiret vnd vorordnet D[octor Johan]nes Frederus der Heiligen Schrifft Doctor vnd Professor in [der Vniuersitet] Rostock.
Dieser K[irchen Pastor vnd Pre]diger ist [zu diesem male gewesen] Herr Joachimus Mancelius Rigensis, [der nicht allein die reine] Euangelilehre, wie sie Ao. 1530 auff dem Reichstage zu Augsburg dem Keyser Carolo 5 vnd den damals Reichsstenden ist vberantwortet worden, in dieser Kirchen, nach den gaben, die ihm Gott gegeben, rein vnd lauter gelehret vnd die hochwirdigen Sacramenten nach der einsetzung des Herrn C[hristi i]n beider [gesta]lt administriret vnd vorreicht hat, sonde[rn auch fl]eissig bef[oddert hat, das] diese Kirche [moch]te gezieret vnd reinlich gehalten werden, wie denn zu seinen Zeiten nicht allein diese Stuele vnd der Predigstuel sampt allen Mans= vnd Frawenstulen, desgleichen die Tauffe vnd alle Fenstern in der Kirchen, [so a]uch die Wede[m oder] das Pfar[aus nebenst der Schulen v]on g[run]d auff seind gebawet [vnd vo]rfertiget worden.
[Der Vogt in diesem Flecken Wer]namu[nde der von einem Erbarn] Raht [der Statt Rostock alhie ein]gesetz[et ist, hat geheissen Heinrich] Bo[ddeker, der ein seiner, alter, be]tag[eter Man fast von seinen 70] [Jaren gewesen] vnd [auch] in d[ie 34 Jaren] diesem Flecken vo[rgestanden] hat.
Der [Schulmeister] der der g . . . . en . . .er Schulen vorgest[anden], hat geheissen Jodocus J[ung]ling.
Vnd der Schnitzcher, der diese Stuele, wie dan auch den Predigstuel sampt allen Mans= vnd Frawenstuelen, daneben auch die Tauffe für die gebur gemacht, hat in diesem Flecken gewohnet vnd geheissen Hans Wegener.
[Dis] ist zum gedechtnis geschrieben vnd hirin gel[eget] [Ao. 15]98 den Mittwochen . . dem Pfi[ngst]marckt, welcher war der 14 [ta]g Junii.


|
Seite 185 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Frauenmark.
Nachtrag zu Jahrb. XXV, S. 282.Die Kirche zu Frauenmark bei Crivitz ist in den Jahrb. XXV, S. 282 flgd., ausführlich und eingehend beschrieben. Diese seltene romanische Felsenkirche war sowohl im Mauerwerk, als in der innern Ausrüstung vernachlässigt und verfallen, so daß eine Restauration geboten erschien, welche denn auch im J. 1872 ausgeführt ist.
Bei dieser Restauration sind die Rundbogenfenster der Apsis und die Chorfenster in ihrer Beschaffenheit erhalten; das zugemauerte Rosenfenster hinter dem Altare ist wieder geöffnet. Da aber die Fenster des Schiffes gelitten hatten und neben den südlichen Fenstern ein großes, viereckiges Loch durchgebrochen war, um mehr Licht in die allerdings dunkle und niedrige Kirche und für den Prediger zu schaffen, so sind im J. 1872 in jeder Wand des Schiffes zwei größere Fenster im Uebergangsstyle mit Ziegeleinfassungen aufgeführt, so daß das viereckige Loch hat wieder geschlossen werden können. Sonst sind im Bau keine Veränderungen vorgenommen.
Alte Malereien auf den Wänden sind bei der Restauration nicht entdeckt.
Von dem Mobiliar hat nur der Altar erhalten werden können.
Der Altar der Kirche zu Frauenmark.
Der Altar der Kirche zu Frauenmark bei Crivitz ist ein gothischer Doppelaltar mit 2 Flügeln aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Die Verhältnisse sind hoch und gut construirt, die Schnitzereien an Form und Arbeit lobenswerth. Der ganze Altar ist 6 Fuß hoch und 12 Fuß breit, also jeder Flügel 3 Fuß breit.
Die Mitteltafel enthält in der Mitte:
die Jungfrau Maria in großer Figur, mit dem Christkinde auf dem Arme, in der Sonne, auf dem Halbmonde gehend, umgeben von einem Rosenkranze in Wolken, in welchen 6 Engel in halber Figur mit musikalischen Instrumenten lobpreisen. In den 4 Ecken sind 4 größere Engel in ganzer Figur, von denen die 2 oberen fliegend eine schwebende Krone über dem Haupte der Maria halten, die beiden unteren knieend anbeten.
Zu beiden Seiten der Maria stehen noch auf der Mitteltafel an jeder Seite 2 kleine Figuren über einander:


|
Seite 186 |




|
zur Rechten:
oben:
S. Anna, mit Maria und dem Christkinde ("selbdritte"),
unten:
S. Georg, mit dem Drachen;
zur Linken:
oben:
[Lambertus], ein Bischof; das Attribut (ein Wurf spieß) in der linken Hand fehlt;
unten:
S. Johannes d. E v., mit dem Kelche.
Die Flügel sind quer getheilt. Jeder enthält in jeder Reihe 3 Heiligen=Figuren, und zwar in der Mitte immer eine weibliche Heilige und zu jeder Seite derselben einen männlichen Heiligen. Die Flügel enthalten folgende Figuren in folgender Reihe, und zwar immer von der Mitteltafel anfangend:
zur Rechten:
oben
S. Paulus, mit Schwert;
S. Katharina,
gekrönte Jungfrau, mit Schwert und Rad;
S.
Petrus, mit 2 Schlüsseln an einem Riemen über
dem Arme hangend und Buch;
unten:
S. Antonius, mit dem Antoniuskreuz und dem
Schwein neben den Füßen;
S. [Margarethe],
gekrönte Jungfrau; in der linken Hand fehlt das
Schwert;
S. Jacobus d. ä., Apostel, mit
Pilgerstab und Buch;
zur Linken:
oben:
S. Johannes d. T., mit dem Lamm auf einem Buche
auf dem Arme;
S. Maria Magdalena in der
linken Hand mit der geöffneten Salbenbüchse,
deren Deckel sie mit der rechten Hand hält;
S. Christoph, mit dem Christkinde auf der
Schulter, auf Wellen;
unten:
S. [Nestor], ein Bischof, mit einem langen Kreuze
in der Hand;
S. Barbara, gekrönte Jungfrau
mit dem Thurme auf der linken Hand;


|
Seite 187 |




|
S. [Laurentius], ein Diakon, die Attribute, ein Rost in der linken Hand und ein Palmzweig in der rechten Hand, fehlen.
Die Malereien auf den Rückseiten der Flügel sind spurlos abgefallen und die Tafeln schon längst übertüncht.
Der Altar ist im J. 1872 nach altem Styl restaurirt und in den Attributen und sonst ergänzt.
G. C. F. Lisch.
Sonst waren nur noch einige Wappen vorhanden, welche noch vor der Restauration, wie folgt, haben beschrieben werden können.
Wappen.
In den beiden östlichen Fenstern der Seitenwände des Chors sind noch zwei ganz gut in Farben gemalte Allianzwappen, beide ursprünglich gleich, jetzt aber lückenhaft, jedoch so, daß sie sich beide noch ergänzen. Das Wappen des Mannes rechts hat einen Querbalken mit 3 Sternen im Schilde, das Wappen links einen quadrirten Schild, beide mit den dazu gehörenden Helmen; die Unterschriften lauten:
| CORDT GRABOVW | MARGRETA WACKERBARDES |
| 1625. | 1617. |
Die ganzen Fenster werden zu diesen Wappen gemalt gewesen sein. In dem nördlichen Fenster ist eine Rautenscheibe mit alter Verbleiung vorhanden, in welcher noch 1 kleine Rauten, jede von ungefähr 1 Zoll Höhe, neben einander, jede mit einem v. Grabowschen Wappen in Farben fein bemalt sind. Dieser ganz eigenthümliche, bisher noch nicht beobachtete Schmuck, welcher von unten gar nicht in die Augen fällt, macht sich sehr gut und angenehm. Die großen Wappen sind viel kräftiger gemalt. Diese Glasmalereien sind bei der Restauration zerfallen und verloren gegangen.
Diese Wappen sind von Cord v. Grabow, auf dem zu Frauenmark eingepfarrten ehemaligen alten Ritterlehn Gömtow, jetzt Friedrichsruhe, gesetzt worden. Gömtow war in der ältesten Zeit ein Lehn der rittermäßigen Familie v. Mallin. Im 16. und 17. Jahrh. war das Gut ein Lehn der Familie v. Grabow. Vgl. Jahrb. XVIII, S. 275 flgd. Dieser Cord v. Grabow war Cordt der jüngere; im J. 1614 erscheinen in den Acten "Churdt Grabow und Churdt Grabow der jünger." Damals saß noch Franz v. Grabow, welcher


|
Seite 188 |




|
1623-24 starb, auf Gömtow; mit ihm und seinen Söhnen starb die Gömtowsche Linie aus. Nach ihm erscheint Cord v. Grabow, nach v. Gamm aus dem Hause Sukwitz, als auf Gömtow gesessen. Sein Schwiegersohn war ein Barner, dessen Wappen noch auf einem Kirchenstuhl steht. Seit den trüben Jahren des dreißigjährigen Krieges verschuldete aber die Familie und das Gut kam auf längere Zeit in die Hände der v. Koppelow. Im J 1631 verpfändete Cord v. Grabow das Gut an seinen "Schwager" Jürgen Christoph v. Koppelow auf Siggelkow, welcher seine "Schwestertochter" zur Frau hatte, für 3000 Gulden; 1641 ward diese Verpfändung an denselben für 4000 Gulden erneuert; 1653 cedirten Cord v. Grabow's Gläubiger das Gut an denselben v. Koppelow für 16,000 Gulden. Daher steht auch das v. Koppelowsche Wappen an einem Kirchenstuhle. 1659 war Hardenack v. Grabow, Cord's Sohn, der nächste Agnat. Dieser Cord v. Grabow ist bisher nur dem Namen nach, seine Frau gar nicht bekannt gewesen. Margarethe Wackerbart stammte ohne Zweifel aus dem Hause Katelbogen, da Jürgen v. Wackerbart auf Katelbogen wiederholt für Cord v. Grabow bürgt; 1632 war Jürgen v. Wackerbart als Klosterprovisor von Rühn gestorben. Auch diese Wappen an den Kirchenstühlen sind bei der Restauration zerfallen und verworfen.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Severin,
zur Pfarre Frauenmark, A. Crivitz gehörend, war ein sehr baufälliger Feldsteinbau mit Ziegeleinfassungen an Thüren und Fenstern, in der letzten Gestalt aus dem 15. Jahrhundert und ohne Kunstwerth. In Severin stand schon im J. 1295 eine Kirche (vgl. Frauenmark); diese Kirche kann aber die jetzt stehende nicht sein, wenigstens nicht in ihrer letzten Gestalt, namentlich an Thüren und Fenstern.
Der Altar ist jedoch gut geschnitzt und nicht ganz ohne Werth. Es ist ein ganz kleiner Flügelaltar, mit kleinen, guten, vergoldeten und bemalten Figuren, wie es scheint, aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Auf der Mitteltafel steht das Bild der Maria mit dem Christkinde in Glorie und Rosenkranz. Die beiden Flügel sind quer getheilt und haben in jeder Abtheilung 2 Heiligenbilder, im Ganzen also


|
Seite 189 |




|
8 kleine Figuren, welche fein geschnitzt sind. Die Anordnung des Altars ist in der Ansicht folgende:
| H. Johannes EV. H. Katharina | H. Barbara. H. Johannes d. T. | |
| Maria. | ||
| H. Gertrud? H. Georg. | H. Margarethe? H. Christoph. |
Die Kanzel war vom J. 1698 und ohne Werth.
Der Eisenbeschlag der Hauptpforte ist eine gute Arbeit mit Lilienverzierungen, das Schloßblech in Form eines Büffelskopfes.
Von den Glocken ist die kleinere vom J. 1527, die größere vom J. 1597, beide mit Inschriften.
Da die Kirche im hohen Grade baufällig war, so ward der Abbruch derselben und die Erbauung einer neuen Kirche beschlossen. Nach Vollendung der neuen Kirche im J. 1871 ist die alte Kirche im J. 1872 abgebrochen.
Der alte Altar und der Türbeschlag sind im J. 1871 zum Antiquarium abgegeben.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche (Kapelle) zu Schlieven,
zur Pfarre Frauenmark im A. Crivitz gehörend, war ein kleines, schlechtes, baufälliges Oblongum=Gebäude aus rohen, nicht einmal gespaltenen Feldsteinen mit Ziegeleinfassungen an Thüren und Fenstern, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, äußerst kunstlos und roh, ohne irgend etwas Bemerkenswerthes. Eben so war das ganze Mobiliar ohne allen Werth. Drei geschnitzte Heiligenfiguren: Gott Vater mit dem Leichnam des Sohnes im Schooße, S. Petrus und eine weibliche Heilige, welche zum Altarschreine auf einer rohen Bretterwand angebracht waren, sind ins Antiquarium genommen. Da die Kapelle sehr baufällig und auch wohl überflüssig war, so ist sie im J. 1872 abgebrochen, um nicht wieder aufgebauet zu werden.
Von den beiden Glocken war die eine ungefähr so alt, wie die Kirche. Beide Glocken sind zum Besten der Mutterkirche verwerthet.
Die ältere Glocke ist im J. 1872 in Wismar umgegossen. In Minuskelschrift stand auf derselben, nach der Lesung des Hrn. Dr. Crull zu Wismar:


|
Seite 190 |




|
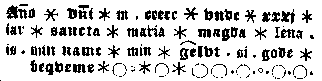
Die Inschrift lief oben um die Glocke in einer Reihe herum. Das Wort bequeme an welches sich eine Reihe von Münzabgüssen schloß, stand auf der Fläche der Glocke. Das Gepräge der Münzen war, wie gewöhnlich, meist zu unklar, um dieselben zu erkennen, jedoch entsprach die dritte in Bild und Umschrift deutlich dem Avers des halben Reichsorts der Herzoge Magnus und Balthasar (Evers II, S. 42), die drittletzte kennzeichnete sich durch den Greifen und den Namen BVCSLAVS als Pommersch, während aus der letzten der Wismarsche Schild erkennbar war.
Eine Gießermarke hatte die Glocke nicht.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirchen
zu
Karchow, Zielow,
Damwolde, Melz, Wendisch=Priborn, Lärz,
Krümmel,
in der Gegend von Wredenhagen und Röbel, sind oder waren nach den Mittheilungen des Herrn Pastors Behm, früher zu Melz, und des Herrn Archivars Hänselmann zu Braunschweig, früher zu Ludorf, Fachwerkgebäude aus Holz und Ziegeln, also ohne kunstgeschichtlichen Werth. Die Holzfachwerkkirchen scheinen am meisten, vielleicht allein, im südlichen Meklenburg verbreitet zu sein.
Die Kirche zu Melz war 1572 erbauet und ist 1816 abgebrochen und durch eine steinerne ersetzt; sie war nach Ueberlieferungen auch von Fachwerk.
Die Kirche zu Wendisch=Priborn war auch von Fachwerk. Im Visitations=Protocolle vom J. 1705 heißt es: "Die Kirche ist von 6 Fach in Holtz mit Maurensteinen die wände außgesetzet, in zimblichem stande. Die Kirche hat überall 22 Fensterluchten." Sie ist im J. 1868 abgebrochen, um durch eine steinerne ersetzt zu werden. In der alten Kirche waren mehrere kleine Glasmalereien aus neueren Zeiten, namentlich ein herzoglich meklenburgisches Wappen vom J. 1591, welches in die Fenster der neuen


|
Seite 191 |




|
Kirche wieder eingesetzt werden soll. Das Jahr 1591 ist wahrscheinlich das Jahr der Erbauung der Kirche. Ein anderes Wappen, welches in das Antiquarium zu Schwerin gekommen ist, war ein Wappen der hochverdienten Herzogin Elisabeth, ersten Gemahlin des Herzogs Ulrich von Güstrow, Tochter des Königs Friedrich I. von Dänemark, welche 15. Octbr. 1586 starb; das Wappen ist auch vom J. 1591 datirt, also der Fürstin, welche wohl noch Antheil an der Erbauung der Kirche hatte, zu Ehren nachgesetzt. Das Wappen hat unter einer Krone einen fünfschildigen Hauptschild, durch ein weißes (Danebrog) Kreuz durchschnitten:
| Dänemark. | Norwegen. |
| (Im goldenen Schilde drei | (Im rothen Felde ein goldener |
| blaue Leoparden.) | Löwe mit einer Hellebarde.) |
| Schweden. | Gothen. |
| (Im blauen Felde drei goldene | (Im rothen Felde ein blauer |
| Kronen.) | Löwe.) |
|
|
|
|
Dieser Hauptschild hat einen kleinen vierfach getheilten Herzschild:
| Schleswig. | Holstein |
| (Im goldenen Felde zwei blaue | (Im rothen Felde ein silbernes |
| Löwen.) | Nesselblatt.) |
| Stormarn. | Oldenburg. |
| (Im rothen Felde ein silberner | (Im goldenen Felde zwei rothe |
| Schwan.) | Querbalken.) |
Dieser Herzschild hat wieder einen ganz kleinen Herzschild:
| Meklenburg |
|
|
Eine Unterschrift lautet:
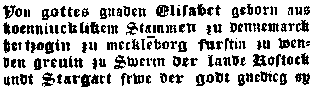
Ein zweites Wappen, welches ebenfalls ins Antiquarium gekommen ist, ist ein (schlechter gemaltes) herzoglich


|
Seite 192 |




|
meklenburgisches Wappen mit sieben Schilden und fünf Helmen, also aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Da das Kreuz für Ratzeburg nicht mit einer Krone bedeckt ist, so gehört das Wappen ohne Zweifel dem Herzoge Gustav Adolph von Güstrow († 1695), unter welchem die Kirche nach den Stürmen des dreißigjährigen Krieges wahrscheinlich restaurirt, jedoch wohl nicht neu gebauet ist, da sich die alten Wappen erhalten haben. Daneben fanden sich z. B. noch 4 kleine ovale Glasbilder, einen Hirten mit Schafen darstellend, aus dem Jahre 1680, und 2 ähnliche mit bürgerlichen Wappen und andere, ohne Jahreszahl. Die Restauration wird also wohl im Jahre 1680 geschehen sein. Schriftliche Nachrichten darüber fehlen.
Nach des Herrn Pastors Behm Besichtigung und meinen eigenen Untersuchungen, welche theilweise schon in den Jahrbüchern mitgetheilt sind, sind dagegen folgende Kirchen der genannten Gegend aus Stein gebauet: Minzow, Nätebow, Ludorf, Leizen, Finken, Kambs, Wredenhagen, Kiewe, Vipperow, Buchholz, Rechlin.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Die Kirche zu Kittendorf
ist, nach den Mittheilungen des Herrn Superintendenten Schmidt zu Malchin eine zweischiffige Kirche mit einem viereckigen Schiff und einem kleinen Altarchor. Die Gewölbe des Schiffes werden durch einen einzigen Pfeiler in der Mitte getragen, grade wie in der Kirche zu Ankershagen. Die große Glocke hat die Inschrift:
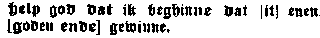
Die mir mitgetheilte Lesung
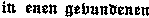 kann nicht richtig sein. Diese
Glocke ist also der großen Glocke gleich, welche
in der Nicolai= oder Schelfkirche zu Schwerin
hängt; vgl. Jahresber. III, S. 193.
kann nicht richtig sein. Diese
Glocke ist also der großen Glocke gleich, welche
in der Nicolai= oder Schelfkirche zu Schwerin
hängt; vgl. Jahresber. III, S. 193.
Die dritte Glocke hat die Inschrift:



|
Seite 193 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Mollenstorf.
Die Kirche zu Mollenstorf bei Penzlin ist ein einfaches Oblongum mit grader Altarwand. Sie ist in ihrem untern Theile von Granit erbauet, hat in der Altarwand 2 Fenster, in der Südwand 3 und in der Nordwand jetzt nur 2 Fenster. Die Kirche hat eine Balkendecke. Nord= und Südwand sind außen überkalkt. Die Fenster der Altarwand lassen noch den alten Charakter erkennen. Sie sind nur schmal, im Spitzbogen gewölbt und ohne Einfassung grade eingehend. Die Pforte im Westen, welche jetzt vermauert ist, hat eine rechtwinklig eingehende Schmiege, deren Gliederung durch einen vollkantigen Stein gebildet wird; überwölbt wird sie ebenfalls im Spitzbogen. Die Südpforte ist modernisirt. Im Innern der Kirche ist in der Nordwand ein altes Schnitzwerk eingemauert, aber leider überkalkt; es stellt die Maria dar, welche den Leichnam des Herrn im Schooße hält.
Von den drei Glocken im Glockenstuhl hat die eine die interessante Inschrift:
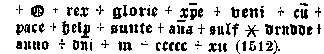
Nach Archiv für Landeskunde Jahrg. XVI, H. 7 und
8, S. 340, soll in der Inschrift stehen:
 ; allein dies steht nicht da;
vielmehr ist ganz klar zu lesen:
; allein dies steht nicht da;
vielmehr ist ganz klar zu lesen:
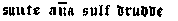 1
).
1
).
Nach demselben Archiv a. a. O. soll bis 1590 eine eigne Pfarre zu Mollenstorf bestanden haben. Urkundlich kommt ein Priester (sacerdos) von Mollenstorf ("Molmerstorp") zuerst 1335, Septbr. 30, als Zeuge zu Penzlin vor. Vgl. Meklb. Urk.=Buch VIII, Nr. 5619.
Rumpshagen.
H. Rönnberg, Cand.


|
Seite 194 |




|



|


|
|
|
Die Kirche zu Kirchdorf auf Pöl.
Nachtrag zu Jahrb. XV, S. 308.
Die a. a. O. erwähnte große Glocke ist im Jahre 1864 umgegossen, so daß günstige Gelegenheit war, die Inschrift auf derselben zu lesen. Sie lautete:
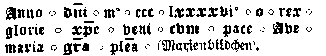 (Marienbildchen).
(Marienbildchen).
Ein Gießerzeichen fand sich auf der Glocke nicht vor.
Ein Irrthum wird es sein, wenn dort S. 307 der H. Nicolaus als Hauptpatron der Kirche angesehen ist, da sich inzwischen ein aus dem J. 1624 stammender Abdruck des alten Kirchensiegels gefunden hat, welcher vielmehr die Mutter Gottes unter einem Baldachin zeigt, so daß man die Kirche als eine Marienkirche anzusehen hat. Die Umschrift des parabolischen Siegels von 2 Zoll Hamb. Höhe lautet:
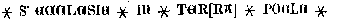
Im Anfange der Glockeninschrift stand auch ein kleines Marienbild.
Wismar.
C. D. W.


|
Seite 195 |




|



|


|
|
:
|
Glocken.
Die Glocken der Kirche zu Dobbertin.
Die oberste Verwaltung des Klosters Dobbertin hat im J. 1872 die drei großen Glocken der Kirche veräußert, weil sie nicht musicalisch zu einander stimmten, und dafür neue Glocken mit harmonirenden Tönen angeschafft. Von diesen alten Glocken ist nun die größte von besonderer Wichtigkeit für die alte Glockenkunde.
1) Die größte Glocke, in der Form die schönste, 972 Kilogramm schwer, ist die älteste und wird aus der ersten Hälfte des 14. Jahrh. stammen. Sie hat 3 Reihen Inschriften unter einander. Die oberste Reihe um den Helm hat eine Inschrift in sehr großer Majuskelschrift, welche im Ganzen zwar schön, strenge und klar, jedoch in einigen Buchstaben etwas geziert ist:
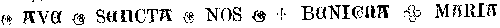
Ein Anhaltspunct für den Anfang ist nicht
gegeben. Ich habe als Anfang das Wort
 genommen, da dieses ja bekanntlich
der Anfang des englischen Grußes ist. Wenn nun
auch die einzelnen Worte verständlich sind, so
ist doch die Construction nicht klar und rein;
das Wort NOS (als Accusativ) bleibt immer ein
Stein des Anstoßes. Ich bin daher auf den
Gedanken gekommen, daß
genommen, da dieses ja bekanntlich
der Anfang des englischen Grußes ist. Wenn nun
auch die einzelnen Worte verständlich sind, so
ist doch die Construction nicht klar und rein;
das Wort NOS (als Accusativ) bleibt immer ein
Stein des Anstoßes. Ich bin daher auf den
Gedanken gekommen, daß
 der Imperativ von einem grade
nicht classischen Verbum benignare (= begnade,
segne uns) sein könne. Einen andern Ausweg kann
ich nicht finden. - Herr Archivar Dr. Wigger
vermuthet, daß NOS eine Abkürzung von
der Imperativ von einem grade
nicht classischen Verbum benignare (= begnade,
segne uns) sein könne. Einen andern Ausweg kann
ich nicht finden. - Herr Archivar Dr. Wigger
vermuthet, daß NOS eine Abkürzung von
 sein könne; aber es steht kein
Abkürzungszeichen da, das sonst in diesen
Umschriften nicht fehlt.
sein könne; aber es steht kein
Abkürzungszeichen da, das sonst in diesen
Umschriften nicht fehlt.
Unter dieser ersten Reihe steht eine zweite, ebenfalls rund herum, ohne Lücke. Diese Reihe ist im allgemeinen in langer, schmaler enger Minuskelschrift gehalten, welche jedoch noch mit Majuskelschrift gemischt ist:


|
Seite 196 |




|
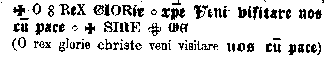
Diese Anrufung: O rex gloriae etc. ist auf alten Glocken, besonders des 15. Jahrhunderts, bekanntlich sehr gewöhnlich wenn auch ohne den Zusatz: visitare nos.
Ganz besonders auffallend ist der Ausdruck
 in Majuskelschrift am Anfange
oder Ende der zweiten Reihe unter dem Kreuz und
in Majuskelschrift am Anfange
oder Ende der zweiten Reihe unter dem Kreuz und
 . Die Buchstaben sollen 2 Worte
bilden, denn es steht ein Stern zwischen
. Die Buchstaben sollen 2 Worte
bilden, denn es steht ein Stern zwischen
 und
und
 Das
Das
 steht verkehrt, d. h. ist recht
modellirt und verkehrt gegossen. Der vorletzte
Buchstabe des letzten Wortes ist aber schwer zu
deuten. Es ist ein ungewöhnlich gezierter und
geschnörkelter Buchstabe, wie ähnliche in der
ersten Reihe vorkommen, und ist einem
steht verkehrt, d. h. ist recht
modellirt und verkehrt gegossen. Der vorletzte
Buchstabe des letzten Wortes ist aber schwer zu
deuten. Es ist ein ungewöhnlich gezierter und
geschnörkelter Buchstabe, wie ähnliche in der
ersten Reihe vorkommen, und ist einem
 sehr ähnlich, jedoch in allen
Zügen mehr gerundet. Ich kann nichts anders
finden, als daß dieser Buchstabe ein
mißverstandenes, verunglücktes
sehr ähnlich, jedoch in allen
Zügen mehr gerundet. Ich kann nichts anders
finden, als daß dieser Buchstabe ein
mißverstandenes, verunglücktes
 = M, und die ganze Redensart
= M, und die ganze Redensart
 der Name der Glocke ("Laß
mich"? oder "Ohne mich"?) sein
soll, den ich freilich nicht erklären kann. Auch
bewährte Theologen haben auf Befragen den Sinn
nicht deuten können.
der Name der Glocke ("Laß
mich"? oder "Ohne mich"?) sein
soll, den ich freilich nicht erklären kann. Auch
bewährte Theologen haben auf Befragen den Sinn
nicht deuten können.
In der dritten Reihe stehen die Namen der 4 Evangelisten auf 4 Seiten der Glocke:
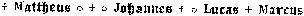
in Minuskelschrift mit Anfangsbuchstaben in
Majuskel. Unter
 steht
steht
 .
.
Was das Alter der Glocke betrifft, so möchte ich den Guß in die Zeit kurz vor der Mitte des 14. Jahrh. setzen, etwa 1340-1350. Für diese Annahme reden die Form der Glocke und der Inschrift=Buchstaben. Die Inschriften sind noch theils in alter Majuskel, theils in alterthümlicher Minuskel gehalten; die seltenen Inschriften werden also in die kurze Zeit des Ueberganges von der Majuskel in die Minuskel fallen.
Für diese Ansicht scheint auch eine gewisse Zeitbestimmung aus der Glocke zu sprechen. Zwar trägt die Glocke keine Jahreszahl, aber doch Zeichen, welche annähernd eine Zeitbestimmung geben. An den stellen der zweiten und dritten Inschriftreihe, wo hier ein kleiner Kreis ° abgedruckt ist, sind die zur Zeit des Glockengusses in Umlauf gewesenen Münzen eingedrückt und mit abgegossen. Diese 7 Münzen


|
Seite 197 |




|
sind nun freilich keine redende Münzen, sondern kleine, starkblechige Bracteaten mit einem einfachen Stierkopfe und mit glattem Rande. Münzen dieser Art werden nach mehrern Anzeichen und Forschungen in die Zeit um die Mitte des 14. Jahrh. fallen, wenn sich auch die Jahrzehende nicht sicher angeben lassen. So hat diese Glocke auch Werth für die vaterländische Münzkunde.
2) Die zweite Glocke, welche nach der Domina Hedwig v. Quitzow den Namen Hedwig trug, ist im J. 1863 von Hausbrand in Wismar gegossen.
3) Die dritte Glocke hat am Ende die Inschrift:
MICHEL BEGUN HATT MICH GEGOSSEN ANNO 1719.
Von demselben bis dahin nicht bekannt gewesenen Glockengießer Michael Begun waren auch zwei in den neuesten Zeiten in Wismar umgegossene Glocken der Kirche zu Krakow vom J. 1717 und der Kirche zu Dobbin bei Krakow, vom J. 1728; vgl. unten.
Schwerin.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Glocken der Kirche zu Bützow.
1.Im Jahre 1873 wurde die große Glocke der S. Elisabeth =Collegiat= Kirche zu Bützow in Wismar umgegossen. Die Krone derselben war tauförmig gearbeitet und endigte jeder der acht Henkel in einem Löwenkopfe von übrigens ziemlich roher Arbeit. Auf dem Halse der Glocke waren zwei Zeilen Schrift in gothischer Minuskel - nur der Anfangsbuchstabe in Majuskel - zwischen glatten Reifen angebracht. Das obere Band mit größeren Lettern war 4 Zoll breit, das untere 2 1/2 Zoll.
In der oberen Reihe las man:
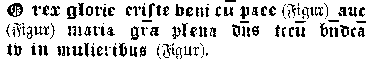
d. i.
O rex glorie criste veni cum pace. Ave, Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.


|
Seite 198 |




|
In der unteren Reihe stand:
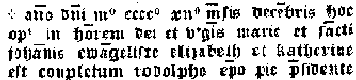 (Gießermarke) (Figur).
(Gießermarke) (Figur).
d. i.
Anno domini mccccxii mensis Decembris hoc opus in honorem dei et virgmis Marie et sancti Johannis ewangeliste, Elizabeth et Katherine est completum Rodolpho episcopo pie presidente.
Die eingeschalteten Figürchen, welche ziemlich roh modellirt waren, boten keinen Anhalt, sie als Darstellungen bestimmter Persönlichkeiten zu erkennen. Das Gießerzeichen bestand aus zwei durch einander gelegten Winkeln, von denen einer nach unten, der andere nach oben offen ist; an den Enden des letzteren sind nach außen und unten gerichtet noch je ein kleiner Haken angebracht.
Dasselbe Zeichen findet sich auf Glocken zu Rostock, Malchin, Lichtenhagen und Warnemünde aus den Jahren 1379 bis 1440.
Auf der Fläche der Glocke war in Umrissen mit Minuskelbuchstaben von 1 1/2 Zoll Höhe, von dem untersten Reifen 2 Zoll entfernt, folgende Inschrift angebracht:
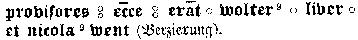 .
.
d. i.
Provisores ecclesie erant Wolterus Liver et Nicolaus Went.
Die Wörter waren durch einfache oder Doppelrauten getrennt. Die Verzierung glich einem gleicharmigen Kreuze, dessen hinterer Arm in eine Art Lilie, die übrigen in kleine Rauten ausliefen.
In Mangels Bützowschen Ruhestunden, XXIII, S. 9. ist die obige Inschrift wesentlich richtig bereits mitgetheilt, nur der Name Liver ist irrtümlich Siver gelesen.
2.
In demselben Jahre verkaufte die Kirchenverwaltung zu Bützow eine unbenutzte, auch von Mantzel a. a. O. nicht erwähnte Glocke.
Die Inschrift zwischen zwei glatten Reifen, an deren unteren sich ein Kranz von Kleeblattbogen schloß, lautete:


|
Seite 199 |




|
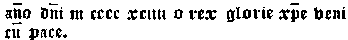
d. i.
Anno domini mccccxciiii. o rex glorie, criste, veni cum pace.
Ein Kreuz zur Bezeichnung des Anfanges war nicht vorhanden.
Auf der Fläche war das Zeichen des Gießers angebracht. Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Glocke von Walkendorf.
Eine im J. 1860 zu Wismar umgegossene Glocke der Kirche zu Walkendorf bei Tessin hatte die Inschrift:
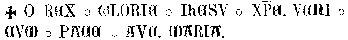
Darunter 4 Male
 mit Kreuz.
mit Kreuz.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
|
Glocke von Gr. Tessin.
Die im Jahrb. XX VII. 1862, S. 218 beschriebene zweite Glocke zu Gr. Tessin bei Neukloster ist seitdem gesprungen und im Jahre 1872 in Wismar umgegossen. Herr Dr. Crull zu Wismar hat die sehr große und schöne Inschrift in Majuskelschrift vor dem Guß abgerieben und durchgezeichnet und die Zeichnung dem Vereine zum Geschenke gemacht.



|


|
|
:
|
Glocken der Kirche zu Steffenshagen.
Im Thurme der merkwürdigen Kirche zu Steffenshagen bei Kröpelin, welche im Jahrb. XIX, S. 395 flgd. beschrieben ist, hangen 2 große Glocken.
Die ältere Glocke hat in doppelter Reihe um den Helm folgende Inschrift in gothischer Majuskel:
1)
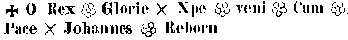


|
Seite 200 |




|
2)
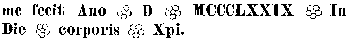
Die zweite Glocke stammt aus dem Jahre 1750.
Beckentin.
H. Rönnberg, Cand.



|


|
|
:
|
Glocke von Lehsten.
Am 13. Julii 1326 bestätigte der Bischof Johann von Schwerin die Bewidmung und Einrichtung der neu gegründeten und erbaueten S. Nicolaikirche zu Lehsten, bei Stavenhagen, (Mecklb. Urk.=Buch VII, Nr. 4749.) Von dieser Kirche ist jetzt nichts mehr übrig; Sie soll im dreißigjährigen Kriege zerstört sein. Auch der Kirchhof ist schon seit längerer Zeit geebnet und zum Theil mit Häusern bebauet. Die einzige Erinnerung ist nur noch ein kleiner, schlechter Glockenstuhl, in welchem eine kleine, hell tönende Glocke hängt mit der Inschrift:
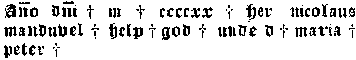
Die Trennungszeichen sind heraldische Lilien. Der
Buchstabe hinter
 und das nachfolgende Wort sind
nicht ganz sicher zu lesen. Von den beiden
anderen Glocken soll eine nach Güstrow verkauft,
die andere nach Gr. Varchow gekommen sein.
und das nachfolgende Wort sind
nicht ganz sicher zu lesen. Von den beiden
anderen Glocken soll eine nach Güstrow verkauft,
die andere nach Gr. Varchow gekommen sein.
Rumpshagen.
H. Rönnberg, Cand.



|


|
|
:
|
Glocke von Qualitz.
Im Jahre 1873 wurden zwei Glocken der Kirche zu Qualitz in Wismar umgegossen. Beide kamen dort bereits zerschlagen an. Die größere, von etwa 1800 Pfd. Gewicht, hatte glatte Bügel, ziemlich flaches Stabwerk oben um die Krone und unten eine alterthümlich geformte Weinranke. Zwischen dem Stabwerk las man:


|
Seite 201 |




|
d. i. Anno domini m cccc lxvi (= 1466)
feria secunda
ante Galli (= October
11). O rex glorie, Jesu
Criste, veni
cum pace. Jaspar, Melchior, Balthasar.
Darunter aus dem Mantel, umgeben von einer eingerissenen Linie, stand
d. i. Clawes Duncker.
Unter dem Namen bemerkte man durch Einritzung in das Modell hervorgebracht das Gießerzeichen und daneben mit vorzüglich fester Hand gezeichnet die H. Katharina mit Rad und Schwert.
Die Zeichnung der Figur, das Gießerzeichen und die Weinlaubverzierung stimmen durchaus zu der schönen Glocke zu Zurow (Jahrb. XXIX, S. 205), welche auch das mit dieser gemein hat, daß die Namen der H. Drei Könige, der "Wetterherren", darauf angebracht sind. Die Wirksamkeit des Gießers, als welchen wir hier Claus Dunker kennen lernen, begreift also sicher die Zeit von 1452 (Thürkow) bis 1466.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
|
Glocken der Kirche zu Vellahn.
Nach dem Bericht des Herrn Baumeisters Daniel zu Hagenow, jetzigen Bauraths zu Neu=Strelitz, hat die zum Abbruch bestimmte Kirche zu Vellahn bei Hagenow (Brahlstorf) folgende Glocken mit folgenden Inschriften:
1) Große Festglocke (Osanna):
1494.
2) Mittelglocke (Vesperglocke):
(Ohne Datum).


|
Seite 202 |




|
3) Kleine Glocke:



|


|
|
|
Glocke von Klinken.
Eine im Jahre 1873 in Wismar umgegossene Glocke der Kirche zu Klinken bei Crivitz hatte, nach der Forschung des Herrn Dr. Crull zu Wismar, folgende Inschrift in gedrängter, undeutlicher gothischer Minuskel, welche recht modellirt gewesen, also verkehrt gegossen, und daher noch schwerer zu entziffern war:
An den durch Kreise ? bezeichneten Stellen waren Bracteaten abgedrückt und abgegossen, wie häufig, leider aber sehr undeutlich. Unter der Inschrift stand ein Gießerzeichen: zwei gekreuzte Zainhaken.



|


|
|
|
Die Glocke zu Consrade.
Die im Jahre 1874 von dem Glockengießer Albrecht Hausbrand zu Wismar umgegossene ältere Glocke der Filialkirche zu Consrade war nach Mittheilung des Herrn Dr. Crull zu Wismar ganz glatt, nur mit einigen Reifen verziert und ohne Inschrift und Gießerzeichen.



|


|
|
|
Glocke von Gr. Vielen.
Nach des Herrn Pastors Köhler Nachrichten über das Kirchspiel Gr. Vielen, im Archiv für Landeskunde 1866, S. 377, hat zu Gr. Vielen eine Glocke die Inschrift:


|
Seite 203 |




|



|


|
|
:
|
Glocke von Gr. Godems
Eine kleine Glocke von Gr. Godems, Pfarre Slate bei Parchim, ward im Jahre 1872 in Wismar umgegossen. Die Glocke hatte die Inschrift:
Darunter ein noch nicht beobachtetes Gießerzeichen.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Glocke von Peccatel bei Schwerin.
(O rex glorie, Criste, veni cum pace, anno domini mdix.)
Das Gießerzeichen sah einem aufgerichteten Pfeile gleich, an dessen unterem Ende sich schräge links ein Dolch mit der Spitze anschloß.
Im Jahre 1872 in Wismar umgegossen.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Glocke von Krakow.
Die im J. 1871 von dem Glockengießer Albrecht Hausbrand zu Wismar umgegossene größere Glocke der Kirche zu Krakow hatte auf dem Mantel die Inschrift:
MICHAEL BEGUN GOS MICH ANNO 1717 IN WELCHEN JAHR DIE EVANGELISCHE KIRCHE IHR ZWEITES JUBILÄUM GOTTLOB GEFEIERT HAT.
Die Glocken von Dobbertin und von Krakow, sowie von Dobbin, waren von demselben Glockengießer.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Glocke von Dobbin.
Eine im J. 1872 in Wismar umgegossene Glocke der Kirche zu Dobbin bei Krakow hatte auf dem Mantel folgende Inschrift in lateinischen Unzialen, kleineren und größeren:


|
Seite 204 |




|
Darunter das Wappen der Barold. Sodann:
Das in der Inschrift enthaltene Datum ist DDDCLLVVVVVIII, also 1728. Christoph August v. Barold war 1726-1746 Besitzer des Gutes Dobbin. Vgl. die Glocken von Dobbertin oben und die Glocke von Krakow von demselben Glockengießer.
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Die Kirchen zu Spornitz, Dütschow, Blievensdors, Herzfeld und Karenzin
(Präpositur Neustadt.).Die Kirche zu Karenzin ist von Fachwerk, die übrigen in der Ueberschrift genannten Kirchen sind Feldsteingebäude mit dreiseitiger Altarwand, welche wohl alle in gleichem Style erbauet, in neuerer Zeit aber auch alle in gleichem Style restaurirt worden sind, so daß sich der alte Styl gar nicht mehr erkennen läßt. Erwähnenswerth ist nur, daß die äußere Altarwand der Kirche zu Blievensdorf eine kleine Nische hat, in welcher vielleicht eine Reliquie oder ein Heiligenbild gestanden hat, doch erscheint sie für ein letzteres etwas zu klein.
An Alterthümern hat nur die Kirche zu Dütschow zwei restaurirte geschnitzte Heiligenbilder an der modernen Kanzel: die Jungfrau Maria, gekrönt, mit dem Christkinde auf dem linken Arm, in der rechten Hand eine Lilie, und einen Heiligen mit Schwert in der Linken und Buch im rechten Arm (Apostel Paulus).
Glocken hangen im hohen Thurm zu Spornitz drei, von denen eine alt ist; die Inschrift um den Helm lautet:
Auf dem Mantel ist zweimal im Relief Christus mit der Erdkugel dargestellt.


|
Seite 205 |




|
Im hölzernen Thurm zu Dütschow hangen zwei Glocken, beide mit einem Gießerzeichen, welches sich auch auf der Glocke von Steffenshagen vom J. 1378 findet. Die kleinere der beiden Glocken hat keine Inschrift und auch weiter keine Verzierungen, die andere hat um den Helm eine Reihe kleiner interessanter Reliefs (Münzabdrücke?) Im Anfange stehen zwei kleine Figuren mit spitzen Schuhen, von denen die eine der anderen einen runden Gegenstand, scheinbar einen Ring, entgegenhält, darauf folgen 6 Medaillons, von denen 4 das Symbol eines Evangelisten tragen; eins zeigt den gekreuzigten Christus, mit Maria und Johannes neben dem Kreuz und eines hat die Brustbilder von drei gekrönten Heiligen, jedenfalls den heiligen drei Königen, deren Namen auch auf der Glocke zu Zurow stehen (Jahrb. XXIX, 205).
Zu Blievenstorf sind 2 Glocken, die eine von 1826, die andere von 1576 mit folgender Inschrift um den Helm:
ANNO DOMINI MDLXXVI HEFT MI DAVID SOUCHET(?) IN GADES NAMEN GATEN. WER GOT VERTRUWET HEFT WOL GEBUWET. HINRIK HUET PASTOR HANS . . . . .
Beckentin.
H. Rönnberg, Cand.
Die Kirchen
zu Paarsch, Lutheran,
Bergrade und Benzin
bei Parchim und Lübz, sind oder waren ebenfalls Fachwerkgebäude, deren immer mehr in Meklenburg bekannt werden.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Paarsch
bei Parchim, eine Filialkirche der St. Georgen=Kirche zu Parchim, war ein kleines Holzfachwerkgebäude mit "Lehmschlag" und baufällig; sie ist daher 1868-1869 abgebrochen und an ihrer Stelle eine neue Kirche gebauet. Das Dorf wird immer nur eine Fachwerkkirche gehabt haben. Denn im Visitations=Protocolle von 1649 heißt es: "Paarsch, Das Kirchlein ist von achzehen gebindt mit dem vmblauffe, vnten mit Eichenen höltzern versohlet vnd in lehmen=


|
Seite 206 |




|
wenden, so auß= vnd inwendig geweißet sein, gesetzet, davon aber etwas mangel ist vndt nothwendig muß gebeßert werden Inwendich stehet ein kleines vergüldetes Altar mit zwenen Flügeln." Dieser alte Altar ist beim Neubau der Kirche entfernt und zurückgesetzt.
Der alte Altar, welcher nicht wieder zur Anwendung gekommen ist, ist ein alter Flügelaltar, ähnlich dem Altar der Kapelle zu Bergrade (vgl. Jahrb. XXXIII, S. 167. Die Mitteltafel ist aus Eichenholz geschnitzt und enthält aus Einem Stück die Anbetung der Jungfrau Maria durch die 12 Apostel in großen Figuren. Die Vorderseiten der beiden Flügel enthalten 4 kleine Gemälde. Auf den Rückseiten der beiden Flügel ist auf jedem Flügel eine große Heiligenfigur, welche sicher die Localheiligen darstellen.
Die kleine Glocke, welche 1874 von dem Glockengießer Albrecht Hausbrand zu Wismar umgegossen ist, hatte nach Mittheilung des Herrn Dr. Crull zu Wismar die Inschrift:
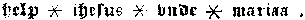
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Lutheran
bei der Stadt Lübz, eine kleine Filialkirche der Pfarrkirche zu Lübz, war auch eine Fachwerkkirche aus Holzwerk mit eingemauerten Ziegelsteintafeln Die Kirche ist im Frühling 1870 wegen Baufälligkeit abgebrochen und sogleich eine neue Kirche in massivem Ziegelbau an der Stelle der alten auf geführt worden. Die alten Ziegel waren noch sehr groß und mögen noch von einer noch altern Kirche stammen. Beim Ausgraben der Erde zu den neuen Fundamenten ward ein mittelalterlicher, kugeliger, blaugrauer Topf in der Erde gefunden, jedoch zerbrochen.
Eine große, alte, heidnische, halbmuldenförmige Quetschmühle aus Granit war als Weihwasserbecken in die Wand gemauert.
Der Altarschrein ist ein alter Doppelflügelaltar, 4 Fuß hoch, 9 Fuß breit.
Die Vorderseite enthält aus Eichenholz geschnitzte und vergoldete und bemalte Figuren. In der Mitte steht die Jungfrau Maria mit dem Christkinde auf dem Arme, in einem Wolkenkranze, auf welchem 2 Füße und 2 Hände mit


|
Seite 207 |




|
den Nägelmalen befestigt sind, umgeben von 6 fliegenden, anbetenden Engeln. Die Flügel sind quer getheilt und enthalten in jeder Abtheilung 2 stehende Heilige. Die Darstellung ist in der Ansicht folgende:
S. Nicolaus (?). S. Margaretha. S. Katharina. S. Andreas.
S. Maria
S. Petrus. S. Barbara. S. Gertrud. S. Erasmus (?).
1) Die erste Figur ist ein segnender Bischof, ohne Attribut, wahrscheinlich der H. Nicolaus, da derselbe nach den Gemälden auf den Rückwänden gewiß einer der Localheiligen der Kirche war.
2) S. Petrus ist nach der Gestalt sicher zu erkennen; die rechte Hand, in welcher er wohl einen Schlüssel hielt, ist abgebrochen.
3) S. Margaretha mit einem Drachen zu den Füßen und
4) S. Barbara mit einem Thurm neben sich, beide als gekrönte Jungfrauen dargestellt und Nothhelferinnen, sind sicher zu erkennen.
5) S. Katharina, gekrönte Jungfrau, mit einem Schwert in der Hand, auch Nothhelferin und Braut Christi, ist auch wohl sicher.
6) S. Andreas mit einem Schrägekreuz.
7) S. Gertrud, im Schleier und mit einem Hospitalmodell im Arme.
8) S. Erasmus(?), Bischof, einer der Nothhelfer, mit einem Kreuzesstab in der Hand, ist wahrscheinlich, jedoch nicht sicher zu bestimmen.
Die ersten Flügel, wenn die Vorderwand durch die Flügel zugedeckt ist, zeigen in Malerei 4 stehende Heilige, von denen wenigstens einige die Localheiligen der Kirche sind. Die Darstellung ist in der Ansicht folgende:
| S. Katha= | S. Martin, | S.Nicolaus, | S.Dorothea, |
| rina, | mit dem | Bischof | mit Rosenkorb |
| mit Schwert | Schwerte | mit 3 Broten | in der Linken |
| und Rad. | den Mantel | auf einem Buche | und einem |
| theilend und | im Arme. | Rosenzweig | |
| mit einem | in der Rechten. | ||
| Krüppel. |
Die Malerei ist ziemlich gut ausgeführt und erhalten. sehr hübsch ist, daß die gemalten Baldachine über den 4 gemalten Figuren durch je 2 abgeschnittene Weinranken mit Blättern und Trauben gebildet sind.


|
Seite 208 |




|
Die Rückwände der zweiten Flügel haben keine Spur von Malerei mehr, sondern sind röthlich übertüncht.
Nach dem Style des Schnitzwerkes und der Malerei stammt dieser Altar aus dem Ende des 15. Jahrhunderts.
In dem Altartische fand sich beim Abbruche desselben noch der Reliquienbehälter, also stammt auch der Altartisch noch aus der katholischen Zeit. Dieser Reliquienbehälter bestand aus einem kleinen zusammengekneteten Wachskuchen von länglich=viereckiger Gestalt, einem Buche von alter Darstellungsform ähnlich, 2 1/2 Zoll Hamburg. Maaß lang, 1 5/8 Zoll breit und 1 Zoll dick (= 5 1/2, 4 und 2 1/4 Centim.) Im Innern sitzt eine ganz kleine, flache bleierne Kapsel, ungefähr 3/4 Zoll (= 1 1/2 Centim.) im Quadrat, in welcher einige kleine Knochensplitter liegen. In die obere Fläche waren an den 4 Ecken und in der Mitte 1 Bruchstück von einer harten, braunen Masse, von der Größe einer Erbse eingedrückt, welche am Licht mit Flamme brannte und einen Geruch etwa wie Birkentheer und Bernstein, ähnlich dem Räucherpulver, von sich gaben, also ohne Zweifel Weihrauchharz waren; die 5 Stücke deuten auf die 5 Wunden Jesu und sind in der Stellung den bekannten 5 Weihkreuzen auf den Altarplatten gleich.
Die Kirche besitzt auch noch eine alte Glocke, welche in einem Glockenstuhl neben dem Kirchengebäude hängt. Die Glocke hat die Inschrift:
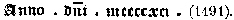
Auf dem Mantel stehen 4 Weihkreuze.
Wahrscheinlich stammen Glocke und Altar aus einer und derselben Zeit.
Ob aber das abgebrochene Kirchengebäude auch so alt war, läßt sich schwerlich bestimmen, ist auch wohl nicht glaublich. Nach einer geschnitzten Inschrift auf einer Stuhlbrüstung:

hat aber die Holzkirche die Stürme des dreißigjährigen Krieges überdauert. Möglich ist es, daß die jetzt abgebrochene Kirche aus dem Jahre 1621 stammte und daß Glocke und Altar aus einer ältern, auch abgebrochenen Kirche herüber kamen, der Altartisch muß dann unberührt stehen geblieben sein.
G. C. F Lisch.


|
Seite 209 |




|



|


|
|
:
|
Die Kapelle zu Bergrade
bei Parchim, Filialkirche von Garwitz, war ebenfalls, wie Paarsch, ein gleiches, verfallenes Gebäude aus Holz und Lehm; vgl. Jahrb. XXXIII, S. 167.
G. C. F Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kapelle zu Benzin,
ebenfalls ein Filial der Kirche zu Lübz, ist gleichfalls ein Fachwerkgebäude, nach dem Visitations=Protocoll vom J. 1706: "Die Kapelle zu Bentzin ist gantz von Holz aufgebauet."
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Friedrichshagen.
Wahrscheinlich nicht lange vor dem Jahre 1265 wurde von dem Kirchspiele Gressow das Kirchspiel Friedrichshagen oder, wie das Volk spricht, Frebbershagen (Fredeberni indago) abgezweigt (Meklb. Urk.=B. 1028). Da ein Komthur des Deutschen Ordens, dem auch Friedrichshagen zum Theil gehörte, in dem hieher eingepfarrten Kl. Krankow damals residirte, so sollte man hier einen Bau erwarten, welcher von einer gewissen Bedeutung wäre. Dies ist aber nicht der Fall und die übrigens sehr hübsch gelegene Kirche ist ein allerdings nicht kleiner, aber roher Bau, welcher der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts angehören dürfte, als die Komthurei bereits veräußert war. Sie bildet eine Halle mit dreiseitigem Chorschlusse, deren Wölbung beabsichtigt, aber nicht ausgeführt worden ist. Dienste und Kragsteine sind nicht vorhanden. Die Fenster, deren an jeder Seite drei sind, sind einpföstig und mit Flachecken eingeschrägt. Ihre Wölbung ist wenig spitzbogig. Bis auf ein ärmliches Dachgesims sind keine Gesimse vorhanden. Der im Westen vorgelegte Thurm hat im untersten Stockwerke auch gewölbt werden sollen.
Das Mobiliar der Kirche stammt aus dem vorigen Jahrhundert und sie enthält nichts aus alter Zeit als ein rohes Temperabild aus dem Jahre 1570 zum Andenken eines


|
Seite 210 |




|
v. Bülow und seiner Gattin, geb. v. Plessen. (S. v. Bülow, Beschr. d. G. v. B., Tab. X, 6).
Wismar.
Dr. Crull.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Pinnow in der West=Priegnitz.
Die alte Feldsteinkirche zu Pinnow in der West=Priegnitz, an der Meklenburgischen Grenze, mit schmalen, leise gespitzten Fenstern im Uebergangsstyl und Pforten im Rundbogenstyl, bewahrt noch einzelne Erinnerungen an die alte Familie von Pinnow und die mit derselben stammverwandte Familie Wagel. Gleich links beim Eintritt durch die südliche Chorpforte steht der Stuhl der Familie von Pinnow, vom Jahre 1565. An der Rücklehne sind, erhaben geschnitten 5 Wappenschilde und daneben, gleichfalls erhaben geschnitten, die entsprechenden Namen und zwar
1) ein rother Schild mit einem weißen Schildzeichen (ähnlich einem Ledermesser) und der Name Clawes Pinnow;
2) ein schwarz und weißer Schild mit rothem Schrägestreifen und der Name Beata Wardenberges;
3) der Pinnow'sche Schild und der Name Achatius Pinnow;
4) ein rother Schild mit weißem Schildzeichen (wie 2 Spitzen) und der Name Wolborch Hentzken;
5) der Pinnow'sche Schild und der Name Arent Achacius Pinnow.
Der letzte Stuhl auf der Nordseite des Schiffs ist der Stuhl der alten Familie Wagel, gleichfalls erhaben geschnitten:
1) ein rother Schild mit dem weißen Pinnowschen Schildzeichen und der Name Jürgen Wagel;
2) derselbe Schild und der Name Hans Wagel;
3) ein schwarz und weißer Schild mit rothem Schrägestreifen und der Name Ursula Wardenberges.
Die alte, aus Eichenholz in Form eines sechsseitigen Kelches gearbeitete Taufe hat auf der einen Seite das volle Pinnow'sche Wappen, flach geschnitzt. Als Helmzier sind 5 Blumen (Pfauenaugen?) an langem Schaft da. Unter dem Wappen steht: JOH. V. PINN. Neben diesem Wappen befindet sich ein Schild mit 3 nach rechts gekehrten Spitzen und als Helmzier eine menschliche Figur, welche in der Rechten einen Stengel mit 3 Blumen (Rosen?) hält. Unter dem Wappen steht ANNA V. KON (v. Königsmark?), neben dem Namen die Jahreszahl 1602. Leider ist die ganze Taufe in


|
Seite 211 |




|
neuerer Zeit mit blauer Farbe überstrichen. Das messingene Taufbecken hat auf dem Rande des Bodens eine Inschrift in folgender Anordnung:
ACCHATZ CHRISTIAN VON PINNOW AGNIES GEBORENE VON RATENOW 1667.
Vor dem Altar deckt ein Leichenstein das Grab des Henning von Rathenow, Erbherrn auf Pinnow und Mellen, welcher geboren wurde 7. Januar 1637 und gestorben ist 15. Mai 1699.
Beckentin. 1873.
H. Rönnberg, Cand.



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Gr. Varchow.
Die Kirche zu Gr. Varchow bei Penzlin bildet ein Oblongum mit dreiseitiger Altarnische. Sie hat ein Granitfundament, ist sonst aber ganz von Ziegeln erbauet. Die Kirche hat eine Balkendecke. Nord= und Südwand haben je 2, die Altarnische hat 3 Fenster. Alle sind im Spitzbogenstyl construirt, sie sind einpfostig, die Zwickel über den Bogen des Pfostenwerks nicht ausgefüllt, die Einfassung wird durch einen Stein mit abgeschrägter Kante gebildet. Die beiden Pforten im Westen und Süden sind ebenfalls spitzbogig und werden durch einen Rundstab eingefaßt. Unter dem Dachsims läuft ein Fries von dunkelgrün glasirten Ziegeln in Form eines Vierpasses. Dieser Fries, sammt dem Pfostenwerk der Fenster, ist bei der jüngsten Restauration allerdings erst eingesetzt, scheint aber an Stelle eines früher schon vorhandenen getreten und vielleicht nach dem Muster eines solchen gefertigt zu sein. Der Thurm im Westen ist später angebauet, jedoch wohl nicht viel später. Der untere Theil ist gewölbt und jetzt zu einer kleinen Taufkapelle eingerichtet. Die Schmiege der Pforte ist ebenfalls restaurirt, ihre Gliederung wird aus Flachecken gebildet. Sämmtliches Mobiliar der Kirche ist neu. Alt scheint nur die messingene Schüssel in der modernen Taufe zu sein, auf deren Boden der Sündenfall dargestellt ist. Von den beiden Glocken im Thurm ist die eine ohne Inschrift, die andere hat eine Inschrift auf Helm und Mantel; es ließ sich wegen der Dunkelheit aber nur herausbringen die Jahreszahl 1568 und der Name Kruse.
Rumpshagen. 1874.
H. Rönnberg, Cand.


|
Seite 212 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Kieth.
Die Kirche zu Kieth bei Krakow ist sehr verfallen und erwartet eine gründliche Restauration.
Die Kirche ist ein Ziegelbau mit Strebepfeilern und bildet ein Oblongum von 3 Gewölben Länge. Sie ist in der Hauptanlage im altgothischen Style aufgeführt und stammt wohl aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts. Die Ostwand und die Südwand haben große, altgothische Fensteröffnungen mit Schräge eingehenden, glatten Laibungen; in jeder dieser großen Fensteröffnungen stehen 3 schmale Fenster, von denen das mittlere höher ist als die beiden andern, durch Mauerpfeiler von einander getrennt. Merkwürdig ist, daß die Nordwand in den Fensterlaibungen junggothisch ist.
Im Innern ist die Kirche auf Wölbung angelegt; jedoch hat sie jetzt statt der Gewölbe eine Balkendecke.
Der Altar ist ein kleiner einfacher Flügelaltar im junggothischen Style, wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Der Altar ist aber sehr verfallen und verschmiert: Sämmtliche Pfeiler und Baldachine, sowie die Krönung fehlen ganz; die Rückwand ist gerissen und schwarz übermalt. Die Figuren sind in der Gewandung ziemlich gut, aber auch übermalt.
In der Mitteltafel steht die Jungfrau Maria auf dem Halbmonde, von 6 kleinen Engeln angebetet; die Sonne fehlt. Zu beiden Seiten stehen an jeder Seite 2 Heiligen Figuren über einander in folgender Ordnung in der Ansicht
| S. Georg. | S. Katharina. | |
| S. Maria. | ||
| S. Anna. | S. Cornelius. |
Die beiden Flügel sind quer getheilt: in jeder Abtheilung stehen 3 Apostel. - (Der H. Cornelius ist dargestellt als Papst mit einem Horn in der Rechten und einem offenen Buche in der Linken.)
Ein Crucifix ist ziemlich gut.
Die Kanzel ist Rococo und ohne Werth.
Außerdem besitzt die Kirche nur noch ein messingenes Becken mit der Darstellung des Englischen Grußes (Ave Maria), wie sich dergleichen im Lande noch häufig finden.
Die Glocken haben keine Inschriften.
Schwerin. 1869.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 213 |




|



|


|
|
:
|
Die Kirche zu Grambow
bei Rehna ist, nach einem frühem Berichte des Herrn Baumeisters Daniel zu Schwerin, welcher dieselbe im J. 1865 restaurirt hat, ein gewöhnlicher, schmuckloser, junggothischer Bau (aus dem 15. Jahrb.), mit Strebepfeilern, ohne bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
|
Die Kirche zu Karow,
A. Lübz, welche im Chor aus einem schlechten junggothischen Ziegelbau, im Schiffe aus einem Fachwerkbau bestand, ist im J. 1872 wegen Baufälligkeit und Werthlosigkeit abgebrochen, um einen neuen Bau Platz zu machen.



|


|
|
:
|
Die Kanzel der Kirche zu Zarrentin
ist schon in den Jahrb. IV, 1839, B, S. 84 als ein beachtcnswerthes Werk, mit altem Schnitzwerk und niederdeutschen Bibelsprüchen, hervorgehoben. Der Herr Pastor Bartholdi zu Zarrentin berichtet jetzt, daß diese Kanzel aus der Marienkirche zu Lübek stammt, und liefert folgenden Beweis. In dem Zarrentiner Visitations=Protocoll vom J. 1707 heißt es nämlich:
"Die Kanzel hat vor diesem in Lübeck in der S. Marien=Kirchen gestanden und ist vor etwa 6 Jahren erst hierher verkauft vor 100 Mk., ist von feinem Schnitzwerk."
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entäußerten sich die Kirchen Lübeks mancher alten Werke, wie z. B. der in den Jahrbüchern gewürdigten großen Altäre von Neustadt und Grabow.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 214 |




|



|


|
|
:
|
III. Zur Siegel= und Wappenkunde.
Das Siegel des Klosters Ivenack.
Zu den wohlthätigsten und wirksamsten alten Stiftungen in Meklenburg gehören die Feldklöster von angesehenen geistlichen Orden. Meklenburg hatte 4 Mönchs=Feldklöster: Doberan und Dargun, beide Cistercienser, Tempzin, Antoniter, und Marienehe, Carthäuser, alle reich und wirksam. Daneben hatte Meklenburg 11 Nonnenklöster welche alle reichen Landbesitz hatten und eine große Thätigkeit entfalteten, meist dem Benedictiner= und Cistercienser=Orden angehörend: Neukloster, Dobbertin, Rühn, Rehna, Zarrentin, Eldena, Ivenack, Malchow, Wanzka, Rostock, Ribnitz, davon 6 im Bisthum Schwerin, 3 im Bisthum Ratzeburg, 1 im Bisthum Camin und 1 im Bisthum Havelberg. Von diesen hatten 2 (Rostock, Cistercienser=Ordens, und Ribnitz, Clarissen=Ordens) ihre Klostergebäude in Städten; die übrigen waren Feldklöster. Die Nonnenklöster übten eine reiche Wirksamkeit im ununterbrochenen lebhaften Verkehr mit den Familien der Landesherren und des alten Landadels, auch mit den Patricierfamilien der Hansestädte, welche alle oft ihre Töchter in die ihnen angemessenen Klöster gaben.
Zu den beliebten Nonnen=Feldklöstern gehörte das Kloster Ivenack bei Stavenhagen, welches zwar nicht sehr groß aber doch ziemlich reich ausgestattet und durch Jungfrauen und Vorsteher vom Adel gesucht war. Das Kloster Ivenack ward am 15. Mai 1252 von dem Ritter Reimbern von Stove, Burgmann auf der Burg Stavenhagen, welche wohl von ihm den Namen trug, gestiftet (vgl. Meklenb. Urk.=Buch II, Nr. 691) und von dem Herzoge Wartislav von Pommern, zu dessen Herrschaft damals noch das Land Stavenhagen gehörte, im J. 1256 bestätigt (vgl. Meklenb. Urk.=Buch II,


|
Seite 215 |




|
Nr. 762). Aufgehoben ward das Kloster im J. 1555 nach vierhundertjährigem Bestehen 1 ).
Ueber die Gründung und den Untergang des Klosters geben folgende zwei in den Jahrbüchern II, B., S. 103 mitgetheilte neu entdeckte Inschriften auf der großen Glocke der Kirche zu Ivenack genauere Auskunft:
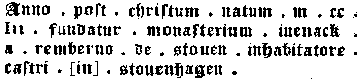
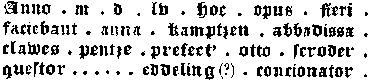
Die letzte Aebtissin war also Anna von Kamptz (1544 † nach 1562), welche jedoch schon 1555 zwei fürstliche Beamten und einen lutherischen Prediger zur Seite hatte.
Zu den wichtigsten Denkmälern der mittelalterlichen Vorzeit gehören die alten Siegel, welche nicht allein über die alte Kunstgeschichte und Schriftkunde, sondern auch über damalige innere Verhältnisse vielfachen Aufschluß geben.
Das alte Siegel des Klosters Ivenack war bisher ganz unbekannt. Im Staats=Archive zu Schwerin, wo seit der Säcularisirung des Klosters dessen Urkunden aufbewahrt werden, sind nur 2 Abdrücke aus dem 15. Jahrhundert von einem Stempel vorhanden, welcher ohne Zweifel aus der Zeit der Stiftung des Klosters stammt: an einer Urkunde vom 17. Septbr. (die Lamberti) 1404, für die Aebtissin Margaretha Rostock ausgestellt von Propst Gerhard von Bertekow, Priorissin Wendel Wilden und dem Convent, und vom 21. Febr. (die Mathie apostoli) 1411, ausgestellt von Propst Gerhard von Bertekow, Aebtissin Margaretha Rostock, Prio=
"18 golt fl. den Junckfrawen zu Juenack ins Closter geben, da mein gnedige fraw vnd freulein bei ihnen gelegen. Brandenburg am 23. Julii 1557."
"2 thaler noch eodem die daselbst."
Die fürstlichen Frauen sind wohl die Herzogin Anna, des Herzogs Albrecht des schönen Wittwe, und ihre Tochter Anna, spätere Herzogin von Kurland.


|
Seite 216 |




|
rissin Margaretha Gützkow und dem Convent; in beiden Urkunden wird gesagt, daß das angehängte Siegel das Siegel des Convents, also das Klostersiegel, sei.

Das hieneben abgebildete runde Siegel zeigt folgende Darstellung: Auf einem Throne sitzt zwischen zwei Lilienstengeln die gekrönte Jungfrau Maria, welche das halb liegende Christkind im linken Arme hält. Die Umschrift lautet:
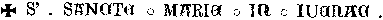
Das Kloster war also ein Marien=Kloster.
Der Herr C. G. J. von Kamptz zu Schwerin hat aus wissenschaftlicher Theilnahme und im sinne der Geschichte seiner Familie, welcher die letzte Aebtissin Anna von Kamptz angehörte und welche mit dem Kloster vielfach in Verbindung stand 1 ), die Zeichnung und den Holzschnitt des Siegels für die Jahrbücher und das Urkunden=Buch geschenkt.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Ueber das Siegel des Nicolaus von Oertzen
in Jahrb. XXXIX, S. 223,
äußert Herr Archivrath, Pastor Dr. Masch zu
Demern brieflich die Vermuthung, ob dasselbe
nicht ein Siegel eines von Oelsen sein und
 statt
statt
 gelesen werden könne, da die von
Oelsen Einen Arm mit einem Ringe im Schilde
führen (vgl. Kneschke Ad. Lex. VI, 573, und v.
Ledebur Ad. Lex. II, 160.)
gelesen werden könne, da die von
Oelsen Einen Arm mit einem Ringe im Schilde
führen (vgl. Kneschke Ad. Lex. VI, 573, und v.
Ledebur Ad. Lex. II, 160.)
Bei wiederholter scharfer Untersuchung lese ich aber in der Umschrift deutlich:



|
Seite 217 |




|
namentlich den Buchstaben r ganz deutlich. Ich muß daher meine Ansicht festhalten, daß dieses Siegel ein bisher unbekannt gewesenes Siegel des Knappen Nicolaus IV. v. Oertzen (1411- 1434) von der Stargardischen Familie von Oertzen ist.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Ein Siegel
des großen Kurfürsten
Friedrich Wilhelm
von Brandenburg.
Zu Dorf Woosmer bei Dömitz ward in der Dorfstraße ein großer messingener Siegelstempel des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg gefunden, von dem Herrn Schullehrer Hildebrand erworben und von diesem durch den Herrn Amtmann Schlettwein zu Dömitz, Mitglied des Vereins, auf dessen Bitte dem Vereine geschenkt.
Das Siegel ist rund und hat 5 1/2 Centimeter im Durchmesser. Es enthält unter dem Kurhut einen Wappenschild mit acht Feldern, welcher an beiden Seiten von einer Einfassung im Rococostyl gehalten wird.
Die 8 Wappen sind folgende:
obere Reihe: Brandenburg. Preußen. Jülich.
mittlere Reihe: Cleve. Kurscepter. Berg.
untere Reihe: Burggr. Nürnberg. Hohenzollern.
Die lateinische Umschrift in 2 Zeilen lautet folgendermaßen:
(Carn. heißt Carnovia, der alte Name für Jägerndorf).
Von diesem Siegel ist bisher kein Abdruck bekannt geworden. In großen, vollständigen Sammlungen, wie die des bewährten Heraldikers Herrn Pastors Ragotzky zu Triglitz bei Pritzwalk in der Mark Brandenburg, findet es sich nicht unter 37 verschiedenen Stempeln des Kurfürsten, auch im Schweriner Haupt=Archive nicht, obgleich dieses eine große Menge von Siegeln des Kurfürsten aus dem 17. Jahrhundert in den zahlreichen Acten bewahrt. Jedoch besitzt Herr Pastor Ragotzky als einziges Stück einen Original=


|
Seite 218 |




|
Abdruck eines Siegels vom J. 1643, welches in der Wappenanordnung dem Siegel von Woosmer gleich ist. Dieses Siegel ist aber kleiner und hat eine Umschrift in nur einer Zeile in deutscher Sprache.
Dieses Original=Siegel von 1643 mit denselben Seiteneinfassungen wird dem Woosmerschen Siegel zum Vorbilde gedient haben, aber nicht recht verstanden sein. Die Wappen des Woosmerschen Siegels sind schlechter gezeichnet und geschnitten, die Einfassung des mittlern Scepterschildes ist gradezu mißverstanden und räthselhaft und die Seiteneinfassungen sind, wenn auch entfernt ähnlich, doch gänzlich styllos und verdreht. Der Siegelstempel von Woosmer ist also sicher kein Originalsiegel des Kurfürsten.
Wahrscheinlich ist das bei Woosmer gefundene Siegel ein interimistisches oder Nothsiegel für irgend eine Behörde, vielleicht nie im Gebrauch gewesen, wenn es überhaupt nicht falsch ist. Vielleicht ist es um die Mitte des 17. Jahrhunderts auf den Zügen des großen Kurfürsten in der Nähe des Ueberganges über die Elbe bei Dömitz verloren gegangen.
Mit diesen Ansichten und Bedenken stimmen auch Herr Pastor Ragotzky zu Triglitz und Herr Pastor, Archivrath Dr. Masch zu Demern, zwei gewiegte Heraldiker und Sammler, überein.
G. C. F. Lisch.



|


|
|
:
|
Das Siegel der Universität Rostock.
Das große, schöne und sinnreiche Siegel der Universität Rostock, welches in Jahrb. XXXIV, S. 249, beschrieben und erläutert ist, ist sonst noch auf bemerkenswerthe Weise zur Anwendung gekommen.
1) Eine alte Matrikel der Universität, ein mächtiger, 7 Zoll dicker Klein=Folioband Pergament, welche den Zeitraum vom 12. Nov. 1719 bis 1760 umfaßt, ist in Schweinsleder gebunden und auf den Außenseiten mit eingepreßten Verzierungen bedeckt. Dieser Einband stammt nach dem Styl der Verzierungen aus dem 16. Jahrhundert. Auf der Rückseite ist zwar eingepreßt:
ACADEMIAE
ROSTOCHIENSIS
RENOVATA Anno. MDCCXIII.


|
Seite 219 |




|
Diese "Renovation" wird aber wohl nur eine äußerliche "Reparatur" gewesen sein. - Auf der Vorderseite des Deckels ist das große Siegel der Universität eingepreßt, wie es a. a. O. beschrieben ist.
2) Dasselbe große Siegel ist zum Schmuck des Neubaues der Universität im J. 1869 zu einem etwa 2 Fuß hohen Relief in Holzschnitzerei benutzt, welches in der Aula in der Rückwand hinter der Rednerbühne aufgerichtet ist.
G. C. F. Lisch.


|
Seite 220 |




|



|


|
|
:
|
IV. Nachtrag.
Römergräber in
Meklenburg.
Von
Dr. G. C. F. Lisch.
Fortsetzung von Jahrb. XXXV, S. 99, und XXXVII, S. 209.
Römische Alterthümer von Häven.
E. Vierte Ausgrabung.
Im Frühling des Jahres 1875 wurden auf dem Domanial=Pachthofe Häven bei Brüel nahe vor dem Hofe in demselben Sandhügel, in welchem seit 8 Jahren viele römische Gräber gefunden sind, beim Sandgraben zur Dämmung des Hofes wieder römische Alterthümer entdeckt. Dies veranlaßte den jetzigen (Gutspächter Herrn Bastian, die Grabungen mit Vorsicht und Ruhe zu betreiben, und so entdeckte derselbe 5 Fuß tief im Sande und ungefähr 10 Fuß von einander zwei Gräber mit Skeleten, deren Schädel im Norden, die Füße im Süden lagen, so daß die Leichen nach Süden schauend begraben waren, wie auch in den früher entdeckten Gräbern beobachtet war. (Vgl. Jahrb. XXXV, S. 123-124, und XXXVII, S. 208. Neben den Skeleten wurden die im Folgenden beschriebenen römischen Alterthümer gefunden, welche Herr Bastian mit großer Sorgfalt so gut es möglich war, sammelte und hob und unter Beförderung des zuständigen großherzoglichen Amtes Warin an die großherzoglichen Sammlungen einsandte.


|
Seite 221 |




|
Grab Nr. 8.
Im Mai 1875 fand Herr Bastian ein Grab, welches von dem menschlichen Skelet nur noch einen zerbrochenen Schädel und einige Alterthümer enthielt. Die übrigen Knochen und vielleicht auch Alterthümer sind wahrscheinlich schon in früheren Jahren beim Sandgraben ausgegraben und verloren gegangen.
Der Schädel ist ein gut erhaltenes Bruchstück, welches das volle Stirnbein mit den Augenhöhlen und der vordern Hälfte des Oberschädels zeigt, also die volle Hälfte des Oberkopfes. Die Bildung mit hoher, senkrechter Stirn ist sehr schön. Die Maaße sind ungewöhnlich klein und die Knochen sehr dünn und fein. Fast könnte man glauben und man hat es wohl geglaubt, der Schädel habe einem kleinen Kinde angehört; aber der Schädel ist schon vollkommen und schön ausgebildet und die Schädelnäthe sind schon vollständig verwachsen, so daß keine Spur von einer Schädelnath zu sehen ist. Der Schädel 1 ) wird also einem schon ziemlich erwachsenen jungen Menschen oder einer zarten weib lichen Person angehört haben.
Der Schädel zeigt eine besondere Eigenthümlichkeit. Quer über der Stirn ist ein langer, schmaler, tiefer Spalt, wie von einem durchdringenden Schwerthieb. Manche Beurtheiler haben darin einen Spatenstich von der Aufgrabung erkennen wollen. Andere, denen auch ich mich anschließe, sehen darin eine Verwundung bei Lebezeiten der begrabenen Person. Der Schädelknochen ist nämlich nach innen nicht zu einem Loche durchbrochen oder zertrümmert, sondern die Wände sind nur regelmäßig und scharf durchgedrängt und stehen im Innern noch fest und angewachsen in pyramidalen Richtungen neben dem feinen durchgehenden Spalt. - Würde der Hieb von einer Verwundung einer lebenden Person herrühren, so würde auf grade nicht erfreuliche Zustände in der Zeit des Begräbnisses zu schließen sein.
In der Nähe dieses Schädels fanden sich folgende Alterthümer:
1) Ein kleines thönernes Gefäß, nach heimischer heidnischer Weise mit Sand durchknetet, hellbraun an Farbe, von einfacher cylindrischer Form, ohne alle Ausbauchungen und ohne alle Verzierung. Das Innere ist bis auf den Rand


|
Seite 222 |




|
schwärzlich gefärbt und auch der äußere Rand hat an mehrern Stellen unregelmäßig kurze schwarze Flecke, als wenn etwas, z. B. Fett, übergeflossen und daran getrocknet wäre.
2) Eine kleine thönerne Urne, schwarz von Farbe und glänzend, fein gearbeitet. Um die obere Hälfte des Bauches laufen zur Verzierung 3 mal 3 fein eingeritzte horizontale Parallellinien in nahen Abständen. Die Urne hat an Gestalt und Verzierung etwas Fremdländisches. Ueber thönerne Urnen in Römergräbern vgl. Jahrb. XXXV, S. 122.
3) Zwei Eimer von Holz, mit Bronze=Beschlag. Die Bänder, die Randeinfassung und die Henkel sind von Bronze. Das Holz ist etwas dickfaserig und zerbrochen und größten Theils verloren gegangen; jedoch sind zur Erkenntniß und Beurtheilung noch Reste genug vorhanden. Die Eimer sind den früher zu Häven gefundenen hölzernen Eimern gleich; vgl. Jahrb. XXXV, S. 118 und 130 und Abbildung Taf. II, Figur 16. Die Henkel sind schmal, dünne und glatt, wie die früher gefundenen Eimerhenkel. Der eine Henkel hat gar keine Verzierungen, der andere gravirte leichte Randverzierungen von Halbkreisen. Die kleinen Nägel zur Befestigung der Bänder auf dem Holze sind sehr geschickt gearbeitet und wie modern.
4) Drei schmale und enge runde Beschläge von Bronzeblech, deren Gebrauch nicht zu errathen ist.
Grab Nr. 9.
Am 1. Juni 1875 fand Herr Bastian ein zweites Grab mit einem vollständigen großen Skelet. Der Schädel, von guter Stirnbildung, mit Unterkiefer, ist groß und sehr stark, wie es scheint ein Kurzschädel (Brachycephale). Die Zähne sind fein und schmal, vollzählig und gesund, aber schon ziemlich stark abgeschliffen. Nach dieser Beschaffenheit scheint der Schädel einem Menschen von wenigstens 50 Jahren angehört zu haben. Die Bein= und Armknochen sind grade nicht sehr stark, aber lang; das Oberschenkelbein (femur) ist 20 Zoll oder 48 Centimeter lang. Das Skelet deutet also auf einen altern, groß gewachsenen Menschen.
Neben dem Skelet fanden sich folgende Alterthümer:
5) Ein thönernes Gefäß, welches aber trotz der sorgfältigsten Vorsicht bei der Ausgrabung sogleich zerfiel.
6) Ein großer glockenförmiger Krater von Bronze, mit einem kleinen, starken Fuß und einem massiven, runden Henkel, wie die früher zu Häven gefundenen Krateren, welche


|
Seite 223 |




|
in Jahrb. XXXV, S. 110 und S. 129 und XXXVII, S. 210, beschrieben und dazu Taf. I, Fig. 1 und Taf. II, Fig. 17 abgebildet sind. Der Krater, in der Oeffnung 9 1/2 Zoll weit, hat einen dicken, schweren Rand und Fuß, aber sehr dünne Wände, welche wie gewöhnlich durch den Erddruck fast alle in kleine Bruchstücke zerbrochen und beim Sandgraben verloren gegangen sind. Der obere Rand hat auf der Außenfläche 3 eingedrehete feine Linien zur Verzierung. Eben so sind auf der Unterseite des Fußes feine Kreise eingedrehet, wie auf den früher gefundenen Gefäßen dieser Art. Auf dem dicken Rande sitzen zwei Henkellappen mit einem Loche zum Einhängen eines Henkels. Der Henkel ist dick und rund und schön verziert, jedoch nicht in der Art, wie die früher gefundenen, auf Taf. II, Fig. 17 abgebildeten Henkel, sondern durch schräge gewundene erhabene Linien, wie ein Seil.
7) Eine größere Heftel oder "Gewandnadel" mit Spiralfeder, von Silber, ähnlich den früher zu Häven gefundenen, zu Jahrb. XXXV, Taf. II, Fig. 22-24 abgebildeten Hefteln (vgl. Jahrb. S. 103 und 116 . Das untere Ende des Bügels läuft in Trapezform aus, ungefähr wie Worsaae Nord. Olds. Taf. 88 Fig. 384, und ist hier mit einer dünnen goldenen oder vergoldeten punctirten Platte belegt, wie die runde Heftel Nr. 8 im Grabe Nr. 7 (Jahrb. XXXVII, S. 211). In der Mitte ist der Bügel mit einer runden Verzierungsplatte belegt gewesen, welche zwar abgebrochen, aber noch vollständig vorhanden ist. Die runde Platte hat ungefähr 2 Cent. im Durchmesser, ist von einem feinen silbernen Perlenringe eingefaßt und mit einer Halbkugel von dunkelblauem Glase belegt. Der Kitt ist noch vorhanden. Die Bestimmung der Verzierungsplatten wird also hiedurch klar.
8) Eine kleinere Heftel oder "Gewandnadel" mit Spiralfeder, von Silber, ähnlich der in Jahrb. XXXV, Taf. II, Fig. 22 abgebildeten Heftel, jedoch kleiner. Der Bügel läuft nach unten in eine runde Verzierungsplatte aus, welche ebenfalls mit grünem Glase in einem dünnen silbernen Perlenringe belegt gewesen ist, wovon noch Bruchstücke bei der Heftel gefunden und vorhanden sind.
9) Sieben birnenförmige oder beutelförmige Bommeln von Bernstein, von Gestalt und Arbeit ganz wie die früher gefundenen und in Jahrb. XXXV, S. 128, und XXXVII, S. 215 beschriebenen und zu Jahrb. XXXV, Taf. I, Fig. 14 abgebildeten Bommeln. Die jetzt gefundenen sind aber nur halb so groß, etwa 15 Millim. lang.


|
Seite 224 |




|
10) Vier kleine Bernsteinknöpfe, Halbkugeln oder flach gewölbte Scheiben von 8 bis 10 Millim. Durchmesser, mit einem kleinen Loche in der Mitte, vielleicht Verzierungen zum Aufnähen oder Aufnieten.
11) Ein Kamm von Knochen, 12 Cent. lang und 6 Cent. hoch, ziemlich gut erhalten. Der Kamm besteht aus starkem Knochen und ist am Griff an jeder Seite mit dünnen Elfenbeinplatten belegt, welche mit Bronzestiften vernietet sind. Um die Niete laufen zur Verzierung wellenförmige Punctlinien. Dieser Kamm gleicht also an Größe und Arbeit ganz dem in der zweiten Aufgrabung gefundenen Bruchstück; vgl. Jahrb. XXXV, S. 126, und Abbildung Taf. II, Fig. 25. Größe und Gestalt sind ungefähr dem in Worsaae Nordiske Oldsager Taf. 84, Nr. 365 abgebildeten Kamm gleich.
12) Drei kleine Thierknochen, wahrscheinlich von einem Schaf. Die Knochen sind fester, glatter und heller, als die Menschenknochen, und wahrscheinlich gekochte Thierknochen von dem Leichenmahle und der Mitgift. Aehnliche Thierknochen wurden auch in dem ähnlichen Grabe Nr. 7 gefunden; vgl. Jahrb. XXXVII, S. 216.
Schlußbetrachtung.
Dieses Grab Nr. 9 gleicht also in Skelet und Beigaben ganz dem wahrscheinlich in der Nähe zuletzt im J. 1872 aufgegrabenen und in Jahrb. XXXVII, S. 209-216 beschriebenen Grabe Nr. 7, welches damals als ein Frauengrab erkannt ward. Die Leiche im Grabe Nr. 9 wird nach den Knochen und Zähnen, so wie manchen Beigaben auch eine weibliche gewesen sein.
![]()
Verbesserungen.
Zu S. 157 muß es in der
Ueberschrift heißen; außereuropäischer
Völker, statt: anderer europäischer
Völker.
Zu S. 163. Die Pfarre zu
Lohmen ist nicht am 3., sondern am 4.
November 1874 abgebrannt.


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
Quartalbericht
desVereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Schwerin, im October 1874.
I. Wissenschaftliche Tätigkeit.
Die Arbeiten für das Meklenburgische Urkunden=Buch haben auch in dem abgelaufenen Quartale ununterbrochen und stetig fortgeführt werden können, so daß der bis zum Jahre 1342 reichende 50. Bogen des IX. Bandes bereits die Presse verlassen hat. Die Zeichnung der zu dem Reste dieses Bandes gehörigen Siegel hat freilich eine kurze Unterbrechung erlitten, da der ausgezeichnete Maler Herr Milde in Lübek leider in Folge seines vorgerückten Alters genöthigt war, diese bisher so musterhaft ausgeführte Arbeit für die Zukunft abzulehnen. Indeß ist es gelungen, statt seiner den bewährten Heraldiker und Zeichner, Herrn Hildebrandt zu Mieste in der Altmark, wieder zu gewinnen, so daß auch von dieser Seite keine weitere Störung zu besorgen ist. Die Kosten zur Zeichnung und zum Holzschnitt der ältesten Stadtsiegel von Malchin und Waren sind von den Magistraten dieser Städte bewilligt worden. Nach nunmehr vollständig geschehener Vertheilung der bewilligten Freiexemplare der ersten 8 Bände


|
Seite 2 |




|
des Werkes an die Behörden des Landes ist der größere Theil des Restes der Auflage, früheren Beschlüssen des Vorstandes gemäß, nunmehr zur größern Sicherheit und zur Erleichterung des überfüllten Antiquariums in das großherzogliche Archiv versetzt worden.
Der Druck des 39. Bandes unserer Jahrbücher, dessen erster Theil bereits in der General= Versammlung am 11. Juni d. J. vorgelegt werden konnte, ist gegenwärtig fast vollendet, so daß seiner Versendung in den nächsten Wochen hoffentlich nichts im Wege stehen wird.
Auch von dem durch unsern verstorbenen Freund Dr. Schiller begonnenen, und dessen Mitarbeiter, Herrn Dr. Lübben, fortgeführten Mittelniederdeutschen Wörterbuche in kürzlich das 6. Heft erschienen, und damit der I. Band von A - E dieses hochverdienstlichen Werkes vollendet. Die Vorrede des Herausgebers beginnt mit einem kurzen Nekrologe seines frühern Mitarbeiters, und berichtet dann über den Plan und die bisherige Ausführung der Arbeit. Möge es ihm vergönnt sein, dieselbe glücklich zu Ende zu führen.
II. Die Sammlungen des Vereins.
A. Die Alterthümersammlung.
Durch den Erwerb einer Privatsammlung von Alterthümern aus allen Perioden, welche der Herr Pastor Voß zu Neustadt dem Vereine gegen Erstattung der für den Ankauf der einzelnen Gegenstände ausgewendeten unerheblichen Kosten gefälligst überlassen hat, hat die Vereinssammlung in dem letzten Quartale einen nicht unbedeutenden außerordentlichen Zuwachs erhalten, wie aus dem folgenden Verzeichnisse der gesammten neuen Erwerbungen hervorgeht:1) Aus der Steinzeit.
1 Dolch aus hellbraunem Feuerstein, sehr kunstreich gearbeitet, 19 Centim. lang; - der Griff und die halbe Klinge eines sehr großen Dolches aus hellgrauem Feuerstein, 15 Centim. lang und gleichfalls von kunstreicher Arbeit; - 1 Lanzenspitze aus dunkelgrauem Feuerstein, 1 Centim. lang; - 1 halbe Säge oder Sichel aus hellgrauem Feuerstein, 8 Centim. lang; - 1 Keil aus grauem Feuerstein 10 Centim. lang; alles gesunden zu Neu=Käterhagen bei Neukloster.


|
Seite 3 |




|
1 Keil aus hellgrauem Feuerstein, 15 Centim. lang, und 1 Streitaxt aus Diorit, nicht polirt und mit kaum angefangenem Schaftloche, gefunden bei Dassow.
1 Keil aus hellgrauem Feuerstein, stark beschädigt, gefunden zu Bockup bei Dömitz.
1 Hammer aus Hornblende, 11 Centim. lang, 6 Centim. breit, und nur etwa 2 Centim. dick, auf der Oberfläche ganz roh und verwittert, jedoch mit einem regelmäßigen Schaftloch, gefunden in einer Wiese zu Alt=Lüblow. 2 Dolchspitzen aus dunkelbraunem Feuerstein, 14 und 9 Centim. lang, sehr dick und stark.
7 messerförmige Feuersteinsspäne, wovon einer bei Ludwigslust gefunden.
1 eiförmiger Granitstein, 25 und 30 Centim. im Umfange, völlig regelmäßig gestaltet und geschliffen, vielleicht ein Reibstein, vielleicht auch natürliche Diluvialbildung.
Die sämmtlichen vorstehend verzeichneten Geräthe stammen aus der Sammlung des Herrn Pastors Voß.
1 Streitaxt aus Diorit, deren Schaftloch mit einem Ringbohrer erst angebohrt ist, so daß der Zapfen oder Dorn im Bohrloche steht. Gefunden 1867 im Holze bei Zippendorf, geschenkt von Fräulein Buchheim, Custodin der schweriner Sammlungen. (Vgl. Jahrb. XXXIX, S. 122.)
1 Streitaxt aus Hornblende, 2 Pfund schwer, am Beilende vielfach abgenutzt und abgesplittert, gefunden auf dem vielbesprochenen Pfahlbauboden bei Wismar, auf dem Torfmoore im Müggenburger Reservat, geschenkt von dem Herrn Dr. Crull in Wismar.
1 Keil aus Feuerstein, 15 Centim. lang und schön polirt, gefunden in einem Hünengrabe bei Kronskamp, geschenkt von dem Herrn Pächter Witt daselbst. (Vgl. Jahrb. XXXIX, S. 115.)
1 Keil aus Feuerstein, gefunden bei Neukloster beim Stämmenroden in den Neumühlschen Tannen, geschenkt von dem Herrn Förster Albrecht zu Neukloster.
1 Keil aus Feuerstein, an der Schneide beschädigt, gefunden auf Fischland tief im Dünensande, geschenkt von dem Herrn Studiosus Westphal aus Schwerin.
1 zungenförmiger Feuerstein, 8 Centim. lang und 4 Centim. breit, an beiden flachen Seiten von Menschenhand durch Absplitterung geebnet, und zum Stoßgeräth tauglich, gefunden auf dem Kaninchenwerder bei Schwerin, wo früher schon wiederholt Steingeräthe gefunden sind, geschenkt von dem Herrn Oberzolldirector Oldenburg in Schwerin.


|
Seite 4 |




|
An fremden Alterthümern dieser Periode endlich schenkte der Herr Oberauditeur Kundt zu Schwerin folgende 1874 bei Saßnitz auf Rügen gefundene Steingeräthe:
1 beilförmiges Werkzeug aus Granit, ganz von der Gestalt und Größe der jetzigen eisernen Beile, jedoch ohne Schaftloch, gefunden am Meeresstrande, und durch die Wellen glatt gerieben, vielleicht Naturbildung;
1 dreiseitig geschlagene Pfeilspitze aus Feuerstein;
4 messerförmige Feuersteinspäne, mit der Schlagmarke und abgenutzten Schneiden.
2) Aus der Bronzezeit.
2 Armringe aus Bronze, der eine massiv und rundlich, mit Querstreifen verziert, der andere flach und breit, blechartig, mit schrägen Strichen verziert, gefunden zu Moraas bei Hagenow. Aus der Sammlung des Herrn Pastors Voß.
1 Armring aus Bronze, blechartig, ganz dem 2. der eben beschriebenen Ringe gleich, und ebenfalls bei Moraas gefunden, wahrscheinlich dazu gehörig, geschenkt von dem Herrn Lehrer Lübstorf zu Parchim, früher zu Raddenfort bei Dömitz.
1 Lanzenspitze aus Bronze ohne Rost, mit Schaftloch und auf der mit 2 Nagellöchern versehenen Schaftröhre mit Dreiecken und abwechselnd wagerechten und senkrechten Strichen verziert, gefunden in der Gegend von Malchow und geschenkt von dem Herrn Dr. Crull zu Wismar.
1 Urne von hellbraunem Thon, 12 Centim. hoch, mit großem Henkel und concentrischen Ringen um den Bauchrand, gefunden zu Krusenhagen bei Wismar. Aus der Sammlung des Herrn Pastors Voß.
Ferner fremde Alterthümer:
Eine kleine (Kinder=) Urne aus Thon, 7 Centim. hoch, worin ein kleiner runder Buckel aus Bronze, 1 Centim. im Durchmesser, und 2 Spindelsteine oder durchbohrte Knöpfe aus dünnem Thonschiefer, 3 1/2 Centim. im Durchmesser, lagen, von welchen letztern einer verloren gegangen ist. Die Urne selbst stand, nebst einer zweiten, ähnlichen, aber nicht mehr vorhandenen, in einer großen, 24 Centim. hohen und 20 Centim. weiten, mit Sand und Knochenresten gefüllten, und 2 Fuß tief unter der Erde zwischen Steinen verpackten Urne aus gelbröthlichem Thon mit einem Henkel. Gefunden unweit Zerbst im Magdeburgischen, geschenkt von dem Herrn Pastor Ragotzky zu Triglitz, correspondirendem Mitgliede des Vereins.


|
Seite 5 |




|
Eine kleine Urne aus schwarzem Thon, unsern mittelalterlichen Gefäßen ähnlich, gefunden in Georgien in den Gräbern von Somthavro bei Mtzoheth, der alten Hauptstadt Georgiens, geschenkt von dem Herrn Reichsconsul Brüning zu Tiflis, aus Schwerin und Mitglied des Vereins.
3) Aus der Eisenzeit.
1 Spindelstein aus Thon, mit concentrischen Reifen verziert, gefunden zu Boldela bei Schwerin, und 1 Spindelstein aus Thon, glatt, gefunden zu Raddenfort bei Dömitz, aus der Sammlung des Herrn Pastors Voß.
4) Aus dem christlichen Mittelalter.
3 sehr starke und große, dunkelgrün glasurte, mit erhabenem, einen Greif, einen Löwen und ein Lilienornament darstellenden Bildwerk geschmückte Ziegel aus einem Fries von dem kleinen, im Sommer 1874 abgebrochenen Schnickmannsthor zu Rostock, welches wohl der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angehört haben mag. Geschenk des Herrn Amtsverwalters Burchard zu Rostock, welchem das löbliche Bauamt daselbst diese Ziegel, die beim Abbruch des Thores am besten erhalten wurden, mit größter Bereitwilligkeit zur Verfügung gestellt hat.
1 schwarze Ofenkachel mit einem Bilde des Evangelisten Lucas auf einem liegenden Stiere sitzend und schreibend, gefunden zu Neustadt; sowie 1 Hufeisen, klein, breit und dünne, gefunden zu Drusewitz bei Tessin in der Recknitzwiese; aus der Sammlung des Herrn Pastors Voß.
1 Siegelstempel. S. Siegelsammlung.
B. Die Münzsammlung.
Die neuen Erwerbungen sind:
2 dänische Zwei=Schillingsstücke, 1617 und 1630; 1 Groschen des Herzogs Christian von Braunschweig=Lüneburg, Bischofs zu Minden, 1622; gefunden bei einem Hausbau zu Parchim. Geschenk des Geh. Justizraths Mencke zu Schwerin.
1 dänisches Zwei=Schillingsstück, 1600, gefunden in der Gegend von Schwerin. Geschenk des Herrn Advocaten Dr. Mantius in Schwerin.
1 Mark, 1 Zwanzig=, 1 Zehn= und 1 Fünf=Pfennigstück der neuen Reichsmünze. Geschenk des Fräulein Buchheim.


|
Seite 6 |




|
C. Die Siegelsammlung.
Herr Advocat Kahle zu Parchim schenkte einen alten aus Zinn gefertigten Siegelstempel mit der Inschrift Marquard Goldberg, gefunden bei der Vertiefung des Brunnens auf dem dortigen Kirchhofe, welcher bis vor 25 Jahren Acker war.
D. Die Bildersammlung.
Auch diese Sammlung erfreute sich mehrfacher Schenkungen:
1) Der Herr Brüning, Reichsconsul zu Tiflis, übersandte 3 Portraits der Gebrüder Siemens, Söhne des Domanialpächters Siemens zu Menzendorf bei Schönberg, theils Lithographie, theils Photographie, nämlich des Werner Siemens, Dr. phil., Königlich preußischen Hauptmanns a. D., Mitgliedes der Academie der Wissenschaften zu Berlin und Chef des Hauses Siemens & Halcke daselbst, geboren den 13. Decbr. 1816, sowie der Jüngern Brüder Wilhelm, Ingenieurs in London, und Walther, Consuls des Norddeutschen Bundes zu Tiflis, geboren den 11. Jun. 1833, gestorben in Tiflis, den 10. Octbr. 1871.
2) An meklenburgischen Ansichten schenkte der Herr Amtmann v. Koppelow zu Gadebusch zwei Photographien, nämlich der Stadt Gadebusch nach einem alten, wahrscheinlich Meran'schen Blatt 1572-1618, und des Schlosses oder Amtes zu Gadebusch, 1867.
3) Der Herr Hauptmann Kundt in Schwerin schenkte Umrisse der Kirchen in Meklenburg zum Gebrauche der Landesvermessung. Lithogr. fol.
4) Von dem hohen Ministerium des Innern endlich ward dem Vereine zu dessen großer Freude ein Exemplar der von der großherzoglichen Landesvermessungs=Commission bearbeiteten ausgezeichneten Karte der Umgegend von Schwerin übermittelt.
E. Die Büchersammlung.
Das folgende Verzeichniß der neu erworbenen Bücher weis't wiederum eine Vermehrung der Bibliothek um 45 Bände nach, größten Theils im Tauschverkehr mit verwandten Vereinen, oder durch Geschenk der Herren Verfasser erworben.


|
Seite 7 |




|
I. Amerika.
- Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution for the year 1871, desgl. 1872. Washington 1873. 8°. 2 Bde. (Tauschexemplar des gen. Instituts.)
II. Russische Ostsee=Provinzen.
- Verhandlungen der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Bd. 8, Heft. 1. Dorpat 1874. 8°.
- Sitzungsberichte der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 1873. Dorpat 1874. 8°. (Mit Nr. 2 Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostsee=Provinzen aus dem Jahre 1873. Riga 1874. 8°. (Tauschexemplar der Gesellschaft.)
III. Dänemark.
- Aarbøger for Nordisk oldkyndighed og Historie. 1873, Heft 2-4. (Tauschexemplar der Gesellschaft für nord. Alterthumskunde zu Kopenhagen.) IV. Die Niederlande.
- Overijsselsche Stad-Dijk-en Markeregten. Thl. III, St. 2 und 3. Zwolle 1874. 8°. (Tauschexemplar des Overyss. Vereins.)
V. Oesterreich= Ungarn.
- Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Wien. Bd. 16. Wien 1874. 8°. (Tauschexemplar der betr. Gesellschaft.)
- Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. IV, Nr. 3-6. (Tauschexemplar der Gesellschaft.)
- Blätter des Vereines für Landeskunde von Niederösterreich. Jahrg. VII. 1873.
- Topographie von Niederösterreich. Heft 5-7. Wien 1873. 74. Gr. 4°. (Nr. 9 und 10 Tauschexemplare des betr. Vereins.)
- Zeitschrift des Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg. Heft 18, Innsbruck 1874. 4°. (Tauschexemplar vom Ferdinandeum.)
- Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. Bd. XI, Heft 12. Hermannstadt 1873. 8°. Ebendas. Jahresbericht 1873.


|
Seite 8 |




|
- v. Hochmeister, Martin. Lebensbild und Zeitskizzen aus der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, von Adolf v. Hochmeister. Hermannstadt 1873. 8°.
- Die Mediascher Kirche von K. Werner. Hermannstadt 1872. 8°.
- Programm des Gymnasiums A. C. zu Hermannstadt. 1873. Inhalt: Schuster, Martin Beitrag zur Statistik des Gymn. 1850-70.
- Reissenberger, Ludw. Kurzer Bericht über die von den Herren Pfarrern A. B. in Siebenbürgen über kirchliche Alterthümer gemachten Mittheilungen. S. a. (1873.) 4°. (Nr. 12-16 Tauschexemplar des Hermannstädter Vereins.)
- Sitzungsberichte der königl. bömischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. 1872 Juli-Dec. 1873. 1874.
- Abhandlungen der königl. bömischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. VI. Prag 1874. 4°.
- Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae opera J. Emler P. II. Vol. I-V. Pragae 1872 - 74. 4°. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft der Wissenschaften.)
VI. Schweiz.
- Argovia. Jahresschrift der historischen Gesellschaft des Cantons Aargau. Bd. VIII. Aarau 1874. 8°. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
VII. Allgemeine deutsche Geschichte und Alterthumskunde.
- Literarischer Handweiser zunächst für das katholische Deutschland. 1874. Nr. 7-10. (Geschenk der Theissingschen Buchh. in Münster.)
- Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. 1874. Nr. 4-6. (Zwei Exemplare.)
VIII. Bayern, Würtemberg, Hohenzollern und Baden.
- Abhandlungen der historischen Classe der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften. Bd. XII. Abth. 2. München 1874. 8°.
-
Döllinger, J. v. Gedächtnißrede auf König Johann
von Sachsen. München 1874. 8°.
(Nr. 23 und 24 Tauschexemplar der gen. Akademie.)


|
Seite 9 |




|
- Die Wartburg. Organ des Münchener=Alterthumsvereins. 1874. 1. 2. (Geschenk des betr. Vereins.)
- Verhandlungen des Vereins für Kunst und Alterthum in Ulm und in Oberschwaben. Ulm 1874. 4°. Heft 6.
- Ulmisches Urkundenbuch, herausgegeben von Friedrich Pressel. Bd. I. Stuttgart 1873. 4°.(Nr. 25 und 26 Tauschexemplar des Ulmer Vereins.)
- Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts=Alterthums= und Volkskunde von Freiburg, Breisgau und den angrenzenden Landschaften. Bd. 3, Heft 3. Freiburg i. Br. 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern. Jahrg. 7. Sigmaringen1874. 8°.
- Schmid, L. Der heilige Meinrad in der Ahnenreihe des erlauchten Hauses Hohenzollern=Sigmaringen. 1874. 8°. (Nr. 28 und 29 Tauschexemplar des Hohenz. Vereins.)
IX. Sachsen und Thüringen.
- Mittheilungen des Königl. sächsischen Alterthumsvereins. Heft 24. Dresden 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Mittheilungen der Geschichts= und Alterthumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes. Bd. VII. Heft 4. Altenburg 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
X. Preußen.
- Achtzehnter Bericht der Philomathie in Neisse. Neisse 1874. 8°. (Tauschexemplar der Gesellschaft.)
- 51ster Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cultur. Breslau 1874. 8°.
- Abhandlungen der schlesischen Ges. f. vaterl. Cultur Philos.=hist. Abth. Breslau 1874. 8°. (Mit Nr. 34 Tauschexemplar der betr. Gesellschaft.)
- Geschichts=Blätter für Stadt und Land Magdeburg. 9. Jahrg. Heft 2. Magdeburg 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Zeitschrift des Harz=Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. VII. Heft 1-3 Wernigerode 1874. 8°.
- Die Urkunden des Klosters Stötterlingenburg, im Auftrage des Harzvereins für Geschichte und Alterthums=


|
Seite 10 |




|
kunde, bearbeitet von C. v. Schmidt=Phiseldeck. Halle 1874. Gr. 8°. (Mit Nr. 37 Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Handelmann, Heinr. Vorgeschichtliche Steindenkmäler in Schleswig=Holstein. Heft 3. Kiel 1874. 4°. (Geschenk des Verfassers.)
- Baltische Studien. Jahrg. 25. Heft 1. Stettin 1874. 8°.
- Haag, Georg. Quelle, Gewährsmann und Alter der ältesten Lebensbeschreibung des Pommernapostels Otto v. Bamberg. Festschrift der Gesellschaft für pomm. Geschichte und Alterthumskunde. (15. Juni 1874). Stettin 1874. 8°. (Mit Nr. 40 Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Bd. 3, Heft 1 und 2. Danzig 1872. 73. 8°. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Altpreußische Monatsschrift. Bd. XI. Heft 4. Königsberg 1874. 8°. (Tauschexemplar des Königsberger Vereins.)
XI. Meklenburg.
- Das Familienfideikommiß. Eine Denkschrift zum meckl. Landtage 1845.
- Krieger, Charlotte. Gedenkblatt des Schmerzes der Liebe beim Heimgange Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs Paul Friedrich. Ludwigslust 1842. 8°. (Mit Nr. 44 Geschenk des Herrn Prem. Lieut. v. Santen.)
Unter den auswärtigen Gelehrten und Freunden der nationalen Alterthumskunde, welche im Laufe dieses Sommers unsere Sammlungen besuchten, sind hervorzuheben der Herr Dr. W. Mannhardt aus Danzig, Jul. 16, und die Italiener Dr. Pigorini, Director des National=Museums zu Parma und Prof. Bellucci an der Universität zu Perugia, 15. September.
III. Die Matrikel des Vereins.
Gleich zu Anfang des nun abgelaufenen Quartals verlor der Verein eins seiner ältesten ordentlichen Mitglieder und bewährtesten Freunde und Beförderer seiner Arbeiten, den ehemaligen Präsidenten des großherzoglichen Staats=Ministeriums zu Schwerin, Jasper v. Oertzen, Excell., auf Leppin bei Stargard. Der Verstorbene trat dem Vereine


|
Seite 11 |




|
schon am 3. Mai 1835, gleich nach seiner Stiftung, bei und ward nach seinem Eintritt in das Ministerium nach dem Abgange des verstorbenen Minister=Präsidenten v. Bülow im Jahre 1858 in der General=Versammlung des Vereins am 11. Jul. d. J. einstimmig zu dessen Präsidenten ernannt, welches Amt er bis zu seinem Wegzuge aus Schwerin in Folge seines Rücktrittes aus dem Staatsdienste im Jahre 1869 mit stets gleicher Liebe und Treue verwaltete. Die hohen Verdienste, welche er sich in dieser Stellung um das Gedeihen des Vereins überhaupt und namentlich um das Zustandekommen eines der bedeutendsten Unternehmungen desselben, der Herausgabe des Meklenburgischen Urkunden=Buches nach der Jubelfeier am 24. April 1860 erwarb, sind schon nach seinem Rücktritte in der General=Versammlung vom 11. Juli 1869 von dem Vorsitzenden unter allgemeiner Theilnahme der Anwesenden, sowie in dem Quartal= und Schlußberichte XXX, 4 dankbar anerkannt, und werden bei der Nachricht von seinem Tode doppelt lebhaft in das Gedächtniß aller Mitglieder, die ihn kannten, zurückgerufen sein. Er starb nach langen Leiden am 20. Jul. 1874 zu Grandchamp bei Neuchatel in der Schweiz, 72 Jahre alt.
Als neue ordentliche Mitglieder sind zu melden:die Herren Organist Meier in Schönberg, Lieutenant Bahrfeld in Bremen, Amtmann Schlettwein zu Dömitz und Vicko v. d. Lühe auf Stormsdorf.
Von den correspondirenden Mitgliedern starb am 12. Septbr. d. J. Dr. Theodor Petranovich, Landesgerichtsrath zu Zara in Dalmatien, Mitglied seit dem 6. Jun. 1851.
W. G. Beyer,
Dr. Archivrath,
als zweiter Secretair des Vereins.


|




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Schwerin, im Januar 1875
I. Wissenschaftliche Thätigkeit.
Auch dies Mal habe ich an dieser Stelle nur zu berichten, daß in den laufenden Arbeiten glücklicher Weise keine Störungen eingetreten, dieselben also regelmäßig fort geschritten sind. Namentlich ist der 39. Band unserer Jahrbuch er, nachdem auch der zweite Theil desselben für die Alterthumskunde im Drucke vollendet war, in dem abgelaufenen Quartale an die Mitglieder und Freunde des Vereins versandt worden. Unter den größern Beiträgen für den folgenden Jahrgang habe ich namentlich 50 neu aufgefundene und von dem Herrn Professor Dr. Ottokar Lorenz in Wien eingesandte Briefe Wallenstein's aus der Zeit seiner Regierung in Meklenburg zu nennen, sowie eine Abhandlung des Herrn Archivars Dr. Wigger, die Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge.
Von dem meklenburgischen Urkunden=Buche hat der bis zum Jahre 1343 reichende 59. Bogen des 9. Bandes so eben die Presse verlassen.
II. Die Sammlungen des Vereins.
Unter den verschiedenen historisch=antiquarischen Sammlungen des Vereins ist in dem letzten Quartale keine ganz leer ausgegangen, wenn auch ihre Erwerbungen theilweise


|
Seite 2 |




|
nicht grade bedeutend sind. Es ist dies gewiß ein sehr erfreuliches Zeugniß dafür, daß unsere Bestrebungen fortwährend lebhaftes Interesse finden, da der Zuwachs fast ohne Ausnahme aus Geschenken stammt, und zwar nicht bloß von den Mitgliedern der verschiedenen Abtheilungen des Vereins, sondern auch von andern Freunden und Gönnern, die unsrer oft aus weiter Ferne freundlich gedenken. Ich erinnere in letzterer Beziehung namentlich an die in dem October=Berichte des vorigen Jahres S. 5 und 6 angezeigte Sendung des Herrn Reichsconsuls G. Brüning zu Tiflis, eines gebornen Schweriners, und die gleich zu erwähnenden Lydischen Steinkeile des Herrn Consulatsverwesers Dr. Stannius zu Smyrna, eines Sohnes des Herrn Professors Stannius in Rostock, denen ich hierdurch den lebhaften Dank des Vereins ausspreche.
Von den neuen Erwerbungen gehören
A. Zur Alterthümersammlung.
1) Aus der Steinzeit.
Eine Streitaxt aus Hirschhorn, gefunden im Torfmoor zu Lüsewitz, geschenkt von dem Herrn Landsyndicus a. D. Groth in Rostock durch Vermittelung des Herrn Amtmanns Burchard daselbst.
1 Keil aus dunkelgrauem Feuerstein, gefunden zu Redefin bei Hagenow, geschenkt von dem Herrn Oekonomen Unruh zu Redefin.
1 halber Keil aus Feuerstein, gefunden zu Neukloster bei Grabungen hinter dem Hofe, geschenkt von dem Herrn Herlitz daselbst.
2) Aus der Bronzezeit.
1 Messer aus Bronze, gefunden im Torfmoor der Stadt Crivitz, geschenkt von dem Herrn Bürgermeister Kothé daselbst.
1 ähnliches Messer, von dem Herrn Gürtler Günther in Schwerin mit altem Metall gekauft und dem Verein geschenkt.
1 Framea aus Bronze mit Schaftloch und Oese ohne allen Rost, gefunden auf dem Stadtfelde von Hagenow, geschenkt von dem Herrn Dr. med. Gley in Schwerin.
3) Aus der Eisenzeit.
1 Spindelstein aus dunkelgrünem Glase mit gelben Zickzacklinien, gleich dem zu Nieder=Rövershagen gefundenen


|
Seite 3 |




|
(vgl. Jahrb. XXXIX, 137), gefunden zu Dämelow bei Brüel, geschenkt von dem Gutsherrn Herrn v. Storch daselbst.
4) Heidnische Alterthümer fremder Völker.
37 Keile oder Beile aus lydischem Stein, gefunden im Gygäischen See bei Sardes in Lydien, ein Geschenk des Herrn Dr. Stannius aus Rostock, kaiserlich deutschen Consulatsverwesers zu Smyrna, an die großherzogliche Sammlung.
B. Zur Münzsammlung.
1 silberne römische Consularmünze des Aulus Albinus für Spanien (101 v. Chr.), gefunden zu Wandrum, geschenkt von dem Herrn Gutspächter Levecke daselbst 1 ).
7 silberne und 11 kupferne Scheidemünzen verschiedener Art, geschenkt von dem Herrn Pastor Bartholdi zu Zarrentin.
1 dänischer Groschen 1677 und 1 dänischer Schilling 1655, gefunden am Seestrande zu Warnemünde, geschenkt von dem Herrn Commissionsrath Wachtler zu Rostock.
C. Zur Bildersammlung.
1) Zeichnung eines sehr alten Grabsteins ohne Inschrift in der Kirche zu Kirchdorf auf Poel, geschenkt von dem Herrn Dr. Crull in Wismar.
2) Ein historisch interessantes Bruchstück der Schmettauschen Karte von Meklenburg 2 ). Geschenk des Herrn Rittmeisters v. Weltzien.
3) Karte der Umgegend von Schwerin, von der großherzoglichen Landesvermessungs=Commission 1874. Geschenk des hohen Ministeriums des Innern.


|
Seite 4 |




|
D. Zur Büchersammlung.
I. Antiquitäten.
- Kemble, J. M. On some remarkable sepulchral objects from Italy, Styria and Mecklenburgh. London 1856. 4°. (Gekauft.)
II. Rußland.
- Rapport sur l'activite de la commission impériale archéologique en 1869. St. Petersbourg 1870. Fol. Dass. en 1870 et 71. ib. 1874. Fol. (Tauschex. der arch. Gesellschaft in Petersburg.)
- Beiträge zur Kunde Ehst=, Liv= und Kurlands, herausgegeben von der esthländischen literarischen Gesellschaft. Bd. II. Heft 1. Reval 1874. 8°. (Tauschex. der Gesellschaft.)
III. Niederlande.
- Overijsselsche stad-, dijk- en markregten. III. St. 4. Zwolle 1874. 8°.
- Verslag van de handelingen der 34. vergadering gehouden te Almelo den 2. Junij 1874. Zwolle 1874. (Nr. 4 und 5 Tauschex. des overysselschen Vereins.)
- Vervou, Fr. van. Enige aentekeningen van't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generael anno 1616, 1617, 1618, 1619, 1620. Leeuwarden 1874. 8°.
- Briefe des Aygaeus de Albada an Rembertus Ackema und andere aus den Jahren 1579-1584, herausgegeben von Dr. E. Friedländer. Leeuwarden 1874. (Nr. 6 und 7 Tauschex. der friesischen Gesellschaft zu Leeuwarden.)
IV. Belgien.
- Bulletin de l'institut archeologique liégeois. XII. liv. 1. Liége 1874. 8°. (Tauschex. des arch. Instituts zu Lüttich.)
V. Schweiz.
- Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Bd. XXIX. Einsiedeln, New=York und Cincinnati 1874. 8°. (Tauschex. des genannten Vereins.)
- Heyne, Mor. Ueber die mittelalterliche Sammlung zu Basel. Basel 1874. 4°. (Tauschex. des gen. Vereins.)


|
Seite 5 |




|
VI. Oesterreich.
- Bericht 32 über das Museum Francisco-Carolinum nebst der 27. Lieferung der Beiträge zur Landeskunde von Oesterreich ob der Ens. Linz 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Museums.)
VII. Allgemeine deutsche Geschichts= und Alterthumskunde.
- Nehring, Alfr. Vorgeschichtliche Steininstrumente Norddeutschlands. Wolfenbüttel 1874. 8°. (Geschenk des Herrn Archivraths Dr. Beyer.)
- Correspondenzblatt des Gesammtvereins. 1874. Nr. 7 bis 9. (Zwei Exemplare.)
- Waitz, G. Deutsche Verfassungsgeschichte. Bd. 5. Kiel 1874. 8°.
- Ders. Urkunden zur deutschen Verfassungsgeschichte im 11. und 12. Jahrhundert. Kiel 187l. 8°.
- Mittelniederdeutsches Wörterbuch von K. Schiller und A. Lübben. Heft 6 und 7. Bremen 1874/75 (Nr. 14- 16 gekauft.)
VIII. Baiern.
- Sitzungsberichte der philosophisch = philologischen und historischen Klasse der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1873. Heft 6. 1874. Heft 1-4. (Tauschex. der gen. Akademie.)
- Mittheilungen des historischen Vereins der Pfalz. IV. Speier 1874. (Tauscher, des gen. Vereins.)
IX. Preußen.
- Schriften des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin. Heft 9 und 10. Berlin 1873. 74. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Berlinische Chronik nebst Urkunden=Buch. Lieferung 11. 1874. (Tauschex. desselben Vereins.)
- Altpreußische Monatsschrift. Bd. XI. Heft 5 und 6. Königsberg 1874. 8°. (Tauschex. der Alterthums=Gesellschaft Prussia.)
- Geschichts=Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Magdeburg 1874. 9. Jahrg. Heft 3. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
- Jahresbericht des historischen Vereins zu Münster. 1874. 8°. (Tauschex. des gen. Vereins.)


|
Seite 6 |




|
X. Meklenburg.
- Böhlau. H. H. A. Mecklenburgisches Landrecht. Bd. 2. Abth. 2. Weimar 1874. (Geschenk des Herrn Verf.)
- Ueber die Versagung des kirchlichen Begräbnisses durch die Pastoren, besonders nach meklenburgischem Rechte, vom Kammerherrn v. Oertzen auf Kotelow. Rostock 1863.
- Die schleswig=holsteinsche Burg. Eine Predigt aus der Ferne von M. Baumgarten, Dr. und Professor der Theologie. Rostock 1864.
- Armen=Ordnung für die Stadt Schwerin nebst der landesherrlichen Confirmations=Acte. Schwerin, den 30. Juli 1873.
- Catalog des Meklenburgischen Grenadier=Regiments Nr. 89 zu Schwerin. (Nr. 25-28 Geschenke des Herrn Premier=Lieutenants v. Santen.)
- Blanck, A. Die Meklenburgischen Aerzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Schwerin 1874. 8°.
- C. Danneil. Chronik der Burg und Stadt Penzlin. Penzlin 1873. 8°. (Nr. 29 und 30 Geschenke des Herrn Oberstabsarzt Dr. Blanck, Verf. von Nr. 29.)
E. Zur Handschriftensammlung.
- Verzeichniß der Officiere, welche seit dem Jahre 1788 bei der Mecklenburg=Schwerinschen Infanterie gedient haben.
- Rang= und Stammliste der Officiere des großherzoglich Mecklenburg=Schwerinschen Infanterie = Regiments vom 13. September 1817.
- Friedens=Etat des Haupt= und Ersatz Kontingents. Schwerin, den 8. September 1862.
- Kriegs=Etat auf 1 5/6 Procent der Bevölkerung nach der Bundesmatrikel vom 14. April 1842. Schwerin, den 8. September 1862.
- Kriegs= und Friedens=Etat des Mecklenburgischen Contingents vom Jahre 1867.
- Geschichte der 4. Grenadier=Garde=Compagnie. (Nr. 1-6 Geschenke des Herrn Premier=Lieutenants v. Santen.)
III. Die Matrikel des Vereins.
Abermals hat der Verein wenige Tage hinter einander zwei langjährige und hochgeschätzte correspondirende Mit=


|
Seite 7 |




|
glieder durch den Tod verloren. Zuerst am 20. October 1874 verstarb der Professor der Rechte Dr. Homeyer in Berlin, Geheimer Obertribunals=Rath und Kronsyndicus, sowie Vertreter der Universität im preußischen Herrenhause. Ausgezeichnet als Germanist und namentlich hochberühmt durch seine Ausgabe des Sachsenspiegels mit Commentar in 3 Bänden, machte er unter anderm auch auf die Bedeutung der Hausmarken besonders in seiner Heimath Pommern und in Meklenburg aufmerksam, was ihn mit den hiesigen verwandten Forschern, vor allen unserm ersten Secretair, Herrn Geh. Archivrath Dr. Lisch, in persönliche Beziehungen und dauernden wissenschaftlichen Verkehr brachte. Er starb in seinem 80. Lebensjahre und dem fast vollendeten 38. Jahre seiner Verbindung mit unserm Verein, zu dessen correspondirendem Mitgliede er gleich bei der Stiftung am 5. October 1835 ernannt ward.
Ihm folgte am 27. October 1874 der Dr. C. L. Grotefend, Geh. Archivrath und Königl. Staatsarchivar zu Hannover in Folge eines Lungen= und Magenkatarrhs, fast 67 Jahre alt, aber noch bis vor kurzem ein anscheinend kräftiger Mann und rüstiger Forscher. Der Verstorbene, seit dem 12. April 1858 correspondirendes Mitglied unsers Vereins, war dessen Stifter und erstem Secretair durch verwandte Studien und gleiche amtliche Stellung schon seit vielen Jahren eng befreundet und stets bereit, die Arbeiten des Vereins durch Rath und That, namentlich bei archäologischen Forschungen, besonders auf dem Gebiete der Numismatik, wo er anerkannte Auctorität war, zu fördern und zu unterstützen. Vor allem aber ist ihm der Verein als thätigem Mitarbeiter an unserm Urkunden=Buche, wozu er bis in die jüngste Zeit zahlreiche Urkunden=Abschriften aus den Hannoverschen Archiven geliefert hat, zu lebhaftem Danke verpflichtet. - Schon als Lehrer an dem Andreanum zu Hildesheim und später an dem Lyceum zu Hannover, an welchem schon sein Vater, der bekannte Philologe Grotefend, als Director angestellt war, widmete er seine Privatstudien vorzugsweise der alten Geographie, Epigraphik und Numismatik, dann auch der Geschichte Deutschlands und namentlich seiner Heimath, und bahnte sich dadurch den Weg zur Anstellung in dem königlichen Archive im Jahre 1853. Daneben stand er an der Spitze des historischen Vereins für Niedersachsen, dessen Zeitschrift voll von seinen Arbeiten ist, und erwarb sich als vieljähriger Corrector des großen nationalen Werkes der Monumenta Germaniae historica sehr wesentliche, wenngleich


|
Seite 8 |




|
außer den Mitarbeitern nur Wenigen bekannte, Verdienste, denen er jedoch wohl vorzugsweise seine Ernennung zum Mitgliede der Göttinger Societät der Wissenschaften und der Berliner Akademie verdankte. Das von ihm und dem Amtsrichter Fiedler herausgegebene Urkunden=Buch der Stadt Hannover, dessen erster Band bis zum Jahre 1369 reicht, ist leider unvollendet geblieben.
Zur Ergänzung der durch diese wiederholten Unglücksfälle allmählich auf 57 herabgesunkene Zahl unsrer auswärtigen Correspondenten, und mit Rücksicht auf die in neuerer Zeit gerade in Schweden und Italien mit besonderem Erfolge gepflegte nationale Alterthumskunde hat der Vorstand des Vereins sich in seiner letzten Sitzung veranlaßt gesehen, die Herren Director Pigorini in Parma und Dr. Oscar Montelius, Secretair des schwedischen Alterthumsvereins in Stockholm, sowie den oben genannten Herrn Professor Ottokar Lorenz in Wien zu correspondirenden Mitgliedern zu ernennen.
Von den ordentlichen Mitgliedern des Vereins sind im Laufe des Quartals gleichfalls zwei ältere Freunde durch den Tod ausgeschieden, nämlich der Landbaumeister Wilh. Wachenhusen zu Rostock, Mitglied seit dem 18. Jan. 1855 und gestorben am 8. Octbr. 1874, und der Pastor Behm zu Vietlübbe bei Plau, früher zu Melz bei Röbel, beigetreten am 30. Septbr. 1866, gestorben am 6. Decbr. 1874. Außerdem hatten die Herren v. Schack auf Nustrow, v. Lützow auf Tessin, Pastor Türk in Güstrow, jetzt als emeritus in Rostock, und Dr. Schultz in Hamburg schon im vorigen Jahre zu Neujahr gekündigt. Als neue Mitglieder haben wir dagegen die Herren Pastor Bartholdi in Zarrentin, v. Schack auf Brüsewitz und v. Schuckmann auf Gottesgabe willkommen zu heißen.
Endlich ist hier noch zu erwähnen, daß durch Vermittelung des Herrn Dr. Pigorini, welcher im vorigen Jahre unser Antiquarium besichtigte, mit dem von ihm geleiteten archäologischen National=Museum in Parma Correspondenz und Schriftenaustausch angeknüpft ist.
W. G. Beyer,
Dr. Archivrath,
zweiter Secretair des Vereins.


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
Quartalbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Schwerin, im April 1875
I. Wissenschaftliche Thätigkeit.
Nachdem im vorigen Jahre beschlußmäßig zwecks weiterer Verbreitung unsers Urkundenbuches 192 Exemplare der ersten bis dahin erschienenen 8 Bände des Werkes unter die Behörden und Bibliotheken des Landes vertheilt worden waren, sind nunmehr nach Beschluß der Ausschußversammlung des Vereins vom 4. Januar d. J. nachträglich auch den höchsten Reichsbehörden, dem Reichskanzler=Amt und dem Reichstage, zwei Exemplare überreicht worden, welche nach dem sehr verbindlichen Schreiben der Herren Präsidenten Delbrück und v. Forkenbek vom 21. Januar mit Dank acceptirt und den betreffenden Bibliotheken einverleibt worden sind. - Inzwischen ist der Druck des 9. Bandes nach kurzer Unterbrechung im Beginne dieses Jahres bis zum 64. Bogen fortgeschritten und wird hoffentlich im Laufe dieses Sommers vollendet sein. - Die Jahresrechnung der abgesonderten Urkundenbuchscasse für das Jahr 1874 ist nach Neujahr abgelegt und dem hohen Ministerium vorschriftsmäßig mit Bericht eingesandt worden, und wird demnächst nebst dem zu erwartenden allerhöchsten Rescripte auch dem Engern Ausschusse der hohen Stände vorgelegt werden.


|
Seite 2 |




|
Auch der 40. Band der Jahrbücher des Vereins ist mit Neujahr unter die Presse gegeben, und wird bereits den Abdruck der im Januarberichte angezeigten Briefe Wallensteins bringen.
Ueber die Verhandlungen der Generalversammlung des Gesammtvereins zu Speyer vom 21. September ff. 1874 erstattet dessen Correspondenzblatt Nr. 12 des Jahrgangs 1874 und Nr. 1-4 von 1875 eingehenden Bericht. Die nächster Versammlung im bevorstehenden Herbste wird zu Detmold abgehalten werden.
II. Die Sammlungen des Vereins
haben in dem letzten Quartale, mit alleiniger Ausnahme der Bibliothek, nur sehr unbedeutende, theilweise gar keine neue Erwerbungen gemacht. Es sind als solche nur zu verzeichnen:
A. Die Alterthümersammlung:
1) Aus der heidnischen Zeit.
Ein kleiner, 4 Zoll hoher, an der Spitze durchbohrter Kegel aus Thon mit Kies untermischt, wie die heidnischen Urnen der Stein= und Bronzezeit, mit 6 ähnlichen auf dem Gute Oyle bei Nienburg an der Weser in der Nähe einer sehr alten Umwallung 3 Fuß tief gefunden, und von dem Herrn v. Arenstorf auf Oyle dem Vereine geschenkt 1 ).
2) Aus dem christlichen Mittelalter.
Eine kleine männliche Figur aus Messing, welche als Leuchterträger diente, (ähnlich den zu Band XXXVII unserer Jahrbücher Tab. I und II abgebildeten angeblich wendischen Götzen), vor mehren Jahren bei dem Bau der Franckschen Apotheke am altstädtischen Markte in Schwerin Nr. 8 von dem verstorbenen Maurer Pamperin gefunden und jetzt aus dessen Nachlasse von seinem Sohne erworben. Der große messingne Stempel eines Siegels des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, gefunden in der Dorfstraße zu Woosmer und von dem Herrn Schullehrer Hilde=


|
Seite 3 |




|
brand daselbst durch Vermittelung des Herrn Amtmanns Schlettwein zu Dömitz geschenkt.
Ein großes messingnes Petschaft mit einer Oese auf der Rückseite, nach dem Style etwa aus dem 16. Jahrhundert, gefunden in Schwan beim Brunnengraben und durch Herrn Franz Cordes daselbst für den Verein angekauft. (Das Wappen mit vielen Schilden und Helmen ist ganz unerklärlich, und die Umschrift in sonderbar gestalteten Minuskeln unleserlich. Vielleicht gehörte das Petschaft einem Betrüger oder Quacksalber).
B. Für die Siegelsammlung.
S. oben A. 2.
C. Für die Bildersammlung.
Eine Abbildung des Kaiserlichen Obristen Helmuth v. Plessen auf Cambs, † 1694. Kupferstich, mit der Umschrift: Hehnvth a Plessen S. C. R. M. equitum colonellvs. Anno 1649. Ehr oder Todt. Auf dem unteren Rande:
Mauritius Lang sculp. Geschenk des Herrn Dr. Crull in Wismar.D. Für die Büchersammlung.
I. Großbrittannien.
- J. M. Kemble. The utility of antiquarian collections, as throwing light on the prehistoric annals of the european nations. Dublin u. London 1857. 8°. (Antiquarisch angekauft.)
II. Rußland.
- Walther, C. F. Lateinische Ode mit beigefügter deutscher Uebersetzung zur Silberhochzeit des russischen Kaiserpaares. Petersburg 1866. 8°.
- Der revid. esthl. Ritter= und Landrechte erstes Buch. Reval 1852. 8°.
- Das ehstländische Landraths=Collegium und Oberlandgericht. Ein rechtsgeschichtliches Bild. Reval 1855. 8°.
- Archiv für die Geschichte Liv=, Esth= und Curlands, herausgegeben von C. Schirren. Bd. I-V. Reval 1861-1865. 8°.


|
Seite 4 |




|
- Neimandt, A. Ueber die Verbindungsweise der in den organischen Körpern enthaltenen Mineralbestandtheile. Reval 1864. 4°.
- Rußwurm, C. Nachrichten über das adelige und freiherrliche Geschlecht Stael von Holstein Esthländische Linie. Theil 2. Urkunden und Regesten. (Heft 1.) Reval 1873. 8°. (Nr. 3-7 Tauschex. der esthl. lit. Gesellschaft zu Reval.)
III. Niederlande.
- Handelingen en mededeelingen van de maatschappij der nederlandsche letterkunde te Leiden. Leiden 1874. 8°.
- Levensberichten der afgestorvene medeleden van de m. d. n. l. Leiden 1874. 8°. (Nr. 8 und 9 Tauschex. der gen. Gesellschaft.)
- 46. verslag der handelingen van het friesch genootschap van geschied-, oudheid-en taalkunde te Leeuwarden. 1873/74. 8°. (Tauschex. der Gesellschaft zu Leeuwarden.)
- Verzameling van stukken betrekkelijk het kloster Alberghen. Zwolle.
- Verzameling van stukken die betrekking hebben tot overijsselsche regt en geschiedenis. Stuk 9. Zwolle 1874. (Nr. 11 u. 12 Tauschex. des Vereins zu Zwolle.)
IV. Luxemburg.
- Publication. de la section historique de l'institut royal grand-ducal de Luxembourg. Année 1873. Luxemb. 1874. 4°. (Tauschex. der gen. Gesellschaft.)
V. Schweiz.
- Das Urner Spiel vom Wilhelm Tell. Nach der Originalausgabe neu herausgegeben von W. Vischer. Basel 1874. 4°. (Tauschex. der hist. und antiquar. Gesellschaft zu Basel.)
VI. Oesterreich.
- Archiv für österreichische Geschichte. Bd. LI. Heft 2. nebst Registerband über Bd. I - L. Wien 1874. 8°.
- Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXV. Heft 1-3. Bd. LXXVI. Heft 1-3. Wien 1873. 74. 8°. (Nr. 15 und 16 Tauschex. der k. k. Akademie in Wien.)


|
Seite 5 |




|
- Jahresbericht des Lesevereins der deutschen Studenten Wiens. Wien 1874. 8°. (Tauschex. des gen. Vereins.)
- Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1874. Nr. 7-10. (Tauschex. der gen. Gesellschaft.)
- Sitzungsberichte der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1874. Nr. 6, 7 und 8. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Scriptores rerum Polonicarum. Tom. I. II. Cracoviae 1872. 74. 8°.
- Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Tom. I. Cracoviae 1874. 4°.
- Correctura statutorum et consuetudinum regni Poloniae anno 1532 decreto publico per Nicol. Taszycki et socios confecta ex rarissima editione authentica opera Michaelis Bobrzynski nunc iterum edita. Cracoviae 1874. 4°. (Nr. 20-22 Tauschex. der Academie der Wissenschaften zu Krakau.)
VII. Allgemeine deutsche Geschichts= und Alterthumskunde.
- Monumenta Germaniae historica medii aevi. Scriptores. Tom. XXIII. Hanoverae 1874. Fol. (Aus dem Großh. Ministerium des Innern.)
- Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. Jahrg. 1874. Heft 10-12. Jahrg. 1875. Heft 1. (Zwei Exemplare.)
- Literarischer Handweiser zunächst für das katholische Deutschland. Jahrg. 1874. Nr. 12-18. Jahrg. 1875. Nr. 1-2. Münster. 8°. (Tauschex. der Redaction.)
- Mittelniederdeutsches Wörterbuch von K. Schiller und A. Lübben. Bd. II. Heft 2. Bremen 1875. 8°. (Angekauft.)
VIII. Baiern.
- Sitzungsberichte der philosophisch=philologischen und historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften in München. 1874. Bd. H. Heft 1 und 2. 8°. (Tauschex. der gen. Akademie.)
- Zeitschrift des historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. Jahrg. I. Heft 1-3. Augsburg 1874. 8°. (Tauschex. des gen. Vereins.)
- Oberbayerisches Archiv für vaterl. Geschichte. Bd. 32. Heft 2 und 3. Bd. 33. Heft 1. München 1872-74. 8°. (Tauschex. des hist. Vereins von und für Oberbayern.)


|
Seite 6 |




|
- Die Wartburg. Organ des Münchener Alterthumsvereins. Nr. 3-5. 7. 8. 9. Jahrg. 1874. 75. (Geschenk des gen. Vereins.)
- Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken. Bd. 12. Heft 3. Baireuth 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
IX. Würtemberg.
- Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Herausgeg. von dem k. statistisch=topographischen Bureau. Jahrg. 1873. I. II. Stuttgart 1874.
- Verzeichniß der Ortschaften des Königreichs Württemberg. Herausgeg. von dem k. statist.=topogr. Bureau. Stuttgart 1874. 8°. (Tauschex. der gen. Behörde.)
- Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensee's und seiner Umgebung. Lindau 1874. 8°. (Tauschexemplar des gen. Vereins.)
X. Großherzogthum Hessen.
- Archiv für hessische Geschichte und Alterthumskunde. Bd. XIII. Heft 3. Darmstadt 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
XI. Sachsen.
- Mittheilungen aus dem Freiberger Alterthumsvereine. Heft 11. Freiberg 1874. 8°. (Tauschex. des betr. Vereins.)
XII. Preußen.
- Altpreußische Monatsschrift. Bd. XI. Heft 7 und 8. Bd. XII. Heft 1. Königsberg i. P. 1874. 75. (Tauschexemplar von der Alterthumsgesellschaft Prussia.)
- Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Jahrgang 9. Heft 4. Magdeburg 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Jahresbericht 48. des Altmärkischen Vereins zu Salzwedel. Magdeburg 1875. 8°. (Tauschex. des gen. Vereins.)
- Pyl, Dr. Theod. Pommersche Geschichtsdenkmäler. Bd. V. Leben und Schriften Augustin Balthasars. Greifswald 1875. 8°. (Geschenk des Herrn Verf.)
- Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrg. 1873. Hannover 1874. 8°. (Tauschex. des betr. Vereins.)


|
Seite 7 |




|
- Zeitschrift des Harz=Vereins für Geschichte und Alterthumskunde. Jahrg. VII. Heft 4. Wernigerode 1874. 8°.
- Teppiche des Jungfrauenstifts Marienberg bei Helmstedt. Erläutert von A. J. v. Münchhausen. Wernigerode 1874. 4°. (Nr. 42 und 43 Tauschex. des Harzer Vereins.)
- Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Alterthümer zu Emden. Heft III. Emden 1874. 8°. (Tauschex. der betr. Gesellschaft.)
- Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. 3. Folge. Bd. 8. Bd. 9. Heft 1 und 2. Bd. 10. Münster 1869-1872. 8°. (Tauschex. des westf. Vereins.)
- Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch=antiquarischer Forschungen. Bd. XIII. 4. Halle 1874. 8°. (Tauschex. des thür. sächs. Vereins.)
- Verzeichniß des Museums schlesischer Alterthümer zu Breslau. 2. Aufl. Breslau 1872. 8°.
- Aus Schlesiens prähistorischer Zeit. Breslau 1874. 4°. (Nr. 47 und 48 Tauschex. des Breslauer Vereins.)
- Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 51. Görlitz 1874. 8°. (Tauschex. der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften.)
- Mittheilungen an die Mitglieder des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. Bd. V. Nr. 1. 1874. 8°.
- Die Deutsch=Ordens Commende Frankfurt a. M. Aus dem Nachlasse des Insp. A. Niedermayer, herausgegeben von Dr. Euler. Frankfurt a./M. 1874. (Nr. 50 und 51 Tauschex. des Frankfurter Vereins.)
- Zeitschrift der Gesellschaft für die Geschichte der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg. Bd. 4. Schlußheft. Bd. V. Heft 1.
- Quellensammlung der Gesellschaft für Schlesw.=Holst.=Lauenb. Geschichte. Bd. IV Heft 1. Kiel 1874. 8°.
- Urkundensammlung der Gesellschaft für Schlew.=Holst.=Lauenb. Geschichte. Bd. IV. Fasc. 1. Kiel 1874. 4°. (Nr. 52-54 Tauschex. der gen. Gesellschaft.)
XIII. Bremen.
- Bremisches Jahrbuch. Herausgegeben von der historischen Gesellschaft des Künstlervereins. Bd. VII. Bremen 1874. 8°.


|
Seite 8 |




|
- Bremisches Urkunden=Buch. Bd. II. Lieferung 2 und 3. Bremen 1875. 4°. (Nr. 55 und 56 Tauschex. des Vereins zu Bremen.)
XIV. Meklenburg.
- Großh. Meklenburg = Schwerinscher Staats=Kalender. Jahrg. 100. 1875. 8°. (Geschenk des Verlegers, des Herrn Dr. Bärensprung= Schwerin.)
- Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Meklenburg. 28. Jahrgang. Neubrandenburg 1874. 8°. (Tauschex. des betr. Vereins.)
-
Personalien aus den Leichenreden
1. auf Christian Wilhelm Hahn auf Seeburg † 1686 und
2. auf Armgart Hahn von Seeburg, Tochter Werner's Hahn, verm. Marschall von Biberstein † 1684.
(Geschenk des Herrn Pastors Ragotzky zu Trieglitz.) - Wigger, Fr. Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge. Schwerin 1875. 8°. (Zwei Exemplare. Geschenk des Herrn Verf.)
- Schwarz, Direct. Dr. Ueber den Stammcharakter der Bevölkerung in der Mark Brandenburg und Meklenburg. Wochenblatt des Johanniter=Ordens 1874. Nr. 48. (Geschenk des Herrn Verf.)
III. Die Matrikel des Vereins.
Seit dem Beginn des neuen Jahres hat der Verein 5 neue ordentliche Mitglieder erworben, nämlich die Herren Dr. med. Schlettwein zu Sternberg, Gutspächter F. Schlettwein zu Bandelstorf, Amtsauditor v. d. Lancken zu Schwerin, Karl Bolten daselbst, und Advocat Kortüm zu Rostock. Dagegen ist in demselben Zeitraum nur ein älteres Mitglied durch den Tod ausgeschieden, der unter allgemeiner lebhafter Theilnahme seiner Mitbürger am 27. Febr. unerwartet verstorbene Medicinalrath Dr. Pfeiffer in Schwerin, vieljähriges, thätiges Mitglied des Bürgerausschusses und seit dem 2. April 1860 auch unserm Verein angehörig. - Außerdem verstarb am 20. März d. J. der Präpositus Franz Boll zu Neubrandenburg, ein hochverdienter meklenburgischer Geschichtsforscher, der namentlich durch seine gründliche Geschichte des Landes Stargard allgemeinem Ruf erwarb und früher lange Zeit hindurch nicht nur Mitglied unteres Vereins, sondern auch thätiger Mit=


|
Seite 9 |




|
arbeiter an dessen Jahrbüchern war, die ihm mehre, sehr tüchtige Abhandlungen verdanken. Seine letzte nicht vollendete Arbeit ist die Chronik seiner Vaterstadt Neu=Brandenburg, für deren Fortsetzung wohl die Verlagshandlung sorgen wird. Die Meklenburgischen Anzeigen widmeten ihm in Nr. 71 vom 27. März d. J. einen ehrenden Nachruf und die Meklenburgische Zeitung brachten am 27. und 28. April seinen Nekrolog.
Zur Correspondenz und zum Schriftenaustausch schlossen sich unserm Vereine an die Akademie der Wissenschaften zu Krakau in Galizien und der neugegründete Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu Kahla im Herzogthum Sachsen=Altenburg.
W. G. Beyer,
Dr. Archivrath,
zweiter Secretair des Vereins.


|
[ Seite 10 ] |




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
:
|
Quartal= und Schlussbericht
des
Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
Schwerin, im Juli 1875
Das mit dem 10. d. M. abgelaufene vierzigste Jahr der geordneten Wirksamkeit unseres Vereins ist auf dem Felde der Literatur der Geschichte unserer Heimath im Ganzen ein recht fruchtbares und gesegnetes gewesen. Was zunächst die Thätigkeit des Vereins selbst während dieses Jahres betrifft, so habe ich vor allem die Freude, meinen Bericht mit der Anzeige beginnen zu können, daß grade mit dem Schlusse desselben der letzte Bogen des 9. Bandes unseres Urkundenbuches die Presse verlassen hat. Der neue Band ist einer der stärksten der bisher erschienenen, und bringt auf 93 Bogen 875 Urkunden, so daß die Gesammtzahl der bisher in diesem großen Nationalwerke gedruckten meklenburgischen Urkunden bereits 6602 beträgt, wodurch das Material zu einer beglaubigten Geschichte unserer Heimath bis zum Schlusse des Jahres 1345 nunmehr vollständig, gesichtet und geordnet der wissenschaftlichen Bearbeitung vorliegt. Von diesen gesammten Dokumenten sind über zwei Drittel bisher ungedruckt, mithin vollständig unbekannt und unbenutzt, und mindestens die Hälfte des letzten Drittels war nur aus entlegenen und fehlerhaften Drucken bekannt, die Zahl derer


|
Seite 2 |




|
aber, welche in dem neuen Abdrucke nach dem Originale, soweit dasselbe noch vorhanden ist, nicht irgend eine Berichtigung oder Erläuterung empfangen hätten, ist verschwindend klein. Unter den 875 Documenten dieses Bandes sind 195 von den einheimischen Fürsten, den Herren von Meklenburg und Werle und den Grafen von Schwerin, ausgestellt, darunter weithin die meisten von Herrn Albrecht von Meklenburg oder seinen Beamten (2), dagegen nur 49 von anderen Fürsten, darunter eine Kaiserurkunde, 33 von deutschen Reichsfürsten, mit Einschluß der Grafen von Holstein und Schleswig, und 15 von auswärtigen Fürsten, den Königen von Schweden, Dänemark und England, meistens die Handelsverhältnisse der Seestädte betreffend. Ferner 132 von der Geistlichkeit Meklenburgs, einschließlich der Bischöfe von Camin und Havelberg, deren Sprengel bekanntlich Theile von Meklenburg mit umfaßten, und 46 von auswärtigen Geistlichen, darunter nicht eine einzige päpstliche Bulle. 74 andere Urkunden sind von einheimischen Städten, namentlich Rostock und Wismar, nur sehr wenige von Schwerin, Güstrow, Parchim, Neubrandenburg, Malchin, Kröpelin, Crivitz und Goldberg ausgestellt, und 11 von auswärtigen Städten, namentlich Lübek, Lüneburg und andern; endlich nicht weniger als 348 von meklenburgischen Privatpersonen, und zwar ziemlich zur einen Hälfte von Rittern und Knappen, zur andern von Bürgern der Städte, und 20 gehören auswärtigen Privatpersonen an. Schon diese Zahlen charakterisiren den betreffenden Zeitraum von 1337 bis 1345 als wesentlich friedlich, und in der That kommt der ganze reiche Inhalt dieses neuen Bandes des großen Werkes fast ausschließlich der Geschichte der Entwickelung der innern Verhältnisse unsrer Heimath zu Gute. - Die äußere Ausstattung ist natürlich dieselbe, wie die der frühern Bände; die Zahl der dem Texte beigedruckten Siegelholzschnitte beträgt 27, nämlich 7 geistliche, 11 fürstliche, 1 städtisches und 8 adlige Familien=Siegel. - Zur rechtzeitigen Herbeischaffung des Materials für den folgenden Band, sowie für die dritte Abtheilung des Werkes, wird kein Fleiß und keine Mühe gespart. So sind z. B. Herr Archivar Dr. Wigger und Herr Archiv=Registrator Jahr erst kürzlich mit einem Schatze von fast 500 Urkunden des 14. Jahrhunderts aus dem Rostocker Stadtarchiv von einer dreitägigen Reise dorthin zurückgekehrt.
Auch der erste Theil des 40. Bandes der Jahrbücher des Vereins, 9 Bogen stark, lag bereits in der General=


|
Seite 3 |




|
Versammlung, die dies Mal des einfallenden Sonntags wegen auf den 12. d. M. verlegt werden mußte, vollendet vor. Die erste und umfänglichste Abhandlung desselben enthält eine gründliche Geschichte der Pilgerfahrten meklenburgischer Regenten nach dem Orient im Zeitalter der Kreuzzüge von dem Herrn Archivar Dr. Wigger, welche in drei Abtheilungen zerfällt, deren erste, S. 2-26, sich mit der Wallfahrt des Obotritenfürsten Pribislav und des Grafen Gunzel I. von Schwerin, 1172, die zweite, S. 27-38, mit der Kreuzfahrt des Grafen Heinrich I. von Schwerin, 1197, und die dritte, S. 39-86, mit der Pilgerfahrt und der Gefangenschaft des Fürsten Heinrich I. von Meklenburg, 1271-1298, beschäftigt. In dieser gediegenen Arbeit besitzt Meklenburg zum ersten Mal eine vollständige und zuverlässige Darstellung dieser interessanten und charakteristischen Episoden aus der Geschichte seines edlen Fürstenhauses, welche auf der sorgfältigsten Benutzung aller bisher bekannten occidentalischen und orientalischen Quellen beruht, und durch welche diese Forschung endgültig abgeschlossen sein dürfte, da die Entdeckung neuer Quellen kaum zu hoffen ist. - Hieraus folgt zunächst der Abdruck einer bisher unbekannten Verordnung des Herzogs Wallenstein über die Einführung gleichen Maaßes und Gewichtes in Meklenburg vom 6. Mai 1629, mitgeteilt von dem Herrn Geh. Archivrath Dr. Lisch, und ihr schließt sich dessen Mittheilung einer Sammlung von 50 eigenhändigen Briefen Wallensteins aus der Zeit von 1627-1630 unmittelbar an. Diese höchst interessanten und für die Besitzergreifung Meklenburgs durch den Usurpator sehr wichtigen Briefe sind fast alle an den Obersten Sant Julian, den Statthalter Wallensteins in Meklenburg, gerichtet, und durch den Herrn Ministerialrath Samwer zu Gotha in dem Archive zu Wallsee in Niederösterreich, einer ehemaligen Sant Julianischen Besitzung, entdeckt, und demnächst mit Erlaubniß Sr. Hoheit des Herzogs Ernst von Sachsen=Koburg, als jetzigen Besitzers der Herrschaft Wallsee, durch den Herrn Prof. Dr. Ottokar Lorenz in Wien an Lisch zum Zwecke der Veröffentlichung eingesandt worden. Herr Prof. Lorenz hatte ohne Zweifel vollkommen Recht, wenn er in seinem Begleitschreiben bemerkt, daß er diesen literarischen Schatz keinen bessern Händen anzuvertrauen wisse, als dem Gründer und Leiter des historischen Vereins Meklenburgs, dessen mühsame, in den Jahrbüchern des Vereins erst vor Kurzem mitgeteilten Forschungen über die Wallensteinsche Regierung Meklenburgs durch diese neue


|
Seite 4 |




|
Entdeckung eine ebenso unerwartete, als glänzende Bestätigung gefunden haben. Auch für die allgemeine Geschichte Deutschlands sind diese Briefe, nicht ganz ohne Interesse, wenn gleich nur von untergeordnetem Werthe. Wallenstein erscheint hier ganz als der treue Diener seines Kaisers, wie ihn neuerdings z. B. Droysen geschildert hat, wogegen Prof. Gindeli in Prag den Charakter dieses ebenso viel geschmähten, als hoch gepriesenen Mannes, in einer auch in meklenburgischen Zeitungen abgedruckten Abhandlung über den Erwerb des ungeheuren Vermögens des einfachen böhmischen Landjunkers, aufs neue tief herabsetzt, vielleicht doch von dem national czechischen Standpunkte des Herrn Verfassers aus etwas zu einseitig und ungerecht, jedenfalls ohne genügende Begründung einer so schweren Anklage. - Den Schluß dieses Jahrgangs bilden zwei kleinere Abhandlungen von Lisch über die Familie Grelle und v. Grelle und zur Topographie der Pfarre Klütz.
Unter den hierher gehörigen historischen Arbeiten außerhalb des Vereins verdienen zwei größere Schriften zur neuesten Geschichte unseres Fürstenhauses den ersten Platz. In der königlichen Hofbuchhandlung von E. S. Mittler und Sohn in Berlin erschien nämlich ein besonders für Meklenburg hochwichtiges Werk unter dem Titel: Der Antheil der unter dem Commando Sr. K. H. des Großherzogs von Meklenburg=Schwerin vereinigt gewesenen Truppen am Kriege 1870/71. Nach officiellen Quellen bearbeitet, mit 2 Uebersichtskarten, 3 Situationsplänen und 5 lithographirten Skizzen. 8°. 1875. Dies in kriegswissenschaftlicher Beziehung von allen competenten Richtern sehr hoch gestellte Werk ist nicht eigentlich für Laien, sondern vorzugsweise für Militärs geschrieben, ist aber jedenfalls unter allen über denselben Gegenstand erschienenen Schriften das vollständigste und gründlichste, und in jeder Beziehung ein würdiges Denkmal der patriotischen Betheiligung Meklenburgs, voran seines heldenmüthigen Fürsten, - des einzigen regierenden deutschen Landesherrn, außer dem greisen Königlichen Kaiserlichen Oberfeldherrn, der es sich nicht nehmen ließ, seine Truppen persönlich zu Gefahr und Sieg zu führen, - an dem großen Freiheitskampfe und dem Wiederaufbaue des deutschen Reiches, der nie erloschenen Sehnsucht zweier Generationen unseres Volkes. Im Uebrigen muß es hier genügen, auf den in den "Mecklenburgischen Anzeigen" 1875, Nr. 96, 97, 101 und 118, mitgetheilten größeren Auszug aus dem Werke selbst und dessen Beurtheilungen durch die Presse zu verweisen.


|
Seite 5 |




|
Diesem kriegerischen Werke steht eine heitere Friedensbotschaft würdig zur Seite, nämlich die in der Sandmeyerschen Hofbuchdruckerei in Schwerin. 8°. 1874 erschienenen: "Erinnerungen aus dem Oriente." Ein Tagebuch, als Manuscript gedruckt. Dies einfach aber fließend geschriebene, eben so unterhaltende, als belehrende Buch enthält auf 410 Seiten eine vollständige Beschreibung der Reise Ihrer Königl. HH. unseres Großherzogs und der Frau Großherzogin nach dem Oriente im Jahre 1871, angeblich von einem militärischen Begleiter der hohen Reisenden. Die Schrift verdient daher mit Recht einen Platz in der historischen Literatur Meklenburgs, als ein gleichzeitiger officiöser Bericht über die neueste Pilgerfahrt unseres Fürstenhauses nach dem heiligen Lande in modernem protestantischen Geiste.
Zu den erschienenen Arbeiten über die ältere Geschichte Meklenburgs gehört dagegen die Chronik der Vorderstadt Neubrandenburg, zusammengetragen durch Franz Boll, Pastor zu S. Johannis daselbst. Der Verfasser, auch sonst als einer der tüchtigsten Historiker unseres Landes bekannt und geachtet, hat die Vollendung dieser seiner letzten Arbeit leider nicht erlebt, da er kurz nach dem Erscheinen des 4ten, bis zum Jahre 1816 reichenden Heftes am 20. März d. J. verstarb, worauf sein Sohn, Professor der Anatomie in Rom, den Druck des letzten Heftes besorgt hat. Früher, seit der Gründung unseres Vereins, dem 3. Dcbr. 1834, ordentliches Mitglied und fleißiger, hochgeschätzter Mitarbeiter desselben, trat der Verstorbene, ein ungewöhnlich thätiger und vielseitig gebildeter Mann, im Jahre 1856 unerwartet und, wie der Berichterstatter versichern zu können in der Lage ist, in Folge eines bedauerlichen Mißverständnisses aus, und hat uns seitdem leider auch seine literarische Mitwirkung entzogen. Unter seinen Beiträgen für die Jahrbücher sind die bedeutendsten die Abhandlung über die deutsche Colonisation Meklenburgs (Band 13, S. 57 ff.); über den Obotritenfürsten Mistuwoi (B. 18. S. 60 ff.) und über die Prilwitzer Götzen (Bd. 19, S. 168 ff. u. 20 S. 208 ff.) Sein bedeutendstes Werk ist aber die 1846/47 in 2 Bänden herausgegebene Geschichte des Landes Stargard. 1 ) Die obgedachte Chronik ordnet den Stoff nicht annalistisch, sondern fachlich in kleinern und größern Abschnitten mit besonderen Ueberschriften, z. B. von der Gründung der Stadt 1218, die Einwohnerschaft und die


|
Seite 6 |




|
städtischen Einrichtungen bis zur Reformation u. s. w. Seine Quellen beschränken sich anscheinend auf gedruckte Werke und das Neubrandenburger Rathsarchiv. Beigegeben sind die wichtigsten Urkunden der Stadt und einzelne seltene kleinere Druckschriften, z. B. ein Bericht über die Zerstörung der Stadt durch Tilly. Der Verfasser war ein Bruder Ernst Boll's, des bekannten Naturforschers und Verfassers einer sehr verbreiteten Geschichte Meklenburgs, woran auch Franz mitbetheiligt war.
Ein anderer wichtiger Beitrag zur Geschichte des Städtewesens in Meklenburg ist gleichfalls von einem Mitgliede und gediegenen Mitarbeiter des Vereins: F. Crull, Dr. med. in Wismar: Die Rathslinie der Stadt Wismar. Halle 1875. XLIV und 134 S. 8°. Nachdem der Herr Verfasser in der höchst interessanten Einleitung das Alter des Rathes (d. h. der Stadt), dessen Besetzung und Ergänzung, die Bedingungen der Wahl, die Zahl der Mitglieder, ihre Vorsteher (Bürgermeister), die Vertheilung der Geschäfte, die Amtseinnahmen, die Stellung der Mitglieder zu einander und der Bürgerschaft eingehend besprochen hat, folgt die wahrscheinlich fast vollständige Matrikel selbst in 3 Abtheilungen, nämlich 1) von 1246-1344, für welchen Zeitraum die Zeugenreihen der Urkunden die einzige Quelle bilden, 2) von 1344-1510 nach der noch im Stadtarchive vorhandenen, von dem Stadtschreiber Nicolaus Swerk begonnenen und seinen Nachfolgern sehr sorgfältig fortgesetzten Rathsmatrikel, d. h. die alljährlichen Protokolle über die Besetzung des Rathsstuhles; endlich 3) von 1510-1829, wo die Stadtsecretaire nur die jedesmaligen Neuwahlen von Bürgermeistern und Rathmannen eintrugen.
Schon etwas früher, im Jahre 1874, erschien in der Schmiedekampf'schen Buchhandlung hieselbst ein gleich verdienstliches, auf überaus mühsamen Forschungen, bei welchen keine irgend zu ermittelnde Quelle unbenutzt geblieben ist, beruhende Arbeit von dem Dr. med. A. Blanck, Oberstabsarzt und Mitglied des Vereins: Die meklenburgischen Aerzte von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, mit kurzen Angaben über ihr Leben und ihre Schriften, 255 S. 8°. Das Verzeichniß ist rein chronologisch, nach dem Datum der Promotion, wo dasselbe zu ermitteln war, geordnet; ein alphabetisches Personal=Verzeichniß erleichtert aber die Benutzung, wenngleich die Hinzufügung eines Orts=Verzeichnisses von den meisten Lesern gewiß sehr dankbar anerkannt sein würde. Das Haupt=Verdienst des Werkes besteht aber


|
Seite 7 |




|
in den sehr sorgfältig gesammelten literarischen Notizen, wodurch dasselbe zu einem sehr wichtigen Beitrage zur Geschichte der Medicin in Meklenburg überhaupt geworden ist. Gelegentlich sei bemerkt, daß der Herr Verfasser gegenwärtig mit einer ähnlichen Arbeit über die Naturforscher Meklenburgs beschäftigt ist, wozu ihm reiche Beiträge von allen Seiten zu wünschen wären.
An diesem Orte möge zugleich eine kurze Hinweisung auf das seit etwa zwei Jahren heftweise erscheinende Sammelwerk: "Allgemeine deutsche Biographie" Platz finden, welches auch eine Reihe kurzer (theilweise doch wohl allzukurzer) Biographien von verdienten Meklenburgern, von dem Secretair Fromm hieselbst, Mitgliede des Vereins, enthält.
Ferner gehört hierher die 1874 in Leipzig bei Leinert erschienene Geschichte der Juden in Meklenburg, von dem Lehrer und Prediger der jüdischen Gemeinde in Güstrow, Dr. L. Donath, 335 S. 8°., eine auf fleißiger archivalischer Forschung, namentlich in dem Geheimen und Hauptarchiv hieselbst, beruhende Arbeit, welche aber leider im Gegensatze zu den frühern einseitig christlichen Urteilen über unsere jüdischen Mitbürger, einen der historischen Wahrheit nicht minder feindlichen einseitig jüdischen Standpunkt nicht verkennen läßt, und deshalb eine eingehendere unparteiische Besprechung, als ihr hier zu Theil werden kann, wohl verdiente.
Der so eben erschienene zweite Band der Beiträge zur Geschichte Meklenburgs, vornehmlich im 13. und 14. Jahrhundert, herausgegeben vom Prof. Dr. Fr. Schirrmacher in Rostock, hat gerade in den letzten Tagen eine ausführlichere Besprechung in den "Meklenburgischen Anzeigen" Nr. 156 und 157 aus kundiger Feder gefunden, weßhalb hier die Angabe des jedenfalls beachtenswerthen Inhaltes genügen möge. Der Band enthält: 1) die Colonisation Meklenburgs im 13. und 14. Jahrhundert von W. Ernst; 2) die meklenburgische Reimchronik des Ernst v. Kirchberg von Heinrich Thoms; 3) Nicolaus II. von Werle von Aug. Rudloff; 4) Ernst v. Kirchberg kein Meklenburger, sondern ein Thüringer, von dem Herausgeber, Prof. Schirrmacher. Von dem Mittelniederdeutschen Wörterbuche, von unserem zu früh verstorbenen Mitgliede Dr. Karl Schiller und Dr. Aug. Lübben begonnen und nach des erstem Tode wesentlich aus dessen nachgelassenen Handschriften von dem letztern allein fortgesetzt, ist nicht nur der erste, den Buchstaben E noch mit umfassende Band von 6 Heften


|
Seite 8 |




|
oder 49 Bogen gr. 8°. vollendet, sondern es sind auch in rascher Folge bereits die drei ersten Hefte des zweiten Bandes (bis "invarich") ausgegeben worden. Je mehr die Tüchtigkeit des auch äußerlich seiner würdig ausgestatteten Werkes Anerkenung findet, desto lebhafter und gerechter ist das Bedauern, daß es dem ersten Gründer desselben nicht vergönnt war, selbst die letzte Hand daran zu legen und sich der Vollendung desselben zu erfreuen.
Gleichzeitig hat auch der bereits durch seine größere Grammatik der niederdeutschen Sprache rühmlich bekannte Dr. Karl Nerger in Rostock, Mitglied des Vereins, als Anhang zu den von ihm unter dem Titel "Tremsen" herausgegebenen niederdeutschen Gedichten der Gebrüder Eggers eine Grammatik des Rostockschen Dialectes (sprachliche Erläuterungen S. 227-278), nebst einem Wörterbuch (S. 279-386), bearbeitet. Breslau, bei Hoffmann, kl. 8°. 1875. Das ist der Anfang zu einer höchst wünschenswerthen Ergänzung des oben angezeigten großen Werkes durch Herausgabe eines vollständigen Glossars des jetzt lebenden niederdeutschen Dialectes, welcher bei Schiller und Lübben leider principiell völlig unberücksichtigt geblieben ist.
Zum Schlusse erlaube ich mir noch, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß die Fortsetzung des von dem Freiherrn v. Stein begründeten, in den letzten Jahren fast ganz ins Stocken gerathenen großen Nationalwerkes der Monumenta Historiae Germanicae nunmehr durch die freigebige Unterstützung des Deutschen Reichs und Oesterreichs gesichert ist. In Folge dessen hat sich im Anfang April d. J. in Berlin bereits die neue, aus 11 Mitgliedern bestehende Centraldirection unter dem Vorsitze des Professors Waitz in Göttingen constituirt, und den künftigen Arbeitsplan, sowie die Geschäftstheilung festgestellt.
Indem ich mich nunmehr zu dem Berichte über die Sammlungen des Vereins wende, bin ich leider in der Lage, die schmerzhafte Entdeckung mittheilen zu müssen, daß der Verein gerade auf diesem Boden, wo er bisher seinen Ruhm und seinen Stolz fest begründet glaubte, nicht mehr auf der Höhe der Wissenschaft steht. Berichterstatter hat die öffentliche Verkündigung dieser unserer Schmach aus dem Munde eines auf der Eisenbahn durch das Land fahrenden Schülers der jetzt dominirenden Wissenschaft der Anthropologie und Urgeschichte des Menschen selbst vernommen! In dem Schweriner Antiquarium, verkündete der Mann, sei zwar eine große Masse


|
Seite 9 |




|
von Alterthümern aufgehäuft, aber sehenswerth, wie ich unschuldig geäußert hatte, sei die Sammlung durchaus nicht, da sie nicht wissenschaftlich geordnet sei. Erstaunt wagte ich die schüchterne Bemerkung, daß die Sammlung bisher gerade in dem Rufe gestanden habe, die einzig wissenschaftlich geordnete Deutschlands zu sein, und mir auch zur Zeit noch keine andere bekannt geworden sei, welche ihr hierin den Vorrang abgewonnen habe, ward aber durch die kurze Erklärung zur Ruhe verwiesen, daß die Ordnung nach dem veralteten System der drei Perioden doch keine wissenschaftliche zu nennen sei. Meine wißbegierige Frage, durch welches neuere System denn jenes veraltete ersetzt, welche Sammlung Deutschlands sich den Ruhm erworben habe, darnach zuerst geordnet zu sein? erhielt ich leider keine Antwort, sondern nur die flüchtige Hinweisung auf Berlin.
Die Sache ist ernst, meine Herren, denn was hier im Eisenbahnwagen so kraß ausgesprochen ward, ist auch in wissenschaftlichen Werken und Versammlungen, namentlich des anthropologischen Vereins, schon oft, wenn auch in bescheidenerer Weise als Thatsache hingestellt, bis jetzt aber freilich noch nicht begründet. Es kann daher nicht oft genug wiederholt werden, daß es auf Irrthum beruht, daß die großen Sammlungen des Nordens, wie die unserige, irgend einem hypothetischen System zu Liebe geordnet seien. Ihre Ordnung beruht vielmehr lediglich aus gewissenhafter Beobachtung der betreffenden Thatsachen, aus welchen sich ergab, daß in diesen Ländern drei durch ihren Bau wesentlich verschiedene und daher schon äußerlich erkennbare Arten heidnischer Begräbnißstätten existiren, und eine constante Erfahrung bei den zahlreichen, mit größter Sorgfalt vorgenommenen Aufdeckungen dieser Gräber stellte die weitere sichere Thatsache ans Licht, daß auch der Inhalt dieser drei Classen von Gräbern eben so wesentlich und charakteristisch von einander abweiche. Lediglich aus Grund dieser sicheren und unumstößlichen Thatsachen hat man demnach die gesammelten Grabalterthümer nach drei Classen geordnet, welchen dann nach weiterer Beobachtung auch die vereinzelt oder in größerer Zahl beisammen außerhalb der Gräber gefundenen, unverkennbar vollkommen entsprechen und sich denselben unterordnen. Hieran schloß sich demnächst die weitere Entdeckung, daß sich nicht selten Gräber der einen Classe auf und über dem einer andern Classe errichtet finden, und zwar stets in demselben Verhältniß, woraus nothwendig folgt, daß die untere Grabart älter sein muß, als die obere. Diese Altersstufe der


|
Seite 10 |




|
drei Gräberclassen harmonirt aber weiter auch mit dem Material und der Beschaffenheit der darin enthaltenen Alterthümer, indem sich in den ihrem Baue nach ältesten Gräbern nur Geräthe von dem rohesten, auch dem Menschen auf der untersten Culturstufe zugänglichen Materiale, Thon, Holz, Knochen und Stein finden, in den Gräbern der mittlern Stufe neben jenen auch kunstreich gearbeitete Alterthümer von Bronze (Kupfer und Gold, also in gediegener Masse gefundenen Metallen, und erst auf der dritten Stufe zugleich Gegenstände aus den nur durch Bergbau zu gewinnenden, Eisen und Silber, vorkommen. Aus allen diesen Beobachtungen sicherer Thatsachen folgt denn endlich unabweislich, daß jene drei Gräberclassen mit ihrem verschiedenartigen Inhalte drei verschiedenen Zeiträumen und Kulturperioden des Menschengeschlechtes angehören. Will und darf man hiernach die Ordnung unserer Sammlungen nach diesen drei in ihnen vertretenen Perioden als ein System bezeichnen, so ist es doch eine völlig verkehrte Auffassung, wenn man behauptet, daß diese Sammlungen von vornherein willkürlich nach diesem System geordnet seien; das System ist vielmehr nur das Ergebniß einer wissenschaftlichen Abstraction aus der auf reinen Tatsachen beruhenden Ordnung unserer Alterthümer. Alle weiter gehenden Schlußfolgerungen, namentlich zur Beantwortung der Frage, ob der Uebergang von der einen jener drei Perioden zu der andern durch allmähliche friedliche Entwickelung, oder durch Anstoß von außen, oder gar durch Einwanderung fremder Volksstämme bewirkt worden, beruhen allerdings auf bloßen Hypothesen, worüber sich streiten läßt und viel gestritten ist, welche aber auf die Ordnung unserer Alterthümer nicht den mindesten Einfluß haben.
Was übrigens gegen die Richtigkeit jener Abstraction überhaupt eingewendet worden, ist in der That höchst unbedeutend. Daß sich Alterthümer aus dem verschiedensten Material in einem und demselben Grabe finden, ist begreiflich, da mit der Einführung des neuen Materials selbstverständlich das ältere nicht sofort völlig verdrängt ward; daß sich aber hin und wieder auch in einem altern Grabe schon ein Stück aus dem erst die spätere Zeit charakterisirenden Metalls findet, z. B. Eisen in einem Bronzegrabe, ist gleichfalls zuzugeben, obwohl es selten vorkommt; dadurch wird aber das Verhältniß nicht geändert, denn da das Eisen nicht bei allen Völkern gleichzeitig in Gebrauch kam, so ist begreiflich, daß sich ein oder das andere Stück dieses Metalles schon sehr lange Zeit vor der allgemeinen Einführung desselben neben der Bronze


|
Seite 11 |




|
findet. Wenn daher Herr Prof. Virchow in Berlin neuerdings neben Geräthen aus Bronze auch Spuren völlig oxidirten Eisens gefunden haben will, so folgt daraus nicht, daß ein ähnliches Verhältniß in allen Gräbern der eigentlichen Bronzezeit vorauszusetzen ist, eine Voraussetzung, welche Herr Prof. Virchow auch meines Wissens nirgends gemacht hat. Ueberdies ist dieser berühmte und in allen medicinischen Wissenschaften, namentlich auch als Anthropolog sehr hoch stehende Gelehrte zur Zeit doch wohl noch zu wenig eigentlicher Archäolog, um die verschiedenen Gräberclassen sicher unterscheiden zu können. Erweisliche Mißgriffe sehr auffallender Art lassen dies Urtheil hoffentlich nicht als bloße Anmaßung erscheinen.
Ueberhaupt, meine Herren, hat die Verbindung der Anthropologie und der Archäologie in dem bereits sehr weit verbreiteten anthropologisch=historischen Vereine, meinem Urtheile nach, wenigstens der letzteren Wissenschaft noch keinen Segen gebracht. Die Teilung der Arbeit ist nicht bloß auf industriellem, sondern auch auf wissentlichem Gebiete zu empfehlen, wogegen sich in dem anthropologischen Vereine auf einem allzuweit ausgedehnten Forschungsgebiete schon jetzt die Richtung auf Centralisation zu Gunsten der größern Städte, namentlich Berlins, nach französischem Style mehr und mehr geltend macht, die mir in hohem Grade bedenklich erscheint. Aus diesen Gründen glaubte ich die kürzlich von Seiten des Vereinsvorstandes zu München an mich gerichtete Aufforderung zur Gründung eines Schweriner Localvereins ablehnen zu müssen, da das Bedürfniß dazu in Meklenburg neben unseren historischem Vereine nach meiner Ueberzeugung überall nicht vorhanden ist.
Nach dieser nothgedrungenen Abwehr verletzender Angriffe auf die Wirksamkeit unseres Vereins habe ich nur noch wenige Bemerkungen über die auch in diesem Jahre sehr bedeutenden und werthvollen Erweiterungen unserer Sammlungen in dem abgelaufenen Jahre hinzuzufügen. Die Alterthumssammlung erwarb nämlich mit Einschluß der in der Anlag Nr. 1. verzeichneten höchst wichtigen Funde des letzten Quartals, 30 einheimische Stücke aus der Steinzeit, 108 aus der Bronzezeit, 20 aus der Eisenzeit und 8 aus dem christlichen Mittelalter, wozu noch 46 Stücke größtentheils sehr wertvoller fremder Altertümer der Stein= und Bronzezeit kommen, welche dem Vereine aus Rügen, aus dem Magdeburgischen, von der Weser, aus Georgien und Lydien von seinen Freunden zugesandt wurden. - Die


|
Seite 12 |




|
Münzsammlung vergrößerte sich nur um 30 Nummern, worunter eine römische Silbermünze aus der Zeit der Republik, die älteste der ganzen Sammlung, 24 silberne und kupferne Scheidemünzen aus Meklenburg, Braunschweig, Dänemark u. s. w., sowie 4 neue deutsche Reichsmünzen. - Die Bildersammlung erwarb 4 Portraits (3 Photographien und 1 Kupferstich), 2 meklenburgische Ansichten (Photographien), 1 Blatt Umrisse meklenburgischer Kirchen, und 1 Karte. - Die Büchersammlung endlich ist wiederum um 195 Bände gewachsen, worunter 22 Meklenburgica, wozu noch 6 Handschriften kommen. Die Erwerbungen der Alterthümer=Sammlung und der Büchersammlung aus dem letzten Quartale von Ostern bis Johannis d. J. sind in den
verzeichnet. Die Erwerbungen der übrigen Sammlungen aus diesem Zeitraume sind zu unbedeutend, um sie besonders auszuführen.
Die
giebt den üblichen Auszug des Herrn Berechners, Ministerial=Secretairs Dr. Wedemeier, aus der Berechnung der Vereins=Casse vom 1. Juli 1874 bis 30. Juni 1875, welcher wiederum recht günstig lautet. Die Einnahme mit Ausschluß der erhobenen Capitalien und des Cassenvorraths ist gegen das Vorjahr von Mk. 1882,33 auf 1896,67, also um Mk. 14,35 gestiegen, was seinen Grund größten Theils der höhern Einnahme aus dem Verkauf unserer Druckschriften zuzuschreiben ist. Die Ausgabe dagegen mit Ausschluß der belegten Capitalien ist von 1759,22 auf 1731,93, also um 27,79 gefallen, was im Ganzen im Vergleich mit dem Vorjahre zu Gunsten des gegenwärtigen eine Differenz Mk. 42,14 macht. Das Vermögen des Vereins ist in diesem Jahre von 6884,83 auf 7048,57, also um 163,74 gestiegen.
Ebenso günstig lautet mein Bericht in Bezug auf den Wachsthum des Vereins an Mitgliederzahl. Es sind im Laufe dieses Jahres 16 ordentliche Mitglieder beigetreten, nämlich die Herren Organist Meier in Schönberg, Lieutenant Bahrfeldt in Bremen, Amtmann Schlettwein in Dömitz, Vicko v. d. Lühe auf Stormstorf, Pastor Bartholdi zu Zarrentin, v. Schack auf Brüsewitz, v. Schuckmann auf Gottesgabe, Dr. med. Schlettwein in Sternberg, Gutspächter F. Schlettwein zu Bandelstorf, Amtsauditor v. d. Lanken in Schwerin, Advocat Kortüm


|
Seite 13 |




|
in Rostock und in dem letzten Quartale die Herren Professor Ponfick in Rostock, Pensionair Peitzner zu Pogreß und Pastor Karsten in Röbel. Dagegen hat der Verein nur 10 ordentliche Mitglieder verloren, zur Hälfte durch den Tod, und zur andern Hälfte durch freiwilligen Austritt. Die letztern sind die Herrn Pastor emer. Türk in Güstrow, jetzt in Rostock, v. Schack auf Nustrow, v. Lützow aus Tessin, Dr. Schultze in Hamburg und Geh. Hofrath Flörcke in Parchim. Durch den Tod dagegen sind ausgeschieden die Herren Minister=Präsident J. v. Oertzen auf Leppin, Landbaumeister W. Wachenhusen in Rostock, Pastor Behm zu Vietlübbe, Medicinalrath Dr. Pfeiffer in Schwerin und neuerdings der Consistorialrath Friedrich Giesebrecht, Pastor und Präpositus zu Mirow, Sohn des Pastors Benjamin Giesebrecht daselbst und Zwillingsbruder unseres vieljährigen correspondirenden Mitgliedes, des ihm am 18. Mai 1873 voraufgegangenen Gymnasiallehrers Prof. Ludwig Giesebrecht in Stettin. Der schon im Jahre 1832 verstorbene Prof. Giesebrecht, Lehrer am grauen Kloster in Berlin und Vater des bekannten Historikers, Geh. Raths und Professors Dr. v. Giesebrecht in München, war gleichfalls ein älterer Bruder. Der Verstorbene, geboren am 5. Juli 1792, studirte 1813 in Berlin und machte, gleich seinem Bruder Ludwig, als Freiwilliger in dem Strelitzer Husarenregiment die Feldzüge gegen Frankreich mit. Im Jahre 1816 ward er seinen Vater adjungirt und nach dessen Tode 1817 als wirklicher Pastor zu Mirow bestellt, später zum Präpositus des Mirower Zirkels und im Jahre 1865, bei Niederlegung seines Amtes, zum Consistorialrath ernannt. Als Schriftsteller hat er sich durch Veröffentlichung mehrer Gelegenheits=Predigten und theologischer Abhandlungen, sowie einer Sammlung geistlicher Lieder (1821) und besonders geistlicher Kriegslieder (1847) bekannt gemacht. Er war Mitglied unseres Vereins seit dem 15. Sptbr. 1835 und starb am 3. Mai 1875.
Von den correspondirenden Mitgliedern starben, wie bereits in den Quartalberichten vom Oktober v. J. und Januar d. J. angezeigt worden ist, der Landesgerichts=Rath Dr. Theodor Petranowich zu Zara in Dalmatien, der Geh. Obertribunals=Rath und Prof. Dr. Homeyer in Berlin, und der Geh. Archivrath Dr. Grotefend in Hannover, wogegen die Herren Director Pigorini in Parma, Dr. Oscar Montelius in Stockholm und Prof. Dr. Ottokar Lorenz in Wien die Güte hatten, ihre Ernennung zu correspondirenden Mitgliedern zu genehmigen. - Zu den mit


|
Seite 14 |




|
uns in Correspondenz und Schriftenaustausch stehenden Gesellschaften und Vereinen sind das archäologische Museum in Parma, die Akademie der Wissenschaften in Krakau in Gallizien und der Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Kahla in Altenburg hinzugetreten.
Der Verein zählte daher zur Zeit der Generalversammlung am 12. Juni d. J. 2 allerhöchste Protectoren, 6 hohe Beförderer, 3 Ehrenmitglieder, 121 correspondirende Gesellschaften, 57 correspondirende Mitglieder und 276 ordentliche Mitglieder. Endlich habe ich den Austritt des Herrn Justizraths v. Prollius aus dem Vereinsausschuß in Folge seiner Ernennung zum meklenburgischen außerordentlichen Gesandten und Minister in Berlin anzuzeigen, welcher den Verein seit einer Reihe von Jahren mit stets gleichem Interesse als Repräsentant vertrat. Statt seiner ward in der Generalversammlung der Herr Ministerialrath Burchard wiederum zum Repräsentanten gewählt, die übrigen Herren Repräsentanten und Beamten aber in ihrer Stellung bestätigt. Der Ausschuß besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:
| Präsident: | Herr Minister=Präsident Graf v. Bassewitz, Excellenz. |
| Vice=Präsident: | Herr Staatsrath Dr. Wetzell. |
| Erster Secretair: | Herr Geh. Archivrath Dr. Lisch. |
| Zweiter Secretair: | der Unterzeichnete. |
| Berechner: | Herr Ministerial=Secretair Dr. Wedemeier. |
| Bibliothekar: | Herr Oberlehrer Dr. Latendorf. |
| Repräsentanten: | die Herren |
| Prorector a. D. Reitz. | |
| Archivar Dr. Wigger. | |
| Revisionsrath Balck. | |
| Ministerialrath Burchard. |
Als Aufseher der Münz= und Bilder=Sammlung bleiben die Herren Masch und Architect Stern gleichfalls an ihrem Platze.
W. G. Beyer,
Dr. Archivrath,
zweiter Secretair des Vereins.


|
Seite 15 |




|
Anlage Nr. 1.
![]()
Verzeichniß
1) Aus der Steinzeit.
Drei Feuersteinspäne mit Schlagmarken von Menschenhand, vielleicht der ältesten Steinzeit angehörig nämlich eine größere dolchartige Spitze, 8 Centimeter lang, ein halbes dreiseitiges Messer und ein ähnliches kleineres und schmaleres Messer, 5 Centimeter lang, gefunden auf der Feldmark der Stadt Güstrow am Parumer See und geschenkt von dem Herrn Senator Beyer in Güstrow.
2) Aus der Bronzezeit.
Hundert Alterthümer, worunter 96 Bronzen, gefunden in einem Moderloche zu Hinzenhagen bei Krakow, geschenkt von dem Herrn Gutsinspector Schwager daselbst. S. Jahrbücher XL. S. 149 ff., wo sich bereits ein Verzeichniß dieser Alterthümer findet.
Ein Bronzemesser, unter altem, zum Einschmelzen angekauften Messing gefunden und dem Verein geschenkt von dem Herrn Gürtler Günther in Schwerin. S. Jahrbücher a. a. O. S. 149.
3) Aus der Eisenzeit.
Zwei Skelette und 10 Alterthümer aus Silber, Bronze, Bernstein, Thon u. s. w., gefunden in zwei neuentdeckten Römergräbern zu Häven und von dem Gutspächter Herrn Bastian daselbst an die großherzogliche Sammlung eingesandt. S. Jahrbücher a. a. O. S. 120 ff.
Drei Glasperlen, gefunden auf dem Burgwall bei Toitenwinkel und geschenkt von dem Herrn Dr. Wiechmann in Rostock.


|
Seite 16 |




|
Eine schwarze Urne und mehre Urnenscherben von einem sogenannten Wendenkirchhof bei Pogreß, ausgegraben und geschenkt von dem Herrn Pensionair Peitzner daselbst 1 ).
4) Aus dem christlichen Mittelalter.
Ein Richtschwert aus Eisen, dessen Spitze abgebrochen ist, aus einer ungenannten Stadt Meklenburgs stammend, und geschenkt von dem Herrn Dr. Crull in Wismar.
Ein hölzerner Auswurfsbecher, bemalt mit den Farben= und Greifen=Wappen der Stadt Rostock mit der Jahreszahl 1794, geschenkt von dem Herrn Ministerialrath Burchard in Schwerin.


|
Seite 17 |




|
Anlage Nr. 2.
![]()
Verzeichniß
(Von Ostern bis Johannis 1875.)
I. Amerika.
- Das Kaiserthum Brasilien im Jahre 1873. Rio de Janeiro. Druck von J. Paul Hildebrandt 1874. 8°. (Von unbekannter Hand aus Rio de Janeiro eingesandt, wahrscheinlich von dem deutschen Drucker.)
II. Niederlande.
- Overijsselsche Stad-Dijk-en Markeregten, d. I. Stadregten, st. I. Boeck van Regten der Stad Kampen. Dat gulden Boeck. Zwolle 1875. 8°.
- Vereeniging tot beoefening van overijsselsche Regt en. Geschiedenis. Verslag van de handelingen der 34. vergadering. Zwolle 1875. 8 °. (Nr. 2 und 3 Tauschexemplare des Ober=Ysselschen Vereins.)
III. Schweiz.
- Archiv für schweizerische Geschichte. Bd. 19. Zürich 1874. 8°. (Tauschexemplar der allgem. geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz in Bern.)
IV. Österreich.
- Archiv für österreichische Geschichte. Bd. 52. 1. Wien 1874. 8°.
- Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philos.=historische Classe. Bd. 77, Heft 1-4. Bd. 78, Heft 1. Wien 1874. 8°.
- Sitzungsberichte. Register zu den Bänden I-LXX von F. S. Scharler. Wien 1874. 8°. (Nr. 5-7 Tauschexemplare der genannten Akademie.)


|
Seite 18 |




|
- Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien Bd. V, Nr. 1-3. 1875. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Volkelt, Joh., Kant's kategorischer Imperativ und die Gegenwart. Wien 1875. 8°. (Tauschexemplar des Lesevereins der deutschen Studenten Wiens.)
- Mittheilungen des historischen Vereins für Steiermark. Heft 22. Graz 1874. 8°.
- Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen. Jahrg. 11. Graz 1874. 8°. (Nr. 10 und 11 Tauschexemplare des histor. Vereins zu Graz.)
- Carinthia, Jahrg. 63 und 64. Klagenfurt 1873 und 1874. 8°. (Tauschexemplar des kärnth. Geschichtsvereins.)
- Sitzungsberichte der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag. 1875. Nr. 1 und 2. (Tauschexemplar der gen. Gesellschaft.)
- Beiträge zur Kenntniß Sächsisch=Reems. Festgabe. (Hermannstadt) 1870. 8°.
- (Schochterus) Der siebenbürgisch=sächsische Bauer. Eine social=historische Skizze. Hermannstadt 1873. 8°.
- Baumann, Ferd., Geschichte der terra Siculorum terrae Sebus des Andreanischen Freibriefs oder des adligen Gutes Gießhübel bei Mühlbach, s. a. 4°.
- Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Bd. XI, Heft 3. Bd. XII, Heft 1. Hermannstadt 1874. 8°.
- Jahresbericht des Vereins für siebenbürgische Landeskunde für das Vereinsjahr 1873/74. Hermannstadt. 8°.
- Programm des Gymnasiums A. C. zu Hermannstadt für das Schuljahr 1873/74 (Inhalt: M. Schuster. Ein Beitrag zur Statistik des evang. Gymnasiums.) Hermannstadt 1874. 4°.
- Programm des evang. Gymnasiums in Schässburg. Hermannstadt 1874. 8°. (Inhalt: C. Gooß. Studien zur Geographie und Geschichte des Trajanischen Daciens.) (Nr. 14-20 Tauschexemplare des siebenb. Vereins)
V. Allgemeine deutsche Sprache Geschichte und Alterthumskunde.
- Schiller, K. und Lübben, A. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bd. II, Heft 3. Bremen 1875. hoch 8°. (Angekauft.)


|
Seite 19 |




|
- v. Sybel, H. Historische Zeitschrift. Bd. 29 und 30. München 1873. 8°. (Von einem Leseverein angekauft.)
- Correspondenzblatt des Gesammtvereins der deutschen Geschichts= und Alterthumsvereine. 23. Jahrg. 1875. Heft 2. 3. 4. (Zwei Exemplare.)
- Literarischer Handweiser, zunächst für das kathol. Deutschland. Jahrg. 1875. Nr. 4-7. (Tauschexemplar von der Redaction.)
VI. Baiern.
- Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München. 1875. Bd. I, Heft 1. (Tauschexemplar der gen. Akademie.)
- Die Wartburg. Organ des Münchener Alterthumsvereins. 1874. Nr. 10-12. 1875. Nr. 1. (Geschenk des betr. Vereins.)
- Bericht 36 über den Stand und das Wirken des histor. Vereins für Oberfranken zu Bamberg. Bamberg 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. 30. Stadtamhof 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Verzeichniß über die Verhandlungen des historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg. Bd. I-XXX. Stadtamhof 1874. 8°.
- Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. Bd. 23, Heft 1. Würzburg 1875. 8°.
VII. Sachsen.
- Zweiter Bericht des Museums für Völkerkunde in Leipzig. 1874. 8°. (Tauschexemplar des betr. Museums.)
VIII. Herzogthum Sachsen=Altenburg.
- Mittheilungen des Vereins für Geschichts= und Alterthumskunde zu Kahla. (Heft 2 unter dem Separattitel: V. Lommer. Regesten und Jahrbücher der Stadt Orlamünde.) Kahla 1871-1874. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
IX. Preußen.
- Jahresberichte I-VI des historischen Vereins zu Brandenburg a. d. H. Brandenburg 1870-1874. (Geschenk des betr. Vereins.)


|
Seite 20 |




|
- Schriften des Vereins für die Geschichte der Stadt Berlin. Heft XI. Berlin 1874. 8°.
- Verein für die Geschichte Berlins. Nr. 8. Januar 1875.
- Berlinische Chronik nebst Urkundenbuch. Liefg. 12. Berlin 1875. (Nr. 34-36 Tauschexemplare des Berliner Vereins.)
- Altpreußische Monatsschrift. Bd. 12, Heft 2 und 3. Königsberg 1875. 8°. (Tauschexemplar der Alterthumsgesellschaft Prussia.)
- Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands. Jahrg. 1873 und 74. Bd. V, Heft 3 und 4. Braunsberg und Leipzig 1874. 8°.
- Monumenta historiae Warmiensis. Bd. V. Braunsberg und Leipzig 1874. 8°. (Mit Nr. 38 Tauschexemplare des ermländischen Vereins.)
- Geschichts=Blätter für Stadt und Land Magdeburg. Jahrg. 10. Heft 1. Magdeburg 1875. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Bd. 25, Heft 2. Stettin 1875. 8°. (Tauschexemplar der betr. Gesellschaft.)
- Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Bd. XII, Heft 1 und 2. Breslau 1874. 1875. 8°.
- Scriptores rerum Silesiacarum. Bd. IX. Breslau 4. 4°.
- Regesten zur schlesischen Geschichte. Vom Jahre 1259 bis 1280. Breslau 1875. 8°. (Nr. 42-44 Tauschexemplare des betr. Vereins.)
- Mittheilungen des historischen Vereins zu Osnabrück. Bd. 10. Osnabrück 1875. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Archiv des Vereins für Geschichte und Alterthümer der Herzogthümer Bremen und Verden und des Landes Hadeln zu Stade. Heft 5. Stade 1875. 8°. (Tauschexemplar des betr. Vereins.)
- Duncker, Alb. Friedrich Rückert als Professor am Gymnasium zu Hanau. Hanau 1874. 8°.
- Verzeichniß der Mitglieder des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Cassel 1874 und 1875. 8°.


|
Seite 21 |




|
- Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge. Bd. 4, Heft 3 und 4. Bd. 5, Heft 1- 4. Cassel 1873 - 1874. 8°. (Nr. 47-49 Tauschexemplare des Casseler Vereins.)
X. Hansestädte.
- Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Thl. V, Liefg. 1. Lübeck 1875. 4°.
- Bericht des Vereins für lübeckische Geschichte und Alterthumskunde über das Jahr 1873. (Nr. 50 und 51 Tauschexemplare des Lübeck. Vereins.)
XI. Meklenburg.
- Donath, L. Geschichte der Juden in Mecklenburg. Leipzig 1874. 8°. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
- Latendorf, Fr. Lehrer und Abiturienten des Fridericianums in Schwerin von 1834-1874. Ein Beitrag zur Statistik und Culturgeschichte aus Mecklenburg. Schwerin 1875. 4°. (Geschenk des Verf.)
- Programm des Gymnasiums zu Parchim (Inhalt: Scholle, M. Ueber Zuverlässigkeit mathematischer Bestimmungen bei dem Gestalten=Bildungsproceß der Pflanzen.) 1875. 4°. (Geschenk des Herrn Director Dr. Hense.)
- Programm des Gymnasiums zu Rostock (Inhalt: Krause. Aus dem Todtenbuche des St. Johannis=Klosters vom Predigerorden zu Rostock. Bruchstück eines Kalendarii des Johannis=Klosters und niederdeutscher Cisiojanus des Konrad Gesselen. Zur Geschichte der ersten Jahre der Universität Rostock.) 1875. 4°.
- Gratulationsschrift des Rost. Gymnasiums zum Doctor=Jubiläum des Prof. Fr. V. Fritzsche 17. Febr. 1875. (Inhalt: Abdruck und Erläuterung eines lat. Spottgedichts auf Rostocker Geistliche nach einer Handschrift der Rostocker Universitäts=Bibliothek vom Jahre 1561 circ.) (Mit Nr. 55 Geschenk des Herrn Director Krause.)
- Programm des (Gynmasiums zu Güstrow. (Inhalt: Kretschmann. Die Kämpfe zwischen Heraclius I. und Chosroes II. Thl. I.) 1875. (Geschenk des Herrn Director Dr. Raspe.)


|
Seite 22 |




|
- Programm der Realschule I. Ordnung zu Schwerin. 1875. (Inhalt: Lindig. Die öffentlichen Brunnen Schwerins, chemisch untersucht.) (Geschenk des Herrn Director Giseke.)
- Programm des Gymnasiums zu Schwerin. (Inhalt: v. Starck. Ueber Leben und Schriften des Johann Agricola, und Latendorf: die Lehrer und die Abiturienten des Fridericianums von 1834-1874. Ein Beitrag zur Schulstatistik.) 1875. (Geschenk des Herrn Director Dr. Büchner.)
Fr. Latendorf,
Dr., Oberlehrer,
als Bibliothekar des Vereins.


|
Seite 23 |




|
Anlage Nr. 3.
![]()
Auszug
Aus der Berechnung der Vereins-Casse vom 1. Juli 1874 bis zum 30. Juni 1875.
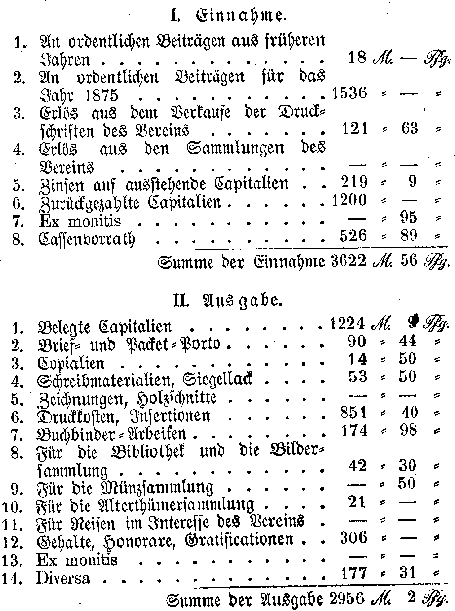


|
Seite 24 |




|
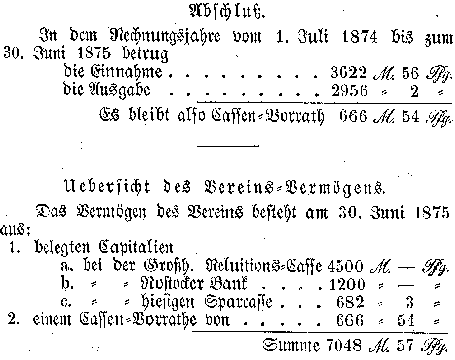
Schwerin, den 30. Juni 1875.
F. Wedemeier, Dr., Ministerial=Secretair,
z. Z. Cassen-Berechner.