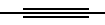|




|


|
|
|
-
Jahrbücher für Geschichte, Band 91, 1927
- Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg
- Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht
- Die Lage der Travemünder Reede
- Die alte Herzogsburg in Neustadt
- August Achilles : ein Künstler der alten Zeit
- Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar
- Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg
- Fanny Tarnow : eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/1927
- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1926 bis 30. Juni 1927 : Schwerin, 1. Juli 1927
Jahrbücher
des
Vereins für mecklenburgische Geschichte
und Altertumskunde,
gegründet von Friedrich Lisch,
fortgesetzt
von Friedrich Wigger und Hermann Grotefend.
Einundneunzigster Jahrgang.
herausgegeben vonStaatsarchivdirektor Dr. F. Stuhr,
als 1. Sekretär des Vereins.Mit angehängtem Jahresbericht.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Schwerin, 1927.
Druck und Vertrieb der
Bärensprungschen Hofbuchdruckerei.
Vertreter: K. F. Koehler, Leipzig.


|




|


|




|
Inhalt des Jahrbuchs.
| Seite | ||
| I. | Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg. Ein Vortrag von Professor Dr. Hermann Krabbo - Berlin | 1 |
| II. | Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 19 |
| III. | Die Lage der Travemünder Reede. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 69 |
| IV. | Die alte Herzogsburg in Neustadt. Von Oberbaurat Adolf Friedrich Lorenz - Schwerin | 123 |
| V. | August Achilles, ein Künstler der alten Zeit. Von Anna Marie Freiin v. Langermann und Erlencamp - Schwerin | 137 |
| VI. | Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar. Von Archivrat Dr. Friedrich Techen - Wismar | 153 |
| VII. | Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg. Von Professor Dr. Robert Beltz - Schwerin | 249 |
| VIII. | Fanny Tarnow, eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen. Von Professor Dr. Adolf Thimme - Göttingen | 257 |
| IX. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/27. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 279 |
| Jahresbericht (mit Anlagen A und B) | 289 | |
| Mitgliederverzeichnis nach dem Stande vom 1. Januar 1928 | 295 | |
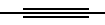


|




|


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Der Übergang des Landes Stargard von Brandenburg auf Mecklenburg
- Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse in der Travemünder Bucht
- Die Lage der Travemünder Reede
- Die alte Herzogsburg in Neustadt
- August Achilles : ein Künstler der alten Zeit
- Das Haus zum Heiligen Geiste zu Wismar
- Die wendischen Schatzfunde aus Mecklenburg
- Fanny Tarnow : eine Skizze ihres Lebens nach neu erschlossenen Quellen
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1926/1927



|


|
|
:
|
I.
Der Übergang
des Landes Stargard
von
Brandenburg auf Mecklenburg.
Ein Vortrag
von
Hermann Krabbo.
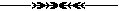


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|
K ein ostdeutsches Territorium hat so viel Gewinn aus der ostdeutschen Kolonisation zu ziehen gewußt, wie die Mark Brandenburg. Im Jahre 1227 war durch die Schlacht bei Bornhöved die Macht des dänischen Königs Waldemar II., des Siegers, gebrochen worden, der bisher die deutsche Ostseeküste von Holstein über Mecklenburg bis Pommern beherrscht und den Deutschen erfolgreich den Weg zur Ostsee gesperrt hatte. Die Pommernherzöge waren seine Lehnsleute gewesen; namentlich auf ihre Kosten haben in den nächsten Jahrzehnten die Markgrafen Johann I. und Otto III., die damals gemeinsam und tatkräftig die Regierung der Mark führten, ihr Land geweitet. In den wenigen Jahren zwischen 1230 und 1236 haben sie den Pommern nacheinander abgenommen den Teltow, den Barnim, die südliche Ukermark bis zur Welse und schließlich das Land Stargard. Letztere Landschaft, die etwa dem Hauptteil des heutigen Mecklenburg-Strelitz entspricht, ging 1236 durch Vertrag an Brandenburg über. Städte waren damals noch nicht im Lande Stargard vorhanden; sie erwuchsen jetzt aber rasch; namentlich der als Städtegründer erprobte Markgraf Johann I. nahm sich nach dieser Richtung des Landes Stargard an. Er hat 1244 hart an der nunmehrigen Grenze gegen Pommern die Stadt Friedland gegründet, diesmal zusammen mit seinem Bruder Otto III.; und die Stadt hat das Gedächtnis der askanischen Brüder auch zu Zeiten, wo sie längst mecklenburgisch geworden war, pietätvoll gewahrt, indem sie im Stadtsiegel auch fernerhin die Bilder der beiden Markgrafen, zwischen denen der brandenburgische Adlerschild abgebildet war, führte. Vier Jahre später, 1248, gründete Johann I. die Stadt Neubrandenburg; der stolze Name ebenso wie die großartige Anlage zeigen, daß der Markgraf diesmal der Welt zeigen wollte, was das aufstrebende Brandenburg in der ostdeutschen Kolonialwelt vermochte. Auch diese Stadt hat, wie durch ihren Namen, so durch ihr Wappen, das den brandenburgischen Adlerhelm über der Stadtmauer zeigt, die Erinnerung an den Gründer wachgehalten.


|
Seite 4 |




|
Als im Jahre 1258 die brandenburgischen Brüder ihre Lande unter sich teilten, kam Land Stargard an Otto III. Der hat im Jahre darauf Stargard zur Stadt erhoben und diese Landschaft gemeinsam mit seinen übrigen Besitzungen 1267 sterbend seinen Söhnen hinterlassen. Es darf gleich hier erwähnt werden, das sicher noch eine vierte Stadt im Lande der askanischen Frühzeit entstammt, nämlich Woldegk. Das Gründungsjahr ist unbekannt; sicher bestand die Stadt 1298; auch sie hat in späterer, mecklenburgischer Zeit im Siegelbild, einem Baum mit dem brandenburgischen Adlerschild darüber, die Erinnerung an die älteste Landesherrschaft festgehalten. Vertreter derselben waren, wie bemerkt, nach dem Tode Ottos III. dessen gemeinsam regierende Söhne; seit 1280 führten ihrer drei zusammen das Regiment, Otto V., Albrecht III. und Otto VI. Der älteste von ihnen, Otto V., der Lange, hat 1278 die Grenzen des Landes geweitet, indem er den Herren von Werle Wesenberg abnahm; dieses war damals schon Stadt, nach Schweriner Recht gegründet, das der Markgraf den Bürgern bestätigte. Zeigte sich Otto V. hier wie auch sonst als ein kriegerischer Fürst, so waren seine beiden Brüder je länger um so stärker von weltflüchtigen, asketischen Gedanken beherrscht, hierin echte Kinder Ottos III., der seinerseits bereits stark unter dem Einfluß der Dominikaner gestanden hatte. Von seinen Söhnen interessiert uns namentlich Albrecht III. Dieser nämlich trennte sich 1284 von seinen beiden Brüdern, Otto dem Langen und Otto dem Jüngeren, und ließ sich aus dem vom Vater ererbten Gebiet ein Drittel aussondern, das er fortab allein verwaltete; Reibungen mit dem ihn an Tatkraft weit überragenden älteren Bruder mögen ihn zu diesem Schritt veranlaßt haben. Das nunmehrige Sondergebiet Markgraf Albrechts III. umfaßte Teile des Barnim mit Strausberg und Eberswalde, östlich der Oder Gebiete nördlich der Warthelinie mit Bärwalde, Landsberg und Soldin, und endlich, was uns hier angeht, das Land Stargard, das von den übrigen Besitzungen des Markgrafen also weit ablag.
Wir müssen uns mit der Person des nunmehrigen alleinigen Landesherrn von Stargard etwas näher beschäftigen. Markgraf Albrecht III. war seit 1269 mit Mechtild, einer Tochter König Christophs von Dänemark, vermählt; die Ehe war mit vier Kindern gesegnet, zwei Söhnen und zwei Töchtern. Die beiden Söhne Otto und Johann, auch Henning genannt, sind vor dem Vater gestorben; Ende 1299 waren sie beide tot; die Töchter aber, Beatrix und Margarete, haben ihn überlebt. Namentlich die ältere der beiden wird uns noch näher angehen. In jüngeren Jahren hat


|
Seite 5 |




|
Albrecht III., damals noch mit seinem Bruder Otto dem Langen zusammen regierend, gelegentlich das Schwert geführt, ohne jedoch im Kampfe Lorbeeren zu ernten; 1279 beteiligte er sich als Verbündeter der Magdeburger an einer Fehde, die ihm wenig Ehre einbrachte. Als sein Aufgebot nämlich im Braunschweigischen lagerte, brach in dessen Reihen nachts eine Panik aus auf die Kunde, daß die Gegner, die beiden waffengewaltigen Fürsten Albrecht der Große von Braunschweig und Otto mit dem Pfeil von Brandenburg, im Anzuge seien. Sehr ergötzlich erzählt da die braunschweigische Reimchronik, wie Markgraf Albrecht in dem nächtlichen Durcheinander sich mit beiden Händen auf einen Ritter stützte, wohl um sich die Eisenhosen anziehen zu lassen, und wie dann dieser Ritter umgerannt wurde und hinfiel und der Markgraf natürlich mit ihm. Jene Zeit verlangte von einem Fürsten in erster Linie die Eigenschaften eines Ritters, und nach dieser Richtung versagte Albrecht offenbar völlig; er war im Felde eine komische Figur. So darf es nicht auffallen, daß er, seit er sich von seinen Brüdern getrennt hatte, ein beschauliches Leben führte und eigentlich nur für die Kirche und ihre Vertreter Interesse an den Tag legte. Namentlich in seinen letzten Lebensjahren, als ihm die beiden Söhne und die Gattin wegstarben, hat er mit vollen Händen sein Gut an die Kirche - man ist geneigt, zu sagen - verschleudert. 1298 gründete er zu Soldin in der Neumark ein Domstift mit reicher Ausstattung an Grundbesitz und sonstigen Rechten; im gleichen Jahr empfing das Cisterziensernonnenkloster Wanzka, das er selbst schon früher im Lande Stargard errichtet hatte, eine Jahresrente von 100 Talenten aus landesherrlichen Einkünften. 1299 wurde zunächst das Dominikanerkloster in Strausberg, in dem sein Vater beigesetzt war, bedacht, ferner das Cisterzienserkloster Himmelpfort mit wiederum reicher Ausstattung gegründet und schließlich dem Cisterzienserkloster Semmritz eine Zuwendung gemacht. In seinem Todesjahr 1300 endlich wurde eine Kirche in Zerbst beschenkt, dann abermals ein Cisterzienserkloster zu Himmelstädt in der Neumark gestiftet, und zwar mit unerhört reichem Grundbesitz - die Stiftungsurkunde nennt außer sonstigen Rechten allein 15 Dörfer, einen Hof, 12 ganze und 4 halbe Seen. Dann bekam das Cisterziensernonnenkloster Bernstein in der Neumark, auch dieses eine frühere Stiftung des frommen Markgrafen, ein Dorf, weiter wurden in der Pfarrkirche der Stadt Eberswalde, in deren Mauern der Markgraf seine letzten Tage verbrachte, mehrere Altäre gestiftet und dotiert, und schließlich wurde den Cisterziensernonnen in Friedland bei Wrietzen in


|
Seite 6 |




|
der Mark ein zusammenfassendes Privilegium erteilt. Dies alles in drei Jahren; ich habe die Liste absichtlich nicht weiter ausgedehnt, um nicht zu ermüden. Wenn die Neugründungen Himmelpfort und Himmelstädt heißen, so beweisen diese Namen, in welche Richtung die Gedanken des frommen Markgrafen sich in seinen letzten Jahren bewegten.
Ich darf nochmals zu den Kindern des Markgrafen zurückkehren; seine beiden Töchter überlebten ihn, wie bemerkt. Die ältere, Beatrix, ist am 11. August 1292 zu Neubrandenburg die Gattin Heinrichs II., des Löwen, von Mecklenburg geworden; sie hat bis zu ihrem Tode im Jahre 1314 in glücklicher Ehe mit ihm gelebt. Sehr viel abenteuerlicher sind die Geschicke ihrer jüngeren Schwester Margarete gewesen; ihr erster Gatte war Przemysl II., Herzog und seit 1295 König von Polen. Das Verhältnis der Ehegatten war nicht gut, denn als der König 1296 ermordet wurde, zieh man seine Gattin der Mitschuld an dieser Untat. Trotzdem fand sich bald ein neuer Bewerber um ihre Hand in der Person des Herrn Nikolaus von Rostock; es war Heinrich von Mecklenburg gewesen, der seinen Rostocker Vetter auf seine Schwägerin hingewiesen hatte. Aber Herr Nikolaus besann sich bald eines anderen und heiratete eine pommersche Herzogstochter. Es ist bezeichnend für den tatenscheuen, weltflüchtigen Markgrafen Albrecht, daß er sich selbst jetzt, wo seiner Tochter doch schwerste Schmach angetan war, nicht aufraffte, die Beleidigung zu rächen. Anders als er aber dachten die übrigen Markgrafen von Brandenburg: Albrechts Vetter, der waffengewaltige Otto mit dem Pfeil und sein Neffe, Markgraf Hermann, brachen sofort zu Ende 1299 trotz strengster Kälte zu einem Vergeltungszuge gegen Nikolaus von Rostock auf und mit ihnen Heinrich von Mecklenburg; auch er war persönlich aufs schwerste gekränkt, weil er doch dem ungetreuen Bräutigam seine Schwägerin Margarete empfohlen hatte. Nur mit schweren Opfern hat Rostock schließlich den Abzug der Brandenburger und ihrer Helfer erkauft. Nebenbei bemerke ich, daß die Markgräfin Margarete, die, wie es hieß, bei der Ermordung des ersten Gatten die Hand im Spiele gehabt und für die der nächstfolgende Verlobte gedankt hatte, in der Tat eine mit Vorsicht zu genießende Dame war: sie hat später den Herzog von Sachsen-Lauenburg geheiratet, und ein lübischer Chronist bemerkt dazu nur, diese Ehe habe dem Lande ihres neuen Gatten nicht zum Segen gereicht.
Wir müssen nochmals zu dem Rachezug gegen Nikolaus von Rostock zurückkehren. Eben aus den Tagen, da er stattfand, liegt


|
Seite 7 |




|
das erste Zeugnis vor, daß Markgraf Albrecht dem Mecklenburger die Verwaltung seines entlegenen Landes Stargard übertragen hatte, und zwar ist diese Übertragung in der Form der Belehnung erfolgt. Das Land blieb also ein Teil der Mark Brandenburg; als Lehnsmann des Schwiegervaters führte Heinrich fortab die Verwaltung von Land Stargard; er hat sich zudem zur Zahlung der erheblichen Geldsumme von 3000 Mark verpflichten müssen. Man wird den Schritt des Markgrafen verstehen: Söhne hatte er nicht mehr, der einzige Schwiegersohn aber trat eben damals tatkräftig für die Ehre des Hauses ein, dem seine Gattin entstammte. Trotzdem Stargard rechtlich ein Teil der Mark Brandenburg blieb, bestand seither die Gefahr, daß das Land mitsamt der stolzen Stadt Neubrandenburg seinem historischen Zusammenhang entfremdet wurde; es lag an der Grenze der mecklenburgischen Länder, und Herr Heinrich der Löwe war ein machthungriger, ehrgeiziger Fürst. Markgraf Albrecht hat das letzte Jahr seines Lebens, als Witwer wie ein Mönch lebend, verbracht; den Boden des Landes Stargard hat er, soviel wir wissen, nicht mehr betreten. Am 4. Dezember 1300 hat er die müden Augen geschlossen. Sein Erbe war sein Neffe Markgraf Hermann; er, der auch die Markgrafen Otto V. und Otto VI. beerbt hatte, vereinigte jetzt also wieder den ganzen Besitz der jüngeren askanischen Linie in seiner Hand; von ihm mußte nunmehr der Mecklenburger das Land Stargard zu Lehen nehmen. Aber Markgraf Hermann erkannte das von seinem Oheim Albrecht geschaffene Rechtsverhältnis nicht an, er beanspruchte die direkte Beherrschung des Landes Stargard als eines Teiles der ihm durch Albrechts Tod zugefallenen Erbschaft. Es wäre darüber wohl über kurz oder lang zu einem Kriege gekommen, wenn nicht der Fall eingetreten wäre, daß die Askanier der Hilfe des Mecklenburgers bedurft hätten. Sie waren nämlich in schweren Konflikt mit dem deutschen König Albrecht geraten, gedachten diesen Streit im Bunde mit König Wenzel II. von Böhmen auszufechten und wünschten, sich dazu der Unterstützung des kriegskundigen Heinrich von Mecklenburg zu versichern. Unter diesen Umständen mußte Markgraf Hermann natürlich betreffs seines Anspruches auf Land Stargard einlenken. So ist es am 15. Januar 1304 zwischen ihm und dem Mecklenburger zu dem feierlichen Vertrag von Vietmannsdorf bei Templin gekommen; der Markgraf hat die betreffenden Urkunden auch von seinen johanneischen Vettern mitsiegeln lassen, da die Zukunft des Landes Stargard eine das brandenburgische Gesamthaus berührende Frage war. Wir erfahren aus dem Vietmannsdorfer Vertrag zunächst, daß Heinrich die Summe, die er seinem


|
Seite 8 |




|
Schwiegervater schuldete, noch nicht beglichen hatte; jetzt wurde sie auf 5000 Mark erhöht, und die Termine, innerhalb deren das Geld abzuzahlen war, wurden genau festgesetzt. Dafür erkannten die Markgrafen an, daß Stargard in der Hand Heinrichs blieb; es galt nunmehr als ein Lehn, das er von Markgraf Hermann trug, und als Leibgedinge von Heinrichs Gattin, der brandenburgischen Beatrix; auch das Erbrecht von deren Kindern wurde in bezug aus den Lehnbesitz anerkannt, wogegen das Land, sofern sie erbenlos sterben sollten, natürlich an Brandenburg zurückfallen sollte. Gleichzeitig wurde ein Bündnis zwischen Heinrich von Mecklenburg und den Brandenburgern abgeschlossen.
Dieses Bündnis trat bald genug in Kraft, als eben der drohende Krieg zwischen König Albrecht und den Markgrafen wirklich ausbrach. Als diese ins Feld rückten, leistete ihnen Herr Heinrich mit 400 Rittern und Knappen Zuzug. Als Lehnsmann wäre er nur verpflichtet gewesen, seine Stargarder Vasallen aufzubieten; unter den 400 Berittenen werden aber - das macht die Größe seiner Streitmacht wahrscheinlich - wohl auch Mecklenburger gewesen sein, die er den Markgrafen auf Grund des Bündnisses zuführte; er konnte es um so eher, als der Böhmenkönig, zu dessen Unterstützung die ganze Schar ins Feld zog, dem Mecklenburger reichlichen Sold für sein Aufgebot in Aussicht gestellt hatte. Führer der Brandenburger waren die waffenkundigen Markgrafen Otto mit dem Pfeil und Hermann, dieselben, die 1299 mit Heinrich zusammen den Rachezug gegen Rostock unternommen hatten, dazu Ottos Neffe Markgraf Waldemar. Der böhmische Feldzug im Oktober 1304 verlief ohne größere Kämpfe, obwohl auf beiden Seiten starke Streitkräfte aufgeboten waren. Die Heere beobachteten sich gegenseitig einige Tage; bei den Hin- und Hermärschen, die damit verbunden waren, soll Herr Heinrich sich durch besonderen Wagemut ausgezeichnet haben. Dann mußte König Albrechts Heer, in dem wegen der herrschenden Kälte Mangel ausbrach, den Rückzug antreten, und König Wenzel konnte nunmehr seine Verbündeten wieder entlassen; Heinrich von Mecklenburg erhielt vom Böhmenkönig einen Sold von 1000 Schock Prager Groschen; er verwendete das Geld, um die Summe, die er für den Lehnsbesitz des Landes Stargard an seinen Lehnsherrn zahlen mußte, voll abzutragen; erst jetzt also konnte er sich als im gesicherten Lehnsbesitz seiner neuen Erwerbung befindlich betrachten.
An dieser Rechtslage änderte sich nichts, als sein Lehnsherr, Markgraf Hermann, am 1. Februar 1308 starb. Er hinterließ einen Sohn, Johann V. von Brandenburg, und für ihn, der erst knapp


|
Seite 9 |




|
sechs Jahre alt war, führte Markgraf Waldemar die Vormundschaft. Er hatte also jetzt die lehnsherrlichen Rechte über das Land Stargard wahrzunehmen. Da er und Heinrich von Mecklenburg, die Waffengenossen im böhmischen Feldzug von 1304 gewesen waren, sich gut miteinander standen, so blieb ihr Verhältnis auch jetzt ungetrübt; zudem pflegte Heinrichs brandenburgische Gemahlin, Frau Beatrix, nach wie vor freundnachbarliche Beziehungen zwischen ihrem Gatten und ihrer Heimat. Beide aber, Waldemar von Brandenburg und Heinrich von Mecklenburg, gerieten eben in diesen Jahren in steigende Abhängigkeit von König Erich II. Menved von Dänemark, der das alte Ziel seines Vorfahren, König Waldemars II., erfolgreich wieder aufgenommen hatte und nach der Beherrschung der deutschen Ostseeküste strebte. Ein erster Schritt war ihm bereits 1300 gelungen: damals hatte Herr Nikolaus von Rostock, der in dauernder Angst vor den Markgrafen lebte, seit er seine brandenburgische Braut hatte sitzen lassen, sein Land dem Dänenkönig als Lehen aufgelassen. Zudem taten die deutschen Ostseestädte ein übriges, durch ihr selbstbewußtes Auftreten die Fürsten zu engstem Zusammenschluß zu bringen; es bereitete sich ein Waffengang zwischen dem werdenden Hansebund der Städte einerseits und den Fürsten, die die reichen Städte ihren Territorien straffer eingliedern wollten, andererseits vor, und König Erich, der als Lehnsherr des Landes Rostock an diesen Dingen interessiert war, wünschte die Gelegenheit zu benutzen, seine Stellung an der deutschen Ostseeküste auszubauen. Der erste Zusammenstoß erfolgte zwischen Wismar und dem Mecklenburger. Dieser hatte die Hochzeit seiner Tochter Mechtild, dem einzigen großgewordenen Kinde aus seiner Ehe mit der Brandenburgerin, im Jahre 1310 zu Wismar feiern wollen; die Stadt aber hatte sich geweigert, die Hochzeitsgäste einzulassen - sie fürchtete wohl wegen der Sicherheit der Stadt, wenn eine zahlreiche ritterliche Hochzeitsgesellschaft in ihr Aufenthalt nahm -, und das Fest mußte zu Sternberg stattfinden. Der beleidigte Heinrich sann natürlich auf Rache gegen die widerspenstige Stadt, die im übrigen den Zeitpunkt, dem Landesherrn die Türe zu weisen, sehr unpassend gewählt hatte. Im folgenden Sommer sollte zu Rostock ein riesiger Hoftag stattfinden, zu dem König Erich die gesamte Fürstenwelt des deutschen Nordostens eingeladen hatte und woselbst Markgraf Waldemar samt 99 Adeligen die Ritterwürde empfangen sollte. Aber auch hier machte die Stadt einen Strich durch die Rechnung, indem sie sich für die ihr zugedachte Ehre bedankte. Sie ließ zwar König Erich in ihre Mauern ein, als er vor Beginn des Festes erschien,


|
Seite 10 |




|
sie ließ ihn aber gleichzeitig wissen, daß sie vor den in Aussicht stehenden Massen der Festteilnehmer ihre Tore schließen werde. Es war dem Dänenkönig nichts übrig geblieben, als die Stadt wieder zu verlassen; das Fest hat dann mit unerhörtem Prunk bei Gehlsdorf, jenseits der Warnow, stattgefunden. Genau wie Wismar den Mecklenburger, so hatte Rostock den Dänen und den Brandenburger schwer gekränkt; gemeinsam sind die drei, nachdem Heinrich allein Wismar unterworfen hatte, daran gegangen, den Trotz Rostocks zu brechen, was erst nach mehr als Jahresfrist gelang. Auch hier also fochten Markgraf Waldemar und Herr Heinrich Schulter an Schulter. Dann aber begann sich ihr Verhältnis zu trüben, und falls es nun etwa dazu kam, daß sie die Waffen widereinander kehrten, mußte auch die bisherige Rechtslage des Landes Stargard kritisch werden; denn Heinrich trug es zu Lehen, Waldemar aber vertrat als Vormund den kleinen Markgrafen Johann als Lehnsherrn. Die Entfremdung zwischen Waldemar von Brandenburg und Heinrich von Mecklenburg trat dadurch ein, daß König Erich von Dänemark jetzt seine Großmachtpläne auch auf Pommern ausdehnte. Dem Mecklenburger konnte es ganz recht sein, wenn Erichs Macht weiter wuchs; denn dieser, der natürlich immer nur vorübergehend an der deutschen Ostseeküste erscheinen konnte, hatte den kriegskundigen Heinrich zu seinem Statthalter und Feldhauptmann bestellt; je mächtiger der König selbst wurde, um so mehr hob sich auch die Stellung seines deutschen Vertreters. Anders Waldemar: wenn der Däne nach Pommern übergriff, so griff er damit in den Machtkreis Brandenburgs ein, denn die Pommernherzöge trugen ihre Lande vom Markgrafen zu Lehen; und wenn etwa der Däne Herr der Odermündung wurde, so konnte er der Mark einen Verkehrsweg unterbinden, auf dessen Freihaltung Waldemar mit Recht höchsten Wert legte. So rückten also jetzt Waldemar und seine pommerschen Lehnsleute von der dänischen Politik ab, und da Heinrich von Mecklenburg diese zu seiner eigenen gemacht hatte, so trat zwangsläufig zwischen ihm und Waldemar eine starke Entfremdung ein. Auch hier trug das selbstbewußte Auftreten einer Stadt zur Zuspitzung der Lage bei: Stralsund hatte sich mit seinem damaligen Landesherrn, dem Fürsten Wizlaw von Rügen, überworfen, und da der Fürst von Rügen sich als Lehnsmann König Erichs bekannte, so stellte die Stadt Stralsund sich nunmehr unter den Schutz des Markgrafen. Das bedeutete noch nicht den Bruch, den vielmehr beide Parteien noch hinauszuzögern trachteten, da weder der König noch der Markgraf zum Kriege gerüstet waren. So vergingen das Jahr 1314 und der Anfang des


|
Seite 11 |




|
folgenden Jahres in wachsender politischer Spannung; hüben und drüben wurden Bundesgenossen geworben. Es war sicher nicht ohne Bedeutung, daß eben in dieser Zeit die Gattin Heinrichs von Mecklenburg, die brandenburgische Beatrix, starb, am 22. September 1314. Ob sie den Bruch ihres Gatten mit Brandenburg verhindert hätte, bleibe dahingestellt; ihr Tod hat es jedenfalls dem Mecklenburger erleichtert, als Feldhauptmann des Königs gegen Brandenburg zu fechten. Zwar hat Heinrich von Mecklenburg noch unmittelbar nach dem Hinscheiden seiner Frau im Gefolge des Markgrafen einen Ritt nach Frankfurt am Main gemacht, wo im Oktober 1314 die bekannte deutsche Doppelwahl stattfand, aus der Ludwig der Bayer und Friedrich der Schöne hervorgingen. Dann aber schieden sich die Wege Waldemars und Heinrichs endgültig; ihr nächstes Zusammentreffen fand auf dem Schlachtfeld statt. Für den Krieg gegen Brandenburg hat König Erich erfolgreich in aller Welt Verbündete geworben: die Könige von Schweden, Norwegen und Ungarn, den Herzog von Polen, die russischen Großfürsten, dann in Norddeutschland die Herzöge Erich von Sachsen-Lauenburg und Otto von Lüneburg, die Fürsten von Rügen und Anhalt-Aschersleben, die Herren von Mecklenburg und Werle, die Grafen von Holstein und Schwerin, schließlich von Geistlichen den Erzbischof von Magdeburg und den Bischof von Schwerin. Haben auch manche der Verbündeten sich nachher nicht aktiv am Kampfe beteiligt, so war ihre Zahl doch immer beängstigend genug, und zu alledem hatte Waldemar gleichzeitig im Süden einen Kampf auf Tod und Leben gegen Markgraf Friedrich den Freidigen von Meißen auszufechten. Seine eigenen Verbündeten waren seine Verwandten, der kleine Markgraf Johann von Brandenburg, der im Sommer 1314 nach Sachsenrecht mit 12 Jahren mündig wurde, aber natürlich bei seinen jungen Jahren nach wie vor nur das tat, was sein bisheriger Vormund Waldemar verlangte. Zu Waldemar stand weiter sein Oheim, Markgraf Heinrich von Landsberg, der aber durch den Krieg gegen Meißen vollauf in Anspruch genommen war; dann seine Vasallen, die Herzöge von Pommern, schließlich die Städte Stralsund und Greifswald. Wennigstens zeitweise ist es ihm gelungen, auch Herrn Johann von Werle auf seine Seite herüberzuziehen. Von den umfangreichen Kämpfen der Jahre 1315 und 1316 gehen uns nur die an der brandenburgisch-mecklenburgischen Grenze sowie die vor Stralsund an. Das Kriegsziel König Erichs war die Befestigung seiner Macht in Pommern, namentlich. die Bezwingung des widerspenstigen Stralsund. Sein Feldhauptmann Heinrich von Mecklenburg hatte sich ihm gänz-


|
Seite 12 |




|
lich verschrieben; er hatte aber noch ein eigenes, besonderes Kriegsziel zu verfolgen, die Behauptung des Landes Stargard. Denn Waldemar hatte ihm, der sich jetzt anschickte, gegen seinen Lehnsherrn zu fechten, Land Stargard als Lehen abgesprochen; da der Lehnsmann es natürlich nicht gutwillig herausgab, so mußten die Märker es sich holen. Dies, die Rückeroberung des Landes Stargard, war das eine Kriegsziel der Brandendurger; das andere bestand in der Unterstützung der Stralsunder und in der Behauptung des märkischen Einflusses in Pommern.
Der Krieg begann Ende 1315 mit einem Angriff der Märker auf Land Stargard. Mit starkem Aufgebot, das sich in der Ukermark, wohl bei Prenzlau, gesammelt hatte, brach Waldemar los. Fürstenhagen, der erste Grenzplatz, wurde leicht überrannt, dann legte sich das Heer vor Woldegk, das sieben Wochen lang bestürmt wurde. Hier aber zeigte sich, wie so oft im Mittelalter, daß die damaligen Verteidigungsmittel den Angriffswaffen überlegen waren. Waldemar hat dem tapfer verteidigten Platz auf alle Weise beizukommen gesucht; tief unter der Erde lies er einen Stollen graben, um so ins Innere der Stadt zu gelangen; aber die Belagerten trieben oberhalb des gegnerischen Stollens einen Gegentunnel vor; dieser wurde von ihnen unter Wasser gesetzt, das dann in den tiefer liegenden märkischen Stollen durchbrach, so das dieser verschüttet wurde und seine Besatzung elendiglich unter der Erde umkam. Wir wissen zufällig, daß die eine Stadt Prenzlau im Dienste des Markgrafen Pferde im Werte von 100 Talenten vor Woldegk einbüßte; ebenso, daß die Stadt Königsberg (in der Neumark) allein anläßlich der Belagerung 40 Wispel Roggen und 50 Karren Bier im Werte von 180 Talenten liefern mußte. Nach schweren Verlusten an Gut und Blut gab Waldemar die Berennung von Woldegk auf. Verteidiger der Stadt war Martin von der Hude, der mecklenburgische Vogt von Stargard, gewesen. Das brandenburgische Aufgebot setzte trotz dieses Fehlschlages den Marsch ins Innere des Landes Stargard in nordwestlicher Richtung fort und erschien nach Durchquerung des Landes vor Neubrandenburg, wo Heinrich von Mecklenburg selbst kommandierte; auch hier scheiterte der Markgraf und verlor 30 Ritter an Gefangenen. Der Rückmarsch nach dem abgeschlagenen Angriff erfolgte in südlicher Richtung; bei Fürstensee, südöstlich von Strelitz, gelang es der mecklenburgischen Besatzung von Burg Stargard noch, den abziehenden Feinden 60 Ritter an Gefangenen abzunehmen. Die Eroberung des Landes Stargard war mißglückt. Das war im Winter 1315/16 gewesen.


|
Seite 13 |




|
Ich darf einschalten, daß unsere genaue Kenntnis über Einzelheiten dieses Krieges vornehmlich auf der unschätzbaren, leider immer noch einer würdigen Ausgabe harrenden mecklenburgischen Reimchronik des Ernst von Kirchberg beruht. Zwar verfaßte der Dichter diesen Teil seines Werkes erst rund zwei Menschenalter nach den Geschehnissen, doch verfügte er über Nachrichten, die sich im allgemeinen, soweit wir sie kontrollieren können, als zuverlässig erweisen, wenngleich er natürlich alles Licht auf seinen mecklenburgischen Helden, Herrn Heinrich den Löwen, fallen läßt. Daß er gelegentlich einmal ihm zuliebe die Dinge etwas verschiebt, werden wir noch feststellen können, wobei aber die Frage offen bleibt, ob solche Verdunkelung der wirklichen Vorgänge nicht schon vor ihm von seinen Gewährsleuten bewirkt worden ist.
Wir kehren zu den kriegerischen Ereignissen zurück, die wir bis zu dem ersten, erfolglosen Angriff Waldemars auf das Land Stargard verfolgt haben. Wie dieser Ansturm mehr den Eindruck eines ritterlichen Draufgehens als den systematischer Kriegsführung macht, so verlaufen auch die weiteren Geschehnisse ziemlich zusammenhanglos, wie zufällig. Unmittelbar nach den Zusammenstößen im Stargardischen flammte der Krieg in einem anderen Teile Mecklenburgs auf. Waldemar hatte, wie erwähnt, den Herrn Johann von Werle auf seine Seite herübergezogen. Gegen diesen wandte sich jetzt ein Aufgebot Heinrichs unter dem Ritter Bertold Preen, zu dem die Grafen Gerhard und Johann von Holstein sowie Heinrich von Schwerin gestoßen waren; der Zusammenstoß erfolgte bei Mölln westlich Neubrandenburg; er verlief glücklich für den Werler, und Graf Heinrich von Schwerin wurde sein Gefangener. Stürmisch jagten die Sieger den fliehenden Feinden nach; aber 7 km weiter westlich, bei Luplow an der oberen Peene, gelang es den Geschlagenen, sich zu neuem Streit zu stellen, und nun wandte sich das Blatt: Johann von Werle mit dreihundert seiner Leute fiel in Gefangenschaft, und die Sieger brachten ihre kostbare Beute, den Werler, noch am gleichen Tage nach Neubrandenburg, von wo ihn Heinrich sicherheitshalber erst nach Stargard, dann nach Sternberg in Westmecklenburg schaffen ließ. Da Waldemar im Augenblick nicht in der Lage war, etwas für die Befreiung seines Verbündeten zu tun, so hat sich Johann von Werle bald mit dem Bund seiner Feinde geeinigt: Am 23. März hat er seine Freiheit erkauft, indem er von der brandenburgischen Seite auf die dänisch-mecklenburgische zurücktrat und gleichzeitig seinen eigenen Gefangenen, den Schweriner Grafen, freigab. Also auch hier hatte das Kriegsglück gegen den Markgrafen entschieden. In denselben Tagen gelang


|
Seite 14 |




|
Herrn Heinrich die Eroberung der festen Eldenburg bei Lübz, die die Brandenburger 1308 an der damaligen Grenze der Prignitz errichtet hatten; auch Strohkirchen, ein ähnlicher märkischer Außenposten zwischen Ludwigslust und Hagenow, fiel ihm anheim. Ein zweiter Einfall, den eine brandenburgische Streifschar ins Land Stargard machte, gelangte zwar wiederum bis in dessen Herz, wurde aber dicht östlich der Stadt Stargard, bei Quastenberg und Dewitz, gebrochen. Den Mecklenburgern aber gelang im Juni die Eroberung von Meyenburg an der Grenze der Prignitz. Faßt man die bisherigen Ereignisse zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Die Brandenburger, die aufs Ganze gingen und Land Stargard erobern wollten, drangen zwar zweimal in stürmischem Anlauf tief in das Land ein; ihre Kräfte reichten aber nicht aus, die festen Plätze zu brechen und damit das im Fluge Gewonnene zu behaupten; die Mecklenburger aber, die sich in der Abwehr befanden, machten in den Kampfpausen kleine Grenzvorstöße und gewannen dabei einzelne feindliche Plätze, was Waldemar ihnen nicht wehren konnte, da er auch an anderen Grenzen seines ringsum bedrohten Landes zwischendurch erscheinen mußte.
Nunmehr aber, als es Sommer wurde, erschien ein neuer Hauptkämpfer auf dem Schauplatz, König Erich von Dänemark. Das Ziel seiner Wünsche bestand darin, in Pommern Fuß zu fassen; den Zugang zum Lande wollte er sich durch die Unterwerfung von Stralsund erkämpfen. Es war Waldemar und seinem Lehnsmann, Herzog Wartislaw von Pommern, rechtzeitig gelungen, ausreichende Streitkräfte in die bedrohte Stadt zu werfen, die nunmehr zu Wasser und zu Lande eingeschlossen wurde. Auf 60 Schiffen legten sich 2000 Dänen davor; König Erich selbst erschien bei seinen Truppen. Von seinen deutschen Gefolgsleuten waren Fürst Wizlaw von Rügen, Bischof Hermann von Schwerin, Herzog Erich von Sachsen-Lauenburg und sein getreuer Feldhauptmann Heinrich von Mecklenburg zur Stelle. Aber die Eingeschlossenen führten die Verteidigung mit Tatkraft und Glück; namentlich gelang es ihnen, sich die Verbindung mit der Außenwelt stets offen zu halten: bei einem Ausfall zur See glückte es den unternehmungslustigen Städtern, das Königsschiff Erichs von Dänemark in Brand zu stecken. Noch ergebnisreicher war ein Ausfall zu Lande, der in der Morgenfrühe des 21. Juni unternommen wurde: zu den Gefangenen, die die Städter einbrachten, zählte Herzog Erich von Lauenburg; sie lieferten ihn an Herzog Wartislaw von Pommern aus, der ihn seinerseits an Waldemar weitergab. Die Stadt "zu dem Sunde", wie sie damals genannt wurde,


|
Seite 15 |




|
ist ebenso unbezwungen aus dieser Belagerung hervorgegangen, wie 312 Jahre später, als der kriegsgewaltige Wallenstein vergeblich vor ihr lag.
Von Stralsund weg wandte sich der unermüdliche Heinrich von Mecklenburg einem neuen Einfall in die märkischen Grenzgebiete zu. Diesmal sollte das Ruppiner Land, das bisher unter dem Krieg noch nicht gelitten hatte und deshalb reiche Beute versprach, heimgesucht werden. Zusammen mit seinem nunmehrigen Verbündeten Johann von Werle machte er im August einen Zug über die Grenze; mit Raub und Plünderung suchten die beiden, deren Aufgebot 800 Berittene und viel Fußvolk umfaßte, das Land um Gransee heim. Sie befanden sich mit ihrer Beute bereits auf dem Rückmarsch zur Grenze, als Markgraf Waldemar sie zwischen Schulzendorf und Groß Woltersdorf ereilte. Er griff sofort an, obgleich er nur 500 Ritter zur Stelle hatte und sein Fußvolk noch nicht heran war; es mußte versucht werden, zu verhindern, daß die Mecklenburger ihre Beute ungestraft in Sicherheit brachten. So kam es zu einem erbitterten Kampfe. Aber die mecklenburgische Übermacht war zu groß; namentlich fiel ins Gewicht, daß ihnen allein Fußvolk zur Verfügung stand - diese Truppe fing eben damals an, beim Ausgang der Kämpfe entscheidend mitzuwirken. Die Fürsten selbst fochten in vorderster Reihe: Heinrich von Mecklenburg bekam einen schweren Axthieb über den Helm, der aber standhielt. Dem Markgrafen, der tief in den Haufen des feindlichen Fußvolks eingedrungen war, gingen im Getümmel Helm und Roß verloren; heftig setzte ihm Niclaus Schrapentroc, ein Bürger aus Grevesmühlen, zu; hier mag Waldemar die Wunde empfangen haben, deren tiefe Narbe, wie wir wissen, sein Antlitz zierte; als er am Erliegen war, griff der mecklenburgische Ritter Wedigo von Plate ein und entriß ihn den ihn umringenden Bauern, natürlich um ihn lebend zu fangen, was ihm Ruhm und Geld eingebracht hätte; das glückte ihm aber nicht, vielmehr befreite der Graf von Mansfeld den Markgrafen und verhalf ihm zu einem ledigen Rosse, geriet darüber freilich selbst in Gefangenschaft. Dies Los teilte neben manchen anderen auch der Graf von Wernigerode mit ihm. Ging Waldemar auch als Besiegter aus dieser Schlacht gegen die Übermacht hervor, so lächelte ihm doch trotz seiner Niederlage das Glück: Die Seinigen nämlich fingen den Grafen Hans von Holstein, einen Stiefbruder König Erichs von Dänemark, und fürstliche Gefangene, für die damals hohe Lösegelder gefordert und gezahlt wurden, waren beim Friedensschluß gute Faustpfänder. Waldemar besaß deren


|
Seite 16 |




|
aber zwei, neben dem Holsteiner den vor Stralsund gefangenen Herzog von Sachsen-Lauenburg. Wenn unser mecklenburgischer Gewährsmann Ernst von Kirchberg das Zahlenverhältnis umkehrt und behauptet, Heinrich der Löwe habe seinen Sieg gegen vierfache brandenburgische Übermacht errungen, so erweist er sich hier als ein echtes Kind des Mittelalters, das stets geneigt war, den Eindruck von Siegen dadurch noch zu steigern, daß sie als wunderbare Erfolge einer Minderheit dargestellt wurden, der Gottes Allmacht Stärke verliehen habe. Erst langsam setzte sich die nüchterne Vorstellung durch, daß - modern ausgedrückt - der liebe Gott es meistens mit der Partei hält, die über die stärksten Bataillone und die meisten Kanonen gebietet. Übrigens haben die Sieger ihren Waffenerfolg nicht weiter ausgenützt; sie zogen schleunigst mit ihrer Beute über die nahe Grenze ab.
Die Schlacht bei Gransee war die letzte größere Kampfhandlung dieses Krieges. Beide Hauptbeteiligte, Erich von Dänemark und Waldemar von Brandenburg, hatten schwere Opfer an Gut und Blut gebracht und waren deshalb geneigt, Frieden zu schließen. Für Heinrich von Mecklenburg lag kein Grund vor, das Ringen allein fortzusetzen; seinen Zweck, die Behauptung des Landes Stargard gegen den Markgrafen, hatte er voll erreicht. So hat man sich noch vor Ablauf des Jahres im Präliminarfrieden von Meyenburg geeinigt, dem 1317 der endgültige Abschluß zu Templin folgte. Unterdessen war der junge Markgraf Johann, der Lehnsherr des Landes Stargard, gestorben; sein Erbe war Markgraf Waldemar. Uns interessiert hier nur, was der Templiner Friede über das Land Stargard bestimmt; Waldemar erklärt in der Friedensurkunde: "wir haben dem Herrn von Mecklenburg den Besitz des Landes Stargard mit all dem Recht übertragen, mit dem er es von Markgraf Johann und seinen Vorfahren" - d. h. den Markgrafen Albrecht III. und Hermann - "hatte". Das Lehnsverhältnis blieb also nach wie vor bestehen. Heinrich von Mecklenburg hatte das Land behauptet dank seiner hervorragenden kriegerischen Tüchtigkeit, dank seinen zahlreichen Verbündeten und dank dem Umstande, daß Waldemar in jenen Kriegsjahren nicht nur an der mecklenburgischen Grenze sich seiner Haut zu wehren hatte, sondern gleichzeitig auch an anderen Fronten in schwere Kämpfe verstrickt war.
An sich hätte es nun in jener fehdelustigen Zeit durchaus im Bereich der Möglichkeit gelegen, daß es bald zu einem neuen Waffengang zwischen Brandenburg und Mecklenburg gekommen wäre; dann hätte Markgraf Waldemar seinem mecklenburgischen


|
Seite 17 |




|
Lehnsmann das Land Stargard erneut absprechen und dessen Wiedergewinnung nochmals und vielleicht unter günstigeren Bedingungen versuchen können. Aber es ist nicht dazu gekommen. Es war ein unerwarteter Glücksfall für Heinrich, daß Waldemar bereits im Jahre 1319 plötzlich kinderlos abschied. Im nächsten Jahre folgte ihm sein noch im Kindesalter stehender Vetter und Nachfolger Heinrich II. als letzter märkischer Askanier ins Grab, und nun begann für die Mark ein Zeitalter der Anarchie, in dem nicht daran gedacht werden konnte, die Stargarder Frage erneut anzuschneiden; immerhin blieb die Rechtslage die gleiche. Als König Ludwig der Bayer im Jahre 1324 die Belehnung seines ältesten Sohnes mit der Mark Brandenburg bekundete, schloß er das Land Stargard ausdrücklich und namentlich in diesen Rechtsakt ein, und die Söhne Heinrichs des Löwen, Albrecht und Johann von Mecklenburg, haben sich 1329 von Markgraf Ludwig dem Älteren die Belehnung mit Stargard erteilen lassen. Der Nachfolger Kaiser Ludwigs des Bayern aber auf dem deutschen Thron, Karl IV., der in offenem Kampf mit seinem Vorgänger König geworden war, hat das Lehnsband, durch das Stargard an Brandenburg geknüpft war, durchschnitten. Es lag König Karl daran, den ihn befehdenden Sohn seines Vorgängers, den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, mit allen Mitteln zu bekämpfen. So hat er sich 1347 entschlossen, das Land Stargard, das die mecklenburgischen Brüder bisher von der Mark Brandenburg zu Lehen getragen hatten, zu einem Reichslehen zu erheben. Im nächsten Jahre hat er die Herren Albrecht und Johann von Mecklenburg auch zu Reichsfürsten erhoben. Der Markgraf von Brandenburg, der eben damals einen Kampf auf Leben und Tod gegen den falschen Waldemar kämpfte, war nicht in der Lage, sich gegen diese Beeinträchtigung seiner Rechte erfolgreich zu wehren.
Ich bin am Ende und fasse kurz zusammen. Das von Brandenburg 1236 erworbene und dann dem Deutschtum erschlossene Land Stargard ist am Ende des 13. Jahrhunderts von seinem damaligen Landesherrn, Markgraf Albrecht III., dem seine Söhne vor der Zeit gestorben waren, als Lehen an seinen Schwiegersohn, den energischen Heinrich von Mecklenburg vergeben worden. Als dieser 1315 in einen Krieg mit Brandenburg geriet und ihm vom Markgrafen das Land Stargard abgesprochen wurde, hat er es nicht zum mindesten dank seiner erprobten Kriegskunst in einem an spannenden Momenten reichen Kampfe behauptet und wurde im Frieden von 1317 erneut als Inhaber des brandenburgischen Lehens Stargard bestätigt. Das Ringen Karls IV. gegen die Wittelsbacher um den deutschen Thron hat dann den


|
Seite 18 |




|
Luxemburger dahin geführt, daß er, um den wittelsbachischen Markgrafen von Brandenburg zu schädigen, das bisher brandenburgische Lehen Stargard in ein Reichslehen umwandelte.
Der historisch gebildete Märker mag bedauern, daß damit gerade eine Stadt wie Neubrandenburg, diese Perle askanischer Stadtgründungskunst, ihrem historischen Zusammenhang entrissen worden ist, einem Zusammenhang, an den der Name der Stadt bis heute erinnert. Der Gang der Geschichte geht über solche sentimentalen Gedanken unbekümmert hinweg. Das Land Stargard hat zwei Menschenalter zur Mark gehört; seit 19 Menschenaltern ist es mecklenburgisch. Die Erinnerung an das ehemalige Lehnsverhältnis hat sich schon im Mittelalter getrübt, ohne doch zu erlöschen. Als im 15. Jahrhundert die Hohenzollern nach Brandenburg kamen und daran gingen, die alte askanische Mark mit all ihren Rechten wiederherzustellen, holte Kurfürst Friedrich I. auch den Anspruch auf Lehnsherrlichkeit über mecklenburgisches Land hervor; darin freilich irrte er völlig, daß er diesen Anspruch auf ganz Mecklenburg ausdehnte; er hatte, wie wir sahen, nur in bezug auf das Land Stargard bestanden. Da die Mecklenburger in den darüber ausbrechenden Fehden im allgemeinen unglücklich kämpften, haben sie sich 1442 zu einem Vertrage bereit gefunden, durch den Kurfürst Friedrich II. zwar seinen lehnsherrlichen Ansprüchen auf Mecklenburg entsagte, dafür aber im Falle des Aussterbens des gesamten mecklenburgischen Fürstenhauses das Recht der Erbfolge in allen mecklenburgischen Ländern zugesichert erhielt. Seither haben die Hohenzollern zu ihren sonstigen Würden auch den Titel und das Wappen eines Herzogs von Mecklenburg angenommen; sie haben beides bis 1918 geführt; erst der Umsturz, den wir erlebten, hat also die letzte, allerdings stark verdunkelte staatsrechtliche Erinnerung daran beseitigt, daß das Land Stargard einst zur Mark Brandenburg gehört hat.
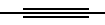


|
[ Seite 19 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Die hoheitsrechtlichen Verhältnisse
in
der Travemünder Bucht
von
Werner Strecker.


|
[ Seite 20 ] |




|
Viertes Gutachten des Mecklenburg=Schwerinschen Geheimen und Haupt=Archivs vom 12. Mai 1927 für das Mecklenburg=Schwerinsche Ministerium des Innern.
Inhalt.
- Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer
- Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs
- Fischerei und Strandrecht
Exkurs. Zum Meeresfischereiregal in Preußen
Anhang. (Zu den Exkursen a - d bei Rörig III, S. 29 ff.)


|
Seite 21 |




|
In unserem Gutachten vom 15. Dezember 1926 sind wir nur auf den Teil des letzten Rörigschen Gutachtens (vom 24. Juni 1926) eingegangen, der von der Travemünder Reede und ihren Grenzen handelt. Wir kommen jetzt, wie wir uns vorbehalten hatten, auf die übrigen Ausführungen Rörigs zurück, wobei wir auch sein vorletztes Gutachten vom 6. Juli 1925 gelegentlich streifen werden 1 ).
I. Das landesherrliche Hoheitsrecht am Küstengewässer.
Vorweg haben wir zweierlei zu bemerken:
Rörig hat die Meinung ausgesprochen, daß unsere Untersuchungen über das Hoheitsrecht am Küstengewässer der Ostsee sich allzu weit von dem eigentlichen Streitgegenstande entfernten, und wir entnehmen aus seinen Worten den Vorwurf, daß die Durchführung des Prozesses auf diese Weise erschwert werde 2 ). Wir brauchen uns hiergegen kaum zu verteidigen. Unsere Forschung war notwendig, weil sie für die spezielle Untersuchung der Rechtsverhältnisse in der Travemünder Bucht die Voraussetzung bildet.
Ferner glaubt Rörig einen Widerspruch zwischen unseren Ausführungen in Archiv II und dem ersten Gutachten Langfelds feststellen zu können 3 ). Dies im einzelnen zurückzuweisen, wird gleichfalls nicht nötig sein. Ebenso wenig wie Rörig selbst haben wir es als unsere Aufgabe betrachten können, ein "Rechtsgutachten im engeren Sinne des Wortes" abzugeben 4 ). Und schon


|
Seite 22 |




|
Langfeld hat in seinem zweiten Gutachten zutreffend erklärt, daß seine und unsere Darlegungen sich nicht widersprechen, sondern ergänzen 5 ).
~~~~~~~~~
Den Nachweis, daß den mecklenburgischen Fürsten im Mittelalter ein Hoheitsrecht über das Meer an ihrer Küste und also auch an der Uferstrecke Priwall-Harkenbeck zugestanden habe, sucht Rörig 6 ) hauptsächlich mit den folgenden beiden Einwürfen zu bekämpfen:
- Die hierin von uns und v. Gierke vertretene Ansicht beruhe auf Analogieschlüssen.
- Die Urkunden, auf die wir uns stützen, seien dispositiver Art, nicht Beweisurkunden. Der Beweiswert dispositiver Urkunden werde aber dadurch verringert, "daß man im Mittelalter oft die Form eines Privilegs wählte, wo es sich in Wirklichkeit nur um die Legalisierung und Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte", sowie auch durch "das Überwuchern des Formelhaft-Schematischen in der äußeren Form der Urkunden" herabgesetzt.
Wir erwidern:
zu 1) Wenn für die ganze deutsche Ostseeküste einschließlich der mecklenburgischen eine Fülle von Material vorliegt, woraus ein landesherrliches Regal am Küstengewässer, im besonderen auch das Fischereiregal hervorgeht, so ist der Schluß, daß es sich hier um ein durchgängiges Recht handelte, und daß nicht etwa das Gewässer vor der 3 1/2 km langen Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck davon ausgenommen war, zwingend und kein Analogieschluß im eigentlichen Sinne. Niemand kann annehmen, daß den Landesherren dieses Recht an einzelnen Teilen der Küste zustand, an anderen dagegen nicht. Unser Schluß ist um so zwingender, als wir durch Quellen aus späterer Zeit nachgewiesen haben, daß Mecklenburg die Strandgerechtigkeit an der strittigen Küstenstrecke besaß. Unter der Strandgerechtigkeit aber verstand man die Hoheit über das Küstengewässer (vgl. besonders Archiv II, S. 84 f.).
zu 2) Was Rörig hier äußert, trifft nicht den Kern der Sache. sondern geht um ihn herum. Die Gegenüberstellung von Beweisurkunde und dispositiver Urkunde wirkt an dieser Stelle ver-


|
Seite 23 |




|
wirrend. Freilich meint Rörig nicht die Beweisurkunde im engeren Sinne der Urkundenlehre, sondern er meint Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge. Die Beweiskraft der dispositiven Urkunde oder Geschäftsurkunde steht außer Zweifel. Allerdings sind die von uns vorgebrachten Urkunden nicht ausgestellt worden, um das landesherrliche Meeresregal zu beweisen, sondern um ein Beweismittel für die durch die Urkunden vollzogenen Verleihungen zu schaffen. Für diese aber ist das Regal die Voraussetzung. Die Erwägungen Rörigs über die Art, wie Privilegien als Erkenntnisquelle zu werten sind, würden am Platze sein, wenn es uns darauf angekommen wäre, die Entwicklung der Seefischerei an der Ostseeküste zu untersuchen. Hätten wir unsere Arbeit hierauf gerichtet, so möchte im einzelnen, soweit das überhaupt möglich ist, zu prüfen sein, ob es sich bei diesem oder jenem Fischereiprivileg um die "Anerkennung eines bestehenden Zustandes" handelte und wie weit sich Seefischerei ohne Privileg gewohnheitsmäßig ausgebildet hat 7 ). Unsere Verwertung der Privilegien aber liegt in ganz anderer Richtung. Aus den landesherrlichen Verleihungen schließen wir auf das Recht der Landesherren, diese Verleihungen vorzunehmen, also auf Grund eines Regals zu handeln. Dieser Schluß ist bei der Fülle des vorliegenden Materials unbedingt zwingend.
Ist aber hiermit die Art des Ergebnisses festgestellt, das wir aus den Privilegien gewonnen haben, so weichen auch die Stützen, die Rörig (III, S. 58, Anm. 13) sich nutzbar machen will. Der von ihm angezogene Satz v. Belows trifft ja auf unsere Beweisführung gar nicht zu. Und wenn H. Hirsch in seinem Buche über die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter 8 ) auseinandersetzt, daß sich die Fortbildung von Immunitätsgerichten unabhängig von den Immunitätsdiplomen vollzog - eine Entwicklung, die nach Hirsch unter dem Einflusse bestimmter staatlicher und sozialer Verhältnisse und auf der Grundlage besonderer Rechtszustände vor sich ging, aber nicht durchgängig war -, so ist doch damit nicht gesagt, daß Rechte nicht aus Privilegien entstehen können - was in tausend Fällen geschehen ist -, und daß aus den Privilegien keine Schlüsse auf Hoheitsrechte der Aussteller


|
Seite 24 |




|
dieser Urkunden zu ziehen seien 9 ). Ebensowenig ist der Ausspruch Sombarts, wonach die Verordnung nicht das Leben schafft, auf unsere Beweisführung anwendbar. Die treibenden Kräfte für die Seefischerei liegen natürlich nicht in den Privilegien. Durch Privilegien aber konnte die Fischerei gefördert und von Abgaben entlastet werden.
Wenn man früher die Wirkung von Privilegien überschätzt hat, so darf man heute jedenfalls nicht in den gegenteiligen Fehler verfallen. Man kann auch nicht sagen, daß sich in den Urkundenstellen, die v. Gierke und wir herangezogen haben, ein "Überwuchern des Formelhaft-Schematischen" bemerkbar mache. Sie unterscheiden sich ja vielfach in dem, was sie gewähren, und die verschiedentlich darin enthaltenen besonderen Bestimmungen bilden zugleich Zeugnisse über "tatsächliche Vorgänge". Wir verweisen hier auf das Gesamtergebnis aus den Urkunden, das v. Gierke (Jb. 90, S. 56) festgelegt hat. In einzelnen Fällen ist geradezu nachweisbar, daß es sich bei der Verleihung von Seefischerei nicht nur um die Anerkennung eines bestehenden Zustandes handelte, sondern daß das Privileg das Primäre war 10 ). Schließlich übersieht Rörig


|
Seite 25 |




|
ganz, daß wir die Rechtsverhältnisse am rügischen Außenstrande bis ins 17. Jahrhundert 11 ), am mecklenburgischen Strande bis ins 18. Jahrhundert 12 ) verfolgt haben. Und hier handelt es sich ja überall um Zeugnisse über tatsächliche Vorgänge und Zustände. Der Rechtszusammenhang aber zwischen diesen Zuständen und den aus den mittelalterlichen Quellen zu erschließenden ist ganz unabweisbar.
Aus den vorgebrachten Urkunden wählt Rörig (III, S. 62) einige aus, die seine Ansicht bestätigen sollen, daß Rechte an Meeresteilen zunächst von den an den Unterläufen von Flüssen gelegenen Städten ausgebildet seien. Er erwidert aber nicht auf die Ausführungen v. Gierkes (S. 13 f.), der diese Ansicht Rörigs bereits auf Grund des übrigen Materials widerlegt hat.
Zu den weiteren Einwürfen Rörigs bemerken wir noch: Seine Interpretation (III, S. 59, Anm. 14 ) der wichtigen pommerschen Urkunde von 1265 für das Kloster Dargun 13 ) ist unrichtig. Es handelt sich um die Worte: in mari salso terre nostre dominio adiacenti. Wir haben darauf aufmerksam gemacht 14), daß adiacere in der Urkundensprache im Sinne von pertinere gebraucht wurde 15 ), sich also auf ein Zubehör bezieht, ferner daß adiacenti zu dominio, der Herrschaft als Begriff, gehört. Demgemäß haben wir so wörtlich wie möglich übersetzt: in der zu unserer Landesherrschaft belegenen, ein Zubehör unserer Landesherrschaft bildenden salzigen See. Diese Übersetzung deckt sich dem Sinne nach mit der v. Gierkes (S. 52, Anm. 57): "in dem Salzmeere, das unserer Landesherrschaft zugehört". Wenn Rörig diese Übersetzung v. Gierkes für "eine willkürliche Vergewaltigung des Textes" erklärt 16 ), so ist dem zu entgegnen, daß seine eigene Auslegung ("in dem Salzmeere, das an das Herrschaftsgebiet unseres Landes angrenzt") das Entscheidende unberücksichtigt läßt. "Das Salzmeer als solches," so sagt er, sei "in der Urkunde mit aller Deutlichkeit als nicht zum Herrschafts-


|
Seite 26 |




|
bereich des Landesherrn gehörig gekennzeichnet." Merkwürdig, daß der Landesherr trotzdem Fischereigerechtigkeit in eben diesem Salzmeere erteilt 17 ). Auf verschiedene andere Urkundenstellen, die ebenfalls die Herrschaft über das Küstengewässer geradezu aussprechen, geht Rörig nicht ein. Er hat auch auf unseren Nachweis, daß für die Küstenfischerei vormals Abgaben erhoben wurden, nichts Stichhaltiges erwidert 18 ).
Zusammenfassend können wir sagen, daß Rörig unsere Beweisführung auch dort nicht erschüttert hat, wo er überhaupt versucht hat, sie anzugreifen.
~~~~~~~~~


|
Seite 27 |




|
In seinem ersten Gutachten (I, S. 44 f.) hat Rörig gesagt, daß sich eine Herrschaft Lübecks auf der Reede durch Okkupation ausgebildet habe, wenn sie nicht unmittelbar aus dem Barbarossaprivileg erwachsen sei. Diese Alternative kann man nicht aufstellen. Gesetzt nämlich den Fall, daß sich die bekannten Worte des Privilegs: "licebit . . piscari . . usque in mare" nicht nur auf Binnenfischerei, sondern auch auf Seefischerei bezögen, so wäre ja damit den Lübeckern nur ein Recht zum Fischfang bestätigt worden, das sie nach Angabe der Urkunde schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten. Sie würden keinerlei Fischereiregal erlangt haben, sondern nur eine bloße Nutzung, wie die lübischen Fischer sie bis auf den heutigen Tag tatsächlich ausgeübt haben. Eine Herrschaft, d. h. eine Gebietshoheit über das strittige Gewässer müßte also in jedem Falle auf andere Weise entstanden sein. Das Privileg könnte sie auch dann nicht begründet haben, wenn Rörigs Auslegung richtig wäre.
Nun aber hat ja Rörig seine These von der Entstehung der Lübecker Gebietshoheit vor der Küstenstrecke Priwall-Harkenbeck auf der - a priori und ohne weitere Prüfung gebildeten - Vorstellung aufgebaut, daß es im Mittelalter keine landesherrliche Meereshoheit gegeben habe. Da die Irrigkeit dieser Vorstellung nachgewiesen ist, fällt selbstverständlich die Möglichkeit eines Erwerbes durch Okkupation im Rechtssinne weg 19 ). Viel schwieriger aber als die Okkupation eines herrenlosen Gebietes ist die Entstehung einer Gebietshoheit auf gewohnheitsrechtlichem Wege oder durch Unvordenklichkeit, weil hier mit den Ansprüchen und dem Widerstande des rechtmäßigen Herrn gerechnet werden muß.
Rörig, der immer noch an der Möglichkeit einer Okkupation festhalten möchte, klammert sich daran, daß wir für die Strecke Priwall-Harkenbeck keine besonderen Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgelegt hätten. Hat denn aber er selber für die angebliche Lübecker Gebietshoheit Zeugnisse aus dem Mittelalter vorgebracht? Nicht eines! Die von ihm angezogenen Quellen beginnen im 16. Jahrhundert. Für eben dieses Jahrhundert ist aber bereits die mecklenburgische Ausübung des Bergerechtes an der Strecke Priwall-Harkenbeck belegt 20 ). Das Bergerecht aber galt als


|
Seite 28 |




|
Zeichen für die Hoheit über das Küstengewässer 21 ). Wir erinnern auch an den Fall von 1516, in dem sich die Herzöge gegen einen Übergriff des Travemünder Vogtes in ihre Strandhoheit verwahrten 22 ). Sodann sind aus den Jahren 1616 und 1618 Beweise dafür vorhanden, daß eine mecklenburgische Fischerei vor der strittigen Küstenstrecke seit über Menschengedenken, also sicher schon im 16. Jahrhundert bestand 23 ). Es ist eine durchaus unzutreffende Behauptung Rörigs, daß die ältesten Zeugnisse über Ausübung von Hoheitsrechten vor der Strecke Priwall-Harkenbeck "mit aller Deutlichkeit für Lübeck, nicht für Mecklenburg" sprächen 24 ). Die ältesten Quellen, die über den Strandrechtsfall von 1516, sprechen nicht für Lübeck. Denn wenn wirklich die eine der beiden Schuten bei Rosenhagen geborgen war, so handelt es sich unbedingt um einen Übergriff des Travemünder Vogtes. Das würde sich nicht nur daraus ergeben, daß Lübeck in seiner Erwiderung auf die Beschwerde es vermied, den Ort Rosenhagen zu nennen 25 ), sondern vor allem daraus, daß Lübeck späterhin niemals die mecklenburgische Strandhoheit vor Rosenhagen angezweifelt, sondern beim Fischreusenstreit ausdrücklich zugegeben hat 26 ). Für das Mittelalter aber läßt sich überhaupt nichts feststellen außer der landesherrlichen Hoheit über das Küstengewässer, von der die kleine Strecke Priwall-Harkenbeck nicht ausgenommen sein konnte.
~~~~~~~~~
II. Zur Beurteilung des Barbarossaprivilegs.
Will man die Worte usque in mare erklären, so ist man auf "vergleichende Stilkritik" angewiesen. Und wenn eine solche Fülle gleichartigen Materials vorgelegt werden kann, wie es von uns geschehen ist, - ein Material, das sich gewiß sehr vermehren ließe 27 ) -, so ist die Stilkritik kein so schwaches Mittel der


|
Seite 29 |




|
Urkundenforschung, wie Rörig (III, S. 64) meint. Er selber hat mit dieser Kritik begonnen, aber auf ganz unzureichender Grundlage 28 ). Nun bemerkt er, daß wir unser Material "nach der ganz zufälligen Anwendung der Worte ,usque in' im Sinne von ,usque ad' zusammengesucht" hätten. Indessen steht das "usque in" im Barbarossaprivileg in einer Grenzangabe, und lauter Grenzangaben sind es, die wir zur Vergleichung herangezogen haben. Er macht ferner darauf aufmerksam, daß vorher in dem Privileg die Worte vorkommen: usque ad villam Odislo, übersieht aber, daß es an anderer Stelle der Urkunde wiederum heißt: usque in Radagost. Wir haben ja gerade (Archiv II, S. 94) hervorgehoben, daß "usque ad" und "usque in" überall in derselben Bedeutung gebraucht wurden.
Für seine eigene sogenannte "vergleichende Stilkritik" glaubt Rörig die Urkunden "unter dem "Gesichtspunkt, daß in ihnen dieselbe Materie zu ordnen war", herangezogen zu haben. Aber es liegt auf der Hand, welche Verwirrung er hierbei anrichtet. In den drei Urkundenstellen, die ihm durch v. Gierke und uns bekannt worden sind und die er III, S. 64 f., bespricht, kommt ja das usque in überhaupt nicht vor. Wie kann man denn in dem Privileg für Treptow an der Rega von 1309 bei der Begrenzung "usque ad spatium miliaris unius in ipsum mare salsum" die Worte "usque" und "in ipsum mare salsum" durch Fettdruck hervorheben, als ob sie zusammengehörten 29 ). Genau so hat Rörig in dem Privileg für Rostock von 1252 das usque, das zu "Warnemunde" gehört, mit den Worten "in marinis fluctibus" in Verbindung gebracht 30 ). Er meint jetzt, wenn es in der Rostocker Urkunde heiße, "daß das beneficium piscature sich erstrecken soll: usque Warnemunde necnon extra portum in marinis fluctibus", so komme das "auf dasselbe hinaus, als wenn es auch für Rostock geheißen hätte: usque in mare". Eben nicht, sondern das "usque in mare" der Barbarossa-Urkunde ist nur mit dem "usque Warnemunde" des Rostocker Privilegs vergleichbar. Es hätte in diesem Privileg gerade so gut gesagt werden


|
Seite 30 |




|
können: per alveum fluminis Warnowe usque in mare necnon extra portum Warnemunde in marinis fluctibus.
Schließlich das Privileg für Schleswig von 1480: "wenthe an dat gemeyne Meer ofte solte See enen Wecke Sees buthen Schlyes Munde". Hier erführen wir nach Rörig, "daß, selbst wenn man sagte: bis ans Meer, damit in Wirklichkeit eine Verleihung bis weit ins Meer gemeint sein" könne. Indessen ist hier zwischen dem "gemeinen" Meere, das natürlich keiner Herrschaft unterworfen war, und dem Küstengewässer zu unterscheiden. Die Stelle ergibt ja deutlich, daß sich das Nutzungsrecht der Stadt nur bis ans gemeine Meer erstrecken sollte, nicht - wie sich von selbst verstand - in dieses hinein. Wir erfahren also, daß das Küstengewässer bis auf eine "Wecke Sees" (Meile) in Anspruch genommen wurde, ebenso wie in dem Privileg für Treptow von 1309 bis auf eine Meile. Demgegenüber ist die Ausdehnung der Meereshoheit bis zur schiffbaren Tiefe, wie sie 1616 im Fischreusenstreit von Mecklenburg vertreten wurde, sehr bescheiden. - In Wirklichkeit hat Rörig an dem "usque im mare" gar keine vergleichende Stilkritik geübt, sondern behauptet, daß Lübeck 1188 Meeresnutzung habe erhalten müssen, weil sie später anderen Städten zuteil wurde. Er begibt sich also selber auf den "Treibsand" eines Analogieschlusses, der hier allerdings als "trügerisch" bezeichnet werden muß; denn Privilegien können sich ja von einander unterscheiden. Ganz etwas anderes ist es, einen Schluß auf die landesherrliche Hoheit über das Küstengewässer vor der Strecke Priwall-Harkenbeck zu ziehen, weil die überall festgestellte Herrschaft über das Küstengewässer unbedingt durchgängig gewesen ist.
Dann wendet sich Rörig (III, S. 67 f.) gegen unsere Verwertung des Berichtes, den die Chronik Arnolds von Lübeck über das Barbarossaprivileg erstattet 31 ). Dieser Bericht soll "in der Hauptsache gar nicht auf den jetzt strittigen Satz über das Fischereirecht" passen, sondern auf "den ihm vorgehenden über Holz und Weidenutzungen". Hier sei bei Arnold und dem Privileg "die wirkliche Parallele vorhanden". Indessen liegt diese Parallele keineswegs nur in den Angaben über Holz- und Weidenutzung; sie liegt auch in der Gewährung von Fischerei. Es ist unvollständig, wenn Rörig angibt, daß der Streit um "pascua" ging, und daß auch Arnold das sage. Denn nach Arnold nahm der Streit seinen Ausgang von dem Travemünder Zoll und dehnte sich dann auf alle Nutzbarkeiten (quicquid commoditatis) aus, die Adolf von Holstein den Lübeckern - weil sie den Zoll nicht zahlen


|
Seite 31 |




|
wollten - nahm. Arnold faßt diese Nutzbarkeiten kurz zusammen. Es sind nach ihm Nutzungen in fluviis (also Fischerei), in pascuis, in silvis. Dann kaufen die Lübecker sich auf des Kaisers Vermittlung vom Zolle los, zahlen auch Geld für die Weidegerechtigkeit, erhalten aber die Gesamtheit der Nutzbarkeiten zurück: et sic a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis, pascuis, silvis. Die Begrenzung "a mari usque Thodeslo" schließt selbstverständlich Meeresfischerei aus. Wenn also die bekannten Worte des Barbarossaprivilegs schon nach dem Ergebnisse der vergleichenden Stilkritik nur "bis zum Meere" bedeuten können, so wird dies durch Arnolds Bericht um so gewisser.
Was Rörig demgegenüber aus der von Arnold mitgeteilten Vorgeschichte des Privilegs ableiten will, ist völlig verfehlt. Er versucht jetzt, die Worte usque in mare auf den Travemünder Zollstreit zurückzuführen. Von dem Zoll, den Graf Adolf von Holstein gefordert habe, seien ja auch die Lübecker Fischer betroffen worden, und so hätten denn "die Störungen unmittelbar am Ausgang zur See" die Veranlassung gegeben, daß das alte Gewohnheitsrecht der Fischerei, das die Lübecker schon zur Zeit Heinrichs des Löwen gehabt hatten, "jetzt auch urkundlich festgelegt wurde". Die Worte usque in mare sollen daher bedeuten: "abgabefrei bis ins Meer hinein". "Sie können," so sagt Rörig, "unter diesen Umständen nicht nur ,bis ins Meer' bedeutet haben, sie müssen es vielmehr." Immer vorausgesetzt natürlich, daß die Lübecker damals schon Seefischerei betrieben (was gar nicht bewiesen ist) und daß die Meinung, es habe die Befreiung von dem Travemünder Zoll ausgesprochen werden sollen, richtig ist. Rörig merkt nicht, daß er sich im Zirkel dreht; seine Folgerung ist zugleich seine Voraussetzung. Auch hätte sichs dann ja gar nicht um Verleihung von Meeresfischerei, sondern um Verleihung von Zollfreiheit gehandelt.
Wo aber, fragen wir, steht an dieser Stelle des Privilegs ein Wort von Zoll oder Abgaben? Es heißt einfach: licebit . . piscari. Hätte hier die Ursache des Streites zwischen Lübeck und dem Grafen Adolf getroffen werden sollen, so würde dies doch natürlich deutlich gesagt sein. Überdies heißt es, daß die Lübecker usque in mare fischen dürften, "sicut tempore ducis Heinrici facere consueverunt". Zur Zeit des Herzogs Heinrich war ja aber gerade der Travemünder Zoll gezahlt worden. Arnold berichtet ausdrücklich, daß Graf Adolf den Lübeckern dies entgegengehalten habe 32 ). Sie hätten erwidert, es sei nicht de iure geschehen,


|
Seite 32 |




|
sondern sei auf Zeit und zur Erhaltung des Kastells Travemünde gewährt worden, weil der Herzog darum ersucht habe 33 ). Wenn also usque in mare heißen würde: abgabenfrei bis ins Meer hinein, so würde dies durch den Zusatz (sicut . . consueverunt) wieder aufgehoben sein. Damit erledigt sich Rörigs vermeintliche Feststellung, daß "das vom Archivgutachten zur Debatte gestellte Material" (nämlich Arnolds Bericht) "bei gründlicher Interpretation" die "beste Stütze" für die Übersetzung "bis ins Meer" sei.
Der ganze Travemünder Zollstreit wird in dem Barbarossaprivileg gar nicht erwähnt. Das war auch nicht nötig. Arnold berichtet, daß Graf Adolf gegen Zahlung von 300 Mark Silbers auf die Zollerhebung verzichtete und auch für die Weidegerechtigkeit 200 Mark erhielt. Hierüber muß zwischen ihm und Lübeck ein besonderer Vertrag geschlossen sein, der in dem kaiserlichen Privileg nicht zum Ausdrucke zu kommen brauchte. Hätte man den Wegfall des Travemünder Zolles noch eigens in dem Privileg betonen wollen, so würde dies natürlich im Hinblick auf die Schiffahrt und den Warenhandel und an den Stellen der Urkunde geschehen sein, wo wirklich von Zollfreiheit die Rede ist, nicht aber im Hinblick auf eine angebliche Meeresfischerei, für die der Zoll viel geringere Bedeutung gehabt haben würde 34 ).
Von den weiteren Einwürfen Rörigs haben wir die Behauptung, daß die Waghenaersche Seekarte von 1586 eine Trave "bis ins Meer" verzeichne, schon in unserem letzten Erachten als ganz unhaltbar zurückgewiesen 35 ). Rörig geht noch ein auf unsere Bemerkung in Archiv II, S. 99: "Wo sollte der Kaiser auch Meeresfischerei verliehen haben? Der Strand gehörte zu jener Zeit sicher schon den anliegenden Territorialherren. . . . Wo sind Beispiele einer Verleihung von Seefischerei an der deutschen Küste durch den Kaiser?" Dem gegenüber verweist Rörig (III, S. 69) auf das Privileg Friedrichs II. für den deutschen Orden von 1226, das v. Gierke (S. 47) herangezogen hat. Es ist aber doch ein großer Unterschied, ob - wie in diesem Falle - eine gesamte


|
Seite 33 |




|
Landeshoheit verliehen wird oder eine Nutzung am Strande bereits beherrschter Territorien. Rörig fügt die Frage bei, wo denn Belege erbracht seien, daß die Territorialherren schon im 12. Jahrhundert über den Strand in einem Umfange zu verfügen gehabt hätten, daß dadurch eine Anerkennung von städtischen Nutzungen berührt würde, wie sie das Lübecker Privileg von 1188 seiner Meinung nach enthält. Soll man denn aber glauben, daß die Herrschaft über das Küstengewässer erst mit dem zufällig erhaltenen Urkunden beginnt? Für das 12. Jahrhundert hat sich doch nur dürftiges Material über die in Betracht kommenden Gebiete erhalten. Gerade für Mecklenburg aber haben wir die beiden Doberaner Privilegien von 1189 und 1192, deren rechtsgeschichtliche Bedeutung dadurch nicht getroffen wird, daß das eine falsch, das andere zweifelhaft ist 36 ). Viel später können beide Urkunden nicht geschrieben sein. Einfach annehmen, daß Friedrich Barbarossa sich 1188 über Rechte der Territorialherren hinweggesetzt habe, geht nicht an. Einer solchen Vermutung widerspricht auch sein Verhalten gegenüber Adolf von Holstein, mit dem er sich ja vor der Erteilung des Privilegs an Lübeck verständigte.
Schließlich aber sind wir zu der Überzeugung gekommen, daß die bisherige, auch von uns in Archiv II vertretene Interpretation, wonach sich die Grenzangaben der strittigen Stelle in dem Barbarossaprivileg auf den Travelauf beziehen sollen, überhaupt verkehrt ist. Es fällt doch auf, daß die Trave gar nicht genannt wird; es heißt einfach: "piscari per omnia (überall) a . . villa Odislo usque in mare preter septa comitis Adolfi". Nun gibt es ja im Holsteinischen zwischen Oldesloe und dem Meere noch verschiedene Fluß- und Bachläufe, die sich in die Trave ergießen, und die Fischwehren des Grafen Adolf brauchen auch nicht nur auf der Trave bestanden zu haben. Es ist dabei zu bedenken, daß die Chronik Arnolds von "fluviis", also von einer Mehrheit von Wasserläufen spricht. Wenn in der Chronik gesagt wird: "a mari usque Thodeslo libere fruerentur fluviis", so ist damit offenbar dasselbe gemeint, was das Barbarossaprivileg mit den Worten ausdrückt, daß die Lübecker überall von Oldesloe bis zum Meere fischen dürften, wie oder in dem Maße, wie sie es zur Zeit Heinrichs des Löwen gewohnt gewesen seien. Die "fluvii" bei Arnold würden also dem "per omnia" des Privilegs entsprechen 37 ). Dann aber ist klar, daß Oldesloe und


|
Seite 34 |




|
das Meer als Grenzbestimmungen für ein dazwischen liegendes Landgebiet des Grafen Adolf aufzufassen sind, worin den Lübeckern Binnenfischerei zustand 38 ). Daß diese Grenzbestimmungen das Gebiet nur ungenau bezeichnen, kann um so weniger stören, als auch die übrigen Grenzangaben des Privilegs ganz unklar sind. Auch würde ja der Hinweis auf die Verhältnisse zur Zeit Heinrichs des Löwen den Umfang der Lübecker Berechtigung festgelegt haben. Überdies gibt es noch eine dritte Quelle, die geradezu beweist, daß unsere Auslegung richtig ist. Wir meinen die von Rörig III, S. 18 erwähnte Bestimmung über Fischereigerechtigkeit, die sich in dem Privileg der Grafen von Holstein für Lübeck vom 22. Februar 1247 findet. Die Stelle lautet:
Preterea concedimus civitati in perpetuum in aquis nostris ius piscandi, exceptis nostris septis, que war (Wehr) dicuntur, secundum omnem consuetudinem et libertatem, quam ipsi Lubicenses in piscationibus nostris noscuntur hactenus habuisse 39 ).
Dieser Satz ist selbstverständlich nichts weiter als eine Bestätigung der umstrittenen Stelle des Barbarossaprivilegs. Es wird ja gar nichts Neues gewährt, sondern nur die alte Gewohnheit anerkannt. Und zwar handelt es sich hier nicht um die einzige Bestimmung des Barbarossaprivilegs, die in der Urkunde von 1247 bestätigt wird. Die Worte aber "in aquis nostris" können sich nicht allein auf den Travelauf beziehen. Sie beziehen sich auf Fischerei in mehreren holsteinischen Binnengewässern. Das nimmt auch Rörig an, der jedoch den Zusammenhang dieser Stelle mit dem Privileg von 1188 nicht erkannt hat. Meeresfischerei am holsteinischen Strande wurde Lübeck dagegen erst durch das bekannte Privileg von 1252 verliehen, in dem kein Wort über eine bereits bestehende Gewohnheit gesagt wird.
In keinem Falle kann mehr zweifelhaft sein, daß die sogenannte Barbarossa-Urkunde für den obwaltenden Rechtsstreit ganz ausscheiden muß. Es läßt sich überhaupt nicht feststellen, ob der fragliche Satz genau so im Original gestanden hat wie in der Fälschung. Das ist aber schließlich einerlei; denn eine Gewährung von Meeresfischerei kann aus dem Satze unter keinen Umständen ge-


|
Seite 35 |




|
schlossen werden 40 ). Und gesetzt den Fall, daß Rörig recht hätte, so würde sichs doch immer nur um eine bloße Nutzung handeln. Ebensowenig aber wie die Fälschung selbst kann die Bestätigung Friedrichs II. von 1226 eine Rolle spielen, und zwar schon deswegen nicht, weil sie ja auch nur denselben Satz enthält, der von Meeresfischerei nicht handelt 41 ).
~~~~~~~~~
III. Fischerei und Strandrecht.
Die lübische Fischerei an der Strecke Priwall-Harkenbeck läßt sich seit dem 16. Jahrhundert verfolgen. Daß die bloße Tatsache ihrer Ausübung nicht für ein Regal Lübecks spricht, ist ohne weiteres klar. Denn die Lübecker fischten sowohl diesseit wie jenseit der Harkenbeck, ebenso am holsteinischen Strande, aber nirgends ausschließlich 42 ). Selbst wenn sie auf der heute strittigen Wasserfläche den Fischfang ohne Wettbewerb anderer ausgeübt hätten - was nachgewiesenermaßen nicht der Fall war -, so brauchte es sich doch keineswegs um eine de iure ausschließliche, auf Regal beruhende Fischerei gehandelt zu haben 43 ).


|
Seite 36 |




|
Wie aber ist es überhaupt dazu gekommen, daß die Lübecker an der Küste Mecklenburgs ungestört fischen durften, ohne daß sie hierfür ein Privileg, ähnlich dem holsteinischen von 1252, aufzuweisen hatten?
Rörig (III, S. 74) glaubt die Ausführungen v. Gierkes über das strittige Gewässer in folgendem "Bilde" zusammenfassen zu können :
"Zunächst mecklenburgisches Fischereiregal mit Erhebung von Abgaben 44 ). Dann: Wegfall der Abgaben und jedes Anzeichens für den Bestand des ehemaligen Regals. Endlich: Trotzdem, also diesmal "aus dem Nichts heraus" 45 ), mecklenburgische Fischereihoheit an derselben Strecke, wo gleichzeitig den Lübeckern Gemeingebrauch an der streitigen Strecke "von Mecklenburg zugestanden" (!) gewesen sein soll."
Eine solche Entwicklung, meint Rörig, habe "nicht gerade den Schein der Wirklichkeit" für sich. Es ist aber auch nur ein Bild, das Rörig gezeichnet hat. Den Ausführungen v. Gierkes entspricht es nicht. v. Gierke hat keinen solchen Bruch mit den mittelalterlichen Verhältnissen und dann - nach einem Vakuum - wieder eine den mittelalterlichen Verhältnissen ähnliche Neuschöpfung angenommen. Sondern nach ihm verlief die Entwicklung folgendermaßen: Mittelalterliches Regal der Landesherren am Küstengewässer nebst Erhebung von Fischereiabgaben, dann Wegfall dieser Abgaben, also Zulassung freier Fischerei, aber unter Wahrung der Hoheit über das Küstengewässer einschließlich der Fischereihoheit. Nach Rörig hätte sichs ja bei den Fischereiabgaben um einen gewöhnlichen Zoll gehandelt, was sicher nicht zutrifft. Aber würde denn nicht der Verzicht auf den Zoll ebenso auffallend sein wie der auf die Abgaben?
Seit wann man, im Gegensatze zu den Verhältnissen des 13. und noch des 14. Jahrhunderts, dazu überging, die abgabenfreie Seefischerei zu gestatten, können wir nicht genauer ermitteln. Wahrscheinlich ist es schon gegen Ende des Mittelalters geschehen infolge des immer stärkeren Eindringens römisch-rechtlicher Anschauungen. Aber nicht nur die Lübecker waren es, denen der Fang am landesherrlichen Strande Mecklenburgs freistand, son-


|
Seite 37 |




|
dern auch die Warnemünder 46 ), die Wismarer, ferner - wie die Akten über den Fischreusenstreit zeigen -, die in der Gegend der Küste wohnenden Dorffischer, wobei allerdings der fischländische Strand eine Ausnahme machte 47 ). Auch holsteinische Fischer lassen sich um 1580 bei Brunshaupten feststellen 48 ).
Wie man im 16. Jahrhundert über die Seefischerei dachte, ergibt sich aus einer Beschwerde, die Rostock 1583 wegen einer Pfändung Warnemünder Seefischer am Dars an den Herzog von Pommern richtete; es heißt darin, daß "vermüge des natürlichen und aller Volcker Rechtens" das "Mehr oder offenbare Sehe und die Fischerey in derselben wie dan auch die littora maris menniglich gemein" und niemand verhindert sei, sich ihrer zu gebrauchen 49 ). Ähnliches klingt uns aus den Briefen der Eigentümer jener 1616 von Lübeck zerstörten Fischreuse entgegen 50 ). Man hatte solchen Anschauungen, die indessen nur auf die Nutzung des Meeres zu beziehen sind, in der Praxis nachgegeben, und nicht nur in Mecklenburg. Für Preußen läßt sich eine ähnliche Entwicklung feststellen. Auch dort bestand im Mittelalter noch jenseit der Haffe im Küstengewässer ein Fischereiregal des Ordens und der Bischöfe von Ermland und Samland, schon im 13. Jahrhundert 51 ). Auch in Preußen wurden Abgaben für die Seefischerei erhoben 52 ). Das preußische Landrecht von 1620 aber erklärte das Meer und alle anderen offenen Wasserströme für "männiglich frey und gemein", so daß jeder dort fischen dürfe 53 ). Vermutlich folgte
( ... )


|
Seite 38 |




|
diese Bestimmung einer schon bestehenden Gewohnheit. Auch am holsteinischen Strande scheint der Fischfang um 1600 bereits frei gewesen zu sein 54 ). Durchgängig allerdings ist diese Entwicklung nicht. So hat sich das mittelalterliche Seefischereiregal an der rügisch-neuvorpommerschen Küste bis auf den heutigen Tag erhalten 55 ).
Eine solche Bestimmung, wie sie das preußische Landrecht von 1620 enthält, findet sich für Mecklenburg nicht. Man wird daher den freien Fischfang am mecklenburgischen Strande als eine gewohnheitsmäßige Übung ansehen müssen, die auf Duldung durch die Landesherren beruhte. Diese Auffassung ergibt sich auch aus den Einwendungen, die 1621 von der Stadt Rostock gegen das Verbot der Warnemünder Seefischerei in der Gegend von Brunshaupten erhoben wurden; ebenso aus der herzoglichen Resolution, die daraufhin erging 56 ). Der Verzicht auf Fischereiabgaben bedeutet jedoch keinen Verzicht auf die Fischereihoheit. In der erwähnten Resolution von 1621 wird zwar den Warnemündern der weitere


|
Seite 39 |




|
Gebrauch der freien Seefischerei zugebilligt, aber die landesherrliche "Gerechtigkeit" vorbehalten. Ferner zeigen der Fischreusenstreit sowie die Fischereistreitigkeiten zwischen der Stadt Ribnitz und der Landesherrschaft im 17. und 18. Jahrhundert 57 ), daß die Fischereihoheit keineswegs aufgegeben war. Wie hätte man sonst auch dazu kommen sollen, den Seefischern in Tarnewitz und Boltenhagen noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts Fischereiabgaben aufzuerlegen, also tatsächlich auf das Regal zurückzugreifen 58 )!
Daß auch am holsteinischen Strande die Fischereihoheit bestehen blieb, ist aus den Kämpfen zu schließen, die Lübeck im 16. Jahrhundert wegen seines dortigen Fischereirechtes durchzufechten hatte 59 ).
Schon in Archiv II haben wir die Ausübung des Fischfanges durch die Lübecker an den Küsten Holsteins und Mecklenburgs in Parallele gesetzt. Es machte rechtlich kaum einen Unterschied, daß Lübeck für das holsteinische Küstengewässer das Privileg von 1252 besaß; denn an die Stelle eines Privilegs trat für den mecklenburgischen Strand die Gewohnheit. Als 1575 lübische Fischer im Holsteinischen, zwischen dem Pelzerhaken und der Niendorfer Wiek, gepfändet waren, berichteten sie ihrem Rate, es sei in jener Gegend von alters her "ein freier Strand" gewesen 60 ). Nicht anders ist die den Fischreusenstreit einleitende Beschwerde Lübecker Fischer von 1616 aufzufassen, daß sie "des Orts, da die Ruse stehet, auch woll jenseits derselben, die Wahde zu ziehen pflegen" 61 ). Die Harkenbeckmündung, bei der die Reuse sich befand, erscheint hier also durchaus nicht - überhaupt nicht im ganzen Fischreusenstreit - als Grenze. Auch beriefen sich die Fischer nicht auf eine Lübecker Gebietshoheit 62 ). In dem Schreiben, das dann der Lübecker Rat an die Eigentümer der Reuse richtete, heißt es, daß den lübischen Fischern durch die Reuse "der Ort, da sie ihren freyen Wadenzug zu haben pflegen, gentzlich benommen" werde 63 ). Dieser Ausdruck "freier Wadenzug" entspricht jener Bezeichnung "freier Strand" (im Holsteinischen) von 1575. Er allein widerlegt schon die Meinung Rörigs, daß Lübeck für den Fischfang im mecklenburgischen Küstengewässer Abgaben erhoben


|
Seite 40 |




|
habe 64 ). Freilich sprach der Rat gleichzeitig von seiner Reede. In Wahrheit aber war an der Strecke Priwall-Harkenbeck und darüber hinaus genau so "freier Strand" wie an der holsteinischen Küste. Und die Vernichtung der mecklenburgischen Fischreusen ist gar nicht anders zu beurteilen als die Zurückdrängung der Anliegerfischerei in der Niendorfer Wiek durch Lübeck. Eher waren die "Repressalien" berechtigt, die der Rat gegenüber der Störung der lübischen Fischerei an dem holsteinischen Strande anordnete 65 ).
In den Gründen für die einstweilige Verfügung des Staatsgerichtshofes für das Deutsche Reich vom 10. Oktober 1925 wird gesagt, es sei bisher nicht glaubhaft gemacht worden, daß es sich bei den Reusenzerstörungen von 1616, 1617 und 1658 um unrechtmäßige Übergriffe gehandelt habe. Diese Unrechtmäßigkeit ist aber schon 1616 und 1617 von Mecklenburg behauptet worden, während sich über den Fall von 1658 nur einseitiges Lübecker Material erhalten hat. Wäre Lübeck im Recht gewesen, so müßten natürlich die Aufstellungen der Reusen Übergriffe gewesen sein, also Unrechtmäßigkeiten auf mecklenburgischer Seite vorgelegen haben. Daß man aber in Mecklenburg nicht nur von seinem Rechte überzeugt war, sondern auch in den Ansprüchen Lübecks etwas völlig Neues erblickte, lehren die Akten von 1616 und 1617. Es ergriffen ja auch die Herzöge Maßregeln zum Schutze ihrer Rechte. Warum sollte dieser Standpunkt Mecklenburgs falsch gewesen sein, obgleich sowohl die allgemeine rechtsgeschichtliche Entwicklung wieder tatsächliche Rechtszustand in der Travemünder Bucht (mecklenburgische Strandhoheit, mecklenburgische Fischerei) für ihn zeugen? Wäre das umstrittene Meeresgebiet wirklich lübeckisch gewesen, so würden die Reuseneigentümer schwerlich gewagt haben, hier nicht etwa nur ein wenig Raubfischerei zu treiben, sondern ein sehr kostbares Fanggerät aufzurichten und es auf dessen Zerstörung ankommen zu lassen.
Wir haben Archiv II, S. 163 bemerkt, daß der Fischreusenstreit nicht im Gebietsrecht wurzele. Dies kann sich aber nicht auf Mecklenburg beziehen, das ja sein Gebietsrecht zu verteidigen hatte. Es soll nur für die Ursache gelten, aus der Lübeck den Streit begann. Sie lag, wie wir in dem früheren Erachten ausgeführt haben, in der Gefahr, die den wichtigsten Fangplätzen


|
Seite 41 |




|
der lübischen Fischer (Travemünder Bucht und Binnengewässer) von den ungeheuren Reusen drohte. Mit der Ansicht, daß die Reusenfischerei den übrigen Fang verderbe, stand ja Lübeck nicht allein 66 ). Die Gefahr wog so schwer, daß die Notwendigkeit, sie abzuwenden, über alle Bedenken hinwegsehen ließ.
Man gewinnt aus den Akten durchaus nicht den Eindruck, daß Lübeck an sein Recht glaubte. Dazu sind seine Erklärungen zu widerspruchsvoll 67 ). Sie sind selber das beste Zeugnis dafür daß die Zerstörung der Reusen sich nicht rechtfertigen ließ; denn es ist völlig unmöglich, in den krausen Lübecker Argumentationen 68 ) einen logischen Gedankengang aufzufinden. Der Spiegel der Kritik wirft diese Erklärungen in folgendem Bilde zurück: Wir


|
Seite 42 |




|
Lübecker behaupten, daß der Ort, wo die Reusen gestanden haben, zu unserer Reede gehört, die uns samt dem Travenstrom, von Oldesloe bis in die offenbare See, auf Grund von Privilegien zusteht. Zwar liegt die Reede nicht in der strittigen Gegend, sondern nahe bei Travemünde, aber weil keine Grenze für sie festgesetzt ist, so können wir sie beliebig weit rechnen. Auch enthalten unsere Privilegien eigentlich nichts von einer Reede, und die Stelle des Privilegs von 1188, die wir meinen, spricht überhaupt nicht von Gebietshoheit, doch muß man sie nur richtig auslegen. Ferner berufen wir uns auf actus possessorios, wenn wir auch die Frage offen lassen, was dies für Akte sind und ob sie just auf dem fraglichen Gewässer vorgenommen wurden. Bei alledem sind wir aber weit davon entfernt, die Strandgerechtigkeit am mecklenburgischen Ufer oder ein alleiniges Fischereirecht zu beanspruchen. Denn es ist schwer zu bestreiten, daß Mecklenburg die Strandgerechtigkeit an seiner Küste und damit auch die Hoheit über das Küstengewässer besitzt; wir sagen dies ungern mit klaren Worten, geben es aber implicite zu, und zum Beweise dessen, daß wir das umstrittene Küstengewässer in Wahrheit gar nicht begehren, führen wir an, daß wir die Reusen nicht beschlagnahmt, sondern die Trümmer haben im Wasser liegen lassen. Ferner leugnen wir nicht, daß die Mecklenburger von jeher mit Netzen und Waden auf unserer Reede gefischt haben. Wir gönnen ihnen dies gerne, bestreiten jedoch, daß sie in der "Possession" sind, Reusen auszusetzen. Dies ist der Punkt, auf den es uns ankommt; wir wünschen, daß die Fischerei sich in den Grenzen des Herkommens hält. Außerdem sind unsere Reede oder unser portus sowie die litora des Meeres nach dem römischen Recht 69 ) loca publica, wo nichts angerichtet werden darf, was den usus publicus behindert. Dies taten aber die Reusen, indem sie den Fischfang schädigten und die Schiffahrt gefährdeten.
So sieht der Mantel aus, mit dem Lübeck sein Unrecht zu verdecken sucht. Die Reede, auf die es sich berief, konnte man, wenn man wollte, zu einem sehr vagen Begriff machen, wird doch in einem Lübecker Wetteprotokoll von 1735 sogar das Gewässer der Niendorfer Wiek, vor Niendorf und Timmendorf, als Reede bezeichnet 70 ). Wäre die Ursache des Fischreusenstreites wirklich
( ... )


|
Seite 43 |




|
darin zu suchen, daß Lübeck eine bis zur Harkenbeck reichende Gebietshoheit verteidigen wollte, so müßte man doch auch erwarten, daß diese Grenze in den Akten eine Hauptrolle gespielt hätte. Daß nirgends gesagt wird, die Harkenbeck bilde die Scheide, fällt um so mehr auf, als die Reusen von 1616 und 1617 dicht bei der Bachmündung gestanden hatten. Wo sie standen, ob diesseit oder jenseit der Harkenbeck, ist gleichgültig gewesen. Lübeck würde sie in jedem Falle zerstört haben, zumal da es erklärte, auch am holsteinischen Strande, wo es ja sicher keine Gebietshoheit hatte, Reusen nicht dulden zu wollen 71 ).
Während um Priwall und Dassower See die Jahrhunderte hindurch immer wieder zwischen Mecklenburg und Lübeck gestritten und prozessiert wurde, hat die Stadt auf das Küstengewässer östlich vom Priwall vormals nur bei den Fischreusenstreitigkeiten Anspruch erhoben. Nachdem die Gefahr, die von den Reusen drohte, aufgehört hatte, vernimmt man von diesem Anspruche nichts mehr 72 ). Es blieb bei der mecklenburgischen Strandhoheit. Einige wenige Gewalthandlungen, die aus besonderer Ursache entsprangen und also erklärbar sind, können für den tatsächlichen Bestand eines Lübecker Hoheitsrechtes um so weniger etwas beweisen, als ihnen unzweifelhafte Hoheitsakte und Verfügungen Mecklenburgs bis in die neueste Zeit gegenüberstehen. Gewalthandlungen, die sich den Reusenzerstörungen an die Seite stellen ließen, haben sich auch anderswo ereignet.
Freilich begründet Rörig seine Meinung, es habe eine Lübecker Fischereihoheit auf dem strittigen Gewässer bestanden, nicht nur mit dem Vorgehen des Rates gegen die mecklenburgischen Reusen. Daß aber auch das übrige Material, das er dafür beibringt, nicht Stich hält, haben wir in Archiv II gezeigt, und v. Gierke hat es ebenfalls nachgewiesen. Hier seien noch einige Worte zur Beur-


|
Seite 44 |




|
teilung der Lübecker Fischereiordnungen und zur Bewertung dessen hinzugefügt, daß Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischergruppen über den Fang vor der Strecke Priwall-Harkenbeck von Lübecker Gerichten entschieden wurden.
Es ist nachgewiesen, daß die lübischen Fischereiordnungen nicht auf gebietsrechtlicher Grundlage aufgebaut sind, sondern auch Gewässer betreffen, die unstreitig nicht lübeckisch waren und sind. Die Ordnungen beruhen sowohl auf der Korporationshoheit des Lübecker Rates über die Fischerzünfte wie auf seiner Personalhoheit über alle lübischen Untertanen, was auf dasselbe hinauskommt 73 ). Sie sind aus demselben Rechte abzuleiten, mit dem der Lübecker Rat den Travemünder Fischern in den Jahren 1580 bis 1583 wiederholt befahl, die Fischerei an der holsteinischen Küste fortzusetzen, wo sie damals auf Widerstand stießen 74 ). Genau so hat Rostock im Oktober 1621 - nach dem Erlasse jener herzoglichen Resolution, die das gegen die Warnemünder Seefischer gerichtete Verbot wieder aufhob, - den Fischern durch den Vogt zu Warnemünde befehlen lassen, daß sie die Fischerei an der landesherrlichen Küste "vleißig warten und treiben" sollten, "darmit wir hinwieder zu vollem Besitz gelangen und sie hinferner wegen Mangels der Fische sich nicht zu entschuldigen haben muegen" 75 ). Und wenn der Rostocker Rat gleichzeitig den Vogt wissen ließ, es dürfe nicht wieder vorkommen, daß die Warnemünder sich gegen herzogliche Untertanen ungebührlich betrügen und deren Fischnetze verdürben, so beruht doch eine solche Verfügung, die das Verhalten der Fischer außerhalb des Stadtgebietes betrifft, ebenfalls nur auf personalhoheitlicher Grundlage.
In diesem Zusammenhange sei auf eine Bemerkung hingewiesen, die sich in dem bekannten Bericht des Travemünder Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828 über die Fischerei der Lotsen findet. Sie lautet: "So viel ich weiß, haben unsere Fischer kein Amt noch Zunft; und in der See hat wohl jeder gleiches Recht" 76 ). In der Tat waren die Travemünder Fischer, die mit den Lotsen in Streit lagen, damals nicht zu einer Zunft zusammengeschlossen 77 ),
( ... )


|
Seite 45 |




|
ebensowenig natürlich die Lotsen. Der Kommandeur war also offenbar der Meinung, daß der Lübecker Senat überhaupt nur kraft einer Zunfthoheit Vorschriften über die Seefischerei erlassen könne.
Was ferner die Entscheidungen Lübecker Gerichte angeht, so waren diese bei Streitigkeiten zwischen den Lübecker Fischergruppen über deren fischereiordnungsmäßige Berechtigungen in jedem Falle zuständig. In dem Prozesse, der 1823 ausbrach, weil die Schlutuper Fischer vor Rosenhagen ihre Waden über die Stellnetze der Travemünder, denen sie das Recht, hier zu fischen, bestritten, hinweggezogen hatten, entschied zunächst die Lübecker Wette, dann das Obergericht, schließlich das Oberappellationsgericht. Genau derselbe Fall hat sich aber 1802 in der Niendorfer Wiek ereignet, und auch über ihn entschied die Wette. So ergibt sich aus der Relation des Oberappellationsgerichtsrates Dr. Hach von 1825 zum Urteil über den vorhin erwähnten Prozeß von 1823. In der Relation wird gesagt, es sei von den Travemündern, um zu zeigen, daß die Schlutuper von der Wette nicht so zurückgesetzt würden, wie sie behaupteten,
"ein Wettebescheid vom 25. Sept. 1802 producirt, woraus sich ergebe, daß die Bekl." (Schlutuper) "damals nicht bloß eigene Straflosigkeit, sondern sogar Bestrafung der Kläger" (Travemünder) "verlangt und erhalten hätten, ungeachtet sie angeklagt worden, daß sie die Klr. in der denselben unstreitig zustehenden Strandfischerei in der Niendorfer Wiek - eine Meile über den Mevenstein hinaus 78 ) - turbiret hätten und daß sie, ohne diesen nur Zeit zur Einziehung ihrer Netze zu gönnen, die Waden darüber hingeworfen hätten" 79 ).
Ein Senatsdekret vom 19. Oktober 1803 sprach sich aber hernach für die Travemünder aus, indem es deren Fischerei in der Niendorfer Wiek in Schutz nahm. Und hierzu bemerkten die Schlutuper, daß, wenn der Senat von seiner Befugnis, die Rollen der Ämter zu ändern, Gebrauch mache, dies nur aus Rücksicht auf das Gemeinwohl geschehen könne 80 ). Also ganz entsprechend den


|
Seite 46 |




|
Schlüssen, die aus den Fischereiordnungen zu ziehen sind, ergibt sich, daß Senat und Wette die Berechtigungen der Fischer auch außerhalb des von Rörig angenommenen Reedegebietes, in der Niendorfer Wiek ebenso geregelt und über Streitigkeiten, die hier entstanden, ebenso entschieden haben, wie es in Hinsicht auf die lübische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck geschehen ist.
Gesetzt einmal den Fall, die Lübecker Gerichte hätten ihre Zuständigkeit überschritten oder gar die Niendorfer Wiek und das Gewässer bis zur Harkenbeck als lübisches Gebiet angesehen, was würde dadurch bewiesen sein? Gar nichts. Denn Lübecker Gerichte sind zu keiner Zeit imstande gewesen, über Hoheitsrechte eines fremden Staates zu präjudizieren, am allerwenigsten in einem internen Lübecker Prozeß, von dem Mecklenburg erst nach hundert Jahren etwas erfährt. In Wirklichkeit aber handelte es sich in diesem Fischereiprozeß von 1823-25 gar nicht um eine gebietsrechtliche Beurteilung der strittigen Wasserfläche, sondern nur um die Auslegung der alten Fischereiordnungen, besonders des Vergleichs von 1610. Und in den Entscheidungsgründen des Oberappellationsgerichtes, das ja seinen Sitz in Lübeck hatte und dem der Dr. Hach, ein früherer Lübecker Wetteherr, angehörte, steht folgender Satz:
"Bey der Beurtheilung der . . Beschwerde der Kläger kommt es nun freilich nicht auf die Grundsätze des gemeinen Rechtes an, wonach es sogar zur Injurienklage berechtigt, wenn man andere in der Befischung der See hindern oder stören will
L 13 § 7. L 14 ff. de iniuriis (47.10) coll.
L 2 § 9 ff. ne quid in loco publico (43.8),
sondern es beruht alles zunächst und hauptsächlich darauf, den richtigen Sinn des am 1. Oktober 1610 geschlossenen Vergleiches auszumitteln."
Der hier ausgesprochene Gedanke setzt voraus, daß man das Gewässer vor Rosenhagen als einen Meeresteil betrachtete, wo nach römisch-rechtlicher Anschauung an sich jedermann fischen konnte, nicht aber als ein mit allen Rechtsmerkmalen eines Binnengewässers ausgestattetes Lübecker Gebiet.
Auf den Prozeß folgte der Fischereivergleich von 1826, der nach Rörig ebenfalls zu Unrecht für die Lübecker Ansprüche ins Feld geführt worden ist. Bei der Vorbereitung des Vergleichs wurde eine Ortsbesichtigung veranstaltet. Hieraus aber, wie Rörig 81 ) will, auf eine "Ausübung der Lübecker Fischereihoheit"


|
Seite 47 |




|
zu schließen, ist ganz unmöglich. Warum hätten denn nicht Lübecker Kommissare auch einmal auf die Niendorfer Wiek hinausfahren sollen, um - etwa zur Vorbereitung des Niendorfer Vergleichs von 1817 - das dortige Fischereigebiet in Augenschein zu nehmen? Wir möchten glauben, daß es geschehen ist. Wenn ferner die Schlutuper Fischer in ihrer Eingabe vom November 1825 bemerkten, daß sie bisher "das ausschließliche Recht auf die ganze Strecke vom alten Blockhause bis zur Harkenbeck in Anspruch genommen" hätten 82 ), so ist klar, daß das Wort "ausschließlich" sich nur auf das Verhältnis der streitenden Fischergruppen bezieht, nicht aber auf fremde Fischerei. Da Rörig das "ausschließlich" durch Fettdruck hervorhebt, so will er es offenbar im Sinne eines Lübecker Fischereiregals auslegen. Dies ist aber eine unstatthafte Pressung der Aktenstelle. Ein Vergleich wie der von 1826 hätte zwischen den Lübecker Fischergruppen auch für die Niendorfer Wiek abgeschlossen werden können. Und eben weil der Vergleich nur die lübischen Fischer band, so war es auch nicht nötig, mecklenburgische Gerechtsame in ihm zu berühren. Auch die Fischereiordnung von 1585 und der Vergleich von 1610 erwähnen keine mecklenburgische Hoheit und Mitfischerei, die, wie wir in Archiv II nachgewiesen haben, gleichwohl bestanden, als die Ordnungen erlassen wurden.
Daß man in Lübeck noch über fünfzig Jahre nach dem Abschlusse des Fischereivergleichs von 1826 durchaus keinen rechtlichen Unterschied zwischen der Fischerei am mecklenburgischen Ufer der Travemünder Bucht und der Fischerei in der Niendorfer Wiek machte, ergibt sich deutlich aus dem, was Rörig aus dem Gutachten des Senators Overbeck mitteilt 83 ). Es wird darin der "Seestrand" beider Buchten, d. h. das Gewässer in der Nähe der Küste, in Hinsicht auf die Fischerei gleichgesetzt. Schon die Ausführungen Rörigs lehren, daß dieses Gutachten eines Lübecker Senators, das nur 17 Jahre jünger ist als das Fischereigesetz von 1896 und nur 32 Jahre vor dem Ausbruche des Streites zwischen Mecklenburg und Lübeck (1911) verfaßt wurde, mit den heutigen Lübecker Behauptungen nicht zu vereinbaren ist, sondern ihnen widerspricht. Wir dürfen dies auch daraus schließen, daß der Lübecker Senat nach einer Mitteilung des Staatsarchivs es abgelehnt hat, uns eine Abschrift des Gutachtens zu erteilen, weil es eingehend interne Rechtsverhältnisse behandele. Eine Gebietshoheit Lübecks über das heute strittige Gewässer


|
Seite 48 |




|
hat Overbeck, der nur völkerrechtliche Meeresgrenzen kannte, sicher nicht angenommen. Und wenn Rörig meint, die von Overbeck gezogene Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld habe "nach Ansicht ihres geistigen Urhebers selbst" die Travemünder Reede nicht seewärts abgegrenzt, sondern durchschnitten, so könnte man aus den von ihm mitgeteilten Textstellen des Gutachtens doch höchstens das Gegenteil folgern. Tatsächlich liegt allerdings die Kriegsschiffreede bei 17 m Wassertiefe jenseit der Linie. Und dieses Gewässer rechnete Overbeck zur offenen See. Es kam ihm eben auf eine nautische Reede und Grenzen dafür nicht an. -
Der Anspruch, den Lübeck im 17. Jahrhundert, um die Zerstörung der Fischreusen zu bemänteln, auf das Küstengewässer bis zur Harkenbeck erhoben hat, wird durch seine gleichzeitig gemachten Zugeständnisse, insbesondere das Zugeständnis der mecklenburgischen Strandgerechtigkeit, tatsächlich wieder aufgehoben. Hätte die Stadt auch späterhin dieses Gewässer als ihr Eigentum angesehen, so würde sie hiervon niemals abgewichen sein. Niemals hätte dann der Lübecker Senat im 19. Jahrhundert die Regeln des Meeresvölkerrechts als maßgebend für die Abgrenzung seiner Hoheit anerkennen können. Gebietsrechte auf einer von den lübischen Fischern so oft besuchten Wasserfläche konnten nicht in Vergessenheit geraten.
Daß auch aus dem Fischereigesetz von 1896 nicht eine Absicht Lübecks gefolgert werden darf, das strittige Gewässer in seine Hoheit einzubeziehen, hat jetzt Wenzel in seiner Abhandlung über die Hoheitsrechte in der Lübecker Bucht (S. 89 ff.) überzeugend nachgewiesen. Und dem entspricht ja auch die Handhabung dieses Gesetzes in den Jahren nach seiner Erlassung. Auch die neuerdings, am 21. März 1927 gemachten Zeugenaussagen Dassower Fischer ergeben wiederum, daß die mecklenburgische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck noch nach 1896 nicht von Lübecker Seite beanstandet wurde.
Rörig (III, S. 103) meint, es sei kein Wunder, daß seit der Festsetzung der Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld "die Irrtümer über die Rechtsverhältnisse auf der Reede und der Niendorfer Wiek innerhalb der Lübecker Verwaltung selbst und in den Kreisen der Fischer sich häuften", daß man, "verführt durch die neue Linie, ein Gegenseitigkeitsverhältnis, zunächst zwischen Lübecker und Niendorfer Fischern annahm, und daß dann in den Kreisen der Fischer vorübergehend der Gedanke aufkommen konnte, sie hätten ein Interesse daran, gegenüber gelegentlicher Fischerei Mecklenburger Fischer auch innerhalb der Linie ein Auge zuzudrücken, weil sie ja


|
Seite 49 |




|
auch im mecklenburgischen Küstengewässer jenseits der Harkenbeck fischten: die einfache Übertragung des - an sich schon falschen - Gegenseitigkeitsstandpunktes den Niendorfer Fischern gegenüber auf die mecklenburgischen!" Diese Vorstellung Rörigs aber leuchtet, was die mecklenburgischen Fischer angeht, an sich nicht ein und entspricht in keiner Weise den Tatsachen. Die von Overbeck vorgeschlagene und 1879 vom Lübecker Senat festgesetzte Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld galt in ihrer ganzen Ausdehnung, sowohl für die Travemünder Bucht wie für die Niendorfer Wiek. Ihr Zweck war lediglich, eine Grenze zu bilden, jenseit der die Travemünder Einwohner, die keiner Innung 84 ) angehörten und nicht eigentlich Fischer waren, den Fang betreiben durften, während innerhalb der Linie die, wie Overbeck sich ausdrückte, "festgeordneten Berechtigungen" der lübischen Fischer und der aus dem Fürstentum Lübeck vorlagen. Wenn diese Linie zu etwas hätte "verführen" können, so würde es höchstens die Annahme gewesen sein, daß innerhalb der Linie nur die genannten Fischer fangberechtigt seien. Es hätte also höchstens die Meinung entstehen können, daß die mecklenburgischen Fischer nicht zugelassen, sondern ausgeschlossen werden müßten. In Wirklichkeit aber haben die Lübecker Fischer den Sinn der Linie, die ja nur für die Travemünder "wilde" Fischerei galt, natürlich gekannt.
In keinem Falle sind denn auch die mecklenburgischen Fischer erst nach 1879 in das Gebiet binnen der Linie eingedrungen. Bei dem jüngsten Zeugenverhör in Leipzig vom 21. März 1927 haben drei Dassower Fischer im Alter von 65, 56 und 43 Jahren ausgesagt, daß nicht nur sie, sondern auch ihre Väter und Großväter vor der Strecke Priwall-Harkenbeck gefischt hätten. Und der 41jährige Fischer Post aus Fährdorf auf Poel erklärte bei dem Verhör in Wismar vom 29. September 1924, daß "unsere alten Vorfahren" immer gesagt hätten, es dürfe in der Travemünder Bucht soweit gefischt werden, als das mecklenburgische Ufer reiche. Die jetzt von Lübecker Seite erhobene Behauptung, daß diese Fischerei auf einer stillen Duldung durch Lübeck beruht habe, kehrt die tatsächlichen Rechtsverhältnisse um. Im übrigen kommt es auf die Lübecker Meinung nicht an. Die mecklenburgischen Fischer haben, wie die Zeugenaussagen ergeben, ihre Berechtigung aus der Hoheit Mecklenburgs abgeleitet. Und es kann nicht zweifelhaft sein, daß der mecklenburgische Besitzstand durch diese Fischerei (der Dassower, Wismarer, Poeler, Barendorfer, wenn nicht noch anderer


|
Seite 50 |




|
Fischer) gewahrt worden ist, auch nach 1896. Wenn die lübischen Fischer, wie Rörig meint, wegen des "Gegenseitigkeitsverhältnisses" es für zweckmäßig hielten, "ein Auge zuzudrücken", so könnte dies nur in Hinsicht darauf geschehen sein, daß Mecklenburger Fischer auch den westlichen Teil der Bucht, nämlich das Gewässer vor der Lübecker Küste aufsuchten 85 ).
~~~~~~~~~
Da ja in Rörigs Beweisführung die These, es habe auf dem angeblichen Reedegebiete seit Jahrhunderten eine ausschließliche Fischerei Lübecks bestanden, eine große Rolle spielt, so ist es für den vorliegenden Streit von höchster Wichtigkeit, daß diese These inzwischen auch für die ganze Westküste der "Reede" zusammengebrochen ist.
Denn es ist nicht einmal so gewesen, daß nur Lübecker und Mecklenburger den Fang in der Travemünder Bucht betrieben. Zu ihnen kamen die Fischer aus den vormals domkapitularischen Dörfern des Fürstentums Lübeck hinzu. In dem kürzlich erschienenen ersten Teil der Arbeit von Kühn über den Geltungsbereich des Oldenburgisch-Lübeckischen Fischereivergleichs von 1817 und die Travemünder Reede wird nachgewiesen, daß die Niendorfer Fischer im 18. Jahrhundert an der Westküste der Bucht bis zum Traveauslauf hin gefischt haben 86 ). Sie fischten also innerhalb der Bucht nicht nur am Strande des Domkapitels, sondern auch an dem sich südlich anschließenden Lübecker Strande


|
Seite 51 |




|
bis zur Flußmündung 87 ). Ohne Zweifel ist diese Fischerei älter als die erste von Kühn dafür angezogene Quelle, ein Lübecker Wetteprotokoll von 1729. Es bestehen nicht einmal Gründe gegen die Möglichkeit, daß die Niendorfer Fischer auch vor der mecklenburgischen Küste erschienen sind.
Auch bei den Verhandlungen, die in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts zwischen dem Domkapitel und der Stadt Lübeck über einen Fischereivertrag zur Beendigung der vielfachen Streitigkeiten geführt wurden, ward die hergebrachte Fischerei domkapitularischer Fischer in der Travemünder Bucht berücksichtigt. Dies geht hervor aus den von Kühn abgedruckten beiderseitigen Vertragsentwürfen, dem des Justizrats Detharding, des Vertreters des Domkapitels, von 1771 und dem Gegenentwurf des Lübecker Syndikus Dreyer von 1774 88 ). Detharding sah den Geltungsbereich des abzuschließenden Vertrages in dem ganzen Strande "von der Trave an, bis an die Gosebeck", also bis zum Ende der Niendorfer Wiek. Und auch nach Dreyer sollten beide Parteien die Freiheit "behalten", Netze, Angeln und Schnüre "allenthalben außerhalb der Trave zu setzen". Daß dies nur heißen kann: außerhalb der Travemündung, ist nach den Darlegungen Kühns nicht mehr zu bestreiten. Dagegen machte Dreyer für die Fischerei mit Waden zwar in der Niendorfer Wiek Zugeständnisse 89 ), wollte aber diese Geräte der Gegenpartei nicht bis zur Trave zulassen. Nach ihm sollten die Heringswaden der domkapitularischen Fischer nur "außerhalb des Traven-Strohms jenseits der Travemunder-Rheede" gezogen werden, während er für die Tobiaswaden die einzelnen Strandstrecken bis zur Gosebeck aufzählte, beginnend mit dem Gneversdorfer und dem Brodtener Strande, von denen der erste ganz, der zweite zum Teil an der


|
Seite 52 |




|
Westseite der Travemünder Bucht liegt 90 ). Daß der Gneversdorfer Strand südlich bis zum Möwenstein gerechnet wurde, macht Kühn sehr wahrscheinlich. Und er erblickt den Anfangspunkt für die Heringsfischerei (jenseit der Travemünder Reede), einen Punkt also, der sich mit dem Endpunkte der Reede deckt, gleichfalls im Möwenstein. Die näheren Nachweise hierfür sind in dem zweiten, uns bisher noch nicht vorliegenden Teile seiner Arbeit zu erwarten 91 ).
Wenn Kühn recht hat, so wäre natürlich auch im Niendorfer Fischereivergleich zwischen Oldenburg und Lübeck von 1817 92 ) die Grenzbestimmung "von der Travemünder Rehde an" auf den Möwenstein zu beziehen. Auch in dem Vergleich gilt diese Grenzbestimmung nur für die oldenburgische Fischerei mit Heringswaden und Tobiaswaden, für deren Gebrauch der Strand nördlich vom Mövenstein wegen seiner steinigen Beschaffenheit allerdings ungeeignet ist. Ferner ist die Bestimmung des Dreyerschen Entwurfes von 1774, wonach beide Parteien mit Netzen, Angeln und Schnüren "allenthalben außerhalb der Trave" fischen dürften,


|
Seite 53 |




|
wörtlich in den § 4 des Niendorfer Vergleiches aufgenommen, doch sind Beschränkungen für die oldenburgischen Fischer hinzugefügt. Wir nehmen an, daß Kühn sich über diesen § 4 noch äußern wird. Soviel aber steht schon jetzt fest, daß der Vergleich den Oldenburgern Fischereiberechtigung in dem angeblichen Reedegebiet zubilligt, und es fragt sich nur noch, wieweit diese Berechtigung geht. Noch das Lübecker Fischereigesetz von 1896 sagt in seinem § 4 unter ausdrücklicher Berufung auf den Niendorfer Vergleich: "Durch die Bestimmungen des § 3" (der die Verteilung der einzelnen Fischereibezirke auf die Lübecker Genossenschaften regelt) "wird nicht berührt das vertragsmäßige Mitbefischungsrecht der Oldenburgischen Fischer in der Travemünder Bucht."
Mithin: Die Behauptung Rörigs, daß Lübeck ein ausschließliches Fischereirecht auf der "Reede", von der Harkenbeck bis zum Brodtener Grenzpfahl besessen habe und besitze, ist nicht nur gegenüber Mecklenburg, sondern auch gegenüber Oldenburg unhaltbar. Seine Auffassung des Niendorfer Vergleichs beruht auf der Annahme, daß man die ganze Wasserfläche bis zum Brodtener Grenzpfahl hin zur Reede und sogar noch zur Trave gerechnet habe, was beides völlig ausgeschlossen ist. Und für den Umstand, daß in dem Dreyerschen Vertragsentwurf von 1774 der Gneversdorfer und der Brodtener Strand eigens aufgezählt werden, hat er eine Erklärung zu geben versucht, die man nur als gewaltsam bezeichnen kann 93 ).
Wichtig ist ferner der Nachweis Kühns, daß das Lübecker Domkapitel noch im 18. Jahrhundert an seinem in die Travemünder Bucht hineinreichenden Strande das Strandrecht ausgeübt hat, und zwar, wie die Nachrichten darüber ergeben, unter voller Anerkennung durch Lübeck 94 ). Auch das Fahrrecht des Kapitels wird für den Brodtener Strand in einem Fall von 1757 bezeugt 95 ). Natürlich hat das Kapitel diese Hoheitsrechte bis zu seiner Auflösung (1803) besessen. Und ganz unmöglich ist demgegenüber die auch von Kühn zurückgewiesene Behauptung des Lübecker Baumeisters Soherr von 1775, daß der Brodtener Strand der Stadt gehöre 96 ). Diese Behauptung aber steht auf gleicher Stufe wie die


|
Seite 54 |




|
des Zöllners Tydemann von 1547, wonach Lübeck über Strom und Strand bis zur Harkenbeck sollte zu gebieten haben.
1599 trug der Großvogt des Domkapitels in einer Kapitelsitzung vor, daß "das ganze littus maris vom Travemünder Felde bis an den Gronenberge und Scharboiß dem Capitul zugehörte". Hiermit brachte er nach Kühn (S. 10) "in Verbindung, daß das Domkapitel in possessione iuris piscandi sei, und folgerte aus beidem das Recht eines Untertanen des Domkapitels, überall an der genannten Strandstrecke zu fischen. Diese ,Capituls Gerechtigkeit' wurde dessen Sekretarius beauftragt, den Wetteherren in einer schwebenden Streitsache in Erinnerung zu bringen. Er tat dies mit dem Erfolge, daß der über ein Guthaben des betr. Kapitelsuntertanen in der Stadt verhängte Arrest aufgehoben wurde." Es war eben überall dasselbe: Strandhoheit schloß die Fischereigerechtigkeit ein. Und es sind nur entsprechende Erscheinungen, daß Lübeck auf der einen Seite die Wadenfischerei der domkapitularischen Fischer zu deren Unwillen 97 ) wider alles Recht stark beschnitt und mit Beschlagnahme von Geräten gegen sie vorging, auf der anderen Seite aber ein paar mecklenburgische Fischreusen zerstörte.
~~~~~~~~~
In seinem zweiten Gutachten (S. 294 f.) behauptet Rörig, daß das Schweriner Archiv an einer "gänzlichen Aktenlosigkeit für das fragliche Gebiet" leide im Gegensatze zu dem "durch die Jahrhunderte hindurch lückenlosen Aktenbefund über ungestörten Genuß der Hoheitsrechte in Lübeck." Hoheitsrechte (Mehrzahl)! Wir müssen dem entgegnen, daß wir mit unseren Aktenbeständen zufrieden sind. Sie haben uns ermöglicht, im Archiv II die mecklenburgische Strandhoheit einschließlich des Fahrrechts nachzuweisen 98 ), während von den gleichartigen Rechten, die Rörig für Lübeck glaubte feststellen zu können, nichts übrig bleibt. Und über die Fischerei konnten, solange man keine allgemeinen Fischereigesetze, auch nicht für die Binnengewässer, erließ, Akten - von Privilegien sehen wir dabei ab -immer nur bei Streitigkeiten entstehen; so die Akten über den Fischreusenstreit und das wichtige Rostocker Protokoll von 1618 99 ). Das war überall dasselbe. Was wüßten wir denn von den Fischereiverhältnissen in der Travemünder Bucht während früherer Jahrhunderte, wenn es keine Konflikte gegeben hätte? Gar nichts! Auch die alten


|
Seite 55 |




|
Lübecker Fischereiordnungen sind ja, wie sie selber lehren, aus Zwistigkeiten der Fischergruppen hervorgegangen. Und ebenso steht es um die Niendorfer Wiek. Für die Fischerei der Niendorfer ist das Quellenmaterial nach Kühn (S. 13) "außerhalb der Zone beständigen Streites äußerst dürftig". Wollte man jedoch aus dem Mangel an Streitakten für irgendein Gewässer folgern, daß überhaupt nur eine Partei gefischt habe, so wäre das ein grober Trugschluß.
Daß aber die tatsächlich für verschiedene Zeiten nachgewiesene mecklenburgische Fischerei vor der Strecke Priwall-Harkenbeck auf privater Berechtigung der Fischer beruhte, daß also die Mecklenburger an der Küste ihres eigenen Landes und dennoch in fremdherrlichem Gewässer gefischt hätten, kann nicht angenommen werden. Ein solches Verhältnis wäre von Haus aus sehr unwahrscheinlich. Das Umgekehrte dagegen, die Nutzung des mecklenburgischen Küstengewässers durch Lübecker Fischer, entspricht der auch sonst festgestellten Entwicklung. Überdies haben wir sichere Anzeichen für die mecklenburgische Hoheit in der Gerichtsbarkeit (Fahrrecht) und besonders in dem Strandrecht im engeren Sinne, dem Bergerecht. Es war allgemeine Regel, in der Ausübung des Bergerechts einen Beweis für den Besitz des gesamten Strandregals, d. h. der Hoheit über das Küstengewässer zu erblicken 100 ). Und daß das Bergerecht vor der Strecke Priwall-Harkenbeck Mecklenburg zustand, darüber kann es keinen Zweifel geben. Hier ist das Bild geschlossen bis zu der mecklenburgischen Verordnung vom 17. Dezember 1874 hin, die zur Ausführung der Reichsstrandungsordnung erlassen wurde und ausdrücklich bis zur Grenze des Lübecker Gebietes, also bis zur Staatsgrenze am Priwall gilt. Die Verordnung ist noch heute in Kraft. Sie setzt, wie es das Bergerecht von jeher getan hat, die Hoheit über das Küstengewässer voraus. Und es entspricht ihr, daß Lübeck in seiner eigenen Ausführung zur Reichsstrandungsordnung vom 2. November 1874 den Lübecker Ostseestrand "von der Mecklenburgischen bis zur Oldenburgischen Gränze", also ebenfalls von der Staatsgrenze am Priwall an, rechnete 101 ).
Demgegenüber kommen die ein bis zwei Übergriffe Lübecks, die aus Jahrhunderten bekannt geworden sind, gar nicht in Betracht. Es handelt sich um die Fälle von 1516 und 1750. Über den von 1516 ist unbedingte Klarheit nicht zu gewinnen. Weil


|
Seite 56 |




|
Rörig (III, S. 119 f.) meint, daß Lübeck damals vor Rosenhagen "das Bergerecht", also ein Regal ausgeübt habe, und daß sich der Fall "ganz ungezwungen in die Nachrichten über die Ausdehnung der Reede" einfüge, so müssen wir noch einmal darauf eingehen 102 ).
Mecklenburg beschwerte sich darüber, daß der Travemünder Vogt zwei landrührige Schuten widerrechtlich geborgen habe, eine am Priwall, die andere bei Rosenhagen. Davon kommt die erste hier nicht in Betracht, weil der Priwall strittig war und Streitigkeiten wegen des Strandrechts dort oft vorkamen. Der Lübecker Rat wiederholte in seiner Entgegnung zunächst die mecklenburgische Behauptung über den Strandungsort beider Schiffe. Man habe inzwischen Erkundigungen eingezogen, wonach beide Schuten auf städtischem Strom und Gebiet Schiffbruch erlitten hätten, die eine hart am Hafenbollwerk und am Priwall, die andere jenseit des Bollwerks auf der Reede 103 ). Ist diese letzte Ortsbestimmung richtig, dann ist die mecklenburgische (Rosenhagen) falsch, und das Schiff war auf der Reede, also nicht weit von der Travemündung, schiffbrüchig geworden. Stimmt es aber mit Rosenhagen - und das ist das Wahrscheinlichere -, dann liegt in dem Lübecker Schreiben eine absichtliche Ungenauigkeit vor; denn die Ortsbestimmung "af gensydt Bolwarkes up der Reyde" konnte kein Mensch auf den Rosenhäger Strand beziehen, der vom Bollwerk ungefähr 3 km weit abliegt. Der Lübecker Rat würde dann eben nur die Strandung am Priwall zugegeben, um den zweiten Fall aber herumgeredet haben 104 ). Warum ging er denn im weiteren Verlaufe des Schreibens nur auf sein Recht am Priwall ein, nicht aber auf ein Recht am Strande vor Rosenhagen, obwohl doch der mecklenburgische Protest beide Örtlichkeiten betraf? Das ganze Schriftstück ist so abgefaßt, daß man es in Mecklenburg gar nicht anders verstehen konnte, als daß beide Schuten am Priwall gestrandet sein sollten. Und wie die Erwiderung der Herzöge lehrt, verstand man es in der Tat so 105 ).
Aber auch wenn wir voraussetzen, daß das eine Fahrzeug bei Rosenhagen gescheitert war, so ist das Verhalten Lübecks dennoch begreiflich. Die Seestädte verwarfen das Bergerecht überhaupt und sprachen den Schiffbrüchigen die Befugnis zu, selber für Ber-


|
Seite 57 |




|
gung zu sorgen 106 ). Sie konnten sich dabei auf gewisse Reichssatzungen und päpstliche Verordnungen gegen das Strandrecht stützen, an deren Erlassung Lübeck großen Anteil hatte 107 ). Außerdem lagen für den mecklenburgischen Strand landesherrliche Privilegien vor, die ebenfalls von Lübeck erwirkt waren, und zwar eine allgemeine Aufhebung des Strandrechts von 1220, eine Bestätigung von 1327 und eine weitere Bestätigung von 1351 worin Herzog Albrecht II. speziell den Lübeckern die selbständige Bergung bei Schiffbrüchen an der ganzen mecklenburgischen Küste zugestand und seinen Beamten verbot, sie dabei zu stören 108 ). Demgemäß, wenn auch ohne die mecklenburgischen Privilegien zu nennen, betonte der Lübecker Rat 1516, daß beide Schuten Lübeckern gehörten und von ihnen selbst geborgen seien. Ferner heißt es in dem Schreiben, die Herzöge würden doch nicht verkürzen wollen, was die gemeinen Rechte und die "naturlike Rede" (d. h. die allgemeine Rechtsempfindung) in diesem Falle gestatteten und den Lübeckern auch durch päpstliche und kaiserliche Begnadungen erlaubt sei.
In Wirklichkeit aber war es Lübeck bekannt, daß die mecklenburgischen Landesherren seit dem 15. Jahrhundert irgendwelche Satzungen gegen das Strandrecht ebensowenig mehr gelten ließen wie die Strandungsprivilegien ihrer Vorfahren. Sie vertraten statt dessen das Bergerecht in seiner schärfsten Gestalt und betrachteten schiffbrüchiges Gut als dem Strandherrn anheimgefallen. Von den beiden Herzögen, an die das Schreiben des Rates von 1516 erging, war Heinrich V. ein ausgesprochener Anhänger dieser Auffassung 109 ) und sein Mitregent Albrecht VII. gewiß nicht minder. Dazu kam, daß die Stimmung der beiden Fürsten gegen Lübeck ohnehin nicht die beste sein konnte. Einige Jahre früher (1506-1508) hatte man wegen des Priwalls und Dassower Sees in offener Fehde gelegen, wobei die Lübecker schwere Verwüstungen auf mecklenburgischem Boden angerichtet hatten 110 ). Wurde


|
Seite 58 |




|
die eine Schute bei Rosenhagen von den herzoglichen Beamten geborgen, so sah man in Lübeck von dem Strandgute nie etwas wieder oder doch besten Falles erst nach langen Verhandlungen und gegen Zahlung von Lösegeld. Das wußte natürlich der Travemünder Vogt so gut wie der Lübecker Rat und die Eigentümer des Schiffes. Deshalb griff der Vogt zu oder lieh wenigstens seine Unterstützung bei der Bergung, und deshalb trat der Rat für ihn ein. Hätte dieser, wie die Herzöge verlangten, das Strandgut an Ort und Stelle zurückbringen lassen, so hätten die Eigentümer es büßen müssen. Wie die Dinge lagen, ist es einigermaßen verständlich, daß der Rat die Bergung nicht nur mit allgemeinen Rechtssätzen, Privilegien und Verordnungen rechtfertigte, die ja überhaupt nur für fremdherrlichen Strand Bedeutung haben konnten, von den Herzögen aber notorischer Weise nicht anerkannt wurden, sondern daß er einen nahe der Grenze vorgekommenen Fall auch gebietsrechtlich zu decken suchte, indem er den Strandungsort leise nach dem Priwall zu verschob. Lübecks Recht auf den Priwall setzte der Rat doch nur deswegen in dem Schreiben auseinander, weil es klar war, daß die Hoheit über die Halbinsel auch deren Strand mit umfaßte, auf dem eines der Schiffe ja zugegebenermaßen gelegen hatte. Jenseit des Priwalls aber gehörte das Ufer unbestritten Mecklenburg. Soll man denn annehmen, daß der Rat sich hier - östlich von Priwall - den überfluteten Strand zuschrieb, am Priwall aber nur unter der Voraussetzung des Eigentums am festen Lande? Gewiß nicht, sondern wenn die eine Schute bei Rosenhagen geborgen war, so liegt in dem Schreiben eine Verschleierung des Tatortes vor. Daraus aber kann man nur folgern, daß Lübeck sich östlich vom Priwall kein Bergeregal und also auch das Strandgewässer nicht beilegte. Das hat es auch später nicht getan, nicht einmal in seinen verworrenen und ganz singulären Erklärungen beim Fischreusenstreit. Rörig will den Fall von 1516 einem anderen von 1660 111 ) gleichsetzen. Aber 1660 hat Lübeck mit keinem Worte behauptet, daß die damals bei Rosenhagen verunglückten Schiffe auf seiner Reede gesunken seien. Es sagte, sie seien "nicht auf dem Unsern angetrieben, sondern an Seiten E. F. Durchl. Lande beschädiget", aber "nicht an den Strandt kommen, sondern drey Klafter (5,17 m) tief in See geblieben". Es bestritt also lediglich, daß solche Tiefe noch zum Strande zu rechnen sei. Darin aber liegt das Zugeständnis, daß


|
Seite 59 |




|
der gesamte Strand vor Rosenhagen, trockener und bespülter, zu Mecklenburg gehöre. Ferner ergibt sich aus dem Falle von 1660, daß der Herzog Christian auch noch das tiefe Wasser vor seiner Küste beanspruchte, also eine Lübecker Hoheit darüber nicht in Betracht zog. Dagegen ergibt sich nicht, das Lübeck eine solche Hoheit vor Rosenhagen geltend machte.
Während Mecklenburg 1516 Protest erhob, hat es von dem weiteren Falle von 1750 wahrscheinlich gar nichts erfahren. Wir haben in unserem Archiv jedenfalls nichts darüber gefunden. Nach dem Material, das Rörig vorlegt 112 ), handelte es sich um Holz, das von einem dicht vor der Travemündung gesunkenen Ballastboote 113 ) weggetrieben und "unter Rosenhagen an der mecklenbürgischen Seiten angeschlagen" war. Die Bergung dieses Holzes durch Lübeck ist nach Rörigs eigener, in seinem zweiten Gutachten 114 ) vertretenen Anschauung ein Übergriff gewesen. Denn wenn - seiner Meinung nach - Mecklenburg das Bergerecht über Fahrzeuge zustand, die "angeschlagen" waren, "so daß vom Strand aus die Bergearbeiten vollzogen werden konnten", so hätte dasselbe doch auch für angeschlagenes Holz gelten müssen. Ein Teil des Holzes war schon am Tage vorher am Priwall angetrieben, und der Leutnant Hinzpeter, der über diesen Fall berichtete, hatte es von Soldaten bewachen lassen, die während der Nacht patrouillierten, "soweit die obrigkeitliche Jurisdiction gehet", d. h , wie auch Rörig angibt, bis zum Ostende des damals noch strittigen Priwalls. Der Strand weiter östlich, an den der Rest des Holzes
angeschwemmt wurde, lag also jenseit der lübischen Jurisdiktion. Und diesen Strand mußten doch die Lübecker beim Bergen betreten.
Immer jedoch bleibt zu bedenken, daß in den Fällen von 1516 und 1750 Übergriffe zwar nach der in Mecklenburg herrschenden Auffassung vorlagen, nicht aber nach der Lübecks, das ganz allgemein die Berechtigung in Anspruch nahm, ohne Einmischung der Strandherren selber zu bergen. Dies hat es z. B. 1660 besonders klar ausgesprochen 115 ). Auch konnte sich Lübeck schon allein auf
( ... )


|
Seite 60 |




|
Grund der oben genannten mecklenburgischen Privilegien zu jeder Bergung von schiffbrüchigem Gut am Mecklenburger Strande befugt halten. Auf diese Privilegien berief es sich noch 1712 und 1728 116 ). Dagegen ist es ganz unmöglich, aus den Fällen von 1516 und 1750 ein Lübecker Bergeregal vor Rosenhagen zu folgern. Denn dieses Regal wie die gesamte Strandhoheit hatte immer der, dem die Hoheit über das Ufer gehörte. Das war allgemein Regel. Hierin liegt auch der einzige Grund dafür, daß Lübeck sich 1329 jenen schmalen Landstreifen nördlich von Travemünde bis zur Brodtener Grenze hin übertragen ließ. Als aber ein Teil dieses Streifens von der See weggespült war und infolgedessen das Gneversdorfer Gebiet ans Meer herantrat, nahm das Lübecker Domkapitel hier das Bergerecht in Anspruch 117 ), auch ein Zeichen dafür, daß dieses Regal vom Uferbesitz abhängig war. Wie hätte denn Mecklenburg seine Strandhoheit nicht behaupten sollen, die sogar das schwache Domkapitel an seiner Küste wahren konnte!
~~~~~~~~~
Im 19. Jahrhundert hat dann Mecklenburg früher als Lübeck allgemeine Verordnungen über den Fischereibetrieb am Außenstrande der Ostsee sowie in den Ostsee-Binnengewässern (Salzhaff, Wismarer Bucht usw.) erlassen. Es sind die Verordnungen von 1868 und 1875. In den Gründen für die einstweilige Entscheidung des Staatsgerichtshofes wird, wenn wir die Stelle recht verstehen, bezweifelt, daß diese Verordnungen auch das Gewässer vor der Strecke Priwall-Harkenbeck betreffen. Dies ergibt sich aber schon daraus, daß Mecklenburg um dieselbe Zeit in anderen Verordnungen, die noch nach 1868 erlassen sind, über das strittige Gewässer, und zwar unter Anerkennung durch Lübeck, verfügt hat,


|
Seite 61 |




|
nämlich in der Verordnung vom 10. Oktober 1874 zum Schutze der Dünen des Ostseestrandes bei Rosenhagen, Barendorf usw. sowie in der Ausführungsverordnung zur Reichsstrandungsordnung vom 17. Dezember 1874 118 ). Unmöglich konnte Mecklenburg das strittige Gewässer das eine Mal als seiner Hoheit unterworfen betrachten, das andere Mal aber nicht 119 ). Und ebensowenig konnte Lübeck diese mecklenburgische Hoheit bald anerkennen, bald bestreiten.
Die Seefischereiverordnung von 1868 wird durch die von 1875 revidiert und außer Kraft gesetzt, ebenso die Verordnung von 1875 durch die von 1891. Diese letzte Verordnung regelt den gesamten Fischereibetrieb sowohl in den Binnengewässern wie in den Küstengewässern. Der Fischereibetrieb in den Küstengewässern aber umfaßt nach § 1 "die Fischerei am Außenstrande der Ostsee" sowie in den Ostsee-Binnengewässern. Der Ausdruck "Außenstrand der Ostsee" wird schon in den Verordnungen von 1868 und 1875 gebraucht. Mithin ist gar kein Zweifel, daß die Verordnung von 1891 denselben Geltungsbereich hat wie die Regelungen von 1868 und 1875. Auch die Verordnungen zum Schutze der Fischerei auf Plattfische von 1904 und 1913 betreffen den Fang "an der ganzen Ostseeküste Unseres Landes". Wäre hier die Strecke Priwall-Harkenbeck nicht mitgerechnet worden, so hätte dies unbedingt ausgesprochen werden müssen 120 ).


|
Seite 62 |




|
Zwischen diese mecklenburgischen Verordnungen fällt zeitlich das Lübecker Fischereigesetz von 1896. Wenzel (S. 89 ff.) hat im einzelnen gezeigt, daß es nicht so auszulegen ist, als ob die vorher von Lübeck anerkannten völkerrechtlichen Grundsätze darin durchbrochen werden sollten. Hierzu stimmt auch die 1879 vom Senator Overbeck vertretene Rechtsanschauung. Und weil Overbeck die völkerrechtliche Ausdehnung der Meereshoheit (Kanonenschußweite) noch auf "etwa eine Seemeile vom Ufer" berechnete, so muß wohl die ebenfalls in der Lübecker Verwaltung zeitweilig vertretene Anschauung, daß diese Ausdehnung drei Seemeilen betrage 121 ), erst nach 1879 aufgekommen sein.
Freilich hat Lübeck sich später auf Grund des Fischereigesetzes von 1896 eine alleinige Hoheit in der Travemünder Bucht zugeschrieben. Da wir aber in der Grenzverlegung von 1923 ein Beispiel dafür haben, wie schnell und unter wie brüchiger Begründung Lübeck sich zu entschließen vermag, Hoheitsrechte in Anspruch zu nehmen, so könnte die nach 1896 bemerkbare Wandlung in seiner Ansicht über das, was ihm in der Travemünder Bucht zusteht, sich allerdings schon aus der mißverständlichen Fassung des Gesetzes von 1896 selbst erklären lassen. Aus der in § 2 gegebenen Umschreibung des Fischereibezirkes III, wonach dieser hauptsächlich durch "die Travemünder Bucht bis zur Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld" gebildet werden soll, vermochte ja sogar die Meinung zu entstehen, daß hier auch noch die Niendorfer Wiek, also die gesamte Wasserfläche binnen der bezeichneten Linie gemeint sei 122 ). Leichter jedenfalls ließ sich aus dem Gesetze eine Einbeziehung des mecklenburgischen Gewässers bis zur Harkenbeck folgern.
Indessen spricht aus dem ganzen Verhalten Lübecks nach 1896 zunächst eine große Unsicherheit. Weder gelang es, die mecklenburgischen Fischer zu verdrängen, noch wurde ihnen gegenüber ein irgendwie konsequentes Verfahren beobachtet, nicht einmal nach 1911. Und höchst bezeichnend ist es, daß der Lübecker Senat seine Erwiderung auf die Anfrage der mecklenburgischen Regierung von 1911 solange hinauszögerte, bis ihm ein Archivbericht vorlag, in dem nur der erste (ungedruckte) Bericht Rörigs erblickt werden kann 123 ). Mithin ist zu schließen, daß Lübeck seine eigentliche Rechtsüberzeugung erst aus den Rörigschen Darlegungen geschöpft hat. Sehr wünschenswert aber wäre es zu erfahren, welches denn "die letzten gutachtlichen Äußerungen" sind, die Rörigs "unge-


|
Seite 63 |




|
druckten vom Jahre 1912 vorausgingen" und die noch ganz von völkerrechtlichen "Vorstellungen beherrscht waren" 124 ). Von wem und wann sind diese gutachtlichen Äußerungen verfaßt? Jedenfalls können wir nur wiederholen, was wir schon oben einmal gesagt haben: Es ist ausgeschlossen, daß Hoheitsrechte, wie Lübeck sie seit Jahrhunderten vor der Strecke Priwall-Harkenbeck besessen haben will, in Vergessenheit gerieten. Und wer hätte denn je seine Rechte eifriger gewahrt als Lübeck!
Schließlich bemerken wir, daß es unseres Erachtens für die endgültige Entscheidung des Streites auf die Zustände der letzten Zeit überhaupt nicht ankommen kann. Denn eine Verjährung der mecklenburgischen Rechte ist ja unter keinen Umständen eingetreten. Mithin ist die Auffassung und das Verhalten Lübecks in der Zeit nach 1896 nur seinen Behauptungen gleichzusetzen, die es beweisen muß. Durch die Rörigschen Gutachten aber wird nichts bewiesen, weder Lübecker Hoheitshandlungen auf dem strittigen Gewässer noch die für die Beanspruchung eines Gebietes notwendigen Grenzen. Im Hinblick auf die Seegrenze hat übrigens Lübeck in seinem dem Staatsgerichtshofe eingereichten Schriftsatze vom 25. Juli 1925 unter VI behauptet, daß die Änderung der Grenzlinie der Travemünder Reede, die es durch die Bekanntmachung vom Januar 1923 vorgenommen habe, "nur eine sachlich geringfügige geographische Berichtigung" enthalte. Indessen lehrt ein Blick auf die Kartenskizze 2 bei Rörig I, daß diese Behauptung ganz unzutreffend ist. Das 1923 hinzugenommene Gebiet, das jenseit der Linie Harkenbeck-Haffkruger Feld liegt, ist ja nur etwa um ein Viertel kleiner als die ganze Travemünder Bucht.
Auch die auf dem Termin in Leipzig am 21. März d. J. übergebene Lübecker Karte mit der blaugefärbten Plate erkennen wir in keiner Weise an. Es ist über diese Karte noch Verschiedenes zu sagen, doch wollen wir uns einen Nachtrag zur Reedelage vorbehalten, bis wir den zweiten Teil der Abhandlung von Prof. Kühn über den "Geltungsbereich des oldenburgisch-lübeckischen Fischereivergleichs von 1817 und die Travemünder Reede" in Händen haben.
~~~~~~~~~


|
Seite 64 |




|
Exkurs.
Zum Meeresfischereiregal in Preußen.
Über dieses Regal vgl. v. Gierke, S. 47 f., und die von ihm zitierte Abhandlung v. Brünnecks, Zur Geschichte des altpreußischen Jagd- und Fischereirechts, Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., Bd. 39, S. 120 ff. Rörig (III, S. 57, Anm. 12) ist auf diese Abhandlung und das preußische Seefischereiregal eingegangen und glaubt, auch hier wieder eine Sonderbildung feststellen zu können. Indessen liegen die Dinge doch so, daß die Zustände, die v. Brünneck für das preußische Küstengewässer nachweist, in die jetzt für die ganze deutsche Ostseeküste ermittelten Rechtsverhältnisse eingeordnet werden müssen. Wenn v. Brünneck meint, es sei daraus, daß das Privileg Kaiser Friedrichs II. für den deutschen Orden von 1226 die Landeshoheit nicht nur am Binnenlande, sondern auch am vorgelagerten Meere übertrug, "allein noch nicht die Schlußfolgerung zu ziehen", daß ein Fischereiregal im Küstengewässer entstanden sei, so ist das natürlich richtig. Denn die Übertragung der Meereshoheit beweist noch nicht die tatsächliche Ausübung eines Fischereiregals. Dieses ist erst aus den preußischen Urkunden zu folgern. Der weiteren Bemerkung v. Brünnecks aber, daß außer dem Privileg noch andere Umstände hätten hinzukommen müssen, um die Ausdehnung des landesherrlichen Binnenfischereiregals in Preußen auf die Küstengewässer "zu ermöglichen und zu rechtfertigen", nicht mehr zuzustimmen. v. Brünneck erörtert dann, daß man im Mittelalter die beiden preußischen Haffe weder als Landseen noch als eine Erweiterung der darin mündenden Flüsse betrachtet, sondern sie mit den jenseit der Nehrungen belegenen Küstengewässern "unter dem einen Begriff Meer" zusammengefaßt habe. "Innerhalb dieses weiteren Gattungsbegriffs" habe man nach der Beschaffenheit des Wassers zwischen "mare recens" und "mare salsum" unterschieden. Weil die Haffe durch das Pillauer und dem Memeler Tief mit dem Meere in Verbindung ständen, so habe es nahe gelegen, die Küstengewässer ihnen rechtlich gleichzustellen. Wichtiger aber noch als die geographische Lage der beiden Haffe "und das darin beruhende nahe Verhältnis, in dem sie sich zur Ostsee und den Küstengewässern befanden", sei ein rechtsgeschichtlicher Vorgang gewesen, der zur Zeit, als der Orden Preußen eroberte, im benachbarten Pommerellen "entweder schon vollendete Tatsache geworden war oder doch im Begriffe stand, verwirklicht zu werden". Gemeint ist das Meeresfischereiregal der Herzöge von Pom-


|
Seite 65 |




|
merellen, das v. Br. mit einer Urkunde von 1257 belegt. Nach diesem Beispiel habe man sich in Preußen gerichtet und sich dabei auf das Privileg von 1226 berufen können. v. Br. hat aber nicht, wie Rörig meint, die Ansicht ausgesprochen, daß das Regal zunächst auf die Haffe und dann auf das Wasser davor ausgedehnt worden sei. Sondern seine Darlegungen können nur so verstanden werden, daß er glaubte, es sei das Binnenfischereiregal auf Haffe und Küstengewässer zugleich übertragen worden. Die rechtsgeschichtliche Beurteilung der Haffe durch v. Brünneck widerspricht der Ansicht Rörigs, daß die Haffe, im Gegensatze zum Meer, wie Binnengewässer behandelt seien.
Nun kommt es für unsere Zwecke nicht darauf an, seit wann das preußische Meeresfischereiregal unter noch unfertigen Verhältnissen ausgeübt sein mag, sondern nur darauf, daß es tatsächlich festzustellen ist. Die Entwicklung, mit der v. Brünneck rechnet, wäre möglich, ist aber nicht bewiesen. Es hindert nichts, anzunehmen, daß das Seefischereiregal ebenso alt ist wie das Binnenfischereiregal, so daß man nicht von diesem auszugehen braucht. Der Hauptgrund für v. Brünnecks Auffassung ist ja die Vermutung, daß der Orden das Meeresfischereiregal nach dem Muster Pommerellens ausgebildet habe. Es erklärt sich aber doch diese Vermutung daraus, daß v. Br. außer dem preußischen allein das Regal der Herzöge von Pommerellen bekannt geworden war, nicht aber der Rechtszustand an der Ostseeküste weiter westlich. Sonst würde er sicher auf diese verwiesen haben, so auch auf Pommern für den Unterschied zwischen "mare recens" und "mare salsum", der sich in pommerschen Urkunden genau so findet. Das
jetzt für die ganze deutsche Ostseeküste zusammengestellte Material läßt ja die mittelalterlichen Rechtsverhältnisse des deutschen Küstenmeeres in neuem Lichte erscheinen. An diesem Material aber redet Rörig immer vorbei, ohne es ernstlich anzupacken. Mit "Sonderbildungen" ist da nicht mehr auszukommen. Wir sind überzeugt, daß v. Brünneck, wenn er noch lebte, uns zustimmen würde; denn was er für Pommerellen und Preußen aus Urkunden über Fischereiverleihungen geschlossen hat, hätte er auch für Pommern, Mecklenburg usw. aus Urkunden gleicher Art gefolgert. - Die weiteren Ausführungen Rörigs erklären sich aus seiner Neigung, Rechtsentwicklungen aus allgemeinen Vorstellungen abzuleiten. Die Quellen widersprechen dem aber. Wie schließlich das preußische Seefischereiregal durch den Hinweis auf Caspar, Hermann von Salza, in Zweifel gezogen werden soll, wissen wir nicht. Die Darlegungen v. Gierkes über dieses Regal bleiben in jedem Punkte unerschüttert.
~~~~~~~~~


|
Seite 66 |




|
Anhang.
Auf die Exkurse a-d bei Rörig III, S. 29 ff., in jedem Punkte zu erwidern, sehen wir uns nicht veranlaßt. Wir bemerken nur:
zu a) Es ist unvorsichtig, daß Rörig sich zum Beweise der Wissenschaftlichkeit seiner Gutachten auf seine "vollkommen unabhängige Stellung beiden Parteien gegenüber" beruft, zu der unsere "dienstliche Abhängigkeit" von einer der Parteien im "seltsamen Gegensatz" stehe. Denn Rörig verteidigt doch nur immerfort, was er als Lübecker Archivar behauptet hat. Eine "dienstliche Abhängigkeit" bei der Gestaltung von Archivberichten hat es in Mecklenburg selbstverständlich nie gegeben, und es liegt uns fern anzunehmen, daß es in Lübeck je anders gewesen sein könnte. - Für die Fischerei vor 1500 verweisen wir auf unsere Ausführungen in Archiv II, S. 137 ff., die Rörig noch nicht vorlagen, als er den Exkurs schrieb, und auf die er später nichts entgegnet hat (vgl. Rörig III, S. 61, Anm. 15 am Schlusse). Das Buch von Giesebrecht, Wendische Geschichten, ist zwar schon von 1843, aber noch sehr brauchbar. Leider hat Rörig nicht das richtige Zitat untersucht. Es kommt nicht auf die Note 1 bei Giesebrecht I, S. 16, sondern auf die Note 2.
zu b) Auf Rörigs Behauptung, daß wir in unserem ungedruckten Erachten von 1923 "oberflächlich" geurteilt hätten, entgegnen wir, daß das Erachten zwar ergänzt und vertieft werden konnte, sich aber in den wesentlichen Punkten bewährt hat. Der Aufsatz von Techen über das Strandrecht an der mecklenburgischen Küste, Hans, Geschbl. 12 (1906), ist nach seinem Erscheinen unserem Archiv nicht unbekannt geblieben, wie die Besprechung im Jahrbuche für mecklenburgische Geschichte 72, Jahresbericht, S. 19 f. beweist. Wir haben uns der Arbeit 1923 bedauerlicherweise nicht erinnert. Aber das Dogma, daß man keine Literatur übersehen dürfe, gilt immer nur solange, bis der Dogmatiker selber einmal dagegen verstößt. Da Rörig sich auf den Aufsatz besonders beruft, so hätte er auch wohl erwähnen können, daß Techen zwar für die Zeit bis zum Ende des 15. Jahrhunderts allen gedruckten Quellenstoff benutzt hat, für die spätere Zeit aber, wie er ausdrücklich


|
Seite 67 |




|
feststellt (S. 291), nur die Akten des Wismarer Ratsarchivs über die Strandungsverhältnisse in der Wismarer Bucht. Er konnte und wollte also für die Zeit nach 1500 nur einen Ausschnitt geben. Die Hauptakten für die ganze mecklenburgische Küste liegen in Schwerin, und sie schaffen über das Strandrecht in mancher Hinsicht erst Klarheit.
zu c am Ende) Die Wismarer Zeugenaussage von 1597 (Archiv II, Anlage I, S. 194, Zeuge 6): "Außer dem großen Bohme heiße es uf der Reide oder im Tiefe" ist wohl nicht so zu verstehen, als ob der Zeuge "das Wismarer Tief selbst eine Reede" habe nennen wollen, sondern er wollte wahrscheinlich sagen, außerhalb des Hafenbaums komme zunächst die Reede, dann das Tief. Der Ausdruck "Reede" erscheint hier ja ganz vereinzelt; die übrigen Zeugen sprachen nur vom Wismarer Hafen und Tief, und manche unterschieden ausdrücklich zwischen beiden. Im übrigen kommt es auf solche Benennungen nicht an. Und wenn der Zeuge 10 meinte, ein Hafen sei dort, wo man Schiff und Gut bergen könne, wie es im Wismarer Tief möglich sei, und dann hinzufügte: Vor Lübeck und Rostock heiße es eine Reede, so ist es doch ganz ausgeschlossen, in solchen Bezeichnungen, die eben nichts sind als Namen für Wasserflächen, auf denen man ankerte oder ankern konnte, einen Beweis für gebietsrechtliche Sonderbildungen zu erblicken. Auch erklärte der Zeuge 4 (Archiv II, S. 197), wenn die Schiffe sich vor anderen Städten außerhalb des Hafenbaumes befänden, so sage man, "daß sie in der See liegen".
zu d) Rörig hat behauptet, daß die Seestädte am landesherrlichen Strande Mecklenburgs bis ins 16. Jahrhundert eine Art von Herrschaft ausgeübt hätten, und erklärt dies mit dem politischen Übergewicht der Städte über die Territorien während des ganzen Mittelalters. Dem gegenüber haben wir auf die starke Stellung der Herzöge im 14. und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts hingewiesen, die eine anerkannte geschichtliche Tatsache ist und sich auch im Verhältnisse zu den Städten geltend machte. Hierüber kann man sich aber nicht aus der Rörig in die Hände geratenen Geschichtlichen (d. h. rechtsgeschichtlichen) Übersicht unterrichten, die Böhlau seinem Mecklenburgischen Landrecht (I, 1871) vorangestellt hat. Diese Übersicht ist ohnehin zu einem guten Teil veraltet. Es hat mit dem herzoglichen Strande nicht das Geringste zu tun, daß Rostock sich im Verhältnisse zu anderen Territorialstädten innerhalb seines eigenen Gebietes großer Selbständigkeit erfreute, kraft seiner immer wieder von ihm betonten landesherrlichen Privilegien. Diese hat Herzog Albrecht II.


|
Seite 68 |




|
1358 durch den Verkauf der hohen Gerichtsbarkeit gekrönt. Daß aber Albrecht II. stärker war als Rostock, mag ja wohl auch Rörig nicht bestreiten wollen. Innere Selbständigkeit einer Stadt ist überhaupt noch kein Beweis für politische Macht. Und trotz seinen Vorrechten ist Rostock, ebenso wie Wismar, stets eine erbuntertänige Stadt geblieben, hat dies auch selber nie geleugnet. - Wegen der Enthauptung des Schwaaner Vogtes schließlich hätte Rörig sich mit unserer Anmerkung 96 in Archiv II (S. 59) auseinandersetzen sollen, nicht aber uns auf Koppmanns Geschichte der Stadt Rostock verweisen dürfen, die wir in der Anmerkung selbst und auch sonst mehrfach zitiert haben. Wir haben die Strand-These Rörigs überdies im einzelnen widerlegt. Sie kann in keiner Weise mehr in Betracht kommen, wenn sich auch Rörig (III , S. 121, Anm. 114) noch darauf berufen will.
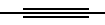


|
[ Seite 69 ] |




|



|


|
|
:
|
III.
Die Lage
der Travemünder Reede
von
Werner Strecker.
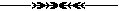


|
[ Seite 70 ] |




|
Erwiderung des Mecklenburg=Schwerinschen
Geheimen und Haupt = Archivs auf das
Erachten Prof. Dr. Rörigs vom 20.
April 1927:
"Die endgiltige
Lösung des Reedeproblems."
*
)
5. Archivgutachten vom 26. September 1927 für das Mecklenburg=Schwerinsche Ministerium des Innern.


|
Seite 71 |




|
Inhalt.
-
Die neuen Quellen über die Reedelage von
1784-1801
Die neuen Quellen. Kartenbeilage 3 zu Rörig IV (Hagensche Karte) S. 73 - 74. Berechnung des Lübecker Fadenmaßes und der 1784 genannten Entfernungen zwischen Bollwerk und Reede, S. 74 - 76. Besprechung der Hagenschen Karte, S. 76 - 79. Anwendung der Quellen von 1784 und 1801 auf die französische Seekarte von 1811 und die dänische von 1860, S. 79 - 80. Desgl. auf die neueste Admiralitätskarte (siehe Kartenbeilage), S. 80 - 82. Streitfall von 1784 S. 82 - 85. Quellen von 1792 und 1731, S. 85 bis 86. Angaben der französischen Karte, Punkt B der Sahnschen Skizze von 1823, S. 87 bis 88. "Reedekopf", Wohlersche Karten, S. 88 bis 89. Anweisungen von 1855 und 1875, S. 90 bis 91. Angaben der heutigen Lübecker Sachverständigen, S. 91 - 94. Ankergrund der inneren Bucht, S. 94 f. Wismarer Reede, S. 95. Mecklenburgische Verordnung von 1925, S. 96. Keine Reede bei Rosenhagen, S. 96 f. Angebliche "Platenreede", S. 97. Irrtümliche Meinung Rörigs über die Lage der Leichterreede, S. 98 f. Quarantänereede S. 99. Ballastordnung von 1787, S. 100. Eigentliche Reede und Reede im geographisch-nautischen Sinne, S. 101 - 104. -
Die Quellen der Akten über
Fischereistreitigkeiten
Fall von 1823, Außenreede, S. 105 - 109. Raumbegriffe im Prozeß von 1823-1825, Begriff der nautischen Reede in der Aussage von 1547 und im Fischereivergleich von 1610, S. 109 bis 114. "Binnen de Reide" und "buten de Reide", S. 114. Aus der Bezeichnung "Reede" keine Gebietshoheit ableitbar, S. 114 f. Punkt A der Sahnschen Kartenskizze von 1823, S. 115 f. Die beiden "Gruppen" unserer Einwendungen gegen Rörigs Beweisführung. S. 116 - 118.
Exkurs. Zur Beurteilung der älteren Seekartenwerke
Nachtrag
Beilage. (Skizze zur Lage der Travemünder Reede um 1800.)


|
[ Seite 72 ] |




|


|
Seite 73 |




|
I. Die neuen Quellen über die Reedelage
von 1784-1801.
In dem neuesten Erachten Prof. Dr. Rörigs vom 20. April 1927 (Nochmals Mecklenburger Küstengewässer und Travemünder Reede. Teil IV. Die endgiltige Lösung des Reedeproblems. Zitiert im Folgenden: Rörig IV) werden für die Reedelage wichtige Quellen aus der Zeit von 1784-1801 vorgebracht. Sie bestehen
- in den Akten über den Fall des englischen Kohlenschiffes von 1784, zumal dem damals von der Frau des Lotsenkommandeurs Scharpenberg erstatteten Bericht, worin die Entfernung der Reede vom Bollwerk in Kabeltau- und Faden-Längen angegeben wird 1 ),
- in den Kartenskizzen und Mitteilungen des Lotsenkommandeurs Wohlers von 1788 und 1801, woraus sich Fadentiefen der Reede ergeben 2 ).
Schwerlich wird ein Leser des Erachtens den Eindruck gewinnen, als ob dieses Material zu den bisherigen Behauptungen Rörigs über die Reedelage stimme. Selbst wenn man die von Rörig vorgenommene Umrechnung der Fadenmaße in Meter und die danach auf der Karteibeilage 3 des Erachtens von Herrn Stabsingenieur Hagen bestimmten Reedelinien gutheißen wollte - was unter gar keinen Umständen möglich ist - , so würde man doch einräumen müssen, daß hier von einer Reede vor Rosenhagen oder auch nur annähernd in der Höhe dieses Dorfes schlechterdings nicht mehr gesprochen werden kann, sondern daß der Ankerplatz im westlichen Teile der Travemünder Bucht und fast vollkommen außerhalb des mecklenburgischen Gewässers liegt. Es handelt sich hier nicht, wie Rörig meint, um "subtile Verfeinerungen" der Kartenskizze 2 seines ersten Erachtens, sondern um einen vollkommenen Umsturz dessen, was aus dieser Kartenskizze zu entnehmen war.


|
Seite 74 |




|
Wir sehen auf der neuen Kartenbeilage 3, die wir in Zukunft die Hagensche Karte nennen wollen 3 ), den Verlauf der Majorlinie im Jahre 1810 eingetragen und parallel zu ihr zwei kurze Striche, die das 1784 in dem Scharpenbergischen Bericht bezeichnete Reedegebiet begrenzen sollen. Ferner finden wir auf der äußeren Grenzlinie drei Anker; sie sollen den Angaben und Karten des Lotsenkommandeurs Wohler entsprechen.
Auf die genannten Grenzstriche und auf die Ankerlage kommt es an. Alles andere ist Nebensache. Nach den Abgrenzungen auf der Hagenschen Karte liegt die Reede um die Majorlinie herum, der Grenzstrich seewärts mit den Ankern gut 300 m dahinter. Es würde hierin, wenn man die Reedelage an sich, ohne Berücksichtigung der Majorlinie, betrachtet, für die Zeit um 1800 nicht einmal ein so wesentlicher Unterschied zu unseren Berechnungen in Archiv III zu erblicken sein, wie Rörig meint, doch müssen wir die Karte berichtigen. Dazu bedarf es einer Betrachtung der Quellen, auf denen sie hier beruht. Und weil es sich in diesen Quellen um Maßangaben nach Faden handelt, so muß zunächst die Länge des Fadens noch einmal festgestellt werden.
Nach Rörig (IV, S. 39) betrug der in Lübeck bei Seemessungen benutzte Fuß, wie aus Umrechnungen von 1875 hervorgehe, 0,2876 m 4 ). Es sei also der Lübecker Fuß. Damit wird zugegeben, daß wir diesen in Archiv III, S. 18 genau richtig berechnet haben (0,28762 m). Und weil der Faden nun einmal 6 Fuß lang ist, so hätten wir eigentlich das weitere Zugeständnis erwarten können, daß die von uns ermittelte Länge des Lübecker Fadens (1,72572 m) ebenfalls richtig und überhaupt allein möglich ist. Statt dessen erklärt Rörig, sie sei "durchweg falsch". Er beruft sich auf die Angabe des Lotsenkommandeurs Wohler von 1801, wonach die Tiefe auf der Reede, "wo die Schiffe gewöhnlich ankern" , "beinahe 5 Faden oder 30 Fuß" betrage. Hier würden - so behauptet Rörig - "30 Fuß nicht etwa 5 Faden gleichgesetzt", sondern sie seien "beinahe 5 Faden". Also sei der Faden etwas größer als sechs Fuß. Indessen ist es doch ganz selbstverständlich, daß die Einschränkung "beinahe" sich auf beide Größen bezieht und daß Wohler die 5 Faden den 30 Fuß gleichsetzte, indem er die Fadenlänge noch einmal in dem gewöhnlichen Grundmaß, nämlich dem Fuß, ausdrückte. Ebenso würden wir heute sagen: 5 preußische Faden oder 9,41 m. Demgemäß hat denn auch Wohler auf seiner Kartenskizze von 1788 eine Tiefe von 5 Faden dort angegeben, wo auf seiner Karte von 1801 30 Fuß stehen. Er wollte also sagen:


|
Seite 75 |




|
Die Tiefen betragen nicht ganz 5 Faden. Übrigens war es auch nicht gut möglich, daß die Schiffe überall genau auf 30 Fuß oder 5 Faden Wasser ankerten; denn die Tiefen wechseln in der fraglichen Buchtgegend schnell.
Weil wir ja wissen, daß man in Lübeck bei Seemessungen den Lübecker Fuß und also auch den Lübecker Faden zugrunde legte, so kann kein anderer Faden in Betracht kommen, auch nicht der englische. Rörig nimmt nun "die mindest mögliche Fadengröße" zu 1,80 m an und begründet dies damit, daß Wohler nebenher auch in Klaftern gerechnet habe und daß man dieses alte Naturmaß mit 1,80 m wiedergebe. Aber Klafter ist nur ein anderer Ausdruck für Faden, und Abrundungen wie die des Klafters auf 1,80 m konnten erst entstehen und sind auch erst entstanden, seit man die alten Längenmaße mit dem Meter und dem Dezimalsystem in Einklang zu bringen suchte. Vorher rechnete man nach Zoll, Fuß, Ellen, Faden (Klafter). Es ist natürlich unmöglich, daß man diese Maße mit dem Meter in Verbindung brachte, das es, als Wohler seine Karte von 1788 zeichnete, überhaupt noch nicht gab und das noch sehr lange in Lübeck gar nicht verwendet wurde. Es wäre dies gerade so, als ob wir unsere heutigen Maßeinheiten nach einem unbekannten oder ungebräuchlichen System abrunden wollten. 1,80 m sind für uns heute ein Begriff, für den Lotsenkommandeur Wohler war es keiner. Der lübische Faden betrug also 6 Fuß = 1,72572 m. Daran ist festzuhalten 5 ).


|
Seite 76 |




|
Wenden wir uns nun zunächst der Quelle von 1784 zu. Es berichtete damals die Frau des Lotsenkommandeurs Scharpenberg, daß "alle Schiffe" 5-6 Kabellängen vom Bollwerk lägen, "wo alldorten die Rehde heißt", und daß eine Kabeltau-Länge 130, 140 Faden betrage. Auch hier können nur Lübecker Faden gemeint sein, umsomehr, als die Länge eines Kabeltaus sonst nur zu 120 Klaftern gerechnet wurde 6 ). Die geringste Entfernung vom Norderbollwerk 7 ) betrug also 650 Faden = 1121,7 m (rund 1120 m), die größte 840 Faden = 1449,6 m (rund 1450 m). Statt der 840 Faden setzt Rörig (IV, S. 42) 900 an, aber zu dieser Vergrößerung besteht nicht der geringste Anlaß; ebenso gut könnte man nach unten, auf 800, abrunden. Rörig kommt so, da er ja einen Faden von 1,80 m annimmt, auf 1620 m als größte Entfernung vom Norderbollwerk; die kleinste beträgt nach ihm 1170 m 8 ). Dem stellen wir die soeben von uns errechneten Abstände vom Bollwerk (1120 und 1450 m) entgegen.
Nun liegen auf der Hagenschen Karte (Kartenbeilage 3 bei Rörig IV) beide Reedegrenzstriche so gut wie ganz im festen Sektor des heutigen Leuchtfeuers. Diese Lage der Reede entspricht den Angaben des Travemünder Lotsenkommandeurs und des Lübecker Hafenkapitäns vom Januar und Februar 1927 9 ). Wenn auch diese Sachverständigen als Reedegebiet nur den Teil des Sektors bezeichnen, der jenseit der 10-m-Tiefengrenze liegt 10 ), so wird doch auch dieseit dieser Grenze, wo die Reede nach den Quellen von 1784-1801 zu suchen ist, das tiefste Wasser von den Lichtstrahlen des Sektors umfaßt. Man wird also annehmen dürfen, daß auch die Reede um 1800 im wesentlichen innerhalb des jetzigen Leuchtfeuersektors lag. Nur für dieses Gebiet passen auch die Angaben der Kartenskizze von 1773 (Archiv III, S. 31 ff.), abgesehen von den 4-Faden-Tiefen, die ja am weitesten travewärts liegen und noch etwas über den Sektor hinausgehen. Sogar bei 1450 m vom Norderbollwerk, also der größten 1784 genannten


|
Seite 77 |




|
Entfernung, kommt man auf der Admiralitätskarte außerhalb des Sektors nicht mehr auf 5 Faden, wo doch die Schiffe nach dem Zeugnisse des Lotsenkommandeurs Wohler ungefähr ankerten 11 ).
Innerhalb des Sektors wird die Reede auf der Hagenschen Karte im Nordwesten begrenzt durch eine Peillinie Badehaus-Kirchturm Travemünde, die nach Rörig (IV, S. 50) 1875 als Nordgrenze des Ankergrundes genannt wird. Für die frühere Zeit ist eine entsprechende Linie nicht nachgewiesen. Zwar findet sich auf der Hagenschen Karte das Gebiet westlich von der Linie als "der Steingrund" bezeichnet, und es wird durch die hinzugefügten Jahreszahlen 1784 und 1836 auf Quellen für diese Benennung verwiesen. Aber 1784 wird nur angegeben, daß ein Schiff nordwärts dem steinigen Grunde zu nahe gelegt worden sei 12 ). Und wenn es 1836 heißt, daß er als "Hoher Zug" bezeichnete Fischereizug "an der rechten Seite von dem Steingrund" begrenzt werde 13 ), so ist damit nicht gesagt, daß der "Steingrund" bis an die heutige Linie Badehaus-Kirchturm gerechnet wurde. Die Seekarten jedenfalls verzeichnen hier noch keinen steinigen Grund. Nach ihnen endet das Steinriff eine kleine Strecke südlich vom Möwenstein 14 ). Es kommt jedoch auf die Linie Badehaus-Kirchturm wenig an.
Nicht zu billigen ist, daß auf der Hagenschen Karte die Entfernungen der Reedestriche vom Bollwerk - die, wie wir sahen, überhaupt berichtigt werden müssen - auf dem Lot abgetragen sind, das vom Bollwerk auf die Majorlinie gefällt ist. Dieses Lot liegt außerhalb des Leuchtfeuersektors, der überdies auf der Hagenschen Karte nicht ganz richtig liegt und etwas nach Nord-


|
Seite 78 |




|
weste verschoben werden müßte. Die abgemessenen Entfernungen stimmen also überhaupt nicht mehr für das Gebiet innerhalb des Sektors. Wenn auch der bis zur Majorlinie reichende sogenannte "Hohe Zug" südlich durch eine "gerade auf das Norderbollwerk gezogene Linie" begrenzt wird 15 ), so darf doch eine solche Fischereischeide nicht einfach für die nautische Reede übernommen werden. Man kann daher die Reedelage nur so bestimmen, daß man von der Spitze des Norderbollwerks aus Kreisbögen mit den Radien der 1784 genannten Abstände (1120 und 1450 m) durch den Sektor des Leuchtfeuers schlägt.
Wir kommen schließlich auf die Tiefenzahlen der Hagenschen Karte und die danach bestimmte Lage der drei Anker, die den auf der Wohlerschen Karte von 1801 vorgefundenen Schiffen entsprechen sollen. Die Tiefenzahlen sind für das fragliche Gebiet aus der französischen Seekarte von 1811 entnommen, weiter draußen sind auch noch Tiefenangaben der neuesten Admiralitätskarte in Klammern hinzugefügt. Mit der Übernahme von Tiefen der französischen Karte können wir uns aber nicht befreunden 16 ). Auf dieser Karte sind es vom Leuchtturm bis zu den Tiefen von 26 französischen Fuß (8,66 m), die 5 Lübecker Faden (8,63 m) entsprechen, gut 1900 bis etwa 2050 m. Auf der Admiralitätskarte aber kommt man bei 1900 m Entfernung vom Leuchtfeuer zwar auch nur auf etwa 8,8 m, bei 2050 m Abstand aber schon fast auf den westlichen Teil der 10-m-Tiefengrenze 17 ), und etwas weiter seewärts ist das Wasser schon 10,9 m tief, während die französische Karte die dem Leuchtturm am nächsten gelegene Tiefenzahl 30 (= 10 m) in 2300 m Abstand vom Turme vermerkt. Es wird


|
Seite 79 |




|
dies auch auf der Hagenschen Karte deutlich. Auf ihr ist die 10-m-Tiefenlinie eingetragen, allerdings nicht ganz richtig, weil sie etwas zu weit an die mecklenburgische Küste herangezogen ist. Am Rande der Linie finden sich die beiden aus der Admiralitätskarte entnommenen Tiefenzahlen 10,9. Jenseit dieser Tiefen aber, die doch schon fast 11 m betragen, stehen Tiefen von 9,9, die aus der französischen Karte stammen 18 ). Sie stehen also an Stellen, wo das Wasser unzweifelhaft viel tiefer ist als 10 m.
Und während auf der Hagenschen Karte die Tiefenzahlen 8,3 (besser 8,6) 19 ) und 8,6, die vor den Ankern eingefügt sind und wohl für die Stelle der Ankerspitzen gelten sollen, etwa 1970 m vom Leuchtturme abliegen, sind entsprechende Tiefen von 8,7 und 8,6 m auf der Admiralitätskarte 20 ) nur 1640-1670 m vom Leuchtturm entfernt. Auch verzeichnet die Hagensche Karte die Ansegelungstonne Lübeck 1 dicht hinter der Tiefe von 8,6 m; auf der Admiralitätskarte aber liegt sie viel weiter seewärts.
Wie sind diese doch nicht bedeutungslosen Unstimmigkeiten zu erklären? Tiefer kann das Buchtgewässer seit dem Ursprungsjahre der französischen Karte nicht geworden sein, eher flacher 21 ). Die Erklärung ist nur darin zu finden, daß die französische Karte, wenn sie auch für ihre Zeit gewiß ein Meisterwerk war, nicht genau ist. Wenn man daher ihre Tiefenangaben in das Meßtischblatt hineinkonstruiert, wie es auf der Hagenschen Karte geschehen ist, so muß das zu Irrtümern führen.
Wollte man die Reedelage auf der französischen Karte mit Hilfe der Quellen von 1784-1801 bestimmen, so müßte man die Originalkarte selbst zugrunde legen. Erinnern wir uns, daß nach der Angabe des Lotsenkommandeurs Wohler von 1801 die Tiefen, wo die Schiffe gewöhnlich ankerten, beinahe 5 Faden, also nicht ganz 8,63 m betrugen. Auf der Skizze Wohlers von 1788 liegt das eingezeichnete Schiff bei 4 1/2 bis 5 Lübecker Faden (7,76-8,63 m). Dies wäre in Einklang zu bringen mit der Kartenskizze von 1773. auf der die Worte "Reede vor Travemünde oder Lübeck" zwischen den Tiefenlinien von 4 und 5 Faden stehen 22 ). Schlägt man nun auf der französischen Karte vom Norderbollwerk aus Kreisbögen in den 1784 genannten Entfernungen von 1120 und 1450 m, so kommt man bei 1120 m zwar


|
Seite 80 |




|
im westlichen Buchtteil über eine Tiefenzahl von 20 französischen Fuß hinaus, erreicht aber nicht die Zahlen 23 und 24, d. h. man kommt wohl noch nicht auf 4 1/2 Faden (etwas über 23 franz. Fuß). Bei 1450 m Entfernung jedoch überschreitet man den Auslauf der Tiefenlinie von 25 Fuß (8,33 m), die noch ein Stück über die Majorlinie vorragt, überschreitet an einer Stelle auch fast eine Tiefenzahl von 25, die unmittelbar an der Majorlinie steht. Über die Majorlinie selbst kommt man im heutigen Sektorgebiet teils gar nicht, teils nur wenig und nirgends mehr als etwa 150 m hinweg. Würde man sich also nach der französischen Karte richten - unter der freilich nicht zutreffenden Voraussetzung, daß ihre Tiefenangaben genau seien - so wären die von Wohler angegebenen Tiefen etwa = 25 französischen Fuß, und dann wäre auch die Reede an der Majorlinie so gut wie zu Ende. Die Tiefenzahlen von 26 Fuß liegen 150 -300 m weiter seewärts als die Tiefenzahl 25, was allerdings nicht ausschließen würde, daß das Wasser auch schon etwas näher bei der Majorlinie, wo keine Zahlen stehen, 26 Fuß tief ist.
Nun könnte man etwa die Seekarte der Neustädter Bucht zugrunde legen, die der dänische Marineleutnant J. P. Schultz 1860 vermessen hat. Sie gibt die Wassertiefen in dänischen Faden und Fuß an und bezeichnet die Tiefengrenzen von 1 bis 10 Faden durch Linien. Schlägt man vom Norderbollwerk aus, das zwar nicht abgebildet ist, dessen Länge man aber aus der Admiralitätskarte (nach der Entfernung der Bollwerkspitze vom Leuchtturme) auf den Maßstab der dänischen Karte übertragen kann, einen Kreisbogen mit dem Radius von 1120 m, so kommt man über die 4-Faden-Linie (7,53 m) eine Strecke hinweg. Mit dem Radius von 1450 m durchschneidet der Bogen schon die erste Zahl einer Tiefe von 4 Faden 4 Fuß (8,79 m) und erreicht fast die 5-Faden-Linie, von der er nur 80 bis höchstens 300 dänische Ellen (50 bis 188 m) abbleibt 23 ). 5 dänische Faden sind aber bereits 9,41 m, also rund 0,80 m mehr als 5 Lübecker Faden. Und zwar kommt man auf die genannten Tiefen im Sektor des Leuchtfeuers, wenn man diesen in die Karte hineinverlegt, und südöstlich von der Linie Badehaus-Kirchturm Travemünde, die man natürlich ebenfalls konstruieren kann.
Aber wir wollen uns nach der genauesten Karte richten, die zur Verfügung steht. Dies ist die jüngste deutsche Admiralitäts-


|
Seite 81 |




|
karte 24 ), und zwar die auf ihr enthaltene Sonderkarte der Einfahrt nach Travemünde. Nach ihr ist unsere beigefügte Kartenskizze hergestellt worden 25 ). Es ist eine Pausenskizze mit den Küstenlinien, soweit sie sich auf der Sonderkarte finden. Übernommen sind ein Teil der Tiefenzahlen, der Leuchtfeuersektor und die heutige Ansegelungstonne Lübeck 1. Innerhalb des Leuchtfeuersektors liegen die Kreisbögen, die vom Norderbollwerk aus in den bekannten Abständen von 1120 und 1450 m geschlagen sind, und es ist das so ermittelte Gebiet durch fette Linien umrandet. Ferner sind in die Skizze hineinkonstruiert die Staatsgrenze am Priwall, der Möwenstein, die Peillinie Badehaus-Kirchturm Travemünde, die Majorlinie in ihrem Verlaufe von 1801, also dem Jahre der Angaben und der jüngsten Karte des Lotsenkommandeurs Wohler, sowie in ihrem Verlauf von 1748, dem Jahre des Scharpenbergischen Berichtes 26 ), schließlich - durch eingeklammerte Kreise bezeichnet - die am weitesten seewärts gelegenen Ansegelungstonnen (rote und schwarze Tonne) der Admiralitätskarte von 1873. Diesseit der Majorlinie sind drei Tiefenzahlen von 8,6 und 8,7 m unterstrichen. Es sind die Tiefen, die 5 Lübecker Faden (8,63 m) entsprechen. Die mittlere dieser Tiefen steht am Rande des Fahrwassers 27 ), könnte also an sich eine Baggertiefe sein; da sie aber im Zuge der 5-Faden-Tiefen liegt, so wird sichs um eine natürliche Tiefe handeln. Weiter nach Nordwesten, nach dem Brodtener Ufer zu, wird das Wasser tiefer. Es steht hier schon eine Zahl von 9,1 und zwischen dieser und der Zahl 8,4 wird sich die 5-Faden-Linie fortsetzen. Weiter westlich finden sich dann geringere Tiefen.
Lagen nun die Schiffe 1801, wie der Lotsenkommandeur Wohler angab, auf beinahe 5 Faden, so müssen sie innerhalb der
P. Friedrich (Lübecker Blätter 1901, S. 68) hat den jährlichen Rückgang des Ufers durchschnittlich auf 1,2 m berechnet. Vgl. auch Benick, Lübecker Heimatbuch 1926, S. 14: ".. nach den Erfahrungen der letzten 90 Jahre jährlich mindestens 1,2 Meter." Seit 1901 waren es jährlich im Durchschnitt 0,85 m.


|
Seite 82 |




|
Majorlinie geankert haben, im Schutze des Brodtener Ufers. Fast das ganze nach der Quelle von 1784 zu konstruierende Reedegebiet liegt diesseit der Majorlinie. Nimmt man das Mittel der 1784 angegebenen Entfernungen (1285 m), so kommt man weder auf unserer noch auf der Hagenschen Karte über die Linie hinaus.
Noch 1849 sind die Schiffe von den Lotsen zum mindesten dicht an der Linie verankert worden, die vom Gömnitzer Turm, der jetzt die Stelle des Majors vertrat, am Brodtener Ufer vorbeilief, wahrscheinlich auf der Linie selbst 28 ). Es wird sich um den Liegeplatz für die größeren Schiffe handeln; denn daß man kleinere Fahrzeuge noch weiter buchteinwärts brachte, ist nach unserer Kartenskizze anzunehmen. In jedem Falle ist es durchaus verständlich, daß 1828 der Lotsenkommandeur Harmsen die Majorlinie als eine Grenze zwischen Reede und See betrachtete 29 ). Ferner ist klar, daß wir auf unserer Kartenskizze in Archiv II die Lage der alten Reede im wesentlichen richtig eingetragen haben, wenn man den vormaligen Verlauf der Majorlinie berücksichtigt.
Unsere neue Karte ergibt, daß die Reede völlig außerhalb des mecklenburgischen Gewässers lag. Selbst wenn man den äußeren Kreisbogen nach der mecklenburgischen Küste zu über den Sektor hinaus verlängern wollte, so würde man eine von der Priwallgrenze nach Norden gerichtete Linie nur unwesentlich überschneiden und jedenfalls nicht mehr in einer Gegend, die für die Reede noch in Betracht gekommen wäre.
Und nun können wir die alten Seekartenwerke von Waghenaer und anderen ganz beiseite lassen 30 ); denn die Reede, wie sie um 1800 lag, könnten wir auch schon für die Zeit des Fischreusenstreites akzeptieren.
Es ist nach diesen Ermittlungen gar nicht möglich, aus dem Falle des englischen Kohlenschiffes von 1784 den Schluß zu ziehen, den Rörig (IV, S. 37) daraus gezogen hat, den Schluß nämlich, daß die Reede im allgemeinen bei der Majorlinie, in der Richtung auf die See zu, angefangen habe. Wie Rörig mitteilt, war in diesem Jahre den Lübecker Fischern ausnahmsweise gestattet


|
Seite 83 |




|
worden, den sogenannten "Hohen Zug" noch über den 1. Mai, den Endtermin der eigentlichen Heringszeit, hinaus zu befischen. Der "Hohe Zug" begann (nach einer Ordnung von 1836) 31 ) an der Majorlinie und führte von hier aus auf das Travemünder Ufer. Nun kam am 2. Mai 1784 das englische Kohlenschiff an. Der Kapitän nahm dem Lotsen das Steuerruder aus der Hand, steuerte sein Schiff selber buchteinwärts und verankerte es im Bereiche des hohen Zuges. Die Lotsen, die über die Verlängerung der Heringszeit nicht unterrichtet waren, erhoben keinen Einspruch, mußten dann aber auf Anordnung der Kämmerei das Fahrzeug weiter seewärts legen.
Wo hatte nun das Schiff ursprünglich geankert? Nach dem Bericht des erkrankten Lotsenkommandeurs 32 ) hatte der Kapitän sein Schiff "dorthin" gesteuert, weil er "es anderwards foll Schiffe fand". Daraus ist nicht viel zu entnehmen. Die Fischer ihrerseits beschwerten sich darüber, daß die Lotsen Schiffe bis auf 80 Faden (138 m) ans Bollwerk herangelegt hätten, "statt dessen zu wünschen stehe, daß sie solche ganz bis nach die Rehde hinausbringen möchten, damit das Fischereigerätschaft durch die Schiffe nicht beschädigt werden könnte" 33 ). Die natürlich unterschätzte Entfernung von 80 Faden erklärte die Frau des Lotsenkommandeurs für ausgeschlossen. Sie gab statt dessen die oft erwähnten Abstände von 650 bis 840 Faden (1120-1450 m) an. Daraus aber, daß die Entfernung von den Fischern so auffallend gering eingeschätzt wurde, ist jedenfalls der Schluß zu ziehen, daß das Schiff recht tief in den Bereich des hohen Zuges hineingefahren war; wenn auch in der Beschwerde der Fischer von einer Mehrheit von Schiffen die Rede ist, so war doch wohl in erster Linie das englische Fahrzeug gemeint. Da außerdem bemängelt wurde, das Schiff sei nordwärts dem steinigen Grunde zu nahe gelegt worden 34 ), so muß es dort geankert haben, wo sich der hohe Zug im Winkel zwischen der Majorlinie und der Küste stärker verkürzt.
Die Klage der Fischer richtet sich offenbar nur dagegen, daß Schiffe ungewöhnlich weit buchteinwärts verankert wurden. Ihr Verlangen aber, es möchten die Schiffe "ganz bis nach die Rehde" hinausgelegt werden, braucht keineswegs zu bedeuten: bis hinter die Grenze des hohen Zuges, also bis hinter die Majorlinie. Das behauptet zwar Rörig, hat es aber nicht


|
Seite 84 |




|
quellenmäßig nachgewiesen. Wäre seine Auffassung richtig, so würde sich ergeben, daß zwischen Fischern und Lotsen über die Lage der Reede keine Einigkeit herrschte. Es kam ja auch während der Heringszeit eine Behinderung der Fischerei durch die Schiffahrt nicht immer in Frage. Diese Zeit endete nach Rörig am 1. Mai. Wann begann sie? Bei den Leipziger Zeugenaussagen vom 21. März 1927 rechnete ein früherer Dassower Fischer 35 ) sie vom Dezember bis zum Frühjahr. Danach würde sie großenteils in den Winter fallen, wann die Segelschiffahrt ruhte. Und wenn im Frühling Schiffe bei ungefähr 5 Faden ankerten, so wurde im Gebiete der hohen Zuges nur die letzte kleine Strecke besetzt, auf die es doch gar nicht ankommen konnte. Auch vor der mecklenburgischen Küste begannen die Wadenzüge ja erst bei 4-5 Faden Tiefe 36 ). Außerdem ließen sich in dem Raume zwischen den Schiffen am Ende noch Waden auswerfen, ohne daß man mit dem Reedebetrieb kollidierte. Je weiter aber die Schiffe buchteinwärts kamen, desto lästiger mußten sie für die Fischerei werden, zumal im nördlichen Teile des hohen Zuges, wo dieser schnell kürzer wird. Wir verstehen daher die Beschwerde von 1784 so, daß die Fischer sich nur gegen allzu nahe am Bollwerk vorgenommene Verankerungen wehrten. Und selbst wenn in der Heringszeit die Schiffe bis an die Majorlinie oder in das Gebiet dicht dahinter zurückgezogen wären, so würde das doch an der Reedelage gar nichts Wesentliches ändern. Man konnte Hunderte von Metern jenseit der Majorlinie ankern, ohne das mecklenburgische Gewässer zu berühren. Daß die Schiffe den Fischern ganz hätten weichen müssen, wäre doch mit dem Grundsatz: "Schiffahrt geht vor Fischerei", der nach Rörig 37 ) in den Lübecker Akten häufig genannt wird, nicht zu vereinbaren. Die Bedürfnisse der Schiffahrt obenanzustellen, war ja überhaupt in den Seestädten allgemeine Regel.
Es ist für die Reedelage doch sehr bezeichnend, daß es zu einem solchen Streite zwischen Fischern und Lotsen überhaupt kommen konnte. Und aus dem vorgelegten Material von 1784 bis 1801 läßt sich nur der eine Schluß ziehen, daß "normal verankerte" Schiffe nicht jenseit, sondern diesseit der Majorlinie lagen, freilich bei 5 Faden auch schon dicht an ihr. Als der englische Kapitän eintraf, dachte er gar nicht daran, seewärts hinter der Linie zu bleiben, wo sich


|
Seite 85 |




|
doch Raum genug bot, sondern er steuerte noch weiter in die Bucht hinein, als üblich war.
Zu der Reedelage, wie sie sich aus den Quellen von 1784-1801 ergibt, paßt auch die in unseren früheren Erachten angeführte Aussage über ein Schiff, das 1792 auf der Reede gekentert war 38 ). Diese Quelle soll nach Rörig 39 ) "gänzlich minderwertig" sein. Dabei handelt es sich um die gleichzeitige Aussage eines Augenzeugen, des mecklenburgischen Strandreiters, und zwar in dem hier interessierenden Punkte um eine der von Rörig sonst so geschätzten Angaben, die nichts Strittiges betreffen - denn die Reedelage war nicht strittig - , sondern beiläufig gemacht wurden. Nach der Erklärung des Strandreiters befand sich das Fahrzeug "unter den auf der Rheede liegenden Schiffen wohl 400 Schritte vom Lande". Zu bezweifeln ist an diesem Bericht die angegebene Entfernung, niemals aber, daß eine Wasserfläche der inneren Bucht gemeint ist. Das Schiff war "durch den Sturm vom Anker getrieben" und "auf der Rheede umgeschlagen", und zwar am 6. Mai, also nach Schluß der Heringszeit. Es darf daher angenommen werden, daß die Schiffe ohne Rücksicht auf den "Hohen Zug" so weit wie möglich buchteinwärts verankert lagen. Die Entfernung von 400 Schritten ist am Tage darauf (7. Mai) geschätzt worden, als die ursprüngliche Lage des Schiffes sich schon geändert haben konnte. Mag sie nun, wie wir in Archiv III angenommen haben, vom Travemünder Ufer aus berechnet sein oder vom Priwall aus, unterschätzt ist sie in jedem Falle 40 ). Die Lübecker Fischer behaupteten ja 1784 sogar, daß Schiffe bis auf 80 Faden (138 m, also noch nicht 200 Schritt) ans Bollwerk herangelegt seien; auch ein Zeichen dafür, daß Entfernungen auf dem Wasser leicht zu gering geschätzt werden. Ferner darf man den Ausdruck "unter den auf der Rheede liegenden Schiffen" nicht pressen. Wenn auch das Fahrzeug mehr oder weniger weit vor den übrigen gelegen haben mag, so konnte man doch aus der Entfernung, vom Ufer aus, den Eindruck haben, daß es sich "unter" diesen befand. Niemals aber hätte das unzweifelhaft ganz in der inneren Bucht liegende Schiff mit Fahrzeugen, die hinter der Majorlinie ankerten, in eine räumliche Verbindung gebracht werden können. Die Art, wie Rörig sich mit


|
Seite 86 |




|
der Quelle von 1792 auseinandersetzt oder vielmehr nicht auseinandersetzt, ist sehr sonderbar. Daß sie ihm nicht ganz bequem ist, schließen wir aus seiner Bemerkung, es handle sich bei unseren Angaben "vermutlich um einen Auszug, der die zutreffenderen Mitteilungen derselben Akten nicht wiedergibt". Dabei sind unsere Angaben vollkommen eindeutig. Rörigs ebenso unüberlegte wie ungehörige Bemerkung veranlaßt uns, diese für die Reedelage ja recht instruktiven Akten im Original beizufügen mit der Bitte, sie dem Staatsgerichtshofe vorzulegen. Die in Betracht kommenden Stellen sind darin bezeichnet 41 ).
Ebenfalls stimmt zu der ermittelten Reedelage eine Nachricht von 1731. Wir entnehmen sie der jetzt abgeschlossenen Arbeit von Kühn über den Geltungsbereich des Oldenburgisch-Lübeckischen Fischereivergleichs von 1817 und die Travemünder Reede 42 ). Es sollten 1731 zwei Niendorfer Fischerboote samt einer Wade, die 1729 von den Lübeckern in der Niendorfer Wiek beschlagnahmt waren, wieder ausgeliefert werden. Dies sollte nach einem Vorschlage des Lübecker Rates geschehen: "außerhalb Travemünde auf dortiger Rhede der Gegend des Leuchten-Feldes". Später ließ der Rat erklären, er sei bereit, "auf der Spitze gegen dem Leuchten-Felde über auf der See, die danische Reede genandt, die Sachen restituiren zu lassen". Wie aus den Ausführungen Kühns hervorgeht, erfolgte die Rückgabe bei der Grenzscheide zwischen dem Leuchtenfelde, also dem Lübecker Strand, und dem Gneversdorfer Strande des Domkapitels, einer Grenze, die nach Kühn im Möwenstein zu suchen ist. Zugleich handelte es sich um die Gegend der alten Schanze, die südlich vom heutigen Seetempel und vom Möwenstein lag 43 ). Hier in der Nähe war also die "danische Reede". Dies kann nur eine Bezeichnung für einen Ankerplatz sein, der, wie die Reede überhaupt, nicht weit vom Leuchtenfelde entfernt war. Man wird ja auch, um ein paar kleine Fischerboote auszuliefern, nicht weit in die See hinausgefahren sein. Wir erinnern in diesem Zusammenhange an jene früher von uns beigebrachte Quelle von 1670 über die "Reide bey dem Lüchtenfeldt" 44 ).


|
Seite 87 |




|
Nun hat Rörig (IV, S. 43 ff.) seine Meinung über die Reedelage durch die französische Seekarte von Beautemps-Beaupré zu stützen gesucht. Er behauptet, wir hätten unser Urteil über diese Karte geändert. Das ist grundverkehrt. Denn wir haben in Archiv II (S. 124) nicht gesagt, daß sie überhaupt wichtiger sei als die moderne Seekarte, sondern wichtiger nur darin, daß es die Peillinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle auf ihr nicht gibt. Weiter haben wir in Archiv II nichts aus der Karte entnommen. Auch haben wir diese in Archiv III (S. 44 ff.) keineswegs als minderwertig bezeichnet, sondern nur gesagt, daß aus ihr die Reedelage nicht hervorgehe. Das ist auch der Fall und wird durch die neuen Quellen von 1784-1801 vollkommen bestätigt. In die Hagensche Karte ist ja einiges aus der französischen hineinkonstruiert. Wir fragen, ob die Worte "Rade de Travemünde" sowie die Bezeichnung des Ankergrundes "Vase couverte de sable fin bonne tenue" sich räumlich mit dem nunmehr festgestellten Reedegebiet decken, das aber auf der Hagenschen Karte nicht richtig liegt. Gewiß nicht! Es ist alles aufrecht zu erhalten, was wir in Archiv III zur Erklärung dieser Bezeichnungen gesagt haben 45 ). Ferner der Punkt a auf der französischen Karte, von dem aus man die an deren Rande abgebildete Ansicht von Travemünde hatte. Der Punkt findet sich auf der Hagenschen Karte am Rande des Sektors. Tatsächlich müßte er aus diesem herausfallen, weil der Sektor nicht ganz richtig liegt und etwas nach Nordwesten zu verschieben ist. Wir haben keinen


|
Seite 88 |




|
Zweifel daran, daß unsere in Archiv III, S. 44 ausgesprochene Meinung stimmt, wonach Beautemps-Beaupré den Punkt auf der damaligen Ansegelungslinie der Traveeinfahrt eingetragen hat 46 ). Im übrigen aber liegt der Punkt ja unmittelbar an der Majorlinie. Schließlich ist in die Hagensche Karte der Punkt B aus der verlorenen Skizze des Navigationslehrers Sahn von 1823 übernommen worden, und zwar nach unserer Rekonstruktion auf der Admiralitätskarte in Archiv III, Beilage 5 b. Statt dessen hätte allerdings unsere Beilage 5 a zugrunde gelegt werden müssen, wo der Punkt auf der französischen Karte bestimmt ist, die für Sahn maßgebend war 47 ). Auf ihr liegt der Punkt noch weiter seewärts. Aber in keinem Falle kann der Punkt B der Mittelpunkt der nautischen Reede sein. Er sollte, wie wir Archiv III, S. 56 f. gezeigt haben, auf der Mittellinie der Travemünder Bucht liegen.
Der tatsächliche Wert des Materials von 1784-1801 läßt sich dadurch nicht abschwächen, daß Rörig das Reedegebiet als einen "Reedekopf" bezeichnen will, wo die Lotsen "im allgemeinen" die Schiffe hingelegt hätten. Wohl wurde auch noch das Gebiet weiter seewärts, mitsamt dem flachen Gewässer am Strande, Reede genannt. Aber darauf kommt es nicht an, sondern auf den Ankerplatz, und dieser ist mit dem "Reedekopf" identisch. Ausdrücklich wird in dem Scharpenbergischen Bericht von 1784 das Gewässer, das 5-6 Kabellängen vom Bollwerk abliegt, als "die Rehde" bezeichnet ("wo alldorten die Rehde heißt"). Weiter draußen konnte nach eben diesem Bericht nicht mehr geleichtert und gelöscht werden. Und auch die Wohlerschen Karten bezeichnen das Gebiet bei 4 1/2 bis 5 Faden Wasser als "Die Rhede" oder als "Große Rhede" (im Gegensatze zur Flußreede). Es ist


|
Seite 89 |




|
dasselbe Gebiet, das auf der kleinen Kartenskizze von 1803 48 ) durch zwei Anker kenntlich gemacht wird. Ganz unmöglich aber ist es, die Reedelage nach den verzeichneten Küstenlinien der Wohlerschen Karten bestimmen zu wollen. Auf der Karte von 1788, meint Rörig (IV, S. 33), sei das Wort "Rhede" "genau in der Mitte" zwischen Pötenitz und Rosenhagen eingetragen. Vor und neben ihm ständen zwei Tiefenangaben von 4 1/2 und 5 Faden. Auf diese Zahlen und das eingezeichnete Schiff kommt es natürlich allein an, nicht auf das Wort "Rhede", das ja nicht auf die Zahlen gesetzt werden konnte. Und quer über die Bucht sich hinziehende Tiefen von 4 1/2-5 Faden gibt es eben nicht in der Mitte zwischen Pötenitz und Rosenhagen. Übrigens liegt das Schiff auf der Karte näher bei der Zahl 4 1/2. Dann will Rörig gar auf dieser Skizze die Majorlinie ziehen, indem er Pötenitz mit dem Steilufer verbindet. Dann liege die Reede dahinter. Mit demselben Recht kann man sagen, daß auf dieser Karte die Reede sich binnen dem Steinriff Seezeichen mit der roten Fahne befindet. Ebenso ist es auf der kleinen Skizze von 1803. Wo aber das Steinriff-Zeichen (Pavillon Rouge) lag, ergibt sich aus der französischen Seekarte (Kartenbeilage 2 a bei Rörig III). Wenn ferner Rörig meint, daß auf der Wohlerschen Karte von 1801 die Entfernung von Travemünde bis zum Grenzpfahl am Priwall 49 ) "sinngemäß" soweit verkürzt sei, daß die Majorlinie "vor die ankernden Schiffe treten würde", so möchten wir fragen, wo denn eigentlich in den Verzeichnungen der Wohlerschen Karten der Sinn anfängt und wo er aufhört. Auf der Karte von 1801 beträgt die Entfernung vom Norderbollwerk bis zu den drei Schiffen nach dem Kartenmaßstabe im Durchschnitt etwa 3900 Fuß = 650 Faden (1121 m). Das ist gerade die geringste der 1784 angegebenen Entfernungen. Aber man kommt dann nach der Admiralitätskarte noch nicht auf 30 Fuß Wasser. Würde man übrigens die fehlenden Küstenlinien der Wohlerschen Karte von 1801 nach den Größenverhältnissen der früheren von 1788 ergänzen, so würde die Majorlinie hinter die Reede fallen. Aber solche Experimente sind auf den Skizzen Wohlers überhaupt nicht zulässig 50 ).


|
Seite 90 |




|
Ferner hat Rörig 51 ) die "Nachricht für Seefahrer" von 1855 herangezogen. Es ist dies ein Merkblatt, das vom Lübecker Lotsendepartement herausgegeben ist. Darin wird gesagt, daß Schiffe, die nachts in den Hafen einlaufen wollten, zum Zeichen dessen, daß sie einen Lotsen verlangten, eine Laterne aufhissen sollten. Werde kein Gegensignal (rotes Licht) gezeigt, "so ist das Einbringen des Schiffes nicht thunlich, dasselbe muß dann entweder in 5 bis 6 Faden Wasser ankern oder bis Tagesanbruch unter Segel bleiben". Dies vergleicht Rörig mit dem "Vorbereitenden Bericht für die Anfertigung der Segelanweisung für die Lübecker Bucht der Reichsmarine" von 1875. Hier heißt es: "Wird die roth-weiße Kugel nicht gezeigt, so ist ein Einlaufen in den Hafen wegen der damit verbundenen Gefahr unzulässig, das Schiff muß dann auf der Rhede in 10 bis 12 m Tiefe ankern oder wieder in See gehen". Beide Male, meint Rörig, sei dieselbe Gegend der Bucht gemeint. Das würde, wenn man 5 bis 6 englische Faden (9,14 bis 10,97 m) oder preußisch-dänische Faden (9,41 bis 11,30 m) annimmt, ungefähr zutreffen, besonders für das Gebiet des Leuchtfeuersektors, das außerhalb des mecklenburgischen Gewässers liegt; hier folgen die Tiefen von etwa 9 bis 12 m dicht aufeinander. Die in den beiden Anweisungen genannten Tiefen berühren uns hier aber gar nicht, weil damit ja keine Leichterreede bestimmt, sondern nur ein zum vorläufigen Ankern geeigneter Platz bezeichnet wird, auf dem die Schiffe lagen, bis sie in den Travemünder Hafen gebracht wurden. Nichts weiter besagt die Nachricht von 1855, als daß man auch ohne Lotsen bis auf 5 Faden buchteinwärts steuern könne; ja sogar noch weiter, denn wenn ein rotes Licht die Ausfahrt des Lotsen anzeigte, so "kann das Schiff sich dem Hafen bis auf 4 1/2 Faden Wasser, das Travemünder Leuchtfeuer in WSW haltend, ohne Gefahr nähern und hat den Lotsen zu erwarten". Dabei blieb den Kapitänen überlassen, nach welchem Faden sie sich richten wollten. 1875 rundete man dann die 5 bis 6 Faden nach dem inzwischen eingeführten Metermaße ab. Warum auch nicht? Auf genaue Tiefen kam es für dieses vorläufige Ankern gar nicht an. In der Anlage 3 zu Rörig 1 bemerkt der Lübecker Hafenkapitän Murken 52 ), daß sich genaue Vorschriften über den Ankerplatz "überhaupt nicht machen" ließen.


|
Seite 91 |




|
Bei den Segelanweisungen und dergleichen handele es sich um "Ratschläge". Das haben wir schon im Archiv III (S. 58) gesagt. Und es brauchen diese Dinge eigentlich gar nicht erörtert zu werden, weil sich daraus keine Gebietshoheit herleiten läßt. Wenn Rörig (IV, S. 56) sagt, daß den Schiffen "geraten bzw. befohlen" werde, auf 10 bis 12 m Wasser zu ankern, so setzt er sich mit dem Worte "befohlen" in Gegensatz zu seinem eigenen Sachverständigen.
Der Ankerplatz, der in den Quellen von 1784 bis 1801 erscheint, ist keineswegs identisch mit dem vorläufigen Ankerplatze auf den Tiefen von 10 bis 12 m. Zu den Erwiderungen, die von dem heutigen Travemünder Lotsenkommandeur und dem heutigen Lübecker Hafenkapitän auf verschiedene von Rörig gestellte Fragen erteilt sind 53 ), müssen wir bemerken, daß die beiden Herren für die vormalige Zeit gar nichts berichten können. Wenn für ein Schiff von 5,17 m Tiefgang eine Ankertiefe von noch nicht 6 m für zu gering erklärt wird 54 ), so ist zu


|
Seite 92 |




|
beachten, daß die alte Reede tatsächlich Tiefen von 8,6 m und mehr hatte. Außerdem ist es unwahrscheinlich, daß jenes Maß von 5,17 m für den Lübecker "Adler", das hier gemeinte Kriegsschiff des 16. Jahrhunderts, überhaupt zutrifft 55 ). Der Lotsenkommandeur erklärt (zu Frage 1), daß für kleine Schiffe das Ankern auf weniger als 12 m Wasser gefährlich sei. Indessen wissen wir, daß die Schiffe vormals - und nach heutigen Begriffen waren sie alle klein - auf weniger als 9 m lagen. Wenn er ferner meint (zu 2), als auf der Reede liegend seien "von jeher" alle Schiffe angesehen worden, die sich zwischen der Ansegelungstonne Lübeck 1 und der Steinrifftonne befanden, so ergibt doch unsere Kartenskizze, daß sie durchaus diesseit der Ansegelungstonne ankerten. Die beiden von dem Kommandeur angeführten Grenzpunkte gab es ja auch früher nicht. Die Steinrifftonne liegt an ihrem jetzigen Orte erst seit 1915 56 ), und 1873 befanden sich die äußersten Ansegelungstonnen (rote und schwarze Tonne) dort, wo sie auf unserer Kartenskizze eingezeichnet sind. Nach und nach sind sie dann weiter hinausverlegt worden 57 ). Außerdem rechnen beide Sachverständigen natürlich mit den heutigen tiefgehenden Seeschiffen. Und was versteht der Lotsenkommandeur hier unter kleinen Schiffen? Wir vermuten, größere, als für die frühere Zeit überhaupt in Frage kommen. Um 1600 gehörten Kauffahrer von 200 Last (= etwa 270 t) 58 ) unzweifelhaft zu den großen. Selbst für das einzig dastehende Kriegsschiff, den "Adler" aus der Zeit des nordischen siebenjährigen Krieges (1563-70) ist auch die geringere der angegebenen Tragfähigkeiten (800 Last) gewiß übertrieben 59 ). In den Jahren vor 1829 fuhren auf Lübeck jährlich über 900 Schiffe (darunter 1/11 mit Ballast) und ebenso viel gingen ab (1/10 mit Ballast). Die Trächtigkeit aller jährlich ankommenden und abfahrenden Fahrzeuge betrug damals nach dem Durchschnitt der


|
Seite 93 |




|
letzten Jahre etwa 50 000 Kommerzlasten 60 ). Danach kamen auf das Schiff durchschnittlich nicht viel über 50 Last. Fahrzeuge, die mit 70 Last und darüber beladen waren und 10 Fuß tief gingen, konnten die Plate nicht überwinden, ohne teilweise auf der Reede gelöscht zu haben 61 ). Es ist also klar, daß die große Mehrzahl der Schiffe überhaupt nicht zu leichtern brauchte. Und auch der Rest der Schiffe kann nach heutigen Begriffen nur sehr klein gewesen sein. Es handelte sich ja auch ganz wesentlich um Ostseeverkehr 62 ).
Unter den Erwiderungen des Lotsenkommandeurs interessiert uns noch Folgendes (zu 2): Er meint, niemals hätten Schiffe, die leichtern wollten, "auf der Plate 63 ) innerhalb der Ansegelungstonne gelegen, woselbst bei auflandigen Winden besonders grobe See steht und vielfach Schiffe beim Brechen von Ankerketten in Trift geraten sind". Schiffe müssen hier also doch gelegen haben. Und daß es früher vorgekommen ist, daß Fahrzeuge auf der Reede vom Anker gerissen wurden, wissen wir ja 64 ). Auch das Schiff von 1792 ist auf solche Weise verunglückt 65 ). Dieselbe Gefahr ist aber nach dem Lotsenkommandeur (zu 7) bei 10 bis 12 m Tiefe ebenfalls vorhanden, wo Rörig die Reede gesucht hat. Auch hier kommt bei schweren Nordoststürmen - und das sind doch gerade die bedrohlichen Winde - "sehr grobe See" auf, so daß Schiffe, die unter solchen Umständen dort ankern, ".gefährlich liegen", "weil die Gefahr besteht, daß die Anker nicht halten und die Ketten brechen".
Der Hafenkapitän seinerseits führt aus (zu 3): Natürlich haben die Schiffe früher versucht und tuen es auch jetzt noch, bei nördlichen Winden so nahe als möglich an das Innere der Reede heranzugehen und dort zu ankern, um, wenn auch nicht durch das Land, sondern durch das flache Steinriff Schutz gegen hohe See


|
Seite 94 |




|
zu haben". Sie sind vormals in der Tat soweit buchteinwärts gefahren, daß sie den Schutz des Brodtener Ufers genossen. Und wenn der Hafenkapitän bemerkt (zu 7), daß Schiffe von 5 bis 6 m Tiefgang auf 10 bis 12 m Wasser unbedenklich ankern könnten, sollten dann 6 bis 8 1/2 m und darüber für die kleinen Fahrzeuge früherer Jahrhunderte nicht genug gewesen sein? Noch auf der Admiralitätskarte von 1873 liegt in der inneren Bucht ein Anker, in der Nähe des Fahrwassers und 300 m westlich einer von der Priwallgrenze nach Norden gezogenen Linie. Seine Spitze ist noch nicht 1250 m vom Norderbollwerk entfernt, und er würde gerade noch binnen der Linie Gömnitzer Turm Brodtener Ufer (Majorlinie) liegen. Dicht hinter ihm, seewärts, steht eine Tiefenzahl von 8 m 66 ). Ebenso auf der gleichen Karte mit den Berichtigungen bis 1887, doch würde hier der Anker mit der Spitze auf der Majorlinie stehen. Vom Norderbollwerk ist er trotzdem keine 1200 m entfernt.
Man darf aus den Angaben der heutigen Lübecker Sachverständigen, die offenbar mit ganz anderen Verhältnissen rechnen, keine Schlüsse auf die Lage der alten Reede ziehen. Die "Kontinuität nach rückwärts" 67 ) ist nicht vorhanden, sie ist nach den Quellen ausgeschlossen. Auch wird die Gefahr des Steinriffes für die ankernden Schiffe von Rörig offenbar nicht richtig eingeschätzt. Wie der Hafenkapitän Murken hervorhebt 68 ), bietet die Travemünder Reede bei südlichen und südöstlichen Winden guten Schutz. Welche anderen Winde sollten denn aber in der inneren Bucht liegende Schiffe aufs Steinriff werfen? Und wenn es bei orkanartigen Stürmen dennoch geschehen könnte, so wäre doch diese Gefahr weiter seewärts auch vorhanden. Keinen Schutz hat man nach dem Hafenkapitän bei nordöstlich-östlichen Winden. Waghenaer hat seiner Zeit nur den Nordost und Nordnordost als bedrohlich bezeichnet 69 ). Und es wird wohl so sein, daß ostnord-östliche Stürme den Schiffen um so weniger schädlich sind, je weiter diese buchteinwärts ankern; denn desto mehr muß der Schutz der mecklenburgischen Küste wirken.
Warum ferner soll der Ankergrund der inneren Bucht nicht gut sein 70 )? Wie der Lotsenkommandeur Wohler 1801 angab, besteht der Grund bei beinahe 5 Faden Tiefe "aus ziemlich


|
Seite 95 |




|
festem Ton mit Sand vermischt", so daß die Anker selten losgerissen würden, wenn auch bei Stürmen öfter die Taue oder die Anker selbst brächen 71 ). Von dem Lübecker Wasserbaudirektor Rehder wissen wir, daß "der auf 5-7 Meter anschwemmende Sand eine feine thonige Beschaffenheit hat, welche das Ausbaggern außerordentlich erschwert" 72 ). Daraus ist natürlich der Schluß zu ziehen, daß der Grund bei 5-7 Meter Tiefe überhaupt Ton enthält. Die Admiralitätskarte von 1873 verzeichnet an der Spitze des oben erwähnten Reedeankers Sk. (Schlick). Auf der neuesten Admiralitätskarte endlich (Sonderkarte der Traveeinfahrt) findet sich in dem Gebiete, das auf unserer beigefügten Skizze mit fetten Linien umrandet ist, die Angabe gr. Sd. (grauer Sand) 73 ); in der Nähe des Gebietes steht f. gr. S. (feiner grauer Sand) 74 ), weiter südlich noch einmal gr. Sd. Das sind dieselben Bezeichnungen des Grundes, die auf der Karte (Hauptkarte) auch weiter draußen, jenseit der Ansegelungstonne, vermerkt sind.
Sehr wohl auch war es zulässig, daß wir in Archiv III (S. 14 f.) andere Ostseereden zur Vergleichung herangezogen haben. Die dort angeführten Reeden sind ja zum Teil ebenso offen oder noch offener als die Travemünder. Geschützter ist die Wismarer. Aber hier lagen auch um 1804 "Schiffe von 150-200 Last, nach Verschiedenheit der Bauart, bey einer Wassertiefe von 14-15 Fuß" 75 ) (4,02-4,31 Meter). Das waren für die damalige Zeit durchaus keine kleinen Schiffe. Ablandige Winde, die das Wasser ein wenig sinken machen, kommen hier natürlich auch vor.
Wir verstehen es nicht, daß Rörig aus den Quellen von 1784-1801 das Ergebnis zieht, alles, was wir über die Reedelage gesagt hätten, sei falsch, alles, was er gesagt habe, sei richtig. Obwohl er die weiteste 1784 genannte Entfernung (840 Faden) ganz unberechtigt zu 900 Faden ausgereckt hat, obwohl auf der Hagenschen Karte die Entfernungen vom Bollwerk bis zu den


|
Seite 96 |




|
Reedegrenzstrichen gar nicht mehr für das Gebiet innerhalb des Leuchtfeuersektors gelten, so geht doch die Reede auch auf dieser Karte nur gut 300 m über die Majorlinie hinaus. Dabei ist es nicht einmal von Wichtigkeit, ob die Reede just an der Majorlinie zu Ende war oder ob die Schiffe auch noch ein bißchen weiter seewärts lagen. Denn daß die Majorlinie eine Hoheitsgrenze gewesen sei, hat ja niemand behauptet. Das Entscheidende ist, daß der Ankerplatz sich in der inneren Bucht befand, nicht da, wo Rörig ihn gesucht hat.
Es sind merkwürdige Vorstellungen, die Rörig sich von den Aufgaben eines wissenschaftlichen Erachtens bildet. Nach ihm wäre Sinn und Zweck unserer Ausführungen in Archiv III in dem Wunsche zu suchen, das "wirkliche" Reedegewässer aus dem Gebiete hinauszuschieben, das in der mecklenburgischen Verordnung vom 23. Februar 1925 umschrieben ist 76 ). Wir möchten wissen, wie wir das machen sollten, wenn nicht die Quellen dafür sprächen. Es ist außerdem völlig unrichtig, daß wir an den "Ortsbestimmungen" der Verordnung "stark beteiligt" seien. Denn beteiligt ist hier allein das Völkerrecht. Was die Verordnung, die wir übrigens erst durch das Regierungsblatt kennen gelernt haben, geltend macht, ist ja gar nicht der alte Strand, sondern die völkerrechtliche Grenze. Diese wird von Mecklenburg verfochten, nicht mehr und nicht weniger.
Weiter meint Rörig (IV, S. 2), wir hätten uns bereits in einer Weise festgelegt, "die einer objektiven Stellungnahme zum mindesten nicht günstig war". Aber wenn er uns eine Reede bei Rosenhagen nachgewiesen hätte, so hätten wir unseren Standpunkt verlassen und verlassen müssen. Hat er selber sich denn nicht "festgelegt"? Auf der Kartenskizze 2 seines ersten Gutachtens ist als "ungefähre Abgrenzung der Reede im nautischen Sinne" die 10-m-Wassergrenze eingetragen. In seinem dritten Gutachten verlegt er die Reede dementsprechend, aber im Gegensatze zu dem von ihm selbst vorgebrachten Kartenmaterial, auf die Höhe von Rosenhagen; manchmal heißt es auch: "etwa" auf dieser Höhe. Wo ist nun die Reede vor Rosenhagen geblieben?
Neuerdings bemerkt Rörig 77 ), er habe mit der Höhe von Rosenhagen nicht den Häuserkomplex gemeint - den aber seine Leser darunter verstehen mußten -, und er gibt zu, daß er besser gesagt hätte: "in der Höhe der Küstenstrecke von Pötenitz bis Rosenhagen". Das sei ihm zu lang gewesen. Es wäre aber außer-


|
Seite 97 |




|
dem auch noch unrichtig gewesen. Denn wenn man die Reede nach der mecklenburgischen Küste zu bestimmt, so lag sie gegenüber der westlichen Hälfte des Pötenitzer Feldes; im übrigen lag sie nördlich vom Priwall und dem Möwenstein näher als der mecklenburgischen Küste.
Auf der Plate aber lag sie nicht. Schon in seinem dritten Erachten hat ja Rörig behauptet, daß wir die Reede auf die Plate, "also auf jenes gefährliche Hindernis der Schiffahrt", verlegt hätten 78 ). In seiner neuen Abhandlung hat er für unsere Reede die Bezeichnung "Platenreede" angewendet. Das Platenrätsel löste sich für uns bereits, als wir die Kartenskizze erhielten, die bei der Verhandlung in Leipzig am 21. März 1927 von Lübecker Seite vorgelegt ist. Sie ist im Maßstabe der Admiralitätskarte angefertigt und deckt sich im allgemeinem mit dieser. Beanstandet werden muß, daß auf der Skizze die Harckenbeckmündung an die Peillinie Pohnsdorfer Mühle-Gömnitzer Turm 79 ) herangezogen ist, was nach der Admiralitätskarte nicht stimmt und auch den natürlichen Verhältnissen nicht entspricht. Die Begrenzung des Steinriffs ist zugleich die 10-m-Tiefenlinie, die aber willkürlich ans Ufer bis zur Travemündung herangezogen ist, durch den Leuchtfeuersektor hindurch und den ganzen Travemünder Badestrand mit umfassend. Die Plate ist blau gefärbt und reicht bis zu einer Linie, die sich vom Möwenstein bis nach Rosenhagen hinzieht. Verlegt man sie auf die Admiralitätskarte, so läuft sie über die Ansegelungstonne Lübeck 1 und überschneidet an einer Stelle noch etwas die 10-m-Tiefenlinie.
Wenn man in Lübeck dieses ganze Gebiet heute "Plate" nennt 80 ), so berührt das unsere Beweisführung nicht im mindesten. Entsprechend müßte ja dann beinahe die ganze Wismarer Bucht eine Sandbank sein. Und wie verhält sich denn dieser Platenbegriff zu den Ausführungen des dritten Rörigschen Gutachtens? Da wurde die Angabe Waghenaers, daß es "auf der Bancken" sechs Ellen (12 Fuß) tief sei, für bei normalem Wasserstande "viel zu hoch gegriffen" angesehen 81 ), 1831 schwankten die Tiefen auf der Plate nach Rörig zwischen 8 und 133/4 Fuß 82 ). Heute aber rechnet man in Lübeck Tiefen von 30 Fuß und darüber zur Plate.


|
Seite 98 |




|
Wo diese in Wirklichkeit war, das lehrt ja die Wohlersche Karte von 1801.
In seinem dritten Gutachten (S. 116) hatte Rörig den Liegeplatz eines 1746 in Brand geratenen Schiffes infolge eines Lesefehlers bei 8 Faden statt bei 5 angenommen 83 ). Er erklärte daher, daß das Schiff in einer Wassertiefe geankert habe, "wie sie nach Ausweis der modernen Seekarte von Rosenhagen aus gerechnet nur in der Richtung auf die Harkenbeck anzutreffen" sei. "Hier war es," so heißt es weiter, "wo das bei dem flachen Wasserstand der Plate notwendige Löschen - zum mindesten teilweise Löschen - der einlaufenden Schiffe und das Laden der ausfahrenden stattfand" usw. Also gar nicht einmal mehr "in der Höhe der Küstenstrecke von Pötenitz bis Rosenhagen", die er doch sonst als Reedegebiet bezeichnet haben will, sondern von Rosenhagen bis zur Harkenbeck. Noch jetzt meint er 84 ): "Wenn auch die Lotsen die Schiffe nach Möglichkeit bis etwa dorthin vorzogen, wo Lotsenkommandeur Wohler seine drei Anker einzeichnete, geleichtert und gelöscht wurde auch noch weiter hinaus auf der Reede, und Schiffe gingen hier immer wieder bis zum heutigen Tage vor Anker". Woher hat er eigentlich diese Kunde? Er beruft sich auf den heutigen Travemünder Lotsenkommandeur, der von der alten Reede gar nichts wissen kann. Und weil der Fall von 1746 weggefallen ist, so beruft er sich statt dessen ferner auf das "mit Steinen beladene, ziemlich weit hinaus auf der Rhede bey Rosenhagen befindliche Wadeschiff", das 1799 vor Rosenhagen im Wirbelsturm sank 85 ). Wie will er denn daraus, daß ein Wadeschiff, das von irgendwoher Steine geholt hatte, bei Rosenhagen vorbeifuhr, auf einen Ankerplatz schließen? Der Scharpenbergische Bericht von 1784 besagt: alle Schiffe lägen 5 bis 6 Kabellängen vom Bollwerk. Würden sie näher ans Land gelegt, "so könten sie beim Norr-Osten-Sturm leicht dem Strande näher kommen". Anderer-


|
Seite 99 |




|
seits aber: "Lähgten wir sie weiter hinaus, so liefen wir mit Prahmen und Böhte die Schiffe zu löschen bey stürmichem Wetter Gefahr, wen wir sie weit von die See hereinholen müßten." Und Sturm kann schnell aufkommen.
Bei Licht betrachtet, ringt Rörig in seinem neuen Gutachten weniger mit uns als mit seinem eigenen "hochwertigen und unbedingt authentischen Beweismaterial" von 1784 bis 1801 86 ). Wieder auch entnehmen wir seinen Darlegungen den Vorwurf, daß wir die Beweisführung erschwerten. Freilich ist es mühevoll, so minutiöse Auseinandersetzungen über die Reedelage zu geben und zu lesen. Aber die Beweisführung wird dadurch nicht erschwert, sondern es wird überhaupt erst Klarheit geschaffen. Und nicht unsere Schuld ist es, daß die Untersuchungen einen so großen Umfang angenommen haben. Warum hat denn Rörig die "authentischen" Quellen, die doch in dem wahrhaftig nicht unübersehbaren Lübecker Archiv leicht zu haben waren, nicht beizeiten vorgelegt? Dann hätten die Forschungen über die älteren Seekartenwerke gar nicht angestellt zu werden brauchen.
Der Ausdruck "Große Reede" wird nach Rörig 87 ) auch in der Quarantäneordnung von 1805 angewendet. Gemeint ist die Reede, wie sie sich aus den Quellen von 1784 bis 1801 ergibt. Und wenn die Lotsen nach der Ordnung von 1805 quarantänepflichtige Schiffe eine viertel Meile nordwärts von der Großen Reede verankern sollten, so hat diese Quarantänereede, wie es 1832 heißt, ja sicher nicht im mecklenburgischen Küstengewässer gelegen. Aber auch sonst ist der gebietsrechtliche Schluß abzulehnen, den Rörig aus der Existenz einer Quarantänereede gezogen hat. Vor anderen Häfen gab es zweifellos ebenfalls Quarantänereeden. Und aus Einrichtungen dieser Art ist kein Eigentumsrecht über das betreffende Meeresgebiet zu folgern, sondern sie gründen sich, ebenso wie das Lotsenwesen und das Leichterwesen, auf die Herrschaft über den Hafen selbst. Schon in Archiv II 88 ) haben wir ausgesprochen, daß kein Schiff sich der Quarantäne unterwirft, weil es sich auf dem


|
Seite 100 |




|
Hoheitsgebiete des Hafenstaates befindet, sondern weil Fahrzeug, Mannschaft und Ladung sonst nicht in den Hafen hineingelassen werden.
Weiter hat Rörig sich auf ein Verbot von 1787 berufen, wonach Ballast bis auf 1/2 Meile von der Großen Reede fort nicht ausgeschüttet werden sollte 89 ). Der Lotsenkommandeur Wohler schlug damals vor, die Ausschüttung erst bei Schwansee oder besser noch an der Rückseite des Steinriffes vornehmen zu lassen, damit der Ballast nicht ins Fahrwasser getrieben werde 90 ). War man eine halbe deutsche Meile - die hier nur gemeint sein kann - von der Großen Reede entfernt, so befand man sich beinahe einen Kilometer jenseit der Harkenbeck, gegenüber der Feldmark von Barendorf. Schwansee grenzt östlich an Barendorf, und sein Strand beginnt 2 km hinter der Harkenbeck. Soll nun also auch das Gewässer vor Barendorf oder gar vor Schwansee den Lübeckern gehört haben? Unmöglich ist es, aus solchen Anweisungen eine Gebietshoheit zu folgern. Nach der Lotsenordnung des Rostocker Rates für den Hafen zu Warnemünde von 1802 hatte der Lotsenkommandeur "darauf zu sehen, daß beym Ballast-Löschen oder Einnehmen, im Hafen oder auf der Rehde, nichts ins Wasser geschüttet, und das Auswerfen des Ballastes in die See durch Versegeln nicht näher, als eine Meile vom Hafen ab geschehe . ." 91 ). Deswegen aber hat doch Rostock nicht das Meer bis auf eine Meile vom Hafen gehört. Wohin sollte es denn führen, wenn überall da, wo Reeden liegen oder lagen, auf Grund von derlei Anweisungen das Meer als Eigengewässer in Anspruch genommen würde 92 )!
Über die Örtlichkeit der alten Travemünder Reede kann es keinen Zweifel mehr geben. Sie war dort, wo in der inneren


|
Seite 101 |




|
Bucht tiefes Wasser am weitesten ans Ufer heranreicht. Man erkennt dies auf der Admiralitätskarte schon an dem Zurückspringen der Tiefenlinien von 4 und 6 m. Und auf dieser "Großen Reede" konnten eine ganze Menge Schiffe liegen 93 ). "Es war," um einen Satz Rörigs 94 ) auf den wirklichen Ankerplatz anzuwenden, "ein Zwang, der in den Dingen selbst lag, daß eben an dieser Stelle der Bucht und an keiner anderen eine Reede im nautischen Sinne entstehen mußte". Denn hier hatte man den besten Schutz, den die Bucht bietet, und zugleich ausreichende Wassertiefen. Nun aber geht doch die bekannte rechtsgeschichtliche Vorstellung Rörigs dahin, daß der wirtschaftliche Reedebetrieb zu einer Reedehoheit und dann zur Ausdehnung dieser Hoheit auf die an die Reede grenzenden Wasserflächen bis zum Ufer geführt habe. Abgesehen davon, daß diese "Durchdringungsthese" schon aus anderen Ursachen nicht zu halten ist 95 ), wo war denn außer in dem Gebiete diesseit der Majorlinie oder höchstens ganz unwesentlich darüber hinaus der wirtschaftliche Reedebetrieb, auf den doch alles aufgebaut ist? Von der nun örtlich festbestimmten Großen Reede können allerdings "keine Auswirkungen auf das Küstengewässer Priwall-Harkenbeck in dem von Lübeck angenommenen Maße ausgegangen sein" 96 ). Für den wirklichen Ankerplatz aber besaß Lübeck Schutzstreifen, und zwar am Lande selbst, wo sie wegen des Bergerechtes überhaupt allein Wert hatten. Es waren das Leuchtenfeld mit dem Travemünder Strand und der Priwall, dessen Besitz freilich bis 1803 umstritten wurde, den aber Lübeck Jahrhunderte hindurch heiß verteidigt hat. Eben am Priwall sind ja die Strandungsfälle außergewöhnlich zahlreich gewesen 97 ). Östlich von der Halbinsel dagegen hörte der Schutzstreifen auf, und wenn hier Schiffe oder Gegenstände ans Land


|
Seite 102 |




|
geworfen wurden, so trat natürlich nicht die rechtliche Absurdität einer Lübecker Bergehoheit ohne Küstenbesitz in Kraft, sondern das mecklenburgische Strandrecht 98 ).
Ankergrund natürlich war auch noch jenseit der Großen Reede, nach der See zu 99 ). Daß man den Namen "Reede" auch
( ... )


|
Seite 103 |




|
für dieses Gewässer verwendete, wäre schon an sich um so verständlicher, als die Travemünder Bucht nicht groß ist. Es ist aber auch vom nautischen Standpunkte aus zu erklären. Wie begründeten es denn Wismarer Zeugen 1597, daß sie den Hafen bis zum Ende der Wismarer Bucht rechneten? Damit, daß man hier "zwischen Landts" kam , wo "Beschutz" war und die Möglichkeit sich bot, ein Schiff vor Anker und Tau zu bergen 100 ). Praktisch-seemännische, nicht gebietsrechtliche Erwägungen führten zu dieser rein nautisch-geographischen Anschauung. Nicht für alle Wismarer Zeugen aber waren Hafen und "Tief" dasselbe, und tatsächlich befanden sich Reede und Hafen im Innenwinkel der Bucht.
Ähnlich lagen die Dinge vor Travemünde. Auch hier kam


|
Seite 104 |




|
man, wenn man in die Bucht einfuhr, binnen Landes, in den Schutz einerseits der mecklenburgischen Küste, andererseits des Brodtener Ufers unter Hinzurechnung des flachen Steinriffteiles, der ebenfalls gegen hohe See schützt 101 ). Die wirkliche Reede aber lag - wie vor Wismar - in der inneren Bucht an der günstigsten Stelle. Und wenn weiter draußen, in dem äußeren Buchtgewässer, Schiffe Anker warfen, etwa des Nachts und bevor sie auf die Große Reede gebracht wurden, so könnte daraus eine Lübecker Gebietshoheit noch weniger gefolgert werden als aus dem Steineholen am Brodtener Strande 102 ) und ebenso wenig wie daraus, daß heute Kriegsschiffe oder andere große Dampfer noch jenseit der angeblichen Peilliniengrenze vor Anker gehen, auf einem Gebiet, das Lübeck selber nicht beansprucht 103 ). Die bloße Ankerung ist nicht einmal auf der Großen Reede ein Beweis für Gebietshoheit. Soll Mecklenburg sein Recht verloren haben, weil vielleicht mitunter auf seinem Buchtanteil ein Schiff Anker warf, was in keinem einzigen Falle aktenmäßig bezeugt ist?
Nicht darauf kommt es an, was man im geographischen Sinne oder auf Grund von geographisch-nautischen Vorstellungen Reede nannte, sondern allein auf die Lotsen- und Leichter-Reede. Diese Feststellung ist zu treffen, bevor die Quellen besprochen werden können, die Rörig aus den Akten über Fischereistreitigkeiten herangezogen hat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~


|
Seite 105 |




|
II. Die Quellen
der Akten über Fischereistreitigkeiten.
Es ist hier einzugehen auf den ersten Teil des neuen Rörigschen Gutachtens 104 ), der die "Reedebegriffe in den Verordnungen etc. der Lübecker Behörden" behandelt.
In Archiv III (S. 51) haben wir den kurzen Auszug Rörigs (II, S. 245) aus einem Wetteentscheid von 1823, worin eine etwa "beim Möwenstein anfangende und sich von dort noch weit in die See erstreckende Außenreede" erwähnt wird, mit dem bekannten Lübecker Fischereiprozeß von 1823-25 in Verbindung gebracht. Tatsächlich bezieht sich der Auszug, wie Rörig jetzt mitteilt, auf eine Beschwerde der Schlutuper Fischer über einen Travemünder Schiffszimmermann, der Krabbenkörbe an der westlichen Buchtküste jenseit des Möwensteins ausgesetzt hatte, was angeblich gegen den Fischereivergleich von 1610 verstoßen sollte. Ferner hatten wir aus dem Auszuge geschlossen, daß die eigentliche nautische Reede ungefähr beim Möwenstein zu Ende gewesen sei und daß man das Gewässer weiter seewärts, "richtiger gesagt jenseit der Majorlinie", als Außenreede bezeichnet habe. Nun hat aber Rörig (IV, S. 5) einen anderen Auszug aus den Akten beigebracht. Er teilt zunächst mit, daß die Wette einen Vergleich befürwortete, der den Travemündern das Setzen von Garnkörben jenseit des Möwensteins gestattet hätte. Dies wurde folgendermaßen begründet:
"Herrn der Wette glauben deshalb vielmehr, daß man im Sinne des Vergleichs von 1610 die Linie von dem Möwenstein auf der holsteinischen Seite nach der Harkenbeck auf der Mecklenburger Seite als Gränzlinie zwischen der See und der Rehde ansehen, das Wasser jenseits derselben, wenn ein Teil davon auch die nirgends erwähnte und beachtete sogenannnte Außenrehde ausmachen möchte, als die offene See und das Wasser diesseits jener Linie . . . . . als die Rehde annehmen müsse, und zwar um so mehr, da . . . . . bis zum Mevenstein noch ein


|
Seite 106 |




|
bedeutender Wasserbezirk für die in dem Vergleich benannte Außentrave und ganze Rehde und für die ausschließlichen Berechtigungen der Lübecker Fischer 105 ) vorhanden ist."
Nach Rörig kommt das Wort "Außenreede" nur an dieser Stelle in den Lübecker Akten vor. Zum wenigsten also hat er es nur einmal gefunden. Weiter meint er, die Außenreede sei "niemals eine Realität gewesen", "sondern das am grünen Tisch ersonnene Auskunftsmittel einer Behörde, die einen Ausgleich schaffen" wolle 106 ). Nun ist allerdings richtig, daß die von der Wette hier gezogene Reedegrenze "am grünen Tisch ersonnen" ist, indem, wie Rörig mit Recht sagt, die beiden in dem Vergleich von 1610 genannten Punkte - Möwenstein und Harkenbeck - "ganz mechanisch" miteinander verbunden wurden. Wenn aber Rörig der Ansicht ist, daß die Wette einen Teil der Reede ausgeschieden und zu diesem Zwecke eine Außenreede "konstruiert", also erfunden habe, so kann man mit demselben Rechte behaupten, daß sie die Außenreede den beiden im Vergleich von 1610 vorgefundenen Punkten zuliebe noch weiter hinausgeschoben habe, als sie tatsächlich lag. Daß der Ausdruck "Außenreede" von der Wette neu aufgebracht wurde, halten wir für ausgeschlossen, und zwar schon deswegen, weil die Wette von der "sogenannten" Außenreede sprach, ein Beiwort, daß niemals hätte angewendet werden können, wenn die Bezeichnung "Außenreede" sonst ungebräuchlich gewesen wäre. Auch in dem früher von Rörig gegebenen Auszuge, dessen Ergänzung wünschenswert ist, wird doch ganz eindeutig die etwa "beim Möwenstein anfangende ... Außenreede" genannt. Daß ein solcher Begriff in einem Streitverfahren, in dem es gerade auf geographische Umschreibungen ankam, plötzlich und ohne Begründung neu eingeführt worden sei, kann man nicht annehmen Zwar erklärte die Wette, die Außenreede werde "nirgends erwähnt und beachtet", aber das bezieht sich doch selbstverständlich nur auf die Fischereiordnungen, im besonderen auf den in Frage stehenden Vergleich von 1610. Warum sollte man die Bezeichnung "Außenreede", die doch anderwärts gebraucht wurde, in Lübeck nicht gekannt haben?
Der Senat war mit dem Wettevorschlage nicht einverstanden. Er griff auf ein früheres Dekret vom 29. Juni 1822 zurück. "Den Travemündern blieb also," wie Rörig hinzufügt, "auch weiterhin das Setzen von Garnkörben an der holsteinischen Seite über den


|
Seite 107 |




|
Möwenstein hinaus verboten." Auch bemerkt Rörig, daß "der Senat sich auf den Standpunkt stellte, daß durch den Vergleich von 1610 die ganze Reede den Travemündern verschlossen sei; folglich auch die über den Möwenstein hinausgehende Uferstrecke." So wurde der Vergleich auch von den Schlutuper Fischern, den Gegnern der Travemünder, aufgefaßt 107 ). Und so hatte vormals auch die Wette gedacht 108 ).
Nun aber hat Kühn nachgewiesen, daß an der westlichen Buchtküste der Brodtener und der Gneversdorfer Strand außerhalb der Reede lagen, und er erblickt die Südgrenze der Gneversdorfer Strandstrecke wohl mit Recht im Möwenstein. Sicher ist soviel, daß sie in der Nähe des Möwensteins und der alten Schanze zu suchen ist 109 ). In dem Niendorfer Fischereivergleich zwischen Lübeck und Oldenburg von 1817 bedeutet die Grenzbestimmung "von der Travemünder Rehde an" nach den Darlegungen Kühns unzweifelhaft: vom Gneversdorfer Strande an, dessen Südgrenze also mit dem Ende der Reede zusammenfällt 110 ). Es ist Kühn darin zuzustimmen, daß in dem Vergleich nur die nautische Reede vor Travemünde gemeint sein kann, die, wie es 1731 heißt, "der Gegend des Leuchten-Feldes" lag 111 ).
Mithin ergibt sich, daß in dem Vertrage von 1817 mit einer Reedegrenze (wahrscheinlich dem Möwenstein) operiert wird, die zu dem gegen die Travemünder gerichteten Senatsdekret von 1822 nicht passen würde. Wenn dieses Dekret den Travemündern die ganze Reede verschließen wollte, zur Reede also auch das Steinriffgebiet jenseit des Möwensteins rechnete, so muß "Reede" hier in einem anderen Sinne aufgefaßt sein als in dem Niendorfer Vergleich von 1817, und man kann dann nur die ganze Travemünder Bucht, also die Reede im geographischen (nicht nautischen) Sinne, darunter verstehen. Eben daraus, daß die Bezeichnungen "Reede" und "Travemünder Bucht" in neuerer Zeit durcheinander gehen 112 ), ergibt sich ja von selbst, daß Reede und Bucht identische Begriffe im geographischen Sinne sind 113 ).


|
Seite 108 |




|
Das Wichtigste, was Rörig aus den Akten über den Streitfall von 1823 mitteilt, ist, daß die Wette das Gewässer jenseit der Linie Möwenstein-Harkenbeck als "offene See" ansah. Damit ist natürlich die ganze Rörigsche Reedebegrenzung gar nicht zu vereinbaren. Die Wette wollte sagen: Die "sogenannte" Außenreede ist eigentlich schon offene See. Nach dem Bericht des Lotsenkommandeurs Harmsen von 1828 fing die See - d. h., wie eine andere Stelle des Schriftstückes ergibt, die offene See 114 ) - sogar schon an der Majorlinie an. Nun fragt Rörig, warum denn die Wetteherren "in ihrem offensichtlichen Bemühen, die allzu schroffen Forderungen der Schlutuper den Travemündern gegenüber einzudämmen", nicht mit Vergnügen auf die Majorlinie als Grenze zurückgegriffen hätten. Aber vorausgesetzt, daß die Wette, die ja kein Lotsendepartement war, von dieser Linie überhaupt etwas wußte, so würde sie sie dennoch nicht haben benutzen können, weil sie ja dann den Travemündern die ganze Wendseite vor dem mecklenburgischen Ufer preisgegeben hätte, was damals keineswegs in ihrer Absicht gelegen haben kann. Denn in Wirklichkeit haben Wette und Senat damals den Fischereivergleich von 1610 nicht interpretiert, sondern vergewaltigt. Der Vergleich gab ja den Travemündern für ihre Stellnetzfischerei klar und deutlich Rechte auf den Strecken Blockhaus-Möwenstein und Blockhaus-Harkenbeck, also gerade innerhalb der Reedegrenze, die von der Wette angeblich im Sinne des Vergleichs, in Wahrheit aber, wie auch Rörig bemerkt, im Widerspruche zu ihm gezogen wurde.
Wie die Wette erklärte, blieb bis zum Möwenstein noch ein bedeutender Wasserbezirk für die in dem Vergleich von 1610 den Travemündern versagte "Außentrave und ganze Rehde". In der Tat lag ja die Reede binnen der von der Wette angenommenen Linie Möwenstein-Harkenbeck. Diese führt mitten durch die Tiefen von 10 bis 12 m, die Rörig für die Reede in Anspruch nimmt, hindurch. Hinter der Linie war nach der Wette nur noch Außenreede oder vielmehr offene See. Daß aber durch die mechanische Verbindung der beiden Fischereigrenzpunkte, die der Vergleich von 1610 nennt, eine im nautischen Sinne haltbare Scheidung zwischen Reede und Außenreede hergestellt sei, daß also die Lotsen und Leichterreede just bis zu der für Reedezwecke ganz unmög-


|
Seite 109 |




|
lichen Linie Möwenstein-Harkenbeck reiche, hat die Wette natürlich selber nicht behaupten wollen. Sie konstruierte nur gewissermaßen eine Fischereireede.
Nach Rörig ergebe sich aus dem Vorgang, daß die Wetteherren "selbst bei ihrem Versuch, zugunsten der Travemünder die Wirkung des Vergleichs von 1610 zu begrenzen, die Reede bis zur Harkenbeck als der Verordnungsgewalt Lübecks unterworfen betrachten; und das bis zum Ufer". Er setzt dabei aber wiederum voraus, daß die lübische Buchtfischerei vor dem Mecklenburger Ufer auf Gebietshoheit beruhte. Und wie steht es denn mit der "offenen See" jenseit der Linie Möwenstein-Harkenbeck, wo doch auch noch Lübecker Eigengewässer gewesen sein soll?
Was Rörig dann weiter über die "räumlichen Grundlagen" (Reede im nautischen Sinne und Reede im weiteren Sinne) ausführt, ist ja nichts Neues mehr, sondern schon in seinem ersten Erachten vorgebracht worden. Auf alle diese Dinge kommt es überhaupt nicht mehr an, seit feststeht, wo die Reede tatsächlich lag. Gewiß haben wir in Archiv III (S. 51 f.) zugegeben, daß in dem Lübecker Fischereiprozeß von 1823-25, in dem die Travemünder endlich ihre rechtmäßigen Ansprüche durchfochten, das ganze tiefe Gewässer der Bucht Reede genannt wurde. Aber ganz entschieden erheben wir Einspruch gegen Rörigs Behauptung, daß dies "in seinen Folgen eine Preisgabe der bisher eingenommenen Position und vor allem der in den von Mecklenburg eingereichten Rechtsgutachten enthaltenen Voraussetzungen örtlicher Art" sei 115 ). Das ist ja gerade der Fehler Rörigs, daß er sich durch die Bezeichnung Reede für das ganze mittlere Buchtgewässer dazu hat verleiten lassen, die eigentliche Reede viel zu weit seewärts auszudehnen, ja - auf der Kartenskizze 2 seines ersten Erachtens - überhaupt erst von der 10-m-Tiefenlinie an zu rechnen, während sie tatsächlich schon vor dieser endete.
Nun wird in den Akten des Oberappellationsgerichts über den erwähnten Prozeß der Ausdruck "eigentliche Reede" gebraucht, und Rörig 116 ) glaubt uns vorwerfen zu können, daß wir diesen "aktenmäßig eindeutig festgelegten Begriff" für unsere "Platenreede" verwendet hätten. Darauf allerdings sind wir nicht verfallen, das "eigentlich" der Gerichtsakten so zu pressen. Weil ja auch die gesamte Bucht bis zu den Küsten hin Reede genannt wurde, das Gericht aber das mittlere, für den Schiffsverkehr in


|
Seite 110 |




|
Betracht kommende Gewässer von der strittigen Fischereistrecke am Ufer unterscheiden wollte, so mußte ein Ausdruck gefunden werden, der diese Trennung aussprach. Hierzu diente das Wort "eigentlich". Wir haben den Akten dadurch volles Genüge getan, daß wir gesagt haben, es sei "das ganze tiefe Gewässer der Bucht als Reede bezeichnet worden." Von einer Außenreede sprechen die Akten nicht. Aber was sie Reede nennen, ist ja auch nicht nur die Außenreede, sondern auch die Leichterreede, weil die ganze neben der Reede verlaufende Fischereistrecke beim Blockhause an der Travemündung beginnt.
Sehr unberechtigt ist auch die Polemik, die Rörig (IV, S. 48 f.) gegen unsere Verwertung des Urteils richtet, das in zweiter Instanz vom Lübecker Obergericht gefällt wurde. Wir haben ja in Archiv III (S. 52) ausdrücklich gesagt, daß die Auslegung des Vergleichs von 1610 durch das Obergericht unzutreffend und auch hernach vom Oberappellationsgericht abgelehnt sei. Das Fehlsame des Urteils lag aber nur darin, daß das Gebiet zwischen Reede und Küste in zwei Längsteile zerlegt und den Travemündern nur der jenseit der Wadenzüge gelegene Teil zugewiesen wurde. Nur dies hat auch das Oberappellationsgericht getadelt. Unser Schluß aber, daß hinter den Wadenzügen noch ein nicht zur Reede zu rechnendes Fischereigebiet gelegen habe, bleibt unberührt. In den Entscheidungsgründen des Oberappellationsgerichts 117 ), die Rörig gegen uns gelten macht, heißt es:
"Die jetzt von den Beklagten vertheidigte, dem vorigen Urtheile zum Grunde liegende Auslegung jener Vorschrift, nämlich daß die Travemünder ihre Netze nur in dem Raume ausstellen dürfen, welcher zwischen der Rhede und derjenigen Entfernung vom Ufer, worin die Schlutupper nach dem Herkommen ihre Waden auswerfen, übrig bleibt, ist eben so wenig anzunehmen."
Hier wird doch die Existenz dieses Raumes nicht geleugnet!
Daß wir auch die Stelle über die Majorlinie, die sich in der Eingabe der Schlutuper Fischer von 1825 findet, im Archiv III, S. 54 f., richtig ausgelegt haben, ergibt unsere Kartenskizze.
Die Vorstellungen örtlicher Art, wie sie in dem Prozeß von 1823-25 erscheinen, hat Rörig in die frühere Zeit zurückprojiziert. Sie seien mindestens seit dem 16. Jahrhundert dieselben gewesen. Wir sind anderer Meinung. Wo wir in den Quellen des 16. und 17. Jahrhunderts auf den Begriff "nautische Reede" stoßen, kann nur die "Reide bey dem Lüchtenfeldt" gemeint sein. So in der


|
Seite 111 |




|
Aussage des Zöllners vor dem Holstentore von 1547. Aus dessen Worten "Strom und Stranth van der Reide an beth in de Herckenbecke" läßt sich niemals folgern, daß er das ganze tiefe Gewässer bis zur Harkenbeck zur Reede habe rechnen wollen. Dann der Fischereivergleich von 1610. Er verschließt den Stellnetzen der Travemünder sowohl den Travestrom innerhalb und außerhalb des Blockhauses (Fahrwasser) wie die "ganze Reide". Vor den Uferstrecken Blockhaus-Möwenstein und Blockhaus-Harkenbeck aber durften die Netze unter gewissen Bedingungen ausgesetzt werden. Folglich: Das Gewässer vor diesen Uferstrecken gehörte nicht zur Reede. Es versteht sich, daß man nur die nautische Reede im Auge hatte, und zwar wiederum die beim Leuchtenfeld. Diese den Travemündern zu verwehren, hatte Sinn. Sie kam an sich in ihrem ganzen Umfange als Fischereigebiet in Betracht. Wenn aber hier, wo die Schiffe sich in mehr oder weniger großer Zahl versammelten, stehende Netze verwendet wurden, so mußte das den Schiffsverkehr und den Leichterbetrieb stören. Warum aber hätte man das Verbot auf die ganze mittlere Buchtfläche ausdehnen sollen? In der eigentlichen Mitte der äußeren Bucht, wo das Wasser am tiefsten ist und die Fahrstraße entlangführt, hätte es überhaupt keinen Zweck gehabt, Netze auszusetzen; denn hier halten sich, wie wir aus dem Prozeß von 1823 wissen, keine Fische mehr auf 118 ). Eben hier aber müßte man doch die Reede suchen, wenn sie wirklich in dieser Gegend gelegen hätte. Nur bei ablandigem Wind käme, wie der Hafenkapitän Murken angibt 119 ), als Ankerplatz für kleinere Schiffe außerhalb des Leuchtfeuersektors "wohl auch noch" die Mecklenburger Seite bis zur 10-m-Tiefengrenze in Betracht. Näher jedenfalls könnten die Schiffe wegen der Gefahr nördlicher Winde auch vormals nicht ans Ufer herangegangen sein; die Wassertiefen sinken hier schnell, der Strand ist viel flacher als vor dem Leuchtenfelde. Zwar wurde noch eine Strecke jenseit der Wadenzüge, die bei 4 bis 5 Faden Tiefe nach der Küste zu begannen, gefischt 120 ); aber dieses für den Fang noch brauchbare, wenn auch gewiß weniger fischreiche Gebiet wurde in dem Vergleich von 1826 den Travemündern für ihre Stellnetze freigegeben, und zwar von der Majorlinie an und für gewisse Zeiten und Tage landwärts bis zur Linie Travemünder Kirchturm-Leuchtturm 121 ), die vor dem Mecklenburger


|
Seite 112 |




|
Ufer ungefähr auf der 10-m-Tiefengrenze verläuft. Es ist eben das Gebiet, das nach dem Hafenkapitän Murken vielleicht noch für Reedezwecke in Betracht käme. Warum also hätte man den Travemündern 1610 verbieten sollen, was ihnen 1826 zugestanden wurde?
Gegen unsere Auffassung des Begriffs "Reede" in dem Vergleich von 1610 spricht keineswegs der Streitfall von 1634, den Rörig (IV, S. 18) anführt. Damals beschwerten sich die Lübecker und Schlutuper Fischer unter Hinweisung auf den offenbar falsch ausgelegten - Vergleich von 1610 darüber, daß die Travemünder ihre Netze an den Buchtküsten bis zum Möwenstein und bis zur Harkenbeck ausgestellt hätten. Daraufhin verbot die Wette den Travemündern das Setzen von Netzen "in der Wentside biß an die Harkenbeeke". Das Wort Reede kommt hier nicht vor. Schauplatz des Konfliktes war, wie so oft, das Gebiet der Wadenzüge in der Nähe des Strandes. Und wenn die Beschwerdeführer darauf hinwiesen, daß den Travemündern doch "die ganze offenbare Sehe auswendig der Harkenbeeke" zur Verfügung steht, und verlangte, daß sie "an ihrem Ordte jenßeit der Harkenbeeke" blieben, so wird dadurch bestätigt, was schon längst feststeht, daß nämlich der Lübecker Rat auch über die Fischerei außerhalb der Harkenbeckmündung Bestimmungen erlassen hat, selbstverständlich nicht auf Grund von Gebietshoheit.
Nun meint Rörig, es begegneten 1634 dieselben Vorstellungen wie bei den Streitigkeiten der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts: Eigentliche (nautische) Reede bis zur Harkenbeck und zwischen Ufer und Reede sich erstreckende, also die Reede in ihrem Verlauf bis zur Harkenbeck begleitende Wendseite. Indessen begegnet nur die Bezeichnung "Wendseite" für die mecklenburgische Seite der Bucht. Aus den Worten "offenbare Sehe auswendig der Harkenbeeke" ist für die nautische Reede, deren Lage und Abgrenzung nach der See zu nicht das geringste zu entnehmen. "Offen", "frei" und "offenbar" waren um jene Zeit beinahe stehende Epitheta des Meeres überhaupt, und im Fischreusenstreit wurde 1616 von den Mecklenburgern auch das Gewässer vor Rosenhagen, wo die Reuse stand, also noch diesseit der Harkenbeck, fortwährend "offenbare" (oder offene, freie) Ostsee genannt 122 ). Wäre der Ausdruck "offenbare Sehe" in der Quelle von 1634 auf eine bestimmte Vorstellung von den lokalen Verhältnissen zurückzuführen, so doch höchstens darauf, daß an der


|
Seite 113 |




|
Harkenbeck die Buchtfischerei zu Ende war 123 ). Mit der Reedelage aber hat das nichts zu schaffen.
Für die ältere Zeit steht nur fest, daß es eine nautische Reede beim Leuchtenfelde gab und daß man auch das Gewässer weiter seewärts, und zwar bis an den Strand, Reede nannte. In diesem umfassenderen Sinne kommt die Bezeichnung, soweit wir sehen, am frühesten im Fischreusenstreit von 1616 vor. Und vor ausgesetzt, daß sie damals nicht erst aufgebracht wurde, so muß sie doch so farblos gewesen sein, daß noch sechs Jahre vorher, eben bei dem Vergleich von 1610, niemand daran dachte, den Ausdruck "ganze Reide" auf die gesamte Bucht zu beziehen.
In dem Fischereiprozesse von 1823-25 ist man nicht zu der offenbar einzig richtigen Auffassung der "ganzen Reide" von 1610 zurückgekehrt, hatte allerdings auch wenig Ursache, sich gerade hierüber den Kopf zu zerbrechen, weil es ja nicht auf das tiefe Gewässer der Bucht, sondern auf die strittige Fischereistrecke am Ufer ankam. Ein Fortschritt gegenüber den früheren Interpretationen durch Lübecker Behörden war es schon, daß man das Wort "Reide" im nautischen Sinne verstand. Auch die Wette meinte jetzt, im Widerspruche zu ihren sonstigen Auslegungen, es habe den Anschein, daß der Tatort vor Rosenhagen, wo die Netze der Travemünder von den Waden der Schlutuper weggerissen waren, weder zum Strom (Travenstrom außerhalb des Blockhauses) noch zur Reede gehöre 124 ). Indem man aber die Reede des Vergleichs von 1610, entsprechend der Fischereistrecke am Ufer, bis zur Harkenbeck rechnete, ergab sich die Scheidung zwischen Reede und Fischereistreifen von selbst.
Wenn auch klar war, daß für den Schiffsverkehr nur das tiefe Wasser in Betracht kam, so scheint uns doch diese Längsteilung des Buchtgebietes erst eine zur Zeit des Prozesses vorgenommene Konstruktion zu sein. Hätte man von jeher solche festen Vorstellungen gehabt, so wären die früheren Auslegungen des Vergleiches von 1610 durch Senat und Wette (Reede gleich der ganzen Bucht, Reede bis zur Linie Möwenstein-Harkenbeck) noch unverständlicher, als sie an sich schon sind. Und es hätte dann schwerlich zu einer solchen Begriffsverwirrung kommen können, daß die Schlutuper Fischer 1823, in dem Falle des Travemünder Schiffs-


|
Seite 114 |




|
zimmermannes, die Reede über den Möwenstein hinausrechneten, also die ganze Bucht darunter verstanden, in dem Prozesse aber, der im selben Jahre ausbrach, behaupteten, das Revier der Travemünder sei die Mitte der Bucht, während die Travemünder entgegneten, dort sei gerade entweder der Travenstrom außerhalb des Blockhauses oder die Reede.
Indessen hat die Scheidung zwischen Reede und Fischereistreifen in der äußeren Bucht gar keine Bedeutung. Denn was man hier Reede nannte, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Außenreede, mochte man sie so bezeichnen oder nicht. Sie ist, wie wir in Archiv III (S. 54) gesagt haben, die Verlängerung der eigentlichen nautischen Reede nach der See zu. Die "eigentliche" Reede aber lag vor dem Leuchtenfelde, in der inneren Bucht.
In Archiv III (S. 59) haben wir angeführt, daß die Travemünder Fischer noch heute die Wasserfläche zwischen dem Traveauslauf und den letzten Fahrwassertonnen als ein Gebiet "binnende Reide" bezeichnen. Rörig 125 ) hat dies nicht bestritten, will es aber so auslegen, als ob das Gebiet diesseit der Reede gemeint sei, weil die Reede "notorisch" außerhalb der Tonnen liege. Seine Deutung ist unhaltbar. "Binnen de Reide" kann schon an und für sich nur heißen: auf der Reede. Und außerdem ist man nach dem Sprachgebrauch der Fischer, wenn man sich jenseit der Ansegelungstonnen befindet, "butende Reide". Entsprechende Begriffe finden wir in Hinsicht auf die Trave in der Fischereiordnung von 1585: "binnen der Traven" (d. h. auf dem Traveflusse selbst) und "in der See, buten der Traven".
"Binnen de Reide" und "buten de Reide" werden hergebrachte Bezeichnungen sein. Willkürlich ist dabei nur die Abgrenzung durch die Ansegelungstonnen; denn diese Richtungspunkte gab es früher nicht, noch auf der Admiralitätskarte von 1890 liegen die äußersten Tonnen viel weiter buchteinwärts, und zwar dicht an der Linie Gömnitzer Turm-Brodtener Ufer (Majorlinie). Ein Gebiet "buten de Reide" aber läßt sich doch höchstens als Außenreede ansehen.
Aus der Bezeichnung "Reede" für eine Wasserfläche, auf der man vor Anker ging oder gehen konnte, läßt sich keine Gebietshoheit ableiten. Heute sind nach Ansicht des Travemünder Lotsenkommandeurs "alle Schiffe, die innerhalb des 54. Breitengrades in Sicht des Leuchtturms ankern, als auf der Reede liegend anzu-


|
Seite 115 |




|
sehen." 126 ) So auch "nach dem Sprachgebrauch der Lotsen" 127 ) Danach können Schiffe kilometerweit jenseit der Harkenbeck und doch auf der Reede sein. Was hat das mit Lübecker Gebietshoheit zu tun! "Da Lübeck," so sagt Rörig 128 ), "aus der Tatsache, daß heute die Reede noch über die Harkenbeck hinausreicht, keine Hoheitsansprüche in Fischereisachen abgeleitet hatte, gehören diese Dinge nicht mehr hierher." Man fragt sich mit Erstaunen, ob denn solche Ansprüche überhaupt für möglich gehalten werden. Und mit ebenso großem Erstaunen liest man bei Rörig 129 ) den Satz: "Um keine Irrtümer aufkommen zu lassen, ist aber festzustellen, daß für alle Fragen, welche mit der Schiffahrt zusammenhängen, die Reede auch außerhalb der Linie Harkenbeck-Gömnitzer Turm ebensogut Lübecker Hoheitsgebiet ist, als die Reede innerhalb dieser Grenze; nur Lübecker Aufsichtsbehörden haben mit den hier ankernden Schiffen zu tun." Wenn diese Aufsichtsbehörden überhaupt mit den Schiffen zu tun haben, so handeln sie selbstverständlich nicht auf Grund von Gebietshoheit, sondern kraft der Hoheit über den eigentlichen Hafen. Sonst sind die Schiffe gar nicht genötigt, Lübecker Aufsichtspersonen an Bord zu lassen.
Was Rörig von seinem Standpunkte aus nachweisen muß, das sind nicht nautische Benennungen für Wasserflächen, sondern unzweifelhafte Lübecker Hoheitshandlungen im mecklenburgischen Küstengewässer. Diese fehlen. Denn daß die Fischerei der lübischen Fischer nicht auf Grund von Gebietshoheit geregelt sein kann, ist in den von mecklenburgischer Seite vorgelegten Erachten gezeigt worden. In dieser Hinsicht behält auch unsere Rekonstruktion des Punktes A auf der Sahnschen Karte von 1823 ihre Bedeutung 130 ). Rörig behauptet, auf der Originalkarte müsse der Punkt anders gelegen haben 131 ). Wenn jedoch


|
Seite 116 |




|
etwas sicher ist, so ist es die Lage dieses Punktes, für den es drei Winkelbestimmungen gibt (zwei genügen schon) und der sich auf zwei Seekarten, von denen eine über hundert Jahre alt ist, bestimmen läßt. Der Punkt liegt sowohl außerhalb der Bucht wie außerhalb der Peillinie Gömnitzer Berg-Pohnsdorfer Mühle. Selbstverständlich handelt es sich, wie Rörig bemerkt, "einfach um einen Punkt, von dem aus die Fischer die äußerste Befischung der Strecke Priwall-Harkenbeck mit Waden vornehmen". Dafür, so fährt Rörig fort, sei es "natürlich vollkommen gleichgiltig, ob sie damit auf irgendeiner Peillinie oder Reedegrenze sich befinden; Wadenzüge der Schlutuper Fischer gehen ja bekanntlich über die Harkenbeck weit hinaus". Alles richtig, aber wie steht es dann mit der Gebietshoheit 132 )?
Seit seinem dritten Erachten vertritt Rörig ja die Meinung, daß man eine "lineare Grenze" seewärts überhaupt nicht gehabt habe. Das hat aus seinen beiden ersten Arbeiten wohl niemand entnommen. Und er kann sich doch eigentlich keiner Täuschung darüber hingeben, daß Grenzen, die Lübeck heute für passend hält, in dem schwebenden Prozesse ohne jede Bedeutung sind. Daß übrigens Rörig (IV, S. 62) die Peilliniengrenze den Ortsbestimmungen im Urteil des Oberappellationsgerichts von 1825 gewissermaßen hinzuinterpretiert, halten wir für ebenso irreführend wie die Vermengung der Peillinie mit den "Angaben der Quelle" des 16. Jahrhunderts bei Rörig III, S. 133.
~~~~~~~~~~
Nach Rörig 133 ) zerfallen unsere "Bemühungen", seine Beweisführung oder, wie er meint, die "urkundlich unbedingt gesicherten Tatsachen" zu erschüttern, in zwei "Gruppen". Erstens nämlich sollen wir "die gesamten in den Lübecker Quellen vorkommenden


|
Seite 117 |




|
Angaben" als Verhüllung von "Anmaßung", "Gewalthandlung" oder "Irrtum" dargestellt haben. Und Rörig nennt das "den Versuch der einseitig parteiischen Verdächtigung der gesamten amtlichen Tätigkeit Lübecks auf diesem Gebiete durch die Jahrhunderte". Das ist eine starke Übertreibung. Für unbedingte Gewalthandlungen Lübecks Mecklenburg gegenüber halten wir nur die Reusenzerstörungen. Bei den paar Übergriffen ins Bergerecht aber liegen die Dinge anders; um sie richtig zu beurteilen, muß man den Widerstreit berücksichtigen, der zwischen den Rechtsanschauungen der Landesherren und der Seestädte über das Bergerecht obwaltete. Die Städte hielten sich für befugt, überall selbständig zu bergen. Daher glaubte auch Lübeck in derlei Fällen nicht gegen die mecklenburgische Gebietshoheit zu verstoßen, um so weniger, als es besondere mecklenburgische Strandrechtsprivilegien besaß 134 ).
Daß aber die Reusenzerstörungen rechtswidrig gewesen sind, ist keineswegs unglaubhaft, wenn Rörig es auch so hinstellen möchte. Man muß allerdings die alten Zeiten kennen mit ihrem schleppenden, oft versiegenden Prozeßverfahren, um zu wissen, was möglich war. Gewohnheitsmäßige private Fischereiberechtigung am mecklenburgischen Strande war kein Rechtstitel für solche Handlungen, ebenso wenig wie die gleichfalls private, auf einem Privileg beruhende Fischereiberechtigung der Lübecker an der holsteinischen Küste ein Rechtsgrund für die Bedrängung der domkapitularischen Fischer in der Niendorfer Wiek gewesen ist. Und wenn Rörig 135 ) meint, daß die "Einwürfe, die von mecklenburgischer Seite zur Zeit des Fischreusenstreites gemacht werden", "zum guten Teil auf faktischer Unkenntnis der Verhältnisse überhaupt beruhen", so ist das gar nicht aufrecht zu erhalten gegenüber der Tatsache, daß diese Einwürfe auf Grund einer eingehenden, unter Aufbietung vieler Zeugen angestellten Untersuchung erhoben wurden. Ferner übersieht Rörig hierbei ganz die tatsächlichen Hoheitshandlungen und Verfügungen Mecklenburgs bis in die neueste Zeit. Oder handelt es sich bei alledem nun etwa um "Anmaßung" und "Irrtum" auf mecklenburgischer Seite? Dann wäre es sehr merkwürdig, daß Lübeck 1874 die Verordnung zum Schutze der Dünen des Ostseestrandes vor Rosenhagen und damit die mecklenburgische Hoheit über das strittige Küstengewässer anerkannte. Keineswegs auch trifft die Behauptung zu, daß es Mecklenburg


|
Seite 118 |




|
"bis zur allerjüngsten Vergangenheit" an "jeglichem staatlichen Organ" zur Wahrnehmung seiner Rechte gefehlt habe. Diese Organe sind die Jahrhunderte hindurch die Amtmänner des Amtes Grevesmühlen und ihre Strandreiter gewesen.
Die zweite Gruppe unserer "Bemühungen" soll in Versuchen bestehen, "besondere, nicht aus den gleichzeitigen Akten entnommene Begriffe einzuführen, um durch sie entweder die in den Akten vorkommenden Begriffe zu ersetzen und zu verwässern oder aber eine künstliche Begriffsverengerung vorzunehmen" usw. Dies zielt auf die Reede. Aber wir haben hier nichts verwässert und auch nichts zu Unrecht verengert, sondern Rörig hat den Reedebegriff übersteigert.
Wir schließen mit der Feststellung, daß die neuerdings von Rörig über die Reedelage beigebrachten Quellen unsere früheren Angaben in erfreulicher Weise bestätigen, und hoffen, daß wir nicht noch zu weiteren Auseinandersetzungen genötigt werden.
~~~~~~~~~~
Exkurs.
Zur Beurteilung der älteren Seekartenwerke.
In der Anmerkung 78 seines neuen Erachtens (IV, S. 53 f.) bekämpft Rörig zunächst unsere Verwertung der Werke Waghenaers. Wir entgegnen, daß wir in Archiv III, S. 20, keineswegs behauptet haben, es sei der Text in Waghenaers "Spiegel der Seefahrt" allgemein wertvoller als die Karten; nur im vorliegenden Falle der Travemünder Reede haben wir den Text für wichtiger erklärt, und zwar mit Recht. Auf der Karte interessiert für die Reede überhaupt nur die Ankerlage, und daß darauf im "Spiegel der Seefahrt" nichts zu geben ist, wird in Archiv III, S. 19, Anm. 60 nachgewiesen, worauf aber Rörig nicht eingeht. Seine geringschätzige Beurteilung des jüngeren Werkes, des "Thresoors von der Seefahrt", greift völlig fehl. Man vergleiche die Abbildung aus dem "Spiegel" bei Rörig III (Kartenbeilage 1) mit dem Kartenausschnitt aus dem "Thresoor" auf unserer Beilage 2 in Archiv III. Wo findet sich denn auf dieser ein "leicht-


|
Seite 119 |




|
fertiges Zusammendrängen" der Angaben des "Spiegels"? Im "Spiegel" verläuft die holsteinische Küste, die doch nicht bloß "fingiert" sein soll, bei Heiligenhafen gegenüber Fehmarn fast in gerader Linie; der große Vorsprung, den sie hier nach Norden bildet, kommt gar nicht zum Ausdruck, wohl aber im "Thresoor", wo die ganze Küstenlinie dem natürlichen Verlaufe, wenn auch vergröbert, nachgebildet ist. Man vergleiche ferner die Zeichnung der Insel Fehmarn, die der Ausschnitt bei Rörig noch größtenteils wiedergibt; im "Thresoor" ist sie viel genauer, die kleinen Buchten der Insel kommen besser zum Ausdruck, auch ist das zwar nicht namentlich bezeichnete Burg einigermaßen richtig eingetragen, während es im "Spiegel" ganz falsch liegt. Angesichts solcher Verbesserungen, deren wir noch mehr anführen könnten, läßt sich nicht von einem "rein buchhändlerischen Unternehmen" sprechen. Es ist denn auch die Karte des "Thresoors" in den Großen doppelten neuen Seespiegel von 1600 mit aufgenommen worden. Der Irrtum freilich, der darin besteht, daß die Plate vor der Travemündung nur über die Lübecker Bucht bis an die holsteinische Küste herangezogen ist, macht sich auf ihr sehr bemerkbar, geht jedoch auf die Karte im "Spiegel" zurück; denn so ist diese nicht aufzufassen, daß sie überhaupt nur die Travemünder Bucht darstellen will, sondern sie zieht Lübecker und Travemünder Bucht in eine zusammen und bringt im Buchtwinkel Angaben, die für die Travemünder Bucht gelten sollen.
Die jüngere Karte verdient den Vorzug. Daß wir sie der Ankerlage wegen gebracht haben, ist doch selbstverständlich. Warum soll denn die Einzeichnung von Anker und Tiefenzahlen "gedankenlose Flüchtigkeit" erweisen, d. h. flüchtiger sein als im "Spiegel"? Mit den Tiefenangaben auf den Karten Waghenaers ist überhaupt nicht viel anzufangen. Wir haben daher auch nur relativen Wert darauf gelegt, obwohl im "Thresoor" die Ankertiefen verschiedentlich berichtigt sind 1 ). Wohl aber haben wir hervorgehoben, daß auf beiden Karten der Anker nach Westen zu liegt, d. h., wie die Karten aufzufassen sind, nach dem Brodtener Ufer zu. Ist das etwa nicht der Fall? Auch dies würden wir jedoch durchaus nicht für entscheidend halten, wenn es nicht zu allen anderen Quellen stimmte. Ganz unwahrscheinlich ist die Meinung Rörigs, daß im "Spiegel" der Anker dem Worte "de Trave" habe ausweichen müssen; der Flußname hätte sich auch binnen Landes anbringen lassen.


|
Seite 120 |




|
Denn um den Flußnamen handelt sichs, nicht um die "Außentrave". Er ist aber nicht aus Platzmangel vor die Mündung gesetzt worden (aus Platzmangel steht er nur jenseit der Plate), sondern Waghenaer hat es auch sonst so gehalten. Ob die sechs in Archiv III, S. 22 (mit Beilage 4) dafür vorgebrachten Beispiele die einzigen sind, die sich anführen lassen, können wir nicht mehr nachprüfen. Sie genügen jedenfalls. Eben auf derselben Karte haben wir das Beispiel des "Yellen". Bei der Warnow, meint Rörig, sei es "nicht so gemacht". Das ist buchstäblich richtig, und jeder Leser nimmt nun natürlich an, daß der Name "Warnow" auf dem Flußlaufe oder an dessen Rande stehe; er ist aber gar nicht angegeben, ebenso wenig wie der der Piasnitz am östlichen Ende der pommerschen Küste (Archiv III, Beilage 4). Im übrigen verweisen wir auf alles, was wir in Archiv III, S. 22 bemerkt haben. -
Wenn ferner behauptet wird, daß das "sättia" in Manssons Seebucht unbedingt "Anker werfen" heiße 2 ), so müßte zunächst einmal die Bedingung erfüllt werden, alle in Betracht kommenden Stellen des Originalwerkes daraufhin zu prüfen. Aber es kommt, wie mir schon in Archiv III, S. 30, gesagt haben, auf die Angabe bei Mansson gar nicht an, weil die deutschen Überarbeitungen des Werkes (es sind nicht eigentliche Übersetzungen) die 5, 7 und 8 Faden in 5 und 6 berichtigt haben. Und wenn man keine Lübecker Faden annimmt, so handelt sichs eben nur um den vorläufigen Ankerplatz bei 5 bis 6 Faden Tiefe, der in der Lübecker "Nachricht für Seefahrer" von 1855 genannt wird (vgl. oben S. 22). Übrigens greift selbst dieser Ankerplatz höchstens ganz unwesentlich in das mecklenburgische Gewässer über. Natürlich aber konnte man, wenn man wollte, auch bei 7 und 8 Faden oder noch weiter draußen ankern, war dann jedoch gleichfalls nicht auf der eigentlichen Reede.
Über die Karte von Peter Gedda haben wir unseren Ausführungen in Archiv III, S. 25 f. nichts hinzuzufügen. Wer die Karte mit unserer neuen Reedeskizze vergleicht, wird eine vollkommene Übereinstimmung feststellen.
Erwähnen wollen wir noch, daß es in dem holländischen Seeatlas von Voogt (De nieuwe groote lichtende Zeefakkel) auf S. 20 über die Lübecker Reede heißt: "Als de Tooren van Travemunde ende de voor Tooren over een komt, ankert men op 5 a 6 vadem." Mit dem "voor Tooren" kann wohl nur der Leuchtturm gemeint sein. Dann wäre aber die Anweisung nicht richtig


|
Seite 121 |




|
oder wenigstens ungenau. Setzt man nämlich den Leuchtturm mit dem Kirchturm überein, d. h. in Linie, so fällt diese aus dem jetzigen Leuchtfeuersektor und dem Fahrwasser völlig heraus und führt, in der äußeren Bucht ungefähr auf der 10-m-Tiefenlinie verlaufend, schräge auf die mecklenburgische Küste zu. Auf der dänischen Seekarte von 1860 z. B. würde sie die Tiefen von 6 dänischen Faden überhaupt nicht mehr fassen und die 5-Faden-Tiefen nur teilweise, auf einem schmalen Gebiet längs der Küste überschneiden. Gerade die quer über die Bucht führenden gleichartigen Tiefen, auf die es für die Reede ankommt, berührt sie nicht. Auch ist an sich schon selbstverständlich, daß die Schiffe nicht in Linie hintereinander lagen, weil die Bucht viel breiteren Raum bietet. Überdies würde die Anweisung sämtlichen älteren Lübecker Reedekarten widersprechen, nach denen sich die Reede quer über einen Teil der Bucht hinzog. Es könnte sich also bei Voogt höchstens um ein Ungefähr handeln; man sah natürlich auf der Reede den Kirchturm hinter dem Leuchtturm liegen, aber man sah beide nicht genau in Linie. Weil jedoch eben die Linie Kirchturm-Leuchtturm in Manssons Seebuche als Ansegelungslinie für die Einfahrt in die Trave bezeichnet wird 3 ), ist es das Wahrscheinlichste, daß Voogt die Reede mit der Ansegelungslinie durcheinander geworfen hat.
~~~~~~~~~~
Nachtrag.
Kurz vor Versendung der Druckexemplare erhalten wir Kenntnis von einem Berichtigungsschreiben des Lübecker Senates vom 15. Nov., wonach sich bei der Vervielfältigung des jüngsten Rörigschen Gutachtens ein Fehler eingeschlichen hat; es sei in dem Bericht der Frau des Lotsenkommandeurs Scharpenberg von 1784 (S. 76 unseres Gutachtens) hinter den Zahlen 130, 140 die Zahl 150 ausgelassen worden. Der Bericht besagt also, daß alle Schiffe 5-6 Kabellängen vom Bollwerk ablägen und daß eine Kabeltau-Länge 130, 140, 150 Faden betrage. Damit wird erklärt und gerechtfertigt, daß Rörig mit einer Kabellänge von 150 Faden operiert und die größte Entfernung vom Bollwerk zu 900 Faden (6 x 150)


|
Seite 122 |




|
angenommen hat, was wir beanstanden mußten. Für die Sache selbst aber ist diese Feststellung belanglos. Denn die weiteste Entfernung vom Bollwerk, die wir auf 1450 m berechnet haben, würde jetzt 1553 m betragen. Auf unserer Kartenskizze müßte also der äußere Kreisbogen vom Norderbollwerk aus mit einem Radius von 1553 statt 1450 m geschlagen werden. Das macht nur gut 100 m Unterschied. Überdies ist Folgendes zu bedenken: Die Entfernung vom Norderbollwerk bis zu dem Punkte der Majorlinie des Jahres 1784, wo diese den südlichen Strahl des heutigen Leuchtfeuers schneidet, beträgt auf unserer Kartenskizze nur etwa 10 m mehr als 6 Kabellängen zu je 130 Faden (= 780 Faden oder 1346 m). Weiter nordwestlich, in der Richtung des Reedegebietes, wird der Abstand zwischen Bollwerk und Majorlinie natürlich größer, beträgt also über 6 Kabellängen zu 130 Faden. Nimmt man das größere Kabelmaß von 140 Faden an, so kommt man mit 5 Kabellängen auf 1208 m, mißt also vom Norderbollwerk bis zur Majorlinie überall mehr als 5 Längen. Ebenso, wenn man das größte Maß von 150 Faden zugrunde legt, von dem 5 Kabellängen = 1294 m sind. Demnach kommt man auch mit den beiden größeren Kabelmaßen schon in dem Gebiet bis zur Majorlinie auf über 5, d. h. auf 5-6 Kabellängen, ja, wie unsere Skizze lehrt, teilweise auch schon auf 6 volle Längen zu 140 Faden (1450 m). Und selbst mit 6 vollen Kabelmaßen zu je 150 Faden überschreitet man die Majorlinie vom Jahr 1784 äußersten Falles nur um gut 200 m. Es kann aber nicht gerade die weiteste Entfernung, die sich auf Grund des Scharpenbergischen Berichtes überhaupt ausrechnen läßt, für die richtige angesehen werden. Hätte die Reede jenseit der Maiorlinie gelegen, so würde man sie mit 5 Kabellängen, welches der drei Maße man auch annimmt, niemals erreicht haben, und sogar die Maßangabe von 6 Kabellängen zu je 130 Faden wäre unzutreffend, weil man damit im Sektorgebiet außer auf einer kleinen Strecke von etwa 80 m nirgends bis an die Majorlinie von 1784 herankommt. Wahrscheinlich ist aber gerade dieses Kabelmaß von 130 Faden in Lübeck das eigentlich gebräuchliche gewesen. Denn man rechnete die Kabellänge sonst zu 120 Faden (s. S. 76 unseres Gutachtens), und 130 Lübecker Faden (224,34 m) sind ungefähr soviel wie 120 englische (219,36 m) oder 120 preußisch-dänische Faden (225,96 m).
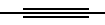


|




|
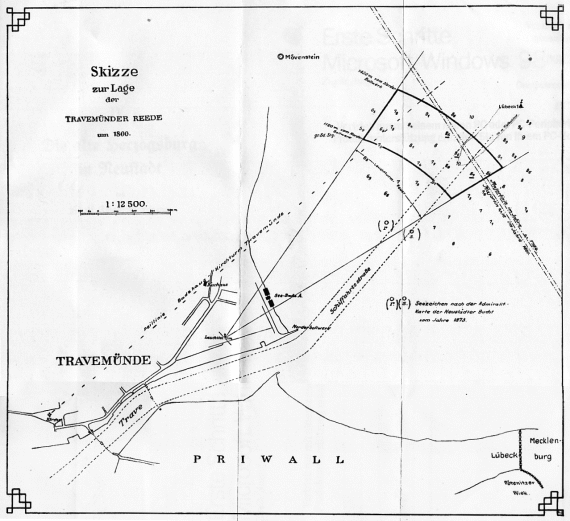


|




|


|
[ Seite 123 ] |




|



|


|
|
:
|
IV.
Die alte Herzogsburg
in Neustadt
von
Adolf Friedrich Lorenz.
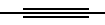


|
[ Seite 124 ] |




|


|
Seite 125 |




|
D er diesjährige Ausflug des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde nach Neustadt gab den Teilnehmern Gelegenheit, die alte Burg zu besichtigen, die - abgesehen von den Stadttoren und Stadtmauern - einer der wenigen einigermaßen erhaltenen mittelalterlichen Wehrbauten in Mecklenburg ist.
Der Blick auf die Burg mit dem stattlichen runden Turm und der hohen Schildmauer über den Wasserspiegel des teichartig erweiterten Burggrabens hinweg ist allgemein bekannt; daß auch die beiden Wohngebäude der Beachtung wert sind, sieht derjenige, der in altem Mauerwerk zu lesen versteht, zumal wenn er das in den Schätzen des Schweriner Archivs vorhandene Aktenmaterial durchforscht, aus dem sich der Zustand der Burg zur Zeit ihres vollständigsten Ausbaus mit den umfangreichen Nebenanlagen im Geiste und auf dem Papier wiederherstellen läßt. Sind doch vor allem letztere seit der Mitte des 18. Jahrhunderts und letzthin noch durch den Erweiterungsbau des Kraftwerks allmählich zerstört oder so verändert, daß sie für das ungeübte Auge kaum noch vorstellbar sind.
Die vorteilhafte Lage des wendischen Fischerdorfs Glewe an den Ufern der Elde und die Nähe der wildreichen Lewitz werden den Grafen Gunzelin von Schwerin bestimmt haben, an dieser zur Verteidigung geeigneten Stelle eine feste Burg anzulegen und den Ort zur "Neuen Stadt" zu erheben. Es kann angenommen werden, daß der Burgberg, vielleicht mit Benutzung einer Sanddüne des Flußtals, künstlich aufgeschüttet ist, denn er erhebt sich verhältnismäßig hoch über die Umgegend und ist von ziemlich regelmäßiger kreisförmiger Gestalt.
Die Burg selber in ihrer heutigen Gestalt ist aber entschieden jüngeren Datums, sie zeigt nicht mehr, wie in Wredenhagen oder Stargard oder Stavenhagen, einen mehr oder weniger kreisförmigen Mauerring mit regellos darin verstreuten Gebäuden, sondern eine planvolle, genau rechteckige Anlage, die auf das spätere Mittelalter schließen läßt. Nur der runde Bergfried fügt sich nicht ganz in dies Rechteck, vielleicht steht er an Stelle eines älteren Turms. (Abb. in Anl. 1.) Das Rechteck von etwa 50 x 35 m wird umschlossen durch eine etwa 2 m starke Ring-


|
Seite 126 |




|
mauer, in deren zwei kurze Seiten sich die beiden Hauptbauten schmiegen, das alte und das neue Haus, während an der südlichen, der Stadt ab- und dem Flusse zugewendeten Seite das Eingangstor und neben ihm der es schützende Bergfried eingefügt sind. Der Bergfried nimmt fast genau die Mitte der Langseite ein, doch so, daß er mit seinem Grundrißkreis die Innenseite der Mauer tangiert, dagegen ist das Mauerstück mit dem Tor soweit aus dem Rechteck herausgedreht, daß seine Achse durch den Mittelpunkt des Turmgrundrißkreises geht. Durch diese Drehung wird erreicht, daß das Tor sich der von Parchim kommenden Landstraße zuwendet. Also eine sehr planvolle Anlage!
Schlie nimmt an, daß die heutige Burg noch von den Grafen von Schwerin, die bis 1358 das Land regierten, erbaut sei. Ich möchte dem nicht widersprechen, aber darauf hinweisen, daß die Mauertechnik wie auch die Bauformen und nicht zuletzt die systematisch planvolle Anlage auf frühestens die Mitte des 14. Jahrhunderts deuten. Herrscht doch fast überall der für das späte Mittelalter charakteristische polnische Verband (1 Läufer, 1 Binder).
Dieser Verband findet sich im ganzen Unterbau des Turms bis dicht unter den Treppenfries 1 ). Der Turm zerfällt in drei deutlich von einander geschiedene Bauabschnitte. Die beiden untersten Stockwerke in polnischem Verband (Ziegelgröße 28x13x9 bei 10 Schichten = 104 cm) stammen aus einer Bauzeit. Eine Tür im Erdgeschoß führt auf einer in der Mauerdicke liegenden Treppe zu einem kreisrunden kuppelgewölbten Raum im 2. Geschoß, neben dem sich zwei übereinander in der Mauerdicke ausgesparte Zellen befinden. Der Raum hat drei große Nischen mit je einem schräge aufwärtsführenden Lichtschlitz, der durch Balken, die in ausgesparte Nuten geschoben wurden, verrammelt werden konnte. Von hier aus führt ein Einsteigeloch in das ebenerdig liegende und durch drei schmale Schlitze belichtete Verließ, das aus quadratischem Grundriß durch Zwickel in die Kreisform übergeführt wird, unten mit Schutt gefüllt ist. Der jetzt von der Treppe aus hineinführende Zugang ist später eingebrochen. Außen läuft um den Turm in ungefährer Höhe der untern Lichtschlitze ein aus glasierten Köpfen gebildetes unregelmäßiges Rautenmuster, ein spätmittelalterliches Schmuckmotiv. Die ganze Anlage entspricht nicht mehr dem frühmittelalterlichen Wehrturm, bei dem die oberen Geschosse nur durch


|
Seite 127 |




|
eine leicht zu beseitigende Außentreppe zugänglich waren und Verteidigungseinrichtungen aufwiesen 2 ). Desto mehr für Verteidigung eingerichtet ist das jüngere dritte Geschoß. Das Mauerwerk hat hier die Steingröße 28x13x8 1/2 bei 10 Schichten = 1 m und zeigt eine scharf abgestochene Fuge, während die Fugen in den anderen Bauteilen breit ausgestrichen sind. Auch die Bauformen (stark überhöhte, fast korbbogenförmige Stichbogen) lassen auf die Spätzeit schließen, nicht zuletzt aber die sehr interessanten Doppelschießscharten, die auf eine ausgebildetere Verteidigungstechnik mit Feuerwaffen Rücksicht nehmen. Ob der Turm ursprünglich über dem 2. Geschoß aufgehört hat? Jedenfalls ist das 3. Geschoß von hier nicht zu erreichen, man hat auf die Zugänglichkeit von unten verzichtet und das Geschoß nur vom Wehrgang aus zugänglich gemacht, die beiden unteren Geschosse dagegen für sich liegen lassen. Sieben, im Grundriß flaschenförmige Nischen enthalten je zwei Schießscharten übereinander, die untere steil nach unten führend und in einen Schlitz endend zum Bestreichen des Fußes des Burgberges, während durch die obere weitere mit Stichbogen geschlossene Scharte wagerecht in die Ferne geschossen werden konnte. Quer vor dieser oberen Nische liegt ein Eichenholzbalken zum Heben des hinteren Geschützteils, was auf die Anwendung schwerer Wurfmaschinen oder leichter Feuergeschütze schließen läßt, oder nach Piper, Burgenkunde, Seite 371, "als drittes Auflager erscheint - - -, dessen Benutzung als solches bei der Höhe des so zur Vertheidigung eingerichteten Fensters freilich nicht unmittelbar vom Boden aus möglich wäre". Ob die an eichenen Auslegearmen noch zum Teil vorhandenen Holzrollen ursprünglich sind, welchem Zweck sie gedient haben können, und ob sie nicht vielleicht späterer Zeit, als auf dem Turm Hagel fabriziert wurde, entstammen, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Nach den Wehrgängen führen beiderseitig einige Stufen durch eine Tür abwärts, zum obersten Geschoß führt eine Wendeltreppe, zum Hof hin liegt eine Luke, die vermutlich zum Aufwinden von Geschützen und Munition gedient hat, sowie eine in der Mauer ausgesparte Zelle. Ein Abort ist heute vermauert. Das Gewölbe über diesem Raum ist eingestürzt und nur in seinen Anfängen vorhanden. Hamann nimmt an, daß hierüber vielleicht eine Plattform mit Zinnenkranz und steinernem Kegelhelm sich erhoben habe, die vielleicht durch eine Pulver-


|
Seite 128 |




|
explosion samt der Kuppel (wodurch auch die Risse im Turm zu erklären seien) zerstört sei 3 ); ausgeschlossen erscheint es nicht.
Jedenfalls hat dann das 16. Jahrhundert ein weiteres Geschoß aufgesetzt, das in Technik und Formen einen ganz anderen Charakter zeigt. Es ist hier ein Wohnbau entstanden. (Steinformat 30x14x10 bei 10 Schichten = 111 cm.) Über einem auskragenden Treppenfries ein unregelmäßiges buntes Mauerwerk, dünne, durch Verankerung gehaltene Wände, willkürlich in die Mauerfläche gesetzte, eine naive Sucht zu schmücken verratende Kreisblenden, vor allem aber die für Obersachsen und Thüringen in der Mitte des 16. Jahrhunderts charakteristischen, auch am alten Fürstenhof zu Wismar gefundenen Vorhangbogenfenster lassen den Verfall der mittelalterlichen Kunst erkennen. Innen ist das Geschoß ein schöner luftiger Raum, Sitzbänke in den Fensternischen, ein Kamin und ein gut erhaltener Abort lassen ihn wohnlich erscheinen. Derartige Aussichtsräume, wenn man so sagen darf, scheinen auch auf anderen Burgen eingerichtet worden zu sein, als man auf Verteidigungfähigkeit der Türme nicht so großen Wert mehr legte 4 ). Den Abschluß bildet eine Kegelhaube mit Uhrhäuschen, ursprünglich mit Schindeln, seit 1823 mit Dachsteinen gedeckt. Das Uhrwerk mit Glocke und Scheibe wird schon 1592 erwähnt.
In engem Zusammenhang mit dem Turm steht die südliche Schildmauer. Eine Untersuchung des Mauerwerks zeigt, daß sie mit seinen beiden unteren Geschossen im Verband steht, auch die Technik ist die gleiche. Doch scheint es von außen, als säße das Tor in einem Mauerwerk anderer Zeit, innen dagegen nicht. Jedenfalls sind die Formen entschieden spätmittelalterliche, sie unterscheiden sich mit ihrem steilen Stichbogen mit beiderseitigem, einen Stein tiefen Toranschlag ganz erheblich von den üblichen spitzbogigen mittelalterlichen Wehrtoren. Ich kann das Tor nur auf das Ende des 15. Jahrhunderts datieren. Was die Balkenlöcher über dem Tor bedeuten, ist nicht klar. Von der Höhe des Wehrgangfußbodens ab wechselt aber der Verband (Steingröße bis Oberkante der Schießscharten 31x15x8 1/2 bei 10 Schichten = 104 cm, darüber 26x13x8 1/2 bei 10 Schichten 104 cm). Dies Mauerwerk steht auch auf beiden Seiten mit dem des Turmes nicht im Verband. Neben drei Schießluken sind in der Tormauer


|
Seite 129 |




|
Sehr deutlich die Nische mit halb zugesetzter Tür und die Balken- und Strebenlöcher eines den Eingang beherrschenden Gießerkers zu erkennen (Pechnase oder machiculi). Eine Wiederherstellung dieses Erkers wäre leicht, zumal da auch die Überdachung des Wehrgangs hier gut erhalten ist. Ein rein dekorativer spätgotischer Zinnenkranz schließt die Mauer ab, auch die Kragsteine der auf der Innenseite zur Verbreiterung des Wehrgangs vorgeblendeten Stichbögen zeigen spätgotische Formen. Ich möchte annehmen, daß Tor und Wehrgang Ende des 15. Jahrhunderts, aber später als das 3. Turmgeschoß, erneuert bzw. vollendet sind.
Wie setzte sich nun im Mittelalter der Wehrgang auf den Wohngebäuden fort? Betrachten wir zunächst das Mauerwerk des Südgiebels des stadtseitig belegenen, jetzt als Gestütsstall dienenden Neuen Hauses. Es hängt in seinem wesentlichen Teile mit dem der Schildmauer zusammen, ist also gleichzeitig mit ihr entstanden. Dies kann man auch vom Hof aus und im Innern des Obergeschosses deutlich erkennen, wo sich die Konsolen des Wehrgangs hinter dem Mauerwerk der Innenmauer des Neuen Hauses fortsetzen, also ursprünglich wohl eine Verlängerung des Wehrgangs getragen haben oder tragen sollten. Der Absturz der äußeren Mauerschale dieses Bauteils im Jahre 1927 (das Mauerwerk besteht auch hier, wie überall bei stärkeren mittelalterlichen Mauern aus zwei schwachen Ziegelsteinverblendungen mit innerem Feldsteinkern) zwang leider dazu, diese Schale neu aufzuführen, so daß heute charakteristische Spuren verwischt sind. Vordem war der Rest eines Treppenfrieses in gleicher Form wie am Abschluß des 3. Turmgeschosses erkennbar, darüber scheint eine lisenenartige und sich in den Zinnenkranz verlierende Auskragung eine Parallele zu der Ecklisene des Baus gebildet zu haben, so daß man hier einen reicheren Staffelgiebel vermuten kann. Bei dem oben erwähnten Absturz wurde in halber Höhe zwischen den jetzigen Fenstern eine vermauerte Nische entdeckt, die innen aber nicht zu sehen ist; ich vermute eine Aborttür oder den Zugang zu einer später zu erwähnenden Freitreppe, ferner war deutlich sichtbar, wie das Felsenkernmauerwerk in verschiedenen Lagen mit verschiedenen Mörteln hergestellt war, bald weißem Steinkalk, bald bläulichgrauer Schwarzkalk. Das Gebäude oder diese Teile der Ringmauer sind dann vermutlich im 16. und zuletzt im 18. Jahrhundert so vielfältig und gründlich verändert worden, daß irgendwelche Vermutungen über das ursprüngliche Aussehen zwecklos werden. Da es 1576 das "Newe Hauß" heißt, kann angenommen werden, daß es erst später in die Ringmauer eingebaut ist, wenngleich die Innenmauer auf dem nördlichen Ende mittel-


|
Seite 130 |




|
alterliches Mauerwerk (polnischen Verband, Steingröße 26x13x9) zeigt. Es wird hier also schon immer ein Haus gestanden haben, vielleicht reichte dieses nur bis zu der außen an der Längsseite sichtbaren, einen deutlichen Absatz bildenden Lisene. Hier ist aber der Verband bis um die Südostecke herum wendisch (2 Läufer, 1 Binder). Haben wir vielleicht in dem zwischen den Lisenen liegenden Bauteil die Burgkapelle zu suchen, die gewöhnlich in der Nähe des Tores lag und in den Urkunden einige Male genannt wird?
Interessanter als diese Fragen ist es aber, daß wir in dem jetzt so unscheinbaren und vernachlässigten Gebäude, dem Neuen Hause, das Wohngebäude des alten herzoglichen Schlosses aus dem 16. und 17. Jahrhundert zu sehen haben. Das Schweriner Archiv gibt die Möglichkeit, sich von dem Aussehen des Gebäudes zu dieser Zeit eine lebhafte Vorstellung zu machen, denn es finden sich dort Beschreibungen in den Inventarverzeichnissen, die den Erbteilungsakten der Jahre 1576, 1592 und 1610 zugrunde liegen, außerdem aber eine Aufmessung der Burg mit ihren ganzen Nebenanlagen in großen Zügen aus dem Jahre 1612 von der Hand des herzoglichen Baumeisters Gert Evert Piloot. (Abb. in Anl. 2.)
Zunächst erhebt sich an der Stelle, wo jetzt die große Tür in das Innere des Gebäudes führt und der häßliche Mauerabsatz sich zeigt, ein steinerner "Windelstein" mit hölzernen Treppenstufen, oben mit einem Fachwerkgeschoß abgeschlossen, und äußerer Freitreppe, darunter ein Keller. Über diese Treppe gelangte man im Obergeschoß in die fürstlichen Gemächer, über einen Vorplatz links in des Herzogs Stube, Kammer, Sekret, rechts in die entsprechenden Räume der Herzogin, Stube, 2 Kammern, Sekret; im Erdgeschoß rechter Hand in ein Kellergewölbe, links über einen Vorplatz in die große Hofstube, den Hauptaufenthaltsraum des Personals und Raum für Festlichkeiten, von dem an einem Ende ein erhöhter Platz als Schreibstüblein mit Gitterwerk abgetrennt war. Im Obergeschoß sind jetzt noch mehrfach auf den glattgeputzten Außenwänden die Anschlußstellen der früheren Fachwerkscherwände und die Holzdübel zur Befestigung der Wandbespannungen sichtbar, ebenso die Fenster- und Abortnischen, so daß man sich eine räumliche Vorstellung der Gemächer machen kann, wenn man von der von 1750 stammenden Holzunterkonstruktion des Daches absieht. Das Inventar von 1592 beschreibt die Räume eingehend: Fußboden von Brettern, Mauersteinen oder Alstraken, die Wände ringsum "bebenkhet", d. h. mit festen Sitzbänken versehen, die Decke "ein gewunden bohn", d. h. ein zwischen den


|
Seite 131 |




|
Balken geputzter Windelboden, selten ein Kachelofen, dagegen offene Kamine, also von einer Einfachheit, die man heute mit dem Begriff eines Fürstenschlosses nicht vereinen kann. An Möbeln werden nur Bettstellen, Tische und Truhen genannt.
Das Ganze entspricht völlig dem Typ des vornehmen Adels oder Fürstenhauses des 16. Jahrhunderts in Norddeutschland: zwei Geschosse, oben zu beiden Seiten eines Vorraums je eine Stube mit und 1 bis 2 Kammern mit Aborten, unten die Hofstube mit erhöhtem Verschlag und die Kapelle, davor ein massiver Treppenturm als Verbindung 5 ).
Ein Inventar von 1714 schildert die Ausstattung aber schon bedeutend reicher:
-
In den fürstlichen Logimentern:
Ihro hochfürstl. Durchl. des Herrn Hertzogen logiment ist mit blau orange gelben und weiß geflammten atlas ausgeschlagen.
Der Eßsaal ist mit bunt-geflamten und gestreiften wollenen Tapeten ausgeschlagen. -
In der Hertzogin logiment
sind die Wände mit geflammt wollen tapisserien ausgeschlagen, -
In der Hertzogin antichambre
die Wände mit Goldleder ausgeschlagen, über der Thür ein klein Gemahlde von einer Dame zu Pferde, -
Im Cabinet
die Wände mit gelber gestreifter brocatelle ausgeschlagen.
Wir kommen jetzt zur Nordmauer, die heute in ruinenhaftem Zustande mit Gesträuch und Gras bewachsen ein malerisches Bild des Verfalls bietet. Der Wehrgang ist verschwunden, die Mauer selbst durch Strebepfeiler, die aber schon bei Piloot 1612 bezeugt sind, gestützt und vielfach untermauert. Der Verband ist hier wieder durchgehends der polnische mit Steinformat 29x14x9. Die Mauer wird durch ein Tor mit Fußgängerpforte und eine Nische durchbrochen. Daß diese nicht ursprünglich sind, sondern einem späteren Bauversuch entstammen, sieht man nicht nur an dem in Steinen kleinen Formats gemauerten, für das 17. Jahrhundert charakteristischen Bossenquadern, sondern auch daran, daß der Anschlag des Tores und der Pforte außen liegen. Beide


|
Seite 132 |




|
sind danach nicht als Hinterpforte zur Stadt hinunter denkbar, denn dann würde der Verschluß innen liegen, sondern sie sind meiner Meinung der Anfang eines hier beabsichtigten, außerhalb der Ringmauer gedachten dritten Flügels. Sollte nicht dieser von Piloot stammen, der vom Herzog mit der Vergrößerung der Burg beauftragt sein könnte, bevor man an den Gedanken herantrat, lieber ein neues Schloß an anderer Stelle zu bauen, und der zu diesem Zweck 1612 den Grundriß aufgenommen haben wird? Zu dieser Annahme paßt auch der kleine, jetzt außerhalb liegende gewölbte Keller, dessen auffallender Einsprung im Grundriß nur durch einen beabsichtigten oder vorhanden gewesenen vierten Strebepfeiler zu erklären ist.
Das zweite Hauptgebäude, das "alte lange Hauß", ist das Wirtschaftsgebäude, als welches es noch 1740 nach einer im Archiv aufbewahrten Zeichnung instandgesetzt wird. Aus dieser Zeit mag das Fachwerk der oberen Außenwand stammen, während die Innenwand schon 1576 in ganzer Höhe Fachwerk zeigte. Das Gebäude enthielt unten Brau- und Backstube, Küche, Speisekammer, Wollstube, Keller, im Obergeschoß einen Malzboden. In seinen Grundzügen wird das Gebäude trotz Umbaus zu Wohnungen, später zum Schulhaus, seinen ehemaligen Zustand bewahrt haben. Die massigen geböschten Eckstrebepfeiler und die kleinen Pfeiler der äußeren Langseite entstammen, nach dem Mauerwerk zu urteilen, dem 16. Jahrhundert. Die Giebel sind im Verband mit der Ringmauer, nur von Dachhöhe ab werden sie von der Instandsetzung von 1740 herrühren.
Die Schildmauer mit Wehrgang schließt wieder den Ring zum Turm hin, doch fehlt hier die Überdachung und sind die Bogenkonsolen schlichter.
In der Mitte des Hofes lag ein Brunnen, wie üblich.
Zur Burg gehörte nun noch ein größerer Bereich von Bauten der Vorburg mit den Außenwirtschaftsgebäuden, das Ganze eingeschlossen und wohl verteidigt durch ein System von durch die Elde gespeisten Wassergräben. Die Abbildung in Anl. 3.) stellt einen Rekonstruktionsversuch dar, der ein Vogelschaubild über die Vorburg gibt.
Naht man sich der Burg von Parchim her, nachdem man das auf einer kleinen Insel zwischen Armen der Elde liegende befestigte Parchimer Tor 6 ) passiert hat, so kommt hinter einer Brücke eine Sägemühle, dann wieder ein Wasserarm 7 ). In der


|
Seite 133 |




|
Richtung der heute vom Schloßplatz zur Burg führenden Straße geht es sodann gerade auf das erste Pforthaus zu, vor dem ein Graben mit Zugbrücke lag 8 ). Das Pforthaus, ein sehr langes Gebäude aus Fachwerk in zwei Geschossen, enthielt neben der Durchfahrt einen Pferdestall, eine kleine Wohnung und oben zwei Kornböden. Das Gebäude, schon 1576 als alt bezeichnet, wurde 1744, da halb eingestürzt, zum Abbruch bestimmt und 1752 abgebrochen. Auf dem Platze lag dann links die Große Mühle mit fünf Glinden, das heutige Kraftwerk. An dieser vorbei führte der Weg dann über eine abermalige Zugbrücke, die völlig um 1890 erst einging, über den Hauptgraben zu einem zweiten Pforthaus, das sich an die südöstliche Ecke der Hauptburg anschmiegte.
Es war gleichfalls in Fachwerk errichtet, nach dem Inventar von 1576 und 1610 als dreistöckig, 1592 dagegen als zweistöckig mit einem zweistöckigen Erker über der Tordurchfahrt bezeichnet. Dieser Widerspruch wird so zu erklären sein, daß der in den Dachstuhl hinaufreichende Erker als drittes Geschoß angesehen werden konnte. Der Bau enthielt neben der Durchfahrt auf der linken Seite die kleine Hofstube mit einem Schreibstüblein, oben mehrere Wohnräume, wohl für Gäste bestimmt, allem Anschein nach ein recht stattliches Gebäude. Auf der rechten Seite ging es in die Küchenmeisterei, gleichfalls in Fachwerk, die in den Burggraben hineingebaut sich zu Füßen des Neuen Hauses schmiegte. Piloot zeichnet auf der Rückseite des Pforthauses einen, wahrscheinlich im ersten Geschoß vorgekragten Gang, der sich auch zu einem Stock an der Küchenmeisterei hinzog und zu dem eine Freitreppe am Giebel des Neuen Hauses führte. Scheinbar gelangte man über diese auch in das Neue Haus.
Nachdem der Burggraken während des 18. Jahrhunderts allmählich vermoddet, die Zugbrücke durch eine massive ersetzt, das zweite Pforthaus, unbekannt wann, verschwunden war, wurde an Stelle des ersteren ein Siel zur Abführung der Abwässer aus den angrenzenden Stadtgrundstücken verlegt. Nach Nordwesten verbreiterte sich der Graben bis an die zum Kirchplatz führende Straße, über ihn führte ein schmaler Damm. 1764 wird Klage geführt, daß die Anwohner hier durch allmähliche Anschüttung den Graben immer mehr einengen und sich Terrain aneignen. Der Graben führt weiter, noch heute vorhanden bzw. erkennbar, um den Burghügel herum, erweitert sich zu einem Teich, der in


|
Seite 134 |




|
jüngerer Zeit mit Karpfen besetzt war, und ist höher gestaut als das Unterwasser der Elde. Jenseits des Grabens lag hier ein großer Zier- und Küchengarten; von dem Gärtnergehöft darin und von der von der Burg zu ihm führenden Brücke ist in den Akten des 18. Jahrhunderts öfter die Rede. Der erwähnte Teich ist durch Aufstauung des Burggrabens hinter dem zum Dorf Kiez führenden sogenannten Hundedamm entstanden. Neben dem Zwecke der Befestigung wird er vor allem eine wirtschaftliche Bedeutung gehabt haben 9 ). Ein kleines Waschhaus an der Stelle, wo heute das ehemalige Schmiedegehöft steht, vervollständigte das typische Zubehör einer Schloßanlage des 16. Jahrhunderts.
Als nun 1619 endgültig mit dem Bau des neuen Schlosses begonnen wurde, erlosch natürlich schnell das Interesse an der alten Burg. Zwar wurde sie noch 1714, wie aus den damals ausgenommenen Inventar hervorgeht, in bewohnbarem Zustande gehalten, zumal da das neue Schloß lange Jahre unvollendet liegen blieb. Doch, nachdem dieses 1717 in der Gestalt, wie es heute vor uns steht, durch L. T. Sturm vollendet war, sank die Burg zum unbedeutenden Nebenhause herab und war damit bei der Geldarmut der Zeit dem allmählichen Verfall preisgegeben. Die am Ende des 17. Jahrhunderts aufgekommene verfeinerte französische Wohnkultur ließ auch die schlichten primitiven Räume hinter dicken Mauern auf engem Hügel als zu unwohnlich erscheinen. Die Hofstube wird noch 1734 repariert, doch wird im Neuen Haus schon 1738, doch unter Schonung der fürstlichen Zimmer, eine kleine Wohnung eingerichtet. 1740 aber stürzt der Fußboden des ehemaligen Audienzzimmers ein, die Kellergewölbe senken sich, die Schornsteine drohen zu stürzen. Die Giebel dieses Flügels haben starke Risse, die übrigens schon 1610 erwähnt werden. Das gleiche scheint im Alten Hause passiert zu sein, denn dieses wird 1740 gründlich umgebaut, woher die oben erwähnte, im Archiv befindliche Zeichnung stammt. 1748 wird beschlossen, da der alte Marstall im ersten Pforthause dem Einsturz nahe, das massive Wohnhaus des alten Schlosses zum Marstall für 24 Pferde und oben zum Kornboden umzubauen. Der Landbaumeister Horst in Boizenburg erhält den Auftrag: 1) das Dach und die Mauern abzubrechen und die Mauer, wo das Treppengebäude gestanden, wieder auszubessern, 2) die Ecke nach der Mühle zu neu aufzu-


|
Seite 135 |




|
mauern, auch nach der Stadt zu die überhängende Mauer auszubessern, ein Stück Mauer nach dem Hof zu, welches stark übergewichen, und worunter sich nachher verfaulte Hölzer gefunden, neu wieder aufzuführen, einen verfallenen Pfeiler nahe an dem hinteren Giebel nach der Stadt zu abzunehmen, an der Seite nach der Stadt zu den Schutt einen Fuß hoch wegzuräumen, den Pfeiler und die vorstehende Mauer abzuräumen, 3) zu beiden Seiten an den Mauern im Stall, unter der Mauer-Platen Kragsteine von Feldsteinen einzumauern und einen Absatz zu machen, 4) Anker einzuziehen, . . . 7) einen blinden Schornstein aufzuführen, . . . 9) die Fenster zu erneuern. Dies geschieht denn auch so gründlich, daß von dem alten Hause nur stehen bleiben die drei Außenmauern und die halbe hofseitige Mauer. Die Fenster werden zugemauert oder verkleinert, die Decken herausgenommen, der Keller zugeschüttet, neue Balkenlagen auf eingemauerten Konsolsteinen eingezogen, das Obergeschoß erhält einen starken inneren Holzverband zur Sicherung der Außenwände, die Giebel und der Windelstein werden abgerissen, eine Hälfte der Hofmauer ganz neu aufgeführt.
1768 droht die Schloßbrücke einzustürzen und wird massiv wieder aufgeführt. Aus dem Jahre 1805 finden sich Akten über umfangreiche Reparaturen am Turm, die dazu führen, daß 1821/23 das Spandach auf Grund eines Gutachtens des Landbaumeisters Barca zu Ludwigslust durch einen Rostocker Turmdachdecker durch ein Steindach ersetzt wird. 1838 wird der Turm zur Fabrikation von Hagel vermietet, weshalb an ihm ein hölzerner Erker errichtet wird, der aber nach Eingehen dieser Industrie 1860 entfernt wird. 1850 erhält die Stadt das Recht, in dem zuletzt zu Wohnungen und als Orangerie benutzten Alten Hause, nach endgiltiger Aufhebung der Hofhaltung im neuen Schlosse, Schulräume einzurichten. Sie stellt bei dieser Gelegenheit durch das bis dahin vermauert gewesene hintere Tor einen Weg zur Stadt für die Schulkinder her. 1860 wird über starke Vermoddung des Schloßgrabens und Schadhaftigkeit der Steineinfassung der Ufer geklagt, trotzdem hat er noch bis etwa 1890 bestanden; erst dann wurde die Brücke abgebrochen und der Graben zugeschüttet.
Durch die Schilderungen Pipers in seiner Burgenkunde wurde man gegen Ende des 19. Jahrhunderts erst wieder auf das ehrwürdige alte Bauwerk aufmerksam, so daß 1897 die vermauert gewesenen Vorhangbogenfenster des Turms durch den Landbaumeister Hamann wiederhergestellt werden konnten.
Doch noch viel ist zu tun, um alle berechtigten Forderungen der Denkmalpflege zu erfüllen. Manche der mehr oder weniger


|
Seite 136 |




|
häßlichen Schuppen und Ställe, die sich im 19. Jahrhundert und schon früher zwischen den alten Mauern eingenistet hatten, sind zwar schon wieder beseitigt. Wann wird es aber möglich werden, das alte Bauwerk von diesen unerfreulichen Zutaten völlig zu säubern, die Gebäude einer zweckmäßigen und würdigen, die gute Erhaltung am besten gewährleistenden Bestimmung wieder zuzuführen und die Umgebung, besonders den in letzten Jahren notgedrungen verwahrlosten Burgberg in den angemessenen Zustand zu versetzen, der einem der ältesten Profanbauwerke Mecklenburgs und ehemaligen Fürstensitze entspricht?
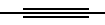


|




|



|




|


|




|
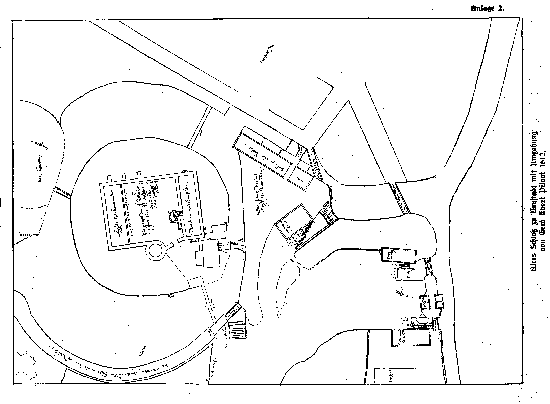


|




|


|




|
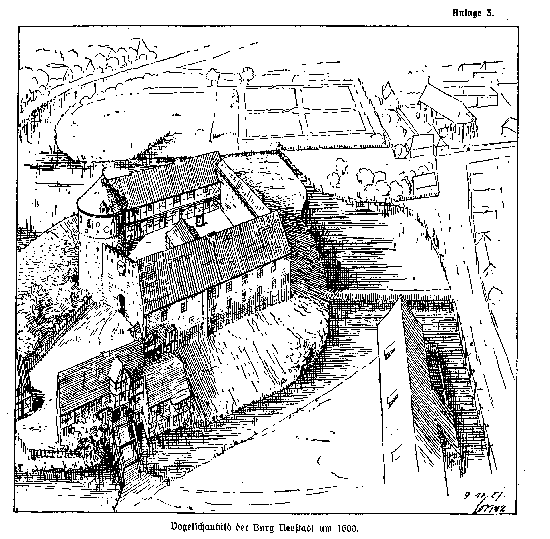


|




|


|
[ Seite 137 ] |




|



|


|
|
:
|
V.
August Achilles
Ein Künstler der alten Zeit
von
A. von Langermann.
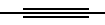


|
[ Seite 138 ] |




|


|
Seite 139 |




|
S obald die kunstwissenschaftliche Arbeit vom Erfassen des einzelnen Kunstwerkes und seines Schöpfers dazu übergeht, deren Zusammenhang mit der geschichtlichen und wirtschaftlichen Umwelt klarzulegen und die Erscheinungsformen des Kunstlebens als Frucht dieser mannigfachen Einflüsse zu betrachten, dehnt sich ihr Arbeitsgebiet ins Ungemessene aus. Was in den Hauptwerken der Großen seinen vollkommenen Ausdruck findet, kündet sich lange vorher an ganz entlegenen Stellen an und wirkt nach bis an die Grenzen künstlerischen Schaffens, wo dieses sich mit dem Handwerk berührt, und bis in die Erzeugnisse begeisterter, aber von keinerlei Fachwissen beschwerter Kunstfreunde.
Für solche Betrachtung sind schließlich auch jene Bildermacher wichtig, die, auf den engen Kreis ihrer Heimat beschränkt und selbst dort nach wenigen Jahrzehnten vergessen, mit flinkem Stift Landschaftsbilder, Städteansichten und Erinnerungen an Tagesereignisse festhalten, die eine Zeitlang die Wand des Kleinbürgerhauses zieren und schon von der nächsten Generation in die Rumpelkammer befördert werden. Von dort holen sie dann wohl einmal Händler und Sammler wieder hervor und entdecken in ihnen neben dem Nachhall verklungener Zeiten und Kunstweisen soviel tüchtiges Können und gute Beobachtung, daß es sich wohl lohnt, den verwehten Spuren nachzugehen und die Schicksale dieser vergessenen Künstler aufzuspüren. Das erfordert langes und mühseliges Stöbern in Archiven und Registraturen, in Trödelläden und in den Mappen von Sammlern, die ihre Schätze unter ganz andern Gesichtspunkten zusammenbrachten. Das Ergebnis wird zunächst nur einen kleinen Kreis erfreuen und zu eigenem Suchen in ähnlicher Richtung anregen, aber darüber hinaus wird das Verständnis für heimatliche Art geweckt, und die Bausteine bereit gelegt für eine größere Arbeit, die weitausgreifend die oben angedeuteten Gedanken und Zusammenhänge klarlegt. Hierfür ist die Graphik fast noch wichtiger als die Malerei, denn durch die Vervielfältigung und die Billigkeit des einzelnen Blattes ist die Verbreitungsmöglichkeit größer. Sie dringt bis in die entferntesten Winkel des Volkslebens und ist dadurch ein sicherer


|
Seite 140 |




|
Gradmesser für das Kunstbedürfnis und die Anschauungsweise der Zeit.
Die Befreiung des Menschengeistes in der Reformationszeit, der Drang, zu allen Fragen des diesseitigen und jenseitigen Lebens selber Stellung zu nehmen, fand Nahrung in Dürers wuchtigen Holzschnitten und später in den Arbeiten der sogenannten Kleinmeister, die jetzt nach langer Vergessenheit wieder ins Licht der Forschung gerückt werden.
Im 17. und 18. Jahrhundert ist es der Kupferstich, mit dessen Hilfe Kriegstaten und Entdeckungen, Fragen der Religion und der Philosophie in die entlegensten Wohnungen Eingang finden.
Für das 19. Jahrhundert übernimmt die Lithographie das Amt des volkstümlichen Kulturvermittlers, oft in seltsamer Verzerrung und Verdünnung, aber immer anregend, oft mit erfrischendem Humor. Jede Gegend, beinahe jede Stadt hat ihren besonderen Künstler, der, manchmal mehr schlecht als recht, aber nach bestem Können und Vermögen, ehrlich und einfältig, der Mit- und Nachwelt zum Ergötzen, Stadt und Land und was sich dort zutrug, "nach der Natur auf den Stein zeichnete".
In Mecklenburg hat die Lithographie bis weit ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts eifrige Pflege gefunden und so manches der damals begründeten "Institute" hat sich bis zum heutigen Tage erhalten. Landschaften, Städteansichten und Trachtenbilder der damaligen Zeit sind über das Gegenständliche hinaus, das über die Baugeschichte manchen erwünschten Aufschluß gibt, auch als Kunstleistung recht annehmbar.
Aus der großen Zahl der in Mecklenburg tätigen Lithographen ragt einer hervor durch die Vielseitigkeit und Sorgfalt seiner Arbeiten, so daß man ihn innerhalb seines begrenzten Kreises wohl als Künstler ansehen und sich mit seinem Lebenswerk etwas näher befassen darf. Das ist August Achilles. Er ist am 16. März 1798 1 ) in Rostock geboren als Sohn des Musketiers August Johann Achilles und seiner Ehefrau Anna Marie Friederike Koch. Am 24. März wurde er in der St. Johanniskirche auf die Namen August Friedrich Johann getauft. Der Vater, der sich auch als Scherenschleifer betätigte, war aus Sachsen gebürtig, seine Mutter aus Stralsund.
Augusts Kindheit, die in die Bedrängnisse der Franzosenzeit fiel, wird sich in ihren Leiden und Freuden in ähnlicher Weise abgespielt haben, wie John Brinckman im Kasper Ohm das Leben


|
Seite 141 |




|
eines Rostocker Jungen schildert. Über seine Schulzeit und etwaige künstlerische Ausbildung erfahren wir nichts. Es hat in der Stadt, die mit ihren prächtigen Kirchen und stattlichen Bürgerhäusern allein schon eine gute Schule für die erwachende Künstlerseele war, stets ein reges Kunstleben geherrscht, und an Gelegenheit zu gutem Unterricht wird es nicht gefehlt haben. Ob es ihm aber möglich war, daran teilzunehmen, ist höchst zweifelhaft, da die Einnahmen des Vaters nur gering gewesen sein werden. Achilles kam zu einem Tischler in die Lehre und ging auf die Wanderschaft "ins Ausland", d. h. nach jenseits der mecklenburgischen Grenzpfähle; wohin, erfahren wir im einzelnen nicht, doch hat er sich länger in Berlin aufgehalten. Dort lernte er den Instrumentenbau und bildete er sich im Zeichnen aus.
Berlin hat ihm also die ersten künstlerischen Eindrücke vermittelt. Dort herrschte damals ein nüchterner, strenger Wirklichkeitssinn, dem es gleichwohl nicht an Feinheit der Beobachtung und der Farbe fehlte. Chodowiecki lebte nicht mehr, und sein Nachfolger an der Akademie ging andere Wege. Aber es gab außerhalb der Akademie Gelegenheiten genug, diese ehrliche Wirklichkeitskunst zu erlernen. Ob Achilles schon damals mit dem gleichaltrigen Franz Krüger in Berührung kam, wird wohl nicht zu ergründen sein, eine gewisse Verwandtschaft in der Auffassung und Arbeitsweise ist, bei aller Wahrung des gehörigen Abstandes, unverkennbar. Die Akten schweigen über diese Zeit; wir können nur feststellen, daß er 1819 noch nicht wieder im Lande war, und daß er 1821 seiner Militärpflicht in Güstrow genügte. Im Jahre darauf ward er zur Reserve entlassen, kehrte nach Rostock zurück und bewarb sich um die Aufnahme als Bürger. Bald darauf heiratete er die Tochter Johanna des in Rußland gebliebenen Hautboisten Fintzenhagen. Vermögen hatten beide nicht, auch der Vater konnte keine Unterstützung geben, aber "in seinen Kenntnissen und Arbeitskraft besitze er die nötigen Mittel", erklärte er in seinem Bewerbungsschreiben. Er wurde als Instrumentenmacher in die Bürgerliste eingetragen und hat anfangs, wie er selber angibt, Guitarren geflickt neben seiner künstlerischen Betätigung. Seine erste Arbeit, der Jahreszahl nach, war eine Ansicht von Doberan vom Jahre 1823. 1824 folgte eine zweite Doberaner Ansicht, vom Jungfernberg aus gesehen, und eine Ansicht von Rostock, die sich beide in der Zeichnung nicht über einen mäßigen Dilettantismus erheben. Die Tönung ist flau und der Baumschlag sehr schematisch; man denkt an Ludwig Richters launige Schilderung der Baumschlagrezepte seiner Lehrzeit.


|
Seite 142 |




|
Aber schon das nächste Blatt von 1825: Badehaus und Neuer Saal bei Doberan (im neu gegründeten Badeort am Heiligen Damm) zeigt eine auffallend geschickte Gruppierung. Die im stumpfen Winkel zueinander stehenden Gebäude sind dadurch in die Tiefe gerückt, daß von links ein mit sechs Pferden bespannter Wagen schräg in das Bild hineinfährt, während nach rechts eine Gruppe Reiter und Fußgänger das etwas verschobene Viereck abschließen. Schon hier verwendet Achilles mit deutlich wahrnehmbarer Absicht die Staffage als Mittel zum Raumbilden und gibt außerdem durch sie ein anschauliches Bild des regen sportlichen Lebens in dem ersten Seebad Deutschlands.
Anscheinend hat Achilles schon damals eine eigene Druckerpresse besessen. Er datiert und bezeichnet alle Arbeiten stets sehr ausführlich, nur selten begnügt er sich mit den Anfangsbuchstaben seines Namens, gelegentlich kommt auch Spiegelschrift vor, oft ist der Drucker angegeben. Wo dieser fehlt, hat er selbst gedruckt; er schreibt auch wohl darunter: "gedruckt und zu haben bei A. Achilles in Rostock".
Eine Ansicht von Warnemünde von 1825 zeigt ihn im Kampf mit der Darstellung der bewegten See.
Anfang des Jahres 1826 scheint Achilles wieder einige Zeit in Berlin gewesen zu sein. Der Berliner Berichterstatter des in Schwerin erscheinenden Freimütigen Abendblattes schreibt am 3. April:
"Erlauben Sie mir, die Besorgnis zu erkennen zu geben, daß Mecklenburg wiederum bald einen sehr ausgezeichneten Künstler verlieren dürfte, wenn es länger gleichgültig gegen ihn bleiben sollte. Es ist Ihr Lithograph Achilles in Rostock. Vielleicht mögen Sie ihn kaum dem Namen nach kennen. Und doch ist nichts gewisser, als daß Deutschland in der Lithographik schwerlich einen Künstler aufzuweisen hat, der ihn überträfe. Hätte der junge Mann seine Werkstätte bei uns, so würde bald der kritische Dreifuß im Morgenblatt bis herab zum jüngsten Gericht, das sich in der Berliner Schnellpost konstituiert hat, von seinem Lob überfließen. Statt dessen fristet der bescheidene Künstler, gebückt und unbekannt, bei Ihnen ein höchst steriles Leben mit Tabellen, Etiketten und dergleichen Lappalien, die sich wohl für einen lithographischen Taglöhner passen, aber nicht für einen Künstler, der eine Stufe der Kunst dominiert, wie Achilles. - Mit einem Wort: der junge Mann war kürzlich einige Wochen bei uns und erhielt Erlaubnis, sich aus den königlichen Schätzen ein Gemälde für seine Kunst wählen zu dürfen. Sein blödes Auftreten erregte fast


|
Seite 143 |




|
Mitleiden, als seine Wahl auf die berühmte Madonna der Giustinianischen Gemäldesammlung von Andrea del Sarto fiel. Aber wie sehr setzte er alle in Erstaunen, als er in ganz unglaublich kurzer Zeit sein vollendetes Kunstwerk zur Prüfung vorlegte. Unser Schadow wußte vor Freude nicht, wie er dem Künstler seine hohe Achtung bezeugen sollte. Er ging das herrliche Produkt mit seinen Schülern prüfend durch, machte sie auf die Meisterschaft der einzelnen Teile des Kunstblattes aufmerksam und empfahl ihnen dasselbe als ein wahres Meisterblatt 2 ). Das ist Ihr Achilles! Suchen Sie ein Exemplar zu bekommen und Sie werden sich wundern. Der feine Kunstsinn Ihres Hofes sollte kaum besorgen lassen, daß ein so gediegener Künstler noch länger ein Tagelöhnerleben führen werde. Wo nicht, so möchte er sich bald bei uns oder anderswo einbürgern, wo der ernste Künstler sich leichter eine unabhängige Stellung verschaffen kann."
Diese tönende Ruhmesfanfare ist in mehr als einer Hinsicht lehrreich. Wir erfahren daraus, daß der Künstler zum Broterwerb allerlei Gebrauchslithographien herstellte, und daß er bestrebt war, die Verbindung mit Berlin aufrecht zu erhalten und zu benutzen. Im Verlauf des Jahres lithographierte er das Titelblatt zu Jeppes Herbarium vivum, dessen anmutige Zeichnung wahrscheinlich auch sein geistiges Eigentum ist. Im Sommer entstand eins seiner bekanntesten und berühmtesten Blätter "Die höchsterfreuliche Wasserfahrt": Großherzog Friedrich Franz I. besucht seine getreue Stadt Rostock, zu Schiff von Warnemünde kommend. Auf schön geschmücktem Fahrzeug steht der Fürst mit seiner Umgebung, dahinter hübsch ausgerichtet mit vollen Segeln die Reihen der Begleitboote. Auf dem hohen Ufer stehen, steif aufgereiht, die Zuschauer. Die langen, dünnen Wellen der Warnow sehen aus wie mit dem Lineal gezogen. Künstlerisch ist diese erfreuliche Wasserfahrt recht unerfreulich; und doch, man betrachtet diese gezeichnete Berichterstattung immer wieder gern, bei aller Unbeholfenheit bleibt ihre ganze Art anziehend.
Ob diese treuherzige Schilderung oder der Hinweis im Abendblatt den Landesherrn bewog, sich des Künstlers anzunehmen, erfahren wir nicht; jedenfalls erhielt Achilles Bilder aus der Großherzoglichen Galerie zum Kopieren, als erstes "Simson und Dalila" von A. van der Werfft und etwas später die "Heilige Familie" von Carlo Maratta. Gleichzeitig beginnt die Reihe der Bildnisse von Mitgliedern des Fürstenhauses.


|
Seite 144 |




|
Er lernt die Behandlung und Abtönung von Licht und Schatten, er wird kühner und freier in der Zeichnung, die Unbeholfenheit verschwindet vollständig. Die Lithographie nach dem Bildnis Friedrich Franz I. von Suhrlandt für das Rostocker Rathaus zeigt die volle Beherrschung aller Mittel. Achilles tritt in seine Glanzzeit ein: 1830 wird er zum Hofzeichner ernannt und nach Schwerin berufen mit einem Jahresgehalt von 200 Talern und freier Feuerung.
Die Übersiedlung wurde sofort ins Werk gesetzt, aber ohne Erfüllung der nötigen Formalitäten. Der Künstler versäumte, sich polizeilich anzumelden, und seine Wirtin mußte für die Aufnahme der Familie Strafe zahlen. Erst nachträglich erwarb er das Schweriner Bürgerrecht, nachdem er das Rostocker aufgegeben hatte.
In der neuen, anregenden Umgebung folgten Jahre emsigen Schaffens und steten Fortschritts. Er arbeitete fleißig in der Bildergalerie nach Potter, Ostade und Ridinger; die Kopien ließ er in Berlin bei Helmlehner drucken, während er für seine Originalzeichnungen die eigene Presse benutzte.
Das militärische Leben der Hauptstadt fand in ihm einen eifrigen Chronisten: Die "Cholera-Wache am Püsserkrug" 1831 und die "Sappeur-Uebung im Buchholz" 1838 sind nicht nur wahrheitsgetreue Schilderungen, sondern auch mit guter Raumwirkung aufgebaute Szenen lebendig bewegter Figuren. Die Köpfe verraten wohl noch oft die Schule Ostades, auch noch im "Blauen Montag" von 1844, aber die mit wechselndem Ausdruck häufig wiederkehrenden Gestalten, wie der kleine Bucklige, der große Mann mit dem Vollbart, und viele andere, zeugen von einer scharfen Beobachtung der stadtbekannten Typen jenes friedlich-gemütlichen Residenzlebens der guten alten Zeit.
Bildnisse der Fürstlichkeiten, des Generals von Kamptz, der Tänzerfamilie Bernadelli und mehrerer Sängerinnen waren viel begehrt und sind noch heute im Handel zu finden. Seine Ansichten von Schweriner Gebäuden, dem Marktplatz und dem Kollegiengebäude (Regierung) belebt er mit Gruppen bildnismäßiger Figuren, in denen die Mitwelt jedenfalls bekannte Persönlichkeiten gesehen hat, so daß sie noch heute ein anschauliches Bild des Verkehrs in den Straßen von damals geben.
Die Kopien nach Ridinger regten ihn zu eigenem Schaffen auf dem Gebiete des Jagdbildes an. "Der gedeckte Eber" von 1834 verrät im Aufbau wohl einige Anlehnung an das Vorbild, ist aber in der Auffassung von Mensch und Tier frisch und lebendig.


|
Seite 145 |




|
Die Figuren der Jäger sind Bildnisse aus dem Jagdgefolge des Fürsten, ebenso auf dem Gegenstück, der Strecke der Eberjagd, wo Großherzog in Alexandrine, im Wagen stehend, sich von ihren Söhnen über die Jagd berichten läßt. Als drittes Stück dieser Reihe ist die fehlgeschlagene Jagd zu nennen mit dem herrlichen Landschaftsbilde des Schweriner Sees in der Nähe der Insel Lieps bei Kleinen.
Mannigfache öffentliche Feiern gaben ihm Anlaß zu gewissenhafter Berichterstattung, die oft wenig Gelegenheit für künstlerische Gestaltung bot, aber durch die bildnistreue Behandlung der Staffage erfreulich wirkt. Die Jubelfeiern für 1813 in Güstrow sind nicht nur wichtig als Erinnerung an diesen Tag, sondern noch viel mehr für die Kenntnis des damaligen Bauzustandes von Schloß und Dom.
Nach dem Tode des Großherzogs Friedrich Franz I. folgte die kurze Regierung seines lebhaften, unternehmenden Enkels Paul Friedrich und seiner Gemahlin Alexandrine, der Schwester Kaiser Wilhelms I. Es ist sehr wahrscheinlich, daß letztere den am Berliner Hof hochgeschätzten Franz Krüger gelegentlich nach Schwerin gezogen hat, und daß Achilles hier mit ihm in Berührung gekommen ist. Jedenfalls lithographiert er ein Bildnis Paul Friedrichs zu Pferde von Krüger, von dem er für das Zeichnen der Pferde viel gelernt hat.
Im Jahre 1842 erlag der Großherzog einer heftigen Krankheit. Achilles zeichnete die Aufbahrung vor dem schweren schwarzen Samtvorhand, im Ton eines seiner schönsten Blätter. Im nächsten Jahr folgten mehrere Stadtansichten, ein Plan des mächtig vergrößerten Schwerin und des von prächtigem Humor erfüllte Blatt "Le Commerce", das sich getrost manchem berühmten Werk jener spottlustigen Zeit an die Seite stellen darf.
Gleichzeitig erscheinen im Verlag von A. Ullmann in Hamburg: Vierländer und Vierländerin, ein Bildnis Wolterecks und eine Darstellung Napoleons, die von den Hamburger Nachrichten günstig besprochen wurden, aber nicht mehr aufzufinden sind. Auch wurde in derselben Zeitung eine Serie von 16 Blättern "Hamburger Bürgermilitär" im Verlage von Fuchs angekündigt, äußerst fein kolorierte, lebendige Figuren.
So zahlreich Lithographien von Achilles im Handel sind, so selten finden sich Originalzeichnungen von ihm. Diese wie das pompöse Bildnis des Oberhofmarschalls von Bülow und des Forstmeisters Mecklenburg blieben im Privatbesitz verborgen. Für den Großherzog machte er 1834 eine Kohlezeichnung, 72 x 95 cm,


|
Seite 146 |




|
Sappeur-Sergeant mit Schurzfell und Bärenmütze, heute in der Mahnckeschen Sammlung. Eine verkleinerte Lithographie kam in den Handel. 1843 verfertigte er für den wismarschen Kapitän J. H. Prüter eine farbige Zeichnung, die dessen Brigg "Doris" vor Wismar in einem schweren Gewittersturm zeigt, bei dem der Blitz in den zweiten Mast schlug. Von dem graublauen Himmel hebt sich das Schiff mit allen Einzelheiten der Takelage gespenstisch leuchtend ab. Die Wellen sind vom tiefsten Blaugrün, über gelbliche Töne, bis zum weiß aufgesetzten Gischt, wunderbar voll abschattiert. Am Horizont taucht die Mole von Wismar auf, dessen Türme man mehr ahnt als deutlich sieht, von leuchtenden Möwen umflattert. So sehr das Bild auch wohl auf die Wünsche des Bestellers Rücksicht nimmt, in dessen Familie es als Denkmal der glücklichen Errettung in hohen Ehren stand, so gibt es doch einen Begriff von dem feinen Farbensinn des Malers. Es ist bedauerlich, daß er nicht öfter Gelegenheit hatte, mit Farbe und Pinsel umzugehen. Unter dem Titel "Wismar an der Ostsee" ist eine Lithographie gleichen Inhalts - die Brigg heißt hier Germania - in den Handel gekommen, die, man möchte sagen, das Gerippe des farbigen Blattes bringt und recht deutlich macht, wie sehr hier alles nur durch die Farbe gegeben ist.
Trotz seiner künstlerischen Fortschritte und seines Fleißes konnte Achilles wirtschaftlich in Schwerin nicht recht gedeihen. Zu den vier Kindern, die er von Rostock mitbrachte, wurden noch drei geboren, doch starb sein ältester Sohn Helmut im Alter von sechzehn Jahren. 1842 wohnte die Familie in der neuen Paulsstadt, in der heutigen Wismarschen Straße, siedelte aber 1844 nach Tappenhagen über, jedenfalls keine Verbesserung. Der Vertrieb der Lithographien war mühsam; die Druckkosten mußten jedesmal vorher durch Subskription zusammengebracht werden, und mehr als 1 Gulden N 2/3 gab es selten für ein figurenreiches Blatt. So faßte der Künstler 1845 den Entschluß, mit den Seinen nach Hamburg zu ziehen. Er verkaufte seine Druckerpresse an den Buchdrucker Sandmeyer und richtete sich mit dem Erlös in Hamburg einen Laden mit Werkstatt ein. Aber wie bei seiner Ankunft in Schwerin versäumte er, sich die Zuzugserlaubnis zu sichern. Als er sein Bürgerrecht in Schwerin aufgegeben hatte, wurde ihm in Hamburg die Aufnahme verweigert, und er selbst mit seiner Familie wieder ausgewiesen. Sie kehrten nach Schwerin zurück, wurden aber nicht wieder als Bürger angenommen. Es folgten schwere Jahre ruhelosen Wanderns und äußerster, wenn auch nicht unverschuldeter Bedrängnisse.


|
Seite 147 |




|
Achilles selber wandte sich zunächst nach Hannover, wo er Auftrag hatte, die Pferde des königlichen Marstalls zu zeichnen. Von diesen Arbeiten ist jedoch nichts mehr aufzufinden. Dann arbeitete er in Boizenburg, Wittenburg und dazwischen immer wieder in Schwerin, ohne daß es ihm gelang, wieder festen Fuß zu fassen.
1849 lithographierte er dort den Einzug des Großherzogs Friedrich Franz II. mit seiner ersten Gemahlin Auguste. Vergleichen wir dieses Blatt mit dem ähnlichen Vorwurf der erfreulichen Wasserfahrt, so erkennen wir deutlich die gewaltigen Fortschritte des Künstlers. Auch hier das Gebundensein an getreue Berichterstattung und das Gegebene des Platzes und der Aufstellung; aber mit welcher Lebendigkeit und wie ungezwungen ist die Aufgabe gelöst. Der Blick auf die Staatskarosse, aus der das junge Fürstenpaar sich freundlich grüßend vorneigt, ist durch die niedere Reihe der Kinder in Landestracht freigegeben; der leere Raum ist durch die spielenden Hunde und die Gruppe der drei Knaben wieder belebt und geschlossen. Die Zuschauer sind nicht mehr starr aufgereiht, sondern bilden freudig bewegte Gruppen. Wir bemerken manche Bekannte von Achilles' früheren Blättern, z. B. den Mann mit der Pfeife und den bärtigen Herrn mit der Hand in der Weste, der so oft wiederkehrt (er steht auch neben dem Denkmal des Großherzogs Paul Friedrich vom selben Jahr 1849), daß man ihn fast für ein Selbstbildnis halten möchte, obgleich diese Vermutung durch nichts gestützt oder gar bewiesen wird.
Die folgenden Jahre brachten mehrere Fürstenbildnisse, darunter das reizende Kinderbild Friedrich Franz III., und seine beiden großartigsten Schöpfungen, den Pferdehandel in der Rostocker Gegend. Ein behagliches, strohgedecktes Bauernhaus, der Bauer mit den Seinen voll Stolz und Spannung, der Pferdejude berechnet schmunzelnd den Gewinn, den das vorgeführte prächtige Pferd ihm bringen wird. Jede Linie ist voll Ruhe und friedlicher Ausgeglichenheit. Auf dem zweiten Blatt ist der Handel abgeschlossen und gebührend mit Rostocker Köhm begossen. Mensch und Pferd sind in wilder Bewegung, und alles lacht über den angstvoll auf dem steigenden Tier hockenden Händler.
Von da an ging es schnell bergab. Die Augen versagten, und die völlig mittellose Familie sah sich in Schwerin mit Ausweisung und Überführung in das Landarbeitshaus bedroht. Der Versuch, in Rostock eine Zeichenschule zu gründen, scheiterte am Widerstand des Rates, die verarmte Familie aufzunehmen. Endlich


|
Seite 148 |




|
fanden die Gehetzten in Altona ein Unterkommen und der Künstler erhielt Arbeit im Verlag von C. Fuchs in Hamburg.
Die letzten selbständigen Blätter sind wohl die mit den beiden wunderlichen Reifrockdamen "der hochgeehrten Kaufmannschaft" und "den hochgeehrten Gewerken" gewidmet, ersteres mit einem rührend zahmen Löwen, in dem wir "Nero, den Löwen des Tower zu London" wiedererkennen, den er in seiner Rostocker Frühzeit auf einem jetzt sehr seltenen Blatt verewigt hatte.
Seit dem Verkauf der eigenen Presse erschienen seine Arbeiten bei Kürschner in Schwerin, die meisten in Berlin bei Hölzer oder Delius. Auffallend ist, daß außer dem frühen Bildnis des Majors von Quistorp nichts in Mecklenburgs größtem Verlag, dem von Tiedemann in Rostock, erschienen zu sein scheint.
Am 9. Februar 1861 starb der Künstler in Altona, und bald darauf brachte die Mecklenburger Zeitung folgenden kurzen Nachruf:
"Der Zeichner und Lithograph August Achilles aus Rostock, welcher vor einer langen Reihe von Jahren hier in Schwerin wohnhaft war, ist am 9. Februar im noch nicht vollendeten 63. Lebensjahr in Altona gestorben. Achilles kann wohl als der Erste angesehen werden, der die Lithographie in Mecklenburg einführte."
Neben und nach ihm hat eine lange Reihe zum Teil sehr achtbarer Künstler die Lithographie gepflegt, aber keiner so vielseitig und mit so gutem Gelingen auf allen Gebieten wie Achilles. Seine Arbeiten fanden den Weg bis in den entlegensten Dorfkaten und weckten dort Teilnahme für die künstlerische Wiedergabe des Lebens an Arbeits- und Festtagen, sowie Liebe zur Heimat und zum Fürstenhause. Er ist gewiß keine große Künstlernatur; dazu wollen wir ihn nicht nachträglich stempeln. Aber die bescheidene Kraft künstlerischen Verständnisses, die ihm gegeben war, hat er redlich benutzt, und so gehört er, wie August Renoir sagt, zu den Künstlern, deren Werke, obwohl unbekannt und vergessen, die Größe eines Landes machen, weil sie gleichzeitig die Epoche und das Erdreich verkörpern, dem sie entstammen.


|
Seite 149 |




|
Lithographien und Zeichnungen
vonAugust Achilles 3 ).
~~~~~
I. Frühzeit. 1823-1830.
| Besitzer: | ||||
| 1823 | Ansicht von Doberan | Stadtarchiv Rostock. | ||
| 1824 | Ansicht von Doberan vom Jungfernberge | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Rostock von der Nordseite | Stadtarchiv Rostock. | |||
| 1825 | Badehaus und Neuer Saal am Heiligen Damm | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Warnemünde von der Seeseite | " " | |||
| 1826 | Titelblatt zu Jeppe's Herbarium vivum | Landesbibliothek Schwerin. | ||
| Madonna nach Andrea del Sarto | P. Günther-Schwerin. | |||
| 1827 | Die höchsterfreuliche Wasserfahrt | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Simson und Dalila, nach van der Werfft | " " | |||
| 1829 | Friedrich Franz I., nach Suhrlandt | " " | ||
| Nero der Löwe des Tower (ohne Jahreszahl) | Frau Jaffé-Schwerin. | |||
| Der Blücherplatz in Rostock | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Warnemünde von der Seeseite, mit "Hoffnung" | " " | |||
| Major von Quistorp; Druck von Tiedemanns Lith. Institut | Stadtarchiv Rostock. | |||
| Die Heilige Familie, nach Carlo Maratta | F. Mahncke-Schwerin. |


|
Seite 150 |




|
II. Schwerin. 1830-1846.
| 1830 | Anna Lembke als Rosalinde | Stadtarchiv Rostock. | ||
| Der Mittag, nach Potter | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Der Abend, nach Potter | " " | |||
| Der Morgen, nach Potter | " " | |||
| (Druck von Helmlehner-Berlin) | ||||
| Die Bärenjagd, nach Ridinger | " " | |||
| 1831 | Die Brandwache am Püsserkrug | " " | ||
| General von Kamptz, Brustbild nach rechts | " " | |||
| Derselbe, Brustbild nach links | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| 1832 | Die Ruhe, nach Potter; Druck von Kürschner | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Die Feier des 10. August am Heiligendamm | " " | |||
| Das Kollegiengebäude in Schwerin | " " | |||
| Der Einzug in Doberan | " " | |||
| 1833 | Übungslager der Sappeure | " " | ||
| Stallszene, nach Potter | " " | |||
| 1834 | Bauern beim Schmause, nach Adriaen Brouwer | " " | ||
| Der gedeckte Eber | " " | |||
| Friedrich Franz I. zu Pferde | P. Günther-Schwerin. | |||
| 1835 | Der Marktplatz in Wismar; Druck von Gundlach | Stadtarchiv Wismar. | ||
| Friedrich Franz I., stehend | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| 1836 | Schwerin, vom Ostorfer Berge aus | " " | ||
| Sängerin Julie Gneib | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| Die unvermutete Überraschung | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Die Strecke der Eberjagd | H. Neubeck-Schwerin. | |||
| 1837 | Die fehlgeschlagene Jagd | Frau Mecklenburg-Schwerin. | ||
| Friedrich Franz I. auf dem Sterbebett | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| 1838 | Der Geiger Ole Bull; Druck bei Kürschner-Schwerin | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Der Schauspieler J. F. A. Beckmann | " " | |||
| General von Kamptz, ganze Figur | " " | |||
| Die Jubelfeier der Freiwilligen in Güstrow | " " | |||
| Niederlegung der Fahnen im Dom zu Güstrow | " " | |||
| Der Abend, nach van Bloemen | Frau Herrmann-Schwerin. | |||
| Paul Friedrich, Brustbild nach links; Druck des Kgl. Lith. Instituts in Berlin | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| 1840 | Oberhofmarschall von Bülow, Kohlezeichnung | v. Bülow-Kobrow. | ||
| Wismar von der See aus | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin | |||


|
Seite 151 |




|
| 1841 | Paul Friedrich zu Pferd; Druck des Kgl. Lith. Inst. Berlin | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| 16 Blatt Hamburger Bürgermilitär, koloriert; Druck Charles Fuchs-Hamburg | Staatsarchiv Hamburg. | |||
| Le Commerce | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| 1842 | Paul Friedrich auf dem Paradebett | " " | ||
| Der Markt in Schwerin | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin | |||
| Rochingham, Pferdebild | " " | |||
| Der große Sappeur, Kohlezeichnung | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Sappeur Sergeant | " " | |||
| Unteroffizier des Meckl. leichten Infanterie-Bataillons | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| Unteroffizier der Meckl. Artillerie | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| Tanzgruppe der 3 Bernadelli | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| 1843 | Wismar an der Ostsee mit Germania | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | ||
| Dasselbe, handkoloriert, mit Doris | A. v. Langermann-Schwerin. | |||
| Plan von Schwerin | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Paul Friedrich, Kniestück | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. | |||
| 1844 | Der blaue Montag | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| 1845 | Fest der Landleute auf dem Kamp | " " |
III. Wanderjahre. 1846-1854.
| Briefkopf; Ansicht von Cuxhaven, ohne Jahreszahl | Staatsarchiv Hamburg. | |||
| Wilhelm Hocker | " " | |||
| Wilhelm Nikolaus Freudentheil | " " | |||
| Johann von Fahse | " " | |||
| 1848 | Friedrich Franz II., ohne Bart, zu Pferde | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| 1849 | Einzug Friedrich Franz II. und Großherzogin Auguste; Druck bei Delius-Berlin | " " | ||
| Denkmal Paul Friedrichs | " " | |||
| Herzog Friedrich Wilhelm; Druck Delius-Berlin | " " | |||
| Alexander von Hirschfeld | v. Hirschfeld-Schwerin. | |||
| 1850 | Großherzog Friedrich Franz II., Druck Kürschner-Schwerin | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| 1851 | Stallszene, nach Potter | " " | ||
| F. Neinhardt | P. Günher-Schwerin. | |||
| 1852 | Friedrich Franz II.; Druck C. Herold-Wismar | Geh. u. Haupt-Archiv Schwerin. |


|
Seite 152 |




|
| 1853 | Friedrich Franz III., als Kind; Druck Kürschner-Schwerin | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Henriette Sonntag | Staatsarchiv Hamburg. | |||
| Pferdehandel auf dem Lande in der Rostocker Gegend | F. Mahncke-Schwerin. | |||
| Schluß des Pferdehandels | " " | |||
| Forstmeister Mecklenburg, Kohlezeichnung | Frau Mecklenburg-Schwerin. | |||
| 1854 | Wittenburg, getönt | F. Mahncke-Schwerin. |
IV. Hamburg. 1854-1861.
| 1857 | Reifrockdame, der hochgeehrten Kaufmannschaft gewidmet | F. Mahncke-Schwerin. | ||
| Reifrockdame, den hochgeehrten Gewerken gewidmet | " " | |||
| 2 Blätter mit je 4 Hamburger Trachten, bunt; Lith. Anstalt von Fuchs-Hamburg | Staatsarchiv Hamburg. | |||
| Warnemünde von der Seeseite, ohne Jahreszahl | F. Mahncke-Schwerin. |
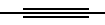


|
[ Seite 153 ] |




|



|


|
|
:
|
VI.
Das Haus zum Heiligen Geiste
zu Wismar
von
Friedrich Techen.
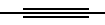


|
Seite 154 |




|
Inhalt.
- Anfänge und Bestimmung des Hauses, Sorge für Arme, Sieche und Pfründner
- Die Verwaltung des Hauses und das Personal
- Der Besitz des Heiligen Geistes
- Die kirchlichen Verhältnisse des Hauses zum Heiligen Geiste
~~~~~~~~~~


|
Seite 155 |




|
I. Anfänge und Bestimmung des Hauses, Sorge für Arme, Sieche und Pfründner.
Das Haus zum Heiligen Geiste kommt schon auf den ersten Seiten des ältesten Stadtbuchs vor, also vermutlich um 1250 oder sehr bald danach. Damals vermachten ihm die Eheleute Dietrich und Adelheid die Hälfte ihrer Habe. Urkundlich fest datierbar wird es zuerst 1253 erwähnt, wo ihm Herr Johann von Mecklenburg das Eigentum über zwei Hufen zu Metelsdorf samt seinen übrigen Rechten daran außer dem Gerichte an Hand und Hals verlieh 1 ). Es kann seiner Lage nach auf der Grenze der Altstadt und der Neustadt 2 ) kaum vor der Stadterweiterung begründet worden sein, da es hart vor den Planken der Altstadt außerhalb dieser lag 3 ). Seine Gründung wird entweder mit der Stadterweiterung zusammenfallen oder ihr sehr bald gefolgt sein. Jene Erweiterung aber mag der Anlage des ältesten Stadtbuchs etwa um ein Jahrzehnt vorangegangen 4 ) und demnach um 1240 erfolgt sein. Der Umstand, daß der Garten des Heiligen Geistes anfänglich bis gegen 1290 über die Heide hinausschoß und sich zwischen Böttcherstraße und Neustadt legte 5 ), spricht für die Anlage, bevor die Neustadt eine weitere Entwicklung gewonnen hatte. Andererseits warnt eine Urkunde von 1255, in der das Haus zum Heil. Geiste begonnen (inchoata) genannt wird 6 ), zu tief in die Vergangenheit hinabzusteigen.


|
Seite 156 |




|
Bestimmt war das Haus zum Heiligen Geiste 7 ) nach Urkunden von 1255 und 1269 8 ), in täglichen Almosenspenden Werke der Barmherzigkeit zu üben, Kranke zu erquicken, Arme und Bekümmerte zu trösten, Dürftige, die kein Unterkommen finden könnten, zu herbergen, Nackte zu kleiden, kürzer nach etwas späteren 9 ), für Arme und Kranke oder Gebrechliche zu sorgen. Unter den Dürftigen, die kein Unterkommen finden könnten, werden wir uns weniger in der Stadt Einheimische als Wandernde und Pilger vorzustellen haben, wie das für den Rostocker Heil. Geist ausgesprochen ist 10 ). Arme, Lahme und Gebrechliche wurden nach einer Urkunde von 1351 bei Tage und bei Nacht von den Straßen aufgelesen, erquickt und unterhalten 11 ).
Die Armen und Kranken wurden wahrscheinlich von Anfang an für längere Zeit, vielleicht für Lebenszeit aufgenommen, wie es bald Regel ward und für Lübeck aus einer Zeit bezeugt ist, die vor der Gründung des Wismarschen Heiligen Geistes liegt. Dort warf nämlich das Domkapitel den Bürgern vor, sie brächten ihre verarmten Verwandten im Heiligen Geist unter, um sich ihrer Unterhaltungspflicht zu entziehen, und es seien die Insassen des Hauses weder geistlich noch gebrechlich, sondern wohl bei Kräften und sie betrieben auch weltliche Geschäfte 12 ). Voraussetzung für ein solches Verfahren ist ein Einkaufen, das denn auch für Wismar schon früh genug und hernach reichlich bezeugt ist.
Von einer Fürsorge für Arme enthalten die Rechnungen und Akten des Wismarschen Heiligen Geistes nicht allzuviel, und öfter


|
Seite 157 |




|
ist man dabei nicht sicher, ob nicht die Pfründner unter den Armen mitbegriffen sind. Stiftungen oder Vermächtnisse von 1306, 1313, 1328, 1359 1368 und 1512 waren doch für die Armen bestimmt 13 ), eine andere von 3 Mk. Rente 1400 zu Betten. Im Jahre 1411 holte der Hofmeister eine arme Frau vom St. Nikolai-Kirchhofe in den Heiligen Geist und gab ihr im Auftrage der Bürgermeister einen Rock 14 ). 1472 April 6 ließ der Bischof von Ratzeburg es gelten, daß der Hofmeister umme der armen lude willen seiner Ladung nicht nachkommen könne 15 ). Ausgaben für Lebensmittel, die den armen luden uppe dat hus zukommen sollten, sind 1492 im Pachtbuche verzeichnet 16 ). Von dem Brote aber, das 1501 für 12 Mk. gekauft ward, erhielten u. a. einen Teil de armen lude up dat hus, einen andern die Pfründner. Es wird hier also unzweideutig zwischen beiden unterschieden. Im folgenden Jahre findet sich 2 1/2 Mk. tho markede in de koken unde den armen up dat hus aver de vasten. Aus den häufigen Anschreibungen für die Armen seit 1530 hebe ich nur einiges aus: 1530 14 pen. vor waskent up deme langen huße den armen (ob die im selben Jahre für 2 Pfennige gekaufte Seife demselben Zwecke gedient hat, ist eine offene Frage), 1531 2 sch. vor hete wegge den armen unde bueknechten, 1533 des öfteren vor wegge den armen (je 6 Pfennige) oder tho markete (je 1 Schilling), sonst vor grone viske (4 Witte), vor waskent, zweimal ener weskerschen und zu Fastnacht vor hete wegge 15 Pfennige. Es ist aber sehr zweifelhaft, ob wirklich Arme oder nicht Pfründner gemeint sind. Die spätere Auskunft von 1579, daß täglich 36 oder 37 Arme im Heiligen Geiste unterhalten werden 17 ), bezieht sich entschieden auf Pfründner.
Für den Unterhalt von Pilgern 18 ) besonders war eine jährliche Hebung von 17 Drömt Korn aus Martensdorf bestimmt, die der Hofmeister Werner Liskow 1371 für 310 Mk. Lüb. kaufte und wovon der Bürgermeister Volmar Lewetzow 50 Mk. zahlte. Davon sollte jeder arme Pilger eine Nachtruhe, ein Viertel Bier


|
Seite 158 |




|
und eine Portion Brot (unum oblatum panis) im oberen Hause erhalten. Im folgenden Jahre stifteten Nikolaus Gogelowe und seine Hausfrau 3 Mk. jährlicher Rente zu Betten und Feurung für die Pilger im oberen Hause 19 ). Sie werden (außer etwa in Krankheitsfällen) nie länger als für eine Nacht beherbergt sein, wie das in Lübeck Vorschrift war. Dagegen war das Heil.-Geist-Hospital zu Greifswald gerade für Aufnahme von Fremden bestimmt 20 ). Das war eine Ausnahme.
Die ältesten Zeugnisse für einen Einkauf fallen zwischen die Jahre 1260 und 1272 21 ). Es war aber gemäß dem ersten nichts neues mehr und bereits eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Denn Johann von Helegena, der hier seinen Sohn einkaufte, hatte selbst die Bruderschaft des Heiligen Geistes, also Wohnung und Pfründe dort, und er kaufte seinem Sohne Unterhalt und Kleidung unter der Bedingung, daß jenem der Austritt freistehn und ihm in diesem Falle das Einkaufgeld - 10 Mk. - erstattet werden solle. Gegen 1272 hin kaufte der Ratmann Hinrik Scheversten seinen Sohn für 6 Mk. ein 22 ). Um dieselbe Zeit gab Mechthild von Brunshaupten eine Tochter in den Heiligen Geist 23 ). Eigner Art ist der Einkauf der Tochter Hildebrand Höppeners. Dieser übergab 1285 auf seinem Siechbette den Ratmannen eine Hufe auf dem Damhufer Felde, damit sie für seine Tochter eine Pfründe im Heiligen Geist erwürben. Sie taten das aber in der Weise, daß sie zunächst bei ihrem Schwager ihren Unterhalt haben und erst, wenn dieser stürbe oder verarmte, Nahrung und Kleidung im Heiligen Geist finden sollte. Dieser erhielt dafür die beträchtliche Summe von 76 Mark. Hildebrand Höppener muß einer der reichsten Bürger gewesen sein 24 ). Könnte man nun auf den Gedanken geraten, daß die Eltern ihren eingekauften Kindern nicht die Fähigkeit zugetraut hätten, sich durchs Leben zu schlagen, so wird doch die Absicht, für die Kinder eine sichere Versorgung und ein ruhiges Leben zu schaffen, vorgewaltet haben, um so mehr, als nicht nur dem Sohne Helegenas, sondern auch dem der Vredeke von Hannover, die sich samt Sohn und Sohneskind 1273 in den Heiligen Geist gab 25 ), die Wahl freigestellt ward, ob sie später


|
Seite 159 |




|
bleiben oder austreten wollten. Auch jenes erst angeführte Zeugnis aus Lübeck ist zu beherzigen, und es kommt noch ein anderes hinzu. Es waren jener Zeit nicht etwa nur Ärmere, die in den Heiligen Geist eintraten, sondern auch vermögende Leute und solche aus den ersten Kreisen suchten dort Zuflucht oder hielten sie sich offen. So der Krämer Bertram, der in den beiden ältesten Stadtbüchern vielfach begegnet und um 1272 dem Heiligen Geiste 18 Mk. übergab, wogegen er dann nach Belieben dort eintreten konnte oder auch nicht 26 ). Die Witwe des Ratmanns Hinrik von Borken aber nahm eine Magd mit in das Haus. Sie gab ihm außer ihrem etwaigen Nachlaß die Nutznießung von 4 Morgen Ackers für sechs Jahre und für ihr, ihres Mannes und ihrer Eltern Seelenheil 2 1/2 Morgen 27 ). Auch die Witwe des 1328 zuletzt genannten Ratmanns Johann von Varen hatte eine Pfründe im Heiligen Geiste 28 ). Die Pfründnerin Katharina Mule kaufte sich für 24 Mark ein Seelgedächtnis beim Großen Kalande 29 ) und schenkte außerdem 10 Mk. Mechthild Winkelman aber stiftete für 240 Mk. Buchenkohlen zur ewigen Verteilung im Heiligen Geiste 30 ).
Ratmannen, die in ihren Vermögensverhältnissen zurückgekommen waren, konnten ihren Unterhalt im Heiligen Geiste finden. So sollte nach Ratsbeschluß von 1325 Konrad von Manderow oder seine Hausfrau, wer den andern überlebte, für den Rest des Lebens dort eine Pfründe erhalten, und 1330 beschloß der Rat allgemein, daß im Falle der Verarmung eines Ratmannes er oder seine Hausfrau auf Wunsch mit einer Pfründe dort versorgt werden solle 31 ).
Aus diesen beiden Beschlüssen geht hervor, daß damals ein Ehepaar noch nicht in den Heiligen Geist eintreten konnte. Das ward später anders, war aber die Folge davon, daß die Insassen des Hauses eine geistliche Brüderschaft bildeten. Wir sahen schon, daß Johann von Helegena, der seinen Sohn in den Heiligen Geist einkaufte, selbst dessen Bruderschaft hatte 32 ). Etwa 1272 ward Hinze Westfal aus Varpen in die Bruderschaft aufgenommen 33 ). Demgemäß wurden die Insassen als Brüder bezeichnet. So jener


|
Seite 160 |




|
Johann, der Urkunden des Hauses gestohlen hatte 34 ). Im Jahre 1275 wird von Konversen gesprochen 35 ). Wären Ordnungen vorhanden wie für Lübeck, Kiel, Barth 36 ), so würden wir klarer sehen. Dort waren die Stifte zum Heiligen Geiste ausgesprochen geistliche Bruderschaften. Es ward von den Insassen Keuschheit und Gehorsam verlangt, sie hatten sich ihres Eigentums zu entäußern, trugen gleiche Tracht, waren zu Gebeten verpflichtet und hatten ein Probejahr zu bestehen. Nach der Ordnung des Stralsunder Armenhauses von 1540 hatten dessen Insassen die Verpflichtung, gade mit singen to laven. Eheleute durften aufgenommen werden, wenn sie nicht mehr zeugungsfähig waren und gelobten, nicht beisammen zu schlafen. In den Heiligen Geist zu Kolberg sollte nach einem Ratsbeschlusse von 1429 hinfort niemand unter fünfzig Jahren aufgenommen werden, auch nicht (um Streit zu vermeiden) Bruder und Schwester, Mutter und Tochter 37 ). Größere Ähnlichkeit mit dem Wismarschen scheint das Haus des Heiligen Geistes zu Lüneburg gehabt zu haben 38 ).
Das erste Zeugnis dafür, daß ein Ehepaar eintrat, ist von 1346. Es waren Johann Mögilke aus Gagzow und seine Hausfrau 39 ). Ein anderes Ehepaar erwarb 1403 zwei Pfründen, andere folgten.
Von 1402 bis 1522 sind wir dank den erhaltenen Rechnungsbüchern über die Pfründenkäufe dieser 120 Jahre recht gut unterrichtet, wenn auch die Buchführung hin und wieder nachlässig ist und zu Zweifeln und Irrtümern Anlaß gibt. Von 1402 bis 1431 wurden 48 volle und 16 halbe Pfründen gekauft, von 1432 bis 1461 48 volle und 52 halbe 40 ), von 1462 bis 1491 23 volle und 17 halbe. Von 1492 bis 1497 ist nichts angeschrieben, von 1498 aber bis 1522 sind 28 volle und 32 halbe Pfründen gekauft worden.


|
Seite 161 |




|
Wieviel Pfründner gleichzeitig beherbergt sind, läßt sich für das Mittelalter nicht ermitteln. Nach einer 1599 erteilten Auskunft wurden damals täglich 36 oder 37 Arme unterhalten. Im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts stellte das Haus zum Heiligen Geiste in der Regel 45 Abendmahlsgäste, in den achtziger Jahren beherbergte das Lange Haus 16-18 und wohnten auf dem Hofe um 20, nie über 30 41 ). Jetzt sind im Langen Hause 11, auf dem Hofe 19 Wohnungen. - Eine Leserin (Kath. Wilken) starb 1669.
Der Preis für die volle Pfründe betrug im 15. Jahrhundert der Regel nach 60 Mk., für die halbe die Hälfte, doch werden seit 1450 oft genug auch nur 50 oder 55 Mk. für die volle und 25 Mk. für die halbe Pfründe oder sonst abweichende Beträge gezahlt. 1303 ward bei einem Vermächtnisse von 24 Mk. ausbedungen, daß die Erben der Testierenden für jemand, der mindestens 12 Jahre alt sein müßte, eine Pfründe für die Zeit seines Lebens erbitten könnten 42 ). Johann Rugensee, der 1308 eine Pfründe für 30 Mk. erkaufte, bedang sich aus, den Hof Steffin als Hofmeister zu verwalten und daraus seinen Unterhalt zu beziehen, solange er sich gut führte 43 ). Im Anfange des 16. Jahrhunderts, wo die Eintragungen in bezug auf die Preise viel zu wünschen übrig lassen, scheint für die volle Pfründe in der Regel 50 Mk., für die halbe 25 Mk. gezahlt zu sein. Vereinzelt wurden zu allen Zeiten höhere Preise erlegt. So kaufte Detlef Wuste sich und einen Sohn 1406 für 150 Mk. ein, Hans Kremer gab 1449 für eine Pfründe 70 Mk., Anneke Schomaker 1516 60 Gulden, also 90 Mk., 1517 Margarete Swanes 67 Mk. Als Zugaben begegnen seit 1466 1/2 oder 1 Tonne Butter für die volle und auch für die halbe Pfründe, 1479 auch 1 Tonne Lachsforellen (öre) und seit 1409 ein Dienst, d. h. ein Schmaus 44 ) oder dessen Ablösung durch Zahlung (Dienstgeld). Die Aufzeichnungen hierüber sind aber nur gelegentlich und selten gemacht. Genauer heißt es nur einmal 1411: dar heft zee vor dan alle plycht unde denst den proveneren, also sik dat van rechte bord. Eine geringere Zahlung ward wohl durch späteren Antritt der Pfründe ausgeglichen. So sollte Hans Lyntbeke, der 1409 eine


|
Seite 162 |




|
Pfründe für 50 Mk. kaufte, sie erst nach drei Jahren beziehen. Von 25 Mk., die Meygenborch Hoppenhovedes 1518 für eine halbe Pfründe gab, zahlte sie 22 Mk. bar und beglich den Rest durch Einbringung einer Kuh. Greteke Stykkebases erhielt 1416 eine Pfründe für umsonst, Katharina Wilkens auf Fürsprache (nach vorbiddinge) 1478 eine halbe für 25 Mk. Zu der von Tilsche Mandages, des karcheren kokesche, 1518 geleisteten Zahlung steuerte ihr Dienstherr 16 Mk. bei. Zu dem Erwerb von Pfründen durch Frauen erklärten deren Ehemänner 1490 und 1491 ihre Zustimmung, wie auch vielfach die Einwilligung der erbberechtigten Verwandten zu den Verträgen über den Einkauf bezeugt ist.
Eine gewisse, und zwar unter Umständen nicht unbeträchtliche Ergänzung des Kaufpreises der Pfründen liegt darin, daß der Nachlaß der Pfründner dem Hause des Heiligen Geistes zufiel. Es läßt sich freilich nicht sagen, ob das ausnahmslos der Fall war. In dem Prövenbok, das allein ausführliche Nachrichten über den Kauf von Pfründen zwischen 1486 und 1543 enthält, ist diese Abmachung ziemlich regelmäßig verzeichnet, doch braucht bei der Natur der Eintragungen das Fehlen nicht als absichtlich angenommen zu werden. Schon 1308 ward mit Helmold Waterlow, der sich für 20 Mk. eine Pfründe kaufte, ohne sie gleich antreten zu wollen, vereinbart, daß das Haus zum Heiligen Geiste seinen Nachlaß ganz erhalten solle, wenn er außerhalb Landes verstürbe, daß er aber über 10 Mk. davon frei verfügen könne, wenn er im Lande verstürbe 45 ). 1415 ward abgemacht, daß von dem Nachlaß einer Pfründnerin das beste par cledere myd deme smyde unde myd deme vodere dem Heiligen Geiste zufallen solle, 1426 dasjenige, was ein Pfründner van inghedomete unde van klederen unde van bedewande einbringe, 1427 van klederen unde van reschoppe oder van ynghedomete unde van klederen. 1536 wies der Rat, als die Kinder des Klawes Krampen über seinen Nachlaß außerhalb des Heil.-Geist-Hauses in Streit geraten waren, diesen dem Heiligen Geiste mit der Begründung zu, daß jener de proven ghehath hadde up deme langen huße. 1500 kam mit der Tengelschen ein Vertrag dahin zustande, daß sie von dem Gelde, das ihr Mann eingebracht hatte, 3 Mk. erhielt, aber 2 grapen, 1 swarten hoyken, 1 roeth wamboghe und 1 par Leydesker haßen dem Heiligen Geiste überließ. Aus dem Nachlaß von 5 oder 6 Pfründnern wurden 1533 27 Mk. 2 Sch. 7 Pfen. erlöst.
Jetzt beträgt das Einkaufsgeld für die 11 Prövnerwohnungen im Langen Hause 315-510 RM., für die 10 auf dem Hofe 525


|
Seite 163 |




|
bis 675 RM., für die 11 Wohnungen ohne Pröve auf dem Hofe (die Freiwohnungen) 75-150 RM. Auf den Nachlaß der Insassen der letzteren hat der Heilige Geist keinen Anspruch. Das Dienstgeld setzt sich in einem Einspringegeld und einer Zahlung zu Wein und Brot für die Prövner des Langen Hauses fort (insgesamt 7,60 Mk. und 1,75 Mk. für den ältesten Ratsreitenden Diener). Mehrere Wohnungen sind für Paare bestimmt. Die Schiffer haben 1670 durch Zahlung von 300 Mk. das Recht gewonnen, eine Person, die ohne Entgelt aufgenommen werden muß, zur Aufnahme vorzuschlagen 46 ).
Es kam vor, daß jemand zwei Pfründen kaufte, so 1428 Metke Sternberges, 1448 Schüttesche, 1481 Taleke Sternberges. Metke Sternberges wandte außerdem noch dem Heiligen Geiste 50 Mk. zu, uppe dat ze deste zeker moghe stan in eren provene[n]. Mann und Frau erwarben entweder 2 Pfründen zusammen oder auch nur 1 1/2 47 ), wovon dann bei dem Tode des einen Gatten dem überlebenden eine volle Pfründe verblieb (was 1456 und 1507 ausdrücklich gesagt ist), oder auch nur eine, die dem überlebenden Gatten voll verbleiben sollte 48 ), einmal auch nur eine halbe zusammen 49 ). Die volle Pfründe wird einmal als ene grote provene bezeichnet 50 ).
Öfter begegnen Siechenpfründen. So zahlte 1440 Katharina Waterwisch 25 Mk. uppe eyn sekenprovene an, kauften 1444 Grawbardesche und Ghezeke Schröder jede für 30 Mk. eine halbe Pfründe in deme sekhuse, Hinr. Schele zahlte 1446 35 Mk. für eine sekenprovene, Leneke oppe deme sekhus 1449 für 1/2 Pfründe 30 Mk. Die letzte Siechenpfründe, die mir bis 1543 begegnet ist, hat 1511 Rykehaveske auf dem Langen Hause gegen Hergabe von einen Morgen Ackers erworben 51 ).
Für die Siechen hatte Otto Becker 1328 eine Rente von 4 1/2 Mk. Lüb. aus Moidentin zu Bier zwecks Erfrischung ge-


|
Seite 164 |




|
stiftet 52 ), Hinr. Körneke aber 1336 seine Hebungen aus Metelsdorf nach dem Tode aller seiner Kinder für die bettlägerigen Kranken des Hauses bestimmt 53 ) und Vicke Mey den armen Siechen eine jährliche Rente von 40 Schillingen aus Witow gegeben. Weiter hatten die Hofmeister Johann Kröger und Johann Schacht samt ihren Ehefrauen 1341 den Ertrag einer Windmühle zu Butter für die Siechen und Pfründner vermacht 54 ), der Priester Konrad Vesperde aber 1406 den Siechen im Siechenhause 55 ) in seinem Testamente 2 Mk. ausgesetzt. Zu Unterhaltung einer ewigen Lampe endlich für sie (coram infirmis) der Pfarrer zu A.-Bukow Dietrich Mummendorp 1339 die Rente von 30 Mk. gegeben 56 ). Zu Lein für die Betten der Kranken sollte die Rente von 60 Mk. dienen, die Nikolaus Vrowede aus Lübeck 1289 vermacht hatte 57 ). Vielleicht kamen auch die zwei Betten, die Hinr. Rikwerstorp und seine Hausfrau Kunigunde 1321 für den Heiligen Geist gestiftet hatten, den Kranken zugute.
Zu ihrer Pflege ward eine Siechenmagd gehalten. Für diese stiftete Hinr. Rikwerstorp 1321 6 Schillinge jährlicher Rente 58 ). Um 1360 wurden für die Dienstboten im Backhause und für die Siechenmagd jährlich 6 Mk. ausgegeben 59 ). Eine zekenmaghet kommt oft in den Rechnungsbüchern vor. Eine namens Gheze kaufte sich 1431 eine halbe Pfründe. Eine andere, die 1517 begegnet, war verheiratet. An Stelle der 1531 zuletzt bezeugten sekenmaget tritt seit 1533 eine provenmaghet. Vereinzelt kommt 1448 ein gastmester auf dem Siechenhause vor, während der Gastmeister in


|
Seite 165 |




|
Lüneburg im ganzen die Stellung des Wismarschen Hofmeisters hatte 60 ).
Für die Siechen wurden 1411 wöchentlich 6 oder 7 Schillinge ausgegeben, öfter sind 4 oder 5 Schillinge für die Siechen gebucht. Manchmal sind Eier oder Fische als für sie gekauft in die Rechnungen eingetragen.
Ein Siechenhaus bestand noch 1616. Ein im Kopfe verworrener früherer Student der Theologie war Jahre lang bis zu seinem 1639 eingetretenen Tode in einer besonderen Bude des Hauses eingeschlossen 61 ).
Nicht immer wurden, wie wir schon gesehen haben, die erkauften Pfründen gleich angetreten, mochte dadurch ein nicht voller Kaufpreis ausgeglichen werden oder nicht gleich eine Pfründe frei sein. Mancher mochte sich auch durch zeitigen Kauf für die Zukunft sichern wollen. So erwarb Gerhard von Grevesmühlen 1302 eine Pfründe für den Fall künftiger Not, bestimmte aber im anderen Fall den Kaufpreis für eine Memorie 62 ). Taleke Lübberstorf sollte eine Leibrente von 5 Mk. beziehen, bis sie in den Genuß ihrer Pfründe käme 63 ).
Die Pfründner werden fast immer eingebürgert gewesen sein. Doch kommen auch Ausnahmen vor. Schon um das Jahr 1272 Hinze Westfal aus Farpen und 1346 Joh. Mögilke und Hausfrau aus Gagzow 64 ). Eine Denske vrouwe leistete 1449 und 1454 Zahlungen oppe 1 hele provene, ein Mann aus Lübeck zahlte 1450 30 Mk. up sine provene, 1466 de provener, de van Lubeke qwam (ob derselbe?) 50 Mk. Klawes Moltekow und seine Hausfrau Grete, die 1418 zwei Pfründen erwarben, scheinen aus Wolterstorf gewesen zu sein.
Bedienstete des Hauses wurden oft (oder in der Regel?) Pfründner, wie noch jetzt die Wirtschafterin (die frühere Köchin) zugleich Pfründnerin ist. Herman, der dem Hofe des Heiligen Geistes bei der Stadt vorstehen sollte, machte sich 1295 Aufnahme in das Haus und Pfründe aus, wenn er nicht mehr arbeiten könne 65 ). Der Hofmeister Klaus Wozerin konnte bei Niederlegung seiner Stelle Wohnung und Pfründe beanspruchen. Seine Hausfrau kaufte sich 1411 eine halbe Pfründe, gab diese aber


|
Seite 166 |




|
1415 gegen eine Leibrente auf. Dem Hofmeister Klawes Beringher und seiner Hausfrau wurden 1476 zwei Pfründen verliehen, ebenso 1528 Klawes Radelof und seiner Hausfrau. Als 1559 mit dem der Untreue überführten Martin Borchardt ein Vertrag geschlossen ward, wonach er die Wirtschaft unter Aufsicht weiter führen sollte, ward ihm und seiner Hausfrau, wenn er nicht mehr wirtschaften könnte oder abgesetzt würde, freie Wohnung thosampt aller nottruft, wo dat van olderß her gebrucklich, zugesichert. Die Siechenmagd Gheze kaufte 1431 eine halbe Pfründe und zwanzig Jahre später zahlte der Knecht des Heiligen Geistes Simon Wend auf seine Pfründe 40 Mk. an. Endlich sollte Leneke Scarpinghesche, die sich 1520 eine halbe Pfründe im Langen Hause kaufte, zunächst in der Küche Dienst tun 66 ).
Bezeichnet werden die Pfründner gewöhnlich als prebendarii oder provener, 1395 einmal als conventuales 67 ).
Daß nur Anwesende ihre Pfründe genießen konnten, kann man als selbstverständlich ansehen. Zum Überfluß ist es 1455 mit Grete Marquardes ausgemacht: wen se hyr ys, so schal se der halven pravene (die sie gekauft hat) bruken; wen se hyr nicht to der stede ys, so kright se dar nicht af.
Für gewöhnlich begriff eine Pfründe Wohnung und Unterhalt, jedoch nicht immer. Tideke Sasse kaufte sich 1430 ene tafele an der kokene, dar schal he eten ghaen de tiid synes levendes, unde vryge wanynghe, Hans Papike 1439 syne vrien tafelen, mit deme havemestere to etende unde to drinkende syne levedaghe. Wobbeke Suwels ward 1522 umme gades wyllen de erste tafelproven zugesagt, wen se wolt, also doch wohl nur der Tisch. Geske Holmes aber erhielt 1537 für 5 Mk. eine halbe provenbode up deme langen huße. Dat is gheschen by deme boschede, dat ße ere ghebreck ansegen in ereme oge. Sie tritt erst in die Pfründe ein, wenn sie nichts mehr verdienen kann, und erhält dann de taffelproven.
Die Wohnungen der Pfründner befanden sich teils im Neuen Hause 68 ), teils im Langen Hause 69 ), teils in Buden am Kirchhofe,
( ... )


|
Seite 167 |




|
teils im Keller 70 ) teils im Siechenhause 71 ). Das Lange Haus besteht noch. Es ist nach Norden zu an den westlichen Teil der Kirche längs der Neustadt angebaut und ebenso wie der westliche Teil der Kirche unterkellert. Die Buden darin werden wir uns als Holzkonstruktionen zu denken haben, wie sie noch im Langen Hause und im größeren Umfange im Heiligen Geiste zu Lübeck fortbestehen. Buden in Fachwerk schlossen sich bis an den Torweg an, andere liegen gegenüber östlich vom Kirchhofe, einige auch an der Nordseite in oder an dem ehemaligen Garten. Nicht selten bedangen sich Prövner eine bestimmte Wohnung aus. Dabei finden sich mancherlei Angaben über die Lage der einzelnen 72 ). In Lüneburg unterschied man von den gewöhnlichen Pfründen Herrenpfründen, deren Inhaber ihren Nachlaß dem Hause nicht zu vermachen brauchten 73 ).


|
Seite 168 |




|
Einige Male wird nur eine Stelle gekauft 74 ). Ein Ehepaar, das eine halbe Pfründe kaufte, sollte eine Kammer haben 75 ). Ehegatten teilten natürlich eine Wohnung, wobei öfter bedungen ward, daß der Überlebende allein wohnen bliebe 76 ). 1466 ward einem Ehepaare ein 2 provenhus zugesichert, das auch der Überlebende allein behalten sollte 77 ). Vater und Sohn sollten ein Haus teilen, der Überlebende es zur Hälfte haben 78 ). Gemäß besonderer Abmachung behielt eine Witwe das bisher mit ihrem Manne zusammen bewohnte Haus für Lebenszeit 79 ).
Aus diesen Abmachungen geht schon hervor, daß die für zwei Leute eingerichteten Wohnungen auch in der Regel von zweien bewohnt werden sollten, selbst wenn sie nicht durch engere verwandtschaftliche Bande verknüpft waren. So wohnten Metteke Sternberges und Taleke Lüberstorp zusammen. Als aber die erstere 1428 eine zweite Pfründe kaufte, bedang sie sich aus, nach dem Tode ihrer Genossin allein in der Wohnung bleiben zu dürfen 80 ). Wobbeke Bordinghes sollte ein halbes Haus zusammen mit den Schwestern Wendele und Gheseke Bergher bewohnen, sterbe eine von den dreien, so sollten die Überlebenden das Haus behalten 81 ). Um in ihrer Wohnung allein zu bleiben, zahlte Greteke Busackers 1456 noch 30 Mk. auf ihre Pfründe hinzu 82 ). Allein wohnten von Anfang an ein Pfründner 1412, eine Pfründnerin zwischen 1437 und 1439, eine Halbpfründnerin 1460 83 ). Ein späteres Alleinwohnen machte sich 1411 eine Halbpfründnerin aus 84 ).
Der Wert von Pfründe und Wohnung ward im 15. Jahrhundert zu 4 bis 6 Mk. jährlich gerechnet. Kurt Stenvort sollte 5 Mk. Leibgedinge beziehen, bis eine ihm zusagende Wohnung frei würde, Herman Sovenbom und Hausfrau 10 Mk., bis ein Haus frei würde, dar me ze an zetten mach 85 ), Greteke Warnow 6 Mk., Kurt Dene 5 Mk., bis sie ihre Pfründen erhielten 86 ). Der


|
Seite 169 |




|
armborsterer Johann Bruggheman, der 1421 mit seiner Hausfrau zwei Pfründen kaufte, sollte aus besonderer Gunst, da sie sie im ersten Jahre nicht antreten könnten, dafür 8 Mk. Rente genießen 87 ). Wenn der Sohn Eggert Neghenoghes seine Pfründe aufgeben und das Haus des Heiligen Geistes verlassen wollte, so sollte er 5 Mk. Leibgedinge erhalten, ebenso der Sohn Detlof Wustes 88 ). Hans Lyntbeke, der zu seiner Großmutter einzog, sollte jährlich 4 Mk. beziehen, weret dat em der provene nycht en lustede 89 ). Die Witwe des Hofmeisters Klawes Wozerin gab 1415 ihre Pfründe gegen eine jährliche Rente von 4 Mk. auf, sollte aber dereinst ihr bestes Paar Kleider mit dem Schmucke dem Heiligen Geiste hinterlassen 90 ).
Die Witwe des Ratmanns Joh. von Varen verkaufte 1348 ihre Pfründe an den Heiligen Geist für 6 Mk. 91 ), Alheid vam Sande 1523 die ihre für 50 Mk., wofür sie sie 1520 gekauft hatte 92 ). Im Jahre 1460 verkaufte Michael van den Berghe seine Pfründe und sein Haus an Grete Marquardes, die dem Heiligen Geiste noch 10 Mk. zuwandte, und im selben Jahre kaufte Ertmer Barendorp von Anneke Krighe eine Pfründe samt Haus 93 ). Die Preise sind nicht angegeben. Daß eine Pfründerin ihre Pfründe verlief (de ortstede up deme seykenhuse), wird 1480 berichtet 94 ).
Über das, was die Pfründner erhielten, sind wir schlecht unterrichtet. Sicher hatten sie noch in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts ihren vollen Lebensunterhalt (wie die in Lübeck und Hamburg noch jetzt), aber die Anschreibungen, die wir in diesem Zeitraum über die Ausgaben für die Küche haben, erstrecken sich auf die gesamte Wirtschaft des Hofmeisters, für seinen eignen Tisch und das ganze Hausgesinde. Unbekannt ist, wann die Pfründen zu einem Zuschusse für die Lebensbedürfnisse der Pfründner geworden sind, doch lassen sich die Anfänge dazu schon in den Rechnungen von 1411 und 1412 erkennen und im Laufe des Jahrhunderts wird sich der Übergang wohl vollzogen haben und damit der trotz fortschreitender Entwertung des Geldes herabgesetzte Preis der Pfründen zusammenhängen. Nach den Rech-


|
Seite 170 |




|
nungen aus den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts erhielten die Pfründner Kohlen, Butter, Fleisch und Grütze, wie viel, bleibt im Dunkeln. 1546 hatten die Armen im Langen Hause Anspruch auf Holz aus dem Wulvesbrok 95 ).
Während der Belagerung Wismars wurden 1712 im November die Lebensmittel durch Geld ersetzt 96 ). Nach der Instruktion von 1853 erhielt jeder Pfründner alle drei Wochen 3,50 Mk., seit 1870 erhielt er alle 14 Tage 3 Mk. (in Lüneburg jetzt wöchentlich 3 Mk.) und zu Weihnachten, Neujahr, Ostern und Pfingsten je 0,75 Mk. (statt früherer ungleicher Zahlungen für Fleisch, Brot und Bier an diesen Festen und früher auch Michaelis und Martini), zu Michaelis 2 Mk. Lichtgeld (statt 3 Pfund Lichte), bei Aufnahme eines Pfründners 7,60 Mk., dazu Anteil an verschiedenen Legaten.
Zunächst sorgten Stiftungen dafür, daß die Leistungen in mehrerer Hinsicht über das Notwendige hinausgingen. So stiftete der 1282 gestorbene Gerbert von Warendorp den Armen im Heiligen Geiste eine Tonne Bier für den Tag, wo man sein Gedächtnis beginge. Das mag die Tonne Bier sein, die nach der zwischen 1359 und 1367 fallenden Rechnung zu Marien Himmelfahrt (Aug. 15) den Pfründnern gegeben ward, jedem 1/2 Stübchen (1 1/2 Liter) 97 ).
Das Haus kann ganz gut 64 Pfründner gehabt haben, und so ist die im Urkundenbuche vorgenommene Änderung, wonach die Tonne unter die Pfründner und die Erntearbeiter geteilt wäre, schwerlich berechtigt. 1438 erhielten Pfründer und Priester an jenem Tage zwei Tonnen Bier. Eine Butterspende für die Siechen und die Pfründner stifteten, wie schon anzuführen war, die Hofmeister Johann Kröger und Johann Schacht samt ihren Ehefrauen 1341 98 ). Danach sorgte 1367 Johann Kelle für die Vergrößerung der Butterspende, worauf jeder Halbpfründner Anspruch hatte 99 ). Ausgaben für Butter finden sich denn auch sehr regelmäßig in den Rechnungen, sie ward tonnenweise gekauft, 1517 öfter aus Rostock, 1530 aus Lübeck. Nach dem Rechnungsbuche von 1483 hatten die


|
Seite 171 |




|
Pfründner Anspruch auf eine Last, also acht Tonnen. Ein Semmel im Werte von 1 Pf. Lüb. stiftete 1340 der Pfarrer von A.-Bukow Dietrich von Mummendorp für jeden Pfründner am Grünen Donnerstage 100 ). Bis der Krieg die Verteilung unmöglich machte, ließ die Kämmerei, bei der das Kapital steht, am Stillen Freitage 17 Reihen Reihensemmmel an die Pfründner im Langen Hause liefern (andere an andere in der Stiftung gleichfalls Bedachte). Außerdem ließen bis zu derselben Zeit die Ältesten der Krämerkumpanei als Verwalter des Brüggeschen Legats an sie zu Marien Verkündigung (März 25) 21 und kurz vor Weihnachten 15 Reihen verteilen, da die von Dr. Johann Brügge 1515 zu Empfängern Bestimmten durch die Religionsveränderung zum größten Teile abgängig geworden waren 101 ).
Im Jahre 1397 stiftete die Pfründnerin Mechthild Winkelman für Kirchherrn, Vikare, Offizianten, Küster und alle Pfründner für jeden zwei Tonnen Buchenkohlen 102 ), und es erscheinen auch in der Folge in den Rechnungen ständig Ausgaben für Kohlen, aber nicht etwa für eine feste Summe. Offenbar schwankte der Preis und es ward nach Bedarf eingekauft: von 1424 bis 1436 für 8 bis 16 1/2 Mk., in der Regel für etwa 14 Mk. Dafür würden bei dem 1412 bezeugten Preise von 14 Pfennigen für die Tonne 192 Tonnen zu kaufen gewesen sein. Im 19. Jahrhundert erhielt jeder Pfründner 1 Faden Buchenholz, ein Ehepaar 1 1/2 Faden. Statt dessen werden jetzt 42 oder 63 Rm. gezahlt. 1461 stiftete gemäß der an dem Schapen befindlichen Inschrift Hinrik Brulvisse, der in diesem Jahre mit seiner Hausfrau Tilseke zwei Pfründen kaufte, einen Schapen, d. i. ein Becken aus Bronze, in das ein Kohlenbecken gehängt werden konnte, die Pfründnerin Katharina Kils aber Dez. 16 unter Beihilfe Hode Steres 2 Mk. jährlicher Rente zu Kohlen auf den Schapen, dar sik de armen lude by wermen de hende 103 ). Der Schapen ist jetzt im Museum. Die Inschrift, in der drei Stellen für die Hänge des Kohlenbeckens ausgespart sind, lautet: anno . domini . m . cccc . lx i. hinrik bruluesse . heft . dessen . schapen . goten . vnde . dorch . got . ge . gheuen . dan (so) . sal . nement . den . he . van .


|
Seite 172 |




|
hir . nemen . orate . deum . pro . eo . (Merk). Dazu mag angemerkt werden, daß 1457 Lorenz Manderow Kohlen für einen Schapen am Eingange (in porticu) von St. Georgen und Helmich Busacker 1485 Kohlen für einen solchen in St. Nikolai stifteten. Noch 1587 wurden 4 Schillinge vor eine tonne kahlen uf dem feurschapen in die Kirche ausgegeben.
Nach den Anschreibungen über die Jahre 1411 und 1412 im Manual waren Sonntag, Dienstag und Donnerstag Fleischtage, gerade wie in Lübeck, Kiel, Barth und auch Hamburg damals und noch im 16. und 17. Jahrhundert 104 ), und mußte der Hofmeister für diese Tage frisches Fleisch einkaufen, was damals der Regel nach 22 bis 26 Schillinge für den Tag kostete 105 ). An den andern Tagen dagegen mußten, wie es scheint, die Pfründner meist schon für sich selbst sorgen und erhielten zu diesem Zwecke Geld. Dann ist eingetragen: do spysede ik de provener mit ghelde, dat kostede 7 Sch. Selten gab es statt Geldes Eier (öfter doch um Ostern), öfter an Montagen Wurst 106 ), gelegentlich auch Fische (täglich für 2 bis 3 Schillinge). In den Fastenzeiten, wozu auch die Adventswochen gehörten, fielen die Fleischtage fort, doch ward am Montag vor Aschermittwoch Fleisch gegeben, so daß vor Beginn der langen Fasten drei Fleischtage auf einander folgten. Mit Weihnachten und Ostern begann wieder die Fleischzeit. In den Fasten gab es erheblich mehr Fische als sonst, namentlich Stockfisch und Dorsch 107 ),
( ... )


|
Seite 173 |




|
es finden sich aber auch Ausgaben für Öl, Reis, Mandeln und Honig, einige Male auch für Weißbrot oder Wecken 108 ). Festtage wie der zweite Weihnachtstag oder Heiligentage wurden nicht berücksichtigt außer Marien Geburt (Sept. 8), wo es Hühner gab zur Hühnervigilie 109 ). Über die Feier zu O sapientia und der Buckvillinge wird weiter unten im 4. Kapitel zu handeln sein. Zu Pfingsten wurden Lämmer gekauft. In der Küche wird meist mit Holz geheizt sein, doch ward dafür 1427 1 voder kalen für 2 Mk. 5 Sch. 8 Pf. erstanden (Man. Bl. 67). Ein Fuder Buchenholz kostete 1533 10 Sch., 2 styge bokenholtes 5 Sch.
Im allgemeinen läßt sich, wie schon angedeutet, nicht auseinander halten, was für Wirtschaft des Hofmeisters, für sein Gesinde und für die Pfründner und Siechen besonders ausgegeben ist, wenn auch außer dem eben Mitgeteilten Ausgaben für Kohlen (1411-1432), Butter (1428-1432, 1520), Grütze (1517 und 1518), Fleisch (1428, 1429), Schweinefleisch (1518) und Bier als für die Pfründner gemacht angezeichnet und einmal 1428 2 Schillinge angeschrieben sind, dat hee (Brun) kokede den proveneren. Das Fleisch ward entweder aus eigener Schlachtung gewonnen, oder es ward frisch vom Markte aus den Scharren


|
Seite 174 |




|
oder eingesalzen tonnenweise gekauft 110 ). Geschlachtet wurden namentlich Rinder und Schweine. Diese wurden in großer Zahl gemästet, wie uns denn auch schon der Schweinehof als in der Nähe gewisser Pfründnerwohnungen belegen begegnet ist (Anm. 72), während ein Schweinestall 1501 vorkommt 111 ). Zu diesem Zwecke werden das ganze Jahr hindurch von Brauern Treber (teygh) in großer Menge gekauft, dazu auch Hafer und Kleie, obgleich von dem eignen Korn, z. B. 1474, 3 Last zum Mästen der Schweine verwendet wurden. Kleie wurde 1425 nicht weniger als 18 Last, die Last für 1 Mark, gekauft. meist von einem Bäcker. Wie die Antonius-Schweine zu Lübeck, so durften sich die des


|
Seite 175 |




|
Heiligen Geistes in den Straßen ihre Nahrung suchen 112 ). Im Herbst wurden sie in die Mast getrieben, im 16. Jahrhundert bis in die Gegend von Hagenow, auch ins Holsteinische. 1587 wurden nach der Rechnung 33 Ferkel verschnitten und ward zu Weihnachten der Hirt für 24 Schweine entlohnt 113 ). Manchmal gingen Schweine in großer Zahl ein, z. B. 1534 eine Sau und 16 Schweine. Dann hatte der Abdecker (racker) guten Verdienst 114 ). Minder oft begegnen Ausgaben für Schafe oder Hammel, Lämmer und Hühner.
Korn, namentlich Roggen, Gerste, Hafer, weniger Weizen, ward in großen Mengen teils in eigener Wirtschaft gebaut, vor allem aber von den Pächtern der Höfe und von den Bauern gemäß ihren Pachtverträgen geliefert, so daß davon nicht nur der Wirtschaftsbedarf voll gedeckt, sondern noch davon verkauft werden konnte. Saatkorn ward freilich gekauft und manchmal auch anderes Korn, z. B. Hafer, wie wir es eben gesehen haben (1412 2 Last und 2 1/2 Drömt Hafer). Ein Teil ward zu Grütze vermahlen, im Jahre 1474 z. B. 1/2 Last Gerste und 4 Drömt Hafer. Der Abfall wird an die Pferde verfuttert sein, da 1412 5 Schillinge vor gruttekaf


|
Seite 176 |




|
ausgegeben wurden, dat de perde eten. Es ward aber auch von Zeit zu Zeit Grütze scheffelweise gekauft (z. T. von einer Frau aus Bukow), 1534 Hafergrütze der Scheffel für 1 Mark, und 1 Faß Hirsegrütze für 3 Sch. Mehl ward selten, entweder sackweise oder nach Gewicht, gekauft 115 ).
Einige Erbsen kamen als Pacht von den Dörfern ein, andere wurden gekauft. 1523 2 Scheffel grawer arweten für 10 Schillinge, vermutlich doch zur Speisung. Wicken wurden 1520 5 Scheffel für 22 1/2 Schilling gekauft. Auf Bohnen bin ich in den Rechnungen nicht gestoßen.
Kohl ward vom Hause selbst gebaut. Es war Aufgabe der Koelmaghet (1424) oder der Kolmome (1427), dafür zu sorgen. 1520 ward 1 Sch., 1524 wurden 4 1/2 Schillinge für Koelplanten (Koilplanten) ausgegeben. 1502 12 Schillinge den ghreveren, dede uppe dem Kolhave groven, unde den plantheren. 1530 ward Kabbuskoel für 6 Pfenninge gekauft, 1412 Kumbesch (d. i. Kumpest, Sauerkraut) für 15 Mk. 2 Sch., Rüben 1411 11 Scheffel, 1412 9 Scheffel, der Scheffel für 1 Schilling, Wurzeln wurden anscheinend nur in geringer Menge gekauft.
Zur Würze dienten Salz, Essig, Senf, Pfeffer, Saffran, Nelken, Honig, Kümmel, Krude, Zwiebeln und Petersilienwurzeln, endlich Salbei 116 ). 1502 sind 14 pen. vor 1 punth olies und 8 pen. vor 1/2 punth manolies angeschrieben.
( ... )


|
Seite 177 |




|
Als seltene Zukost wurden Käse und Krebse, um Weihnachten Äpfel, Birnen und Nüsse beschafft 117 ).
Gebacken ward 1411 und 1412 etwa alle drei Wochen, 1493 von Neujahr bis Michaelis 13 Male. Ein besonderes Backhaus ist in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts bezeugt 118 ). Das Korn zum Backen hatte der Heilige Geist reichlich. Die Behandlung, allerdings in umgekehrter Folge, führt eine Eintragung von 1533 an: 5 sch. vor backent, sichtent, sackent unde malent. Das Backen und gewiß auch das Sichten ward einem Lohnbäcker (husbecker 1515) aufgetragen. Es kostete 1411 regelmäßig 4 1/2 Schilling, 1493 6 1/2, 1499 5 Schillinge 1530 kostete das Backen eines Scheffels Brot 8 Pfenninge. Verbacken wurden 1474 9 Last Roggen. Als besonderes Gebäck erscheinen um die Osterzeit wygelvladen 119 ).
Man kaufte aber zu dem hausgebackenen Brote anderes hinzu. Schon 1411 und 1412 wytbrot for die Pfründner zum 7. Dezember (in Unser Leven Vrowen avende) und Ostermontag für 4 Schillinge, 1499, Osterbrot (passchenbrot) für 2 Mk. 1517 wurden 12 Mk. 14 Schillinge für wyt broth ausgegeben, 1518 für weitenbroth 13 1/2 Mk., 1526 für wythbroth, welke is halt up der karvestock, 14 Mk. Weißbrot und Weizenbrot ist demnach dasselbe. Von dem 1501 für 12 Mk. gekauften Brote erhielten einen Teil die Bürgermeister, einen anderen die Armen des Hauses, einen dritten die Pfründner, den vierten die Kirche. 1530 wurden einmal withbrothkryngele für 9 Pfenninge gekauft, vermutlich den Kümmelkringeln entsprechend, die man noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Sommerzeit in Milch brockte. Roggenbrot (spißebroth) ist 1530 für 18 Pfenninge angeschrieben, öfter


|
Seite 178 |




|
1533 wegge för die Armen für je 6 Pfenninge. Die Heißwecken sind früher erwähnt.
Auch gebraut ward im Heiligen Geiste, und zwar bis 1631, während man im Lübecker Hospital das Brauen erst 1775 aufgab. Sein Brauhaus begegnet 1427 und 1523, wo dort ein Herd gebaut oder ausgebessert ward 120 ). An Anlagen zum Brauen oder an Braugerät kommen vor die Darre 121 ), Malzkörbe 122 ), ein seykuven, zeygvlechten (wohl als Einlage in den Seihbottich, um die Treber aufzufangen) 123 ), die Pfanne, das Pfanneneisen 124 ), vielleicht auch ein Klärbottich 125 ) und wahrscheinlich Rinnen. Öfter mußte das Darrenlaken 126 ), worauf vermutlich das gedörrte Malz aufgeschüttet ward, erneut werden.
Zum Heizen der Darre ward Darrholz gekauft 127 ). 1523 wurden 7 Mk. für Brauholz (bruholt) ausgegeben. Es wird aber auch ein nicht geringer Teil des sonst gekauften (stichholt,


|
Seite 179 |




|
bokenholt) und des in den eigenen Holzungen geschlagenen Holzes für das Brauen verbraucht sein.
Für Hefe (ghest) zu einem Bräu wurden 1492 4 1/2 Schillinge, 1501 2 Schillinge bezahlt, 1411 1 Mk. vor 4 molte thu malende.
Wasser zum Brauen ward 1523 und 1515 herangefahren 128 ). Das erinnert an die Inschrift an der Wasserkunst: dulcis aquae dum permultis urgebat ab annis Wismariam, finis nescia , pauperies, vidimus advehier zythi coctoribus undas ex puteis parvo, at saepius aere gravi. Während endloser Mangel an süßem Wasser Wismar in vielen Jahren drückte, sahen wir es den Brauern um kleines, öfter aber um großes Geld aus den Brunnen zuführen. Ich habe diese Brunnen in meiner Abhandlung über das Brauwerk in Wismar 129 ) doch nicht richtig gedeutet. Es sind damit, wie aus den Aufzeichnungen des gleichzeitigen Jürgen Wever hervorgeht, die pipensode auf dem Ziegenmarkte und auf dem Platze gemeint, nicht irgend beliebige sode oder gar die Grube. Und noch ein anderes kann ich jetzt an jener Untersuchung 130 ), und zwar aus den Rechnungen des Heiligen Geistes, berichtigen. Die Bezeichnung hel- oder hellbrauer ist nicht jünger, sondern älter als helpbruwer und, wenngleich der hellebruwer, wie er seit 1499 zu belegen ist, der Gehilfe des Brauers war, so ist die Deutung doch dunkel. Eine ältere Bezeichnung ist schopenbruwer (1492), die später auf den Brauer oder Meisterbrauer übertragen ward. Der Brauer ward um jene Zeit mit 10 Schillingen, sein Gehilfe mit dem dritten Teil davon, nämlich 10 Witten, für den Bräu entlohnt; die Seihwärterin erhielt 4 Witte. Dazu kam vermutlich stets freie Verpflegung 131 ).


|
Seite 180 |




|
Der Brauer (noch 1483 bruwerknecht) besorgte nicht nur das Brauen, sondern auch die Bereitung des Malzes 132 ). Das Spunden des fertigen Bieres war nicht mehr Sache des Brauers, sondern des Trägers, der auch als Bierspunder bezeichnet wird 133 ).
Einen Teil des zum Brauen benötigten Hopfens baute der Heilige Geist selbst, zu Zeiten wie 1498 konnte er sogar Hopfen verkaufen, meist mußte hinzugekauft werden 134 ), s. am Ende des dritten Kapitels. Das Malz ward teils aus der eigenen Gerste bereitet, teils gekauft, z. B. 1428 1 Last für 13 Mk. Im Jahre 1474 wurden 11 Last Gerste verbraut.
Gebraut ward 1412 zehnmal, 1493 von Neujahr bis Michaelis sechsmal. Jener Zeit kostete das Brauen je 12 Schillinge, 1493 durchschnittlich 18 Schillinge, 1515, wo viermal gebraut ward, 22 Schillinge. 1517 und 1518 ward wieder sechsmal gebraut.
Nicht immer mag das selbstgebraute Bier für alle Anforderungen gut genug gewesen sein, zu andern Zeiten mag es nicht gereicht haben. Auf das erste hin kann man die geringeren Ausgaben für Bier deuten, namentlich die bei besonderen Gelegenheiten 135 ), das andere wird man annehmen müssen, wenn ganze Tonnen gekauft wurden 136 ). Regelmäßig erhielten die Ratsdiener zu ihrer Fastnachtsfeier 3 Tonnen 137 ).
Eimbeker Bier ward 1517 auf die Schreiberei des Rats gesandt (für 2 Schillinge), Hamburger Bier 1530 zweimal für je


|
Seite 181 |




|
11 Pfennige gekauft, öfter Weißbier (withbere), einmal für die Wendorfer, als sie zu Martini ihre Pacht brachten. 5 Tonnen Kovent wurden 1520 für 15 Schillinge gekauft.
Nicht nur für kirchliche Zwecke (Wein und Oblaten), sondern auch für manche Gelegenheit mußte Wein gekauft werden, meist in kleinen Mengen, ohne daß der Anlaß genannt wird. 1493 wurden von Neujahr bis Sonnabend nach Fronleichnam so 27 Schillinge 7 Pfennige ausgegeben, wobei im allgemeinen der Wein plankweise, also zu 3/8 Litern, gekauft ward. Das Plank kostete 9 oder 11 Pfennige. Dem Offizial Joachim Michaelis aus Rostock ward 1517 ein Stübchen (etwa 3 Liter) für 6 Schillinge gespendet. Mag. Schabow erhielt 1518 1 Quart (3/4 Liter) Malvasier. Öfter ward Gewürzwein (klaret) gekauft, z. B. 1499: 15 sch. vor 1 stoveken klaretes, do ik rekenschop dede.
Most gehörte zu der Mahlzeit zur Buckvigilie (1517) und zu der Hühnervigilie (1499, 1522).
~~~~~~~~~~
II. Die Verwaltung des Hauses
und das Personal.
Die Verwaltung des Hauses zum Heiligen Geiste scheint anfänglich dem ganzen Rate zugestanden zu haben. Die Ratmannen und Vorsteher des Heiligen Geistes verpachteten 1280 Martensdorf 138 ), der Rat stand für den Heiligen Geist 1290 Besitz zu Hornstorf ab und erwarb solchen zu Martensdorf 139 ), verkaufte Acker, der diesem vermacht war 140 ), Leibrente 141 ) und ließ 1293 Haus und Speicher, 1294 aber mehrere Wurten auf, die jenem gegeben waren oder zustanden 142 ). Die Ratmannen nahmen 1295 einen Hofmeister für den Hof des Heiligen Geistes bei der Stadt an, der bleiben sollte, solange er nach dem Ermessen der Ratmannen und Pfleger seiner Stelle genüge 143 ) 1321 ward der Hof zu Metelsdorf den Ratmannen für den Heiligen Geist aufgelassen, im Jahre darauf wurden die Ratmannen verpflichtet, eine vom Heiligen Geist gekaufte Rente dem Rentner durch die Vorsteher zahlen zu


|
Seite 182 |




|
lassen. Mit Wissen und Willen der Ratmannen verkauften endlich 1331 die Verweser Rente 144 ).
Aus diesen Verhältnissen erklärt es sich auch, daß in dem Wismarschen Privilegienbuche, dem von dem Stadtschreiber Hinrik von Embeke angelegten Urkundenkopiar, dessen Inhalt nach dem Brande des Rathauses 1351 von Herzog Albrecht authentifiziert ward, den Urkunden der Stadt 34 des Heiligen Geistes aus den Jahren 1253-1342 angehängt sind, daß Urkunden und Briefe des Heiligen Geistes von dem Stadtschreiber geschrieben wurden 145 ), daß die reitenden Diener auch für den Heiligen Geist ritten 146 ),
( ... )


|
Seite 183 |




|
und daß Stadt und Heiliger Geist einander in Geldsachen häufig aushalfen 147 ).


|
Seite 184 |




|
Später ward der Rat durch einige Ratmannen, zunächst 1319 zwei Ratmannen, sicher seit 1324 durch zwei Bürgermeister abgelöst, die als Vormünder bezeichnet zu werden pflegen 148 ). Im Jahre 1321 vermachte Hinrik Rikwerstorp diesen Vorstehern jährlich 1 Mark zu 2 Paar Schuhen 149 ). Das Zeugnis hierüber ist in gezwungenen lateinischen Versen erhalten und daher auf ihre Bezeichnung als rectores de consulibus civitatis und hernach als domini provisores kein Gewicht zu legen. Namentlich genannt werden die Vorsteher zuerst 1323. Es sind zwei Ratmannen, die ein Erbe für den Heiligen Geist verkaufen und ihm den Schutz des apostolischen Stuhls und die Bestätigung seiner Gerechtsame erwerben 150 ). Im Jahre darauf sind es zwei Bürgermeister mit Johann von Klütz, dann 1329 und 1332 mit Otto Becker 151 ). Dieselben Bürgermeister tauschen 1342 als Vorsteher Klüßendorf für Klein-Ziphusen ein 152 ). Ebenso kaufen zwei Bürgermeister als Vorsteher 1351, 1364, 1368 und 1369 Landbesitz, übernehmen Rente oder lassen sich Rechnung legen 153 ). Sie haben wesentlich die Befugnisse, die sie später als Patrone des Hauses ausübten, indem jedes gewichtigere Verwaltungsgeschäft, wie Kauf von Landbesitz, Verpachtungen, Pachterlaß, Verkauf von Leibrente, Kauf von Rente, Annahme des Hofmeisters, Aufnahme von Pfründnern. Verkauf von Bauernerben oder Rente daraus durch die Bauern und gewiß sonst Wichtigeres vor ihnen abgemacht werden mußte oder ihrer Einwilligung bedurfte, ihnen auch Rechnung gelegt werden mußte. Die Rechnungaufnahme haben sie seit Errichtung des Revisionsdepartements (1828) als Mitglieder des Konsulats. In Lübeck waren seit der Mitte des 14. Jahrhunderts stets die beiden ältesten Bürgermeister Vorsteher des Hospitals.


|
Seite 185 |




|
Anstatt zweier Bürgermeister als Vorsteher kommen zu Zeiten auch drei oder alle vier vor. Drei in den Jahren 1431, 1439-1485, 1488-1490, 1531, vier 1428-1430, den Jahren des neuen Rates, 1453, 1466-1479, 1483, 1491, 1514, 1517, 1522-1528, fünf 1470, zwei 1485-1487, 1497-1502, 1525, 1530.
Während der früheren Umsturzjahre waren zuerst 1410 drei Bürger den beiden Bürgermeistern zugeordnet und scheinen von 1411 bis 1416 allein die Obliegenheiten als Vorsteher ausgeübt zu haben; nur einmal (1411 Oktober 1) findet sich ein Bürgermeister neben ihnen. Einige dieser Bürger, die von Jahr zu Jahr entweder alle oder doch teilweise neuen Platz machten, wurden, ohne daß das in ihrem Verhältnisse zum Heiligen Geist etwas geändert hätte, während ihrer Amtszeit in den Rat berufen. Die letzten sind noch am 27. September als Vorsteher bezeugt, obgleich der alte Rat schon am 1. Juli wieder eingesetzt war.
Am 14. April 1418 nahmen der Bürgermeister Gert Below und der Ratmann Joh. Vrese als Vorsteher na rade her Johannes Bansekowen (Bürgermeister) Pfründner auf.
Die Vorteile, die die Bürgermeister als Vorsteher hatten, sind während des Mittelalters nicht nennenswert. Daß bei Gelegenheiten wie der Rechnungsaufnahme eine Erfrischung gereicht ward, verstand sich damals von selbst. Sonst findet sich nur 1493 vermerkt: 25 sch. vor dat wygelbroth den borghermesteren, und 1501: 12 Mk. vor broth, dar hebben aff ghekreghen eyn parth de bormestere unde eyn parth de armen lude up dat hus unde [eyn] parth de provenere, eyn parth in de koken 154 ). Erst in späterer Zeit mit dem Aufkommen der Kontraktgebühren und der Ausbildung der Sporteln erwuchsen Einnahmen, die einigermaßen zu Buch schlugen. Das wenigste läßt sich davon aus den Rechnungen feststellen. Nach dem Austausche von Bantow erhielt der Patron der Heiligen-Geist-Hebung jährlich zu Michaelis 30 Mk. kur. als Holz- und Buttergeld aus Hinter-Wendorf, von 28 Rauch- und Pachthühnern aus Mittel-Wendorf, Bantow und Blowaz. 1754 wurden vier verkauft und erhielten der älteste Bürgermeister und der Patron je sechs (wenn nicht beides zusammenfiel, wo dann der Bürgermeister zwölf bekam), der Inspektor vier, die Provisoren acht. 1830 wurden 27 Hühner aus Klüßendorf, Wendorf und Benz verteilt (13, 9, 5). Von 12 Gänsen aus Klüßendorf und zwei aus Benz wurden 1744 10 verkauft, während der Inspektor eine und die Provisoren drei bekamen. Dagegen waren noch 1587 61 Rauch- und Pachthühner aus Mittel-Wendorf, Bantow und Benz "für die


|
Seite 186 |




|
armen und auf dem have verspeisedt". Es ward aber damals auf den Höfen oder Dörfern nach dem Muster der Fürsten Ablager bezogen, wofür die Rechnung leider nur eine Andeutung bietet: 4 Mk. 1 sch. 3 pf. vor weine, so dies jar uf die ablager szein mitgenohmen worden. Nach dem Erwerb von Preensberg wurden dort Räumlichkeiten für die Vorsteher eingerichtet, vermutlich unter dem Titel der Gerichtshaltung, wogegen die unzufriedenen Bürger von Sommervergnügen sprachen, wie es in großartigeren Formen die Vorsteher des Lübeckischen Stifts Westerau abhielten. Der verwaltende Provisor (s. unten) erhielt, um das gleich mitzunehmen, für die Verwaltung gemäß Beschlüssen von 1742 Nov. 17 und 1746 Aug. 20 ein jährliches Honorar von 120 Mk. N 2/3 (= 140 Mk.) und seit der Veräußerung von Bantow den Marktpreis von zwei Drömt Roggen, die er bis dahin zu Martini von dort bezogen hatte 155 ).
In einigen Fällen handelte auch später noch der ganze Rat für das Haus zum Heiligen Geiste. So kauften 1441 Febr. 25 Bürgermeister und Ratmannen und Hofmeister eine Rente aus der Bede zu Bantow, verlieh 1416 im März oder April der Neue Rat mit Einwilligung der Vorsteher eine Pfründe und ward 1562 Klüßendorf mit Bewilligung des Rates verpachtet.
Seit der Reformationszeit treten wieder bürgerliche Provisoren oder Vorweser neben die Bürgermeister. Zuerst 1526 bei den Abrechnungen, in den Jahren 1532, 1536 und 1537 sogar zwei Bürger allein (jedoch einmal mit Einwilligung der Bürgermeister), 1533 und 1534 neben einem Ratmann, und 1535 drei Bürger neben einem Ratmann. Am 14. März 1538 schließt der Bürgermeister Kort Niebur vor seinen drei Mitbürgermeistern ein ihn und den Heiligen Geist angehendes Geschäft ab. Die Verhältnisse dieser Zeit verminderter Ratsgewalt sind undurchsichtig. Unklar ist namentlich eine Aufzeichnung von 1532 Apr. 9 über die Übergabe des Inventars an den neuen Hofmeister Hans Busschow. Sie lautet: In jegenwardicheit der ersamen heren her Nicolaus Heyne, Jochym Heyneken, rathmannen, Claws Bolten, Cordt Rodoszs, Jochym vam See, Hans Schabbelth unde Claws Nanneken, borgeren tor Wismer, hebben Hans Busschowen vorstender vorhantrecket desse


|
Seite 187 |




|
naschreven gudere und rescoppes des hilligen Gestes, welke mester Herman Rempter em naleth, don he afftoch, . . . 156 ).
Von 1541 bis 1545 finden wir als Verweser einen oder zwei Bürger neben einem Bürgermeister, 1555 zwei Bürger, 1559 bis 1568 zwei Ratmannen und einen Bürger oder, nachdem auch dieser in den Rat eingetreten war, dieselben als drei Ratmannen, 1578 zwei Ratmannen (immer noch dieselben seit 1559 oder 1562) und einen Bürger. Seit 1536 führte einer dieser bürgerlichen Vorsteher die Rechnung.
Hin und wieder werden neben den Verwaltern auch die Insassen des Hauses als mit abschließende Rechtssubjekte genannt, selbstverständlich ohne wirklich zugezogen zu sein. So wird 1383 Zessin, 1389 und 1397 Bede oder eine Hebung aus Bede an die Vormünder oder Vorsteher des Hauses zum Heiligen Geiste unde den personen darinne (oder dessulven huses) verpfändet 157 ).
Weder der Rat noch die Bürgermeister konnten sich um die täglichen laufenden Geschäfte kümmern, sondern bestellten dazu Vorsteher oder Meister 158 ). Als solche begegnen zuerst 1280 und 1283 Joh. von Gogelloywe und Jordanus pellifex, an der zweiten Stelle ohne Amtsbezeichnung 159 ). An anderen Stellen werden sie um dieselbe Zeit (1288, 1290 und 1295) als tutores benannt, ohne Namen 160 ). Man könnte zwar zweifeln, ob in diesen tutores wirklich die Meister oder nicht vielmehr rätliche Vorsteher zu erblicken sind; da es sich aber um Geschäfte handelt, die einerseits der ganze Rat, anderseits Johann von Gögelow und der Pelzer Jörden abschlossen, nämlich um Veräußerung von Grundbesitz in der Stadt, so werden sie doch als bürgerliche Vorsteher des Hauses anzusehen sein.
Diese bürgerlichen Vorsteher verpachteten 1280 den Hof Martensdorf und sollten 1295 neben dem Rate zu befinden haben, ob der für den bei der Stadt belegenen Hof angenommene Hofmeister seiner Aufgabe genügte 161 ).
Die Benennungen vormunder, tutores, provisores, procuratores werden sowohl für die Bürgermeister wie für die Hofmeister verwendet, nur einmal habe ich 1407 die als amministrator gefunden 162 ). Eindeutig ist (wenigstens für die ältere Zeit) selbst


|
Seite 188 |




|
nicht die Bezeichnung magister oder Meister, die zuerst 1282 in einer schon angeführten Stelle vorkommt. So werden päpstlichen Urkunden die rätlichen Vorsteher als magistri benannt 163 ).
In einer Urkunde von 1331 verursacht die Verbindung provisores sive magistri domus sancti Spiritus, die mit Wissen und Einverständnis des Rates Rente verkaufen 164 ), einige Zweifel. Johann von Klütz aber und Otto Becker (der 1328 Bier zur Erquickung der Armen stiftete), die 1324, 1329 und 1332 neben zwei Bürgermeistern unter der gemeinsamen Bezeichnung als provisores Klein-Ziphusen kaufen, einen Vertrag wegen der Walkmühle abschließen oder Steffin verpachten 165 ), können nur Hofmeister gewesen sein, ebenso Johann Kröger und Johann Schacht, die von 1341-1348 zusammen oder auch einer von ihnen allein für sich oder neben Bürgermeistern als provisores bezeugt sind 166 ). 1351 werden neben zwei Bürgermeistern als tutores Johann Yebekendorp und Johann Holst als procuratores et magistri genannt 167 ). Es ist das die letzte Stelle, wo zwei Hofmeister begegnen. Fortan treffen wir stets (wie schon 1324) nur einen. Zuerst Werner Lischow 1368 und 1371 168 ), nur einmal als procurator bezeichnet, aber 1368 Rechnung ablegend. Die Kornhebung, die er 1371 für Pilger erwarb, hat er schwerlich aus eignen Mitteln bezahlt, wohl aber hat er im gleichen Jahre 200 Mark für Glasfenster in der neuen Kapelle des Heil. Geistes, 70 Mk. für die Decke der Kirche und eine Vikarei zu S. Nikolai gestiftet 169 ).
Danach finden wir Nikolaus Wozerin 1397 (magister) und 1398 170 ) und, nachdem er durch Thiedeke Murman von 1399 bis 1406 171 ), Herman Schröder 1407 (amministrator) und Thiedeke Zurow 1408 und 1409 (vorstender) abgelöst war, wieder 1411 und 1412. Es folgen Johann Wise 1413-1415, Lüdeke Rike 1415 bis 1427, Hinrik Nigeman 1427-1449, wenn nicht noch länger, Klawes Beringer mindestens seit 1458 bis 1476 172 ), Hinrik


|
Seite 189 |




|
Langhe 1476-1483 und wiederum 1501 und 1502, Hans Rogge 1486 Juli 11 bis 1491, Hans Hamme 1493 173 ), Marcus Rikehof 1498-1501, Schiffer Girges Wulf 1502-1511, Hans Gudejohan 1514-1517, Klawes Radelof 1518-1531, Herman Rempter wohl 1531 und 1532 174 ), Hans Busschow 1532-1542, Martin Borchwerth 1542-1559 (1545 als Werkmeister bezeichnet). Ob Bernd Pegel, der 1485 April 16 und 1486 Juni 22 abrechnete (das letzte Mal in Beisein Hans Rogges), Hofmeister gewesen, ist nicht sicher. Die Eintragungen sind in erster Person gemacht, so daß das Fehlen der Bezeichnung hier nicht darüber entscheidet, ob der gleichnamige älteste Bürgermeister spricht oder nicht. Dieser wird auffallender Weise nicht unter den Bürgermeistern genannt, die damals die Rechnung aufnehmen. Nun könnte er ja aus besondern Gründen zeitweilig (natürlich mit Zuziehung Untergeordneter) die Verwaltungsgeschäfte übernommen gehabt haben; aber die von gleicher Hand wie die Abrechnung eingetragene Notiz: item dede ik her Dyderik Hammen (dem Pfarrer, der, wie es scheint, jener Zeit die eigentliche Verwaltung in Händen hatte) na hete der borgemestere 8 1/2 elen rodes Leydesches 175 ), läßt das doch nicht zu.
Die Hofmeister wurden von den Bürgermeistern angenommen 176 ). Sie hatten die Wirtschaft zu leiten und die Rechnung zu führen und zu bestimmten Zeiten vor den Bürgermeistern abzurechnen. 1492 ließ, wie schon anzuführen war, der Ratzeburger Bischof es gelten, daß der Hofmeister wegen der Armen seiner Ladung nicht nachkommen könne. Bei Aufnahme von Pfründnern wirkte der Hofmeister vielfach neben den Bürgermeistern mit 177 ), ebenso bei Verkauf von Rente und Leibrente, bei Ankauf von ländlichem Besitze, bei Verpachtung der Höfe und bei Bewilligung von Rentenverkauf durch die Bauern. Mit Einwilligung des Hofmeisters verleihen die Bürgermeister 1470 und 1474 Pfründe und Wohnung 178 ). Vor den Vorstehern, zwei Bürgermeistern, und dem Hofmeister, wird 1399 Urfehde geschworen 179 ). Der Hofmeister


|
Seite 190 |




|
weist 1410 einem Pfründner seine Wohnung an und trifft 1429 mit der Witwe eines anderen ein Abkommen wegen dessen künftiger Wohnung 180 ); er allein verkauft 1517 eine halbe Pfründe 181 ). Vor dem Hofmeister tritt 1473 ein Bauer zu Mittel-Wendorf sein Erbe an seinen Sohn ab 182 ). Der Hofmeister legt Bauern Bußen für Blut und blau auf und ermäßigt sie, er stiftet Vertrag und zieht zu Mittel-Wendorf und Benz Buße ein 183 ), er schließt 1400 einen Leibrentenvertrag ab 184 ). Ihm ist die Verteilung des aus der 1371 von Werner Lischow erworbenen Rente beschafften Biers und Brotes an die Pilger zugewiesen 185 ).
Vom Hofmeister wird 1397 vorausgesetzt, daß er verheiratet ist 186 ). Zur Teilnahme an des Hofmeisters Tische kaufte 1578 der Barbier Peter Reder den Sohn einer Schwester ein 187 ), wie man in früheren Zeiten sich hin und wieder Versorgung am Tisch eines Werkmeisters der Pfarrkirchen erworben hatte. Dafür daß der Hofmeister freie Kleidung hatte, spricht eine Eintragung von 1431 188 ). Er konnte auch Ausgaben für eine Kollation in Rechnung stellen 189 ).
Klawes Woserin hatte nach Niederlegung seines Amtes Anspruch auf Wohnung und Pfründe, seine Hausfrau aber, die sich 1411 eine Pfründe gekauft hatte, ließ sich dafür 1415 eine Leibrente geben. Lüdeke Rike kaufte, als er sein Amt 1428 niederlegte, für sich und seine Hausfrau Leibrente. Sein Nachfolger Hinrik Nigeman im gleichen Jahre ebenfalls für sich und seine Hausfrau, aber mit der Bedingung, daß sie in ihren Bezug erst eintreten sollten, wenn er seinem Amte nicht mehr vorstehen könnte 190 ). Als seine Witwe nach 1449 van deme godeshuse toch, ward ihr auf Lebenszeit ein silberner Becher geliehen. Sie starb 1458 191 ). Klawes Beringer und seiner Hausfrau ward bei Aufgabe seiner Vorsteherschaft 1476 eine Pfründe verliehen 192 ). Eben-


|
Seite 191 |




|
so gaben die Bürgermeister 1528 dem Vorsteher Klawes Radelof Pfründe und Wohnung 193 ).
Der der Untreue überführte Hofmeister Martin Borchardt ward durch ein Abkommen von 1559 Febr. 6 zwar zu Schadenersatz angehalten, aber zugleich verpflichtet, die Wirtschaft fortzuführen, wobei ihm zur Kontrolle zwei Ratmannen, zwei Bürger und ein Schreiber an die Seite gestellt wurden. Diese sollten die Einnahmen und Ausgaben haben und die Rechnung führen, er aber nichts ohne deren Wissen und Willen tun. Würde er zur Verwaltung unfähig oder abgesetzt, so ward ihm freie Wohnung thosampt aller nottroft zugesichert, wo dat van olderß her gebrucklich. Er räumte, nachdem er mit den Vorstehern in Uneinigkeit geraten war, gemäß einem neuen Vertrage vom 12. Oktober des Jahres den Heiligen Geist 194 ).
Mit dem Ende des Jahres 1631 hörte die Hofhaltung auf. Das Vieh ward verkauft, ein Bauknecht, ein Baujunge und zwei Mägde wurden entlassen. Es blieben nur der Hofmeister, die Hofmeisterin und die Prövenmagd, seit 1636 nur Hofmeister und Prövenmagd (= Köchin). Nach einer Auskunft von 1828 war immer der älteste reitende Diener Hofmeister und hatte als solcher die Aufsicht über den Heiligen-Geisthof und die dort wohnenden Pfründner 195 ). Er bewohnte eine Bude auf dem Hofe. Noch jetzt erhält bei Aufnahme eines Pfründners der älteste reitende Diener 1,75 Mk. Einspringegeld.
Die erste Rechnunglegung eines Hofmeisters, die uns bekannt ist, ist vom Ende Juni 1369. Sie fand vor zwei Bürgermeistern statt. Als Ergebnis wird eine Forderung des Hofmeisters von 88 Mk. verzeichnet 196 ). In derselben Art sind die meisten späteren Aufzeichnungen über die Abrechnung gehalten, so daß die Beträge der Einnahmen und Ausgaben im Dunkel bleiben. Nach einer Bestimmung der Bürgermeister Johann Dargetzow und Johann Tuckeswert von 1387 sollte regelmäßig in der Epiphaniasoktave abgerechnet werden 197 ). Doch hat man sich später nicht daran gekehrt. Öfter wurden die Stadtschreiber zugezogen. So 1432 bis 1434, 1437 bis 1439 und 1485 und 1522 (ebenso zu Pfründenkäufen und Verpachtungen 1432, 1435, 1485).


|
Seite 192 |




|
Ausnahmsweise ward 1411 Juni 18 nicht von dem Hofmeister, sondern von den Verwaltern, dem Ratmanne Hinr. Rampe, Klawes Kusel und Dame vor dem Rate abgerechnet. Sie wurden entlassen und an ihrer Stelle Hinr. Warendorp, Gottschalk Scheversten und Kurd von Pegel zu Vorstehern erwählt 198 ).
Zu der Abrechnung mußte gemäß einer Aufzeichnung von 1490 der Fischer des Heiligen Geistes einen guten Hecht oder ein gutes Faß Fische liefern 199 ). Vermutlich ist auch sonst aufgetischt worden. 1428 Juli 21 ward in der Küche abgerechnet, 1524, 1526, 1528 und 1535 in der Schreiberei.
Einige Male erfahren wir doch die Höhe der Einnahmen und Ausgaben. 1411 Juni 18 hatte Klawes Woserin 765 Mk. eingenommen und 866 Mk. ausgegeben (seit wann?) 200 ). Bei seiner Abrechnung vom 30. November desselben Jahres beliefen sich Einnahmen wie Ausgaben auf 1380 Mk., Dez. 24 die Einnahmen seit dem 18. Juni auf 1394 Mk., die Ausgaben auf 1303 Mk. 201 ), wobei es rätselhaft ist, wie sich diese Zahlen erklären mögen. Ende Juni 1412 wird eine Einnahme von 867 Mk. und eine Ausgabe von 886 Mk., Nov. 29 eine Ausgabe von 1341 Mk. verzeichnet 202 ). Als Woserin wiederum 1412 Dez. 24 (des sonavendes vor wynachten) mit den Vorstehern rechnete, betrugen seine Einnahmen seitdem 18. Juni 1411 1366 Mk., seine Ausgaben 1509 Mk., die Einnahmen und Ausgaben Kurds von Pegel 334 Mk. 203 ).
Aufzeichnungen über Abrechnungen der üblichen Art haben wir von 1428 Apr. 8, Juli 21, 1429 Febr. 16, Sept. 25. Dann nach dem Fehlen einiger Blätter (was in der Blattzählung nicht berücksichtigt ist) von 1430 Sept. 26 - hier ist einmal die Einnahme auf 275 1/2 Mk., die Ausgabe auf 267 Mk. angegeben -, 1431 März 17, Okt. 4, 1432 Apr. 9, Sept. 30, 1433 Mai 4, Okt. 8, 1434 März 18, Sept. 28, 1437 Okt. 1, 1438 Mai 1, Okt. 4 (nur vor einem Bürgermeister mit dem Stadtschreiber), 1439 Apr. 21, Okt. 20, 1440 Apr. 5, Okt. 9, 1441 Mai 9, Okt. 9, 1442 Juni 7, Nov. 1, 1443 Mai 5, Okt. 16, 1444 Mai 13, Okt. 14, 1445 Okt. 17, 1446 Mai 15, Okt. 16, 1447 Mai 9, Okt. 29, 1448 Okt. 6 oder 13 (dominica Dionisii), 1449 Okt. 12, 1450 Nov. 1, 1451 Sept. 30, 1452 Mai 22, 1453 Apr. 8, 1454 Sept. 30, 1455 Juni 16 und Okt. 24. Nach langer Unterbrechung von 1499 Okt. 27, 1500


|
Seite 193 |




|
Nov. 26, 1501 Sept. 21. Inzwischen geben die Abrechnungen von 1485-1487 die Höhe der Einnahmen und der Ausgaben an: 1485 Ap. 16 (E. 307 Mk. 10 Sch., A. 300 Mk. 13 1/2 Sch.), Nov. 8 (E. 51 Mk. 6 Pf., A. 214 Mk. 11 Sch. 4 Pf.), 1486 Juni 22 (E. 289 Mk. 6 Pf., A. 343 Mk. 11 Sch. 10 Pf.), Sept. 26 (E. 7 1/2 Mk., A. 100 Mk. 3 1/2 Sch.), 1487 Mai 8 (E. 328 Mk. 11 Sch., A. 390 Mk. 12 Sch. 8 Pf.) 204 ).
In der Reformationszeit wurden die bürgerlichen Vorsteher zu der Rechnungsablegung zugezogen. Diese fand 1526 Apr. 9 vor 2 Bürgermeistern und in Gegenwart zweier Bürger über das Jahr von Michaelis 1523 bis Michaelis 1524, am folgenden Tage aber mit dem Unterschiede, daß nur ein Bürger zugegen war, über das Jahr von Michaelis 1524 bis Michaelis 1525 statt. Die Rechnung über das Jahr von Michaelis 1526 bis Michaelis 1527 ward 1528 März 21 vor den vier Bürgermeistern aufgenommen. 1535 Sept. 8 dagegen rechneten der Ratmann Joachim vom See, Hans Schabbelt, Markus Meiger und Hans Kistemaker vor den Verordneten des Rates, dem Bürgermeister Grawe und dem Ratmann Hinr. Dürjar in Beisein der neuen Verweser Bernd Hoppenacke und Marten Schepel über die Jahre 1533/4 und 1534/5 ab (ausgenommen über die Schuld der Hofmeister Radelof und Buschow), und am folgenden Tage entlastete sie der Rat.
Zum Rechnen im täglichen Leben brauchte man Rechenpfenninge. Über den Kauf von solchen berichten zwei Eintragungen: 3 penninghe vor telleghelt (1492), 1 schillingh to talgelde (1517) 205 ).
( ... )


|
Seite 194 |




|
Rechnungen oder Teile von Rechnungen sind schon aus recht alten Zeiten vorhanden. Die ersten von 1304 finden wir im ältesten Stadtbuche §§ 1133 und 1134, daneben aber ältere Aufzeichnungen über Geldgeschäfte mit der Stadt, die z. T. zwischen 1260 und 1270 fallen 206 ). Eine Übersicht und einen Einblick über und in Besitz, Einnahmen, Ausgaben, Wirtschaft und Betrieb des Hauses gewähren jedoch erst die Rechnungsbücher und das Manual. Das älteste Rechnungsbuch, das durch den sonst nicht wohlberufenen Sergeanten Büsch aus unsicherem Privatbesitz an Dr. Crull gekommen und von diesem wieder dem Ratsarchive zugestellt ist, haben wir gedruckt im Mecklenburgischen Urkundenbuche Nr. 8428. Die dafür in der Anmerkung ausgemittelte Datierung von 1357-1367 läßt sich noch um ein weniges näher bestimmen auf die Jahre 1359 bis 1367, und zwar wird die Rechnung eher an das letzte als an das erste Jahr hinanzurücken sein 207 ).
Das Manual besteht aus 111 Blatt Papier in Folio und enthält mit großen Lücken und bei sehr verschiedenartiger Buchung Ausgaben, Einnahmen und Abrechnungen von 1411 bis 1487. Auf Bl. 104 (zum J. 1429) ist auf ein anderes, verlorenes Buch verwiesen. Es heißt dort: desse anderen rekenschop (Abrechnung mit dem Müller Hans Kors) de sok an deme nygen boke.
Das 2. Rechnungsbuch, betitelt de utgift unde de upboringe des Hilgen Gestes, umfaßt auf 50 Blatt Pergament und 53 Blatt Papier in Quart die Jahre 1369 bis 1487. Der Titel trifft nur


|
Seite 195 |




|
auf den zweiten Teil (1484-1487) zu, während im ersten Verkaufe von Renten und Pfründen verzeichnet sind. Hinten auf dem Umschlage steht, noch eben lesbar: Dyt bock wort gehalt ut der Pegel schappe XI. Augusti anno etc. XXIIII.
Ein Heft von 14 Blatt Papier enthält eine genaue Zusammenstellung über das Soll der regelmäßigen Einnahmen und der Verpflichtungen des Heiligen Geistes von 1483 und ein Inventar von 1532, ein anderes von 2 Lagen von 16 und 12 Blättern verzeichnet die Pächte und Renten von 1486-1491.
Als Pachtbok ist ein Buch von 65 Blatt bezeichnet, das von 1487 bis 1493 reicht, in seinem größten Teil aber ähnlich dem Manual genaue Aufzeichnungen über die Ausgaben von 1491 bis 1493 enthält.
Das dritte Rechnungsbuch von 186 Seiten Papier in Quart bringt Einnahmen und Ausgaben der Jahre 1498 bis 1502.
Es folgen einzelne Rechnungen über die Jahre 1515, 1517 und 1518, 1520, 1522, 1524, 1526/7, 1530/1, 1533/4.
Eine Fortsetzung des ersten Teils des 2. Rechnungsbuches ist das 1486 angelegte Prövenbok in Folio. Es zählt 18 Blatt Pergament und 25 Blatt Papier und enthält, bis 1578 reichend, auch Einzeichnungen anderer Art.
Einnahmen sind im Manual von 1411, 1412, von 1424-1437, von 1439-1466, 1468, 1472 und von 1475-1477 angeschrieben, von 1484 bis 1487 im 2. Rechnungsbuche 208 ). Sie folgen aber nicht etwa fortlaufend auf einander, sondern wie in der Anmerkung angegeben ist. Zusammenrechnungen finden sich selten. Es waren für 1460 585 Mk. und 110 1/2 Mk. Ausstände, 1461 486 1/2 Mk., 1462 423 1/2 Mk., 1463 427 1/2 Mk., 1464 430 1/2 Mk., 1465 380 1/2 Mk. 1515 wurden 525 Mk. 5 Sch. 4 Pf. eingenommen, waren 264 Mk. rückständig, wurden 534 Mk. 14 1/2 Sch. ausgegeben und blieben 25 Mk. 6 Sch. geschuldet; 1516 370 Mk. 4 Sch. 10 Pf. eingenommen, 276 Mk. 1 Sch. rückständig, wurden 370 Mk. 10 Sch. 9 Pf. ausgegeben und blieben 103 Mk. 14 Sch. 10 Pf. geschuldet; 1517 554 Mk. 14 Sch. 4 Pf. eingenommen und 561 Mk. 1 Sch. 7 Pf. ausgegeben; 1518 385 Mk. 4 Pf. eingenommen, 59 Mk. 12 Sch. rückständig, wurden 381 Mk. 10 Sch. 6 Pf. ausgegeben und blieben 35 Mk. 8 Sch. geschuldet; 1533 351 Mk. 3 Sch. 7 Pf. eingenommen und 351 Mk. 8 Sch. 10 Pf. ausgegeben; 1534 369 Mk. 12 Sch. 9 Pf. eingenommen und 353 Mk. 5 Sch.


|
Seite 196 |




|
11 Pf. ausgegeben. Nachgerechnet hab ich nirgend und auch die acht unübersichtlichen Buchungen zusammengezählt. Es kann ja nur darauf ankommen, einen Eindruck zu gewinnen, und auch der bleibt unvollkommen, da meist die Kornhebungen fehlen. Zusammengesetzt sind die Einnahmen aus Geldhebungen und Renten aus Dörfern und Gütern, eignen und beliehenen, aus Pächten von Acker und Mühlen, Hausrenten, verkauftem Korn, Holz, Wolle, Vieh, Heu, dem Ertrag aus Verkauf von Pfründen, Vermächtnissen und Opfergaben, endlich dem Erlös von Nachlaßsachen.
Die Dörfer sollten an Pacht und Bede 209 ) erbringen,
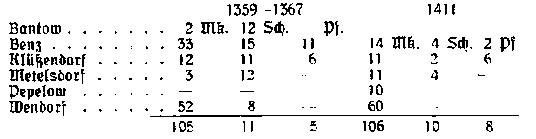
sie brachten

1483 wurden an Pacht, Bede und Rente von Gütern als Soll 450 Mk. 5 Sch. berechnet.
An Korn waren zu erwarten 1359-1367 aus
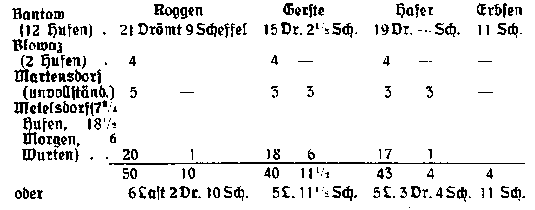


|
Seite 197 |




|
Es kamen ein 1411 aus

Es waren zu fordern 1475 aus
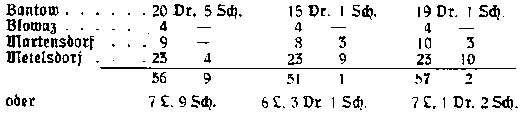
Es kamen ein 1499 aus
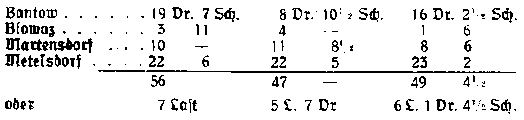
nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;1515
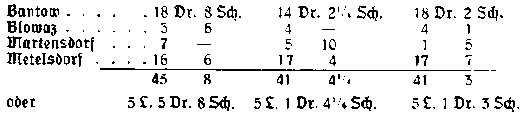
Die Höfe erbrachten 1474 1515

1483 sollten aus Dörfern und Höfen einkommen 9 L. 7 Dr. 8 1/2 Sch. R., 9 L. 3 Dr. 6 1/2 Sch. G., 10 L. 1 Dr. 3 Sch. H.
Verkauft wurden 1498 Weizen für 13 Mk., Korn für 25 Mk., Saatgerste für 3 1/2 Mk., Schweine für 10 Mk. 7 Sch., Wolle für 11 1/2 Sch., Holz für 1 1/2 Mk., insgesamt für 54 Mk. 2 1/2 Sch. 1515 6 Sch. Weizen für 1 Mk. 7 Sch., 4 Dr. Roggen für 9 Mk., 5 L. 7 Dr. Gerste für 74 Mk., Hopfen für 12 Mk., insgesamt für 96 Mk. 7 Sch.


|
Seite 198 |




|
Die Ausgaben liegen vor von 1411 und 1412, 1424-1439 im Manual, von 1484-1487 im 2. Rechnungsbuche, von 1492 und 1493 im Pachtbok, von 1499-1502 im 3. Rechnungsbuche 210 ).
Die Wirtschaft erforderte 1424 einen Meisterknecht, zwei Treiber, einen Jungen, einen Schweinekoch, einen Schweinehirten, einen Kuhhirten, drei Mägde, eine Kohlmagd und eine Siechenmagd. In der Ernte kamen ein Hocker, eine Binderin, ein Staker hinzu. Sonst wurden noch ein Höpfner beschäftigt und im Winter Drescher 211 ). Gottesgeld bei Mietung von Dienstboten treffen wir in den Rechnungen erst 1530 und 1531 212 ). Lohn ward zweimal im Jahre bezahlt: Sommerlohn und Winterlohn, nur sind diese Löhne ungenau angeschrieben, wohl weil sie unregelmäßig gezahlt wurden. Der Sommerlohn des Meisterknechts betrug 4 Mk., der der Treiber 3 Mk., der des Jungen 1 Mk. Eine Magd erhielt im Sommer 1 1/2 Mk., im Winter 1 Mk. 4 Sch., eine andere im Sommer und Winter zusammen 4 Mk. 2 Sch., die kleine Magd im Winter 1 Mk. Der Jahreslohn des Schweinekochs betrug 3 1/2 Mk. 1517 erhielt der Meisterknecht im Sommer 7 Mk., im Winter 4 Mk., der kleine Knecht im Sommer 6 1/2 Mk., im Winter 3 Mk., der große Treiber im Sommer 5 Mk., im Winter 3 Mk., der kleine Treiber im Sommer 4 1/2 Mk., im Winter 2 1/2 Mk., der Schweinekoch 213 ) im Sommer 4 Mk., die Köchin im Sommer 3 Mk., im Winter 1 1/2 Mk., die Molkenmagd 214 ) 215 ) dasselbe, die


|
Seite 199 |




|
Kleinmagd im Sommer 1 1/2 Mk., im Winter 12 Sch., die Siechenmagd im Winter 2 Mk. Etwas abweichende, teils höhere, teils niedrigere Löhne wurden 1518 gezahlt. Im 17. Jahrhundert treffen wir eine Küsterin im Langen Hause, die ich in Ermangelung einer besseren Stelle hier anführe. Ob die Ausgeberin im Langen Hause - 1676 starb eine solche namens Gertrud - der Köchin gleichgestellt werden kann, lasse ich dahingestellt. Wie weit die Dienstboten Anspruch auf Kleidung hatten, bleibt zweifelhaft. Ausgaben für solche finden sich nur ab und zu in den Rechnungen für Schuhe, Lein und Nählohn 216 ). Regelmäßig wurden in der Ernte Erntehandschuhe oder Bindehandschuhe angeschafft 217 ). Zu Weihnachten bekamen die Leute des Heiligen Geistes Opfergeld 218 ), zu Zeiten auch Badegeld 219 ).
Natürlich war der Bestand an festgelohnten Knechten und Mägden ebensowenig in den verschiedenen Zeiten gleich wie der zu gelegentlicher Arbeit Angenommenen. Am Ende des 15. Jahrhunderts taucht vor allem der Reitknecht (rideknecht) auf, zuerst 1483 bezeugt 220 ). Er wird die Aufgabe gehabt haben, die Dörfer zu bereiten, dort Bestellungen auszurichten und polizeiliche Funktionen auszuüben und war gewaffnet. 1501 erscheinen Reitknechte im Plural. Früher werden die reitenden Diener des Rates damit beauftragt worden sein, wie auch Büttel und Kohlenmesser


|
Seite 200 |




|
Diensten herangezogen wurden 221 ). Als Entgeld ward den Ratsdienern zu Fastnacht ein Schmaus bereitet 222 ). Um Weihnachten erhielten die Spielleute 2 1/2 Schillinge oder 2 Schillinge 223 ), der Mühlknecht zu Fastnacht einen Schilling stupelgelt 224 ).
Ein Häckselschneider (hackelssnyder, strosnyder, vodersliyder ) kommt 1499, 1515, 1517, 1518 vor. Ein Fischer erhält 1520 5 Mk. im Sommer, 1 1/2 Mk. im Winter, eine Kuhhirtin (koeherdessche) 1499 4 Sch. 225 ). Auch sonst begegnen Ausgaben für das Hüten der Kühe und namentlich der Schweine. Für Weidegeld (wydegelt) werden 1515 1 Mk., 1522 17 Schillinge ausgegeben. 1502 erhielt der Schweinehirt 8 Schillinge für Lohn unde vor wennenth, das Gewöhnen der Schweine an die Weide (wie auch für das Gewöhnen des Rindviehs bezahlt ward) 226 ). Ein Kleinknecht wird der klover gewesen sein, der 1433 1 Mk. 10 Sch. Sommerlohn erhielt und sonst noch 4 Mk., ein anderer (?) 6 Sch. für das Hüten der Schweine, dieser wird auch swyneklover benannt, woneben ein swyneknecht und ein swen vorkommt 227 ). In Nahrung
Danach wird schon damals die noch um 1870 bestehende Sitte gewesen sein, daß sich die Kinder Ruten (mit buntem Bande) banden, um damit Heißwecken einzutreiben (hetwecken her, hetwecken her!).


|
Seite 201 |




|
gesetzt ward auch ein Schweinschneider. Er hatte den Schweinen auch Glocken in die Ohren zu hängen und war außerdem Tierarzt und Kesselflicker 228 ).
Dem Betriebe entspricht das Inventar. Es waren Martini 1498 vorhanden 229 ): 2 sulveren bekere unde 12 sulveren lepele, 1 sulveren cruce, 2 myssinghes handvate, 5 grote handbekene, 2 myssinghes becken, 6 grote tynnen spisevate, [10] lutke tynnen spisevate efte kolschottelen, 4 lutke tynnen salzere, 1 groten grapen, dede bruket wert to den honren in Unser Leven Drowen dage nativitatis, 18 grapen in der koken, 4 lutke grapen in deme syttende, 2 grote ketelle unde 3 drivote, 1 lutke ketel, 6 bruwketele, 2 lutke hantkelle unde 2 rosten, 1 brantrode unde 2 [in] deme schorstene, noch 2 in deme backaven, 2 brathschapen unde 2 vurschapen, 4 brathspete, 4 grote stovekenkannen, 5 halleff stoveken kannen, 15 qwarter unde stope, 1 tynnen vlaske van enem halfstoveken, 2 myssinghes luchter, 2 molenspillen, 1 lutke unde 1 grothe, 8 1/2 dromet moltes, 5 last 2 dromet 9 schepel roggen, 3 dromet arweten, neuen haveren, 40 syde speckes, men nen kovlesk, 14 olde secke, nene nyge, 1 bunt louwendes, heden unde vlessen tosamende, 2 bedde unde 2 hovetpole, noch 1 olt hovetlaken, 4 cleyne knechtebedde unde noch 2 meghodebedde unde noch 1 bedde, dat heft de rideknecht, 6 par olde lakene, 7 olde stolkussen unde puste. 1m Jahre 1532 Apr. 9 wurden Hans Büsschow übergeben: 3 olde(n) sulveren lepele, dat ander sulverwerk steyt uth, 1 handfatl 1 kopperen panne under dem hantfate. 2 grote missinges becken, 7 tynnen vate, 6 tynnen kolschottelen, 4 tynnen falsere, 1 tynnen soltfat, 1 tynnen kouwschen, 4 klene becken, 1 henseschale, 23 grapen luttick unde grot myt deme alder grotesten grapen, 1 groten ketele myt 1 drivote, 3 lutke swarte ketel, noch 1 ferendelketel, 1 bruwpanne, 7 bruwketele, 2 rosten, 2 bratspete, 1 brantrode, 1 eren schapen, 2 kopperen vurschapen, 4 grote stoveken kannen


|
Seite 202 |




|
2 halfstoveken, 6 quarterstope, 1 planke als 1 wynkanne, 2 dicke korte planken, 1 apen stop, wen de buren to have denen, 1 tynnen flassche, 3 grote haneken vor de konventstanden, 1 tunnen botterfat, 1 moser, 39 side speckes, 3 1/2 smere, 42 metteworste kleyn unde groth, 51 spete koflessches unde swynflesskes, 1 ferendel botteren, by 50 punt rotschers unde nopsen tohope, 1 achtendel heringes, 3 tunnen bers, by 2 dromt mels, 1 scepel havergrutte, 1 1/2 scepel soltes, 1 1/2 scepel erweten, etlike garstgrutte by 2 scepeles, 6 dromet moltes, 2 1/2 dromet roggen myn 2 scepelen, 8 scepel haveren, 2 dromet hoppen, 13 moltsecke, 14 stucke garnes, heden unde flessen, 1 lispunt flasses myn, 1 marketpunt, etlike heden in ene tunnen gestoppet, 2 bedde up dem sittende myt eneme hovetpole, 4 knechtebedde myt 4 hovetpolen, 2 megedebedde myt 2 hovetpolen, 1 deckebedde, 1 swynkokbedde, 1 pol, 29 beddelaken kleyn unde grot, 1 ledderen bankpoel, 8 stolkussen, 2 megedehoyken, 5 tafellaken, 1 lank drellet tafellaken, 6 rullen, 1 schap in der koken, 1 schap in sittende, 1 kuntore in der dorntzen, 1 lange tafelle ym sittende, 3 exsen, 2 byle, 1 blatbyl, 3 1/2 par plochiseren, 1 wendehake, 2 borse, 1 iseren stangen. 3 seytzen, 2 erffetlee, 2 neviger, 1 grote sage, 1 koventesklocke, 1 missinges dorchslach, 3 wagen myt etlick selen unde thouwen, 20 hovet koquekes, 8 kalvere, 8 perde, 27 swyne luttyck unde groth.
Es entsprechen aber auch die Ausgaben für Anschaffungen oder Ausbesserungen. Zunächst für den Betrieb des Ackerbaues: für Wagen und Zubehör wie Räder (die stets paarweise gekauft wurden), Achsen, Schienen, Rungen, Bretter, Deichsel, Wiesbaum, Gestelle, Wagenteer, für Schleifen, Karren, Schiebkarren, Pflüge und Zubehör und Eggen, für Zäume, Halter, Sättel, Gürtel, Steigbügel 230 ), für Hacken, Spaten, Schaufeln und
( ... )


|
Seite 203 |




|
Sensen 231 ), für Kuhleuchten 232 ), für Hufbeschlag 233 ), für Scheffel 234 ) und für Schweinekessel 235 ). Dann für Äxte, Beile und andere Schmiede- und Schlosserarbeit 236 ). Grapen,
( ... )


|
Seite 204 |




|
Pfannen und Kessel scheinen nur ausgebessert zu sein, die Ergänzung dürfte aus den Nachlaßsachen der Pfründner stattgehabt haben. Angeschafft wurden dagegen Kellen, Hähne, Leuchter, Leuchten, Durchschläge und Zubehör 237 ). Viel ward der Böttcher in Nahrung gesetzt. Seine Arbeit war mannigfaltig: Tonnen, Fässer verschiedener Art, Kufen, Balgen, Kübel, Eimer usw. wurden gebraucht 238 ). 1534 wurden 4 Witten für
5 1/2 sch deme koppersmede vor de pannen to lappende; 1424: 10 sch. vor kethele to lappende (Man. Bl. 62), 1502: 3 1/2 sch. vor eynen gheteketel tho makende (3. Rechnungsb. S. 167), 6 sch. vor 2 grothe kethele tho makende (S. 167), 1531: 2 sch. dem ketelboter vor 2 ketel to beteren: 1430: 2 sch. vor 1 kelle (Manual Bl. 82), 1501: 2 sch. vor 1 kellen in de koken (3. Rechnungsbuch S. 124), 1533: 6 sch. 3 pen. vor 1 konporn waterkelle; 1411: 2 myssynghes hane, dar me mede dat beer tappet vor 7 sch. (Man. Bl. 17), 1501: 9 sch. vor luchther unde vor hanen tho betherende vor de sthanden (3. Rechnungsbuch S. 120); 1492: 1 sch. vor 1 luchten. 1533: 2 sch. vor 1 luchte to beteren; 1411: 2 themeze vor 5 sch. (Man. Bl. 13), 1432: 3 sch. vor 1 themes Hermen Bote (Bl. 88, B. war Schweineschneider und Kesselflicker), 1492: 7 wytte vor 1 dock tho eneme temese.


|
Seite 205 |




|
ein Krumbholt zu einer Bahre (bore) gezahlt. Die Becher der Rechnungen waren teils aus Holz, teils aus Silber 239 ). Ausgaben für Körbe habe ich nur selten bemerkt, dagegen regelmäßig für Besen. Eine Matte ward 1428 für 5 Witte erstanden. Der perseboem, für den 1428 3 Schillinge ausgegeben wurden, wird zu einer Ölpresse gehört haben, wie denn ab und an Leinsamen gekauft ward 240 ). Unverständlich dagegen ist mir: 5 sch. vor beer, dat drunken de brodere, do se de molen borden des avendes in der koken 241 ). Vier Krahnräder wurden 1424 in Zahlung gegeben 242 ). Verschiedenartiges Tauwerk hatte der Reifer zu liefern 243 ). Licht goß man selbst, sowohl für die Wirtschaft wie für kirchliche Zwecke. Zu Ostern und Weihnachten wurden Kerzen geweiht, und solche scheinen teilweise verkauft zu sein 244 ).
Ausgaben für Betten kommen nicht vor. Sie werden zur Genüge von den Pfründnern eingebracht und etwa nötige Federn in der Wirtschaft gewonnen sein. Doch ward 1522 ein Bettüberzug (beddesbure) für 4 Schillinge gekauft, öfter Leinwand, noch öfter aber ward Weblohn bezahlt. Aus dem von Tzye Vocken hinterlassenen Garn wurden 5 Laken weniger 2 Ellen gewebt, das Laken ward zu 12 Ellen gerechnet. Ausgaben für Bleichen treffen wir


|
Seite 206 |




|
in den Rechnungen von 1515 bis 1518 245 ). Andere Leinwand ward zu Säcken gekauft oder Garn dazu verwoben 246 ). Für das Schwärzen zweier Schürzentücher (schorteldoke) ward 1530 ein Schilling bezahlt.
Auch Tuch ward gekauft und zu Kleidungsstücken verarbeitet 247 ). Ebenso Felle oder Leder für Schuhzeug 248 ). Zwei Paar Lederhandschuhe (ladderhantschen) kosteten 1515 7 Witte.
~~~~~~~~~~
III. Der Besitz des Heiligen Geistes.
Aus milden Gaben, Vermächtnissen, dem Erlös von Pfründen und vielleicht auch von Leibrenten bildete sich in kurzem ein ansehnliches Vermögen. Nachzuweisen ist das im einzelnen nicht.


|
Seite 207 |




|
Nur von den Vermächtnissen läßt sich eine Vorstellung gewinnen. So schenkte 1261 der Ritter Johann von Werden 3 Mk. Rente aus der Münze des Herrn von Mecklenburg 249 ). Noch vorher oder um dieselbe Zeit vermachten ein Dietrich und seine Ehefrau Adelheid dem Heiligen Geiste die Hälfte ihres Vermögens, Ludolf, der Ehemann der Frau Wenede, sein Erbe, Gertrud, die Ehefrau Bruns, eine Bude, Hinrik Scheversten zwei Wurten, der Mühlknecht Konrad 1 Mk., wenn er von seiner Fahrt ins Heilige Land nicht zurückkehre 250 ). Etwa zehn Jahre später vermachten ihm Reineke 2 Mk., Alkil 3 Mk., Gert Mönnik 1 Mk., der Knecht Reineke 1 Mk., die Schwiegermutter Henneke Keligs 30 Mk., 1276 Hinrik von Grevesmühlen den Zehnten von 6 Hufen zu Nantrow 251 ), 1279 Abbo von Pöl 60 Mk. zur Verteilung, Jakob Tesseke eine Hebung von 18 Scheffeln Gerste aus 1 1/2 Hufen zu Pöl, 1280 Rikolf an der Grube 2 Mk., 1282 Gerbert von Warendorf eine jährliche Hebung von 10 Scheffeln Getreide aus 4 Hufen zu Hornstorf 252 ), dann bis 1300 Hinrik Lore von Borken einen Morgen Acker auf dem Dargezower Felde, Werner von Zütfen 1 Mk., der Bäcker Degenhard und seine Hausfrau die Hälfte ihres Nachlasses (mindestens 32 Mk.) 253 ), Walther Pornehagen aus Grevesmühlen 8 Schillinge, Wessel Wise 3 Mk. zum Bau, der Knochenhauer Hinrik Westfal 2 Schillinge, Gödeke von Swineborg aus Lübeck 10 Mk., der Grapengießer Hoger 2 Mk. zur Verteilung, Dethard 8 Schillinge, Hinrik von Homborch und der Goldschmid Eberhard je 4 Schillinge 254 ), Hinrik Swarte einen halben Morgen auf dem Dargezower Felde, Hinrik Lübekervare 8 Schillinge, Wikburg 1 Mk. und einen Grapen 255 ). Nach 1301 Johann Plote 8 Schillinge und 1313 Gert von Damhusen 4 1/2 Morgen Acker 256 ). Andere Vermächtnisse sind nur mittelbar bezeugt, indem der Verkauf von Grundstücken, die dem Heiligen Geiste durch Vermächtnis zugefallen waren, zu Stadtbuch einge-


|
Seite 208 |




|
tragen ist. Solcher ist keine ganz geringe Zahl zu verzeichnen 257 ). Von manch anderen Gaben wird keine Kunde auf uns gekommen sein, und nach dem Verluste fast aller Stadtbücher und mittelalterlichen Testamente wissen wir von den späteren Vermächtnissen äußerst wenig. Im Jahre 1318 vermachte der Ritter Helmold von Plessen ein Drittel aus dem Erlöse seines Hofes in der Papenstraße, 1322 der Ritter Ludolf Negendanke, der schon 1313 eine jährliche Hebung von 1 Last und 22 Scheffeln Hafer- und Gerstenmalz aus der Wotrenzmühle geschenkt hatte, 4 Mk. jährlicher Rente aus einem Erbe in der Stadt und Johann Ketelhot 250 Mark 258 ), 1327 die Priester Dietrich und Bernd eine Hebung von 15 Drömt Getreide aus Blowaz, 1357 oder vorher Hinrik Smid ein Haus zu Skanoer 259 ). Im 15. Jahrhundert geben die Bücher des Stiftes einige Auskunft. Die 5 Nobel von Tzye Vocke, für die 1411 11 Mk. 4 Sch. gelöst wurden, mögen zu deren Nachlaß gehört haben, und ob das Paternoster, das 24 Schillinge einbrachte, vermacht oder anheim gefallen ist, bleibt unsicher 260 ). Dagegen erhielt der Heilige Geist von 1447 bis 1449 aus vier Testamenten 60 Mk. und 1456 aus einem fünften 8 Mk. 261 ). 1479 gab der Pfründner Albert Hildebrand einen Hopfenhof gegen die Verpflichtung, einer Enkelin zu ihrer Aussteuer einen Mantel oder Zeug zu einem Rocke zu geben 262 ), eine Pfründnerin gab nach 1486 eine silberne Brosche mit dem Bedinge, daß ihr deren Wert im Falle von Not ersetzt würde 263 ). 1514 gab Willeke Solkow 5 Mk. und 1517 wurden zum Bau 13 Mk. 6 Schillinge gegeben 264 ).
An Leibrenten hatte der Heilige Geist um 1360 jährlich 277 1/2 Mk. zu zahlen und verkaufte von 1401 bis 1411 an solchen 190 Mk. für etwa 2050 Mk Kapital 265 ). Später scheinen Geschäfte dieser Art sehr zurückgegangen zu sein und sind die Eintragungen


|
Seite 209 |




|
äußerst mangelhaft. Möglicherweise hängt dieser Rückgang mit dem 1435 in der Bürgersprache erscheinenden Verbot zusammen, daß niemand sein Gut ohne Bewilligung des Rates um Leibgedinge verkaufen solle 266 ), wobei die Absicht mitgewirkt haben könnte, der Stadt vorzugsweise das so anzulegende Kapital zuzuwenden. Über die Pfründenverkäufe des 15. Jahrhunderts ist im 1. Kapitel berichtet.
Auch Pfandgeschäfte wurden gemacht, vermutlich doch um Gewinn zu erzielen. So schuldete der Schweriner Vogt Hinrik von Dramm im Dezember 1402 110 Mk., die er Michaelis 1403 erstatten sollte und wofür er als Sicherheit sulverpande gab. Vermutlich betrug das angeliehene Kapital 100 Mk. und stellten die 10 Mk. die Zinsen dar, was über das damals Übliche nicht hinausging. 1437 wurden Reymerschen [van Plessen] van den Brule 80 Mk. uppe sulverpande geliehen.
Nur diese Gaben und Vermächtnisse und das gegen Verkauf von Pfründen und Leibrenten eingekommene Kapital können den Ankauf von ländlichem Besitze und von Renten in dem Umfange ermöglicht haben, wie es urkundlich bezeugt vorliegt. Was noch an Kapital fehlte, verschaffte man sich durch Verkauf von Renten 267 ), während bei vorübergehendem Bedarf der Verwalter vorschoß oder hier und da kleine Anleihen machte 268 ).


|
Seite 210 |




|
Indem ich die Zeugnisse über den Erwerb von Grundbesitz durchmustere, scheide ich aus, was erkennbar zu rein gottesdienstlichen Zwecken dienen sollte.
Im Jahre 1253 verlieh Herr Johann von Meklenburg dem Heiligen Geiste das Eigentum an 2 Hufen zu Metelsdorf, die jener gekauft hatte, und 1318 sein Enkel, Herr Heinrich, das Eigentum über das ganze von Vicke von Stralendorf verkaufte Dorf, 1321 aber über den Hof, den Johann Rosendal von Plessen verkauft hatte und zu dem 1325 noch eine von Rambow abgetrennte Hufe (ebenfalls zu Eigentum) gelegt ward. 1333 wurden 3/4 Hufe und 4 Morgen gekauft 269 ). Zum Hofe gehörte der Teich oberhalb der Mühle zu Rotentor. Mit dem Dorfe ward das niedere Gericht bis zu 60 Schillingen Buße, von dem Gerichte über Hals und Hand aber ein Drittel verliehen, beim Hofe das ganze Gericht. Durch die Stiftung des Ratmanns Hinrik Rikwarstorp bekam der Heilige Geist noch eine jährliche Hebung von 16 Drömt Getreide, 4 Mk. Wend. und 20 Hühnern. Den Hof befreite Herzog Albrecht 1353 von Dienst und Bede. Im selben Jahr war eine Rente von 12 Mk. aus der Bede gekauft und 1389 ward die Bede des Dorfes in Pfandbesitz gebracht 270 ).
1263 kaufte der Heilige Geist von den Herrn von Mecklenburg ein Feldstück zwischen der Steffiner Mühle und der Scheide von Karow mit dem großen Sumpfe und erhielt 1326 von Herrn Heinrich die Bestätigung der von den von Barnekow erkauften Stauung auf dem Karower Felde, wofür die Bauern durch Land vom Hofe Steffin abgefunden wurden 271 ). Dieser Hof und die Mühle werden demnach zu der frühesten Ausstattung gehört haben. Urkunden darüber fehlen. 1353 verlieh Herzog Albrecht den Hof mit dem höchsten Gerichte und befreite ihn von Dienst und Bede 272 ).
Daß Hinrik von Grevesmühlen den Heiligen Geist 1276 mit dem Zehnten von 6 Hufen zu Nantrow bedachte, haben wir gesehen. Zwei Jahre später verlieh Bischof Herman von Schwerin das


|
Seite 211 |




|
Eigentum über 6 1/2 Hufen, die der Heilige Geist dort gekauft hatte, und 1279 verkaufte ihm noch Frau Anastasia 4 Hufen mit Eigentum 273 ). Der Besitz ist auf unbekannte Weise vor 1535 verloren gegangen.
Wann der Hof Martensdorf in den Besitz des Heiligen Geistes gekommen ist, wissen wir nicht. Er ward 1280, nicht zum erstenmal, verpachtet. 1290 ward das Eigentum über 4 1/2 Hufen zu Martensdorf erworben, die der Ritter Hinrik von Stralendorf samt dem Gerichte im Dorfe bis zu 24 Schillingen außer über 3 Hufen verkauft hatte, wogegen wiederum 4 Hufen zu Hornstorf abgetreten wurden, die durch ein Vermächtnis erworben waren. 5 weitere Hufen wurden z. T. nach 1323, z. T. 1368 durch Kauf gewonnen. 1353 verlieh Herzog Albrecht den Hof mit der höchsten Gerichtsbarkeit und befreite ihn von Dienst und Bede. Die Bede aus dem Dorfe ward dem Heiligen Geiste 1389 verpfändet 274 ).
Einen Hof dicht vor den Toren der Stadt, genauer vor der Windpforte, besaß er 1295. Er wird 1339 zuletzt genannt 275 ).
Die Güter des Heiligen Geistes befreite der Landesherr 1325 von Bede und Ablager und bestätigte ihm die Freiheit aller seiner Güter außerhalb und in der Stadt 276 ).
Die Mühle zur Klus, oder, wie sie früher hieß, zur Wotrenze, woraus, wie schon erwähnt, Ritter Ludolf Negendanke 1313 eine jährliche Hebung von 1 Last und 22 Scheffeln Hafer- und Gerstenmalz geschenkt hatte, kaufte der Heilige Geist 1345 von dem Priester Werner Lewezow gegen Leibrente. Sie ward 1351 wieder verkauft, muß aber zurückerworben sein, da sie 1458 nochmals veräußert ward 277 ). An Renten, die darin stehen geblieben oder zum geringeren Teile 1462 hinzugekauft waren und die jährlich 25 Mk. betrugen, erlitt der Heilige Geist später beträchtliche Verluste. In den Jahren 1483, 1488, 1533 und 1538 mußten Rückstände erlassen oder Herabsetzung der Rente bewilligt werden. Wieviel die 1483 festgelegte Befreiung vom Mahlzwange wert gewesen sein mag, ist nicht abzuschätzen. Die Pacht hatte um 1360 21 Mk. und 1 Last und die 1313 geschenkte Malzhebung betragen 278 ).


|
Seite 212 |




|
Der 1324 erworbene Hof Kl.-Ziphusen ward 1342 gegen Hof und Dorf Klüßendorf mit der niederen Gerichtsbarkeit und einem Drittel der höchsten verkauft, 1353 aber verlieh Herzog Albrecht den Hof mit der höchsten Gerichtsbarkeit und befreite ihn von Dienst und Bede 279 ).
Benz ward 1339 mit allem Gericht, Bede und Dienst für 500 Mk. formell an Rat und Stadt verkauft und ihnen bestätigt. Der Platz aber, den die Urkunden darüber im Privilegienbuche einnehmen, beweist, daß das Dorf schon bei Anlegung dieses Buches, also vor 1343, dem Heiligen Geiste gehörte. Für die Jahre 1354 und 1360 wird das durch andere Urkunden direkt bestätigt 280 ).
Mittel-Wendorf (Everkestorp) kaufte der Heilige Geist 1348 für 600 Mk. von der Witwe Riken Westfals zu Lübeck 281 ).
Bantow ging 1351 durch Kauf von Thimme von Gutow für 720 Mk. als Eigentum und mit der niederen Gerichtsbarkeit in den Besitz des Hauses über, Herzog Albrecht aber verzichtete auf die hohe Gerichtsbarkeit und allen Dienst, Abgaben und Bede 282 ).
Zessin, das der Heilige Geist 1383 kaufte, hat er, wahrscheinlich 1385, an die Stadt abgetreten 283 ).
Ob der Hof Mecklenburg, der nach einer Urkunde von 1399 von ihm verpachtet ward 284 ), wirklich im Besitz des Heiligen Geistes gewesen, ist mir sehr zweifelhaft. Ich kann mich dem Verdachte nicht entziehen, daß Mekelenborghe für Metenstorpe verschrieben ist, denn für diesen Hof vermißt man einen Pachtvertrag aus jener Zeit, während 1398 und 1399 solche wegen Steffins, Martensdorfs und Klüßendorfs abgeschlossen sind.
Damit ist die Reihe der mittelalterlichen Erwerbungen von ländlichem Besitze abgeschlossen.
Rüggow, das bis 1713 den Geistlichen Hebungen von St. Marien gehört hatte, damals aber von diesen hatte verkauft werden müssen, um Geld für das schwedische Militär flüssig zu machen, kaufte der Heilige Geist am 29. Juli 1743.
1752 Juni 23 ward Preensberg mit einer Bauernstelle zu Kartlow für den Heiligen Geist gekauft.
Bantow ward in einem Vergleiche über die Renten und Pächte der Wismarschen Geistlichen Hebungen aus dem Mecklenburgischen abgetreten und dafür Hinter-Wendorf, damals noch ein Dorf mit


|
Seite 213 |




|
3 Bauernstellen, Pachthof seit 1794, eingetauscht. Die Verträge sind von 1756 Nov. 13 und 1757 März 10 datiert. Hierbei wurden auch die Pächte aus Metelsdorf und dem Dorfe Martensdorf aufgegeben. Es war nämlich der nach den Urkunden erworbene Besitz dieser Dörfer im Laufe der Jahrhunderte auf die seit 1609 in Geld statt bis dahin in Korn erlegten Pachterträge 285 ) daraus eingeschwunden, wogegen die fürstlichen Beamten vermöge der ständig erhöhten Dienste nach 1475 die Herren geworden waren. Auf gleiche Weise war der Georgenkirche Saunstorf, den geistlichen Hebungen von St. Marien Düvelsers entfremdet worden. Undurchsichtig ist, wo der dienstfreie Hof Metelsdorf, der 1368 oder, wenn meine Vermutung wegen des angeblichen Hofes Mecklenburg das Richtige trifft, 1399 zuletzt vorkommt, abgeblieben ist, und wie es gekommen ist, daß der Heilige Geist das Dorf Klüßendorf hat festhalten können. Es müssen, obgleich eine Entfreiung nicht beurkundet ist, von den dortigen Bauern keine Dienste für die Landesherrschaft erfordert sein, wogegen solche für den Heiligen Geist 1533 bezeugt sind. Die auf ursprünglich Metelsdorfer Gebiet angelegte Mühle, die vielleicht schon 1324, sicher seit 1331 bezeugt ist, gehörte dem Heiligen Geiste sicher bis 1429 286 ). Schon 1329 war eine Walkmühle 287 ) damit verbunden, die wir später im Besitze der Stadt finden und neben der oder an deren Stelle im 17. Jahrhundert die Papiermühle angelegt ward.
Weder die alte noch die neue Steffiner Mühle - die Mühlen zu Rotentor und zu Viereggenhof - scheint der Heilige Geist je besessen zu haben. Dagegen besaß er kürzere Zeit hindurch zwei Windmühlen, eine vor dem Mecklenburger, die andere vor dem Lübschen Tore, diese eine Gabe der Hofmeister Johann Kröger und Johann Schacht. Beide wurden um die Mitte des 14. Jahrhunderts veräußert. Bald jedoch muß das bei letzterer vorbehaltene Vorkaufsrecht ausgeübt sein, da die aus den sechziger Jahren stammende Rechnung 31 Mk. Pacht daraus anführt 288 ). Dieselbe Pacht


|
Seite 214 |




|
kam noch 1415 auf, 1451 aber brachte die Mühle nur noch 10 Mk. ein und 1489 ward allein der Mühlenhof durch Verpachtung genutzt 289 ). Für die Ruten 290 ) und die Mühlsteine hatte der Eigentümer zu sorgen, wogegen der Pächter für Abnutzung der Steine zahlte. Sie wurden 1429 von Hamburg bezogen 291 ).
1485 konnte der Heilige Geist drei Fischteiche verpachten 292 ). Genannt werden 1523 der Steffiner Teich, 1534 der walkedyk. Die Fischerei auf dem Teiche der Mühle zum Rotentor (Rodemole) ward 1414 gegenüber Ansprüchen des Klawes Zurow dem Heiligen Geiste vom Lübecker Rate zugesprochen 293 ). Es ist dabei merkwürdig, daß Mühle und Mühlenteich keine Einheit zu bilden scheinen. Der Steffiner Teich ist der der Karower Mühle (später Grönings-Mühle). Erwerbungen in bezug auf ihn gehören zu den frühesten, von denen wir Kunde haben (aus den Jahren 1263 und 1326). 1487 war Streit um das auf und an ihm wachsende Rohr und Holz, do ward deme gadeshuse des hillighen Ghestes toghevunden allent, wat men myt deme dyke kan bestouwen 294 ). Nach der Rechnung von 1670 gehörte auch der Teich der Steffiner (Viereggen-) Mühle damals dem Heiligen Geiste. Ein Soll gegenüber St. Jakobs heuerte dessen Vorsteher vom Heiligen Geiste 1530 um 4 Schillinge jährlich 295 ). Zu Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. hielt der Heilige Geist sich einen eignen Fischer und ließ durch ihn fischen. Vielfältig sind die Anschaffungen von Netzen (Stocknetzen, Schlingnetzen, Heringnetzen), Körben (Garnkörben und Rutenkörben), Waden und Flügeln samt Zubehör und die Ausgaben für den Kahn, schließlich auch für das Ziehen der Wade 296 ).
( ... )


|
Seite 215 |




|
Der Umfang des Ackerbesitzes des Heiligen Geistes auf dem Stadtfelde läßt sich für die mittelalterliche Zeit weder bestimmen noch auch nur schätzen. Wir wissen allein von Vermächtnissen, namentlich von Ackerstücken auf dem Dargezower Felde, weshalb auf den Anfang dieses Kapitels verwiesen sein mag. Als Entgelt für eine Siechenpfründe ward 1501 ein Morgen zwischen dem Kronskamp und der Landwehr gegeben 297 ). Fünf Posten von Ausgaben van ackere, die im Gesamtbetrage von 30 Mk. und 14 Sch. im Jahre 1411 unter den Renten gebucht sind, vermag ich nicht zu deuten. 1502 bezog der Heilige Geist aus Acker bei der Hornstorfer Burg 9 Mk. Pacht, 1563 teilte er seine Wiese vor dem Lübschen Tore beim Rennbaum in 6 Gärten ein und gab sie in Erbpacht weg 298 ). Um den Wulfsbrok war 1546 Streit, da auch ein Müller (welcher ?) Ansprüche darauf erhob. Von seiten des Hofmeisters ward behauptet, dieser Wulfsbrok sei früher eyn moerbrock und wyetbram gewesen, wovon der damalige Verwalter wohl 60 Fuder habe hauen und auf den Mühlenhof bringen lassen, um das Fuder für 2 bis 4 Sch. zu verkaufen. Hernach sei dort Erlenholz gewachsen. Es handelt sich um den Wulfsbrok hinter Damhusen.
Auch darüber ist keine Klarheit zu gewinnen, was der Heilige Geist an Häusern oder Buden in der Stadt besessen hat, zumal dieser Besitz sehr veränderlich gewesen sein wird. Was ihm an


|
Seite 216 |




|
solchem in der ältesten Zeit aus Vermächtnissen zukam, mußte gemäß Stadtrecht verkauft werden. Dafür sind uns manche Beispiele begegnet. Nachher mag nicht so strenge darauf gehalten sein 299 ), vor allem wird er aber im 15. Jahrhundert beim Niedergange der Stadt gleich den anderen Kirchen Hausgrundstücke haben übernehmen müssen, um nicht seine Renten zu verlieren 300 ). 1451 bezog er Miete aus drei Häusern, und aus Buden beim Scheunhofe (an der Neustadt oder auf der Heide) 301 ). Diese Buden hatte er noch ein halbes Jahr später, ebenso auch das Haus an der Speicherstraße, andere aber beim Lübschen und beim Pöler Tore, außerdem Buden an der Hahnreistraße. Der Mietsertrag war unbedeutend, 1451 17 1/2 Mk. im Jahr, ein wenig größer um 1500. 1529 ward ein Haus in der Altwismar-Straße um 46 Mk. an Hinrik Timm und seine Hausfrau auf Lebenszeit verkauft, 1545 eine wüste Wurt an der Hahnreistraße veräußert. Ein Haus, aus dem St. Nikolai 5 Mk. Rente zu fordern hatte, wollte der Heilige Geist 1489 preisgeben, doch vermittelten die Bürgermeister, daß er es behielt und St. Nikolai sich mit 3 Mk. Rente begnügte, die um 60 Mk. sollten abgelöst werden können 302 ).
Zu einem Hause am Lübschen Tor ward 1486 Anteil an einem Sode gekauft 303 ).
Schoß für diesen Grundbesitz habe ich nur 1437, 1438 und 1502 angeschrieben gefunden 304 ). Eine Erklärung dafür weiß ich nicht. Sie würde leichter auszudenken sein, wenn niemals Schoß gebucht wäre. Auf den Wachstafeln 305 ) kommt der Heilige Geist mit butenschot nicht vor.
Von den Renten, die der Heilige Geist an sich kaufte, würden wir aus den erhaltenen Urkunden oder den Rechnungen kein zutreffendes Bild gewinnen können, da von jenen die in früherer


|
Seite 217 |




|
Zeit abgelösten zurückgegeben sind, diese aber ungenügende Auskunft geben. Ein um das Jahr 1470 angelegter Urkundenkopiar erlaubt aber wenigstens für diese Zeit festzustellen, was das Stift an Renten aus Gütern oder Dörfern zu fordern hatte. Es waren jährlich 376 Mk. 4 Schillinge. Erworben sind sie in den Jahren von 1397 bis 1464. Dabei ist es allerdings nicht verständlich, weshalb drei Urkunden 306 ) über 80 Mk. Rente, die ich mitgerechnet habe, in dem Kopiar übergangen und erst in Nachträgen berücksichtigt sind. Nach der Rechnung von 1451 kamen damals nur 209 Mk. ein, während die angeführten Güter und Dörfer nach den Verschreibungen 260 Mk. hätten erbringen und nach Ausweis des Kopiars gar 362 Mk. 4 Sch. hätten einkommen müssen. Hauptschuldner waren die von Stralendorf, von Plessen und vom Lo. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurden die Rückstände immer größer und in wiederholten Verträgen mußte im 16. Jahrhundert immer mehr von den Forderungen nachgelassen werden. Allerdings waren die Hauptposten bis 1422 zu 10 v. H. und die spätern Renten zu 8, 7, 6 v. H. erstanden worden. In der Stadt hatte der Heilige Geist um 1360 1400 Mk. mit rund 84 Mk. Rente, 1411 aber 1600 Mk. Kapital ausstehn 307 ). Die noch bestehenden mittelalterlichen Renten aus dem Mecklenburgischen Domanium wurden 1757 beim Austausche von Bantow abgelöst, 1435 aus Scharfstorf erworbene 1857.
Als am 16. Januar 1832 die Vereinigung der Geistlichen Hebungen vollzogen ward, besaß der Heilige Geist an Landgütern Hinter-Wendorf, Martensdorf, Steffin, Klüßendorf, Rüggow und Preensberg, an Dörfern Benz, Klüßendorf, Mittel-Wendorf und eine Stelle zu Kartlow sowie Viereggenhof. Die Pachterträge daraus machten 7054 Taler N 2/3, also in Markwährung 24689 Mk. aus. An Acker auf der städtischen Feldmark hatte er 75 1/2 Morgen und 2 Last, die 317 Taler N 2/3 oder 1109,50 Mk. einbrachten, an alten Renten aus Scharfstorf, Westenbrügge, Vorwerk und Niendorf bezog er jährlich 19 Taler 34 Sch. N 2/3 oder 69,25 Mk. An zinsbaren Kapitalien standen außerdem aus 15450 Taler N 2/3 oder 54075 Mk., an rückständigen Zinsen bei der Akzisekammer 11 900 Taler N 2/3 oder 41650 Mk., wogegen 48177 1/2 Taler N 2/3 oder 168621,25 Mk. geschuldet wurden. Aus dem Verkaufe


|
Seite 218 |




|
der Güter und Dörfer zu Erbpachtrecht wurden in den Jahren 1832 bis 1846, wo dieser Verkauf restlos durchgeführt war, 105306 Taler 12 Sch. N2/3 oder 358571,83 Mk. gelöst. Der jetzt daraus aufkommende jährliche Kanon beträgt 41140,33 Mk.
Von zwei Höfen wissen wir, daß sie am Ende des 13. und am Anfange des 14. Jahrhunderts durch Hofmeister bewirtschaftet wurden. Es ward nämlich, als Johann Rugensee 1308 sich eine Pfründe kaufte, ihm zugesichert, daß er, so lange er sich in Steffin als Hofmeister gut führe, dort seinen Lebensunterhalt haben solle. Unter ähnlichen Bedingungen nahm der Rat 1295 für den vor der Windpforte belegenen Hof einen Hofmeister an. Dieser brachte 12 Mk. in die Wirtschaft ein, sollte aber abziehen, wenn er seine Schuldigkeit nicht täte, und dann nur 6 Mk. zurückerhalten. Im andern Falle ward ihm für sein Alter Aufnahme in das Haus zum Heiligen Geiste und eine Pfründe zugesichert 308 ).
Mit diesen beiden Ausnahmen wurden die Höfe schon während des Mittelalters und bis zu ihrer Vererbpachtung verpachtet. Nach den mittelalterlichen Verträgen ward keine feste Pacht vereinbart, sondern der Verpächter am Ertrage der Ernte beteiligt. Er gab auch einen Teil der Aussaat her und hatte einen Teil des Viehs zu stellen, wogegen ihm wiederum auch davon Nutzen zufloß. Solcher Verträge über die Höfe Kl.-Ziphusen, Metelsdorf, Steffin, Martensdorf, Klüßendorf, Mecklenburg (?) sind im kleinen Stadtbuche von 1328 bis 1399 nicht weniger als 29 erhalten und es würden ihrer noch mehr sein, wenn nicht jetzt zwischen 1375 und 1393 eine breite Lücke klaffte; 17 davon sind im Mecklenburgischen Urkundenbuche gedruckt. Voran geht ein Vertrag über Martensdorf vom Jahre 1280 309 ), es folgen sechs aus den Jahren 1406 bis 1424 über Steffin und Martensdorf im zweiten Rechnungsbuche und einige aus dem 16. Jahrhundert von 1528 bis 1568 über Klüßendorf, Martensdorf und Steffin im Prövenboke.
Die Pachtdauer betrug meist 4, selten 3 oder 6 Jahre 310 ). Der Verpächter bedang sich die dritte Garbe vom Ertrage zu Kl.-Ziphusen (1328), Martensdorf (1332, 1338, 1347, 1366), Steffin (1338), Klüßendorf (1350) oder zu Metelsdorf die vierte (1328, 1338, 1347, 1363, 1368), im letzten Jahre zwei Garben von dreien zu Kl.-Ziphusen (1328), Martensdorf (1332 von der Sommersaat, 1347, 1366) und Klüßendorf (1350 von der Sommersaat), drei Garben von vier von der Sommersaat zu Metelsdorf (1328, 1347, 1363, 1368). Um 1483 Scheint man aus Martensdorf und Klüßen-


|
Seite 219 |




|
dorf auf feste Erträge gerechnet zu haben, nämlich 10 Drömt Roggen, 9 Drömt Gerste, 1 Last Hafer aus dem einen und je 1 Last Roggen, Gerste und Hafer aus dem andern. Für Steffin wurden, je nachdem der Meier baue, je 6-8 Drömt Roggen, Gerste und Hafer angesetzt. Die letzte Einsaat des Pächters hatte der zu entsprechen, die er vorgefunden hatte, und ebenso die Menge des Korns, womit er abziehen konnte, der von ihm eingebrachten.
Pferde, Rinder und Schafe gehörten je zur Hälfte dem Pächter und dem Verpächter 311 ). Demnach kauften 1412 der Heilige Geist und der Meier zusammen ein Pferd um 6 Mk., wovon jeder die Hälfte zahlte 312 ). Von den Schweinen sollte der Pächter bei seinem Abzuge den dritten Teil zurücklassen. Aus Martensdorf erhielt der Heilige Geist Michaelis 1489 5 Schweine und eine alte Kuh, 1490 1 junch bulleken, 1 yunch osseken, 6 Schweine und 1 Schaf, aus Steffin Michaelis 1490 eine alte Kuh, 6 Schweine und 8 Lämmer, während bei der Teilung in der Kreuzwoche jeder Teil 8 Lämmer und 10 junge und 20 alte Schafe erhielt 313 ).
Windschaden an Gebäuden hatte nach dem Vertrage von 1338 über Martensdorf, Metelsdorf und Steffin und dem von 1347 über Martensdorf der Pächter herzustellen 314 ); nach denen von 1347, 1363 und 1368 über den Hof Metelsdorf 315 ) sollte der Pächter Dächer und Zäune bessern helfen; nach denen von 1398, 1415, 1423 und 1424 über Steffin und Martensdorf Zäune und Lehmwände bessern, während die Sorge für das Hakelwerk ihm nur in dem ersten Vertrage zugewiesen ward, in den andern dem Verpächter 316 ). Über die von den Pächtern ausgeführten Bauten fehlt es natürlich an Nachweisungen, wogegen die Rechnungen vielfältig von der Bautätigkeit des Heiligen Geistes zeugen. Zu


|
Seite 220 |




|
Steffin ward 1424 ein Wagenschauer gebaut, 1425 und 1492 ein Ofen gesetzt, zu Martensdorf 1427 die Milchkammer verputzt, 1428 und 1429 Gebäude gedeckt und ein Baugerüst aufgeschlagen, 1493 ein größerer Bau aufgeführt, 1534 an einer Scheune gebaut, in Klüßendorf 1515 ein Tor gebaut und 1517 ein Ofen aufgeführt, 1533 ein Viehstall ausgebessert 317 ).
( ... )


|
Seite 221 |




|
Für Brandschäden durch Schuld des Pächters sollte er aufkommen gemäß Verträgen über Martensdorf von 1347, 1366, 1424, Metelsdorf 1363 und 1368, Steffin 1398, 1406, 1415, 1423, Klüßendorf 1399, dagegen sollte von Landes wegen, von der Herren wegen oder von Krieges wegen verursachten Schaden der Heilige Geist tragen (Steffin 1415 und 1423).
Die Verträge aus dem Ende des 14. und dem Anfange des 15. Jahrhunderts (im zweiten Rechnungsbuche) enthalten nur Bestimmungen über Brandschaden, Zäune usw., nicht aber über die Pacht. Gleichartig den älteren sind die von 1528 über Klüßendorf und von 1533 über Steffin, ausführlicher sind sie über das Inventar. Der Klüßendorfer Pächter sollte vom Sommerkorn die vierte, vom Winterkorn die dritte Garbe, der Steffiner durchweg die dritte Garbe geben; bei Schlachtungen sollte von Rindern die Hälfte, von Schweinen ein Drittel abgegeben werden. Es wurden sehr viel Pferde, weniger Kühe gehalten, zu Klüßendorf 28 Pferde und 20 Kühe, zu Steffin 24 Pferde und 24 Kühe. Ob die 60 Schafe, die die fürstlichen Jagdhunde 1529 zu Steffin totbissen, dem Heiligen Geiste oder dem Pächter gehörten oder beiden, ist nicht gesagt 318 ). Der Pächter von Steffin Martin Karow ward 1533 als erblicher Pächter angenommen, es wurden aber die Pachtleistungen im Laufe der Jahre stark herabgesetzt, denn als 1568 ein Sohn den Hof übernahm, brauchte dieser wie bisher nur noch den Zehnten vom Korn und den dritten Scheffel von den Erbsen abzuliefern. Der ältere Vertrag über Klüßendorf enthält nichts über seine Dauer. Gerke Dikman übernahm aber 1562 den Hof für seine Lebenszeit mit der Aussicht, daß ein Sohn an seine Stelle treten würde. Für Martensdorf wurden die Leistungen noch 1562 auf die dritte Garbe von Stroh und Korn festgesetzt, und es sollte jährlich ein fertiger, d. h. schlachtreifer, Ochse oder eine fertige unfruchtbare Kuh, von den geschlachteten Schweinen aber ein Drittel abgeliefert werden. Auch dieser Vertrag war ein Erbpachtvertrag.
Dienste erscheinen zuerst in den Verträgen von 1562 über Klüßendorf und von 1568 über Steffin. Der Pächter von Klüßendorf sollte, wenn angesagt, der Stadt und dem Heiligen Geiste mit


|
Seite 222 |




|
Pferden und Wagen gleich wie die von Martensdorf und Steffin dienen, der von Steffin dem Heiligen Geiste und der Stadt. Im Anfange des 17. Jahrhunderts wurden die Höfe für feste Geldpächte ausgetan, die für Steffin 1602, Martensdorf 1603, Klüßendorf 1608 zuerst gezahlt wurden. Ob bis dahin der Heilige Geist noch immer an dem Ertrage der Ernte beteiligt, oder ob feste Kornpächte vereinbart gewesen, ergeben die Rechnungen nicht.
Zu gewisser Zeit wurden die Pächter bewirtet. So hatte der Hofmeister 1412 die Meier zu Pfingstmontag zu Tische 319 ). Im 16. Jahrhundert hatten sie mindestens zum Teil ihre Freiheit eingebüßt. Es wird das damit in Zusammenhang stehen, daß sie Erbpächter wurden. Sie bedurften zu Heiraten der Einwilligung der Vorsteher 320 ).
Die Einkünfte aus den Dörfern bestanden aus Pacht, Bede und Gefällen, der Gerichtsbarkeit, die Pacht aus Kornpacht oder Geldpacht 321 ), wie es die Zusammenstellungen im zweiten Kapitel zeigen. Bede und Geldpacht sind aber in den Rechnungen z. T. zusammengeflossen. Wenn die Bauern ihre Pacht brachten, wurden sie mindestens seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts bewirtet oder ihnen eine Vergütung in Geld zuteil, vielleicht um sie zu pünktlicher Ableferung anzuspornen 322 ). Außer zu Pacht und Bede waren sie zu Diensten verpflichtet, über die aus älterer Zeit nur spärliche Angaben vorliegen und die sicher bis ins 16. Jahrhundert sehr erträglich waren. Hernach ward das anders. Welche


|
Seite 223 |




|
außerordentliche Ausdehnung und welche Bedeutung sie erlangten, zeigt ein zwischen 1627 und 1645 abgefaßtes Schriftstück über die Erträgnisse des Grundbesitzes des Heiligen Geistes, wozu bemerkt werden mag, daß gleiche oder sogar darüber hinausgehende Dienste auch sonst im Lande Mecklenburg verlangt wurden 323 ) 324 ). Danach mußten die Benzer Bauern wöchentlich 3 Tage mit Pferden dienen und einen vierten Tag Handdienst leisten, die Käter aber 4 Tage Handdienste tun. Diese Dienste wurden damals für zwei Jahre um 400 Mk., für sechs weitere Jahre um 500 Mk. jährlich vermietet. Zunächst sollten aber, weil das Dorf unter den vielfältigen Truppendurchzügen sehr gelitten hatte, den Bauern wöchentlich 1 Tag Pferdedienst und den Kätern 1 Tag Handdienst für zwei Jahre erlassen und für diese beiden den andern vorangehenden Jahren die Dienste nur mit 300 Mk. bezahlt werden. Dabei blieb "die Ernte mit einer Seißen und dazu gehörigem Volke nach Lante Gebrauch". Später mußten die Benzer nach Preensberg dienen und seit 1754 waren ihnen, wie den Klüßendorfer Bauern seit 1724, Pacht und Dienste erlassen, weil sie zu Hofe dienen mußten. Wesentlich besser als die Benzer waren um die gleiche Zeit die Bantower Bauern gestellt. Diese brauchten nur 12 Tage im Jahre mit Wagen und Pflügen zu dienen und 6 Tage Handdienst zu tun, allerdings auf dem Wismarschen Stadtfelde. Sie hatten sich zu dem Zwecke abends in Wismar einzufinden und konnten des anderen Abends mit Toresschluß wieder abfahren. Während der Ernte hatten sie jeder mit einer Sense zu dienen, bis das Korn gemäht war, und auch zu binden, zum Einfahren aber je zwei einen Wagen zu stellen. Daneben blieben der Stadt die üblichen Fuhrleistungen. Sie werden nicht übermäßig gewesen sein. Es war üblich, die Dienenden durch Speise oder Trank zu erquicken. Das zeigt besonders deutlich eine Erzählung Lambert Slaggerts aus dem Kloster Ribnitz, wo 1526 die Bauern von Klockenhagen revoltierten, als durch ein Versehen nicht dafür gesorgt war 325 ). Ebenso wurden die Träger und die Fischer für Dienstleistungen für Wismar im 16. und 17. Jahrhundert mit Bier, Brot, Hering und Speck traktiert 326 ), und in einer Auskunft über die Verwaltung des Heiligen Geistes von 1599 heißt es: auch werden allewegen,


|
Seite 224 |




|
wan die pauren zue hoffe dienen, dieselben gespeiset 327 ). Nur aus den Ausgaben, die solche Gegenleistungen verursachten, erfahren wir aus älterer Zeit etwas von den Diensten der Bauern. So 1412 März 21: do gas ik ut 5 1/2 sch. vor vyssche thu markede, do hadde de hilghe Ghest de bur van den Wentorp thu denste 328 ). 1492: 8 sch. tho markede in sunte Micheles daghen, done de Wenttorper hyr weren, unde den armen luden uppe dat hus unde byr in de koken 329 ); 1531 1 sch. vor wegge, don de Wentorper to holte weren; 1533: 2 sch. vor herink, do de Wentorper plogeden; 1534: 4 witte vor ber, don ick de Wentorper hadde ym holte to Bentze. 1526: 3 sch. vor bere den Benseren, don se plogeden. 1533 Mai 6 weren de Klutzendorper up deme acker tegen sunte Jacob unde worpen mesß 330 ). Wahrscheinlich beziehen sich auch Eintragungen von 1493 auf Dienst: tho haveren tho ploghende 2 tunnen bers, 1 t bers tho der brakeltydt, tho strekende 1 t bers 331 ). Noch bis zuletzt mußten die Wendorfer Bauern dem Heiligen Geiste das Holz anfahren und bekamen dafür Bier, seit 1790 ein Trinkgeld.
Für die Stadt geleistete Dienste sind 1411 bezeugt: do wy den mes van deme markede voren, do gaf ik den arbeydesluden 4 schillinge 332 ). Die Dienste der Bantower Bauern sind vorher erwähnt.
Die Hofwehr gehörte im 19. Jahrhundert einzig den Wendorfer Bauern selbst, die deshalb bei der Vererbpachtung ihrer Stellen kein Erbstandgeld zu zahlen brauchten. Dem dürfte die abgebrannten Bauern gewährte Hilfeleistung entsprechen: Woltere thu Banttecowe, dede vorbrant was, 5 Mk., dat hete my de vormundere (1412) 333 ).
Zeugnisse über die Gerichtsbarkeit sind nicht ganz selten. 1411 schuldete Hinrik Cok zu Metelsdorf 1 tunne brokebers 334 ). 1414 Dez. 22 verwillkürte sich der junge Hinr. Kartlow von deme syttende rychte, nicht zu schaden also wyde, alse des hilghen Ghestes bede is 335 ). 1486 Jan. 28 strafte der Hofmeister Wendorfer Bauern für Blut und Blau um je 12 Schillinge, erließ ihnen aber einen Teil davon. Bei der Verhandlung wurden 5 Kannen Bier getrunken. Am 27. April desselben Jahres stiftete er zu Benz nach


|
Seite 225 |




|
einer Schlägerei einen Vertrag und zog Buße ein 336 ). 1530 ward Martin Karow zu Wendorf nach einer Schlägerei verurteilt, Hans Koppelman 17 Schillinge zu geben, den Arzt zu bezahlen und das Gericht zu befriedigen 337 ). 1531 hielt der Hofmeister Jan. 27 einen Gerichtstag mit den Bauern 338 ). Wegen einer Schlägerei mußte Drewes Greve zu Wendorf an Matthias Kale daselbst 1533 6 Mk., 3 Pfund Butter und für einen Schilling Brot geben, ohne daß einer Buße an den Heiligen Geist gedacht wird 339 ). Im gleichen Jahr kam Heine Berendes aus Klüßendorf ins Gefängnis (yn des hilligen Gestes slote) wegen unnützer Worte gegen die Vorsteher und den Schulzen zu Klüßendorf, "szo dat de sulve Heyne nicht sick wolde stillen ofte raden laten", und schwur am Tage darauf Urfehde 340 ). Ein untreuer Hirt der Bantower Bauern leistete 1533 Urfehde, nachdem er aus des Heiligen Geistes Gefängnis (slote) entlassen war 341 ). In demselben Jahr führt die Rechnung dreimal 3 Mk. brokegeld auf, einmal van der slachtinge to Bantkow. Trotz wiederholten Verbots hatte Hans Barner zu Bantow mit den andern Bauern um halb und halb gesät und ohne Erlaubnis seine Tochter aus des Heiligen Geistes Gute verheiratet. Ihm ward in dem durch den Verweser mit den Bauern gehaltenen Gerichte das Urteil gefunden, daß er zweimal 60 Mk. Lubisch geben solle. Da er sich in späteren Verhandlungen über die Herabsetzung der Buße widerspenstig benahm, ward er in de slothe gesetzt, ihm aber nach weiteren Verhandlungen 1535 die Buße auf 4 Gulden ermäßigt. Er mußte Urfehde schwören 342 ). 1556 ward Klawes Gerstenmeiger zu Bantow, der seine Frau weggejagt hatte, gefänglich eingezogen und genötigt, sie wieder aufzunehmen, sowie an den Heiligen Geist Buße zu zahlen und Urfehde zu leisten 343 ). Endlich mußte 1563 Hans Hosank zu Benz, der trotz Friedegebots den Sohn eines Nachbarn verwundet hatte und deshalb in Verhaft genommen war, Urfehde schwören 344 ).
Weiter verfolge ich diese Zeugnisse nicht. Nach Vereinigung der Geistlichen Hebungen trat an Stelle der Gerichtshaltung der einzelnen ein gemeinsames Hebungsgericht, bis dem die Neuord-


|
Seite 226 |




|
nung von 1879 auch ein Ende machte, gleich wie der städtischen Gerichtsbarkeit.
Als Ausfluß der Gerichtsbarkeit kann die Mitwirkung der Vorsteher des Heiligen Geistes bei Erbschichtungen, Abteilungen und ähnlichen Verträgen angesehen werden. 1413 ließ sich der Heilige Geist Schadloshaltung geloben van alleme schaden, den dat ghodeshus des hilghen Ghestes nemen mochte van der erfschychtynghe weghen, dede Hinrik Gherlych, meyger to der Stevyne, dede synes wyves kynderen Ghesen, de dar dot is . . . . Desse vorscrevenen stucke synt deghedynghet unde ghelovet vor deme zyttende rychte an deme hilghen Gheste to der Wismer vor de kokene . . . . 1413 Sept. 26 345 ).
Die älteste Aufzeichnung über die Abfindung eines Bauernsohns haben wir aus dem Jahre 1348 aus Martensdorf. Der Abgefundene erklärte sich in Wismar vor dem Richter und den Bauern für befriedigt, und der Vertrag sollte so giltig sein, wie wenn er zu Martensdorf vereinbart wäre 346 ). - In dem Erbe Gottfrieds zu Metelsdorf behielten im Jahre 1354 eine Schwester seines Vaters 20 Mk. Lüb. und drei Halbgeschwister 24 Mk., wogegen jene bis zur Aufkündigung des Verhältnisses, diese bis zu Erreichung ihrer Jahre und der Auszahlung ihres Anteils von dem Bauern unterhalten werden sollten 347 ). In Wendorf behielt 1409 die Mutter Köpke Sniders 150 Mk. in seinem Erbe und blieb bei ihm wohnen 348 ). Ebenda trat 1473 Peter Klutzendorp sein Erbe an einen gleichnamigen Sohn gegen 300 Mk. ab. Seine Schwester sollte der junge Bauer mit 50 Mk. und einem Paar Kleider vom besten Tuche aussteuern 349 ). - In Benz schuldete 1521 Klawes Bolte an Hinr. Helmes und dessen Schwestersohn Hinr. Holst 31 1/2 Mk. aus seinem Erbe, die er allmählich abtragen sollte 350 ). - 1524 kaufte Hans Lowe den Gläubigern seines Vaters dessen Erbe zu Mittel-Wendorf um 250 Mk. ab 351 ). - 1536 fand Hans Koppelman [zu Klüßendorf] seinem Stiefvater Hans Lubbeke mit 33 Mk. ab, wovon 3 Mk. für ein Bett gerechnet wurden 352 ). - 1540 ward Hans Louwen frouwe mit 15 Mk. Lüb., der Hälfte des


|
Seite 227 |




|
Flachses und Leins und zwei Schweinen uth deme erve [zu Wendorf] ghedelet. Hovetman des erves: Hinr. Louwe 353 ). - Zu Klüßendorf wollte Hans Karow den auf ihn vererbten Katen 1541 nicht länger behalten und trat ihn unter Einverständnis zweier anderer Brüder an seinen Bruder Martin um 19 Gulden ab 354 ). - Ebendort fand 1553 Hans Koppelman seinen Stiefvater Joachim Brüsehaver um 10Mk. von seinem Katen ab, hatte aber außerdem 24 Mk., die jener verdient hatte, in Teilzahlungen von jährlich 2 Mk. an ihn zu entrichten 355 ). - Zu Bantow wurden 1554 dem Sohne Karl Garstenmeygers namens Vicke 20 Mk. und das beste Pferd (das um 11 Mk. verkauft ward) von dem Erbe ausgesprochen; heiratete er, so sollte er daraus zur Hochzeit 1 Tonne Fleisch, 4 Scheffel Roggen und 6 Tonnen Bier haben. Wenn seine Mutter wieder heiratete, so sollte sie ihn 12 Jahre lang mit Nahrung, Kleidung und Schuhwerk versorgen 356 ). - Hans Barner zu Bantow überließ 1555 sein Erbe seinem gleichnamigen Sohn und fand seine andern beiden Söhne mit 24 Mk. ab 357 ). Zu Wendorf gab 1558 die Witwe des Klawes Grise der Schwester ihres Mannes aus Freundschaft 15 Mk. aus dem Erbe und fand damit sie und ihre Söhne ab 358 ). - Zu Benz erhielten 1563 die Gebrüder Dassow statt des oft geforderten Brautschatzes ihrer Mutter im Betrage von 15 Mk. von Achim Otto im Wege des Vertrags 7 1/2 Mk. 359 ).
Unverständlich ist eine Aufzeichnung von 1427 über den Verkauf eines Erbes zu Wendorf an Hans Kruse. Die "andern" zwei Kinder des früheren Bauern wurden mit 5 Mk. abgefunden 360 ).
Als Vicke Sander 1519 aus Bantow abzog, schuldete er dem Heiligen Geiste 4 Mk. und je 4 Drömt Roggen, Gerste und Hafer, was er in 5 Jahren abtragen sollte. Er zahlte aber noch 1534 5 Mk. 361 ).
Nicht klar, obgleich umständlich genug, sind die Bedingungen, unter denen Arnd Sander 1528 sein Erbe zu Bantow an Hans Swakebeen abstand. Als Kaufpreis werden 150 Mk. genannt, wo-


|
Seite 228 |




|
gegen er und seine Hausfrau ihren Unterhalt und jährlich 2 Gulden von der Stelle haben sollten 362 ).
1533 kaufte Görries Rolant vom Heiligen Geiste ein von Gruttemaker abgestandenes Erbe [zu Bantow] von 40 Mk. Lüb., die er in 13 Jahren abtragen sollte. Er erhielt für 3 Jahre Pachterlaß und Nachlaß von einem Gulden an der jährlichen Rente von 50 Mk., die in dem Erbe standen. Für die ihm gegebenen 2 1/2 Drömt Saatroggen sollte er in den drei freien Jahren jährlich 6 Scheffel Roggen geben 363 ).
Die Bauern konnten im 14. und 15. Jahrhundert mit Bewilligung der Vorsteher des Heiligen Geistes - eine Bewilligung, die teils ausdrücklich ausgesprochen ist, teils darin begriffen liegt, daß die Verträge in Bücher des Hauses eingetragen sind oder die Vorsteher Hilfe durch Pfändung verheißen - aus ihren Erben Renten oder Leibrenten verkaufen. Aus späterer Zeit sind keine Beispiele dafür vorhanden, aus jenen Jahrhunderten aber ziemlich zahlreiche. Der Zinsfuß war nicht höher als bei Verkauf von Renten durch die Grundherrschaft, 1352 verpfändete Johann Hartwig zu Mittel-Wendorf sein Gut dort für 10 Mk., die er mit 1 Mk. zu verrenten verhieß 364 ). 1354 verpflichtete sich ein Bauer zu Benz, dem Heiligen Geiste eine Schuld von 10 Mk. mit jährlich 1 Mk. zu verrenten, wofür er seine beiden Hufen verpfändete und Pfändungsrecht zugestand 365 ). Im selben Jahr übernahm Gödeke, der Sohn des Nikolaus zu Metelsdorf, eine Schuld von 15 Mk., in die sein Vater gegenüber dem Heiligen Geiste geraten war, und versprach sie wie jener mit 24 Schillingen zu verrenten 366 ). 1356 verkaufte ein Bauer zu Mittel-Wendorf für 10 Mk. eine Rente von 1 Mk., die im Falle der Nichtzahlung die Vorsteher des Hei-


|
Seite 229 |




|
ligen Geistes für den Rentner auspfänden sollten 367 ). 1357 verpfändete Nikolaus von Proseken zu Mittel-Wendorf sein dortiges Gut der Siechenmagd des Heiligen Geistes für 8 Mk., wofür er 13 Schillinge Rente zahlen wollte 368 ). Bauern aus Metelsdorf verkauften 1402 2 Mk. Rente für 15 Mk., 1440 3 Mk. für 50 Mk., 1462 3 1/2 Mk. für 50 Mk., 1475 1 Mk. für 10 Mk. 369 ); aus Mittel-Wendorf 1422, 1423, 1425 und 1427 4 Mk. für 50 Mk., 1422 5 Mk. für 60 Mk., 1424 6 Mk. für 100 Mk., 1466 5 Mk. für 100 Mk., 1511 2 1/2 Mk. für 50 Mk., dazu 1419 eine Leibrente von 10 Mk. für 100 Mk 370 ). Daß dabei die Pacht des Heiligen Geistes immer voranging, versteht sich von selbst, ist aber ausdrücklich bei Rentenverkäufen von 1422 und 1425 bezeugt. Es sollte aber auch eine Schuld des Bauern von 30 Mk. an sines sones kint vorgehen und der kyndere pleghe vor de 30 Mk. 371 ). Zu Bantow wurden viermal je 4 Mk. Rente für 50 Mk. verkauft vor 1434, zwischen 1442 und 1445, 1449 und 1483 372 ). Zu Klüßendorf verkaufte 1437 ein Käter für 20 Mk. 2 Mk. Leibrente auf vier Augen 373 ), endlich zu Martensdorf 1446 ein Bauer 2 Mk. Rente, deren Preis nicht angegeben ist 374 ).
Es ist vorher bemerkt worden, daß der Ackerbesitz des Heiligen Geistes während des Mittelalters nicht abzuschätzen und daß die Ausgaben von 1411 für Acker nicht zu deuten seien. Wahrscheinlich handelte es sich um Ackerpacht. 104 1/2 Mk., die 1437 für Acker ausgegeben wurden 375 ), werden Kaufgeld gewesen sein, zumal da in diesem und dem folgenden Jahre Schoß für Acker bei Damhusen gezahlt ward. Unklar sind Ausgaben, die von 1424 bis 1438 mit Ausnahme der Jahre 1430 und 1431 vor de lote oder vor lote gebucht sind, und zwar 1424 bis 1429 9 Mk., von 1432 bis 1438 aber 3 Mk., als deren Empfänger 1428 die Kämmerer, 1429 aber die Herren angegeben werden. Es müssen wohl städtische Ackerlose gewesen sein, aber einen rechten Vers kann ich mir nicht daraus


|
Seite 230 |




|
machen, um so weniger, als Acker bei St. Jakobs, wo nach einer Stelle 376 ) die Lose lagen, vierzig Jahre später, wo wir über die Sache genauer unterrichtet sind, nicht zum Lottacker gehörte 377 ). Später war der bei St. Jakobs von der Stadt erworbene Acker, das kleine Stadtfeld und das Krukower Feld, Morgenacker. Da zudem nicht glaublich ist, daß bei der Verlosung so viel Stücke auf den Heiligen Geist gefallen sein sollten, daß er 9 Mark als Lottgulden dafür zu entrichten hatte, so wird die Zahlung als Pacht anzusehen sein. Ackerpacht ward auch noch nach den Rechnungen von 1515-1518 und von 1533 gezahlt, und zwar 3 Mk. 2 Sch., 4 Mk. 10 Sch., 3 Mk. 14 Sch., 3 1/2 Mk. Nur an der letzten Stelle ist der Verpächter (her Jacob Stytint) und die Lage des Ackers (uv deme Hogenvelde by deme Rodendore) angegeben. Der untreue Hofmeister Martin Borchart mußte 1559 alles Korn "von dem vor sich sulvest thogehureden acker und lothen . . ., mit deß gadeßhußes perden ingearnet, geploget und geworven", herausgeben und sich verpflichten, diesen Acker hinfort für den Heiligen Geist zu bewirtschaften.
Auch eine Wiese war gepachtet. Es wurden nämlich für das Jahr 1428 den Kämmerern 12 Mk. vor lote unde vor wisch gezahlt 378 ). In späteren Jahren wurden ein oder zwei Ratmannen, vielleicht die Kämmerer, wahrscheinlich aber diejenigen, denen sie als Wiesenlos zugefallen war, als Empfänger der Pacht genannt. Die Pacht betrug 1424, 1425 und 1427 3 Mk., 1429 3 1/2 Mk. Die Wiese lag vor dem Lübschen Tore und war noch 1587 in Pacht des Heiligen Geistes 379 ). Vielleicht ist es dieselbe, von der es 1411 heißt: kofte (d. h. pachtete) ik ene hoyghwis vor 3 Mk. van deme molre thu der Koppernisse 380 ).
Die Ackerwirtschaft beschränkte sich darauf nicht, sondern es war auch die Aufgabe, Anteil an der Ernte der Höfe selbst einzubringen. Das ergibt sich klipp und klar aus den älteren Rechnungen 381 ). Sonst begegnen außer dem, was wir an Ausgaben für


|
Seite 231 |




|
das Gesinde und für Ackergerät angetroffen haben, noch Ausgaben für Saatkorn und Mist 382 ). Andere Ausgaben für die Ernte sind in der vorangehenden Anmerkung mitgesammelt. Endlich noch einige Worte über den Hopfenbau. Im 16. Jahrhundert hatte der Heilige Geist zwei Hopfenhöfe, einen großen und einen kleinen. Es begegnen Ausgaben für das Graben, das Düngen, das Anschärfen der Hopfenstangen, ihr Aufstecken, das Anbinden und Beschneiden des Hopfens, das Abnehmen und das Pflücken und das Sammeln der Stangen. Die Ranken wurden geschnitten und verfüttert 383 ). Übrigens ward schon 1420 für das Hauen der hoppenstaken gezahlt. Die wichtigsten Arbeiten besorgten berufsmäßige Hopfengärtner (hoppenere), z. T. in verdungener Arbeit. Ausgaben für den Hopfenbau treffen wir zuletzt in der Rechnung von 1558. Über die Ausdehnung des Hopfenbaus bei Wismar ist zu vergleichen Hans. Geschichtsblätter 1915 S. 264-266, 316-318.
~~~~~~~~~~
( ... )


|
Seite 232 |




|
IV. Die kirchlichen Verhältnisse des Hauses zum Heiligen Geiste.
Im Jahre 1255 beschenkten auf Bitten der Ratmannen Bischof Friedrich von Ratzeburg und Herr Johann von Mecklenburg, der erste als Diözesan, der andere offenbar als Kirchenpatron, das Haus des Heiligen Geistes mit Kirchhof und Begräbnis unter den dazugehörigen gottesdienstlichen Verrichtungen, so daß ohne Benachteiligung der angrenzenden und das Haus begreifenden Pfarren nur vor den Ohren der Kranken die Sakramente verwaltet werden könnten. Es sollte sich aber kein Priester damit befassen, der nicht mit bischöflicher Zulassung und Genehmhaltung der Ratmannen kanonisch eingesetzt wäre 384 ). Diese gottesdienstlichen Verrichtungen sind bald erweitert worden, und vierzehn Jahre später genehmigten wiederum in gemeinsamer Urkunde Bischof und Landesherr unter Zustimmung der Pfarrer von St. Marien und St. Georgen die tägliche Abhaltung von Gottesdienst und Verwaltung aller Sakramente für die Kranken außer der Taufe und übertrugen den Ratmannen die Einsetzung des


|
Seite 233 |




|
Priesters 385 ). Im folgenden Jahre nahm der Landesherr bei Übertragung der Georgenkirche an den Schwertorden den Heiligen Geist ausdrücklich vom Kirchspiel jener Kirche aus 386 ). Demgemäß ging auch nach einer Aufzeichnung von 1319 von den Opfern des Heiligen Geistes nichts nach St. Georgen 387 ).
Obgleich die Warendorpsche, vom Pfarrer zu versehende Messe schon 1282 und eine tägliche Messe für das Seelenheil Heinrichs von der Weser 1300 bestand und 1307 Bischof Herman von Ratzeburg den Rat ermächtigt hatte, eine Vikarei in den Heiligen Geist zu verlegen, muß es um diese Zeit doch zweifelhaft gewesen sein, ob sich die Begründung einer Vikarei dort durchsetzen ließe. Es bestimmte nämlich Gerd Tribbezees zwischen 1308 und 1316, daß eine von ihm geplante Messe in St. Georgen gesungen werden solle, wenn sie dort nicht gefeiert werden könne. 1326 erlaubte dann Bischof Markwart unter Einwilligung des Pfarrers von St. Georgen, daß in der Kirche des Heiligen Geistes täglich zwei und bei einem Begräbnis drei Messen gehalten werden dürften 388 ). Die Zahl der Meßstiftungen ist bald darüber hinausgegangen. Davon das Nähere unten.
Im Jahre 1323 nahm Papst Johann XXII. den Heiligen Geist in den Schutz des apostolischen Stuhls und bestätigte ihm, wie die von Bischof Ulrich von Ratzeburg verliehenen Rechte im besonderen, so auch alle seine Freiheiten und Rechte im allgemeinen, und 1331 gestand der Ratzeburger Bischof Markwart bei seinem Vertrage mit dem Rate auch dem Heiligen Geiste zu, daß er bei seinen beweislichen Rechten und Freiheiten verbleiben und wie von alters den bischöflichen Zehnten in gedroschenem Korn ohne Stiegen seitens des Bischofs geben solle 389 ).
Um weitere Gnaden des päpstlichen Stuhles bemühte man sich 1388. Damals schrieb der Wismarsche Bevollmächtigte Jakob Repest, er glaube, es sei für den Heiligen Geist zu erlangen, daß bei geschlossenen Türen den Insassen des Hauses das Venerabile gezeigt werden dürfe 390 ), versteht sich, in Fällen des Interdikts.


|
Seite 234 |




|
Daraus ist entweder doch nichts geworden, oder die Urkunde darüber ist verloren gegangen. Dagegen erlangte die ganze Stadt 1398 das Privileg, daß trotz Anwesenheit von Gebannten und Interdizierten öffentlicher Gottesdienst gehalten, und 1400, daß ein Interdikt in der Stadt nur auf besondern päpstlichen Befehl verkündet werden dürfe.
Über den Bau der Kirche selbst fehlt es an Nachrichten und das Gebäude ist im ganzen so einfach, daß sich ihm wenig ablesen läßt. Es wird im großen Ganzen dem 14. Jahrhundert zugeschrieben werden müssen. Wegen des Näheren sei auf Schlie, Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin 2, S. 157-160, verwiesen. Welches die neue Kapelle ist, zu deren Bau wie zu Glasfenstern der Kirche Werner Liskow 1371 200 Mk. gab, ist nicht festzustellen. Gleichzeitig gab er für die Decke der Kirche 70 Mk. Diese Decke ward 1687 und 1688 erneuert und mit der noch jetzt bestehenden, aber durch Verlegung einzelner Bretter zerrissenen Bemalung versehen 391 ). Die acht schweren Pfeiler an der Südseite der Kirche sind ihr 1577 vorgelegt und 1665 ihren Giebeln die jetzige Form gegeben. Infolge der Explosion der Pulvertürme von 1699 "mußte die Kirche bis auf das Mauerwerk heruntergenommen werden", wie die in den Knopf des neuen Dachreiters gelegte Urkunde vom 10. Oktober 1700 berichtet 392 ). In den Jahren 1691 und 1737 ward die Kirche ausgemalt, doch waren diese Malereien später übertüncht worden. Um das Jahr 1900 hat der Rentner C. W. Hermes die Tünche abkratzen und das Innere in ursprünglichem Rohbau herstellen lassen. Derselbe hat auch die alten Prozessionsleuchter der Träger und den jüngeren der Schmiede erneuern lassen und gute Kronleuchter und Leuchter gestiftet. Somit hat bis in die neueste Zeit Freigebigkeit von Bürgern für die Kirche gesorgt.
Anderseits ist ihr Bestehen in den letzten 100 Jahren mehrmals bedroht gewesen. Im Jahre 1828 fragte der Großherzogliche Kommissar Freiherr von Nettelbladt, ob es nicht überhaupt angemessen gefunden werden mögte, die Einleitung zur Säkularisierung und zum Abbruch der Kirche (die seit der Französischen Zeit noch immer als Exerzierhaus benutzt ward) zu machen. Der rein aus Ersparungsrücksichten eingegebene Gedanke ward ernsthaft verfolgt, und der Ausschuß war dafür, wie man ja auch zwölf Jahre früher die Kirche der Grauen Mönche niedergelegt hatte. Doch


|




|



|




|


|
Seite 235 |




|
kam man zum Glück davon zurück und ebenso von dem 1900 in den einflußreichsten Kreisen erörterten Gedanken an Stelle der Kirche ein Schulhaus zu errichten. Denn so schmucklos und einfach sie auch ist, so ist sie doch im Straßenbilde nicht wohl zu entbehren.
Der Hochaltar ward am 12. Oktober 1326 von Bischof Markwart von Ratzeburg zu Ehren der Apostel Bartholomaeus und Matthaeus und des Evangelisten Markus geweiht, doch sollte die Weihe am Sonntage vor Allerheiligen gefeiert werden 393 ). Die Weihe des Kirchhofs folgte am 2. Juli 1329 mit der Bestimmung, daß die Kirchweihe am Sonntag vor Pfingsten begangen werden sollte 394 ). Begangen ward sie im Jahre 1412 am Sonntage Judica 395 ). Der Hochaltar ward 1563 auf Betreiben des Superintendenten mit dem von St. Marien ausgetauscht. Nach Schröder war die Tafel 1493 angefertigt worden. Sie ist unterdessen verloren gegangen, während der jetzt in der Kirche des Heiligen Geistes stehende Altar unter seinen auf vorgezogener Leinwand gemalten Bildern noch Reste des Ende 1356 fertig gewordenen Altarschreins von St. Marien birgt 396 ).
Ein Organist ist zuerst 1411 bezeugt, also muß die Kirche schon damals eine Orgel gehabt haben. Später finden sich mehrfach Ausgaben dafür. Im 17. Jahrhundert war zeitweise keine (betriebsfähige?) Orgel vorhanden 1669 aber doch ein Organist 397 ).
( ... )


|
Seite 236 |




|
Ein Taufstein fehlt und ist in katholischer Zeit gewiß nicht angeschafft gewesen. Später wird sich der taufende Pastor mit einem Becken beholfen haben. Denn mindestens seit Beginn des 17. Jahrhunderts, wahrscheinlich aber schon früher in der evangelischen Zeit ist in der Kirche auch getauft worden.
Die erhaltene Glocke ist von 1473 398 ). Es war nicht die erste, die die Kirche besaß, da 1436 14 Mk. 2 Sch. to der beterynghe der klokken ausgegeben wurden 399 ).
Die Ausstattung mit Silbergerät wird nie entfernt so reich gewesen sein wie die der drei Pfarrkirchen, darf aber doch nicht gering angeschlagen werden. Im Jahre 1535 wurden zu den Bedürfnissen der Stadt u. a. 3 Monstrantien, 2 Kelche mit Patenen, 2 Ampullen, 1 Becher, 1 Ölbüchse, 1 Weihrauchfaß, 1 Pacem (peßecruce), im ganzen 131/3 Pfund Silber eingezogen, und nochmals mußte die Schatzkammer 1576 über 9 Pfund an vergoldetem oder weißem Silber hergeben, wie damals auch die Meßgewänder und das golddurchwirkte Bahrtuch veräußert wurden 400 ). Die erhaltenen Inventare sind mangelhaft, und die beiden im Predigerbuche S. 241 verzeichneten vergoldeten Kelche (der eine aus Silber, der andere aus Kupfer) gehörten nach St. Jakobs. Durch Schenkungen aus dem 17. Jahrhundert wuchs der Bestand wieder an, 1653 verehrten Zacharias Schnor und seine Ehefrau Eva Drews 401 ) einen vergoldeten Kelch, zu einem neuen von Peter Jost 1664 angefertigten hatte Hans Hadler 22 Taler gegeben, 1671 schickte der Rat einen vergoldeten Kelch, der im Rathause gefunden war. So konnten 1676 sieben Kelche verzeichnet werden 402 ), von denen je zwei nach St. Jakobs und nach dem Schwarzen Kloster gehörten. Ein silbernes vergoldetes Kännchen schenkte noch 1672 Dorothea Ditz 403 ). Im übrigen führt das Inventar von


|
Seite 237 |




|
1676 noch außer den zu den Kelchen gehörenden Patenen an 1 messingenes Taufbecken, 1 zinnerne Flasche, 1 zinnerne Gießkanne, 8 zinnerne Leuchter (von denen drei dem Schwarzen Kloster gehörten), 3 Altarlaken und 5 Meßgewänder. Das 1832 aufgenommene Inventar zählt an Silbergerät 6 Kelche (wovon ein kupfervergoldeter), 1 Becher, 1 Kanne und 1 Fläschchen auf, indem es offenbar die nach St. Jakobs gehörigen Kelche mit begreift, während es die beiden dem Schwarzen Kloster zuständigen Kelche getrennt aufführt.
Der Pfarrer wird in der ältesten Zeit nicht als solcher, sondern einfach als Priester und noch 1340 als mit der Seelsorge für die Kranken betrauter erster Vikar genannt, als welchem ihm damals Dietrich Mummendorp jährlich zu Gründonnerstag 6 Semmel aussetzte, während er den übrigen Vikaren deren je 2 zuwies 404 ). Als erster Kirchherr (wie man primus rector doch wird übersetzen müssen) wird er um 1360 in der viel benutzten Rechnung genannt. Er erhielt damals wie später jährlich 10 Mark 405 ). Hinzu kamen jedenfalls Naturalleistungen, jedoch kennen wir ihren Umfang nicht. Namen lassen sich aus dem Mittelalter nur wenige beibringen. Dietrich Hamme ist der älteste (1474 bis 1486, freilich nirgend geradezu als Pfarrer bezeichnet). Ihm folgte der 1487 bezeugte Nikolaus Krowel, danach Ludolf Westfal (1500 bis 1514) und Erasmus Vedderman (1523).
Auch nach der Reformation behielt der Rat das Recht, den Pfarrer vorzuschlagen, und gewann das einer Berufung. Als sich nach Überwindung der Übergangszeit feste Verhältnisse herausgebildet hatten, war der Gang folgender. Es wurden in der Regel zwei Kandidaten zu einer Gastpredigt in St. Marien, danach zu einer Probepredigt in St. Georgen 406 ) aufgefordert und dann vom Rate zur Wahl gestellt. Bei der Wahl hatte der Rat eine Stimme, die andere die Gemeinden von St. Georgen, dem Heiligen


|
Seite 238 |




|
Geiste, St. Jakobs und dem Schwarzen Kloster 407 ). War keine Einigkeit, so entschied das Los. Danach ward das geistliche Ministerium gefragt, ob es Einwendungen zu machen habe. Wo nicht, so ward das Bestallungsschreiben ausgestellt und erfolgten nach einer vierstündigen Prüfung oder Unterredung 408 ), für die das geistliche Ministerium zuständig war, die Ordination durch den Superintendenten und die Einweisung an Altar, Taufe und Kanzel durch den Kirchenpatron, in die Wedem durch die Provisoren und ward die Bestallung ausgefertigt 409 ). In der schwedischen Zeit ging die Einweisung in die Kirche an den Superintendenten über, indem der Tribunalspräsident sie 1659 als bischöfliches Recht beanspruchte und die Ausübung bei Gelegenheit der Ordination dem Superintendenten übertrug. Als schon 1621 einmal der Superintendent mit der Ordination die Anweisung an die Kanzel verbunden hatte, hatten die Bürgermeister dagegen protestiert 410 ). Noch 1578 war das Verfahren ein viel einfacheres gewesen, indem der Rat nach einer in St. Marien gehaltenen Probepredigt das geistliche Ministerium und die Gemeinde nach Einwendungen fragte und danach berief, also ohne Wahl. Man hatte damals noch Scheu, jemand einem öffentlichen Durchfall auszusetzen.
Zu predigen hatte der Pfarrer sonntäglich in der Kirche des Heiligen Geistes, dazu alle vierzehn Tage in der zu St. Jakobs (bis zur Zerstörung dieser Kirche 1631) und alle Sonnabende seit 1594 in der des Schwarzen Klosters 411 ). Die Predigtstunden lagen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts morgens Uhr 6, im Anfang des 17. Uhr 7, seit 1753 Uhr 8 412 ). Während in den übrigen Kirchen noch im Jahre 1700 vor der Predigt eine Stunde lang gesungen ward, begnügte man sich im Heiligen Geiste mit halbstündigem Gesange 413 ).
In den Jahren, wo nach dem Sturze des Turmes für die Gemeinde von St. Nikolai in der Graumönchenkirche Gottesdienst gehalten ward (1703-1707), war anstatt dieser die Kirche des Heiligen Geistes Garnisonkirche 414 ).


|
Seite 239 |




|
Der Umfang der Gemeinde war gering. Im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts hatte der Pastor aus dem Heiligen Geist höchstens 45, aus St. Jakobs 35, aus dem Schwarzen Kloster 30 Kommunikanten, in den achtziger Jahren desselben Jahrhunderts nie über 100 insgesamt 415 ).
Dem beschaulichen Leben, das die Pastoren demgemäß führen konnten, und angeborener Neigung von Waak (Wacenius), Springinsgut und Dietrich Schröder danken wir das Predigerbuch. Es ist von Springinsgut angelegt, der die verlorenen Aufzeichnungen Waaks ausgezogen hat, und seine Nachfolger haben sich zur Fortsetzung für verpflichtet gehalten. Sie berichten allesamt ausführlich über ihre Berufung und mehr oder weniger eingehend über Vorfälle während ihrer Amtszeit. Des weiteren haben sie ihre Predigttexte der Nachwelt überliefert und über die Sterbefälle, Taufen und Hochzeiten in ihrer Gemeinde Buch geführt, was sonst den Küstern zufiel. Das Buch ist vom letzten Pastor nach St. Georgen mitgenommen und wird bei der dortigen Pfarre auf bewahrt.
Die jährlichen Einkünfte des Pastors bestanden bis 1605 in 200 Mk. an Gelde und Naturalien, von denen in den Berufungsschreiben 2 1/2 Drömt Roggen, 3 feiste Schweine, 1 Last Kohlen und 6 Fuder Holz (5 Fuder Erlen- und 1 Fuder Eichenholz) 416 ) angeführt werden. Man berechnete diese zu 22 1/2 Mk., 18 Mk., 3 Mk., 36 Mk. Daneben standen ihm achtmal im Jahre Grapenbraten zu, der 1641 auf 24 Mk. berechnet ward, 7 Pfund Butter (1621 zu 2 1/2 Sch., seit 1649 zu 7 Sch. das Pfund gerechnet), 30 Eier, Milch (1633 zu 10 Mk. gerechnet), Obst, Speck (1651 zu 6 Mk. berechnet), 1/2 Lamm, 9 Tonnen Bier, Fische (1641 zu 20 Mk. gerechnet), allerhand Lebensmittel aus dem Schwarze n Kloster (1652 zu 10 Mk. gerechnet), 15 Reihensemmel und 8 Schillinge für Osterfladen, endlich 2 Mk. für Wachs und 2 Mk. für Mai. Die 3 Schweine, die 1605 zu 18 Mk. gerechnet waren, wurden es seit 1648 zu 48 Mk. Seit 1632 scheinen diese Naturalien fast alle durch Geld abgelöst zu sein. Insgesamt betrugen seit 1661 die Hebungen des Pastors an Besoldung, Naturalien und Legatengeldern rund 480 Mk. 417 ). Die Akzidenzien, die hinzukamen, wird man nicht hoch anschlagen dürfen. Für die damalige Zeit muß damit gut auszukommen gewesen sein.


|
Seite 240 |




|
Das Pfarrhaus lag an der Neustadt. Es ward nicht leer überliefert, sondern mit einigem Hausrat versehen. Dieser bestand 1676 in 10 Bänken, 1 Schlafbank, 2 Bettstellen, 1 huuß- oder bettschap (wohl einem Wandbett), 3 Tischen, 1 Lade, 1 zweitürigem Schranke, 2 Bücherbrettern und 2 Kesselhaken 418 ).
Von den Pastoren ward 1578 Isensee wegen seines Verhaltens gegenüber der Einführung der Konkordienformel entlassen. Die Reihe seiner Vorgänger und Nachfolger ist bei Schröder in seiner Predigerhistorie zu finden. Sie ist dahin zu ergänzen, daß auf Hinze 1753 Christian Albert Delbrügk (st. 1786 Okt. 6) und auf diesen 1787 Christian Wilhelm Schultz folgte. Als dieser 1805 zum Pastor an St. Georgen berufen war, trat die Regierung mit der Absicht hervor, die Pfarre am Heiligen Geist eingehen zu lassen und ihre Aufkünfte zur Aufbesserung der Gehalte der übrigen Geistlichen Wismars zu verwenden. Der Rat war damit einverstanden, zumal da ihm für den Fall der Wiedererrichtung das Aufleben seiner Patronatsrechte zugestanden ward. Die Einziehung der Pfarre konnte aber bei der Kleinheit der Gemeinde ganz unbedenklich erscheinen.
Für den Küster hatte Hinrik Rikwartsdorp 1321 eine jährliche Hebung von 2 Schillingen ausgesetzt, um 1360 wurden an ihn 1 1/2 Mk. gezahlt, 1411 erhielt er vierteljährlich 8 Schillinge 419 ). Die mittelalterlichen Küster waren Priester und rückten mehrmals zum Pfarrer auf, z. B. Lutke Westphal (Küster 1485-1487) und Erasmus Vadderman (Küster 1514) 420 ). Sie verrichteten im 15. Jahrhundert mancherlei Schreibarbeit für das Haus zum Heiligen Geiste. Sie erhielten dafür 1425 12 Schillinge, 1428 und 1429 je 1 Mk. im Jahre 421 ). Später hielten sie gleich den Küstern der andern Kirchen eine Schule, wie das für 1702 bezeugt ist, wo wegen deren Visitation zwischen den Pastoren von St. Georgen und vom Heiligen Geiste Streit entstand 422 ). Bei Beerdigungen zu St. Jakobs, wo wegen Mangels einer Glocke nicht geläutet werden konnte, sang in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts der Küster "mit seinen 12 Knaben".
Auch mehrere der Mittelalterlichen Organisten waren Priester, so Nikolaus Rode (1411) und Joh. Gemmelkerne (1485-1487) 423 ).


|
Seite 241 |




|
Von den ältesten Vikareien oder Messen, die am Heiligen Geist begründet waren, war schon zu reden. So weit unser lückenhaftes Wissen reicht, schlossen sich ihnen die folgenden an.
Zweifelhaft ist, ob die Almissen (elemosine) des Ratmanns Johann Ketelhot als Almosen- oder als Messestiftung anzusehen sind. Sie waren 1322 mit 250 Mk. Kapital begründet 424 ). Zwei Messen begründete 1336 Hinr. Körneke. Eine davon war mit Hebungen aus Triwalk ausgestattet, die andere mit 16 Mk. Rente aus Vorwerk, Ost-Golwitz und dem Hofe zum Velde (später Kaltenhof) auf Pöl trat erst 1405 nach dem Tode der Enkel des Stifters ins Leben 425 ). Dafür, ob die Vikarei Johann Derneborgs am Heiligen Geiste bestätigt war, bietet dessen Schuldbekenntnis von 1324 nicht genügenden Anhalt 426 ). Es ist das letzte Zeugnis für sie. Die Vikarei, die um 1360 Wolter Kalsow zu versehen und für die der Heilige Geist 16 Mk. Rente zu zahlen hatte, ist wahrscheinlich die Vicke Kortenackes, die der Rat 1368 dem Stadtschreiber Joh. Moyleke verlieh. Das Kapital (400 Mk.) war 1331 angelegt und dabei bestimmt, daß die Vikarei nach dem Tode des Stifters erstehen solle 427 ). Auch später hatten die Stadtschreiber sie inne, so 1437 Gottfried Persevale und 1501 und 1502 Herman Krumthunger 428 ). Eine Vikarei oder Almissen 429 ) Joh. und Hinr. Luneborchs, deren Patrone die Schneider waren, war mit 400 Mk. ausgestattet. Sie bestand schon 1410 430 ). Eine Vikarei der Träger, deren mittelalterliches Gestühl noch jetzt in der Kirche steht und deren schon erwähnte Lichtbäume sie schmücken, ist 1493 bezeugt 431 ), eine ewige Messe der Schiffszimmerleute 1415 432 ), Altar und Vikarei der Zimmerleute an der Südseite der Kirche zwischen der


|
Seite 242 |




|
westlichen Tür und dem St.-Gertruden-Altar 1421 433 ), eine Vikarei der Schmiede 1422 434 ). Diese letzte war in der Reformationszeit dem Pfarrer an St. Georgen Hinr. Möllens und dem Kaplan Joh. Kale übertragen, denen nach einer Abmachung von 1542 der Heilige Geist jährlich 6 Mk. geben sollte. An die Stelle von Möllens trat nach dessem Tode Never 435 ).
Eine erste Messe, d. h. eine Frühmesse, begegnet 1427 436 ). To der ere godes sines hilgen lichammes de acht dage over de tiide to holdende, setzte die Kirchenfrau Mödeke 1446 den Priestern jährlich 1 Mk. aus 437 ). Eine sonnabendliche Hochmesse von der Gottesmutter ward 1474 mit 1 Mk. Rente begründet, wovon der Pfarrer zwei Drittel und der Küster ein Drittel haben sollte 438 ). Eine Fronleichnamsmesse mit den Stationen stiftete 1500 Gottschalk Reder und stattete sie mit 13 Morgen Acker und einem Hopfenhofe aus. Der Pfarrer sollte sie jeden Donnerstag singen 439 ).
Endlich begründete in demselben Jahre Hinrik von der Lühe zu Buschmühlen mit Bewilligung der Pfarrer von St. Georgen und vom Heiligen Geiste die sieben Zeiten der heiligen Jungfrau mit 720 Mk. Kapital. Sie sollten nach Ordnung des Bistums Ratzeburg täglich von fünf Priestern und dem Küster gesungen werden. Verlangt ward Pünktlichkeit, untersagt aber Störung durch Rufen oder Lachen oder Spazieren. Es sollte nicht regellos noch schnell, sondern langsam (lenkliken) und mit den gehörigen Pausen gesungen werden und niemand sich vorzeitig entfernen. An drei Tagen in der stillen Woche, zu Ostern, Pfingsten und Allerheiligen samt den Oktaven, zu Weihnachten und den folgenden vier Tagen, zu Himmelfahrt und Fronleichnam sollten die Priester dem Pfarrer singen helfen und dann von den Marienzeiten befreit sein. Bischöflicherseits ward die Stiftung am 5. Juli 1501 bestätigt.
Welches Lehen 1529 Herzog Magnus dem Propste von Neukloster übertragen wünschte, wissen wir nicht. Johann Reinecke hatte es aufgegeben.
Nur einmal (1520) erscheint in den Rechnungen Manen misse des sonnavendes. Sie brachte dem Pfarrer 1 Mk. ein.


|
Seite 243 |




|
Mit der von Gerbert von Warendorp 1282 gestifteten Messe war eine Memorie für ihn und seine Eltern verbunden 440 ), 1302 bedang sich Gerhard von Grevesmühlen eine solche, wenn er seine Pfründe nicht antreten würde 441 ). Hinrik Rikwartsdorp und seine Ehefrau Künne stifteten sich 1321, Mechthild Winkelman 1397 Memorien 442 ), Hinrik von der Lühe aber machte für sich und seine Hausfrau deren vier jährlich aus. Die Sonntags und Montags gehaltene Vigilien und Seelmessen mit Kornhebungen aus Metelsdorf mögen dem Andenken Hinrik Körnekes gewidmet gewesen sein 443 ). An die Rikwartsdorpsche Memorie aber denke ich bei der in den Rechnungen oft vorkommenden, zuletzt 1555 genannten Hühnervigilie, da zu den Hebungen seiner Stiftung 20 Hühner aus Metelsdorf gehörten. Sie ward am Vortage von Marien Geburt (Sept. 8) begangen und es ist gelegentlich der Verköstigung der Pfründner schon im ersten Kapitel darüber berichtet worden. Die Beteiligung der Priester bezeugen Rechnungen von 1438 und 1493 444 ). Von einer Stiftung der Familie Buk, worauf doch die Buckvillinge oder Buckvillige der Rechnungen von 1517 und 1518 zurückgeführt werden muß, fehlt es an Nachrichten. Wir wissen zwar, daß Timme Buk 1347 eine Vikarei in Wismar begründet hat 445 ), aber nicht, an welcher Kirche.
Die Zahl der am Gottesdienste in der Kirche des Heiligen Geistes beteiligten Priester läßt sich für keine Zeit feststellen. 1424 bis 1426 wurden außer an Pfarrer, Küster und Organisten an vier Priester halbjährlich 4 1/2 bis 8 Mk. und an einen fünften vierteljährlich 4 Mk. Rente gezahlt 446 ). Es liegt nahe anzunehmen, daß nicht nur die Kapitalien der betreffenden Vikareien in den Gütern des Heiligen Geistes bestätigt waren, sondern daß auch die Messen in seiner Kirche gesungen wurden. Eine gewisse Bestätigung bietet der Umstand, daß einer dieser Priester her Disthus als Priester der Schmiede bezeichnet wird, und diese hatten ja eine Vikarei dort. Aber ein anderer, her Johann Osten, wird als Priester der Goldschmiede genannt, und daß die Goldschmiede dort


|
Seite 244 |




|
ebenfalls eine Vikarei gehabt haben sollten, davon findet sich sonst keine Spur 447 ). Anlaß genug zur Vorsicht. Deshalb sehe ich auch davon ab, die späteren Rentenzahlungen an Priester als Zeugnisse für den Gottesdienst am Heiligen Geiste zu verwenden.
Den Priestern und dem Küster vermachte Mechthild Winkelman 1397 je 2 Tonnen Buchenholzkohlen, die ihnen jährlich um Johannis geliefert werden sollten. Kurz vor Weihnachten, wenn O sapientia gesungen ward, hatten sie regelmäßig eine Kollation. O sapientia ist der Beginn der ersten der großen Weihnachtsantiphonen, die statt des oder nach dem Magnificat gesungen wurden. Ihr Termin fällt vom 12. bis 17. Dezember, in den Bistümern Lübeck und Schwerin auf den 14. Dezember 448 ), der des Ratzeburger Bistums war sonst nicht bekannt, aber nach der Rechnung von 1412 449 ) ward in Wismar die O sapientia am 17. Dezember gesungen: Item des sonavendes vor sunte Thomas daghe . . . item drunken de prestere 1 tunne beers mit den broderen tu O sapientia, do se dat drunken tu allen kerken, de kostede 10 sch. Es war also allgemein für die Priester üblich, sich an diesem Tage eine Güte zu tun. Die spätern Zeugnisse geben weder Datum noch werfen sie Seitenlichter. Es sind Ausgaben für Bier, Fische, Vögel, Hühner, Grapenbraten, die sie verzeichnen 450 ).
Auch sonst speisten die Priester öfter auf Kosten des Gotteshauses. Die Rechnung von 1412 verzeichnet zu Exaudi (dem Sonntage vor Pfingsten): so eten de prestere dar, dat kostede 10 sch.; des sondaghes thu Pynxsten do spysede ik 8 lammere de kosteden 4 pen. unde 21 sch., dat sint de lammere, de ik kofte in Pynxsteavende (d. h. dem Tage vor Pfingsten); item so eten hir de prestere, do gaf ik ut 4 sch. vor grone vlesch unde 3 sch. vor beer; Aug. 24: do eten hir de prestere, dat kostede 4 sch.; Sept. 21: so eten hir de prestere, do gaf ik ut 4 sch. 2 pen. vor vyssche tu markede, unde drunken vor 2 sch. beer; Nov. 1: so eten hir de prestere, dat kostede 4 sch. 451 ).
Ausgaben für Wein und Oblaten sind im ersten Kapitel mit erwähnt. Sie gehören so selbstverständlich zum regelmäßigen


|
Seite 245 |




|
Gottesdienst, daß eine Sammlung keinen Sinn hätte. Regelmäßig wurden jährlich bis 1524 4 Schillinge für das Chrisma zur letzten Ölung ausgegeben 452 ), zu Weihnachten und Ostern aber je 18 Pfenninge an den Pfarrer und Küster wygelgeld (noch 1548, nicht mehr 1550). Es wird sich um die Kerzenweihe handeln 453 ). Geweihte Kerzen aber scheinen verkauft zu sein 454 ). Auch Weihrauch mußte von Zeit zu Zeit gekauft werden 455 ). Zu Pfingsten und Fronleichnam ward die Kirche mit Birkenreisern (Maien) geschmückt 456 ), und wahrscheinlich erhielt auch der Pfarrer solche, woraus es sich erklären wird, daß er später Anspruch auf eine Zahlung dafür hatte 457 ).
Genauere Aufzeichnungen über die Opfer; die das Jahr über fielen, haben wir nur von 1411. Damals wurden in den Blöcken, d. h. den Opferstöcken, in der Zeit vom 15. August 1411 bis zum 23. Juni 1412 27 Mk. 14 Sch. 2 Pf. gefunden, von den Tafeln (d. h. doch durch Sammlungen mit dem Belde 458 )) vom 24. Juni bis zum 8. Dezember 2 Mk. 7 Sch. 10 Pf. gewonnen. Am ergiebigsten erwiesen sich Ostern, Pfingsten und Mariens Himmelfahrt mit 4 bis nahezu 6 Mk., Aug. 24 wurden (seit Aug. 15) 2 1/2 Mk., ebensoviel Weihnachten (seit Sept. 21) und am Sonntage vor Palmarum (seit Febr. 24) in den Blöcken gefunden. Die Tafeln brachten zu Allerheiligen den höchsten Ertrag mit 9 Schillingen, Visitationis Mariae 6 Sch., Marien Empfängnis 5 Sch.


|
Seite 246 |




|
Für die Ausübung des 1255 erhaltenen Begräbnisrechtes zeugen die Grabsteine der Kirche 459 ). Die Pfründnerin Grete Markwardes gab 1460, um ein Grab in der Kirche zu erlangen, dem Hause 10 Mk. 460 ). Es trug aber das Haus (wie noch jetzt) für die Pfründner die Begräbniskosten, sicher seit 1530. Sie waren, obwohl den Toten alle Ehre geschah, recht bescheiden. Ein Sarg kostete 7 Sch. 3 Pf., der Totengräber erhielt 4 Sch. 4 Pf., die Totenfrau (selemanersche) 1 1/2 Sch., der Küster für das Läuten 1 Sch., der Pfarrer aber für Vigilie und Seelmesse (vor villiegelt, zuletzt 1531) 2 Schillinge.
Das Reinhalten der Kirche wird Aufgabe der Kirchenfrau (kerkvrouwe) gewesen sein. Eine solche ist zuerst 1435 bezeugt, wo sie viermal im Jahr je 2 Mk. erhielt 461 ), unbekannt, ob als Lohn oder Rente, wahrscheinlich doch das letzte; zuletzt kommt eine solche 1612 vor. Die Kirchenfrau Mödeke stiftete 1446 1 Mk. Rente für Gottesdienst in der Fronleichnamsoktave und 1 Mk. für allgemeine Zwecke des Hauses 462 ), und später habe ich keine Entlohnungen in den Rechnungen gefunden, weshalb man annehmen kann, daß sie für ihre Mühewaltung durch freien Unterhalt entschädigt oder daß das Amt einer Pfründnerin ohne Entgelt übertragen ward. Die Kirchenfrau Grete Holste übergab ihrer Nachfolgerin Dortie Meibom 1455 eine Barschaft von 23 Pfenningen 463 ). Vielleicht hatte sie beim Verkauf von Nachlaßsachen mitzuwirken. Wenigstens läßt sich in dieser Richtung eine Anschreibung von 1526 deuten: 2 1/2 Mk. dedit de karkfrowe van des hilligen [Geistes] bedde. Später hatte die Köchin für das Reinhalten der Kirche zu sorgen und erhielt dafür jährlich 6 Mark 464 ).
Zum Schluß die kirchlichen Abgaben. Nach dem oben angeführten Vertrage von 1331 hatte sich der Bischof von Ratzeburg damit zufrieden gegeben, daß der Zehnte auch künftig in gedroschenem Korn ohne zu stiegen entrichtet würde. Später muß die Naturalleistung in eine feste Geldleistung von 12 Mark umgewandelt worden sein. Wenigstens buchen die Rechnungen von 1411 und 1483 deme byschope van Razeborch 12 Mk. van sineme


|
Seite 247 |




|
thegeden 465 ). 1487 Jan. 2 wurden diese 12 Mk. für den Zehnten an den Notar des bischöflichen Offizials gezahlt, während später von 1502 an nur die Zahlung ohne den Grund eingetragen wird 466 ). Wenn in der Zwischenzeit (1431, 1433, 1435, 1437) die 12 Mk. an die Kalandsherren (offenbar die des Großen Kalandes) gezahlt sind 467 ), so werden sie eben diesen vom Bischofe aus irgendeinem Anlaß zugewiesen sein. Der Heilige Geist selbst scheint den Zehnten in Korn eingezogen zu haben 468 ).
Noch eine andere Zahlung wird 1501 als Zehnt, 1485-1487 als stolpgelt und 1499 als stolbede bezeichnet 469 ). Es waren 3 Mk., die die Domherren von Schwerin seit 1435 zu fordern hatten, und zwar wegen Metelsdorfs und Klüßendorfs 470 ). Völlig dunkel ist es allerdings, wie das Schweriner Domkapitel dazu gekommen sein sollte, aus Dörfern, die zum Bistum Ratzeburg gehörten, einen Zehnten zu erheben, und das späte Auftreten dieser Benennung erweckt auch nicht gerade Vertrauen. Bei stolbede ist man versucht, an Stola zu denken, darf aber nicht außer acht lassen, daß die ältesten Zeugnisse bewußt stoelpbede oder stolpdede gerade wie stolpgelt bieten. Ein zuerst 1499 auftauchender Betrag


|
Seite 248 |




|
von 23 Schillingen stollebede 471 ) ist später 1587 wegen der Wendorfer und Klüßendorfer an den Küchenmeister zu Mecklenburg bezahlt und erst 1756 abgelöst. Ihde führt in seiner trefflichen Geschichte der Steuern des Amts Schwerin an, daß in wenigen Ämtern, z. B. Doberan, im 15. bis 17. Jahrhundert neben der Königsbede noch eine stollbede als jährliche ordentliche Bede gegeben wurde 472 ). Eine Erklärung hatte auch er nicht.


|




|



|




|


|
[ Seite 249 ] |




|



|


|
|
:
|
VII.
Die wendischen Schatzfunde
aus Mecklenburg
von
Robert Beltz.
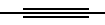


|
[ Seite 250 ] |




|


|
Seite 251 |




|
E in hervorragender pommerscher Schatzfund, von Quilitz auf der Insel Usedom, hat Veranlassung zu einer Behandlung der interessanten Fundgruppe und einer Zusammenstellung der auf deutschem Boden gemachten Funde gegeben (Baltische Studien N. F. XXIX 1927 S. 151 f.). Auf die eigentümliche Stellung, die sich dabei für Mecklenburg ergibt, auch hier einzugehen, rechtfertigt sich um so mehr, als in den Jahrbüchern seit sehr langer Zeit (Jahrgang LVIII 1893 S. 175) von dieser Erscheinung überhaupt nicht die Rede gewesen ist und die Anschauungen darüber sich natürlich seitdem gewandelt haben. Die wendischen Schatzfunde, nach einem fast durchgehenden markanten Zuge auch Hacksilberfunde genannt, sind bekanntlich Silbervorräte, bestehend aus Schmucksachen oder Münzen, die zum großen Teil zerhackt oder sonst zerbrochen sind, also im wesentlichen Wertmetall darstellen überwiegend sicher an verborgener Stelle geborgenes Gut, nur selten "Hausschätze". Die auffallende Beimengung massenhafter arabischer Münzen hat früher allgemein dazu geführt, auch in den Schmucksachen orientalische Erzeugnisse zu sehen, während jetzt der nordische Ursprung der meisten feststeht. Die Zusammensetzung der Schatzfunde ist das Ergebnis zweier sich begegnender Handelsbewegungen, der nordischen ("wikingischen") und einer orientalischen, die beide ihre Hauptwege durch das altrussische Gebiet nahmen. Die Münzen ermöglichen eine Datierung. Die frühesten Funde fallen in den Anfang des neunten Jahrhunderts, nur wenige sind jünger als 1060. Das Hauptland der Schatzfunde in Deutschland ist Pommern, wo die große Zahl von 85, darunter die größten überhaupt, bekannt geworden ist, und es ist zweifellos, daß sich darin die Bedeutung der größten Handelstadt des Nordens, Jumne (Vineta), wiederspiegelt. Auch sonst gibt die Häufung von Fundstätten Handelszentren (Heithabu, Oldenburg, Kolberg, Danzig) oder Verkehrswege an.
Da ist nun sehr zu beachten das Zurücktreten unseres Landes. Wir hatten bisher einen einzigen Schatzfund von Bedeutung, den von Schwaan 1859 (Jahrb. 26 S. 241), und erst in letzter Zeit haben sich zwei dazugesellt, von Stavenhagen 1924 (noch nicht veröffentlicht) und von Blumenhagen bei Neustrelitz 1923 (veröffentlicht von W. Karbe in präh. Zeitschr. XVI 1925 S. 76 und Kunst- und Geschichtsdenkmäler von Mecklenburg-Strelitz I 2


|
Seite 252 |




|
S. 1), dieser auch dadurch interessant, daß es sich hier wirklich einmal um einen "Hausschatz" handelt.
Durchmustert man aber die älteren Berichte, so ergibt sich doch eine leichte Erhöhung, und gerade mecklenburgische Funde sind es gewesen, die zu der richtigen Auffassung der Münzfunde geführt haben, nachdem man vorher nur in z. T. wildphantastischen Deutungen sich mit ihnen abgefunden hatte. O. G. Tychsen, der seinerzeit weltbekannte Orientalist, Professor in Bützow und Rostock, schrieb 1779 in den Gelehrten Beiträgen zu den Mecklenburg-Schwerinschen Nachrichten: "Vor das Erste sind alle bisher an der Ostsee gefundenen Münzen größtenteils solche, welche vom J. Christi 892 bis 998 in den Ländern Irak, Chorasan und Mawaralnahra zu Bagdad, Samorkand, Balch, Alschasch, Kufa, Basra, Enderade, Ferabar und Buchara von den Semanidischen Regenten dieser Länder mit den Namen der jedesmal lebenden Bagdadischen Chaliphen, als welche sie für die rechtmäßigen Nachfolger Muhammends erkannten, geprägt worden sind. Die Zahl der älteren von Bagdadischen Chaliphen geprägten Münzen, welche unter diesen Semanidischen zuweilen gefunden werden, ist im Verhältnis dieser letzteren nur sehr geringe. . . . Weil im zehnten Jahrhundert Monz-Ledinillach Egypten eroberte und sich zum Chaliphen aufwarf, so war davon die Folge, daß alle Gemeinschaft mit den Bagdadischen Chaliphen aufgehoben, und also der bisher über Alexandrien geführte starke orientalische und indische Handel sich zum Theil nach Rußland hinzog und den Grund zu der wichtigen Handlung der an der Ostsee belegenen Handelsstädte und zu dem nachher errichteten Hanseatischen Bunde legte. Hieraus läßt sich leicht wahrnehmen, woher bloß das von Bagdadischen Chaliphen gemünzte oder mit ihren Namen versehene Silbergeld ausschließungsweise nach Rußland und so weiter in unsre Gegenden habe kommen können. . . . Dieses Silbergeld sandten nun die Russen oder die Neben-Comtoirs der Hanseestädte als Rimessen für Waren nach den Haupt-Comtoirs in Nowogrod. Riga, Dörpt u. s. w., von da es dann an die Interessenten in den Handelsstädten an der Ostsee gelangte."
Die Bedeutung der Handelsstädte für die Deutung der Münzfunde ist hier durchaus richtig hervorgehoben, und es stellt ein starkes Gewicht für die Ansetzung von Jumne bei Wollin dar, daß sich gerade dort die Münzfunde häufen, wie an keiner zweiten Stelle (Balt. Stud. a. a. O. S. 187). Von Jumne nun führte sogar eine Handelsstraße auch nach Mecklenburg. In der berühmten Schilderung die Adam von Bremen (II, 19) von der nobilissima civitas Jumne gibt, die als sane maxima omnium, quas


|
Seite 253 |




|
Europa claudit, ci vi tatum erscheint, heißt es weiter: Ab illa civitate brevi remigio trajicitur hinc ad Dyminem urbem, quae sita est in ostio Peanis fluvii, ubi et Rugi habitant; inde ad Semland - -. Iter ejus modi est, ut ab Hammaburc vel ab Albia flumine septimo die pervenias ad Jumne civitatem per terram; nam per mare navim ingrederis ab Sliaswig vel Aldinburc, ut pervenias ad Jumne. In den verschiedenen Behandlungen, welche die Stelle gefunden hat, ist der in den hinc-inde liegende Gegensatz nicht genügend beachtet. Das kann doch nur heißen: von Jumne geht es auf der einen Seite (westlich) nach Demmin, auf der andern (östlich) nach dem Samland. Es wird doch niemand im Ernst inde auf Demmin beziehen und annehmen, daß man von Jumne nach dem Samland den Weg über Demmin genommen habe; auch das breve remigium findet seine Erklärung durch den Gegensatz zu dem weiten Wege nach dem Samland (darf also nicht, wie Schuchhardt, Arkona, Rethra, Vineta 1926 S. 84 will, für die Ansetzung von Jumne bei Peenemünde ins Feld geführt werden), und die Ansetzung von Demmin in ostio Peanis fluvii verliert ihr Befremdendes, wenn man es mit "am Eingange zur Peene" faßt. Bis Demmin ging von Hamburg, Adams Ausgangspunkte, der Landweg; dort begann die Wasserstraße. Die Richtung dieses Landweges ist sogar urkundlich bezeugt. In der Urkunde, in der Bischof Berno die Grenzen des Klosters Dargun festsetzt (1173 M.U.B. I 111), wird auch eine via, quae per se de Dimin viantes deducit ad Dargon et Lucho, als Grenzbezeichnung verwendet, und in einer Schenkungsurkunde des Fürsten Kasimar von Pommern an dasselbe Kloster (1216 M.U.B. I 223) ebenso eine via regia, quae ducit de Luchowe in Lavena (Laage), sicher dieselbe Straße, deren Fortsetzung dann nach Werle bei Schwaan geführt haben mag. Die Bedeutung einer via regia im Wendenlande ist ungeklärt. Eine aus derselben Zeit beglaubigte via regia (eine Abzweigung wird 1241 als antiqua strata bezeichnet) ging durch Obersachsen und die Lausitz, Dresden, Bautzen, Görlitz, Lauban nach Breslau (Zeitschr. f. Ethnol. 1892 S. [413]). Es ist hier von "Erdschanzen" die sie deckten, die Rede.
Auch unsere via regia ist sehr stark bewehrt und verbindet bedeutende Burgen, Demmin, Dargun, Laage, wohl auch Werle; bei Lüchow suchen wir sie seit Jahren. Aber einen Niederschlag in Schatzfunden hat sie nicht gefunden. Auf dem Wege bis Demmin sind mehrere Schatzfunde in den Kreisen Anklam und Demmin geborgen, dann aber kommt in jener Gegend nur ein Fund mit sächsischen, rheinischen, niederländischen, böhmischen Münzen und sog. Wenden-


|
Seite 254 |




|
pfennigen, welche den Fund auf etwa 1040 datieren, dabei einige feine Filigranohrringe, von Remlin b. Gnoien (Jahrb. 9 S. 390, 460, dahin gehört vielleicht auch ein Dirhem von Harun al Raschid 796, Jahrb. 17 B S. 30), und weiter der große Fund, der 1859 auf der Feldmark von Schwaan am linken Ufer der Warnow gegenüber der Burg Werle gemacht wurde (Jahrb. 26 S. 241) und der eine Fülle von Schmucksachen und Münzen enthielt (Gewicht 3 kg), welche die Datierung auf etwa 1030 geben. Auch der weitere Weg nach Hamburg und Oldenburg in Wagrien verrät sich durch Funde nicht. G. Staak hat aber neuerdings (die Abhandlung wird in der Heimatbundzeitschrift veröffentlicht werden) auf einen in der Volkssage als "Rilterdamm" bezeichneten und in Resten erhaltenen Weg hingewiesen, der von Bützow seinen Weg nach der Wismarschen Burg nimmt, wo wir die Handelsstadt Rerik (s. u.) suchen dürfen. Auch in dem großen, mir leider unverständlichen Werke des Russen Egorow über die Kolonisation Mecklenburgs 1914 ist die große Handelsstraße von Demmin nach Lübeck (richtiger Oldenburg) so eingetragen.
Vielleicht ist den Funden in der Gegend von Gnoien doch eine größere Bedeutung zuzuschreiben. 1184 unternimmt der junge König Knut II. von Dänemark einen Rachezug gegen die circipanischen Wenden, welche den Sturz Heinrich des Löwen zu einem Aufstande ausgenützt haben. Er geht über das Trebelmoor, zieht an einer Feste Lubechinca (= Lübchin, welches von beiden, ist hier belanglos) vorüber, ohne sie zu erobern, und muß sich begnügen, eine "Kaufstadt" zu plündern. In dieser "Kaufstadt" sieht man die heutige Stadt Gnoien, faßt sie aber nur als "Marktflecken" auf (z. B. Rudloff, Gesch. Mecklenburgs vom Tode Niklots 1901 S. 81). Man glaubt allgemein, den Slawen "Städte" überhaupt noch nicht zuschreiben zu dürfen. Das geht zu weit. Eine aufmerksame Lektüre der Biographen Ottos von Bamberg weist doch in den zwanziger Jahren des zwölften Jahrhunderts auf Siedlungen städtischen Charakters, in denen Kaufleute nicht nur zu Markttagen, sondern zu ständiger Niederlassung weilten. Und auf ostslawischem Boden ist eine städtische Organisation schon im neunten Jahrhundert, ganz deutlich 1 ) schon in der Zeit vom neunten bis elften Jahrhundert; im zwölften wird sogar die große Stadt Nowgorod mit ihrer Herrschaft von Großkaufleuten die Herrin eines riesigen, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisierten Gebietes. Ihre Vorläufer sind die gorod genannten


|
Seite 255 |




|
Residenzen der nordischen (warägischen) Fürsten, die als Eroberer und Kaufleute in das Land kamen und die Träger jenes Silberhandels gewesen sind, der uns hier beschäftigt. Ihr Bezirk ist nicht in erster Linie ein militärischer, sondern das Rohstoffgebiet für den Handel in den Städten. Ungemein bezeichnend ist hier (im nördlichen Rußland) der Name für die kleinen Bezirke pogosty aus dem Stamm gost = Gast, d. h. Fremder, Kaufmann.
Solche Erscheinungen haben für uns natürlich nur den Wert von Parallelen, die wir nicht etwa ohne weiteres auf unserem Boden voraussetzen dürfen, mit denen als Möglichkeiten wir aber auch hier zu rechnen haben. Das aber dürfen wir sagen, daß der Verfasser der Knytlingasaga, der die Taten seines Helden, des Königs Knut, im Stile nordischer Wikingerverherrlichung schildert, schwerlich die Plünderung eines einfachen wendischen Marktfleckens eingesetzt haben wird und daß der betroffene Ort (mag es nun Gnoien oder ein anderer sein) doch wohl eine Station an oder in der Nähe der großen Handelsstraße Jumne Hamburg (Oldenburg) gewesen ist.
Wir zählen die mecklenburgischen Funde, von Nordwesten beginnend, auf, und zwar auch einzelne Münzen aus der "Hacksilberzeit", weil da doch die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß sie zerstreuten Schatzfunden entstammen.
Dassow. Arabische Münzen und "Brakteaten". Tychsen a. a. O. S. 158. Verschollen. - Gadebusch. 1200 Münzen. v. Ledebur, Zeugnisse eines Handelsverkehrs mit dem Orient, Berlin 1840 S. 67. Verbleib nicht bekannt. - Wismar. Münzen. Schröder, Kurze Beschreibung der Stadt und Herrschaft Wismar 1743 S. 39. Verschollen. - Steinhaufen bei Wismar; großer Fund an arabischen Münzen und Schmucksachen. v. Ledebur S. 67. Verschollen. - Sukow (?) bei Schwerin. Deutsche Münzen, Ringschmuck, Ohrringe. Jahrb. 9 S. 388. - Bei Schwerin. 27 Münzen, 10. Jahrh. Jahrb. 5 B S. 140. Verbleib nicht bekannt. - Boizenburg. Münze. Desgl. - Gegend von Neustadt ("in der Lewitz"). Arabische, deutsche, englische, ungarische Münzen, um 1030. Jahrb. 4 B S. 57. - Rühn bei Bützow. Arabische Münzen, 809. Tychsen, Bützower Nebenstunden III 1768. Verschollen. - Schwaan. S. o. - Marlow. Schmuckstück. Jahrb. 8 B S. 77. - Wahrscheinlich Gegend von Penzlin. Arabische Münzen vom Anfang des neunten Jahrh. Jahrb. 5 B S. 96. - Stavenhagen. S. o. - Ludorf bei Röbel. Deutsche Münzen des zehnten Jahrh. Jahrb. 1 B S. 37. - Warlin (Pragsdorf ?) bei Stargard. Angelsächsische und arabische Münzen, Schmuckringe. Jahrb. 1 B S. 37. Verschollen. - Pragsdorf bei Stargard. Größerer Fund arabischer Münzen. Jahrb.


|
Seite 256 |




|
1 B S. 37. - Blumenhagen bei Neustrelitz. S. o. - Krumbeck bei Feldberg. Arabische Münzen. v. Ledebur S. 67. Verschollen. - Zahren bei Fürstenberg, Münzen. Karbe, Kunst- und Geschichtsdenkmäler S. 1.
Diese an Zahl geringen, über das Land zerstreuten Funde erweisen nur, daß auch Mecklenburg seinen Anteil an der großen nordisch-orientalischen Handelsbewegung gehabt hat. Zu Handelswegen oder Handelszentren lassen sie sich nicht gruppieren. Eine wichtigere Handelsstadt hat ja das Land in der eigentlichen "Hacksilberzeit" nicht besessen. Wohl liegt hier das älteste überhaupt auf slawischem Gebiet erwähnte emporium; die Dänen nannten es Reric, der einheimische Name ist nicht bekannt, auch nicht seine Lage. Aber die Erwähnung fällt in die Zeit des Anfangs der Handelsbewegung (808), und da wird berichtet, daß der Dänenkönig Gottfried die Stadt zerstört und die Kaufleute nach Sliesthorp (Schleswig) übergeführt habe. Sie wird zwar 810 noch einmal genannt (Quellen s. bei Wigger, Annalen), verschwindet dann aber in der Überlieferung und hat offenbar weiterhin keine Rolle gespielt. Der Handel zur See geht auf Schleswig = Haithabu über und von dort oder von Oldenburg direkt nach Jumne; Mecklenburg ward nicht berührt. Der Landhandelsweg von Hamburg über Jumne ist ja durch das Land gegangen (s. auch Jahrb. 58 S. 177 und oben), hat aber keine wesentlichen Spuren in Funden hinterlassen. So findet das Zurücktreten der interessanten Erscheinung der Schatzfunde in Mecklenburg seine einfache Erklärung.
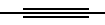


|
[ Seite 257 ] |




|



|


|
|
:
|
VIII.
Fanny Tarnow.
Eine Skizze ihres Lebens
nach neu erschlossenen Quellen
von
Adolf Thimme.
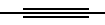


|
[ Seite 258 ] |




|


|
Seite 259 |




|
D ie interessante Frau, als Künstlerin, Dichterin, Kameradin der Männer, Freundin der Frauen, stets liebend und geliebt, anregend und angeregt, Meisterin des Gesprächs, des Briefschreibens, des vielsagenden Lächelns, der gefühlvollen Träne, als Mittelpunkt eines geselligen Kreises von Dichtern und Künstlern: das ist für Deutschland ein Produkt, eine Entdeckung der Romantik. - Wenn es recht ist, einer Henriette Herz, Rahel Levin, Caroline Schlegel, Therese Heyne zu gedenken und des Ruhmes ihrer Liebenswürdigkeit, ihres Geistes, der Liebe, die sie aus- und einatmen, des Glanzes ihrer Persönlichkeit, so ist es unrecht, eine Frau der Vergessenheit anheimfallen zu lassen, die ihres Gleichen war: Fanny Tarnow.
Sie ist 1779 in Güstrow in Mecklenburg geboren als Tochter eines Advokaten, der im Verlauf seiner Grundstücksgeschäfte auch Landwirt wurde, als solcher Bankerott machte und dabei auch das Vermögen seiner Frau, einer geborenen v. Holstein, zusetzte. Tarnow bekam zwar eine Anstellung bei der mecklenburgischen Ritterschaft, zog sich aber verbittert von seiner Familie zurück, die infolgedessen in Not geriet. Er ist offenbar ein übler Gatte und Vater gewesen, denn seine Tochter Fanny sagt einmal von einem tyrannischen Hausherrn: Ich habe hier all den rohen Mißbrauch der männlichen Härte als Hausherr wieder vor mir, der mir meine Jugend verdüstert und mich mein ganzes Leben lang gequält hat. Um so liebevoller schlossen sich die vier Kinder an die Mutter an, die als die schöne Tochter eines angesehenen, reichen Grundherrn wohl ein besseres Leben hätte erwarten dürfen, als ihr an der Seite Tornows zuteil ward.
Von den Kindern wurde der Sohn Offizier, die älteste Tochter verheiratete sich mit einem Bürgermeister, ihre Tochter wurde die Schriftstellerin Amely Bölte, die später die Biographin ihrer Tante Fanny wurde.
Die übrigen zwei Töchter mußten Erzieherinnen werden, Betty später in Weißenfels, Fanny zuerst auf Rügen, bei einem Herrn v. Schmiterlow, dessen Gut bei Schoritz lag, dem Geburtsort von Ernst Moritz Arndt. Da Arndt mit Schmiterlow befreundet war, so machte Fanny hier leicht seine Bekanntschaft. Er war nicht nur der erste bedeutende Mann, der ihr entgegentrat, er war auch der erste leidenschaftlich erregte Patriot, und Fannys Herz hat stets bei dem Gedanken an das Vaterland höher geschlagen. Es ist nur natürlich, daß auch Arndt, der seit 1801 Witwer war, das außerordentlich lebhafte, geist- und gemütvolle Mädchen an-


|
Seite 260 |




|
ziehend fand, er wurde jedenfalls Fannys große, leidenschaftliche Lebensliebe. Noch 1836 Schreibt sie: 10 Jahre lang war mein Leben ein Gottesdienst dieser Liebe. Arndt bezeichnet Fanny in einem Briefe aus dem Jahre 1803 als eine seiner Freundinnen, ein sehr liebenswürdiges, unterrichtetes und gesittetes Frauenzimmer, wohl gebildet, die immer in der feinen Welt gelebt habe, und deren Geist und Güte durch zwei Unglücksjahre geläutert sei. Wie es kam, daß das Verhältnis Arndts zu Fanny Tarnow abgebrochen wurde, ist mit Sicherheit nicht zu ermitteln. Die Biographen Arndts vermuten, daß er sich zurückgezogen habe, weil Fanny ihre Neigung zu früh oder zu lebhaft kundgegeben habe. Diese Vermutung gründet sich aber nur auf die gehässige Notiz der Amely Bölte in der Biographie ihrer Tante, daß der zu schnelle Gang ihrer Liebesintriguen alle Bewerber abgeschreckt habe. Diese Biographie 1 ) ist überhaupt dem Andenken der Fanny Tarnow verhängnisvoll geworden, ihre Mitteilungen und Urteile sind maßgebend gewesen für alle, die über die Tarnow sich bisher geäußert haben 2 ). Man hat die dort vorgebrachten Behauptungen einfach angenommen, weil hier auch die einzigen Mitteilungen vorlagen, die man über Fanny hatte, noch dazu aus der Feder einer Verwandten. Erst die von mir im Nachlaß der Luise v. François gefundenen Tagebücher und Briefe vermochten weiteren Aufschluß zu bringen. Für mich war das Ergebnis, daß ich die Charakteristik der Fanny Tarnow durch ihre Nichte Amely Bölte als ein unglaubwürdiges, boshaftes Zerrbild bezeichnen muß, hervorgegangen aus verwandtschaftlicher Mißgunst und Neid und auch wohl aus dem Gegensatz zwischen der Weltanschauung der romantischen Tante und der nüchtern-rationalistischen Nichte.
Was Arndt anlangt, so behauptet die Bölte, ihre Tante hätte ihn fast gar nicht gekannt, und ihre Liebe sei nur ein Trugbild ihrer Phantasie gewesen. Man vergleiche damit obigen Brief Arndts, ferner einen Brief Fannys an Arndt aus dem Jahre 1811, in dem sie sagt: "Sie waren, als wir uns kennen lernten, schon ein Mann, der das Leben und die Welt klar auffaßte und sich selbst im Wechsel tiefen Leids und schönen Glücks erprobt hatte. . . .Dieser ungebrochene Mut, dies feste Hinblicken auf das Ziel, dies unerschütterliche Wollen und, in so finsterer Zeit, dies Vertrauen, diese Hoffnung - oh, mein Freund, möge das Schicksal Ihren prophetischen Traum wahr machen und Sie noch einst ein freies Vaterland erblicken! Arndt, ich möchte es Ihnen recht ernst und warm aussprechen, wie ich Sie erkenne und ehre. Mancher früher


|
Seite 261 |




|
von uns Deutschen hochgefeierte Mann weiß ja jetzt den Jünglingen seiner Nation nichts gescheuteres zu raten, als die Fesseln, in die uns fremder Übermut und eigne Schwäche geschlagen hat, mit Anstand tragen zu lernen. Wie not sind uns Männer, die noch den Mut haben, wahr und frei zu sein! Was Sie sind, Arndt, und was Sie wirken, gehört einer freudigeren und stolzeren Nachwelt an. Der Samen, den Sie ausstreuen, kann nicht verloren gehen. Wenn Sie nicht mehr sind, Arndt, so werden einst noch Deutschlands Jünglinge dem Manne danken, der in ihre Seelen den ersten Funken der heiligen Rache für die gegenwärtige Schmach warf!" Als sie 1817 in Berlin war, überwältigt sie das Gefühl der Möglichkeit, Arndt wiederzusehn, und sie schreibt in ihr Tagebuch: Ich fuhr gestern in die Kirche, um Schleiermacher predigen zu hören - ich ahnte nicht, daß die Erinnerungen, die sein Anblick in mir weckte, noch solche Macht über mich haben könnten. Ich glaubte seine Frau, seine Schwester, Arndts Braut, zu erkennen. Die Möglichkeit, diesen auch zu erblicken, preßte mir das Herz bis zum Zerspringen zusammen. Ich betete für Ihn und für sie zu Gott - aber wie ich ihn geliebt habe, liebt ihn keine andre, und keine wird: so glücklich durch ihn werden, als ich es geworden wäre. Und bin ich denn nun nach 10jähriger Trennung mit ihm an Einem Ort! Ich kann ihn bei jedem Gang erblicken, kann im Gewühl bei ihm vorüberstreifen. Mein Gott, es ist doch ein herbes Gefühl, Herz und Leben an eine solche kalte Gleichgültigkeit verloren zu haben! Mein ist er, Gott hat uns für einander geschaffen - sonst hätte ich ihn nicht so unaussprechlich und so treu lieben können. Er hat sonst Hitzig stets besucht, wenn er hier war - nun kommt er nicht. Warum meidet er mich zu sehn? ist das Schonung, oder gar Nichtachtung? O wie würde ihn die schmerzen, wenn er einst jenseits erfährt, wie ich ihn geliebt und was ich um ihn gelitten habe. Laß ihn nur recht, recht glücklich werden, lieber Vater im Himmel!
Ferner hat die Tarnow ihren ersten größeren Roman, die Natalie, nach ihrem eignen Geständnis eigentlich nur für Arndt geschrieben, von dem Wunsche beseelt, daß er ihn lesen möge. Dieses merkwürdige, unter strömenden Tränen und in höchster Leidenschaftlichkeit geschriebene Buch ist eine Art Selbstbiographie und behandelt in seinem ersten Teil Fannys Kindheit und ihren Aufenthalt in Rügen. Im Mittelpunkte der Erzählung steht das Verhältnis der Natalie zu Moritz Valuda, d. h. der Fanny Tarnow zu Ernst Moritz Arndt. Da hier das Ende des Verhältnisses so dargestellt wird, daß Valuda durch eine schnelle Abreise sich der Natalie entzieht, weil er das Freundschaftsverhältnis zwischen Natalie und


|
Seite 262 |




|
einem andern Verehrer mißdeutet, so ist es wahrscheinlich, daß diese Entwicklung der Wahrheit am nächsten kommt, zumal wir von einer schnellen Abreise Arndts nach Schweden wissen. Ein eigentlicher Bruch hat zwischen beiden nicht stattgefunden: wie Arndt ihr 1811 einen Dankesbrief schreibt, weil sie ihm bei der Herausgabe seiner Gedichte behilflich gewesen war, so finden wir seinen Namen auch noch 1830 unter den Subskribenten auf die Auswahl ihrer Schriften.
Die Zeit ihrer Erziehertätigkeit in verschiedenen adligen Häusern dauerte etwa 12 Jahre, dann kehrte sie, damals schon eine bekannte Schriftstellerin, zu ihrer erkrankten Mutter zurück, deren Unterhalt sie bis zu ihrem im Jahre 1815 erfolgten Tode mit ihrer Feder und ihrer Nadel bestritt, denn sie war zeitlebens auch eine Meisterin feiner Handarbeiten. Nach dem Tode der Mutter schloß Fanny Tarnow mit dem Verleger ihrer Natalie, Eduard Hitzig aus Berlin, innige, für das Leben vorhaltende Freundschaft, ließ ihre Thorilde von Adlerstein erscheinen, fuhr dann auf die Einladung ihrer Freundin Elise Schleiden nach Ascheberg am Plöner See und von da nach Petersburg, um sich dort eine Existenz zu gründen. Hier schrieb sie für das Cottasche Morgenblatt Berichte über Rußland und fand nicht nur in den besten bürgerlichen, sondern auch in der Hofgesellschaft begeisterte Aufnahme. Der Kaiser Alexander selbst gewährte ihr Zutritt zu den Kunstschätzen der Eremitage, außer mehreren Frauen wurden bekannte Männer wie der Maler Karl v. Kügelgen und der General Maximilian Klinger, der ehemalige Sturm- und Drangdichter, ihre Freunde, und der General Graf Georg Sivers trat in gegenseitiger Liebe ihrem Herzen besonders nahe. Aber obwohl auch die Kaiserinwitwe versuchte, sie in Petersburg zu halten, indem sie ihr die Direktion des Katharinenstifts anbot, "um dem Stift durch den Namen einer so berühmten, allgemein verehrten Schriftstellerin Glanz zu geben", so ging sie doch, teils aus Heimweh nach dem Vaterlande, teils weil sie das nordische Klima nicht vertrug, schon nach Jahresfrist nach Deutschland zurück. Über diesen Petersburger Aufenthalt berichtet das von mir in der Deutschen Rundschau 1921 veröffentlichte Tagebuch.
Nach einigen Verwandtenbesuchen ging sie nun auf einige Zeit zu Hitzig nach Berlin, verkehrte mit dem dortigen romantischen Kreise, besonders mit Amadeus Hofmann, Chamisso, Fouqué und seiner Frau, schloß auch mit Helmina v. Chézy Freundschaft. Ein Aufenthalt in Hamburg, der ihr eine vorübergehende Freundschaft mit der Schriftstellerin Amalie Schoppe brachte, ging sie wieder nach Berlin zurück, und von da 1820 auf Veranlassung der


|
Seite 263 |




|
Helmina v. Chézy nach Dresden, um mit dieser Freundin zusammen die "Iduna, Schriften deutscher Frauen" herauszugeben. Beide wohnten zusammen und nahmen auch einen gemeinsamen Sommeraufenthalt in Schandau. Hier aber kam es zwischen beiden zu heftigen Szenen und zum Bruch, worauf Fanny sich in einem anderen Hause einmietete. Hier vermißte sie bald ihr rot eingebundenes Tagebuch und erfuhr, daß Helmina es ihr entwendet und, um sie zu blamieren, ihren Freunden daraus vorgelesen habe. Nur mit Mühe gelang es ihr, durch einen befreundeten Pfarrer das Tagebuch zurückzuerhalten, aber natürlich war der Bruch zwischen beiden Frauen nach dieser häßlichen Geschichte, bei der alle rechtlich denkenden Menschen auf Seite Fanny Tarnows getreten waren, dauernd unheilbar. Fanny brauchte nun die Ausrede, daß das Tagebuch eigentlich nur ein Romanentwurf sei, und sie habe nur "ich" geschrieben, um dem Entwurf Lebendigkeit zu verleihen, worauf Helmina erwiderte, sie löge, daß ihr der Dampf zum Halse hinausschlüge. In der Tat enthielt das Tagebuch ohne Zweifel intime Aufzeichnungen über die Neigung Fannys zu einem gewissen Karlos 3 ) in Schandau und zu einem Dr. Waldemar Seifart aus Lauenstein bei Dresden, zwei junge Leute, die die nun schon alternde Schriftstellerin glühend umwarben. Daß Fanny in diesen Blättern ihr jung gebliebenes Herz offenbarte, gab der boshaften Chézy eben den Anlaß zur Prosanierung dieses Heiligtums. Ich habe mich deshalb so ausführlich über diese Geschichte verbreitet, weil jenes rot eingebundene Tagebuch, wenn ich nicht irre, in meinem Besitz ist. Ich habe es ebenfalls wie das Petersburger im Nachlaß der Luise v. François gefunden, und zwar sind diese Tagebücher, wie eine Stelle eines Briefes der Tarnow an die François ausdrücklich angibt, der letzteren zu ihrer freien Verfügung vermacht worden. Indessen enthält das Buch ein: mir noch nicht lösliches Rätsel: Die von Helmina entweihte Partie, wohl den Sommer 1820 umfassend, ist herausgerissen, darauf folgen eine größere Anzahl leerer Blätter und sodann vom 7. August 1822 umfangreiche Aufzeichnungen, die bis zum Jahre 1829, bis zu Fannys Übersiedlung nach Weißenfels, reichen. Die herausgerissene Partie ist der Biographin Amely Bölte wohl nicht bekannt gewesen, aber sie hat allerdings Aufzeichnungen ihrer Tante aus den Jahren 1820 und 1821 benutzt; der vorhandene Teil des Dresdener Tagebuches ist ihr unbekannt geblieben, ebenso das Petersburger Tagebuch. Ich denke mir nun, daß Fanny die Blätter leer gelassen hat, um nachträglich die Aufzeichnungen noch einzutragen, die vom Herbst 1820 bis August


|
Seite 264 |




|
1822 reichten und von der Biographin benutzt sind. Diese Eintragung hat sie aber doch unterlassen und dann später die Anfangspartie und noch einige Blätter, die Verfängliches enthielten, herausgerissen, als sie beschlossen hatte, das Buch in die Hände der François zu geben.
Die zwischen 1820 und 1829 liegende Dresdener Zeit gestaltete sich nun für Fanny zunächst recht erfreulich. Sie wurde mit Tieck, Tiedge und Elisa von der Recke befreundet und wurde Mitglied des romantischen Liederkreises, der sich um Friedrich Kind, den Dichter des Freischütz, Theodor Hell, den Herausgeber des Taschenbuchs Penelope, und Artur v. Nordstern, d. h. den Minister von Nostiz, bildete. Außerdem hatte sie innerhalb und außerhalb dieses literarischen Kreises, der auch die Musik pflegte, einen starken Familien- und speziell Damenverkehr. Am 26. August 1822 notiert sie z. B., daß sie seit dem 15. noch keinen Mittag zu Hause gegessen habe. Besonders nahm sich eine ältere Dame, Frau v. Fink, ihrer mütterlich an, richtete ihr in ihrem Hause gratis eine Wohnung ein, so daß sie hier auch ein häusliches Zusammenleben, eine Art Familienglück, fand. Sie kauft sich ein Bett, einen Sekretär, Porzellan, silberne Löffel, Gläser, gibt Teegesellschaften und findet, daß es bei ihr immer am allergemütlichsten sei. Von Cotta bekommt sie jährlich 40 Louisdor, von andern Verlegern 50-60, und damit hat sie ihr gutes Auskommen. Sie wird auch als Sehenswürdigkeit und Berühmtheit viel eingeladen. Sie schreibt daher in ihr Tagebuch: "So leicht wüßte ich mir kein angenehmeres Leben zu denken, wie mein jetziges, - umgeben von gebildeten Menschen, von ihnen wert gehalten, durch meine Verhältnisse gezwungen, meine Lieblingsbeschäftigung, Lesen und Schreiben, zu meinem Berufe zu machen, für den Augenblick ohne Nahrungssorgen - aber," fügt sie seufzend hinzu - "doch, ach! nicht glücklich! Denn die besten Anlagen meiner Natur bleiben ungeübt, unentwickelt, kommen niemand zu gut. Ich bin allein!" Oder sie schreibt: "Besuche, interessante Lektüre, Arbeit; alles gut und angenehm, aber welche Rechenschaft soll man einst Gott von solchem Leben ablegen? Welche Pflicht habe ich zu üben? Was hat mein Herz zu leisten?" Ein andermal klagt sie: "Gestern ermüdete mich die Vorlesung bei Tieck. Die vielen Zerstreuungen reiben mich auf. Für den Umgang mit 2 bis 3 mir wahrhaft lieben Menschen gäbe ich all diese Geselligkeit freudig hin. So viel Menschen um mich, so viele Freundlichkeit, und doch in der Tiefe meiner Seele das Gefühl einer grenzenlosen Einsamkeit!" Es sind das Stoßseufzer einer normalen alten Jungfer.


|
Seite 265 |




|
Ein anderes Mal täuscht die angeborene Liebe zu Glanz und allem vornehmen Wesen und das Bewußtsein von ihrer außerordentlichen Beliebtheit, ihrer zentralen Stellung in der Gesellschaft, sie über die innere Einsamkeit und Leere hinweg: "Was bin ich denn?" fragt sie sich, heimgekehrt von einer Gesellschaft bei der Gräfin Dohna oder der Fürstin Jarazewska, "ein blutarmes, verblühtes, bürgerliches Mädchen, ohne alle Familienkonnexionen, bin ich nichts als Fanny Tarnow. Mein bißchen Talent ist es nicht, die Brachmann, Chézy, Ahlefeld, sie alle sind mir gleich. Was unterscheidet mich denn? Was gibt mir diesen ausgezeichneten Standpunkt in der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung?" Und sie beantwortet sich diese Frage damit, daß sie meint, es sei ihre besondere Eigentümlichkeit und Gabe, sich die Liebe und das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Im Zweifel an der Zuneigung eines geliebten Mannes erhofft sie auch von dieser Gabe die Möglichkeit, sich Männerliebe zu gewinnen: "Warum willst du, die allgemein Gefeierte, die durch Geist und Herz vor Tausenden ausgezeichnete Frau, deren Macht über so viele doch einzig ihrem Gemüt entspringt, nicht an die Möglichkeit glauben, ihm teuer zu sein?"
Denn das war doch eigentlich der Grund, warum sie immer wieder das Gefühl der Einsamkeit, der Leere, der Sinnlosigkeit ihres Lebens überkam, daß ihr Ideal von Liebe sich ihr nicht verwirklichen wollte. Der Schmerz wie das Glück des Lebens von Fanny Tarnow beruhte auf der Zärtlichkeit ihres Herzens. "Unruhiges Streben, schmerzliche Sehnsucht zehrten stets an mir," sagt sie, "das Glück kann uns meiner Ansicht nur durch die Liebe kommen." In ihrem 41. Lebensjahre (1820) schreibt sie in ihr Tagebuch: "Ich gelte für eins der geistreichsten Weiber unseres Zeitalters, ich besitze Kenntnisse, Seele, Begeisterung, ich kann alles Große und Schöne empfinden, kann glücklich sein im Anschauen der Natur, im Genusse der Kunst, ich bin großsinnig von Gemüt und Charakter, alle kleinlichen Regungen des Neides, des Hasses sind mir fremd - und alles verschwindet vor dem Eindruck, welchen der Kuß eines geliebten Mannes auf mich macht." "Und fehlt mir, die ich mich nie einem ,Manne hingegeben habe, nicht die Krone der Weiblichkeit? Bleibt nicht vielleicht die liebenswürdigste Seite meines Charakters nun ewig unentwickelt? Und bin ich denn nicht auch ein Weib? Ein Weib mit Glut der Phantasie und warmem Blut? Muß ich es nicht als Entbehrung fühlen, diese Fähigkeit, beglücken zu können, nicht entwickeln zu dürfen, wenn ich den Mann entzückt, flehend, berauscht zu meinen Füßen sehe? Es liegt für mich in solcher Leidenschaftlichkeit des


|
Seite 266 |




|
Mannes ein eigner Zauber. Es ist ein ganz anderes, ein schönes, ein erhebendes Gefühl, sich geachtet, wert und hoch gehalten zu fühlen - aber für unsre Weiblichkeit ist es ein unaussprechlich süßer und gewiß ein wahrhaft und rein menschlicher Genuß, uns als Weib, als liebenswürdiges, Wonne und Glück spenden könnendes Weib begehrt zu fühlen." Und doch schrickt sie vor dem Gedanken an eine eheliche Verbindung immer wieder zurück. Und sie fährt fort: "Hingabe als Genuß betrachtet hat keinen Reiz für mich - ich kenne das nicht, ich habe das nie entbehrt, nie gewünscht und in meiner Phantasie war hier von jeher eine Grenze, wo sie darum verschüchtert stehen blieb. Aber die Männer haben mich ahnen lassen, wie sie ein Weib in solchen Augenblicken zu vergöttern vermögen - und daher ist mir die Idee eines Ehebettes ordentlich schauderhaft zuwider."
Aber ihre große Liebesleidenschaft, die Liebe zu Ernst Moritz Arndt, ist ja nun längst vorüber. Mit Bezug auf ihn hatte sie geschrieben: "Warum mußte mein Gemüt, durch Poesie gebildet, so empfänglich für den Zauber wahrer Liebe sein? Warum mußte mir in Arndt der einzige Mann erscheinen, dem ich mich ganz hätte hingeben mögen? Was ist mir aller Ruhm im Vergleich zu dem Glück, das mir durch das Herz hätte werden können!"
Jetzt, in Dresden, in ihren 40er Jahren, wo sie die leidenschaftliche Huldigung mehrerer, aber weit jüngerer Männer empfängt, werden ihr statt der großen, reinen Liebe nur schmerzliche Herzenswirren zuteil. Sie gibt sich diesen hin, teils weil sie nicht anders kann, teils weil ihr ein liebewehes Herz noch immer lieber ist als ein kaltes, erstorbenes. Sie wünscht nichts Materielles aus dieser Liebe, als daß sie ihr "Vermittler werde zwischen ihr und der Gottheit, daß sie sie durchglühe für das sittlich Schöne, und daß ihre Seele auch die gelähmten Fittiche wieder zu entfalten vermöge." Etwas prosaischer ausgedrückt: Sie erhofft von dieser Liebe eine Neubefruchtung ihrer Phantasie, eine Neubelebung ihres schriftstellerischen Könnens, weil dadurch wieder in ihr etwas vorhanden sei, das ihre Darstellung beseelen werde, auf daß ihr das Schwanenlied ihres Herzens gelingen möge. So hat sie sich in den ersten Dresdener Jahren der Liebe zu dem jugendlich schönen Dr. Waldemar Seifart überlassen, obwohl sie sich bewußt war, daß er an geistiger Begabung und Bildung tief unter ihr stand. Aber sie begrüßt diese Liebe als ein Glück, als einen neuen Frühling der Empfindung, der nun auch wieder Blüten der Poesie treiben werde. Sie braucht, um produzieren zu können, solche Herzenbewegungen. So fühlt sie sich in dieser Liebe glücklich, und am Schluß des Jahres 1822 schreibt sie in ihr


|
Seite 267 |




|
Tagebuch: "Ein glückliches, schönes, unvergeßliches Jahr liegt hinter mir!" Aber daß ihr Herz von ihrer Liebe überwältigt ward, mußte sie dann mit Bitterkeit erkennen, als der geliebte Waldemar ihr eines schönen Tages des nächsten Jahres mit der freudigen Kunde nahte, daß er sich anderweit verlobt habe, mit einem hübschen, unbedeutenden, aber jungen Mädchen. Da ist sie außer sich, und Gefühle, deren sie sich nie fähig gehalten hat, bedrängen ihr Herz. Und sie prophezeite ihm: Sein Los wird nun eine bis zur Gemeinheit flache Alltäglichkeit werden! Aber als die Wirklichkeit noch schlimmer wurde als diese Voraussage und die junge Frau einige Jahre später durch Selbstmord endete, da stand Fanny an ihrem Grabe in bitterer Reue darüber, daß sie diese Unglückliche gehaßt und ihr den Besitz ihres Waldemar nie gegönnt habe.
In den Jahren 1825 und 1826 machte Fanny größere Reisen. Zuerst in ihre Heimat zu Verwandten und Freunden, wobei sie auch in nahe Beziehungen zu der verwitweten Erbgroßherzogin Auguste trat, infolge ihres rege betätigten religiösen Interesses. Sodann brachte sie längere Zeit in Frankfurt und Weimar zu, wo sie Goethe kennen lernte.
Nach Dresden zurückgekehrt, erlebte sie anfangs 1827 ihr letztes Liebeserlebnis als 48jährige. Wie sie im Tagebuch erzählt; trieb es plötzlich einen 22jährigen Jüngling, namens Schroeder, der Maler war oder werden wollte, zu ihr hinzueilen, aus Sehnsucht nach Seelennahrung, wie sie schreibt. Mit ihm entwickelt sich nun noch einmal ein Liebesverhältnis, das von seiner Seite höchst exaltiert zu sein schien. Er zollte ihr eine Anbetung, wie "man sie nur Göttlichem und Heiligem zollen" kann, und sie war in ihrem Herzen gerührt und nur von Zweifeln gequält, ob sie noch wert sei, eine so reine Huldigung zu empfangen. So konnte es denn nicht ausbleiben, daß sie schließlich von neuem enttäuscht, diesmal aber wohl auch betrogen wurde. Denn Schroeder, der sie in Dresden malte oder wenigstens zu malen versuchte, von da nach Düsseldorf und zuletzt nach Hamburg ging, scheint es nur darauf angelegt zu haben, Geld und Geldeswert von ihr zu erlangen. Sie eilte im September 1828, von ihm zu Hilfe gerufen, nach Hamburg, opferte ihm alles, was sie an Geld noch aufbringen konnte, traf ihn aber körperlich und geistig heruntergekommen an. Später fand er in Hamburg guten Verdienst, weigerte sich aber, die zwei Gemälde, die er von ihr mitgenommen hatte, sowie die 500 Taler, die sie ihm geliehen hatte, zurückzugeben. Diese traurige Erfahrung, sowie der Verlust lieber Freundinnen, besonders der Frau v. Fink, die im Jahre 1828 starb, und endlich


|
Seite 268 |




|
neue Krankheit und ein böses Augenleiden, machten sie so traurig, daß sie im Winter 1828/29 mit Selbstmordgedanken umging. In dieser Stimmung faßte sie den Entschluß, Dresden zu verlassen und nach Weißenfels überzusiedeln, wo sie im Oktober 1828 ihre Schwester Betty besucht und in angenehmen Verhältnissen angetroffen hatte. Durch ihre Freigebigkeit gegen Schroeder, durch ihre längere Krankheit war sie nun aber in wirtschaftliche Bedrängnis geraten; sie kündigte daher eine Subskription an auf eine Auswahl ihrer Schriften in 12 Bänden, die ihr bei 600 Subskribenten etwa 5000 Taler Reingewinn brachte. Auch setzte ihr ein Freund, der Engländer Ch. Wigram, eine Rente von jährlich 50 Taler aus, und endlich bekam sie seit 1828 von Maximilian Klinger aus Petersburg bis an seinen Tod (1831) jedes Jahr 50 Taler zugesandt. Den Frühling 1829 hindurch war sie krank und Michaelis 1829 zog sie nach Weißenfels, wo sie sich ganz erholte und wie in einem ruhigen und sicheren Hafen angelangt fühlte. Mit dem lebhaftesten Dankgefühl gegen Gott blickt sie daher im Dezember 1829 auf dieses Jahr zurück. Ihr Tagebuch schließt mit den Worten: "Ich habe nicht umsonst gelebt, denn die Achtung vieler edler Menschen ist mein, und nach so unsäglichem Elend ist mir doch noch die Fähigkeit geblieben, Gott zu lieben, mich an allem Schönen und Guten, vorzüglich aber an der Natur zu erfreuen und auch als Christin mit meinem Tode vertraut zu machen."
Nachdem sie sich in Weißenfels eingelebt hatte, richtete sie hier aber auch wieder einen literarischen Kreis ein, indem sie junge Leute aus gebildeten Familien, die sich für Literatur interessierten, Montags abend um sich versammelte. An diesen Abenden hat die junge Luise v. François teilgenommen und hier in der wachsenden Freundschaft zu der Tarnow die Richtung auf das Literarische erhalten. Wenn nun Fanny Tarnow in dem stillen Provinzialstädtchen auch ganz einfach und ohne Aufwand, selbst ohne Toiletten und Gesellschaften, aber zufrieden lebte, so blieb sie doch durch Reisen nach Dresden, Berlin und Leipzig auch im Zusammenhang mit der literarischen Welt. Ihr Leipziger Freund Gustav Kühne, der Herausgeber der Zeitung für die elegante Welt, nannte sie bei einem Besuche in Weißenfels: Eine Iphigenie unter den Weißenfelsern, und es klingt wie ein Ton aus vergangenen Zeiten, wenn er ihr schreibt: "Sie stehen so fest und sicher am Bogen meines Lebens, daß das Bedürfnis zu verehren und zu huldigen nie irre geht, wenn es bei Ihnen bleibt." Gegen das Ende der 30er Jahre versichert sie, daß sie beglückt sei durch die stille Heiterkeit, die nun am Ende ihres Lebens der Grundton ihres Wesens geworden sei.


|
Seite 269 |




|
In Weißenfels ist sie von 1829 bis 1842 geblieben, dann aber zog sie nach Dessau und kehrte damit noch einmal in die große, vornehme Welt zurück. Den Anlaß, von Weißenfels fortzugehen, gab ihr die Verheiratung ihrer Schwester Betty mit dem Kriegsrat Kauffmann in Berlin. Tagebücher haben wir weder aus Weißenfels noch aus Dessau von ihr, aber mit ihrem Fortgang beginnt der umfangreiche Briefwechsel mit Luise v. François den ich ebenfalls im Nachlaß der François fand, und der bis zu ihrem Tode im Jahre 1862 reicht. Er wirft nicht nur ein Licht auf ihr Leben in Dessau, sondern auch auf das Leben und Wesen des Anhalter Hofes und nicht zum wenigsten auch auf den Charakter und die Entwicklung der Luise v. François. Er verbreitet sich ferner über religiöse, literarische und künstlerische Fragen und nimmt den lebhaftesten Anteil an den politischen Ereignissen, den schleswig-holsteinischen Freiheitskämpfen, der Revolution von 48 und der darauf folgenden Reaktion. Einige Mitteilungen aus diesen Briefen mögen die Lebensgeschichte der Tarnow noch vervollständigen helfen. - Im Jahre 1843 schreibt sie aus Dessau: "Von mir, liebste Luise, kann ich Ihnen nur Erfreuliches sagen. Mein Befinden ist besser, wie es seit vielen Jahren war, und in geselliger Beziehung bleibt mir nichts zu wünschen übrig. Die Form des Lebens, in der ich mich hier bewege, sagt mir zu, da ich in solchen Kreisen groß geworden und fast immer, die in Weißenfels verlebten Jahre ausgenommen, darin gelebt habe. Als Bürgerliche bin ich von dem eigentlichen, steifen Zwang des Hoflebens entbunden, da ich nicht tafelfähig bin - desto angenehmer sind aber die kleinen Zirkel bei den Herrschaften. Die Herzogin ist geistreich und liebenswürdig, ihre Tochter, Prinzessin Agnes, ein wahres Herzblatt, und mit der Prinzessin Friedrich könnte ich beinahe den Ausdruck gebrauchen, daß mein Umgang mit ihr recht angenehm sei, da ich wöchentlich einen Abend, bisweilen auch zwei, bei ihr zubringe. Wir haben viel große Gesellschaften, ein ziemlich gutes Theater, schöne Konzerte, allerliebste Lesezirkel, Bücher vollauf - meine Hausgenossen sehn mich ganz so an, als ob ich zu ihnen gehöre, kurz, es bleibt mir vor der Hand nichts zu wünschen übrig. Bloß meine Toilette fordert hier mehr Aufwand, und noch gestern, als ich in schwerem, reich besetztem Seidenkleide und weiß atlassenem, spanischem Federhut vor dem Spiegel stand, mußte ich lachen, wenn ich mich der jahrelangen sorglosen Bequemlichkeit meines Anzugs erinnerte." Von den schönen Frühlingstagen des Mai 1843 in Dessau ist sie ganz entzückt: "Wie habe ich den Mai genossen! Ich bin täglich mit einer oder der andern meiner Freundinnen spazieren gefahren.


|
Seite 270 |




|
Das ganze Land ist ein reizender, lieblicher Park. Nie hatte ich mir träumen lassen, daß der Abend meines Lebens noch so reich und schön werden könnte!" Dazwischen freilich liegen wieder einige Krankheiten, die sie immer wieder befallen, dann aber auch wieder schöne Reisen nach Leipzig, Berlin oder Dresden, von denen sie immer mit großem Gewinn an Lebensfreude heimkehrt. Allmählich tut sie dann aber auch Einblicke in allerlei "unwürdige Kabalen an dem Duodezhofe" zu Dessau, die ihr es zuletzt doch bedenklich erscheinen lassen, der Luise v. François zu einer Stelle als Gesellschafterin an diesem Hofe zu raten. Aber sie wird nicht müde, diese junge Lieblingsfreundin zu bitten, sie doch in Dessau zu besuchen, und äußert jedesmal, wenn ihr dieser Wunsch erfüllt ist, ihre höchste Freude. Alles weist auch darauf hin, daß Fanny in diesen Jahren in durchaus angenehmen Verhältnissen - auch pekuniär - lebte, wie schon der Vorschlag zeigt, der Luise 100 Taler und mehr zu leihen zu ihrer Ausstattung mit Kleidung, für den Fall, daß sie nach Dessau kommen wolle. Vom Jahre 1846 an, als sie jeder schriftstellerischen Tätigkeit, auch dem Übersetzen, entsagte, war sie freilich in ihrer Einnahme beschränkt, während sie vorher "unbesorgt über Hunderte verfügen" konnte, und bedauert nun, nichts mehr zu verschenken zu haben, da dies ihre beste Lebensfreude gewesen sei; allein sie hatte sich soviel erworben, daß sie für das Notwendige nicht zu sorgen brauchte. Die politischen und konfessionellen Ereignisse nahmen in den nächsten Jahren, wo sie weniger Geselligkeit pflegte, ihr Interesse fast ausschließlich in Anspruch. Auf dem literarischen Gebiet begrüßt sie besonders Werke, die es wagen, "diesen hohlen, nichtigen Erbärmlichkeiten unseres Fürstenpöbels" die Wahrheit zu sagen, würdigt aber auch im vollen Maße "die Kraft und das selbstschöpferische Vermögen" Hebbels in seiner Maria Magdalena. In monatelangen, fast jährlich wiederholten Besuchen bei der Majorin Serre in Maxen bei Dresden erfreut sie sich an dem Umgange mit Dichtern, Künstlern und Gelehrten, von denen das Haus dort nie leer wird, sowie an der Verehrung und Herzlichkeit, mit der alle alten Freunde und neue Bekannten sie auszeichnen, und die ihr in ihren "späten Lebensjahren alle Annehmlichkeiten einer achtungswerten Berühmtheit gewährt, ohne daß sie die Dornen derselben zu fürchten braucht". Gegen das siebzigste Lebensjahr hin entsagt sie allen Hofgesellschaften um so lieber, als sie "dieser jämmerlichen Intriguen, dieser Kriecherei und dieses schmutzigen Eigennutzes" satt ist und in jedem Jahre mehr erkennen lernt, wie wenig der Mensch bedarf, um zufrieden zu sein. Die Zeit (1847) aber erscheint ihr so reich, so groß, so schauerlich schön,


|
Seite 271 |




|
daß sie in ihr das Interesse für die Schöpfungen der Phantasie fast unterdrückt. Wenn sie sich nun auch allmählich etwas einsam fühlt, so sieht sie im Winter doch wieder einige junge Frauen zum Leseabend bei sich. Aus dem jüngeren Geschlecht aber überschüttet sie, während sie aus ihren Bedenken gegen den Charakter ihrer Nichte und späteren Biographin Amely Bölte kein Hehl macht, die junge geistvolle Luise v. François mit Liebe und Zärtlichkeit und wird nicht müde, diese behufs Gründung einer selbständigen Existenz auf den Weg der schriftstellerischen Betätigung zu verweisen, bis sie in der Tat um die Mitte der 50er Jahre zur Feder greift. Sicherlich hätte sie bei ihrer Liebe zu der jüngeren Freundin sich nicht so bemüht; diese zur Schriftstellerei zu veranlassen, wenn sie nicht selbst auch Freude und Erfolg in dieser Tätigkeit gefunden hätte. Wenn sie nun auch immer mehr sich durch die Gicht auf ihr Zimmer beschränkt sah, und schon dadurch ihre Einsamkeit immer größer wurde, so ist doch bei der Lebhaftigkeit ihrer Teilnahme an Literatur, Kunst und Politik, aber auch an dem Ergehen ihrer Verwandten und Freundinnen und bei ihrer durch alle trüben Stimmungen immer wieder durchbrechenden Zuversicht, nicht nur auf ein glückliches Leben mit Gott im Jenseits, sondern auch auf den endlichen Sieg des Guten in der Welt, gar nicht daran zu denken, ein solches reiche und nach menschlichen Verhältnissen glückliche Leben wie das von Fanny Tarnow ein verfehltes nennen zu wollen. "Ich lebe in stiller, friedlicher Einsamkeit," schreibt Fanny an Luise, "das Andenken meiner Freunde ist der Segen, der auf meinem Alter ruht." Mit voller Anteilnahme feierte sie noch das Schillerfest von 1859 mit, wobei sie in Leipzig durch ein Ehrendiplom als Mitglied des Schillervereins überrascht wurde. Ihre letzten Freuden aber waren die ersten Erfolge ihrer geliebten Luise v. François als Schriftstellerin.
Der 82jährigen gichtgelähmten Greisin wurde endlich ihre Sehnsucht nach dem Tode durch ein sanftes Ende im Juni 1862 erfüllt. Luise v. François aber legte die Briefe ihrer Fanny in einen Umschlag zusammen und schrieb auf die Rückseite des letzten: Der letzte Brief von meiner treuen lieben alten Freundin.
Das lebensgroße, von Friederike Hasse in Dresden im Jahre 1820 oder 1821 gemalte Ölbild 4 ) der Fanny Tarnow zeigt ein von wundervollen dunklen Augen beherrschtes Antlitz von edlem, geistigem Ausdruck mit einem leisen Zug von schwärmerischer Wehmut. Dem feingeschnittenen Munde glaubt man es, daß von


|
Seite 272 |




|
dem Zauber seiner Beredsamkeit auch eine Helmina v. Chézy sich hinreißen ließ.
Amely Bölte, die zu ihrer Tante Fanny infolge "der Unvereinbarkeit der Gemüter", wie ihr beiderseitiger Freund Varnhagen sich ausdrückt, nie ein gutes Verhältnis fand, stellt ihre Tante als selbstgefällig und überspannt hin. Vor der nüchternen Wirklichkeit habe sie sich entrüstet in ihr Zimmer zurückgezogen und im Jean Paul gelesen. So habe sie sich mit Truggestalten umgeben, vor denen sie selbst täglich "eine Komoedie des inneren Gesichts" aufgeführt habe. Hochmut liege diesem Spiele zugrunde: man möchte sich schöner, besser erscheinen, als man in Wirklichkeit sei, und schaffe sich darum ein Bild seiner selbst, welches allen Anforderungen der Eitelkeit genüge. So laufe das Ganze schließlich auf fortwährendes Kitzeln der Selbstliebe hinaus. Doch hätte die Sache auch eine "sehr tragische" Seite gehabt, denn weil sie ihre Bewerber durch den "zu schnellen Gang ihrer Liebesintriguen" und ihr aus dem Spiel der Phantasie stammendes starkes Entgegenkommen abgeschreckt habe, so habe sie bei einem liebeglühenden Herzen selten Liebe gefunden, habe sich aber stets eingebildet, geliebt und begehrt zu sein, auch wenn sich die Neigung des andern noch durch nichts verraten hätte. Auch habe sie, ohne schön zu sein, durch Hervorhebung ihrer Persönlichkeit die Ansprüche einer Schönheit gemacht und sei dadurch lächerlich geworden. Schließlich klingt das Buch der Bölte recht elegisch aus; das letzte Kapitel, den "Abend des Lebens", d. h. 40 Jahre, von 1822 bis 1862, auf nur acht Seiten schildernd, beginnt mit den Worten: "Es tritt für jede Frau ein Moment ein, wo sie innerlich vom Leben scheidet. An dieser Grenze des Daseins (mit 43 Jahren!) finden wir Fanny Tarnow mutlos in eine öde Zukunft starrend, unbefriedigt von der Gegenwart, der Vergangenheit mit kleinen Anwandlungen von Reue gedenkend." Zu genau dem gleichen Zeitpunkt schrieb Fanny, wie wir sahen, in ihr Tagebuch: "Ein glückliches, schönes, unvergeßliches Jahr liegt hinter mir!"
Ach nein, diese ganze Charakteristik ist ein boshaftes Zerrbild. Wenn die Nichte über ihre Tante so dachte, so hätte sie ihre Biographie nicht schreiben sollen. Besonders bedenklich erscheint dabei, daß sie die in ihren Besitz genommenen vier Tagebücher der Tante vernichtet hat. Daß diese ihrer Nichte nicht traute, ersieht man daraus, daß sie ihre späteren Tagebücher nicht der Nichte, sondern ihrer Freundin Luise v. François vermacht hat. Aber die Bölte hat es erreicht, daß ihr Buch das Urteil sämtlicher Schriftsteller, die sich über Fanny Tarnow geäußert haben, von Rudolf Schleiden bis Hermann Anders Krüger, bestimmt hat.


|
Seite 273 |




|
Gewisse Grundlinien ihres Charakters sind in der Biographie ja richtig gezogen, aber das Gesamtbild als eines von eitlen und phantastischen Wahnideen getriebenen und schließlich gefoppten Wesens und die Darstellung ihres Lebens als eines unglücklichen und verfehlten ist falsch. Es scheint wirklich so, als ob die Bölte die Stellen, die in den Tagebüchern von Glück und Sonne redeten, geflissentlich unterdrückt habe. Richtig ist ja, daß die Tarnow, wie alle Romantiker, ihr Herz verhätschelt hat, die Ströme des Gefühls und die Stürme der Leidenschaft für die einzig natürlichen Äußerungen geistiger Vornehmheit gehalten und das Alltägliche als gemein verachtet hat. Es mag auch sein, daß sie Liebesandeutungen gegenüber zu leichtgläubig war oder sie zu tragisch nahm, aber es ist unzweifelhaft falsch, daß, wie Rud. Schleiden in seinen Jugenderinnerungen 5 ) meint, die Tarnow sich von jedem Manne, der sich höflich mit ihr unterhielt, geliebt glaubte. Zum Beweise für diese Behauptung beruft auch er sich eben auf das Buch der Nichte Amely Bölte.
Fanny Tarnow mag in ihrer leidenschaftlichen und bisweilen exaltierten Weise geneigt gewesen sein, sich von jemand geliebt oder gehaßt zu glauben, der von einer gleich leidenschaftlichen Empfindung, wie sie ihr Herz durchwogte, weit entfernt war. Auch das mag man zugeben, daß ihr Gefühl leicht umschlagen konnte, daß sie jemanden, den sie lange für edel gehalten hatte, nun plötzlich infolge einer Handlung, die ihr gemein vorkam, vielleicht infolge eines Mißverständnisses, aus der Liste ihrer Freunde strich. Aber daß sie in der Weise, wie die Bölte behauptet, Trugbildern nachgejagt sei, ist falsch. Besonders ist das unwahr, daß sie in jedem Manne einen Heiratskandidaten begrüßt habe. Eine sinnliche Natur im gewöhnlichen Sinne war sie überhaupt nicht. Indem die Bölte meint, daß ihre Tante sich oft fälschlich eingebildet habe, geliebt zu sein, sucht sie die Unmöglichkeit solcher Verliebtheiten der Männer dadurch darzutun, daß sie dieselbe als abschreckend häßlich schildert. Das Ölbild aber straft sie Lügen. Im Gegenteil läßt sich aus ihrer Erscheinung annehmen, daß sie einen starken Eindruck auf die Männer machte, und zwar auch oder grade auf solche, die sich sonst gegen Frauen spröde verhielten, wie Maximilian Klinger oder der Graf Georg Sivers. Allerdings hat Fanny auch von letzterem geglaubt, daß er sie liebe. Aber damit stimmt auch der Brief des Grafen an Fanny überein, der in Riegers Klinger abgedruckt ist. In diesem Briefe schreibt Graf Sivers: "Eben, meine edle Freundin, komme ich


|
Seite 274 |




|
vom Hofe zurück, und noch viel zu aufgeregt, um auf meinem Lager den Schlummer finden zu können, setze ich mich nieder, um an Sie zu schreiben, deren holdseliges Bild auch nicht einen Augenblick aus meinem Herzen verdrängt ist. - Von allen Wundern, die Ihr Geist bewirkt, von allem Zauber, den Ihre Liebenswürdigkeit je geübt hat, ist unstreitig, die Klinger für Sie empfindet, das größte wie der mächtigste." Und er schließt: "Ich bin sehr unruhig, sehr bewegt, teure, teure Freundin. Wie sich nun auch alles wende, immer droht mir Trennung, und wie soll ich es lernen, ohne Sie, meinen Genius, meinen guten Engel, meine Schutzheilige, zu leben!" Damit stimmt genau, was Fanny selbst in ihrem Tagebuche schreibt. - Vollends die vielen Ausbrüche der Leidenschaft anderer Männer, denen Fanny in ihrem Leben ausgesetzt war, kann sie sich unmöglich nur eingebildet haben, dazu waren sie zu handgreiflich. In ihrem Petersburger Tagebuch klagt sie nach einer leidenschaftlichen Szene mit einem gewissen Beske: "Welch ein Tag, Gott, welch ein Tag! Soll denn diese furchtbare Gewalt der fremden Leidenschaft über mein Leben niemals aufhören? Zwei Stunden lang hat er zu meinen Füßen gelegen, sie geküßt, meine Knie umfaßt, geweint - oh mein Gott, das ist nicht Liebe, es ist die Gewalt der leidenschaftlichsten Sinnlichkeit!"
Fanny bezeichnet sich selbst mit einiger Selbstironie zur Zeit, da ihr Bild gemalt ist, als "verblüht, mit Spuren, daß sie ehemals hübsch war." Ist das zuviel gesagt? War also in den Jahren ihrer Blüte ihr Äußeres schon anziehend, so war es ihre geistige Person ohne Zweifel noch in weit höherem Maße. Der "Zauber ihrer Beredsamkeit" riß die Helmina v. Chézy hin. "Ich trug sie wie ein Kleinod im Herzen," fügt sie hinzu. Das Ideale, Edle, Große zog sie im Gebiete des Geistigen besonders an. Daher war sie auch eine leidenschaftliche Patriotin, was ihre Aufzeichnungen aus der Zeit vor und zu den Freiheitskriegen ebenso beweisen, wie ihr Heimweh in Rußland und ihre Erregung während der Kämpfe von 1848. Nach der Schlacht von Jena (1806) schreibt sie: "Ich habe ganze Nächte geweint, mich schlaflos wie auf Dornen gewälzt - nun ist jede Hoffnung für Deutschland dahin. Wie erträgt man das Leben noch!" Nach des Major Schills Tode ruft sie aus: "Warum kann ich nicht Blut statt Tränen weinen! Gott lasse mich nie die Zeit erleben, wo wir geduldig wie der Ochs im Joche einhergehen werden!" Und im Jahre 1848 schreibt sie an H. v. François: "Alle Träume meiner glühenden Jugendbegeisterung für Freiheit und Vaterland leben in meiner Seele wieder auf!"


|
Seite 275 |




|
Bei ihrem "Bedürfnis, Höheres zu verehren", kann es nicht Wunder nehmen, daß die Tarnow auch ein starkes religiöses Gefühl hatte. Sie ehrte es noch im Alter als eins der edelsten Geschenke der Vorsehung, daß ihr ein so zuversichtliches Bewußtsein der Unsterblichkeit zuteil geworden sei. "Aber," fügt sie hinzu, "alles, worüber gestritten werden kann, ist nicht mehr zum Wesen der Religion gehörig." In der Natalie erzählt sie, daß der Mystizismus ihres Konfirmandenunterrichts sie wie Poesie ergriff, wie denn ihr ästhetisches Bedürfnis von ihrem religiösen nicht zu trennen war. Den Dogmenglauben hat sie immer abgelehnt, dagegen sich der Theosophie genähert. Als sie Arndts Bekanntschaft macht und bei seinem ersten Anblick schon Vertrauen und Liebe empfindet, denkt sie dabei an ein Begegnen in einem früheren Leben; "solche Momente," sagt sie, "sind wahrscheinlich Momente der Wiedererkennung, sind heilig!" "Viele Denker," schreibt sie an die François, "schreiben dem groben Erdenleib eine sensible Atmosphäre zu, und dieser feine unsichtbare Ätherleib vermag uns viele Wunder zu erklären. Alles Äußere, alle Ereignisse sind nur Material für die bildende Schöpfungskraft der Seele."
Eine übergroße Empfindlichkeit war die Eigenschaft, die der Tarnow die meisten Qualen ihres Lebens verursachte, körperliche wie geistige. Häufig war sie krank, meist infolge seelischer Erschütterungen. So leicht sie geneigt war, Freundschaften zu schließen, so leicht zog sie sich auch zurück, wenn sie sie verletzt fühlte. Unendlichen Kummer haben ihr die Kränkungen ihrer Bekannten, wirkliche und eingebildete, gemacht, und sie liebt ihre Luise v. François besonders auch deswegen, weil sie sie nie beleidigt hat: "Sie, meine Luise, sind mir doch die Nächste und Verwandteste auf Erden! Sie allein haben mich nie betrübt, nie gekränkt. Das lohne Ihnen Gott!"
Und doch blieb auch dieses Verhältnis nicht ohne einen geheimen Stachel für die ältere Freundin. Fanny mußte es erleben, daß ihre geliebte Luise, wenn auch durch sie angeregt und veranlaßt, die literarische Laufbahn doch in ganz anderer und völlig unromantischer Weise einschlug und daher auch den ihr so oft angebotenen und so gern erteilten literarischen Rat der älteren Freundin ablehnte. Die ersten Erfolge der François waren somit für Fanny Überraschungen, die sie wohl mit herzlicher Freude begrüßte, an denen sie aber geistigen Anteil nicht hatte.
Fanny Tarnow ist einmal als vierjähriges Kind aus Angst vor ihrem Vater, der sie mit dem Stock züchtigen wollte, aus dem Fenster gesprungen. Die Folge des Sturzes war langes Krankenlager, noch längere Kränklichkeit, dauernde Entfremdung von dem


|
Seite 276 |




|
Vater. Dies trug auch dazu bei, daß sie ein so frühreifes Kind wurde, fast ohne Gespielen aufwuchs, sich so bald zur Lektüre hinwandte. "Als Kind von sechs Jahren las ich schon Romane," erzählt sie, "und als ich 16 alt war, vergötterte ich Schiller Stücke, Don Karlos wußte ich auswendig, Kabale und Liebe, die Räuber entzückten mich." Um dieselbe Zeit schickte sie sich an, auch selbst schriftstellerisch tätig zu sein. Sie schreibt 1846 an Luise v. François: "Es ist mir durch mehr als 50jährige Gewohnheit zur andern Natur geworden, täglich einige Frühstunden am Schreibtisch zuzubringen." Vielleicht aber darf man dieses Schreiben zunächst als Tagebuchschreiben definieren, dessen sich Fanny stets mit Hingebung befleißigt hat. Sicherlich ist sie aber auch schon sehr früh gedruckt worden, denn eine alte Tagebuchstelle lautet: "Durch meine kleinen Versuche in der Literatur bin ich bekannter geworden, als ich vermuten konnte." Und weiter: "Durch die Stillersche Buchhandlung [in Rostock] habe ich erfahren, daß meine an Wieland, Rochlitz und Seume eingesandten Sachen mit achtungsvoller Güte aufgenommen sind, zu gleicher Zeit las ich in dem Freimütigen eine mich betreffende Anzeige des Redakteurs, dem der Censor den Abdruck meines Aufsatzes untersagt hat." Das ist doch in der Tat für eine Anfängerin schon ein schöner Erfolg. Ihre erste größere Erzählung, Allwina von Rosen, wurde dann 1806 von den vorhin genannten drei Männern, der Redaktion des Journals für deutsche Frauen, gebracht.
Von dem von Helmina v. Chézy ihr gestohlenen Tagebuch hatte ja Fanny Tarnow die Ausrede gebraucht, es wäre ein Romanentwurf. Ganz so unrichtig, wie die Chézy meinte, war das doch wohl nicht. Denn sie hat in der Tat ihre Tagebücher, wie auch ihre Briefe, zu ihren schriftstellerischen Arbeiten sehr stark benutzt. Manche von ihren Erzählungen sind ganz oder größtenteils selbst erlebt. So besonders die Natalie, die ihre Jugendgeschichte enthält, und die "Erinnerungen aus Franziskas Leben", in denen Kopien von ihrer Mutter und ihr selbst, Eduard Hitzig und Graf Sivers vorkommen. Hier ist es auch einmal möglich, durch Vergleich mit dem Petersburger Tagebuch den Grad der Übereinstimmung zwischen beiden festzustellen. In der Novelle heißt es:
| Novelle: | Tagebuch: | |
| Wir schwiegen beide, solange der | Es war Abendfeier in der Natur, | |
| Wagen durch die Gassen rollte, | als wir wieder ins Freie kamen. | |
| allein sowie wir ins Freie kamen, | Er fing an mit mir zu sprechen, | |
| fing er ohne alle Vorbereitung an, | und in dem Augenblick war alle | |
| mit mir von seiner Lage zu reden, | meine Bangigkeit verschwunden. | |
| und bei dem ersten Worte war alle | Mir war, als sei ich gestorben und |


|
Seite 277 |




|
| meine Bangigkeit verschwunden. | rede wie sein Schutzengel mit ihm | |
| Mir war, als sei ich schon gestor- | - er zeichnete mir das Bild einer | |
| ben und rede als sein Schutzengel | Gattin, wie er sie sich wünschte - | |
| mit ihm. Er erwähnte den Wunsch | nun ja, es war mein Bild, Zug | |
| seiner Mutter, ihn mit Lady Cae- | für Zug - und wo, fragte er | |
| cilie verheiratet zu sehn, allein er | mich, die Augen zu mir aufhebend, | |
| schilderte mir auch, wie ihn, seinem | wo soll ich diese Gattin finden, da | |
| Sinn und seinen Gefühlen nach, | mein Herz nicht verstanden wird, | |
| eine alltägliche Ehe schon so un | und jede Frage ohne Antwort | |
| glücklich machen müsse, als sei es | bleibt? Ich habe meine Frau un- | |
| eine schlechte: er zeichnete das Bild | endlich geliebt, und eben daher | |
| einer Gattin, wie er sie sich wün | würde mich eine gewöhnliche Ehe | |
| sche; es war nicht Caeciliens Bild, | schon so unglücklich machen, als | |
| es war das meinige Zug für Zug, | sei es eine schlechte. . . . Ich konnte | |
| wie ich wußte, daß ich in seiner | ihm nun alles, alles sagen, ohne | |
| Seele lebte . . . . Ich fühlte, daß | Rückhalt alles - er mußte fühlen, | |
| der Schmerz, mit dem ich kämpfte, | wie wert er mir war, und daß ich | |
| mir das Recht gab, ganz wahr | nicht glücklich sein kann, ohne ihn | |
| gegen ihn seien zu dürfen . . . ich | glücklich zu wissen. . . . Wir nah- | |
| tat es ohne irgendeinen Rückhalt | men Abschied voneinander für diese | |
| . . . er mußte fühlen, daß er mir | Welt, ja ich hätte ihn glücklich ge- | |
| teuer, sehr teuer war, daß ich nicht | macht, ich wäre es durch ihn ge- | |
| glücklich zu sein vermochte, ohne | worden. Allein Gott spricht durch | |
| ihn glücklich zu wissen . . . Wir | unsere äußeren Verhältnisse und | |
| nahmen noch an diesem Abend | noch durch einen anderen Umstand | |
| Abschied voneinander auf lange | es aus, daß wir nicht füreinander | |
| Zeit, vielleicht auf immer. "Leben | bestimmt sind, ich wünsche nicht | |
| Sie denn wohl, Franziska," sagte | einmal, daß es anders wäre. Aber | |
| er mir, "Ihr Andenken bleibt | nun soll mir auch die grausame | |
| meine schönste, meine unvergeß- | Vernunft nichts einreden gegen | |
| lichste Erinnerung, der Segen mei- | den Schmerz dieser Trennung, ich | |
| ner Lebensfreuden, die Weihe mei- | will ihn rein fühlen. "Leben Sie | |
| ner Tugenden. Sie werden, wo Sie | dann glücklich," sagte er, "Ihr | |
| auch leben, alle edlen Menschen an | Andenken bleibt meine unvergeß- | |
| sich ziehen . . . aber keiner wird | lichste und schönste Erinnerung. | |
| Ihr Andenken bewahren, wie es | Sie werden, wo Sie auch leben, | |
| in meiner Brust bis zum letzten | alle edlen Menschen an Sich ziehen, | |
| Schlage meines Herzens lebt." Er | aber nie wird jemand Ihr Anden- | |
| küßte mir die Hand, ich gab ihm | ken inniger bewahren als ich." | |
| die andre auch, und segnete ihn | Er küßte mir die Hand, ich gab | |
| und sein edles Leben, und dann | ihm die andre auch, aber ich | |
| schieden wir. - | konnte ihm nicht meine Lippen | |
| bieten, wie er es zu wünschen | ||
| schien, ohne es fordern zu wollen. |
Warum hat nun Amely Bölte die sämtlichen von ihr benutzten Tagebücher (mindestens vier) vernichtet? Es scheint doch so, daß sie dadurch eine Nachprüfung ihres Buches und der Charakteristik ihrer Tante verhindern wollte. Das ist ihr auch gelungen. Die Erfindungsgabe Fanny Tarnows ist, wie sie selbst wußte, nicht groß gewesen. Ich will aber auf den Inhalt ihrer Romane nicht eingehen, sie sind tot, wie die ihres Meisters Fouqué. Nur zur Probe gebe ich ganz kurz den Inhalt der Erstlingsnovelle Allwina.


|
Seite 278 |




|
von Rosen: Allwina lernt einen polnischen Grafen kennen, mit schönen dunklen Augen und einer prachtvollen Uniform, dem ihr Herz auf den ersten Blick zufliegt. Durch ihr wundervolles Tanzen und ihr zauberhaft graziöses Gespräch hingerissen, entbrennt auch er in Leidenschaft. Da er aber in die polnische Revolution verwickelt ist, und ihre Tante auch nicht wünscht, daß sie sich nach Polen verheiratet, so kommt es zum herzzerreißenden Abschied auf ewig. Aber nach einiger Zeit kauft sich der polnische Graf durch Vermittlung der guten Tante ein Rittergut in der Nähe der Eltern Allwinas, und diese wird ihm dort zu ihrer Überraschung eines Tages unter Pauken und Trompeten, blühenden Blumengewinden und Tränen seligsten Entzückens reich geschmückt an das Herz gelegt. Ich glaube, das gäbe heute noch einen wunderhübschen Film. - In den späteren Geschichten stirbt die edelmütige Heldin, nachdem sie dem Glück entsagt, meist an einer romantischen Krankheit, wovon sie eine reiche Auswahl bietet, mit Bevorzugung des gebrochenen Herzens. "Es hat wohl nie eine subjektivere und sentimentalere Schriftstellerin gegeben als sie, und dennoch halten wir sie für eine wahrhaftige Dichterin. Wahr und ergreifend ist von ihr der unsäglichste aller Jammer, der einer ungleichartigen Ehe geschildert," schreibt Franz Horn im Jahre 1819, "Ihre Thorilde v. Adlerstein ist das nächtlichste aller Bücher, selbst die Tugend erscheint hier als schwarzverschleierte Gestalt."
Die phantastisch-romantischen Elemente ihrer Dichtungen, das Zauberhafte, Dämonische, die weiche Mondscheinstimmung, die tränenreiche Entsagung, stehen aber unausgeglichen neben den realistischen, aus dem Leben genommenen Szenen, geistvollen Bemerkungen, feinen Beobachtungen, hübschen Naturschilderungen. Dadurch tritt die dürftige Erfindung und schwache Komposition erst besonders deutlich hervor. Einen gegebenen Stoff weiß die Tarnow gewandt, klar und spannend vorzutragen. Sie ist nicht nur gefühlvoll, sondern auch geistreich und anmutig, allerdings ohne Humor. So sind die vortrefflichen Berichte, die sie über Rußland und Petersburg an Cotta sandte, noch heute mit Genuß zu lesen. Es wäre nicht schwer, aus ihren anschaulichen Schilderungen, anmutigen Plaudereien und gemütvollen Briefen ein Bändchen zusammenzustellen, das sie der unverdienten Vergessenheit entreißen würde, in die sie nicht ohne Schuld ihrer Biographin versunken ist. Mehr allerdings als ihre Schriftstellerei bedeutet ihre lebensprühende, bezaubernde, für die jüngere Romantik so überaus charakteristische Person. Von hier aus gesehen ist Fanny Tarnow in der Tat eine der glänzendsten Frauengestalten ihrer Zeit.
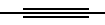


|
[ Seite 279 ] |




|



|


|
|
:
|
IX.
Die geschichtliche und landes=
kundliche Literatur
Mecklenburgs 1926/1927
von
Werner Strecker.
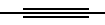


|
[ Seite 280 ] |




|


|
Seite 281 |




|
- Schuchhardt (Carl), Arkona, Rethra, Vineta. 2., verb. u. verm. Aufl. Berlin 1926, Schoetz u. Co.
- Beltz (Robert), Vorgeschichtl. Stätten u. Untersuchungen in Meckl.-Schwerin i. J. 1926: Nachrichtenbl. f. deutsche Vorzeit, Jg. III, H. 1, 1927.
- Beltz (Robert), Bannriten in Wendengräbern: Zeitschr. Meckl. 21.
- Becker, Unsere Grabungen in Dierkow: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- Tode (Alfred), Ein früheisenzeitliches Gräberfeld in Selmsdorf: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeburg, 9. Jg., H. 2.
- Hasenkamp (Georg), Zwei Burgstädte der unteren Elbe, Siedlungsgeographische Betrachtung von Boizenburg und Lauenburg: Mitt. d. Geogr. Gesellsch. Rostock, 1926.
- Eckermann (Walther), Die Siedlungen des nordöstlichen Mecklenburg: Mitt. d. Geogr. Ges. z. Rostock, 11.-15. Jg., 1925.
- Witte (Hans), Slawische Reste in Mecklenburg und an der Niederelbe. Bei W. Volz, Der ostdeutsche Volksboden, 2. erw. Aufl., Breslau, Hirt, 1926. Sonderdruck.
- Witte (Hans), Forschungen zur Geschichte des Deutschtums im Osten, Vortrag auf der Historikertagung in Breslau Okt. 1926: Altpreußische Forschungen, Jg. 4, H. 1, 1927.
- v. Bülow (Jobstheinrich), Wie d. m. Land mit deutschen Bauern besiedelt wurde: Rost. Anz. 17. Juli 1926 (Nr. 164).
- Curschmann (Fritz), Die Aufgaben der Historischen Kommissionen bei der Erforschung der mittelalt. Kolonisation Ostdeutschlands, Vortrag auf der Historikertagung in Breslau Okt. 1926: Altpreußische Forschungen, Jg. 4, H. 1, 1927.
- Krüger (Georg), Mittelalterl. Ordensniederlassungen im Lande Stargard: M. Monatsh. Mai 1927.
- Winkler (Wilhelm), Der Güstrower Erbfolgestreit bis zum Ausscheiden Gutzmers (1695-1699): Meckl.-Strelitzer Geschichtsbl., 2. Jg., 1926.
- Beste (Niklot), Mecklenburgs Verhältnis zu Kaiser und Reich vom Ende des Siebenj. Krieges bis zum Ausgang des alten Reiches (1763-1806): M. Jahrb. 90.
- Schulz (Franz), Aus vergilbten Papieren, Aufzeichnungen des Freiw. Jägers Fischer im Brandenb. Husarenreg. Nr. 3, komm. z. Hauptquartier des Feldm. Fürsten v. Blücher. Der 18. Juni 1813: Meckl. Nachrichten 1927, Nr. 139, 140.
- Kriegsnöte der Stadt Schwerin: Meckl. Nachr. 1927, Nr. 134, 140.
- v. Pentz (C. A.), Franz v. Florencourt und das großdeutsche Mecklenburg: Wochenschr. f. Politik u. Kultur, 24. Jg., H. 23 (11. Juni 1927).
- Grobbecker (Hans), Mecklenburg-Strelitz in den Jahren 1848-1851: Meckl.-Strelitzer Geschichtsbl., 2. Jg., 1926.


|
Seite 282 |




|
- Pagel (Karl), Mecklenburg und die deutsche Frage von 1866 bis 1870/71: Meckl.-Strelitzer Geschichtsbl., 2. Jg., 1926.
- v. Maltzan (Wilh., Frh., Moltzow), Der Mecklenb. Adel: Deutsches Adelsblatt 1926, Nr. 17.
-
Schultze (Johannes), Kaiser Wilhelms I.
Briefe an seine Schwester Alexandrine und
deren Sohn Großherzog Friedrich Franz II.
Berlin u. Leipzig (Köhler), 1927.
Bespr. von G. Schuster, Forsch. z. Brandenb. u. Preuß. Gesch. Bd. 40, 1, S. 177 f.
- Krüger (Georg), Dreißig Dörfer des Fürstentums Ratzeburg, Geschichte der Bauernschaft, 2. Aufl., erweitert u. bis zur Gegenwart fortgeführt von Prof. Dr. Heinrich Ploen. Herausg. v. Heimatbund f. d. Fürst. Ratzeburg. Schönberg i. M. 1926 (Hempel). 351 S.
- Familiengeschichtl. Quellen, Zeitschr. familiengeschichtl. Quellennachweise, Band 2, herausg. von Oswald Spohr, Leipzig, Degener u. Co., Inh. Osw. Spohr.
- Familiengeschichtl. Fehler-Quellen, Samml. familiengeschichtl. Fehlermaterials, Beil. z. d. Familiengesch. Quellen. Bd. 1, H. l u. 2. Schriftl. W. K. v. Arnswaldt-Fischbeck (Weser). Leipzig, Degener u. Co.
- Bohnsack (Joh.), Familie und Volk, Forschung und Aufstieg: Zeitschr. Meckl. 21, H. 4.
- Schmaltz (Friedrich), Rostocker Ehen in alter Zeit: M. Jahrb. 90.
- v. Rodde (Cuno, Frhr.), Gelegenheitsfindlinge aus meinen genealogischen Sammlungen: M. Jahrb. 90.
- Münster (Otto), Bernhard Christian Kosegarten, Pastor in Grevesmühlen 1750-1803: Zeitschr. Meckl. 21, H. 4.
- Salinger (J.), Klimatische Kuren an der Ostsee: M. Monatshefte 2, S. 337-339.
- Krause (Ludwig †), Die Rostocker Heide im Spiegel ihrer Orts-, Forst- und Flurnamen, mit 5 Karten, herausg. von Julius Bühring und Ernst Dragendorff. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock XIV, 1925.
- B., Mecklenburgs Waldbäume: Rost. Anz. 31. Juli 1926, Nr. 176, 3. Beibl.
- Bieger, Der mecklenb. Wald einst u. jetzt: Meckl. Monatshefte Aug. 1926.
- v. Bronsart, Die Redefiner Wildbahn: Meckl. Monatshefte Aug. 1926.
- Buddin (Fr.), Die Flurnamen von Blüssen, Hof und Dorf Menzendorf, Lübseerhagen, Mit Karte: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 8. Jg. 1926, Nr. 3.
- Staak (G.), Flurnamen: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 8. Jg., 4.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Gr.- u. Kl.-Bünsdorf: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 9. Jg., 1.
- Warnke (W.), Der Klüschenberg bei Stargard: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 3. H., 1926.


|
Seite 283 |




|
- Karbe (Walter), Die Feldberger Seen: Meckl.-Strelitzer Heimatbl. 2. Jg., 2. H., 1926.
- Becker (J.), Die Rostocker Heide und der Mensch: Zeitschr. Meckl. 22. Jg., H. 2.
- Spiegelberg (Rud.), Ostseebad Insel Poel. 1927.
- zu Schmidt (Otto), M., ein Heimatbuch. Wismar 1925. Bespr. v. G. Kohfeldt in Lit. Wochenschr. 1926, Sp. 875.
- Krambeer (Karl), Mecklenburgische Sagen. 2. Aufl. Ribnitz, Demmler, 1926.
- Krambeer (Karl), Mecklenb. Sagen für die mecklenb. Schulen. 2. Aufl. Ribnitz., Demmler, 1926.
- Strenge (Erich), Denkmalschutz u. Bibliotheken: Zeitschr. Meckl. 21, H. 4.
- Trost (Fritz), Ein Beitrag zur Niedersachsenfrage Mecklenburgs: Zeitschr. Meckl. 22. Jg., H. 1.
- Romberg (G. †), Über Bauern-Hof- und -Haus: Zeitschr. Meckl. 21, H. 4.
- Cords, Runde Häuser in mecklenburgischen Dörfern: Meckl. Monatshefte Sept. 1926.
- Witte (Hans), Einbäume: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeburg, 8. Jg., 1926, Nr. 3.
- Karbe (Walter), Der Einbaum vom Mövensee: Meckl.-Strel. Heimatbl. 2. Jg., H. 3, 1926.
- Ahrens (Adolf), Angelgeräte unserer Großväter: Meckl. Monatshefte Sept. 1926.
- Buddin (Fr.). Senf und Senfmühlen: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 9. Jg., 1.
- Peters (Marie), Mecklenburgische Bauerntänze: Meckl. Monatsh. Okt. 1926.
- Karbe (Walter), Ein unbekannter niederdeutscher Druck (Bußgebet zur Abwendung von Kometengefahr): Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., H. 1, 1926.
- Collijn (Isaak), Neue Beiträge z. Druckertätigkeit d. Michaelisbrüder in Rostock: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- v. Maltzan-Moltzow (Wilh. Frhr.), Parforcejagden und Pferdemarkt in Neubrandenburg: Deutsches Adelsblatt 1926, Nr. 17.
- v. Bassewitz-Wesselstorf (Graf), Rennsport in Mecklenburg: Deutsches Adelsblatt 1926, Nr. 17.
- Dabelstein, D. Dampffährenverbindung zwischen Warnemünde u. Gjedser: M. Monatshefte Juli 1926.
- Dabelstein, Die ehemaligen mecklenb. Staatseisenbahnen: Meckl. Monatshefte, Dez. 1926.
- Dabelstein, 80 Jahre Eisenbahn Schwerin-Hagenow: M. Monatshefte, April 1927.
- Denkschrift über die forstlichen Verhältnisse in Mecklenburg, bearb. im Auftr. d. Meckl.-Schwer. Minist. f. Landwirtsch. u. Forsten von den Forstmeistern v. Dörina, v. Maltzahn, Clodius, dargeb. der 23. Hauptvers. d. Deutschen Forstvereins zu Rostock, Aug. 1926.
- Drepper (R.), Forstgeschichtliches aus der Rostocker Heide: Meckl. Monatshefte Aug. 1926.


|
Seite 284 |




|
- Heuschert (Carl Aug.), Eine wirtschaftl. Betrachtung der Staatsforsten im Lande Stargard mit besonderer Würdigung ihrer Bedeutung für den Staatshaushalt: Meckl.-Strelitzer Geschichtsblätter, 2. Jg., 1926.
- Bericht über die 46. Hauptversammlung des Vereins mecklenb. Forstwirte (29. Aug. 1925). 1926.
- v. Bülow, Meckl.-Strelitzer Wald: M. Monatsh. Mai 1927.
- v. Warburg, Aus Vergangenheit und Gegenwart mecklenburgischer Warmblutpferdezucht: Deutsches Adelsblatt 1927, Nr. 17.
- Ahrens (Robert), Die Wohlfahrtspolitik des Rostocker Rats bis zum Ende des XV. Jahrh.: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- Werther (Wilh.), Die Gründung der Sparkasse in Rostock im J. 1825: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- Augustin (Karl), Geschichte der Stadt Parchim. Zur 700-Jahrfeier d. Stadt im Auftr. d. Rates herausg. 1926.
- Kägebein (A.), Parchim, Ein Gedenkblatt zum 700jähr. Bestehen der Stadt: Meckl. Nachr. 1926, Nr. 207 (5. Sept.) - 210 (9. Sept.).
- Wessel (F.), Geschichte der Stadt Tessin, Parchim 1926.
- Büsch (Walther), 700 Jahre Wittenburger Geschichte: Meckl. Nachr. 8. Aug. 1926 (Nr. 183).
- Lorenz, Aus "Kalens" längst vergangenen Tagen: Meckl. Monatshefte Sept. 1926.
- Buddin (Fr.), Das Rathaus in Schönberg: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeburg, 8. Jg., 1926, Nr. 3.
- Rugenstein, zum 75. Jubiläum des Stiftes Bethlehem zu Ludwigslust: Meckl. Monatsh. Okt. 1926.
- Denkschrift zur 425jährigen Jubelfeier der Bäcker-Innung zu Güstrow. 1926.
- Hacker (Helmuth), Kloster Ribnitz und seine Klosterdörfer: Diss. Hamburg 1926.
- Schüßler (Hermann), Alt-Woldegk: Bürgermeister Burchardt und seine Zeit 1700-1750: Meckl.-Strel. Geschichtsbl., 2. Jg., 1926.
- Lau (Carl Aug.), Alt-Woldegk. Die Kiekbuschmühle: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 1. H., 1926.
- Lau (Carl Aug.), Alt-Woldegk. Der Streit mit dem Göhrenschen Müller: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 2. H., 1926.
- Warnke (M.), Der Papageienberg in Stargard: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 1. H., 1926.
- Müller (Helmut), Der Friedhof in Stargard: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 3. H., 1926.
- Horn (Alfred, †), Zur Geschichte des Kirchspiels Selmsdorf im Fürstentum Ratzeburg, 2. Band. Schönberg i. M. 1926.
- Ploen (Heinr.), Ein Jubiläum. Wie die bischöflichen Dörfer der mecklenb. Pfarreien Lübsee und Mummendorf vor 550 Jahren erworben wurden: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeburg, 8. Jg., 1926, Nr. 3.
- Müller-Kaempff, Erinnerungen an Ahrenshoop: M. Monatshefte Juli 1926.


|
Seite 285 |




|
- Buhle (Paul), Aus der Vergangenheit der Schelfgemeinde: Gemeindeblatt der Schelfkirche, Schwerin 2. Jg. Nr. 2, Febr. 1927.
- Menges (Emmy), D. Dom zu Güstrow 1226-1926: M. Monatshefte Juli 1926.
-
Schmaltz. (Karl) u. Gehrig (Oskar), Der Dom
zu Güstrow in Geschichte und Kunst. Güstrow,
Michaalsche Hof- u. Ratsbuchdruckerei,
1926.
Bespr. in Zeitschr. f. Denkmalpflege, 1. Jg. (1927), H. 4. - Schmaltz (Karl), Die Kirchenbauten Mecklenburgs, Schwerin 1927 (Bahn).
- Brückner, Rundkirchen in Mecklenb.-Strelitz: M. Monatsh. Mai 1927.
- Ehl (Heinrich), Norddeutsche Feldsteinkirchen. 1926 (Westermann).
- C. B., Mittelalterliche Klosterbauten Mecklenburgs: Rost. Anz. 1926 Nr. 206 und 207 (4., 5. Sept.).
- Lorenz (Ad. Friedrich), Aus Alt-Rostock, Kröpeliner Tor mit Brücke und Ravelin 1800. Der Zwinger vor dem Steintor: Meckl. Monatsh. Juni 1927.
- Dehn (Gustav), Über d. Turmanlage d. St. Marienkirche zu Rostock II: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- Dehn (Gustav), Der gotische Giebel mit Fayenceverzierung (Haus des Bürgermeisters Kirchhof) zu Rostock: Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 15 (Jg. 1926).
- Lutsch (Hans, †), Bausteine zur Kunstgeschichte im Hansegebiete: Hans. Geschbl. 31 (1927). (S. 177 ff.: Doberan.)
- Ehmig (Paul), Die Bedeutung der Kleinstadt für Städtebau und Siedlung. Vortrag, geh. auf d. Städtetag in Parchim 17. Juni 1927. Meckl. Zeitschr. f. Rechtspflege, Rechtswiss., Verw. 1927, H. 11 u. 12. Zeitschr. f. Kommunalwirtschaft XVII. Jg., 1927, Nr. 15.
- Brückner (Margarethe), Die Holzplastik in Mecklenb. von ihren Anfängen bis zum Ausklang des "weichen Stils" (ca. 1250-1450). Diss. Rostock 1926, T. Hinstorffs Hofbuchdruckerei.
- Bethe (Hellmuth), Ein unbekannter norddeutscher Schnitzaltar des 14. Jahrhunderts (Rossower Altar): Cicerone, Halbmonatsschr. f. Künstl., Kunstfr. u. Sammler. 1927, H. 10.
- v. Langermann (A.). Mecklenburger Bildnis-Miniaturen: Mecklb. Monatshefte Sept. 1926.
- Hustaedt (Konrad), Mecklenburg-Strelitzsche Maler. II. Georg Kannengießer 1814-1900: Meckl.-Strelitzer Geschichtsbl. 2. Jg. 1926.
- Schmidt (Wilhelm), Adolf Jöhnssen, ein Maler der Heimat: Meckl. Monatshefte 1927, Febr.
- Dettmann (Gerd), Der Schöpfer des Schweriner Schloßgartens. Der Baumeister Jean Legeay, eine französische Episode in Mecklenburg: Meckl. Ztg. 19. Jan. 1927.
- Krüger (Georg), Die Goldschmiedezunft in Neubrandenburg: Meckl.-Strelitzer Heimatbl., 2. Jg., H. 3, 1926.
- Meyer (Clemens), Über den Werdegang des Schweriner Streichquartetts: Meckl. Ztg. 6. 9. 1926, Nr. 207.


|
Seite 286 |




|
- Meyer (Clemens), Aus alten Zeiten, Samml. kl. Stücke alter Meister, für Violine u. Klavier bearb., Bd. II: Aus Mecklenburger Archiven. 1926 (Breitkopf u. Härtel. Leipzig).
- Hustaedt (Konrad), Landesmuseum Neustrelitz. Neuausstellung der Jagd- und Forstabteilung: Landeszeitung Neustrelitz 926, Nr. 180 (4. Aug.).
- Bahrfeldt (Emil), Zur Münzkunde der Niederlausitz im 13. Jahrh.: Niederlausitzer Mitt. XVII, 2, 1926. Meckl. Münzen auf S. 223 f., 245 nebst Abbild.
- Dommes, Kleine persönl. Erlebnisse in der Schlacht von Soissons im Jan. 1915: Mitt. d. Off.-Ver. F.-A.-Reg. 60, Nr. 44 (1927). Weitere Episoden geschildert von Haupt, ebd. Nr. 45.
- Haupt, Aus den Rückzugskämpfen nach der Marne 1914: Mitt. d. Ver. d. Off. des ehem. G. M. F.-A.-Rgt. 60, Nr. 46 (9. Jg. 1927).
- v. Troschke (Frhr.), Gesch. d. 1. Großh. Mecklenb. Dragoner-Reg. Nr. 17. Ludwigslust, P. Niemanns Buchdruckerei.
- Langfeld (Adolf), Über die Grenzen der Staatshoheit von Mecklenburg-Schwerin und Lübeck in der Lübecker Bucht: M. Jahrb. 90 (1926).
- Langfeld (Adolf), Über die Grenzen der Staatshoheit in der Travemünder Bucht: M. Jahrb. 90 (1926).
- v. Gierke (Julius), Die Hoheits- und Fischereirechte in der Travemünder Bucht. Jetzt gedruckt M. Jahrb. 90 (1926).
- Rörig (Fritz), Nochmals Mecklenburgisches Küstengewässer und Travemünder Reede, I.-III. Teil: Zeitschr. d. Ver. f. Lübeck. Gesch. u. Altertumsk. XXIV, 1, 1926.
- Strecker (Werner), Die Travemünder Reede, Reedelage und Reedegrenze: M. Jahrb. 90 (1926).
- Ploen (Heinr.), Eine alte Formel für die Ausübung des Fahrrechts im Stifte Ratzeburg: Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 9. Jg., 1.
- Stuhr (Friedrich), Die geschichtl. u. landeskundl. Literatur Mecklenburgs 1925/26: M. Jahrb. 90.
- Winkel (Fr.), E. Th. J. Brückner, ein mecklenburgischer Dichter des Hainbundes und Freund von J. H. Voß: Meckl.-Strelitzer Geschichtsbl. 2. Jg. 1926.
- Schlüter (Ernst), Friedrich August Lessen, ein mecklenb. Abenteurer: Meckl. Monatsh. 1927, Febr.
- Winkel (Fr.), Kegebein: Meckl.-Strel. Heimatbl., 2. Jg., 2. H., 1926,
- Teuchert (H.), Meckl. Wörterbuch. II: Tun, tünen: Ztschr. Meckl. 21, H. 4.


|
Seite 287 |




|
Alphabetisches Verzeichnis.
A
del, meckl. 20.
Ahrenshoop 84.
Alexandrine, Großherzogin-Mutter 21.
Altar
(Rossower) 98.
Angelgeräte 50.
B
äckerinnung (Güstrow) 75.
Bannriten
3.
Bauern, Hof- u. Haus 46. 47.
Bauernschaft, im Fürst. Ratzeburg 22.
Bevölkerung 45.
Boizenburg 6.
Brückner, E. Th. J., Dichter 118.
Buchdruck
53. 54.
D
ampffähre 57.
Denkmalschutz
44.
Dierkow 4.
Doberan 95.
Dragoner-Regiment 17. 110.
E
inbaum 48. 49.
Eisenbahnen 58.
59.
Erbfolgestreit (Güstrower) 13.
F
ahrrecht 116.
Fischer, Freiw. Jäger
15.
Florencourt, Franz v., Politiker
17.
Flurnamen 30. 34-36.
Forstwirtschaft 60 ff..
Friedrich Franz
II., Großherzog 21.
G
oldschmiede (Neubrandenburg) 103.
Güstrow
Bäckerinnung 75.
Dom 86.
87.
Gutzmer, Johann, Geh. Rat 13.
J
agd, Parforce- 55.
Jöhnssen, Adolf,
Maler 101.
K
annengießer, Georg, Maler 100.
Kegebein, Gerh. Friedr., Dichter 120.
Kirchenbau 86 ff..
Klosterbauten 91.
Kosegarten, Christian, Pastor 28.
Kriegs-
und Militärgeschichte 108-110.
L
egeay, Jean, Baumeister 102.
Lessen, Friedr. Aug., Dichter 119.
Literatur 117.
Lübsee 83.
Ludwigslust
(Stift Bethlehem) 74.
M
alerei 99-101.
Miniaturen, Bildnis-
99.
Mummendorf 83.
Münzkunde 107.
Museum (Neustrelitz) 106.
Musik 104. 105.
N eukalen 72.
O
rdensniederlassungen 12.
Ostsee 29.
P
archim 68. 69.
Pferdemarkt
(Neubrandenburg) 55.
Pferdezucht 65.
Plastik, Holz- 97 ff..
Poel, Insel 40.
R
ennsport 56.
Rethra 1.
Ribnitz
(Kloster) 76.
Rostock
Bauten
92-94.
Ehen in alter Zeit 26.
Heide 30. 39. 61.
Sparkasse 67.
Wohlfahrtspolitik 66.
S
agen 42. 43.
Schönberg (Rathaus)
73.
Schwerin
Kriegsnöte 16.
Schelfgemeinde 85.
Schloßgarten
102.
Streichquartett 104.


|
Seite 288 |




|
Seen, Feldberger 38.
Selmsdorf 5. 82.
Senfmühlen 51.
Siedlungsgeschichte 6
ff..
Slawen (Reste) 8.
Städtebau
96.
Stargard 37. 80. 81.
T
änze, Bauern- 52.
Tessin 70.
Travemünder Bucht 111-115.
W
ald 30 ff.. 60 ff..
Wildbahn
(Redefiner) 33.
Wilhelm I., Kaiser 21.
Wittenburg 71.
Woldegk 77-79.
Wörterbuch, Mecklenb. 121.


|




|



|


|
|
:
|


|




|



|
Seite 289 |




|
Jahresbericht
über das Vereinsjahr
vom 1. Juli 1926 bis 30. Juni 1927.
Es sind im abgelaufenen Vereinsjahr 32 Mitglieder eingetreten, davon 3 als Beförderer 1 ). Zu den Beförderern rechnet außerdem der Gutsbesitzer Herr Henry Sloman auf Bellin, der dem Verein im Jahre 1926 eine sehr dankenswerte Zuwendung von 500 Mk. gemacht hat. Ausgetreten sind 20 Mitglieder, verstorben 16. 1 Mitglied ist für das Vereinsjahr 1925/26 als verstorben nachzutragen. Am 30. Juni 1927 zählte der Verein 4 Ehrenmitglieder, 7 korrespondierende Mitglieder, 4 Beförderer und 639 ordentliche Mitglieder. Vgl. Anlage A 2 ). Mehrere der neu eingetretenen korporativen Mitglieder haben sich zur Entrichtung eines erhöhten Beitrages bereit erklärt.
Unter den Toten des Vereinsjahres ist der Gymnasialprofessor a. D. Dr. August Rudloff, der mehr als vier Jahrzehnte als Lehrer am Schweriner Realgymnasium wirkte und unserem Verein seit 1878 angehörte. Als Historiker hat er sich durch seine Forschungen auf dem Gebiete der mecklenburgischen Geschichte einen Namen gemacht. Zu der bekannten, im vormaligen Süsserottschen Verlage erschienenen Mecklenburgischen Geschichte in Einzeldarstellungen steuerte er das dritte Heft bei, das die Zeit vom Tode Niklots bis zur Schlacht bei Bornhöved (1160-1227) behandelt. Ferner gab er zusammen mit anderen Gelehrten die Bilder aus der Mecklenburgischen Geschichte heraus, die besonders für den Gebrauch in höheren Lehranstalten bestimmt sind und zwei Auflagen erlebten.


|
Seite 290 |




|
In unseren Jahrbüchern hat Rudloff wertvolle und sorgfältig gearbeitete Abhandlungen über die Topographie der Länder Schwaan und Laage und über die mecklenburgische Vogtei Schwaan veröffentlicht 3 ). Um den verstorbenen Gelehrten zu ehren, ist sein Bildnis diesem Jahresbericht beigegeben worden.
Dankbar sei der Treue gedacht, mit der Rudloff und viele der durch den Tod ausgeschiedenen Mitglieder während langer Jahrzehnte zum Verein gehalten haben. Am längsten von allen ist der Erblandmarschall Johannes Freiherr v. Maltzan, Burg Penzlin, Mitglied gewesen, seit 1873, über ein halbes Jahrhundert; mehr als vierzig Jahre hindurch der Landessuperintendent D Max Kliefoth in Bad Doberan und der Landrat Fritz v. Böhl, Rubow; mehr als dreißig Jahre der Bürgermeister a. D. Geh. Kommerzienrat Heinrich Witte in Wismar, der Amtsrichter a. D. Paul Witt zu Tessin und der Generalleutnant z. D. Willy v. Haeseler in Schwerin; mehr als fünfundzwanzig Jahre der Universitätsprofessor Geh. Justizrat Lic. Dr. jur. et phil. Hugo Sachsse in Rostock.
Zu den Vereinen, mit denen wir im Austauschverkehr stehen, ist der Deutsche Roland, Verein für deutsch-völkische Sippenkunde, in Berlin hinzugekommen, der uns gegen unser Jahrbuch seine monatlich erscheinenden "Mitteilungen" liefert. Ferner wurde der Austausch mit der Zeitschrift "Deutsche Gaue" in Kaufbeuren eröffnet.
Am Nachtragsbande zum Urkundenbuche und an den Regesten des 15. Jahrhunderts ist von Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr und Staatsarchivrat Dr. Steinmann weitergearbeitet worden. Dankenswerter Weise hat das Ministerium die Jahres-Staatsbeihilfe für diese Werke von 200 auf 600 Mk. erhöht. Das ist aber nur ein Siebentel der in der Vorkriegszeit von der Regierung und den Ständen jährlich gemeinsam überwiesenen Summe. Da in Anbetracht der Finanzlage des Landes ein höherer Zuschuß zurzeit nicht gegeben werden kann, so ist leider an die Drucklegung des Nachtragsbandes und der Regesten wegen der hohen Kosten vorderhand nicht zu denken.
Die Fortsetzung der Jahrbuchregister hat Archivinspektor Carow für die Bände 60-70 fast fertiggestellt. Wir hoffen, dieses neue Register bald herausbringen zu können. Für den Druck des Jahrbuches sind von der Notgemeinschaft


|
Seite 291 |




|
der deutschen Wissenschaft in Berlin bereits zweimal erhebliche Zuschüsse gezahlt worden, und zwar für das Jahrbuch 89 tausend Mark, für das Jahrbuch 90 elfhundert Mark. Wir sind der Notgemeinschaft für diese Beihilfen zu lebhaftem Danke verpflichtet.
Im verflossenen Herbst und Winter veranstaltete der Verein wiederum sechs Vortragsabende im Schweriner Archivsaal. Es sprachen: am 3. Nov. Studienrat Dr. Bibeljé (Schwerin) über Irland und England; am 26. Nov. Universitätslektor Dr. Gehrig (Rostock) über mecklenburgische Maler des 19. und 20. Jahrhunderts; am 10. Dez. Universitätsprofessor Dr. Schüßler (Rostock) über Persönlichkeit und Ziele Friedrichs des Großen vor seiner Thronbesteigung; am 14. Jan. Archivar Dr. Endler (Neustrelitz) über Mecklenburg und die deutsche Frage 1806-1815. ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Gedankens; am 15. Febr. Museumsdirektor Prof. Dr. Lauffer (Hamburg) über das Deutschtum in Siebenbürgen; am 8. März Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Schuchhardt (Berlin) über Neues zur Frage nach dem Ursprung der Germanen. Die Vorträge von Dr. Gehrig, Prof. Lauffer und Geheimrat Schuchhardt waren von Lichtbildern begleitet.
Am 5. April 1927 fand in Schwerin die 92. Hauptversammlung statt. Sie brachte uns einen Vortrag des Studienrats Gaedt (Schwerin) über König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und die deutsche Einheitsbewegung. Es folgten der Geschäftsbericht und der Kassenbericht (Anlage B.) Die gemäß der Satzung ausscheidenden Vereinsbeamten wurden für das folgende Geschäftsjahr wiedergewählt. Ein Antrag des Ersten Sekretärs, am 8. Juli einen Ausflug durch die Lewitz nach Neustadt-Glewe zu unternehmen, fand die Zustimmung der Versammlung.
Der satzungsändernde Beschluß der Hauptversammlung von 1926, wonach die alte Fassung des § 7 über die Zahlung des Mitgliederbeitrages von 6 Mk. wiederhergestellt werden sollte 4 ), hat inzwischen die nach § 23 der Satzung erforderliche ministerielle Genehmigung gefunden.
Schließlich sei mitgeteilt, daß der auf der vorigen Hauptversammlung beschlossene Ausflug nach Bützow und Kloster Rühn zur Besichtigung der dortigen historischen Bauten am 7. Juli 1927 unter Führung des Ersten Sekretärs vor sich ging. Es beteiligten sich etwa 30 Vereinsmitglieder und Gäste.


|
Seite 292 |




|
Vereinsausschuß für das Jahr 1927/28.
Präsident: Staatsminister Dr. Langfeld, Exz.
Vizepräsident: Ministerialdirektor v. Prollius.
Erster Sekretär: Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr.
Zweiter Sekretär: Staatsarchivrat Dr. Strecker.
Rechnungsführer: Rechnungsrat Sommer.
Bücherwart: Landesbibliotheksdirektor Dr. Crain.
Bilderwart: Regierungsrat Rechtsanwalt Dr. Wunderlich.
Repräsentanten: Ministerialdirektor Dr. Krause,
Generaldirektor Gütschow,
Geh. Archivrat Dr. Grotefend, Ehrenmitglied,
Generalleutnant v. Woyna, Exz.
Der zweite Vereinssekretär.
W. Strecker.
~~~~~~~~~~
Anlage A.
Veränderungen des Mitgliederstandes
im Vereinsjahre 1926-1927.
Als Beförderer sind eingetreten:
die Stadt Röbel, das Mecklenburg-Schwerinsche Amt Waren und die Hauptstadt Schwerin.
Eingetreten sind:
1. Geh. Medizinalrat Prof. Dr. med. Arthur Barth, Schwerin. 2. Realgymnasium Schwerin. 3. Amtshauptmann Dr. iur. Hans Müller, Schwerin. 4. Frau Major Helene v. Koppelow, geb. v. Blücher, Schwerin. 5. Studienrat Dr. phil. Bruno Hollmann, Schwerin. 6. Kreismedizinalrat Dr. med. Hans Kölzow, Schwerin. 7. Ministerialrat Rudolf Schmidt, Schwerin. 8. Frau Margarete Diestel, geb. Augustin, Schwerin. 9. Studienrat Dr. phil. Theodor Lindemann, Schwerin. 10. Studiendirektor Friedrich Lüth, Schwerin. 11. Hoflieferant Carl Demmien, Schwerin. 12. Fräulein Elisabeth v. Wedelstaedt, Schwerin. 13. Der Rat der Stadt Ludwigslust. 14. Der Rat der Stadt Teterow. 15. Ministerialrat Dr. Adolf Josephi, Schwerin. 16. stud. phil. Hugo Lübeß, Schwerin. 17. Studienrat Helmuth Gaedt, Schwerin. 18. Der Rat der Stadt Parchim. 19. Landesmedizinalrat Dr. med. Karl-Erich Marung, Schwerin. 20. Frau Margarete v. Arnim, geb. Paschen, Schwerin. 21. Rechtsanwalt Max Hilweg, Schwerin. 22. Professor Lic. Dr. Ernst Schaumkell, Ludwigslust. 23. Rentner Hans Stubbendorf,


|
Seite 293 |




|
Schwerin. 24. Pfarrer i. R. Edmund Hartung, Schwerin. 25. Bauassessor Kurt Klatt, Schwerin. 26. Die Stadt Wittenburg. 27. Frau Ottilie v. Oertzen, geb. v. d. Lühe, Schwerin. 28. Lehrer Friedrich Mierow, Upahl bei Grevesmühlen. 29. Der Amtsausschuß des Mecklenburg-Schwerinschen Amtes Ludwigslust.
Ausgetreten sind:
1. Dr. med. Hans Ratzeburg, Schwerin. 2. Dr. H. Polzer, Berlin. 3. Lehrerin Helene Jüngling, Schwerin. 4. Studienrat Dr. Rudolf Jacobs, Wismar. 5. Pastor J. Köhler, Leussow. 6. Oberst a. D. Eberhard v. Müller, Schwerin. 7. Staatsarchivrat Prof. Dr. Hermann Krabbo, Berlin-Steglitz. 8. Genealoge Ed. de Lorme, Hannover. 9. Generalarzt a. D. Dr. Wilh. Kamm, Karlsruhe. 10. Ministerialamtmann Hans Esemann, Schwerin. 11. Architekt Erich Bentrup, Schwerin. 12. Frau Grete Behm, Schwerin. 13. Gutspächter Ernst Burgwedel, Hof Malchow. 14. Rektor Heinrich Roloff, Crivitz. 15. Lehrer Rudolf Lechler, Gr. Rogahn. 16. Lehrer Adolf Plagemann, Kl. Rehberg. 17. Schulrat Wilhelm Schulz, Lübtheen. 18. Kaufmann Ernst Schramm, Wiesbaden. 19. Oberingenieur Willy Tabbert, Waidmannslust. 20. Richter Dr. Parey, Bremen.
Gestorben sind:
1. Rittmeister a. D. Friedrich Carl Paetow auf Lalendorf, am 28. Sept. 1926. 2. Justizrat Dr. Robert Hinrichsen, Güstrow, am 16. Okt. 1926. 3. Gymnasialprofessor Dr. August Rudloff, Schwerin, am 18. Okt. 1926. 4. Bürgermeister a. D. Geh. Kommerzienrat Heinrich Witte, Wismar, am 26. Okt. 1926. 5. Major a. D. Wilhelm v. Schwanenfeld, Graf v. Schwerin, Göhren, am 29. Okt. 1926. 6. Drost a. D. Kammerherr Gustav v. Oertzen, Kittendorf, am 19. Nov. 1926. 7. Landessuperintendent D Max Kliefoth, Bad Doberan, am 31. Dez. 1926. 8. Landrat Fritz v. Böhl, Rubow, am 6. Jan. 1927. 9. Ökonomierat Ludwig Peitzner, Hof Drieberg, am 22. Jan. 1927. 10. Amtsrichter a. D. Paul Witt, Tessin. 11. Generalleutnant z. D. Willy v. Haeseler, Exz., Schwerin, am 4. März 1927. 12. Geh. Justizrat Lic. theol. Dr. iur. et phil. Hugo Sachsse, Univ.-Prof., Rostock, am 14. März 1927. 13. Drost Richard Kuhrt, Malchow, am 26. März 1927. 14. Geh. Medizinalat Prof. Dr. Arthur Barth, Schwerin, am 7. Mai 1927. 15. Erblandmarschall Johannes Freiherr v. Maltzan, Burg Penzlin, am 30. Mai 1927. 16. Stadtkassier a. D. William Ebeling, Wismar.
Nachtrag zum Vereinsjahr 1925/26.
Gestorben: Gutsbesitzer Eduard Sparding, Wohlenhagen, am 21. Juni 1926.
~~~~~~~~~~


|
Seite 294 |




|
Anlage B.
Auszug aus der Vereinsrechnung
für den Jahrgang 1925/26.
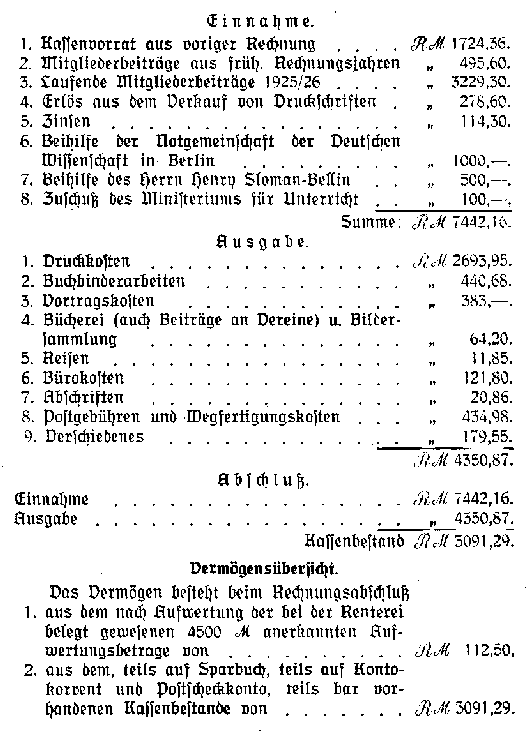
Der Rechnungsführer.
Sommer.


|
Seite 295 |




|
Mitglieder=Verzeichnis
des Vereins für Mecklenburgische Geschichte undAltertumskunde * ).
Nach dem Stande vom 1. Januar 1928.
~~~~~~~~~~
- Grotefend, Dr., Geh. Archivrat, Staatsarchivdirektor a. D., Schwerin. 1921. (46).
- Beltz, Dr. Prof., Abteilungsvorstand am Landesmuseum, Schwerin. 1924. (48).
- v. Weltzien, Generalmajor a. D., Rostock. 1925. (49).
- Schäfer, Dr. Prof., Geh. Reg.-Rat, Berlin-Steglitz. 1925. (50).
- Wehrmann, Dr. phil., Gymnasialdirektor, Greifenberg (Pomm.). 1897. (154).
- Krieg, Amtsgerichtsrat, Sangerhausen. 1904. (155).
- Schuchhardt, Dr. Prof., Geh. Reg.-Rat, Museumsdir. a. D., Berlin-Lichterfelde West. 1907. (156).
- Reinecke, Dr. Prof., Stadtarchivdir., Lüneburg. 1908. (157).
- Kretzschmar, Dr., Staatsrat, Vorstand des Staatsarchivs, Lübeck. 1910. (158).
- Stieda, Dr. Prof., Geh. Hofrat, Leipzig. 1912. (159).
- Oesten, Ingenieur, Berlin. 1912. (160).
Die Mitglieder werden gebeten, alle Veränderungen der Amtsbezeichnung und Wohnung dem Verein alsbald mitzuteilen.


|
Seite 296 |




|
- Sloman, Gutsbesitzer, Bellin bei Zehna. 1926. (1).
- Röbel, Stadt. 1926. (2).
- Waren, Meckl.-Schwer. Amt. 1926. (3).
- Schwerin, Hauptstadt. 1927. (4).
- Aarhus, Staatsbibliothek. 1921. (2387).
- Abel, Gutsbesitzer, Bukow b. Teterow. 1922. (2467).
- v. Abercron, Drost a. D., Ehlerstorf b. Oldenburg (Holst.). 1881. (965).
- Ahrendt, Fabrikbesitzer, St. Petersburg. 1910. (2021).
- Ahrens, Oberfinanzinspektor, Schwerin. 1925. (2601).
- Albrecht, Johannes, Rechtsanwalt, Güstrow. 1916. (2154).
- Albrecht, Oskar, Kreisbaumeister a. D., Wittenberge. 1921. (2391).
- v. Alt-Stutterheim, Generalmajor, Schwerin. 1922. (2438).
- Amelung, Oberingenieur, Schwerin. 1922. (2442).
- Andreas, Dr., Univ.-Prof., Heidelberg. 1919. (2276).
- Arnade, Regierungsbaurat, Schwerin. 1923. (2550).
- v. Arnim, Frau Margarete, Schwerin. 1927. (2652).
- Arnold, Oberstleutnant a. D., Schwerin. 1922. (2409).
- v. Arnswaldt, Oberforstmeister, Schlemmin. 1900. (1660).
- Asmus, Dr., Arzt, Teterow. 1907. (1921).
- Augustin, Lehrer, Granzin b. Lübz. 1920. (2305).
- Baalk, Kaufmann, Berlin-Tempelhof. 1919. (2181).
- Bachmann, Pastor, Pampow b. Holthusen. 1883. (1222).
- v. Bahrfeldt, Dr. phil. h. c., General der Inf., Exz., Univ.-Prof., Halle (Saale). 1911. (847).
- Baller, Dr., Ministerialdir. a. D., Schwerin. 1880. (944).
- Barfurth, Dr., Ministerialrat, Schwerin. 1915. (2140).
- Barmwoldt, Oberschulrat, Schwerin. 1924. (2586).
- v. Barner, Kammerherr, Gutsbesitzer, Trebbow. 1922. (2468).
- Barnewitz, F., Dr. phil. et jur., Charlottenburg. 1919. (2184).
- Barnewitz, Hans, Dr., Studienrat, Bützow. 1910. (2029).
- Barten, Ministerialrat, Schwerin. 1922. (2426).
- Basedow, Reichsb.-Oberinsp., Rechnungsrat, Schwerin. 1912. (2096).
- Graf Bassewitz, Gutsbesitzer, Bristow b. Teterow. 1922. (2470).
- v. Bassewitz, Gutsbesitzer., Schimm b. Ventschow. 1882. (1015).
- Bauch, Amtsgerichtsrat, Wittenburg. 1926. (2627).
- Beckmann, Regierungsbaurat, Güstrow. 1922. (2482).


|
Seite 297 |




|
- Behm, Heinrich, D Dr., Landesbischof, Schwerin. 1887. (1307).
- Behm, Martin. Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen- u. Ohrenleiden, Schwerin. 1924. (2596).
- Behm, Ulrich, Konsistorialrat, Schwerin. 1884. (1242).
- Behn, Friedrich, Dr. Prof., Mainz. 1920. (2311).
- Behn, Wilh., Dr., Bürgermeister, Ludwigslust. 1909. (1999).
- Beltz, Studienrat, Lankow. 1909. (2003).
- Berndes, Landdrost, Rostock. 1919. (2268).
- Bernhardt, Propst, Lübz. 1904. (1816).
- v. Bernstorff, Graf, C., Forstmeister a. D., Haus Angenrod, Kreis Alsfeld, Oberhessen. 1882. (1031).
- v. Bernstorff, Graf, Hermann, Kammerherr, Gutsbesitzer, Wedendorf b. Kirch Grambow. 1904. (1812).
- Beste, Dr. phil., Vikar, Benthen b. Lübz. 1925. (2619).
- Beutin, Dr., Ministerialrat, Schwerin. 1909. (1994).
- Bibeljé, Dr., Studienrat, Schwerin. 1920. (2327).
- Bicker, Adolf F., Fabrikbesitzer, Essen-Bredeney. 1922. (2462).
- Bicker, Friedrich, Gutsbesitzer, Ramelow. 1919. (2255).
- v. Biel, Legationsrat, Gutsbesitzer, Kalkhorst. 1909. (1998).
- Biereye, Dr. phil., Studienrat, Rostock. 1909. (1985).
- Bierstedt, Ministerialrat, Berlin-Schlachtensee. 1912. (2057).
- Birckenstaedt, Dr. med., Arzt, Flensburg. 1911. (2050).
- v. Blücher, Hellmuth, Major a. D., Schwerin. 1919. (2217).
- v. Blücher, Ulrich, Wirkl. Geh. Rat, Exz., Doberan. 1881. (955).
- Bock, Ernst Albrecht, auf Gr. Brütz. 1921. (2374).
- Bock, Hans Christian, Gutsbesitzer, Domänenrat, Schwerin. 1923. (1723).
- Bock, Hermann Carl, Gutsbesitzer, Kl. Köthel. 1922. (2473).
- Boeckel, Kommerzienrat, St. Petersburg. 1912. (2092).
- Böhm, Dr., Tierarzt, Schwerin. 1915. (2138).
- Bohm, Gutsbesitzer, Kl. Wehnendorf. 1922. (2486).
- Böhmer, Pastor, Mecklenburg i. M. 1893. (1468).
- Bohnsack, Lehrer, Ludwigslust. 1925. (2622).
- Boldt, Dr. med., Sanitätsrat, Berlin. 1913. (2099).
- Bolten, Rittmeister d. L., Gutsbesitzer, Mustin. 1917. (2163).
- Bothe, Dr., Rechtsanwalt, Justizrat, Güstrow. 1914. (2132).
- Graf Bothmer, auf Bothmer b. Klütz. 1922. (2431).
- Frhr. v. Brandenstein, Ministerpräsident a. D., Wirkl. Geh. Rat, Exz., Niendorf b. Bad Kleinen, 1904. (1823).
- Brandt v. Lindau, Fräulein Helene, Schwerin. 1923. (2512).
- Brauer, Oberzollinspektor a. D., Schwerin. 1910. (2020).


|
Seite 298 |




|
- Brauns, Hans, Dr., Sanitätsrat, Schwerin. 1919. (2198).
- Brauns, Ludwig, Bankbeamter, Schwerin. 1925. (2606).
- Brauns, Otto, Dr. jur., Landgerichtspräsident, Schwerin. 1902. (1758).
- Brauns, Otto, Landgerichtsrat, Rostock. 1919. (2213).
- Brede, Kaufmann, Hamburg. 1920. (2331).
- Bremer, Hauptmann a. D., Geschäftsführer des Kreislandbundes, Schwerin. 1923. (2575).
- Brückner, Dr., Ministerialdirektor, Schwerin. 1914. (2123).
- Brümmer, Dr., Ober-Staatsanw., Hamburg. 1894. (1483).
- Brunckhorst, Gutsbesitzer, Karcheez b. Tarnow. 1922. (2457).
- Brunnengräber, Fabrikbesitzer, Schwerin. 1919. (2221).
- Brunst, Franz, Reval. 1925. (2624).
- Brüssow, Ober-Regierungsbaurat, Schwerin. 1900. (1644).
- Brüx, Pastor, Schwerin. 1917. (2156).
- Büchner, Reichsbankdirektor, Eisenach. 1915. (2139).
- Buddenhagen, Mittelschullehrer, Warnemünde, 1925. (2602).
- Buhle, Dr., Studiendirektor, Schwerin. 1912. (2069).
- Bühring, Konsul, Schwerin. 1925. (2618).
- v. Bülowscher Familienverband, Schriftführer: Gutsbesitzer Freiherr v. Bülow, Beiernaumburg, Bez. Halle a. S. - Offiz. Vertreter der Familie: v. Bülow, Oberstleutnant z. Dr., Arendsee i. M. 1900. (1645).
- v. Bülow, Frl. Clara, Lehrerin, Schwerin. 1925. (2620).
- v. Bülow, Friedrich, Konteradmiral, Ratzeburg. 1920. (2313).
- v. Bülow, Henning, Kammerherr, Gutsbesitzer, Rodenwalde b. Vellahn i. M. 1921. (2355).
- v. Bülow, Jobst Heinrich, Leutnant a. D., Berufsgenealoge Schwerin-Ostorf. 1921. (2386).
- v. Bülow, Marie, geb. Gräfin Boineburg, Kaltenmoor b. Lüneburg. 1916. (2155).
- v. Bülow-Trummer, Ferdinand, Dr. jur., Ministerialrat, Schwerin. 1921. (2343).
- Burmeister, Heinrich, Kaufmann, Schwerin. 1892. (1451).
- Burmeister, Martin, Kaufmann, Schwerin. 1903. (1791).
- Burth, Hoflieferant, Stadtrat, Schwerin. 1912. (2058).
- Buschmann, Landgerichtsdirektor, Schwerin. 1923. (2510).
- v. Busse, Generalleutnant a. D., Exz., Schwerin. 1921. (2372).
- Carow, Archivinspektor, Schwerin. 1918. (2176).
- Chrestin, Ministerialrat, Schwerin. 1919. (2199).
- Claßen, Frau, geb. Becker, Schwerin, 1927. (2668).
- Claussen, Hof-Musikalienhändler, Schwerin. 1926. (2631).
- Cordes, Major d. L. a. D., Schwerin. 1898. (1587).


|
Seite 299 |




|
- Cordua, Dr., Ministerialdirektor, Neustrelitz. 1912. (2083).
- Crain, Dr., Direktor der Landesbibliothek, Schwerin. 1909. (1988).
- Cramer, Landgerichtsrat, Güstrow. 1920. (2303).
- v. Cramon, Dr. Rittmeister a. D., Berlin-Grunewald. 1920. (2300).
- Cyrus, Dr. med., Arzt, Schwerin. 1926. (2631).
- Dabelstein, Dr., Regierungsrat a. D., Reichsbahnrat, Schwerin. 1922. (2425).
- Dahse, Präsid. d. Reichsbahndirekt., Schwerin. 1913. (2097).
- Dalitz, Kanzlist, Stavenhagen. 1922. (2493).
- Dehns, Ministerialrat, Schwerin. 1919. (2212).
- Demmien, Hoflieferant, Schwerin. 1926. (2644).
- v. Dewitz, Staatsminister a. D., Exz., Cölpin b. Stargard. 1883. (1208).
- Diehn, Zahnarzt, Rostock. 1922. (2415).
- Dierke, Direktor der Meckl. Landgesellschaft, Zippendorf. 1922. (2427).
- Diestel, Heinr., Direktor der Ansiedl.-Ges., Schwerin. 1916 (2149).
- Diestel, Frau Margarete, geb. Augustin, Schwerin. 1926. (2641).
- Diestel, Robert, Gutsbesitzer, Schwerin. 1902. (1750).
- v. Dincklage, Freiherr, Schwerin. 1920. (2322).
- Dolberg, Domänenpächt., Pinnowhof b. Glasin. 1922. (2475).
- Dorendorf, Regierungsrat, Schwerin. 1923.
- Dragendorff, Dr. phil., Archivrat, Rostock. 1900. (1701).
- Dreyer, Amtsgerichtsrat, Hagenow. 1923. (2501).
- Dühring, Pfarrer, Leuthen (Bez. Cottbus). 1908. (1946).
- Duncker, Dr. phil., Studienrat, Angermund b. Düsseldorf. 1908. (1958).
- Düwahl, Hoflieferant, Goldschmied, Plau. 1911. (2037).
- Ebeling, Geh. Oberschulrat a. D., Schwerin. 1893. (1458).
- Eberhard, H., D Dr., Oberlandesgerichtspräsident, Rostock. 1899. (1597).
- Eberhard, Raimund, Landgerichtsrat, Schwerin. 1916. (2147).
- Ebert, Dr. med., Sanitätsrat, Arzt, Grevesmühlen. 1900. (1713).
- Ehmig, Dr. ing., Ministerialdirektor, Schwerin. 1908. (1980).
- v. Ehrenkrook, Regierungsrat, Ludwigslust. 1925. (2600).
- Eichbaum, Hans, Landdrost, Crivitz. 1890. (1352).
- Eichbaum, Ludwig, Ministerialrechnungsdirektor, Schwerin. 1919. (2195).


|
Seite 300 |




|
- Elisabeth, Frau Herzogin zu Mecklenburg, Hoheit, Doberan. 1920. (2299).
- Endler, Dr., Archivrat, Neustrelitz. 1922. (2463).
- Engelhardt, Dr. med., San.-Rat, Arzt, Röbel. 1905. ( 1860).
- Erythropel, Carl, Spark.-Rendant, Hagenow. 1919. (2270).
- Erythropel, Herm., Amtsgerichtsdir., Schwerin. 1908. (1960).
- Evers, Friedr., Telegraphendirektor, Schwerin. 1911. (2035).
- Evers, Karl, Kaufmann, Allgem. Elektriz.-Gesellsch., Erfurt. 1922. (2461).
- Falk, Finanzrat, Schwerin. 1919. (2261).
- Faull, Otto, Hof- u. Justizrat, Rechtsanwalt, Schwerin. 1897. (1548).
- Faull, Rudolf, Dr., Bankdirektor, Schwerin. 1917. (2161).
- Feine, Dr., Univ.-Prof., Rostock. 1924. (2590).
- Felsing, Staatstheaterintendant, Schwerin. 1922. (2440).
- Fischer, Verlagsdirektor, Schwerin. 1923. (2572).
- v. Flotow, August, Kammerherr, Gutsbesitzer, Kogel b. Malchow. 1907. (1936).
- v. Flotow, Jürg., Gutsbesitzer, Stuer-Vorwerk. 1907. (1933).
- Francke, Hofbuchdruckereibesitzer, Schwerin. 1925. (2610).
- Friederichs, Amtsgerichtsrat a. D., Schwerin. 1912. (2086).
- Friedland i. M., Gymnasium. 1903. (1805).
- Fritzsche, Franz, Dr., Gymn.-Professor, Schwerin. 1919. (2210).
- Fritzsche, Wolfgang, Studienrat, Schwerin. 1923. (2508).
- Frohnhöfer, Revisionsamtmann, Schwerin, 1924. (2582).
- Fust, Reg.- u. Baurat, Stendal. 1909. (2001).
- Gaedt, Studienrat, Schwerin, 1927. (2162).
- Gaehtgens, Pastor, Parum b. Wittenburg. 1922. (2404).
- Galle, Dr., Studiendirektor, Schwerin. 1924. (2594).
- v. Gamm, Rittmeister, Harzburg. 1913. (2103).
- Gebhard, Frau San.-Rat, Dr., Schwerin. 1927. (2663).
- Gehrcke, Kaufmann, Schwerin. 1919. (2215).
- Gehrke, Amtsgerichtsrat, Trivitz. 1913. (2116).
- Gernentz, Dr., Studienrat, Schwerin. 1924. (2580).
- Giese, Versicherungsdirektor, Schwerin, 1907. (1919).
- Giesenhagen, Dr., Geheimrat, Univ.-Prof., München. 1883. (1232).
- Glantz, Gutsbesitzer, Wölzow b. Bobzin. 1922. (2474).
- Glatz, Dipl.-Ing., Peg.-Baumeister a. D., Schwerin. 1919. (2218).
- Glawe, Oberfinanzinspektor, Schwerin. 1921. (2357).
- Goesch, D, Oberkirchenrat, Schwerin. 1922. (2395).


|
Seite 301 |




|
- Goetze, Dr., Arzt, Wehlau i. Ostpr. 1919. (2252).
- Goldberg, Rat der Stadt, 1871. (809).
- Goosmann, Lehrer, Wittenburg. 1923. (2523).
- Gramkow, Malermeister, Schwerin. 1920. (2286).
- Griephan, Hauptmann, Hamburg. 1924. (2592).
- Grohmann, Pastor, Alt Meteln b. Lübstorf. 1897 (1564).
- Großkopf, Bankbeamter, Schwerin. 1922. (2483).
- Grotefend, Dr., Staatsarchivdirektor, Stettin. 1905. (1841).
- Groth, Techn. Marinesekr., Kiel-Diedrichsdorf. 1923. (2500).
- v. Grundlach, Frau verw. Landrat, Schwerin. 1923. (2515).
- Güstrow, Rat der Stadt. 1897. (1566).
- Güstrow, Realgymnasium. 1903. (1796).
- Güstrow, Verein für Kunst u. Altertum. 1892. (1439).
- Gütschow, Karl, Generaldirektor, Schwerin. 1912. (2068).
- Gütschow, Rudolf, Oberleutnant a. D., Schwerin. 1927. (2662).
- Gütschow, Walter, Versich.-Direktor, Schwerin. 1927. (2661).
- Haack, Ernst, D, Geh. Oberkirchenrat, Schwerin. 1902. (1259).
- Haack, Martin, Domprediger, Schwerin. 1919. (2267).
- Haack, Richard, Pastor, Gr. Trebbow b. Lübstorf. 1912. (2073).
- Haacke, Franz, Dr., Rechtsanwalt, Schwerin. 1919. (2201).
- Haacke, Paul, Dr., Hofapotheker, Schwerin. 1919. (2220).
- Haacker, Reichsbahnamtmann, Schwerin. 1919. (2219).
- Hagen, Zolldirektor a. D., Schwerin. 1922. (2402).
- v. Hahn, Graf, Hofmarschall, Kammerherr, Basedow. 1901. (1730).
- Hamann, Stadtbaurat, Schwerin. 1920. (2304).
- v. Hammerstein, Freiherr, Dr., Oberkirchenrat, Schwerin. 1908. (1947).
- Hartung, Pfarrer i. R., Schwerin. 1927. (2655).
- Hasenkamp, Dr., Prof., Gutsbesitzer, Vielist b. Grabowhöfe. 1922. (2481).
- Heider, Kaufmann, Schwerin. 1920. (2287).
- Hennings, Reichsbahninspektor, Schwerin. 1922. (2489).
- Hensan, Studienrat, Rostock. 1919.
- Herbst, Buchhändler, Schwerin. 1920. (2613).
- Herrmann, Adolf, Landesversicherungs-Praktikant, Grevesmühlen. 1922. (2488).
- Herrmann, Ludwig, Reichsbahnoberinspektor, Schwerin. 1922. (2487).
- Hermes, Dr. med., Arzt, Altona, 1907. (1903).
- Heuck, Adolf, Ministerialdir. a. D., Schwerin, 1899. (1626).
- Heuck, Herm., Landgerichtsdir. a. D., Schwerin. 1922. (2408).
- Heucke, Mühlenbesitzer, Parchim. 1923. (2528).


|
Seite 302 |




|
- Hill, Eisenbahnoberinspektor a. D., Rechnungsrat, Schwerin. 1922. (2452).
- Hilweg, Rechtsanwalt, Schwerin. 1927. (2653).
- Himstedt, Hauptmann a. D., Schwerin. 1922. (2420).
- v. Hirschfeld, Hausmarschall, Kammerherr, Schwerin. 1909. (1995).
- Hofferber, Bankprokurist, Schwerin. 1923. (2524).
- Hoffmann, Frau Fabrikbesitzer, Schwerin. 1922. (2497).
- Hofmeister, Adolf, Dr. phil., Prof., Greifswald. 1906. (1876).
- Hofmeister, Hermann, Dr. Prof., Hannover, 1919. (2258).
- Hollien, Reichsbahninspektor, Schwerin. 1923. (2502).
- Hollmann, Dr. phil., Studienrat, Schwerin. 1926. (2638).
- Holtz, Lic., Pastor, Gammelin. 1925. (2621).
- Hoofe, Kaufmann, Schwerin. 1899. (1600).
- Hübbe, Zolldirektor, Schwerin. 1919. (2185).
- Hüniken, Gutsbesitzer, Vogelsang b. Lalendorf. 1922. (2451).
- Husmann, Pfarrer, Sögel (Hannover). 1899. (1608).
- Huther, Landgerichtsrat, Berlin. 1921. (2361).
- Hütten, Landgerichtsrat, Schwerin. 1921. (2356).
- Jacobs, Postdirektor, Ludwigslust. 1896. (1539).
- Jaeppelt, Bankbeamter, Schwerin. 1922. (2446).
- Jesse, Domänenpächter, Glambeck b. Warin. 1923. (2499).
- v. Igel, Frau General, Exz., Schwerin. 1919. (2188).
- Ihlefeld, Major d. L. a. D., Schwerin. 1902. (1762).
- v. Jordan, Abteilungspräsident beim Landesfinanzamt, Schwerin-Ostorf. 1922. (2393).
- Jörn, Landesveterinärrat, Schwerin. 1919. (2214).
- Josephi, Dr., Ministerialrat, Schwerin. 1927. (2648).
- Junge, Kaufmann, Hoflieferant, Schwerin, 1907. (1941).
- Junker, Hoflieferant, Schwerin. 1919. (2224).
- Kaestner, Dr. med., Facharzt für Hautleiden, Schwerin. 1905. (1853).
- Kähler, Prof., Generalmusikdirektor, Schwerin. 1909. (2011).
- v. Kamptz, Oberregierungsrat a. D., Lüneburg. 1902. (1774).
- v. Kardorff, Kammerherr, Gutsbesitzer, Böhlendorf, 1922 (2471).
- Karsten, Heinrich, Pastor, Gehlsdorf b. Rostock. 1920. (2306).
- Karsten, Lorenz, Oberregierungsrat, Schwerin. 1920. (2335).
- Karsten, Martin, Studienrat, Schwerin. 1923. (2543).
- Kayser, Syndikus, Woltersdorf b. Berlin. 1924. (2597).
- Keding, Rechtsanwalt, Schwerin. 1922. (2441).
- Kerstenhann, Dr., Generalstaatsanwalt a. D., Rostock. 1882. (1004).


|
Seite 303 |




|
- Kiel, Preuß. Staatsarchiv. 1911. (2041).
- Kittel, Oberregierungsrat, Schwerin. 1919. (2205).
- Klaehn, Landesschulrat, Schwerin. 1923. (2514).
- Klatt, Bauassessor, Schwerin. 1927. (2656).
- Kleffel, Ministeriraldirektor a. D., Schwerin. 1900. (1667).
- Klemann, Pfarrer, Neuarenberg, Kr. Hümmling. 1921. (2359).
- Klien, Oberverwaltungsgerichtsrat, Schwerin. 1919. (2207).
- v. Klinggraeff, Kammerherr, Gutsbesitzer, Pinnow b. Neubrandenburg. 1896. (1530).
- Klipstein, Dr. med., Kreis-Med.-Rat, Wismar. 1921. (2366).
- Klitzing, Oberrevisor, Schwerin-Ostorf. 1924. (2584).
- Kloerß, Gymn.-Prof., Schwerin. 1903. (1776).
- Klotz, Regierungsrat a. D., Gutsbesitzer, Ankershagen i. M. 1922. (2449).
- Klüssendorf, Oberpostrat, Coblenz. 1924. (2588).
- Knebusch, Dr., Justizrat, Rechtsanwalt, Güstrow. 1908. (1969).
- Knüppel, Justizoberinspektor, Güstrow. 1919. (2264).
- Koch, Studienrat, Ribnitz. 1918. (2180).
- Koester, Leutnant d. R. a. D., Gutsbesitzer, Oesterrade b. Sehestedt. 1903. (1784).
- Kohfeldt, Dr., Prof., Oberbibliothekar, Rostock. 1902. (1770).
- Kohl, Oberstleutnant a. D., Schwerin. 1927. (2666).
- Kohlenberg, Kaufmann, Schwerin. 1923. (2517).
- Köhn, Emil, Buchdruckereibesitzer, Schwerin. 1920. (2282).
- Köhn, Friedr., Propst, Garwitz b. Klinken, 1907. (1920).
- Kohring, Dr. jur., Amtsgerichtsrat, Grevesmühlen. 1919. (2187).
- Kolbow, Ministerialrat, Schwerin. 1919. (2259).
- Kölzow, Dr. med., Kreismedizinalrat, Schwerin. 1926. (2639).
- König, Sparkassendirektor, Schwerin, 1914. (2125).
- Kootz, Pastor, Kratzeburg. 1904. (1828).
- v. Koppelow, Frau verw. Major, Schwerin. 1926. (2637).
- Kopsicker, Kaufmann, Schwerin. 1899. (1603).
- Kothé, Dr. Landgerichtsrat, Schwerin. 1919. (2206).
- Kracht, Lehrer, Parchim, 1922. (2496).
- Krasemann, Kammerrat, Schwerin. 1918. (2174).
- Krause, Dr. h. c., Ministerialdirektor, Schwerin. 1895. (1509).
- Krille, Optiker, Schwerin. 1923. (2522).
- Krüger, Axel, Buchdruckereibesitzer, Schwerin. 1924. (2581).
- Krüger, Georg, Oberkirchenrat, Neustrelitz. 1895. (1511).
- Krüger, Werner, Präsident des Staatsrechnungsamtes i. e. R., Schwerin. 1905. (1857).


|
Seite 304 |




|
- v. Kühlewein, Hauptmann a. D., Schwerin. 1925. (2611).
- Kundt, Ministerialdirektor a. D., Schwerin. 1902. (1756).
- Langbein, Kirchenrat, Schwichtenberg b. Friedland. 1897. (1552).
- Lange, Dr., Amtsgerichtsrat, Wismar. 1895. (1512).
- v. Langermann und Erlencamp, Freiin, Anna-Marie, Schwerin. 1921. (2341).
- v. Langermann und Erlencamp, Friedrich, Freiherr, Landra, Gutsbesitzer, Dambeck. 1890. (1358).
- Langfeld, Dr., Staatsminister a. D., Exz., Schwerin. 1882 (1002).
- Lau, Fabrikbesitzer, Woldegk. 1925. (2617).
- Laudan, Kaufmann, Rostock. 1924. (2593).
- v. Leers, Kammerherr, Ludwigslust. 1926. (1986).
- Leffers, Pastor, Rostock. 1921. (2360).
- Leipzig, Universitätsbibliothek. 1909. (2004).
- Lemcke, Dr., Oberkirchenratspräsident, Schwerin. 1900. (1653).
- Lenthe, Hofgraveur, Schwerin. 1890. (1360).
- Leopoldt, Ministerialinspektor, Schwerin. 1922. (2484).
- v. Levetzowscher Familienverband. Schriftführer: J. H. v. Levetzow, Werle b. Wend. Warnow. 1902. (1765).
- v. Levetzow, Alexander, Major, Gutsbesitzer, Lelkendorf b Neukalen. 1908. (1962).
- v. Levetzow, Freiherr, Karl, Rittmeister a. D., Gutsbesitzer Schloß Divac b. Auspitz (Mähren). 1908. (1971).
- Lewerenz, Dr. med., Arzt, Schwerin. 1919. (2237).
- Lierse, Reg.-Baurat, Güstrow. 1919. (2246).
- Lindemann, Dr., Studienrat, Truppenunterrichtsleiter, Schwerin. 1926. (2642).
- Liß, Ministerialrat a. D., Hofbaurat, Schwerin. 1905. (1848).
- Lorentz, Landesfinanzamtspräsident, Schwerin. 1899. (1592).
- Lorenz, Oberbaurat, Schwerin, 1922. (2410).
- Löwenthal, Felix, Justizrat, Rechtsanwalt, Schwerin. 1882. (1141).
- Löwenthal, Gustav, Kommerzienrat, Schwerin. 1919. (2208).
- Lübbe, Kaufmann, Schwerin. 1911. (2033).
- Lübcke, Dr., Drost a. D., Rechtsanwalt, Röbel. 1920. (2316).
- Lübeß, cand. phil., Schwerin. 1927. (2649).
- Lübstorf, Oberbaurat, Schwerin. 1906. (1895).
- v. Lücken, Regierungsrat, Gutsbesitzer, Massow i. M. 1922. (2418).


|
Seite 305 |




|
- Ludwigslust, Amtsausschuß des Meckl.-Schwer. Amtes. 1927. (2660).
- Ludwigslust, Rat der Stadt. 1926. (2646).
- Lueder, Gutsbesitzer, Redewisch b. Klütz. 1922. (2448).
- v. d. Lühe, Cathar., Frau verw. Hofmarschall, Exz., Schwerin. 1925. (2612).
- v. d. Lühe, Frau Margarethe, Schwerin. 1916. (2151).
- Lüß, Gymn.-Prof., Studienrat, Schwerin. 1919. (2209).
- Lüth, Studiendirektor, Schwerin. 1926. (2643).
- Maaß, Regierungsinspektor im Ministerium für Handel u. Gewerbe, Berlin-Dahlem. 1918. (2178).
- Maertens, Hauptmann, M. d. L., Gutsbesitzer, Neuhof a. Poel. 1926. (2628).
- Mahncke, Fritz, Kaufmann, Schwerin. 1919. (2226).
- Mahncke, Polizeimajor, Königsberg i. Pr. 1921. (2376).
- Mahnke, Seminarist, Neukloster. 1920. (2384).
- v. Maltzan, Friedrich, Freiherr, Oberforstmeister, Dobbertin. 1894. (1501).
- v. Maltzan, Ulrich, Freiherr, Gutsbesitzer, Gr. Luckow b. Vollrathsruhe. 1893. (1470).
- Marcus, Rechtsanwalt, Güstrow. 1913. (2098).
- Markmann, Dr., Referendar, Karlsruhe, 1919. (2182).
- Marsmann, Landgerichtsdirektor, Schwerin. 1900. (1703).
- Marung, Dr. med., Landesmedizinalrat, Schwerin, 1927. (2651).
- Masch, Vermessungsdirektor, Recklinghausen i. Westf. 1918. (2179).
- Masius, Jugend-Pastor, Friedrichsthal b. Schwerin. 1923. (2533).
- Maßmann, Regierungsrat, Schwerin. 1908. (1949).
- Mau, Friedrich, Rreg.-Baurat, Wismar. 1900. (1692).
- Mau, Wilhelm, Dr., Studienrat, Güstrow, 1921. (2368).
- Maybaum, Dr., Landesschulrat, Schwerin. 1904. (1810).
- v. Meerheimb, Freiherr, Gutsbesitzer, Gr. Gischow b. Jürgenshagen. 1922. (2443).
- Melz, Ina, Frau verw. Ministerialdirektor, Schwerin. 1922. (2445).
- Melz, Karl, Dr., Syndikus, Landgerichtsrat a. D., Hamburg. 1919. (2253).
- Metelmann, Buchhändl., Leipzig-Marienbrunn, 1923. (2518).
- Metterhausen, Regierungsrat a. D., Schwerin. 1903. (1798).
- Meyer, Arnold Lorenz, Bankdirektor, Schwerin. 1919. (2242).


|
Seite 306 |




|
- Meyer, Clemens, Kammervirtuos, Schwerin. 1912. (2061).
- Michaelis, Weinhändler, Wismar. 1891. (1416).
- Mierow, Lehrer, Upahl b. Grevesmühlen. 1927. (2659).
- Millies, Kanzleirat, Schwerin. 1913. (2113).
- Mitschke, Buchhändler, Striegau, Bez. Breslau. 1923. (2549).
- Moeller, Präsident der Oberpostdirektion, Geh. Postrat Schwerin. 1895. (1516).
- Moll, Verwaltungspraktikant, Malchin. 1922. (2492).
- Moncke, Mühlenbesitzer, Neubrandenburg. 1906. (1888).
- v. Monroy, Frl., Studienrat, Schwerin. 1923. (2516).
- Müller, Friedrich, Reg.-Baurat a. D., Rostock 1906. (1887).
- Müller, Hans, Dr. jur., Amtshauptmann, Schwerin. 1926 (2636).
- Münster i. W., Preußische Univ.-Bibliothek. 1915. (2137).
- Münster, Pastor, Grevesmühlen. 1903. (1787).
- Mussäus, Zolldirektor, Schwerin. 1919. (2236).
- Nagel, Verwaltungsinspektor, Kloster Malchow. 1922. (2495).
- Neckel, Apothekenbesitzer, Schwerin. 1921. (2382).
- v. Nettelbladt, Frhr., Major, Strafanst.-Insp., Dreibergel. 1908. (1957).
- Neubeck, Friedrich, Kaufmann, Schwerin. 1911. (2048).
- Neubeck, Hans, Dr, jur., Rechtsanwalt, Schwerin. 1909. (2010).
- Neubrandenburg, Gymnasium. 1904. (1825).
- Neubrandenburg, Landwirtschaftskammer. 1906. (1884).
- Neubrandenburg, Museumsverein. 1890. (1387).
- Neumann, Johann, Dr., Bürgermeister a. D., Lübeck. 1908. (1954).
- Neumann, Otto, Reg.-Braurat, Wismar. 1923. (2532).
- Neumann, Walther, Dr., Studiendirektor, Rostock. 1920. (2325).
- Nieny, Dr., Facharzt für Chir., Oberarzt des Stadtkrankenhauses, Schwerin. 1919. (2231).
- Noster, Justizamtmann i. R., Rechnungsrat, Berlin-Schönberg. 1911. (2045).
- Nüsch, cand. phil., Göttingen. 1921. (2380).
- v. Occolowitz, Ministerialamtmann, Schwerin. 1923. (2507).
- Oeding, Reg.- u. Baurat, Schwerin. 1925. (2616).
- v. Oertzen, Arthur, Major a. D., Potsdam. 1920. (2315).
- v. Oertzen, Hermann, Landdrost, Rostock. 1899. (1618).
- v. Oertzen, Krarl Bernhard, Forstmeister a. D., Kotelow. 1920. (2312).


|
Seite 307 |




|
- v. Oertzen, Leuthold, Landrentmeister a. D., Gutsbesitzer, Kotelow, 1881. (968).
- v. Oertzen, Frau, geb. v. d. Lühe, Schwerin. 1927. (2658).
- v. Oertzen, Ulrich, Gutsbesitzer, Salow b. Friedland, 1920. (2314).
- Oertzen, Dr. med., Arzt, Rostock. 1900. (1693).
- Ohlerich, Kaufmann, Schwerin. 1919. (2249).
- Ohloff, Ökonomierat, Rostock. 1909. (1996).
- Ohse, Präsident a. D. der Oberpostdirektion, Geh. u. Oberpostrat, Schwerin. 1921. (2336).
- Oldenburg, Notar, Wismar. 1890. (1358e).
- v. Ondarza, Pastor, Belm, Kr. Osnabrück. 1922. (2417).
- Otte, Kaufmann, Uelzen, Bez. Hannover. 1923. (2534).
- Pahren, Regierungsamtmann, stellvertr. Leiter des Landes-Wohlfahrtsamtes, Schwerin, 1923. (2535).
- Parchim, Rat der Stadt. 1927. (2650).
- Parchim, Lehrerbibliothek der städt. Schulen. 1921. (2339).
- Parey, Rechnungsrat, Eisenbahnoberinspektor a. D., Schwerin. 1922. (2476).
- Paschen, Verwaltungsinspektor, Hagenow. 1921. (2344).
- Passow, Dr. phil. et jur., Prof., Göttingen. 1904. (1808).
- Peeck, Reichsbahndirektor, Geh. Reg.-Rat, Schwerin. 1902. (1760).
- Pentz, Karl August, Gutsbesitzer, Volzrade b. Lübtheen. 1921. (2363).
- Pentz, Martin, Studienrat, Wismar. 1922. (2498).
- v. Peschke, Oberst a. D., Schwerin. 1923. (2569).
- Peters, Friedr., Oberzollinspektor a. D., Schwerin. 1897. (1549).
- Peters, Fritz, Studienrat, Schwerin. 1918. (2167).
- Peters, Gottfried, Oberpostinspektor a. D., Schwerin. 1920. (2289).
- Peters, Wilhelm, Dr., Justizrat, Rechtsanwalt, Schwerin. 1912. (2060).
- Petersen, Hermann, Dr., Präsident des Landesverwaltungsgerichts, Schwerin. 1919. (2232).
- Petersen, Paul, Domänenpächter, Gr. Strömkendorf b. Wismar. 1912. (2433).
- Pfeiffer, Dr. Prof., Geh. Obermedizinalrat, Landesmedizinalrat, Schwerin. 1919. (2186).
- Plate, Studienrat, Schwerin. 1914. (2130).
- Ploen, Regierungsrat, Schwerin. 1923. (2571).


|
Seite 308 |




|
- Plog, Friedr., Hofdekorationsmalermeister, Schwerin. 1919 (2245).
- Plog, Friedr., Kunst- u. Dek.-Maler, Schwerin. 1919. (2277).
- Pingel, Propst, Bützow, 1900. (1665).
- Plagemann, Dr., Konsul, Danzig-Langfuhr, 1913. (2107).
- v. Plessen, Gutsbesitzer, Trechow b. Bützow. 1903. (1803).
- Plüschow, Oberlandforstmeister, Schwerin. 1895. (1517).
- Pohl, Dr., Gutsbesitzer, Wessin. 1922. (2464).
- Pöhlmann, Dr., Facharzt f. Lungenkrankh., Schwerin. 1919. (2238).
- Pohrt, Dr., Facharzt für Chir., Schwerin. 1919. (2227).
- Poll, Geh. Regierungsrat, Schwerin. 1905. (1845).
- Prestien, Justizrat, Rechtsanwalt, Parchim. 1907. (1917).
- Pries, Adolf, Dr., Geh. Hofrat, Bürgermeister, Neubrandenburg. 1883. (1189).
- Pries, Johann Friedrich, Geh. Oberbaurat, Schwerin. 1897. (1554).
- Proehl, Ökonomierat, Schwerin, 1907. (1906).
- v. Prollius, Adolf, Wirkl. Geh. Rat, Gesandter a. D., Exz., Schwerin, 1927. (2671).
- v. Prollius, Jaspar, Ministerialdirektor a. D., Schwerin. 1882. (975).
- Prösch, Studienrat, Schwerin. 1920. (2290).
- Prosch, Dampfsägereibesitzer, Grabow. 1924. (2583).
- v. Rantzau, Oberhofmarschall, Exz., Schwerin. 1901. (1731).
- Raspe, Bürgermeister, Wismar. 1919. (2250).
- v. Raven, Ober-Regierungsrat, Schwerin. 1914. (2122).
- v. Reden, Frau verw. Major, Schwerin. 1923. (2565).
- Regenstein, Kaufmann, Neubukow. 1922. (2416).
- Rehse, Eisenbahninspektor a. D., Generalagent, Schwerin. 1914. (2135).
- Reichert, Kaufmann, Dömitz, 1909. (2006).
- Reincke-Bloch, Dr. phil., Univ.-Prof., Breslau. 1904. (1904).
- Reinecke, Ratsapothekenbesitzer, Parchim. 1907. (1930).
- Reinhardt, Albert, Postdirektor, Rostock. 1906. (1879).
- Reinhardt, Ernst, Amtshauptmann a. D., Gadebusch. 1898. (1582).
- Rickert, Lehrer, Schwerin. 1921. (2367).
- v. Restorff, Gutsbesitzer, Radegast b. Satow. 1923. (2509).
- Reuter, Karl, Studiendirektor, Doberan. 1915. (2142).
- Reuter, Ludwig, Propst, Breesen b. Neubrandenburg, 1883. (1211).


|
Seite 309 |




|
- Ribnitz, Volksschule, 1923. (2555).
- Ringeling, Gerhard, Dr., Studienrat, Doberan. 1913. (2112).
- Ringeling, Wilhelm, Realschuldir., Geh. Studienrat, Prof., Schönberg i. M. 1883. (1182).
- Ritter, Fabrikbesitzer, Grabow. 1920. (2326).
- Roepke, Büroinspektor, Schwerin. 1922. (2455).
- Rohr, Eisenbahninspektor, Schwerin. 1920. (2302).
- Rohrdantz, Pastor, Schwerin. 1927. (2669).
- Romberg, Bruno, Dr., Studienrat, Güstrow. 1921, (2377).
- Romberg, Gotthard, Dr. rer. po1., Berlin-Borsigwalde. 1923. (2558).
- v. Römer, Dr. med., Oberstabsarzt, Residentschaftsinspekteur des Gouvern.-Gesundheitsamtes, Pamekasan (via Surabaia). 1927. (2667).
- Roscher, Ober-Regierungsrat a. D., Schwerin. 1921. (2362).
- Rose-Grabow, Frl., Kunstmalerin Schwerin. 1919. (2190).
- Rostock, Bücherei der höheren Schulen. 1900. (1714).
- Rostock, Ratsarchiv. 1906. (1873).
- Rostock, Oberlandesgericht. 1907. (1943).
- Rostock, Rechtshistorisches Seminar der Landesuniversität. 1924. (2591).
- Rostock, Rostocker Bank. 1922. (2459).
- Rötger, Finanzrat, Schwerin. 1910. (2027).
- Rubach, Reichsbankrat, Lübeck. 1923. (2505).
- Ruß, Kaufmann, Schwerin. 1919. (2230).
- Rust, Dr., Medizinalrat, Schwerin. 1911. (2039).
- Rütz, Dr., Studienassessor, Neukloster. 1921. (2370).
- Saschenbrecker, Oberbürgermeister, Schwerin. 1920. (2297).
- Sandrock, Propst, Gr. Brütz b. Rosenberg. 1900. (1677).
- Saß, Geh. Reg.-Rat, Abteilungsdir. a. D., Schwerin. 1921. (2385).
- Sauer, Geh. Postrat a. D., Schwerin. 1925. (2607).
- v. Schack, Oberst a. D., Schwerin. 1904. (1821).
- Schade. Landdrost, Schwerin. 1919. (2228).
- Schäfer, Dr., Prof., Sevilla, Spanien. 1898. (1586).
- Schaumkell, Lic. Dr., Gymn.-Prof., Ludwigslust. 1927. (1766).
- Scheele, Schulrat, Ratzeburg. 1925. (2614).
- Schepler, Eisenbahninspektor, Waren. 1925. (2609).
- Schlesinger, Dr., Ministrerialdirektor, Schwerin. 1922. (2401).
- Schlettwein, Adolf, Ministerialdirektor z. D., Rostock. 1919. (2271).
- Schlettwein, Kurd, Reg.-Rat u. Major a. D., Berlin-Lankwitz. 1919. (2247).


|
Seite 310 |




|
- Schliemann, Lehrer, Börzow b. Grevesmühlen. 1922. (2422).
- Schlüter, Amtsgerichtsrat, Hagenow. 1925. (2608).
- Schmaltz, D Dr., Pastor, Schwerin. 1900. (1707).
- Schmidt, Hans, Reg.-Rat, Ludwigslust. 1927. (2664).
- Schmidt, Rudolf, Ministerialrat, Schwerin, 1926. (2640).
- Schmidt-Sibeth, Landdrost, Bad Doberan, 1900. (1659).
- Schnapauff, Ludwig, Pastor, Bernitt. 1914. (2134).
- Schnapauff, Ulrich, Dr. med., Arzt, Freiburg i. Br. 1923. (2530).
- Schneider, Kaufmann, Schwerin. 1916. (2150).
- Schnelle, Kassier a. D., Schwerin, 1892. (1442).
- Schoof, Pastor, Schwerin. 1926. (2625).
- Schramm, Kaufmann, Hespeler (Ontario), Canada. 1921. (2349).
- Schröder, Gustav, Amtsgerichtsrat, Warin. 1891. (1420).
- Schröder, Paul, Rechtsanwalt, Wismar. 1923. (2540).
- Schroeder, Edmund, Studienrat, Schwerin. 1924. (2589).
- Schroeder, Walter, Studienrat, Schwerin. 1924. (2598).
- Schroeder, Dr., Schlachthofdirektor, Salzwedel, 1919. (2196).
- Schult, Dr., Ministerialrat, Schwerin, 1921. (2390).
- Schultz, Hoflieferant, Stadtrat, Schwerin. 1912. (2075).
- Schultze, Pfarrer, Herzberg (Mark). 1919. (2248).
- Schulz, Siegfried, Gutspächter, Vietlübbe. 1906. (1865).
- Schulz, Wilhelm, Dr, jur., Ober-Reg.-Rat u. Direktor der Landesstrafanstalt, Dreibergen. 1920. (2320).
- Schumacher, Stadtamtmann, Schwerin. 1922. (2485).
- Schumann, Domänenpächter, Volkenshagen b. Mönchhagen. 1922. (2436).
- Schüßler, Hermann, Maurermeister, Woldegk. 1919. (2192).
- Schüßler, Wilhelm, Dr., Univ.-Prof., Rostock. 1922. (2419).
- Schwaar, Ministerialdirektor, Schwerin. 1908. (1975).
- Schwartz, Versicherungsdirektor, Amtsgerichtsrat a. D., Schwerin. 1922. (2411).
- Schwerin, Landesmuseum. 1891. (1413).
- Schwerin, Statistisches Amt, 1891. (1412).
- Schwerin, Realgymnasium. 1926. (2635).
- Schwerin, Bibliothek der städtischen Schulen, 1910. (2016).
- Schwerin, Mecklb. Bank. 1922. (2456).
- v. Schwicheldt, Gräfin, Frau Oberhofmeisterin, Exz., Schwerin. 1912. (2094).
- Seeler, Bürgermeister, Neustadt-Glewe. 1927. (2665).
- Seidel, Dr., Prof., Geh. Reg.-Rat, Museumsdirektor, Berlin. 1885. (1272).


|
Seite 311 |




|
- Sibeth, Geh. Justizrat, Rostock. 1883. (1169).
- Siegfried, Herbert, Dr., Referendar, Rostock. 1926. (2630).
- Siegfried, Paul, Generalstaatsanwalt, Rostock. 1902. (1768).
- Silberstein, Dr., Landesrabbiner, Rostock. 1911. (2036).
- Simon, Dr. iur., Gutsbesitzer, Schmachthagen. 1922. (2458).
- Singhol, Ministerialamtmann a. D., Schwerin. 1889. (1345).
- Sohm, Dr., Kammerdirektor, Schwerin. 1919. (2233).
- Sommer, Rechnungsrat, Schwerin. 1910. (2023).
- Spangenberg, Gust., Amtsgerichtsrat, Schwerin. 1919. (2235).
- Spangenberg, Hans, Dr., Univ.-Prof., Rostock. 1921. (2371).
- Spiegelberg, Dr. med., Arzt, Kirchdorf i. M. 1921. (2365).
- Sprenger, Dr., Reg.-Rat, Schwerin. 1922. (2403).
- Staack, Regierungsbaurat, Parchim. 1906. (1900).
- Staak, Studienrat, Rostock. 1920. (2293).
- Stampe, Landwirt, Neuhof b. Wittenförden. 1902. (1751).
- Stargard, Mecklb.-Strel. Amt. 1927. (2670).
- Starke, Dr. med., Arzt, Wismar. 1921. (2351).
- Staude, Kommissionsrat, Malchin. 1908. (1346).
- Steinhagen, Domänenpächter, Strohkirchen b. Rehna, 1922. (2437).
- Steinmann, Dr., Staatsarchivrat, Schwerin, 1920. (2307).
- Stephans, Weinhändler, Schwerin. 1919. (2244).
- Stettin, Preuß. Staatsarchiv. 1900. (1643).
- Stockholm, Stadt-Archiv u. Bibliothek. 1923. (2503).
- v. Stralendorff, Kammerherr, Gutsbesitzer, Gamehl b. Kartlow. 1887. (1308).
- Stralsund, Stadtbibliothek. 1926. (2626).
- Stratmann Dr., Ministerialrat a. D., Bankdirektor, Schwerin. 1912. (2085).
- Strecker, Dr., Staatsarchivrat, Schwerin, 1913. (2115).
- Strenge, Erich, Bibliothekar, Schwerin, 1907. (1942).
- Strenge, Joh. Albrecht, Inhaber der Stillerschen Hofbuchhandlung, Schwerin. 1908. (1977).
- Strömer, Studienrat, Schwerin. 1923. (2568).
- Stubbendorf, Rentner, Schwerin. 1927. (2654).
- Studemund, Otto, Landgerichtsdir., Schwerin. 1919. (2220).
- Studemund, Wilhelm, Pastor, Schwerin. 1902. (1755).
- Stuhr, Dr., Staatsarchivdirektor, Schwerin, 1891. (1409).
- Taetow, Pastor, Rossow b. Fretzdorf. 1896. (1532).
- Tarnow, Betriebsoberinspektor, Sachsenberg. 1919. (2234).
- Techen, Dr., Stadtarchivrat, Wismar. 1886. (1282).
- Tessin, Dr. phi1., Hamburg. 1920. (2334).


|
Seite 312 |




|
- Teterow, Rat der Stadt. 1926. (2647).
- Thomes, Pfarrer, Ratzeburg. 1926. (2633).
- Thormann, Justizrat, Rechtsanwalt, Wismar, 1890. (1386).
- Tiedemann, Dr., Amtsgerichtsrat, Schwerin. 1923. (2564).
- Timm, Hans Erich, Oberrentmeister, Malchin. 1921, (2346).
- Timm, Frau verw, Landbaumeister, Schwerin. 1919. (2191).
- Tischbein, Dr., Ministerialdir., Meckl. Gesandter, Berlin, 1921. (2354).
- Tode, Dr. phil., Kiel. 1920. (2319).
- Tretow, A., Gutsbesitzer, Kartlow i. M. 1923. (2559).
- Tretow, Erhard, Dr., Rechtsanwalt, Wismar. 1923. (2539).
- Tretow, Walter, Rechtsanwalt, Wismar. 1922. (2394).
- Trost, Friedrich, Dr., Lehrer, Bützow. 1923. (2519).
- Trost, Walter, Forstgeometer, Ludwigslust. 1923. (2520).
- Tschirch, Dr. med., Arzt, Wismar. 1921. (2342).
- Vanheiden, Kaufmann, Parchim. 1925. (2604).
- Verhein, Dr., Studienrat, Harburg (Elbe). 1920. (2283).
- Vick, Studienrat, Schwerin. 1914. (2129).
- Viedt, Louis, Buffalo (Ver. Staat.). 1923. (2554).
- Vorberg, Kommissionsrat, Schwerin. 1920. (2280).
- v. Voß, Achim, Rentner, Dresden. 1907. (1902).
- Voß, Ernst, Pastor, Basedow. 1919. (2193).
- Voß, Otto, Pastor, Cramon. 1925. (2603).
- Voß, Theodor, Amtsgerichtsdirektor a. D., Schwerin. 1900. (1709).
- Voß, Wilhelm, Dr., Bibliotheksdirektor a. D., Reg.-Rat, Schwerin. 1886. (1275).
- Waechter, Ministerialrat, Schwerin. 1916. (2153).
- Wagner, Friedrich, Dr., Gerichtsassessor, Schwerin. 1924 (2599).
- Wagner, Gustav, Silbermühle b. Plau. 1923. (2553).
- Wagner, Richard, Dr., Gymn.-Prof., Studienrat, Schwerin. 1897. (1563).
- Walm, Pastor, Hoh. Wangelin b. Vollrathsruhe. 1913. (2111).
- Walter, Ministerialdirektor z. D., Bankdirektor, Schwerin. 1905. (1847).
- Waren, Rat der Stadt. 1911. (2044).
- Weber, Franz, Dr., Oberschulrat, Schwerin. 1925. (2605).
- Weber, Hans Ludwig, Dr., Stellv. Syndikus der Handelskammer, Rostock. 1925. (2615).
- v. Wedelstaedt, Fräulein, Sekretärin, Schwerin. 1926. (2645).
- Wehmeyer, Justizrat, Rechtsanwalt, Schwerin. 1882. (1023).


|
Seite 313 |




|
- Weger, Versicherungsdirektor, Plau. 1923. (2553).
- Wegner, Verwaltungspraktikant, Grabow, 1921. (2348).
- Weinreben, Zahnarzt, Schwerin. 1908. (1948).
- Wempe, Dr., Bürgermeister, Schwerin. 1926. (2629).
- v. Wenckstern, Oberlandstallmeister, Exz., Redefin. 1921. (2352).
- Wendt, Amtsgerichtsrat, Schwerin. 1924. (2379).
- v. Werthern, Freifrau Sofie, Schwerin. 1924. (2576).
- Wesemann, Studienrat, Neustrelitz. 1922. (2424).
- Westphal, Franz, Dr., Studienrat, Schwerin. 1919. (2240).
- Westphal, Hertha, Dr., Beamt. d. Landw.-Kammer, Rostock. 1923. (2551).
- Weyer, Dr. iur., Gutsbesitzer, Schwerin. 1923. (2561).
- Wichmann, Finanzamtmann, Schwerin-Ostorf. 1912. (2078).
- Wiegandt, Dr., Studienrat, Wismar. 1916. (2144).
- Wiegels, Wilhelm, Zahnarzt, Schwerin. 1907. (1922).
- Wiegels, Wilhelm, Dr., med., Frauenarzt, Schwerin. 1925. (2623).
- Wiepert, Volksschuldirektor, Güstrow. 1911. (2034).
- Wiese, Lehrer, Eldena i. M. 1920. (2323).
- Wilbrandt, Kammerrat, Schwerin. 1922. (2478).
- Wilcke, Lehrer, Gr. Walmstorf b. Grevesmühlen, 1921. (2369).
- Wilde, Fritz, Abteilungsdirektor, Schwerin. 1919. (2183).
- Wilde, Heinr., Landgerichtsrat, Güstrow. 1919. (2266).
- Wildfang, Landdrost, Wismar. 1900. (1698).
- Wilhelmi, Axel, Dr., Obermedizinalrat, Kreisarzt a. D., Schwerin. 1892. (1445).
- Wilhelmi, Paul, Forstrechnungsrat a. D., Schwerin. 1912. (2090).
- Willemer, Dr. med., Obermedizinalrat, Ludwigslust. 1900. (1671).
- Willgeroth, Gustav, Bankvorstand, Wismar. 1916. (1531).
- Winkelmann, Ingenieur, Schwerin. 1923. (2570).
- Witte, Friedrich, Dr., Fabrikbesitzer, Rostock. 1922. (2447).
- Witte, Hans, Dr., Archivdirektor, Neustrelitz, 1898. (1574).
- Wittenburg, Rat der Stadt, 1927. (2657).
- Wittmann, Oberbaurat, Schwerin. 1912. (2087).
- Wittrock, Pastor, Schwerin. 1920. (2281).
- Wolff, Gottfried, Rechtsanwalt, Parchim. 1907. (1925).
- Wolff, Wolrad, D, Geh. Oberkonsistorialrat, Oberhofprediger a. D., Schwerin. 1882. (1068).
- Wollenberg, Landgerichtsrat, Schwerin. 1920. (2292).


|
Seite 314 |




|
- Wossidlo, Dr., Gymn.-Prof., Waren. 1890. (1356).
- v. Woyna, Generalleutnant a. D., Exz., Schwerin. 1919. (2273).
- Wunderlich, Dr., Reg. Rat i. e. R., Rechtsanwalt, Schwerin. 1901. (1734).
- Zander, Hofrat, Bürgermeister, Stargard i. M. 1906. (1882).
- Zarncke, Major a. D., Domänenpächter, Reppentin b. Plau. 1907. (1939).
- Zastrow, Albrecht, Lehrer, Wismar. 1923. (2529).
- Zastrow, Friedr., Landessekretär, Schwerin. 1907. (1909).
- Zelck, Dr., Bürgermeister a. D., Rechtsanwalt, Rostock. 1895. (1507).
- v. Zepelin, Gutsbesitzer, Rostock. 1922. (2450).
- Ziereke, Pastor, Röbel. 1910. (2022).
- Zingelmann, Regierungsbaurat, Lübz. 1896. (1541).