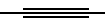|
[ Seite 249 ] |




|



|
|
:
|
VII.
Die wendischen Schatzfunde
aus Mecklenburg
von
Robert Beltz.
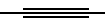


|
[ Seite 250 ] |




|


|
Seite 251 |




|
E in hervorragender pommerscher Schatzfund, von Quilitz auf der Insel Usedom, hat Veranlassung zu einer Behandlung der interessanten Fundgruppe und einer Zusammenstellung der auf deutschem Boden gemachten Funde gegeben (Baltische Studien N. F. XXIX 1927 S. 151 f.). Auf die eigentümliche Stellung, die sich dabei für Mecklenburg ergibt, auch hier einzugehen, rechtfertigt sich um so mehr, als in den Jahrbüchern seit sehr langer Zeit (Jahrgang LVIII 1893 S. 175) von dieser Erscheinung überhaupt nicht die Rede gewesen ist und die Anschauungen darüber sich natürlich seitdem gewandelt haben. Die wendischen Schatzfunde, nach einem fast durchgehenden markanten Zuge auch Hacksilberfunde genannt, sind bekanntlich Silbervorräte, bestehend aus Schmucksachen oder Münzen, die zum großen Teil zerhackt oder sonst zerbrochen sind, also im wesentlichen Wertmetall darstellen überwiegend sicher an verborgener Stelle geborgenes Gut, nur selten "Hausschätze". Die auffallende Beimengung massenhafter arabischer Münzen hat früher allgemein dazu geführt, auch in den Schmucksachen orientalische Erzeugnisse zu sehen, während jetzt der nordische Ursprung der meisten feststeht. Die Zusammensetzung der Schatzfunde ist das Ergebnis zweier sich begegnender Handelsbewegungen, der nordischen ("wikingischen") und einer orientalischen, die beide ihre Hauptwege durch das altrussische Gebiet nahmen. Die Münzen ermöglichen eine Datierung. Die frühesten Funde fallen in den Anfang des neunten Jahrhunderts, nur wenige sind jünger als 1060. Das Hauptland der Schatzfunde in Deutschland ist Pommern, wo die große Zahl von 85, darunter die größten überhaupt, bekannt geworden ist, und es ist zweifellos, daß sich darin die Bedeutung der größten Handelstadt des Nordens, Jumne (Vineta), wiederspiegelt. Auch sonst gibt die Häufung von Fundstätten Handelszentren (Heithabu, Oldenburg, Kolberg, Danzig) oder Verkehrswege an.
Da ist nun sehr zu beachten das Zurücktreten unseres Landes. Wir hatten bisher einen einzigen Schatzfund von Bedeutung, den von Schwaan 1859 (Jahrb. 26 S. 241), und erst in letzter Zeit haben sich zwei dazugesellt, von Stavenhagen 1924 (noch nicht veröffentlicht) und von Blumenhagen bei Neustrelitz 1923 (veröffentlicht von W. Karbe in präh. Zeitschr. XVI 1925 S. 76 und Kunst- und Geschichtsdenkmäler von Mecklenburg-Strelitz I 2


|
Seite 252 |




|
S. 1), dieser auch dadurch interessant, daß es sich hier wirklich einmal um einen "Hausschatz" handelt.
Durchmustert man aber die älteren Berichte, so ergibt sich doch eine leichte Erhöhung, und gerade mecklenburgische Funde sind es gewesen, die zu der richtigen Auffassung der Münzfunde geführt haben, nachdem man vorher nur in z. T. wildphantastischen Deutungen sich mit ihnen abgefunden hatte. O. G. Tychsen, der seinerzeit weltbekannte Orientalist, Professor in Bützow und Rostock, schrieb 1779 in den Gelehrten Beiträgen zu den Mecklenburg-Schwerinschen Nachrichten: "Vor das Erste sind alle bisher an der Ostsee gefundenen Münzen größtenteils solche, welche vom J. Christi 892 bis 998 in den Ländern Irak, Chorasan und Mawaralnahra zu Bagdad, Samorkand, Balch, Alschasch, Kufa, Basra, Enderade, Ferabar und Buchara von den Semanidischen Regenten dieser Länder mit den Namen der jedesmal lebenden Bagdadischen Chaliphen, als welche sie für die rechtmäßigen Nachfolger Muhammends erkannten, geprägt worden sind. Die Zahl der älteren von Bagdadischen Chaliphen geprägten Münzen, welche unter diesen Semanidischen zuweilen gefunden werden, ist im Verhältnis dieser letzteren nur sehr geringe. . . . Weil im zehnten Jahrhundert Monz-Ledinillach Egypten eroberte und sich zum Chaliphen aufwarf, so war davon die Folge, daß alle Gemeinschaft mit den Bagdadischen Chaliphen aufgehoben, und also der bisher über Alexandrien geführte starke orientalische und indische Handel sich zum Theil nach Rußland hinzog und den Grund zu der wichtigen Handlung der an der Ostsee belegenen Handelsstädte und zu dem nachher errichteten Hanseatischen Bunde legte. Hieraus läßt sich leicht wahrnehmen, woher bloß das von Bagdadischen Chaliphen gemünzte oder mit ihren Namen versehene Silbergeld ausschließungsweise nach Rußland und so weiter in unsre Gegenden habe kommen können. . . . Dieses Silbergeld sandten nun die Russen oder die Neben-Comtoirs der Hanseestädte als Rimessen für Waren nach den Haupt-Comtoirs in Nowogrod. Riga, Dörpt u. s. w., von da es dann an die Interessenten in den Handelsstädten an der Ostsee gelangte."
Die Bedeutung der Handelsstädte für die Deutung der Münzfunde ist hier durchaus richtig hervorgehoben, und es stellt ein starkes Gewicht für die Ansetzung von Jumne bei Wollin dar, daß sich gerade dort die Münzfunde häufen, wie an keiner zweiten Stelle (Balt. Stud. a. a. O. S. 187). Von Jumne nun führte sogar eine Handelsstraße auch nach Mecklenburg. In der berühmten Schilderung die Adam von Bremen (II, 19) von der nobilissima civitas Jumne gibt, die als sane maxima omnium, quas


|
Seite 253 |




|
Europa claudit, ci vi tatum erscheint, heißt es weiter: Ab illa civitate brevi remigio trajicitur hinc ad Dyminem urbem, quae sita est in ostio Peanis fluvii, ubi et Rugi habitant; inde ad Semland - -. Iter ejus modi est, ut ab Hammaburc vel ab Albia flumine septimo die pervenias ad Jumne civitatem per terram; nam per mare navim ingrederis ab Sliaswig vel Aldinburc, ut pervenias ad Jumne. In den verschiedenen Behandlungen, welche die Stelle gefunden hat, ist der in den hinc-inde liegende Gegensatz nicht genügend beachtet. Das kann doch nur heißen: von Jumne geht es auf der einen Seite (westlich) nach Demmin, auf der andern (östlich) nach dem Samland. Es wird doch niemand im Ernst inde auf Demmin beziehen und annehmen, daß man von Jumne nach dem Samland den Weg über Demmin genommen habe; auch das breve remigium findet seine Erklärung durch den Gegensatz zu dem weiten Wege nach dem Samland (darf also nicht, wie Schuchhardt, Arkona, Rethra, Vineta 1926 S. 84 will, für die Ansetzung von Jumne bei Peenemünde ins Feld geführt werden), und die Ansetzung von Demmin in ostio Peanis fluvii verliert ihr Befremdendes, wenn man es mit "am Eingange zur Peene" faßt. Bis Demmin ging von Hamburg, Adams Ausgangspunkte, der Landweg; dort begann die Wasserstraße. Die Richtung dieses Landweges ist sogar urkundlich bezeugt. In der Urkunde, in der Bischof Berno die Grenzen des Klosters Dargun festsetzt (1173 M.U.B. I 111), wird auch eine via, quae per se de Dimin viantes deducit ad Dargon et Lucho, als Grenzbezeichnung verwendet, und in einer Schenkungsurkunde des Fürsten Kasimar von Pommern an dasselbe Kloster (1216 M.U.B. I 223) ebenso eine via regia, quae ducit de Luchowe in Lavena (Laage), sicher dieselbe Straße, deren Fortsetzung dann nach Werle bei Schwaan geführt haben mag. Die Bedeutung einer via regia im Wendenlande ist ungeklärt. Eine aus derselben Zeit beglaubigte via regia (eine Abzweigung wird 1241 als antiqua strata bezeichnet) ging durch Obersachsen und die Lausitz, Dresden, Bautzen, Görlitz, Lauban nach Breslau (Zeitschr. f. Ethnol. 1892 S. [413]). Es ist hier von "Erdschanzen" die sie deckten, die Rede.
Auch unsere via regia ist sehr stark bewehrt und verbindet bedeutende Burgen, Demmin, Dargun, Laage, wohl auch Werle; bei Lüchow suchen wir sie seit Jahren. Aber einen Niederschlag in Schatzfunden hat sie nicht gefunden. Auf dem Wege bis Demmin sind mehrere Schatzfunde in den Kreisen Anklam und Demmin geborgen, dann aber kommt in jener Gegend nur ein Fund mit sächsischen, rheinischen, niederländischen, böhmischen Münzen und sog. Wenden-


|
Seite 254 |




|
pfennigen, welche den Fund auf etwa 1040 datieren, dabei einige feine Filigranohrringe, von Remlin b. Gnoien (Jahrb. 9 S. 390, 460, dahin gehört vielleicht auch ein Dirhem von Harun al Raschid 796, Jahrb. 17 B S. 30), und weiter der große Fund, der 1859 auf der Feldmark von Schwaan am linken Ufer der Warnow gegenüber der Burg Werle gemacht wurde (Jahrb. 26 S. 241) und der eine Fülle von Schmucksachen und Münzen enthielt (Gewicht 3 kg), welche die Datierung auf etwa 1030 geben. Auch der weitere Weg nach Hamburg und Oldenburg in Wagrien verrät sich durch Funde nicht. G. Staak hat aber neuerdings (die Abhandlung wird in der Heimatbundzeitschrift veröffentlicht werden) auf einen in der Volkssage als "Rilterdamm" bezeichneten und in Resten erhaltenen Weg hingewiesen, der von Bützow seinen Weg nach der Wismarschen Burg nimmt, wo wir die Handelsstadt Rerik (s. u.) suchen dürfen. Auch in dem großen, mir leider unverständlichen Werke des Russen Egorow über die Kolonisation Mecklenburgs 1914 ist die große Handelsstraße von Demmin nach Lübeck (richtiger Oldenburg) so eingetragen.
Vielleicht ist den Funden in der Gegend von Gnoien doch eine größere Bedeutung zuzuschreiben. 1184 unternimmt der junge König Knut II. von Dänemark einen Rachezug gegen die circipanischen Wenden, welche den Sturz Heinrich des Löwen zu einem Aufstande ausgenützt haben. Er geht über das Trebelmoor, zieht an einer Feste Lubechinca (= Lübchin, welches von beiden, ist hier belanglos) vorüber, ohne sie zu erobern, und muß sich begnügen, eine "Kaufstadt" zu plündern. In dieser "Kaufstadt" sieht man die heutige Stadt Gnoien, faßt sie aber nur als "Marktflecken" auf (z. B. Rudloff, Gesch. Mecklenburgs vom Tode Niklots 1901 S. 81). Man glaubt allgemein, den Slawen "Städte" überhaupt noch nicht zuschreiben zu dürfen. Das geht zu weit. Eine aufmerksame Lektüre der Biographen Ottos von Bamberg weist doch in den zwanziger Jahren des zwölften Jahrhunderts auf Siedlungen städtischen Charakters, in denen Kaufleute nicht nur zu Markttagen, sondern zu ständiger Niederlassung weilten. Und auf ostslawischem Boden ist eine städtische Organisation schon im neunten Jahrhundert, ganz deutlich 1 ) schon in der Zeit vom neunten bis elften Jahrhundert; im zwölften wird sogar die große Stadt Nowgorod mit ihrer Herrschaft von Großkaufleuten die Herrin eines riesigen, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten organisierten Gebietes. Ihre Vorläufer sind die gorod genannten


|
Seite 255 |




|
Residenzen der nordischen (warägischen) Fürsten, die als Eroberer und Kaufleute in das Land kamen und die Träger jenes Silberhandels gewesen sind, der uns hier beschäftigt. Ihr Bezirk ist nicht in erster Linie ein militärischer, sondern das Rohstoffgebiet für den Handel in den Städten. Ungemein bezeichnend ist hier (im nördlichen Rußland) der Name für die kleinen Bezirke pogosty aus dem Stamm gost = Gast, d. h. Fremder, Kaufmann.
Solche Erscheinungen haben für uns natürlich nur den Wert von Parallelen, die wir nicht etwa ohne weiteres auf unserem Boden voraussetzen dürfen, mit denen als Möglichkeiten wir aber auch hier zu rechnen haben. Das aber dürfen wir sagen, daß der Verfasser der Knytlingasaga, der die Taten seines Helden, des Königs Knut, im Stile nordischer Wikingerverherrlichung schildert, schwerlich die Plünderung eines einfachen wendischen Marktfleckens eingesetzt haben wird und daß der betroffene Ort (mag es nun Gnoien oder ein anderer sein) doch wohl eine Station an oder in der Nähe der großen Handelsstraße Jumne Hamburg (Oldenburg) gewesen ist.
Wir zählen die mecklenburgischen Funde, von Nordwesten beginnend, auf, und zwar auch einzelne Münzen aus der "Hacksilberzeit", weil da doch die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß sie zerstreuten Schatzfunden entstammen.
Dassow. Arabische Münzen und "Brakteaten". Tychsen a. a. O. S. 158. Verschollen. - Gadebusch. 1200 Münzen. v. Ledebur, Zeugnisse eines Handelsverkehrs mit dem Orient, Berlin 1840 S. 67. Verbleib nicht bekannt. - Wismar. Münzen. Schröder, Kurze Beschreibung der Stadt und Herrschaft Wismar 1743 S. 39. Verschollen. - Steinhaufen bei Wismar; großer Fund an arabischen Münzen und Schmucksachen. v. Ledebur S. 67. Verschollen. - Sukow (?) bei Schwerin. Deutsche Münzen, Ringschmuck, Ohrringe. Jahrb. 9 S. 388. - Bei Schwerin. 27 Münzen, 10. Jahrh. Jahrb. 5 B S. 140. Verbleib nicht bekannt. - Boizenburg. Münze. Desgl. - Gegend von Neustadt ("in der Lewitz"). Arabische, deutsche, englische, ungarische Münzen, um 1030. Jahrb. 4 B S. 57. - Rühn bei Bützow. Arabische Münzen, 809. Tychsen, Bützower Nebenstunden III 1768. Verschollen. - Schwaan. S. o. - Marlow. Schmuckstück. Jahrb. 8 B S. 77. - Wahrscheinlich Gegend von Penzlin. Arabische Münzen vom Anfang des neunten Jahrh. Jahrb. 5 B S. 96. - Stavenhagen. S. o. - Ludorf bei Röbel. Deutsche Münzen des zehnten Jahrh. Jahrb. 1 B S. 37. - Warlin (Pragsdorf ?) bei Stargard. Angelsächsische und arabische Münzen, Schmuckringe. Jahrb. 1 B S. 37. Verschollen. - Pragsdorf bei Stargard. Größerer Fund arabischer Münzen. Jahrb.


|
Seite 256 |




|
1 B S. 37. - Blumenhagen bei Neustrelitz. S. o. - Krumbeck bei Feldberg. Arabische Münzen. v. Ledebur S. 67. Verschollen. - Zahren bei Fürstenberg, Münzen. Karbe, Kunst- und Geschichtsdenkmäler S. 1.
Diese an Zahl geringen, über das Land zerstreuten Funde erweisen nur, daß auch Mecklenburg seinen Anteil an der großen nordisch-orientalischen Handelsbewegung gehabt hat. Zu Handelswegen oder Handelszentren lassen sie sich nicht gruppieren. Eine wichtigere Handelsstadt hat ja das Land in der eigentlichen "Hacksilberzeit" nicht besessen. Wohl liegt hier das älteste überhaupt auf slawischem Gebiet erwähnte emporium; die Dänen nannten es Reric, der einheimische Name ist nicht bekannt, auch nicht seine Lage. Aber die Erwähnung fällt in die Zeit des Anfangs der Handelsbewegung (808), und da wird berichtet, daß der Dänenkönig Gottfried die Stadt zerstört und die Kaufleute nach Sliesthorp (Schleswig) übergeführt habe. Sie wird zwar 810 noch einmal genannt (Quellen s. bei Wigger, Annalen), verschwindet dann aber in der Überlieferung und hat offenbar weiterhin keine Rolle gespielt. Der Handel zur See geht auf Schleswig = Haithabu über und von dort oder von Oldenburg direkt nach Jumne; Mecklenburg ward nicht berührt. Der Landhandelsweg von Hamburg über Jumne ist ja durch das Land gegangen (s. auch Jahrb. 58 S. 177 und oben), hat aber keine wesentlichen Spuren in Funden hinterlassen. So findet das Zurücktreten der interessanten Erscheinung der Schatzfunde in Mecklenburg seine einfache Erklärung.