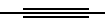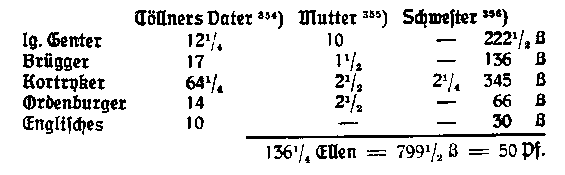|




|


|
|
|
-
Jahrbücher für Geschichte, Band 96, 1932
- Das Rostocker Patriziat bis 1400
- Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart
- Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan
- Über die Besiedlung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256
- Lochäxte aus Mecklenburg
- Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932
- Jahresbericht über das Vereinsjahr vom 1. Juli 1931 bis zum 30. Juni 1932 : Schwerin, 1. Juli 1932
Verein für mecklenburgische Geschichte und
|
|
|
|
Mecklenburgische |
||
Jahrbücher |
||
Gegründet von Friedrich Lisch,
fortgesetzt
|
||
96. Jahrgang 1932 |
||
Herausgegeben von
|
||
Schwerin i. M.
Druck und Vertrieb der Bärensprungschen Hofbuchdruckerei


|




|


|




|
Inhalt des Jahrbuchs.
| Seite | ||
| I. | Das Rostocker Patriziat bis 1400. Von Studienreferendar Dr. Hans Ulrich Römer - Malchin | 1 |
| II. | Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Mit Bildtafel. Von Studienrat Hans Beltz - Schwerin | 85 |
| III. | Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan. Von Dr. Wilhelm Biereye - Stettin | 135 |
| IV. | Über die Besiedelung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256. Von demselben | 151 |
| V. | Lochäxte aus Mecklenburg. Mit zwei Bildtafeln. Von Professor Dr. Dr. h. c. Robert Beltz - Schwerin | 189 |
| VI. | Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572. Mitgeteilt von Pastor emer. Friedrich Bachmann - Schwerin | 197 |
| VII. | Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932. Von Staatsarchivrat Dr. Werner Strecker - Schwerin | 207 |
| Jahresbericht (mit Anlagen A und B). Mit Bildtafel | 235 | |
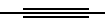


|
[ Seite 1 ] |




|



|


|
|
|
- Das Rostocker Patriziat bis 1400
- Die Schweriner Kornmühlen von den Anfängen bis zur Gegenwart
- Zur ältesten Geschichte des Geschlechts v. Maltzan
- Über die Besiedlung des Landes Parchim durch die deutsche Ritterschaft 1226-1256
- Lochäxte aus Mecklenburg
- Die Mecklenburger im Wittenberger Ordiniertenbuch von 1537 bis 1572
- Die geschichtliche und landeskundliche Literatur Mecklenburgs 1930-1932



|


|
|
:
|
I.
Das Rostocker Patriziat
bis 1400
von
Hans Ulrich Römer.
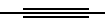


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|
Inhaltsverzeichnis.
| Einleitung. | Seite | |
| Stand der Forschung | 5-9 | |
| Kapitel I. | ||
| Entstehung und Entwicklung des Rostocker Patriziats | 9-29 | |
| Kapitel II. | ||
| Der Beruf der Rostocker Patrizier | 29-49 | |
| Kapitel III. | ||
| Die Vermögenslage der Rostocker Patrizier | 49-71 | |
| Kapitel IV. | ||
| Die soziale Stellung des Rostocker Patriziats | 71-84 | |


|
[ Seite 4 ] |




|
Quellen.
Mecklenburgisches Urkundenbuch Bd. I-XXIV. Schwerin 1863-1913.
Die ältesten Stadtbuchfragmente Rostocks 1258-1262. Hrsgg. von E. Dragendorff. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock (fortan zitiert BGR.). Bd. II, 2. Rostock 1897.
Stadtbuchblatt von 1257-1258. Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. III, 1. Rostock 1900.
Stadtbuchblatt von ca. 1262. Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. IV, 1. Rostock 1904.
Die Chronik des Dietrich vam Lohe (1529-1583). Hrsgg. von E. Dragendorff: BGR. XVII. Rostock 1931.
Witschop-Buch Nr. II (1338-1384).
Stadtbuch Nr. II (1270-1288) - früher Stadtbuch C.
Stadtbuch Nr. III (1289-1294) - früher Stadtbuch D.
Stadtbuch Nr. IV (1295-1303) - früher Stadtbuch E.
Stadtbuch Nr. V (1304-1314) - früher Hausbuch.
Stadtbuch Nr. VIII (1324-1335) - früher Hausbuch.
Stadtbuch Nr. IX (1337-1353) - früher Hausbuch.
Stadtbuch Nr. X (1354-1367) - früher Hausbuch.
Abkürzungen.
MUB. = Mecklenburgisches Urkundenbuch.
BGR. = Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock.
MJB. = Jahrbücher des Vereins für meckl. Geschichte und Altertumskunde.
HGB. = Hansische Geschichtsblätter.
Pfingstbl. = Pfingstblätter des Hansischen Geschichtsvereins.
HZ. = Historische Zeitschrift.


|
[ Seite 5 ] |




|
Einleitung.
Stand der Forschung.
Das bekannte Werk des Freiherrn Karl Heinrich Roth von Schreckenstein über das Patriziat in den deutschen Städten 1 ) war zur Zeit seiner Veröffentlichung (1856) eine verdienstvolle Leistung. Es entspricht aber nicht mehr den heutigen Forderungen der Wissenschaft, da die Erforschung der Stadtgeschichte durch bahnbrechende Forschungen neuerer Rechts- und Wirtschaftshistoriker auf eine festere Grundlage gestellt ist und es damals noch an Sonderuntersuchungen fehlte, welche die gemeinsamen Züge und die Abweichungen in der Beschaffenheit und Entwicklung des Patriziats deutlich erkennen lassen.
Die in den letzten 40 Jahren erschienenen Untersuchungen über das Patriziat der Städte Dortmund 2 ), Lübeck 3 ), Goslar,
Derselbe, Das Lübeckische Patriziat. (Fortan zitiert: Wehrmann II.) Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, Band V, Heft 3. Lübeck 1888.


|
[ Seite 6 ] |




|
Hildesheim, Braunschweig 4 ), Breslau 5 ), Nürnberg 6 ), Straßburg, Basel, Freiburg, Worms 7 ), Köln 8 ), Lindau 9 ), Münster 10 ), Soest 11 ) erkennen im allgemeinen an, daß die Patrizier sich im Besitz der wichtigsten städtischen Ämter befanden, daß sie zu den gesellschaftlich gehobenen und wohlhabendsten Bürgern gehörten und ihre Abschließung sich vornehmlich gegen den Handwerkerstand richtete. Andere wichtige Fragen haben dagegen eine sehr verschiedene Antwort erhalten. Einer sicheren und umfassenden Klärung bedarf z. B. die Frage, aus welchen Berufsschichten sich das Patriziat einer mittelalterlichen Stadt zusammensetzte. Ohlendorf vertritt die Ansicht, daß die Patrizier Niedersachsens aus grundherrlichen und ritterlichen Altfreien hervorgingen und sich erst später dem Gewandschnitt, dem Handel und anderen Berufen zuwandten 12 ). In Dresden


|
Seite 7 |




|
gehörten zur ersten Bürgerklasse, "aus welcher der Ratsstuhl besetzt wurde, die Bürger, welche innerhalb oder außerhalb des Weichbildes einen größeren Grundbesitz, Vorwerke und Meiereien besaßen und von deren Erträgnissen lebten, nächstdem die Kaufleute ..." 13 ). In Münster konnten sowohl Ministeriale als auch Kaufleute in das städtische Patriziat aufgenommen werden, nur mußten sie von einem schöffenbaren Geschlecht abstammen 14 ). F. Keller gelangt zu dem Ergebnis, daß in Lindau die ältesten Patrizier vermutlich Kaufleute waren, daß man aber von einem Patriziat im Vollsinn des Wortes erst sprechen könne, als um etwa 1300 ein starker Zuzug von Adligen und Ministerialen in die Reihen dieser handeltreibenden ältesten Geschlechter erfolgte 15 ). In Görlitz scheinen Kaufleute als Mitglieder des ältesten Patriziats überhaupt nicht nachweisbar zu sein 16 ). Die Soester Patrizier stammten, wie es scheint, z. T. aus der Kaufmannschaft, z. T. waren sie ländlicher altfreier Herkunft 17 ). Das Nürnberger Patriziat setzte sich nach den Forschungen von J. Meyer aus Ministerialen, Kaufleuten und Grundeigentümern zusammen 18 ). Demgegenüber bestreitet Max Foltz einen stärkeren Anteil der Ministerialen an der Zusammensetzung der städtischen Patriziate von Straßburg, Basel, Worms und Freiburg 19 ). Für Köln stellt Friedrich Lau den Satz auf: "Entsprechend der hervorragenden Handelsbedeutung der Stadt sind die meisten der hervorragenden Kölner Familien aus dem Kaufmannsstand hervorgegangen oder haben sich doch demselben schon früh zugewandt" 20 ). In der Abhandlung Luise von Winterfelds finden wir über die Dortmunder Patrizier folgende Angaben: "Jedenfalls kennen wir vor 1400 keinen Ratsherrn, der zu einer landadligen Familie gerechnet hätte" - "die Geschlechter waren freie Kaufleute, die den Handel ... als ihre altge-


|
Seite 8 |




|
wohnte sichere Nahrung (!) betrachteten ..." 21 ). In den Breslauer Patriziern endlich glaubt Georg Pfeiffer meistens Kaufleute sehen zu können, die indessen bald dazu übergingen, ihr flüssiges Kapital durch Ankauf von Grundbesitz und Renten zu sichern 22 ).
Die Forschungen Werner Sombart's, Georg von Below's und anderer Wirtschaftshistoriker haben die Frage angeregt, ob die großen Vermögen, die man im Hoch- und Spätmittelalter in der Hand der Patrizier findet, aus angehäufter Grundrente oder aus Handelsgewinnen entstanden sind. Die Untersuchung Julie Meyer's z. B. beantwortet die Frage folgendermaßen: "Wohl finden sich unter den reichen Leuten Nürnbergs, unter den Patriziern frühere Grundherren und städtische Grundeigentümer, doch verdanken sie ihren Reichtum nicht dem Grund und Boden, den sie besitzen, denn die Rente aus Grundbesitz ist wesentlich kleiner als der Gewinn aus dem Handel" 23 ). Auch in Wien 24 ), Köln 25 ), Lübeck 26 ), Straßburg 27 ), Halle 28 ), Dortmund 29 ) und anderen Städten 30 ) stammten die großen patrizischen Vermögen offenbar aus Handelsgewinn. In Braunschweig, Hildesheim und Goslar dagegen sollen die ersten Überschüsse der Patrizier aus dem


|
Seite 9 |




|
Grundbesitz stammen und den Fernhandel erst ermöglicht haben 12).
Recht verschieden sind auch die Ergebnisse, die über das Verhältnis des Patriziats zum Rittertum gewonnen sind.
Die vorliegende Arbeit will den Versuch machen, die von der Wissenschaft angeregten Fragen über die Geschichte des Patriziats für die Stadt Rostock zu beantworten und damit einen Beitrag zur allgemeinen Städtegeschichte Deutschlands wie zur Landesgeschichte Mecklenburgs zu liefern. Die Beschaffenheit des Patriziats mecklenburgischer Städte ist mit Ausnahme des Patriziats der Stadt Rostock in besonderer Arbeit noch nicht untersucht worden. Über das Rostocker Patriziat handelt G. C. F. Lisch in zwei kurzen Aufsätzen (1846 und 1848) 31 ), die jedoch den Gegenstand bei weitem nicht erschöpfen und wichtige Fragen, z. B. welchen Berufsschichten die Rostocker Patrizier vornehmlich angehörten und auf welchem Wege sie ihre großen Vermögen erwarben, nicht eingehend genug beantworten.
Entstehung und Entwicklung
des
Rostocker Patriziats.
Eine Gründungsurkunde Rostocks ist nicht erhalten. Die erste überlieferte, für Rostock ausgestellte Urkunde vom 24. Juni 1218 32 ) ist in die Urkunde vom 25. März 1252 eingerückt 33 ). Im Jahre 1218 bestätigte Heinrich Borwin I., Fürst
Derselbe, Über das Rostocker Patriziat. (Fortan angeführt: "Lisch II".) MJB. XIII S. 254 ff. Schwerin 1848.


|
Seite 10 |




|
von Mecklenburg, mit seinen Söhnen Heinrich und Nikolaus den Einwohnern Rostocks die Zollfreiheit in seinem ganzen Herrschaftsbereich sowie den Gebrauch des Rechtes der Stadt Lübeck. Rostock entstand demnach vor 1218. Schon damals bestand in der Stadt ein Ratskollegium; zehn Rostocker Ratmannen treten neben einigen Großen Mecklenburgs als Zeugen der Urkunde dieses Jahres auf. Ein Rat ist in Rostock auch weiterhin nachweisbar. Er vereinigte in seiner Hand zunächst nur gewisse Hoheits- und Verwaltungsrechte, wahrscheinlich die Marktgerichtsbarkeit und die freiwillige Gerichtsbarkeit. Der landesherrliche Einfluß in der Stadt überwog noch. Im Lauf des 13. Jahrhunderts mehrten sich dann die Befugnisse des Stadtrats. Er erwarb unter anderem die Steuer- und Finanzverwaltung, das Gerichtswesen, das Zoll -und das Münzwesen, das Geleits- und das Judenregal. Um 1325 war die bürgerliche Selbstverwaltung im wesentlichen ausgebildet 34 ). Die Wahl des Rates erfolgte jährlich und auf ein Jahr. Im Ratsverzeichnis vom 5. April 1266 heißt es 35 ): Anno domini MCCLXVl presidebant consilio ..., es folgen die Namen von achtzehn Rostocker Ratmannen; das Verzeichnis von 1267 beginnt mit den gleichen Worten, zählt aber unter ebenfalls achtzehn Ratsherren eine Reihe von Namen auf, die im Verzeichnis des vorhergehenden Jahres nicht erscheinen 36 ). Die jährliche Erneuerung des Rates geschah von alters her auf dem Wege der Kooptation, d. i. der Selbstergänzung. Das bezeugt eine Urkunde vom 8. Januar 1314, in welcher bestimmt wird, daß in diesem Jahr Rat und Landesherr die Wahl der neuen Ratsherren gemeinsam vornehmen sollten, daß aber vom nächsten Jahre ab der alte Rat allein, wie es von jeher üblich gewesen sei, die neuen Mitglieder wählen sollte 37 ). Auf diese Weise war es den im Rat befindlichen Bürgern leicht möglich, unliebsame Elemente aus dem Stadtrat fernzuhalten und die Leitung der Stadt möglichst in ihrem Besitz zu erhalten. Dieses Recht der Selbstergänzung


|
Seite 11 |




|
eröffnete andererseits den Mitgliedern des Rates die Möglichkeit, Verwandten und Freunden bei der Neuwahl der Ratmannen Zutritt zu dieser bereits um 1300 gegenüber der landesherrlichen Macht fast selbständigen 38 ) und somit sehr einflußreichen Körperschaft zu verschaffen. So konnte in Rostock wie in anderen deutschen Städten des Mittelalters ein Geschlechterregiment entstehen. Ein Blick auf die erhaltenen Ratslisten und die anderweitigen urkundlichen Erwähnungen aller oder einzelner Ratsherren zeigt in der Tat, daß nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Gesamtbürgerschaft im Stadtrat vertreten war. Wir bemerken im Rat z. B. in häufiger Wiederkehr die Namen Baumgarten, Beseler, Buxstock, Fehmern, Freden, Frese, Gothland, Hoffmann, Holloger, Horn, Katzow, Koppmann, Koesfeld, Kröpelin, Kruse, Kyritz, Lage, Lemhus, Lise, Lore, Löwe, von der Möhlen, Mönch, Nachtrabe, Pape, Quast, Rode, Unruh, Vöge, Wiese, Wilde, Witt, Töllner und andere mehr 39 ). Innerhalb der Ratsfamilien wurden zahlreiche Heiraten geschlossen. Damit bildete sich eine große, häufig durch verwandtschaftliche Bande verbundene Gemeinschaft der im Rostocker Stadtrat vertretenen Familien: "Das Rostocker Patriziat". Schon im 14. Jahrhundert war die Mehrzahl der Rostocker Ratsfamilien untereinander verwandt. Die beiden Familien Töllner und Koppmann z. B., die selbst miteinander verschwägert waren, hatten verwandtschaftliche Beziehungen zu dreizehn patrizischen Familien, und zwar bereits in der dritten Generation. Ein Ausschnitt aus den Stammtafeln der Töllner und Koppmann möge zur besseren Veranschaulichung beitragen 40 ).


|
Seite 12 |




|
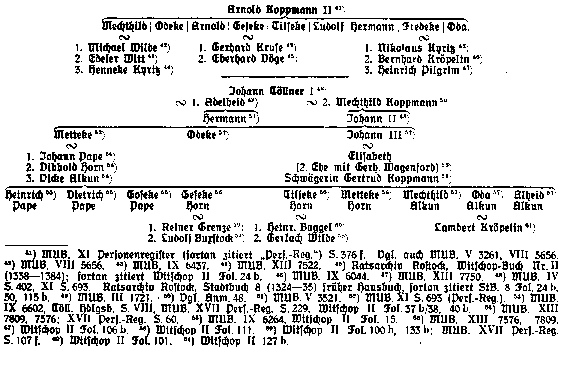


|
Seite 13 |




|
Das Rostocker Patriziat entwickelte sich aus dem Stadtrat. Damit verlief seine Entwicklungsgeschichte abweichend von der mancher anderen städtischen Patriziate Deutschlands. Max Foltz z. B. betont, daß in Straßburg auch vor der Entstehung des Stadtrates die Belange der Bürgerschaft durch eine Aristokratie vertreten wurden 62 ), und Friedrich von Klocke spricht von einem Patrizierausschuß als Vorläufer des Stadtrates von Soest 63 ). Für die Mitglieder des Rostocker Patriziats gilt demnach voll und ganz der Satz Georg von Belows: "Die Ratsfähigkeit bildete das Hauptkennzeichen der Patrizier" 64 ). Als Ratsherr erhielt der Patrizier in den Urkunden ebenso wie der Ritter und der Geistliche den Titel "dominus" 65 ); ein Patrizier, der zur Zeit einer Beurkundung irgendwelcher Art nicht Mitglied des Stadtrates war, wurde meistens "honestus vir", "discretus vir" usw. genannt. Dem gewöhnlichen Bürger gab man in den Urkunden in der Regel nur die einfache Bezeichnung "civis". Noch einige andere Anzeichen lassen sich aus den Quellen erbringen, die auf das frühzeitige Bestehen eines Patriziats in Rostock hinweisen. Schon für das 13. Jahrhundert bezeugen manche Urkunden, daß der Rat zur Beratung gewisser, vermutlich wichtigerer Fragen nicht die ganze Bürgerschaft, sondern nur einen Teil heranzog. Im Jahre 1278 z. B. erließ der Rat eine Verordnung über die Verlosung der Kaufbuden im Rathaus "cum senioribus civitatis" 66 ). Als sich die Stadt im Jahre 1283 an einem Landfriedensbündnis beteiligte, wurde festgesetzt, daß zu den jährlich viermal stattfindenden Zusammenkünften der vertragschließenden Parteien "rectores, iudices et iurati .. de discretioribus civitatum" gewählt werden sollen 67 ). Im Jahre 1287 verzichtete der Rostocker Vogt auf Skanör, Eike, auf den Ersatz des Geldes, das er während seiner Tätigkeit auf Skanör für die Stadt hatte ausgeben müssen, "coram discretioribus nostre civitatis" 68 ). Unter diesen "cives seniores" bzw. "cives dis-


|
Seite 14 |




|
cretiores" usw. haben wir wahrscheinlich Angehörige der ratsfähigen Familien zu erkennen 69 ). Wie soll man weiter die Zunftkämpfe in Rostock um 1286/87 und 1312 erklären, wenn man nicht annimmt, daß in der Stadt eine bevorrechtigte Oberschicht bestand, gegen die sich die damals wohl schon wohlhabende und selbstbewußte übrige Bürgerschaft erhob? Den Anlaß zum Aufstand wird das Streben der Bürger gegeben haben, politische Rechte entsprechend ihrer sozialen Lage zu gewinnen!
Um 1286/87 entstand zum erstenmal ein Aufruhr gegen den Rat. Sechs Ratsherren wurden aus der Stadt vertrieben und ihrer Habe beraubt; sechs andere Rostocker Bürger traten an die Stelle der Vertriebenen 70 ). Unter den neu gewählten Ratsherren befanden sich unter anderem auch Johann Kempe und Heinrich von Ibendorf. Von Johann Kempe wissen wir, daß er Handwerker war; er erscheint einmal in einer Urkunde als "Magister Johannes Pugil" 71 ). Auch Heinrich von Ibendorf scheint Beziehungen zum Handwerkerstand gehabt zu haben. Wir hören von ihm, daß er sechs Handwerksämtern eine Beteiligung am Rat versprochen, dieses Versprechen aber später geleugnet haben soll und deshalb wegen Meineides aus der Stadt verwiesen wurde 72 ). Das Ziel des Aufstandes, wahrscheinlich die Durchbrechen der patrizischen Ratsfähigkeit zugunsten aller Bürger, wurde indessen nicht erreicht. Schon 1292 begegnet uns einer der aus der Stadt vertriebenen Ratmannen wieder als Rostocker Ratsherr 73 ). Das Patriziat gewann seine alte Stellung zurück. Ergebnislos verlief auch die zweite Erhebung der Bürgerschaft gegen den Rat im Jahre 1312. Zwar erlangten die Handwerker vorübergehend einigen Einfluß auf die Wahl des Stadtrates, doch schon 1314 wurde die alte Verfassung wieder hergestellt 74 ). Weitere Kämpfe während des 14. Jahrhunderts berichten die Rostocker Quellen nicht. Die alte Ordnung blieb erhalten.


|
Seite 15 |




|
Das tatsächliche Bestehen eines Patriziats in Rostock während des 13. und 14. Jahrhunderts kann demnach wohl nicht geleugnet werden, wenn auch nirgends in den Urkunden eines Geschlechterregiments in irgendeiner Weise Erwähnung getan wird 75 ). Es bestand in Rostock nicht wie in zahlreichen anderen deutschen Städten des Mittelalters eine Gesellschaft, in der die Geschlechter vereinigt waren. Wir finden in Dortmund die Reinoldigilde 76 ), in Lübeck die Zirkelgesellschaft 77 ), in Köln die Richerzeche 78 ), in Lindau die Gesellschaft zum Sünfzen 79 ), in Soest die Schleswiger Bruderschaft 80 ), in Rostock dagegen nichts dergleichen. Ebenso erscheint der Name "Patrizier" in den Quellen vor 1400 nie. Dieser Name findet sich auch in anderen deutschen Städten in dieser Zeit noch nicht. Das Wort "patricius" kommt erst seit 1500 häufiger vor, und zwar "mehr in Büchern als in der Urkundensprache" 81 ). So gebraucht es z. B. Heinrich Bebel "Ulm betreffend" in einer Druckschrift vom Jahre 1508 82 ). In Rostock tritt es nach Lisch erst in der Zeit vor dem Dreißigjährigen Kriege auf 83 ).
Die Feststellung des zeitlichen Ursprungs des Rostocker Patriziats bereitet einige Schwierigkeiten. Urkundlich kann man das städtische Patriziat bis in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückverfolgen. Betrachtet man die erhaltenen Verzeichnisse der Ratsmitglieder vor 1300 sowie die Erwähnungen der Ratsherren als Zeugen von Beurkundungen während dieser Zeit, so kann man schon hier die häufige Wiederholung der gleichen Namen bemerken, die wir bereits als ein Kennzeichen der Zugehörigkeit zum Patriziat erkannt


|
Seite 16 |




|
haben. So tritt z. B. Reineke Reimbert in der Zeit von 1266 bis 1297 elfmal als Ratsherr auf, Engelbert Baumgarten in der Zeit von 1262 bis 1283 siebenmal, Albrecht Lore in der Zeit von 1261 bis 1282 ebenfalls siebenmal. Eine große Anzahl anderer Beispiele ließe sich anführen 84 ). Aus dem 13. Jahrhundert stammen auch die oben schon erwähnten Fälle, in denen neben den Rat sog. "einsichtige Bürger", die "cives seniores" bzw. "cives discretiores" usw., Anteil an der Erledigung gewisser Fragen nahmen 85 ).
Für die Zeit vor 1250 versagen die Rostocker Quellen fast vollständig. Nur eine einzige Urkunde ist aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhalten, die Aufschluß über diese Zeit geben könnte, eben die Urkunde vom 24. Juni 1218. Ein Versuch, die von Paul Meyer in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts verlegte obere Zeitgrenze des Rostocker Patriziats 86 ) in die erste Hälfte des Jahrhunderts vorzuverlegen, ist daher auf Rückschlüsse aus späteren Jahren angewiesen. Das seit 1250 erhaltene Quellenmaterial der Stadt bietet dafür manche wertvolle Anhaltspunkte. Zeugenreihen von Beurkundungen Testamente, Erbschaften, An- und Verkäufe oder ähnliche urkundliche Aufzeichnungen ermöglichen die Feststellung, daß schon in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in vielen Fällen bei der Neuwahl des Stadtrates der Sohn, der Bruder oder irgendein anderer Verwandter eines Ratmannes in den Rat gewählt wurde und nicht irgendein beliebiger Bürger der Stadt. Es ist dies eine Erscheinung, die dann im 14. Jahrhundert noch offenkundiger wird und zu der bereits erwähnten Verwandtschaft der meisten Ratsfamilien führt 87 ).
Ein bemerkenswertes Einzelbeispiel für das 13. Jahrhundert ist die Geschichte der Familie des Rostocker Ratsherrn Reimbert vom Alten Markt. Reimbert hatte drei Söhne und vier Töchter 88 ). Eine Tochter hieß Taleke 89 ); die Namen der drei anderen Töchter sind nicht bekannt; diese drei heirateten; die Namen von Reimberts Schwiegersöhnen sind überliefert. Man erhält also folgende Stammtafel:


|
Seite 17 |




|
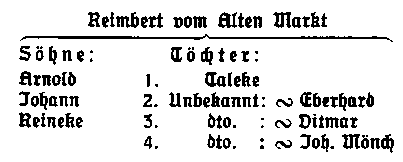
Reimbert selbst war Ratmann im Jahre 1252 90 ). Auch seine drei Söhne erreichten die Ratswürde. Arnold wurde in der Zeit von 1275 bis 1278 zweimal in den Rat gewählt 91 ), Johann in der Zeit von 1279 bis 1284 dreimal 92 ) und Reineke in der Zeit von 1267 bis 1300 elfmal 93 ). Von seinen drei Schwiegersöhnen ist nur einer, Eberhard, nicht als Ratsherr nachweisbar. Ditmar saß im Rat in den Jahren 1252 und 1275 94 ), Johann Mönch in der Zeit von 1252 bis 1267 achtmal 95 ).
Weiter erscheinen im Stadtrat als Brüder Gerlach und Johann (1259), Hermann Witt und Johann Töllner (1257, 1286), Johann Rode und Albrecht Spießnagel (1284, 1278), Siegfried und Hermann (vor 1261, 1257), Dietrich und Gerhard von Lage (1284, 1280), Gerhard und Albrecht Lore (1252, 1261), Simon und Ernst (1257, 1252). Die folgenden Ratsherren stehen im Verhältnis von Vater und Sohn: Johann und Konrad Klein (1258/62, 1263), Bertram und Gottfried (1218, 1257), Vollant und Nikolaus Schwarz (1264, 1275), Meinrich und Heinrich (1257, 1294), Siegfried und Johann Siefers (vor 1261, 1261), Reineke und Gerhard von Lage (1275, 1304/6), Gerwin und Hermann Lemhus (1288, 1310), Lübbert in der Lagerstraße und Johann Lübberts (1284, 1305), Simon und Ernst (1252, 1275), Rötger und Johann (1252, 1284), Adolf und Heinrich (1257, 1262), Rötger Klein und Eberhard (1259). Verschwägerung besteht zwischen: Meinrich und Jacob von Malchin (1257, 1262), Johann Rathenow und Peter Witt (1257, 1262), Johann Klein und Gödeke (1258/62, 1262), Reineke von


|
Seite 18 |




|
Lage und Arnold Quast (1275, 1287), Gerhard und Reiner Lore (1252, 1278) 96 ).
Die große Zahl der gegebenen Beispiele erweckt den Eindruck, daß das Rostocker Patriziat in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nicht erst im Entstehen begriffen ist; zeigen sie doch, daß sich schon damals der Ratssitz innerhalb gewisser Familien gleichsam vererbte. Man darf wohl annehmen, daß eine Zeit vorausging, während welcher sich im Rostocker Patriziat allmählich diese Erscheinung. herausbildete, und darf daher rückschließend aus den Verhältnissen nach 1250 wohl vermuten, daß das städtische Patriziat wahrscheinlich schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts entstanden ist.
Das Rostocker Patriziat hat indessen vor 1300 keinesfalls bereits das Gepräge eines fest geschlossenen gesellschaftlichen Standes gehabt. Dazu ist die Zahl der ihm zuzurechnenden Familien viel zu groß, der Wechsel innerhalb der Ratsfamilien zu schnell. Das Patriziat war nur erst die Schicht der ratsfähigen Bürger der Stadt, die ununterbrochen Zugang erfuhr und Abgang erlitt. Patrizische Heiraten und Sippengefühl besaßen, wie wir gesehen haben, häufig Bedeutung und mochten den Aufstieg in den Rat erleichtern. Aber das einheitliche Gepräge, das man hiernach beim Patriziat erwarten könnte, wird noch durch den raschen Wechsel innerhalb der Ratsfamilien beeinträchtigt. Überhaupt scheinen besondere Bedingungen für die Aufnahme in den Rat noch nicht bestanden zu haben. Das Bürgerrecht genügte wahrscheinlich im allgemeinen. So war es z. B. möglich, daß Lübbert von der Neustadt, der erst 1259 auf Grund der Bürgschaft des Gerbers Gerhard als Stadtbürger aufgenommen war 97 ), schon vor 1262 in den Rat gelangen konnte 98 ). So erklärt sich auch die Tatsache, daß in den fünfzig Jahren von 1250 bis 1300 etwa zweihundert verschiedene Namen in den Urkunden als Ratsmitglieder auftreten, sei es


|
Seite 19 |




|
in den Ratsverzeichnissen oder in anderweitigen Erwähnungen von Ratsherren. Eine stattliche Reihe von Bürgern ist überhaupt nur ein einziges Mal im Rat belegbar, wie z. B. ein Ratmann Egbert 1257 99 ), ein Ratmann Burchhard vom Markt 1289 100 ) oder ein Ratmann Heinrich von Rathenow 1262 101 ). Nur drei Rostocker Bürger erreichten im 13. Jahrhundert eine zwölfmalige Wiederwahl 102 ), nur zehn eine zehnmalige Wahl in den Rat. Doch ist schon während der letzten fünfzig Jahre vor 1300 ein stetes Abnehmen in der Zahl der ratsfähigen Familien zu bemerken sowie ein stetes Anwachsen der Zahl derjenigen Ratmannen, die die Ratswürde zu wiederholten Malen erreichten. Die Zahl derer, die nach meiner Berechnung das Ratsamt, soweit die erhaltenen Urkunden bezeugen, zum erstenmal erreichen, beträgt in den acht Jahren von 1252 bis 1260 rund siebenzig, in den zwanzig Jahren von 1260 bis 1280 gleichfalls rund siebenzig und in den letzten zwanzig Jahren des 13. Jahrhunderts nur noch rund vierzig. In folgender Übersicht, die aus den erhaltenen Rostocker Quellen gewonnen ist, erhält man ein gutes Bild von der dauernden und auffallend schnellen Verminderung der Zahl der Ratsfamilien. Es treten neu ein in den Rat von:
1252-1260 c. 70, in zehnjährigem Durchschnitt c. 70,
1260-1280 c. 70, in zehnjährigem Durchschnitt c. 35,
1280-1300 c. 40, in zehnjährigem Durchschnitt c. 20.
Auch die Zahl derjenigen Ratmannen, die nur einmal im Rat belegbar sind, erfährt im Lauf des 13. Jahrhunderts eine stete Abnahme. Sie fällt von rund fünfundzwanzig während der Zeit von 1250 bis 1261 auf rund achtzehn während der Zeit von 1262 bis 1280 und auf nur zehn während der Zeit von 1280 bis 1300.
Ein ganz anderes Bild zeigt das 14. Jahrhundert. Das Patriziat ist jetzt bedeutend fester gefügt, der Wechsel innerhalb des Kreises der ratsfähigen Familien ist sehr viel ge-


|
Seite 20 |




|
ringer. Die Ratsherren werden sehr häufig wiedergewählt, sie erscheinen zwanzigmal und mehr in der Ratswürde. Besonders deutlich wird der Wandel, den das Patriziat nach Aussage der erhaltenen Urkunden im Lauf des 14. Jahrhunderts erfuhr, wenn man die zweite Hälfte des Jahrhunderts betrachtet. Nicht einmal zehn beträgt die Zahl der Ratsherren, die sich als solche nur in einem einzigen Jahr nachweisen lassen, mehr als dreißig erscheinen dagegen zehnmal, zwanzigmal, ja noch häufiger in diesem Amt. Vergleichen wir einmal diese fünfzig Jahre mit den entsprechenden des 13. Jahrhunderts an Hand folgender Übersicht:
Fast fünfzig Bürger sind in nur einem Jahr Ratmannen.
Nur etwa zehn Bürger bekleiden die Ratswürde zehnmal und mehr.
Die Höchstzahl der Amtsjahre eines Ratsherrn ist 14.
Die Gesamtzahl der im Rat nachweisbaren Bürger ist rund zweihundert.
Nur etwa fünf Bürger sind in nur einem Jahr Ratmannen.
Rund dreißig Bürger bekleiden die Ratswürde mehr als zehnmal.
Die Höchstzahl der Amtsjahre eines Ratsherrn ist 27.
Die Gesamtzahl der im Rat nachweisbaren Bürger ist rund siebenzig.
Im 14. Jahrhundert begnügten sich die Ratsherren bei einer Neuwahl des Rates wahrscheinlich nicht mehr nur mit dem Bürgerrecht des Bewerbers. Vielmehr scheinen die patrizische Heirat oder anderweitige Verwandtschaft mit einem Ratsherrn oder Patrizier in den meisten Fällen die Voraussetzung für die Aufnahme in den Stadtrat gewesen zu sein. Man kann übrigens die gleiche Erscheinung auch in anderen mittelalterlichen Städten beobachten. So sagt z. B. Luise von Winterfeld für Dortmund: "Reichtum allein genügte nicht, sondern erst durch patrizische Heiraten erschloß sich einem freien Mann der Kreis der Ratsgeschlechter" 103 ). Für Köln drückt sie den gleichen Gedanken folgendermaßen aus: "Blutsver-


|
Seite 21 |




|
wandtschaft ist stets und zuweilen mehrere Generationen hindurch der Aufnahme ins Patriziat vorhergegangen" 104 ). Eine patrizische Heirat wurde naturgemäß dem wirtschaftlich Starken lieber gewährt als dem wirtschaftlich Schwachen. So begann im 14. Jahrhundert die für das Patriziat so kennzeichnende Verbindung von Reichtum und Ansehen stärker hervorzutreten, wie wir in einem späteren Abschnitt ausführlicher darlegen wollen. Das Urkundenmaterial gestattet uns, den Werdegang eines Rostocker Patriziers im 14. Jahrhundert genauer zu verfolgen. Wieviel schwieriger war es im 14. Jahrhundert für den Rostocker Bürger Peter Kremer, zum Ratmann gewählt zu werden, als für Lübbert in der Neustadt, der bereits drei Jahre nach Erwerb des Bürgerrechtes Ratsherr werden konnte (1262) 105 ).
Über Peter Kremer, den ersten Ratmann der Familie Kremer, lassen sich folgende urkundlich belegbaren Tatsachen erbringen: Er war ein Kaufmannssohn, der durch Handelsgewinn und Geldverleih ein reicher Mann wurde. Im Jahre 1321 erhielt er von dem Patrizier Bernhard Koppmann einen Schuldbrief über 185 Mark 106 ); 1329 verlieh er weitere 70 Mark 107 ), 1334 22 Mark 108 ) und 1335 47 Mark 109 ); zusammen mit dem Patrizier Engelbert Baumgarten verlieh er 1336 weitere 60 Mark 110 ). Allmählich nahm sein Geldgeschäft einen immer größeren Umfang an. Im Jahre 1350 betrugen seine Außenstände bereits die ansehnliche Summe von rund 1625 Mark. In der gleichen Zeit erhielt er für Tuche, Weine und ein Pferd rund 300 Mark. Im Jahre 1350 erscheint er in den Urkunden als Gläubiger zweier Bürger zu Zütphen in Geldern zum erstenmal als "consul", d. h. Ratmann 111 ). Seine Gattin Berta heiratete nach seinem Tode den Patrizier Lambert Witt 112 ). Seine Schwester Elisabeth wurde vor dem Jahre 1334 die Ehefrau von Bernhard Koppmann, dem Sohn


|
Seite 22 |




|
des Ratsherrn gleichen Namens 113 ). Nach dem Tode ihres ersten Gatten heiratete Berta um 1340 den Rostocker Ratmann und späteren Bürgermeister Ludolf von Gothland 114 ). Ihre dritte Ehe schloß sie mit Engelbert Steinbeck 115 ). Heseke, eine Tochter von Peter Kremer, heiratete, wie nicht anders zu erwarten ist, einen Patrizier Heinrich Kruse (1347) 116 ). Durch die Heiraten von Peter Kremers Enkelinnen mit Angehörigen der patrizischen Familien Horn bzw. Wilde war das ursprüngliche Kaufmannsgeschlecht fest im städtischen Patriziat verankert. Es heiratete Elisabeth Kruse, eine Enkelin von Peter Kremer, den Patrizier Gerwin Wilde 117 ), und ihre Schwester Grete schloß ihre Ehe mit dem Patrizier Rikwin Horn 118 ).
Die Geschichte der Familie Kremer beleuchtet in anschaulicher Weise die Bedeutung, die der Reichtum sowie die patrizische Heirat im 14. Jahrhundert für die Ratsfähigkeit einer Familie hatten. Peter Kremer erreichte die Ratsfähigkeit erst als reicher Kaufmann und als Verwandter mehrerer patrizischer Familien. Die Geschichte dieser Familie ist zugleich ein vortreffliches Beispiel dafür, daß bereits nach 1300 das Rostocker Patriziat sich als einen Stand fühlte und nicht etwa nur eine Gesellschaftsklasse, eine Honoratiorenschicht war.
"Honoratiorentum ist meist geneigt, den Zugezogenen von gestern oder vorgestern in sich aufzunehmen, wenn er, ziemlich gleich welcher Herkunft, nur Gesellschaftsfähigkeit nach jeweils herrschender Anschauung auf der Grundlage bestimmten Vermögens oder gewisser Lebensführung, nach Beruf und Bildungszuschnitt gesehen, besitzt" 119 ). Das Rostocker Patriziat des 14. Jahrhunderts dagegen forderte in der Regel engere Bande, nahm mit Vorliebe den Verwandten eines Patriziers in den Rat auf.
Bemerkenswert jedoch ist es, daß auch im 14. Jahrhundert das Patriziat sich noch nicht völlig von der übrigen Bürgerschaft Rostocks abschloß, sondern daß es sich auch noch nach 1300, wenn auch in bescheidenem Maße, mit frischem Blut erneuerte und verjüngte, wie es z. B. die Familiengeschichte


|
Seite 23 |




|
von Peter Kremer zeigt. Was Rostock betrifft, so kann man Georg von Below nur beistimmen, wenn er sagt: "Allerdings war diese Exklusivität des Patriziats in Deutschland keine sehr strenge" 120 ). Auch in der Geschichte der Patriziate anderer deutschen Städte kann man die Beobachtung machen, daß die Abschließung ihrer Oberschicht im 14. Jahrhundert noch nicht besonders streng war. So stellt z. B. Luise von Winterfeld für Dortmund fest, daß das dortige Patriziat bis 1400 kein bereits abgeschlossener Stand war 121 ), und Friedrich Lau betont für Köln, daß ein völliger sozialer Abschluß der Geschlechter bis 1396 überhaupt nicht bestanden hat 122 ).
Der Mangel einer strengen Abschließung des Patriziats bestimmte auch sein Verhältnis zum Handwerkertum. Naturgemäß blieb die mit der Zeit fortschreitende Festigung des Rostocker Patriziats, das sich von einer schnellem Wechsel unterworfenen Schicht zu einem einheitlicheren, fester gefügten und sich von der übrigen Bürgerschaft schärfer abhebenden Stand im 14. Jahrhundert entwickelte, nicht ohne Einfluß auf das Verhältnis vom Patriziat und Handwerkertum. Das Handwerkertum als ganzes scheint zwar auch im 13. Jahrhundert vom Ratsstuhl ausgeschlossen gewesen zu sein 123 ). Der Aufstand von 1286/1287 sollte ja die Ratsfähigkeit der Geschlechter durchbrechen und den Handwerkern den Zutritt zum Stadtrat verschaffen. Im Jahre 1287 erscheint der Handwerksmeister Johann Kempe vorübergehend im Rat 124 ). Doch schon vor diesen Zunftkämpfen um 1286/87 lassen sich einige Rostocker Ratsherren nachweisen, deren Namen auf Zugehörigkeit ihrer Träger zum Handwerkertum zu deuten scheinen. Es sind dies unter anderen:
Heinrich Faber (1218) 125 ), Rudolf Pelzer (1358) 126 ),
Eilard Faber (1258/62) 127 ), Goswin Carnifex (1262) 128 ),


|
Seite 24 |




|
Wicbern Pistor (1262) 129 ), Nikolaus Carnifex (1258) 130 ),
Gerhard Lore, auch Cerdo genannt (1252) 131 ).
Es ist indessen mit dem vorhandenen Quellenmaterial nicht mit Sicherheit nachzuweisen, daß die erwähnten Ratsherren tatsächlich Handwerker waren. So vermutet denn Paul Meyer, daß es sich bei diesen Namen nicht um Berufsbezeichnungen, sondern um Familiennamen handelt. Er stützt sich dabei auf ein Verbot Heinrichs des Löwen, das die Handwerker in Lübeck vom Ratsstuhl ausschloß und das wohl auch in Rostock gegolten habe 123). Da aber das Verbot Heinrichs des Löwen nicht in allen denjenigen Städten, die sich des lübischen Rechts bedienten, durchgeführt wurde, wie z. B. in Wismar 132 ), so kann es durchaus möglich sein, daß in Rostock in dieser frühen Zeit, d. h. um 1250, auch Handwerker in den Stadtrat gelangten, zumal noch im Jahre 1281 eheliche Verbindung zwischen Patriziat und Handwerkerstand in Rostock quellenmäßig belegbar ist. In diesem Jahre heiratete der Rostocker Ratmann Hermann Lise die Tochter eines Goldschmiedes 133 ). Dazu kommt, daß in einer Urkunde, die zwischen 1296-1300 ausgestellt wurde, ein Schildmacher den Titel "her" erhielt. Die gleiche Urkunde bringt als Zeugen eine große Zahl von Ratmannen; aber nur vier der angeführten Ratsherren erhalten den Titel "her" , die andern werden nur namentlich aufgeführt 134 ). Nach dem zweiten Aufruhr der Handwerker um 1312/14 scheint dann kein Handwerker mehr in den Rat gelangt zu sein. Die Erhebung war, wie schon erwähnt ist, ergebnislos verlaufen 135 ).


|
Seite 25 |




|
So hob sich das Rostocker Patriziat im 14. Jahrhundert nach außen hin, wie es scheint, als einheitliches Ganzes von der übrigen Bürgerschaft, insbesondere vom Handwerkertum, ab. Die Zusammensetzung des Patriziats jedoch, die Verteilung von Reichtum und Ansehen, war ungleichmäßig. Das Patriziat war damals keine gleichartige Schicht, sondern umfaßte verschiedenartige Menschen. Wir finden innerhalb des Kreises der Rostocker Ratsfamilien eine Anzahl von Geschlechtern, die viele Jahrzehnte lang durch Angehörige im Rat vertreten waren, deren Ratsmitgliedschaft teilweise schon im 13. Jahrhundert begann und bis tief in das 14. Jahrhundert fortdauerte, trotz allem Wechsel, der besonders vor 1300 zahlreichen Familien ihre Ratsfähigkeit häufig sehr schnell wieder nahm. Wir finden andererseits auch noch im 14. Jahrhundert kleine, im städtischen Rat nur wenige Jahre nachweisbare Familien; aber ihre Zahl ist nur gering. Zwischen beiden Extremen bemerkt man dann eine Zahl von Rostocker Ratmannen, die ihrer Familie den Ratssitz etwa ein Menschenalter erhalten konnten. So kann man also das Rostocker Patriziat im 14. Jahrhundert in drei, sich von einander abhebende Gruppen gliedern. In einer ersten Gruppe fasse ich alle diejenigen patrizischen Familien zusammen, deren Ratsmitgliedschaft etwa 3/4 Jahrhundert und mehr währte. Hierzu gehören folgende Familien:
| im Rat vertreten | ||||||||
| 1. | Witt-Töllner | von | etwa | 1260 | bis | über | 1400 | hinaus, |
| 2. | Rode | " | " | 1250 | " | etwa | 1400, | |
| 3. | Kröpelin | " | " | 1260 | " | über | 1400 | hinaus, |
| 4. | Koppmann | " | " | 1265 | " | etwa | 1400, | |
| 5. | Frese | " | " | 1280 | " | " | 1400, | |
| 6. | Wilde | " | " | 1300 | " | " | 1400, | |
| 7. | Quast | " | " | 1285 | " | " | 1370, | |
| 8. | Lise | " | " | 1260 | " | " | 1360, | |
| 9. | Kruse | " | " | 1320 | " | " | 1400, | |
| 10. | Kyritz | " | " | 1310 | " | " | 1390, | |
| 11. | Horn | " | " | 1325 | " | " | 1400, | |
| 12. | Holloger | " | " | 1330 | " | " | 1400, | |
| 13. | Gothland | " | " | 1270 | " | " | 1380, | |
| 14. | Beseler | " | " | 1310 | " | " | 1390, | |
| 15. | von der Aa | " | " | 1350 | " | " | 1450, | |
| 16. | Baumgarten | " | " | 1260 | " | " | 1370, | |
| 17. | Nachtrabe | " | " | 1280 | " | " | 1390. | |


|
Seite 26 |




|
Die Ratsmitgliedschaft der Familie Witt-Töllner z. B. setzte ein mit Hermann Witt im Jahre 1257 136 ); dieser Hermann bereits wurde zehnmal (in der Zeit von 1257 bis 1278) in den Rat gewählt. Die nächste bedeutendere Persönlichkeit dieser Familie war Johann Töllner, der in den Jahren von 1327 bis 1360 siebenundzwanzigmal die Ratswürde bekleiden konnte; sechzehnmal (in der Zeit von 1339 bis 1360) amtierte er als Bürgermeister. In den Jahren 1355, 1356 und 1357 waren die Witt-Töllner sogar mit drei Mitgliedern ihrer Familie im Rat vertreten. Johann Töllner war Bürgermeister, Hermann Witt und Lambert Witt waren Ratsherren 137 ). Wie Johann Töllner, so war auch Lambert Bürgermeister, und zwar während der Zeit von 1368 bis 1373. Der letzte vor 1400 im Stadtrat nachzuweisende Angehörige der Witt-Töllner ist Heinrich, der zwanzigmal (in der Zeit von 1373 bis 1400) in den Rat gewählt wurde, davon siebenmal zum Bürgermeister 138 ). Ebenso müssen die 16 anderen Familien dieser Gruppe im Rat einen großen Einfluß gehabt haben. So wurde, um noch ein Beispiel zu geben, Ludolf von Gothland in der Zeit von 1351 bis 1380 nicht weniger als 29mal in den Rat gewählt. Ein anderer Ludolf Gothland, ein Heinrich, ein Arnold erscheinen gleichfalls lange Zeit hindurch als Rostocker Ratmannen 139 ). Die vermutlich große Bedeutung aller oben erwähnten patrizischen Familien in Rat und Bürgerschaft erkennt man überdies auch daran, daß sie fast alle mit einem Mitglied ihrer Familie, eine ganze Reihe sogar mit mehreren ihrer Angehörigen in der Bürgermeisterwürde nachgewiesen werden können. Als solche treten die betreffenden Ratsherren in den Urkunden mit den Titeln "burgimagistri", "borghermester", "proconsules" usw. auf 140 ). Genannt seien hier 141 ):


|
Seite 27 |




|
| 1. | Johann von der Aa, |
als Ratmann seit
1371,
als Bgm. 16mal v. 1373-1400, |
| 2. | Johann Töllner, |
als Ratmann seit
1327,
als Bgm. 16mal v. 1339-1360, |
| 3. | Arnold Kröpelin, |
als Ratmann seit
1346,
als Bgm 16mal v. 1361-1392, |
| 4. | Johann Kyritz, |
als Ratmann seit
1354,
als Bgm. 12mal v. 364-1384, |
| 5. | Ludwig Kruse, |
als Ratmann seit
1371,
als Bgm. 11mal v. 1378-1396, |
| 6. | Heinrich Rode, |
als Ratmann seit
1327,
als Bgm. 10mal v. 1339-1359, |
| 7. | Joh. Baumgarten, |
als Ratmann seit
1355, 1351 ?
als Bgm. 8mal v. 1359-1367, |
| 8. | Engelb. Baumgarten, |
als Ratmann seit
1308/09,
als Bgm. 7mal v. 1323-1348, |
| 9. | Heinrich Witt, |
als Ratmann seit
1373,
als Bgm. 7mal v.1390-1400, |
| 10. | Lambert Witt, |
als Ratmann seit
1352,
als Bgm. 6mal v. 1368-1373, |
| 11. | Lud. v. Gothland, |
als Ratmann seit
1316,
als Bgm. 5mal v. 1338-1347, |
| 12. | Arnold Koppmann, |
als Ratmann seit
1314,
als Bgm. 5mal v. 1323-1335, |
| 13. | Dietrich Holloger, |
als Ratmann seit
1331,
als Bgm. 4mal v. 1351-1357, |
| 14. | Hermann Lise, |
als Ratmann seit
1329,
als Bgm. 4mal v. 1359-1364, |
| 15. | Gerwin Wilde, |
als Ratmann seit
1357,
als Bgm. 4mal v. 1370-1374, |
| 16. | Dietrich Frese, |
als Ratmann seit
1314,
als Bgm. 3mal v. 1318-1323, |
| 17. | Johann Rode, |
als Ratmann seit
1325,
als Bgm. 2mal v. 1334?-1339, |
| 18. | Johann Witt, |
als Ratmann seit
1286?,
als Bgm. 2mal v. 1297-1298, |
| 19. | Johann Rode, |
als Ratmann seit
1284,
als Bgm. 2mal v. 1289-1298, |
| 20. | Eberh. Nachtrabe, |
als Ratmann seit
1283,
als Bgm. 1mal 1289, |


|
Seite 28 |




|
| 21. | Ludwig Kruse, |
als Ratmann seit
1323,
als Bgm. 1mal: 1343, |
| 22. | Heinrich Frese, |
als Ratmann seit
1343,
als Bgm. 1mal: 1350, |
| 23. | Heinrich Quast, |
als Ratmann seit
1332,
als Bgm. 1mal: 1350. |
Weniger einflußreiche Geschlechter sind nur ganz vereinzelt in dem Amt eines Rostocker Bürgermeisters belegbar, wie etwa Wienold Baggel, der 20mal Ratsherr, davon 7mal Bürgermeister war 142 ), oder Johann Pape, den ich 15mal (in der Zeit von 1314 bis 1334) als Ratsherrn, davon 6mal als Bürgermeister nachweisen kann 143 ). Eine bedeutende Persönlichkeit setzte sich eben durch unter den übrigen Ratmannen und wurde zum Bürgermeister gewählt, auch wenn sie nicht einem der großen Geschlechter angehörte. Im allgemeinen scheint aber das Bürgermeisteramt von den großen Patrizierfamilien für sich beansprucht und von ihren Angehörigen verwaltet worden zu sein. Das Vorrecht der Bürgermeister vor den übrigen Ratmannen bestand hauptsächlich darin, daß sie die Sitzungen des Stadtrates leiteten 144 ).
In eine zweite Gruppe, die man etwa als patrizische Mittelschicht bezeichnen könnte, gehören unter anderem die Familien Baggel (im Rat nachweisbar von etwa 1375 bis 1400), Buxstock (von etwa 1370 bis 1400), Belster (von etwa 1380 bis 1400), Hoffmann (von etwa 1375 bis 1400), Grenze (von etwa 1355 bis etwa 1400), Katzow (von etwa 1380 bis etwa 1400), Koesfeld (von etwa 1260 bis 1305), Kahl (von etwa 1360 bis 1385), Lage (von etwa 1275 bis 1315), Mönch (von etwa 1250 bis etwa 1305), Niendorf (von etwa 1355 bis 1400), Pape (von etwa 1280 bis 1330), Pilgrim (von etwa 1350 bis etwa 1375), Vöge (von etwa 1320 bis etwa 1380), Vot (von etwa 1270 bis etwa 1300) und Wiese (von etwa 1260 bis 1300). Diese Familien waren in der Regel durch zwei oder drei Mitglieder im Rat vertreten, manchmal auch nur durch ein einziges, wie etwa die Belster. Arnold Belster war Ratmann 15mal in der Zeit von 1382 bis 1400.
In die dritte Gruppe rechne ich die vielen Rostocker Ratmannen, die in einem einzigen, in zwei, auch drei oder vier


|
Seite 29 |




|
Jahren im Ratsstuhl saßen. Manchen von ihnen kann man nur die persönliche, nicht aber die ständische Patrizierwürde zusprechen; patrizischen Standes galt eine Familie erst, wenn das Ratsamt sich gleichsam forterbte; die Zugehörigkeit zum Patriziat als Stand wurde durch Geburt erworben. Ratsherren, die zu dieser Gruppe zählen, sind etwa Meinrich von Bremen (1262) 145 ), Hermann von Fehmarn (1289, 1290) 146 ), Heinrich Hart (1302, 1303, 1304) 147 ), Konrad Klein (1263, 1264, 1266, 1267) 148 ) u. a.
Die Entwicklung beförderte schon im 13., besonders aber im 14. Jahrhundert die Herausbildung einer kleinen, politisch und wirtschaftlich mächtigen Spitzengruppe. Das 14. Jahrhundert war die Zeit, in welcher das Rostocker Patriziat ein geschlosseneres Gepräge gewann.
Der Beruf der Rostocker Patrizier.
Der Versuch, den Beruf der Rostocker Patrizier festzustellen, stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, denn das erhaltene Urkundenmaterial des 13. und 14. Jahrhunderts enthält nur ganz wenige deutliche Angaben darüber, aus welcher Berufsschicht dieser oder jener Patrizier der Stadt hervorgegangen ist. Besonders schwierig ist die Untersuchung für die früheste Zeit des 13. Jahrhunderts, in der die Verhältnisse noch flüssig waren und die Stadt sich erst mit Ansiedlern füllte. Die Einwohner Rostocks waren damals zum großen Teil Einwanderer die von nah und fern in die junge, aufblühende Stadt nahe der Ostsee kamen, in der Hoffnung, dort ihren Lebensunterhalt finden zu können 149 ). Man darf vermuten, daß die Einwanderer vor allem Kaufleute waren, die der Handelsgewinn lockte, vielleicht auch jüngere Söhne ländlicher Grundbesitzer, die dem älteren


|
Seite 30 |




|
Bruder die väterliche Scholle überlassen mußten und nun in Rostock einen Beruf irgendwelcher Art zu ergreifen beabsichtigten. Will man versuchen, über diese Vermutung hinaus den beruflichen Ursprung der ältesten in Rostock eingewanderten Familien, die schon im 13. Jahrhundert die Ratsfähigkeit erwarben, festzustellen, so wird man sich mit mehr oder weniger sicheren Schlußfolgerungen begnügen müssen.
Das Mittel, die patrizischen Familiennamen heranzuziehen, um Aufschluß über die berufliche Herkunft der Patrizier zu erhalten, ist häufig schon in Arbeiten, die sich die gleiche oder eine ähnliche Aufgabe stellen, angewendet worden 150 ). Aber auch durch Schlußfolgerung aus dem Namen läßt sich über den beruflichen Ursprung der Rostocker Patrizier der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts nichts Sicheres aussagen. Durch die Urkunde vom 24. Juni 1218 151 ), die einzige erhaltene aus dieser frühen Zeit, sind zwar die Namen von zehn Rostocker Ratmannen bekannt - es sind dies Heinrich Schmied, Heinrich Pramuhl, Hermann, Rudolf, Lüder, Bertram, Witzel, Lambert, Bode und Heinrich Lantfer -, man kann aber aus diesen Namen die berufliche Abstammung ihrer Träger nicht erkennen. Erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts tauchen in den Quellen patrizische Familiennamen auf, die einen Schluß auf die berufliche Herkunft der betreffenden Patrizier überhaupt ermöglichen. Man kann die Beobachtung machen, daß gewisse Mitglieder des Rostocker Patriziats in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts als Familiennamen die Bezeichnung einer Stadt oder eines Dorfes führen. Die Annahme liegt nahe, daß die Gegenden - Städte, Dörfer usw. -, nach denen ein Rostocker Patrizier benannt ist, die ursprüngliche Heimat der betreffenden Personen oder Familien war. Erinnert man sich noch der Tatsache, daß in den größeren mittelalterlichen Städten Handel und Gewerbe überwogen, so wird man zu der Schlußfolgerung gelangen, daß diejenigen Rostocker Patrizier, deren Namen auf Zusammenhang ihrer Träger mit einer größeren, ferner gelegenen Stadt Deutschlands weisen, in der Hauptsache wohl aus den Kreisen der dortigen Kaufleute


|
Seite 31 |




|
oder Handwerker hervorgingen, während die Vorfahren solcher Patrizier, die den Namen irgendeines ländlichen Ortes oder einer kleinen Landstadt Deutschlands als Familiennamen tragen, wahrscheinlich zu einem guten Teil den ländlichen Schichten der dortigen Bevölkerung angehörten.
Man kann daher zwei Gruppen scheiden und zur ersten Gruppe diejenigen Rostocker Patrizier des 13. Jahrhunderts rechnen, deren Namen auf Herkunft aus ländlichen Kreisen deuten. Zu dieser Gruppe gehören offenbar die Familien Baumgarten und Volkenshagen, die Ratmannen Johann von Bukow (1258), Rudolf von Schwastorf (1262), Heinrich Radele (1262), Bernhard von Bölkow (1262), Martin von Wolde (1289), Ottbert von Selow (1294), Gerbert von Kabelstorf (1300), Ludolf von Warnemünde (1252), Lambert von Malchin (1262), Heinrich von Bützow (1275) und andere mehr.
Betrachten wir die urkundlichen Angaben über die patrizischen Familien Baumgarten und Volkenshagen etwas genauer. Die Familie Baumgarten trägt ihren Namen offenbar nach dem Dorf gleichen Namens bei Bützow 152 ). In Rostock ist die Familie frühestens 1257 nachweisbar 153 ). Da schon im gleichen Jahr ein Engelbert Baumgarten als "dominus" quellenmäßig nachzuweisen ist 153), muß die Familie ziemlich schnell in das Rostocker Patriziat gelangt sein. Im Jahre 1262 kaufte ein Bruder von Engelbert Baumgarten, Willekin 154 ), von Heinrich von Viezen Güter in Prangendorf bei Bützow 155 ), im Jahre 1268 von dem Ritter Reimar von Hamburg eineinhalb Hägerhufen in Mönchhagen bei Ribnitz 156 ). Weiter verfügte er 1270 in seinem Testament über zahlreiche Getreiderenten aus Brünkendorf, Diedrichshagen, Mönchhagen und Prangendorf, dazu über einhundert Mark, über ein Erbe mit Hof bei St. Johann in Rostock, eine Salzpfanne, über Waffen und Silbergerät 157 ). Der obengenannte Engelbert Baumgarten kaufte 1268 gleichfalls anderthalb Hägerhufen in Mönchhagen 156). Teilnahme am Handel ist für Angehörige der Baumgarten erst verhältnismäßig spät nachweisbar, eine Tatsache, die allerdings auch eine


|
Seite 32 |




|
Folge von Verlusten an Urkunden sein kann. Ist es nun wahrscheinlich, daß der Handel, falls er betrieben wurde, in den wenigen Jahren von 1258 bis 1262 bzw. bis 1270 in einer so frühen Zeit solche Gewinne abgeworfen hat, daß damit die Käufe und Vermögenswerte des Testamentes erklärt werden können? Vielmehr möchte ich auf Grund der uns erhaltenen Urkunden folgendes annehmen: Die Familie Baumgarten besaß vermutlich in oder bei dem Dorf Baumgarten Grundbesitz irgendwelcher Art; sie zog um 1257 mit einem gewissen Vermögen nach Rostock und wird hier eben wegen ihrer wirtschaftlich sicheren Verhältnisse schnell in das städtische Patriziat gelangt sein. So erklären sich auch leicht die Käufe in den Jahren 1262 und 1268, sowie die Bestimmungen des Testaments vom Jahre 1270. Wie die Familie Baumgarten, so scheint auch die ebenfalls patrizische Familie Volkenshagen vor ihrem Erscheinen in Rostock ländlichen Grundbesitz gehabt zu haben. Diese Familie, die auch von "Ribnitz" heißt, ist seit 1311 in Rostock nachweisbar 158 ). In diesem Jahr vermachte Thie seinen beiden Söhnen Gottschalk und Matthias das Dorf Volkenshagen mit aller Nutzung und mit allem Recht, das er dort besaß, als mütterliches Erbe 159 ). Zwei Jahre darauf tritt er als Zeuge einer Beurkundung neben anderen Rostocker Bürgern auf 160 ); schon 1314 war er Ratmann 161 ). Die aus den Urkunden gewonnene Geschichte beider Familien weist somit in die gleiche Richtung wie die Schlußfolgerung aus dem Namen.
Der zweiten Gruppe können wir diejenigen Patrizier des 13. Jahrhunderts zurechnen, die den Namen einer größeren Stadt Deutschlands als Familiennamen führen. Die meisten der namengebenden in den Urkunden nachweisbaren Städte liegen in dem altdeutschen Kulturgebiet im Westen, Nord- und Südwesten von Rostock. Ich erwähne hier: Johann von Braunschweig (1252), Arnold von Köln (1252), Konrad von Magdeburg (1257), Hildebrand von Lübeck (1257), Hermann von Dortmund (1261), Meinrich von Bremen (1262), Arnold von Soest (1279), Johann von Braunschweig (1283), Dietrich von Soest (1283), Johann von Lübeck (1296) usw. Die Zahl der Patrizier, die man auf Grund ihres Namens mit einer Stadt bzw. mit einem Dorf usw. in Zusammenhang bringen kann,


|
Seite 33 |




|
ist in den Urkunden des 13. Jahrhunderts verhältnismäßig groß; im 14. Jahrhundert vermindert sich die Zahl solcher Patrizier beträchtlich.
Man wird mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß diese nach fern gelegenen, altberühmten Handelsstädten benannten Bürger durch Handelsbeziehungen ihrer Heimatstadt mit Rostock, durch die sich hier bietenden Aussichten auf Handelsgewinn bewogen wurden, in die mecklenburgische Seestadt auszuwandern. Da sie in der Regel gewiß schon vorher dem Kaufmannsberuf angehörten, vermochten sie in Rostock schnell Wohlstand und dasjenige Ansehen zu erwerben, das sie befähigte, eine Ratsstelle zu erwerben.
Die Frage, welchem Beruf von Haus aus die im 13. Jahrhundert als Patrizier nachweisbaren Einwanderer angehörten, ist also nur vermutungsweise zu beantworten. Wichtiger ist es festzustellen, aus welchen Berufsschichten sich das in Rostock ansässige Patriziat des 13. und 14. Jahrhunderts zusammensetzte. Hat es vornehmlich aus Landwirten, Handwerkern oder Kaufleuten bestanden?
Die Urkunden enthalten zahlreiche Angaben, die scheinbar auf Landwirtschaft und Viehzucht als Beruf mancher Patrizier hinweisen. Sie berichten, daß dieser oder jener Patrizier z B. eine Fischerei, eine Mühle 162 ), einen Stall usw. pachtete oder kaufte. So kaufte der Patrizier Johann von der Aa im November des Jahres 1381 eine Mühle auf dem Mühlendamm mit dem angrenzenden Hof und allem weiteren Zubehör 163 ). Doch darf man daraus nicht etwa schließen, daß Johann von der Aa vielleicht Müller war. Dagegen spricht schon folgende Tatsache: Johann von der Aa war in den Jahren 1381 und 1382 Ratmann 164 ). Als solcher mußte er im Frühjahr 1382 verschiedene Reisen für die Stadt machen, am 2. März nach Malchin 165 ), am 7. März nach Wismar 166 ), am 16. März nach


|
Seite 34 |




|
Nyköping 167 ), von wo er erst im Anfang April nach Rostock zurückkehrte 168 ), am 10. April nach Laage 169 ). Diese Tatsachen sprechen dagegen, daß Johann von der Aa Müller war. Offenbar dienten jene Käufe nur dazu, flüssiges Kapital sicher anzulegen. Ähnlich verhält es sich mit dem in den Jahren 1275, 1282, 1283 genannten "dominus Hermanus molner". Dragendorff sieht in diesem Hermann keinen eigentlichen Müller; er weist darauf hin, daß in älterer Zeit in der Regel nur das Mühlengebäude den Müllern gehörte, während das Mühlengrundstück und der Wasserlauf Eigentum des Landesherrn oder gewisser Privatpersonen waren, denen die Müller Kornrenten zu leisten hatten. Einen solchen Eigentümer eines Mühlengrundstückes vermutet Dragendorff in diesem "dominus Hermanus molner" 170 ). Daß z. B. Mühlen von den Patriziern oft nicht zur Ausübung des Berufes, sondern zur Anlage ihres flüssigen Kapitals erworben wurden, zeigen überdies die zahlreichen Fälle, in denen manche Patrizier nicht die ganze Mühle erstanden, sondern nur einen Teil, die Hälfte oder auch nur ein Viertel. So verkaufte 1354 der Ratmann Johann von der Kyritz an Arnold Kröpelin eine viertel Mühle auf dem Mühlendamm 171 ), 1393 Bernhard Koppmann an Gerhard Grenze die Hälfte der Viergelindenmühle 172 ). Manche Patrizier erwarben Wiesen, die sie pachteten oder kauften, wie z. B. Eberhard Nachtrabe (1289) 173 ), Heinrich Mönch (1292) 174 ), Hermann Lemhus (1325) 175 ), Johann Grenze (1362) 176 ), Gerhard Rohde (1363) 177 ), Arnold Kröpelin (1380) 178 ); andere besaßen Äcker, Gärten, Vieh, Höfe, Güter, Dörfer, Scheunen und anderes mehr. Möglicherweise trieben sie zum Teil Landwirtschaft und Viehzucht nebenbei, besaßen einen Acker, den sie selbst bebauten, wie es für die Witwe von Dietrich Frese und


|
Seite 35 |




|
ihren Sohn nachweisbar ist. Die einschlägige Urkundenstelle überliefert, daß Mutter und Sohn im Jahre 1331 die Bede und das ganze Gericht von dem Dorf Barnstorf bei Rostock verkauften, ausgenommen die Bede von dreieinhalb Hufen; diese Hufen behielten sie für sich selbst zurück unter der Bedingung, "quod, quamdiu dictos tres mansos et dimidium personaliter colimus, .... precarie non dabuntur de eisdem .... 179 ). Da jedoch die meisten der soeben genannten Patrizier nachweislich Handelsleute gewesen sind, ist anzunehmen, daß sie jene Liegenschaften nicht als Landwirte, sondern in der Regel zur Anlage ihres Kapitals erwarben. Sehr oft kauften oder pachteten die Patrizier Grundbesitz der Renten wegen. Als Beispiel hierfür sei erwähnt, daß der Rostocker Patrizier Heinrich Frese zusammen mit der Stadt im Jahre 1284 das Dorf Spotendorf kaufte 180 ), jedoch schon 1286 das Eigentum des Dorfes gegen lebenslängliche Nutzung der Stadt zu Stadtrecht überließ 181 ). Ebenso entsagte Engelbert Baumgarten, der sich 1327 am Kauf von Kassebohm beteiligt hatte 182 ), 1342 seinen Ansprüchen wieder 183 ). So hielt es eine große Zahl von Patriziern. Der Erwerb von Grundbesitz ist bei ihnen demnach in der Regel nicht als Grundlage des landwirtschaftlichen Berufes anzusehen. Höchstens haben sie die Landwirtschaft bisweilen als eine Art Nebenberuf betrieben.
Der zweite in der Stadt sehr verbreitete Berufsstand, das Handwerk, hat an der Bildung des Patriziats ebenfalls keinen irgendwie erheblichen Anteil gehabt. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, daß im 13. Jahrhundert dieser oder jener Ratmann dem Handwerkerstand angehörte: Namen wie Carnifex, Pistor, Faber und Pelzer, die sich in den Ratsverzeichnissen oder sonstigen Erwähnungen von Ratsherren finden, scheinen auf Zugehörigkeit zu Handwerkerkreisen hinzuweisen; indessen zählen Ratsherren, die diese oder ähnliche Namen hatten, zu den Ausnahmen 184 ). Andere Anhaltspunkte bieten die aus dem 13. Jahrhundert erhaltenen Urkunden nicht, so daß man mit einiger


|
Seite 36 |




|
Sicherheit annehmen darf, daß, wenn überhaupt Handwerker dem Patriziat angehörten, die Zahl derselben nur ganz gering war. Ebenso unwahrscheinlich ist es, daß im 14. Jahrhundert ein größerer Prozentsatz der Patrizier Handwerker war. Der Aufstand der Handwerker im Jahre 1312 war erfolglos und wiederholte sich bis zum Jahre 1405 nicht 185 ). Die Wahl eines Handwerkers in den städtischen Rat hätte durch Vereinbarung zwischen Patriziern und Handwerkern erfolgen können; aber auch dies wird in den Urkunden nicht bezeugt.
Da die ratsfähigen Geschlechter des 13. und 14. Jahrhunderts in größerem Umfang weder die Landwirtschaft noch das Handwerk gepflegt haben, bleibt nur die Annahme übrig, daß sie im wesentlichen dem Kaufmannsstand angehört haben 186 ). Wenn die Quellen jener Zeit nur wenig unmittelbare Angaben über die Handelstätigkeit der Patrizier mitteilen, so erklärt sich das leicht aus der Tatsache, daß Kauf und Verkauf von Liegenschaften, überhaupt Bodengeschäfte aller Art ihrer rechtlichen Natur nach weit eher zu amtlichen Eintragungen führen als Handelsgeschäfte. Auf Grund des Namens kann man den Kaufmannsberuf erschließen bei Lübbert Dünafahrer, Eler Wandschneider, vielleicht auch Heinrich von Kurland und Gottfried Isländer. Nach den Urkunden des 13. Jahrhunderts sind folgende Patrizier als Kaufleute nachzuweisen: Arnold Koppmann, Dolmar von Koesfeld, Hermann von Lage, Markwart, Meincke, Hermann Modenhorst, Johann Mönch, Johann von Rathenow, Eler Wandschneider, Johann von Stade, Heinrich, Adolfs Sohn, Nikolaus von der Möhlen, Johann Rode, Arnold Quast, Johann Nising, Herder Fleck, Lübbert Dünafahrer, Konrad Dubben, Johann Grenze, Heinrich Kruse, Rötger Horn. Häufiger sind unmittelbare urkundliche Belegstellen aus dem 14. Jahrhundert; sie bezeugen den Kaufmannsberuf z. B. für Johann und Gerhard von der Aa, Winold Baggel, Peter von Freden, Engelbert Baumgarten, Heinrich Buxstock, Johann von Dülmen, Peter Frese, Johann Make, Ludolf von Gothland, Nikolaus Hasenkroch, Matthias Hoffmann, Dietrich Horn, Dietrich Holloger, Reiner Grenze, Matthias Koggenmeister, Johann von der Kyritz, Gerhard


|
Seite 37 |




|
Wulff, Hermann Beseler, Edeler Witt, Johann Töllner, Gerwin Wilde, Johann Rode und andere.
Die Tatsache, daß die Rostocker Patrizier im 13. und 14. Jahrhundert zum guten Teil Kaufleute waren, ergibt sich auch aus allgemeinen Erwägungen. Waren sie doch die Oberschicht einer Stadt, in der offenbar von jeher ein reger kaufmännischer Geist herrschte 187 ). Schon die günstige Lage Rostocks an der Warnow in der Nähe der Ostsee weist daraufhin. Die Stadt selbst förderte den Handel ihrer Bürger auf jede nur mögliche Weise. So sorgte sie für die Instandhaltung des Warnemünder Hafens. Im Jahre 1288 z. B. kam es zu einem Vertrag zwischen ihr und dem Patrizier Rötger Horn. Dieser verpflichtete sich, im Hafen von Warnemünde eine Tiefe von 12 Fuß herzustellen und fünf Jahre lang zu erhalten; die Stadt bewilligte ihm hunderttausend Ziegelsteine und versprach, ihm für seine Arbeit vierhundert Mk. Silber oder eintausenddreihundertfünfzig Mk. Pfennige zu zahlen 188 ). Im Jahre 1385 führte der Rostocker Ratmann Gerhard Grenze im Auftrag des Rates der Stadt Rostock im Hafen von Warnemünde Arbeiten in Höhe von 1000 Pfund aus 189 ). Schon im 13. Jahrhundert schloß die Stadt zahlreiche Handelsverträge mit auswärtigen und überseeischen Mächten zur Sicherung und Förderung des Handels ihrer Bürger 190 ). Sie drohte 1259 in Gemeinschaft mit den Städten Lübeck und Wismar allen See- und Straßenräubern mit Acht und Verfestung 191 ). Sie beteiligte sich um 1260 an einem Vertrag, den mehrere Städte, in denen das lübische Recht galt, zum Vorteile ihrer Kaufleute schlossen, "ita quod negociatores maris libere possint negacionem suam exercere" 192 ). Häufig wurden Handelsprivilegien der Stadt gegeben und erneuert. In Dänemark, Norwegen, Schweden,


|
Seite 38 |




|
in Estland, Riga, Nowgorod, auf Seeland und anderswo genossen die Rostocker Kaufleute Freiheiten 190); in Rostock suchte man sie jedenfalls wie in anderen Städten gegen den Wettbewerb fremder Kaufleute zu schützen 193 ).
Die Behauptung ist daher kaum gewagt, daß das Rostocker Patriziat des 13. und 14. Jahrhunderts ein fast reines Handelspatriziat war. So verstehen wir jetzt auch die rasche und häufige Verschiebung des patrizischen Grundbesitzes in und um Rostock. Für den Kaufmann war es ein Gebot der Klugheit, Liegenschaften zu erwerben, um so etwaige Handelsverluste ohne größere Erschütterungen seines Vermögens überstehen zu können. Aus diesem Streben der Patrizier nach Grundbesitz zwecks Sicherung der sozialen Stellung erklären sich die vielen urkundlichen Aufzeichnungen über den Kauf von Häusern, Buden, Äckern usw. durch Patrizier, während andererseits die ebenso zahlreichen Verkäufe von Liegenschaften, die zahlreiche Patrizier vornahmen, offenbar z. T. in der Absicht erfolgten, mit dem so frei gewordenen Kapital irgendein erfolgversprechendes Handelsgeschäft auszuführen. Glückte das Unternehmen, so machte der betreffende Patrizier von dem Recht des Wiederkaufs, das er sich im 14. Jahrhundert oftmals vorbehielt, Gebrauch., erwarb wohl auch andere Wertgegenstände neu hinzu. Im Dezember 1352 verkauften z. B. die beiden Rostocker Patrizier Gerhard und Lambert Rode dem Ratmann Johann Pilgrim ihr Erbe neben dem Kreuzkloster für 165 Mark ... "ea apposita condicione, quod dicti Gherardus et Lambertus prefatam hereditatem pro CL et XV marcis Rozst. den. reemere poterunt in festo nativitatis Domini ultra ad continuum annum" 194 ). So verstehen wir ferner in diesem Zusammenhang auch, warum das Rostocker Patriziat im 13. Jahrhundert einen so losen Zusammenhang besaß, warum der Kreis der ratsfähigen Familien so groß war und ununterbrochen neue Familien Aufnahme ins Patriziat fanden und andere verdrängten.
Das Ergebnis, daß der Handel das eigentliche Betätigungsfeld der meisten Rostocker Patrizier gewesen ist, wird sich bestätigen lassen, wenn wir uns nunmehr der Frage zuwenden,


|
Seite 39 |




|
ob die Rostocker Patrizier Großhandel bevorzugt oder im wesentlichen vom Kleinhandel gelebt haben. Die in der Literatur bis vor kurzem herrschende Ansicht betonte, daß der mittelalterliche Handel kein selbständiger Großhandel, sondern zumeist Kleinhandel, oft in Verbindung mit gelegentlichem Einkauf im großen gewesen sei. G. von Below bemerkt 195 ): Der Warenimport sei "neben den Kleinhändlern, welche die besonderen Waren ihres Kleinhandels einführten, und den Handwerkern, welche die von ihnen selbst erzeugten Waren hineinbrachten, namentlich von Gelegenheitshändlern besorgt worden". So hätte insbesondere der patrizische Kaufmann gern die Gelegenheit ergriffen, dann und wann einen starken Posten einzuführen. Groß- und Kleinhandel habe im Mittelalter in einer Hand gelegen, aber so, daß dem Kleinhandel die größere Bedeutung zukomme, daß der Kleinhändler den Großhandel "mitbesorgt" habe. Noch weiter ging Sombart 196 ), indem er die mittelalterlichen Kaufleute mit den Handwerkern auf eine Stufe stellte. "Ihr ganzes Denken und Fühlen, ihre soziale Stellung, die Art ihrer Tätigkeit, alles läßt sie den kleinen und mittleren Gewerbetreibenden ihrer Zeit verwandt erscheinen." Im Gegensatz hierzu wies schon Friedrich Keutgen auf die hohen Warenumsätze im Mittelalter hin und betonte, daß schon diese Periode den Großhändler gekannt habe 197 ). Die gleiche Meinung vertrat in neuester Zeit Fritz Rörig. Er sieht in den Lübecker Kaufleuten des ausgehenden 13. und des 14. Jahrhunderts echte Großhändler, für die der Gewandschnitt, d. h. der Verkauf von Tuchen im kleinen, nur "eine geschäftliche


|
Seite 40 |




|
Funktion neben vielen anderen" gewesen sei. Der Fehler der üblichen Lehrmeinung sei der, daß sie in dem mittelalterlichen Kaufmann vornehmlich den Wandschneider, d. i. den Kleinhändler, sähe und so zu der Leugnung eines selbständigen Großhandels gelange 198 ).
Die erhaltenen Rostocker Quellen bezeugen, daß eine Reihe von Patriziern sowohl im 13. als auch im 14. Jahrhundert den Kleinhandel in und um Rostock pflegte, d. h. an Verbraucher verkaufte. Als Wandschneider sind nachweisbar: Volmar von Koesfeld (1283) 199 ), Dietrich Wilde 200 ), Dietrich Horn 201 ), Peter Kremer 202 ), Johann Töllner II 203 ), Johannes Töllner III 204 ), Arnold Koppmann 205 ), Edeler Witt 206 ) (alle um etwa 1350). Neben Tuchen, zum größten Teil flandrischer Herkunft, verkauften Peter Kremer Pferde und Wein 207 ), Dietrich Wilde Mehl, Fleisch und Mühlsteine 208 ), Dietrich Horn Brot, Bier und Butter 209 ), Johann Töllner II Heringe und Getreide, Johann Töllner III Speck, Holz und Borden 210 ). Andere Patrizier scheinen unter anderem mit Salz gehandelt zu haben; so kaufte Arnold Koppmann 1267 für 10 Mark ein Salzhaus in der Saline zu Sülz bei Marlow und verpflichtete sich überdies zu Salzlieferungen an die Klöster Dargun und Bergen auf Rügen 211 ). Weiter sind Rostocker Patrizier im Weinhandel beschäftigt gewesen. In der Abrechnung der Rostocker Weddeherren des Jahres 1362 steht unter anderem eine Ausgabe an Reiner Grenze für ein Faß Wein, welches drei Ohm und


|
Seite 41 |




|
anderthalb Stübchen enthielt 212 ). Reiner Grenze lagerte seinen Wein im Ratskeller; er mußte einmal für 15 Ohm vier Mark "Tapphegeld" bezahlen 213 ). Eine Reihe von Patriziern war wahrscheinlich im Getreidehandel tätig. Wir können dies wohl annehmen von denjenigen, die im Besitze eines "granarium", d. h. eines Getreidespeichers waren 214 ). Als Eigentümer, Besitzer oder Pächter eines solchen "granarium" sind nachzuweisen die Patrizier Johann Mönch (1252) 215 ), Hermann von Lage (1257) 216 ), Johann von Rathenow (1257) 217 ), Johann von Stade (1262) 218 ), Heinrich Adolphi (1262) 219 ) und andere.
Von wem die eben genannten Patrizier ihre Waren bezogen, geht aus den Quellen meist nicht hervor. Es ist wahrscheinlich, daß die Wareneinfuhr häufig von Handelsgesellschaften besorgt wurde. Der Vorteil, den eine solche Handelsgesellschaft (Sozietät) bot, bestand einmal darin, daß sich das Wagnis des einzelnen Kaufmannes verminderte, dann vor allem für den patrizischen Ratsherrn darin, daß er Zeit für seine Tätigkeit im Dienste der Stadt gewann 220 ). So heißt es einmal in dem einzigen, für Rostock erhaltenen, von Koppmann herausgegebenen Handlungsbuch des Wandschneiders Johann Töllner: "Notandum, quod ex frusto patris mei recepi 4 Brugenses ..." 221 ); sein Vater aber war Mitglied einer Gesellschaft, die Tuch im großen aus Flandern nach Rostock, zuweilen über Stralsund, einführte 222 ). Diese Sozietät scheint ein vorübergehendes Unternehmen gewesen zu sein 223 ), jedenfalls


|
Seite 42 |




|
ist sie nur während der Jahre von 1345 bis 1349 oder 1350 nachweisbar. Vier Rostocker Patrizier waren in dieser Gesellschaft vereinigt: der Bürgermeister Johann Töllner II, sein Sohn Johann Töllner III, Arnold Koppmann, der Schwager von Johann Töllner III, und Edeler Witt, der Schwager von Arnold Koppmann. Alle vier Teilhaber der Handlungsgesellschaft betrieben nebenbei anscheinend einen Kleinhandel, in welchem sie die von der Sozietät eingeführten Packen Tuch im kleinen weiter verkauften.
Noch eine ganze Reihe solcher Sozietäten gab es in Rostock vor 1400, aber nur über diese eine, an der die beiden Töllner beteiligt waren, sind zusammenhängende Nachrichten überliefert, bei den andern findet sich oft nur ein kurzer Hinweis in den Quellen. So wird eine Sozietät bestanden haben zwischen den drei Patriziern Peter von Freden, Johann Make und Peter Frese; sie lieferten im Jahre 1395 gemeinsam für hundert Mark Tuch an die Stadt 224 ). So bestand eine Sozietät wohl auch zwischen Peter von Freden und Winold Baggel, die dem Salzhandel oblag 224), eine andere zwischen Lambert Witt, Gerhard von der Aa und Eberhard Beseler, die etwa 1360 etwa 80 Mk. erhielten "ex parte domus laterum", d. i. von der städtischen Ziegelei 225 ), der sie vielleicht Holz für die Ziegelöfen geliefert hatten 226 ). Im Jahr 1399 kamen Bertold Lange und Hermann Beseler vor den Rat und berichteten, daß sie an Heringen geschädigt worden seien "alse se ere ghelt hadden in selschop" 227 ). Im Jahre 1390 verfügte Gerhard Wulff vor einer Wallfahrt über sein Vermögen "sive in prompta pecunia sive in societatibus" 228 ); 1362 erhielt Gerwin Wilde bei einer Erbteilung unter anderm "societatem" seines Vaters "in molaribus" 229 ). 1351 erhielten die Kinder von Edeler Witt alles Geld "sive in societatibus aut debitis ubicumque existat", ausgenommen die Schulden des Herzogs in Höhe von 200 Mark 230 ); 1349 vermachte Johann Rode testamentarisch dem Otto Smoke 50 Mk. "de bonis, que ex nostra societate


|
Seite 43 |




|
mihi cedere poterint et debere" 231 ), und im Jahre 1331 heißt es von den Gebrüdern Horn: "Fratres .. sunt ex parte .. societatis, quam invicem habuerunt, complanati .." 232 ).
Neben dem Kleinhandel bestand sicher schon vor 1400 ein regelmäßiger Großhandel der Patrizier 233 ). Man darf sich auch hier nicht durch die dürftigen urkundlichen Angaben dazu verleiten lassen, einen ständigen patrizischen Großhandel während dieser Zeit abzulehnen. Die Urkunden verzeichneten Rechtsgeschäfte; der Großhandel, welcher in privater Hand lag, bot wenig oder keinen Anlaß zu amtlichen Aufzeichnungen. Rostock kannte wahrscheinlich so gut wie Lübeck den Patrizier als Großhändler, vermutlich als einen Großhändler von bescheideneren Ausmaßen, denn Rostock war nicht wie Lübeck "der Großhandelsplatz par excellence des damaligen Nordeuropa" 234 ). Wie der Lübecker, so stellte wohl auch der Rostocker Kaufmann sein Geschäft bereits vor 1400 auf eine neue, moderne Basis 235 ). Als Beweis dafür stelle ich hier einige Quellenangaben über die Handelstätigkeit des Patriziers und Ratmanns Peter Kremer zusammen. In einer in Lübeck ausgestellten Urkunde vom Jahre 1342 heißt es: Omnibus .. innotescat, quod ego Conradus Nigenstad integraliter percepi a Petro Cremere, ciui in Rostock, centum et duas marcas denariorum Lubicensium mihi pro duodecim talentis pagamenti in Brugis venditis debitas per presentacionem Hermanni de Munstere, ciuis Lubicensis 236 ). Zum 14. Oktober 1344 ist über-


|
Seite 44 |




|
liefert: Ego Wernerus dictus Wullenpunt, ciuis in Lubeke, recognosco ..., quod Petrus Kremer, ciuis in Rozstok, mihi octoginta quinque libras grossorum ... persoluit, pro qualibet libra octo marcas ..., quas emit a Ghisekino et Hinrico Wi1den in Brugis 237 ). Zum 4. April 1346 wird berichtet: Ego Hinricus Starcadere, ciuis in Rozstok, recognosco, me a Petro Kremer, meo conciue, 48 marcas recepisse, quas Everhardus Capporie emit in Brugis 238 ). Eine Urkunde vom 14. August 1350 bezeugt: Nos Symon ..., ciues in Sutphen, ... recognoscimus ..., nos teneri obligatos ... Petro Kremer ... in centum et viginti aureis clippeis, ... in Brugis suo hospiti Euerhardo Coper ... persoluendis 239 ). Eine weitere Urkunde vom 17. August 1352 bezeugt: Ego . et ..., ciues in Sutphania, recognoscimus, nos Petro dicto Kremer teneri obligatos 120 clippeos aureos, quos in Brugis sibi seu a1icui a1teri sui ex parte ... persolvere promittimus 240 ). Zum Schluß sei erwähnt die Mitteilung einer Urkunde vom 21. Januar 1355: Ego ... ciuis in Rozstok ... recognosco, quod ... Petrus Kremer ... mihi XII talenta grossorum ex parte Euerhardi Copper, ciuis in Brugis, persoluit 241 ). Peter Kremer verkörperte einen ganz besonderen kaufmännischen Typ. Er war nicht mehr der ständige Begleiter seiner in Flandern gekauften Waren, reiste nicht mehr selbst zu jedem Einkauf dorthin. Diese Aufgabe überließ er anscheinend seinem "hospes" Eberhard Kopper in Brügge, der überdies als Bürger dieser flandrischen Stadt im Handel die Vorzüge des einheimischen Kaufmannes genoß, die der Rostocker Peter Kremer nicht besaß. Eberhard Kopper hatte das Recht, in Peter Kremers Namen Waren zu kaufen und Zahlungen entgegenzunehmen. Auch in Lübeck scheint Peter Kremer einen Mitarbeiter in Hermann von Münster gehabt zu haben; wie Kopper das Brügger, so besaß Hermann von Münster das lübische Bürgerrecht. Nur


|
Seite 45 |




|
gelegentlich wird unser Rostocker Patrizier zwecks Abwicklung geschäftlicher Unternehmungen auswärts geweilt haben 242 ). Ermöglicht aber wurde diese bereits an moderne Verhältnisse erinnernde Leitung eines kaufmännischen Betriebes dadurch, daß Rostocker Kaufleute teilweise wie die Lübecker ihr Geschäft bereits im 14. Jahrhundert auf der Grundlage von Schriftstücken betrieben 243 ). Schriftliche Anweisungen an die Mitarbeiter in anderen Städten konnten nunmehr häufig die persönliche Anwesenheit des Kaufherrn ersetzen. Jetzt war eine straffere Organisation eines größeren Kaufgeschäftes möglich, konnte sich der Handel eines Bürgers gleichzeitig nach verschiedenen Gegenden erstrecken. Dadurch, daß Peter Kremer und damit der Sitz der Handelsfirma in Rostock war und blieb, unterschied sich dieses Geschäft von manchem früherer Zeit 244 ). Leider ist ein Handlungsbuch, das Peter Kremer wahrscheinlich zur Kontrolle seines Betriebes führte, nicht erhalten; es würde gewiß ähnlich wie das uns erhaltene Handlungsbuch Johann Töllners ausgesehen haben. In Töllners Geschäft wurde nach Koppmann neben diesem erhaltenen Buch offenbar ein zweites geführt, eine Art Kladde, auf die bei Prüfungen zurückgegriffen werden konnte 245 ). Hier sehen wir bereits die Anfänge einer doppelten Buchführung. Aber so modern diese Art der Geschäftsführung unseres Rostocker Patriziers auch anmutet, man darf doch nicht vergessen, daß dieses Handlungsbuch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Die Technik der Buchführung, wie sie von Johann Töllner gehandhabt wurde, war noch einfach. Gebucht wurde eine Unzahl kleiner Verkäufe; Gesamtabschlüsse und Gesamtübersichten fehlen entweder ganz oder


|
Seite 46 |




|
sind höchst unklar 246 ). Bei den meisten Buchungen finden sich zugleich Vermerke über den Fälligkeitstermin der zu leistenden Zahlungen; die Waren wurden also sehr oft nicht bar bezahlt. Aber auch diese Termine wurden von der Kundschaft häufig nicht innegehalten, so daß die fällig gewordenen, uneingelösten oder nur teilweise bezahlten Posten zum zweiten, bisweilen sogar zum dritten Mal im Handlungsbuch erscheinen.
So liest man z. B. unter Nr. 441 eine Forderung Johann Töllners an "dominus Segherus", die als Nr. 518 zum zweiten und als Nr. 713 zum dritten Mal gebucht wurde. Immerhin war doch die Schriftlichkeit des Verfahrens gewonnen. Johann Töllner besaß hinreichend Schrift- und Sprachkenntnis, um die Buchungen eigenhändig und in lateinischer Sprache vornehmen zu können 247 ). Weiteren Aufschluß über das Bestehen eines Rostocker Großhandels gibt unter anderem eine Urkunde, die Beschwerden der Stadt Rostock gegen die Grafen von Holstein und deren Helfer, Vasallen und Vögte wegen vielfach gegen Rostocker Bürger geübter Gewalttätigkeiten und Beraubungen überliefert 248 ). So verloren z. B. Heinrich Pape Güter im Wert von 60 Mark, Dietrich Horn Bier, Brot, Leinwand und weißes Tuch im Wert von 75 Mark Rost., derselbe ein anderes Mal 2 1/2 Tonnen Butter. Weiter wurden Hermann Beseler und Heinrich Buxstock Hopfen, Gerstenmalz und Tuche im Wert von 100 Mk. rein, sowie zwei Diener genommen. Hennekin Kröpelin büßte bei Ravensburg auf dem Schiff des Paul Jonesson Gerstenmalz und Leinwand im Wert von 34 Mark Rost. ein. Eberhard von Freden hatte vier Last Heringe, eine Tonne Salz, eine Kiste, Kleider und 20 Kalbfelle im Wert von 100 Mk. Rost. zu beklagen. Außerdem büßte er zu anderer Zeit Mehl, Gerstenmalz und Bier, die auf der Kogge eines gewissen


|
Seite 47 |




|
Thop verladen waren, in Höhe von 200 Mk. Rost. ein. Vielleicht ist auch Dietrich Holloger als Großhändler anzusprechen; er vermachte testamentarisch im Jahre 1351 dem Hennekin Holloger 20 Mk. lüb. und vier silberne Löffel 249 ); dieser Hennekin, der sich in Bergen aufhielt, mochte ein Mitarbeiter von Dietrich Holloger sein. Vielleicht trieb weiter auch der Bürgermeister Lambert Witt Handel nach Skanör; jedenfalls besaß er dort unter anderm die Einkünfte von zwei Fleischbuden, die er 1372 seinem unehelichen Sohn Hermann anwies 250 ). Von dem Patrizier Ludolf von Gothland wissen wir, daß er mit seinem Bruder Heinrich im Jahre 1301 einem Wisbyer Bürger 400 Mark zu zehn Prozent lieh 251 ), demnach hatte er dorthin vermutlich Handelsbeziehungen. Auf Großhandel der Patrizier weist ferner noch das verhältnismäßig geringe Interesse hin, das sie besonders im 14. Jahrhundert für den Gewandschnitt zeigten. Wir sahen bereits, daß nur wenige von ihnen den Tuchverkauf im kleinen pflegten, daß viele andere mit Wein, Malz, Fleisch usw. Handel trieben. Der Wandschneider, der Tuch nach Ellen verkaufte, war Kleinhändler. Dieser Beruf aber hatte offenbar seine Anziehungskraft für manchen Rostocker Patrizier des 14. Jahrhunderts verloren, er übte den Wandschnitt in dieser Zeit wohl nur nebenbei aus, war im Hauptberuf eben Großhändler 252 ). So erklären sich die gewaltigen Vermögen, die mancher Patrizier in seiner Hand vereinigen konnte, denn schwerlich hat der Kleinhandel damals derartige Gewinnmöglichkeiten in sich geschlossen; so erklärt sich auch das Streben der Stadt nach Handelsprivilegien in auswärtigen Ländern. In die gleiche Richtung weist ferner eine Bestimmung, die sich im Entwurf eines Schonischen Privilegs findet, wie es die Rostocker etwa 1352 von König Magnus von Schweden begehrten 253 ). Sie wollten unter anderem für einen Packen Tuch, den zwei Pferde ziehen konnten, dem dortigen Vogt überhaupt


|
Seite 48 |




|
keine Abgaben entrichten; erst dann, wenn vier Pferde nötig seien, sollte eine kleine Summe erhoben werden dürfen. Schließlich weist eine Ratswillkür vom Jahre 1360 auf das Vorhandensein von Großhändlern im Rostock des 14. Jahrhunderts 254 ). Diese Willkür sollte den Handel mit Öl, Mandeln und Reis zwischen den einführenden Kaufleuten und den Krämern regeln. Es heißt in der Urkunde, daß die Bürger, "apportantes oleum qualecumque de partibus alienis", das Öl in ihren Wohnungen nach beliebigem Maß verkaufen durften, daß aber diejenigen, die Öl einführten "de Lubeke aut Stralessund seu civitatibus circumiacentibus in vicino, non trans stagnum, non minus quam decem talenta de eo simul" verkaufen durften. Man begünstigte also den Überseekaufmann.
Der Rostocker Großhandel erreichte wahrscheinlich nicht den Umfang des Handels anderer namhafter Ostseestädte, wie etwa Lübecks oder Stralsunds, immerhin aber bezifferte sich der Wert des Rostocker Außenhandels bereits im Jahre 1369 auf 62208 Mark lübisch bzw. auf 590976 Mark heutiger Währung, im Jahre 1378 auf 87040 bzw. auf 826880 Mark 255 ). Im 14. Jahrhundert trieben patrizische Kaufleute Rostocks u. a. Handel nach Wordingborg auf Seeland, nach Kopenhagen 256 ) und der englischen Küste 257 ); sie durchfuhren den Grönessund zwischen den Inseln Falster und Möen, hatten Beziehungen nach Gjedser, nach Hindsgaul auf Fünen, nach Horsens und Bygholm auf Jütland und nach Ravensburg auf Laaland 257). In der Stadt selbst bestanden Gesellschaften (Kompagnien) der Bergen-, Flandern-, Riga-, Schonen-, Spanien- und Wyk-Fahrer 258 ).
So liefert uns das Gesamtbild, das wir von der Art und dem Umfang des Handels der Rostocker Patrizier vor uns haben erstehen sehen, den Beweis dafür, daß der Groß- und Fernhandel im Rostock des 14. Jahrhunderts von den dortigen Patriziern geschätzt und ausgiebig gepflegt wurde. Ob in-


|
Seite 49 |




|
dessen die wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit bereits eine Verzichtleistung dieses oder jenes Patriziers auf den Kleinhandel in und um Rostock gestatteten, muß dahingestellt bleiben 259 ). In der Regel wird jedenfalls der patrizische Großkaufmann auch die Vorteile, die der Kleinhandel dem Kaufmann bot, nicht verschmäht und neben seinem En-Gros-Geschäft ein Detail-Geschäft betrieben haben, in dem er seine Waren in kleinen Mengen unmittelbar an den Verbraucher absetzte. Vielleicht wird man dem Charakter, welchen in der Mehrzahl der Fälle der patrizische Großhandel während des 14. Jahrhunderts in Rostock hatte, einigermaßen gerecht, wenn man mit Umkehrung der Belowschen These sagt, daß nicht der Kleinhändler den Großhandel, sondern der Großhändler den Kleinhandel "mitbesorgt" hat 260 ).
Die Vermögenslage der Rostocker Patrizier.
Das Vermögen der Rostocker Patrizier ist im 13. und 14. Jahrhundert aus Handelsgewinn, Grundbesitz und Geldgeschäften entstanden. Die Zusammensetzung des patrizischen Vermögens aus diesen drei Quellen wird von der Forschung im allgemeinen anerkannt; heftig umstritten dagegen ist noch die Frage, aus welcher dieser drei Quellen die ersten und aus welcher die höchsten Gewinne stammten.
In der reichen Literatur, die über die bürgerlichen Vermögen des Mittelalters handelt, sind vor allem zwei Richtungen vertreten, deren Vorkämpfer Werner Sombart und Georg von Below sind. Die von ihnen über die Entstehung


|
Seite 50 |




|
des bürgerlichen Reichtums aufgestellten Theorien bezeichnen wir der Einfachheit und besseren Übersicht wegen kurz mit Grundrenten- und Kaufmannstheorie.
Die Grundrententheorie Sombarts 261 ) besagt etwa folgendes: Der Handel als Primärquelle des bürgerlichen Reichtums scheidet vollkommen aus; denn der Warenumsatz war im Mittelalter äußerst gering, die Zahl der Händler dagegen sehr groß, so daß der Gewinn des Einzelnen nur minimal gewesen sein kann. Der Handel konnte erst in großem Stil vermögenbildend wirken, "wenn er erst einmal aus dem verhängnisvollen Zirkel: Kleiner Umsatz - hohe Spesen - geringe Profitmenge - keine Akkumulation - herausgehoben" wurde 262 ). Ebenso scheidet das Geld- und Rentengeschäft als Primärquelle des bürgerlichen Reichtums aus. Nur die bereits Wohlhabenden konnten auf diesem Weg zu wirklichem Reichtum gelangen. "Die paar großen renommierten Häuser für die fetten Bissen, eine Anzahl mittlerer Geschäfte für die Mittelware der milites und armigeri und der große Haufe für die in Not geratene oder spielwütige misera contribuens plebs" 263 ). Entscheidend für die Bildung des Reichtums in der Hand der städtischen Bürger ist vielmehr die Be-


|
Seite 51 |




|
deutung der Grundrente. Nach Sombart befindet sich in der Frühzeit einer mittelalterlichen Stadt der größte Teil des Grund und Bodens in dem Besitz weniger Familien infolge Schenkung, Kauf usw. Fast alle, die sich später in der Stadt ansiedeln wollten, mußten sich also auf den Hufen dieser Familien niederlassen und dafür einen Zins, eben die Grundrente, entrichten. Mit der steigenden Zuwanderung in die Stadt wurde die Nachfrage nach Bauplätzen größer und größer, der Zins wurde wieder und wieder gesteigert, das Vermögen der wenigen Grundeigentümer nahm immer größere Ausmaße an. Dem so wohlhabend gewordenen Bürger konnten nunmehr neben der Grundrente auch der Handelsgewinn und die Geldrente weiteren Verdienst einbringen. Nach dieser Theorie ist also der Patrizier zu Beginn der Entwicklung Grundbesitzer gewesen 264 ).
Im Gegensatz dazu steht die Kaufmannstheorie von Georg von Below 265 ). Seiner Meinung nach kommen bei der Bildung großer Vermögen die verschiedensten Momente neben einander in Betracht. "Wollte man aber eine Rangordnung herstellen, so müßte die von Sombart versuchte umgekehrt werden. Wenigstens insofern, als akkumulierte ländliche Grundrenten für die Bildung der Anfänge städtischen Reichtums so gut wie gar nicht in Betracht kommen oder sogar: schlechthin gar nicht" 266 ). Die städtische Grundrente ist nur vereinzelt für die Entstehung eines Vermögens von einiger Bedeutung gewesen. Der Patrizier ist zu Beginn der Entwicklung meistens Kaufmann, erst später Grundbesitzer.
Vermittelnd zwischen beiden steht die Theorie von Rudolf Häpke 267 ). Nach ihm sind Rente und Handel gemeinsam am Bau der Vermögen beteiligt. "Wer dabei mehr leistet, hängt von dem einzelnen Fall ab; ein allgemeineres Urteil wird sich


|
Seite 52 |




|
wohl schwerlich nach Lage der Dinge mit einiger Sicherheit fällen lassen" 268 ).
Wie kam es in Rostock zur Entstehung des patrizischen Vermögens? Für die früheste Zeit, die Jahre bis etwa 1250, läßt sich über diese Frage nichts Sicheres aussagen, denn die Urkunde vom Jahre 1218 als einzige erhaltene der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts 269 ) gibt hierüber keinen Aufschluß. Man wird indessen auf Grund der bereits gewonnenen Erkenntnis, daß die städtischen Patrizier des 13. und 14. Jahrhunderts in der Mehrzahl Kaufleute waren, annehmen dürfen, daß der Handelsgewinn schon vor 1250 in irgendeiner Weise am Bau des patrizischen Vermögens beteiligt war. Über seine Höhe wird man allerdings keine Gewißheit erlangen können. Es ist ferner nicht möglich, auf gesicherter urkundlicher Grundlage zu entscheiden, ob in diesem ältesten Stadium der Entwicklung Rostocks Grund- bzw. Geldrenten für die Ansammlung von Kapital in der Hand der Patrizier überhaupt von Bedeutung waren. Immerhin besteht die Wahrscheinlichkeit, daß die Geldrente damals schon ein vermögenbildender Faktor war. Aus den erhaltenen Urkunden der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts geht nämlich hervor, daß die Rostocker Patrizier dieser Jahrzehnte das Geldgeschäft ziemlich häufig pflegten und auch verhältnismäßig hohe Gewinne erzielten. So lieh z. B. im Jahre 1286 Elisabeth Baumgarten, die Witwe von Bernhard Baumgarten, der Stadt 600 Mark zu 10 Prozent zunächst auf ein Jahr 270 ); ihr Gewinn belief sich demnach pro Jahr auf 60 Mark. Im Jahre 1294 gaben verschiedene andere Patrizier der Stadt ebenfalls recht ansehnliche Anleihen: Johann Witt lieh 1000 Mark gegen eine Rente von 100 Mark aus der collecta, Johann Rode lieh 550 Mark zu 10 Prozent, Bertram Dame zweimal je 200 Mark zu 10 Prozent, desgleichen zu demselben Prozentsatz Heinrich Mönch 200 Mark, Johann Lise 150 Mark und Bertram Dame nochmals 200 Mark 271 ). Vermutlich hat sich das Geldgeschäft aus bescheideneren Anfängen entwickelt. Demnach hätte die Geldrente schon in den Jahrzehnten nach 1218 zur Entstehung des patrizischen Reichtums in Rostock beigetragen.


|
Seite 53 |




|
Anders steht es mit der Grundrente. Sie wird in der ältesten Zeit nach Entstehung der Stadt wohl nur in Ausnahmefällen ein kapitalbildendes Moment von einiger Bedeutung gewesen sein. Vornehmlich zwei Umstände sprechen dagegen, daß ein größerer Teil von Rostocker Patriziern in so früher Zeit mit Hilfe der Grundrente eine nennenswerte Steigerung des Vermögens zu erzielen vermochte: einmal der räumliche Umfang des patrizischen Grundbesitzes in und um Rostock, zum andern die rechtliche Form der Vergebung von Grund und Boden. Nur dann, wenn die Mehrzahl der Rostocker Patrizier damals über ausgedehnten Grundbesitz hätte verfügen können, könnte man allgemein von einem großzügigen Mitwirken der Grundrente am Bau der patrizischen Vermögen sprechen. Nun läßt sich aber nirgends in den erhaltenen Urkunden vor 1300 ein Kauf- oder Schenkakt usw. nachweisen, durch den Rostocker Patrizier so frühzeitig in den Besitz eines größeren Teiles der städtischen und ländlichen Hufen gelangt wären. Dagegen ist es eine quellenmäßig belegbare Tatsache, daß während des ersten Jahrhunderts nach Gründung der Stadt Rostock der Landesherr, die Stadt selbst und die Kirche Eigentümer von ausgedehntem Grundbesitz, von zahlreichen Buden und Gebäuden sowie von ländlichen Hufen waren. Außer den städtischen Kirchen, Klöstern und Hospitälern verfügten auch manche auswärtigen Klöster über Grund und Boden in Rostock. Im Jahre 1262 versprach ein Rostocker Bürger dem Kloster Doberan den Erlös seines Erbes in Rostock 272 ), das nach seinem Tod und dem Tod seiner Frau verkauft werden sollte. Schon 1263 besaß dieses Kloster ein Haus in der Stadt 273 ) und 1280 eine Kapelle auf dem Klosterhof 274 ). Im Eigentum des Rates der Stadt befanden sich unter anderm ein größerer Teil der Stadtgärten, Schlachthäuser, Wiesen und umliegenden Dörfer sowie zahlreiche Verkaufsstellen der verschiedensten Gewerbe 275 ); und noch im Jahre 1325 zahlten allein 84 Schlachter die Abgaben von ihren Verkaufsbuden an die Stadt 276 ). So hatten also die Patrizier, wollten sie ihren Grund und Boden, ihre Buden oder Gebäude an neu einwandernde Kolonisten nutz-


|
Seite 54 |




|
bringend veräußern, in dem Landesherrn, der Stadt und der Kirche mächtige Konkurrenten, denn auch deren Streben wird sich voraussichtlich auf möglichste Ausnutzung ihres Besitzes an städtischen und ländlichen Hufen, an Buden und Häusern aller Art gerichtet haben. Infolgedessen waren die Patrizier gezwungen, ihr Eigentum gegen einen nur mäßigen Zins auszuleihen, weil eine hohe Forderung an Grundrente den Interessenten abgeschreckt und bewogen hätte, sich auf landesherrlichem, städtischem oder kirchlichem Besitz anzusiedeln. Besonders in Zeiten starker Bevölkerungsvermehrung in der Stadt durch neue Einwanderer mochte es vielleicht manchem Patrizier gelingen, seinen Grund und Boden zu vorteilhaften Bedingungen zu veräußern. Nun war es aber damals auch in Rostock ein vielgeübter Gebrauch, daß die Vergebung von Grund und Boden in der Form der Erbleihe erfolgte, und diese Form der Übertragung wurde der zweite Faktor, der dem Patrizier eine Vermögensbildung großen oder größeren Stils durch die Grundrente vereitelte 277 ). Die Erbleihe ist ein Vertrag zwischen dem Eigentümer z. B. einer area und dem Beliehenen; dabei bleibt das Eigentum dem Verleiher vorbehalten, nur die Nutzung wird dem Beliehenen zugestanden. Für diese Nutzung muß dem Eigentümer ein Zins, d. i. die Grundrente, gezahlt werden, die in vielen Fällen für alle folgende Zeit schon bei Abschluß des Vertrages fixiert wurde. Dies bezeugen unter anderem einige Beispiele aus den Jahren 1262, 1280, 1282: (1262) Constitutus coram consilio Reineco, filius domini Reimberti, profitebatur, quod ... ab ipso haberent aream unam ..., pro qua singulis annis XXIII solidi presentabuntur eidem .... Et hoc perpetuo stabit 278 ). (1280) Johannes filius domini Isern et ... resignauerunt aream suam ... Et de illa ... quattuor marcas pro censu areali perpetuo singulis annis dabunt 279 ). (1282) Recognovit Engelbertus ..., quod Volmarus de Cosfelde habeat in hereditate sua integrali ..., singulis annis III marcas census areali


|
Seite 55 |




|
perpetuo ... 280 ). Die Folge einer Fixierung der Grundrente war nun, daß mancher Patrizier, welcher seinen Grund und Boden unter dieser Bedingung veräußert hatte, in seiner wirtschaftlichen Existenz durch die dauernde Münzverschlechterung und durch " das bis in das 14. Jahrhundert hinein anhaltende Sinken der Kaufkraft des Geldes" 281 ) schwer geschädigt wurde. Größere Beträge brachte ihm die Grundrente nicht.
Diese Erwägungen lassen den Wahrscheinlichkeitsschluß zu, daß nicht Grundrente, sondern Handelsgewinn und Geldrente die ersten wesentlichen vermögenbildenden Faktoren in Rostock waren. Von einer entscheidenden oder gar ausschließlichen Bedeutung der Grundrente kann man nicht sprechen. Vielmehr scheint nach den vorhandenen Quellen der ältesten Zeit die Grundrente in Rostock nur untergeordnete Bedeutung für die Bildung des patrizischen Reichtums gehabt zu haben.
Das Verhältnis von Grundrente, Handelsgewinn und Geldleihe für die Entstehung der patrizischen Vermögen hat sich in späterer Zeit geändert. Dies möge eine Untersuchung über die Höhe der Gewinne, die der Handel, das Boden- und Geldgeschäft um etwa 1350 abwarfen, erweisen.
Die Möglichkeit, eine Vorstellung von der Rentabilität eines Rostocker Handelsgeschäftes dieser Zeit zu erhalten, bietet sich uns in dem von Koppmann veröffentlichten Handlungsbuch von Johann Töllner III. Dieses Buch verzeichnet in seinem ersten Teil die Geschäfte einer Handlungsgesellschaft, an der Johann Töllner II, Johann Töllner III, Arnold Koppmann und Edeler Witt in der Zeit von 1345 bis 1349 oder 1350 beteiligt waren 282 ). Die Tätigkeit der Sozietät bestand darin, Tuch in Flandern einzukaufen und dieses in Rostock und der Umgebung der Stadt wieder zu verkaufen 283 ). Der erste Einkauf der Gesellschaft erfolgte am 8. September 1345 284 ), der letzte datierbare wurde am 11. Juni 1349 abgeschlossen 285 ). Da nach diesem Termin noch ein weiterer Packen Tuch von der Gesellschaft verkauft wurde 286 ), ehe Johann Töllner III


|
Seite 56 |




|
ausschied 287 ), darf man annehmen, daß sie ungefähr vier Jahre bestand. Während dieser vier Jahre setzte die Sozietät insgesamt 10 Packen Tuch ab 288 ). Über drei dieser 10 Packen fehlen leider jegliche näheren Angaben, von fünf dagegen sind Einkaufs-, Verkaufspreis und Gewinn feststellbar. Der erste Packen, bestehend aus 71 Tuchen, wurde von der Gesellschaft mit 697 Pfund 14 ß 6 (?PF) bezahlt 289 ); als Gesamterlös der Gesellschaft berechnet Koppmann, der Herausgeber des Handlungsbuches, 883 Pf. 290 ). Somit belief sich der Gewinn aus diesem Packen Tuch für die Sozietätsmitglieder auf 185 Pfund 1 ß 6 (?PF), d. i. 26 Prozent 290). Eine Übersicht über das Gesamtgeschäft der Sozietät, soweit es überhaupt erfaßbar ist, erhalten wir durch die nachstehende Tabelle 291 ):
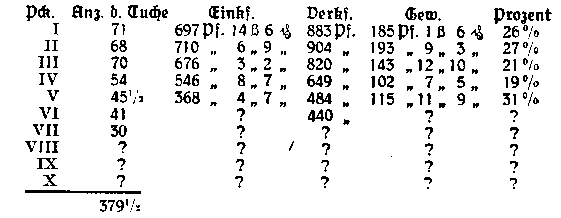
Die Gesellschaft arbeitete also mit einem Gewinn, der zwischen 19% als Minimal- und 31% als Maximalgewinn liegt; hiernach würde der durchschnittliche Gewinn etwa 25% betragen haben.
Der zweite Teil des Handlungsbuches enthält nähere Vermerke über ein von Johann Töllner III allein betriebenes Handelsgeschäft 292 ). Töllner vertrieb in diesem Geschäft nicht nur Tuche, sondern u. a. auch Borden für Fenster, Böttcherholz, Hafer und Speck 293 ). Die ersten von ihm gebuchten, zeitlich


|
Seite 57 |




|
bestimmbaren Schuldposten datieren aus dem Jahre 1346 294 ), der Einkauf des Böttcherholzes erfolgte 1348 295 ), weitere zeitlich nicht näher zu bestimmende Einkäufe folgten. Auf Grund dieser Vermerke darf man wohl annehmen, daß dieses auf eigene Kosten betriebene Geschäft Johann Töllners ungefähr in dieselben Jahre fällt, während welcher die Sozietät ihre Waren verkaufte. Danach würden sich Johann Töllners Eintragungen in das Handlungsbuch hier ebenfalls auf etwa vier Jahre erstrecken 296 ). Nicht von allen verkauften Waren ist der Gewinn Töllners feststellbar, sondern nur für das Böttcherholz und die englischen Tuche.
Das Holzgeschäft ist im Handlungsbuch in den Abschnitten XV und XVI verbucht. Aus diesen geht hervor, daß Johann Töllner insgesamt 1207 Faß Böttcherholz einkaufte und dafür eine Summe von 75 Pfund entrichtete. Verkauft wurden von ihm
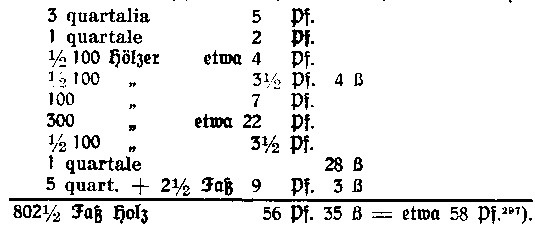
297
).
Hinzu kommen 400 Faß Holz, die ohne Angabe des Preises gebucht 298 ) sind. Rechnet man als Einnahme für diese 400 Hölzer 1/2 x 58 Pf. = 29 Pf., so ergibt sich für das Holzgeschäft eine Gesamteinnahme von 87 Pfund. Einen Überblick bietet nachstehende Tabelle:
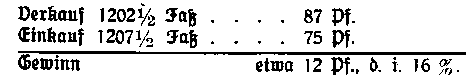


|
Seite 58 |




|
Eine Zusammenstellung über das Geschäft mit englischen Tuchen gibt Töllner im Abschnitt XIV seines Handlungsbuches. Danach kaufte er 103 1/2 Ellen englischen Tuches für etwa 13 Pf.; er mußte also für eine Elle 2 ß bezahlen. Töllner verkaufte die Elle durchschnittlich mit 2 ß 8 (?PF) 299 ), d. h. mit einem Gewinn von 33%. Wir erhalten demnach bei Johann Töllner einen Gewinn, der als Minimalgewinn beim Holzgeschäft 16%, als Maximalgewinn bei dem Geschäft in englischem Tuch 33% betrug. Als Durchschnittsprozent ergibt sich wie schon bei der Sozietät ein Gewinn von 25% 300 ).
Der Ertrag des Geldgeschäftes blieb hinter den Gewinnen, welche der Handel den Rostocker Patriziern einbrachte, erheblich zurück. Der Geldverleih trug dem Patrizier auch um die Mitte des 14. Jahrhunderts etwa 10% Verdienst ein 301 ). So verzinste z. B. die Stadt eine Anleihe von 100 Mark, die sie vor dem Jahre 1373 bei Eberhard Beseler aufgenommen hatte, mit 10% 302 ), so erhielt Otbert Witt im Jahre 1320 für 30 Mark 3 Mark Zins, desgleichen Ludolf v. Gothland im Jahre 1343 für 240 Mark 303 ) 24 Mark Zins 304 ). Im Jahre 1344 erwarb Dietrich Horn gegen Verleihung von 600 Mark 10% Zinsen aus den Dörfern Zarnewanz, Roggentin, Gutendorf, Dänschenburg und Freienholz 305 ). Doch lassen sich aus den Urkunden auch zahlreiche Belege dafür bringen, daß die Zinsen weniger als 10% betrugen. Im Jahr 1363 z. B. borgte Gerwin Wilde 200 Mark, für die er nur eine Rente von 18 Mark bezahlte 306 ); im Jahre 1385 nahm die Stadt bei Gerhard Grenze eine Anleihe in Höhe von 1000 Mark zu 8% auf 307 ); 1395 verzinste sie ihm 1250 geliehene Mark mit ebenfalls 8% 308 ). Manchmal sank der Zinsfuß sogar unter 8%.


|
Seite 59 |




|
So zahlte Herzog Albrecht von Mecklenburg dem Giso von Halteren für eine Anleihe von 500 Pf. nur 6% Zinsen 309 ), und Johann Töllner erhielt für 1300 Pf., die ihm seine Frau als Mitgift eingebracht hatte, nur 92 Pf. Renten (7%) 310 ). Ein Zinsfuß über 10% wurde wohl meistens nur in Fällen dringender Not bewilligt. So heißt es zum Jahre 1313, daß Arnold und Heinrich Quast dem Heinrich Kurland 24 Mark Rente für 200 Mark verkauften 311 ). Mithin mußte Heinrich Kurland 12% Zinsen bezahlen; in der Regel brachte das Geldgeschäft den Patriziern 10% Zinsen. Der Gewinn war damit erheblich niedriger als derjenige, den der Handel abwarf.
Welche Bedeutung hatte endlich die Grundrente, die Verwertung von Häusern, Buden, Wiesen, Ackerhufen usw. für die Vermögensbildung patrizischer Familien? Ein Hindernis, welches ein entscheidendes Mitwirken der Grundrente am Bau der patrizischen Vermögen in den Jahrzehnten nach der Gründung der Stadt ziemlich unwahrscheinlich hatte erscheinen lassen 312 ), fiel im 14. Jahrhundert offenbar nicht mehr so stark ins Gewicht: Die Patrizier waren nicht mehr in dem gleichen Maße wie ehemals gezwungen, ihren Grund und Boden gegen eine verhältnismäßig niedrige Pacht zu veräußern. Die Gefahr, vom Landesherrn oder von der Stadt unterboten zu werden, schwand, je mehr Landesherr und Stadt ihren Grundbesitz aus finanziellen Gründen zu verkaufen genötigt waren. Viele ursprünglich landesherrliche bzw. städtische Hufen waren in den Besitz der Patrizier übergegangen. Schon war es keine Seltenheit mehr, daß ein Patrizier eine ganze Reihe von Häusern, Buden oder ländlichen Hufen sein Eigen nannte. So geht aus dem Testament von Arnold Koppmann im Jahre 1336 hervor, daß er zwei große Steinhäuser in der Stadt besessen, die verschiedensten Renten aus Häusern, Buden und Mühlen bezogen hatte und überdies Eigentümer der Dörfer Pastow, Broderstorf und Ademeshagen gewesen war 313 ). Johann Töllner I besaß drei Steinhäuser und eine Badestube 314 ); Heinrich Witt u. a. die Dörfer Broderstorf und Pastow, eine Kornmühle, einen Anteil von einer Walkmühle und mit seinem Bruder


|
Seite 60 |




|
zusammen zwei Häuser, sechs Buden und das Brauhaus 315 ), Gerwin Wilde endlich mit seinem Bruder ein Haus in der Krämerstraße, dazu eine Mühle, bis zum Jahre 1359 die Hälfte der Vogtei, seit 1367 ein Achtel des Dorfes Sildemow, seit 1373 ganz Kussewitz, seit 1375 Haus und Hof in der Schwaanschen Straße 316 ). Daß dieser oft recht beträchtliche Grundbesitz der Rostocker Patrizier Beiträge zum Vermögen steuerte, ist klar. Einmal sicherte er seinem Eigentümer den Bezug der Grundrente, die nicht mehr so stark wie früher durch die Rivalität anderer Großgrundherren gedrückt wurde; zum andern gab er den Patriziern Kreditmöglichkeiten für größere Handelsspekulationen. Die Rostocker Quellen enthalten in der Tat mannigfache Vermerke darüber, daß dieser oder jener Patrizier Teile seiner Liegenschaften gegen eine Rente verpfändete. Der gewährte Kredit wurde wahrscheinlich häufig zur Finanzierung einer Handelsunternehmung verwandt, nach deren Abschluß der verpfändete Besitz alsdann zurückerworben wurde. Durch Verpfändung eines Teiles ihrer Liegenschaften (einer "hereditas") erlangten z. B. Gerhard und Lambert Rode im Jahre 1352 einen Kredit von 165 Mark 317 ); die Einlösung erfolgte 1353 318 ). Im Jahre 1355 wiederholte sich derselbe Vorgang: Die beiden Brüder verpfändeten abermals ihre "hereditas" und lösten sie nach einem Jahr wieder ein 318). Im Jahre 1351 verkauften Johann Kyritz und Eberhard Vöge eine Rente von 16 Mark gegen einen Kredit von 200 Mark in einem Gebäudekomplex; auch hier wurde vereinbart, daß die Rente rückkäuflich sein sollte 319 ). Auch auf diese Art und Weise trug der Grund und Boden zur Vermehrung des patrizischen Vermögens bei.
Der entscheidende Faktor bei der Bildung und dem weiteren Ausbau der patrizischen Reichtümer war also offenbar der Handelsgewinn. Der Geldhandel steuerte gleichfalls zur Steigerung des Reichtums bei, wenn auch in bescheidenerem Maße; der Grund und Boden sicherte außer den Beträgen, die der Grundrente entstammten, wohl vor allem die Stetigkeit des


|
Seite 61 |




|
Vermögens und damit die gleichmäßige Fortdauer der Stellung des Patriziats.
Die Patrizier vermochten mit Hilfe so hervorragender Einnahmequellen wie ihre Standesgenossen in andern deutschen Städten des Mittelalters große Reichtümer zu sammeln, deren Ausmaße nicht unterschätzt werden dürfen 320 ). Natürlich bestanden zwischen den Vermögen der einzelnen Patrizier oft recht erhebliche Unterschiede. Der intelligente und geschickte Kaufmann, der günstige Gelegenheiten rasch und richtig zu nutzen verstand, mußte ganz andere Werte schaffen können als ein nur durchschnittlich oder wenig begabter Handelsmann. Ein Typus des kaufmännisch begabten, in seinen Unternehmungen erfolgreichen Patriziers war in Rostock der Ratsherr Arnold Kröpelin. Er kaufte im Jahre 1350 das Dorf Kessin bei Rostock mit Hof und Mühle für 1600 Mark 321 ), erwarb 1352 zusammen mit drei andern Rostockern und seinem Bruder Lambert, dem Güstrower Dekan, Wahrstorf für 550 Mark 322 ). Er erwarb ferner 1354 ein Viertel einer Mühle, eine ganze Mühle mit sechs Last Getreide, Getreiderenten im Wert von 200 Mark, endlich ganz Deutsch-Kussewitz mit dem Hof Finkenberg, mit Mühle und Fischerei für die runde Summe von 2000 Mark 323 ). Im Jahre 1355 besaß er die Bede von Roggentin (pro Hufe 1 Mark), von Kokendorf, Finkenberg und der Hälfte des Dorfes Kussewitz, ein Objekt, das später mit 400 Mark eingelöst wurde 324 ). Gleichfalls 1355 beteiligte er sich an dem Kauf von acht Hufen und zwei Katen in Evershagen (pro Hufe 4 Mark, ein Topf Flachs, 1 1/2 Huhn), wofür insgesamt 622 Mark bezahlt wurden 325 ). Mit Lambert Kröpelin zusammen stattete er 1357 seine Nichte Irmgard mit 250 Mark und 100 Mark Silber aus 326 ), desgleichen 1365 seine Nichte Elisabeth mit 460 Mark bar und einer Rente von 14 Mark (an Stelle von 150 Mark) 327 ). Seine Renteneinkünfte konnte


|
Seite 62 |




|
er 1357 um 127 1/2 Mark vermehren 328 ). Im Jahre 1359 machte er neue Käufe in Finkenberg, Deutsch-Kussewitz und Kessin in Höhe von 276 Mark 329 ), erwarb er neu eine Mühle vor dem Kröpeliner Tor 330 ). Im Jahre 1362 kaufte er eine Rente von 10 Mark aus dem Stadtzoll für 45 Mark 331 ); weitere 4262 Mark schuldete die Stadt ihm im Jahre 1364 332 ). Ein Jahr darauf kaufte er eine Badestube, eine Hausstätte und einen Brunnen mit Tropfenfall 333 ), im Jahre 1372 eine Walkmühle 334 ). In den Jahren 1370 und 1373 zahlte die Stadt ihm 250 Mark als Einlösung für verkaufte Renten 335 ). Im Jahre 1374 gab er eine Hypothek von 42 Mark Silber auf 2 1/2 Hufen, Hof und Grundstück in Bramow 336 ), im Jahre 1375 erhielten er und sein Sohn Lambert für 1300 Mark das Dorf Teschendorf mit der landesherrlichen Bede, mit dem Gericht und ohne die Verpflichtung zum Roßdienst als Pfand 337 ). Im gleichen Jahr bezogen sie für 250 geliehene Mark 18 Mark, das Gericht und die Bede in Evershagen 338 ). Im Jahre 1376 wurde die Kleinschmiedestraße sein Eigentum "cum omni proprietate et libertate, cum perpetuis redditibus" 339 ). Arnold Kröpelin beteiligte sich weiter am Kauf von Harmstorf, das 1378 für 1600 Mark von seinem Herrn verkauft wurde 340 ); im Jahre 1380 erscheint Arnold als Pächter von zwei Wiesen 341 ); im Jahre 1382 kaufte er ein Haus in der Langenstraße 342 ), 1383 den dritten Teil von Mönchhagen für 920 Mark 343 ), im Jahre 1384 19 1/2 Mark städtische Rente und das Dorf Bartelsdorf 344 ), im Jahre 1389 ein Viertel einer


|
Seite 63 |




|
Walkmühle 345 ). Sein Rentenbesitz betrug, soweit er urkundlich überhaupt erfaßt werden kann, nach Ablauf von annähernd 40 Jahren fast 8900 Mark (in heutiger Währung schätzungsweise etwa 62000 Mark); sein Grundbesitz umfaßte die drei Dörfer Kessin, Deutsch-Kussewitz und Bartelsdorf, den dritten Teil des Dorfes Mönchhagen sowie mehr oder weniger große Teile der Dörfer Wahrstorf, Harmstorf und Teschendorf. Männer von ähnlichem hervorragenden kaufmännischen Talent scheinen die Rostocker Patrizier Johann Rode, Arnold von Gothland, Dietrich Holloger und Johann Töllner III gewesen zu sein. Das Testament des Rostocker Patriziers, Ratsherrn und späteren Bürgermeisters Johann Rode von 1349 vermittelt in anschaulicher Weise eine Vorstellung von den ungewöhnlichen Ausmaßen seines Vermögens. Seiner Frau vermachte er 60 Mark lüb. Rente aus dem Kloster Doberan und 600 Mark bares Geld, dazu drei silberne Becher, die Hälfte der silbernen Löffel, die Nutzung eines Hauses auf zehn Jahre, nach deren Verlauf sie alle "utensilia, que ad me perduxit, ... cum dimidietate . utensiliorum ..." ihres Mannes erhalten sollte, ferner eine Anzahl Renten aus den Dörfern Göldenitz und Niendorf, sowie jährlich 20 Aale aus der Warnow 346 ), deren Fischerei er für 1000 Mark erworben hatte 347 ); außerdem erhielt sie weitere 100 Mark, die sie zur Armenpflege verwenden sollte 346). Das Hauspersonal wurde mit insgesamt 30 Mark bedacht, die Kirche mit 720, die Nonnen im heiligen Kreuz mit 100 Mark, die Minoriten in St. Katharinen mit je 4 Sch.; kirchliche Beamte und Priester erhielten zusammen eine Summe von 16 Mark und 64 Sch. Für die Armenpflege wurden weitere 910 Mark sowie verschiedene Renten bereitgestellt. Die Ausgaben für sein Seelenheil hatte er mit 10 Mark eingesetzt, außerdem dafür verschiedene Geld- und Getreiderenten bestimmt. Seine Verwandten erbten insgesamt 3200 Mark und eine größere Zahl von Renten, Bekannte und Geschäftsfreunde erhielten 250 Mark, einige Schuldner eine Reduzierung ihrer Schulden um 50% 346). Der Patrizier Arnold Koppmann hinterließ bei seinem Tode (1336) 5650 Mark bar, 226 Mark Renten, zwei große Steinhäuser, eine Mühle, 7 1/2 Last Getreiderenten, 100 Mark Silber, verschiedene Buden


|
Seite 64 |




|
in der Stadt und die Dörfer Pastow, Broderstorf und Ademeshagen 348 ). Die Testamente der Patrizier Arnold von Gothland (1351) und Dietrich Holloger (1351) enthalten Bestimmungen über etwas bescheidenere Summen. Arnold von Gothland verteilte in seinem Testament rund 1000 Mark in Form von Renten oder barem Geld, 20 Mark Silber, verschiedene Silbersachen und Kleidungsstücke, ein Schlachtroß und ein Pferd 349 ); der Rostocker Patrizier Dietrich Holloger konnte seinen Erben etwa 1400 Mark Rostocker, 60 Mark lüb., ein Haus mit Inventar, einen Hof mit zwei Buden, Silbersachen und ein Pferd hinterlassen; wie Johann Rode, so gewährte auch er verschiedene Schuldenerlasse 350 ).
Ein Einblick in den Besitzstand des Rostocker Patriziers Johann Töllner III wird sich ergeben, wenn wir den Versuch machen, das jährliche Mindesteinkommen dieses patrizischen Kaufherrn des 14. Jahrhunderts ungefähr zu bestimmen. Zu diesem Zweck bedienen wir uns wieder seines Handlungsbuches. Johann Töllner selbst gibt in Abschnitt XIX an, daß er als Mitgift seiner Frau bei der Hochzeit 1085 Pfund erhielt und davon 280 Pf. für die Hochzeitsfeier und die Brautkleider aufwandte. Es verblieben ihm demnach von der Mitgift rund 800 Pf. In Abschnitt XX des Handlungsbuches vermerkt Johann Töllner, daß ein Erbanspruch seiner Frau ihm weitere 1300 Pf. eintrug. Diese 1300 Pf. erhielt er aber erst in den Jahren 1350 oder 1351 351 ). Johann Töllner legte sie in Rentenkäufen an und bezog dafür eine jährliche Einnahme von 92 Pf., wie er im Handlungsbuch angibt 352 ). Ein Beleg dafür, daß er auch die ihm von den 1085 Pf. verbliebenen 800 Pf. zu Rentenkäufen benutzt hätte, läßt sich im Handlungsbuche nicht nachweisen. Man wird deshalb wohl annehmen dürfen, daß er diese 800 Pf. in seine Handlungsgeschäfte steckte. 362 Pf. gab er als seinen Anteil in die Sozietät, wie aus Abschnitt X Nr. 181 hervorgeht. Über die restlichen 438 Pf. läßt sich nichts Sicheres aussagen; vielleicht dienten sie als Betriebskapital des neben der Handelsgesellschaft betriebenen Handelsgeschäftes. In den Jahren 1346/1349 setzte sich das Jahreseinkommen Töllners,


|
Seite 65 |




|
soweit es erfaßbar ist, aus den Überschüssen beider Geschäfte zusammen. In den Jahren nach seinem Ausscheiden aus der Sozietät, etwa seit dem Jahre 1350, wurde es gebildet aus dem Reingewinn des Einzelgeschäftes und der jährlichen Rente von 92 Pf. Für diese Zeit, die Jahre nach 1350, kann man Töllners jährliches Einkommen ungefähr bestimmen unter der Voraussetzung, daß Töllners Geschäftsgewinn, wie er aus dem Handlungsbuch für die Zeit von 1346 bis 1349 zu berechnen ist, in den folgenden Jahren sich nicht wesentlich verändert hat.
Die Einnahmen aus dem Handelsgeschäft verteilen sich auf das Tuch-, Borden-, Holz-, Hafer- und Speckgeschäft. Die Tuche wurden in der Regel nach Ellen verkauft; als ganze Ballen setzte er nur acht ab, und zwar:
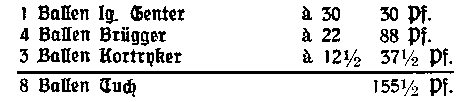
Schnittweise konnte Töllner 1927 3/8 Ellen verkaufen; im einzelnen:
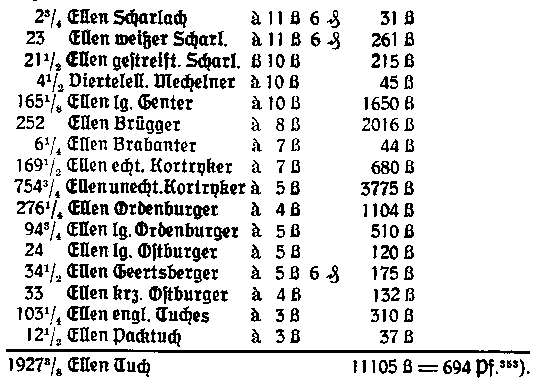
353
).


|
Seite 66 |




|
Außerdem bezogen an Tuchen:
Der Tuchhandel brachte insgesamt eine Einnahme von 155 1/2 Pf., 694 Pf., 50 Pf. = 899 1/2 Pf.
Die Einnahme aus dem Holzgeschäft erreichte die Höhe von 87 Pf. 357 ). Der Bordeneinkauf umfaßte 90 Dtzd., etwa 70 Dtzd. sind als verkauft verbucht 358 ); bei einem Verkaufspreis von 8 ß pro Dtzd. 359 ) erzielte Töllner aus dem Bordengeschäft rund 35 Pf. Einnahme 360 ). An Hafer wurden 4 1/2 Last 14 Drömt zu 38 1/2 Pf. verkauft 361 ). Für den Speck ist der Verkaufspreis nicht bekannt; Töllners Ausgabe belief sich auf 29 Pf. 12 ß 362 ).


|
Seite 67 |




|
Bei einem Gewinn von 25% 363 ) hätte Töllner also eine Einnahme von 37 Pf. gehabt.
Als Gesamteinnahme ergibt sich nunmehr: 899 1/2 Pf. aus dem Tuch-, 35 Pf. aus dem Borden-, 87 Pf. aus dem Holz-, 38 1/2 Pf. aus dem Hafer- und etwa 37 Pf. aus dem Speckgeschäft = insgesamt 1097 Pf. Verkaufte Töllner seine Waren im Durchschnitt mit 25% Gewinn, so hätte er in seinem Geschäft während der rund vier Jahre, die die Buchungen des Handlungsbuches umfassen, ungefähr 220 Pf. verdient. Für das Jahreseinkommen Töllners gewinnen wir demnach folgende zwei Posten:
| 92 Pf. Einnahme aus Renten, |
| 55 Pf. Einnahme aus dem Geschäft, |
| __________________________________ |
| Sa.: 147 Pf. Jahreseinkommen = etwa 150 Pf. |
Nach Koppmann hatte zur Zeit des Handlungsbuches 1 Pf. in runder Rechnung den Wert von 8 Mk. 364 ). 150 Pf. würden also etwa 1200 RM. entsprechen. Eine Seite Speck kostete zu Töllners Zeit 14 ß = 7 Mk. Dieser Preis wird sich auf ein ausgemästetes Schwein bezogen haben, da man damals eine rationelle Schweinezucht wohl noch nicht kannte. Eine Seite Speck von einem ausgemästeten Schwein wird heute mit etwa 40 RM. bezahlt. Töllners 1200 RM. würden danach ungefähr dem sechsfachen Wert heutigen Geldes, etwa 7000 RM., entsprochen haben 365 ).


|
Seite 68 |




|
Dieser Versuch, den Reichtum des Rostocker Patriziers in den Wert heutigen Geldes umzurechnen, kann jedoch im Bestfall nur einen Annäherungswert liefern, da die Kaufkraft des Geldes im 14. Jahrhundert nicht hinreichend bekannt ist und überdies manche wichtige Eintragung verloren gegangen sein wird. Indessen lassen auch die erhaltenen Quellen erkennen, daß das Vermögen zahlreicher Patrizier eine oft recht kostspielige Lebenshaltung gestattete. Bei Hochzeiten z. B. wurde bisweilen höchster Prunk entfaltet. Darauf weist schon die Tatsache hin, daß Arnold Koppmann in seinem Testament vom Jahre 1336 für die Hochzeit seiner Tochter Elisabeth 2000 Mk. bestimmte 366 ), daß weiter Johann Töllner für die Hochzeitsfeierlichkeiten 200 Pf. 367 ), für das Brautgewand außerdem 80 Pf. verausgabte 368 ). Das Hochzeitsgewand der Braut wird in einzelnen Fällen sogar aus dem damals sehr teuren Scharlach gefertigt gewesen sein. Liseke Horn z. B. empfing von ihrem Bruder Dietrich für ihre Hochzeit ein paar Kleider aus Scharlach 369 ). Ebenso legten die Patrizier offenbar großen Wert auf ein stattliches Alltagskleid. Eine Kleiderordnung ist für Rostock zwar erst für spätere Zeit (1587) überliefert 370 ). Ob im 14. Jahrhundert schon Bestimmungen über Kleider getroffen waren, muß dahingestellt bleiben. Unterschiede in der Kleidung der Patrizier und der übrigen Einwohner Rostocks bestanden indessen bereits. Aus Johann Töllners Handlungsbuch läßt sich erkennen, daß die teuersten Stoffe in der Regel von den Patriziern, die billigen von den Handwerkern gekauft wurden. Nur selten bezahlte der Handwerker die Elle mit 10 (ß) und mehr, das ganze Handlungsbuch enthält elf Fälle 371 ), in denen Töllner an Handwerker Tuche dieser Preislage verkaufte. Den Scharlach kaufte Johann Töllner wohl nur zur "Befriedigung des eigenen Bedarfes" 372 ). Die Patrizier bezogen vornehmlich die nächst teueren Tuche, wie etwa langes Genter und Brügger Tuch 373 ).


|
Seite 69 |




|
Der Patrizier besaß auch bisweilen Schmucksachen aus Silber oder Gold, die man damals vermutlich nicht gerade häufig in Rostock sah. Johann Rode vermachte in seinem Testament 1349 seiner Frau u. a. zwei bessere silberne Becher, ihren eigenen silbernen Becher und die Hälfte aller silbernen Löffel 374 ). Arnold von Gothland überwies 1351 testamentarisch seinem Sohn Arnold u. a. einen goldenen Gürtel, 2 silberne Krüge, 5 goldene Ringe und Geschmeide, seinem Sohn Ludolf 5 goldene Ringe, einen silbernen Gürtel, 9 silberne Löffel und 2 silberne Krüge 375 ). Johann Horn war 1392 Eigentümer von einer silbernen Scheibe, 18 silbernen Knöpfen und nochmals 31 1/2 silbernen Knöpfen 376 ). Dietrich Holloger hinterließ an Schmucksachen 3 silberne Schalen, einen silbernen Gürtel, ein silbernes Messer und 4 silberne Löffel 377 ).
Dem Zuschnitt eines patrizischen Haushalts entsprach der Bestand an dienendem Personal. Die Quellen verzeichnen u. a. folgende Fälle: Johann Rode hatte 2 Diener, 2 Mägde und 1 Koch 378 ), Lambert Witt 2 Diener und 1 Magd 379 ), Arnold von Gothland 2 Diener, 1 Magd und 1 "scolaris" 380 ), Dietrich Holloger hielt 1 Diener und 1 Magd 381 ), Johann Töllner 1 Diener, 1 Magd, 1 Koch, 1 Wandscherer und 1 Kleriker 382 ).
Die Tatsache, daß die Patrizier über Reichtum verfügten, erhellt ferner aus Schenkungen an die Kirche. Viele Patrizier, selbst die weniger reichen, wandten der Kirche oder ihren Organisationen irgendwelche Stiftungen zu. In den Testamenten wurden Dotationen und Spenden ausgesetzt: Pfarrer, Kapellane, Klöster und Mönche, Arme und Kranke wurden bedacht 383 ).


|
Seite 70 |




|
In dem Testament von Johann Rode erhielt die Kirche insgesamt eine Summe von 800 bis 900 Mk. 384 ).
Auf ausgezeichnete wirtschaftliche Verhältnisse weisen endlich, und nicht zuletzt, die recht ansehnlichen Mitgiften hin, die eine Patriziertochter bei ihrer Heirat von Eltern und Verwandten empfing, sowie die Abfindungen, die die Kinder erster Ehe bei Wiederheirat des Vaters oder der Mutter erhielten. So brachte Oda Alkun, die Tochter des Rostocker Ratmannes Vicke Alkun, bei ihrer Hochzeit im Jahre 1373 ihrem Mann, dem Lambert Kröpelin, "pro dote sua" 1105 Mark bar, eine goldene Spange im Wert von 50 Mk., 26 Mk. Rente aus städtischen Wiesen in Warnemünde u. a. m. 385 ). Die Mitgift, welche Walburg, die Witwe des Ratmanns Matthias Hoffmann, im Jahre 1399 ihrem zweiten Mann verschreiben ließ, setzte sich zusammen aus einem Haus in der Kosfelder Straße, zwei Häusern in der Kröpeliner Straße, zwei Buden vor St. Petri, der Hälfte von einem Eckhaus und drei Buden am Mittelmarkt, aus 300 Mk., für die 20 Mk. Rente erworben wurden, weiteren 225 Mk. und der Hälfte aller Renten, die sie aus der Köhlerei in der Heide bezog, aus 650 Mk., die Matthias Hoffmann im Rostocker Gericht besaß, und 10 Mk. Rente aus Einnahmen des Stadtrates 386 ).
Eine solche herrenmäßige Lebensführung hätten sich die Patrizier nicht leisten können, wären sie noch von dem bloßen Streben nach "Nahrung" beherrscht gewesen. Mochten auch die zu Zünften zusammengeschlossenen Handwerker Rostocks den Ideen der Bedarfsdeckungswirtschaft huldigen, in der patrizischen Oberschicht der Stadt herrschte bereits ein Wirtschaftsgeist, der durch rücksichtsloses Gewinnstreben bestimmt war. Sehr deutlich geht diese Tatsache aus den erhaltenen Urkunden hervor. Die Patrizier kauften Äcker, Wiesen und Gärten, Verkaufsstände, Wechselbuden und Badestuben, Dörfer und Güter, ganz oder teilweise, Mühlen und Häuser oder Anteile davon, ganze Gebäudekomplexe; sie pachteten Zölle, Steuern und Liegenschaften aller Art; sie liehen Geld in jeder nur möglichen Höhe und zu jedem annehmbaren Zinsfuß. Jedes Wertobjekt war ihnen willkommen, jede Verdienstmöglichkeit er-


|
Seite 71 |




|
griffen sie; angesehene und einflußreiche ebensowohl wie auch weniger wohlhabende Patrizier. Die patrizischen Großkaufleute des 14. Jahrhunderts trieben nicht Bedarfsdeckungswirtschaft, die nach W. Sombart für das Wirtschaftsleben des Mittelalters charakteristisch ist, sondern teilweise eine Erwerbswirtschaft großen Stiles.
Die soziale Stellung des Rostocker Patriziats.
In den mittelalterlichen Städten Deutschlands gelangte bekanntlich der Rechtssatz zur Anwendung: Stadtluft macht frei; der Hörige, welcher Bürger geworden war, wurde durch seinen Aufenthalt in der Stadt nach Jahr und Tag frei. Es wurden also abweichend von der Entwicklung auf dem platten Land, wo mitunter der Grundsatz: Luft macht unfrei, anerkannt wurde 387 ), Standesausgleichung und Beseitigung der Unfreiheit zur bestimmenden Tendenz der mittelalterlichen Stadtentwicklung. Indessen ist es auch in den Städten damals nicht zur Bildung eines einheitlichen Bürgerstandes 388 ) gekommen. Die spätmittelalterliche Stadtgemeinde kannte zwar keine Geburtsunterschiede, wohl aber Gegensätze nach "Beruf und Besitz" 389 ), Gegensätze, die um so stärker zum Vorschein kamen, je mehr die Bürgerschaft einer Stadt sich vergrößerte. Denn da jede an Umfang zunehmende soziale Gruppe den Gesetzen der wachsenden Differenzierung der ihr angehörenden Glieder unterliegt 390 ), mußten sich innerhalb der Gesamtbürgerschaft einer Stadt Unterschiede in der sozialen Geltung der einzelnen Stände mehr und mehr herausbilden.
Man darf deshalb als sicher annehmen, daß während des 13. und 14. Jahrhunderts in Rostock keineswegs eine "ideale


|
Seite 72 |




|
Harmonie sozialer Ordnung 391 ) geherrscht hat. Vielmehr besteht große Wahrscheinlichkeit dafür, daß das Ansehen des Patriziats damals ein weit größeres war als das des Handwerkerstandes. Die gewerbliche Arbeit konnte infolge der Zunftbestimmungen damals, wenn überhaupt, so doch nur geringe Profite abwerfen, die Patrizier aber betrieben besonders im 14. Jahrhundert einen äußerst lebhaften und gewinnbringenden Handel. Während also die Zunftverfassung den Handwerker in der freien Entfaltung seiner Fähigkeiten hemmte, vermochte der geschäftstüchtige Patrizier mit Hilfe des Handels und der Geldleihe ganz beträchtliche Kapitalien zu sammeln. Er stand an führender Stellung im Wirtschaftsleben des städtischen Gemeinwesens. Erhebliche Unterschiede werden in der Vermögenslage zwischen Patriziern und Handwerkern bestanden haben. Schon aus dieser Tatsache ergibt sich, daß auch die soziale Stellung des Rostocker Patriziers eine weit bessere war als die des Handwerkertums, denn gerade das Ökonomische war in jenem längst vergangenen Zeitalter ein gesellschaftsbildendes Moment von ausschlaggebender Bedeutung.
In gleichem Maß geeignet, die soziale Stellung der Patrizier zu heben und die Differenzierung der Bürgerschaft Rostocks zu vergrößern, waren die politischen Verhältnisse in der Stadt. Die Patrizier waren die politischen Führer der städtischen Gemeinde, die Handwerker die Beherrschten. Nur die Patrizier bekleideten in der Regel die Würde eines Ratsherrn, in der Hand von Patriziern befanden sich die verschiedenen Ratsämter 392 ). Mußten sie auch im 13. Jahrhundert mit den Landesherren die politische Leitung Rostocks teilen, so konnten sie doch seit etwa 1325 die Geschicke der großen mecklenburgischen Ostseestadt fast ausschließlich nach ihrem Ermessen leiten. Macht und Einfluß aber im politischen Leben der Stadt werden ihnen Ansehen und Ehren gebracht haben, sowohl innerhalb der Gesamtbürgerschaft als auch bei den ständischen Gewalten der näheren und ferneren Umgebung.
Die Tatsache, daß die Patrizier der Stadt ein größeres Ansehen besaßen als die Handwerker, kann nach der urkundlichen Überlieferung nicht angezweifelt werden. Schon die Benennungen 393 ), die die Rostocker Patrizier in den Urkunden


|
Seite 73 |




|
des 13. und 14. Jahrhunderts erhielten, zeigen deutlich, daß die Patrizier in der Stadt, beim Landesherrn, bei Rittern und Geistlichen eine vor den übrigen Bürgern bevorzugte Stellung einnahmen. "Discreti viri", "seniores, prudentes", "beshêdene lude", "de uppersten borghere" werden sie in Urkunden genannt 394 ). Im Unterschied von den einfachen Bürgern, den "cives" 395 ), "der mênheit", denen solche auszeichnenden Titel in der Regel nicht gewährt wurden. In andern Städten heißen die Patrizier auch familiares, dilecti cives 396 ) oder domicelli (Junker) 397 ). Die Bezeichnung Junker oder Stadtjunker läßt sich im 13. und 14. Jahrhundert in Rostock noch nicht nachweisen. Erst im 15. Jahrhundert taucht in den Quellen der Name Junker oder Stadtjunker auf. Diese Bezeichnung erhielten damals die Mitglieder der Schützengesellschaft des Wieker Gelages. Vereinigt waren in dieser Gesellschaft die sogenannten Wiekfahrer, diejenigen Kaufleute der Stadt, die "nach Norwegen, insbesondere nach Oslo und Tönsberg" Handel trieben. Da diese Schützengesellschaft "offenbar die vornehmste und vermutlich auch die älteste" war, darf man wohl annehmen, daß ihre Mitglieder zum guten Teile, vielleicht sogar ausschließlich Angehörige des städtischen Patriziats waren 398 ). Die gleichen Bezeichnungen kehren wieder in zwei Aufzeichnungen in der Matrikel der Rostocker Landfahrer u. Krämer-Kompagnie in den Jahren 1624 und 1625 399 ). In dieser Zeit soll nach Lisch in Hochzeits- und Leichenprogrammen auch der Titel Patrizier vorkommen 400 ). Auf einen andern Unterschied zwischen Patriziern und Bürgern ist bereits hingewiesen; die Patrizier als die vornehmen Bürger der Stadt zeichneten sich wahrscheinlich schon im 14. Jahrhundert durch reichere Kleidung


|
Seite 74 |




|
vor den einfachen cives aus 401 ). Ihr Reichtum gestattete ihnen so manchen Luxus, den der Handwerker sich nicht leisten konnte. Eine rechtsgültige Verordnung über den Aufwand, den die einzelnen Stände in Rostock treiben durften, stammt allerdings erst aus dem 16. Jahrhundert. Nur den Bürgermeistern, den Ratmannen und andern, "so von Geschlechtern seien", gestattete die Kleiderordnung vom Jahre 1587, "der Stadt zu Ehren und ihres Standes halber Kleider mit Mardern, Wölfen, Füchsen und anderem Futter gefüttert und mit Sammite verbremet" zu tragen. Die gleiche Ordnung bestimmte ferner, daß Personen "furnehmen standes" nicht über 40, Personen "mitteln standes" nicht über 30 und Personen "geringern standes" nicht über 20 Hochzeitsgäste einladen dürften 402 ). Leider läßt sich auch dieses Vorrecht der Patrizier vor 1400 noch nicht quellenmäßig belegen. In manchen andern deutschen Städten war es ferner ein Standesvorrecht der Patrizier, ihre Festlichkeiten im Rathaus oder Ratskeller begehen zu dürfen 403 ). Ob dieses Recht, Tanzereien, Hochzeiten, Festschmäuse im Rathaus feiern zu dürfen, in Rostock allen Mitgliedern des städtischen Patriziats zustand, läßt sich mit den erhaltenen Quellen nicht sicher beweisen. Das Rostocker Weinbuch von 1382 bis 1391, "ein Rechnungsbuch", das "Präsente an Wein, Bier, Met und Spezereien verzeichnet" 404 ), enthält nur Vermerke darüber, daß Rostocker Ratmannen und ihre Damen das Rathaus zu geselligen Zwecken benutzten. Das Weinbuch überliefert in Nr. 1193, daß den "honestis dominis et dominabus corisantibus in theatro" von der Stadt ein Stübchen Wein als Geschenk gestiftet wurde 405 ).
Die Dürftigkeit des Quellenmaterials, in dem Kulturgeschichtliches aus dem mittelalterlichen Rostock weit weniger überliefert ist als Rechts- und Verfassungsgeschichtliches, macht es unmöglich, Einzelheiten über weitere in Friedenszeiten von den Patriziern beanspruchte und von der großen Masse der einfachen cives wohl auch anerkannte Standesvorrechte zu


|
Seite 75 |




|
bringen. Es kann nur darauf hingewiesen werden, daß die Patrizier z. B. in Nürnberg auch das Recht hatten, bei Tanzfestlichkeiten den Vortritt zu erhalten 406 ), daß in Hildesheim "die Junker, die Söhne der Ratsgeschlechter", in der Pfingstzeit an den Feiertagen im Rathaus auf und unter der Laube zum festlichen Mahl vereinigt waren 407 ), daß in Lübeck bei der Hochzeit eines Patriziers der Spielgräfe des Rats mit seiner Musik dem Hochzeitszug voran zur Trauung in die Kirche zog und einen künstlich bearbeiteten silbernen Stab trug, der nur für die Hochzeiten von Mitgliedern der Zirkelgesellschaft bestimmt war 408 ).
Dagegen läßt es sich quellenmäßig nachweisen, daß man den Rostocker Patriziern auch in Kriegszeiten mancherlei Auszeichnungen zugestand. Mitglieder des Patriziats waren es wohl meistens, die die Schiffe und Kriegshaufen ihrer Heimatstadt hinausführten vor den Feind, die an verantwortungsvoller Stelle die militärischen Operationen der Bürgerschaft leiteten und in eroberten Gebieten die Belange Rostocks vertraten 409 ). So wurden auf der Versammlung der Hansestädte Lübeck, Stralsund, Stettin, Greifswald, Wismar und Rostock, die am 15. März 1368 in Rostock stattfand, die beiden Patrizier Johann von Baumgarten und Johann Nachtrabe zu "capitaneos" der Rostocker Schiffe bestellt 410 ); so war der Patrizier Nicolaus von Schutow Rostocker Vogt auf Schonen (1370) 411 ); so waren die beiden Patrizier Friedrich Sunderland und Johann Kahl, wie der Hanserezeß vom Jahre 1364 berichtet, im Krieg gegen Dänemark Befehlshaber je eines Schiffes 412 ); so war 1366 der Patrizier Friedrich Sunderland Rostocker Kommandant auf Schonen 413 ). Johann von der Aa 414 ), Heinrich Frese 415 ) und Bernhard Koppmann 416 ) erscheinen in den Ur-


|
Seite 76 |




|
kunden als Hauptleute. Als Leiter der kriegerischen Unternehmungen Rostocks und Führer der städtischen Streitkräfte gegen auswärtige Feinde zogen die Patrizier doch wahrscheinlich wie der Ritter hoch zu Roß ins Feld 417 ). Man wird dies annehmen dürfen, wenn auch urkundlich nur von einem Patrizier, von Arnold von Gothland 418 ), belegt werden kann, daß er ein Schlachtroß zu seinen Lebzeiten besessen hatte.
So groß und so verschiedener Art indessen die Vorrechte und Ehrungen der Rostocker Patrizier in der Stadt gewesen sein mochten, von den wichtigen Bürgerpflichten waren auch sie nicht befreit. Wie der einfache civis, so zog auch der Patrizier zum Kampf hinaus, wachte wie dieser über der Sicherheit der Stadt. Wie in Wismar beruhte wohl auch in Rostock das städtische Heerwesen in dieser Zeit noch auf der allgemeinen Wehrpflicht der Bürger 419 ). Zu Wachdiensten z. B. wurden selbst Ratmannen der Stadt herangezogen, Befreiungen wurden nur sehr selten und ungern gewährt 420 ). Keine Urkunde überliefert schließlich, daß die Patrizier etwa Steuerfreiheit für ihren Grundbesitz gehabt hätten. Im Gegenteil, aus einer Urkunde vom Jahre 1367 kann man folgern, daß auch von ihnen Steuern und Abgaben an die Stadt entrichtet wurden. In diesem Jahr kauften zwei Angehörige eines einflußreichen Patriziergeschlechts, die Brüder Heinrich und Ludwig Kruse, einige städtische Grundstücke. Ausdrücklich ist in dem über diesen Kauf niedergeschriebenen Vertrag erwähnt, daß die beiden Brüder diese Liegenschaften "liberas", d. i. frei von Wacht- und Steuerdiensten, besitzen sollten 421 ).
Aber nicht nur in der Stadt, nicht nur von der "mênheit" der Bürger wurden die vom Patriziat beanspruchten Vorrechte anerkannt, auch die außerstädtischen ständischen Gewalten waren bereit, den Patriziern eine Vorzugsstellung zuzuerken-


|
Seite 77 |




|
nen, sie vor den Handwerkern auszuzeichnen. Fürsten und Ritter gebrauchten, um ihr Luxusbedürfnis befriedigen zu können, oft das Geld des städtischen "Kapitalisten". Es ist ja bekannt, daß selbst die Könige von England, Norwegen und andern Ländern den Patriziern der deutschen Städte mit bisweilen recht beträchtlichen Summen verschuldet waren. Die Patrizier wiederum erhielten von Fürsten und Rittern Zugeständisse anderer Art. Häufig nahm ein Fürst einen Patrizier als seinen Lehnsmann an 422 ), erwies ihm damit gleiche Ehren und Auszeichnung wie seinen ritterlichen Vasallen. Häufig auch heiratete ein Ritter eine Patrizierin oder gab seine Tochter einem Patrizier zur Ehefrau, erkannte so den Patrizier als ebenbürtig an. An andern Orten wieder erreichte der Patrizier Aufnahme in eine Turniergenossenschaft, auch wohl in einen Ritterorden, empfing sogar manchmal den Ritterschlag 423 ), oder es wurde einer Patrizierin der Zutritt zu irgendeinem angesehenen, bisher vom Rittertum für sich allein beanspruchten Stift gewährt.
So waren in dieser und jener Gegend Deutschlands die Beziehungen zwischen den ritterlichen und patrizischen Familien durchaus freundschaftlich, gestaltete sich der Verkehr zwischen diesen beiden Ständen in zwangloser Weise. Vielfach mochten wohl finanzielle Beweggründe das Rittertum zu einem Entgegenkommen dem damals mächtig sich entwickelnden Patriziat gegenüber bestimmen, vielleicht zu einem Entgegenkommen gewissermaßen zwingen. Man kann jedoch auch verschiedene Momente anführen, die dem Ritter die Zugeständnisse, die er machte oder machen mußte, erheblich erleichterten. Der Patrizier leistete wie der Ritter Kriegsdienst mit Streitroß und Knechten; er besaß wie jener Dörfer und Höfe, oft in großer Zahl, konnte so wie jener in die Stellung eines fürstlichen Lehnsmannes gelangen. Hier und da ahmte der Patrizier die Lebensgewohnheiten des Ritters nach, indem er ritterliche Waffenspiele zu pflegen begann und statt oder neben der einfachen Hausmarke ein Wappen führte 424 ). Andererseits zogen


|
Seite 78 |




|
Ritter häufig in die Stadt 425 ), widmeten sich dort dem Kaufmannsstande; ritterliche Frauen und Jungfrauen wählten eine Stadt als Aufenthaltsort, da sie hier besser als auf dem Lande Schutz und Sicherheit genossen 426 ). Die Lebensweise manchen Patriziers unterschied sich nicht mehr sonderlich von der des Ritters; Wappen-, Turnier-, Lehns- und Stiftsfähigkeit, bisher ausschließlich Standesvorrechte des Fürsten- und Rittertums 427 ), wurden bisweilen auch von den städtischen Patriziern erlangt. Es gibt jedoch auch dafür Beispiele, daß man das Patriziat von Domstiftern und Ritterorden ausschloß, es überhaupt als einen dem Rittertum sozial untergeordneten Stand betrachtete 428 ). Auch die Patrizier waren bisweilen von einem solchen Mißtrauen gegen das Rittertum oder einzelne Glieder dieses Standes erfüllt, daß sich Beziehungen überhaupt nicht oder nur schwer anbahnen konnten 429 ). Die Verhältnisse waren also in den verschiedenen Städten Deutschlands nicht gleichartig.
Die Nürnberger Patrizier 430 ) waren im Mittelalter wie die Ritter lehnsfähig, einzelne von ihnen erhielten sogar den Ritterschlag. Eine "eigentliche Stiftsfähigkeit des Nürnberger Patriziats" bestand indessen nicht; das Patriziat schuf sich eigene, minderprivilegierte Stellen. Ebenso galt die Turnierfähigkeit der Patrizier nur in beschränktem Maße. Wie in
sein siegel macht er groß und schwere
mit einem herrlichen schein
Der Adel kumpt im here
Aus India über mere
von Muscaten und Negelein.
Abgedruckt bei Roth v. Schreckenstein, Das Patriziat a. a. O. S. 513.


|
Seite 79 |




|
der Stiftsfähigkeit, so erlangten die Patrizier auch in diesem Punkt keine vollständige Gleichstellung mit dem Rittertum. "Die Ehre des Patriziats ist demnach adelsartig, aber nicht volladlig." Auch die Breslauer Patrizier 431 ) besaßen die passive Lehnsfähigkeit, d. h. sie konnten in die Stellung eines fürstlichen Lehnsmannes gelangen. Wie in Nürnberg, so erhielten auch in Breslau Patriziersöhne den Ritterschlag und waren damit turnierfähig. Das Patriziat als solches aber war wohl erst seit dem 16. Jahrhundert aktiv an den Turnieren beteiligt. Die Patrizier waren weiter siegel- und wappenfähig, gelangten zu Dom- und Chorherrnpfründen und heirateten häufig in ritterbürtige Familien hinein. Das Dortmunder Patriziat wieder war "dem niederen Adel nicht unebenbürtig" 432 ). Es war "den Geschlechtern unbenommen, als freie Vasallen Lehen zu empfangen ..." 433 ). Im Kriegsfall leisteten die Patrizier Dienst mit Pferden und Knechten 434 ). "Verschwägerungen zwischen dem Patriziat und dem Landadel" sind dagegen nur spärlich überliefert 435 ). Auch läßt sich vor 1400 kein Ratsherr nachweisen, "der zu einer landadeligen Familie gerechnet hätte" 436 ). Ritter wurden in der Stadt überhaupt nicht geduldet, sondern "nur frei und echt geborene Leute" aufgenommen, "die den Bürgereid geleistet hatten und über größeren städtischen Grundbesitz verfügten" 437 ). Den Patriziern der Stadt Halle war das Rittertum unschwer zugänglich 438 ). In Soest war eheliche Verbindung zwischen patrizischen und rittermäßigen Familien durchaus keine Seltenheit. Auch führten die Geschlechter von alters her neben der Hausmarke ein Wappen 439 ). In Lüneburg kamen ebenfalls Verbindungen zwischen Rittertum und Patriziat vor 440 ). Volger sagt jedoch in seiner Abhandlung: "Fassen wir aber den Begriff des Adels dahin, wie ihn der allgemein gültige Rechtsgebrauch als den allein richtigen in dem Wesen der Sache begründeten erfordert, als den politisch und erblich bevorrechtigten Stand


|
Seite 80 |




|
der ritterlichen und mit Lehnsbesitz ausgestatteten Familien eines Landes, die namentlich das Recht hatten, persönlich auf dem Landtag zu erscheinen und die dagegen für die Benutzung ihrer Lehngüter dem Landesherrn zu Kriegs- oder andern Diensten verpflichtet waren, so ist klar, daß keins dieser Kennzeichen des mittelalterlichen niederen Adels auf die Patrizierfamilien im allgemeinen zutrifft" 441 ). In Lübeck endlich war es mit der Pflicht eines Bürgers vereinbar, daß man durch Grundbesitz Lehnsmann wurde. Auch nahmen die Patrizier wohl an Waffenspielen teil, aber diese hatten einen von Turnieren sehr abweichenden Charakter. Ausdrücklich hebt Wehrmann hervor, "daß die Patrizier selbst sich nicht als dem Adel ebenbürtig angesehen haben" 442 ).
Wie war nun das Verhältnis zwischen dem mecklenburgischen Rittertum und dem Rostocker Patriziat? Nach Lisch führten die Rostocker Patrizier Schild und Helm, waren also siegelfähig; auch lehns- und turnierfähig waren die Geschlechter, wie Lisch besonders hervorhebt. Er gibt weiter zu, daß in vereinzelten Fällen die Stammväter einer ritterlichen und patrizischen Familie verwandt gewesen sein mögen, betont aber, daß die Vorfahren der Rostocker Patrizier meistens zu den bürgerlichen Kreisen gerechnet hätten 443 ). H. Ernst 444 ) vertritt die Ansicht, "daß der Verkehr zwischen Rittertum und Patriziat in Mecklenburg in jeder Beziehung ungehindert" gewesen sei. Als Begründung weist Ernst u. a. auf die häufigen Heiraten zwischen ritterlichen und patrizischen Familien hin. In einer Liste stellt er dann alle diejenigen Ritter zusammen, die er zugleich als Ratmannen oder Bürger einer mecklenburgischen Stadt nachweisen kann. Als Bürger bzw. Ratmannen von Rostock nennt er die Ritter: von Berlin, Braunschweig, Büren, Bützow, Buch, Dähn, Foot, Frese, Grenz, Hamburg, Kampz, Karin, Kind, Klein, Kröpelin, Krull, Kühl, Lage, Lehsten, Lepel, Life, Lüneburg, Magdeburg, Malchin, Maltzahn, Meinke, Moltke, Pape, Plön, Quast, Raven, Rehschinkel, Ribnitz, Rode, Rötger, Rostock, Schwaß, Sommer, Stade, Wesend, Witt, Wittenburg, Wokrent, Wolde, Zehna und Zwove. Er fährt dann fort: "Vorstehendes Verzeichnis gibt uns alle


|
Seite 81 |




|
denkbaren Kombinationen der Ritterschaft mit der ratsfähigen Bürgerschaft. Einige Vasallenfamilien gaben nur vereinzelt Glieder an die Städte ab, andere finden wir dort häufiger vertreten, bei einer dritten Kategorie halten sich beide Stellungen die Waage, und vereinzelt entsagen die Familien der Vasallität, um dauernd in den Städten zu bleiben. Ebenso gehen auf der andern Seite einige städtische, besonders Lübecker Familien ganz in das Lehnsverhältnis über. Andere verzweigen sich in eine städtische und Vasallenlinie, wieder andere nutzen ihre Ritterbürtigkeit nur in einzelnen Gliedern oder auch nur vorübergehend aus." "Die häufigen Ehen und die ebenso häufige Wahl der in den Städten lebenden Vasallen zu Rats- und Bürgermeisterstellen lassen beide Stände als solidarisch erscheinen."
Die Annahme von Lisch und Ernst 445 ), daß zwischen einer Reihe von ritterlichen und patrizischen Familien verwandtschaftliche Beziehungen bestanden, erweist sich durch einige urkundliche Belege als haltbar. So schloß im Jahre 1373 der Ritter Vicke Alkun, der seit 1361 Ratmann in Rostock war 446 ), die Ehe mit Oda, der Tochter des Patriziers Lambert Kröpelin 447 ); so heiratete vor dem oder in dem Jahre 1382 der Knappe Arnold von Gummern die Patrizierin Grete von Gothland 448 ), die Schwester von Ludicke von Gothland 449 ); so vermählte sich vor dem Jahre 1397 der Ritter Matthias von Axekow mit einer Tochter des Rostocker Ratsherrn Engelbert Katzow 450 ). Ehen zwischen einem Rostocker Patrizier und der Tochter eines Ritters lassen sich nicht so häufig auf Quellenangaben stützen. Ein mir bekannter Fall ist die Ehe zwischen dem Patrizier Johann von Braunschweig mit Alburg von Gamm. Nach Johanns Tod wurde Alburg die Gemahlin des Ritters Konrad von Schwinge 451 ), eine Tatsache, die ein Beweis dafür ist, daß die Ehe mit einem Patrizier einer Ritterbürtigen nicht als unwürdig galt.
Auf zuverlässigen Quellenangaben ruht weiter die Behauptung von Lisch und Ernst, daß die Rostocker Patrizier wie


|
Seite 82 |




|
die Ritter lehnsfähig waren. So werden im Jahre 1327 als "cives in Rozstok, bona vasallica possidentes", bezeichnet Conradus Domechow, Arnold Koppmann, Gerlacus de Pomerio, Thideko Lyze, Hermannus Lyze, Hinricus Bode, Volzekinus de Zene, Hinricus Gyszekow 452 ). Eine große Zahl weiterer Beispiele ließe sich anführen; sie lassen erkennen, daß die Patrizier als Lehnsleute dem Landesherrn gegenüber die gleiche Stellung einnahmen wie die Ritter. Wird in vielen Urkunden doch ausdrücklich vermerkt, daß ein Patrizier das Lehngut "jure vasallico", "in pheodum justum" usw. erwarb. So heißt es in einer Urkunde vom 27. Dezember 1304: "Nicolaus ... dominus de Werle ... contulimus Johanni de Dame dicto, ciui in Rozstok, ... villam Nykiz integraliter, jure nostrorum vasallorum" 453 ). Im Jahre 1331 übertrug Fürst Albrecht von Mecklenburg Dorf und Hof Jürgenshagen an die beiden Brüder Dietrich und Johann Wilde "jure pheodali" 454 ). Im Jahre 1278 erhielt der Rostocker Patrizier Gerhard von Lage von den Fürsten zu Werle das Dorf Bölkow zu Lehen "ad eandem justitiam ..., qua ceterique vasalli ... bona ipsorum a nobis possidere dinoscuntur" 455 ). Für Landesherren und Patrizier brachte indessen ein solches Verhältnis in mancher Beziehung Nachteil. Der Landesherr, der einem Patrizier ein Lehn übertrug, hatte nach dem damals herrschenden Recht Anspruch auf gewisse Lehnspflichten seiner Lehnsleute, die nach Schröder Treue und Ehrerbietung, Lehnsdienst und Gerichtspflicht umfaßten 456 ). Wahrscheinlich war es für den Landesherrn oft schwer, von den Patriziern die Leistung der Lehndienste, besonders des Roßdienstes, zu erlangen, denn häufig genug war der Patrizier durch seine kaufmännische Tätigkeit oder durch seine Aufgaben im Dienst der Stadtverwaltung voll in Anspruch genommen. Aus dem gleichen Grunde konnte ein solches Verhältnis auch den Wünschen der Patrizier nicht entsprechen. Man mochte deshalb auf beiden Seiten geneigt sein, die Lehndienste durch andere Leistungen zu ersetzen oder das Lehnsverhältnis ganz zu lösen. Eine vom 10. April 1285 datierte Urkunde überliefert z. B., daß der Patrizier Nicolaus v. d. Möhlen und sein Sohn das Dorf


|
Seite 83 |




|
Dolgen "in pheodum justum" erwarben, "hoc tamen excepto, quod nobis ... in nullo servitio sunt obnoxii, sed pro servitio unam mensuram mellis ... ministrabunt" 457 ). Häufiger noch lassen sich Beispiele dafür in den Urkunden anführen, daß ein Patrizier Eigentümer eines Dorfes, Hofes usw. wurde. Im Jahre 1349 erhielt der Ratmann Heinrich Kruse Eigentum und alle Freiheit in Dorf und Hof Sildemow 458 ). Im Jahre 1375 kaufte Arnold Kröpelin Teschendorf mit Gericht und landesherrlicher Bede 459 ). Im Jahre 1383 besaß der Bürgermeister Johann von der Aa die Hälfte von Wendisch-Klein mit Bede und Gericht 460 ).
Überzeugend hat Lisch weiter den Nachweis geführt, daß "alle Geschlechter", welche im Mittelalter in Rostock im Rat saßen, Schild und Helm führten, also siegelfähig waren, "daß dagegen kein anderer Bürger Schild und Helm", sondern "nur ein Hauszeichen im Siegel führte" 461 ).
Keine Aufzeichnung indessen ist erhalten, aus der man schließen könnte, daß die Rostocker Patrizier vor 1400 stiftsfähig gewesen wären oder daß einzelne Mitglieder des Patriziats den Ritterschlag erhalten hätten, damit also turnierfähig geworden wären. Vielmehr darf man wohl annehmen, daß die Rostocker patrizischen Familien die Turnierfähigkeit nicht besaßen. Zwar berichtet Reinhold in seiner Chronik der Stadt Rostock von einem glänzenden Turnier, welches König Erich von Dänemark im Mai des Jahres 1311 im Rosengarten vor den Toren Rostocks veranstaltet habe. Zu diesem Turnier sei eine große Anzahl von Fürsten, Herzögen, Markgrafen, Erzbischöfen, Bischöfen, Edelleuten und auch Ratspersonen aus den verschiedensten Gegenden Deutschlands herbeigeeilt. Reinhold weiß jedoch von einer Teilnahme der Ratsleute an dem Turnier nichts zu berichten 462 ). In späterer Zeit trieben die Rostocker Patrizier allerdings wie in anderen Städten Waffenspiele. Koppmann erwähnt ein Papageienschießen in Rostock, das im 15. Jahrhundert von den Schützengesellschaften der Landfahrer-Brüderschaft und des Wiker Gelages veranstaltet wurde, sowie


|
Seite 84 |




|
ein Scheibenschießen der Kompagnie der Büchsenschützen auf dem Schießwall 463 ). Weiter geht aus der Chronik des Dietrich vam Lohe (1529-1583) 464 ) hervor, daß die Patrizier, "de stadtjunkeren", am 6. Juni 1580 "den vogel ... schoten", aber als Turniere kann man diese Spiele nicht bezeichnen. Dagegen kann man Lisch nur zustimmen, wenn er immer wieder den bürgerlichen Ursprung des Rostocker Patriziats betont 465 ). Es führten wohl eine Anzahl von ritterlichen und Rostocker Patrizierfamilien den gleichen Namen 466 ), aber "die Gleichheit des Namens ist im Mittelalter durchaus kein Beweis für die Namensverwandtschaft zweier Geschlechter" 467 ). Da H. Ernst die oben erwähnte Liste, in der er diejenigen Ritter aufzählt, die zugleich als Bürger oder Ratmannen nachweisbar sein sollen, zum guten Teil auf Grund der "bloßen Namensgleichheit" 468 ) aufgestellt hat, darf man auch seine weitgehenden Folgerungen über das Verhältnis von Rittertum und Patriziat in ihrer Allgemeinheit nicht als richtig anerkennen. Von den Rostocker Patriziern hatten jedenfalls nur verhältnismäßig wenige verwandtschaftliche Beziehungen zu rittermäßigen Familien 469 ). Ausgesprochen gering aber ist die Zahl derjenigen Ritter oder Knappen, die man mit Hilfe urkundlicher Belege als Rostocker Ratmannen nachweisen kann 470 ). Rittertum und Rostocker Patriziat erscheinen nicht so sehr "als solidarisch" 471 ), sondern besser wird man dem Verhältnis zwischen beiden Ständen gerecht werden, wenn man, ähnlich wie J. Meier, die Ansicht vertritt, daß das Patriziat dem Rittertum nicht in allen Punkten gleichgestellt war. Denn die Turnier- und die Stiftsfähigkeit besaß der Rostocker Patrizier wahrscheinlich nicht.
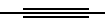


|
[ Seite 85 ] |




|



|


|
|
:
|
II.
Die Schweriner Kornmühlen
von den
Anfängen
bis zur Gegenwart
von
Hans Beltz.
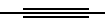


|
[ Seite 86 ] |




|


|
[ Seite 87 ] |




|
D ie Bestrebungen der Gegenwart um die Erhaltung der heimatlichen technischen Kulturdenkmale erfordern eine entsprechende geschichtliche Ergänzung: Neben die Sammlung der noch vorhandenen Denkmale im jetzigen Zustand ist zu stellen die Erforschung von deren Entstehung, Werdegang und geschichtlicher Umwelt. Diese Aufgabe trifft mit Bestrebungen der Wirtschaftsgeschichte zusammen, die heute lebendig sind. Die Geschichte der Technik im weitesten Rahmen erforscht Dr. ing. e. h. Franz Maria Feldhaus 1 ), ebenso der Verein deutscher Ingenieure 2 ). Beide lassen es sich angelegen sein, alles nur irgendwie erreichbare Material über alle Zweige der Technik zu sammeln, wobei natürlich die Gesamtdarstellung einer einzelnen Denkmalsart von ihnen nur gelegentlich gebracht werden kann. Es ist aber heute schon möglich, daß andere Kräfte nur eine Art technischer Betriebe in ihrer Entwicklung durchforschen und zu gewissen abschließenden Darstellungen gelangen.
In der letzten Zeit ist in verschiedenen Gegenden Deutschlands die Geschichte von Mühlenbetrieben zu erforschen versucht worden 3 ). Für unser Heimatland Mecklenburg ist zwar reichstes Aktenmaterial über Mühlen vorhanden, zur Bearbeitung systematisch aber noch nicht herangezogen. An Darstellungen gibt es nur vier kleine Arbeiten:
"Mühlenrecht und Mühlenbetrieb" im Archiv für Landeskunde, wahrscheinlich von dem Herausgeber selbst 4 ). Diese


|
Seite 88 |




|
Arbeit zieht nur die Zustände um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Betracht, die zum Teil recht veraltet sind und auf Rechtszustände des 18. Jahrhunderts zurückführen.
"Zur Geschichte des Amts der Wassermüller zu Rostock" von Dragendorff 5 ), eine Arbeit, die die Zunftrolle von 1490 behandelt und dabei allerlei Einzelheiten des Mühlenwesens erwähnt.
"Von mecklenburgischen Mühlen" von Barnewitz 6 ), eine Arbeit, die unsystematisch, aber sehr unterhaltend mancherlei aus Geschichte und Zuständen, aus Sitten und Sagen im heimischen Mühlenwesen erzählt.
"Entwicklung und Lage der Getreidemüllerei in Mecklenburg-Schwerin seit Einführung der Gewerbefreiheit" von Mohaupt 7 ), eine wenig anspruchsvolle Dissertation, die in die bekannten Ergebnisse der allgemeinen Mühlengeschichte einige mecklenburgische Daten aus neueren Statistiken einsetzt.
Die Forschung im Geh. und Haupt-Archiv über mecklenburgische Mühlen führte bald zu einer Beschränkung im Thema wie in der Stoffmenge. Über ländliche Müllerei ist ein Bild noch nicht zu gewinnen; Klostermühlen, Gutsmühlen, rein dörfliche Betriebe, dörfliche Betriebe in Stadtnähe erfordern, jede für sich, eine Bearbeitung unter anderen Gesichtspunkten. Die ältesten technischen Betriebsmittel und die zu ihnen gehörigen mittelniederdeutschen Ausdrücke, ebenso die Geschichte der Müllerzunft sollen späteren Arbeiten vorbehalten bleiben. Bei der Arbeit über städtische Mühlen war durch Dragendorffs Arbeit ein Einblick in Rostocker Mühlenverhältnisse zu gewinnen, in Wismarsche Verhältnisse aus Techens Geschichte der Stadt Wismar, die, wenn auch nur in zwei umfangreichen Anmerkungen, einige Wesenszüge hervorhebt. Dabei stellte sich heraus, wie eigenartig und abweichend nicht nur von jenen beiden Städten, sondern auch von Parchim und Malchin die Stellung und Entwicklung der Getreidemüllerei in der Stadt Schwerin immer gewesen ist. Die weitere Forschung ergab hierüber ein abgerundetes Bild.


|
Seite 89 |




|
Die Mühlen der Stadt Schwerin gehören zweifellos zu den ältesten unseres Landes. Das ist allerdings urkundlich nicht zu belegen. Da man Fälschungen unter den Bewidmungs- und Bestätigungsurkunden des Schweriner Bistums vermutete, die später als solche erwiesen schienen, traten Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt der Mühlenentstehung ein. Wigger, Jesse, Salis weichen alle voneinander ab 8 ). Da zurzeit die allgemein angenommene Ansicht von Salis wieder bestritten wird und alle von ihm angefochtenen Urkunden außer MUB. 100 B echt sein sollen 9 ), so wird hier versucht werden, unabhängig von diesen Urkunden einiges zu klären. In Heinrichs des Löwen echter Bewidmungsurkunde von 1171 10 ) wird von Mühlen nicht geredet; die ebenfalls echte Bestätigung seines Sohnes Kaiser Otto IV. von 1209 11 ) nennt molendinarem locum et aquam prope Zwerin versus aquilonem als Dotationen für das Bistum; weiter erhält das Domkapitel in der echten Bestätigung des Papstes Tölestin von 1191 12 ) 2 wichskepel de molendino in aquilonari parte Zverinensis civitatis. Daß letztere Urkunde, die nur in einer Abschrift des 16. Jahrhunderts erhalten ist, vor den anderen von Salis genannten Fälschungen echt sei, ließe sich auch noch anzweifeln: es ist gar zu wenig, was danach in den 20 Jahren seines Bestehens das Bistum neu erworben hätte; es ist sehr eigenartig, daß weder Tölestin 1197 13 ) das wichtige Recht "bannum Zwerinensis provincie" bestätigt, noch auch alle anderen Bestätigungen, die doch Fälschungen zugunsten des Bistums sein sollen, dieses


|
Seite 90 |




|
Hauptrecht, den Bann, dem Bischof zubilligen. Also sei auch die Abgabe der zwei Wispel von der Mühle beiseite gelassen. Das erste zweifellos feststehende Datum der sogenannten Bischofsmühle wäre dann der 21. Mai 1209. Der Bischof erhält nur Grund und Boden, dazu das Mühlenwasser. Salis interpretiert, der Graf habe sich Gerechtigkeit und Gebäude vorbehalten. Das wäre eine sehr eigenartige Dotation, durch die der Graf von Schwerin sich selbst als den Besitzer des Betriebes vom Bischof als dem Besitzer von Grund und Boden abhängig macht. So könnte man geneigt sein, zu deuten, der Bischof erhält Grund und Boden, weil Mühlengerechtigkeit und Betrieb überhaupt noch nicht bestanden. Jedoch sollen aus dieser echten Urkunde keine Schlüsse gezogen werden.
Das zweite Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nennt auch die Grafenmühle zum erstenmal urkundlich. 1217 verleihen Gunzelin und Heinrich, Grafen zu Schwerin, procuratori luminis apud altare sancte Catherine 4 solidos de molendino prope Zwerin posito, procuratori alterius luminis apud sanctum Georgium de eodem molendino totidem 14 ).
Nun ist nicht anzunehmen, daß erst ungefähr 50 Jahre nach Gründung der Stadt Mühlen gebaut sind. Orte, die von Mühlen ihren Namen erhielten: Molenbeke (zwischen Schwerin und Wittenburg), Mölln, Grevesmühlen, ebenso der selbstverständliche sprachliche Gebrauch der Worte molendinum, molendinaris locus deuten auf sichere Bekanntschaft mit dem Mühlenwesen hin 15 ). Die Mühle ist die wichtigste Einrichtung für die Ernährung des Volkes. Schwerin ist aber so unbedeutend nicht, daß angenommen werden könnte, seine Bevölkerung habe sich in deutscher Zeit mit vorgeschichtlichen Reibsteinen, wie die Wenden sie noch hatten, begnügt. Schon das Vorhandensein des gräflichen und des bischöflichen Hofes mit zahlreichen Personen höheren Standes spricht dafür, daß frühzeitig das Handwerk der Mehlbereitung an einer Hauptstelle von einem Fachmanne betrieben wurde. Der wichtigste Grund aber, die Mühle in die Zeit der Gründung der Stadt oder gleich nach ihr zu setzen, ist die Bedeutung der Mühlen für die Ver-


|
Seite 91 |




|
teidigung der Städte 16 ). Das Niveau des Wasserspiegels vom Großen oder vom Ziegelsee ist in der Zeit der Stadtgründung auch für Pfaffenteich und Fließgraben anzunehmen, d. h. noch viel tiefer, als es sich jetzt nach verschiedentlichen Senkungen im Laufe der letzten hundert Jahre zeigt. Der Fließgraben und der Grenzgraben zwischen Pfaffenteich und Beutel an der Nordseite der Altstadt waren wohl kleine Wasserläufe, konnten zur Verteidigung aber nicht gebraucht werden. Erst mit dem Mühlenbau, mit Wehren und Wasserstau konnten die Wasserläufe breit und tief werden und Verteidigungszwecke erfüllen. Da für die deutschen Grafschaften in den 60er und 70er Jahren des 12. Jahrhunderts noch recht unsichere Verhältnisse bestanden, da Rückschläge, wie der von 1178 in Doberan, sich möglicherweise bis Schwerin auswirken konnten, so ist wahrscheinlich mit dem Palisadenbau auch das Aufstauen der Gewässer und der Mühlenbau in den ersten Jahren nach Gründung der Stadt betrieben worden. Das ergibt aber notwendig die Priorität der Grafenmühle vor der Bischofsmühle, die abseits von der Stadt lag, während überall sonst die Verteidigungsmühle, wie es der Sinn erforderte, am Stadtrand lag. Nur die Grafenmühle konnte den Verteidigungszwecken der Stadt dienen; die Bischofsmühle konnte nur das Wasser des Medeweger Sees stauen, ihr Unterwasser, Freiwasser, verlief sich schnell und leicht, wenn es nicht wieder aufgestaut wurde. Von diesen Betrachtungen aus kann man rückwärts schließen und sagen, daß die Bestätigung der Mühle im Besitz des Bischofs 1178 durch Papst Alexander durchaus im Bereich der Möglichkeit liegt, ohne daß hiermit zu der Frage der Fälschungen im übrigen Stellung genommen wird. Daß der Bischof die Mühle vom Grafen erhielt, ist anzunehmen, der Zeitpunkt der Schenkung aber ist nicht genau festzulegen.
So treten uns die beiden Schweriner Mühlen, die Grafen- oder Binnenmühle und die Bischofsmühle, schon innerhalb der ersten Jahrzehnte nach der Gründung der Stadt als Besitz der Personen entgegen, nach denen sie noch heute genannt werden. Beide Mühlen blieben auf lange Zeit die einzigen vor der Stadt, während andere Städte bald eine größere Anzahl aufwiesen. Für die gesamte Geschichte des Mühlenwesens der Stadt Schwerin ist von Anfang ihres Bestehens an die Neu-


|
Seite 92 |




|
mühle mitzuzählen, die in der Mitte des 14. Jahrhunderts urkundlich zuerst auftritt 17 ). Ihre Entstehungsgeschichte ist später zu erörtern.
Die Lage der Mühlen und der sie treibenden Gewässer in ihren Beziehungen zu heutigen Ortsbezeichnungen mag die Grundlage für die weitere Darstellung abgeben. Die Grafenmühle lag dort, wo heute das Herbordtsche Grundstück als alleinstehender Hausblock zwischen Kaiser-Wilhelm-, Schloß- und Klosterstraße steht. Die Grundmauern und Kellergewölbe dieses alten Gebäudes zeugen noch heute von ihrer einstigen Bestimmung. Die Mühle lag außerhalb der Palisaden, außerhalb der seit etwa 1400 entstandenen Stadtmauer 18 ). Das Wasser, das die Mühlenräder trieb, kam teils durch den Fließgraben (heutige Kaiser-Wilhelm-Straße) vom Pfaffenteich her, teils durch die Seeke, die (etwas östlich des Zuges der heutigen Rostocker Straße verlaufend, im Bogen südlich der heutigen Helenenstraße zum Fließgraben einschwenkend) das Wasser des Ostorfer Sees kurz vor der Mühle in den Fließgraben führte 19 ). Wenn die Faule Grube (im Zuge der heutigen Bischofs- und Wladimirstraße, die früher noch als Straße jenen Namen trug) auch mit dem Fließgraben in Verbindung stand, so hatte sie doch nie Bedeutung als Mühlen treibender Wasserlauf. Der Mühlendamm lag, wie es sich eigentlich von selbst versteht, unmittelbar vor dem Grundwerk der Grafenmühle und verband die höher gelegenen Ufer, wie sie heute in der ansteigenden Schloßstraße und westlich vom Marienplatz erkennbar sind. Über diesen Mühlendamm führte auch noch in späteren Jahrhunderten der Hauptausgang aus der Stadt, lag doch unmittelbar neben ihm das Mühlentor. Der Ablauf der Wasser der Grafenmühle, das sogenannte Freiwasser, ging in den Burgsee, dessen Bucht noch im 19. Jahrhundert bis dicht an die Mühle heranreichte.
Die Bischofsmühle war in alter Zeit nicht in die Stadt einbezogen; sie lag sogar weit von ihr entfernt und war nur nach Verlassen des Schmiedetores auf dem Höhenwege westlich


|
Seite 93 |




|
der Stadt, der alten Wismarschen Landstraße, zu erreichen, aber nicht über das Gebiet des Bischofs, die Schelfe und den Spieltordamm, der in ältester Zeit kein Fahrdamm war. Da, wo heute am Bürgermeister-Bade-Platz die kleinen einstöckigen Häuser an die Nordgrenze des Gaswerkes stoßen, war der älteste Mühlenbetrieb. Das heute vor dem Abbruch stehende hohe Gebäude zwischen Aubach und Gutenbergstraße kam in seinen Grundbestandteilen erst 1763 hinzu. Getrieben wurde die alte Bischofsmühle durch die Wasser von "6 gewaltig großen Sehen, als Mettweger, Lankower, Groß und Klein Stücker, Trebbower und Rugensehe, die überhalb solcher Mühlen belegenn und allen ihren Ausfluß uf dieselbe haben" 20 ). Ein breiter Arm des Medeweger Sees erstreckte sich bis unmittelbar vor die Mühle. Und doch war auch hier nicht immer Überfluß an Triebkraft. Der Mühlendamm war nicht sehr lang, da beiderseits Höhen das schmale Tal begrenzten. Das Freiwasser der Bischofsmühle hatte mehrere Wege in den Pfaffenteich.
Die Lage der Neumühle am Südostende des gleichnamigen Sees, die noch heute erkennbar ist, bedarf keiner Erörterung. Jedoch als Gegensatz zu den anderen ist zu erwähnen, daß es sich beim Bau des Mühlendammes hier um die Anlage einer sehr großen Talsperre gehandelt hat, und daß die Neumühle das ganze Jahr hindurch gute Wasserverhältnisse hatte. Ihr Freiwasser ging in langem Lauf bei Görries in den Ostorfer See.
Verlauf und Beziehungen der Gewässer rühren an wichtige geschichtliche Probleme. Alle diese Seen und Wasserläufe waren nicht im Besitze der Stadt. Es war der Stadt also jeder Einfluß auf die Mühlen des Grafen und des Bischofs unmöglich, und doch war sie wegen der Ernährung ihrer Einwohner stark auf sie angewiesen. Pfaffenteich, Ziegelsee und Medeweger See waren im Besitz des Bischofs, die weiter oberhalb gelegenen


|
Seite 94 |




|
Seen im Besitz von Grundherren, Ostorfer und Burgsee im Besitz des Landesherrn.
Die Mühle des Grafen gebrauchte zum Aufstau ihres Wassers den Teich des Bischofs. Staute der Müller zu hoch, so verlangsamte er den Zufluß aus der Seeke. Bei natürlichen Verhältnissen freilich konnte das Wasser nicht sehr hoch ansteigen, weil es sich auf die zu große Fläche von Pfaffenteich und Ziegelsee verteilen mußte. Nach dem Aufbau der Schweriner Landschaft ist anzunehmen, daß, genau wie der Werder gegenüber Karlshöhe, wie der Rücken bei der heutigen Hafenbahnbrücke in der Mitte des Ziegelsees vorspringen, so auch in seinem südlichen Teile (also vor dem heutigen Schweinemarkt) eine Landzunge weit nach Westen in das Wasser vorsprang. Wie die beiden nördlicheren Stellen ließ auch sie nur eine schmale Wasserstraße zwischen sich und dem Westufer offen. Es hatte also diese Halbinsel der Schelfe ursprünglich keine Landverbindung mit dem Westufer. Der Spieltordamm kommt zuerst 1284 vor 21 ). Dieser Damm ermöglichte erst ein höheres Aufstauen des Wassers in dem Pfaffenteich; ein Wasserdurchlaß war in älterer Zeit in dem Damm nach seiner Erbauung nicht vorhanden. Der höhere Stau bedingte aber den Einbau einer Stauschleuse im Kanal nördlich der Altstadt, wahrscheinlich eine stärkere Abdämmung der Seeke gegen die tiefen Wiesen am Burgsee. Schleuse und Damm sind oft von Wichtigkeit gewesen. Zu hoher Stau ließ das Wasserrad der Bischofsmühle im Freiwasser ersaufen und deren Betrieb zum Stillstand kommen. Zu sparsamer Verbrauch von Wasser auf der Bischofsmühle beraubte die Binnenmühle ihrer Triebkraft.
Über die mittelalterliche Geschichte der Mühlen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts stehen nicht viele Urkunden und Akten zur Verfügung. Darum soll erst vom reicheren Fließen des Materials an eine systematische Darstellung gewählt werden, während das mittelalterliche Material zeitlich aneinander gereiht werden mag.
Nach der Untersuchung über jene Urkundengruppe, die mit der Gründung zusammenhängt, kommen wir nun zu der Entwicklung der Mühlen am Ende des 13. Jahrhunderts. Über


|
Seite 95 |




|
den Besitz des Bischofs und des Grafen waren noch Unklarheiten vorhanden, die sich auch auf die Bischofsmühle bezogen. Graf und Bischof schritten 1284 zu einer klaren Abgrenzung ihres beiderseitigen Besitzes 22 ). Nach einem Austausch von Gebieten innerhalb der Stadt wurde dem Bischof die Schelfe zugewiesen mit dem Bemerken: ita tamen, quod comes et sui heredes tantum de terra in vinea possunt accipere, quantum necesse fuerit ad aggerem reparandum; weiter soll der Bischof haben: stagnum, quod Tegelse vulgariter dicitur, ab aggere, molendini nostri ex utraque parte litoris usque ad lacum, ubi lacus magnum stagnum infiuit. Similiter stagnum, quod molendino nostro affluit, ascendendo sursum usque in stagnum de Magno Medewege et ipsum stagnum usque ad lacum in utraque parte litoris nostrum (des Bischofs) erit. Aus dem ersten Satz geht zunächst hervor, daß der "agger" im Besitz des Grafen bleibt, denn für seine Mühle ist er wichtig. Er kann kein anderer als der Spieltordamm sein. Er muß auch mit der Bezeichnung "ab aggere molendini nostri" gemeint sein. Dieses Wort darf nicht auf den Staudamm der Bischofsmühle bezogen werden, der ja am Ausfluß des Medeweger Sees oberhalb der Mühle lag. Der "agger molendini nostri" steht aber in einem Satz über den Ziegelsee. So enthält die Bezeichnung "Damm unserer Mühle" von seiten des Bischofs eine Unklarheit; es wäre also zu übersetzen: Damm bei unserer Mühle. Der Spieltordamm steht auch nicht einmal in einer Zweckverbindung mit der Bischofsmühle; was aus dem Wasser unterhalb der Mühle wird, hat keinen Belang für den Müller der Bischofsmühle. Es scheint, als läge die Anlage der Spieltordammes nicht weit zurück vor 1284. Die in dieser Urkunde zum ersten Male auftauchende Bezeichnung der Größe der Grafenmühle von vier Rädern, einer beträchtlichen Größe, legt dieses ebenfalls nahe. Eine so große Mühle bedurfte einer großen Wassermasse als Antriebskraft. Diese wurde erst durch den Bau des Dammes geschaffen, der die aufgestauten Wassermassen in einem verkleinerten Becken zusammenhielt und dazu den Vorteil gewährte, das Freiwasser der Bischofsmühle auch der Grafenmühle nutzbar zu machen. Oberhalb der Bischofsmühle befand sich nicht ein Bach (wie jetzt der


|
Seite 96 |




|
Aubach), sondern schon in jenen Zeiten ging der Mühlenteich unmittelbar in den Medeweger See über; nur das kann der Wortlaut der Urkunde bedeuten. Und wenn der Zustand eines breiten, unmittelbar bis zur Mühle reichenden Seearmes noch 1713 urkundlich 23 ) und 1729 auf einer Karte besteht 24 ), so beweist das den alten natürlichen Zustand.
Nachdem Graf und Bischof ihre Mühlen das ganze Jahrhundert in Eigenbewirtschaftung gehabt hatten, verkaufte 1292 der Graf seine, also die Binnenmühle, an Abt und Konvent des Klosters Reinfeld 25 ); 1349 verpfändete der Bischof die seine zusammen mit anderen Gütern an die Brüder und Vettern v. Bülow, die dieses Pfandgut untereinander teilten 26 ). Die neue Art der Nutzung solcher Betriebe hing wahrscheinlich mit dem Aufkommen städtischen Geld- und Kreditwesens zusammen, von dem die Fürsten bald lernten. Die Binnenmühle wurde bei jenem Verkauf als eine von vier Gängen bezeichnet (quatuor rotarum); der Kaufpreis von 1624 Mk. lüb. wurde noch im gleichen Jahre bezahlt; die Stadt erklärte, sie habe keine Rechte an der Mühle, werde ihr aber auch unter der neuen Besitzerin Schutz gegen Feinde gewähren. Die Stadt tat ja gut daran, denn sie war für ihre Bürger, die hier mahlen ließen, an ihr interessiert. Über den Beginn eines etwaigen Mahlzwanges, der bei Doberan schon 1287 27 ) festgesetzt wurde, läßt sich für Schwerin noch nichts sagen.
Die Wasserverhältnisse, die 1284 einen Vergleich nötig machten, führten bald wieder große Streitigkeiten herbei. 1328 glaubte der Bürger Hermann Wend (Slavus), ein Anrecht auf die Schleuse (gurgustrium) an der Grafenmühle zu haben 28 ). Nach einem Zeugnis des Vogtes von Schwerin und des Rates der Stadt trat er sie aus freiem Antrieb gern und völlig an den Grafen ab, und der Streit zwischen Kloster und Hermann Wend war "amabiliter" geschlichtet. Oberhalb dieser Schleuse wurde bald eine neue angelegt juxta pontem sancti spiritus 29 ), die nicht weit von der Grafenmühle lag. Sie wurde


|
Seite 97 |




|
als "vorescutte" (Vorschütt, Vorstau) bezeichnet, diente also dem Mühlenbetrieb; bei ihrer Anlage vor der Faulen Grube, zugleich vom Grafen und Rat genehmigt, hatte sie eine besondere Bedeutung: sie sollte durch Öffnen und Schließen das Wasser des Fließgrabens in die Faule Grube eintreten lassen und diese so reinigen, bzw. diese vom Fließgraben trennen. Mit der Entwicklung der Stadt war auch der Mühlenbetrieb gewachsen. Das erforderte eine große Wassermenge, hohen Stau. Da legte 1344 der Dekan Konrad für das Domkapitel bei Gelegenheit einer Ausbesserung, die das Kloster Reinfeld an der Schleuse im Kanal zwischen Stadtmauer und Schelfe, also anscheinend auf Bischofsgebiet, vornehmen wollte, mit heftigen Worten Verwahrung ein 30 ). Wenn auch die Beauftragten der Klosterbrüder ihm, dem Dekan, mit einer Schrotwaage das Maß der alten Schleuse bewiesen und erklärten, sie wollten nach genauen Maßen jener alten Schleuse, nicht höher und nicht tiefer, bauen, so war ihm das alles doch nicht sicher genug; denn die Wasserhöhe durfte wegen der Räder der eigenen Mühle unter keinen Umständen steigen. 14 Tage später wurde ein förmlicher Vergleich zwischen dem Kloster einerseits und dem Bischof und dem Domkapitel andererseits geschlossen, daß ersteres von da an und für zukünftige Zeiten die Schleuse in ihrer damaligen Höhe - also nicht höher - halten sollte, ebenso das Grundwerk seiner Mühle. Im nächsten Jahre 1345 erwarb das Kloster Reinfeld diese Schleuse vom Bischof für 100 Mk. lüb., die sofort bezahlt wurden 31 ). Der heftige Protest des Dekans, die Höhe des Kaufpreises von 100 Mk. für eine Schleuse zeugen von der Wichtigkeit des Gegenstandes für beide Teile.
Nach dieser Zeit (1357) tauchte zum ersten Male die Neumühle auf 32 ). Ob ihre Erbauung damals als Aushilfe erfolgte - der obige Streit in Schwerin deutet auf Wassermangel bei der Grafenmühle hin -, ob der Graf schon 1298 nach dem Verkauf seiner Mühle erkannte, daß sein Haushalt zu teuer wurde und wieder eine eigene Mühle nötig hatte, woraus man auf einen Bau der neuen Mühle bald nach 1298 schließen könnte, ob nur die ganz besonders gute örtliche Beschaffenheit hier einen Mühlenbau veranlaßte, vielleicht sogar schon vor


|
Seite 98 |




|
1298, all das müssen offene Fragen bleiben. Auch die Bezeichnung "nige" Mole sagt nichts, denn neu könnte sie, so gut wie heute, auch schon vor 1298 geheißen haben.
1362 erwarb Detlef von Züle diese Neumühle zur Pfandnutzung für eine Forderung von 400 Mk. lüb. von dem Herzog Albrecht II., der eben erst in ihren Besitz gekommen war 33 ).
Kurz vor der Wende zum 15. Jahrhundert kamen die Mühlen wieder in den Eigenbetrieb der früheren Besitzer zurück. Die Bischofsmühle zwar nicht in den des Bischofs, sondern in den des Domkapitels. Der Bischof verkaufte sie 1392 an den Domherrn Johann Berchteheile für 400 Mk. lüb. 34 ); dieser schenkte sie 1397 an das Kapitel 35 ), dem sie bis zum Westfälischen Frieden verblieb. Die Herzöge erwarben 1398 vom Kloster Reinfeld die Grafenmühle zurück 36 ). Die Mitwirkung des Papstes und die Vermittlung des Lübecker Bischofs sind formalrechtliche Dinge bei der Übergabe, die nicht weiter erörtert werden sollen. Die Neumühle war im Anfang des 15. Jahrhunderts wieder in der Hand des Herzogs; wann sie aus der Verpfändung zurückfiel, ist nicht zu ersehen.
Gleich am Anfang des 15. Jahrhunderts beginnen mit 1409 die Schloßregister die wertvollsten Angaben über die Eigenwirtschaft zu machen. Da sind (auf Datum und Scheffelzahl) genaue Buchungen über die Ablieferungen der Mühlen an die herzogliche Küche, an das Backhaus, an das Brauhaus, in den Keller. Es ist zu erkennen, daß den Hauptteil der Hofwirtschaft an Weizen und Roggen Neumühl lieferte, an Malz die Grafenmühle, "de Molen to Zwerin, binnen Zwerin"; sie wurde wegen dieser Lieferung kurz de Moltmolen genannt, wenngleich sie auch Weizen und Roggen lieferte. Neben ihnen lieferten Banzkow und Eichsen an den Hof. Der Verkauf aus der Binnenmühle hielt sich auf einem Durchschnitt von 50 bis 60 Mk. lüb. In den Löhnen vollzog sich im 15. Jahrhundert eine Steigerung: 1409 erhielten die Mühlenmeister 1 Mk., Wagendriver (Pungenfahrer) 12 ß; 1454 ff. erhielten die Meister 4 Mk., Matter in der Stadt 3 Mk., ebenso die Wagendriver


|
Seite 99 |




|
in der Binnenmühle und Neumühl. Die Ausgaben für den Betrieb waren natürlich sehr ungleich. Neumühl brauchte immer mehr Geld für Hufschlag als die Grafenmühle. Der Bedarf an Bicken, Rynen, Spillen, "bamit de nyge Sten ward upgebracht", an Tappen, Bende to de Wellen, Neghelen war sehr verschieden 37 ). Ein rheinischer Mühlenstein kostete 40 Mk., der gebräuchlichere Sandstein 16 Mk. 1458-60 wurden die Mühlen mit Steinen planmäßig neu beliefert: Binnenmühle mit zwei Sandsteinen, Neumühle mit zwei Sandsteinen und zwei rheinischen, Eichsen mit zwei Sandsteinen. Leider läßt sich Bezugsquelle und Gebrauchsdauer der Steine weder feststellen noch berechnen.
Von der Bischofsmühle konnte für das ganze spätere Mittelalter nur ein Aktenstück aufgetrieben werden: 1534 nahmen die Domherren ein Kapital von 100 Mk. auf gegen eine jährliche Rente von 4 Mk.; die 100 Mk. wurden für Einrichtung und Grundwerk (grindt) der Bischofsmühle verwandt.
Das vervollkommnete Kanzleiwesen der Renaissancezeit, die bessere Aufbewahrung der Urkunden und Akten sind auch beim Forschen über Mühlen spürbar. So ist es von der Zeit an möglich, einzelne Seiten der Mühlenentwicklung zusammenfassend zu behandeln: Bau und Vergrößerung, Pachthöhe und Pachtrecht, Verhältnis zur Stadt, Verhältnis der Müller zueinander, Dinge der Einrichtung und des Betriebes der Mühlen.
Die Mühlenbauten unserer Zeit zeigen eigentlich immer eine sehr große Lebensdauer, auch die nur aus Holz gebauten Windmühlen; mehrere von ihnen reichen in das zweite Drittel des 18. Jahrhunderts zurück. Wenn wir solche Festigkeit auch den Mühlen früherer Jahrhunderte im allgemeinen zusprechen können, so zeigt doch die Geschichte, daß gerade über die Mühlen schwerste Geschicke dahingegangen sind und sie in ihrer Entwicklung gehemmt haben, wenn auch die Größe und Art der Mühlen an der allgemeinen Aufwärtsentwicklung teilnimmt.


|
Seite 100 |




|
Die Binnenmühle hat ihre stolze Größe von vier Rädern, die sie 1298 hatte, nicht behalten, wie etwa die Vierradenmühle zu Neubrandenburg. Wann der Rückgang eintrat, ist nicht ersichtlich; doch deuten die Berichte der Schloßregister darauf hin, daß der Rückgang auf zwei Gänge schon vor 1409 lag. 1598 heißt es in einer Liste 38 ): Schwerinsche Mühle mit der Windmühle zwei Gänge; ein Vergleich ihrer Pachthöhe mit der anderer Mühlen zeigt, daß die Wassermühle zwei Gänge hatte und die Windmühle für sich berechnet wurde. Mit dieser Windmühle war immerhin schon wieder eine Vergrößerung des Mühlenbetriebes eingetreten. Mit ihr scheint die schon 1576 genannte Mühle auf dem Berge Jerusalem identisch zu sein. Die Annahme, diese Mühle auf dem Berge Jerusalem habe auf der Schelfe gestanden, kann nicht stimmen, da die Schelfe zum Gebiet des Administrators Herzog Ulrich gehörte, die Mühle aber in den Tutelakten für die Söhne Johann Albrechts I. genannt wurde. In einem Register von 1633, das nur Mühlen des Schweriner Amtes enthält, heißt es: Schwerinsche Mühle zwei Gänge, Neumühle zwei Gänge, Mühle auf dem Berge ein Gang 39 ). Das ist alles, was wir über diese Windmühle wissen: weder die Stelle des Berges Jerusalem, noch die Zeit ihrer Entstehung, noch die ihres Untergangs ist zu finden. 1631 war die Binnenmühle sehr zerbrochen; aber der Binnenmüller Martin Berg, ein geschickter Zimmermann und Tischler, der sie noch 1638 verwaltete, wird, wozu er sich bei seiner Anstellung verpflichtete, sie wieder instand gesetzt haben. Sehr nahm der große Krieg die Mühle in den letzten Jahren mit. Vielleicht ist auch die Windmühle damals zerstört. Nach des Herzogs Befehl sollten aus den mecklenburgischen Ämtern zum Schweriner Mühlenbau Gelder aufgebracht werden; diese aber reichten am 14. Juni 1647 bei weitem nicht zu diesem Zweck; so wurde den Ämtern eine zweite Umlage von 136 Rtlrn. auferlegt: Schwerin 16, Neustadt 13, Marnitz 6, Grabow 11, Eldena 11, Dömitz 9, Grevesmühlen 10, Mecklenburg 7, Redentin 7, Farben 7, Poel 7, Bukow 7, Doberan 16, Neukloster 9 Rtlr. Nach einer Unterliste lieferte der Doberaner Küchenmeister Bernd Crüger diese Summe am 22. Juli 1647


|
Seite 101 |




|
ab 40 ). Trotz dieser großen Ausbesserung war 1649 schon wieder eine notwendig; wieder mußte Bernd Crüger 16 Rtlr. zur Entlohnung der Tagelöhner, eigener Amtsuntertanen, binnen zehn Tagen an den Sekretarius Beckmann in Schwerin liefern. Dieses Mal war das Grundwerk zu erneuern: 20 Personen täglich benötigt, bei der Rahmen (Ramme) Pfähle zu stoßen 41 ). Bei dem großen Brande der Stadt 1651 wurde auch die Binnenmühle vom Feuer ergriffen und die ganze Erneuerungsarbeit vernichtet 42 ). Da von 1653 an die Bischofsmühle in der Verwaltung des Binnenmüllers war und das Mühlenwesen in den nächsten Jahrzehnten einen großen Aufschwung nahm, muß sie sogleich wieder voll aufgebaut sein. Die kleinen Schäden auf eigene Kosten auszubessern, war der Müller verpflichtet.
Neumühl und die Bischofsmühle scheinen in der Neuzeit nicht größer geworden zu sein. Neumühl hat noch immer zwei Gänge, die Bischofsmühle war ein kleiner Betrieb von einem Gang geblieben. Von ihr sind zwei Inventare der Jahre 1578 und 1600 weiter unten zu behandeln. Im Dreißigjährigen Krieg verwaltete sie ein gefreiter Soldat im Auftrage der schwedischen Heerführung. Dieser Gefreite war wahrscheinlich ein Müller, denn in den Stammrollen der Regimenter beider Parteien wurden Müller und Zimmermeister in der Reihenfolge der Rangstufen immer zu oberst bei den Gefreiten genannt. Durch die Nachlässigkeit dieses Gefreiten ist die Bischofsmühle in den ersten Tagen des Jahres 1642 abgebrannt. Über ihren Wiederaufbau wissen wir nichts weiter, als daß 1649 in einem Haus von fünf Gebinden ein Betrieb mit zwei böhmischen Mühlensteinen war 43 ).
Unter dem berüchtigten Mühlenpächter Meister Jochim Hoykendorf 1553-76 sind die Mühlen in vollem Betriebe. Über


|
Seite 102 |




|
Bauten in dieser Zeit erfahren wir nur kurz, daß Hoykendorf die Grundsteine zum Neubau seines Wohnhauses aus herzoglichem Besitz mit Hilfe eines Steinhauers gestohlen hat. Im Jahre 1700 bat Mühlenmeister Hancke die Kammer um zwei Buchen zu Schaufeln und um Spillholz. Der Herzog befahl, aus der Lewitz oder der Wildbahn eine kleine Eiche anzuweisen, "so zum Rande umb den Steinen geschnitten werden muß", und das zweite Fuder Spill- (Kamm-) holz 44 ). 1709 klagte Hancke über Baufälligkeit beider Mühlen, für deren Ausbesserung er an Zimmermannslohn über 100 Rtlr. ausgegeben hätte. Er wollte aus diesem Grunde und anderen Gründen seine Pacht herabgesetzt wissen. Daß sich ein halbes Jahrhundert nach der Neuerrichtung beider Mühlen eine solche große Ausbesserung vernotwendigte, nimmt nicht wunder. Ob Hancke damals den dritten Gang auf der Binnenmühle, den sie 1717 hatte, erbaute oder erst kurz vor 1717, ist nicht zu erkennen. Freilich konnten alle drei Gänge wegen niedrigen Wassers nie zugleich gehen.
Wieder taucht die Frage der Windmühlen auf. Hancke hatte am 21. Januar 1711 drei Mühlen, ein Meister Ahrens 1722 vier Mühlen. Von den drei Mühlen scheint die eine die alte Lohmühle (heutige Schleifmühle, im 16. Jahrhundert Pulvermühle) gewesen zu sein, die etwas später "ein Pertinenz zu hiesiger Mühlen" heißt. Am 21. April 1711 wird die Bischofsmühle und Windmühle im Gegensatz zur Binnenmühle genannt. Daraus geht hervor, daß die Windmühle der Binnenmühle nicht mehr bestand, daß aber die zur Bischofsmühle gehörige, die im Januar 1711 noch nicht da war, in den nächsten drei Monaten errichtet sein muß. Diese Bockmühle auf dem Mühlenberge (an der heutigen Mühlenstraße) ist auf dem "Grundriß der Stadt und Vestung Schwerin von Tilly 1729" 45 ), auf dem auch die übrigen drei Mühlen verzeichnet sind, als solche deutlich zu erkennen. Diese Bockmühle ließ der Müller Jörn 1731 aus seinem Vertrag, und ein Reiter vom Leibregiment zu Pferde nahm sie in Pacht, obgleich sie sehr baufällig war. Er besserte sie aus, geriet aber bald mit seinen Pachtzahlungen in Rückstand, so daß die Kammer sich genötigt


|
Seite 103 |




|
sah, ihm die Mühle abzunehmen und sie dem Müller Röper von der Binnenmühle wieder zu überlassen. Das Grundwerk der Binnenmühle bedurfte 1734 einer gründlichen Ausbesserung. Die Kammer lieferte wie gewöhnlich das Material, die herzogliche Schatulle steuerte 12 Rtlr. zur Bezahlung für bereits geschnittene Bretter, Rämell u. dgl. bei. Mit dem starken Wachsen der Schelfstadt verlor die Bockmühle durch naheliegende Häuser ihren Wind und wurde 1749 auf die Höhe westlich der Bischofsmühle verlegt 46 ). Ihr neuer Standort war an dem Wege, der etwa vom Luisenplatz über das heutige Bahnhofsgelände nach Klein-Medewege führte; sie lag damit viel günstiger zur Bischofsmühle.
Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts wurden die Mühlenbetriebe sehr vergrößert 47 ). Als der Müller Röper jun. 1763 die Mühle zu neuem Pachtsatz übernahm, wurde ihm die Verpflichtung zum Bau einer neuen zweigängigen oberschlächtigen Mühle bei der Bischofsmühle auferlegt. Der Bau wurde sofort ausgeführt, dabei lieferte die Kammer Holz, Kalk und Steine, der Müller trug die baren Kosten in Höhe von 2000 Rtlrn. "Der Müller zahlt bis 1766 ein besonderes locarium, erhält dann bei etwaigem Rücktritt von der Pacht 500 Rtlr. zurück, und die Mühle ist Eigen Serenissimi" wurde in den Niederschriften über die Baubedingungen am 9. Februar und 1. März 1763 bemerkt. Das alte Werk an der Südseite des Mühlenteiches blieb in Betrieb, das neue lag östlich des Teiches und entließ sein Freiwasser durch einen neuen Graben unmittelbar in den Ziegelsee. Röper behielt die Pachtung lange. Beim Antrag auf Verlängerung seines Vertrages 1784 wies er noch einmal auf diese hohen Kosten hin; jetzt konnte er sich freilich schon auf mehr berufen, nämlich die hiesige Binnenmühle mit Aufwand zweckmäßig eingerichtet, einen gänzlich neuen Anbau erstellt und zum Bau des Wohnhauses des Binnenmüllers 1777


|
Seite 104 |




|
900 Rtlr. Zuschuß geleistet zu haben. Dieser Neubau ist das noch heute erhaltene Haus Herbordt. Bald erhielt auch die Bischofsmühle neue Wohngelegenheiten, zwar nicht für einen Mühlenpächter; denn noch bei der Versteigerung von 1809 hieß es, die Mühlen müßten zusammen verpachtet werden, weil bei der Bischofsmühle sonst ein neues Wohnhaus nötig würde. Das mittlere der heutigen kleinen Häuser an der Nordseite der Gasanstalt trägt in einem der sogenannten Hahnenbalken die Jahreszahl 1791 eingeschnitzt. Der sehr reiche Mühlenpächter Stüdemann wird das Haus für den Mühlenbetrieb und für die Wohnungen seines Meisters und des Mühlenschreibers errichtet haben.
Schwerin hatte also um 1800 die Binnenmühle mit drei Gängen, die Bischofsmühle mit vier Gängen und mit der Bockmühle; auch Neumühl ist damals mit seiner zweigängigen Mühle in der Hand Stüdemanns. Dagegen zählte Rostock damals 6 Wasser-, 4 Wind- und 1 Grützmühle, 11 Betriebe; Waren 8; Wismar 6; Güstrow und Malchin je 2 städtische Betriebe.
Die Entwicklung des 19. Jahrhunderts steht unter dem Zeichen der Großmühle. Aus Amerika kam der mechanisierte Betrieb, der alle Mahlvorgänge in einen zusammenhängenden mechanischen Ablauf brachte; aus Österreich und der Schweiz kam der Walzenstuhl nach Deutschland mit seinen Ergänzungsmaschinen, den Vorreinigern und Sichtern; durch sie wurde Feinausmahlung = Hochmüllerei und Grobausmahlung = Niedermüllerei geschieden. Zwar drangen die Neuerungen nicht schnell in Mecklenburg ein, doch verfolgte man die Entwicklung genau 48 ). Die Bevölkerungszunahme im neuen Jahrhundert, die wirtschaftlichen Fortschritte in der Landwirtschaft wirkten auf das Mühlenwesen ein. 1816 hatte der neue Teil der Bischofsmühle drei Gänge. 1819 erhielt die Binnenmühle eine holländische Windmühle vor dem Wittenburger Tor, nach einer Federzeichnung im Besitz des Herrn Mühlenbesitzers W. Janssen ein Erdholländer. 1824 erhielt die Bischofsmühle den großen Galerieholländer hinter der Augustenstraße. 1842 baute Mühlenpächter Röper in der Bischofswassermühle an Stelle der Wasserräder eine Turbine, nach Mohaupt die erste Turbine in einer Mühle Deutschlands. 1844 baute der Binnenmüller Heldt den zweiten Holländer, eine große Galeriemühle mit zwei Walzenstühlen. 1853 wurde zwar der alte Wasserbetrieb der


|




|
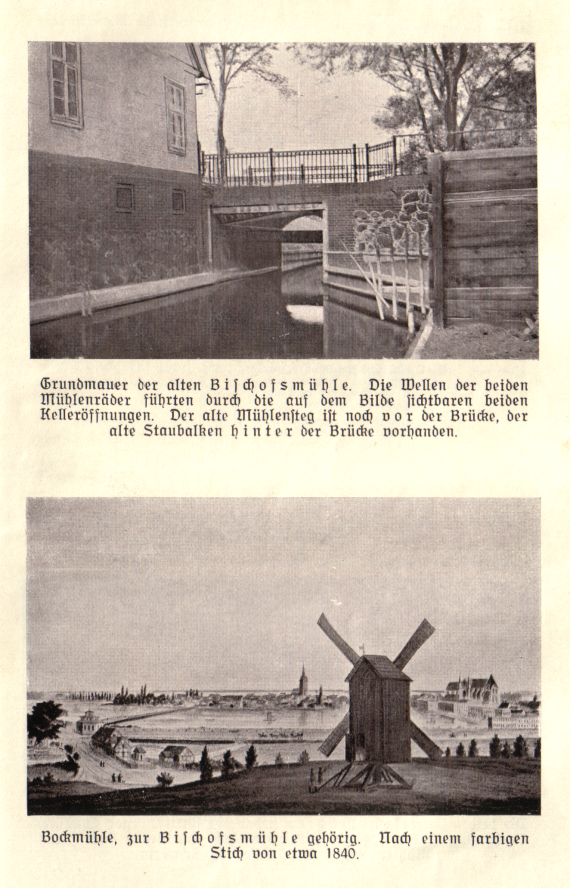


|




|
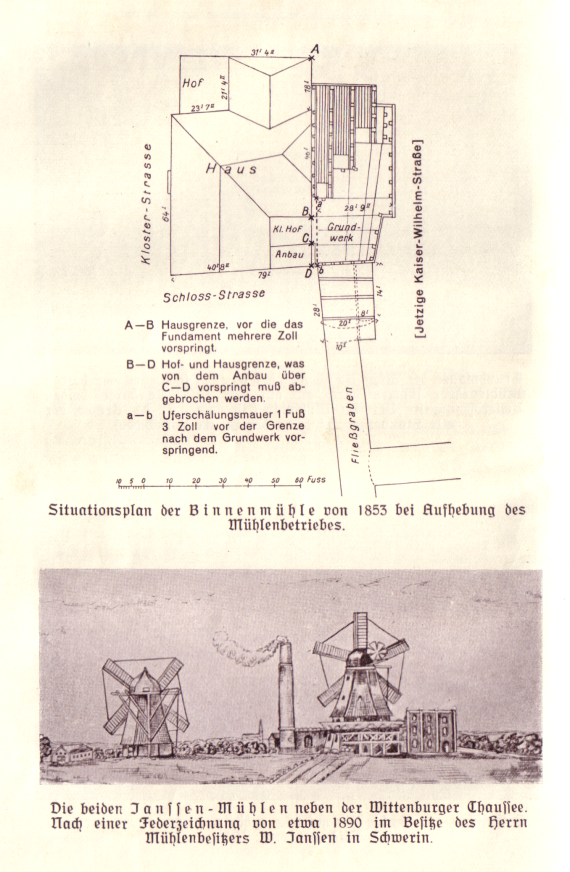


|
Seite 105 |




|
Grafen- oder Binnenmühle wegen des Baues der Poststraße, jetzt Kaiser-Wilhelm-Straße, aufgehoben 49 ), aber dafür konnte 1860 Karl Pingel, der Pächter der Bischofsmühle, diese in eine Dampfmühle verwandeln und, nachdem er 1864 Besitzer geworden war, das neue Mühlengebäude errichten, auf das er eingedenk der großen Vergangenheit seiner Mühle jene bekannte Inschrift "Ora et labora 1865" setzte 50 ). Damit hörte der Wasserbetrieb auf, und der Mühlengraben zum Ziegelsee wurde zugeschüttet; nur ein Gang im alten kleinen Mühlengebäude blieb kümmerlich als Wassermühle in Betrieb. 1863 gelangten die Windmühlen am Wittenburger Tor in die Hand des Pächters W. Janssen. Dieser umbaute 1875 als Besitzer die große Holländermühle mit dem Fabrikgebäude einer Dampfmühle und gab der Windmühle fünf Flügel. Freilich wurde der Windmühlenbetrieb 1894 aufgehoben, und nun wurden auch die oberen Teile in Böden verwandelt; bis zum Ende des Jahrhunderts aber vergrößerte Janssen ständig den Betrieb, der zuletzt eine Fläche von 8707 Quadratzoll = 1025,53 qm bedeckte.
1868/69 war in Mecklenburg die Gewerbefreiheit eingezogen, was eine starke Anregung zum Mühlenbauen gab. Sei 1870 tauchte eine Windmühle in Tannenhof auf; 1871 baute Heinrich Awe seinen großen Galerieholländer südlich der Friedrich-Franz-Straße, 1885 Rieckhof einen kleineren Holländer an derselben Straßenseite weiter nach Lankow hin. 1891 erbaute Beckmann die Dampfmühle an der nördlichen Seite der Friedrich-Franz-Straße; er mahlte aber nur für die Militärverwaltung.
Damit war der Höhepunkt der Mühlenentwicklung in Schwerin erreicht: 3 Dampfmühlen, 2 Galerieholländer, 2 Erdholländer, 1 Bockmühle, mit Neumühl noch eine Wasser- und eine Windmühle mehr, also 10 Betriebe, der Schleifmühle und der Lohmühle vor der Jägerstraße gar nicht zu gedenken.
Nun erfolgte ein schneller Rückgang. Gebrüder Pingel müssen in den achtziger Jahren erst die Bockmühle abstoßen, dann die Holländermühle verpachten; 1892 können sie auch die


|
Seite 106 |




|
Dampfmühle nicht mehr halten, die Janssen erwirbt. 1893 wird die Bockmühle abgebrochen, nachdem sie zuletzt kläglich von Hand zu Hand gewandert ist. 1896 brennt die Mitte der Janssenmühle aus, was aber die Tatkraft ihres Besitzers nicht lähmt. Im Juni 1914 wird das große Mühlenwerk Janssens durch einen gewaltigen Brand völlig vernichtet. 1909 brennt die kleinere Holländermühle an der Friedrich-Franz-Straße ab, 1910 der Galerieholländer hinter der Augustenstraße. Paul Fischer erwirbt kurz vor dem Kriege die Awesche Mühle; er bricht sie im zweiten Kriegsjahr ab und verkauft sie nach auswärts. Janssen setzt seine Pläne, eine Großmühle am Ziegelsee zu bauen, bei den Behörden nicht durch und verlegt seinen Hauptbetrieb nach Kleinen. Die Bischofsmühle tritt er 1915 ab an Deppen, den aber die letzten Zeiten wirtschaftlichen Rückgangs 1926 zwingen, sein Werk stillzulegen. Heute steht diese uralte Mühle als trauriges Denkmal großer Vergangenheit da. Die Dampfmühle an der Friedrich-Franz-Straße wird in eine A.-G. verwandelt; sie ist freilich Großhandelsmühle und noch kürzlich wieder ausgebaut. Neben ihr besteht nur noch seit 1903 die Linowsche Dampfmühle, die in der Hauptsache für die mit ihr verbundene Bäckerei arbeitet.
Neumühl hat fast keine Größenentwicklung gehabt. 1611 hat sie eine Walkmühle (Windmühle) mit einem Stempel, deren Lage unbekannt ist, also keine Kornmühle. Nach der Landesvermessung der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gehört zu Neumühl der Erdholländer am scharfen Knick des Weges Neumühl-Lankow; diese Mühle liegt nach einem Blatt der Generalstabskarte aus den achtziger Jahren stadtwärts direkt vor dem Neumühler Gehöft auf der Höhe über der Wittenburger Kunststraße. Sie brannte 1900 ab. Obgleich die Stadt damals keine Windmühle wieder errichten wollte, ist doch bald wieder eine erbaut, und zwar auf der Höhe jenseits Neumühl, wo Verfasser als Schüler um 1903/04 sie liegen sah. Die Wassermühle, die schon im Erbzinsvertrag von 1818 nicht mehr als Korn-, sondern als Öl- und Walkmühle erschien 51 ), brannte 1902 völlig aus. Bald darauf muß auch


|
Seite 107 |




|
die Windmühle von Neumühl abgebrochen sein, spätestens 1909; denn seitdem führt das Adreßbuch keinen Müller in Neumühl mehr.
Heute ein Großbetrieb, ein mittlerer Betrieb, nicht ein einziger Kleinbetrieb außer der kleinen, vor wenig Jahren errichteten Motormühle von Beckmann in Görries, - das ist der Abschluß der Geschichte der Schweriner Mühlen.
Als Mecklenburg zur Zeit Heinrichs des Löwen in das helle Licht der Geschichte trat, gehörte die Anlage von Mühlen zu den grundherrlichen Rechten, die die Grundbestandteile des heraufkommenden Landesherrentums bildeten. Das Recht des Mühlenregals war damals anscheinend im Entstehen, und gelegentlich kommt seine Ausübung durch den Kaiser in den Urkunden vor. Auf mannigfache Weise traten Regal und landesherrliches Grundrecht in den mecklenburgischen Territorien in Erscheinung.
Die Dotation der Bischofsmühle durch den Grafen war Ausfluß aus diesem Recht. Dabei gingen an den Bischof nicht nur die Nutzung dieses Rechtes über, sondern das grundherrliche Recht selbst. Wenn die Grafenmühle in der Form des Kaufes an das Kloster Reinfeld überging, so blieb doch hier eine gewisse Bindung an den Landesherrn gewahrt, wie der Streit mit Hermann Wend und die Rücknahme der Mühle 1398 bezeugen. Die Eigenbewirtschaftung der Schweriner Mühlen im 15. Jahrhundert ging im 16. Jahrhundert in das Rechtsverhältnis der Pachtung über, was bei der Bischofsmühle vielleicht erst im 17. Jahrhundert geschah.
Die Pachtverhältnisse der folgenden Jahrhunderte sind nach der wirtschaftlichen wie nach der rechtlichen Seite überaus reich überliefert.
Die Binnenmühle hatte 1598 mit einer Pacht von
30 Drbt. Roggen (à Scheffel 28 ß) 52 ) und
80 Drbt. Malz (à Scheffel 20 ß),


|
Seite 108 |




|
zus. mit der Windmühle mit einer Pacht von
5 Drbt. Roggen und
8 Drbt. Malz
einen Pachtwert von 1220 Rtlr.; Neumühl mit 38 Drbt. Roggen, 2 Drbt. Weizen einen solchen von 604 Rtlr. 1603 sind diese Werte auf 700 fl. (= 350 Rtlr.) bzw. 350 fl. (= 175 Rtlr.) gesunken, was mit der Bewegung des allgemeinen Wirtschaftslebens übereinstimmt, sich in den einzelnen Gründen aber noch nicht klären ließ. Im Dreißigjährigen Kriege mußte Löther 52a ) für die Binnenmühle 120 Drbt., sein Nachfolger Gantzauer auf Einspruch 140 Drbt. zahlen trotz schwerer Kriegszeiten. Gantzauers Matterknecht J. Ahrens, der später Malzmeister in der Binnenmühle war, berichtete 1675, Gantzauer habe immer behauptet, daß die Mühle viel mehr tragen, daß die Malzmühle allein die Pension bringen könnte. Nach dem Kriege trat wieder ein bedeutender Rückschlag in der Pachthöhe ein: in des Müllers Hoykendorf Vertrag von 1655 53 ) war die Pacht mit 2 Drbt. Weizen, 34 Drbt. Roggen, 36 Drbt. Malz festgesetzt, für Neumühl mit 21 Drbt. Roggen,. für die 1648 mit dem Bistum ans Herzogtum Schwerin gekommene Bischofsmühle mit 17 Drbt. 4 Scheffel Roggen. Jeder Müller hatte dazu jährlich 2 bis 4 Mastschweine zu liefern 54 ). Über Hoykendorfs Pachtung sind zwei weitere Angaben vorhanden:
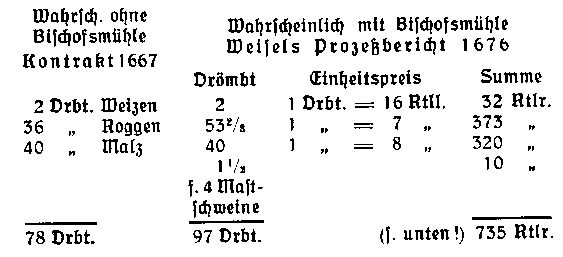
Bei Abschluß des Vertrages mit Jochim Jörn 1677 wurde von der Kammer ein Durchschnittsgetreidepreis von 6 Rtlr. 4 ß


|
Seite 109 |




|
für 1 Drömbt zugrunde gelegt, also bedeutend weniger, als Weisel angibt. Dieser Preis würde für Hoykendorf eine Pacht von 590 Rtlr. bedeutet haben (s. unten!). Nach einem gleichzeitigen Kammerbericht war der Oberakzisemeister Daniel Weisel, der nach Absetzung Hoykendorfs ein Jahr lang die Mühlen verwaltete, zu folgender Pachtsumme verpflichtet:
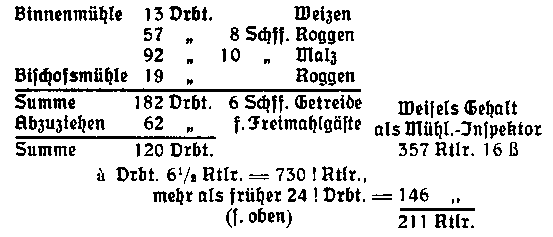
Wenn man die 19 Drbt. der Bischofsmühle gleich 136 Rtlr. setzte, würde für die Binnenmühle sich eine Pacht von 594 Rtlr. (s. oben!) ergeben. Die Neumühle wurde 1667 zu 28 Drbt. Roggen verpachtet. Daniel Weisel drückte die beiden ihm unterstellten Müller, Ahrens auf der Binnenmühle, Icke auf der Bischofsmühle, so sehr, daß sie sich bei der Kammer beklagten.
Jörns eigener Vertrag lautete auf 2 Drbt. Weizen, 30 Drbt. Roggen, 40 Drbt. Malz, 4 Mastschweine = 73 1/2 Drbt. Das würde nach Weisels Einheitspreisen eine Pachtsumme von 572 Rtlr. ergeben, nach dem Durchschnittspreis der Kammer 477 3/4 Rtlr. Wenn auch diese Angaben bei einem Vergleich noch gewisse Unklarheiten lassen, so war doch anders ein Ergebnis nicht zu erzielen. Die Berechnungen arbeiten mit abgerundeten und manchmal stark angleichenden Zahlen und folgen darin Weisels Art in seiner umfassenden Buchführung 55 ).


|
Seite 110 |




|
Jörns Nachfolger zahlt 1709 150 Drbt. = 730 Rtlr.; eine Liste aller Mühlen im Amte Schwerin von 1718 setzt für Hancke wieder nur 120 Drbt. = 706 Rtlr. Die Kornpreise in dieser Liste zeigen in den verschiedenen Gegenden desselben Amtes starke Unterschiede. Neumühl zahlte 1718 43 Drbt., gegen 1667 eine wesentliche Erhöhung, die auch weiterhin stetig blieb. Wenn der folgende Müller auf der Binnenmühle, Jörn (II), um 1730 nur 636 Rtlr. zahlte, so wurde der Rückgang diesmal mit dem großen, durch drei Jahre andauernden Wassermangel begründet. Sein Nachfolger zahlte für die drei ersten Pachtjahre 10 Drbt. mehr als er und war verpflichtet, dann noch einmal einer Erhöhung der Pacht um 10 Drbt. zuzustimmen, wenn bessere Wasserverhältnisse herrschten. Um diese 10 Drbt. entspann sich ein drei Jahre währender Streit, der mit der Festsetzung von 716 Rtlrn. endete. Bei Ansetzung des gleichen Kornpreises wie 1730 würde das eine Erhöhung von wenig mehr als 1 Drbt. bedeuten. Freilich wurde dem Pächter Röper dazu auferlegt, 100 Rtlr. Sicherheit zu stellen, wozu vorher schon Ahrens verpflichtet war, der aber seine Summe noch nicht wieder zurückerhalten hatte. Diese Sicherheitsstellung blieb von nun an eine dauernde Einrichtung. Einige andere kleine Verpflichtungen kamen für Röper noch dazu 56 ).
Mit dem starken Wachsen der Betriebsgröße der Mühlen, das, wie wir berichteten, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einsetzte; verband sich natürlich eine Erhöhung der Pachtsummen. Gleichzeitig setzte ein Schwanken der Meinung über den Wert der gebundenen Wirtschaftsform ein. Die besonders schlechte Finanzlage der herzoglichen Kassen um diese Zeit ist bekannt 57 ). Der Streit des Herzogs Friedrich mit der Kammer, der sich Jahrzehnte hinzog, berührte das ganze mecklenburgische Wirtschaftsleben. All das machte sich bei der Verpachtung der Mühlen stark bemerkbar. 1763 wurde die Pacht aller Mühlen um 500 Rtlr. 28 ß N 2/3 erhöht und dem Müller die Sonderleistung des oben erwähnten Mühlenbaues auferlegt. Wenn auch das Wachsen der Bevölkerung, die Entwertung des Geldes hierbei mitspielte, so hatte doch das zähe Drängen der Kammer auf höhere Pacht mehr seinen Grund in den eben


|
Seite 111 |




|
genannten Dingen. Nach Röpers Tode 1785 wurde der Ertragsanschlag für einen Pachttermin auf 3416 Rtlr. 41 ß außer zu lieferndem Korn festgesetzt. Meister Volrad Wasmuth, "ein nicht unbemittelter und friedfertiger Mann", bot in dem Termin - es handelte sich nicht mehr um einfache Verpachtung, sondern um nackten Meistbot ohne Berücksichtigung des bisherigen Pächters - allerdings noch mehr, nämlich 3600 Rtlr., dazu 98 Drbt. reinen Roggen, den er mit 8 Scheffel Aufmaß à Last zum herzoglichen Kornboden zu liefern hatte.
Nachdem schon 1763 Erwägungen über getrennte Verpachtung der Mühlen gepflogen waren, trat diese 1817 wirklich ein. Die Ertragsanschläge der Kammer bezifferten sich für Binnen- und Bischofsmühle auf 7886 Rtlr. Die Versteigerung erbrachte
| 5025 Rtlr. | für die Binnenmühle, | |
| 3655 Rtlr. | für die Bischofsmühle (mit Windmühle), | |
| ---------- | ||
| Summe | 5025 Rtlr. | Überschuß 794 Rtlr. |
Dabei hatte schon der Ertragsanschlag die Pacht der letzten acht Jahre um 1821 Rtlr. überstiegen; der Termin brachte also einen Gesamtüberschuß von 2614 Rtlrn. Schon vier Tage nach dem Termin erteilte das großherzogliche Ministerium den Zuschlag und gestand 16 Vertragsjahre zu. Fast scheint es, als sei es kein Zugeständnis, sondern als wolle das Ministerium diese hohe Pachtsumme möglichst lange festhalten; um so mehr könnte man dies glauben, als Jahre schweren wirtschaftlichen Rückganges folgen. Zunächst brachte freilich noch im selben Jahre der Termin zur Veräußerung des Erbzinsrechtes von Neumühl die Summe von 12510 Rtlr. durch Wasmuths Erben, was die Kammer in höchstes Erstaunen setzte.
Die Mißjahre brachten für alle drei Betriebe den vollen Zusammenbruch. 1824 mußte der Großherzog die Binnenmühle zurücknehmen unter einem jährlichen Verlust von 2200 Rtlr.; der neue Pächter Glamann wurde dann 1830 freilich schon wieder auf 3000 Rtlr. gesteigert; er zahlte sie auch. Wiencke, der neue Pächter der Bischofsmühle, war von Wasmuth jun. nur vorgeschoben, war in Wirklichkeit dessen Verwalter mit einem Gehalt von 300 Rtlr. Als Wasmuths Erben ihm seinen Vertrag nicht halten wollten, klagte er gegen sie; andererseits wollte er aber auch nicht von seinem formalen Recht, der Pachtung, Abstand nehmen. Bei einer neuen Versteigerung


|
Seite 112 |




|
1825 setzte er sein ganzes Vermögen daran, die Pachtung zu behalten. Bald aber bat er um Herabsetzung der Pacht und um Rücksichtnahme bei der Zahlung seiner rückständigen Pachtsummen von 3500 Rtlrn. Lange blieb der Großherzog unnachgiebig; er befahl von neuem allgemeine Versteigerung. Diese brachte plötzlich nur 1860 Rtlr.; 2850 waren gefordert. Nach vielen Schreibereien hin und her steigerte Wiencke sein Gebot auf 2200, dann auf 2400, zuletzt auf 2500 Rtlr. Zu diesem Preise erhielt er die Pachtgenehmigung mit Auferlegung vieler kleiner Bedingungen. Als er 1830 starb, mußten seine Erben wieder um die Pacht kämpfen und sich schließlich auf die Summe von 2800 Rtlrn. einlassen; auch im Streit um die Rückstände erfolgte endlich eine Einigung. Auch um Neumühl entspann sich ein großer Streit. Kuetemeyer, der Vertreter der Wasmuthschen Erben, führte ihn mit großer Kraft und Gewandtheit; bei seinem großen Ansehen konnte er sich Schroffheiten und Schärfen gegen die Kammer leisten, "die 1817 die Verpachtung rücksichtslos hochgetrieben habe". Hart blieben die Antworten der Kammer.
Grundzins und Zeitpacht für die Hufe betrugen 1725 Rtlr. 14 ß 6 Pf., der Mühlenanschlag 543 Rtlr. 14 ß 6 Pf. Letzteren setzte die Kammer 1826 auf 325 Rtlr. 19 ß 3 Pf. herab, womit Kuetemeyer sich zufrieden gab. Der Kampf ging aber weiter um die Rückstände und Pachtvorschüsse (diese wahrscheinlich der Ersatz für die frühere Sicherheitsleistung). Endlich verkaufte Kuetemeyer 1829 für Wasmuths Erben Neumühl um 8045 Rtlr. an den Müller Heldt von der Woldmühle; gegen 1817 ein großer Verlust.
Mit 1830 ungefähr brechen diese Pachtakten ab. Das ständige Wachsen der Bevölkerung, die modernen Einrichtungen der vermehrten Mahlmittel werden ständig steigende Pachtsummen gebracht haben. Festzustellen war der Preis für das Wohnhaus der Binnenmühle. Dieses wurde bei Aufhebung des Wassermühlenbetriebes für 2935 Rtlr. an Müller Voß verkauft, der von hier aus die Windmühlen am Wittenburger Tor weiter betrieb. Festzustellen war der Preis, für den Karl Pingel 1864 die Bischofsdampfmühle mit Wasser-, Bock-, Holländermühle kaufte, wobei einiges Inventar schon sein eigen war. Der Preis für alle diese Mühlen mit einem Mahlkontingent von 82000 Scheffeln, von denen 6600 aus der Stadt, die übrigen aus 28 Domanialdörfern kamen, betrug 43 100 Rtlr.


|
Seite 113 |




|
Nicht nur von diesen rein wirtschaftlichen Fragen des Pachtverhältnisses der Müller, sondern auch von der förmlichen und rechtlichen Seite der Mühlenverpachtung gewinnt man ein klares Bild.
Die Pächter hatten den Müllereid zu schwören, wie er in der Polizeiverordnung von 1572 steht (in der von 1516 noch nicht vorhanden) 58 ) und wie er in einer zweiten Form aus der Zeit Adolf Friedrichs I. von etwa 1620 erhalten ist 59 ). Die Eidesleistung kam wahrscheinlich um die Mitte des 16. Jahrhunderts auf. Da der Übergang aus der Eigenwirtschaft zur Verpachtung der Mühlen in dieses Jahrhundert fällt, liegt der Gedanke eines Zusammenhanges des Müllereides mit der veränderten Wirtschaftsart nahe, wenngleich er sich nicht genau erweisen läßt. Seitdem wurden in den folgenden Jahrhunderten immer wieder Müllereide geleistet.
Leider ist nur ein einziger Pachtvertrag erhalten, der des Müllers Jörn vom 11. Juni 1677 60 ). Der Vertrag ist auf zwei Jahre geschlossen; als Pachtzeiten kommen sonst noch vor 3, 6, 10, 12, 16, 18 Jahre. Ein Vertrag lautete bei der Binnen- und bei der Bischofsmühle immer auf Zeitpacht 61 ), während Neumühl mindestens seit 1784, wo Jörn als Erbmüller bezeichnet wurde, wahrscheinlich aber viel früher, im Erbpachtverhältnis stand. Nach jenem Vertrag waren die Lasten und Pflichten des Müllers: Pachtzahlung (Nr. 2 des Vertrages), freie Übernahme von Eisen- und Steinverschleiß (Nr. 3), gebührliche Behandlung der Mahlgäste, ehrliches Metzen bei bestimmtem metzenfreien Mahlen für Hofstatt, Prediger, Hofbediente und Schützenkönig, dazu Zimmermannsarbeit auf dem Schloß (Nr. 4), Erhaltung und Pflege der Gebäude, Geräte, Brücke und Schleusen (Nr. 5), Aufstellung eines Inventarverzeichnisses (Nr. 6). Bestimmungen über Herabsetzung der Pacht bei Kriegsschäden, Vorpachtrecht bei gleicher Pachtsumme, Bürg-


|
Seite 114 |




|
schaft des Müllers mit seiner beweglichen und unbeweglichen Habe, auch der seiner Familie, und eine Zeugenliste bilden den Schluß des Vertrages.
Inventarverzeichnisse werden des öfteren erwähnt, es fanden sich aber nur zwei nicht sehr umfangreiche der Bischofsmühle von 1578 und 1600 62 ).
Mehrere vorher getroffene Abmachungen, Verhandlungen, Erwägungen der Kammer sind vorhanden, die aber in dem wirklichen Pachtverhältnis nicht immer aufrechterhalten blieben, Aus ihnen sei nur erwähnt die seit alters gebräuchliche Bestimmung: Holz und Materialien sollen bei Ausbesserungen dem Müller gereicht werden, eine Bestimmung, die in Jörns Vertrag nicht klar zum Ausdruck kam. In diesen Erwägungen traten im Jahre 1763 zuerst die Gedanken der getrennten Verpachtung der Mühlen und des Wettbewerbs der Betriebe hervor; dabei waren natürlich das Recht des Mahlzwanges, des jus banni oder des Mahlbezirkes, das Metzen in natura (statt in Geld oder nach Gewicht) lästig. Die Empfehlung solcher Pläne, die uns eigentlich in das 19. Jahrhundert zu gehören scheinen, waren noch sehr vorsichtig; wie die Kammer berichtete, waren eines Tages Vorschläge der Polizeikommission, die nach dieser Richtung zielten, sogar völlig aus den Akten der Kammer verschwunden.
1809 schlug Stüdemann bei einem Antrag zu einem neuen Pachtvertrag vor: "Zur Behebung aller Schäden im Mühlenbetrieb, die für Bürger, Verpächter, für die Qualität des Mehles doch noch immer vorhanden sind, ist das einzige Mittel: Freie Konkurrenz, Verpachtung ohne Bevorrechtung. Malchin ist sehr zufrieden damit, Rostock, Güstrow, Waren, Malchin haben weder Metze noch Mahlgeld und sind ein Beispiel, daß es auch ohne dem gut geht; Schwerin steht einzig in der Welt da." Erst 1817 bekannte sich auch der Großherzog grundsätzlich zu diesem Gedanken, erklärte aber, die örtlichen Verhältnisse der Schweriner Mühlen zwängen zu dem anderen Wege. Noch in den dreißiger und vierziger Jahren schwankte die Kammer zwischen beiden Wegen; es lockerten sich die Formen der gebundenen Wirtschaftsart, der Mahlzwang wurde durchbrochen und erleichtert, die Bannbezirke verschoben sich, die Pungen-


|
Seite 115 |




|
wagen durften in andere Bezirke fahren, bis 1869 mit der Aufhebung des Zunftwesens und der vollen Durchführung freier Wirtschaftsformen auch im Mühlenwesen alle alten Einrichtungen dahinschwanden.
Zu den Rechtspflichten der Müller gehörte auch die Beachtung des herzoglichen Rechts auf Alleinhandel mit Mühlensteinen 63 ). Seit 1530 liegen darüber Akten vor. Wann es entstanden ist, ob neben ihm ein gewisser selbständiger Handel der beiden Städte Wismar und Rostock bestand, die im Mittelalter stärksten Mühlensteinhandel hatten, ist nicht zu erkennen. Boizenburg als der Hafen des Güstrower, Dömitz als der des Mecklenburger Landesteils, waren die Lagerplätze der aus dem Elbsandsteingebirge bezogenen Steine, welche gelegentlich auch aus Perleberg kamen. Die rheinischen Steine - es waren wahrscheinlich französische Hartsteine: "Franzosen" - wurden meistens über Hamburg bezogen. Dieses Recht auf Alleinhandel bestand unverändert bis 1781. Die Zwangsmahlgäste waren verpflichtet, ihren Müllern die Steine gegen Entlohnung anzufahren. In den letzten Jahren vor 1781 häuften sich die Klagen, daß die Müller sich der Pflicht entzogen, das herzogliche Recht zu achten; dabei erkent man nicht, wo sie kauften. Es erfolgten Mahnungen an die Müller, bei 50 Rtlrn. Strafe nirgends anders als vom Elbzollkommissar Ehlers in Dömitz zu beziehen, dem der Betrieb des Mühlensteinhandels bis Ostern 1781 verpachtet war. Kurz vor Ablauf dieser Pachtzeit wurde am 12. Januar 1781 den Müllern im Domanium die alte Verpflichtung vor der Hand erlassen; dafür setzte der Herzog voraus, daß die Müller sich des Rechts der freien Anfuhr durch Zwangsmahlgäste begäben. Die allgemeine Verordnung über die Aufhebung des Alleinhandelsrechts auf Mühlensteine wurde in den Mecklenburger Nachrichten vom 27. Januar 1781 veröffentlicht.
Pachtverhältnisse sind auch vor Ablauf der Pachtzeit aufgehoben worden. Jochim Hoykendorf wurde im Frühjahr 1676 seiner Pachtung enthoben und durch einen langen Rechtsstreit wegen vielerlei Verfehlungen zur Rechenschaft gezogen; für ihn führte ein Jahr lang der Salz- und Oberakzisemeister Daniel Weisel eine harte Verwaltung mit genauester Buchführung; von ihr sind Reinschrift und Unterlagen vollständig


|
Seite 116 |




|
erhalten; über seine kühnen Abrundungen darin ist oben berichtet worden. Auch der Mühlenpächter Ahrens verlor wegen seiner Unterschleife die Mühlen, und zwar auf Drängen der Mühlenzunft 64 ). Das war im Jahre 1725. Ein weiterer Fall vorzeitiger Zurücknahme des Pachtgegenstandes durch den Großherzog Friedrich Franz I. ist oben bei der Darstellung der Pachterträge behandelt worden.
Die Frage der staatlichen Gesetze über das Mühlenwesen soll nur kurz gestreift werden. Auf den Unterschied zwischen der Polizeiordnung von 1516 und denen von 1562/72 ist hingewiesen. Der Landesgrundgesetzliche Erbvergleich enthält in Beilage Nr. VII (Instruktion für die Einnehmer bei dem städtischen Modo Contribuendi), Anmerkungen zu Kapitel 6 und 7, neben einer Eidesformel Bestimmungen über die Steuerpflicht der Müller. Gewerbe- und Nahrungssteuer brauchen die Leute mit Kopf- und Kammersteuer nicht zu zahlen 65 ). An bestimmten Angaben über Steuern ist nur eine vorhanden: Hancke berechnete 1709 seine Ausgaben für die Mühle; zu ihnen gehörten 16 Rtlr. Lizent und Kopfgeld. In einer Rundfrage der Kalkulatoren 1770 sind nach Ansicht des Herzogs Friedrich die Müller mit in die Gewerbe- und Nahrungssteuer eingeschlossen, obgleich er zweifelte, daß durchgehends auf diese Erlegnisse gehalten würde. Entsprungen war diese Rundfrage einem früher eingetretenen Fall. Meister Röper von der Binnenmühle war 1756 zur Gewerbe- und Nahrungssteuer veranlagt worden; er hatte sich über die Steuerstube beschwert, Herzog Friedrich aber die Bitte in puncto exemtionis abgelehnt. Die endgültige Regelung erfolgte dann 1779 durch die allgemeine Verordnung: die Müller haben trotz des Rechtes auf Freiheit von Gewerbe- und Nahrungssteuer doch für den Fall, daß sie durch Malzen, Brennen und großen Verkehr (heißt vermutlich Mehlhandel) bürgerliche, mithin steuerpflichtige Nahrung treiben, ordentlich und ediktmäßig steuern müssen. Erwähnt sei auch


|
Seite 117 |




|
die Angabe über die Türkensteuer des Bischofsmüllers aus der Zeit, als er noch zum Stift Bützow gehörte. Er zahlte 1579 = 6 ß; 1576 = 8 ß; 1596 = 16 ß; 1597 = 20 ß; 1600 = 8 ß; 1602/3 = 12 ß jedes Jahr.
Die Bestimmung in dem LGGEV. Art. 14 §§ 259 und 261 über Mühlen bezieht sich auf ritterschaftliche Handwerker. Der Schweriner Mühlenpächter war aber amtssässig, Domanialeinwohner. Erst im Anfang des 19. Jahrhunderts erwarb er das Bürgerrecht der Stadt Schwerin.
Mit diesen Ausführungen ist schon das Verhältnis der Mühlen zur Stadt gestreift. Mehrfach war gesagt, daß die Stadt Schwerin eine Sonderstellung im Mühlenwesen hätte. Im Mittelalter hatte der Rat dem Kloster Reinfeld seinen Schutz zugesagt, er mußte sich ja die Inhaber der Mühle günstig stimmen. Der Rat konnte zunächst nichts weiter tun, als etwaige Beschwerden seiner Bürger zu unterstützen, deren Zwangsmahlpflicht zur Binnenmühle aktenmäßig erst kurz vor dem Dreißigjährigen Kriege festgestellt werden konnte. Freilich konnte es dabei vorkommen, daß unter den abgefaßten Zwangsmahlgästen, die versuchten, ihr Korn auf der Bischofsmühle mahlen zu lassen und dem Binnenmüller seine Metze zu entziehen, sich ein Ratsverwandter fand 66 ). Auch in dem großen Rechtsstreit Jochim Hoykendorfs vertrat der Rat die Belange seiner Bürger in nachdrücklicher Weise. In der Zeit, als bei der Kammer die ersten Zweifel an dem Wert der gebundenen Wirtschaftsart auftraten, machte der Rat den ersten Versuch, eine selbständige Stellung gegenüber dem herzoglichen Mühlenmonopol zu erreichen 67 ). Am 26. Juli 1763 legte er dem Herzog einen umfangreichen Antrag vor, alle Mühlen zusammen zu gleichen Bedingungen wie Mühlenmeister Röper in Pacht zu nehmen und für gute Bedienung der Einwohner zu sorgen (wobei schärfster Tadel an Röpers bisherigem Verfahren geübt wurde). Am Tage vorher hatten Rat, Sechszehnmänner und Bürgerschaft diesen Plan gutgeheißen. Unter Führung des


|
Seite 118 |




|
Stadtsekretärs Kuetemeyer hatten sich drei reiche Bürger, Bürger und Kornhändler Hollien, Bürger und Bäcker Görentz, Bürger Lütgens, verpflichtet, der Kammer gegenüber für Geldbeschaffung und für gute Afterpächter der Mühlen zu bürgen. Auf Empfehlung seines Rates Blume antwortete Herzog Friedrich am 1. August, daß man von Röpers Vertrag, über den schon Ende April in der Kammer verhandelt war, noch Abstand nehme, daß mit den Deputierten des Rates zu verhandeln und die Frage der Stempelsäcke (s. unten!) noch zu beheben sei, daß die anderen "Conditiones preferabel" seien. - Wie mag die Sache weiter verlaufen sein? - Wir wissen es nicht. Aber Röper hatte bald darauf wieder die Mühle, und schon 1765 beschwerte sich der Rat über den großen Kornhandel Röpers, der über den Handel mit Metzenkorn weit hinausgehe, ohne daß Röper an den Oneribus civicis (städtischen Lasten) teilnähme. Röpers Gegeneingabe wurde kurz und schroff von der Kammer abgelehnt: "Du hast dazu keine Konzession; der § 374 des LGGEV. spricht wider dich." Dabei wurde dem Rat mitgeteilt, daß der Brüeler Pachtmüller durch Gerichtsbeschluß verurteilt wäre, die Bürgerschaft zu erwerben; auf des Rates Bitte wurde ihm von dem Herzog das Brüeler Urteil zugestellt. Röper aber tat, als habe er alles Recht auf seiner Seite, und machte gar keine Miene, städtische Obliegenheiten zu erfüllen. Ein jahrelanger ähnlicher Streit wurde 1825/27 und 1831/40 zwischen der Stadt und dem Mühlenpächter Glamann ausgefochten; wieder hieß die städtische Beschwerde: Der Mehlhandel des Binnenmüllers bringt viel, aber der Müller zahlt nur wenig. Einen zweiten großen Vorstoß, die Mühlen in seinen Betrieb zu bekommen, machte der Rat vor dem Versteigerungstermin 1816. Vergleiche mit anderen Städten, z. B. Parchim, das überhaupt keine Mühlenabgaben kenne, auch mit anderen Ländern, wurden von der Stadt in ihrem Antrag herangezogen. Der Bericht des Amtshauptmannes Glöckler, der zwar viele Schäden in den Schweriner Mühlenverhältnissen zugab und gute Verbesserungsvorschläge machte (der Bischofsmühle einen Weizenmahlgang einzurichten, die Binnenmühle durch Beigabe einer Windmühle mit Weizengang und durch bessere Leitung der Seeke vom Pfaffenteich unabhängig zu machen), gipfelte in dem Satz: "Der Rat will sich nur allem Mühlenzwang entziehen." Man fühlt die Abneigung des übergewissenhaften Beamten gegen so viel bürgerlichen Freiheitssinn. Auch


|
Seite 119 |




|
der begutachtende Kammerrat wußte der Schäden noch neue: in trockenem Sommer mahlt die Bischofsmühle nur mit einem Gang, und oft ist Korn zum Abmahlen schon nach Moidentin gebracht 68 ). Wenn er mit Wismar und Rostock verglich, dann kam er doch wieder zu ablehnendem Bescheide: "So lange Mühlen verpachtet werden, muß der Zwang bleiben, bei Eigentum wäre es anders." So fand der Großherzog die Lösung in dem Vergleich, daß die Schweriner Mühlen geteilt würden, daß Neumühl in Erbpacht, die Stadtmühlen in Zeitpacht ohne weiteren als bestehenden Mahlzwang ausgegeben werden sollten, daß Landbaumeister Wünsch mit dem Amtshauptmann über die besten Mittel dazu verhandeln und Vorschläge machen sollte. Die Stadt hatte also wiederum nichts erreicht. Auch für sie kam der wirkliche Anbruch der Neuzeit erst mit dem Jahre 1869 der Entstehung der Gewerbefreiheit.
Einer städtischen Angelegenheit soll hier noch gedacht werden, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Mühlenwesen steht. Als 1780 bei einer gründlichen Ausräumung des Fließgrabens in der Nähe des Mühlentores (anscheinend nicht durch den Müller, sondern durch den Rat) dem am Fließgraben wohnenden Bürger D. Bernien seine lebende Hecke beschädigt wurde und er um ein neues Bollwerk am Fließgraben bat, bewilligte es die Stadt bereitwillig, Bernien mußte aber die Hälfte des Holzes bezahlen. Der Grund für dieses Vorgehen der Stadt, der nur beiläufig erwähnt ist in den Worten des Bürgermeisters: "Wir wollen die Einfahrt in unsere Stadt etwas anständiger machen", ist doch von Bedeutung. Da man aus Wittes mecklenburgischen Kulturbildern den dürftigen Zustand der damaligen Städte und das gleichgültige Verhalten der Stadtverwaltungen gegenüber Schmutz und Unordnung kennt, so fällt dieser Verschönerungssinn der Schweriner Stadtverwaltung ganz besonders ins Auge 69 ).
Die Windmühle des Binnenmüllers und die des Bischofsmüllers standen von Anfang an auf städtischer Feldmark, wie das eine Karte von etwa 1847 nachweist, die im Besitz der Reichsbahndirektion Schwerin ist. Daher steht die Jurisdiktion und Polizei auf ihnen den städtischen Behörden zu. Auf der Bischofsmühle hat die Stadt um 1864 nur die Sicherheitspolizei,


|
Seite 120 |




|
aber im Kaufvertrag H. Pingels wird diesem in § 18 auferlegt, daß er sich jederzeit gefallen lassen muß, daß auch auf ihr Jurisdiktion und Polizei den städtischen Behörden übertragen werden. Das wird bald darauf durchgeführt sein. Der Platz vor dem Mühlengebäude geht aber erst 1875 in Stadtrecht über.
Das Verhältnis der Mühlen zueinander brachte durchweg recht bewegte Zustände und Ereignisse. Hier in Schwerin war das nicht der Fall. Gegensätze zwischen Grafen- und Bischofsmühle, wie sie im Mittelalter um die Stauhöhe bestanden hatten, kamen seit dem Westfälischen Frieden nicht mehr vor, da nun die Mühlen in einer Hand waren. Vor und im Dreißigjährigen Kriege wurde in einigen Fällen das Ausmahlen, so nannte man das Mahlen in einem anderen als dem Zwangsbezirk, den Schweriner Bürgern leicht gelegt. Ein Bericht des Amtmannes Pellikan 1593 an den Administrator Herzog Ulrich zeigte, daß kurz vorher solche Fälle durch Räte von beiden Seiten in Richtigkeit gebracht und jedem Teil ein Bericht zur Nachachtung zugestellt war. Selbst der Schwedenobrist Ribling und sein Leutnant in Groß-Medewege, welche die Bischofsmühle unter sich hatten, erhielten in diesem Punkt Recht für ihre Mühle. Auch in der Frage des Ausmahlens waren nach dem Kriege die Gegensätze geschwunden. Erst im 19. Jahrhundert traten die Mühlen wieder in Wettbewerb zueinander; aber nun waren die alten Streitgründe des Wasserstaues nicht mehr von Wichtigkeit, denn beide Betriebe hatten bei niedrigem Wasserstand einen Ersatz der Triebkraft in ihren Windmühlen.
Der Wettbewerb der Mühlen um die Grenzen ihrer Bannbezirke war in Schwerin ebenfalls gering: die Binnenmühle hatte das Gebiet der Altstadt, die Bischofsmühle die Schelfe und die altbischöflichen Dörfer 70 ), Neumühl einen großen ländlichen Mahlbezirk von Pampow am Buchholz bis Trebbow und Dalberg an der Stepenitz. Nach Südosten grenzte an Schwerin der Bannbezirk der Banzkower Mühle mit Consrade und Mueß als den nächsten Dörfern; die hatten es sicher bequemer nach Banzkow als nach Schwerin auf dem umständlichen Weg durch die Stadttore mit ihren einschränkenden Bestimmungen. Zwischenfälle mit Banzkow fanden sich in den Akten nicht.


|
Seite 121 |




|
Ein Streit zwischen dem Trebbower Gutsmüller Hans Ratke aus der Düsterloksmühle, die fast bis 1800 an der Au südlich vom Trebbower See im nördlichsten Winkel des Waldes lag, und dem Binnenmüllermeister Adam Wilcken 1651 drehte sich nicht um irgendwelche sachlichen Dinge, sondern war eine reine Beleidigungsklage. Wilcken hatte den Ratke vor Knechten einen Pfuscher genannt, mußte ihm aber nach vielen Gerichtsverhandlungen eine Ehrenerklärung geben. Zwischen der Binnenmühle und Neumühl wird nur zweimal ein Streitfall erwähnt. 1682 beschwerte sich Jochim Jürgen über seinen eigenen Bruder, Müller in Neumühl, daß er Mehl zur Stadt verkaufte, daß Leute aus der Stadt Korn nach Neumühl zum Ausmahlen brächten. Der Herzog befahl dem Generalmajor von Halberstadt, er sollte es verhindern, d. h. die Torposten sollten die Müllerwagen zurückweisen. In einer ähnlichen Beschwerde Hanckes 1711 wurde zum Ausdruck gebracht, daß solches Ausmahlen auf den Landmühlen dem Steuerkommissar gleichgültig wäre, wenn er nur seine Steuer bekäme, daß er, der Müller, aber die Schädigung nicht ertragen könnte. Erst im 19. Jahrhundert setzte für den Neumühler Müller ein großer Wettbewerb mit seinen ländlichen Nachbarmüllern ein. Man durchbrach immer mehr die feststehenden Banngrenzen 71 ), von dem Gedanken des bürgerlichen Individualismus und der in Preußen geltenden Gewerbefreiheit beeinflußt. Zwangsmahlgäste gingen zu fremden Mühlen über; Pungenwagen aus Dambeck, Mühlen-Eichsen, ja selbst aus der Grönings-Mühle bei Wismar suchten seine Mahlgäste zu gewinnen und fuhren ihm immer wieder in seinen Bezirk. Die Regierung verhielt sich schwankend, verbot und strafte hier, gewährte Sonderfreiheit dort, hob Vorschriften ganz auf und kehrte dann doch wieder zu dem alten Verfahren zurück. Am verwirrtesten ist die Sache in den vierziger Jahren; wiederum ist es das Jahr 1869, das mit überalterten Sitten aufräumte.
Die zunftmäßigen Verhältnisse der Müller müssen gesondert in einer Arbeit über die Müllerzünfte des ganzen Landes behandelt werden. Hier ist nur so viel zu sagen, daß von der alten Form einer freien, selbständigen Müllerzunft für Schwerin keine Nachrichten vorliegen, daß aber die neue Form der Zunft, die sich Ihre Sonderrechte vom Herzog erbat, von Schwerin aus-


|
Seite 122 |




|
ging. Jener berüchtigte Hoykendorf hatte sie in den letzten Jahren vor seinem Sturz gegründet; mit ihm schlief die Sache wieder ein; am 16. Januar 1700 griff Hancke den Gedanken der Zunft wieder auf. Auf seinen Antrag gab der Herzog in einer Zunftrolle für die Müller des ganzen Landes diesen ihre Sonderrechte. Ein reges Zunftleben entwickelte sich; die eine Landeszunft teilte sich in Amtszünfte; aber all das führt über Schweriner Angelegenheiten und den Rahmen dieser Arbeit hinaus.
Der Stand und die Person des Müllers galten als unehrlich 72 ). In den Akten der Schweriner Mühlen ist darüber nicht viel zu finden. 1671 klagte der Malzmeister Ahrens, der den Brauern und Bäckern wegen richtiger Zahlung der Akzise auf die Finger zu sehen hatte, daß sein Sohn, der das Mühlenhandwerk gelernt, darauf gewandert und in Wismar auch vorgerücket ist, und er selbst "bloß wegen dieses meines Amtes vor Schelme gescholten" seien, daß man dem Sohn Schurzfell und Bindaxt genommen und ihn habe unehrlich machen wollen. Wenn in demselben Jahre Hoykendorf eine Flut von Schimpfworten der Hedwig Turow, Bürgers und Kürschners Andreas Dabelsteins Eheweibes, über sich ergehen lassen mußte, so hatte diese tapfere Frau sicher Recht mit den Vorwürfen, er sei ein Dieb und Schelm, weil er zu viel metze (matte, vgl. S. 124). In dem anschließenden Rechtsstreite wurde in vielen Verhören aber nur ein richtiger Rattenschwanz von Klatsch vorgebracht; wie sein Ausgang war, ist nicht zu ersehen. Vier Jahre später ereilte den Hoykendorf sein Schicksal. In seinem letzten Rechtsstreite kamen alle seine Betrugsarten und Unterschleife, so viel nur ein Müller begehen kann, an das Tageslicht. Sie sollen weiter unten bei der Behandlung des Mühlenbetriebes besprochen werden. Nur ein Müllerwort sei hier erwähnt: "Schäfer, Müller und Leineweber sind nicht die reinlichsten unter denen, so tapfer zugreifen." Hoykendorfs eigene Leute nannten ihn den alten Dieb. Der Matterknecht Peter Schwitzer wurde von seinem Kameraden mit der Redensart gewarnt, "wenn er nicht aus der Mühle kommen wehre, hätte er Leib und Seele vermattet". Auch später sind es immer die gleichen Klagen über die Unehrlichkeit, über zu vieles Metzen, die gegen die Müller erhoben wurden. Hoykendorf und Röper


|
Seite 123 |




|
jun. scheinen die schlimmsten gewesen zu sein, während 1730 dem Jörn nachgesagt wurde, er sei bis dahin der ehrlichste gewesen.
Zu der Geschichte des Mühlenwesens gehört die Entwicklung der technischen Einrichtungen und des Betriebes. Soweit diese Dinge Ausbesserungen und Vergrößerungen betrafen, sind sie oben behandelt. Es kann sich hier natürlich nicht um eingehende Durcharbeit jedes einzelnen technischen Teiles der Mühle handeln. Besonders Fragen der Bauart von Wasserrädern verschiedener Art, von Vorgelegen usw., oder die Frage der mathematischen Berechnung von Formen der Windmühlenflügel, der Bauart von Kammrad, Hauptwelle und Königswelle, von Kron- und Stirnrädern müssen völlig wegfallen, da in den Akten über diese Dinge nichts zu finden war. Für diesen Teil der Arbeit muß das Wesentliche der Mühleneinrichtung und des Betriebes als bekannt vorausgesetzt und können nur die Funde aus den Akten in ihm zur Darstellung gebracht werden.
Zu den ältesten Stücken über technische Teile der Mühle gehören die zwei Inventarverzeichnisse der Bischofsmühle von 1578 und von 1600 73 ). Unter Fortlassung der unwichtigen Dinge, wie Schleete, Bedachungsmaterial, sollen die Hauptsachen genannt werden: Sohlen im Grundwerk sind baufällig; Mühlensteine (nach Alter und Brauchbarkeit); das große Mühleneisen und die Pfanne 74 ), vier Mühlenbicken; die vier eisernen Bänder und die zwei eisernen Zapfen; mit zwei Driefscheiben, so dazu gehören (1578) zwei Triefbende gleichfalls (1600); Aufstellung oder Gerüst, darauf man den Mühlenstein aufbringet (1578), das Gerüste zum Mühlenstein ist nicht vorhanden, ist auch bei dieses Müllers Zeiten nicht vorhanden gewesen (1600) 75 ).
Über die Räder und Wellen ist nichts weiter erwähnt als einmal der Bedarf an Hartholz. Oft aber begegnet die Läufte


|
Seite 124 |




|
oder Zarge, jenes Holzgestell, das die Steine umgibt, um das durch die schleudernde Bewegung der Steine herausfliegende Mehl aufzufangen und durch eine Öffnung abzuleiten. Die Zarge war der häufige Anlaß zu Betrügereien und folglich zu Beschwerden. Zwischen dem Bodenstein und der Zarge blieb natürlich ein Rest Mehl zurück, was der Korn liefernde Laie nicht wußte. Dieser Raum war manchmal mit Absicht so breit gehalten, daß er 1-1 1/2 Scheffel faßte. Der "auf Sauberkeit haltende" Müller ließ, natürlich nur aus Gründen der Sauberkeit, ihn öfter ausräumen - der Inhalt, sein Gewinn. Wer am nächsten Tage als erster mahlte, mußte den Raum in der Zarge wieder füllen; auch wenn er mißtrauisch dem Mahlvorgang und dem Treiben des Müllers zuschaute, merkte er diesen Betrug nicht. In Gegenwart der herzoglichen Knechte schalt Hoykendorf seine Knechte, daß man für das herzogliche Korn, das gerade am frühen Morgen eintraf, die Mühle und besonders die Steine nicht gereinigt habe. Nur um der Reinlichkeit, nur um des Hofes willen? - Meister Ahrens, der seinem Lehrjungen befahl, Löcher in die Mattenkiste zu bohren, der ihm zeigte, wie er durch brav Weizenstehlen sich silberne Jackenknöpfe verdienen könnte, hatte einen besonderen Ausdruck für das Reinigen des Raumes in der Läufte: Treben. Was hat man gegen den Betrug getan? - Gestraft, wenn er zu groß und entdeckt wurde. Die erste Vorschrift für eine Begrenzung des Abstandes zwischen Stein und Läufte auf zwei Zoll, für Auffüllung des Hohlraumes mit Kleie und Steinmehl fand sich 1864 im Kaufvertrag des Bischofsmüllers Pingel.
Am ausführlichsten ist die Matte behandelt: "Ein Messingmatte (1578), ein Messing, doch alte und geflickte Matte (1600). Die Matte, hd. die Metze, war das Einheitsmaß für Korn und Mehl; l4 Metzen = 1 Scheffel Roggen oder Weizen 76 ); 12 Metzen = 1 Scheffel Malz, das loser liegt. Das Messen blieb unverändert bis ins 19. Jahrhundert hinein. Um die Matte drehte sich das halbe Mühlenleben. Matte war zugleich das Maß der Entlohnung für das Mahlen, der immer gültige Grund aller Streitigkeiten und Klagen. 1676 war sie aus Eisen, 1699 wurde bei einer Prüfung des Betriebes eine neue aus Kupfer angefertigt, die der prüfende Küchenmeister Klähn lieferte. Wenn es da heißt, die alte sei vom Meister Jörn gemacht, der zugleich Zimmermann war, so ist anzunehmen, daß sie aus Holz war; auch heißt es da, es läge noch eine auf dem Boden,


|
Seite 125 |




|
wohl hundert Jahre alt. Die Form der Matte war meistens die des runden Kübels zu 4-5 Pfund Inhalt heutigen Gewichts 76 ). Bei ihr bestand die Seitenwandung aus einem einzigen gebogenen Brett. Doch gab es auch die schaufelförmige Matte, die Mattenkelle. Dem Hoykendorf wurde einmal nachgerühmt: "Er faßt die Matten beim Stiel, hält dieselbe vorn aus, mattet mit freier Hand und nimmt nicht mehr zu Matten, als was in freier Hand drauf liegen bleibt, läßt solches in die Molden schütten, nicht aber aus den Rümpen, Säcken oder Kufen die Matten in die Molden raken." Dieses Lob erhielt er freilich nicht in seiner letzten Zeit. Wenn 1723 die Matte laut Verordnung durchaus mit Streicheisen und Bolzen versehen werden mußte, so konnte das nur bei der runden Form geschehen. Nun mußte bei jedem Metzen die Oberfläche durch das Streicheisen geglättet werden; das Häufen der Matte war unmöglich, ein großer Verlust für den Müller. Im gleichen Jahre mußte auch schon Meister Ahrens verklagt werden, er habe Bolzen und Streicheisen von der Matte abgerissen. Die immerwährenden Klagen führten 1756 zu der Verordnung, daß die Metze auch in Geld entrichtet werden könnte. Die gewogene Metze setzte sich erst seit 1825 allmählich durch. Das gemetzte Mehl wurde in die verschlossene Mattenkiste geschüttet und aus ihr nur vom Meister entnommen. Die älteste Schilderung einer solchen lautet: "Der Khum oder Troch, aus ein Buchenholz gehauen zur Mattkisten, daran die Krampe und das Schloß, dem Möller zugehörig." Später trat diese Form nicht mehr auf. Der ganzen Zeitentwicklung entsprechend wurden sie nicht mehr so schwer wie mittelalterliche Kirchenladen oder eisenbeschlagene Truhen hergestellt. Die Ausübung des Metzens stand dem Matter, Matterknecht, Sackkieker schon in ältesten Zeiten zu. Neben diesen Gefäßen waren in der Mühle Kufen, Kübel, Bütten (große und kleine) in Benutzung, ohne daß im einzelnen Formen und besonderer Zweck ersichtlich wäre. Eine Metzenkufe von 1671 sollte zum Aufnehmen des angelieferten Kornes vor dem Metzen dienen; sie hatte 8 Scheffel Inhalt. Von diesen ließ Hoykendorf nur drei Matten nehmen, obgleich er nach einer herzoglichen Verordnung schon bei 6 Scheffeln zu 3 Matten berechtigt gewesen wäre. Wie alle Aussagen Hoykendorfs, ist auch diese über die besondere Größe der Metzenkufe sehr vorsichtig aufzunehmen. Das vorgeschriebene Maß


|
Seite 126 |




|
des Metzens war in jenen Jahren von 1 Scheffel Korn 1 Metze, von 3 Scheffel Malz 1 Metze.
Beim Anschlag zur neuen Verpachtung 1677 wurde die Metze von Weizen mit 1/13, die Metze von Roggen mit 1/12, die Metze von Malz mit 1/21 zugrunde gelegt, was nur ungefähr dem vorhergenannten Maß gleichkommt. Angaben über die rechtliche Höhe der Metze sind sehr spärlich, selbst im Vertrag sind sie mit allgemeinen Worten umschrieben. Das war den Müllern selbstverständlich sehr angenehm und öffnete dem Betrug immer wieder Tür und Tor. Später änderte sich die Maßzahl etwas: In einer Liste von 1753 über versteuertes Korn ist die Metze von Weizen, Roggen, Malz, Branntweinschrot und Futterschrot mit 1/12 des Scheffels gerechnet. Das war auch noch 1809 der Fall, als ein Antrag der Bäckerzunft auf Herabsetzung der Metze von 1/12 auf 1/16 bei Branntweinschrot abgelehnt wurde, und noch 1864, als im Kaufvertrag Pingels die Metze von jeglicher Kornart mit 1/12, aber von Malz mit 1/16 festgesetzt wurde. 1864 war natürlich längst die Matte nach Gewicht genommen, aber ihre Berechnung geschah noch immer nach der alten Art.
Zu den Maßen gehören auch die Stempelsäcke. Im Landesgrundgesetzlichen Erbvergleich, Beilage Nr. VII, war bestimmt: Stempelsäcke sollen Maße nach einem approbierten Rahmen haben (d. h. einen Scheffel enthalten), die Stempelung soll in Gegenwart des Steuereinnehmers geschehen, der Stempel hat an der Stempelnaht zu stehen; zu den Säcken darf kein gekrimptes, gekochtes, gewalktes Leinen genommen werden, auch der Saum nicht breit und oft umgeschlagen werden, ebenso nicht die Seitennähte; solcher Sack, ordentlich gehalten, soll für gültig passieren, Fälschungen sind dem Einnehmer zu melden, das Korn wird dann konfisziert und Strafe gezahlt. In einer Beschwerde des Rates von Schwerin, der über die Betrügereien mit Stempelsäcken völlig verzweifelt war, sagten die Beschwerdeführer, 1749 sei über Stempelsäcke ein Instrument herausgekommen, das aber leider nicht im LGGEV. enthalten sei. Diese amtlichen Säcke enthielten durch List und Betrug halbmal so viel, als wozu sie gestempelt, einige mehr als das Gedoppelte ihres Stempelzeichens - "aus bis ans Ende der Welt nicht zu elidierenden Ursachen".
Mit dem neumodischen Werkzeug, Waage genannt, verschwanden allmählich im 19. Jahrhundert Metze und Stempel-


|
Seite 127 |




|
sack. Wieder war es das Jahr 1763, das zum erstenmal dieses unglaublich neue Maßmittel der Waage in Betracht zog. Herzog Friedrich selbst stellte an seine Kammer die Forderung, Waagen in den Mühlen einzurichten; es blieb aber erfolglos. Als 1809 die Kammer unter Vorschlägen zur Verbesserung des Mühlenwesens einiger schon vorhandener Waagen Erwähnung tat, bei denen aber keine Aufsicht wäre, die auch schlecht bedient würden, empfahl sie Anstellung unparteiischer Wäger. Aber erst 1818 wurde die Anschaffung von Waagen Gesetz für die Mühlen. Es waren also Waagen in der Mühle; ihre Benutzung durch die Bevölkerung geschah aber nur gezwungenermaßen; erst 1835 konnte ein Müller schreiben, daß sich freiwilliges Wägen in den Mühlen mehrte. Zunächst gab es eine Waage nur auf der neuen holländischen Windmühle am Wittenburgerr Tor und auf der Bockmühle. 1827 wurde ein solches Wägegeschirr beschrieben: ein eiserner Wagebalken von 5 Fuß Länge, 2 tannenbretterne, mit Eisen beschlagene Schalen, woran 8 eiserne Ketten, jede zu 30 Gelenken, befindlich sind; die Gewichte hierzu sind 4 gegossene eiserne zu je 100 Pfund, ein gegossenes, eisernes zu 50, je ein gleiches zu 25, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1 Pf. Zwar beschrieb Landbaumeister Wünsch, dem man auch sonst Kenntnis und Einführung aller möglichen technischen Neuheiten und Erfindungen zutraute, die Schnellwaage, d. h. also die Dezimalwaage. Über ihre Einführung aber wissen die Akten nichts.
Über die Entwicklung der Mehlreinigung vom Beuteln zum Sichten war leider gar nichts in den Akten zu finden.
Der Mühlen- oder Pungenwagen, den man noch hie und da gelegentlich auf den Landstraßen als ein kennzeichnendes Bild aus dem Mühlenleben erblickt, war seit den ältesten Zeiten das notwendige Verbindungsmittel zwischen der Mühle und ihren Kunden, wie ja der Wagendriwer schon 1409 vorkam. Bemerkenswert ist es, daß die Räder der schweren Pungenwagen durch ihre Erschütterung auf mehrere Ruten Umfang hin das Pflaster der Straße schnell schlecht machen sollten. Immerhin sind im 18. Jahrhundert Mühlenwagen die schwerste Fuhrwerksart gewesen. Gegen den Vorschlag, den Mühlenwagen, wie in Hamburg, Blockräder zu geben, wandte sich 1769 Amtmann Streubel mit der Behauptung, nicht die eisenbeschlagenen, handbreiten Felgen seien schuld, sondern Räder anderer Wagen mit schmalen Felgen, weil sie einschneidend wirkten; Blockrädern könnte man keine breiteren Felgen geben, ihre Aus-


|
Seite 128 |




|
besserung alle 6-8 Wochen brächte keinen Vorteil. Mit dem Pungenwagen befuhr der Knecht ungestört von dem Wettbewerber seinen Bezirk, bis man im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts die alten Bindungen durchbrach. Besonders der Müller von Neumühl wurde in seinem Bezirk arg bedrängt. Er suchte sein Recht mit Amt und Landreiter, mit Strafen und Verträgen und mußte doch Schritt für Schritt vor der neuen Zeit zurückweichen. Wut und List, schlechte Geschäftszeiten und Sorge, Zusammenhalten ganzer Dorfschaften gegen mißliebige Müller ziehen in lebendigen, anschaulichen Bildern am Auge des Lesers der Akten vorüber.
Der Mühlenbetrieb war je nach Größe der Mühle, nach Zahl und Art der Arbeitskräfte sehr verschieden; noch heute sieht man in der einen Mühle peinliche Sauberkeit, in der andern Bruch und Schmutz; erlebt man in der einen genaue Buchführung, in der andern unzureichende Zettelwirtschaft.
Im allgemeinen war der Ablauf des Mahlbetriebes folgender: Der Zwangsmahlgast oder der Pungenfahrer brachte das Korn zur Mühle. Der Matter empfing es und nahm die Matte in Gegenwart des Mahlgastes; die Bäcker und Brauer mußten zugleich den Akzisezettel, den jeder Gewerbetreibende sich rechtzeitig von der Steuerstube zu besorgen hatte, abliefern; ohne diesen Zettel durfte der Müller von Bäckern und Brauern kein Korn annehmen. Der Müller war verpflichtet, jedem Mahlgast innerhalb dreier Tage sein Korn abzumahlen. Länger brauchte der nicht zu warten, sondern konnte vom Müller sich die Erlaubnis zum Ausmahlen bescheinigen lassen. Dabei entspannen sich die Streitigkeiten, die der Anlaß wurden zu einem Kammererlaß, der alles Schimpfen auf den Mühlen untersagte. Das Korn oder Mehl in der Mattenkiste stand unter Mitaufsicht des Mühlenschreibers, eines Unterbeamten der Steuerstube. Er führte den zweiten Schlüssel zur Mattenkiste. Er hatte auch die Annahme der Akzisezettel und die monatliche Verrechnung der Akzise mit Einreichung dieser Zettel an die Steuerstube. Solche Zettel befinden sich bei den Rentereirechnungen, ordentlich gebündelt, in großer Menge 77 ). Beim Abmahlen des


|
Seite 129 |




|
Kornes war der Müller mit seinem Matter und dem Jungen oft auf nächtliches Mahlen angewiesen, je nach Verhältnissen von Wasser und Wind. Aber nur bei Tageslicht durfte er Korn annehmen oder Mehl ausgeben. Die Kammer kannte eben die Betrügereien und die Schliche auf den Mühlen. Bei einer Durchschnittsleistung eines Mahlganges üblicher Größe von 8-10 Scheffeln die Stunde konnte der Müller seine Kunden ordnungsmäßig bedienen. Diese erhalten durch Pungenwagen oder Selbstabholung die von ihnen gewünschte Art des Mehles oder Schrotes zurück. Diese allgemeine Schilderung des Ablaufs im Betriebe mag genügen, da eine genauere Darstellung allzu mannigfaltigen, besonderen Erscheinungen Rechnung tragen müßte.
Die Arbeit des Historikers gilt dem alten Mühlengewerbe. Die neuzeitlichen Großmühlen mit ihren für die verschiedensten Zwecke fein durchdachten Maschinen sind in ihren wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen, in ihren Sitten und Gebräuchen der heutigen Gleichmacherei aller Fabrikbetriebe verfallen. Besichtigung und Durchforschung solcher Mühlenwerke beschäftigen den Techniker, Statistiker, Wirtschaftspolitiker. Dem Historiker gibt die Kenntnis solcher Betriebe erst den Blick für die eigenartigen Vorzüge altdeutschen Handwerks; in der Rückschau von der Großmühle aus geht ihm auf, was für ein Stück lebensvollster deutscher Kultur sich in tote Technik gewandelt hat. Das alte Mühlenwesen wird nie, weder wirtschaftlich noch rechtlich, wieder erstehen; als wertvolle technische Denkmale alter Zeit stehen heute die Wassermühle, die holländische und die Bockmühle da. Darum kann gerade hier die Arbeit des Historikers heute abgerundete Bilder zeichnen; sie muß auch heute einsetzen, ehe zu viel des Alten verloren geht. Eine Arbeit wie die vorliegende möchte zu weiteren Forschungen auf diesem Gebiet anregen. Nicht nur für die engere Heimatkunde, auch für die Kultur des gesamten Deutschlands liegen hier Forschungsaufgaben, die, als solche kaum gesehen, nur in wenigen, vereinzelten Fällen in Angriff genommen sind.


|
Seite 130 |




|
1. Liste der Schweriner Müller.
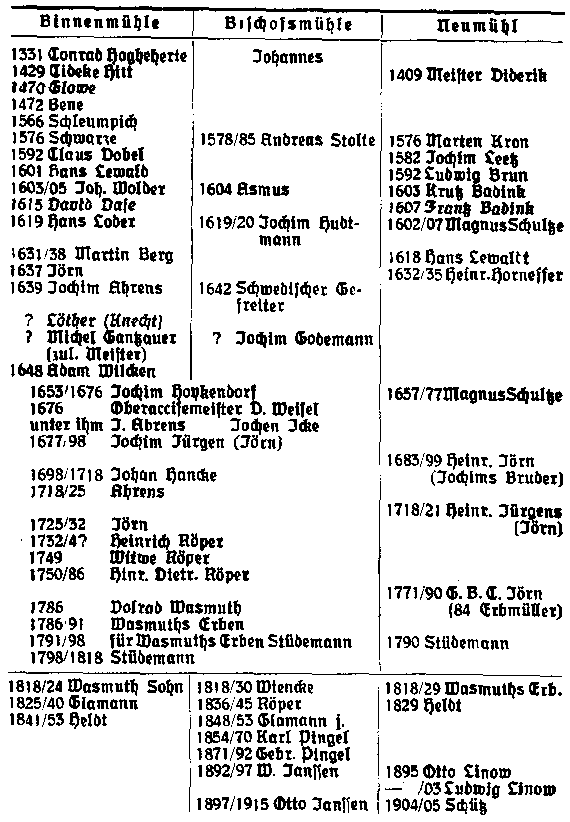


|
Seite 131 |




|
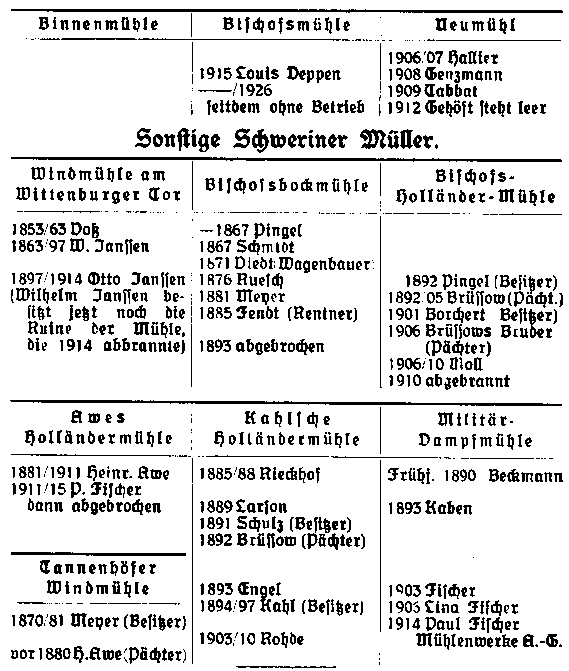
2. Müllereid von etwa 1620.
Ich Joachim Moller lobe und schwere, falls der durchl. hochwürd. hochgeb. Fürst und Herr, Herr Adolph Friedrich, Herzog zu Megklenburg, mein gnädiger Fürst und Herr, mir für S. F. Gn. Müller auf der Müle allhier zu Schwerin gnädig bestellen und annehmen lassen, daß demnach hochgedachten S. F. Gn. ich getreu, hold und gehorsamb sein, S. F. Gn. Frommes und Bestes jederzeit wissen und befödern, hingegen aber Schaden und Nachteil besten meinem Vermuggen nach wehren und abwenden, insonderheit aber S. F. Gn. Untertanen und Mülengeste schleunigst befodern, die-


|
Seite 132 |




|
selben mit keiner ungebürlichen Matten belegen, weniger einigen Betrug oder Falschheit drunter gebrauchen, noch durch die Meinigen solchs zu geschehen verhängen, keinem einigen Menschen an Malz, Weizen, Rogken oder Gersten mahlen oder in den Rumpf gießen, es ist mir dann zuvor ein Accis-Zettel überreicht, und ein mehreres an Korn, als darin enthalten, nit mahlen, solche Zettel in die dazu vorordente Lade stecken, den Scheffel nach Rostocker Maß zurichten, keinen einzigen Unterschleif so wenig in der Masse, als sonsten gebrauchen, auch, das solchs durch meine Knechte geschieht, nit verhengen und insgemein alles dasjenige verrichten soll und will, was einem redlichen Müller eignet und gebuert. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort.
3. Mühlenvertrag von 1677.
Wir Christian Ludwig, von Gottes Gnaden Herzog von Mecklenburg, pp. urkunden und geben hiermit zu wissen, daß zwischen Uns und Unserm Müller hieselbst und lieben getreuen Jochim Jorn wegen Unser Mühlen alhier in Schwerin nachfolgender Pensionscontract mit gutem Wolbedacht verabredet und geschlossen worden:
1) Erstlich versprechen Wir besagte Unsere Kornmühle alhie in der Stadt dem Müller Jochim Jorn umb eine jährliche gewisse Pension auf zwey Jahr lang, als von diesen Trinitatis laufenden 1677ten Jahres bis wider Trinitatis Anno 1679, einzuthun, dergestalt und also, daß er dieselbe sambt allen dazu gehörigen Mahlgästen und davon fallenden richtigen Matten und allen andern Hebungen, ohne was nachgehends ausbescheiden, die gedachten zwey Jahr über unberechnet einhaben, genießen und gebrauchen, inmassen ihm dan dieselbe eingereumet und er bey geruhiger Possession und Geniesbrauch derselben die Pensionjahr über geschützet und vertreten, auch was ihm dabei an einem und andern geliefert wirdt, desfalß ein richtiges Inventarium verfertigt werden soll, nach welchem dan der Müller beym Abtrit die Mühle widerumb liefern mus und will.
2) Dahingegen und vors ander verspricht der Müller Jochim Jorn vor diese Einhab- und Genießung bemelter Unser Mühlen Uns oder Unserm Ambte alhie jährlich und alle Jahr besonders - ohne was er Uns überdem laut eines absonderlich getroffenen Vergleichs à part entrichtet - zwey Drbt. Weitzen, sechs und dreißig Drbt. Rocken und vierzig Drbt. Maltz, alles Rostocker Maße, an guten untadelhaften Korn allemal gegen Trinitatis zu geben und abzutragen oder auch mit bahrem Geld nach dem Wehrt, als das Korn jedes Jahr auf Trinitatis gelten wirdt, und macht dazu jährlich zu Unser Hofstaht in hiesiger Mühle vier Schweine tüchtig feist und erleget die Pension ohn einigen Verzug, Exception oder Behelf, wie die immer Nahmen haben und erdacht werden möchten.
3) Vors dritte nimbt er bey dieser Unser Kornmühle allen Eisen- und Steinschlett über sich und hatt Uns desfals an der Pension nichts zu kurtzen.
4) Vors Vierte soll er Unsere Unterthanen und Mühlengäste, wan dieselbe zur Mühlen kommen, schleunigst, und so viel ohne Waßersmangel immer geschehen kan, befodern und zur Ungebühr nicht aufhalten, dieselben auch mit keinen ungebührlichen Matten


|
Seite 133 |




|
belegen, weniger einigen Betrug oder Falschheit darunter gebrauchen, noch durch die Seinigen solches zu thun verhengen, sondern allemahl die Matte beym Stiel faßen, vorn aushalten und nicht mehr, als was in freyer Hand darauf ligen kan, zur Matte nehmen und in die Molde schütten, nicht aber aus den Rumpen, Säcken oder Kufen die Matten in die Molde racken laßen. Solte aber über Zuversicht was furgehen und darüber Klage geführt werden, ist er dafür gehalten und muß nach Befinden für sich und sein Volk desfals büßen, gestalt er auch alles Korn, so für Unsere hiesige Hofstaht, item die Prediger, wie auch einige Unsere Bedinte, so vorhin mattenfrey gewesen, gemahlen wirdt, imgleichen dem Schutzenkönige wöchentlich zwey Drbt. Maltz, dan ferner das Commißkorn für hiesige Unsere Soldatesque, wan derselben was gereichet wirdt, mattenfrey mahlen, auch, wan Wir seiner zur Verfertigung Unser Zimmer bedürftig, sich dazu gleich andern Unsern Müllern ohnwegerlich gebrauchen lassen soll.
5) Die Mühle solI er zum Fünften in gutem Stande erhalten und derselben als ein guter Müller vorstehen, was an und in der Mühle schadhaft befunden wirdt, - doch daß ihm das benötigte Holtz verschafft und, so große Arbeit vorfält, dazu vom Ambte behufige Arbeitsleute zugegeben werden sollen - zu besserlichem Stande bringen und, was also an der Kornmühle, auch die Brucken, zu thun vorfält und er und seine Knechte mit ihrer Hand und Zimmerarbeit verrichten können, ohne Abstatung einigen Tagelohns verrichten, auch sonsten auf die vorhandene Schleußen und Vorschutte jedesmahl, Tages und Nachts, gute Achtung geben, damit selbige bei grossen Wasser, und wan es nötig, zu rechter Zeit aufgezogen und zugesetzet werden, damit kein Schade entstehe, welchen er sonsten, so er durch sein Veruhrsachen und Fahrläßigkeit geschieht, zu erstaten gehalten ist.
6) Ferner und vors Sechste soll gedachter Müller auf besagte Unsere Mühle gute fleißige Acht haben, daß mit brennenden Lichtern und ferner behutsamb ümbgegangen werde, und, da durch sein oder den Seinigen Verwahrlosung Uns einiger Fewrschaden, so Gott aber gnädig verhüte, zuwachsen solte, wollen Wir die Erstattung dessen von ihm oder seinen Mitbeschriebenen gewertig sein.
7) Vors Siebende, zum Fall auch mehrbesagter Müller an seinem Mattekorn oder an der Mühlen und deren Zubehör durch Kriegsmacht und Gewalt - welches der liebe Gott gnädig verhüten wolle - Schaden zugefügt werden sollte, derselbe soll nach Befindung und Billigkeit moderiret und an den Pächten oder Pension gekürzet werden, gestalt auch der Müller nach verflossenen Pensionjahren, wan er die Mühle länger behalten und dasjenige, was ein ander mehr dafür bieten möchte, geben wolte, ihm für einen andern gelassen werden soll. Wo nicht, soll er nach geendigten Pensionjahren die Mühle nach dem Inventario Uns vollenkömblich zu Unser guten Begnugung hinwider einantworten und dieselbe abzutreten schuldig sein.
8) Schließlich und fürs Achte, damit Wir und Unsere Ambtskammer wegen der versprochenen Pension und sonsten, was in diesem Contract in obgesetzten Punkten verschrieben, desto mehr gesichert sein mögen, so thut der Möller Jochim Jorn vor sich und seine


|
Seite 134 |




|
Erben sub pacto executivo nicht allein all das Seinige, so er an Vieh und Fahrnis alhier hat und in die Mühle ferner bringen wird, besondern auch all seine übrige beweg- und unbewegliche Güter, itzige und künftige, an was Ohrt dieselbe auch sein möchten, zu einer wahren Hypothec und Unterpfand wißent- und wolbedächtlich verschreiben und einsetzen und hatt davon diesen Contract festiglich und unverbrüchlich zu halten versprochen und angelobet und danebst aller rechtlichen Behelfe, Exceptionen und Ausfluchte, wie die Nahmen haben und diesem Pensioncontract schädlich sein möchten, als weren sie wörtlich anhero gesetz, vor sich und seine Erben wissentlich und wolbedächtlich renuncyret und abgesaget, auch zu mehrer und fester Haltung Greger Stahlen und Niclaus Neuman, beide Bürger und respective Frey- und Ambts-Schuster hieselbst, zu seinen unzweifentlichen Bürgen eingesetzet, welche auch die Bürgschaft gutwillig über sich genommen und nebst dem Principal sich unterschrieben. Deßen zu Uhrkunde ist dieser Contract zwiefach verfertigt, mit Unserem fürstl. Kammerinsigel bestetiget und von dem Müller auch unterschrieben, ein Exemplar bey Unser fürstl. Ambtskammer behalten und das ander dem Müller zugestellet. So geschehen auf Unser Residenz und Vestung Schwerin, 11. Juni 1677.
4. Liste der Dörfer im Neumühler Bannbezirk.
| 1560. |
Nach Ihde, Jahrb. 77,
Beiheft, S. 262 (Liste anscheinend
sehr unvollständig):
Steinfeld, Wüstmark bei Pampow, Görries, Klein-Medewege, Warnitz, Krebsförden, Pingelshagen, Kirchstück, Groß-Welzien, Wittenförden. Die angrenzenden Bezirke von Mühleneichsen und Banzkow. |
| 1676. |
Liste in Weisels Journal
der Brauer und Becker: Nachricht was
vor Dörfer zur Neuen Mühlen gehoren
und daselbst mahlen müssen, ohne
dieselben, so noch von andern
Ohrtern dahinkommen, und Becker
allhier aus der
Stadt:
Zippendorf, Ostorf, Kräbsforde, Wüstemarck, Pampow, Groß- und Klein-Rogan, Dorf Görries, Wittenförden, Grambow, Wangerin, Warnitz, Driberg, Daalberch, Rugen See, Böcken, Grievenhagen, Trebow, Niemarck, Pingelshagen, Medeweg (wo Doct. Hein seel. sein Fr. wohnet). Der Schäfer aus dem Haselholz; Stück gehoret auch dazu. NB. ohne die Bäcker aus hiesiger Stadt. |
| 1818. |
Akten von Wasmuths Erben:
Ertragsanschlag von den der Neumühle
bis Johannis 1838 beigelegten
Zwangsmahlgästen:
Dorf Görries, Krebsförden, Wüstmarck, Hof Pampow, Dorf Pampow, Wittenförden, Hof Großen Rogahn, Dorf Großen Rogahn, Dorf Klein Rogahn, Lankow, Warnitz, Pingelshagen, Hof und Dorf Driberg, Dorf Böcken, Hof Dorf Ostorf, Hof Kl. Medewege, Dorf Dalberg, Hof Herrensteinfeld, Hof Wandrum, Hellkrug. |
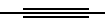


|
[ Seite 135 ] |




|



|


|
|
:
|
III.
Zur ältesten Geschichte
des Geschlechts
v. Maltzan
von
Wilhelm Biereye.
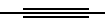


|
[ Seite 136 ] |




|


|
[ Seite 137 ] |




|
I m Ratzeburger Zehntenlehnregister von 1230 wird als Inhaber des halben Zehnten von Campow, Ksp. Schlagstorf 1 ), und Klocksdorf, Ksp. Carlow 1), und von je zwei Hufen in Lehsten 2 ) und Besenthal 3 ), Ksp. Gudow, und in Kölzin, Ksp. Zarrentin 4 ), ein Bernhard ohne weiteren Zunamen genannt. Im 36 Hufen großen Dorf Lehsten trug außer Bernhard 1230 noch ein Bruno den Zehnten von zwei Hufen vom Bischof zu Lehen. Vielleicht steht dieser Bruno in Beziehung zu den filii Brunonis, die zusammen mit Wedekind v. Walsleben in Sterley 2) saßen.
Man hat im allgemeinen angenommen, daß es sich in Campow und Klocksdorf um einen Bernhard v. Maltzan, in Langen-Lehsten und Besenthal um einen Bernhard v. Lehsten und in Kölzin um Bernhard v. Lehsten oder einen dritten Bernhard handele. Auffällig sind aber zwei Umstände: 1. daß der Schreiber des RZR. es nicht für nötig befunden hat, diese beiden Bernhards in seinem Protokoll durch Zusätze oder auf andere Weise zu unterscheiden, wie er es doch bei Bernardus Trimpe in Schlagbrügge 1) getan hat; 2. daß wir über diesen angeblichen Bernhard v. Lehsten außer der Notiz des RZR. überhaupt keine, über Bernhard v. Maltzan nur sehr spärliche Nachrichten auch über die Zeit nach 1227 haben; das gibt bei der bedeutenden sozialen Stellung, die der älteste Bernhard v. Maltzan als erster Schiedsrichter für das Land Ratzeburg bei dem Vergleich zwischen Bischof Isfried von Ratzeburg und seinem Domkapitel 1194 einnahm 5 ), doch zu denken. Aus dieser Überlegung heraus ergeben sich zwei Fragen: 1. Was wissen wir überhaupt über den Bernhard v. Maltzan oder den Bernhard v. Lehsten in der Zeit von 1200 bis 1250? 2. Bestehen


|
Seite 138 |




|
wesentliche Gründe gegen eine Annahme, daß alle diese Bernharde ohne Zusatz im RZR. mit einander identisch sind?
Über einen Bernhard v. Lehsten wissen wir aus dieser Zeit nichts. Ein Bernardus de Mulzian war am 8.IX.1230 Zeuge, als Bischof Gottschalk von Ratzeburg sich mit der Stadt Lübeck über die gemeinsame Grenze ihrer Länder einigte 6 ). Da Campow dicht an der Grenze des Bistums nach Lübeck zu liegt, kann hier der Campower Bernhard des RZR. gemeint sein. Das ist alles, was wir über diesen Bernhard unmittelbar wissen. Nun gab es aber in dieser Zeit noch einen Bernhard de Wigenthorp, über dessen Herkunft und Familienzugehörigkeit man sich viel Kopfzerbrechen gemacht hat. Und dieser Bernhard v. Wigendorf oder Wiendorf saß 1230 zusammen mit Johann v. Maltzan auf Schlag-Resdorf und hatte dort sogar doppelt so viel Zehntenlehen als Johann 7 ).
Bernhard v. Wiendorf wird zum erstenmal im April 1229 in Güstrow erwähnt. Er war hier anwesend, als Bischof Brunward von Schwerin das Güstrower Domkollegiatstift bestätigte 8 ). Unmittelbar vor ihm ist in der Zeugenliste ein Bruno cognatus noster, d. h. Blutsverwandter des Bischofs, aufgezeichnet. Die hier angegebenen ritterlichen Zeugen scheinen dem erweiterten Vormundschaftsrat für die noch nicht regierungsfähigen Enkel Borwins I. angehört zu haben. Als Zeuge ist Bernhard vom März 1235 ab bei folgenden Anlässen erwähnt:
14.III.1235. act. Güstrow: Fürst Nikolaus von Werle verlieh der Stadt Malchow Schweriner Stadtrecht 9 );
15.II.1237. dat. Rostock: Fürst Borwin von Rostock verlieh der Abtei Doberan landesherrliche Privilegien 10 );
6.III.1237: Fürst Nikolaus von Werle schenkte dem Güstrower Kollegiatstift die Kirche von Lüssow 11 );
31.VII.1238. dat. Güstrow: Fürst Nikolaus verlieh dem Kloster Dargun landesherrliche Rechte 12 );


|
Seite 139 |




|
12.VIII.1240: Fürst Nikolaus bestätigte dem Kloster Dargun die Dörfer Gielow und Benitz, 4 km s. Malchin 13 );
18.I.1241. dat. Güstrow: Fürst Nikolaus schenkte dem Kloster Eldena 30 Hufen im Lande Ture bei Mirow 14 );
6.VI.1243: Fürst Nikolaus verlieh dem Kloster Doberan das Eigentum von zwei Hufen in Klein-Schwiesow 15 );
21.VI.1243: Fürst Nikolaus bestätigte Ritter Heinrich Grubes Schenkung von vier Hufen in Kl.-Schwiesow an den Güstrower Dom 16 );
29.XII.1243. dat. Güstrow: Fürst Nikolaus verlieh dem Kloster Doberan 50 Hufen zu Zechlin im Lande Ture 17 );
1.VII.1248. dat. Güstrow: Fürst Nikolaus gestattete bauliche Veränderungen in der Stadt Güstrow 18 );
5.III.1255. act. Doberan: Bischof Rudolf von Schwerin bestätigte das Kloster Doberan; zugegen war auch Fürst Nikolaus 19 );
24.IX.1255: Bischof Hermann von Kammin bestätigte dem Güstrower Domkapitel die ihm von Bischof Konrad geschenkten Zehnten von 63 Hufen im Lande Circipanien 20 ).
In den ersten hier aufgeführten Urkunden steht Bernhards Name noch am Schluß der Zeugenlisten, was auf verhältnismäßig jugendliches Alter des Ritters schließen läßt; in der letzten leitet er sie als erster ein. Schon um 1230 scheint er, vielleicht im Zusammenhang mit seiner Betätigung in der Vormundschaftsregierung, sich dem Dienst des Fürsten Nikolaus von Werle zugewandt zu haben. In seinem Gefolge war er bei Urkundenhandlungen vor allem im Norden und Osten des Landes von 1235 ab zugegen; nach 1243 scheint er sich vom Hofleben zurückgezogen und nur gelegentlich in der Umgebung seines Lehensherrn geweilt zu haben. Er besaß, wie aus einer Urkunde Borwins III. von Rostock 21 ) vom 1.I.1250 erhellt, das Dorf Behnkenhagen, 3 km s. Gelbensande, das er in Sorge um sein, seiner Gemahlin und seiner Kinder Seelenheil um 1249 dem Kloster Doberan übertrug. Nach 1255 verschwindet


|
Seite 140 |




|
der Name v. Wiendorf 22 ) ganz aus der Überlieferung, obwohl Bernhard 1250 noch Kinder hatte.
Hellwig 23 ) hält diesen Bernhard v. Wiendorf für identisch mit dem 1247 erwähnten Ritter Bernhard v. Camin 24 ). Dort hatte ein Ritter Bernhard den Zehnten von vier Hufen mit anscheinend nicht ganz sicheren Rechtsansprüchen vom Bischof zu Lehen, die er jetzt mit aller Macht (omnimodis) verkaufen wollte. Um zu verhindern, daß die Zehnten in weltliche Hände übergingen, gestattete Bischof Ludolf von Ratzeburg dem Domherrn Bertold, die Kaufsumme für diese Zehnten der Dombaukasse zu entnehmen. Um letzte Bedenken der Domherren gegen die Erwerbung der Zehnten in dem immerhin reichlich entfernten Camin 25 ) aus dem Wege zu räumen, hat der Bischof mit dem Domkapitel getauscht und ihm für den Zehnten der vier Caminer Hufen den von vier Hufen in Molzahn, 7 km önö. Ratzeburg, zugewiesen 26 ). Hellwig 27 ) hält diese vier Hufen für den Rest der Besetzungshufen, für die Bernhard noch vor 1230 im Austausch die vier Hufen in Schlag-Resdorf gegeben worden seien. Jegorov stimmt dieser m. E. recht dürftig begründeten Annahme zu und sucht sie durch neue Überlegungen zu stützen 28 ). Nach dem RZR. gab es auch einen Johann v. Camin, der 1230 den Zehnten des halben Dorfes Törber, 4 km n. Rehna 29 ), und von drei Hufen in aliud Wedewen-


|
Seite 141 |




|
thorp 30 ) bei Wedendorf im Ksp. Grambow, 2 km ö. Rehna, zu Lehen trug. 1265 wird im Gefolge des Schweriner Grafen ein Bernhard v. Grambow erwähnt, der vielleicht 31 ) mit einem Bernhard de Wedewentorp, was dann in anderer Form Wiendorf (s. aber die öfter auftretende Schreibweise Wigenthorp) geheißen haben könnte, identisch sei. So wird auf dem Weg über den Wedendorfer Zehntinhaber Johann v. Camin eine Identizität zwischen Bernhard v. Camin und Bernhard v. Wiendorf hervorgezaubert. Diese Art der Beweisführung ist natürlich völlig abwegig, auf eine etwaige Identität der beiden Bernhards wird aber noch weiter unten zurückzukommen sein.
1335 32 ) war Schlag-Resdorf nicht mehr im Besitz der Wiendorfs oder Maltzans, sondern des Lübecker Bürgers Heinrich Sixti 33 ); die genauere Zeit zwischen 1230 und 1335, zu der es von ihnen aufgegeben worden ist, läßt sich urkundlich nicht mehr ermitteln; fest steht aber immerhin, daß von den erhaltenen Urkunden, in denen Bernhard v. Wiendorf von 1235 ab erscheint, keine auf Beziehungen zur Gegend von Schlag-Resdorf hinweist, das seinem Wirkungskreis im Fürstentum Werle doch recht fern lag. Auffällig ist in diesem Zusammenhang das Streben auch des Bernhard v. Camin, seine Zehnten in Camin so bald wie möglich los zu werden. Daraus ist doch zu schließen, daß er diese Gegend verlassen wollte oder gar schon verlassen hatte, so daß die Einziehung der Zehnten daselbst für ihn mit großen Schwierigkeiten verbunden war.
Vielleicht war der Bernhard v. Camin aber mit dem Zehntinhaber Bernhard in Kölzin, 6 km n. Camin, identisch. Auch in Kölzin hatte Bernhard 1254 anscheinend keinen Besitz mehr. 1251 tauschte das Kloster Zarrentin vom Ritter Burchard v Böddenstedt drei Hufen in Kölzin ein 34 ) und kaufte im Mai 1254 vom Ritter Siegfried v. Dargenow 13 Hufen und acht Katen 35 ). Unter den drei Hufen des Burchard v. Böddenstedt können die zwei Hufen Bernhards nicht gewesen sein, da sie zehntenpflichtig waren. Wohl aber werden sie sich unter den


|
Seite 142 |




|
von Siegfried v. Dargenow verkauften befunden haben, da wir nach 1254 nur noch von Besitz des Klosters Zarrentin in Kölzin wissen. Siegfried v. Dargenow hatte dann schon vorher auch die beiden Settinkehufen des Bernhard erworben.
Wie kam aber gerade Siegfried v. Dargenow dazu? Eine Erklärung gibt das Zehntenregister. Dargenow 36 ) grenzte unmittelbar an Langen-Lehsten, und sein Besitzer war der Gutsnachbar des dortigen Zehntinhabers Bernhard. Über die Besitzveränderungen in Langen-Lehsten, Dargenow und Besenthal schweigen die Urkunden bis 1350 ganz, aber ebenso von irgend einer Anwesenheit Bernhards in dieser Gegend, in der er doch 1230 so umfangreichen Besitz hatte, während Ritter aus dem benachbarten Dargenow öfter genannt werden und 1252 sogar in Friedrich dem Bistum Ratzeburg einen Bischof stellen konnten 37 ). Jegorov schließt hieraus, daß die Dargenows ein Zweig der Lehsten wären und von ihnen Kölzin geerbt hätten 38 ). Wahrscheinlicher ist m. E., daß die von Jegorov als v. Lehsten angegebene Familie bald nach 1230 die Gegend um Lehsten und Besenthal verlassen hat. Die Dargenower Nachbarn haben dann den Besitz in Lehsten, Besenthal und Kölzin für billigen Preis erworben und dadurch ihren Wohlstand begründet, der sich in der Wahl eines ihrer Geschlechtsmitglieder zum Ratzeburger Bischof auswirkte. Dann hätte nicht nur Bernhard v. Camin, sondern auch Bernhard in Lehsten, Besenthal und Kölzin das Land vor 1250 verlassen.
Wie Bernhard in Lehsten verschwindet aber auch Bernhard v. Maltzan in Campow und Klocksdorf bald aus der Ratzeburger und Lübecker Überlieferung. Er scheint schon vor 1237 das Ratzeburger Land verlassen zu haben, da er sonst doch nicht unter der großen Zahl von Zeugen gefehlt hätte, die in Ratzeburg oder Rehna Weihnachten 1237 zusammenströmten, als Bischof Ludolf das neugegründete Nonnenkloster in Rehna 39 ) bestätigte 40 ). Ein Einwand ist hier aber möglich. War der


|
Seite 143 |




|
Zehntinhaber von Campow auch wirklich. wie das RZR. angibt, ein Bernhard? Am 12. IX. 1252 verlieh Herzog Albrecht von Sachsen der Ratzeburger Kirche alle Güter in Campow, die Berlif und seine Söhne ihm für diesen Zweck aufgelassen hatten 41 ). Ausdrücklich ausgenommen sind von dieser Verleihung diejenigen "Rechte, die der Herzog früher in ihnen gehabt hatte, die Hoheitsdienste, die ihm nach gemeinem Landesrecht von den sechs Hufen zu leisten waren". Campow war aber nach dem RZR. 42 ) nur sechs Hufen groß. Dann muß entweder Berlif in die Rechte Bernhards eingetreten sein, oder Berlif war derselbe Mann wie Bernhard, und es liegt in einer der beiden Quellen ein Schreibfehler vor. 1257 spricht Bischof Friedrich von Ratzeburg von den Zehnten, die Bernolfus und seine Söhne von ihm als Lehen gehabt hätten 43 ). Hier ist zweifellos derselbe Mann wie Berlif gemeint. Die Umwandlung in das immerhin auch seltene Bernolf beweist, daß man sich über den genauen Namen dieses Mannes in Ratzeburg selbst nicht klar war. Vielleicht ist also auch der Name Bernhard im RZR. beim Ort Campow eine eigenmächtige Verballhornisierung des dem Schreiber sonst unbekannten Namens Berlif. Dann wäre der Bernhard in Campow aus der Untersuchung auszuscheiden und der Zusatz de Mulzian im MUB. 379 würde sich nur auf den im Molzahn benachbarten Klocksdorf ansässigen Bernhard beziehen, das auch der Grenze gegen Lübeck nicht fern lag.
Auch Bernhard v. Wiendorf verschwindet aus dem Bistum Ratzeburg und ist seit 1235 nur noch im Lande Werle nachweisbar.
Aus allen diesen Beobachtungen heraus lassen sich folgende Hypothesen aufstellen:
- Alle Bernharde sind dieselbe Person.
- Es sind nur zwei Bernharde zu unterscheiden: a) v. Wiendorf, b) v. Lehsten, Besenthal, Campow, Klocksdorf, Kölzin, Camin.
- Es sind nur zwei Bernharde zu unterscheiden: a) v. Wiendorf und Camin, b) v. Lehsten, Besenthal, Campow, Klocksdorf und Kölzin.
- Es handelt sich um drei Bernharde: a) v. Wiendorf und Camin, b) v. Lehsten, Besenthal und Kölzin, c) von Klocksdorf und Campow.


|
Seite 144 |




|
- Es handelt sich um drei Bernharde: a) v. Wiendorf, b) v. Lehsten, Besenthal, Kölzin und Camin, c) von Klocksdorf und Campow.
- Es sind im ganzen vier Bernharde: a) v. Wiendorf, b) v. Lehsten, Besenthal und Kölzin, c) von Klocksdorf und Campow, d) von Camin.
In allen sechs Fällen ist aber immer der Vorbehalt zu machen, daß auf Campow vielleicht gar kein Bernhard, sondern ein Berlif saß.
Hypothese 1 ist nicht annehmbar. Bernhard v. Wiendorf ist vermutlich erst nach 1201 mit Albrecht von Orlamünde ins Land gekommen, während der Klocksdorfer Bernhard aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Bernhard v. Maltzan vom 8. XI. 1230 identisch ist 44 ) und die Maltzans schon 1197 im Ratzeburgischen saßen. Eine thüringische Urkunde vom Jahre 1241 45 ), die über Hufen in Aspa bei Kapellendorf handelt, nennt unter den Zeugen einen Ritter Bodo de Wigendorp. Dies Wigendorf liegt aber nur 7 km ö. Weimar, der Heimat des Grafen Albrecht von Orlamünde, Ratzeburg und Holstein. Albrecht wird daher den Anlaß gegeben haben, daß ein Angehöriger des in Wigendorf ansässigen Rittergeschlechts die Heimat verließ, um in des Grafen Dienst im Ratzeburgischen sein Glück zu versuchen, und dort mit Lehen ausgestattet wurde. Bernhards Beziehungen zum Grafen Albrecht scheinen auch der Anlaß gewesen zu sein, daß er nach Albrechts Sturz 1227 Ratzeburg verließ und bei den werleschen Fürsten Aufnahme suchte und fand.
Hypothese 2 scheint mir die wahrscheinlichste zu sein. Über die Gründe, die mich für die Annahme bestimmen, daß Bernhard v. Camin ein Maltzan und nicht ein Herr v. Wiendorf war, wird noch gelegentlich der Frage nach dem Johannes gehandelt werden 46 ).
Hypothese 3, s. zu Hypothese 2.
Hypothese 4 erscheint mir zweifelhaft; denn wenn der Verfasser des RZR. überhaupt verschiedene Träger des Rufnamens Bernhard durch Beinamen kenntlich machte, ist nicht zu verstehen, warum er diesen Brauch bei den Bernhards in Camin,


|
Seite 145 |




|
Lehsten, Besenthal, Kölzin, Klocksdorf außer acht gelassen hätte. Erklärlich ist dies Verhalten nur, wenn man annimmt, daß dieser Bernhard in Camin usw. am Ratzeburger Hof eine so bekannte Persönlichkeit war, daß eine nähere Bezeichnung sich erübrigte.
Hypothese 5 und 6: s. zu Hypothese 2 und 4.
Einzugehen ist in diesem Zusammenhang auf den andern Träger des Namens Maltzan, auf Johann v. Maltzan, der im RZR. als Lehensträger der Zehnten von zwei Hufen in Schlag-Resdorf genannt ist 47 ). Er war im Sommer 1236 beim Abschluß des Bündnisses zwischen Bischof Brunward von Schwerin und Fürst Johann von Mecklenburg gegen den Bischof von Kammin und die Pommernherzöge im Gefolge des Mecklenburgers zugegen 48 ). Er scheint am Feldzug teilgenommen und im eroberten Gebiet bei Dargun Wohnsitz genommen zu haben; denn im April 1239 war er Zeuge, als Fürst Johann das Kloster Dargun von allen Lasten aus dem Dorfe Cantim, dem heutigen Lehnenhof, 4 km n. Dargun, und aus vier Hufen in Stassow befreite 49 ). Von den in der Zeugenliste auf ihn folgenden Rittern Bernhard und Hermann v. Hakenstedt 50 ) wissen wir, daß sie später Besitz in der Gegend nördlich Dargun und bei Gnoien hatten. Im Juli 1241 war er beim Pommernherzog Wartislav III. in Demmin, als dieser das Kloster Eldena bei Greifswald bestätigte 51 ).
Ein Johann, ohne Zunamen, war nach dem RZR. Lehensträger der Zehnten des halben Dorfes Mazleviz bei Lehsten 52 ), von drei Hufen in Schlagsdorf, 3 km s. Molzahn bei Ratzeburg 53 ), von je zwei Hufen in Püttelkow 54 ), 3 km n. Wittenburg, und zusammen mit seinem Bruder in Manderow, 7 km nö. Grevesmühlen 55 ), von je einer Hufe in Vietlübbe, 5 km


|
Seite 146 |




|
ö. Gadebusch 56 ), und in Johannstorf, 3 km nw. Dassow 57 ). Einer von diesen Johanns ist ohne weiteres bestimmbar, der Zehnteninhaber in Vietlübbe; durch das verbindende et in der Eintragung Godefridus I et Johannes I ist er als Bruder Gottfrieds v. Bülow hinreichend gekennzeichnet. Er ist also zunächst aus der Untersuchung auszuscheiden.
Schlagsdorf grenzt an das Dorf Molzahn, 5 km östlich Schlagsdorf liegt Klocksdorf; Mazleviz, das heute untergegangen ist, muß nach der Anordnung des RZR. an Lehsten gegrenzt haben. Daraus ergeben sich Schlüsse auf Beziehungen des Johann in Schlagsdorf und Mazleviz zu dem oben behandelten Bernhard, und die Wahrscheinlichkeit der Hypothesen 2 und 3 wird dadurch erhöht. Wie steht es aber mit Püttelkow? Eine annehmbare Erklärung ist aus dem urkundlichen Material nicht zu gewinnen. Wohl erscheint 1282 einmal ein Dietrich v. Püttelkow. Aber der Beiname de Putlechow, der als solcher nur dies eine Mal vorkommt, soll offensichtlich nicht das Geschlecht, sondern nur den Wohnort dieses Dietrich angeben. Der Rufname Dietrich findet sich aber sonst nicht im maltzanschen Geschlecht, dem augenscheinlich die Zehntinhaber von Schlagsdorf und Mazleviz angehörten. Da Johannes Gans in den s. liegenden Kirchspielen Pritzier und Vellahn von unserm Johann deutlich durch den Beinamen Auca unterschieden wird, ist anzunehmen, daß es sich 1230 in Püttelkow um den in Ratzeburg gut bekannten Vasallen Johann von Schlagsdorf und Mazleviz handelt, der später seinen Besitz daselbst an einen anderen Ritter abgegeben hat. Manderow und Johannstorf liegen auf Kolonialboden, der erst im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts besiedelt wurde 58 ). Nicht ganz ohne Belang ist die Angabe hinsichtlich Manderows, daß Johannes noch einen Bruder gehabt habe. Manderow war 1224 freies Eigentum des Bischofs 59 ), was im März 1236 noch einmal durch Kaiser Friedrich II. bestätigt wurde 60 ). Hier scheint Johann also nur eine kurze Zeit Besitz gehabt zu haben.


|
Seite 147 |




|
Auch aus Schlagsdorf scheint Johann 1238 schon verschwunden zu sein. Denn als am 14. IV. 1238 Herzog Albrecht von Sachsen dem Ratzeburger Domkapitel die Kirche von Schlagsdorf übertrug, waren die Zehntinhaber von Schlagsdorf, die das RZR. für 1230 angibt, nicht unter den Zeugen 61 ). Von den Schicksalen des Dorfes Mazleviz ist keine Nachricht erhalten.
Von Bedeutung werden jetzt aber die Nachrichten, die über Bernhard und Johann v. Camin überliefert worden sind. Sie trugen ihren Namen wohl beide nach dem Kirchdorf Camin, 7 km sw. Wittenburg. Über Bernhard ist schon oben gehandelt worden 62 ). Johann v. Camin war nach dem RZR. Lehensinhaber der halben Zehnten des Dorfes Törber, 5 km ö. Rehna 63 ), und von drei Hufen in aliud Wedewenthorpe, dem späteren Kirch-Grambow, 3 km ö. Rehna 64 ). Johann ist schon vor dem Juli 1256 verstorben. Denn Bischof Friedrich von Ratzeburg verkaufte am 15. VII. 1256 dem Pfarrer Heinrich von Proseken den Zehnten von drei Hufen in Törber und von drei Hufen in Grambow 65 ). Diese sechs Hufen waren nach Johann v. Camins Tode, der sie vom Bischof zu Lehen getragen hatte, wieder an das Bistum zurückgefallen. Daraus ist zu schließen, daß Johann keine Nachkommen hatte.
Unmittelbar an Törber grenzten die später maltzanschen Dörfer 66 ) Volkenshagen und Zehmen, an aliud Wedewenthorp = Kirch-Grambow das vor 1255 67 ) von Ludolf von Maltzan gekaufte Gr.-Hundorf. Der Erwerb der Dörfer Volkenshagen und Gr.-Hundorf durch Ludolf v. Maltzan fällt also zeitlich mit dem Ableben Johanns v. Camin zusammen. Es werden also vermutlich beim Tode Johanns v. Camin seine Kirchenlehen in Törber und Kirch-Grambow an das Bistum zurückgefallen sein; aber den übrigen Besitz in diesen beiden Dörfern erbte Ludolf v.


|
Seite 148 |




|
Maltzan, der ihn dann durch Ankäufe in der Umgegend erweiterte. Dafür, daß Ludolf bedeutenden Besitz in Kirch-Grambow geerbt hat, scheint ferner die Tatsache zu sprechen, daß unmittelbar s. des maltzanschen Besitzes in der Grafschaft Schwerin, des Dorfes Gottesgabe, 10 km w. Schwerin, ebenfalls ein Dorf Grambow liegt, auf das wohl bei seiner Gründung der Name des maltzanschen Kirch-Grambow übertragen sein wird. Daraus ergibt sich enge Beziehung der Herren v. Camin zu den Maltzans.
Februar 1265 erscheint im Gefolge des Grafen von Schwerin ein Ritter Bernhard v. Grambow, 1278 weilen beim Pommernherzog die Knappen Johann und Ludolf v. Grambow. Schon die Vornamen Johann, Ludolf und Bernhard zeigen an, daß wir es hier mit einem Zweig der Maltzans zu tun haben, etwa mit einem Bruder Ludolfs v. Maltzan, der auf Grambow saß. Von 1256 bis 1280 wird nur ein Maltzan, Ludolf, im Dienst bald der Schweriner Grafen, bald der Fürsten von Mecklenburg genannt, der außerdem noch im Besitz von Grambow, s. des Cummerower Sees, war 68 ). Er scheint der Haupterbe aller Maltzanschen Linien gewesen zu sein, die vom Bernhard v. Maltzan von 1194 abstammten. Den Besitz westlich der Linie Schönberg-Schaalsee scheint die Familie aber 1250 schon aufgegeben zu haben.
Nach Schlagsdorf hat sich ein Geschlecht genannt, das später im rügenschen Teil Vorpommerns reichen Besitz hatte; es wird, wie der in ihm öfter vorkommende Spezialname Reinbold - Bolto vermuten läßt, von Reinbold in Schlagsdorf abstammen. Auch hier zeigen die außer Reinbold bis 1300 verwendeten Rufnamen Johann, Ludolf und Bernhard, daß es sich um einen Zweig der Maltzans handelt.
Auf Grund der bisherigen Untersuchung lassen sich folgende Personen als Mitglieder oder nahe Verwandte der Maltzans unterscheiden:
- zwei eng durch Nachbarschaft des Besitzes zusammenhängende, im RZR. ohne Beinamen aufgezeichnete Bernhard und Johann in der Gegend von Molzahn, Lehsten und Kölzin; Bernhard ist identisch mit einem 1230 genannten Ritter Bernhard v. Maltzan;
- zwei eng mit einander zusammenhängende Bernhard und Johann v. Camin, die Besitz in der unmittelbaren Nach-


|
Seite 149 |




|
barschaft des späteren maltzanschen Kerngebiets um Rehna hatten;
- ein ratzeburgischer Lehensträger Johann in Schlag-Resdorf, der durch den Zusatz "de Multsan" im RZR. deutlich von den beiden bisher aufgezählten Johanns geschieden wird; er ist zuletzt in Demmin nachweisbar;
- ein Reinbold in Schlagsdorf, auf den das in Wappen und Rufnamen den Maltzans eng verwandte Geschlecht v. Schlagsdorf in Rügisch-Vorpommern zurückgeht und der schon 1219 69 ) genannt wird;
- ein isoliert auftretender Bernhard v. Wiendorf, der mit Johann v. Maltzan nur durch gleichzeitigen Besitz in Schlag-Resdorf in Beziehung stand.
Alle sieben Ritter haben einen Zug gemeinsam: sie verschwanden bald aus den Besitzungen, die sie 1230 noch im Herzogtum Sachsen-Lauenburg und in der Grafschaft Schwerin hatten, und wandten sich auf dem Wege über das Mecklenburger Fürstentum, wo wenigstens Johann v. Camin bei Rehna hängen blieb, weiter nach Osten. Anscheinend hing das mit der großen Umwälzung von 1227 zusammen. Reinbold von Schlagsdorf hatte zu dem engeren Ritterkreis um den gestürzten Orlamünder Grafen gehört; und das vergaßen ihm und seinem Geschlecht die siegreichen Herren in Lauenburg und Schwerin nicht. So begaben sich die Maltzans und ihre Sippen auf die Wanderschaft nach Osten, und das Auftreten Heinrichs v. Camin in der Gegend um Rehna 1230 mag schon in den Beginn dieser Abwanderung gehören.
Und jetzt erklärt sich auch das auffällige Schweigen der Urkunden über die Nachkommen jenes ältesten Bernhard v. Maltzan von 1194. Der Familienname ist noch gar nicht fest bestimmt; und da Molzahn, Bernhards Hauptgut, noch vor 1230 in den Besitz des Bistums zurückgekehrt zu sein scheint, nannten seine Söhne und Enkel sich nach den Dörfern, auf denen sie saßen. Nur Johann v. Maltzan auf Schlag-Resdorf hat den Beinamen des Ahnherrn beibehalten und später auf seinen Sohn Ludolf vererbt.
Für Versuche, in die Geschichte des Geschlechts für die Zeit vor 1194 einzudringen, mag als wichtiges Hilfsmittel die Feststellung der in ihm typischen Namengruppe: Bernhard -Johann - Ludolf (- Reimbold) dienen.


|
Seite 150 |




|
Zum Schluß soll der Versuch gemacht werden, eine Stammtafel der ersten beiden Generationen, die auf Bernhard v. Maltzan von 1194 folgten, aufzustellen.
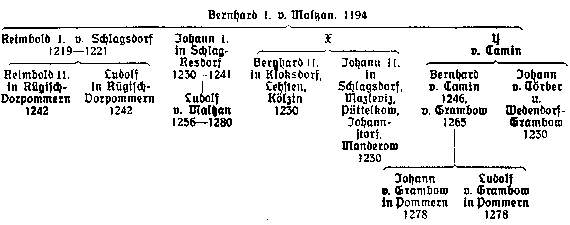


|
Seite 151 |




|



|


|
|
:
|
IV.
Über die Besiedelung
des Landes
Parchim
durch die deutsche
Ritterschaft
1226-1256
von
Wilhelm Biereye.
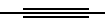


|
[ Seite 152 ] |




|


|
[ Seite 153 ] |




|
D as Buch des Professors Jegorov: Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert 1 ) hat neben anderen Problemen der mecklenburgischen Geschichte auch das von der Herkunft und den Wanderungen des mecklenburgischen Adels wieder neu zur Erörterung gestellt. Es soll hier zunächst auf einem kleinen Gebiet versucht werden, die Ergebnisse der von Jegorov allzusehr vernachlässigten genealogischen Kleinarbeit für die Siedlungsgeschichte nutzbar zu machen.
Der Gang der Untersuchung ist damit klar gegeben. Es ist festzustellen: 1. Wann tauchen im Parchimer Lande die dorthin eingewanderten Ritter zuerst auf ? 2. Woher kommen sie? 3. Wie breiten sie sich über das Land aus? 4. Falls sie das Land frühzeitig wieder verlassen haben, wohin gehen sie?
Ob vor 1226 schon eine Siedelung, etwa ein wendischer Burgwall, bei Parchim bestanden hat, ist für die in diesem Aufsatz gestellten Fragen von geringer Bedeutung 2 ). Als Heinrich II. Borwin im Anfang des Jahres 1226 daran ging, das Land Parchim den deutschen Kolonisten zu öffnen, kann die Zahl seiner Bewohner nur unbedeutend gewesen sein. Die Urkunde über die Bewidmung des neu erbauten Ortes Parchim mit einem Stadtrecht schildert diese Gegend damals als "öde und unwegsam und dem Dienst der Götzen geweiht" 3 ). Der Ort Parchim war in ihr die erste kolonisatorische Anlage, von der aus das umliegende Land in der kurzen Zeit von 70 Jahren fast ganz eingedeutscht wurde.
Hoffmann hat kürzlich nachgewiesen, daß es sich in der merkwürdigen Urkunde MUB. 319 nicht so sehr um ein Stadt-


|
Seite 154 |




|
recht für Parchim, als um einen Vertrag zwischen dem Fürsten und den Lokatoren handelt, die zum Bau der Stadt und zur Besiedelung des umliegenden Landes verpflichtet wurden 4 ). Sie waren wohl wie die Kolonisten 5 ) vom Fürsten nicht nur aus dem benachbarten mecklenburgischen Gebiet herbeigerufen, sondern auch aus entfernteren Ländern, wo immer siedlungsfrohe Unternehmer sich darboten.
Die nächstälteste erhaltene Parchimer Urkunde vom 4. Juni 1229 6 ) behandelt die Errichtung von vier Kapellen im bisherigen Kirchspiel Parchim seitens des für Pribislav die Vormundschaft führenden Fürsten Johann von Mecklenburg und die Entschädigung des Parchimer Pfarrers für den dadurch entstehenden Ausfall an Einnahmen 7 ). In ihr treten zwei Männer auf, die als solche Lokatoren anzusehen sind, Gerhard v. Malin und Nanno v. Lentzen 8 ).
Nanno v. Lentzen (Lensyn, Lencin, Lentsin) wird 1240 ausdrücklich als Ritter bezeichnet. Aus dem Zunamen ist zu schließen, daß er aus Lenzen in der Priegnitz eingewandert ist 9 ). Von 1229 bis 1249 erscheint er mehrfach in Urkunden des Fürsten Pribislav 10 ). Da sie alle Verhältnisse der Stadt Parchim


|
Seite 155 |




|
betreffen, wird Nanno v. Lentzen dort auch seinen Wohnsitz, vielleicht als Burgmann, gehabt haben. Über Nachkommen Nannos v. Lentzen ist nichts überliefert worden; das pommersche Geschlecht der Letenin oder Lentenin, das um 1260 bei Pyritz nachweisbar ist 11 ), wird schon der Schreibart des Zunamens wegen kaum auf Nanno v. Lentzen zurückgeführt werden können, zumal der bezeichnende Rufname Nanno in ihm nicht vorkommt. Dieser Nanno de Lensyn führte den Beinamen v. Lentzen wohl nur für seine Person nach dem Ort, von dem aus er nach Parchim zog, und war ein Mitglied der Familie v. Kardorff. Die Vermutung stützt sich auf zwei Gründe: 1. Der eigenartige Name Nanno findet sich bei den Kardorffs. Als Graf Albrecht v. Holstein und Orlamünde um 1216 der Hamburger Marienkirche die Schenkung einer Hufe in Kirchenwerder seitens seines Truchsessen Dietrich bestätigte, wurden als Zeugen auch Nanno de Kercthorpe et filius eius Hermannus aufgezeichnet 12 ), und als der Graf dem Bischof Iso von Verden 1217 Land auf der Insel Kirchwerder übertrug, waren Hermannus de Kercthorp et fratres sui zugegen 13 ). 2. Von 1274 ab ist in Parchim ein Siegfried v. Kardorff nachweisbar 14 ), ohne daß sich ein bestimmter Anlaß für seine Zuwanderung finden ließe. Er wird Nannos Sohn gewesen sein. Der Name v. Lentzen kommt aber nur bei dem Nanno von 1229, 1240, 1247 und 1249 vor und ist sonst im mecklenburgischen Adel während des 13. und 14. Jahrhunderts unbekannt.
Gerhard v. Malin wird in der Urkunde vom 4. VI. 1229 vom Herzog urbanus noster genannt. Die Übersetzung des Wortes urbanus mit "Bürger" ist deshalb nicht angängig, weil derselbe Gerhard 1244 als Ritter aufgeführt wird 15 ). Vielleicht bezieht sich diese sonderbare Bezeichnung auf Gerhards Dienst in der Burg etwa als Burgmann, vielleicht steht sie in Zusammenhang mit dem Begriff cultores civitatis in MUB. 319, den Hoffmann mit Lokator übersetzte.


|
Seite 156 |




|
Woher stammte Gerhard v. Malin? Nach einer Bemerkung des MUB. 16 ) soll der Zuname von einem später in die Feldmark der Stadt Parchim aufgegangenen Dorf Malin herrühren. Aber dies angebliche Dorf Malin wird bis 1350 in keiner Urkunde erwähnt. Dagegen gab es ein Dorf Malin, 3 km w. Gadebusch, das heutige Möllin, das schon 1194 17 ) und 1230 im RZR. 18 ) vermerkt ist. Die Tatsache, daß 1230 der bischöfliche Anteil der Zehnten in diesem Dorf nicht an einen weltlichen Lehensträger vergeben war, scheint zunächst dagegen zu sprechen, daß Möllin Gerhards Wohnsitz vor seiner Abwanderung nach Parchim gewesen sei. Aber es ist denkbar, daß Gerhard damals, als er dem Ruf Borwins II. und seiner Söhne folgte, seinen Besitz in Malin an das Bistum veräußerte, um sich das für die Lokation erforderliche Betriebskapital zu verschaffen. Denn ohne Betriebskapital wäre an einen Erfolg in der Siedlung kaum zu denken gewesen; und die Kirche war am ehesten imstande, Geldmittel flüssig zu machen. Ferner deutet auf nahe Beziehung Parchims zu der Gadebuscher Gegend der Umstand, daß auch aus dem unmittelbar an Möllin grenzenden Roggendorf in den 40er Jahren die Brüder v. Holdorf am Hofe des Fürsten Pribislav von Parchim erschienen 19 ). Gerhard zog vor 1229 nach Parchim, wo er südlich der Stadt das später in sie aufgegangene Dorf Böken gründete 20 ). Sechs Hufen aus diesem Dorf schenkte er 1229 der Burgkapelle zu Parchim, die als Entschädigung für die durch die Teilung des Kirchspiels verursachte Einbuße an Einkünften dem Pfarrer der Altstadt Parchim übergeben wurde 21 ). Sein Sohn Gerhard vermachte weitere sechs Hufen in Böken zwischen 1256 und 1270 der Marienkirche in der Neustadt 22 ), seine Urenkel 31/2 Hufen der Schloßkapelle 23 ). Erst 1337 haben die Herren v. Malin ihre letzten Ansprüche auf Besitz in Böken aufgegeben 24 ).


|
Seite 157 |




|
Die 1344 im Besitz der Herren v. Malin befindlichen Güter in Slate, Klockow, Brokow, Lubow, Voddow und Slepekow 25 ), die, bis auf Slate, später in der Stadtfeldmark von Parchim aufgingen, scheinen erst im 14. Jahrhundert von der Familie erworben zu sein 26 ). Außerdem hatten sie Besitz bei Lübz 27 ), ohne daß wir Einzelheiten darüber angeben können.
Gerhard ist bis 1244 28 ), seine Söhne Martin und Gerhard sind von 1247 bis 1253 29 ) im Gefolge Pribislavs des öfteren erwähnt. Als Pribislav 1256 aus Parchim vertrieben wurde, sind die Malins im Lande geblieben und in den Dienst der Werler Fürsten getreten, bei denen Nikolaus v. Malin es 1294 zum Vogt in Parchim brachte 30 ). Erst 1316 sind Malins in andern als Werler Diensten nachweisbar; sie wurden Gefolgsleute Heinrichs des Löwen von Mecklenburg 31 ) und ließen sich in der Gegend um Crivitz nieder.
In der Urkunde Pribislavs vom Jahre 1240, in der er den Verkauf des Dorfes Bicher an die Stadt Parchim bestätigte 32 ), finden sich unter den Zeugen die Ritter Arnold v. d. Möhlen, der schon oben erwähnte Nanno v. Lentzen und Hermann Kanut; die ebenfalls testierenden 12 Ratsherren der Stadt tragen alle deutsche Namen. Ritter und Ratsherren sind hier geschieden. Fraglich ist, ob diese Ratsmänner von Anfang an bürgerlichen Standes gewesen sind, oder ob nicht ein Teil von ihnen den ursprünglich militärischen Beruf des Ritters mit dem eines Stadtherrn vertauscht hat. Nach ihrem Herkunftsort sind bezeichnet: Segebodo von Gadebusch, Gottfried von Mölln aus dem Lauenburgischen, Lutbert von Brusow aus der Gegend um Kröpelin 33 ), Johann von Bevenhusen aus dem Lüneburgischen, ein Ratsmann von Hamme; Wilhelm von Damme wird nicht aus Damm, w. Parchim, stammen, aber vielleicht war er der Lokator dieses Dorfes, der sich später in


|
Seite 158 |




|
die Stadt Parchim zurückzog. Da diese Ratsherren mit einem Teil der Lokatoren von 1226 identisch sein werden, gibt ihre Liste einen Anhalt darüber, aus welchen Gegenden die nicht ausdrücklich als Ritter bezeichneten Siedlungsunternehmer stammten. Das Fürstentum Mecklenburg ist mit Gadebusch und Brusow zweimal vertreten, das Herzogtum Sachsen-Lauenburg einmal mit Mölln, das Herzogtum Lüneburg einmal mit Bevensen, 21 km sö. Lüneburg; schwierig ist es bei Hamme, festzustellen, ob es sich hier um Hamme bei Hamburg oder etwa um Hamme, 4 km sw. Haselünne, im Amte Berserbrück handelt, zumal auch ein Damme 10 km ö. Berserbrück liegt.
Auch die ritterlichen Lokatoren werden zum Teil aus diesen Gegenden stammen. Neu tritt uns in der Urkunde vom Jahre 1240 zunächst Arnoldus de Molendino, v. d. Möhlen, entgegen. Ein Herr v. d. Möhlen wird zuerst 1218 erwähnt. Bei der Verleihung von Hufen in Lübesse und Uelitz, 16 km s. Schwerin, seitens der Schweriner Grafen an das Kloster Reinfeld waren am 25. VII. 1218 34 ) in Schwerin als Zeugen anwesend: Alard Badelaken, Alard v. Brüsewitz 35 ), Reimbold v. Drieberg, Rudolf v. Plate 36 ), Bernhard v. d. Möhlen, Hermann Schwabe, Werner v. Lüneburg und der Vogt Cotzo. 1219 werden bei der Bestätigung der Immunität des Klosters Reinfeld durch die Grafen 37 ) Alard Badelaken, Alard v. Brüsewitz, Reinbold v. Drieberg und Bernhard v. d. Möhlen genannt. Die Brüsewitze und die Driebergs saßen in der Eichsener Gegend, etwa 12 km nw. Schwerin. Jegorovs 38 ) Vermutung, daß der Beiname de Molendino sich auf das 7 km n. Drieberg liegende Dorf Mühlen-Eichsen beziehe, hat also viel für sich.
Dann teilte sich das Geschlecht v. d. Möhlen in zwei Linien, die vertreten sind durch die Brüder Eberhard und Johann und durch die Parchimschen Vasallen Arnold und Bernhard. Eberhard 39 ) und Johann 40 ) standen von 1232 bzw. 1235 bis 1248


|
Seite 159 |




|
im Dienst der Schweriner Grafen, bei denen Eberhard Truchseß war. Bedeutsam erscheint das Auftreten der Brüder als Zeugen 1235, als Graf Günzel von Schwerin dem Kloster Dünamünde zum Ersatz für den ihm durch seinen Vater, den Grafen Heinrich, zugefügten Schaden 12 Hufen in Siggelkow, 5 km sö. Parchim, zu ihrem dortigen Klosterhof verlieh 41 ). 1241 und 1246 42 ) testierte je einer der Brüder in Urkunden, die das Land Ture, das heutige Amt Lübz, ö. Parchim, betreffen. Beide Male befanden sie sich aber im Gefolge von Angehörigen des Schweriner Grafenhauses.
Arnold und Bernhard dagegen waren Vasallen des Fürsten Pribislav von Parchim. Von 1240 an läßt Arnold sich in seiner Umgebung feststellen 43 ). 1247 war er Zeuge, als Graf Günzel von Schwerin zu Pribislavs Gunsten auf seine Besitzungen im Lande Ture verzichtete 44 ); am 20. IV. 1249, als Pribislav dem Parchimer Priester Johannes Einkünfte in Parchim schenkte 45 ). Bei dieser Gelegenheit wird auch Bernhard v. d. Möhlen zum erstenmal genannt. Als Pribislav 1256 das Fürstentum Parchim verlassen mußte, sind Arnold und Bernhard im Lande geblieben. Sie wurden Vasallen der Schweriner Grafen, die jetzt die Verwaltung des Landes Parchim übernahmen. So waren sie am 13. XII. 1264 zugegen, als die Schweriner Grafen dem Kloster Dünamünde die Hälfte des von Bertold v. Lengeden erkauften Dorfes Crucen bei Siggelkow überließen 46 ). Über Arnold schweigen von nun ab die Quellen. Bernhard war noch am 6. VI. 1265 auf der Burg zu Parchim Zeuge, als Herzogin Helena von Sachsen dem Heil. Geist-Hause in Parchim das Eigentum von drei Hufen in Grebbin, 9 km n. Parchim, schenkte 47 ). Als im folgenden Jahre die Fürsten Johann und Hermann von Mecklenburg mit den Schweriner Grafen ein Bündnis gegen den Fürsten Heinrich von Mecklenburg abschlossen, führten die Ritter Bernhard


|
Seite 160 |




|
v. d. Möhlen und Hermann v. Hagenow die Verhandlungen für die Grafen 48 ).
Die häufige Erwähnung der Herren v. d. Möhlen in Urkunden, die sich auf das Land Ture und die nähere Umgegend von Siggelkow beziehen, läßt vermuten, daß sie hier ansässig waren. Dahin weist ferner der Umstand, daß im März 1275, als Graf Heinrich von Dannenberg dem Grafen Günzel von Schwerin die Burg Marnitz, 7 km s. Siggelkow, verpfändete, ein sonst genealogisch kaum einzuordnender Johann v. d. Möhlen die Verpflichtungserklärungen des Grafen Günzel als Treuhänder für den Dannenberger entgegennahm 49 ). 1273 hatte Nikolaus I. von Werle das Parchimer Land erworben. Die Herren v. d. Möhlen, die zu Anfang des 14. Jahrhunderts im Dienste der Werler Fürsten gestanden haben und häufig in Parchimer Angelegenheiten erwähnt sind, werden Glieder der Parchimschen Linie dieses Geschlechts gewesen sein 50 ).
Das Geschlecht der Knut oder Kanut ist zuerst im Ratzeburgischen nachweisbar. Noch vor 1230 war zusammen mit Segebodo v. Holdorf ein Ritter Heinrich Knut Zeuge bei dem Vertrage zwischen Bischof Gottschalk von Ratzeburg und den Dannenberger Grafen über das Land Wanninke 51 ). Hermann Knut befand sich 1240 im Gefolge des Fürsten Pribislav von Parchim und ebenfalls am 7. IV. 1244, als der Fürst der Stadt Plau das Dorf Slapzow zur Stadtfeldmark verlieh 52 ). Wo das Lehen dieses Geschlechts im Parchimer oder Plauer Lande lag, ist nicht überliefert. Als Fürst Pribislav in die Verbannung nach Wollin ging, hat die Familie sich geteilt. Ein Zweig folgte dem alten Lehensherrn nach Pommern; denn als 1289 Pribislavs Sohn, Pribislav von Daber und Belgard, dem Kloster Bukow 200 Hufen im Lande Belgard übertrug, befand sich als Zeuge unter seinen Gefolgsleuten auch ein Cristoforus Cnuth 53 ). Ein domicellus Knuth, dessen Rufname aber nicht angegeben ist, erscheint 1292 in der Zeugenliste einer Urkunde


|
Seite 161 |




|
Bogislavs II. von Pommern, als dieser der Witwe Johann Sweders den abgabefreien Besitz der Alten Fähre bei Anklam bestätigte 54 ).
Aber auch im Gefolge Nikolaus II. von Werle befand sich 1284 ein Ritter mit Namen Cnut. Er war September 1284 Zeuge, als der Fürst dem Plauer Bürger Heinrich Swartepape Pacht aus der Plauer Mühle verpfändete 55 ), und im November, als er der Neustadt Röbel das Eigentum von 15 Hufen im Dorf Cussecowe zu Stadtrecht verkaufte 56 ). 1285 war er bei den Verhandlungen des Fürsten mit der Ritterschaft der Länder Röbel, Malchow und Wenden wegen Übernahme eines Teils seiner Schulden in Sprenz anwesend 57 ). Zum letztenmal erscheint er urkundlich als Zeuge im August 1289, als Fürst Nikolaus dem Kloster Dobbertin das Eigentum von vier Hufen in Burow, 6 km s. Lübz, verlieh 58 ). Er besaß 30 Hufen in Tralow bei Lärz, 4 km nw. Mirow, die er 1285 an das Kloster Dobbertin verkaufte 59 ). Da Ritter Cnuth nur in Urkunden des Fürsten Nikolaus erscheint, die sich auf die Gegend von Röbel, Plau und s. Lübz beziehen, wird er nicht zum engeren Gefolge des Fürsten gehört, sondern nur als erfahrener Ortskundiger in dieser Gegend seine Zeugenschaft zur Verfügung gestellt haben; er wird hier ansässig gewesen sein. Fraglich erscheint aber, ob er gleich von Anfang an Besitz in Tralow hatte, da diese Gegend nicht zu Pribislavs Herrschaft gehört hat, sondern seit 1230 werlisches Gebiet war. War Knut schon zu Pribislavs Zeiten im Parchimer Fürstentum seßhaft, so wird man seinen Besitz in der Gegend südlich Lübz suchen müssen.
Erst 1347 werden wieder zwei Mitglieder des Geschlechts, Henneke und Heinrich, genannt, die Vasallen Nikolaus IV. von Werle-Goldberg waren 60 ).
1241 erscheinen in Pribislavs Gefolge, als er dem Kloster Dargun das Gut Darbein, 5 km n. Dargun, verkaufte, an neuen Rittern: Johann v. Schnakenburg, Nikolaus v. Hamburg, Bernhard und Hermann v. Hakenstedt et ceteri castren-


|
Seite 162 |




|
ses 61 ). Der Ausdruck et ceteri castrenses zeigt an, daß auch die namentlich angeführten Ritter Burgmannen waren. Auf welcher Burg sie saßen, ist nicht angegeben. Da Pribislav sich in der Urkunde aber als dominus de Parchem bezeichnet, wird auch Parchim der Burgsitz dieser castrenses gewesen sein 62 ). Die Anlage einer Burg und ihre Besetzung mit Burgmannen in der kleinen abgelegenen parchimschen Enklave Darbein an der pommerschen Grenze wäre sinnlos gewesen.
Wie Pribislav in den Besitz von Darbein gelangt ist, ist nicht überliefert worden. Vielleicht hat er am Zuge seines Bruders Johann 1236 gegen die Pommern teilgenommen, als Bischof Brunward von Schwerin Anspruch auf den Zehnten in diesen Gegenden erhob, und Darbein als Beuteanteil erhalten, mit dem er dann einen Slaven Ratislav belehnte.
Johann v. Schnakenburg trägt seinen Beinamen nach dem Dorf Schnakenburg a. Elbe, 9 km sö. Lenzen. Die Heimat des Geschlechts scheint aber nicht hier, sondern im Alten Lande bei Jork gelegen zu haben 63 ). Johann ist schon unter Borwin I.


|
Seite 163 |




|
nach Mecklenburg gewandert. Seit 1218 begegnet er häufig im Gefolge des Fürsten, bei dem er eine bevorzugte Stellung eingenommen zu haben scheint 64 ). Von 1221 ab stand er im Dienst Heinrichs II. Borwin von Rostock-Werle 65 ) und führte, als Borwin I. am 28. I. 1227 gestorben war, mit andern Mitgliedern der Ritterschaft die Vormundschaft über dessen unmündige Enkel 66 ). Nach der Landesteilung von 1229 folgte er dem Fürsten Nikolaus von Werle, in dessen Dienst er bis 1240 blieb 67 ).
Nach dem 24. IV. 1241 hat Johann v. Schnakenburg sich auf kurze Zeit an der Kolonisation vor allem des Landes Plau beteiligt. Er besaß das Dorf Slapzow. Am 7. IV. 1244 68 ), nach der Rückkehr Johanns v. Schnakenburg in werlesche Dienste 69 ), hat Fürst Pribislav von Parchim den Plauer Bürgern den Besitz von Slapzow mit allem Recht außer dem Halsgericht überlassen und ihnen freigestellt, das Dorf an Kolonisten auszutun oder es zur Stadtweide zu legen. Am 24. Juli 1259 bezeugte aber der Verweser des östlichen Teils des ehemaligen Fürstentums Parchim, Fürst Nikolaus von Werle, daß die Plauer Bürger das Dorf Slapzow mit den Zehnten und allen übrigen Einkünften von Herrn Johann v. Schnakenburg und seinen Erben für ihr gutes Geld gekauft hätten 70 ). Da aber Bischof Rudolf von Schwerin Anspruch auf die Zehnten erhoben habe und sie zu eigenem Gebrauch verwenden wollte, habe Johann v. Schnakenburg mit seinen Erben in der Kirche der Minoritenbrüder zu Rostock vor dem Bischof sein Recht auf den Zehnten erwiesen und von ihm den Verzicht darauf verlangt. 1263 hat dann Johanns Sohn Gerhard der Stadt Plau diese Befreiung des an sie von seinem Vater verkauften Zehnten von bischöflichen Ansprüchen bestätigt und seine und seiner


|
Seite 164 |




|
Kinder ausdrückliche Zustimmung zu diesem Verkauf gegeben 71 ). Der Widerspruch zwischen der Verleihung Slapzows durch Pribislav an die Stadt und dem Verkauf des Dorfes durch Johann v. Schnakenburg erklärt sich am besten auf folgende Weise: Der Verkauf seitens Johanns war schon vor dem 7. IV. 1244 erfolgt; Pribislav überwies an diesem Tage nur die Gerichtsbarkeit an die Stadt und gab ihr das Eigentum an den von Johann erkauften Gütern und Zehnten. Bischof Rudolf hat dann gegen die Verfügung des Fürsten über die Zehnten, die er für sich selbst beanspruchte, Einspruch erhoben, der erst 1259 beseitigt worden ist 72 ).
Johann v. Schnakenburg hat bald wieder das Parchimer Fürstentum verlassen. Vom 12. IX. 1243 ab bis etwa 1271 hat er im Dienst der Rostocker Fürsten gestanden 73 ). Immerhin besaß er im Lande Ture noch das Dorf Kreien, 5 km sö. Lübz, aus dem er um seines und seiner Gemahlin Seelenheils willen vor 1271 acht Hufen an das Kloster Stepenitz abtrat 74 ).
Im Fürstentum Parchim ließ sich aber Johanns Bruder Hermann nieder, der sich nach seinem Besitz v. Reppentin nannte. Das Dorf Reppentin liegt 3 km sw. Plau. Er scheint von Nikolaus von Werle wegen einer Eheangelegenheit geächtet worden zu sein und floh zum Markgrafen Otto von Brandenburg, der den Werler Fürsten 1269 zwang, Hermann wieder in seine Güter einzusetzen 75 ). 1271 bestätigte er die Schenkung seines Bruders an das Kloster Stepenitz 76 ). Nachkommen scheint er nicht hinterlassen zu haben.
Weniger klar liegen die Beziehungen der Herren v. Hakenstedt zum Parchimer Lande. Die Heimat des Geschlechts war Hakenstedt, 14 km w. Magdeburg. Schon 1147 befand sich ein Ritter Dietrich de Hackenstedt im Gefolge des Erzbischofs Friedrich von Magdeburg 77 ). Zwischen 1196 und 1200 war ein Ritter Bernhard v. Hackenstedt in Ratzeburg anwesend, als Bischof Isfried die von der Gräfin Adelheid von Ratzeburg


|
Seite 165 |




|
dem Dorf Walksfelde verliehenen Befreiungen bestätigte 78 ). Da Isfried vor seiner Erhebung zum Bischof Propst im Kloster Jerichow, n. Magdeburg, gewesen war, mag Bernhard v. Hackenstedts Übersiedelung in das ratzeburgische Kolonialland auf seine Bekanntschaft mit Isfried zurückzuführen sein.
Dann tauchen erst wieder 1239 zwei Angehörige des Geschlechts v. Hakenstedt, Bernhard und Hermann, auf 79 ). Sie befanden sich im Gefolge des Fürsten Johann von Mecklenburg, als er im April 1239 das vom Kloster Dargun gekaufte Dorf Lehnenhof, 3 km n. Dargun, und vier Hufen in Stassow, 10 km nw. Gnoien, die den Mönchen von Bartolds Witwe Ermengard geschenkt worden waren, von allen landesherrlichen Lasten befreite. Da 1269 Hermann II. v. Hakenstedt von der Kirche zu Gr.-Methling zwei Hufen in Warrenzin, 8 km sw. Darbein, eintauschte 80 ), die schon sein verstorbener Vater 81 ) ihr als Kirchengut angewiesen hatte 82 ), ist anzunehmen, daß Bernhard und Hermann I. schon zur Zeit der Ausstellung jener Urkunde vom April 1239 in der Darguner Gegend ansässig waren. Sie werden zu jener Gruppe von Rittern gehören, die am Kampf Bischof Brunwards von Schwerin und der wendischen Fürsten gegen die Pommern 1236 teilnahmen und für ihre Dienste mit Lehen auf dem eroberten Boden belohnt wurden. Die Beziehungen der Hakenstedts zu Pribislav von Parchim werden daher auf die gemeinsame Beteiligung am Kampfe von 1236 oder auf die Nachbarschaft des Hakenstedtschen Besitzes zum fürstlichen Dorf Darbein zurückzuführen sein. Sehr eng scheinen sie aber nicht gewesen zu sein, da die Hakenstedts nur 1241 in Pribislavs Gefolge genannt werden. Vielleicht entsprachen die Aussichten die sich ihnen in Parchim boten, nicht den Hoffnungen, die sie sich von einer engeren Verbindung mit dem jungen Dynasten gemacht hatten.


|
Seite 166 |




|
Das Schwergewicht des Hakenstedtschen Besitzes lag im 13. Jahrhundert in der Gegend um Dargun und Gnoien 83 ). Allerdings begegnen wir von 1284 bis 1300 gelegentlich Bernhard II. von Hakenstedt, Hermanns II. Bruder 84 ), als Zeugen in Urkunden, die sich auf die Umgegend von Röbel beziehen 85 ); aber sichere Schlüsse auf etwaige Hakenstedtsche Güter im Lande Röbel oder Ture lassen sich aus diesen Angaben nicht folgern. Hatten sie hier Besitz, so ging er nicht auf Verleihungen Pribislavs zurück.
Von einer ritterlichen Familie v. Hamburg ist bis 1241 nichts überliefert worden. Es ist aber möglich, daß der Ritter Nikolaus v. Hamburg identisch ist mit dem Vogt Nikolaus von Hamburg, der 1220 und 1222 Gefolgsmann des Grafen Albrecht von Orlamünde und Holstein war und in dem ich ein Mitglied der Familie Salem-Wittenburg vermute 86 ). Seine Nachkommen scheinen unter dem Namen de Wittenburg im Lande Parchim gelebt zu haben. Am 25. II. 1278 verpfändeten die Werler Fürsten den Knappen Wedekind v. d. Brüggen und Bernhard v. Wittenburg eine Getreidehebung aus der Mühle in Plau für die beträchtliche Summe von 300 Mk. lübsch, wobei auch ein Knappe Heinrich v. Tralau für die Fürsten bürgte 87 ). Und am 24. VIII. 1293 verkaufte Fürst Nikolaus von Werle dem Geistlichen Johann v. Wittenburg eine jährliche Kornhebung aus der Mühle in Parchim 88 ). Unter diesem Johannes clericus de Wittenborgh wird kaum ein Pfarrer der Stadt Wittenburg gemeint sein, sondern de Wittenborgh ist ein Teil seines Namens. Das Namensregister des MUB. 89 ) hat diesen Johann gleichgesetzt mit dem Lübecker Domherrn Johann v. Wittenburg, dem Sohn des Ratsherrn Heinrich v. Wittenburg. Dem widerspricht aber neben den örtlichen Verhältnissen vor allem, daß die Namen der Brüder Johanns, Marquard und Bernhard, in der Lübecker Familie im 13. Jahrhundert nicht überliefert sind,


|
Seite 167 |




|
während ein Knappe Bernhard v. Wittenburg im Lande Parchim 1278 ansässig war 90 ). Es ist nicht anzunehmen, daß dieser Knappe einem lübischen Ratsgeschlecht entstammte. Als Johanns Brüder werden genannt: Marquard mit mehreren Söhnen und ein anscheinend schon verstorbener Bernhard mit einem Sohn. In einer Urkunde vom 1. II. 1324 wird unser Johann zwar als Sohn eines Heinrich v. Wittenburg und seiner Gemahlin Assela bezeichnet; er erhält hier aber den Titel perpetuus vicarius in Lubeke 91 ). Dann war er also nicht Domherr in Lübeck, wie etwa der Johann v. Wittenburg von 1266 in MUB. 1060, denn die Vikare waren nicht Mitglieder des Domkapitels, sondern nur Stellvertreter für abwesende Domherren 92 ). Wie die Urkunde vom 1. II. 1324 zeigt, saß die Verwandtschaft dieses Johann v. Wittenburg vielmehr in Parchim, wo schon 1282 ein Heinrich v. Wittenburg als Bürger von Alt-Parchim urkundlich erscheint 93 ). Diese Wittenburgs in Parchim sind vielleicht Nachkommen des Nikolaus v. Hamburg, die sich dem bürgerlichen Berufe zugewandt haben.
Allzu groß ist die Zahl der bis 1241 nachweisbaren ritterlichen Einwanderer nicht. Sie kommen, wenn auch gelegentlich vielleicht auf Umwegen, aus dem Ratzeburgischen wie die Hakenstedts, Knut und wohl auch Nikolaus v. Hamburg, aus der Grafschaft Schwerin wie die v. d. Möhlen, aus dem Fürstentum Mecklenburg wie die Malins und Johann v. Schnakenburg und aus der Priegnitz wie Nanno v. Lenzen. Von unmittelbarer Einwanderung aus dem südlich von Parchim liegenden Brandenburg und dem altdeutschen Gebiet links der Elbe ist nichts zu spüren. Aber die Namen sind so unbedingt deutsch 94 ), daß mit Ausnahme des dänisch anmutenden Knut es sich hier nur um Abkömmlinge von Familien handeln kann, deren Ahnherren westlich der Elbe auf altdeutschem Boden gesessen haben.


|
Seite 168 |




|
Die Einwanderung erfolgte bisher von Westen und Nordwesten her. Die Zusammensetzung der parchimschen Ritterschaft änderte sich aber 1244. Wohl als Folge der Heirat Pribislavs mit einer Tochter Herzog Barnims I. von Pommern erscheinen 1244 mehrere Ritter an seinem Hof, die bis dahin in Pommern nachweisbar sind. Sie werden als Begleiter der jungen Fürstin in das Land Parchim gekommen sein. Als Pribislav am 7. IV. 1244 der Stadt PIau das Dorf Slapzow zur Feldmark hinzu verlieh, waren als Zeugen Heinrich v. Artelnburg, Gerhard v. Mallin, ein Ritter Dunco, Wedekind v. Walsleben, Hermann Knut, ein Ritter Witto, Bartold Soneke und Tethard v. Weye zugegen 95 ).
Jegorov 96 ) hat die Behauptung aufgestellt, daß Herren v. Artlenburg über Woitendorf bei Demern, 13 km önö. Ratzeburg, nach Osten gewandert seien. Die großen Bedenken, die dieser Annahme gegenüberstehen, werden an anderer Stelle vorgebracht werden 97 ). Die Herren v. Artlenburg stammen zweifellos aus Artelnburg an der Elbe, wo ihre Vorfahren bis zur Zerstörung der Burg zu Ende des 12. Jahrhunderts als herzogliche Ministerialen saßen. Auf welchem Wege sie dann aber nach Pommern gelangt sind, wird sich schwerlich mit Sicherheit feststellen lassen. Manches spricht dafür, daß Werner v. Artlenburg 1236 im Gefolge Johanns von Mecklenburg am Kampf gegen die Pommern teilnahm und zum Lohn mit dem Dorf Cornim bei Dargun ausgestattet worden ist. Später ist er dann als Burgmann im benachbarten Demmin in pommersche Dienste übergetreten. Da die Artlenburgs dasselbe Wappen führten 98 ) wie die Walslebens und häufig mit ihnen zusammen in pommerschen Urkunden genannt werden, können sie stammverwandt sein. Dagegen spricht aber die Verschiedenheit der Familiennamen in beiden Geschlechtern, die nur den in Pommern damals sehr häufig vorkommenden Rufnamen


|
Seite 169 |




|
Johannes gemeinsam haben; wenn oft in den Zeugenlisten Herren v. Artlenburg und v. Walsleben zusammen auftreten, so ist das wohl darauf zurückzuführen, daß Mitglieder beider Geschlechter Burgmannen in Demmin waren.
Ebensowenig läßt sich über den Aufenthalt des Ritters Heinrich v. Artlenburg vor seiner Einwanderung nach Parchim feststellen. Gehörte er zu jener Ritterschar, die im Gefolge der pommerschen Herzogstochter von Osten her in das Land gezogen war, oder kam er aus dem Westen, vielleicht aus dem Fürstentum Mecklenburg, wie ein Teil der bisher genannten ritterlichen Zuwanderer ? Gegen einen engeren Zusammenhang mit den pommerschen Artlenburgs spricht vor allem der Umstand, daß der Rufname Heinrich ihnen bis 1320 fremd war. Nachkommen scheint Heinrich nicht hinterlassen zu haben, da Herren v. Artlenburg im Lande Parchim sonst nicht mehr vorkommen.
Genauer sind wir über die Herkunft Wedekinds v. Walsleben unterichtet.
Das Geschlecht v. Walsleben stammt aus dem Dorf Walsleben, 7 km sö. Osterburg, in der Altmark.
Die in diesem Geschlecht besonders bevorzugten Namen waren Wedekind und Johann. Vieles spricht dafür, daß der im RZR. von 1230 mehrfach genannte Wedekind ein Glied dieser Familie war. Zunächst ist es der Umstand, daß in der Zeit bis 1300 der Rufname Wedekind, abgekürzt als Wedego, sich in Mecklenburg und Pommern nur bei dieser Familie findet. Im RZR. wird ein Wedekind 99 ) genannt als Inhaber der Zehnten von drei Hufen in Sterley, 9 km s. Ratzeburg. im Lande Ratzeburg 100 ), von einer Hufe in Wölschendorf, 3 km n. Rehna, im Lande Gadebusch 101 ), von fünf Hufen in Benckendorf, 3 km nw. Dassow, im Lande Dassow 102 ), und von zwei Hufen in Everstorf, 5 km nö. Grevesmühlen, im Lande


|
Seite 170 |




|
Breesen 103 ). Die Kolonisation in Breesen und in Dassow scheint erst um das Jahr 1220 energisch aufgenommen worden zu sein 104 ). Gleichzeitiger Lehensbesitz in den Ländern Ratzeburg und Gadebusch scheint aber zurückzugehen auf die Zeit vor 1201, als beide Länder noch unter der gemeinsamen Herrschaft der Ratzeburger Grafen standen. Wie bei dem Geschlecht der Hakenstedts 105 ) liegt auch bei den Herren v. Walsleben die Annahme nahe, daß sie durch Bischof Isfried, den früheren Propsten des 20 km sö. von Walsleben liegenden Klosters Jerichow, in das Ratzeburger Land gerufen worden sind.
Mit dem Wedekind des RZR. scheint der Ritter Wedekinus identisch zu sein, der 1229 in der Zeugenliste zur Urkunde über die Schenkung des Dorfes Disnak seitens des Herzogs Albrecht von Sachsen an das St. Johannishospital in Jerusalem erscheint 106 ). Es stimmt gut zu der Annahme, daß es sich hier zugleich um einen Wedekind v. Walsleben handele, daß dem Namen Wedekinus unmittelbar der Name Hermannus de Magdeborch vorhergeht.
Das Geschlecht scheint sich dann in zwei Linien geteilt zu haben. Die eine hat zwischen 1230 und 1240 die Wanderung nach Osten fortgesetzt, während die andere einen Teil der im RZR. aufgeführten Güter behielt und nur noch gelegentlich in den Urkunden als Herren v. Sterley erscheint.
Schon im Juli 1236 tauchte in Pommern am Hofe Herzog Wartislavs III. ein Wedgo auf, der zwar nicht den Beinamen v. Walsleben trug, aber dennoch sicher dieser Familie zuzurechnen ist. Nur bei den Walsleben kam auch in Pommern bis 1300 dieser Rufname vor; und aus einer Urkunde der Pommernherzöge vom Jahre 1244 107 ) ist ersichtlich, daß damals neben Johann v. Walsleben noch ein weiteres Glied des Geschlechts in Demmin ansässig war, dessen Rufname aber nicht genannt wird. 1236 riefen die Pommernherzöge in ihrer Be-


|
Seite 171 |




|
drängnis, in die sie durch ihr Eintreten für Bischof Konrad III. von Kammin anläßlich des Schwerin-kamminschen Bischofsstreits geraten waren, die Hilfe deutscher Ritter gegen die mecklenburgischen Fürsten herbei. Zu ihnen scheint auch Wedego gehört zu haben. 1236 wird er im Gefolge Wartislavs III. mit den beiden aus der Schweriner Grafschaft stammenden Rittern Konrad v. Schönwalde und Luthard v. Brüsewitz 108 ) aufgeführt. April 1240 109 ) war er in Stolp, Frühjahr 1244 in Demmin 110 ) im Gefolge Barnims I. Dann verschwindet Wedego v. Walsleben aber bis 1260 ganz aus der pommerschen Ritterschaft.
Zur gleichen Zeit, im April 1244, stellte sich am Hofe des Fürsten Pribislav von Parchim, der gerade damals die Tochter Herzog Barnims I. von Pommern heiratete, ein Ritter Wedekind v. Walsleben ein 111 ). Als Lehen trug er bis Anfang 1253 vom Parchimer Fürsten das Dorf Zarchlin, 7 km nnw Plau; Februar 1253 ging Zarchlin in den Besitz des Klosters Doberan über 112 ). 1244, 1247 und 1253 wird er als Zeuge in Pribislavs Gefolge urkundlich aufgeführt 113 ). An Wedekinds Namen haftet der schwere Vorwurf des Verrats an seinem Lehensherrn Pribislav, den er 1256 gefangennahm und an Bischof Rudolf von Schwerin auslieferte. Die Einzelheiten dieser Tat und die Gründe, die sie veranlaßten, sind aus den Quellen nicht mehr zu erkennen 114 ). Wedekind wurde aber mit "seinen Söhnen und Erben und Dienern, die bei der Gefangennahme dabei gewesen" waren, in die Urfehde einbezogen, welche die mecklenburgischen Fürsten und Graf Günzel von Schwerin am 28. XI. 1256 dem Bischof Rudolf in Schwerin schwuren 115 ). Danach muß Wedekind Söhne gehabt haben. Nach 1256 begegnen die Walslebens nicht mehr in Urkunden des Parchimer Landes; Wedekind wird es vorgezogen haben, aus der ritterlichen Gesellschaft in Parchim zu verschwinden


|
Seite 172 |




|
und nach Pommern zurückzukehren, wo sich von 1260 ab öfter wieder ein Wedekind v. Walsleben zeigt 116 ). Um 1269 scheint er gestorben zu sein 117 ). Er hinterließ vermutlich drei Söhne: Waldemar 118 ), Wedekind 119 ) und Giseko 120 ). Waldemar ist früh verstorben, Wedekind II. und Giseko waren 1287 Vasallen des Bischofs von Kammin. Der in Demmin bleibende Zweig des Geschlechts waren Nachkommen Johanns v. Walsleben, der 1244 wohl Burgmannenamt und Burgmannenlehen seines nach Parchim ziehenden Bruders Wedekind I. übernommem hatte.
Die Vuncos und Zonekes scheinen slavische Rittergeschlechter zu sein. Bei den Vuncos oder Wnkas zeigt sich das schon in der häufig wechselnden Schreibweise des Namens; als hätte der Notar Schwierigkeiten gehabt, diesen Namen mit den ihm gebräuchlichen Buchstaben des lateinischen Alphabets lautgetreu wiederzugeben. Heinricus Vunco war wohl einer der ersten slavischen Großen in Pommern, die die Sitten der deutschen Ritter annahmen und sich in den neuen militärischen Berufsstand der milites aufnehmen ließen. Er wird in den Urkunden zum erstenmal als Zeuge genannt, als am 28. IV. 1240 Herzog Barnim I. von Pommern von Bischof Konrad von Kammin im Kloster Stolp, 6 km w. Anklam, den Bischofszehnten von 1800 Hufen in den Landschaften Prenzlau, Penkun, Stettin, Zehden und Pyritz zu Lehen nahm und dafür dem Bistum das Land Stargard a. I. überließ 121 ). Er befand sich 1242/3 als Heinrich Wnka, Vunka und Vuncko im Gefolge Herzog Barnims 122 ), um dann 1244 im Lande Parchim aufzutauchen 123 ). Eine bedeutende Rolle scheint weder er noch Bartold Zoneke inmitten der deutschen Ritterschaft der neuen Heimat gespielt zu haben. Dennoch werden seine Nachkommen auch nach Pribislavs Vertreibung aus dem Lande dort geblieben sein.


|
Seite 173 |




|
1286 erscheint der Name Wnke wieder im Lande Werle-Parchim. Als Fürst Nikolaus II. von Werle am 10. VIII. 1286 dem Kloster Dobbertin die Hälfte des Dobbertiner Sees und den Vogtszug auf dem See von Kleisten, 4 km nö. Dobbertin, verkaufte, war unter einer stattlichen Zahl von Rittern und Knappen des Fürsten auch ein Knappe Johannes Wncke anwesend. Die Urkunde ist in Malchow gegeben 124 ). Und die Wahrscheinlichkeit, daß wir es hier mit einem Nachkommen jenes Vunco von 1244 zu tun haben, wird noch gesteigert durch eine Urkunde des Werler Fürsten vom 29. XII. 1294 125 ), nach der er dem vorpommerschen Kloster Neuenkamp das Eigentum von fünf Hufen in der Nähe von Goldberg (circa oppidum Goldberghe situatorum) verkaufte, die früher der "Ritter Johannes, genannt Wnken, der ehemalige Vogt daselbst, besessen hatte und die einstmals zum Burglehen von Richenhagen 126 ) gehört hatten". Johann Wnkes Name fehlt zwar unter den Zeugen; aber durch diese Urkunde wird klar, daß am Ende des 13. Jahrhunderts ein Ritter Johann Wnke noch Güter aus dem Richenhagener Burglehen besaß, deren Besitz vermutlich noch auf Pribislavs Gefolgsmann Vunco vom Jahr 1244 zurückgeht. Johannes Vunko wurde sogar Vogt von Röbel; vielleicht war der Knappe Johann von 1286 sein Sohn; und noch vom Juli 1331 bis zum Jahr 1338 geht ein Knappe Konrad Wnko durch die Urkunden des Landes Parchim 127 ).
Ein Zusammenhang des Geschlechts der Wnkas mit den Wenkes und Vinekes, den das Register des MUB. vermutet 128 ), wird aber kaum bestehen. Heinrich Wnka kam aus Stettin nach Parchim. Die Wenkes tauchen aber bei Dargun auf 129 ) und Ritter Vineke war allem Anschein nach ursprünglich bei Wismar ansässig 130 ).


|
Seite 174 |




|
Von den Sonekes ist Bartold das erste urkundlich überlieferte Mitglied; sowohl der Vorname Bartold wie die sonst übliche Schreibart des Zunamens Zonike sprechen für slavischen Ursprung. Während der nächsten drei Jahrzehnte schweigt die Überlieferung über ihn. Ein Zweig des Geschlechts ist aber doch im Lande verblieben. Am 15. V. 1277 wird unter den Knappen der Werler Fürsten in Parchim ein Soneke 131 ), am 25. II. 1278 in Plau ein Sonekinus 132 ) erwähnt. Vermutlich ist es derselbe Mann wie der Ritter Friedrich Soneke, der am 22. VI. 1284 die Bestätigung der Gerechtsame der Stadt Parchim durch die Werler Fürsten mitunterzeichnete 133 ).
Die pommersche Herkunft des Geschlechts wird wahrscheinlich durch das Auftreten eines Friedrich Szoneke 1254 134 ) und 1257 135 ) im Gefolge der Pommernherzöge und des Fürsten Jaromar von Rügen. Ein Zweig des Geschlechtes erscheint von 1273 ab in Stargard 136 ) und in der Ukermark. Doch reichen die Quellen nicht aus, festzustellen, ob diese Sonekes aus Pommern oder dem Lande Parchim dorthin eingewandert sind.
Thethard v. Weye entstammt einem bremischen oder verdenschen Ministerialengeschlecht 137 ). Nur zwei Mitglieder dieser Familie sind im 13. Jahrhundert im Kolonisationsgebiet nachweisbar und werden nur je einmal genannt: unser Thethard und ein Knappe Alexander dictus de Weye, der von Fürst Wizlav von Rügen das Dorf Voigdehagen, 4 km s. Stralsund, zu Lehen trug und es vor dem 16. X. 1289 an die Stadt veräußerte 138 ). Es ist bei diesem spärlichen Material nicht möglich, Schlüsse zu ziehen über den Weg, den Thethard auf seiner Wanderung nach Parchim gezogen ist.
Rätsel gibt der Name Witto auf. Wäre der ratzeburgische Ritter Albus oder Otto v. Kogel gemeint, so würde man doch die deutsche Form Witte erwarten. Die Endung -o scheint mir


|
Seite 175 |




|
wie bei Vunko auf slavischen Ursprung hinzudeuten. Dafür spricht auch eine andere Beobachtung. Am 23. III. 1235 werden in Demminer Urkunden des Herzogs Barnim I. von Pommern ein Pribislauus albus und sein Bruder Zlauko v. Wollin als Zeugen genannt 139 ). Stammvater des Geschlechts war Pribbezslaus de Kamin, der schon 1215 in Demmin am Hofe des Pommernherzogs nachweisbar ist 140 ). Der Zusatz Albus ist zunächst sicher kein Familienname, sondern ein ganz individueller Beiname des Pribislav. Vielleicht erklärt sich daraus auch das Fehlen des Vornamens bei dem Witto unserer Urkunde. Es gab eben unter den slavischen Rittern, die aus Pommern nach Parchim zogen, nur diesen einen Albus. In Pommern verschwindet dann dieser slavische Pribislav Witto. Erst 1268 taucht wieder ein Tezlav Witte und sein Bruder Dubislav in Usedom, Wollin und Kamin auf 141 ). Er nimmt hier von vorneherein eine gehobene Stellung ein und tritt in den Zeugenlisten gelegentlich selbst vor die deutschen Ritter. In Wollin fand auch Pribislav von Parchim nach seinem Sturze Zuflucht, Ich halte es daher für wahrscheinlich, daß Pribislav Witto oder seine Söhne zusammen mit dem Fürsten Pribislav das Land Parchim verlassen haben und wieder in ihre alte Heimat Wollin-Kammin zurückgekehrt sind. Im Lande Parchim sind Nachkommen dieses Witto nach 1256 nicht feststellbar.
Als 1247 Fürst Pribislav sich mit den Grafen von Schwerin über streitige Besitzungen in den Ländern Ture und Brenz verglich 142 ), waren als Zeugen nur deutsche Ritter anwesend: Nanno v. Lenzen, Wedekind v. Walsleben, Martin und Gerhard v. Malin, Arnold v. d. Möhlen und Heinrich v. Hagenow. Neu ist unter ihnen nur Heinrich v. Hagenow.
Nur sehr dürftig sind die unmittelbaren Nachrichten, die über die Familie v. Hagenow erhalten sind. Sie saß im Lande Wittenburg und im Ratzeburgischen und war eines der Geschlechter, die in den Sturz Albrechts von Orlamünde verwickelt wurden; sie gehörte dem Lebenskreis der Salems an. In der Grafschaft Schwerin und im Herzogtum Sachsen war


|
Seite 176 |




|
ihre politische Rolle 1227 ausgespielt. Heinrich v. Hagenow mag gehofft haben, jetzt im Lande Parchim wieder eine führende Stellung zu erwerben.
Die Einwanderung weiterer ritterlicher Geschlechter zeigt die Zeugenliste einer Urkunde des Fürsten Pribislav vom 20. IX. 1249. Der Fürst verlieh in ihr dem Priester Johannes zu der Kirche in der Neustadt Parchim die dortige Burgkapelle mit sechs Hufen in Böken, eine Hof- und Hausstelle zwischen Burggraben und Mühlendamm und die Schulen in der Stadt. Die Urkundenhandlung ging auf der Burg Parchim vor sich, und bei ihr zugegen waren Nanno v. Lenzen, Arnold und Bernhard v. d. Möhlen, Dietrich Berser, Johann v. Restorf (de Redekestorp), die Brüder Iwan und Nikolaus v. Below, die Brüder Gerhard und Martin v. Malin und die Brüder Heinrich und Segebodo v. Holdorf (Holtdorp) 143 ).
Die Herren v. Bersen stammen vermutlich aus Westfalen, aus der Gegend des Klosters Bassum 144 ), nach dem sich das erzbischöflich bremische Ministerialengeschlecht der de Bersen oder de Bersne 145 ) nannte. Gegen diese Annahme spricht allerdings die gelegentlich in ostelbischen Urkunden neben der sonst gebräuchlichen Form des Zunamens Bersarius, Bersarinus, Bersere angewandte Variation Bursarius oder Bursere 146 ) und das Fehlen der bei den ostelbischen Bersers vertretenen Rufnamen Otto und Dietrich bei dem im Erzbistum Bremen zurückgebliebenen Zweig der Familie 147 ). Aber diesem Einwurf steht doch das Auftreten der rechtselbischen Bersers in Urkunden entgegen, die das Kloster Amelungsborn betrafen 148 ), und die Einreihung der Brüder Otto und Dietrich Bursarius zwischen die aus dem Bistum Verden stammenden Ritter Lippold Behr und Vogt Georg Schake in der Zeugenliste einer werleschen Fürstenurkunde vom 26. V. 1239 149 ). Das älteste


|
Seite 177 |




|
bisher nachweisbare Glied dieses Geschlechts ist Otto Bersarius, der am 30. X. 1230 bei dem Grenzvertrag der Söhne Heinrichs II. Borwin mit Graf Günzel von Schwerin im Gefolge der ersteren Zeuge war 150 ). Otto Bursarius befand sich unter den Rittern des Werler Fürsten Nikolaus, als dieser am 7. IV. 1236 in Güstrow der Stadt Malchin das Schweriner Stadtrecht verlieh 151 ), und zusammen mit einem Dietrich Bursarius, als Nikolaus am 26. V. 1239 das Kloster Amelungsborn als Erbpächter in die Mühle von Priborn, 9 km s. Röbel, einsetzte 152 ).
Im Februar 1243 stoßen wir in Pommern auf einen Sifridus Berser, der zusammen mit Heinrich Vunka bei Schenkungen Herzog Barnims an das neugegründete Stettiner Nonnenkloster in seinem Gefolge genannt wird. Allerdings kommt Siegfried nur dies eine Mal in den Urkunden vor 153 ).
Otto Berser begegnet unter den werleschen Vasallen noch 1244 154 ), 1249 155 ), 1256 156 ) und 1261 157 ). Da er 1256 als miles de Robele bezeichnet 158 ) wird und da sechs von den acht Urkunden, in denen Otto vorkommt, in Röbel datiert sind 159 ), ist anzunehmen, daß Otto dort Burgmann war.
Dietrich war 1239 zusammen mit Otto Berser Vasall des Fürsten Nikolaus von Werle 160 ). Am 20. IX. 1249 befand er sich in Parchim beim Fürsten Pribislav 161 ). Dietrich ist dann nur noch einmal am 14. II. 1253 als Gefolgsmann Pribislavs urkundlich erwähnt, als dieser in Wismar dem Kloster Doberan das Dorf Zarchelin, 7 km nnw. Plau, verkaufte 162 ). Ob Dietrichs Übertritt aus werleschem Dienst in den Pribislavs unter Vunkas Einfluß 163 ) erfolgte, ist ebenso-


|
Seite 178 |




|
wenig festzustellen wie die Gegend im Lande Parchim, wo sein Lehen lag.
Nach 1261 verschwindet das Geschlecht Berser ganz aus der Ritterschaft des Kolonisationsgebiets. Vielleicht begnügten Ottos und Dietrichs Nachkommen sich mit der bescheideneren Rolle eines Parchimer Bürgers, unter denen 1282 noch ein Otto Berser genannt wird 164 ).
Ritter mit dem Zunamen de Redekestorp, v. Restorf, tauchen in mecklenburgischen Angelegenheiten zum erstenmal im August 1227 auf, als die Markgrafen Otto und Johann von Brandenburg in Werben in der Altmark die Schenkung des Dorfes Mirow seitens der Söhne Heinrich Borwins an den Johanniterorden bestätigten 165 ). Nicht weniger als fünf Brüder v. Restorf: Johann. Albert, Friedrich, Hartmann und Brüning, waren bei dieser Gelegenheit zugegen. Sie saßen zweifellos auf dem 5 km südlich Lenzen liegenden Gut Restorf. Vielleicht erklärt dieser Umstand die Einwanderung der Restorfs in das Land Parchim. 3 km ö. Restorf liegt ein Holtorf, 8 km ö. Schnakenburg; und 1229 finden wir einen Nanno v. Lenzen, 1241 Johann v. Schnakenburg, 1249 die fratres dicti de Holtorp 166 ) bei Pribislav von Parchim. Ebenfalls in Werben waren Albert und Helmbrecht v. Redixtorpe im Juli 1238 Zeugen, als die Markgrafen dem Kloster Dünamünde das Eigentum an 30 Hufen in Zachow und an 52 Hufen zu Siggelkow verliehen, die die Grafen von Dannenberg und von Schwerin von den Markgrafen zu Lehen getragen hatten 167 ). In die mecklenburgische Ritterschaft ist das Geschlecht dann eingetreten mit Ritter Johannes de Redekestorp 1249 in Parchim 168 ), und zwar allem Anschein nach unmittelbar und nicht auf dem Weg über brandenburgische Dienste.
Die Ritter Brüning und Albert de Redingestorp, die im Mai 1267 im mecklenburgischen Stargard als Zeugen auftraten, als Markgraf Otto das Dorf Daberkow, 5 km nö.


|
Seite 179 |




|
Woldegk, gegen Zehnten im Lande Pritzwalk vertauschte 169 ), sind vielleicht Johanns Söhne; denn Brüning war am 15. V. 1277 am Hof der Werler Fürsten, als sie der Parchimer Geistlichkeit das Recht zu testieren verliehen 170 ). Albert hielt sich anscheinend im Lande Stargard auf, wo er im August 1270 eine in Lichen ausgestellte Urkunde testierte, in der die Markgrafen der Stadt Friedland das Übermaß auf ihrer Feldflur überließen 171 ). Am 20. VIII. 1280 befand er sich in Berlin unter den brandenburgischen Vasallen, als die Markgrafen sich mit ihnen über die Aufhebung der Bede und der außerordentlichen Frohnden verglichen. Bei dieser Gelegenheit waren auch Zabel und Gerhard de Redingestorp zugegen 172 ).
Von ihnen wird Zabel oft in Urkunden der Werler Fürsten genannt. Er begegnet uns hier zuerst zum 13. I. 1274 in Röbel, als die Werler Fürsten dem Kloster Amelungsborn das Eigentum des Dorfes Berlinchen, 8 km nö. Wittstock, verkauften 173 ). Als die Fürsten sich mit Bischof Heinrich von Havelberg über Freienstein und die Grenze bei Wittstock einigten, wurden Ritter Zabel v. Restorf und Heinrich v. Vlotow, Vogt in Röbel, damit beauftragt, die Grenzen vom Einfluß der Vosse in den Daberbach bis zum Dorf Babitz zwischen Neu-Haslow und Randow und Alt-Haslow festzulegen 174 ). Er wird also besondere Ortskenntnis in dieser Gegend gehabt haben und in ihr ansässig gewesen sein. Unter den Zeugen der Urkunde über diesen Vertrag stehen Prizbur et frater eius Sabellus de Redichsdorp. Wir sehen hier gut an einem Beispiel, wie slavische Namen in deutsche Familien eindrangen. Pritzbur ist der oft genannte Ritter Pritzbuer von Havelberg. Zabel kann daher nur sein Stiefbrüder gewesen sein. Zabels Vater hatte also eine Witwe aus dem slavischen Geschlecht der Havelbergs geheiratet, die den in dieser Familie oft vorkommenden Namen Zabel auf einen Sohn aus ihrer zweiten Ehe übertrug.
In der Zeit vom August 1275 bis zum Mai 1285 war Zabel im Gefolge der Markgrafen 175 ), die er sogar nach Görlitz


|
Seite 180 |




|
begleitete 176 ). 1277 war er bezeichnenderweise Zeuge, als die Brandenburger dem Bischof von Havelberg das Eigentum der Ländereien um Babitz, 4 km ö. Wittstock, verliehen 177 ). 1280 testierte er bei der Verleihung des Dorfes Sagwitz bei Schwarz an das Kloster Dobbertin 178 ), 1282 bei der Übertragung des Eigentums an den Dörfern Schwarz, Zeten und Diemitz, sw. Wesenberg 179 ). Auch Gerhard und Zabel möchte ich für Söhne Johanns, vielleicht aus einer zweiten Ehe, halten. Sie waren allem Anschein nach im Grenzgebiet zwischen Brandenburg und dem Lande Parchim, bei Babitz in der Gegend von Wittstock mit Landbesitz ausgestattet.
Das erste bekannte Glied der Familie v. Below, Nikolaus, war am 24.V. 1217 mit Otto Albus, Nothelm v. Göldenitz und Werdag v. Mölln Zeuge, als Bischof Heinrich von Ratzeburg die der Bergedorfer Kirche vom Grafen Albrecht von Orlamünde gemachten Schenkungen in Kurslak, Börnsen und Wendorf bestätigten 180 ). Ungefähr um dieselbe Zeit treffen wir ihn auch im Gefolge des Grafen Günzel von Schwerin, als dieser dem Ratzeburger Bistum Güter in Groß-Eichsen verlieh, die sein Lehensmann Heinrich dem Bistum verkauft hatte 181 ). Dann ist Nikolaus noch im Februar 1228 im Gefolge des Grafen Heinrich von Schwerin nachweisbar, als dieser den Schweriner Domherren den bisher vorenthaltenen Teil der Zehnten im Lande Zelesen zurückgab 182 ) und das Dorf Medewege, 4 km n. Schwerin, von landesherrlichen Lasten befreite 183 ). Zwanzig Jahre schweigt dann die Überlieferung über die Belows, bis sie erst wieder 1249 in Parchim auftauchen. Aus dem Lebenskreis des Nikolaus v. Below ergibt sich, daß seine Heimat im Ratzeburgischen oder in der Gegend von Groß-Eichsen zu suchen ist. Sie wird das Dorf Belowe, im Ksp. Breitenfelde, das heutige Bälau, 3 km w. Mölln, sein und nicht Below, 7 km w. Goldberg, das von den Belows erst nach ihrer Einwanderung im Lande Parchim in Erinnerung an die alte Heimat angelegt


|
Seite 181 |




|
sein wird 184 ). Da in Bälau aber 1230 kein Lokator mehr nachweisbar ist, sondern der halbe Zehnte des 12 Hufen umfassenden Dorfes ohne Abzug für einen solchen dem Propsten des Ratzeburger Domkapitels zustand 185 ), ist anzunehmen, daß die Belows schon damals das Ratzeburger Bistum verlassen und vorher ihren Besitz an das Domkapitel veräußert hatten.
1249 waren Iwan und Nikolaus v. Below, vermutlich Söhne des Nikolaus von 1217 und 1228, bei Fürst Pribislav von Parchim. Vielleicht hatten die Brüder Arnold und Bernhard v. d. Möhlen sie nach sich gezogen in das neue Land. Iwan erscheint nur noch einmal am 14. II. 1253 in des Fürsten Gefolge in Wismar 186 ). Nikolaus II. tritt noch bis 1278 auf, und zwar in Urkunden, die sich auf die Stadt Parchim beziehen 187 ).
Die Belows sind nach 1256 im Lande geblieben und haben dort reichen Besitz erworben. Sie bildeten zu Ende des 13. Jahrhunderts zusammen mit den Brüsewitzen und Malins geradezu die typischen Geschlechter für die Länder Goldberg und Parchim. Sie hatten später Besitz in Below, 6 km w. Goldberg, wo sie 1299 eine Familienkapelle gründeten 188 ), in Augzin und Zidderich 189 ), w. Goldberg, und in Dütschow, 12 km ö. Parchim 190 ). Erst 1296 ist ein Below, Wulwoldus, außerhalb des Landes anzutreffen als Truchseß Herzog Bogislavs IV. und Herr auf Kröslin, Venzemin und Vreest n. Wolgast 191 ).
Der älteste Vertreter des Geschlechts v. Holdorf ist Segebodo, der 1226 und 1229 in mecklenburgischen Diensten tätig war 192 ). Er saß nach dem RZR. 1230 in Roggendorf, 5 km w.


|
Seite 182 |




|
Gadebusch 193 ), und läßt sich unter den Vasallen des Fürsten Johann von Mecklenburg noch bis 1237 verfolgen 194 ). Die Brüder Heinrich und Segebodo II. v. Holdorf, die am 20. IX. 1249 in Pribislavs Umgebung auftauchten, werden seine Söhne gewesen sein, die durch die Malins aus dem 4 km nö. Roggendorf liegenden Dorf Möllin in das Land Parchim herbeigeholt sein mögen. Sie sind dort auch geblieben, als Pribislav in die Verbannung gehen mußte. Heinrich war im September 1271 Zeuge, als Nikolaus II. von Werle dem Kloster Dargun ein Drittel der Einnahmen aus dem Hochgericht in den Dörfern verlieh, die es in seinem Lande besaß 195 ); Segebodo im Januar 1273, als der Fürst der Stadt Parchim ihre Rechte bestätigte 196 ), und im April 1274, als Nikolaus dem Kloster Stepenitz das Eigentum der Dörfer Karbow und Wilsen und von 30 Hufen in Kreien, s. Lübz, verlieh 197 ). Dann treffen wir beide Brüder zusammen noch im Juni und im August 1274 in Nikolaus' Gefolge in der Umgegend von Röbel 198 ) In welchem Teil des Landes sie ansässig gewesen sind, läßt sich aber aus den angeführten Urkunden nicht feststellen.
Erst 1311 erscheint wieder ein Mitglied dieser Familie in der Überlieferung, der Knappe Gert Holdorf, der mit andern Rittern Zehnte aus Severin, 9 km nw. Parchim, vom Ritter Siegfried von Plön als Pfand erhalten hatte 199 ). Sonst begegnet dieser Gert aber nur noch in Angelegenheiten, die den nordwestlichen Teil des Fürstentums Mecklenburg betreffen 200 ); er scheint also bald nach 1311 in die alte Heimat seines Geschlechts wieder zurückgewandert zu sein.
Am 14. II. 1253 verkaufte Pribislav in Wismar dem Kloster Doberan das Eigentum am Dorfe Zarchelin, das Wedekind v. Walsleben von ihm zu Lehen gehabt hatte, mit dem Zehnten 201 ). Zarchelin liegt 7 km n. Plau. Die in der Zeugenliste aufgeführten Ritter: Widukind v. Walsleben, Mar-


|
Seite 183 |




|
tin v. Malin, Dietrich Berser, Iwan v. Below, Gerhard v. Leisten, Heinrich v. Rolstedt werden als Gefolgsleute des Fürsten und mit Ausnahme Wedekinds v. Walsleben nicht als ortskundige Nachbarn des Dorfes Zarchelin testiert haben. Neu sind in Pribislavs Umgebung Heinrich v. Rolstedt und Gerhard v. Leisten.
Heinrich v. Rolstedt wird nur noch 1256, anscheinend im Juni 202 ), in Sternberg als Zeuge erwähnt, als Pribislav dem Kaplan Jordan die Kapelle in Wahmkow, 18 km s. Sternberg, verlieh und allen seinen Rechten an vier Hufen der Kirche zu Raden, 4 km nö. Sternberg, entsagte. Hinzu kommt die Nachricht eines Clandrianschen Regests mit dem Datum 1262, wonach Fürst Johann von Mecklenburg dem Kloster Dobbertin "zwey Hufen am Dorffe Bülowe und eine Hufe im Dorffe Stitne, welche Hinricus von (R)olstede besessen hat", verlieh 203 ).Bülow ist das Bülow, 9 km ö. Crivitz, Stieten liegt 7 km s. Sternberg. Heinrich v. Rolstedt war, wie das Zeugenverzeichnis der beiden Urkunden und die Lage der veräußerten Güter zeigt, nicht bei Parchim ansässig. Vielleicht war er Burgmann Pribislavs auf der erst kürzlich vom Fürsten erbauten Feste Richenberg. Weder über seine Herkunft noch über sein und seines Geschlechts Verbleib sind urkundliche Nachrichten überliefert.
Nach Gerhard v. Leisten ist wohl das Dorf Leesten, das heutige Leisten, 6 km n. Plau, genannt worden 204 ). Man hat in diesem Gerhard das Mitglied eines aus Langen-Lehsten im Lauenburgischen stammenden Geschlechts v. Lehsten sehen wollen. Wir wissen jedoch von dieser Familie aus der Zeit vor 1253 nichts 205 ). Es lebten aber damals in Pommern zwei Ritter Heinrich und Dietrich de Listen, die in Zeugenlisten der Urkunden 206 ) unter die aus Brandenburg eingewanderten Ritter eingereiht sind. In der ältesten, vom 25. II. 1243 207 ), befindet Heinrich v. Listen sich in der Gesellschaft des 1244 nach Parchim


|
Seite 184 |




|
eingewanderten Heinrich Wnko 208 ). Daher nehme ich an, daß er von Heinrich Wnka in das Land Parchim nachgezogen worden ist. Gerhard mag der Sohn Heinrichs de Listen gewesen sein. Wenn diese Vermutung zutrifft, beweist sie, daß auch die aus Pommern eingewanderten Ritter wie Wnka in dauernder Verbindung mit ihrem Ursprungsland blieben. Noch im Juni 1284 war Gerhard v. Leisten in Parchim, als Fürst Nikolaus die Gerechtsame der Stadt bestätigte 209 ).
Die beiden letzten erhaltenen Urkunden des Fürsten Pribislav sind im Juni 1256 in Sternberg ausgestellt worden; in der einen verlieh er seinem Kaplan Jordan die Pfarre in Wamkow, 8 km s. Sternberg 210 ), in der andern entsagte er allen seinen Rechten an vier Hufen der Kirche zu Raden, 3 km n. Sternberg 211 ). Die Rechtshandlungen sind in Sternberg vollzogen worden. Bei ihnen waren als Zeugen die Ritter Hermann Brushavere und sein Bruder Arnold, Heinrich v. Rolstedt 212 ) und Heinrich v. Boltdorf (bzw. Boltendorpe) zugegen. Da unter ihnen keiner der um Parchim festgestellten Vasallen vertreten ist, scheinen sie Burgmannen in Richenberg gewesen zu sein.
Die Brüder Hermann und Arnold Brusehaver werden aus der Grafschaft Schwerin gekommen sein, wo 1246 ein Ritter Friedrich Brusehaver zusammen mit Eberhard und Johann v. d. Möhlen 213 ) als Zeuge in Angelegenheiten des Klosters Reinfeld genannt wird. Die Herren v. d. Möhlen mögen hier die Vermittler beim Übertritt der Brusehavers in parchimsche Dienste gewesen sein. Seit Juni 1255 treten allerdings auch Brüsehaver in Pommern, in der Gegend von Pyritz, auf 214 ). Aber es ist kein Bindeglied unter Pribislavs Rittern nachweisbar, das auf Beziehungen des Parchimer Hofs zu Pyritz schließen läßt. Hinzu kommt, daß Hermann noch vor 1264 in schwerinsche Dienste zurückgetreten zu sein scheint 215 ). Arnold Brüsehaver blieb wohl im Lande Parchim. Er hat seinen frü-


|
Seite 185 |




|
heren Lehnsherrn Pribislav im Februar 1270 nach Schwerin begleitet, als dieser dort allen Ansprüchen auf die Stadt Parchim entsagte 216 ). Seit 1270 war er Vasall Nikolaus II. von Werle und scheint bei Plau ansässig gewesen zu sein.
Über die Herkunft und den Verbleib von Heinrich v. Boltendorf läßt sich nichts mehr ermitteln. Er wird in den Quellen nur in diesen beiden Urkunden des Fürsten Pribislav genannt.
Betrachtet man die Parchimer Ritterschaft bis 1256 zusammenfassend nach ihrer Herkunft, so ist festzustellen, daß sie bis 1243 ausschließlich von Westen und Nordwesten her zuwanderte. Von 1244 ab stellte sich als Folge dynastischer Familienverbindung auch erheblicher Zuzug von Osten, von Pommern her, ein. Zum Teil waren es Ritter deutschen Ursprungs, wie Wedekind v. Walsleben, Dietrich Berser 217 ) und Gerhard v. Leisten, dessen Geschlecht aus dem Brandenburgischen zu stammen scheint, zum Teil aber auch Slaven, wie Heinrich Wnka, Bartold Soneke und Witto. Von den übrigen nach 1244 zugewanderten Rittern kamen Heinrich v. Hagenow aus dem südwestlichen Teil des Landes Wittenburg, Johann v. Restorf aus der Gegend von Lenzen, die Belows und Brusehavers aus dem Gebiet nördlich Schwerin, die Holdorfs aus dem Gadebuscher Lande. Nicht feststellbar war allein die Heimat der Ritter Heinrich v. Rolstedt und Heinrich v. Boltendorf, nur unbestimmt die Thethards v. Weye.
Mit Ausnahme der drei zuletzt Genannten sind die deutschen Ritter nicht unmittelbar aus dem deutschen Mutterlande zugewandert; sie selbst oder ihre Vorfahren lassen sich vor ihrem Einzug in das Land Parchim schon in anderen Gegenden rechts der Elbe nachweisen. Im allgemeinen kamen sie vom Westen oder Nordwesten her; von Norden und z. T. Nordosten, aus dem Werler Fürstentum, zogen nur Johann v. Schnakenburg, die Hakenstedts und Dietrich Berser in das Land. Aber gerade sie gehörten Geschlechtern an, deren Heimatsburg bestimmt auf altdeutschem Boden stand. Dem Zunamen nach wird man ferner Nikolaus v. Hamburg unbedingt als deutschen Ritter ansehen müssen.


|
Seite 186 |




|
Schwieriger läßt sich die Nationalität feststellen bei den Herren v. Lenzen, v. Malin, v. d. Möhlen, v. Artlenburg, v. Walsleben, v. Hagenow, v. Restorf, v. Below, v. Holdorf, v. Leisten und Brusehavere. Mit Ausnahme der Brusehavers nennen sie sich alle nach Ortsnamen, die durch das Bindewort de mit dem Rufnamen verbunden sind. Deutlich stehen diesen Namensbildungen die bestimmt als slavisch anzusehenden: Vunco, Witto, Bartoldus Zoneke und der dänische Hermannus Kanut gegenüber; die Zunamen fehlen hier ganz oder werden gebildet, indem man den Namen des Vaters hinzufügt. Wie aber die Bezeichnung nach Örtlichkeiten ganz der Gewohnheit in den Ländern westlich der Elbe entsprach, so weisen dahin auch die ausschließlich deutschen Vornamen der zuerst genannten Gruppe. Ein Vergleich der Zeugenlisten unserer parchimschen Urkunden mit denen gleichzeitiger Urkunden der pommerschen Fürsten erweist überzeugend, daß hier zwei verschiedene Nationalitäten sich gegenüberstehen, obwohl Pribislav selbst doch Wende war. Wenn man Jegorov auch insofern zustimmen muß, daß es sich bei der Besiedelung des Landes Parchim in der Hauptsache um eine geographische Umschichtung des damals schon rechts der Elbe ansässigen Adels gehandelt hat, so ist desto schärfer die von ihm verfochtene Theorie abzulehnen, daß dieser Adel slavisch gewesen sei, wofür er allerdings den Beweis vorenthalten hat.
Ganz deutlich zeigt sich hier das starke Übergewicht der deutschen Einwanderer gegenüber den slavischen, die auch nur als Gefolgsleute ihrer Herzogstochter die pommersche Heimat verlassen haben. Anstoß zur Wanderung scheint in vielen Fällen die Einwirkung schon im parchimschen Lande seßhaft gewordener Ritter gegeben zu haben, die immer noch in Verbindung mit der Heimat blieben und von dort die Söhne von Nachbarn oder Verwandten veranlaßten, wie sie selbst in dem noch zu erschließenden Land eine neue, weitere und gutes Fortkommen verheißende Heimat zu suchen. So zog Nanno v. Lenzen die Ritter Johann v. Schnakenburg, Johann v. Restorff und vielleicht auch die Holdorfer Brüder herbei, die Herren v. d. Möhlen beeinflußten die Belows und Brüsehavers, Nikolaus v. Hamburg-Wittenburg rief Heinrich v. Hagenow ins Land, die Malins die Herren v. Holdorf.
Die meisten dieser Familien sind nach Pribislavs Vertreibung im Lande geblieben. Nach Pommern sind - wohl


|
Seite 187 |




|
zusammen mit ihrem unglücklichen Fürsten - der Herr v. Weye, dessen Sohn oder Enkel gegen Ende des Jahrhunderts Besitz in Voigdeshagen, s. Stralsund, hatte, Witto und Knut ausgewandert, dessen Nachkomme noch Pribislavs Sohn nach Belgard begleitete. Wedekind v. Walsleben verließ wohl aus anderen Gründen den ihm zu heiß gewordenen Parchimer Boden und kehrte nach Demmin zurück. Die Hakenstedts haben sich vielleicht schon vor 1256 wieder der Gegend um Gnoien und Dargun zugewandt. Nicht feststellbar war das Verbleiben Heinrichs v. Artlenburg und Heinrichs v. Boltendorf.
Die Wohnorte dieser Ritter innerhalb des Landes Parchim lassen sich oft nur vermutungsweise auf Grund mehrfachen Auftretens als Zeuge in derselben Gegend erschließen. Danach saßen in der Umgegend von Plau die Brüsehavers und die Schnakenburgs (Slapzow, Reppentin), 7 km n. die Leistens auf Leisten, bei Goldberg die Wnkas und Belows (Zidderich, Augzin, Below), südlich Sternberg Heinrich v. Rolstedt (Stieten). Südlich Lübz erscheinen die Belows, Schnakenburgs (Kreien), Knut, v. d. Möhlen (Siggelkow) und auf weit vorgeschobenem Außenposten die Restorffs auf Babitz. Es handelt sich also überall um ausgesprochenes Grenzgebiet nach Norden, Osten und Süden; auffällig ist das Fehlen der eingewanderten Ritter im Westen des Landes. In nächster Umgebung von Parchim, wo die Nachkommen des Nikolaus v. Wittenburg und Dietrich Bersers sich als Bürger niederließen, waren anscheinend nur die Lenzen-Kardorffs und die Malins ansässig. Das Innere des Landes ist erst nach 1256 germanisiert worden.
Der Aufsatz wollte prüfen, ob es möglich sei, durch ausführliches Eingehen auf die Geschichte der einzelnen ritterlichen Geschlechter im mittelalterlichen Mecklenburg ein zuverlässigeres Bild über die Besiedelung des Landes zu gewinnen, als es bisher vorlag. Der auf einen kleinen Teil Mecklenburgs und auf kaum ein Menschenalter beschränkte Versuch führte zu dem überraschenden Ergebnis, daß von den 29 Rittern, die von den Urkunden zwischen 1226 und 1256 im Lande Parchim genannt werden, für 26 ihre Herkunft und für 25 ihr oder ihrer Nachkommen Verbleib festzustellen ist. Mit diesen 29 Rittern wird aber der weitaus größte Teil des damals in das Land Parchim eingewanderten Schwertadels erfaßt sein.


|
Seite 188 |




|
Angesichts des Jegorovschen Buches mit seiner stark slavischen Tendenz wird die Geschichte der Kolonisation Gesamt-Mecklenburgs durch die Deutschen noch einmal einer eingehenden Nachprüfung unterzogen werden müssen, die auszugehen hat von Sonderuntersuchungen der einzelnen Landesteile. Eine Reihe solcher Untersuchungen sind vom Verfasser schon für andere Teile des Landes vorgenommen worden. Sie zeigen fast noch stärker, als die bisherige Auffassung es tat, daß die Besiedelung des Landes eine Großtat allein der deutschen Ritterschaft gewesen ist, an der der slavische Adel nur in ganz geringem Maße beteiligt war.
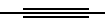


|
[ Seite 189 ] |




|



|


|
|
:
|
V.
Lochäxte aus Mecklenburg
von
Robert Beltz.
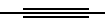


|
[ Seite 190 ] |




|


|
[ Seite 191 ] |




|
1. Hirschgeweihaxt von Schwerin,
Kaiser=Wilhelm=Straße.
Bei Kanalisationsarbeiten wurde 1925 in der Gegend von Haus Nr. 43 etwa 1,5 m tief im Schwemmboden eines Gewässergrundes, wohl des einst Pfaffenteich und Burgsee verbindenden "Fließgrabens", eine Hirschgeweihaxt gefunden. Es ist ein Stück bester Erhaltung, von besonderer Form, 15,5 cm lang. Die untere Seite ist glatt, wohl durch Abnutzung beim Gebrauch, die Arbeitsfläche ist mit feinen, sich kreuzenden Strichen verziert. Das Gerät war ursprünglich eine Geweihhacke mit Schaftröhre von den Vorg. Altert. 15, 139 behandelten Form, die aus dem Stück einer Stange so gebildet wurde. daß ein Sprossenstumpf zu einem Schaftloch durchbohrt wurde. Sie ist dann im Schaftloch gebrochen, mit einem neuen Loch versehen und so zu einer Axt ähnlich der üblichen Form Vorg. Altert. 15, 136-138 (s. auch Jahrb. 95 S. 171 und unten Nr. 2 geworden.
Zur zeitlichen Stellung, Hirschgeweihhacken, wie die, aus denen unsere Axt hergestellt ist, deren Entstehung aus einer Frühform, wo die ganze Sprosse als Griff benutzt wird, z. B. ein Stück von Arneburg 1 ) deutlich zeigt, reichen in eine frühe Periode unserer Steinzeit (Mesolithik) und gehören dort der sog. Kjökkenmödding- (Ertebölle-) Stufe an. Belege geben die Funde von Ellerbeck 2 ), von der Trave 3 ), Lietzow 4 ). Aber sie gehen nicht nur tief in die jüngere Steinzeit hinein, wie Funde in jungsteinzeitlichen Gräbern, z. B. Priemern Altmark, Kl. Krebbel (Posen) und Jordensmühl 5 ) erweisen und werden selbst


|
Seite 192 |




|
in Kupfer nachgebildet 6 ), sondern kommen auch in der Bronzezeit bis in jüngere Perioden hinein vor 7 ). In Mecklenburg sind außer dem oben genannten schönen Stück von Hagenow noch solche vom Plauer See und aus der Gegend von Penzlin bekannt geworden, alle einem entwickelten Typ angehörend, den Kossinna mit II bezeichnet 8 ). Da es Einzelfunde sind, ist eine genaue Zeitbestimmung auf Grund der Fundverhältnisse nicht möglich. Bei dem besprochenen bringt aber die Verzierung eine gewisse Wahrscheinlichkeit für ein höheres Alter. Verzierungen an Schaftröhrenhacken sind mir sonst nicht bekannt, aber sehr wohl möglich 9 ), und den unsern sehr ähnliche Strichmuster haben Knochenplatten des großen Fundes von Bloksbjerg bei Kopenhagen 10 ), der im allgemeinen in dieselbe spätmesolithische Zeit zu setzen ist, wie die oben genannten Funde und Geweihäxte, die der unseren voll entsprechen in dem zwischen Maglemose und Kjökkenmödding zu setzenden Funde von Holmegaard 11 ).
2. Hirschgeweihhammeraxt von Schwerin,
Aubach.
Beim Ausmodden ist vor einiger Zeit eine Hirschhornaxt gefunden. Sie ist von mäßiger Erhaltung, mürbe und mit stark abgesplitterter Oberfläche, 18 cm lang, hergestellt aus dem sehr starken Wurzelstock (5 cm Durchmesser. An Form ähnelt sie am meisten dem Vorg. Altert. 15, 137 abgebildeten Stück aus dem bekannten "Urvolkgrabe" von Plau. Die Rose ist entfernt, das breite Schaftloch (2,5 cm Durchm.) liegt nahe dem


|




|
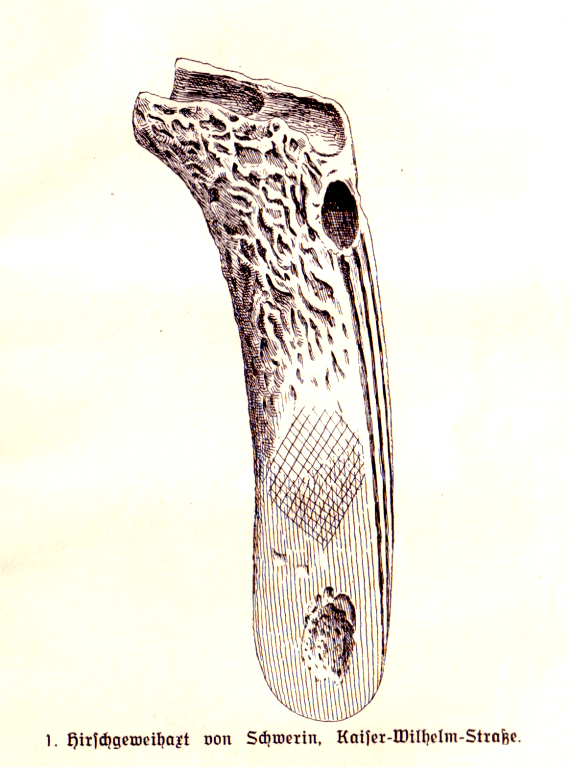


|




|



|
Seite 193 |




|
Wurzelende, die furchige Oberfläche war abgeschabt und sorgsam geglättet. Der vordere Teil (nicht ganz ein Drittel der Fläche) ist mit eingedrückten Würfelaugen verziert, die in lockeren waagerechten Reihen angeordnet sind; der Abschluß der verzierten Fläche ist durch eine seichte Linie markiert. Durch die Anbringung am Schneideteile unterscheidet sich unser Stück von der Masse der kreisverzierten Äxte, die jetzt in der gehaltvollen Abhandlung von Hans Lange 12 ) gesammelt vorliegen und in der auch der Beweis geführt ist, daß sie nicht steinzeitlich sind, sondern erst der jüngeren Bronzezeit angehören.
3. "Amazonenaxt" von Waren.
Im Staatlichen Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin befindet sich eine Axt mit bogenförmigen Erhöhungen an beiden Enden, sog. "Amazonenaxt", bezeichnet Waren II 6162, von 15,7 cm Länge. Es ist der in Vorg. Altert. zu Tafel 9, 64 behandelte Typus. Zu den zwei dort aus Mecklenburg-Schwerin aufgezählten Exemplaren kommt noch eines von Dragun bei Gadebusch; aus Mecklenburg-Strelitz ist eines von Pasenow bei Woldegk bekannt geworden.
Die Form, bei der man zunächst an Metallvorbilder denken wird, findet ihre Erklärung nach den überzeugenden Darlegungen von Nils Überg, Nordiska stridsyxornas typologi S. 7 f. und Das nordische Kulturgebiet 1918 S. 23 f., einfach durch Weiterbildung der einfachen Keulenaxt mit Schaftrille, indem der Mittelteil immer mehr vergrößert und verflacht wird. Die mecklenburgischen Stücke gehören seiner Gruppe C an. Zeitlich fallen sie in eine jüngere Stufe unserer großen Steingräber.
Eine Weiterbildung stellt der Typ Vorg. Altert. 9, 53 dar (Überg, Gruppe D). Die Form ist schmaler und gestreckter geworden, der eine Kamm aufgegeben. Zu den a. a. O. S. 51


|
Seite 194 |




|
aufgezählten Stücken kommen jetzt noch: Rosenhagen bei Grevesmühlen, Gutow bei Grevesmühlen, Grevesmühlen (Mus. f. Vor- und Frühgeschichte, Berlin, 14 cm lang, mit ungewöhnlich stark ausgebildetem, die Entwicklung deutlich anzeigendem Kamm), Jamel bei Grevesmühlen 13 ), Schwerin Grenadierstraße, Bützow, Penzlin 14 ). Das Stück von Rosenhagen soll einem Hünengrabe entstammen, das von Jamel ist einem der bekannten Gräber in der Everstorfer Forst entnommen. Damit findet der Typ seine Datierung, die mit dem Befunde in dem großartigen Steingrab in der Forst Mönchgut auf Rügen 15 ) übereinstimmt; es ist dieselbe Zeit der "jüngeren Ganggräber", in welche die oben behandelte Form gehört. Sonst kommen Äxte dieser Form in geschlossenen Funden überhaupt kaum vor.
4. Axt von Sietow.
Bei dem Chausseebau Waren-Röbel ist vor Jahren in der Nähe von Sietow eine Lochaxt aus schwarzem, leicht gesprenkeltem Felsgestein, anscheinend Diorit, gefunden und jetzt in die junge, fröhlich aufblühende vorgeschichtliche Sammlung des Maltzaneums in Waren gelangt. Das Stück ist 18 cm lang und (im Schaftloch) 3 cm hoch, von ausgezeichneter Arbeit, metallischer Schärfe der Formengebung und bester Erhaltung, wohl das schönste im Lande bekannt gewordene, dem ein Ehrenplatz im Landesmuseum gebührte. Der Typ ist der der "vielkantigen" 16 ) Äxte; die besprochene gehört der älteren Entwicklung an, ist langgestreckt, hat auf den ganz leicht ein-


|




|



|




|
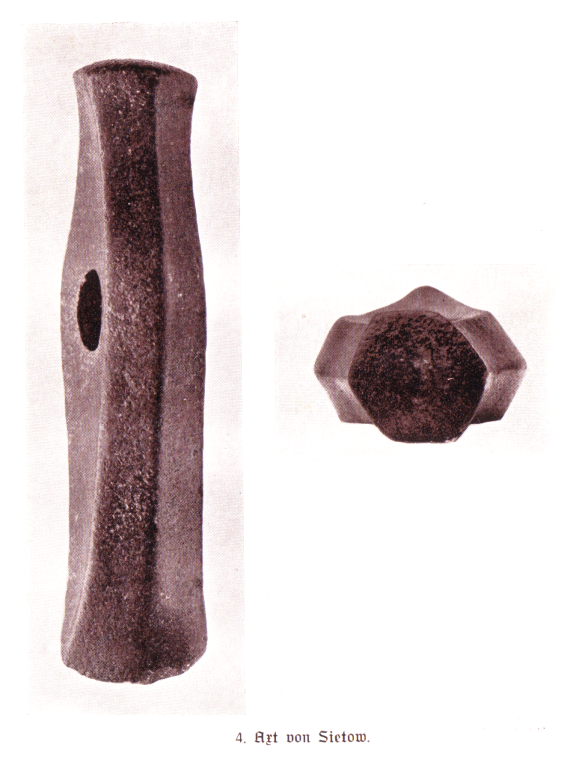


|
Seite 195 |




|
gezogenen Seitenflächen einen Grat, schwache, gleichmäßige Vertiefung von Oberseite und Unterseite, kleine Ausbiegung der Schneide nach beiden Seiten, Ausbuchtung am Schaftloch und nur schwach gewölbtes Bahnende (also nicht den üblichen Knauf) mit Benutzungsspuren. Ein gleiches Stück ist in den Vorgeschichtlichen Altertümern nicht abgebildet, weil sich damals keines in der Sammlung befand; verwandte sind S. 52 unter II 3 a a behandelt; zu den aufgezählten sind hinzugekommen solche von Pennewitt bei Warin, Kritzemow bei Rostock, Bandow bei Schwaan, Groß-Lukow bei Penzlin (Bruchstück) und eines unbekannten Fundorts.
Das Hauptverbreitungsgebiet der vielkantigen Axt liegt in Oberösterreich in den kupferzeitlichen Pfahlbauten des Mondsees (vgl. Reallexikon VIII S. 102) und Attersees; hier tritt sie in Massen und herrschend auf; vereinzeltes Vorkommen in Ungarn, Italien, Süddeutschland ist als Ausstrahlung dieses Zentrums aufzufassen. Eine große Heerstraße aber verbindet die Gruppe mit dem skandinavischen Norden (diese Verhältnisse sind auf Grund des gesamten weit zerstreuten Materials von Ni1s U(c)berg. Das nordische Kulturgebiet in Mitteleuropa während der jüngeren Steinzeit, Uppsala 1918, S. 81 f., klar gelegt); ihr Weg geht nicht direkt die Elbe entlang, sondern östlich, wie es deutlich gerade an dem Material in Mecklenburg hervortritt, wo die große Mehrzahl der Funde dem Osten des Landes angehört, und verbindet den Typ mit einheimischen. Es lag nahe, in dieser Straße den Weg zu sehen, welcher dem Norden das erste Metall, das Kupfer, brachte und zugleich Steinäxte in Formen, deren Beeinflussung durch Metallgeräte auf der Hand liegt. Die genaue Formenanalyse U(c)bergs hat ergeben, daß es ganz so einfach nicht steht; es scheint erwiesen, daß die frühsten "vielkantigen" Äxte ihre Vorbedingungen im nordischen Kulturkreise haben, in den sie auch hineingehören, und daß ein komplizierterer Austausch von Kulturgütern grundlegend gemacht werden muß, nicht nur die einfache Übertragung aus dem Süden. Ein Eingehen darauf führt über den Rahmen dieser Mitteilung, die ja nur ein wertvolles Stück bekannt geben will, hinaus. Es genüge der Hinweis, daß wir berechtigt sind, in der Sietower Axt einheimisches Fabrikat zu sehen.
Erübrigt noch die Zeitbestimmung. Diese wird dadurch erschwert, daß die "vielkantigen" Äxte auf dem Kulturgebiet,


|
Seite 196 |




|
zu dem auch Mecklenburg gehört, durchgehend Einzelfunde sind und sich nicht an bestimmte Grab- oder Siedlungsfunde anschließen lassen. Aber zu einer allgemeinen Bestimmung genügt der Zusammenhang mit der österreichischen Pfahlbauten- (Kupfer-) Kultur. Diese kann nur der in Skandinavien durch die Ganggräber charakterisierten Stufe III (Montelius), und zwar deren jüngerem Abschnitt, entsprechen. Wir haben Ganggräber in Mecklenburg nicht; ihre Entsprechung sind unsere größeren Steinkammern und Hünenbetten; mit diesen haben wir also die Äxte vom Sietower Typ zusammenzubringen.
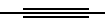


|
[ Seite 197 ] |




|



|


|
|
:
|
VI.
Die Mecklenburger im
Wittenberger
Ordiniertenbuch
von 1537 bis 1572
mitgeteilt von
Friedrich Bachmann.
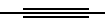


|
[ Seite 198 ] |




|


|
[ Seite 199 ] |




|
U nter den Quellen für die Erkenntnis wissenschaftlicher und überhaupt geistiger Bestrebungen früherer Zeiten stehen seit geraumer Zeit die Matrikeln der Hochschulen im Vordergrunde; von vielen Seiten sind diese Verzeichnisse nach den Studenten einzelner Landschaften durchforscht; für unsere mecklenburgische Heimat hat sich dieser Arbeit mit emsigem Mühen C. W. A. Balck unterzogen (M. Jb. 48-50), und H. Grotefend hat diese auf deutsche Universitäten sich beschränkenden Sammlungen durch Auszüge aus der Matrikel von Bologna ergänzt (M. Jb. 53). Seitdem ist auf Adolf Hofmeisters Anregung die Herausgabe unserer Rostocker Matrikel von ihm selber begonnen und nach seinem allzufrühen Tode von Ernst Schäfer vollendet und mit trefflichen Registern versehen.
Neben den Verzeichnissen der eigentlichen Hochschulen kommen aber für die Geistesgeschichte wie für die Orts- und Familiengeschichte noch manche anderen Listen in Betracht; so hat Wehrmann aus dem Schüleralbum des Stettiner Pädagogiums die Mecklenburger herausgezogen (M. Jb. 58).
Ein Quellenwerk etwas anderer Art, für unsere Heimat bisher nicht beachtet, liegt vor in dem Wittenberger Ordiniertenbuch, das 1894 und 1895 in zwei Bänden, die Jahre 1537-72 umfassend, von Georg Buchwald herausgegeben ward. Es enthält das Verzeichnis aller auf der Hochschule der Reformation zum Predigtamt des Evangeliums eingesegneten Geistlichen. Gerade in Wittenberg wurden nicht nur die für den Dienst der kursächsischen Kirche bestimmten Pastoren ordiniert, sondern auch die aus dem Sitze der Reformatoren nach andern Orten und Ländern erbetenen und gesandten Geistlichen. Besonders groß ist die Zahl der nach Österreich berufenen Ordinanden - bis dort die Gegenreformation einsetzt. Dagegen sind die nach Mecklenburg Berufenen nicht sehr zahlreich vertreten; das wird daher rühren, daß in Mecklenburg verhältnismäßig früh eigene Superintendenten bestellt wurden, Riebling für Parchim schon 1540. So wird die große Zahl der mecklenburgischen Pastoren im Lande bestellt und ordiniert sein. Immerhin dürfte es lohnen, die Mecklenburg berührenden Angaben auszuziehen und zusammenzustellen, um so mehr als sich


|
Seite 200 |




|
dadurch einige bisher unbekannte Pastoren 1 ), vielleicht auch ein früherer selbständiger Pfarrsitz ergeben. Aus den Listen, die in späterer Zeit, etwa ab 1562, die eigenen Angaben der Ordinanden über Herkunft, Ausbildung und Berufung enthalten, ergibt sich mancher kulturgeschichtlich beachtenswerte Einblick in Lebensgang und Entwicklung der Pfarramtsanwärter im ersten Halbjahrhundert der lutherischen Kirche. Erwünschte Ergänzungen zu den Angaben des Ordiniertenbuchs selber bieten die eigenhändigen, in der Bibliothek zu Gotha erhaltenen Aufzeichnungen des Superintendenten und Professors Paul Eber († 1569) über die durch ihn von 1558 bis 1567 Ordinierten (durch E. bezeichnet). Die Ordinationen wurden außer durch Luther selbst durch die Superintendenten Johann Bugenhagen und den eben genannten Paul Eber vollzogen, doch wurden sie bei Behinderung von anderen Geistlichen, besonders Georg Major und Sebastian Fröschel, vertreten.
In den folgenden Auszügen sind in der Regel nur die wichtigeren Daten angegeben; nur bei einigen bisher unbekannten oder sonst namhafteren Männern habe ich die Angaben ziemlich wörtlich abgedruckt 2 ). Bei der geringen Zahl der Mecklenburg betreffenden Männer glaubte ich auch die wenigen verzeichnen zu sollen, von denen nur ihr Studium in Rostock erwähnt wird; auffälligerweise sind einige davon nicht in der Rostocker Matrikel aufzufinden, darunter einer mit sechsjährigem dortigen Studium.
Band I bei Buchwald enthält 1976 fortlaufend numerierte und 3 nachgetragene Namen, Band II 1261, deren Nummern wieder von vorn beginnen; Paul Eber führt noch 6 weitere Männer an, die im Ordiniertenbuch ausgelassen sind; 1556/57 stellt der Herausgeber eine größere Lücke fest. Es folgen nun die Mecklenburg berührenden Namen der Reihe nach.
I 340. 1541 Okt. 5: Joannen Bautz von Neubrandenburg untern Herzogen von Mecklenburg, Edituus 3 ) zu Meylaw unter Bischof Albrecht zu Magdeburg, zum Pfarramt daselbst.


|
Seite 201 |




|
382. 1542 März 29: Mattheus Roloff von Lütken Quassow im Lande Mecklenburg, a. dies. [der Wittenberger] Univ. z. Priesteramt ber. gen Tangermünde.
444. 1542 Sept. 20: Magister Andreas Cocus von Lübben, aus dieser Univ. berufen zum Predigtamt gen Bützow im Fürstentum Mecklenburg (nicht bei Willgeroth).
541. 1543 Okt. 3: M. Joannes Frisius von Sneck, aus dieser Univ. zum Pfarramt berufen gen Grubenhagen im Fürstentum Meckl. (Willg., S. 516).
708. 1545 Sept. 9: Sebastianus Bock von Finsterwalde, a. dies. Univ. zum Priesteramt ber. gen Grubenhagen (Willg., S. 517).
881. 1547 Aug. 17: Paulus Bock von Finsterwalde, Schulmeister zu Niemigk, zum Pfarramt ber. gen Schorssow im Fst. Meckl. (fehlt bei Willg., der S. 507 Anm. 16 die Kirche als schon 1520 eingerissen angibt).
885. 1547 Aug. 24: Martinus Pissingk von Eisenach, a. d. Univ. zum Priesteramt berufen gen Grubenhagen (fehlt bei Willg.).
925. 1548 Febr. 8: Sebastianus Birnstiel, a. dies. Univ. ber. z. Predigtamt z. Herzoge v. Mecklenburg (nicht b. Willg.).
991. 1549 März 20: Pancratius Hinricus von Niemigk, Schulmeister zu Grubenhagen, dahin berufen zum Predigtamt (fehlt bei Willg.).
1086. 1550 Juli 2: Doctor Johannes Aurifaber von Breslau, a. dies. Univ. ber. z. Pred.-Amt gen Rostock (Willg. 1427).
1092. 1550 Aug. 6: M. Johannes Kittel von Jüterbock, a. dies. Univ. ber. z. Pfarramt gen Brandenburg, Neustadt (Willg. 1393).
1165. 1551 Juni 24: M. Joachimus Newman von Wismar, a. dies. Univ. ber. z. Pfarramt gen Stade (Rost. Matr. II S. 96 b imm. 1536 Ost.: M. Jochim Nigeman Wismariensis).
1381. 1553 April 19: M. Tilemannus von Heßhausen in Westphalen, von Niederwesel, a. dies. Univ. ber. z. Pfarramt gen Goslar (ist Heßhusius Willg. 1399).
1644. 1555 Juni 26: Petrus Terhatz, Baccalaureus zu Neubrandenburg, ber. z. Pf. gen Nietzke.


|
Seite 202 |




|
1717. 1556 April 8: M. Andreas Wisslingus von Osnabrück, Pro[fe]ssor lingue hebree universitatis Rostock, daselbsthin ber. z. Pr. (Rost. Matr. II 127 a imm. 1553 Juli: Mgr. Andreas Vueslingus ..., S. 128: ... artium mgr. Coloniae promotus rec. ad fac. artium 1. Aug.; obiit Rostochii anno 1577 4. Januarii, bei Willg. nicht als Pastor aufgeführt).
1785. 1558 Juli 10: Nicolaus Praetorius Labicensis, vocatus ad functionem ecclesiae in Rostock d. 17. Aug. 58 (nicht bei Willg.).
1843. 1559 Jan. 25: Johannes Berckaw Pontanus, vocirt gen Grubenhagen (nicht bei Willg.).
E.: consulis filius versatus hic quadriennium (hier 2. Febr. Ord.-Tag!).
1850. 1559 Febr. 22: MagisterLucas Bagkmeister Lüneburgensis, voc. in aulam Reginae Daniae 1559 März 5 (Rost. Matr. II 146 a; Willg. 1415).
1858. 1559 März 8: M. Simon Pauli Schweizinensis (!). (Rost. Matr. II 122; Willg., 1400).
E.: Paulus Suerinensis versatus huc quadriennium semper docuit, vocatus est ad legendum et concionandum in ecclesia Suerinensi ab Duce Johanne Alberto (hier 18. März Ord.-Tag!).
1962. 1560 März 10: Henricus Soldanus Pomeranus, vocirt in patriam Bardt.
E.: versatus hic annum et Rostochii (fehlt in d. Matr.!) et Gryphiswaldiae et servivit in scholis quinquennium, - ad munus diaconi (hier 17. März Ord.-Tag!).
II 99. 1561 Mai 4: Tilemannus Lengius Ostervicensis voc. ad min. eccl. in arcem Niendorf (b. Halberstadt) per Johannem von der Assenburg (Rost. Matr. II 120 a imm. 1551 Mai als T. Lenge).
E.: vers. hic in Ac. quadriennium, Rostochii annum, postea ferme 5 annos serviit scholis.
131. 1561 Sept. 7: M. Henricus Piperites Haiensis voc. ab. princ. Udalricho Megalburgensi ad doc. eccl. in oppido Grebesmulen (Willg. 1190: Piper 4 )).


|
Seite 203 |




|
E.: fuit ante decennium ferme triennium [fehlt offenb. hic], deinde rexit scholam Gustroviensem integros septem annos et reversus nobiscum fuit sesquiannum.
207. 1562 Mai 31: Carolus Guntherus Carolostadianus Francus, voc. a comtissa Rinevensi (!) ad min. eccl.
E.: vers. in acad. Marburgensi tres, Rostochiana octo (Matr. II 119 a imm. 1550 Okt., baccal. art. 1552 Sept. 20 S. 124 b), Witebergensi quatuor annos, et cum ... Doctore Johanno Draconite (zu Rostock 1551-60) peregrinatus in Prussiam, voc. ad gub. eccl. in pago Procellen (bei Lohr) sub ditione comitum ab Rineck (brieflich empfohlen durch Pastor Johann Conrad Ulmer - Lohr).
326. 1563 August 29: Johannes Ukius natus in pago Bioldorp, natione Danus, voc. ad doc. evang. in eccl. Bioldorp.
E.: Biölberup (!), 3 Meil. v. Flensburg, vers. in schola Wismariensi triennium, Rostochii biennium, in hac acad. biennium, voc. ...,ut patrem senem concionando sublevet, qui agit pastorem jam ultra 40 annos in eodem pago (nicht in d. Rost. Matr.; Johannes Vucke de Ditmercia 1483 Nov., I 235, wohl ein Vorfahr).
327. 1563 August 29: M. Henricus Hauckenthal Witstochiensis, Rostochii per quinquennium, voc. ad gubernationem scholae in patria (4 Jahre), ut me confirmarem in studiis, veni ad Witebergam 1556 (2 1/2 J.), ornatus gradu Magisteri philosophici, revocatus ad gub. scholae patriae (4 1/2 Jahre), voc. (dort) ad min. eccl. (Rost. Matr. II 114 a imm. 1547 Nov. 12: Henricus Hackendal Wistochiensis).
354. 1563 Novb. 14: Fabianus Critenus Soraviensis in patria schola per novennium minister, voc. ad munus Diaconi in eccl. Saganensi.
E.: didicit in academiis Francofordiana, Regiomontana et Rostochiana ferme biennium (fehlt i. d. Rost. Matr.).


|
Seite 204 |




|
402. 1564 Mai 23: Petrus Lossius, patria Oederensis, natione Misnensis, voc. ad munus docendi in pago Harta (Sup. Kemnitz) dedit operam literis Rostochii.
E.: vers. in ac. Rostochiana sesquiannum, egit ludi rectorem in oppidulo Comethau biennium (fehlt in der Rostocker Matrikel!!).
425. 1564 Aug. 23: Jeremias Stricerius Holsatus Grobensis, ex schola Lubecensi Rostochium profectus ... propter belli vicinitatem et annonae caritatem discedere coactus .. in acad. Viteb. profectus ..., ex qua ad eccles. Grobensem ad munus diaconi vocatus (nicht in der Rost. Matr.).
E.: commendatus literis fratris Johannis Stricerii, pastoris in coenobio Cismariensi.
510. 1565 Sept. 4: Franciscus Kusne (!), natus in pago Linto, stud. Wittenberg quadriennium, colloborator (!) scholae Belitz ensis per annum, voc. ad min. evangelii a capitaneo Wesenbergensi 5 ) in pago Peicatel (nicht bei Willg.).
E.: nennt ihn Cuno.
511. 1565 Sept. 4: Blasius Pantzer, natus in oppido Britzen, stud. Wittenberg triennium, collaborator scholae Bruckcensis, voc. ad min. evang. a capitaneo Wesenbergensi in pago Blumenhagen (fehlt bei Georg Krüger, Pastoren im Lande Stargard, M. Jb. 69).
637. 1566 Okt. 7: Joannes Cocceius Northusanus, operam ded. literis Northusae, in principis Mechelb. schola Suerin, in acad. Pragensi, deinde praefui ludo Aldenbergensi, voc. ad eccl. Eule sub Heinr. de Bunaw.
670. 1567 Jan. 8: Paulus Struck Oldenburgensis Holsatus, Schule zu Lübeck, dann zu Rostock, hernach in Königsberg 3 Jahr, darauf propter penuriam sumptuum mit einigen adeligen Jünglingen nach Leipzig, hernach eine Zeitlang in Wittenberg, von dort durch den Rat seiner Heimat ins Pfarramt berufen (Rost. Matr. II 140 a imm. 1560 Juni: Paulus Strük).


|
Seite 205 |




|
806. 1568 April 28: Christianus Rodenus Ditmariensis, Schule zu Hamburg, dann vom Vater nach Rostock geschickt, 1557-60, darauf drei Jahre daheim im Schulamt, seit 1566 zwei Jahre in Wittenberg, ins Pfarramt nach Holstein am 15. April 1568 durch Caspar von Bockwalt berufen (Rost. Matr. II 134 a imm. 1557 Mai 20: Christianus Rode).
879. 1569 März 9: Nicolaus Luckius Lentzensis, schola Soltwedelensi et Brunsvicensi, anno 66 Vitebergam per biennium, a nobili viro Matthia Gans ad funct. eccles. in oppido Schoneberg prope Lubecam vocatus (fehlt bei Krüger, Pastoren d. Fürst. Ratzeburg).
906. 1569 Juni 15: Nicolaus Sturmer Beltzensis, wird vom Superintendenten Joh. Dursten und dem Praefekten Heinrich Staupitz an die ecclesia Rostockensis (nachher Rostochana) berufen, womit sicher nicht Rostock in Meckl. gemeint ist.
1234. 1572 Okt. 4: Paulus Koppius Nimicensis, erst in der heimatlichen Schule, mit 14 Jahren auf die Fürstenschule zu Meißen, wo er sechs Jahre durch Kurfürst Augusts Gnade bleiben durfte, dann ein Jahr auf eigene Kosten auf der Wittenberger Hochschule, infolge Ablebens seines Vaters mußte er dann in der Fremde durch Unterricht sein Brot suchen, eine Zeitlang bei einem (meckl.) Edelmann, von dem er die Vokation für die Kirche Blumenhagen in Mecklenburg erhielt; die Berufungsurkunde ist aber von zwei Männern, Berent und Christoph von Peckatel, ausgestellt, die ihn zur Prüfung und Ordination nach Wittenberg schickten; dort wurde er nach öffentlicher Prüfung in seinem 24. Lebensjahre von D. Frid. Widebram zum Predigtamte eingesegnet (fehlt ebenfalls bei Krüger a. a. O.).
Von den 36 aufgeführten, von 1541-72 zu Wittenberg ordinierten Männern hat einer (382) die Weihe von Martin Luther empfangen, bei 13 Pastoren ist Joh. Bugenhagen, bei 17 Paul Eber, bei 2 Sebastian Fröschel, bei je 1 Georg Major und Friedr. Widebram als Ordinator angegeben; einmal fehlt diese Angabe.


|
Seite 206 |




|
Ortsregister 1 )
Blumenhagen II 511. 1234.
Neu-Brandenburg
340. 1644.
Bützow 444.
Grevismühlen II
131.
Grubenhagen 541. 708. 885. 991.
1843.
Güstrow II 131.
Mecklenburg
925.
Peckatel II 510.
Klein-Quassow
382.
Rostock 1086. 717. 1785. 1962. II 99.
207. 326. 327. 354. 402. 425. 670. 806.
Schönberg II 879.
Schorssow 881.
Schwerin 1858. II 637.
Wesenberg II 510.
511.
Wismar 1165. II 326.
Personenregister. 2 )
Aurifaber, Joh. 1086.
Bacmeister, Lucas
1850.
Bautz, Joh. 340.
Berckau, Joh.
1843.
Birnstiel, Sebastian 925.
Bock,
Paul 881.
Bock, Sebastian 708.
von
Buchwald, Kaspar II 806.
von Bünau,
Heinrich II 637.
Dursten, Joh. II 906.
Frisius, Joh. 541.
Gans, Matthias II
879.
Günther, Karl II 207.
Hackendal,
Heinr. II 327.
Heßhusius, Tilemann
1381.
Hinricus, Pankraz 991.
Kittel,
Joh. 1092.
Cocceius, Joh. II 637.
Cocus (Koch), Andreas 444.
Koppius, Paul II
1234.
Critenus, Fabian II 354.
Cuno
(Kusne), Franz II 510.
Lenge, Tilemann II
99.
Lossius, Peter II 402.
Luckius,
Nicolaus II 879.
Neumann (Niemann), Joachim
1165.
Pantzer, Blasius II 511.
Pauli,
Simon 1858.
von Peckatel, Berent u.
Christoph II 1234.
Piper (Piperites),
Heinr. II 131.
Pissing, Martin 885.
Praetorius, Nikolaus 1785.
Rineck, Gräfin
II 207.
Rode, Christian II 806.
Roloff, Matthaeus 382.
Soldanus, Heinr.
1962.
Staupitz, Heinr. II 906.
Stricerius, Hieronymus II 425.
Struck, Paul
II 670.
Sturmer, Nikolaus II 906.
Terhatz, Peter 1644.
Ukius (wohl Wuke),
Joh. II 326.
Wißling (Wesling), Andreas
1717.
Wuke s. Ukius.


|
[ Seite 207 ] |




|



|


|
|
:
|
VII.
Die geschichtliche und landes=
kundliche Literatur
Mecklenburgs 1930-1932
von
Werner Strecker.
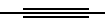


|
[ Seite 208 ] |




|


|
[ Seite 209 ] |




|
- Dahlmann-Waitz, Quellenkunde zur deutschen Geschichte, herausg. von Herm. Haering. 9. Aufl. Leipzig, Koehler, 1931. Registerband, 1932.
- Jahresberichte f. deutsche Gesch., herausg. v. A. Brackmann u. F. Hartung. 3. Jg. 1927. Leipzig, Koehler, 1929, S. 487-89 (Mecklenb.) - 4. Jg., 1928 (1930), S. 413-17. - 5. Jg., 1929 (1931), S. 454-459.
- Strecker (Werner), Die geschichtl. u. landeskundl. Lit. Mecklenburgs 1929/30. M. Jb. 94.
- Borchling (Conrad) u. Claussen (Bruno), Niederdeutsche Bibliographie. Gesamtverzeichnis der niederdeutschen Drucke bis zum Jahre 1800. Lief. I-VII (1473-1547) ersch. Neumünster, Karl Wachholtz, 1931, 1932. 4 °.
- Familiengeschichtl. Bibliographie, herausg. v. d. Zentralst. f. deutsche Pers.- u. Fam.-Gesch., Leipzig. Bd. I (1900-20) bearb. v. Friedr. Wecken. Lief. 1 u. 2. 1931, 32. Bd. III (H. 6-9, 1927-30), bearb. v. Joh. Hohlfeld, abgeschl. 1931.
- Bruns (Friedr.), Der Verfasser d. lübischen Stadeschronik. Ztschr. d. Ver. f. lübeck. Gesch. XXVI, 2, S. 247-276.
- Hamburgisches Urkundenbuch, herausg. vom Staatsarchiv der Freien u. Hansestadt Hamburg. 2. Bd., 2. Abt., S. 145-388. 1311-1320. Hamburg 1930.
- Dragendorff (Ernst), Die Chronik des Dietrich vam Lohe (1529-1583). Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock. Bd. 17 (1931) S. 1-110.
- Biereye (Wilh.), Über die ältesten Urkunden des Klosters Doberan. M. Jb. 94, S. 231-266.
- Petzsch (W.) u. Martiny (G.), Wall u. Tor der Tempelfeste Arkona. Prähist. Ztschr. XXI, 1930, 3./4. H., S. 237-264.
- Petzsch (W.), Die neuen Ausgrabungen in der Tempelburg Swantevits auf Arkona. Monatsbl. d. Ges. f. pomm. Gesch. u. Alt.-Kunde, 45. Jg. (1931), Nr. 4, S. 50-57.
- Schuchhardt (Carl), Die Burg im Wandel der Weltgeschichte. Museum der Weltgeschichte, herausg. v. Paul Herre. Akademische Verlagsgesellsch. Athenaion, Wildpark-Potsdam 1931. 350 S. mit 358 Abb. u. 15 Taf. 8 °. [S. 231-235 werden slawische Burgen Mecklenburgs behandelt.]
- Beltz (Rob.), Zum Steintanz von Boitin. Rost. Anz. 30. 11. 30, Nr. 280.
- Müller (Rolf), Die astronomische Bedeutung des meckl. "Steintanzes" bei Bützow. Prähist. Ztschr. Bd. XXII, 1931, S. 197-202.


|
Seite 210 |




|
- Reifferscheid (Heinrich), Hacke aus Hirschgeweih, gefunden am Conventer See bei Rethwisch. Mit Bildtafel. M. Jb. 95 (1931) S. 171-174.
- Reifferscheid (Heinrich), Streitaxt aus Felsstein, gefunden in Penzlin. Mit Bildtafel. M. Jb. 95 (1931) S. 175-178.
- Becker (Julius), Vorgeschichtl. Funde in Ziesendorf. M. Monatsh. 1931, Okt., S. 468-472.
- Beltz (R.), Hünengräber von Liepen bei Tessin. Zeitschr. M. 26. Jg. (1931), H. 1, S. 3-5.
- Augustin (K.), Ein Hünengrab bei Parchim, Ztschr. M. 26. Jg. (1931), H. 1, S. 2.
- Beltz (Robert), Die Vorgeschichte im Heimatbund M. Sachliches u. Persönl. aus fünf Jahrzehnten. M. Monatsh. 7. Jg. (1931), 9. H., S. 440-444.
- Hofmeister (Adolf), Die Vineta-Frage. Monatsbl. f. pomm. Gesch. u. Alt.-Kunde 46. Jg. (1932), Nr. 6, S. 82-89.
- Jegorov (Dmitrij Nik.), Die Kolonisation Mecklenburgs im 13. Jahrhundert. Bd. I: Material u. Methode. Übers. v. Harald Cosack. XV u. 438 S. Mit 1 Beil. Bd. II: Der Prozeß der Kolonisation. Übers. v. Georg Ostrogorsky. XXI u. 485 S. 2 Karten. Herausg. v. Osteuropa-Institut: Bibliothek geschichtl. Werke aus d. Literaturen Osteuropas, Nr. 1, Bde. I, II. Breslau, Priebatsch, 1930 8 °.
- Witte (Hans), Jegorovs Kolonisation von Mecklenburg im 13. Jahrhundert. Deutsche Hefte für Volks- und Kulturbodenforschung, Jg. 1, 1930, Heft 2, S. 94-116. Derselbe, Jegorovs zweiter Band über den Prozeß der Kolonisation in Mecklenburg. Ebd. H. 4, S. 241-253.
- Witte (Hans), Jegorovs Kolonisation Mecklenburgs. Ein kritisches Nachwort. Herausg. v. Osteuropa-Institut: Bibl. geschichtl. Werke aus den Literaturen Osteuropas, Nr. 1, Bd. III. Breslau, Priebatsch, 1932. XII u. 233 S. 8 °.
-
Endler (C. A.), Gab es eine deutsche
Kolonisation Mecklenburgs? Zu dem Buch des
Russen Jegorov. M. Monatsh. 1931 (April), S.
165-168. Weitere Besprechungen des
Jegorovschen Werkes sind erschienen von:
Wentz, Korr.-Bl. d. Gesamtvereins d.
deutschen Gesch.- u. Altertumsvereine, 79.
Jg., 1931, Nr. 1, Sp. 68-76; Pauls
(Volquart), Ztschr. d. Ges. f.
Schl.-Holstein. Gesch. 60, 2 (1931), S.
556-572: Sch., Forsch. z. Brandenb. u.
Preuß. Gesch. 43, 2, S. 388-390; B.,
Monatsbl. d. Ges. f. pommersche Gesch. u.
Alt.-Kunde, 45. Jg., 1931, Nr. 10, S.
150-152; Strecker (Werner), M. Jb. 95
(1931), S. 204-208; Biereye (Wilh.), Ztschr.
d. Ver. f. lüb. Gesch. XXVI, H. 2, S.
325-58; Gollup Herm.), Ztschr. d. Ver. f. d.
Gesch. Schlesiens, Bd. 66 (1932), S.
303-05,
[Hier bes. Kritik der Schlüsse Jegorovs aus heraldischem Material.] - Seelmann (Wilh.), Der Cie und zur Besiedlungsgeschichte von M.-Strelitz. Niederdeutsches Jb. 56/57, 1930/31, S. 180-188.
- Staak (Gerhard), Aufgaben u. Probleme der meckl. Ortsnamenforschung. M. Monatsh. 8. Jg., 5. H. (Mai 1932), S. 202-206.


|
Seite 211 |




|
- Witte (Hans), Von Mecklenburgs Geschichte und Volksart. Meckl. Gesellsch. 1931/32. 107 S. 8 Abb.
- Hofmeister (Adolf), Der Kampf um die Ostsee vom 9. bis 12. Jahrh. Greifswalder Univ.-Reden 29. Greifswald, L. Bamberg, 1931.
- Hoffmann (Karl), Die Stadtgründungen Mecklenburg-Schwerins vom 12. bis zum 14. Jahrhundert (auf siedlungsgeschichtl. Grundlage). M. Jb. 94, S. 1-200.
- Besprechung vorstehender Arbeit, von Georg Finck in Zeitschr. d. Ver. f. lüb. Gesch. XXVI, 2, S. 401-4. Ferner bespr. v. H. E. Feine in Ztschr. d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch., Bd. 52, Germ. Abt., S. 458-60.
- Barleben (R.), Brandenburgisch-meckl. Händel. Prignitzer Volksbücher H. 78. Pritzwalk, Tiemken [1928].
- Reincke (Heinr.), Kaiser Karl IV. u. d. deutsche Hanse. Pfingstbl. d. Hans. Gesch.-Vereins 22, 1931. 93 S.
- v. Ranke (Leop.), Wallenstein, Herzog z. M. Mit 5 Flugschriften a. d. J. 1628, 29, 30. Veröff. d. Meckl. Ges. (Leipzig) 1930.
-
Ein Stimmungsbild aus dem großen [30jähr.]
Kriege. Aus vergang. Tagen, Blätt. f. d.
Förd. d. Fam.-Gesch. Nr. 12 (20.7.31), S.
50-56. Bei W. Meinert, Lübtheen i.
M
[Betr. kaiserliche Truppen in Mecklenburg u. den Zustand des kaiserl. Heeres 1642.] - Schmidt (Walther), Geschichte des niedersächsischen Kreises vom Jahre 1673 bis zum Zusammenbruch der Kreisverfassung. Niedersächs. Jb. f. Landesgesch. Bd. 7, 1930, S. 1-134.
- Kentmann (Alex), Das Herzogtum M.-Strelitz in den Befreiungskriegen u. seine Verhandlungen mit dem Zentralverwaltungsrat. Diss. Rostock 1931. M.-Strel. Geschbl., 7. Jg., 1931, S. 1-109.
- Wagner (Richard), Aus dem Tagebuch einer Pastorentochter 1811-1815. M. Jb. 94, S. 267-274.
- Jacobi (H.), Goethe und Homburg. Mitt. d. Gesch.- u. Altert.-Ver. zu Bad Homburg v. d. H., Heft XVII, 1932. Sonderdr., 112 S. [Hierin, S. 58 ff., Nachrichten über den 1774 gehegten Plan einer Ehe zwischen dem Erbprinzen Friedrich Franz von M.-Schw. u. der Prinzessin Luise von Hessen-Darmstadt, späteren Gemahlin des Herzogs Carl August von Sachsen-Weimar.]
- Linz (Konrad), Königin Luise. Ein Lebensbild aus schicksalsschwerer Zeit. Berlin, Selle-Eysler, A.-G. [1932]. 159 S. 8 °.
-
Jagow (Kurt), Wilhelm und Elisa. Die
Jugendliebe des alten Kaisers. Leipzig,
Koehler, 1930. 316 S. Mit Abb. 8
°.
[Behandelt auch die Stellung des Großherzogs Georg v. M.-Strelitz u. d. Großherzogin Alexandrine.] - Kronprinzessin Cecilie, Erinnerungen. Leipzig, K. F. Koehler, 1930. 236 S. Mit Abb. 8 °.
-
Nabel (U.), Das Ballhaus an der
Fuhlentwiete. M. Ztg. 1930, Nr. 290 (12.
Dez.).
[Betr. das mecklb. Hof- u. Gesandtschafts-Ouartier in Hamburg im 18. Jahrh.]


|
Seite 212 |




|
- Meckl. Geschlechterbuch, herausg. v. Bernh. Koerner, bearb. in Gemeinsch. mit Otto v. Cossel u. Jobst Heinrich v. Bülow. 2. Band, 1931. Görlitz, Starke. XLIII u. 671 S. (74. Bd. d. Deutschen Geschlechterbuches, Geneal. Handb. bürgerl. Fam.)
- Gottschald (Max), Deutsche Namenkunde mit Namenbuch. München, J. F. Lehmann [1931]. 435 S.
- Bahlow (Hans), Mecklenburgisches Namenbüchlein. Ein Führer durch Mecklenburgs Familiennamen. Rostock, Hinstorff, 1932. 32 S. 8 °.
- Spiegelberg (Rud.), Die allg. Erbanlagen d. Charakters. Archiv d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. in M., N. F., 6. Bd., 1931, S. 3-82.
- Plöhn (Hans Arnold), Geistliche u. Beamte im Fürstentum Ratzeburg. Nach Masch, Gesch. d. Bistums Ratzeb., 1835, zusammengestellt. Zeitschr. d. Zentralst. f. niedersächs. Fam.-Gesch., 11. Jg. (1929), Nr. 12, S. 248-50.
- Willgeroth (Gustav), Beiträge zur Wismarschen Familienkunde. Aus den Kirchenbüchern, Bürgerbüchern, Volkszählungslisten, dem Stadtbuch und anderen Quellen zusammengestellt. Wismar, Selbstverlag, 1932. 207 S. 8 °.
-
Feilcke (Kurt), Die Männer der Kirche im
Herzogtum Lauenburg 1580-1590. Zeitschr. d.
Zentralstelle f. niedersächs. Fam.-Gesch.,
XIII. Jg., 1931, Nr. 1.
[Darunter einige Mecklenburger.] - Endler (C. A.), Nachträge zu Krüger-Ploen "Dreißig Dörfer". Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 12. Jg. 1930, S. 47 f.
- Endler (C. Aug.), Hauswirte in Wahrsow vor 1618. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 1, S. 12.
- Endler (C. Aug.), Die Hauswirte in Duvennest vor 1618. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., Nr. 2, S. 26.
- Bollow (Albert), Die Bauern des Amtes Neustadt in M. im Jahre 1690. Der deutsche Roland, 19. Jg., H. 5/6, S. 41 f.
-
Schwartz (Paul), Neues zur Fridericianischen
Urbarmachung des Warthebruchs. Die Neumark,
Jahrb. d. Ver. f. Gesch. d. Neumark, H. 7,
1930.
[Unter den Kolonisten in den neumärk. Städten folgende aus Mecklenb.: in Falkenburg J. Hr. Bär, Bäcker: in Landsberg Val. Gössel, Messerschmied aus Fürstenberg, und J. Schmuck, Riemer aus Grabow; in Peitz M. Braun, Tuchmacher aus Mölln.] - Wiegandt (Max), Die Auswanderung aus Mecklenburg-Schwerin in überseeische Länder, besonders nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika [1861-1864]. M. Jb. 94, S. 275-294.
-
Brody (Abraham) och Valentin (Hugo), Aaron
Jsaacs minnen. En judisk kulturbild från
Gustaviansk tid. Stockholm, Hugo Gebers
förlag [1932]. 370 S. 8 °. Darin (S. 40-57):
Silberstein (Siegfried): Aaron Isaac i
Mecklenburg.
[Betr. den Stempelschneider A. J., 1730-1816, der zeitweilig in Bützow lebte.] - Ahlers, Wilh. Karl Georg Ahlers [Bürgermeister in Neubrandenburg]. Ein Erinnerungsblatt. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 4, S. 59-62.


|
Seite 213 |




|
- Dr. Alban, Arzt und Maschinenbauer. Die Lebensschicksale eines meckl. Erfinders. M. Ztg. 30.11.1930, Nr. 271.
- Eine ostmeckl. Erinnerung an E. M. Arndt. Ostmeckl. Heimat, Jg. 2, 1929, Nr. 2, S. 9-12.
- Rohrdantz (Theodor), Landesbischof Behm. M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 279-281.
- Buddin (Fr.), Die Familie Bicker. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg. (1931), Nr. 2, S. 20-23.
- v. Blücher (Ulrich), Nachtrag z. neuesten Gesch. d. Fam. v. Blücher. Festschr. z. Feier d. 40jähr. Best. d. Fam.-Verbandes. 1930. 12 S. Gr.-8 °.
- Strecker (Werner), Briefe Blüchers an den Großherzog Friedrich Franz I. M. Jb. 95 (1931), S. 163-170.
- Wiedemann (Franz). Blüchers Grabstätten bei Krieblowitz. Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, 65. Bd., 1931, S. 473-501.
- Becker (Julius), John Brinckmans Reifeprüfung. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 564 f.
- Vitense (O.), Der Malchiner Turnvater Bülch. Ostmeckl. Heimat, Jg. 4, 1931, Nr. 12, S. 93 f.
- v. Bülow (Agnes), Das Epitaph der Äbtissin Judith v. Bülow in der Klosterkirche zu Isenhagen. Bülowsches Fam.-Bl. Nr. 10, Okt. 1931, Sp. 14 f.
- Willgeroth (Gustav), Stammtafel der Familie Crull. Auf Grund des von Sanitätsrat Dr. Paul Crull-Rostock gesammelten Materials bearbeitet. Als Manuskript gedr. 1931. 92 S. 8 °
- Stein (Otto), Aus der Geschichte meiner Vorfahren Cruse. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, H. 1, S. 8-10.
- Böhmer (Gerh.), Otto Beatus Danneel [Senator in Teterow]. M. Monatsh. 1930, S. 490-492.
- Buddin (Fr.), Über die Grabstätte des Oberförsters Danckwarth im Rugensdorfer Wald. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 4, S. 64.
- Ausgestorbene Familien des meckl. Adels. Bearb. u. herausg. v. G. Frhr. v. Pentz u. C. A. Pentz v. Schlichtegroll. Lief. 1: v. Drieberg [1931]. Bei W. Meinert, Lübtheen i. M.
- Buddin (Fr.), Die Ekengreenstraße bei der neuen Bürgerschule in Schönberg [betr. Fam. Ekengreen]. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 12. Jg. (1930), Nr. 4, S. 51-56.
- v. Notz (F.), Aus einer alten Bibel. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 1, S. 4-8; Nr. 2, S. 20 f. [Betr. Fam. des Amtmannes Peter Flügge in Schönberg († 1669).]
- Stuhr (Friedrich), Hermann Grotefend zum Gedächtnis. Mit Bildtafel und Schriftenverzeichnis. M. Jb. 95 (1931), S. I-XII.
- Zimmermann (Paul), Hermann Grotefend [zum Gedächtnis]. Archivalische Zeitschrift, 3. Folge, 7. Bd., 1931, S. 301-308.
- Wutke (Konrad), Hermann Grotefend [Nachruf]. Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schlesiens, 65. Bd., 1931, S. 551-555.
- Sch., Hermann Grotefend und Ferdinand Frensdorff zum Gedächtnis. Hannov. Magazin, Jg. 7, 1931, Nr. 2, S. 19-21.


|
Seite 214 |




|
- Heidmärker (L.), Eduard Heyck. Zu seinem 70. Geburtstage am 30. Mai 1932. M. Monatsh., 8. Jg., 5. H. (Mai 1932), S. 219-221.
- Was wird, wenn einer zwar zu jung, aber nicht dumm ist? Zur Gesch. der Hinstorffschen Verlagsbuchhandlung. Hinstorffs Jubiläums-Almanach 1831-1931, Wismar 1930, S. 11-19.
- Schmidt (Wilh.), Detloff Carl Hinstorff, Leben u. Wirken eines mecklenburg. Buchhändlers. M. Monatsh., 7. Jg. (1931), 9. H., S. 415-421.
- Haenchen (Karl), Friedrich v. Holsteins Herkunft und Jugend. M.-Strel. Geschbl., 7. Jg., 1931, S. 109-130. [Betr. den Geh. Rat v. H. im Auswärt. Amt.]
- Meincke (Wilh.), Victor Aimé Huber in Mecklenburg. Seine Redaktion der "Meckl. Blätter" 1834/35. - Etwas über Rostocker Universitätsleben vor 100 Jahren. M. Monatsh., 7. Jg., 1931 (Dez.), S. 591-593.
- Gahlbeck (Rud.), Generalmusikdirektor Prof. Willibald Kaehler. M. Monatsh. 1931 (Mai), S. 241-243.
- Albrecht (Klaus), Rudolph Karstadt, ein Kaufmann aus Mecklenb. M. Monatsh. 1931 (Febr.), S. 79-82.
- Schult (Friedr.), Die Kerstings in Güstrow. Meckl. Tagesztg. Güstrow, 27. März 1932. Sonderdr.
- Gehrig (Oscar), Goethe und der Maler Kersting. M. Monatsh., 8. Jg., 1932, H. 3, S. 105-108.
- v. Ketelhodt (Gerd, Frhr.), Über die Anfänge der Familie von Ketelhodt. Zeitschr. d. Zentralstelle f. niedersächs. Familiengesch. XIII. Jg. (1931). Nr. 3, S. 44-46.
- Ziercke (Walther), Das Geschlecht von Knuth. Ein siebenhundertjähr. Gedenken. Gemeinde-Bl. d. Kirchgem. Alt-Röbel, Ludorf, Nätebow, 6. Jg., 1930, Nr. 8, S. 56-60; 7. Jg., Nr. 1, S. 2-4.
- v. Lützow (Ferd.), Ludwig v. Lützow a. d. Hause Groß-Salitz, Meckl.-Schwer. Staatsminister. Lützowsches Fam.-Bl., 2. Bd., Nr. 27, Okt. 1931, S. 218-221.
- Hartmann (Joach.), Masch un sin Tid in Demern. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 3, S. 43-46.
- Mendelssohn u. Mecklenburg, Ergänzungen zu dem gleichnam. Aufsatz von Siegfr. Silberstein. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschland, Jg. 2, Nr. 2.
- Silberstein (Siegfried), Moses Mendelssohns Witwe in Neustrelitz. Zeitschr. f. d. Gesch. d. Juden in Deutschl. 1932. Sonderdr.
- Winkel (Fr. †), Georg v. Oertzen. M.-Strel. Heimatbl., 6. Jg., 1930, H. 3, S. 57-65.
- Ouvrier (E.), Gesch. einer französ. Fam. [Ouvrier] in Deutschland. Halle, Werkmeister & Co., 1930. 153 S. 8 °. Mit Stammtafeln, darunter mecklenb. Linie.
- Zum Gedächtnis des Kirchenrates Heinrich Passow [† 1880 als Pastor zu Alt-Röbel und Ludorf]. Gemeindebl. d. Kirchgem. Alt-Röbel, Ludorf usw., 6. Jg., 1930, Nr. 6.
- v. Pentz (Ernst Aug.), Landoberstallmeister a. D. Christian v. Pentz Dr. h. c. Aus vergangenen Tagen, Blätter f. d. Förder. d. Fam.-Gesch., Nr. 11 (15.4.31), S. 41-43.


|
Seite 215 |




|
- Piper (Reinhard), Otto Piper. Zu seinem 10. Todestag am 23. Febr. 1931. M. Monatsh. 1931 (Febr.), S. 67-70.
- Lammert (Friedr.), Zur Erinnerung an Prof. Johannes Reinke [vorm. Prof. der Botanik in Kiel]. Lauenb. Heimat, 7. Jg., 1931, H. 2, S. 53-56.
- Neumann (Walther), Hermann Reincke-Bloch. Deutsches Biographisches Jahrbuch 1929, S. 255-259.
- Wald (Roderich). Neubrandenburg, Fritz Reuter u. Carl Anton Piper. Ztschr. M., 26. Jg., H. 2, S. 54-58.
- Heinr. Schliemanns Selbstbiographie. Bis zu seinem Tode vervollständigt von Alfr. Brückner. Herausg. von Sophie Schliemann. 1. u. 2. Teil. Veröff. d. Meckl. Gesellsch., Nr. 3, 4. Leipzig 1930/31. 116 u. 118 S. 8 °.
- Meyer (Ernst), Heinrich Schliemanns Besuch in Ankershagen 1883. Nach unveröff. Briefen u. Angaben von Zeitgenossen. M. Monatsh. 1931 (Jan.), S. 41-44.
- Böhmer (Gerh.), Das Lebensbild des Grafen Hans Schlitz. Teterow i. M., Buchdruckerei v. H. Müschen [1930]. 149 S. 8 °.
- [Hänsel (Rob.)], Dr. Berthold Schmidt. Ein Bild seines Lebens u. Schaffens. Dargebr. d. Andenken seines Ehren-Vors. vom Geschichts- u. Altertumsforsch.-Verein zu Schleiz. 1930. Mit Bild u. Verzeichnis d. Schriften Schmidts. 21 S. 8 °.
-
P. V., Wilhelm Schmidt zu seinem 60.
Geburtstag. M. Monatsh. 8. Jg., 1932, H. 3,
S. 131 f.
[Betr. den plattdeutschen Dichter W. S.] - Wilhelm Schmidt to sin 60. Geburtsdag. De Wiespaal, Monatl. Bil. v. d. Lübecker General-Anz., 1932, Nr. 5.
- Silberstein (Siegfried), Zur Geschichte d. Oppenheimerschen Bibliothek [betr. einschlägigen Briefwechsel des Bützower Professors u. Bibliophilen O. G. Tychsen]. Mitt. der Soncino-Ges., Nr. 7, März 1931.
- Wotschke (Theodor), Leonhard Christian Sturms religiöse und kirchliche Stellung. Nach Briefen in der Staatsbibliothek Berlin. M. Jb. 95 (1931), S. 103-142.
- Röpke (Walter), Willi Ule. Ein Bild seines Lebens, Wirkens und Wesens. Mit Verz. d. Schriften Ules. Mitt. d. Geogr. Ges. zu Rostock, 20. u. 21. Jg., 1928-30, S. 7-38.
- Röpke (Walter), Der Begründer der Landeskunde Mecklenburgs. Prof. Willi Ule zum 70. Geburtstag am 9. Mai 1931. Meckl. Ztg., 5.5.1931, Nr. 103.
- Hustaedt (K.), Christian Philipp Wolff. Ein Meckl.-Strel. Hofbaumeister und Bildhauer. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 4, S. 53-58.
- Schult (Otto), Denkmalschutz in M.-Schwerin 1930-31. M. Jb. 95 (1931), S. 179-182. Mit folgenden Berichten: I. Reiffercheidt (Heinrich), Denkmale der Vor- und Frühgeschichte, S. 182-184. II. Lorenz (Adolf Friedrich), Die Baudenkmale, S. 184-198. III. Josephi (Walter), Denkmale der Kunst und des Kunstgewerbes, S. 199-200.


|
Seite 216 |




|
- Wossidlo (Richard), Mecklenburgische Volksüberlieferungen Bd. IV: Kinderreime, 1. Teil. Rostock, C. Hinstorff [1931]. XXIII u. 287 S.
- Wossidlo (Richard), Volkstümliches aus Mecklenburg. Volkssagen von Malchow. Ostmeckl. Heimat, Jg. 3, 1930, Nr. 9, S. 65-69.
- Staak (Gerh.), Beiträge zur magischen Krankheitsbehandlung. Die magische Krankheitsbehandlung in der Gegenwart in Meckl. Rostock 1930. 356 S. 8 °.
- M. K., Allerlei Volksmedizin in Niederdeutschland. Ostmeckl. Heimat, Jg. 2, 1929, Nr. 1, S. 5 f.
- Kriege (W.), Hexendienst im südwestl. M. M. Heimat, 10. Jg., 1931, Nr. 4, S. 8-10.
- Wirtschaftsgeschichtliches in meckl. Flurnamen. M. Heimat, 11. Jg., 1932, Nr. 1/3, S. 4 f.
- Staak (G.), Der Flurname "up dei Süße" und das Beiwort "süß" in meckl. Flurnamen. Zeitschr. M., 26. Jg. (1931), H. 1, S. 5-8.
- Stein (Otto), Die Blumenholzer Flurnamen. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 2, S. 23-25.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Demern, Dorf u. Hof. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 12. Jg., 1930, Nr. 3, S. 37-40.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Kl.- und Gr.-Mist. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 12. Jg. (1930), Nr. 4, S. 57-59.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Palingen. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 13. Jg. (1931), Nr. 2, S. 26-29.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Lauen (mit Hof) und Bardowiek. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeburg, 13. Jg. (1931), Nr. 3, S. 40-43.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Lüdersdorf u. Wahrsow (Dorf u. Hof). Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 4, S. 57-61; 14. Jg., 1932, Nr. 1, S. 9-12.
- Buddin (Fr.), Flurnamen von Duvennest und dem Vorwerk Lenschow (vormals zu Hof Wahrsow). Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 2, S. 21-26.
- Knull (Wilh.), Was uns die Gotthuner Flurnamen erzählen. Mit einer Karte. Gemeindebl. d. Kirchgemeinden Alt-Röbel, Ludorf, Nätebow, 6. Jg., Nr. 4, Juli 1930.
- Steinmann (U.). Die Flurnamen der Hagenower Feldmark. Zeitschr. M., 25. Jg., 1930, Nr. 3, S. 89-95; Nr. 4, S. 110-115.
- Herholz (Walter), Der "Wendenwall" bei Kl.-Luckow. Ostmeckl. Heimat, Jg. 1, 1928, Nr. 9, S. 65-67.
- Trost, Ein Nachtrag zur Rundlingsfrage. Ztschr. M., 25. Jg., 1930, Nr. 4, S. 101-104.
- Witte (Hans), Mecklenburgs Südosten in Hinsicht seiner Stammesart. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 50-55.
- Ringeling (Gerhard), Das Niedersachsen-Problem. M. Monatsh. Febr. 1931, S. 73-75.
- Wossidlo (Richard), Über das Volkstum des Amtes Waren. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 58-64.
- Puls (K.), Land u. Leute des Rammer Landes. Ztschr. M., 25. Jg., 1930, Nr. 4, S. 98-101.


|
Seite 217 |




|
- Asmus (Wolfg. Dietr.), Bürgerl. u. städt. Leben in den Städten Ostmecklenburgs zu Anfang d. 16. Jahrh. Ostmeckl. Heimat, Jg. 4, 1931, Nr. 8, S. 57-59; Nr. 9, S. 65-67.
- Warncke (J.), Der Trachtenschmuck des Ratzeburger Landes im Schönberger Heimatmuseum. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 12. Jg., 1930, S. 34-36.
- Schmidt, Die Dombibliothek in Ratzeburg. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 2, S. 18 f.
- Pries (Joh. Friedr.), Gehöft in Lärz, Amt Waren. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 55-58. [Betr. Bauernhausforschung.]
- Pries (Joh. Friedr.), Haken u. Pflug. Ztschr. M., 25. Jg., 1930, Nr. 4, S. 105-110.
- Steinmann (Ulrich), Boizenburger Hausinschriften. Sonderdruck aus der Elbzeitung, 1931, Nr. 43.
- Ein Ehevertrag aus Petersberg von 1596. Mitget. von Endler (C. A.). Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 12 Jg. (1930), Nr. 4, S. 56.
- Schüßler (Fritz), Die Hakenbüchsen der Woldegker Schützengilde. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 2, S. 25-28.
- Augustin (Karl), Aus alten Innungsakten. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 534 f.
- Endler [Carl Aug.], Zunftschilder u. Zunftgebräuche. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 525-528.
- Schlüter (Ernst), Zur Geschichte des Handwerks. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 519-524.
- Schlüter (Ernst), Der Handwerker im niederdeutschen Volkshumor. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 540-544.
- Folkers (Joh. Ulr.), Ein alter meckl. Zimmermann. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 529-531.
- Fiesel (L.), Meckl. Zinngießerei. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 536-539.
- Gosselck (Joh.), Glaserleben, wie es sich in Handwerksliedern u. Sprüchen des 18. Jahrh. widerspiegelt. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 549 f.
- Ost (Günther), Althamburger und Altmecklenburger Zeitungen. Ein Beitrag zur Gesch. d. Inkunabeln der Zeitungspresse. Ztschr. d. Vereins f. Hamburg. Gesch., Bd. 32, 1931, S. 197-209. [Nachweis, daß eine in der ersten Hälfte des 17. Jahrh. erscheinende "Neue wöchentliche Hamburger Zeitung" in Rostock herausgegeben ist, während eine bisher für rostockisch gehaltene "Postzeitung" nach Hamburg gehört.]
- [Franz, (Wilh.)], Aus der Geschichte der M[eckl.] Z[eitung]. Meckl. Ztg., 175. Jg., 1932, Nr. 1.
- Reiter (H.), Das erste Mecklb. Hygienemuseum im Schloß zu Schwerin. M. Monatsh. 1931 (Febr.), S. 53-57.
- Fischer (Joh.), Zur Geschichte des. meckl. Irrenwesens. Allg. Ztschr. f. Psychiatrie, 95. Bd., 1. H., 1931, S. 1-13. Sonderabdr.
- Rugenstein, Fünfzig Jahre Kinderheilanstalt Bethesda in Bad Sülze. M. Monatsh. 1931 (Okt.), S. 494-496.
- Witt (Klaus), Mit der Postkutsche durch meckl. Gaue. Reiseerinnerungen eines Norwegers [Treschow-Hanson] aus dem


|
Seite 218 |




|
Jahre 1806. Landeszeitung für beide M., 47. Jg. (1932), Nr. 49, 2. Beil.
- Nevermann (Hans), Der Drache in Meckl. Niederdeutsche Monatsh., 5. Jg., 1930, S. 61-63.
- Zierow (M.), Niederdeutsche Vergleiche zwischen Mensch u. Tier. M. Heimat, 10. Jg., 1931, Nr. 3, S. 11-13.
- Schlüter (Ernst), Ein alter Pfingstbrauch aus Rostock. M. Monatsh., 8. Jg., 5. H. (Mai 1932), S. 207-209.
- Burmeister (Walter). Das Hahnschlagen zu Ulrichshusen. M. Heimat, 9. Jg., 1930, Nr. 4/5, S. 37 f.
- Barnewitz (Hans W.), Bei niederdeutschen Regimentern. Ein Kapitel Soldatensprache. Rost. Anz. 1930, Nr. 255 (31. Okt.).
- Gosselck (J.), Dat leewe Brood. M. Monatsh. 1930 (Sept.), S. 427-429.
- Kaysel (Otto), Von großherzogl. Läufern. M. Monatsh. 1930 (Dez.), S. 602 f.
- Szymanski (Hans), Die Segelschiffe der deutschen Kleinschifffahrt. 88 S. Mit 45 Abb. Pfingstbl. d. Hans. Gesch.-Vereins 20, 1929.
- Wagner (Eugen), Die Holzversorgung der Lüneburger Saline in ihrer wirtschaftsgeschichtl. u. kulturgeogr. Bedeutung. Diss. Kiel. Druck u. Verl. v. Otto Fritz. Düsseldorf. 242 S. u. 2 Karten. [Betr. auch meckl. Holzhandel, Kanalprojekte, Schaalfahrt.]
- Joerß (Harry), Von der Rechenkunst des hansischen Kaufmanns. M. Monatsh. 1931 (Okt.), S. 489-491.
- Barnewitz (Hans W.), Von mecklenb. Mühlen. Ostmeckl. Heimat, Jg. 4, 1931, Nr. 3, S. 17-19; Nr. 4, S. 25-27.
- Barnewitz (Hans W.), Von Einliegern und Tagelöhnern. M. Heimat, 11. Jg., 1932, Nr. 1/3, S. 5-7.
- Schlie (Ernst), Mecklenburgs erste Maschinenfabrik. M. Monatsh. 1930 (Dez.), S. 591-595. [Betr. die Albansche Fabrik in Kl.-Wehnendorf und Plau.]
- Bethke (Hans Otto), Der gewerkschaftliche u. der wirtschaftsfriedliche Gedanke in den Landarbeiterberufsverbänden beider Mecklenburg. Diss. Rostock. Carl Hinstorffs Hofbuchdruckerei 1927. 99 S.
- Kiffmeyer (Wilh.), Die Steuerbelastung der mecklenb. Landwirtschaft in den Betriebsjahren 1913/14 u. 1925/26-1927/28. Diss. Würzburg. Buchdruckerei von Herm. Freise, Parchim, 1930. 68 S.
- Wegner (Walter), Untersuchungen zur Frage der sozialen Belastung des Grundbesitzes in Meckl.-Schwerin. Diss. Rostock, 1931. 66 S.
- Deutler (Karl), Kreditbanken eines Agrarlandes vor und nach dem Kriege. Diss. Rostock, 1930. 120 S.
- Seyferth (Paul), Suckwitz u. Diestelow. Neue Wege ländl. Siedlung. Berlin-Spandau. Wichern-Verlag, 1931. 30 S. 8 °.
- Aus der mecklenburgischen Luftfahrt. Die Ernst-Heinkel-Flugzeugwerke in Warnemünde-Rostock. M. Monatsh. 1930 (Aug.), S. 372-378.


|
Seite 219 |




|
- Borchert (M. J.), Die mecklenb. Ziegelei-Industrie. M. Monatsh. 1931 (März), S. 140-143.
- Helms, Entwicklung u. Bedeutung der Rinder- u. Schweinezucht. Jubil.-Ausg. des Rostocker Anzeigers v. 1. April 1931, Nr. 76.
- Eddelbüttel (Heinr.), Von den Tartufli oder peruvianischen Papas [Kartoffeln] u. ihrem ersten Auftreten in Meckl. M. Monatsh. 1931 (April), S. 177-181.
- Schiermeyer (Kurt), Die Rohholzversorgung des meckl.-schwer. Sägereigewerbes aus den heimischen Rohholzquellen. Diss. Rostock, 1931. 156 S.
- Mielck (Otfried), Mecklenburgs Dauermilch-Industrie. M. Monatsh., 7. Jg., 1931, 8. H., S. 386-389.
- Ohage (Joh.), Fermente, Peptone und Lezithine oder: Etwas aus der chemischen Industrie in Meckl. M. Monatsh. 1931 (Okt.), S. 479-483. [Betr. chemische Fabrik von Witte in Rostock.]
- Huch (Ricarda), Lebensbilder mecklenb. Städte. Meckl. Gesellsch., Leipzig, 1930/31. 127 S. 8 °.
- Hustaedt (K.), Blumenholz. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931. H. 2, S. 19-23.
- Stuewer, Aus der Geschichte der Boddiner Kirche. Ostmeckl. Heimat, Jg. 2, 1929, Nr. 16, S. 122 f., 143 f., 150 f., 156-58, 166 f.
- Schreiber (Thea), Die Kirche zu Brunshaupten. M. Monatsh. 1931 (Juni), S. 263-268.
- Clodius Camin (Gesch. d. Gemeinde). Gemeindeblatt f. d. Gemeinden in der Propstei Wittenburg 1927 Nr. 4; 1928 Nr. 2, 3; 1929 Nr. 2, 4; 1930 Nr. 1-1931 N. 1; 1931 Nr. 3 f.
- Ploen (H.), Der Dassower Ackersleute Kampf um Besitz, Rechte u. Freiheit. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 13. Jg., 1931, Nr. 4, S. 53-57.
- Romberg, Der Dassower Kirchturm. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 4, S. 50-52.
- Brömse (Luise), Der Sturm auf Fisch land 1747. M. Monatsh., 8. Jg., 1932, H. 3, S. 126-127
- Wendorff (Friedr.), 50 Jahre [Gadebuscher] Stadtgeschichte. Gadebusch-Rehnaer Zeitung, Jub.-Ausg., 1. Dez. 1930, Nr. 140, 2. Beil.
- Suhrbier (Heinr.), Unser [Gadebuscher] Schulwesen im Wandel der letzten 50 Jahre. Ebd 4. Beil.
- Brandenburg (H.), Die Männer im Feuer. Aus der Tätigkeit der [Gadebuscher] Freiwill. Feuerwehr. nach alten u. neuen Protokollen. Ebd. 5. Beil.
- Ahlers, Aus der Geschichte der i. J. 1729 eingegangenen M.-Str. Pfarre zu Gevezin. M.-Str. Heimatbl., 8. Jg., 2. H., S. 29-34.
- Kurz (O.), Der große Brand Grabows 1725 und der Wiederaufbau der Stadt. Grabower Heimathefte Nr. 1, herausg. v. d. Ortsgruppe des Heimatbundes Meckl. 1931, Grabow, E. K. Greiner. 8 °. 71 S. Mit Abb. u. Karte.
- Droß (Fr. W.), Karl August von Weimar und die "Franzosentid" in Mecklenburg. Meckl. Musenalmanach 1931/32, herausg.


|
Seite 220 |




|
von Christoph Dittmer, S. 93-100. Gedruckt auch Mecklenburgische Tageszeitung (Güstrower Ztg.) 1932, Nr. 70 (24.3.). [Betr. Aufenthalt des Herzogs Karl August in Güstrow 1806.]
- Steinmann (Ulrich), Hagenower Hausinschriften. Hagenower Kreisblatt 1931, Nr. 143.
- Kiencke (Otto), Vermessung u. Bonitierung der Stadtfeldmark Hagenow. Ztschr. M., 26. Jg., H. 2, S. 45-48.
- Müller (Bernhard), Geschichte der Schule zu Bad Kleinen. 1932. Masch.-Schr. Landesbibl. Schwerin.
- Rütz (Alfred). Neukloster in der Geschichte. M. Monatsh. 1931 (Mai), S. 222-226.
- Das Klützer Pfarrhaus. Die Pastoren in Klütz. Von den Kirchenjuraten. Gemeindeblatt f. d. Kirchgem. Klütz, 1930, Nr. 10.
- Das Klützer Organistenhaus. - Die Organisten in Klütz. - Über die Orgeln in der Klützer Kirche. Gemeindebl. f. d. Kirchgemeinde Klütz 1931, Nr. 12.
- Von alten Mühlen in unserer Gemeinde [Klütz]. Gemeindebl. f. d. Kirchgemeinde Klütz 1931, Nr. 12, 13.
- Wentz (Gottfried), Zur Geschichte des Mönchshofes Kotze. M. Jb. 95 (1931), S. 147-152.
- Endler, Hauswirte in Lüdersdorf vor 1618. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 4, S. 61.
- Curschmann (Hans), Dem Friedrich-Franz-Hospiz im Ostseebad Müritz i. M. z. 50. Geburtstag. M. Monatsh. 1930 (Juli), S. 350-352.
- Ahlers, Der Neubrandenburger Stein von 1608 u. seine Inschrift, nach Aufzeichnungen des Bürgermeisters Geh. Hofrat Ahlers. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 1, S. 9-13.
- Endler (Carl Aug.), Die Palinger Hauswirte seit 1444. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürstent. Ratzeb., 13. Jg. (1931), Nr. 2, S. 29 f.
- Aus der Geschichte Pampows [Verschiedene kleine Arbeiten]. M. Heimat, 10. Jg., 1931. Nr. 5.
- Voß (Ernst), Papenhagen. Ostmeckl. Heimat, Jg. 3, 1930, Nr. 7, S. 55 f.
- Augustin (Klaus), Zur Geschichte des ehemaligen Parchimer Fischeramtes. Archiv f. Fischereigesch., H. 15, Okt. 1931. 44 S.
- v. Lützow (Henning, Frhr.), Schäden des Dreißigjähr. Krieges in Perlin und Banzin. Lützowsches Fam.-Bl. 2. Bd., Nr. 24 (April 1930), S. 199.
- Hellwig (L.), Chronik der Stadt Ratzeburg. 2. Aufl. Ergänzt bis auf die Gegenwart. Ratzeburg, Lauenburg. Heimatverlag. 1929. VIII u. 203 S. 8 °.
- Haupt (Richard), Die Grundsteinlegung zum Ratzeburger Dom. Lauenb. Heimat, 5. Jg. (1929), H. 3. S. 90-92.
- v. Notz (Ferd.), Die Kapellen u. Totengrüfte der Sachsenherzöge im Ratzeb. Dom. Lauenb. Heimat, 5. Jg. (1929), H. 2, S. 59-68.
- v. Notz (Ferd.), Die Ritterrüstung im Dom zu Ratzeburg. Lauenb. Heimat, 5. Jg. (1929), H. 1, S. 27-29.
- Lenschow (W.), Der Dachreiter u. anderes vom Ratzeburger Dom. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 1, S. 2-3.


|
Seite 221 |




|
- v. Notz (Ferd.), Irrungen. Ein Beschwerdefall aus der Zeit des ausgehenden Ratzeburger Domstifts. M.-Str. Heimatbl., 8. Jg., 1932, H. 2, S. 21-29.
- Fischer-Hübner, Die Buchdruckerei auf dem Domhof zu Ratzeburg. Lauenb. Heimat, 5. Jg. (1929), H. 1, S. 23-27; H. 3, S. 102-05; 6. Jg. (1930), H. 1,S. 19-21; H. 2, S. 69-71.
- John (Fritz), Die Kirche zu Retschow. M. Heimat. 11. Jg., 1932, Nr. 1/3, S. 1-3.
- Freynhagen(Walter), Die Wehrmachtsverhältnisse der Stadt Rostock im Mittelalter. M. Jb. 95 (1931), S. 1-102.
- Das evangelische Rostock 1531-1931, Festschr. zu Rostocks 400jähr. Reformationsjubiläum. Rostock, C. Boldt (1931). 119 S. 8 °.
- (Mattiesen, H.), Das Rostocker Stadtbild in alter Zeit. Katalog der vom Kunstverein u. vom Verein f. Rostocks Altertümer veranstalteten Ausstellung. Rostock, 1930, Druck v. Carl Hinstorff. 20 S. 8 °.
- Sedlmaier (Rich.), Rostock. Deutsche Lande, deutsche Kunst, herausg. v. Burkhard Meier. Deutscher Kunstverlag, Berlin 1931.
- Sedlmaier (R.), Vom zerstörten Rostock. M. Monatsh. 1931 (Febr.), S. 84-88.
- Martins (Paul), Wie Rostock im 19. Jahrhundert anwuchs. M. Monatsh. 1931 (Mai), S. 216-221.
- Schultz (Otto), Die Entwicklung Rostocks in den letzten 50 Jahren. Jubil.-Ausg. d. Rost. Anz. vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Fischer, Ein Neubauprojekt des Heiligen-Geist-Hospitales zu Rostock aus dem Jahre 1806. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock Bd. 17 (1931), S. 111-113.
- Sch[napau]ff, Rostock als Hafenstadt. Jubil.-Ausg. d. Rostocker Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Benjes (C.), Das Rostocker Volksschulwesen. Jubil.-Ausg. d. Rostocker Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Mattiesen (E.), Rostocker Musikleben (1881-1931). Jubil.-Ausg. d. Rost. Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Der Werdegang des "Rostocker Anzeigers". Jubil.-Ausg. des Rost Anz. vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Rüß (Friedrich-Carl), Aus der 700jähr. Geschichte der Kirche u. des Klosters Rühn. M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 252-257.
- Lorenz (Ad. Friedr.), Kloster Rühn. M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 258-260.
- Gehrig (Oscar), Kunst u. Kunsthandwerk in der Kirche zu Rühn, M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 264-265.
- Barnewitz (H. W.), Die Fürstenwappen des Rühner Altars. M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 263.
- Trost (Friedr.), Der Wiederaufbau Rühn-Pustols nach dem 30jähr. Kriege, das Lebenswerk einer mecklenb. Herzogin. M. Monatsh. 1932 (Juni), S. 261 f.
- Barnewitz (Hans W.), Aus der Geschichte der Teterower Schützenzunft. Teterower Nachrichten v. 17.7.1930, Nr. 164.
- Krause, Bilder aus der Gesch. des Dorfes Hohen-Viecheln. M. Heimat. 11. Jg., 1932, Nr. 1/3, S. 18-21.


|
Seite 222 |




|
- Linshöft (P.), Hohen-Viechelnsche Erbpachtfischerei. Ebd. S. 25 f.
- Das Kirchdorf Walkendorf bei Gnoien. Ostmeckl. Heimat, Jg. 2, 1929, Nr. 9, S. 67 f.
- Voßberg (Herbert), Die Reformation in der Stadt Waren (Müritz.). Auf Grund der Quellen erstmalig dargestellt. Waren 1931, Sonder-Abdruck aus dem Georgenboten, Gemeindebl. d. Warener Georgengemeinde. 15 S. 8 °.
- Voßberg (H.), Zur Baugeschichte der Warener Kirchen. Festschrift. Waren 1932. 11 S. Mit 1 Bildtafel.
- Strüwer (Wilh.), Geruhsame Zeiten. Erinnerungen aus meinen Kindertagen in Waren um 1840/50. Warener Tageblatt 1931, Nr. 183, 189, 195, 201, 207, 213, 219.
- Voß (Ernst), Wargentin. Ostmeckl. Heimat, Jg. 3, 1930, Nr. 3, S. 17-19.
- Beu (Heinr.), Auszug aus d. Chronik der Schützenzunft zu Warin, Festbuch zum 275jähr. Jub. d. Schützenzunft zu Warin. 1931. 14 S.
- Einiges aus Warnemündes Kirchengeschichte. Gemeindeblatt d. Kirchgemeinde Warnemünde, 8. Jg., Nr. 3, Mai 1931.
- v. Bülow (Jobst Heinr.), Wieschendorf u. Elmenhorst c. p. Bülowsches Fam.-Bl. Nr. 11, Okt. 1930, u. Forts.
- Röpke (W.), Wismar. Eine geogr. Studie. Fritz Reuter, Heimatbl. f. alle Meckelbörger, de in Norddütschland wahnt. Hamburg 1930, 11. Jg., Nr. 11 (Bespr. in Mitt. d. geogr. Ges. zu Rostock, 20./21. Jg., S. 47 f.).
- Kleiminger, Die Funde bei den Ausschachtungen auf dem Mönchenkirchhof [in Wismar]. Mecklenburger Tagesblatt, Wismar, 2.7.1931, Nr. 151.
- Schüßler (Herm.), Die [Woldegker] Feldmark und ihre Separation. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 3, S. 35-45.
- Wölzow. Lützowsches Fam.-Bl., 2. Bd., Nr. 25, Okt. 1930, S. 205 208.
- Schmid (Heinr. Felix), Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westslavischem Boden und ihre Entwicklung während des Mittelalters. III. (Schluß-) Teil. IV. Kap.: Die vorkolonialen Elemente der Grundlagen der Pfarrorganisation in den ehemals slavischen Ostseeländern. Ztschr. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch. LI. Bd., Kan. Abt. XX, S. 202 ff.
- Schmaltz (Karl), Das Erbe der Väter, Meckl. Kirchengeschichte im Grundriß. Unsere rneckl. Heimatkirche, H. 2. Schwerin, Verlag d. Evang. Preßverbandes M. [193o]. 31 S. 8 °.
- Bernhöft (Hans), Der Triumph des Ansveruskultes über die Marienverehrung im Ratzeburger Dom. Ein Beitrag zur Ansverusforschung. Lauenb. Heimat, 7. Jg., 1931, H. 3, S. 98 f.
- Wentz (Gottfr.), Übersichtskarte d. kirchl. Einteilung d. Mark Brandenb. u. d. angrenzenden Gebiete i. J. 1500. (Hist. Atlas d. Provinz Brandenb., herausg. v. d. Hist. Komm. f. d. Provinz. Br. u. d. Reichshauptstadt Berlin. 1. Reihe, Kirchenkarten, Karte 1). Dazu Erläuterungsheft, 18 S. Berlin, Reimer, 1929.


|
Seite 223 |




|
- Wotschke (Theodor), Zwei Freunde August Hermann Franckes [S. A. Hennings, Pastor in Recknitz, u. Joh. Chr. Menckel, Hofprediger in Schwerin]. M. Jb. 94, S. 201-216.
- Wotschke (Theodor), Aus den Briefen des Hofkantors Rudolph in Dargun. M. Jb. 94, S. 217-230.
- Im Dienste des Herrn. Blätter aus der Arbeit des † D Dr. Heinrich Behm, Landesbischof in Meckl.-Schw. Unter Mitwirk. v. Julius Sieden herausg. v. D Joh. Behm. Schwerin, Fr. Bahn, 1930. 267 S., 1 Bildnis.
- Schoof (Friedr.), Die Arbeiterkolonie Neu-Krenzlin. Unsere meckl. Heimatkirche, H. 1. Schwerin, Verlag d. Evang. Preßverbandes M. [1930]. 16 S. 8 °.
- Die Große Stadtschule zu Rostock in 3 1/2 Jahrhunderten. Eine Jubiläumsschrift, herausg. von Studiendirektor Dr. Walther Neumann. Rostock 1930. 8 °. 186 S. Mit Abb. u. 1 Plan.
- Neumann (Walther), Aus der guten alten Zeit der Rostocker Großen Stadtschule. M. Monatsh. 1930 (Sept.), S. 445-449.
- Neumann (Walther), Ein Rostocker Kulturbild aus dem Anfang des 17. Jahrh. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, Bd. 17 (1931), S. 129-133. [Betr. Schulwesen.]
- Kohfeldt (G.), Aus dem ersten Jahrhundert der Rostocker Großen Stadtschule. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, Bd. 17 (1931), S. 115-128.
- Beckmann (Paul), Die Große Stadtschule zu Rostock und das Plattdeutsche. M. Monatsh. 1930 (Sept.), S. 450-453.
- Brandt, Die höheren Schulen von Meckl.-Schwerin in den letzten 50 Jahren. Jubil.-Ausg. d. Rostocker Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Schult, Die Volksschule 1881 und 1931. Jubil.-Ausg. des Rostocker Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Gerchow, Giesebrechts pädagogische Reise durch Deutschland und die Schweiz. M.-Str. Heimatbl., 8. Jg., 1932, H. 1, S. 11-15. [Betr. Studienreise des Leiters des Landschullehrerseminars in Mirow, Giesebrecht, 1818.]
- Baalk (Arthur), Die Backsteingotik Norddeutschlands. Ihre kunstgeschichtl. Entdeckung u. Darstellung. Ihr Wesen u. ihre Verbreitung. Niederdeutsche Monatsh., 4. Jg., 1929, S. 143-46; 180-83.
- Josephi (Walter), Mecklenburg u. seine bildende Kunst. Jubil.-Ausg. d. Rostocker Anzeigers v. 1. April 1931, Nr. 76.
- Baalk (A. M.), Die mittelalterlichen Taufsteine in M.-Schw. Einige vorläuf. Feststell. Ztschr. M., 25. Jg., 1930, Nr. 4, S. 116-123.
- Schmaltz (Karl), Mittelalterliche Kruzifixe in Meckl. M. Monatsh. 1931 (April), S. 154-158.


|
Seite 224 |




|
- Stade (Gerhard), Mecklenburgische Kanzelaltäre. M. Monatsh. 7. Jg., 1931, 8. H., S. 382-385.
- Josephi (Walter), Die Güstrower Domapostel. Meckl. Bilderhefte, herausg. v. Inst. f. Kunstgesch. d. Landesunivers., H. v. Rostock, Hinstorff, 1931. 18 S. 8 Abb. u. 12 Taf. 8 °.
- v. Langermann u. Erlencamp (A. M., Freiin), Der Dom zu Schwerin. Schwerin, Bärensprung, 1931. 40 S., mit Abb. 8 °.
- Messinggrabplatte der Bischöfe Gottfried († 1314) und Friedrich († 1375) v. Bülow im Dom zu Schwerin. Zur 700-Jahr-Feier des Geschlechts v. Bülow 1929 herausgegeben vom Familienverbande. - Messinggrabplatte der Bischöfe Ludolf († 1339) und Heinrich († 1347) v. Bülow im Dom zu Schwerin. Steindruck. Bärensprungsche Hofbuchdruckerei, Schwerin. Vgl. Bülowsches Familienblatt Nr. 7 ff.
- Haupt (Rich.), Drei Baumeister. Lauenb. Heimat, 6. Jg., 1930, H. 3, S. 81-87; H. 4, S. 132-34. [Betr. Erbauer des Domklosters u. des Domes in Ratzeburg.]
- v. Notz (Ferd.), Der Dom zu Ratzeburg. Lauenb. Heimatverlag, Ratzeburg [1932]. 99 S. 8°. 16 Taf. mit Abb.
- v. Notz (Ferd.), Der Apostelaltar im Ratzeburger Dom. Lauenb. Heimat, 5. Jg., 1929, H. 3, S. 92-98; H. 4, S. 142-45.
- Warncke (J.), Ergänzende Mitteilungen über den Apostelaltar im Ratzeburger Dom. Lauenb. Heimat, 6. Jg., 1930, H. 4, S. 157 f.
- v. Notz (Ferd.), Alte Wandmalereien des Ratzeburger Doms. Lauenb. Heimat, 6. Jg., 1930, H. 3, S. 87-91; H. 4, S. 135-40; H. 5; 7. Jg., 1931, H. 1, S. 16-19. Ergänzung hierzu 7. Jg., H. 4, S. 124-26.
- Stern (Dora), Rudolf Stockman aus Antwerpen, ein Renaissance-Bildhauer in Rostock. M. Monatsh. 1931 (Okt.), S. 507-512.
- Josephi (Walter), Cornelius Krommeny und sein Rühner Altar. Mit Bildtafel. M. Jb. 95 (1931), S. 153-162. Mit einer Übersicht über die Werke Krommenys nach dem jetzigen Stande.
- Reifferscheid (Heinrich), Unbekannte Werke des Georg David Matthieu. Mit 2 Bildtafeln. M. Jb. 95 (1931), S. 143-146.
- Dettmann (Gerd), Der Bildhauer Rudolph Kaplunger. M. Monatsh. 1930 (Okt.), S. 493-499.
- Gehrig (Oscar), Georg Friedrich Kersting. Ein meckl. Maler aus der Zeit der Freiheiskriege. Meckl. Gesellsch. 1931/32. 94 S. Mit 35 Abb. u. Briefen, Zeugnissen, Dokumenten.
- Franke (Hermann), Der Maler Willi Schomann (1881-1917). M. Monatsh. 1931 (Jan.), S. 38-40.
- Reifferscheid (Heinr.), Eine meckl. Künstlerfamilie. Zu Rudolph Suhrlandts 150. Geburtstage. M. Ztg. 19.12.31, Nr. 296.
- Dettmann (Gerd). Der meckl. Hofmaler Prof. Rudolf Suhrlandt. M. Monatsh., 7. Jg., 1931 (Dez.), S. 599-607.
- Dreyer (Ernst Ad.), Der Bildner u. Dichter Ernst Barlach. Niederdeutsche Monatsh., 4. Jg., 1 S. 282-88.
- G. B., Der Maler Wilh. Noack u. seine Bedeutung für die "Meckl. Schweiz". Ostmeckl. Heimat, Jg. 1, 1928, Nr. 8, S. 57-59.
- Dreyer (Ernst Ad.), Der Graphiker Arthur Eulert. Niederdeutsche Monatsh., 4. Jg., 1929, S. 41-43.


|
Seite 225 |




|
- Schröder (Albert), Ernst Lübbert. Niederdeutsche Monatsh., 4. Jg., 1929, S. 242-46.
- Dreyer (Ernst Adolf), Heinrich Tessenow. Niederdeutsche Monatsh., 5. Jg., 1930, S. 46-50.
- Bink (Hermann), Der preußische Herzogshof u. das altmeckl. Kunsthandwerk. M. Heimat, 10. Jg., 1931, Nr. 1/2, S. 3 f.
- Floerke (Anna Marie), Mecklenburgische Bucheinbände im 16. Jahrhundert. Archiv f. Buchbinderei, Zeitschr. f. Einbandkunst, Jg. 30, H. 10 [1930], S. 109-111.
- Schult (Friedr.), Güstrower Zinnguß. M. Monatsh. 1930 (Nov.), S. 531.
- v. Levetzow (Axel), Die Schlacht am Kummerower See 6. Juli 1164. Ostmeckl. Heimat, Jg. 2, 1929, S. 129-32; 137-39. [Verf. vertritt die Ansicht, daß die Schlacht bei Verchen am meckl. Ufer des Kumm. Sees geschlagen sei.]
- Zipfel (Ernst), Geschichte des Großh. Meckl. Grenadier-Reg. Nr. 89. XV u. 561 S. Mit vielen Abb. u. Kartenskizzen, einer Ehrentafel der im Weltkriege gefallenen Reg.-Angehörigen u. 2 Kartenbeilagen. Schwerin, Bärensprung, 1932.
- Viehmann, Augenblicksbilder aus der Durchbruchsschlacht. 1. Der Angriffsmorgen. 2. Der Sturm auf Vraucourt. Nachr.-Bl. d. Bundes Meckl. Grenadiere, Juli 1930, Nr. 28.
- v. Beckedorff, Mit der 6./60 in der Sommeschlacht. Mitt. d. Ver. d Off. d. ehem. G. M. F.-A.-Regts. Nr. 60, E. V., 12. Jg., 1930, Nr. 67, S. 10-21.
- Milenz (Hermann), Über Militär-Musik und Militär-Musiker (Musik-Dirigenten) in Mecklenburg. Mit Bildern. Maschinenschrift, 1932. Landesbibliothek Schwerin.
- Witte (Hans), Minderheitenrecht vor 700 Jahren im Sachsenspiegel. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 4, S. 64-68.
- Fink (Georg), Die Hoheits- u. Fischereiverhältnisse auf der Lübecker Bucht u. der jüngste Rechtsstreit zwischen Lübeck u. Meckl.-Schwerin. Vierteljahrschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. 23, 1930.
- Endler (Carl Aug.), Die Seßhaftigkeit des Bauernstandes im Lande Ratzeburg vor dem 30jähr. Kriege. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 4, S. 62-64.
- Bosse (Werner), Die Politik der Kammer als Domanialbehörde im Lande Stargard (1755-1806). Ein Beitrag zur Agrar- und Finanzpolitik des deutschen Merkantilismus. M.-Str. Geschbl., 6. Jg., 1930, VIII u. 112 S. Diss. Rostock 1930.
- Brandordnung f. d. Bistum Ratzeburg v. 16. Sept. 1698. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg. (1931), Nr. 2, S. 24-26.
- Endler (Carl Aug.), Die Brandgilden im Lande Ratzeburg. Heimatkal. f. d. Land Ratzeburg 1932, S. 137 f.
- Busch (W.), Brandgilde u. Feuerordnuug des Amtes Schönberg vom Jahre 1650. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 14. Jg., 1932, Nr. 2, S. 26-29.


|
Seite 226 |




|
- Lichenheim (Max), Die Erbenberechtigung in Ribnitz. Diss. Rostock 1931.
- Tatarin-Tarnheyden (Edgar), Die Rechtsstellung des Amtshauptmanns in M.-Schw. in verwaltungs- und staatspolitischer Beleuchtung. Zugleich ein Beitrag zum Problem einer Reichsverwaltungsreform. Rostocker Abh., H. 12. Rostock, Hinstorff, 1931. 62 S.
- Holstein (Fritz), Das Siedlungswesen in Meckl.-Schw. vor dem Weltkriege unter besonderer Berücksichtigung der Büdnereien. Diss. Jena 1927. 106 S.
- Bormann (Kurt), Erhaltung oder Veräußerung des staatl. Domänenbesitzes in M.-Schw. M. Landwirtsch. Mitt., H. 9, 1930. 51 S.
- Dalsky, Die Einheitsbewertung der meckl. Landwirtschaft. Schwerin, Bärensprung, 1931. 155 S. 8 °.
- Fischer (W.), Die meckl.-schw. Landessteuern nebst vollständigem Stempeltarif. Systematische Darstell. f. d. prakt. Gebrauch. Rostock, Carl Hinstorff, 1931. 83 S. 8 °.
- Heidemann (H.), Handbuch für den meckl.-schw. Polizeibeamten. Wismar, Hinstorff, 1931. 167 S. 8 °.
- Stech (Herm.), Die gemeindliche Selbstverwaltung in M.-Strelitz. Diss. Rostock 1931. 125 S.
- Raspe (Hans), Entwicklung der Kommunalfinanzen in den meckl.-schwer. Städten nach der Währungsfestigung. Bearb. im Auftr. d. Vorstandes d. Meckl. Städtetages. In: Beitr. z. kommunalen Finanzwirtsch., H. 37 d. Schriften des Vereins f. Kommunalwirtsch. u. Kommunalpolitik e. V. Berlin-Friedenau. Sonderdruck. 15 S.
- Marquardt (Kurt), Die Entwicklung des Wohnungswesens in den Städten Mecklenburg-Schwerins seit der Markstabilisierung. Diss. Rostock 1931. 79 S.
- Aul (Werner), Die Entwicklung des Zunftwesens in M.-Strelitz unter Einfluß der landesherrl. Gewerbepolitik 1731-1868. Diss. Rostock 1931. 39 S.
- Gutachten des Reichssparkommissars über die Landesverwaltung Mecklenburg-Schwerins. 1930. Reichsdruckerei. 415 S. 4 °.
- Stellungnahme des Beamtenbundes für Mecklenburg-Schwerin zum Gutachten des Reichssparkommissars über die Landesverwaltung Mecklenburg-Schwerins. Schwerin, Druck von Sandmeyer, 1930. 71 S.
- Das Gutachten des Reichssparkommissars u. das meckl. Schulwesen. Text des Gutachtens mit Anmerkungen, herausg. v M.-Schw. Landeslehrerverein, dem M. Lehrerinnenverein u. dem Verein M. Philologen. Beil. z. M. Schulztg. Nr. 37/38 v. 9. Sept. 1930.
- Bieger (W.) u. Pillmann (W.), Handbuch des in Meckl.-Schw. geltenden Forst-, Jagd- u. Naturschutzrechtes nebst Ausbildungs- u. Prüfungsbestimmungen f. d. Forstbeamten. Rostock, G. B. Leopold, 1930. 176 S. 8 °.
- Köster (Ludw.), Die Jagd in der Rostocker Heide u. d. Jagdrecht in Meckl. in frühester Zeit bis zur Gegenwart. Wismar, Hinstorff, 1929. 76 S. 8 °.


|
Seite 227 |




|
- Henle (Rud.), Reichsreform u. Länderstaat. Rostock, Leopolds Univ.-Buchh., 1931. 28 S. 8 °.
- Folkers (Joh. Ulr.), Mecklenb. in der Neugliederung des Deutschen Reiches. Ztschr. f. Geopolitik, 8. Jg., 7. H., Juli 1931, S. 517-524.
- Folkers (Joh. Ulr.), Was soll bei der Neugliederung des Reiches aus Mecklenburg werden? Niederdeutsche Monatsh., 6. Jg., 1931, S. 34-41.
- Nordmark, Die Ostseelösung für Schleswig-Holstein, Lübeck, Meckl. Eine Denkschrift zur Reichsreform. Rendsburg [1931]. 64 S. 8 °.
- Nöbbe (Erwin), Der Brakteatenfund von Eutin 1904. Nordelbingen, Bd. 7, 1928, S. 23-34. [S. 28-31 meckl. Brakteaten.]
- Münzen u. Medaillen von Mecklenb., Rostock, Wismar, Auktionskatalog der Firma Felix Schlessinger, Berlin-Charlottenb., 1931. 2 u. 112 S., 34 Tafeln.
- Nöbbe (Erwin), Goldbrakteaten in Schleswig-Holstein u. Lauenburg. Nordelbingen, Bd. 8, 1930/31, S. 48-83.
- v. Bahrfeldt (Max), Niedersächsisches Münzarchiv. Verhandlungen auf den Kreis- u. Münzprobationstagen des Niedersächsischen Kreises 1551-1625. II. Bd. (1569-1578), 1928, X u. 567 S. III. Bd. (1579-1601), 1929, VII u. 479 S. IV. Bd. (1602-1625), 1930, VIII u. 625 S. 4 °. Mit Tafeln u. Abb. Halle, Verl. d. Münzhandlung A. Riechmann & Co. Veröff. d. hist. Komm. f. Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Schaumb.-Lippe u. Bremen.
- Meier (Ortwin), Geschichtlich-sphragistische Untersuchungen über die Herkunft und das Auftauchen, wie auch über die Entwicklung des Pferdes im Wappen der Herzöge von Braunschweig-Lüneburg. Hannoversche Geschbl. N. F. 1. Bd., H. 4 (1930), S. 145-190; H. 5-6 (1931), S. 222-224. [Der Verf. vertritt die Ansicht, daß die welfischen Herzöge das Wappenpferd von den Schweriner Grafen übernommen hätten, um ihren Einspruch dagegen auszudrücken, daß die ihrer Lehnsherrschaft unterstehende Grafschaft Schwerin an den Herzog von Mecklenburg verkauft war. Indessen hätte dieser Protest höchstens die westelbischen Besitzungen der Grafen betreffen können, weil die Grafschaft selbst kein braunschweigisches, sondern sächsisches Lehn war. Die Schweriner Grafen ihrerseits hätten nach Ansicht des Verf. das Pferd von ihren Dienstmannen Grote-Schwerin übernommen, die sich ihrer Lehnsherrschaft hätten entziehen wollen. Durch die Annahme des Wappens habe die Lehnsherrschaft betont werden sollen.]
- Lindhult (Niklas A.), Riksvapnet tre kronor. Historiskt-heraldiska anteckningar från Mecklenburg och Danmark samt om några svenska stadsvapen. Svenska Kommunalbladet, Årgång 6, Nr. 1-2, April 1932, S. 14-17.
- Barnewitz (Hans W.), Ein altes meckl. Landeswappen. Ostmeckl. Heimat, Jg. 5 (1932), Nr. 9, S. 65 f. [Wallensteinisches Münzwappen.]


|
Seite 228 |




|
- Seelmann (Wilh.), Mundartliches aus Mecklenburg. Korr.-Bl. d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforsch., Jg. 1930, H. XLIII, 3, S. 46-48.
- Gosselck (Joh.), Die Sprache der meckl. Fischer. Ztschr. M., 26. Jg. (1931), H. 1, S. 8-12.
- Küntzel (Otto), 20 Mecklenburg-Strelitzsche Vogelnamen. Korr.-Bl. d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforsch., Jg. 1930. H. XLIII, 3, S. 41.
- Gosselck (Joh.), Standes- und Berufslieder aus Mecklenburg. Mitt. aus d. Meckl. Volksliederarchiv. Rost Anz. 1930, Nr. 255 (31. Okt.).
- Gosselck (J.), Das Drehorgellied auf seiner Wanderung durch Mecklenburg. Aus dem Volkslied-Archiv mitgeteilt. M. Monatsh. 1930 (Aug.), S. 379-384.
- Claussen, Das niederdeutsche Schauspiel in Mecklenburg vor 1800. Rost. Anz. 1930, Nr. 255 (31. Okt.).
- Rüther (Eduard), Joh. Heinr. Voß in Otterndorf. Nach den Briefen an seinen Freund, den Bürgermeister H. W. Schmeelke. - Westermann (Paul), Entwicklung der Joh.-Heinr.-Voß-Schule von Voßens Zeit bis zur Gegenwart. Otterndorf, Ball [1928]. 60 S. m. Abb. 8 °. (Nach Halbjahrsverz. d. Börsenvereins 1928, 1.)
- Droß (Fr. W.), Etwas über Goethes meckl. Beziehungen. M. Monatsh., 8. Jg., 1932, H. 3, S. 102-104.
- Krogmann (W.), Ulrike v. Levetzows Erinnerungen an Goethe. M. Monatsh., 8. Jg., 1932, 3. H., S. 114-118.
- Wippermann (F.), Kasper-Ohm im Vlämischen. Niederdeutsche Monatsh., 6. Jg., 1931, S. 17 f.
- Karbe (W.), Das Bagnio [Gedicht des Neustrelitzer Dichters Kegebein]. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 1, S. 14-18.
- Briefwechsel des Kardinals Diepenbrock mit Gräfin Ida Hahn-Hahn vor u. nach ihrer Konversion, herausg. v. Alfons Nowack. München, Kösel & Pustet, 1931. 77 S. 8 °.
- Brömse (Heinr.), Fritz Reuters hochdeutscher Roman. Niederdeutsches Jb. 56/57, 1930/31, S. 204-219.
- Mahn (E.), Neues über Fritz Reuter u. d. Neubrandenburger Sammlung. M.-Str. Geschbl., 6. Jg., 1930, S. 113-155.
- Ahlers, Persönliche Erinnerungen an Gestalten der Reuterzeit. M.-Str. Heimatbl., 6. Jg., 1930, H. 3, S. 51-57.
- Ringeling (Gerhard), Ein Dichter u. sein Verleger. (Nach bisher unveröffentlichten Reuter-Briefen.) M. Monatsh., 7. Jg. (1931), 9. H., S. 424-428.
- Kühl, Der "Güstrower Wollmarkt" in Erlangen und Fritz Reuter in Neubrandenburg. Ostmeckl. Heimat, Jg. 3, 1930, Nr. 8, S. 62 f.
- Winkel (Fr. †), Korl Kräpelin. M.-Str. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 1, S. 1-9. [Betr. den bekannten Rezitator Reuterscher Werke.]
- Pöhlmann (Hans), Theodor Fontane u. Meckl. Ostmeckl. Heimat, Jg. 1, 1928, Nr. 7, S. 53 f. [Mit 2 Briefen Fontanes.]
- Franck (Hans), Mein Leben u. Schaffen. Bekenntnisse, 14. H., herausg. durch die Gesellsch. d. Bücherfreunde zu Chemnitz, 1929. 21 S. 8 °.


|
Seite 229 |




|
- Hagemeister (Erich), Hans Franck, der Niederdeutsche. Niederdeutsche Monatsh., 4. Jg., 1929, S. 254 58.
- Wiechmann (Hermann), Hans Franck. Versuch einer Einführung in seine Welt. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeb., 13. Jg., 1931, Nr. 3, S. 37-39.
- Hansen (Niels), Friedrich Griese. M. Monatsh. 1930, S. 385-388.
- Neueste Spezialkarte von M.-Schw. u. M.-Str. 1:300000. Rostock, C. Boldt, 1930.
- Wilke (Th.), [Karte der] Beide[n] Freistaaten M. 1:750000. 16. Aufl. Güstrow, Opitz, 1931.
- Neue Verkehrskarte v. M.-Schw. u. -Strel. u. Oldenburg m. Hamburg, Lübeck, Bremen. 1:600000. 34. Auf. Stolp, Eulitz, 1930.
- In Wendisch Lands. Eine Entdeckungsreise vor vierzig Jahren. Eingeleitet und übersetzt von W. Karbe. M.-Str. Heimatbl., 8. Jg., 1932, H. 1, S. 1-11. [Übers. aus einer Reisebeschreibung des Engländers Doughty.]
- Meyers Reisebücher. Meckl., Lübeck, Hamburg, Schlesw.-Holsteinische Ostseeküste. 2. Aufl. Leipzig 1931.
- Die deutschen Ostseebäder, herausg. v. Verband deutscher Ostseebäder. [Ausg. 32. 1931.]
- Malerisches Mecklenb. 2. Bd.: Östliche Küste, Rostock u. Hinterland. 59 ganzseit. Bilder in Kupfertiefdruck nach Aufnahmen von Hans Reinke. Neustrelitz, Karl Hagen, 1930. 8 °.
- Timm (Heinr.), Böhmer (Gerh.), Burmeister (Walter), Unser Heimatland Meckl. Langensalza, J. Beltz [1932]. 68 S. m. Abb. 8 °.
- Gosselck (J.), Wanderbuch: Südost-Mecklenb. u. d. Oberen Seen. Rostock, C. Boldt (1931). 78 S. u. 22 Karten. 8 °.
- Das Rostocker Wanderbuch. Mit Kartenskizzen. Rostock, C. Boldt [1929]. 68 S. u. 26 S. Karten. 8 °.
- Führer durch Neustrelitz u. Umgegend. 5. verm. u. verb. Ausl. Herausg. im Auftr. d. städt. Verkehrsamtes von der "Landeszeitung f. beide Mecklb." Neustrelitz 1930.
- Schuh (Fr.), Der augenblickliche Stand der geologischen Forschung in Mecklenburg. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 33-41.
- Schuh (Fr.), Über die geologischen Verhältnisse der Umgegend von Waren. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 41-44.
- v. Bülow (Kurd), Das pommersch-mecklenb. Grenztal. Unser Pommerland, 12. Jg., 1927, S. 168-173.
- Böhmer (G.), Mecklenburgs natürliche Landschaften. Meckl. Schulzeitung 1929, Nr. 9. Bespr. von Ule, Mitt. d. Geogr. Ges. z. Rostock, 20. u. 21. Jg. (1928-30), S. 41 f.
- Röpke (Walter), Untersuchungen über die Sölle in Meckl. Rostock, Leopold, 1929. 95 S., 2 Taf. u. 6 Abb. 4 °.
- Röpke (Walter), Wesen u. Entstehung der Sölle. Ostmeckl. Heimat, Jg. 3, 1930, Nr. 20, S. 153-57; Nr. 21, S. 161-63.
- Röpke (Walter), Mecklenburgs Seen. Eine geographische Übersicht. M. Monatsh. 1930 (Juli), S. 311-315.


|
Seite 230 |




|
- Lütjen (Joh.), Die Schwankungen des Grundwassers in Meckl. Ein Beitr. z. Grundwasserkunde Norddeutschlands. Diss. Rostock 1931. 79 S., 3 Tab. u. 1 Karte.
- Karte der Salzwasservorkommen in M.-Schw., herausg. von d. M.-Schw. Geolog. Landesanstalt in Rostock. Lith. Mit masch.-schriftl. Bem. von Fr. Schuh, 1931 (Landesbibl. Schwerin).
- Die Ergebnisse der geolog. u. geophysikal. Untersuchungen der Jahre 1928 und 1929 in der Umgebung des Lübtheener Salzstockes. (Aufsätze verschied. Verf.) Mitt. aus der Meckl. geolog. Landesanstalt (H. XXXIV), N. F. IV.
- Karbe (W.), Die nachglaziale Gehängeerosion bei Grauenhagen. M.-Strel. Heimatbl., 7. Jg., 1931, H. 3, S. 45-49.
- v. Maltzahn, Frhr., Die Lewitz als Naturschutzgebiet. Vortrag. Bericht über die 51. Hauptversammlung des Vereins Meckl. Forstwirte zu Schwerin vom 14.-16. Juli 1930, S. 18-38.
- Kühl (Paul), Neubrandenburg. Eine erdgeschichtl., verkehrs- u. wirtschaftsgeogr. Landschaftsstudie. Zur Erinnerung an d. Zerstörung Neubrandenburgs durch Tilly am 9. März 1631. Als Mskr. gedr.
- Rabeler (Werner), Die Fauna des Göldenitzer Hochmoores in Mecklb. Diss. Rostock 1931. Zeitschr. f. Morphologie u. Ökologie d. Tiere, 21. Bd., 1./2. H., Sonderdr.
- Rabeler (W.), Die Wirbeltiere des Göldenitzer Hochmoores. Archiv d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. i. M., N. F. 5. Bd., 1930, S. 33-44.
- Derselbe, Bemerkungen zur Psozidenfauna Mecklenburgs. Ebd. S. 45.
- Kuhk (R.), Nachtrag zur Übersicht über die Kolonien der Trauer-Seeschwalbe Chlidonias n. nigra (L.) in M. Ebd. S. 51-54.
- Clodius (G.), Der Hamster (Cricetus frumentarius) in M.-Schw. Ebd. S. 56-58.
- Hainmüller (C.), Ergänzungen zur Käferfauna Mecklenburgs. Ebd. S. 59-62.
- Krüger (Konrad), Der weiße Storch in Meckl.-Str. in d. Jahren 1928/29. M.-Str. Heimatbl., 6. Jg., 1930, H. 4 (Sonderheft Vögel der Heimat), S. 71-78.
- Derselbe, Gefiederte Raubritter in Meckl.-Str. Ebd. S. 84-88.
- Knöfel W.), Kamerabilder aus Mecklenburgs Vogelwelt. Ebd.
- Burr (Friedr.), Vogelleben an der Müritz. Ostmeckl. Heimat, Jg. 4, 1931, Nr. 6, S. 41-43; Nr. 7, S. 50-53.
- Dahnke (Walter), Flora von Parchim u. Umg. II. Archiv d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. i. M., N. F. 5. Bd., 1930, S. 1-32.
- Krause (Ernst H. L.), Rückblick auf die Systematik der meckl. Brombeeren. Ebd. 6. Bd., 1931, S. 83-94.
- Bieger, Die jagdlichen Verhältnisse in Meckl.-Schwerin einst und jetzt. Jubil.-Ausg. d. Rostocker Anzeigers vom 1. April 1931, Nr. 76.
- Hainmüller (C.), Maltzaneum, naturhistorisches Museum für Mecklenburg in Waren. Zeitschr. M., 27. Jg. (1932), H. 2, S. 45 f.


|
Seite 231 |




|
Alphabetisches Verzeichnis
A
aron Isaac, Stempelschneider 57.
Ahlers, Bürgerm. 58.
Alban, Maschinenbauer
59.
Amtshauptleute, deren Rechtsstellung
311.
Ansveruskult 255.
Arkona 10
f.
Arndt, E. M. 60.
Auswanderung
56.
Axt (vorgeschichtl.) 16.
B
acksteingotik 269.
Ballhaus (in
Hamburg) 43.
Bankwesen 174.
Banzin
212.
Bardowiek 126.
Barlach, Ernst
290.
Bauern 54. 305.
Befreiungskriege
37 f.
Behm, Landesbischof 61. 259.
Bevölkerung 133. 135.
Bibliographie 1
ff.
Bicker, Fam. 62.
v. Blücher, Fam.
63.
v. Blücher, Feldmarschall 64 f.
Blumenholz 122. 184.
Boddin 185.
Boizenburg 142.
Brakteaten 330. 332.
Brandgilden 308 f.
Brinckman, John 66.
346.
Brombeeren 395.
Brunshaupten
186.
Buchdruckerei (Ratzeburg) 219.
Bucheinbände 296.
Bülch, Turnlehrer
67.
v. Bülow, Fam. 68. 276.
Burgen 12.
C
amin 187.
Cecilie, Kronprinzessin
42.
Crull, Fam. 69.
Cruse, Fam.
70.
Danckwarth, Oberförster 72.
Danneel, Otto Beatus 71.
Dassow 188 f.
Demern 92. 123.
Denkmalschutz 114.
Diepenbrock, Kardinal 348.
Diestelow
175.
Doberan 9.
Domänen 313.
Drache 158.
Drehorgel 341.
v.
Drieberg, Fam. 73.
Drucke, niederdeutsche
4.
Duvennest 53. 128.
E
hevertrag 143.
Einlieger 169.
Ekengreen, Fam. 74.
Elisa, Prinzessin
Radziwill 41.
Elmenhorst 248.
Erbenberechtigung 310.
Eulert, Arthur,
Graphiker 292.
F
amiliengesch. 5. 44 ff.
Feuerlöschwesen 193. 307 ff.
Finanzwirtschaft der Kommunen 318.
Fischeramt (Parchimer) 211.
Fischerei
240.
Fischersprache 338.
Fischland
190.
Flügge, Fam. 75.
Flurnamen 120
ff.
Fontane, Theod. 355.
Forstrecht
324.
Franck, Hans, Schriftsteller 356
ff.
Francke, Aug. Herm. 257.
Friedrich
Franz I., Großh. v. M.-Schw. 39, 64.
G
adebusch 191-193.
Gehängeerosion
381.
Geologie 371 ff.
Germanisierung
s. Kolonisation.
Gevezin 194.


|
Seite 232 |




|
Giesebrecht, Seminardirektor 268.
Goethe 88.
344 f.
Göldenitz 384 f.
Gotthun
129.
Grabow 195.
Griese, Friedr.,
Schriftsteller 359.
Grotefend, Hermann
76-79.
Güstrow 196. 297.
Dom
274.
Grundwasser 378.
H
acke (vorgeschichtl.) 15.
Hagenow
130. 197 f.
Hahn-Hahn, Gräfin 348.
Hahnschlagen 161.
Haken 141.
Hakenbüchsen 144.
Hamster 388.
Handwerk 145 ff.
Hanse 33.
Hausinschriften 197.
Heyck, Ed. 80.
Hexenwesen 119.
Hinstorff, Detl. Carl,
Verleger 82.
v. Holstein, Friedr., Geh. Rat
83.
Holzhandel 166.
Huber, Victor Aimé
84.
Hünengräber 18 f.
Hygienemuseum 154.
J
agd 325. 396.
Jagdrecht 324 f.
Industrie 170. 176 f. 180 ff.
Innung s.
Zunft.
Irrenwesen 155.
K
aehler, Willib. 85.
Käfer 389.
Kanzelaltäre 273.
Kaplunger, Rud.,
Bildhauer 285.
Karl IV., Kaiser 33.
Karl August, Herzog v. Sachsen-Weimar 196.
Karstadt, Rud. 86.
Karten 360 ff.
Kartoffelbau 179.
Kegebein, Dichter
347.
Kersting, Fam. 87.
Kersting,
Georg Friedr, Maler 88. 286.
v. Ketelhodt,
Fam. 89.
Kirche 185 f. 189. 194. 201. 214
ff. 220. 222. 233 ff. 242 f. 247. 253 ff. 269
ff.
Kleinen, Bad 199.
Klütz 201
ff.
v. Knuth, Fam. 90.
Kolonisation 22
ff.
Kotze (Mönchshof) 204.
Krankenbehandlung 117 f.
Kräpelin, Karl,
Rezitator 354.
Kreis, niedersächs. 36.
333.
Krenzlin, Neu- 260.
Kriegs- u.
Mil.-Gesch. 35. 37 f. 212. 298 ff.
Krommeny, Corn., Maler 283.
Kruzifixe
272.
Kulturgeschichte 114 ff.
Kunst
269 ff.
L
andarbeiter 171.
Landeskunde 360
ff.
Lärz 140.
Lauen 126.
Läufer
164.
Lenschow 128.
v. Levetzow, Ulrike
345.
Lewitz 382.
Lieder 340 f.
Liepen b. Tessin 18.
Literaturgeschichte
340 ff.
vam Lohe, Dietrich, Chronist
8.
Lübbert, Ernst, Maler 293.
Lübecker
Bucht 304.
Lüdersdorf 127. 205.
Luftschiffahrt 176.
Luise, Königin v.
Preußen 40.
Luise, Prinzessin v.
Hessen-Darmstadt 39.
v. Lützow, Ludw.,
Staatsmin. 91.
M
ark Brandenburg 32.
Masch, Pastor,
Archivrat 92.
Matthieu, Georg David, Maler
284.
Medaillen 331.
Mendelssohn
(Moses) 93 f.
Merkantilismus 306.
Milch (Dauer-) 181.
Mist, Gr.- u. Kl.-
124.
Mönchshof (Kotze) 204.
Moor
(Hoch-, Göldenitzer), 384 f.
Mühlen 168.
203.
Mundart 337.
Münzkunde 330
ff.
Müritz, Bad 206.
Müritz, See
393.
Musik (Militär-) 302.


|
Seite 233 |




|
N
amenkunde 45 f.
Naturschutzrecht
324.
Neubrandenburg 207. 383.
Neukloster 200.
Neustadt (Amt) 54.
Niedersachsen 134.
Noack, Wilh., Maler 291.
v.
O
ertzen, Georg, Dichter 95.
Ortsgeschichte 183 ff.
Ortsnamen 27.
Ouvrier, Fam. 96.
P
alingen 125. 208.
Pampow 209.
Papenhagen 210.
Parchim 19. 211. 394.
Passow, Heinr., Kirchenrat 97.
v. Pentz,
Christ., Landoberstallmstr. 98.
Perlin
212.
Personengeschichte 44 ff.
Pfingstbrauch 160.
Pflanzen 394 f.
Pflug 141.
Pietismus 110. 257. 258.
Piper, Carl Anton, Politiker 102.
Piper,
Otto, Burgenforscher 99.
Polizei 316.
Psoziden 386.
Pustohl (b. Rühn) 237.
Q uellen 6 ff.
R
amm 136.
Ratzeburg, Fürstentum 48.
51. 138. 305. 307 f.
Ratzeburg, Dom,
Domstift 139. 214 ff. 255. 277 ff.
Ratzeburg (Stadt) 213.
Recht 303 ff.
Reichsreform 326 ff.
Reincke-Bloch, Herm.
101.
Reinke, Joh., Botaniker 100.
Retschow 220.
Ribnitz 310.
Reuter,
Fritz 349 ff.
Rostock
Bauten,
Entwicklung, Kunst, Stadtbild 223 ff. 282.
Hafen 229.
Hospital z. Heil. Geist
228.
Kirche 222.
Musikleben
231.
Schulwesen 230. 261 ff.
Wehrmacht 221.
Rudolph, Hofkantor
258.
Rühn (Kloster) 233 ff. 283.
Rundling 132.
S
achsenspiegel 303.
Sägerei
180.
Salzstock, Lübtheener 380.
Salzwasser-Vorkommen 379.
Schauspiel,
niederd. 342.
Schiffahrt 165.
Schliemann, Heinr. 103 f.
Schlitz, Hans,
Graf 105.
Schmidt, Berth., Archivrat
106.
Schmidt, Wilh., plattd. Dichter 107
f.
Schomann, Willi, Maler 287.
Schönberg, Amt 309.44 ff.
Schulwesen 192.
199. 261 ff. 323.
Schützenzünfte 238.
246.
Schwerin (Dom) 275 f.
Seen 368.
377.
Selbstverwaltung 317.
Siedlungswesen 175. 312.
Soldatensprache
162.
Sölle 375 f.
Soziallasten
173.
Sparkommissar, Reichs- 321 ff.
Sprachwissenschaft 337 ff.
Stadeschronik,
lübische 6.
Stadtgründungen 30 f.
Stargard (Land) 306.
Steintanz (zu Boitin)
13 f.
Steuern 172. 314 f.
Stockmann,
Rud., Bildhauer 282.
Storch 390.
Sturm, Leonh. Chr. 110.
Suckwitz 175.
Suhrlandt, Fam. 288.
Suhrlandt, Rud., Maler
289.
Sülze 156.
T
agelöhner 169.
Taufsteine 271.
Tessenow, Heinr., Architekt 294.
Teterow
238.
Tie 26.
Tierwelt 384 ff.
Tracht 138.
Trauer-Seeschwalbe 387.
Tychsen, O. G., Prof. 109.


|
Seite 234 |




|
Ule, Willi, Geograph 111 f.
Urkundenlehre 9.
V
ererbung 47.
Verfassung 303
ff.
Verwaltung 172 f. 303 ff.
Viecheln, Hohen- 239f.
Viehzucht 178.
Vineta 21. 390 ff.
Vögel 387. 390 ff.
Vogelnamen 339.
Volkskunde 28. 114 ff.
Volkstracht 138.
Vorgeschichte 10 ff.
Voß, Joh. Heinr. 343.
W
ahrsow 52. 127.
Walkendorf
241.
Wall, Wenden-, b. Kl.-Luckow 131.
Wallenstein 34.
Wappenkunde 334 ff.
Waren, Stadt 242-44. 397.
Waren, Amt
135.
Wargentin 245.
Warin 246.
Warnemünde 247.
Warthebruch 55.
Wieschendorf 248.
Wilhelm, Prinz v. Preußen
41.
Wirbeltiere 385.
Wirtschaftsgeschichte 165 ff.
Wismar 49.
249 f.
Wohnungswesen 319.
Woldegk 144.
251.
Wolff, Chr. Ph., Baumeister 113.
Wölzow 252.
Z
eitungen 152 f. 232.
Ziegelei
177.
Ziesendorf 17.
Zinnguß 297.
Zunft 145 ff. 320. Vgl. Brandgilden, Schützenzünfte.
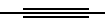


|




|



|


|
|
:
|


|




|



|
[ Seite 235 ] |




|
Jahresbericht
über das Vereinsjahr
vom 1. Juli 1931 bis 30. Juni 1932.
Es verstarb im Berichtsjahre unser Ehrenmitglied, der Generalmajor z. D. Julius v. Weltzien in Rostock, der während langer Zeit unser ältestes Mitglied gewesen war. Er hat dem Verein seit 1864, nicht weniger als 67 Jahre, angehört. Zum Ehrenmitgliede wählte ihn die Hauptversammlung von 1925 zur Feier seiner sechzigjährigen Mitgliedschaft. Ferner verloren wir durch den Tod den Gutsbesitzer Henry Sloman auf Bellin, Beförderer seit 1926, und dreizehn ordentliche Mitglieder, darunter drei der älteren Getreuen des Vereins: Rentner Otto Schnelle zu Schwerin, Mitglied seit 1892, Amtsgerichtsrat i. R. Christian Lange in Wismar, Mitglied seit 1895, und Apothekenbesitzer Paul Reinecke in Parchim, Mitglied seit 1907.
Wegen der Not der Zeit sind ein Beförderer und achtundvierzig Mitglieder ausgetreten. Eingetreten sind acht Mitglieder (Anlage A). Der Verein zählt am Schlusse des Berichtsjahres 4 Ehrenmitglieder, 7 korrespondierende Mitglieder, 7 Beförderer und 470 ordentliche Mitglieder.
Der Druck des Nachtragsbandes zum Urkundenbuche ist bis zum 54. Bogen fortgeschritten. Auch die Arbeit an den Registern zu diesem Bande ist wesentlich gefördert worden. Zu Mitgliedern der Urkundenbuchs-Kommission wurden an Stelle des verstorbenen Geheimrates Grotefend und des auf seinen Wunsch ausgeschiedenen Ministerialdirektors v. Prollius unser Vereinsrepräsentant Generalleutnant v. Woyna und der Unterzeichnete gewählt.


|
Seite 236 |




|
Einen Schriftenaustausch haben wir neuerdings aufgenommen mit der Föreningen Gotlands Fornvänner zu Wisby auf Gotland und mit dem Archäologischen E.-Majewski-Museum der Gesellschaft der Wissenschaften in Warschau.
Im Herbst und Winter des Berichtsjahres fanden im Schweriner Archivsaal drei Vortragsabende statt. Es sprachen: am 4. Nov. Univ.-Prof. Dr. Schüßler aus Rostock über die Denkwürdigkeiten des Fürsten Bülow; am 4. Dez. Museumsdirektor Univ.-Prof. Dr. Lauffer aus Hamburg über die Kulturgeschichte des niederdeutschen Backsteinbaues (Lichtbildervortrag); am 26. Februar Pastor D Dr. Schmaltz aus Schwerin über die geschichtliche Entwicklung der Klosteranlagen mit besonderer Berücksichtigung der mecklenburgischen Klöster (Lichtbildervortrag).
Die 97. Hauptversammlung des Vereins wurde am 15. April 1932 in Schwerin abgehalten. Als Vortragenden hatten wir den Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Schuchhardt aus Berlin-Lichterfelde gewonnen, der seit einem Vierteljahrhundert unser korrespondierendes Mitglied ist und uns schon manchesmal auf Vereinsabenden durch weitblickende und kenntnisreiche Behandlung prähistorischer Themen erfreut hat. Er sprach diesmal in einem Lichtbildervortrage über Verschiedenen Jenseitsglauben in der frühen Vorgeschichte. Auf den Vortrag folgten der Geschäftsbericht des Unterzeichneten für das Jahr 1931/32 und der Kassenbericht des Rechnungsführers für das Jahr 1930/31 (Anl. B), für den Entlastung erteilt wurde. Auf Antrag des ersten Sekretärs stimmte die Versammlung einem vorläufigen Beschlusse des Vereinsausschusses vom 5. Oktober 1931 zu, wonach der Jahresbeitrag von 8 RM. wieder auf den ursprünglichen Satz von 6 RM. verringert werden sollte 1 ). Dieser herabgesetzte Beitrag war inzwischen schon für das Vereinsjahr 1931/32 erhoben worden. Der erste Sekretär richtete bei dieser Gelegenheit einen Appell an die Versammlung, dem Verein in der gegenwärtigen schweren Zeit die Treue zu halten und neue Mitglieder zu werben. - Den schon im Juli 1931 geplanten historischen Ausflug nach Parchim, der damals wegen Regenwetters hatte ausfallen


|
Seite 237 |




|
müssen, beschloß man jetzt, am 6. Juli 1932 zu unternehmen. - Leider hatte unser Vereinsrepräsentant Generaldirektor Gütschow sich durch ein Gehörleiden veranlaßt gesehen, sein seit 1920 verwaltetes Amt niederzulegen. Für seine langjährige Mühewaltung und sein dem Verein bewiesenes Interesse sei ihm auch hier herzlichst gedankt. An seine Stelle wählte die Versammlung auf Vorschlag des Präsidenten einstimmig Ministerialdirektor Schwaar zum Repräsentanten. Die Vereinsbeamten wurden für das nächste Geschäftsjahr wiedergewählt.
Der Vereinsausschuß setzt sich für das Jahr 1932/33 wie folgt zusammen:
Präsident: Staatsminister i. R. D Dr. Langfeld, Exz.
Vizepräsident: Ministerialdirektor Dr. Krause.
Erster Sekretär: Staatsarchivdirektor Dr. Stuhr.
Zweiter Sekretär: Staatsarchivrat Dr. Strecker.
Rechnungsführer: Rechnungsrat Sommer.
Bücherwart: Direktor der Landesbibliothek Dr. Crain.
Bilderwart: Pastor emer. Bachmann.
Repräsentanten: Generalleutnant a. D. v. Woyna, Exz.,
Rechtsanwalt Dr. Wunderlich,
Ministerialdirektor Schwaar.
Der zweite Vereinssekretär.
W. Strecker.


|
Seite 238 |




|
Anlage A.
Veränderungen des Mitgliederstandes
im Vereinsjahr 1931-1932.
Ehrenmitglieder.
Gestorben: Generalmajor z. D. Julius v. Weltzien, Rstock, am 9. Okt. 1931. Mitglied seit 8. Dez. 1864, Ehrenmitglied seit 3. April 1925.
Beförderer.
Gestorben: Gutsbesitzer Henry Sloman, Bellin, am 29. Okt. 1931. Beförderer seit 1926, Mitglied seit 5. Aug. 1922.
Ausgetreten: die Stadt Güstrow.
Ordentliche Mitglieder.
Eingetreten: 1. Landessuperintendent Liz. Alfred Galley, Parchim. 2. Freifrau Anna v. Langermann und Erlencamp, Schwerin. 3. Wolf Deneke v. Weltzien, Essen a. d. Ruhr. 4. Studienreferendar Dr. phil. Walter Freyenhagen, Schwerin. 5. Rektor August Schack, Hagenow. 6. Rechtsanwalt Wolfgang Lange, Wismar. 7. Präsident der Oberpostdirektion Ernst Harzmann, Schwerin. 8. Kaufmann Heinrich Mahn, Schwerin.
Gestorben: 1. Weinhändler Friedrich Stephans, Schwerin, am 5. Juli 1931. 2. Forstrechnungsrat Paul Wilhelmi, Bützow, am 29. Juli 1931. 3. Dr. Hans Ludwig Weber, Erster Syndikus der Handelskammer in Rostock, am 10. Sept. 1931. 4. Oberstleutnant a. D. Theodor Arnold, Schwerin, am 29. Nov. 1931. 5. Bankdirektor Dr. Rudolf Faull, Schwerin, am 9. Dez. 1931. 6. Rentner Otto Schnelle, Schwerin, am 13. Jan. 1932. 7. Justizrat Dr. Wilhelm Peters, Schwerin, am 19. Jan. 1932. 8. Amtsgerichtsrat i. R. Christian Lange, Wismar, am 21. Jan. 1932. 9. Kammerherr Walter v. Leers, Ludwigslust, am 29. Jan. 1932. 10. Verlagsdirektor Hermann Fischer, Pyritz, am 2. Febr. 1932. 11. Sanitätsrat Dr. H. Boldt, Berlin-Schöneberg. 12. Apothekenbesitzer Paul Reinecke, Parchim, am 15. Febr. 1932. 13. Rechtsanwalt Karl Keding, Schwerin, am 16. April 1932.


|
Seite 239 |




|
Anlage B.
Auszug aus der Vereinsrechnung
für den Jahrgang 1930-1931.
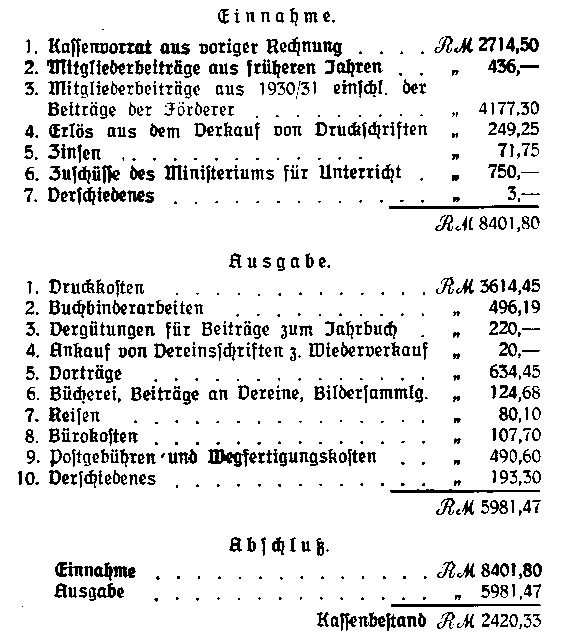


|
Seite 240 |




|
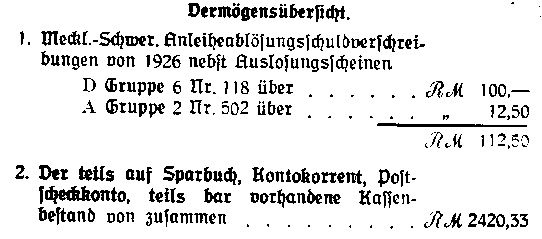
Der Rechnungsführer.
Sommer.