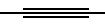|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
:
|
I.
Das Kanzleiwesen der Grafen
von
Schwerin und der Herzöge
von
Mecklenburg=Schwerin
im Mittelalter
von
Wilhelm Grohmann.
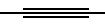


|
[ Seite 2 ] |




|


|
[ Seite 3 ] |




|
Inhaltsverzeichnis.
| Seite | |||
| Einleitung: | Die Ordnung Mecklenburgs durch Heinrich den Löwen im Jahre 1167 | 4 | |
| I. Kapitel: | Die Kanzlei der Grafen von Schwerin und der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin in ihrer geschichtlichen Entwicklung | 5-48 | |
| § 1. | Entstehung und Geschichte der gräflich schwerinschen Kanzlei bis zur Vereinigung der Grafschaft mit dem Herzogtum Mecklenburg (1359) | 5-17 | |
| § 2. | Entstehung und Geschichte der mecklenburgischen Kanzlei bis zur Vereinigung der Grafschaft Schwerin mit dem Herzogtum Mecklenburg (1359) | 17-25 | |
| § 3. | Geschichte der mecklenburg-schwerinschen Kanzlei von 1359 bis zum Tode Heinrichs IV. (1477) | 25-42 | |
| § 4. | Die mecklenburgische Kanzlei und die Verwaltungsreformen unter Herzog Magnus II. | 42-48 | |
| II. Kapitel: | Die Organisation der Kanzlei | 48-64 | |
| § 1. | Amtsstufen, Titel, Zahl, Stand und Besoldung der Kanzleibeamten | 48-55 | |
| § 2. | Kanzlei und Rat | 55-64 | |
| 1. | Die Zugehörigkeit insbesondere der Kanzler zum landesfürstlichen Rat | 55-58 | |
| 2. | Das Zusammenwirken von Kanzlei und Rat | 58-64 | |
| III. Kapitel: | Die Tätigkeit der Kanzlei | 64-79 | |
| § 1. | Die Tätigkeit des Kanzlers und der Kanzleibeamten | 64-71 | |
| § 2. | Die mecklenburgischen Kanzleibücher | 71-79 | |
| 1. | Die Lehnsrolle der Grafen von Schwerin | 72-73 | |
| 2. | Die Register der mecklenburgischen Herzöge | 73-79 | |
| Anlage I: | Zusammenstellung des Kanzleipersonals | 80-83 | |
| A. | Liste des Kanzleipersonals der Grafen von Schwerin | 80-81 | |
| B. | Liste des Kanzleipersonals der mecklenburgischen Fürsten und der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin | 81-83 | |
| Anlage II: | Zusammenstellung der Kanzleivermerke unter den Urkunden der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin | 84-88 | |


|
[ Seite 4 ] |




|
Einleitung.
Die Grafschaft Schwerin ist eine Schöpfung Heinrichs des Löwen. Sie verdankt ihre Existenz der großzügigen Kolonisationspolitik des Sachsenherzogs, welche das Ziel verfolgte, die eroberten slavischen Gebiete rechts der unteren Elbe für das Deutschtum zu gewinnen. Zu diesem Zwecke richtete der Herzog längs der neuen Slavengrenze deutsche Grafschaften ein, deren Aufgabe es war, die eroberten Gebiete mit Deutschen zu besiedeln und zu germanisieren. Die Entstehung der Grafschaft Schwerin 1 ) fiel in ein Jahr, das für die Geschichte Mecklenburgs von entscheidender Bedeutung ist. Heinrich der Löwe sah sich im Jahre 1167 genötigt, mit den obotritischen Fürsten Frieden zu schließen. Er mußte sich den Rücken frei halten für den bevorstehenden Kampf mit seinen norddeutschen Standesgenossen, die sich in dieser Zeit, erbittert über seine rücksichtslose Politik, in offener Empörung gegen ihn befanden. Er ordnete die Dinge in den mecklenburgischen Landen in der Weise, daß er die obotritischen Fürsten in den größten Teil ihrer Besitzungen wieder einsetzte. Jedoch die südwestlichen Teile des ursprünglich obotritischen Herrschaftsgebietes, die um Schwerin liegenden und sich bis Hagenow und Boizenburg erstreckenden Gebiete, erhob er zu einer selbständigen Grafschaft und stellte an ihre Spitze seinen getreuen Lehnsmann, den aus dem Braunschweigischen stammenden Gunzelin v. Hagen, der schon früher mit der Statthalterschaft über ganz Obotritien betraut gewesen war. Mecklenburg bestand also jetzt, abgesehen von den beiden kurze Zeit vorher gegründeten Bistümern Ratzeburg und Schwerin, im wesentlichen aus zwei Territorien, der Grafschaft Schwerin und dem Fürstentum Mecklenburg. Durch die Regelung von 1167 wurden die mecklenburgischen Lande in den sächsischen Lehnsverband aufgenommen.
Nach dem Sturze Heinrichs des Löwen blieben die neuen, dem Slaventum entrissenen Gebiete ihrem Schicksal überlassen. Jedoch vermochte der Zusammenbruch der welfischen Machtstellung im Norden Deutschlands das Kolonisationswerk nicht zu hindern. Mit den deutschen Kolonisten dringt auch deutsches Wesen, deutsches Recht und deutsche Sitte in die mecklenburgischen Lande ein und scheint sich früher in der Grafschaft Schwerin als in der obotritischen Herrschaft Geltung verschafft zu haben.
~~~~~~~~~~


|
[ Seite 5 ] |




|
Kapitel I.
Die Kanzlei der Grafen von Schwerin
und der Herzöge von
Mecklenburg=Schwerin
in ihrer
geschichtlichen Entwicklung.
§ 1.
Entstehung und Geschichte der gräflich=schwerinschen Kanzlei bis zur Vereinigung der Grafschaft Schwerin mit dem Herzogtum Mecklenburg. (1359.)
Die Regierungsweise der Grafen von Schwerin zeichnet sich durch den persönlichen Charakter des Regimentes aus. Wie die Fürsten der deutschen Territorien im allgemeinen, so sind auch die Grafen von Schwerin Hauptorgan und Mittelpunkt der gesamten Verwaltung gewesen. Die Angelegenheiten der Verwaltung finden grundsätzlich ihre Erledigung dadurch, daß der Fürst sie persönlich prüft und die Entscheidung im einzelnen fällt.
Die mittelalterliche Verwaltung des deutschen Fürstentums wird ferner charakterisiert durch das Fehlen von festen Residenzen. Die Urkunden der Grafen von Schwerin sind ein Zeugnis dafür, daß der Aufenthaltsort der Grafen und ihres Hofhaltes andauernd wechselte. Die Grafen zogen von Burg zu Burg. In Schwerin, Neustadt, Grabow, Wittenburg, Boizenburg usf. hatten sie ihre Schlösser, wo sie einen großen Teil ihrer Regierungshandlungen vollzogen. Durch diesen steten Wechsel ihres Aufenthaltsortes boten sie allen Untertanen Gelegenheit, sich mit Wünschen, Beschwerden und Forderungen aller Art persönlich an den Landesfürsten zu wenden. Es scheint sogar als Pflichtvernachlässigung gegolten zu haben, wenn die Fürsten es versäumten, die einzelnen Teile ihres Landes zu bereisen 1 ). Die unstete Art dieser von Ort


|
Seite 6 |




|
zu Ort wandernden Hofhaltung war in den wirtschaftlichen und Verkehrsverhältnissen jener Zeit begründet. Die bei überwiegender Naturalwirtschaft hauptsächlich in Naturalien abgelieferten Einkünfte des Landes konnten wegen der mangelhaften Verkehrsverhältnisse nicht an einer zentralen Stelle gesammelt werden, sondern wurden in den einzelnen gräflichen Burgen abgeliefert. Hier war der natürliche Aufenthaltsort der Grafen samt ihrem Hofhalte.
Freilich gab es schon frühzeitig Lieblingsburgen, in denen sich die Grafen besonders häufig und länger aufhielten als anderswo. So scheinen sie mit Vorliebe in ihrer Schweriner Burg verweilt zu haben. Eine große Anzahl von Grafenurkunden, besonders aus den Jahren 1269 - 74, weist Schwerin als Ausstellungsort auf.
Die Grafen wurden in der Verwaltung ihres Landes unterstützt durch die Inhaber der Hofämter (Truchseß, Marschall, Kämmerer, Schenk) 1 ). Auch Geistliche und angesehene Vasallen des Landes (viri providi fideles et honesti) wurden um ihren Rat gefragt 2 ) und zu Regierungsgeschäften herangezogen. Diese ritterlichen Hofbeamten und angesehenen Vasallen des Landes verfügten wohl über wirtschaftliche Kenntnisse und besaßen meist gewiß praktischen Blick genug, um die Grafen in geeigneter Weise zu beraten und ihnen als ausführende Organe auf dem Gebiete der Verwaltung zu dienen. Aber sie waren in der Regel nicht im Besitze einer höheren geistigen Bildung und verfügten vor allem meist nicht über die notwendigen elementaren Kenntnisse des Lesens und Schreibens. Dagegen die zum gräflichen Gefolge gehörigen Hofgeistlichen beherrschten nicht nur die damalige Schriftsprache, das Lateinische, sondern besaßen auch wenigstens elementare Rechtskenntnisse, wodurch sie zu unentbehrlichen Beratern der Grafen wurden und für die Erledigung sämtlicher schriftlichen Angelegenheiten der Grafen geeignet waren. Die Entstehung einer geordneten Kanzlei gehört erst einer späteren Zeit an. Zunächst wurden die Hofgeistlichen, insbesondere die Kapläne,


|
Seite 7 |




|
die durch ihre Funktion als Beichtväter der Grafen deren Vertrauen in besonderem Maße besaßen, gelegentlich oder dauernder dazu verwendet, das noch sehr wenig umfangreiche gräfliche Schreibewerk zu erledigen 1 ). Im 13. Jahrhundert wird, wie es scheint, das Amt eines gräflichen Notars oder Schreibers geschaffen. Der erste Notar der Schweriner Grafen begegnet uns im Jahre 1217 in der Person eines Hermann 2 ). Seit dieser Zeit scheint das Amt eines Notars am gräflichen Hofe ohne größere Unterbrechung bestanden zu haben.
Hofnotariat und Hofkapellanat sind eng miteinander verbunden gewesen. Ein großer Teil der gräflichen Hofnotare ist aus der gräflichen Kapelle hervorgegangen, ja, die als Hofnotare begegnenden Geistlichen sind meist zugleich auch noch Hofkapläne gewesen 3 ). Solange die Schweriner Grafen die Regierung über die Grafschaft gemeinsam führten, bedienten sie sich auch gemeinsamer Schreiber. Als aber 1274 Graf Gunzelin III. starb, einigten sich seine beiden Söhne Helmold III. und Nikolaus I. über die Erbschaft in der Weise, daß dieser die Lande Boizenburg, Wittenburg und Crivitz, jener dagegen Schwerin, Neustadt und Marnitz erhielt 4 ). Diese Regelung der Erbschaft brachte es mit sich, daß seit dem Jahre 1274 beide Linien besondere Schreiber beschäftigten. Infolge der Zerschlagung der Grafschaft und der damit verbundenen Trennung des ursprünglich gemeinsamen Hofhaltes konnte man sich um so länger mit einem geringen Schreiberpersonal begnügen.
Die gräflichen Hofnotare haben bald kürzere, bald längere Zeit das gräfliche Schreibewerk besorgt. Manche entschwinden sehr bald unseren Augen, andere dagegen, wie die Notare Giselbert oder Conrad, sind 15 bzw. 18 Jahre im gräflichen Hofdienst nachzuweisen. Nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit begegnen sie


|
Seite 8 |




|
dann in der Regel als Domherrn des Schweriner Stiftes oder als Inhaber von Pfarrstellen. Die Grafen scheinen bewährten Schreibern absichtlich Pfarrstellen gerade in den Ortschaften verschafft zu haben, wo sich eine gräfliche Burg befand. Sie mußten es als ein natürliches Bedürfnis empfinden, in der Nähe ihrer Burgen bewährte Persönlichkeiten zu wissen, die Erfahrung in Sachen des gräflichen Schreibewesens hatten.
Es liegt im Wesen der mittelalterlichen Verwaltung, daß die Persönlichkeit des Beamten ausschlaggebend ist für die Bedeutung seines Amtes. Das gilt für alle mittelalterlichen Hofbeamten 1 ). Ihre persönlichen Eigenschaften kommen ihrem Amte zugute. Denn es gibt an den mittelalterlichen Fürstenhöfen noch keine strenge Abgrenzung der Kompetenz für die einzelnen Hofämter. Deshalb müssen uns die Persönlichkeiten der Hofbeamten in besonderem Maße interessieren. Leider sind uns nur wenige und kurze Notizen über die ältesten gräflichen Hofnotare erhalten.
Hermann. Der erste Notar der Schweriner Grafen ist, wie schon erwähnt, Hermann. Daß er zugleich auch Kanonikus des Schweriner Domstiftes war, ist nicht auffällig, war doch die Schweriner Burg, der Lieblingssitz der Grafen, kaum 15 Minuten entfernt von dem geistlichen Mittelpunkt der mecklenburgischen Lande. Wir werden noch oft darauf aufmerksam machen müssen, daß das Schweriner Domstift eine beträchtliche Anzahl der geistlichen Hofbeamten gestellt hat 2 ). Von Hermann, dem ersten gräflichen Hofnotar 3 ), erfahren wir mehr über seine geistliche Laufbahn als über seine Stellung im Hofleben. Vom Diakon 4 ) bringt er es zum Kustos 5 ) des Schweriner Stiftes.
Giselbert. Der nächste Notar ist Giselbert, ebenfalls Schweriner Kanonikus und Subdiakon 6 ). Kurze Zeit vor der


|
Seite 9 |




|
Schlacht bei Bornhöved im Jahre 1227 1 ) findet er sich als Notar und Kaplan der Schweriner Grafen 2 ). 15 Jahre lang, von 1227 bis 1242, ist Giselbert oder Gesico, wie er gelegentlich 3 ) genannt wird, am Schweriner Grafenhofe nachzuweisen.
Albert. In den folgenden Jahren begegnet uns kein Schreiber. Von 1251 bis 1255 hat der Notar Albert die Schreibgeschäfte des Grafen Gunzelin III. besorgt. Er erscheint bald als Skriptor 4 ), bald als Notarius 5 ).
Hoger. Von 1270 bis 1275 ist Hogerus als Notar und Kaplan der Schweriner Grafen nachweisbar. Hoger muß uns deshalb besonders interessieren, weil er uns zunächst im Hofdienst der Dannenberger Grafen begegnet, von wo aus er dann später an den Hof der Schweriner Grafen gelangt. Diese Tatsache ist insofern von Bedeutung, da man damit rechnen muß, daß durch den Übertritt aus den Hofdiensten des einen Grafen in die des anderen Sitten und Gewohnheiten mit übernommen werden, die sich vor allem im Urkundenwesen bemerkbar machen können. Hoger ist zunächst Kaplan 6 ), dann Notar 7 ) des Grafen Adolf von Dannenberg gewesen. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Grafenhäusern, die ihren Ausdruck fanden in einem Heirats- und Freundschaftsvertrag 8 ), mögen die Veranlassung gegeben haben für den Übertritt Hogers in den Hofdienst der Schweriner Grafen. Hier ist er zunächst Kaplan 9 ), bald aber auch Notar 10 ) gewesen. Später wurde Hoger Pfarrer von Grabow 11 ), blieb aber trotzdem als Hofkaplan in gräflichen Diensten. Er taucht dann noch einmal als Hofkaplan des Grafen Volrath von Dannenberg auf 12 ).
Werenbert. Neben Hoger ist auch Werenbert als Notar des Grafen Gunzelin III. und seiner Söhne tätig, und zwar scheint er der eigentliche Hofnotar dieser Zeit bei den Grafen gewesen zu sein, da er mehrfach ausdrücklich "notarius" neben


|
Seite 10 |




|
dem "capellanus" Hoger genannt wird 1 ). Als nach dem Tode des Grafen Gunzelin III. im Jahre 1274 die beiden Linien Schwerin und Wittenburg-Boizenburg begründet wurden, ging er in den Dienst der Wittenburger Linie über und scheint dem Grafen Nikolaus I. noch eine Reihe von Jahren Schreiberdienste geleistet zu haben. Auch als Pfarrer von Boizenburg 2 ) schied er nicht aus dem Hofdienst aus, sondern blieb zum mindesten noch Kaplan beim Grafen Nikolaus I. 3 ). In den folgenden Jahrzehnten haben sowohl die Schweriner wie auch die Wittenburger Grafen ihre besonderen Schreiber gehabt. Zunächst möge die Aufzählung der am Hofe der Schweriner Linie beschäftigten Schreiber folgen.
Conrad. Von 1282 bis etwa 1300 ist bei Helmold III. und seinem Sohn Gunzelin V. der schon neben Hoger als gräflicher Kaplan 4 ) auftretende Conrad tätig gewesen. Auch er war als Notar zugleich auch Angehöriger des Schweriner Domstiftes 5 ) und mag mit dem Schweriner Propst Conrad 6 ) identisch sein. 1281 erscheint er ausnahmsweise als Kaplan der Grafen beider Linien 7 ), seit 1282 8 ) ist er ausschließlich im Hofdienst der Schweriner Linie nachzuweisen.
Johann v. Warsow. Neben ihm tritt uns Johann v. Warsow zunächst als Kaplan des Schweriner Grafen Helmold III. entgegen. Beide, Conrad und Johann, bleiben auch nach Helmolds Tode (1295) unter dessen Sohn Gunzelin V. in ihrem Amte. Um 1300 sind beide noch im Hofdienst beschäftigt 9 ).
Borchard v. Crivitz. 1304 10 ) ist bei Gunzelin V. von Schwerin ein Borchard von Crivitz Notar gewesen, der noch 1307 in einer Urkunde als Kleriker Gunzelins auftritt 11 ). In diesem Jahre stirbt der Graf. Sein Bruder Heinrich III. beschäftigt um


|
Seite 11 |




|
1332 einen Petrus 1 ) und 1333 einen Lambertus Rochow 2 ) als Hofnotare. Ob einer dieser beiden Schreiber identisch ist mit einem ungenannten Notar, den Graf Heinrich III. um 1330 nach Lübeck zu schicken beabsichtigte, um mit den Lübeckern wegen der Mißhandlung eines gräflichen Dieners zu verhandeln, läßt sich nicht ausmachen. Jedenfalls war dieser ungenannte Schreiber "rector ecclesie" in Boizenburg 3 ).
Über das Schreiberpersonal der Wittenburger ist ebenfalls nur sehr wenig bekannt. Wir hatten gesehen, daß Werenbert nach der Erbschaftsregelung von 1274 bei Nikolaus I. von Wittenburg tätig war.
Nikolaus, Luderus. Um 1289 muß ein Nikolaus 4 ) und 1296 ein Luderus 5 ) am Hofe der Wittenburger Linie als Schreiber beschäftigt gewesen sein. Auch Hofkapläne haben gelegentlich bei der Beurkundung von Rechtsgeschäften mitgewirkt 6 ). 1323 stirbt Nikolaus I. Unter seinem Sohne Nikolaus II. begegnen um 1331 ein Martinus 7 ), 1335 ein Johannes 8 ), 1348 Bernhard Parzow 9 ) und 1349 Helmold 10 ) als Notare und Schreiber der Wittenburger Grafen.
Die Tätigkeit der eben genannten Notare wird grundsätzlich das gesamte Schreibwesen, wahrscheinlich auch das Rechnungswesen der Schweriner Grafen umfaßt haben. Außer den Urkunden sind uns nur sehr wenige schriftliche Erzeugnisse der gräflichen Verwaltung erhalten. Die in den 90er Jahren des 13. Jahrhunderts angelegte Lehnsrolle der Grafen von Schwerin über ihre linkselbischen Besitzungen, die den Bedürfnissen der Grundherrschaft und der territorialen Verwaltung entsprungen ist, wird sicherlich von einem gräflichen Schreiber angefertigt worden sein 11 ).
Auch an dem Beurkundungsgeschäft sind die Schreiber beteiligt gewesen. Die Herstellung der Urkunden lag während des 12. und 13. Jahrhunderts auch in Mecklenburg, insbesondere in der Grafschaft Schwerin, noch vorwiegend, jedoch nicht grundsätz-


|
Seite 12 |




|
lich in den Händen der Empfänger 1 ). Da ein großer Teil der Urkunden für Geistliche, bzw. für geistliche Institute ausgestellt wurde, so lag es nahe, daß die Herstellung der Urkunden sehr häufig von den schriftkundigen Empfängern besorgt wurde. Die Bittsteller reichten ausgefertigte Urkunden bei den Grafen ein und legten sie zur Besiegelung vor 2 ). Oder sie trugen ihre Anliegen den Landesfürsten vor, welche ihrerseits nach vorausgegangener Verhandlung die Empfänger mit der Ausfertigung der Urkunde beauftragten 3 ).
Die Hofnotare hatten, falls die Urkunden vom Empfänger hergestellt waren, die Aufgabe, darüber zu wachen, daß der Inhalt der ausgefertigten Urkunde mit dem übereinstimmte, was in der vorhergehenden Verhandlung gräflicherseits bestimmt worden war. Sie mußten die Grafen vor Fälschungen und Erschleichungen seitens der Empfänger schützen, die eingereichten Entwürfe auf ihre rechtlichen Konsequenzen prüfen, gegebenenfalls korrigieren oder ganz neu ausarbeiten.
Auf dieses Geschäft der Überprüfung scheint sich auch die


|
Seite 13 |




|
datum-per-manus-Formel zu beziehen 1 ). Sie erscheint in Urkunden vieler deutscher Fürsten, "besonders häufig und regelmäßig in den Urkunden Heinrichs des Löwen und der Bischöfe und Fürsten des Nordostens im 13. Jahrhundert" 2 ). In Urkunden der Schweriner Grafen findet sie sich meines Wissens zuerst 1227 3 ), bei den mecklenburgischen Fürsten zum erstenmal 1219 in Verbindung mit dem ersten uns bekannten mecklenburgischen Notar Eustachius 4 ). Die datum-per-manus-Formel scheint mit Vorliebe in einer Zeit Verwendung gefunden zu haben, als es noch keine organisierte Kanzleien gab. Sie verschwindet seit Anfang des 14. Jahrhunderts aus den Urkunden der Schweriner Grafen wie auch der mecklenburgischen Fürsten 5 ). Über die Bedeutung dieser Formel herrscht in der Literatur im wesentlichen Übereinstimmung. Sie beweist nicht die Mundierung oder Konzipierung, "sondern nur Prüfung und Beglaubigung der betreffenden Urkunde durch den Datar, der dafür die Verantwortlichkeit seinem Herrn und anderen gegenüber übernimmt" 6 ), und bedeutet bei Empfängerherstellung im Munde der Hofnotare "geradezu die Garantie für die Richtigkeit der Urkunde im Sinne des Ausstellers" 7 ). Wir können diese Formel nur unter der Bedingung Aushändigungsformel nennen, daß wir den Begriff der


|
Seite 14 |




|
Aushändigung nicht zu eng fassen und auch die vorausgehende Überprüfung und Besiegelung darunter begreifen 1 ). Wie die datum-per-manus-Formel selbst eine Nachahmung der päpstlichen Schlußformel zu sein scheint 2 ), so will sie auch nicht mehr als diese sagen und bildet einen Ersatz für die in anderen Urkundengebieten namentlich bei den königlichen Urkunden häufiger vorkommende Rekognitionszeile 3 ). Dabei ist zu beachten, daß sie keinen notwendigen Bestandteil der Urkunde bildet. Auch läßt sich nicht erweisen, daß die Formel bei bestimmten Situationen, etwa bei Abwesenheit der Fürsten, von dem beglaubigenden Notar hinzugefügt wurde, um damit zum Ausdruck zu bringen, daß der Regierungsakt nicht auf speziellen Befehl des Landesfürsten vorgenommen wurde 4 ). Allgemein läßt sich nur sagen, daß man bei wichtigen und feierlich vollzogenen Rechtshandlungen sich dieser Formel mit Vorliebe bediente.
Auch die Besiegelung der Urkunden wird zu dem Aufgabenkreis der Notare gehört haben. Ferner war der Notar verantwortlich dafür, daß das Siegel seines Herrn nicht mißbraucht wurde, ja, er wird sogar das gräfliche Siegel in Verwahrung gehabt haben. Jedoch die Tätigkeit der Hofnotare bei dem Beurkundungsgeschäft erstreckte sich nicht allein auf die Überprüfung, Korrektur und Besiegelung der von den Empfängern eingereichten Urkunden, sondern oftmals ist auch die ganze Urkundenherstellung von ihnen besorgt worden. Die Urkunden sind wohl niemals ausschließlich von Empfängern hergestellt. Je mehr die Empfängerausstellung zurücktrat, desto mehr erweiterte sich der Anteil der Notare am Beurkundungsgeschäft. Seit den letzten Jahrzehnten des 13. Jahr-


|
Seite 15 |




|
hunderts beobachtet auch Buchwald 1 ) eine "ordnende Hand" über den Schweriner Grafenurkunden.
Die Grafen von Schwerin haben in der älteren Zeit Gelegenheitsschreiber und ständige Notare verwendet, um das noch geringe Schreibwesen zu bewältigen. Sie haben sich anscheinend lange darauf beschränken können, einen oder höchstens zwei Schreiber zu beschäftigen. Ihr Territorium war von verhältnismäßig geringem Umfang, besonders seit der Erbschaftsregelung von 1274. Daraus ist es vielleicht zu erklären, daß wir erst um die Mitte des 14. Jahrhunderts die ersten Spuren einer organisierten Kanzlei entdecken können, während in anderen deutschen Territorien geistlicher und weltlicher Fürsten bereits im 13. Jahrhundert, bald früher, bald später, organisierte Kanzleien nachzuweisen sind 2 ). Das erste sichere Anzeichen für das Bestehen einer organisierten Kanzlei bei den Schweriner Grafen stammt aus dem Jahre 1354, in dem zum erstenmal ein Protonotar des Grafen Otto I. von Schwerin in der Person des Johann von Schepelitz genannt wird 3 ). Ein Kanzler erscheint zuerst 1357 bei dem Grafen Nikolaus III. von Wittenburg 4 ). Mit der Einrichtung des Amtes eines Protonotars bzw. eines Kanzlers ist eine Amtsstufenfolge geschaffen, die ein sicheres Kennzeichen dafür bietet, daß die Kanzlei organisiert ist.
Die Gründe für die Entstehung einer organisierten Kanzlei sind offenbar zum Teil in der Zunahme der allgemeinen Verwaltungstätigkeit und speziell des Beurkundungsgeschäftes zu suchen. Die Schriftlichkeit des gräflichen Geschäfts-, Verwaltungs- und Rechtslebens und die Gewohnheit der Untertanen, sich Besitz und Rechte durch Privilegien verbriefen zu lassen, bürgerten sich auch in der Grafschaft Schwerin mehr und mehr ein und steigerten die Arbeitslast der einzelnen Hofnotare. Hinzu kam das allmähliche Zurücktreten der Empfängerherstellung. Um den neuen Anforderungen zu genügen, bedurfte es der Einrichtung eines organisierten technischen Hilfsorgans der gesamten Verwaltung, mit dessen Hilfe eine festere Regelung des Geschäftsverfahrens ermöglicht wurde. Deshalb war vor allem eine Personalvermehrung und die Schaffung einer ausgeprägten Amtsstufenfolge ein dringendes Erfordernis.


|
Seite 16 |




|
Der Unterschied zwischen Hofnotariat und Kanzlei ist offenbar mehr ein gradueller als ein prinzipieller gewesen. Während Steinacker 1 ) einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Hofnotariat und organisierter Kanzlei macht, betont Breßlau 2 ), wie mir scheint, mit Recht, daß die Funktionen der Hofnotare dieselben gewesen sind wie die der Beamten einer organisierten Kanzlei. Durch die Organisation der Kanzlei wird eine ältere Einrichtung, das Hofnotariat, weiter ausgebildet und vervollkommnet.
Der erste uns bekannte Vorstand der organisierten gräflichen Kanzlei ist der bereits erwähnte Protonotar des Grafen Otto I. von Schwerin, der Stendaler Domherr Johann v. Schepelitz 3 ), gewesen. Nach dem Tode Ottos I. im Jahre 1356 und der im gleichen Jahre erfolgten Wiedervereinigung der beiden gräflichen Linien Wittenburg-Boizenburg und Schwerin wurde Johann v. Schepelitz von Nikolaus III. und Otto II., Bruder und Neffen Ottos I., übernommen. In den Urkunden dieser beiden letzten Schweriner Grafen begegnet er 1356 gelegentlich als "ouerster scriuer" und gräflicher Rat 4 ). In demselben Jahre wird er zum Pfarrer von Wittenburg präsentiert 5 ) und ist als solcher noch in der gräflichen Kanzlei beschäftigt gewesen 6 ). 1368 vertauschte er seine Wittenburger Pfarre mit der Pfarre zu Rathenow, anscheinend um in seine ursprüngliche Heimat, die Mark, zurückzukehren 7 ). Das Amt eines Kanzleivorstandes hat Johann von Schepelitz als Pfarrer von Wittenburg offenbar nur noch kurze Zeit bekleidet. 1357 begegnet uns als Kanzler des Grafen Nikolaus III. der anscheinend aus der Grafschaft Tecklenburg stammende Werner Struwe, Pfarrherr zu Tecklenburg 8 ), welcher später bei den Verhandlungen über die Zahlungen des Kaufgeldes


|
Seite 17 |




|
für die Grafschaft Schwerin eine bedeutende Rolle gespielt hat 1 ). Werner Struwe ist der letzte Vorstand der selbständigen Schweriner Kanzlei gewesen. Da die Schweriner Kanzlei seit der Vereinigung der Grafschaft mit dem Herzogtum Mecklenburg im Jahre 1359 in die mecklenburgische Kanzlei aufging, ist es erforderlich, die Geschichte der mecklenburgischen Kanzlei zunächst gesondert zu behandeln.
§ 2.
Entstehung und Geschichte der mecklenburgischen Kanzlei bis zur Vereinigung der Grafschaft Schwerin mit dem Herzogtum Mecklenburg im Jahre 1359.
Seit dem 13. Jahrhundert besteht auch in dem Fürstentum Mecklenburg eine Lokal- und Zentralverwaltung nach dem Vorbild anderer deutscher Fürstentümer 2 ). Deutsche Rechtsanschauungen, deutsches Lehnswesen, deutsche Sitten und Gebräuche konnten in das mecklenburgische Territorium eindringen, seitdem die obotritischen Fürsten im Anfang des 13. Jahrhunderts die Grenzen ihres Landes den nach Nord und Ost drängenden deutschen Kolonisten mehr und mehr öffneten 3 ). Auch der Brauch, über Vorgänge rechtlicher Natur Urkunden auszustellen, und die Gewohnheit der Untertanen, sich Privilegien und Rechte von den Landesfürsten verbriefen zu lassen, bürgerten sich sehr bald in Mecklenburg ein.
Das Amt eines Notars, eines ständigen Schreibers, ist am Hofe der mecklenburgischen Fürsten ungefähr um dieselbe Zeit eingerichtet worden wie bei den Grafen von Schwerin. Die Fürsten bedurften eines Beamten an ihrem Hofe, der imstande war, die fürstliche Korrespondenz und die gesamten Schreibgeschäfte der fürstlichen Verwaltung zu erledigen. 1218 erscheint in den Urkunden der mecklenburgischen Fürsten zum erstenmal ein Notar 4 ), jedoch bleibt uns sein Name verschwiegen. Vielleicht ist dieser unbenannte Notar identisch mit Eustachius, der seit 1219 5 ) als


|
Seite 18 |




|
Hofnotar der mecklenburgischen Fürsten nachweisbar ist und bis zum Jahre 1233 als Schreiber beschäftigt war. Seit dem Jahre 1219 bzw. 1218 hat das Amt eines Notars ohne jegliche Unterbrechung am Hofe der mecklenburgischen Fürsten bestanden. Durchweg sind die einzelnen Notare recht lange im Hofdienst beschäftigt gewesen. So ist der Notar Rudolf von 1231 bis 1246 1 ), Arnold von 1231 bis 1242 2 ), Heinrich von 1244 bis 1269 3 ) und Gottschalk von 1266 bis 1282 4 ) nachzuweisen. Häufig sind zwei oder drei Schreiber nebeneinander tätig gewesen. Wie bei den Grafen von Schwerin, so sind auch am Hofe der mecklenburgischen Fürsten Beziehungen zwischen Hofnotariat und fürstlicher Kapelle nachweisbar. Der bereits erwähnte Heinrich war lange Zeit, bevor er zum erstenmal als "notarius" erwähnt wird, fürstlicher Kaplan und wird auch später gelegentlich "capellanus et notarius" genannt 5 ). Auch Rudolf war als Notar zugleich Kaplan 6 ).
Die Tätigkeit der mecklenburgischen Hofnotare wird im wesentlichen dieselbe gewesen sein wie die der Schreiber am Schweriner Grafenhofe. Sie hatten das gesamte Schreibwesen, wahrscheinlich auch das Rechnungswesen der Fürsten zu erledigen. Im besonderen haben sie bei dem Beurkundungsgeschäft mitgewirkt. Daß im 13. Jahrhundert auch in Mecklenburg die Urkunden zum großen Teil von Empfängerhand hergestellt worden sind, betont nicht nur Buchwald, sondern auch Kunkel 7 ). Bei Empfängerherstellung lag es den Notaren ob, die von den Bitt-


|
Seite 19 |




|
stellern eingereichten Entwürfe zu überprüfen und zu korrigieren. Auf dieses Geschäft der Überprüfung werden wir auch hier die schon besprochene datum-per-manus-Formel beziehen dürfen 1 ). Gelegentlich wird aber auch die ganze Urkundenherstellung von den fürstlichen Schreibern besorgt worden sein. Auch die Besiegelung der Urkunden scheint in der Regel Sache der Hofnotare gewesen zu sein. Ein Fall ist mir bekannt, wo in der corroboratio einer Urkunde des Fürsten Borwin von Mecklenburg aus dem Jahre 1218 ein Notar mit der Ausführung der Besiegelung ausdrücklich betraut wird 2 ).
Die Hauptlandesteilung, welche nach dem Tode des Fürsten Heinrich Burwy (1227) von dessen Enkeln durchgeführt wurde und die Teilherrschaften Rostock, Werle und Parchim begründete, ist für die Entwicklung des Kanzleiwesens der Fürsten von Mecklenburg von großer Bedeutung gewesen. Während sich die Herrschaft Parchim nur wenige Jahrzehnte behaupten konnte 3 ), hat sich am Hofe der Fürsten von Rostock und Werle ein selbständiges Kanzleiwesen entwickelt. Sowohl die Fürsten von Rostock wie die werleschen Fürsten haben ihre eigenen Schreiber gehabt 4 ). Der vor der Landesteilung von den mecklenburgischen Fürsten gemeinsam verwendete Schreiber Conrad ist später in den Dienst des Fürsten Nikolaus, Stammvaters der werleschen Linie, übergegangen 5 ). Am Hofe der werleschen Fürsten hat sich dann nicht viel später als bei den Fürsten von Mecklenburg eine selbständige, organisierte Kanzlei entwickelt 6 ). Die
( ... )


|
Seite 20 |




|
Herrschaft Mecklenburg war durch die Erbschaftsregelung nach dem Tode Heinrich Burwys beträchtlich verkleinert worden. Sie umfaßte im wesentlichen nur noch die nordwestlichen Gebiete des heutigen Mecklenburg, deshalb haben die Kräfte einzelner Schreiber verhältnismäßig lange ausgereicht, um das fürstliche Schreibewerk zu bewältigen, zumal die Mündlichkeit des Verfahrens und die Sitte, Rechtshandlungen durch symbolische Akte zu vollziehen, ferner die Empfängerherstellung zunächst vorgeherrscht haben werden und ein regelrechtes Schreibbüro unnötig machten.
Das erste sichere Anzeichen für das Bestehen einer organisierten Kanzlei am Hofe der mecklenburgischen Fürsten tritt uns etwa drei Jahrzehnte früher als bei den Grafen von Schwerin im Jahre 1323 1 ) entgegen, in dem zuerst ein Protonotar des Fürsten Heinrich II. nachweisbar ist. Rothgerus war der erste Kanzleivorstand 2 ). Unter ihm haben in den Jahren 1326 - 1329 nicht weniger als 6 bzw. 7 Notare oder Schreiber z. T. nebeneinander Schreiberdienste verrichtet 3 ). Der Kanzlertitel erscheint zum erstenmal 1337 4 ).
( ... )


|
Seite 21 |




|
Es ist vielleicht kein Zufall, daß nicht lange nach der Erwerbung der Lande Stargard, Wesenberg, Lychen und der Herrschaft Rostock durch Heinrich II., dem Begründer der mecklenburgischen Einigungspolitik 1 ), die ersten Spuren einer organisierten Kanzlei wahrnehmbar sind. Durch diese Erwerbungen wurde das mecklenburgische Territorium nahezu verdreifacht. In demselben Maße wuchsen die Anforderungen, die die Verwaltung des Landes an das Schreiberpersonal der Fürsten stellte. Auch der Rückgang der Empfängerherstellung und die Zunahme des schriftlichen Verkehrs mögen mitgewirkt haben, das Geschäftsverfahren fester zu regeln, das Schreiberpersonal zu vermehren und so die Kanzlei mit einem Kanzleivorstand an der Spitze zu organisieren.
Auf die Geschichte der mecklenburgischen Kanzlei seit der Erwähnung des ersten Protonotars bis zur Vereinigung des Herzogtums mit der Grafschaft Schwerin im Jahre 1359 sind die politischen Ereignisse dieser Jahre nicht ohne Einfluß geblieben. Der Tod Heinrichs II. (1329) bedeutete für das Kanzleiwesen einen offensichtlichen Rückschlag. Da Heinrich keine mündigen Erben hinterließ, wurde eine Vormundschaft eingesetzt, die bis zum Jahre 1336 für die unmündigen Söhne Heinrichs, Albrecht und Johann, die Regierung führte 2 ). Für das Bestehen einer festgegliederten Kanzlei während dieser Vormundschaftsregierung sind keinerlei Spuren vorhanden. Rothgerus, der Protonotar Heinrichs II., erscheint zwar noch gelegentlich in den Urkunden 3 ), hat aber offenbar das Amt eines Protonotars nicht mehr bekleidet. Auch von den zahlreichen Schreibern, die uns gerade unmittelbar vor dem Tode Heinrichs II. entgegentreten, verschwinden die meisten aus dem Hofdienst und gehen zum Teil zurück in den ausschließlichen Dienst der Kirche und ihrer Institutionen 4 ). Nur
( ... )


|
Seite 22 |




|
Johannes von Prenzlau hat nachweislich im Dienste der Vormundschaft gestanden. Er wird gelegentlich von Wipert von Lützow, einem Mitglied der Vormundschaftsregierung, bei dem Lübecker Rat beglaubigt 1 ). Die Vermutung, daß in diesen Jahren eine festorganisierte Kanzlei vielleicht gar nicht existiert hat, wird gestützt durch die Beobachtung, daß der Wismarer Stadtschreiber Heinrich von Eimbeck in dieser Zeit gelegentlich mit der Urkundenherstellung. betraut wurde 2 ).
Das mecklenburgische Kanzleiwesen wurde wieder neu belebt, als Albrecht II., der 1336 großjährig geworden war, bald nach der Übernahme der Regierung Berthold Rode an die Spitze der Kanzlei berief. Bis 1352 führte Albrecht mit seinem jüngeren Bruder Johann die Regierung gemeinsam. Bis zu diesem Jahre haben beide Fürsten sich anscheinend auch einer gemeinsamen Kanzlei bedient. Sowohl in den Urkunden Albrechts wie Johanns wie auch in denen, welche von beiden gemeinsam ausgestellt sind, finden wir durchweg dieselben Kanzleibeamten 3 ). Auf Drängen Johanns, der 1348, wie sein älterer Bruder, zum Herzog erhoben war, wurde am 25. November 1352 eine Teilung des Landes Mecklenburg durchgeführt, wobei Johann den weit geringeren Anteil, nämlich die östlichen Gebiete Mecklenburgs, Stargard und dessen Nebenländer, sowie die Länder Sternberg und Eldenburg erhielt 4 ). Durch diese Teilung zweigte sich von der mecklenburgischen Kanzlei eine besondere mecklenburg-stargardische Kanzlei ab. Ein Teil des ursprünglich von beiden Brüdern gemeinsam ver-
Z. B. M. U.-B. IX, 5373 (19. 4. 1338). Von dieser Urkunde existieren zwei Ausfertigungen, welche nach der Anmerkung des Herausgebers des M. U.-B. von dem Wismarer Stadtschreiber Nikolaus Zwerk geschrieben sind. Wismar ist bekanntlich ein bevorzugter Aufenthaltsort der mecklenburgischen Fürsten gewesen. Daraus mögen sich die Beziehungen der fürstlichen Geschäftsverwaltung zur Ratsstube der Stadt Wismar erklären.


|
Seite 23 |




|
wendeten Kanzleipersonals findet sich nach der Durchführung der Landesteilung ausschließlich im Hofdienst des Stargarder Herzogs Johann. So ist z. B. der seit 1349 in der mecklenburgischen Kanzlei beschäftigte Schreiber Heinrich Rode an den Stargarder Hof übergetreten. Herzog Johann wie auch die späteren Stargarder Fürsten haben bis zur Wiedervereinigung Stargards mit Mecklenburg-Schwerin im Jahre 1471 anscheinend durchweg ihre eigenen Schreiber gehabt, und nicht selten wird ein Kanzler oder Protonotar genannt, so daß die Kanzlei am Stargarder Hof vermutlich organisiert gewesen ist 1 ).
Drei Persönlichkeiten haben in der Zeit von 1323 bis 1359 an der Spitze der mecklenburgischen Kanzlei gestanden: von 1323 bis 1329 der bereits erwähnte Rothgerus, von 1337 bis 1351 Berthold Rode und seit 1352 Bertram Behr. Als Rothgerus zum erstenmal als Protonotar begegnet, konnte er schon auf eine lange Tätigkeit im Hofdienst zurückblicken. Seit 1310 ist er als Schreiber und Hofkaplan 2 ) des Fürsten Heinrich II. nachweisbar. Zugleich war er Pfarrer an St. Nikolai zu Wismar 3 ), Schweriner Domherr 4 ) und seit 1323 Rektor der Marienkirche zu Rostock 5 ). Diese Stellung bekleidete er auch noch nach seiner Amtszeit als fürstlicher Protonotar 6 ).
Berthold Rode, der zweite mecklenburgische Kanzleivorstand, stammte aus der angesehenen Rostocker Bürgerfamilie gleichen Namens 7 ). Durch den Rostocker Ratsherrn Johann Rode, der Mitglied der Vormundschaftsregierung für Albrecht II. gewesen war, ist Berthold Rode vermutlich an den Hof der mecklenburgischen Fürsten gekommen. Albrecht II. hat dann später die Beziehungen seines Kanzlers und Ratgebers zu der begüterten Rostocker Bürgerfamilie gelegentlich auszunutzen verstanden, um durch Aufnahme einer Anleihe aus einer finanziellen Verlegenheit


|
Seite 24 |




|
herauszukommen 1 ). Als Geistlicher war er zunächst Inhaber einer von seinen Verwandten gestifteten Vikarei in Rostock 2 ), dann Pfarrer von Gadebusch 3 ) und seit 1347 Rektor an der St. Petrikirche zu Rostock 4 ). Nach 15jähriger Tätigkeit schied er aus dem Hofdienst aus. Da er nach 1351 nicht mehr urkundlich nachweisbar ist, ist er vermutlich bald gestorben.
Der Kanzlerwechsel ist zwischen dem 8. Dezember 1351 und 30. März 1352 erfolgt 5 ). Wie Berthold Rode, so ist auch sein Nachfolger Bertram Behr vor seiner Kanzlerschaft vermutlich nicht in der Kanzlei beschäftigt gewesen. Über Bertram Behrs geistliche Laufbahn ist wenig bekannt. Er gehörte dem Lübecker Domstift an 6 ) und war seit 1355 Inhaber der Vikarei auf dem Fürstenhof zu Wismar 7 ), später an St. Nikolai ebendort 8 ).
Das übrige Kanzleipersonal tritt während dieses Zeitabschnittes zunächst ziemlich stark hervor. Die zahlreichen Notare und Schreiber unter dem Protonotariat des Rothgerus wurden schon aufgeführt 9 ). Auch unter Berthold Rode begegnet uns eine ganze Anzahl von Kanzleibeamten: von 1339 bis 1340 der Schweriner Domherr 10 ), spätere Pfarrer an St. Nikolai zu Rostock 11 ) und fürstliche Hofkaplan 12 ) Helmold von Plessen; von 1340 bis 1344 der Notar Gottfried 13 ); um 1345 Markwart 14 ); 1346 bis 1350 Johannes Raboden 15 ), der als Geistlicher der Ratzeburger Diözese um 1340 das Rektorat der Schule von St. Marien zu Wismar übernommen hatte 16 ) und später als herzoglicher Hofnotar die Pfarre zu Schwaan erhielt 17 ). Seit 1349 18 ) ist auch Heinrich von Griben, der aus dem Kloster Stolp an den Hof der


|
Seite 25 |




|
Mecklenburger gekommen zu sein scheint 1 ), in der herzoglichen Kanzlei beschäftigt und ist bis 1359 als Notar nachzuweisen 2 ). 1358 begegnet er als Pfarrer von Boizenburg 3 ). Von 1349 bis 1352 hat auch Heinrich Rode 4 ), ein Verwandter des Kanzlers, der mecklenburgischen Kanzlei angehört, bis er dann nach der Landesteilung des Jahres 1352 an den Hof Johanns von Stargard überging. Von 1351 bis 1352 wird gelegentlich auch ein Johannes Suhm als Notar erwähnt 5 ).
Über das unter Bertram Behr arbeitende Kanzleipersonal läßt sich wenig ermitteln. Eine Anzahl von Geistlichen (pape, clerici und capellani) sind in dieser Zeit am herzoglichen Hof nachweisbar und werden gelegentlich zu den der Kanzlei obliegenden Geschäften herangezogen sein, so z. B. der spätere Kanzler Johann Schwalenberg 6 ), ebenso der später als Notar begegnende Bernhard Mallin 7 ). Den ausdrücklichen Titel "notarius" führt während der Kanzlerschaft Bertram Behrs bis zum Jahre 1359 außer Heinrich von Griben nur ein Gottschalk, Pfarrer von Gnoien 8 ).
§ 3.
Geschichte der mecklenburg-schwerinschen Kanzlei von 1359 bis zum Tode Heinrichs IV. (1477).
Durch ihre Vereinigung mit dem Herzogtum Mecklenburg fand die Grafschaft Schwerin sowie auch die gräflich schwerinsche Kanzlei im Jahre 1359 das Ende ihres Sonderdaseins. Die Schweriner Grafen überließen den mecklenburgischen Herzögen käuflich


|
Seite 26 |




|
die Grafschaft Schwerin 1 ) und zogen sich in die von ihren Vorfahren ererbte Grafschaft Tecklenburg zurück. Durch diesen Kauf wurden die mecklenburgischen Fürsten die unmittelbaren Rechtsnachfolger der Grafen von Schwerin.
Für die mecklenburgische Kanzlei bedeutete die Erwerbung der Grafschaft Schwerin eine beträchtliche Erweiterung ihres Zuständigkeitsbereiches, welcher im 15. Jahrhundert durch den Erbfall der werleschen und stargardschen Länder nochmals bedeutend vergrößert wurde. Deshalb werden diese Erwerbungen immerhin eine Vermehrung des Kanzleipersonals notwendig gemacht haben. Ob bei der Vereinigung Mecklenburgs mit der Grafschaft Schwerin Kanzleibeamte der gräflichen Kanzlei in die der mecklenburgischen Fürsten übernommen wurden, läßt sich nicht erweisen. Auch nach der 1436 erfolgten Erwerbung der werleschen Lande finden sich unter dem Kanzleipersonal der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin keine Persönlichkeiten, die früher der werleschen Kanzlei angehörten. Jedoch als die Vereinigung der mecklenburgischen Lande durch den Erbfall der Stargarder Lande im Jahre 1471 ihren Abschluß gefunden hatte, ist nachweislich einmal ein früherer Schreiber der Stargarder Kanzlei, namens Joachim Heydeberg 2 ), von den mecklenburg-schwerinschen Herzögen übernommen worden. Die Beobachtung, daß etwa seit der Mitte des 14. Jahrhunderts mit Ausnahme des Kanzlers verhältnismäßig selten Kanzleibeamte in den Zeugenlisten der herzoglichen Urkunden auftreten, berechtigt keineswegs zu dem Schluß, daß die Zahl der beschäftigten Schreiber nur sehr gering gewesen sei. Wir müssen vielmehr jene Erscheinung wohl darauf zurückführen, daß man sich


|
Seite 27 |




|
mehr und mehr daran gewöhnte, bei der Aufführung von Zeugen sich vornehmlich auf die fürstlichen Ratgeber, namentlich auf die Hof- und Lokalbeamten (Marschall, Kammermeister, Kanzler und Vögte) zu beschränken.
Das mecklenburgische Kanzleiwesen verharrte während des späteren Mittelalters im großen und ganzen auf derselben Entwicklungsstufe, welche es durch die Organisation der Kanzlei in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts erreicht hatte. Bis zu den Verwaltungsreformen Herzog Magnus II. am Ende des 15. Jahrhunderts hat die Organisation der Kanzlei nur geringfügige Veränderungen erfahren. Zur Entlastung des Kanzlers, dessen Tätigkeit sich mehr und mehr auf das gesamte Gebiet der Verwaltung erstreckte, scheinen besonders im 15. Jahrhundert die Notare, Sekretäre und Schreiber stärker zur Mitarbeit an der Erledigung verantwortungsreicher Kanzleigeschäfte herangezogen worden zu sein. Sie haben sich namentlich um die Mitte des 15. Jahrhunderts nicht nur an der Konzipierung der Urkunden beteiligt, sondern anscheinend auch bei der Korrektur und Überprüfung der Urkunden mitgewirkt 1 ). Und während der Kanzler Kröpelin (1361 - 62) das von ihm angelegte Kanzleibuch zum großen Teil noch selbst geführt hat, scheint die Führung der Kanzleibücher im 15. Jahrhundert hauptsächlich den Sekretären und Schreibern obgelegen zu haben. Je mehr diese dem Kanzler untergeordneten Kanzleibeamten zu den verantwortungsvolleren Geschäften der Verwaltung herangezogen wurden, desto größer wurde ihr Einfluß und ihre Bedeutung. Das kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß sie gelegentlich zu den Räten der Herzöge gehörten 2 ).
Um die Mitte des 15. Jahrhunderts scheint es auch das Amt eines Protonotars oder Vizekanzlers neben dem Kanzleramt gegeben zu haben, jedoch nur vorübergehend. Mit Johann Hesse, der diese Titel während der Kanzlerschaft Henning Karutzes (1440 - 1446) kurze Zeit, bevor er den Kanzlerposten selber übernimmt, gelegentlich führt 3 ), verschwinden die Bezeichnungen


|
Seite 28 |




|
"prothonotarius" und "vicecancellarius" wieder aus der mecklenburgischen Kanzlei.
Der innere Ausbau des Geschäftsbetriebes der Kanzlei während des hier zu behandelnden Zeitabschnittes wird im wesentlichen durch die Ausbildung bestimmter Kanzleibräuche charakterisiert. Vor allem drei neue Erscheinungen treten uns entgegen: Die Anwendung der niederdeutschen Sprache in den Urkunden, das Vorkommen von Kanzleibüchern und Kanzleivermerken auf den Urkunden. Schon während der Kanzlerschaft Bertram Behrs in den 50er Jahren des 14. Jahrhunderts war die Zahl der aus der mecklenburgischen Kanzlei ausgehenden niederdeutschen Urkunden im Steigen. Wie groß das Bedürfnis, die Urkunden in der eigenen Mundart abzufassen, schon früher war, beweisen die häufig in lateinischen Urkunden vorkommenden deutschen Wörter, deren sich der Konzipient bediente, wenn ihm der entsprechende lateinische Ausdruck fehlte 1 ). Bis 1312 scheint man sich der niederdeutschen Sprache nur bei fürstlichen und Staatsverträgen, später gelegentlich auch bei anderen Urkunden bedient zu haben 2 ). Häufig fertigte man zwei Urkundenexemplare an, eins lateinisch, ein anderes niederdeutsch. Oder man stellte niederdeutsche Übersetzungen von lateinisch abgefaßten Urkunden her. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts setzte sich die niederdeutsche Sprache in den mecklenburgischen Herzogsurkunden immer stärker durch 3 ). Die lateinische
( ... )


|
Seite 29 |




|
Kirchensprache hat am Ende des Jahrhunderts in den Urkunden durchaus ihren Vorrang verloren. Sie wird mehr und mehr das Opfer der Verweltlichung der Kultur.
Auch Kanzleibücher sind zeitweise in der Mecklenburg-Schweriner Kanzlei geführt worden. Sie setzen nicht nur die Organisation der Kanzlei voraus, sondern deuten auch darauf hin, daß die Kanzlei wenigstens zu der Zeit, wo nachweislich solche Bücher geführt worden sind, einigermaßen ständig und regelmäßig zu arbeiten pflegte. Man betrachtet daher die Kanzleibücher als "das Kennzeichen und die Errungenschaft einer geordneten organisierten Kanzlei" 1 ). Nur wenige Registerbruchstücke der mecklenburgischen Kanzlei sind uns erhalten. Als nicht lange nach der Erwerbung der Grafschaft Schwerin Johannes Kröpelin (1361 bis 1362) an die Spitze der Kanzlei berufen wurde, hat dieser Kanzler den Brauch der Registerführung in die mecklenburgische Kanzlei eingeführt 2 ). Vor Johannes Kröpelins Amtstätigkeit sind mir keinerlei Anzeichen von Registerführung in der mecklenburgischen Kanzlei begegnet. Jedoch diese Ansätze zu einem geregelten Verwaltungsverfahren scheinen über ihre ersten Anfänge nicht hinausgekommen zu sein. Die politischen Verhältnisse Mecklenburgs in den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts, insbesondere der Kampf der Herzöge um ihre nordische Machtstellung, mögen dazu beigetragen haben, die stetige Fortentwicklung und den inneren Ausbau der Verwaltung zu hemmen. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts sind in der Schweriner Kanzlei wieder nachweislich Geschäftsbücher zur Kontrolle der Verwaltung geführt worden, namentlich während der Zeit, als Johann Hesse (1440 bis 1449) der Kanzlei angehörte.
Mit Johann Hesse, welcher sich um die innere Ausgestaltung des Kanzleibetriebes sehr verdient gemacht zu haben scheint, dringt auch in die Kanzlei der Mecklenburg-Schweriner Herzöge der in anderen Territorien schon längst übliche Brauch 3 ) ein, die Ur-


|
Seite 30 |




|
kunden gelegentlich mit Kanzleivermerken zu versehen. Auf einer Urkunde der mecklenburgischen Herzöge ist mir ein solcher Vermerk zum erstenmal im Jahre 1446 begegnet, und zwar in der Form von "de mandato domini Jo. Hesse", etwas früher schon auf Registerabschriften, zuerst 1442 in der Form von "dominus mandauit et examinauit" 1 ). Nicht immer läßt es sich mit Sicherheit ausmachen, ob in einem Falle, wo sich unter einer Registerabschrift ein Kanzleivermerk findet, ein solcher Vermerk auch auf dem entsprechenden Original gestanden hat 2 ). Die Kanzleivermerke sind seitens der Kanzlei bzw. der Kanzleibeamten zu ihrer persönlichen Deckung dem Landesfürsten gegenüber auf Urkunden oder Registerabschriften geschrieben und begegnen auch noch nach dem Ausscheiden Johann Hesses aus der Schweriner Kanzlei gelegentlich unter Urkunden, Urkundenabschriften oder Konzepten 3 ). Als Vorläufer der Kanzleivermerke werden wir mit Redlich 4 ) die datum-per-manus-Formel ansehen dürfen, welche besonders charakteristisch ist für die Zeit, als die Kanzlei noch nicht organisiert war. Die Kanzleivermerke enthalten nicht nur wichtige Nachrichten über die Entstehung der Urkunden, sondern sind auch eine ergiebige Quelle für die Erforschung der mittelalterlichen Hofverwaltung. Besonders dort, wo sie häufig zu finden sind und die mannigfachsten Formen aufweisen, wie etwa in österreichischen und brandenburgischen Urkunden, geben sie uns erwünschten Aufschluß über das Zusammenwirken von Rat und Kanzlei 5 ).


|
Seite 31 |




|
Die Neuerungen im Geschäftsbetrieb der Kanzlei, insbesondere das Vorkommen der Kanzleibücher und Kanzleivermerke, sind wohl durchweg auf die Initiative der maßgebenden Persönlichkeiten der Kanzlei, vor allem bestimmter Kanzler, zurückzuführen. Daraus erklären sich die Schwankungen in der Tätigkeit der Beamten und in den Kanzleigebräuchen. Die Kanzler scheinen nicht nur das Kanzleiwesen jeweils bestimmend beeinflußt zu haben, sondern sind überhaupt die Seele der mittelalterlichen Verwaltung gewesen. Deshalb erwecken ihre Persönlichkeiten und ihre Lebensumstände ein besonderes Interesse.
Nach der Erwerbung der Grafschaft Schwerin (1359) blieb zunächst Bertram Behr an der Spitze der Kanzlei Albrechts II., jedoch nur noch kurze Zeit. Am 25. Mai 1360 begegnet er noch als Kanzler. Bald darauf fiel er bei Albrecht II. in Ungnade und wurde seines Amtes entsetzt, offenbar infolge eines Zwistes mit anderen Hofbeamten, insbesondere mit einem Getreuen des Herzogs, dem Ritter Heinrich v. Stralendorf. Es ist uns ein undatiertes Schriftstück Bertram Behrs erhalten, in welchem er sich bei dem Herzog gegen Anschuldigungen des Ritters Stralendorf verantwortet 1 ). Aus diesem Schreiben geht offensichtlich hervor, daß dem Kanzler zum Vorwurf gemacht worden ist, er habe


|
Seite 32 |




|
gegen die Interessen seines Herrn gehandelt. Nach der Darstellung Bertram Behrs haben seine persönlichen Widersacher bei dem Herzog gegen ihn intrigiert mit dem Erfolg, daß der Kanzler in Ungnade fiel. Bertram Behrs Versuch, den Herzog von seiner Unschuld zu überzeugen 1 ), ist offenbar nicht gelungen. Fast ein Jahr scheint er vom Hofe verbannt gewesen zu sein. 1361 erscheint er aber wieder in den herzoglichen Urkunden als "clericus noster dilectus" 2 ).
An die Spitze der Kanzlei war inzwischen der Magister Johannes Kröpelin (1361 - 62) berufen worden. Er war Geistlicher der Schweriner Diözese und muß über eine umfangreiche Bildung verfügt haben 3 ). Nach Johann Kröpelin hat im Jahre 1363 wiederum Bertram Behr das Kanzleramt vorübergehend bekleidet 4 ). Da im Jahre 1366 seiner als "cancellarius bone memorie" gedacht wird, muß er spätestens in diesem Jahre gestorben sein 5 ).
Von 1366 bis 1374 war Johann Schwalenberg Kanzler am Hofe Albrechts II. Seit 1358 ist er als Hofgeistlicher 6 ), seit 1361 als Schreiber 7 ) nachzuweisen. Er gehört also in die Reihe derjenigen Kanzler, welche unmittelbar aus der Kanzlei hervorgegangen sind. 1360 begegnet er als ständiger Vikar in Lübeck 8 ), bald darauf wurde er von Herzog Albrecht dem Ratzeburger Bischof für die Besetzung der Gadebuscher Pfarre präsentiert 9 ). 1364 unternahm er eine Pilgerfahrt zum Papst nach Avignon und er-


|
Seite 33 |




|
reichte zugunsten seiner Gadebuscher Kirche einen Ablaß 1 ). Schwalenberg gehörte dem Schweriner Domstift an und wurde 1372 Domscholastikus, anscheinend entgegen der Anordnung des Papstes Gregor XI., welcher zum Nachfolger des verstorbenen Schweriner Scholastikus den Rektor der Neubukower Pfarrkirche Johann Bukow bestimmt hatte 2 ). Johann Schwalenberg entfaltete am Hofe Albrechts II. als herzoglicher Rat und Kanzler eine reiche Tätigkeit. In den meisten Urkunden, die während seiner Kanzlerschaft ausgestellt wurden, tritt er als Zeuge auf. Solange er herzoglicher Hofbeamter war, scheinen seine geistlichen Berufspflichten oft stark in den Hintergrund getreten zu sein. Gelegentlich konnte er sogar den ihm vom Papst erteilten Auftrag, in einem Appellationsprozeß als Richter zu fungieren, nicht ausführen, sondern subdelegierte seinerseits einen anderen Geistlichen als Richter 3 ). Bei Herzog Albrecht scheint Johann Schwalenberg in hoher Gunst gestanden zu haben. Er wurde nicht nur in seiner geistlichen Laufbahn gefördert 4 ), sondern auch mit Pfründen ausgestattet 5 ). - Während der letzten Jahre Albrechts II., von 1375 - 79, versah Albert Konow das Kanzleramt. Dieser war mindestens seit 1369 Propst des Klosters Eldena 6 ) und ist anscheinend auch während seiner Kanzlerschaft in enger Verbindung mit dem Kloster geblieben, da wir ihn gelegentlich für dieses wirken sehen 7 ). Auch auf das materielle Wohl seines Klosters ist er sehr bedacht gewesen 8 ). Nach dem Tode


|
Seite 34 |




|
Albrechts II. im Jahre 1379 ist er unter dessen Söhnen nur noch kurze Zeit Kanzler gewesen 1 ). Seit diesem Jahre widmete er sich wieder ausschließlich dem Dienste des Klosters Eldena.
Fünf Kanzler haben während der Regierungszeit Albrechts II. (1336 - 79) an der Spitze der mecklenburgischen Kanzlei gestanden. Sie scheinen durchweg eine bedeutende Rolle im herzoglichen Hofleben und in der Verwaltung des Landes gespielt zu haben. Die meisten Urkunden erwähnen sie als Zeugen oder fürstliche Ratgeber.
Über das mecklenburgische Kanzleiwesen unter den Nachfolgern Albrechts II., Heinrich III., Magnus I., Albrecht III. 2 ) und Albrecht IV. 3 ), ist nur sehr wenig bekannt. Das Kanzleipersonal tritt in den Urkunden dieser Jahre, welche uns zum Teil in sehr geringem Umfange erhalten sind, auffallend stark zurück. Nicht einmal eine lückenlose Zusammenstellung der Kanzler ist möglich. Im Jahre 1384 begegnet uns als Kanzler Albrechts IV. und seines Oheims Magnus I. Johann Reinwerstorf 4 ), Propst zu Neukloster 5 ), welcher als solcher am 10. August 1385 von dem Schweriner Bischof Potho seiner pröpstlichen Würde entkleidet und durch einen Nachfolger ersetzt wurde 6 ). 1386 wird Detlev v. Siggen als Kanzler Albrechts III. erwähnt 7 ); Johann Brugow, welcher von Küster 8 ) irrtümlich unter den Kanzlern der Herzöge von Schwerin aufgeführt wird, war 1389 Kanzler am Stargarder, nicht am Schweriner Hofe 9 ).


|
Seite 35 |




|
Durch die Schlacht bei Falköping im Jahre 1389 erreichte die mecklenburgische Machtstellung im Norden endgültig ihr Ende. Der Schwedenkönig und Herzog von Mecklenburg Albrecht III., nach dem Tode seiner Brüder und seines Neffen Albrechts IV. der allein noch übrige erwachsene männliche Sproß des Schweriner Hauses, geriet in die Gefangenschaft der norwegischen Königin Margarete und wurde über sechs Jahre auf der Feste Lindholm in Haft gehalten. Johann von Mecklenburg-Stargard, welcher während der Gefangenschaft Albrechts III. zur Regentschaft im Reiche Schweden und im Herzogtum Mecklenburg-Schwerin berufen ward 1 ), war durch die nordischen Händel vollauf in Anspruch genommen, sodaß Mecklenburg-Schwerin in diesen Jahren "so gut wie verwaist" war. Nachdem Albrecht III. im Jahre 1395 nach langwierigen Verhandlungen aus der Haft entlassen worden war und die Regierung in Mecklenburg-Schwerin wieder übernommen hatte, wurde das Kanzleramt von 1396 bis 1399 von Karl Hakonsson versehen 2 ). Dieser Kanzler war, wie schon der Name beweist, Schwede von Geburt. Durch die Beziehungen Albrechts III. zu Schweden wird er an den Hof der Mecklenburg-Schweriner Fürsten gekommen sein. Er war gleichzeitig Inhaber einer hohen geistlichen Würde in Schweden, nämlich des Archidiakonates von Upsala 3 ). Karl Hakonsson hat zusammen mit dem Ritter Helmold von Plessen anscheinend eine führende Rolle in der mecklenburgischen Politik gespielt 4 ).


|
Seite 36 |




|
Der nächste uns bekannte Kanzler, Johannes von Bentlage, ist wieder unmittelbar aus der Kanzlei hervorgegangen. Schon 1388 war er Schreiber Albrechts III. 1 ); 1406 taucht er wieder auf als Kanzler 2 ) und scheint dieses Amt 1407 noch in Händen gehabt zu haben 3 ). Um 1388 war er Pfarrer in Buchholz 4 ). An seine Stelle als Kanzler scheint Henning Slapelow getreten zu sein, welcher 1409 den Kanzlertitel führt 5 ). Mit dem Tode Albrechts III. im Jahre 1412 schließt eine für die Erforschung des mecklenburgischen Kanzleiwesens recht wenig ertragreiche Periode ab.
Unter Johann IV. († 1422), dem Neffen, und Albrecht V. († 1423), dem Sohn Albrechts III., gelangte mit Nikolaus Reventlow wiederum eine Persönlichkeit an die Spitze der Kanzlei, welche alle für das Kanzleramt erforderlichen Eigenschaften besessen zu haben scheint. Schon bevor er in den mecklenburgischen Hofdienst eintrat, befand er sich in der geachteten Stellung eines officialis generalis, iudex und subconservator der Schweriner Kirche 6 ). Mindestens 23 Jahre, von 1415 bis 1438 7 ), hat Nikolaus Reventlow das Kanzleramt am Schweriner Hofe bekleidet und überstand zweimal den Regierungswechsel, im Jahre 1423, als die Herzogin Katharina für ihre unmündigen Söhne die Regierung übernahm, und 1436, nachdem Katharinas Sohn Heinrich IV. großjährig geworden war. Seine wissenschaftliche Ausbildung hat er vermutlich an der Erfurter Universität genossen 8 ). Er war nicht nur theologisch gebildet (Magister), sondern scheint auch über umfangreiche Rechtskenntnisse verfügt zu haben. Im Februar 1434 wurde er an der Rostocker Universität unter dem Titel Licentiatus in iure canonico can-


|
Seite 37 |




|
cellarius principis terre ehrenhalber immatrikuliert 1 ), eine Ehrung, welche in dieser Zeit nicht einzigartig dasteht, aber immer eine geachtete Stellung voraussetzt. Nikolaus Reventlow ist also vielleicht der erste juristisch geschulte Kanzler in Mecklenburg gewesen. Die Gewohnheit, Juristen zu Leitern der Kanzlei zu bestellen, bürgerte sich jedoch erst seit Ende des 15. Jahrhunderts in Mecklenburg ein. Reventlow gehörte zu den einflußreichsten Räten der mecklenburgischen Herzöge und wurde mit Vorliebe in den Urkunden an die Spitze der Zeugenliste gestellt. Das Kanzleramt in den Händen dieses gelehrten Mannes scheint das erste und wichtigste Hofamt gewesen zu sein. Seit etwa 1422 ist der Kanzler wieder in nähere Beziehungen zur Kirche getreten. Mehrfach tritt er uns als Schweriner Domherr in den herzoglichen Urkunden entgegen 2 ) und übt als solcher 1424 Patronatsrechte an der Vikarei der Kröpeliner Pfarrkirche aus 3 ). Um 1431 war er Archidiakon in Waren 4 ). Den Kanzlerposten hatte er 1438 noch inne. Bald darauf wird er gestorben sein, da am 14. Mai 1440 sein Nachfolger im Kanzleramt, Henning Karutze, zu ewigem Gedächtnis seines Vorgängers dem Schweriner Kapitel eine Stiftung machte 5 ).
Von 1440 bis 1446 verwaltete Henning Karutze das Kanzleramt. Schon vorher stand er in mecklenburgischen Hofdiensten, seit 1437 nachweislich als Schreiber 6 ). Vielleicht hat er aber schon früher der Kanzlei angehört 7 ). Wie Nikolaus Reventlow, gehörte auch Henning Karutze dem Schweriner Domstift an 8 ) und war um 1446 Archidiakon von Rostock 9 ), später Pfarrer an St. Jakobi daselbst 10 ). Am 30. März 1446 ist er mir zum letztenmal urkundlich als Kanzler begegnet. Zerwürfnisse mit dem Herzog Heinrich IV. scheinen nicht die Veranlassung gegeben zu haben, daß er vom Kanzleramt zurücktrat, da er auch später vielfach in


|
Seite 38 |




|
Diensten des Herzogs tätig war und enge Beziehungen zum Hof aufrecht erhielt 1 ).
An Henning Karutzes Stelle trat etwa im Jahre 1446 Johannes Hesse. Seit 1440 ist er als Schreiber nachzuweisen 2 ). Neben dem Kanzler Henning Karutze wird auch er seit 1444 gelegentlich Kanzler 3 ) oder Protonotar 4 ) und seit 1446 mitunter Vizekanzler 5 ) genannt. Dies ist wohl der einzige Fall, wo in der mecklenburgischen Kanzlei während des späteren Mittelalters neben dem Kanzler ein Protonotar oder Vizekanzler nachzuweisen ist. Am 21. Oktober 1449 begegnet Johannes Hesse zuletzt als Kanzler. Falls er identisch ist mit einem Studenten gleichen Namens, welcher im W.-S. 1425/26 an der Rostocker Universität als baccalaureus Pragensis immatrikuliert war, so stammt er aus Pasewalk in Pommern 6 ). 1440 war er Pfarrer in Harmsdorf 7 ). Bald darauf wurde er Pfarrer an der St. Petrikirche zu Rostock 8 ). 1444 schenkte Heinrich IV. seinem Schreiber für treue Dienste auf Lebenszeit die auf die Bewohner des Dorfes Papendorf gelegten Dienste, Beden, Ablager oder sonstigen Auflagen 9 ). Da diese Hebungen 1453 seinem Nachfolger im Pfarramt an der Petrikirche verliehen wurden 10 ), so ist er vermutlich nicht lange nach seinem Ausscheiden aus dem mecklenburgischen Hofdienst gestorben.
Von 1450 bis 1458 begegnet der Kanzlertitel m. W. überhaupt nicht. Die Kanzleigeschäfte sind in diesen Jahren vor allem von den abwechselnd Schreiber und Sekretär genannten Heinrich Bentzien und Hermann Widenbrügge besorgt worden. Heinrich Bentzien nahm durchaus die Stellung eines Kanzlers ein. Er war fast auf allen Gebieten der herzoglichen Verwaltung und Regie-


|
Seite 39 |




|
rung tätig 1 ). Den Kanzlertitel führte er erst gelegentlich seit 1459 2 ). Aber auch später wird er gewöhnlich Sekretär oder einfach Schreiber genannt. Heinrich Bentzien war um 1453 Pfarrer zu Hohen Sprenz 3 ), später Vikar an der Marienkirche zu Rostock 4 ), dann Pfarrer an St. Jakobi daselbst 5 ). Seit 1462 gehörte er auch dem Lübecker Domstift an 6 ). Seit dem Ende der 60er Jahre zog sich Heinrich Bentzien mehr und mehr aus dem Hofleben zurück, um sich seinem geistlichen Berufe zu widmen. Jedoch begegnet er später noch gelegentlich in den Zeugenlisten Heinrichs IV. und gehörte sogar noch nach dessen Tode (1477) zu den Ratgebern der drei Söhne Heinrichs IV. 7 ).
Etwa 1469 8 ) übernahm Thomas Rode das Kanzleramt. Seit 1461 gehörte er der Kanzlei an, zunächst als einfacher Schreiber 9 ), von 1467 bis 1469 als Sekretär 10 ). Schon bevor er den Kanzlerposten übernahm, spielte er eine bedeutende Rolle am Hofe Heinrichs IV., und als Kanzler scheint er der einflußreichste Hofmann und geschickteste Diplomat des Herzogs gewesen zu sein. Häufig


|
Seite 40 |




|
verhandelte er im Namen Heinrichs IV. mit dem Lübecker Rat 1 ). 1472 und 1474 entsandte ihn der Herzog zu diplomatischen Verhandlungen zum Kaiser 2 ), 1477 war er mit Aufträgen beim Papst 3 ). Auch als Sachwalt des Herzogs tritt der Kanzler gelegentlich auf 4 ). Er war Heinrichs IV. rechte Hand in fast allen Angelegenheiten der Regierung und Verwaltung und ein unentbehrlicher Ratgeber 5 ).
Wie als mecklenburgischer Hofbeamter, so brachte er es auch als Geistlicher zu hohen Würden. Zunächst war er Pfarrer an St. Nikolai zu Wismar 6 ), später erhielt er das Rektorat der Marienkirche zu Rostock 7 ). Um 1474 begegnet er als Schweriner Domherr 8 ) und Administrator des Schweriner Stiftes 9 ). Nach dem Tode Heinrichs IV. (1477) blieb er noch eine Reihe von Jahren mecklenburgischer Kanzler, bis er schließlich 1486 sein Amt niederlegte. Bald darauf wurde er Propst des neu errichteten Domstiftes an St. Jakobi zu Rostock 10 ). Bei den Unruhen, die gegen das
( ... )


|
Seite 41 |




|
junge Domstift von der Rostocker Bevölkerung erregt wurden, wurde er erschlagen, die übrigen Domherren, darunter der Dekan des Stiftes und frühere Kanzler Heinrich Bentzien, verjagt oder gefangen. Dieses Ereignis rief die sog. Rostocker Domfehde hervor, die schließlich mit der Entrichtung eines Sühnegeldes seitens der Rostocker und mit der Errichtung eines Sühnekreuzes für den erschlagenen Kanzler endete.
Über die sonstigen Beamten, welche von 1359 bis 1477 der mecklenburgischen Kanzlei angehörten, ist wenig bekannt. Wie bereits bemerkt wurde, tauchen sie nur gelegentlich in den Urkunden auf und verschwinden fast völlig hinter den Kanzlern. Soweit sie in den Quellen auftreten, sind sie einigermaßen vollständig in Anlage 1 zusammengestellt. Hier sollen nur diejenigen hervorgehoben werden, welche häufiger genannt werden, insbesondere die Sekretäre. Der erste Kanzleibeamte, welcher häufiger den Titel "secretarius" führte, ist Johannes Kremer, der von 1412 bis 1430 der mecklenburgischen Kanzlei angehörte 1 ). Er war zunächst Pfarrer in Boizenburg 2 ), dann in Gadebusch 3 ). Später begegnet er als ständiger Vikar an der Schweriner Kirche 4 ). Neben ihm tritt 1428 Johann Achim, Pfarrer von Wittenburg 5 ), mehrfach als Schreiber auf 6 ). Von 1427 bis 1430 gehörte er zu den Räten der Herzogin Katharina 7 ) und stand noch 1431 als Propst von Neukloster in Beziehungen zum Hofe 8 ). Später war er Pfarrer an St. Jürgen zu Wismar 9 ). Von 1430 bis 1431 ist Gerhard Brüsewitz als Sekretär nachzuweisen 10 ). Von 1450 bis 1462 gehörten als Sekretäre und


|
Seite 42 |




|
Schreiber Hermann Widenbrügge 1 ), von 1456 bis 1463 Johannes Raden 2 ), etwa von 1465 bis 1470 Johannes Berner 3 ), seit 1471 Joachim Heydeberg 4 ) und seit 1472 Laurentius Stoltenborg 5 ) der mecklenburgischen Kanzlei an. Hermann Widenbrügge war zunächst Pfarrer von Belitz 6 ), dann Kirchherr an St. Marien zu Rostock 7 ). Johann Raden war Pfarrer von Marnitz 8 ). Wie der Kanzler Thomas Rode, so blieben auch die beiden Sekretäre Joachim Heydeberg und Laurentius Stoltenborg nach dem Tode Herzog Heinrichs IV. im Jahre 1477 unter dessen Söhnen Albrecht V., Magnus II. und Balthasar weiterhin in der mecklenburgischen Kanzlei tätig.
§ 4.
Die mecklenburgische Kanzlei und die Verwaltungsreformen unter Herzog Magnus II. 9 )
Herzog Magnus II. (1477 - 1503) hat nicht nur das Verdienst, die durch unvernünftige und verschwenderische Hofhaltung seiner Vorfahren zerrütteten finanziellen Verhältnisse Mecklenburgs gebessert und neu geordnet zu haben, sondern er ist vor allem der Forderung seiner Zeit, die mittelalterliche Verwaltung und Regierung zu modernisieren, in weitem Maße gerecht geworden.


|
Seite 43 |




|
Getrieben von den Strömungen der Zeit, hat er das Reformwerk in Angriff genommen. Dabei haben ihm allem Anschein nach fremde Verwaltungsverhältnisse zum Vorbild gedient. Vor Übernahme der Regierung weilte er vielfach an fremden Fürstenhöfen, insbesondere in Franken und am Hofe der brandenburgischen Kurfürsten, welche mit dem mecklenburgischen durch enge verwandtschaftliche Bande verknüpft waren 1 ), und gehörte 1462 sogar dem brandenburgischen Rate an 2 ). Dort hat er sicher viele Anregungen empfangen und Erfahrungen gesammelt. Zur Mitarbeit an den Reformen zog er anscheinend mit Bewußtsein hauptsächlich Nichtmecklenburger, insbesondere Mittel- und Süddeutsche, an den Hof in der Überzeugung, daß die mittel- und oberdeutsche Kultur-, Verwaltungs- und Regierungstechnik der norddeutschen überlegen war. So stammte der Nachfolger Thomas Rodes, der Kanzler Johann Tigeler (1486 - 93), aus Waltershausen bei Gotha, sein Nachfolger Dr. Anthonius Grunwald (1493 - 1501) aus Nürnberg, der Kanzler Brand von Schönaich (1502 - 1507) und sein Neffe und Nachfolger Caspar von Schönaich (1507 - 1547) aus der Lausitz. Auch Claus Trutmann, der erste mecklenburgische Rentmeister, von 1501 bis 1502 Vizekanzler, stammte wie Tigeler aus Waltershausen 3 ). Mit Hilfe dieser Beamten, welche sämtlich der Kanzlei angehörten, hat Magnus sein Reformwerk durchgeführt.
Wenn auch viele Neuerungen der eigenen Initiative des Herzogs entsprungen sein mögen 4 ), so haben doch seine Gehilfen keinen geringen Anteil an der Neuordnung Mecklenburgs gehabt. Die organisatorische Tätigkeit Grunwalds kommt vor allem darin zum Ausdruck, daß er zu Beginn seiner Amtstätigkeit im Jahre 1493 eine Kanzleiordnung entwarf und dadurch der Kanzlei eine festere Organisation gab 5 ). Die Verdienste Tigelers, Grunwalds


|
Seite 44 |




|
und Trutmanns liegen besonders darin, daß sie es verstanden, "die neuen Bestrebungen und Ideen folgerichtig weiter auszubauen und durchzuführen und um die eine oder andere Anregung zu bereichern" 1 ).
Die mecklenburgische Kanzlei ist durch die Reformen Magnus II. nicht unberührt geblieben. Durch die Rezeption des römischen Rechtes, durch das Ende der 90er Jahre des 15. Jahrhunderts gegründete ordentliche Hof- und Landgericht 2 ), ferner durch die weitere Ausgestaltung des schriftlichen Verfahrens in der Verwaltung wurde die Arbeitslast der Kanzlei beträchtlich gesteigert. Insbesondere aber wuchsen die Aufgaben der Kanzlei durch die Zentralisation der Finanzverwaltung, womit Magnus bald nach Übernahme der Regierung das Reformwerk begann. Während es im Mittelalter eine Zentralstelle für sämtliche Einnahmen des Landes nicht gab, richtete Magnus II. in Schwerin eine Zentralkasse ein, in welche der größte Teil der Geldeinkünfte von den einzelnen Vogteien abgeführt wurde 3 ). Diese Zentralstelle war zunächst die Vogtei Schwerin, welche jedoch nur vorübergehend "die Funktion einer Zentralkasse" gehabt hat. Wahrscheinlich schon seit 1480, mit Sicherheit seit 1489 strömten die Einnahmen des Landes alljährlich zu bestimmten Terminen (von Martini bis Nikolai) in der herzoglichen Kanzlei zusammen. Die Verwaltung der Zentralkasse und die Führung der entsprechenden Rechnungsbücher hat offenbar zunächst den Sekretären und Schreibern obgelegen. Die beiden Kanzleisekretäre Johann Tigeler und Laurentius Stoltenborg scheinen abwechselnd die Rechnungsbücher geführt zu haben. Auch als Kanzler behielt Johann Tigeler diese Funktion bei, bis dann, nachdem Tigeler sich im Jahre 1493 zur Ruhe gesetzt hatte, ein besonderer Rentmeister in der Person des Claus Trutmann berufen wurde. Dieser wurde in der Verwaltung der Zentralkasse (auch Renterei oder Kammer genannt) verschiedentlich von Kanzleisekretären und -schreibern unterstützt und vertreten. Jedoch seit 1506 begegnen auch besondere dem Rentmeister unterstellte Rentschreiber. Erst in den letzten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts scheint die Renterei von der Kanzlei getrennt zu sein. "Dagegen stellte sie in der ersten Hälfte des Jahrhunderts noch keine selbständige Behörde dar, sondern gehörte zur Kanzlei" 4 ).


|
Seite 45 |




|
Die neuen Anforderungen, welche an die Kanzlei gestellt wurden, machten vor allem die Berufung eines Rechtsgelehrten an die Spitze der Kanzlei notwendig. Wenn auch schon in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts ein Rechtsgelehrter in der Person des Nikolaus Reventlow (1415 - 1438) das Kanzleramt versehen hatte, so ist doch von einer "Tendenz der mecklenburgischen Fürsten, Juristen zu Leitern der Kanzlei zu bestellen, bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts nichts zu spüren" 1 ). 1493 wurde der Doktor der kaiserlichen Rechte Antonius Grunwald aus Nürnberg zum Kanzler berufen 2 ). Seit dieser Zeit waren die mecklenburgischen Kanzler in der Regel Juristen. Die Übergangszeit zeigt sich darin, daß Antonius Grunwald, wie auch sein Nachfolger Brand von Schönaich (1502 - 1507) von Haus aus noch Geistliche waren. Der erste Laienkanzler war Caspar von Schönaich (1507 - 1547) 3 ); jedoch schon früher gegen Ende des 15. Jahrhunderts begegnen uns Laien in der mecklenburgischen Kanzlei, z. B. der Schreiber Johannes Berskamp (1491) 4 ). Auch der Rentmeister Claus Trutmann, welcher nach dem Tode Grunwalds bis zur Wiederbesetzung des Kanzleramtes von 1501 bis 1502 zugleich auch Vizekanzler war, gehört zu den ersten Laien in der Kanzlei 5 ).
Freilich als Berufsbeamte in modernem Sinne werden wir die fürstlichen Beamten der Zentralverwaltung um 1500 (Kanzler, Sekretäre, Rentmeister und Hofmeister) 6 ) wohl kaum bezeichnen können 7 ), da das Berufsbeamtentum, welches die amtliche Tätigkeit zum Lebensberuf macht, sich erst ganz allmählich ausbildete 8 ). Daß aber die Verwaltungsreformen Magnus II. die Entwicklung des Berufsbeamtentums in hohem Maße gefördert haben, steht zweifellos fest. Das kommt auch darin zum Ausdruck, daß die Hofbeamten mehr und mehr ein festes, "meist recht hohes Jahres-


|
Seite 46 |




|
gehalt" bezogen 1 ), während sie früher im wesentlichen durch weltliche oder geistliche Lehen, Exemptionen und Nutzungen aller Art entlohnt wurden. Auch Schmoller 2 ) sieht darin, daß nach und nach "an die Stelle des Unterhalts in der Familie des Herrn oder der Landdotierung die Bezahlung der arbeitsteiligen Leistungen durch Gehalte" trat, nur eine Entwicklungsstufe des modernen Berufsbeamtentums.
Die entscheidende Bedeutung der Verwaltungsreformen besteht in der allmählichen Umbildung des Rates zu einer modernen Behörde. An der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts begegnen uns zum erstenmal wirkliche Hofräte in Mecklenburg, welche sich von den consiliarii des Mittelalters (Landräten) dadurch unterscheiden, daß sie lediglich dem Fürsten verpflichtet und in der Regel Gelehrte (Juristen) waren 3 ). Sie zerfielen einerseits in "wesentliche" oder "tägliche" Hofräte, die dauernd am Hofe waren, andererseits in Hofräte "von Haus aus", die nur gelegentlich an den Hof gerufen wurden 4 ). Während im Mittelalter regelmäßige Ratssitzungen unbekannt waren, hatten sich die Hofräte nach der Hofordnung von 1504 täglich zu bestimmten Stunden "an eyne bequeme stedt, dor zu verordent", zu versammeln und alle Angelegenheiten der Herzöge, des Hofes, des Landes und der Untertanen "zuvorhoren, zuberatschlagen, zuantworten, beizulegen, zuvortragen, zurichten", ohne daß die Herzöge ständig dabei zugegen zu sein brauchten 5 ). Die kollegialische Arbeitsweise und die grundsätzlich erteilte Befugnis, selbständig Regierungshandlungen vorzunehmen und von sich aus Entscheidungen zu treffen, verliehen dem Rat den Charakter einer modernen Behörde. Die Entwicklung des Rates zu einer Behörde wurde ferner dadurch gefördert, daß bereits unter Magnus' Regierung "eine gewisse Tendenz zu festen Residenzen sich ausbildete" 6 ). Aus diesem Rat, der als zentrale Behörde zunächst Rechtsprechung und Verwaltung am Hofe erledigte, ging dann im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts ein System von Einzelbehörden hervor. Um 1658 haben wir drei


|
Seite 47 |




|
Behörden: "eine richterliche, die Kanzlei 1 ), eine Zentrale für die Landesverwaltung, die Kammer, und als dritte und höchste Behörde den geheimen Rat, der später den Namen Landesregierung erhielt" 2 ).
Zu den "wesentlichen" oder "täglichen" Hofräten gehörten vor allem die Beamten der Zentralverwaltung (Kanzler, Sekretäre, Rentmeister und Hofmeister). Unter ihnen nahm der Kanzler, bis 1504 der einzige ständig am Hofe weilende Gelehrte 3 ), als leitender Staatsbeamter eine besonders einflußreiche Stellung ein. Jedoch blieben die mecklenburgischen Kanzler von Tigeler bis Caspar von Schönaich nach wie vor in engster Verbindung mit der Kanzlei. Die meisten Urkundenkonzepte sind von ihnen selbst entworfen 4 ).
Durch die Reformen Magnus II. wurden der mecklenburgischen Kanzlei zwar neue Aufgaben gestellt, jedoch scheint sie sich ihrem Wesen nach nicht verändert zu haben. Deshalb trage ich Bedenken, die Kanzlei (einschließlich der Renterei) mit Steinmann 5 ) als "zentrale Behörde" zu bezeichnen. "Eine Kanzlei ist nämlich nichts Abgelöstes für sich, sondern sie ist das Schreibbüro einer Behörde oder eines Amtes mit Behördencharakter" 6 ). Dadurch, daß sie der zentralen Behörde als Schreibbüro diente, stand sie in engsten Beziehungen zum Rat. Dieses Verhältnis von Rat und Kanzlei kommt besonders deutlich in den Kanzleiordnungen des 16. Jahrhunderts zum Ausdruck, welche zugleich auch Rats- und Regierungsordnungen sind 7 ). Die Kanzlei selbst aber blieb technisches Hilfsorgan der gesamten Verwaltung.
Die Reformen des 15. und 16. Jahrhunderts bilden im wesentlichen Institutionen fort, die im 13. Jahrhundert entstanden sind.


|
Seite 48 |




|
Schmoller 1 ) sieht, wie mir scheint, mit Recht das Charakteristische dieser Epoche mehr darin, "daß sie an allen Punkten nach einer festen Ordnung, nach einer Gestaltung der im Keime vorhandenen politischen und sozialen Ideen ringt, als daß sie ganz neue schöpferische Gedanken gehabt und eingeführt hätte". Nach diesem Gesichtspunkt dürfen wir wohl auch die Entstehung und den Charakter der modernen Behördenorganisation in Mecklenburg-Schwerin beurteilen.
Kapitel II.
Die Organisation der Kanzlei.
§ 1.
Amtsstufen, Titel, Zahl, Stand und Besoldung der Kanzleibeamten.
Das erste Amt am Hofe der mecklenburgischen Fürsten, welches "eine gewisse, wenn auch unvollkommene Organisation" erhielt, war die Kanzlei. Während auch in Mecklenburg die Verwaltung der anderen Hofämter auf der persönlichen Erfahrung ihrer Inhaber beruhte, bildete sich in der Kanzlei eine Tradition, welche eine festere Regelung des Verwaltungsbetriebes und eine gewisse Schulung des Beamtenpersonals ermöglichte. Eine große Anzahl mecklenburgischer Kanzleivorsteher ist aus der Kanzlei selbst hervorgegangen. Notare und Schreiber, die sich besonders bewährt hatten, wurden mit Vorliebe zum Kanzler bzw. Protonotar befördert. So konnte Rothgerus (1323 - 29), der erste mecklenburgische Protonotar, mindestens auf eine 13jährige Tätigkeit als fürstlicher Notar zurückblicken, als er etwa im Jahre 1323 an die Spitze der mecklenburgischen Kanzlei gestellt wurde. Auch die Kanzler Johannes Schwalenberg (1366 - 74), Johannes von Bentlage (1406/7), Henning Karutze (1440 - 1446), Johann Hesse (1444 - 49) und Thomas Rode (1469 - 86) waren teils kürzere, teils längere Zeit, bevor sie zum erstenmal den Kanzlertitel führten, als Schreiber in der Kanzlei beschäftigt.
Die Abstufungen in der Rangordnung des Kanzleipersonals sind das beste Kennzeichen für eine gewisse Organisation der


|
Seite 49 |




|
Kanzlei. Es bilden sich nach und nach drei einander übergeordnete Amtsstufen, deren Inhaber am Ende des Mittelalters die Titel Kanzler, Sekretär und Schreiber (bzw. Unterschreiber) führten. Als Kanzleivorstand und Leiter der Kanzleigeschäfte stand der Kanzler bzw. Protonotar dem Range nach über dem übrigen Kanzleipersonal. Das geht nicht nur aus den Titeln der Kanzleibeamten hervor, sondern auch aus der Reihenfolge, in welcher sie in den Urkunden als Zeugen aufgeführt werden. Fast ohne Ausnahmen stehen die Kanzleivorsteher in den Zeugenlisten vor den Notaren, oft unmittelbar vor diesen 1 ), bisweilen aber auch durch die Knappen von den Notaren getrennt 2 ). Die übergeordnete Stellung des Kanzlers kommt zum Ausdruck auch in den Aufzeichnungen über einen Kriegszug der Mecklenburger in das Stiftsland Hildesheim aus dem Jahre 1472, wonach dem Kanzler Thomas Rode drei Pferde, dem Schreiber Laurentius Stoltenborg dagegen nur ein Pferd gestellt werden 3 ).
Wie das mecklenburgische Kanzleiwesen selbst erst allmählich festere Formen annahm, so haben auch die Titel der Kanzleibeamten zunächst stark geschwankt. Sowohl am gräflich-schwerinschen Hofe wie auch bei den mecklenburgischen Fürsten wurden die Hofschreiber im 13. Jahrhundert abwechselnd "notarius" oder "scriptor", oft mit dem Zusatz "curie" 4 ), betitelt. Häufig werden sie in den Urkunden auch einfach nach ihrer geistlichen Stellung am Hofe "capellanus" 5 ), gelegentlich auch "scolaris" 6 ) benannt. Jedoch herrschte der Ausdruck "notarius" von vornherein vor und verdrängte die übrigen Bezeichnungen mehr und mehr 7 ). Die hauptsächlich wohl durch die territoriale Vergrößerung Mecklenburgs bedingte Vermehrung des Kanzleipersonals im 14. Jahrhundert machte die Berufung eines Kanzleivorstandes


|
Seite 50 |




|
erforderlich, welcher zunächst den Titel "prothonotarius" führte. Dieser Ausdruck begegnet, wie bereits erwähnt wurde, zum erstenmal 1323 in Verbindung mit dem fürstlichen Kaplan und Schreiber Rothgerus 1 ) und wird von diesem auch später 2 ) gelegentlich geführt. Seitdem Berthold Rode (1337 - 1351) an der Spitze der mecklenburgischen Kanzlei stand, bürgerte sich auch in Mecklenburg der Kanzlertitel, der zum ersten Male 1337 auftaucht 3 ), nach und nach ein. Jedoch wird Berthold Rode noch abwechselnd "prothonotarius" 4 ), "maior notarius" 5 ) oder "notarius (curie) 6 ), am häufigsten aber, besonders oft in der letzten Zeit seiner Amtstätigkeit, als "cancellarius" (Kantzler, kentzelere, kencellere oder kenselere) 7 ) bezeichnet. Bertram Behr (1352 bis 1360; 1363) führte in der Regel, Johannes Kröpelin (1361 - 62) recht häufig den Kanzlertitel 8 ). Die nächsten mecklenburgischen Kanzleivorsteher, von Johannes Schwalenberg (1366 - 1374) bis Henning Karutze (1440 - 1446), werden fast ausschließlich Kanzler genannt. Erst unter Johann Hesse, der von 1440 bis 1449 der Kanzlei angehörte, taucht die Bezeichnung "prothonotarius" vorübergehend wieder auf. Johannes Hesse erscheint abwechselnd als Protonotar 9 ), Kanzler 10 ), Vizekanzler 11 ) oder auch einfach als Schreiber 12 ). Heinrich Bentzien und sein Nachfolger Thomas Rode werden bald als Schreiber, bald als Sekretär, bald als Kanzler bezeichnet 13 ).
Die den Protonotaren bzw. den Kanzlern untergeordneten Kanzleibeamten wurden im 14. Jahrhundert im allgemeinen als Notare, in Urkunden, welche in deutscher Sprache abgefaßt sind, als "schriuer" betitelt. An Stelle des Notars trat im 15. Jahrhundert der Sekretär. Johannes Kremer (1412 - 1430) führt diese neue Amtsbezeichnung m. W. zum erstenmal und zwar im


|
Seite 51 |




|
Jahre 1412 1 ). Während besonders häufig im Anfang des 14. Jahrhunderts unter Heinrich II. von Mecklenburg die fürstlichen Ratgeber als "secretarii" bezeichnet wurden 2 ), beschränkte man im 15. Jahrhundert diesen Ausdruck durchweg nur auf Angehörige der Kanzlei. Offenbar wurde der Titel "notarius" zur besseren Unterscheidung von den öffentlichen Notaren (notarii publici imperiali auctoritate) aufgegeben, wie es Lewinski 3 ) auch für Brandenburg wahrscheinlich gemacht hat. Diese Vermutung erscheint mir deshalb wohl begründet, da die mecklenburgischen Sekretäre zum Teil zugleich auch notarii publici waren, wie z. B. der Sekretär Gerhard Brüsewitz und der spätere Kanzler Heinrich Bentzien 4 ). Dem Range nach scheinen die Sekretäre den ehemaligen Notaren gleichgestanden zu haben.
Über die dritte Kategorie der Kanzleibeamten, die Kopisten und Mundatoren, erfahren wir fast gar nichts. 1456 wird einmal ein "vnderschrieber" 5 ) erwähnt namens Johannes Raden, der später sogar zu den Räten Heinrichs IV. gehörte 6 ).
Wieviel Beamte jeweils nebeneinander in der Kanzlei beschäftigt wurden, läßt sich nur ungenau bestimmen. Unter dem ersten Kanzleivorstand Rothgerus sind in den Jahren 1326 - 29 etwa sechs 7 ), unter dem Kanzler Berthold Rode in den Jahren 1349 - 51 drei bis vier Notare 8 ) nebeneinander nachweisbar. Im


|
Seite 52 |




|
15. Jahrhundert sind gewöhnlich außer dem Kanzler nicht mehr als zwei bis drei Sekretäre gleichzeitig nachzuweisen, so 1428 unter Nikolaus Reventlow die Schreiber und Sekretäre Johannes Kremer und Johann Achim, in den Jahren 1461 - 62 unter Heinrich Bentzien Hermann Widenbrügge, Johannes Raden und Thomas Rode 1 ).
Außerdem hatten die Fürstinnen des Landes und die erwachsenen Söhne der Fürsten bisweilen oder regelmäßig ihre eigenen Privatschreiber 2 ). In welchem Verhältnis diese zur mecklenburgischen Kanzlei gestanden haben, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Ob auch die Landesfürsten sich ihrer gelegentlich bedienten, ist aus den Quellen nicht ersichtlich.
Die mecklenburgischen Fürsten des Mittelalters wählten sich ihr Kanzleipersonal durchweg aus der Geistlichkeit des Landes. Bei den meisten Kanzleibeamten ist nachzuweisen, daß sie dem geistlichen Stande angehörten 3 ). Unter Heinrich II. begegnet uns ausnahmsweise einmal ein Notar namens Heinrich Frauenburg, der nachweislich dem weltlichen Stande angehörte 4 ). Geistliche wurden auf kürzere oder längere Zeit zur Verrichtung von Schreiberdiensten an den Hof gerufen und scheinen während ihrer Amtstätigkeit von ihren geistlichen Pflichten "gleichsam beurlaubt" gewesen zu sein. Solange sie der fürstlichen Kanzlei angehörten, betrauten sie mit der Ausübung ihres geistlichen Amtes


|
Seite 53 |




|
Vikare oder Stellvertreter 1 ). Jedoch scheinen sie sich auch während ihrer Amtstätigkeit bei Hofe gelegentlich um ihr geistliches Amt gekümmert zu haben 2 ).
Die Kanzleibeamten, insbesondere die Kanzler, erfreuten sich am Hofe der mecklenburgischen Fürsten einer sehr geachteten Stellung. Sie stammten zum Teil aus vornehmen Familien, so der Kanzler Bertram Behr (1352 - 60, 1363) aus der im 16. Jahrhundert ausgestorbenen Familie gleichen Namens 3 ). Auch Notare stammten häufig aus bekannten Geschlechtern, so Antonius (1327 bis 1329) und Helmold (1339 - 40) von Plessen und Heinrich von Griben (1349 - 59). Der Kanzler Berthold Rode (1337 - 51) und der Notar Heinrich Rode (1349 - 52) gehörten einer angesehenen Rostocker Ratsherrn- und Kaufmannsfamilie an 4 ).
Die Amtsdauer der Kanzleibeamten schwankte verhältnismäßig stark. Am längsten, mindestens 23 Jahre (1415 - 38), versah Nikolaus Reventlow das Kanzleramt. Thomas Rode gehörte der Kanzlei acht Jahre (1461 - 69) als Schreiber bzw. als Sekretär und 17 Jahre (1469 - 86) als Kanzler an, Rothgerus ist 13 Jahre (1310 - 23) als Notar und sechs Jahre (1323 - 29) als Protonotar nachzuweisen. Oft jedoch war die Amtstätigkeit auf kürzere Zeit beschränkt. Der Kanzler Johannes Kröpelin hat beispielsweise höchstens zwei Jahre (1361 - 62) der mecklenburgischen Kanzlei angehört. Die Gründe für das Ausscheiden der Beamten aus der Kanzlei sind meistens unbekannt. Wie die mittelalterlichen Fürsten ihre Beamten nach eigenem Ermessen beriefen, so konnten sie dieselben auch jederzeit ihres Amtes entheben. Wer sich etwas zuschulden kommen ließ, wurde durch einen anderen ersetzt. Als der Kanzler Bertram Behr 1360 bei Herzog Albrecht II. in Ungnade gefallen war, trat an seine Stelle Johannes Kröpelin 5 ). Da die Kanzleibeamten aber auch nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit häufig noch als Zeugen in den Urkunden der mecklenburgischen Fürsten fungieren und als angesehene Prälaten und Räte oft eine


|
Seite 54 |




|
einflußreiche Rolle im Hofleben spielten 1 ), so werden Zerwürfnisse mit dem Landesherrn nicht allzu oft der Anlaß zum Abschied aus der Kanzlei gewesen sein.
Wie die übrigen mecklenburgischen Hofbeamten, so bezogen auch die Beamten der Kanzlei offenbar kein festes Gehalt, sondern bestritten ihre Bedürfnisse zum Teil aus den geistlichen Stellen, welche sie innehatten, und aus Gebühren. Kraft ihres Patronatsrechtes waren die Fürsten in der Lage, ihren geistlichen Hofbeamten einträgliche Pfarrstellen und Einkünfte von Vikareien zu beschaffen 2 ). Auch die reichdotierten geistlichen Stifte, besonders das Schweriner, Lübecker und später auch das Rostocker Domstift, waren geeignete Versorgungsstätten für bewährte Kanzleibeamte 3 ). Ferner erhielten diese als Entgelt für ihre Tätigkeit bei Hofe Hebungen, Exemtionen und Nutzungen aller Art. Dem Schreiber und späteren Kanzler Johannes Hesse verlieh Heinrich IV. nach einer Urkunde vom 1. Januar 1444 für treue Dienste die auf die Einwohner des Dorfes Papendorf gelegten Dienste, Bede, Ablager oder sonstigen Auflagen auf Lebenszeit 4 ), und Thomas Rode erhielt als Schreiber desselben Fürsten im Jahre 1463 die Gerechtsame und Lehnware, "als wy hebben in vnseme lenen vnde vicarien to kabelstorpe in vnse voghedie to gustrowe beleghen" ebenfalls auf Lebenszeit 5 ).
Außerdem wird den Kanzleibeamten ein Teil der für die Ausfertigung der Urkunden erhobenen Sporteln zugefallen sein.


|
Seite 55 |




|
Daß die Kanzlei Gebühren erhob, geht aus einem indirekten Zeugnis hervor. In einer Urkunde über den Verkauf der Insel Poel durch Heinrich II. heißt es, daß die fürstlichen Notare für Bestätigungsurkunden keine Gebühren erhalten sollten 1 ). Außer den Sporteln scheinen die Kanzleibeamten auch für das Abrechnen mit den Vögten des Landes Entgelt erhalten zu haben. So werden dem Kanzler Thomas Rode einmal für eine Abrechnung mit dem Schwaaner und Neubukower Vogt Klaus Oldeswager 3 Gulden ausgehändigt 2 ). Auch sonstige Geldzuwendungen sind an die fürstlichen Schreiber gemacht worden. In dem Ausgaben- und Einnahmeverzeichnis des herzoglichen Vogtes zu Schwerin aus dem Jahre 1373 heißt es: "Item domino meo X. marc; quarum Johanni notario ducis Hinrici VI. fuerunt presentate" 3 ). Im übrigen hatten sie, wie auch das übrige Gefolge, auf den Amtsburgen der Fürsten freie Wohnung, Kleidung 4 ), Verpflegung und für ihre Pferde freie Unterkunft und Fütterung 5 ). Für Reisen und diplomatische Missionen wurden ihnen von den Vögten Reisespesen ausgezahlt 6 ).
§ 2.
Kanzlei und Rat.
1. Die Zugehörigkeit insbesondere der Kanzler zum landesfürstlichen Rat.
Die beiden Organe der landesfürstlichen Hofverwaltung und Regierung im Mittelalter sind der Rat und die Kanzlei. Während die Kanzlei in Mecklenburg spätestens im 14. Jahrhundert eine gewisse Organisation erhielt, blieb der landesfürstliche Rat,


|
Seite 56 |




|
dessen Entstehung einer früheren Zeit angehört als die Entstehung einer organisierten Kanzlei 1 ), bis zum Ausgange des 15. Jahrhunderts vollkommen unorganisiert 2 ). Beide Amtsstellen standen in nahen Beziehungen zueinander und waren in ihrer Tätigkeit eng aufeinander angewiesen. Es ist mit vollem Recht darauf hingewiesen worden, daß der stets wechselnde Rat in der Kanzlei seinen Mittelpunkt hatte 3 ). Durch ihre Amtspflicht waren die Kanzleibeamten genötigt, möglichst ständig am Hofe anwesend zu sein. Ihre vielseitige Tätigkeit verschaffte ihnen in besonderem Maße Erfahrungen auf fast allen Gebieten der Verwaltung, so daß die mecklenburgischen Fürsten ihres Rates kaum werden entbehrt haben können. Der Kanzlei lag es vor allem ob, die Beschlüsse, über die sich die Fürsten mit ihren Räten geeinigt hatten, in die richtige urkundliche Form zu bringen, und zwar so, daß die Urkunde inhaltlich genau den Verfügungen des Landesherrn entsprach. Eine präzise Ausarbeitung des Wortlautes der Urkunde war aber nur möglich, wenn der ausfertigende Kanzleibeamte selbst an der vorausgehenden Beratung teilgenommen hatte oder wenigstens genaue Kenntnis von den Ergebnissen der Verhandlungen erhielt. Insbesondere die Amtspflicht des Kanzlers als verantwortlichen Leiters sämtlicher Kanzleigeschäfte machte seine Anwesenheit bei den Ratsverhandlungen erforderlich. Eine Verbindung zwischen den beiden Amtsstellen der landesfürstlichen Verwaltung und Regierung war vor allem "durch das Medium des Vorstandes der Kanzlei", nämlich des Kanzlers, geschaffen.
Die Zugehörigkeit der Kanzleibeamten zum landesfürstlichen Rate mußte also geradezu als ein dringendes Bedürfnis empfunden werden. Sie wird bewiesen durch mannigfache Zeugnisse. Da insbesondere die Kanzler recht häufig in den Urkunden als Zeugen auftreten, so ist es an sich schon sehr wahrscheinlich, daß sie dem landesfürstlichen Rate angehörten, zumal da im 14. und


|
Seite 57 |




|
besonders im 15. Jahrhundert die Zeugen mecklenburgischer Urkunden meist consiliarii waren. Bei den meisten mecklenburgischen Kanzleivorstehern läßt sich ihre Zugehörigkeit zum landesfürstlichen Rate direkt nachweisen. So begegnet der erste uns bekannte mecklenburgische Protonotar Rothgerus mehrfach in der Reihe der consiliarii 1 ), ebenso die Kanzler Berthold Rode 2 ), Bertram Behr 3 ), Johannes Kröpelin 4 ), Karl Hakonsson 5 ), Nikolaus Reventlow 6 ), Henning Karutze 7 ), Johann Hesse 8 ), Heinrich Bentzien 9 ) und Thomas Rode 10 ).
Ob auch die Notare und Schreiber, besonders diejenigen, welche häufiger in den Urkunden als Zeugen auftreten, dem Rate angehörten, läßt sich aus den Quellen nicht beweisen. Direkte Zeugnisse für ihre Zugehörigkeit zum Rate können wir auch kaum erwarten, da Aufzählungen fürstlicher consiliarii in mecklenburgischen Urkunden des 14. Jahrhunderts zwar nicht so spärlich sind, wie etwa in brandenburgischen Urkunden 11 ), aber immerhin sich ziemlich selten finden. Im 15. Jahrhundert dagegen gehörten nachweislich auch die Sekretäre meist dem fürstlichen Rate an. Die Sekretäre Johann Kremer und Johann Achim werden gelegentlich ausdrücklich als "nostri fideles consiliarii" 12 ) oder "truwe rathgeuer" 13 ) bezeichnet, ebenso erscheinen Heinrich Bentzien und Hermann Widenbrügge bald als "vse leuen getruuen rathgeuer" 14 ), bald als "de erwerdighen vnde duchtigen vnse redere vnd leuen getruuen" 15 ). Der Schreiber Johannes Raden wird einmal mit andern "unse gude manne vnde raed" 16 ) genannt.


|
Seite 58 |




|
2. Das Zusammenwirken von Kanzlei und Rat 1 ).
Es liegt im Wesen der mittelalterlichen Kanzlei, daß sie nicht nach Art einer modernen Behörde an einem festen Orte lokalisiert war, sondern mit dem von Ort zu Ort, von Amtsburg zu Amtsburg wandernden fürstlichen Hofhalte den Herzog auf seinen Reisen durch das Land begleitete 2 ). Dasselbe gilt auch von den landesfürstlichen Räten. Sobald die Umstände es erforderten, mußte die Kanzlei in Tätigkeit treten. In Kisten oder Truhen verpackt, wird man oft Schreibgeräte, Geschäftsbücher, wichtige Schriftstücke und Urkunden mit sich geführt haben. In unsicheren und fehdereichen Zeiten konnte es dann wohl vorkommen, daß das ganze wandernde Archiv unterwegs bei Überfällen auf das herzogliche Gefolge verloren ging oder geraubt wurde 3 ). Seit der Erwerbung der Grafschaft Schwerin (1359) war das Schweriner Schloß der bevorzugte Aufenthaltsort der mecklenburgischen Fürsten. Hier scheint die Kanzlei in einer besonderen Schreibstube, die gelegentlich "schriuery" oder "scriuerie" 4 ), später aber "Meckelnburgische Cantzeley" oder auch "cancellaria dominorum ducum Magnopolensium" 5 ) genannt wurde, ihr Standquartier gehabt zu haben.
Die Kanzlei war technisches Hilfsorgan der gesamten Verwaltungstätigkeit der Landesfürsten. Der Geschäftsgang der Kanzlei beruhte auf enger Zusammenarbeit mit dem fürstlichen Rate. Das Zusammenwirken zwischen dem Fürsten und seinen Räten einerseits und der Kanzlei andererseits beschränkte sich


|
Seite 59 |




|
nicht allein auf das Beurkundungsgeschäft, tritt aber hier am deutlichsten hervor. Für die Erforschung des Geschäftsganges der mecklenburgischen Kanzlei, insbesondere bei der Beurkundung, kommen, abgesehen von einigen Urkundennotizen, als wichtigste Quelle die Kanzleivermerke in Betracht. Diese Vermerke, welche besonders um die Mitte des 15. Jahrhunderts von den Beamten der ausstellenden mecklenburgischen Kanzlei gelegentlich unter die Urkunden, Konzepte und Registerabschriften geschrieben wurden, enthalten wichtige Angaben über die einzelnen Stadien des Beurkundungsgeschäftes und vermitteln uns einen Einblick in den Geschäftsbetrieb der Kanzlei.
Die wenigen mir bekannten mecklenburgischen Kanzleivermerke zeichnen sich vor anderen besonders dadurch aus, daß sie verhältnismäßig eindeutig sind, während die Interpretation beispielsweise der österreichischen Kanzleivermerke Schwierigkeiten macht, da diese zu einem Teil prädikatlos sind und infolgedessen oft nicht mit Sicherheit erkennen lassen, auf welches Stadium der Beurkundung sie sich beziehen. Die mecklenburgischen Kanzleivermerke zerfallen in zwei Gruppen. Für die erste Gruppe ist typisch der Vermerk "de mandato domini Jo. Hesse" 1 ). Mit der Person des den Beurkundungsbefehl erteilenden Fürsten ist der Name des Kanzleibeamten verbunden, welcher die Verantwortung für rechte kanzleimäßige Ausfertigung der Urkunde trug. Oft sind derartige Vermerke noch eindeutiger gefaßt, indem der Name des Kanzleibeamten mit dem Prädikat "scripsit" verbunden ist, etwa "ad mandatum (oder de mandato) domini Thomas Rode scripsit" 2 ). Daß dieses "scribere" sich auf die Konzipierung, nicht auf die Mundierung der Urkunde bezieht, geht, wie mir scheint, auch daraus hervor, daß sich derartige Vermerke gelegentlich unter Konzepten finden, und zwar sind sie von derselben Hand, welche das Konzept anfertigte, in einem Zuge mit dem Text des Konzeptes geschrieben 3 ). Wir wollen diese Gruppe der Vermerke als Kanzleiunterfertigungen bezeichnen.
Für die zweite Gruppe der Kanzleivermerke sind zwei Formen charakteristisch.


|
Seite 60 |




|
1. "Dominus mandauit et examinauit" oder "dominus per se iussit et examinauit" oder "de mandato domini Hinrici Magnopolensis et per se examinatum" 1 ).
In diesen Vermerken wird des Beurkundungsbefehles seitens des Herrschers und der durch diesen vorgenommenen Revision des Beurkundungsgeschäftes gedacht.
2. "De mandato domini ducis et examinauit coram consiliariis" oder "de mandato domini Magnopolensis et examinauit cum suis consiliariis in Parchim suprascriptis" oder "de mandato domini et fideliter cum predictis consiliariis examinauit Jo. Hesse" u. ä. 2 ).
In diesen Fällen wird nicht nur des Beurkundungsbefehles und der Revision der Urkunde seitens des Herrschers gedacht, sondern es wird außerdem noch die Mitwirkung der Räte bei der Überprüfung, gelegentlich auch der Ort, wo die Revision stattfand, und selten der Name des ausfertigenden Kanzleibeamten hervorgehoben. Beide Formen dieser zweiten Gruppe der Kanzleivermerke wollen wir mit Stowasser Doppelvermerke nennen, da sie sich auf verschiedene Stadien der Beurkundung beziehen 3 ). Besonders aufschlußreich ist schließlich noch ein Kanzleivermerk, welcher folgenden Wortlaut hat: "ad mandatum domini Thomas Rode scripsit, sigillauit presentem literam et est examinata in consilio" 4 ). Hier wird also nicht nur des Beurkundungsbefehles, der Fertigung durch den Kanzler Thomas Rode und der Revision im Rate, sondern auch der Besiegelung der Urkunde durch den Kanzler gedacht.
Auf Grund der Kanzleivermerke und einiger noch anzuführender Urkundennotizen gewinnen wir für den Geschäftsgang bei der Beurkundung folgendes Bild. Der Fürst setzte mit seinen consiliarii in den Ratssitzungen den Rechtsinhalt fest und revidierte bisweilen das Konzept, ausnahmsweise wohl auch die Reinschrift. Der Kanzlei dagegen lag die formelle Fassung, die Konzipierung und Mundierung der Urkunde ob. Diese Zweiteilung bei dem Beurkundungsgeschäft kommt in den Kanzleivermerken deutlich zum Ausdruck.


|
Seite 61 |




|
"Der unmittelbare Entstehungsgrund der Urkunde ist der Wille des Ausstellers und sein ausdrücklicher oder selbstverständlicher Befehl, eine Urkunde herzustellen" 1 ). Da das Regiment der mittelalterlichen Fürsten, insbesondere auch der mecklenburgischen Herzöge, durchaus persönlichen Charakter trug, entstanden die Urkunden prinzipiell auf Befehl der Herrscher (de mandato, ad mandatum domini, dux per se iussit usw.), wie es fast alle Kanzleivermerke betonen, oder doch wenigstens mit deren Wissen und auf Grund sicherer Kenntnis (ex certa scientia), wie es häufig in der Korroborationsformel der Urkunden zum Ausdruck gebracht wird 2 ). Nachdem in der Ratsverhandlung die sachliche Grundlage für die Herstellung der Urkunde geschaffen war, erhielt die Kanzlei bzw. ein Kanzleibeamter den Befehl, den Beschluß des Herrschers oder der Ratssitzung in die urkundliche Form zu bringen. In vielen Fällen wird der Beurkundungsauftrag in mündlicher Form der Kanzlei übermittelt worden sein 3 ). Häufig werden aber als Grundlage für die Ausarbeitung eines Konzeptes kurze Notizen über das sachliche Detail des zu beurkundenden Rechtsgeschäftes und über die Zeugen gedient haben. Diese Aufzeichnungen werden häufig von dem Kanzleibeamten (Kanzler oder Sekretär), welcher der betreffenden Ratsverhandlung beiwohnte, gemacht worden sein 4 ). Hatte die


|
Seite 62 |




|
Kanzlei den Beurkundungsbefehl erhalten, so wurde in der Regel wohl ein Konzept 1 ), bisweilen aber aus Zeitersparnis auch gleich die Reinschrift 2 ) angefertigt. Das letztere Verfahren wird man besonders in bestimmten Fällen, wie bei Ausfertigung von Legitimationen, Bestallungen usw., angewandt haben.
Hatte der ausfertigende Kanzleibeamte das Konzept oder auch gleich die Reinschrift angefertigt, so erfolgte die Revision 3 ). Ob der Kanzler als verantwortlicher Leiter der Kanzleigeschäfte die Befugnis hatte, bei unwichtigen Sachen die Kollation und Revision selbständig zu besorgen, läßt sich nicht nachweisen, ist aber sehr wahrscheinlich 4 ). Häufig scheint die Revision durch die mecklenburgischen Fürsten selber vorgenommen zu sein. Diejenigen Kanzleivermerke, welche der Urkundenrevision gedenken, betonen fast alle, daß der Fürst an der Revision persönlich beteiligt war, z. B. die Vermerke "dominus per se iussit et examinauit" und mit besonderem Nachdruck "de mandato domini Henrici Magnopolensis et per se examinauit". Häufig wird auch zum Ausdruck gebracht, daß der Fürst die Revision "coram" oder "cum consiliariis" vornahm oder daß die Urkunde "in consilio" geprüft wurde. Besonders deutlich aber geht die persönliche Beteiligung des Fürsten bei der Urkundenrevision hervor aus der Notiz eines Briefes, welchen der herzogliche Schreiber Thomas Rode im Jahre 1466 an den Wismarer Protonotar Gottfried Parseval richtete. In diesem Schreiben heißt es: "Mitto vobis copiam littere concepte et confecte, quam dominus per se correxit, emendauit et ita conscribendam decreuit,


|
Seite 63 |




|
adiciens verbum, postquam littera fuit confecta, consolatorium tale, quod ..." 1 ). In diesem Falle ordnete also der Herzog an, unter Berücksichtigung der von ihm persönlich vorgenommenen Korrekturen den Urkundenentwurf umzuändern.
Die Frage, ob sich die Revision auf das Konzept oder auf die Reinschrift bezieht, läßt sich für Mecklenburg weder nach der einen noch nach der anderen Seite mit Sicherheit entscheiden 2 ). Da recht häufig Korrekturen nötig waren, so wäre es im allgemeinen allerdings unzweckmäßig gewesen, die Reinschrift anzufertigen, bevor der Wortlaut des Konzeptes auf seine sachliche Richtigkeit geprüft war. Die Kanzleivermerke sagen über den Zeitpunkt der Revision nichts Bestimmtes aus. Jedoch die zahlreich uns erhaltenen Urkundenkonzepte, welche häufig Korrekturen aufweisen, sprechen dafür, daß in vielen Fällen das Konzept überprüft und korrigiert wurde.
Sobald die Revision erfolgt und die nötigen Korrekturen vorgenommen waren, erhielt die Kanzlei den Fertigungsbefehl, d. h. den Auftrag, die Reinschrift herzustellen 3 ). Erst dann erfolgte evtl. nach nochmaliger Prüfung der Reinschrift die Besiegelung. Die Korroborationsformeln der mecklenburgischen Urkunden weisen darauf hin, daß es zur Besiegelung der Urkunden ebenfalls in der Regel des speziellen Befehls seitens der Fürsten bedurfte 4 )
Es ergibt sich also, daß die Kanzlei bei dem Beurkundungsgeschäft unter schärfster Kontrolle des Herrschers und der landesfürstlichen Räte stand. Der Fürst konnte an sich dreimal selbst-


|
Seite 64 |




|
tätig in den Geschäftsgang eingreifen: Er übermittelte erstens den Beurkundungsbefehl an die Kanzlei zur Herstellung eines Entwurfes, nach erfolgter Revision erteilte er zweitens den Fertigungsbefehl zur Herstellung der Reinschrift und schließlich konnte er nach Überprüfung der Reinschrift den Vollziehungsbefehl zur Besiegelung der Urkunde geben. Die Kanzlei diente bei dem Beurkundungsgeschäft also lediglich als technisches Hilfsorgan.
Kapitel III.
Die Tätigkeit der Kanzlei.
§ 1.
Die Tätigkeit des Kanzlers und der Kanzleibeamten.
Das mittelalterliche Ämterwesen unterscheidet sich von dem modernen Behördenwesen besonders dadurch, daß es keine streng durchgeführte Arbeitsteilung, keine Zuerkennung von "Dezernaten" an bestimmte, durch Amt oder Vorbildung qualifizierte Hofbeamte oder Räte kennt. Der Aufgabenkomplex der Verwaltung ist nicht in einzelne Ressorts aufgeteilt, sondern wird von den Landesfürsten mit Unterstützung und grundsätzlich unter Hinzuziehung seiner Hofbeamten und Räte zum großen Teil persönlich erledigt. Hieraus erklärt sich die vielseitige Tätigkeit insbesondere des Kanzlers. Da die Beamten der Kanzlei als Geistliche über technische Fertigkeiten, elementare Rechtskenntnisse und über eine überragende Bildung verfügten, wurden sie mit besonderer Vorliebe zu den verschiedensten Verwaltungs- und Regierungsgeschäften verwendet.
Als landesfürstliche consiliarii wurden vor allem die Kanzler zu den Ratsverhandlungen hinzugezogen und hatten den Herrscher nach bestem Wissen und Gewissen zu beraten. Wegen ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten bildeten sie im Rate der Fürsten "die notwendige Ergänzung zu den ritterbürtigen consiliarii". Als Zeugen und gelegentlich als Mitsiegler 1 ) traten sie für die in den Ratsverhandlungen getroffenen Entscheidungen der Fürsten ein. Auch wurden sie gelegentlich zusammen mit anderen fürstlichen Räten beauftragt und bevollmächtigt, im Namen der Fürsten


|
Seite 65 |




|
Rechtsgeschäfte abzuschließen 1 ). Im Jahre 1328 nahm der Notar Meynardus im Auftrage seines Herrn den Schoß von Rostock in Empfang 2 ). Häufig wurden Kanzler oder Schreiber von den Fürsten zu den Vögten entsandt mit dem Auftrage, größere oder kleinere Geldbeträge anzufordern 3 ). Das Geld wurde ihnen dann meist wohl gegen Vorzeigung einer mit dem Siegel des Herzogs versehenen Anweisung ausgehändigt 4 ). Mit Vorliebe wurden die Kanzler mit diplomatischen Missionen betraut. Kein Hofbeamter ist in den 60er und 70er Jahren des 15. Jahrhunderts so häufig zu Verhandlungen mit dem Lübecker und Stralsunder Rat, mit dem Kaiser oder gar dem Papst verwendet worden wie die Kanzler und Sekretäre Heinrich Bentzien und Thomas Rode 5 ). Auch die Verhandlungen mit dem Schweriner Bischof in den Jahren 1447 und 1448 wegen Aufnahme von Anleihen wurden von Beamten der Kanzlei geführt und zwar von dem Schreiber Heinrich Reventlow (1447) und dem Kanzler Johann Hesse und Heinrich Bentzien (1448) 6 ). Die Verwendung der Kanzler zu den allgemeinen Verwaltungs- und Regierungsgeschäften läßt sich wohl mehr herleiten aus den Aufgaben, die sie als herzogliche Räte zu erfüllen hatten, als aus ihren Pflichten, die ihnen als Schreiber oblagen. In seiner Funktion als Schreiber hatte der Kanzler, unterstützt durch die übrigen Kanzleibeamten, den gesamten Schriftverkehr der fürstlichen Verwaltung zu bewältigen. Dabei ist zunächst festzustellen, daß, wie in der fürstlichen Verwaltung im allgemeinen, so auch speziell im Geschäftsbetrieb der Kanzlei eine strenge Abgrenzung der Kompetenz nicht zu beobachten ist. Der Kanzler hatte zwar als Vorstand der Kanzlei die Notare und Schreiber zu beaufsichtigen und war verantwortlich für eine gewissenhafte und geregelte Geschäftsführung, jedoch erledigte er die Geschäfte der Kanzlei gemeinsam mit den übrigen Kanzleibeamten. So sind beispielsweise im 15. Jahrhundert die Urkunden bald vom Kanzler, bald von den Sekretären konzipiert


|
Seite 66 |




|
worden 1 ). Und selbst das mechanische Geschäft der Urkundenregistrierung ist gelegentlich vom Kanzler besorgt worden. Ein großer Teil der Einträge in das vom Kanzler Kröpelin 1361 angelegte Register stammt von der Hand des Kanzlers.
Zu den wichtigsten und ständigen Aufgaben der Kanzlei gehörte die Herstellung der Urkunden. Im 12. bis 13. Jahrhundert, als die Urkunden noch zu einem großen Teil von Empfängerhand hergestellt wurden, beschränkte sich die Tätigkeit der Hofnotare bei dem Beurkundungsgeschäft vor allem auf Prüfung und Beglaubigung der Urkunden 2 ). Seitdem aber die Empfängerherstellung seltener wurde, steigerte sich der Anteil der Kanzlei an dem Beurkundungsgeschäft. Entscheidungen, welche die mecklenburgischen Fürsten persönlich bzw. nach Beratung mit den consiliarii trafen, erhielten in der fürstlichen Kanzlei ihre urkundliche Form.
Während vor Entstehung einer organisierten Kanzlei das fürstliche Siegel, welches an den Urkunden zur Beglaubigung befestigt wurde, sich anscheinend im Gewahrsam der Hofnotare befand, trug in späterer Zeit der Kanzler als Vorstand der Kanzlei und Leiter der Kanzleigeschäfte die Verantwortung für rechtmäßigen Gebrauch des Siegels. Lisch 3 ) sieht in den fürstlichen Siegeln "die eigentlichen Insignien oder Amtszeichen des Kanzlers", welche dieser "notwendig allein und mit Verantwortlichkeit führen mußte". Der Kanzler verwahrte nicht nur das Siegel, sondern scheint meist auch die Urkunden selbst gesiegelt zu haben. Wo einmal in den Quellen diejenige Persönlichkeit kenntlich gemacht ist, welche die Siegelung ausführte, da ist als Siegelnder der Kanzler genannt 4 ).


|
Seite 67 |




|
Der Kanzler hatte mit Hilfe seiner Beamten die gesamte private und amtliche Korrespondenz der Fürsten zu führen. Notizen über die Aufträge, die man entgegengenommen und für deren Erledigung man Sorge zu tragen hatte, finden sich gelegentlich auf Briefkonzepten 1 ). Ferner wird es Aufgabe des Kanzlers gewesen sein, seinem Herrn die Kenntnis der eingegangenen Schriftstücke zu vermitteln. Auch bei den Landtagsverhandlungen scheinen dem Kanzler bestimmte Funktionen obgelegen zu haben. Aus dem einzigen aus dem Mittelalter erhaltenen mecklenburgischen "Landtagsprotokoll" geht hervor, daß der Kanzler nicht nur über die Verhandlungen protokollierte, sondern auch die Stände mit dem Inhalt der etwa zu verhandelnden kaiserlichen Mandate oder dergleichen bekannt machte 2 ).Auch auf dem Gebiete der Finanzverwaltung waren Kanzler und Notare tätig. Das älteste Aktenstück über die Verwaltung


|
Seite 68 |




|
des Haushaltes der mecklenburgischen Fürsten stammt von der Hand des Kanzlers Bertram Behr 1 ). Dieses Schriftstück, bestehend aus 13 Blättern in Folioformat, enthält die Verrechnung der in der ersten Hälfte des Jahres 1354 für den Herzog Albrecht II. eingenommenen und ausgegebenen Gelder 2 ). Häufig lesen wir in den Urkunden, daß durch den Kanzler, Notar oder Sekretär Gelder an Gläubiger der mecklenburgischen Fürsten in deren Namen ausbezahlt 3 ) oder über eingegangene Beträge Empfangsbescheinigungen ausgestellt wurden 4 ).
Durch ihre technischen Fertigkeiten und Kenntnisse waren Kanzler und Notare in erster Linie dazu befähigt, die Fürsten in der Kontrolle des Rechnungswesens zu unterstützen. Freilich hat im Mittelalter eine regelmäßige Kontrolle der Vögte oder Geldeinnehmer durch die mecklenburgischen Fürsten bzw. durch die Kanzlei allem Anschein nach nicht stattgefunden, da in Mecklenburg bis zum Ende des 15. Jahrhunderts eine geordnete Finanzverwaltung überhaupt nicht existierte. Die Vogteien des Landes waren selbständige Wirtschafts- und Verwaltungsbezirke, welche unmittelbar unter der Person des Fürsten standen 5 ). Deshalb möchte ich die Bezeichnung der mecklenburgischen Kanzlei als "Oberrechnungsbehörde", wie etwa die Kanzlei der Wettiner von H. B. Meyer 6 ) genannt wird, vermeiden. Die mecklenburgischen Fürsten rechneten nur gelegentlich, nicht zu bestimmten Terminen, sondern nach der Amtszeit der Vögte oder über eine beliebige Reihe von Jahren oder Monaten mit den Vögten ab 7 ). Die Abrechnungen erfolgten nicht in der Kanzlei, wie z. B. durchweg in der Mark Brandenburg 8 ), sondern der Herzog ließ in der Regel die


|
Seite 69 |




|
Vögte mit den von ihnen geführten Rechnungsbüchern zur Rechnungslegung dorthin kommen, wo er gerade sich aufhielt 1 ). Aus den in größerem Umfange besonders aus der Zeit Heinrichs IV. (1436 - 77) erhaltenen Abrechnungen geht hervor, daß der Herzog meist "dorch" oder "vermiddelst" seiner Kanzleibeamten - Kanzler oder Sekretäre - , ganz selten durch andere Personen - Zöllner, Pfarrer, Räte - mit den Vögten abrechnen ließ. Die Kanzleibeamten dienten lediglich als Beauftragte oder technische Hilfskräfte bei der Abrechnung. Sie hatten das Durchrechnen der Rechnungsbücher, welche die Grundlage der Revision bildeten, zu erledigen. Vor Zeugen stellten sie die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben der Vogtei fest. Darauf wurden über das Ergebnis der Abrechnung zwei gleichlautende Schriftstücke ausgefertigt, von denen das eine dem Vogt ausgehändigt, das andere in der Schreibstube der mecklenburgischen Herzöge, die zugleich als Archiv diente, zur Kontrolle der Verwaltung aufbewahrt wurde 2 ).
In den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts hat gelegentlich der Sekretär Hermann Widenbrügge die Abrechnungen ausgeführt 3 ), seit etwa 1463 sind die meisten Abrechnungen durch den Schreiber und späteren Kanzler Thomas Rode vollzogen 4 ), während seit 1472 auch der Sekretär Laurentius Stoltenborg hin und wieder die Rechnungsbücher der Vögte revidierte 5 ). Gelegentlich waren auch mehrere Kanzleibeamte zusammen an der Abrechnung beteiligt 6 ).
Zu den wichtigsten Bedürfnissen einer einigermaßen geordneten Verwaltung gehört das Registraturwesen. Wie der Schriftverkehr fast der gesamten Verwaltung vom Kanzler und seinen


|
Seite 70 |




|
Beamten bewältigt werden mußte, so war auch Anlage und Führung der Geschäftsbücher, welche erst eine Kontrolle der Verwaltung und eine Übersicht über die Verwaltungstätigkeit ermöglichten, Sache der Kanzlei als Hilfsorgan der gesamten Verwaltungstätigkeit der Herrscher und ihrer Räte. (Über die mecklenburgischen Kanzleibücher vgl. unten § 2 S. 71 ff.)
Wie in anderen Territorien 1 ), so war auch in Mecklenburg der Kanzler, wie es scheint, zugleich Vorsteher des fürstlichen Archives. Die archivalischen Schätze der mecklenburgischen Fürsten wurden nicht nur zum großen Teil in der Schreibstube im Schweriner Schlosse aufbewahrt, sondern auch von Beamten der Kanzlei verwaltet. Das darf man wohl aus dem Ende des 15. Jahrhunderts in der Kanzlei entstandenen Urkundenrepertorium schließen, welches die Titel führt "Registrum certarum litterarum existencium in custodia cancellarie dominorum Magnopolensium" oder "registratura der vorsigelten brieffe In der meckelnburgischen Cantzeley zu Sweryn vorwart", wie es auf dem Umschlage genannt wird 2 ). Die recht bedeutende Anzahl der erhaltenen Urkunden, welche gerade den Landesteil der mecklenburgischen Linie und die Angelegenheiten dieses Hauses betreffen, beweist uns hinlänglich, welche Aufmerksamkeit die mecklenburgischen Fürsten von je her ihrem eigenen Archive schenkten. Bei der Vereinigung der einzelnen Teilherrschaften mit dem Herzogtum Mecklenburg waren sie aufs sorgsamste darauf bedacht, auch den archivalischen Nachlaß der einzelnen Fürstenhäuser zu erwerben und ihrem Archive einzuverleiben 3 ). In dem Archive wurden auch manche für die Kontrolle der Verwaltung wichtigen Schriftstücke, Konzepte, Registerlagen, die Abrechnungen und vor allem die Rechnungsbücher der


|
Seite 71 |




|
Vögte aufbewahrt. Um das mecklenburgische Archiv haben besonders im 16. Jahrhundert die Kanzler Caspar von Schönaich und Dr. Wolfgang Ketwigk, ferner der Sekretär Samuel Fabricius und der Notar Daniel Clandrian sich bleibende Verdienste erworben 1 ).
§ 2.
Die mecklenburgischen Kanzleibücher, insbesondere die Register.
Im Vorwort zum M. U.-B. 2 ) spricht Lisch sein Bedauern darüber aus, daß die Konzeptbücher, Lehnsrollen und Register aller Art aus älterer Zeit nicht bei den Urkunden aufbewahrt und somit zum größten Schaden der mecklenburgischen Landesgeschichte verloren gegangen sind. Mit dieser Bemerkung setzt Lisch voraus, daß im Mittelalter auch in Mecklenburg Geschäftsbücher zur Kontrolle der Verwaltung geführt wurden. Diese Voraussetzung ist allein schon auf Grund der allgemeinen Erwägung berechtigt, daß die spätmittelalterliche Verwaltung besonders größerer Territorien sich kaum vorstellen läßt ohne Geschäftsbücher, welche Kontrolle und Übersicht über die Verwaltungstätigkeit ermöglichten. Je mehr sich die deutschen Territorien zu selbständigen staatlichen Gebilden ausgestalteten, desto größer wurde das Bedürfnis der Verwaltung nach solchen Geschäftsbüchern. Besonders die Finanzverwaltung machte Aufzeichnungen, Steuerverzeichnisse, Rechnungsbücher und dgl. erforderlich 3 ). Lehenbücher unterrichteten über den Besitzstand der Fürsten und die militärischen Pflichten der fürstlichen Vasallen 4 ). Die wichtigste Gruppe der Geschäftsbücher der Verwaltung sind die eigentlichen Kanzleibücher, insbesondere die Register.
Die Anfänge der Registerführung an deutschen Fürstenhöfen fallen in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Registerführung bürgerte sich in den landesfürstlichen Kanzleien etwa


|
Seite 72 |




|
um dieselbe Zeit wie in der Reichskanzlei ein 1 ). Unter Register im diplomatischen Sinne verstehen wir "Bücher, in welchen Kopien oder Auszüge der auslaufenden Schriftstücke einer Kanzlei eingetragen werden" 2 ). Durch die Registrierung der auslaufenden Schriftstücke wahrten sich die Fürsten den Überblick über die eigenen Verfügungen und konnten sich jederzeit zu politischen oder rechtlichen Zwecken auf die Register berufen.
Wie bereits angedeutet wurde, ist es mit der Überlieferung der mecklenburgischen Geschäfts- und Kanzleibücher schlecht bestellt. Jedoch die wenigen uns erhaltenen Überreste legen Zeugnis davon ab, daß auch in der mecklenburgischen Kanzlei der Brauch, Geschäftsbücher zu führen, wenigstens zu bestimmten Zeiten nicht unbekannt war. Abgesehen von einer Anzahl von Rechnungsbüchern aus dem 15. Jahrhundert, die von den fürstlichen Lokalbeamten geführt wurden und deshalb von unserer Betrachtung ausgeschlossen werden sollen, sind uns nur eine Lehnsrolle der Grafen von Schwerin, zwei Registerhefte und ein Lehnsregisterheft der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin erhalten.
Über die Lehnsrolle der Grafen von Schwerin, welche eine allerdings wohl unvollständige Zusammenstellung der linkselbischen Besitzungen der Grafen enthält, können wir uns kurz fassen, da sie bereits mehrfach abgedruckt und eingehend besprochen worden ist 3 ). Sie ist in der Form einer Urkunde abgefaßt. Das Pergament war von vornherein zu klein geschnitten, sodaß der Schreiber auch die Rückseite benutzen mußte. Die Lehnsrolle ist von den Herausgebern in 91 Paragraphen aufgeteilt. Die Para-


|
Seite 73 |




|
graphen 1 - 86 scheinen in einem Zuge von einem Schreiber geschrieben zu sein, §§ 87 - 88 sind von demselben Schreiber, aber wohl zu anderer Zeit hinzugefügt worden. Dagegen §§ 89 - 91 stammen, wie es scheint, von einer zweiten Hand.
Aus welchem Jahre die uns vorliegende Lehnsrolle stammt, läßt sich schwer bestimmen. Aus dem ersten Satze könnte man schließen, daß sie in der ersten Regierungszeit des Grafen Helmold II., also ungefähr 1274 oder 1275, geschrieben sei 1 ). Jedoch die Untersuchungen Maschs, v. Hammersteins und vor allem Lischs haben ergeben, daß aus inneren Gründen die Lehnsrolle in der Gestalt, wie sie uns vorliegt, später abgefaßt sein muß 2 ). Es hat die größte Wahrscheinlichkeit für sich, daß die Rolle, wie sie uns erhalten ist, nicht lange nach dem Regierungsantritt des Grafen Gunzelin V., also Ende 1296 oder im Jahre 1297, "als die Vasallen zur Muthung ihrer Lehne geladen wurden", von einem älteren durchkorrigierten Exemplar abgeschrieben und am Schluß vom Grafen Gunzelin fortgesetzt ist 3 ).
a) Aus der Zeit des Kanzlers Johannes Kröpelin (1361 - 62) sind uns zwei Registerhefte erhalten; beide haben Folioformat. Sie werden im Schweriner Archiv unter "Schuldbriefe I, 23/24" aufbewahrt.
Das erste Heft besteht aus einer sechs Bogen starken Lage, anscheinend aus Baumwollpapier 4 ). Die 24 Seiten des Heftes, welche keinerlei Numerierung von gleichzeitiger Hand aufweisen, sind sämtlich beschrieben. Die Lage ist geheftet mit einem zusammengedrehten Papierfaden. Da das Heft durch keinen Einband geschützt war, haben sich die beiden äußeren Blätter von dem Heftverband abgelöst und werden bei dem Registerheft verwahrt.
Wie aus der Überschrift hervorgeht, ist dieses erste mecklenburgische Register am 20. März 1361 von dem Protonotar und Kanzler Johannes Kröpelin angelegt worden. Die Überschrift, die aber offenbar nicht von der Hand des Kanzlers herrührt, lautet: "Incipit registrum, inchoatum per Johannem Crö-


|
Seite 74 |




|
pelin, prothonotarium illustris principis domini Alberti ducis Magnopolensis etc. sub anno incarnacionis domini MCCCLX primo, sabbato ante dominicam Palmarum". Da Johannes Kröpelin an demselben Tage urkundlich zum erstenmal als mecklenburgischer Kanzleibeamter und zwar als Kanzleivorstand begegnet 1 ), so ist die Vermutung wohl berechtigt, daß die Anlage des Registers auf die Initiative des neuen Kanzleichefs zurückzuführen ist. Das Register enthält 31 Abschriften von Urkunden, welche größtenteils in der Zeit von März bis Juli 1361 ausgestellt worden sind. Im M. U.-B. sind aus diesem Zeitabschnitt außer den im Register enthaltenen nur drei Urkunden abgedruckt, welche im Register fehlen. Daraus können wir ersehen, daß in dieser Zeit ein recht beträchtlicher Teil der Urkunden registriert sein wird.
Der achte Eintrag trägt das Datum vom 6. Juni 1358. Jedoch bemerkt der Kanzler dabei, obgleich sein Vorgänger Bertram Behr die Urkunde noch hätte besiegeln müssen, so habe er doch auf besonderen Befehl seines Herrn am 20. Mai 1361 das fürstliche Siegel angehängt 2 ). Diese Urkunde ist also auch erst 1361 ausgehändigt. Der achtzehnte Eintrag ist die Abschrift von einer Urkunde aus dem Jahre 1359. Bei der fünfundzwanzigsten Abschrift fehlt jegliche Datierung. Im übrigen stammen die Urkunden aus dem Jahre 1361. Der fünfzehnte Eintrag, eine Verpfändungsurkunde, ist augenscheinlich zum Zeichen der Kassation durchstrichen. Der neunzehnte Eintrag enthält nur den Anfang einer Urkunde und ist ebenfalls durchstrichen. Der Herausgeber des M. U.-B. hält es für wahrscheinlich, daß das betreffende Konzept überhaupt nicht mundiert worden ist 3 ).
Das zweite aus der Zeit des Kanzlers Kröpelin stammende Register ist dem ersteren durchaus ähnlich. Es bestand ursprünglich aus einer sieben Bogen starken Lage aus Linnenpapier, wie es scheint 4 ). Jedoch von den letzten sieben unbeschriebenen Blättern sind drei abgetrennt, sodaß das Heft jetzt nur noch aus vierzehn beschriebenen und acht unbeschriebenen Blättern besteht. Es hat, wie auch das ältere Heft, Folioformat und ist in ebenderselben Weise mit einem zusammengedrehten Papierfaden ge-


|
Seite 75 |




|
heftet. Auf den frei gebliebenen Blättern finden sich mitunter Zeichnungen und Sprüche von der Hand späterer Schreiber.
Das Heft enthält im ganzen 23 Abschriften von Urkunden Albrechts II., welche größtenteils während der Zeit vom 6. Februar bis 31. Oktober 1362 ausgestellt wurden. Von den in dieser Zeit in der herzoglichen Kanzlei ausgestellten Urkunden sind uns nach dem M. U.-B. 27 erhalten, von denen sich 18 Abschriften im Register finden. Man registrierte also mit Auswahl. Der achte Eintrag ist die Abschrift von einer Urkunde, welche als Datum den 22. November 1360 aufweist. Der Kanzler Kröpelin schickt dieser Kopie folgende Bemerkung voraus: "Item sequens litera decreta fuit ante tempus meum, sed tempore meo est sigillata. Cuius tenor talis est" (es folgt die Abschrift). Es handelt sich also hier um einen ganz ähnlichen Fall, wie er uns schon oben in dem älteren Register begegnet ist. Ferner sind in dieses Registerheft noch vier Urkunden aus dem Jahre 1360 und 1361 aufgenommen (Eintrag 7 - 10). Der siebzehnte Eintrag betrifft die Bestätigung eines Verkaufes seitens Johann v. Moltkes durch Albrecht II. In diesem Falle ist außer der Bestätigungsurkunde auch der Anfang der Moltkeschen Verkaufsurkunde mitgeteilt.
Beide Hefte sind so eingerichtet, daß die vier Ränder der einzelnen Seiten meist durch vertikale und horizontale Linien von der zu beschreibenden Fläche abgegrenzt und in der Regel frei gelassen sind. Mitunter haben die Schreiber aber auch über den Rand geschrieben. Auf die freigelassenen Ränder sind im 16. Jahrhundert von der Hand des späteren Kanzlers Caspar von Schönaich (1507 - 47) kurze Inhaltsangaben der einzelnen Urkunden und alle möglichen Randglossen, die sich auf den Inhalt der Abschriften beziehen, geschrieben worden, ein Zeichen, daß die Registerhefte auch noch in späterer Zeit praktische Dienste leisteten. Offenbar von der Hand Caspar von Schönaichs stammen auch die Unterstreichungen wichtiger Stellen in den einzelnen Kopien, besonders der Namen, Daten und Zahlen.
Grundsätzlich sind die Urkunden in ihrem vollen Wortlaut, nicht etwa in der Form kurzer Auszüge, registriert worden. Gelegentlich finden sich jedoch Kürzungen, besonders der Intitulatio und des Schlußprotokolls 1 ). Da die meisten Einträge von der Hand des Kanzlers Kröpelin stammen, so müssen sie zum größten Teil in den Jahren 1361 - 62 gemacht sein, in welchen er der mecklenburgischen Kanzlei angehörte.


|
Seite 76 |




|
Die Abschriften beider Registerhefte lassen sich ihrem Inhalte nach nicht unter einem gemeinsamen Gesichtspunkt zusammenfassen, sondern betreffen die verschiedensten Gebiete der Verwaltung und Regierung. Es sind Abschriften von Bestätigungs-, Verpfändungs-, Belehnungs-, Vertrags-, Schenkungsurkunden usw. Beide Hefte sind weder als "Konzept-" 1 ) noch als "Copeibücher" 2 ), sondern als allgemeine Register zu bezeichnen, da sie durchgehends Abschriften von Urkunden enthalten, welche einerseits die verschiedensten Gebiete der Verwaltung und Regierung betreffen, andererseits in der herzoglichen Kanzlei ausgestellt worden sind. Die Bezeichnung "registrum", wie sie sich in der Überschrift und unter dem achten Eintrag des älteren Heftes findet, entspricht durchaus der heutigen Terminologie.
Die Reihenfolge der Abschriften in beiden Registern ist nicht immer chronologisch. Die chronologische Anordnung ist im ganzen in dem zweiten Registerheft etwas strenger durchgeführt als in dem ersteren. Über die Frage, ob die Registrierung der Urkunden auf Grund der approbierten Konzepte oder nach den Reinschriften erfolgte, besitzen wir keine eindeutigen Zeugnisse. Jedoch hätten die Reinschriften als Grundlage der Registrierung gedient, so müßte sich in den Registern eine einigermaßen chronologische Anordnung der Abschriften beobachten lassen. Die beiden Register erwecken durchaus den Eindruck, als ob sie in aller Muße zusammengeschrieben wären. Man sammelte offenbar die Konzepte und fertigte die Abschriften an, wann sich gerade Zeit und Gelegenheit dazu fand. Es ergibt sich also als sehr wahrscheinlich, daß die Registrierung auf Grund der Konzepte erfolgte, und zwar ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt des Ausganges der Originale 3 ).
b) Ein weiteres uns erhaltenes Kanzleibuch stammt aus der Kanzlei Heinrichs IV. (1436 - 77) und unterscheidet sich wesentlich


|
Seite 77 |




|
von den beiden besprochenen Registerheften. Es wird im Schweriner Archiv aufbewahrt unter den Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefen und trägt die aus späterer Zeit stammende Signatur P. 93. Das Buch oder Heft besteht aus einer fünf Bogen starken Papierlage und einem Umschlagbogen, ebenfalls aus Papier. Die Lage hat Folioformat und ist mit einem schmalen Pergamentstreifen geheftet. Die Ränder der einzelnen Seiten des Heftes sind meist freigelassen, jedoch gelegentlich haben die Schreiber über den Rand geschrieben. Auf der oberen Seite des Umschlagbogens und auf den Rändern der einzelnen Seiten finden sich kurze Inhaltsangaben der Kopien, die zum Teil von der Hand des späteren Kanzlers Caspar von Schönaich, zum Teil aber auch von gleichzeitiger Hand stammen. Caspar von Schönaich hat, wie es scheint, auch die ersten beiden Blätter numeriert (fol. 1; fol. 2). Die einzelnen Einträge sind durchweg recht sorgfältig geschrieben. Besonders eine Hand, von welcher ein großer Teil sämtlicher Abschriften stammt, zeichnet sich durch peinliche Sauberkeit aus 1 ). Neben dieser begegnen noch mehrere andere Handschriften. Sehr flüchtig ist ein Eintrag auf dem letzten beschriebenen Blatt geschrieben. Ein längerer Passus, welchen der Schreiber in der Eile ausließ, ist auf dem linken Rande nachgetragen. Unter den einzelnen Abschriften finden sich häufig Kanzleivermerke, welche teils in einem Zuge mit dem dazu gehörigen Eintrag unter die Abschrift geschrieben worden sind, teils von einer anderen Hand nachgetragen wurden.
Das Registerheft enthält Abschriften oder Auszüge von 22 Urkunden, welche in den Jahren 1442 - 47 ausgestellt wurden. In den meisten Fällen ist Heinrich IV. der Aussteller. Jedoch sind auch Abschriften von einigen wichtigen Urkunden, welche für den Herzog ausgestellt wurden, in das Register aufgenommen: Abschriften von zwei Urkunden Kaiser Friedrichs III. für Heinrich IV., ferner von zwei Urkunden, worin zwei Lehnsmannen des Herzogs bekennen, daß dieser ihnen Burg und Schloß Gnoien bzw. Dömitz überantwortet habe. Die Urkundenabschriften betreffen mit wenigen Ausnahmen Belehnungen mit Grund und Boden, Einkünften und Gerechtsamen. Wir werden diese Abschriftensammlung vielleicht am besten als Sonderregister, speziell als Lehnsregister bezeichnen können 2 ).
Zu einem Teil sind die Urkunden in ihrem vollen Wortlaut, bisweilen nur mit Kürzungen im Titel und in der Endformel ab-


|
Seite 78 |




|
geschrieben. Fast die Hälfte (10 von den 22 Urkunden) ist dagegen nur in der Form von Regesten in das Registerheft aufgenommen. Die Abschriften sind keineswegs chronologisch angeordnet. So weist die achte Abschrift fast das späteste Datum von allen Einträgen auf (22. Februar 1447). Daraus geht offenbar hervor, daß zum wenigsten die Einträge 8 - 22, wahrscheinlich aber auch die ersten 7, frühestens aus dem Jahre 1447 stammen können, obgleich die meisten Abschriften ein früheres Datum tragen. Näheres läßt sich nicht ermitteln über die Frage, wann das Register angelegt ist bzw. wann die einzelnen Abschriften in das Register eingetragen wurden.
Bei der Registrierung dienten offenbar auch hier die approbierten Konzepte, nicht die Reinschriften als Grundlage. Das ergibt sich allein schon aus dem Umstand, daß die meisten Einträge, wie bereits bemerkt wurde, oft mehrere Jahre nach Ausfertigung der Urkunden gemacht wurden, als die Originale längst in dem Besitze der Empfänger waren. Die Vermutung, daß, wie in der Reichskanzlei und meist auch in den landesfürstlichen Kanzleien, so auch in der mecklenburgischen Kanzlei durchweg die Konzepte als Vorlage bei der Registrierung dienten, wird noch verstärkt durch die Beobachtung, daß einige Konzepte aus der Mitte des 15. Jahrhunderts ausdrücklich den Registrierungsbefehl "registretur" aufweisen 1 ).
~~~~~~~~~~
Es erhebt sich schließlich noch die Frage, ob die wenigen uns erhaltenen Registerbücher oder Hefte die einzigen in ihrer Art sind, welche aus der mecklenburgischen Kanzlei hervorgegangen sind. Diese Frage ist sicherlich zu verneinen. Freilich wird man sich vielfach damit begnügt haben, die Urkundenkonzepte zu sammeln und sorgfältig aufzubewahren. Sie bildeten einen dürftigen Ersatz für die zur Kontrolle der Verwaltung fast unentbehrlichen Register. Jedoch wie bereits erwähnt wurde, sind uns einige Konzepte aus der Mitte des 15. Jahrhunderts erhalten, auf denen sich der Registrierungsbefehl "registretur" findet. Das deutet darauf hin, daß auch um 1450 in der mecklenburgischen Kanzlei registriert wurde.


|
Seite 79 |




|
Ferner befindet sich im Schweriner Archiv "ein in Pergament geheftetes, hinten, auch sonst defektes Convolut", welches "einige Register über die Güter im Toitenwinkel und dessen Pertinenzien wie auch verschiedene Kopien der von den Moltken ausgestellten Pfandverschreibungen" aus den Jahren 1441 - 73 enthält. Wie das Lehnsrepertorium des Schweriner Archivs (unter "Toitenwinkel") fernerhin angibt, ist das Buch 123 Folien stark, von denen Fol. 113 und 122 fehlen. Leider ist eine nähere Untersuchung dieses Registers nicht möglich, da es zur Zeit im Schweriner Archiv trotz aller Bemühungen nicht aufzufinden ist. Die Frage, ob dieses Register aus der mecklenburgischen Kanzlei hervorgegangen ist, läßt sich vorläufig nicht mit Bestimmtheit beantworten. Überhaupt ist es nicht ausgeschlossen, daß noch weitere Register der mecklenburgischen Herzöge aus dem späteren Mittelalter irgendwo unentdeckt und im Verborgenen ruhen, wie bis vor kurzem etwa die Register der Grafen und Herzöge von Cleve-Mark, welche von Ilgen in einer Privatbibliothek aufgefunden wurden 1 ). Wenn uns auch nur wenige Bruchstücke von mecklenburgischen Registern erhalten sind, so dürfen wir jedenfalls aus der mangelhaften Überlieferung nicht den verfrühten Schluß ziehen, daß der mecklenburgischen Kanzlei im Mittelalter der Brauch der Registerführung fremd gewesen sei.
~~~~~~~~~~


|
Seite 80 |




|
Anlage I.
Zusammenstellung des Kanzleipersonals 1 ).
A. Liste des Kanzleipersonals der Grafen von Schwerin.
| Hermann, Notar, 1217. | |
| Giselbert, Notar (auch scriptor genannt), 1227, 1235. | |
| Albert, Notar (auch scriptor genannt), 1251 - 55. | |
| Hoger, Notar, 1270; Hofkaplan bis 1275 2 ). | |
| Werenbert, Notar, 1270 - 74 3 ). | |
| Linie Schwerin (stirbt 1344 mit Graf Heinrich III. aus). | Linie Wittenburg - Boizenburg (1274-1356). |
| Conrad, Notar, 1282 - 84; Hofkaplan bis 1300. | Werenbert, Notar, 1282, Hofkaplan bis 1297. |
| Borchard v. Crivitz, Notar, 1304. | Luderus, Notar, 1289. |
| Petrus v. Bützow, Notar, 1332. | Nikolaus, Notar, 1296. |
| Lambertus Rochow, Notar, 1333. | Gerhard, Notar, 1323 - 25. |
| ~~~~~~ | Martin, Notar, 1331. |
| Johannes, Notar, 1335. | |
| Bernhard Parzow (Passow),1349. | |
| Helmold, Notar, 1349. | |
| Otto I., Sohn Gunzelins VI. von Wittenburg, regiert zu Schwerin 1344 - 56. | |
| Albert Foysan, Notar, 1349; 1353 (später noch Hofkaplan). | |
| Johannes v. Schepelitz , Protonotar, 1354 - 56. | |


|
Seite 81 |




|
Wiedervereinigung der beiden gräflichen Linien unter Nikolaus III. und seinem Sohn Otto II. im Jahre 1356.
Johannes v. Schepelitz, ouerster schriuer 1356 1 ), Notar, 1357.
Werner Struwe, Kanzler, 1357.
B. Liste des Kanzleipersonals der mecklenburgischen Fürsten und der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin.
I.
Die mecklenburgischen Hofnotare bis zur erstmaligen Erwähnung eines Kanzleivorstandes (1323) 2 ).
- Eustachius, Notar, 1219.
- Conrad, Notar (auch scriptor gen.), 1226 - 44.
- Rudolf, Notar, 1231 - 46.
- Arnold, Notar, 1242.
- Berthold, Notar, 1248.
- Heinrich, Notar, 1256 - 65.
- Johannes, Notar, 1266 - 69.
- Gottschalk, Notar, 1266 - 79.
- Heinrich v. Kamin, Notar (auch Scholar gen.), 1296 bis 1300.
- Johann, Notar, 1297.
- Johannes Vogel, Notar, 1305 - 7.
- Nikolaus, Notar, 1310.
- Rothgerus, Notar, 1310 - 1323.
- Christian v. Dolla, Notar, 1313.
II.
Das mecklenburgische Kanzleipersonal seit
dem erstmaligen Auftreten eines
Kanzleivorstandes (1323)
bis zum
Tode Herzog Heinrichs IV. v.
Mecklenburg-Schwerin (1477).
-
Rothgerus, Protonotar, 1323 - 29
3
).
Heinrich Frauenburg, Notar, 1324 - 26.
Johannes v. Prenzlau, Notar, 1327 - 29; 1334.


|
Seite 82 |




|
Heinrich, Notar, 1326 - 29.
Meinhard, Notar, 1327 - 29.
Antonius v. Plessen, Notar, 1327 - 29.
Nikolaus Manteuffel, Notar, 1328.
Hilaricus, Notar, 1329.
-
Berthold Rode, Kanzler (auch Protonotar,
1351 maior notarius genannt), 1337 -
51.
Helmold v. Plessen, Notar, 1339 - 40.
Gottfried, Notar, 1340 - 44.
Markwart, Notar, 1345.
Johannes Raboden, Notar, 1346 - 50.
Heinrich v. Griben, Notar, 1349 - 51.
Heinrich Rode, Notar, 1349 - 51.
Johannes Suhm, Notar, 1351. -
Bertram Behr, Kanzler (gelegentlich auch
Protonotar genannt), 1352 - 60; 1363.
Heinrich Rode, Notar, 1352 1 ).
Gottschalk, Notar, 1353.
Heinrich v. Griben, Notar, 1359 2 ).
Bernhard Mallin, Notar, 1359 - 60. - Johannes Kröpelin, Kanzler(auch als Protonotar erwähnt), 1361 - 62.
-
Johannes Schwalenberg, Kanzler, 1366 -
74.
Heinrich Sluz, Notar, 1366.
Martin Schütz, Notar, 1373 - 74. -
Albert Konow, Kanzler, 1375 - 79.
Albert Schweder, 1377.
Johann Wittenburg, Notar, 1380. -
Johann Reinwerstorf, Kanzler, 1384.
Johann Möller, 1385 3 ). -
Detlev v. Siggen, Kanzler, 1386.
Johannes v. Bentlage, 1388.
Arnold Kran, Notar, 1395 (schon früher Hofgeistlicher). - Karl Hakonsson, Kanzler, 1396 - 99.


|
Seite 83 |




|
- Johannes v. Bentlage, Kanzler, 1406 - 7 1 ).
-
Henning Slapelow, Kanzler, 1409.
Johannes Roggentin, 1409. -
Nikolaus Reventlow, Kanzler, 1415 - 38.
Johannes Kremer, Sekretär und Schreiber, 1412 - 30.
Johann Achim, 1428.
Gerhard Brüsewitz, Sekretär, 1430 - 31.
Henning Karutze, 1437. -
Henning Karutze, Kanzler, 1440 - 46
2
).
Johannes Hesse (seit 1440 als Schreiber, seit 1444 als Kanzler, Protonotar oder Vizekanzler erwähnt).
Johann Mack, 1443 - 44. -
Johannes Hesse, 1444 - 49 abwechselnd als
Kanzler, Protonotar oder Vizekanzler erwähnt
3
).
Heinrich Reventlow, 1447.
Heinrich Bentzien, Sekretär seit 1447. -
Heinrich Bentzien, Kanzler, 1459; 1464. Als
Vizekanzler 1459 erwähnt; sonst Sekretär
oder Schreiber genannt
4
).
Hermann Widenbrügge, Sekretär, 1450 - 62.
Johannes Raden, 1456 - 63.
Thomas Rode, Schreiber und Sekretär, 1461 - 69.
Johann Berner, 1465 - 69. -
Thomas Rode, Kanzler, 1469 - 1486.
Johann Berner, 1469 - 70 5 ).
Joachim Heydeberg, Sekretär seit 1471 6 ).
Laurentius Stoltenborg, Sekretär seit 1472.
~~~~~~~~~


|
Seite 84 |




|
Anlage II.
Zusammenstellung der Kanzleivermerke unter den Urkunden der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin.
Die Kanzleivermerke sind die wichtigste Quelle für die Erforschung des Geschäftsganges einer mittelalterlichen Kanzlei. Sie finden sich unter Urkunden der mecklenburgischen Herzöge seit dem Jahre 1442 auf Originalen, Konzepten und Abschriften. Sie bilden keineswegs einen notwendigen Bestandteil jeder Urkunde, sondern treten nur gelegentlich auf. Die Vermerke sind stets lateinisch formuliert, auch in solchen Urkunden, deren Text in deutscher Sprache abgefaßt ist. Auf Originalen und Konzepten sind die Vermerke in der Regel von der Hand desselben Schreibers geschrieben, von welchem auch der Text der betreffenden Urkunde stammt. Auf Registerabschriften sind sie gelegentlich von anderer Hand nachgetragen. Sämtliche Kanzleivermerke, die mir auf Originalen begegnet sind, stehen rechts auf der äußeren Seite des umgeschlagenen Buges. Auf Registerabschriften und Konzepten befinden sie sich rechts unter dem Text.
Die unten folgende Zusammenstellung der mecklenburgischen Kanzleivermerke, die ich habe ermitteln können, ist nach chronologischen Gesichtspunkten angefertigt. Außer dem genauen Wortlaut der Vermerke ist regelmäßig Datum, Inhalt und Fundort der betreffenden Urkunde, unter welcher mir ein Kanzleivermerk begegnet ist, angegeben.
|
|
|||
| Datum | Inhalt der Urkunde | Fundort | Kanzleivermerk |
|
|
|||
|
1.
1385 20. I. Schwaan |
Albrecht, König v. Schweden, verleiht dem Rostocker Bürgermeister Johann von der Aa Dorf und Höfe Lütten-Klein. | M. U.-B. XX, Nr. 11 653 | Jo. Mollr. |
|
2.
1442 - Wilsnack |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verleiht dem Jaspar Ganz, Herrn zu Putlitz, und seinem Bruder die Dörfer Rebzin, Menzendorf und Möllenbeck. |
Gedr. M.
J.-B. XXV, S. 315
S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XII. |
dominus mandauit et examinauit. |
|
3.
1443 - Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verleiht Gerd Bassewitz Hof und Dorf Körchow. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XV. | r. dominus per se et examinauit. |


|
Seite 85 |




|
|
|
|||
| Datum | Inhalt der Urkunde | Fundort | Kanzleivermerk |
|
|
|||
|
4.
1443 29. IX. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verleiht Johann Bassewitz Hof und Dorf Levetzow, den Hof zum Kalenberg und den Wenthof. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XIV. | dominus per se iussit et examinauit. |
|
5.
1443 4. XII. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verleiht der Ehefrau Wedegen v. Zülows 70 Mark lüb. Pfennige in dem Dorfe Stralendorf zum Leibgedinge. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XVI. | dominus per se iussit et examinauit. |
|
6.
1443 10. XII. Rostock |
Herzog Heinrich IV. bestätigt nach empfangener Huldigung den Rostocker Bürgern die Gerechtsame der Stadt. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XI. | de mandato domini et fideliter cum predictis consiliariis examinauit Jo. Hesse. |
|
7.
1443 11. XII. Rostock |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, spricht Rostock frei aus der Reichsacht, mit Vollmacht von Kaiser Friedrich III. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 IX. | dominus per se mandauit coram predictis etc. |
|
8.
1444 1. I. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, schenkt die auf die Dorfleute des Dorfes Papendorf gelegten Dienste, Beden und Ablager oder sonstigen Auflagen seinem getreuen Schreiber Johannes Hesse, z. Zt. Kirchherrn zu St. Petri in Rostock, auf Lebenszeit. | Orig. S.A.Domst. Rost. Nr. 19. Abschrift in Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 III. | de mandato domini per se et examinauit coram consiliariis in Wissmaria. Der Vermerk fehlt auf dem Original. |
|
9.
1444 12. IX. - |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bekennt, daß vor ihm und einigen seines Rates der Knappe Gottschalk Preen zu Bibow die Hälfte seines Besitzes in den Dörfern Bibow, Breesen, Ventschow und Jesendorf dem Johann Bassewitz für 2000 Mark lüb. aufgelassen hat. Der Herzog belehnt letzteren mit den genannten Gütern. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 IV. | de mandato domini ducis et examinauit coram consiliariis. |
|
10.
1445 1. X. Rehna |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verleiht den fürstlichen Anteil des Dorfes Bentze (Gerichtsbarkeit usw.) an seinen Kammermeister Otto Vieregge, jedoch mit Vorbehalt der Bede. | S.A.Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 V. | de mandato domini et examinauit coram consiliariis supradictis. |


|
Seite 86 |




|
|
|
|||
| Datum | Inhalt der Urkunde | Fundort | Kanzleivermerk |
|
|
|||
|
11.
1446 26. I. Rostock |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, eignet dem Kloster Marienehe die Dörfer Gr. und Kl. Retze zu mit allem Zubehör und nimmt das Kloster in seinen Schutz. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 VI. | de mandato domini Magnopolensis et examinauit cum suis consiliariis in Parchim suprascriptis. |
|
12.
1446 11. III. Plau |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, belehnt Wulf v. Oldenburgs Ehefrau Katharina mit Gülte und Pacht aus dem Dorfe Tolzin und Siraue. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XVII. | dominus per se iussit et examinauit. |
|
13.
1446 17. III. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verkauft wiederkäuflich dem Propst, Dekan, den Domherrn und Vikarien der Kirche zu Schwerin 4 Mark lüb. jährl. Gülte aus der Bede in dem Dorfe Warnitz. | Orig. S.A. Bistum Schwerin Nr. 138. | de mandato domini Jo. Hesse. |
|
14.
1446 12. IV. Neustadt |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, belehnt Heinrich Grapen und seine Ehefrau Katharina mit allen ihren Gütern in Mecklenburg. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XVIII. | dominus per se iussit et examinauit. |
|
15.
1446 25. V. Rostock |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, erlaubt seinem Getreuen Arnd Hasselbeck, seine verpfändeten Güter zu gebrauchen. | S.A. Lehnsakten, Lehns- und Konsensbriefe P. 93 XIX. | de mandato domini et examinauit. |
|
16.
1446 25. VII. Doberan |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verpfändet an Claus Kosse zu Teschow 43 Mark 4 Schill. sund Bede, 6 Scheffel Hundekorn usw. im Dorfe Cammin und höchstes Gericht und Dienst des ganzen Dorfes. | Orig. S.A. Gutsurkunden Cammin (Güstrow). | de mandato domini Magnopolensis et examinauit coram predictis consiliariis. |
|
17.
1446 11. XI. - |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verkauft wiederkäuflich dem Prior und Konvent des Klosters zu Marienehe 15 Mark lüb. jährl. Gülte aus seiner Bede im Dorfe Klein-Schwaß (Kirchspiel Biestow) für 300 Mark lüb., womit er 20 Mark lüb. jährl. Gülte der genannten Bede eingelöst hatte. | Orig. S.A. Klosterurkunden Marienehe. | de mandato domini Hinrici Magnopolensis et per se examinauit. |


|
Seite 87 |




|
|
|
|||
| Datum | Inhalt der Urkunde | Fundort | Kanzleivermerk |
|
|
|||
|
18.
1447 3. VIII. Güstrow |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bewilligt auf Bitten seines Vizekanzlers Johann Hesse, daß dem Arnd Landesberger 20 Mark sund. Rente aus dem Dorfe Papendorf für 250 Mark wiederkäuflich verkauft werden dürfen. | Orig. S.A. Gutsurkunden Papendorf. | de mandato domini Magnopolensis Hinricus Bentzien. |
|
19.
1448 8. IX. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, leiht, nachdem seine Vorfahren den Lützows, herzoglichen Marschällen, wohnhaft zu Grabow, Schloß, Stadt und Land Grabow für 6000 Mark lüb. verpfändet hatten, von den jetzigen Lützows noch 1000 rh. Fl. dazu auf dasselbe Pfand. | Orig S.A. Amtsurkunden Grabow. | de mandato domini ducis Hinricus Bentzien. |
|
20.
1454 8. XI. Ribnitz |
Heinrich d. ä. von Stargard und Heinrich IV., Herzoge von Mecklenburg, bescheinigen den Empfang von 910 Rhein. Gulden der Summe, die ihnen die Städte Stralsund, Greifswald und Demmin mit ihren Mitlobern schulden. | Orig. Stadtarchiv Stralsund, Schrank VI, 5. | de mandato dominorum ducum supradictorum Hinricus Bentzin subscripsit. |
|
21.
1454 25. XI. Ribnitz |
desgl. den Empfang von 450 Rhein. Gulden. | desgl. | de mandato dominorum ducum Mangnopolensium etc. Hinricus Bentzin. |
|
22.
1461 11.V. Rostock |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bestätigt für sich und seine Söhne den Bürgermeistern und Ratmännern der Stadt Rostock alle ihre Privilegien. Er gelobt den Rostockern, sie zu beschirmen, so daß man sie nicht außerhalb der Stadt vor Gericht ziehen darf. | Konzept S.A. Stadturkunden Rostock. | ad mandatum domini Thomas Rode scripsit. |
|
23.
1461 - Lübeck |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bekennt, dem Lübecker und Schweriner Domherrn Cord Loste auf die diesem schon verpfändete Bede zu Lübberstorf 40 Mark lüb. geliehen zu haben, so daß die Lösungssumme nun 240 Mark beträgt. | Orig. S.A. Gutsurkunden Lübberstorf. | ad mandatum domini Thomas Rode scripsit. |
|
24.
1466 18. VII. Schwerin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, verkauft wiederlöslich den Gebrüdern v. Sperling 22 Mark Bede in Zickhusen für 300 Mark. | Orig. S.A. Schuldbriefe I Nr. 257. | de mandato domini Thomas Rode scripsit. |


|
Seite 88 |




|
|
|
|||
| Datum | Inhalt der Urkunde | Fundort | Kanzleivermerk |
|
|
|||
|
25.
1469 25. IV. - |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, konsentiert, daß die Smeker dem Kloster zu Marienehe ihre Güter, Hufen, Höfe usw. zu Elmenhorst (Vogtei Schwaan) mit Gerichten, Diensten und aller Gerechtigkeit verkauft haben. | Kopie oder Konzept S.A. Klosterurkunden Marienehe. | ad mandatum domini Thomas Rode subscripsit. |
|
26.
1471 8. V. - |
Albrecht und Johann, Herzöge von Mecklenburg, bekennen, daß ihnen der Bischof Johann v. Ratzeburg 300 Mark lüb., die dieser ihnen schuldig war, bezahlt hat, und quittieren ihm darüber. Der Herzog Johann siegelt für beide. | Orig. S.A. Bistum Ratzeburg copiale II Nr. 00. | de mandato eorundem illustrium et altigenitorum praedictorum Alberti et Johannis fratrum SlaviaeInferioris etc. Vicko Dessin secretarius eo rundem m. p. |
|
27.
1471 16. VII. Neubrandenburg |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bestätigt Güter, Eigentum und alle Privilegien, Briefe oder Instrumente der Stadt und der Einwohner von Neubrandenburg. | 2 gleichzeitige Abschriften S.A. Stadturkunden Neubrandenburg. | ad mandatum domini Thomas Rode scripsit sigillauit presentem litteram et est examinata in consilio. |
|
28.
1474 24. V. Tempzin |
Heinrich IV., Herzog v. Mecklenburg, bekennt, schuldig zu sein Heinrich Hagenow, Gebietiger des St. Antonius-Hofes zu Tempzin, insgesamt 120 Guld. | Konzept S.A. debita passiva (Akten). | Laurencius Stoltenborch scripsit. |
|
29.
1476 23. IV. Wismar |
Heinrich IV., Herzog v Mecklenburg, sowie dessen Söhne Albrecht, Magnus und Balthasar heben die von Kaiser Friedrich ihnen bewilligten Wasserzölle zwischen Rostock und Warnemünde, Wismar und Poel für alle Zeit auf, nachdem die Städte Rostock und Wismar sie als ihren Privilegien widerstreitend erwiesen haben. | Druck auf Papier ca. 1620 - 30 S.A. Stadturkunden Rostock. | ad mandatum et ad decretum praefatorum dominorum omnium contentorum ad tenorem earum literarum cum clausula apposita post datum literae e[i]usdem sunt conscripta et sigillata, quod ego Thomas Rode contestor manu propria. |