

|
Seite 172 |




|



|
|
:
|
Die Kirche zu Granzin,
Amts Lübz, war ein ganz kleines, oblonges Gebäude, mit dreiseitigem Chorschluß, unregelmäßig aus Feldsteinen und Ziegeln aufgeführt, ohne Thurm und Anbauten, ohne allen künstlerischen und geschichtlichen Werth und Schmuck, ungefähr gegen das Ende des 15. Jahrhunderts gebaut, wahrscheinlich im Jahre 1486, da die Glocke diese Jahreszahl hat. Die Pforten und Fenster waren ohne künstlerische Gliederungen aus gewöhnlichen Backsteinen aufgeführt und hatten keine andern Profilirungen, als die rechtwinkligen des Backsteins. Gewölbe waren beabsichtigt, aber nicht zur Ausführung gekommen, und die Bretterdecke war verfallen. Da nun die Kirche für die Gemeinde viel zu klein, und dazu noch baufällig und werthlos war, so ward der Bau einer neuen Kirche beschlossen und die alte Kirche abgebrochen. Beim Abbruche der Kirche fand sich in den Fundamenten nirgends ein als solcher bezeichneter Grundstein, da der Herr Pastor Malchow sorgfältige Aufmerksamkeit darauf verwandt hat.
Die Kirche hatte folgende Geräthe, welche zum größten Theil ins Antiquarium zu Schwerin versetzt sind.
Der Altar ist ein kleiner Doppelflügelaltar, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, auf der Vorderseite mit geschnitzten Figuren, auf den Hinterseiten mit Gemälden bedeckt; Schnitzerei und Malerei sind schlecht und ohne besonderen Werth. Die Vorderseite hat gemusterten Goldgrund, unten mit blau=roth=weißen Franzen, wie viele Altäre aus jener Zeit.
Die geschnitzte und bemalte Vorderseite hat auf der Mitteltafel die Jungfrau Maria mit dem Christkinde, über welchem ein kleiner anbetender Engel schwebt. Die Maria ist ziemlich gut, aber das Christkind ist sehr schlecht und im höchsten Grade manierirt, eben so der Engel. An jeder Seite der Maria stehen auf der Mitteltafel 2 Heiligen=


|
Seite 173 |




|
figuren, deren Namen auf die Heiligenscheine gemalt sind, von ziemlich guter Arbeit:
oben: rechts: die H. Anna, die Mutter der Maria,
mit dem Christkinde auf dem rechten Arme und
einer kleinen Maria links neben sich, welche zum
Christkinde hinauflangt, mit der Inschrift:
S
 NCT
NCT

 NN
NN
 OR.
OR.
oben: links: die H. Katharine, die Braut Christi,
ein Schwert mit beiden Händen fassend; das Rad
fehlt und ist auch nicht vorhanden gewesen:
Inschrift: S
 NCT
NCT
 K
K
 TERIN
TERIN
 OR.
OR.
unten: rechts: der H. Nicolaus, einer der 14
Nothhelfer, ein Bischof, mit der rechten Hand
segnend, auf dem linken Arm ein geschlossenes
Buch haltend, auf welchem drei runde Brote
liegen; Inschrift: S
 NCTVS NICOL
NCTVS NICOL
 VS;
VS;
unten: links: der H. Erasmus, ein Bischof, auf
dem rechten Arm ein geöffnetes Buch haltend, mit
der linken Hand einen Bischofsstab, welcher
freilich verloren gegangen, von welchem jedoch
noch das Tuch (Sudarium) vorhanden ist; andere
Attribute sind nicht vorhanden gewesen;
Inschrift: S
 NCTVS ER
NCTVS ER
 SMUS.
SMUS.
Auf den Flügeln stehen die 12 Apostel, von ganz schlechter Arbeit, deren Namen auf den Sockelleisten auf blauem Grunde stehen.
Die zweiten Flügel, wenn die Vorderseite zugeklappt ist, enthalten die Leidensgeschichte Christi in 8 Gemälden, ohne künstlerischen Werth; die Flügel sind queer getheilt, so daß auf jeder Tafel zwei Gemälde stehen; die Gemälde sind in folgender Ordnung, in der Ansicht von links nach rechts, folgende:
| oben: | 1) Christi Gebet am Oelberge, |
| 2) Christi Gefangennehmung, | |
| 3) Christus vor Pilatus, welcher sich die Hände wäscht, | |
| 4) Christi Geißelung, | |
| unten: | 5) Christi Dornenkrönung, |
| 6) Christi Hinausführung in der Dornenkrone (Ecce homo), | |
| 7) Christi Kreuztragung, | |
| 8) Christi Kreuzigung. |
Auf der Rückseite der zweiten Flügel ist in zwei durchgehenden, großen Figuren die Verkündigung Maria in etwas besserer Malerei dargestellt: in der Ansicht rechts: die Maria, vor einem Betpulte knieend, links der Engel mit einer Urkunde in der Hand, an welcher drei Siegel hangen


|
Seite 174 |




|
und auf
welcher in drei Zeilen steht:AVE
 R
R
 │ CI
│ CI
 PLE │ N
PLE │ N
 DOMI
DOMI
Auf dem Kirchenboden fand sich ein sehr großer Belt (Opferstock), welcher größer ist als gewöhnlich und nicht zum Herumreichen, sondern nur zum Aufstellen gedient haben kann, da er ungefähr 2 Fuß hoch und sehr schwer ist. Auf einem hervorragenden Sockel steht eine regelmäßig ausgeschnittene und bemalte Hinterwand, vor welcher die hohe Figur eines Bischofs mit den Füßen in einem Grapen (dreibeinigen Kessel) steht; er erhebt die rechte Hand zum Segnen und hat in der linken Hand ein jetzt fehlendes Attribut (einen Bischofsstab oder eine Winde) gehalten. Dieser in einem Grapen stehende Bischof ist der H. Erasmus, Welcher in einen Kessel mit siedendem Pech gesetzt ward, und welchem schließlich die Eingeweide ausgewunden wurden; das Attribut des Grapens beim H. Erasmus, welches in Meklenburg oft vorkommt, scheint Norddeutschland eigenthümlich zu sein (vgl. Jahrb. XXIV, S. 344). Neben der Bischofsfigur stehen auf dem Belt zwei kleinere männliche Figuren, zur Rechten eine nackte, zur Linken eine mit Hemd und Mütze bekleidete Figur, von denen jede ein kurzes, viereckiges Stück Holz (? von der Winde?) in den Händen hält.
Diese Heiligenfigur, welche sicher der H. Erasmus ist, ist also dieselbe Figur, welche auf dem Altar mit dem Namen des H. Erasmus dargestellt ist. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß die Kirche zu Granzin dem H. Erasmus geweihet war.
In der Kirche fanden sich noch zwei Flügel von einem andern Doppelflügelaltare, welche auf einer Seite jeder mit einer großen Figur bemalt sind; auf dem einen Flügel steht die H. Gertrud im Schleier, mit Heiligenschein, ein Hospital auf den Händen tragend; auf dem andern Flügel steht eine reich geschmückte Jungfrau in einem rothen Hut mit vielen großen weißen Federn, ohne Heiligenschein, eine brennende Kerze in der linken Hand haltend.
An der Nordseite neben dem Altare stand ein hohes Wand=Tabernakel: über einem kleinen Wandschranke erhob sich an der Wand ein recht gut gearbeiteter und erhaltener gothischer Thurm von ungefärbtem Eichenholz, 12 Fuß hoch, welcher aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, also aus der Zeit der Erbauung der Kirche stammt. Durch die umsichtige Fürsorge des Pastors Malchow ist dieses hübsche Tabernakel unbeschädigt abgebrochen und eben so gut erhalten nach Schwerin transportirt worden.


|
Seite 175 |




|
An der südlichen Chorpforte der abgebrochenen Kirche war eine heidnische Quetschmühle als Weihwasserbecken eingemauert.
Die Kanzel war in dem schlechtesten Style der Zopfzeit erbaut und ohne allen Werth.
Eine Glocke hat die Inschrift:
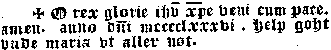
Wahrscheinlich ist diese Glocke zur Zeit der Erbauung der Kirche gegossen.
Alle im Vorstehenden beschriebenen Alterthümer werden gleich alt sein und aus der Zeit der Erbauung der abgebrochenen Kirche, nach der Jahreszahl der Glocke wahrscheinlich aus dem Jahre I486, stammen.
G. C. F. Lisch.
