

|
[ Seite I ] |




|



|
|
|



|



|
|
:
|
I.
Ernst von Kirchberg,
seine Herkunft und seine Auseinander-
setzung mit der Sprache in der
Mecklenburgischen Reimchronik
von
Werner Knoch.
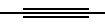


|
[ Seite II ] |




|


|
[ Seite III ] |




|
Inhaltsübersicht.
| Die Bedeutung der Mecklenburgischen Reimchronik und das Ziel der Untersuchung | 1 |
| a) Die Beurteilung Kirchbergs in der Wissenschaft | 1 |
| b) Quellenverhältnisse und Aufbau der Reimchronik | 2 |
| c) Die Ausstattung der Handschrift | 4 |
| d) Die Persönlichkeit des Auftraggebers, Herzog Albrechts II. des Großen von Mecklenburg | 5 |
| Albrecht als Politiker | 5 |
| Beziehungen zwischen Mecklenburg und Böhmen | 7 |
| Die Bedeutung des Werkes als Chronik für Albrecht | 8 |
| Pläne für die Mecklenburgische Reimchronik | 8 |
| Das Herzog-Albrecht-Buch, ein geschichtlich-literarisches Werk des Auftraggebers über sich selbst | 9 |
| Die Kirchbergchronik als Denkmal der Persönlichkeit Albrechts II. | 10 |
| e) Stil der Mecklenburgischen Reimchronik | 11 |
| Metrik, Reim- und Sprachgebrauch in der Chronik | 12 |
| Die Notwendigkeit der genealogisch-heraldischen Verfasserbestimmung | 12 |
| Das eigentliche Ziel der vorliegenden Untersuchung: Verständnis des Sprachgebrauchs in der Chronik | 13 |
| 1. Teil: Die Herkunft Ernst von Kirchbergs als Voraussetzung für den Sprachgebrauch in der Mecklenburgischen Reimchronik | 14 |
| 1. Die Geschlechter von Kirchberg im Mittelalter | 14 |
| Angaben über den Verfasser; Gang der Untersuchung | 14 |
| Quellen | 17 |
| Abkürzungen der Literatur | 18 |
| Hochadel | 21 |
| Östereichische, bayrische, schweizerische Adelsgeschlechter von Kirchberg | 26 |
| Elsaß, Lothringen, Pfalz | 27 |
| Baden, Württemberg | 28 |
| Luxemburg, Süden und Westen der Rheinprovinz | 30 |
| Die übrigen Teile der Rheinprovinz | 32 |
| Niederdeutschland und Ostmitteldeutschland | 36 |
| Thüringen | 38 |
| Nassau | 45 |
| Hessen | 47 |


|
Seite IV |




|
| 2. Das niederhessische Rittergeschlecht von Kirchberg. | 48 |
| Das Dorf | 48 |
| Der ursprüngliche Stand des Geschlechts | 49 |
| Das Geschlecht im 13. Jahrhundert | 53 |
| Das Geschlecht im Patriziat der Städte | 56 |
| Ernst von Kirchberg | 58 |
| Ergebnis der Bestimmung der Herkunft des Verfassers für die sprachliche Auswertung der Mecklenburgischen Reimchronik | 59 |
| 2. Teil: Kirchbergs Auseinandersetzung mit der Sprache in seiner Mecklenburgischen Reimchronik | 61 |
| Der Schreiber der Handschrift und seine Behandlung des Textes | 61 |
| Kirchbergs Auseinandersetzung mit der Sprache | 66 |
| Fragestellung der sprachlichen Untersuchung | 66 |
| Wandlungen im Sprachgebrauch und Ausnahmeformen in Reim und Schreibung, die sich mit Sicherheit auf den Verfasser zurückführen lassen | 68 |
| 1. sayde - sagete | 68 |
| 2. leyde - legete | 70 |
| 3. ê, æ 1 - ei | 71 |
| 4. uo - o | 72 |
| 5. -te in den sw. Prät. und rd - r | 72 |
| 6. noch - nach | 73 |
| 7. v - b | 73 |
| 8. Anhang: | 73 |
| Auseinandergehen von Reim und Schreibung: | 73 |
| a) rcht - rt | 73 |
| b) vy - vehe | 74 |
| Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs in der Helmoldübersetzung | 75 |
| 1. Reime ė:ê, æ 1 und die Schreibungen o für ou | 75 |
| 2. -ig - -ik, -ich und he anstatt her | 75 |
| 3. Die Ausnahmegruppen I und II | 77 |
| 4. Die drei sprachlichen Wendepunkte | 78 |
| 5. Zwei Ausnahmegruppen im Zusammenhang mit dem ersten und dritten Wendepunkt | 80 |
| Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs im weiteren Verlauf der Reimchronik | 82 |
| 1. Der Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung und der Sprachgebrauch nach diesem Bruch | 82 |
| 2. Wiederaufnahme früher zurückgedrängter Ausnahmeformen gegen Ende des Werks | 83 |
| 3. Spracherscheinungen, die aus den letzten Teilen der Helmoldübersetzung in den Schlußteil der Chronik hinübergehen | 84 |


|
Seite V |




|
| Die Metrik in der Reimchronik | 85 |
| 1. Vorbemerkungen | 85 |
| 2. Versglätte | 87 |
| 3. Silbenzahl der Verse | 88 |
| 4. Kadenzen | 89 |
| Die sprachliche Einstellung des Verfassers, ihr Verhältnis zu seiner metrischen Einstellung und die Bedeutung des Sprachgebrauchs in der Reimchronik: | 89 |
| Die Prachthandschrift hat Autographenwert | 90 |
| Die sprachliche Einstellung des Verfassers | 91 |
| Der Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung als Arbeitspause | 92 |
| Die literarisch geprägte Sprache der Chronik und die Metrik ihrer Verse gehen auf dieselbe Einstellung des Verfassers zurück | 95 |
| Die Stellung der Mecklenburgischen Reimchronik in der Geschichte der Gattung und die Bedeutung des Sprachgebrauchs für Kirchbergs Werk | 96 |
| Auswertung der Sprache der Reimchronik | 98 |
| in der Richtung auf die Dialektgeographie und die Sprachgeschichte | 98 |
| in der Richtung auf die Erforschung der mhd. Literatursprache | 99 |


|
Seite VI |




|
Abkürzungen.
Einfache Zahlen ohne Titel oder Namen bezeichnen Seite und Zeile in der Kirchbergausgabe Westphalens (wenn es Zahlen zwischen 593 und 840 sind) oder in der Helmoldausgabe Schmeidlers (wenn es Zahlen zwischen 1 und 218 sind).
Ausgabe der Mecklenburgischen Reimchronik von Ernst Joachim von Westphalen, Monumenta inedita rerum Germanicarum praecique Cimbricarum et Megapolensium, Tom. 4, Lipsiae 1745.
Helmoldausgabe: Helmoldi Presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum, Ed. secunda, rec. Bernh. Schmeidler, in Script. Rer. Germ. in us. schol., Hannover und Leipzig 1909.
Bei den Zitaten sind die Stellenangaben nach Westphalen, aber der Wortlaut buchstäblich nach der Handschrift gegeben.
Ü nach der Stellenangabe eines Kirchbergzitats bedeutet, daß die Worte in einer Kapitelüberschrift, nicht im laufenden Text stehen.
v nach der Stellenangabe eines Kirchbergzitats bedeutet, daß der Schreiber seine falsche Schreibung, auf die an der betreffenden Stelle Bezug genommen ist, selbst richtig gestellt hat.
MJ: Jahrbücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.


|
Seite 1 |




|
Die Bedeutung
der Mecklenburgischen
Reimchronik
und das Ziel der Untersuchung.
Die letzte Arbeit, die sich förderlich mit der Mecklenburgischen Reimchronik beschäftigt hat, "Ernst von Kirchberg, kein Mecklenburger, sondern ein Thüringer" von F. Schirrmacher, stammt aus dem Jahre 1875. Seitdem hat die mecklenburgische Geschichtsforschung die Chronik weiter ausgewertet; es sei etwa an Wiggers genealogische Forschungen zum mecklenburgischen Herzogshaus in MJ 50 und an Koppmanns Aufsatz "Die Ereignisse in Rostock von 1311, Sept. 17. bis 1314, Jan. 21.", MJ 56, erinnert. Aber nach diesen Arbeiten schien es, als ob das Kirchbergsche Werk im wesentlichen ausgeschöpft und sein Stoff von der Forschung aufgearbeitet sei. Und in der Tat sind für die Geschichtsforschung die reichlich überlieferten Urkunden unvergleichlich wichtiger als Kirchbergs Nachrichten. Über den Kreis der mecklenburgischen Geschichtsforschung hinaus ist die Chronik mit ihren über 26000 Reimversen kaum bekannt geworden, trotz Bemühungen wie denen von Bartsch, Bech und Bahder 1 ). Bei alledem ist man zu keiner Würdigung gelangt, die der Reimchronik ganz gerecht würde. Ein jüngeres Werk, das Kirchberg etwas ausführlicher erwähnt, ist die "Geschichte


|
Seite 2 |




|
von Mecklenburg" von O. Vitense 2 ): Um 1375 verfaßte Ernst von Kirchberg über dessen Lebensumstände - er soll Thüringer von Geburt gewesen sein - weiter nichts bekannt ist, eine "Reimchronik" in mhd. Sprache von Karl dem Großen bis 1337. Sie hat jedoch für die Geschichte unseres Landes nur in ihrem letzten Teil einen gewissen Wert, da sie sich hier neben einigen einheimischen Quellen, besonders einer Doberaner Herzogsgenealogie, auf mündliche Berichte stützt. Im übrigen ist sie nur eine (zumal fehlerhafte) Übersetzung von Helmolds Slavenchronik und ein Auszug aus Arnolds Slavenchronik und der Sächsischen Weltchronik ..." Stammlers "Verfasserlexikon" und Ehrismanns "Grundriß" nehmen von Kirchberg keine Kenntnis. Einen Versuch, die Mecklenburgische Reimchronik aus den Kräften der Zeit heraus zu deuten, macht Nadler in seiner Literaturgeschichte (in der 4. Auflage im 1. Band, in den früheren Auflagen im 2. Band); seine Gesamtauffassung ist jedoch abwegig, und einzelne Angaben über die Chronik sind unzutreffend. Maschek (im 5. Band in der Reihe "Realistik des Spätmittelalters" der "Deutschen Literatur in Entwicklungsreihen") begnügt sich damit, Nadlers Angaben vergröbert zu übernehmen.
Die Quellenverhältnisse liegen für rund die ersten zwei Drittel des Kirchbergschen Werkes klar. Hier ist die Chronik nämlich im wesentlichen eine freie Übersetzung der verbreiteten Slavenchronik Helmolds. Die Einschiebung von fünf Kapiteln ist alles, was Kirchberg braucht, um die Cronica Slavorum in eine mecklenburgische Chronik zu verwandeln. Die Helmoldübersetzung füllt über 16000 Zeilen. Mit 756, 41 ist sie beendet. Die Helmoldchronik schließt mit der Schilderung der Ereignisse des Jahres 1171 ab.
Nur ungefähr das letzte Drittel, rund 9000 Verse, hat Kirchberg selbständig zusammengestellt. Hier behandelt er die Geschichte Mecklenburgs systematisch von 1171 bis zum Jahre 1329, zum Regierungsantritt des Veranlassers des Werkes oder vielmehr zum Beginn der zunächst für den damals minderjährigen Albrecht eintretenden vormundschaftlichen Regierung. Der Aufbau dieses Abschnittes ist durchsichtig. Er zerfällt in zwei Teile, die durch den Einschnitt der Hauptlandesteilung nach dem Tode Heinrich Burwys (Borwins) I. unter die vier Söhne seines vor ihm verstorbenen Sohnes gekennzeichnet wer-


|
Seite 3 |




|
den. Diese Gliederung wird dem Verlauf der einzelnen Ereignisse, ihrer Bedeutung und ihrem Verhältnis zueinander durchaus gerecht. Kirchberg setzt die Hauptlandesteilung in das Jahr 1231, was nicht urkundlich gesichert, aber im großen und ganzen richtig ist. Der erste Abschnitt bis zu dieser Zeit umfaßt nur rund 1200 Verse. Er berichtet über die mecklenburgischen Fürsten und die Ereignisse in ihrer Regierungszeit in zeitlicher Reihenfolge. 767, 8 beginnt der zweite Abschnitt nach der Hauptlandesteilung. Er ist nicht zeitlich, sondern nach den mecklenburgischen Fürstenhäusern gegliedert. Im Zusammenhang mit der Geschichte der einzelnen Linien berührt er Ereignisse bis zu den Jahren 1374 und 1377.
Die Quellen für den Teil nach der Helmoldübersetzung sind nicht in jedem Punkt faßbar. Thoms 3 ) hat über die wenigen sicheren Quellen eine Übersicht gegeben und darüber hinaus eine Anzahl Parallelstellen gesammelt, ohne daß man bei den Werken, denen die einzelnen Stellen entnommen sind, an wirklich von Kirchberg benutzte Quellen denken könnte. Der erste Abschnitt bis zur Hauptlandesteilung macht einen ausgesprochen annalenmäßigen Eindruck, so daß man beim Vergleich mit anderen Teilen der Chronik das Gefühl hat, als ob Kirchberg hier annalistische Aufzeichnungen, die etwa im Kloster Doberan vorhanden gewesen sein könnten, bearbeitet hätte. Ein Beispiel für solche Klosterannalistik liegt in der lat. "Doberaner Genealogie" 4 ) vor, deren Benutzung durch Kirchberg nachgewiesen ist. Kirchbergs Chronik schildert eine Reihe Ereignisse, für die sonst keinerlei Quellen erhalten sind. Man wird hier nicht zu viel mit mündlicher Überlieferung rechnen dürfen. Wenn auch Legenden wie die von dem heiligen Blut zu Doberan (757, 46 - 759, 16), von der Gründung Rostocks und Wismars (763, 1 - 6) von Johanns I. Theologiestudien und Leben (767, 27 - 49) und viele andere Erzählungen damals mündlich umgelaufen sind, so kann Kirchberg für sie ebensowohl schriftliche Aufzeichnungen, und zwar wahrscheinlich des Klosters Doberan, benutzt haben, die später verloren gegangen sind. Bestimmte Sterbedaten (762, 3 - 66), die Angaben über Pribislavs Gemahlin Woyslava (757, 27 - 37), die Jah-


|
Seite 4 |




|
reszahl der zweiten Gründung Doberans (761, 3 - 762, 3) usw. beweisen jedenfalls mit voller Deutlichkeit, daß Kirchberg Doberaner Quellen gekannt und ausgewertet hat, die verschollen sind. Die Quellen, die Kirchberg zur Verfügung standen, waren mindestens zu einem Teil vorzüglich. Ihm müssen Urkunden der herzoglichen Kanzlei und des Doberaner Klosters zugänglich gewesen sein, denn es läßt sich aufzeigen, daß er sie bei der Darstellung der Rostocker und Wismarer Ereignisse 1310 - 1314 und, um eine weitere Stelle zu nennen, etwa auch 767, 49 - 62 benutzt hat - ein Nachweis, der dem grundsätzlichen Verfahren des Mecklenburgischen Urkundenbuches, einige Stücke aus der Kirchbergchronik aufzunehmen, durchaus Recht gibt. Kirchberg beschränkt sich in dem selbständigen Teil nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung nicht auf die mecklenburgischen Ereignisse, sondern flicht in mehr oder weniger lockerem Zusammenhange Reichs-, Kaiser-, Papst-, Bischofs-, sächsische, pommersche, brandenburgische, schwedische, dänische Geschichte ein, für die besondere Quellen in Frage kommen.
So schätzbar die Nachrichten der Chronik sind - in dem, was sie berichtet, in ihrer Eigenschaft als Quelle über die Ereignisse, steht sie an Wert hinter der Urkundenüberlieferung weit zurück. Allein das betrifft nur einen Teil ihrer geschichtlichen Bedeutung, denn die Mecklenburgische Reimchronik ist selbst eine Urkunde, sie ist eine Geschichtsquelle von einzigartigem Wert für die Albrechtzeit, und zwar einfach durch ihr Vorhandensein und ihre Eigenart. Die Chronik ist überliefert in einer Prunkhandschrift größten Formats 5 ). Sie besteht aus 29 achtblättrigen Lagen aus Pergament von her. vorragender Güte: es ist so glatt und weiß, daß man Haar- und Fleischseite kaum unterscheiden kann. Die Blattgröße beträgt im Durchschnitt 43 X 32 cm. Mit dem kostbaren Pergament ist man verschwenderisch umgegangen. Der Schreibspiegel deckt nur rund 29 X 24 cm. Den Schriftspiegel füllt in Zeilen von ungefähr 1 cm Höhe eine prunkvolle große und klare Buchminuskel. Wie sehr die Schreibweise auf Schönheit des Eindrucks bedacht ist, verrät auch der Gebrauch der Abkürzungen. Der laufende Text ist nahezu abkürzungsfrei, die Kapitelüberschriften dagegen ver-


|
Seite 5 |




|
wenden Abkürzungen sehr reichlich, offenbar deshalb, weil sich so die Überschriften knapp und zusammengedrängt am schönsten in den breit hinfließenden Text einfügen. Ihre höchste Pracht entfaltet die Handschrift in der Illumination. Den Kopf jedes Kapitels schmückt im ersten Viertel der Handschrift eine liebevoll ausgezierte Initiale oder ein Miniaturbild.
Wüßte man es nicht aus der Vorrede des Verfassers selbst, so würde man es aus der Ausstattung der Handschrift erschließen können, daß der Auftraggeber der Reimchronik der mecklenburgische Herzog Albrecht II. selbst war. Die Entstehungsgeschichte des Werkes und der Handschrift ist bis ins einzelne zu verfolgen und mag an anderer Stelle geschildert werden. Das Werk wurde am 8. Januar 1378 begonnenen und die Handschrift, wie sich zeigen läßt, noch vor dem Tode des Herzogs (18. oder 19. Februar 1379) im Text mit den überlieferten Miniaturen vollendet. Sie ist bis auf ein paar Blätter, die, vermutlich im 16. Jahrhundert, ausgerissen wurden, vollständig erhalten; von den rund 28000 Versen, auf die sich die Chronik in ihrem ursprünglichen Umfang berechnen läßt, sind über 26000 auf uns gekommen. Der Schaden, der dem Werk entstand, ist erfreulicherweise nicht allzu beträchtlich 6 ). Die Illumination ist nur in etwa einem Viertel der Handschrift durchgeführt, sie wurde, wie sich beweisen läßt, beim Tode des Auftraggebers abgebrochen.
Schon die Entstehungsgeschichte erhellt, wie stark das Werk von seinem Auftraggeber, Albrecht II. bestimmt ist. Man kann das Denkmal nur verstehen, wenn man Albrecht II. kennt. Unter ihm hat Mecklenburg im 14. Jahrhundert seine größte Zeit erlebt. Es nahm eine bedeutende, freilich rasch vorübergehende Machtstellung ein. Sein Aufstieg war von Fürst Heinrich II. dem Löwen (1302 - 1329) vorbereitet. Der Mann, der Mecklenburg zur Höhe seiner Macht führte, war Heinrichs II. Sohn Albrecht II., der den Beinamen "der Große" bekommen hat (1329 - 1379) 7 ).
Er trägt seinen Beinamen mit Recht, unter den Regenten Mecklenburgs ist er wohl der bedeutendste gewesen. Er stand seinem Vater an kriegerischer Tatkraft nicht nach, er


|
Seite 6 |




|
war als Feldherr hervorragend, aber zugleich ein großer Politiker. Nachdem das in den fast ununterbrochenen Kriegen seines Vaters überanstrengte Land wieder zur Ruhe gekommen war und Kräfte gesammelt hatte, griff er in die Reichspolitik und in die nordeuropäische Politik ein. Der entscheidende Schritt war sein enger Anschluß an den Kaiser Karl IV. Der Erfolg, den Albrecht damit errang, war 1348 die Erhebung der mecklenburgischen Fürsten zu reichsunmittelbaren Herzögen. 1358 folgte der Erwerb der Grafschaft Schwerin. Zum Herzogstitel trat noch der Titel des Grafen von Schwerin, und Schwerin wurde jetzt Hauptresidenz Albrechts.
Albrecht II, hat die territoriale Entwicklung Mecklenburgs, abgesehen von den vormals geistlichen Gebieten, im allgemeinen abgeschlossen. Er hat weit mehr erstrebt. Die letzten 16 Jahre seines Lebens hat er die nordeuropäische Politik entscheidend bestimmt. Ihr galten seine größten Pläne, und hier tritt die Gestalt des Politikers Albrecht überragend hervor. Seine Unternehmungen darf man nicht rein dynastisch werten. Die Durchführung seiner Pläne hätte, ohne daß ihm das bewußt war, in gewissem Sinne den Ausbau und die Krönung der mannigfachen wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenhänge bedeutet, die Schweden und Norddeutschland verbanden 8 ); und darum war seine Politik weder naturwidrig noch kurzsichtig 9 ). Albrecht II. vermochte seinen Sohn als König in Schweden durchzusetzen und ihn zu halten. Zuletzt konnte er darauf hinstreben, die dänische Krone für seinen Enkel zu erwerben. Das Unglück war, daß, nachdem das mecklenburgische Haus in Heinrich dem Löwen und seinem Sohn außerordentlich tüchtige Herrscher hervorgebracht hatte, beim Tode Albrechts, der 1379 erst 60 Jahre alt, unerwartet starb, kein Nachfolger da war, der den Verhältnissen gewachsen war. So zerfiel alles.


|
Seite 7 |




|
Das Bild Herzog Albrechts II., das man aus seinen politischen und kriegerischen Taten gewinnt, kann man aus der Kirchbergchronik vervollständigen. Das Werk beweist, daß er an geistigen und künstlerischen Strömungen seiner Zeit Anteil genommen hat. Es bestanden Verbindungen zwischen Mecklenburg und Böhmen. Sie waren schon dadurch gegeben, daß Karl IV. Prag zur Hauptstadt des Reiches machte, und zwar zur politischen und zur geistigen. Am augenfälligsten kommt das zum Ausdruck in der Gründung der ersten deutschen Universität 1348. So groß die Bedeutung dieser Gründung für das ganze Reich war, sie wirkte sich doch nicht überall gleichmäßig aus; das oberdeutsche Gebiet wurde dadurch bei weitem nicht so stark berührt wie Norddeutschland und damit auch Mecklenburg 10 ). In Prag studierten viele Mecklenburger, und auch unter den Professoren sind bekannte Mecklenburger namhaft zu machen. Hinrich Retzekow aus Ribnitz bei Rostock gehörte in den letzten 20 Jahren des Jahrhunderts zu den angesehensten Prager Professoren. Dietrich Sukow aus Rostock erreichte in Prag die Würde eines Juristenrektors. Der Mecklenburger Henning Boltenhagen führte 1409 als Rektor die Deutschen von Prag nach Leipzig. Von Mecklenburgern, die später in ihrer Heimat als Ratsschreiber oder im Domkapitel zu Schwerin zu Amt und Würden kamen, weiß man, daß sie in Prag studiert haben. Und als schließlich 1419 die Universität Rostock gegründet war, waren "von den ersten zwölf Rektoraten .... nicht weniger als zehn mit ehemaligen Prager Dozenten und Scholaren besetzt".
Albrecht II. hat hier die geistigen Beziehungen wie in seiner nordischen Politik die kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen in seine politischen Bestrebungen eingehen und damit zu höchster Wirkung gedeihen lassen. Albrecht II. traf oft, mitunter mehrmals im Jahre, mit Karl IV. zusammen, und 1376, um ein einzelnes Beispiel anzuführen, wurde zur Festigung der luxemburgisch-mecklenburgischen Beziehungen eine Verlobung zwischen einem Sohn des Kaisers und einer Enkelin Albrechts II. geschlossen. Bei solch engem Zusammengehen ist es verständlich, wenn sich der künstlerische Geschmack am Hofe des mecklenburgischen Herzogs nach der böhmischen Kunst ausrichtete. Als Denkmal dafür stellt sich die


|
Seite 8 |




|
Kirchberghandschrift dar. Ihre Miniaturen und das Rankenwerk um die Schreibspalten bedürfen einer kunstgeschichtlichen Untersuchung; sie erinnern an die Wenzelbibel, die nicht viel später als die Kirchberghandschrift entstanden sein wird. Vielleicht läßt sich V. C. Habichts Ansicht 11 ) erhärten, daß hier der böhmische Einfluß auf die niederdeutsche Kunst am frühesten zutage tritt 12 ). Der Gedanke Albrechts II., den Glanz seines Hofes gerade durch eine solche Prachthandschrift zu erhöhen, geht gewiß auf Anregungen zurück, die er im Umgang mit Karl IV. erhalten hat.
Daß diese Prachthandschrift allerdings eine Chronik enthält, ist aus anderen Zusammenhängen zu verstehen. Es bestehen innere Beziehungen zur Braunschweigischen Reimchronik, die das sächsische Herzogshaus, von dem die Mecklenburger bis in Albrechts II. Zeit lehnsabhängig waren, verherrlichte und die eine große Wirkung ausgeübt hat; denn ihre Spuren lassen sich bis in die altschwedische Literatur verfolgen. 12a ). Der Wert, den Albrecht II. dem Werk beimaß, erhellt daraus, daß er, wie an anderer Stelle gezeigt werden wird, den Verfasser in seinem Archiv arbeiten und wichtige Urkunden in sein Werk aufnehmen ließ. Es sollte eine zuverlässige Darstellung der Voraussetzungen und der Entwicklung der mecklenburgischen Macht werden. So schuf sich Albrecht II. in der Kirchbergschen Chronik ein Werk, dessen künstlerische Ausstattung den Schätzen am Böhmenhofe und dessen Inhalt den ähnlichen Werken der benachbarten politischen Gemeinschaften, der Braunschweigischen Reimchronik, ja, der berühmten chronistischen Tätigkeit Lübecks nacheiferte.
Die Chronik ist in der überlieferten Form nicht zu dem ursprünglich geplanten Schluß gediehen; sie hatte von Karl dem Großen bis zur Entstehungszeit des Werkes


|
Seite 9 |




|
reichen sollen. Noch 825, 18 - 21, etwa 2000 Verse vor dem zu erschließenden, nicht erhaltenen Schluß der Reimchronik, sagt der Verfasser mit Bezug auf den 1329 gestorbenen Heinrich II.:
noch lange von synen kynden nicht.
Ich wil vzrichten rechte
erst der von Werle geslechte.
Das kann im Zusammenhang nichts anderes heißen, als daß er in demselben Werk noch über Heinrich II. hinausgehen und die Söhne Heinrichs II., unter ihnen also Albrecht II., den Auftraggeber der Chronik, und seine Regierungszeit noch behandeln will. Die letztere Feststellung ist besonders wichtig, denn sie schließt die Spekulationen über das Vorhandensein eines "Herzog-Albrecht-Buches" von Kirchberg aus. Sie besagt ganz einwandfrei, daß Kirchberg ein solches Werk noch nicht abgefaßt hatte. Darum kann man die Verse 837, 39 ff.:
Knyse Janeke waz des nam,
Und czwo tochtere schon und here:
dy Cronike sayd von den wol mere
In herczogin Albrechtis buche,
wer es wiszin wil, der suche!
nicht dahin auslegen, als ob Kirchberg hier auf ein früheres Werk von sich verweise, das verloren sei. Er kann mit dieser Stelle nur etwas meinen, was er plante. Ob der Plan ausgeführt wurde? Sicher dürfte sein, daß Kirchberg die Mecklenburgische Reimchronik, wie sie in der überlieferten Handschrift niedergelegt ist, noch vor dem Tode des Veranlassers Albrecht II. (18. oder 19. Februar 1379) beendet hat; es wäre sonst kaum möglich gewesen, daß Kirchberg den Auftraggeber in der Vorrede, deren einer Teil nach der Beendigung der Chronik geschrieben ist 13 ), erwähnt, ohne seines Todes zu gedenken, zumal er von ihm mit so lobenden Worten spricht. Nun umfaßt das Werk rund 28000 Verse, und da Kirchberg, wie er in der Vorrede ausdrücklich sagt, erst am 8. Januar 1378 mit der Chronik begann, ergibt sich eine ganz erstaunliche Arbeitsleistung für ein Jahr; Kirchberg kann also vor dem Tode Albrechts nichts außer der vorliegenden Reimchronik geschrieben haben. Wie es aber mit Kirchbergs Tätigkeit nach


|
Seite 10 |




|
dem Tode Albrechts stand, das kann man aus der Behandlung des Werkes kurz vor der Fertigstellung des Codex erschließen. Die Illumination wurde, nachdem sie ungefähr zu einem Viertel durchgeführt war, abgebrochen, und für den fertiggeschriebenen Text hatte man so wenig Wertschätzung, daß man, wie der Zustand der beschmutzten Außenseiten der einzelnen Lagen zeigt 14 ), die Lagen längere Zeit ungebunden und unbeachtet liegen ließ. Das sind Tatsachen, die man nur mit dem Tode des Veranlassers des Werkes und der Einstellung seiner Nachfolger erklären kann, die für seine künstlerischen und literarischen Pläne ebenso wenig Verständnis hatten wie für seine politischen Leistungen. Danach ist es wohl ausgeschlossen, daß Kirchberg nach dem Tode Albrechts des Großen als mecklenburgischer Geschichtsschreiber weitergewirkt und daß man ihm ein neues Werk in Auftrag gegeben hätte. Fraglich ist nun, ob an der genannten Stelle ein eigenes Werk über Albrecht oder nur ein Schlußstück der vorliegenden Chronik gemeint ist. Auf ein besonderes Werk könnte vielleicht die Ausdrucksweise wer es wiszin wil, der suche deuten, die sich von den sonst in der Chronik vorkommenden Verweisungen unterscheidet, sowie der Umstand, daß - laut dem erst nach der Fertigstellung der Chronik verfaßten Schluß der Vorrede 13 ) - das Werk, wie es vorlag, im Gegensatz zu dem ursprünglichen Plan mit der Zeit vor dem Regierungsantritt Albrechts II. abgeschlossen sein dürfte. Aber auch, wenn das buch nach der im Mhd. ganz gewöhnlichen Bedeutung nur einen besonderen Teil, eine Fortsetzung des überlieferten Werkes meint, so erscheint es schon damit, da sonst in der Mecklenburgischen Reimchronik keinerlei Einteilung in größere Abschnitte als Kapitel vorkommt, auffällig abgehoben und für sich gestellt.
Man wird es gewiß bedauern, daß das "Herzog-Albrecht-Buch" nicht zur Ausführung gekommen ist. Aber bereits der Plan ist bemerkenswert und für die Persönlichkeit Albrechts II. aufschlußreich. Denn das Buch hätte den Auftraggeber selbst zum Helden einer - mehr oder weniger von der übrigen Chronik abgehobenen - geschichtlich-literarischen Darstellung gemacht. Und das erschiene außergewöhnlich. Werke über sich selbst haben Kaiser schreiben lassen können - aber Fürsten? Erst Kurfürst Friedrich I. von der Pfalz, der als Förderer der Universität Heidelberg zum Humanismus und zur Renaissance hin-


|
Seite 11 |




|
überführt, hat in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts eine Chronik über seine Taten schreiben lassen 15 ).
Es kann dahingestellt bleiben, wie es sich mit dem "Herzog-Albrecht-Buch" verhält. Jedenfalls ist durch eine Betrachtung der Mecklenburgischen Reimchronik, wie sie überliefert ist, das Bild Albrechts II. abzurunden. Es ist derselbe Mann, der sich die Chronik von Ernst von Kirchberg hat schreiben lassen, der den Herzogstitel für sein Haus erwarb, der Mecklenburg zu seiner höchsten Machtstellung geführt hat, der eine weitausschauende nordeuropäische Politik trieb, der der neuen Kunst offenstand und der vielleicht sogar den renaissancemäßig anmutenden Plan eines geschichtlich-literarischen Werkes über sich selbst faßte. Die Mecklenburgische Reimchronik aber sollte nach dem Willen ihres Auftraggebers eine Kostbarkeit des herzoglichen Hofes und ein geschichtlich-literarisches Werk sein, Ausdruck zugleich und Rechtfertigung von Glanz und Macht des mecklenburgischen Herzogshauses im 14. Jahrhundert, und sie ist bis heute das Denkmal der großartigen Persönlichkeit Herzog Albrechts II. geblieben.
Wenn nun die Mecklenburgische Reimchronik so weitgehend vom Auftraggeber bestimmt erscheint - wo liegt der Anteil des Verfassers am Werk? Man wird ihn ganz allgemein darin suchen, wie er dem Plan, dem Grundgedanken des Auftraggebers Gestalt gab. Man wird zuerst an den Stil denken, in dem man bei literarischen Werken die Ausprägung der Verfasserpersönlichkeit am ehesten zu finden gewohnt ist. Und der stilistische Befund ist allerdings auch in diesem Falle für den Verfasser sehr aufschlußreich, wenn auch nur in der Hinsicht, daß von Stil im engeren Sinne bei Kirchberg keine Rede sein kann, noch weniger als sonst schon bei Reimchroniken. Ernst von Kirchberg hat keinerlei stilistischen Ehrgeiz; er bemüht sich nicht einmal um die zu seiner Zeit gängigen stilistischen Formen. Die Beziehung der mecklenburgischen Reimchronik zur Dichtung bleibt, von dieser Seite aus gesehen, äußerlich, sie umfaßt den Stil nicht mit. Innerlich ist die Reimchronik - dem Stoff nicht unangemessen - nüchternste Berichtsprosa. Die Chronik möchte, wie schon erwähnt wurde, für Mecklenburg das ersetzen, was für Lübeck die Rats-


|
Seite 12 |




|
chronistik war. Wenn die Geschichtsschreibung trotzdem in das "höfische" Reimgewand gekleidet wurde, so ist dabei bemerkenswert, daß Kirchberg eine stilistische Umformung nicht für notwendig hielt; in anderen Bezirken aber ist der Wille des Verfassers deutlich zu spüren: in der Metrik, im Reim und allgemein in der grammatischen Form der Sprache. Und in diesen Bestrebungen ist die Leistung Kirchbergs zu fassen. Seiner ausgesprochenen Sorgfalt im Versbau, im Reim- und überhaupt im Sprachgebrauch nachzugehen, ist der Weg zur Auswertung der Mecklenburgischen Reimchronik, wenn man sie als literarisches Werk des Verfassers betrachten will.
Die Chronik ist, wie unten nachgewiesen wird, in Mecklenburg abgefaßt und niedergeschrieben, die Sprache des Textes ist aber hochdeutsch. Diese Tatsache enthält bereits die Frage nach den Grundlagen für die sprachliche Beurteilung: wie ist die Sprachform zu fassen, handelt es sich hier um die künstliche Literatursprache eines Niederdeutschen, oder hat sich der mecklenburgische Herzog seine Chronik von einem Hochdeutschen verfassen lassen? Wie schwierig eine solche Frage zu entscheiden ist, braucht nicht lange theoretisch erörtert zu werden, es läßt sich an einem Fall aus der Geschichte der deutschen Philologie erläutern. Als Helm sich im Jahre 1899 mit Heinrich von Hesler zuerst eingehender beschäftigte, setzte er ihn PBB 24, 175 ins Ordensland, nachdem er schlesische Herkunft des Dichters ausführlich erwogen hatte. Edward Schröder stellte ZfdA 43, 183 sofort das Unbefriedigende dieser Untersuchung fest und wies auf Westfalen als Heimat des Dichters hin. Helm nahm daraufhin seine eigene Ansicht zurück und die Edward Schröders an, ja, er ging in der gewiesenen Richtung einen Schritt weiter als Schröder, indem er 1902 in der Einleitung zur Ausgabe des Evangeliums Nikodemi S. LXXII ungefähr mit denselben Mitteln und mit derselben Überzeugungskraft anstatt der preußischen die westfälische Abkunft Heslers sprachlich bewies. Nun aber wurde Eduard Schröder auf Urkunden aufmerksam, die ihn veranlaßten, thüringische Herkunft in Erwägung zu ziehen (ZfdA 53 (1912), 400). Helm hat sich zu der Verfasserfrage nicht mehr geäußert. Krollmann aber hat die Urkunden gründlich bearbeitet und dabei die Herkunft Heslers einwandfrei festgestellt (Zeitschr. d. westpreuß. Geschichtsvereins 58, Danzig 1918 S. 93 - 110). Nach seinen familien- und ortskundlichen Darlegungen steht auch


|
Seite 13 |




|
für Edward Schröder die ostthüringische Heimat des Dichters sicher (ZfdA 70 (1933), 132; Reimstudien 3 (1935), 141).
Dieser Weg der urkundlichen Bestimmung der Herkunft ist auch bei Kirchberg zu beschreiten. Denn nur auf diesem Weg kann man zu sicheren Ergebnissen gelangen. Es ist aber gleichzeitig der einzige Weg, um die sprachliche Forschung auf diesem Gebiet weiterzubringen. Das mag wiederum ein einzelnes Beispiel beleuchten. Die wenigen n-losen Infinitive, die unten mit besprochen werden, könnten keinerlei Hinweis auf die Heimat des Verfassers geben; denn Kirchberg stammt aus einem Gebiet, das heute das Inf.-n bewahrt und dessen früheres Verhalten zu dieser grammatischen Erscheinung gerade erst auf Grund der genealogischen und heraldischen Bestimmung Kirchbergs geklärt werden kann! Ohne um die Heimat zu wissen, ohne die vermutliche Mundart des Verfassers zu kennen, sind n-lose Infinitive also bei Kirchberg überhaupt nicht zu beurteilen. Ist die Heimatzuweisung dagegen sicher, dann ist zuerst die Sprache des Denkmals selbst zu deuten, und zum andern lassen sich darüber hinaus Erkenntnisse von weiterreichender Geltung gewinnen. Wie mit dem Inf.-n im einzelnen, so ist es mit der Sprache Kirchbergs im ganzen. Wollte man mit den bisherigen sprachlichen Bestimmungsmethoden vorgehen, würde man nicht einmal zu einer sicheren Beurteilung der Sprache gelangen. Falls man umgekehrt Kirchbergs Herkunft unabhängig von seiner Sprache, ohne Zuhilfenahme sprachlicher Mittel bestimmen kann, so ist aus der Sprache des Denkmals eine wesentliche Förderung der sprachlichen Forschung zu gewinnen. In dem einen Fall - soviel zeigte schon das Beispiel des Inf.-n - geben mhd. Grammatik und Dialektgeographie keine Auskunft, in dem andern Fall ergeben sich neue Erkenntnisse für sie. Es ist daher unabweisbar, die Herkunft Ernst von Kirchbergs, des Verfassers der Mecklenburgischen Reimchronik, rein auf genealogischem und heraldischem Wege zu bestimmen, so schwierig und umfänglich die Untersuchung werden mag.
Mit der Bestimmung der Herkunft des Verfassers sind die äußeren Voraussetzungen für seinen Sprachgebrauch erfaßt. Sie sind unumgänglich für das Verständnis der Sprache, aber sie sind noch nicht entscheidend. Die Sprache eines literarischen Denkmals geht nicht einfach aus der Mundart der Heimat des Verfassers oder der Entstehungslandschaft des Werkes hervor,


|
Seite 14 |




|
sie ist auch nicht etwa ein bloßes Gemisch von Mundart und Literaturtradition. Die Sorgfalt, die Kirchberg ähnlich wie auf den Versbau auf den Reim und überhaupt die Sprache verwendet, weist darauf hin, daß die Sprachformen aus anderen Gründen heraus verstanden werden müssen. Dem nachzugehen, ist das Vorhaben der gegenwärtigen Untersuchung. Sie bemüht sich, den eigentlichen Aufgaben sprachlicher Forschung zu dienen, zu denen die Herkunftsbestimmung des Verfassers nur Vorarbeit ist.
1. Teil:
Die Herkunft Ernst von Kirchbergs als Voraussetzung für den Sprachgebrauch in der Mecklenburgischen Reimchronik.
1. Die Geschlechter von Kirchberg im Mittelalter.
Angaben über den Verfasser; Gang der Untersuchung. Der Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik nennt in der Vorrede seinen Namen, Ernst von Kirchberg. Dazu gibt die Miniatur am Kopf der Vorrede das Bild des Verfassers und, was das Wichtigste ist, sein Wappen; die Miniatur stellt, wie auch die Miniaturen vor den weiteren Kapiteln, im Bilde das dar, was der folgende Text enthält, ein Gebet des Verfassers. Daß es sich bei der ersten Miniatur um den Verfasser selbst handelt, hat zuerst Lisch MJ 12 (1837) gesehen. Der Wappenschild zeigt in weiß drei Spitzen (schwarz, schwarz-rot und rot). Die Helmzier ist ein Manneskopf mit braunem Bart, auf dem Kopfe sind zwei Spitzen, von denen wiederum die eine eine schwarze, die andere eine rote Spitze in weiß enthält. Die Helmdecke ist rot. Kritisch gesichert zu werden braucht weder die Namensnennung noch die Miniatur. Diese Angaben in der Originalfassung, die dem Besteller Herzog


|
Seite 15 |




|
Albrecht II. eingehändigt werden sollte, stimmen selbstverständlich.
Ein Geschlecht von Kirchberg mit diesem Wappen ist bisher unbekannt. Daß trotzdem versucht werden muß, die Herkunft des Verfassers der mecklenburgischen Reimchronik aus seinem Namen und seinem Wappen ohne Beihilfe der Sprache des Werkes festzustellen, wurde bereits oben dargelegt. Aus den Erörterungen ging gleichzeitig hervor, daß die Verfasserfestlegung gar nicht scharf und sicher genug sein kann. man darf sich nicht dadurch abschrecken lassen, daß gerade Kirchberg zu den verbreitetsten mittelalterlichen Namen gehört. Man muß sich eine Überschau über sämtliche mittelalterlichen Geschlechter mit diesem Namen verschaffen, die irgendwie bekannt sind, um unter ihnen das Geschlecht des mecklenburgischen Reimchronisten Schritt für Schritt einzugrenzen. Der Beweis besteht in diesem Falle nicht nur darin, daß ein Geschlecht aufgezeigt wird, zu dem der Verfasser gehört haben könnte, sondern noch darin, daß sämtliche Geschlechter, die überhaupt in Frage kommen könnten, ausgeschlossen werden zugunsten eines einzigen. Die Ermittlung eines Geschlechts, das dem Namen und dem Wappen des Verfassers entspricht, ist also nur ein Teil der Aufgabe; die Hauptaufgabe ist die, zu zeigen, daß der Verfasser zu keinem anderen Geschlecht gehört haben kann.
Die umfängliche Zusammenstellung aller Geschlechter von Kirchberg kann auch für andere Zweige der Wissenschaft nutzbringende Ergebnisse abwerfen. Bei wenigen anderen Geschlechtern wird in der mittelalterlichen Geschichtskunde solch ein Durcheinander herrschen wie bei den Kirchbergern. Die Verwirrung, die in den Registern der Urkundenbücher, ja sogar in genealogischen Werken und in Wappen- und Siegelsammlungen zutage tritt, ist überraschend. Um ein zahmes Beispiel aus den verhältnismäßig bekanntesten hochadligen Geschlechtern und aus den letzten Jahren zu nennen: im Jahre 1933 werden im Urkundenbuch des Eichsfeldes (Geschichtsquellen der Prov. Sachsen N.R. 13) die Grafen Konrad und Emicho zu den thüringischen Grafen von Kirchberg geschlagen, obwohl sie überhaupt nicht zu einem Kirchbergischen Geschlecht gehören, sondern zu den berühmten Wildgrafen von Kirburg (über Kirn an der Nahe), während umgekehrt Schmithals, weil er nicht erkennt, daß die Elisabeth von Kirberg im Stift Elten eine Tochter aus dem Wildgrafengeschlecht ist, in seinem Aufsatz "Drei freiherrliche Stifter am Niederrhein" (Annalen des histo-


|
Seite 16 |




|
rischen Vereins f. d. Niederrhein 84 (1907), 150) ein sonst unbekanntes Geschlecht von Kirberg in der Eifel erwägt. Man sieht gerade hier, wie unerläßlich für die richtige Zuteilung eine vorausgehende Übersicht über sämtliche Geschlechter ist. Es wird der Kürze halber im folgenden auf Polemik verzichtet, so wesentlich sie in vielen Punkten zur Verdeutlichung beitragen würde. In den meisten Fällen sind die hier gegebenen Zuordnungen und Ableitungen sicher. Andere Meinungen wurden nur angeführt, wo die Verhältnisse nicht völlig zweifelsfrei lagen. Wo schon eine Arbeit über ein Teilgebiet vorhanden war, begnügt sich die Übersicht mit einem einfachen Verweis, ohne auf Einzelfehler einzugehen, die die Gesamtfrage nicht berühren.
Natürlich muß sich eine solche Übersicht auf das bereits veröffentlichte Material beschränken. Sie kann außer den darstellenden Werken nur die gedruckten Urkunden und die Regesten-, Wappen- und Siegelveröffentlichungen verwerten. Gewiß ist das wenig im Verhältnis zu den vorhandenen Urkundenschätzen, und natürlich läßt sich die Geschichte der einzelnen Geschlechter noch stark ausbauen. Aber die ritterlichen Geschlechter von Kirchberg scheinen in den bisher veröffentlichten Urkunden ziemlich vollständig erfaßt zu sein. Es ist unwahrscheinlich, daß es Geschlechter gegeben hätte, die den Urkundensammlungen ganz und gar entgangen wären. Die Stichprobe bei dem niederhessischen Rittergeschlecht bestätigt das. So viel klarer die Geschichte des Geschlechts aus den Mitteilungen des Staatsarchivs Marburg hervorgeht, aus den gedruckten Urkunden konnte schon das Geschlecht selbst, seine soziale Stellung und sein Herkunftsort bestimmt werden.
Für die hier notwendigen Zusammenstellungen der Kirchberg-Geschlechter lassen sich ohne Bedenken einige Einschränkungen machen. Es brauchen nicht die Geschlechter in allen Gegenden Deutschlands mit gleicher Eindringlichkeit untersucht zu werden. Soviel ergibt sich aus der Sprache der Reimchronik ohne allen Zweifel, daß der Verfasser aus Österreich, Bayern oder der Schweiz nicht stammen kann. Das bedeutet keine Benutzung sprachlicher Hilfsmittel zur Verfasserbestimmung. Es wäre sinnlos, wollte man annehmen, daß Ernst von Kirchberg aus den genannten Gebieten stammen könnte. Für Österreich, Bayern und die Schweiz genügt es daher, nur die Geschlechter durchzusehen, die schon genealogische oder heraldische wissenschaftliche Beachtung erfahren haben.


|
Seite 17 |




|
Im übrigen läßt sich kaum vermuten, aus welcher Gegend das Geschlecht des Reimchronisten stammt. Die Form des Namens, in der sich der Verfasser selbst nennt, gibt keinen Anhalt. Schirrmacher geht davon aus, daß Kirchberg, nicht etwa Kerkberg, die mundartliche Aussprache des Verfassers gewesen sein müsse, weil ja für den Reim auf werg beide Formen gleichwertig seien und darum die handschriftliche Schreibung die echte Namensform wiedergebe. Er hat dabei nicht beachtet, daß im Mittelalter die Namenschreibung nicht fester als die Schreibung aller anderen Worte war. So erscheint die Burg bei Jena in Urkunden bald als Kirch- und Kerchberg, bald als Kirc-, Kerc-, -berg, -berc und -perg, ja sogar als Churberg (diese Namenformen alle bei Schmid). Die gleichmäßig geregelte Sprache der Handschrift wäre Grund genug, um die Form Kirchberg allein daraus zu erklären. Aus den Urkunden müssen also alle Kerk-, Ker- und Karberg, Kerch-, Kirch- Kir- und Kerberg gesammelt werden. -berg und -burg im zweiten Bestandteil werden meist miteinander verwechselt. Dagegen braucht Kilburg (Kyllburg) nicht aufgenommen zu werden. Dieser Ort an der Kyll im Kreise Bitburg im Regierungsbezirk Trier ist so auffällig mit dem Flußnamen verbunden, daß er sich auch in einem Familiennamen nicht in Kirchberg hätte verwandeln können. Außerdem gilt nur für das alemannische Gebiet der Wechsel kirche - kilche, nur hier sind die Kilchberg wie die Kirchberg zu berücksichtigen.
Quellen. Die Quellen und Vorarbeiten hier aufzuzählen, ist unmöglich. Durchgesehen ist alles, was in Dahlmann-Waitz, "Quellenkunde der deutschen Geschichte" (9. Auflage von H. Haering, Leipzig 1931) unter den Nummern 1153 bis 1216, 1244 bis 1273, 1314 bis 1508 verzeichnet ist, eine Reihe weiterer Arbeiten, die an anderen Stellen zu finden waren, und das, was sich aus der Durchsicht dieser Arbeiten ferner ergab. Für Thüringen und Hessen wurde alles durchgesehen, was irgend aus Spezialbibliographien, geschichtlichen und landeskundlichen Werken der Gegenwart und Vergangenheit zu ermitteln war. Für die übrigen Gebiete wurde außer der genannten Literatur noch das verwertet, was sich über irgendwelche Orte oder Geschlechter von Kirchberg in den Bibliographien zur Geschichte einzelner Gebiete, wie sie Dahlmann-Waitz Nr. 956 bis 976 zusammenstellt, findet. Die Erscheinungen der letzten Jahre wurden mit bibliographischen Hilfsmitteln des Dahl-


|
Seite 18 |




|
mann-Waitz Nr. 945 ergänzt, für Hessen, Thüringen und Randgebiete wurden außerdem die laufenden Bibliographien der Zeitschriften, für Mecklenburg die Jahresbibliographien der MJ benutzt. Für Hessen wurden noch alle in den Dahlmann-Waitz-Nrn. 1104 - 1106 und 1108 genannten Zeitschriften durchgesehen, ebenso alle Bände der MJ. Außerdem wurden die genealogischen, heraldischen und sphragistischen Werke, wie sie Dahlmann-Waitz in den Abschnitten 8 und 9 unter den "Hilfswissenschaften" anführt, dazu die mittelalterlichen Wappenbücher, die bei Frh. v. Berchem, Galbreath und Hupp, "Die Wappenbücher des deutschen Mittelalters" (Schweizer Archiv für Heraldik 39 (1925), 40 (1926) und 42 ( 1928) zusammengestellt sind, und die Arbeiten darüber, soweit sie mir erreichbar waren. Auch auf diesem Gebiete wurden die Neuerscheinungen bis in die Gegenwart herein berücksichtigt.
Abkürzungen der Literatur.
AHG - Archiv für hessische Geschichte und Altertumskd., Darmstadt.
Alberti - Otto von Alberti, Württembergisches Adels- und Wappenbuch I, Stuttgart 1889.
AssebUB - Asseburger Urkundenbuch, hsg. von Joh. Graf von Bocholtz-Asseburg. Bd. 1 (Hannover 1876), Bd. 3 (Hannover 1905).
Avemann - H. F. Avemann, Vollständige Beschreibung des Geschlechts der Burggrafen von Kirchberg, Frankfurt a. M. 1747.
Balds - A. Baldsiefen, Das Kassiusstift in Bonn und die Standesverhältnisse seiner Mitglieder im Mittelalter, Rheinische Geschichtsblätter 9, 1910.
Bruchmann - K. G. Bruchmann, Der Kreis Eschwege, Territorialgeschichte der Landschaft an der mittleren Werra = Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 9, Marburg 1931.
Brunner - H. Brunner, Gudensberg, Kassel 1922.
Classen - W. Classen, Die kirchliche Organisation Althessens im Mittelalter = Schriften des Instituts für geschichtliche Landeskunde von Hessen und Nassau 8, Marburg 1929.
CodDSaxR - Codex diplomaticus Saxoniae Regiae, hsg. von Otto Posse und Hubert Ermisch. I. Hauptteil: Abt. A, 3 Bde., Abt. B, 3 Bde. II. Hauptteil: 18 Bde. Leipzig 1864 - 1909
Dobenecker - Otto Dobenecker, Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae, 3 Bde., Jena 1896 - 1925
Dorvaux - N. Dorvaux, Les anciens pouillés du diocèse de Metz = Mémoires de la société d'archéologie et d'histoire de la Moselle 18, Nancy 1902.


|
Seite 19 |




|
Erath - Codex diplomaticus Quedlinburgensis, ed. A. U. ab Erath, Francofurti ad Moenum 1764.
Fahne - A. Fahne, Geschichte der kölnischen, jülichschen und bergischen Geschlechter, Köln und Bonn, 1. Teil 1848. 2. Teil 1853.
Falckenheiner - C. B. N. Falckenheiner, Geschichte hessischer Städte und Stifter, Bd. 1 Kassel 1841, Bd. 2 Kassel 1842.
GeschQuSachs - Geschichtsquellen der Provinz Sachsen.
Gudenus - Codex diplomaticus anecdotorum res Moguntinas illustrantium ed. V. F. de Gudenus, 1. Bd. Göttingen 1743, 2. Bd. Frankfurt und Leipzig 1747.
Hammer - Hammer, Die ausgestorbenen Herren von Kirchberg. Würtembergische Jahrbücher 1838, S. 335 - 356.
Hefner - Otto Titan v. Hefner, Stammbuch des blühenden und abgestorbenen Adels in Deutschland. Bd. 2. Regensburg 1863.
HennebUB - Hennebergisches Urkundenbuch, 1. Teil hsg. von K. Schöppach, Meiningen 1842, 3. Teil hsg. von G. Brückner, Meiningen 1857.
Heyck - Eduard Heyck, Deutsche Geschichte, 2. Bd., Bielefeld und Leipzig 1906
Jordan - R. Jordan, Chronik der Stadt Mühlhausen i. Thür., 1, Mühlhausen 1900.
Kneschke - E. H. Kneschke, Neues allgem. deutsches Adelslexikon. 5. Bd., Leipzig 1864.
Lacomblet - Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, hsg. von Theod. I. Lacomblet, Bd. 3 1853, Bd. 4 1857, Düsseldorf.
Matrikel der Universität Köln: Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde 8: Bd. 1 1928 2 , Bd. 2 1919, Bd. 3 1931.
Neubauer - Andreas Neubauer, Regesten des Klosters Werschweiler = Veröffentlichungen des historischen Vereins der Pfalz 13, Speyer 1921.
OberbadGeschlb - Oberbadisches Geschlechterbuch, hsg. von Jul. Kindler von Knobloch. 2. Bd., Heidelberg 1905.
Otto - E. F. Otto, Adel und Freiheit im deutschen Staat des frühen Mittelalters = Neue deutsche Forschungen, Abt. Mittelalterliche Geschichte 2, Berlin 1937.
Posse - Otto Posse, Die Siegel des Adels der Wettiner Lande, 4. Bd., Dresden 1911.
PublPrStArch - Publikationen aus den Preußischen Staatsarchiven.
PublRheinG - Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde.
Quellen z. lothr. Gesch., hsg. von der Gesellschaft für lothring. Geschichte und Altertumskunde, 1. Bd. Metz 1901, 2. Bd. ebd. 1905
RegBadenHachberg - Regesten der Markgrafen von Baden und Hachberg, Bd. 3, hsg. von H. Witte, Innsbruck 1907.
RegMagd - Regesta Archiepiscopatus Magdeburg. von v. Mülverstedt, Magdeburg: 2. Teil 1881, 3. Teil 1886.
RegTrier - Regesten der Erzbischöfe zu Trier von Adam Goerz, Trier 1861.


|
Seite 20 |




|
Reimer - Heinr. Reimer, Historisches Ortslexikon für Kurhessen = Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen und Waldeck 14, Marburg 1926.
RheinAntiqu - Denkwürdiger und nützlicher rheinischer Antiquarius, Mittelrhein, II. Abt. 17. - 19. Bd., Koblenz 1870.
Riedesel - E. E. Becker, Die Riedesel zu Eisenbach, Bd. 2, Offenbach 1924.
Rietstap - I. B. Rietstap, Armorial général, Tome 1, Gouda 1884 2 .
Rolland - V. Rolland, Planches de l'armorial général. Bd. 3, Paris 1909.
Schirrmacher - Friedr. Schirrmacher, Ernst von Kirchberg, kein Mecklenburger, sondern ein Thüringer, Rostock 1875.
Schmid - Eduard Schmid, Geschichte der Kirchbergschen Schlösser auf dem Hausberg bei Jena, Neustadt a. O. 1830.
Schöttgen-Kreysig - Diplomataria et scriptores historiae Germanicae, hsg. von Christian Schöttgen und Georg C. Kreysig, Bd. 1, Altenburg 1753.
Siebm - Siebmachers großes und allgemeines Wappenbuch, begründet von Otto Titan v. Hefner, Nürnberg seit 1854, zitiert nach Bänden, Teilen, Seiten.
Siebm 1772 - Johann Siebmachers Wappenbuch, Nürnberg 1772.
UBAltenberg - Urkundenbuch der geistlichen Stiftungen des Niederrheins, Teil 3: Abtei Altenberg, Bd. 1, hsg. von H. Mosler, Bonn 1912.
UBGereon - Urkundenbuch des Stiftes St. Gereon zu Köln, hsg. von P. Joerres, Bonn 1893.
UBMittrh - Urkundenbuch zur Geschichte des Mittelrheins, Bd. 1, hsg. von Heinrich Beyer, Koblenz 1860, Bd. 3, hsg. von L. Eltester und A. Goerz, Koblenz 1874.
VeröfflHess - Veröffentlichungen der historischen Kommission für Hessen und Waldeck. Marburg.
WenckUB - Helfrich B. Wenck, Hessische Landesgeschichte, 1783 - 1803, Urkundenbuch, 3 Bde.
WfälUB- Westfälisches Urkundenbuch, Bd. 4, 1. Abt. hsg. von R. Wilmans, Münster 1874, 3. Abt. bearbeitet von Heinr. Finke, Münster 1877 - 1894; Bd. 6 hsg. v. H. Hoogeweg, Münster 1898.
Wintzingeroda-Knorr - Die Wüstungen des Eichsfeldes = GeschQu Sachs 40 (Halle 1903).
WirtembUB - Wirtembergisches Urkundenbuch, hsg. von dem Königl. Staatsarchiv in Stuttgart.
WürttembGeschqu - Württembergische Geschichtsquellen, hsg. von der Württembergischen Kommission für Landesgeschichte, Bd. 7, Stuttgart 1905, Bd. 23, Stuttgart 1934.
Zedler - Joh. H. Zedler, Großes Universallexikon, Bd. 15, Halle und Leipzig 1737.
ZHG - Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, Kassel.
ZHarzv - Zeitschrift des Harzvereins
ZVaterlGWestf - Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, hsg. von dem Verein f. Gesch. u. Altertumskde. Westfalens.


|
Seite 21 |




|
Hochadel. Es gibt drei Grafengeschlechter von Kirchberg, ein thüringisches, ein schwäbisches und ein bairisch-österreichisches. Das bairisch-österreichische, über das F. A. Schreiber, "Otto der Erlauchte", München 1861, kurz gehandelt hat, ist deshalb bemerkenswert, weil es außer dem niederhessischen das einzige Geschlecht von Kirchberg ist, in dem sich im Mittelalter der Name Ernst nachweisen läßt. Es ist jedoch in dem Zweig, in dem ein Graf im 11. Jahrhundert und sein Enkel im 12. Jahrhundert diesen Namen trugen, bereits 1234 erloschen. Das Wappen zeigte unter rotem Schildhaupt drei Reihen blaues Pelzwerk auf Silber (vgl. Siebm VI, 1, 1 Tafel 157 und S. 152).
Das schwäbische Grafengeschlecht, für das bloß auf Alberti I, 400 verwiesen zu werden braucht, ist das bekannteste unter allen, die den Namen Kirchberg tragen. Schon früh sind diese schwäbischen Grafen in der nächsten Umgebung der deutschen Könige und begleiten sie durch alle Landschaften des Reiches. Sie bekleiden hohe Würden in der Kirche und im deutschen Ritterorden, sie begegnen in Urkunden am Niederrhein wie in Thüringen oder in Hanserezessen. Das Geschlecht ist durch den Minnesinger Konrad, dessen Lieder die Manessische Sammlung überliefert, in die Literaturgeschichte eingegangen; über ihn hat zuletzt Edward Schröder ZfdA 67, 108 gehandelt. Der Name Ernst kommt in diesem Geschlecht nie vor. Sein Wappen mit der Mohrin ist bei Alberti und an anderen Stellen einzusehen. Seine Stammburg lag an der Iller im heutigen Oberamt Laupheim in Württemberg. Nach dem Aussterben des Geschlechts ist die Grafschaft an die Fugger gekommen.
Das thüringische Grafengeschlecht nannte sich nach der Burg Kirchberg, die sich auf der Hainleite auf schwarzburg-rudolstädtischem Gebiet im Amt Straußberg erhob und deren Überreste genau beschrieben sind im "Pflüger" 5 (1928), 193 f. Ums Jahr 1300 ist es im Mannesstamm ausgestorben. Ein Ernst kommt in ihm nicht vor. Das Siegel zeigt einen Querbalken im Schild, im 13. Jahrhundert auch zweimal eine Rose, abgebildet bei Posse, Tafel 19 und 20, und schon bei Schirrmacher 25.
Am ausführlichsten behandelt dieses Geschlecht K. Meyer "Die Grafen von Kirchberg" (ZHarzv 15 (1882), S. 228 - 245). Leider ließ Meyer den reichen Stoff, den die Urkundenbücher damals schon allgemein zugänglich gemacht hatten, weithin ungenutzt,


|
Seite 22 |




|
vor allem wertete er Erath nicht aus. H. Eberhardt "Die Burgstätten Kirchberg auf der Hainleite und ihre Geschichte", Pflüger 5 (1928), 193 - 207, 469 ff., gibt reichlich Literaturangaben. Für die Geschichte des Geschlechts geht er über Meyers stark ergänzungsbedürftige Ergebnisse nicht hinaus. Er kennt für die Grafen von Kirchberg nur vier Urkunden mehr als Meyer: Friedrich 1155 aus Dobenecker, Christian als Deutschordensritter 1246 aus Dobenecker III, Werner 1306 und 1309 aus dem Urkundenbuch des Klosters Ilsenburg (= GeschQuSachs 6) und aus Hertels "Wüstungen im Nordthüringgau" (= GeschQuSachs 38, 1899).
Eine Ergänzung der Belege ist am Anfang der Geschichte der Grafen von Kirchberg notwendig. Der CodDSaxR druckt im 1. Hauptteil Abt. A Bd. 2 S. 175 f. eine Urkunde aus dem Jahre 1155 ab, in der sich der Abt von Fulda, das Kloster Walkenried und der Landgraf von Thüringen über einen Tausch einigen. Schon die Teilnehmer an dem Vertrag lassen sehr vornehme Zeugen erwarten. Wenn dann unter ihnen Friedrich von Kirberg erscheint, wenn vor ihm nur Angehörige gräflicher Geschlechter stehen und wenn die Zeugen offensichtlich einem klar umgrenzten Gebiet im nördlichen Thüringen entstammen, so ist damit sicher, daß es sich um ein Glied des thüringischen Grafengeschlechts handelt. So faßt ihn auch Dobenecker im Register zu seinem 2. Bande auf. Die im Jahr 1156 als Zeugen vorkommenden Dietrich und Friedrich von Kirchberg hat Dobenecker keinem der bekannten Geschlechter von Kirchberg zuzuordnen gewagt. Die Urkunde hat Joh. F. Schannat in seinem "Fuldischen Lehn-Hof", Frankf. a. M. 1726, S. 259 abgedruckt. Darin trägt ein oberhessischer Freier einen Teil seines freien Eigens dem Kloster Fulda zu Lehen auf. Die Zeugen sind aus einem ausgedehnten Gebiet zusammengekommen, schon daraus darf man schließen, daß sie sehr vornehmer Abkunft sind, sonst hätte man sich mit näheren Nachbarn begnügen können. Die Zeugen vor den beiden Kirchbergern werden ausdrücklich als Grafen bezeichnet. Unter den bekannten Geschlechtern von Kirchberg - daß die beiden einem sonst ganz unbekannten Geschlecht angehörten, kommt nicht in Frage - kann demnach für die Zeugen kein anderes in Betracht gezogen werden als das thüringische gräfliche Geschlecht. Dazu kommt, daß die Urkunde sicher vor dem Abt von Fulda ausgestellt ist und daß ein Friedrich aus dem gräflichen thüringischen Geschlecht im Jahr vorher als Zeuge beim Abt von


|
Seite 23 |




|
Fulda erscheint. Man gewinnt also einen weiteren Beleg für Friedrich und zudem einen bisher unbekannten Dietrich.
Alle übrigen Mitglieder dieses Geschlechtes, die aus gedruckten Urkunden bis zum Jahre 1266 bekannt sind, sind in Dobeneckers Regesten enthalten. Im folgenden brauchen also bloß Ergänzungen aufgeführt zu werden nach Urkunden, die aus späterer Zeit bei Meyer fehlen. Aus der älteren Linie sind noch belegt: Heinrich IV. 1270 bei Erath 242, 1271 RegMagd 3, 15, 1280 in GeschQuSachs 7, 1 Nr. 155, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1282 und 1286 Erath 275 und 280, 1302 als verstorben Erath 337. Seine Schwester Hedwig ist als Kanonisse in Quedlinburg bereits 1277 zu belegen Erath 262, dann 1281 ebd. 274, als Küsterin 1289 RegMagd 3, 742, Erath 289; die drei Schwestern: Elisabeth als Praeposita in Vrosa, Hedwig und Jutta als Quedlinburger Kanonissen zusammen 1286 Erath 280. Die Angaben bei Meyer, daß Elisabeth nach 1291 nicht mehr vorkomme und daß Hedwig 1290 gestorben sei, treffen nicht zu. Die drei Schwestern Elisabeth, Hedwig und Jutta stellen noch 1302 eine Urkunde zusammen aus, Erath 337. Ebenso stimmen Meyers Angaben nicht, daß der Halberstädter Dompförtner Rudolf nur bis 1267 vorkomme, RegMagd 2, 753, 755, 3, 661 belegen ihn 1268 und 2, 768 sogar 1269. Vicedominus Magedeburg. Werner erscheint 1267, Schmidt PublprStArch 21 Nr. 1152 und RegMagd 2, 734, 743, 746, 1269 ebd. 771, 772, 773, Friedrichs II. Witwe Berta, über deren späteres Schicksal Meyer nichts vermeldet, 1272 AssebUB 1, 242 und RegMagd 3, 34 ff., sein Sohn Werner 1271 GeschQuSachs 7, 1 Nr. 135, 1272 RegMagd 3, 34 ff., 1296 Erath 303, 1299 RegMagd 3, 393, 1304 PublprStArch 27, 2, 1306 ebd. 29 und GeschQuSachs 6 Nr. 190, 1307 PublPrStArch 27, 33, 1309 ebd. 60 und GeschQuSachs 38,104; diese Belege führen beträchtlich über Meyer hinaus, der in seiner Arbeit gesteht, daß ihm die Belege nach 1272 fehlen. Werners Bruder Friedrich III. kann Meyer bloß bis 1266 belegen; auch hier bittet er selbst um Ergänzung. Aus den RegMagd 3, 34 ff. ist wenigstens sein Vorkommen 1272 nachzuweisen. Sein Bruder Hermann, Kanonikus in Halberstadt, wird genannt 1270 AssebUB 1, 234 und RegMagd 3, 663, 1271 AssebUB 1 Nr. 353, 1273 RegMagd 3, 42, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1285 ebd. 344 f., 1288 RegMagd 3, 231, um 1290 ebd. 3, 263, 1291 3, 267, 745 und Erath 916, 1296 Erath 303. Aufschlußreich sind wieder die Belege für ihre Schwester Gisla, die Meyer 1280 als Gattin Werners von Scherenbecke zuletzt


|
Seite 24 |




|
belegt; sie kommt abgesehen von einem Beleg 1271 RegMagd 3, 20 f. und einem 1272 ebd. 3, 34 ff. noch vor 1280 GeschQuSachs 7, 1 Nr. 155, 1283 GeschQuSachs 13, 340, 1285 ebd. 344, 1287 ebd. 2, 1, 42, 1296 Erath 303, 1299 RegMagd 3, 393 und 1304 PublPrStArch 27, 5. Wenn das Regest RegMagd 3, 34 ff. vom Jahre 1272 richtig ist, hatte Bertha noch eine sonst unbekannte Tochter Luchardis und einen sonst unbekannten Sohn Ulrich. Aus der jüngeren Linie ist der Halberstädter Domherr Volrad sehr häufig in GeschQuSachs 7 belegt, ferner 1267 RegMagd 2, 742, 1268 ebd. 2, 753, 3, 661, 1270 ebd. 3, 7, 663 und AssebUB 1, 234 und noch recht häufig in diesem Urkundenbuch, 1271 GeschQuSachs 30, 215, aber nicht nur bis 1272, wie Meyer angibt, sondern auch noch 1278 RegMagd 3, 114 und GeschQuSachs 9, Nr. 128.
Müssen diese Belege und Personen zu Meyers Zusammenstellungen hinzugefügt werden, so müssen anderseits auch zwei Personen, die er fälschlich zu diesem Geschlecht gestellt hat, abgestrichen werden: Elisabeth und Ermgard bei Meyer S. 242 gehören zu dem burggräflichen Geschlecht.
Die berühmten Wildgrafen von Kirburg bezeichnen ihren Sitz über Kirn an der Nahe manchmal als Kirberch. Der Fehler, daß die Wildgrafen als irgendwelche Kirchberger Grafen angesehen werden, begegnet in den Registern der Urkundenbücher immer wieder. Umgekehrt ist H. Oesterley "Historisch-geographisches Wörterbuch", Gotha 1883, S. 343b, zu vorsichtig gewesen, denn der 1155 in den Ann. S. Disib. contin. vorkommende Mann, den er für unbestimmbar hält, ist ein Wildgraf. Der Schild des Geschlechts zeigt 3 (2, 1) Löwen (RheinAntiqu 2, 18).
Die Burggrafen von Kirchberg, das ganze Mittelalter hindurch eins der mächtigsten thüringischen Adelsgeschlechter, nannten sich nach ihrer Burg über Jena. Den Vornamen Ernst gibt es bei ihnen nicht. Im Wappen führten sie drei schwarze Pfähle, später auch den Löwen. Siegelabbildungen bei Posse Tafel 17 - 19. Auch die Schilde, die Rolland 3, 321 wohl mit einigen Unstimmigkeiten in der untersten Reihe abbildet (der dritte von links und der letzte in der Reihe), sind nicht die Schilde besonderer Geschlechter, sondern gehören beide den Burggrafen; den erstgenannten führten sie als Besitzer der Herrschaft Sayn-Hachenburg (s. zur raschen Übersicht Kneschke 5, 109, sonst Avemann), der letzte stellt die schon immer geführten Schilde quadriert dar.


|
Seite 25 |




|
Hans-Ulrich Barsekow "Die Hausbergburgen über Jena" (Jena 1931) behandelt das Geschlecht der Burggrafen bis 1427 im ganzen hinreichend. Für die spätere Zeit muß man auf Avemann zurückgreifen. Da er durchschnittlich ein zutreffendes Bild des Geschlechts entwirft, sei es hier unterlassen, Verbesserungen sowie Ergänzungen, die zahlreich zu machen wären, anzuführen. Nur eines sei kurz berührt, die Erwähnung der Burg Kirchberg im Jahre 1000. Die Quelle, Vita Burchardi, ist auffällig mißverstanden worden. Noch die jüngste Textausgabe, von Heinrich Boos in seinen "Quellen zur Geschichte der Stadt Worms" 3 (Berlin 1893), S. 106, 7, sieht in dem erwähnten Kirichberg die Stadt im Kreis Simmern. Ohne allen Zweifel ist aber die Burg der späteren Burggrafen bei Jena gemeint. Doch auch die, die das annehmen, haben die Quelle zum Teil falsch verstanden. Wintzingeroda-Knorr geht davon aus, daß Burchard in dem fraglichen Kirchberg "nur mit großer Mühe zur Übernahme des Bischofssitzes in Worms bewogen worden" war und daß aus diesem Grunde der Erzbischof die nächste Gelegenheit hätte ergreifen müssen, ihn zu weihen, um ihm damit ein Zurücktreten unmöglich zu machen; daraus folgt dann, daß dasjenige Kirchberg gemeint sein muß, das am nächsten bei Heiligenstadt auf dem Eichsfeld liegt, wo Burchard geweiht wurde. Aber diese Beweisführung übersieht, daß Burchard nach einem Versprechen an den Erzbischof nicht mehr zurücktreten konnte, und vor allen Dingen, daß der Kaiser nach dem Bericht in Kirchberg sofort die Investitur vollzogen hat. Barsekow, S. 5, "bleibt unverständlich", weshalb der Kaiser vom äußerst beschleunigten Zug von Regensburg über Zeitz nach Gnesen so weit nach Westen, bis Heiligenstadt, abbiege. Barsekow überlegt nicht, daß bei der Zeit, die der Kaiser zu seinem Zuge brauchte, ein solcher Abstecher nach Heiligenstadt einfach unmöglich war (Genaueres P. Kehr, "Die Urkunden Ottos III.", Innsbruck 1890, S. 252), vor allen Dingen aber behauptet er ohne Grund das Gegenteil von dem, was die einzige Quelle, die Vita Burchardi, darüber berichtet, daß nämlich nach der Investitur Burchard licentia ab imperatore accepta, cum archiepiscopo allein nach Heiligenstadt zog, und zu allem Überfluß sagt die Vita ein paar Zeilen weiter, daß nach der Weihe Burchard nur vom Erzbischof entlassen ist, weil er sich eben vom Kaiser schon in Kirchberg, vor dem Zug nach Heiligenstadt, getrennt hatte. Ebenso unmöglich nach dem ausdrücklichen Bericht der Quelle ist P. Kehrs Ansicht, daß das Zusam-


|
Seite 26 |




|
mentreffen zwischen dem Kaiser und Burchard auf dem Zuge rückwärts von Gnesen nach Mainz stattgefunden habe; es steht doch deutlich da: Imperator enim de Italia regressus Saxoniam ingreditur. Von allen ist übersehen worden, daß Burchard, von der Investitur aus gerechnet, "post aliquos dies" nach Heiligenstadt kommt. Damit allein ist schon Kirchberg an der Saale sichergestellt. Es ist sowieso das Gegebene, von Regensburg nach Zeitz lag es dem Kaiser am Wege.
Hervorgehoben sei noch, daß zu diesem Geschlecht die Schwestern Irmgard und Else gehören, die für das gräfliche thüringische Geschlecht in Anspruch genommen worden sind. Wenn übrigens Barsekow S. 54 meint: "Von Else schweigt die Geschichte bis auf jenes einzige Mal" (1350), so hat er einen wichtigen Beleg übersehen, weil er den reichhaltigen und auch für dieses Geschlecht höchst bedeutsamen Erath nicht kennt. Bei Erath 496 kommt Elisabeth von Kerberch im Jahre 1356 als domvruwe in Quedlinburg vor; auch für ihre Schwester Irmgard ist die Urkunde wichtig, weil sie darin in derselben Eigenschaft, vor ihrem Aufstieg zur Küsterin (urkundlich 1366) erscheint.
Österreichische, bayrische, schweizerische Adelsgeschlechter von Kirchberg. Diese oberdeutschen Bezirke seien nur gestreift, da sie für den Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik unter keinen Umständen in Frage kommen können. Die Orte Kirchberg sind in Österreich unter allen deutschen Gebieten am dichtesten belegt, allein das "Historische Ortsnamenlexikon des Landes Oberösterreich" von K. Schiffmann zählt im 2. Band (Linz 1935, S. 38 f., 596) 18 bereits im Mittelalter belegte Ortschaften Kirchberg auf! Von den bekannten Geschlechtern stammen aus Österreich und Bayern außer dem schon behandelten Grafengeschlecht ein altes Rittergeschlecht, das im Wappen zwei gekreuzte goldene Streitkolben auf rotem Grunde führte, von dem ein Zweig 1623 in den Freiherrenstand erhoben wurde (Hefner 2, 257 b, Kneschke 5, 111, Siebm IV, 4, 1 Tafel 114, IV, 5 Tafel 46), weiter ein altes Rittergeschlecht mit einem aufsteigenden Löwen im Wappen, über das Kneschke 5, 110, Hefner 2, 257 b f., Siebm IV, 4, 1, Tafel 114, handeln, ein steirisches Geschlecht mit einem waagerecht geteilten, unten goldenen, oben rot-silbernen Wappen, das im 15. Jahrhundert ausstirbt, dessen Erbtochter Herrand III. von Trautmannsdorff heiratete, so daß dieses


|
Seite 27 |




|
Kirchbergsche Wappen in das der Trautmannsdorff aufgenommen wurde (Siebm I, 3 A, 267 b, und I, 3, 1, 41 a, I, 3 A Taf. 359), endlich ein krainisches Geschlecht mit einem gevierteten Wappen mit Kirche und wachsendem Mann mit ungarischer Mütze und Fahne (Zedler 15, 726), das noch 1679 blühte und in Krain begütert war (I. W. Valvasor "Des hochlöblichen Herzogtums Crain topographisch-historische Beschreibung 9. Buch" (3. Bd.), Wagensperg in Crain 1679, S. 116 a, Tafel 517, 11. Buch S. 329 b). Der Name Ernst ist unter diesen Geschlechtern nirgends bekannt. Aus der Schweiz ist nur ein Geschlecht von Kilchberg von Bedeutung, es führte im Wappen eine vierblättrige silberne Blume (OberbadGeschlb II, 280).
Elsaß, Lothringen, Pfalz. Von dem Orte Kirchberg im Kreis Thann im Oberelsaß ist urkundlich nichts bekannt. Kirchberg bei Drulingen im Kreise Zabern ist zuerst 1178 belegt (Alsatia aevi Merovingici . . . diplomatica, ed I. D. Schöpflin, Bd. 1, Mannheim 1772, S. 265), dann 1360 (Dorvaux S. 19), ferner 1391 (Quellen zur lothring. Gesch. 2, 217), im 15. Jahrhundert und später bei Dorvaux S. 31, 594, 629, in den Jahren 1481 und 1485 auch im Rappoltsteinischen Urkundenbuch, hsg. von K. Albrecht, 5 (1898), 244, 355. Personen, die sich nach diesem Ort genannt hätten, sind nicht bekannt. Auf das Kirchberg am Wald im Kreis Saarburg und seine Pfarrkirche beziehen sich wohl die Urkunde Nr. 176 vom Jahre 1310 und die Urkunde Nr. 659 vom Jahre 1331 in den Quellen z. lothr. Gesch. 1, ebenso wohl die Belege aus den Jahren 1376 und 1380 in Mettensia, Mémoires et documents publ. par la Soc. nationale des antiquaires de France, Bd. 5 (1908) und vom Jahre 1397 in "Urkunden und Akten der Stadt Straßburg", 1. Abt. Bd. 6, hsg. von I. Fritz (Straßb. 1899) S. 677, 25. Als Personenname ist dieser Ortsname nicht bekannt geworden. Kerprich-lès-Dieuze im Kreis Château-Salins ist schon im 13. Jh. bei Dorvaux S. 61 später S. 29 und öfter belegt. Nach diesem Ort nannte sich Lodewic von Kirperg 1203, der in dem Regest Nr. 18 bei Neubauer als Zeuge erscheint. (Der Herausgeber ordnet ihn in seinem Register in zweierlei Hinsicht falsch ein, indem er ihn zu einem Angehörigen eines adligen Geschlechts macht, das er aus Kirrberg südöstlich von Homburg in der Pfalz stammen läßt.)
Aus diesem Kirrberg südöstlich von Homburg


|
Seite 28 |




|
in der Pfalz ist vor 1237 ein Pleban belegt (Neubauer Nr. 92); der Ort allein kommt 1240 vor (ebd. Nr. 108), der Pfarrer 1245 (ebd. Nr. 126), der Ort 1289 (A. Neubauer "Regesten des ehemaligen Klosters Hornbach" = Mitteilungen des historischen Vereins f. d. Pfalz 27 (1904)), 1301 (Mitteilungen des historischen Vereins f. d. Saargegend 13, 1914, S. 237, Nr. 810), 1360 (Dorvaux S. 19), 1357 - 1361 (Quellen z. lothr. Gesch. 2, 217). Der Ort wird erwähnt in dem "Urkundenbuch zur Geschichte der ehemals Pfalzbayerischen Residenzstadt Zweibrücken", hsg. von L. Molitor, Zweibrücken 1888. Man vergleiche ferner "Veröffentlichungen der pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften" 1 (1927), 331 unter Sigehartswilre. Belege für das 15. Jh. finden sich bei Neubauer. "Werschweiler" Nr. 855, 879, 889, 985. Zur Personenbezeichnung hat der Ort sicher einmal gedient: im Jahre 1423 (ebd. Nr. 855); der Herausgeber macht ihn irrtümlich zu einem Angehörigen eines "Adelsgeschlechtes". Ob die in der Matrikel der Univ. Köln vorkommenden Gasp. Nuyt und Heinrich de Kirborch aus diesem Ort oder aus dem nassauischen Kirchberg bei Limburg stammen, läßt sich nicht entscheiden. Noch schwieriger ist die Herkunft des Magisters Johann von Kirchberg, 1446 Pfarrer in Sprendlingen, zu erklären (RegBadenHachberg 3, 170).
Baden, Württemberg. F. X. K. Staiger "Meersburg am Bodensee", Konstanz 1861, S. 186, spricht die vage Vermutung aus, daß aus dem badischen Kirchberg im Amt Salem, im Bezirksamt Überlingen am Bodensee, ein ritterliches Geschlecht gestammt habe. Das entbehrt jeglicher Stütze und sogar jeglicher Wahrscheinlichkeit. Dagegen ist ein plebanus von hier im Jahre 1229 im WirtembUB 3, 246 belegt, der Ort allein im Jahre 1290 im WirtembUB 9, 331.
Aus Kirchberg bei Büsingen im Bezirksamt Konstanz setzt das OberbadGeschlb II, 286 ein Geschlecht von Kirchberg nur mit wenigen nicht nachprüfbaren Belegen als zweifelhaft an. Jedoch hat das OberbadGeschlb den ersten Beleg für dieses Geschlecht auch für das oben schon genannte schweizerische Geschlecht von Kilchberg geltend gemacht.
Württemberg ist mit Kirchbergen reichlich bedacht. Nicht zu berücksichtigen ist hier das junge, unbedeutende Geschlecht mit dem schrägrechts mit drei Zinnen in rot und silber geteilten Schild. Darüber handelt Zedler 15, 726, Siebm 1772, II, 98.


|
Seite 29 |




|
Nach dem Ort Kirchberg im Oberamt Laupheim nannte sich nicht nur das berühmte Grafengeschlecht, sondern auch bürgerliche Personen. Belege im Ulmischen Urkundenbuch 2 (hsg. von G. Veesenmeyer und H. Bazing, Ulm 1900), 685 für das Jahr 1369 und S. 647 für das Jahr 1367.
Nach dem Ort Kirchberg im Oberamt Biberach hat sich, soviel bekannt ist, keine Familie genannt; denn Heinricus de Kirberch, 1231 (WirtembUB 3, 296), und H. de Kirchperc, 1244 (ebd. 4, 76), stammen gewiß nicht, wie der Herausgeber annehmen will, aus Kirchberg im Oberamte Biberach, sondern sind sicherlich zu den Personen zu stellen, die zu Kilchberg südwestlich von Tübingen gehören: Heinricus de Kirchperc im Jahre 1236, bei C. F. Stälin, "Wirtembergische Geschichte" 2 (Stuttgart und Tübingen 1847), S. 446, und um 1240 im Ulmischen Urkundenbuch Bd. 1 (hsg. F. Pressel, Stuttgart 1873) S. 68; in dem letztgenannten Band finden sich noch weitere urkundliche Nachweise für dieses Geschlecht. Zum selben Ort sind auch Friedrich de Kilperch dictus Lescher, der 1292 vorkommt (WirtembUB 10, 76), und Konrad Lescher von Kirchberg, genannt 1415 (WürttembGeschqu 7, 488, 33, 489, 13), zu rechnen.
Kirchberg an der Murr im Oberamt Marbach ist im WirtembUB in den Bänden 2, 4, 7, 8, 9 reichlich belegt. Ein eingehendes Bild von dem Ort mit seinen Bewohnern und Abgaben um 1350 gewähren die WürttembGeschqu 23, 160, 30 - 164, 326, 20, 31. In diesem Ort muß man ein Geschlecht alten Ortsadels annehmen, von dem keine weiteren Nachrichten überliefert sind. Die einzige Kunde davon ist die Bemerkung in den WürttembGeschqu 23, 163, 16, daß um 1350 diu von Kirberg in dem Orte wohnte und Besitzungen hatte; doch dürfte allein hierdurch, wie auch K. O. Müller, der Herausgeber der Quelle, annimmt, der Ortsadel erwiesen sein. Nach diesem Ort tragen ferner Einwohner in Waiblingen ihren Namen: WürttembGeschqu 23, 183, 31.
Nach dem Kirchberg im württembergischen Schwarzwaldkreis, im Oberamt Sulz, tragen Arnold von Kirchberg mit seinen Söhnen Arnold und Eberhard, genannt 1095 (R. Kraus, "Geschichte des Dominikanerfrauenklosters Kirchberg", Württembergische Vierteljahrshefte f. Landesgeschichte N. F. 3, 292), und Burkart von Kilchberg, genannt 1113 (Zeitschrift f. Gesch. d. Oberrheins 2, 195) ihre Namen. Es handelt sich vielleicht um ein hohenbergisches Dienstmannengeschlecht, wie Kraus annimmt, ebenso gut können diese Personen na-


|
Seite 30 |




|
türlich dem Zweige eines anderen Geschlechtes angehören, der sich nach dieser seiner Besitzung nannte. Ein Wappen ist von ihnen kaum zu erwarten, jedenfalls nicht erhalten.
Ein reichlich bezeugtes Rittergeschlecht von Kirchberg stammt aus dem Ort Kirchberg an der Jagst im Oberamt Gerabronn (darüber G. Bossert "Die Herren von Kirchberg an der Jagst" in den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte 12, 55 - 61, sowie die übrige bei Alberti angegebene Literatur). Dieses Geschlecht führte als Wappenschild zunächst einen Sparren. Kunz von Kirchberg, gesessen zu Seldeneck, hat dann das Helmkleinod, das für das Geschlecht sonst belegt ist, den Bocksrumpf, in den Schild genommen (Abb. Siebm. 6, 2 Tafel 16 und 120). Diese Kirchberger standen zu den Nürnberger Burggrafen in Beziehung; das weisen für verschiedene Personen Bossert und schon Hammer 352, 355, endlich Siebm VI, 2, 17 a nach. Dazu ist noch die Urkunde vom Jahre 1447 in den RegBadenHachberg 3, 186 zu nehmen. Zu diesem Geschlecht gehört auch der Konrad von Kirchberg, den Posse fälschlich von den Thüringern abstammen läßt und dessen Siegel er Tafel 20 Nr. 6 abbildet. Eine Reihe Geistlicher von Kirchberg sind in der Umgebung des Würzburger Bischofs belegt. Bossert schied sie ohne weitere Begründung, und ohne ihre Geschlechtszugehörigkeit angeben zu können, aus diesem Geschlecht aus. Da aber nicht einzusehen ist, warum sie nicht dazu gehören sollen, und da eine bessere Einordnung nicht zu finden ist, muß man sich wohl Seyler (Siebm VI, 2, 17 a) und Hammer 353 anschließen, die die Würzburger Geistlichen zu diesem von der Jagst stammenden Geschlecht rechnen. Hinzuzufügen ist noch Ulricus de Kyrchberg, custos et archidiaconus in Würzburg 1320, aus dem HennebUB 1 S. 81. Nach alledem dürfte auch der Stiftsvikar Jakob von Kirchberg, 1366 in Aschaffenburg (PublPrStArch 60 Nr. 548), hierher gehören. Den Namen Ernst trägt keiner von den Kirchbergern aus diesem baden-württembergischen Bezirk. Ohne Bedeutung ist das kleine Weißenkirch(en)berg, das zur Gemeinde Brunst im Gericht Schillingsfürst in Mittelfranken gehört. Die Pfarrkirche dieses Ortes ist im Jahre 1350 im Hohenlohischen Urkundenbuch 3 (hsg. von K. Weller und Belschner, Stuttgart 1912), S. 432, 30 belegt.
Luxemburg, Süden und Westen der Rheinprovinz. Unter allen Orten namens Kirchberg ist der auf


|
Seite 31 |




|
dem Hunsrück im Kreis Simmern am häufigsten belegt. Es brauchen keine einzelnen Stellen angeführt zu werden. Die Verwechslungen dieses Ortes mit anderen, besonders mit dem Kirburg der Wildgrafen, das sich in den Registern der Urkundenbücher so häufig findet, sind leicht zu bemerken und brauchen hier nicht erwähnt zu werden. Es begegnen eine Anzahl Bürgerliche, die im Namen ihre Herkunft aus diesem Ort angeben, z. B. im Jahre 1225 (UBMittrh III, 218), im Jahre 1340 (PublRheinG 19, 3, 102), im Jahre 1388 (PublRheinG 19, 3, 103), im Jahre 1453 (RegBadenHachberg 3, 319), im Jahre 1445 (PublRheinG 19, 4, 322). Später: Matrikel der Univ. Köln 3, 587 b; Trierisches Archiv Ergänzungsheft 11 und 14. Vielleicht heißt auch der Johannes von Kirberch vom Jahre 1258 im UBMittrh III, 1065 nach diesem Ort; doch könnte er ebenso zur Kirburg über Kirn gehören. Ein Adelsgeschlecht, das sich von Kirchberg auf dem Hunsrück herleitete, gab es im 13. Jh. und später nicht. Wenn in den Urkunden ein Burggraf von Kirchberg, ein dapifer de Kirchperg und Truchsessen von Kirchberg vorkommen, so deuten die Belege keineswegs auf Geschlechter dieses Namens, sondern lediglich auf Bezeichnungen einzelner Dienstmannen des Erzbischofs von Trier nach dem Hofamt, das sie beim Erzbischof vertraten, und dem Lehen, das sie dafür trugen. Belege für solche Dienstmannen im Rhein Antiqu 2, 17, 168, denen Peter des drossessin son van Kijrperch 1363/4 (Trierisches Archiv, Ergänzungsh. 9, Trier 1908, S. 42 a) hinzuzufügen ist. Belegt ist ferner in RegTrier S. 92 fürs Jahr 1356 Jakob Mümming von Kirberg als Burgmannn des Erzbischofs von Trier. Wenn H. Beyer ZVaterlGWestf 2, 194 (1839) von einem Burggrafen Jakob von Kirchberg 1346 spricht, so dürfte sich eine irrige Übersetzung der Bezeichnung castellanus eingeschlichen haben. Es hat aber ein ritterliches Geschlecht gegeben, das aus diesem Kirchberg stammte und sich zunächst auch danach nannte, das RheinAntiqu II 19, 247 - 258 umständlich abgeleitet und verfolgt wird. Dieses Geschlecht legte jedoch seit ungefähr 1200 den Namen von Kirchberg ab und nannte sich von Heinzenberg nach seiner Burg, die vermutlich damals bezogen wurde. Das Wappen des Geschlechts zeigt eine Schnalle. Ein Ernst kommt in ihm ebenso wenig vor wie unter allen bekannten anderen Trägern dieses Namens.
In Luxemburg gibt es ein Kirchberg bei Eich. Es ist zuerst 1150 UBMittrh I, 609 f. belegt. Von diesem Ort schreibt sich im Jahre 1410 Johannes Petri Kirberch de Rodincgen im


|
Seite 32 |




|
Kanton Esch in Luxemburg (PublRheinG 23, 7 Nr. 835), wenn das Rodingen richtig bestimmt ist. Der Aachener Jodocus Kirbrich im Jahre 1461 (CodDSaxR II, 16, 228 b, 77) dürfte sich nach dem Kirberichshof in der Nähe von Aachen genannt haben. Sehr früh und sehr häufig ist in Urkunden Kirchberg südlich von Jülich vertreten. Die Pfarrkirche wird schon für das Jahr 889 angesetzt; die dafür angezogene Urkunde ist zwar gefälscht (hierüber ausführlich R. Wilmans "Die Kaiserurkunden der Provinz Westfalen" Bd. 1, Münster 1867, bes. S. 353), aber vor dem Jahre 1077, in dem die Pfarrkirche schon lange bestanden haben muß. Für das Jahr 1159 ist sie bei Lacomblet 4, 777 belegt. Spätere Belege finden sich in den PublRheinG 19, 2, 21, 4, 23, 5, 28, 1, im UBGereon, in den Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln Heft 39 und 40, in der ZVaterlGWestf 3, 143, 178. Die Personen, die sich nach diesem Orte genannt haben, sind alle Bürgerliche. Ein adliges Geschlecht, das daher stammen soll, wird nur in mehreren Urkundenbüchern irrigerweise angenommen. Denn Francke Goylen sůn van Kirberch (PublRheinG 19, 2, 38, 4) war natürlich kein Adliger, ebenso wenig waren es die Pastoren, die sich nach PublRheinG 28, 2, 1 (das Register ordnet die Personen nicht richtig zusammen) im 16. Jh. nach diesem Kirchberg benennen, oder der 1546 bis 1575 belegte Peter von Kirberich Vogt zu Jülich, PublRheinG 19, 2; man vergleiche hierzu besonders PublRheinG 11, 2 S. 57 Anm., 184, 191!
Die übrigen Teile der Rheinprovinz. Rietstap 1, 1094 a und nach ihm Rolland 3 Tafel 321 setzen eine clevische Familie von Kirberg mit einem roten Sparren im silbernen Schild an. Allein das Geschlecht verdankt nur einem Fehler älterer Literatur sein Dasein. Den einzigen Anhaltspunkt für das ganze Geschlecht bildet der 1649 als clevischer Landrentmeister der Grafen von Bronckhorst vorkommende Martin von Kirberg genannt Haen (L. Frh. v. Ledebur, "Adelslexikon der preußischen Monarchie" 1 (1855), 432 b). Dadurch, daß man, wie Zedlitz-Neukirch ("Neues Preußisches Adelslexikon", Suppl., Leipzig 1839, S. 271), diesen Mann fälschlich zweiundeinhalb Jahrhunderte zurückdatierte und daß man ihn mit allen anderen in der Gegend belegten Personen von Kirchberg kurzerhand zusammenbrachte, gewann man ein adliges Geschlecht. Man setzte weiter dieses neugewonnene Geschlecht mit einem anderen Geschlecht von Kirchberg gleich, das


|
Seite 33 |




|
adlig war und für das man Belege aus Franken kannte - in Wirklichkeit stammt es aus Württemberg und ist oben mit behandelt worden -, und aus dieser unhaltbaren Gleichsetzung gewann man das Wappen für das angebliche clevische Geschlecht. Eine noch schlimmere Verwirrung hat Hefner angerichtet (II, 257 a). Er hat nicht nur mit Zedlitz-Neukirch die niederrheinischen und die fränkischen Kirchberge durcheinander geworfen, er hat dazu noch aus Fahne 1, 225 die Vermengung mit den Wildgrafen zu Kirburg übernommen und hat danach seiner fränkisch-"clevischen" Familie das Wappen der Wildgrafen zugeschrieben.
Im Clevischen hat es also, soviel man weiß, kein Geschlecht von Kirchberg gegeben. Dafür sind aus der Kölner Gegend mehrere adlige Geschlechter, auch mit ihren Wappen, bekannt. Die Dinge liegen hier ganz besonders schwierig. Nirgends vielleicht ist das Verhältnis der gedruckten Quellen zu dem vorhandenen Material oder gar zu den historischen Personen und Ereignissen so ungünstig wie gerade hier. Nur eindringende archivalische Arbeit kann da endgültige Klärung bringen. Doch wird man sich, so gut es geht, vorläufig auf Grund des gedruckten Stoffes Klarheit zu schaffen suchen. Ein Fehler läßt sich leicht beseitigen. Rietstap 1, 1094 a und Rolland 3, Tafel 321, geben ein "westfälisches" Geschlecht an, das im Schild 3 (2, 1) Löwen von 4 Kreuzen begleitet führe. Ihre Quelle kann hier nur der eben erwähnte Fahne sein, denn der Schild, den Rietstap und Rolland diesem Geschlecht beilegen, ist der Schild der Wildgrafen; genau dieser Schild ist, um nur ein Beispiel zu geben, auf dem Grabstein des Wildgrafen 1369 eingehauen (RheinAntiqu 2, 18, 699). Rietstap und Rolland übernehmen also hier, ähnlich wie Hefner, Fahnes Vermengung urkundlich belegter ritterlicher Kirchbergs aus der Umgebung Kölns mit den Wildgrafen. Im Nachtrag (2, 78) hat Fahne zwar den genealogischen Sachverhalt, daß die Wildgrafen ein anderes Geschlecht sind, das mit den rheinischen Rittern nichts zu tun hat, selbst erkannt, nicht aber den heraldischen, daß das Wappen, das er angegeben hat, nur den Wildgrafen zukommt. Er läßt vielmehr das verwechselte Wappen bei den niederrheinischen Rittern bestehen und weist der wildgräflichen Kirburger Familie, deren Trennung von den anderen wildgräflichen Linien ihm nicht klar geworden ist, den Schild mit einem Löwen zu, den aber in Wahrheit die Wildgrafen von Daun, eine andere Familie aus demselben Geschlecht, führen. So sind


|
Seite 34 |




|
die Kirchberge aus der Umgebung Kölns durch Verwechslung zu einem falschen Wappen gekommen - und bis heute dabei geblieben.
Die Erkenntnis dieser Verwirrung trägt zur Klärung der schwierigen Frage nach den Kirbergen um Köln herum bei. Es sind zwei Siegel niederadliger Geschlechter von Kirberg am Niederrhein bekannt, eins aus den Jahren 1392 - 96 mit drei Schlägeln (Fahne 1, 225), das aber nur in Verbindung mit einem Mann belegt ist, mit Adam von Kirberg, Vasallen des Afterdechanten zu Köln, mit seiner Frau Blitza zu Pesch wohnhaft, zu dem man keinen weiteren urkundlichen Ritter von Kirchberg in Beziehung setzen kann, und eins aus dem Jahre 1361 mit einem Hufeisen rechts im Schildhaupt (UBAltenberg S. 638), das ebenfalls nur einmal vorkommt, und zwar als Siegel des Ritters Gerhard von Kirberch bei einer Verzichtserklärung. Man darf jedoch wohl weitergehen und eine Gruppe sonst bekannter Personen als Angehörige desselben Geschlechtes daran anschließen. Im Jahre 1335 erscheint nämlich in einer Angelegenheit, die eng mit jener Verzichtserklärung des Gerhard von Kirberch zusammenhängt, ein Ritter Heinrich von Kirberch, der zweifellos zum gleichen Geschlecht gehört (ebd. 519). Ritter Heinrich von Kirberch - offenbar handelt es sich um dieselbe Person - kommt in mehreren Urkunden vor: im Jahre 1314, Gudenus 2, 1008 f., im Jahre 1318, Lacomblet 3, 136. Im Jahre 1326 wird Wilhelmo de Kirbergh nato Henrici de Kirbergh militis ein Kanonikat in Werden verliehen (PublRheinG 23, 1, 405). Es wird sich hier um dieselben Kirberge handeln. Ein anderer Wilhelm aus demselben Geschlecht kommt 1314 neben Heinrich In der vorhin genannten Urkunde vor. Ebenso wird der Wilhelm von Keirberg hierher gehören, dessen Witwe Ida und dessen Tochter Geirdruyd 1377 bei Lacomblet 3, 703 belegt sind, endlich der dominus H. de Kyrbergh, der 1329 (UBGereon 332) erwähnt wird. Daß diese beiden Geschlechter von Kirberg, die allerdings nur spärlich belegt sind, aus der näheren oder weiteren Umgegend Kölns stammen, ist nach den Urkunden offensichtlich. Vier Orte des Namens sind aus diesem Gebiet bekannt. Einer muß bei Monheim am Rhein zwischen Köln und Düsseldorf gelegen haben. Er besteht heute nicht mehr, muß aber wohl angenommen werden, wie es schon UBGereon im Register mit Fragezeichen getan hat. Denn von den anderen Kirbergen kommt keins in Frage, wenn 1246 der Pfar-


|
Seite 35 |




|
rer in Monheim Einkünfte aus Blee, das ganz in der Nähe liegt, und Kirberch angewiesen erhält (UBGereon 127). Kyrberg und Munheym werden noch einmal eng zusammen genannt im UBAltenberg 479 und 502 in den Jahren 1322 und 1326. Ein anderer Ort, heute Kierberg geschrieben, im Landkreis Köln, ist nur aus jüngerer Zeit bekannt, Die Höfe Kirberg bei Solingen sind ebenfalls nicht urkundlich zu belegen. Doch dürfte sich der Vater des 1348 im UBAltenberg 591 f. vorkommenden Schöffen Gobelinus von Stheynbuggele im Landkreis Solingen, filius Hermanni de Kirberg, mit großer Wahrscheinlichkeit nach den Höfen bei Solingen genannt haben. Endlich gibt es Höfe in der Pfarrei Sonnborn westlich Elberfeld, die sich früh schon nachweisen lassen und bis heute bestehen. Nach den Traditiones Werdinenses (hsg. von W. Crecelius in der Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins 7 (Bonn 1871), 42) besaß die Abtei Werden bereits 1265 Hörige in diesen Höfen. In den Jahren 1457 (PublRheinG 19, 3, 20) und 1472 (ebd. 22) gab es Besitzstreitigkeiten um das Gut. Noch heute blüht eine Familie, die aus dem Sonnborner Gut Kirberg stammt, die aber nur bis 1573 zurückverfolgt werden kann (Monatsschrift des Bergischen Geschichtsvereins 21, Elberfeld 1914, 11 - 13). Wenn man unter den vier Orten Kirberg die Wahl hat, wird man das Geschlecht von Kirberg mit dem Hufeisen im Schildhaupt vermutungsweise aus dem Sonnborner Kirberg stammen lassen, um so mehr, als ein Abkömmling dieses Geschlechtes, wie oben erwähnt ist, Kanonikus in Werden wurde. Das Geschlecht von Kirberg mit den drei Schlägeln im Wappen wird man dann einem anderen Kirberg zuweisen, aber welchem, lassen die bis jetzt bekannten Angaben nicht erkennen.
In einer großen Anzahl Urkunden kommen Kölner und Bonner Geistliche namens Kirberg vor. Gottschalk von Kirberg, der eine Reihe wichtiger Posten bekleidet hat, ist sehr oft belegt: PublRheinG 23, 2, 23, 3, 21, 4, im Jahre 1320 bei I. S. Seibertz, Landes- und Rechtsgeschichte des Herzogtums Westfalen 3, 2 (1843) Nr. 581, für die Jahre 1327 - 1357 bei Balds 233; Mathias de Kyrberch im Jahre 1359/60 UBGereon 414, im Jahre 1361 im Dortmunder Urkundenbuch I (bearb. K. Rübel Dortmund 1885) S. 548; Petrus de Kirperch PublRheinG 23, 3, 34; Gerlach de Kirberg PublRheinG 23, 2; Wilhelmus de Kirberg, Dekan im Kassiusstift in Bonn, in den Jahren 1367 - 71 bei Balds 262; Johann von Kirberg, Kanoniker im Kassius-


|
Seite 36 |




|
stift in Bonn, im Jahr 1381 bei Balds 263; Hermann von Kyrbergh, Kanonikus, im Jahre 1516, Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln Heft 40, S. 64. Die Belege reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob es sich um Adlige oder Bürgerliche handelt. Die Register der Urkundenbücher leiten ihre Namen immer von dem Köln nächstgelegenen Orte her, das stimmt gewiß nicht in allen Fällen.
Weitere nichtadlige Personen, die keinem bestimmten Herkunftsort zuzuweisen sind: der armiger Wilhelm von Kirberg im Jahre 1328, Lacomblet 3, 197; "Daym van Kirbergh, auch genannt von Moerenhoeven" 1401, der seinen Streit mit Sankt Gereon durch den Vogt zu Jülich ausgleichen läßt, kann vielleicht auch aus dem Kirchberg bei Jülich stammen (UBGereon 523). Unbestimmbar ist auch die Herkunft des Zimmermeisters Clais von Kirberg in Köln 1406 (Mitteilungen aus dem Stadtarchiv Köln Bd. 5 Heft 14, S. 40 f). Ganz hoffnungslos sind die Personenbelege in den PublRheinG, wo es sich um geistliche Pfründen handelt, die sehr oft weit weg von dem Heimatsort vergeben werden; die Aufführung solcher Fälle erübrigt sich, ebenso die Belege in der Matrikel der Univ. Köln. Mehrdeutig sind auch die Angaben über Pfarrkirchen Kirberg und ähnliches, wie z. B. in PublRheinG 23, 6, 442 u. ö.
Niederdeutschland und Ostmitteldeutschland. In diesem Gebiet begegnet der Orts- und Personenname Kirchberg nur ganz vereinzelt. Ein altes Pfarrdorf Kerkberge lag bei Böddeken im Kreis Büren im Regierungsbezirk Minden. H. Schneider, "Die Ortschaften der Provinz Westfalen bis zum Jahre 1300" (Diss. Münster 1936, Münstersche Beiträge zur Geschichtsforschung 3. Folge Heft 12) S. 75 b führt es mit einem Beleg an, und zwar aus dem Jahre 1287. Nach 1300 kann man es als Kirchspiel öfter belegt finden: 1334 ZVaterlGWestf 43, II, 46, 1361 PublRheinG 23, 4 Nr. 798, 1384 ZVaterlGWestf 22, 346, 351, 44, II, 96. Es ist aber früh wüst geworden; so ist es belegt: 1409 ebd. 44, II, 96, 1439 ebd. 31, II, 185, 1513 ebd. 22, 354. Als Personenname ist dieser Ortsname nicht bekannt geworden, es sei denn, daß der Lübecker Bürger Johann Kerkberch, der im Jahre 1398 im Urkundenbuch der Stadt Lübeck IV (1873) S. 760 belegt ist, von daher eingewandert sei, oder daß der famulus Volcoldus de Kerberge, der 1252 dreimal als Zeuge beim Bischof von Minden (WfälUB 6


|
Seite 37 |




|
Nr. 560 und 563, Osnabrücker Urkundenbuch 3, bearb. von F. Philippi, S. 38) belegt ist, aus diesem Ort stammt - er könnte aber ebenso gut aus einem anderen Orte kommen!
Das ganze weite ostdeutsche Gebiet beherbergt nur ein Geschlecht mit dem Namen Kerberg - wobei es dahingestellt bleiben soll, ob dieser Name wirklich einem hd. Kirchberg entspricht. Das Geschlecht nahm seinen Ausgang aus der Prignitz, aus der Nähe von Pritzwalk. Belege finden sich in A. F. Riedels Cod. dipl. Brandenburg. (Berlin 1838 - 69), auch I, 18, 483 und I, 14, 58 f. Der Zweig, der in der zweiten Hälfte des 14. Jh. nach Mecklenburg übersiedelte, ist am eindringlichsten erforscht, zuerst von Lisch MJ 12 (1847), 43 - 56 mit Siegelabbildungen, dann von Schirrmacher. Der Grund zu dieser Beschäftigung mit dem Geschlecht lag in der irrtümlichen Annahme, daß der mecklenburgische Reimchronist dazu gehört hätte. Ein anderer Zweig erwarb sich Besitzungen in Holstein (vgl. Hefner II, 246 b). Der Name Ernst ist in allen Zweigen dieses Geschlechts unbekannt. Ihr Wappen war durch Spitzen senkrecht in eine weiße und eine rote Hälfte geteilt.
Ein weiteres "Schloß und Dorf in oder bei der Altmark" hat das Register des Cod. dipl. Brandenburg. erfunden. I, 14, 58 f. ist das Kirchberg bei Pritzwalk gemeint. I, 14, 402 f. aber muß ein Lesefehler für Reichenberg vorliegen (dafür sei nur auf I. F. Danneil, "Kirchengeschichte der Stadt Salzwedel", Halle a. S. 1842, S. 100 hingewiesen). Die drei übrigen Belege beziehen sich auf Burggrafen von Kirchberg!
Nach dem Gut Kerberg, das dem Adelsgeschlecht aus der Prignitz den Namen gegeben hat, hat sich der Laurentius Kerperg de Pritzwalg 1488 und 1490 (CodDSaxR II, 16, 365 b, 31 und 17, 322 a, 16) und der Hans Kerberge, Ratmann in Havelberg 1373 (Cod. dipl. Brandenburg. I, 3, 298), genannt.
Auf ostmitteldeutschem Boden ist Kirchberg südlich von Zwickau als Stadt mit Schloß 1348 (3. Jahresschrift des Altertumsvereins Plauen Nr. 376), 1359 (5. Jahresschrift d. Altertumsvereins Plauen Nr. 429), 1372 (ebd. Nr. 483), als opidum Kirperg 1349/50 in den Schriften der sächsischen Kommission für Geschichte 8, 2 belegt. Im Jahre 1453 ist ein Caspar Kirchberger (CodDSaxR II, 14, 248, 11) genannt, derselbe Mann ist noch einmal 1463 belegt (ebd. 257, 1 und 38). Aus den Jahren 1474 und 1484 sind zwei Freiberger Einwohner dieses Namens bekannt (CodDSaxR II, 16, 294 b, 50 und


|
Seite 38 |




|
344 a, 4). Ob eine Anzahl weiterer Personen in Universitätsmatrikeln ihre Namen von diesem Ort tragen oder von anderen, läßt sich nicht ausmachen. "Beiträge zur Geschichte der Herrschaft Wiesenburg und der Stadt Kirchberg" lieferte Anton Bär, Kirchberg 1898.
Nur aus jüngster Zeit sind Kirchberg in der Kreishauptmannschaft Chemnitz und Kirchberg südwestlich Königstein in der Amtshauptmannschaft Pirna bekannt.
Der Ort Kirchberg zwischen Schönbach und Graslitz südlich vom Erzgebirge ist zwar als zum Kloster Waldsassen gehörig schon 1158 und öfter im 12. Jh. belegt (Mon. Egrana, hsg. von H. Gradl, Eger 1886, Bd. 1, 24, 33, 39), aber Personen haben sich, soviel bekannt ist, nicht danach benannt, ebenso wenig nach Kirchberg an der Neiße im Kreis Falkenberg in Schlesien, das als Ort 1335 im Cod. dipl. Silesiae 29, 37 bezeugt ist; das Geschlecht, das Riedel Cod. dipl. Brandenburg. Im Namenverzeichnis 2, 145 von diesem Ort herleitet, ist erfunden, die Personen gehören sämtlich zu den Burggrafen von Kirchberg.
Bürger namens Kirchberg treten in Böhmen und Schlesien erst spät auf, und auch dann so selten, daß man an eingewanderte Geschäftsleute denken muß: im Jahre 1443 in Aussig (Städte- und Urkundenbücher aus Böhmen, hsg. von A. Horčička 3, 109), im Jahre 1462 in Schweidnitz (Mon. Germ. francisc. Abt. II., Bd. 1, 1, hsg. von P. C. Reisch, Düsseldorf 1917, Nr. 484), im Jahre 1489 ein Buchhändler in Breslau (Script. rer. Siles., hsg. von G. A. Stenzel, Bd. 3, Breslau 1847, S. 319), im Jahre 1504 ein Breslauer Bürger und Reichensteiner Hüttenherr (Cod. dipl. Siles. 20), und andere noch später.
Genau so spärlich ist, wie nicht anders zu erwarten, der Name im Deutschordensgebiet und in den Ostseeprovinzen vertreten. Die Deutschordensbrüder stammen aus den großen bekannten Adelsgeschlechtern. Ein Bürgerlicher Johannes Kirbergh erscheint nur in den Revaler Zollbüchern 1383 (Hans. Urkundenbuch 5, 69 a).
Thüringen. Den beiden hochadligen Geschlechtern von Kirchberg in Thüringen schließt sich je ein Ministerialen- oder Burgmannengeschlecht von Kirchberg an. Das Ministerialengeschlecht von Kirchberg bei Jena hat zuerst Wol-


|
Seite 39 |




|
demar Lippert, "Studien über die wettinische Kanzlei und ihre ältesten Register im 14. Jh." I, im Neuen Archiv für sächsische Geschichte 24 (1903), 1 - 42, bei Konrad von Wallhausen (S. 13 bis 29) kurz behandelt. Lippert verweist nur auf Avemann und auf Schmid. Was da besprochen wird, braucht im folgenden nicht noch einmal aufgeführt zu werden. Von 1228 bis 1266 sind die Mitglieder dieses Geschlechtes bei Dobenecker Bd. 3 zusammengestellt. Häufiger begegnen Mitglieder im CodDSaxR II, 1 - 3. Ferner sind Werner von Kirchberg 1274 (CodDSaxR II, 4, 117) und 1275 (ebd. II, 15, 190, 36), der 1277 als verstorben belegte Wiricus von Kirchberg (ebd. 191, 23), die Margareta dicta de Kercberc, Äbtissin im Nonnenkloster Nimbschen bei Grimma, zwischen 1257 und 1282 (ebd. 195, 13), die Brüder Gottfried und Wirich von Kirchberg 1287 (Thüringische Geschichtsquellen N. F. 3, 1, Nr. 32) und der Wiricus; de Kerchberg, Pfarrer in Kohren, 1303 (GeschQuSachs 36, 502 und F. X. Wegele, "Friedrich der Freidige", Nördlingen 1870, S. 438 - Schirrmacher gibt die Urkunden dem Namen und dem Inhalt nach unrichtig wieder) zu diesem Geschlecht zu rechnen. Für den Konrad von Kirchberg, den er seinem Thema nach behandelt, hat Lippert Urkunden übersehen. Er kommt in den GeschQuSachs 22 sehr oft vor; auf ihn bezieht sich auch die Urkunde S. 60 in diesem Band, die das Register infolge eines Mißverständnisses einer anderen Person zuschreiben will. Andere Urkunden waren zur Zeit von Lipperts Untersuchung noch nicht veröffentlicht. Konrad kommt noch vor: im Jahre 1349 (Schriften der sächsischen Kommission für Geschichte 8, 284), im Jahre 1350 (ebd. 287, 289, 294), im Jahre 1367 (GeschQuSachs N. R. 7, 322 f., Mon. Vaticana res gestas Bohem. ill. II, hsg. von Novák , Prag 1907). Zu diesem Geschlecht gehören weiter Wirich von Kirchberg 1371 (GeschQuSachs 22, 266) und 1373 (ebd. 298), Johann von Kirchberg, Sohn des verstorbenen Wirich von "Wachau", 1373 (ebd.), und Hartmann von Kirchberg 1363 (GeschQuSachs 22, 126), 1364 (ebd. 379), 1371 (ebd. 266), vielleicht auch der Nordhäuser und Naumburger Kanonikus Heinrich von Kirchberg 1357 (GeschQuSachs 22, 59, 366) und der Erfurter Kleriker Th. dictus de Kirchberg 1290 (GeschQuSachs 23, 276). Sicher dagegen stammt aus diesem Geschlecht Wirich von Kerchberg, der 1415 Pfarrer in Bucha südöstlich von Jena war (Thür. Geschichtsquellen N. F. 3, 2, 32, Jena 1903). Der Name Ernst ist in diesem Geschlecht nicht bekannt. Sein Wappen, das Posse


|
Seite 40 |




|
Tafel 19 Nr. 5 und 6 abbildet, zeigt unter einem verzierten Schildhaupt - Lipperts eingehendere Beschreibung beruht nur auf ungenügenden Wiedergaben - 3 (2, 1) Weinblätter. "In der Familie waren literarische Neigungen nicht fremd, wie zwei frühere Träger des Namens zeigen, der in der Geschichte Heinrichs des Erlauchten und der Stadt Erfurt bekannte Dr. decret. Magister Heinrich von Kirchberg und Wiricus von Kirchberg, der im Jahre 1303 der Kanzlei Friedrichs des Freidigen angehörte" (Lippert 21). Die stärkste literarische Tätigkeit in der Familie hat der von Lippert behandelte Konrad entfaltet. Der Dr. decret. Magister Heinrich von Kirchberg ist als Held des Carmen satiricum Nicolai de Bibera occulti Erfordensis berühmt geworden (Ausgabe von Th. Fischer in GeschQuSachs 1, Halle 1870). Hierüber handelte zuletzt, allerdings mit irrigem Ergebnis, aber mit Angabe aller älteren Literatur, A. Schmidt, "Untersuchungen über das Carmen satiricum occulti Erfordensis" in Sachsen und Anhalt 2 (Magdeburg 1926), 76 - 158, ferner Dobenecker in der "Festschrift für Armin Tille" S. 22. Seine Zugehörigkeit zu diesem Geschlecht von Kirchberg läßt sich zwar nicht beweisen, dürfte aber das einzig Mögliche sein.
Während das Ministerialengeschlecht auf der Jenaer Burg schon seit längerem bekannt ist, wurde ein Ministerialengeschlecht der thüringischen Grafen von Kirchberg auf der Hainleite bisher noch nicht erwogen, wenn man von der Ansicht I. F. Müldeners ("Historisch-diplomatische Nachrichten von einigen . . . . Bergschlössern", Leipzig 1752, S. 59) absieht, die nirgends aufgenommen wurde. Das Geschlecht springt aus den bekannten Urkunden klar heraus. Eine lokal beschränkte Zeugenschaft ums Jahr 1206 (Dobenecker II, 246) beweist, daß ein Widego von Kirchberg sich nach dem Ort oder einer der beiden Burgen der Grafen von Kirchberg genannt hat. Ein Widego von Kirchberg ist schon 1203 in zwei verschiedenen Urkunden bezeugt, die aber wohl gleichzeitig ausgestellt sind (GeschQuSachs N. R. 1, 369, 369 f. - Schirrmacher 8 meint diese Urkunde natürlich!), und zwar unter derartigen Umständen, daß man zu der Annahme genötigt ist, daß er mit dem Widego um 1206 identisch ist. Dann aber ist Gozmar von Kirchberg, der urkundlich 1203 mit Widego unmittelbar zusammen genannt wird, ein Mitglied desselben Geschlechtes. Zweifellos gehören zu diesem Geschlecht noch Johann von Kirchberg 1223 (Dobenecker II, 380) und Hartungus de Kerch-


|
Seite 41 |




|
berc 1264 (Dobenecker III, 503). Später erlangte das Geschlecht größere Bedeutung, als es nämlich wichtige schwarzburgische Verwaltungsstellen bekleidete. Daß diese schwarzburgischen Vasallen Abkömmlinge der früheren Dienstmannen der Grafen von Kirchberg sind, beweisen die urkundlichen Berichte in Pauli Jovii "Chronicon Schwartzburgicum" (gedruckt in Schöttgen-Kreysig 1, 455), aus denen zu entnehmen ist, daß im Jahre 1418 Berldt von Kirchberg zu dem schwarzburgischen Adel der Pflege und des Gerichts Heringen (südöstlich von Nordhausen) gehört. 1423 ist Berlt von Kirchberg schwarzburgischer Amtmann zu Arnstadt (ebd. 468). Natürlich gehören die schwarzburgischen Vasallen Conrad von Kirchberg 1398 (ebd. 249 f.) und nach alledem auch sicherlich Cristan von Kerchberg 1338 (Schöttgen-Kreysig I, 798) zu diesem Geschlecht. Wenn die weiteren Berld, Heinrich, Jons, Albrecht und Lorenz von Kirchberg wirklich belegt sind, wie Mülverstedt (Siebm VI, 13 (1908) S. 44 b) und Müldener behaupten, so müssen auch sie zu diesem Geschlecht gehören. Aller Wahrscheinlichkeit nach trägt endlich der vicarius C. de Kerchberg der Jechaburger Kirche 1317 (S. A. Würdtwein, "Diplomataria Maguntina" 1, Magontiaci 1788, 129) seinen Namen von dem ganz nahe gelegenen Kirchberg. Zum Schluß braucht nur noch bemerkt zu werden, daß das, was Mülverstedt über einige dieser Belege sagt, sowohl in den Grundlagen (er gibt z. B. 1298 statt 1398, 1441 statt 1423) wie in der Ausdeutung nicht zu halten ist. Der Name Ernst kommt unter den bekannten Mitgliedern des Geschlechtes, wie man sieht, nicht vor.
Über ihr Wappen sei eine Vermutung ausgesprochen. R. P. F. Bucelinus bildet in den zu Ulm erschienenen Foliobänden "Germania topo-chrono-stemmato-graphica" I (1655), 4, 149, II (1662), 2, 186, II, 2 B, 6, III (1671), 3, 225 ein Wappen mit gekreuzten Schrägbalken ab, das er den Burggrafen von Kirchberg zuweist, denen es sicherlich nicht gehört. Man darf es wohl für ein Geschlecht von Kirchberg in Anspruch nehmen. Wie die Übersicht dieses Kapitels zeigt, kennt man von allen Geschlechtern Kirchberg die Wappen außer von zwei württembergischen, dem, das sich nach dem Ort im Oberamt Sulz im Schwarzwaldkreis nannte, von dem aber nur wenige Personen und nur um 1100 belegt sind, und dem, das seinen Namen nach dem Ort an der Murr im Oberamt Marbach trägt, von dem aber nur die letzte Frau aus dem Jahre 1350 bekannt ist. Es ist unwahrscheinlich, daß die Angaben von


|
Seite 42 |




|
Bucelinus sich auf diese Geschlechter beziehen sollen; dagegen war doch gerade in jüngerer Zeit das Adelsgeschlecht in schwarzburgischen Diensten viel bekannter. Zu dieser Erwägung kommt eine andere Nachricht. Avemann 328 berichtet von einem Gewährsmann, der "Briefe von G. und W. von Kirchberg gesehen" habe, "da das Siegel ein quer ineinander geschränktes Kreuz im Schilde gewesen" - bei diesem Gewährsmann liegt einmal die Gegend ziemlich fest, und unter allen Geschlechtern von Kirchberg ist von keinem außer diesem schwarzburgischen bekannt, daß die Namen G. und W. gemeinsam in einer Urkunde auftreten könnten; zu Gozmar und Widego, die 1203, wie oben angeführt, zusammen belegt sind, würde das alles gut passen. Wenn sich auch durch Nachfragen weder über das Geschlecht noch über das Wappen bei den Archiven in Sondershausen und Schwarzburg etwas Näheres ermitteln ließ, dürfte nach alledem die Vermutung doch so gut wie gesichert sein.
Im 15. Jh. und später begegnen auch Personen ohne Adelsprädikat mit dem Namen der Burg auf der Hainleite bzw. des benachbarten Dorfes, für das im Pflüger 5, 200 f. allerdings nicht unverdächtige Zeugnisse angeführt werden. Hierher ist sicherlich 1410 ein Dienstmann der Grafen von Honstein (CodDSaxR I B 3, 156 Z. 19) zu rechnen, sehr wahrscheinlich ein Altarist zu Wegeleben 1425 (PublPrStArch 40, 628) und ein Quedlinburger, der 1492 und 1500 als Bürger und 1504 als proconsul erscheint (GeschQuSachs 2, 2 S. 58 Z. 40, S. 75 Z. 20, S. 89 Z. 5, vielleicht auch zwei Querfurter 1478 und 1484 (CodDSaxR II, 16 S. 315 b Z. 33 und S. 344 b Z. 8). Vermutlich sind hier die Namen nur Herkunftsbezeichnungen, möglich wäre es auch, daß es spätere Mitglieder des eben behandelten Burgmannengeschlechts sind, die ihren Adel abgelegt haben.
Die klaren Verhältnisse des eichsfeldischen Geschlechts von Kirchberg sind von Posse verwirrt worden, zunächst dadurch, daß er es aus Kirchberg südlich von Seesen im Harz stammen läßt. Dieser Ort ist mit seiner Kirche früh und vielfach belegt (z. B. um 1223 Dobenecker II, 381). Im Jahre 1344 besitzt er eine Burg (G. Max, "Die Burgen der Südwestseite des Harzes", ZHarzv 2, II, 111 - 126, wo weitere Angaben zu finden sind; Hilmar von Strombeck, ZHarzv 3, 283 bis 285). Bürger verschiedenen Berufs und niedere Geistliche, die sich nach diesem Ort genannt haben, sind belegt in Hildesheim (Urkundenbuch der Stadt Hildesheim, hsg. von R. Doeb-


|
Seite 43 |




|
ner, Hildesheim 1881 - 1901, 2., 3., 5., 6. und 7. Band; Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüneburg, hsg. von H. Sudendorf, Bd. 10, Hannover 1880; Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim 6, Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens 28, Leipzig 1911). Ferner in Goslar: Werner (von) Kercberghe, Bürger vor 1332 und Ratmann 1360 - 63 (GeschQuSachs 31, 619, 32 Nr. 404 u. ö), Jordan Kerberge 1360 - 64 (ebd. Bd. 32), das Kerbergische Haus 1349 (ebd.), weitere Goslarer dieses Namens in den Jahren 1423, 1425, 1426 (CodDSaxR II, 16 S. 76 b Z. 10, S. 84 b Z. 15, 17 S. l04 b Z. 10), in den Jahren 1432 und 1486 (GeschQuSachs 8, 1, 154 b Z. 10 und 328 a Z. 33), Vikar Jordan Kerberg am Münster in Goslar mit seiner Tochter im Jahre 1452 (GeschQuSachs 25, 309). Ebenso wird nach diesem Kirchberg bei Seesen der Meier Kerberch in Waterler in der Grafschaft Wernigerode 1370 (GeschQuSachs 15, 306) und Borchardus Kerberch de Netelinghen im Kreis Marienburg in Hannover 1422 (CodDSaxR II, 16 S. 70 Z. 25) genannt sein. Auch der Magister und Kanonikus in Magdeburg Johannes Kerbergh 1427 (GeschQuSachs 10, 249) hängt wohl mit dem Ort zusammen. Endlich trägt der servus des Ritters Lippold von Freden, Konrad von Kirchberg, 1283 (Urkundenbuch des historischen Vereins für Niedersachsen 2, Hannover 1852, S. 312) seinen Namen wahrscheinlich nach diesem Kirchberg. Ein adliges Geschlecht hat sich aber niemals danach genannt, nur die wenigen Nachkommen der Eva von Trott aus der Verbindung mit Herzog Heinrich dem Jüngeren von Braunschweig erhielten den Namen "von Kirchberg".
Dagegen liegt auf dem Eichsfeld selbst ein Ort, nach dem sich ein adliges Geschlecht genannt hat, das später verwüstete Kirchberg bei Dingelstedt. Daß das in Rede stehende Geschlecht aus diesem Orte stammt, hatte Wintzingeroda-Knorr bereits 1903 aus Urkunden bewiesen, worüber Posse hinwegsah. Wintzingeroda-Knorr hat in Regesten alles zusammengetragen, was ihm über das Geschlecht bekannt war. Das neue "Urkundenbuch des Eichsfeldes", bearbeitet von A. Schmidt, Teil 1 (bis zum Jahr 1300, GeschQuSachs N. R. 13, Magdeburg 1933) bringt in der erfaßten Zeit die Urkunden in vollem Wortlaut, die Wintzingeroda-Knorr nur als Regesten anführt und erreicht im einzelnen genauere Datierung; zum Teil bietet es auch für die Geschichte des eichsfeldischen Geschlechts von Kirchberg neues Material, das bis jetzt unbekannt war.


|
Seite 44 |




|
Die Urkunde Nr. 534 belegt den Ort Kirchberg für das Jahr 1273, die Urkunde Nr. 213 Heinrich von Kirchberg und seine Witwe Uda, seinen Sohn Heinrich, seinen Bruder Werner und dessen Sohn Werner im Jahr 1221, die Urkunde Nr. 638 den Gleichensteiner Burgmann Heinrich von Kirchberg im Februar 1288, die Urkunde Nr. 641 im April 1288. Übersehen hat Wintzingeroda-Knorr die Belege für "Konrad von Kirchberg, Sohn Ottos, in einer Urkunde des Klosters Reifenstein" im Kreis Worbis 1329 (Schirrmacher 11), für Otto de Kerchberc und seinen Bruder Hartmann im Jahre 1334 (GeschQuSachs 3, Nr. 866), Johann von Kirchberg in einer Urkunde des Klosters Reifenstein im Jahre 1356 (Schirrmacher 12) und vor allen Dingen Konrad von Kirchberg mit seinem Siegel im Jahre 1360 im HennebUB 3, 25 f. Inhaltreiche Ergänzungen für das Geschlecht von Kirchberg kurz vor und nach 1400, wo (wahrscheinlich zwei) Legate von Kirchberg in häufiger Fehde mit dem Landgrafen von Thüringen und der mit ihm verbündeten Reichsstadt Mühlhausen liegen, bietet der CodDSaxR I B, 2 S. 7 Z. 40 (hier Legat von Kirchberg als Burgmann in Aldinsteyn östlich von Allendorf an der Werra), S 10 Z. 36, S. 85, Z. 19, 21, 3 S. 41 4 Z. 7 (Legat von Kirchberg als Burgmann in Glichinstein), S. 294, Z. 21 - 4 und Jordan 105. Endlich hat Wintzingeroda-Knorr noch übersehen, daß I. Jaeger im Urkundenbuch der Stadt Duderstadt (Hildesheim 1885) S. 318 den Ort Kirchberg fürs Jahr 1497 belegt. Ort und Geschlecht Kirchberg werden öfter erwähnt in dem Aufsatz von Maternus Jungmann über "das Freigut in Duderstadt" in "Unser Eichsfeld", hsg. von K. Hentrich und K. Löffler 1 (Heiligenstadt 1906) S. 53 - 8, 74 - 7, 91 - 2 für die Jahre 1420, 1424, 1440, 1464, 1481, 1525. Müssen Wintzingerodas Zusammenstellungen durch diese Belege ergänzt werden, so ist ein anderer Beleg, den er auf den Ort oder das Geschlecht von Kirchberg auf dem Eichsfeld bezieht, zu streichen. Die Urkunde 1141 Nov. 9 Erfurt meint das wüste Kirchberg bei Bischhausen in Niederhessen, worauf es übrigens auch Dobenecker I und nach ihm Bruchmann beziehen. Zu welchem Geschlecht der Erfurter Kanoniker Heinrich von Kirchberg vom Jahre 1458 (AssebUB 3, 317) gehört, ist nicht zu bestimmen.
Schirrmacher wollte den Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik zu diesem Geschlecht rechnen. Damit kommt er der Gegend, aus der er wirklich stammt, sehr nahe. Die eine Schwierigkeit, die sich bei Schirrmachers Annahme ergibt, daß


|
Seite 45 |




|
der Name Ernst unter den verhältnismäßig zahlreichen bekannten Personen dieses Geschlechts nie begegnet, hat er dadurch aus dem Wege zu räumen gesucht, daß er voraussetzte, es habe einer der Kirchberger den bei den Grafen von Gleichen, die nachweislich Kirchberger als Burgmannen hatten, traditionellen Vornamen Ernst bekommen. Leider war es Schirrmacher nicht möglich, trotz vielen Bemühungen seine Vermutung heraldisch nachzuprüfen, denn das Gothaer Archiv, in dem vorher Sagittarius und nachher Posse das Siegel gefunden haben, antwortete ihm damals auf seine Anfrage, daß die Urkunde mit dem Siegel des Geschlechts nicht vorhanden sei. Dadurch wurde Schirrmacher zu weitläufigen Erwägungen und zum Abdruck verschiedenster Wappen geführt, was alles mit den Eichsfelder Kirchbergern nichts zu tun hat. Ihr Schild zeigt einen steigenden Steinbock (Abb. bei Posse, Tafel 20 Nr. 5). Durch das Wappen ist es sichergestellt, daß der mecklenburgische Reimchronist nicht zu diesem Geschlecht gehörte. Allerdings ist bisher nur dieses eine Siegel der eichsfeldischen Kirchberger bekannt; denn - das führt auf den zweiten Fehler Posses - das andere Siegel, das Posse zu dieser Familie abbildet (ebd. Nr. 6), kann nicht hierher gehören. Dieses Wappen zeigt keinen steigenden Steinbock, sondern einen Bocksrumpf, und es stammt aus Uffenheim, also aus dem Bereich der Nürnberger Burggrafen. Nach dem Wappenbild wie nach den politischen Beziehungen kommt nur das württembergische Geschlecht in Frage, für das dieses Wappen auch schon von Alberti I, 401 veröffentlicht ist, was Posse übersehen hat. Zum Wappen ist auch noch die Helmzier bekannt, und zwar aus dem Siegel Konrads von Kirchberg 1360; nicht einmal von diesem Siegel hat Posse Kenntnis genommen, obwohl es Schirrmacher 24 beschrieben hat. Die Helmzier bestand danach aus "drei Spindeln entweder mit Hahnenfedern . . . oder mit kleinen gestürzten Halbmonden besteckt".
Nach dem Kirchberg bei Dingelstedt haben sich auch Bürgerliche genannt. Das Mühlhäuser Geschoßregister von 1418/9 (Mühlhäuser Geschichtsblätter 28 (1929), 153 - 217) belegt ihrer vier.
Nassau. Kirchberg im Oberwesterwald-Kreis, 8 km östlich von Hachenburg, ist zuerst für das Jahr 1215 belegt (UBMittrh III, 36), weiter für das Jahr 1220 (ebd. 118), für das Jahr 1244 (ebd. 602), für das Jahr 1261 (RegTrier 51),


|
Seite 46 |




|
für das Jahr 1319 mit Pfarrkirche (ebd. 347), ebenso für das Jahr 1325 (ebd. 348). Einen kurzen Überblick über die spätere Geschichte lese man bei C. V. Vogel, "Beschreibung des Herzogtums Nassau", 1843, S. 696 f. nach. Vogel behauptet, daß sich auch Adlige nach diesem Orte genannt hätten, sie seien aber 1421 ausgestorben. Da er aber keinen Beleg, nicht einmal eine bestimmte Jahreszahl anführt und sich in den gedruckten Urkunden keine Spur gefunden hat, braucht man seine Behauptung nicht ernst zu nehmen.
Das Kirberg im Amt Limburg hieß ursprünglich Kirchdorf (Selecta juris et historiarum, hsg. von H. C. Senckenberg, 2, Frnkf. 1734, S. 411). 1355 aber, wie die Limburger Chronik (Deutsche Chroniken des Mittelalters 4, 1, Hannover 1883, S. 43, 19 - 22) erzählt, baute der Graf von Dietz dort eine Burg und erhob den Ort, der nunmehr Kirpurg oder Kirberg und ähnlich hieß, zur Stadt. Die Burg ist heute Ruine (Piper, Burgenkunde, 1905 2 , S. 651 a), abgebildet in "Nassovia, Zeitschrift f. nassauische Gesch. u. Heimatkde." 22 (Neuhof, Kr. Teltow, 1921) S. 75. Im Jahre 1373 wird sie (RegTrier 108) urkundlich erwähnt, ebenso im Jahre 1487 ("Quellen zur Frankfurter Geschichte" I, hsg. von H. Grotefend, Frkf. 1884, S. 228, 21) und im Jahre 1496 (I. P. Kuchenbecker, Analecta Hassiaca, Collectio I, Marburg 1728, 117 f.). Vogels Beschreibung von Nassau erwähnt den Ort als altes Zentgericht zum Jahre 1276 (S. 418), 1355 (S. 335, 786 ff.), 1391 (S. 338) und später. Das "Amt Kirberg" erscheint 1353, 1355, 1362 bei Wenck, UB 1, 242 f.
Vermutlich werden der Bergen-Enkheimer Einwohner Locze von Kirchberg um 1380 (PublPrStArch 69 Nr. 219) und sicherlich Johannes Kierburg de Ycczesteyn (etwa 20 km nördlich von Wiesbaden) 1443 und Johannes Kirperg de Itsteyn 1469 (GeschQuSachs 8, 1, 197 b, 44 und 333 b, 14) ihre Namen von diesem Ort tragen. Ob der Johan und der Konrad Kyrpurgh, die in Trier promoviert haben (Trierisches Archiv, Ergänzungsheft 16, 24 f.), aus diesem oder dem Kirburg bei Hachenburg oder einem anderen Kirchberg oder Kirchburg stammen, läßt sich nicht entscheiden. Ebenso ist nicht zu sagen, aus welchem Ort oder - falls sie eine Adlige sein sollte - aus welchem Geschlecht die soror Anna de Kirburg im Nekrologium des Klosters Klarenthal bei Wiesbaden (Veröffentlichungen der historischen Kommission für Nassau 3, S. 83) stammt. Der Kuriosität halber sei erwähnt, daß wichtige und große Urkundenbücher die württembergischen Grafen von Kirchberg sowie


|
Seite 47 |




|
die Wildgrafen von Kirburg aus diesem Ort stammen lassen. Es hat sich kein adliges Geschlecht nach diesem Ort genannt.
Hessen. Dem nur aus wenigen Häusern bestehenden (Landau AHG II, 358 - 60) Kirchberg an der Lahn unterhalb Staufenberg in Oberhessen sieht man heute die Bedeutung nicht mehr an, die der Ort einstmals gehabt hat. Dieses Kirchberg ist dasjenige, das von allen hier behandelten Orten am frühesten urkundlich nachweisbar ist. Die Kirche erscheint bereits in einer Urkunde vom Jahre 810 (vgl. Heber, "Die 9 vormaligen Schottenkirchen in Mainz und in Oberhessen", AHG 9, 193 - 348, bes. S. 263 - 287). Seitdem spielte es das ganze Mittelalter hindurch eine Rolle in der kirchlichen Organisation Hessens (vgl. Classen, bes. S. 97 ff. u. ö.). Aus den Jahren 1226 und 1227 (Riedesel II, 1 f.; Gudenus 2, 53 f.) kennt man einen Plebanus von Kirberg. Das Gericht Kircperg wird 1237 (Gudenus 1, 544 ff.), die Kirche 1327 (AHG 5, Abhandlung 17, S. 14), der Pfarrer 1329 (PublPrStArch 19, Nr. 533), 1337 (Cod. dipl. Moenofrancofurtanus, neu bearb. von F. Lau, 2, Frankfurt 1905), der Pfarrer und der Altarist und sogar ein "Kindermeister", der in diesem Zusammenhang auf eine Schule schließen läßt, 1367 (AHG 5, Abhandlung 17, S. 11), ein Altarist 1382 (PublPrStArch 73 Nr. 1181) erwähnt. Die Glocken von Kirchberg stammen aus den Jahren 1321, 1380 und 1432 (AHG 9, 286). Der Graf von Nassau baute hier zwischen 1368 und 1371 (nicht 1366, wie die Chroniken schreiben, vgl. Landau, AHG II, 358 - 60) eine Burg, die aber von dem Landgrafen von Hessen, dem Grafen von Ziegenhain und anderen sofort wieder niedergebrochen wurde. 1396 wird die Hälfte des Gerichtes Kirperg mit seinen Orten urkundlich genannt (Wenck, UB 2, 467 ff.). Der für 1467 bezeugte Pfarrer zu Engelrod Johann Kirchberg (Riedesel II, 287) trägt seinen Namen vermutlich nach diesem Ort. Wo der Mainzer Stiftsherr Johann Kirchperg 1479 (AHG N. F. 5, 90) herstammt, ist nicht zu ermitteln.
Kirchberg bei Bischhausen, Kreis Eschwege, wurde vermutlich im Dreißigjährigen Kriege wüst. Über den Ort handelt die gute Arbeit von Bruchmann S. 38, 57 f., 62, 65, auf die hier nur verwiesen zu werden braucht. Daß sich nach diesem Orte jemand genannt hätte, ist nicht bekannt.
Dagegen stammt aus dem anderen niederhessischen Kirchberg bei Gudensberg ein adliges Geschlecht, das im nächsten Abschnitt besprochen werden soll.


|
Seite 48 |




|
2. Das niederhessische Rittergeschlecht von Kirchberg 16 ).
Das Dorf. Das Dorf Kirchberg bei Gudensberg im Kreis Fritzlar hat eine im Verhältnis zu seiner späteren Bedeutung glänzende Vergangenheit, wie sie nur auf so altem geschichtlichen Boden wie hier im Herzen des alten Hessengaus möglich ist. Ums Jahr 1010, als Heimerad auf seiner Flucht von Hersfeld dahin kommt, wird es zum ersten Mal literarisch erwähnt, als villa mit Kapelle (Ekkeberti Vita Haimeradi, MonGermHist. Script. 10, Hannover 1852, 601, 15). 1064 brachte es der Gaugraf Werner an sich, gab es aber 1066 auf seinem Sterbebette an das Kloster Hersfeld zurück (Lamperti Monachi Hersfeldensis Annales, rec. O. Holder-Egger, Script. rer. germ. in us. schol. (Hannover 1894), 92, 16, 101, 28). Seitdem war das Dorf ungestörter hersfeldischer Besitz oder mindestens Lehnsbesitz, d. h. der Hauptteil des Dorfes mit dem Meierhof, wenn man ihn so bezeichnen will, und der Kirche; Besitzungen in Kirchberg hatten auch das Benediktinerkloster Breitenau (A. Fey, "Das ehemalige Benediktiner-Kloster Breitenau", Hessenland 10, 86, ff., 102 ff., 118 ff., bes. an der letzten Stelle; eine Urkunde hierüber vom Jahre 1368 bei G. Lennep, "Codex probationum" seiner Abhandlung von der Leyhe zu Landsiedel-Recht, Marburg 1768, S. 522 f.) und das Petersstift in Fritzlar (Angaben zu den Jahren 1209 und 1310 bei K. E. Demandt, "Der Besitz des Fritzlarer Petersstiftes im 13. Jh.", ZHG. N. F. 51, Kassel 1936, S. 35 - 118, zum Jahre 1371: Falckenheiner 1, 175, zum Jahre 1390: ebd. 179, zum Jahre 1396: ebd. 179 f.). Ein Pleban ist in dem Dorf 1227 (Reimer 279) und 1339 (G. Landau, Beschreibung der deutschen Gaue 2 2 , Halle 1866, S. 60) belegt. Weiteres über die Kirchengeschichte des Ortes findet sich bei Classen S. 191 f. Im Jahre


|
Seite 49 |




|
1290 werden zwei Lehnshufen in Kirchberg genannt, ohne daß daraus hervorgeht, wer der Inhaber der Lehnshufen gewesen sei (PublPrStArch 3, Leipzig 1879, S. 385, 30). Zum Jahre 1285 wird PublPrStArch 3, 331, 7 eine besondere Meßrute erwähnt, die von Kirchberger Bauern gebraucht wurde.
Das Dorf war im Mittelalter von Graben und Hagen umschlossen, eine Burg hat es in dem Ort nie gegeben, auch nicht in seiner näheren Umgebung. Das geht mit aller Sicherheit aus der Urkunde von 1344 hervor, in der sich das Geschlecht der Hunde von Kirchberg als Herr des Dorfes dem Landgrafen gegenüber verpflichtet, nicht einmal den Kirchhof gegen seinen Willen burgähnlich auszubauen oder einen Ausbau zuzulassen (G. Landau, "Der Wartberg", ZHG 8, 101, 1860). Der Kirchberger Kirchhof hatte freilich eine günstige natürliche Lage und war wohl sowieso leicht befestigt (E. Wenzel, "Befestigte Kirchhöfe in Hessen", ZHG N. F. 32, Kassel 1908, 14, 16, 23).
Der ursprüngliche Stand des Geschlechts. Nach diesem Ort hat sich ein Rittergeschlecht von Kirchberg genannt. Daß sein Name von dem Dorf herrührt, geht aus den Beziehungen des Geschlechts zum benachbarten Landadel und zu den Städten und aus seinem Besitz in der Umgebung klar hervor, wenn man auch keine unmittelbaren Beziehungen zu dem Ort selbst feststellen kann.
Das Geschlecht trägt immer den Namen Kirchberg oder ähnlich. Die Vermutung des WfälUB 4, 1. Abt. Nr. 78 Anm., wonach drei oder vier Personen namens Ker(s)cenberg zu diesem Geschlecht gehören sollen, ist zurückzuweisen. Die Herausgeber des WfälUB halten Ker(s)cenberg für eine "Korruption" von Kirchberg. Das ist schon methodisch höchst bedenklich; solche Konjekturen an Eigennamen in Urkunden können nur in ganz klaren Fällen als erlaubt gelten. Wie soll außerdem der Schreiber aus einem Kir(ch)berg oder Ker(k)berg - denn Formen mit -en-, selbst mit -e- nach dem ersten Kompositionsglied gibt es in der Überlieferung nirgends - ein Ker(s)cenberg haben machen können? Was aber das Entscheidende ist: die Vermutungen der Herausgeber stellen sich in Gegensatz zu den Urkunden, die sie erklären sollen. Die Urkunde Nr. 854 in der 3. Abt. vom Jahre 1260 spricht den Sachverhalt deutlich genug aus; man darf ihr wenigstens das folgende unbedenklich entnehmen: die Familie nannte sich nach


|
Seite 50 |




|
ihrem Lehen, das vom Kloster Bredelar ging, Kercenberg; das Lehen muß in einer Gegend gelegen haben, für die Reginhard von Itter (in der Nordecke des hessischen Kreises Frankenberg) und Pleban, Bürgermeister und Rat der Stadt Korbach (in Waldeck) als Aussteller und die Ritter von Ytter und von Dalwich (Dalwigsthal nördlich von Sachsenberg in Waldeck) als Zeugen einer Verkaufsurkunde in Frage kamen. Gewiß hat der Rudolf von Kerscenberg 1219, der ein Gut in Wynemarinchusen (wohl Wiemeringhausen nördlich von Winterberg oder Wirminghausen westlich von Arolsen - der Beweis für die Möglichkeit dieser Entsprechung liegt in dem Wohnplatz im Ennepe-Ruhr-Kreis, der 1219 als Wynemarinchusen, heute als Wirminghausen erscheint, Schneider, s. o. S. 36, S. 145 a) besessen hatte, mit zu dieser Familie gehört. Das ist alles, was man nach den gedruckten Urkunden sagen kann, es genügt aber vollauf, um in den Ker(s)cenberg eine eigene Familie zu erkennen; sogar ihr Abstammungsort, jetzt Wüstung, ist annähernd bestimmbar. Das niederhessische Geschlecht von Kirchberg kommt übrigens nie so weit westlich vor.
Die ältesten Kirchbergschen Urkunden zeigen sehr bedeutsame Zusammenhänge. Zu frühest nach den bisher bekannten Urkunden tritt ein Mitglied des niederhessischen Geschlechts als Zeuge im Jahre 1197 auf (Wenck, UB 3, 92). Da beurkundet der Abt von Hersfeld, daß der Propst des Klosters Aua an der Geis westlich von Hersfeld dem nobilis vir Volkwin von Naumburg Besitzungen in der weiteren Umgebung des Klosters abgekauft habe. Daß der Rudolfus de Kyrchberc zu diesem Rechtsgeschäft als Zeuge hinzugezogen wird, liegt offenbar an dem Aussteller der Urkunde. Der Ort Kirchberg, nach dem sich das Geschlecht nannte, war ja seit alters hersfeldisches Lehen. Es darf also aus dieser Urkunde geschlossen werden, daß Rudolf von Kirchberg damals hersfeldischer Lehnsmann war und in solcher Eigenschaft in dem nahgelegenen Naumburg, wo die Urkunde ausgestellt ist, in der Umgebung seines Lehnsherrn weilte.
Die schwierige Frage ist nur die, ob die Kirchberger das Dorf als freie Adlige zu Lehen trugen oder ob sie als Ministerialen des Abts von Hersfeld in Kirchberg saßen, und falls sie Ministerialen waren, ob sie zu den Geschlechtern gehörten, die aus dem alten Stand der Edelfreien hervorgegangen waren und den Kern der Ministerialen bildeten, oder ob sie von ehemaligen Hörigen des Abts von Hersfeld abstammten,


|
Seite 51 |




|
die in die Ministerialität aufgestiegen waren. Es ist die Zeit, wo eingreifende soziale und rechtliche Umgruppierungen im Gange sind und wo sich die neue Form der "Ministerialität", des "Rittertums" bildet. Die Grenzen zwischen den alten Edelfreien und einem Teil der früheren Hörigen werden dabei verwischt. Weder über die Einzelheiten noch über das Grundsätzliche dieser Vorgänge besitzen wir bis jetzt zufriedenstellende Kenntnisse. Daß dabei frühere Hörige zu Ministerialen emporstiegen, ist eine überall beglaubigte Tatsache, fraglich bleibt nur, in welchem Umfange das geschehen ist. Ebenso sicher steht, daß alte Edelfreie sich in die Ministerialität ergeben haben; gerade der Übertritt eines nobilis vir in die militia des Abts von Hersfeld im Jahre 1107 ist urkundlich überliefert, er wird von E. F. Otto S. 334 f. besprochen. Daß endlich die Kirchberger noch als Edelfreie ein Lehen vom Hersfelder Abt genommen hätten, begegnet keinerlei Bedenken; von einem Reichsfürsten, wie es der Reichsabt von Hersfeld war, konnten Edelfreie nach der Heerschildordnung natürlich ein Lehen nehmen, waren doch sogar Grafen Hersfelder Lehnsträger (vgl. P. Hafner, "Die Reichsabtei Hersfeld bis zur Mitte des 13. Jhs.", Hersfeld 1936 2 , S. 125 f., auch F. W. Hack, "Untersuchungen über die Standesverhältnisse der Abteien Fulda und Hersfeld bis zum Ausgang des 13. Jhs.", Quellen und Abhandlungen zur Geschichte der Abtei und Diözese Fulda 7, Fulda 1911, S. 65 f.).
Die Stellung von Kirchbergern in Zeugenreihen läßt keinen Schluß auf den ursprünglichen Stand zu. In der ersten einschlägigen Urkunde von 1197 ist die Stellung eines Rudolf von Kirchberg doppeldeutig. In einer Urkunde von 1253 (C. P. Kopp, Ausführliche Nachricht von der älteren und neueren Verfassung der geistlichen und Civil-Gerichten in den fürstlich hessen-kasselischen Landen, 1. Teil, Kassel 1769, Beilagen S. 121), in der Kirchberger vorkommen, sind die Zeugen nicht mehr nach den ursprünglichen Verhältnissen angeordnet, ohne daß sich vorläufig erkennen ließe, welche neue Ordnung aus der Reihenfolge spricht.
Hier müßte eine Geschichte der niederhessischen Ritterschaft eingreifen. Die urkundliche Überlieferung ist so reich, daß man aus ihr eine eindringliche und lebensnahe Geschichte Niederhessens schreiben könnte, die bedeutsamen Gewinn für die Sozialgeschichte, ja für die Volksgeschichte, natürlich auch für die Ortsgeschichte wie für die weitere Landesgeschichte ver-


|
Seite 52 |




|
hieße. Vieles, was den Einzeluntersuchungen von der Sozial- und von der Ortsgeschichte her bis jetzt unerkennbar bleiben mußte, wird sich, sobald die Urkundenüberlieferung des Gebietes in ihrer Gesamtheit aufgearbeitet sein wird, allein durch den Vergleich und die gegenseitige Erhellung des vielfältigen Stoffes aufklären lassen.
Der Ministerialenstand, der das politische, wirtschaftliche und geistige Leben des hohen Mittelalters maßgebend beeinflußt, hat wohl in jeder deutschen Landschaft eine andere Entwicklung durchgemacht. Allgemein dürfte heute, zumal nach E. F. Otto, "Adel und Freiheit im deutschen Staat des frühen Mittelalters", sicherstehen, daß der Ministerialenstand des Mittelalters im wesentlichen auf den alten Edelfreien, nicht auf den Hörigen beruht. Diese alten edelfreien Geschlechter sind im Mittelalter noch als Ortsadel landschaftsweise zu verfolgen. Von den württembergischen Verhältnissen etwa hat V. Ernst, "Die Entstehung des niederen Adels" (Stuttgart 1916) und "Mittelfreie" (Stuttgart 1920) ein sehr eindringliches Bild gezeichnet 17 ). Für Niedersachsen z. B. kommt Wittich, "Altfreiheit und Dienstbarkeit des Uradels in Niedersachsen" (Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 4, 77) zu dem Ergebnis: " . . . Die Ahnen der Dienstleute sitzen im Land umher auf kleinen, unbefestigten Herrenhöfen . . . In ganz Niedersachsen gibt es kaum ein Dorf, das nicht einem Ministerialengeschlecht den Namen gegeben hätte." Ähnlich liegen die Verhältnisse auch in Hessen. Von einer ganzen Anzahl hessischer Adelsfamilien, die in mittelalterlichen Urkunden auftreten, konnte Frh. G. Schenk zu Schweinsberg, "Beiträge zur Geschichte und Genealogie des hessischen Adels" (ZHG N. F. 2, 43 f.) nachweisen, daß sie von alten Edelfreien herkommen. In einem Bezirk ein wenig nördlich von Kirchberg stammte, wie eine glücklich überlieferte Urkunde zeigt, nahezu aus jedem Dorf ein edelfreies Geschlecht (ebd. 44). Für die Dichte der adligen Geschlechter in der Umgebung Kirchbergs braucht bloß auf die lehrreiche Zusammenstellung Brunners 131 verwiesen zu werden. Ebenso fand P. Illgner (Fuldaer Geschichtsblätter 10, Fulda 1911, S. 161 - 175) eine überraschend große Zahl adliger Familien auf dem kleinen Gebiet des Kreises Hünfeld.


|
Seite 53 |




|
Eine Burg besaßen diese ortsadligen Geschlechter nicht. Auch das niederhessische Kirchberg-Geschlecht hat keine Burg gehabt. Das muß hier ausdrücklich betont werden, weil man vielleicht zu dem Glauben kommen könnte, I.-I. Winkelmann ("Wahrhafte Beschreibung der Fürstentümer Hessen und Hersfeld", Bremen 1697, Teil 2, S. 257 a) erhalte eine sonst verschollene Kunde "von dem alten verwüsteten Schloß Kirchberg, von den Edelleuten, die Hunde zu Kirchberg genannt", - das sind die jahrhundertelang nachweisbaren Besitzer des Dorfes Kirchberg - "im Jahre 1351 erbauet". Aus seiner Beschreibung geht jedoch klar hervor, daß es sich nur um eine Verwechslung mit der Ruine Schaumburg bei Hoof handelt. Über diese Ruine vgl. Reimer 422 b. Auch die Behauptung Pfaffs in seiner Mühlhäuser Chronik, die Jordan 136 unbedenklich nachschreibt, daß es in dem niederhessischen Ort Kirchberg ein Schloß gegeben habe, worin angeblich 1469 Mühlhäuser Bürger gefangen gehalten wurden, beruht auf einer Verwechslung, diesmal mit dem Schloß Kirchberg bei Seesen am Harz (vgl. dazu die a. S. 42 angegebenen Aufsätze von Max und Strombeck). Die Stammsitze der niederadligen Geschlechter waren die Meierhöfe. Ein solcher Hof ist auch im Dorfe Kirchberg zu erkennen, es ist der größte Hof im Ort, er stellt eine burgähnliche Besitzung dar und steht in enger Verbindung mit der Kirche. Wieviele Adelssitze in Niederhessen so aussehen, ergibt sich aus P. Illgners Abhandlung über die Kirchhofsfesten im Kreis Hünfeld (Fuldaer Geschichtsblätter 11, Fulda 1912, S. 37 - 42).
Aus alledem ist noch kein unbedingt sicherer Schluß auf den ursprünglichen Stand der Kirchberger zu ziehen. Es fügt sich aber alles, was man über sie weiß, zu der allein wahrscheinlichen Annahme zusammen, daß sie ein altes, edelfreies Geschlecht sind, das im Dorf ansässig war und das sich, wie so viele andere Geschlechter des niederen Adels, in die Ministerialität ergeben mußte und so zunächst im Gefolge des Reichsabtes von Hersfeld auftritt.
Das Geschlecht im 13. Jahrhundert. Die Stellung des Geschlechtes während des 13. Jahrhunderts ist klarer abzuschätzen. Das halbe Dutzend Urkunden, das dazu verwendet werden kann, genügt schon, um ein Bild zu entwerfen. Die Kirchberger gehörten nicht zu den ganz unbedeutenden und für das Leben ihrer Landschaft gleichgültigen Ortsadelsgeschlechtern, die im wesentlichen über ihr Lehen nicht hinaus-


|
Seite 54 |




|
gewirkt haben. Anderseits gehörten sie auch nicht zu den Geschlechtern, die über den kleineren Gerichtsbezirk oder die Grafschaft hinaus in das Leben der Territorien eingriffen, die etwa zu den landschaftlichen Rechtsgeschäften des Landgrafen von Hessen, des Erzbischofs von Mainz und in ähnlichen Fällen Zeugen stellten. Die Kirchberger gehörten zu den Geschlechtern, die im Leben des kleineren politischen Bezirks ihre Stellung einnahmen und sich an den einen oder anderen der mächtigsten Männer des Bezirks anschlossen.
Eine Verbindung der Kirchberger mit dem Abt von Hersfeld ist einzig in der Urkunde von 1197 bezeugt. Dagegen standen die Kirchberger in engster Beziehung zu den beiden Männern, die zu ihrer Zeit die bedeutendste Rolle in Niederhessen spielten, zunächst zu Giso von Gudensberg und dann zu Konrad von Elben (südöstlich von Naumburg in Niederhessen). Von den vier wichtigsten Urkunden aus dem 13. Jh., in denen Kirchberger als Zeugen auftreten, hat Konrad von Elben zwei ausgestellt (von 1253, Kopp a. a. O., und von 1259 WfälUB 4, 3 Nr. 780), und in einer weiteren Urkunde (von 1236, Knetsch, vgl. oben Anm. 16) steht er selbst unmittelbar hinter Giso von Gudensberg und vor den Brüdern von Kirchberg in der Zeugenreihe. Giso von Gudensberg ist der bedeutendste Mann in den beiden Urkunden von 1236 und 1237 (Knetsch); 1237 eröffnet er die Zeugenreihe der Laien, 1236 übereignet er ein Gut. Daß Konrad von Elben "einer der angesehensten und einflußreichsten Männer des Landes" und Giso von Gudensberg "eine nicht minder angesehene Persönlichkeit als jener Konrad" war, zeigt sich vor allem darin, daß sie vom Landgrafen zu Landrichtern ernannt wurden, d. h. daß sie die wichtigsten Beamten in der Verwaltung waren (Brunner 72 und 46). Sie gehörten zu den Männern, die bei den Staatsereignissen in Hessen anwesend sind und die Urkunden des Erzbischofs von Mainz und des Landgrafen von Hessen mit bezeugen.
Zu dem Kreis, in dem Kirchberger immer wieder auftreten, gehören außerdem als wichtige Mitglieder die Edelfreien, viri nobiles, domini Heinrich von Uttershausen (vgl. Reimer unter diesem Stichwort, ferner ZHG N. F. 2, 64), der 1237 und 1253 vor den Kirchbergern in der Zeugenreihe steht, Hermann von Holzhausen, der 1236 in der durch Kirchberg bezeugten Urkunde eine Schenkung macht und 1237 als Zeuge unmittelbar vor Wigand von Kirchberg steht, vor allem auch Heinrich von Urff, der 1253 zusammen mit Wigand von Kirchberg un-


|
Seite 55 |




|
ter den Zeugen vorkommt, 1266 als Landfriedensrichter in Hessen, also, wie oben dargelegt, als eine Person von großer Bedeutung auftritt (Brunner 75) und Wigands von Kirchberg Witwe vor 1270 geheiratet hat. Wenn Schenk zu Schweinsberg ZHG N. F. 2, 68 angibt, daß die Urff "ausdrücklich als Ministerialen bezeichnet" werden, so ist damit kein zutreffendes Bild ihres Standes gegeben; gewiß treten sie seit 1160 in Urkunden - ZHG N. F. 12, 82, 97 - als Ministerialen des Erzbischofs von Mainz auf, aber dabei darf nicht vergessen werden, daß bis 1309 die Burg Urff samt dem dazu gehörigen Dorf - ZHG N. F. 12, 84, vgl. ferner Reimer 478 b - Besitz der von Urff als freies Eigen war. Bei dieser Sachlage waren die von Urff, trotzdem sie ein Ministeriallehen von dem ersten Fürsten des Reiches genommen hatten, doch auch rechtlichformell edelfrei, ein öfter vorkommender Fall in jenen Zeiten.
Es erübrigt sich, die anderen Namen aufzuzählen, die in den Urkunden mit Kirchbergern verbunden auftreten. Der Lebenskreis des Geschlechts ist klar umrissen. So weit man seine Geschichte kennt, hat es in der Mitte des 13. Jhs. seine größte Zeit erlebt. Am 18. Juni 1236 sind Arnoldus Wigandus fratres de Kirchberc belegt; in einer Urkunde vom Jahre 1237, in einer vom 8. August 1253 und einer vom 2. März 1259 erscheint der bedeutendste Vertreter des Geschlechts, der miles Wigand von Kirchberg. Er ist vor 1270 gestorben. In diesem Jahre werden Güter, die seine Tochter Gisla von ihm geerbt hatte, an das Kloster Haina verkauft. Es handelt sich um Besitzungen in Altenlotheim (5 km nördlich Frankenau) und Eldinghausen ("Wüst im Gericht Geismar westlich Frankenau", Reimer 112 b). Aus der Verkaufsurkunde vom 15. Mai 1270 und in zwei Verzichtsurkunden vor dem 24. Juni 1271 und am 21. Januar 1274 lernt man Wigands Witwe Beatrix, die in zweiter Ehe Heinrich von Urff geheiratet hatte, seine Töchter Gisla, Guda und Beatrix und seinen Sohn Wigand kennen, der mit einer Sophia vermählt war. Was F. Frh. v. Gilsa in seinem Aufsatz über "die Burg zu Niederurf und ihre Besitzer" (ZHG N. F. 12, Kassel 1886, 84, 98) über die Urkunde sagt, trifft, wie mir auf meine Anfrage Herr Staatsarchivdirektor Dr. Knetsch mitteilte, nicht zu. Der letzte bekannte Vertreter des landadligen Geschlechts von Kirchberg im 13. Jh. ist Thomas von Kirchberg, der 1279 in einer Urkunde des Klosters Merxhausen (zwischen Kirchberg und Naumburg; Knetsch) vor-


|
Seite 56 |




|
kommt, und zwar als Burgmann in der Stadt Gudensberg (Brunner 131).
Das Geschlecht im Patriziat der Städte. Nach Thomas von Kirchberg hört man 100 Jahre nichts mehr von dem Geschlecht. Das liegt gewiß nicht allein an der mangelnden Erschließung der Urkundenüberlieferung. Das landadlige Geschlecht von Kirchberg wird, vermutlich bald nach dem Tode Wigands, an Bedeutung eingebüßt haben. Sein Besitz kann nie groß gewesen sein. Belegt als Besitzung ist aus dem 13. Jh. nur das, was Wigands Tochter Gisla geerbt hatte. Als Hauptbesitz muß aus der oben dargelegten Geschichte des Geschlechts das hersfeldische Lehen Kirchberg erschlossen werden. Dieses Lehen aber ging den Kirchbergern verloren. Wann und warum, ist unbekannt. 1313 besaßen es wahrscheinlich bereits die Hunde von Holzhausen, das Geschlecht, das es dann bis zu seinem Aussterben 1660 inne hatte (Reimer 279).
Das sind die Wirkungen jener Bewegungen des 13. und des folgenden Jahrhunderts, die sich auf den Adel überhaupt so verheerend ausgewirkt haben. Das landadlige Geschlecht von Kirchberg teilt das Schicksal des allergrößten Teils der altadligen Familien, wie es sehr eindringlich der Vortrag von E. Stendell, "Beiträge zur Geschichte der in der Umgebung der Stadt Eschwege ehemals angesessenen niederadligen Geschlechter" (Eschwege 1892), zeigt. In dem von Stendell betrachteten Bereich überstehen von mehr als 30 Familien nur 6 das 15. Jahrhundert! Der gewöhnliche Weg ist der, daß das Geschlecht in dem Patriziat der Städte fortlebt. Es ist schon oft beobachtet worden (Schenk von Schweinsberg, ZHG N. F. 2, 68 f.; P. Illgner, Fuldaer Geschichtsblätter 10, 174), wie viele niederadlige Geschlechter gerade auch in Hessen in die Städte ziehen und eine wie wichtige Rolle sie in der führenden Bevölkerung der Städte spielen. Auch die Kirchberger haben sich in die niederhessischen Städte eingegliedert. Man müßte es voraussetzen, selbst wenn man keinen Beleg hätte. Für das folgende ist zu beachten, daß nicht jeder, der sich in den niederhessischen Städten "von Kirchberg" nennt, ein Abkömmling des alten Adelsgeschlechts ist. Auch wenn ein Bauer oder Handwerker aus dem Ort Kirchberg in die Stadt zieht, wird er sich so genannt haben; dieser Herkunftsname "von" ist der gebräuchlichste Namentyp aus den Anfängen der Familiennamengebung. Es hätte keinen Zweck, bei der folgenden Aufzählung


|
Seite 57 |




|
in jedem Falle entscheiden zu wollen, ob es sich um einen Nachkommen des Rittergeschlechts oder bloß um einen Mann aus dem Ort Kirchberg handelt. Bei vielen ist der erstere Fall sicher, bei einigen der letztere.
Schon 1273 tritt ein Johannes de Kerperg als consul auf, und zwar in der Stadt Wolfhagen (WfälUB IV, 3 Nr. 1319), 1297 erscheint Hermannus de Kericberg in derselben Stadt als consul (ebd. Nr. 2452). Im Rat ist das Geschlecht vor und nach 1313 häufig nachweisbar (K. Lyncker, "Geschichte der Stadt Wolfhagen", ZHG Supplement 6, Kassel 1855, S. 13 mit entstellten Angaben!). Hier handelt es sich offensichtlich um das alte Adelsgeschlecht. In Naumburg treten Bertold von K. 1309 als Ratmann, Cord von K. 1360 als Zeuge auf; Ylut v. K. macht mit den Gütern der Naumburger Kirchbergs vor 1374 eine Stiftung für das waldeckische Kloster Höhnscheid (Knetsch).
Die meisten Männer mit dem Namen "von Kirchberg" finden sich in Fritzlar, der bedeutendsten Stadt in der näheren Umgebung. Als Bürger und Schöffen werden genannt: 1295 Ditmar v. K. (Knetsch), 1298 - 1316 Hermann v. K. (Knetsch, PublPrStArch 19, 26, 32, 219), 1335 Ernst v. K. (Knetsch). Dies ist der erste Ernst von Kirchberg, dem man in ganz Deutschland begegnet, wenn man vom früh ausgestorbenen bairisch-österreichischen Grafengeschlecht absieht. Bei den Kirchbergern in Fritzlar handelt es sich offenbar um eine Familie, und hier darf mit ziemlicher Sicherheit die Abkunft von dem Adelsgeschlecht angenommen werden. In diesem Zusammenhang ist die Frage aufzuwerfen, ob der Name Ernst in diesem Geschlecht und in seiner Fritzlarer Abzweigung üblich gewesen ist. Der Name erscheint um so bedeutungsvoller, als er nicht häufig ist und außerdem von Süddeutschland nach Norddeutschland hin an Häufigkeit wohl auch noch abnimmt. Außerdem sind in Fritzlar der Vikar oder Priester Sigfrid v. K. 1313 und 1314 (Knetsch), der mit ihm wohl identische Priester Sigfrid v. K. 1336 (PublPrStArch 19 Nr. 634) und der Altarist Conrad von K. 1395 belegt (Knetsch). Der zuletzt genannte Konrad stammt sicherlich nicht aus der Stadt, sondern aus dem Landadel von Kirchberg. Die Familie ist - wenn man sie überhaupt an die adligen Kirchberger anschließen will - allem Anschein nach im Bürgertum aufgegangen und hat dabei auch das "von", das damals immer mehr zu einer adligen Namensform wurde, abgelegt. Nun heißen die Bürger und Schöffen in Fritzlar einfach Hermann Kirchberg (1384), Sigfrid Kirchberg


|
Seite 58 |




|
(1389, 1391, 1400, dieser auch VeröfflHess 9, 2), Heinz Kirchberg (1461-7) und Henne K. (1481, Knetsch). Von den Fritzlarer Kirchbergs stammen ab der Hermann K., der 1441 Student und 1453 Altarist war, und der Student Johann K. von 1445 (ZHG N. F. 46, 421 ff., 1927).
Der Schöffe, der 1356 in der Neustadt Gudensberg mit dem Namen "von Kirchberg" auftritt, wird nicht mit dem Adelsgeschlecht in Zusammenhang zu bringen sein, sein Name wird bloß seinen Herkunftsort andeuten sollen (Brunner 227). Dasselbe wird für die Kirchberg von 1347, 1353, 1499 und Kirchberger von 1410 in Kassel gelten (VeröfflHess 9, 2). Endlich ist noch der Ratmann Henne K. aus Naumburg (Knetsch) anzufügen.
Soviel haben die Belege wohl klargemacht, daß die hundert Jahre, während derer die Zeugnisse der landadligen Familie nach den bisherigen Kenntnissen verstummen, ausgefüllt sind von dem Übergang in das Patriziat der Städte und dann von dem Aufgehen der alten Adelsfamilie im einfachen Bürgertum. Von dem Landadel von Kirchberg sind aus dem Ausgang des 14. Jh. noch ein paar spärliche Nachrichten bekannt. "1380 muß ein Atte von Kircperg zusammen mit Heinrich von Rüdinhusen und Reinhart von Rosteberg dem Landgrafen Hermann von Hessen Urfehde schwören" (Knetsch). Die Namen der Genossen kommen von dem Ort Rodenhausen im Amtsgericht Fronhausen südlich Marburg und von dem Schloß Rusteberg etwa 10 km westlich Heiligenstadt. "In Merxhausen ist 1383 - 1392 Bertradis v. K. als Priorin nachweisbar, ihre Schwester Hette (Hedwig) als Konventualin" (Knetsch).
Ernst von Kirchberg. Den letzten Beleg für ein männliches Mitglied der adligen Familie von Kirchberg bietet eine Urkunde vom 2. November 1384 (Knetsch), nach der "Ernst v. K. seine Wiese über Beldirshusen (= Beltershausen, wüst im Gericht Elben) an zwei Bauern zu Altendorf wiederkäuflich für 10 Pfund hessische Pfennige Fritzlarer Währung" verkauft. Diese Urkunde ist entscheidend für die Bestimmung des mecklenburgischen Reimchronisten. Das erste Beweisstück liegt in dem Namen Ernst. Er begegnet hier, nachdem er schon 1335 vorgekommen war, das zweite Mal in demselben Geschlecht, während er sonst in keinem der Dutzende von mittelalterlichen Geschlechtern von Kirchberg zu finden ist. Das Wichtigste aber ist das Siegel des Ernst von Kirchberg, das


|
Seite 59 |




|
diese Urkunde trägt. Das Wappen dieser niederhessischen Adligen und das des Verfassers der mecklenburgischen Reimchronik ist eines und dasselbe. Die Übereinstimmung gewinnt dadurch noch stärkere Bedeutung, daß die Wappen der anderen Geschlechter von Kirchberg bis auf zwei für diesen Fall bestimmt nebensächliche württembergische, wie oben bereits festgestellt wurde, bekannt und unverwechselbar anders sind und daß sich überhaupt unter den sämtlichen deutschen Wappen, die für diese Untersuchung durchgesehen worden sind, kein ähnliches findet!
So ergibt sich vom genealogischen und vom heraldischen Blickpunkt als völlig sicher, daß der Verfasser der Mecklenburgischen Reimchronik zu dem niederhessischen Adelsgeschlecht gehört hat und zu keinem anderen Geschlecht gehört haben kann. Damit ist er seinem Stand und seiner Heimat nach bestimmt.
Denn als Angehöriger dieses Geschlechtes, das im 14. Jh. sicherlich keine ausgedehnten Besitzungen hatte, wird er in Niederhessen aufgewachsen sein. Die Mundart dieses Gebietes liegt in der Tat seiner literarischen Sprache zugrunde. Wo er schreiben und reimen gelernt hat, ob in Niederhessen, vielleicht in Fritzlar, oder an einem anderen Ort, ist nicht zu erkennen. Seine Reim- und Schreibsprache weist jedenfalls keine Eigenheiten auf, die beispielsweise auf Thüringen oder Mainz deuten würden. Kirchbergs Schreib- und Reimweise ist gewählter als in der sonstigen Überlieferung, die aus dem Niederhessen des 14. und 15. Jahrhunderts erhalten ist 18 ); andere Unterschiede sind nicht geltend zu machen. Die sprachliche Untersuchung hat diese Verhältnisse genauer zu klären. Eine andere Frage ist es, ob der mecklenburgische Reimchronist und der in der Urkunde von 1384 genannte Verkäufer der Wiese identisch sind. Es ist durchaus wahrscheinlich. Weitere Urkundennachforschung wird vielleicht auch diese Frage klären können.
Ergebnis der Bestimmung der Herkunft des Verfassers für die sprachliche Auswertung der Mecklenburgischen Reimchronik. Das wich-


|
Seite 60 |




|
tigste Ergebnis besteht darin, daß das Ziel erreicht ist, das in dem einleitenden Kapitel aufgestellt wurde, ausreichende und sichere Voraussetzungen für die sprachliche Beurteilung der Chronik zu schaffen. Konnte man bisher dem Niederhessischen kein mundartnahes Denkmal mit Sicherheit zuweisen, so ist durch den genealogischen und heraldischen Nachweis der Herkunft Ernst von Kirchbergs, der durch die sprachliche Untersuchung in jedem Punkt bestätigt wird, für Niederhessen ein datierbares Denkmal von nicht weniger als 26000 Reimversen gesichert. Nun hat man für das 14. Jahrhundert zwischen dem Niederdeutschen, dem Thüringischen, für das besonders an Johannes Rothe erinnert sei, und dem mit Literaturdenkmälern reicher gesegneten Rheingebiet eine zuverlässige Verbindung in der sprachlichen Überlieferung. Das ist - ganz abgesehen von dem eigentlichen Ziel der sprachlichen Untersuchung, der Auswertung des Denkmals für die Sprachgeschichte im Vergleich mit der Dialektgeographie und für das Verständnis des Wesens der mhd. Literatursprache - für die mhd. Grammatik in zwei Punkten von unmittelbarer Bedeutung. Das Denkmal erweitert die Kenntnis vom mhd. Mitteldeutschen um neues Material, es gibt etwa auf Fragen, die Edward Schröder zur Verbreitung gewisser Spracherscheinungen immer wieder gestellt hat, zum Teil klare Antwort. Wichtiger aber ist noch, daß das schon bekannte Material von der sprachlichen Untersuchung Kirchbergs aus in verschiedenen Punkten in neuem Licht erscheint; das gilt z. B. für Johannes Rothe und für die Dichtung von der heiligen Elisabeth, ganz besonders aber für die Deutschordenssprache, deren Erforschung sich als verlockendste und dringlichste Aufgabe der mhd. Sprachforschung bietet.


|
Seite 61 |




|
2. Teil:
Kirchbergs Auseinandersetzung
mit der
Sprache in seiner
Mecklenburgischen
Reimchronik
19
).
Der Schreiber der Handschrift und seine Behandlung des Textes.
Ehe man an die sprachliche Untersuchung der Kirchbergschen Reimchronik herangehen kann, ist die Vorfrage zu lösen, ob und wieweit der Text Ernst von Kirchbergs zu Ermittelungen über die Sprache des Verfassers taugt. Das hängt von der Überlieferung ab. Ihr hat sich die Untersuchung zunächst zuzuwenden. Die Schweriner Handschrift der Mecklenburgischen Reimchronik hat vielfach für ein Autograph des Verfassers gegolten. Daß das nicht zutrifft, ist leicht zu erweisen. Es ergibt sich schon aus einigen Fehlern, die dem Verfasser nicht unterlaufen sein können. 617, 66 v ist zunächst bito geschrieben, was der Schreiber allerdings selber in Otto geändert hat, 719, 60 osten anstatt Otten, 721, 22 zunächst Meysan, das der


|
Seite 62 |




|
Schreiber dann in Meylan besserte, 601, 28 v birta, dann in Birca gebessert, 806, 1 eckebrecht anstatt Ottebrecht, 629,15 versh anstatt versX, 807, 1 fefe anstatt feste; 598, 39 hat die Handschrift:
dy Thenen durch dy Sassin hy
Dy habin vor en keynen fryde.
Auch dieser Fehler ist für den Verfasser undenkbar. Es muß heißen: dy Thenen dort, dy Sassin hy . . . Es ist die Übersetzung von 9, 13 - 15: piraticas exercentes predas, ex una parte Danis, ex altera Saxonibus infestum. 625, 43 f:
"hör a", sprach her, "Buthue,
Mit dynen gesellen wy nu zu rade!"
ist wohl zu lesen: ge nu zu rade! In dieser Art ließen sich weitere Fehler aufführen. Ihre Deutung ist einhellig. Wie ein Blick zeigt, handelt es sich nicht um Schreibfehler, wie sie die Chronik sonst reichlich enthält und wie sie nachher kurz zu besprechen sind, sondern um Lesefehler. Allein damit ist schon bewiesen, daß die Prachthandschrift entstanden ist als Abschrift einer Vorlage. Die Lesefehler sind aber so grob und auffällig, daß sie zur Genüge zeigen, daß die Handschrift nicht vom Verfasser geschrieben, ja darüber hinaus nach der Niederschrift durch einen Schreiber nicht einmal vom Verfasser durchgesehen sein kann. Denn wenn der Verfasser auch nur flüchtig die Handschrift noch einmal durchgesehen hätte, würde er diese und eine Reihe andere Fehler bemerkt haben und hätte sie leicht ausbessern können. Es sei nur an die naheliegende Königsberger Handschrift Tilos von Kulm erinnert, die vom Dichter sorgfältig korrigiert wurde (s. die Einleitung zur Ausgabe von Kochendörffer, DTM 9, 1907). In der Mecklenburgischen Reimchronik findet sich nirgends auch nur die leiseste Spur einer Durchsicht. Es ist merkwürdig, daß Kirchberg sich um die endgültige Fassung der für den Herzog bestimmten Prachthandschrift so wenig gekümmert hat. Man muß sich mit dieser Tatsache abfinden. Es wäre wohl eine zu einfache Erklärung, wenn man annehmen wollte, der Verfasser sei gestorben, kurz bevor er die letzte Hand an sein Werk hätte legen können. Eher wird es so sein, daß der Tod des Auftraggebers Albrecht II. die geplante letzte Durchsicht des Textes ebenso wie die Fertigstellung der Illumination der Handschrift verhinderte.


|
Seite 63 |




|
Die frühere Ansicht, daß die Kirchberghandschrift Autograph sei, ist jedoch nicht ganz unverständlich, und zwar deshalb, weil der Schreiber sehr zurückhaltend gearbeitet hat und sich kaum bemerkbar macht. Offensichtlich war er niederdeutsch zu schreiben gewöhnt. 806, 60 Ü steht wyf (Weib) und 809, 20 gaf (gab). Das sind Formen, die in dem Reim- und Sprachgebrauch Kirchbergs undenkbar sind. In der hessischen Mundart und Urkundensprache fallen auslautend f und b zusammen; aber das könnte, selbst analogisch oder sonstwie, nie zu den genannten Formen führen; in hessischen Urkunden erscheint zwar b für f, aber f für b im Auslaut gibt es einfach nicht. Jene Formen sind nur als Entgleisungen eines nd. Schreibers deutbar.
Wenn man so für die Herkunft des Schreibers auf Niederdeutschland gewiesen ist, läßt sich hiermit auch das Mißverständnis: durch für dort 598, 39, das bereits erwähnt wurde, deuten. Die Verlesung des in der Vorlage stehenden dort als durch ist jedenfalls bei einem hd. Schreiber schwerer verständlich als bei einem nd., weil das Wort, das im Plattdeutschen heute nicht vorhanden ist, im Mnd. (s. die Wörterbücher!) "sehr selten" und wohl nur unter hd. Einfluß vorkommt. Nicht aus dem Nd. dürfte zu erklären sein, daß p anstelle des normalmhd. ph, das auch in der Chronik gewöhnlich so erscheint, am häufigsten bei dem ersten Vorkommen jedes Wortes geschrieben wird; hier wird eher nhess. Schreibgebrauch vorliegen, der aus der Vorlage vom Schreiber übernommen ist.
Der Beweis für die Heimat des Schreibers liegt aber nicht in Schreibungen, die auf lautliche Verhältnisse zurückgehen, sondern im Schreibgebrauch selbst, in der Verwendung der Schreib- und Abkürzungs-Zeichen. Daß man heute über solche Dinge noch nicht viel sagen kann, liegt daran, daß man sie bisher zu wenig beachtet hat. Man betrachtete Handschriften und sprachgeschichtliche Denkmäler allzu ausschließlich unter lautlichen Gesichtspunkten. Gerade die Erscheinungen, die frei von lautlich-grammatischen Beziehungen sind, geben für Lokalisierung und Feststellung von Schreibschulen klarere und festere Anhaltspunkte. Hier liegt ein Mittel zur Erkenntnis kultureller Zusammenhänge vor, das bisher zu wenig ausgewertet ist. Die mutigen Anfänge bei K. Bartsch in seiner Untersuchung der Jenaer Liederhandschrift, 1923 (Palaestra 140), sollten zur Nachfolge reizen. Sehr aufschlußreich ist bei Kirchberg die Verwendung des Abkürzungszeichens, das in der


|
Seite 64 |




|
Mehrzahl der Fälle als -er aufgelöst werden muß. Doch gebraucht es die Handschrift an zwei Stellen auch für -e: land' 598, 12 und vnd' 702, 31. Hierzu muß man noch folgende Lesefehler des Schreibers stellen: vnde: wunde anstatt vnder: wunder 612, 27, lichtege- anstatt lichter gebort 627, 15 v, de anstatt der 600, 27 (das r-lose Pronomen für das Mask., bei Kirchberg öfter, auch im Reim, gebraucht, lautet stets dy) und eyne anstatt eyner 793, 65. Der erste Fehler läßt sich gar nicht anders und die übrigen Fehler schwerlich anders verstehen, als daß dem Schreiber für den Haken, der in der Vorlage -er bedeuten sollte, -e als Auflösung am nächsten lag. Ein solcher Haken als Abkürzungszeichen für -e ist auch im Hd. bekannt, aber dort ausschließlich nach d, nach keinem anderen Buchstaben, und dann auch nur im 12. Jh. und zu Anfang des 13. Jhs.; Bartsch benutzt diese Abkürzung -d' geradezu zur Datierung (Germania 8, 274. Weitere Belege aus dieser Zeit Germania 3, 348; Kapteyns Wigalois-Ausgabe, Rhein. Beitr. 9, 1926, S. 28*). Anders auf nd. Gebiet. Hier kann das -e durch einen Haken nach jedem Buchstaben bezeichnet werden, und außerdem erstreckt sich diese Gepflogenheit über mehrere Jahrhunderte. Im Hartebok z. B., das um 1500 geschrieben ist, begegnet der Haken oft nach verschiedenen Konsonanten (Valentin und Namelos, hsg. von W. Seelmann, Norden und Leipzig 1884, S. X f.). Weil der Beobachtungsstoff noch zu gering ist, mögen diese Erwägungen nicht ganz schlüssig erscheinen. Immerhin wird man schon auf Grund dieser Erörterungen in dem Schreiber einen Mann sehen dürfen, der nd. zu schreiben gelernt hatte und gewohnt war.
Eine andere Annahme wäre von vornherein unwahrscheinlich. Ist es schon auffällig, daß sich der mecklenburgische Herzog für seine Reimchronik einen nhess. Verfasser wählt, so wäre es noch auffälliger, wenn er dazu außerdem einen nhess. Schreiber genommen hätte. Das Natürliche war doch, daß die Herstellung der Handschrift einem bewährten Schreiber aus seiner Kanzlei oder noch wahrscheinlicher aus dem Kloster Doberan übertragen wurde. Er nahm sicherlich für sein Prachtwerk, für die kostbare Pergamenthandschrift den besten Schreiber, den er dort fand. Ein solcher Schreiber aber, muß man erwarten, wird auch für besondere Staatsurkunden herangezogen worden sein. Unter diesem Gesichtspunkt ist es wohl nicht bedeutungslos, daß mir bei der Durchsicht der Urkunden jener Zeit im Schweriner Archiv eine Schriftverwandt-


|
Seite 65 |




|
schaft der Kirchberghandschrift mit einer Gruppe Doberaner Urkunden auffällig schien. Vielleicht kann hier eine eingehendere Untersuchung der mecklenburgischen Urkunden und des Kanzleiwesens Klärung bringen. Zu einem Urkundenschreiber würde es passen, daß er die Chronik zwar von Anfang an gut schreibt, daß er zunächst jedoch in der Buchschrift sichtlich ungeübt ist. Im Laufe der Arbeit nimmt die Minuskel an Leichtigkeit und Gleichmäßigkeit zusehends zu.
Der wichtigste Umstand, der die Eignung des Denkmals für sprachliche Untersuchungen bestimmt, ist die Behandlung des Textes durch den Schreiber. Darüber kann man Klarheit gewinnen nur dadurch, daß man alle erkennbaren Schreiberäußerungen in der Handschrift, d. h. aber in diesem Fall alle erkennbaren Fehler des Schreibers, zusammenstellt und unter dem angegebenen Gesichtspunkt auswertet. Die Fehler der Kirchberghandschrift zerfallen in zwei Gruppen, Schreib- und Lese-Fehler. Die Schreibfehler sind zahlreich, sind aber rein in der Schreibtätigkeit begründet und bedürfen deshalb hier keiner Erörterung; sie sind lediglich mechanisch assoziativer Art. Bei dem größten Teil der Fälle handelt es sich um Vorauswirkung eines folgenden Wortes auf das vorhergehende (Musterbeispiel: yn gar czortzlichir czid anstatt kortz- 759, 52 v), viel seltener um Nachwirkung eines vorhergehenden Wortes auf ein folgendes. Zu den Lesefehlern gehören einige, in denen der Schreiber ein paar Konstruktionen falsch faßt, weil sie nicht leicht zu übersehen sind; oder er setzt gelegentlich falschen Kasus oder Numerus, weil er den Text nur in kleinen Stücken, gewöhnlich versweise, aufnimmt. Das sind Fehler, die gering an Zahl sind und den Text nirgends ernsthaft entstellen, Fehler, die wie die eben erwähnten Schreibfehler sich in einem langen Text auch bei größter Sorgfalt zwangsläufig einstellen. Aufschlußreicher für die Behandlung des Textes durch den Schreiber sind die Lesefehler, die schon zum Beweis dafür heranzuziehen waren, daß die Prachthandschrift vermutlich von einem Niederdeutschen nach Vorlage geschrieben und sicherlich von dem Verfasser nicht durchgesehen wurde: bito - Otto, meysan - Meylan, wy - ge und die anderen bereits genannten Beispiele, denen hier etwa noch 712, 24 v: mey(-)eedig anstatt mey(-)tedig und ähnliche Fälle hinzugefügt werden könnten. Für diese Gruppe von Fehlern ist die Ursache leicht festzustellen, und sie ist von entscheidendem Wert für die Beurteilung der Textbehandlung durch den Schreiber;


|
Seite 66 |




|
alle diese Fehler zeigen, daß der Schreiber seine Vorlage mechanisch nachschrieb, daß er alle schwierigen Stellen, wie die Beispiele darlegen, lieber Strich für Strich nachmalte, auch wenn er keinen rechten Sinn damit verband, als daß er sie nach seiner Auffassung zurecht gebogen hätte. In den 26000 Versen hat sich aber bei genauer Nachprüfung keine größere Flüchtigkeit und keine Eigenmächtigkeit beim Schreiber ergeben. Er hat sich seiner Aufgabe mit Treue und Sorgfalt gewidmet. Der Gesamteindruck, der sich aus der Arbeit des Schreibers ergibt, ist also der günstigste, den man sich für die Auswertung des Textes wünschen kann.
Kirchbergs Auseinandersetzung mit der Sprache.
Fragestellung der sprachlichen Untersuchung. Nachdem die Erörterung der Textbehandlung durch den Schreiber freie Bahn geschaffen hat, kann sich die Untersuchung der Sprache des Verfassers zuwenden. Es genügt dabei nicht, den Sprachgebrauch nach den grammatischen Kategorien zusammenzustellen und dann mit anderen Denkmälern der Zeit aus der Nachbarschaft oder mit lebenden Mundarten aus der Heimat des Verfassers zu vergleichen. Wenn man an Wesentliches herankommen will, muß man die Wege weiter gehen, die die mhd. Reimgrammatik eingeschlagen hat. Sie ist längst über die Statistik dessen, was ein Dichter reimt, hinausgegangen und hat aufschlußreiche Ergebnisse aus dem gewonnen, was ein Dichter nicht reimt, ja Kraus, Zwierzina, Edward Schröder sind mehr und mehr dazu gekommen, aus der Beobachtung, wo und wie der Dichter etwas reimt, ihre Schlüsse zu ziehen. Man wird zugeben müssen, daß man die Sprachformen, ehe man sie aus ihrem Zusammenhang herauslöst und mit anderen Formen anderer Denkmäler oder der Mundarten vergleicht, eigentlich erst aus dem Denkmal, aus dem jeweiligen besonderen Zusammenhang heraus verstehen müßte. Wenn man gewöhnlich darauf verzichtet, so geschieht es wohl wegen der Schwierigkeiten, die einer genauen Erfassung der Sprachformen entgegenstehen. Man muß es dann aber in Kauf nehmen, daß man sich Fehldeutungen aussetzt, und vor allen Dingen, daß man über Statistik, Aufzählung und Beschreibung oder äußerliche zeitliche Ordnung, wie man sie seit langem übt, oder auch räumliche Ordnung, wie sie die Dialektgeographie so stark hervorhebt, nicht hinauskommt. Wenn man zur vornehmsten


|
Seite 67 |




|
Aufgabe, der sprachlichen Deutung, vorschreiten will, dann muß man die Besonderheit jedes Denkmals und darin wiederum die Besonderheit jedes Beleges berücksichtigen, man muß also die Grundsätze, die sich in der Literaturgeschichte mehr und mehr Geltung verschaffen, auch für die sprachliche Untersuchung anwenden, man muß vor der sprachlichen Auswertung die Frage nach der Eigenart der jeweils untersuchten literarisch geprägten Sprache stellen.
Die erste und eigentlich schwierigste Aufgabe dabei ist die, den Ansatzpunkt zu finden, von dem aus der Sprachgebrauch des Denkmals aufzurollen ist. Wir können uns heute nicht ohne weiteres vorstellen oder nachfühlen, wie ein mittelalterlicher Schreiber oder Dichter der Sprache gegenüberstand. Denn heute ist die Sprache für die Verwendung in Schrift und Reim nach Lauten und Formen so festgelegt, daß grundsätzliche Schwierigkeiten gar nicht auftauchen können. Die Einstellung eines Reimers oder Schreibers zur Sprache in mittelalterlichen Werken ist in jedem einzelnen Falle erst zu ergründen. Bei alledem handelt es sich um eine Kernfrage für das Verständnis der hochmittelalterlichen Dichtung. Je formvollendeter ein Werk ist, je besser es dem Dichter gelungen ist, die Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit der Sprache zu meistern, um so undurchsichtiger erscheint uns das fertige Werk vorerst für die Sprachuntersuchung. Die Möglichkeit, die sprachlichen Formen eines mittelalterlichen Denkmals verstehen zu können, eröffnet sich am ehesten da, wo die Schwierigkeiten der Sprachgebung nicht ganz bezwungen sind, wo ein Bruch im Sprachgebrauch vorliegt, wo sich der Sprachgebrauch gewandelt hat oder nicht gleichmäßig durchgeführt ist. Erst die Wandlungen und Unregelmäßigkeiten können die Ursachen für den Sprachgebrauch sichtbar machen. So wird die vorliegende Untersuchung ihre Folgerungen weniger aus den gebrauchten Formen selber ziehen als aus der Verwendungsart und aus dem Vergleich der verschiedenen Formen. Sie will damit die Arbeiten, die zur Erhellung der mittelalterlichen Literatursprache zuerst in großem Stil von Zwierzina und Kraus über Hartmann, Wolfram, Veldeke in Angriff genommen und dann in den bedeutenden jüngeren Arbeiten von Edw. Schröder und Zwierzina fortgesetzt wurden, weiterführen. Eine solche Untersuchung bildet bei einem Denkmal des 14. Jhs. die notwendige Grundlage für die weitere Auswertung der Sprache, da die Grundsätze des Sprachgebrauchs in einer Reim-


|
Seite 68 |




|
chronik dieser Zeit erst aus dem Denkmal selbst erarbeitet werden müssen. Gleichzeitig ist damit der Erkenntnis des Wesens der mittelalterlichen Literatursprache gedient. Es muß einmal ein Denkmal des 14. Jh. nach solchen Gesichtspunkten bearbeitet werden, damit man die Unterschiede in der Literatursprache gegenüber der hoch- und frühhöfischen Zeit, aber auch die Gemeinsamkeiten, die die Literatursprache das ganze Mittelalter hindurch auszeichnen, deutlicher erkennen kann.
Da die Auswertung der Kirchbergschen Sprache möglichst umfassend sein soll, muß, bevor die Auswahl und Verwendung der Sprachformen betrachtet wird, noch untersucht werden, wieweit die Schreibung sich als Grundlage für die Beurteilung des Sprachgebrauchs mit eingliedern läßt. Obwohl sich gezeigt hat, daß die Handschrift nicht Autograph ist, läßt die Betrachtung der Arbeitsweise des Schreibers doch die Aussicht offen, auch außerhalb des Reimes den Sprachgebrauch des Verfassers erkennen zu können. Wenn das möglich ist, gewinnt die sprachliche Untersuchung an Gewicht. Es treten wichtige Bestandteile des Sprachgebrauchs zutage, die im Reim nie begegnen können. Vor allem aber läßt sich dann endlich einmal zeigen, was noch bei keinem mittelalterlichen Dichter gelungen ist, wie Reim und Schreibung zueinander stehen, und das wiederum gestattet weitere Einsichten in die Schreibsprache (Urkundensprache, Geschäftssprache), die Reimsprache und das Wesen der Literatursprache im Mittelalter.
Wandlungen im Sprachgebrauch und Ausnahmeformen in Reim und Schreibung, die sich mit Sicherheit auf den Verfasser zurückführen lassen. 1. sayd(e(n) - saget(e(n). Wer bloß auf die Formen achtet, dem wird die Verteilung der Kontraktion und der Erhaltung von g ziemlich regellos scheinen, und er wird aus den sayd(e(n) und saget(e(n) bei Kirchberg keine sicheren Aufschlüsse gewinnen können. Gleich dies erste Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die ganz besondere Stelle des Vorkommens jeder Form ihrer Bedeutung entsprechend zu würdigen. Im folgenden werden die sämtlichen Belege für die 3. Sg. Präs. Ind. und die 3. Sg. und Pl. Prät. Ind. von sagen aufgezählt.
In der Schreibung treten anfangs nur Formen mit Kontraktionsdiphthong auf (616, 32; 620, 16, 23; 627, 64, 66; 629, 3; 637, 56), dann erscheinen nichtvokalisierte Formen mit


|
Seite 69 |




|
g (640, 58; 642, 57), die vokalisierten Formen beherrschen aber weiterhin den Sprachgebrauch (648, 57; 651, 3; 652, 11; 655, 42; 658, 39; 666, 22), dann bekommen die nichtvokalisierten Formen das Übergewicht (670, 36 -age- im Reim; 677, 44 -age- in der Schreibung; 678, 32 und 65 -ay-; 679, 50 -age- im Reim; 680, 11 -age- in der Schreibung; 686, 16 -ay-; 686, 25 -age- im Reim; 687, 66 -age- in der Schreibung; 691, 13 -ay-; 691, 22 und 695, 17 -age-) und herrschen in mehr oder minder ausgeprägter Überlegenheit durch das ganze weitere Werk vor (nicht vokalisierte Formen: 699, 27, 64; 701, 54; 704, 37 (Reim); 705, 17; 706, 22 (Reim), 38 (Reim); 716, 10; 720, 22 (Reim); 726, 46; 731, 49 (Reim); 733, 1; 738, 6; 742, 8; 745, 59; 751, 39; 753, 49 (Reim); 754, 15; 758, 55 (Reim), 65; 764, 6, 17; 766, 38; 771, 21; 776, 18, 27; 783, 28; 785, 38; 786, 52 (Reim); 789, 43; 796, 16, 25; 804, 61; 805, 2, 26 (Reim); 818, 15; 834, 47; 836, 27; 838, 25; vokalisierte Formen: 698, 11; 705, 24; 716, 10; 734, 5; 737, 31; 757, 8, 12, 44 (Reim); 758, 25; 771, 23; 777, 18; 780, 40; 811, 63; 813, 14, 15; 825, 31; 826, 15; 834, 28; 837, 39). Scharfe Grenzen bestehen nicht, doch beginnt das Vorherrschen der nichtvokalisierten Formen mit einem deutlichen Einschnitt. So klar die Vokalisationen bis 666, 22 in der Überzahl sind, so klar setzt mit 670, 36 das Übergewicht der unkontrahierten Formen ein. Der Beleg 670, 36 teilt die Chronik der Schreibung der Lautgruppe -aget- nach in zwei Abschnitte.
Ebenso auffällig gliedert sich die Chronik nach den Reimen der Lautgruppe -aget- in zwei Abschnitte. Ob der Verfasser mit oder ohne Vokalisierung reimen wollte, kann man nach den Reimen nicht entscheiden. "Beweisende Reime" gibt es hier nicht; denn da bei Kirchberg der Kontraktionsdiphthong mit keinem anderen Laut, auch nicht dem alten Diphthong ei, zusammenfällt, kann die Lautgruppe -aget-, ob vokalisiert oder nicht, nie anders als in sich reimen. Für den gegenwärtigen Zusammenhang kommt es aber nur darauf an, daß der Verfasser die Lautgruppe -aget- ausschließlich in einem späteren Abschnitt des Werkes überhaupt in den Reim stellt (zuerst 670, 36) und daß er im Gegensatz dazu in dem früheren Abschnitt, wie die Häufigkeit der Reimstellung in dem späteren Abschnitt beweist, diese Lautgruppe aus der Reimstellung fernhält. Es ist ein mindestens ebenso auffälliger Unterschied in der Reimverwendung des Wortes wie in der Schreibverwendung.


|
Seite 70 |




|
Im Reim wie in der Schreibung zerfällt die Chronik in Bezug auf die Lautgruppe -aget- in zwei grundsätzlich verschiedene Abschnitte - und diese Abschnitte, das ist das Entscheidende, fallen zusammen. Der Wandel fällt im Reim wie in der Schreibung auf denselben Punkt.
Daß sich der Schreiber, der, wie oben gezeigt wurde, die Handschrift schrieb, ohne daß der Verfasser sein Werk nachprüfte, etwa die Grundsätze seiner Schreibung nachträglich aus dem Reimgebrauch abgeleitet hätte, ist deshalb unmöglich, weil kein beweisender Reim da ist und der Reim ebenso gut mit wie ohne Kontraktion gemeint sein und geschrieben werden könnte. Die Veränderungen im Reimgebrauch bestehen ja in nichts anderem als in der Häufigkeit, mit der die Worte im Reim erscheinen - lautlich und orthographisch sind sie vollkommen neutral. Reim und Schreibung können hier nicht auf verschiedene Personen zurückgehen. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als daß der gleichzeitige Wandel in der Schreibung wie im Reimgebrauch aus ein und derselben Ursache, einem Wandel in der literarischen Sprachgepflogenheit des Verfassers, hervorgeht.
2. leyde(n) - legete(n). Eine ähnliche Entwicklung wie in der Lautgruppe -aget- liegt in den Prät. leyde(n) - legete(n) vor. Zum Unterschied von den -aget- liegt aber der Einschnitt bei den leyde(n) - legete(n) an einer anderen, späteren Stelle und ist außerdem gekennzeichnet durch beweisende Reime. Reimten vorher leit:arbeit 600, 62 und :kunterfeyt 601, 18 und leyde:beyde 601, 4 und :arbeyde 690, 17, so reimt 697, 59 legeten:irwegeten und 720, 18 und 789, 57 legite:irwegite; irwegete(n) ist ein Wort, das weder im Reim noch in der Schreibung bei Kirchberg jemals mit Vokalisierung auftritt. Bei der sorgfältigen Auswahl der Reimworte, mit denen einerseits leit, leyde, anderseits legete(n) gepaart werden, stellen sich die Bindungen als "beweisende Reime" dar. Das bedeutet, daß bis 690, 17 die vokalisierten Formen des Prät. gereimt werden, daß aber mit 697, 59 ein neuer Abschnitt beginnt, in dem nur die nichtvokalisierten Formen in den Reim gestellt, die vokalisierten ferngehalten werden. Dafür läßt sich ein weiteres Beweisstück anführen. Die Formen leit, leyde sind, wie schon die Zusammenstellung zeigt, sehr leicht reimbar, sie erscheinen daher, solange sie erlaubt sind, verhältnismäßig oft im Reim; bis 690, 17 kommen auf 8 Prät.-Formen von "legen" im Versinnern 4 Formen im


|
Seite 71 |




|
Reim. Wenn im zweiten Abschnitt nur 3 Prät.-Formen von "legen" im Reim erscheinen, obwohl nicht weniger als 35 Formen im Versinnern auftreten, so liegt darin ein Beweis, daß nur die nichtvokalisierten Formen legete(n), auf die es kaum Reimwörter gab, in den Reim gestellt und die oft reimbaren leit, leyde vermieden wurden.
Ebenso deutlich zerfällt die Chronik in der Schreibung des Prät. von "legen" in zwei Abschnitte, einen ersten Abschnitt, der ganz überwiegend vokalisierte (600, 62; 601, 4; 601, 18; 610, 47; 620, 31; 622, 52; 630, 46; 687, 30; 688, 52; 690, 18; nichtvokalisierte Formen bloß: 623, 35, 680, 35), und einen zweiten Abschnitt, der ebenso überwiegend nichtvokalisierte Formen (696, 63; 697, 59; 701, 10; 705, 37, 44; 712, 58; 714, 49; 716, 23; 720, 18; 722, 51; 723, 29; 728, 65; 759, 26; 760, 35, 60; 761, 3; 765, 21; 789, 57; 795, 20; 800, 48; 802, 13; 817, 29; 822, 33; 836, 53; vokalisierte Formen nur: 710, 18; 711, 2; 718, 48; 728, 58; 733, 52, 54; 738, 46; 786, 12; 793, 55; 797, 36; 809, 26; 811, 8; 827, 23; 830, 21) kennt. Und wiederum fallen die Abschnitte in dem Reimgebrauch und in der Schreibung zusammen. Auch hier muß die Schreibung, und nicht bloß der Reim, die Sprache des Verfassers spiegeln, denn die Schreibung ist nicht aus dem Reimgebrauch abgeleitet, und zwar deshalb, weil legete 696, 63 schon vor dem Reimbeleg 697, 59 erscheint und somit die Schreibung, nicht der Reim, den zweiten Abschnitt, der die nichtvokalisierten Formen bevorzugt, von sich aus eröffnet.
So liegt in der Entwicklung von legete - leyde, leit im Schreib- und Reimgebrauch neben sagete - sayde ein weiterer klarer Beweis vor, daß die Schreibungen unmittelbar wie die Reime auf den Verfasser zurückgehen.
3. ê, æ 1 - ei. ê und æ 1 (der gewöhnliche Umlaut von â, wie in der Sprachuntersuchung später ausführlicher zu zeigen ist) sind bei Kirchberg identische Laute, wogegen æ 1 und æ 2 , der Umlaut, den man als Sekundärumlaut bezeichnen kann und der nur in wenigen Worten vorkommt, scharf auseinandergehalten werden; geschrieben wird für alle diese Laute übereinstimmend e. Der alte Diphthong ei wird bei Kirchberg ei bzw. ey geschrieben. e und ei, ey sind so klar und durchgängig von allem Anfang sowohl in der Schreibung wie im Reim geschieden, daß besondere Beispiele dafür überflüssig sind. Nur an drei Stellen scheinen in der Schreibung die Laute


|
Seite 72 |




|
vermengt zu sein. 609, 26 virczeich (Prät. st. V. I), 649, 18 du leiszes ("du läßt"), 666, 45 erbeirlich (Adv.). Man könnte das für eine Besonderheit allein des Schreibers halten. Im Reim werden ei, ey und ê, æ 1 immer auseinandergehalten - bis auf eine einzige Stelle, 668, 53, wo der Opt. Prät. breichin mit dem Subst. czeychin gebunden ist. Dieser Reim zeigt, daß schon der Verfasser ey, ei mit ê, æ 1 vermengt. Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß der Schreiber seine Schreibungen nicht nachträglich von dem späteren Reim abgeleitet haben kann. Es ist klar, daß die Schreibungen in diesem Anfangsabschnitt ebenso wie der Reim auf den Verfasser zurückzuführen sind.
4. uo - o. Das normalmhd. uo wird bei Kirchberg regelmäßig u geschrieben; auch hier sind bei der reichen Zahl der Belege Beispiele überflüssig. Nur an sehr wenigen Stellen verstößt die Schreibung gegen die Regel: 599, 21 bischdom, 604, 16 moste, 625, 41 alzohant, 659, 59 ouer, 757, 46 Ü zo Doberan. Im Reim hält Kirchberg uo und ô in jeder Stellung auseinander; auch vor rt reimen die Prät. rurte(n), furte(n) auf der einen Seite und die zahlreichen Prät. horte(n), (vir)storte(n) auf der anderen Seite nur sauber in sich - bis auf einen Ausnahmefall, wo die Part. Prät. virstort: gevort 611, 53 gebunden sind. Dadurch ist bewiesen, daß auch bei der Wiedergabe des normalmhd. uo in den Schreibungen durch o, die nicht durch den Schreiber nachträglich aus dem Reim abgeleitet sein können, die Sprache des Verfassers überliefert ist.
5. -te in den sw. Prät. und rd - rt. Bei Kirchberg gehen d < germ. Þ und t < germ. ð im Inlaut im allgemeinen durcheinander, in der Schreibung wie im Reim. In bestimmten Fällen jedoch trennt er sie streng: die Endung der sw. Prät. -te hat stets t, und in der Stellung nach r werden d und t sauber geschieden. Dieses Verhalten ist im Hessischen nicht anders zu erwarten. Auch dies gilt für die Schreibung wie für den Reim. Deshalb reimt Kirchberg keines der sehr zahlreichen Prät. ordinirte, studirte, confirmirte, suspendirte, frequentirte, visitirte, regirte, consecrirte, czirte usw. jemals auf eines der zahlreichen Subst. czirde, girde, wirde usw. oder auf die Ordnungszahl vierde, obwohl vokalisch bei Kirchberg nachweislich keinerlei Trennung bestand, sondern jede der beiden Gruppen, die mit den etymologisch bedingten t und die mit den etymologisch bedingten d, reimen nur unter sich. Es gibt nur eine höchst aufschlußreiche Gruppe von Ausnahmefällen.


|
Seite 73 |




|
704, 11 steht in der Schreibung plötzlich entgegen der Regel visitirde Prät., und 718, 5 schreibt er noch einmal futerden Prät., 712, 29 sogar die nach den Belegen der Wörterbücher in Mittel- und Norddeutschland unerhörte Form mardir ("Marter"). Das sind die einzigen Ausnahmen in der Schreibung - und 706, 2 steht die einzige Ausnahme im Reimgebrauch: celebrirde (Prät): czirde (Subst.). Hier ist ebenso klar wie in den vorausgehenden Fällen, daß die Schreibung dem Reimgebrauch nicht nachgebildet sein kann, sondern daß sie von den Grundsätzen des Verfassers bestimmt sein muß. Man kommt notwendig zu dem Schluß, daß der Verfasser selbst - aus welchen Gründen, ist später zu überlegen - seine sonst durchgängig eingehaltene Regel von den d- und t-Unterschieden durchbricht.
6. noch - nach. "Noch" ist durch die ganze Chronik stets - und das Wort kommt sehr oft vor - noch geschrieben, bis auf zwei Ausnahmen: eine Vers-Innenschreibung nach 657, 43 und einen Reim nach:geschach 661, 44, der, wie später ausführlicher zu zeigen sein wird, als -o-Reim nach Kirchbergs Sprache unmöglich zu verstehen wäre. Dieses Beispiel zeigt mit voller Deutlichkeit nicht nur, daß Reim und Schreibung aufs innigste zusammengehen, sondern auch, daß die Schreibung nicht vom Reimgebrauch abgeleitet sein kann. Die letzte Spur dieser Erscheinung findet sich 680, 26; da hatte der Schreiber zuerst nach geschrieben, es dann aber zu noch verbessert.
7. v - b. Kirchberg trennt in der Schreibung wie im Reim das normalmhd. v vom normalmhd. b. Nur im Anfang begegnen einige Reime zwischen v und b: 628, 53 lieue (Liebe): brieue, 639, 16 behuben (Behuf) : gruben, 670, 52 prubit:ubit. Außer in diesen Reimschreibungen kommt sonst in der Schreibung keine Vermischung vor; nur 659, 59 ist ouer anstatt des regelmäßigen ubir geschrieben. Es ist klar, daß diese Schreibung mit dem Reimgebrauch zusammenhängt, also auf den Verfasser zurückgeht. Daß die Schreibung ouer etwa nur aus den Reimen irgendwie nachträglich abgeleitet sein könnte, ist nicht möglich, weil es sich ja um ganz verschiedene Worte handelt, die sicher nicht aufeinander eingewirkt haben.
8. Anhang: Auseinandergehen von Reim und Schreibung. a) rcht - rt. Die Reime Kirchbergs mit rht sind fast alle mit rt gebunden, dagegen ist in der


|
Seite 74 |




|
Handschrift im Versinnern ausnahmslos rcht geschrieben. Das geht so weit, daß der Stamm von "fürchten" in einer und derselben Zeile verschieden erscheint: 703, 43 vorchtig sy wordens vast irvort (:wort), wobei das letzte Wort nach Kirchbergs Reim- und Schreibgebrauch nur zu ervürhten, nicht etwa zu erværen gehören kann. Es würde aber ein falsches Bild geben, wenn man bei diesen Feststellungen stehen bliebe. In Wirklichkeit ist es so, daß Reim und Schreibung auch bei rcht regelmäßig zusammengehen außer in zwei oder drei kleinen Abschnitten. Kirchberg reimt nämlich rht nur 7mal, und zwar an den folgenden Stellen: 682, 9; 699, 65; 703, 43; 711, 21 - 785, 12; 798, 42 - 826, 38. Diese Reime rcht:rt waren sehr bequem und mußten sich dem Verfasser aufdrängen, er hätte sie sehr häufig verwenden können. Daraus, daß das nicht der Fall ist, ergibt sich, daß der Verfasser die Reimform rt für rcht vermeidet, er hat sogar einmal das Prät. vorchte auf worchte gereimt (721, 30), das durch Systemzwang zweifelsfreies rcht hat. Es ist also dieselbe sprachliche Haltung im Reim wie in der Schreibung, nur nicht so ausnahmslos. Daß die Schreibung in diesem Fall die kleinen Abweichungen von der durchgängigen Regel im Reimgebrauch nicht mitmacht, braucht nicht zu verwundern. Es handelt sich nicht etwa um eine Ausgleichung der Verfasserschreibungen durch den Schreiber im Gegensatz zu seiner sonstigen Haltung, sondern um die Verschiedenheit der Reimsprache und Schreibsprache beim Verfasser selbst. Reimen und Schreiben fällt in zwei getrennte Sprachtraditionen; und wie Roethe in den "Vorreden zum Sachsenspiegel" darauf hingewiesen hat, daß man nicht reimt, wie man spricht, sondern wie man es gelernt hat, so gilt auch, daß man nicht schreibt, wie man spricht oder reimt, sondern wie es den Schreibregeln entspricht.
b) vy - vehe. Ein ähnlicher Fall wie rcht - rt
liegt in den Entsprechungen von nhd.
"Vieh" vor. Das Wort kommt in dem Werk
insgesamt 5mal vor, 2mal im Reim, v
 :n
:n
 601. 9 und
601. 9 und
 e:v
e:v
 e 671, 8, und 3mal im Versinnern,
immer vehe geschrieben, 672, 33; 731, 11; 757,
61. Man könnte annehmen, daß es sich bei dem
Gegensatz von Reimform und Schreibform um die
verschiedene Sprache zweier Individuen handle.
Wenn aber Kirchberg so geschrieben hätte, wie er
reimt, wenn also in der Vorlage im Versinnern vy
gestanden hätte - soll man annehmen, daß der
Schreiber 672, 33, 120 Verse nach dem
e 671, 8, und 3mal im Versinnern,
immer vehe geschrieben, 672, 33; 731, 11; 757,
61. Man könnte annehmen, daß es sich bei dem
Gegensatz von Reimform und Schreibform um die
verschiedene Sprache zweier Individuen handle.
Wenn aber Kirchberg so geschrieben hätte, wie er
reimt, wenn also in der Vorlage im Versinnern vy
gestanden hätte - soll man annehmen, daß der
Schreiber 672, 33, 120 Verse nach dem


|
Seite 75 |




|
zweiten Reimbeleg, die sonst immer treulich wiedergegebene Vorlage willkürlich ändert und vehe dafür schreibt? Sicherlich muß man die Verschiedenheit im Sprachgebrauch auch hier dem Verfasser zuweisen. Wenn Kirchberg vy, das ein sehr bequemes Reimwort abgab, nach 671, 8 nicht mehr im Reim verwendet, so heißt das, daß er das Wort zu reimen vermeidet - gleichzeitig aber zieht in der Schreibung die nicht reimbare Form vehe ein, die in der hess. Kanzleisprache durchaus üblich ist. Der Wandel liegt zwischen 671, 8 und 672, 33, er fällt also, sehr bedeutsam, genau mit dem Wandel im Gebrauch der vokalisierten bzw. nichtvokalisierten Formen von -age- zusammen! Es wird demnach wohl sicherstehen, daß auch in diesem Fall in der Schreibung nicht minder als im Reim die Sprache des Verfassers erhalten ist.
Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs in der Helmoldübersetzung. Der letzte Abschnitt diente noch der Grundlage, auf der die sprachlichen Erörterungen aufzubauen haben, indem er die Spracherscheinungen zusammenstellte, die außer dem Reim mit Sicherheit auf den Verfasser zurückgehen. Die Untersuchung wendet sich jetzt ihrer Hauptaufgabe zu, der genaueren Betrachtung der Wandlungen im Sprachgebrauch und der Ausnahmeerscheinungen, mit dem Ziel, die Eigenart des Sprachgebrauchs in diesem Denkmal zu verstehen.
1. Die Reime ė:ê, æ 1 und die Schreibungen o für ou. ė wird in der Regel nur mit sich selbst gereimt, doch begegnen ausnahmsweise Reime auf ê oder æ1. Die sämtlichen Belege dafür sind: (I) 596, 29; 599, 13, 36; 600, 61; 602, 47; 608, 60; (II) 623, 49; 625, 18; (III) 641, 12, 57; 648, 65; (spätere Belege) 672, 37; 705, 3; (gegen den Schluß des Gesamtwerks) 815, 58.
Die Schreibung o für ou gehört zu den Ausnahmen. Sie kommt nur an den folgenden Stellen in der Chronik vor: (I) 604, 12; (II) 615, 4; 616, 3; 621, 39; (III) 638, 31; 639, 44; (bis hierher immer glob-); 645, 10 (enthobeten); 652, 64; 656, 22 (robery); (spätere Belege) 693, 49 (kofmanschaft); 713, 1 (robery); 721, 66 (enthobidet); 736, 17 (hof).
Hier sind zwei Spracherscheinungen zusammengestellt, die äußerlich gar nichts miteinander zu tun haben, eine Reim-


|
Seite 76 |




|
und eine Schreiberscheinung, Belege für eine ausnahmsweise vorkommende Reimbindung in den e-Lauten und für einen Ausnahmefall in der Schreibung der Gutturalvokale. Das Auffällige ist nun, daß diese Ausnahmeerscheinungen nicht bunt durcheinanderstehen oder sich gleichmäßig über die Chronik verteilen, sondern daß sie in deutlich abgehobenen Gruppen nestweise zusammengehäuft auftreten (bei der Aufzählung der Belege sind die Gruppen an ihrem Anfang durch römische Zahlen bezeichnet), und vor allem, daß diese verschiedenen Ausnahmegruppen sich bei beiden Lauterscheinungen in denselben Abschnitten der Chronik finden. Das heißt: die Ausnahmeformen, die zwischen den Regelformen sehr selten sind, brechen stoßweise in Gruppen durch, und der Rhythmus dieser Durchbrüche ist bei ganz verschiedenen Spracherscheinungen der gleiche. Da ein äußerer Zusammenhang zwischen den besprochenen Ausnahmen nicht bestehen kann, deutet der gleiche Rhythmus auf einen inneren Zusammenhang. Und da es sich in dem einen Fall um Reime handelt, die natürlich auf den Verfasser zurückgehen, ist der Rhythmus im Auftreten der Ausnahmegruppen, der sich auch in der Schreibung findet, als Ausdruck des Verfassers im Sprachgebrauch gesichert.
2. -ig - -ik, -ich und he anstatt her. Die Adj.-Endsilbe -ig wird bei Kirchberg regelmäßig so geschrieben. Ausnahmen (Schreibung -ik oder -ich) finden sich lediglich: (I und II) 593, 4; 595, 21, 31; 596, 18; 597, 2; 598, 46; 608, 7; 610, 12; 611, 63; 614, 66; 616, 26; 619, 52; 622, 1, 11, 21; 623, 37; (III) 644, 3; 654, 12; (späterer Beleg) 691, 4; (nach der Helmoldübersetzung) 774, 1.
Die 3. Sg. des Pers.-Pron, lautet bei Kirchberg in der Regel her. Die Form he findet sich in der Chronik nur an folgenden Stellen: (I und II) 603, 24; 610, 60; 612, 19; 617, 41; 622, 29; 629, 49; 632, 30; (III) 648, 3; 651, 18; 653, 9; 654, 60, 62; 659, 9, 29; (spätere Belege) 690, 38; 698, 53; 737, 40; 738, 36; (nach der Helmoldübersetzung) 773, 7.
Bei den beiden hier zusammengestellten Erscheinungen sind die Gruppen, in denen die Ausnahmen hervortreten, untereinander sehr ähnlich. Es ist aber deutlich, daß die hier mit römischen Zahlen bezeichneten Gruppen auch denen der beiden vorigen Beispiele entsprechen, wenn man davon absieht, daß die ersten beiden Abschnitte, die sich bei den vorigen Beispielen trennen ließen, hier ineinander übergehen. Niemand wird in


|
Seite 77 |




|
diesem Zusammenhang erwarten, daß strenge Übereinstimmung und scharfe Grenzen bestehen. Aber man fühlt doch deutlich bei den verschiedenen Erscheinungen immer wieder denselben Rhythmus, in dem die Ausnahmen durch die breite Masse der Regelformen durchbrechen.
3. Die Ausnahmegruppen I und II. Die an den eben behandelten vier Spracherscheinungen hervortretenden Ausnahmegruppen I und II lassen sich auch bei anderen Ausnahmeerscheinungen verfolgen. Die beiden Ausnahmegruppen sind nicht in jedem Fall scharf voneinander zu trennen. Bei sechs Erscheinungen handelt es sich rein um Angelegenheiten des Reimes, zwei davon sind auf den I. Abschnitt beschränkt.
Unter den Formen von "liegen" mit n-Endung (bei den -t-Endungen herrschen andere Verhältnisse) ist der erste Beleg im Reim lyn 609, 56 (:syn Inf.) zugleich der einzige Beleg in dieser Form, denn später reimt Kirchberg nur noch lig(g)en.
611, 35 reimt er Wenden:venden, einen Reim e:i vor nd, den er sonst, so oft er sich anbietet, vermieden hat.
Die auf älteres -iuwi- zurückgehende Lautfolge wird, wie später zu behandeln ist, auf ursprüngliches -iuw- ohne Umlaut und auf û in Hiatstellung gereimt; im Anfang der Chronick jedoch, im Abschnitt II, gilt noch der Reim des ursprünglichen -iuwi- auf das aus wgerm. *-aww- hervorgegangene ouw: 619, 48 gebuwe ("Gebäude") : schůwe ("Schau") und 632, 61 getruwen (Adj. Dt. Pl.) : schuwen ("schauen"). Aus der Dichte der Belege sieht man, wie leicht solche Reime zu verwenden waren; in den späteren Teilen seines Werkes hat Kirchberg sie vermieden.
Dasselbe gilt von dem Comp. des Adv., das bei Kirchberg gewöhnlich nach und auch na geschrieben wird, nar, der nur zweimal im Reim steht, 605, 27 und 622, 10, sonst weder im Reim noch in der Schreibung vorkommt.
Neben legete und leyde kennt Kirchberg noch die Prät.-Form lachte zu "legen", die aber nur zweimal vorkommt, beidemal im Reim, 604, 19; 618, 58. Da sie eine sehr bequeme Reimform abgab, muß sie sonst in der Chronik bewußt gemieden sein.
In der 1. Sg. Ind. Präs. sw. V. setzt Kirchberg 3mal die Endung -n in den Reim: 607, 55; 637, 8; 745, 61.
Beiden bisher angeführten Erscheinungen ist es, weil es sich um Erscheinungen im Reim handelt, sicher, daß die sprach-


|
Seite 78 |




|
liche Haltung des Verfassers dahintersteht. Nun halte man Spracherscheinungen wie die folgenden dazu!
Im Pers.-Pron. der 3. Sg. taucht neben her und he auch er in der Schreibung auf, aber bloß 599, 58 und 608, 64.
"Eine" heißt in der Schreibung einmal in der ganzen Chronik ene (610, 4).
Die Endsilbe "-schaft" heißt in der Schreibung bis 610, 28, 613, 2, 614, 37, 59 -schaf, von da an -schaft.
Gleich von Anfang an gebraucht Kirchberg die Schreibform hy "hier", doch kommt daneben noch zweimal hir vor: 610, 66; 619, 6.
Die erste Form von "liegen" mit n-Endung, die außerhalb des Reims geschrieben wird, heißt lyn 619, 48; es ist zugleich die einzige in dieser Form, weil später nur noch lig(g)en, lygen und liegen geschrieben wird; der Zusammenhang mit der oben behandelten Reimform ist deutlich.
Das Adv. und die Präp. "nah" und "nach", deren Reimgebrauch andere Wege geht und an anderer Stelle zu behandeln ist, werden im Versinnern immer, natürlich außerordentlich häufig, nach geschrieben, außer an folgenden Stellen, wo na steht: 602, 61; 609, 21; 619, 45; 625, 55; (kurz vor Schluß des Werkes) 832, 64, eine Erscheinung, die natürlich mit den nur 605, 27 und 622, 10 vorkommenden Reimen des Comp. nar zusammenhängt und schon dadurch mit Sicherheit dem Verfasser zugewiesen wird.
Der oft vorkommende Name Heinrich erscheint im Anfang ausnahmslos als Henrich, von 628, 27 Ü, 629, 36 usw. ab ebenso ausnahmslos als Hinrich.
4. Die dreisprachlichen Wendepunkte. a) Der Wendepunkt um 670/1. Dies ist der auffallendste Wendepunkt in der Helmoldübersetzung. Der Einschnitt, der im Sprachgebrauch an dieser Stelle liegt, machte sich schon in mehreren Fällen bemerkbar, die oben mit Sicherheit dem Verfasser zugewiesen werden konnten. Hier ist der entscheidende Übergang von der vokalisierten Form sayde zu sagete; Kirchberg vermeidet die Form mit -ay- von 670, 36 ab. Ebenso vermeidet er das Wort vy im Reim seit 671, 8; so gut wie sicher ist die Form vehe, die 672, 33 in die Schreibung eintritt, die Form, die der Verfasser von diesem Abschnitt an erstrebt. Von 670, 52 ab vermeidet er auch in Reim wie Schreibung die Vermischung der normalmhd. v und b. 668, 53 steht der letzte Beleg für ey anstatt ê, æ 1 . Auch daß die Verwen-


|
Seite 79 |




|
dung von o anstatt u für normalmhd. uo in Reim und Schreibung zum letzten Male 659, 59 begegnet, wird mit dem sprachlichen Wendepunkt um 670/1 zusammenhängen; daß der letzte Beleg rund 1000 Verse vorher auftritt, wird daher kommen, daß die Ausnahmen o anstatt u überhaupt sehr selten auftreten.
An diesen bereits behandelten und dem Verfasser mit Sicherheit zugewiesenen Erscheinungen kann man die Bedeutung dieses sprachlichen Wendepunktes schon erkennen. Nun lassen sich weitere Lauterscheinungen, die äußerlich nichts miteinander zu tun haben, hieran anschließen. 670, 10 begegnet der Dt. Pl. Subst. ohne -n nach r im Reim (gar:den beyden schar) und 671, 38 in der Schreibung (den burgir). Diese n-losen Dt. kommen nur noch einmal in der Chronik vor, und zwar ist 637, 57 Ü mit den Rugianer geschrieben. In Beziehung zu diesem -n-Abfall im Dt. Pl. nach r steht der Abfall des Inf.-n. Die sämtlichen Belege sind hier: 597, 23; 610, 39; 625, 43; 671, 46; 687, 23. Die ersten vier Belege sind durch den Reim gesichert, und das Vermeiden dieser Formeigenheit schließt sich offensichtlich wieder an den bekannten Wendepunkt an. Nur kommt hier noch ein Beleg in der Schreibung nach, den man sicherlich nicht auf eine Nachlässigkeit des Schreibers, sondern auf den Verfasser zurückführen muß.
In lockerem Zusammenhang mit dem Wendepunkt um 670/1 stehen zwei Erscheinungen, von denen im folgenden die sämtlichen Belege aufgezählt werden: die Metathese in vrochten "fürchteten" 620, 27, vnirvrocht 657, 54 (der einzige Reim dieser Metathese), vrochtin 672, 38, vrochtet "fürchtet" 673, 7, godevruchtig 825, 39 (mit einer Form im letzten Teil der Chronik, wie sie schon öfter zu beobachten war) und der Vokal ey in den Formen von "gehen" (mit Ausnahme des Imp. Pl., der nur mit ey belegt ist) für das durchgängige ê oder â: 625, 49; 660, 37; 678, 21, 46.
b) Der zweite Wendepunkt. Er liegt etwa 2000 bis 2500 Verse nach dem ersten und wird bestimmt durch zwei sicher auf den Verfasser zurückgehende Erscheinungen. Kirchberg vermeidet von hier ab die Reime â:o vor r, die sehr viel Reimgelegenheiten haben und die an folgenden Stellen in der Chronik belegt sind: 605, 47; 612, 56; 615, 5; 623, 45; 635, 19; 637, 27; 656, 47; 662, 42; 666, 3; 672, 16; 674, 42; 689, 5 - 788, 59; 792, 9; 804, 28; 810, 19; 833, 21; die zusammen-


|
Seite 80 |




|
hängende spätere Gruppe hat besondere Gründe, auf die unten eingegangen wird.
Die anderen Fälle wurden bereits behandelt. Bis zu dem Beleg 690, 17 wird die kontrahierte Form leyde gereimt und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auch geschrieben, mit dem Beleg 696, 63 beginnt ein neuer Abschnitt, in dem der Reim ausschließlich und auch die Schreibung meistens die unkontrahierte Form legete verwendet.
c) Der dritte Wendepunkt. Hier ist ein auffälliger Wandel im Reimgebrauch anzuführen. Kirchberg verwendet für "hoch", wenn man von der Schreibform houch absieht, hoch und ho im Reim, ohne daß man dabei Unterschiede zwischen Adj. und Adv. feststellen könnte. Beider Form hoch läßt sich die Verteilung über die Chronik nicht ohne weiteres erklären. Für ho ist sie durchsichtig. Die Reimbelege für ho sind 599, 38; 604, 18, 62; 607, 43; 608, 23, 29; 627, 9; 632, 26; 641, 20; 656, 43; 668, 39, 55; 687, 26; 690, 55; 696, 59; 703, 21, 45; 704, 52; 707, 46 - 762, 15; 784, 4.
Wahrscheinlich schließt an diesen Wendepunkt auch ein anderer Wandel im Reim an. Kirchberg bindet mhd. uo und u vor s an folgenden Stellen: 618, 40 sus:fůs ("Fuß"), 642, 39 ebenso, 649, 21 Vicelinus:wus ("wuchs"), 696, 39 fůz ("Fuß"): altissimus. Man hat genügend Belege vorher, um zu sehen, daß später der Reim gemieden ist, aber zu wenig Belege, um zu entscheiden, ob sich der Wandel nicht vielleicht doch an den zweiten Wendepunkt anschließt.
5. Zwei Ausnahmegruppen im Zusammenhang mit dem ersten und dritten Wendepunkt. Während die vorhin besprochenen Ausnahmegruppen I, II und III innig verbunden sind und diese Ausnahmen sich im Anfang der Chronik finden, sollen jetzt zwei Gruppen von Ausnahmen behandelt werden, die nur in zwei eng umgrenzten Bezirken mitten in der Helmoldübersetzung auftauchen, ohne daß vorher oder nachher ähnliche Ausnahmefälle begegneten.
a) Zu der ersten Ausnahmegruppe schließen sich die folgenden Erscheinungen zusammen: Kirchberg bindet î und ie in der Chronik, abgesehen von einem später zu behandelnden Sonderfall, nicht, auch nicht im absoluten Auslaut, so verlockend die Reimmöglichkeiten sind. Es gibt nur zwei Ausnahmen: by:ny 663, 45 und hy:fry 671, 11.


|
Seite 81 |




|
Fast an genau denselben Stellen gebraucht Kirchberg einen ganz anderen Reim, der ebenfalls sonst vermieden wird. Er reimt nämlich 663, 13 und 670, 4 die Entsprechung von "Ruhe" ruw:gebuw mit einem Lautwert, der dem normalmhd. ouw entspricht, wie die sprachliche Untersuchung darzulegen hat, während er vorher und nachher (651, 35 und 708, 64) ru:nu mit dem Laut des normalmhd. uo bindet.
Zu dieser Ausnahmegruppe gehören noch die Reime und Schreibungen nach anstatt noch, die bereits oben dem Verfasser mit Sicherheit zugewiesen werden konnten; sie sind 657, 43 und 661, 44 zu belegen, während 680, 26 der Schreiber ein zuerst geschriebenes nach selber in noch verbessert.
Am weitesten dehnt sich der Bereich der Ausnahmen in der Schreibung oy anstatt ou aus, die nicht als Umlautsform anzusehen ist, sondern eine mundartliche "Färbung" zum Ausdruck bringt. Die Verteilung zeigt aber einwandfrei, daß auch diese Ausnahmen mit zu der hier besprochenen Gruppe gehören: 650, 52, 55, 57; 656, 43; 683, 65.
b) Eine ebenso auffällige Gruppe von Ausnahmen, die weder vor- noch nachher in der Chronik ihr Gegenstück haben, findet sich in einem zweiten eng umgrenzten Abschnitt zusammen, und zwar handelt es sich dabei um Erscheinungen, die für den Verfasser sicherzustellen sind. So begegnen hier die einzigen Reime von i und î in offener Silbe auf ie: kliebe (3. Sg. Opt. Prät. st. V. I): liebe 690, 47, klieben (Inf. st. V. I): lieben 711, 44, die einzige Reimform êr für sonst durchgängiges ê (im Reim auf her 701, 35) und die einzige Form lye für das sonst herrschende liez im Reim auf vye ("fing") 702, 64. Vielleicht die auffälligste Ausnahmeform ist die oben bereits besprochene Reim- und Schreibform d nach r anstatt t in der Endung der sw. Prät. 704, 11, 706, 2 und 718, 5 sowie in dem Wort mardir ("Marter") 712, 29, zumal die Form mardir unerhört erscheint. Endlich stehen in offensichtlichem Zusammenhang mit dieser Ausnahmegruppe die ebenfalls bereits behandelten Reime rht:rt; sie stehen 682, 9; 699, 65; 703, 43; 711, 21 - 785, 12; 798, 42 - 826, 38; in diesem Fall also mit drei Ausnahmen auch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung. Eine bemerkenswert ähnliche Verteilung der Ausnahmeformen zeigt ein Fall der Schreibung im Versinnern. Kirchberg gebraucht den Akk. Sg. der männlichen Eigennamen durchaus wie üblich ohne Endung. In einem bestimmten Abschnitt kommt jedoch in der Schreibung


|
Seite 82 |




|
auch die Endung -e vor. Was die Endung zu bedeuten hat, soll später erläutert werden. Hier kommt es bloß auf die Verteilung dieser Ausnahmeformen an. Die sämtlichen Belege für diese Akk.-Form im Denkmal sind: 688, 64; 697, 33; 698, 35; 699, 1; 714, 6; 725, 14; 736, 55; 737, 60; 747, 60; 773, 50; 814, 34. Es geht daraus mit aller Deutlichkeit hervor, daß die Endungs-e im Akk. Sg. der männlichen Eigennamen in ihrem Auftreten eng mit den Reimen rht : rt zusammenhängen und daß auch diese seltsamen Ausnahmeformen mitten im Werk zu den Ausnahmeerscheinungen gehören, die als Gruppe den regelmäßigen Sprachgebrauch durchbrechen.
Die Verteilung der Ausnahmeformen und der Wandlungen des Sprachgebrauchs im weiteren Verlauf der Reimchronik. 1. Der Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung und der Sprachgebrauch nach diesem Bruch. Die Reime o:u vor ld, lt. Kirchberg hält o und u im Reime im allgemeinen auseinander, auch vor ld und lt. Dennoch reimt er die Subst. hulde(n), schult, -de, gedult, den Inf. virschulden und das Part. gefult : wolde(n), solde(n) (Prät. und Subst.), holt, -de (Adj.) und Gerolt, -de in einer großen Anzahl Fälle. Sämtliche Belege: 614,62; 624, 16; 644, 18; 645, 56; 659, 14; 670, 7; 676, 34; 677, 14; 690, 14; 698, 42; 699, 40; 700, 61; 707, 15; 709, 6; 711, 13; 718, 56; 721,46; 723, 12, 32; 726, 1; 728, 35; 742, 26; 748, 4; 749, 38; 751, 18; 752, 7; 755, 16 - 801, 26; 828, 21. Diese Erscheinung ist bereits in sich völlig eindeutig. Der Grund für das plötzliche Abbrechen des Reims nach 755, 16 ist klar, wenn man weiß, daß mit 756, 41 die Helmoldübersetzung schließt.
Die Vokalisierung der Lautgruppe -aget(-). Als Beispiele seien herausgegriffen das Prät. "sagte", die 3. Sg. Präs. Ind. "sagt" und das Reimwort "unverzagt". Sämtliche Belege für "sagte" und "sagt" in den etwa 3500 Versen zwischen 738, 6 und 771, 21 sind: 738, 6; 742, 8; 745, 59; 751, 39; 753, 49; 754, 15; alle mit nichtvokalisiertem -age-. Plötzlich 757, 8, 12, 44; 758, 25 vier dichtgedrängte Formen mit vokalisiertem ay. Dann aber wiederum nichtvokalisierte -age-: 758, 55, 65; 764, 6, 17; 766, 38; 771, 21. Noch auffälliger erscheint der Reimgebrauch von "(un)verzagt". Von 679, 50 an bis zum Schluß des Werkes wird nur die Form (vn)virczagit in den Reim gestellt, 12mal, mit einer einzigen Ausnahme vnvirczayd


|
Seite 83 |




|
757, 45! Diese Beispiele bestätigen den scharfen Bruch, der durch den letzten Beleg, einen Reim, für den Verfasser schon erwiesen ist. Aber sie zeigen mehr. Sie zeigen nicht nur, daß der Sprachgebrauch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung sich plötzlich ändert, sondern darüber hinaus, wie er sich ändert. Eine solche zusammengedrängte Masse von ausschließlich vokalisierten Formen, zumal in der Umgebung einer so großen Anzahl reiner g-Formen, ist im Sprachgebrauch der Chronik einzigartig. Sie findet ihr Gegenstück nur im ersten Abschnitt des Werkes, wo vnvirczayd 594, 15; 614, 65; 671, 24 gereimt wird und wo vor dem Wendepunkt 670, 36, wie oben dargelegt, sayd(e(n) herrschen. Dieser Vergleich beweist schlagend, daß der Sprachgebrauch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung auf eine freilich nur kurze Strecke von rund 200 Zeilen, im Gegensatz zu dem Sprachgebrauch in den unmittelbar vorausgehenden und den unmittelbar nachfolgenden Teilen des Werkes, derselbe ist wie im Anfangsabschnitt der Reimchronik.
o anstatt u für normalmhd. uo. Die sämtlichen Belege für die Schreibung o anstatt des regelmäßigen u für das normalmhd. uo bei Kirchberg sind: 599, 21; 604, 16; 61 1, 53; 625, 41; 659, 59 - 757, 46 Ü! Die Verteilung der Ausnahmeformen ist ebenso eindeutig wie die Verteilung der auffälligen -age-Vokalisierungen und erhärten den eben geführten Beweis, daß Kirchberg unmittelbar nach der Helmoldübersetzung für ein kurzes Stück den Sprachgebrauch des ersten Abschnittes seines Werkes wieder aufnimmt.
2. Wiederaufnahme früher zurückgedrängter Ausnahmeformen gegen Ende des Werkes. Nach der raschen Überwindung des Bruches im Anschluß an die Beendigung der Helmoldübersetzung ist der Sprachgebrauch ungefähr so wie vorher seitdem zweiten und dritten sprachlichen Wendepunkt. Er wandelt sich dann aber, indem Formen auftreten, die schon früher überwunden und seitdem nicht mehr hervorgetreten waren. Es bilden sich auch hier deutliche Gruppen heraus.
a) e für i vor n-Verbindungen. Es ist höchst bemerkenswert, daß diese Erscheinung, die von Kirchberg durch das ganze Werk hindurch klar gemieden wird, nur zweimal auftritt, und zwar in einem Reim 611, 35 und in einer Reimschreibung (wenkin : irtrenkin) 781, 37.


|
Seite 84 |




|
-ik und -ich anstatt -ig in der Endsilbe. Andere Schreibungen als die regelmäßigen -ig waren nur im I. und II. Abschnitt häufig, nahmen danach rasch ab bis 644, 3; 654, 12; 691, 4. Nun kommt 774, 1 noch ein selich vor.
Die Wiederaufnahme der Reimform ho. Sie war bis zum dritten Wendepunkt häufig gebraucht, dann plötzlich vermieden. 762, 15 und 784, 4 tritt sie wieder auf.
Reime â:o vor r. Nachdem sie bis 689, 5 unbedenklich gebraucht waren, brachen sie plötzlich ab. Ebenso plötzlich beginnen sie wieder: 788, 59; 792, 9; 804, 28; 810, 19; 833, 21.
rcht : rt. Dieser Reim, der in der zweiten Ausnahmegruppe mehrfach auftrat, sonst überall gemieden wurde, erscheint noch 785, 12; 798, 42; 826, 38.
b) ė : ê, æ 1 . Nachdem dieser Reim im I. Abschnitt unbedenklich verwendet, im II. und III. Abschnitt bereits zurückgedrängt war und danach nur noch 672, 37 und 705, 3 vorkam, taucht 815, 58 noch ein strydbere:were ("Wehr") auf.
vrochten "fürchteten" u. ä. Die Metathese ist in diesem Wort an folgenden Stellen belegt: 620, 27; 657, 54; 672, 38; 673, 7 - 825, 39.
na anstatt nach im Versinnern geschrieben. Im Versinnern (im Reim ist es anders) wird stets nach für die Präp. und das Adv. geschrieben, außer an 5 Stellen, die na schreiben: 602, 61; 609, 21; 619, 45; 625, 55 - 832, 64.
3) Spracherscheinungen, die aus den letzten Teilen der Helmoldübersetzung in den Schlußteil der Chronik hinübergehen. Es ist hier wie stets zu betonen, daß der Sprachgebrauch nichts Starres ist. So gehören mit zum lebendigen Bild der Sprache die Ausnahmeformen, die nur in den letzten Teilen der Helmoldübersetzung und zu Beginn des Schlußteils der Chronik vorkommen und eine Brücke von Sonderformen über den tiefen Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung hinweg bilden.
Präteritalausgleich. Kirchberg unterscheidet bei den starken Verben Sg. und Pl. Prät. durchgängig. Nur bei "bleiben" und "schreiben" taucht Ausgleich auf, und zwar an folgenden Stellen: 746, 29 (blieb), 762, 8 (schrieb), 779, 25 (schrieb), 787, 5 (bleb).
froide, froyde anstatt des gewöhnlichen froude. Diese oi-, oy-Schreibungen begegnen nur an folgen-


|
Seite 85 |




|
den Stellen: 691, 7; 708, 7; 715, 18, 24; 722, 18; 725, 28; 755, 62, 65, 66; 759, 9; 760, 7; 776, 30, 49; 777, 66; 778, 6, 8, 9, 13, 15.
Die Schreibung ou anstatt o oder u vor ld, lt. Bei durchgängiger Vorherrschaft der Schreibung o bzw. u kommen ou-Schreibungen in soulde ("sollte"), woulde ("wollte"), soult ("Sold"), houlde ("Huld"), schoulde ("Schuld") vor, dazu je einmal in voulten ("füllten"), Geroult (Eigenname.). Die sämtlichen Belege sind: 644, 18; 645, 56, 56; 657, 21; 662, 52, 52; 670, 7, 17; 671, 23; 675, 50, 64; 677, 38, 39; 690, 28; 691, 17; 704, 46; 707, 15, 15; 708, 27, 33; 717, 29; 723, 51, 52; 726, 39; 729, 45, 46; 733, 59; 747, 39; 748, 17; 755, 35, 55, 56; 762, 37, 38; 771, 23, 24; 784, 10; 785, 54; 786, 17, 17; 790, 62, 63; 791, 10; 792, 24, 31, 49, 50; 796, 24; 801, 26, 26, 27, 28; 802, 52, 65; 803, 44, 44, 55; 805, 40, 41, 43, 45, 47, 50; 806, 4, 5; 809, 5, 42; 813, 25; 815, 46; 828, 21, 22.
Die Metrik in der Reimchronik. 1. Vorbemerkungen. Für die Betrachtung der Metrik ist über ein Zehntel des erhaltenen Werkes, 2618 Verse, genau untersucht worden. Neben den 118 Versen der Vorrede wurden 5 Stücke von je 500 Versen ausgewählt. Die Auswahl durfte nicht Stichproben in gleichen Abständen durch die Chronik hindurch vornehmen, sondern mußte die Erkenntnisse berücksichtigen, die sich aus der Entstehung der Chronik gewinnen lassen und die an anderer Stelle begründet werden sollen. Die Vorrede darf nicht als einheitliches Ganzes in metrischen Untersuchungen auftreten, weil, wie sich nachweisen läßt, nur die 82 Verse ihres ersten Teils (von Anfang 593, 1:
Emanuel et yschiros,
bis 595, 2:
du hohir tetragramaton!)
Vorrede im eigentlichen Sinne und vor Beginn des Werkes abgefaßt sind. Der zweite Teil, die übrigen 36 Verse (von 595, 3:
dutsch vz latinischin buchstabin
bis 595, 26:
So ydelich icht habe getan,
daz mich doch ymant strafe dran!)


|
Seite 86 |




|
ist offenbar nach dem Abschluß des Gesamtwerkes geschrieben. Es wurden ausgewählt die ersten 500 Verse des Werkes im Anschluß an die Vorrede 595, 27 - 600, 7 (bis strid), dann 500 Verse vom Ende der Helmoldübersetzung, die vermutlich in fortlaufender Arbeit fertig gestellt sind, und zwar - da mit 741, 28 die wichtige breite Einschiebung in den Helmoldtext beginnt, die die erste selbständige Leistung Kirchbergs bezeichnet und schon den Übergang zum letzten Teil der Chronik darstellt - das Stück 736, 36 (von sy ab) - 741, 27. Als nächstes Stück wurden 500 Verse nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung (756, 41) ausgewählt, und zwar 757, 46 - 762, 39 (bis enterbin); das erste Kapitel nach 756, 41 wurde übergangen, um mögliche Unklarheiten zu vermeiden. Als typisches Beispiel für den selbständigen Teil von Kirchbergs Arbeit sind die 500 Verse 768, 42 - 773, 38 (marg) ausgesucht, das erste Stück, für das keine Quellen nachweisbar sind. Schließlich ist das erhaltene Schlußstück 835, 54 (wy) - 840, 58 hinzugenommen.
Von Kirchbergs Metrik läßt sich eine verhältnismäßig sichere Vorstellung gewinnen. Die Überlieferung des Werkes ist die beste, die man sich wünschen kann, und die Schreibung der Handschrift ist in jedem Punkt, der nachprüfbar ist, der Schreibung des Verfassers gleichzusetzen. Trotzdem darf man natürlich die Verse nicht buchstäblich so, wie sie in der Handschrift stehen, skandieren. Es läßt sich in der sprachlichen Untersuchung zeigen, daß die schriftliche Niederlegung des Werkes bestimmten Grundsätzen des Schreibgebrauchs folgt, die lediglich für die Schreibung Sinn haben, während der deklamatorische Vortrag, in dem die Chronik vorgelesen wurde. und der dem Verfasser bei seiner Arbeit im Ohr lag, sicherlich anderen Grundsätzen als den orthographischen folgte. Für "und" beispielsweise kommen in der Handschrift die zweisilbige. Form vnde und die einsilbige Form vnd vor. In der Schreibung sind sie deutlich geregelt, nach orthographischen Gesichtspunkten: vnde wird nur im Anfang der Chronik geschrieben und erscheint in späteren Abschnitten ganz vereinzelt, sonst ist vnd als Schreibform durch die Chronik straff durchgeführt; für die Metrik dagegen ist jeweils vnde oder vnd, zwei- oder einsilbig zu lesen, wie es der Vers verlangt. Dies metrisch zu begründen, würde hier zu weit führen. Ebenso ist es eine orthographische Regelung, daß die Schreibungen gloube, gnade, gnug auf den Anfang des Werkes beschränkt sind; sie können metrisch jederzeit im Werk für die überall durchgeführten


|
Seite 87 |




|
Schreibformen geloube, genade, genug eingesetzt werden. gemeyne, geselle dagegen sind immer so zu lesen. Weitere, seltener vorkommende Fälle von Beibehaltung oder Fortfall eines -e- im In- oder Auslaut bei Pronominen, Substantiven und Verben sind von der metrischen Untersuchung, die vielleicht einmal in anderem Zusammenhang behandelt werden kann, ebenso klar zu entscheiden.
Männlich zweisilbige Kadenzen gibt es bei Kirchberg nicht mehr. Die kurzen offenen Starktonsilben sind gelängt. Verse wie
zu Doberan begrabin
826, 2 f. oder
Si absoluirte sider,
daz sy solden wider
(Liggen dem keysir Frederich)
769, 46 f. sind bei Kirchberg, bei dem Pausen und ungewöhnliche beschwerte Hebungen unmöglich sind, nur klingend zu lesen. Entsprechend ist auch in dem Vers 597, 64
die wonent den Wenden by
für Kirchberg keine andere Lesung möglich als mit beschwerter Hebung auf wónent.
2. Versglätte.
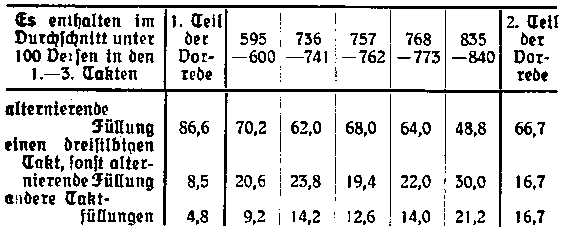
Auftakt und Kadenzen sind bei dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt worden. Daß die beiden Vorredenteile im Vergleich mit den anderen Stücken eine hervorragende metrische Stellung einnehmen würden, war von vornherein zu erwarten. Den ersten Teil der Vorrede zeichnet eine nie


|
Seite 88 |




|
wieder erreichte Glätte des Verses aus. Hier wollte der Verfasser metrisch wie auch stilistisch, wie sich leicht nachweisen läßt, ein Glanzstück seiner kunst bieten. Der weit weniger glatte zweite Teil der Vorrede mag in seinem Verhältnis zum ersten Teile als Zusammenfassung des Ergebnisses der metrischen Entwicklung während der Arbeit gelten. Aus der Übersicht über die Versglätte läßt sich deutlich dreierlei feststellen. Zunächst ist zu sagen, daß die Glätte des Verses im Laufe der Arbeit ganz allgemein nachläßt. Das geht jedoch nicht gleichmäßig durch die Chronik hindurch vor sich, sondern - darin liegt die zweite Feststellung - in zwei Absätzen, mit einem deutlichen neuen Einsatz nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung. In der Metrik liegt hier ein ebenso klarer Bruch vor wie im Sprachgebrauch. Schließlich kann man noch die Metrik der einzelnen Abschnitte genauer in ihrem Verhältnis zueinander erfassen. Das Wichtigste dabei ist die Tatsache, daß die Metrik bei dem Neueinsatz nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung der Metrik am Anfang der Chronik (595 - 600) gleicht. Das ist wiederum eine schöne Bestätigung der Beobachtung; die am Sprachgebrauch gemacht wurde, und zugleich eine Vertiefung der daran gewonnenen Erkenntnis. An die Sprache der Chronik erinnert es weiter, daß die Verteilung der verschiedenen Taktfüllungen in dem ersten selbständigen Stück Kirchbergs nach der Helmoldübersetzung, 768 - 773, fast genau mit der Stichprobe gegen Ende der Helmoldübersetzung, 736 bis 741, übereinstimmt. Nach dem weiteren Nachlassen der Versglätte kommt der zweite Teil der Vorrede wieder ungefähr an das Stück unmittelbar nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung heran.
3. Silbenzahl der Verse.
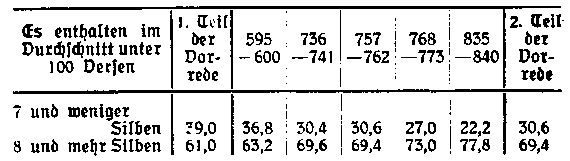
Wie der Sprachgebrauch ist auch die Metrik nichts Starres und schließt keineswegs schematisch alle Erscheinungen ein, und wie in der Sprache einige Ausnahmeformen den tiefen Bruch am Schluß der Helmoldübersetzung überbrücken, so gibt es auch


|
Seite 89 |




|
in der Metrik Erscheinungen, in denen der Neueinsatz in dem Stück 757 - 762 nicht so stark hervortritt. Von der Silbenzahl der Verse aus gesehen ruft der Überblick über die Metrik eher den Eindruck einer durchgehenden Entwicklung hervor, doch zeigt der starke Unterschied zwischen dem Stück 757 - 762 und dem Stück 768 - 773 im Vergleich mit dem Unterschied zwischen dem Stück 736 - 741 und dem Stück 757 - 762, daß auch im Hinblick auf die Silbenzahl nach der Helmoldübersetzung ein Neueinsetzen bemerkbar ist. Die Übereinstimmung der Metrik im zweiten Teil der Vorrede mit dem Stück nach der Helmoldübersetzung kommt in der Silbenzahl ebenso zum Ausdruck wie in der Glätte des Verses.
4. Kadenzen.
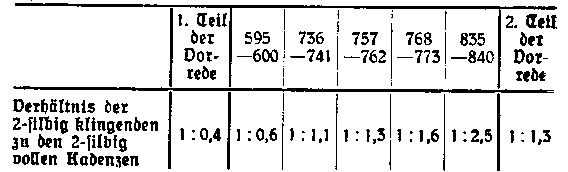
Alle Kadenzen in einer Übersicht zusammenzustellen, hat wenig Wert. Man kann deshalb nichts unmittelbar daraus erschließen, weil die Verteilung der Kadenzen zwischen einsilbig vollen und anderen, wie sich bei Kirchberg denken läßt, in gewissen Grenzen beliebig schwankt und damit natürlich die Zahlen schwer deutbar macht. Es geht bei den Kadenzen in der Chronik darum, ob bei 2-silbiger Kadenz der Vers voll oder klingend schließt. Hier liegt der fruchtbare Punkt für die Untersuchung der Kadenzen, der durch die Verhältniszahlen deutlich herausgestellt ist. Die Zunahme der vollen Kadenzen gegenüber den klingenden bis zum Sechsfachen ihres Verhältnissatzes hängt natürlich mit der Zunahme der Silbenzahl zusammen, aber doch nicht allein, wie der Vergleich mit der vorigen Übersicht lehrt. In den Kadenzen zeigt sich vielmehr ein neues Bild der Metrik, das aber gerade den Gesamteindruck bestätigt, den die Metrik der Reimchronik in den bisher behandelten Erscheinungen darbot.
Die sprachliche Einstellung des Verfassers, ihr Verhältnis zu seiner metrischen Einstellung und die Bedeutung des Sprachgebrauchs


|
Seite 90 |




|
in der Reimchronik. Die verschiedenartigen sprachlichen Beispiele, deren Schreibung immer wieder auf den Verfasser zurückzuführen war, lassen es ausgeschlossen erscheinen, daß etwa der Schreiber in bestimmten Spracherscheinungen seine eigene Orthographie entgegen dem Sprachgebrauch des Verfassers eingesetzt hätte. Die ganz seltenen Ausnahmeformen, die sich im Text finden und die mit besprochen worden sind, sind der Prüfstein für die Sorgfalt des Schreibers; denn wenn irgendwo, dann hätte es in solchen Fällen nahegelegen, die vereinzelten und höchst auffälligen Formen an die ebenso klare wie häufig angewendete Regel anzugleichen. So ergibt sich der merkwürdige Sachverhalt, daß bis in die feinsten Einzelheiten die Handschrift die Schreibung des Verfassers darstellt, obwohl zu beweisen war, daß sie vom Verfasser nicht nur nicht geschrieben, sondern nicht einmal durchgesehen worden ist. Die endgültige Niederschrift des Kirchbergschen Werkes ist ohne Verbindung mit dem Verfasser entstanden, und doch hat die Schweriner Prachthandschrift Autographenwert!
Das ist nur so erklärlich, daß Ernst von Kirchberg an der Vorlage der Handschrift mitgewirkt hat. Wie man sich das im einzelnen denken soll, ist nicht so wichtig; es genügt, daß der Sachverhalt einwandfrei ist. Man möchte zuerst an Diktat denken. Das würde eine Reihe Schreibformen verständlich machen, aber schwerlich alle. Die große Menge der Fälle und die, wie oben aufgewiesen werden konnte, auffällig klare Abgrenzung der Beleggruppen lassen doch an mehr als Diktat oder Durchsicht der Handschriftenvorlage glauben. Wie soll bei einem Diktat z. B. eine so seltsame, aber doch im Zusammenhang so kennzeichnende Form entstehen wie mardir, die als Schreibform unerhört und auch als gesprochene Form so gut wie unmöglich ist? Sollte er dem Schreiber die Schreibung mit -d- besonders angesagt haben? Sollte er nachträglich an der einen Stelle bei dem Worte martir ein t in d korrigiert haben? Das ist eines so unwahrscheinlich wie das andere. Es scheint alles darauf hinzudeuten, daß der Verfasser die Vorlage selbst schrieb. Dann würde sich alles ungezwungen erklären. Wie an anderer Stelle aus seinem Wortschatz nachgewiesen werden soll, muß Kirchberg Kanzleibeamter gewesen sein, etwa wie Johannes Rothe. Der Gedanke, daß Kirchberg in der Vorlage für die Prachthandschrift sein Werk eigenhändig niedergeschrieben hat, liegt also nicht fern. Das Ergebnis der sprachlichen


|
Seite 91 |




|
Betrachtung gestattet jedenfalls eine Auswertung der Reimchronik in umfassendem Maße und erlaubt auch die Schreibung und ihr Verhältnis zum Reim usw. in die weitere Untersuchung einzubeziehen.
Die Untersuchung ergab eine klare Gliederung des Sprachgebrauchs. Die Ausnahmeformen und die Wandlungen im Sprachgebrauch sind keine gelegentlichen mehr oder weniger zufälligen Besonderheiten, sie treten nicht beliebig über die Chronik verstreut auf, sondern in deutlichen Gruppen zusammengeschlossen. Es wurde öfter darauf hingewiesen, daß die gruppenweise Verbindung keine äußeren Gründe haben kann. Demnach müssen das gleichzeitige Auftauchen der Ausnahmen bei verschiedenen Spracherscheinungen und die Wandlungen im Sprachgebrauch innere Gründe haben, d. h. sie müssen auf den Verfasser, auf seine jeweilige sprachliche Einstellung zurückgehen.
Der Rhythmus, der sich im Durchbrechen der Ausnahmen in den Abschnitten I, II und III so deutlich bemerkbar macht, und die übrige Gliederung des Sprachgebrauchs sind der Ausdruck des sprachlichen Verhaltens des Verfassers. Den Sprachgebrauch am Anfang des Werkes kennzeichnet die Fülle der Ausnahmen, wie sie im Abschnitt I, dem an Ausnahmen reichsten Teil des Werkes, zusammengehäuft erscheinen. Schon nach dem Abschnitt I wird ein Teil der Ausnahmen zurückgehalten, viele Formen erscheinen in der Chronik nie wieder. Eine Reihe Ausnahmen brechen aber im Abschnitt II wieder durch. Der Abschnitt III ist im Vergleich mit den beiden ersten schon sehr schwach mit Ausnahmen besetzt. Es sind nur noch verhältnismäßig wenige Erscheinungen, die hier nicht der Regel nach ohne Ausnahmen durchgeführt sind, und auch in diesen Fällen ist die Zahl der Ausnahmen gering gegenüber den ersten Abschnitten. Die Ausnahmeabschnitte I, II und III bilden eine zusammenhängende Gruppe. Sie gliedert sich in die drei Abschnitte durch das rhythmische Hervortreten der Ausnahmen und dadurch, daß die Fülle der Ausnahmen des Anfangs absatzweise eingeschränkt wird, bis sie am Ende der Gruppe so gut wie verschwunden ist, ohne daß neue Ausnahmen währenddessen auftreten. Das Ergebnis der sprachlichen Einstellung nach dem Schluß dieser Gruppe ist, daß die Buntheit und Lockerheit des Sprachgebrauchs, wie er am Anfang herrschte, in vielen Punkten beschränkt und gebändigt ist.
Kirchberg bleibt aber bei diesem Sprachgebrauch nicht stehen.


|
Seite 92 |




|
An den drei Wendepunkten, die nach 670/1 im Abstand von je etwa 2000 Versen aufeinanderfolgen, geht er in der eingeschlagenen Richtung weiter. Hier werden Formen beseitigt, die als Ausnahmen vorher neben den später allein geltenden Regelformen einhergingen, hier gibt es aber auch Wandlungen in der Anwendung verschiedener Formen, ohne daß die einen als Ausnahme-, die anderen als Regelformen gelten könnten. Wie schon oben angedeutet wurde und wie nach dieser Übersicht einleuchtet, ist der Höhepunkt der Regelmäßigkeit nach dem dritten Wendepunkt erreicht. Danach beginnt schon wieder eine Ausnahme nach der anderen Fuß zu fassen. Es handelt sich bei alledem natürlich nicht um eine glatte, mechanische Entwicklung, sondern um die lebendige Auseinandersetzung des Verfassers mit der Aufgabe der sprachlichen Formgebung seines Werkes.
Es begegnen nach den Ausnahmegruppen I, II und III noch zwei Ausnahmegruppen, die sich aber wesentlich von den Gruppen I, II und III unterscheiden. Die Ausnahmen betreffen jetzt nur wenige Spracherscheinungen, sie treten außerhalb dieser Gruppen weder vor- noch nachher auf, sie sind aber lautlich und flexivisch sehr auffällig. Die Ausnahmen sind klar in Gruppen zusammengeschlossen und sind auch, wie an einer anderen Stelle zu zeigen ist, gemeinsam zu erklären. Sie stehen - das zeigte schon die Zusammenstellung der Belege oben - mit dem ersten und dem dritten sprachlichen Wendepunkt in Beziehung, indem die Kerngebiete der Ausnahmeformen unmittelbar vor den Wendepunkten liegen. Schon das weist auf ihre Bedeutung im sprachlichen Verhalten des Verfassers hin. Die Einschränkung der Ausnahmeformen an den Wendepunkten und der Gebrauch neuer eigenartiger Ausnahmeformen in den Gruppen unmittelbar neben ihnen widersprechen sich in der sprachlichen Einstellung des Verfassers nicht.
Der schärfste Einschnitt im Sprachgebrauch der Mecklenburgischen Reimchronik liegt unmittelbar nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung. Der Bruch muß schon deshalb sehr tief sein, weil sich die Änderung in der sprachlichen Einstellung im Raum von wenigen Versen so einschneidend bemerkbar machte. Der Sprachgebrauch ist ganz anders als in den vorhergehenden und anschließenden Teilen der Chronik, er ist nämlich für kurze Zeit so, wie er zu Anfang des ganzen Werkes war. Die Erklä-


|
Seite 93 |




|
rung dafür soll erst nach dem Vergleich mit der Metrik versucht werden. Gegen Ende der Chronik geht die errungene Regelmäßigkeit der Sprache durch das Wiederauftreten früher unterdrückter Ausnahmen wiederum verloren.
Ist diese Übersicht über die Gliederung des Sprachgebrauchs in der Hauptsache aus den Ausnahmeformen gewonnen, so kommt man zu demselben Bild, wenn man Kirchbergs Verhalten zu einer sprachlichen Erscheinung wie der Vokalisation des g in der Lautgruppe -aget(e(-), -eget(e(-) durchverfolgt. Die Übersicht beschränkt sich hier der Klarheit halber auf die bereits oben herangezogenen Worte, zu denen deshalb die Belege hier nicht mehr aufgeführt zu werden brauchen. Die Chronik beginnt mit Diphthongierung. Die Formen leyde und sayde u. ä. herrschen ausnahmslos in rund 3000 Versen. Dann erscheinen die ersten seltenen Ausnahmen mit -g-, die den Eindruck des völligen Vorherrschens der diphthongierten Formen nicht beeinflussen. Erst mit dem ersten Wendepunkt, 670, 36, wird das anders, aber auch nur für die sayd(e) - saget(e). Man sieht an diesem Beispiel besonders deutlich, wie auch die Ausnahmegruppen I, II und III mit den Wendepunkten zusammenhängen; es ist nicht schwer zu erkennen, daß sich in dem verschiedenen Verhalten gegenüber der Vokalisierung des -g- dieselbe sprachliche Einstellung wie in den vorhin besprochenen Ausnahmeformen der ersten drei Ausnahmegruppen ausdrückt. Die Geschlossenheit des Sprachgebrauchs im ersten Teil der Chronik prägt sich in dem durchgängigen Vorherrschen der Vokalisation aus, die Gliederung in die drei Gruppen tritt ähnlich hervor wie bei den Ausnahmeformen: die für die Gesamtheit der Ausnahmegruppen I, II und III kennzeichnenden Eigenheiten kommen am stärksten im Abschnitt I zum Ausdruck, darum herrscht in Abschnitt I ausnahmslos Vokalisierung, während die beiden anderen Abschnitte zunehmend diese Einstellung aufgeben und so im Abschnitt II eine, im Abschnitt III zwei Formen mit -g- erscheinen. Mit dem ersten Wendepunkt 670, 36 tritt zuerst für die -aget(e(-) ein Wandel ein, mit dem zweiten Wendepunkt auch für die -eget(e(-). So entspricht hier nach den Wendepunkten das Vorherrschen der nichtvokalisierten Formen dem, was in den früher behandelten Spracherscheinungen an dieser Stelle als Regelmäßigkeit und Klarheit hervortritt. Äußerlich haben die Gesamtheit der Ausnahmeformen und das Verhalten zur g-Vokalisierung nichts gemein, aber in der Gliederung der so


|
Seite 94 |




|
verschiedenartigen Entwicklung zeigt sich die gleiche beide Spracherscheinungen bestimmende sprachliche Einstellung des Verfassers. Das tritt am auffälligsten bei dem tiefsten Einschnitt im Sprachgebrauch hervor, beim Abschluß der Helmoldübersetzung. Hier kehrt Kirchberg für rund 200 Zeilen zu den reinen vokalisierten Formen zurück, wie er sie im Ausnahmeabschnitt I angewendet hat, um dann allerdings gleich wieder die sprachliche Einstellung wie nach den Wendepunkten zu finden. Auch bei den g-Vokalisierungen zeigt es sich, daß am Schluß das sprachliche Verhalten, wie es sich im Laufe der Chronik. herausgebildet hatte, langsam wieder in das sprachliche Verhalten des Anfangs zurückbiegt.
In einer aufs äußerste zusammengedrängten Form schließlich kann man den Wandel der sprachlichen Einstellung in dem Reimwort (vn)virczayd - (vn)virczaget gespiegelt finden. Die ersten drei Belege 594, 15; 614, 65; 671, 24 haben -ay-, alle weiteren Belege 679, 50; 701, 27; 706, 22; 716, 5; 753, 50; 758, 51; 785, 41; 786, 51; 789, 50; 794, 39; 812, 49; 821, 11 -age-, außer einem unmittelbar nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung: 757, 45. Gerade diese Erscheinung kann dem Betrachter die Tiefe des sprachlichen Einschnitts einerseits und die kurze Geltungsdauer der sprachlichen Einstellung nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung anderseits zum Bewußtsein bringen; denn unmittelbar auf die Ausnahmeform mit Vokalisation 757, 45 folgt die Regelform vnvirczaget 758, 51.
Aus dieser Zusammenfassung tritt die sprachliche Einstellung des Verfassers und ihre bestimmende Rolle für den Sprachgebrauch deutlich heraus. Tieferen Einblick in das Wesen der sprachlichen Einstellung gewinnt man, wenn man die Metrik heranzieht, die in kennzeichnenden Zügen vorgeführt wurde. Die einzelnen Abschnitte stehen nach ihrer metrischen Einstellung in einem klaren Verhältnis zueinander, das zum Vergleich mit dem Sprachgebrauch in den verschiedenen Teilen der Chronik einlädt. Vor allem erscheint in der Metrik eine Beobachtung der sprachlichen Untersuchung bestätigt, daß nämlich unmittelbar nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung die Einstellung genau so ist wie zu Beginn der Reimchronik.
Mit Hilfe der Beobachtungen auf verschiedenen Gebieten ist der Grund für den Bruch nach dem Abschluß der Helmoldübersetzung und für die Übereinstimmung des Verhaltens an dieser Stelle mit dem Verhalten zu Beginn des ganzen Werks zu bestimmen. Es liegt hier ebenso, wie es Kraus bei Veldeke


|
Seite 95 |




|
nachweisen, Langosch beim Göttweiger Trojanerkrieg wahrscheinlich machen konnte, daß nämlich ein solcher Bruch im Reimgebrauch auf eine Arbeitspause zurückzuführen ist. Das läßt sich bei Kirchberg durch die Untersuchung der Entstehungsgeschichte stützen und sichern. Danach dürfte feststehen, daß Kirchberg nach den 17000 Versen der Helmoldübersetzung vor dem neuen Abschnitt, der auf anderen Quellen aufbauen und für den er den Stoff anders als bisher erst im großen zusammenstellen mußte, in seiner Niederschrift des Chroniktextes eine Pause eintreten ließ.
Daß er nun nach dem Wiederbeginn der Textausarbeitung dieselbe sprachliche und metrische Einstellung einnimmt wie zu Anfang seines Gesamtwerkes, ohne daß irgendwelche äußere Verbindung über die dazwischenliegenden verschiedenen Einstellungen möglich ist, beweist, daß jene Einstellung bei dem Verfasser tiefer bestimmt ist. Es muß die Einstellung sein, die ihm ungezwungen am nächsten lag. Das paßt zu der Gliederung des Sprachgebrauchs. Die vielen Ausnahmeformen, die ganze Buntheit des Sprachgebrauchs, die oben hervorgehoben wurden, lassen Kirchbergs sprachliche Haltung am Anfang der Chronik und besonders im Abschnitt I wie auch in den ersten Versen nach. dem Abschluß der Helmoldübersetzung recht locker erscheinen. Demgegenüber läßt die Zurückdrängung der Ausnahmeformen, das immer stärkere Streben nach Regelmäßigkeit deutlich die Anspannung in der sprachlichen Einstellung spüren. Der Unterschied zwischen der sprachlichen Einstellung nach 756, 41 und der am Beginn des Werkes ist klar. Nach der Arbeitspause macht Kirchberg in 100 - 200 Zeilen den Wandel in dem sprachlichen Verhalten durch, zu dem er vorher ziemlich hundertmal so viel Raum gebraucht hatte. Der Rückfall. in die Ausgangshaltung ist rasch überwunden und die vorher langsam herausgearbeitete Einstellung in kurzem wiedergewonnen. Auch aus inneren Gründen muß der Gegensatz zwischen dem anfänglichen sprachlichen Verhalten und dem später errungenen ein Gegensatz zwischen Lockerheit und Anspannung sein. Es wäre unmöglich, daß Kirchberg, wenn er nach der Arbeitspause mit Anspannung einen Sprachgebrauch durchzuführen begonnen hätte, bereits nach rund 200 Versen bei einem nahezu entgegengesetzten Sprachgebrauch angelangt wäre.
Kommt man so zwangsläufig zu der Folgerung, daß im großen betrachtet Kirchbergs sprachliche Haltung von Locker-


|
Seite 96 |




|
heit zu Anspannung übergeht - ein Wandel, der sich nach der Arbeitspause verkürzt wiederholt -, um am Schluß des Werkes zur Lockerheit zurückzukehren, so hat man aus dem Werk selbst einen Maßstab gewonnen, an dem die verschiedenen Sprachformen sicherer als durch Vergleich mit anderen Denkmälern oder lebenden Mundarten beurteilt werden können, und man hat gleichzeitig einen Gesichtspunkt gewonnen, von dem aus sich ermessen läßt, welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit der Sprache für Kirchberg hat. Die Metrik, das zeigt vor allem die Übersicht über die Versglätte, geht den umgekehrten Weg wie der Sprachgebrauch. Sie beginnt mit glatten Versen, von denen weniger als 30 v. H. nicht alternieren, und endet mit einem sehr viel lockereren Versbau mit über 51 v. H. nicht alternierenden Versen. Der Rückfall in die Ausgangshaltung stellt sich hier so dar, daß die Versglätte des Anfangs trotz inzwischen lockererem Versbau beinahe wieder erreicht wird. Das heißt also: Je lockerer die Metrik, um so angespannter der Sprachgebrauch, und umgekehrt. Was er an Anspannung auf die eine Seite verwendet, geht der anderen ab. Überwiegt zunächst die Sorge um den Vers, so nimmt ihn später das Bemühen um die Sprache mehr in Anspruch, und dabei verwendet er auf den Vers nicht mehr so viel Sorgfalt.
Wenn sich in einer längeren Arbeit bloß gewisse Beziehungen zwischen metrischer Technik und Reimtechnik beobachten ließen, so wäre das nicht besonders auffällig, es wäre leicht aus der Entstehungsweise längerer Werke verständlich. Hier aber liegen innigere und tiefere Verbindungen vor, eine durchgängige Wechselbeziehung, die an einschneidenden Stellen des Werkes besonders stark hervortritt, die aber in ununterbrochener Folge durch die ganze Arbeit hindurchgeht und die einen wesensmäßigen Zusammenhang der beiden Erscheinungen beweist. Die von Kirchberg in der Mecklenburgischen Reimchronik literarisch geprägte Sprache und die Metrik seiner Verse sind in ihren Wandlungen und in ihrer Gliederung untrennbar verbunden. Sie müssen daher beide von denselben Kräften hervorgebracht und jeweils der Ausdruck einer und derselben Einstellung des Verfassers sein. Die innige Verknüpfung des grammatischen Sprachgebrauchs mit der metrischen Form gibt den rechten Maßstab für die Würdigung seiner sprachlichen Bemühungen. Sie zeigt, daß der Sprachgebrauch bei Kirchberg nichts Äußerliches


|
Seite 97 |




|
ist, sondern daß ihm für das Werk dieselbe Bedeutung zukommt wie der metrischen Form.
Die Deutung des Sprachgebrauchs gibt Aufschluß über das Wesen des Werkes und läßt seine Form durchsichtig werden. Man kann ihm nun einen bestimmten Platz in der Geschichte der Gattung der Reimchronik zuweisen. Die deutschen Reimchroniken haben sich neben der im engeren Sinne wissenschaftlichen Chronistik und den Dichtungsgattungen des Mittelalters entwickelt. Es konnte naturgemäß an Einwirkungen nicht fehlen, die sich in der inneren und äußeren Form der Reimchroniken bemerkbar machen. Man hat etwa bei Ottokar darauf hingewiesen, wie sehr er im Banne des höfischen Epos steht. Auch die Braunschweigische Reimchronik, um ein Kirchberg naheliegendes Beispiel zu erwähnen, sieht das Geschehen im Glanz der höfischen Kultur und stellt es in der Form des höfischen Epos dar. Eine andere literarische Gattung macht sich in der Reimchronik über Peter Hagenbach geltend. Diese Chronik faßt die geschichtlichen Charaktere und Handlungen nach dem Muster geistlicher Weltbetrachtung auf und zeigt darum nicht zufällig in der äußeren Form nachweisbare Berührungen mit den geistlichen Spielen des Mittelalters.
Kirchberg hat kein Verhältnis zur Literatur. Es wäre müßig, bei ihm etwa nach Anklängen an andere Literaturwerke zu suchen. Kirchberg ist literarisch ebenso beziehungslos, wie es Hans Neumann für Johannes Rothe nachgewiesen hat. Mit einer Erwähnung von Hector, der der bekannteste unter allen literarischen Helden ist und an den ihn möglicherweise die Braunschweigische Reimchronik hätte erinnern können, und mit den Wendungen in lerte minne und manheit und dy stoltzen helde vrechin, die sich in den 26000 Versen der Chronik seltsam verloren ausnehmen, sind die literarischen Bezüge Kirchbergs schon ziemlich erschöpft.
Das Ziel der Mecklenburgischen Reimchronik war ein urkundenmäßiger Tatsachenbericht, so wie ihn etwa die niederdeutschen Prosachroniken gaben. Aber Kirchberg schreibt seine nüchterne und sachliche Wiedergabe der geschichtlichen Ereignisse nicht in schlichter Prosa nieder, und zwar offensichtlich deshalb, weil das nach mittelalterlicher Auffassung für eine allzu anspruchslose Form gegolten hätte. Der Bedeutung, die das Werk nach dem Willen Albrechts II. haben sollte, und der großartig prunkvollen äußeren Ausstattung der für den Herzog bestimmten Pracht-


|
Seite 98 |




|
handschrift mußte eine gehobene Darstellungsweise entsprechen. Und so beherrscht Kirchbergs Chronik ein ausgeprägtes Streben nach gewählter Form. Das konnte freilich nicht im stilistischen Bezirk zum Ausdruck kommen, weil eben die innere Form des Werkes das nicht zugelassen hätte. In der Tat ist stilistisch an der Mecklenburgischen Chronik nichts zu bemerken. Die Genetiv-Umschreibungen, die ihm die Stilistik seiner Zeit zur Verfügung stellte, hat Kirchberg gern aufgenommen, aber eigentlich nicht als stilistisches Mittel, sondern eher als bequemes Handwerkszeug, als billige Formel. Nur dem ersten Teil der Vorrede, an dem er mit besonderer Anspannung arbeitete und den er zu einem Kabinettstück seiner kunst machen wollte, widmete er stilistisches Bemühen, wie es allgemein in der Literatur der Zeit üblich war. Kirchbergs Formbemühen liegt auf einer anderen Ebene, er richtete es auf das Sprachlich-Grammatische, auf den Reim und auf die Metrik. Das Werk soll nach dem Willen des Auftraggebers und des Verfassers keine Dichtung, sondern ein Dokumentarwerk sein. Und so ist es nur dem Wesen der Arbeit gemäß, daß keine künstlerische Gestaltungskraft dafür eingesetzt ist, daß aber eine anerkennenswerte handwerkliche Schaffenskraft dem Ganzen eine angemessene Form verleiht. Will man das im weiteren Sinne als eigentümliche stilistische Aufgabe dieses Werkes gelten lassen, so kann man sagen, daß für diese Reimchronik die Sauberkeit des Reims, die Sorgfalt der Metrik und nicht zuletzt die ehrliche Arbeit an der grammatischen Formgebung der Sprache, der hier ein Maß von Sorgfalt wie kaum in einem vergleichbaren Werk gewidmet ist, dasselbe bedeuten, was in Literaturwerken die stilistische Gestaltung ist.


|
Seite 99 |




|
Für die Bearbeitung der ersten Aufgabe ist durch die Untersuchung von Kirchbergs sprachlicher Einstellung ein zuverlässiger Grund gelegt. Man braucht nicht mehr nach dem Vergleich mit anderen Denkmälern Vermutungen darüber anzustellen, was literatursprachliche Tradition oder Zusammengehen mit der Mundart ist, und die Sprachformen danach zu beurteilen, sondern man kann über die Spracherscheinungen nach der Einstellung Kirchbergs aus dem Denkmal heraus entscheiden. So sind sicherere und weiterreichende Erkenntnisse für die mittelhochdeutsche Grammatik zu gewinnen als auf anderem Wege. Die Dialektgeographen haben öfter angedeutet, wie sie das Niederhessische verstehen - aus ihren Anschauungen heraus verstehen müssen. Ein sorgfältiger Vergleich dessen, was sich aus Kirchberg als mundartlich für das 14. Jahrhundert erweisen läßt, mit den lebenden Mundarten führt zu Erkenntnissen, die auf den immer wieder begangenen und inzwischen ausgetretenen Pfaden der Dialektgeographie nicht zu erreichen gewesen wären und aus denen die Dialektgeographie methodische Folgerungen ziehen kann.


|
Seite 100 |




|
nis von Reimsprache und Schreibsprache, für die Beziehungen zwischen Literatur-, Urkunden- und Geschäftssprache, für die Beziehungen zwischen Mundart, Umgangssprache und Hochsprache im Mittelalter.
In beiden Richtungen der Auswertung, nach der Dialektgeographie und Sprachgeschichte und nach der mittelhochdeutschen Literatursprache hin, kann Kirchberg nur Ausgangspunkt, nur ein Glied unter anderen sein. Die rechte Auswertung Kirchbergs und der in der vorliegenden Arbeit herausgestellten Ergebnisse verlangt einen größeren Rahmen, in dem größere Gegenstände in den Mittelpunkt gestellt werden. Die gegenwärtige Arbeit beschränkt sich darauf, die tragfähigen Grundlagen zu schaffen. Sie will nicht weiter gehen, weil sie im engeren Kreis um Kirchberg nur zu Teilergebnissen führen könnte, während in anderem Zusammenhang ganze Ergebnisse zu erreichen sind.
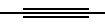


|
[ Seite 101 ] |




|



|



|
|
:
|
II.
Die Urformen
des
Niedersachsenhauses
in Mecklenburg
von
Franz Engel.
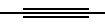


|
[ Seite 102 ] |




|


|
[ Seite 103 ] |




|
Inhalt.
| Seite | |
| Übersicht über die bisherige Hausforschung | 105 |
| Ausgrabungen von Wüstungen | |
| Siedlungsgrabung bei Hungerstorf | 108 |
| Siedlungsgrabung bei Ramm | 113 |
| Haus 2 | 115 |
| Haus 5 | 119 |
| Über die Größe mittelalterlicher Häuser | 124 |
| Archivalische Quellen: | |
| Karten und Zeichnungen: | |
| Karten des 16. Jahrhunderts | 127 |
| Flurkarten des 18. Jahrhunderts | 128 |
| Bauzeichnungen des 19. Jahrhunderts | 131 |
| Akten und Amtsbücher: | |
| Protokollbücher des Amtes Schwerin 1748 - 74 | 134 |
| Amtsbeschreibung von Boizenburg 1696 | 144 |
| Inventar des Klosteramtes Ribnitz von 1620 | 145 |
| Amtsakten von Ramm. 18. Jahrhundert | 147 |
| Ergebnisse: | |
| Auswertende Übersicht über die benutzten Quellen | 147 |
| Durchfahrtsdielenhaus ist Urform des Niedersachsenhauses (im Südwesten Flettdielenhaus) | 150 |
| Über die Herkunft der Urformen | 152 |
| Historische Entwicklung des mecklenburgischen Bauernhauses | 154 |


|
[ Seite 104 ] |




|
Verzeichnis der Abbildungen.
| Seite | |||
| Abb. | 1. | Zusammenstellung der 5 Haustypen (Durchfahrts-, Durchgangs-, Flett-, Flettarm- und Sackdielenhaus) | 106 |
| Abb. | 2. | Grabung Hungerstorf, Haus 2. Grabungsbefund | 110 |
| Abb. | 3. | desgl. Rekonstruktion | 111 |
| Abb. | 4. | Grabung Ramm, Haus 2. Grabungsbefund | 116 |
| Abb. | 5. | desgl. Rekonstruktion | 117 |
| Abb. | 6. | Grabung Ramm, Haus 5. Grabungsbefund | 120 |
| Abb. | 7. | desgl. Rekonstruktion | 121 |
| Abb. | 8. | Ausschnitt aus der Karte von Meierstorf um 1580 | 128 |
| Abb. | 9. | Ausschnitt aus der Flurkarte von Kl. Thurow um 1770. Häuser mit durchlaufender Diele | 129 |
| Abb. | 10. | Niedersachsenhäuser des 17. und 18. Jahrhunderts mit durchlaufender Diele in Mecklenburg | 130 |
| Abb. | 11. | Durchfahrtsdielenhaus Moraas III (Bonnes). Rekonstruktion nach einer Bauzeichnung von 1865 | 132 |
| Abb. | 12. | Die Hausformen des Amtes Schwerin um 1760 | 138 |


|
[ Seite 105 ] |




|
Seit den umfassenden Untersuchungen des Bahnbrechers der deutschen Hausformenforschung Willi Peßler in der Zeit vor dem Weltkrieg hat sich die Wissenschaft um die gründliche Untermauerung und die Spezialisierung seiner damaligen Ergebnisse bemüht. Es galt, einerseits die von Peßler ermittelten Grenzen der verschiedenen Haustypen genauer festzulegen und andererseits die Entstehungszeit und die gegenseitige Beeinflussung der einzelnen Typen zu ergründen.
Während der verstorbene Geh. Oberbaurat Pries die Abhängigkeit der verschiedenen jüngeren Formen und ihre allmähliche Wandlung zum Gegenstand mehrerer Abhandlungen gemacht hatte, suchte Prof. Dr. Folkers in Rostock in den letzten Jahren vor allem die Urform des Niedersachsenhauses in Mecklenburg zu ermitteln. Es ist das Verdienst von Folkers, als erster darauf hingewiesen zu haben, daß vermutlich sämtliche jüngeren Formen des Niedersachsenhauses aus dem mittelalterlichen Durchfahrtsdielenhaus entstanden sind.
Schon 1930 sprach Folkers die Vermutung aus, daß der Urtyp des mecklenburgischen Bauernhauses eine offene, von einem Giebelende zum anderen führende Durchfahrtsdiele gehabt habe 1 ). Auf Grund weiterer Untersuchungen kam er dann 1939 in Übereinstimmung mit Pries zu dem Ergebnis, daß die Durchfahrtsdiele bis etwa ins 18. Jahrhundert allgemein üblich gewesen sei und erst dann durch die Einrichtung von Wohnräumen am hinteren Ende des Hauses zugebaut wurde 2 ).
Fragen wir uns jedoch, worauf Folkers seine Ansichten stützt 3 ). so müssen wir feststellen, daß er, von dem gegenwärtig


|
Seite 106 |




|
noch vorhandenen Bestand an Bauernhäusern ausgehend, Rückschlüsse auf die früher herrschenden Bauformen zieht 4 ).
An einer Anzahl gerade der ältesten Häuser weist Folkers teilweise am Baubestand und teils auf Grund von Aussagen der Besitzer nach, daß ehemals eine Durchfahrts- oder zum mindesten Durchgangsdiele vorhanden gewesen sei. Wenn diese Feststellungen erstens für sehr alte und zweitens für eine möglichst
Zur Verdeutlichung für den nicht sachkundigen Leser seien hier kurz die verschiedenen in diesem Aufsatz behandelten Haustypen einander gegenübergestellt:
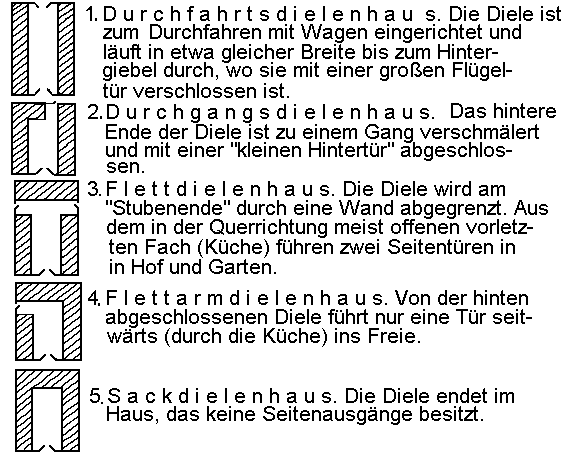


|
Seite 107 |




|
große Anzahl von Häusern gemacht werden können, so läßt sich eine allgemeine Entwicklungstendenz vom Durchfahrtsdielenhaus zum Flettdielenhaus und seinen Abarten folgern. Aus diesem Gedankengang heraus kommt Folkers zu dem Ergebnis, daß das Durchfahrtsdielenhaus als die gemeinsame Urform der heutigen Haustypen anzusehen sei.
Nun muß allerdings zugegeben werden, daß aus diesen Feststellungen nur mit Vorbehalt Schlüsse auf die Urform des Niedersachsenhauses gezogen werden können. Es sind im wesentlichen zwei Probleme, die näherer Untersuchung bedürfen. Erstens ist, wie Folkers selbst sagt, zu bedenken, daß direkte Untersuchungen mittelalterlicher Bauernhäuser bis jetzt nicht möglich waren, da der alte Bestand, den die Volkskunde nachprüfen kann, nur bis etwa 1600 zurückreicht 5 ). Für die Urform des Hauses in den vorhergehenden 400 Jahren sind wir also auf andersartige Forschungsmethoden angewiesen. Zweitens ist trotz aller Bemühungen die Anzahl derjenigen Häuser, an denen eine ehemalige Durchfahrtsdiele noch nachzuweisen ist, im Ganzen genommen doch recht gering. Zur Ergänzung muß deshalb auch hier nach anderen Quellen gesucht werden.
Der Zweck dieses Aufsatzes soll es sein, die Möglichkeiten zur Lösung der beiden angedeuteten Probleme aufzuzeigen und besonders die bisher bereits erzielten Untersuchungsergebnisse festzuhalten und der Forschung zugänglich zu machen 6 ).
Die erste Frage, nach den ältesten Formen des mecklenburgischen Bauernhauses, ist mit Sicherheit nur durch die Spatenforschung zu lösen. Es konnten bisher zwei Siedlungsgrabungen durchgeführt werden. Im folgenden wird zunächst die Ausgrabung bei Hungerstorf und zweitens die Grabung bei Ramm ausführlich zu behandeln sein.
Die zweite Frage, nach der allgemeinen Verbreitung der Durchfahrts- oder Durchgangsdielenhäuser, läßt sich durch die


|
Seite 108 |




|
umfassende Heranziehung archivalischer Quellen weitgehend beantworten. Ein großes, bisher jedoch völlig unbeachtetes Material bieten die Flurkarten des 18. Jahrhunderts und vereinzelte ältere Karten, die z. T. bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Daneben sind für das Gebiet des Domaniums aus den Amtsakten wie Protokollbüchern, Amtsbeschreibungen, Gehöftsakten usw. für das 17. und 18. Jahrhundert zahlreiche aufschlußreiche Angaben über die Bauart der Häuser zu entnehmen. Diese archivalischen Quellen sollen im zweiten Teil des Aufsatzes besprochen werden.
Siedlungsgrabung bei Hungerstorf [Abb. 2 und 3].
Die erste Ausgrabung eines mittelalterlichen Bauernhauses konnte ich im September 1936 in der Wüstung Hungerstorf bei Grevesmühlen durchführen. In der Nähe des heutigen Gutes Hungerstorf waren Steinschlägern beim Chausseebau in einem Revierteil der Everstorfer Forst eigenartige Steinsetzungen aufgefallen. Nach eingehenden Untersuchungen konnten diese als Fundamentreste mittelalterlicher Gebäude erkannt werden. Daraufhin wurde die Ausgrabung einzelner Abschnitte der umfangreichen Anlage in Angriff genommen.
Aus den Scherbenfunden ergab sich, daß die Gebäude, von denen die Fundamente stammten, frühestens im 14. Jahrhundert bewohnt gewesen waren, um schon seit etwa 1450 wieder wüst zu liegen 7 ). Auf Grund dieser Datierung konnte geschlossen werden, daß es sich um die Reste der Wüstung Hungerstorf handelte. Die ebenfalls in dieser Gegend zu vermutenden Wüstungen Vulnustorp, Konradsdorf und Klevenow schieden aus, weil die beiden ersteren schon weit vor jener Zeit, Klevenow dagegen wahrscheinlich erst um 1600 verödeten.
Der Ort Hungerstorf wird zum ersten Male 1372 urkundlich erwähnt. Damals verlieh der Herzog Albrecht II. dem Knappen Johann von Molen seinen "anval in dem hove und in dem ghantzen gude to Hungherstorp" 8 ). Die letzte Nennung des Hofes


|
Seite 109 |




|
geschieht in einem Steuerregister des Jahres 1411 9 ). Das Gut wird dann wie so viele mecklenburgische Orte im Verlauf des 15. Jahrhunderts verödet sein, denn nach 100jährigem Schweigen der Quellen ist seit 1520 nur noch von dem "Hungerstorper felde" die Rede 10 ). Die wüste Feldmark war teils im Pachtbesitz der Bauern aus Hilgendorf, teils mit Wald bestanden.
Bereits 1578 war die Flur wenigstens zu einem Teil wieder in die Nutzung des Amtes Grevesmühlen übergegangen 11 ). Um 1608 wurde in Hungerstorf ein herzoglicher Hof errichtet 12 ), jedoch nicht an der Stelle des ehemaligen Gutes, sondern einige 100 Meter von diesem entfernt, dort wo noch heute der Gutshof liegt.
Die Ausgrabung zeigte, daß der Platz des alten Hofes seit dessen Verödung im 15. Jahrhundert nicht wieder in Kultur genommen und wahrscheinlich stets mit Wald bestanden war. Diesem Umstand verdanken wir die lange Erhaltung der Steinfundamente, die erst vor wenigen Jahren bei dem Chausseebau beseitigt worden waren.
Andererseits wurde die Ausgrabung durch die zahlreichen Buchenwurzeln und den festen Lehmboden sehr erschwert. Obwohl die Grabung erst nach Herausnahme der Fundamentsteine erfolgte, konnte doch der Umriß mehrerer Gebäude bereits an der Oberfläche auf Grund der Rinnen, in denen die Steine gelegen hatten, genau vermessen werden.
Der Gutshof lag an einem Sumpf, der im Mittelalter wohl noch einen kleinen See gebildet hatte. Er war in älterer Zeit von einer dicken Feldsteinmauer umschlossen, die dann anscheinend aus Sicherheitsgründen durch einen hohen Erdwall mit Graben ersetzt wurde. Bei 70 Meter Länge war der Hof etwa 50 Meter breit.
Das Herrenhaus ließ sich zwar in seinem Umriß noch deutlich erkennen, zeigte jedoch bei der Grabung im Einzelnen so viele Unklarheiten, daß hier auf ein näheres Eingehen ver-


|
Seite 110 |




|
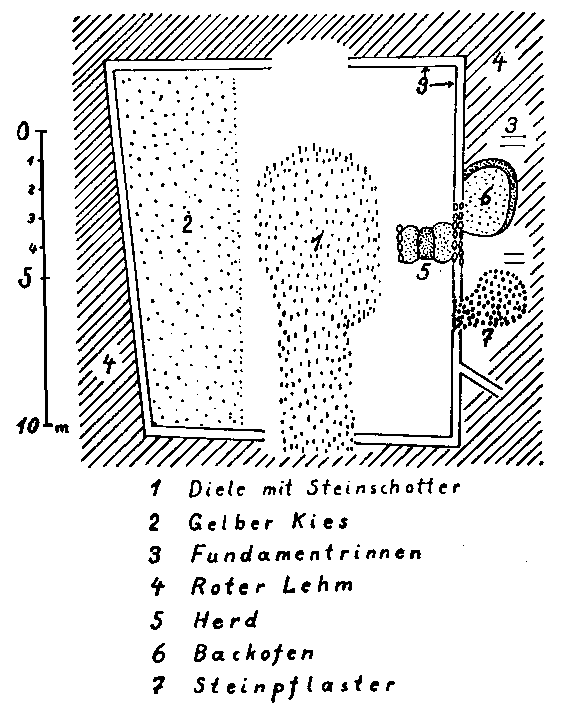
zichtet werden muß. Auf Fundamenten von großen Feldsteinen waren unter spärlicher Verwendung von Ziegeln im Klosterformat (30 X 17 X 9 cm) die Mauern aufgeführt. Der Fußboden bestand aus festgestampftem Lehm und war stellenweise mit Ziegeln gepflastert. In der Mitte des einen Raumes lag anscheinend der offene Herd aus flachen Feldsteinen. An die Außenseite der Hauswand lehnte sich der Backofen, dessen Gewölbe aus Lehm und einzelnen Ziegeln aufgeführt war.


|
Seite 111 |




|
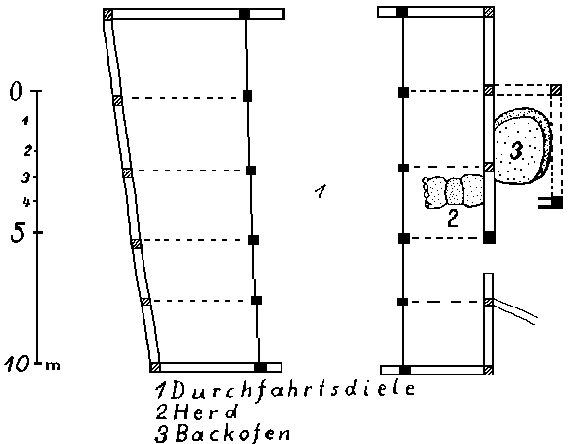
Neben diesem Wohnhaus standen kleinere Wirtschaftsgebäude, deren eines, nach den dort gefundenen Hufeisen zu urteilen, als Pferdestall gedient haben mag. Auf einer kleinen Anhöhe dicht neben dem Wohnhaus hatte der Ritter einen festen Wartturm mit quadratischem Grundriß errichtet.
Reichere Aufschlüsse ergab die Ausgrabung eines Bauernhauses, das 40 Meter außerhalb des umwallten Gutshofes lag 13 ). Die Fundamentrinne, in der noch eine Anzahl Feldsteine vorhanden waren, ließ ein etwas unregelmäßiges Rechteck mit einer Länge von 13 und 12 1/2 Meter und einer Breite von 12 und 10 1/2 Meter erkennen. Die Fundamentrinne wies


|
Seite 112 |




|
an den Schmalseiten 2 Lücken von etwa 3 Meter und 2 1/2 Meter Breite und an der rechten Längsseite eine schmale Lücke von etwa 1 Meter Breite auf, offenbar die Einfahrtstore und der Seitenausgang. Letzterer war mit faustgroßen Steinen dicht gepflastert. Während der natürliche Waldboden aus rötlichem Lehm besteht, war der Boden im Innern des Hauses allgemein heller und gelblicher gefärbt.
Die Innenaufteilung des Hauses war im einzelnen nicht mehr zu erkennen. Es zeigte sich jedoch, daß auf der linken Seite ein etwa 3 - 4 Meter breiter Streifen mit einer harten, gelben Kiesschicht bedeckt war. Außerdem wurde die Form der Längsdiele erkennbar durch das scharfkantige Schottermaterial, das man wohl zur besseren Haltbarkeit in den Lehm eingestampft hatte.
Der nur ganz wenig erhöhte Herd hatte sich gut erhalten. Er bestand aus einer harten, rotgebrannten Lehmplatte von etwa 100 X 50 Zentimeter Größe, die beiderseits von zwei etwas größeren, gelblich gebrannten Platten umgeben war. Seine Gesamtbreite betrug etwa 1,50 Meter. Schräg hinter dem Herd an der Außenwand des Hauses, deren Fundamentsteine hier noch vorhanden waren, lag der Backofen. Die dunkel gebrannte Lehmplatte und die allerdings nur ganz geringen Wölbungsansätze ließen seine Form deutlich erkennen. Die beiden kurzen Fundamentstücke an seiner Außenseite (Nr. 3 der Abb. 2) mögen einst die Stützen für eine Überdachung getragen haben. Dagegen ist die Bedeutung des kurzen, schräge an der Hauswand ansetzenden Fundamentstückes nicht zu erklären.
Die Berechtigung der Rekonstruktion des Hauses ergibt sich einerseits aus dem Grabungsbefund, andererseits aus den allgemeinen Bauelementen des Niedersachsenhauses. Die Lage der Längsdiele, ihre annähernde Breite und die Einfahrtstore an beiden Enden bedürfen keiner Erklärung.
Der Abstand der Ständer voneinander - oder mit anderen Worten die Tiefe der Fächer - war zunächst lediglich rückschließend aus jüngeren Bauernhäusern mit 2 1/2 Meter angenommen. Bei Einzeichnung dieses Maßes zeigte sich jedoch folgendes: 1. Die Länge des Hauses betrug fast genau 5 X 2 1/2Meter. 2. Das schräge Fundamentstück an der rechten Außenwand setzte in 2 1/2 Meter Entfernung von der Vorderfront an. 3. Der Abstand der einen Wange der Seitentür von der vorderen Wand betrug 2 X 2 1/2 Meter. 4. Die durch ein kurzes


|
Seite 113 |




|
Fundamentstück nachgewiesene Rückwand des Backofenanbaues traf in 4 X 2 1/2 Meter Entfernung von der Vorderfront auf die Seitenwand. Durch diese mehrfache Wiederkehr der Entfernung von 2 1/2 Meter an der Längswand dürfte die Aufteilung des Hauses in 5 Fächer von je 2 1/2 Meter Tiefe hinreichend begründet sein.
Fassen wir die Ergebnisse der Grabung nochmals kurz zusammen, so ist über Aufbau und Einrichtung des Hungerstorfer Niedersachsenhauses aus der Zeit um 1400 folgendes zu sagen:
Die Außenwände des Hauses waren auf Feldsteinfundamenten errichtet, während die Ständer vermutlich auf Balkenschwellen ruhten. Es war ein sogenanntes Durchfahrtsdielenhaus, d. h. die Längsdiele war nicht wie bei den meisten uns heute bekannten älteren Häusern im Hintergrund durch eine Wand abgeschlossen, sondern führte frei durch das ganze Haus hindurch. Dieses setzte voraus, daß der Herd nicht, wie häufig in späterer Zeit, im Mittelpunkt des Hauses lag, sondern an die eine Längswand gerückt war. Frei konnte der Blick durch die ganze Länge des Hauses schweifen. Aus verschiedenen Anzeichen ergibt sich, daß das Haus in 5 Fach von 2 1/2 Meter Tiefe eingeteilt war. Zur Linken der schottergepflasterten Diele befanden sich vermutlich die Stände für das Vieh, während sich auf der rechten Seite um den Herd herum das häusliche Leben abspielte. Hier führte auch eine schmale Tür und ein steingepflasterter Gang in den Garten und zum Backofen, der unter einem kleinen Anbau an der Außenwand des Hauses errichtet war.
Siedlungsgrabung bei Ramm (Abb. 4 - 7).
Eine zweite Siedlungsgrabung konnte ich im April bis Juni 1939 im Forstrevier Ramm bei Lübtheen unternehmen.
Dort, im Gebiet der sogenannten Jabelheide, geht noch heute die Sage, daß das ehemals große Dorf Ramm durch den von einem wütenden Bullen aufgewirbelten Sand verschüttet und erst später an der jetzigen Stelle wieder aufgebaut worden sei. Da in den weiten Sandgebieten der Jabelheide zahlreiche, heute mit Kiefern aufgeforstete Wanderdünen vorhanden sind, bestand immerhin die Möglichkeit, diese alte Sage mit einem Naturereignis in Verbindung zu bringen.


|
Seite 114 |




|
Bei Gelegenheit von forstgeologischen Bodenuntersuchungen wurden in einem mit dem Flurnamen "Kirchenstelle" bezeichneten Forstabschnitt mittelalterliche Siedlungsspuren entdeckt, und ein alter Forstarbeiter konnte mir außerdem genau die Stelle bezeichnen, an der vor Jahren beim Bäumeroden Totenschädel gefunden worden waren. Die vorläufige Untersuchung und die anschließenden Grabungen erwiesen den wahren Kern der Sage, denn die Reste des ehemaligen Dorfes Ramm lagen unter einer Sandschicht begraben, die stellenweise mehr als 1 Meter dick war.
Die historischen Nachrichten über die Wüstung Ramm sind bedauerlicherweise nur sehr spärlich. Urkundlich wird das Dorf zum ersten Male im Jahre 1363 erwähnt 14 ). Es gehörte schon damals ebenso wie auch später zu den Besitzungen des Schlosses Redefin. Wichtig ist eine Quelle aus dem Jahre 1595 15 ), in der es heißt: "Zu Ramm hat vorzeiten eine Kapelle gestanden, und ist auf Maria Magdalena alda ein Kirchweih und Jahrmarkt gewesen; hat 14 Hufen Landes und davon der Pastor 14 Scheffel Roggen gehabt; ist aber alles mit Sande verweht, und hat Volradt Pentze zum Redefin daselbst einen Meierhof und Schäferei. Sonsten auch wohnen noch daselbst 5 Kossaten, als Hans Rukith, Hans Vernicke, Karsten, Lutke und Hans Buseke". - Aus dieser Nachricht geht hervor, daß Ramm im Mittelalter ein Bauerndorf mit Kapelle gewesen war und vermutlich schon lange vor 1595 unter Flugsand begraben wurde. Die in vorstehender Nachricht gebrauchte Bezeichnung "daselbst" bezieht sich auf das an anderer Stelle neu errichtete Dorf Ramm. Wegen des völligen Fehlens weiterer Nachrichten über die Wüstung sind wir bei der Datierung der Siedlungsreste allein auf die durch die Ausgrabung zutage geförderte mittelalterliche Keramik angewiesen.
Nach der Verschüttung des alten Dorfes Ramm durch den Sand hatte man die wüste Dorfstätte verlassen und an einem günstigeren Platz, nämlich an der Stelle des heutigen Dorfes Ramm, eine neue Siedlung angelegt. Weil Ramm damals in adligem Besitz war, sind die Nachrichten über die Anfänge des neuen Dorfes sehr spärlich. Erstmalig hören wir 1571 von mehreren Bauernstellen 16 ), und in der Quelle von 1595 wer-


|
Seite 115 |




|
den ein Meierhof und fünf Kossatenstellen in Ramm erwähnt. Der Meierhof scheint 1571 noch nicht vorhanden gewesen und erst kurz nach diesem Jahr angelegt zu sein. Von dem Wohnhaus dieses Hofes, das in einer Quelle von 1709 genau beschrieben ist, wird im zweiten Abschnitt unserer Abhandlung noch zu sprechen sein.
Durch die Voruntersuchungen an der wüsten Dorfstätte wurde zunächst die Lage von sechs verschiedenen Herdstellen ermittelt. Jedoch konnten wegen des stellenweise dichten Baumbestandes und verschiedener Störungen im Boden bisher nur zwei Hausgrundrisse vollständig ausgegraben werden. Außerdem wurde ein Teil des Friedhofes bei der Kapelle freigelegt.
Über die auf dem Friedhof ausgegrabenen Skelette kann hier nur soviel gesagt werden, daß die genaue Auswertung der Schädel- und Körperformen sehr wichtige Resultate ergeben wird, handelt es sich doch nach den bisherigen Untersuchungen größtenteils um Menschen von nordwestdeutschem Typus 17 ); und das inmitten der Jabelheide, eines Gebietes, das noch bis gegen Ende des Mittelalters angeblich slawisch geblieben sein soll. Hier ist noch hinzuzufügen, daß sich auch in der gefundenen Keramik keinerlei Spuren slawischen Einflusses zeigten.
Erwähnenswert ist, daß unter den Fundamenten der mittelalterlichen Häuser eisenzeitliche Scherben ausgegraben wurden. Diese wiederholte Besiedlung des gleichen Platzes scheint darauf hinzudeuten, daß der Boden vor der Überdeckung mit Flugsand einigermaßen ertragfähig und außerdem die Wasserversorgung im Gegensatz zu den heutigen Verhältnissen gesichert gewesen ist.
Das ältere der beiden ausgegrabenen Häuser (Haus Nr. 2 des Grabungsplanes 18 )) stammt nach Ausweis der Scherbenfunde bereits aus dem 13. bis 14. Jahrhundert. Es hatte ebenso wie das Hungerstorfer Haus eine Länge von 13 Metern, doch war es vorne nur acht und hinten sieben Meter breit, bei einer Dielenbreite von etwa 3 1/2 Metern.
Das Haus war weder auf Steinfundamenten noch auf langen Grundschwellen errichtet. Vielmehr waren die meisten Ständer an der Diele und in den Außenwänden direkt in den


|
Seite 116 |




|
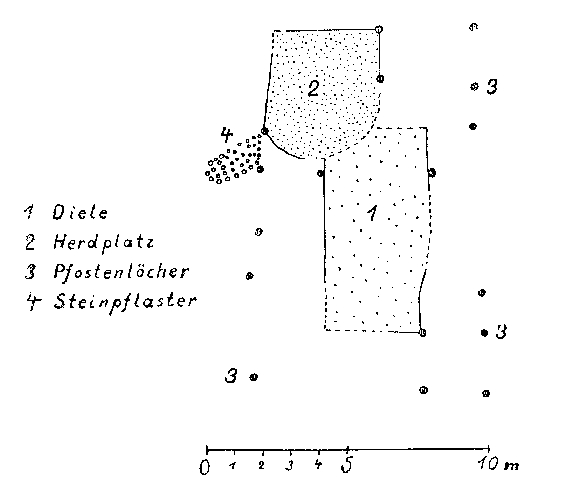
Erdboden eingegraben. Deutlich hoben sich die 40 - 80 Zentimeter tiefen Pfostenlöcher durch ihre dunklere Färbung von dem helleren Sand des gewachsenen Bodens ab. Die anscheinend unten zugespitzten Pfosten waren in einigen Fällen noch durch Steine verkeilt worden. Einige Pfostenlöcher waren wegen Störungen im Boden nicht mehr erkennbar, andere fehlten jedoch, so daß hier die Ständer auf Balkenunterlagen gestanden zu haben scheinen. Schwellenbalken für die Wandfüllungen hatten sich nur in der linken hinteren Hausecke erhalten, dort, wo sie durch das Herdfeuer angekohlt waren.
Eine eigenartige Konstruktion zeigte das hintere Ende des Hauses, in dem statt der zwei Ständer zu beiden Seiten der Diele nur ein großer Mittelständer vorhanden war. Daß sich hierdurch die Raumaufteilung und wahrscheinlich auch die Dachkonstruktion gegenüber dem Durchfahrtsdielenhaus wesentlich ändern mußte, liegt auf der Hand.


|
Seite 117 |




|
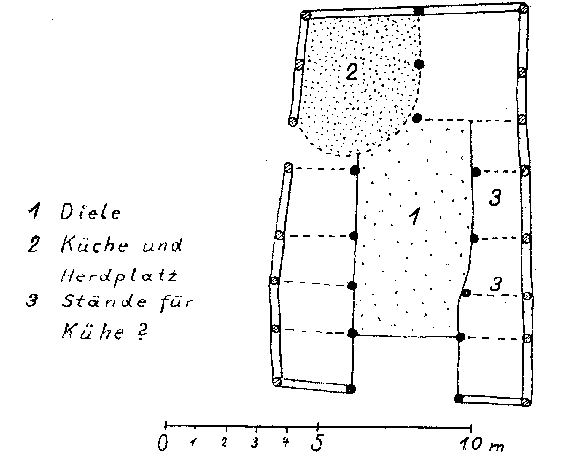
Den gesamten Raum zwischen den drei Mittelständern und der Außenwand nahm der umfangreiche Herdplatz ein. Diese 3 3/4 X 4 1/2 Meter große, leicht gewölbte Lehmfläche war an einzelnen Stellen stark, an anderen nur wenig durch Feuer gehärtet und außerdem mit manchen Unebenheiten und Löchern versehen. Offenbar diente dieser ganze Raum als Küche, in der auf dem Fußboden an beliebiger Stelle über offenen Feuern die Speisen zubereitet wurden. Zahlreiche Topfscherben wiesen auf die Bestimmung dieses Platzes hin.
Die Diele war aus festgestampftem, jedoch nicht gebranntem Lehm gefertigt und hob sich von der übrigen Hausfläche, die aus mehr oder weniger lehmigem und verfärbtem Sand bestand, scharf ab. Sie reichte nicht bis zur vorderen Hauswand und fand hinten etwa an den Mittelständern ihr Ende.
Eine Pflasterung aus kleinen, etwa faustgroßen Steinen an der linken Hauswand ließ auf einen Seitenausgang schlie-


|
Seite 118 |




|
ßen. Ein in eine schmale Grube dicht neben der Außenseite der rechten Hauswand eingepreßtes Rinderskelett dürfte vielleicht auf die Verwendung dieser Hausseite als Kuhstall hinweisen.
Die Ausführung der Rekonstruktionszeichnung ergibt sich aus vorstehenden Ausführungen und bedarf keiner näheren Erläuterung. Das Haus hatte eine Länge von sieben Fach und war sieben bis acht Meter breit. Eine oder beide Abseiten wurden vermutlich als Viehställe benutzt 19 ). Die meisten Ständer ruhten nicht auf Sohlen, sondern waren als Pfosten in die Erde eingegraben. Das Haus war nicht mit Durchfahrtsdiele gebaut, zeigte vielmehr in seinem hinteren Abschnitt mit den drei Mittelständern und der Küche mit ebenerdigen Kochplätzen eine recht primitiv anmutende Raumaufteilung 20 ).
Abgesehen von dieser Besonderheit erscheint es berechtigt, von einem Flettarmdielenhaus zu sprechen, da offenbar nur ein Seitenausgang vorhanden war. Folkers ist der Auffassung, daß im Südwesten Mecklenburgs die Flettdielenhäuser sich mindestens schon im 17. Jahrhundert durchzusetzen beginnen und daß sich die Flettdiele durchweg erst aus der Durchfahrtsdiele entwickelt habe 21 ). Auf Grund des Grabungsergebnisses können wir diese Ansicht dahin ergänzen, daß das Flettarmdielenhaus schon im 13. Jahrhundert in Südwestmecklenburg nachzuweisen ist.
Eine bauliche Eigentümlichkeit ist das Fehlen von Sohlenbalken in dem Haus 2 von Ramm, dessen Ständer direkt in die Erde eingegraben waren. Ob diese Pfostenbauweise im Mittelalter weiter verbreitet gewesen ist, läßt sich vorläufig noch nicht entscheiden, denn sowohl im Hungerstorfer Haus als auch im Rammer Haus 5 standen die Ständer auf Sohlenschwellen.


|
Seite 119 |




|
Bemerkenswert ist jedoch, daß sich dieser heute völlig ungebräuchliche Pfostenbau noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts und vereinzelt sogar um 1750 nachweisen läßt 22 ). Jedoch beschränkte sich diese Bauart meist auf kleine Gebäude oder Anbauten und wurde schon im 17. Jahrhundert als primitiv und veraltet empfunden.
Der zweite vollständig freigelegte Hausgrundriß der Wüstung Ramm (Haus Nr. 5 des Grabungsplanes [Abb. 6] ) stammt ungefähr aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Jedoch ist die Datierung nicht völlig gesichert, da die Keramik dieser Periode bisher noch nicht genügend bearbeitet werden konnte und kein ausreichendes Vergleichsmaterial vorliegt. Um die weitgehenden Auswertungsmöglichkeiten von mittelalterlichen Siedlungsgrabungen aufzuzeigen, soll auf die Einzelheiten auch dieses Hausgrundrisses und die Rekonstruktion des Gebäudes im folgenden näher eingegangen werden.
Das Haus ist im Gegensatz zu den beiden vorher besprochenen fast genau rechtwinklig und mit gerade ausgefluchteten Wänden errichtet. Es ist nur sehr klein (7 1/2 X 11 1/2 Meter) und wohl nicht als eigentliches Bauernhaus, sondern eher als Wohnhaus eines Schäfermeisters oder Pächters anzusehen.
Im Gegensatz zu Haus 2, das von seinen Bewohnern ver-


|
Seite 120 |




|
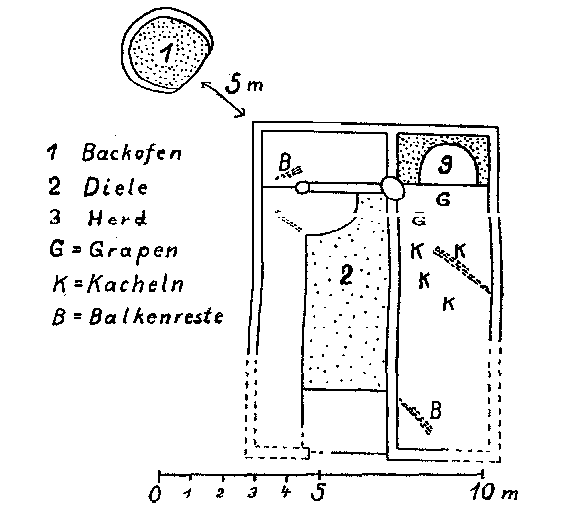
lassen und dann allmählich zerfallen zu sein scheint, ist Haus 5 durch einen Brand vernichtet worden. Dadurch erklärt es sich, daß das Balkenwerk nicht langsam völlig vermodert und vergangen ist, sondern als Holzkohle stellenweise noch in seiner alten Struktur erhalten blieb. Auf der rechten Seite des Hauses war die Außenwand beim Brand in sich zusammengebrochen, so daß der Schutt das Feuer unter sich erstickte und die Grundschwellen nicht zu Asche verbrannten, sondern als verkohlte Reste bis heute erhalten blieben. Die Lehmwand der linken Hausseite dagegen war als Ganzes in das Innere des Hauses gestürzt. Dadurch lagen die Grundschwellen frei und


|
Seite 121 |




|
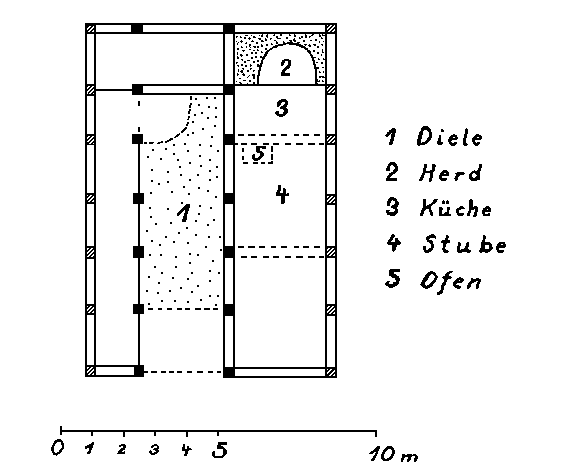
konnten bis auf geringe Kohlen- und Aschenreste vom Feuer verzehrt werden.
Die Hauptständer des Hauses zu beiden Seiten der Diele waren ebenso wie die Ständer in den Außenwänden auf etwa 30 Zentimeter dicken Sohlenbalken errichtet. Nur für zwei Dielenständer im hinteren Abschnitt des Hauses hatte man je einen großen Feldstein als Unterlage benutzt. Die Sohlen lagen ohne besondere Fundamente direkt auf dem gewachsenen Sandboden. Sehr aufschlußreich für die Rekonstruktion der Fachbreite und der Höhe der Wände mußte es sein, daß sich an vier Stellen längere Stücke der umgestürzten Ständer als verkohlte Reste erhalten hatten.
Die festgestampfte Lehmdiele begann erst in zwei Meter Abstand von der Vorderfront und endete in der gleichen Entfernung von der Hinterwand des Hauses. An einer Lang- und einer Schmalseite war sie durch Balkenschwellen begrenzt. Ob der halbrunde Ausschnitt in der Diele mit der Raumaufteilung im Zusammenhang steht oder auf eine zufällige spätere Bodenstörung zurückzuführen ist, muß dahingestellt bleiben.


|
Seite 122 |




|
Wie durch einfache Begrenzungsstriche auf der Zeichnung angedeutet ist, hob sich der schmale Hausabschnitt links neben der Diele durch andersartige Verfärbung des Bodens deutlich von dem Raum hinter der Diele und andererseits von dem Raum am Vordereingang ab und dieser seinerseits wieder von dem Boden außerhalb des Hauses. Die Erkennung der erwähnten Begrenzungslinien muß natürlich für die Raumaufteilung des Hauses von Wichtigkeit sein.
Die nur wenig erhöhte, hartgebrannte Lehmplatte des Herdes zeigt eine halbkreisförmige, leicht muldenartige Vertiefung, die als der eigentliche Kochplatz anzusehen ist. Vor dem Herd lagen u. a. die Scherben von zwei tönernen Grapen und in einigem Abstand davon zahlreiche grünglasierte Kacheln des zertrümmerten Stubenofens.
Auf einem Hügel in etwa fünf Meter Entfernung von der linken hinteren Hausecke war der fast kreisrunde Backofen von 2 1/2 Meter Durchmesser errichtet. Die harte, flach gewölbte Lehmplatte zeigte an drei Seiten noch die Ansätze von steilen Aufbiegungen als Reste des eingestürzten Lehmgewölbes. Der Eingang zum Ofen befand sich an der dem Haus zugekehrten Seite, wo die Gewölbeansätze fehlten. Hier war vor dem Ofen der Boden muldenartig vertieft. Ein großer Haufen von Asche und Holzkohlenresten neben der rechten Gewölbeseite läßt auf ausgiebige Benutzung des Backofens schließen.
Die Rekonstruktionszeichnung ergibt sich mit allen Einzelheiten aus dem Grabungsbefund. Die Tiefe der Fächer bzw. der Abstand der Ständer voneinander ist aus verschiedenen Anzeichen mit Sicherheit zu erschließen: Die Enden der Lehmdiele sind von der Vorderfront ebenso wie von der Rückseite des Hauses zwei Meter entfernt. Den gleichen Abstand von der Hinterwand haben die beiden großen Fundamentsteine, und auch die Tiefe des Herdes entspricht diesem Maß. Ferner zeigen die beiden umgestürzten Ständer an der linken Außenwand und an der rechten Dielenseite mit ihren Enden auf zwei Punkte, die von der Vorder- bzw. Rückwand des Hauses ebenfalls zwei Meter entfernt sind. Aus diesen Merkmalen ist zu schließen, daß die Tiefe des ersten und letzten Hausfaches genau zwei Meter betragen hatte.
Denken wir uns die beiden anderen umgestürzten Ständer an der linken Dielenseite und an der rechten Hauswand in


|
Seite 123 |




|
ihren Fußpunkten aufgerichtet, so betragen ihre Abstände von den Ständern des hinteren Faches genau 1,80 Meter bzw. 2 X 1,80 Meter. Hiermit stimmt überein, daß die Ständer des letzten Faches 4 X 1,80 Meter entfernt sind. Das ganze Haus bestand demnach aus sechs Gefachen, von denen die beiden äußeren eine genaue Tiefe von zwei Metern, die mittleren von 1,80 Metern hatten.
Die Benutzung des zweiten Faches, von hinten gerechnet, als Küche ist durch den Herd und die Grapenfunde nachgewiesen. Im dritten und vierten Fach befand sich offenbar die heizbare Stube, wie aus den hier geborgenen zahlreichen Ofenkacheln zu schließen ist. Die Funde häuften sich im rückwärtigen Teil des dritten Faches, um hier plötzlich abzubrechen und in dem Küchenfach völlig zu fehlen. Zwischen Stube und Küche wird also eine Wand aufgeführt gewesen sein, an die sich der Ofen anlehnte.
Der Platz im letzten Fach neben dem Herd war anscheinend von einem einzigen breiten Raum eingenommen. Dieses ist aus der einheitlich schwärzlichen Bodenfärbung zu schließen, die sich scharf von der helleren des davor liegenden Abseitenfaches abhebt. Die anzunehmende linke Dielenwand fand also im letzten Fach keine Fortsetzung.
Die Lage des Haupteinganges des Hauses ist durch das Fehlen des Schwellenbalkens in der Mitte der vorderen Schmalseite gesichert. Zugänge zur Küche und Stube von der Diele aus müssen über die Balkenschwelle gegangen sein und konnten nicht näher nachgewiesen werden. Ob das Haus noch weitere Türen über den Schwellen besessen hat, etwa am hinteren Ende der Diele, oder einen Ausgang von der Küche aus, muß fraglich bleiben, da aus dem Grabungsbefund hierüber kein Aufschluß zu gewinnen war. Ein Tor im Hintergiebel ist nicht anzunehmen, da sonst im hintersten Fach wohl kein Querraum vorhanden gewesen, sondern die linke Dielenwand bis zum letzten Ständer durchgeführt worden wäre.
Fassen wir die Ergebnisse nochmals kurz zusammen. Das Haus Nr. 5 der Wüstung Ramm war als Niedersachsenhaus mit einer Länge von sechs Fach errichtet. Über den Haustyp erbrachte die Grabung keine völlige Klarheit. Dem Befund nach scheint jedenfalls keine Durchfahrtsdiele vorhanden gewesen zu sein. Ob aber am Ende der Diele 1 oder 2 Seitenausgänge ins Freie führten oder ob wir ein Sackdielenhaus


|
Seite 124 |




|
vor uns haben - was bei der Kleinheit des Hauses immerhin möglich wäre - ließ sich aus dem Grabungsbefund nicht entscheiden.
Die Raumaufteilung weicht stark von der des normalen Niedersachsenhauses ab und dürfte in der besonderen Zweckbestimmung des Hauses ihre Erklärung finden. Die Diele ist nur 2,50 Meter und die linke Abseite gar nur 1,40 Meter breit. Die rechte Seite des Hauses hat demgegenüber eine Breite von 2,80 Metern, so daß Küche und Stube einen verhältnismäßig großen Teil des ganzen Baues einnehmen. Ließen schon diese Maße auf eine Abweichung von der gewöhnlicher Bauart und eine Bevorzugung der rechten Seite schließen, so findet sich die Erklärung in der Länge des von der rechten Außenwand in das Innere des Hauses gestürzten Ständers. Dieser war noch in einer aufmeßbaren Länge von 2,50 Metern erhalten und kann daher besonders in Anbetracht der geringen Breite des Hauses von nur 7,50 Metern nicht als Ständer einer niedrigen Abseite gedient haben. Die Länge dieses Ständers und die Breite der Wohnräume lassen nur den eine Schluß zu, daß das Haus in Dreiständerbauart errichtet worden war.
Wegen seiner geringen Ausmaße und der Besonderheiten der Raumaufteilung dürfte sich das Haus kaum für einen Bauernbetrieb geeignet haben. Wahrscheinlich hat es als Wohnhaus eines Schäfers oder Pächters gedient. Gegen seine Verwendung als kleinbäuerliche Kate spricht das Vorhandensein eines Ofens, der aus künstlerisch geformten, figurenreichen Kacheln aufgebaut war.
Wüstung Hungerstorf,
| Länge | 13 - 12,50 m |
| Gesamtbreite | 12 - 10,50 m |
| Dielenbreite | ca. 4,50 m |
| Anzahl der Fächer | 5 |
| Tiefe der Fächer | 2,50 m |
| Herd | 1,00 X 1,50 m |
| Backofen | 1,50 X 2,50 m |


|
Seite 125 |




|
Wüstung Ramm.
|
|
||
| Haus 2 | Haus 5 | |
| (um 1300) | (um 1500 | |
|
|
||
| Länge | 13 m | 11,50 m |
| Gesamtbreite | 7 - 8 m | 7,50 m |
| Dielenbreite | ca. 3,50 m | 2,50 m |
| Anzahl der Fächer | 7 | 6 |
| Tiefe der Fächer | ca. 2 m | ca. 2 m |
| Herd | 3,75 X 4,50m | 1,75 X 2,75 m |
| Backofen | -,- | 2,50 X 2,50 m |
Moraas III
| Länge | 21 m |
| Gesamtbreite | 12,50 m |
| Dielenbreite | 7 m (später 6 m) |
| Anzahl der Fächer | 7 |
| Tiefe der Fächer | 2,75 m |
| Herd | 0,75 X 2,50 m |
| Backofen | -,- |
Die Größenverhältnisse der heutigen Bauernhäuser unterscheiden sich wesentlich von den mittelalterlichen Bauten - die Allgemeingültigkeit der Grabungsergebnisse vorausgesetzt. Das Hungerstorfer sowie die Rammer Häuser waren 13 bzw. 11,50 Meter lang bei einer Breite von 11 bzw. 7,50 Meter. Demgegenüber haben die Gebäude der späteren Jahrhunderte etwa eine Größe von 21 mal 13 Metern 23 ). Noch stärker prägte sich der Unterschied in der Breite der Hausdiele aus. Diese war im Mittelalter mit drei bis vier Metern nur etwa halb so groß wie in den ältesten heute noch vorhandenen Gebäuden, die allgemein eine Dielenbreite von sechs bis acht Metern aufweisen 24 ). Diese starken Unterschiede lassen erkennen, daß seit


|
Seite 126 |




|
dem Mittelalter die Ausmaße der Bauernhäuser umfassende Veränderungen erfahren haben müssen, die wahrscheinlich durch die gegen Ende des Mittelalters einsetzende wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung bedingt waren.
Archivalische Quellen zur Bauernhausforschung
Eine bisher für die Bauernhausforschung fast gänzlich ungenutzte Quellengattung bilden die in den Archiven aufbewahrten Akten und Karten vergangener Jahrhunderte 25 ). Freilich sind fast nirgends Hausformen um ihrer selbst willen beschrieben oder dargestellt. In Akten, die bei den verschiedenartigsten Gelegenheiten entstanden sind und manigfachen Inhalt haben, finden sich gelegentlich das bewegliche Inventar der Häuser, die Anzahl der Türen, der Erhaltungszustand des Balkenwerkes u. a. m. beschrieben. Aus diesen Angaben oder aus Flurkarten, auf denen die Dorflage und die einzelnen Gebäude eingezeichnet sind, läßt sich häufig die Bauform der Häuser mit hinreichender Genauigkeit bestimmen.
Die Erkenntnis, daß archivalische Quellen ergiebig genug sind, um systematisch und in. großem Umfang für die Untersuchungen herangezogen werden zu können, bedeutet einen wesentlichen Fortschritt für die Hausforschung. Man ist nun nicht mehr auf mühsame Reisen zu Aufmessungen an Ort und Stelle und auf vorsichtige Rückschlüsse von heutigen auf ver-


|
Seite 127 |




|
gangene Formen allein angewiesen. Vielmehr lassen sich mit verhältnismäßig geringer Mühe die Bauformen früherer Jahrhunderte direkt aus den Quellen erkennen.
Zwei Schwierigkeiten sind allerdings vorhanden. Einerseits sind diejenigen Akten oder Karten, die Angaben über Bauformen in genügender Ausführlichkeit enthalten, nicht leicht in dem gesamten Aktenmaterial der Archive ausfindig zu machen. Andererseits liegt es in der Eigenart der Quellen, die ja keine eigentlichen Baubeschreibungen geben wollen, begründet, daß sie nur über eine beschränkte Anzahl von Fragen der Bauernhausforschung Aufschluß geben. Zu berücksichtigen ist ferner, daß die Ausdrucksweise der Quellen vielfach nicht ganz klar ist und verschiedene Deutungsmöglichkeiten zuläßt, so daß in allen Fällen eine scharfe Kritik und vorsichtige Auswertung angebracht erscheint.
Für die Untersuchung der Durchfahrts- und Durchgangsdielenhäuser in vergangenen Jahrhunderten sind jedoch. die. Archivalien besonders ergiebig, und zwar sowohl hinsichtlich der großen Anzahl der Hausbeschreibungen, als auch der unzweideutigen Erkennbarkeit dieser Bauformen.
Zwei Quellengruppen sind hier vor allem aufschlußreich und lohnen eine systematische Bearbeitung:
1. Karten und Zeichnungen, und zwar in erster Linie die Flurkarten des 18. Jahrhunderts, daneben Kartenzeichnungen des 16. Jahrhunderts und vereinzelt Bauzeichnungen aus dem 19. Jahrhundert 26 ).
2. Amtsbücher der herzoglichen Domanialämter aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
Karten und Zeichnungen.
In der ersten Quellengruppe nehmen die Karten des ausgehenden 16. Jahrhunderts eine besondere Stellung ein, weil sie zwar zahlenmäßig erheblich geringer sind als die des 18 Jahrhunderts, aber dafür um so wertvoller für die Forschung. Einerseits geben sie uns nicht die bloßen Grundrißformen wie die jüngeren Karten, sondern, entsprechend der in jenen Zeiten üblichen Kartenzeichnung, die Gesamtansicht des Hauses, andererseits erlauben sie Rückschlüsse auf das Alter bestimmter


|
Seite 128 |




|
Formen und die Häufigkeit von deren Anwendung zur Zeit der Anfertigung der Karte.
Die hier beigefügte, von dem Maler Peter Böckel gezeichnete Karte gibt ein Abbild des Dorfes und Gutes Meierstorf bei Grevesmühlen aus der Zeit um 1580. Es ist erfreulich zu sehen, mit welcher Liebe und Sorgfalt der Zeichner ein plastisches Bild des Dorfes und seiner verschiedenartigen Baulichkeiten entwirft.
Natürlich wird bei diesen ältesten Darstellungen stets eine stark kritische Sichtung bei der Auswertung der Einzelformen am Platze sein. Nun sind wir jedoch gerade bei Peter Böckel in der Lage, seine Zeichnung mit anderen von ihm angefertigten Karten zu vergleichen. Wir müssen feststellen, daß seine Darstellung aller Einzelheiten stets individuell ist und - abgesehen von einigen Verzeichnungen - den tatsächlich vorhandenen Formen entsprochen zu haben scheint. Auch ist mit Sicherheit anzunehmen, daß er alle dargestellten Gebäude usw. selber gesehen und die Zeichnung wohl an Ort und Stelle entworfen hat, denn die Karte bildet die Illustration zu einem Prozeß um einzelne Grundstücke, die von Böckel mit Sorgfalt verzeichnet sind.
Die Karte bietet zahlreiche Einzelheiten und Anregungen für die Hof- und Dorfforschung, von denen hier einige nur kurz aufgezählt werden sollen: 1. Lage und Anzahl der Gebäude in den einzelnen Gehöften. 2. Schutz der Gehöfte durch breiten Wall, Hofzaun oder Hecke. 3. Form der Giebel, ob Vollwalm, Halbwalm oder Steilgiebel u. a. m.
Für die Problemstellung des vorliegenden Aufsatzes ist es wichtig, daß sämtliche Bauernhäuser, deren Rückseiten auf der Karte sichtbar sind, im Hintergiebel ein großes Tor aufweisen. Auch das Wohnhaus des zweiten adligen Hofes "Jurgen sein Bawhoff" zeigt dieses hintere Tor. Wir können daraus den Schluß ziehen, daß in Meierstorf im 16. Jahrhundert das Haus mit offener Durchfahrtsdiele den allein herrschenden Bautyp darstellte.
Eine wichtige Quelle für die Verbreitung des Durchfahrtsdielenhauses in älterer Zeit bilden die Flurkarten des 18. Jahrhunderts. Zwar lagen damals die weitaus größte Zahl der Bauernhöfe und damit auch deren Häuser im Gebiet. des herzoglichen Domaniums, aber bedauerlicherweise sind die


|




|
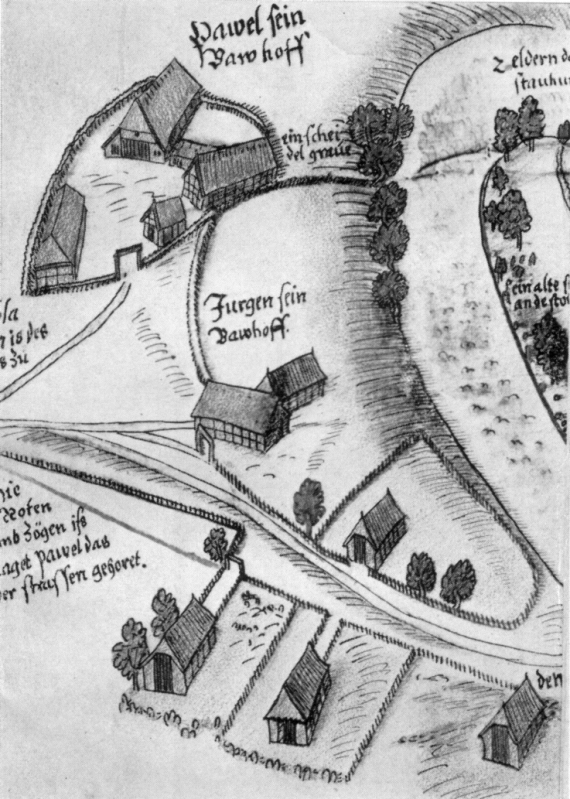
(vgl. hierzu S. 128).


|




|


|
Seite 129 |




|
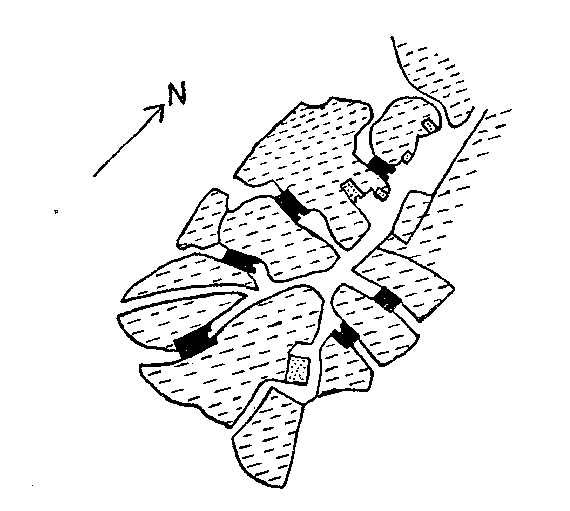
älteren Flurkarten dieses Gebietes durch den Brand des Kollegiengebäudes im Jahre 1865 bis auf wenige Reste verloren gegangen. Darum mußten gerade die wichtigsten Gebiete des Landes für unsere Untersuchungen ausfallen. Erhalten sind jedoch die Karten des ehemaligen Herzogtums Strelitz und des Fürstentums Ratzeburg, die für die Untersuchung herangezogen wurden.
Abgesehen von den wenigen Domanialkarten vermögen schon die Karten des ritterschaftlichen Gebietes ein deutliches Bild von der ehemaligen Verbreitung des Hauses mit durchlaufender Diele zu geben.
Die von sämtlichen ritterschaftlichen Besitzungen Mecklenburgs auf Anordnung des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs von 1755 angefertigten sogenannten Direktorialkarten sind außerordentlich sorgfältig gezeichnet. Neben ihrer großen


|
Seite 130 |




|
Bedeutung, die sie fast bis in unsere Zeit für das Vermessungs- und Steuerwesen behalten hatten, bilden sie für die Wissenschaft eine unerschöpfliche Quelle, die besonders für die Siedlungsforschung immer neue Aufschlüsse zu geben vermag. Ihr großer Wert für die Untersuchung der Dorf- und Hofanlagen der älteren Zeit ist allgemein bekannt; überraschen muß es jedoch, daß sie auch für die Hausformenforschung trotz ihres für diese Zwecke verhältnismäßig kleinen Maßstabes von etwa 1:5000 wichtige Aufschlüsse zu geben vermögen. Neben der hier interessierenden Frage nach der Verbreitung der Durchfahrtsdielenhäuser sei nur an das Problem der Typengrenze zwischen Niedersachsenhaus und Querhaus, das Problem der Hofbildung, der Verbreitung der Querscheunen u. a. m. erinnert.
Nachdem die Genauigkeit der Darstellung erkannt war wurden - soweit greifbar - sämtliche Flurkarten des 18. Jahrhunderts daraufhin durchgesehen, ob sich das Vorhandensein von Durchfahrts- oder Durchgangsdielenhäusern in der Zeichnung der Dörfer nachweisen ließe. Wie das Beispiel der Karte von Kl. Thurow (Abb. 9) zeigt, führt in vielen Fällen ein breiter Weg direkt zum Hintergiebel der Längshäuser, um dort zu enden. Die Genauigkeit der Darstellung voraus gesetzt, kann hieraus mit Sicherheit auf das Vorhandensein einer bis zum Hintergiebel durchlaufenden Diele geschlossen werden. Eine Unterscheidung zwischen Durchfahrts- und Durchgangsdielenhäusern ist auf Grund der Kartenzeichnung nur in wenigen Fällen möglich, weshalb bei einer allgemeinen Übersicht von vornherein hierauf verzeichnet werden muß.
Auf der angeschlossenen Karte von Mecklenburg wurden alle Häuser mit durchlaufender Diele durch je ein Kreuz bezeichnet. Die Karte soll nur eine vorläufige Übersicht geben, wie groß die Zahl der Durchfahrtsdielenhäuser in den verschiedenen Landesteilen war. Genauere Untersuchungen und ausführlichere Veröffentlichungen sind z. Z. wegen des Krieges nicht durchführbar. Die Gesamtzahl der mit Hilfe der Flurkarten ermittelten Häuser mit durchlaufender Diele beträgt 239, von denen der weitaus größte Teil im Westen und besonders im Nordwesten des Landes liegt.
Dieses Gesamtbild muß aus verschiedenen Gründen außerordentlich lückenhaft bleiben und kann nur einen ganz geringen Teil der im 18. Jahrhundert tatsächlich vorhandenen Durchgangs- und Durchfahrts-Dielenhäuser erfassen. Denn erstens sind, wie bereits erwähnt, die älteren Domanialkarten


|




|
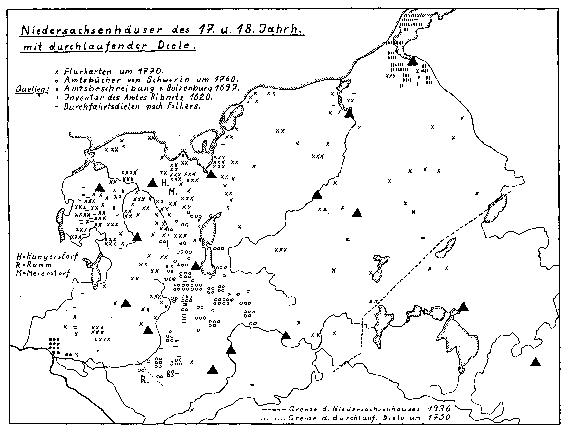


|




|


|
Seite 131 |




|
bis auf wenige Annahmen vernichtet, zweitens konnten bisher nicht sämtliche noch vorhandenen Flurkarten bearbeitet werden; drittens sind auf den Karten bei weitem nicht alle Häuser mit durchlaufender Diele einwandfrei zu erkennen, einerseits weil manche Landmesser die Dorflagen nicht sorgfältig genug gezeichnet haben, und andererseits, weil sehr viele Häuser frei auf ihrem Hofplatz lagen, so daß sich ein etwa vorhandener Hinterausgang auf der Karte nicht ausprägt (vgl. Karte von Kl. Thurow [Abb. 9] ). Berücksichtigen wir diese Ausfälle, so ist zu schließen, daß die Zahl der Häuser mit durchlaufender Diele ganz erheblich größer gewesen ist als auf der Übersichtskarte zum Ausdruck kommt.
Als Ergebnis der Bearbeitung der Flurkarten ist festzustellen, daß der besprochene Haustyp noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts in fast ganz Mecklenburg verbreitet war. Die sich aus der Übersichtskarte ergebende ungleichmäßige Verteilung der Häuser und ihre starke Anhäufung im Nordwesten des Landes dürfte nur zu einem Teil den wirklichen Verhältnissen entsprechen, denn die Heranziehung weiterer Quellen, wie der Protokollbücher des Amtes Schwerin und des Inventars des Klosteramtes Ribnitz vermögen das Gesamtbild wesentlich zu ergänzen und zu verändern, wie die Karte zeigt.
Eine Gruppe von Karten, die hier nur kurz erwähnt zu werden braucht, sind die vereinzelten Bauzeichnungen alter Häuser aus dem Anfang und der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Sie sind meist durch herzogliche Beamte von überalterten Häusern angefertigt worden, um auf Grund dieser Zeichnung den Umbau und die Modernisierung in die Wege leiten zu können, und bilden deshalb eine wertvolle Quelle für die Erkenntnis alter Bauformen.
Eine dieser Zeichnungen wurde für den vorliegenden Aufsatz nach dem Original umgezeichnet und der ursprüngliche Zustand des Hauses nach Möglichkeit rekonstruiert (Abb. 11). sie wurde hier abgedruckt, um erstens die Einrichtung eines Durchfahrtsdielenhauses aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege zu zeigen und zweitens ein neuzeitliches Bauernhaus mit den ausgegrabenen mittelalterlichen, die alle im gleichen Maßstab hier abgebildet sind, vergleichen zu können. Wir sehen auf den ersten Blick, daß die mittelalterlichen Bauten erheblich kleiner als das Haus von Moraas waren. Wenn wir


|
Seite 132 |




|
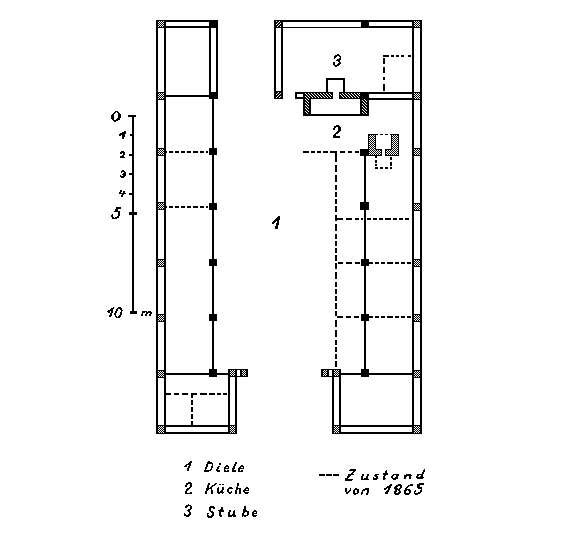
aber annehmen, daß die Vorschauer und das Stubenende spätere Erweiterungen dieses Haustyps sind, so müssen wir sofort eine erstaunliche Übereinstimmung der Größe zwischen diesem und dem Hungerstorfer Haus feststellen. Die Raumaufteilung ist freilich eine völlig andere.


|
Seite 133 |




|
Akten und Amtsbücher.
Wohl die wichtigste und aufschlußreichste archivalische Quelle für die Hausforschung bilden die bereits erwähnten Amtsbücher und Amtsbeschreibungen einiger Ämter. In diesen und den zugehörigen Akten finden sich verstreut zahlreiche mehr oder weniger ausführliche Beschreibungen von Bauernhöfen und Häusern.
Für die ritterschaftlichen Ämter sind demgegenüber, abgesehen von den bereits besprochenen Flurkarten, fast gar keine genauen archivalischen Nachrichten über Hausformen enthalten. Erstens sind überhaupt nur sehr wenig Akten über die bäuerlichen Verhältnisse in diesen Gebieten vorhanden und zweitens ist hier im 18. Jahrhundert die Zahl der Bauernhöfe erheblich geringer als im Domanium.
Vereinzelt sind schon aus dem 16. und 17. Jahrhundert Beschreibungen von Bauerngehöften in den Akten überliefert. Jedoch sind diese meist zu allgemein gehalten, als daß über die Formen der Häuser hinreichend Aufschluß zu gewinnen wäre. Im allgemeinen werden die Inventare erst seit der Mitte des 18. Jahrhunderts so ausführlich, daß sie außer über die Zahl der Fächer oder Gebinde auch Angaben über die Inneneinrichtung der Gebäude, über Diele, Stuben und Kammern, Zahl und LAge der Türen u. a. m. enthalten. Eine bemerkenswerte Ausnahme scheint das Inventar des Klosteramtes Ribnitz zu bilden, das genaue Beschreibungen bereits aus dem Jahre 1620 gibt.
Aus der großen Menge des archivalischen Aktenmateials konnten bisher erst drei Quellen systematisch bearbeitet werden:
- die Amtsbücher des Amtes Schwerin aus der Zeit von 1748 - 1774 27 );
- die Amtsbeschreibung des Amtes Boizenburg aus dem Jahre 1696/97 28 );
- das Inventar des Klosteramtes Ribnitz aus dem Jahre 1620 29 ).


|
Seite 134 |




|
Diese Quellen sollen im folgenden in zweierlei Hinsicht besprochen werden. Erstens wird die Anzahl der Häuser mit durchlaufender Diele zu ermitteln sein, um das aus den ritterschaftllichen Flurkarten erzielte Ergebnis wenigstens für drei Ämter zu ergänzen, zweitens soll das zahlenmäßige Verhältnis der durchlaufenden Dielen zu den Flettdielen näher untersucht und ihre gegenseitige Abhängigkeit festgestellt werden.
Vielleicht die ergiebigste Quelle für die Hausforschung sind die Protokollbücher des Amtes Schwerin. Enthalten sie doch in dem angegebenen Zeitraum über 250 ausführliche Hausbeschreibungen 30 ). Erst 1748 beginnen die genauen Nachrichten, während sie vorher allzu summarisch abgefaßt sind. Es handelt sich um sogenannte Amtsverlaßbücher, die vorwiegend Protokolle über Abtretung oder Übernahme von Bauernstellen enthalten. Bei diesen Gelegenheiten wurden außer dem lebenden und toten Inventar des Hofes meist auch die Einrichtung der Gebäude mit allen Einzelheiten verzeichnet. Für die Art der Abfassung dieser Berichte sei hier ein Beispiel aus dem Jahre 1750 angeführt 31 ).
Actum Stralendorf den l. September 1750.
Als . . . der Untertan Christian Gracke zum Wirt auf dem Schmillschen Gehöfte alhie zu Stralendorf . . . bestellet und . . . angewiesen werden sollte, . . . so wurde zuforderst das Inventarium aufgenommen:
Das Haus
ist von 6 Verbind mit einem Vor- und Hinterschauer, die Sohlen sind in mittelmäßigem Stande, das Dach ist überall schlecht und nichts nütze.
Die Haustür ist von 2 Flügeln Tannenbrettern mit Eisenhaken und Hängen.


|
Seite 135 |




|
Eingangs zur linken Hand sind 2 Kammern, deren Türen von alten Tannen- und Buchenbrettern, die eine gehet in Bügeln, die andere hat Eisenhaken und Hänge.
Die hinterste Tür von 2 Flügeln Tannenbrettern mit 4 Eisenhaken und Hängen.
Eingangs zur rechten Hand sind 2 Kammern, die erste Kammertür von Tannenbrettern mit Haken, Hängen, Schloß und Schlüssel.
Die andere Kammertür ist von altem Buchenholz, gehet in Bügeln.
Der Schwiebogen von Mauersteinen.
Die Stubentür ist von alten Tannenbrettern, gehet unten in die Welle und hat oben einen Eisenhaken und Hänge. In der Stube der Ofen von Mauersteinen, der Boden gewunden, die Fenster taugen nichts.
Bei der Stube ist eine Kammer, deren Tür von Tannenbrettern mit Eisenhaken und Hängen, Schloß und Schlüssel.
Die Kammern sind alle mit Bohlen beleget.
Die Scheune
ist von 4 Verbind, an Sohlen und Dach in mittelmäßigem Stande.
An beiden Enden Flügeltüren von Tannenbrettern mit Eisenhaken und Hängen und Stichkrampen.
Aus der vorliegenden Beschreibung läßt sich ohne Schwierigkeiten die Form des Wohnhauses ebenso wie der Scheune erkennen. Die Nachricht, daß sich an beiden Enden des Gebäudes zweiflügelige Türen befanden, dürfte mit Sicherheit auf eine Durchfahrtsdiele schließen lassen. Es handelt sich demnach um ein Durchfahrtsdielenhaus ohne Seitenausgänge. schon aus diesem einen, willkürlich aus der Menge der Inventare herausgegriffenen Beispiel zeigt sich der Wert und die Ergiebigkeit der so zahlreichen Beschreibungen für die Hausforschung.


|
Seite 136 |




|
|
|
|||||||
| Durch- | Durch- | Flett- | Neubauten 33 ) | ||||
| fahrts- | gangs- | arm- | Flett- | Sack- | von | ||
| diele | diele | diele | diele | diele | Flett- | Flett- | |
| armdln. | dielen | ||||||
|
|
|||||||
| Dambeck | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Kleinen | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Drispeth | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Alt Meteln | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Grevenhagen | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dalberg | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| Lübstorf | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Hundorf | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Böken | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Drieberg | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Pingelshagen | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Zittow | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Warnitz | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Lankow | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Wittenförden | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Görries | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Kl. Roghan | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Gr. Rogahn | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Krebsförden | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Mueß | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Godern | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| Pinnow | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Petersberg | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Wüstmark | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| Pampow | 11 | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| Stralendorf | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| Bolthusen | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Lehmkuhlen | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Plate | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 1 | - |
| Peckatel | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Banzkow | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Göhren | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| Settin | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Zapel | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Tramm | - | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - |


|
Seite 137 |




|
|
|
|||||||
| Durch- | Durch- | Flett- | Neubauten | ||||
| fahrts- | gangs- | arm- | Flett- | Sack- | von | ||
| diele | diele | diele | diele | diele | Flett- | Flett- | |
| armdln. | dielen | ||||||
|
|
|||||||
| Klinken | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Garwitz | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - |
| Mirow | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| Sülte | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Sülstorf | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 |
| Lübesse | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| Ülitz | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| Goldenstädt | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| Rastow | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Moraas | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| Redefin | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| Picher | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Gr. Krams | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Alt Krenzlin | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Neu Krenzlin | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Loosen | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Alt Krams | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|
|
|||||||
| Belsch | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
| Lübbendorf | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| Probst Jesar | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Lübtheen | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| Trebs | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Laupin | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Hohen Woos | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| Vielank | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 |
Die vorstehende Liste enthält sämtliche aus den Amtsbüchern des Amtes Schwerin festgestellten Hausformen. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß sie nur einen Bruchteil aller in den erwähnten Dörfern damals vorhandenen Häuser umfaßt. Aus der Entstehung der Quelle ergibt sich, daß nur die Gebäude, die in dem Zeitraum von 1748 - 1774 ihren Besitzer gewechselt hatten, Aufnahme haben finden können. Auch diese wurden nur soweit berücksichtigt, als sie mit genügender Ausführlichkeit in den Amtsbüchern beschrieben sind, was gegen Ende der Periode jedoch häufig nicht mehr der Fall ist.
Die Gesamtzahl der im Amt Schwerin ermittelten Wohnhäuser mit durchlaufender Diele beträgt 137. Eintragung in die beigegebene Übersichtskarte von Mecklenburg läßt erkennen, wie lückenhaft das aus den Flurkarten gewonnene Ergebnis ist 34 ). Schienen nach Durchsicht der Flurkarten in dem


|
Seite 138 |




|
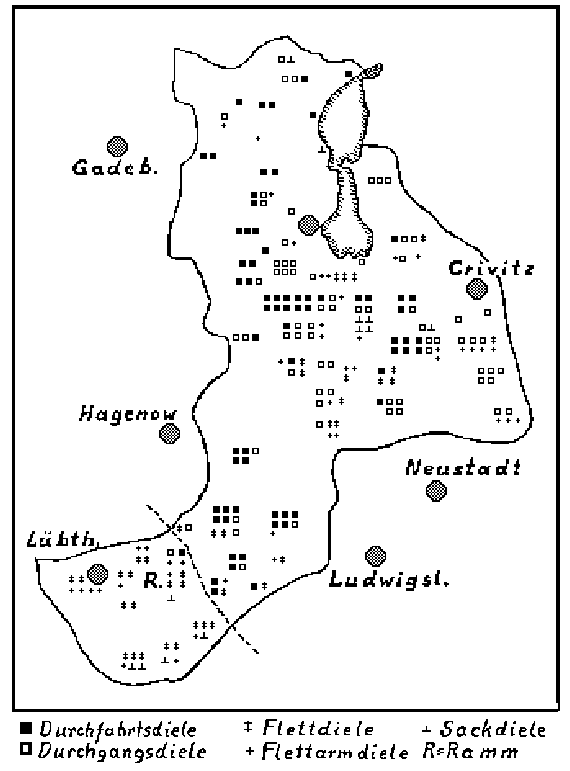


|
Seite 139 |




|
Raum südlich von Schwerin fast gar keine durchlaufenden Dielen vorzukommen, so zeigen die Amtsbücher diesen Haustyp gerade hier in gedrängter Fülle.
Im Gegensatz zu den Flurkarten war auf Grund der genauen Angaben in den Amtsbüchern die Trennung zwischen Durchfahrts- und Durchgangsdielen möglich. Beide sind etwa zu gleichen Teilen, nämlich mit 68 und 69, im Amte vertreten. Doch dürfte die Zahl der Durchfahrtsdielen in Wirklichkeit noch höher gewesen sein, da alle Gebäude, in denen nicht ausdrücklich eine "große Hintertür" oder eine "Tür mit zwei Flügeln", sondern nur eine "Hintertür" oder "hintere Ausgangstür" erwähnt ist, zu den Durchgangsdielenhäusern gerechnet wurden.
Im folgenden sollen die bisher behandelten Durchfahrts- und Durchgangsdielenhäuser mit den übrigen Grundtypen des Niedersachsenhauses verglichen und daraus die Grundzüge der baulichen Entwicklung im Amt Schwerin abgeleitet werden.
Die Eintragung der verschiedenen Hausformen in die Karte des Amtes läßt deutlich zwei verschiedene Typengebiete hervortreten, die gesondert zu besprechen sind 35 ). Während im Hauptteil des Gebietes die durchlaufenden Dielen mit 137 zu 57 gegenüber sämtlichen sonstigen Typen beträchtlich überwiegen, sind in dem Zipfel des Amtes, der zur Elbe hinweist, südlich der Linie Redefin -Loosen fast ausschließlich Flett-, Flettarm- und Sackdielenhäuser vertreten.
Das Zahlenverhältnis der fünf verschiedenen Grundtypen ist für beide erwähnten Gebiete des Amtes in der folgenden Tabelle zusammengestellt. Diese enthält sämtliche in den Amtsbüchern des bearbeiteten Zeitraumes erwähnten Wohnhäuser, soweit ihre Typenzugehörigkeit aus den Beschreibungen klar ersichtlich war. Bei den Durchfahrts- und Durchgangsdielenhäusern ist in zwei besonderen Spalten das Vorkommen von einer oder zwei Seitentüren vermerkt. Ferner sind diejenigen Häuser, die in den Beschreibungen ausdrücklich als alt und baufällig bezeichnet werden, und andererseits alle, die nach 1700 neu errichtet oder umgebaut worden sind, gesondert aufgeführt. Von dem letzten Teil der Tabelle mit den Gebäuden des Amtes Boizenburg wird später zu sprechen sein.


|
Seite 140 |




|
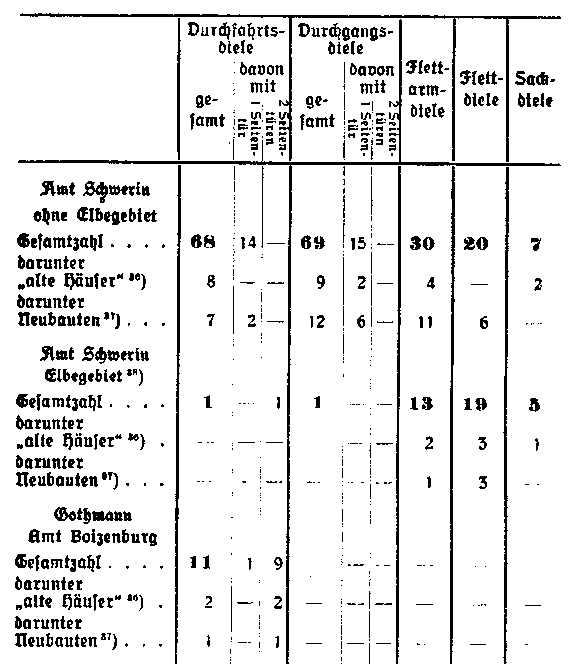
36) Häuser, die in den
Beschreibungen als alt und baufällig
bezeichnet sind.
37) Häuser, die nach
1700 entweder neu errichtet oder umgebaut
worden sind.
38) Umfaßt den Südzipfel
des Amtes, südlich von der Linie Redefin-Loosen.


|
Seite 141 |




|
Wie Folkers in seinen Untersuchungen betont, sind Durchfahrtsdielen fast ausschließlich auf sehr alte Häuser beschränkte Alle jüngeren Bauten zeigen andere Formen. Auch in den alten Häusern lassen sich Durchfahrtsdielen meist nur noch an geringen baulichen Einzelheiten nachweisen, da sie fast alle schon vor längerer Zeit durch den Einbau von Stuben in Flett- oder Flettarmdielen umgewandelt worden sind 39 ). Auf Grund dieser Beobachtungen kommt Folkers zu dem Schluß, daß das Durchfahrtsdielenhaus schon seit langem im Aussterben begriffen ist und daß die Wandlung zunächst zum Durchgangsdielenhaus und dann zu der neuzeitlichen Bauweise des Flett- und Flettarmdielenhauses bereits im 18. Jahrhundert begann 40 ). Mitten in diese Übergangsperiode führen uns die Amtsbücher.
Noch war die größere Zahl aller Häuser mit durchlaufender Diele versehen, aber schon damals ist mehrfach von Umbauten die Rede, bei denen das Haus durch Hinzufügung eines Stubenendes erweitert und dadurch in seiner Raumaufteilung oft grundlegend verändert wurde. Hierfür einige Belege aus den Amtsbüchern: 1757 heißt es von einem als sehr alt bezeichneten Hause in Warnitz, vor etwa 20 Jahren sei die Stube und die Schlafkammer hinten am Garten als ein Vorschauer angehängt 41 ); von einem alten Haus in Peckatel wird 1760 erwähnt, daß vor 21 Jahren das Stubenfach angebaut wurde 42 ); bei Dalberg heißt es von einem Haus, "das Stubenende ist außerdem angebaut, worin die Stube und Kammer ist" 43 ); ähnlich wird in Böken angegeben, "das Stubenende ist als eine Abseite in der Quere angebaut" 44 ). Insgesamt sind in den Amtsbüchern 13 Häuser erwähnt, die durch Anbau eines Stubenendes verändert wurden. Da die wirkliche Zahl der An- und Umbauten sicher viel höher ist, muß damit gerechnet werden, daß zahlreiche Flett-, Flettarm- und Sackdielen erst im 18. Jahrhundert aus zugebauten Durchfahrts- oder Durch-


|
Seite 142 |




|
gangsdielenhäusern entstanden sind. Die Haustypen mit Hinterausgang müssen also noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts weit zahlreicher als in der Untersuchungsperiode gewesen sein.
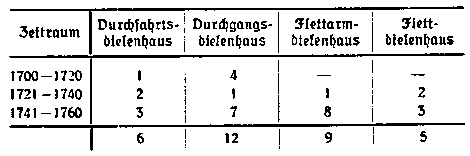
Wenn auch die Zahl derjenigen Häuser, bei denen das Baujahr aus den Akten festgestellt werden konnte, nicht sehr groß und von Zufälligkeiten abhängig ist, so gibt die vorstehende Tabelle doch ungefähr einen Überblick über die Bautätigkeit im Amt Schwerin. Die Zahl der neuerrichteten Durchfahrtsdielenhäuser war im 18. Jahrhundert nicht mehr groß, doch wurden noch um die Mitte des Jahrhunderts und darüber hinaus im Jahre 1767 einzelne Gebäude dieses Typs neu gebaut. Besonders beliebt waren Durchgangs- und Flettarmdielenhäuser, während das Flettdielenhaus erst langsam weitere Verbreitung fand. Während die erste Spalte der Tabelle die Bauform der Vergangenheit und die letzte die der Zukunft enthalten, zeigen die beiden mittleren Spalten, welche Haustypen schon seit Anfang des 1. Jahrhunderts bzw. seit dessen Mitte modern waren.
Die folgenden Erörterungen beziehen sich zunächst nur auf den Hauptteil des Amtes Schwerin ohne Berücksichtigung des Elbegebietes, das anschließend gesondert betrachtet werden soll. Noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts waren in diesem Hauptteil über ein Drittel aller Wohnbauten reine Durchfahrtsdielenhäuser, und auch 1750 wurden noch mehrere Bauten deses Typs neu errichtet. Durchgangsdielenhäuser waren in der gleichen Anzahl vertreten, so daß trotz aller


|
Seite 143 |




|
Modernisierungsbestrebungen noch 71 Prozent aller Gebäude mit durchlaufender Diele versehen waren. Die Anzahl der neuerrichteten Durchgangsdielenhäuser zeigt sogar eine stetige Zunahme. Andererseits war diese Hausform schon lange üblich, denn mehrere dieser Bauten stammten bereits aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges -- unter der Annahme, daß den ausdrücklich als alt bezeichneten Häusern ein Alter von 100 und mehr Jahren zuzusprechen ist.
Von den 137 Häusern mit durchlaufender Diele waren 29, d. h. etwa 21 Prozent, mit einem Seitenausgang versehen. Diese Beobachtung bietet jedoch keine Überraschung, da wir eine Seitentür sogar schon bei dem viel älteren Hungerstorfer Durchfahrtsdielenhaus gefunden hatten. Bemerkenswerterweise ist in diesem Gebiet an keinem einzigen Haus mit durchlaufender Diele das Vorhandensein von zwei Seitentüren festgestellt worden.
Den Hauptteil der neben den Häusern mit durchlaufender Diele auftretenden neuartigen Bauformen bildete das Flettarmdielenhaus mit 30 Gebäuden. Jedoch ist dieses ein Typ, der sehr leicht aus Durchfahrts- oder Durchgangsdielenhäusern mit Seitentür durch Verbauung des Hinterausgangs entstehen konnte. Vielleicht waren die vier als "alt" bezeichneten Flettarmdielenhäuser auf diese Weise aus jenen älteren Bautypen entstanden. Daß die Flettarmdielenhäuser in jener Zeit sehr beliebt und in starker Zunahme begriffen waren, zeigte die verhältnismäßig große Zahl von Neubauten, die fast sämtlich in der Zeit zwischen 1740 und 1760 entstanden sind.
Bei den reinen Flettdielenhäusern ist eine Ableitung aus den älteren bodenständigen Typen in den meisten Fällen unwahrscheinlich, weil diese nie mit zwei Seitentüren versehen waren. Die Flettdielen scheinen erst im 18. Jahrhundert in das Untersuchungsgebiet eingedrungen zu sein, denn ihre Zahl ist überhaupt nur gering - etwa ein Zehntel aller Wohnhäuser -, außerdem sind gar keine alten und baufälligen Flettdielenhäuser vorhanden, vielmehr sind 5 von den 18 Häusern dieses Typs Neubauten aus der Zeit von 1730 - 1760.
Die wenigen Sackdielenhäuser des Untersuchungsgebietes bilden offenbar nur einen sekundären Bautyp. Meist handelt es sich um kleine Gebäude, von denen außerdem zwei erst durch Anbau eines Stubenendes entstanden zu sein scheinen.
Im Elbegebiet, als dem südlichsten Teil des Amtes Schwerin, herrschten im 18. Jahrhundert grundsätzlich andere


|
Seite 144 |




|
Baugewohnheiten als in den nördlich anschließenden Landschaften. Außer zwei Häusern mit durchlaufender Diele an der Grenze des Gebietes sind ausschließlich Bauten mit Flett- oder Flettarmdiele und daneben noch einige Sackdielenhäuser vorhanden. Hier waren offenbar die reinen Flettdielen bodenständig, denn nicht nur ihre Gesamtzahl, sondern auch die Zahl der alten Gebäude ebenso wie die der Neubauten ist größer als die entsprechende Anzahl der Flettarmdielenhäuser. Außerdem ist das einzige vorhandene Durchfahrtsdielenhaus nach Art der Flettdiele mit zwei Seitentüren versehen - eine Bauform, die im Nordteil des Amtes überhaupt nicht vorkommt.
Sackdielenhäuser sind auch in diesem Gebiet nur in geringer Anzahl vertreten. Möglicherweise sind sie hier als besonderer Bautyp anzusehen, da sie mehrfach auch an größeren Gebäuden festzustellen sind und schwerlich aus Flett- oder Flettarmdielen entstanden sein können.
Die Beschreibung des Amtes Boizenburg aus dem Jahre 1696/97 enthält Angaben über sämtliche im Amt vorhandenen Wohnhäuser und sonstigen Gebäude 46 ). Jedoch sind außer den Inventaren der Amtshöfe und der Höfe in der Teldau 47 ) nur die Beschreibungen einiger Bauernhäuser in Gothmann und Bandekow genügend ausführlich, um daraus die Hausformen mit Sicherheit bestimmen zu können. Diese Häuser, und zwar elf in Gothmann und zwei in Bandekow, haben sämtlich Durchfahrtsdielen mit großen Türen von zwei Flügeln an beiden Enden.
Neun von den elf Gebäuden in Gothmann sind an beiden Seiten mit Nebentüren versehen. Diese Bauart läßt vielleicht


|
Seite 145 |




|
auf einen starken Einfluß des Flettdielenhauses schließen, wie sich ja auch im Amt Schwerin nur im Elbegebiet das Durchfahrtsdielenhaus mit zwei Seitentüren findet. Diese Form scheint in Gothmann bodenständig zu sein, denn sie ist sowohl bei einem Neubau vorhanden als auch bei zwei wegen Alters baufälligen Häusern, die vielleicht schon aus dem Ende des 16. Jahrhunderts stammen. Ob die beiden Gebäude in Bandekow Seitenausgänge gehabt haben, geht aus der Beschreibung nicht hervor.
Das Inventar des Klosteramtes Ribnitz von 1620 ist eine wichtige Quelle, die schon aus verhältnismäßig sehr früher Zeit genaue Beschreibungen von Bauernhäusern liefert. Bei einer beabsichtigten Vertauschung der Klostergüter wurde von einer Kommission ein genaues Verzeichnis der gesamten Besitzungen aufgenommen.
Hierbei wurden auch die Abgaben und das lebende und tote Inventar der Klosterbauern protokolliert. Ein Beispiel aus Bartelshagen möge die Art der Gebäudebeschreibung zeigen 48 ):
"Hans Westphal, ein Baumann . . . . Sein Haus ist von 7 Gebinden ohne beide Kihlende.
Vor den großen Tor und Heck an einer Seiten zwei, in der andern ein Stall, uff beiden Abseiten Stallung.
Bei der kleinen Tür, unter den hintersten Kyhlende, eine Stuben, darin 3 Fenster, 1 Kachelofen, umbher eine Lehmwandt mit einem Windelboden, dabei eine Lucht von 4 Fenstern.
Über der Dehle ein Bahlenboden mit Lehm beschlagen halb, die an der Hälfte mit Schlet belegt.
Das Holzwerk, Ständer und Wände gut, das Dach ist ziemlich."
Der Baubestand und die Einrichtung ist klar. Das Haus von sieben Gebinden bzw. sechs Fach Länge war vorne und hinten mit Vorschauern oder Kühlenden unter zwei Vollwalmen versehen. Wie noch heute im Nordosten Mecklenburgs üblich, lag das große Einfahrtstor zurückgezogen zwischen den beiden Vorschauern. Die Diele führte frei durch das ganze Haus. In den beiden Abseiten befanden sich Ställe und an der einen Seite


|
Seite 146 |




|
neben der Stube eine Lucht, d. h. ein Dielenarm, der bis an die Hauswand reichte und dort mit Fenstern versehen war. Diese Lucht, in der der Herd lag, wurde als Küche benutzt. Der einzige geschlossene Raum im Hause war die mit Lehmwänden und einer Decke (Windelboden) versehene heizbare Stube unter dem hinteren Dachwalm neben der Küchenlucht. Der Kachelofen wurde wahrscheinlich vom Herd aus geheizt.
Fraglich bleibt zunächst, ob die Häuser eine Durchfahrtsdiele hatten oder ob am hinteren Giebel nur eine kleine Fußgängertür vorhanden war. Die in allen Hausbeschreibungen angewendeten Bezeichnungen "großes Tor" und "kleine Tür" sind nur scheinbar ein Hinweis für das Vorhandensein einer bloßen Fußgängertür. Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß der Ausdruck "Tür" im Gegensatz zu dem heutigen Sprachgebrauch damals lediglich einen Ausgang ohne Rücksicht auf seine Größe bezeichnete und häufig auch für das doppelflügelige vordere Tor angewendet wurde. Außerdem wird die Bezeichnung "kleine Tür" in den zahlreichen Hausbeschreibungen des Inventars ganz stereotyp zur Unterscheidung der beiden Haustüren gebraucht, und auch in einem reinen Durchfahrtsdielenhaus dürfte die Hintertür stets kleiner als das Einfahrtstor gewesen sein. Wichtig ist die Angabe in mehreren Hausbeschreibungen, daß die Stube unter dem hintersten Kühlende in der Abseite und ihr gegenüber in der anderen Abseite eine Kammer oder häufig der Backofen gelegen habe. Die Diele scheint also in voller Breite oder doch nur wenig eingeengt bis an die hintere Wand des Hauses geführt zu haben. Hieraus folgt mit hoher Wahrscheinlichkeit, daß die Häuser des Klosteramtes Ribnitz echte Durchfahrtsdielen hatten.
In dem Ribnitzer Amtsinventar von 1620 sind insgesamt 175 Beschreibungen von Bauernhäusern enthalten. Von diesen sind 72 für unsere Untersuchung nicht zu verwerten, weil sie entweder lückenhaft sind oder außer der Haupttür keine weiteren Ausgänge erwähnen 49 ). Abgesehen von zwei Ausnahmen mit ein bzw. zwei Seitentüren hatten sämtliche genau beschriebenen Häuser einen Hinterausgang. Es ist also zu folgern, daß die Niedersachsenhäuser des Klosteramtes Ribnitz um 1620 fast ausnahmslos mit durchlaufender Diele, wahrscheinlich mit breiter Ausfahrt, versehen waren.


|
Seite 147 |




|
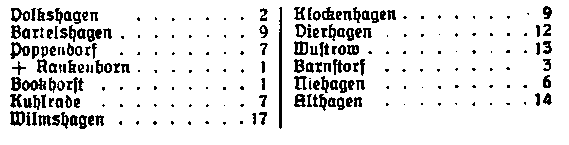
Ein Aktenstück über den Ort Ramm möge die Einzeluntersuchungen archivalischer Quellen beschließen, da es eine gewisse Ergänzung zu den Grabungsergebnissen darstellt. Nachdem die Wüstung Ramm vom Sande verschüttet worden war, hatte man an anderer Stelle eine neue Siedlung angelegt. Bei dem Verkauf dieses Meierhofes im Jahre 1709 wurde ein Inventar angefertigt, in dem das Wohnhaus mit 14 Verbinden, zwei Abseiten und zwei Kröpelgiebeln als ein "ganz altes Zimmer" bezeichnet wird. Es hatte zu beiden Seiten Viehställe und außerdem zwei Seitentüren. Die besondere Erwähnung des hohen Alters läßt darauf schließen, daß es bereits bei der Neueinrichtung des Hofes Ramm bald nach 1571 erbaut worden war. Dadurch wäre also ein weiterer Beweis gefunden, daß das Niedersachsenhaus mit Flettdiele in dieser Landschaft, die ja zu dem bereits erwähnten Elbgebiet des Amtes Schwerin gehörte, bereits in früher Zeit heimisch war.
Ergebnisse.
Um zu einer rückschauenden Übersicht über den Gang der Untersuchung zu gelangen, sollen noch einmal kurz die verschiedenen Quellen in ihrer Ergiebigkeit für die Hausforschung miteinander verglichen werden. Der Wert der einzelnen Untersuchungsmethoden liegt einerseits in der Anzahl der mit ihrer Hilfe zu ermittelnden Hausformen, andererseits in deren Alter begründet, denn je näher eine Quelle dem Mittelalter steht,


|
Seite 148 |




|
desto aufschlußreicher muß sie für das zur Erörterung stehende Problem sein.
Angefangen mit der Gegenwart seien im folgenden die verschiedenen Quellen ihrem Alter nach einander gegenübergestellt:
1. Von den gegenwärtig noch vorhandenen Bestand an Niedersachsenhäusern geht Folkers aus und sucht aus den Bauformen der ältesten Häuserrückschließend festzustellen, welche Form im Mittelalter allgemein herrrschend war. Solange keine weiteren Quelle zur Verfügung standen oder systematisch verwertet wurden, mußten alle Schlußfolgerungen unsicher bleiben, da das benutzte Material sowohl der Menge als auch dem Alter nach der Ergänzung bedurfte. Immerhin war es ergiebig genug, daß Folkers der Forschung den richtigen Weg zu zeigen vermochte 51 ).
Durchfahrtsdielenhäuser nach Folkers mit Angabe der Baujahre.
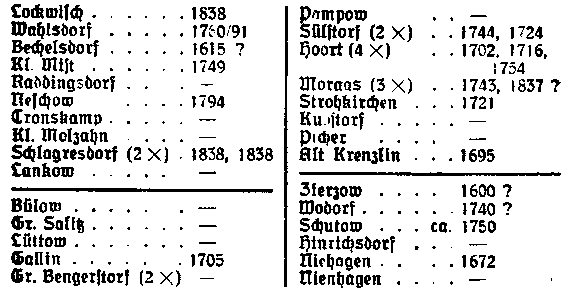


|
Seite 149 |




|
2. Einen weiteren Beitrag liefern die in den Archiven aufbewahrten Bauzeichnungen des 19. Jahrhunderts, die meist die Gebäude bereits vor dem neuzeitlichen Umbau darstellen.
3. Die Flurkarten der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts weisen das zahlreiche Vorkommen der durchlaufenden Diele in Mecklenburg nach, wobei die Unterscheidung zwischen Durchfahrts- und Durchgangsdiele im einzelnen nicht möglich ist. Sie zeigen zunächst nur, daß deren Verbreitung noch im 18. Jahrhundert groß war, und zwar, wie oben erwähnt wurde, erheblich größer als auf der beigegebenen Karte zum Ausdruck kommt. Sie erlauben jedoch keine zuverlässigen Schlüsse auf die wirkliche Anzahl, die unterschiedliche Stärke der Verbreitung in den verschiedenen Landesteilen sowie das Verhältnis zu den anderen Hausformen.
4. Die Akten der Domanial- und Klosterämter aus dem 17. und 18. Jahrhundert konnten bisher nur zu einem kleinen Teil erschlossen werden. In den Amtsbeschreibungen, Gehöftsakten usw. harrt noch ein umfangreiches, aber schwer zugängliches Material der Bearbeitung. Diese Quellen vermögen einerseits Aufschluß zu geben über die zahlenmäßige Verbreitung der Häuser mit durchlaufender Diele und andererseits über deren genaues Verhältnis zu anderen Bauformen und damit über die Entwicklungsgeschichte des mecklenburgischen Bauernhauses. Wohl die umfangreichste und ergiebigste Quelle überhaupt sind die Protokollbücher des Amtes Schwerin aus der Zeit von 1748 bis 1774. Einzelne aufschlußreiche Angaben lieferte die Boizenburger Amtsbeschreibung von 1696. Besonders wichtig war das Ribnitzer Inventar von 1620. Einerseits sind Quellen aus dem Osten des Landes bisher ziemlich selten, und andererseits erlaubt das Inventar Rückschlüsse auf das 16. Jahrhundert und leitet dadurch bereits zum Mittelalter über.
5. Zahlenmäßig gering, aber dafür um so wertvoller sind die Karten des 16. Jahrhunderts, da einige von ihnen vollständige Abbildungen von Bauernhäusern der damaligen Zeit enthalten.
6. Die Ausgrabungen mittelalterlicher Hausgrundrisse sind die wichtigste und sicherste, jedoch auch am schwersten erreichbare Quelle historischer Hausforschung. Da weder Zeichnungen noch Beschreibungen von Gebäuden aus jenen frühen Jahrhunderten vorliegen, sind sie für uns das einzige Mittel, ein direktes


|
Seite 150 |




|
Bild von den Urformen des Niedersachsenhauses zu erhalten. Welche weitreichenden Rekonstruktions- und Erkenntnismöglichkeiten hier vorhanden sind, hoffe ich in den vorliegenden Untersuchungen über die Ausgrabung der Wüstungen Hungerstorf und Ramm gezeigt zu haben.
Die abschließende Auswertung der bisher durchgeführten Einzeluntersuchungen hat von den beiden Grabungen als den ältesten direkten Quellen auszugehen. Ihre so sehr verschiedenen Ergebnisse lassen eine getrennte Betrachtung als notwendig erscheinen.
Durch die Grabung Hungerstorf konnte ein Durchfahrtsdielenhaus aus der Zeit um 1400 nachgewiesen werden. Die gleiche Form zeigen. soweit erkennbar. sämtliche Häuser auf der Karte von Meierstorf im 16. Jahrhundert. Wenn schon diese rein zufällig aus dem alten Bestand an Häusern heraus gegriffenen Beispiele die gleiche Bauform aufweisen und wenn sich ferner diese Form als so dauerhaft erwiesen hat, daß sie sich in sehr zahlreichen Dörfern bis ins ausgehende 18. Jahrhundert (vgl. Flurkarten) und teilweise sogar bis in unsere Zeit (Folkers) findet, so ist sie wohl mit Recht als ursprünglich und bodenständig anzusehen. Die Akten der Ämter Schwerin und Boizenburg zusammen mit den Flurkarten und den Folkersschen Untersuchungen weisen nach, daß diese Folgerung außer für den Nordwesten auch für den gesamten Westen des Landes mit Ausnahme des Elbgebietes bei Lübtheen Gültigkeit hat.
Wir kommen also zu dem Ergebnis, daß das Durchfahrtsdielenhaus die wohl ausschließlich herrschende Urform des Niedersachsenhauses in Westmecklenburg war.
Die Besiedlung Mecklenburgs in der Kolonisationszeit verlief von Westen nach Osten. Nun ist nicht einzusehen, welche anderen Hausformen als die im Westen herrschenden Typen von den Kolonisten eingeführt sein könnten und woher diese stammen sollten. Auf Grund dieser Überlegung und weil durchlaufende Dielen noch im 18. Jahrhundert (Flurkarten) und heute (Folkers) im ganzen Land vorkommen, ist anzunehmen daß Durchfahrtsdielenhäuser ehemals auch im Osten des Landes allgemein üblich waren. Da diese Folgerung durch die Aus-


|
Seite 151 |




|
wertung des Ribnitzer Inventars von 1620 weitgehend bestätigt wird, kann das Durchfahrtsdielenhaus als Urform des Niedersachsenhauses in fast ganz Mecklenburg angesehen werden 52 ).
Der Wandel vom Durchfahrts- zum Durchgangsdielenhaus muß, wie die Schweriner Amtsbücher erkennen ließen, schon im 17. Jahrhundert vor sich gegangen sein. Daß zur gleichen Zeit bereits in nennenswerter Zahl Flettarmdielenhäuser durch Verbauung des Hinterausganges entstanden waren, erscheint möglich, ist aber nicht mit Sicherheit nachzuweisen. Jedenfalls war das Flettarmdielenhaus neben dem Durchgangsdielenhaus im 18. Jahrhundert offenbar die beliebteste Bauform und in starker Zunahme begriffen 53 ). Daneben wurden noch nach 1750 einzelne Durchfahrtsdielenhäuser neu errichtet 54 ). Wohl seit Anfang des 18. Jahrhunderts war das


|
Seite 152 |




|
Flettdielenhaus, das anscheinend als eine fremde, nicht aus den bodenständigen Typen entwickelte Form anzusehen ist, in langsamem Vordringen aus dem Elbgebiet nach Norden begriffen.
Die Ausgrabung in der Wüstung Ramm ergab die Aufdeckung eines Flettarmdielenhauses aus der Zeit um 1380. Auch das Haus des neuen Hofes Ramm wurde im 16. Jahrhundert mit Flettdiele erbaut, deren Einfluß sich ferner im 17. Jahrhundert in den Häusern von Gothmann bei Boizenburg erkennen ließ 55 ). Die Auswertung der Amtsbücher ergab ferner, daß die Flettdiele nur in einem scharf abgegrenzten Gebiet an der mecklenburgischen Südwestgrenze verbreitet war. Von hier aus dürfte sie im 18. Jahrhundert nach Norden vorgedrungen sein. Die Grenze dieses Gebietes, die südlicher zu liegen scheint als Folkers annimmt 56 ), bedarf noch genauer Erforschung.
Wenn, wie wir nachgewiesen hatten, im größten Teil Mecklenburgs das Durchfahrtsdielenhaus als Urform des Niedersachsenhauses anzusehen ist, so muß vorausgesetzt werden, daß in allen Gebieten Westdeutschlands, aus denen die Siedler in der Kolonisationszeit nach Mecklenburg kamen, ebenfalls einheitlich das Durchfahrtsdielenhaus geherrscht hat. Folkers glaubt dieses annehmen zu dürfen 57 ). Zahlreiche Beispiele in verschiedenen Gebieten Nordwestdeutschlands scheinen die weitere Verbreitung der Durchfahrts- oder Durchgangsdielen-


|
Seite 153 |




|
häuser in älterer Zeit zu bestätigen 58 ). Allerdings muß die Tatsache zu denken geben, daß für den größten Teil Niedersachsens bisher wenig über diese Urform bekannt oder veröffentlicht ist.
Niedersachsenhäuser mit durchlaufender Diele sind in fast allen Teilen des nordwestdeutschen Raumes teils zahlreich, teils vereinzelt nachzuweisen. Im folgenden sollen die mir bisher bekannt gewordenen Beispiele in einer kurzen Übersicht zusammengestellt werden, die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit machen kann.
In Holstein nördlich der Unterelbe zwischen Stör und Eider herrscht das "Holstenhaus mit Achtergang" (Lehmann, das Bauernhaus in Schleswig-Holstein, Altona 1927, S. 4 - 13). Durchgangsdielenhäuser aus diesem Gebiet (Moorhusen und Kleinsonnendeich in den Elbmarschen und Todenbüttel sind ferner abgebildet im Atlas des Verbandes deutscher Architekten (Das Bauernhaus im Deutschen Reiche, herausgegeben vom Verband deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, Dresden 1906. Atlasband Schleswig-Holstein, Tafel 1 und 2, und Textband S. 109).
In dem Marschenland südlich der Unterelbe, von Hamburg bis Cuxhafen findet sich das "niedersächsische Kübbungshaus mit Hintergiebelflur" (H. Ellenberg, Über die bäuerliche Wohn- und Siedlungsweise in NW-Deutschland in ihrer Beziehung zur Landschaft, insbesondere zur Pflanzendecke. Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Niedersachsen, Hannover 1937, Heft 3 S. 227). Die zweite Giebeltür bei den Häusern im alten Lande bei Hamburg dürfte ebenfalls ein Rest der durchlaufenden Diele sein (W. Lindner, Das niedersächsische Bauernhaus in Deutschland und Holland. Hannover 1912, S. 179). Häuser mit Durchgangsdiele stehen noch vereinzelt im Reg.-Bez. Stade (Lindner a. a O. S. 66).
In der Lüneburger Heide waren früher Häuser mit einer Tür im Hintergiebel vorhanden. Ein derartiges Haus von 1571 befindet sich im Celler Museum (W. Bomann, Bäuerliches Hauswesen und Tagewerk im alten Niedersachsen, Weimar 1927, S. 46 und Abb. 1).
Nördlich von der Stadt Hannover in Isernhagen u. s. O. konnte ich 1940 während des Krieges durch Erkundigungen bei alten Leuten feststellen, daß früher vereinzelt Durchgangsdielenhäuser vorhanden gewesen sind.
In Glentorf bei Braunschweig stand ein Niedersachsenhaus mit Hinterausgang aus dem Jahre 1703 (abgebildet im Atlas des Versandes deutscher Architekten. Braunschweig Blatt 1).
Im Oldenburgischen erwähnt Lindner Durchgangsdielenhäuser (a. a. O. S. 66). In einem Haus aus Osterseefeld in Budjadingen erinnert ein langer Gang an die ehemalige Hintertür (Atlas des Verbandes deutscher Architekten. Oldenburg).
In Südwestfalen, im Weserbergland, im Ravensbergischen und westlich bis Hagen sind Durchgangsdielenhäuser allgemein verbreitet (W. Peßler, Die Abarten des altsächsischen Bauernhauses, Archiv für Anthropologie, NF 8, 1909, und P. Sartori, Westfälische Volkskunde, Leipzig, S. 20). Bei einer Reise durch die Dörfer längs der
( ... )


|
Seite 154 |




|
In einem schmalen Landstrich Südwestmecklenburgs herrschte seit alters das Flettdielenhaus. Folkers sucht den Grund hierfür in dem über die Elbe herüberwirkenden Einfluß des Altsachsenhauses, das sich schon früh vom Durchfahrtshaus zum Flettdielenhaus weiterentwickelt habe 59 ). Das Haus von Ramm stammt jedoch bereits ans dem 14. Jahrhundert, d. h. aus der Zeit kurz nach der Kolonisation, in der ja nach der im vorigen Absatz gemachten Voraussetzung noch das Durchfahrtsdielenhaus in altsächsischem Gebiet geherrscht hätte. Wahrscheinlich haben sich die Flettdielenhäuser des Elbgebietes nicht erst nachträglich aus ursprünglichen Durchfahrtsdielenhäusern unter fremdem Einfluß entwickelt. sondern sie sind bereits in der Kolonisationszeit von den Neusiedlern mitgebracht worden. Diese hätten dann freilich aus anderen Gebieten stammen müssen als die Kolonisten der übrigen mecklenburgischen Gebiete. Jedenfalls zeigt schon diese kurze Gegenüberstellung, daß über die Herkunft der Urformen des mecklenburgischen Niedersachsenhauses noch manche Unklarheiten bestehen, die der Aufhellung bedürfen.
Eine kurze Übersicht über die Wandlungen des mecklenburgischen Niedersachsenhauses im Rahmen der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung vom Mittelalter bis zur Gegenwart möge den Aufsatz beschließen. In der Kolonisationszeit hatte der deutsche Bauer zunächst die Aufgabe, sich auf Neuland eine Existenz aufzubauen und zu sichern. Anzahl und Einrichtung der Gebäude mußten auf das Notwendigste beschränkt bleiben. Das niedersächsische Einraumhaus wird allen Anforderungen genügt haben, ohne daß irgendwelche Nebengebäude vorhanden waren.
Weser zwischen Hameln und Karlshafen konnte ich im Sommer 1939 zahlreiche stattliche Häuser mit durchlaufender Diele beobachten. Schon von der Straße aus kann häufig der Blick durch das ganze Haus bis auf den rückwärtigen Hofplatz schweifen.
In den westlichen Grenzgebieten Deutschlands und der benachbarten holländischen Provinz Drenthe ist die Durchgangsdiele allgemein verbreitet (Lindner a. a. O.).


|
Seite 155 |




|
Die schweren Unruhen, die das offene Land noch im 15. Jahrhundert erschütterten, hatten zur Folge, daß zahlreiche Höfe und Dörfer verwüstet und nicht wieder aufgebaut wurden 60 ). Die Seßhaftigkeit der Bevölkerung war äußerst gering 61 ), und der fehlende Wohlstand verhinderte die Weiterentwicklung des Niedersachsenhauses. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen hatten sich seit der Kolonisationszeit kaum geändert, so daß das ursprüngliche Wohnstallhaus noch immer den Ansprüchen genügte 62 ). Wie die Ausgrabungen zeigten, hatte es nur geringe Ausmaße, und seine Diele war etwa halb so breit wie in späteren Jahrhunderten. Ob schon damals vereinzelte Nebengebäude vorhanden waren, ließen die Grabungen nicht erkennen.
Das 16. Jahrhundert mit seinen großen wirtschaftlichen Umwälzungen brachte eine Blütezeit des Bauerntums, das sich überall tatkräftig zu regen begann. Zugleich mit dem wirtschaftlichen Aufschwung im Lande und der Hochkonjunktur des Getreidehandels setzte die Entwicklung zur adligen Gutsherrschaft und andererseits eine Festigung der ländlichen Verhältnisse ein. Bei zunehmendem Wohlstand war die Seßhaftigkeit des Bauerntums in stetigem Anwachsen, und mit der allgemeinen Bevölkerungsvermehrung stieg auch die Durchschnittszahl der auf einem Hof arbeitenden Personen 63 ). Die Anbaufläche


|
Seite 156 |




|
des Getreides wurde in allen Feldmarken durch Urbarmachen von großen Teilen des alten Weidelandes erheblich vergrößert 64 ).
Als Folge dieser Veränderungen sind vermutlich erst damals im 16. Jahrhundert die großräumigen Bauernhäuser mit breiter Dreschdiele entstanden. Der Typ des Durchfahrtsdielenhauses wurde zwar noch beibehalten, aber das Raumbedürfnis war größer geworden. Und doch reichte trotz der Errichtung von Vorschauern und kleinen Anbauten der Platz noch nicht aus, so daß wohl auf den meisten Höfen Scheunen und Speicher errichtet wurden. Hatte man sich bis dahin mit dem offenen Einraumhaus begnügt, so schritt man nun bei steigendem Wohlstand allgemein zum Einbau von ofengeheizten Stuben und einzelnen Kammern in den Abseiten neben der Durchfahrtsdiele 65 ).
Der Dreißigjährige Krieg brachte die gewaltsame Unterbrechung dieser verheißungsvollen Anfänge. Erst im 18. Jahrhundert konnte sich eine Entwicklung fortsetzen, die sich in vielem bereits im 16. Jahrhundert angebahnt hatte. Das Haus erfuhr eine weitere Vergrößerung; allerdings nicht so sehr aus wirtschaftlichen Gründen, sondern um den gesteigerten Wohnbedürfnissen zu genügen. Mehrfach ist in den Quellen erwähnt, daß am Stubenende ein besonderes Fach als Wohnteil angebaut wurde und dadurch eine Verlängerung des Hauses erfolgte 66 ). Häufig dürfte dieser Anbau quer vor der Hinterfront des Hauses der Grund für die Einengung und völlige Abschließung der durchlaufenden Diele gewesen sein.
Die Urform des Durchfahrtsdielenhauses hatte sich etwa seilt dem 18. Jahrhundert überlebt. Die Zukunft gehörte dem Flettarmdielenhaus und dem neu eindringenden und bald alle anderen Formen überflügelnden Flettdielenhaus und seinen Abarten. Die Gesamtanlage der Bauernhöfe war seit dem


|
Seite 157 |




|
16. Jahrhundert kaum verändert. Fast überall war außer dem Wohnhaus, in dem regelmäßig das Vieh zu beiden Seiten der Diele untergebracht war, eine Scheune vorhanden, während die Anzahl der sonnigen Nebengebäude wie Schuppen, Ställe, Backhäuser usw. noch gering war 67 ).
Im 19. Jahrhundert erfolgten die Intensivierung der Landwirtschaft und grundlegende Veränderungen in der Anlage der Höfe und Häuser. Um dem verfeinerten Wohnbedürfnis Rechnung zu tragen, wurde die völlige Trennung der Wohn- und Wirtschaftsräume durchgeführt. Die Bauernhöfe wurden nun mit Vorliebe im sogenannten Gutstyp angelegt, bei dem drei Seiten des Hofplatzes von Gebäuden eingenommen wurden. Quer im Hintergrund lag das Wohnhaus und zu beiden Seiten die Scheunen, Ställe und Schuppen.
Erst die jüngsten Siedlungsbauten brachten vielfach wieder die Vereinigung sämtlicher Wohn- und Wirtschaftsräume unter einem Dach 68 ). Die Inneneinrichtung des Hauses hat allerdings mit jenen alten Bauten nichts mehr gemeinsam und entspricht den modernen Anforderungen an Wohn- und Wirtschaftsräume.
Die Wandlungen des Niedersachsenhauses haben gezeigt, daß sich jede Wirtschafts- und Kulturstufe ihre entsprechenden neuen Formen schafft. Die der Pionierzeit des mecklenburgischen Bauerntums angemessene Urform hatte sich unter den veränderten Verhältnissen der folgenden Jahrhunderte als so anpassungsfähig und bodenständig erwiesen, daß noch heute zahlreiche Niedersachsenhäuser in den Bauerndörfern des ganzen Landes die Zeiten überdauert haben. Das vorige Jahrhundert und besonders die Siedlungsbauten der Systemzeit schie-


|
Seite 158 |




|
nen die völlige Abkehr von den altüberlieferten Formen zu bringen. Erst unsere Zeit besinnt sich wieder auf die bodenständige Form des Niedersachsenhauses, das unter seinen mächtigen Dachflächen die gesamten Wohn- und Wirtschaftsräume des Hofes birgt.
Wäre es auch völlig verfehlt, alle Neubauten nachdem gleichen Muster errichten zu wollen oder gar die alten Formen blindlings zu kopieren. so ist doch die Kenntnis der Urformen und ein offener Blick für die bodenständige Baugestaltung früherer Jahrhunderte erforderlich, um von dieser Grundlage aus artgemäße Lösungen für die Errichtung von Siedlungsbauten finden zu können.
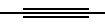


|
[ Seite 159 ] |




|



|



|
|
:
|
III.
Die geschichtliche
und landeskundliche
Literatur
Mecklenburgs 1939 - 1940
von
Friedrich Stuhr.
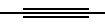


|
[ Seite 160 ] |




|


|
[ Seite 161 ] |




|
Bibliographie.
- Stuhr (Friedrich), Die geschichtl. u. landeskundl. Literatur M.'s 1938 - 1939. M. Jahrb. 103, 1939, S. 167 - 186.
Vorgeschichte.
- Asmus (Gisela), Die vorgeschichtlichen rassischen Verhältnisse in Schleswig-Holstein u. M. (Offa Bücher, hrgb. vom Museum vorgeschichtl. Altertümer in Verbindung mit der Gesellsch. für Schlesw.-Holst. Gesch. in Kiel, N.F. Bd. 4). Neumünster (Karl Wachholz) 1939. 106 S.
- Beltz (Robert), Zum wendischen Grabfeld von Damm. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 1. S. 15 - 17.
- Kasbohm (Willi), Das wendische Skelettgräberfeld in Damm bei Schwaan. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 1. S. 12 - 15.
- Kröplin (Otto), Aus der Vorgeschichte des Kreises Wismar. "Die Spange", Jahrb. für d. Kreis Wismar 1940, S. 30 - 40.
- Sverdrup (Georg), Die Hausurnen u. die Heiligkeit des Hauses. (betr. auch M.) Avhandlinger, utgift av det Norske Videnskaps-Akademi i. Oslo 1939. Oslo (Jacob Dybwad) 1940, S. 1 - 46.
Geschichte.
- Dragendorff (Ernst), Das hansisch-niederländische Bündnis (1616) u. die Stadt Rostock. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 21. Bd., 1939, S. 4 - 19.
Fürstenhaus.
- Hofmeister (Adolf), Die Töchter Herzog Bogislaws VI. von Wolgast (betr. auch das m. Fürstenhaus), Pomm. Jahrb. Bd. 34 1940, S. 47 - 57.
Familien- und Personengeschichte.
- Beltz (Hans) Familienforschung in M. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 181, S. 2 - 4.
- Götze (Theod.), Dr. Otto Becker, einer der letzten Ratzeburger Domschüler. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürft. Ratzeburg, 22. Jg., 1940, Nr. 2, S. 18 - 20.
- Rehbein (Arthur), Der erste Schmied der deutschen Unterseewaffe. (Marine-Oberbaurat a. D. Dr. Gustav Berling aus Schwerin). M. Monatsh. 15 Jg., 1939, H. 178 S. 450.
- Bieneck-Küster, Kritische Beiträge zur Gesch. der Familie von Brandenstein. Der Herold, Neue Folge der Vierteljahrsschrift des Herold Bd. I, 1940, H. 5. S. 201 - 219. Mit einer Hauptstammtafel 1293 - 1587.


|
Seite 162 |




|
- Schmidt (Rudolf), Geschichte des Geschlechts von Buch. 1. Bd.: 407 S., 72 Tafeln. 2. Bd.: 361 S., 68 Tafeln. Eberswalde (Müller) 1939. 1940.
- Busch (Wolfg.), Zur Geschichte der Schulzenfamilie Busch I in Rodenberg. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 22. Jg., 1940, Nr. 3., S. 41 - 48.
- Bd., Kritische Bemerkungen zur Frage der Herkunft u. zum Wappen der Hauswirtsfamilie Busch II in Rodenberg. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 22 Jg., 1940, Nr. 3, S. 49 - 52.
- Schultze (Hugo), Aus dem Stammbuch des Georg Dedeken, 1590 - 95 Kapellan in Schönberg. Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg 21. Jg., 1939, Nr. 2, S. 25 - 32.
- Altvater, Ernst Dragendorff †. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock 21. Bd., 1939, S. 1 - 3.
- Mitt. des Geschlechtsverbandes vonFlotow. Nr. 5, Juli 1939.
- Perückenmacher Carl Leopold Friederichs in Crivitz (1733 - 1781) Fam.-Zeitschr. der Geschlechter Friederichs, Bd. 3, H. 10, 1940, S. 87.
- Schroeder (Edmund), Carl Graff, "der Bismarck des deutschen Kunstgewerbes". [geb. Grabow 4. Mai 1844]. Mitt. d. Altschülerschaft des Realgymn. u. d. Wilh.-Gustloff-Schule zu Schwerin, Nr. 18, März 1940 S. 513 - 519.
- Pohl (Franz Heinrich), Künder bäuerlichen Lebens. Zum 50. Geburtstag des Dichters Friedrich Griese am 2. Okt. [1940]. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 190, S. 182 - 185.
- Wenz (Gottfried), Karl Koppmann zum hundertsten Geburtstage. Hans. Gesch.-Bl. 64 Jg., 1940, S. 81 - 110.
- Waschinski (Emil), Der hamburgische Humanist und Syndikus Albert Krantz (1448 - 1517) als Pädagoge. Zeitschr. des Ver. für Hamburgische Gesch. 39. Bd., 1940, S. 139 - 178.
- Bd. [Buddin], Wer war Kühnel? Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 22. Jg., 1940, Nr. 2, S. 37 - 38.
- von Mettenheimner (Carl) 1824 - 1898. Werden, Wollen und Wirken eines alten Arztes in Briefen u. Niederschriften. Abhandl. zur Gesch. d. Medizin u. der Naturwissenschaften, Heft 35. Berlin (Emil Ebering) 1940. 551 S.
- Kurz (O.), Ein seltsamer Grabstein [des Kirchenökonomus Müller in Grabow, † 1851.]. M. Monatsh. 16. Jg. 1940 H. 181, S. 17 - 18.
- Buddin (Fr.), Wilhelm Neese. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 22. Jg., 1940, Nr. 3, S. 56 - 59.
- Oertzen-Blätter Nr. 14, Dez. 1939, 12 S. Nr. 15, Dez. 1940, 16 S.
- Mitt. des Fam.- u. Sippen-Verbandes der alten m. Familie Oldenburg. H. 1, April 1940, S. 1 - 32.
- Brügmann (Gerd), Stammtafel der m. Müllerfamilie (von der) Osten. Schwerin 1938 - 39. 41 S. in Maschinenschrift.
- v. Ravensche Fam.-Nachr., Nr. 50, 51, 1940 - 41. Darin: 19. Geschlechtsfolge.
- Karnatz (Ludwig), Sie [Luise Kuntze] soll im Tode Liebe ernten. Eine Reuterstudie. Bethlehemskalender 1940, S. 97 - 104.


|
Seite 163 |




|
- Mitt. über die Gesch. der Familien Rosenow Nr. 46, Sept. 1939, S. 653 - 680 [Abschluß des 1. Bd. von 1896 - 1939, hrsg. von Pastor Ludwig Rosenow] Nr. 47, Sept. 1940, S. 681 bis 692. [Die Bedeutung des Namens R.].
- Meyer (Ernst), Heinrich Schliemann, Großkaufmann u. Ausgräber. Das Reich, 1940, Nr. 32.
- Hübner (Rudolf), Vor 50 Jahren starb Schliemann. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 192, S. 223.
- Gosselck (Johs.), Ernst Schlüter. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 182, S. 30.
- Schmidt'sches Familienblatt [Nachr. des Fam.-Verbandes "Fam. Jacob Schmidt-Burg"]. Bad Doberan-Kröpelin (Alex Michaels). Nr. 4 (1940).
- Kärst (Otto), Das Leben eines m. Kolonialpioniers, [Wilhelm Schultz aus Ludwigslust]. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 180, S. 485 - 490.
- Hardow (Rudolf), Das Nürnberger Geschlecht der Stoy. (Nachkommen in M.-Strelitz). Der deutsche Roland 27. Jg.,1939, H. 7, S. 41 - 43.
Kulturgeschichte, Volkskunde.
- Nevermann (Hans), Das Museum für Völkerkunde in Rostock. Komm.-Pol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock 9. H., 1938, S. 14 - 17.
- Kothe (Irmgard), Fremde Hand über m. Land. "Odal", Monnatsschrift für Blut u. Boden, 9. Jg., 1940, H. 8, S. 613 - 618.
- Folkers (Johann Ulrich), Sinnbilder an alten m. Bauernhäusern. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 353 - 359.
- Lübeß (H.), Der Meister der Koggen. Beim m. Modellschiffbauer in Wismar. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 182 S. 26 - 28.
- Kurz (Oskar), Von alten Grabower Festen. Zeitschr. M., 34. Jg., 1939, H. 3/4, S. 182 - 184.
- Endler (Carl August), M.'e. Brautschachteln. Zeitschr. M. 33. Jg., 1940, H. 1, S. 27 - 30.
- Engel (Franz), Hausmarkenforschung in M. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 178, S. 438 - 441.
- Gosselck (Johannes), Die Pinnower Flurnamen. Ein Beispiel für die Entstehung u. Fortführung einer Flurnamenliste. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 2 S. 48, 49, 57 - 60.
- Buddin (Fr.), Flurnamen in Rodenberg. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 21. Jg., 1939, Nr. 3, S. 45 - 49.
Siedlung.
- Hollmann (Bruno), Von Biala nach M. Zeitschr. M. 34. Jg., 1939, H. 3/4, S. 173 - 175.
- Müller (Martha), Bei den M.'ern im ehemaligen Polen. Zeitschr. M., 35. Jg., 1940, H. 1, S. 2 - 8.
- Müller (Maria), Heimkehr der M.'er [aus Polen]. Zeitschr. M., 34 Jg., 1939, H. 3/4, S. 177 - 181.


|
Seite 164 |




|
Landeskunde.
- v. Bülow (K.), Ein Gang durch die erdgeschichtliche Landessammlung. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 378 - 383.
- v. Bülow (Kurd), Untergrund u. Jung-Weichselzeitliche Endmoränen im mittleren Norddeutschland (bes. in M.). Archiv des Vereins der Freunde der Naturgesch. in M., N.F., 13. Bd., 1938, S. 10 - 30.
- Engmann (Karl Friedrich), Untersuchungen über Vegetation u. Aufbau des Drispether Hochmoores u. über den Ablauf der nacheiszeitlichen Waldgeschichte auf dem jungdiluvialen Bodenflächen in Nordwest-M., Archiv des Ver. der Freunde der Naturgesch. in M., NF., 14. Bd., 1939, S. 109 - 122.
- Range (Paul), Ein geologisches Profil quer durch die Schönberger Mulde. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 22. Jg., 1940, Nr. 1, S. 10 - 11.
- v. Bülow (K.), 20 000 Jahre m. Wald. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, 177. H., S. 406 - 409.
- Bericht des Forstjunkers v. Jasmund vom 3. Dez. 1801 über die Beschaffenheit der Ratzeburger Forsten. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 22. Jg., 1940, Nr. 1, S. 3 - 9.
- Schultz (Karl Hermann), Waldbestand u. Forstwirtschaft im südwestlichen M. vom 16. bis 18. Jahrhundert. Diss. Rostock. Schwerin (Bärensprung) 1940. 27 S.
- v. Arnswaldt (Georg), Aus der Arbeit des Naturschutzes in M. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940. H. 2, S. 33 - 39.
- v. Arnswaldt, Neue Naturschutzgebiete in M., M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 188, S. 154 - 155; H. 190 S. 189 - 191.
- v. Arnswaldt. Die starken Eichen in M., M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 322 - 326.
- Bd., Die Törber Eiche. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 22. Jg., 1940, Nr. 1, S. 1 - 2.
- Held (Otto-Hermann), Bemerkenswertes aus der älteren ornithologischen Literatur M.'s. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 2, S. 52 - 55.
- Lübcke (W.), Die Vogelfreistätte "Großer Schwerin". Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 2 S. 55 - 57.
- Wachs (Horst), Naturschutz auch im Kriege! Die Vogelinsel Langenwerder bei Wismar. Kosmos, 1940, H. 6, S. 138 140.
- M. in Zahlen 1933 - 1938. Hrgb. vom M. Statistischen Landesamt. Sonderdruck aus d. Staatshandbuch für M. Schwerin (Nied. Beob.) 1939. 51 S.
Ortsgeschichte.
- Kerst (Manfred). Die Stadtformen M.'s u. ihre Entwicklung im 19. u. ihre Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Diss. Rostock. Gütersloh i. W. (Thiele) 1940. VII u. 52 S.
- Martens (Heinrich), Die "Martens-Stelle" in Altenhagen bei Kröpelin. M. Monatsh. 16. Jg., 1940 S. 89 - 92.
- Prüfer (Karl-Fr.), Vom Bauerndorf zum Stadtteil Rostocks. Aus der Gesch. des Dorfes Barnstorf. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 327 - 334.
- Farnow (Friedrich), Dodow. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 21. Jg., 1939, Nr. 2 S. 18 - 24.


|
Seite 165 |




|
- Beltz (Robert), Noch einmal Dodow. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 1, S. 25 - 27.
- Otto (Hermann), Italienische Baumeister in M.: Festung Dömitz. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 188, S. 147 - 150.
- Kurz (O.), Grabower Siegel u. Wappen. Sonderdruck aus der Eldezeitung vom 23. Nov. 1940, Nr. 276, 7 S.
- Schack, Die Geschichte des Dorfes Granzin im Kreise Hagenow. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 2 S. 43 - 47, 50, 51.
- Lorenz (Adolf Friedrich), Weiteres über die Baugeschichte des Schlosses Lübz. M. Jahrb. 103, 1939, S. 1 - 16.
- Rütz (Alfred), Neukloster im Mittelalter. "Die Spange", Jahrb. für d. Kreis Wismar 1940, S. 17 - 21.
- Meyer (Ernst), Berühmte Männer aus Neustrelitz [Schliemann, Riefstahl, Villatte, Kraepelin, Thoms, Much, Kundt, v. Engel]. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 178, S. 451 - 455.
- Kloock (Franz), Aus der Gesch. des Dorfes Perniek. "Die Spange", Jahrb. für d. Kreis Wismar 1940, S. 22 - 29.
- Schröder (Gertrud), Der Kampf der "Lübischen Dörfer" auf Poel und ihre Sonderrechte. 1803 - 1877. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 1, S. 17 - 24.
- Beltz (Robert), Zu Rerik. Zeitschr. M. 34. Jg., 1939, H. 3/4, S. 175 - 177.
- Krogmann (Willy), Rerik. M. Jahrb. 103, 1939, S. 77 - 84.
- Ploen, 550 Jahre Hauswirtsfamilie Renzow in Rodenberg, Stelle III. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg 21. Jg., 1939, Nr. 3, S. 41 - 44. [Nachdruck aus Schönberger Heimatkalender 1929].
- Bildnisse "Rostocker Bürgermeister". Rost. Rundschau. Juni - Juli 1937, S. 6 - 7. Aug. 1937, S. 18. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock 2. H., 1937, S. 15; 3. H., 1938, S. 16; 4. H., 1938, S. 17; 6. H., 1938, S. 19; 7. H., 1938, S. 26; 10. H., 1939, S. 23.
- Kühl (Kurt), Die Seestädte Rostock und Wismar im Ostseeverkehr. Diss. Rostock. Seestadt Rostock (Gottlieb Holst) 1939, 54 Seiten.
- Babendererde (Paul), Rostocks Seehandel während der Kontinentalsperre. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, Seite 41 - 51.
- Schröder (Walter Johannes), Wo lag der älteste Rostocker Seehafen? Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, S. 20 28.
- Fiesel (L.), Grabungen nach dem ältesten Rostocker Seehafen u. der Danskeborg. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, S. 29 - 32.
- Rohlack (Hans), Kautionsliste 1809 - 1810 [für Schiff und Ladung]. Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, S. 52 - 76.
- Schnitzler (Elisabeth), Das geistige u. religiöse Leben Rostocks am Ausgang des Mittelalters. Historische Studien, Heft 360, Berlin (Ebering) 1940. 130 S.
- Jakobs (Theodor), Rostocks Theatergeschichte. Komm.-Pol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 6. H., 1938, S. 8 - 10.


|
Seite 166 |




|
- Beckmann (Paul), Rostocker Straßennamen. Komm.-Pol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 2. H., 1937, S. 24 - 25; 3. H., S. 17 - 19, 21; 5. H., 1938, S. 14 - 15.
- Babendererde (Paul), Rostocker Hausmarken. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 3. H., 1938, S. 20 - 21.
- Becker (J.), Die vorgeschichtliche Abteilung des Rostocker Museums. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 9. H., 1938 S. 3 - 5; auch in Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, S. 88 - 90.
- Gräbke (Hans Arnold), Kunst- u. Kulturgeschichte Rostocks Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 9. H., 1938, S. 6 - 10.
- Pries (Arthur), Blücherplatz u. Blücherdenkmal in Rostock. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 8 H., 1938, Seite 14 - 21.
- Gräbke (Hans Arnold), Die Städtische Kunstsammlung [in Rostock]. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 9. H., 1938, S. 11 - 13.
- Gräbke (H. A.), Die geschichtliche Abteilung [des Rostocker Museums].Beitr. z. Gesch. d. Stadt Rostock, 21. Bd., S. 90 - 93.
- Gehrig (Oscar), AlteDarstellungen des Klosters zum Heil. Kreuz. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 4. H., 1938, S. 18 - 21.
- Gräbke (Hans Arnold) u. Babendererde (P.), Das Kloster zum Heiligen Kreuz. Komm.-Pol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 4. H., 1938, S. 2 - 16.
- Lembke (Gertrud), Die ersten Rostocker Lotterien 1519 u. 1524, dazu Lotterieankündigung von 1523. Beitr. z. Gesch. d.Stadt Rostock, 21. Bd., 1939, S. 77 - 87.
- Fiedler (W.), Dorfgeschichte von Sarmstorf (Kreis Gustrow) 1939.
- Tiedemann (Franz), Die "Smilower Döp" [Taufstein], angeblich aus der Schmilauer Kapelle, jetzt in der Ratzeburger Vorstadt Dermin. Mitt. f. d. Fürst. Ratzeburg, 21. Jg., 1939, Nr. 2, S. 33 - 34.
- v. Monroy (Ernst Friedrich), Das "Petermännchen"-Bild im Schweriner Schloß und seine ursprüngliche Bedeutung. M. Jb. 103, 1939, S. 67 - 76.
- Soldatentradition in Schweriner Straßennamen. M. Ztg. 6. u. 10. Febr. 1940, Nr. 31 und 35.
- Peek (H.), Die Gesch. des Dorfes Vogtshagen. Quellen zur bäuerlichen Hof- u. Sippenforschung, 1936, Okt., 30 Bl.
- Pries (Arthur), Ein Dorf veränderte sich [Wantzlitz bei Grabow]. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 368 - 370.
- Jacobs (Theodor) u. Riedel (Karl), Warnemünde von einst und von heute. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 7. H., 1938, S. 2 - 12.
- Gosselck (Johannes), Brauchtum u. Sitten [in Warnemünde] Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 7. H. 1938, S. 20 - 23.
- Riedel (K.). Über Warnemünder Hausmarken als Familien- u. Sippensymbole. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock, 7. H., 1938, S. 18 - 19.


|
Seite 167 |




|
- Gosselck (Johannes), Das Heimatmuseum in Warnemünde. Kommunalpol. Schriftenreihe der Seestadt Rostock 9. H., 1938, S. 18 - 19.
- Gosselck (Johannes), Ein m. Kulturbild aus dem Anfang des 18. Jahrhs. [betr. Pachtkontrakt mit Hans Lülke über den Krug zu Kl. Welzin 1712]. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 184, S. 71- 74.
- Horstmann (Hans), Wallenstein's Flotte vor Wismar. Eine flaggengeschichtliche Studie.Beitr. z. Gesch.d. Stadt Rostock 21. Bd., 1939, S. 33 - 40.
- Moeller (Toennies), Das neue Heimatmuseum der Seestadt Wismar M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 335 - 338.
- Albrecht (Edmund), Die Bevölkerungsbewegung einer m. Landgemeinde [Zittow] vom 17. bis zum 20. Jahrh. Archiv für Bevölkerungswissenschaft u. Bevölkerungspolitik X, 1940, H. 1, S. 33 - 45.
- Brinker (Fritz), Die Entstehung der "ritterschaftlichen Bauernschaften" in M. (Steder-Niendorf, Wendisch-Priborn, heute Freienhagen, Buchholz, Grabow, Zielow u. Rossow). Diss. Rostock 1939. Seestadt Rostock (Hinstorff) 1940. XI u. 163 S.
Kirche.
- Biereye (Wilhelm), eingehende Besprechung zu "Karl Jordan, Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. Leipzig 1939". In Zeitschr. für Lüb. Gesch. u. Alt.-Kunde Bd. 30, H. 2, S. 382 bis 386. - Vgl. die gesch. u. landesk.Lit. M.'s 1938 - 39, Nr. 34.
- Fischer-Hübner, Die Umwandlung des Domstifts Ratzeburg. [1504]. Mitt. d. Heimatb. f. d. Fürst. Ratzeburg, 22. Jg., 1940, Nr. 1, S. 12 - 14.
- Wittrock (Viktor), In Sturm u. Stille. Ein baltisches Pfarrerleben in bewegter Zeit [betr. auch M.] Schwerin (Friedrich Bahn) 1940, 304 S.
Universität, Schulen.
- Stieda (Wilhelm) † Alt-Rostocker Professoren. M. Jahrb. 103, 1939, S. 17 - 66.
- Altschülerschaft der John-Brinckman-Schule zu Güstrow: Unsere Schule 100 Jahre alt. Nachr.-Bl. der Schule Nr. 10, 1940, S. 175 - 214.
- Wiegandt (Max), Die Parchimer Friedrich-Franz-Schule (Oberschule f. J.) in den Jahren 1932 - 39. Parchim (Beyer u. Niehoff). [1939].
Kunst.
- Josephi (Walter), Adolf Friedrich von Schack u. Anselm Feuerbach. Original-Briefe des Künstlers u. seiner Mutter im Geh. u. H.-Archiv zu Schwerin. M. Jahrb. 103, 1939, S. 85 - 166. - Auch als Sonderdruck 1939, S. 1 - 82.
- Kleiminger (Wolfgang), Frühhanseatische Plastik in Wismar. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, S. 128 - 131.
- Lübeß (H.), Fabeltiere des Mittelalters [Schnitzwerke in St. Georgen zu Wismar] M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 371 - 374.


|
Seite 168 |




|
- Fischer (Kurt), Ein Baumeister zog durch das Land. [Philipp Brandin 1563 - 1594]. Sonntagspost des "Nied. Beob." vom 23. Juli 1939, Folge 30.
- Thöne (Friedrich), Franz Bunke. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 179, S. 467 - 471.
- Gehrig (Oscar), Ulrich Hotow, der Maler u. Graphiker. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 179, S. 467 - 471.
- Wohlfahrt (H. E.), Das Leben u. Schaffen des 70jährigen Güstrower Malers Heinrich Wilke. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, H. 180, S. 491 - 495.
Kriegs- und Militärgeschichte.
- Görlitz (Walter), Fürst Blücher von Wahlstatt Rostock (Carl Hinstorff) 1940. 455 S.
- Duderstadt (Henning), Helmut von Moltke an unsere Zeit. Zum 140. Geburtstag. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 190, S. 185 - 188.
- Haupt, Vor 25 Jahren. Die ersten Augusttage 1914. Mitt. d. Off.-Ver. Feld-Art.-Rgt. 60, 21. Jg., Nr. 102, 1939.
- Die Fahnen des II/89 u. III/89. Nachr.-Bl. des ehem. M. Grenadier-Rgts. 89, Nr. 67, April 1940, S. 1 - 3.
- Str. u. E., Kasernen ehemals u. heute in Schwerin u. Neustrelitz. Nachr.-Bl. des ehem. M. Grenadier-Rgts. 89, Nr. 68, Juli 1940, S. 2 - 4.
Münzkunde.
- Petersen (Ernst), Nordische Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit aus M. Zeitschr. M. 35. Jg., 1940, H. 2, S. 40 - 42.
- Löning (George A.), Muntepennige - eine mittelalterliche Abgabe in Norddeutschland. Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abt. 59. Bd., 1939, S. 273 bis 277.
Recht.
- Glatz (Carl Heinrich), Die Entwicklung des Freiheitsstrafvollzuges in M. Diss. Rostock. Rostock (Carl Hinstorff) 1940. 105 Seiten.
Sprachwissenschaft, Literaturgeschichte.
- Krogmann(Willy), Warum das Niederländische uns verwandt klingt. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, S. 125 - 127.
- Rust (Wilhelm), John Brinckmans Brautbriefe. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, S. 360 - 364.
- Sauber (Wilhelm), Fritz Reuters Leben u. Werke im Spiegel des Nationalsozialismus. M. Monatsh. 16. Jg., 1940, H. 182, S. 20 - 25.
- Schwentner (Ernst), Fritz Reuter und Jacob Grimm. Korr.-Blatt d. Ver. für niederdeutsche Sprachforschung, Jg. 1940, H. 53/3, S. 33 - 36.
- Otto (Hermann), Fritz Reuters Dichtung "Kein Hüsung" in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. M. Monatsh. 15. Jg., 1939, 177. H., S. 414 - 419.


|
Seite 169 |




|
Alphabetisches Verzeichnis
A ltenhagen 68.
B
arnstorf 69.
Bauernhäuser 42.
Becker (Otto) 10.
Berling (Gustav) 11.
Bibliographie 1.
Blücher Fürst 129.
Blücherdenkmal 95.
v. Brandenstein (Fam.)
12.
Brandin (Philipp) 125.
Brautschachteln 45.
Brinckman (John)
138.
v. Buch (Geschlecht) 13.
Buchholz
115.
Bunke (Franz) 126.
Busch (Fam.)
14. 15.
D
amm 3. 4.
Dedeken (Georg) 16.
Dodow 70. 71.
Dömitz 72.
Dragendorff
(Ernst) 17.
Drispeth 54.
v. E ngel (Fam.) 77.
F
amiliengeschichte 9 ff.
Feuerbach
(Anselm) 122.
v. Flotow (Geschlecht)
18.
Flurnamen 47. 48.
Freienhagen
115.
Friederichs (Carl Leopold) 19.
Fürstenhaus 8.
G
eschichte 7.
Grabow 44. 73.
Grabow (Dorf) 115.
Graff (Carl) 20.
Granzin 74.
Griese (Friedrich, Dichter)
21.
Güstrow 120.
H
ausmarken 46. 92. 109.
Hausurnen
6.
Heinrich der Löwe 116.
Hotow
(Ulrich, Maler) 127.
K
irche 116 ff.
Koggen 43.
Kontinentalsperre 85.
Koppmann (Karl)
22.
Kraepelin (Fam.) 77.
Krantz
(Albert Humanist) 23.
Kriegsgeschichte 129
ff.
Kühnel 24.
Kulturgeschichte 40 ff.
94. 111.
Kundt (Fam.) 77.
Kunst 94.
96. 122 ff.
Kuntze (Luise) 32.
L
andeskunde 52 ff.
Langenwerder
(Insel) 65.
Literaturgeschichte 138
ff.
Lübz 75.
Lülke (Fam.) 111.
M
artens (Fam.) 68.
v. Mettenheimer
(Carl, Arzt) 25.
Militärgeschichte 129
ff.
v. Moltke (Helmut) 130.
Much
(Fam.) 77.
Müller (Kirchenökonomus)
26.
Münzkunde 134. 135.
Museen 40. 93.
97. 110. 113.
N
aturschutz 59.60. 65.
Neese
(Wilhelm) 27.
Neukloster 76.
Neustrelitz 77.
Steder-Niendorf 115.
v.
O
ertzen (Fam.) 28.
Oldenburg
(Fam.) 29.
Ortsgeschichte 67 ff.
(v.
d.) Osten (Fam.) 30.
P
archim 121.
Perniek 78.
Personengeschichte 9 ff.
Pinnow 47.
Poel 79.
Wendisch-Priborn 115.


|
Seite 170 |




|
R
atzburg 10. 57. 117.
v. Raven
(Fam.) 31.
Recht 136.
Renzow (Fam.)
82.
Rerik 80. 81.
Reuter (Fritz) 32.
139 - 141.
Riefstahl (Fam.) 77.
Rodenberg 48. 82.
Rosenow (Fam.) 33.
Rossow 115.
Rostock 7. 40. 52. 69. 83 -
100. 119.
S
armstorf 101.
v. Schack (Adolf
Friedrich) 122.
Schliemann (Heinrich) 34
35. 77.
Schlüter (Ernst) 36.
Schmidt
(Fam.) 37.
Schmilau 102.
Schönberg
55.
Schulen 120. 121.
Schultz
(Wilhelm, Kolonialpionier) 38.
Schwerin
103. 104.
Siedlung 39 ff.
Sprachwissenschaft 137.
Stoy (Geschlecht) 39.
T
heater 90.
Thoms (Fam.) 77.
Törber 62.
U niversität 119.
V
ilatte, (Fam.) 77.
Vogtshagen
105.
Volkskunde 2. 40 ff.
Vorgeschichte 2 ff. 93.
W
allenstein 112.
Wantzlitz 106.
Wappen 73.
Warnemünde 107 - 110.
Kl.
Welzin 111.
Wilke (Heinrich, Maler)
128.
Wismar 84. 112. 113. 123. 124.
Wismar (Kreis) 5.
Z
ielow 115.
Zittow 114.
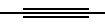


|
Seite 171 |




|



|



|
|
:
|
IV.
Zur Petermännchen-Sage.
Durch einen glücklichen Fund konnte Ernst Friedrich von Monroy (Meckl. Jahrb. CIII, S. 67 f.) nachweisen, daß die Persönlichkeit auf dem Quid-si-sic-Gemälde des Schweriner Schlosses nicht den Schloßgeist darstellt. Weiter wies von Monroy darauf hin, daß die älteste erhaltene schriftliche Nachricht über den Schloßgeist vom 12. November 1747 weder Beziehungen zu jenem Bilde habe, noch den Namen "Petermännchen" kenne. Beides sei demnach ein Ergebnis der Volksphantasie erst nach dem Jahre 1747.
Inzwischen fand ich eine noch ältere Erwähnung des Schloßgeistes in einem Briefe vom 27. Januar 1705, der mit dem Strelitzer Archiv (I, 543) in das Geheime und Hauptarchiv zu Schwerin gelangte:
Johann Knegendorff an Herzog Adolf Friedrich II. von Mecklenburg-Strelitz.
Güstrow, den 27. Jan. 1705.
Durchleuchtigster Herzog
Gnädigster Fürst und Herr.
. . . Man will alda 1 ) das Schloß erweitern und vergrößern, das Dach auch abnehmen laßen und das Maurwerck höher aufführen. Es soll sich alda, wie ich numehro für gantz gewiß erfahren, ein kleiner Mann sehen laßen,welcher anfangs ein schwartzes Kleid gehabt, anitzo aber im weißen Kleide erscheinen soll: Er soll zweyen Laquayen schon tüchtige Orfeigen gegeben haben . . .
Ew. Hochfürstl. Durchl.
Untertänigst-Treu-Gehorsamster Diener


|
Seite 172 |




|
Auch in dieser Erwähnung finden sich keine Beziehungen zum Quid-si-sic-Bilde, ebenso wenig kennt man den Namen "Petermännchen", bezeichnet den Geist vielmehr nur als einen "kleinen Mann" (1747: "kleines Mängen").
Walter Josephi.


|
[ Seite 173 ] |




|


|
[ Seite 174 ] |




|
