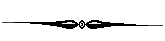|
[ Seite 1 ] |




|



|
|
:
|
I.
Studien zur Geschichte des
Herzogs
Christian (Louis) (1658 - 1692)
von
Gymnasial=Professor Dr. Richard Wagner.
II.
Herzog Christians Bündnis mit Frankreich und zweite Ehe.
1. Seine Motive für das französische Bündnis= und Eheprojekt.
D ie ersten Regierungsjahre des Herzogs Christian fallen noch in die Zeit des schwedisch=polnischen Krieges, der im Jahre 1660 durch den Frieden zu Oliva beendet ward und in den letzten Jahren vor dem Friedensschluß gerade über Mecklenburg, als es kaum anfing, sich von den Drangsalen des dreißigjährigen Krieges zu erholen, wieder neue schwere Leiden brachte. Von Wismar aus erpreßten die Schweden mancherlei Lieferungen, und einmal gelangte ein schwedisches Heer vom Nordosten des Landes her bis über Bützow hinaus; noch weit höher aber waren die Kosten, noch weit schlimmer die Unbilden, die dem Lande durch die Armeen der verbündeten Gegner Schwedens verursacht wurden, die nicht nur, was sie zu ihrem Unterhalte brauchten, mit rücksichtstloser Gewalttätigkeit ohne Bezahlung einforderten, sondern sich die ärgsten Plünderungen und Exzesse zuschulden kommen ließen, 1 ) obgleich beide mecklenburgischen Fürsten sich streng neutral hielten.
Herzog Christians fürstliches Selbstgefühl ward durch diese Behandlung empfindlich verletzt; die Reichsverfassung gab ihm indessen Anspruch auf Entschädigung, und er säumte denn auch


|
Seite 2 |




|
nicht, entsprechende Forderungen am Kaiserhofe zu stellen. Als er mit kühlem Achselzucken abgewiesen ward, beruhigte er sich keineswegs dabei, wie sein Güstrower Vetter, Herzog Gustav Adolf, der dieselbe Not gelitten, vielmehr bildet die Satisfaktionsforderung fortdauernd den Angelpunkt seiner politischen Entwürfe, und er hielt um so zäher daran fest, als eine ausreichende Geldsumme auch noch in mehr als einer andern Beziehung für ihn nützlich werden konnte.
Auf Grund des Testaments Adolf Friedrichs erhoben die jüngeren Brüder Christians Ansprüche auf die beiden im Jahre 1648 mit der Schweriner Landeshälfte vereinigten Fürstentümer Schwerin und Ratzeburg. 2 ) Auch diese Streitfrage hatte ihre politische Seite. Es handelte sich darum, ob endlich die Primogenitur in Mecklenburg zur Geltung kommen oder ob die Zerstückelung des fürstlichen Besitzes noch verschlimmert und für unabsehbare Zeit verlängert werden sollte. Nun hatten sich die Brüder nicht abgeneigt gezeigt, gegen eine entsprechende Geldentschädigung von ihren Ansprüchen auf die beiden Fürstentümer abzusehen, aber woher bei dem Zustande des Landes und der fürstlichen Kassen diese Summe nehmen? Auch die Herzogin=Witwe Marie Katharina hatte noch beträchtliche Geldforderungen an den regierenden Herrn, dazu hatte Christian am Anfang seiner Regierung die von seinem Vater verpfändeten fürstlichen Ämter und Höfe eigenmächtig einziehen lassen, sich aber dadurch eine Unzahl von Prozessen zugezogen, die sämtlich für ihn ungünstig verliefen. Auch hier konnte eine größere Geldsumme, welche die Mittel bot, die Forderungen der Herzogin zu befriedigen und die verpfändeten Güter einzulösen, alles ebnen und so dem Herzog die ersehnte Ruhe verschaffen.
Vom Kaiser abgewiesen, suchte er andere Freunde zu gewinnen, um so eifriger, als er der Freundschaft Mächtigerer aus vielen Gründen bedurfte. Sie konnte die sämtlichen schon erwähnten Streitfragen zu seinen Gunsten entscheiden helfen, sie konnte ihm in den Zwistigkeiten, in die er mit Herzog Gustav Adolf geraten war, einen Rückhalt bieten, vielleicht auch seine Stände ihm fügsamer machen. Er besuchte deshalb persönlich den Deputationstag, der unter dem Vorsitz des Kurfürsten von Mainz in Frankfurt tagte, 3 ) und richtete von hier aus unter


|
Seite 3 |




|
dem 20. Januar 1660 Schreiben an das gesamte Kurkollegium wie an die einzelnen Kurfürsten, in denen er um Unterstützung seiner Satisfaktionsforderung bat, insbesondere schloß er sich an den Kurfürsten von Mainz, den tatkräftigen Johann Philipp v. Schönborn, an, der ihn auch mehrfach seiner Unterstützung versicherte, ohne freilich diese Versicherungen sogleich in die Tat umsetzen zu können. Eine Reise nach Holland im Jahre 1661 benutzte er, um bei Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg in Cleve vorzusprechen und sich mit ihm in ein näheres Einvernehmen zu setzen. Er fand auch bei ihm eine Aufnahme, die ihn sehr befriedigte, und Friedrich Wilhelm bewilligte ihm eine Allianz, in der sich beide wechselseitigen Beistand versprachen (datiert vom 3. Oktober 1661). 4 ) In einem Schreiben, das er am Tage nach Abschluß dieses Bündnisses an seine Räte sandte, bezeichnet er als Motiv für diese Allianz den Wunsch, daß er "auf alle Fälle einen Rücken haben möge, zumal wenn ihm was angemutet werden sollte, so ihm, seinem Estat und Land und Leuten zum Präjudiz, Schaden und Nachteil gereichen könnte, darwider ihn S. Libd. maintenieren wollen", und ordnet an, daß die Räte für Friedrich Wilhelm eine kurze Information über die verschiedenen Angelegenheiten, die ihn damals belästigten, fertigen sollen. Allein, so nützlich ihm die Allianz mit dem mächtigen Nachbar in mancherlei Hinsicht, z. B. gegenüber Exekutionsbeschlüssen in den Pfändungsprozessen oder auch in seinen Streitigkeiten mit dem Güstrower Vetter und mit der Herzogin=Witwe und seinen Geschwistern, werden konnte: für seine Kriegsentschädigungsforderungen hatte er von Friedrich Wilhelm, der ja selbst zu den Kriegführenden gehört hatte, keine Unterstützung zu erwarten. Und eben war zu den früheren Beschwerden noch eine neue hinzugekommen, gegen die ebenfalls Brandenburg, selbst wenn es gewollt hätte, keine Abhülfe hätte schaffen können: die Schweden hatten im Juni 1661 die Schanze in Warnemünde, von der aus sie auch nach dem Westfälischen Frieden die Zahlung des Seezolles erzwungen hatten, die aber im verflossenen Kriege zerstört war, wieder aufgebaut, 5 ) die Vogtei in Warnemünde


|
Seite 4 |




|
gewaltsam erbrochen 6 ) und ihren Lizent=Einnehmer wieder eingesetzt, der nun den Zoll wieder erhob. Ein in Wien eingegebenes Memorial erzielte nur den Beschluß, die Sache sei zu vertagen (differatur). Aber auch Brandenburgs Macht reichte nicht aus, um Schweden zum Nachgeben zu zwingen und diesen Krebsschaden, unter dem Rostocks früher so blühender Handel und Wohlstand dahinsiechte, zu beseitigen.
Und endlich gab es noch eine Angelegenheit persönlicher Art, die den Herzog auf das höchste interessierte, in der er aber von Friedrich Wilhelm bisher keine Förderung seiner Absichten erfahren und auch keine zu erwarten hatte: die Trennung von seiner Gattin Christine Margarete. Christian sah die Scheidung als vollzogen an, sobald die Frist von zwei Monaten, die der Spruch des Schweriner Ehegerichtes vom 19. Oktober 1660 der Gattin für ihre Rückkehr zu ihm gesetzt hatte, verstrichen war; 7 ) allein weder die Geschiedene noch ihr Bruder, Herzog Gustav Adolf v. Güstrow, noch ihre Wolfenbütteler Anverwandten, noch selbst Christians Brüder erkannten den Spruch als zu Recht bestehend an. Auch Kurfürst Friedrich Wilhelm hegte die gleiche Anschauung. Christian aber wünschte sich möglichst bald wieder zu vermählen in der Hoffnung, daß ihm noch Kinder geschenkt werden würden. Auf welchem Wege war die Erfüllung dieses seines Wunsches zu erreichen? Einen Weg gab es, auf den er schon oft aufmerksam gemacht war. Oft genug schon war ihm vor seiner Thronbesteigung von katholischer Seite eingeflüstert worden, der Papst werde sich bereit finden lassen, seine Ehe für ungültig zu erklären, wenn er zum allein seligmachenden Glauben übertrete, und es hatten bereits französische Eheprojekte, wenn auch geheimnisvoll=phantastischer Art, gespielt. 8 ) Christian hatte sie in der ersten Zeit nach seiner Thronbesteigung, als er einen letzten Versuch machte, sich mit seiner Gattin wieder zu einigen, ruhen lassen, jetzt nahm er sie wieder auf. Schon von seinem früheren Aufenthalt in Frankreich her hegte er eine


|
Seite 5 |




|
Vorliebe für französisches Wesen, und somit faßte er, als ihm die Werbung um eine katholische Prinzessin deutschen Ursprungs nicht geglückt war, 9 ) im Ernst die Vermählung mit einer französischen Prinzessin ins Auge. Um sie zu erreichen, entschloß er sich, das Opfer des Übertritts zu bringen. Seine neue französische Gattin sollte ihm dann den französischen Hof gewinnen helfen, daß er ihm in seinen Bedrängnissen seine Unterstützung lieh. Denn wer anders konnte ihm helfen als eben Frankreich, schon damals ganz unbestritten die erste Macht in Europa, und sein junger König Ludwig XIV., der eben nach dem Tode seines Beraters Mazarin die Zügel der Regierung selbst in die Hand genommen hatte? Frankreich konnte helfen, wenn es wollte, und es war auch zu erwarten, daß es wollen würde. Hatte es doch durch die sogenannte Rheinische Allianz seit dem Jahre 1658 bereits eine ganze Anzahl deutscher Staaten an sich gefesselt. 10 ) Warum sollte es den Mecklenburger Herzog abweisen, wenn er sich der Zahl dieser Klienten anzureihen wünschte? Wirksamer freilich als der Beitritt zur Rheinischen Allianz mit ihren allgemein gehaltenen Bestimmungen mußte für Christian der Abschluß eines besonderen Schutzvertrages mit spezielleren Bestimmungen sein. Aber vielleicht ließ sich auch dieser erreichen, wenn Christian den französischen Hof durch seinen Übertritt zum Katholizismus und eine französische Heirat günstig stimmte und seine Gattin ihren Einfluß für ihn aufwandte. Schon gleich nach seiner Thronbesteigung war Christian nahegelegt worden, sich an Frankreich anzuschließen. 11 ) Damals hatte er noch gehofft, sich selbst ohne fremde Unterstützung helfen zu können. Nun, da er eingesehen, daß dies unmöglich war, richteten sich seine Augen wieder auf Frankreich, und mit dem Plan, sich unter Frankreichs Schutz zu stellen, verband sich der Wunsch, von seinen Ehenöten befreit zu werden und eine zweite Vermählung zu schließen zu einem untennbaren Ganzen, dessen einzelne Glieder - der Übertritt, die Vermählung und das Bündnis - sich gegenseitig bestimmten und bedingten. Denn wenn er von einer


|
Seite 6 |




|
französischen Heirat einen günstigen Einfluß auf seine Beziehungen zu König Ludwig erwartete, so bedurfte er umgekehrt, sobald er, der Fürst eines norddeutschen, von protestantischen Territorien umgebenen Landes, katholisch wurde, eben deshalb noch mehr wie bisher, damit ihm der Übertritt zum Katholizismus nicht seine Stellung zu seinen Untertanen und seinen Nachbarn vollends verdürbe, eines starken Rückhaltes, den wiederum Frankreich bieten konnte. Wenn aber einmal Frankreich gewonnen war, warum sollte es nicht möglich sein, selbst die inneren Verhältnisse Mecklenburgs mit seiner Hülfe nach Christians Wünschen umzugestalten? In Frankreich hatte sich das absolute Fürstenregiment durchgesetzt. War Christian erst des Königs Verwandter, warum sollte es nicht gelingen, diesen zu bewegen, daß er den Widerstand der mecklenburgischen Stände brechen und auch dort den Absolutismus einführen half? Eine Vorbedingung dafür war die Auflösung der Kommunion, die den Schweriner Landesteil an den Güstrower fesselte und jede Selbständigkeit der Landesverwaltung unterband. Und war nicht eigentlich Herzog Christian nach dem Testamente Johann Albrechts I. der rechtmäßige Herrscher über das ganze Land? Nach seiner eigenen Anschauung wenigstens war sein Vater überhaupt nicht befugt gewesen, zum Nachteil seiner Nachfolger in die Teilung zu willigen. Der Wiener Hof hatte sich allerdings dieser Anschauung nicht angeschlossen und dem Güstrower Herzog trotz der Remonstrationsversuche Christians die Belehnung erteilt, aber vielleicht war auch hierin König Ludwig zum Eintreten für Christian, wenn dieser katholisch und sein Verwandter wurde, zu bewegen; schon, wenn sich nur die Kommunion beseitigen ließ, war viel gewonnen. So verbanden sich in Christians Erwägungen zahlreiche Gedankengänge, um ihn in seinem dreifachen Plan zu bestärken. Anfang 1662 war er mit sich im Reinen und entschlossen, selbst nach Frankreich zu gehen und alles dort persönlich zu betreiben; denn so meinte er am besten und schnellsten zum Ziele zu kommen. Da aber eine Reise an den französischen Hof nicht ratsam war, ohne daß er vorher einer einer guten Aufnahme versichert war, so sandte er zunächst seinen Kammerjunker Nikolaus v. Bünsow 12 ) voraus, um ihm selbst die Wege zu ebnen und sich zugleich nach einer passenden Frau für ihn umzusehen. (März 1662.)


|
Seite 7 |




|
2. Bünsows Sendung nach Paris.
Bünsow reiste zuerst in die Niederlande nach Brüssel, um dort den französischen Diplomaten Grafen de Fruges aufzusuchen, mit dem Christian bereits Verbindung angeknüpft hatte. Er brachte eine Instruktion mit (datiert vom 21. März 13 ), nach der er dem Grafen im Vertrauen mitteilen sollte, er habe Auftrag, sich um die Protektion des Königs Ludwig als Garanten des Westfälischen Friedens zu bewerben. Den Anknüpfungspunkt für die Bitte sollte der Hinweis auf Christians frühere Kriegsdienste für Frankreich bieten, als Motiv des Gesuches werden die erlittenen Kriegsdrangsale und der Wunsch nach künftigem Schutz angegeben. Auch ein Schreiben des Herzogs an den König hatte Bünsow bei sich und ersuchte Fruges im Auftrage seines Herrn, mit ihm zusammen nach Paris zu reisen, das Schreiben dem Könige zu übergeben und die Verhandlungen mit ihm einzuleiten. Von dem Vermählungsplane und dem Übertritt war in der offiziellen Instruktion nicht die Rede; daß es sich aber auch um die Heirat handelte, daß ferner Christian schon damals völlig entschlossen war, um sie zustande zu bringen, die Religion zu wechseln, falls es gewünscht wurde, ersieht man aus einer geheimen Nebeninstruktion für Bünsow, die der Herzog am selben Datum, dem 21. März, eigenhändig in Stintenburg niedergeschrieben hat und die zugleich ein dokumentarischer Beleg für die Erwartungen ist, die er an die Verbindung mit Frankreich knüpfte. Sie lautet (mit einigen Kürzungen):
1. "Damit diese Heirat desto besser glücken möge, kann Er mein Ihm wohlbekanntes Gemüt und humeur dergestalt beschreiben, daß meine Intention dahin gehet, einig und allein der Prinzeß zu Gefallen zu sein, ihr Interesse, es mag auch bestehen worin es immer wolle, von allen meinen Kräften zu befördern, mir äußerst werde angelegen sein lassen, und damit der Religion halber keine Diffikultät vorfallen möge, werde ich mich auch hierin also erweisen, daß deswegen keine Uneinigkeit noch Streit zu vermuten"; dafür erwartet er "alle Satisfaktion zu Konservierung meines Estats und Juris primogeniturae, denn von Gott= und Rechtswegen mir das ganze Land und Regierung zu


|
Seite 8 |




|
führen allein gebührt, hat mir bis dato nur an Gelegenheit und Mitteln ermangelt, solches zu maintenieren, wozu hoc modo leichtlich zu gelangen, - und kann aus dieser Heirat eine gar große Revolution zu der Demoiselle höchsten Vergnügung erfolgen, mehr avantage zu geschweigen, so pro tempore et loco seiner Prudenz nach nebenst dem Comte de Fruges Er leichtlich wird finden können.
2. Ich lasse mir auch gefallen, in Frankreich, wo es begehrt wird, zu subsistieren, ich werde mir alles gefallen lassen (!) und allemal complaisant im höchsten Grad mich zu erweisen haben, Gott wolle mir einen glücklichen Fortgang gnädiglich gönnen und verleihen, damit ich einmal zum rechten Stand kommen möge."
3. Bünsow soll zusehen, daß es nicht auf die lange Bank geschoben werde, "denn Er wohl weiß, in was terminis es sonsten mit mir steht, welches aber billig diesem Großen wird weichen müssen. Wie meine Depense und Estat bei meiner Gott gebe glücklichen Überkunft honorablement den anderen Prinzen soviel möglich gleich zu machen, dessen wird Er sich zum genausten informieren."
Diese eigenhändige Auslassung bezeugt auf das deutlichste, wie trübe Herzog Christian damals seine Lage ansah, wie ihm die französische Allianz und Heirat als der letzte Rettungsanker, der ihn allein noch vor dem Untergang schützen könnte, erschien, und welche Wendung seines Schicksals er davon erwartete. Bezeichnend ist auch seine Bereitwilligkeit, wenn es verlangt werde, mit seiner neuen Gattin in Frankreich dauernd Wohnung zu nehmen; für ihn wäre das kein Opfer gewesen, denn, wie er selber in einem Schreiben an Bünsow (vom 8. September 1662) sagt, sein eigener "humeur" war "auch mehr französisch". 14 )
Als künftige Gattin hatte er bereits eine bestimmte Prinzessin ins Auge gefaßt, Marie Marguerite Ignace d'Elboeuf de Lorraine,


|
Seite 9 |




|
die im Alter von 24 Jahren stand. In ihrer Umgebung befand sich eine Schwester des Grafen Fruges, somit darf man vermuten, daß Christian eben durch den Grafen Fruges auf die Prinzessin aufmerksam gemacht war.
Bünsow fand den Grafen denn auch zu dem gewünschten Dienste bereit, und der Herzog sandte nun noch ein Kreditiv für den Grafen selbst (datiert Bützow, den 22. April) mit einem lateinischen Memorial, in dem er um Satisfaktion und Schutz bittet und dafür alle denkbare Unterstützung der Interessen des französischen Königs verspricht. 15 )
Nach Paris, wohin sich beide Abgesandte nun aufmachten, wurde ihnen noch der Spruch des Ehegerichts vom 19. Oktober 1660 nachgeschickt. Dem Begleitschreiben fügte Christian die Nachschrift bei: "Ich bin bereit, so bald es begehrt wird, cito dahin zu kommen."
Mitte Juni hatte der Graf Audienz beim König, übergab Christians Schreiben und brachte dessen Anliegen vor. Der König nahm es nicht unfreundlich auf und forderte alsbald eine Landkarte, um sich die Lage von Mecklenburg darauf anzusehen; er meinte dann allerdings, ob der Herzog nicht in die vorhandene Allianz eintreten wolle, befahl aber doch dem Staatssekretär de Lionne, dem damaligen Leiter der auswärtigen französischen Politik, mit dem Grafen weiter zu verhandeln. Die Antwort Lionnes aber war ähnlich wie die des Königs selbst. Man lehnte es ab, Herzog Christian eine besondere Allianz zu bewilligen und ihm spezielle Protektion zuzusichern; hierfür sei sein Land zu abgelegen, und der König würde dergestalt etwas versprechen, was er nicht werde halten können. Aber "durch seine Alliierten (von der Rheinischen Allianz) S. Fürstl. Durchlaucht zu assistieren, könnte wohl geschehen." Man werde auch an Monsieur de Gravel - den französischen Gesandten beim Deputationstage in Frankfurt und nachher beim Reichstage in Regensburg - deswegen Ordre erteilen, um sich bei den Alliierten darüber zu informieren. Über das Eheprojekt schrieb Bünsow in demselben Berichte (vom 15. Juni), in dem er diese Resultate meldete, es sei jetzt nicht à propos, Mademoiselle wolle gern den Herzog von Savoyen heiraten, dessen Mutter habe dies bisher verhindert, sei aber


|
Seite 10 |




|
schwer krank. Übrigens machte die Prinzessin auf Bünsow keinen günstigen Eindruck, sie habe zwar, schrieb er den 29. Juni, eine schöne Figur, aber sei im Gesicht sehr mager und sehe sehr alt aus, dazu sei sie - wenigstens damals, wohl aus Liebeskummer - alle Zeit melancholisch, spreche wenig und sei selten guter Laune.
Der mündlichen Antwort des Königs entsprach ein freundliches Schreiben desselben an den Herzog, datiert Paris, den 13. Juni 1662, worin er ihn, ohne in Einzelheiten einzugehen, seines königlichen Schutzes versichert, 16 ) auch die versprochene Order an Gravel ging ungesäumt nach Frankfurt.
Waren auch Christians Erwartungen nicht ganz erfüllt, insofern man ihm keine besondere Allianz bewilligen wollte, so benutzte er doch bereitwillig das Entgegenkommen des Königs, um weiter zu verhandeln, und beließ zu diesem Zwecke Bünsow in Paris, während Graf Fruges wieder nach den Niederlanden zurückreiste. Zugleich wies der Herzog seinen Bevollmächtigten auf dem Frankfurter Deputationstage, Rat Hagemeier, an, bei Gravel und dem Kurfürsten von Mainz seine Aufnahme in die Rheinische Allianz zu betreiben. Hier in Frankfurt ließ sich auch anfangs alles recht gut an. Nach einem Berichte des Rates vom 12. Juli hatte Gravel damals bereits Befehl erhalten, Herzog Christian "quovis modo zu assistieren", und versprach alle guten Dienste. Auch der Erzbischof von Mainz zeigte, wie schon früher, so auch jetzt, freundliches Entgegenkommen, auch andere Gesandte von Mitgliedern der Rheinischen Allianz machten keine Schwierigkeiten; doch verging der Sommer über den vorbereitenden Verhandlungen, auch fehlte es noch an einer Vollmacht für den formellen Antrag um Aufnahme in die Allianz, die erst den 30. September d. J. von Christian in Ratzeburg ausgestellt wurde. Doch gelang es Hagemeier noch vor dem Schlusse der Frankfurter Tagung (Ende 1662), die Zustimmung sämtlicher Mitglieder der Allianz für die Rezeption zu erwirken mit Ausnahme des Hauses Braunschweig=Lüneburg, dessen Gesandter, Dr. Alexandri, sich entschuldigte, er habe noch keine Instruktion, sein Herr, der Herzog von Wolfenbüttel, werde aber nicht unter=


|
Seite 11 |




|
lassen, sich mit den beiden andern lüneburgischen Höfen, Celle und Hannover, deswegen in Verbindung zu setzen. Diese Zögerung war Absicht: Wolfenbüttel, wie bei seiner Stellung zu Christian, besonders in der Ehefrage, begreiflich ist, 17 ) war gegen dessen Aufnahme in die Allianz und brauchte nur sein Votum dauernd zurückzuhalten, um sie zu hintertreiben, da zu der Aufnahme eines neuen Mitgliedes nach den Satzungen der Allianz die einmütige Zustimmung sämtlicher Glieder gehörte. Das Jahr 1662 ging also zu Ende, die Tagung zu Frankfurt schloß und der Reichstag zu Regensburg begann, ohne daß Christians Antrag genehmigt war. Hagemeier bezog auch den Reichstag und übernahm es, auch dort die Aufnahme weiter zu betreiben. Außerdem sandte Christian seinen geschicktesten Diplomaten Michael Albrecht von Schwaan nach Regensburg, um dort für ihn in seinen verschiedenen Angelegenheiten tätig zu sein; aber auch diesem gelang es nicht, die Zurückhaltung von Wolfenbüttel zu überwinden.
Inzwischen war es Bünsow in Paris nicht viel besser gegangen. Er war dort mit einem Jesuitenpater, Joscelin des Desserts, in Verkehr getreten, mit dem er öfter über die Ehescheidung sprach. Der Pater riet zum Religionswechsel, um den Schutz des Königs zu gewinnen (d. 3. August). Um dieselbe Zeit suchte sich ein Marquis de Guidanes oder Gudanes - so schreibt er sich selbst -, ein gewissenloser Abenteurer, an Christian anzunesteln mit allerlei Versprechungen, er wolle eine Ehe zwischen ihm und einer Prinzessin, die sehr schön und noch jung und eine rechte Cousine des Königs sei, zustande bringen; die Dame zu nennen, weigerte er, bis Christian Dispensation von Rom habe, suchte aber den Herzog zu einer Zusammenkunft mit ihm in Antwerpen zu veranlassen, wo er ihm mündlich von der Prinzessin, mit der er schon gesprochen habe, weitere Eröffnung tun wollte. Da aber zu gleicher Zeit der Graf Fruges von einer längeren, nicht ungünstig verlaufenen Unterredung seiner Schwester mit der Prinzessin von Elboeuf über Herzog Christian berichtete, so ließ sich der Herzog auf die Reise nach Antwerpen nicht ein, deren Nutzen doch sehr fragwürdig war. In betreff des Übertrittes waren ihm Bedenken gekommen, er könne wegen seines Landes so auf den Sturz nicht geschehen, man könne


|
Seite 12 |




|
sonst sagen, er hätte es einer Dame zu Gefallen getan. Keinesfalls wollte er, wie er den 4. August schreibt, auf das bloße Reden des Paters hin die Religion wechseln, 18 ) er wünschte vielmehr, daß erst mit dem Könige "etwas Fruchtbarliches zum Effect gebracht werde; wenn er dann selber komme, würden die Sachen sich anders schicken." Das heißt: Er scheute sich, ohne bestimmtere Zusicherungen des Königs den Übertritt zu wagen, der ihm ohne festen Rückhalt an diesem seine ganze Stellung im Lande und seinen Nachbarn gegenüber verderben konnte. Er hatte das Schreiben des Königs vom 13. Juni am 17./27. Juni mit einem Dank für den günstigen Bescheid beantwortet und dabei angefragt, ob es dem König angenehm sein werde, wenn er selber dorthin komme, um ihm seinen Respekt zu beweisen und ihm besser auseinanderzusetzen, worin er glaube, ihm nützlich sein zu können. 19 ) Ähnlich schrieb er an Lionne, und beide nahmen auch diese Schreiben freundlich auf, aber von einer Reise Christians nach Paris riet der König ab, doch könne er den Herzog vielleicht an der Grenze irgendwo sprechen (Rel. vom 31. August). Nach Bünsows Ansicht war die Etikette die Ursache dieser Ablehnung.
Um diese Zeit hatte die Herzogin von Elboeuf wieder einmal über Christian mit der Schwester des Grafen Fruges ein Gespräch gehabt; darin hatte sie gesagt, wie Bünsow den 24. August berichtete, wenn sie sehe, daß Christians Ehe vom Papste kassiert werde und er wirklich seine Religion geändert hätte, dann könne es sich noch wohl begeben, daß sie sich zu der Ehe entschließe, aber ohne des Königs Konsens könne sie es nicht tun; dieses aber müßte alles vorhergehen. Bünsow entnahm sich freilich aus diesen Worten, daß sie sich schwerlich mit dem Herzog verheiraten werde; überdies hatte er in Erfahrung gebracht, daß die Minister dem König eingeredet hätten, die Heirat sei wider sein Interesse.


|
Seite 13 |




|
Indessen nahm sich nun der Marquis de Gudanes, der sich vorgenommen hatte, sich um jeden Preis Herzog Christians Gunst zu gewinnen, der Sache an. Er sprach mit dem Beichtvater der Prinzessin, versprach auch, Bünsow in ihr Haus einzuführen und mit ihm nach Hamburg zu kommen, um dort mit dem Herzog das Weitere zu verabreden.
Der Herzog brachte freilich dem Marquis - sehr mit Recht - kein großes Vertrauen entgegen, aber auf die Zusammenkunft ging er ein. Sie fand im Oktober 1662 statt. Gudanes kam mit einem Passe des Königs und mit einer Instruktion, worin ihm Erkundigungen verschiedener Art bei Christian und über denselben aufgetragen wurden. Man kannte den Marquis am Pariser Hofe als einen unzuverlässigen Abenteurer, wies aber doch die Gelegenheit, die er bot, sich über Herzog Christian zu informieren, nicht von der Hand. Gudanes hatte zunächst zu fragen, in welcher Weise (de quelle façon) der Herzog die Religion ändern wolle und ob dieser Schritt ihm nicht den Haß seiner Untertanen zuziehen werde, ob sein Ministerium ihn billige ober ob er den Entschluß gefaßt, ohne ihn seinen Räten mitzuteilen; in diesem Falle sollte der Marquis von den Nachbarn Mecklenburgs auf gute Manier (avec adresse) zu erfahren suchen, wie wohl Christians Untertanen seinen Übertritt aufnehmen würden. Ferner soll er sich nach dem Grunde seines Zwistes mit seinem Vetter von Güstrow erkundigen und ob die Güstrower Landeshälfte besser sei als die Schweriner, ob Güstrow ein wichtigerer Platz sei als Schwerin und ob sein Vetter imstande sei, Kabalen im Lande anzurichten, in welchem Ansehen er stehe und ob er sich gut mit seinen Nachbarn stehe. Weiter soll sich Gudanes informieren, wer Wismar besitze (! das scheint also der Verfasser des Aktenstückes nicht gewußt zu haben) und ob es kein Mittel gebe, es durch Kredit oder Geld in die Hände des Herzogs zu bringen. Ferner ob Christians Gattin 20 ) Freunde habe, ob etwa der Kurfürst von Sachsen oder der von Brandenburg sie unterstütze oder andere benachbarte Fürsten sich für sie erklärten. Er soll die Zahl der Brüder und Schwestern des Herzogs, ihre Verhältnisse und ihre etwaigen Mehransprüche an den Herzog erkunden, auch zu erfahren suchen, wie hoch sich die Einkünfte des Herzogs an Geld oder Naturalien belaufen, wie viel Plätze er besitzt und wie hoch seine Schulden sind, ob er mächtig sei


|
Seite 14 |




|
in seinen Staaten und ob in seiner Landeshälfte sein Vetter und seine übrigen Verwandten imstande seien seine Macht zu hemmen, ob seine Schwestern sich verheiraten wollen und wie hohe Apanagen seine Brüder beziehen, ob seine Renten sich in ein anderes Land übertragen lassen. Auch über sein Alter und seine Gemütsart (ses humeurs) soll er Erkundigungen einziehen - denn in dieser Beziehung ging Herzog Christian kein guter Ruf voraus 21 ) - und alles geheim halten. 22 )
Der Herzog gab Gudanes ein Kreditiv an den König mit, ferner Schreiben an die Königin=Mutter, die er um Unterstützung seiner Wünsche bittet, an die Mademoiselle d'Elboeuf, auch an den Erzbischof von Paris und endlich ein langes Memoire, datiert vom 8. November 1662, worin er die verschiedenen Fragen, die ihm Gudanes vorlegte, ausführlich beantwortet und die Bedenken, die man in Paris hegte, zu zerstreuen sucht. Er spricht zu Anfang desselben seinen Entschluß aus, die Religion zu wechseln und die der Prinzessin, die er heiraten werde, anzunehmen; sie möge überzeugt sein, daß dies ein starker Beweis seiner Achtung für ihre Person sei. Seinen Untertanen werde dies gleichgültig sein, er werde ihr Gewissen nicht zwingen. Darauf folgt eine Stelle über Herzog Gustav Adolf, die in wörtlicher Übersetzung lautet: "Was unsern Vetter betrifft, so steht es fest, daß ich ihm immer den Landesteil bestritten habe, den er in meinen Staaten besitzt, aus dem Grunde, daß mein verstorbener Herr Vater nicht die Befugnis gehabt hat, zu tun, was er zu meinem Präjudiz getan hat - nämlich sich auf die Landesteilung einzulassen -, da die Souveränitätsrechte von einer Natur sind, die immer dem Chef (des Hauses) verbleibt, und wir können mit Recht behaupten, daß wir etwas wiedergewinnen, was durch eine ungerechte Überraschung (Übervorteilung) entwendet ist, 23 ) und das wiederzuerlangen unsere Affären bisher nicht gestattet haben, aber wir sind erbötig, zu zeigen, daß wir in der Lage sind, 24 ) unser Land wieder in den Stand zu bringen, in dem


|
Seite 15 |




|
es ehemals war und sein muß, trotz unseres Unglücks" Darauf zieht er einen Vergleich zwischen dem Schweriner und dem Güstrower Land, sehr zugunsten des ersteren. Das Güstrower habe keinen festen Platz, er besitze dagegen drei ansehnliche Festungen, Schwerin, Dömitz und Bützow, die er einzeln schildert. "Außerdem" - fährt er fort - "haben unsere Staaten, die er (Gustav Adolf) besitzt, für uns die Gefühle bewahrt, die sie ihrem wirklichen Souverän schuldig sind, und sehen ihn nur als einen Usurpator an (!!), der im Sterben liegt. Seine Gesundheit ist infolge von Ausschweifungen und seiner schwachen Konstitution so angegriffen, daß wir berechtigt sind zu erwarten, daß die Investitur, die wir haben, uns in wenigen Monaten 25 ) zustatten kommen wird."
Ebenso gewagt, wie alles dies, ist die nun folgende Behauptung, er habe auch Hoffnung, Wismar den Schweden zu entreißen; die Gründe dafür will er dem Marquis mündlich auseinandergesetzt haben. Dann kommt er auf seine Ehe zu sprechen und weist nach, daß seine frühere Ehe bereits gelöst sei. Die benachbarten Fürsten, meint er, würden sich nicht einmischen, wenn er sich wieder vermähle. Um seiner künftigen Gattin größere Sicherheit zu bieten, stellt er in Aussicht, ihr in seinen Staaten einen Treueid schwören und sie in seine Plätze als Herrscherin aufnehmen zu lassen. 26 ) Er bespricht dann die "Verlegenheit" mit seinen Brüdern; diese sei seit einem Monat durch kaiserliche Kommission beendet, 27 ) und zwar auf Bedingungen, die für ihn sehr vorteilhaft seien. "Wir denken also fast nicht mehr daran, daß sie auf der Welt sind." (Wie brüderlich liebevoll!) Schulden habe er im ganzen Reiche keinen Sou, 28 ) und was die seines Vaters betreffe, so stellten dessen Gläubiger ihm keine Forderungen mehr, seit man ihnen nachgewiesen, daß der Vater nicht berechtigt gewesen sei, etwas zu leihen, und er


|
Seite 16 |




|
sei von dieser Seite her völlig in Ruhe. 29 ) Seine Einkünfte, die allerdings in Naturalien beständen, verpachte er um Geld, das er ohne Mühe in jedes Land durch die Banken von Hamburg und Lübeck bringen lassen könne. Ihre Höhe habe er dem Marquis mündlich gesagt und angeboten zu beweisen, daß er sie nach Bedürfnis noch weit vermehren könne, denn da er erst seit fünf Jahren regiere und in dieser Zeit in all seinem Unglück fortwährende Beweise von Eifer und Treue von seinen Untertanen erhalten habe, so habe er bisher nichts "über seine Rechte" (au dela de nos droits) einfordern wollen, ja er habe sogar etwas davon noch zurückgestellt (recaché), um sie zu verpflichten, in ihrer Schuldigkeit fortzufahren. 30 )
Mit diesen verschiedenen Schreiben reiste der Marquis wieder nach Paris, mit ihm Bünsow, der Befehl bekam, auch auf den Marquis sorgfältig Acht zu geben. Den 24. November kamen beide in Paris an. Die Königin=Mutter sowie das Fräulein v. Elboeuf nahmen die Schreiben freundlich an, machten aber alles weitere von der Entscheidung des Königs abhängig, der erst Anfang Dezember wieder nach Paris kam. Der aber zeigte keine Neigung, sich, wie er sagte, "in einen Weiberkrieg zu mischen", sondern überwies die Fortsetzung der Verhandlungen wieder Lionne, und dieser trug Bedenken, Wolfenbüttel, dessen Stellung zu Christian ihm wohl bekannt war, zu erzürnen und war der Ansicht, daß sich Herzog Christian unmöglich bei Lebzeiten seiner ersten Gattin wiedervermählen könne. Der König werde den Herzog in seinen gerechten Forderungen alle Zeit unterstützen, aber nicht dergestalt, daß seine eigenen Alliierten dadurch choquiert würden.
Den 15. Dezember brachte zwar Gudanes ein Schreiben von Lionne, daß der König die zweite Heirat billige, allein am 22. Dezember heißt es dann wieder, der König wolle vorerst über folgende Punkte versichert sein:
1. daß der Spruch des Ehegerichts der Gemahlin und ihren Freunden mitgeteilt sei,
2. daß die benachbarten Fürsten sich hierin nicht mischen wollten, auch die Gemahlin nicht unterstützen, denn er wolle seine Cousine einer so gewagten Situation nicht aussetzen,


|
Seite 17 |




|
3. daß Christian der Gemahlin ihre Güter zurückgegeben habe.
In mehreren ausführlichen Antwortschreiben mit Aktenstücken des Kanzlers über die Ehescheidung suchte der Herzog diese Bedenken zu zerstreuen (Ende 1662 und Anfang 1663).
Allein es wollte alles nichts helfen, vielmehr machte um diese Zeit Lionne dem Marquis gegenüber einmal die Äußerung, "es gebe keinen Narren in Frankreich gleich ihm, der die Partei des Herzogs von Mecklenburg halte; der Marquis müsse sehr vom Herzog beschenkt sein, oder man müsse ihm die Augen sehr verblendet haben, daß er nicht besser in E. F. D. humeur hätte penetrieren können."
Der Jesuitenpater hatte nach Hamburg an den französischen Residenten und an französische Kaufleute geschrieben. Die Antworten waren sehr ungünstig ausgefallen. Der Herzog solle keinen Kredit mehr haben und sein Land solle ruiniert sein; er selbst sei kein Fürst von Parole, man könne auf sein Wort nicht trauen; nichts sei ihm rarer als bares Geld, und habe er zufällig etwas, gebe er es für Alchymie aus, gegen die König Ludwig eine starke Abneigung hatte. Er folge keinem Menschen, sondern wolle nach seinem Kopfe alles regulieren, dabei sei er so heftiger Gemütsart, daß es besser sei, weit von ihm als bei ihm zu sein. Er folge viel eher den Ratschlägen eines Lakaien oder Kammerdieners als denen eines ehrlichen und vornehmen Mannes. Seine Gemahlin habe er dergestalt unwürdig behandelt, daß sein ganzes Land, das ihn mehr aus Furcht als aus Liebe respektiere, Mitleiden mit ihr habe. Wenn er getrunken habe, sei er nicht wie die andern Fürsten lustig, sondern streitsüchtig, denn er sei über alle Maßen unruhig, ohne Gewissen und ohne Religion. Auch von seinen früheren Erlebnissen in den Niederlanden hatte man sehr ungünstig gefärbte Schilderungen. Fast mit jeder Post kamen neue schlimme Nachrichten. So zeigte am 17. Januar der Jesuit einen Brief, worin behauptet war, der Herzog sei so schlecht mit Möbeln eingerichtet, daß er aus Not nach Amsterdam oder Antwerpen gehen müsse, um in einem Hause, das einigermaßen, aber nicht, wie es einem Prinzen gebühre, möbliert sei, wohnen zu können. Alles dies bekam Herzog Christian aus Bünsows Berichten, der ihm nichts verschleierte, zu lesen, aber es focht ihn alles nicht an und machte ihn nicht wankend. Über sein persönliches Betragen äußerte er sich (den 15. Januar) in seiner Antwort auf den Brief Bünsows vom 1. November: "Wir


|
Seite 18 |




|
wissen Uns und Unsere humeur schon zu gouvernieren, wie ein jeder kluger Regent an seinem Ort nach Beschaffenheit des Estats und pro qualitate et circumstantiis rerum, temporum et morum solches in Acht haben wird." Endlich fand Bünsow gerade in der Massenhaftigkeit dieser schlimmen Ausstreuungen eine Handhabe, vom Könige die Erlaubnis zu erwirken zu einer Reise seines Herrn nach Paris, damit er sich "von allen den Injurien, so man ihm beimesse, purgieren könne."
Vom Hofe erhielt der Marquis de Gudanes den Auftrag, mit Bünsow nach Mecklenburg zu reisen, um den Herzog "noch ferner zu informieren". Man hatte diesen nämlich in Paris als einen "Barbaren" geschildert, der von Hofetikette nichts wisse.
3. Herzog Christian in Paris bis zu seinem Übertritt.
Es gehörte viel Mut dazu, unter solchen Umständen die Reise zu wagen. Herzog Christian hatte diesen Mut, und der Marquis wußte ihn in seiner Zuversicht, daß es ihm leicht und schnell gelingen werde, alle Hindernisse zu beseitigen, noch zu bestärken. So trat er denn, obgleich es damals mit dem Heiratsplan so schlecht stand, daß Bünsow ihm anheimgab, ob er ihn nicht ganz aufgeben wolle, trotzdem jetzt mit seiner Absicht, sich wieder zu vermählen, offen hervor: er notifizierte sie vor seiner Abreise dem Herzog von Wolfenbüttel mit der Bitte, seine Frau Base in Kenntnis zu setzen, und sandte an Herzog Gustav Adolf noch von Schwerin aus den Marquis de Gudanes mit der gleichen Anzeige. Der Marquis, ein vollkommen gewissenloser Mensch, den nur der Ehrgeiz eine Rolle zu spielen wie die Habsucht leiteten, benutzte diese Gelegenheit, mit dem Güstrower Hofe eine verräterische Verbindung anzuknüpfen. Er erbot sich, für 200 Pistolen alle Schriftstücke, die er in Herzog Christians Angelegenheiten in Händen habe, dem Güstrower Hofe mitzuteilen, auch gegen eine dauernde Pension von 6000 Gulden jährlich von Zeit zu Zeit Herzog Christians Pläne den Güstrower Räten zu offenbaren und Anleitung zu geben, wie sie denselben entgegenarbeiten könnten, auch selber mit zu verhindern, daß die Heirat Fortgang nehme, so daß Herzog Christian "in Paris umsonst sein Geld verzehre".
Herzog Gustav Adolf wies dies Anerbieten nicht ab, überließ aber aus begreiflichem Mißtrauen dem Franzosen, der ja schon durch sein Anerbieten seine eigene Unzuverlässigkeit zur Genüge dartat, die Sache nicht allein, sondern sandte einen seiner Beamten,


|
Seite 19 |




|
den Hofrat Rühl, nach Paris, der die 200 Pistolen für Gudanes mitbekam, aber auch die Weisung, sich nach ihm zu erkundigen. Den Vorwand für seine Absendung bot ein Scheinauftrag in bezug auf den Warnemünder Zoll. Rühl hatte, abgesehen von der Überwachung des Marquis, die Aufgabe, in Paris auch seinerseits im Verein mit dem dort schon befindlichen Güstrower Agenten Heiß gegen Christians Pläne, sowohl die Allianz wie die Wiedervermählung, zu arbeiten. Außerdem ward noch ein geheimer Korrespondent in Paris gewonnen, ein Adliger am französischen Hofe selbst, der sich den Anschein gab, sehr einflußreiche Verbindungen dort zu besitzen und für die Besoldung von 200 Talern jährlich über alles, was Christian betreffe, insgeheim, ohne selbst Heiß bekannt zu sein, auf dem Wege über Holland an den Güstrower Hofrat Schäfer berichtete und seinen eigenen wie aller seiner Freunde Einfluß gegen Christian aufzubieten sich anheischig machte. 31 )
Zugleich schrieb Herzog Gustav Adolf auch an den König von Schweden, der denn auch seinem Gesandten in Paris eine ähnliche Anweisung gab, wie die Güstrower und auch die Wolfenbütteler Konfidenten sie erhielten; von Wolfenbüttel aus bearbeitete man den französischen Gesandten in Regensburg, Gravel, und unter dem 24. Februar 1663 schrieb Christine Margarete an den König einen Protest gegen Christians etwaige Wiedervermählung. 32 ) Den 26. Februar wandte sie sich in einer Ein=


|
Seite 20 |




|
gabe an den Kaiser, die drei Bitten enthielt; erstens die kaiserliche Kommission, die inzwischen, den 17. April 1662, eingesetzt war, fortzusetzen, zweitens, sie in speziellen kaiserlichen Schutz zu nehmen und drittens, Herzog Christian zu befehlen, daß er vor gänzlicher Entscheidung des Streites mit ihr sich aller neuen Heiratstraktaten enthalte.
Im allgemeinen mit der Stellung des Güstrower Hofes bekannt gemacht durch ein Schreiben vom 12. Februar, in welchem Gustav Adolf seiner Absicht zu heiraten widersprach, doch im einzelnen noch ohne Kenntnis von allen diesen Gegenschachzügen, reiste Herzog Christian Ende Februar nach Paris ab. 33 )
Vom 17. März ist sein erstes Schreiben aus Paris datiert, wo er nun den ganzen Rest des Jahres 1663 und auch den größten Teil des Jahres 1664 zubrachte.
Noch von Antwerpen aus sandte er den 26. Februar an seine Räte ein Blankett für ein Schreiben an seinen Bruder Herzog Karl, in dem dieser die Versicherung erhalten sollte, daß Christians Intention wie auch seine Reise nur auf ihres "uralten Fürstlichen Hauses Aufnehmen" gerichtet sei, woran sich dann die Bitte schließen sollte, Karl möge sich von niemand zu widriger Meinung bewegen lassen. Das Schreiben wurde auch von den Räten nach Christians Wünschen eingerichtet, verfehlte aber völlig


|
Seite 21 |




|
seinen Zweck: Herzog Karl war so wenig von der Richtigkeit dieses Weges, um das mecklenburgische Fürstenhaus in Aufnahme zu bringen, überzeugt, daß er sofort mit seinen Brüdern und Gustav Adolf in Verhandlung trat wegen eines gemeinsamen Protestes der Brüder und vorläufig ebenfalls ein Protestschreiben an König Ludwig richtete.
Somit fand Herzog Christian die Lage in Paris weit schwieriger, als er nach den Schilderungen des Marquis angenommen hatte. Zum Glück kam dessen Verrat gleich im Anfang von Christians Aufenthalt an den Tag: Hofrat Rühl sprach wider seine Instruktion mit Heiß über Gudanes, 34 ) und Heiß entdeckte des Marquis verräterische Absicht dem Herrn v. Lionne, um, wie er zu seiner Rechtfertigung angab, Herzog Christian von diesem Intriganten, auf den er sich einzig und allein verlasse, zu trennen, und auch Herzog Gustav Adolf zum Besten. Der drohenden Verhaftung wußte der schlaue Marquis allerdings durch schleunige Abreise zu entgehen.
Den 3./13. April meldet Christian seinen Räten die Entdeckung dieser gegen ihn angestellten gefährlichen Machination 35 )


|
Seite 22 |




|
und befiehlt, daß dem Gebet, das während seiner Abwesenheit angeordnet war, noch eine Danksagung angehängt werde. Auch Ritter= und Landschaft erhielt ein Schreiben über den Vorfall, damit sie selbst, wie er den Räten schreibt, hinter "die Wahrheit kommen und sehen und urteilen möge, was für ein Unterschied unter Unser reellen offenherzigen Konduite und des widrigen Teils verborgenen, ja machiavellistischen Stratagemen und Kunststücklein sei und zu wem sie sich in allen begebenden Fällen einer wahren landesväterlichen Fürsorge über kurz oder lang zu versehen haben mögen."
Von dieser Gefahr befreit, ging nun Herzog Christian mit verdoppeltem Eifer der Ausführung seiner Pläne nach. Er wartete täglich dem König auf, 36 ) stellte ihm in persönlicher Audienz sowie in einer schriftlichen Eingabe seine Lage vor 37 ) und bat um seinen Schutz. Der König behandelte ihn mit ausgesuchter Höflichkeit 38 ) und ließ sich bereit finden, an Gravel eine neue


|
Seite 23 |




|
Anweisung ergehen zu lassen, nach Möglichkeit für Christian zu wirken, daß man ihn mit Reichsexekutionen in Frieden lasse. Auch an den König von Schweden ging ein Schreiben ab, datiert vom 25. April des Jahres, das sich auf Christians Streit mit den Brüdern bezieht: König Ludwig wisse durch den Herzog, daß der König viel Einfluß auf dessen Brüder habe (beaucoup de crédit sur l'esprit des princes ses frères) und seine Empfehlung also sehr nützlich sein könne, um sie zu bewegen, von ihren "Verfolgungen" abzustehen und andere freundschaftliche Wege einzuschlagen zur Wiederherstellung der Eintracht im fürstlichen Hause. Er (König Ludwig) werde sich ihm verpflichtet fühlen für jede Gunst und Protektion, die er dem Herzog in diesen Streitigkeiten bewilligen werde. Man riet auch dem Herzog, seine Bewerbung um Aufnahme in die Rheinische Allianz auf dem Reichstage in Regensburg, der mittlerweile begonnen hatte, zu erneuern. Christian sandte den 20. April Befehl dazu nach Regensburg, wo damals neben Hagemeyer sein geschicktester Diplomat, der Geh. Rat v. Schwaan, und sein späterer Kanzler, der Rat Wedemann, für ihn tätig waren. Indessen setzte Wolfenbüttel seinen Widerstand auch hier fort, indem es den ganzen Sommer des Jahres hindurch seinen Gesandten erklären ließ, er habe über diese Sache noch keine Instruktion. Seinem ersten Memorial, das kurz gefaßt war, ließ Christian den 30. April ein zweites ausführlicheres folgen, das er persönlich an Lionne übergab. Als Zweck desselben wird im Anfang bezeichnet, es solle eingehender als das erste zeigen, welche Unterstützung der Herzog vom Könige zu erhalten wünsche und was andererseits dieser von ihm erwarten könne. Er wolle sich seinen Feinden, um all die lästigen Prozeduren abzuschneiden, konsiderabel machen
1. durch einen Allianzvertrag mit dem König, dessen Wirkung sein würde, daß es dem Könige gefiele, sich mit besonderer Sorgfalt der Interessen und Forderungen des Herzogs anzunehmen,
2. durch die Unterhaltung seiner Truppen und die Erhaltung seiner Garnisonen sowie die Verstärkung beider im Bedürfnisfall.
Der Herzog gibt dem König anheim, zu erwägen, ob sein Land, das sowohl für sich wie auch durch die Nachbarschaft der Hansestädte Lübeck und Hamburg und anderer an Bevölkerung wie Mitteln reicher Länder viele Vorteile biete, ihm nicht im Falle eines Krieges dazu dienen könne, um dort Werbungen anzustellen und ein Truppenkorps zu unterhalten, das Diversionen machen und die Feinde in Atem halten könne; ob nicht die guten Festungen im Herzogtum, Dömitz, "der Schlüssel von Nieder=


|
Seite 24 |




|
und Obersachsen", Schwerin und Bützow, ferner auch Stintenburg 39 ) und einige wichtige Pässe sich dazu eigneten, sich dort zu halten, seinen Rückzug dorthin zu nehmen, Ausfälle und andere militärische Aktionen zu machen, ob nicht S. Hoheit ebenso gut wie irgend ein anderer fremder Fürst oder Staat S. Majestät die besten deutschen Truppen würde liefern können; ob nicht während des Friedens die erwähnten Plätze Gelegenheit zu Gewinn bieten könnten, im Falle S. Hoheit mit S. Majestät sich über eine Summe Geldes als Anleihe einigte, für die Verbesserung seiner Güter, den Rückkauf seiner Domänen und verschiedene andere notwendige und vorteilhafte Zwecke und ob nicht S. Hoheit, der einen außerordentlichen Eifer für die Interessen des Königs habe (qui a un zèle extrème pour le bien des affaires de S. Maj.), ihm Dienste leisten könne auf dem gegenwärtigen Reichstag vermittelst seiner Verbindungen und seiner drei Stimmen.
Endlich wendet sich der Herzog gegen die Anschwärzungen und boshaften Erfindungen, die man über ihn verbreitet habe, denen gegenüber er aller Welt zeigen wolle, daß er kein anderes Ziel habe, als das wahre Interesse seines Staates, vereint mit dem der Allgemeinheit und dem Frankreichs (le véritable intérest de son Estat uni avec celui du public et de la France). Er bittet also um baldige Errichtung des Traktates.
Als man am Hofe zauderte, ließ er noch ein drittes Memoire folgen. 40 ) Er appelliert darin noch einmal an den Edelmut des Königs, zu dem er seine Zuflucht genommen habe; der König habe sich durch den Glanz seiner Tugenden und seines Glückes eine solche Achtung erworben, daß sein bloßer Name genüge, um die in Schranken zu halten, die seinen Freunden und Verbündeten übel wollten. Man werde also keinen Krieg um Christians willen gegen den König führen, vielmehr den Schutz, den der König ihm gewähre, achten. Weiter behauptet er, daß es nur Bosheit (une noire malice) oder übereilter Ehrgeiz sei, wenn man ihm Klagen wegen der Ehe angezettelt habe; man wünsche, daß er ohne legitime Nachfolger sterbe. Dann klagt er über die unaufhörlichen Exekutionsdrohungen, mit denen er heimgesucht werde und die ihn, wenn man sie ausführte, außer Besitz


|
Seite 25 |




|
seiner Länder setzen würden. Diese Prozeduren seien ihm gänzlich unerträglich und zielten direkt auf den Ruin seiner Person, seiner Ehre und seiner Staaten ab. Aber die Gerechtigkeit seiner Sache, die Leichtigkeit des Schutzes, der Ruhm, der diese "heroische Handlung" begleiten werde, lasse ihn hoffen, daß der König ihn nach den Schritten, die er bereits für ihn getan, nicht in sein Land werde zurückkehren lassen, ohne ihn getröstet zu haben durch die Wirkungen seiner Hochherzigkeit und Wohltätigkeit zur Verwirrung seiner Feinde, Kräftigung seines Staates und Erfüllung seiner glühendsten Wünsche; diese seien, mit aller seiner Macht das Wohl, die Ehre und das Glück S. Majestät, des königlichen Hauses und des ganzen Frankreichs fördern zu helfen. Er "fleht also demütig", daß es dem König gefalle, die Hand daran zu legen, daß seinen Feinden durch wirksamen Schutz ihre ungerechten Hoffnungen vereitelt würden; als ausreichend dazu sieht er die Werbung und Unterhaltung eines guten Regimentes Musketiere und von drei oder vier Kompanien Kavallerie an, die er immer zum Dienste des Königs bereithalten werde.
Aus einer Aufzeichnung, die im Schweriner Archiv aufbewahrt wird, lernt man noch drei geheime Artikel kennen, die der Herzog in den Allianzvertrag aufgenommen wünschte und die er mithin ohne Zweifel ebenfalls zur Kenntnis des Königs und Lionnes gebracht hat; sie haben den Inhalt:
1. daß sich der König mit Schweden zusammen der Klagen des Herzogs annehme, falls ihn der Reichstag zu Regensburg nicht zufriedenstelle;
2. daß der König ihm eine - zu vereinbarende, vermutlich jährliche - Pension gebe zu Verstärkung seiner Garnison und zum Unterhalt einiger Kompanien Kavallerie, was mit dem vorher schon ausgesprochenen Wunsche übereinstimmt, und
3. daß der König ihm 300000 Taler leihe, 41 ) rückzahlbar nach 10 Jahren, um sich ihrer zur Ordnung seiner häuslichen


|
Seite 26 |




|
Angelegenheiten zu bedienen, eine bestimmtere Fassung des schon im zweiten Memoire ausgesprochenen Wunsches.
In der Zeit zwischen dem zweiten und dritten Memoire wandte sich der Herzog auch an den Papst mit einem Schreiben (datiert vom 11. Mai), worin er um Aufnahme in die katholische Kirche bat. Mit dem Kardinal Barberini, der in Paris und am Hofe weilte, wird er schon im Anfang seines Pariser Aufenthaltes in Verbindung getreten sein, und dieser nahm die Verhandlung über die Ehescheidung mit dem Papst in die Hand.
Aber auch hier ging alles für Christians Ungeduld zu langsam. Ebenso wollten seine Pariser Affären nicht von der Stelle rücken. Der König ließ sich zwar bereit finden, ein neues Empfehlungsschreiben für Christian an Schweden zu richten (den 21. Mai), 42 )
Von einer anderen Seite lernt man diese Gerüchte kennen aus einem Berichte der Güstrower Gesandten in Regensburg Joh. Fr. Gans und Joh. Chr. Hauswedel vom 14./24. März 1664: "Im übrigen ist uns auch allhier, was E. F. Dhl. vor diesem, von wegen unternommener Zession des Anteils Mecklenburg=Schwerin, an die Krone Frankreich spargieret, von Schwedischer Gesandtschaft vertraulich berichtet, mit dem Zusatz, daß zu solchem Behuf jemand von Paris aus abgefertigt sei, um die Beschaffenheit der Lande, und was für feste Plätze darin begriffen, in Augenschein zu nehmen." Mit solchen Erkundigungen war schon Gudanes beauftragt, und es mögen noch andere mit demselben Auftrag abgeschickt sein. Darin sah man denn eine Bestätigung jener Gerüchte. Ende 1663 beschäftigte man sich auch am brandenburger Hofe mit diesen Gerüchten. Der Kurfürst gibt den 18./28. Dez. d. J. (s. Urk. und Aktenstück XI, S. 264) dem Freiherrn von Schwerin in Torgau den Auftrag, dem Kursächsischen Geh. Rat, Freiherrn von Friesen zu sagen, es wäre ihm Bericht zugekommen, von dem er jedoch nicht wüßte, ob er fundiert sei, daß Frankreich von dem neulich katholisch gewordenen Herzog von Mecklenburg sein ganzes Herzogtum oder doch einen großen Teil desselben an sich zu erhandeln beabsichtige." Nicht unmöglich ist, daß Isabella Angelika, die das Land nachher an Gustav Adolf (s. u.) und 1673 (s. Chr. L. S. 104) an Friedrich Wilhelm hat abtreten wollen, schon damals an Derartiges gedacht und gelegentlich davon gesprochen hat.


|
Seite 27 |




|
aber mit einer Allianz hielt er zurück. Das Eheprojekt mit dem Fräulein v. Elboeuf zerschlug sich gänzlich, 43 ) hauptsächlich, wie es scheint, weil sie dem Herzog nicht gefiel, auch die verwitwete Herzogin v. Nemours, Tochter des verstorbenen Herzogs v. Longueville, an die er darauf dachte, zeigte sich nach anfänglichem Entgegenkommen seiner Werbung unzugänglich. Das Haupt=


|
Seite 28 |




|
hindernis war, daß man am Hofe Christians Ehescheidung nicht für gültig hielt. Vielleicht aber bot sich, so rechnete man, in dem mecklenburgischen Ehestreit eine Handhabe, auch den Güstrower Herzog Frankreich zu verpflichten, wenn nämlich Frankreich zwischen den getrennten Gatten eine Vermittelung oder eine Scheidung mit Zustimmung von Christine Margarete bei Befriedigung ihrer Ansprüche zustande brachte. Man übersah am Pariser Hofe die Lage noch nicht so, daß man nicht eine solche Lösung zu beiderseitiger Zufriedenheit für möglich gehalten hätte. So erfolgte also den 29. Mai 1663 an Herzog Gustav Adolf die Antwort des Königs, er werde mit seiner Autorität nichts unterstützen, was der Herzogin Christine Margarete zum Präjudiz gereichen könne, vielmehr alles, was von ihm abhänge, dazu beitragen, um Herzog Christian zur Wiedervereinigung mit seiner Gattin zu bestimmen. Ähnlich lautete das Antwortschreiben an Christine Margarete. Es ist nun freilich aus den Schreiben, die Christian in die Heimat sandte, nicht zu ersehen, daß man ihm wirklich ernstlich zugeredet hätte, sich mit seiner Gattin zu versöhnen, allein auch eine Förderung seiner Heiratspläne erfuhr er von Seiten des Hofes in keiner Weise.
Dazu blieben die Verhältnisse in der Heimat, über die ihm seine Räte mit jedem Posttage - die Woche zweimal - berichteten, fortdauernd recht schwierig. Zwar die längst durch Gerichtsspruch befohlene Rückgabe von Stintenburg und Zarrentin gelang es ihm, obgleich König Ludwig hierin nicht auf seiner Seite stand, durch das ganze Jahr 1663 hindurch immer und immer wieder hinauszuschieben. Mitte Mai hatten seine Räte auf einer Konferenz mit den Subdelegierten der kaiserlichen Kommission sich genötigt gesehen, die Rückgabe binnen zwei Monaten zu versprechen, und der Herzog gab den 15. Juni seine Zustimmung, wenn auch mit der Bedingung, daß die Werke von Stintenburg zu schleifen und die Mobilien fortzuschaffen seien. Die Rückgabe wurde nun auf den 18. Juli angesetzt, allein Kurfürst Friedrich Wilhelm erwies sich so gefällig, nicht auf dem Termin zu bestehen. Aber in Sachen der Geschwister und der Stiefmutter erschienen drohende kaiserliche Reskripte. Wegen der rückständigen Apanagegelder wurde Christian am 4. Mai zum Gehorsam binnen zwei Monaten angewiesen, im widrigen Falle wurde die Exekution den vorigen Kommissaren (dem Administrator von Magdeburg, August v. Sachsen und Christian Ludwig von Celle) übertragen. Am selben Datum erschien ein Reskript wegen der zwei Fürstentümer; es enthielt zwar nicht die Forderung, diese abzutreten, aber die


|
Seite 29 |




|
früher in Aussicht gestellte Verordnung wegen der Interimsalimente, die Kommissare sollen Christian anhalten, seinem Bruder Karl neben Mirow 3000, Johann Georg 4000 Taler jährlich zu geben, und zwar von Adolf Friedrichs Tod an gerechnet, sodann 2000 Taler für die Kosten; auch hier folgt die Klausel, wenn Christian binnen zwei Monaten nicht gehorche, solle Exekution erfolgen. Auch für Güstrow wurde in seinen Beschwerdepunkten gegen Christian den 4. Juli ein neues Mandat ausgefertigt, durch welches die ausschreibenden Fürsten des niedersächsischen Kreises Exekutionsbefehl erhielten, wenn Christian in 6 Wochen nicht gehorche. Es kam allerdings zunächst erst zu einem Monitorium der Kreisdirektoren (des Administrators August v. Sachsen und des Herzogs August v. Wolfenbüttel), aber die Exekutionsgefahr rückte doch näher und näher. Auch von den Schuld= und Pfändungssachen wurden einige im Laufe des Jahres 1663 äußerst unbequem. Der Landrat v. Lehsten drang im Interesse seiner Mündel, der Barnewitzschen Erben, denen die Ämter Lübz und Crivitz pfandweise gehört hatten, auf deren Rückgabe, die "Buchwaldtschen Bürgen", die für Kapitalien, welche Adolf Friedrich von der Familie v. Buchwaldt geliehen hatte, Bürgschaft geleistet hatten, erhielten den 18. März ein Monitorium - und zwar schon ein wiederholtes - von Herzog Christian Ludwig v. Celle, worin ihnen die Exekution angedroht wurde, wenn binnen sechs Wochen nicht Zahlung des Restes jener Summe erfolge; auch sie wandten sich, wie natürlich, an den Herzog und drangen auf Zahlung von seiner Seite.
Alle diese Bedrängnisse faßte der Herzog Ende Mai (den 31.) in einem Schreiben zusammen, das er in gleichem Wortlaut an alle Kurfürsten - nach Regensburg - sandte, mit der Bitte, ihm zu helfen. Aber die Antworten gingen, wie gewöhnlich, langsam ein. Am freundlichsten war auch jetzt wieder Friedrich Wilhelm v. Brandenburg. Er legte bei dem an seinem Hofe anwesenden kaiserlichen Gesandten warme Fürsprache für Christian ein, unterstützt von dem Fürsten Johann Georg v. Anhalt, der dies selbst an Christian (Königsberg, den 4. Juli) schrieb und dabei u. a. erzählte, er habe dem Gesandten besonders vorgestellt, "wie sehr solche präzipitante Prozeduren von dem Reichshofrat gegen die Reichsfürsten die Gemüter vom Kaiser alienierten". In einer Nachschrift heißt es, Christian "habe sich von Friedrich Wilhelm alles zu versehen, was er von einem getreuen Freund sich wünschen möge". Um am Kaiserhof zu seinen Gunsten zu wirken, sandte Christian Mitte des Jahres den Geh. Rat v. Schwaan


|
Seite 30 |




|
von Regensburg nach Wien, 44 ) nachdem der erneuerte Versuch in Regensburg, Aufnahme in die Rheinische Allianz zu finden, wieder an dem passiven Widerstande Wolfenbüttels gescheitert war.
Wohl noch unmittelbarer drückend als alles dies war für Christian die Geldnot, in die er infolge der unvorhergesehenen Verlängerung seines Pariser Aufenthaltes geriet. Um sich bei den französischen Granden in Ansehen zu setzen, glaubte er mit äußerem Glanze auftreten zu müssen und scheute zu diesem Zwecke auch größere Ausgaben nicht. So ließ er sich eine Karosse fertigen, die auf 8000 Franken geschätzt wurde, und ein Service, das sogar 10000 Taler kostete. 45 )
Er übersah deshalb schon sofort nach seiner Ankunft, daß er mit den mitgebrachten Geldern bei weitem nicht auskommen werde, und bestellte schon den 18. März einen Geldwechsel, den er aber nicht erhielt. Vom April ab werden seine Forderungen dringender: Den 13. April wünscht er, daß Ritter= und Landschaft 50000 Taler für ihn aufbringe, woran freilich nicht zu denken war; vier Tage später will er binnen sechs Wochen 30000 Taler in Hamburg deponiert haben. Anfang Mai denkt er daran, das Amt Neustadt zu versetzen, acht Tage später soll es Marnitz sein, oder es soll das Gut Kritzow verkauft werden. Ende Mai lebt er in "äußerster Not" und sendet den Kammerjunker v. Bünsow nach Schwerin, um 100000 Taler aufzutreiben. Dies erwies sich jedoch bei den kümmerlichen Verhältnissen im Lande als völlig unmöglich, aber zwei Zahlungen, eine von 10000, die andere von 12000 Talern, erfolgten nun im Juli, und zwar ohne Versetzung und Verkauf. Die erste wurde sofort für die dringendsten Schulden verbraucht, auch die zweite reichte nicht weit; schon den 11. September wünscht er wieder umgehend Geld, sehr dringend auch den 5. Oktober; auch erhielt er in Raten im ganzen noch 30000 Taler bis zu seiner Abreise im Juni 1664, womit er sich notdürftig hinstützte. Die fortwährende Geldknappheit aber hielt, wie er selber meint, seine Pläne auf. "Hätten Wir in Zeiten den Succurs des Geldes erlangt", schreibt er den 31. August, "so möchten Wir nach erreichtem Unseren guten Dessein, Unsere Rückreise wohl schon längst beschleunigt haben."


|
Seite 31 |




|
So mochte denn seine Miene gewiß häufig, wie einmal Richardiere nach Güstrow schreibt, recht sorgenvoll aussehen. 46 ) Zu seiner Zerstreuung verfiel er in der langen Wartezeit wieder auf seine alte Liebhaberei, die Alchymie; 47 ) endlich zeigte sich zunächst für den Eheplan eine neue, verheißungsvolle Aussicht. Etwa gegen Ende Juni begann der Herzog seine Werbung seiner künftigen zweiten Gattin, der verwitweten Herzogin von Châtillon, Isabelle Angélique v. Montmorency=Bouteville, zuzuwenden. 48 ) Isabelle Angélique de Montmorency 49 ) war geboren im Jahre 1626; schon im folgenden Jahre hatte sie ihren Vater verloren, der wegen eines Duelles auf Richelieus Befehl enthauptet wurde. Dessen Gattin zog sich dann auf ihre Landgüter zurück, wo sie sich der Erziehung ihrer drei Kinder widmete, zweier Töchter 50 ) und eines Sohnes, des späteren Marschalls v. Luxemburg. Ums Jahr 1643 kamen beide Töchter nach Paris, sie fanden bei Hofe gute Aufnahme, noch bessere im Hotel des Prinzen Condé, dessen Gattin, ebenfalls eine Montmorency, ihnen nahe


|
Seite 32 |




|
verwandt war. Im Jahre 1645 vermählte sich Isabella, nicht ohne eine romantische in Szene gesetzte Entführung, mit Gaspard, dem Sohne des Herzogs v. Coligny=Châtillon. 51 ) Gaspard erhielt den 9. Februar 1649 bei Charenton eine Wunde, an der er starb, während seine Gattin hochschwanger war. Sie gebar einen Sohn, der ihr aber im Alter von 8 Jahren durch einen plötzlichen Tod wieder entrissen ward (1657). In der Zeit der Unruhen der Fronde nahm sie regen Anteil an der Politik auf Seite der Fronde, aber doch im Sinne des Friedens. Noch immer blendend schön, dazu klug und geistreich, mit guter Laune begabt und nicht ohne Ehrgeiz, wußte sie fortdauernd eine bedeutende Stellung am französischen Hofe zu behaupten. 52 ) Des Witwenstandes überdrüssig, fand sie bald an Christians Werbungen Gefallen, der ein stattlicher Mann war und ihr gegenüber alle Liebenswürdigkeit entfaltete, deren er irgend fähig war. 53 ) Auch für die Stellung als souveräne deutsche Fürstin und als Gattin eines Herren aus


|
Seite 33 |




|
uraltem fürstlichen Hause mochte sie nicht unempfänglich sein. Nur bedingterweise richtig aber war es, wenn Richardiere den 10. August nach Güstrow berichtete, daß auch der König die Ehe gerne sehen werde, um in Deutschland eine Person von "Geist, Einsicht und Intriguen" zu Diensten zu haben. In Wahrheit enthielten sich König Ludwig und seine Staatsmänner jeder Einmischung in die Ehefrage, wie noch den 27. September Lionne dem Güstrower Agenten Heiß bestimmt erklärte.
Ende August und Anfang September verbreitete sich in Paris das Gerücht, daß aus der Ehe nichts werden würde, sei es, daß sich absichtlich die beiden Liebenden kühler stellten, um die Gegner zu täuschen, oder daß sich Isabella wirklich eine Zeitlang zurückzog. Tatsache ist, daß sie, zu weltklug, um sich einer Neigung, wenn sie wirklich eine solche empfand, ohne weiteres hinzugeben, heimlich in Deutschland Erkundigungen über Christians Verhältnisse, auch über seine erste Ehe, einziehen ließ. Selbstverständlich geschah von Güstrow aus alles mögliche, um sie zurückzuschrecken; man sandte ein lateinisches Aktenstück mit dem Nachweis, weshalb Christians erste Ehe nicht als getrennt anzusehen sei, an Lionne und Richardiere, der den Auftrag bekam, Isabella Angelika damit bekannt zu machen, und der auch allerlei Wunderdinge von den Intriguen, durch die er Christians Pläne durchkreuze, zu berichten weiß.
Da erfolgte Ende September der erste wichtige Schritt Christians zur Verwirklichung seiner Pläne, sein Übertritt zum Katholizismus.
4. Übertritt und Bündnis.
Schon vom Anfang seines Pariser Aufenthaltes an hatte Herzog Christian seine Geneigtheit, das katholische Bekenntnis anzunehmen, in mannigfaltiger Weise bekundet. Er besuchte regelmäßig die Messe, nahm einen katholischen Priester als Almosenier in seinen Dienst und konferierte häufig und eifrig mit katholischen Gelehrten und Geistlichen. 54 ) Doch war für ihn der Übertritt unmöglich, ehe er die Gewähr hatte, daß seine erste Ehe durch den Papst getrennt werde. Eben hierüber fiel die Entscheidung in Rom Anfang August. Den 6. August stellte Papst Alexander VII. zwei Breven aus, von denen das eine den Kardinal Barberini bevollmächtigte, Herzog Christian in den Schoß der


|
Seite 34 |




|
katholischen Kirche aufzunehmen, das zweite ihn autorisierte, Christians erste Ehe, weil seine Gattin im zweiten Grade mit ihm verwandt sei, für nichtig und unkräftig zu erklären und Christian von der Strafe des Inzestes - dieses scharfe Wort steht in dem Aktenstücke -, die er durch diese Ehe auf sich geladen, zu absolvieren. 55 )
Als diese Bullen in Paris angelangt waren, ließ der Kardinal den 26. September durch einige Zeugen, die Christian stellte, vor drei Advokaten des Pariser Parlaments beurkunden, daß der Herzog mit Christine Margarete in der Tat im zweiten Grade verwandt sei. Dann schwur Christian den 29. September im Hause des Kardinals zu St. Germain seine lutherische Ketzerei ab, die Feier der Firmelung wurde Sonntag den 30. September in der Hofkirche begangen, und eben dort erhielt er den 1. Oktober das Abendmahl. 56 )
Nach seinem Übertritt nahm Christian zu Ehren des Königs Ludwig zu seinem bisherigen Namen noch den Namen Louis an. 57 ) Über den geschehenen Übertritt stellte ihm der Kardinal ein Attest aus und vollzog auch auf Grund des zweiten päpstlichen Breve den 3. Oktober die Nichtigkeitserklärung der Ehe des Herzogs. 58 ) Dieses Aktenstück sandte der Herzog unverweilt an den Kaiser


|
Seite 35 |




|
mit der Bitte, auch seinerseits die Trennung der Ehe zu bestätigen und etwaige Kinder aus einer zweiten Ehe von ihm für sukzessionsfähig zu erklären.
So wenig man auch am Kaiserhofe mit Christian Louis' engem Anschluß an Frankreich zufrieden war, sein Übertritt zum Katholizismus konnte dort nur Wohlgefallen erregen. Die gewünschte Erklärung erfolgte also den 8. Januar 1664.
Auch am Pariser Hofe befestigte sich seine Stellung durch seinen Übertritt außerordentlich, ohne ihn freilich sogleich in seinem Eheprojekt zu fördern; was dieses betraf, so wurde der Pariser Hof durch einen feierlichen Protest von Christian Louis' Brüdern, der um diese Zeit eintraf, sowie durch ein Schreiben des Güstrower Herzogs, der den Dispens des Papstes anfocht, in seiner Zurückhaltung noch bestärkt, und eine - übrigens nur vorübergehende - Verbannung seiner Erwählten nach ihrem Landsitz Merlou - der acht französische Meilen von Paris entfernt lag - und die Tätigkeit seiner Gegner warfen weitere Hindernisse in den Weg. 59 ) Wohl aber kam er in der Allianzfrage seinem Ziele näher. Am 19. Oktober schrieb er in die Heimat: "Meine Sachen gehen gottlob sehr gut", und am selben Tage nach Regensburg als Antwort auf eine Meldung, daß die Wolfenbüttelsche Erklärung über seine Aufnahme in die Rheinische Allianz noch nicht da sei: "Wir werden Unsern conseil darnach richten und schon iis invitis subsistieren." Der König zeichnete ihn sichtlich aus; den 4. November investierte er ihn in öffentlicher feierlicher Versammlung in den Orden des heiligen Geistes. 60 ) Voller Befriedigung darüber setzt der Herzog, als er das Bevorstehen dieses Ereignisses seinen Räten mitteilt (den 2. November), die Worte hinzu: "Und darbei


|
Seite 36 |




|
wirds gewiß nicht verbleiben. Es wird allen Benachbarten verwundern und Mich bei ihnen mehr considerable machen, geschweige was Güstrow und Wolfenbüttel dazu sagen werden; allein es wird ihnen ihr Anschlag vor diesmal mißlingen." Mit Bestimmtheit erwartet er "mehr gütige Bezeigung, Affektion, Allianz und Conföderation." 61 ) Den 23. November heißt es dann: "Unsere Sachen stehen auf dem Schluß." Seine Bemühungen waren, seit es deutlich war, daß die Aufnahme in die Rheinische Allianz sobald nicht werde zu erreichen sein, auf eine Separat=Allianz gerichtet, und jetzt kam man ihm am Versailler Hofe entgegen. Die Verhandlungen über die Einzelheiten zogen sich noch einige Wochen hin, den 18. Dezember kam endlich das Werk zum langersehnten Abschluß. Der Allianzvertrag lautet wörtlich: 62 )


|
Seite 37 |




|
L'oppression que Monsieur le Prince Christian Louis Duc de Mecklebourg a soufferte en ses Estatz et en ses biens, pendant les années 1658 et 1659 par les excedz qui ont esté commis, et les ravages et violences qui ont esté exercées par les troupes de divers Princes et Potentatz au prejudice des traittez de Paix de Munster et d'Osnabruk, sans qu'aucun des confederez ausd (= aux dits) traittez se soit mis en peine de luy en procurer les reparation et desdommagement, Bien que tous les Princes de l'Empire en fussent garands, ayant fait cognoistre aud S (Sieur) Duc, que des garenties si generales ne peuvent avoir l'effect qu'on s'en estoit proposé a cause de la diversité des Interestz et des affections de ceux qui y sont tenus, et que c'est avec juste subjet que le Roy, qui a tousjours tesmoigné un zele extreme pour la manutention de la liberté germanique, comme aussy pour l'observation desd traittez, auroit jugé necessaire d'y pouruoir par de particulieres liaisons et confederations auec des Princes et Estatz cointeressez a la d e Paix et bien Intentionnez, afin de s'opposer ensemble a ceux qui voudroient y donner quelque atteinte, et
Die Unterdrückung, die der Herr Herzog Christian Louis von Mecklenburg in seinen Staaten und seinen Gütern während der Jahre 1658 und 1659 erfahren hat durch die Exzesse, die begangen sind, und die Verherungen und Gewalttaten, die ausgeübt sind durch die Truppen verschiedener Fürsten und Potentaten zum Präjudiz der Friedensverträge von Münster und Osnabrück, ohne daß einer der in den gedachten Verträgen Verbündeten sich die Mühe gegeben hätte, ihm dafür Ersatz und Entschädigung zu verschaffen, obgleich alle Fürsten des Reiches Garanten dafür gewesen sind, hat den genannten Herrn Herzog erkennen lassen, daß so allgemeine Garantien nicht die Wirkung haben können, die man sich davon versprochen hatte, wegen der Verschiedenheit der Interessen und Neigungen derer, die daran gebunden sind, und daß mit gerechtem Grunde der König, der immer einen außerordentlichen Eifer für die Aufrechthaltung der deutschen Freiheit wie auch für die Beobachtung der genannten Verträge bezeugt hat, es für notwendig gehalten hat, dafür zu sorgen, durch besondere Bündnisse und Verträge mit den bei dem gen. Frieden interessierten und wohl intentionierten Fürsten und Staaten, um sich gemeinsam denen entgegenzustellen, die ihnen irgendwie Eintrag könnten tun wollen, und nach gemeinsamer Ansicht und Übereinkunft dazu bei=


|
Seite 38 |




|
concourir de commun aduis et concert a faire reparer les contrauentions qui se feroient a leur prejudice, Led S Duc voyant dailleurs les bons effectz que produit le traité d'alliance de Sa Ma té auec quelques Electeurs, Princes et Estatz de l'Empire fait a Mayence le 18 e Aoust 1658, et qui dure encore aujourdhuy au grand bien de l'Empire et desd Confederez, par les traitez et actes de prorogation qui en ont esté faits, Considerant en outre que le Roy en est le principal et plus solide appuy, a crû ne pouuoir mieux faire, dans les besoings qu'il a d'estre puissamment protegé, que d'auoir recours a Sa Ma té dans la constitution presente des affaires, et rechercher l'honneur de son alliance. Surquoy Sa d e Ma té ayant desiré de correspondre par les effects de sa bienveillance, a la confiance que le d S Duc a fait paroistre et pour cet effect donné pouvoir transcrit a la fin du present traité au S Hugues de Lionne Marquis de Fresnes et de Berny Con er (conseiller) de Sa Ma té en ses Con cez (conseils) d'Estat et Privé Commandeur de Ses ordres Ministre et Secretaire d'Estat, de conferer et convenir des conditions dud traité
zutragen, daß die zu ihrem Präjudiz geschehenen Kontraventionen abgestellt werden; der genannte Herr Herzog hat ferner die guten Wirkungen gesehen, die der Allianzvertrag S. Maj. mit einigen Kurfürsten, Fürsten und Staaten des Reichs hervorbringt, der in Mainz den 18. August 1658 geschlossen ist und noch heute zu großem Heile des Reiches und der genannten Verbündeten fortdauert durch die Verlängerungs=Verträge und =Akte, die darüber geschlossen sind; in der Erwägung außerdem, daß der König deren vornehmste und festeste Stütze ist, hat er in seinem Bedürfnis nach einem mächtigen Schutze nichts besseres tun zu können geglaubt, als in der gegenwärtigen Lage der Dinge seine Zuflucht zu Seiner Majestät zu nehmen und die Ehre seiner Allianz nachzusuchen. Daraufhin hat S. Maj. durch die Wirkungen seines Wohlwollens dem Vertrauen, das der genannte Herr Herzog gezeigt hat, zu entsprechen gewünscht und in dieser Absicht dem Herrn Hugo v. Lionne, Marquis v. Fresnes und v. Berny, Staats= und Geheimem Rat S. Maj., Kommandeur seiner Orden, Minister und Staatssekretär, die am Ende stehende Vollmacht zum Zwecke des gegenwärtigen Vertrages ausgestellt, über die Bedingungen des gen. Vertrages mit dem genannten Herrn Herzog zu verhandeln und abzuschließen.


|
Seite 39 |




|
avec led S r Duc, Ilz en ont arresté les articles qui en suivent.
Le dit S r Duc Declare que de son propre mouvement pure et franche volonté Il se met avec ses Estatz, Villes, Places, Subjectz et biens en la protection de Sa Ma té , la priant de l'y vouloir recevoir, Surquoy Sa Ma té Declare pareillement qu'elle reçoit, prend et met le d S Duc avec Ses d Estatz, places, vassaux, subjectz, et biens en son alliance et protection, et de ses successeurs Roys de France, et promet en foy de Roy de les defendre et de s'employer sincerement de tout son pouvoir pour les garentir de toute oppression et violence, mesme de toutes charges extraordinaires et de quartiers d'hyver conformement aux traitez de Westphalie, et maintenir led S Duc dans la possession et jouissance de d Estatz, places, droits, terres et seigneuries qui luy appartiennent, et qui luy ont esté remises, cedées et delaissées par lesd traittez.
Comme aussy d'employer son credit, ses offices, et authorité vers les Princes de l'alliance, a ce que led Sr Duc y soit admis et reçu sans retardement, led S Duc
Sie haben die folgenden Artikel festgesetzt:
Der genannte Herr Herzog erklärt, daß er aus eigenem Antriebe und vollkommen freiem Willen sich mit seinen Staaten, Städten, Plätzen, Untertanen und Gütern in den Schutz S. Maj. stellt und sie bittet, ihn darin aufnehmen zu wollen, daraufhin erklärt S. Maj. in ähnlicher Weise, daß sie den gen. Herrn Herzog mit seinen gen. Staaten, Plätzen, Vasallen, Untertanen und Gütern in seine Allianz und seinen Schutz und den seiner Nachfolger, Könige von Frankreich, nimmt und stellt, und verspricht auf Königs Wort, sie zu verteidigen und sich aufrichtig mit seinem ganzen Einfluß ins Mittel zu legen, um sie vor jeder Unterdrückung und Gewalttat, selbst vor allen außerordentlichen Auflagen und vor Winterquartieren, den westfälischen Verträgen entsprechend, zu schützen und den gen. Herrn Herzog in dem Besitz und Genuß der gen. Staaten, Plätze, Rechte, Landgüter und Herrschaften, die ihm gehören und die ihm durch die genannten Verträge zurückgegeben, abgetreten und überlassen sind, aufrecht zu erhalten, wie auch seinen Kredit, seine Dienste und sein Ansehen bei den Fürsten der Allianz anzuwenden, damit der gen. Herr Herzog ohne Verzögerung zugelassen und aufgenommen werde, wogegen der gen. Herr Herzog verspricht und sich verpflichtet, unverzüglich nach der


|
Seite 40 |




|
Promettant et s'obligeant d'y entrer du consentement des autres alliez, Incontinant apres la ratification du present traitté et cependant de donner ordre a ses Deputez dans des Diettes d'appuyer de leurs suffrages les Interestz de Sa Ma té , et des d Confederez, aux fins mentionnées dans le susd traité d'alliance.
S'il arrive que le Roy veuille faire des levées de gens de guerre dans l'allemagne pour son service, led Sr Duc consent dez a present de leur donner passage et retraite dans ses Estatz, et de leur y faire fournir des vivres au prix courant, Mesme de souffrir que lesd levées soient faites en ses Estatz, ou Il les favorisera volontiers offrant de s'employer luy mesme a les faire suivant les capitulations qui en seront dressées.
En cas que S Ma té soit obligé pour le maintien de la Paix ou pour en faire reparer les contraventions d'envoyer des troupes dans l'Empire, led S r Duc sera pareillement obligé de donner libre passage et seure retraitte dans ses Estats, pays, et villes auxd troupes et de leur faire fournir des vivres en payant, au prix courant,
Ratifikation des gegenwärtigen Vertrages mit Zustimmung der anderen Alliierten darin einzutreten und inzwischen seinen Deputierten auf Reichstagen Befehl zu geben, mit ihren Stimmen die Interessen S. Maj. und der gen. Verbündeten zu unterstützen, zu den Zwecken, die in dem o. gen. Allianzvertrag erwähnt sind.
Wenn es sich ereignet, daß der König Kriegsleute in Deutschland für seinen Dienst werben lassen will, so ist der gen. Herr Herzog damit einverstanden, ihnen von jetzt ab Durchzug und Rückzug in seine Staaten zu gewähren und ihnen dort Lebensmittel zum laufenden Preise liefern zu lassen, auch zu gestatten, daß die gen. Werbungen in seinen Staaten geschehen, wo er sie gern begünstigen wird, mit dem Erbieten, selber sich damit zu befassen, sie nach den darüber errichteten Kapitulationen anzustellen.
Im Falle, daß S. Maj. gezwungen ist, zur Aufrechterhaltung des Friedens oder um die Kontraventionen dagegen rückgängig zu machen, Truppen in das Reich zu senden, soll der gen. Herr Herzog in gleicher Weise verpflichtet sein, den gen. Truppen freien Durchzug und sicheren Rückzug in seine Staaten, Länder und Städte zu gewähren und ihnen Lebensmittel zum laufenden Preise gegen Bezahlung zu liefern, unter der Bedingung, daß sie sich mit aller Achtung betragen, die man einem Sonverän


|
Seite 41 |




|
a la charge qu'elles s'y comporteront auec tous les respects deubs a un Souverain, et ne pourront exiger aucunes contributions, taxes, ou Impositions, ny prendre aucuns deniers sur les Estatz et Places dud S Duc, ny rien exiger de ses Subjetz, ny de leurs hostes, qu'en payant, Et que les d officiers et soldats de Sa Ma té auront l'exercice libre de la Religion Catholique, apostolique, et Romaine, dans les lieux dependans de la souveraineté dud S r Duc, avec liberté d'y achepter des armes et munitions de guerre, et de les transporter hors de ses d Estatz, Comme aussy de donner seure retraite et libre entrée et sortie aux vaisseaux du Roy et de ses subjetz dans ses ports, havres, et rades, et liberté d'y sejourner et d'achepter dans ses Estatz les bois propres a bastir des vaisseaux, et de les en sortir pour l'usage et service de Sa Ma té et de ses subjectz, en payant les droits accoustumez.
Le Roy s'employera volontiers par tout ou besoin sera, mesme en la Diette qui se tient presentement a Ratisbonne par les offices de ses Deputez et des Princes ses amys et alliez, pour faire avoir satisfaction aud S r Duc de ce qui
schuldig ist, und keine Kontributionen, Taxen oder Auflagen einfordern noch irgendwelche Gelder auf die Staaten und Plätze des gen. Herrn Herzogs aufnehmen noch etwas von seinen Untertanen oder ihren Wirten fordern dürfen als gegen Bezahlung, und daß die gen. Offiziere und Soldaten S. Maj. die freie Ausübung der katholischen, apostolischen und römischen Religion haben sollen in den Orten, die von der Souveränität des gen. Herrn Herzogs abhängig sind, mit der Freiheit, dort Waffen und Kriegsmunition zu kaufen und sie über die Grenze seiner gen. Staaten zu bringen, wie auch den Schiffen des Königs und seiner Untertanen sicheren Rückzug und freie Einfahrt und Ausfahrt in seinen Häfen und Reeden zu gewähren und Freiheit, sich dort aufzuhalten, und in seinen Staaten Hölzer zu kaufen, die sich zum Schiffsbau eignen, und sie zum Gebrauch und Dienst S. Maj. und seiner Untertanen auszuführen gegen Zahlung der gewöhnlichen Zölle.
Der König wird sich gern bemühen, überall, wo es nötig sein wird, auch auf dem Reichstage, der gegenwärtig in Regensburg abgehalten wird, durch die Dienstleistungen seiner Deputierten und seiner fürstlichen Freunde und Verbündeten, um dem gen. Herrn Herzog Genugtuung zu verschaffen für das, was


|
Seite 42 |




|
luy peut estre deub pour les torts et degasts qui luy ont esté faits depuis la publication de la Paix, et particulièrement pour le payement de ses contribu ons (contributions) et remboursemens des sommes qui luy sont deues, mesme de cells de six cent mille livres a luy adjugée par lesd traitez de Paix.
Le Roy Interposera aussy son authorité et ses offices pour moyenner un accord ferme et durable entre led S r Duc, et ceux qui le poursuivent en execution des commissions qui ont esté delivrées contre luy en sorte que les affaires et differends estant composez a l'amiable, led S r Duc puisse vivre cy apres en repos et tranquillité.
Les Ratifications de part et d'autre seront fournies et eschangées dans le temps de trois mois du Jour et Datte des presentes.
Fait Double a Paris le dix huitiesme Jour de Decembre Mil Six cens Soixante trois.
Signé De Lionne, Christian Louis et a costé est opposé le cachet de leurs armes.
Es folgt noch die Vollmacht des Königs an Lionne, datiert Paris den 20. November 1663, und die Ratifikation, St. Germain en Laye, den 18. März 1664.
man ihm etwa schuldig ist wegen der Unbilden und Verwüstungen, die ihm zugefügt sind seit der Veröffentlichung des Friedens, und besonders wegen der Bezahlung seiner Kontributionen und Erstattung der Summen, die man ihm schuldet, auch der von 600000 Livres, die ihm in den gedachten Friedensverträgen zugesprochen sind.
Der König wird auch sein Ansehen und seine Dienste ins Mittel legen, um einen festen und dauerhaften Vertrag zustande zu bringen zwischen dem gen. Herrn Herzog und denen, die ihn verfolgen in Ausführung der Kommissionen, die gegen ihn eingesetzt sind, der Art, daß nach freundschaftlicher Beilegung der Affairen und Streitigkeiten der gen. Herr Herzog hinfort in Ruhe und Frieden leben kann.
Die Ratifikationen von beiden Seiten sollen in der Zeit von drei Monaten von dem Tage und Datum der Gegenwärtigen (Schriftstücke) geliefert und ausgetauscht werden.
Doppelt ausgefertigt Paris, den 18. Dezember 1663.
Gezeichnet de Lionne, Christian Louis und an der Seite ist ihr Wappensiegel beigesetzt.


|
Seite 43 |




|
Prüft man die Bedingungen, die sich Christian Louis, um Frankreichs Schutz zu gewinnen, hat auferlegen lassen, so können sie, an dem Maßstabe der Verhältnisse jener Zeit gemessen, nicht besonders hart erscheinen. So ist sehr beachtenswert, daß die französischen Truppen, die etwa seine Staaten durchziehen, nicht das Recht erhalten, die mecklenburgischen Festungen zu betreten, 63 ) während der Große Kurfürst im Jahre 1679, also zu einer Zeit, wo Frankreich dem deutschen Reiche bereits schwere Wunden geschlagen hatte und die Gefährlichkeit der Übermacht wie des Übermutes der Franzosen bereits weit deutlicher geworden war als 1663, den Franzosen jenes Recht zugestand. 64 ) Christian Louis ist auch hier, wie oft, nicht ohne Behutsamkeit und Umsicht verfahren. Andererseits ist nicht zu verkennen, daß er selbst längst nicht alles erreicht hatte, was er gehofft. Vor allem ließ man sich in Frankreich nicht dazu herbei, ihm Geldsummen, unter welcher Form auch immer, zu bewilligen. Ferner: von einer Anerkennung seines Rechtes auf das ganze Land, auf die Güstrower Landeshälfte ist nicht die Rede, und das Eintreten des Königs gegenüber den "Verfolgern" seines Schützlings besteht nur in freundschaftlicher Vermittelung. Allein Christian Louis wird selbst bei ruhiger Erwägung der Sachlage seine anfänglich allzu hoch gespannten Erwartungen als unerfüllbar erkannt haben, wollte es doch auch schon etwas bedeuten, daß ihm der König diese besondere Allianz bewilligt hatte, 65 ) und gute Folgen waren für ihn daraus zu erwarten.


|
Seite 44 |




|
So ist die frohe Stimmung, die seine Schreiben aus diesen Tagen atmen, sehr erklärlich.
Eine neue Gnade des Königs folgte Anfang 1664. Den 8. Januar erklärte er den Herzog in seinem Reiche für souverän. 66 )
Voller Entzücken schreibt dieser den 11. Januar: "Es ist nunmehr allhier alles mit großer Reputation und avantagie geschlossen"; - "Der König hat Uns so große Ehre getan, als sein Lebtag keinem regierenden Fürsten in Frankreich widerfahren, hat Uns königlich große Promessen getan, solches vor Uns zu tun, daß Wir in der Tat augenscheinlich seine Affektion werden zu verspüren haben, woran Wir denn auch nicht zweifeln, dann I. Majestät schon einen guten Anfang gemacht, und gewiß es nicht darbei lassen werden, wie Wir denn desfalls, da nötig, gnugsamb Documenta produzieren könnten, aber alles bis zu


|
Seite 45 |




|
seiner Zeit, Unsere Nachbarn werden sich bedenken einige Ungelegenheit Uns anzutun, zumahlen die hiesige Residenten alschon große Augen bekommen, und sich desfalls sehr jalous erweisen. Der König als ein aufrichtiger genereuser Herr achtet solches nicht, und befordert dieses mehr Unser Vorhaben als es schadet. Wir wollen Unser Land in Ruhe wissen und Uns überall considerabel machen, und schuldigen Respekt und Gehorsam verschaffen. Diese intention ist christlich, billig und dem ganzen Lande, ja dem alten Hause Mecklenburg höchst nötig, wie solches alle Unsere actiones, wills Gott, ausweisen sollen."
Seine gute Stimmung ward auch durch die Meldung der Räte (den 14. Januar) nicht getrübt, daß man sich auf dem gleichzeitigen Kreistag habe vernehmen lassen, die Exekution wegen der fürstlichen Brüder, ebenso die wegen der Ämter Lübz und Crivitz, ließen sich nicht länger aufhalten, sie sollten mit 1200 Mann geschehen. Er bedauert in seiner Antwort (den 8. Februar), daß die Brüder "ihre zu des Hauses endlichem Verderb und gründlichem Ruin, welcher aus den Zerstückelungen und Zerreißungen erfolgen muß, gerichtete Intention auch mit der Extremität endlich ins Werk richten wollen", setzt aber hinzu, der König nehme sich auch in dieser Hinsicht seiner an, schreibe an die Herren Kommissare, besonders Schweden, und schicke Expresse ab, gebe auch seinen Ministern zu Regensburg und an anderen Orten Ordre, ernstlich sich seiner anzunehmen.
Dies alles war in vollem Zuge, als Christian Louis die Unterstützung des Königs, noch ehe sie recht wirksam werden konnte, fast verscherzt hätte, und zwar durch übereilten Abschluß seiner zweiten Ehe.
5. Christian Louis' zweite Heirat.
Von Christian Louis' Wiedervermählung wollte König Ludwig schlechterdings nichts wissen. Er sandte den 6. Dezember an Herzog Gustav Adolf ein Schreiben, worin er ihm keinen Zweifel läßt, daß er sich sehr über Christian Louis' Übertritt gefreut habe, auch offen gesteht, er habe dazu beigetragen, soviel in seiner Macht gestanden, um ihm das notwendige Licht in einer für sein Seelenheil so wichtigen Sache zu geben; aber Gustav Adolf dürfe noch weniger zweifeln, daß er sich, was Christian Louis' Ehe betreffe, in keiner Weise einmischen werde, als um ihn zu ermahnen, wie er es immer getan und noch tue, sich mit seiner ersten Gattin wieder zu versöhnen; er glaube auch darin


|
Seite 46 |




|
soviel Erfolg gehabt zu haben, daß Christian Louis gegenwärtig nicht an eine zweite Ehe denke. 67 ) Der Brief ist allem Anscheine nach durchaus aufrichtig gemeint und hatte die Folge, daß weitere Schritte von seiten Gustav Adolfs und seiner Schwester vorläufig suspendiert wurden. Christian Louis hatte aber die zweite Ehe keineswegs aufgegeben, und zwei Monate später hatte sich die Stellung des Königs und des Hofes in dieser Frage schon ein wenig zu seinen Gunsten verschoben, offenbar infolge der kaiserlichen Erklärung vom 8. Januar.
Den 20. Februar 1664 verhandelte auf Befehl des Königs der französische Gesandte in Regensburg, Gravel, mit dem wolfenbüttelschen Gesandten und sagte ihm, der König, der für die Herzogin Genugtuung vermittetn wolle, wünsche zu wissen, was sie begehre, sie möge erklären, ob sie wieder zu ihrem Gatten zurückkehren wolle oder nicht, damit auf dem einen oder andern Wege die Sache beigelegt werden könne; der Herzog müsse endlich wissen, woran er sei, er habe dem König versprochen, in betreff der Rückgabe der Güter alles zu tun, was die Herzogin verlange.
Noch ungünstiger für Christine Margarete lautet ein Handschreiben des Königs an Gravel, datiert vom 7. März, dessen wesentlichen Inhalt der wolfenbüttelsche Geschäftsträger nach Hause berichtete. Ludwig befiehlt darin, daß Gravel fortfahre, in der Heiratssache mit dem Wolfenbütteler zu verhandeln, damit die Sache entweder durch Vereinigung oder Trennung beigelegt werde. "Denn sollte es die Meinung haben, wie etliche in Paris glauben, daß sich die Herzogin mit des Herzogs Brüdern vereinbart habe, nicht wieder zu ihm gehen und auch in keine andere Heirat von ihm willigen zu wollen, damit er keine Leibeserben zur Sukzession bringen könne, 68 ) so wäre solches eine große Herzenshärtigkeit, und weil der Kaiser selbst das päpstliche Absolutionsbreve approbiert, so könne er, der König, endlich,


|
Seite 47 |




|
Gewissens halber, eine anderweite Heirat nicht länger aufhalten; er sehe jedoch lieber, daß der Herzogin Satisfaktion widerfahre."
Man sieht, der König befreundete sich mehr und mehr mit der zweiten Heirat seines Schützlings, allein er wünschte die Leitung der Angelegenheit in seiner Hand zu behalten, wie er denn auch dem Herzog und seiner Erkorenen Weisungen gegeben haben muß, nicht ohne seine Einwilligung in die Ehe zu treten. Trotzdem war dies, als der König den Brief vom 7. März unterzeichnete, bereits geschehen.
Christian Louis, der nur zu gut wußte, daß Verhandlungen, um seine erste Gattin in Güte zur Einwilligung in die Scheidung zu bewegen, erfolglos sein würden, wurde zu ungeduldig, um noch länger zu warten, und Isabella Angelika ließ, seit der Kaiser den etwaigen Kindern aus einer zweiten Ehe des Herzogs Sukzessionsberechtigung zugesichert, ihre Bedenken schwinden. So kam der Ehekontrakt zustande, den der Herzog den 28. Februar unterzeichnete.
Dieser Ehekontrakt erregt in manchen seiner Bestimmungen weit schwerere Bedenken als das französische Bündnis. Schon daß die Ehe der Rechtsprechung des Pariser Gerichtshofes (de la prévosté de Paris) unterstellt wurde, war recht bedenklich. Denn damit trat der souveräne deutsche Fürst für seine ehelichen Verhältnisse unter französische Gerichtsbarkeit. Ferner wurde zwischen den Gatten vollständige Gütergemeinschaft festgesetzt, nur die Artillerie und die Munitionsvorräte des Herzogs ausgenommen. Damit unterwarf er seine gesamten Domänen dieser Bestimmung, die Französin wurde Miteigentümerin derselben. Allerdings sollten die Erwerbungen, die seine Gattin etwa noch in Frankreich machen werde, ihr und ihren Erben als Sondereigentum verbleiben, gegen Erstattung der Summen, die etwa aus dem gemeinsamen Vermögen genommen werden, um den Preis für diese Erwerbungen zu bezahlen. Umgekehrt darf auch Christian Louis neue Erwerbungen für sich und seine Erben behalten gegen Zahlung der Hälfte des Erwerbspreises. Beide Gatten sollen nicht gehalten sein, die Schulden, die der andere vor der Ehe gemacht hat, zu bezahlen. Als Mitgift versprach sie dem Gemahl 400000 Livres zuzubringen, doch sollten von dieser Summe 100000 Livres ihr Eigentum bleiben. An diese Bestimmung schließt sich ein Passus, durch den das Eigentumsrecht für alle anderen Güter, Mobilien und Immobilien, die die Herzogin gegenwärtig besitzt, und alle, die


|
Seite 48 |




|
ihr etwa durch Erbschaft, Schenkung oder sonst zufallen, ihr und ihren Erben vorbehalten wird; ja es soll für den Bestand der Inventare, die über das Vermögen der Herzogin aufgenommen werden, oder deren Geldwert das Vermögen der Ehegemeinschaft oder, wenn das nicht ausreicht, das eigene des Herzogs haften. 69 ) In einem andern Passus wird ihr gestattet, so oft sie es für nötig hält, nach Frankreich zu reisen und dort alle für die Verwaltung ihrer Güter erforderlichen Maßregeln selbständig zu treffen. Beide Bestimmungen zusammen machten die Gütergemeinschaft für den Herzog, abgesehen von den 300000 Livres, völlig illusorisch; seine Gattin behielt vollkommen freie Hand, ob sie ihm überhaupt etwas von den Erträgen ihrer Güter zukommen lassen wollte und wieviel, dagegen wird er mit seinem gesamten Besitz - dem derzeitigen, da dieser ja der Ehegemeinschaft angehörte, und den etwaigen künftigen Erwerbungen - für die Erhaltung des Vermögens seiner Gattin haftbar gemacht. Dafür erhielt sie allerdings kein Nadelgeld. Als Witwengeld werden ihr jährlich 30000 Livres verschrieben auf die Domänen und Fürstentümer Ratzeburg, Bützow, Schwerin, Dömitz und andere Domänen, Rechte, Landgüter, Einkünfte und Herrschaften, er setzt also nicht nur die beiden Fürstentümer, sondern außer diesen noch das Residenzamt und das Amt Dömitz - zu dem der Zoll gehörte! - zum Pfande für das Wittum. Noch unvorsichtiger aber war es, daß er ihr als Witwensitz die Festung Dömitz zusicherte und ihr überdies, falls ihr diese nicht gefiel, die Berechtigung gab, einen andern von seinen Plätzen, "welchen sie will", zu wählen. Dömitz in der Hand der Französin konnte


|
Seite 49 |




|
einmal eine schwere Gefahr für Mecklenburg werden, der Schluß des Passus aber gab ihr das Recht, den Nachfolger ihres Gatten, wenn es ihr beliebte, aus seiner eigenen Residenz zu vertreiben, um dort selbst Wohnung zu nehmen. Für den Fall, daß der Herzog sie mit unmündigen Kindern hinterlasse, ward ihr, bis der älteste Sohn 14, die Töchter 12 Jahre zählen, gegen die Verpflichtung zur Erziehung nicht nur der Genuß der Güter ihrer Kinder eingeräumt, sondern auch die Landesregierung (la régence, gouvernement et administration), ohne irgend welche Verpflichtung, darüber Rechenschaft abzulegen. Mit Rücksicht auf diesen Fall sollten ihr bei ihrer ersten Reise nach Mecklenburg Stände, Truppen und Untertanen als ihrer souveränen Herzogin den Huldigungseid leisten. Über den Kontrakt verpflichtet der Herzog sich, die Bestätigung des Kaisers und die Genehmigung der Landstände einzuholen.
Es ist bezeichnend, daß keiner der deutschen Beamten, die den Herzog begleiteten, dieses Aktenstück vor der Unterzeichnung zu sehen bekam; die ganzen Verhandlungen wurden vielmehr vor ihnen auf das sorgfältigste geheim gehalten und lediglich zwischen den Vertrauten der Herzogin und dem Herzog selbst betrieben, der dabei durch seinen damaligen französischen Vertrauten, den Sekretär le Cocq, einen etwas zweifelhaften Ehrenmann, beraten ward. Augenscheinlich hat sich der Herzog, um endlich zum lang ersehnten Ziele zu kommen, überreden lassen, auf alles einzugehen, was man von ihm wünschte. Daß er gegen das Bedenkliche des Kontraktes nicht blind war oder es wenigstens bald erkannte, darf man aus dem Umstande schließen, daß er es unterließ, die Genehmigung des Kaisers wie der Landstände einzuholen. 70 )
Gänzlich unklar ist, wie es darauf mit der Auszahlung der Mitgift zugegangen ist. Er hat eine Quittung ausgestellt, datiert vom 2. März 1664, in der er mit eigenhändiger Unterschrift bestätigt, daß er die 400000 Livres in Louisdors, spanischen Pistolen, Silberlouis und anderen Münzen empfangen habe und zugleich, daß


|
Seite 50 |




|
er in den "ruhigen Besitz" 71 ) aller Möbel, Silbergefäße, Kleinodien und anderer Sachen gesetzt sei, die der Herzogin in Paris gehörten und in einem notariell beglaubigten Inventar verzeichnet waren; ebenso quittiert er über die Ausstattung der Schlösser in Châtillon und Merlou. In Wahrheit gab er seine Unterschrift, ohne von den 400000 Livres irgend etwas bekommen zu haben. 72 )
An demselben 2. März, dem Sonntag Invocavit, ward in der Kirche des Kirchspiels St. Roc, in deren Nähe das Hotel der Herzogin, in der Rue de St. Honoré, lag, um Mitternacht die Trauung durch Mr. de Bongaret, Prior von Merlou, Kanonikus von Notre Dame de Paris, vollzogen. 73 )
Die Trauung geschah also in aller Heimlichkeit und ohne Einwilligung des Königs, ein sehr gewagter Schritt, der die Stellung des Herzogs wie seiner Gattin zum König wie zum Hofe erheblich verschob. Dem König verbarg man die Nachricht mehrere Wochen; er wußte noch nichts davon, als er den 8. März in St. Germain den Schutzvertrag vom 28. Dezember ratifizierte. 74 )


|
Seite 51 |




|
Als er sie endlich erfuhr, ward er so unwillig, daß er beide Gatten weder sehen noch hören wollte, weil sie wider seinen Befehl gehandelt. Dies erfuhr ein junger Herzog von Wolfenbüttel, der damals in Paris war, und schrieb es den 28. März seiner Mutter Sophie Elisabeth, und diese teilte es ihrem Bruder, dem Güstrower Herzog, mit. 75 )
Das neuvermählte Paar hielt sich also fürs erste in stiller Zurückgezogenheit, während inzwischen bei Hofe ihre Freunde, deren wenigstens die Herzogin viele hatte, für sie wirkten. Ihre einflußreichste Gönnerin war die Königin=Mutter, die selbst viel dazu beigetragen haben soll, daß die Ehe zustande kam. Die sämtlichen Verwandten der Herzogin, die Prinzen von Condé und Conti, auch der Marschall Turenne und andere erklärten ihre Zustimmung zu dem Ehekontrakt. So fand sich endlich auch der König in die vollzogene Tatsache, und das fürstliche Paar durfte wieder bei Hofe erscheinen, 76 ) freilich ohne daß der König von ihrer Ehe Notiz nahm.
Der Herzog selbst hatte in seinen Briefen an seine heimische Regierung über diese Verlegenheiten völlig geschwiegen, jetzt erst, den 11. April, schrieb er: "Auch in der Heiratssache haben Wir es sowohl wegen Unser freundl. herzvielgeliebten - ein ganz ungewöhnlich warmer Ausdruck in seinem Munde 77 ) - Gemahlin Person als fürstlicher Tugend, hoher Qualitäten, großen Esprits


|
Seite 52 |




|
und naher Verwandtnis mit fürstlichen und königlichen Personen zu Unserm Wohlvergnügen erhalten", und ordnet ein Dankfest für das ganze Land an. In der Tat war Isabella Angelika, obgleich schon 37 Jahre alt, allem Anscheine nach noch wohl geeignet, ein Mannesherz zu fesseln. Auch der wolfenbüttelsche Gesandte in Paris, der sie in diesen Tagen selbst sah und sich lange mit ihr unterhielt, schildert sie (den 18. April) als eine "schöne und sehr angenehme Dame von einem bewundernswerten Esprit, fähig zu bezaubern," und urteilt, Christian Louis hätte nicht besser wählen können. Er rühmt noch ihre Duldsamkeit in Sachen der Religion; sie habe in der Herrschaft Châtillon seit dem Tode ihres Gatten sowohl die (protestantische) Schule belassen wie auch alle Einwohner in ihrer Religion unangefochten gelassen, ja ihnen viel Freundlichkeiten erwiesen und sich dadurch ihre Zuneigung erworben. Zudem sei sie geschickt in der großen Politik. Von dieser ihrer Gabe machte sie nun den Gebrauch, daß sie alle Hebel in Bewegung setzte, um die Verhältnisse ihres Gatten zu ordnen, 78 ) wie auch ihrer Ehe Anerkennung zu verschaffen. Auch der König ließ sich bereit finden, seine Tätigkeit für seinen Schützling wieder aufzunehmen.
6. Die Tätigkeit des Königs für Christian Louis im Sommer 1664.
Die erste Sorge war, die verschiedenen gegen Christian Louis bereits angeordneten Reichsexekutionen aufzuhalten. Zu diesem Zwecke erhielt der französische Resident in Hamburg, Bidal, Befehl, nach Wolfenbüttel, Celle und Halle, auch nach Lübeck und Güstrow zu reisen und überall im Namen seines Herrn um Unterlassung der Exekutionen anzuhalten. Nach Schweden wurde ein Gardekapitän mit einem Schreiben des Königs gesandt. Auch die Herzogin schrieb selbst an Bidal, und schon den 26. April konnte dieser ihr eine gute Nachricht mitteilen. Er hatte mit dem schwedischen Geh. Rat Nicolai konferiert, und dieser hatte gesagt, man brauche keine Exekution durch Schweden zu be=


|
Seite 53 |




|
fürchten. 79 ) In der Tat unterblieb die Exekution wegen der Brüder überhaupt, und die wegen der Ämter Lübz und Crivitz wurde wenigstens um mehr als ein halbes Jahr hinausgeschoben.
Was die Ehe betraf, so entschloß sich der König, um eine künftige Anerkennung derselben vorzubereiten, jetzt ernstlich zu versuchen, was er schon vorher beabsichtigt hatte, nämlich eine Vermittelung zwischen Christian Louis und seiner ersten Gattin, um diese zum Rücktritt von der Ehe gegen Entschädigung zu bewegen.
Der Güstrower Geschäftsträger Heiß übernahm es, als Bevollmächtigter des Königs nach Güstrow, auch zu Christian Louis' Brüdern und nach Wolfenbüttel zu reisen. Sein Auftrag ging also nicht dahin, von den Interessenten die Anerkennung der zweiten Ehe des Schweriner Herzogs, die man am französischen Hofe offiziell als überhaupt nicht vorhanden ansah, sondern nur die Zustimmung zu der vollzogenen Scheidung zu erwirken. Daneben hatte er auch über eine Allianz und einen Handelsvertrag mit Güstrow zu verhandeln. 80 ) Für einen so überzeugten Protestanten, wie Herzog Gustav Adolf, war in dieser Frage jede Nachgiebigkeit vollkommen ausgeschlossen. Handelte es sich doch nicht nur um die Interessen seiner Schwester oder des mecklenburgischen Fürstenhauses allein, sondern um eine Frage von der allerhöchsten Bedeutung für die sämtlichen evangelischen Stände Deutschlands, ja das evangelische Bekenntnis überhaupt, die Frage nämlich, ob es dem Papste erlaubt sei, eine Ehe, die zwischen zwei Nichtkatholiken geschlossen war, zu trennen, wenn einer der Gatten katholisch wurde. Dazu kam noch die Besorgnis, daß Mecklenburg=Schwerin durch ein katholisches Fürstenpaar wieder zum Katholizismus zurückgeführt werden könnte. Deshalb hatte Gustav Adolf sofort auf die erste Nachricht von der Eheschließung unter dem 23. März ein Schreiben an den König abgesandt, in dem er die Hoffnung ausdrückt, daß der König Christian Louis' zweite Ehe nicht billigen, vielmehr für nichtig erklären werde, sowie einen


|
Seite 54 |




|
lateinischen Protest, der durch Heiß dem Herzogspaare in Paris eingehändigt werden sollte. Und am 24. März hatte er sich an den Kaiser gewandt mit der Bitte, er möge der zweiten Ehe seine Bestätigung versagen; zugleich hatte er in Regensburg einen gemeinsamen Schritt sämtlicher evangelischen Stände bei dem Kaiser beantragen lassen, der denn auch mit ganz ungewohnter Schnelligkeit zustande kam. Vom 13. April ist das gemeinsame Memorial der evangelischen Reichsstände datiert, in dem sie den Kaiser ersuchen, er möge die angemaßte Gewalt des Papstes durchaus nicht gestatten und die Konfirmation über die päpstliche Entscheidung "und was dem kaiserlichen Dekreto fernerweit angehänget", wieder kassieren. Das Schriftstück wurde von dem schwedischen und wolfenbüttelschen Gesandten den 24. April / 1. Mai dem Kaiser, der damals selbst in Regensburg war, persönlich übergeben. Einige Tage später (den 27. April / 4. Mai,) ließ Herzog Gustav Adolf durch seinen Gesandten Heiß ein Schreiben von ihm selbst übergeben, das ebenso wie das gemeinsame Memorial der evangelischen Stände vorzugsweise die Berechtigung des Papstes zur Trennung der ersten Ehe Christian Louis' anfocht. Und als dann Gustav Adolf hörte, daß sein nach Paris gesandter lateinischer Protest dort - auf Lionnes Anraten - nicht übergeben sei, erließ er einen neuen deutschen Protest (vom 27. April), den er der Schweriner Regierung und auch Christian Louis selbst nach Paris brieflich zufertigte.
In ähnlichem Sinne handelten die Brüder Christian Louis'. Den 7. April sandten sie ein Schreiben an die Schweriner Regierung, worin sie ihres Bruders erste Gemahlin für die allein rechtmäßige erklärten: andere Schritte waren in Vorbereitung.
Da kam Ende April Heiß in Güstrow an. Dorthin war er zuerst gereist und sandte von da aus die Schreiben des Königs nach Wolfenbüttel mit der Post an ihre Adressaten. Das Schreiben an Herzog Gustav Adolf, das er mitbrachte, begründet des Königs Wunsch, seinem Freunde Christian Louis in seiner Familie Ruhe zu verschaffen, mit der abgeschlossenen Allianz, betont dann, daß Christian Louis von seiner, übrigens auf Grund des päpstlichen Breves und eines kaiserlichen Dekretes abgeschlossenen, zweiten Ehe dem Könige vorher keinerlei Mitteilung gemacht habe; trotzdem sei der König noch immer zur Vermittelung geneigt, er wünsche bei dieser Gelegenheit Herzog Gustav Adolf einen Beweis von der Aufrichtigkeit zu geben, mit der er sich den Interessen seiner Freunde zu widmen pflege, und sende deshalb Heiß, um, wo möglich, eine Vereinbarung zu treffen über die Mittel, alles zu


|
Seite 55 |




|
einem guten Ende zu führen, zum Wohle und zur Sicherheit der einen und der andern.
Von Paris aus wurde Heiß unterstützt durch einige Schreiben, die Richardiere an den Herzog richtete, die aber in Wahrheit aus dem französischen Ministerium selber stammten, wo man den Güstrower Korrespondenten aufgespürt hatte und ihn nun für diesen Zweck benutzte. Darin wurden mit den verlockendsten Farben die Vorteile geschildert, die der Abschluß einer Allianz wie eines Handelsvertrages mit Frankreich für den Güstrower Herzog und sein Land haben werde. 81 ) In einem der Schreiben (vom 29. Juni) wird, um Gustav Adolf mürbe zu machen, mit den Ansprüchen gedroht, durch die Christian Louis dem Güstrower Vetter auf Grund des großväterlichen Testaments gefährlich werden


|
Seite 56 |




|
könne. Gerade Gustav Adolfs Streitigkeiten mit dem Schweriner Vetter seien ein starker Grund für ihn, in die Allianz einzutreten, um Christian Louis' Pläne zu zerstören, indem er ihm dieselbe Autorität entgegenstelle, auf die jener alle seine Hoffnungen begründe. 82 ) Nur eine Bedingung müsse erfüllt werden: Gustav Adolf müsse in der Ehesache Entgegenkommen zeigen.
Herzog Gustav Adolf begnügte sich vorläufig damit, Heiß anheimzugeben, er möge sich an seine Schwester nach Wolfenbüttel wenden, teilte aber gleichzeitig dieser und Herzog August seine ihnen ohnehin schon wohlbekannte Ansicht nochmals mit. So erhielt selbstverständlich Heiß, als er nun in Wolfenbüttel erschien, von Christine Margarete die Antwort, sie könne unmöglich die zweite Ehe ihres Gatten anerkennen. Darauf verweilte Heiß nochmals einige Tage in Güstrow, ging dann gegen Ende Mai nach Hamburg und verhandelte von dort aus noch eine Weile brieflich weiter; aber während er fortfuhr (z. B. den 3. Juni), eine Vereinbarung mit Christine Margarete zu empfehlen, wodurch sich Gustav Adolf die Freundschaft des Königs gewinnen könne, wünschte man in Güstrow die Ehesache ganz aus der Verhandlung auszuscheiden, war aber geneigt, in eine Allianz mit dem Könige zu treten, hierauf aber ging man wiederum in Frankreich nicht ein.
An dieser Situation änderte auch eine kurze Reise nichts, die Christian Louis selbst im Sommer dieses Jahres nach Mecklenburg machte. In Schwerin angekommen (den 13. Juni), meldete er dies dem Güstrower Vetter und schrieb dabei, er habe Mr. Bidal, den französischen Gesandten in Hamburg, so verstanden, daß sich Gustav Adolf gegen Heiß "so raisonable erklärt, daß zu aller ersprießlichen Correspondenz guter Succeß zu verhoffen sei". Gustav Adolf antwortete (den 14. Juni) äußerst kühl, ja abweisend: "Was Mr. Bidal mag erwähnt haben, können Wir nicht wissen. Unsere Erklärung sonsten gegen Ihre Maj. von Frankreich ist also eingerichtet gewesen, wie es die Gerechtigkeit der Sachen und Unsers hohen Hauses und dessen Anverwandten und Alliierten Respekt und Interesse erfordert hat." Christian Louis brach hierauf die Korrespondenz mit Güstrow in dieser Sache ab, tat aber in der Zeit seiner Anwesenheit im Lande einen Schritt seinen Brüdern gegenüber, der ihm einen bedeutenden Erfolg eintrug. Er sandte von Ratzeburg aus, den 9. August, ein Aktenstück nach


|
Seite 57 |




|
Wien, worin er sich erbot, seinen Brüdern zu den früher schon angebotenen 15000 Talern noch 3000 zuzulegen, also im ganzen 18000 Taler für seine Brüder und Schwestern und 6000 für seine Witwe jährlich zu zahlen. Sein Anerbieten wurde durch französischen Einfluß unterstützt. 83 ) Schwan reiste nach Wien und entfaltete sein ganzes Geschick, auch Kurmainz und andere Freunde Christian Louis' waren für ihn tätig, und den 25. September erfolgte der Beschluß des Reichshofrates, man solle des Herzogs Anerbieten den Herren Kommissaren übersenden mit dem Befehl, die Erklärung der Kläger darüber einzuholen und zu berichten; von der längst verhängten Exekution war nicht mehr die Rede, sie war durch den Beschluß faktisch aufgehoben. 84 )
Christian Louis erhielt die Nachricht hiervon nicht mehr im Lande, schon Anfang September reiste er wieder nach Paris.
König Ludwigs Gesandter Heiß war schon Ende Juni wieder zurückgereist und erhielt ein Schreiben, das Gustav Adolf ihm nach Hamburg sandte, erst in Paris. In dem Schreiben erklärte Gustav Adolf seine Bereitwilligkeit, in eine Allianz mit Frankreich zu treten, und beauftragte Heiß, im Falle er Neigung dazu


|
Seite 58 |




|
verspüre, die Verhandlungen darüber am französischen Hofe einzuleiten; 85 ) nur müsse die Ehesache davon gänzlich getrennt bleiben.
Der König empfing Heiß in Fontainebleau - Mitte Juli - sehr freundlich, sprach aber doch, als er seinen Bericht gehört, die Erwartung aus, daß Gustav Adolf in Anbetracht seiner Vermittelung in seinen Bemühungen fortfahren werde, alles in Freundschaft beizulegen. Lionne weigerte sich zuerst überhaupt, mit dem Könige über eine Allianz zu sprechen, ehe Gustav Adolf mit Christian Louis einig sei. Er ließ sich allerdings dann doch dazu herbei, brachte aber, wie nicht anders zu erwarten war, den Bescheid, der König wünsche erst die Zwistigkeiten zwischen den Gliedern des Hauses Mecklenburg in Güte beigelegt zu sehen, und obgleich Gustav Adolf (den 9. August) schrieb, er könne nicht einsehen, warum wegen solcher Streitigkeiten, wozu er nicht die geringste Ursache gegeben, die Allianz und die Verhandlungen über den Handelsvertrag aufzuschieben seien, Heiß möge auf diese mit allen dienlichen Remonstrationen fleißig dringen, so hatte es doch bei der einmal gegebenen Entscheidung sein Bewenden. Nur insoweit nahm der König auf die Wünsche von Güstrow und Wolfenbüttel Rücksicht, daß er die Anerkennung seiner Kousine als Herzogin von Mecklenburg, die man nach Heißens Rückkehr am französischen Hofe öffentlich auszusprechen beabsichtigt hatte, aufschob, auch die persönlichen Bemühungen von Isabella Angelika vermochten nichts daran zu ändern, ebensowenig die Fürbitte, die der päpstliche Legat auf Befehl des Papstes beim König einlegte. 86 )
Hierauf beschränkte sich aber der Erfolg aller Schritte, die der Güstrower wie der Wolfenbütteler Hof und Christian Louis' Brüder gegen dessen zweite Ehe unternahmen. In Wien hüllte man sich allen Zuschriften gegenüber, die sich hierauf bezogen, in ein tiefes Schweigen. 87 )


|
Seite 59 |




|
7. Erste Mißhelligkeiten zwischen Christian Louis und Isabella
Angelika; Tauschplan der Herzogin.Als Christian Louis im September nach Paris zurückkehrte, ward er von seiner Gattin mit lebhafter Freude empfangen; ihre Freude war um so größer, als sie damals die Hoffnung hegte, ihm einen Erben schenken zu können. 88 ) Trotzdem war das eheliche Glück nicht so ganz ungetrübt. Isabella Angelika kränkte es, daß man ihre Ehe noch immer nicht anerkennen wolle; sie blieb nicht unempfindlich gegen die mannigfachen Proteste, die in ihre Hand gelangten, darunter selbst solche von den nächsten Anverwandten ihres Mannes. Daß dessen sämtliche erwachsene Brüder ihr (in ihrem Schreiben vom 14. Mai) rund heraus erklärten, ihre Ehe sei in ihren Augen nicht legitim, ihre Kinder nicht erbberechtigt, sie selbst könne nicht als Herzogin von Mecklenburg anerkannt werden, "weil es schon eine gebe, die diesen Titel mit mehr Berechtigung (plus légitimement) besitze", machte doch tiefen Eindruck auf sie. Sie begann einzusehen, daß sie voreilig gehandelt, als sie sich mit Christian Louis vermählt, ehe die Trennung seiner ersten Ehe allseitig anerkannt war. 89 )
Dazu gesellten sich noch andere Sorgen, die dieses Gefühl in ihr noch verstärkten. Ihr wurde klar, daß sich ihr Gatte keineswegs in der glänzenden Finanzlage befinde, wie sein erstes Auftreten in Paris den Anschein erweckt hatte. Und ihr selbst ging es nicht besser, ihre Güter waren mit Schulden belastet, und gerade durch ihre Ehe zog sie sich einen Prozeß wegen der Herrschaft Châtillon zu, der ihr lange Zeit, bis sie ihn schließlich endgültig gewann, schweren Verdruß verursachte und große Kosten machte:


|
Seite 60 |




|
sie selbst nennt einmal die Summe von 200000 Talern. Also war Sparsamkeit nötig, ihr Gatte aber übte diese nicht in dem Grade, wie es ihr erforderlich schien. Sie hatte auch den Eindruck, als wenn er sich nicht mit dem nötigen Eifer seinen Staatsgeschäften wie persönlichen Angelegenheiten widme. 90 ) Umgekehrt hatte Christian Louis die Ehe mit ihr gerade mit aus dem Grunde gesucht, weil er gehofft hatte, durch ihre Reichtümer aus seinen finanziellen Verlegenheiten befreit zu werden.
Gleich in der ersten Zeit der Ehe, am 15. Mai, sollen beide Gatten über die Geldfrage in einen scharfen Zwist geraten sein; 91 ) das ist sehr glaublich, das heftig aufbrausende Wesen des Herzogs ist ja bekannt. Isabella Angelika wußte ihn aber mit ihrer liebenswürdigen Gewandtheit bald wieder zu begütigen. Ähnliches mag öfter vorgekommen sein. Einige Male geschah es, daß Gläubiger des Herzogs Arrest legten auf Sachen, die ihr gehörten. Hieraus entnahm sie die Veranlassung zu einem merkwürdigen Vorgehen: Hinter dem Rücken ihres Gatten und ohne sein Wissen wandte sie sich in einer Eingabe vom 2. Oktober an den Chatelet=Hof zu Paris (den Hof der Notare, wo Rechtsgeschäfte der Art besorgt wurden) und ließ die Gütergemeinschaft aufrufen (den 12. November). Zugleich wird ihr Gatte auf ihren Antrag dazu verurteilt, die 400000 Livres Mitgift zurückzuzahlen mit Zinsen vom 2. Oktober 1664 an, auch alle Mobilien,


|
Seite 61 |




|
die sie ihm zugebracht, zurückzugeben, ferner, bis ihr Wittum eröffnet sei, eine jährliche Pension von 30000 Livres zu zahlen. Sie erhält sogar die Erlaubnis, die ihrem Gatten gehörigen Mobilien und andere Sachen zu verkaufen und die davon gelösten Gelder auf Abschlag und bis zur gänzlichen Regelung ihrer Forderungen zu behalten; des Beklagten Schuldner werden angewiesen, ihre Schulden an die Herzogin zu entrichten.
Bei der Verhandlung vor dem Chatelet=Hofe trat in der Rolle eines von Christian Louis bestellten Prokurators ein Rechtsgelehrter namens Auvry auf, dem der Herzog den 8. Oktober eine Vollmacht dafür ausgestellt hatte. Er erschien freilich nicht bei der Verhandlung, und sein Klient wurde deswegen in contumaciam verurteilt; dieses Urteil aber ward Auvry zugestellt, der es auch annahm, womit für den Gerichtshof der Fall erledigt war. Merkwürdig nur, daß Christian Louis von diesem seinem Vertreter überhaupt nichts wußte, und doch war die Vollmacht, wie sich später auswies, echt! Nach der eigenen späteren Darstellung des Herzogs hatte er sich wieder einmal täuschen lassen; er ließ sich überreden, die Vollmacht zu unterzeichnen, wie es scheint, ohne ihren Inhalt genauer zu prüfen; möglich auch, daß er ein Blankett unterzeichnet hat zu irgend einem anderen Zwecke, das man für dieses Manöver benutzte. 92 )
Mit dem ergangenen Urteil hatte sich Isabella Angelika auf alle Fälle gesichert, sie behielt es aber vorläufig in Händen, ohne seine Ausführung zu betreiben, ja ohne dasselbe auch nur ihrem Gatten zustellen zu lassen, 93 ) nur wußte sie ihn, indem sie die gesamte Verwaltung ihrer Güter und Einkünfte in der eigenen Hand behielt, tatsächlich von der Gütergemeinschaft auszuschließen, trotzdem er nicht aufhörte, auf deren völlige Ausführung zu dringen. Dabei war sie gewandt genug, um ihn mit ihren Liebesbeteuerungen immer wieder zu begütigen, so daß das gute Verhältnis äußerlich von Bestand blieb. 94 )


|
Seite 62 |




|
Nachdem die Herzogin sich von ihrem Krankenlager einigermaßen erholt hatte, trafen die Gatten Vorkehrungen zu einer gemeinsamen Reise nach Mecklenburg. Allein die Gesundheit der Herzogin erlaubte die Reise in der rauhen Jahreszeit noch nicht, und sie wurde aufgeschoben. Mitgewirkt hat bei diesem Aufschub auch wohl die dringende Abmahnung des Güstrower Hofes, der durch Heiß an Isabella Angelika sagen ließ, die Reise werde ihr nur Ungelegenheiten verursachen.
Inzwischen hatte Isabella Angelika im geheimen an einer ganz anderen Lösung aller Schwierigkeiten gearbeitet; sie war nämlich auf den Gedanken gekommen oder gebracht, ob es nicht möglich sei, die Regierung über das Schweriner Land an den Güstrower Herzog abzutreten, der sich dafür zu verpflichten hatte, ihrem Gatten jährlich eine bestimmte Summe zu zahlen. Der erste Anstoß zu diesem Plan scheint von Heiß herzurühren, wenigstens nach dessen eigener Aussage; er will in einem Gespräche mit Isabella Angelika als Mittel zur Beilegung der Streitigkeiten den Vorschlag gemacht haben, Christian Louis möge mit einem seiner Verwandten einen Vertrag schließen, gegen eine bestimmte jährliche Pension sein Land abzutreten; er behauptet, auch den Herzog diesem Plan geneigt gefunden zu haben. 95 ) Von einer solchen Absicht des Herzogs findet sich nun freilich nirgends eine sichere Spur, im Gegenteil ist es bei dem Verhältnis zwischen ihm und seinen Verwandten, bei dem hohen Werte, den er auf seine Stellung als souveräner Fürst legte, und der ungewöhnlichen Wachsamkeit, mit der er stets darauf hielt, daß ihm von diesen Rechten nichts abbröckele, durchaus unwahrscheinlich, daß er je im Ernst etwas derartiges beabsichtigt hat; er wird, wie seine Weise war, eine ausweichende Antwort gegeben haben, die Heiß als eine zustimmende auffaßte. Der Herzogin aber, die ihren Gatten am liebsten in Frankreich behalten hätte, leuchtete der Vorschlag ein, und mit ihr scheint Heiß noch öfter darüber gesprochen zu haben. Bei seiner Gesandtschaftsreise nach Güstrow machte er Herzog Gustav Adolf


|
Seite 63 |




|
hiervon Mitteilung. 96 ) Was dieser darauf geantwortet hat, ist nicht überliefert, aber schwerlich geschah es ohne sein Vorwissen, wenn Heiß in einer Unterhaltung mit Lionne über diesen Gegenstand, über den er den 31. Oktober berichtet, auf dessen Frage, er sehe nicht, mit wem man sicher darüber verhandeln könne, Herzog Gustav Adolf nannte, der es mit Zustimmung der übrigen Interessenten tun könne, womit das Gespräch sein Ende gefunden hatte. Vor dieser Unterhaltung war schon den 10. Oktober zwischen Lionne und Heiß von demselben Thema die Rede gewesen, damals hatte Lionne von der Zuneigung des Königs für Gustav Adolf gesprochen und geäußert, er wünsche mit ihm lieber als mit jemand anders über einen Tausch des Schweriner Landes gegen eine jährliche Rente zu verhandeln. Man kannte den Plan also auch am Hofe zu Paris, aber nach dem 31. Oktober kam Lionne nicht wieder darauf zurück; warum nicht, ist leicht zu sagen: Gustav Adolfs Widerstand in der Ehefrage brachte ihn um König Ludwigs Gunst und ließ es als durchaus untunlich erscheinen, ihm zum Besitze des Schweriner Landes zu verhelfen. Isabella Angelika verfolgte den Plan allerdings noch eine Weile. Den 22. Mai 1665 schreibt Heiß nach Güstrow, sie sei ärgerlich, daß Gustav Adolf ihn nicht nach Mecklenburg kommen lasse, um den bewußten Plan zu fördern, wohlverstanden in der Absicht, eine möglichst hohe Rente daraus zu ziehen, im Falle man sich über den Tausch einige. 97 )
Ende des Jahres 1664 reiste Christian Louis wieder - und zwar ohne seine Gattin - in die Heimat zurück, wo er nun bis auf einen kurzen Besuch in Paris zum Osterfest des Jahres 1665 fast zwei Jahre verblieb. Die Briefe, die sie ihm nach=


|
Seite 64 |




|
sandte, atmen die ganze Zärtlichkeit des liebenden Weibes, sie ist tief bekümmert über seine Abwesenheit 98 ) und umarmt ihn tausend und abertausend Mal. Den 9. Januar schreibt sie: "Ich möchte, daß die ganze Erde Euch unterworfen sei und Euch anbete, denn ich habe eine Leidenschaft für Euren Ruhm, die außerordentlich ist, und eine Zärtlichkeit für Eure Person, die alle Vorstellung übersteigt, die Ihr Euch davon machen könnt." 99 )
In dieselbe Zeit gehört freilich auch die oben schon erwähnte Bemerkung, daß sie sich zu früh vermählt habe. Unmittelbar vor dieser versichert sie, sie suche nur deswegen ihre Affairen in guten Stand zu setzen, um Christian Louis alles zu opfern - was freilich zu dem heimlich erwirkten Gerichtsurteil wenig stimmt - und äußert auch die Absicht (l'envie extrême!) nach Mecklenburg zu gehen und sich dort bekannt zu machen, um selbst alle die schlechten Eindrücke zu zerstören, die man dort von ihr verbreitet habe, und zu zeigen, daß sie "eine gute Deutsche" sei. Allein sie schob - unter allerlei nichtigen Vorwänden, wie ihr Gatte ihr später vorwarf - die Reise immer wieder hinaus, 100 )


|
Seite 65 |




|
bis sie endlich - erst im Jahre 1672 - um eines hochpolitischen Planes willen sich dazu entschloß, eine Zeitlang als Regentin in Mecklenburg zu schalten, eine Regentschaft, die freilich zu einer langjährigen schweren Entzweiung mit ihrem Gatten führte. 101 )
8. Weitere Tätigkeit des Königs für Christian Louis.
Die Ehe mit Isabelle Angélique v. Montmorency hat die großen Erwartungen, mit denen Christian Louis sie einging, nicht erfüllt; sie hielt sehr bald nur äußerlich zusammen, und hinter dem glänzenden äußeren Firnis lauerte Mißtrauen. "Ihr wisset wohl: Frauenlist geht über alles", in diese Worte hat einmal der Herzog sein Urteil über seine Gattin zusammengefaßt. Ebenso trug ihm das Bündnis mit Frankreich nicht die Früchte ein, die er anfänglich davon erwartete. Indessen ohne Frucht blieb es keineswegs. Man muß es König Ludwig nachrühmen, daß er sich redlich bemüht hat, seinem mecklenburgischen Schützling aus seinen Nöten zu helfen, und es ist nicht zu verkennen, daß Christian Louis infolge dieses Eintretens des mächtigsten Herrschers der Welt für ihn wirklich "konsiderabler" wurde, wie er es wünschte, und daß ihm dadurch Erleichterung in seinen Bedrängnissen zuteil wurde. Das schlagendste Beispiel dafür ist neben dem oben schon erwähnten Prozeß der Brüder, dem die gefährliche Spitze nicht ohne Mithülfe Frankreichs abgebrochen wurde, der Verlauf der sogenannten Güstrowschen Exekution Ende 1664 und Anfang 1665, der im Christian Louis S. 64 ff. geschildert ist. Man sieht daran, was ein Fürst im damaligen Deutschen Reiche sich erlauben durfte, über den Frankreich seine schützende Hand hielt. Hier möge noch ein Schreiben des Königs im Auszuge angeführt werden, das er den 22. November 1664 an den Kurfürsten Friedrich Wilhelm gesandt hat. 102 ) Es heißt darin: "Mehrere Gründe lassen es dem Könige sehr wünschenswert er=
 , die ihr der Prozeß gekostet
hat), c'est une chose que toute la France me
reproche tous les jours et ce qui est le
plus fâcheux le M. d'Albret (der Marschall
d'Albret war ihr Gegner in dem Prozeß) en a
profité, qui est une seconde douleur pour
moi, et la troisième est que cela m'a
empêchée de vous suivre dès le premier
voyage que vous fites dans vos états.
, die ihr der Prozeß gekostet
hat), c'est une chose que toute la France me
reproche tous les jours et ce qui est le
plus fâcheux le M. d'Albret (der Marschall
d'Albret war ihr Gegner in dem Prozeß) en a
profité, qui est une seconde douleur pour
moi, et la troisième est que cela m'a
empêchée de vous suivre dès le premier
voyage que vous fites dans vos états.


|
Seite 66 |




|
scheinen, daß ein gutes Einvernehmen zwischen den sämtlichen Mitgliedern des mecklenburgischen Fürstenhauses hergestellt werde. Zu diesem Zwecke entsendet er den H. du Fresne, Mitglied seines Staatsrates. Und da er erfahren hat, daß der Kaiser den Kurfürsten von Brandenburg zum Kommissar für die Wiedereinsetzung der Herzogin Christine Margarete in ihre Güter gemacht hat, so hat er den H. du Fresne auch beauftragt, den Kurfürsten aufzusuchen, und zwar, um denselben darauf hinzuweisen, daß man nicht zu Tätlichkeiten werde zu schreiten brauchen in dieser Exekution, da Herzog Christian ihm sein Wort gegeben habe, der genannten Fürstin alles, was ihr gehöre, zurückzugeben. Der König aber wünscht, als Wirkung der Freundschaft, die Friedrich Wilhelm ihm versprochen durch Erneuerung ihrer alten Allianz, 103 ) daß der Kurfürst seine Geschicklichkeit und seinen Einfluß aufwendet, um zwischen den Parteien ein Abkommen über ihren anderen größeren Zwist zu treffen. Es werde dies dem Kurfürsten ohne Zweifel gelingen, und du Fresne werde ihm des Königs Gedanken über diesen Gegenstand ausführlicher auseinandersetzen."
Am liebsten hätte Christian Louis die Güter der Herzogin, Stintenburg, was er zu einer kleinen Festung hatte umschaffen lassen, und das Amt Zarrentin, selbst behalten. Wenn er hierin nachgab und beide ihrer rechtmäßigen Besitzerin zurückgab, so beweist das obige Schreiben, daß er dies auf Veranlassung König Ludwigs tat, den dabei neben seinem Gerechtigkeitsgefühl gewiß die Rücksicht auf Güstrow und noch mehr auf Wolfenbüttel leitete. Andererseits sehen wir den König fortgesetzt bemüht, Isabella Angelika die Wege zur vollen Anerkennung ihrer Ehe zu ebnen, er hatte es immer noch nicht aufgegeben, Christine Margarete zur Anerkennung der Scheidung zu bewegen. Zu diesem Zwecke sollte du Fresne auch nach Wolfenbüttel gehen und unterwegs beim Kurfürsten von Mainz vorsprechen, um auch diesen zum Eintreten für Christian Louis in dieser Sache zu veranlassen. Neben dem Ehestreit hatte er auch die anderen Streitigkeiten, in die Christian Louis noch verwickelt war, zu schlichten. In seiner Begleitung befand sich ein Edelmann, der dem Kurfürsten von Mainz ein Schreiben von Isabella Angelika überbrachte. Du Fresne erkrankte am Hofe des Erzbischofs, sandte aber jemand nach Berlin und Wolfenbüttel mit seinem Beglaubigungsschreiben und der Bitte, die Exekution aufzuschieben, bis er komme. Der


|
Seite 67 |




|
Mainzer Kurfürst ließ in der Tat den französischen Sendboten durch seinen Rat Dr. Jodoci unterstützen, den er an Friedrich Wilhelm sandte mit einer ähnlichen Instruktion, wie sie der König gegeben. 104 ) Du Fresne gab dann die Reise ganz auf, wohl weil er einsah, daß in der Ehesache jede Vermittelung fruchtlos sein werde. 105 )
An seiner Stelle wurde dann Antoine de Lumbres nach Mecklenburg gesandt, der zwar mit den Brüdern Christian Louis' keine Einigung zustande brachte, wohl aber mit dem Güstrower Herzog. 106 )
Das Resultat der Lumbrischen Traktaten fiel freilich wenig nach Christian Louis' Wünschen aus, indessen blieb er doch der französischen Freundschaft treu. Bezeichnend für das Verhältnis, in dem er sich zu dem französischen König stehen fühlte, ist es, daß er ihn in einem Briefe an seine Gattin, der in den Anfang der Lumbrischen Traktaten fällt (vom 16. Juli 1665), "unsern König" nennt. 107 ) Weit deutlicher ist ein Brief, den er den 13. Februar 1666 an den König schrieb, als er gehört hatte, daß Ludwig den Engländern den Krieg erklärt hatte. 108 ) Er bietet darin als Dank für die Güte des Königs gegen ihn sich selbst und seine Staaten an, über die der König verfügen möge wie über ein Gut, das ihm gänzlich gehöre. 109 ) Man kann den Brief wegen


|
Seite 68 |




|
seines für einen freien deutschen Fürsten unwürdigen Tones der Unterwürfigkeit tadeln, aber man darf nicht etwa glauben, daß hier der Herzog sein Land als Besitz dem König hätte antragen wollen. Das vom 15. Februar datierte Schreiben an den Residenten Bidal, auf welches sich der Herzog am Schlusse des Schreibens an den König bezieht, erläutert seine Meinung näher durch den Hinweis, seine Staaten seien so gut gelegen, wie irgend welche andere in Niedersachsen, für Werbungen und um Offiziere zu liefern. 110 ) Es handelt sich also zweifellos nur um Dienste, die er dem König leisten will, um neuen Anspruch auf Gegendienst zu gewinnen. Der König verstand es auch nicht anders und antwortete mit einem freundlichen, aber allgemein gehaltenen Dank und der Versicherung, ihm Beweise seines Wohlwollens zu geben, wenn sich die Gelegenheit dazu böte. 111 )
Eine solche Gelegenheit bot sich noch in demselben Jahre. Den 21. August 1666 starb Christine Margarete. Damit war die Hauptschwierigkeit, die bisher der öffentlichen Anerkennung der zweiten Ehe Christian Louis' auch am französischen Hofe entgegengestanden hatte, beseitigt. Recht bedenklich freilich war die Form, in die König Ludwig diese seine Anerkennung kleidete. Noch immer sah er die Ehe, die ohne seine Erlaubnis geschlossen war, als überhaupt nicht bestehend an, folglich mußte sie, um als bestehend zu gelten, erst geschlossen werden; dieser Schlußfolgerung entsprechend, ließ er den Herzog, als dieser nach dem Tode seiner ersten Gattin wieder nach Paris gekommen war, zu einer neuen Trauung mit Isabella Angelika in Gegenwart des Herrn v. Lionne nötigen. 112 )


|
Seite 69 |




|
Mit höchstem Widerstreben, da durch die erneute Eheschließung die bisherige Ehe zum Konkubinat gestempelt wurde, fügte sich der Herzog der Willensmeinung des Königs, der durch huldvollen Empfang des Ehepaares die bittere Pille nachträglich zu versüßen suchte und auch die Ehepakten bestätigte (den 24. November). Immerhin war durch diese zweite Eheschließung der Vorteil gewonnen, daß fortab die Ehe völlig unangreifbar war, auch der Güstrower Herzog und Christian Louis' Brüder mußten nun Isabella Angelika als rechtmäßige Herzogin von Schwerin anerkennen. Dies war aber für Isabella Angelika eine Vorbedingung einer etwaigen Reise nach Mecklenburg. Die Gatten schrieben also zu diesem Zwecke an Gustav Adolf. Gleichzeitig wurde am Pariser Hofe Heiß in demselben Sinne bearbeitet. Als Gustav Adolf sich noch immer ablehnend verhielt, legte sich noch einmal der König selbst ins Mittel. Er sandte den 24. Mai 1667 sowohl an den Güstrower Herzog wie die beiden nächstältesten Brüder Christian Louis', Karl und Johann Georg, Schreiben, in denen er die erneute Eheschließung und seine Bestätigung des Ehevertrags ratifiziert, "um alle Skrupel selbst in den zartesten Gewissen zu heben." Die Brüder scheinen das Schreiben nicht beantwortet zu haben; Herzog Gustav Adolf antwortete, (den 17. August), er werde keine Schwierigkeiten mehr machen.
Dieser Fall ist nach dem Abschluß der Lumbrischen Traktaten der erste und für lange Zeit der einzige, wo König Ludwig für seinen Verbündeten eintrat, und es ist klar, daß es sich hierbei nicht mehr um eine Verpflichtung des Königs auf Grund des Allianzvertrages handelt, sondern um eine Gefälligkeit, die er seiner Kousine, der Herzogin von Mecklenburg, in ihren Familienangelegenheiten erweist.


|
Seite 70 |




|
Den Allianzvertrag hielt man augenscheinlich am französischen Hofe mit den Lumbrischen Traktaten für erledigt. Man benutzte indessen Christian Louis' Ergebenheit, um dem deutschen Reichstage in Regensburg das Schauspiel vorzuführen, wie ein deutscher Fürst im Namen und Auftrage des französischen Königs dem französischen Gesandten Gravel in feierlicher öffentlicher Versammlung im Münster den St. Michaelsorden überreichte (den 8. Januar 1670). 113 ) So sehr dies auch der Eigenliebe des Herzogs schmeichelte, so waren seine Erwartungen doch damit noch nicht erfüllt. Er hielt nach wie vor an der Hoffnung fest, daß noch einmal ein reellerer Gewinn aus seiner Freundschaft für Frankreich und seinen König zu erzielen sein werde, und war, um ihn zu verdienen, fortdauernd zu neuen Beweisen seiner Ergebenheit bereit. Dies trieb ihn dazu, im Jahre 1672 für Frankreich am holländischen Kriege teilzunehmen. Der Verlauf dieses seines Feldzuges wird das Thema der nächsten Studie bilden.